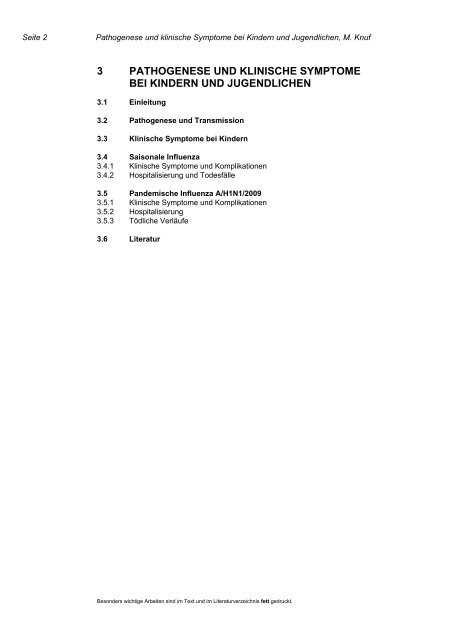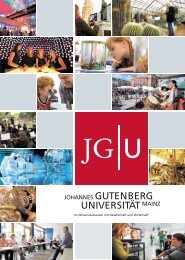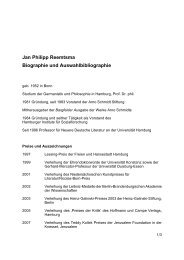3 pathogenese und klinische symptome bei kindern und jugendlichen
3 pathogenese und klinische symptome bei kindern und jugendlichen
3 pathogenese und klinische symptome bei kindern und jugendlichen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 2<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
3 PATHOGENESE UND KLINISCHE SYMPTOME<br />
BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN<br />
3.1 Einleitung<br />
3.2 Pathogenese <strong>und</strong> Transmission<br />
3.3 Klinische Symptome <strong>bei</strong> Kindern<br />
3.4 Saisonale Influenza<br />
3.4.1 Klinische Symptome <strong>und</strong> Komplikationen<br />
3.4.2 Hospitalisierung <strong>und</strong> Todesfälle<br />
3.5 Pandemische Influenza A/H1N1/2009<br />
3.5.1 Klinische Symptome <strong>und</strong> Komplikationen<br />
3.5.2 Hospitalisierung<br />
3.5.3 Tödliche Verläufe<br />
3.6 Literatur<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf Seite 3<br />
3.1 Einleitung<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich unterscheiden sich Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome der<br />
pandemischen A/H1N1/2009-Infektion <strong>bei</strong> Kindern nicht von der saisonalen<br />
Influenza. Dennoch gibt es einige Besonderheiten. Zunächst erfolgt eine kurze<br />
Rekapitulation der Pathogenese der Influenzainfektion.<br />
3.2 Pathogenese <strong>und</strong> Transmission<br />
Wirtszellen für Influenzaviren sind v. a. die Epithelien der Atemwege <strong>und</strong> die<br />
Endothelien der Blutgefäße. Die Infektion der Wirtszellen erfolgt in konsekutiven<br />
Schritten. Zunächst bindet das Influenzavirus an die Zellmembran. Hier<strong>bei</strong> haftet<br />
das Hämagglutinin (HA) an spezielle Rezeptoren der Zelloberfläche. Danach<br />
gelangt das Virus per Endozytose komplett in die Wirtszelle. Hier<strong>bei</strong> fusioniert das<br />
Viruspartikel mit der Membran der aufnehmenden Endosomen. Dieser Vorgang<br />
wird durch die proteolytische Spaltung des HA in H1 <strong>und</strong> H2 vermittelt.<br />
Endosomale Milieuveränderungen (Erhöhung des pH-Wertes!) können diese<br />
Fusionen <strong>und</strong> damit die Infektion verhindern. Sodann erfolgt das un-coating, <strong>bei</strong><br />
dem das Virus von seiner Hülle befreit wird. Es folgen die Transkription der viralen<br />
RNS <strong>und</strong> die Replikation. Hier<strong>bei</strong> entstehen 3 Arten von RNA: vRNA, mRNA<br />
(Produktion virusspezifischer Proteine) <strong>und</strong> Minusstrang-vRNA. Die mRNA gelangt<br />
in das Zytoplasma; hier induziert sie in den Ribosomen die Synthese der<br />
Virusproteine (Translation). Neu gebildete HA- <strong>und</strong> Neuraminidase- (NA-)Moleküle<br />
werden zur Zellmembran transportiert. Auch die übrigen Virusbestandteile werden<br />
ebenfalls zur Zellmembran transportiert, dort werden die neuen Virusbestandteile<br />
gepackt (assembly) <strong>und</strong> nach extrazellulär ausgeschleust. Die Freisetzung der<br />
fertigen Viruspartikel erfolgt mithilfe der Spaltung der seralinhaltigen Rezeptoren<br />
durch die NA des Virus. Mit Influenza infizierte Zellen sterben ab. Ist die Infektion<br />
mit Influenzaviren als Aerosol über den Respirationstrakt erfolgt, sind auch die<br />
(s. oben) zunächst betroffenen Zellen die Epithelien der Atemwege. Die hieraus<br />
resultierenden Symptome sind nahezu immer hohes Fieber <strong>und</strong> Husten.<br />
Anders als <strong>bei</strong> der saisonalen Influenza bzw. saisonalen H1N1-Infektion liegt <strong>bei</strong><br />
der pandemischen H1N1-Infektion experimentellen Daten zufolge offensichtlich<br />
eine deutlich ausgeprägtere Virusverbreitung (virus shedding) vom oberen<br />
Respirationstrakt aus vor. In einer niederländischen, tierexperimentellen Studie [1]<br />
wurden je 6 Frettchen mit 10 6 TCID 50 (50 % tissue culture infectious dose) des<br />
pandemischen H1N1-Influenzavirus bzw. des saisonalen Influenzavirus intranasal<br />
infiziert. Das 2009-A/H1N1-Virus war aus einem Patienten mit mildem Verlauf<br />
isoliert worden. Frettchen mit einer pandemischen H1N1-Infektion nahmen<br />
innerhalb der ersten Woche etwas mehr an Gewicht ab: Mit saisonalem<br />
Influenzavirus infizierte Tiere verloren innerhalb von 7 Tagen 10 % des Gewichtes,<br />
während H1N1 (pandemisch) infizierte Frettchen 12 % ihres Gewicht einbüßten.<br />
Klinisch erholten sich die Frettchen mit einer saisonalen Infektion nach 4 Tagen<br />
deutlich schneller als mit H1N1 infizierte Frettchen. Letztere wiesen eine um<br />
2 Tage verzögerte Besserung der <strong>klinische</strong>n Symptome auf. Darüber hinaus<br />
verbleibt das H1N1-Virus länger in Nase <strong>und</strong> Rachen der Tiere <strong>und</strong> ist auch noch<br />
nach 7 Tagen signifikant nachweisbar. Die Virusausscheidung im Rachen der<br />
Frettchen war in der Gruppe der mit 2009-A/H1N1-infizierten Tiere um 1,5-fach<br />
höher als in der Gruppe mit saisonalem Virus. Je 3 Tiere wurden nach 3 bzw.<br />
7 Tagen getötet <strong>und</strong> histopathologisch untersucht. Nach 3 Tagen war der<br />
Virusbefall der Lungen (Anfärbung mit monoklonalen Antikörpern) in <strong>bei</strong>den<br />
Gruppen vergleichbar. Nach 7 Tagen waren 10, 20 <strong>und</strong> 40 % (saisonale Influenza)<br />
sowie 20, 40 <strong>und</strong> 70 % (2009-A/H1N1) der Lungen virusinfiziert. Im weiteren<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Seite 4<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
Verlauf wurden 4 „naive“, influenzages<strong>und</strong>e Frettchen in Käfige mit infizierten<br />
Tieren überführt. Bereits nach kurzer Zeit (Tabelle 1) waren die zuvor ges<strong>und</strong>en<br />
Frettchen infiziert.<br />
Virus<br />
Saisonal<br />
A/H1N1<br />
2009<br />
A/H1N1<br />
Infizierte Frettchen<br />
Aerosolkontakte, zuvor ges<strong>und</strong>e Tiere<br />
Schnupfen<br />
Beginn nach<br />
Beginn nach<br />
Virus<br />
Virus<br />
Inokulation Schnupfen<br />
Inokulation<br />
shedding<br />
shedding<br />
(Tage)<br />
(Tage)<br />
4/4 4/4 1 3/4 4/4 1,2<br />
4/4 4/4 1,2 4/4 4/4 1,2<br />
Tabelle 1 Transmission im Tierexperiment (saisonal H1N1 vs. 2009 H1N1).<br />
Das Virus verbreitete sich <strong>bei</strong> den je 4 Versuchstieren unabhängig von der Art des<br />
Erregers nach intranasaler Applikation genauso schnell wie nach Aerosolkontakt.<br />
Die Autoren schließen aus den tierexperimentellen Daten, dass das 2009-A/H1N1-<br />
Virus aufgr<strong>und</strong> der längeren Persistenz <strong>und</strong> der höheren Virusdichte im<br />
Respirationstrakt <strong>bei</strong> vergleichbaren Transmissionscharakteristika das Potenzial<br />
hat, das saisonale H1N1-Virus kompetitiv zu verdrängen.<br />
3.3 Klinische Symptome <strong>bei</strong> Kindern<br />
Systematische Untersuchungen, die <strong>klinische</strong> Symptome der saisonalen (H1N1)<br />
Influenza mit der pandemischen (H1N1) Influenza) Influenza vergleichen, liegen<br />
nicht vor. Im Folgenden werden daher zunächst <strong>klinische</strong> Symptome,<br />
Komplikationen, Hospitalisierung <strong>und</strong> Todesfälle der saisonalen Influenza<br />
kursorisch zusammengestellt. Anschließend erfolgt die Darstellung von<br />
Einzelberichten zu Symptomen <strong>und</strong> Komplikationen der pandemischen Influenza<br />
auf Basis von Einzelberichten. Systematische nationale oder internationale<br />
(Sentinel-) Untersuchungen liegen nicht vor.<br />
3.4 Saisonale Influenza<br />
3.4.1 Klinische Symptome <strong>und</strong> Komplikationen<br />
Neben den typischen Symptomen wie plötzlicher Beginn mit hohem Fieber,<br />
respiratorischen Symptomen, Muskel- <strong>und</strong> Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen,<br />
allgemeinem Krankheitsgefühl sind Komplikationen bekannt. Hierzu gehört mit<br />
einer Häufigkeit von bis zu 15 % der Fälle die Otitis media. Daneben treten<br />
folgende Komplikationen auf:<br />
• Enzephalopathie,<br />
• Krupp <strong>und</strong> Epiglottitis,<br />
• Pneumonie, Tracheobronchitis <strong>und</strong> Bronchiolitis,<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf Seite 5<br />
• Myokarditis <strong>und</strong><br />
• Reye-Syndrom.<br />
Nicht selten gehen mit dem Fieber auch Fieberkrämpfe einher. Das Kind spielt <strong>bei</strong><br />
der Verbreitung der saisonalen <strong>und</strong> der pandemischen Influenza eine große Rolle.<br />
Kinder sind "Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt" des Infektionsgeschehens, weil die<br />
Ausscheidung einer großen Anzahl von Viren im Zusammenhang mit der (Erst-)<br />
Infektion überdurchschnittlich lange erfolgt. Die Unterbringung in Kinder-, Jugend<strong>und</strong><br />
Gemeinschaftseinrichtungen geht zudem mit einer hohen Exposition <strong>und</strong><br />
Kontaktrate einher, <strong>und</strong> das kindertypische "unhygienische Verhalten" begünstigt<br />
die Virusverbreitung. Neben virusspezifischen Besonderheiten spielen für die<br />
<strong>klinische</strong>n Symptome der Influenza (Respirationstrakt!) im Kindesalter anatomische<br />
Besonderheiten eine besondere Rolle. Der Innendurchmesser der Atemwege ist<br />
<strong>bei</strong> Kindern im Verhältnis zum späteren Lebensalter geringer (Abb. 1); dies<br />
begünstigt pathogenetisch schwere Verläufe des entstehenden<br />
Schleimhautödems.<br />
Kleinkind<br />
Erwachsener<br />
1 mm dickes Ödem im<br />
Bereich des Rinknorpels<br />
Durchmesser 50% verringert < 25% verringert<br />
Strömmungsfläche 75% erniedrigt ca. 44% erniedrigt<br />
Atemwegswiderstand 16 x erhöht 3 x erhöht<br />
Abbildung 1 Folgen einer Schwellung im Bereich des Ringknorpels <strong>bei</strong> Klein<strong>kindern</strong> im<br />
Vergleich zum Erwachsenen. (Abb.: Knuf).<br />
3.4.2 Hospitalisierung <strong>und</strong> Todesfälle<br />
Säuglinge <strong>und</strong> Kleinkinder werden besonders häufig wegen Atemwegsinfektionen<br />
durch eine Influenza zur Behandlung vorgestellt. Die Konsultationsrate je<br />
100.000 Einwohner ist mit bis zu 8000 deutlich höher als <strong>bei</strong> Erwachsenen.<br />
Zweifelsohne liegt <strong>bei</strong> Senioren eine deutliche Übersterblichkeit, meist infolge einer<br />
influenzaassoziierten Pneumonie vor. Andererseits finden sich neben der höheren<br />
Rate an Arztkontakten im Kindesalter auch, insbesondere im Vergleich zu jungen<br />
Erwachsenen <strong>und</strong> Erwachsenen, deutlich erhöhte Hospitalisierungsraten. Die<br />
Notwendigkeit zur Krankenhausbehandlung ist durchaus mit der <strong>bei</strong> älteren<br />
Menschen (über 60 Jahre) vergleichbar. Tabelle 2 ergibt die Inzidenz der<br />
influenzaassoziierten Hospitalisationen <strong>bei</strong> Kindern in den Vereinigten Staaten <strong>und</strong><br />
in Deutschland aufgr<strong>und</strong> verschiedener Studien wieder.<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Seite 6<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
Ort [Referenz] Zeit Inzidenz Inzidenz relatives Risiko<br />
pro 100.000 pro 100.000 0 < 5/5-16<br />
0 bis < 5 Jahre 5-16 Jahre<br />
Houston [Glezen 1993] 1985-90 427 5 85<br />
Kalifornien [Mullooly 1982] 1967-73 120 40 3<br />
Kalifornien [Izurieta 2000] 1993-97 136 19 7,2<br />
Seattle [Izurieta 2000] 1992-97 90 16 5,6<br />
Kiel [Weigl 2002] 1996-01 123 22 5,6<br />
Kalifornien [Mullooly 1982] 1967-72 470* 210 2,2<br />
Tennessee [Neuzil 2000] 1973-93 382** 40 9,6<br />
Tabelle 2 Influenzaassoziierte Hospitalisationen <strong>bei</strong> Kindern (Nach CDC).<br />
Die Studien unterscheiden sich methodologisch erheblich; dies erklärt die<br />
unterschiedlichen Ergebnisse. Sehr eindrücklich liegt jedoch ein einheitlicher Trend<br />
vor. Die Inzidenz influenzaassoziierter Hospitalisationen ist allen Studien zufolge<br />
besonders häufig <strong>bei</strong> Säuglingen <strong>und</strong> Klein<strong>kindern</strong>. Die Verbreitung des Virus<br />
durch Kinder illustriert Abb. 2. Kleinkinder, Kinder (<strong>und</strong> Jugendliche) unterhalten<br />
das „Feuer der Influenza“. Die im Vergleich zu Erwachsenen deutlich höheren<br />
Transmissionsraten sind durch eine längere Ausscheidungsdauer, enges/beengtes<br />
Miteinander <strong>und</strong> mangelhafte Hygiene bedingt [2, 3]. Diese Umstände sind für die<br />
saisonale Influenza <strong>und</strong> auch für die pandemische Influenza zu berücksichtigen.<br />
Kinder<br />
KJGE<br />
Kindergarten<br />
Schnelle Ausbreitung der Influenza<br />
(1-2 Wochen) 1<br />
Ausscheidung von hoher Viruslast, länger als<br />
Erwachsene 2<br />
Transmission<br />
Geschwister Eltern Betreuer Großeltern<br />
Abbildung 2 Kinder als „Transmitter“ der Influenza. (Abb.: Knuf).<br />
Neben dem hohen Hospitalisierungsrisiko ist besonders hervorzuheben, dass<br />
Frühgeborene oder Kinder mit einer Lungenerkrankung bzw. einer kardialen<br />
Erkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf<br />
(Hospitalisation) aufweisen. Die durchschnittliche Krankenhausaufenthaltsdauer<br />
<strong>bei</strong> Kindern unter 5 Jahren liegt <strong>bei</strong> 6,3 Tagen [6]. Die ambulante Konsultationsrate<br />
für respiratorische Infektionen durch Influenza lag in Deutschland <strong>bei</strong> 1,1 % [6].<br />
Analysiert man die Hospitalisationsraten genauer, so sind insbesondere junge<br />
Säuglinge hiervon betroffen. Der Krankenhausbehandlung gehen schwerwiegende,<br />
v. a. respiratorische Symptome voraus. Wenig beachtet, jedoch ein<br />
Faktum, sind influenzabedingte Todesfälle, auch <strong>bei</strong> Kindern. Todesfälle<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf Seite 7<br />
unterliegen ebenfalls einer deutlichen Altersabhängigkeit. Die meisten Fälle treten<br />
<strong>bei</strong> Säuglingen auf. Während der Influenzasaison 2003/2004 starben in den<br />
Vereinigten Staaten 153 Kinder (unter 17 Jahren) an Influenza [7]. Es waren 63 %<br />
der Kinder jünger als 5 Jahre <strong>und</strong> 75 % der Betroffenen jünger als 2 Jahre.<br />
Bemerkenswert war, dass 47 % der Kinder zuvor ges<strong>und</strong> gewesen waren. Nach<br />
den Senioren (älter als 65 Jahre) weist die Altersgruppe der unter 6 Monate alten<br />
Kinder die höchste Sterblichkeitsrate auf. Da sich besonders in interpandemischen<br />
Perioden die Aufmerksamkeit häufig auf ältere Menschen mit schweren<br />
Krankheitsverläufen konzentriert, entsteht offenbar der falsche Eindruck, dass die<br />
Influenza <strong>bei</strong> Kindern nicht besonders gravierend verläuft. Tatsächlich werden <strong>bei</strong><br />
Kindern schwere Krankheitsverläufe <strong>und</strong> Todesfälle beobachtet (s. oben). Monto u.<br />
Sullivan [8] analysierten 1993 die Altersverteilung in 2 Ausbrüchen von Influenza<br />
A/H3N2. Alle Altersgruppen waren an den Infektionen mit Influenza-A/H3N2-Viren<br />
beteiligt, jedoch überwogen in <strong>bei</strong>den Ausbrüchen die Erkrankungen von Kindern<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen deutlich.<br />
3.5 Pandemische Influenza A/H1N1/2009<br />
3.5.1 Klinische Symptome <strong>und</strong> Komplikationen<br />
Bezüglich der pandemischen A/H1N1-Influenza ist festzustellen, dass zunächst in<br />
Nordamerika junge Erwachsene betroffen waren [9]. In Europa (Großbritannien)<br />
hingegen wurden v. a. Klein- <strong>und</strong> Schulkinder von der H1N1-Influenza befallen<br />
[10]. Hauptansteckungsort war <strong>bei</strong> 101 von 238 Kindern die Schule [10]. Cluster-<br />
Untersuchungen in den USA führten zu einer attack rate unter Haushaltsbedingungen<br />
von bis zu 27,3 %. Die Analyse eines Ausbruchs in einer Schule<br />
ergab, dass ein Schulkind 2,4 andere Kinder innerhalb der Schule infiziert hatte<br />
[11].<br />
Eine britische Untersuchung [12] analysierte 89 Kinder, <strong>bei</strong> denen mithilfe der<br />
Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR) Influenza A/H1N1<br />
(pandemisch) nachgewiesen wurde. Die Kinder waren im Median 5,7 Jahre alt. Es<br />
waren 50 der 89 Kinder männlichen Geschlechts. Die überwiegende Anzahl der<br />
Patienten wies hohe Temperaturen, Husten, eine Rhinorrhö <strong>und</strong> auskultarisch<br />
diagnostizierbares Giemen auf. Weniger häufige Symptome waren Tachypnoe,<br />
Atemnot, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Myalgien, Erbrechen, Durchfall,<br />
Fieberkrämpfe <strong>und</strong> abdominelle Beschwerden.<br />
Im Vergleich zur saisonalen H1N1-Infektion im Kindesalter ist die pandemische<br />
Form offenbar bislang klinisch „milder“ verlaufen.<br />
Zwischen 2004 <strong>und</strong> 2007 wurden in Großbritannien 58 Kinder mit einer<br />
saisonalen H1N1-Infektion auf eine Intensivstation eingewiesen [13]. Die Kinder<br />
waren 2,7 Jahre (Median) alt. Im Vordergr<strong>und</strong> standen respiratorische Symptome.<br />
Neun Kinder wiesen neurologische Symptome auf. Von den 58 Kindern starben<br />
9 Betroffene. Prädisponierende Erkrankungen (neurologische Erkrankungen,<br />
chronische respiratorische Erkrankungen, Frühgeburtlichkeit) hatten 32 Patienten<br />
<strong>und</strong> alle 9 Verstorbenen. Es mussten 17 Kinder mit Inotropika behandelt werden.<br />
Drei Patienten erhielten eine extrakorporale Membranoxygenierung. Myokarditisfälle<br />
traten nicht auf.<br />
Neurologische Komplikationen der saisonalen Influenza (Krampfanfälle,<br />
Enzephalitis, Reye-Syndrom) sind seit Langem bekannt (s. Abschn. 3.4.1). Es<br />
liegen aber auch erste Berichte von neurologischen Komplikationen durch die<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Seite 8<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
pandemische H1N1-Influenza vor [14]. In Dallas wurden innerhalb eines Monats<br />
405 Patienten mit einer H1N1-Infektion identifiziert. Es mussten 44 Betroffene<br />
hospitalisiert werden; hier<strong>bei</strong> waren 83 % der Patienten jünger als 18 Jahre. Vier<br />
Kinder bzw. Jugendliche wiesen erhebliche neurologische Probleme auf<br />
(Tabelle 3).<br />
Charakteristikum Patient A Patient B Patient C Patient D<br />
Alter (Jahre) 17 10 7 11<br />
Geschlecht Männlich Weiblich Männlich Weiblich<br />
Hospitalisation Mai 18–21 Mai 23–29 Mai 26–28 Mai 27–30<br />
Neurologic<br />
complication(s)<br />
diagnosed<br />
Enzephalopathie<br />
Anfälle,<br />
Enzephalopathie<br />
Anfälle<br />
Enzephalopathie<br />
Intervall “Beginn<br />
respiratorischer<br />
Symptome bis erste<br />
neurologische<br />
Auffälligkeiten“ (Tage)<br />
1 4 2 1<br />
Fieber (maximal, °C) 39,2 40,0 38,2 38,9<br />
Liquordiagnostik<br />
Leukozyten (per mm 3 ;<br />
Differentierung)<br />
2<br />
2<br />
4<br />
4<br />
(Keine Diff.)<br />
(65 % Lymphozyten<br />
(Keine Diff.)<br />
(95 % Lymphozyten<br />
31 % Monozyten)<br />
5 % Monozyten)<br />
Glukose (mg/dl;<br />
normal: 50–80 mg/dl)<br />
39 63 58 65<br />
Protein (mg/dl;<br />
normal: 10–45 mg/dl)<br />
37 50 15 21<br />
Kultur Kein Wachstum Kein Wachstum Kein Wachstum Kein Wachstum<br />
Neurotope Diagnostik<br />
Kraniale<br />
Computertomographie<br />
Keine<br />
intraparenchymatösen<br />
Auffälligkeiten,<br />
Pansinusitis<br />
Punktförmige<br />
Verkalkung,<br />
linksfrontaler Kortex<br />
Keine<br />
intrakraniellen<br />
Auffälligkeiten<br />
Keine<br />
intrakraniellen<br />
Auffälligkeiten;<br />
Sinusitis<br />
Magnetic resonance<br />
imaging<br />
Nicht durchgeführt Keine<br />
parenchymatösen<br />
Auffälligkeiten<br />
Kortikal (T 2 ):<br />
Hyperintense<br />
Fokusse in<br />
weißer<br />
Substanz<br />
Keine<br />
intrakraniellen<br />
Auffälligkeiten<br />
Elektroenzephalographie<br />
Nicht durchgeführt Generalisierte,<br />
kontinuierliche,<br />
polymorphe, δ-<br />
Aktivität, kein Fokus<br />
Parietal<br />
intermittierende,<br />
polymorphe δ-<br />
Aktivität<br />
Verlangsamte<br />
Hintergr<strong>und</strong>aktivität<br />
Tabelle 3 Charakteristika <strong>bei</strong> pädiatrischen Patienten mit neurologischen Komplikationen<br />
durch pandemische H1N1-Infektion, Dallas, April bis Mai 2009.<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf Seite 9<br />
In einer anderen Untersuchung wurden die ersten 45 pandemischen Influenza-<br />
A/H1N1-Fälle in Zypern (Juni bis August 2009) hinsichtlich der <strong>klinische</strong>n<br />
Charakteristika untersucht. Vorzugsweise waren Schulkinder betroffen [15].<br />
Tabelle 4 fasst die <strong>klinische</strong>n Symptome <strong>bei</strong> Kindern mit durch Laboruntersuchungen<br />
bestätigter nachgewiesener A/H1N1-Infektion zusammen.<br />
Symptom Anzahl/Kinder mit Angaben Anteil ( %)<br />
Fieber 44/45 98<br />
Husten 43/45 96<br />
Rhinorrhö 34/43 79<br />
Erbrechen 8/39 21<br />
Durchfall 7/40 18<br />
Konjunktivitis 3/45 7<br />
Halsweh 25/34 73<br />
Krankheitsgefühl a 21/31 68<br />
Kopfschmerzen a 17/30 57<br />
Arthralgien a 8/34 24<br />
a Bei Kindern über 5 Jahre (n=35).<br />
Tabelle 4 Klinische Charakteristika von A/H1N1-Infektion (Nach ECDC/CDC).<br />
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 19 der 45 Kinder<br />
mit Oseltamivir behandelt wurden. Die Autoren heben hervor, dass das Influenza-<br />
A/H1N1-Virus sich auf Zypern rasch verbreitet hat <strong>und</strong> die Infektion mit<br />
„klassischen“ Symptomen einherging. Der Verlauf war praktisch nicht von einer<br />
saisonalen Influenza zu unterscheiden <strong>und</strong> in der <strong>klinische</strong>n Ausprägung eher<br />
"mild".<br />
3.5.2 Hospitalisierung<br />
Besonders häufig mussten pädiatrische Patienten (bis zum vierten Lebensjahr)<br />
stationär behandelt werden, wenn eine pandemische Influenza A/H1N1<br />
nachgewiesen wurde. Mit ansteigendem Alter ist danach die Hospitalisierungsrate<br />
(d. h. die Zahl der Hospitalisierungen pro 100.000 Einwohner) der von<br />
erwachsenen Patienten relativ ähnlich (Australien, USA; [16]).<br />
Der Altersmedian von 829 hospitalisierten Fällen lag in Deutschland zum<br />
28.08.2009 <strong>bei</strong> 20 Jahren. Übereinstimmend liegen Berichte aus den USA,<br />
Australien <strong>und</strong> Kanada vor, dass Kinder unter 4 Jahren die höchste<br />
Hospitalisierungsrate aufwiesen. Diese lag (Analogie zur saisonalen Influenza!)<br />
etwa 4- bis 7-mal höher als <strong>bei</strong> den höheren Altersgruppen. In den USA wurden<br />
4,5 je 100.000 der 0- bis 4-jährigen Einwohner, 2,1 je 100.000 der 5- bis 24-<br />
Jährigen, 1,1 je 100.000 der 25- bis 49- Jährigen <strong>und</strong> 1,2 je 100.000 der 50- bis<br />
64-Jährigen stationär behandelt. Eine ansteigende Inzidenz (1,7 pro 100.000) war<br />
dann <strong>bei</strong> den über 65-Jährigen aufgr<strong>und</strong> einer laborbestätigten Infektion mit<br />
Influenza A/H1N1 zu beobachten [17]. Auch in Großbritannien kamen die höchsten<br />
Hospitalisierungsraten <strong>bei</strong> Kindern unter 5 Jahren vor [18].<br />
Die kumulativen Hospitalisierungsraten für die Influenza A/H1N1 in Bezug auf<br />
verschiedene Altersgruppen in den USA von Mai bis Juli 2009 [19] näherten sich<br />
den durchschnittlichen Hospitalisierungsraten der saisonalen Influenza der letzten<br />
3 Saisons schon frühzeitig an (Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen) oder<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Seite 10<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
überschritten sie sogar <strong>bei</strong> Schul<strong>kindern</strong> [19], obwohl die reguläre Influenzasaison<br />
noch gar nicht begonnen hatte. Für Deutschland liegen solche Daten allerdings<br />
(noch) nicht vor.<br />
3.5.3 Tödliche Verläufe<br />
Französische Autoren haben alle weltweiten Todesfälle durch A/H1N1 (bis<br />
16.07.2009) analysiert. Die meisten Todesfälle traten <strong>bei</strong> Patienten in einem Alter<br />
zwischen 20 <strong>und</strong> 49 Jahren auf. Allerdings wurden hier auch regional deutliche<br />
Unterschiede festgestellt [20]. Die Aufteilung hinsichtlich Alter <strong>und</strong> Geschlecht von<br />
448 Todesfällen (weltweit) gibt Abb. 3 wieder. Kleinkinder sind in ähnlicher Weise<br />
betroffen wie Erwachsene im "Risikoalter" über 60 Jahre.<br />
Abbildung 3 Todesfälle durch pandemische A/H1N1-Infektion, Differenzierung nach Alter<br />
<strong>und</strong> Geschlecht [20].<br />
Übereinstimmend konnte in den USA, Australien <strong>und</strong> Kanada gezeigt werden,<br />
dass besonders häufig junge Kinder unter 4 Jahren hospitalisiert werden mussten<br />
[21]. Dies könnte allerdings auch mit einem besonderen Konsultations- <strong>und</strong><br />
Aufnahmeverhalten in dieser Altersgruppe assoziiert sein. In Deutschland waren<br />
bisher besonders die Altersgruppen zwischen 15 <strong>und</strong> 24 Jahren von der<br />
pandemischen A/H1N1-Influenza betroffen. Die Erkrankungen in dieser<br />
Altersgruppe gingen allerdings bislang nicht mit einem höheren Anteil schwerer<br />
Verläufe oder Todesfälle einher. In einer am 04.09.2009 erschienenen Publikation<br />
[21] wurden die bis Ende August in den Vereinigten Staaten gemeldeten Influenza-<br />
A/H1N1-Todesfälle zusammengefasst. Bis dahin waren 36 Todesfälle <strong>bei</strong> Kindern<br />
unter 18 Jahren beobachtet worden. Hiervon waren 19 % jünger als 5 Jahre!<br />
Höher als <strong>bei</strong> saisonaler Influenza war in dieser Population der Anteil von Kindern<br />
mit Gr<strong>und</strong>krankheiten: Es wiesen 67 % der verstorbenen Kinder eine<br />
Gr<strong>und</strong>krankheit auf; hier<strong>bei</strong> überwogen neurologische Gr<strong>und</strong>krankheiten (61 %),<br />
gefolgt von chronischen Lungen- (28 %) <strong>und</strong> angeborenen Herzkrankheiten (8 %).<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf Seite 11<br />
3.6 Literatur<br />
1. Munster VJ, de Wit E, van den Brand JM, Herfst S, Schrauwen EJ, Bestebroer TM, van de<br />
Vijver D, Boucher CA, Koopmans MM, Rimmelzwaan GF, Kuiken T, Osterhaus AD,<br />
Fouchier RA (2009) Pathogenesis and transmission of swine origin 2009 A(H1N1) influenza<br />
in ferrets. Science 325:481–483<br />
2. Reichert TA, Sugaya N, Fedson DS, Glezen WP, Simonsen L, Tashiro M (2001) The<br />
Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza. N Engl J Med<br />
344(12):889–896<br />
3. Haas W, Köpke K, Schweiger B, Buda S, Buchholz U, Harder T, Krause G (2009) Deutsch<br />
Arztebl 106:A1<br />
4. Turner D, Wailoo A, Nicholson K, Cooper N, Sutton A, Abrams K (2003) Systematic review<br />
and economic decision modelling for the prevention and treatment of influenza A and B.<br />
Health Technol Assess 7(35):iii–iv, xi–xiii, 1–170<br />
5. Principi N, Esposito S, Marchisio P, Gasparini R, Crovari P (2003) Socioeconomic impact of<br />
influenza on healthy children and their families. Pediatr Infect Dis J 22 [Suppl10]:207–210<br />
6. Forster J (2003) Influenza in children: the German perspective. Pediatr Infect Dis J 22<br />
[Suppl 10]: 215–217<br />
7. Bhat N, Wright JG, Broder KR, Murray EL, Greenberg ME, Glover MJ, Likos AM, Posey DL,<br />
Klimov A, Lindstrom SE, Balish A, Medina MJ, Wallis TR, Guarner J, Paddock CD, Shieh<br />
WJ, Zaki SR, Sejvar JJ, Shay DK, Harper SA, Cox NJ, Fukuda K, Uyeki TM (2005)<br />
Influenza-associated deaths among children in the United States, 2003–2004. N Engl J Med<br />
353(24):2559–2567<br />
8. Monto AS, Sullivan KM (1993) Acute respiratory illness in the community. Frequency of<br />
illness and the agents involved. Epidemiol Infect 110:145–160<br />
9. Shinde V, Bridges CB, Uyeki TM, Shu B, Balish A, Xu X, Lindstrom S, Gubareva LV, Deyde<br />
V, Garten RJ, Harris M, Gerber S, Vagasky S, Smith F, Pascoe N, Martin K, Dufficy D,<br />
Ritger K, Conover C, Quinlisk P, Klimov A, Bresee JS, Finelli L (2009) Triple-reassortant<br />
swine influenza A (H1) in humans in the United States, 2005–2009. N Engl J Med<br />
360(25):2616–2625<br />
10. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19232<br />
11. Yang Y, Sugimoto JD, Halloran ME, Basta NE, Chao DL, Matrajt L, Potter G, Kenah E,<br />
Longini IM (2009) The transmissibility and control of pandemic influenza A (H1N1) virus.<br />
Science, DOI 10.1126/science.1177373<br />
12. Hackett S, Hill L, Patel J, Ratnaraja N, Ifeyinwa A, Farooqi M, Nusgen U, Debenham P,<br />
Gandhi D, Makwana N, Smit E, Welch S (2009) Clinical characteristics of paediatric H1N1<br />
admissions in Birmingham, UK. Lancet 374:605<br />
13. Lister P, Reynolds F, Parslow R, Chan A, Cooper M, Plunkett A, Riphagen S, Peters M<br />
(2009) Swine-origin influenza virus H1N1, seasonal influenza virus, and critical illness in<br />
children. Lancet 374:605–607<br />
14. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2009) Neurologic complications<br />
associated with novel influenza A (H1N1) virus infection in children – Dallas. MMWR Morb<br />
Mortal Wkly Rep 58(28):773–778<br />
15. Koliou M, Soteriades ES, Toumasi MM, Demosthenous A, Hadjidemetriou A (2009)<br />
Epidemiological and clinical characteristics of influenza A(H1N1)v infection in children: the<br />
first 45 cases in Cyprus, June – August 2009. Euro Surveill 14(33)<br />
16. National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control<br />
and Prevention (2009) Use of influenza A (H1N1) 2009 monovalent vaccine:<br />
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2009.<br />
MMWR Recomm Rep 58(RR-10):1–8<br />
17. http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/downloads/mtg-slides-jul09-flu/02-Flu-Fiore.pdf<br />
18. HPA Weekly National Influenza Report 06 August 2009;<br />
http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1249543005132)<br />
19. European Centre for Disease Prevention and Control (2009) Pandemic (H1N1) 2009 –<br />
Weekly report: individual case reports EU/EEA countries. 31 July 2009:<br />
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Documents/090731_Influenza_A(H1N1)_Analysis_of_<br />
individual_data_EU_EEA-EFTA.pdf<br />
20. Vaillant L, La Ruche G, Tarantola A, Barboza P, for the epidemic intelligence team at InVS<br />
(2009) Epidemiology of fatal cases associated with pandemic H1N1 influenza 2009. Euro<br />
Surveill 14(33)<br />
21. http://www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP/downloads/mtg-slides-jul09-flu/02-Flu-Fiore.pdf;<br />
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/08-09/w32_09/index-eng.php,<br />
http://www.mja.com.au/public/rop/contents_rop.html<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.
Seite 12<br />
Pathogenese <strong>und</strong> <strong>klinische</strong> Symptome <strong>bei</strong> Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, M. Knuf<br />
22. Centers for Disease Control and Prevention (2009) Surveillance for pediatric deaths<br />
associated with 2009 pandemic influenza A/H1N1 virus infection – United States; April-<br />
August 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 58(34):941–947<br />
Besonders wichtige Ar<strong>bei</strong>ten sind im Text <strong>und</strong> im Literaturverzeichnis fett gedruckt.