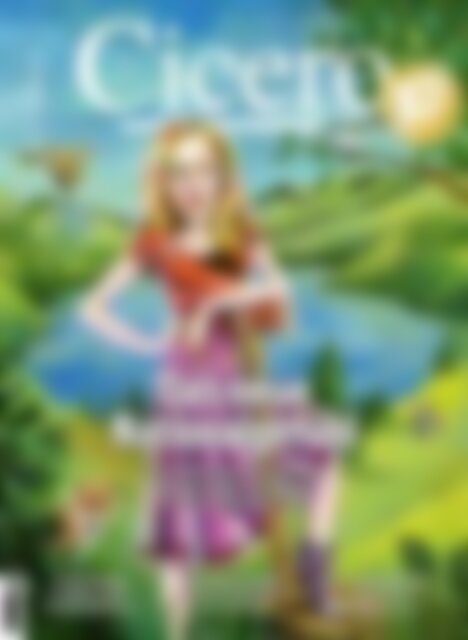Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nº09<br />
SEPTEMBER<br />
2014<br />
€ 8.50<br />
CHF 13<br />
Österreich: 8.50 €, Benelux: 9.50 €, Italien: 9.50 €, Spanien: 9.50 € , Finnland: 12.80 €<br />
09<br />
4 196392 008505<br />
Letzter Vorhang<br />
Der Niedergang des<br />
deutschen Stadttheaters<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong><br />
<strong>Nationalgefühl</strong><br />
Schottland. Schweiz. Deutschland?<br />
Warum Staaten heute wieder<br />
ihr Heil im Alleingang suchen<br />
Geheimwaffe Swift<br />
Zwingt ein Finanzdienstleister<br />
Putin in die Knie?<br />
Zurück zum Sie!<br />
Ein Aufschrei<br />
gegen das Duzen
ATTICUS<br />
N°-9<br />
SCHOTTEN DICHT?<br />
Titelbild: Olaf Hajek; Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Bannockburn kennt in Schottland<br />
jedes Kind. Am 23. und 24. Juni 1314<br />
tobte dort eine Schlacht, in der das<br />
schottische Heer die englischen Truppen<br />
zurückschlug. Es war einer der raren<br />
Siege der Hochländer über den Aggressor<br />
aus dem Süden. Am Ende behielten die<br />
Engländer die Oberhand. 700 Jahre nach<br />
der Battle of Bannockburn möchten die<br />
schottischen Nationalisten um Regierungschef<br />
Alex Salmond die Engländer<br />
abermals abschütteln, diesmal nicht in<br />
einer Schlacht, sondern per<br />
Volksabstimmung.<br />
<strong>Das</strong> Referendum am 18. September<br />
fällt in eine Zeit, in der der Nationalismus<br />
in Europa ohnehin auf dem Vormarsch<br />
ist. Die Schweiz hat gerade ihre<br />
Grenzen dichter gemacht. Großbritannien<br />
könnte 2017 die EU verlassen,<br />
wenn die Europakritiker erfolgreich an<br />
englische <strong>Nationalgefühl</strong>e appellieren.<br />
In Deutschland ist mit der AfD eine<br />
national ausgerichtete Kraft entstanden.<br />
Auch anderswo in Europa wird unverhohlen<br />
gefragt: Wären wir alleine nicht<br />
besser dran?<br />
Die Sympathie der <strong>Cicero</strong>-Redaktion<br />
für Europa gilt. Man muss das Phänomen<br />
des <strong>neue</strong>n Nationalismus nicht mögen,<br />
aber die Debatte darüber ist nötig. Ist der<br />
Nationalstaat die Instanz mit der stärksten<br />
Bindekraft, wie sich bei der Fußball-<br />
WM wieder gezeigt hat? Kommt dieses<br />
<strong>Nationalgefühl</strong> zurück, weil es im Sinne<br />
des europäischen Gedankens unterdrückt<br />
wurde? Der Politologe Herfried Münkler<br />
kommt zu einem dialektischen Ergebnis<br />
( ab Seite 16 ). Thomas Weber,<br />
Geschichtsprofessor im schottischen<br />
Aberdeen, hat in seinen Lehr- und<br />
Wanderjahren im Ausland erfahren,<br />
dass es etwas gibt, das er als Deutscher<br />
für unmöglich hielt: guten Nationalismus<br />
( ab Seite 22 ).<br />
Der Publizist Wilfried Scharnagl<br />
und der frühere EU-Kommissar Günter<br />
Verheugen streiten über das richtige<br />
Verhältnis zur Nation – und sind sich<br />
doch einig: Wenn Schottland seine<br />
Unabhängigkeit erklärt, löst das eine<br />
Kettenreaktion in Europa aus ( ab Seite<br />
26 ). Ein glühendes Plädoyer für Schottlands<br />
Unabhängigkeit hält in dieser<br />
Ausgabe Sean Connery, früher James<br />
Bond, heute Agent der schottischen<br />
Sache.<br />
Mit besten Grüßen<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Chefredakteur<br />
3<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Erlebe Deinen Herzklopfmoment<br />
www.dein-suedafrika.de<br />
„Ich verspüre Gänsehaut.<br />
<strong>Das</strong> Brüllen des Löwen geht<br />
durch und durch. Ein Augenblick,<br />
den ich nie vergessen werde.“<br />
Buchen Sie noch heute Ihren South African Airways Flug<br />
nach Südafrika ab EUR 699* und reisen Sie im Zeitraum<br />
von 1. März 2015 bis 2. Juli 2015.<br />
Buchungen über flysaa.com oder 069 / 299 803 20.<br />
* Preisbeispiel p.P. inkl. Steuern & Gebühren für Hin- und Rückflug von Frankfurt oder München<br />
nach Johannesburg. Angebot gültig bis 30. 09. 2014. Stand: 01. 08. 2014.
INHALT<br />
TITELTHEMA<br />
16<br />
EIN GEFÜHL VON GEBORGENHEIT<br />
Der Nationalstaat ist effektiv und leistungsfähig.<br />
<strong>Das</strong> gilt im Schlimmen wie im Guten<br />
Von HERFRIED MÜNKLER<br />
Illustration: Olaf Hajek<br />
22<br />
DIE ALTEN SÜNDEN<br />
SIND VERJÄHRT<br />
Ein deutscher Historiker<br />
lernt in Schottland guten<br />
Nationalismus kennen<br />
Von THOMAS WEBER<br />
26<br />
„DIE GROSSEN VERLIERER SIND DIE LÄNDER“<br />
Der bayerische Separatist Wilfried<br />
Scharnagl und Ex-EU-Kommissar<br />
Günter Verheugen im Streitgespräch<br />
Von ALEXANDER MARGUIER und<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
30<br />
EINE EINMALIGE<br />
GELEGENHEIT<br />
Glühendes Plädoyer<br />
für die schottische<br />
Unabhängigkeit<br />
Von SEAN CONNERY<br />
5<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
32 IM OHR DAS MASSAKER<br />
Der deutsche Zahnarzt Ali Khalaf<br />
setzt sich in Berlin für seine<br />
jesidischen Verwandten ein<br />
Von CHRISTOPH SEILS<br />
54 AN DER SEITE DER BÜRGER<br />
Vassilios Skouris fällt als Präsident<br />
des Europäischen Gerichtshofs<br />
wegweisende Urteile<br />
Von HARTMUT PALMER<br />
82 MIDAS MUSK<br />
Geld hat er genug, daher<br />
teilt Tesla-Gründer Elon<br />
Musk seine Patente für<br />
Elektroautos mit allen<br />
Von ELLEN ALPSTEN<br />
34 EINE MARKE<br />
FDP-Vizechefin Marie-Agnes<br />
Strack-Zimmermann wirbt für<br />
die Umbenennung ihrer Partei<br />
Von DENISA RICHTERS<br />
36 ERDOGANS SPÄTZLE<br />
Lobbyismus für die Türkei und<br />
grüne Identität: Rezzo Schlauch<br />
bringt beides locker zusammen<br />
Von JULIA PROSINGER<br />
38 „SIE SIND EINE MORALTANTE“<br />
Zwei grundverschiedene linke<br />
Publizisten sprechen über Putin,<br />
Mandarine, Moral und die Liebe<br />
Von JAKOB AUGSTEIN und FRANK A. MEYER<br />
44 UNVERBLÜMT<br />
Die Debatte um den Gazakrieg<br />
bringt eine unheimliche<br />
antisemitische Allianz hervor<br />
Von TIMO STEIN<br />
46 DIE HOCHBURG<br />
Die Chefs der AfD im Erzgebirge<br />
sind erfolgsverwöhnt. Bei ihnen<br />
lässt sich viel über die DNA<br />
einer Protestpartei lernen<br />
Von GUNNAR HINCK<br />
58 DAS MASTERMIND<br />
Hamas-Chef Chalid Maschal sitzt fester<br />
im Sattel, als manche glauben wollen<br />
Von SILKE MERTINS<br />
60 ZÜNDELNDE SCHEICHS<br />
<strong>Das</strong> Emirat Katar ist einer<br />
der wichtigsten Finanziers<br />
islamistischen Terrors<br />
Von LINA KHATIB<br />
64 STILLE WASSER<br />
In Argentinien gibt es das<br />
größte Süßwasserdelta der<br />
Welt – ein Fotoessay über das<br />
Leben nach Gezeiten<br />
Von ALEJANDRO CHASKIELBERG<br />
74 DIE MISSION NACH DEM KRIEG<br />
Die Nato bekommt einen <strong>neue</strong>n<br />
Generalsekretär. Der muss das<br />
Bündnis neu ausrichten<br />
Von HEIDI REISINGER<br />
76 DER BÖSE IST IMMER DER WESTEN<br />
In der Ukrainekrise hat die russische<br />
Propaganda tiefe Spuren in den<br />
Köpfen der Russen hinterlassen<br />
Von MORITZ GATHMANN<br />
84 AUS REISHÜLSEN GEBAUT<br />
Bernd Duna hat in Asien<br />
einen Ersatzstoff für<br />
Tropenhölzer gefunden<br />
Von TIL KNIPPER<br />
86 DIE SWIFT-WAFFE<br />
Über eine Finanzfirma in<br />
Belgien könnte der Westen<br />
Russland von den Bankkonten<br />
der Welt abschneiden<br />
Von TOMÁŠ SACHER<br />
90 „NUR ALDI IST<br />
DOCH TRAURIG“<br />
Der Kaufmann Volker Wiem<br />
über Motoröl, Olivenöl und<br />
den Erfolg des Andersseins<br />
Von TIL KNIPPER<br />
86<br />
51 FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… ob sie als Amazon-Kundin<br />
ein schlechter Mensch ist<br />
Von AMELIE FRIED<br />
46<br />
Altwerden<br />
Protestieren im Gartenhaus<br />
64<br />
am Fluss<br />
Kriegführen am Finanzmarkt<br />
Fotos: Christoph Busse für <strong>Cicero</strong>, Alejandro Chaskielberg; Illustration: Mario Wagner<br />
6<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
SALON<br />
CICERO<br />
STANDARDS<br />
94 OPERATION PINK<br />
Die Modedesignerin Elsa<br />
Schiaparelli und ihre Mission<br />
im Zweiten Weltkrieg<br />
Von ILONKA WENK<br />
96 TRAGEN SIE DEUTSCH?<br />
Was zeichnet eigentlich deutsche<br />
Mode aus? Eine Erkundung<br />
106 DIE WERTARBEITERIN<br />
Frauke Gerlach ist die <strong>neue</strong><br />
Chefin des Grimme-Instituts<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
108 TIFLIS? POTI?<br />
HAUPTSACHE ITALIEN<br />
Die Autorin Nino Haratischwili rückt<br />
Europa auf 1300 Seiten zurecht<br />
3 ATTICUS<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
8 STADTGESPRÄCH<br />
12 FORUM<br />
14 IMPRESSUM<br />
138 POSTSCRIPTUM<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
Von ANNE WAAK<br />
Von FRÉDÉRIC SCHWILDEN<br />
102 GIB MIR MEIN SIE ZURÜCK!<br />
Warum uns beim Duzen<br />
das Gespür für menschliche<br />
Größe abhandenkommt<br />
110 „SHAKESPEARE ALTERT NIE“<br />
Thomas Ostermeier und Hartmut Lange<br />
über den größten Dichter aller Zeiten<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
Von HOLGER FUSS<br />
Fotos: Patrick Houi/Hien Le; Illustration: Martin Haake<br />
104 WARUM ICH TRAGE,<br />
WAS ICH TRAGE<br />
Jedes Kleidungsstück, das<br />
ich besitze, kann eine<br />
Geschichte erzählen<br />
Von HATICE AKYÜN<br />
96<br />
Glanz oder Modehandwerk<br />
116 MAN SIEHT NUR, WAS<br />
MAN SUCHT<br />
Heinrich Füsslis böser Blick auf<br />
eigene Eheangelegenheiten<br />
Von BEAT WYSS<br />
118 DER LETZTE VORHANG<br />
Wie könnte die Zukunft des deutschen<br />
Stadttheaters aussehen? Eine Rundreise<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
124 LITERATUREN<br />
Mit Büchern von Dave Eggers,<br />
Bernhard Schlink, Volker<br />
Reihnhardt und Karen Köhler<br />
130 BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
Die lettische Organistin Iveta Apkalna<br />
liest Mankell, Hesse – und Janis Rainis<br />
Von CLAUDIA RAMMIN<br />
134 HOPES WELT<br />
Mit Google-Brille auf der Bühne<br />
Von DANIEL HOPE<br />
136 DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
Von T.C. BOYLE<br />
118<br />
Überleben trotz hoher Kosten<br />
Der Titelkünstler<br />
Wie bebildert man Gefühle<br />
für eine Nation? Eigentlich<br />
lösen sie in Deutschland<br />
unangenehme Assoziationen<br />
aus: Nation, das klingt<br />
alt, männlich, kriegerisch.<br />
Aber wir wollten anlässlich<br />
des schottischen Referendums<br />
unseren Blick öffnen,<br />
ohne wieder beim alten<br />
Mann im karierten Rock zu<br />
landen, der ähnlich alten<br />
Whisky trinkt. Wir wollten<br />
nicht im Klischee enden.<br />
Der Berliner Künstler Olaf<br />
Hajek hat sich der Frage<br />
angenommen. Als Motiv<br />
wählte er eine Frau. Jung,<br />
selbstbewusst, aber gar<br />
nicht großspurig sieht sie<br />
aus. Auch wenn sie nicht<br />
eindeutig in einem bestimmten<br />
Land zu verorten<br />
ist, so fühlt sie sich erkennbar<br />
wohl in der Natur ihrer<br />
Heimat. Ihrer selbst ist sie<br />
sich so sicher, dass sie es<br />
allein versuchen kann mit<br />
der Zukunft. Vielleicht gibt<br />
ihr ihre Nation auch nur<br />
festen Stand in einem geeinten<br />
Europa. Interessant:<br />
Der schottische Mythos ist<br />
trotzdem ziemlich stark.<br />
Olaf Hajek hat noch ein<br />
zweites Bild gemalt, das im<br />
Innern dieses Heftes folgt.<br />
Der Schotte im Kilt kommt<br />
dort zu seinem Recht.<br />
7<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Der SPD-Chef mäht unbeobachtet den Rasen, Rolf Hochhuth rät vom Besuch<br />
seines eigenen Stückes ab – und bei der Linkspartei geht das Theater weiter<br />
Gauck, die Zweite?<br />
Zögerliche SPD<br />
Hassprediger<br />
Der Imam differenziert<br />
Rasenmäher-Trauma<br />
Kein Bild mit Gabriel<br />
FDP wie Grüne, auch einige Christdemokraten<br />
haben sich bereits für<br />
eine zweite Amtszeit von Bundespräsident<br />
Joachim Gauck ausgesprochen.<br />
Gauck selbst lehnt es bisher ab, sich zu<br />
diesem Thema zu äußern. Er antwortet<br />
lieber: „Sie sehen einen Mann vor<br />
sich, der sich sehr freut.“ <strong>Das</strong> ist noch<br />
kein Ja, aber auch kein Nein zu einer<br />
Verlängerung vom Jahr 2017 an. Eines<br />
jedoch ist klar: Seine Lebensgefährtin<br />
Daniela Schadt steht dem Gedanken<br />
ganz gewiss nicht ablehnend gegenüber;<br />
die ehemalige Journalistin erfreut sich<br />
längst sehr an den Pflichten und Aufgaben,<br />
die das Amt auch für sie mitbringt.<br />
In der SPD hingegen wird die Idee einer<br />
zweiten Amtszeit für Gauck sorgsam<br />
zurückhaltend behandelt. Denn die<br />
Sozialdemokraten brauchen den Präsidentenposten<br />
nach der Bundestagswahl<br />
2017 womöglich als politisches Spielmaterial<br />
für eine Koalition. tz<br />
Was macht eigentlich Sheikh Abu<br />
Bilal Ismail? Der Imam hatte in<br />
der Neuköllner Al-Nur-Moschee Mitte<br />
Juni für die Vernichtung der Juden gebetet.<br />
Im Internet war ein Video aufgetaucht,<br />
auf dem Ismail die israelischen<br />
Juden als „Schlächter des Propheten“ bezeichnet.<br />
Er bittet darin, die jüdischen<br />
Zionisten bis zum letzten Mann zu töten.<br />
Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt<br />
wegen des Verdachts der Volksverhetzung.<br />
Bilal Ismail soll nun wieder in Dänemark<br />
sein. Dort ist er eigentlich Imam<br />
der Grimhøj Moschee in Aarhus. Der<br />
Vorsitzende der Organisation hinter der<br />
Moschee, Oussama El Saadi, stellt sich<br />
indes vor Abu Bilal. Er spricht von einem<br />
Übersetzungsfehler. In einer Mitteilung<br />
heißt es: Imam Bilal sei bewusst falsch zitiert<br />
worden. Er rufe nicht zum Mord an<br />
Juden auf, sondern bitte lediglich Allah,<br />
zionistische Juden zu töten. So viel Differenzierung<br />
muss schon sein. ts<br />
<strong>Das</strong>s SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar<br />
Gabriel trotz aller Amtsgeschäfte<br />
jede Woche von Berlin nach<br />
Goslar reist, daraus macht er kein Geheimnis.<br />
In Goslar arbeitet seine Frau<br />
Anke als Zahnärztin, und Töchterchen<br />
Marie besucht die Kita. Gabriel hat versprochen,<br />
sie einmal pro Woche, meist<br />
am Mittwoch, dort abzuholen. Ungern<br />
gibt Gabriel jedoch zu, dass er zu<br />
Hause auch für den Garten zuständig<br />
ist. Er hat sich dafür einen stattlichen<br />
Aufsitz-Rasenmäher zugelegt, lehnt es<br />
aber konsequent ab, sich darauf fotografieren<br />
zu lassen. Vermutlich erinnert<br />
sich Gabriel an ein Rasenmäher-Bild<br />
seines Amtsvorgängers Oskar Lafontaine.<br />
Der war einst beim Rasenmähen<br />
von <strong>Cicero</strong> abgelichtet worden – und<br />
hinterher lachte die halbe Republik darüber,<br />
wie ausgeprägt massig auf dem<br />
Foto Lafontaines „Maurer-Dekolleté“<br />
über seinem Po zur Geltung kam. tz<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
8<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
∆Wie wachsen Fachkräfte nach?<br />
Der deutsche Mittelstand bildet 86 % aller Auszubildenden aus, im weltweit vorbildlichen<br />
dualen Ausbildungssystem. Und das ist nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt,<br />
Verantwortung zu übernehmen. Als eine der größten Förderbanken der Welt investiert<br />
die KfW in Unternehmen und Arbeitsplätze – und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebensbedingungen<br />
nachhaltig zu verbessern.<br />
Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Sommertheater<br />
Hochhuth warnt<br />
Linkspartei<br />
Neues Dreamteam<br />
SPD-Generalin<br />
Ausputzen oder stören?<br />
In der Hauptstadt schreibt man Sommerloch<br />
mit H wie Hochhuth. Einmal<br />
im Jahr sorgt der Stückeschreiber<br />
für Trubel im Berliner Ensemble – und<br />
zwar, wenn die Eigentümerin der Immobilie<br />
am Schiffbauerdamm, die<br />
Holzapfel-Stiftung, ihr Recht wahrnimmt,<br />
„in den Theaterferien ein selbst<br />
finanziertes Gastspiel anzubieten“. Ilse<br />
Holzapfel war Hochhuths Mutter. Diesmal<br />
übertraf der 83-Jährige sich selbst,<br />
indem er vor seinem eigenen Stück<br />
warnte. Natürlich wollte Rolf Hochhuth<br />
nicht von dem Textmonstrum „Sommer<br />
14 – ein Totentanz“ abraten, sondern<br />
von der Zurichtung durch Regisseur<br />
Torsten Münchow. Dieser bot energische<br />
Schnitte und ein pfiffiges Bühnenbild:<br />
Die Hauptfiguren der Julikrise waren<br />
in einem Wellnesstempel für High<br />
Potentials gestrandet, Bademäntel inklusive.<br />
Dort mussten sie Hochhuth-<br />
Texte aufsagen. Udo Walz mimte (in<br />
der Premiere nur) einen Friseur. Ottfried<br />
Fischer hatte einen winzigen Auftritt<br />
mit Kaiser Franz Joseph zugeschobenen<br />
Sätzen, Mathieu Carrière gab<br />
im Elitencamp einen quengeligen Kaiser<br />
Wilhelm mit Sonnenbrille, Caroline<br />
Beil eine Fürstin. Im Foyer des am<br />
vierten Abend schütter besuchten Theaters<br />
saß Hochhuth an einem Tischlein,<br />
spreizte die Zehen in der Sandale<br />
und tat, was er kann: finster schauen,<br />
Anstoß nehmen, die Zeitläufte herabrufend.<br />
Dann und wann gab er ein<br />
Autogramm. Dieser Sommer war ein<br />
November. akis<br />
Für die Linke gilt Gregor Gysi als<br />
unverzichtbar. Mehrere Versuche,<br />
Kronprinzen aufzubauen, sind in<br />
25 Jahren misslungen. Jetzt könnte<br />
das nächste Prinzenpaar scheitern. Eigentlich<br />
war ausgemacht, dass Gysi<br />
den Vorsitz der Bundestagsfraktion<br />
Mitte der Legislaturperiode abgibt. Der<br />
66-Jährige schmiedete schon Pläne für<br />
die Zeit nach der großen Politik.<br />
Die beiden Nachfolger Sahra Wagenknecht<br />
und Dietmar Bartsch stehen<br />
bereit. In der Fraktion wurden bereits<br />
Posten vergeben und die Einflusssphären<br />
neu abgesteckt. Doch zugleich<br />
machte sich dort eine politische Eiszeit<br />
breit. Denn Wagenknecht und Bartsch<br />
können nicht miteinander.<br />
Jetzt kommt es vielleicht ganz anders.<br />
Wie so viele Politiker ist auch<br />
Gysi der Politik verfallen. Gründe,<br />
noch ein paar Jahre dranzuhängen, finden<br />
sich immer. Hinzu kommt: Gysi ist<br />
der auserkorenen Nachfolgerin in tiefer<br />
Abneigung verbunden. Auch gönnt er<br />
seinem Nicht-mehr-Freund Lafontaine,<br />
dem Lebensgefährten Wagenknechts,<br />
diesen letzten Triumph nicht.<br />
Kurz vor der Sommerpause traf<br />
sich im Bundestag eine illustre Runde<br />
einflussreicher Abgeordneter und entwarf<br />
einen Alternativplan: Gysi hängt<br />
noch ein paar Jahre dran. An seiner<br />
Seite übernimmt die Parteichefin Katja<br />
Kipping den Co-Vorsitz der Fraktion.<br />
Die Linke hätte ein <strong>neue</strong>s Dreamteam<br />
und Kipping endgültig die Macht in der<br />
Partei an sich gerissen. cse<br />
Die SPD-Generalsekretärin Yasmin<br />
Fahimi hat offenbar unter dem<br />
Eindruck der gewonnenen Fußballweltmeisterschaft<br />
über ihre eigene politische<br />
Funktion nachgedacht. Zumindest<br />
klingt die Wortwahl der ehemaligen<br />
Gewerkschaftssekretärin, die seit ihrer<br />
Berufung ins Willy-Brandt-Haus<br />
noch nicht sonderlich viel von sich reden<br />
gemacht hat, sehr nach dem wohlvertrauten<br />
Kicker-Jargon. Anfänglich<br />
hatte Fahimi ihre Position auf dem rotschwarzen<br />
Spielfeld noch mit „Torwart“<br />
beschrieben. Da die CDU/CSU<br />
bisher allerdings nicht besonders kraftvoll<br />
auf den SPD-Kasten zielt, will sich<br />
die 46-Jährige jetzt offenbar spieltaktisch<br />
umorientieren. Jedenfalls bezeichnet<br />
sie <strong>neue</strong>rdings „frühes Stören“<br />
im Mittelfeld als ihre wichtigste<br />
Aufgabe auf dem Rasen der Politik.<br />
In der Umgebung des SPD-Vorsitzenden<br />
Sigmar Gabriel vernimmt man dies<br />
mit leisem Missvergnügen: Stören –<br />
wen denn? Die Entourage des Parteichefs<br />
kommentiert mit schrägem Blick<br />
auf den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden<br />
Ralf Stegner ziemlich unmissverständlich:<br />
„In dieser Funktion operiert<br />
der ja bereits ausgiebig.“ Hier<br />
könne sich die Generalsekretärin, flüstern<br />
daher Gabriel-Vertraute, ja gerne<br />
fußballstrategisch „als Vorstopperin<br />
betätigen“. Den modernen Libero mit<br />
offensiver Spielweise praktiziere Gabriel<br />
bereits. Aber einen „Ausputzer“<br />
könne die SPD zuweilen schon noch<br />
gut vertragen. tz<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
10<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
1<br />
Stadt<br />
1<br />
Netzwerk<br />
227<br />
Partner<br />
20<br />
Jahre<br />
1 000<br />
Dank<br />
www.berlin-partner.de/20Jahre<br />
#20JahrefürBerlin
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
FORUM<br />
Es geht um den Islam, Amerika, Karl Lauterbachs<br />
medizinische Kompetenz und bärtige Jungfrauen<br />
Zum Beitrag „Die zaudernde Weltmacht“ von Roger Cohen, August 2014<br />
Was die Welt nicht braucht<br />
Amerika war und ist zweifellos in vielen Bereichen führend, und die Welt hat<br />
ihm sicher etliche positive, erfreuliche Entwicklungen zu verdanken, aber es<br />
trägt auch für viele Fehlentwicklungen Verantwortung. Ob die Welt alles, was<br />
aus Amerika kommend über sie geschwappt ist, wirklich gebraucht hätte, sei einmal<br />
dahingestellt, entziehen konnte sie sich ihm nur schwerlich. Was die Welt<br />
aber keinesfalls braucht, weil es sie destabilisiert und ihre Ordnung völlig durcheinanderbringt,<br />
ist eine freiheitlich demokratische Weltmacht, die demokratische<br />
Grundsätze leichtfertig über Bord wirft, wenn sie es für angeraten hält, und die<br />
Gesetze anderer Staaten missachtet.<br />
Nelly Böhmert, Rodenbach<br />
Zum Beitrag „Totalitäre Religion“ von<br />
Frank A. Meyer, August 2014<br />
Treffende Worte<br />
Vielen Dank für die treffenden<br />
Worte in Ihrem Artikel. Es ist so nötig,<br />
dass jemand das Offensichtliche<br />
formuliert und auf den Punkt bringt.<br />
Leider ist die deutsche Gesellschaft<br />
mehr und mehr von einer linken<br />
Sichtweise dominiert, die eine kritische<br />
Auseinandersetzung mit Themen<br />
der Integration und eben auch<br />
mit dem Islam unmöglich macht. Ich<br />
habe mich oft gefragt, woran das<br />
liegt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung<br />
aus dem von Sigmund Freud<br />
formulierten Abwehrmechanismus<br />
„Reaktionsbildung“ (bei dem unangemessene<br />
Gedanken abgewehrt<br />
werden, indem sie ins Gegenteil umgekehrt<br />
werden) und einer unerträglichen<br />
kognitiven Dissonanz, die<br />
entstehen würde, wenn die Wirklichkeit<br />
in die Vorstellungswelt vieler<br />
Sozialromantiker Einzug halten<br />
würde.<br />
Daniel Spitzer, Heilbronn<br />
Religion ist nie modern<br />
Als ich in der Unterzeile von der<br />
Überlegenheit des „christlich-jüdischen<br />
Kulturkreises“ las, hatte<br />
ich einen Moment lang Zweifel am<br />
sonst so kritischen Blick von Herrn<br />
Meyer. Aber zum Glück hat die Redaktion<br />
den Kommentar nur falsch<br />
zusammengefasst. Vom Christenund<br />
Judentum muss in einem Artikel<br />
über den reaktionären Islam (übrigens<br />
eine gute Analyse!) gar nicht<br />
vergleichend die Rede sein, da jede<br />
Religion, wie Meyer schreibt, „Behinderung<br />
von Intelligenz, von Neugierde,<br />
von Ehrgeiz, von Eigenverantwortung<br />
– von Leben“ ist. Mit<br />
Schaudern denke ich ans Luther-Jubiläum<br />
in drei Jahren, wenn es wieder<br />
allerorten heißen wird, wie modern<br />
„unsere“ Religion ist. Religion<br />
ist nie modern, muss es auch nicht<br />
sein. Denn die Selbstentwürdigung<br />
des Menschen durch den Glauben<br />
an einen, der ihn und andere lenkt,<br />
wohnt jeder Religion inne.<br />
Tilman Lucke, Berlin<br />
Danke<br />
Danke für Ihren aufklärerischen<br />
und gradlinigen Beitrag im <strong>neue</strong>n<br />
<strong>Cicero</strong>. Nicht immer liebe ich, was<br />
Sie schreiben, aber lese alles. Dieser<br />
Beitrag ist so klar, dass ich mich<br />
spontan dafür bedanken muss.<br />
Kurt Reuter, Heusenstamm<br />
Mangelnde Seriosität<br />
Die August-Ausgabe des <strong>Cicero</strong><br />
steht unter dem Titel: „Ist der Islam<br />
böse?“ Als ich das sah, hoffte<br />
ich, dass es in dem Heft um Ressentiments<br />
gehen würde, und<br />
nicht, dass abgestandene Ressentiments<br />
ein weiteres Mal aufgewärmt<br />
würden.<br />
Da Herr Meyer nicht als Experte<br />
ausgewiesen wird, gehe ich<br />
davon aus, dass er vom Islam ungefähr<br />
so viel weiß wie andere informierte<br />
Menschen auch. Nun kann<br />
es ja erfrischend sein, wenn informierte<br />
Laien ihre Eindrücke und<br />
Gedanken schildern. Aber wenn<br />
sich jemand anschickt, ohne tiefere<br />
Kenntnis über das Wesen einer Religion<br />
zu schreiben, ist doch jede<br />
Seriosität schon verloren gegangen.<br />
In seinem Hang zum Essentialismus<br />
steht Herr Meyer den islamistischen<br />
Fundamentalisten in<br />
nichts nach, wenn er meint, am Islam<br />
sei etwas, das alle seine Vorkommen<br />
im Vorhinein verdirbt<br />
und es unmöglich macht, muslimischen<br />
Glaubens und gleichzeitig<br />
modern, intellektuell, zweifelnd<br />
und so weiter zu sein.<br />
Philipp Bode, Oldenburg<br />
12<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
EHR<br />
GROSSE THEMEN ZUM KLEINEN PREIS<br />
FAHNE<br />
T<br />
10 x CICERO<br />
zum Preis von<br />
8 AUSGABEN<br />
Illustrator: Olaf Hajek<br />
ZUM JUBILÄUM:<br />
DAS CICERO 10-MONATS-ABO!<br />
Feiern Sie mit <strong>Cicero</strong> 10-jähriges Jubiläum<br />
und beschenken Sie sich selbst mit 10 <strong>Cicero</strong>-<br />
Ausgaben zum Preis von 62,– Euro.<br />
Zum Preis von 62,– Euro statt 85,– Euro im Einzelkauf erhalten<br />
Sie insgesamt 10 Ausgaben <strong>Cicero</strong> frei Haus (zwei Ausgaben<br />
kostenlos sowie acht weitere Ausgaben zum Vorzugspreis von<br />
7,75 Euro). Der Bezug von <strong>Cicero</strong> endet dann automatisch,<br />
eine Kündigung ist nicht erforderlich.<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice:<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: cicero.de<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1164086<br />
<strong>Cicero</strong><br />
10-Monats-Abo
IMPRESSUM<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexander Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
CHEFIN VOM DIENST Kerstin Schröer<br />
RESSORTLEITER Lena Bergmann ( Stil ),<br />
Judith Hart ( Weltbühne ), Dr. Alexander Kissler ( Salon ),<br />
Til Knipper ( Kapital ), Constantin Magnis<br />
( Reportagen ), Dr. Frauke Meyer-Gosau ( Literaturen )<br />
CICERO ONLINE Christoph Seils ( Leitung ),<br />
Petra Sorge, Timo Stein<br />
ASSISTENTIN DES CHEFREDAKTEURS<br />
Monika de Roche<br />
REDAKTIONSASSISTENTIN Sonja Vinco<br />
ART-DIREKTORIN Viola Schmieskors<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION (DRUCK + DIGITAL) Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Michael Voss<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
VERTRIEBSLOGISTIK Ingmar Sacher<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Michael Passen<br />
DRUCK/LITHO Neef+Stumme<br />
premium printing GmbH & Co.KG<br />
Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Jörg Heidrich, Tel.: +49 (0)5831 23-122<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
ANZEIGENLEITUNG<br />
( verantw. für den Inhalt der Anzeigen )<br />
Anne Sasse, Sven Bär<br />
ANZEIGENVERKAUF<br />
Jessica Allgaier, Stefan Seliger ( Online ),<br />
Jacqueline Ziob, Svenja Zölch<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski (PremiumContentMedia)<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 83 515 ( IVW Q2/2014 )<br />
LAE 2014 122 000 Entscheider<br />
REICHWEITE 390 000 Leser ( AWA 2014 )<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: + 49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
VERLAG Tel.: + 49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
ANZEIGEN Tel.: + 49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER<br />
Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung<br />
auf Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur<br />
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2014, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION DER RINGIER GRUPPE<br />
Zum Beitrag „Die Blutspur des<br />
Propheten“ von Gilles Kepel, August 2014<br />
Zynischer Missbrauch<br />
Religiosität ist, anerkannt oder geleugnet,<br />
ein Grundbedürfnis des<br />
Menschen. Es ist eine tragische Paradoxie,<br />
dass die Religionen einerseits<br />
zu den größten Kulturgütern<br />
der Menschheit gehören, andererseits<br />
für sie eine große Gefahr darstellen.<br />
Religiöser Transzendenzbezug<br />
ist schwer zu rationalisieren.<br />
<strong>Das</strong> verführt zu dogmatisch fixierter<br />
Irrationalität. Es ist diese unheilvolle<br />
Allianz zwischen Dogmatismus<br />
und Irrationalität, welche<br />
Religionen dafür anfällig macht,<br />
zu Nährböden für machtpolitische<br />
Ideologisierungen zu werden.<br />
Der Islam ist in dieser Hinsicht<br />
besonders gefährdet, da sich in seiner<br />
Lehre ein inhärentes Gewaltpotenzial,<br />
das sich politisch ausbeuten<br />
lässt, mit einer im Vergleich zu den<br />
anderen großen Religionen geringergradigen<br />
intellektuellen Durchdringung<br />
verbindet. Diese Gefahr<br />
wird durch die weltweite Verbreitung<br />
des Islam noch potenziert. Dabei<br />
ist nicht der muslimische Glaube<br />
selbst das Problem, sondern der<br />
zynische Missbrauch intellektueller<br />
Schwachstellen der islamischen<br />
Glaubenslehre im Interesse politischer<br />
Machtausübung.<br />
Dr. Jürgen Lambrecht, Baden-Baden<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu<br />
einer <strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen<br />
gerne weiter. Sie erreichen uns werktags von 7:30 Uhr bis<br />
20:00 Uhr und samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
TELEFON 030 3 46 46 56 56<br />
TELEFAX 030 3 46 46 56 65<br />
E-MAIL abo@cicero.de<br />
ONLINE www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-MAIL info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. Abopreise inkl. gesetzlicher MwSt.<br />
und Versand im Inland, Auslandspreise auf Anfrage. Der Export und Vertrieb<br />
von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln<br />
ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,50 €, CH: 13,– CHF, A: 8,50 €<br />
JAHRESABONNEMENT ( ZWÖLF AUSGABEN )<br />
D: 93,– €, CH: 144,– CHF, A: 96,– €<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €<br />
KOMBIABONNEMENT MIT MONOPOL<br />
D: 138,– €, CH: 198,– CHF, A: 147,– €<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen. Falls<br />
Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler nicht<br />
erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei seinem<br />
Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist dann in der<br />
Regel am Folgetag erhältlich.<br />
Europa schaut zu<br />
Als ich vor etlichen Jahren für drei<br />
Jahre beruflich in arabischen Ländern<br />
tätig war, gab es zwar auch<br />
schon Terror, aber nicht in dem teuflischen<br />
Ausmaß wie heute. Die Verschleppung<br />
von über 200 jungen<br />
Schulmädchen in Nigeria, das feige<br />
Vorgehen von Al Schabab in Somalia<br />
oder die grausamen Tötungen<br />
der „IS-Horden“ in Syrien und im<br />
Irak sind Verbrechen an der eigenen<br />
Bevölkerung.<br />
Was ist zu tun? Die Alliierten<br />
damals haben uns Deutsche von<br />
den feigen Nazi-Schergen befreit.<br />
Wie lange noch will Europa nur Zuschauer<br />
spielen?<br />
Dipl.-Ing. Erwin Chudaska, Rödermark<br />
14<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
Zum Beitrag „Ich scanne jeden<br />
automatisch“ von Georg Löwisch und<br />
Christoph Schwennicke, August 2014<br />
Karikatur: Hauck & Bauer<br />
Klinischer Theoretiker<br />
<strong>Cicero</strong> nennt sich „Magazin für<br />
politische Kultur“, und in diesem<br />
Sinne klang das Gespräch (Interview<br />
erscheint mir zu hoch gegriffen)<br />
mit Herrn Lauterbach nur als<br />
eine dünne „politische“ Dampfplauderei.<br />
Die nichtssagenden Allgemeinplätze<br />
des Interviewten zeigten<br />
einmal mehr, wie weit Herr Lauterbach<br />
vom Alltag des Arztes entfernt<br />
lebt. Weder sind seine „medizinischen“<br />
Verlautbarungen noch seine<br />
Anamnesen und Befunde spezifisch<br />
für einen Arzt. Es handelt sich in<br />
seinen Antworten fast nur um<br />
Oberflächlichkeiten, Vermutungen<br />
und Banalitäten.<br />
Es wäre schön und politisch<br />
korrekt, wenn Herr Lauterbach sich<br />
eindeutiger dazu bekennt, nur ein<br />
klinischer Theoretiker zu sein ( seine<br />
ärztliche Zulassung hat er ja auch<br />
erst vor kurzer Zeit erhalten ). Denn<br />
lebendige Patienten und einen<br />
Arbeitsalltag als Arzt hat er lange<br />
nicht mehr erlebt. Deshalb sind seine<br />
Ideen, Theorien und Pläne für den<br />
deutschen Medizinbetrieb kontraproduktiv<br />
und nur klientelorientiert<br />
(und am Ende wieder überteuert für<br />
die gesetzlich Versicherten).<br />
Dr. Moritz Ries, Ebstorf<br />
Zum Beitrag „Bärtige Jungfrauen küsst<br />
man nicht“ von Beat Wyss, Juli 2014<br />
Medizinische Erklärung<br />
Im Artikel über die heilige Kümmernis<br />
vermisse ich als Frauenarzt<br />
eine naturwissenschaftliche alternative<br />
Erklärung. Es gibt seltene Eierstocktumore,<br />
die aus sich heraus<br />
männliche Geschlechtshormone bilden<br />
und bei den betroffenen Frauen<br />
zu einem erheblichen Bartwuchs<br />
führen können. In Abhängigkeit<br />
von der Wachstumsgeschwindigkeit<br />
des Tumors kann der Bartwuchs relativ<br />
rasch auftreten, sodass aus<br />
der Distanz von mehreren Jahrhunderten<br />
ein Bartwuchs „über Nacht“<br />
plausibel erscheint.<br />
Prof. Dr. Volker Hanf, Fürth<br />
Zu <strong>Cicero</strong>, August 2014<br />
Bereichernd<br />
Ich bin ein frisch gebackener <strong>Cicero</strong>-Leser.<br />
Zu meinem Geburtstag<br />
habe ich ein Abo von meiner<br />
Mutter geschenkt bekommen. Wie<br />
sich herausstellt, hätte meine Mutter<br />
mir kein besseres Geschenk machen<br />
können. Denn ich kenne kein<br />
vergleichbares Magazin. Hervorragende<br />
journalistische Arbeit, von<br />
der man nicht genug kriegen kann.<br />
Perfekte Themenauswahl mit super<br />
Hintergrundrecherchen sowie die<br />
Profile, die Sie von vielen Politikern<br />
zeichnen, bereiten mir in jedem Artikel<br />
aufs <strong>neue</strong> Euphorie.<br />
Gerade weil der Spiegel meiner<br />
Meinung nach qualitativ sehr leidet,<br />
kann ich meine Freude über den <strong>Cicero</strong><br />
und all seine zahlreichen Facetten<br />
nicht mehr länger für mich<br />
behalten. Darum wollte ich mir dieses<br />
Lob für niemand anderen als die<br />
Redaktion aufsparen: Vielen Dank<br />
für die bereichernde journalistische<br />
Glanzleistung!<br />
Laura-Marina Föller, Bonn<br />
Richtigstellung<br />
Im August-Heft berichtete Peter Henning<br />
unter dem Titel „Licht im Schacht“<br />
auf S. 103 von einer Begegnung mit der<br />
Schriftstellerin Judith Hermann. Wir<br />
bedauern außerordentlich, feststellen<br />
zu müssen, dass es die Begegnung zwischen<br />
der Autorin und Peter Henning<br />
nicht gegeben hat. Wir entschuldigen<br />
uns in aller Form bei Frau Hermann für<br />
die falsche Berichterstattung, die zudem<br />
noch zu früh erfolgt ist: Ihr Roman<br />
„Aller Liebe Anfang“ ist am 15. August<br />
2014 im Verlag S. Fischer erschienen.<br />
Die <strong>Cicero</strong>-Redaktion<br />
Anmerkung der Redaktion<br />
Zu dieser Richtigstellung, die auf<br />
Wunsch des Verlags S. Fischer erscheint,<br />
möchten wir anmerken, dass der Autor<br />
uns getäuscht hat. Er gab schriftlich<br />
und telefonisch eingeholte Zitate als<br />
Resultat eines Treffens aus. Wir bedauern<br />
den Vorfall sehr.<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.<br />
Wünsche, Anregungen und Meinungsäußerungen<br />
senden Sie bitte an redaktion@cicero.de<br />
15<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
EIN GEFÜHL VON<br />
GEBORGENHEIT<br />
Von HERFRIED MÜNKLER<br />
Der Nationalstaat stellt die effektivste<br />
und leistungsfähigste Ordnung dar, die es in<br />
der politischen Geschichte je gegeben hat.<br />
<strong>Das</strong> gilt im Guten wie im Schlimmen – die<br />
Fusion von Staat und Nation bleibt ein<br />
gefährliches Projekt<br />
Illustrationen OLAF HAJEK<br />
16<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
Der Begriff „Nationalstaat“ geht uns flott von<br />
den Lippen. Dabei ist das Kompositum aus<br />
Nationalität und Staatlichkeit das Ergebnis<br />
harter politischer Kämpfe – politischer Konflikte<br />
im Innern, in denen politische Intellektuelle die<br />
Idee der Nation als Hebel der Veränderung angesetzt<br />
haben, um den Dienern des Königs die Macht streitig<br />
zu machen, ebenso aber auch zwischenstaatlicher<br />
Kriege, in denen unter Verweis auf nationale Zugehörigkeit<br />
Grenzen verschoben und Menschen vertrieben<br />
wurden. Die Idee der Nation hat in der politischen<br />
und kulturellen Geschichte Europas eine<br />
überaus ambivalente Wirkung gehabt. Sie diente als<br />
Parole der Befreiung wie der Unterdrückung. Ob die<br />
Nation bei ihren Bürgern einen guten Ruf hat oder<br />
eher übel beleumundet ist, hängt von den geschichtlichen<br />
Erfahrungen ab. Dementsprechend<br />
unterschiedlich wird<br />
das Nationale in Europa beurteilt:<br />
Während Polen und Franzosen auf<br />
ihre Nation nichts kommen lassen,<br />
sind die Deutschen skeptisch, wenn<br />
von der Nation die Rede ist, jedenfalls<br />
bei politischen Fragen. In Angelegenheiten<br />
des Sports ist man<br />
etwas großzügiger.<br />
Dabei ist keineswegs eindeutig,<br />
was mit Nation gemeint ist und<br />
nach welchen Kriterien man ihr zugerechnet<br />
wird: Ist sie das Ergebnis<br />
einer Zugehörigkeitserklärung, die<br />
individuell oder im Kollektiv abgegeben<br />
worden ist, oder handelt es<br />
sich um eine Schicksalsgemeinschaft,<br />
in die man hineingeboren<br />
wird? Steht der Begriff der Nation,<br />
wissenschaftlich formuliert, für „demos“<br />
oder „ethnos“? Über diese Frage ist zu Beginn<br />
des 20. Jahrhunderts eine Debatte zwischen deutschen<br />
und französischen Gelehrten ausgetragen worden, Ernest<br />
Renan und Friedrich Meinecke in vorderster Linie.<br />
Ausgangspunkt war der Problemfall Elsass, wo<br />
man deutsch sprach, sich aber mehrheitlich der französischen<br />
Republik zugehörig fühlte. Die Zugehörigkeitslinien<br />
überschnitten sich, Kulturnation stand gegen<br />
Staatsnation. Der Konflikt ließ sich erst lösen, als<br />
man ein Drittes ins Spiel brachte: Europa als gemeinsamen<br />
politisch-kulturellen Raum. Nationalitätenkonflikte<br />
haben eine Intensität, der nur noch Religionskonflikte<br />
gleichkommen. Will man deren kriegerische<br />
Austragung vermeiden, braucht man übergreifende<br />
Ideen und Strukturen. Der Völkerbund war und die<br />
Vereinten Nationen sind ein Projekt, das Konfliktpotenzial<br />
des Nationalen zu entschärfen, ohne auf die<br />
Kohäsionskraft und das Solidarisierungspotenzial des<br />
Nationalen verzichten zu müssen. Ob das auch für die<br />
EU gilt, ist umstritten. Die Idee der Nation sperrt sich<br />
Der Staat will<br />
die Menschen<br />
ordnen und<br />
disziplinieren.<br />
Die Nation<br />
dagegen versetzt<br />
sie<br />
in Aufregung<br />
gegen ein Zuviel an Europa, wenn dies auf eine Trennung<br />
von Nation und Staat hinauslaufen soll. Die Suche<br />
nach Kompromissen ist zäh und schwierig; einmal<br />
mehr machen sich die unterschiedlichen Erfahrungen<br />
mit der Nation bemerkbar.<br />
Im Zusammenspiel von Staatlichkeit und Nationalität<br />
steht der Staat für die Statik des politischen<br />
Systems, für eine Ordnung, die vor allem aus vertikalen<br />
Verstrebungen besteht, während der Nation ein<br />
starkes Moment von Dynamik eigen ist: Gegen die<br />
Vertikalität des Staates stellt sie horizontale Bindungen,<br />
gegen die Fürsorglichkeit von „Vater Staat“ die<br />
„Brüderlichkeit“ der Bürger. Ein ums andere Mal war<br />
es die politische Idee der Nation, die Veränderungen<br />
angestoßen hat, etwa in den Anfängen der Französischen<br />
Revolution, als der Begriff der Nation zum<br />
Hebel wurde, um Königsherrschaft<br />
und Ständeordnung aus den Angeln<br />
zu heben und die Idee von der<br />
Rechtsgleichheit aller Bürger durchzusetzen.<br />
Oder im Deutschland des<br />
Vormärz, als sich Nation und Demokratie<br />
miteinander verbanden,<br />
um gegen Restauration, Kleinstaaterei<br />
und Ungleichheit anzukämpfen.<br />
Der Staat war und ist darauf<br />
bedacht, die Menschen in Ruhe zu<br />
halten, sie zu ordnen und zu disziplinieren.<br />
Die Nation dagegen versetzt<br />
sie in Aufregung und bringt<br />
sie in Bewegung.<br />
Es kommt nicht von ungefähr,<br />
dass die Kombination von Staat und<br />
Nation, der Nationalstaat, die effektivste<br />
und leistungsfähigste politische<br />
Ordnung darstellt, die es in der<br />
politischen Geschichte gegeben hat,<br />
im Guten wie im Schlimmen. <strong>Das</strong> zeigen Verlauf und<br />
Nachgeschichte des Ersten Weltkriegs: Betrachtet man<br />
den Krieg einmal als eine Auseinandersetzung zwischen<br />
Nationalstaat und multinationalem Großreich im<br />
Sinne konkurrierender politischer Ordnungsmodelle,<br />
so war sein Ausgang ein schlagender Nachweis für die<br />
Überlegenheit des Nationalstaats: Er konnte nicht nur<br />
seine materiellen Ressourcen besser einsetzen, sondern<br />
auch die Opferbereitschaft der Menschen in viel<br />
höherem Maße mobilisieren, als dies die Großreiche<br />
des Ostens vermochten. Mit Blick auf die Opferbereitschaft<br />
kann man das auch als ein Argument gegen die<br />
Nationalstaaten auffassen – freilich nur so lange, wie<br />
man sie auf das Menschenschlachthaus Krieg bezieht.<br />
<strong>Das</strong> Zusammenspiel von Staat und Nation beruht<br />
jedoch auf Voraussetzungen, die weder selbstverständlich<br />
noch überall herzustellen sind. So gibt es<br />
Räume, wie etwa den Balkan, wo sich eine kleinräumige<br />
Siedlungsstruktur unterschiedlicher ethnischer<br />
(und religiöser) Gruppen herausgebildet hat, sodass<br />
19<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
die Gründung eines Nationalstaats dort zwangsläufig<br />
zur Entstehung nationaler Minderheiten führen musste,<br />
die einen niederen Status bekamen und sich diskriminiert<br />
fühlten. So entstand die Versuchung, auf die daraus<br />
erwachsene politische Instabilität mit „ethnischen<br />
Säuberungen“ zu reagieren. In anderen Fällen wurde<br />
eine „Obernation“ erfunden, unter der die verschiedenen<br />
Ethnien zu einer nationalen Einheit zusammengefasst<br />
werden konnten. In einigen Fällen ging das gut,<br />
wie bei den Deutschen, wo Sachsen, Franken, Bayern,<br />
Schwaben und all die anderen auf den Status einer Nation<br />
verzichteten und sich mit dem des Volksstamms<br />
beschieden; in anderen Fällen führte es zu Spannungen<br />
und Separationsbestrebungen, etwa in Spanien,<br />
wo die Katalanen die Unabhängigkeit anstreben, oder<br />
bei den Briten, wo die Schotten jetzt in einer Abstimmung<br />
entscheiden, ob sie sich von<br />
den Engländern trennen, mit denen<br />
sie seit mehr als drei Jahrhunderten<br />
einen gemeinsamen Staat bilden.<br />
Tschechen und Slowaken haben<br />
sich in den neunziger Jahren<br />
friedlich getrennt, im Unterschied<br />
zu Jugoslawien, wo das zu mehreren<br />
Kriegen führte. Wie es um die<br />
Ukraine als Nationalstaat bestellt<br />
ist, wird sich in den nächsten Monaten<br />
zeigen. <strong>Das</strong> Zusammenbringen<br />
von Staat und Nation ist ein politisch<br />
riskantes Projekt: Wenn es<br />
scheitert, hinterlässt es meist eine<br />
Spur der Verwüstung.<br />
Es waren und sind die Staatenund<br />
Bürgerkriege, die viele in der<br />
Auffassung bestärkt haben, man<br />
solle, ja müsse sich von der Idee der<br />
Nation verabschieden und stattdessen<br />
politische Einheiten bilden, die weniger starke Inklusions-<br />
und Exklusionsmechanismen aufweisen. Je<br />
mehr Kompetenzen von den europäischen Nationalstaaten<br />
auf „Brüssel“ übergehen, desto stärker wird<br />
die EU zu einem solchen Projekt. Nach den Vorstellungen<br />
einiger soll die Nation eine weitgehend auf Folkloreniveau<br />
gestutzte Größe sein, der politisch so gut wie<br />
keine Bedeutung mehr zukommt. Man erhofft sich davon<br />
eine stärkere Integration des EU-Raumes.<br />
Die Ironie der europäischen Integration besteht jedoch<br />
darin, dass man so die Nation gerade nicht loswird:<br />
Die nationalen Selbstständigkeitsbestrebungen<br />
der Katalanen, Schotten, Bretonen und manch anderer<br />
sind nichtintendierte Effekte der EU. Erst die EU hat<br />
die Überzeugung bestärkt, man könne sich vom bisherigen<br />
Staat lossagen, weil die negativen wirtschaftlichen<br />
und sozialen Effekte durch die EU abgefedert<br />
würden. Ohne die Überlebensgarantien der EU wären<br />
die Separationsforderungen Parolen einer kleinen Minderheit<br />
geblieben, politische Folklore eben.<br />
Staaten werden geschaffen, von Politikern,<br />
Bürokraten und Militärs. Nationen dagegen<br />
werden erfunden, und dabei spielen Gelehrte<br />
und Intellektuelle eine entscheidende Rolle.<br />
Sie sorgen für eine gemeinsame Hochsprache, indem<br />
sie deren Wortschatz bereichern und eine Grammatik<br />
ausarbeiten, indem sie die Geschichte der Nation festhalten<br />
und Karten zeichnen, die deren Grenzen zeigen.<br />
So entsteht in Raum und Zeit ein Identifikationsangebot,<br />
das vielen als eine zweite Natur erscheint. <strong>Das</strong> alles<br />
sind jedoch – nach der <strong>neue</strong>ren Forschung – Imaginationen,<br />
also nur Vorstellungen und Erfindungen.<br />
Diese Imaginationen sind allerdings sehr wirksam:<br />
Sie schaffen Ebenen der Zusammenarbeit und Chancen<br />
für Karrieren, die es bis dahin in dieser Breite<br />
und Egalität nicht gegeben hat. <strong>Das</strong> Imaginative wird<br />
zum Realen. Es war (und ist) diese<br />
Erfahrung, die viele Menschen so<br />
eng an die Nation gebunden hat.<br />
Der Nationalstaat<br />
ist auch<br />
so etwas wie<br />
die Rückversicherung<br />
der EU.<br />
Ohne ihn wäre<br />
sie auf Treibsand<br />
gebaut<br />
Sie hat ihnen gegeben, was zuvor<br />
nur getrennt zu haben war: sozialer<br />
Aufstieg und das Gefühl von<br />
Geborgenheit. Mit der Globalisierung<br />
hat sich beides wieder voneinander<br />
getrennt, und es gibt einen<br />
Zwang, sich für das eine oder das<br />
andere zu entscheiden.<br />
Es sind jedoch nicht nur die<br />
Globalisierungsverlierer, die an<br />
der Nation hängen und den Nationalstaat<br />
nicht aufgeben wollen. Der<br />
Nationalstaat ist auch so etwas wie<br />
eine Rückversicherung der EU. <strong>Das</strong><br />
hat sich in der Eurokrise gezeigt.<br />
Als die EU vielen als ein Raum der<br />
Entsolidarisierung erschien, wurde<br />
der Nationalstaat als Raum der Solidarität<br />
wahrgenommen. Diese Wahrnehmung mag zutreffend<br />
oder falsch sein, aber sie wirkt. Eine EU ohne<br />
nationalstaatlichen Unterbau wäre ein in den Treibsand<br />
der Globalisierung gebautes Haus. Es bekäme<br />
bald Risse und fiele auseinander. Die Verbindung von<br />
Statik und Dynamik, die dem Nationalstaat gelungen<br />
ist, lässt sich auf europäischer Ebene nicht wiederholen.<br />
Man muss die Nationen mitsamt einer gewissen<br />
Staatlichkeit in die EU einbauen, um ihr die erforderliche<br />
Elastizität zu verschaffen.<br />
HERFRIED MÜNKLER ist Professor für<br />
Politikwissenschaften an der Humboldt-<br />
Universität in Berlin. Vom 1951 geborenen Autor<br />
zahlreicher Bücher ist zuletzt erschienen: „Der<br />
Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918“<br />
Foto: Caro Fotoagentur<br />
20<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Überblick<br />
EUROPA UND<br />
SEINE SEPARATISTEN<br />
Schotten, Katalanen, Südtiroler:<br />
Projekte der Abspaltung sind in Europa<br />
häufig. Mal sind sie in der Schwebe ,<br />
mal gescheitert oder schon vollzogen<br />
SCHOTTLAND<br />
Am 18. September entscheidet<br />
eine Volksabstimmung, ob<br />
Schottland nach über 300 Jahren<br />
das Vereinigte Königreich verlassen<br />
wird. Wie genau eine<br />
Abspaltung vonstattengehen soll,<br />
wissen auch die hartgesottensten<br />
Separatisten nicht.<br />
KATALONIEN<br />
Diktator Franco unterdrückte<br />
Sprache und Kultur der<br />
Katalanen brutal. Im demokratischen<br />
Spanien sind es die<br />
Transferzahlungen, die eine<br />
Sezession im reichen Barcelona<br />
populär machen. Katalonien<br />
will am 9. November über die<br />
Unabhängigkeit abstimmen. <strong>Das</strong><br />
spanische Verfassungsgericht hält<br />
das Referendum für unrechtmäßig.<br />
FLANDERN<br />
Die flämischen Separatisten<br />
aus dem wohlhabenden Norden<br />
sehnen die Auflösung des<br />
belgischen Staates herbei. Die<br />
Überweisungen ins arme, fran-<br />
zösischsprachige Wallonien sind<br />
ihnen ein Graus. In der <strong>neue</strong>n<br />
Mitte-Rechts-Regierung, in der<br />
flämische Parteien klar überwiegen,<br />
sitzen die Separatisten nun<br />
gar mit am Kabinettstisch.<br />
NORDITALIEN<br />
Laut schimpft die Lega Nord auf<br />
Rom und Italiens Süden – und regierte<br />
jahrelang an der Seite Silvio<br />
Berlusconis. Derzeit findet ihr Ruf<br />
nach Unabhängigkeit in Venetien<br />
Anklang: Laut einer inoffiziellen<br />
Online-Abstimmung unterstützt<br />
dort eine Mehrheit die Trennung<br />
von Italien.<br />
GRÖNLAND<br />
Die ehemalige dänische Kolonie<br />
genießt weitgehende Autonomie.<br />
Bereits 1985 war das Territorium<br />
aus der Europäischen Union<br />
ausgetreten. Wirtschaftlich ist<br />
es aber immer noch vom EU-<br />
Mitglied Dänemark abhängig.<br />
Nationalisten geht die Autonomie<br />
nicht weit genug – sie wollen ein<br />
souveränes Grönland.<br />
SÜDTIROL<br />
Als Kriegsbeute ging Südtirol nach<br />
dem Ersten Weltkrieg an Italien.<br />
Mit einer weitgehenden Autonomie<br />
schien Rom eine Antwort auf die<br />
Sezessionsforderungen gefunden<br />
zu haben. Doch die italienische<br />
Misere gibt den deutschsprachigen<br />
Separatisten wieder Auftrieb. Eine<br />
Mehrheit aber bilden sie nicht.<br />
KORSIKA<br />
Anschläge auf Napoleons Heimatinsel<br />
scheinen nach beinahe<br />
40 Jahren passé. Die korsische<br />
Untergrundbewegung FLNC hat diesen<br />
Sommer verkündet, auf Gewalt<br />
verzichten zu wollen. Nun sollen<br />
Verhandlungen mit der französischen<br />
Regierung der Mittelmeerinsel<br />
mehr Autonomie verschaffen.<br />
BASKENLAND<br />
Die Terroristen der Eta haben<br />
der Gewalt abgeschworen. Doch<br />
mit dem Ende der Anschläge<br />
ist die Frage der Autonomie<br />
noch nicht gelöst. Der Ruf nach<br />
Unabhängigkeit bleibt in der<br />
nordspanischen Region äußerst<br />
populär. <strong>Das</strong> zeigte sich bei den<br />
jüngsten Wahlen: Seit 2012 stellen<br />
die baskischen Nationalisten wieder<br />
die Regierung.<br />
UNGARN<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg<br />
büßte Ungarn zwei Drittel seines<br />
Staatsgebiets ein. Dies haben<br />
die hartgesottenen Nationalisten,<br />
unter ihnen Präsident Viktor<br />
Orbán, bis heute nicht verwunden.<br />
Regelmäßig provoziert<br />
Budapest seine Nachbarn mit<br />
Autonomieforderungen für die<br />
ungarischen Minderheiten, zuletzt<br />
im Mai die Ukraine.<br />
NORDIRLAND<br />
<strong>Das</strong> Karfreitagsabkommen zwischen<br />
Dublin und London brachte 1998 so<br />
etwas wie Stabilität in den Norden<br />
der Insel. Aber radikale Gegner<br />
der britischen Präsenz und ebenso<br />
sture Unionisten bleiben weiter eine<br />
Gefahr für Nordirland.<br />
BAYERN<br />
Wäre Bayern eigenständig durch<br />
die Geschichte geschritten, dann<br />
wäre es heute eine „Mittelmacht“,<br />
vergleichbar mit Holland, dozierte<br />
einst Edmund Stoiber. Allerdings:<br />
Die offen sezessionistisch agierende<br />
Bayernpartei errang bei der<br />
Landeswahl 2013 nur 2,1 Prozent.<br />
JUGOSLAWIEN<br />
Nach den Kriegen der neunziger<br />
Jahre war der Vielvölkerstaat<br />
Geschichte. Serbien hatte vergeblich<br />
das Unabhängigkeitsstreben<br />
der Slowenen, Kroaten und Bosnier<br />
bekämpft. Als letzter Staat spaltete<br />
sich Montenegro friedlich ab.<br />
In Kosovo und Bosnien schwelt der<br />
Konflikt bis heute.<br />
TSCHECHOSLOWAKEI<br />
Den Kommunismus schüttelten<br />
Tschechen und Slowaken noch Seite<br />
an Seite ab. Aber auf eine gemeinsame<br />
Verfassung oder auch nur<br />
den Namen der jungen Demokratie<br />
konnten sie sich nicht mehr einigen.<br />
Ab 1993 gingen Tschechien und die<br />
Slowakei, einvernehmlich getrennt,<br />
eigene Wege.<br />
SM<br />
Anzeige
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
DIE ALTEN<br />
SÜNDEN SIND<br />
VERJÄHRT<br />
Wie ich auf Umwegen<br />
und zu meinem eigenen<br />
Erstaunen mit dem<br />
heiklen Begriff der<br />
Nation endlich Frieden<br />
schloss: Erfahrungen<br />
eines deutschen Historikers,<br />
der seit 18 Jahren<br />
im Ausland studiert,<br />
lehrt und forscht<br />
Von THOMAS WEBER<br />
Als ich im Herbst 1996 schwer bepackt einen<br />
Zug nach England bestieg, um in Oxford<br />
mein Studium der Geschichte fortzusetzen,<br />
hätte ich kaum geglaubt, dass mir zehn Jahre<br />
später eine 1918 in Polen geborene Jüdin mein erstes<br />
Deutschland-T-Shirt schenken würde. Schon gar nicht<br />
hätte ich mir vorstellen können, dass ich 18 Jahre später,<br />
im Jahr 2014, Verständnis für Nationalisten bei einem<br />
Unabhängigkeitsreferendum haben würde.<br />
Wie alle guten Deutschen bin ich in Oxford sogleich<br />
der Oxford University European Society beigetreten<br />
– und nicht der German Society der Universität.<br />
Ich fand zwar schon damals das Gebaren von Deutschen<br />
in Oxford albern, die auf keinen Fall als Deutsche<br />
wahrgenommen werden wollten, dadurch aber<br />
genau das Gegenteil erreichten. In deutsche Uniform<br />
gekleidet – Jack-Wolfskin-Jacke und Sandalen mit Socken<br />
–, ereiferten sie sich mit starkem deutschen Akzent<br />
pausenlos darüber, wie teuer hier doch alles sei.<br />
Dennoch dauerte es eine Zeit, bis ich merkte, dass<br />
ich mit der European Society der wahren Oxford University<br />
German Society beigetreten war. Denn die<br />
meisten Griechen, Polen oder Franzosen waren der<br />
Greek, Polish oder French Society und nur gelegentlich<br />
der European Society beigetreten. Dennoch waren<br />
sie genauso proeuropäisch wie die Deutschen. Sie<br />
verstanden sich auch gut mit uns, konnten nur oft nicht<br />
verstehen, warum so viele junge Deutsche unbedingt<br />
nur europäisch, aber nicht auch deutsch sein wollten.<br />
Es war eigenartig: Trotz der Millionen von Deutschen<br />
ermordeten Polen des Zweiten Weltkriegs hatten<br />
meine polnischen Freunde in Oxford mit Deutschland<br />
ein viel geringeres Problem als manche deutsche<br />
Kommilitonen. Sie griffen Radosław Sikorski vor, der<br />
ein Jahrzehnt vor mir in Oxford studiert hatte. Im Jahr<br />
2011 sollte Sikorski, mittlerweile zum polnischen Außenminister<br />
avanciert, sagen, dass er heute deutsche<br />
Macht weniger fürchte als deutsche Untätigkeit.<br />
Als ich nach sechs Jahren England verließ, um<br />
meine erste Dozentenstelle in Glasgow anzutreten,<br />
war ich abermals gezwungen, meinen Nationen- und<br />
Nationalismusbegriff zu überdenken. Eine Zeit lang<br />
lief ich täglich auf dem Weg zu meinem Büro an einem<br />
Wahlplakat der schottischen Nationalisten vorbei. Es<br />
feierte schottische Nationalisten aller Hautfarben. In<br />
Deutschland hätte das gleiche Poster Werbung für einen<br />
Eine-Welt-Laden gemacht.<br />
Ferner entpuppte sich mein Glasgower Kollege<br />
und Freund Conan Fischer als glühender schottischer<br />
Nationalist, der eng mit der Führung der schottischen<br />
Nationalisten vernetzt ist. Als vielleicht wichtigster<br />
Experte für den Aufstieg der deutschen Nationalsozialisten<br />
kennt der gebürtige Neuseeländer wie kein<br />
Zweiter die dunklen Seiten des Nationalismus. Dennoch<br />
erzählte Fischer mir begeistert von einem Nationalismus,<br />
der gleichermaßen nationale Identität<br />
und Kultur auf der einen und europäische Integration<br />
auf der anderen Seite bejaht. Zu meinem Erstaunen<br />
stellte Fischer mir seine taufrischen Forschungen vor.<br />
22<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
Sie zeigten, dass ein Nebeneinander von ausgeprägter<br />
Vaterlandsliebe und europäischer Integration weder<br />
neu noch ein Geschöpf der nationalen Identitäten der<br />
Staaten der Neuen Welt ist und schon gar nicht rechtem<br />
Gedankengut entsprang.<br />
Natürlich hätten weder die Vaterlandspartei<br />
des späten Kaiserreichs noch die NSDAP<br />
mit einem solchen Nationalismusbegriff etwas<br />
anfangen können. Aber Fischers faszinierende<br />
Funde offenbarten, dass deutsche und französische<br />
Politiker in der Zeit zwischen Stresemann<br />
und Hitler eine solche Nationen- und Europapolitik<br />
verfolgten.<br />
So richtig fielen mir die nationalen Scheuklappen<br />
in Kanada in der jüdischen Familie meiner Frau<br />
von den Augen. Bei meinem ersten Besuch bei meinen<br />
künftigen Schwiegereltern in Toronto wehte mir eine<br />
kanadische Flagge entgegen, als ich auf das Haus zuging,<br />
in dem meine Frau aufgewachsen war. Genauso<br />
selbstverständlich, wie die Frau meiner Familie am<br />
jährlichen Canada Day sich in den Farben Kanadas<br />
zum Grillen kleidet, schenkte mir die Großmutter meiner<br />
Frau vor der Fußball-WM 2006 ein Deutschland-T-<br />
Shirt. Meine Schwiegereltern verstanden nicht, wieso<br />
die zur Weltmeisterschaft auftauchenden schwarzrot-goldenen<br />
Fahnenmeere zu Kontroversen in meiner<br />
Heimat führten: „Aber es ist doch schön, wenn sich<br />
die Deutschen mit ihrer Mannschaft freuen.“<br />
Der Kontrast zwischen kanadischer Vaterlandsliebe<br />
und deutscher wohlgemeinter, aber verkrampfter<br />
Nabelschau wurde mir in den vergangenen Jahren immer<br />
wieder in der unterschiedlichen Erinnerung an den<br />
Ersten Weltkrieg deutlich. 1997 reiste meine Frau mit<br />
ihren Schülern der National Ballet School in Toronto<br />
zum 90. Jahrestag der Schlacht von Vimy Ridge nach<br />
Frankreich. Zusammen mit 3000 weiteren in Replikauniformhemden<br />
gekleideten kanadischen Schülern gedachten<br />
sie der Toten am kanadischen Nationaldenkmal<br />
in Vimy. Begeistert ließen sie sich zusammen mit<br />
dem damaligen kanadischen Oppositionsführer Michael<br />
Ignatieff fotografieren.<br />
Bewegend beschreibt Ignatieff in einem seiner Bücher<br />
diesen Tag und bettet ihn dort in die Geschichte<br />
des kanadischen Liberalismus ein, der vielleicht attraktivsten<br />
politischen Bewegung der Welt. Bei Ignatieff,<br />
dem Autor der Schutzverantwortungsdoktrin der UN,<br />
sind nationale Identität und Internationalismus zwei<br />
Seiten einer Medaille und beide den Toten der Weltkriege<br />
verpflichtet. Die eine Seite bedingt die andere,<br />
da Nationalstaaten nach Ignatieff den Menschen erlauben,<br />
auch in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts<br />
Herr im eigenen Haus zu sein.<br />
Auch Joschka Fischer sprach in einem Band mit<br />
dem Historiker Fritz Stern über das Totengedenken an<br />
den Ersten Weltkrieg. Wie Ignatieff fühlt sich Fischer<br />
dem progressiven Lager zugehörig. Hier enden aber<br />
die Gemeinsamkeiten. Voller Verachtung zog Deutschlands<br />
Ex-Außenminister über Denkmäler wie dasjenige<br />
in Vimy her. Sie sind für ihn nur „ein paar verwitterte<br />
Steine in Form von Kriegerdenkmälern und<br />
Soldatenfriedhöfen“. In den Erinnerungsfeiern an der<br />
ehemaligen Westfront kann er nur „erstarrte Rituale<br />
in Flandern und Nordfrankreich“ sehen. Er war offensichtlich<br />
im Gegensatz zu Ignatieff nicht bei der Gedenkfeier<br />
der Schüler meiner Frau zugegen. Denn Fischer<br />
meint, solche Feiern stießen junge Leute ab und<br />
stünden so einer „kollektiven Erinnerung und Selbstvergewisserung“<br />
im Wege.<br />
Fischers Reaktion ist typisch für den Irrglauben<br />
mancher Deutscher, dass alle anderen Nationen die<br />
gleichen Schlüsse wie sie selbst aus den dunkelsten<br />
Kapiteln gezogen hätten und dass diese Schlüsse programmatisch<br />
sein sollten für eine bessere Zukunft.<br />
Was Fischer und andere Deutsche nicht merken: Sie<br />
stoßen nicht nur die Schüler meiner Frau, sondern die<br />
ganze Welt vor den Kopf. Sie erreichen das Gegenteil<br />
ihres Zieles. Sie treiben Völker auseinander.<br />
Wie mir in den vergangenen 18 Jahren in Oxford,<br />
Glasgow, Toronto, meinen Wanderjahren in Amerika<br />
in Chicago, Philadelphia und am Institute for Advanced<br />
Study in Princeton, dann in Aberdeen und in<br />
Harvard klar geworden ist, beruht die deutsche Herangehensweise<br />
an Nationalstaatlichkeit auf einem einfachen<br />
Denkfehler. Weil die Kriege der Jahre 1914<br />
bis 1945 Auseinandersetzungen zwischen bestehenden<br />
und entstehenden Nationalstaaten gewesen sind,<br />
wird irrigerweise gefolgert, dass die Essenz von Nationalstaatlichkeit<br />
ein überhöhter Nationalismus sei, der<br />
Die deutsche<br />
Herangehensweise<br />
an Nationalstaatlichkeit<br />
beruht auf einem<br />
einfachen<br />
Denkfehler<br />
24<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Illustrationen: Olaf Hajek (Seiten 23 bis 25); Foto: Picture Alliance/DPA<br />
mehr oder weniger unweigerlich zu gewaltsamen Konflikten<br />
führe. In Wahrheit waren die Konflikte der ersten<br />
Hälfte des 20. Jahrhunderts deshalb so blutig, weil<br />
sie Teil einer Transformationsphase von multiethnischen,<br />
dynastischen Reichen, wie sie bis ins 19. Jahrhundert<br />
die Norm gewesen waren, zu modernen Nationalstaaten<br />
sind.<br />
Diese Transformation verlief relativ reibungsfrei<br />
in West- und Nordeuropa, wo die Grenzen<br />
dynastischer Reiche und jene von Ethnien<br />
mehr oder weniger deckungsgleich<br />
waren. Die Logik der Transformation in solchen Gebieten<br />
hingegen, die von ethnischen und religiösen Flickenteppichen<br />
übersät waren wie in Zentral-, Ost- und<br />
Südosteuropa, sorgte für Jahrzehnte ethnischer Säuberungen<br />
und Genozide. Wenn diese Transformation abgeschlossen<br />
ist, sind Nationalstaaten nicht mehr, nicht<br />
weniger kriegerisch als andere Arten von Staaten. Und<br />
sie stehen keineswegs supranationaler Integration im<br />
Wege, wenn diese geboten ist, damit etwa Europäer<br />
auch im 21. Jahrhundert Herren in ihrem Haus sind. Im<br />
Gegenteil: Sie ermöglichen eine Integration mit höherer<br />
politischer Legitimität, sodass sich auch deutsche<br />
Politiker einmal trauen könnten, die Deutschen über<br />
die großen Schicksalsfragen ihrer Zukunft in Referenden<br />
abstimmen zu lassen.<br />
Ich konnte dem deutschen Denkfehler über die<br />
Geschichte und die Gegenwart von Nationalstaaten<br />
durch meine Erfahrungen als Auslandsdeutscher entgehen.<br />
Vor allem konnte ich ihm durch die liberale<br />
Wissenschaftskultur von Oxford, Aberdeen oder Harvard<br />
entkommen. Es ist wahrlich nicht so, als ob es<br />
in Deutschland keine guten Historiker gäbe. In der<br />
deutschen Zunft vergiften aber Historiker wie der<br />
Berliner Geschichtswissenschaftler Heinrich-August<br />
Winkler durch infame Unterstellungen, wie wir sie aus<br />
dem Wahlkampf zwischen George W. Bush und John<br />
Kerry kennen, das Klima und hemmen Innovation. In<br />
Deutschland würde ich meine akademische Karriere<br />
mit innovativer Forschung vielleicht riskieren. Es ist<br />
kein Zufall, dass Cambridge – und keine deutsche Universität<br />
– derzeit in der Erforschung deutscher Geschichte<br />
weltweit führt.<br />
Wenn die Attacken zu absurd werden, kann ich<br />
mich ins Flugzeug nach Boston oder Aberdeen setzen<br />
und in eine freiere Welt zurückkehren. In Aberdeen<br />
begegne ich dann natürlich schottischen Nationalisten.<br />
Vielleicht ist Schottland sogar vom 18. September<br />
an ein eigener Staat. Ein solcher Fall löste bei mir<br />
keine Begeisterung aus, aber auch keine Abscheu, wie<br />
bei jener Art von Deutschen, die die Welt, ohne es<br />
zu verinnerlichen, in erster Linie durch deutsche Augen<br />
betrachten. So echauffierte sich kürzlich Jürgen<br />
Habermas über das schottische Unabhängigkeitsreferendum.<br />
Der schottische Wunsch nach Unabhängigkeit<br />
sei, so sagte er am Institute for Advanced Study<br />
Bei Joschka<br />
Fischer und<br />
Jürgen Habermas<br />
sehen wir<br />
deutsche Selbstbezogenheit,<br />
blind für andere<br />
Erfahrungen<br />
in Princeton, eine pure Regression, ein nostalgisches<br />
Fantasieren, das mit den politischen Problemen der<br />
Gegenwart nichts zu tun habe. Wie bei Joschka Fischer<br />
sehen wir hier eine deutsche Selbstbezogenheit,<br />
die blind ist für andere Erfahrungen. Es sind gerade<br />
meine linken und linksliberalen schottischen Freunde,<br />
die mir erzählen, dass sie für Schottlands Unabhängigkeit<br />
stimmen werden.<br />
In Schottland ist die Debatte über das Referendum<br />
bisher relativ unaufgeregt verlaufen, da alle im Gegensatz<br />
zu Habermas wissen, dass sich nicht ein Rückfall<br />
in die Sünden der Vergangenheit oder aber eine europäische<br />
Zukunft gegenüberstehen. Vielmehr geht es<br />
bei den europabegeisterten Schotten um zwei Dinge:<br />
zum einen darum, welche Art von Union sie mit den<br />
Engländern eingehen; auch die Nationalisten wollen<br />
nicht alle Bande mit dem südlichen Nachbarn kappen.<br />
Zum anderen, ob sie als Schotten oder als Briten Teil<br />
einer sich vertiefenden EU sein werden.<br />
Wenn ich es ganz unverkrampft haben will,<br />
kann ich nach Toronto fliegen. Da kann ich das <strong>neue</strong><br />
Deutschland-T-Shirt überstreifen, das mir mein jüdischer<br />
Schwiegervater für die diesjährige WM geschenkt<br />
hat, und begeisterten Deutschen begegnen,<br />
etwa dem Kölner Iraner, der in Toronto das „Pfannkuchen<br />
Köln“-Café betrieb, oder dem indischen Taxifahrer,<br />
der mir begeistert von seiner Zeit in Düsseldorf<br />
erzählt und mich mit einer Deutschlandflagge<br />
am Wagen zum Flughafen fährt. Und bei all dem<br />
wird niemand vergessen, dass der deutsche Holocaust<br />
den Großvater meiner Frau 1941 in Polen ermordet<br />
hat.<br />
THOMAS WEBER ist Professor of History<br />
and International Affairs an der University of<br />
Aberdeen, Gastwissenschaftler an der Harvard<br />
University und schrieb unter anderem „Hitlers<br />
erster Krieg: Der Gefreite Hitler im Weltkrieg“<br />
25<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
„DIE GROSSEN VERLIERER<br />
SIND DIE LÄNDER“<br />
Der ehemalige EU-Kommissar<br />
Günter Verheugen und der<br />
bayerische Separatist Wilfried<br />
Scharnagl streiten über<br />
Europa und das Streben nach<br />
Unabhängigkeit<br />
Moderation ALEXANDER MARGUIER<br />
und CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Herr Verheugen, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten<br />
im Europäischen Parlament, Martin Schulz,<br />
hat in den letzten Tagen des zurückliegenden Europawahlkampfs<br />
plakatiert: „Nur wenn Sie SPD wählen,<br />
kann ein Deutscher Kommissionspräsident werden.“<br />
War das nicht ein Rückfall in nationale Denkmuster,<br />
die Ihre Partei eigentlich überwinden will?<br />
Günter Verheugen: Ich habe diesen Slogan nicht<br />
verstanden. Und da ich etwas von Wahlkämpfen verstehe,<br />
war ich auch nicht überzeugt davon, dass er<br />
überhaupt wirkt. Ganz davon abgesehen, dass so ein<br />
Spruch bei unseren Nachbarn eher ungute Gefühle<br />
weckt. Die Frage, wer Kommissionspräsident wird,<br />
kann nicht davon abhängig gemacht werden, woher<br />
jemand kommt. Sondern ausschließlich von der Qualifikation<br />
und der Überzeugungskraft.<br />
Wilfried Scharnagl: Wenn die CSU solch einen<br />
Slogan plakatiert hätte, hätte es eine Riesenkampagne<br />
gegen uns gegeben. Außerdem wählt kein Mensch einen<br />
Spitzenkandidaten, den er nicht kennt. <strong>Das</strong> zeigt<br />
auch die ganze Absurdität dieses Projekts. Bei der<br />
Europawahl wurden in Wahrheit nationale Wahlen<br />
abgehalten.<br />
Verheugen: Trotzdem wurde durch die Kür von<br />
Spitzenkandidaten der Finger in eine Wunde gelegt.<br />
Nämlich das Gefühl einer Mehrheit der Bürgerinnen<br />
und Bürger in Europa, dass sie nicht darüber mitbestimmen<br />
können, was in Brüssel passiert. Deshalb<br />
sollte auch die Frage der Spitzenkandidaten solide<br />
verankert werden, anstatt es dem taktischen Kalkül<br />
der Parteien zu überlassen. Jedenfalls bin ich überzeugt<br />
davon, dass es keinen Kommissionspräsidenten<br />
mehr geben wird, der vorher nicht zum Spitzenkandidaten<br />
seiner Parteienfamilie bestimmt wurde. Irgendwann<br />
wird das auch in den entsprechenden Verträgen<br />
so stehen. Und dann bekommen wir vielleicht so etwas<br />
wie eine echte parlamentarische Demokratie auf<br />
europäischer Ebene.<br />
Scharnagl: Da bin ich völlig anderer Meinung.<br />
Eine echte parlamentarische Demokratie würde nämlich<br />
bedeuten, dass das Europäische Parlament entscheidende<br />
demokratische Qualität hat. Denn dann<br />
müsste auch der Grundsatz „one man, one vote“ gelten.<br />
Verheugen: Mit diesem Argument spricht ja auch<br />
das Bundesverfassungsgericht dem Europäischen Parlament<br />
die demokratische Qualifikation ab. Ich halte<br />
diese Begründung für himmelschreiend. Wenn man<br />
sich Demokratie nur vorstellen kann in der egalitären<br />
Form, wie sie sich in den Nationalstaaten durchgesetzt<br />
hat, kann das auf supranationaler Ebene nicht funktionieren.<br />
Denn natürlich müssen auch kleine Nationen<br />
so vertreten sein, dass sie wahrgenommen werden.<br />
Was würde denn „one man, one vote“ konkret für die<br />
Sitzverteilung im Europäischen Parlament bedeuten?<br />
Scharnagl: Entweder, dass Sie das Parlament so<br />
aufblähen, dass auch kleine Länder mindestens einen<br />
Sitz bekommen. Andernfalls eben, dass kleine Länder<br />
Allianzen schließen müssen, um dort vertreten zu sein.<br />
Oder dass man sich am amerikanischen Beispiel mit<br />
Senat und Repräsentantenhaus orientiert.<br />
„Schleichende Entdemokratisierung“: Wilfried Scharnagl<br />
kritisiert den europäischen Einigungsprozess<br />
26<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Verheugen: <strong>Das</strong> ist doch überhaupt nicht möglich!<br />
Scharnagl: <strong>Das</strong> ist doch wieder typisch! Auf die<br />
Frage, ob das Volk abstimmen darf, sagt Herr Verheugen,<br />
das ist nicht möglich!<br />
Verheugen: Natürlich nicht! <strong>Das</strong> Grundgesetz erlaubt<br />
es nicht.<br />
Scharnagl: Ach, Herr Verheugen, das Grundgesetz<br />
ist schon viele Male geändert worden!<br />
Verheugen: Aber genau diese Änderung haben<br />
CDU und CSU immer verhindert.<br />
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
„Die EU erhebt keinen imperialen Anspruch“: Günter<br />
Verheugen sieht die Union als Wertegemeinschaft<br />
Verheugen: Aber Herr Scharnagl, das Charakteristische<br />
an Europa ist doch gerade die Vielfalt seiner<br />
nationalen Identitäten! Was die Menschen in Europa<br />
am stärksten bindet, ist die Zugehörigkeit zu einer Nation.<br />
Es wäre auch unhistorisch, sich ein Europa vorzustellen,<br />
das die Tradition der Nationen über Bord wirft.<br />
Scharnagl: Man kann doch kein Europäisches Parlament<br />
mit einer allumfassenden Zuständigkeit schaffen,<br />
wenn es kein europäisches Staatsvolk gibt!<br />
Verheugen: Die Krankheit der Europäischen Union<br />
besteht doch vielmehr darin, dass in den Augen der<br />
Menschen die Balance zwischen nationaler Verantwortung<br />
und europäischem Machtanspruch vollständig gestört<br />
ist. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in einem<br />
supranationalen Verbund ein „Staatsvolk“ brauchen.<br />
Dieses Denken entspricht doch nur dieser typisch deutschen<br />
Staatsrechtstheorie.<br />
Scharnagl: Ich sehe das Hauptproblem in einer<br />
schleichenden Entdemokratisierung. Der frühere und<br />
der amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts,<br />
Hans-Jürgen Papier und Andreas Voßkuhle,<br />
stellen eindeutig fest, dass die großen Verlierer des<br />
europäischen Vereinigungsprozesses die deutschen<br />
Länder sind. Deren Parlamente haben nämlich immer<br />
weniger Macht. Dort verdunstet die demokratische<br />
Substanz der deutschen Länder, auf denen unsere<br />
Verfassung gründet. Und diese Länder existierten bereits<br />
vor Gründung der Bundesrepublik!<br />
Herr Scharnagl, der Titel eines Ihrer letzten Bücher<br />
lautet „Bayern kann es auch allein“. Würden Sie Ihre<br />
Landsleute gern über eine Autonomie des Freistaats<br />
abstimmen lassen?<br />
Herr Scharnagl, wäre ein souveränes Bayern denn<br />
noch Mitglied der EU?<br />
Scharnagl: Warum fangen Sie beim Ende an? Betrachten<br />
Sie doch erst einmal die innerdeutsche Entwicklung.<br />
Da ist es doch so, dass die gesetzgebende<br />
und sogar die vollziehende Gewalt seit dem Jahr 1949<br />
systematisch von den Ländern auf den Bund übertragen<br />
wurden. Es muss das Gleichgewicht eines lebendigen<br />
deutschen und europäischen Staatswesens wiederhergestellt<br />
werden. Es kann nicht sein, dass sich<br />
alles immer mehr in Berlin konzentriert und dann von<br />
Berlin nach Brüssel geliefert wird. <strong>Das</strong> muss gestoppt<br />
werden! Ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass<br />
Bayern in einer Europäischen Union von der Einwohnerzahl<br />
und der Wirtschaftskraft her auf den Plätzen<br />
sieben oder acht stünde und daher in Europa entsprechendes<br />
politisches Gewicht haben müsste.<br />
Verheugen: <strong>Das</strong> ist ein anregendes und amüsantes<br />
Gedankenspiel – aber eben auch nicht mehr. Die Konsequenz<br />
eines bayerischen Alleingangs wäre ja die europäische<br />
Kleinstaaterei. Die Kleinstaaten könnten es<br />
nur deshalb allein schaffen, weil es dieses dichte Netz<br />
der europäischen Integration gibt. Sobald einer von ihnen<br />
nicht mehr von den offenen Grenzen profitieren<br />
würde, wäre er zum Scheitern verurteilt.<br />
Scharnagl: Warum kann es denn keine europäische<br />
Organisation geben, in der die Regionen ihre Interessen<br />
in Europa selbst vertreten? Warum brauchen wir eine<br />
Art Stiefmuttervertretung über Berlin?<br />
Verheugen: Herr Scharnagl, Sie greifen die Staatsidee<br />
der deutschen Nation an!<br />
Scharnagl: Ich will sie zunächst einmal durchlüften.<br />
Verheugen: Es funktioniert deshalb nicht, weil es<br />
so starke Regionen wie die deutschen Länder sonst nur<br />
noch in Österreich gibt.<br />
„ Sie greifen<br />
die Staatsidee<br />
der deutschen<br />
Nation an! “<br />
Günter Verheugen<br />
zu Wilfried Scharnagl<br />
27<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
Herr Scharnagl, Sie zitieren den Philosophen Friedrich<br />
August von Hayek mit den Worten, wenn man die Freiheit<br />
abschaffen wolle, müsse man ein großes Reich<br />
schaffen. Es seien die großen zentralistischen Machtund<br />
Einheitsstaaten, die in Tod und Verderben führten.<br />
Ist die EU tatsächlich solch ein Höllenfeuer?<br />
Scharnagl: Für mich schon. Weil der Reichtum Europas<br />
in seiner Vielfalt niedergebügelt wird.<br />
Verheugen: Mit aktiver Beteiligung aller Mitgliedstaaten!<br />
Man kann der EU vieles vorwerfen, aber ganz<br />
sicher nicht, dass sie einen imperialen Anspruch erhebt.<br />
Sie ist ein auf Freiwilligkeit und gemeinsamen Werten<br />
gegründeter Verband ohne jeden Herrschafts- und<br />
Expansionsanspruch. Der Vergleich mit Hayek ist da<br />
wirklich irreführend. Ich glaube nicht, dass die europäische<br />
Integration ein Risiko für die Freiheit bedeutet.<br />
Zumindest, wenn wir uns nicht selbst in ein immer<br />
engeres Korsett an Vorschriften und Regeln zwängen.<br />
Ist die EU als Staatsgebilde überdehnt?<br />
Scharnagl: Die jahrelange Erweiterungspolitik<br />
war ein Irrweg. Es haben doch vor sieben Jahren alle<br />
gewusst, dass weder Bulgarien noch Rumänien reif für<br />
eine Aufnahme ist. Man hat Milliarden über Milliarden<br />
Euro in diese Länder investiert. Und sie bleiben<br />
doch ein großes ungelöstes Problem innerhalb der EU.<br />
Verheugen: Rumänien und Bulgarien sind zum<br />
Beitritt eingeladen worden vor dem historischen Hintergrund<br />
des Kosovokonflikts. <strong>Das</strong> war eine geopolitische<br />
Entscheidung. Und die geopolitischen Erwartungen<br />
haben Rumänien und Bulgarien erfüllt. Ohne sie<br />
hätten wir ein riesiges Problem.<br />
Scharnagl: Mit ihnen erst recht. Es gibt aus diesen<br />
Ländern massiven Zuzug in die deutschen Sozialsysteme.<br />
Und Korruption und Kriminalität sind leider<br />
auch mit diesen beiden Ländern verbunden.<br />
Verheugen: Also, wenn Sie mich fragen, welches<br />
Land das größte Korruptionsproblem in Europa hat,<br />
dann fallen mir nicht Rumänien und Bulgarien ein. Natürlich<br />
hat jeder gewusst, dass diese Länder gewaltige<br />
Defizite haben. Die Frage ist doch aber: Lässt sich demokratische<br />
Reife besser fördern, wenn sie drin oder<br />
wenn sie draußen sind? Die übereinstimmende Meinung<br />
war: besser, wenn sie drin sind.<br />
Schottland, Katalonien, Ungarn – sind die aufkommenden<br />
Fliehkräfte des Nationalen unmittelbare<br />
Folge der Erweiterung?<br />
WILFRIED SCHARNAGL<br />
Der 74 Jahre alte Journalist<br />
und Buchautor war enger<br />
Weggefähr te von Franz Josef<br />
Strauß und von 1977 bis<br />
2001 Chefredakteur der CSU-<br />
Parteizeitung Bayernkurier<br />
GÜNTER VERHEUGEN<br />
Der 70 Jahre alte Sozialdemokrat<br />
war von 1999 bis 2009 Mitglied der<br />
EU-Kommission und dort zunächst<br />
für die Erweiterung zuständig, später<br />
für Industrie und Unternehmenspolitik.<br />
Er leitet heute eine Beratungsfirma<br />
Verheugen: Die Fälle liegen unterschiedlich. Aber:<br />
Ja, dieser epochale Wandel – weg von der Integration<br />
als westeuropäisches Projekt hin zu einem gesamteuropäischen<br />
Projekt mit Völkern, die jahrzehntelang ihrer<br />
nationalen Souveränität beraubt wurden – weckt in<br />
diesen Ländern einen Nachholbedarf. Mir war das immer<br />
klar, und ich finde auch nicht, dass das ein großes<br />
Problem ist. Aber dieses nationale Selbstbewusstsein<br />
darf man bitte nicht verwechseln mit Nationalismus.<br />
Polen zeigt vorbildlich, dass europäische Orientierung<br />
und ein starkes <strong>Nationalgefühl</strong> sehr gut vereinbar sind.<br />
Scharnagl: Ein Narr, der nicht für die Einigung Europas<br />
ist. Aber genauso ein Narr, der meint, wir müssen<br />
die Nationalstaaten auslöschen, damit Europa funktioniert.<br />
Es ist doch grotesk: Wenn sich die Deutschen<br />
freuen über die Fußballweltmeisterschaft, dann kommen<br />
sofort die Volkserzieher und sagen: <strong>Das</strong> geht zu<br />
weit! Gerade bei den Grünen. Wo früher stand: „Atomkraft,<br />
nein danke!“, steht jetzt: „Patriotismus, nein<br />
danke!“ Wenn einer der Grünen-Häuptlinge, Anton<br />
Hofreiter, im Streit über die selbstherrliche Politik<br />
der EZB deutsche Politiker dazu auffordert, sich die<br />
Deutschlandfarben aus dem Gesicht zu wischen! <strong>Das</strong><br />
wäre in Polen undenkbar! Überall wäre das undenkbar!<br />
Schottland stimmt am 18. September über seine Unabhängigkeit<br />
ab. Was wären die Folgen eines Erfolgs<br />
der Nationalisten in Edinburgh?<br />
Scharnagl: Wenn sich Schottland wuchtig lossagt,<br />
dann würde da etwas ins Rutschen kommen. Dann würden<br />
es auch andere versuchen, dann würden sich auch<br />
die Katalanen nicht mehr aufhalten lassen. <strong>Das</strong> Thema<br />
wäre in ganz großem Stil auf der europäischen Agenda.<br />
Verheugen: Vor einem Jahr hätte ich gesagt: Da brauchen<br />
wir gar nicht drüber zu reden, das wird nicht passieren.<br />
Aber dank der Ungeschicklichkeiten der britischen<br />
Regierung muss man heute sagen: Es wird mit Sicherheit<br />
knapp. <strong>Das</strong>selbe gilt auch für das Referendum der Briten<br />
über den Verbleib in der EU im Jahr 2017. Da halte<br />
ich den Ausgang sogar für noch ungewisser. Wenn die<br />
Schotten für ihre Unabhängigkeit stimmen, dann wird<br />
das zu einem tiefen Grundsatzkonflikt innerhalb der EU<br />
führen. Denn die Länder, die dann befürchten müssen,<br />
dass ihnen ihre Regionen ebenfalls um die Ohren fliegen,<br />
werden strikt dagegen sein, dass man diesen schottischen<br />
Separatismus mit einer Aufnahme in die EU belohnt.<br />
Also: In den nächsten Monaten entscheidet sich<br />
auf der britischen Insel Grundsätzliches für Europa.<br />
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
28<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Von Bestsellerautor<br />
John le Carré<br />
Ein Film von<br />
Anton Corbijn<br />
AB 11. SEPTEMBER IM KINO
TITEL<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> <strong>Nationalgefühl</strong><br />
EINE EINMALIGE GELEGENHEIT<br />
Von SEAN CONNERY<br />
Nun, da ich schon mehr als 50 Jahre für die Unabhängigkeit<br />
eintrete, habe ich das Gefühl,<br />
dass man alle Argumente schon bis zum Überdruss<br />
gehört hat. Jetzt, da der Tag der Abstimmung<br />
naht, löst sich ein Schreckgespenst nach dem andern<br />
auf, die Gegner der Unabhängigkeit an die Wand gemalt<br />
haben. Ein <strong>neue</strong>s Gefühl der Hoffnung auf eine<br />
bessere Zukunft macht sich breit. Schottland hat die<br />
Chance, eine große Veränderung herbeizuführen.<br />
Ein Land wird vor allem durch seine Kultur bestimmt.<br />
Sie verschafft internationale Sichtbarkeit und<br />
regt das globale Interesse an – viel mehr als es die Politik<br />
des Landes, das Geschäftsleben<br />
oder die Wirtschaft je<br />
vermögen.<br />
Schottland ist wahrhaft gesegnet<br />
mit einer schillernden<br />
Geschichte, einer starken Identität,<br />
seinen tief verwurzelten<br />
Traditionen, seinem Engagement<br />
für künstlerische Er<strong>neue</strong>rungen<br />
und seinen vielfältigen<br />
und schönen Landschaften.<br />
All dies hat dazu beigetragen,<br />
dass Schottland eines der bekanntesten<br />
Länder der Erde ist.<br />
Als Schotte, der viel Zeit seines<br />
Lebens nicht in Schottland verbracht<br />
hat, bin ich immer wieder<br />
erstaunt über die Kenntnisse<br />
der Menschen und ihrer<br />
Liebe für diese Nation.<br />
Ich habe keine Zweifel daran, dass ein Grund hierfür<br />
das 1999 konstituierte schottische Parlament ist.<br />
Mein Eindruck ist, dass die Dezentralisierung eine<br />
<strong>neue</strong> Ausdrucksform kultureller Werte und einen<br />
<strong>neue</strong>n Stolz auf unser nationales Erbe gefördert hat;<br />
sie hat einen Rahmen geschaffen für die gälische Sprache<br />
bis zu einer innovativen Architektur. Als ich an<br />
der Eröffnung des Parlaments in meiner Heimatstadt<br />
Edinburgh teilnahm, war das einer der stolzesten Tage<br />
meines Lebens.<br />
Ich glaube daran, dass Schottland mehr schaffen<br />
kann. Die Zustimmung für die schottische Unabhängigkeit<br />
im September wird die Aufmerksamkeit der<br />
Welt erregen. Sie wird noch stärker auf unsere Kultur<br />
und unsere Politik schauen. <strong>Das</strong> gibt uns die einmalige<br />
Gelegenheit, sich auf unser Erbe und unsere Kreativität<br />
zu besinnen. Durch die Kraft der Unabhängigkeit<br />
wird es uns Schotten gelingen, unsere Kultur weiterzuentwickeln,<br />
sie zu bereichern und sie effektiver zu<br />
vermarkten. Wir können da auf den Erfolg von Veranstaltungen<br />
wie den Commonwealth-Spielen, dem Ryder<br />
Cup und vielen anderen Festivals aufbauen. Kultur<br />
und Kreativität sind eine Kraft zum Wohle der Gesellschaft,<br />
und mit den verbesserten Ressourcen, die die<br />
Unabhängigkeit bietet, wird Schottland mit den Besten<br />
im Wettbewerb stehen.<br />
Niemand wird überrascht sein, dass ich besonders<br />
begeistert bin von den Möglichkeiten, die eine Unabhängigkeit<br />
der schottischen Filmindustrie eröffnet – sie<br />
animiert <strong>neue</strong> ausländische Investitionen<br />
und die internationale<br />
Vermarktung Schottlands<br />
als unverwechselbarer Drehort.<br />
Eine größere und selbstbewusstere<br />
Film- und Rundfunkbranche<br />
wird einen Zufluss an Mitteln<br />
und <strong>neue</strong>n Arbeitsplätzen<br />
nach sich ziehen.<br />
Wenn man die Zahlen betrachtet,<br />
ist vollkommen klar,<br />
dass es sowohl große wirtschaftliche<br />
wie auch kulturelle<br />
Vorteile gibt. Im Jahr 2011 hat<br />
Schottlands kreative Industrie<br />
2,8 Milliarden Pfund (etwa<br />
3,5 Milliarden Euro) erwirtschaftet.<br />
Die historischen Stätten<br />
haben 2 Milliarden Pfund<br />
(2,5 Milliarden Euro) eingebracht<br />
und für 60 000 Arbeitsplätze gesorgt. <strong>Das</strong> sind<br />
eindrucksvolle Zahlen. Mit der Unabhängigkeit könnten<br />
sie noch eindrucksvoller werden.<br />
Ich respektiere vollkommen, dass die Entscheidung,<br />
vor der Schottland am 18. September steht, eine<br />
derjenigen ist, die dort leben und arbeiten – das ist<br />
richtig und angemessen. Als Schotte und als jemand,<br />
der sein Leben lang Schottland wie auch die Kunst geliebt<br />
hat, bin ich überzeugt, dass die Gelegenheit für<br />
die Unabhängigkeit zu gut ist, um sie zu verpassen.<br />
Einfacher ausgedrückt: Es gibt nichts Kreativeres,<br />
als eine <strong>neue</strong> Nation zu schaffen.<br />
SEAN CONNERY, 84, ist von Geburt und mit Leidenschaft<br />
Schotte. Seit Jahren kämpft er für die Unabhängigkeit<br />
Schottlands. Allerdings nicht im Auftrag Ihrer Majestät wie<br />
einst als James Bond<br />
Dieser Text ist erstmals erschienen im New Statesman; Foto: Chris Watts/Scopefeatures.com/Bulls Press [M]<br />
30<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
„ Liebe ist alles,<br />
was über einen selbst<br />
hinausgeht.<br />
Man fängt in dem<br />
Augenblick zu<br />
lieben an, in dem<br />
man sich selbst nicht<br />
mehr als Zentrum<br />
seiner Überlegungen<br />
begreift “<br />
Der Publizist und Verleger Jakob Augstein im Gespräch mit Frank A. Meyer, Seite 38<br />
31<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
IM OHR DAS MASSAKER<br />
Der deutsche Zahnarzt Ali Khalaf ist Jeside. <strong>Das</strong> Leiden seiner Verwandten bekommt er<br />
live übers Handy mit. Er versucht alles, um ihnen von Deutschland aus zu helfen<br />
Von CHRISTOPH SEILS<br />
Die Weltpolitik kommt selten nach<br />
Bad Salzuflen. Mitte August jedoch,<br />
an einem bewölkten Freitagnachmittag,<br />
demonstrieren plötzlich<br />
500 Jesiden in der Kleinstadt. Ostwestfalen<br />
ist eine Hochburg der Religionsgemeinschaft<br />
in Deutschland. „Stoppt den<br />
Isis-Terror“, skandieren die Menschen.<br />
Grün-rot-gelbe Fahnen wehen auf dem<br />
mittelalterlichen Salzhof.<br />
Am Rande steht Ali Khalaf, 41 Jahre<br />
alt. Er trägt einen dunkelgrauen Anzug<br />
und hat einen weißen Knopf im Ohr. Eigentlich<br />
telefoniert er schon den ganzen<br />
Tag. Immer wieder erreichen ihn Hilferufe<br />
aus seiner Heimat. Khalaf versucht<br />
über einen Gewährsmann ins Auswärtige<br />
Amt und in die US-Botschaft vorzudringen.<br />
„Warum tun die nichts?“, fragt<br />
er verzweifelt. In Kocho, einem Dorf im<br />
Irak, haben die Milizen des neu gegründeten<br />
Islamistenstaats schon vor Tagen<br />
die Jesiden zusammengetrieben. Ali<br />
Khalaf bekommt das mit, live über sein<br />
Handy. Massaker in Zeiten der Globalisierung.<br />
„Man kann nichts mehr machen“,<br />
sagt er mit Tränen in den Augen,<br />
„die Hinrichtungen haben begonnen.“<br />
Auf der Straße in Bad Salzuflen sprechen<br />
ihn Passanten mit „Dr. Ali“ an. Eigentlich<br />
ist er nur ein Zahnarzt mit einer<br />
kleinen Praxis an Rande der Altstadt.<br />
Im Alter von neun Jahren wurde er mit<br />
seiner Familie aus dem Irak nach Syrien<br />
vertrieben. Mit 24 floh er von dort nach<br />
Deutschland. Er erhielt Asyl und baute<br />
sich in Bad Salzuflen eine Existenz auf.<br />
Stolz ist Ali Khalaf auf seine deutsche<br />
Approbation, „natürlich“ besitze er die<br />
deutsche Staatsbürgerschaft.<br />
Seit ihn die ersten Hilferufe aus dem<br />
Irak erreicht haben, hat Ali Khalaf eine<br />
Mission. Seine Frau und seine zwei Kinder<br />
bekommen ihn kaum noch zu Gesicht,<br />
seine Patienten behandelt ein Vertreter.<br />
Stattdessen mobilisiert er Freunde, Verwandte,<br />
Glaubensbrüder und beteiligt<br />
sich an der Gründung eines Hilfskomitees.<br />
Er wird von SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />
empfangen und im Auswärtigen<br />
Amt von Staatssekretär Stephan Steinlein.<br />
Er organisiert Hilfslieferungen und<br />
Demonstrationen. „Ich muss das tun“,<br />
sagt er, „ich kann nicht eine Minute in<br />
meiner Praxis arbeiten.“<br />
<strong>Das</strong> Jesidentum ist eine Religion im<br />
Schatten, älter als Islam und Christentum,<br />
eine heilige Schrift gibt es nicht.<br />
Im Irak lebt etwa die Hälfte der weltweit<br />
circa eine Million Jesiden. Dort werden<br />
sie dreifach diskriminiert. Ethnisch<br />
zählen sie zur kurdischen Minderheit,<br />
religiös leben sie in der Diaspora, politisch<br />
werden sie verfolgt. Und nicht nur<br />
im Irak, sondern auch im Iran, in Syrien<br />
und der Türkei. Die IS-Fanatiker töten sie<br />
als „Ketzer“, als „Teufelsanbeter“.<br />
NACH DEUTSCHLAND KAMEN die ersten<br />
Jesiden vor einem halben Jahrhundert,<br />
heute sind es 50 000 bis 100 000.<br />
„Bislang haben sie in Deutschland im Verborgenen<br />
gelebt“, sagt Ali Khalaf. Nach<br />
außen schotten sie sich ab, Hochzeiten<br />
sind nur innerhalb der Gemeinschaft erlaubt.<br />
„Wir mussten das tun“, erklärt er,<br />
die Jesiden seien über Jahrhunderte verfolgt<br />
worden, „wir mussten uns schützen.“<br />
Aber er räumt ein, dass sich seine Religion<br />
modernisieren und öffnen müsse.<br />
Familienangehörige von Ali Khalaf<br />
sind zusammen mit Zehntausenden anderen<br />
Jesiden ins Sindschar-Gebirge geflohen,<br />
eine Tante ist entführt worden.<br />
„Warum ist es möglich, mit den Eingeschlossenen<br />
im Berg zu telefonieren, aber<br />
nicht möglich, die IS-Terroristen zu stoppen?“,<br />
fragt er verzweifelt. Keiner tue etwas,<br />
„auch die kurdischen Peschmerga<br />
lassen uns im Stich“.<br />
In seinem Wohnzimmer hat Khalaf<br />
ein improvisiertes Büro eingerichtet,<br />
im Fernsehen laufen via Satellit kurdische<br />
Nachrichten. „Wir müssen verhindern,<br />
dass die Jesiden vernichtet werden“,<br />
sagt er und tippt WhatsApp-Botschaften.<br />
Dann springt er auf, redet mal kurdisch,<br />
mal arabisch, mal deutsch. „Was haben<br />
Sie für Infos?“, ruft er ins Telefon. „Melden<br />
Sie sich, wenn Sie was wissen, auch<br />
von den Amerikanern, damit wir die Angehörigen<br />
beruhigen können.“<br />
<strong>Das</strong> Massaker im Sindschar-Gebirge<br />
konnte zunächst abgewendet werden,<br />
aber das Morden geht weiter. In<br />
Kocho sterben mindestens 80 Jesiden.<br />
Ali Khalaf steht in Bad Salzuflen auf dem<br />
gepflasterten Salzhof und berichtet den<br />
Demonstranten von den Hinrichtungen.<br />
„Hawara“, ruft er ihnen zu, ein kurdischer<br />
Trauerschrei.<br />
„Die Kurden verfolgen eine dreckige<br />
Strategie“, sagt Ali Khalaf, „die bekommen<br />
jetzt ihre Waffen, aber uns hilft keiner.“<br />
Nur für einen Moment standen die<br />
Jesiden im Fokus. Vielleicht lasse sich die<br />
Aufmerksamkeit nutzen, hofft er, vielleicht<br />
helfe Deutschland, vielleicht richteten<br />
die Vereinten Nationen eine Schutzzone<br />
ein, um zumindest die jesidischen<br />
Heiligtümer in Lalisch zu schützen.<br />
Ali Khalaf wird weiter telefonieren,<br />
und er will wieder nach Berlin fahren.<br />
Die Erwartungen an die Bundesregierung<br />
sind riesig. Die Demonstranten<br />
in Bad Salzuflen beschwören nicht nur<br />
die „internationale Solidarität“, sondern<br />
rufen auch „Danke, Deutschland“. „Es<br />
ist ein Drama“, sagt Dr. Ali. Wann er in<br />
seine Zahnarztpraxis zurückkehrt, weiß<br />
er nicht.<br />
CHRISTOPH SEILS, Politologe,<br />
ist Ressortleiter Online von <strong>Cicero</strong><br />
Foto: Michael Löwa für <strong>Cicero</strong><br />
32<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
EINE MARKE<br />
Sie will die FDP wieder aufbauen. Und umbenennen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist<br />
Vizechefin der Liberalen. Sie selbst profiliert sich als Kommunalpolitikerin in Düsseldorf<br />
Von DENISA RICHTERS<br />
Foto: Andreas Bretz<br />
Wenn sie einen freien Kopf<br />
braucht, steigt Marie-Agnes<br />
Strack-Zimmermann auf ihre<br />
BMW C 1200. Es ist ein ungleiches Paar,<br />
die zierliche Frau und die schwere Maschine.<br />
Doch auf ihrer BMW kommt die<br />
56 Jahre alte Freidemokratin auf andere<br />
Gedanken, gerade in schwierigen Zeiten.<br />
Davon gab es reichlich, seit die Düsseldorfer<br />
Kommunalpolitikerin auf Vorschlag<br />
von FDP-Chef Christian Lindner<br />
im Dezember 2013 zu einer der Vizevorsitzenden<br />
gewählt wurde. Als Frau mit<br />
Lebenserfahrung und Familie, frei von<br />
bundespolitischen Altlasten wurde sie<br />
Teil des Neuanfangs.<br />
Noch immer liegen die Liberalen<br />
in Umfragen unter 5 Prozent. Auch<br />
die Landtagswahlen in Ostdeutschland<br />
versprechen nicht den ersehnten Aufschwung.<br />
Strack-Zimmermann hat in der<br />
Debatte um die Neuausrichtung der Partei<br />
den radikalsten Vorschlag gemacht:<br />
Sie schlug vor, die FDP umzubenennen.<br />
Dafür gab es viel Spott. Aber sie sagt:<br />
„Politik ist nichts für Weicheier.“<br />
Strack-Zimmermann weiß, dass es<br />
Jahre dauern kann, Vertrauen zurückzugewinnen.<br />
15 Jahre gehörte sie zur<br />
schwarz-gelben Mehrheit im Düsseldorfer<br />
Rathaus. Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt,<br />
in der auch Lindner lebt,<br />
ist schuldenfrei, legt an Einwohnern zu,<br />
ist beliebt bei Familien und Investoren.<br />
Strack-Zimmermann spielte darin eine<br />
tragende Rolle. Bis zum 25. Mai. Da landete<br />
die FDP bei den Kommunalwahlen<br />
in NRW bei 4,7 Prozent. Zerrieben zwischen<br />
Imagedesaster, AfD und bürgerlichen<br />
Grünen. In Düsseldorf, wo Strack-<br />
Zimmermann innerhalb weniger Jahre<br />
von einer Stadtteilpolitikerin zur Bürgermeisterin<br />
aufgestiegen war, holten die Liberalen<br />
7 Prozent. Ein gutes Ergebnis angesichts<br />
des Gegenwinds. Doch für die<br />
CDU/FDP-Mehrheit reichte es nicht. Dabei<br />
hatte die liberale Frontfrau für den<br />
CDU-Amtsinhaber Dirk Elbers sogar auf<br />
eine Oberbürgermeister-Kandidatur verzichtet.<br />
Obwohl sie vielen Bürgerlichen<br />
als die Bessere galt: Er der Zauderer mit<br />
der Attitüde des Arroganten, sie die Anpackerin,<br />
zuverlässig, eine Marke.<br />
Erst ging Schwarz-Gelb verloren,<br />
später der OB-Posten des Bündnispartners<br />
von der CDU. Strack-Zimmermann<br />
wirft so etwas nicht um. „Die Kompetenz<br />
liegt in den Kommunen“, sagt die Politologin<br />
mit Doktortitel. Ein Potenzial, das<br />
die Bundes-FDP vernachlässigt habe. Zu<br />
viel neo-, zu wenig sozialliberal. Kaltherzig<br />
das Image. Dabei sei liberale Politik,<br />
davon ist sie überzeugt, die sozialste<br />
überhaupt. „Weil Geld erst erwirtschaftet<br />
und dann ausgegeben wird.“<br />
IN IHR BÜRGERMEISTERBÜRO im Rathaus<br />
ist ein Grüner eingezogen. Der<br />
<strong>neue</strong> OB heißt Thomas Geisel, ein Sozialdemokrat.<br />
Im Wahlkampf hatte Strack-<br />
Zimmermann ihn als Schuldenmacher<br />
beschimpft. Nun sitzt sie mit ihm, der<br />
SPD und den Grünen am Verhandlungstisch.<br />
Eine Ampelkoalition soll sich zu<br />
einer knappen Ratsmehrheit zusammenraufen.<br />
Strack-Zimmermann, die gerade<br />
noch ausgeteilt hat, muss nun als FDP-<br />
Kreisvorsitzende lächelnd manches ertragen,<br />
damit die Liberalen in Düsseldorf<br />
mitregieren können. Womöglich ist am<br />
Ende Opposition die würdigere Variante.<br />
Leicht fällt ihr das alles nicht. Strack-<br />
Zimmermann wird ungehalten, wenn aus<br />
ihrer Sicht etwas falsch läuft. Wie bei der<br />
Rentenpolitik der Großen Koalition in<br />
Berlin. „Jetzt wäre die Gelegenheit, Geld<br />
zurückzulegen. Stattdessen wird es aus<br />
dem Fenster geworfen, als ob wir nicht<br />
mehr alle Tassen im Schrank hätten!“<br />
Nein, den Wählern hinterherrennen will<br />
sie nicht. Oft sieht man sie mit der Aktentasche<br />
in der Hand mit resolutem Schritt<br />
von einem Termin zum anderen eilen. Im<br />
Vorbeigehen schüttelt sie Hände. Dann<br />
weicht der düster-konzentrierte Blick<br />
kurz einem Lächeln.<br />
Sie hat eine Familie mit drei Kindern<br />
gemanagt, nun will sie gestalten, notfalls<br />
mit unkonventionellen Mitteln. Dazu gehört<br />
ihr Vorstoß, der FDP einen <strong>neue</strong>n<br />
Namen zu geben. Christian Lindner hat<br />
die Idee schnell abgetan. Harley-Davidson<br />
habe in einer Krise auch nicht den<br />
Traditionsnamen aufgegeben, sondern<br />
die Motoren modernisiert, sagt er.<br />
Strack-Zimmermann gibt nicht klein<br />
bei. Aus der Verlagsbranche, in der sie als<br />
Selbstständige arbeitet, weiß sie, dass es<br />
manchem wenig beachteten Buch geholfen<br />
hat, den Titel zu ändern. „Natürlich<br />
geht es um Inhalte und Personen. Aber<br />
auch um die Frage, ob die Marke FDP<br />
noch die richtige ist.“<br />
Als FDP-Vize ist sie in Deutschland<br />
herumgekommen, hat erlebt, wie schwer<br />
liberale Politik zu vermitteln sein kann.<br />
Wo der Wohlstand gering ist und die Arbeitslosigkeit<br />
hoch, lässt sich mit dem<br />
Prinzip Eigenverantwortung, des Förderns<br />
und Forderns, nicht punkten. Doch<br />
gerade dann sei das nötig, sagt sie.<br />
„Trümmerfrau“ hatte ihr Parteifreund<br />
Wolfgang Kubicki sie bespöttelt,<br />
als sie das Vizeamt der darniederliegenden<br />
Liberalen übernahm. „Frauen wie<br />
meine 90-jährige Mutter haben es geschafft,<br />
Deutschland wieder aufzubauen“,<br />
kontert Strack-Zimmermann. Immerhin<br />
eine Sanierungsstrategie für die FDP.<br />
Wie auch immer sie heißen möge.<br />
DENISA RICHTERS berichtet in Düsseldorf<br />
über Kommunalpolitik. Sie ist Redakteurin<br />
der Rheinischen Post und beobachtet Strack-<br />
Zimmermanns Karriere seit Jahren<br />
35<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
ERDOGANS SPÄTZLE<br />
Rezzo Schlauch fand Anerkennung durch Provokation: ein Gründungsgrüner pro Autos<br />
und für den Krieg, ein Gründungsgrüner bei EnBW. Jetzt arbeitet er für Erdogan<br />
Von JULIA PROSINGER<br />
Foto: Hans-Bernhard Huber/Laif<br />
Eine Welle schwappt durch Stuttgart,<br />
geradewegs zu auf einen Tisch in<br />
der Innenstadt, Weinstube Vetter.<br />
Dort hält die Welle an und bestellt einen<br />
schwäbischen Rostbraten. Mit Spätzle.<br />
Ein paar Stuttgarter drehen die<br />
Köpfe, manche winken. Sie kennen die<br />
Welle, sie kennen den Gang, ein Rollen,<br />
kein Laufen.<br />
Die Welle heißt Rezzo Schlauch. Bei<br />
der Kandidatur als Oberbürgermeister<br />
1996, bereits seiner zweiten, kokettierte<br />
der Grüne mit diesem Kultstatus. „Keiner<br />
kennt den Roten. Keiner kennt den<br />
Schwarzen. Alle kennen Rezzo.“ Er verlor<br />
knapp, weil die SPD ihren aussichtslosen<br />
Gegenkandidaten nicht zurückzog.<br />
Von diesen alten Zeiten erzählt er<br />
gern, hingegossen an den Bistrotisch<br />
wie eine von Dalis zerfließenden Uhren.<br />
Die Beine fortgestreckt, der Flosse einer<br />
Meerjungfrau gleich, den Schädel auf einen<br />
Arm gestützt, den Bauch im freien<br />
Fall zwischen Tisch und Stuhl. Im Bundestag,<br />
wo er einst Grünen-Fraktionschef<br />
war, sollen seine Mitarbeiter ihm geraten<br />
haben: „Fläz doch nicht so.“ Schlauch<br />
hörte nicht. Schlauch blieb Schlauch.<br />
Heute, mit 66 und neun Jahre nachdem<br />
er sich aus der Politik zurückgezogen<br />
hat, ist er Lobbyist und überredet<br />
deutsche Firmen, ihre Angst vor der<br />
Türkei abzulegen. Im Namen der türkischen<br />
Investitionsagentur Ispat. Sie untersteht<br />
Recep Tayyip Erdogan, einst als<br />
Modernisierer gefeiert, dann als Brutalo<br />
vom Gezi-Park gehasst, gerade als Regierungschef<br />
zum Präsidenten gewählt.<br />
Als Schröder zu Putin ging, Niebel zur<br />
Rüstungsindustrie und Pofalla zur Bahn,<br />
schrien viele. Nur Rezzo darf Rezzo sein.<br />
Von ihm erwartet man keine Moral.<br />
Er lag schließlich immer schräg, so<br />
wie jetzt am Tisch. Als Student in Freiburg<br />
war er Mitglied einer Burschenschaft. Im<br />
Landtag von Baden-Württemberg störte<br />
der junge Anwalt durch Zwischenrufe,<br />
verteidigte Hausbesetzer und Kiffer. Er<br />
gründete die Grünen mit, eine Partei<br />
der Provokation. Die wiederum provozierte<br />
er, wenn er Sätze sagte wie diesen:<br />
„Mit Frauenpolitik holt man heute<br />
keinen Schwanz mehr hinterm Ofen vor.“<br />
Bereits 1984 dachte er laut über eine<br />
schwarz-grüne Koalition nach. Er ließ<br />
sich im Sportwagen fotografieren. Boxte<br />
mit Joschka Fischer den Kosovo-Einsatz<br />
durch. Machte mit dienstlich erflogenen<br />
Bonusmeilen Urlaub in Thailand.<br />
Wer viel umtreibe, mache eben Fehler,<br />
sagt Schlauch. Ist das nicht sogar sympathisch?<br />
Seine Geschäftspartner mögen<br />
ihn deshalb, den einfachen Hohenloher<br />
Pfarrerssohn, den dialektschwätzenden<br />
Teddybären, der mal, ganz menschlich,<br />
auf dem Weinfescht zu viel trinkt. Und<br />
den die Moralstrenge der Grünen anwidert.<br />
Erst kürzlich schalt er sie für ihre<br />
Steuerpläne, motzte über den Veggie-<br />
Day, dann zog er sich wieder zurück.<br />
SCHWARZ-GRÜN IST eine Realität, Fritz<br />
Kuhn OB in Stuttgart, was gestern Provokation<br />
war, ist heute Normalität. Wo<br />
soll er noch hin, Rezzo Schlauch?<br />
2005 verließ er die Politik freiwillig.<br />
„Mir fehlt nichts. Wenn ich eine<br />
Bühne brauche, suche ich mir eine.“<br />
Noch während seiner Tätigkeit als parlamentarischer<br />
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium<br />
hatte Schlauch beim<br />
Atomriesen EnBW unterschrieben. Der<br />
Grüne verkauft es als Revolution: „Als<br />
Achtundsechziger predigten wir den<br />
Marsch durch die Institutionen, jetzt<br />
wird es Zeit für den Marsch durch die<br />
Industriekomplexe.“<br />
Schlauch berät auch einen Anbieter<br />
von chinesischen Zahnersatzprodukten,<br />
einen Online-T-Shirt-Handel und zwei<br />
Bauernbuben von der Schwäbischen<br />
Alb, die Zündkerzen durch Mikrowellen<br />
ersetzen wollen. Er hat gerade als<br />
Rektor bei einer <strong>neue</strong>n Hochschule für<br />
Computerspiele in Stuttgart unterschrieben.<br />
„Manchmal verstelle ich mich –<br />
dann bin ich der, der ich bin“, ein alter<br />
Spontispruch.<br />
Macht Ihnen das gar nichts aus, ausgerechnet<br />
Erdogan zu unterstützen, Herr<br />
Schlauch? Die Welle rollt an. „In der Politik<br />
habe ich manchmal problematischere<br />
Positionen einnehmen müssen – in der<br />
Substanz kann ich das gut vertreten. Ich<br />
bin felsenfest überzeugt, dass die Industrialisierung,<br />
die in der Türkei maßgeblich<br />
unter Erdogan stattgefunden hat, und<br />
die damit einhergehende gesellschaftliche<br />
Modernisierung nicht mehr umkehrbar<br />
sind.“<br />
Man kann sich vorstellen, wie Gerhard<br />
Schröder sich gefühlt haben muss,<br />
wenn Fischer nach einem Koalitionskrach<br />
mal wieder den Fraktionschef Schlauch<br />
vorbeischickte. Schlauch brachte Schröder<br />
dazu, seinen Ärger herunterzuschlucken.<br />
„Unsere Gespräche waren nicht<br />
selten von Rotwein getränkt.“<br />
Schlauch schwappt vom Tisch. Die<br />
Türken, er wechselt auf die Metaebene,<br />
hätten doch eine ganz andere politische<br />
Kultur. Da könne man deutsche<br />
Maßstäbe nicht ansetzen. „In zehn Jahren<br />
werden die Europäer die Türkei auf<br />
Knien bitten, in die EU zu kommen. Was<br />
würde es dem Prozess bringen, wenn ich<br />
jetzt unter großem öffentlichen Aplomb<br />
Kritik üben würde?“<br />
Durchgespült. Wenn die Welle verebbt,<br />
bleiben nur ein paar Tropfen.<br />
JULIA PROSINGER lebt als Reporterin<br />
in Berlin. Ihr Blick reicht vom Lokalen<br />
auf die Weltbühne; oft verbindet sie die<br />
beiden Ebenen<br />
37<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Jakob Augstein ( links ) und Frank<br />
A. Meyer. „Moralische Außenpolitik<br />
gibt es nicht“, sagt Augstein<br />
Zwei grundverschiedene<br />
Linke,<br />
zwei Generationen,<br />
ein Norddeutscher<br />
und ein Schweizer.<br />
Die Publizisten<br />
Jakob Augstein und<br />
Frank A. Meyer<br />
sprechen über den<br />
frommen Putin,<br />
die fahrlässige EU,<br />
über Machtsphären<br />
und Moral.<br />
Und über die Liebe<br />
Fotos ANTJE BERGHÄUSER<br />
„ SIE SIND EINE<br />
38<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
MORALTANTE “<br />
39<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Jakob Augstein: Herr Meyer, würden Sie<br />
die Ukrainekrise als einen Konflikt zwischen<br />
Ost und West bezeichnen?<br />
Frank A. Meyer: <strong>Das</strong> ist ein Konflikt<br />
zwischen Ost und West. Aber nicht<br />
so, wie wir den Ost-West-Konflikt in Erinnerung<br />
haben: dort das diktatorische<br />
Sowjet-Imperium, hier der freie Westen.<br />
Es ist ein Konflikt zwischen der römischchristlichen<br />
und der orthodox-christlichen<br />
Kultur. Natürlich: nicht nur! Aber<br />
eben doch ein Konflikt, dessen Ursachen<br />
tiefer in der Geschichte zu finden sind<br />
und nicht einfach im Machtpoker zwischen<br />
dem EU-Raum und Russland. Die<br />
Religionskultur ist ein ganz wesentlicher<br />
Punkt, der vom Westen, von Brüssel,<br />
auch von der Nato leider kaum in<br />
Betracht gezogen wurde. <strong>Das</strong>s man auf<br />
europäischer Ebene ein Assoziierungsabkommen<br />
mit der Ukraine aushandelte,<br />
ohne die kulturellen Bruchlinien in diesem<br />
Land zu beachten, war fahrlässige<br />
ökonomische Machtpolitik.<br />
Dann sind Sie ja ein richtiger Putin-<br />
Versteher.<br />
Ich kann verstehen, dass es in der<br />
Ukraine zu kulturellen Verwerfungen<br />
kam: Ungleichzeitigkeiten. Ja, wir erleben<br />
in diesem Konflikt die Ungleichzeitigkeit<br />
der ehemaligen sowjetischen<br />
Welt, die sich in jüngster Zeit ganz stark<br />
nach dem Orthodoxen zurücksehnt. <strong>Das</strong><br />
sieht man in der Ukraine, in Russland<br />
und auch bei Putin selbst. Der frühere<br />
KGB-Agent ist fromm geworden. Er gräbt<br />
nach einer Herkunftskultur, die von der<br />
Sowjetdiktatur verschüttet wurde.<br />
Ob er selber fromm ist oder nicht, wissen<br />
wir nicht. Er wurde in einem Interview<br />
gefragt, da hat er sich nicht geäußert.<br />
Er umgibt sich mit dem orthodoxen<br />
Klerus, sonnt sich in kirchlichem Glanz.<br />
Aber Sie glauben doch nicht, dass er das<br />
macht, weil er selbst fromm geworden<br />
ist!<br />
Ich glaube, er sucht nach einer <strong>neue</strong>n<br />
alten Identität für sich und für Russland.<br />
Auf uns Westeuropäer wirkt das befremdlich.<br />
Unsere Identität ist eine moderne,<br />
säkulare. Wir suchen Identität<br />
eher in unserer Demokratie, in der Sicherung<br />
des Rechtsstaats und im Erhalt von<br />
Freiheitsräumen. Unsere Frage lautet:<br />
„ Die EU hat<br />
die kulturellen<br />
Bruchlinien in<br />
der Ukraine<br />
nicht beachtet.<br />
Fahrlässige<br />
Machtpolitik “<br />
Frank A. Meyer<br />
Wie setzen wir das Ich und das Wir in<br />
ein möglichst ausgewogenes Verhältnis?<br />
Sie erklären den Ukrainekonflikt zu einem<br />
kulturellen Konflikt. Ich glaube,<br />
so groß ist der kulturelle Unterschied<br />
zwischen den Russen und uns gar nicht,<br />
sondern hier handelt es sich um einen<br />
Interessenkonflikt zwischen Kulturen,<br />
die vielleicht nicht in einem Geschwisterverhältnis<br />
zueinander stehen, aber<br />
in einem Vetternverhältnis. Wir erleben<br />
einen Interessenkonflikt, es geht<br />
um Abgrenzung und um Dominanz.<br />
Mich hat sehr gewundert zu hören und<br />
zu lesen: „Die Geopolitik kehrt zurück.<br />
<strong>Das</strong> Denken in Einfluss- und Machtsphären<br />
kehrt zurück.“ <strong>Das</strong> Denken in Einfluss-<br />
und Machtsphären prägt doch<br />
die internationale Politik immerzu, in<br />
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.<br />
In den letzten 20 Jahren haben<br />
40<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Anzeige<br />
JAKOB AUGSTEIN, 4 7,<br />
ist Verleger der Wochenzeitung<br />
Der Freitag und<br />
Publizist. Für Spiegel und<br />
Spiegel Online schreibt<br />
er die Kolumne „Im Zweifel<br />
links“. Der gebürtige<br />
Hamburger wuchs als<br />
Sohn des Spiegel-Gründers<br />
Rudolf Augstein auf<br />
FRANK A. MEYER, 70, ist<br />
Kolumnist und publizistischer<br />
Berater des Ringier-Verlags.<br />
<strong>Das</strong> Geschehen der Berliner<br />
Republik kommentiert er<br />
jeden Monat in <strong>Cicero</strong>. In<br />
der Schweiz schreibt er wöchentlich<br />
im Sonntagsblick.<br />
Er wuchs im zweisprachigen<br />
Biel-Bienne als Sohn eines<br />
Uhrmachers auf<br />
die Chinesen die Bühne der Weltpolitik<br />
betreten, Indien und Pakistan tragen<br />
einen schweren Konflikt aus, auf globaler<br />
Ebene gibt es seit 9/11 den Konflikt<br />
zwischen christlicher und islamischer<br />
Welt. <strong>Das</strong> sind immer Konflikte<br />
um Einfluss- und Machtsphären.<br />
Lieber Jakob Augstein, ich habe ganz<br />
bewusst gesagt: Es ist nicht ausschließlich<br />
ein kultureller Konflikt. Doch wir Europäer<br />
haben etwas übersehen. Wir haben<br />
es schon bei der Integration von Bulgarien<br />
und Rumänien in die EU übersehen: Die<br />
früheren „Satelliten-Staaten“ der Sowjetunion,<br />
wie wir sie nannten, haben nicht<br />
viel Zeit und Gelegenheit gehabt, demokratisches<br />
Bewusstsein zu entwickeln. Sie<br />
haben ihre Geschichte nicht bewältigen<br />
können. Sie lebten bis 1989 als hermetisch<br />
abgeschlossene Gesellschaften. Diktatur<br />
ist ja hermetisch. Der Kommunismus<br />
hat verhindert, dass sich die Kultur dieser<br />
Völker entwickelt. Zwischen Kirche und<br />
Staat konnte kein zeitgemäßes Verhältnis<br />
entstehen. Bleiben wir bei der Ukraine:<br />
Die Ostukraine ist kulturell anders grundiert,<br />
pflegt andere kulturelle Sensibilitäten<br />
als die Westukraine. Aber natürlich haben<br />
Sie recht: <strong>Das</strong> alles ist auch ein Kampf<br />
um Einflusssphären. Die Welt ist derart<br />
ökonomisiert, dass es tatsächlich immer<br />
auch um krude kommerzielle Macht geht.<br />
Warum tun wir uns denn so schwer,<br />
das einfach zuzugestehen und zu sagen:<br />
„Hier herrscht ein Kampf um Einflusssphären.<br />
Die Russen haben ihre Interessen,<br />
und wir haben unsere – mal<br />
schauen, ob es einen Interessenausgleich<br />
gibt, oder: mal schauen, ob sich<br />
hier tatsächlich der Stärkere durchsetzt?“<br />
Weshalb laden wir diese Debatte<br />
so stark mit Moral auf? Warum<br />
müssen wir sagen: „Putin ist der Böse.<br />
Er ist ein Aggressor, der das Gleichgewicht<br />
der Kräfte in Europa bedroht.“<br />
Dabei geht es dem Westen selbst doch<br />
um nichts anderes als die Verschiebung<br />
des Gleichgewichts zu seinen Gunsten.<br />
Wir haben eine kulturelle Bruchstelle,<br />
wir haben Ungleichzeitigkeiten,<br />
und wir haben ganz automatisch den<br />
Kampf um ökonomische Einflusssphären.<br />
<strong>Das</strong> sind die drei Konfliktfelder. Wir wollen<br />
auch Putin verstehen. Motive nachvollziehen<br />
zu können, heißt aber noch<br />
nicht, sie zu billigen. Sie und ich haben<br />
bestimmte Maßstäbe für den Umgang mit<br />
dem Völkerrecht. Und wir haben ein bestimmtes<br />
Verständnis vom Umgang mit<br />
den Menschen. Wir können unsere Werte<br />
zwar nicht anderen Kulturen und Staaten<br />
überstülpen, aber wir können sagen:<br />
„Die Werte, die in eurem Land gelten,<br />
sind nicht unsere Werte.“<br />
Aber moralische Außenpolitik gibt es<br />
nicht.<br />
In der Außenpolitik gibt es keine<br />
Freunde, nur Interessensphären. Aber<br />
es ist dennoch ganz klar, dass man in einer<br />
Wertewelt verwurzelt ist und aus dieser<br />
Wertewelt heraus ethische und moralische<br />
Prinzipien für das eigene Handeln<br />
entwickelt. Alles andere wäre zynisch!<br />
Wenn wir Wirtschaftsbeziehungen mit<br />
Saudi-Arabien pflegen, kennen wir keine<br />
moralische Komponente.<br />
eröffnung 16. Sep, 19 uhr<br />
akademie der künSte, hanSeatenweg<br />
41<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014<br />
www.berlinartweek.de
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Wir müssen diskutieren, ob wir mit<br />
Saudi-Arabien eine Wirtschaftsbeziehung<br />
haben wollen. <strong>Das</strong> wird ja auch diskutiert.<br />
Ich behaupte überhaupt nicht, dass die<br />
westliche Außenpolitik – ob die amerikanische,<br />
europäische oder deutsche – stets<br />
moralisch handelt. Ich sage nur: Es gibt<br />
sie, die Werte, es gibt sie, die Moral. Daran<br />
orientiert man sich. <strong>Das</strong> tun Sie doch<br />
ganz einfach als Mensch. Der Begriff Moral<br />
ist zu Unrecht diffamiert. Moral steckt<br />
in uns: im Menschen, in jedem Menschen –<br />
das ist das Universale.<br />
Die Moral, von der Sie sprechen, ist immer<br />
eingebettet in ein sehr feines Gewebe<br />
aus eigenen Interessen und Einsicht<br />
in eigene Möglichkeiten. Sie ist<br />
deshalb nachrangig. Am Ende ist nicht<br />
die Moral das entscheidende Kriterium<br />
für außenpolitisches Handeln, und das<br />
ist auch gut so! Alles andere wäre eine<br />
Katastrophe. Außenpolitik, überhaupt<br />
Politik, ist nicht dafür da, die Moral eines<br />
Landes zu vertreten, sondern seine<br />
Interessen – das ist ein anderer Job. Was<br />
ich als unangenehm empfinde, ist unsere<br />
moralische Argumentation im Verhältnis<br />
zu anderen Staaten und Kulturkreisen.<br />
Wenn wir glauben, es uns nicht<br />
leisten zu können, tun wir es nicht.<br />
Wenn wir aber glauben, es uns leisten<br />
zu können, tun wir es. Wer es tut, diskreditiert<br />
sich meiner Meinung nach für<br />
alle Situationen. Deshalb sollten wir es<br />
niemals tun.<br />
Sie sagen „wir“. Wer ist für Sie das<br />
„Wir“?<br />
Die westliche Öffentlichkeit.<br />
Und da widerspreche ich nun vehement.<br />
Es beeindruckt mich stark, auf<br />
welch differenzierte Weise diese Debatte<br />
in der Öffentlichkeit geführt wird,<br />
gerade als Debatte um Werte. Es heißt<br />
nicht einfach zynisch: „Siemens hat Interessen<br />
in Moskau. Ergo lass uns schweigen,<br />
um diese Interessen nicht zu gefährden.“<br />
<strong>Das</strong> wäre Interessenpolitik, reine<br />
Interessenpolitik. Ich finde es toll, dass es<br />
Leute gibt, die sagen: „Hier geht es um<br />
universale Werte, die nicht nur bei uns,<br />
sondern auch in diesem Teil der Welt gelten<br />
müssen.“<br />
Für mich ist der Konflikt in der Ukraine<br />
ein gutes Beispiel dafür, wie der Westen<br />
„ Außenpolitik ist<br />
nicht dafür da,<br />
die Moral eines<br />
Landes zu vertreten,<br />
sondern<br />
seine Interessen “<br />
Jakob Augstein<br />
seine Werte instrumentalisiert. Der<br />
Westen sagt: „Weil wir diese Werte haben,<br />
haben wir auch das Recht, dieses<br />
und jenes zu tun.“ Andere Kulturkreise<br />
sagen: „Weil wir diese Interessen haben,<br />
machen wir das und das.“ Aber im Endeffekt<br />
läuft es auf dasselbe hinaus.<br />
Sie sagen: „Wir im Westen sind<br />
Heuchler.“ Ein moralisches Urteil. Sie<br />
fällen ebenfalls moralische Urteile. Sie<br />
sind das beste Beispiel dafür, dass es immer<br />
auch um die Moral geht.<br />
Es ist vor allen Dingen ein emotionales<br />
Urteil, kein moralisches. Es geht mir auf<br />
die Nerven.<br />
Nur Moral kann so viele Emotionen<br />
freisetzen. Ich will aber festhalten:<br />
Es gibt das Problem der Ungleichzeitigkeit;<br />
wir haben es in der EU selbst. Beim<br />
Computerhandel an der Börse entscheiden<br />
Nanosekunden über Erfolg und Misserfolg.<br />
Gleichzeitig leben in diesem Europa<br />
Gesellschaften, deren Probleme auf<br />
Jahreszahlen wie 1914 oder 1933 oder<br />
1945 oder 1956 oder 1968 oder 1973 –<br />
das Jahr der Ölkrise – zu datieren sind.<br />
Schon das Fernsehen hat uns Bilder gebracht<br />
aus Weltgegenden, die wir vorher<br />
nicht kannten …<br />
… der Vietnamkrieg ist ein Fernsehkrieg<br />
gewesen.<br />
Genau. Deshalb hat er uns in ethische<br />
Bedrängnisse gebracht, die die Leute so<br />
vorher nicht kannten. Plötzlich sahen<br />
sie sich mit der Vorstellung konfrontiert,<br />
in Mitteleuropa komfortabel zu Hause<br />
zu sein, während in einem anderen Teil<br />
der Erde Kinder verbrannt werden.<br />
Sie beschreiben jetzt eine moralische<br />
Konfliktsituation. Die Welt ist voller moralischer<br />
Konfliktsituationen. Damit ist<br />
sie voller Moral. Wir streiten uns über<br />
Konfliktsituationen aus unserem moralischen<br />
Impetus heraus. Hätten wir ihn<br />
nicht, könnten wir Geschäftsleute sein<br />
und sagen: „Ist uns doch einerlei – machen<br />
wir doch einfach gute Geschäfte!“<br />
Aber das tun wir nicht.<br />
Aber genauso machen wir es: Wir zermartern<br />
uns erst das Hirn, machen<br />
dann die Geschäfte und gehen am Ende<br />
gut essen. <strong>Das</strong> ist es, was wir tun.<br />
Ja, aber das charakterisiert eine<br />
moderne, aufgeklärte Gesellschaft, die<br />
Skepsis kennt – auch dem eigenen Handeln<br />
gegenüber …<br />
… und die in einem Zustand permanenter<br />
moralischer Selbstüberforderung lebt.<br />
Was dabei herauskommt, ist eine Art<br />
Perversion.<br />
Nein. Die Bilanz unserer Gesellschaft<br />
ist nun wirklich eine positive.<br />
In einem Balzac-Roman findet sich – ich<br />
habe das in einem Buch von Henning<br />
42<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Ritter gelesen – das Beispiel des Mandarins.<br />
Einer sagt: „Was würdest du<br />
tun, wenn du in China mit einem Gedanken<br />
einen Mandarin töten und dadurch<br />
selbst unvorstellbar reich werden<br />
könntest? Würdest du es machen?“<br />
<strong>Das</strong> beschreibt das moralische Dilemma<br />
im 19. Jahrhundert – praktisch erdacht,<br />
geradezu paradigmatisch. Damals<br />
war das nur ein Gedankenspiel. Heute<br />
ist es Realität. Wir handeln so. Wir töten<br />
durch unsere Gedanken immerzu<br />
irgendwelche Leute auf der Welt und<br />
werden dadurch unvorstellbar reich.<br />
Auf die Frage, die im 19. Jahrhundert<br />
gestellt wurde, geben wir die Antwort:<br />
„Ja, wir machen das.“<br />
Sie sind mir ja eine Moraltante. Sie<br />
sind die größte Moraltante, die mir untergekommen<br />
ist! Was Sie hier entwickeln,<br />
ist reine moralische Empörung. Ich kann<br />
mich nur wiederholen: Die Antwort hat<br />
Kant mit dem kategorischen Imperativ<br />
gegeben: Handle stets nach der Maxime,<br />
die zugleich als Prinzip einer allgemeinen<br />
Gesetzgebung gelten kann. Dieser<br />
Imperativ steckt im Menschen, weil der<br />
Mensch sowohl ein Ich-Mensch als auch<br />
ein Wir-Mensch ist.<br />
Ja, aber die Leute sehen doch, dass es so<br />
nicht läuft. Sie können mit einem Gedanken<br />
den Mandarin töten, aber der<br />
Mandarin kann sie nicht töten. Sie tun<br />
es, weil sie es können.<br />
Längst kann der Mandarin töten. Er<br />
tötet Tausende. Jedes Jahr tötet der moderne<br />
Mandarin in seinem Reich Tausende.<br />
Die Menschen, die dem Mandarin<br />
nicht passen, werden aus der Gesellschaft<br />
entfernt und kaputt gemacht, körperlich<br />
und seelisch. So ist es seit dem Mandarin<br />
Mao. China ist eine Diktatur – wir sind<br />
gegen diese Diktatur. Natürlich: Auch<br />
die Mächte des Westens begehen aus Interessen<br />
Böses … <strong>Das</strong> ist skandalös. In<br />
der Demokratie gibt es täglich Skandale,<br />
weil wir eine freie Gesellschaft sind. In<br />
der Diktatur gibt es keine Skandale, es<br />
sei denn, den einen einzigen: die Diktatur<br />
selbst.<br />
Hier veröffentlichen wir Auszüge aus Frank<br />
A. Meyers Buch „Es wird eine Rebellion geben.<br />
Was unsere Demokratie jetzt braucht.<br />
Gespräche mit Jakob Augstein“, das im<br />
September im Verlag Orell Füssli erscheint<br />
„DIE LIEBE, DAS WUNDER“<br />
Sie birgt das Glück, ist die Hoffnung, geht immer<br />
nach draußen. Gedanken über ein großes Gefühl<br />
Jakob Augstein: Sie haben gesagt,<br />
dass Sie über die Liebe sprechen<br />
wollen. Warum?<br />
Frank A. Meyer: Wir sprechen über<br />
das Leben. Kann man über das Leben<br />
reden, ohne über die Liebe zu reden?<br />
<strong>Das</strong> kann man schon.<br />
Ich kann es nicht. Ich glaube, man<br />
kann es grundsätzlich nicht. Es gibt<br />
keinen großen Roman, keine große<br />
Erzählung, die vom Leben des Menschen<br />
handelt, ohne von der Liebe<br />
zu handeln. Wirklich leben heißt:<br />
Man liebt und man scheitert im<br />
Lieben. Die Liebe birgt das Glück. Die<br />
Liebe, das ist der Raum, den wir dem<br />
geliebten Menschen öffnen: „Bitte<br />
tritt ein, ich liebe Dich.“ Die Liebe ist<br />
das Wunder, das sich in jedem Leben<br />
ereignet – hoffentlich. Ja, es ist die<br />
Hoffnung an sich.<br />
Die Liebe, von der Sie sprechen – ist<br />
das eine Liebe für andere Menschen<br />
oder auch für Ideen oder Dinge?<br />
Ich liebe keine Ideen. Ich liebe kein<br />
Vaterland. Ich liebe keine Dinge. Ich<br />
liebe nur Menschen.<br />
Sind Sie ein Macho?<br />
Aber sicher. Sie doch auch.<br />
Ich habe Sie gefragt.<br />
Ich bin ein Mann – also bin ich ein<br />
Macho. Glauben Sie etwa, meine<br />
Generation habe den Macho schon<br />
überwunden? Es wird lange dauern,<br />
bis sich unsere Erkenntnis, dass Männerherrschaft<br />
das Allerdümmste ist,<br />
auch genetisch umgesetzt hat. <strong>Das</strong><br />
soll keine Entschuldigung sein. Wir<br />
sind ja dabei, unser Stammhirn mit<br />
dem Verstand zu steuern, jedenfalls<br />
wir zwei, hoffe ich. Aber einfach ist<br />
das nicht.<br />
Fällt Ihnen das schwer?<br />
Ihnen nicht?<br />
Ich bin hier, um Sie zu befragen.<br />
Immer wenn es persönlich wird, weichen<br />
Sie aus. Warum eigentlich?<br />
Weil ich ein zurückhaltender Norddeutscher<br />
bin. <strong>Das</strong> liegt bei uns in<br />
der Kultur.<br />
Und ich bin Süditaliener?<br />
Sie kommen aus der Schweiz.<br />
Biel ist von Hamburg bestimmt<br />
700 oder 800 Kilometer entfernt.<br />
Es könnte auch einfach so sein,<br />
dass Sie in dieser Hinsicht scheu<br />
sind.<br />
Ja, das bin ich auch.<br />
Wie sehen Sie nun die Liebe?<br />
Ich glaube, Liebe ist alles, was<br />
über einen selbst hinausgeht.<br />
Man fängt in dem Augenblick zu<br />
lieben an, in dem man sich selbst<br />
nicht mehr als Zentrum seiner<br />
Überlegungen begreift. Liebe ist<br />
immer etwas, das nach draußen<br />
geht. Von drinnen nach draußen.<br />
<strong>Das</strong> ist eine sehr schöne Formulierung.<br />
Die merke ich mir. Liebe<br />
ist letztlich ein Transzendieren.<br />
Da gibt es für mich auch eine<br />
religiöse Komponente.<br />
Ja, so sehe ich das auch. Deshalb<br />
finde ich, dass das Christentum<br />
eine ganz große zivilisatorische<br />
Errungenschaft ist. Als Religion<br />
der Liebe hat es die Zivilisation<br />
unglaublich vorangebracht.<br />
Es ist eine Religion, die den Menschen<br />
befreit.<br />
Es ist eine sehr romantische Religion<br />
im Vergleich zum Beispiel<br />
zur Gesellschaftsreligion in der<br />
chinesischen Kultur, wo es mehr<br />
darum geht, wie die Leute gut<br />
miteinander zurechtkommen.<br />
In der Religion der Liebe geht es<br />
immer um das Verhältnis vom<br />
Ich zu Gott. In der chinesischen<br />
Kultur geht es immer um das<br />
Ich und die anderen. Der Christ<br />
muss Gott in sich selbst und<br />
in seinen Mitmenschen lieben.<br />
Die Idee, dass es ein Innen<br />
und ein Außen gibt, habe ich<br />
erst verstanden, als ich Kinder<br />
hatte. Vorher habe ich keinen<br />
Unterschied zwischen einer<br />
Innen- und einer Außenwelt<br />
gemacht.<br />
Die Liebe ist das intime Hinausgehen<br />
des Menschen über sich<br />
selbst. <strong>Das</strong> Bürgersein ist das gesellschaftliche<br />
Hinausgehen des<br />
Menschen über sich selbst.<br />
43<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Kommentar<br />
UNVERBLÜMT<br />
Der Gazakrieg lässt<br />
einen Antisemitismus in<br />
Deutschland aufbrechen,<br />
der an dunkle Traditionen<br />
anknüpft und eine <strong>neue</strong><br />
Allianz hervorbringt<br />
Von TIMO STEIN<br />
Der Ton ist rau. Der Diskurs ermüdend, weil er<br />
keine Mitte hat. Er kennt nur Pole: Selbst im<br />
so empörungsstarken Internet setzt das Stichwort<br />
Israel beispiellose Empörung frei. Von Apartheid<br />
ist die Rede, von einer So-called-Demokratie, einem<br />
künstlichen Staat, dem zionistischen Aggressor, von<br />
Völkermord und Massakern an<br />
Palästinensern. Israels Premier<br />
Benjamin Netanjahu wird eine<br />
derart obsessive Aufmerksamkeit<br />
zuteil, dass jeder zwielichtige<br />
Diktator vor Neid erblassen<br />
müsste. In Köln, Essen, Stuttgart,<br />
Duisburg und Berlin skandieren<br />
sie „Kindermörder Israel“,<br />
„Judenschweine“, sie singen die<br />
Internationale oder rufen „Allahu<br />
Akbar“: Allah ist groß. Die<br />
Feindschaft zu Israel ist der gemeinsame<br />
Nenner sehr unterschiedlicher<br />
Akteure: Islamisten,<br />
Linke, Rechte, Anhänger der<br />
Querfrontbewegung, die in Berlin<br />
auf montäglichen Demonstrationen<br />
links- wie rechtsradikale<br />
Positionen und Insignien vereint.<br />
Der gemeinsame Feind ist Israel.<br />
Man könnte auch von gelungener<br />
Integration sprechen, wenn die religiös motivierte<br />
Judenfeindschaft in Teilen der muslimischen<br />
Community auf solchen Kundgebungen auf die landesübliche<br />
„Israelkritik“ stößt. Wenn Friedensbewegte<br />
aus den Opfern von einst die Täter von heute machen<br />
und ihr Nie-wieder-Krieg-Pathos auf Israel projizieren,<br />
ein Land, das sich seit seiner Gründung sein <strong>Das</strong>ein an<br />
allen Fronten erkämpfen muss. Wann endlich, so lautet<br />
Protest vor dem Holocaust-Museum in<br />
Washington D. C. gegen den Gazakrieg<br />
der israelkritische Tenor, wollen die Juden aus unserer<br />
Geschichte lernen? Schließlich haben wir Deutschen<br />
den Holocaust auch hinter uns gelassen.<br />
Die Proteste kennzeichnet eine Überidentifikation<br />
mit der Krise in Nahost, welche die Kritiker die einzige<br />
Demokratie in dieser Region mit besonderem Maß<br />
messen lässt. So kommt es, dass Israel der einzige Staat<br />
ist, dessen Existenz im Jahre 2014 noch infrage gestellt<br />
wird. Es ist ein Blick mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.<br />
Ursache und Wirkung werden bis in biblische Zeiten<br />
historisiert oder gänzlich außer Kraft gesetzt. Zu Nahost<br />
haben alle in Deutschland eine Meinung, die selten<br />
wägend und häufig wütend daherkommt. Die Debatte<br />
wird so unerbittlich geführt, als würden sich Leid und<br />
Elend der Welt in Luft auflösen, wenn sich nur Israel<br />
in Luft auflöste.<br />
Zum Antisemitismus gehört es, an Juden Maßstäbe<br />
anzulegen, die man an andere Menschen nicht<br />
anlegt. Ihnen werden Eigenschaften zugeschrieben,<br />
die sie pauschal erhöhen oder erniedrigen. Wenn der<br />
Krieg in Nahost ausbricht, zeigt<br />
sich, wie tief solche Stereotype<br />
in der Gesellschaft verankert<br />
sind. Studien sprechen davon,<br />
dass 15 bis 20 Prozent der Deutschen<br />
antisemitische Haltungen<br />
haben. Heute wird deutlich, wie<br />
anschlussfähig sich Israelkritik<br />
für den Antisemitismus zeigt.<br />
Natürlich, Kritik an Israel<br />
ist nicht per se antisemitisch. Sie<br />
wird es aber dann, wenn sich die<br />
Kritik nicht gegen die Politik Israels,<br />
sondern gegen Israel als jüdischen<br />
Staat selbst wendet.<br />
Nach 1945 war offener Antisemitismus<br />
noch tabuisiert. Er<br />
suchte sich ein <strong>neue</strong>s Gewand<br />
und fand den Antizionismus,<br />
der erklärte, sich nicht gegen<br />
die Juden, sondern gegen Israel<br />
zu richten. Doch häufig sagten<br />
Israelkritiker Zionist und meinten Jude, sie argumentierten,<br />
als hätte es den Holocaust nie gegeben. Es ist<br />
diese Geschichtslosigkeit, die ihn immer schon anfällig<br />
für antisemitische Stereotype macht.<br />
Gleichwohl bestand die antizionistische Argumentation<br />
darauf, dass nicht die Juden, sondern die<br />
Zionisten kritisiert würden. Dagegen macht die antizionistische<br />
Rhetorik im Sommer 2014 auf den<br />
Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images<br />
44<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Anzeige<br />
X, Y, ZUKUNFT – SO TICKT<br />
DIE NEUE GENERATION<br />
Demonstrationen und in den Kommentarspalten des<br />
Internets aus den Zionisten ganz unverblümt Juden.<br />
Deutsche demonstrieren vor Synagogen statt vor israelischen<br />
Botschaften. Juden auf der ganzen Welt werden<br />
in kollektive Haftung für israelische Politik genommen.<br />
Die Israelis werden zu den Nazis von heute<br />
erklärt, während gleichzeitig antisemitische Organisationen<br />
wie Hamas oder Hisbollah als Freiheitsbewegung<br />
verharmlost werden. Von alttestamentarischer<br />
Rache ist die Rede: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.<br />
Ein biblischer Vers, den bereits der nationalsozialistische<br />
Stürmer instrumentalisierte, um das Judentum<br />
als Vergeltungsreligion zu stigmatisieren.<br />
Israel wird zum Fremdkörper innerhalb der arabischen<br />
Welt erklärt, dem das eigentliche Volk der Palästinenser<br />
gegenübersteht. All diese Erzählungen sprechen<br />
Israel die Legitimität ab. All diese Erzählungen<br />
haben ein antisemitisches Narrativ, das an früher erinnert,<br />
als die Juden zum Fremdkörper in Europa erklärt<br />
wurden.<br />
Selbst Deutsche, die sich in der Tradition des Humanismus<br />
und der Menschenrechte sehen, verteidigen<br />
Antidemokraten, Hassprediger und eine Hamas,<br />
die für alle nachlesbar den Tod der Juden zum Programm<br />
erhoben hat. <strong>Das</strong>s gerade die Friedensbewegung,<br />
die Linke diese falsche Solidarität übt, hat freilich<br />
Tradition.<br />
Nach 1945 war die Linke in Deutschland zunächst<br />
proisraelisch ausgerichtet. Diese Positionierung kippte<br />
infolge des Sechstagekriegs im Juni 1967. Israel setzte<br />
sich damals militärisch gegen vermeintlich überlegene<br />
Truppen arabischer Staaten durch. Dieser Sieg entfachte<br />
eine proisraelische Begeisterung in bürgerlichkonservativen<br />
Kreisen in der Bundesrepublik. In der<br />
Konsequenz verlor eine bewusst gegen die Elterngeneration<br />
ausgeübte proisraelische Positionierung vieler<br />
Linker ihre oppositionelle Sprengkraft. Die USA,<br />
die Eltern und Springer unterstützten Israel, so dachten<br />
viele, dann musste man als junger Linker doch gegen<br />
die Zionisten auf die Straße gehen.<br />
Schon damals wies die Kritik am US-Kapitalismus<br />
Ähnlichkeiten mit alten antisemitischen Verschwörungstheorien<br />
auf, wenn sie sich nicht nur gegen Strukturen<br />
wandte, sondern in Personen und Institutionen<br />
eingängige Feindbilder erschuf. 1967 war der Anfangspunkt<br />
einer verzerrten Israelkritik, die für eine ganze<br />
Generation identitätsstiftend sein sollte.<br />
Heute erleben wir ein <strong>neue</strong>s 1967. Der Antisemitismus<br />
tritt wieder ganz offen auf. Er eint Linke, Rechte<br />
und Islamisten, er bringt zusammen, was eigentlich<br />
nicht zusammenpasst. Eine unheimliche Allianz.<br />
Leseprobe auf www.beltz.de<br />
255 Seiten, gebunden | ISBN 978-3-407-85976-1<br />
Auch als erhältlich<br />
»Die heimliche Revolution der Generation Y hat<br />
gerade erst begonnen. Wenn die Ypsiloner einmal<br />
in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind,<br />
wird unsere Welt eine andere sein.«<br />
Klaus Hurrelmann, Erik Albrecht<br />
DIE BUNDESTAGSFRAKTION LÄDT EIN<br />
<strong>Cicero</strong>_ANZ_Eckfeld_Beltz_Hurrelmann_GenerationY.indd 1 11.08.2014<br />
Foto: Zack Seckler/Corbis<br />
DER GRÜNE FREIHEITSKONGRESS<br />
19. September im Bundestag<br />
TIMO STEIN ist Redakteur bei <strong>Cicero</strong> online. Von ihm<br />
erschien 2011 das Buch „Zwischen Antisemitismus und<br />
Israelkritik: Antizionismus in der deutschen Linken“<br />
Infos & Anmeldung » gruene-bundestag.de
46<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
DIE HOCHBURG<br />
Von GUNNAR HINCK<br />
In wenigen Gegenden sind Politiker der AfD so erfolgreich<br />
wie im Erzgebirge. Sie tagen in einem Gartenhäuschen in<br />
Großrückerswalde. Die Sachsen erzielen Topergebnisse. Aber:<br />
Sie haben ein Frauenproblem<br />
Fotos CHRISTOPH BUSSE<br />
47<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
Der Geruch von Fleisch und Zwiebeln<br />
erfüllt das Gartenhäuschen,<br />
er steigt von einem Teller Mettbrötchen<br />
auf. Die Männer im Raum würden<br />
zugreifen, aber erst einmal muss die<br />
Tagesordnung des Kreisvorstands der<br />
AfD Erzgebirge durchgearbeitet werden.<br />
Carsten Hütter, 50 Jahre, Kfz-Meister,<br />
Autohausbesitzer und Oberfeldwebel<br />
a. D., sitzt am Tischende. Es ist sein<br />
Gartenhäuschen, hier in Großrückerswalde<br />
bei Marienberg, und es ist sein<br />
Kreisverband. Er motiviert, moniert und<br />
mahnt. Die Wahlkampfhelfer aus Nordrhein-Westfalen<br />
müssen betreut werden!<br />
Trommelt mehr Plakataufhänger zusammen!<br />
Teilt unsere Posts auf Facebook!<br />
Ein Pin-up-Girl lächelt von der Wand<br />
herunter. Eine Golftasche lehnt in der<br />
Ecke. <strong>Das</strong> Gartenhäuschen ist wohl das,<br />
was man im Englischen eine man cave,<br />
eine Männerhöhle, nennt. <strong>Das</strong> Familienhaus<br />
steht in sicherer Distanz knappe<br />
40 Meter entfernt.<br />
Hütter ist Landesvize der sächsischen<br />
AfD. Der Wahlkampf läuft. Am 31. August<br />
wählen die Sachsen ihren Landtag,<br />
Hütter kandidiert auf einem aussichtsreichen<br />
Listenplatz. Seit der Bundestagswahl<br />
vor einem Jahr und erst recht seit<br />
den Kommunal- und Europawahlen im<br />
Mai gilt Sachsen als AfD-Hochburg. In einem<br />
Gürtel entlang der Grenze zu Tschechien<br />
und Polen, der vom Vogtland im<br />
Westen bis Görlitz im Osten reicht, waren<br />
Im Erzgebirge<br />
setzte einst sogar<br />
die SED auf die<br />
CDU. Aber nun<br />
nagt die AfD an<br />
der Union<br />
Sein Gartenhaus, seine AfD.<br />
Carsten Hütter ( links ), Parteichef<br />
im Kreis Erzgebirge, mit einem<br />
Mitstreiter, der Gastwirt ist<br />
die Wahlergebnisse nochmal höher. Im<br />
Erzgebirge erreichte sie bei den Europawahlen<br />
11,4 Prozent, in manchen Städten<br />
wie Schwarzenberg und eben in der<br />
Großen Kreisstadt Marienberg um die<br />
13 Prozent. Seit der Wahl im Mai sitzen<br />
sieben AfD-Abgeordnete im Kreistag, die<br />
SPD hat nur ein Mandat mehr. Hier in der<br />
Hochburg kann man etwas über das Wesen<br />
der AfD lernen, über ihre DNA.<br />
EIN SOMMERABEND, kurz nach sieben,<br />
draußen ist die Luft etwas abgekühlt.<br />
Drinnen in Hütters Gartenhäuschen<br />
riecht es frisch nach dem Hobbykellerholz,<br />
mit dem die Wand verkleidet ist.<br />
Es geht auch ums Geld, heikel, denn der<br />
Kreisverband ist jetzt, in Wahlkampfzeiten,<br />
finanziell und personell am Limit.<br />
Ein wenig Geld kommt von der Bundespartei,<br />
viel zahlt Hütter selbst, 1000 Euro<br />
im Monat allein für den Sprit. Aber die<br />
Kostenerstattung aus dem Landeshaushalt<br />
ist greifbar. Und die Mittel und Mitarbeiter,<br />
die einer Landtagsfraktion zustehen.<br />
Hütter mahnt: „Fraktions- und<br />
Parteiaufgaben müssen klar getrennt<br />
sein, da achtet der Rechnungshof drauf.“<br />
Im Erzgebirge rüttelt die AfD an der<br />
mächtigen CDU. Eine <strong>neue</strong> Partei, die<br />
nur 60 Mitglieder im Kreis hat und nur<br />
20 aktive, macht der CDU Probleme. Die<br />
Union ist in dieser Gegend traditionell<br />
so verankert, dass schon die SED in einigen<br />
Städten Bürgermeister der Blockpartei<br />
CDU hinnahm; sie wusste, wie<br />
schwer es gewesen wäre, SED-Bürgermeister<br />
einzusetzen. Die Menschen sind<br />
für ostdeutsche Verhältnisse überdurchschnittlich<br />
gläubig. Die evangelische<br />
Landeskirche ist stark, überdies beten<br />
die Menschen in Freikirchen und evangelikalen<br />
Gemeinden, die nach 1989 entstanden<br />
sind. Viel Wald, raues Klima, die<br />
Leute sind eigensinnig. Manche Familien<br />
arbeiten noch wie im 19. Jahrhundert und<br />
pflegen ihr Handwerk in der Werkstatt<br />
hinterm Haus. 1000 Euro mehr oder weniger<br />
in der Kasse können zu einer Existenzfrage<br />
für einen Betrieb werden.<br />
Nachfrage bei Albrecht Kohlsdorf,<br />
früher lange CDU-Landrat: Was macht<br />
die CDU falsch? Kohlsdorf meint, die<br />
Euro-Rettungspolitik habe Wähler von<br />
der CDU weggetrieben. Die Erzgebirger<br />
seien Sparer, die Angst um ihre Einlagen<br />
hätten. Zudem wünschten sich<br />
48<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
viele ein Korrektiv der CDU. Nachdem<br />
die FDP versagt habe, wählten viele die<br />
AfD. Kohlsdorf fällt auf, dass die lokalen<br />
AfD-Kandidaten Unbekannte sind. Hat<br />
er recht, ist dies ein Zeichen dafür, dass<br />
die AfD im Erzgebirge eine typische Protestpartei<br />
ist, die nicht wegen des Personals<br />
oder ihrer Verankerung gewählt<br />
wird, sondern als Ventil für den Unmut<br />
vieler Menschen dient.<br />
DIE TAGESORDNUNG ist endlich abgearbeitet.<br />
Hütter gibt die Mettbrötchen frei.<br />
Die Männer öffnen ihre Bierflaschen.<br />
Der harte Kern der AfD Erzgebirge<br />
besteht an diesem Abend aus Hütter<br />
und vier anderen. Ein ernsthafter<br />
Sie fühlen sich unverstanden –<br />
dieses Gefühl eint die Männer<br />
von der AfD. Und es findet<br />
Widerhall<br />
Polizeihauptkommissar, ein introvertierter<br />
Berufsschullehrer, ein ruhiger Steuerberater<br />
und ein wütender Wirt. Der<br />
Wirt – schwarze Weste, schwerer Dialekt<br />
– ballt die Faust. Er presst die Worte<br />
heraus: „Die Gaststättenkultur wird hier<br />
zerstört!“ Wegen des Rauchverbots habe<br />
er seinen Betrieb aufgeben müssen. Er<br />
vertritt außerdem das Ressentiment-Element<br />
der AfD, wenn er von „dem deutschen<br />
Steuerzahler“ spricht und den<br />
Asylbewerbern, die „auf unsere Kosten“<br />
leben. Wenn der Wirt in Fahrt kommt,<br />
verzieht der Hauptkommissar das Gesicht<br />
und verteidigt die Asylbewerber<br />
mit bedächtiger Stimme: „Sie nehmen<br />
nur ihre Rechte wahr.“ Es seien „traumatisierte<br />
Leute“, denen man nicht jeden<br />
Regelverstoß ankreiden sollte.<br />
Der Hauptkommissar spricht über<br />
die Droge Crystal Meth, die in Tschechien<br />
produziert und über die Grenze<br />
gebracht wird. Die Therapie der Süchtigen<br />
sei so wichtig wie die strafrechtliche<br />
Verfolgung. Er könnte locker als Drogenpolitiker<br />
der SPD durchgehen.<br />
Der Lehrer, <strong>neue</strong>rdings im Kreistag,<br />
stört sich an der Ausländerpolitik. Sie<br />
gehe von einer Willkommenskultur aus,<br />
die jedoch „basisfremd“ sei. Man müsse<br />
sich an der Masse der Wähler orientieren.<br />
Er schimpft auch über die CDU-Seilschaften,<br />
die sich seit 1990 in Marienberg<br />
gebildet hätten.<br />
Auch Carsten Hütter ist von der<br />
CDU enttäuscht. 2010 trat er aus, weil<br />
sie ihm zu links geworden war. Die Mehrwertsteuererhöhung,<br />
die die Große Koalition<br />
in Berlin – 2005 bis 2009 – beschlossen<br />
hatte, sei ein Schlag gewesen.<br />
Und: Als normales Mitglied habe er nie<br />
eine Chance gehabt, in der Partei vor Ort<br />
etwas zu werden. Ein kleiner Funktionärskreis<br />
vergebe die Posten unter sich.<br />
Sachsen sei nach fast 25 Jahren an der<br />
Regierung von der CDU durchtränkt, die<br />
Amtsträger benähmen sich wie Gutsherren.<br />
„Wer als Kleinunternehmer mit den<br />
Steuern säumig ist, dem sperren sie sofort<br />
das Konto – Zack, Ende.“<br />
Die Motive der einzelnen Vorstandsmitglieder<br />
sind verschieden. Aber sie alle<br />
fühlen sich unverstanden. Pathetisch gesagt:<br />
Sie halten sich für politisch heimatlos.<br />
Dieses Gefühl stößt auf Widerhall.<br />
Befragt man Passanten auf der Straße<br />
in Marienberg zur Landtagswahl, stößt<br />
49<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
man immer wieder auf das Wort Alternative,<br />
ohne dass damit gleich die Partei gemeint<br />
ist, die den Begriff im Namen trägt.<br />
Die FDP sei keine Alternative, seit deren<br />
Landeschef die evangelische Kirche kritisiert<br />
habe, sagt eine 60 Jahre alte Frau<br />
mit Einkaufstasche.<br />
Am Morgen. Carsten Hütter ist auf<br />
Kontrollgang in der Werkstatt seines<br />
Autohauses. Zwei Azubis richten Trabants<br />
her, die die sächsische AfD für<br />
eine Wahlkampftour einsetzen will. Die<br />
Frage, was Hütter machen würde, wenn<br />
die Mitarbeiter SPD- oder CDU-Anhänger<br />
wären und die Arbeit für die AfD verweigern<br />
würden, stellt sich hier nicht. Er<br />
ist der Chef, der Patriarch.<br />
Die Termine drängen. In Chemnitz<br />
muss er AfD-Broschüren von der Druckerei<br />
abholen, in Dresden AfD-Werbefilme<br />
fürs Fernsehen abnehmen. Hütter<br />
organisiert auch den Wahlkampf der<br />
Landespartei. Eine schnelle Zigarette,<br />
Marlboro light mit tschechischem Warnhinweis<br />
auf der Packung. Hütter raucht<br />
aus und steigt in seinen 300-PS-Mercedes-Geländewagen.<br />
„Habe ich günstig<br />
gebraucht gekauft“, sagt er. Der Wagen<br />
Oldtimerservice, Ersatzteilhandel,<br />
Abschleppservice. Und dann<br />
noch die AfD. Bringt Carsten<br />
Hütter das alles zusammen?<br />
zieht an den Toyotas und Dacias und Subarus<br />
vorbei.<br />
Hütter kommt aus Unna am Rand<br />
des Ruhrgebiets, was man an seinem Dialekt<br />
hört. 1990 war er Zeitsoldat bei der<br />
Bundeswehr. Er meldete sich, um nach<br />
Marienberg zu kommen, wo die Bundeswehr<br />
die Kaserne der Nationalen Volksarmee<br />
übernommen hatte. <strong>Das</strong> Erzgebirge<br />
interessierte ihn, seit er mit seinem<br />
Vater zu DDR-Zeiten dort gewesen war.<br />
Carsten Hütter ist der Typus findiger<br />
Geschäftsmann, der mit Flexibilität und<br />
<strong>neue</strong>n Ideen seine Existenz sichert.<br />
Inzwischen verkauft er nicht nur Autos,<br />
sondern führt einen Onlinehandel<br />
für Allradersatzteile, möbelt Oldtimer<br />
auf und betreibt einen Abschleppdienst.<br />
Er holt deutsche Autofahrer zurück, die<br />
irgendwo im tschechischen Grenzgebiet<br />
liegen geblieben sind und nicht weiterwissen.<br />
Auch wenn jemand in der Nacht<br />
aus Prag anruft, zögert er angeblich nicht.<br />
„Ich bin in einer Stunde dort“, sagt Hütter.<br />
Dann koppelt er einen Anhänger an<br />
seinen Geländewagen, fährt über die<br />
Grenze und hievt das liegen gebliebene<br />
Auto auf sein Gespann.<br />
50<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Merkwürdig: Die AfD im Erzgebirge<br />
betont die Probleme, die mit der<br />
offenen Grenze nach Tschechien zusammenhängen.<br />
Doch ihr Spitzenmann profitiert<br />
längst von der offenen Grenze. Die<br />
Angst vor Zuwanderung, die trotz eines<br />
Ausländeranteils von nur 1,5 Prozent im<br />
Erzgebirge existiert, teilt er nicht. In Marienberg<br />
soll ein <strong>neue</strong>s Flüchtlingsheim<br />
eröffnet werden, das Asylthema ist Stadtgespräch.<br />
Insgesamt soll das Erzgebirge<br />
mehr Asylbewerber aufnehmen als ursprünglich<br />
geplant. „Die Asylbewerber<br />
müssen doch irgendwohin“, sagt Hütter.<br />
Seine private Meinung zur Einwanderungsfrage<br />
steht vermutlich quer zur<br />
Mehrheitsmeinung im Erzgebirge: Man<br />
brauche Einwanderung, die Region leide<br />
unter Wegzug und Überalterung.<br />
HÜTTER STAMMT aus einem katholischen<br />
SPD-Elternhaus. Der Vater blieb auch in<br />
der Partei, als er sich nach Jahrzehnten<br />
als Angestellter selbstständig machte.<br />
„Er sagte, die SPD kann ich nicht verraten,<br />
weil sie so viel für mich getan hat.“<br />
Katholisch, Ruhrgebiet, SPD-Eltern – wer<br />
diese Prägung durchlaufen hat, kann<br />
vermutlich nie ein echter Fremdenfeind<br />
werden, der ist stark gegen nationalkonservatives<br />
Denken immunisiert. Die offizielle<br />
Meinung des AfD-Politikers Carsten<br />
Hütter ist folglich etwas konstruiert.<br />
„Abmachungen müssen eingehalten werden,<br />
man kann nicht einfach die Zahl der<br />
Asylbewerber erhöhen“, sagt er.<br />
Ein Wahlkampfauftritt ein paar Tage<br />
später im Waldgasthof Bad Einsiedel in<br />
Seiffen, der alten Holzspielzeug-Stadt.<br />
Grenzgebiet in 700 Meter Höhe, das<br />
Handy wählt sich automatisch ins tschechische<br />
Netz ein. Die AfD lädt zur Diskussion<br />
zum Thema Grenzkriminalität.<br />
20 Leute haben sich versammelt, fünf<br />
sind Funktionäre der AfD. Der Saal ist<br />
kühl, ein nackter Betonboden, die Luft<br />
müffelt.<br />
„Wie Sie hören, ich komme nicht von<br />
hier!“, sagt Hütter. Er legt die Hände ineinander,<br />
ein wenig wie Angela Merkel,<br />
aber es wirkt etwas unsicher. Er hat sich<br />
für den Tag eine Krawatte zum Kurzarmhemd<br />
angezogen. Er redet über den Stellenabbau<br />
bei der Polizei und fordert mehr<br />
Personal für die Polizei, mehr Grenzkontrollen<br />
und vor allem Kontrollen von<br />
„einschlägigen Autos“. „Wenn Sie heute<br />
FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… ob sie als Amazon-Kundin ein schlechter<br />
Mensch ist<br />
Alle sind sich <strong>neue</strong>rdings einig: Amazon ist böse. Von ungebremster<br />
Expansion ist die Rede, von miesen Arbeitsbedingungen.<br />
Amazon will nicht nur Verlage überflüssig machen und<br />
sich langfristig die gesamte Produktions- und Vertriebskette von Büchern<br />
einverleiben, der Konzern will unser Kaufverhalten kontrollieren.<br />
Zuzugeben, dass man bei Amazon kauft, ist in meinen Kreisen inzwischen<br />
fast so populär wie der Konsum von Kinderpornografie.<br />
Ich bin zwischen den 15 000 Büchern meiner Eltern aufgewachsen.<br />
Die Liebe zu Büchern und die Hochachtung für jene, die sie schreiben,<br />
gestalten, verlegen und verkaufen, wurde mir gewissermaßen mit der<br />
Muttermilch eingeflößt. Amazon zu boykottieren, müsste selbstverständlich<br />
für mich sein. Aber ich schaffe es nicht, jedenfalls nicht völlig.<br />
Und frage mich, ob es dafür eine Rechtfertigung gibt.<br />
Seit ich einen Kindle besitze, bestelle ich viele Bücher als E-Book,<br />
die ich mir sonst nicht gekauft hätte. An meinen Downloads verdienen<br />
nicht nur die Bösen bei Amazon, sondern auch Autoren und Verlage.<br />
Außerdem bin ich nicht nur Leserin, sondern auch Autorin. Meine Bücher<br />
werden in großer Menge bei Amazon gekauft. Meine Verlagsoberen<br />
schimpfen zwar auf den Versandhändler, machen aber trotzdem<br />
Geschäfte mit ihm, weil sie gar nicht anders können. Soll ich als Autorin<br />
verlangen, dass sie auf einen ihrer wichtigsten Vertriebspartner<br />
verzichten – zu ihrem und meinem Schaden?<br />
Gut möglich, dass Amazon das Monster ist, als das viele den Konzern<br />
sehen. Aber dieses Ungeheuer haben wir alle gezüchtet, es ist<br />
eine Ausgeburt unserer Konsumgier, unserer Ungeduld, unserer Bequemlichkeit.<br />
Wir haben es gefüttert und gehätschelt, und nun, da es<br />
alles zu verschlingen droht, jammern wir und glauben, wir könnten es<br />
wieder einfangen und unschädlich machen.<br />
Dafür ist es zu spät. Wir können nur versuchen, es zu domestizieren.<br />
Verlage müssen hart verhandeln und dürfen sich nicht erpressen<br />
lassen – die Konzerne Hachette und Bonnier machen es gerade vor.<br />
Und wir Kunden können durch unser Kaufverhalten Einfluss nehmen.<br />
Dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir dem Monster einen<br />
Happen zuwerfen. Wir können es nämlich jederzeit auf Diät setzen.<br />
AMELIE FRIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin.<br />
Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über Männer, Frauen und was das Leben<br />
sonst an Fragen aufwirft<br />
51<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
In Seiffen erwähnt Hütter drei Mal,<br />
dass er Familienvater mit fünf Kindern<br />
ist. Er präsentiert sich als Oberhaupt einer<br />
großen Familie, das in das vermeintliche<br />
konservative Ideal passt. Dabei stammen<br />
seine Kinder aus drei Ehen. <strong>Das</strong>s<br />
Ehen zerbrechen können, ist auch in konservativen<br />
Milieus so selten nicht. Im Gespräch<br />
mit dem Reporter erzählt Hütter<br />
offen von den Brüchen in seinem Privatleben.<br />
Aber als Politiker nutzt er die Zahl<br />
Fünf als Einsatz im bürgerlich-konservativen<br />
Leistungswettbewerb: Wer bietet<br />
mehr? Wer hat die heilste und größte<br />
Familie?<br />
Foto: Privat (Autor)<br />
einen Notruf absetzen, braucht die Polizei<br />
im Erzgebirge fünf Minuten, um zu<br />
Ihnen zu kommen“, sagt er und setzt eine<br />
Kunstpause. „Fünf Minuten können sehr<br />
lang sein – Sie können drei Mal in den<br />
fünf Minuten sterben, bevor die Polizei<br />
kommt.“ Ein paar ältere Frauen im Raum<br />
blicken zu Boden, vermutlich malen sie<br />
sich aus, wie das ist, in fünf Minuten dreimal<br />
zu sterben.<br />
<strong>Das</strong> ist das populistische Moment der<br />
sächsischen AfD. Selbst wenn ein Funktionär<br />
wie Hütter eigentlich liberal eingestellt<br />
ist, wittert er die Ängste der Leute<br />
und nutzt sie.<br />
In Seiffen möchte er aber auch etwas<br />
anderes loswerden: „Früher war unsere<br />
Zeiteinteilung zwischen Beruf und Familie<br />
besser, früher hatte man mehr Zeit,<br />
es war weniger hektisch.“ Es ist ironisch,<br />
dass ausgerechnet der umtriebige Unternehmer<br />
über Work-Life-Balance spricht,<br />
aber es ist ihm ernst.<br />
Sorgen macht er sich auch schon wegen<br />
der Zeit nach dem 31. August, wenn<br />
er im Parlament sitzt. So ein Abgeordnetenmandat<br />
frisst Zeit, was wird dann<br />
aus den Allradersatzteilen, den Oldtimern<br />
und dem Abschleppdienst?<br />
Er mag das Leben im Erzgebirge mit<br />
„Vater, Mutter und Kind“ – wobei Hütter<br />
„Vatta“ und „Mutta“ sagt. Es erinnere ihn<br />
an seine Kindheit, wo „der Vatta gesagt<br />
hat: Mutta muss nicht mehr arbeiten, weil<br />
ich jetzt genug Geld verdiene.“<br />
Der Sommer der AfD in Sachsen.<br />
Nach dem 31. August winkt die<br />
Belohnung<br />
Die AfD als<br />
Rückzugsgebiet<br />
für den konservativen<br />
Mann.<br />
Und dann noch<br />
eine Chefin mit<br />
„Topfigur“<br />
BESONDERS CHRISTLICH wie Frauke Petry<br />
– sächsische Spitzenkandidatin, Pastorenfrau<br />
und vierfache Mutter – sind die<br />
Vorstandsmitglieder der erzgebirgischen<br />
AfD nicht. Keiner von ihnen ist in einer<br />
Kirche aktiv oder betont seinen Glauben.<br />
Ihre Familienwerte rühren mehr aus einem<br />
Lebensgefühl.<br />
Nach außen präsentiert sich die AfD<br />
als Familien- und Heimatpartei, nach innen<br />
dient sie, zumindest im Erzgebirge,<br />
als eine Art Rückzugsgebiet für den heterosexuellen<br />
mittelalten konservativen<br />
Mann. Hier können noch Zoten gerissen<br />
werden, wenn man unter sich ist,<br />
hier kann man Frauke Petry ungehemmt<br />
nicht nur nach inhaltlichen Kriterien bewerten.<br />
„Eine Topfigur“, sagt er und berichtet<br />
stolz, wie er einmal in ihrem Garten<br />
war und sie im Minirock gesehen hat.<br />
In der AfD-Hochburg spielen Frauen<br />
dagegen kaum eine Rolle. Im Gartenhäuschen<br />
in Großrückerswalde sehen<br />
die AfDler dieses Defizit. Sie sind gerade<br />
beim Personal. Carsten Hütter sagt:<br />
„Wir brauchen mehr Frauen.“ Die anderen<br />
schauen ihn ratlos an. Hütter spricht<br />
weiter. Mit sich selbst. Er erwähnt eine<br />
Melanie, eine Mandy. „Lasst uns doch<br />
die mal fragen.“ Schweigen. Hütter wird<br />
grundsätzlich. „Die Frauen haben’s doch<br />
auch schwer in der Politik mit dem Haushalt<br />
und den Kindern.“<br />
Die Genderdebatte in der Männerhöhle,<br />
eine echte Alternative.<br />
GUNNAR HINCK<br />
ist Politologe und freier<br />
Journalist in Berlin. Von ihm<br />
erschien 2007 das Buch<br />
„Eliten in Ostdeutschland“<br />
52<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
„ Ich habe während<br />
des ganzen WM‐Finales<br />
nicht richtig<br />
mitbekommen, für wen<br />
er eigentlich war “<br />
Hans-Jürgen Papier, früher Präsident des Bundesverfassungsgerichts, über seinen Freund<br />
Vassilios Skouris, Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Seite 54<br />
53<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
AN DER SEITE DER BÜRGER<br />
Google-Urteil, Datenspeicherung, Eurorettung: Der Europäische Gerichtshof macht von<br />
sich reden. An seiner Spitze steht Vassilios Skouris, der mächtigste Richter Europas<br />
Von HARTMUT PALMER<br />
Foto: Martin Langhorst/Photoselection<br />
Der Mann mit der hermelinbesetzten<br />
Schärpe über der Schulter<br />
redet und redet. Juristen-Französisch.<br />
Die Dolmetscher in ihren Kabinen<br />
rackern sich ab und übersetzen<br />
jedes Wort simultan, aber die Sätze bleiben<br />
unverständlich an diesem Dienstagmorgen<br />
im Großen Sitzungssaal des Europäischen<br />
Gerichtshofs in Luxemburg.<br />
Bis plötzlich der Vorsitzende Richter<br />
den Wortschwall stoppt. „Kommen Sie<br />
zur Sache, Herr Anwalt“, sagt Vassilios<br />
Skouris.<br />
„Pardon?“<br />
„Sie sollen bitte zur Sache kommen“,<br />
wiederholt der Präsident in makellosem<br />
Französisch – und lächelt höflich.<br />
Advokat Didier Matray, Chef und<br />
Mitbegründer einer der größten belgischen<br />
Wirtschaftskanzleien, hebt ratlos<br />
die Hände. Was hat er falsch gemacht?<br />
Es geht um Flüchtlinge, die in Belgien<br />
um ihre Anerkennung als Asylanten<br />
kämpfen. Sie sind krank, einer hat Aids.<br />
Sie haben sich mit der Unterstützung von<br />
Menschenrechtsorganisationen bis zum<br />
belgischen Verfassungsgericht hochgeklagt.<br />
Dieses Gericht will nun von den<br />
Kollegen in Luxemburg wissen, ob das<br />
Begehren der Flüchtlinge mit europäischem<br />
Recht vereinbar ist. Nein, sagen<br />
die europäischen Regierungen. Ja, sagen<br />
die Anwälte der Flüchtlinge.<br />
Ein Fall für die Große Kammer. Sie<br />
tagt immer nur hier, im Großen Sitzungssaal.<br />
Es gibt keine Fenster, man<br />
weiß nicht, wie die Welt draußen aussieht.<br />
Die Wände sind mit goldgelbem<br />
Stoff verhängt. Vorne am Richtertisch<br />
sitzen neben dem Vorsitzenden Skouris<br />
14 Richter – alle in roten Roben, außerdem<br />
ein Kanzleimitarbeiter und der Generalanwalt.<br />
Gegenüber in Schwarz die<br />
Anwälte der Betroffenen und die der Mitgliedstaaten,<br />
am Rednerpult Matray mit<br />
seiner Hermelinschärpe. Deutschland,<br />
Frankreich, Griechenland und die Europäische<br />
Kommission sind beteiligt. Auch<br />
Großbritannien, erkennbar an der Perücke,<br />
die der Anwalt Ihrer Majestät trägt.<br />
Didier Matray, der den Widerstand<br />
der Regierungen vortragen und begründen<br />
sollte, ist aus dem Konzept geraten.<br />
Er fängt sich hastig und redet – noch<br />
schneller als vorher.<br />
Wieder unterbricht ihn der Gerichtspräsident:<br />
„Bitte reden Sie langsam, damit<br />
der Präsident und das Gericht Ihnen<br />
folgen können.“ Ein paar Sekunden ist es<br />
jetzt ganz still im großen Saal. Niemand<br />
rührt sich. Bis der Präsident dem Anwalt<br />
mit einem leichten Kopfnicken zu verstehen<br />
gibt, dass er fortfahren soll.<br />
ES SIND SOLCHE Momente, in denen<br />
Vassilios Skouris demonstriert, dass er<br />
die Fäden in der Hand hat – auch wenn<br />
andere den Durchblick verlieren. Der<br />
66 Jahre alte Grieche hat Routine und<br />
Macht. Er ist der einflussreichste Jurist in<br />
Europa. Sein Gericht macht immer häufiger<br />
Schlagzeilen: Google-Urteil, Vorratsdatenspeicherung,<br />
Eurorettung, Familiennachzug.<br />
Wenn Andreas Voßkuhle,<br />
der Präsident des Bundesverfassungsgerichts,<br />
und sein Senat über ein deutsches<br />
Gesetz entscheiden, betrifft das<br />
maximal 80 Millionen Deutsche. Wenn<br />
Skouris und seine Richter urteilen, kann<br />
das Auswirkungen auf 28 Staaten und<br />
mehr als eine halbe Milliarde Europäer<br />
haben. Trotzdem ist er in Deutschland<br />
kaum bekannt.<br />
Donnerstagmorgen, Kabinett des<br />
Präsidenten. <strong>Das</strong> Büro liegt im siebten<br />
Stock des Präsidialbaus. Von hier<br />
hat man einen wunderbaren Blick über<br />
den Luxemburger Kirchberg. Als Skouris<br />
2003 zum ersten Mal von seinen Kollegen<br />
zum Gerichtspräsidenten gewählt<br />
wurde, war das hier noch eine Brache.<br />
Jetzt stehen neben dem Palais zwei goldfarbene<br />
Bürotürme, in denen die meisten<br />
der 2139 Mitarbeiter des Gerichts untergebracht<br />
sind. Ein dritter Büroturm ist<br />
geplant. Es gibt <strong>neue</strong> Straßen, Grünflächen,<br />
aber noch keine hohen Bäume. Ein<br />
paar Hotels haben sich angesiedelt. Die<br />
Gerichtsgebäude sind im Erdgeschoss<br />
miteinander durch eine 300 Meter lange<br />
überdachte Galerie verbunden. Es war<br />
Skouris, der dafür das Geld – insgesamt<br />
350 Millionen Euro – beim Großherzogtum<br />
lockermachte.<br />
Der Präsident weiß um seine Macht,<br />
aber er schätzt es nicht, wenn darüber<br />
diskutiert wird. Er will leise Einfluss nehmen,<br />
so ist sein Gerichtshof gewachsen,<br />
Schritt für Schritt.<br />
In Karlsruhe beobachtet man sein<br />
Wirken seit Jahren mit Argwohn. Wer<br />
hat das letzte Wort? <strong>Das</strong> Bundesverfassungsgericht<br />
hat sich im Urteil über<br />
den Lissabon-Vertrag die Letztkontrolle<br />
über „ausbrechende Rechtsakte“ der Europäischen<br />
Union vorbehalten – und damit<br />
auch über alle Entscheidungen des<br />
EuGH. Die Eiserne Lady Margaret Thatcher<br />
vermutete schon vor drei Jahrzehnten<br />
im „EuGH das wahre Machtzentrum<br />
der Gemeinschaft“. Roman Herzog, erst<br />
oberster Verfassungsrichter und später<br />
Bundespräsident, zog 2007 vom Leder:<br />
„Der EuGH entzieht mit immer erstaunlicheren<br />
Begründungen den Mitgliedstaaten<br />
ureigene Kompetenzen.“<br />
Vassilios Skouris kennt die Kritik.<br />
„Jeder ist frei zu glauben, was er möchte.<br />
Was soll ich dazu sagen?“ Er schaut zum<br />
Fenster hinaus.<br />
Es kränkt ihn, dass ausgerechnet<br />
Herzog, dessen Vorlesungen er als Student<br />
vor 40 Jahren in Berlin besucht hat,<br />
so über den EuGH lästert. „Es ist sehr bitter,<br />
wenn einem vorgeworfen wird, dass<br />
55<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
„ Er lässt<br />
keinen so<br />
dicht an<br />
sich heran,<br />
dass man<br />
hinter<br />
seine Stirn<br />
schauen<br />
könnte “<br />
Heiko Maas,<br />
Bundesjustizminister, über<br />
Vassilios Skouris<br />
man das Recht verletzt. Gerade wenn<br />
man einem Gericht angehört.“ Aber er<br />
will den Konflikt nicht anheizen. „Wenn<br />
zwei Gerichte frontal aufeinanderprallen,<br />
kann keines davon profitieren. Es<br />
gibt dann nur Besiegte.“<br />
Vier Mal haben ihn seine Richterkollegen<br />
für jeweils drei Jahre gewählt, so<br />
lange amtierte kein anderer Präsident.<br />
Beiläufig lässt er jetzt aber durchblicken,<br />
dass er nächstes Jahr nicht mehr antreten<br />
will. „Irgendwann mal gibt es eine<br />
Grenze, und es gibt auch einen Schluss.“<br />
Am 6. Oktober 2015 wird er aufhören.<br />
Deutsch spricht der 1948 in Thessaloniki<br />
geborene Jurist fließend, weil seine<br />
Eltern ihn in seiner Heimatstadt auf eine<br />
deutsche Schule schickten. Er ist in beiden<br />
Ländern heimisch geworden. Nach<br />
dem Abitur ging er 1965 mit 17 Jahren<br />
als Stipendiat nach Westberlin und studierte<br />
Jura. Es war die Zeit der Studentenunruhen<br />
und bald auch der Diktatur<br />
in Griechenland, die von 1967 bis 1974<br />
dauerte. Gelegentlich nahm er an Demonstrationen<br />
gegen die Junta teil, aber<br />
nie als Wortführer. Er hielt sich immer<br />
zurück. Statt mit Studenten zu demonstrieren,<br />
ging er lieber ins Olympiastadion,<br />
wenn Hertha BSC spielte.<br />
Er war Schüler von Karl August<br />
Bettermann, der Öffentliches Recht und<br />
Prozessrecht las und dessen Assistent er<br />
später in Hamburg wurde. Dort lernte<br />
er auch Hans-Jürgen Papier kennen. Sie<br />
wurden Freunde. Oft haben sie mit ihren<br />
Familien Urlaub in Skouris’ Ferienhaus<br />
auf der Halbinsel Chalkidiki gemacht. Einige<br />
Jahre waren sie gleichzeitig Präsidenten:<br />
Er in Luxemburg, Papier in Karlsruhe.<br />
Eine schöne Zeit. Es gab zwar noch<br />
den Grundsatzkonflikt zwischen den Gerichtshöfen<br />
– aber er ruhte.<br />
FRÜHER SAGTE man dem EuGH nach, er<br />
entscheide im Zweifel im Sinne der EU-<br />
Kommission und der europäischen Regierungen,<br />
nicht der Bürger. Seit Skouris<br />
Präsident ist, behauptet das niemand<br />
mehr.<br />
2008 stärken die Luxemburger<br />
Richter die Rechte homosexueller Lebenspartner,<br />
als sie entscheiden, dass der<br />
überlebende Partner Anspruch auf Witwerrente<br />
hat. 2011 schützen sie Asylbewerber<br />
vor der Abschiebung nach Griechenland.<br />
Und im April dieses Jahres<br />
fegt die Große Kammer unter Vorsitz<br />
von Skouris die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung<br />
vom Tisch. Im Mai<br />
dann das Google-Urteil: Wer alte Eintragungen<br />
aus der Suchmaschine entfernen<br />
lassen will, kann jetzt deren Löschung<br />
verlangen. Im Juli schließlich verboten<br />
die Richter deutschen Behörden, türkischen<br />
Ehepartnern automatisch den Zuzug<br />
nach Deutschland zu verwehren,<br />
wenn sie durch den Sprachtest fallen.<br />
<strong>Das</strong> Urteil zu den belgischen Flüchtlingen<br />
steht noch aus. Sollte das Gericht<br />
die Frage bejahen, ob auch eine schwere<br />
Krankheit wie Aids ein Asylgrund sein<br />
kann, könnten sich Hunderte Kranke aus<br />
Afrika auf den Weg nach Europa machen.<br />
Deshalb sind die Regierungen – darunter<br />
Deutschland – strikt dagegen.<br />
Spannend wird es auch, wenn der<br />
EuGH sich demnächst zu der Frage äußert,<br />
ob der Präsident der Europäischen<br />
Zentralbank, Mario Draghi, europäisches<br />
Vertragsrecht verletzt hat, als er ankündigte,<br />
er werde in theoretisch unbegrenzter<br />
Höhe Staatsanleihen aufkaufen, um<br />
Not leidende EU-Staaten vor Spekulanten<br />
zu schützen. Dieser sogenannte<br />
OMT-Beschluss ist heftig umstritten. <strong>Das</strong><br />
Bundesverfassungsgericht neigt der Auffassung<br />
der Draghi-Kritiker zu, hat aber<br />
genau diese Frage im Februar dem EuGH<br />
zur Prüfung vorgelegt.<br />
Natürlich lässt der Präsident mit keiner<br />
Andeutung erkennen, in welche Richtung<br />
er denkt. Zu seinem Erfolgskonzept<br />
gehört es, sich nie zu früh festzulegen<br />
und sich schon gar nicht politisch einordnen<br />
zu lassen. Gewiss: Die sozialistische<br />
Regierung unter Kostas Simitis hat ihn<br />
1999 nach Luxemburg geschickt, eine<br />
andere sozialistische Regierung wollte<br />
ihn 2011 zum Ministerpräsidenten küren.<br />
Aber wer von ihm wissen will, wo<br />
er politisch steht, erntet nur ein spöttisches<br />
Lächeln: „Sie erwarten doch nicht,<br />
dass ich darauf antworte.“<br />
Im Juni hat ihn Justizminister Heiko<br />
Maas in Luxemburg besucht. Man sprach<br />
über die Vorratsdatenspeicherung. Es sei<br />
klar geworden, sagt der Sozialdemokrat<br />
Maas, „dass, selbst wenn die Kommission<br />
eine <strong>neue</strong> Richtlinie vorlegen sollte,<br />
es eine anlasslose Sammlung von Daten,<br />
wie einige Sicherheitspolitiker sie<br />
sich noch immer wünschen, nicht geben<br />
wird“. Aber auch er kann Skouris nicht<br />
einsortieren: „Er lässt keinen so dicht an<br />
sich heran, dass man hinter seine Stirn<br />
schauen könnte.“<br />
Skouris’ Freund Papier sagt: „Ich<br />
habe meine Vermutungen, aber wir haben<br />
darüber nie gesprochen.“ 2006, als<br />
Papier noch Präsident in Karlsruhe war,<br />
wurde er zum Endspiel der Fußball-WM<br />
ins Berliner Olympiastadion eingeladen:<br />
Frankreich gegen Italien. Er brachte einen<br />
Gast mit – Skouris. Direkt vor den<br />
beiden Rechtsgelehrten saß Bill Clinton,<br />
weiter vorne Angela Merkel. „Ich habe<br />
während des ganzen Spieles nie so richtig<br />
mitbekommen, für wen er eigentlich ist.“<br />
Wo er steht, erzählen seine Urteile:<br />
Auf dem Boden des europäischen Rechts –<br />
im Zweifel an der Seite der Bürger.<br />
HARTMUT PALMER hat schon viele Richter<br />
porträtiert, angefangen vom Vorsitzenden<br />
des Parteispendenprozesses 1986. An Skouris<br />
gefiel ihm die straffe Verhandlungsführung<br />
56<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
NETZ<br />
LESEGENUSS MIT<br />
UNBEGREN<br />
MÖGLICHKEITEN<br />
MULTIMEDIA-<br />
ERLEBNIS<br />
AUF DEM IPAD<br />
VORZUGSPREIS:<br />
5,49 €<br />
<strong>Cicero</strong> für Tablet und PC<br />
Profitieren Sie von den Vorteilen<br />
der digitalen <strong>Cicero</strong>-Version und<br />
lesen Sie <strong>Cicero</strong> auf Ihrem iPad,<br />
Tablet oder PC.<br />
Mehr Informationen unter<br />
www.cicero.de/digital<br />
<strong>Cicero</strong> Digital
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
DAS MASTERMIND<br />
Fernab von Gaza, aus dem sicheren Doha, dirigiert Chalid Maschal die Raketenangriffe<br />
auf Israel. Dadurch erweist sich der Hamas‐Chef als mächtigster Palästinenser<br />
Von SILKE MERTINS<br />
Foto: Kate Geraghty/The Sydney Morning Herald/Fairfax Media via Getty Images<br />
<strong>Das</strong> gerahmte Foto über den Polstersesseln<br />
in Chalid Maschals Arbeitszimmer<br />
zeigt eine Großaufnahme<br />
der Jerusalemer Altstadt. Über<br />
der Al-Aksa-Moschee und der goldenen<br />
Kuppel des Felsendoms hängen<br />
schwere, dunkle Wolken. Es sieht aus,<br />
als könnte jeden Augenblick ein Unwetter<br />
losbrechen.<br />
Maschal hat sein Leben wie auf diesem<br />
Bild ausgerichtet – immer am Rande<br />
eines Sturmtiefs. Der Politbüro-Chef der<br />
radikalislamischen Palästinenserorganisation<br />
Hamas geht seinen Geschäften<br />
meist bei klarem, blauem Himmel nach.<br />
Aber das, was er dabei einfädelt, erinnert<br />
an ein Weltuntergangsszenario: Raketenhagel<br />
auf Südisrael, Tunnelbau zum<br />
Angriff auf Soldaten, Entführungen, Terroranschläge<br />
– und im Ergebnis nicht enden<br />
wollende israelische Luftschläge und<br />
Zerstörung in Gaza.<br />
Die Aufnahme von seinem Arbeitszimmer<br />
stammt aus einer Serie privater<br />
Fotos, die Maschal der Fotografin des australischen<br />
Journalisten Paul McGeough<br />
erlaubt hat. Sie zeigen Maschals Tagesablauf<br />
in seinem Haus in einem Vorort von<br />
Doha, im märchenhaft reichen Golfemirat<br />
Katar. Hierher ist er geflohen, seit er<br />
wegen des syrischen Bürgerkriegs seinen<br />
Exilsitz in Damaskus verlor. Auf einem<br />
dieser Bilder scherzt der 58-Jährige mit<br />
einem politischen Weggefährten, auf einem<br />
anderen ist er mit seinen Enkelkindern<br />
zu sehen, dann wieder beim Training<br />
in einem privaten Fitnessstudio und<br />
an der Tischtennisplatte.<br />
Es sind diese Fotos aus dem Frühjahr<br />
2013, die nun während des Gazakriegs<br />
wieder auftauchen, auf Facebook und<br />
Twitter. Wie kann Maschal es sich beim<br />
Essen und beim Fitness gut gehen lassen,<br />
während im Gazastreifen Hunderte<br />
Menschen sterben? Gleichzeitig werden<br />
schwere Korruptionsvorwürfe gegen ihn<br />
erhoben. In der Hamas brodele es, heißt<br />
es. Ihm sei die Kontrolle über die Organisation<br />
entglitten.<br />
Mit der Wirklichkeit hat das wenig<br />
zu tun. Alle Berichte haben eines gemeinsam:<br />
Die Quellen sind dubios. <strong>Das</strong>s<br />
Hamas-Chef Maschal abgeschlagen im<br />
Luxusexil sitzt, bleibt Wunschdenken.<br />
Die Hamas hat eine disziplinierte<br />
Entscheidungs- und Kommandostruktur,<br />
sagt der Hamas-Experte Matthew<br />
Levitt vom Thinktank Washington Institute.<br />
Differenzen entstünden höchstens<br />
in der Hitze des Gefechts. „Der militärische<br />
Flügel erkennt die zentrale Rolle<br />
der politischen Führer bei operativen<br />
Entscheidungen an.“<br />
DAHER SEI ES ABSURD zu glauben, der<br />
exilierte Chef sei ins Hintertreffen geraten.<br />
„Chalid Maschal hat in dieser historischen<br />
Schlacht an Einfluss gewonnen,<br />
ebenso wie die Hamas“, sagt Hani<br />
al Masri, Direktor des Palestinian Center<br />
for Media and Research. Die Mehrheit<br />
der Palästinenser sieht nicht, dass die<br />
Hamas Zivilisten als Schutzschild missbraucht<br />
und immer <strong>neue</strong> Luftangriffe<br />
provoziert. Sie sieht das Entsetzen der<br />
Israelis über den unterbrochenen Flugverkehr<br />
und das ausgebaute Tunnelsystem.<br />
Und dass es Maschal ist, der das<br />
Geld dafür besorgt.<br />
<strong>Das</strong> britische Magazin New Statesman<br />
listete ihn schon 2010 auf Platz 18<br />
der 50 einflussreichsten Menschen der<br />
Welt. Inzwischen ist er der mächtigste palästinensische<br />
Politiker seit Jassir Arafat.<br />
Chalid Maschal entscheidet im Nahen<br />
Osten über Krieg und Frieden.<br />
In der Bevölkerung ist Maschal ohnehin<br />
eine Legende. Seit der israelische<br />
Geheimdienst Mossad 1997 versucht hat,<br />
ihn umzubringen, gilt er als „lebender<br />
Märtyrer“. Den Agenten gelang es zwar,<br />
Maschal ein Gift ins Ohr zu injizieren,<br />
dabei wurden sie jedoch erwischt, und<br />
der jordanische König zwang die Israelis,<br />
ein Gegengift einzufliegen.<br />
Heute ist Maschal alles in einer Person:<br />
Waffenschmuggler, Fundraiser, Diplomat,<br />
Oberbefehlshaber und PR-Experte.<br />
Er hat es perfektioniert, radikale<br />
Inhalte in harmlos klingende Sätze zu<br />
kleiden. „Bevor Israel stirbt, muss es gedemütigt<br />
und degradiert werden“, sagte<br />
er vor sechs Jahren in Damaskus. Heute<br />
klingt das so: „Wir bekämpfen nicht die<br />
Juden an sich. Wir bekämpfen die Besatzer.“<br />
Aber in beiden Fällen soll Israel von<br />
der Landkarte ausradiert werden.<br />
In Katar hat Maschal einen Verbündeten<br />
und Geldgeber für seine Ziele gefunden.<br />
„Er lebt komfortabel und hat<br />
Zugang zu Entscheidungsträgern“, sagt<br />
Theodore Karasik, Forschungsdirektor<br />
des Institute for Near East and Gulf Military<br />
Analysis in Dubai. „Katar garantiert<br />
seine Sicherheit.“<br />
Ob das reicht? Vor vier Jahren tötete<br />
der Mossad Mahmoud al Mabhouh, Mitbegründer<br />
der Qassam-Brigaden, in seinem<br />
Hotelzimmer in Dubai. Gerade erst<br />
hat Israels Außenminister Avigdor Lieberman<br />
dazu aufgerufen, Maschal endlich<br />
zur eliminieren: „Es ist der einzige<br />
Weg, der Hamas Schaden zuzufügen.“<br />
Frei bewegen kann sich der mächtigste<br />
Palästinenser deshalb auch in Katar<br />
nicht. Ein alter Freund, erzählt der<br />
australische Journalist McGeough, vergleicht<br />
Maschal deshalb mit seinem im<br />
Käfig sitzenden Kanarienvogel. Er hat<br />
ihn Chalid genannt.<br />
SILKE MERTINS ist seit 25 Jahren im Nahen<br />
Osten unterwegs. In den Wohnzimmern der<br />
Hamas-Vertreter faszinieren sie besonders die<br />
umhäkelten Papiertaschentuch-Boxen<br />
59<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
ZÜNDELNDE<br />
SCHEICHS<br />
Katar will um jeden<br />
Preis ein Global<br />
Player sein. Um sich<br />
außenpolitisch zu<br />
profilieren, finanziert<br />
das Emirat isla mis tische<br />
Gruppen und legt sich<br />
mit seinem Nachbarn<br />
Saudi-Arabien an.<br />
Mit fatalen Folgen<br />
Von LINA KHATIB<br />
Illustrationen SIMON PRADES<br />
Der Emir ist kleinlaut geworden.<br />
Noch im Frühjahr hatte Katars<br />
Machthaber mit allen Mitteln<br />
versucht, eine bedeutendere politische<br />
Rolle in der Golfregion zu spielen. Nun<br />
steht sein Land unter Druck, insbesondere<br />
durch den regionalen Hauptrivalen<br />
Saudi-Arabien. Katar hat sich verkalkuliert<br />
– sowohl in Syrien als auch bei seiner<br />
Unterstützung für die Muslimbruderschaft<br />
in Ägypten.<br />
Alle Versuche, Baschar al Assads<br />
Regime in Syrien zu stürzen, sind bislang<br />
gescheitert. Die von Katar geförderten<br />
dschihadistischen Gruppen,<br />
insbesondere der Al-Qaida-Ableger Al-<br />
Nusra-Front, gelten in den USA und in<br />
anderen Golfstaaten inzwischen als Gefahr<br />
für die Stabilität des gesamten Nahen<br />
Ostens. In Ägypten unterdrückt<br />
die Regierung des Militärs Abdel Fatah<br />
al Sisi Katars Hauptverbündete – Hunderte<br />
Muslimbrüder wurden verhaftet<br />
und zum Tode verurteilt.<br />
EIGENTLICH KÖNNTE Katar sich einfach<br />
auf dem Reichtum ausruhen, den sich das<br />
Königreich durch seine Gas- und Erdölvorkommen<br />
erworben hat. <strong>Das</strong> Emirat,<br />
das kleiner als Thüringen ist und etwa<br />
halb so viele Einwohner hat, will sich<br />
aber nicht mit seinen internationalen<br />
Investitionen wie beim Automobilkonzern<br />
VW, dem Bauunternehmen Hochtief<br />
oder der Deutschen Bank begnügen.<br />
Es will vor allem aus dem Schatten des<br />
übermächtigen Nachbarn Saudi-Arabien<br />
heraustreten. Dafür sind dem Emirat alle<br />
Mittel recht – sei es die Fußball-WM ins<br />
eigene Land zu holen oder Islamisten zu<br />
finanzieren.<br />
Katars Streben nach größerer politischer<br />
Macht hat zu einer direkten<br />
Konfrontation mit dem saudischen Königreich<br />
geführt. Vorerst zog Katar dabei<br />
den Kürzeren und wurde von den<br />
Nachbarn wieder auf saudischen Kurs<br />
gebracht.<br />
2011 sah das noch anders aus. Die<br />
arabischen Aufstände waren für Katar<br />
eine willkommene Gelegenheit, sich als<br />
regionaler Player zu profilieren. Dabei<br />
setzten der Emir und seine Leute auf die<br />
Muslimbruderschaft: Sie war in Ägypten,<br />
Tunesien und Libyen die am besten organisierte<br />
politische Bewegung, und sie<br />
schien auch die Kraft mit den besten Erfolgsaussichten<br />
zu sein. So unterstützte<br />
das Emirat die Muslimbrüder mit kräftigen<br />
Finanzspritzen, später sollten sie<br />
einmal Katars Machtinteressen sichern.<br />
<strong>Das</strong> erwies sich als Fehlinvestition.<br />
In Libyen konnten die Muslimbrüder bei<br />
den Wahlen keine Mehrheit gewinnen, in<br />
Ägypten gewannen sie zwar, verspielten<br />
aber mit ihrem Versuch, ein Machtmonopol<br />
aufzubauen, schnell wieder alle<br />
Sympathien.<br />
Katar hielt weiter an ihnen fest. Mit<br />
fatalen Folgen. Saudi-Arabien, ein Erzrivale<br />
der Bruderschaft, förderte und<br />
finanzierte Sisis Militärputsch gegen<br />
Ägyptens Präsidenten Mohammed Mursi.<br />
Unter der Ägide Saudi-Arabiens beriefen<br />
drei Golfstaaten ihre Botschafter aus<br />
der katarischen Hauptstadt Doha zurück.<br />
60<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Damit nicht genug: Saudi-Arabien stufte<br />
die Muslimbruderschaft als terroristische<br />
Vereinigung ein und forderte eine solche<br />
Einstufung auch von Europa. Man<br />
müsse, hieß es aus Riad, die Öffentlichkeit<br />
darauf aufmerksam machen, welch<br />
Unsicherheitsfaktor Katar in der Golfregion<br />
sei.<br />
Doha hat auf Riads Druck reagiert<br />
und die Unterstützung für die Muslimbruderschaft<br />
eingeschränkt. In Ägypten<br />
hat die Bruderschaft absehbar keine Aussicht<br />
auf eine Rückkehr an die Macht, womit<br />
auch Katar dort kaum Einfluss gewinnen<br />
kann. Kairo steht mittlerweile fest<br />
unter der Kuratel der Saudis.<br />
Wie stark, ließ sich während der<br />
Waffenstillstandsverhandlungen zwischen<br />
Israel und der Hamas in Kairo beobachten.<br />
Katar hatte sich gerne zum wesentlichen<br />
Vermittler stilisiert. Es pflegte<br />
enge Beziehungen zur Hamas, es hatte<br />
Hamas-Chef Chalid Maschal (Porträt auf<br />
Seite 58) Asyl gewährt, nachdem die Organisation<br />
sich gegen Baschar al Assad<br />
gestellt hatte, und es hatte die palästinensischen<br />
Islamisten finanziell kräftig<br />
unterstützt. Alles umsonst – während der<br />
Waffenstillstandsverhandlungen in Kairo<br />
hatte Katar nur eine Nebenrolle.<br />
AUCH IM FALLE SYRIENS hat sich das<br />
Emirat gründlich verrechnet. Sowohl<br />
Saudi-Arabien als auch Katar wollten<br />
zwar den Sturz Assads. Allerdings unterstützten<br />
sie jeweils unterschiedliche<br />
oppositionelle Gruppen und vertieften<br />
damit nur deren politische Spaltung.<br />
Erst dadurch wurde der Erfolg anfangs<br />
noch marginaler dschihadistischer<br />
Gruppen möglich. Dschihadistische Milizen,<br />
die jeweils von saudischem oder<br />
katarischem Geld finanziert wurden,<br />
bekämpften bald nicht mehr den syrischen<br />
Präsidenten, sondern bekriegten<br />
sich gegenseitig.<br />
So finanzierte der saudische Prinz<br />
Bandar bin Sultan dschihadistische Gruppen<br />
wie die Armee des Islam, während<br />
Katar die Al-Nusra-Front unterstützte.<br />
Alle setzten auf die Dschihadisten. <strong>Das</strong><br />
sollte sich rächen – Dschihadisten mit<br />
katarischem und saudischem Geld gingen<br />
nicht gemeinsam gegen das Assad-<br />
Regime vor, sondern verwickelten sich<br />
61<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
in Kämpfe an zwei anderen Fronten: gegen<br />
die Terrorgruppe Islamischer Staat.<br />
Und gegeneinander.<br />
Was das Ganze noch komplizierter<br />
macht, sind die nichtstaatlichen Akteure,<br />
darunter machthungrige Prinzen, die jeweils<br />
eigene militante Gruppen in Syrien<br />
finanzieren, selbst solche, die wie der Islamische<br />
Staat quer zur Außenpolitik<br />
sowohl Katars wie Saudi-Arabiens agieren.<br />
Sie benutzen die Dschihadisten, um<br />
ihre Regierungen unter Druck zu setzen.<br />
Diese Kriegssponsoren mit ihren unterschiedlichen<br />
Zielen sind verantwortlich<br />
für etliche Kämpfe zwischen den jeweiligen<br />
Protegés in Syrien. Was wiederum<br />
dazu führt, dass auch den von Staaten,<br />
also von Katar und Saudi-Arabien, unterstützten<br />
Dschihad-Rebellen noch immer<br />
jede kohärente Militärstrategie für<br />
den Kampf sowohl gegen Assad wie gegen<br />
den Islamischen Staat fehlt.<br />
Doha hat sich in eine<br />
Lage manövriert, in<br />
der es ohne Riad nichts<br />
mehr machen kann<br />
KATARS AMBITIONEN in Syrien erlitten<br />
drei wesentliche Rückschläge: Die Al-<br />
Nusra-Front konnte keine Erfolge erzielen;<br />
die USA setzten das Emirat unter<br />
Druck, jegliche Unterstützung für die<br />
Dschihadisten einzustellen und stattdessen<br />
in enger Absprache mit Saudi-Arabien<br />
die gemäßigte Opposition in Syrien<br />
zu unterstützen; die aber ist in Gestalt<br />
der Nationalen Koalition der syrischen<br />
Oppositionskräfte und der Freien Syrischen<br />
Armee schwach und zersplittert.<br />
<strong>Das</strong> wiederum hat verschiedene<br />
Gründe: Etlichen Angehörigen der Nationalen<br />
Koalition fehlt die politische Erfahrung.<br />
Die Freie Syrische Armee hat keine<br />
realistische Militärstrategie gegen eine<br />
immer noch starke syrische Armee. Und<br />
die internationale Gemeinschaft unterstützt<br />
Syriens Opposition nur zögerlich.<br />
Doch der wesentliche Grund für<br />
die Schwäche der Opposition ist auch in<br />
der Rivalität zwischen Katar und Saudi-<br />
Arabien zu suchen. Saudi-Arabien wollte<br />
schon bald nach der Gründung der Nationalen<br />
Koalition 2012 in Doha mehr Kontrolle<br />
über die Organisation – und bekam<br />
sie im Juli 2013 auch, als der enge saudische<br />
Verbündete Ahmed al Dscharba<br />
zum Präsidenten der Nationalen Koalition<br />
der syrischen Revolutions- und<br />
Oppositionskräfte gewählt wurde; ihm
Foto: Privat; Übersetzung: Pieke Biermann<br />
folgte im Juli 2014 mit Hadi al Bahra<br />
ebenfalls ein Mann der Saudis.<br />
Hundertprozentig war der saudische<br />
Einfluss innerhalb der Nationalkoalition<br />
allerdings von Anfang an nicht.<br />
Die einzelnen Fraktionen werden von unterschiedlichen<br />
ausländischen Gönnern<br />
unterstützt; die einen sind Freunde der<br />
Saudis, andere Freunde Katars. Diese Polarisierung<br />
innerhalb der Koalition hat<br />
das Vertrauen untereinander geschwächt<br />
und zu internen Reibereien auf der obersten<br />
Führungsebene geführt.<br />
AUCH KATARS VERSUCHE, sich durch die<br />
Zusammensetzung der Koalition Einfluss<br />
zu verschaffen, sind fehlgeschlagen. Katar<br />
wollte vor allem die syrische Muslimbruderschaft<br />
zum Herzstück des Oppositionsbündnisses<br />
Syrischer Nationalrat<br />
machen, der seinerseits die wichtigste<br />
Institution innerhalb der Koalition sein<br />
sollte. In Syrien ist die Bruderschaft aber<br />
weder beim Volk beliebt, noch verfügt<br />
sie über ein ähnliches Potenzial wie das<br />
der ägyptischen Muslimbrüder vor dem<br />
Sturz Mohammed Mursis; sie geriet bald<br />
zur bloßen Randgröße, was die ganze Nationalkoalition<br />
eher in Richtung Saudi-<br />
Arabien als Katar trieb.<br />
Unter ähnlichen internen Reibereien<br />
und einem Mangel an Strategie leidet<br />
auch die zum Teil von Katar finanzierte<br />
und von einem Teil der sunnitischen<br />
Mehrheit Syriens getragene Freie Syrische<br />
Armee. Außerdem hat sie seit Beginn<br />
des Bürgerkriegs schwere Verluste<br />
sowohl durch das syrische Regime als<br />
auch durch den Islamischen Staat hinnehmen<br />
müssen.<br />
Diese drei Faktoren – die militärischen<br />
Niederlagen der Freien Syrischen<br />
Armee und der Al-Nusra-Front, die politischen<br />
Niederlagen der syrischen Muslimbrüder<br />
und der Druck der USA, den<br />
Geldfluss an Dschihadisten zu stoppen –<br />
haben Katar veranlasst, seine Syrienpolitik<br />
zu ändern.<br />
Heute arbeitet das Emirat gemeinsam<br />
mit den Saudis daran, die syrische<br />
Opposition zu einen und militärisch zu<br />
stärken sowie die Unterstützung für<br />
Dschihadisten zu unterbinden. Weder<br />
Saudi-Arabien noch Katar allein bekommen<br />
jedoch die Dschihadisten in<br />
den Griff, weil zu viele private Akteure<br />
ihre eigenen Machtinteressen verfolgen.<br />
Beide Golfstaaten haben daher Angst vor<br />
Unruhen im eigenen Land, falls sie kurzen<br />
Prozess mit den Mäzenen der dschihadistischen<br />
Gruppen machen. Besonders<br />
Katar unter seinem <strong>neue</strong>n jungen<br />
Emir Tamim al Thani scheut Maßnahmen,<br />
die die Stabilität im Land beeinträchtigen<br />
und die Position des Herrschers gefährden<br />
könnten.<br />
Im Fall Ägyptens hat Saudi-Arabien<br />
klar über Katar obsiegt. <strong>Das</strong> Emirat hat<br />
pragmatisch reagiert und das Sisi-Regime<br />
öffentlich anerkannt, nachdem es Katars<br />
Protegé Mursi mit einem Militärputsch<br />
aus dem Amt jagte. Im Fall Syriens ist<br />
die Lage komplizierter. Sowohl Katar als<br />
auch Saudi-Arabien sind inzwischen zu<br />
Geiseln der schwächelnden oppositionellen<br />
Gruppen geworden, die sie selbst geschaffen<br />
oder gefördert haben.<br />
Jetzt, da der Islamische Staat im Irak<br />
und in Syrien militärisch erfolgreich ist<br />
und das Assad-Regime immer noch ein<br />
enormes Durchhaltevermögen zeigt, haben<br />
sowohl Katar als auch Saudi-Arabien<br />
Macht und Einfluss in Syrien eingebüßt.<br />
Die größeren Verluste hat allerdings<br />
das Emirat erlitten: Es wollte mit seiner<br />
ambitionierten Außenpolitik eine größere<br />
Unabhängigkeit von Saudi-Arabien.<br />
Stattdessen hat es sich in eine Lage manövriert,<br />
in der es ohne Riad nichts mehr<br />
unternehmen kann. <strong>Das</strong>s Katar wieder<br />
auf Linie gebracht worden ist, zeigt, dass<br />
Saudi-Arabien vorerst der stärkste politische<br />
Player in der Golfregion bleibt.<br />
Falls Saudi-Arabien und Katar aus<br />
ihren Fehlern etwas lernen können, dann<br />
dies: Wollen sie ihre politische Bedeutung<br />
bewahren, müssen sie politische Rivalitäten<br />
überwinden und strategische<br />
Kooperationen eingehen. Wie sich die<br />
beiden Staaten in nächster Zeit in Ägypten,<br />
Syrien und im Gazakonflikt engagieren,<br />
wird entscheidend sein für die künftige<br />
Außenpolitik beider Staaten.<br />
LINA KHATIB ist Direktorin des<br />
Carnegie Middle East Center in<br />
Beirut und Mitbegründerin des<br />
Middle East Journal of Culture<br />
and Communication<br />
Anzeige<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst<br />
und Leben, den internationalen<br />
Kunstbetrieb wider. Herausragende<br />
Porträts und Ausstellungsrezensionen,<br />
spannende Debatten und<br />
Neuig keiten aus der Kunstwelt, alles<br />
in einer unverwechselbaren Optik.<br />
Hier bestellen:<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 1140045<br />
MONOPOL<br />
PROBE<br />
63<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
64<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
STILLE<br />
WASSER<br />
<strong>Das</strong> Leben im argentinischen<br />
Paraná‐Delta bestimmen die Gezeiten.<br />
Der Fotograf Alejandro Chaskielberg<br />
hat die Symbiose von Mensch und Landschaft<br />
in Mondlicht getaucht<br />
Ein Steg führt Sergio auf ein Baggerschiff, das am<br />
Ufer liegt. Früher arbeitete er als See mann an Bord.<br />
Doch der Kapitän starb, und das Schiff wurde<br />
zurückgelassen. Heute ist es sein Zuhause<br />
65<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Dieser Jäger wird von allen El Tucumano genannt.<br />
Er lebt in einem Bambushain, ohne Elektrizität,<br />
ohne Kontakt zu anderen Menschen. Gerade hat er<br />
ein Wasserschwein erlegt
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
Luna Paiva steht vor der Zárate-Brazo-Largo-Brücke, die<br />
über den Paraná führt. Sie ist die Tochter des argentinisch-paraguayischen<br />
Fotografen Roland Paiva. Jahrelang<br />
fotografierte er das Delta und seine Umgebung<br />
68<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Straßen sucht man im Paraná-Delta vergeblich.<br />
Dieser Bauarbeiter wartet am Fluss auf eine<br />
lancha colectiva, den öffentlichen Wasserbus, der<br />
ihn nach Hause bringen soll<br />
69<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Eine Frau liegt am Rande eines Bachbetts, das sich<br />
durch eine der vielen Inseln windet. <strong>Das</strong> Wasser<br />
steht tief. Bei der nächsten Flut wird es den<br />
anschwellenden Fluss ableiten
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
Paraná de las Palmas: Hier sieht man jeden<br />
Dienstag das Einkaufsboot Raquel N den Fluss<br />
hinauffahren. Es bringt frische Lebensmittel<br />
und Getränke zu den Isleños<br />
Etwa 40 Kilometer nordwestlich der argentinischen<br />
Hauptstadt Buenos Aires, vor den Toren<br />
von Tigre, öffnet sich die Welt der weißen Reiher,<br />
der Sumpfhirsche und der Capybaras, der Schwertlilien<br />
und der Moskitos. Der braune Strom des Paraná<br />
mündet hier nach langer Reise in den Río de la Plata<br />
und bildet kurz vor dem Atlantik auf über 14 000 Quadratkilometern<br />
eines der größten Süßwasserdeltas der<br />
Welt: das Paraná-Delta.<br />
Ein subtropisches Labyrinth aus unzähligen verschlungenen<br />
Wasserwegen und Insellandschaften erschließt<br />
sich hier – bewohnt von den Isleños, wie die<br />
fernen Städter die Einheimischen nennen.<br />
<strong>Das</strong> karge Gemüt der Inselbewohner und die eigenwillige<br />
Schönheit der Gegend sind es, die Alejandro<br />
Chaskielberg faszinieren. Zwei Jahre verbrachte der<br />
argentinische Fotograf im Delta, lenkte sein Motorboot<br />
die Flussarme hinauf und beobachtete den Paraná und<br />
die Menschen, die mit ihm in selten einträchtiger Symbiose<br />
leben. Der Rhythmus von Leben und Arbeit, allein<br />
bestimmt von den Gezeiten.<br />
Entstanden ist so die Porträtreihe „The High Tide“.<br />
Sie erzählt von der Gemeinschaft im Delta, von der<br />
Mühsal und dem ökonomischen Überleben am Rande.<br />
Fotografiert wurde ausschließlich nachts, bei Vollmond.<br />
„Ich wollte traumhafte Szenarien schaffen“, sagt Chaskielberg,<br />
„aber mit echten Menschen in echten Situationen.“<br />
Herausgekommen sind surreale Bilder, die<br />
die Lücke zwischen Dokument und Fiktion schließen.<br />
Die Inselbewohner selbst interessieren sich nur<br />
wenig für ihre Porträts. Für sie sind es Momentaufnahmen<br />
in völliger Regungslosigkeit, bis der Mond<br />
wieder abnimmt. Zurück bleiben die Menschen. Und<br />
der Fluss. <br />
Sarah-Maria Deckert<br />
72<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
NEU<br />
Jetzt auch als App<br />
für iPad, Android<br />
sowie für PC/Mac.<br />
Hier testen:<br />
spiegel-geschichte.<br />
de/digital<br />
ELIZABETH I. Die jungfräuliche Königin<br />
GLORIOUS REVOLUTION Der Siegeszug des Parlaments<br />
QUEEN VICTORIA Die Erfindung der Royal Family<br />
www.spiegel-geschichte.de
WELTBÜHNE<br />
Kommentar<br />
DIE MISSION<br />
NACH DEM KRIEG<br />
Anders Fogh Rasmussen hatte sich das anders vorgestellt.<br />
Als erster ehemaliger Premierminister im Amt des Nato-<br />
Generalsekretärs wollte er eine größere Durchschlagskraft<br />
haben als alle seine Vorgänger. Viel politischer agieren würde er,<br />
strategischer handeln und vor allem mit seiner Erfahrung als dänischer<br />
Premierminister die Nato-Staaten zusammenraufen und<br />
die Allianz fit machen für die Zukunft. Vor schwierigen Aufgaben<br />
würde er nicht zurückschrecken und wichtige Projekte vorantreiben.<br />
Der Bürokratie die Sporen geben. Am Ende würden<br />
die Fußstapfen, die er hinterlässt, groß sein.<br />
Tatsächlich muss sich der <strong>neue</strong> Generalsekretär Jens Stoltenberg,<br />
der am 1. Oktober das Amt von Rasmussen übernimmt,<br />
vor dessen Fußstapfen nicht fürchten. Dabei hatte sich Rasmussen<br />
redlich bemüht. Er hatte viele gute Ideen und noch bessere<br />
Namen dafür. Zweifellos ist er ein Meister im Branding, dem<br />
Erschaffen von Markennamen. Smart Defense, für eine verbesserte<br />
Abstimmung bei technischen Kooperationsprojekten,<br />
und Connected<br />
Forces Initiative, für eine Vernetzung<br />
der Streitkräfte bei Ausbildung und<br />
Übungen, sind nur die prominentesten<br />
Beispiele. Dennoch ist die To-do-<br />
Liste, die er seinem Nachfolger hinterlässt,<br />
herausfordernd.<br />
ABZUG AUS AFGHANISTAN<br />
Jahrelang stand dieses Thema unangefochten<br />
an erster Stelle jeder Nato-<br />
Runde. Der Abschluss der Isaf-Mission<br />
und der Übergang zur Ausbildungsmission<br />
Resolute Support stellen ein<br />
politisches und militärisches Minenfeld<br />
dar. Im wahrsten Sinne des Wortes.<br />
Anschläge auf Nato-Soldaten könnten<br />
sich wiederholen und die Allianz<br />
dazu bringen, die Pläne zu überdenken.<br />
Derart schwierige Herausforderungen<br />
können nur im engen Schulterschluss<br />
der Verbündeten gelingen.<br />
Von HEIDI REISINGER<br />
Der künftige Nato-<br />
Generalsekretär<br />
Jens Stoltenberg<br />
muss das Bündnis<br />
auf eine <strong>neue</strong> Lage<br />
einstellen: das Ende<br />
des Einsatzes in<br />
Afgha n is tan, die<br />
Aggressivität Putins,<br />
die gekürzten<br />
Wehretats. Was<br />
Stolten berg tun sollte.<br />
Und was er<br />
falsch machen kann<br />
NEUAUSRICHTUNG DER ALLIANZ IM ZUGE DER UKRAINEKRISE<br />
Die Krise wurde zwar nicht von der Nato ausgelöst, aber<br />
sehr schnell zu einem defining moment der Allianz. Betroffen<br />
von der Krise sind alle drei Kernaufgaben der Nato – die<br />
Bündnisverteidigung, das Krisenmanagement und die Zusammenarbeit<br />
mit Nicht-Nato-Staaten, den sogenannten Partnern.<br />
Alle Bereiche müssen neu ausbalanciert werden.<br />
Die Ukrainekrise, die nicht wie andere Krisen zuvor weit<br />
weg vom Bündnisgebiet stattfindet, sondern mitten in Europa,<br />
rüttelt am Sicherheitsgefühl vieler osteuropäischer Verbündeter.<br />
Die USA zeigten für deren Bedürfnisse erneut mehr<br />
Verständnis als die europäischen Nachbarn. Eine stärkere militärische<br />
Präsenz in den Nato-Staaten nahe am Krisenherd<br />
muss ernsthaft diskutiert werden (dürfen), geht es bei einem<br />
militärischen Bündnis schließlich genau darum.<br />
Vordergründig hielt die Allianz erstaunlich gut zusammen.<br />
So gut, dass auch die Probleme in den transatlantischen<br />
Beziehungen zeitweise überdeckt wurden. Doch diese Einigkeit<br />
muss nun in eine politische Strategie übersetzt werden,<br />
die auch nach der aktuellen Krise Gültigkeit besitzt. <strong>Das</strong>, obwohl<br />
oder gerade weil die Positionen der Verbündeten teilweise<br />
weit auseinander liegen.<br />
74<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
DIE ALLIANZ UND RUSSLAND<br />
Die Kombination von überraschendem<br />
Handeln und militärischen Fähigkeiten,<br />
die man den Russen nicht<br />
zugetraut hatte, traf die Allianz unvorbereitet.<br />
Obwohl man wusste, dass in<br />
Moskau die Unzufriedenheit wuchs und<br />
alle offiziellen russischen Strategiepapiere<br />
von der Nato als einer Hauptgefahrenquelle<br />
sprachen, hatte man jahrelang<br />
die Beziehungen zu Russland dahinplätschern<br />
lassen. Die Zusammenarbeit galt<br />
seit Jahren als politische Fassade ohne<br />
wirkliche Substanz.<br />
Es wird niemandem etwas ausmachen,<br />
dass die geringe Zusammenarbeit<br />
mit den russischen Streitkräften<br />
wegfällt. Doch die Frage, wie man mit<br />
Russland in Zukunft politisch umgehen<br />
soll, ist heikel. Für eine Reihe von Nato-<br />
Staaten hat der Kreml in der Ukrainekrise<br />
sein wahres Gesicht gezeigt; für sie kommt eine partnerschaftliche<br />
Zusammenarbeit nicht mehr infrage. Andere sehen das lockerer, wollen<br />
weiterhin Geschäfte machen und haben kein Interesse an einer Funkstille.<br />
Einige Staaten fühlen sich durch die Krise nicht direkt betroffen<br />
und verhalten sich daher eher indifferent.<br />
Die Wirksamkeit des derzeitigen Kurses, alle Kontakte abzubrechen<br />
und nur den Nato-Russland-Rat auf Botschafterebene aufrechtzuerhalten,<br />
ist mehr als zweifelhaft. Erzieherische Maßnahmen gegenüber Moskau<br />
sind sinnlos. Alle Energie sollte darauf gerichtet werden, eine gemeinsame<br />
Linie innerhalb des Bündnisses zu finden.<br />
In Wahrheit<br />
geht es nicht<br />
um zusätzliche<br />
Fähigkeiten,<br />
sondern darum,<br />
militärische<br />
Grundkompetenzen<br />
zu erhalten<br />
HEIDI REISINGER ist Expertin für<br />
Sicherheitspolitik am Nato Defense<br />
College in Rom. Sie gibt ihre persönliche<br />
Meinung wieder<br />
MILITÄRISCHE FÄHIGKEITEN ENTWICKELN<br />
In Wahrheit geht es nicht um zusätzliche Fähigkeiten, sondern darum, militärische<br />
Grundkompetenzen zu erhalten. In Zeiten fortdauernder Geldknappheit,<br />
die auch die großen und militärisch starken Mitgliedstaaten erfasst hat, darf<br />
sich niemand der Illusion hingeben, dass Staaten in naher Zukunft mehr für Verteidigung<br />
ausgeben würden. Oder dass sie die Mittel, die sie aufgrund der auslaufenden<br />
Afghanistanmission einsparen, in ihre Streitkräfte investieren. <strong>Das</strong><br />
Smart-Defense-Programm sollte sicherstellen, dass durch koordinierte gemeinsame<br />
Planung und eine verbesserte Zusammenarbeit „mehr mit weniger“ erreicht<br />
werden könnte. Realistisch ist eher, dass in Zukunft „weniger mit weniger“<br />
geschafft werden muss.<br />
Wenn sich dieser Trend nicht stoppen lässt, so muss doch sichergestellt werden,<br />
dass kontrolliert gekürzt wird und keine kleinen Bonsai-Streitkräfte übrig<br />
bleiben. Wichtige militärische Fähigkeiten dürfen nicht verloren gehen – insbesondere<br />
solche, die die Allianz durch ihre langjährige Mission in Afghanistan erworben<br />
oder ausgebaut hat. Gerade im Zuge des Übergangs von einer Nato im<br />
Einsatz zu einer einsatzbereiten Nato muss das Bündnis mit Bedacht vorgehen.<br />
Es wird systematisch angelegte und finanziell unterfütterte Übungsprogramme<br />
benötigen, um zu vermeiden, dass Fähigkeiten verloren gehen.<br />
PARTNERSCHAFTEN DER NATO<br />
Die zum Teil überalterten Partnerschaftsprogramme,<br />
auf deren Grundlage die Nato mit<br />
Nicht-Nato-Staaten kooperiert, wurden auf<br />
Drängen Rasmussens überarbeitet, was ihm<br />
hoch anzurechnen ist. Problematisch ist nur,<br />
dass man es allen recht machen wollte. Als Resultat<br />
dieser inkonsequenten Reform sind viele<br />
politische Marker verloren gegangen. Keiner<br />
weiß mehr genau, was es eigentlich bedeutet,<br />
„ein Partner der Nato“ zu sein. Kann das jeder<br />
werden, und was hat man davon? Und was will<br />
die Allianz damit erreichen? Auch hier hat die Ukrainekrise die letzten Klarheiten<br />
beseitigt: Obwohl klar war, dass die Ukraine als Nicht-Nato-Staat keinen<br />
Anspruch auf Artikel 5, die Bündnisverteidigung hat, hatte sich Kiew mehr vom<br />
„Partner Nato“ versprochen.<br />
<strong>Das</strong> Thema Partnerschaften bedarf daher auf beiden Seiten der Klärung. Partnerstaaten<br />
in Osteuropa, in der islamischen Welt, Afrika und Asien brauchen in<br />
Zukunft vor allem politische Ansagen, was mit der Nato-Partnerschaft genau gemeint<br />
ist und bezweckt wird.<br />
Auch die Nato muss für sich einiges klären: Soll sie mit Schurkenstaaten kooperieren,<br />
wenn dies operationell geboten ist? Sind alle Partner gleich wichtig? Und<br />
wie soll die Nato mit den (bald ehemaligen) Isaf-Partnern in Verbindung bleiben,<br />
wenn die Mission erst einmal Geschichte ist und damit die Sitzungen, Treffen und<br />
die konkrete militärische Zusammenarbeit wegfallen? Über keine dieser Fragen<br />
sind sich die Verbündeten einig.<br />
Die Antwort auf diese Fragen und viele weitere Punkte auf der langen To-do-<br />
Liste, wie etwa die Ausrichtung der Nato auf <strong>neue</strong> Bedrohungen wie Cyberangriffe,<br />
die Raketenabwehr oder mögliche Konflikte in der Arktis, kann der Generalsekretär<br />
nicht im stillen Kämmerlein finden. Es sind vor allem die Mitgliedstaaten, die<br />
mitziehen und mit viel Überzeugungsarbeit zum Konsens geführt werden müssen.<br />
Da reicht keine persönliche Magie des Generalsekretärs, sondern nur harte Arbeit,<br />
die meistens – wenig medienwirksam – im Hintergrund geleistet wird.<br />
Dringend erforderlich sind daher eine <strong>neue</strong> Bescheidenheit und eine ausgleichende<br />
Gesprächskultur. Jens Stoltenberg scheint man das nicht extra sagen zu<br />
müssen. Jedenfalls sind von ihm bisher keine Starallüren bekannt.<br />
75<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Report<br />
DER<br />
BÖSE<br />
IST IMMER<br />
DER<br />
WESTEN<br />
Von MORITZ GATHMANN<br />
Fotos DENIS SIMPSON<br />
Die Propagandamaschine<br />
des Kremls hat tiefe Spuren in den<br />
Köpfen der Russen hinterlassen.<br />
Sie gibt den Menschen Antworten,<br />
die ihnen gefallen. Putin wird<br />
zum Helden stilisiert<br />
76<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
77<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
WELTBÜHNE<br />
Report<br />
Seit zwei Jahrzehnten bin ich in Russland unterwegs,<br />
und über die Jahre habe ich mich an diese<br />
seltsame Doppelrolle gewöhnt: In Russland bin<br />
ich der Deutschen-Erklärer, der Europa-Erklärer, sogar<br />
der USA-Erklärer. Ich versuche den Russen darzulegen,<br />
warum die Frauen von Pussy Riot bei uns als<br />
Heldinnen gelten, was der Vorteil von echter Demokratie<br />
und Pressefreiheit ist, und ganz allgemein, dass<br />
wir im Westen ihnen nichts Böses wollen.<br />
Zu Hause dann erkläre ich den Deutschen – obwohl<br />
Russen-Versteher inzwischen fast schon ein<br />
Schimpfwort ist –, warum viele Russen nach Jahren<br />
des Chaos’ Putins Stabilität höher schätzen als die Demokratie,<br />
warum man über Pussy Riot nur verständnislos<br />
den Kopf schüttelt, und immer, immer wieder,<br />
warum der Deutschen liebster Russe Michail Gorbatschow<br />
in Russland nicht geliebt wird.<br />
Bisher war es so: Man stritt, dann schüttelte man<br />
den Kopf über die Absonderlichkeiten des anderen,<br />
und gut war’s. Aber jetzt ist alles anders.<br />
„Kannst du mir bitte mal erklären, was in der Welt<br />
los ist? Warum zeigt man uns, dass die Ukraine Bomben<br />
auf die eigenen Bürger wirft, und dann werden<br />
Sanktionen gegen Russland verhängt?“, fragt mich<br />
ein Freund, 33 Jahre jung, gebildet, Mittelschicht, Geschäftsmann.<br />
Und ich denke: Wir kommen nicht mehr<br />
zusammen.<br />
Nachdem in der Ukraine die Maidan-Bewegung<br />
gesiegt hat, scheinen die Russen kollektiv in den Schützengraben<br />
gesprungen zu sein. Von dort rufen sie den<br />
Ukrainern, den Westlern, insbesondere aber den Amerikanern<br />
zu: Keinen Schritt näher oder wir schießen!<br />
Ich habe Freunde, die den Separatisten in der Ostukraine<br />
Geld zukommen lassen, weil sie überzeugt sind,<br />
dass der Osten der Ukraine zu Russland gehört. Ich<br />
habe Freunde, die der Staatspropaganda keinen Glauben<br />
schenken, aber die Putin dennoch unterstützen,<br />
weil er sich der amerikanischen Dominanz<br />
entgegenstellt. Und ich habe<br />
einige wenige Freunde, vor allem solche,<br />
die Fremdsprachen sprechen und<br />
die deshalb jenes Weltbild, das ihnen<br />
zu Hause vorgesetzt wird, mit dem<br />
aus anderen Ländern abgleichen können,<br />
die stehen an diesem Schützengraben<br />
und murmeln: „Seid ihr denn<br />
alle verrückt geworden?“<br />
Wie konnte es so weit kommen?<br />
Einen großen Anteil daran hat die<br />
russische Propagandamaschine. Um<br />
den 20. Februar, als der ukrainische Präsident Wiktor<br />
Janukowitsch aus Kiew floh und der Maidan siegte,<br />
stellte der Kreml die Regler dieser Maschine auf Volldampf.<br />
Die Erzählung, die der russische Fernsehzuschauer<br />
seitdem in jeder Nachrichtensendung in<br />
Variationen serviert bekommt, geht so: In Kiew haben<br />
Faschisten, unterstützt und instruiert von den<br />
Amerikanern, den demokratisch gewählten<br />
Präsidenten gestürzt und die<br />
Macht errungen. Nun geht von ihnen<br />
eine physische Bedrohung gegen alle<br />
Russen, ja alles Russische an sich aus.<br />
<strong>Das</strong> Verlockende an dieser Erzählung<br />
ist, dass es vor diesem durch und<br />
durch finsteren Hintergrund einen<br />
Helden gibt: Russland. Russland rettet<br />
seine Landsleute, Russland unterbreitet<br />
Friedensvorschläge, Russland<br />
nimmt Flüchtlinge auf. Die Schuld für<br />
die tragischen Ereignisse in der Ukraine<br />
trägt dagegen der Westen. Davon<br />
waren Ende Juli dem unabhängigen<br />
Meinungsforschungsinstitut Lewada<br />
zufolge 64 Prozent der Russen überzeugt.<br />
Nur 3 Prozent sehen eine Einmischung<br />
Russlands als Grund.<br />
Mit dem Sieg der Maidan-Bewegung<br />
änderte sich die Berichterstattung<br />
grundlegend: Waren zuvor noch in begrenztem<br />
Maße unterschiedliche Stimmen<br />
zu hören, gibt es seitdem nur noch<br />
eine. Waren die Ereignisse im Nachbarland<br />
zuvor nur ein Thema unter vielen,<br />
dominiert die Ukraine nun jede Nachrichtensendung.<br />
„Die Bevölkerung konnte sich dagegen nicht mehr wehren“,<br />
sagt der Soziologe Denis Wolkow, der sich bei<br />
Lewada intensiv mit der Wirkung von Medien auf die<br />
öffentliche Meinung beschäftigt.<br />
Der Soziologe erinnert an eine ähnlich mediale<br />
Aufrüstung in früheren Zeiten: Im Herbst 1999<br />
wurde mit einer Dämonisierung des Gegners der<br />
zweite Tschetschenienkrieg vorbereitet, 2008 wurde<br />
der Georgienkrieg von ähnlich lautem patriotischen<br />
Getöse begleitet. „Aber das Niveau ist heute viel höher“,<br />
sagt Wolkow, „die Propaganda<br />
kompromissloser.“<br />
Im Kreml, sagt Wolkow,<br />
habe man schnell verstanden,<br />
wie man die Ereignisse in der<br />
Ukraine für die eigenen Zwecke<br />
nutzen könne, unter anderem,<br />
um die Umfragewerte des<br />
Präsidenten wieder zu steigern.<br />
Die nähern sich inzwischen der<br />
Rekordmarke von 90 Prozent –<br />
bis zum Beginn der Ukrainekrise<br />
waren sie konstant gefallen.<br />
Im November 2013 hatten nur noch 61 Prozent<br />
der Russen Putins Präsidentschaft positiv bewertet.<br />
Ein weiterer Unterschied zu früher: Diesmal ist die<br />
mediale Landschaft bereinigt wie nie zuvor. Im Januar<br />
verbannten viele Kabelbetreiber den letzten unabhängigen<br />
Fernsehsender Doschd auf Druck aus ihren Netzen.<br />
Wenig später wurde das populäre unabhängige<br />
Auf dem<br />
Moskauer Platz<br />
der Revolution<br />
sorgt ein<br />
Mitarbeiter<br />
eines Sicherheitsdiensts<br />
im Militarylook<br />
für Ordnung<br />
Die westlichen<br />
Sanktionen<br />
werden in<br />
Moskau mit<br />
Spott quittiert.<br />
Auf einem<br />
Moskauer BMW<br />
steht: „Sanktionen!<br />
Präsident<br />
Barack Obama<br />
und den Mitgliedern<br />
des<br />
amerikanischen<br />
Kongresses ist<br />
es verboten,<br />
in dieses Auto<br />
einzusteigen<br />
und mit ihm zu<br />
fahren“<br />
78<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Fotos: Denis Simpson/n-ost (Seiten 76 bis 79)<br />
Nachrichtenportal Lenta „geköpft“: Der Besitzer entließ<br />
die Chefredakteurin, mit ihr verließ der größte<br />
Teil der Journalisten das Portal. Aber das Internet nutzen<br />
ohnehin nur wenige Russen, um sich zu informieren:<br />
90 Prozent der Erwachsenen erhalten Nachrichten<br />
über Russland und die Welt im Fernsehen. Gut<br />
drei Viertel der Russen glauben, was ihnen dort gezeigt<br />
wird.<br />
Erfolgreich ist die Propaganda auch, weil sie die<br />
Sehnsüchte der Menschen befriedigt. Schlüsselmoment<br />
der Konsolidierung zwischen Regime und Bevölkerung<br />
war die Annexion der Krim: <strong>Das</strong>s sie zu Russland<br />
gehört, galt unter den Russen immer als Gemeinplatz,<br />
die Schenkung an die Ukraine im Jahr 1954<br />
als historischer Fehler. „Die Russen haben den Anschluss<br />
der Krim unterstützt. Da dieser politische Akt<br />
Unterstützung gefunden hat, vertraut man auch der<br />
Berichterstattung darüber“, sagt Andrei Wyrkowski,<br />
Medienwissenschaftler an der Journalistikfakultät der<br />
Moskauer Lomonossow-Universität.<br />
Der bekannte Historiker Andrei Subow spricht<br />
von einer „nationalen Psychose“, die sein Land erfasst<br />
habe. Subow diagnostiziert in Anlehnung an das<br />
„Versailler Syndrom“ der Deutschen nach dem Ersten<br />
Weltkrieg bei den heutigen Russen das „Belowescha-<br />
Syndrom“. Im Urwald von Belowescha hatte Boris<br />
Jelzin im Dezember 1991 die Auflösung der Sowjetunion<br />
vollendet. <strong>Das</strong>s er das Imperium praktisch widerstandslos<br />
aufgab, wird von vielen Russen als Urkatastrophe<br />
empfunden.<br />
So wie die Deutschen sich die Niederlage von 1918<br />
mit dem „Dolchstoß“ erklärten, so sei der Zusammenbruch<br />
der Sowjetunion im Volksbewusstsein die Folge<br />
von „Verschwörung und Verrat“ durch die Feinde. Der<br />
Feind – das sind die USA und die Nato, der Verräter<br />
heißt Michail Gorbatschow. Nun sei der lang ersehnte<br />
Moment der Revanche gekommen – diese Botschaft<br />
senden zumindest der Kreml und seine Medien.<br />
Der renommierte Historiker Subow selbst wurde<br />
Opfer dieser Psychose: Anfang März entließ ihn seine<br />
Universität MGIMO, die Kaderschmiede des Außenministeriums.<br />
Der Grund: ein Zeitungsartikel, in dem<br />
er die Annexion der Krim mit dem Anschluss Österreichs<br />
verglichen hatte. Inzwischen darf Subow allerdings<br />
wieder lehren.<br />
DER WUNSCH, DEN AMERIKANERN wieder – mindestens<br />
– auf Augenhöhe zu begegnen, ist dabei keine fixe<br />
Idee Putins: Er hat heute den Großteil der Bevölkerung<br />
hinter sich. Seit mehreren Jahren stellt das Institut Lewada<br />
den Russen folgende Frage: „Bevorzugen Sie es,<br />
eine Großmacht zu sein, aber mit einem bescheidenen<br />
Lebensniveau, oder ein eher schwaches Land, aber<br />
mit einer blühenden Wirtschaft?“ Im März 2014 bewerteten<br />
48 Prozent es als wichtiger, eine Großmacht<br />
zu sein, 47 Prozent wählten die Variante Wohlstand.<br />
2006 war der Großmachtstatus nur 36 Prozent wichtig,<br />
62 Prozent wollten den Wohlstand. „Viele sind bereit,<br />
Anzeige<br />
Quo vadis, Europa?<br />
Der Kontinent findet keine Ruhe. Er driftet von<br />
Krise zu Krise. Die Baustelle Europa benötigt also<br />
nichts dringender eine geistige Ordnung.<br />
Werner Weidenfeld gibt eine klare Antwort auf die<br />
Fragen der Zeit und formuliert ebenso originelle<br />
wie plausible Perspektiven.<br />
128 Seiten. € 12,00 [D]<br />
ISBN 978-3-466-37122-8<br />
www.koesel.de
WELTBÜHNE<br />
Report<br />
Zwieback zu essen, dafür aber in einer Großmacht zu<br />
leben“, fasst Subow das Ergebnis zusammen.<br />
Die trotzige Reaktion vieler Russen auf die westlichen<br />
Sanktionen und der kaum spürbare Protest gegen<br />
die im August erlassenen Einfuhrverbote für westliche<br />
Lebensmittel beweisen das. „Wir sind bereit, den<br />
Gürtel enger zu schnallen. Aber wir<br />
wollen uns nicht mehr sagen lassen,<br />
was wir zu tun und zu lassen haben“,<br />
sagt etwa ein 60 Jahre alter Ingenieur<br />
aus einer Kleinstadt bei Moskau.<br />
Subow weist allerdings auf einen<br />
wichtigen Unterschied zu den Deutschen<br />
der dreißiger Jahre hin: Die<br />
Russen fürchten den Krieg. Lewada<br />
zufolge glauben zwei Drittel der Befragten,<br />
dass der Konflikt im Osten<br />
der Ukraine in einen Krieg zwischen<br />
Russland und der Ukraine münden<br />
könnte. Die Hälfte glaubt sogar an<br />
einen dritten Weltkrieg. Zwar waren<br />
noch gut die Hälfte der Russen<br />
Ende Juli bereit, ihre Führung in einem<br />
Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.<br />
Doch die Eskalation des<br />
Konflikts im Osten der Ukraine, die<br />
Bilder von zerstörten Häusern und getöteten Zivilisten,<br />
haben auf viele ernüchternd gewirkt. Im März, als die<br />
Kriegsgefahr noch sehr abstrakt erschien, waren noch<br />
drei Viertel der Russen auf Kriegskurs.<br />
Die Dämonisierung des Gegners kennt derweil<br />
keine Grenzen. Russische Medien schlachten jeden<br />
Fehler der Ukrainer aus. Es begann, als das ukrainische<br />
Parlament drei Tage nach dem Sieg der Maidan-<br />
Bewegung den Sonderstatus der russischen Sprache abschaffte.<br />
„Und das sollen keine Faschisten sein?“, fragt<br />
mich ein Freund aus St. Petersburg. <strong>Das</strong>s Übergangspräsident<br />
Alexander Turtschinow unter westlichem Druck<br />
wenig später sein Veto gegen die Entscheidung einlegte,<br />
ist in Russland nie angekommen.<br />
LETZTE ZWEIFEL BESEITIGTE das „Massaker von<br />
Odessa“, wie es in Russland genannt wird: Am 2. Mai<br />
kamen dort bei Unruhen 48 Menschen ums Leben. Die<br />
meisten Opfer waren prorussische Aktivisten, die im<br />
brennenden Gewerkschaftshaus eingeschlossen wurden.<br />
Während die Katastrophe in westlichen Medien<br />
nur am Rande thematisiert wurde, hat sie in den Köpfen<br />
der Russen tiefe Spuren hinterlassen. Grund sind<br />
auch die erschütternden Bilder, die das Fernsehen<br />
zeigte und die in den sozialen Netzwerken hunderttausendfach<br />
geteilt wurden: Ein Mob johlender Nationalisten,<br />
die Molotowcocktails auf das Gewerkschaftshaus<br />
werfen, Menschen, die sich in Panik aus den oberen<br />
Stockwerken stürzen, verkohlte Körper.<br />
Bilder dieser Art dominieren die russische Berichterstattung<br />
über die Ukraine. Von den Kämpfen<br />
der ukrainischen Armee mit den Separatisten in der<br />
Ostukraine bekommt der russische Fernsehzuschauer<br />
vor allem getötete Zivilisten zu sehen, in den Abendnachrichten<br />
hört er die Hilferufe von Menschen, deren<br />
Wohnungen von Ukrainern zerbombt wurden. <strong>Das</strong><br />
wirkt. Es wirkt umso mehr, als die Menschen vor der<br />
Kamera russisch sprechen und<br />
vor Häusern stehen, die so auch<br />
in jeder russischen Stadt zu finden<br />
sind. Viele Russen haben zudem<br />
Bekannte oder Verwandte<br />
in der Ukraine, die per Telefon,<br />
in E-Mails und in den russischsprachigen<br />
sozialen Netzwerken<br />
von ihrem Leben im Kriegszustand<br />
berichten. Für die Deutschen<br />
sind, auch wenn es zynisch<br />
klingen mag, die Opfer<br />
von Krieg und Vertreibung in<br />
Luhansk zwar bemitleidenswert,<br />
aber fern und fremd.<br />
So kommt es, dass die Vorstellungen<br />
von den Ereignissen<br />
in der Ukraine sich so stark unterscheiden,<br />
dass wir praktisch<br />
nicht mehr darüber sprechen<br />
können. Bei „Maidan“ denke ich an die friedlichen<br />
Demonstrationen von Hunderttausenden gegen einen<br />
korrupten Präsidenten, mit denen alles begann. Russen<br />
hingegen denken an bewaffnete Faschisten, die<br />
unschuldige Polizisten mit Molotowcocktails bewerfen.<br />
Beim Stichwort „Slawjansk“ erzählen die Russen<br />
von angeblichen Napalmangriffen auf friedliche Zivilisten,<br />
und ich erzähle vom russischen Ex-Geheimdienstler<br />
Igor Strelkow, der die Stadt in seine Gewalt<br />
brachte und damit den bewaffneten Konflikt erst auslöste.<br />
Strelkow? Die meisten meiner Bekannten blicken<br />
mich fragend an, wenn ich den Namen nenne. Über<br />
die wirklichen Hintergründe des Konflikts erfährt der<br />
russische Zuschauer wenig. Die Gegner der ukrainischen<br />
„Strafbataillone“ hießen im russischen Fernsehen<br />
lange Zeit „friedliche Befürworter der Föderalisierung“,<br />
dabei waren es von Anfang an bewaffnete<br />
Freischärler. Auch über die Unterstützung mit Waffen<br />
und Kriegsgerät über die russische Grenze erfahren<br />
die Russen nichts.<br />
Wohlmeinende Freunde und Verwandte sagen<br />
meist irgendwann versöhnlich: Die Wahrheit liegt wohl<br />
in der Mitte. Aber als Journalist, der alles mit eigenen<br />
Augen gesehen hat, muss ich ihnen entgegnen: Nein,<br />
dort liegt sie nicht.<br />
MORITZ GATHMANN bereiste Russland<br />
zum ersten Mal 1994 während eines<br />
Schüleraustauschs. Seit zwölf Jahren berichtet<br />
er als Journalist aus der Region. Er ist mit<br />
einer Russin verheiratet<br />
Stolz ragen<br />
die Kuppeln<br />
der Basilius-<br />
Kathedrale<br />
über Moskau.<br />
<strong>Das</strong> Gefühl<br />
von Stärke<br />
gibt Putin mit<br />
seiner Politik<br />
nun seiner<br />
Bevölkerung<br />
Fotos: Inger Vandyke/VWPics/Redux/Laif, Privat (Autor)<br />
80<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
„ Manchmal muss<br />
ich aber auch nach<br />
London fliegen<br />
und im Koffer cash<br />
die Gehälter für<br />
die kommenden drei<br />
Monate zurück<br />
nach Teheran bringen “<br />
Richard Oladi, britischer Trader an der Börse in Teheran, über die alltäglichen Auswirkungen der<br />
Finanz- und Wirtschaftssanktionen im Iran, Seite 86<br />
81<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
MIDAS MUSK<br />
Um Geld geht es Elon Musk schon lange nicht mehr. Als Gründer von Paypal und Tesla<br />
hat er Milliarden verdient. Jetzt teilt er seine Patente für Elektroautos mit allen<br />
Von ELLEN ALPSTEN<br />
In Jon Favreaus Film „Iron Man“<br />
zwingt der Bösewicht Obadiah Stane<br />
seine Wissenschaftler, die genialen<br />
Entwürfe seines Gegenspielers, des Milliardärs<br />
Tony Stark, zu studieren, bis ihnen<br />
die Köpfe rauchen. Ähnlich geht es<br />
nun der Konkurrenz des Unternehmers<br />
Elon Musk, der die Patente seines Automobilkonzerns<br />
Tesla offengelegt hat.<br />
„Wie will man wirklich etwas ändern,<br />
wenn nicht alle Zugriff zum notwendigen<br />
Wissen haben?“, fragt Musk entwaffnend<br />
in seinem Blog. Der Vergleich<br />
zwischen Iron Man Tony Stark und Elon<br />
Musk liegt nah, aber noch mehr erzählt<br />
Musks Reaktion darauf: „Fällt Ihnen außer<br />
mir noch jemand ein, der dem Vergleich<br />
standhält?“, fragt der gebürtige<br />
Südafrikaner gern.<br />
Aber ist alles wirklich so einfach?<br />
Also: Musk, der visionäre Technologe<br />
und Physiker; Musk, der grenzenlos risikofreudige<br />
Spieler; Musk, der rücksichtslose<br />
Lebemann. In der Alphamann-<br />
Apartheidsgesellschaft im Pretoria der<br />
siebziger Jahre aufgewachsen, las das<br />
Kind Elon – sein Name bedeutet auf Hebräisch<br />
„Eiche“, er selbst ist allerdings<br />
nicht jüdisch – alles von Lexika über<br />
Schopenhauer und Nietzsche bis zum<br />
„Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“. Von<br />
da an kam es ihm nicht mehr so sehr auf<br />
die Antwort als auf die richtige Fragestellung<br />
im Leben an. Sein erstes Videospiel<br />
entwickelte er mit zwölf Jahren und<br />
verkaufte es für 300 Dollar. Um dem Militärdienst<br />
zu entgehen, wanderte Musk<br />
erst nach Kanada, dann in die USA aus.<br />
Seine Teilnahme an dem Master-Programm<br />
in Physik der Stanford University<br />
währte zwei Tage: Statt weiter zu<br />
studieren, baute Musk lieber Unternehmen<br />
auf. Er gehörte zu den Gründern des<br />
Bezahldiensts Paypal, für den Ebay später<br />
1,5 Milliarden Dollar zahlte.<br />
Musk dachte nicht daran, in Pension<br />
zu gehen, sondern griff mit Space X, dem<br />
ersten privaten Konzern für Raumtransporte<br />
und -reisen, nach den Sternen: Er<br />
wolle auf dem Mars sterben, allerdings<br />
nicht schon beim Aufprall, sagte Musk<br />
nur halb im Scherz. Seine Leute konstruieren<br />
gerade 60 Meter hohe Raketen,<br />
die Fracht und bis zu sieben Passagiere<br />
transportieren können.<br />
IST ER WIE MIDAS, jener Sagenkönig, der<br />
alles, was er anfasste, zu Gold machte?<br />
Musk träumte weiter. Schon früh hatte<br />
er über Elektroautos nachgedacht, die<br />
wollte er nun auch bauen. Aber die Wirtschaftskrise<br />
traf seine junge, reelle Firma<br />
so hart, dass er sich Heiligabend 2008 mit<br />
seinem gesamten Privatvermögen in den<br />
Konzern einbrachte: All in! Für seine Vision<br />
setzte er den letzten Knopf auf seiner<br />
Hosennaht aufs Spiel.<br />
<strong>Das</strong> Risiko lohnte sich, denn 2009<br />
stieg Daimler mit 50 Millionen Dollar<br />
bei Tesla ein. Die Firma war gerettet, die<br />
Google-Gründer Larry Page und Sergey<br />
Brin zählten zu den ersten Abnehmern<br />
des Modells Tesla S. Über das vergangene<br />
Jahr stiegen die Tesla-Aktien um<br />
142 Prozent. Musks Modelle halten bei<br />
allem mit – Ästhetik, Stauraum, Service,<br />
Bequemlichkeit, Sicherheit –, und er bietet<br />
schnelle Ladestationen.<br />
Hat er Angst vor dem Scheitern? Ja,<br />
aber er weiß sie zu begrenzen. Schlimmer<br />
ist für ihn die Vorstellung, eines Tages zu<br />
sterben – auf der Erde oder dem Mars –<br />
und nicht alles getan zu haben, um die<br />
hochgesteckten Ziele zu erreichen.<br />
<strong>Das</strong> wahre Genie, der wahre Spieler<br />
kennt eben keine Grenzen und ist<br />
absolut, in allem. Seine erste Frau Justine,<br />
eine Schriftstellerin, lernte ihn als<br />
armen Studenten kennen und lieben.<br />
Nach dem plötzlichen Kindstod ihres<br />
ersten Sohnes Nevada gebar sie in nur<br />
zwei Jahren erst Zwillinge, dann Drillinge:<br />
Alles Söhne. „Ich bin deine Frau,<br />
nicht deine Angestellte“, warnte Justine<br />
ihn, während sie gegen eine postnatale<br />
Depression kämpfte. „Wenn du<br />
meine Angestellte wärst, hätte ich dich<br />
längst gefeuert“, erwiderte Musk – und<br />
tat dann doch genau dies. Über das Ende<br />
der Ehe wurde sie im Büro ihrer Therapeutin<br />
informiert.<br />
Musk dagegen beschrieb sich damals<br />
als „sehr privat“. <strong>Das</strong> änderte sich: No<br />
Sex before Marriage, beschied ihm die<br />
englische Schauspielerin Talulah Riley –<br />
optisch eine Mischung aus Kate Moss<br />
und Milla Jovovich – bei ihrem Kennenlernen<br />
in einer Londoner Bar. Nur sechs<br />
Wochen später waren sie verlobt. Wie<br />
schon Justine wurde Talulah in kürzester<br />
Zeit sehr blond und sehr schlank. Gemeinsam<br />
zierten sie die Titel der Regenbogenpresse.<br />
Kein Fest fand mehr ohne<br />
die Musks statt – sei es die Oscar-Verleihung<br />
oder ein Dinner bei Obama. Doch<br />
nur ein Jahr später verkündete Musk auf<br />
Twitter das Ende der Ehe. Seitdem ist das<br />
Paar mal zusammen, mal getrennt.<br />
Musks feine Gesichtszüge erinnern<br />
noch immer an den Jungen, der unter der<br />
Freiheit des unendlichen Sternenhimmels<br />
Südafrikas von einer grenzenlosen Welt<br />
träumte. Träume, die Wirklichkeit werden<br />
sollen: Koste es, was es wolle; die Suche<br />
wie auch das Finden. Denn das Gegenteil<br />
einer großen Wahrheit, schrieb<br />
einst der Physiker Niels Bohr, ist ebenfalls<br />
eine große Wahrheit. Auch den Vergleich<br />
mit Bohr würde Musk vermutlich<br />
nicht scheuen.<br />
ELLEN ALPSTEN hat nichts gegen<br />
Internetunternehmer, aber schreiben kann<br />
sie am besten über sie, wenn sie sich zwingt,<br />
offline zu bleiben<br />
Foto: Brian van der Brug/Los Angeles Times/Polaris/Laif<br />
82<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
AUS REISHÜLSEN GEBAUT<br />
Auf der Suche nach einem Ersatzstoff für Tropenhölzer hat Bernd Duna in Asien<br />
ein <strong>neue</strong>s Material entdeckt. Jetzt will er mit Resysta die Welt erobern<br />
Von TIL KNIPPER<br />
Bernd Duna hat schon mit 21 Jahren<br />
nach dem Tod seines Vaters den<br />
Familienbetrieb für Gartenmöbel<br />
übernehmen müssen, zusammen mit seinem<br />
Bruder Markus. Wenn man ihn fragt,<br />
was er heute macht, antwortet der inzwischen<br />
43-Jährige: „Ich bin Zulieferer für<br />
die Chemieindustrie.“ Dann schickt der<br />
stets gut gebräunte Duna sein schepperndes<br />
Lachen hinterher, das immer ein bisschen<br />
so klingt, als könne er selbst nicht<br />
ganz fassen, was da in den vergangenen<br />
Jahren passiert ist.<br />
Ihren Anfang hat die Geschichte dieses<br />
einschneidenden Strategiewechsels<br />
2005 in Asien. Bernd Duna, Typ wohlgenährter<br />
Surfer mit schulterlangem Haar,<br />
ist auf der Suche nach einem Ersatzstoff<br />
für Tropenhölzer, die aufgrund ihrer<br />
Härte und Beständigkeit beim Bau von<br />
Gartenmöbeln breite Verwendung finden.<br />
Für Duna ist das ein Problem, weil seine<br />
Kunden einerseits hohe Materialansprüche<br />
stellen, andererseits mit dem Kauf<br />
ihrer Gartenmöbel nicht zur Abholzung<br />
des Regenwalds beitragen wollen. „Ich<br />
war es selbst leid, Tropenhölzer zu kaufen,<br />
bei denen ich die Herkunft nie hundertprozentig<br />
nachvollziehen konnte und<br />
deren Preise unaufhaltsam nach oben<br />
gingen“, sagt Duna.<br />
Die Lösung seines Problems hat<br />
Duna in Malaysia gefunden. Über einen<br />
Bekannten lernt er den Chemiker<br />
Alexander Siu kennen. Der experimentiert<br />
in seinem Familienbetrieb damals<br />
schon seit geraumer Zeit mit einem Holzersatzstoff<br />
herum, der aus Reishülsen<br />
und PVC besteht. Siu zeigt Duna sein<br />
Referenzobjekt, einen „Reis“-Steg in<br />
Hongkong, der seit sieben Jahren ununterbrochen<br />
Sonne und Salzwasser ausgesetzt<br />
ist. „Die schlimmsten Bedingungen,<br />
die man sich vorstellen kann“, sagt Duna.<br />
Aber das Material sieht aus wie neu: Es ist<br />
nicht aufgequollen, nicht verbogen, splittert<br />
nicht und die Farbe ist unverändert.<br />
„Es fehlte nur noch der echte Touch and<br />
Feel von Holz“, sagt Duna, ein großer<br />
Freund der Anglizismen.<br />
Gemeinsam entwickelten Duna und<br />
Siu das Reisholz weiter. Optik, Haptik<br />
und das Herstellungsverfahren werden<br />
verbessert. <strong>Das</strong> Ergebnis heißt Resysta<br />
und besteht zu 60 Prozent aus Reishülsen,<br />
zu 22 Prozent aus Steinsalzen und<br />
zu 18 Prozent aus Mineralöl. Marktreife<br />
erreichte ihr <strong>neue</strong>r Werkstoff 2007, als<br />
sie ihren ersten Stuhl aus Resysta verkauften.<br />
2009 kamen die ersten Bodendielen<br />
hinzu. Nachdem die Materialentwicklung<br />
noch unter dem Dach der vom<br />
Vater gegründeten Firma MBM stattgefunden<br />
hatte, gründeten Duna und Siu<br />
2011 die Firma Resysta International in<br />
Taufkirchen bei München.<br />
Glaubt man Duna, sind die Einsatzmöglichkeiten<br />
für Resysta fast unbegrenzt:<br />
Nicht nur für Gartenmöbel,<br />
sondern auch für Hausfassaden, Bäder,<br />
Zäune, Türen, Fenster, Böden und Bootsdecks<br />
sei das wasserfeste, trittsichere Resysta<br />
wegen seiner Witterungsbeständigkeit<br />
geeignet.<br />
In der Tat stößt das <strong>neue</strong> Material<br />
bei Kunden auf großes Interesse: Internationale<br />
Konzerne wie McDonalds, Starbucks<br />
und Tchibo nutzen bereits Möbel<br />
aus Resysta in ihren Außenbereichen,<br />
und auch das Disney Resort in Orlando<br />
hat 1000 Gartenstühle aus dem <strong>neue</strong>n<br />
Werkstoff aufgestellt. Luxushotels in<br />
China, Miami und Südtirol haben ihre<br />
Wellnessbereiche mit Resysta verkleidet.<br />
Schon dieses Jahr rechnet Duna mit einem<br />
Umsatz von 20 Millionen Euro, den<br />
er in den kommenden drei bis vier Jahren<br />
auf 250 Millionen Euro steigern will.<br />
Nur von der ursprünglichen Idee,<br />
die gesamte Wertschöpfung alleine<br />
auszureizen – von der Herstellung des<br />
Werkstoffs bis hin zu dessen Veredelung –<br />
musste sich Duna verabschieden: „<strong>Das</strong><br />
hätten wir finanziell gar nicht stemmen<br />
können.“ Stattdessen liefert er das im eigenen<br />
Werk in Malaysia erstellte Pulver<br />
aus Reishülsen und einer geheimen Formel<br />
aus Additiven an Chemieunternehmen<br />
wie Ineos in der Schweiz oder Westlake<br />
in den USA. Die fügen Steinsalze<br />
und PVC hinzu und verkaufen es als<br />
Granulat an Möbel- und Fensterhersteller<br />
wie Schüco oder Salamander, die es<br />
erhitzen und nach eigenem Bedarf pressen<br />
und formen können.<br />
<strong>Das</strong> Geschäftsmodell hat sich Duna<br />
bei Gore-Tex abgeguckt. „Dieser atmungsaktive,<br />
wasserdichte Stoff war ein<br />
tolles Produkt, aber richtig erfolgreich<br />
wurde die Firma erst, als sie es an andere<br />
große Hersteller verkaufte. Wir wollen<br />
das Gore-Tex der Holzindustrie werden“,<br />
sagt Duna. Um Qualität und Materialzusammensetzung<br />
garantieren zu können,<br />
verpflichtet Duna jedes Partnerunternehmen,<br />
den „Made of Resysta“-Button zu<br />
verwenden.<br />
TIL KNIPPER leitet das Ressort Kapital bei<br />
<strong>Cicero</strong>, besitzt aber mangels Balkons oder<br />
eigener Terrasse gar keine Gartenmöbel<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht haben?<br />
Den Mittelstand!<br />
<strong>Cicero</strong> stellt in jeder Ausgabe<br />
einen mittelständischen<br />
Unternehmer vor.<br />
Die bisherigen Porträts<br />
finden Sie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
Foto: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
84<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Report<br />
86<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
DIE<br />
SWIFT-<br />
WAFFE<br />
Über eine Finanzfirma<br />
in Belgien könnte der<br />
Westen Russland von den<br />
Bankkonten der Welt<br />
abschneiden<br />
Von TOMÁŠ SACHER<br />
Illustrationen MARIO WAGNER<br />
Hier soll eine Institution sitzen, die den Konflikt<br />
in der Ukraine schnell beenden könnte? Wer<br />
als Besucher zum ersten Mal nach La Hulpe<br />
kommt, mag das kaum glauben. Die etwas verschlafene<br />
belgische Kleinstadt, die eine halbe Stunde Fahrt<br />
südlich von Brüssel liegt, präsentiert sich sommerlich<br />
träge. Bürgerliche Einfamilienhäuser, eine enge Hauptstraße<br />
mit wenigen Läden und Restaurants, wallonische<br />
Provinz in Reinkultur.<br />
Aber plötzlich steht man vor einem meterhohen<br />
Zaun, der einen weitläufigen Park mit Teich und<br />
Springbrunnen umschließt. Durch die Baumkronen<br />
hindurch sieht man ein pseudoklassizistisches Gebäude<br />
mit großen Fensterfronten, das einem Schloss<br />
nachempfunden ist. Durch den Haupteingang fahren<br />
regelmäßig Limousinen mit abgedunkelten Scheiben<br />
ein und aus. Wer sich zu lange davor herumtreibt,<br />
gerät ins Visier der zahlreichen Überwachungskameras<br />
und wird kurze Zeit später vom Sicherheitsdienst<br />
freundlich, aber entschieden aufgefordert, wieder<br />
zu verschwinden. Vorher gestellte Anfragen für<br />
Interviews oder schriftliche Fragenkataloge bleiben<br />
unbeantwortet.<br />
Willkommen bei Swift, der Society for Worldwide<br />
Interbank Financial Telecommunication, deren Hauptsitz<br />
hinter diesem Zaun liegt. Über die Computersysteme<br />
dieses Finanzdienstleisters tauschen Banken in<br />
mehr als 200 Staaten ihre Zahlungsdaten aus. <strong>Das</strong> als<br />
Genossenschaft organisierte Privatunternehmen arbeitet<br />
am liebsten genau so, wie seine Eigentümer, mehr<br />
als 10 000 Finanz institute weltweit, es mögen: diskret,<br />
schnell und ohne viele Fragen zu stellen.<br />
3000 Angestellte arbeiten in der Zentrale in La<br />
Hulpe, in Büros an den großen Finanzplätzen der Welt<br />
und in drei großen, hermetisch abgesicherten Rechenzentren<br />
in der Schweiz, den Niederlanden und den<br />
USA. Täglich verschickt Swift mehr als 20 Millionen<br />
Nachrichten seiner Mitglieder, hinter denen Transaktionen<br />
von mehr als 7,5 Billionen Euro stehen. <strong>Das</strong><br />
1973 gegründete Unternehmen hat sich zum Rückgrat<br />
des grenzüberschreitenden, internationalen Zahlungsverkehrs<br />
entwickelt, ganz gleich, ob es um Überweisungen,<br />
Wertpapierverkäufe oder den Rohstoffhandel<br />
geht. Mitglieder können mit ihrer Swift-Nummer<br />
über das Datennetzwerk sicher und schnell miteinander<br />
kommunizieren.<br />
Gleichzeitig genießt Swift durch seine weltweite<br />
Monopolstellung eine ungeheure Macht, weil Nichtmitglieder<br />
faktisch vom internationalen Zahlungsverkehr<br />
ausgeschlossen sind. Eine Macht, die immer öfter<br />
auch politische Begehrlichkeiten weckt. Schließt<br />
man die Banken eines Landes aus dem Swift-Netzwerk<br />
aus, kann man dessen Exportwirtschaft in die<br />
Knie zwingen.<br />
Auch im Ukrainekonflikt gehört die Swift-Waffe<br />
zum Arsenal, das EU und USA zur Verfügung steht.<br />
„Je nachdem, wie Putin weiter vorgeht, ist es durchaus<br />
vorstellbar, dass die Swift-Waffe auch gegen<br />
Russland zum Einsatz kommt“, sagt der Ökonom<br />
und Russlandfachmann Anders Aslund vom renommierten<br />
Peterson Institute for International Economics<br />
in Washington. Der Finanzsektor in Russland<br />
nimmt dieses Szenario sehr ernst. Ein möglicher Ausschluss<br />
aus Swift heißt in russischen Bankenkreisen:<br />
die „Atomwaffenoption“.<br />
BIS VOR KURZEM wäre diese Art der politischen Instrumentalisierung<br />
des Swift-Systems undenkbar gewesen.<br />
Selbst Kubas und Nordkoreas Banken sind seit<br />
der Gründung nie aus dem Swift-System ausgeschlossen<br />
worden. Doch seit 2012 gibt es einen Präzedenzfall,<br />
den Iran. Während die ganze Welt damals wegen<br />
des Atomwaffenprogramms Teherans über einen<br />
möglichen Militärschlag der Amerikaner oder Israelis<br />
diskutierte, trafen die USA und die EU überraschend<br />
eine andere Entscheidung. Beide verschärften ihre<br />
Wirtschaftssanktionen gegen den Iran und verboten<br />
den in den USA und der EU ansässigen Banken alle<br />
finanziellen Transaktionen mit dem Iran und dessen<br />
87<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Report<br />
Finanzsektor. Swift schweigt zunächst; erst einige Wochen<br />
später bestätigte der damalige Swift-Vorstandschef<br />
Lazaro Campos, dass die iranischen Banken aus<br />
dem Netzwerk ausgeschlossen worden waren.<br />
Dem Unternehmen selbst und der Finanzindustrie<br />
scheint die Instrumentalisierung durch die Politik unangenehm<br />
zu sein. Nach außen präsentiert sich Swift<br />
am liebsten als eine neutrale, supranationale Institution,<br />
die die erzielten Gewinne immer direkt wieder<br />
in die Sicherheit des eigenen Datennetzwerks investiert.<br />
Bei Nachfragen zur Verbannung des Iran verweist<br />
Swift auf die eigene Webseite. Dort heißt es, als<br />
belgisches Unternehmen habe man sich an das EU-<br />
Recht zu halten und lediglich die im März 2012 von<br />
der EU beschlossenen Sanktionen umgesetzt. Auch<br />
die großen deutschen Swift-Mitglieder pflegen weiter<br />
das Bild von der Neutralität des Systems. Und was ist<br />
mit dem Iran oder einem möglichen Ausschluss Russlands?<br />
„Fragen Sie direkt bei Swift nach, da gibt es<br />
von unserer Seite nichts zu kommentieren“, lautet die<br />
immer gleiche Antwort der Pressestellen der großen<br />
deutschen Banken.<br />
Was die Verbannung des Iran aus Swift in der Praxis<br />
bedeutet, davon kann Richard Oladi ein Lied oder<br />
eher ein ganzes Gesangbuch voll singen. Der Brite arbeitet<br />
an der Teheraner Börse für eine in London ansässige<br />
Tradingfirma. Seit der Zugang der iranischen<br />
Banken zum Swift-System blockiert ist, kann Geld<br />
nur noch auf Schleichwegen in und aus dem Golfstaat<br />
transferiert werden. Was vorher mit einem Knopfdruck<br />
ging, hat sich seitdem zu einem Abenteuer entwickelt.<br />
„Anfangs konnten wir noch mithilfe von Wechselstuben<br />
im Irak, die über gute Kontakte zu Banken in<br />
Dubai und der Türkei verfügten, Geldtransfers abwickeln“,<br />
erzählt Oladi. Es handelt sich um ein uraltes<br />
System, das auf Persisch Havaleh heißt. Aber die<br />
USA und Europa erhöhten den Druck auf die Banken<br />
der iranischen Nachbarländer. Diese stiegen aus dem<br />
Der Ausschluss<br />
aus dem Swift-System<br />
für internationale<br />
Zahlungen ist die<br />
Atomwaffenoption der<br />
Sanktionspolitik<br />
Havaleh-Kreislauf aus, um nicht den eigenen Zugang<br />
zu den westlichen Finanzmärkten zu riskieren. „So<br />
war auch diese Route für unsere Überweisungen nicht<br />
mehr verfügbar“, sagt Oladi.<br />
Plötzlich wurden einfachste Dinge, wie die Bezahlung<br />
der iranischen Angestellten, zu großen Herausforderungen,<br />
weil das Geld dafür aus London kam. „Wir<br />
fingen an, das Geld per Kurier oder via DHL in bar zu<br />
verschicken. Manchmal muss ich aber auch nach London<br />
fliegen und im Koffer cash die Gehälter für die<br />
kommenden drei Monate zurück nach Teheran bringen“,<br />
sagt Oladi.<br />
Der Bannstrahl aus La Hulpe hat den Iran hart getroffen.<br />
Zusammen mit den Sanktionen gegen den iranischen<br />
Finanzsektor und die Öl exportierenden Unternehmen<br />
hat der Ausschluss aus dem internationalen<br />
Zahlungsverkehrssystem die iranische Wirtschaft erheblich<br />
geschwächt. In den vergangenen zwei Jahren<br />
ist das Bruttoinlandsprodukt des Landes um knapp<br />
ein Drittel gesunken.<br />
DIE GESPRÄCHE MIT DEM IRAN sind noch nicht erfolgreich<br />
abgeschlossen, aber insbesondere die amerikanische<br />
Diplomatie geht davon aus, dass der Swift-Bann<br />
entscheidend war, um die iranischen Politiker zurück<br />
an den Verhandlungstisch zu bringen, und gleichzeitig<br />
den Weg geebnet hat für die Wahl des moderaten<br />
Präsidenten Hassan Rohani im vergangenen Jahr.<br />
Entsprechend groß ist die Versuchung jenseits des Atlantiks,<br />
die Swift-Waffe auch im Ukrainekonflikt gegen<br />
Russland in Stellung zu bringen. „Unter Präsident<br />
Barack Obama setzen die USA in der Außenpolitik<br />
verstärkt auf wirtschaftliche Sanktionen, während<br />
George W. Bush lieber Soldaten geschickt hat“, sagt<br />
Ökonom Aslund.<br />
Wie ernst es die Obama-Regierung mit ihrer Sanktionspolitik<br />
meint, hat sie Anfang Juli unter Beweis gestellt.<br />
<strong>Das</strong> US-Justizministerium verurteilte die französische<br />
Großbank BNP Paribas zu einer Rekordstrafe<br />
in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro, weil sie<br />
gegen die von den USA verhängten Sanktionen gegen<br />
den Sudan, den Iran und Kuba verstoßen hatte. „Hier<br />
wurde sehr deutlich gemacht, was passiert, wenn eine<br />
Bank aus dem Westen gegen die von den USA aufgestellten<br />
Regeln verstößt“, sagt Anders Aslund.<br />
Gegen Russland sind die USA schon bisher wesentlich<br />
entschlossener vorgegangen als die Europäer. Die<br />
beiden US-Kreditkartenunternehmen Mastercard und<br />
Visa haben bereits im März die Zusammenarbeit mit<br />
mehreren russischen Banken fristlos beendet. Da wirkt<br />
es eher hilflos, wenn Öl-Oligarch und Putin-Freund<br />
Gennadi Timtschenko demonstrativ ironisch in die russischen<br />
Kameras sagt: „Funktioniert ja prima!“ Er verwende<br />
jetzt einfach das chinesische System UnionPay.<br />
<strong>Das</strong>s dessen Infrastruktur in Russland sehr übersichtlich<br />
ist, verschweigt er lieber.<br />
88<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Bisher schrecken vor allem die Staaten in Mittelund<br />
Osteuropa aufgrund ihrer Abhängigkeit von russischen<br />
Gaslieferungen vor weiteren Maßnahmen zurück.<br />
Die Südeuropäer fürchten einen Rückfall ihrer<br />
krisengeschwächten Volkswirtschaften in die Rezession,<br />
während Großbritanniens Finanzindustrie in der<br />
Londoner City nur ungern auf das lukrative Geschäft<br />
mit den Russen verzichten will. Anders die USA: Sie<br />
plädieren für härtere Sanktionen, ein Ausschluss Russlands<br />
aus dem Swift-System inklusive. Allerdings sind<br />
sie auf die Europäer angewiesen. Denn La Hulpe liegt<br />
ja in Belgien, weshalb das Unternehmen nicht dem<br />
amerikanischen Recht unterliegt.<br />
Foto: Privat<br />
Auch sonst beginnen die bisher verhängten Sanktionen<br />
in Russland offenbar zu wirken. Der Leitindex<br />
der Moskauer Börse hat seit Beginn des Jahres bereits<br />
16 Prozent seines Wertes eingebüßt. Die Europäische<br />
Zentralbank beziffert den Kapitalabfluss aus Russland<br />
seit Ausbruch des Konflikts auf mehr als 160 Milliarden<br />
Euro.<br />
Anders als in Washington steht man in Brüssel<br />
und den anderen europäischen Hauptstädten noch<br />
weitergehenden Finanz- und Wirtschaftssanktionen<br />
eher zögerlich gegenüber. „Die Fälle Iran und Russland<br />
kann man nicht vergleichen, weil das europäische<br />
und das russische Bankensystem wesentlich<br />
enger miteinander verknüpft sind“, sagt Hosuk Lee-<br />
Makiyama vom European Center for International Politics<br />
and Economics in Brüssel, der sich seit langem<br />
mit den Auswirkungen internationaler Sanktionspolitik<br />
beschäftigt.<br />
FALLS DER KONFLIKT in der Ukraine weiter eskaliert<br />
oder Russland sich unabhängige Staaten wie Georgien<br />
oder Moldawien oder sogar die Nato- und EU-Mitglieder<br />
im Baltikum vornimmt, wären schärfere Sanktionen<br />
der Europäer sicher. Schon jetzt schränken EU<br />
und USA den Zugang Russlands zu westlichen Kapitalmärkten<br />
ein. Russische Banken, die mehrheitlich<br />
im Staatsbesitz sind, bekommen keine Darlehen mehr,<br />
wenn sie eine Laufzeit von mehr als 90 Tagen haben.<br />
Die Geldinstitute sind jedoch stark abhängig vom westlichen<br />
Kapitalmarkt. Würde der Hebel bei Swift umgelegt<br />
wie im Fall des Iran, wären die Geldströme des<br />
russischen Finanzsektors gestoppt. Russland wäre von<br />
den Konten der Welt abgeschnitten.<br />
Dies wäre faktisch gleichbedeutend mit einem Exportverbot<br />
für russisches Gas und Öl und träfe die<br />
russische Volkswirtschaft hart. Die weitgehend staatlich<br />
kontrollierte Energieindustrie hat allein im Jahr<br />
2012 durch Exporte 278 Milliarden Euro verdient. <strong>Das</strong><br />
entspricht 80 Prozent des russischen Staatshaushalts.<br />
In La Hulpe hinter den Fassaden der Swift-Zentrale<br />
wird man die drohende Sanktionsspirale wohl mit<br />
Sorge verfolgen. Wird Swift zum zweiten Mal politisch<br />
eingesetzt, könnte dies das Geschäftsmodell des belgischen<br />
Dienstleisters gefährden. Es ist bekannt, dass die<br />
Russen und Chinesen schon mehrfach Gespräche über<br />
den Aufbau eines alternativen Systems geführt haben.<br />
An einer Fragmentierung des Zahlungsverkehrs in einer<br />
globalisierten Welt kann aber insbesondere der<br />
Westen kein Interesse haben, der bisher über seine<br />
Großbanken das Swift-System kontrolliert.<br />
Die Lehre aus dem Kalten Krieg kann für alle Beteiligten<br />
daher nur lauten, dass die „Atomwaffenoption“<br />
der Sanktionspolitik am besten als Drohung<br />
funktioniert.<br />
TOMÁŠ SACHER<br />
leitete das Wirtschaftsressort des tschechischen<br />
Magazins Respekt und beobachtet seit<br />
langem die Beziehungen zwischen Russland<br />
und Europa<br />
89<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Interview<br />
„ NUR ALDI IST<br />
DOCH TRAURIG “<br />
Fotos HENNING BODE<br />
Volker Wiem gehört der Supermarkt des Jahres 2014<br />
in Hamburg-St. Georg. Ein Gespräch über Motoröl,<br />
die Lebensmittelkultur in der Discounterrepublik Deutschland<br />
und den Erfolg des Andersseins<br />
90<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
„ In Berlin muss<br />
man leider mit<br />
der Lupe nach<br />
guten Supermärkten<br />
suchen “<br />
Gibt es insgesamt ein regionales Gefälle?<br />
Ja, eindeutig. Je weiter Sie in den<br />
Süden kommen, desto besser werden die<br />
Supermärkte. Ich glaube, das ist auch<br />
kulturell bedingt, weil die Menschen<br />
im Norden und im Osten Deutschlands<br />
lange wenig Wert auf gutes Essen gelegt<br />
haben.<br />
Herr Wiem, warum macht Einkaufen im<br />
Supermarkt fast überall auf der Welt<br />
mehr Spaß als in Deutschland?<br />
Volker Wiem: Es gibt ja diesen<br />
Spruch, dass die Deutschen mehr Geld<br />
für ihr Motoröl ausgeben als für ihr Olivenöl.<br />
<strong>Das</strong> wirkt sich natürlich auch auf<br />
die Supermarktkultur hierzulande aus.<br />
Bei den Franzosen und den Italienern ist<br />
es genau andersrum. Denen ist es nicht so<br />
wichtig, dass es ihrem Auto gut geht, die<br />
kümmern sich lieber ums eigene Wohlergehen:<br />
gute Flasche Wein, guter Käse,<br />
Aufschnitt – die Wertschätzung für gutes<br />
Essen ist in diesen Ländern einfach größer<br />
als bei uns.<br />
Sie betreiben mit Ihrer Familie acht<br />
Edeka-Filialen in Hamburg. Einer Ihrer<br />
Märkte wurde gerade vom Handelsverband<br />
zum „Supermarkt des Jahres 2014“<br />
gewählt. Woran erkenne ich als Kunde,<br />
ob ich einen gut geführten Supermarkt<br />
betrete?<br />
Ich achte als Erstes darauf, ob die<br />
Mitarbeiter aufmerksam und freundlich<br />
sind. Finde ich in allen Abteilungen einen<br />
Ansprechpartner, wenn ich beraten<br />
werden will? Wird Käse und Aufschnitt<br />
so verpackt und aufgeschnitten,<br />
wie ich das möchte? Sieht die Ware an<br />
der Fleisch- und Fischtheke gut aus, sind<br />
Obst und Gemüse frisch? Wenn Sie das<br />
alles bejahen können und dann noch die<br />
Volker Wiem<br />
Dem 44-jährigen Kaufmann<br />
gehört zusammen mit seiner<br />
Frau, seinem Schwager und<br />
seinem Schwiegervater die<br />
Edeka-Kette Niemerszein mit<br />
acht Filialen in Hamburg,<br />
die insgesamt 400 Mitarbeiter<br />
beschäftigt. Schon Wiems<br />
Eltern hatten einen Supermarkt,<br />
sodass er als Baby nicht im<br />
Kinder-, sondern im Einkaufswagen<br />
neben der Kasse schlief<br />
Atmosphäre stimmt, dann sind Sie in einem<br />
guten Supermarkt.<br />
Wenn Sie die deutsche Supermarktkultur<br />
benoten müssten, wo liegen wir da<br />
auf der Schulnotenskala?<br />
Es gibt alles zwischen sehr gut und<br />
mangelhaft. Gerade die von selbstständigen<br />
Händlern betriebenen Läden, die es<br />
ja fast nur noch bei Edeka und Rewe gibt,<br />
werden mit sehr viel Passion und Leidenschaft<br />
geführt, und auch im Kaufhausbereich<br />
gibt es gute Abteilungen. Aber es<br />
gibt eben Regionen, wo man mit der Lupe<br />
nach guten Supermärkten suchen muss.<br />
<strong>Das</strong> gilt für Berlin, aber auch in Hamburg<br />
war es lange Zeit schwierig.<br />
Der deutsche Lebensmittelmarkt wird<br />
mit einem Marktanteil von über 40 Prozent<br />
ja sehr stark von den Discountern<br />
beherrscht. Waren die inzwischen verstorbenen<br />
Gebrüder Albrecht aus Ihrer<br />
Sicht eher gewiefte Gauner oder großartige<br />
Unternehmer?<br />
Als Gauner würde ich sie nie bezeichnen,<br />
und für ihr Lebenswerk Aldi<br />
bewundere ich sie. Mit so günstigen Produkten<br />
so viel Geld zu verdienen, das<br />
muss man erst mal hinbekommen. <strong>Das</strong><br />
ist ja irgendwie fast ein Treppenwitz,<br />
dass die Erfinder des Discounters zu den<br />
reichsten Deutschen aufgestiegen sind.<br />
Aber haben die Aldi-Brüder mit der<br />
Schaffung der Discounterrepublik<br />
Deutschland unserem Umgang mit Lebensmitteln<br />
nicht eher geschadet?<br />
Sicher haben sie das Einkaufsverhalten<br />
der Deutschen geprägt, aber man<br />
muss mit einem solchen Konzept auch<br />
auf eine Mentalität stoßen, die das gut<br />
findet. Sie haben erkannt, was die deutschen<br />
Kunden haben wollten, nämlich<br />
extrem günstige Lebensmittel. Es liegt<br />
aber nicht nur an den Preisen. In Frankreich<br />
ist der Marktanteil der Discounter<br />
wesentlich geringer, obwohl es den Franzosen<br />
wirtschaftlich schlechter geht als<br />
uns. Ich finde es aber traurig, wenn man<br />
sich als Kunde nur auf das Angebot Aldi<br />
beschränkt, weil einem da viel entgeht.<br />
91<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
KAPITAL<br />
Interview<br />
„ Über den<br />
Preis können<br />
wir nicht gewinnen,<br />
aber<br />
wir setzen uns<br />
über bessere<br />
Qualität ab “<br />
Was zum Beispiel?<br />
Viele Leute wollen mir immer erzählen,<br />
dass es bei Aldi und Lidl ausgezeichnete<br />
Weine gäbe. Da bin ich eher skeptisch,<br />
weil Wein eben nicht gleich Wein<br />
ist. Für mich muss hinter einem guten<br />
Wein ein Winzer mit einer Philosophie<br />
stehen, der seine Arbeit mit Leidenschaft<br />
macht und nicht nur auf Profitmaximierung<br />
aus ist. Weingüter, die so arbeiten,<br />
können aber gar nicht in den von den<br />
Discountern benötigten Mengen liefern.<br />
Verstehen Sie sich denn als Verkäufer<br />
oder wollen Sie Ihre Kunden zu besseren<br />
Essern und Trinkern erziehen?<br />
Den Begriff Erziehen mag ich in diesem<br />
Zusammenhang nicht. Wir sind eher<br />
Entwicklungshelfer, die die Kunden liebevoll<br />
überzeugen wollen, dass es noch<br />
mehr gibt als den Einheitsbrei der Lebensmittelindustrie.<br />
Ich finde es sprachlich<br />
schon so furchtbar, dass sich die großen<br />
Hersteller als Industrie verstehen.<br />
Dabei haben wir im Deutschen mit dem<br />
Wort Lebensmittel den schönsten Begriff<br />
für unsere Nahrung. <strong>Das</strong> sind unsere Mittel<br />
zum Leben, mit denen wir viel zu unachtsam<br />
umgehen.<br />
Aber Sie verkaufen doch auch die Marken<br />
der großen Hersteller?<br />
Ja, aber es kommt auf die Mischung<br />
an. Wir beziehen nur etwa die Hälfte<br />
In die <strong>neue</strong>ste Filiale hat Wiem<br />
einen historischen Krämerladen<br />
integriert, den er Bernhard Paul,<br />
Chef des Zirkus Roncalli, aus<br />
dessen Sammlung abgekauft hat<br />
unseres Sortiments über Edeka, den Rest<br />
kaufen wir über eigene Lieferanten oder<br />
direkt beim Erzeuger ein. Da wir solche<br />
Kontakte intensiv pflegen, bekommen<br />
wir für unser Weinsortiment auch Weine,<br />
die sonst nur an den Fachhandel und die<br />
Gastronomie geliefert werden.<br />
Wer sind Ihre schärfsten Wettbewerber?<br />
Ich kümmere mich nicht so sehr um<br />
die Konkurrenz, mich interessieren vor<br />
allem die Wünsche der Kunden. Daher<br />
bin ich auch ständig in den Läden präsent.<br />
Ich weiß, dass ich den Wettbewerb<br />
über den Preis eh nicht gewinnen kann,<br />
aber man kann sich auch durch bessere<br />
Qualität absetzen.<br />
Wie geht das konkret?<br />
Wir haben zum Beispiel die Produkte<br />
vieler regionaler Kleinsterzeuger<br />
im Sortiment. Süßigkeiten und Schokolade,<br />
Gebäck und Kaffee verschiedener<br />
Manufakturen aus Hamburg. Wir haben<br />
als Erste echten Hamburger Gin und<br />
Wodka von zwei verschiedenen kleinen<br />
Brennern verkauft oder das Craft Beer<br />
von der wiederbelebten Elbschlossbrauerei.<br />
Die Jungs von Fritz-Kola haben gegenüber<br />
von einem unserer Märkte mit<br />
der Abfüllung ihrer Limonaden angefangen<br />
und die ersten Kisten noch per Hand<br />
zu uns gebracht. Hier in St. Georg, in unserer<br />
<strong>neue</strong>n preisgekrönten Filiale, betreiben<br />
wir jetzt auch die Bäckerei selbst. Dafür<br />
haben wir uns die besten Sachen von<br />
vier verschiedenen Lieferanten zusammengestellt.<br />
Die Kunden honorieren das,<br />
weil sie wissen, dass andere Supermärkte<br />
ihnen das nicht bieten können. Teilweise<br />
empfehlen sie uns auch <strong>neue</strong> Erzeuger.<br />
Die Bedeutung guter Mitarbeiter und der<br />
Qualität der Ware haben Sie schon betont.<br />
Wie wichtig ist die Präsentation?<br />
Unser Firmenmotto heißt: Anders<br />
sein als die anderen. Die Präsentation<br />
soll die Frische der Ware unterstreichen.<br />
Deswegen haben wir schon seit Jahren<br />
offene Salatbars, die Fertiggerichte zum<br />
Mitnehmen kommen aus unserer eigenen<br />
Küche, und es gibt überall Probierstationen.<br />
In St. Georg lagern wir unseren<br />
Käse in einem gläsernen Klimaraum,<br />
es gibt Sitzecken zum Verweilen, und besonders<br />
stolz bin ich auf unseren historischen<br />
Krämerladen, den wir Roncalli-<br />
Chef Bernhard Paul aus seiner Sammlung<br />
abkaufen konnten.<br />
<strong>Das</strong> Gespräch führte TIL KNIPPER<br />
92<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
„ Ich kann ein Kleid<br />
in meinem Schrank<br />
sehen und sagen:<br />
1997, Fifth Avenue,<br />
ich war mit diesem<br />
Mann zusammen,<br />
und es war der<br />
schönste Sommer<br />
meines Lebens “<br />
Hatice Akyün erklärt „Warum ich trage, was ich trage“, Seite 104<br />
93<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
Porträt<br />
OPERATION PINK<br />
70 Jahre Zweiter Weltkrieg: Mit der Modedesignerin Elsa Schiaparelli rückt eine besondere<br />
Zeitzeugin in den Blick – dank ihrer nun auf Deutsch erscheinenden Autobiografie<br />
Von ILONKA WENK<br />
Foto: Condé Nast Archive/CORBIS<br />
Ende August 1944. Nach ihrer Landung<br />
in der Normandie kämpfen<br />
sich die alliierten Truppen vorwärts,<br />
um Europa von der Nazidiktatur<br />
zu befreien. Gerade hat General von<br />
Choltitz in Paris kapituliert. Emigranten<br />
fiebern ihrer Heimkehr entgegen – in<br />
New York auch die 53-jährige Elsa Schiaparelli,<br />
eine der großen Modedesignerinnen<br />
des 20. Jahrhunderts.<br />
Die Wahlfranzösin italienischer Herkunft<br />
begab sich während des Zweiten<br />
Weltkriegs auf US-Mission, wo sie für<br />
den Ruf der französischen Mode kämpfte.<br />
Ihre Motive waren nicht politisch – und<br />
doch ist Elsa Schiaparelli damit zwischen<br />
alle Fronten geraten. Ihre Autobiografie<br />
„Shocking Life“ von 1954 erscheint jetzt<br />
erstmals in deutscher Übersetzung. Im<br />
Ton entspricht sie ihrer Markenfarbe Shocking<br />
Pink – strahlend, vital, offensiv.<br />
Der Reihe nach. Als römische Professorentochter<br />
heiratet sie blutjung einen<br />
Esoteriker, mit dem sie nach New<br />
York geht. Er lässt sie mittellos mit der<br />
Tochter Gogo sitzen. Sie schließt Freundschaft<br />
mit surrealistischen Künstlern wie<br />
Man Ray und Marcel Duchamps und<br />
zieht 1929 mit ihnen nach Paris.<br />
Sie ist eine Autodidaktin. In Paris<br />
baut sie ihr eigenes Mode-Imperium auf.<br />
Ihre bizarren Kleider, von den Surrealisten<br />
Salvador Dalí oder Jean Cocteau mit<br />
Hummern und Schubladen bemalt, machen<br />
Schlagzeilen. Ihr legendäres Skelett-Kleid,<br />
das durch Steppungen das<br />
menschliche Knochengerüst nachzeichnete,<br />
schrieb Modegeschichte. Einfälle<br />
wie breite Schulterpolster, asymmetrische<br />
Dekolletés und der Einsatz von<br />
Reißverschlüssen als Blickfang gehen<br />
auf sie zurück.<br />
Der brisante Teil von Schiaparellis<br />
Leben beginnt im Mai 1940. Die<br />
deutschen Truppen haben bereits die<br />
Beneluxländer überrannt. Nur zu genau<br />
wissen die Pariser Vertreter der<br />
Haute Couture, was ihnen blüht, wenn<br />
die Deutschen auch bei ihnen einmarschieren:<br />
„Heim ins Reich“ – die Gleichschaltung<br />
ihrer französischen Eleganz<br />
mit dem völkischen Geschmack der Besatzer.<br />
Aber Lucien Lelong, selbst Couturier<br />
und Sprecher der Standesorganisation<br />
Chambre Syndicale, verhandelt<br />
geschickt. In einer Art Blase, abgeschottet<br />
vom Ausland, wird die Branche überleben.<br />
Die Pariser Modemacher kleiden<br />
nun keine Hollywoodstars mehr ein, sondern<br />
die Frauen von Hitlers Statthaltern.<br />
DIESE ISOLATION VERANLASST prominente<br />
Modeschöpfer wie Jeanne Lanvin<br />
bei einem Geheimtreffen im unbesetzten<br />
Biarritz in Südwestfrankreich, eine<br />
Kollegin in die USA zu schicken: Elsa<br />
Schiaparelli, denn sie kennt sich dort<br />
aus. Während des Krieges macht es sich<br />
„Schiap“ zur Aufgabe, die Wertschätzung<br />
für die französische Mode von den<br />
USA aus in die Zeit nach dem Krieg hinüberzuretten.<br />
Äußerlich unscheinbar<br />
und ohne Erfahrung als Rednerin startet<br />
sie eine zweimonatige Vortragsreise<br />
mit Modenschauen durch 42 Städte. Zunächst<br />
läuft es zäh, doch am Schluss, in<br />
St. Paul, Minnesota, bejubeln sie Tausende<br />
Zuhörerinnen.<br />
Um dem wachsenden Elend in Europa<br />
zu begegnen, organisiert sie Benefizauktionen,<br />
die Rekordsummen erzielen.<br />
In den New Yorker Räumen von „American<br />
Aid To France“ veranstaltet sie zum<br />
Beispiel eine sensationelle Verkaufsausstellung<br />
mit Werken ihrer Malerfreunde<br />
Salvador Dalí, Marcel Duchamp,<br />
Fernand Léger und Pablo Picasso. Wenn<br />
nur das FBI mit seinem Verfolgungswahn<br />
nicht wäre. Spioniert sie, die gebürtige<br />
Italienerin, etwa für Mussolini? Und ist<br />
der konfiszierte braune Samthut aus Paris,<br />
den sie über Chile an ihre Adresse in<br />
Princeton schicken ließ, nicht Beweis für<br />
ein Komplott auch mit den Nazis?<br />
Elsa Schiaparelli muss sich getrieben<br />
gefühlt haben, wie ein Flüchtling. Zum<br />
Albtraum wird eine Reise, die sie unternimmt,<br />
um in Frankreich eine Medikamentenspende<br />
der Quäker abzuliefern.<br />
Spontan schaut sie in Paris vorbei, wo<br />
ihr das Personal treu die Stellung hält. Im<br />
Zug dorthin nehmen ihr die Deutschen<br />
das Geld ab. Und für den Weg zurück<br />
zum Hafen von Lissabon quer durch die<br />
Vichy-Zone fehlen ihr die Transitvisa.<br />
Schiaparelli entgeht zwar einer Inhaftierung,<br />
doch zurück in den USA ändert<br />
sie erneut ihr Leben: Sie wird Krankenschwester<br />
und betreut in New York<br />
junge Patienten, die an Polio erkrankt<br />
sind – so wie als Kind auch ihre Tochter<br />
Gogo, die sich inzwischen selbst für<br />
Hilfskorps engagiert.<br />
Der Gipfel der Absurdität: Bevor<br />
Schiaparelli nach vier Jahren wieder in<br />
Paris einreisen darf, muss sie sich einem<br />
Verhör stellen. Wie ein Schulmädchen<br />
legt sie Vertretern der Chambre Syndicale<br />
über ihren Einsatz in den USA Rechenschaft<br />
ab. Auch geschäftlich ist die<br />
Lage schwierig. Vor ihrer Pariser Boutique<br />
stehen zwar die GIs Schlange, die<br />
Parfum für ihre Freundinnen kaufen wollen.<br />
Doch insgesamt hat sich der Stil ihres<br />
Labels überlebt. Während ihrer Rivalin<br />
Coco Chanel, einer politischen Opportunistin,<br />
das Comeback gelingt, zieht<br />
Schiaparelli in ihrer tunesischen Villa Bilanz<br />
– unsentimental und mit grimmigem<br />
Humor. So ist ein Zeitdokument entstanden,<br />
das alle Moden überdauert.<br />
ILONKA WENK ist freie Autorin und schreibt<br />
am liebsten über Mode, Kunst und Design.<br />
Sie lebt in München<br />
95<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
Report<br />
TRAGEN SIE<br />
DEUTSCH?<br />
Von ANNE WAAK<br />
Fotos: Patrick Houi/Hien Le, Laurent Humbert/Madame Figaro/Laif<br />
So sieht es der deutsche Nachwuchs:<br />
Rock und Bluse aus der aktuellen<br />
Kollektion von Hien Le ( links ). Dies<br />
erinnert an die schlichte Eleganz,<br />
für die der Name Jil Sander steht<br />
Frankreich hat Tradition, Italien hat Glamour, die<br />
USA haben Weltläufigkeit. Aber was zeichnet eigentlich<br />
deutsche Mode aus? Eine Erkundung<br />
97<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
Report<br />
BIRKENSTOCK,<br />
CAMP DAVID<br />
Zwei Marken, an denen<br />
man in Deutschlands<br />
Fuß gängerzonen nicht<br />
vorbeikommt und die auch<br />
im Ausland das Image<br />
deutscher Mode prägen –<br />
auch wenn Camp David<br />
amerikanisch klingt<br />
Vielleicht hat die Mode gerade ihren deutschesten<br />
Moment seit langem. Genauer: die Schuhmode.<br />
Denn wenn es in diesem nun dahinsterbenden<br />
Sommer einen Trend gab, dann hieß er: hässliche<br />
Schuhe. Von hier bis Seoul galten sie auf einmal<br />
als der letzte Schrei. Und da Deutsche sich mit Hässlichkeit<br />
auszukennen scheinen, lief also die halbe Welt<br />
in Birkenstocks und Adiletten rum. Sprich: Orthopädische<br />
Sandalen mit Korksohle und Plastikschlappen<br />
für die Dusche. Die ganz Harten trugen dazu weiße<br />
Tennissocken.<br />
Apropos hässlich: Läuft man durch deutsche Innen-<br />
und Kleinstädte, wird einem schnell klar, wie die<br />
derzeit erfolgreichste deutsche Modemarke heißt. Man<br />
muss nur lesen, was da allenthalben auf Männerbrüsten<br />
und -rücken steht: Camp David. <strong>Das</strong> ist jenes Label,<br />
dem Dieter Bohlen als Werbefigur zum Durchbruch<br />
verhalf – das mit den Dada-Schriftzügen wie „Int. 1963<br />
New York Superior Club“.<br />
Clinton heißt das Brandenburger Unternehmen,<br />
das hinter Camp David und der Damen-Linie Soccx<br />
steht. (Ja, Clinton wie der amerikanische Präsident,<br />
Camp David wie der präsidiale Sommersitz, Soccx<br />
nach der Präsidentenfamilien-Katze). Man veröffentlicht<br />
keine Umsatzzahlen, schon 2011 aber lag der<br />
jährliche Erlös bei mehr als 100 Millionen Euro, heute<br />
dürfte es ein Vielfaches sein. <strong>Das</strong> von drei badischen<br />
Brüdern geführte Familienunternehmen, das 1993 seinen<br />
ersten Laden in Berlin eröffnete und lange Jahre<br />
den ganz überwiegenden Teil seines Umsatzes in Ostdeutschland<br />
machte, verkauft mittlerweile in 250 eigenen<br />
Stores in 20 europäischen Ländern.<br />
EINE ANDERE DEUTSCHE Erfolgsgeschichte ist die von<br />
Philipp Plein. Der ehemalige Münchner Jura-Student<br />
ist innerhalb weniger Jahre zu so etwas wie dem deutschen<br />
Roberto Cavalli geworden, der seinen Namen<br />
als Tattoo auf dem Arm trägt und dessen Kollektionen<br />
hinreichend mit „viel mit viel dran“ beschrieben<br />
sind: Leder, Fell, Strass und Nieten. Die zeigt er auf<br />
der Mailänder Modewoche, verkauft werden sie höchst<br />
Fotos: Camp David, 2014 BIRKENSTOCK GmbH & Co. KG<br />
98<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Fotos: Thuy Pham, Patrick Houi/Hien Le<br />
erfolgreich in 35 eigenen Läden in Monte Carlo, Saint-<br />
Tropez, Cannes, Moskau, Kitzbühel, Seoul, Baku, Dubai,<br />
Miami. Auch bei Philipp Plein ist man geizig mit<br />
Umsatzzahlen, die Zuwachsraten aber sind steigend.<br />
Ein rasantes Wachstum, von dem andere Modefirmen<br />
nur träumen können: Strenesse, seit 2013 Ausstatter<br />
der deutschen WM-Elf, befindet sich seit Anfang<br />
Juli im Insolvenzverfahren. Um das 65 Jahre alte<br />
bayerische, mit rund 20 Millionen Euro verschuldete<br />
Unternehmen zu retten, soll nun ein Finanzinvestor<br />
gesucht werden.<br />
Camp David, Philipp Plein, Strenesse. Prollig,<br />
edelprollig und schnarchöde, das sind anscheinend<br />
die Koordinaten der deutschen Mode. „Deutschland<br />
ist ein sehr großer Markt, wir haben Geld, wir geben<br />
auch sehr viel Geld für Mode aus – im Schnitt mehr<br />
als die Franzosen“, sagt Rike Döpp, Gründerin der<br />
Mode-PR-Firma Agency V mit Sitz in New York, Berlin<br />
und Kopenhagen. „Aber wir kaufen eben s.Oliver<br />
und Esprit, Closed und Schumacher.“ 65 Prozent beträgt<br />
der Marktanteil deutscher Labels am heimischen<br />
Modemarkt. „Was wir nicht haben“, sagt Döpp,<br />
„ist die große Mode. Der Teil, der auf den Catwalks<br />
stattfindet.“<br />
In Frankreich hat Luxusmode mit Häusern wie<br />
Louis Vuitton, Chanel und Yves Saint Laurent Tradition,<br />
in Italien atmet sie mit Gucci, Dolce & Gabbana<br />
und Versace Glamour, die USA stehen mit Labels<br />
wie Tommy Hilfiger oder Michael Kors für Sportlichkeit<br />
und Internationalität. Deutschland hat: Kleidung.<br />
Also Unauffällig-Bieder-Mittelständiges, das man in<br />
der Fußgängerzone kauft: Betty Barclay, Tom Taylor,<br />
Carlo Colucci, Tom Tailor, s.Oliver (das s. steht für<br />
„Sir“) oder, auf der edleren Seite: Gerry Weber, Marc<br />
Cain und René Lezard. Fast ist man geneigt, die Namen<br />
dieser allesamt in den fünfziger bis siebziger Jahren<br />
gegründeten Marken zu Zeugen einer kleinen Mentalitätsgeschichte<br />
der Deutschen zu machen. Der Befund<br />
müsste wohl lauten: Hier sollte eine große Sehnsucht<br />
nach Weltläufigkeit befriedigt werden. Denn keiner<br />
dieser Namen geht auf real existierende Menschen<br />
oder gar Designer zurück.<br />
GANZ IM GEGENSATZ zu den hoffnungsvollen deutschen,<br />
und das heißt immer: Berliner Nachwuchslabels<br />
der jüngeren Generation. International sind<br />
sie von ganz allein, denn heute sind es besonders<br />
Designer mit sogenanntem Migrationshintergrund,<br />
die ein Label gründen: Issever Bahri arbeiten sich<br />
an den Handarbeitstechniken ihrer türkisch-griechischen<br />
Großmütter ab, das Markenzeichen des Bulgaren<br />
Vladimir Karaleev sind offene Säume, der Laote<br />
Hien Le gilt dank der minimalistischen Schnitte seiner<br />
einfarbigen Seidentops und Blousons als legitimer<br />
Nachfolger Jil Sanders – ein Ehrentitel, den auch<br />
das deutsch- vietnamesische Duo Perret Schaad schon<br />
verpasst bekam. Ein Grund, warum ausgerechnet<br />
HIEN LE<br />
Der Laote gab sein<br />
Debüt 2011 auf der Berliner<br />
Fashionweek. Er macht<br />
elegante Mode mit simplen<br />
Schnitten und wird mit<br />
Jil Sander verglichen, die als<br />
deutsche Designerin nach<br />
außen immer noch die größte<br />
Strahlkraft besitzt<br />
Einwanderer den Schritt in die Selbstständigkeit<br />
wagen, sieht Derya Issever, eine Hälfte von Issever<br />
Bahri, in deren weniger ausgeprägtem Sicherheitsdenken.<br />
„Man muss relativ sorglos an eine Label-Gründung<br />
herangehen, es einfach machen. Die Sicherheit,<br />
einen festen Job zu haben, kennen viele Migranten<br />
der zweiten Generation nicht. Und so wachsen auch<br />
ihre Kinder ohne dieses Bedürfnis auf.“<br />
Was nur von Vorteil sein kann. Denn selbst internationaler<br />
Erfolg, wie ihn das deutsch-französische<br />
Duo Augustin Teboul oder Issever Bahri haben, garantiert<br />
kein akzeptables Auskommen. Derya Issever und<br />
Cimen Bahri haben Nebenjobs, Annelie Augustin und<br />
Odély Teboul sind auf Zuschüsse ihrer Familien angewiesen<br />
und auf Preisgelder der Wettbewerbe, die sie<br />
99<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
Report<br />
MYKITA<br />
2003 gründeten vier<br />
Freunde die Berliner<br />
Brillenmanufaktur,<br />
die ihre Brillen heute<br />
in über 60 Ländern<br />
verkauft. Die Besonderheit:<br />
Die Modelle<br />
kommen ohne Lötund<br />
Schraubverbindungen<br />
aus<br />
regelmäßig gewinnen. „Deutschland ist keine Modenation“,<br />
fasst Annelie Augustin das Problem zusammen.<br />
Augustin Teboul verkaufen, wie viele junge deutsche<br />
Designer, einen Großteil ihrer Sachen in Asien (in ihrem<br />
Fall in Hongkong) und den USA. „Wenn wir merken,<br />
dass der amerikanische Markt gut für uns läuft,<br />
stellen wir uns schon die Frage, ob wir unsere Kollektion<br />
nicht lieber in New York zeigen als in Berlin.“ So<br />
wie Hugo Boss. Aber auch die wenigen anderen Großen<br />
der deutschen Mode zeigen ihre Kollektionen lieber<br />
im Ausland: Jil Sander in Mailand, Wolfgang Joop<br />
in Paris.<br />
LABELS, DIE ZWISCHEN diesen deutschen Klassikern<br />
und den Newcomern angesiedelt sind, wie Kaviar<br />
Gauche oder Lala Berlin, seit mehr als zehn Jahren<br />
erfolgreich, treten ein wenig auf der Stelle. „Für<br />
Investoren sind die Berliner Labels zu nischig und besitzen<br />
zu wenig Strahlkraft“, sagt Modeexpertin Döpp.<br />
„<strong>Das</strong> funktioniert nicht.“<br />
Anders als die Londoner oder New Yorker Modemacher:<br />
Ende 2013 stieg mit LVMH der größte Luxuskonzern<br />
der Welt beim Unternehmen des 30-jährigen<br />
Iren J. W. Anderson ein – gerade fünf Jahre nach<br />
SASKIA DIEZ<br />
Die Münchner<br />
Schmuckdesignerin<br />
verkauft ihre<br />
Kollektionen von<br />
Japan bis Kanada.<br />
<strong>Das</strong> Design ist<br />
klar, verspielt sind<br />
jedoch oft die<br />
Hängungen<br />
dessen Unternehmensgründung. Nur kurz zuvor hatte<br />
LVMH Anteile des Labels des britischen Schuhdesigners<br />
Nicholas Kirkwood und des New Yorkers Joseph<br />
Altuzarra gekauft, genau wie LVMHs direkter Konkurrent<br />
Kering beim schottischen Womenswear-Designer<br />
Christopher Kane. Diese relativen Newcomer sind nun<br />
auf dem besten Weg dahin, international bedeutende<br />
Modehäuser zu werden.<br />
Der Wegzug vom Label Achtland erscheint in diesem<br />
Licht konsequent. Nach nur drei Jahren, in denen<br />
Thomas Bentz und Oliver Lühr die Marke in Berlin aufgebaut<br />
hatten, zogen die Lieblinge der Modepresse zurück<br />
nach London. Als Grund gaben die beiden an, in<br />
Berlin keine internationale Plattform und Zugang zu<br />
internationalen Einkäufern gefunden zu haben. London<br />
dagegen hat in den vergangenen Jahren weltweit<br />
100<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Fotos: Mykita(2), Martin Fengel/Saskia Diez, Julian Baumann, Joachim Bessing (Autorin)<br />
anerkannte Designer wie Peter Pilotto, Mary Katrantzou<br />
und Erdem hervorgebracht, die heute zum Beispiel<br />
bei Saks Fifth Avenue in den USA verkaufen. Die<br />
einzigen deutschen Labels, die exklusive amerikanische<br />
Kaufhäuser führen, heißen Escada und Hugo Boss,<br />
dazu kommen die Abendroben von Talbot Runhof.<br />
Die Zeiten, in denen Escada das weltweit größte<br />
Damenmodeunternehmen und das Juwel in der Krone<br />
deutscher Damenmode war und von Prinzessin Diana,<br />
Kim Basinger oder Demi Moore getragen wurde, sind<br />
nur noch blasse Erinnerung. Hugo Boss immerhin<br />
schafft sich mit der Verlegung seiner Modenschauen<br />
nach New York und der Verpflichtung des Amerikaners<br />
Jason Wu einen stetig wachsenden internationalen<br />
Nimbus.<br />
Aber vor allem eine Marke steht wie keine andere<br />
für deutsche Mode. In dem kürzlich erschienenen Band<br />
„German Fashion“ ( Prestel ) antworten die meisten der<br />
befragten deutschen Stylisten, Designer und Redakteure<br />
auf die Frage, was ihnen zu „deutscher Mode“<br />
einfällt: Jil Sander. <strong>Das</strong> Label, das seit dem privat begründeten<br />
Abgang seiner Gründerin unter der kreativen<br />
Führung des langjährigen Prada-Designers Rodolfo<br />
Paglialunga steht, ist seit den neunziger Jahren<br />
Synonym für aufgeräumte, zeitlose und doch elegante<br />
Mode, die zum nüchternen Image des Landes und seiner<br />
Bewohner passt. Ein klares Profil, das den meisten<br />
anderen Labels zu fehlen scheint.<br />
IM SELBEN BUCH antworten die Betreiber der Berliner<br />
Luxusboutique The Corner, Emmanuel de Bayser<br />
und Josef Voelk, auf die Frage, warum sie keine deutschen<br />
Labels führen: „Wir wählen die Marken aus, die<br />
eine sehr präzise Identität haben – was uns bei vielen<br />
Designern aus Berlin ein wenig fehlt.“ Es mangelt also<br />
an Alleinstellungsmerkmalen. <strong>Das</strong> ist auch Suzy Menkes<br />
aufgefallen, der weltweit wichtigsten Modekritikerin:<br />
„Wenn ich nach Berlin komme, suche ich was<br />
ganz anderes als in Paris und London“, sagt sie. Und<br />
das scheint es noch nicht so richtig zu geben. Während<br />
Antwerpen nach wie vor für avantgardistische Mode<br />
steht, die ein halbes Dutzend Designer wie Walter Van<br />
Beirendonck, Ann Demeulemeester und Dries Van Noten<br />
Anfang der Achtziger von der Antwerp Royal Academy<br />
of Fine Arts aus zum Markenzeichen belgischer<br />
Mode machten, hat deutsche Mode bislang noch kein<br />
Alleinstellungsmerkmal gefunden.<br />
Anders sieht es da schon bei Accessoires aus: Der<br />
Schmuck von Sabrina Dehoff und Saskia Diez ist in<br />
Shops von Japan bis Kanada erhältlich, die Tücher<br />
von Vonschwanenflügelpupke im New Yorker Kaufhaus<br />
Saks, die opulenten, im Erzgebirge herstellten<br />
henkellosen Abendtaschen von Katrin Langer auf der<br />
Website Moda Operandi, die von der Münchnerin Ayzit<br />
Bostan designten Taschen für pb 0110 im superhippen<br />
Pariser Store „The Broken Arm“. Die Brillenfirma Mykita<br />
hat sogar eigene Läden in New York, Tokio, Mexiko<br />
und Kolumbien.<br />
Zu Agency Vs erfolgreichsten Marken in New York<br />
gehört dann auch Nomos Glashütte. Die Firma stellt<br />
erschwingliche mechanische Uhren her. „Sie machen<br />
das, was man von deutschem Design erwartet“, sagt<br />
Döpp. „Langlebiges Handwerk, das nüchtern ist und<br />
visuell trotzdem spannend.“ Genau das, wofür Jil Sander<br />
bis heute steht. „Darin sind wir gut und das nimmt<br />
man uns auch ab.“<br />
Vielleicht hilft in Sachen der großen Mode ein<br />
Blick nach London: Genau 30 Jahre ist es her, dass<br />
der British Fashion Council gegründet wurde, mit dem<br />
Ziel, die Entwicklung des britischen Modedesigns voranzutreiben.<br />
Mittlerweile zählt die London Fashion<br />
Week zu den Big Four, den vier wichtigsten Modewochen<br />
der Welt. Berlins eher bescheidene Fashion Week<br />
hingegen befindet sich gerade mal im achten Jahr ihres<br />
Bestehens.<br />
Derweil baut sich der Camp-David-Konzern Clinton<br />
im brandenburgischen Hoppegarten eine 57 Millionen<br />
Euro teure Europazentrale.<br />
ANNE WAAK<br />
ist freie Autorin<br />
und trägt<br />
selbst kaum<br />
deutsche Mode<br />
Anzeige<br />
Von der zärtlichen<br />
Verteidigung der Vernunft<br />
Was passiert, wenn der kleine Prinz erwachsen wird?<br />
Emile Vigneron denkt die Geschichte vom kleinen<br />
Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry weiter und<br />
lässt den großen Prinzen Geschichten erzählen über<br />
die Orte, Begegnungen und Erlebnisse während seiner<br />
langen Reise in einer globalisierten Welt.<br />
www.gtvh.de<br />
GÜTERSLOHER<br />
VERLAGSHAUS<br />
Emile Vigneron<br />
DER GROSSE PRINZ<br />
Wenn der kleine Prinz<br />
erwachsen wird<br />
160 Seiten / Halbleinen<br />
15 farbige Illustrationen von Peter Menne<br />
€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) / CHF* 21,90<br />
ISBN 978-3-579-07079-7<br />
*empf. Verkaufspreis
STIL<br />
Etikette<br />
GIB MIR MEIN<br />
SIE ZURÜCK!<br />
Unsere Gesellschaft<br />
ist völlig verduzt.<br />
Doch die kollektive<br />
Du-Anrede ist eine<br />
Maskerade, hinter<br />
der sich Verachtung<br />
verbirgt<br />
Von HOLGER FUSS<br />
Illustration SERAFINE FREY<br />
Ein Kollege hatte mich unlängst zu<br />
einem Geburtstagsbarbecue am<br />
Elbufer mitgenommen. Ich war weder<br />
eingeladen noch kannte ich jemanden.<br />
Der Gastgeber wurde 49, wendete<br />
in sommerlichen Dreiviertelhosen und<br />
Sandalen die Steaks auf dem Rost und<br />
begrüßte mich leutselig mit: „Ich bin der<br />
Bernd!“ Ich entbot meine Geburtstagswünsche<br />
und antwortete: „Ich bin der<br />
Herr Fuß!“ Die Vorteile waren dreierlei.<br />
Erstens hatte die ansonsten dahinplätschernde<br />
Gesellschaft ihren running<br />
gag. Zweitens konnte sich die Gästeschar<br />
meinen Namen nachdrücklicher einprägen.<br />
Drittens erfuhr ich umgekehrt lauter<br />
Vornamen, an denen ich das Hamburger<br />
Sie ausprobieren konnte: „Silke, darf ich<br />
Ihnen noch Wein nachschenken?“<br />
Eine Art Volksbelustigung durch paradoxe<br />
Intervention. Üblicherweise neigt<br />
die Generation der Babyboomer, neigen<br />
die Endvierziger und Anfangfünfziger<br />
zum formlosen Umgang miteinander. Sie<br />
marinieren den zwischenmenschlichen<br />
Verkehr in einer Duz-Soße, der schwer<br />
zu entkommen ist. <strong>Das</strong> vertrauliche Ankumpeln<br />
zwischen einander wildfremden<br />
Erwachsenen bei privaten Geselligkeiten<br />
gehört zu den gemäßigten Ausschreitungen<br />
in Sachen Etikettenignoranz.<br />
Weitaus fahrlässiger mutet es an, wie<br />
sich im öffentlichen Raum eine Duz-Hegemonie<br />
ausbreitet. Bei den gut 6000 Reklamekontakten,<br />
die ein Institut pro Tag<br />
und Kopf ermittelt hat, werden wir immer<br />
öfter in der zweiten Person Singular<br />
angesprochen. Ein Smartphone behauptet:<br />
„In dir steckt mehr, als du denkst.“<br />
Eine Bausparkasse tönt: „Du kaufst den<br />
Luxus, dich über alles aufzuregen – nur<br />
nicht über steigende Energiepreise.“ Ein<br />
102<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
schwedisches Möbelhaus mahnt: „Wann<br />
hast du eigentlich das letzte Mal deine<br />
Matratze ausgewechselt?“ Als Besucher<br />
einer deutschen Filiale des Unternehmens<br />
hören wir aber schon mal eine<br />
Lautsprecherdurchsage: „Gesucht wird<br />
der Halter des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen<br />
XY. Bitte melden Sie sich umgehend<br />
an der Information!“ Damit die<br />
Älteren beim flüchtigen Hinhören nicht<br />
denken, es würde nach einem Kind gesucht,<br />
wird sicherheitshalber gesiezt.<br />
IM BERUFSALLTAG nimmt das Duzen epidemische<br />
Ausmaße an. In Österreich dominiert<br />
laut einer Umfrage das Du am<br />
Arbeitsplatz zu 58 Prozent. Hierzulande<br />
dürfte es ähnlich sein. Die Verwirrung<br />
ob der Anreden ist dermaßen groß, dass<br />
Praxisratgeber kursieren. Denn, heißt es<br />
bei stil.de, „es ist heute nicht mehr so,<br />
dass man sich im Berufsleben nur noch<br />
dann duzt, wenn man sich schon länger<br />
kennt oder einander sympathisch ist“.<br />
So hat eine Nürnberger Bank vor<br />
Jahren bereits das Du zur Firmenetikette<br />
erklärt – vom Vorstandsvorsitzenden<br />
bis zum Pförtner. „Wir wollen es möglichst<br />
geschlossen tun“, gab der Bankchef<br />
vor. „<strong>Das</strong> müssen wir üben, und es wird<br />
manchmal auch zu Irritationen führen.“<br />
Wohlgemerkt, sagte der Banker: „Es handelt<br />
sich nicht um ein Sympathie-Du, sondern<br />
um einen Ausdruck von Professionalität<br />
im Sinne des englischen You.“<br />
Sattelfest scheint der Mann im Angelsächsischen<br />
nicht gewesen zu sein. You<br />
heißt übersetzt nicht Du. You ist zweite<br />
Person Plural und bedeutet Euch. <strong>Das</strong><br />
altenglische Thou, zweite Person Singular,<br />
war die ursprüngliche Duz-Form. Im<br />
13. Jahrhundert setzte sich in England als<br />
Anrede das vornehme You nach dem Vorbild<br />
französischer Hofsitten durch. <strong>Das</strong><br />
intime Thou blieb in literarischer Form<br />
etwa bei Shakespeare erhalten – und dem<br />
Zwiegespräch mit Gott, wie die Bibelübersetzung<br />
in der King-James-Version<br />
belegt: „How hast thou helped him that<br />
is without power?“, hadert Hiob mit seinem<br />
Schöpfer („Wie sehr stehst du dem<br />
bei, der keine Kraft hat?“).<br />
Kurzum, das You ist keine Umarmung<br />
von jedermann, sondern ein diskreter<br />
Nachhall vergangener Zeiten, da<br />
die Menschen einander auf schickliche<br />
Distanz hielten. In deutschen Landen<br />
Die Tyrannei<br />
der Nähe durch<br />
das Du verdanken<br />
wir der antibürgerlichen<br />
Bewegung der<br />
sechziger Jahre<br />
gingen jahrhundertelang das Ihr und das<br />
Er dem späteren Sie und Du voraus. Adel<br />
wie Klerus wurden seit dem 8. Jahrhundert<br />
ge-ihr-zt: „Erlaubt Ihr, dass ich vortrete?“<br />
Der Fürst selbst pflegte den Pluralis<br />
Majestatis: „Wir erlauben.“ Als sich<br />
im 19. Jahrhundert die ständische Gesellschaft<br />
in eine bürgerliche wandelte,<br />
wurde das Sie gebräuchlich, mithin die<br />
Anrede „Herr“, „Frau“ und „Fräulein“.<br />
Bis nach dem Ersten Weltkrieg siezten<br />
Kinder ihre Eltern.<br />
Die Tyrannei der Nähe durch das Du<br />
verdanken wir der antibürgerlichen Bewegung<br />
der sechziger Jahre. Rock ’n’ Roll<br />
und studentische Linke orientierten sich<br />
am kommunistisch-genossenschaftlichen<br />
Bruder-Du. Siezen galt als spießig, das<br />
universelle Du täuschte ein egalitäres<br />
Miteinander vor. Die Anfänge des westdeutschen<br />
Zwangs-Duzens erlebte ich in<br />
den siebziger Jahren, als die Achtundsechziger<br />
an den Schulen unterrichteten<br />
und ich meinen Lateinlehrer „Niklas“<br />
nennen sollte. Die einstigen Duz-Lehrer<br />
erteilten Zensuren. Die heutigen<br />
Duz-Vorgesetzten sind weisungsbefugt.<br />
Einmal entzog ein Journalistenkollege<br />
seinem Chef aus Protest das Du – und<br />
wurde kurz darauf entlassen.<br />
Unsere verduzte Gesellschaft ist<br />
eine Simulation. Wir spüren die sinkende<br />
Temperatur im täglichen Konkurrenzkampf.<br />
Mit dem Du wollen wir uns<br />
Freundlichkeit, Vertraulichkeit und Nestwärme<br />
vorgaukeln. Dahinter verbirgt<br />
sich die Lebenslüge einer Generation.<br />
Die Babyboomer regieren das Land –<br />
in Wirtschaft, Politik, Kultur. Es sind die<br />
Plusminusfünfzigjährigen, die sich weigern,<br />
erwachsen zu werden. Obwohl<br />
sie Kinder haben, leitende Positionen<br />
einnehmen und erste Altersbeschwerden<br />
beklagen, delirieren sie beharrlich, jung<br />
zu sein. Frauen lassen sich liften, betagte<br />
Kerle laufen in Kapuzenjacken herum.<br />
Wer von Berufs wegen Krawatte trägt,<br />
gibt eine Zwangslage zu erkennen – wie<br />
in einen Konfirmationsanzug genötigt.<br />
Derlei Dresscodes verraten, dass<br />
die Babyboomer noch immer so tun, als<br />
hätten sie mit der Welt der Erwachsenen<br />
nichts gemein. Mit den gesellschaftlichen<br />
Widersprüchen, der sozialen Kälte,<br />
dem Raubbau an der Natur. Es wird Zeit,<br />
dass meine Generation akzeptiert, dass<br />
sie selbst verantwortlich ist für die Verwahrlosung<br />
der Sitten.<br />
Zu den Prototypen der Peter-Pan-<br />
Fraktion gehören der TV-Komiker Stefan<br />
Raab, 47, und der Kulturstaatssekretär<br />
Berlins, Tim Renner, 49. Der vormalige<br />
Musikmanager mit dem Gestus des ewigen<br />
Halbstarken sagt: „Facebook ist für<br />
mich der Kontakt zur Groundcontrol.“<br />
In seiner Behörde arbeitet er an behaglichen<br />
Umgangsformen: „Selbst das für<br />
die Musikbranche notorische Duzen haben<br />
wir in der Verwaltung übernommen.<br />
Wir duzen uns zwar noch nicht alle, sind<br />
aber auf dem besten Wege.“<br />
MEINE ALTERSKOHORTE nennt solch eine<br />
Haltung modern. Tatsächlich steckt hinter<br />
der vermeintlichen Lockerheit ein<br />
verächtlicher Brutalismus. Wir schauen<br />
auf andere Menschen herab wie auf<br />
uns selbst. <strong>Das</strong> Gespür für menschliche<br />
Größe ist uns abhandengekommen. Deshalb<br />
gehen wir achtlos miteinander um,<br />
halten uns für affektgesteuerte Gestalten,<br />
die mutlos auf Verbraucherrechte pochen.<br />
Deshalb entfährt uns das Du.<br />
Eine Rekultivierung des Sie wäre ein<br />
aufschlussreiches kollektives Exerzitium.<br />
Wir kämen raus aus der unechten Nähe<br />
und würden einen wohltuenden Abstand<br />
schaffen, einen Spielraum für unsere<br />
Wahrnehmung, um das Andersartige<br />
beim Mitmenschen zu entdecken. Es<br />
könnte ein Trainingslager sein, um zu lernen,<br />
von Sterblichen wieder grandios zu<br />
denken und Respekt zu empfinden. Ich<br />
kenne Menschen, die das tun. Es sind<br />
Menschen, die gerne siezen.<br />
HOLGER FUSS empfindet als Norddeutscher<br />
seit jeher schon ein Unbehagen wider unpassende<br />
Vertraulichkeiten<br />
103<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
STIL<br />
Kleiderordnung<br />
WARUM<br />
ich trage,<br />
WAS<br />
ich trage<br />
HATICE AKYÜN<br />
Wenn ich als Kind in die Moschee<br />
in Duisburg ging, ließ<br />
ich meine deutsche Welt draußen.<br />
Ich ging mit einem Kopftuch hinein.<br />
Es störte mich nicht, weil das Kopftuch<br />
für mich nichts Bedrohliches hatte.<br />
Meine Großmutter trug eines, meine Mutter<br />
auch. Sobald ich aber raus aus der Moschee<br />
war, zog ich es mir vom Kopf und<br />
stopfte es in meine Tasche. In der Schule<br />
trug ich es nie, das wurde auch nicht von<br />
mir verlangt. Auch meine Schwestern<br />
trugen nur in der Moschee Kopftücher.<br />
Irgendwann wollte mein Vater, dass ich<br />
mich mehr auf die Schule konzentriere.<br />
So ging ich nach der Schule nicht mehr in<br />
die Moschee, und das Kopftuch war damit<br />
auch aus meinem Leben verschwunden.<br />
Ich trage es nur noch, wenn ich Festlichkeiten<br />
in der Moschee besuche, wie<br />
religiöse Trauungen oder das Ende der<br />
Fastenzeit. Junge Frauen tragen heute ihr<br />
Kopftuch mit Stolz. Es ist einerseits ein<br />
Zeichen von Religiosität und andererseits<br />
ihr wichtigstes modisches Accessoire.<br />
Ich bin mit vier Schwestern in einer<br />
türkischen Familie in Deutschland groß<br />
geworden. In der türkischen Gesellschaft<br />
werden Mädchen sehr feminin erzogen.<br />
Wir waren immer von vielen weiblichen<br />
Verwandten umgeben. Ich wuchs mit dieser<br />
Femininität auf. Meine Schwestern<br />
und ich haben schon mit zehn Jahren gelernt,<br />
einen Kajalstift zu benutzen oder<br />
uns mit einem Faden die Augenbrauen<br />
zu zupfen. Wenn man als Mädchen mitbekommen<br />
hat, dass man seine Weiblichkeit<br />
ausleben darf, geht man als Frau im<br />
Erwachsenenalter ganz anders damit<br />
um. Als ich studierte, haben meine deutschen<br />
Freundinnen nicht besonders auf<br />
sich geachtet. Sie trugen weite T-Shirts<br />
und Schlabberhosen, während ich sehr<br />
Hatice Akyün, 45, ist eine deutsche<br />
Autorin und Journalistin.<br />
Ihr Buch „Einmal Hans mit scharfer<br />
Soße“ wurde zum Kinoereignis.<br />
Diesen Monat erscheint ihr viertes<br />
Buch „Verfluchte anatolische<br />
Berg ziegenkacke“<br />
darauf bedacht war, wie ich aussah. Da<br />
war ich natürlich mit meinen offenen<br />
Haaren und hohen Schuhen immer die<br />
Exotin. Mit meiner Kleidung lebte ich<br />
auch meine Emanzipation aus. Weiblich<br />
und selbstbewusst.<br />
Ich habe nicht viele Kleidungsstücke,<br />
aber alles, was ich besitze, jedes Paar<br />
Schuhe und jedes Kleid, kann eine Geschichte<br />
erzählen. Ich kann meinen Kleiderschrank<br />
aufmachen, ein Kleid sehen<br />
und sagen: 1997, Fifth Avenue, ich war<br />
mit diesem Mann zusammen, und es war<br />
der schönste Sommer meines Lebens. Ich<br />
habe Respekt vor meinen Kleidern, denn<br />
sie bewirken etwas, sie lösen Erinnerungen<br />
in mir aus. Für besondere Anlässe<br />
liebe ich den ganz großen Auftritt und<br />
bereite ihn strategisch vor. <strong>Das</strong> ist das<br />
Türkische an mir. Alles muss passen:<br />
<strong>Das</strong> Auto muss vorfahren, der Gang über<br />
den roten Teppich, die Ausstrahlung, die<br />
Körperhaltung und das Lächeln müssen<br />
stimmen. Vornehme Zurückhaltung zeigt<br />
man im Verhalten, nicht im Auftreten.<br />
Peinlich angezogen fühlte ich mich nie.<br />
Vieles würde ich heute nicht mehr tragen,<br />
aber jedes meiner Outfits entsprach zu<br />
seiner Zeit meinem Lebensgefühl.<br />
Aufgezeichnet von LENA BERGMANN<br />
Foto: Heike Steinweg<br />
104<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
„ Der Georgier ist<br />
der Fuck-off-Genießer<br />
vor dem Herrn. <strong>Das</strong><br />
kannst du wirklich mit<br />
Italien vergleichen “<br />
Die Schriftstellerin Nino Haratischwili über ihr Heimatland Georgien, dessen Geschichte im<br />
20. Jahrhundert sie in einem <strong>neue</strong>n 1300-Seiten-Roman erzählt, Seite 108<br />
105<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
DIE WERTARBEITERIN<br />
Die <strong>neue</strong> Chefin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, will Fernsehen und Internet<br />
dauerhaft kritisch begleiten. Früher ließ sie sich von der Staatsmacht wegtragen<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
Foto: Frank Schoepgens für <strong>Cicero</strong><br />
Ob Kurt Krömer einmal im Jahr<br />
nach Marl wallfahrt, vielleicht<br />
mit Bastian Pastewka und Christian<br />
Ulmen, Joko und Klaas im Gefolge?<br />
Die Spaßmacher haben Grund, der mittelgroßen<br />
Stadt in Nordrhein-Westfalen<br />
auf Knien zu danken, denn hier, zwischen<br />
dem Einkaufszentrum „Marler<br />
Stern“ und zwei beeindruckend hässlichen<br />
Betontürmen auf schmalem Säulenfuß,<br />
dem Marler Rathaus, residiert das<br />
Grimme-Institut. Dessen jährlich verliehener<br />
Grimme-Preis prämiert „vorbildliches,<br />
modellhaftes“ Fernsehen, und die<br />
fünf Komiker haben ihn schon erhalten.<br />
Seit Mitte des Jahres hat das Haus<br />
eine <strong>neue</strong> Herrin, erstmalig ist es eine<br />
Frau, erstmalig eine Politikerin, von den<br />
„Grünen“. So stand es zu lesen. Frauke<br />
Gerlach widerspricht: Weder habe sie ein<br />
Parteibuch noch sei sie Politikerin. Sie<br />
finde nur ihre Werte am ehesten bei den<br />
Grünen wieder. Darum arbeitete sie von<br />
1996 bis 1998 im Büro des grünen Bundestagsabgeordneten<br />
Gerald Häfner und<br />
war die vergangenen 15 Jahre Justiziarin<br />
und stellvertretende Geschäftsführerin<br />
der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer<br />
Landtag. <strong>Das</strong>s sie nun bei Marl eine<br />
Bleibe sucht, hängt eher mit der Medienkommission<br />
des Landes zusammen. Die<br />
gebürtige Kielerin stand dem Gremium,<br />
das auch über die Belegung der Senderplätze<br />
im Kabelfernsehen entscheidet,<br />
seit 2005 vor. Damals nannte sie längst<br />
einen Fernseher ihr Eigen.<br />
Zuvor, in den wilden achtziger Jahren,<br />
hatte sie gegen die Einführung des<br />
Privatfernsehens unterschrieben. Und<br />
gegen den Nato-Doppelbeschluss, zu<br />
dessen Verhinderung sie im niedersächsischen<br />
Nordenham einen Platzverweis<br />
in Kauf nahm. „Ich war in einer Bezugsgruppe,<br />
so hieß das damals. Wir hatten<br />
trainiert, wie man sich wegtragen lässt.“<br />
Ein Mensch der Bewegungen sei sie, nicht<br />
der Parteien. Freiheit ist ihr wichtiger als<br />
Linientreue. Sie will wissen, diese groß<br />
gewachsene Frau mit der Wuschelfrisur<br />
und dem verschmitzt zu nennenden Lächeln,<br />
wie „politische Steuerungsprozesse“<br />
funktionieren. <strong>Das</strong> Studium der<br />
Jurisprudenz sollte Klarheit schaffen.<br />
Gerlachs Überzeugungsgerüst lautet:<br />
Gesetze brauchen Normen, Systeme<br />
brauchen Regeln und Gesellschaften<br />
Werte. Im Bereich der digital zugespitzten<br />
Medien erweisen sich Gesetze zunehmend<br />
als stumpf. In ihrer Dissertation<br />
von 2011 folgerte sie, dass „in Zeiten<br />
des Internets“ komplexe Prozesse weniger<br />
vom Recht als von Geld und Macht<br />
gesteuert werden. Ergo – da schließt sich<br />
der Kreis zu Marl – muss die Gesellschaft<br />
sich ihrer Werte gewiss sein. <strong>Das</strong> Recht<br />
allein kann die Normen des Zusammenlebens<br />
weder retten noch hervorbringen.<br />
FRAUKE GERLACH will deshalb das<br />
Grimme-Institut zu einem Ort des permanenten<br />
Mediendiskurses machen.<br />
Qualität bedeute nicht nur, dass eine<br />
Fernseh- oder Onlineproduktion handwerklich<br />
herausrage – „Man kann auch<br />
eine Hinrichtung gut erzählen“ –, Qualität<br />
bedeute auch, Werte einzuhalten,<br />
Menschen nicht herabzusetzen, Minderheiten<br />
nicht zu kujonieren. Es wäre ein<br />
Gang zurück zu den Quellen, verdankt<br />
sich doch der 1961 ins Leben gerufene<br />
Grimme-Preis einer medienpädagogischen<br />
Initiative des deutschen Volkshochschul-Verbands.<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> Medium sollte<br />
einen Qualitätslotsen bekommen.<br />
Der Kielerin ist es wichtig, das Fernsehen<br />
ebenso wie das Internet kritisch<br />
zu begleiten. „Wir müssen die gesellschaftliche<br />
Entwicklung, die mit gewissen<br />
Formaten einhergeht, beobachten“ –<br />
„Dschungelcamp“ und „Bachelorette“<br />
dürfen sich auf Marler Seitenblicke<br />
freuen, jenseits von Grimme-Preis und<br />
Grimme Online Award.<br />
Zentral für diese Neupositionierung<br />
als immerwährender Ständetag der audiovisuellen<br />
Medien soll eine Kooperation<br />
mit einer renommierten nordrhein-westfälischen<br />
Universität sein.<br />
Landesmittel von 200 000 Euro jährlich<br />
stehen bereit, „um den Themenschwerpunkt<br />
‚Medien und Gesellschaft im digitalen<br />
Zeitalter‘ zu bearbeiten“. Doktoranden<br />
sollen sich künftig in Marl<br />
tummeln, dessen Ruf lauter als bisher in<br />
der Hochschullandschaft erschallen darf.<br />
Frauke Gerlach schlägt Pflöcke ein.<br />
Grenzen der Ideen gibt es kaum,<br />
Grenzen des Machbaren sehr wohl. Auf<br />
Rosen ist das Institut mit seinen 33 Mitarbeitern<br />
nicht gebettet. Hoffnungsfroh<br />
stimmt Frauke Gerlach, dass es seit diesem<br />
Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen<br />
mit 1,12 Millionen Euro institutionell<br />
statt projektbezogen gefördert wird. Seit<br />
Juli ist auch eine jährliche Förderung von<br />
850 000 Euro durch die Landesanstalt<br />
für Medien festgeschrieben. Eine „kurzund<br />
mittelfristige Planungssicherheit“ sei<br />
gegeben bei insgesamt „sehr knapp bemessener<br />
finanzieller Ausstattung“.<br />
Der Frau, der es um Freiheit, um<br />
Werte, um Normen im Angesicht der<br />
Flimmerschirme geht, kommt am leichtesten<br />
das Wort Struktur über die Lippen.<br />
„Ich bin ein Strukturmensch“, sagt<br />
sie am Ende eines Marler Nachmittags,<br />
sie verwandle gerne Unordnung in Ordnung.<br />
Strukturen sorgten für einen „ganz<br />
alten Wert“, für Verlässlichkeit. Womit<br />
der Wert aller Werte benannt wäre.<br />
ALEXANDER KISSLER studierte<br />
Medienwissenschaft, nicht Jura, um ebenso<br />
den Strukturen der Welt auf die Spur zu kommen.<br />
Heute leitet er das Ressort Salon<br />
107<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
TIFLIS? POTI? HAUPTSACHE ITALIEN<br />
Die Schriftstellerin Nino Haratischwili stammt aus Georgien und schreibt auf Deutsch.<br />
Ihr <strong>neue</strong>r Roman rückt Europa auf 1300 Seiten zurecht und vermisst das 20. Jahrhundert<br />
Von FRÉDÉRIC SCHWILDEN<br />
Wir sitzen in Hamburg auf einer<br />
Bank vor einem Café. Es regnet,<br />
als wolle die Welt untergehen.<br />
Dicke Tropfen, die fast wehtun,<br />
wenn sie den Kopf treffen. Zum Glück<br />
sind da Sonnenschirme. Und zum Glück<br />
macht Nino Haratischwili das Ganze<br />
nichts aus. Wahrscheinlich ist sie ein Regenmensch.<br />
Es raucht sich einfach besser,<br />
wenn es regnet.<br />
Also raucht sie und trinkt einen Latte<br />
macchiato und eine Rhabarberschorle.<br />
Am 1. September erscheint ihr dritter<br />
Roman „<strong>Das</strong> achte Leben (Für Brilka)“.<br />
Auf 1280 Seiten legt Haratischwili eine<br />
106 Jahre dauernde georgische Familiengeschichte<br />
vor. Eine Chronik über das<br />
Jahrhundert der größten, der schrecklichsten<br />
und wichtigsten Umstürze.<br />
Zum Teil ist es ihre Geschichte. „Autobiografisch,<br />
das möchte ich klarstellen,<br />
ist dieser Roman nicht“, sagt sie. Dennoch<br />
ist es unumgänglich, die eigene<br />
Geschichte zu erzählen, wenn man die<br />
Geschichte des Landes, aus dem man<br />
stammt, erzählen will. 1983 wird Nino<br />
Haratischwili in der Hauptstadt Tiflis geboren.<br />
Diese liegt für den Kontinentaleuropäer<br />
ebenso wie etwa die Hafenstadt<br />
Poti irgendwo drüben im Osten. Ein nicht<br />
greifbares Land, arm vielleicht. Tatsächlich<br />
ist Georgien die Schnittstelle zwischen<br />
Europa und Asien.<br />
In ihrem Buch schreibt sie viele Sätze<br />
über Georgien, Sätze, die kurz, aber stark<br />
sind. „Ich finde“, schreibt sie, „dass unser<br />
Land durchaus sehr komisch sein kann<br />
(nicht nur tragisch, will ich damit sagen).“<br />
Sie erzählt die Entstehungsgeschichte<br />
Georgiens: Auf einem Jahrmarkt hatten<br />
die Menschen einst um die Gunst Gottes<br />
buhlen müssen. Wer am lautesten schrie,<br />
durfte sich ein Land aussuchen. Ein Mann<br />
mit Bart und Wampe, der bereits Wein<br />
intus hatte, verschlief die Aufteilung der<br />
Erde. Gott weckte ihn und wollte wissen,<br />
warum der Mann kein Interesse an einem<br />
eigenen Land habe. Der Mann antwortete,<br />
er sei zufrieden, die Sonne scheine,<br />
er begnüge sich mit dem, was übrig bleibt.<br />
Gott hatte als Urlaubssitz für sich den<br />
schönsten Fleck der Erde zurückbehalten.<br />
Mit Flüssen, Wasserfällen, Früchten<br />
und „dem besten Wein der Welt“ – das<br />
schreibt Haratischwili wirklich –, und so<br />
erhielt der dicke Mann Georgien.<br />
„<strong>Das</strong> achte Leben“ besteht aus sieben<br />
einzelnen Büchern, die die Namen<br />
der Protagonisten tragen. „Buch 1 – Stasia“<br />
oder „Buch 3 – Kostja“. <strong>Das</strong> letzte<br />
Buch heißt „Buch 8 – Brilka“ und besteht<br />
aus drei weißen Seiten. Es ist die ungeschriebene<br />
Zukunft eines jungen Mädchens.<br />
Die einzelnen Bücher springen<br />
zwischen Berlin-Wedding im Jahr 2006,<br />
Sankt Petersburg vor der Oktoberrevolution<br />
oder sonstwo in einer Welt zwischen<br />
modernem Europa und Sowjetunion.<br />
HARATISCHWILI KOMMT 1995 das erste<br />
Mal nach Deutschland. Die Mutter sucht<br />
Arbeit im Westen. In der heimatlichen<br />
Schule hatte sie Deutsch gelernt. Der Vater<br />
geht in die Ukraine. Sie bleibt zwei<br />
Jahre, Nordrhein-Westfalen, kleines Dorf.<br />
Mit 14 kehrt sie zurück nach Georgien,<br />
macht ihr Abitur. 2003 beginnt sie in<br />
Hamburg Theaterregie zu studieren. Bis<br />
heute hat Haratischwili mehr als nur eine<br />
Hand voll Preise gewonnen, den Autorenpreis<br />
des Heidelberger Stückemarkts etwa,<br />
den Adelbert-von-Chamisso-Preis, den<br />
Kranichsteiner Literaturförderpreis. Ihre<br />
Stücke werden in Deutschland und Georgien<br />
gespielt. Im November feiert „Land<br />
der ersten Dinge“ am Deutschen Theater<br />
in Berlin Premiere. Haratischwili kann<br />
nicht still sitzen. Sie muss schreiben.<br />
Der Regen prasselt noch auf die Sonnenschirme.<br />
Haratischwili ist schwarz<br />
gekleidet. Schwarze, offene Schuhe, rot<br />
lackierte Zehen, schwarzes Oberteil,<br />
schwarze Haare. Von weitem würde man<br />
vielleicht denken, sie sei eine grimmige<br />
Frau. Aber wenn sie lacht, lacht sie wie ein<br />
Hühnchen, das Geburtstag hat. „Der Georgier<br />
ist der Fuck-off-Genießer vor dem<br />
Herrn“, sagt sie und lacht. „<strong>Das</strong> kannst<br />
du wirklich mit Italien vergleichen.“ Sie<br />
redet über die Mentalitätsunterschiede<br />
zwischen Ost und West. Erklärt den Tamada,<br />
den georgischen Tischanführer, der<br />
bei Gelagen bestimmt, wann getrunken<br />
wird. Erzählt von ihrem Lieblingsgericht<br />
„Hühnchen in Walnusssauce“.<br />
Ihr dritter Roman ist eine Frage an<br />
sich selbst. Wer bin ich? Wo komme ich<br />
her? Um das zu beantworten, kartografierte<br />
Haratischwili ein ganzes Jahrhundert.<br />
Für die Recherchen besuchte sie<br />
russische Bibliotheken, Moskau („der<br />
Horror, etwas Graues, Grausames, Unfreundliches“),<br />
Sankt Petersburg („offener,<br />
freundlicher, schöner, europäischer“).<br />
Collagenartig schreibt sie<br />
manchmal. Wenn sowjetische Propagandaposter<br />
mitten im Text auftauchen.<br />
Poppig, wenn sie vom Kiffen und Pink-<br />
Floyd-Hören hinter dem Eisernen Vorhang<br />
schreibt. Historio grafisch, wenn<br />
man Zeuge von Revolutionen wird.<br />
„Wir finden einander“ … bricht die<br />
Erzählung von „Buch 7 – Niza“ ab. Nino<br />
Haratischwili hat sich gefunden. In einem<br />
großen, sprachgewaltigen Buch, das Georgien<br />
näher an Europa rückt. Von Europa<br />
schreibt die Autorin einmal als einem<br />
„Kontinent der Gleichgültigkeit“.<br />
Aber dass ihr das alles andere als egal<br />
ist, zeigt der Roman.<br />
FRÉDÉRIC SCHWILDEN ist Reporter und<br />
Autor aus Berlin. Den Bart hat er schon,<br />
an der Wampe muss er noch arbeiten, um<br />
Georgier zu werden<br />
Foto: Henning Bode für <strong>Cicero</strong><br />
108<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Gespräch<br />
„ SHAKESPEARE<br />
Thomas Ostermeier ( links )<br />
und Hartmut Lange schätzen<br />
Shakespeare – aus sehr<br />
verschiedenen Gründen<br />
110<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
ALTERT NIE “<br />
450 Jahre Shakespeare:<br />
Wie lässt sich der größte<br />
Dichter aller Zeiten<br />
entschlüsseln? Regisseur<br />
Thomas Ostermeier und<br />
Schriftsteller Hartmut<br />
Lange über Poesie,<br />
Politik und den ewigen<br />
Zwang zur Verstellung<br />
Moderation ALEXANDER KISSLER<br />
Fotos THOMAS MEYER<br />
Christian Wulff griff auf William Shakespeare<br />
zurück, um seine Zeit als Bundespräsident<br />
zu bilanzieren: „Mir ist mehr<br />
Unrecht geschehen, als ich je Unrecht<br />
getan habe.“ So drückt der tragisch<br />
scheiternde König Lear seinen gerechten<br />
Zorn gegen eine ungerechte Weltordnung<br />
aus: „I am a man more sinned<br />
against than sinning.“ Ist Wulff eine Figur<br />
von shakespearescher Größe?<br />
Hartmut Lange: Er ist es insofern,<br />
als ich mich angesichts der massiven<br />
Anwürfe der Presse gefragt habe, ob er<br />
sich nicht irgendwann am Fensterkreuz<br />
erhängt. Ansonsten hat er mit diesem<br />
Zitat immerhin gezeigt, dass er gebildet<br />
ist. Einen Shakespeare-Kenner würde ich<br />
ihn nicht nennen.<br />
Sie hingegen, Herr Ostermeier, haben<br />
den „Sommernachtstraum“, „Maß für<br />
Maß“, „Hamlet“ und „Othello“ inszeniert.<br />
Demnächst werden Sie sich „Richard<br />
III.“ vornehmen. Warum ist das<br />
Theater vernarrt in Shakespeare?<br />
Thomas Ostermeier: Ganz einfach:<br />
Weil er der komplizierteste Autor überhaupt<br />
ist.<br />
Inwiefern?<br />
Ostermeier: Seine Stücke haben sehr<br />
unterschiedliche Echoräume, die es freizulegen<br />
gilt. Ich inszeniere ihn, um ihn<br />
besser zu verstehen. Erst auf der Bühne<br />
entkleidet sich vieles, was man bei der<br />
Lektüre nicht begreift. Der dreidimensionale<br />
Raum macht es offenbar.
SALON<br />
Gespräch<br />
Was wird da offengelegt?<br />
Ostermeier: Die zwei wichtigsten<br />
Gründe für meine Lust an Shakespeare<br />
sind die politische Dimension der Stücke<br />
und die Beziehung der Figuren zum<br />
Zuschauerraum. Beides hängt zusammen:<br />
indem die Figuren wissen, dass<br />
ihnen zugeschaut wird, und indem sie<br />
sich gegenseitig dabei zugucken, wie sie<br />
sich verstellen. Der Zwang zur Verstellung<br />
kommt aus der Situation. Darin war<br />
Shakespeare ein Meister. Dieses Maskenhafte,<br />
dieses Schauspielen in der Öffentlichkeit<br />
hat eine eminent politische<br />
Bedeutung.<br />
Sie, Herr Lange, nannten Shakespeare<br />
jüngst „den Größten aller Zeiten“. Laut<br />
Ralph Waldo Emerson schrieb er den<br />
„Text des modernen Lebens“.<br />
Lange: Herr Ostermeier spricht als<br />
Mann des Theaters. Sie können aber<br />
die Stücke auch wie einen Roman lesen.<br />
Mich fasziniert er als literarisches Phänomen,<br />
da ist Shakespeare jemand, der nie<br />
altert. Er bleibt archetypisch. Er hat im<br />
16. Jahrhundert die ganze Psychopathologie<br />
der Mächtigen, aber auch die Psychopathologie<br />
des Privaten vorweggenommen,<br />
alles, was nach ihm kam, von<br />
Goethe bis Ibsen. Im Unterschied zu diesem<br />
aber hatte er einen großen Sinn für<br />
Dichtung. Shakespeare ist in Blankverse<br />
geschmiedeter Geist.<br />
Auf Blankverse wartet man in Ihren Inszenierungen<br />
vergebens. Ihr „Sommernachtstraum“<br />
von 2006 sah sich der<br />
Kritik ausgesetzt, Shakespeare sei bloß<br />
Vorwand für zappeliges Körpertheater.<br />
Ostermeier: Der „Sommernachtstraum“<br />
für das Theaterfestival Athen war<br />
ein spezielles Projekt in Zusammenarbeit<br />
mit der in Berlin lebenden argentinischen<br />
Choreografin Constanza Macras.<br />
Meine gewissermaßen seriöse Beschäftigung<br />
mit Shakespeare beginnt danach,<br />
und da spielt die Sprache eine unwahrscheinlich<br />
große Rolle. Wenn Marius von<br />
Mayenburg, Autor und Dramaturg an der<br />
Schaubühne, eine Übersetzung erstellt,<br />
versucht er immer, die Form aus dem<br />
Stoff heraus zu entwickeln, nicht umgekehrt.<br />
Ich habe eine viel zu große Demut<br />
vor und viel zu viel Bewunderung<br />
für Shakespeare, als dass ich mich einem<br />
sprachlichen Einerlei überließe. Vieles<br />
„ Mir bereitet<br />
es ein großes<br />
Vergnügen, den<br />
bildungsbürgerlichen<br />
Kanon<br />
in gegenwärtigen<br />
Welten<br />
zu inszenieren “<br />
Thomas Ostermeier<br />
bleibt unübersetzbar. Wenn Hamlet sagt,<br />
„I’m too much in the sun“, schwingt mehr<br />
mit, als wir im Deutschen ausdrücken<br />
können: der Sohn, die Sonne an sich, die<br />
Sonne als Herrschersymbol, das von der<br />
Hitze ausgetrocknete Gehirn. Wir wollen<br />
Shakespeares geistige Welt für die Ohren<br />
heutiger Zuschauer nicht vereinfachen,<br />
aber verständlich machen.<br />
Muss es deshalb Prosa sein?<br />
Ostermeier: Durch die Prosaübersetzungen<br />
sind wir näher am inhaltlichen<br />
Gehalt, als wenn wir uns an deutschen<br />
Blankversen versuchten. Die Worte<br />
in der englischen Sprache haben wesentlich<br />
weniger Silben als in der deutschen.<br />
Wenn man versucht, die gleiche<br />
Silbenanzahl im deutschen Blankvers zu<br />
bedienen, kommt es unweigerlich zu verkürzten<br />
oder sinnentstellenden Sätzen.<br />
Noch schlimmer wird es, wenn man noch<br />
den Reim am Versende einhalten will.<br />
Dies ist auch einer der Gründe, warum<br />
die klassischen Übersetzungen Shakespeares<br />
so unverständlich sind. Und wenn<br />
man im Theater nichts versteht, schaltet<br />
man nach kürzester Zeit ab.<br />
In Ihrem „Hamlet“, Herr Ostermeier,<br />
sagt Ophelia, der Prinz habe ihr „seine<br />
Zuneigung signalisiert“. <strong>Das</strong> ist flapsig.<br />
Lange: Es ist eben falsch, Shakespeare<br />
in Prosa zu übersetzen. Die Unerlöstheit<br />
seiner Figuren ist eingebunden in<br />
Sprengkapseln des Poetischen. Die Form<br />
gehört zur Substanz. Wenn Hamlet den<br />
„Sein oder Nichtsein“-Monolog in Prosa<br />
hielte, wäre er schon in einer Psychoanalyse<br />
gewesen, wo man ihm gesagt hätte:<br />
Versuchen Sie doch, vom Blankvers wegzukommen,<br />
dann geht es Ihnen besser.<br />
Nein. In den Wänden des Blankverses<br />
muss Hamlet mit sich zurechtkommen.<br />
Deshalb ist Shakespeare letztlich nicht<br />
zu übersetzen. Man muss ihn nachdichten,<br />
wie es die großen Romantiker getan<br />
haben. Dann wird er „unser Shakespare“.<br />
Darum konnte Ferdinand Freiligrath<br />
im Vormärz dichten: „Deutschland ist<br />
Hamlet.“ Jede Nacht nämlich gehe „die<br />
begrabne Freiheit um“. Haben wir Deutschen<br />
einen besonderen Bezug zu diesem<br />
gedankenvollen, tatenarmen Helden?<br />
Immerhin hat ihn ein Studium in<br />
Wittenberg zum Zauderer gemacht.<br />
Ostermeier: Marcel Reich-Ranicki<br />
sagte einmal, jede Zeit müsse ihren<br />
„Hamlet“ entdecken. Insofern ist „Hamlet“<br />
an die jeweilige Zeit und den jeweiligen<br />
Ort gebunden und nicht spezifisch<br />
deutsch. <strong>Das</strong> Zaudern möchte ich aber<br />
ein wenig in Schutz nehmen: Es ist eine<br />
entscheidende Kulturleistung, dass Hamlet<br />
immer wieder vor dem Mord zurückschreckt.<br />
Im protestantischen Wittenberg<br />
ist ihm der katholische Glaube, der<br />
in dieser Zeit auch einen großen Anteil<br />
Aberglaube hatte, ausgetrieben worden.<br />
Nun aber redet auf einmal ein Geist zu<br />
ihm und drängt zur rächenden Tat. Wie<br />
soll er sich da verhalten? Aus Hamlet<br />
spricht eine metaphysische Unsicherheit.<br />
Ihm kam das Weltbild abhanden.<br />
112<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Lange: Die Ursache des unglücklichen<br />
Bewusstseins von Hamlet – dass das<br />
Denken Feiglinge aus uns allen macht –<br />
begründet erst die Zivilisation des Menschen.<br />
Für Bertolt Brecht hingegen, der<br />
in seinen Dramen das Archetypische<br />
durch Ideologie ersetzt, war dieses Zurückschrecken<br />
vor der Tat eine logische<br />
Schwäche. Hamlet erschien ihm als Zauderer,<br />
den man in einer Parteiversammlung<br />
zur Ordnung rufen müsste.<br />
Zu den überzeitlichen Erkenntnissen<br />
gehört, was Sie so benannten: An den<br />
Dramen Shakespeares könne man studieren,<br />
„wie die Triebhaftigkeit des<br />
Menschen ( … ) ausschließlich durch das<br />
Denken pervertiert wird“. Ermuntert<br />
uns Shakespeare, weniger zu denken?<br />
Lange: Nein, es gibt da keinen Ausweg.<br />
Menschliches Existieren bleibt eine<br />
große Unvereinbarkeit. Diese Unvereinbarkeit<br />
müssen wir in eine menschenfreundliche<br />
Haltung sublimieren. Wenn<br />
wir stattdessen eine gerechtere gesellschaftspolitische<br />
Ordnung schaffen wollen,<br />
landen wir in China oder Nordkorea.<br />
Da wäre die politische Dimension perdu.<br />
Ostermeier: Shakespeare ist immer<br />
politisch. Der Soziologe Ulrich Beck<br />
prägte 2006 den Begriff der „Generation<br />
Hamlet“ und meinte die damals 30- bis<br />
40-Jährigen, die eine Welt gestalten sollen,<br />
„die auf entmutigende Weise kompliziert<br />
geworden ist“. Wie Hamlet haben<br />
sie das diffuse Gefühl, etwas sei faul,<br />
wissen aber nicht, wo der Feind steht. Sie<br />
spüren nur diesen Zwang zur Handlung<br />
in einer überkomplexen Welt.<br />
Lange: Es kommt aber nicht darauf<br />
an zu handeln, sondern ethisch, menschenfreundlich<br />
zu handeln.<br />
Ostermeier: <strong>Das</strong> Unwohlsein in Europa<br />
speist sich momentan vor allem daraus,<br />
dass die von Ihnen genannte gerechte<br />
Ordnung weit entfernt scheint.<br />
Lange: Da muss ich entgegnen: Der<br />
Mensch, der sozial befreit ist, fängt an,<br />
existenziell zu leiden.<br />
Ostermeier: Hamlet leidet, weil, wie<br />
er sagt, „the time is out of joint“. Die<br />
Übersetzung, die Welt sei aus den Fugen,<br />
trifft es nicht. Bei uns heißt es, „die Zeit<br />
ist ganz verrenkt“. Eine Zeit, ein Zeitalter<br />
kann man vielleicht – anders als die<br />
Welt – wieder einrenken.<br />
Lange: Eine solche Nachdichtung ist<br />
legitim. Grundsätzlich aber darf der Regisseur<br />
nicht im Innovationswahn versinken.<br />
Er muss wissen, dass der große<br />
schöpferische Tigersprung von Shakespeare<br />
kommt. Darum gefiel es mir nicht,<br />
Herr Ostermeier, dass in Ihrer Inszenierung<br />
von „Hedda Gabler“ die Menschen<br />
so absolut gegenwärtig waren, auch in<br />
den Kostümen. Bei Ibsen muss ich das<br />
Zeitalter von Edvard Munch vor mir sehen,<br />
muss der Tigersprung in die Frühzeit<br />
der Psychoanalyse gerichtet sein.<br />
Ostermeier: Mir bereitet es ein großes<br />
Vergnügen, den bildungsbürgerlichen<br />
Kanon in gegenwärtigen Welten zu inszenieren.<br />
Ich würde nie sagen, so muss<br />
man es machen.<br />
„ Der Wahn,<br />
innovativ sein<br />
zu müssen, ist<br />
das schlimmste<br />
Gift im Kulturbetrieb.<br />
Bitte rutschen<br />
Sie nicht in<br />
diese Fallgrube! “<br />
Hartmut Lange<br />
Als Sie „Maß für Maß“ inszenierten, die<br />
bittere Komödie über die Korruption der<br />
Macht, wurde mehr über die Schweinehälfte<br />
debattiert, die von der Bühnendecke<br />
hing, als über Shakespeare. Können<br />
kräftige Bilder den Text verdunkeln?<br />
Ostermeier: Es ist ein großes Missverständnis,<br />
wenn Sie in mir einen Exponenten<br />
des Körper- oder Bildertheaters<br />
sehen. <strong>Das</strong> bin ich nicht. „Maß für<br />
Maß“ wurde „altmeisterlich“ genannt.<br />
Der wunderbare, leider verstorbene Gert<br />
Voss gab den Herzog Vincentio und sagte<br />
danach, er habe das Stück nun erst richtig<br />
verstanden, obwohl er bereits in den<br />
achtziger Jahren in einer „Maß für Maß“-<br />
Inszenierung den Angelo gespielt hatte.<br />
Ich versuche wirklich, mich in diesen<br />
„Tigersprung“ hineinzubohren, in dieses<br />
pervertierende Denken, von dem<br />
Herr Lange sprach. „Maß für Maß“ ist<br />
mein Lieblingsstück, exemplarisch für<br />
viele Stoffe von Shakespeare: Da tritt<br />
jemand – Angelo – mit einem fast stalinistischen<br />
Veränderungswillen auf, will<br />
alles besser machen in diesem verrotteten<br />
Kleinstaat, dessen Herzog sich zurückgezogen<br />
hat. Und entdeckt plötzlich<br />
den Abgrund in sich. <strong>Das</strong> 20. Jahrhundert<br />
war voll von solchen Diktatoren der<br />
Reinheit. Um diese Perversionen zu begreifen,<br />
fängt man an zu denken, und das<br />
Denken bringt einen irgendwann um den<br />
Verstand.<br />
Lange: Wodurch Shakespeare den<br />
Nihilismus vorwegnahm. Nietzsches<br />
Diktum vom Menschen als dem „nicht<br />
festgestellten Tier“, das den Zugang zum<br />
Instinkt verloren habe und dessen Intellekt<br />
nicht in der Lage sei, die Sache zu<br />
korrigieren, findet sich bei Shakespeare<br />
vorab bestätigt.<br />
Also keine Utopie nirgends?<br />
Ostermeier: Seine Utopie war der<br />
weise Herrscher. „Maß für Maß“ hatte<br />
er zum Amtsantritt von König Jakob I.<br />
geschrieben, und in seinem letzten<br />
Stück, „Der Sturm“, hat der der Macht<br />
entsagende Zauberer Prospero, ehemals<br />
Herzog von Mailand, das letzte Wort,<br />
zerbricht den Zauberstab. Eine andere<br />
Antwort hatte er nicht.<br />
Lange: Dennoch enden die meisten<br />
Stücke nicht negativ. Es wird geschlachtet,<br />
wird gemordet, aber der Kreuzigungsgedanke<br />
und dessen Ernst fehlen.<br />
113<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Gespräch<br />
Als Theaterpraktiker wusste er, dass<br />
die Zuschauer nach Hause gehen wollen<br />
mit dem Trost, dass alles Schlimme<br />
vielleicht anders werden könnte. Der<br />
Zwang zur Utopie ist eine menschliche<br />
Notwendigkeit.<br />
<strong>Das</strong> elisabethanische Theater, schreibt<br />
Shakespeare-Biograf Hans-Dieter Gelfert,<br />
war auch „ein kommerziell betriebenes<br />
Unterhaltungsmedium wie<br />
im 20. Jahrhundert das Kino“.<br />
Ostermeier: Ich finde den Gedanken<br />
reizvoll, Shakespeare stamme aus einer<br />
katholischen Familie, in der das Katholische<br />
weiterhin gepflegt wurde oder zumindest<br />
als Sehnsucht vorhanden war. Er<br />
wäre dann in einer Zeit, in der es katholische<br />
Umsturzversuche gab und in der<br />
Katholiken in England von den regierenden<br />
Anglikanern verfolgt und ermordet<br />
wurden, gezwungen gewesen, seine Identität<br />
zu verbergen. Er hätte sich verstellen<br />
müssen – so wie sein ganzes Arsenal<br />
an Figuren, die ihre eigentliche Identität<br />
verheimlichen müssen, um überleben<br />
zu können.<br />
Lange: Sobald Sie als Dichter Gott<br />
auf die Zunge nehmen, können Sie entweder<br />
in die Kirche gehen oder nach<br />
Hause.<br />
Thomas Ostermeier<br />
Der aus Soltau stammende<br />
45-jährige Regisseur ist seit<br />
2009 alleiniger künstlerischer<br />
Leiter der Berliner „Schaubühne“.<br />
Bereits fünf Mal wurden seine<br />
Inszenierungen zum Theatertreffen<br />
eingeladen. Zuletzt führte<br />
er Regie bei Lillian Hellmans<br />
„Die kleinen Füchse“<br />
starke Zeiten für Kunst gibt. Nationalsozialismus<br />
und Stalinismus waren kunstunfähig,<br />
das Biedermeier war nicht so<br />
kunstfähig wie das Barock. Hätte Shakespeare<br />
zu Schuberts und nicht zu elisabethanischer<br />
Zeit gelebt, hätte er dieses gigantische<br />
Werk nicht vollbringen können.<br />
Ostermeier: Wie wichtig Ambivalenzen<br />
in den Figuren sind, weiß heute<br />
theoretisch jeder Drehbuchautor. Praktisch<br />
gelingt es niemandem so gut, wie<br />
es Shakespeare gelang.<br />
Zu den Ambivalenzen rechnet auch das<br />
Nebeneinander von Brutalität und Komik.<br />
Die Gewalt gebiert Monster, und<br />
die Monster treiben mit dem Entsetzen<br />
Scherz.<br />
Lange: <strong>Das</strong> ist der psychopathologisch<br />
freie Fall, an dem sich bis heute<br />
nichts geändert hat. Er setzt die eigentliche<br />
<strong>Das</strong>einsenergie frei und ist zugleich<br />
unser Verhängnis. Deswegen ist<br />
das Erschrecken Blaise Pascals für mich<br />
so wichtig: Darüber, sagt er, ob es Gott<br />
gibt, muss man nicht reden. Aber es verrät<br />
äußerste Geistesschwäche, wenn der<br />
Mensch nicht erkennt, wie groß sein<br />
Elend ohne Gott ist. Der Satz lässt sich<br />
auch atheistisch deuten, ich kann ihn<br />
unterschreiben.<br />
Es heißt bei Shakespeare auch „Die<br />
ganze Welt ist eine Bühne“.<br />
Ostermeier: Ja, „all the world’s a<br />
stage“ in „Wie es euch gefällt“. Allerdings<br />
stand als Motto über Shakespeares<br />
Globe Theater „Totus mundus agit histrionem“.<br />
<strong>Das</strong> heißt, die ganze Welt „spielt“<br />
den Schauspieler, sie zwingt zum Spiel,<br />
zu Verheimlichung und Maskerade – ein<br />
Konzept von Leben als Spiel, das in unserer<br />
puritanischen Gegenwart auf dem<br />
Altar des Authentizitätswahns geopfert<br />
wurde.<br />
John Keats zufolge liegt die Größe<br />
Shakespeares darin, dass er in allen wesentlichen<br />
Punkten Ja und Nein zur selben<br />
Zeit sagt. Macht die Ambivalenz ihn<br />
unsterblich?<br />
Lange: <strong>Das</strong> Phänomen Shakespeare<br />
ist einzigartig in seiner Totalität und seinem<br />
archetypischen Vermögen, bis heute.<br />
<strong>Das</strong> ist für mich ein Geheimnis, das kann<br />
ich nicht erklären. In Rechnung stellen<br />
müssen wir jedoch, dass es schwache und<br />
Hartmut Lange<br />
Der 1937 in Berlin geborene<br />
Schriftsteller arbeitete in der<br />
DDR als Dramaturg und<br />
schrieb Stücke, ehe er sich<br />
1965 in den Westen absetzte.<br />
Für seine tiefgründigen und<br />
lakonischen Novellen, zuletzt<br />
in dem Band „<strong>Das</strong> Haus in<br />
der Dorotheenstraße“, wurde<br />
er vielfach ausgezeichnet<br />
Können im Zeitalter der Pornokratie,<br />
des Splatter-Movies und der allgegenwärtigen<br />
Comedy überhaupt Gewalt<br />
und Komik im Sinne Shakespeares dargestellt<br />
werden?<br />
Ostermeier: <strong>Das</strong> ist das Schwierigste<br />
überhaupt. Ich habe im „Sommernachtstraum“<br />
die komischen Handwerker-<br />
und Rüpelszenen gestrichen, ebenso<br />
die Volksszenen in „Maß für Maß“. Nach<br />
400 Jahren sind viele Pointen nicht mehr<br />
zu verstehen. Die traditionelle Unfähigkeit<br />
des deutschen Theaters zum Tempo<br />
und zur Pointe tut ihr Übriges. Ungekürzt<br />
dauerten die meisten Stücke<br />
fünfeinhalb Stunden und mehr.<br />
Ebenfalls schwierig ist die Überfülle an<br />
geflügelten Worten. Der „Hamlet“ erscheint<br />
als Massenabwurfstelle von Zitaten,<br />
„es ist was faul im Staate Dänemark“,<br />
„Schwachheit, dein Name ist<br />
Weib“, „der Wahnsinn hat Methode“.<br />
Ostermeier: „Mehr Inhalt, weniger<br />
Rhetorik!“ Für den Theatermacher ist<br />
Fotos: Thomas Meyer/Ostkreuz für <strong>Cicero</strong> (Seiten 110 bis 114)<br />
114<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
das ein riesiges Problem. Im „Hamlet“<br />
habe ich deshalb „Sein oder Nichtsein“<br />
an den Anfang gesetzt und bringe den<br />
Monolog zwei weitere Male. In der Hoffnung,<br />
man hört beim dritten Mal wirklich<br />
zu und wartet nicht nur auf die berühmte<br />
Stelle.<br />
Lange: Wenn es funktioniert, ist es<br />
in Ordnung. <strong>Das</strong> Prinzip der Wiederholung<br />
ist uns aus dem Leben vertraut, wo<br />
fast alles Wiederholung ist, allerdings<br />
um den Preis der Langeweile. <strong>Das</strong> gehört<br />
zum Prinzip der Unvereinbarkeit. Dagegen<br />
hat Shakespeare aufbegehrt durch<br />
poetische Verdichtung.<br />
In der <strong>neue</strong>n Spielzeit, Herr Ostermeier,<br />
inszenieren Sie also an der „Schaubühne“<br />
den Oberschurken Richard III., den,<br />
wie Alfred Kerr ihn nannte, „heuchlerischen<br />
Metzger“, der am Ende ruft:<br />
„Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich<br />
für ein Pferd!“ Lars Eidinger, Ihr Hamlet<br />
und Angelo, wird ihn darstellen. Was<br />
erwartet uns?<br />
Ostermeier: Wir wollen uns am<br />
Globe Theater orientieren und es an der<br />
Schaubühne nachempfinden – gemäß<br />
der schönen Theorie, wonach sich Literatur<br />
erschließt über die Architektur jener<br />
Räume, für die sie geschrieben wurde.<br />
Wir werden einen Raum bauen mit drei<br />
Galerien, für 300 Zuschauer, die das<br />
Gefühl haben sollen, mit dem Arm die<br />
Schauspieler berühren zu können. Und<br />
diese werden die Anwesenheit ihres Dialogpartners,<br />
des Publikums, ständig spüren.<br />
Selbst „Sein oder Nichtsein“ war ja<br />
ein solcher Dialog mit den Zuschauern.<br />
Lange: Eine gute Idee. Sie müssen<br />
aber auch konsequent sein.<br />
Ostermeier: Inwiefern?<br />
Lange: Sie müssen es als Verfremdung<br />
ersichtlich machen. Sie müssen wissen,<br />
dass das alles gar nicht geht, und es<br />
trotzdem tun.<br />
Ostermeier: Oh ja.<br />
Lange: Es darf nicht den Hauch von<br />
Innovation geben. Der Wahn, innovativ<br />
sein zu müssen, ist das schlimmste Gift<br />
im Literatur- und Kulturbetrieb. Bitte<br />
rutschen Sie nicht in die Fallgrube des<br />
Innovativen!<br />
Ostermeier: Aber Herr Lange, ich<br />
habe selber schon genug Zweifel an meiner<br />
Arbeit. Machen Sie es mir nicht noch<br />
schwerer …! (Beide lachen. Abgang.)<br />
Anzeige<br />
LESEGENUSS BEGINNT<br />
MIT NEUG E<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo sparen<br />
Sie gegenüber dem<br />
Einzelkauf.<br />
Ohne Risiko<br />
Sie gehen kein Risiko<br />
ein und können Ihr<br />
Abonnement jederzeit<br />
kündigen.<br />
Mehr Inhalt<br />
Monatlich mit Literaturen<br />
und zweimal im<br />
Jahr als Extra-Beilage.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 18,– Euro* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 18,– Euro* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich<br />
nichts weiter zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> im Anschluss monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 93,– Euro /60,– Euro<br />
für zwölf Ausgaben pro Jahr (für Studenten bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung). Sie können die Bestellung<br />
binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte<br />
Ausgabe erhalten, nicht jedoch vor Erhalt einer Widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1<br />
Abs. 2 Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig erklärten Entschlusses,<br />
die Bestellung zu widerrufen. Sie können hierzu das Widerrufs-Muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen.<br />
Der Widerruf ist zu richten an: <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, Telefon: 030 3 46 46 56 56, E-Mail: abo@cicero.de<br />
Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit kündigen.<br />
<strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Michael Voss.<br />
*Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Meine Adresse:<br />
Vorname<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
BIC<br />
IBAN<br />
Name<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: cicero.de<br />
Unterschrift<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1140025<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
DREI<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
18,– Euro*<br />
<strong>Cicero</strong> Test
SALON<br />
Man sieht nur, was man sucht<br />
VERLIEBTEN und VERRÜCKTEN<br />
aber kocht das Hirn Von BEAT WYSS<br />
Keine Eselei: Heinrich Füssli warf mithilfe von<br />
Shakespeares „Sommernachtstraum“ einen bösen<br />
Blick auf eigene Eheangelegenheiten<br />
116<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Fotos: © Tate London 2014, Gaetan Bally/Keystone Schweiz/Laif (Autor)<br />
Was für ein erotisch<br />
harmonisches Durcheinander!<br />
Oberon hat<br />
es angezettelt. Nach<br />
einem Streit mit seiner<br />
Titania träufelte der Elfenkönig Nektar<br />
vom wilden Stiefmütterchen auf die<br />
Augen der schlummernden Gattin. In<br />
den Erstbesten, den sie beim Aufwachen<br />
zu Gesicht bekäme, soll sich Titania<br />
nun verlieben. Zu ihrem Opfer wird<br />
der brave Weber Zettel, nächtlicherweile<br />
mit Laienschauspielern auf Theaterprobe<br />
im Athener Wald unterwegs.<br />
Ihm hat Puck, der Spezi des Elfenkönigs,<br />
einen Eselskopf auf den Hals gezaubert.<br />
<strong>Das</strong>s Liebe blind macht, soll Titania<br />
lernen. Wir stehen vor Shakespeares<br />
„Sommernachtstraum“, III. Akt, erste<br />
Szene. Die nackte Schöne umschmeichelt<br />
den braven Handwerker: „Und sieh’, ich<br />
liebe dich! Drum folge mir; / Ich gebe Elfen<br />
zur Bedienung dir.“<br />
Aus allen Ecken schießt das Gefolge<br />
herbei, um ihrem Befehl zu folgen. Bohnenblüte,<br />
Spinnweb, Motte und Senfsamen<br />
sind aufgerufen, es dem Angebeteten<br />
an keiner leiblichen Gunst fehlen<br />
zu lassen. Senfsamen, der winzig kleine<br />
Elf, hat sich auf Zettels Hand gesetzt und<br />
hebt die Arme, um die Schärfe seines<br />
Gewürzes den Nüstern des Eselsköpfigen<br />
zuzufächeln. „Ihre Freundschaft hat<br />
mir schon oft die Augen übergehen machen“,<br />
erwidert Zettel des Elfen Gruß.<br />
Dem Langohr regt sich weniger Liebeslust<br />
denn Appetit auf Rinderbraten.<br />
Über dem tonigen Gemälde liegt,<br />
typisch für Heinrich Füssli, ein silbergrauer<br />
Schleier. Der Schweizer Maler<br />
erweist damit der Druckgrafik seine<br />
Reverenz und gibt einen Wink an den<br />
Füssli malte „Titania und der<br />
eselsköpfige Zettel“ 1789 für<br />
Londons Shakespeare Gallery<br />
Kunstliebhaber, seine teuren Originale<br />
seien auch als Kunstdrucke erhältlich.<br />
Der Auftraggeber von Füsslis „Midsummer<br />
Night’s Dream“, John Boydell, war<br />
denn auch ein Verleger, der mit Druckgrafik<br />
ein Vermögen gemacht hatte. Sein<br />
ehrgeizigstes Unternehmen wurde der<br />
Bau einer Bildergalerie zu Themen aus<br />
Shakespeares Dramen, für die neben<br />
Joshua Reynolds, dem Präsidenten der<br />
Royal Academy, auch Benjamin West<br />
aus Philadelphia und Füssli als prominenteste<br />
Künstler verpflichtet werden<br />
konnten.<br />
Die Gemälde dienten als Vorlagen<br />
für eine illustrierte Prachtausgabe des<br />
Gesamtwerks vom Dramatiker aus Stratford,<br />
der zu jener Zeit europaweit wiederentdeckt<br />
wurde. Die festliche Eröffnung<br />
der Shakespeare Gallery an der Pall<br />
Mall in Westminster fand am 4. Mai 1789<br />
statt. Im Sinne zufälliger Notwendigkeit<br />
fällt auf dieses Datum der feierlich begangene<br />
Vorabend von der Eröffnung der<br />
Generalstände in Versailles, mit deren<br />
Sitzung die Schockwellen der Französischen<br />
Revolution begannen.<br />
Durch das Londoner Kulturereignis<br />
sollte die Historienmalerei in England<br />
gefördert werden, die im puritanischen<br />
Land bisher kaum entwickelt war. Von<br />
der Londoner middle class begrüßt, von<br />
Hochfinanz und Gelehrten der Akademie<br />
unterstützt, war das Durchschnittspublikum<br />
schockiert von der bizarren Teufelsmalerei<br />
des „wilden Schweizers“. Auch<br />
der Adel gab sich reserviert.<br />
In Füsslis Meisterwerk treten nicht<br />
nur Figuren auf, die aus Shakespeares<br />
Feder stammen. Vom Privatleben des<br />
Künstlers souffliert ist die leichtseidig bekleidete<br />
Schöne rechts außen. Sie führt<br />
vor, wie es weiterginge, würde der Traum<br />
ewig währen. In manierlicher Pose hält<br />
Titanias weibliches Pendant einen kümmerlich<br />
greisen Affenzwerg mit langem<br />
Bart an kurzer Leine. Der 47-jährige Lebemann<br />
hatte in einer Anwandlung von<br />
midlife crisis Sophia Rawlins geheiratet.<br />
Beat Wyss<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt Kunstwissenschaft<br />
und Medienphilosophie an der<br />
Staatlichen Hochschule für<br />
Gestaltung in Karlsruhe und<br />
schreibt jeden Monat in<br />
<strong>Cicero</strong> über ein Kunstwerk<br />
und dessen Geschichte.<br />
Kürzlich erschien bei Philo<br />
Fine Arts sein Essay „Renaissance<br />
als Kulturtechnik“<br />
Die junge Frau aus der Grafschaft Somerset<br />
hatte wenig am Hut mit intellektuellen<br />
Spinnereien. Der Ehestand des<br />
Künstlers war nützlicher Schutzschild,<br />
als Füssli kurz nach der Hochzeit Mary<br />
Wollstonecraft kennenlernte, die sich in<br />
den sprühenden Exzentriker mit der früh<br />
ergrauten Löwenmähne verliebte.<br />
Der Verehrte begnügte sich, mit der<br />
Philosophin der Frauenrechte im Salon<br />
über die Revolution zu schwärmen,<br />
derweil die Gemahlin den Tee reichte.<br />
Unfair bleibt die hinterrücks gefallene<br />
Bemerkung, überliefert von Füsslis Biografen:<br />
Die Wollstonecraft sei eine „philosophische<br />
Schlampe“.<br />
Hinter dem Frühromantiker steckte<br />
eben die Avantgarde des Biedermeier.<br />
117<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Reportage<br />
DER LETZTE<br />
VORHANG<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
<strong>Das</strong> Stadttheater ist so etwas wie das<br />
Rückgrat der Kulturnation Deutschland.<br />
Aber nicht nur Geldmangel und<br />
Bevölkerungswandel bedrohen seine Existenz.<br />
Der Niedergang hat System<br />
Illustrationen MARTIN HAAKE<br />
<strong>Das</strong> Dessauer Theater ist eine überragende<br />
Einrichtung – zumindest<br />
architektonisch. Mit einer Höhe<br />
von 36 Metern zählt es zu den größten<br />
Bühnenhäusern Europas und prägt schon<br />
von weitem das Bild der Stadt; nach den<br />
Worten des Oberbürgermeisters handelt<br />
es sich denn auch um den „kulturellen<br />
Leuchtturm Anhalts“. Demnächst<br />
beginnt die 220. Spielzeit, die Tradition<br />
des Theaters ist beinahe so ehrfurchtgebietend<br />
wie seine 1938 im Zuge eines<br />
Neubaus fertiggestellte Fassade mit<br />
ihren zwölf imposanten Pilastern. Hitler<br />
und Goebbels waren damals zur Eröffnung<br />
dabei, gegeben wurde Webers<br />
„Freischütz“. 1893 war Richard Wagners<br />
„Ring“ erstmals in Dessau zu sehen gewesen,<br />
ein Jahr später kam dessen Witwe<br />
Cosima höchstpersönlich angereist, um<br />
„Hänsel und Gretel“ zu inszenieren. Die<br />
Stadt galt von da an als „Bayreuth des<br />
Nordens“.<br />
Zu DDR-Tagen gab es für Vorstellungen<br />
in dem Haus, wo anfangs noch<br />
Hilde Benjamins Schauprozesse abgehalten<br />
wurden, kaum Karten zu bekommen<br />
– trotz der knapp 1100 Plätze. Besucher<br />
aus dem ganzen Land sorgten für<br />
ausverkaufte Reihen und jubelten Stars<br />
wie Eva-Maria Hagen in „My Fair Lady“<br />
zu. So spiegelt sich in der Geschichte<br />
des Dessauer Theaters das Selbstverständnis<br />
Deutschlands als „Kulturnation“<br />
geradezu exemplarisch wider: von<br />
den Anfängen als herzogliches Hoftheater<br />
über die Zeiten kultureller Volkserbauung<br />
mit allen Höhen und Tiefen bis<br />
in die Endphase des Subventionstheaters<br />
in der ausblutenden Provinz. Denn<br />
in letzter Zeit machen die Dessauer Bühnen<br />
trotz künstlerischer Erfolge fast nur<br />
noch wegen ihrer finanziellen Misere<br />
von sich reden. Der Deutsche Kulturrat<br />
führt sie seit dem vergangenen Jahr<br />
auf seiner „roten Liste“ der bedrohten<br />
118<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
119<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Reportage<br />
Kultureinrichtungen – wie etliche andere<br />
Stadttheater auch.<br />
André Bücker war mit großen Erwartungen<br />
nach Dessau gekommen. Vor fünf<br />
Jahren wurde er aus Halberstadt als Intendant<br />
ans Anhaltische Theater berufen,<br />
für ihn ein Aufstieg von der Regional- in<br />
die Bundesliga. „Mir war schon klar, dass<br />
es auch hier nicht einfach würde. Aber<br />
dass es sich so auswächst – und vor allem,<br />
dass es von der Landesregierung ausgeht,<br />
hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Der<br />
Mittvierziger sitzt im Sweatshirt an seinem<br />
überfüllten Schreibtisch, hinter ihm<br />
ein Plakat der „Götterdämmerung“. Die<br />
Wagner-Oper hat er 2012 selbst inszeniert,<br />
die Kritiken – auch in der überregionalen<br />
Presse – waren teilweise hymnisch.<br />
Aber jetzt geht es nicht um die<br />
Kunst, sondern ums Geld: Knapp drei<br />
Millionen Euro weniger im Jahr stellt das<br />
Land Sachsen-Anhalt der renommierten<br />
Dessauer Spielstätte künftig zur Verfügung,<br />
und noch vor ein paar Monaten sah<br />
es deswegen so aus, als seien die Tage des<br />
Anhaltischen Theaters als Vier-Sparten-<br />
Haus mit Oper, Schauspiel, Ballett und<br />
Puppenbühne endgültig gezählt.<br />
DENN EINBUSSEN IN DIESER HÖHE sind<br />
eigentlich nicht zu verkraften. <strong>Das</strong> ahnte<br />
wohl auch Sachsen-Anhalts Kultusminister<br />
Stephan Dorgerloh (SPD), der Urheber<br />
des Sparbeschlusses. Sein Vorschlag:<br />
Dessau solle sich in Zukunft auf<br />
das Musiktheater beschränken und auf<br />
Schauspiel und Ballett verzichten. <strong>Das</strong><br />
brachte dem Politiker viel Kritik ein –<br />
nicht nur wegen der reichlich kühnen<br />
Vorstellung, ein Haus mit 1072 Plätzen<br />
in einer 84 000-Einwohner-Stadt praktisch<br />
nur noch mit Opern bespielen zu<br />
können. Denn auch finanziell hätte<br />
sich das kaum gerechnet: „Unser Budget<br />
liegt jetzt bei 18 Millionen Euro im<br />
Jahr. Aber wenn wir zwei Sparten abwickeln<br />
und 100 Leute entlassen, kosten<br />
wir eben immer noch 17 Millionen“,<br />
sagt Bücker. Er ist nicht der Einzige, der<br />
sich über die kulturpolitische Konzeptionslosigkeit<br />
der schwarz-roten Landesregierung<br />
ärgert. Auch viele Dessauer Bürger<br />
fühlten sich vor den Kopf gestoßen:<br />
„Schluss mit dem Sparwahn – das Theater<br />
bleibt“, hieß es auf Plakaten, die zu<br />
Hunderten an Laternenmasten in der Innenstadt<br />
hingen.<br />
Jetzt bleibt das Theater tatsächlich<br />
erhalten, zumindest bis auf Weiteres.<br />
<strong>Das</strong>s alle vier Sparten gerettet werden<br />
konnten, grenzt für deren Intendanten<br />
an ein Wunder. Bücker, dessen Vertrag<br />
im nächsten Jahr ausläuft, nennt es<br />
„eine sensationelle und nahezu unglaubliche<br />
Entscheidung des Dessauer Stadtrats“,<br />
die gekürzten Landesmittel innerhalb<br />
der nächsten vier Jahre durch<br />
knapp zehn Millionen Euro aus der eigenen<br />
Kasse zu ersetzen; tatsächlich<br />
wollten die Kommunalpolitiker, die ihre<br />
Bühnen schon bisher mit acht Millionen<br />
Euro jährlich unterstützen, auf Tanz und<br />
Schauspiel nicht verzichten.<br />
Für eine strukturschwache und von<br />
Abwanderung gebeutelte Stadt wie Dessau<br />
ist das ein finanzieller Kraftakt sondergleichen.<br />
Aber auch das Theater muss<br />
Opfer bringen: Bis 2018 fallen 50 von<br />
340 Arbeitsplätzen weg, außerdem haben<br />
sich alle Mitarbeiter auf eine Teilzeitregelung<br />
mit 10 Prozent Gehaltseinbuße<br />
eingelassen. Schauspielern, die<br />
ohnehin nur zwischen 1650 und maximal<br />
2600 Euro monatlich verdienen, verlangt<br />
solch ein Schritt einiges ab. Und<br />
die Zuschauer müssen ebenfalls Verzicht<br />
üben. „Wir bleiben zwar weiterhin<br />
ein produzierendes Ensemble in allen<br />
vier Sparten. Aber natürlich müssen<br />
wir unser Angebot einschränken“, sagt<br />
Bücker. <strong>Das</strong> heißt: weniger Aufführungen,<br />
weniger <strong>neue</strong> Inszenierungen, kleinere<br />
Produktionsbudgets.<br />
„Wir werden uns die Theaterlandschaft<br />
nicht mehr leisten können“, lautet<br />
das Credo von Sachsen-Anhalts Kultusminister<br />
Stephan Dorgerloh – entsprechend<br />
wurden auch dem Theater in Halle<br />
die Landesmittel um jährlich drei Millionen<br />
Euro gekürzt. Die Stadt an der Saale<br />
hat seit der Wende ebenfalls einen Einwohnerschwund<br />
zu verkraften, wenn<br />
auch nicht in dem Ausmaß wie Dessau.<br />
Wobei sich natürlich die Frage stellt, ob<br />
diese Abwanderung nicht eher noch verstärkt<br />
wird, wenn das kulturelle Angebot<br />
ausgedünnt wird. André Bücker hält das<br />
demografische Argument ohnehin für<br />
eine Floskel: „Seit der Wende hat Dessau<br />
40 000 Einwohner verloren, aber unsere<br />
Zuschauerzahlen sind trotzdem konstant.“<br />
Zumindest in Sachsen-Anhalt gehe<br />
es den Verantwortlichen vielmehr um einen<br />
grundlegenden Strukturwandel in<br />
der Kulturpolitik: „Man ist zunehmend<br />
daran interessiert, Dinge zu pflegen,<br />
die auch touristisch verwertbar sind“,<br />
glaubt Bücker. Also Museen, Denkmäler,<br />
Kirchen. Oder Events wie das „Lutherjahr<br />
2017“, das dem evangelischen<br />
Theologen Dorgerloh viel Zeit, Mühen<br />
und Geld wert ist.<br />
Eine Theater- und Orchesterlandschaft<br />
so wie in Deutschland gibt es<br />
auf der Welt kein zweites Mal: rund<br />
140 Stadttheater, Staatstheater und<br />
Landesbühnen; 131 klassische Orchester,<br />
dazu rund 220 Privattheater und<br />
rund 150 Theater- und Spielstätten ohne<br />
festes Ensemble. Berlin leistet sich drei<br />
Opernhäuser, aber selbst in einem Provinzstädtchen<br />
wie Anklam im östlichen<br />
Mecklenburg-Vorpommern mit seinen<br />
knapp 13 000 Einwohnern hebt sich der<br />
Vorhang einer Landesbühne. <strong>Das</strong> alles<br />
kostet viel Geld, und besonders die kommunal<br />
finanzierten Stadttheater bekommen<br />
den Spardruck zu spüren. Denn die<br />
Kultur zählt zu den sogenannten freiwilligen<br />
Aufgaben, das heißt: Auf diesem<br />
Gebiet entscheiden die Städte selbst, wie<br />
viel ihnen das Angebot für ihre Bürger<br />
wert ist. Und das hängt eben vor allem<br />
davon ab, wie viel in den Kassen noch<br />
übrig ist, nachdem die Pflichtaufgaben<br />
etwa für Hartz IV oder Kindertagesstätten<br />
erfüllt sind.<br />
WUPPERTAL ZUM BEISPIEL leistet sich<br />
unter anderem ein Opernhaus nebst<br />
88-köpfigem Sinfonieorchester. Und<br />
weil Orchestermusiker im Vergleich zu<br />
den Kollegen vom Schauspiel ziemlich<br />
gut bezahlt werden und arbeitsrechtlich<br />
hervorragend abgesichert sind, schlägt<br />
so ein Orchester ordentlich zu Buche:<br />
In Wuppertal sind es rund 6,5 Millionen<br />
Euro pro Jahr, das entspricht einem<br />
Drittel des Gesamtbudgets der kommunalen<br />
Stadttheaterbetriebe, zu denen<br />
noch Schauspiel und Musiktheater gehören.<br />
Wer in solchen Strukturen, die stark<br />
von Verwaltung, Politik und dem ewigen<br />
Spardruck geprägt sind, künstlerisch erfolgreich<br />
sein will, muss sich etwas einfallen<br />
lassen.<br />
Der jüngste Einfall an den Wuppertaler<br />
Bühnen heißt Stagione-Prinzip, was<br />
faktisch auf eine Auflösung des Opernensembles<br />
hinausläuft: Toshiyuki Kamioka,<br />
Chefdirigent der Wuppertaler Sinfoniker,<br />
120<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
„ Unser Budget liegt bei<br />
18 Millionen Euro im Jahr.<br />
Aber wenn wir 100 Leute entlassen,<br />
kosten wir eben immer<br />
noch 17 Millionen “<br />
André Bücker, Intendant am Theater Dessau<br />
will künftig für jede Opernproduktion<br />
die nötigen Sänger je nach Bedarf nur<br />
noch saisonweise anheuern. Zwar waren<br />
die meisten Opernsängerinnen und -sänger<br />
bisher auch nur über Jahresverträge<br />
an das Haus gebunden, aber es gab immerhin<br />
einen Kreis von etwa zwölf dem<br />
Haus dauerhaft verbundenen Stimmen.<br />
Damit ist jetzt Schluss, und viele wittern<br />
deshalb den kulturellen Ausverkauf.<br />
In der Zeitung Die Welt etwa hieß<br />
es: „In Wuppertal geht es also nicht um<br />
ein Stadttheater <strong>neue</strong>n, schlankeren Typs.<br />
Hier wird vielmehr eine Struktur ausgehöhlt,<br />
ohne eine <strong>neue</strong> zu schaffen.“ <strong>Das</strong><br />
Stagione-Prinzip laufe darauf hinaus,<br />
dass „auch alle paar Wochen eine billige<br />
osteuropäische Tourneebühne vorbeikommen“<br />
könne.<br />
Enno Schaarwächter, kaufmännischer<br />
Geschäftsführer der Wuppertaler<br />
Bühnen, nimmt solche Kritik durchaus<br />
ernst. Der Mann ist Anfang 60 und<br />
hat schon vieles miterlebt am Theater, so<br />
leicht bringt ihn da nichts aus der Fassung.<br />
Er sieht es pragmatisch: Wenn<br />
man in Wuppertal auch in Zukunft noch<br />
sechs Opernproduktionen im Jahr auf die<br />
Bühne bringen wolle, müsse man eben<br />
flexibel sein. Früher seien auch ältere<br />
Sänger, deren Stimmen nicht mehr so<br />
gut waren, im Ensemble gehalten worden.<br />
„Aber wenn der Chefdirigent dem<br />
breiten Opernrepertoire seines Orchesters<br />
gerecht werden will, kann er bei<br />
unserer schlechten Finanzlage eigentlich<br />
nur so vorgehen, wie Herr Kamioka<br />
es tut.“ Hire and fire an der Oper? Erwarten<br />
nicht auch die Zuschauer eine gewisse<br />
Beständigkeit beim künstlerischen<br />
Personal? „Wenn man der Auffassung ist,<br />
dass die Identifikation des Publikums mit<br />
dem Ensemble ein wichtiger Faktor ist,<br />
mag dieses Argument zutreffen. Andererseits<br />
können wir die Struktur, so wie<br />
sie ist, nicht unendlich halten.“<br />
HAGEN LIEGT von Wuppertal nur eine<br />
halbe Stunde Zugfahrt entfernt. Wer dort<br />
am Hauptbahnhof aussteigt, wird von einer<br />
Stadt empfangen, der die vergangenen<br />
20, 30 Jahre ersichtlich nicht gutgetan<br />
haben. Wo früher Fachgeschäfte<br />
waren, sind heute Ein-Euro-Shops untergebracht;<br />
der Weg ins Zentrum wird gesäumt<br />
von Back-Stores, türkischen Brautmode-Läden<br />
und Billigklamotten-Outlets.<br />
121<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Reportage<br />
Dann steht man plötzlich vor dem Hagener<br />
Stadttheater, das inmitten der Tristesse<br />
fast wie ein Tempel in der Wüste<br />
wirkt. 1911 wurde die von engagierten<br />
Bürgern gegründete Spielstätte eröffnet,<br />
das stolze Selbstverständnis als „Bürgertheater“<br />
lebt bis heute fort.<br />
An diesem frühsommerlichen Abend<br />
wird Jules Massenets „Don Quichotte“<br />
gegeben, eine auf dem gleichnamigen<br />
Romanklassiker beruhende Oper aus<br />
dem frühen 20. Jahrhundert – in französischer<br />
Sprache mit deutschen Übertiteln.<br />
Wem die deutsche Kulturlandschaft nicht<br />
vertraut ist, würde kaum glauben, dass so<br />
etwas in einer Stadt wie Hagen möglich<br />
sein kann, noch dazu an einem ganz normalen<br />
Wochentag: Orchester und Sänger<br />
leisten erstklassige Arbeit, die Inszenierung<br />
ist moderat modern, das Bühnenbild<br />
liebevoll bis ins Detail. Trotzdem<br />
sind die Zuschauerreihen allenfalls zu<br />
zwei Dritteln besetzt. Dem Bürgertheater<br />
gehen die Bürger aus.<br />
Norbert Hilchenbach ist seit sieben<br />
Jahren Intendant am Hagener Theater,<br />
einem 280-Mitarbeiter-Betrieb inklusive<br />
Opernensemble, Orchester und Ballett.<br />
In dieser Zeit ist die Stadt um knapp<br />
10 000 Einwohner geschrumpft, Tendenz<br />
weiter fallend. Anfang der achtziger<br />
Jahre lebten noch knapp 220 000 Menschen<br />
in Hagen, heute sind es nur noch<br />
186 000. Der Ausländeranteil ist hoch,<br />
jeder zweite Jugendliche hat einen Migrationshintergrund.<br />
Außerdem sind<br />
die kommunalen Finanzen ein Desaster,<br />
die Stadt ist mit 1,2 Milliarden Euro<br />
verschuldet – als sogenannte Nothaushaltskommune<br />
bekommt sie zwar Hilfen<br />
vom Land Nordrhein-Westfalen, wird<br />
dafür aber bei ihren Ausgaben streng<br />
kontrolliert.<br />
Was das für die schönen Künste bedeutet,<br />
kann man sich denken. Von 2018<br />
an wird das städtische Kulturbudget um<br />
weitere 10 Prozent gekürzt; derzeit liegt<br />
es bei rund 25 Millionen Euro im Jahr, wovon<br />
allein 14,5 Millionen Euro ans Theater<br />
fließen. 10 Prozent weniger für die<br />
städtischen Bühnen, das entspräche einer<br />
jährlichen Einbuße von rund 1,5 Millionen<br />
Euro. „Illusorisch“ nennt Intendant<br />
Hilchenbach die Vorstellung, sein Haus<br />
könne solch einen finanziellen Einschnitt<br />
verkraften. Denn inzwischen seien sämtliche<br />
Einsparpotenziale ausgeschöpft, „und<br />
die Selbstausbeutung ist enorm“. <strong>Das</strong><br />
Durchschnittseinkommen der Mitarbeiter<br />
am Hagener Theater liegt bei monatlich<br />
knapp 2500 Euro brutto.<br />
Aber braucht Hagen überhaupt ein<br />
eigenes Theater? Immerhin liegen Städte<br />
wie Bochum, Essen, Dortmund und eben<br />
Wuppertal in unmittelbarer Reichweite –<br />
und alle verfügen über große Opern- oder<br />
Schauspielbühnen. Norbert Hilchenbach<br />
findet diese Frage „etwas unverschämt“.<br />
Denn „das würde ja bedeuten, dass man<br />
eine bestimmte Zahl von Kilometern<br />
zwischen zwei Städten haben müsste,<br />
um selbst Kunst zu machen“. Außerdem:<br />
„Wenn hier erst mal die Bude zu wäre,<br />
würde die Attraktivität Hagens entscheidend<br />
nachlassen, und das würde auch<br />
die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtern.“<br />
So dreht sich die Rechtfertigungsspirale<br />
ständig weiter.<br />
Denn es ist ja eben nicht so, dass das<br />
Publikum dem Hagener Theater die Türen<br />
einrennt. Die Auslastung liegt angeblich<br />
bei 76 Prozent, das ist ein guter<br />
Wert. Aber es wird immer schwieriger,<br />
das Haus zu füllen. Noch in den achtziger<br />
Jahren gab es kaum eine Chance, in Hagen<br />
überhaupt ein Theater-Abo zu ergattern,<br />
in der darauffolgenden Dekade war<br />
das schon nicht mehr so. „Und der Intendant<br />
vor mir hat dann eklatante Schwierigkeiten<br />
bekommen, weil die Abozahlen<br />
runtergingen, aber gleichzeitig eigentlich<br />
kein Publikum für den freien Kartenverkauf<br />
da war“, sagt Hilchenbach. Er selbst<br />
tut alles, um auch jüngere Zuschauer anzulocken,<br />
es gibt Familienkonzerte zur<br />
Fußball-WM, Kinderoper oder moderne<br />
Musiktheaterproduktionen wie „Lola<br />
rennt“. Außerdem spendiert der örtliche<br />
Theaterförderverein Tausenden Schülern<br />
kostenlose Eintrittskarten. Trotzdem<br />
sind nur 35 Prozent der Besucher jünger<br />
als 50 Jahre. Und Migranten fürs Theater<br />
zu gewinnen, das sei ohnehin „ganz,<br />
ganz schwierig“, wie Hilchenbach unumwunden<br />
zugibt.<br />
HAT DAS DEUTSCHE STADTTHEATER unter<br />
solchen Voraussetzungen überhaupt<br />
noch eine Zukunft? Hilchenbach gibt sich<br />
vorsichtig optimistisch: „Ich glaube, dass<br />
wir weiter um unsere Existenz kämpfen<br />
müssen, aber letztlich bestehen bleiben.“<br />
Sein Kollege Enno Schaarwächter<br />
von den Wuppertaler Bühnen ist da<br />
„ Ich glaube,<br />
das System<br />
Stadttheater<br />
krankt in sich,<br />
und das liegt<br />
nicht nur am<br />
mangelnden Geld “<br />
Karl M. Sibelius,<br />
Intendant am „Theater an der Rott“<br />
in Eggenfelden<br />
122<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Anzeige<br />
VSF&P<br />
BES<br />
LER<br />
LEST<br />
Foto: Andrej Dallmann<br />
schon weniger zuversichtlich: „Die Oper<br />
mit großen Produktionen wird es mit Sicherheit<br />
auch weiterhin geben. Aber was<br />
das Schauspiel angeht, mache ich mir die<br />
größten Sorgen.“<br />
„ICH GLAUBE, das System Stadttheater<br />
krankt in sich, und das liegt nicht nur<br />
am mangelnden Geld.“ Der Mann, der<br />
so spricht, ist Mitte 40, von zierlicher<br />
Gestalt, lacht viel und trägt an diesem<br />
Vormittag eine grüne Pluderhose. Karl<br />
M. Sibelius provoziert gern, und als bekennender<br />
Schwuler mit Ehemann und<br />
zwei adoptierten Kindern sind seine Familienverhältnisse<br />
schon Provokation genug.<br />
Zumindest in der niederbayerischen<br />
Provinz. Dort leitet Sibelius das „Theater<br />
an der Rott“ in Eggenfelden, Deutschlands<br />
einziges landkreiseigenes Theater.<br />
Eine unter seiner Intendanz entstandene<br />
Inszenierung von Werner Schwabs<br />
„Die Präsidentinnen“ ist beim Publikum<br />
hoch umstritten gewesen, solche Stoffe<br />
waren die Eggenfeldener bis dahin nicht<br />
gewohnt. Aber in weniger als zwei Jahren<br />
hat Sibelius, gebürtiger Österreicher<br />
und ehemaliger Musicaldarsteller, die<br />
Zuschauerschaft mit seinem Programm<br />
deutlich verjüngt; der Altersdurchschnitt<br />
liegt jetzt nicht mehr bei über 60, sondern<br />
bei knapp über 40. „Was hier aufgebaut<br />
wurde, macht Kunst mit wenig Geld<br />
möglich“, sagt Sibelius. Wo andere klagen,<br />
ist er stolz auf sein kleines Budget.<br />
Und darauf, dass sein Haus in der Fachzeitschrift<br />
Die deutsche Bühne trotzdem<br />
zu einem der innovativsten Theater abseits<br />
der Zentren gekürt wurde.<br />
Eggenfelden hat knapp 13 000 Einwohner,<br />
das „Theater an der Rott“ existiert<br />
seit 1963 und ist in einer ambitioniert<br />
umgebauten, ehemaligen<br />
Mehrzweckhalle mit 400 Plätzen untergebracht.<br />
„Wir kommen mit zwei Millionen<br />
Euro im Jahr hin. Für andere Häuser,<br />
die nicht viel größer sind, reicht oft<br />
das Zehnfache dieser Summe nicht aus.“<br />
Trotzdem zeigt Sibelius zu 90 Prozent<br />
Eigenproduktionen und kommt auf sage<br />
und schreibe 18 Premieren im Jahr. Sogar<br />
Branchenstars wie der Opernregisseur<br />
Peter Konwitschny oder Róbert<br />
Alföldi, ehemaliger Chef des Budapester<br />
Nationaltheaters, haben unter Sibelius’<br />
Intendanz in Eggenfelden inszeniert.<br />
Was läuft hier anders?<br />
Karl M. Sibelius macht das, womit<br />
jetzt auch die Oper in Wuppertal ihr<br />
Glück versucht – nur noch viel konsequenter.<br />
Denn im „Theater an der Rott“<br />
gibt es außer zehn ständigen Mitarbeitern<br />
überhaupt kein festes Ensemble.<br />
Sämtliche Künstler werden für das jeweilige<br />
Stück als Gäste geholt, Proben<br />
und Produktionsarbeit geschehen vor<br />
Ort. Dann wird das Ergebnis in kurzen<br />
Abständen sechs bis neun Mal hintereinander<br />
aufgeführt; danach gehen Schauspieler,<br />
Sänger und Musiker wieder ihrer<br />
Wege. Stagione-Prinzip in Reinkultur.<br />
„Ich merke bei Leuten, die sonst nur an<br />
großen Theatern arbeiten, wie froh sie<br />
sind, wenn sie mal nicht in diesen Strukturen<br />
arbeiten müssen – denn hier bei<br />
uns gibt es keine Bürokratie und auch<br />
keine Grabenkämpfe zwischen den einzelnen<br />
Sparten“, sagt Sibelius.<br />
Wenn es nach ihm ginge, müsste die<br />
gesamte deutsche Stadttheater-Landschaft<br />
einer Entschlackungskur unterzogen<br />
werden. „<strong>Das</strong> Hauptproblem an den<br />
meisten Häusern sind die großen Kollektive,<br />
nämlich Orchester und Chor. Die<br />
fressen allein schon ein Drittel des Gesamtbudgets<br />
auf. Und dann verlangen<br />
die Musiker auch noch für jeden Furz<br />
eine Sonderzahlung.“ Von der Bürokratie<br />
ganz zu schweigen, denn die meisten<br />
Stadttheater sind immer noch voll in<br />
die kommunalen Verwaltungsstrukturen<br />
eingebunden – „und an vielen Häusern<br />
ist der Gemeinschaftssinn verloren gegangen,<br />
weil die Leute von den Verkrustungen<br />
frustriert sind“.<br />
IM NÄCHSTEN JAHR geht Karl M. Sibelius<br />
als Intendant ans Stadttheater Trier – dort<br />
erwarten ihn 230 feste Mitarbeiter, Orchester,<br />
Ballett, Schauspiel- und Opernensemble.<br />
Und eine seit Jahren schwelende<br />
Debatte über die finanzielle Zukunft.<br />
„Die Theater in Deutschland müssen dringend<br />
simplifiziert werden“, glaubt Sibelius.<br />
„Man muss ihnen ihre Würde zurückgeben,<br />
anstatt sie in Kostendiskussionen permanent<br />
schlechtzureden.“ In Trier wird sich<br />
zeigen, ob das möglich ist.<br />
ALEXANDER MARGUIER ist<br />
stellvertretender Chefredakteur<br />
von <strong>Cicero</strong>. Im Theater Hagen<br />
war er schon als Kind mit seinen<br />
Großeltern zu Gast<br />
Literarisches Trio<br />
Christoph Peters<br />
Sechs Bücher und ein Gast<br />
Literaturen-Redakteurin Frauke<br />
Meyer-Gosau und Literaturkritiker<br />
Jörg Magenau diskutieren mit dem<br />
Schriftsteller Christoph Peters über<br />
literarische Neuerscheinungen<br />
dieses Jahres:<br />
Über den Roman „Der Circle“ von<br />
Dave Eggers, über Teresa Präauers<br />
„Johnny und Jean“ und über den<br />
Roman „Orfeo“ von Richard Powers.<br />
Zum Schluss geben die Teilnehmer<br />
des Trios noch drei aktuelle Literatur-<br />
Tipps ab.<br />
Dienstag, 23. September 2014, 20 Uhr,<br />
Literaturforum im Brecht-Haus,<br />
Chausseestraße 125, 10115 Berlin<br />
Eintritt 5 € / 3 € an der Abendkasse,<br />
kein Kartenvorverkauf<br />
In Kooperation mit:<br />
Literaturforum<br />
im Brecht-Haus<br />
diensTag,<br />
23. sepTember,<br />
20 Uhr<br />
Tickets unter:<br />
030 28 408 155<br />
© Peter von Felbert<br />
cicero.de<br />
123<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Literaturen<br />
Neue Bücher, Texte, Themen<br />
Zeitroman<br />
Ändere die Welt, sie braucht es!<br />
Dave Eggers’ Roman „Der Circle“ ist extrem spannend: Er erzählt,<br />
worauf wir mit unserer schönen <strong>neue</strong>n Google-Welt zusteuern<br />
Wem würde das nicht gefallen:<br />
aus einer mittelmäßigen Position<br />
bei einer Provinzfirma<br />
ohne Entwicklungspotenzial in einen<br />
Großkonzern mit lockerer Campus-Kultur<br />
einzusteigen, der sich gerade daranmacht,<br />
die Weichen für das gesellschaftliche<br />
Zusammenleben der Zukunft neu<br />
zu stellen? Mae Holland, Anfang 20, College-Absolventin<br />
in Psychologie, täte<br />
nichts lieber, als für das prosperierende<br />
Unternehmen mit dem Namen „Der Circle“<br />
zu arbeiten. Es hält das Monopol<br />
auf dem Suchmaschinen-, E-Mail- und<br />
Hip, transparent und intim, als<br />
wär’s eine Erfindung von Dave<br />
Eggers: Besprechungsecke in der<br />
Google-Zentrale in Zürich<br />
SMS-Markt und lässt darüber hinaus im<br />
Wochenrhythmus eine zukunftsweisende<br />
Erfindung auf die andere folgen – Information<br />
ist sein Geschäft.<br />
Und Mae hat Glück. Annie, ihre beste<br />
Freundin aus College-Zeiten, gehört im<br />
„Circle“ zur sogenannten „Vierzigerbande“,<br />
der erweiterten Leitungsgruppe<br />
des Konzerns, über der nur noch das Triumvirat<br />
der Gründer schwebt, „Die drei<br />
Weisen“ genannt. Annie setzt sich ein,<br />
und Mae bekommt tatsächlich einen Arbeitsplatz<br />
im Unternehmen. Mit ihrem<br />
ersten Tag dort beginnt der Roman.<br />
Er führt uns in einen Konzern, in<br />
dem demonstrative Lockerheit mit engmaschiger<br />
Kontrolle und, im Falle defizitären<br />
Verhaltens, auch harter persönlicher<br />
Konfrontation eine unlösbare<br />
Verbindung eingeht. Doch wie herrlich ist<br />
allein der Campus, auf dem man hier residiert!<br />
Nicht nur ein saftiger Rasen, auch<br />
Foto: Google Zürich<br />
124<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Sportanlagen und Auftritte der angesagtesten<br />
Künstler laden zur Entspannung<br />
ein. In den Cafeterias kochen Spitzenköche,<br />
es gibt abendliche Unterhaltungsprogramme<br />
für jeden Geschmack, Eintritt<br />
und Verköstigung selbstredend frei.<br />
Hat ein Mitarbeiter Gäste, kann er sie im<br />
„Circle“-eigenen Hotel unterbringen, wer<br />
es abends nicht mehr nach Hause schafft,<br />
bezieht im Wohnheim ein luxuriös ausgestattetes<br />
Zimmer. Selbst die Hunde<br />
der Angestellten werden fürsorglich betreut,<br />
die Kinder gehen auf dem Campus<br />
zur Schule, eingekauft wird ebenfalls in<br />
„Circle“-Geschäften, auf höchstem Niveau<br />
natürlich – eigentlich gibt es für die<br />
Mitarbeiter keinen vernünftigen Grund,<br />
das Gelände überhaupt noch zu verlassen.<br />
„Alles, was das Leben unserer Circler<br />
besser macht, wird auf Anhieb möglich“,<br />
heißt die Parole, und das schließt<br />
auch die Fürsorge für Familienmitglieder<br />
mit ein. Ohne Weiteres wird Maes schwer<br />
kranker Vater mitsamt der Mutter in die<br />
Krankenversicherung aufgenommen, sodass<br />
Mae ihre ungeteilte Aufmerksamkeit<br />
wieder der Arbeit zukommen lassen<br />
kann. <strong>Das</strong> allerdings ist auch nötig. Denn<br />
was der „Circle“ nach außen erreichen<br />
will – alle Welt kommuniziert mit aller<br />
Welt, jeder teilt jedem jederzeit mit, was<br />
er erlebt, denkt und fühlt –, das muss natürlich<br />
erst recht im Inneren gelten. Wer,<br />
wie Mae, gern allein in einer einsamen<br />
Bucht mit dem Kajak unterwegs ist, ist<br />
da schon auf einem schlechten Weg. Und<br />
weil es mittlerweile – natürlich eine Erfindung<br />
des „Circle“ und im Nu weltweit<br />
verbreitet – lolligroße Kameras gibt, die<br />
noch an den entlegensten Plätzen installiert<br />
sind, fliegt ihre private Heimlichkeit<br />
bald auf. Ihr Vorgesetzter in der<br />
Kundenbetreuungsabteilung bittet sie<br />
zum Gespräch, das eher einem Verhör<br />
gleicht. Und Mae sieht alles ein. „Teilen<br />
ist Heilen“, „Alles Private ist Diebstahl“,<br />
„Geheimnisse sind Lügen“ bekennt sie<br />
anschließend, unter dem Jubel ihrer Kollegen,<br />
im Gespräch mit einem der obersten<br />
Chefs auf offener Bühne.<br />
Denn Mae ist ein inbrünstig der umfassenden<br />
Verbesserung der Gegenwart<br />
zugewandter Mensch. Und ist es nicht<br />
am besten, wenn alle Menschen in größtmöglicher<br />
Offenheit miteinander leben?<br />
Am Ende wird sie das öffentliche Aushängeschild<br />
des „Circle“ sein, das die<br />
So lauten die<br />
Leitsätze für<br />
ein Leben nach<br />
den Regeln<br />
des „Circle“:<br />
„Teilen ist Heilen“ –<br />
„Alles Private<br />
ist Diebstahl“ –<br />
„Geheimnisse<br />
sind Lügen“<br />
nach Millionen zählenden Follower per<br />
Livestream über alle Ereignisse auf dem<br />
Campus auf dem Laufenden hält.<br />
Es ist eine der großen Leistungen<br />
dieses Romans, dass er nachvollziehbar<br />
macht, wie Menschen, die nur das Allerbeste<br />
für alle wollen, zu freudigen Gehilfen<br />
bei der Ausbreitung allumfassender<br />
Kontrolle über das Leben jedes Einzelnen<br />
werden. Und eigentlich ist es doch<br />
auch wirklich besser, eine Kamera in jedem<br />
Zimmer zu haben, damit die hinfällige<br />
Mutter sich nicht unbemerkt etwas<br />
tut. Und großartig ist es auch, Opfer von<br />
Entführungen in Sekundenschnelle aufspüren<br />
zu können, weil schon den Kindern<br />
ein Chip eingepflanzt wurde, über<br />
den sie jederzeit lokalisierbar sind. Ganz<br />
und gar fabelhaft überdies, wenn Politikern<br />
Hinterzimmerkunkeleien unmöglich<br />
werden, weil sie Tag und Nacht eine<br />
Kamera um den Hals tragen, die jeden ihrer<br />
Schritte und jedes Gespräch öffentlich<br />
macht. Wäre es da nicht der Weg zur vollendeten<br />
Demokratie, wenn jeder Bürger<br />
verpflichtet wäre, ein „TruYou“-Konto<br />
einzurichten, über das nicht nur – mit<br />
Klarnamen, nicht länger anonym – alle<br />
Internetaktivitäten abgewickelt würden,<br />
sondern das auch den Eintrag ins Wählerverzeichnis<br />
vollzieht? Alle Menschen<br />
gingen plötzlich zur Wahl!<br />
Wie die Parolen zur Abschaffung der<br />
Privatheit stammt auch dieser Vorschlag<br />
von der kreativen Mae. Die „Weisen“<br />
freuen sich unbändig darüber, denn natürlich<br />
ist es sehr viel angenehmer, wenn<br />
der Vorschlag für totalitäre Zugriffe aus<br />
der Masse selbst kommt. Mae, die als<br />
Erste im „Circle“ begonnen hat, mit der<br />
Kamera um den Hals ein „transparentes“<br />
Leben zu führen, ist dabei mit ihrem Bedürfnis,<br />
beachtet, gelobt und geliebt zu<br />
werden, das ideale Sektenmitglied – der<br />
Leser nämlich denkt bei alledem nicht<br />
nur an Google oder Facebook, er wird<br />
auch den Gedanken an „Scientology“<br />
nicht los. Und sieht in Eggers’ Roman,<br />
wie eine auf die totale Herrschaft über<br />
Seele, Geist und Körper angelegte, dabei<br />
Geldmittel in großem Stil an sich bringende<br />
Vereinigung eben nicht an die Lust<br />
am Bösen, sondern gerade an die besten<br />
Absichten aller anknüpft: Alle Maßnahmen<br />
des „Circle“ haben neben ihrer<br />
machtexpansiven immer auch eine unmittelbar<br />
positive Seite.<br />
Auf die grundlegende Ambivalenz<br />
der Menschen wie der Erfindungen, mit<br />
denen der „Circle“ seine Verfügungsgewalt<br />
ausbaut, ist Eggers’ Roman gegründet.<br />
Widerstand findet sich demgegenüber<br />
kaum: Maes Eltern haben<br />
von der Totalüberwachung schließlich<br />
genug, Maes früherer Freund Mercer<br />
flieht in die Wälder (und nimmt, von einem<br />
Mob und „Circle“-Drohnen verfolgt,<br />
ein trauriges Ende). Doch liegt<br />
das Ungleichgewicht zwischen Ablehnung<br />
und Bejahung ganz in der Logik<br />
des Buches: Weshalb ein intelligenter<br />
Mensch sich engagiert zum Werkzeug eines<br />
nach Weltherrschaft strebenden Privatunternehmens<br />
macht, darum geht es,<br />
und höchst spannend werden die Konsequenzen<br />
dieser Bereitschaft ausgebreitet.<br />
<strong>Das</strong>s dies keine grundstürzende Literatur<br />
ist, ist da völlig egal. Wann zuletzt<br />
hätte uns ein Roman die Welt, in der wir<br />
gerade zu leben beginnen, so bis ins Detail<br />
einsichtig gemacht? Und wie ambivalent<br />
erscheint danach plötzlich selbst die<br />
gute alte Forderung „Ändere die Welt,<br />
sie braucht es!“ Frauke Meyer-Gosau<br />
Dave Eggers<br />
„Der Circle“<br />
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und<br />
Klaus Timmermann<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014. 560 S.,<br />
22,99 €<br />
125<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
CICERO: PLAT T<br />
IN DIESEN EXKLUSIVEN<br />
HOTELS<br />
REIZ<br />
Anzeige<br />
Roman<br />
Oh, diese kleinen<br />
Niederlagen<br />
Bernhard Schlinks <strong>neue</strong>s<br />
Werk funktioniert selbst als<br />
Parodie nur mäßig<br />
Hotel auf der Wartburg<br />
Auf der Wartburg 2<br />
99817 Eisenach<br />
Telefon: 03691 797-0<br />
www.wartburghotel.arcona.de<br />
» Seit 100 Jahren empfängt und bewirtet der „Gasthof für<br />
fröhliche Leut“ hoch über Eisenach kultivierte und anspruchs<br />
volle Reisende. Für die Pflege der politischen Kultur<br />
sorgt <strong>Cicero</strong>, das die hohen Erwartungen unserer Gäste<br />
auch in journalistischer Hinsicht bestens erfüllt.<br />
Wir freuen uns sehr über diese besondere Partnerschaft.«<br />
Jens V. Dünnbier, Hoteldirektor<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan/Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger<br />
Hotel · Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach ·<br />
Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Brandenburger<br />
Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel<br />
Maritim, The Mandala Hotel, The Mandala Suites, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel,<br />
Savoy Berlin, Sofitel Berlin Kurfürstendamm · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel<br />
Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental<br />
Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Ettlingen: Hotel-Restaurant<br />
Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch ·<br />
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic<br />
Kempinski, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel,<br />
Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel<br />
Adler · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im<br />
Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger<br />
Grandhotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug<br />
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München:<br />
King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss<br />
Neuhardenberg · Nürnberg: Le Méridien · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel<br />
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Le Méridien, Hotel am Schlossgarten ·<br />
Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Wien: <strong>Das</strong><br />
Triest · SCHWEIZ Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide<br />
Royale · Luzern: Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel<br />
Weggis · Zermatt: Boutique Hotel Alex<br />
Möchten auch Sie zu diesem exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an. E-Mail: hotelservice@cicero.de<br />
Wenn ein emeritierter Professor<br />
für Öffentliches Recht ein<br />
Buch schreibt, das Roman<br />
heißt, und wenn in diesem Buch ein<br />
Rechtsanwalt die Hauptfigur ist, dem<br />
„die Vorstellung gefallen hatte, als Richter<br />
oben zu sitzen“, und wenn dieser verhinderte<br />
Richter „einer jüngeren Frau<br />
was bieten“ konnte und sich nun „einen<br />
Reim machen“ will auf die Geschichte eines<br />
Gemäldes, das verschwand und nach<br />
40 Jahren wieder auftaucht und auf dem<br />
seine ehemalige Geliebte Irene zu sehen<br />
ist, weshalb er dem Gemälde nach Australien<br />
hinterherreist, seine Ehe, die er<br />
„erfolgreich durchgezogen“ hatte, zurücklässt<br />
und lernt, „was wirklich geschehen<br />
ist, ist doch etwas anderes, als<br />
was Menschen sich ausdenken“, aber<br />
beharrt, „dass es mit Irene anders hätte<br />
laufen können, als es gelaufen war“, und<br />
wenn dieser Anwalt in Australien auf die<br />
schwer kranke Irene trifft und deren Ex-<br />
Mann und den Maler des Bildes und erfährt,<br />
dass Irene, die „sich eine Menge“<br />
herausnahm, in der DDR untergetaucht<br />
war, und wenn der Jurist schließlich sein<br />
„altes Leben nicht mehr“ will und das<br />
Denken „nicht abstellen“ kann, obwohl<br />
er dabei „nichts zustande brachte“, und<br />
sich also fragt, ob es „gerade die kleinen<br />
Niederlagen“ sind, „über die wir nicht<br />
hinwegkommen“ – können wir dann dieses<br />
Buch, das selbst als Paulo-Coelho-Parodie<br />
kaum funktioniert, einen Roman<br />
nennen und den emeritierten Professor<br />
Schlink einen Schriftsteller? Nein, können<br />
wir nicht. Können wir beim besten<br />
Willen leider nicht. Alexander Kissler<br />
Bernhard Schlink<br />
„Die Frau auf der Treppe“<br />
Diogenes, Zürich 2014. 256 S., 21,90 €<br />
<strong>Cicero</strong>-Hotel
SALON<br />
Literaturen<br />
Anzeige<br />
Biografie<br />
<strong>Das</strong> Böse ist<br />
immer nur ein Teil<br />
Volker Reinhardt porträtiert<br />
den Marquis de Sade als<br />
Widerständler und Libertin<br />
Wüstling, Ketzer, diabolische<br />
Ausgeburt: Mit dem Marquis<br />
de Sade schien der Antichrist<br />
auf Erden geboren. Solche Attribute<br />
durchziehen die Rezeptionsgeschichte<br />
seiner vor Perversitäten und Ferkeleien<br />
nur so strotzenden Schriften. Mit Romanen<br />
wie „Juliette oder die Vorteile des<br />
Lasters“ verbinden sich die Feier des Verbrechens<br />
und orgiastische Exzesse. Doch<br />
wirkt in den erschütternden Dokumenten<br />
mehr als die bloße Anarchie eines Geisteskranken?<br />
Wie viel philosophisches<br />
Kalkül steckt dahinter?<br />
Glaubt man Volker Reinhardts imposanter<br />
Biografie über den „Unterwanderer<br />
aller Werte“, wie er ihn mit<br />
Seitenblick auf den späteren Nietzsche<br />
nennt, so trieben im Kopf des am 2. Juni<br />
1740 geborenen Sohnes eines provenzalischen<br />
Landadelsgeschlechts ganz andere<br />
Kräfte ihr Unwesen, nämlich überraschenderweise<br />
jene der Aufklärung.<br />
Um diesen interpretatorischen Kunstgriff<br />
plausibel zu machen, stellt der Freiburger<br />
Historiker – bislang vor allem durch<br />
seine Studien zur Renaissance bekannt –<br />
Leben und ausführliche Werkexegese gegenüber.<br />
Und siehe da, hinter der Fratze<br />
des Grauens tritt ein Januskopf hervor.<br />
Zwar ist unbestritten, dass sich der<br />
gräfliche Dandy allzu gern widerwärtigen<br />
sexuellen Experimenten hingab und<br />
dafür mehrfach inhaftiert wurde. Doch<br />
Reinhardt zeigt auch den Kontrast: Während<br />
der Misanthrop de Sade in seinen<br />
Texten die Schwachen buchstäblich abschlachtete,<br />
war er tatsächlich auch ein<br />
generöser Freigeist, der gleich mehrere<br />
Familien in Not mit Almosen versorgt haben<br />
soll. Zudem war er aufgrund staatlicher<br />
wie kirchlicher Repression ein<br />
couragierter Aktivist während der Französischen<br />
Revolution. Also ein leuchtendes<br />
Bild mit dunklen Abgründen?<br />
Nicht allein sein bürgerschaftliches<br />
Engagement lässt einen grazilen Herrn<br />
des aufgeklärten Humanismus erkennen,<br />
sondern gleichfalls seine Prosa. Selbst<br />
wenn sich der Leser manchmal nicht des<br />
Eindrucks erwehren kann, dass Reinhardt,<br />
obwohl er es von sich weist, uns<br />
einen Wolf als Schaf verkaufen möchte,<br />
offenbart sein Zugang ein vielschichtiges<br />
Prisma. Wer etwa „Aline und Valcour“<br />
(1793) zur Hand nimmt, sieht in<br />
den Missbrauchsszenen auf einem versteckten<br />
Schloss die ganze Bestialität der<br />
menschlichen Seele, empfindet aber keinen<br />
Genuss daran.<br />
Im Gegenteil: Der Autor übt sich als<br />
Seelenanalytiker, dessen Schilderungen<br />
auf eine, so Reinhardt, „Ethik des Widerstandes“<br />
hinausliefen. Von seinem Gefängnis<br />
aus sah der Romancier täglich<br />
die Guillotine und den Blutdurst der Mitmenschen.<br />
Indem er seiner Literatur das<br />
Übel der menschlichen Seele einschreibt,<br />
will er den Leser provozieren, ihn zur<br />
Rebellion gegen das Verkommene und<br />
für die Freiheit anstiften. <strong>Das</strong> Böse ist<br />
keine Zeremonie, sondern ein Motiv zum<br />
Aufbegehren. <strong>Das</strong>s der Graf auch konkret<br />
eine bessere Welt vor Augen hatte,<br />
wird en passant in einem Inselparadies<br />
anschaulich, das er den düsteren Orgien<br />
in „Aline und Valcour“ gegenüberstellt.<br />
Frühsozialismus trifft auf Liberalismus.<br />
Widersprüche bleiben und lassen<br />
Diskussionsstoff für Jahrhunderte: Freud<br />
schrieb ausgehend von der Persona non<br />
grata seine Gedanken zum „Sadismus“<br />
nieder, der Surrealist André Breton sah<br />
im Marquis den Vorboten des freien Denkens<br />
– und die Gegenwart? Die schaut das<br />
Dschungelcamp und bunte Sado-Maso-<br />
Reportagen zum Amüsement. „Der Marquis<br />
hätte sich vor Grauen und Lachen<br />
geschüttelt.“ Die Dekadenz scheint gängige<br />
Praxis geworden, „die Anstößigkeit<br />
ist heute von allen Seiten bedroht. Sie<br />
wiederherzustellen war ein Ziel dieser<br />
Biografie.“ Dem kann man nur zustimmen:<br />
Ein ambitionierter Auftakt für eine<br />
Debatte über die Wurzeln des Bösen und<br />
seines Gegenteils. Björn Hayer<br />
Volker Reinhardt<br />
„De Sade oder Die Vermessung<br />
des Bösen“<br />
C. H. Beck, München 2014. 464 S., 26,95 €<br />
Zwei Brüder.<br />
Zwei Kontinente.<br />
Eine große Geschichte.<br />
Der <strong>neue</strong> große Roman<br />
der preisgekrönten<br />
Bestsellerautorin Jhumpa Lahiri<br />
Auch als<br />
E-Book<br />
erhältlich<br />
© Marco Delogu<br />
127<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Literaturen<br />
Erzählungen<br />
Vor dem Tod noch ein Banana-Split<br />
Auf Geschichten wie diejenigen von Karen Köhler haben wir lange<br />
gewartet: Sie sind unsentimental, witzig, dabei grundernst<br />
Nichts an meinem Elternhaus ist<br />
einladend. Der Zaun hat Zacken.<br />
Die Bäume Nadeln. Die Hecken<br />
Dornen. Die Jalousien sind heruntergelassen,<br />
die Türen verschlossen, die<br />
Schlösser mit Schlössern gesichert. Die<br />
Hälfte vom Rasen vorne ist weg, dafür<br />
gibt es eine asphaltierte Einfahrt, auf der<br />
ein Auto parkt, das schon länger nicht bewegt<br />
wurde. Mutter hat keinen Führerschein<br />
und Vater kann das Auto seit dem<br />
Schlaganfall nicht mehr fahren. Er kann<br />
nur noch seinem Tod entgegenliegen.“<br />
Diese Autorin hält sich mit Gefühlsduseleien<br />
nicht lange auf. <strong>Das</strong> Elternhaus<br />
ist schrecklich, die Eltern sind schrecklich,<br />
die Besuche bei ihnen sind schrecklich.<br />
Die Nachbarn sind auch schrecklich:<br />
„Frau Wichert (…) kommt mir mit Schirm<br />
und schlechter Laune entgegen. Sie führt<br />
eine Wurst mit Beinen aus. Ich glaube,<br />
die Sorte nennt man Beagle.“<br />
Ich muss lachen. Karen Köhler<br />
schreibt schlecht gelaunt, hat dabei trotzdem<br />
jede Menge Witz und erfindet unerhörte<br />
Bilder. In ihren Erzählungen<br />
geht es um das Scheitern der Liebe, ums<br />
Kranksein und Altwerden, um den Tod,<br />
um Verlust und Enttäuschung, und immer<br />
„4. Du riechst<br />
nach meinem<br />
Vater. 5. Du hast<br />
keine Ziele.<br />
6. Deine Socken<br />
haben Löcher“<br />
ist das irgendwie auch komisch. In einer<br />
der Storys ist das Hobby der Ich-Erzählerin<br />
das traditionelle Brokatweben auf<br />
alten Webstühlen. Und was webt sie? <strong>Das</strong><br />
Konterfei von Verbrechern. Verbrecher<br />
in Brokat. Originell finde ich auch die<br />
Top-Ten-Liste „Warum-ich-nicht-mit-dirzusammen-sein-kann“:<br />
„1. Du besitzt nur<br />
ein einziges Buch. 2. <strong>Das</strong> Buch trägt den<br />
Titel ‚Excel for Dummies‘. 3. Du trinkst<br />
immer. 4. Du riechst nach meinem Vater.<br />
5. Du hast keine Ziele. 6. Alle deine Socken<br />
haben Löcher. 7. Immer lässt du Verschlüsse<br />
offen. 8. Du gehst nicht wählen.<br />
9. Deine Küsse schmecken nach Asche.<br />
10. Du wirst mich verlassen.“<br />
DIESE LISTE SAGT MEHR über die Frau<br />
aus, die sie geschrieben hat, als über den<br />
Mann, an den sie gerichtet ist. Die Frau<br />
hat ein Problem mit ihrem Vater, sie liest<br />
viel, sie ist ordentlich, sie geht wählen,<br />
sie hat Verlassensängste. <strong>Das</strong> heißt, unsere<br />
coole Erzählerin ist ein Mensch mit<br />
Verantwortungsgefühl und großer Sensibilität<br />
hinter einer eher patzigen Fassade.<br />
Und von Geschichte zu Geschichte<br />
gewinnen wir sie lieber und machen uns<br />
Sorgen wegen ihres anstrengenden Lebens,<br />
bewundern ihre Tapferkeit in<br />
schlimmen Krankheiten, möchten ihr begegnen<br />
und ihr ein Glas Wein spendieren.<br />
Karen Köhler schreibt sich mit ihrer<br />
lässigen und doch hochkonzentrierten<br />
Prosa direkt in mein Herz. Auf<br />
diese Sichtweise habe ich schon lange<br />
gewartet: weg vom Betroffenheitston<br />
im hundertsten „Ich-habe-Krebs-undmeine-Eltern-sind-dement-und-was-istwohl-der-Tod“-Roman.<br />
Hier ist der Tod<br />
überall, mitten im Leben, ganz normal,<br />
und es wird kein großes Gewese darum<br />
gemacht, Krankheit ist ein Teil des Lebens,<br />
gegen den Auflehnung sinnlos<br />
ist, Augen zu und durch. Umso grotesker,<br />
dass ausgerechnet Karen Köhler die<br />
Windpocken bekam, als sie dieses Jahr<br />
in Klagenfurt lesen sollte. Schade, denn<br />
dieser Klartext hätte im intellektuellen<br />
Spinnengewebe des Wettbewerbs ordentlich<br />
Durchzug gemacht. Die Geschichte,<br />
die gelesen werden sollte, heißt „Il Comandante“:<br />
eine krebskranke junge Frau<br />
und ein rollstuhlfahrender Altfreak begegnen<br />
sich in der Klinik und machen<br />
es sich ein bisschen nett. Ich muss wahrscheinlich<br />
sterben, sagt sie. Klar musst<br />
du das, lacht er, müssen wir doch alle,<br />
aber vorher kann man wohl noch mal<br />
ein Banana-Split-Eis essen. Sie essen eins,<br />
und er stirbt, und sie verzweifelt daran<br />
fast mehr als an ihrem Krebs.<br />
Köhlers Figuren sind Außenseiter,<br />
Kranke, Einsame, aber sie sind auch Comandante,<br />
Indianer und Raketenangler.<br />
Ein Mädchen mit Kälte im Herzen und<br />
Zukunftsangst reist durch Italien und<br />
schickt Postkarten, Polar nennt sie sich.<br />
Rom, Ischia, Neapel, Pompeji, es wird<br />
wärmer, auf der 14. Postkarte erscheint<br />
das Wort „Liebe“ und auf der 17. ein<br />
„Ja“: knapp, schön, einfach. In „Name Tier<br />
Beruf“ kommt ein Björn nach 15 Jahren<br />
mit einer Flasche Champagner zurück,<br />
als wäre nichts passiert, als wäre seine<br />
Freundin nicht tot, und als hätte er ihre<br />
Schwester damals nicht geschwängert –<br />
immer atemloser wird die Geschichte,<br />
aber am Ende ist Frieden. Immer schafft<br />
es Karen Köhler, in das Lebensdurcheinander<br />
Ruhe und eine Art Frieden zu bringen,<br />
selbst wenn es der Frieden des Todes<br />
ist. Sie schreibt lakonisch, knapp, und sie<br />
endet sanft: So ist es eben. Karen Köhler<br />
wollte Kosmonautin werden, nun ist sie<br />
eine: eine <strong>neue</strong> Stimme im Kosmos der<br />
Literatur. <br />
Elke Heidenreich<br />
Karen Köhler<br />
„Wir haben Raketen geangelt“<br />
Hanser, München 2014. 240 S., 19,90 €<br />
128<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
entdecken sie ihre<br />
heimat neu!<br />
25 jahre nach<br />
dem mauerfall<br />
Reiseberichte, Reportagen und<br />
Sehenswertes entlang der ehemaligen<br />
innerdeutschen Grenze.<br />
<strong>Das</strong> <strong>neue</strong> MERIAN deutschland.<br />
Ab dem 21.08. im Handel!<br />
Deutschland, Land der Superlative! Es gibt kaum ein zweites Land, das auf kürzere Entfernung stärkere Kontraste bietet. Gehen<br />
Sie mit uns auf eine Reise durch Deutschland – 25 Jahre nach dem Fall der Mauer – und entdecken Sie <strong>neue</strong> Ansichten mit Egon Bahr,<br />
Gregor Gysi, Wolfgang Schäuble, Juli Zeh und Roger Willemsen. Oder machen Sie <strong>neue</strong> Grenzerfahrungen mit Achill Moser und<br />
Matthias Politycki entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze von der Ostsee bis nach<br />
Bayern. Deutschland ist anders, verschiedenartig, spannend – und MERIAN hält die<br />
aufregendsten Seiten Deutschlands für Sie bereit. Der <strong>neue</strong> MERIAN Deutschland,<br />
ab dem 21. August 2014 im guten Buch- und Zeitschriftenhandel.<br />
Per Telefon unter 0 40/87 97 35 40 oder über www.merian.de
SALON<br />
Bibliotheksporträt<br />
DIESER FLUSS<br />
BIST IMMER NUR DU<br />
Die lettische Organistin Iveta Apkalna verdankt Harald Schmidt<br />
ihr Deutsch, Hermann Hesse einen Zuspruch in schwerer<br />
Stunde und Imants Ziedonis Ratschläge fürs ganze Leben<br />
Von CLAUDIA RAMMIN<br />
Der Olymp hat es ihr angetan. Jener Ort, in dem sich diejenigen tummeln,<br />
die Großartiges geleistet haben. Wie jene, denen der lettische Autor<br />
Peteris Apinis in seinem Buch „Hundred great Latvians“ ein Denkmal<br />
setzt. Den schweren Band auf den Knien, sucht Iveta Apkalna unter den<br />
alphabetisch aufgeführten Namen solche, die westeuropäischen Ohren geläufig<br />
sein dürften: Mark Rothko, Gidon Kremer, Sergei Eisenstein, Heinz<br />
Erhardt. „Eine erstaunliche Leistung für ein Zwei-Millionen-Volk, aber für<br />
die lettische Musikerin gibt es in dieser Galerie offenbar keinen Platz mehr“,<br />
scherzt sie und bekennt, dass sie offenbar nicht ganz so weit sei.<br />
Iveta Apkalnas Instrument ist die Orgel, ein majestätisches Monstrum,<br />
das zu bespielen Schwerstarbeit bedeutet. Wer die 36-jährige Mutter zweier<br />
kleiner Kinder sieht, traut ihr das kaum zu: Feenhaft schwebt sie auf High<br />
Heels durch ihre Berliner Altbauwohnung. Dort stehen hinter der Eingangstür<br />
Bücherregale mit Biografien berühmter Komponisten und Pianisten,<br />
Werken gängiger amerikanischer Autoren wie Bill Bryson, Oliver Sacks und<br />
fast alles von Henning Mankell. Ihr Vater war Kriminalinspektor, als kleines<br />
Mädchen wollte sie das auch werden. Aber offenbar habe sie jemand<br />
mit Fernbedienung in die richtige Richtung geschickt, meint Iveta Apkalna<br />
und richtet den Blick kurz gen Himmel.<br />
Üben nicht meistens Männer den Beruf des Organisten aus? In Lettland<br />
sind es hauptsächlich Frauen, denn „Frauen in postsowjetischen Ländern<br />
sind sehr stark, wir halten viel aus“. Sie habe zur Orgel eine intensive Beziehung<br />
– wie zu einem Partner, dessen Stärken und Marotten man kennen<br />
sollte. Stur, eigensinnig und geradezu „maximalistisch“ sei sie ihren Weg<br />
gegangen – als Einzelkind, sich mehr oder weniger selbst überlassen. Weil<br />
die Mutter als Pianistin viel arbeitete, „musste ich eine Menge selbst schaffen“.<br />
Mit 15 Jahren beschloss Iveta Apkalna, an der Musikschule ihrer Heimatstadt<br />
Rezekne, südöstlich von Riga, neben Klavier Orgel zu studieren.<br />
Es war die allererste Orgelklasse in Lettland nach der politischen Wende.<br />
Schnell merkte sie, dass das Instrument „jeden Millimeter in meinem Körper<br />
bewegt, auch psychisch, als ob ich gespielt würde“.<br />
130<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Ihre Mutter besaß eine riesige Kollektion Schallplatten, überwiegend<br />
Klavier- und Orgelmusik, oft geistlicher Art. Die hörte sie als Kind mit Begeisterung<br />
– obwohl unter der sowjetischen Besatzung alles verboten war,<br />
was mit Religion und Kirche zu tun hatte. Mit 16 spielte sie Orgel beim Besuch<br />
von Papst Johannes Paul II. in Lettland. Defizite habe es während der<br />
sowjetischen Zeit in Lettland in allen Bereichen gegeben. Bücher waren rar.<br />
Viele der Originalwerke lettischer Klassiker stehen nun neben lettischen Ausgaben<br />
deutscher Literaten im Regal in Riga, dem Zweitwohnsitz. Manches<br />
Werk wandert hin und her. Etwa Janis Rainis, „unser größter, wichtigster<br />
Autor“, der Goethes „Faust“ ins Lettische übersetzte. „Feuer und Nacht“<br />
zähle zu den Meilensteinen der lettischen Befreiungsliteratur, sagt Apkalna.<br />
Lettisch, Englisch, Deutsch: Die Musikerin zappt mit hohem Tempo<br />
durch die Sprachen. Ihr perfektes Deutsch hat sie während der Studienzeit<br />
an der Musikhochschule Stuttgart durch Harald Schmidt und dessen Show<br />
gelernt. Jeden Abend saß sie vor dem Fernseher, verstand zwar kein Wort,<br />
aber ihr Wunsch, die deutsche Sprache zu lernen, war geweckt. Sie holte<br />
sich das Rüstzeug dann während eines Sprachkurses in Riga. Damals wusste<br />
sie nicht, dass der Entertainer selbst Organist ist – später gab sie mit ihm<br />
gemeinsam in der Kölner Philharmonie ein Konzert für Kinder.<br />
Als ihr gegen Ende des Studiums nicht klar war, was aus ihr werden<br />
sollte, stieß Iveta Apkalna auf Hesses „Siddharta“ und war fasziniert von<br />
der Suche des jungen Helden nach seinem Weg. Gleichzeitig beschäftigte<br />
sie sich mit der Musik von Philip Glass und entdeckte Parallelen. Die Minimal<br />
Music, deren Rhythmen sich litaneihaft wiederholen, sei wie ein steter<br />
Fluss, der sich nicht ändert. „Doch während ich an diesem Fluss sitze, verändere<br />
ich mich.“ <strong>Das</strong> war auch bei anderen Werken von Hesse wie dem<br />
„Glasperlenspiel“ zu spüren und habe ihr bei der Selbstfindung geholfen.<br />
Welches Buch würde sie heute zur Hand nehmen, wenn sie nicht mehr<br />
weiterwüsste? Die „Epifanijas“ von Imants Ziedonis. Sie greift nach dem<br />
schmalen Bändchen und zitiert: „Es gibt viele Wahrheiten in dieser Welt.<br />
Man droht verrückt zu werden, wenn man nicht seine eigene hat.“ <strong>Das</strong> Buch<br />
begleitet sie fast immer, sie lese die Weisheiten jedes Mal neu. So wie sie<br />
seit 15 Jahren dieselben Werke von Bach spielt, dem Komponisten, der für<br />
sie Alpha und Omega ist.<br />
Sie liest Bücher in lettischer, zuweilen auch russischer Sprache. Den Kindern<br />
erzählt sie deutsche Geschichten auf Lettisch. Ihr Mann, ein Deutscher,<br />
von Beruf Tonmeister und Produzent, lernt Lettisch, „natürlich“. Jüngst haben<br />
sie während ihres Urlaubs parallel auf Deutsch und Lettisch „Homo<br />
Novus“ von Anslavs Eglitis gelesen und sich sehr amüsiert über die liebevoll-spöttische<br />
Betrachtung der Kunstszene im Riga der zwanziger Jahre.<br />
Den lettischen Pass will Iveta Apkalna behalten. Augenzwinkernd fügt<br />
sie hinzu: „Never say never.“ In Apinis’ Buch über die berühmten Letten<br />
blättert sie oft. „Seit ich in Deutschland lebe, bin ich patriotischer geworden.“<br />
Foto: Götz Schleser für <strong>Cicero</strong><br />
CLAUDIA RAMMIN würde die Werke von Bach gerne so gut spielen wie Apkalna<br />
133<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
SALON<br />
Hopes Welt<br />
TWEET! KLATSCH! POST IT, AMADEUS!<br />
Wie ich einmal in Bristol dem Kommunikationswahn erlag und<br />
so die Musik von übermorgen erlebte<br />
Von DANIEL HOPE<br />
Die gegenwärtige Debatte über die Zukunft<br />
der klassischen Musik verfolge ich<br />
mit großem Interesse. Auf der einen Seite<br />
stehen die eingefleischten Klassikliebhaber, die<br />
ihre Musik genauso genießen wollen wie eh und<br />
je. Auf der anderen Seite will eine ganze Bewegung<br />
klassische Musik „anders“ präsentieren,<br />
vom Ort bis zur Dramaturgie des Abends. Dazwischen<br />
stehen wir Interpreten, die sich entscheiden<br />
müssen, zu welcher Gruppe wir gehören. Sehr<br />
oft erwähnt die <strong>neue</strong> Bewegung jene Lockerheit,<br />
die im 18. Jahrhundert im Konzertsaal herrschte.<br />
Wenn man aber bedenkt, dass sich damals die<br />
Leute lautstark unterhielten, rauchten, tranken<br />
und Karten spielten, oder dass die Herren gerne<br />
mit dem Rücken zum Podium saßen, damit sie<br />
den Damen besser in die Augen schauen konnten,<br />
gelangt man zu der Erkenntnis, dass nicht jeder<br />
Fortschritt unbedingt negativ ist.<br />
Jedoch sorgt das Abo-Publikum auch heute<br />
für genügend Störfaktoren. Die Palette reicht<br />
von endlosen Hustenanfällen über herunterfallende<br />
Schlüsselbunde bis zum vehementen Türenknallen<br />
von Besuchern, die vorzeitig nach<br />
Hause gehen. Hochsensible Musiker lassen sich<br />
durch derartige Geräuschentwicklungen aus<br />
der Fassung bringen. Von dem Pianisten Alfred<br />
Brendel war bekannt, dass er allergisch auf intensives<br />
Husten reagierte, vernichtende Blicke<br />
ins Auditorium warf und manchmal rief: „Ich<br />
weiß nicht, ob Sie mich hören, ich höre Sie gut!“<br />
Neulich spielte ich bei der Bristol Proms, einem<br />
<strong>neue</strong>n Festival, gegründet vom britischen<br />
Theaterregisseur Tom Morris und Universal Music.<br />
Die Konzerte finden im wunderschönen,<br />
1766 erbauten Old Vic Theatre statt. Morris’ Anliegen<br />
ist es, klassische Musik auf höchstem Niveau<br />
unprätentiös darzubieten. Im letzten Jahr<br />
wurde mein Konzert mit einer Computeranimation<br />
ergänzt, Kameras folgten meinen Bewegungen<br />
und produzierten spontan etwas dazu. Ein<br />
Teil des Publikums steht direkt vor der Bühne, so<br />
wie es bei der Londoner Proms Tradition ist.<br />
Vor jedem Konzert wendet sich Morris an<br />
das Publikum: Klatschen ist stets erlaubt, jeder<br />
darf fotografieren, sofern das Bild gleich gepostet<br />
oder getweetet wird. Der letzte Punkt ist heikel.<br />
Unlängst ist der legendäre Pianist Krystian<br />
Zimerman bei einem Rezital explodiert, als er einen<br />
Besucher entdeckte, der ihn mit dem Handy<br />
filmte. Zimerman habe viele Plattenprojekte verloren,<br />
weil man ihm sagte, das Repertoire sei<br />
bereits auf Youtube, erklärte er wenige Minuten<br />
später. In Bristol entschloss ich mich, dem<br />
Kommunikationswahn, der unsere heutige Gesellschaft<br />
hemmungslos infiltriert, einen Schritt<br />
näherzutreten. Für die zweite Hälfte meines<br />
Konzerts setzte ich eine Google-Brille auf und<br />
filmte die anderen Musiker und das Publikum.<br />
Interessant war die Reaktion eines Mannes,<br />
der die ganze erste Hälfte mit seinem Handy gefilmt<br />
hatte und sich jetzt lauthals über die Verletzung<br />
seiner Rechte beschwerte. Als er sich jedoch<br />
am nächsten Tag auf meiner Facebook-Seite<br />
verewigt sah, schrieb er begeisterte Kommentare<br />
dazu. So also klingt die Zukunftsmusik.<br />
DANIEL HOPE ist Violinist von Weltrang und schreibt<br />
jeden Monat in <strong>Cicero</strong>. Sein Memoirenband „Familienstücke“<br />
war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch<br />
„Toi, toi, toi! – Pannen und Katastrophen in der Musik“<br />
( Rowohlt ) und die CD „Spheres“. Er lebt in Wien<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
134<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Mehr sehen. Mehr erfahren.<br />
Mehr GEO.<br />
Auch als eMagazine.<br />
www.geo.de<br />
Jetzt im Handel.
SALON<br />
136<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
Foto: Ali Ghandtschi/Photoselection<br />
T.C.<br />
Die letzten 24 Stunden<br />
Schreiben, weiter<br />
schreiben,<br />
bis der Wald um<br />
mich schweigt<br />
BOYLE<br />
Tom Coraghessan Boyle<br />
Der aus New York stammende, in<br />
Kalifornien lebende Schriftsteller<br />
schrieb zahlreiche Kurzgeschichten<br />
und Romane, zuletzt „San Miguel“.<br />
Als später Beatnik schürft er in der<br />
Seele der amerikanischen Nation<br />
Eigentlich sind 24 Stunden eine<br />
Zeit, in der man so ziemlich alles<br />
und nichts erledigen kann.<br />
Vielleicht ist es somit keine<br />
schlechte Idee, einfach im Bett<br />
liegen zu bleiben und sich noch ein wenig<br />
auszuruhen, bevor das ewige Ende<br />
naht. Denn wozu noch sich anstrengen,<br />
wozu noch Blumen gießen, Versicherungen<br />
abschließen und das Zeitungsabonnement<br />
kündigen, wenn sowieso bald alles<br />
vorbei sein wird? Ebenso wenig bin<br />
ich der geeignete Typ für letzte Worte<br />
an Freunde und Familie. Wahrscheinlich<br />
werde ich mich deshalb einfach aus dem<br />
Staub machen und ganz allein in die Wälder<br />
fahren.<br />
Auf dem Weg dahin mache ich noch<br />
kurz auf dem Friedhof von Santa Barbara<br />
Halt. Es ist kein trostloser, sondern<br />
ein schöner Ort, nur eine Meile von unserem<br />
Haus entfernt. Bislang habe ich in<br />
diesem Ort kaum mehr als ein störendes<br />
Hindernis auf dem Weg zum Strand gesehen,<br />
weshalb es gewiss nicht schaden<br />
könnte, mich dort schon einmal persönlich<br />
vorzustellen und mich als Bewohner<br />
in spe mit den örtlichen Gepflogenheiten<br />
vertraut zu machen.<br />
Danach fahre ich weiter in die Bergregionen<br />
Kaliforniens. Im Radio laufen<br />
die Beach Boys oder, besser noch, die<br />
Ramones. Erst als ich nach ein paar Stunden<br />
jene Waldhütte erreiche, in die ich<br />
mich sonst gelegentlich für mehrere Wochen<br />
zum Schreiben zurückziehe, wird<br />
mir klar, dass ich nun plötzlich wirklich<br />
allein bin. Es gibt dann nichts mehr, was<br />
mich auf den letzten Metern noch verletzen<br />
oder enttäuschen könnte, denn das<br />
können ja nur Menschen. Und so ist es ein<br />
beruhigendes Gefühl, schließlich nichts<br />
als Tiere um sich herum zu haben, die mir<br />
bei unserer Unterhaltung kurz vor dem<br />
Tod nur noch jene Antworten geben, die<br />
ich hören will.<br />
Natürlich hätte ich auch meine<br />
Schreibmaschine dabei. Früher hatte ich<br />
mir immer fest vorgenommen, 95 Jahre<br />
alt zu werden und nur bis 94 zu schreiben,<br />
um das letzte Jahr dann mit Golfspielen<br />
verbringen zu können. Mittlerweile<br />
würde ich es vorziehen, bis zum<br />
Schluss in die Tasten zu hauen, zu schreiben,<br />
bis ich vom Stuhl kippe. Ich glaube,<br />
dass sich aus dem nahenden Ende die<br />
größtmögliche Inspiration schöpfen lässt.<br />
Dabei sehe ich es bis heute eigentlich gar<br />
nicht ein, warum eines Tages überhaupt<br />
mit alledem Schluss sein soll.<br />
<strong>Das</strong>s bislang offenbar jeder Mensch,<br />
der einmal gelebt hat, auch gestorben ist,<br />
bedeutet doch keineswegs, dass es mir<br />
deshalb genauso ergehen muss. In der katholischen<br />
Mythologie ist die Jungfrau<br />
Maria auch nicht gestorben, sondern hat<br />
ohne Zwischenstopp den direkten Weg<br />
in den Himmel genommen. Nun bin ich<br />
zwar keine Jungfrau mehr, aber ich kann<br />
es zumindest mal versuchen.<br />
Und falls ich doch ganz irdisch und<br />
gewöhnlich in meiner Waldhütte abtreten<br />
sollte, wäre es ganz wunderbar zu<br />
wissen, dass die Person, die mich dort eines<br />
Tages halb verwest finden wird, sich<br />
die Mühe machen würde, meine Aufzeichnungen<br />
bei irgendeinem Verlag einzuwerfen.<br />
Vielleicht würde es nicht schaden,<br />
diese noch zu veröffentlichen, weil<br />
man ja in der Regel vor seinem Tod mehr<br />
zu Papier bringt als danach und es somit<br />
die allerletzten Zeilen sein könnten.<br />
Wirklich große Künstler jedoch machen<br />
auch nach ihrem Ableben weiter:<br />
Jimi Hendrix und Michael Jackson zum<br />
Beispiel produzieren noch immer mindestens<br />
ein Album pro Jahr.<br />
Aufgezeichnet von CLAAS RELOTIUS<br />
137<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
POSTSCRIPTUM<br />
N°-9<br />
PAZIFISTEN<br />
Nein, es sind nicht Leute wie Margot<br />
Käßmann, die den Pazifismus in<br />
Verruf bringen. Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende<br />
hat zwar in einem Interview<br />
den viel zitierten Satz gesagt, sie fände es<br />
gut, wenn die Bundesrepublik nach dem<br />
Vorbild Costa Ricas auf eine Armee<br />
verzichten könnte. Um dann aber gleich<br />
einen weniger oft zitierten Satz hinterherzuschieben:<br />
„Natürlich weiß ich, dass das<br />
eine Utopie ist, allein wegen der Einbindung<br />
Deutschlands in die Nato.“ Käßmann,<br />
die ja manchen als der Inbegriff<br />
friedensbewegter Naivität gilt, ist so naiv<br />
eben doch nicht. Außerdem wird man<br />
einer Theologin kaum zum Vorwurf<br />
machen können, dass sie an ihrer Überzeugung<br />
festhält, mit immer mehr Rüstung<br />
lasse sich kein Frieden schaffen. Nur weil<br />
das ein bisschen nach Poesiealbum klingt,<br />
muss es ja nicht falsch sein.<br />
Aber man kann die Sache auch anders<br />
sehen, sogar als evangelischer Theologe.<br />
So wie Joachim Gauck, der den Vorwurf<br />
von 67 ostdeutschen Geistlichen, er folge<br />
nicht mehr den pazifistischen Grundsätzen,<br />
wie sie von den Kirchen in der DDR<br />
verfochten worden seien, so beantwortete:<br />
Der Bundespräsident könne nicht erkennen,<br />
dass der vom Evangelium gewiesene<br />
Weg ausschließlich der Pazifismus sei.<br />
Denn schuldig werden könne man sowohl<br />
mit einem Ja als auch mit einem Nein zu<br />
militärischer Gewalt. Die Terrorherrschaft<br />
des „Islamischen Staates“ und ein drohender<br />
Völkermord an den Jesiden lassen sich<br />
jedenfalls durch eine radikalpazifistische<br />
Verweigerungshaltung nicht aus der Welt<br />
schaffen. Wenn Gauck also darauf beharrt,<br />
im Kampf für Menschenrechte sei es<br />
„manchmal erforderlich, auch zu den<br />
Waffen zu greifen“, dann wird er damit<br />
nicht nur seiner Verantwortung als Staatsoberhaupt<br />
gerecht. Sondern auch der<br />
Schutzverantwortung der Vereinten<br />
Nationen.<br />
Man muss Gaucks Meinung nicht teilen.<br />
Ihn deswegen aber als „Dschihadisten“ zu<br />
beschimpfen, der „wie ein Irrer alle paar<br />
Monate dafür wirbt, dass sich Deutschland<br />
endlich wieder an Kriegen beteiligt“, ist<br />
eine infame Grenzüberschreitung. <strong>Das</strong>s sie<br />
ausgerechnet von einem CDU-Mitglied<br />
begangen wurde, nämlich dem Bestsellerautor<br />
und gern gesehenen Talkshowgast<br />
Jürgen Todenhöfer, scheint in der Union<br />
bisher kaum jemanden sonderlich zu<br />
stören. Für einen Parteiausschluss ist der<br />
selbst ernannte Friedensapostel Todenhöfer<br />
beim Volk wohl einfach zu populär.<br />
Seinen Vulgärpazifismus macht das aber<br />
keinen Deut besser.<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur<br />
von <strong>Cicero</strong><br />
DIE NÄCHSTE CICERO-AUSGABE ERSCHEINT AM 25. SEPTEMBER<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
138<br />
<strong>Cicero</strong> – 9. 2014
NAVI<br />
ION<br />
TAG<br />
Der Original-<strong>Cicero</strong>-Kalender<br />
Mit praktischer Wochenansicht auf einer Doppelseite<br />
und herausnehmbarem Adressbuch. Begleitet von<br />
Karikaturen, bietet der Kalender viel Platz für Ihre<br />
Termine und Notizen. Im handlichen DIN-A5-Format,<br />
mit stabiler Fadenheftung und wahlweise in rotem<br />
Surbalin- oder schwarzem Ledereinband erhältlich.<br />
Meine Adresse:<br />
Vorname<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
BIC<br />
IBAN<br />
Name<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante<br />
Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an<br />
abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Ja, ich möchte den <strong>Cicero</strong>-Kalender 2015<br />
bestellen!<br />
Ex. in rotem Surbalin je 25 EUR*/19,95<br />
EUR für Abonnenten Bestellnr.: 1219366<br />
Ex. in schwarzem Leder je 69 EUR*<br />
Bestellnr.: 1219365<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen<br />
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-<br />
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung.<br />
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung<br />
des Widerrufs. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing<br />
GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Michael<br />
Voss. *Preise zzgl. Versandkosten von 2,95 € im Inland, Angebot und<br />
Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong><br />
Kalender
Die ganze<br />
Welt im Blick.<br />
Antje Pieper<br />
Die <strong>neue</strong> Moderatorin im<br />
auslandsjournal<br />
mittwochs | 22:15 Uhr