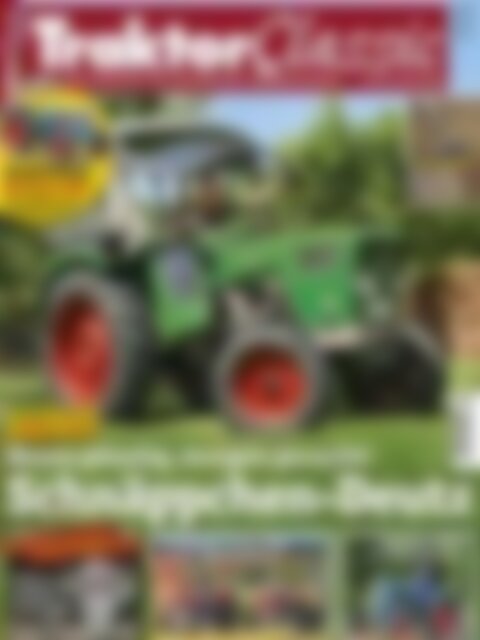Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5,50€<br />
A: €6,30<br />
CH: SFR 11,00<br />
I : €7,45<br />
LUX: €6,50<br />
DAS MAGAZIN FÜR HISTORISCHE LANDMASCHINEN<br />
5/2014 AUG/SEP<br />
HANOMAG<br />
Brillant 600<br />
Drei Jahre lang<br />
restauriert<br />
Expertentipps:<br />
Schraube<br />
abgerissen<br />
– was tun?<br />
<strong>Traktor</strong>-Check:<br />
DEUTZ D 4006<br />
Heute günstig, morgen gesucht:<br />
<strong>Schnäppchen</strong>-<strong>Deutz</strong><br />
Welches Kennzeichen<br />
ist das richtige für Sie?<br />
Hilfe im<br />
Schilder-<br />
Dschungel<br />
Ein Schlepp im Kornfeld<br />
Getreide-Ernte mit Schlütern<br />
Hagedorn HS 15<br />
Eine Rarität kehrt heim
CLASSIC PARTS 2013/2014<br />
DER NEUE KATALOG IST DA!<br />
Erhältlich<br />
bei Ihrem<br />
Landmaschinen-<br />
Fachhändler.<br />
ERSATZTEILE PASSEND FÜR: DEUTZ, EICHER, FAHR, FENDT, FORDSON, GÜLDNER,<br />
HANOMAG, JOHN DEERE, KRAMER, MAN, MASSEY FERGUSON, MCCORMICK,<br />
MERCEDES-BENZ, MWM, PORSCHE DIESEL, RENAULT, SCHLÜTER, STEYR<br />
GRANIT CLASSIC PARTS steht für Oldtimer-Ersatzteile und Zubehör<br />
für alle Hersteller von <strong>Deutz</strong> über HANOMAG bis MASSEY FERGUSON<br />
und PORSCHE DIESEL. Der neue Katalog GRANIT CLASSIC PARTS<br />
2013/2014 mit über 550 Katalogseiten voller Neuheiten für alle<br />
Marken ist das Ersatzteillexikon für jeden Oldtimer-Freund. Ihr<br />
Landmaschinen-Fachhändler hält den neuen Katalog gerne für Sie<br />
bereit. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel.<br />
GRANIT PARTS - Wilhelm Fricke GmbH - www.granit-parts.com
EDITORIAL<br />
Von Ulf Kaack | Verantwortlicher Redakteur<br />
Perfekt oder patiniert?<br />
Schrauben,<br />
Fahren,<br />
Träumen<br />
Liebe <strong>Traktor</strong>freunde,<br />
die Schönheit eines <strong>Traktor</strong>s begründet sich nicht in einer makellosen<br />
Fassade. Sie entsteht in der Funktionalität seiner Technik, dem Klang<br />
und seinem ursprünglichen Karosseriedesign. Dies ist die Sicht der Dinge<br />
von Reinhard Buschfranz, dessen <strong>Deutz</strong> D 4006 wir beginnend mit der<br />
Seite 12 vorstellen. Kosmetische Reparaturen oder optisches Tuning<br />
lehnt er ab. Diese puristische Philosophie entspricht im Übrigen der<br />
Denke vieler akademischer Technikhistoriker, die modifizierende<br />
Restaurierungen für Fahrzeuge in Museen ablehnen und die Konservierung<br />
des gegenwärtigen Zustandes verfechten. Alles andere kommt der<br />
Geschichtsfälschung nahe.<br />
Jede Restaurierung hat<br />
ihren ganz eigenen Reiz.<br />
Ganz anders ist Fabio Wesche bei der Wiederauferstehung seines<br />
Hanomag Brillant 600 vorgegangen: Auf den Seiten 32 bis 37 erfahren<br />
Sie, wie sich der junge Mann mit einer eigenen kreativen Ideologie an<br />
eine immens aufwändige Restaurierung gewagt hat. Das Arbeitsergebnis<br />
ist optisch und technisch von einer hervorragenden Qualität, die Respekt<br />
einfordert. Besser als neu war nicht das Ziel – es ist das nicht geplante<br />
Ergebnis des Prozesses.<br />
Und dann gibt es natürlich solche Glückspilze wie Rudi Ahlers mit<br />
dem zweiten D 4006 in unserem <strong>Traktor</strong>-Check. Vorbildliche Pflege,<br />
regelmäßige Wartung und eine extensive Nutzung haben seinen kantigen<br />
<strong>Deutz</strong> in einem hervorragenden Gebrauchtzustand mit leichten<br />
Nutzungsspuren erhalten. Die obigen Fragen muss er sich nicht stellen!<br />
Wie so häufig im Leben – das ist meine feste Überzeugung – gibt es gerade<br />
bei der Restaurierung historischen Ackergeräts mehrere Wahrheiten, die<br />
allesamt legitim sind und ihren Reiz haben. Freuen wir uns über das<br />
bunte Kaleidoskop, das uns unsere gemeinsame <strong>Traktor</strong> leidenschaft<br />
immer wieder bietet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch viel<br />
Spaß mit der aktuellen Ausgabe<br />
von TRAKTOR CLASSIC.<br />
GeraMond Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Jetzt am<br />
Kiosk!<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Foto: Iris Meyer<br />
Online blättern oder<br />
Testabo mit Prämie unter:<br />
www.autoclassic.de/abo
INHALT<br />
Heft 5/2014<br />
MIT POSTER<br />
AUF SEITE 50<br />
32<br />
Hanomag Brillant 600<br />
Hannoveraner perfekt restauriert<br />
Mit Schlüter ins Getreide<br />
Arbeit mit klassischen <strong>Traktor</strong>en<br />
38<br />
RS 09 und GT 124<br />
gegen Fendt GT<br />
Großer Ost-West-Vergleich<br />
43 der Geräteträger<br />
PORTRÄT<br />
4<br />
FENDT GT GEGEN RS 09 UND GT 124<br />
In beiden Teilen Deutschlands<br />
spielten Geräteträger ab den<br />
1950er-Jahren gleichsam<br />
bedeutende Rollen. Wir lassen<br />
die Erzeugnisse des <strong>Traktor</strong>enwerkes<br />
Schönebeck gegen die<br />
des einst im Westen führenden<br />
Anbieters Fendt antreten.<br />
Spätheimkehrer<br />
Hagedorn HS 15: Aus Frankreich brachte Wenzel<br />
Heitmann einen ultraseltenen Hagedorn HS 15 mit,<br />
der vor 62 Jahren exakt in seinem Heimatort gebaut<br />
wurde. Zufälle gibt’s! 24<br />
Brillanter Jugendstil<br />
Hanomag Brillant 600: Dieses Exemplar überzeugt in<br />
allen Details, kommt mit diversen technischen Raffinessen<br />
daher und ist das Werk eines Jugendlichen. 32<br />
Doppel im Korn<br />
TITEL<br />
Arbeit mit klassischen <strong>Traktor</strong>en: Martin Oeinghaus<br />
erntet sein Getreide mit einem Schlüter Super 650 und<br />
einem gezogenen Fahr-Mähdrescher. 38<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
Geräteträger aus Ost und West: Zwei Systeme im Vergleich<br />
Zwei Systeme<br />
aus zwei<br />
Systemen<br />
Extra<br />
TITEL<br />
Zwei Systeme aus<br />
zwei Systemen<br />
TITEL<br />
Geräteträger in Ost und West: Wir lassen<br />
die Erzeugnisse des DDR-<strong>Traktor</strong>enwerkes<br />
Schönebeck gegen die des einst im Westen<br />
führenden Anbieters Fendt antreten. 43<br />
SERVICE<br />
Heute günstig,<br />
morgen gesucht<br />
TITEL<br />
<strong>Traktor</strong>-Check <strong>Deutz</strong> D 4006: So einen habe ich doch<br />
eben noch auf dem Acker gesehen! In der Tat steht<br />
das Kölner Massenprodukt erst an der Pforte zum<br />
Klassiker. Aber er wird einer werden, ganz sicher! 12<br />
Dichtung und Wahrheit<br />
Motoreninstandsetzung: Unser MWM D 308-3<br />
nimmt Gestalt an. Heute ist die Kupplungsseite<br />
des Motors dran. Außerdem wird die Montage der<br />
Zylinder vorbereitet. 72<br />
Durch den Schilderwald<br />
<strong>Traktor</strong>-Kennzeichen: Welches Kennzeichen ist für<br />
meinen Schlepper das richtige? Hier der Fahrplan<br />
durch den Kennzeichendschungel. 78<br />
Nach fest kommt lose …<br />
TITEL<br />
Schrauben und Muttern: Schrauben können einen<br />
ziemlich ärgern, wenn sie mit einem Schlag abreißen.<br />
Peter Götzinger zeigt, was dann zu tun ist. 82
TRAKTOR<br />
CHECK<br />
<strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Kantiger Kölner auf dem<br />
Weg zum Klassiker<br />
12<br />
GESCHICHTE<br />
Masse und Rasse<br />
Chronik 1954: Schlepper der kleinen Leistungsklassen<br />
bis 20 PS avancierten zumeist zu Bestsellern, große Typen<br />
oberhalb von 30 PS blieben oftmals Ladenhüter. 22<br />
Glückloser Meister<br />
Wesseler Ackermeister: Im Angebot der kleinen, aber<br />
stets auf eine lückenlose Modellpalette bedachten H.<br />
Wesseler OHG durfte ein Geräteträger nicht fehlen. 30<br />
Technikgeschichte aus Köln<br />
150 Jahre <strong>Deutz</strong>:<br />
Nicht nur im <strong>Traktor</strong>enbau<br />
setzte<br />
<strong>Deutz</strong> Akzente.<br />
Vor 150 Jahren<br />
begann in Köln<br />
eine Erfolgsgeschichte,<br />
die dem<br />
Verbrennungs -<br />
motor weltweit<br />
zum Durchbruch<br />
verhalf. 90<br />
RUBRIKEN<br />
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Der besondere Schlepper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Kleinanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69<br />
Leser fragen – Experten antworten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88<br />
Günther, der Treckerfahrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />
Kommentar, Quiz, Leserbriefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94<br />
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
<strong>Vorschau</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />
TRAKTOREN IN DIESER AUSGABE<br />
<strong>Deutz</strong> D 4006 . . . . . . . . . . 12<br />
Farmall F-12 . . . . . . . . . . . 6<br />
Fendt Geräteträger . . . . . 43<br />
GT 124 . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Güldner ALD . . . . . . . . . . 22<br />
Hagedorn HS 15 . . . . . . . 24<br />
Hanomag Brillant 600 . . 32<br />
HELA D 37 . . . . . . . . . . . . . 9<br />
HELA D 120 . . . . . . . . . . . 22<br />
HELA D 215 . . . . . . . . . . . 22<br />
Holder B 12 . . . . . . . . . . . 94<br />
Kramer K 45 . . . . . . . . . . 22<br />
Kramer KL 11. . . . . . . . . . . . 94<br />
Normag Kornett I und II . . . 22<br />
Porsche-Diesel Junior . . . . 9<br />
RS 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Schlüter S 30 . . . . . . . . . . . . 38<br />
Schlüter Super 500 V. . . . . . 38<br />
Schlüter Super 650 . . . . . . . 38<br />
Schlüter Compact 950 V6 . . 38<br />
Wesseler Ackermeister . . . . 31<br />
Wesseler W/WL 36. . . . . . . . 22<br />
Zetor Major . . . . . . . . . . . . . 96<br />
Zetor Super . . . . . . . . . . . . . 22<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
5
DER BESONDERE SCHLEPPER MB-trac 1500<br />
STERN AUF DEM ACKER<br />
Mit dem MB-trac setzte Mercedes-Benz vor rund vier Jahrzehnten neue<br />
Maßstäbe auf dem Acker. Trotz vereinzelter Unkenrufe über die Optik<br />
der „rasenden Telefonzellen“ etablierte sich der Multifunktionsschlepper<br />
aus Gaggenau schnell am Markt. Land- und Forstwirte, aber auch kommunale<br />
Anwender ließen sich schnell von der Technik, den Einsatzmöglichkeiten<br />
und der Wirtschaftlichkeit überzeugen. Auch beeindruckten<br />
die komfortablen Arbeitsbedingungen für den Fahrer durch die schwingungsarm<br />
in der Fahrzeugmitte aufgebaute Kabine mit ihrem großzügigen<br />
Platzangebot, serienmäßiger Servolenkung und auf Wunsch sogar<br />
einer Klimaanlage. Längst sind die robusten Gaggenauer in der Klassiker-Szene<br />
angekommen, wobei sie auf dem Acker noch deutlich häufiger<br />
als auf Oldtimertreffen zu sehen sind. Der hier bei der Arbeit mit der<br />
Scheibenegge abgebildete MB-trac 1500 wurde von Juli 1980 bis Februar<br />
1987 produziert. Exakt 2.855 Kunden entschieden sich für den 150 PS<br />
starken „Sternenkreuzer“.<br />
Ulf Kaack<br />
6
Foto: Ulf Kaack<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
7
PANORAMA<br />
Neuigkeiten und Wissenswertes<br />
OLDTIMERTREFFEN<br />
Feuerwehr im Fokus<br />
Bis in die 1960er-Jahre hinein – und in<br />
den neuen Bundesländern zum Teil bis<br />
zur Wende – fuhren die Freiwilligen<br />
Feuerwehren auf <strong>Traktor</strong>en in den Einsatz.<br />
Meist hatten die Ortswehren einen<br />
einachsigen Anhänger im Gerätehaus,<br />
der im Fall einer Feuersbrunst hinter<br />
dem Schlepper aus dem Fuhrpark eines<br />
Feuerwehrmanns gehängt wurde. Ohne<br />
Blaulicht und Martinshorn ging es so<br />
mit eher beschaulicher Geschwindigkeit<br />
zum Brandort. Allerdings hatte ein<br />
Treckergespann in schwerem Gelände<br />
gegenüber einem konventionellen Feuerwehrfahrzeug<br />
durchaus Vorteile.<br />
Aus diesem Grund feiern die „Oldtimer<br />
Frünn Lütt Meckels“ ihren 25.<br />
Geburtstag am 16. und 17. August gemeinsam<br />
mit der Freiwilligen Feuerwehr<br />
Klein Meckelsen, die in diesem<br />
Jahr auf eine 90-jährige Geschichte zurückblicken<br />
kann. Das Motto des Oldtimertreffens<br />
steht unter dem Begriff<br />
„Landwirtschaft und Feuerwehr“. Geplant<br />
ist eine Sonderschau, die zeigt,<br />
wie in den Jahren nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg Brände in ländlichen Regionen<br />
bekämpft wurden.<br />
Hierzu sind besonders die Besitzer<br />
solch betagter Feuerwehranhänger eingeladen.<br />
Klar, dass die alten Gerätschaften<br />
während des Oldtimertreffens auch<br />
live im Einsatz erlebt werden können.<br />
Weitere Infos und Kontakt unter<br />
www.oldtimer-fruenn.de im Internet.<br />
Klein Meckelsen liegt übrigens in Niedersachsen,<br />
auf halbem Wege zwischen<br />
Bremen und Hamburg direkt an der A1.<br />
DIESELDUNST IN OBERBAYERN<br />
Vitale Oldies im<br />
Museum<br />
Fotos: Sammlung B.Brüns<br />
Solche Prachtbajuwaren auf ihren<br />
nicht minder prächtigen Schleppern<br />
gehen am Sonntag, 20. Juli, im Freilichtmuseum<br />
Glentleiten des Bezirks<br />
Oberbayern oberhalb des Kochelsees<br />
auf große Fahrt! Rund 100 Oldtimer<br />
aller Marken – keiner jünger als 40<br />
Jahre – knattern an diesem Tag über<br />
das Museumsgelände. Ein Teilemarkt<br />
rundet das Geschehen ab. Hinfahren<br />
und dabei sein – es lohnt sich!<br />
Foto: Boenisch<br />
8
Aufgespürt: HELA D 37<br />
Als Fotograf und Autor ist Udo Paulitz seit Jahrzehnten ein Urgestein der Szene. Zahlreiche Bücher<br />
über Nutzfahrzeuge hat er verfasst, sein Bildarchiv ist eine wahre Schatzkammer, die er immer an<br />
dieser Stelle für die Leser von TRAKTOR CLASSIC öffnet und einen besonderen Exoten vorstellt.<br />
Fundstücke<br />
aus dem Bildarchiv von<br />
Udo Paulitz<br />
Die kleine Landmaschinenfabrik Hermann<br />
Lanz im oberschwäbischen Aulendorf<br />
widmete sich zunächst der Herstellung<br />
einfacher Geräte für die Landund<br />
Hofwirtschaft. Im Jahr 1929, zu einer<br />
wirtschaftlich sehr ungünstigen und<br />
turbulenten Zeit, stellte<br />
man den ersten funktionstüchtigen,<br />
von einem kleinen<br />
Ver gasermotor angetriebe-nen<br />
Motormäher auf<br />
die Eisen räder. Bei den fol -<br />
genden, in Kleinserie per<br />
Hand zusammengeschraub -<br />
ten und stets verbesserten<br />
Fahrzeugen wurden sowohl<br />
Vergaser- als auch Dieselmotoren<br />
installiert. Mit der<br />
Zeit wurden diese Modelle<br />
im Erscheinungsbild einem<br />
richtigen <strong>Traktor</strong> immer<br />
ähnlicher. 1937 erfolgte die<br />
Abkehr von der bisherigen<br />
Einzelmontage zur Serienfabrikation,<br />
die erstmals bei<br />
dem neuen luftbereiften<br />
Schleppermodell D 37 praktiziert wurde.<br />
Bei den ab sofort üblichen Modellbezeichnungen<br />
standen das „D“ für<br />
Diesel, während aus den nachfolgenden<br />
Ziffern das Erscheinungsjahr – in<br />
diesem Fall 1937 – ersichtlich war. Das<br />
neue Fahrzeug entstand in Blockbauweise<br />
und wurde von dem wasser -<br />
gekühlten Zweizylinder-<strong>Deutz</strong>-Vor kam -<br />
mer-Diesel F2M 313 mit 20 PS angetrieben.<br />
Ein hauseigenes Vierganggetriebe<br />
sorgte für eine Maximalgeschwindigkeit<br />
von 18 km/h. Von einigen Detailverbesserungen<br />
abgesehen recht ähnlich<br />
war das ab 1938 angebotene Modell<br />
D 38, in das jetzt aber der 22 PS-<strong>Deutz</strong>-<br />
Motor F2M 414 installiert wurde. Ähnlich<br />
verhielt es sich mit dem im darauffolgenden<br />
Jahr fabrizierten Typ D 39.<br />
Von diesen drei, einheitlich für 4.200<br />
Reichsmark verkauften Typen entstanden<br />
immerhin rund 450 Einheiten. Dieses<br />
Modell fiel noch im gleichen Jahr<br />
den Typenbegrenzungen des Schell-Planes<br />
zum Opfer. Bei der nun begonnenen<br />
Modellreihe D 40 verzichtete Hermann<br />
Lanz auf die jahresgebundenen<br />
Typenausweisungen<br />
und bezeichnete alle<br />
ab 1940 gebauten <strong>Traktor</strong>en<br />
als D 40. Auch er besaß<br />
den 22 PS-<strong>Deutz</strong>-Motor<br />
und das bekannte Vierganggetriebe.<br />
Beim D 40<br />
kamen einige aus den Erfahrungen<br />
der Vormodelle<br />
gewonnene Neuerungen<br />
zum Tragen. Insbesondere<br />
aber machten sich die Auswirkungen<br />
des Krieges in<br />
Form von Rohstoffmangel<br />
bemerkbar, sodass an allen<br />
Ecken und Enden gespart<br />
werden musste. Trotz allem<br />
wurde der bis Mitte<br />
1942 in insgesamt 1.214<br />
Exemplaren hergestellte D 40 ein Erfolg.<br />
Ausgerüstet war der Bauernschlepper<br />
mit Licht- und Anlassanlage, Differenzialsperre,<br />
Zapfwelle, Riemenscheibe und<br />
verstellbarer Spur. Auf Wunsch stand<br />
sogar eine Seilwinde zur Verfügung.<br />
Udo Paulitz<br />
EX-BUNDESPRÄSIDENT AUF EINEM PORSCHE DIESEL<br />
Als Christian Wulff noch strahlte<br />
Damals war für Ministerpräsident<br />
Christian Wulff die Welt noch in Ordnung,<br />
2010 bei seiner letzten Sommerreise<br />
durch Niedersachsen. Er war<br />
im Land erfolgreich, seine Frau Bettina<br />
umsorgte ihn und Sohn Linus im<br />
Einfamilienhaus in Großburg wedel<br />
bei Hannover, und den Urlaub verbrachte<br />
er gern und oft fern der Heimat<br />
mit großzügigen Promi-Freunden.<br />
Das glatte Berliner Parkett lag<br />
noch vor ihm, von Affären war noch<br />
keine Rede. Das erklärt, warum „Landesvater“<br />
Wulff bei einem Besuch des<br />
Heeslinger Landmaschinen- und Ersatzteilespezialisten<br />
Fricke im Landkreis<br />
Rotenburg/Wümme vergnügt<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
und unbeschwert hinter dem Lenkrad<br />
eines top-restaurierten und blitzeblanken<br />
Porsche Diesel Junior Platz<br />
nahm. Ebenfalls bestens gelaunte Fricke-Lehrlinge<br />
umringten den smarten<br />
Wulff und posierten erkennbar gern<br />
mit der damaligen Nachwuchs-Hoffnung<br />
der Bundes-CDU. An diesem<br />
28. Juni 2010 blieb es für Wulff allerdings<br />
bei einer Sitzprobe, eine Testfahrt<br />
mit dem Porsche machte er<br />
nicht. Ob er sich nicht traute, ist nicht<br />
überliefert. Zwei Tage später wurde<br />
Wulff in das Amt des Bundespräsidenten<br />
gewählt. Auftritte mit klassischen<br />
<strong>Traktor</strong>en gehörten von da an<br />
nicht mehr zu seinen Aufgaben.<br />
Ex-Bundespräsident Christian Wulff am Steuer eines<br />
Porsche Junior.<br />
Foto: Andreas Dittmer<br />
9
PANORAMA<br />
Historisches und Wissenswertes<br />
FUNHUNTERS INTONIEREN TRAKTOR-SONG<br />
Treckerhymne<br />
Dieser Song könnte für die „Rost- und<br />
Dieselfraktion“ zum Hit der Saison<br />
werden: „Trecker“ titelt eine extrem<br />
energiegeladene, ganz im Stil der<br />
1990er-Jahre produzierte Nummer<br />
der 2014 gegründeten Gruppe „Funhunters“.<br />
Okay, angesichts des 160<br />
bpm-Tempos werden Freunde traditioneller<br />
Blasmusik und kulturelle<br />
Feingeister sicher ihre Probleme mit dem Partykracher<br />
haben, doch hat das Stück ganz sicher das Zeug dazu,<br />
zur Festzelthymne der Oldtimertreffen zu werden. „Trecker“<br />
steht in fünf Versionen auf allen gängigen Internet Plattformen<br />
wie Amazon oder Itunes zum Download bereit. Wer vorab mal in<br />
das dynamische Machwerk der „Funhunters“ reinhören möchte,<br />
dem sei ein Auge und ein Ohr auf Youtube empfohlen.<br />
WWW.TRAKTORCLASSIC.DE<br />
Sie haben abgestimmt:<br />
Welche Kriterien sind wichtig, damit ein <strong>Traktor</strong> Ihre besondere<br />
Aufmerksamkeit auf sich zieht?<br />
Die Marke<br />
49,7%<br />
Technische Raffinesse und Leistung<br />
20,5%<br />
Die individuelle Fahrzeughistorie<br />
29,8%<br />
Wichtige Ereignisse werfen<br />
ihre Schatten<br />
voraus<br />
DVD-TIPP<br />
Günther – der<br />
Treckerfahrer live<br />
Die Kolumne von Günther dem Treckerfahrer ist<br />
eine feste Größe in jeder Ausgabe von TRAKTOR<br />
CLASSIC. Hinter dieser schnodderig-kantigen Figur<br />
verbirgt sich der Comedian und Kabarettist Dietmar<br />
Wischmeyer, unter anderem bekannt aus seinen regelmäßigen Auftritten<br />
in der ZDF heute-show sowie durch diverse Bücher, Tonträger und<br />
ausgedehnte Tourneen. Unter dem Titel „Deutsche Helden“ ist aktuell<br />
eine Doppel-DVD erschienen, die zwei aufgezeichnete Live-Shows vom<br />
Meister des scharfzüngigen Zynismus beinhaltet. Eine gute Gelegenheit<br />
also, unseren humoristischen Treckerfahrer einmal auf der Bühne<br />
zu sehen – wenn auch aus der Retorte. Außerdem so beliebte Figuren<br />
wie der kleine Tierfreund, Kurt – die Arschkrampe, Mike und Willi<br />
Deutschmann. Hart ins Gericht geht er 250 Minuten lang mit geballtem<br />
Brachialhumor mit allem, was in diesem Land an den Pranger gehört.<br />
Die Doppel DVD „Deutsche Helden“ ist für 19,90 Euro im Handel erhältlich<br />
und kann unter www.fsr-shop.de im Internet bestellt werden. UK<br />
BUCHTIPPS<br />
Bestseller aus Köln<br />
Der erschwingliche „Elfer-<strong>Deutz</strong>“ verdiente<br />
sich den Namen „Bauernschlepper“,<br />
weil er ab 1936 zu Tausenden die kleinen<br />
Höfe motorisierte. Auch in einer aufgefrischten<br />
Nachkriegsversion war er schon<br />
ab 1946 viele Jahre lang überaus erfolgreich.<br />
Albert Mößmer beschreibt nicht<br />
nur umfassend Entwicklung, Technik,<br />
Ausstattung und Zubehör des offiziell<br />
zunächst „F1M 414“ genannten<br />
Verkaufsschlagers aus Köln und seiner<br />
späteren zahlreichen Varianten. Ergänzend<br />
betrachtet er auch die zeitgleich<br />
produzierten großen Brüder des „Elfers“<br />
und seine werksinternen Nachfolger,<br />
ehe er den populären „Bauernschlepper“ mit seinen Konkurrenten<br />
vor allem nach 1950 vergleicht. Viele Tabellen, Fotos, Plakate,<br />
Schnittzeichnungen und Dokumente ergänzen das breite Infoangebot.<br />
Das Buch eignet sich voraussetzungslos für Einsteiger, bietet aber<br />
auch Experten einen fundierten und detailreichen Überblick. HF<br />
Albert Mößmer: <strong>Deutz</strong> Bauernschlepper. Typengeschichte und Technik<br />
des Elfer-<strong>Deutz</strong> und der luftgekühlten Einzylinder-Versionen, 135 Seiten,<br />
viele Abbildungen, GeraMond Verlag, München 2014<br />
ISBN 978-3-86245-618-5<br />
DVD-BOX „EICHER-TRAKTOREN“<br />
Bayerisches<br />
Kulturgut<br />
Eicher-Freunde aufgepasst! Unter dem Titel „Eicher-<strong>Traktor</strong>en<br />
– die Zuverlässigen aus Oberbayern“<br />
gibt es hier auf gleich fünf DVDs das volle<br />
Brett über die hellblauen Kultklassiker. Direkt<br />
dem Werksarchiv von Eicher haben die Macher<br />
dieser Box diverse Werbe- und Dokumentarfilme entnommen. Alles kleine<br />
cineastische Ikonen mit dem Charme ihrer Zeit. Vorgestellt wird das Eicher-Programm<br />
von 11 bis 60 PS im Arbeitseinsatz in den 1950er-Jahren.<br />
Ebenso die Porträts des Kombigeräteträgers EGT 19 und des Puma ES 201.<br />
Ein technikhistorisches Stück Zeitgeschichte stellt die Präsentation Panther,<br />
Tiger, Königstiger und Mammut durch Josef Eicher 1959 in München<br />
dar. Das gesamte Spektrum des Herstellers aus dem bayerischen Forstern<br />
wird in alten und neuen bewegten Bildern dargestellt. Ein besonderes<br />
Schmankerl ist dabei eine Reportage über den einzigen noch funktionsfähigen<br />
Holzgasschlepper von Eicher. Die DVD „Eicher-<strong>Traktor</strong>en – die<br />
Zuverlässigen aus Oberbayern“ kann unter www.agrarvideo.de zum Preis<br />
von 59,95 Euro im Internet bestellt werden.<br />
UK<br />
10
MARKANTES AUS BRANCHE UND SZENE<br />
Meilensteine<br />
Jahrestage, Jubiläen, Ereignisse… Was geschah in der Branche, bei den Herstellern und in der Szene? Klaus<br />
Tietgens hat in seinem <strong>Traktor</strong>-Kalendarium rückwärts geblättert und erinnert an dieser Stelle an die wichtigsten<br />
Begebenheiten. Eine informative Reise in die Vergangenheit.<br />
Mit dem WD R 26 stieg die<br />
Hanomag 1924 erfolg -<br />
reich in das<br />
Geschäft mit<br />
Radschleppern<br />
ein.<br />
… begründete die Hanomag den Erfolg ihrer<br />
einfachen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen<br />
Radschlepper. Die Ära der Tragpflüge ging gerade<br />
zu Ende, und die Kettenschlepper des Hauses hatten sich zwar<br />
eine stabile Marktnische erobert, waren für viele Anwendungen<br />
jedoch unnötig aufwändig und teuer. Am Vorbild des Fordson<br />
orientiert, brachte das Hannoversche Unternehmen 1924<br />
einen ebenfalls in Blockbauweise ausgeführten, in zahlreichen<br />
Details jedoch praxisgerechter gestalteten Radschlepper auf<br />
den Markt. Interessante Finanzierungsmodelle festigten den<br />
Verkaufserfolg des Neulings. Rationelle Serienfertigung, stetige<br />
Weiterentwicklung und nicht zuletzt die zu Beginn der<br />
1930er-Jahre erfolgte Ablösung des anfänglich verwendeten<br />
Ottomotors durch den legendären Dieselmotor D 52 verhalfen<br />
der Hanomag zu einer führenden Marktposition. Innerhalb einer<br />
ausgeweiteten Modellpalette überlebte das Grundkonzept<br />
des WD-Radschleppers bis in die frühen 1940er-Jahre.<br />
Vor 90 Jahren …<br />
… machte die International Harvester<br />
Company einen entscheidenden Schritt<br />
vom reinen Zugschlepper zum Mehrzweckgerät. Der revolutionäre<br />
Farmall konnte neben dem Pflügen auch alle Aussaat-,<br />
Pflanz- und Pflegearbeiten erledigen und damit die zur Bewirtschaftung<br />
eines Hofes bislang noch immer notwendigen Pferde<br />
ersetzen. Ende 1923 standen die ersten Vorserienexemplare mit<br />
den für die Erprobung und geplante Vorführungen unverzichtbaren<br />
Anbaugeräten bereit. Knapp ein Jahr später wurden die<br />
ersten serienmäßigen, in zahlreichen Punkten verbesserten<br />
Schlepper an Kunden ausgeliefert. Ab 1. Oktober 1926 lief der<br />
Farmall von den Bändern des eigens für seine Fertigung errichteten<br />
Werks in Rock Island, Illinois, vom Band, und 1927 wurden<br />
die ersten der 9.502 in jenem Jahr gefertigten Schlepper<br />
nach Europa verschifft. Als der Erstling 1932 nach insgesamt<br />
134.453 Einheiten von der Bühne abtrat, war um ihn herum bereits<br />
eine ansehnliche Modellfamilie herangewachsen.<br />
Vor 90 Jahren …<br />
Der Farmall markierte 1924 den Schritt vom reinen Zugschlepper<br />
zum Mehrzweckgerät.<br />
Doppelname, markantes<br />
Design und<br />
moderne Technik<br />
verhalfen der Volvo-<br />
BM-Valmet-Serie 05<br />
ab 1982 zu großen<br />
Verkaufserfolgen.<br />
… leitete Valmet eine entscheidende Ausweitung seiner internationalen<br />
Aktivitäten ein. Im September 1979 unterzeichnete<br />
das finnische Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit Volvo<br />
BM, der mittelfristig in einer kompletten Übernahme der<br />
Landtechniksparte des schwedischen Konzerns mündete. Die Entwicklungsarbeiten<br />
an einer neuen Schlepperserie hatten zu diesem Zeitpunkt<br />
bereits begonnen. Im Juni 1982 wurde diese unter der neu gebildeten Marke<br />
„Volvo BM Valmet“ präsentiert – und genoß sowohl bei finnischen als<br />
auch bei schwedischen Kunden den Status eines einheimischen Erzeugnisses.<br />
Ab 1986 trugen die Schlepper den alleinigen Namen Valmet, und<br />
1990 endete mit den letzten Komponentenlieferungen die Beteilung von<br />
Volvo BM am gemeinsamen Projekt. Das bald darauf zum nordeuropäischen<br />
Marktführer avancierte Unternehmen genießt unter dem Namen<br />
„Valtra“ und – seit 2004 – unter dem Dach des AGCO-Konzerns noch<br />
heute einen hohen Grad an Eigenständigkeit.<br />
Klaus Tietgens<br />
Vor 35 Jahren …<br />
Fotos: Archiv Tietgens<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
11
TRAKTOR-CHECK <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Pflegen ist besser als Restaurieren – hier<br />
steht der Beweis mit knapp 5.500 Betriebsstunden<br />
in über vier Jahrzehnten.<br />
12
DER SCHNÄPPCHEN-DEUTZ: KANTIG, UNVERWÜSTLICH, LUFTGEKÜHLT<br />
Heute günstig,<br />
morgen gesucht<br />
Der D 4006 von <strong>Deutz</strong> ein gesuchter Youngtimer? So einen habe ich doch eben<br />
noch auf dem Acker gesehen! In der Tat steht das Kölner Massenprodukt erst<br />
an der Pforte zum Klassiker. Aber er wird einer werden, ganz sicher!<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
13
TRAKTOR-CHECK <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Kantiges Design und integrierte Frontscheinwerfer<br />
revolutionierten 1968 die<br />
Optik der 06er-Baureihe von <strong>Deutz</strong>.<br />
Dass sein D 4006 ein Klassiker sein<br />
könnte, kam Rudi Ahlers bislang<br />
nicht in den Kopf. Sein Vater hatte<br />
den giftgrünen Kölner einst für<br />
den kleinen Nebenerwerbsbetrieb gekauft.<br />
1972 war das. Die kleine Landwirtschaft<br />
gibt es schon lange nicht mehr. Den vorbildlich<br />
gepflegten <strong>Deutz</strong> nutzt der 60-jährige<br />
Jäger vor allem für Revierarbeiten:<br />
„Beim Anpflanzen von Hegebüschen und<br />
Wildruhezonen zieht er den Anhänger<br />
mit Pflanzen und Arbeitsgerät, kommt<br />
beim Holzrücken im Wald und beim Bau<br />
von Hochsitzen zum Einsatz“, berichtet<br />
Rudi Ahlers. „Ein zuverlässiger Allrounder,<br />
auch abseits von landwirtschaftlichen<br />
Anwendungen – solide und anspruchslos.“<br />
Diese Eigenschaften kann Reinhard<br />
Buschfranz aus Gütersloh nur bestätigen:<br />
„Bei einem Minimum an Pflegeaufwand<br />
ist der D 4006 – ebenso wie seine kleinen<br />
und großen Brüder – praktisch nicht kaputt<br />
zu kriegen. Und wenn der kantige<br />
Geselle irgendwann mal über seine Verschleißgrenzen<br />
hinaus ist, sind Reparaturen<br />
in der Regel ohne großen Zeit- und<br />
Geldaufwand möglich.“ Der 52-jährige<br />
Westfale muss es wissen, denn er ist bekennender<br />
<strong>Deutz</strong>-Aktivist. Insgesamt 14<br />
Stück Eisenwaren aus dem Kölner Sortiment<br />
nennt er zurzeit sein Eigen. Bis auf<br />
einen D 25 allesamt Youngtimer, vorzugsweise<br />
aus der 06er-Serie.<br />
Die beiden Söhne Marcel (11) und Jan-<br />
Hendrik (14) sind mindestens genauso<br />
wie der Senior vom <strong>Deutz</strong>-Bazillus ergriffen<br />
und packen bei sämtlichen anfallenden<br />
Arbeiten mit an. Dabei sind alle drei<br />
keine Verfechter der „Besser als neu-Philosophie“.<br />
Reinhard Buschfranz: „Sämtliche<br />
<strong>Traktor</strong>en in unserer Sammlung tragen<br />
die Spuren ihrer Zeit und die<br />
Wunden ihres Arbeitslebens. Diese Patina<br />
bleibt erhalten. Wir sorgen bei unseren<br />
Bei Ersatzteilen besteht die Wahl: Originale,<br />
Nachfertigungen oder Gebrauchtteile.<br />
Bei den frühen Modellen verlief die Ölleitung auf der Oberseite des Rumpfes und wurde<br />
später von den <strong>Deutz</strong>-Ingenieuren plan darin integriert.<br />
Fotos: U. Kaack<br />
14
Sonderausstattung<br />
Kaufpreis (DM) 1972: 12.550<br />
1977: 18.500<br />
Technische Daten – <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Technische Bezeichnung D 4006<br />
Bauzeit 1/68 – 1980<br />
Neuzulassungen (D) ca. 30.000<br />
Motor F3L 912<br />
Verfahren<br />
Viertakt/Direkteinspritzung<br />
Kühlung<br />
Luft<br />
Zylinderzahl 3<br />
Hubraum (cm 3 ) 2.827<br />
Bohrung x Hub (mm) 100 x 120<br />
Leistung (PS/bei U/min) 35 / 2.150<br />
Drehmoment (Nm/bei U/min) 129 / 1.500<br />
Getriebe <strong>Deutz</strong> TW 35.1/35.3<br />
Gänge v/r 8/2, 8/4<br />
Höchstgeschw. (km/h) 20 – 25<br />
Vorderachse<br />
Pendelnd, auf Wunsch teleskopierbar;<br />
Allrad: SIGE 3500<br />
Batterie (V/Ah)<br />
12 V / 88 Ah<br />
Leergewicht (kg) 1.765 – 1.945; Allrad: 2.280<br />
Zul. Gesamtgewicht (kg) 3.200<br />
Länge (mm) 3.470; Allrad: 3.535<br />
Breite (mm) 1.535<br />
Höhe (mm) 1.550<br />
Radstand (mm) 1.995; Allrad: 2.060<br />
Bodenfreiheit (mm) 430; Allrad: 245<br />
Wendekreis (m) 7,2; Allrad: 9,0<br />
Spurweite vorne (mm) 1.260 / 1.420; Allrad: 1.370<br />
mit Teleskopachse (mm) 1.260 – 1.860<br />
Spurweite hinten (mm) 1.250 / 1.510<br />
mit Verstellfelgen (mm) 1.220 – 1.730<br />
Bereifung vorne 5.50-16; 6.00-17; 7.50-16; Allrad: 7.50-18<br />
Bereifung hinten 12.4-28; 12.4-32; 9.5-36<br />
Serienausstattung 8/2-Gang-Getriebe mit Bolzenschaltung für<br />
die oberen beiden Gänge, Motorzapfwelle<br />
615 U/min, Hydraulik (26 l/min), Kraftheber<br />
(Hubkraft 1.560 kg)<br />
8/4-Gang-Getriebe mit synchronisierter Gangschaltung,<br />
unabhängige Zapfwelle 615/1.020<br />
U/min; Frontlader, seitliches Mähwerk, Heizgebläse,<br />
Komfortsitz, Flaschenhalter<br />
Ein eingeschworenes <strong>Deutz</strong>-Team: Reinhard, Jan-Hendrik und Marcel<br />
Buschfranz schwören auf die grünen Eisenwaren aus Köln.<br />
Der D 4006 zusammen mit seinem „größeren Bruder“, dem D 5006<br />
mit 45 PS Leistung. Zusammen bildeten sie die Mittelklasse der<br />
06er-Reihe von <strong>Deutz</strong>.<br />
Restaurierungen für eine gut funktionierende<br />
Technik sowie den gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Sicherheitsstandard. Die<br />
Optik bleibt weitestgehend unangetastet.<br />
Unsere <strong>Deutz</strong>-<strong>Traktor</strong>en gehören in keinen<br />
Showroom, allenfalls dann und wann<br />
auf ein Oldtimertreffen. Im Gegenteil: Regelmäßig<br />
müssen sie auf Hof und Acker<br />
beweisen, was sie zu leisten vermögen<br />
und wofür sie gebaut sind.“<br />
Kantiges Design<br />
Es waren turbulente Zeiten in der Branche,<br />
als <strong>Deutz</strong> 1968 mit der Präsentation der<br />
neuen Baureihe 06 innerhalb seiner Modellpalette<br />
einen radikalen Generationswandel<br />
vollzog. Aufgrund der allgemeinen<br />
Marktsättigung litten die Hersteller<br />
schon seit Jahren unter rückläufigen Verkaufszahlen.<br />
Gleichzeitig verlangten die<br />
Kunden immer höhere Motorleistungen<br />
und ein breiteres Anwendungsspektrum.<br />
Viele kleinere und mittlere Schlepperproduzenten<br />
fielen vor dem Hintergrund notwendiger<br />
teurer Innovationen und auf<br />
Grund von Betriebsgewinnen, die wie Butter<br />
in der Sonne schmolzen, wirtschaftlich<br />
in den Abgrund.<br />
Die Kölner reagierten offensiv in der<br />
Rezession: Nachdem die 05er-Baureihe<br />
Die kantigen Allrounder sind kaum kleinzukriegen<br />
und außerdem kostengünstig im Betrieb.<br />
bei ihrem Erscheinen 1965 bereits Akzente<br />
gesetzt und dem Unternehmen in den<br />
Folgejahren gute Gewinne beschert hatte,<br />
reagierte die Fachwelt durchaus erstaunt<br />
über die Präsentation der 06er-Reihe be-<br />
Exakt 5.496 Betriebsstunden hat der D 4006<br />
von Rudi Ahlers in 42 Jahren absolviert.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Häufig rosten die Holme an der Rückseite<br />
der hinteren Kotflügel.<br />
Radlager, Achsschenkel und Lenkgestänge<br />
bedürfen eines prüfenden Blickes.<br />
15
TRAKTOR-CHECK <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Die in die Motorhaube integrierten Scheinwerfer<br />
sind werksseitig gummigelagert.<br />
Das Kombiinstrument aus dem Hause Bosch<br />
sollte funktionieren. Ersatz ist nicht billig!<br />
Anfällig: Nicht selten sind die Aufnahmen<br />
für die Oberlenker gebrochen.<br />
Farbschema <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Baujahr Blechteile Rumpf Felgen<br />
ab 1968 Smaragdgrün (RAL 6001) Betongrau (RAL 7023) Rubinrot (RAL 3003)<br />
ab 1970 Smaragdgrün (RAL 6001) Betongrau (RAL 7023) Feuerrot (RAL 3000)<br />
ab 1973 Smaragdgrün (RAL 6001) Betongrau (RAL 7023) Blutorange (RAL 2002)<br />
ab Aug/Sep 1974 <strong>Deutz</strong>-Grün 74 Braungrün (RAL 6008) Blutorange (RAL 2002)<br />
ab Apr/Mai 1978 <strong>Deutz</strong>-Grün 74 Schwarzblau (RAL 5004) Weißaluminium (RAL 9006)<br />
reits drei Jahre später. Geblieben waren<br />
hingegen die beiden konstruktiven Eckpfeiler<br />
des Herstellers: Unverwüstlich<br />
und luftgekühlt!<br />
Abgerückt waren die Gestalter vom<br />
runden Karosseriedesign, das 1959 mit<br />
dem Start der D-Serie die <strong>Deutz</strong>-Optik<br />
prägte. Stattdessen bestimmten – ganz<br />
dem Zeitgeist folgend – klare Linien und<br />
eine eckige Formgebung das Erscheinungsbild.<br />
Die Scheinwerfer waren nun<br />
vorn in die Motorhaube integriert, Rumpf<br />
und Karosserie wurden erstmals in unterschiedlichen<br />
Farben lackiert. Und auch<br />
technisch hatte sich etwas getan: Unter<br />
den Hauben der zunächst sechs Modelle,<br />
die <strong>Deutz</strong> 1968 auf der DLG-Ausstellung<br />
in München unter dem Motto „Premiere<br />
für die neue Kraft“ vorstellte, kamen Motoren<br />
der neu entwickelten 912er-Reihe<br />
zum Einsatz. Diese arbeiteten durchweg –<br />
wie zuvor die seit 1967 in einzelne Typen<br />
eingebauten Triebwerke der Serie 812 D –<br />
mit Direkteinspritzung.<br />
Wie gewohnt, deckten die Kölner mit<br />
der Baureihe so ziemlich das gesamte<br />
Spektrum des landwirtschaftlichen Bedarfs<br />
ab: Für Klein- und Nebenerwerbsbetriebe<br />
offerierten sie die beiden Zweizylinder-Modelle<br />
D 2506 und D 3006 mit 22<br />
und 30 PS. Die Leistungsspitze markierten<br />
der D 7506 und 9006 mit sechs Zylindern<br />
und 75 bzw. 90 PS – und kurzzeitig<br />
der Knicklenker D 16006 mit 160 PS.<br />
„Der D 4006 bildete mit seinem 35 PS<br />
starken F3L 912-Dieselmotor die untere<br />
Mittelklasse“, erklärt Rudi Ahlers die damalige<br />
Programmpolitik des Konzerns,<br />
der zu diesem Zeitpunkt unter dem Namen<br />
KHD – Klöckner-Humboldt-<strong>Deutz</strong> –<br />
firmierte. „Mit dem D 5006 hatte man ihm<br />
einen um zehn PS stärkeren großen Bruder<br />
an die Seite gestellt. 1972 folgte der D<br />
4506, der mit 40 PS eine scheinbare Lücke<br />
im mittleren Leistungssegment auffüllte.“<br />
Gebrochen: Geberfeder für die<br />
Regelhydraulik.<br />
Kontrollieren: Ist der Bedienhebel für die<br />
Transfermatic gängig?<br />
16<br />
Die Bremsleistung des D 4006 war in den<br />
ersten Fertigungsjahren unbefriedigend.<br />
Besserung trat nach Verwendung einer neuen<br />
Legierung bei den Trommeln ein.<br />
Erfolg in der Krise<br />
Die 06er-Reihe sorgte dafür, dass <strong>Deutz</strong><br />
trotz des schwächelnden Marktes an die<br />
Spitze der deutschen Zulassungsstatistik<br />
gespült wurde. Dabei entwickelte sich der<br />
D 4006 als echter Verkaufsschlager. Mit<br />
mehr als 30.000 Fahrzeugen ist er hierzulande<br />
noch heute der am häufigsten an<br />
den Landmann gebrachte Schlepper. Bereits<br />
im ersten Produktionsjahr unterzeichneten<br />
4.892 Kunden einen Kaufvertrag.<br />
In Sachen <strong>Deutz</strong>-Technik macht Reinhard<br />
Buschfranz so schnell keiner was<br />
vor. Der gelernte Landmaschinenmechaniker<br />
kennt sich vor allem mit den Youngtimern<br />
des Herstellers bestens aus. Der
Geschraubt wird bei Familie Buschfranz im Team. Restaurierungen<br />
beschränken sich auf die Technik, die Patina bleibt erhalten.<br />
D 4006 in seiner Sammlung liegt ihm besonders<br />
am Herzen. Sein Vater Paul hat<br />
ihn 1970 neu beim örtlichen Landmaschinenhändler<br />
gekauft. „13.000 Mark hat er<br />
damals dafür bezahlt – inklusive dem<br />
Baas- Frontlader der Größe 2 mit runden<br />
Schwingen sowie einem vollhydraulischen<br />
Mähwerk“, erinnert sich der Westfale.<br />
„Damit haben wir unseren 15 Hektar-<br />
Hof mit 14 Kühen und 50 Schweinen<br />
bewirtschaftet. Den <strong>Deutz</strong> habe ich schon<br />
als Kind gefahren. Nachdem mein Vater<br />
1997 bei einem Unfall ums Leben kam,<br />
führe ich den Hof im Nebenerwerb und<br />
ohne Viehwirtschaft weiter. Regelmäßig<br />
ziehe ich den D 4006 zur Arbeit ran. Allerdings<br />
deutlich weniger als früher, denn<br />
auch der Rest meiner <strong>Deutz</strong>-Flotte will ja<br />
beschäftigt werden.“<br />
In den 44 Jahren hat der <strong>Traktor</strong> nur<br />
zweimal seinen Dienst verweigert. Einmal<br />
musste die wegen des häufigen Frontladerbetriebs<br />
ziemlich mitgenommene<br />
Kupplung mit neuen Belegen versehen<br />
werden. Das andere Mal kam er wegen<br />
seines schlechten Startverhaltens in die<br />
Werkstatt. Dort diagnostizierten die Mechaniker<br />
ganz normalen Motorverschleiß.<br />
Reinhard Buschfranz: „Damals wurden<br />
die Laufbuchsen und die Kolbenringe getauscht.<br />
Durch die Baukastenkonstruktion<br />
des Motors eine wenig aufwändige Reparatur,<br />
die auch finanziell in einem<br />
überschaubaren Rahmen blieb.“<br />
Überhaupt ist die Ersatzteilsituation<br />
für die Kölner Mittelklasse recht entspannt.<br />
Sämtliche Originalersatzteile sind<br />
noch erhältlich. Auch werden reichlich<br />
Ob original, gebraucht oder nachgefertigt – das<br />
Ersatzteilangebot lässt keine Wünsche offen.<br />
Nachfertigungen zu deutlich günstigeren<br />
Konditionen angeboten, wobei hier die<br />
Qualität der Ware der besonderen Aufmerksamkeit<br />
des Kaufwilligen bedarf.<br />
Wer es noch günstiger haben will, schaut<br />
sich auf dem Gebrauchtteilemarkt um.<br />
Angesichts der hohen Produktionszahlen<br />
ist hier das Angebot bis hin zum kompletten<br />
Schlachtfahrzeug riesig. Zudem sind<br />
diverse Teile innerhalb der 06er-Reihe<br />
miteinander austauschbar. Die Motorenreihe<br />
F3L 912 wurde zudem weltweit in<br />
Baumaschinen, Aggregaten und Lastkraftwagen<br />
eingebaut und ist für Robustheit,<br />
Zuverlässigkeit, Lebensdauer und geringen<br />
Verbrauch bekannt. So lohnt bei der<br />
Ersatzteilsuche für den Motor durchaus<br />
ein Blick in die weiteren Sparten von<br />
<strong>Deutz</strong>.<br />
Pflegen und Warten<br />
Auch der 1972 gebaute D 4006 von Rudi<br />
Ahlers hat zweimal die Arbeitsaufnahme<br />
verweigert. „Das lag allerdings daran, dass<br />
sich jeweils die Batterie wegen zu geringer<br />
Nutzung kaputt gestanden hat“, sagt er.<br />
„Erst knapp 5.500 Betriebsstunden hat er<br />
auf dem Zähler – das grenzt in 42 Jahren<br />
fast schon an Arbeitsverweigerung – und<br />
wurde dabei auch nie so richtig rangenommen.<br />
Vor allem der nicht vorhandene<br />
Frontlader schont die Technik.“<br />
Trotz der geringen Laufleistung hat er<br />
die Wartungsintervalle stets penibel eingehalten:<br />
„Wichtig sind regelmäßige Ölwechsel<br />
auch bei nicht so häufiger Nutzung.<br />
Vor allem nach Arbeitseinsätzen,<br />
bei denen der <strong>Deutz</strong> so richtig schmutzig<br />
wurde, habe ich anschließend die Kühllamellen<br />
am Motor mit dem Kompressor<br />
ausgeblasen. Hier kann sich schnell mal<br />
hartnäckiger Dreck einnisten und die<br />
thermische Belastung des F3L 912 unnötig<br />
überstrapazieren. Es empfiehlt sich<br />
auch, den Trecker regelmäßig mit dem<br />
<strong>Deutz</strong> D 4006: Neuzulassungen in Deutschland<br />
Jahr 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 gesamt<br />
Stückzahl 4.451 5.008 4.471 3.677 2.173 1.789 1.452 1.891 1.741 1.307 819 611 517* 29.907<br />
* inklusive D 4007 (ab 8/80)<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
17
TRAKTOR-CHECK<br />
Rudi Ahlers setzt den<br />
D 4006 vor allem in seinem<br />
Jagdrevier ein, hier<br />
zum Transport eines<br />
fahrbaren Hochsitzes.<br />
Die Jagdhunde Eik und<br />
Dana sind stets dabei.<br />
Schlauch abzuspritzen. Reinigen ist die<br />
billigste Art der Rostvorsorge.“<br />
Ebenso wichtig ist beim D 4006 das regelmäßige<br />
Sauberhalten der Atemwege.<br />
Bis 1970 verwendete der Kölner Hersteller<br />
Ölbadluftfilter, die recht aufwändig zu<br />
pflegen waren. Anschließend kamen Trockenluftfilter<br />
zum Einsatz, bei denen die<br />
Patrone mit wenigen Handgriffen zu<br />
wechseln war. „Man muss es nur tun“,<br />
sagt Rudi Ahlers.<br />
Ersatzteilpreise <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Keilriemen<br />
10,90 Euro<br />
Blinkschalter<br />
84,85 Euro<br />
Spurstange<br />
94,32 Euro<br />
Motordichtsatz komplett 127,40 Euro<br />
Einspritzdüse<br />
21,90 Euro<br />
Schalldämpfer<br />
79,00 Euro<br />
Tankdeckel<br />
17,41 Euro<br />
Rückleuchte<br />
59,00 Euro<br />
Bremsbeläge (Satz)<br />
25,00 Euro<br />
Lichtmaschine<br />
154,47 Euro<br />
Kraftstoff-Förderpumpe<br />
20,90 Euro<br />
Inkl. Mehrwertsteuer. Quelle: www.fz-agritechnik.de<br />
Genau hinsehen<br />
Worauf muss ein Interessent beim Kauf eines<br />
D 4006 achten? <strong>Deutz</strong>-Experte Reinhard<br />
Buschfranz hat eine ganze Reihe von<br />
Tipps parat: „Es beginnt mit der Sichtkontrolle.<br />
Zuerst gilt es festzustellen, ob das<br />
Fahrzeug komplett ist. Es gibt zwar nichts,<br />
was der Ersatzteilmarkt nicht hergibt –<br />
aber die Länge der Mängelliste spiegelt<br />
letztendlich den späteren Zeit- und Geldaufwand<br />
wieder. Und den auszuhandelnden<br />
Kaufpreis.“<br />
Das A und O: Prüfen, ob Motor, Getriebe<br />
und Hydraulik Schmierstoffverluste<br />
vorweisen. Optimaler Weise wird der Verschleißgrad<br />
des Diesels mit einem Kompressionsmesser<br />
festgestellt. Aufschluss<br />
über einen schlechten Zustand des Dreizylinders<br />
geben natürlich unwilliges<br />
Startverhalten, hohe Abgasentwicklung<br />
und unruhiges Laufverhalten.<br />
Wichtig ist anschließend eine intensive<br />
Prüfung des Karosseriezustands. „Wie bei<br />
jedem <strong>Traktor</strong> sind auch bei der 06er-Baureihe<br />
arbeitsbedingte Beulen sowie Rost<br />
ein Thema“, so die Erfahrung des 52-jähri-<br />
Der wartungsfreundliche Trockenluftfilter<br />
löste ...<br />
Das tiefe Tulpenlenkrad<br />
wurde 1972 ...<br />
Auch die<br />
Lichtmaschine<br />
wurde im<br />
Zuge der Modellpflege<br />
...<br />
...die im Ölbad arbeitende<br />
Version 1970 ab.<br />
... durch eine flachere<br />
Variante abgelöst.<br />
... durch ein leistungsstärkeres<br />
Modell ersetzt.<br />
18
Marktpreise<br />
<strong>Deutz</strong> D 4006<br />
Vermehrt sieht man den<br />
D 4006 auf Oldtimertreffen.<br />
Ohne Frage, das Alter dazu<br />
hat er. Doch noch deutlich öfter kann man ihn<br />
im täglichen Arbeitseinsatz beobachten. Auf<br />
kleineren Betrieben oder als Zweitfahrzeug<br />
steht er uneingeschränkt seinen Mann als leistungsfähige<br />
Allzweckwaffe mit niedrigen Betriebskosten.<br />
Und das wird sicher noch einige<br />
Zeit so bleiben. Doch ohne Zweifel steht der<br />
Kölner Mittelklässler an der Schwelle zum Klassiker.<br />
Allein der Markenname ist ein Garant für<br />
diesen Status. Die Zeit ist ideal für Kaufinteressenten:<br />
Der Markt gibt momentan Fahrzeuge in<br />
allen Zuständen her – und das innerhalb eines<br />
moderaten Preisgefüges. Fertig restaurierte<br />
D 4006 bilden allerdings die Ausnahme – und<br />
wer ein solches Prachtexemplar hat, behält es<br />
in der Regel auch. Allerdings geben das „Brot<br />
und Butter-Image“ und die hohen Produktionszahlen<br />
kaum Hoffnung für eine steile Wertsteigerung.<br />
Einzig die seltene Allrad-Variante<br />
und der nicht minder rare Schmalspurschlepper<br />
D 4006 P stellen eine ernsthafte Herausforderung<br />
fürs Portemonnaie dar. Ambitionierten<br />
Käufern sei ans Herz gelegt, nicht gleich beim<br />
erstbesten angebotenen Exemplar zuzuschlagen.<br />
Der Markt gibt reichlich Fahrzeuge her, so<br />
dass ein sorgfältiger Abgleich von Zustand und<br />
gefordertem Preis bei der späteren Restaurierung<br />
deutlich Zeit und Geld sparen kann. Extras<br />
wie Frontlader, Heizung oder Fahrerkabine<br />
sorgen meist für einen entsprechenden<br />
Aufschlag.<br />
Zustand fast gebraucht stark verneuwertig<br />
schlissen<br />
Preis (Euro) 7.000 3.500 1.800<br />
gen Landmaschinenmechanikers. „Das<br />
Meiste ist vordergründig zu erkennen.<br />
Pflicht ist ein Blick unter die hinteren Kotflügel.<br />
Fast immer gammeln hier die Holme<br />
weg.“<br />
Die Frontscheinwerfer sind werkseitig<br />
durch Metallstifte und Gummiführungen<br />
schwingend befestigt. Häufig wird hier gepfuscht<br />
und bei Reparaturen der Lampe<br />
einfach eine starre Schraubverbindung<br />
hergestellt, so die Erfahrung des Westfalen.<br />
Blanke Reifen stellen aufgrund ihrer<br />
gängigen Größe kein Beschaffungs- und<br />
Finanzproblem dar. Und ist der Kaufinteressent<br />
gerade an den Vorderrädern zugange,<br />
sollte er durch heftige Bewegung<br />
der selbigen das Spiel von Radlagern und<br />
Achsschenkeln kontrollieren. Auf ähnliche<br />
Weise ist das Spiel von Lenkung und<br />
Lenkgetriebe auf seinen Gesundheitszustand<br />
zu überprüfen. Auch die einwandfreie<br />
Arbeitsweise des Multifunktionsschalters<br />
links neben dem Lenkrad<br />
erfordert eine Überprüfung. Ist das Instrument<br />
defekt, ist Ersatz aus dem Teileregal<br />
von Bosch ziemlich teuer.<br />
Schwachpunkte am Heck<br />
Ganz besondere Aufmerksamkeit sollten<br />
Kaufinteressenten der Heckpartie des<br />
D 4006 widmen. Reinhard Buschfranz:<br />
„Schwachpunkte sind die Aufnahmen der<br />
Oberlenker und die Geberfedern für die<br />
Regelhydraulik, die unter hoher Belastung<br />
oftmals reißen.“ Unterhalb der Rückseite<br />
des Fahrersitzes befindet sich außerdem<br />
ein Bedienhebel zur optimalen Justierung<br />
der über das <strong>Deutz</strong>-Transfermatic-System<br />
betriebenen Anbaugeräte. „Damit kann die<br />
Ackerschiene auf zwei Positionen hydraulisch<br />
fest eingestellt werden, um mechanische<br />
Beschädigungen an den Arbeitsmaschinen<br />
zu vermeiden“, weiß Reinhard<br />
Buschfranz. „Seinerzeit recht innovativ,<br />
denn die Mitbewerber arbeiteten noch mit<br />
Stangen oder Ketten. Die <strong>Deutz</strong>-Besitzer<br />
haben diese Funktion in der Praxis meist<br />
nicht angewendet. Daher ist der Justierhebel<br />
durch Nichtnutzung meist festgegammelt.“<br />
„In den ersten beiden Fertigungsjahren<br />
war die Wirkung der Bremsen eine Katastrophe“,<br />
plaudert der <strong>Deutz</strong>-Profi weiter.<br />
Bei der Montage der Zwillingsbereifung<br />
legen Jan-Hendrik (Foto links) und Marcel<br />
tatkräftig Hand an.<br />
„Einige Bauern haben seinerzeit für den<br />
Prüftermin beim TÜV die Trommeln mit<br />
Wasser geflutet, um eine bessere Verzögerung<br />
zu erzielen. Ab 1970 verwendeten<br />
die Kölner eine bessere Legierung und bekamen<br />
das Problem leidlich in den Griff.“<br />
Modellpflege<br />
Überhaupt gab es zu Beginn der 1970er-<br />
Jahre die ersten Modellpflegemaßnahmen<br />
Der offene Tankdeckel verschwand<br />
mit der ersten Modellpflege ...<br />
Die Heizeinrichtung lieferte<br />
<strong>Deutz</strong> seinerzeit gegen Aufpreis.<br />
Der <strong>Deutz</strong>-<br />
Komfortsitz<br />
konnte dem<br />
Gewicht ...<br />
... unter einer Klappe auf der Motorhaube.<br />
... und der<br />
Größe des<br />
Fahrers angepasst<br />
werden.<br />
Wohlige Wärme genoss der Fahrer<br />
aus den beiden Heizdüsen an den<br />
Füßen.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
19
TRAKTOR-CHECK <strong>Deutz</strong> D 4006<br />
VERDECK- UND KABINENVARIATIONEN<br />
Vom Sonnendach bis zur beheizten Kabine gibt es alle denkbaren Bedachungsvarianten<br />
bei den 4006ern – direkt ab Werk, als Zubehör vom Landmaschinenhändler oder in Eigeninitiative<br />
mehr oder weniger professionell „zurechtgefrickelt“.<br />
Weinberg und Allrad<br />
Zwei Exoten innerhalb der Baureihe dürfen<br />
an dieser Stelle nicht vergessen werden:<br />
Unter der Bezeichnung D 4006 P<br />
wurde von 1968 bis 1972 eine Schmalverbreiterung<br />
und ein klappbares Armaturenbrett,<br />
das Reparaturen wesentlich erleichterte.<br />
Zwei Jahre später führten die<br />
Kölner mit ihrem <strong>Deutz</strong>-Grün eine frischere<br />
und hellere Farbgebung der Karosserie<br />
ein. Der Rumpf kam nun in einem<br />
braungrünen Ton daher, während die Felgen<br />
weiterhin in Blutorange die Lackierbox<br />
des Werkes verließen. Ein erneuter<br />
Wechsel der Kolorierung kam 1978: Nun<br />
seitens des Herstellers: Der Ölbadluftfilter<br />
wich einem Trockenluftfilter, statt des<br />
Tulpenlenkrades mit seiner tief versenkten<br />
Nabe kam nun ein flacheres Steuer<br />
zum Einsatz und auch die Lichtmaschine<br />
wurde durch eine leistungsstärkere Variante<br />
ersetzt. 1972 verschwand der runde<br />
Tankdeckel auf der Motorhaube unter einer<br />
Klappe. Der Schlepper erhielt einen<br />
geteilten Vorderachsbock zur Spurweitenwaren<br />
die Felgen in Aluminiumweiß und<br />
der Rumpf in Schwarzblau gehalten.<br />
Auch an die Bequemlichkeit dachten<br />
die <strong>Deutz</strong>-Entwicklungsingenieure seinerzeit<br />
vermehrt. Der Komfortsitz ließ sich an<br />
die Größe und das Gewicht des Fahrers<br />
anpassen. Die Polster waren klappbar ausgeführt,<br />
so dass das Aufsteigen auf den<br />
<strong>Traktor</strong> erheblich erleichtert wurde. Der D<br />
4006 von Rudi Ahlers verfügt über eine<br />
heute in Sammlerkreisen begehrte Zusatzausstattung:<br />
eine Heizung. „Die gab es damals<br />
gegen Aufpreis, und sie sorgt in<br />
Kombination mit der geschlossenen Kabine<br />
zwar nicht für tropische Temperaturen,<br />
macht die Arbeit in der kalten Jahreszeit<br />
aber deutlich angenehmer“, so seine Erfahrung.<br />
Serienmäßig rüstete <strong>Deutz</strong> den D 4006<br />
mit einem einfachen Sonnendach mit<br />
Windschutzscheibe und losen Seitenteilen<br />
aus. Ab 1970 kam der nun vorgeschriebene<br />
Überrollbügel für die Fahrersicherheit<br />
dazu. Gegen Aufpreis konnten<br />
die Käufer zwischen dem Fritzmeier-Verdeck<br />
M 214, der Fritzmeier-Verdeckkabine<br />
M 711 und der Fritzmeier-Kabine FK<br />
9202 wählen. Weitere Bedachungsvarianten<br />
verschiedener Hersteller – beispielsweise<br />
Edscha und Peko – hatte der örtliche<br />
Landmaschinenhändler im Angebot.<br />
So wird Rudi Ahlers auf seinem <strong>Deutz</strong><br />
von einer DIETEG-Kabine vor den Witterungseinflüssen<br />
geschützt. Eigene Kabinen<br />
baute <strong>Deutz</strong> erst ab 1978 mit Einführung<br />
der DX-Serie – bediente sich für die<br />
kleineren Typen aber noch auf Jahre hinaus<br />
bei Zulieferern.<br />
Die Schmalspurausführung D 4006 P ist unter <strong>Deutz</strong>-Sammlern begehrt.<br />
Nur 800 Fahrzeuge wurden in fünf Jahren gebaut.<br />
Rarität: Von der Allradvariante D 4006 A konnte <strong>Deutz</strong> bis 1972 nur<br />
rund 600 Exemplare an den Mann bringen. Fotos (2): Archiv Tietgens<br />
20
MERKZETTEL<br />
DEUTZ D 4006<br />
–Das bessere Fahrzeug<br />
ist die bessere Wahl.<br />
– Für Hobby-Einsteiger<br />
geeignet.<br />
– <strong>Schnäppchen</strong> direkt<br />
ab Hof sind durchaus<br />
möglich.<br />
– Überschaubares<br />
Budget für<br />
Reparaturen und<br />
Restaurierungen.<br />
– Hervorragende<br />
Ersatzteilversorgung.<br />
– Bei Ersatzteilen:<br />
Original- und<br />
Markenprodukte<br />
bevorzugen.<br />
– Moderate Wert stei -<br />
gerung zu erwarten.<br />
Mit dem F3L 912 präsentierte <strong>Deutz</strong> 1968 einen neuen Motor im Segment<br />
der dreizylindrigen Dieseltriebwerke.<br />
spurversion für den Einsatz in Plantagen,<br />
Baumschulen und in den Weinbergen auf<br />
die Räder gestellt. Vom Basismodell unterschied<br />
sie sich durch die Spurweite vorn<br />
mit 806 bis 1.150 Millimetern und hinten<br />
von 755 bis 1.270 Millimetern. Entsprechend<br />
geringer fiel die Außenbreite aus.<br />
Das Triebwerk war wie bei der normalspurigen<br />
Ausführung in zwei Varianten lieferbar,<br />
die sich im Getriebe und der Zapfwelle<br />
unterschieden. Die Variante „F“ hatte<br />
das Getriebe TW 35.1 mit acht Vorwärtsund<br />
zwei Rückwärtsgängen in zwei Gruppen<br />
sowie eine Motorzapfwelle, die über<br />
ein Zweistufenpedal geschaltet wurde. Die<br />
Variante „U“ mit dem Getriebe TW 35.3<br />
verfügte über ein Vierganggetriebe mit drei<br />
Gruppen – langsam, schnell und rückwärts.<br />
Damit standen acht Vorwärtsgänge<br />
und vier Rückwärtsgänge bereit. Die komplett<br />
unabhängige Zapfwelle wurde mittels<br />
eines Handhebels und einer separaten<br />
Kupplung geschaltet. Etwa 800 Exemplare<br />
des D 4006 P wurden gebaut und sind heute<br />
bei Sammlern entsprechend hoch nachgefragt.<br />
Gesucht und entsprechend teuer sind D 4006<br />
in der Allrad- und Schmalspurausführung.<br />
Nicht minder gesucht – und entsprechend<br />
teuer – ist die Allrad-Variante<br />
D 4006 A, die nur bis 1972 angeboten und<br />
hierzulande in rund 600 Exemplaren verkauft<br />
wurde. Für gut erhaltene Fahrzeuge<br />
werden – wenn sie denn überhaupt auf<br />
dem freien Markt angeboten werden – locker<br />
mal eben 10.000 Euro aufgerufen. Der<br />
Vierradantrieb führte seinerzeit zu einer<br />
Zunahme des Leergewichts um rund 400<br />
Kilogramm. Die Nachfrage hielt sich jedoch<br />
in Grenzen, da Allrad-Interessenten<br />
zumeist ein leistungsstärkeres Modell aus<br />
der 06-Reihe wählten.<br />
Insgesamt zeichnet sich der <strong>Deutz</strong><br />
D 4006 durch seine grundsoliden Allroundeigenschaften<br />
aus. „Eine ehrliche<br />
Haut, keine Diva“, wie Rudi Ahlers meint.<br />
Betrieb, Reparaturen und Restaurierung<br />
sind überschaubar und technisch nicht<br />
übermäßig anspruchsvoll. Darum eignet<br />
sich die Mittelklasse aus Köln hervorragend<br />
für Hobby-Neueinsteiger und handwerklich<br />
„Minderbegabte“ – nicht zuletzt<br />
wegen ihres hohen Nutzwertes. Auf dem<br />
Oldtimertreffen wird man damit sicher<br />
nicht im Rampenlicht stehen, beim <strong>Traktor</strong>pulling<br />
keine Pokale abräumen und<br />
auch riesige Wertzuwächse sind nicht zu<br />
erwarten. Nein, er ist so, wie er ist, der<br />
D 4006: wenig sexy, dafür aber ein rundum<br />
unkomplizierter und zuverlässiger<br />
Weggefährte.<br />
Ulf Kaack<br />
Als Allround-Trecker ist der D 4006 auch heute noch in vielen<br />
landwirtschaftlichen Bereichen uneingeschränkt einsetzbar.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
21
GESCHICHTE Chronik 1954<br />
CHRONIK – VOR 60 JAHREN<br />
Masse und Rasse<br />
Die Neuerscheinungen des Spätsommers 1954 spiegeln<br />
auf überdeutliche Weise die damalige Nachfragesituation<br />
wider. Schlepper der kleinen Leistungsklassen<br />
bis 20 PS avancierten zumeist<br />
zu Bestsellern, große Typen oberhalb von<br />
30 PS blieben oftmals Ladenhüter.<br />
Der Hela D 120 hatte<br />
dem D 20 einen Kriechgang voraus und<br />
verzichtete auf die hintere Portalachse.<br />
Luft- und Wasserkühlung lieferten<br />
sich in der ersten Hälfte der 1950er-<br />
Jahre ebenso einen Wettstreit wie<br />
Zwei- und Viertakter. Zumeist<br />
spielte sich dieser in den kleinen Leistungsklassen<br />
ab, denn schwere Kaliber<br />
wurden zwar von vielen Herstellern angeboten,<br />
doch oftmals nur in bescheidenen<br />
Stückzahlen verkauft.<br />
D 215 und der D 120, die beide von<br />
MWM-Einzylindermotoren der langhubigen<br />
Baureihe angetrieben wurden. Der<br />
im D 215 verbaute KDW 415 E holte aus<br />
1,2 Litern Hubraum 15 PS, der KDW 615 E<br />
im etwas schwereren D 120 verfügte über<br />
1,5 Liter Hubraum und leistete 20 PS.<br />
Identisch war die Abstufung der sechs<br />
Vorwärtsgänge im Bereich von 1,8 bis 20<br />
Güldner holt Luft<br />
Güldners Dieselmotoren dienten einst<br />
nicht nur zum Antrieb der hauseigenen<br />
Schlepper, sondern wurden in nennenswerter<br />
Zahl auch an Wettbewerber ge -<br />
liefert. Dem entbrennenden Wettstreit<br />
zwischen Luft- und Wasserkühlung begegneten<br />
nach den Motorenwerken<br />
Mannheim (MWM) nun auch die Aschaffenburger.<br />
Mit den vom 2DN übernommenen<br />
Zylinderabmessungen entwickelten<br />
sie den 2LD mit ins Schwungrad integriertem<br />
Kühlgebläse. Neben dem im vorigen<br />
Heft beschriebenen Fahr D 130 fungierte<br />
der Zweizylinder auch im Güldner ALD<br />
als treibende Kraft. Davon abgesehen war<br />
Luftkühlung und Zweitaktverfahren<br />
brachten Farbe ins Spiel.<br />
der Neuling weitgehend baugleich mit<br />
dem – vom oben angesprochenen Motor<br />
2DN angetriebenen – ADN. Für die Kraftübertragung<br />
sorgte hier wie dort das ZF-<br />
Getriebe A-5, der Radstand betrug knapp<br />
1,8 Meter. Im Rennen um die Kundengunst<br />
behielt der wassergekühlte Kandidat<br />
die Nase vorn: Er avancierte bis 1959<br />
mit insgesamt 7.827 Exemplaren zu einem<br />
der meistgebauten Güldner-Schlepper<br />
aller Zeiten. Der ALD ließ es hingegen<br />
bei 2.737 Einheiten bewenden.<br />
Hela schafft Vielfalt<br />
Hela setzte seine Strategie fort, Schleppern<br />
mit dem bewährten Portalgetriebe<br />
identisch motorisierte Typen mit dem<br />
leichteren, ebenfalls im eigenen Hause gefertigten<br />
Kriechganggetriebe zur Seite zu<br />
stellen. Auf den D 112 (s. TC 3/2014) und<br />
den D 117 (s. TC 4/2014) folgten nun der<br />
km/h. Der D 215 wurde 1955 für 5.740<br />
DM angeboten, der 20-PS-Typ kostete<br />
rund 1.000 DM mehr. In der breiten Hela-<br />
Modellpalette erreichten beide nur bescheidene<br />
Produktionszahlen. Der D 215<br />
brachte es bis Juni 1957 auf 199, der D 120<br />
bis Anfang 1956 nur auf 23 Exemplare.<br />
Kramer will hoch hinaus<br />
Das seit November 1952 erprobte Kramer-<br />
Flaggschiff K 45 gelangte ab September<br />
1954 vermehrt in Kundenhand. Es han-<br />
Der Normag Kornett II mit Zwei-<br />
taktmotor machte dem<br />
Faktor I mit Viertaktmotor hausinterne Konkurrenz.<br />
Der Wesseler WL 36 mit luftgekühltem Dreizylindermotor füllte<br />
eine Programmlücke zwischen 28 und 40 PS.<br />
Fotos: Archiv K. Tietgens<br />
22
Mit dem ALD ergänzte nun auch Güldner sein Programm um einen<br />
luftgekühlten Schlepper.<br />
Mit dem K 45 erweiterte Kramer sein Programm nach oben – der<br />
große Erfolg blieb allerdings aus.<br />
delte sich gewissermaßen um eine<br />
Extrapolation des recht erfolgreichen<br />
K 33 mit luftgekühltem Dreistatt<br />
Zweizylindermotor (<strong>Deutz</strong><br />
F3L 514 statt F2L 514) und stärkerem<br />
Getriebe (ZF A-17 statt A-15).<br />
Letzteres gewährte dem K 45 die<br />
Ausrüstungsmöglichkeit mit vom<br />
Fahrantrieb unabhängiger Zapfwelle.<br />
Als Imageträger mag Kramers<br />
Flaggschiff seine Aufgabe erfüllt<br />
haben, als direkte Stütze des<br />
Geschäftes weniger. Innerhalb von<br />
drei Jahren verließen gerade einmal<br />
24 Exemplare mit dem obengenannten<br />
Getriebe und darüber<br />
hinaus fünf mit dem nochmals stärkeren<br />
ZF A-23 das Werk.<br />
Weniger im Westen, aber um so mehr im Osten Deutschlands<br />
brachte es der Zetor Super zu einer gewissen Verbreitung.<br />
raumes war der Motor mit einer schräg<br />
nach unten gerichteten Kolbenpumpe<br />
ausgerüstet. Gemeinsam mit der effizienten<br />
Direkteinspritzung ergab sich so ein<br />
außergewöhnlich guter Wirkungsgrad mit<br />
einem minimalen Kraftstoffverbrauch von<br />
nur 166,5 g/PSh. Im September 1954 ergänzte<br />
der zunächst als F 16 B und wenig<br />
später als K 16 geführte „Kornett II“ das<br />
Angebot, in dem der prinzipiell unveränderte<br />
Motor 16 PS abgab. Durch Einbau<br />
der Vorderachse unterhalb des Motors ergab<br />
sich die kuriose Situation, dass der<br />
Radstand des Kornett II mit 1.530 mm um<br />
120 mm kürzer ausfiel als jener des<br />
schwächeren Kornett I. Fortan bestand im<br />
Normag-Programm eine Überschneidung<br />
zwischen den Zweitaktern und der mit<br />
dem Faktor I bei 15 PS beginnenden Vier-<br />
Normag im Zweitakt<br />
Bereits Ende Mai 1953 hatte die Normag<br />
auf der 42. DLG-Wanderausstellung in<br />
Köln ihr Einstiegsmodell G 12 präsentiert,<br />
das wenig später unter der Bezeichnung<br />
F 12 und ab Anfang 1954 unter dem Beinamen<br />
„Kornett I“ verkauft wurde. Herz<br />
des Neulings war ein luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor.<br />
Anders als beispielswiese<br />
die Hanomag, Holder und<br />
Stihl trieb die Normag den Leichtbau<br />
nicht auf die Spitze und ließ den Motor<br />
aus großzügigen 1,3 Litern Hubraum<br />
schöpfen, so dass er für 12 PS Dauerleistung<br />
lediglich 1.500 U/min bemühen<br />
musste. Zur besseren Spülung des Brenntakt-Baureihe.<br />
Preislich lagen die<br />
Kornett-Typen mit 4.980 bzw.<br />
5.950 DM (in Grundausrüstung) allerdings<br />
unterhalb des für 6.180<br />
DM feilgebotenen Faktor I. Der<br />
12/14-PS-Typ brachte es bis 1956<br />
auf fast 4.000 Exemplare, der Kornett<br />
II auf etwa 1.700.<br />
Exoten aus West(falen) und Ost<br />
Von der überregionalen Öffentlichkeit<br />
weitgehend unbemerkt hatte<br />
die H. Wesseler OHG im westfälischen<br />
Altenberge mittlerweile eine<br />
beachtliche Produktpalette aufgebaut.<br />
Jüngste Sprösslinge waren<br />
die erstmals im März 1954 beim TÜV vorgeführten<br />
Typen W 36 und WL 36. Ersterer<br />
wurde vom wassergekühlten MWM-Dreizylinder<br />
KD 12 D angetrieben, letzterer<br />
von dessen luftgekühltem Gegenstück<br />
AKD 112 D. Für die Kraftübertragung sorgte<br />
in beiden Fällen das Fünfganggetriebe<br />
ASS 145 des Berliner Herstellers Prometheus<br />
– bis kurz nach Kriegsende ein bedeutender<br />
Lieferant der Schlepperindustrie,<br />
mittlerweile eher eine Randfigur der<br />
Szene. Als Randfigur konnte in Westdeutschland<br />
auch der Zetor Super mit<br />
42 PS starkem Vierzylindermotor gelten.<br />
Er ergänzte das Angebot des Herstellers<br />
aus dem tschechischen Brünn nach oben<br />
und brachte es im Ostblock und nicht zuletzt<br />
in der DDR zu großer Bedeutung.<br />
Klaus Tietgens<br />
Technische Daten der beschriebenen Schlepper<br />
Modell Güldner ALD Hela D 215 Hela D 120 Kramer K 45 Normag Normag Wesseler Zetor Super<br />
Kornett I Kornett II W/WL 36<br />
Zyl.; Arbeitsverfahren 2; 4-Takt 1; 4-Takt 1; 4-Takt 3; 4-Takt 1; 2-Takt 1; 2-Takt 3; 4-Takt 4; 4-Takt<br />
Hubraum (cm 3) 1.305 1.178 1.478 3.991 1.283 1.283 2.552 / 2.715 4.156<br />
Leistung (PS/bei U/min)17 / 2.000 15 / 1.600 20 / 1.600 45 / 1.600 12 / 1.500 16 / 1.500 36 / 2.000 42 / 1.500<br />
Getriebe: Gänge v/r 5/1 6/1 6/1 5/1; 6/1 5/1 5/1 5/1 5/1<br />
Höchstgeschw. (km/h) 20 20 20 20 – 28 18 18 27 24<br />
Gewicht (kg) 1.050 1.220 1.375 2.500 1.000 1.150 1.700 2.860<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
23
PORTRÄT Hagedorn HS 15<br />
RARITÄT MIT LOKALKOLORIT: HAGEDORN HS 15<br />
Spätheimkehrer<br />
Eigentlich wollte Wenzel Heitmann in Frankreich Holz einkaufen.<br />
Zurück kam er mit einem ultraseltenen Hagedorn HS 15<br />
auf dem Tieflader, der vor 62 Jahren exakt in seinem<br />
Heimatort gebaut wurde. Zufälle gibt’s!<br />
Wenzel Heitmann aus dem westfälischen<br />
Warendorf gilt als einer<br />
der Pioniere der Oldtimerszene.<br />
Seit vier Jahrzehnten sammelt<br />
und restauriert er <strong>Traktor</strong>en und Standmotoren.<br />
„Schon früher konnte ich das nicht<br />
mitansehen, wenn die Bauern ihre alten<br />
Trecker einfach dem Schrotthändler mitgaben“,<br />
erinnert sich der 62-Jährige an die<br />
24<br />
Anfänge. Und weil er als Besitzer eines Sägewerkes<br />
genug Platz hatte, begann er die<br />
ausgemusterten Oldies seiner Nachbarn bei<br />
sich aufzunehmen. Zum Restaurieren war<br />
es da nur noch ein winziger Schritt.<br />
Der Schwerpunkt seiner Sammlung<br />
bildet die Marke <strong>Deutz</strong>. Aber natürlich<br />
war ihm der Name Hagedorn ein Begriff,<br />
hatte das Unternehmen doch in seinem<br />
Heimatort Warendorf jahrzehntelang<br />
<strong>Traktor</strong>en und Landmaschinen gebaut.<br />
Wenzel Heitmann: „Ich weiß noch, wo die<br />
alte Gießerei war, da ist heute das Arbeitsamt<br />
drin. Die anderen Werkhallen stehen<br />
leider nicht mehr.“ Mit den <strong>Traktor</strong>en der<br />
Marke hatte sich der 62-Jährige nie konkreter<br />
befasst: „Die waren selbst hier ein<br />
Mythos. Alle wussten, dass es sie mal ge-<br />
Fotos: B. Wisitinghausen
Auf geht's zum Ackern: Hagedorn HS 15 mit<br />
dem passenden Kartoffelschleuderroder.<br />
geben hatte, aber keiner hätte sagen können,<br />
wo noch einer zu finden gewesen<br />
wäre.“ Bis zum Jahr 1988.<br />
Französische Sensation<br />
Wenzel Heitmann war für sein Sägewerk<br />
in Frankreich unterwegs. Von einem<br />
Weinbauern in der Champagne wollte er<br />
Eichenstämme kaufen. „Wir schlendern<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
so über dessen Hof und zufällig gucke ich<br />
in eine von den offenen Scheunen“, beschreibt<br />
er den aufregenden Moment.<br />
„Die Marke des kleinen <strong>Traktor</strong>s habe ich<br />
zunächst gar nicht erkannt, aber natürlich<br />
war ich als Sammler erst mal neugierig.“<br />
Bei näherem Hinsehen erkannte er das<br />
prägnante Hagedorn-Logo aus gegossenem<br />
Aluminium: „Ich konnte es kaum<br />
glauben. Mit einer Taschenlampe habe ich<br />
dann das Typenschild gesucht und fand<br />
es oben am rückwärtigen Verkleidungsblech<br />
gegenüber vom Lenkrad.“<br />
Der französische Besitzer konnte sich<br />
nicht daran erinnern, wo er den Hagedorn<br />
mal her hatte, so lange stand der schon<br />
einsam und vergessen in seinem Unterstand.<br />
Er nutzte den kleinen Trecker vor<br />
25
PORTRÄT Hagedorn HS 15<br />
Startprozedur: Der MWM-Diesel<br />
wird klassisch mit der Handkurbel<br />
zum Laufen gebracht.<br />
langer Zeit, um mit einer Seilwinde die<br />
Lastschlitten zwischen den Rebenreihen<br />
hoch zu ziehen. Dafür war die Zapfwelle<br />
umgebaut worden.<br />
Wenzel Heitmann gelang es, das Holzgeschäft<br />
mit dem Hagedorn zu verknüpfen,<br />
was nicht schwer war: „Der Franzose war<br />
froh, den alten Blechhaufen los zu sein.“<br />
Zurück auf vertrautem Warendorfer Boden<br />
ging es an die Bestandsaufnahme. Der kleine<br />
HS 15 war sogar fahrbereit. Gut zu erkennen<br />
war die Fahrgestellnummer 12108,<br />
die Plakette gab das Baujahr mit 1951 an –<br />
allerdings die einzigen historischen Hinterlassenschaften,<br />
denn Brief oder sonstige<br />
Unterlagen waren Fehlanzeige.<br />
Wenzel Heitmann hat den Schlepper<br />
teilzerlegt und entsprechend aufgear -<br />
beitet. Dabei stellte sich heraus, dass bei<br />
dem wassergekühlten MWM-Einzylinder<br />
KDW415E einst Väterchen Frost zugeschlagen<br />
hatte. Auf der rechten Seite lässt<br />
sich ganz deutlich die reparierte Narbe eines<br />
früher geplatzten Motorblockes erkennen.<br />
„Dafür hat er noch die Originalplombe<br />
am Anschlag des Gasgestänges als<br />
Drehzahlbegrenzer“, wie er stolz zeigt.<br />
Glühen und Kurbeln<br />
In Verbindung mit dem einfachen Hurth-<br />
Getriebe G 76 mit fünf Vorwärtsgängen<br />
und einem Rückwärtsgang war der<br />
26<br />
MWM-Motor eine seinerzeit oft gewählte<br />
Kombination. Ein Anlasser ist nicht vorhanden,<br />
obwohl Motor und Getriebe -<br />
glocke für den Anbau geeignet sind. Der<br />
Besitzer: „Da dachte so manch ein Bauer<br />
bestimmt mit Gedanken an seinen<br />
Knecht: ‚Den kann der Heini ruhig andrehen‘.“<br />
Immerhin lässt sich der Motor<br />
Hagedorn: Qualität aus Westfalen<br />
Rund zehn Jahre vor dem Ausbruch des Ersten<br />
Weltkriegs entstand die Firma Hagedorn als<br />
Familienbetrieb der Brüder Anton und Georg im<br />
münsterländischen Warendorf. In der ländlich<br />
strukturierten Region stieg der Bedarf an landwirtschaftlichen<br />
Geräten, wobei Metall als Werkstoff<br />
nach und nach die Holzbauweisen ablöste.<br />
Der Betrieb wuchs schnell zu einem bedeutenden<br />
Arbeitgeber. Hagedorn verfügte bereits früh<br />
über eine eigene Gießerei, und Mitte der<br />
1920er-Jahre begann der Bau von motorgetriebenen<br />
Maschinen. Eine Dekade später folgte ein<br />
universell einsetzbarer Ackerschlepper in Rahmenbauweise<br />
nach dem Vorbild des Kramer Allesschaffers<br />
unter der Typenbezeichnung Westfalia.<br />
Dabei griff Hagedorn auf zugekaufte<br />
Verdampfermotoren von <strong>Deutz</strong> zurück. Kriegsbedingt<br />
ruhte die Produktion bis 1949. Nun waren<br />
rahmenlose Schlepper gefragt. Sie waren mit<br />
zugekauften Motoren und Getrieben einfach<br />
und preiswert herzustellen. Regionale Land -<br />
maschinenhersteller hatten die Möglichkeiten,<br />
Metall zu bearbeiten und zu gießen – mehr<br />
brauchte es nicht, um mit den extern eingekauften<br />
Komponenten einen einfachen Trecker auf<br />
schon vorglühen und hat einen Dekompressionshebel,<br />
der gleichzeitig zum Abstellen<br />
benutzt wird. Ohne Starter braucht<br />
der Hagedorn nur eine kleine Batterie für<br />
die Kerzen sowie das Licht, wenn die Maschine<br />
nicht mitläuft. Auch sonst ist der<br />
Schlepper betont einfach gehalten. Einzig<br />
eine Öldruckanzeige gibt Auskunft über<br />
die Räder zu stellen. Bei Hagedorn wurden zwei<br />
Modelle gebaut: Der kleinere HS 15 konnte mit<br />
zwei verschiedenen Motoren geordert werden.<br />
Neben dem wassergekühlten MWM-Einzylinder<br />
KDW415E mit einer Leistung von 14 PS gab es<br />
eine Version mit dem luftgekühlten, 15 PS starken<br />
<strong>Deutz</strong> F1L 514. Für die Kraftübertragung<br />
sorgte durchweg das Hurth-Getriebe G 76 mit<br />
fünf Vorwärtsgängen und einem Rückwärts -<br />
gang. Dazu gab es den HS 25 mit dem wassergekühlten<br />
<strong>Deutz</strong>-Zweizylindermotor F2M 414 und<br />
Vierganggetriebe. Dieses Modell mit immerhin<br />
25 PS soll aber ein Einzelstück geblieben sein.<br />
Zu Beginn der 1950er-Jahre stellte Hagedorn<br />
die Schlepperfertigung ein. Über die Gründe<br />
kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass der<br />
Versuch von Hagedorn, im Schlepperbau an den<br />
Erfolg der Vorkriegszeiten anzuknüpfen, nicht<br />
gelang. Das Unternehmen konzentrierte sich<br />
wieder auf den Bau von Landmaschinen. Mit<br />
Ladewagen und Kartoffelrodern war Hagedorn<br />
europaweit erfolgreich am Markt, ebenso mit<br />
Geräten für den Spargel- und Gemüseanbau. Zu<br />
Beginn der 1990er-Jahre stellte Hagedorn seine<br />
Unternehmenstätigkeiten ein.
Handarbeit war angesagt: Der Anlasser<br />
wurde beim kleinen Hagedorn gerne eingespart,<br />
war aber nachrüstbar.<br />
Hagedorn hatte einst mit Grasmähern angefangen.<br />
Der Mähwerksantrieb war darum<br />
immer noch Standard.<br />
Riemenscheibe und Zapfwelle – hier umgebaut<br />
für die französischen Weinberge – gehörten<br />
ebenfalls zur Grundausstattung.<br />
Ein Warendorfer Gussteil aus betriebseigener Fertigung kombiniert<br />
Werkzeugkasten und Sitzhalterung.<br />
Über einen Dekompressionshebel wird der MWM-Motor des<br />
Hagedorn abgestellt. Der Öldruckabnehmer wurde verstopft.<br />
die Befindlichkeiten der Maschine im Betrieb.<br />
Und die ist vermutlich nachgerüstet<br />
worden, gehörte jedenfalls nicht zur<br />
Grundausstattung. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
des HS 15 ließen mit Riemenscheibe,<br />
Mähwerksantrieb und Zapfwelle<br />
kaum Wünsche offen für den Landwirt in<br />
den frühen 1950er-Jahren.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Vielerorts zeigen sich charakteristische<br />
Merkmale, wie sie jeder Hersteller seinen<br />
Produkten aufdrückt. In diversen Details<br />
verwirklichten die Hagedorn-Konstrukteure<br />
eigene Vorstellungen. So hat der<br />
Mähwerksantrieb eine intelligente Kombination<br />
aus zwei Fußpedalen zum Einund<br />
Ausschalten. Für den Spaltölfilter<br />
Der HS 15 ist<br />
Wenzel Heitmanns Stolz.<br />
hatten sich die Warendorfer – wie andere<br />
Hersteller auch – etwas einfallen lassen.<br />
Weil der immer in der Gefahr war, vernachlässigt<br />
zu werden, koppelte Hagedorn<br />
die Ratsche mit dem Bremspedal.<br />
Beim Betätigen der Bremse wird so über<br />
ein Gestänge der Spaltölfilter mitgedreht.<br />
Technische Raffinessen<br />
Auch den Anbauteilen drückten die<br />
Kleinserienproduzenten ihren Stempel<br />
auf. Der Werkzeugkasten – bei vielen Marken<br />
häufig so etwas wie das Erkennungszeichen<br />
– ist bei Hagedorn unter dem Sitz<br />
angebracht. Das massive Gussteil aus der<br />
eigenen Gießerei beinhaltet zugleich die<br />
Aufnahmestütze für Feder und Sitzschale.<br />
Besonders raffiniert ist der Vorderachsbock<br />
– ebenfalls in der eigenen Schmiede<br />
gefertigt. Versehen mit einem Paar waagerecht<br />
angebrachter Federn, ist die Vorderachse<br />
gegen den Bock leicht flexibel aufgehängt.<br />
Kleine Rempler werden so<br />
abgefangen. Doch die Konstruktion kann<br />
offenbar noch mehr: „Mit einer Art mechanischer<br />
Umlenkung in die Senkrechte<br />
wird auch die ganze Vorderachse beim<br />
Fahren leicht gefedert“, erklärt Wenzel<br />
Heitmann. „So etwas habe ich zuvor noch<br />
nie gesehen.“<br />
Denn serienmäßig wurde der HS 15 mit<br />
einer ungefederten Pendelachse geliefert,<br />
27
PORTRÄT Hagedorn HS 15<br />
Vor jeder Reihe muss der Schleuder -<br />
stern abgesenkt werden.<br />
Der Clou: Der hauseigene Vorderachsbock<br />
hat eine Federung mit Doppelfunktion.<br />
Die Vorderräder laufen in bewährten Rollenlagern.<br />
Zum Tanken und Wasserauffüllen muss die<br />
Haube abgenommen werden.<br />
28<br />
Das Markensymbol<br />
machte<br />
Wenzel<br />
Heitmann<br />
einst in<br />
Frankreich<br />
auf den<br />
Schlepper<br />
aufmerksam.<br />
Technische Daten – Hagedorn HS 15<br />
Techn. Bezeichnung HS 15<br />
Bauzeit 12/49 - 8/51<br />
Stückzahl 55 - 60<br />
Motor<br />
MWM KDW415E;<br />
<strong>Deutz</strong> F1L 514<br />
Verfahren<br />
Viertakt-Wirbelkammer-Diesel<br />
Kühlung<br />
Wasser (<strong>Deutz</strong>: Luft)<br />
Zylinderzahl 1<br />
Hubraum (cm 3 ) 1.178 (<strong>Deutz</strong>: 1.330)<br />
Bohrung x Hub (mm) 100 x 150 (110 x 140)<br />
Leistung (PS bei U/min) 14/1.500 (15/1.650)<br />
Getriebe Hurth G 76<br />
Gänge v/r 5 / 1<br />
Höchstgeschw. (km/h)20<br />
Leergewicht (kg) 1.370 – 1.430<br />
Zul. Gesamtgew. (kg) 1.600<br />
Länge (mm) 2.530<br />
Breite (mm) 1.520<br />
Höhe (mm) 1.550<br />
Spurweite v/h (mm) 1.250 – 1.450<br />
Bereifung v/h 5.50-16 / 9.00-24<br />
Serienausstattung Zapfwelle, Riemenscheibe,<br />
Einzelradbremse,<br />
Mähwerkantrieb,<br />
Vorglüheinrichtung,<br />
Differentialsperre,<br />
zwei Kotflügelsitze<br />
Sonderausstattung Mähwerk, elektrischer<br />
Anlasser<br />
Neben einem zusätzlichen Fußgaspedal fallen<br />
besonders die beiden Pedale für die<br />
Mähwerksbetätigung auf.<br />
Über ein Gestänge wird mit dem Bremspedal<br />
der Ölspaltfilter betätigt.
zugekauft beim Zulieferer Bergische Patentachsen<br />
Wiehl (BPW). Das Bauteil verfügt<br />
bereits über Kegelrollenlager in den<br />
Naben, wie die Schmiernippel verraten.<br />
Auch die Karosserieteile sind einfach gehalten,<br />
dabei aber sehr robust aus geführt.<br />
Einzig bei der Frontmaske schwelgten die<br />
Warendorfer richtiggehend. Nicht weniger<br />
als acht Zierstreifen umrunden den Kühlergrill.<br />
Auf eine große Haube indes wurde<br />
verzichtet. Um zu tanken oder Wasser<br />
nachzufüllen, muss das Mittelsegment abgenommen<br />
werden.<br />
Warum die Hagedorn-<strong>Traktor</strong>en so<br />
selten blieben, kann Wenzel Heitmann<br />
nicht erklären: „Der Name hatte einen<br />
guten Ruf, daran kann es nicht gelegen<br />
haben.“ Damals verkauften sich die<br />
Maschinen fast ausschließlich regional<br />
und über Mund-zu-Mund-Propaganda.<br />
„Wahrscheinlich wollten sich die Brüder<br />
Hagedorn mehr auf den Bau landwirtschaftlicher<br />
Geräte konzentrieren, ihr<br />
Kerngeschäft. Es war halt ein Handwerksbetrieb<br />
und kein Industrieunternehmen“,<br />
spekuliert er. Mehr kann der 62-Jährige<br />
über die gebauten Stückzahlen sagen.<br />
„Immer ist von deutlich weniger als 20<br />
Hagedorn HS 15 die Rede, doch diese<br />
Zahl ist viel zu niedrig angesetzt. Ich habe<br />
noch mit früheren Werksangehörigen gesprochen.<br />
Die sagten durch die Bank, es<br />
seien zwischen 55 und 60 <strong>Traktor</strong>en gebaut<br />
worden.“<br />
Praxistest bestanden<br />
Passend zu seinem raren HS 15 besitzt<br />
Wenzel Heitmann diverse Anbaugeräte<br />
der längst verblichenen Marke Hagedorn.<br />
Sein Kartoffelschleuderroder stammt aus<br />
den 1930er-Jahren. Die Funktionsweise ist<br />
schnell erklärt: Eine kleine, flach angebrachte<br />
Schar bricht den Kartoffeldamm<br />
auf und hebt die Pflanzen gleichzeitig<br />
leicht an. Diese Rodeschar ist in Höhe und<br />
Neigung verstellbar. Unmittelbar dahinter<br />
rotiert der eigentliche Schleuderradstern,<br />
der durch die eigene Radbewegung angetrieben<br />
wird. Die schaufelartigen Zinken<br />
werfen das Erd- und Kartoffelgemisch der<br />
Reihe in einer flachen Schicht gut zwei<br />
Meter zur Seite.<br />
„Einen guten Schleuderroder erkennt<br />
man daran, dass er mit kehrenden Bewegungen<br />
arbeitet“, weiß Heitmann. „Schlagendes<br />
Drehen würde nämlich die Knollen<br />
beschädigen.“ Bedingt durch die<br />
Hagedorn war selbst auf dem Regionalmarkt als<br />
<strong>Traktor</strong>enbauer nur von geringer Bedeutung.<br />
primitive Technik mit einem Winkelgetriebe<br />
geht das nur in eine Richtung. Am<br />
Ende jeder Reihe muss der <strong>Traktor</strong>ist die<br />
Mechanik ausheben, wenden und zurückfahren,<br />
um anschließend den nächsten<br />
Kartoffeldamm in Angriff zu nehmen.<br />
Feldarbeiter folgten einst dem Gespann<br />
und sammelten die Ernte mit der Hand<br />
ein. „Da waren sechs oder sieben Kartoffelleser<br />
voll ausgelastet, damit der Trecker<br />
nicht bei der nächsten Reihe warten<br />
musste oder über die Knollen der vorherigen<br />
fuhr“, nimmt der 62-Jährige an. Und<br />
die Geschwindigkeit, die <strong>Traktor</strong> und Roder<br />
beim neuzeitlichen Test auf dem Feld<br />
vorlegen, ist in der Tat beeindruckend.<br />
Auf den leichten Sandböden bei Warendorf<br />
macht der HS 15 mit seinen 14 PS immer<br />
noch eine gute Figur und zieht den<br />
Roder flott über den Acker. In dieser Kombination<br />
ein wohl einmaliges Bild. Wieviele<br />
der wenigen Dutzend Hagedorn dem<br />
Zahn der Zeit bis heute getrotzt haben, ist<br />
nicht bekannt. Es dürften kaum mehr als<br />
eine Handvoll sein.<br />
Bodo Wistinghausen<br />
Hagedorn im Netz<br />
www.hagedorn-traktor.de.vu<br />
Ein seltenes Gespann: der Hagedorn-Kartoffelschleuderroder<br />
ist in Kombination mit dem HS 15 wahrscheinlich einmalig.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
29
GESCHICHTE<br />
Geräteträger und Systemschlepper<br />
Zwei Hydraulikzylinder sorgen zusammen<br />
mit einem Gestänge für die<br />
Aushebung der Ackergeräte.<br />
WESSELER ACKERMEISTER<br />
Glückloser Meister<br />
Im Angebot der kleinen, aber stets auf eine lückenlose Modellpalette bedachten H. Wesseler OHG<br />
durfte ein Geräteträger nicht fehlen. Trotz praxisgerechter Motorleistung und zeitgemäßer Technik<br />
überzeugte der „Ackermeister“ nur wenig mehr als 100 Kunden.<br />
Die historische Entwicklung der H.<br />
Wesseler OHG ist nicht untypisch<br />
für einen jener zahllosen kleinen,<br />
vom Boom der landwirtschaftlichen<br />
Motorisierung getragenen Betriebe.<br />
Neben der Landwirtschaft betrieb die Familie<br />
vor den Toren von Altenberge in<br />
Westfalen eine Schmiede. 1936 oder 1937<br />
baute Heinrich Wesseler seinen ersten eigenen<br />
Ackerschlepper und weckte damit<br />
das Interesse der Nachbarschaft.<br />
Volles Programm<br />
Nach rund 20 Exemplaren ruhte die Fer -<br />
tigung kriegsbedingt, konnte jedoch<br />
1948 wieder aufgenommen werden. Mit<br />
der ausschließlichen Verwendung von<br />
MWM-Motoren folgte Wesseler ab 1950<br />
dem Beispiel anderer Hersteller und hob<br />
sich zugleich klar von den Erzeugnissen<br />
eines nur sechs Kilometer entfernt ansässigen<br />
<strong>Deutz</strong>-Händlers ab. Eine breite Modellpalette<br />
sollte möglichst alle Kundenwünsche<br />
abdecken. So standen ab 1953<br />
Schlepper von 12 bis 40 PS im Angebot,<br />
und 1964 waren es schließlich sechs Typen<br />
von 20 bis 56 PS.<br />
30<br />
Nach einer Ausweitung der Fertigungskapazitäten<br />
verließ im April 1956 der erste<br />
Geräteträger die Werkhallen in Altenberge.<br />
Die technische Basis bildete das Einstiegsmodell<br />
des Hauses, der WL 12. Für dessen<br />
Antrieb sorgte der luftgekühlte MWM-Einzylindermotor<br />
AKD 112 E mit 12 PS, das<br />
ZF-Getriebe A-5 war in diesem Schlepper<br />
eben erst vom leichteren A-4 abgelöst worden.<br />
Dieses verfügte in zwei Gruppen über<br />
insgesamt sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge<br />
und konnte auf Wunsch um<br />
Für den Antrieb des WLG 18 sorgt der<br />
luftgekühlte MWM-Zweizylindermotor<br />
AKD 311 Z.<br />
eine zusätzliche Kriechgruppe mit 3/1<br />
Gängen ab 0,8 km/h ergänzt werden. Der<br />
Geräterahmen bestand aus einem Vierkantholm,<br />
an dem die Vorderachse pendelnd<br />
aufgehängt war. Letztere war ausziehbar<br />
und sorgte damit im Verein mit den hinteren<br />
Verstellfelgen für eine von 1.250 bis<br />
2.000 mm variierbare Spurweite. Die Aushebung<br />
der am Rahmen zu montierenden<br />
Gerätschaften wurde, ebenso wie der Kippmechanismus<br />
der optionalen Ladepritsche,<br />
mittels zweier Hydraulikzylinder ak-<br />
Portalvorgelege an der zum ZF-Getriebe<br />
A-5/6 gehörenden Hinterachse ergeben<br />
eine großzügige Bodenfreiheit.<br />
Fotos: Archiv K. Tietgens
Mit Anhängekupplung und hydraulischem<br />
Dreipunkt-Kraftheber begegnet der WLG 18<br />
den Herausforderungen des Arbeitsalltags.<br />
tiviert. Wie seine meisten Konkurrenten<br />
eignete sich der „Ackermeister WLG 12“<br />
mit vorderem Zugmaul, hinterer Anhängekupplung,<br />
Ackerschiene und optionalem<br />
Dreipunkt-Kraftheber für die gleichen Aufgaben<br />
wie herkömmliche Ackerschlepper.<br />
Leistung läuft<br />
Mit kaum mehr als 6.000 Mark war der<br />
Ackermeister konkurrenzlos preisgünstig,<br />
doch setzten 12 PS der Durchführung mehrerer<br />
Arbeitsgänge gleichzeitig enge Grenzen.<br />
Gerade einmal fünf Kunden gaben<br />
sich mit dieser bescheidenen Motorleistung<br />
zufrieden. Glücklicherweise stand<br />
seit August 1956 der WLG 18 im Angebot,<br />
dessen luftgekühlter MWM-Zweizylindermotor<br />
AKD 311 Z mit 18 PS für energischeren<br />
Vortrieb sorgte. Das hier verwendete<br />
ZF-Getriebe A-5/6 stellte zwar nur sechs<br />
Vorwärtsgänge von 1,4 bis 20 km/h zur Verfügung,<br />
doch blieben angesichts der recht<br />
günstigen Abstufung dieser auch von Lanz,<br />
Ritscher und Eicher verwendeten Kraftübertragung<br />
kaum Wünsche offen. Mehr<br />
Leistung bot ab 1957 ohnehin nur Eicher,<br />
und als Fendt seinen schwächlichen 12-<br />
PS-Erstling 1958 endlich durch einen 19-<br />
PS-Geräteträger ersetzt hatte, konterte Wesseler<br />
im August 1959 mit dem WLG 20, der<br />
dem WLG 18 lediglich eine auf 20 PS gesteigerte<br />
Motorleistung voraus hatte.<br />
Erstaunliche Parallelen<br />
Dabei verwendete Wesseler den gleichen<br />
Motor wie Fendt, und dieses Spiel wie-<br />
derholte sich drei Jahre später. Fendt präsentierte<br />
1961 den F 225 GT, Wesseler im<br />
August 1962 den WLG 25. Hier wie dort<br />
gelangte der luftgekühlte MWM-Zwei -<br />
zylinder AKD 112 Z mit 25 PS zum Einsatz,<br />
und hier wie dort verfügte das Getriebe<br />
über drei Gruppen mit insgesamt 8/4<br />
Gängen – eine Eigenkonstruktion bei<br />
Fendt, das ZF A-205 mit zweistufiger<br />
Zapfwelle (540/1.000 U/min) bei Wesseler.<br />
Als Fendt im Juli 1964 den 30 PS starken<br />
F 230 GT herausbrachte, fiel Wesseler<br />
leicht zurück. Der ab Oktober 1964<br />
gelieferte WLG 28 bot mit 27 PS zwar<br />
nicht viel weniger Leistung als der Fendt,<br />
presste diese jedoch aus dem MWM-<br />
Zweizylinder AKD 1105 Z, während der<br />
Typische Ausstattung:<br />
Hydraulisch kippbare Lade -<br />
pritsche – hier auf dem WLG 18.<br />
Fendt aus dem Dreizylinder AKD 1105 D<br />
(dort AKD 210,5 D genannt) der gleichen<br />
Baureihe schöpfen konnte.<br />
Bescheidene Nachfrage<br />
Mehr Kaufkraft konnte der Fendt ohnehin<br />
abschöpfen. Dessen Produktion überschritt<br />
im Frühjahr 1966 die Marke von 5.000<br />
Exemplaren, während sich für den zunächst<br />
WLG 28, Anfang 1965 kurzzeitig<br />
Binnen weniger Monate reagierte Wesseler auf<br />
den Wunsch der Kunden nach mehr Leistung.<br />
Kurz vor Torschluss: Wesselers letzter<br />
Ackermeister leistete 27 PS, fand jedoch<br />
nur 13 Käufer.<br />
WLG 30 und schließlich WLG 227 genannten<br />
Wesseler bis dahin gerade einmal 13<br />
Käufer entschieden. Nicht ohne Grund hatte<br />
das kleine westfälische Unternehmen zu<br />
Beginn des Jahres 1966 eine Vertretung für<br />
Fiat-Schlepper übernommen und stellte<br />
die unrentable Eigenfertigung nach dem<br />
Tod von Heinrich Wesseler sen. einige Monate<br />
später ein. Nur rund 3.600 Exemplare<br />
hatten das Werk verlassen, doch selbst daran<br />
gemessen, nehmen sich wenig mehr als<br />
100 Geräteträger bescheiden aus. Das knappe<br />
Budget hatte es dem Hersteller nicht erlaubt,<br />
die Vorteile des Prinzips in der Werbung<br />
hinreichend herauszustellen und<br />
eine optimal darauf abgestimmte Gerätereihe<br />
anzubieten.<br />
Klaus Tietgens<br />
Lesen Sie in der nächsten Folge:<br />
Verborgene Blüte: Kurzlebige Geräteträger-Raritäten<br />
Wesseler Ackermeister von 1956 bis 1966<br />
Typ Produktions- Produktions- Motor Leistung Getriebe Gänge v/r Radstand Eigenge- Preis<br />
zeit zahl (PS bei U/min) (mm) wicht (kg) (DM)<br />
WLG 12 4/56 – 11/56 4 AKD 112 E 12 / 2.000 A-4 6/2; 9/3 2.070 1.100 6.070<br />
WLG 18 8/56 – 4/59 AKD 311 Z 18 / 2.000 A-5/6 6/1 2.150 1.220 7.350<br />
WLG 20 8/59 – 3/62 AKD 311 Z 20 / 2.200 A-5/6 6/1 2.150 1.220 7.950<br />
WLG 25 8/62 – 8/64 ca. 30 AKD 112 Z 25 / 2.000 A-205 8/4 2.180 1.650 k. A.<br />
WLG 28, 30, 227 10/64 - 3/66 13 AKD 1105 Z 27 / 2.600 A-205 8/4 2.200 1.530 – 1.730 k. A.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
31
PORTRÄT Hanomag Brillant 600<br />
Eine wuchtige Erscheinung<br />
dank der breiten Hinterräder<br />
und des Frontgewichts.<br />
PRÄZISIONSARBEIT: HANOMAG BRILLANT 600<br />
Brillanter Jugendstil<br />
Wuchtige Optik, kräftiger Motor, kerniger Sound. Dieser Hanomag Brillant 600 überzeugt in allen<br />
Details, kommt mit diversen technischen Raffinessen daher. Und ist das Werk eines Jugendlichen,<br />
der ihn in dreijähriger Kleinstarbeit liebevoll restauriert hat.<br />
Er ist Perfektionist, steht auf robuste<br />
Technik mit individueller Note und<br />
ist seit Februar volljährig: Fabio Wesche<br />
war 15 Jahre alt, als er sich für<br />
den Kauf eines betagten Hanomag Brillant<br />
600 entschied. Ein Restaurierungsobjekt<br />
für anspruchsvolle Könner. Schaut man<br />
32<br />
sich heute seinen perfekt dastehenden<br />
Hannoveraner an, so zieht man mit Respekt<br />
die Mütze vor dem Arbeitsergebnis<br />
und der Leistung des jungen Mannes.<br />
Das handwerkliche Können von Fabio<br />
kommt nicht von ungefähr. Sein Vater Jens<br />
ist Landmaschinen-Mechanikermeister.<br />
Im Nebenerwerb betreibt er eine Selbsthilfewerkstatt<br />
sowie einen Reparaturbetrieb<br />
für Pkw und landwirtschaftliches Gerät in<br />
Müden, einem Dorf im Süden der Lüneburger<br />
Heide. Ein <strong>Deutz</strong> D 15, ein Fendt<br />
Favorit 3 sowie ein Fendt Farmer 311 LSA<br />
gehören zum Familienfuhrpark und sind<br />
Fotos: U. Kaack, F. Wesche
Gute Substanz,<br />
aber<br />
reichlich<br />
Arbeit.<br />
Fabios Hanomag<br />
im Urzustand.<br />
Der Brillant wird<br />
schrittweise zerlegt.<br />
Spezialkonstruktion<br />
zur Zahnrad-Hebung.<br />
Frisch einge -<br />
schweiß tes Blech.<br />
Teilentkerntes<br />
Getriebe.<br />
Lager mit<br />
Kugel -<br />
schwund im<br />
Achstrichter.<br />
regelmäßig in Gebrauch. Fabio wuchs in<br />
diesem Umfeld aus Metall und Diesel auf.<br />
Von Kindsbeinen an war er in der Werkstatt<br />
präsent und lernte schnell das<br />
Schrauben sowie die technischen Zusammenhänge.<br />
Autos und Motoräder gelangten<br />
dabei nie in den Fokus seiner Interessen:<br />
„Von Beginn an war ich von alten und<br />
auch modernen <strong>Traktor</strong>en fasziniert – vor<br />
allem wenn der Markenname Fendt auf<br />
dem Typenschild steht. Meine Eltern haben<br />
das immer tatkräftig unterstützt, weil<br />
es unbestritten ein sinnvolles Hobby ist.“<br />
Konfirmationsgeld investiert<br />
So war es gar nicht so selbstverständlich,<br />
dass sich Fabio vor gut zweieinhalb Jahren<br />
für den Kauf seines Hanomag Brillant<br />
600 entschied. „In der Tat war ich auf einen<br />
Fendt scharf“, erinnert sich der 18-<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Jährige. „Ich hatte gerade Konfirmation<br />
und war entsprechend finanzstark, da<br />
stand bei uns im Dorf eben dieser Hanomag<br />
zum Verkauf. Die Marke war hier in<br />
der Region vor allem wegen der Nähe zum<br />
Herstellerwerk in Hannover bei den Bauern<br />
recht stark vertreten. Also habe ich<br />
mich in meinem jugendlichen Eifer für –<br />
wie ich damals meinte – die zweitbeste<br />
Lösung entschieden. Heute bin ich glücklich<br />
über den Entschluss.“<br />
Fast zwei Jahrzehnte lang stand der<br />
blaue Brillant 600 unbewegt auf dem Anwesen<br />
eines Landwirts in der Nachbarschaft.<br />
Ein Getriebeschaden hatte ihn seinerzeit<br />
unfreiwillig in den Vorruhestand<br />
geschickt. Der Eigentümer forderte einen<br />
fairen Kurs für das 1965 gebaute Gefährt<br />
und hatte schneller als erwartet einige<br />
Quadratmeter mehr Platz in seiner Scheune<br />
frei. „Anfang 2012 war das“, erinnert<br />
sich Fabio. „ Nahezu zeitglich bekam ich<br />
Vaters Profi-Werkstatt war ein optimales<br />
Arbeitsumfeld für die Restaurierung.<br />
meinen Ausbildungsvertrag zur Unterschrift<br />
zugeschickt.“ Mechaniker für<br />
Land- und Baumaschinentechnik heißt<br />
seitdem sein berufliches Ziel. Im Sommer<br />
kommt er ins dritte Lehrjahr.<br />
Unübersehbar passten die Rahmenbedingungen<br />
aus Hobby, Beruf und Arbeitsumfeld<br />
für den jungen Niedersachsen per-<br />
33
PORTRÄT Hanomag Brillant 600<br />
Auch bei der landwirtschaftlichen Arbeit<br />
macht der betagte Hanomag eine gute Figur.<br />
fekt. Nachdem der Brillant mit dem Kärcher<br />
und allerhand groben chemischen<br />
Mixturen von seinem Dreckpanzer befreit<br />
war, nahm Fabio sich in Vaters professionell<br />
eingerichteter Werkstatt zunächst das<br />
schwächelnde Getriebe vor: „Wegen eines<br />
Lagerschadens und eines Defektes am Differentialkorb<br />
machte es heftige, metallisch-schlagende<br />
Geräusche. An entspanntes<br />
Fahren war damit überhaupt<br />
nicht zu denken.“<br />
So manchem Schrauber graust es angesichts<br />
eines Getriebeschadens. Nicht so<br />
Fabio: Furchtlos entkernte er das Räderwerk<br />
und lagerte es komplett neu. „Das<br />
Zahnrad des dritten Ganges war, bedingt<br />
durch ständigen Frontladerbetrieb, runter<br />
bis aufs Zahnfleisch“, grinst er spitzbübisch<br />
und fügt hinzu: „Irgendwie muss<br />
ich mich bei den Zähnen des neuen Zahnrades<br />
verzählt haben. Hinterher lief der<br />
Hanomag ein bisschen schneller.“<br />
Wegen des Getriebeschadens war bei<br />
der Vorgelegewelle ein Zahn herausgebrochen.<br />
Mit einer Portion Glück bekam der<br />
damals 16-Jährige passenden Ersatz, eingelegt<br />
in Ölpapier und im originalenKarton<br />
der Hanomag. Auch die Simmerringe<br />
in den Achstrichtern hat er erneuert.<br />
Gute Kontakte gefragt<br />
Überhaupt sind Ersatzteile für den Brillant<br />
600 so eine Sache. „Zu kriegen ist<br />
grundsätzlich alles“, so Fabios Erfahrung.<br />
„Neue Originalteile sind oftmals extrem<br />
teuer, Nachfertigungen hingegen schlecht<br />
und trotzdem teuer. In den Niederlanden<br />
blüht der Handel mit Gebrauchtware, so<br />
dass ein Blick über die Grenze immer gut<br />
ist. Unterm Strich braucht der Hanomag-<br />
Aktivist vor allem Geduld und gute Kontakte<br />
– oder ein dickes Portemonnaie!“<br />
Die Bremswirkung, so das Ergebnis einer<br />
Probefahrt, ging selbst bei einem beherzten<br />
Tritt aufs Pedal gegen Null. Der<br />
Zustand besserte sich deutlich, nachdem<br />
die Beläge mit dem Sandstrahler aufgeraut<br />
wurden. Auch die Handbremse liefert<br />
mit erneuerten Belägen die von ihr geforderte<br />
Verzögerungswirkung.<br />
Die Doppelkupplung wurde durch das<br />
Aufnieten neuer Beläge praktisch in den<br />
Neuzustand versetzt, und dann ging es an<br />
den Motor. Der machte keine Probleme,<br />
lief rund und sauber. Trotzdem öffnete Fabio<br />
den 50 PS starken D 28 CR, um sich<br />
von dessen inneren Werten zu überzeugen<br />
… und war überzeugt. Er spendierte<br />
einen Satz fabrikneuer Einspritzdüsen<br />
und dichtete den Vierzylinder-Wirbelkammerdiesel<br />
neu ab. Das war’s!<br />
Neue Sicht der Dinge<br />
Alles schien auf eine perfekte Restaurierung<br />
in Richtung Originalzustand hinaus<br />
zu laufen. Doch während der laufenden<br />
Neue Instrumente<br />
zieren<br />
das Cockpit.<br />
Frischlackierte<br />
Kotflügel<br />
...<br />
34<br />
Motivierender<br />
Baufortschritt.<br />
... und Felgen.
Marktpreise<br />
Hanomag Brillant 600<br />
Damals wie heute bildeten<br />
Hanomag-<strong>Traktor</strong>en die solide<br />
und gehobene Mittelklasse.<br />
Da macht auch der Brillant 600 keine Ausnahme,<br />
im Gegenteil: Der Rundhauber ist<br />
beliebt und gesucht in der Szene. Innerhalb von<br />
fünf Jahren fanden allein auf deutschen Ländereien<br />
mehr als 3.200 Exemplare eine Heimat.<br />
Für einen Exotenstatus reicht das nicht aus. Der<br />
Markt gibt Fahrzeuge von Schrott bis zur Spitzenrestaurierung<br />
her. Ein Kauf direkt beim Bauern<br />
ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Interessenten<br />
sei ein wenig Geduld empfohlen.<br />
Überzogene Preisvorstellungen auf der Anbieterseite<br />
sind nicht selten. Darum macht es Sinn,<br />
verschiedene Angebote zu vergleichen. Vor dem<br />
Hintergrund recht hoher Ersatzteilpreise sollten<br />
auch die anstehenden Investitionen in ein Restaurierungsobjekt<br />
reiflich überlegt werden.<br />
Oftmals ist ein intakter Brillant 600 unter dem<br />
Strich kostengünstiger als die verschlissene<br />
Billigvariante. Mittel- und langfristig stellt diese<br />
Baureihe von Hanomag eine gute Wertanlage<br />
mit Steigerungspotential dar.<br />
Zustand fast gebraucht stark verneuwertig<br />
schlissen<br />
Preis (Euro) 6.000 3.500 2.000<br />
Für die Montage von Anbaugeräten lässt die<br />
Heckpartie des Hanomag kaum Wünsche offen.<br />
Arbeiten änderte sich die Philosophie des<br />
jungen Mannes: „Auf einem Oldtimertreffen<br />
hatte ich einen baugleichen Brillant<br />
600 gesehen, der allerdings von einem<br />
Roots-Gebläse zwangsbeatmet wurde. Etwas<br />
mehr Speed und Leistung konnte ich<br />
mir sehr gut vorstellen. Außerdem setzte<br />
sich bei mir mehr und mehr die Erkenntnis<br />
durch, dass mein <strong>Traktor</strong> in erster Linie<br />
mir und nicht den Originalitätsfundamentalisten<br />
gefallen soll.“<br />
Also verkaufte Fabio Wesche das D 28<br />
CR-Aggregat und machte auch gleichzeitig<br />
den LFE-Frontlader – heute bereut er<br />
das – zu Geld. Davon kaufte er einen<br />
70 PS starken D 28 LA, den die Hanomag<br />
einst in ihren Leichtlastwagen und Allradfahrzeugen<br />
verbaute. Was er sich da in<br />
die Werkstatt holte, war Kernschrott. Das<br />
wusste er vorher und schreckte ihn wenig:<br />
„Kolbenfresser auf allen vier Zylindern,<br />
die Laufbuchsen durchgegammelt und<br />
die Einspritzanlage komplett im Eimer.<br />
Einzig die Kurbelwelle präsentierte sich<br />
Schöner und kräftiger – so lautete<br />
die neue Perfektionsphilosophie.<br />
in einem hervorragenden Zustand. Es gab<br />
reichlich zu tun.“<br />
Er zerlegte den Diesel in seine Bestandteile<br />
und baute ihn von der Basis neu auf.<br />
Einen Buchsenauszieher musste er sich<br />
selber anfertigen, sein Einsatz entwickelte<br />
sich anschließend zum Akt roher Gewalt.<br />
Der Zylinderkopf wurde in einem Spezialbetrieb<br />
komplett überarbeitet, und auch<br />
die Generalüberholung der Einspritzpumpe<br />
überließ Fabio einem Experten. Die<br />
Kühlkanäle hat er in handelsüblicher Cola<br />
eingelegt und anschließend mit dem<br />
Sandstrahler behandelt. Sämtliche Lager<br />
wurden erneuert, selbstredend auch die<br />
Dichtungen. Ein Fachbetrieb gewöhnte<br />
dem leckenden Kühler das Tropfen ab.<br />
Den undichten Kraftstofftank, der seit<br />
1993 trocken dastand, konnte er durch<br />
Hartlöten selbst abdichten.<br />
Präzisionsarbeit<br />
Beim Zusammenbau des Motors trat die<br />
perfektionistische Ader des jungen Mannes<br />
vollends ans Licht. Er entdeckte sein<br />
Faible für galvanische Veredelungen und<br />
ließ sämtliche Metallleitungen eloxieren.<br />
Vernickelte Schrauben fanden Zugang zu<br />
den Gewindegängen. Beim Lackieren des<br />
Motors klebte er die Kontaktstellen der<br />
einzelnen Komponenten ab, damit anschließend<br />
– an den Kanten mit feinem<br />
70-PS-Motor in desolatem<br />
Zustand.<br />
Das Kurbelgehäuse<br />
wird<br />
überarbeitet ...<br />
... ebenso der<br />
Zylinderkopf.<br />
Aufgeladene<br />
70-PS-Power!<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
35
PORTRÄT Hanomag Brillant 600<br />
ne vom alten D 28 CR-Triebwerk montieren.<br />
Das führte zu einer geringeren<br />
Schmierstoffmenge im Ölkreislauf, woraus<br />
wiederum eine höhere thermische<br />
Belastung resultierte. Er baute einen Temperaturmesser<br />
ein, um das Problem ständig<br />
im Blick zu haben. Doch bislang kippte<br />
die Nadel auch bei stärkster Belastung<br />
noch nie in den roten Bereich. Konstant<br />
bei 70 Grad bleibt sie stehen.<br />
Im Cockpit tauschte der Auszubildende<br />
sämtliche Armaturen gegen fabrikneue<br />
Instrumente aus, ebenso alle Lampen und<br />
Begrenzungsleuchten. Jedes Kabel der<br />
recht einfach gestrickten Elektrik wurde<br />
neu verlegt und die Verbindungen<br />
wurden erneuert. Vor Schmutz geschützt,<br />
verlaufen sie jetzt in Leerrohren und<br />
Schrumpfschläuchen.<br />
Wie bei jeder Restaurierung gerieten die<br />
ungeliebten Karosseriearbeiten zu einer<br />
zeitaufwändigen Quälerei. Die Endspitzen<br />
und Stabilisierungsholme der Kotflügel<br />
waren durchgerostet. Hier schweißte Fabio<br />
neues Blech ein. Diverse kleinere und<br />
mittlere Korrosionsherde bekämpfte er erfolgreich<br />
mit den üblichen Methoden.<br />
Schleifen, strahlen, verzinnen, spachteln<br />
… dann rückte Vater Jens dem Hanomag<br />
mit der Farbpistole aufs Blech. Zwei Lagen<br />
Grundierung und vier Schichten Lack<br />
trug er auf – dann strahlte die Fassade in<br />
fabrikneuem Glanz. Übrigens weicht der<br />
Farbton in Nuancen – das ist so gewollt –<br />
vom originalen Hanomag-Blau ab.<br />
Sämtliche Buchsen und Bolzen der Vorderachse<br />
wurden erneuert, und das Ge-<br />
Hanomag im Internet<br />
www.hanomag-traktoren.de<br />
www.hanomag-museum.de<br />
www.fahrzeugseiten.de<br />
Der gerade erst volljährig gewordene<br />
Fabio Wesche hat eine überzeugende<br />
Restaurierung abgeliefert.<br />
Pinsel nachgestrichen – auch die Dichtungsränder<br />
zu erkennen sind.<br />
Klar, dass auch das ursprüngliche<br />
Roots-Gebläse restlos zum Herrn war.<br />
Doch hatte Fabio sich vorausschauend<br />
schon um Ersatz für dieses ebenso seltene<br />
wie teure Bauteil gekümmert. Die<br />
Schaufelräder des mechanischen Laders<br />
hat er mit Graphit beschichtet, erzählt der<br />
Schrauber: „Durch das flüssigkeitsbeständige<br />
Graphit wird eine bessere Dichtigkeit<br />
erzielt und der mit 0,3 bis 0,4 bar recht geringe<br />
Ladedruck leicht erhöht. Unterm<br />
Strich ergibt das eine Leistungssteigerung<br />
auf etwa 75 PS.“<br />
36<br />
Technische Daten<br />
Technische Bezeichnung Brillant 600<br />
Bauzeit 1962–1967<br />
Neuzulassungen in D über 3.200<br />
Motor<br />
D 28 CR<br />
Verfahren<br />
Viertakt/<br />
Wirbelkammer<br />
Kühlung<br />
Wasser<br />
Zylinderzahl 4<br />
Bohrung x Hub (mm) 90 x 110<br />
Hubraum (cm 3 ) 2.799<br />
Leistung (PS/bei U/min) 50 / 2.300<br />
Drehmoment (Nm/bei U/min) 176 /1.800<br />
Getriebe<br />
Hanomag<br />
Gänge v/r 2 x 5/1 = 10/2<br />
Höchstgeschw. (km/h) 20–25<br />
Leergewicht (kg) 2.520<br />
Zul. Gesamtgewicht (kg) 3.450–3.800<br />
Länge (mm) 3.550<br />
Breite (mm) 1.720–2.120<br />
Höhe (mm) 1.770<br />
Radstand (mm) 2.104<br />
Bodenfreiheit (mm) 415<br />
Spurweite v/h (mm) 1.550–1.820/<br />
1.500–1.725<br />
Bereifung v/h 6.00-16, 6.00-20, 7.50-16 /<br />
11-32, 11-36, 11-38, 13-30, 14-30<br />
Sonderausstattung Mähwerk, Hanomag<br />
Pilot-Regelhydraulik, Frontlader (LFE), Fahrerdach,<br />
Verdeck mit Windschutzscheibe<br />
(Fritzmeier), Arbeitsscheinwerfer,<br />
Abreißkupplung, Seilwinde, Spurverstellfelgen<br />
hinten, Kriechganguntersetzung<br />
Verändertes Motorenkonzept<br />
Statt durch den serienmäßigen Ölbadluftfilter<br />
atmet das Roots-Gebläse durch eine<br />
Filterpatrone. Ein optisch prägnantes<br />
Edelstahlrohr vorn an der linken Seite des<br />
Fahrzeugs transferiert den Sauerstoff zum<br />
Lader. Und auch die Auspuffanlage ist<br />
eine Eigenanfertigung, die dem veränderten<br />
Motorenkonzept geschuldet ist. Das<br />
schalldämpferlose Endrohr musste ein<br />
ganzes Stück nach hinten verlegt, der<br />
Durchlass auf der Oberseite der Haube<br />
entsprechend angepasst werden. Das Ergebnis<br />
ist eine deutlich elegantere Linienführung<br />
und dazu ein kerniger Sound, der<br />
sich hören lassen kann.<br />
Es waren diese optischen und technischen<br />
Finessen, die fortan die Restaurierung<br />
bestimmten. „Besser als ab Werk“, so<br />
Fabios Credo. Aber nicht um mit einem<br />
harley-artigen Extremfinish bei den Oldtimertreffen<br />
auf dicke Hose zu machen,<br />
sondern um seinen eigenen perfektionistischen<br />
und ästhetischen Ansprüchen gerecht<br />
zu werden.<br />
Damit der neue Motor im Bereich der<br />
Vorderachse passend eingebaut werden<br />
konnte, musste Fabio die kleinere Ölwan-
Für den Fall eines Defekts<br />
hat Fabio ein weiteres<br />
Roots-Gebläse in<br />
seinem Ersatzteillager.<br />
Überall am Motor findet<br />
sich vom Galvaniseur<br />
veredeltes Metall.<br />
sicht des Hannoveraners ziert nun ein 100<br />
Kilogramm schweres Frontgewicht vom<br />
Robust 800. „Das hat mir mal in recht desolatem<br />
Zustand ein Kumpel geschenkt<br />
und ich habe es anschließend wieder landfein<br />
gemacht“, plaudert Fabio. „Das Gewicht<br />
ist sehr selten. Auf Treffen hat man<br />
mir dafür bereits mehrfach richtig fette<br />
Geldbeträge geboten. Klar, dass der wohlgeformte<br />
Eisenklotz unverkäuflich ist.“<br />
damals der finanziellen Situation geschuldet<br />
war, bereue ich mittlerweile sehr. Irgendwo<br />
werde ich sicher noch einmal ein<br />
passendes Hebewerk finden.“<br />
Der Brillant 600 fristet übrigens kein<br />
behütetes Dasein in einer klimatisierten<br />
Garage. Im Gegenteil, regelmäßig wird er<br />
zur Arbeit herangezogen: Freunden geht<br />
Fabio mit seinem Hanomag in der Landwirtschaft<br />
zur Hand und erledigt damit im<br />
Dachsanierung<br />
Das ursprüngliche Verdeck mit gerader<br />
Frontscheibe hat Fabio verkauft und dafür<br />
eine Fritzmeier M 215-Überdachung montiert,<br />
die vormals einen McCormick-Fahrer<br />
vor Wetterkapriolen schützte. Die stark<br />
gewölbte Scheibe fügt sich viel harmonischer<br />
in die Gesamtoptik des Brillant 600<br />
ein, so die Erklärung für die Maßnahme.<br />
Vor dem Einbau ließ er die Plane nach den<br />
Originalzeichnungen neu anfertigen und<br />
ersetzte sämtliche Gummidichtungen.<br />
Vierzig Klamotten Vortrieb entwickelt<br />
der Brillant 600 – mit TÜV-Segen!<br />
Zwei Jahre dauerten die Präzisionsarbeiten,<br />
bis der Hanomag im heutigen Glanz<br />
dastand. Die TÜV-Abnahme stellte für den<br />
technisch und optisch modifizierten Brillant<br />
600 mit nunmehr 75 PS und einer<br />
Spitzengeschwindigkeit von 40 km/h bei<br />
3.000 U/min keine Hürde dar. Mit anerkennenden<br />
Worten für die solide Schrauberkunst<br />
erteilte der Prüfer Brief und Siegel.<br />
Für Fabio allerdings kein Grund, das Projekt<br />
nun als beendet anzusehen: „Es gibt<br />
immer etwas zu tun. Kürzlich konnte ich<br />
zwei äußerst rare 34 Zoll-Verstellfelgen ergattern,<br />
die in der Szene mit Gold aufgewogen<br />
werden. Die werden zurzeit aufgearbeitet<br />
und in Kürze – mit neuen und vor allem<br />
breiteren ,Socken‘ versehen – montiert.<br />
Auch den Verkauf meines Frontladers, der<br />
Betrieb seines Vaters diverse Transportaufgaben.<br />
Selbstverständlich lässt sich<br />
das Duo mit dem gewissen Altersunterschied<br />
auf den Oldtimertreffen der Region<br />
sehen und selbst beim <strong>Traktor</strong>pulling, woran<br />
die beiden rund ein Dutzend Mal im<br />
Jahr teilnehmen, machen sie eine ausgesprochen<br />
gute Figur.<br />
Ulf Kaack<br />
Mehr als 3.200 Brillant 600<br />
wurden von 1962 bis 1967 allein in<br />
Deutschland verkauft – viele<br />
weitere gingen in den Export.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
37
PORTRÄT<br />
Arbeit mit klassischen <strong>Traktor</strong>en<br />
SCHLÜTER UND FAHR IM EINSATZ<br />
Doppel im Korn<br />
Martin Oeinghaus erntet sein Getreide mit einem gezogenen Fahr-Mähdrescher. Der besitzt<br />
zwar nicht die Schlagkraft eines modernen Selbstfahrers, überzeugt im Schlepptau eines<br />
Schlüter Super 650 aber mit Zuverlässigkeit und sauberem Arbeitsergebnis.<br />
Der Begriff „Getreide“ kommt aus<br />
dem Mittelhochdeutschen und<br />
steht für „das (von der Erde) Getragene“.<br />
So urtümlich wie – und<br />
noch älter als – diese Definition ist die<br />
Kultivierung selbst. Seit mehr als 10.000<br />
Jahren wird der Getreideanbau im Nahen<br />
Osten praktiziert, vor etwa 7.000 Jahren<br />
verbreitete er sich in Mittel- und Westeuropa.<br />
Die Früchte der Pflanzen aus der Familie<br />
der Süßgräser dienen als Grundnah-<br />
rungsmittel zur menschlichen Ernährung<br />
und als Viehfutter, aber auch zur Herstellung<br />
von Genussmitteln und technischen<br />
Produkten. Die sieben Hauptgattungen<br />
sind Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Reis,<br />
Mais und Hirse.<br />
Sonnentanz<br />
Martin Oeinghaus aus dem westfälischen<br />
Tecklenburg baut im Nebenerwerb<br />
auf rund vier Hektar Fläche Weizen,<br />
Gerste und Mais an. Während der Mais<br />
einer nahegelegenen Biogasanlage zugeführt<br />
wird, dienen die anderen beiden<br />
Sorten bevorzugt der Schweinefütterung,<br />
nicht zuletzt in der eigenen Zucht. Martin<br />
baut sein Getreide – sofern möglich –<br />
reihum auf drei verschiedenen Schlägen<br />
an. Im vergangenen Jahr waren das zwei<br />
Hektar Weizen und jeweils ein Hektar<br />
Gerste und Mais. Die Erntebedingungen<br />
waren durchaus günstig. Auf einen<br />
38
durchwachsenen Juni folgte ein trockener<br />
und zunehmend warmer Juli. In diesem<br />
recht großen Zeitfenster hätte man<br />
vermutlich beruhigt warten können, bis<br />
ein Lohnunternehmer mit seinem Mähdrescher<br />
anrückt.<br />
Unabhängig mit eigenem Gerät<br />
In anderen Jahren hätte sich das weitaus<br />
schwieriger gestaltet. Unter Umständen<br />
wäre es nötig gewesen, das Getreide nach<br />
der Ernte zu trocknen, bis es seiner endgültigen<br />
Verwertung zugeführt werden<br />
kann. Über die dafür nötigen Anlagen<br />
verfügt Martin zwar, doch bleibt der logistische<br />
Aufwand beträchtlich. Um freizügiger<br />
planen zu können, hat der Nebenerwerbslandwirt<br />
sich daher vor fünf<br />
Jahren einen eigenen Mähdrescher zugelegt,<br />
einen Fahr M 66 TS des Baujahres<br />
1978. Dabei handelt es sich um einen der<br />
letzten gezogenen Drescher aus deutscher<br />
Fertigung. Gegenüber dem ebenso<br />
leistungsfähigen Selbstfahrer M 66 S ist<br />
Kleines Malheur – schnell behoben:<br />
Erster Trommelwickler nach fünf Jahren.<br />
Professionell: Das Abtanken während<br />
der Fahrt fordert geschulte<br />
Augen und Gefühl für die Technik.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
39
PORTRÄT<br />
Arbeit mit klassischen <strong>Traktor</strong>en<br />
Länge läuft: Das Gespann misst vom<br />
Frontgewicht des Schlüter bis zum Auswurfkanal<br />
des Fahr gut zwölf Meter.<br />
er aufgrund des fehlenden Antriebsaggregates<br />
kostengünstiger in Anschaffung<br />
und Unterhalt.<br />
Ums Eck: Das lange, aber vielteilige Gespann aus Schlepper, Presse und Anhänger ist überraschend<br />
wendig.<br />
Kreisrund ist die<br />
vollkommene<br />
Form: Wendevorgang<br />
im Hof mit<br />
Schlüter S 30 und<br />
Krone „Emsland“.<br />
Großes Besteck<br />
Die nötige Antriebsleistung von mindestens<br />
40 PS stellt keine Hürde dar, denn<br />
Martin verfügt über einen gut bestückten<br />
Schlepper-Fuhrpark. Als Zugfahrzeug für<br />
den Fahr diente im vergangenen Jahr ein<br />
Schlüter Super 650 des Baujahres 1969,<br />
dessen 65 PS starker Sechszylindermotor<br />
sich bei der Ernte nicht übermäßig anstrengen<br />
musste. Einen unübersehbaren<br />
Nachteil hat diese Konstellation dennoch.<br />
In betriebsbereitem Zustand misst<br />
das Gespann aus Schlepper und Drescher<br />
fast zwölf Meter in der Länge und fünf<br />
Meter in der Breite – und das Schneidwerk<br />
läuft rechtsseitig neben dem<br />
Schlepper. Beim Anmähen ist daher etwas<br />
Geschick erforderlich. Indem Martin<br />
den Schlüter direkt in die durch Pflegearbeiten<br />
erzeugten Fahrspuren steuert,<br />
vermeidet er jedoch Beschädigungen des<br />
Bestandes und verliert dank der rechteckigen,<br />
weitgehend ebenen Schläge<br />
kaum wertvolle Zeit.<br />
Professionell abgetankt<br />
Die wahrhaft sommerliche Witterung<br />
brachte es mit sich, dass die Gerste gegen<br />
Ende Juli nur noch 13,5 Prozent Feuchtigkeit<br />
in sich trug – weit unter den geforderten<br />
15 Prozent, also auf der sicheren<br />
Seite. Folglich rückte Martin dem Bestand<br />
an einem sonnigen Montagmorgen<br />
guter Dinge zu Leibe. Das Korntankvolu-<br />
Fotos: K. Tietgens<br />
40
men des Fahr-Mähdreschers beträgt 1,5<br />
Kubikmeter, was auch auf nur einem<br />
Hektar mehrmaliges Abtanken erfordert.<br />
Dabei gingen Martin und sein aus der<br />
Nachbarschaft rekrutierter Erntehelfer<br />
André Klagges äußerst professionell vor.<br />
André steuerte einen allradgetriebenen<br />
Schlüter Super 500 V mit wachsamem<br />
Auge neben dem Drescher her, so dass<br />
Martin die Körner direkt während der<br />
Fahrt auf die gepflegten Krone-Emsland-<br />
Anhänger befördern konnte.<br />
Weitgehend problemlos<br />
Nicht nur der strahlend blaue Himmel<br />
sorgte für zufriedene Gesichter, auch die<br />
weitgehend zuverlässig arbeitende Technik.<br />
Nur ein außerplanmäßiger Zwischenstopp<br />
wurde notwendig, als sich ein größeres<br />
Büschel um die Dreschtrommel des<br />
Fahr gewickelt hatte. „In der fünften Erntesaison<br />
hatte ich nun meinen allerersten<br />
Trommelwickler mit dem Fahr“, zieht<br />
Martin gelassen Bilanz, zumal er das Malheur<br />
innerhalb weniger Minuten behoben<br />
hatte. Beim M 66 TS war dabei körperlicher<br />
Einsatz gefordert, erst in modernen<br />
Maschinen verfügt die Dreschtrommel<br />
über eine Reversiereinrichtung.<br />
Abtransport durchs Nadelöhr<br />
Für den Abtransport stand ein weiterer<br />
Schlüter-Schlepper bereit – ein S 30 des<br />
Baujahres 1962. Sein kerniger Zweizylindermotor<br />
ist mit 32 PS durchaus kräftig<br />
genug, um die gängigen 5,7- und 8-Tonnen-Anhänger<br />
vom Acker auf den Hof zu<br />
ziehen. Vor allem aber ist der Oldtimer<br />
wendig genug, um die kostbare Fracht<br />
von der schmalen Asphaltstraße ohne<br />
viel Kurbelei am Lenkrad durch die<br />
schmucke, aber nicht weniger schmale<br />
Hofeinfahrt zu befördern. Dass diese<br />
Fracht nicht übermäßig schwer ausfiel,<br />
ist der recht trockenen Witterung des Jahres<br />
2013 geschuldet. Erträge von 6,3 Tonnen<br />
Weizen und 5,8 Tonnen Gerste pro<br />
Hektar reißen niemanden vom Hocker.<br />
Dafür entschädigten wenigstens die angenehmen<br />
Erntebedingungen.<br />
Kleine Ballen wieder aktuell<br />
Recht groß ist hingegen die Ausbeute<br />
beim anschließenden Einfahren des<br />
Strohs. Nicht wenige Betriebe sorgen mit<br />
entsprechenden Spritzmitteln für einen<br />
niedrigen Wuchs des Getreides, was die<br />
Ernte erleichtert. Martin verzichtet darauf,<br />
da dadurch auch das Wachstum der<br />
Wurzeln und damit speziell in dieser<br />
grundwasserarmen Gegend die Flüssigkeitsaufnahme<br />
beeinträchtigt werden<br />
können. Entsprechend gut hat die Welger-Hochdruckpresse<br />
des Typs AP 42 zu<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
52 PS und vier angetriebene Räder haben mit<br />
dem Einachser leichtes Spiel – leiden muss<br />
die Technik auf Martins Betrieb nicht.<br />
Technische Daten der beteiligten Schlepper<br />
Typ Schlüter S 30 Schlüter Schlüter Schlüter<br />
(SF 303) Super 500 V Super 650 Compact 950 V6<br />
Baujahr 1962 1967 1969 1984<br />
Motor ASM 303 SD100W4 SD100W6 MAN D 0226 ME51<br />
Verfahren Viertakt/Direkt- Viertakt/Direkt- Viertakt/Direkt- Viertakt/Direkteinspritzung<br />
einspritzung einspritzung einspritzung<br />
Kühlung Wasser Wasser Wasser Wasser<br />
Zylinderzahl 2 4 6 6<br />
Bohrung x Hub (mm) 115 x 145 100 x 125 100 x 125 102 x 116<br />
Hubraum (cm 3 ) 3.012 3.927 5.890 5.687<br />
Leistung (PS/bei U/min) 32 / 1.800 52 / 1.800 65 / 1.800 90 / 2.200<br />
Drehmoment 137 / 1.200 216 / 1.300 275 / 1.300 334 / 1.300<br />
(Nm/bei U/min)<br />
Getriebe ZF A-208 ZF A-210 III ZF A-216 II ZF T-3245<br />
Gänge v/r 8/4 8/4 8/4 12/5<br />
Höchstgeschw. (km/h) 20 28 30 40<br />
Radstand (mm) 1.970 2.176 2.492 2.400<br />
Wendekreis (m) 5,8 8,5 7,3 8,6<br />
Bereifung vorne 6.00-16 8.3-24 7.50-20 14.9R24<br />
Bereifung hinten 9.5-32 14.9-30 18.4R34 18.4R38<br />
Eigengewicht (kg) 1.775 2.850 3.160 4.400<br />
Zul. Gesamtgew. (kg) 2.250 3.500 4.260 6.900<br />
Neupreis (DM) 10.790 ca. 18.000 ca. 20.000 77.300<br />
Guten Flug: Schlüter Compact 950 V6 mit Welger-<br />
Hochdruckpresse AP 42 und Ballenschleuder.<br />
41
PORTRÄT<br />
Arbeit mit klassischen <strong>Traktor</strong>en<br />
Nadelöhr: Der S 30 ist ein idealer Partner, um die kostbare Fracht<br />
durch die enge Hofeinfahrt zu befördern.<br />
Platz ist unter der<br />
kleinsten Mütze:<br />
Beifahrersitz auf<br />
dem Schlüter S 30.<br />
tun, als sie sich durch das Schwad frisst<br />
und die kompakten Ballen auf den Ackerwagen<br />
schleudert. Weniger beeindruckt<br />
vom Geschehen zeigt sich das großzügig<br />
dimensionierte Zugfahrzeug, ein Schlüter<br />
Compact 950 V6 des Baujahres 1984.<br />
Abnehmer für seine insgesamt 1.500<br />
Bund Weizenstroh und 650 Bund Gerstestroh<br />
hat Martin zur Genüge: Seine hauseigene<br />
Schweinezucht und zahlreiche<br />
Reitställe in der näheren Umgebung.<br />
Beruf und Berufung<br />
Etwa einen halben Tag lang sind die beiden<br />
mit einem Hektar beschäftigt. Der moderne<br />
Selbstfahrer und die Großpackenpresse<br />
eines Lohnunternehmers würden sich<br />
zwar nicht so lange damit aufhalten, wären<br />
aber kaum zum günstigsten Zeitpunkt<br />
verfügbar. Außerdem können die Kunden<br />
des Nebenerwerbslandwirtes mit kleinen<br />
Strohballen deutlich mehr anfangen als mit<br />
den ohne schweres Gerät nicht zu hantierenden<br />
Großpacken. Dass die Arbeit mit<br />
historischem Gerät kaum weniger Spaß bereitet<br />
als das anschließende Grillgelage auf<br />
der heimischen Terrasse, sei überdies nicht<br />
verschwiegen.<br />
Klaus Tietgens<br />
André und der Super 500 V folgen<br />
dem Ruf des vollen Korntanks,<br />
Compact 950 V6 und Welger AP 42<br />
warten auf ihren Einsatz.<br />
42
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
Geräteträger aus Ost und West: Zwei Systeme im Vergleich<br />
Extra<br />
FENDT GT GEGEN RS 09 UND GT 124<br />
Zwei Systeme<br />
aus zwei<br />
Systemen<br />
In beiden Teilen Deutschlands<br />
spielten Geräteträger ab den<br />
1950er-Jahren gleichsam<br />
bedeutende Rollen. Wir lassen<br />
die Erzeugnisse des <strong>Traktor</strong>enwerkes<br />
Schönebeck gegen die<br />
des einst im Westen führenden<br />
Anbieters Fendt antreten.
VERGLEICH<br />
Geräteträger in Ost und West<br />
Nicht nur der Fendt kommt dank guten Lenkeinschlages<br />
und Einzelradbremse gut ums Eck.<br />
Nahezu ein halbes Jahrhundert ist<br />
vergangen, seit diese beiden Geräteträger<br />
das Licht der Welt erblickt<br />
haben. Sie sind gebürtige<br />
Deutsche, und doch dürften in all der Zeit<br />
nur wenige Zusammentreffen ihrer weitverzweigten<br />
Familien stattgefunden haben.<br />
Möglicherweise sind sich einzelne<br />
Mitglieder auf Messen oder in exotischen<br />
Ländern begegnet, vielleicht haben sie<br />
sich auch gelegentlich argwöhnisch bis<br />
sehnsüchtig über den eisernen Vorhang<br />
hinweg beäugt. Der Fendt F 230 GT wurde<br />
nämlich 1965 in Marktoberdorf/Allgäu<br />
fertiggestellt, während der GT 122 etwa<br />
gleichzeitig das Gelände des <strong>Traktor</strong>enwerks<br />
Schönebeck vor den Toren Magdeburgs<br />
verließ.<br />
II<br />
Ausreifung eines Konzeptes<br />
Beide wurden ihren Herstellern regelrecht<br />
aus den Händen gerissen. Fendt<br />
baute 1965 die Rekordzahl von mehr als<br />
3.000 Geräteträgern, das <strong>Traktor</strong>enwerk<br />
Schönebeck erzielte gar fast den vierfachen<br />
Ausstoß. Mit ihnen war ein bereits<br />
vor dem Zweiten Weltkrieg erdachtes<br />
und zu Beginn der 1950er-Jahre zur Serienreife<br />
gediehenes Konzept zu einer vorläufigen<br />
Perfektion gediehen, die auch<br />
anfängliche Skeptiker überzeugte. Bedienkomfort,<br />
Motorleistung und Haltbarkeit<br />
entsprachen nun den von vielen Betrieben<br />
gestellten Anforderungen. Dabei<br />
gilt zu berücksichtigen, dass diese in beiden<br />
Teilen Deutschlands nicht grundsätzlich<br />
identisch waren.<br />
Zweieiige Zwillinge<br />
Berücksichtigt man Geburtsdatum und<br />
Erscheinungsbild unserer beiden Vergleichskandidaten,<br />
könnte man sie für<br />
zweieiige Zwillinge halten. Beide tragen<br />
ähnliche Gesichtszüge, sofern man überhaupt<br />
von Gesichtszügen sprechen kann.<br />
Viel mehr als ein schlankes Vierkantrohr<br />
verbindet die vordere nämlich nicht mit<br />
der hinteren Achse. Typische Erkennungsmerkmale<br />
wie Motorhaube und<br />
Kühlergrill sucht man vergeblich. Weil<br />
der von Steffen Franke aus Gera beigesteuerte<br />
Fendt mit einer Ladepritsche ausgestattet<br />
ist, bleibt dem Betrachter der zarte<br />
Ansatz einer Motorhaube verborgen. Erst<br />
auf den zweiten Blick kommt das Antriebsaggregat<br />
zu Tage, ein luftgekühlter<br />
Dreizylinder der Motorenwerke Mannheim<br />
(MWM). Umso stutziger macht uns<br />
das leuchtend rote Ackergerät aus Schönebeck<br />
in der Front- und Seitenansicht.<br />
Nur eine zarte Lenksäule und diverse Bedienelemente<br />
grenzen den Fahrerstand<br />
vom Vierkantholm ab. Selbst auf ein klassisches<br />
Armaturenbrett wurde verzichtet.<br />
Stattdessen finden sich die Instrumente in<br />
einer Konsole am linken Kotflügel. Wo<br />
sitzt also die treibende Kraft? Der luftgekühlte<br />
V2-Motor wurde von hinten an das<br />
Getriebe angeflanscht und wohnt platzsparend<br />
eine Etage unter dem Gesäß des<br />
Fahrers.<br />
Hürdenlauf<br />
Da jener vom Heck aufsteigt, ist schon<br />
eine gewisse „Räuberleiter“ vonnöten,<br />
um den Arbeitsplatz zu erreichen. Diese<br />
Aufstiegshilfe wurde im Werk sinnvollerweise<br />
in Form von drei Trittstufen an<br />
der rechten Fahrzeugseite installiert –<br />
eine hinter dem Kotflügel, eine schräg<br />
hinter dem Motor und eine klappbare<br />
oberhalb des Kraftstofftanks. Zu betreten<br />
sind diese möglichst mit der Schrittfolge<br />
„rechts – links – rechts“, woraufhin dem<br />
linken Fuß der Zugang zu seinem Bestimmungsort<br />
vor dem Fahrersitz freisteht.<br />
Lohn der Mühe: Eine nahezu ungehinderte,<br />
von der schlanken Lenksäule<br />
nicht nennenswert verbaute Sicht nach<br />
vorne. Die hohe Sitzposition trägt ihren<br />
Teil dazu bei, dass man nicht nur die am<br />
Rahmen befestigten Arbeitsgeräte, sondern<br />
auch das Geschehen vor dem Fahrzeug<br />
gut im Blick hat.<br />
Nadelöhr<br />
Der Fahrer des Fendt muss beim Aufstieg<br />
keinen Motor überwinden – und<br />
doch gut überlegen, mit welchem Bein<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
Gemessen an seiner Länge, zeigt sich<br />
der GT 122 überraschend wendig.<br />
er das Unterfangen in Angriff nimmt. In<br />
diesem Fall beginnt man am besten mit<br />
dem rechten Fuß auf der Ackerschiene,<br />
setzt dann den linken auf das Trittblech<br />
links neben dem Sitz und fädelt den<br />
rechten vor den Schalthebeln hindurch<br />
an seinen Bestimmungsort. Deutlich<br />
niedriger als auf dem Schönebecker GT<br />
kauert man hinter dem Lenkrad, das –<br />
ähnlich den zeitgenössischen Ackerschleppern<br />
– aus dem Armaturenbrett<br />
ragt. Davor befindet sich der Kraftstofftank,<br />
doch duckt sich die schmale Motorhaube<br />
weitgehend aus dem Sichtfeld.<br />
Nur das hintere Drittel des Anbaurahmens<br />
hat man auf dem Fendt schlechter<br />
im Blick als auf seinem Gegenstück aus<br />
der ehemaligen DDR.<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
Nahezu zeitgleich wurden die ,systemgleichen<br />
Brüder’ in der BRD und der DDR präsentiert.<br />
Wege zum Ziel<br />
In vielen Details und Baugruppen ist der<br />
Fendt näher am klassischen Standardschlepper<br />
positioniert als der GT 122.<br />
Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte<br />
schafft Klarheit. Bereits vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg arbeiteten die ersten Tüftler daran,<br />
den reinen Zugschlepper zur Mehrzweckmaschine<br />
weiterzuentwickeln. Dabei<br />
beließen es einige bei der Evolution,<br />
doch manche wagten die Revolution. Zu<br />
letzteren gehörte der Erfurter Konstrukteur<br />
Egon Scheuch.<br />
In Zusammenarbeit mit der Auto Union,<br />
Abteilung DKW-Einbaumotoren, ersann<br />
er zu Beginn der 1940er-Jahre einen<br />
leichten Einachsschlepper. Ein Ziel der<br />
Konstruktion war, den als Antrieb für Bindemäher<br />
beliebten DKW-Motor EL 301<br />
auch außerhalb der Erntesaison nutzen zu<br />
können. Der 48 kg leichte, luftgekühlte<br />
Einzylinder holte aus 292 Kubikzentimetern<br />
Hubraum 6 PS – genug für die Arbeit<br />
mit gezogenen Hack- und Drillmaschinen,<br />
Düngerstreuern und Kultivatoren, aber<br />
auch für leichte Transporte. Für höhere<br />
Ansprüche wurde der Einachser mit drei<br />
statt zwei Vorwärtsgängen plus Rückwärtsgang<br />
und stärkeren Motorisierungen<br />
angeboten. Wahlweise kamen der stärkere<br />
Einzylinder EL 462 mit 462 Kubikzentimetern<br />
und 8,75 PS oder zwei 6 PS-Motoren<br />
zum Einsatz. In letzterem Fall ergaben<br />
sich zusätzliche Möglichkeiten: Leichte<br />
Arbeiten konnte man mit nur einem Motor<br />
und entsprechend geringerem Kraftstoffverbrauch<br />
verrichten. Auf die gleiche<br />
Weise konnte man im Falle einer Motorstörung<br />
zudem mit einem Antriebsaggregat<br />
weiterfahren.<br />
Vom Einachser zum Universalgenie<br />
Mit zusätzlichem Hinterrad war dieser<br />
sogenannte „Motorvorderwagen“ auch<br />
selbständig fahrbar, doch versprachen<br />
fest angebaute statt gezogener Geräte eine<br />
flexiblere, effizientere Arbeit. Daher<br />
entwickelte der nunmehr in der Sow -<br />
jetischen Besatzungszone ansässige<br />
Scheuch seine Konstruktion nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg zum Geräteträger weiter.<br />
In seinem um 1947 entstandenen<br />
Prototypen „Spinne“ schloss sich an den<br />
Triebblock des Einachsers nach vorne ein<br />
rundes Rohr an, an dem die Arbeitsgeräte<br />
befestigt wurden – und sich bei der Arbeit<br />
somit im Blickfeld des Fahrers befanden.<br />
Außerdem ließ sich das Rohr um<br />
40 Zentimeter ausziehen, so dass man<br />
zwischen bestmöglicher Wendigkeit und<br />
größtmöglichem Anbauraum wählen<br />
konnte.<br />
Von der Spinne zum Maulwurf<br />
Möglicherweise erwies sich das<br />
Teleskop rohr im harten Einsatz und bei<br />
verdrecktem Schlepper als wenig praktikabel,<br />
denn bei seinem nächsten, 1949<br />
als IFA „Maulwurf“ präsentierten Prototyp<br />
rückte Scheuch wieder von dieser<br />
III
VERGLEICH<br />
Geräteträger in Ost und West<br />
Idee ab. Der zentrale Anbaurahmen hatte<br />
nun einen eckigen Querschnitt, und der<br />
Motor war vor der Vorderachse angeordnet.<br />
Dabei handelte es sich nach wie vor<br />
um den aus dem früheren Einachser bekannten<br />
EL 462 mit 8,75 PS, der seine<br />
Kraft über eine im Zentralrahmen verlaufende<br />
Antriebswelle an ein nicht näher<br />
beschriebenes Getriebe abgab. Dem Streben<br />
nach Einfachheit und Bodenschonung<br />
entsprach das Eigengewicht von<br />
nur 570 kg. Vorne, zwischen den Achsen<br />
und im Heck fand sich reichlich Platz<br />
zum Geräteanbau. Die vielfältigen Möglichkeiten<br />
dürften die leichte Konstruktion<br />
und vor allem den schwachbrüstigen<br />
Motor an ihre Grenzen gebracht<br />
haben. Außerdem war noch keine Hydraulikanlage<br />
vorhanden, so dass sämtliche<br />
Arbeitsgeräte von Hand ausgehoben<br />
und eingesetzt werden mussten.<br />
Dennoch übernahm das <strong>Traktor</strong>enwerk<br />
Schönebeck die Konstruktion und entwickelte<br />
sie zur Serienreife.<br />
IV<br />
Scheinwerfer im Untergeschoss:<br />
Fendt von vorne.<br />
Im Vergleich: Überrollschutz, Achsen und Felgen<br />
Der Überrollbügel des Fendt war nicht serienmäßig,<br />
wurde von der Berufsgenossenschaft<br />
jedoch ab 1970 vorgeschrieben.<br />
Für die notwendige Anpassung an<br />
Unebenheiten sorgt das Zentralgelenk<br />
kurz vor der Motorverkleidung des Fendt.<br />
Starre Felgen am Fendt F 230 GT.<br />
Der Überrollkäfig aus Drahtgewebe gehörte<br />
für die Schönebecker Geräteträger ab<br />
1964 zum Serienumfang.<br />
Die Vorderachse des GT 122 ist in Breite und<br />
– mittels der Schwenklaschen zwischen<br />
Achsschenkel und Rad – in Höhe verstellbar.<br />
Verstellfelgen am GT 122.<br />
RS 08/15 – das Multitalent<br />
Auf dem Weg dorthin musste das grundsätzlich<br />
für zukunftsträchtig erachtete<br />
Konzept einige tiefgreifende Modifikationen<br />
und eine erhebliche Verstärkung<br />
über sich ergehen lassen. Die ersten fünf<br />
Funktionsmuster des RS 08/15 wurden<br />
im Mai 1952 zur Erprobung übergeben.<br />
Bis zum Jahresende folgten 25 weitere<br />
Exemplare, und die eigentliche Serienfertigung<br />
lief zu Beginn des Jahres 1953<br />
an. Wiederum gelangte ein auf einer<br />
DKW-Entwicklung beruhender Zweitakt-<br />
Ottomotor zum Einsatz, doch handelte es<br />
sich nunmehr um einen deutlich stärkeren<br />
Zweizylinder mit 690 Kubikzentimetern<br />
Hubraum, der im VEB Motorenwerk<br />
Karl-Marx-Stadt gefertigt wurde. Er gelangte<br />
bereits seit 1949 im Personen -<br />
wagen IFA F8 zum Einsatz, doch wurde<br />
seine Leistung für den Einsatz im Geräteträger<br />
von 20 PS bei 3.500 U/min auf<br />
15 PS bei 3.000 U/min reduziert. Gegenüber<br />
der Einbaulage im ursprünglichen<br />
„Maulwurf“ war er nach hinten gerückt<br />
und befand sich nun unmittelbar vor<br />
dem Fahrerplatz. Das Wendegetriebe<br />
stellte vorwärts und rückwärts jeweils<br />
acht Gänge im Bereich von 1,6 bis 15,3<br />
km/h zur Verfügung. Zu ausreichender<br />
Traktion verhalf die serienmäßige Differentialsperre,<br />
zu einem minimalen Wendekreis<br />
von fünf Metern die Lenkbremse.<br />
Die sowohl vorne als auch hinten herausgeführten<br />
Zapfwellen ließen sich abhängig<br />
von der Motordrehzahl und von der<br />
zurückgelegten Wegstrecke schalten.<br />
Nach kurzer Zeit standen nicht weniger<br />
als 40 verschiedene Geräte zum Anbau<br />
an das neuartige Fahrzeug im Angebot.<br />
Bis 1956 verließen immerhin 5.751 Einheiten<br />
das Werk, doch erwiesen sich das<br />
recht üppige Eigengewicht von 1.330 kg<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA<br />
Fotos: K. Tietgens/ Archiv Tietgens
sowie die mangelnde Standfestigkeit und<br />
der hohe Kraftstoffverbrauch des Ottomotors<br />
als nachteilig.<br />
RS 09 – Diesel im Heck<br />
Mit diesen Defiziten sollte der Nachfolger<br />
RS 09 aufräumen. Das Eigengewicht<br />
konnte auf 1.070 kg gesenkt werden, und<br />
der Motor war komplett aus dem Blickfeld<br />
des Fahrers verschwunden. Er wurde<br />
nunmehr von hinten an das Getriebe angeflanscht<br />
und befand sich somit unterhalb<br />
des Fahrersitzes. Da in der DDR<br />
immer noch kein Kleindieselmotor serienreif<br />
war, wurde dem <strong>Traktor</strong>enwerk<br />
Schönebeck der Import eines geeigneten<br />
Antriebs genehmigt. Die Entscheidung<br />
fiel auf den luftgekühlten, überaus leichten<br />
und kompakten V2-Dieselmotor FD 21<br />
des Wiener Herstellers Warchalowski.<br />
Aus einem Liter Hubraum holte dieser 18<br />
PS bei 3.000 U/min. Da nur die Einfuhr<br />
von 1.000 Exemplaren genehmigt worden<br />
war – und aus Devisenmangel vermutlich<br />
nicht einmal 800 geliefert wurden, bereitete<br />
das Dieselmotorenwerk Schönebeck<br />
eiligst eine Lizenzfertigung vor. Dies erwies<br />
sich als nicht ganz unproblematisch,<br />
und die erste Ausführung FD 21/1 war<br />
trotz auf 15 PS reduzierter Leistung nicht<br />
restlos standfest. Besser funktionierte der<br />
im Januar 1961 nachgereichte FD 22 mit<br />
auf 1.145 Kubikzentimeter vergrößertem<br />
Hubraum und zunächst 16,5 bzw. später<br />
18 PS. Offensichtlich hatten die Öster -<br />
reicher den Ostdeutschen keinen Erfolg<br />
bzw. keine nennenswerten Stückzahlen<br />
zugetraut, denn Lizenzgebühren verlangten<br />
sie nicht.<br />
RS 09/124 und GT 124 – mehr Leistung<br />
Ab 1963 wurde in der DDR eine einheitliche<br />
Kennzeichnung für Motoren eingeführt.<br />
Der FD 22 hieß fortan 2 KVD 9 SVL,<br />
der damit versehene Geräteträger RS<br />
09/122 bzw. GT 122. Parallel dazu ging im<br />
Juni 1964 der RS 09/124 bzw. GT 124<br />
in Serie, der dem vielfach geäußerten<br />
Wunsch nach einem stärkeren Geräteträger<br />
nachkam. In dessen Heck arbeitete der<br />
im Motorenwerk Cunewalde entwickelte,<br />
wiederum luftgekühlte V4-Dieselmotor 4<br />
VD 8/8 SVL, der aus 1,6 Litern Hubraum<br />
schöpfen konnte und 25 PS bei 3.000<br />
U/min bereitstellte. Gleichzeitig führte<br />
das Werk eine neue Getriebevariante ein,<br />
die 18 statt 15 km/h Höchstgeschwindigkeit<br />
ermöglichte. Die größere Baulänge<br />
des Motors erforderte diverse Änderungen<br />
am Umfeld, so an der Zapfwelle.<br />
Hervorstechendes Unterscheidungsmerkmal<br />
ist jedoch die Verkleidung des<br />
Kühlgebläses: Einteilig beim Cunewalder<br />
Vierzylinder, mehrteilig beim Schönebecker<br />
Zweizylinder. Zum besseren Schutz<br />
des Fahrers wurden die Geräteträger fortan<br />
mit einem umsturzsicheren Fangrahmen<br />
ausgerüstet. Der stärkere GT 124 erwies<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
Neuzulassungen/Produktionszahlen<br />
Jahr Fendt* TWS**<br />
1952 – 30<br />
1953 – 1.050<br />
1954 – 1.136<br />
1955 – 1.650<br />
1956 – 1.885<br />
1957 698 201<br />
1958 951 1.805<br />
1959 ca. 2.000 3.889<br />
1960 ca. 2.000 5.285<br />
1961 2.147 5.784<br />
1962 2.784 7.052<br />
1963 2.796 7.592<br />
1964 2.443 11.045<br />
1965 2.958 11.724<br />
1966 2.095 12.210<br />
1967 1.450 10.120<br />
1968 1.199 6.500<br />
1969 1.548 8.900<br />
1970 1.529 9.415<br />
1971 1.581 9.000<br />
1972 1.446 4.000<br />
gesamt ca. 30.000 120.273<br />
* Neuzulassungen in Deutschland<br />
** Produktionszahlen; ab 1970 aus dem VEB Landmaschinen-<br />
und Gerätebau Haldensleben<br />
Beleuchtung im Obergeschoss:<br />
GT 122 von vorne.<br />
Im Vergleich: Cockpits<br />
Konventionell: Armaturenbrett des Fendt.<br />
Ölthermometer, Öldruckmesser, Vorglühkontrollleuchte<br />
und einige andere<br />
Bedienelemente links neben dem Fahrer.<br />
V
VERGLEICH<br />
Mit Vierzylinder-Dieselmotor im Heck:<br />
Der ab 1964 gebaute GT 124.<br />
Mit einteiliger Kühlgebläseverkleidung:<br />
V4-Dieselmotor aus Cunewalde.<br />
VI<br />
Im Vergleich: Zapfwellen<br />
Mit eigenem Antrieb, vorn aus dem Getriebe<br />
he rausgeführt : Mähwerk des Fendt.<br />
Die Frontzapfwelle des Fendt wird links<br />
neben dem Motor herausgeführt.<br />
Mit zweiteiliger Kühlgebläseverkleidung:<br />
V2-Dieselmotor aus Schönebeck.<br />
sich klar als beliebteste Variante. Dennoch<br />
blieb der GT 122 im Programm. Groß war<br />
der Preisunterschied zum sieben PS stärkeren<br />
124er nicht und dürfte doch in manchen<br />
Fällen die Kaufentscheidung beeinflusst<br />
haben. Der Erstbesitzer von Robby<br />
Hüllners GT 122 hatte beispielsweise<br />
15.820 Mark (Ost) zu zahlen. Der GT 124<br />
Von der Frontzapfwelle angetrieben: Mähwerk<br />
des RS 09 bzw. GT 122/124..<br />
Energieversorgung für Zwischenachsgeräte:<br />
Frontzapfwelle des RS 09.<br />
hätte gerade einmal 800 Mark mehr gekostet,<br />
allerdings auch etwas höhere Unterhaltskosten<br />
verursacht.<br />
Enorme Stückzahlen<br />
Bis zur Produktionseinstellung 1972 verließen<br />
mehr als 120.000 Geräteträger das<br />
<strong>Traktor</strong>enwerk Schönebeck – der westdeutsche<br />
GT-Spitzenreiter Fendt erreichte<br />
innerhalb eines halben Jahrhunderts mit<br />
allen Baureihen zusammen nur knapp die<br />
Hälfte. In diese stolze Zahl sind freilich<br />
zahlreiche Abwandlungen des RS 09 einbezogen,<br />
darunter der Maisschlepper RS<br />
26, der Hofschlepper RS 27, der Plantagentraktor<br />
RS 28, der Hopfentraktor RS<br />
56, der hydraulische Schwenkkran T 157<br />
und der Portaltraktor PT 129 mit fast zwei<br />
Metern lichter Durchgangshöhe. Diese Varianten<br />
entstanden allerdings nur in vergleichsweise<br />
geringen Stückzahlen – und<br />
teilweise erst durch nachträglichen Umbau<br />
serienmäßiger Fahrzeuge.<br />
Ein Einzelstück blieb der allradge -<br />
triebene Bergtraktor mit vier gleich großen<br />
Rädern, Frontmotor und Verkleidung<br />
im Stil des ZT 300. Auf den ZT konzentrierten<br />
sich bald sämtliche Aktivitäten<br />
des <strong>Traktor</strong>enwerkes Schönebeck. Die<br />
Fertigung der Geräteträger wurde um<br />
1970 an den VEB Landmaschinen- und<br />
Gerätebau Haldensleben abgegeben, wo<br />
1972 die letzten Exemplare fertiggestellt<br />
wurden.<br />
Beliebt, aber ohne Nachfolger<br />
Danach gab es verschiedene Anläufe, die<br />
Fertigung des Geräteträgers in verbesserter<br />
Form wieder aufleben zu lassen, doch<br />
letztendlich blieb die Produktpalette des<br />
<strong>Traktor</strong>enwerkes Schönebeck auf die<br />
ZT-Serie beschränkt. Bis zum Fall des „Ei-<br />
Lesen Sie weiter auf Seite X<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
Packen<br />
Selbermachen Media GmbH, Neumann-Reichardt-Straße 27-33, 22041 Hamburg<br />
Sie es an!<br />
Die neue SELBER MACHEN ist da –<br />
Werkzeuge und Maschinen im Test,<br />
kreative Ideen fur Ihr Zuhause, praktische<br />
Schritt-fur-Schritt-Anleitungen.<br />
Bauen, Gestalten, Renovieren –<br />
ab sofort auf 100 Seiten!<br />
Abo mit attraktiver Prämie bestellen unter<br />
www.selbermachen.de/praemie
VERGLEICH<br />
Geräteträger in Ost und West<br />
FENDT GT und RS 09<br />
VIII<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
IX
VERGLEICH<br />
Der Heckmotor des<br />
RS 09 spart Baulänge,<br />
lässt den Fahrersitz<br />
jedoch in die<br />
Höhe rücken.<br />
sernen Vorhanges“ blieben die GTs allenthalben<br />
beliebt.<br />
Auf den großen, genossenschaftlich organisierten<br />
Betrieben der DDR gab es zur<br />
Genüge Sonderaufgaben zu erledigen, allen<br />
voran bei Aussaat und Pflege. Die Aufgaben<br />
eines klassischen Ackerschleppers<br />
hatten die Spezialisten kaum jemals zu<br />
übernehmen, denn dafür standen Standardschlepper<br />
vergleichbarer Leistungsklassen<br />
– nicht zuletzt der Famulus – in<br />
den Startlöchern. RS 09 und GT 122/124<br />
durften je nach montierter Anhängekupplung<br />
maximal 750 oder 3.000 kg an den<br />
Haken nehmen, und das nach Werksvorgabe<br />
auch nur auf dem direkten Weg zum<br />
Acker und nicht für Transportfahrten.<br />
Retter der Kleinbetriebe?<br />
In der damals viel kleiner strukturierten<br />
westdeutschen Landwirtschaft lagen die<br />
Verhältnisse anders. Hier wurde der Geräteträger<br />
zwar ebenfalls als Zusatzmaschine<br />
für große, vor allem aber als Erstmaschine<br />
für kleine Betriebe angepriesen.<br />
Ein Grund dafür bestand darin, dass potentielle<br />
Arbeitskräfte zunehmend aus der<br />
Landwirtschaft in andere Erwerbszweige<br />
abwanderten und vor allem kleinere Betriebe<br />
sich nicht in der Lage sahen, die<br />
steigenden finanziellen Ansprüche des<br />
Personals zu befriedigen. Den Ausweg sah<br />
man in der Durchführung mehrerer Arbeitsschritte<br />
zugleich von möglichst nur<br />
einer Person.<br />
Auf der DLG-Ausstellung 1951 in Hamburg<br />
präsentierten die Unternehmen Lanz<br />
Chance, aus Fehltritten anderer Hersteller<br />
gewonnene Erkenntnisse bei der Konstruktion<br />
eines eigenen Geräteträgers zu<br />
nutzen.<br />
Abgesehen von einer soliden Mechanik<br />
galt das Ziel der Montage der Arbeitsgeräte<br />
allein mit der Hilfe eines einfachen Dorns,<br />
also ohne spezielles Werkzeug. Zunächst<br />
spielte das Geräteträger-Projekt neben dem<br />
Ausbau des Programms der 12 bis 40 PS<br />
starken „Dieselross“-Standardschlepper<br />
zwar nur eine Nebenrolle, doch lieferten<br />
die 1952 und 1953 präsentierten 12 PS-Dieselrösser<br />
F 12 GH und HL mit ihrer auf den<br />
ersten Blick eigenartigen Bauweise eine<br />
gute Grundlage für einen künftigen Geräteund<br />
Ruhrstahl zwei vielbeachtete Geräteträger,<br />
und in den Folgejahren bereicherten<br />
weitere Konstruktionen den Markt, ohne<br />
dass jedoch eine rundum befriedigende Lösung<br />
darunter gewesen wäre. Zu schwache<br />
Motoren mit unzureichender Standfestigkeit,<br />
eine ungenügende Hydraulik oder<br />
mangelnde Abstimmung mit den Anbaugeräten<br />
bzw. eine umständliche Montage<br />
sorgten bei den Käufern für Verdruss und<br />
schreckten potentielle Kunden ab.<br />
Fendt greift an<br />
Daher stand man der Entwicklung in<br />
Marktoberdorf zunächst abwartend gegenüber<br />
– und nutzte später geschickt die<br />
Marktpreise der Geräteträger<br />
Die beachtlichen Produktionszahlen lassen es<br />
erahnen, die alles in allem robuste und pflegeleichte<br />
Technik untermauert den Eindruck: Geräteträgern<br />
von Fendt und dem <strong>Traktor</strong>enwerk<br />
Schönebeck kann man in ländlichen Regionen<br />
noch heute regelmäßig bei der alltäglichen Arbeit<br />
beiwohnen. Das Problem für Kaufinteressenten:<br />
Wer seinen treuen Packesel noch so gut gebrauchen<br />
kann, rückt ihn nur ungern heraus.<br />
Steigende Ansprüche an Schlagkraft und<br />
Bedienkomfort haben dennoch dazu geführt,<br />
dass die Universalgenies vermehrt in Rente gehen<br />
und zumeist eine neue Heimat in Sammlerhand<br />
finden. Besondere Reize liegen dabei nicht<br />
zuletzt im Nutzwert und im ungewöhnlichen<br />
Aussehen einer heute nur noch von kleinen Spezialherstellern<br />
angebotenen Fahrzeuggattung.<br />
Die Seltenheit hat dabei keinen nennenswerten<br />
Einfluss auf das Preisniveau – die knapp motorisierten<br />
Erstlinge RS 08/15 und F 12 GT werden<br />
zumeist billiger verkauft als ihre Nachfahren.<br />
Insgesamt erzielen die Fendt-<br />
Geräteträger deutlich höhere<br />
Preise als die DDR-Erzeugnisse,<br />
doch haben letztere in den vergangenen<br />
Jahren zu einer starken Aufholjagd<br />
angesetzt. Hier wie dort gilt, dass aufwändige<br />
Instandsetzungen die Geldbörse stärker belasten<br />
als der Aufpreis für ein entsprechend besser<br />
erhaltenes Exemplar.<br />
Preise (Euro):<br />
Zustand fast gebraucht stark ver-<br />
Typ neuwertig schlissen<br />
RS 08/15 6.000 3.000 1.200<br />
RS 09 7.000 3.400 1.400<br />
GT 124 7.500 3.600 1.500<br />
Fendt F 12 GT 7.000 4.000 1.800<br />
Fendt F 220 GT 8.000 4.500 2.000<br />
Fendt F 225 GT 8.500 4.800 2.200<br />
Fendt F 230 GT 9.500 5.500 2.800<br />
Fendt F 231 GT 10.000 6.000 3.000<br />
X<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
träger. Man hatte Motor und Getriebe nämlich<br />
so eng wie möglich zusammengebaut,<br />
so dass sich der Fahrersitz deutlich hinter<br />
der Hinterachse befand. Für den entscheidenden<br />
Impuls in dieser Richtung sorgte<br />
der 1953 von Hermann Fendt eingestellte<br />
Georg Heidemann. Der inzwischen 62 Jahre<br />
alte Heidemann war vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg Chefkonstrukteur bei der Stock-<br />
Motorpflug AG gewesen und hatte in der<br />
Nachkriegszeit als freischaffender Konstrukteur<br />
für verschiedene Unternehmen<br />
gearbeitet. Auf der Suche nach einer möglichst<br />
einfachen Lösung stellte Heidemann<br />
bereits 1953 einen ersten Prototypen auf<br />
die Räder. Die Antriebseinheit stammte<br />
vom noch taufrischen Dieselross F 12 HL,<br />
bei dem man Motor und Getriebe so eng<br />
wie möglich zusammengebaut hatte.<br />
Erste Schritte<br />
Wie für alle seine damaligen Schlepper bezog<br />
Fendt den Antrieb von den Motorenwerken<br />
Mannheim (MWM). Der luftgekühlte<br />
Einzylinder des Typs AKD 12 E mit<br />
einem Hubraum von 905 cm³ leistete 12 PS<br />
bei 2.000 U/min. Das Getriebe wies in zwei<br />
Gruppen jeweils drei Vorwärtsgänge und<br />
einen Rückwärtsgang auf, mit einem<br />
Schalthebel waren insgesamt sechs Vorwärtsgeschwindigkeiten<br />
von 1,8 bis 20<br />
km/h und zwei Rückwärtsgänge mit 2,7<br />
bzw. 10,8 km/h zu schalten. Der direkt daran<br />
angeflanschte Motor ragte nur wenig<br />
über die Vorderkante der Hinterräder hinaus.<br />
Daran schloss sich nach vorne der<br />
aus zwei eng zusammenstehenden Holmen<br />
bestehende Geräterahmen mit pendelnd<br />
daran aufgehängter Vorderachse an.<br />
Dieses F 12 GT genannte Fahrzeug präsentierte<br />
man 1953 auf der DLG-Wanderausstellung<br />
in Köln. Die durchweg positiven<br />
Reaktionen des Publikums ermutigten<br />
Fendt zur Weiterentwicklung, bei der besonderes<br />
Augenmerk auf verbesserte<br />
Anbaumöglichkeiten durch optimierte<br />
Befestigungen und eine überarbeitete Hydraulikanlage<br />
sowie auf eine entsprechende<br />
Abstimmung der Anbaugeräte gelegt<br />
wurde. Dennoch nahm man nach wie vor<br />
von einer Serienproduktion Abstand, zumal<br />
mittlerweile zwar zahlreiche Hersteller<br />
Geräteträger auf den Markt gebracht hatten,<br />
jedoch keiner damit dauerhafte<br />
Verkaufserfolge erzielen konnte.<br />
Daher wendete man sich an Prof. Dr.-<br />
Ing. Walter Gustav Brenner vom Institut für<br />
Landtechnik der Technischen Hochschule<br />
München, um den Geräteträger einer ausgiebigen<br />
Erprobung in der Praxis unterziehen<br />
zu lassen. Prof. Brenner wählte einen<br />
unter schwierigen Gelände- und Bodenverhältnissen<br />
arbeitenden Familienbetrieb mit<br />
Im Vergleich: Aufstieg<br />
einer Nutzfläche von elf Hektar aus. Dieser<br />
Betrieb verkaufte seinen 17 PS-Schlepper<br />
und das bislang für leichte Arbeiten eingesetzte<br />
Pferd und bekam einen Fendt F 12<br />
GT einschließlich passender Gerätereihe<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Nach einem Jahr und 897 Einsatzstunden<br />
bei der Saatbettbereitung, beim Drillen,<br />
bei verschiedenen Pflege- und Erntearbeiten,<br />
beim Pflanzen der Kartoffeln, bei<br />
der Grünlandbewirtschaftung sowie auf<br />
dem Hof mit dem Frontlader stand fest,<br />
dass sich sämtliche Arbeitsgeräte ohne<br />
Werkzeug innerhalb von weniger als fünf<br />
Minuten an- und abbauen ließen. Ab 1956<br />
Trotz überzeugender Technik und Konzeption<br />
blieben Kunden zunächst skeptisch.<br />
„Naturtreppe“ am Fendt F 230 GT. „Räuberleiter“ zum Fahrerplatz des RS 09.<br />
setzte Fendt 17 weitere GT auf anderen<br />
Betrieben ein. Das Ziel war eine weiter optimierte<br />
Abstimmung von Fahrzeug und<br />
Geräten zwecks vereinfachter Handhabung<br />
sowie die Erprobung der Kombination<br />
verschiedener Arbeitsgänge. Den sogenannten<br />
Marburg-Test absolvierte der F<br />
12 GT mit Bravour und erhielt nach rund<br />
Im Vergleich: Blick vom Fahrersitz<br />
Schlanke Lenksäule und<br />
Bedienelemente des RS 09 schränken das<br />
Sichtfeld des Fahrers nur geringfügig ein.<br />
Durchsichtig ist die Motorverkleidung des<br />
Fendt nicht, aber ihre schlanke Statur trübt<br />
die Aussicht nach vorne nicht übermäßig.<br />
1.000 Betriebsstunden im Test Nr. 149 als<br />
erster GT die „Große Bronzene DLG-Preismünze“.<br />
Der lange Weg zur Serie<br />
Dieses Urteil und die zufriedenstellend verlaufene<br />
Erprobung bewegten Fendt im Mai<br />
1957 zur Aufnahme der Serienfertigung<br />
des F 12 GT. Anstelle der eng zusammenstehenden<br />
Rohre bestand der Geräterahmen<br />
nun aus einem einzelnen Holm mit<br />
rechteckigem Querschnitt.<br />
Anders als bei den DDR-Geräteträgern<br />
war die Vorderachse jedoch nicht pendelnd<br />
am Rahmen aufgehängt, sondern fest<br />
damit verbunden. Für die nötige Verschränkung<br />
sorgte ein direkt vor dem Motor<br />
liegendes Zentralgelenk mit einem maximalen<br />
Pendelausschlag von 15 Grad.<br />
Daher folgten die vorne oder zwischen den<br />
Achsen montierten Geräte den Bewegungen<br />
der Vorderachse. Während bei den Prototypen<br />
eine Haube mit senkrechtem vorderem<br />
Abschluss verwendet wurde,<br />
verbarg sich der Motor der Serienausführung<br />
unter einer schräg nach vorne abfallenden<br />
Abdeckung, an die sich nach hinten<br />
der Kraftstofftank anschloss. Neben der<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
XI
VERGLEICH<br />
Geräteträger in Ost und West<br />
Unverbaute Sicht: Die ab 1970<br />
herausgebrachten Fendt-Geräteträger<br />
tragen den Motor liegend<br />
unter dem Fahrerstand.<br />
570 U/min-Getriebezapfwelle im Heck gab<br />
es eine Gerätezapfwelle für den vorderen<br />
Anbauraum. Diese verfügte im Gegensatz<br />
zum hinten verwendeten Keilwellenprofil<br />
nach DIN 9611 über einen glatten Wellenstumpf<br />
mit Mitnehmerstift, wurde von der<br />
Rückseite des Getriebes aus über ein Verlagerungsgetriebe<br />
angetrieben und verlief<br />
links vom Fahrersitz oberhalb der Hinterachse.<br />
Sie lief wahlweise mit 256 U/min<br />
oder wegabhängig. Das optionale Seitenmähwerk<br />
wurde über ein Getriebe vom<br />
vorderen Kurbelwellenende aus angetrieben.<br />
Die maximale Drehzahl der Mähkurbel<br />
betrug 1.060 U/min. Vorne und im Heck<br />
standen hydraulische Kraftheber in aufgelöster<br />
Bauweise zur Verfügung. Der Arbeitszylinder<br />
des Heckkrafthebers lag<br />
„Schau-Voraus-Prinzip“: Fendt<br />
F 220 GT bei Pflanzarbeiten.<br />
rechts neben dem Fahrersitz und wirkte<br />
auf die unter dem Sitz liegende Hubwelle.<br />
Der Anbauraum zwischen den Achsen<br />
wurde von zwei an der Vorderachse angelenkten<br />
Hydraulikzylindern versorgt, die<br />
auch zum Kippen der Pritsche und zum<br />
Heben des Frontladers dienten. Der F 12<br />
GT fand innerhalb eines knappen Jahres<br />
über 1.000 Käufer und avancierte damit<br />
hierzulande auf Anhieb zum beliebtesten<br />
Geräteträger. Dies ist ein Beleg für die Ausreifung<br />
der Konstruktion, zumal der Fendt<br />
unter einem an sich unverständlichen<br />
Vom ersten Prototypen bis zum serienmäßigen<br />
Fendt GT vergingen vier Jahre.<br />
Schwachpunkt litt. Vielen Kunden war die<br />
Motorleistung von nur 12 PS für die Nutzung<br />
der vielseitigen Möglichkeiten des GT<br />
nämlich zu knapp bemessen. Obwohl die<br />
professionellen Tester die Leistung für ausreichend<br />
hielten, dürften sie übersehen haben,<br />
dass alle Konkurrenten mittlerweile<br />
zumindest wahlweise Motoren mit rund<br />
20 PS anboten.<br />
Leistung läuft<br />
Schon nach kurzer Zeit reagierte Fendt auf<br />
die Kritik an der zu knapp bemessenen<br />
Leistung und ersetzte den F 12 GT bereits<br />
1958 durch den F 220 GT mit 19 PS starkem<br />
Zweizylindermotor. Dieser AKD 311<br />
Z stammte wiederum von MWM, verfügte<br />
über einen Hubraum von 1.400 cm³ und<br />
war, wie alle von Fendt für Geräteträger<br />
verwendeten Motoren, luftgekühlt. Für<br />
das Getriebe waren nun 3/1 zusätzliche<br />
Kriechgänge mit Arbeitsgeschwindigkeiten<br />
ab 0,7 km/h lieferbar.<br />
Diesen verbesserten Geräteträger unterzogen<br />
das Institut für Schlepperforschung<br />
der FAL in Braunschweig, die KTL-Versuchsstation<br />
Dethlingen und das KTL-<br />
Schlepperprüffeld Darmstadt nebst dazugehöriger<br />
Geräte reihe von Mai 1958 bis<br />
April 1959 einer ausgiebigen Prüfung über<br />
1.200 Betriebsstunden. In der Folge wurde<br />
das Fendt-Einmannsystem von der DLG<br />
anerkannt und mit der Silbernen Preismünze<br />
ausgezeichnet. Allein die Fendt-<br />
Geräteträger hielten hierzulande Ende der<br />
XII<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
1950er-Jahre einen Marktanteil<br />
von knapp zwei Prozent und<br />
machten fast ein Fünftel der<br />
Schlepperproduktion in Marktoberdorf<br />
aus. Nach der Vorstellung<br />
des stärkeren F 225 GT ließ<br />
das Interesse der Kunden am F<br />
220 GT stark nach. Unter der Bezeichnung<br />
F 220/1 GT erhielten<br />
die letzten 240 Exemplare das 8/4-<br />
Gang-Getriebe des F 225 GT mit unabhängiger<br />
Zapfwelle.<br />
Schon 1960 definierten die Spitzenmodelle<br />
der Konkurrenten Eicher und Ritscher<br />
mit Leistungen von 30 bzw. 25 PS<br />
und aufwendiger Getriebetechnik einen<br />
neuen technischen Standard.<br />
MERKZETTEL<br />
GERÄTETRÄGER WEST<br />
– ausgiebige<br />
Erprobungsphase<br />
– Alternative zum<br />
Standardschlepper<br />
– erst ab 1958<br />
aus reichend<br />
motorisiert<br />
– häufig modifiziert<br />
– vielfach preisgekrönt<br />
MERKZETTEL<br />
GERÄTETRÄGER OST<br />
– als „verlängerter<br />
Einachser“ geboren<br />
– Ergänzung zum<br />
Standardschlepper<br />
– erst ab 1957 mit<br />
Dieselmotor<br />
– Verkaufs- und<br />
Exportschlager<br />
– variantenreich<br />
Stärker und feiner<br />
Daher stellte man dem F 220 GT anlässlich<br />
der Feierlichkeiten zum 100.000sten<br />
Fendt-Schlepper im Mai 1961 den F 225<br />
GT zur Seite, der vom luftgekühlten<br />
MWM-Motor AKD 112 Z mit einer Nennleistung<br />
von 25 PS angetrieben wurde,<br />
der zweizylindrigen Version des zuvor im<br />
F 12 GT verwendeten Aggregates. Das<br />
neue Getriebe verfügte in zwei Vorwärtsgruppen<br />
und einer Rückwärtsgruppe jeweils<br />
über vier Gänge, insgesamt also<br />
über 8/4 Fahrstufen im Bereich von 1 bis<br />
20 km/h. Eine Doppelkupplung ermöglichte<br />
den fahrunabhängigen Betrieb der<br />
Zapfwelle, so dass man bei laufendem<br />
Arbeitsgerät anfahren, anhalten und<br />
schalten konnte. Ein aufsehenerregendes<br />
Anwendungsbeispiel war eine Gerätegruppe,<br />
mit deren Hilfe sich der F 225 GT<br />
innerhalb einer halben Stunde zum Rüben-Vollernter<br />
ergänzen ließ, der die Rüben<br />
in einem Arbeitsgang köpfen, putzen,<br />
roden und anschließend wahlweise auf<br />
dem Schwad ablegen oder in einem hydraulisch<br />
kippbaren Bunker sammeln<br />
konnte. Bis Ende 1961 wurden 1.126 Einheiten<br />
des F 225 GT produziert, während<br />
es der F 220 GT im ganzen Jahr nur auf<br />
1.021 Stück brachte. Zusammen trugen<br />
Nur eines von vielen Bei -<br />
spielen für die Wandlungs -<br />
fähigkeit des RS 09 ist der<br />
Portaltraktor PT 129 – umgebaut<br />
in vermutlich weniger als<br />
30 Exemplaren bei der Firma<br />
Manhardt in Wutha. Foto: Hüllner<br />
die beiden Geräteträger mehr<br />
als 21 Prozent zum Jahresausstoß<br />
von 10.221 Fendt-Schleppern<br />
bei.<br />
Endlich 30<br />
Mit gewissem Respektsabstand<br />
zum in dieser Hinsicht offensiveren,<br />
aber dennoch weniger erfolgreichen<br />
Konkurrenten Eicher wagte<br />
Fendt sich mit dem F 230 GT auf der Hannoverschen<br />
DLG-Ausstellung im Mai 1964<br />
in die 30 PS-Klasse vor.<br />
Erstmals griff man auf einen Dreizylindermotor<br />
zurück, nämlich den luftgekühlten<br />
MWM AKD 210,5 D. Dieser Antrieb<br />
leistete 30 PS bei 2.000 U/min und arbeitete<br />
nach dem sogenannten Gleichdruck-Vor-<br />
Beliebte Zusatzausstattung für den RS 09:<br />
Zwischenachshacke und von der Frontzapfwelle<br />
angetriebenes Seitenmähwerk.<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
XIII
VERGLEICH<br />
Geräteträger in Ost und West<br />
kammerverfahren, das eine weiche<br />
Verbrennung und eine gewisse Kraftstoffunempfindlichkeit<br />
gewährleisten sollte,<br />
jedoch für einen höheren spezifischen Verbrauch<br />
sorgte als bei den bisher verwen -<br />
deten Direkteinspritzern. Obwohl die Auslieferung<br />
erst im Juli 1964 einsetzte,<br />
produzierte Fendt bis zum Ende des Jahres<br />
nicht weniger als 1.650 Exemplare des<br />
F 230 GT. Der F 220 GT fiel aus dem Programm,<br />
während es der F 225 GT immerhin<br />
noch auf 990 Einheiten brachte, um dem<br />
F 230 GT das Feld ab 1965 zu überlassen.<br />
Sparsamer mit Direkteinspritzung<br />
Nach dem Intermezzo mit dem Gleichdruck-Vorkammerverfahren<br />
stellten die<br />
Motorenwerke Mannheim ab Mitte der<br />
1960er-Jahre fast alle ihre Erzeugnisse auf<br />
Direkteinspritzung um. So entstand aus<br />
dem AKD 210,5 D der neue D 308-3 mit<br />
einer geringfügig auf 32 PS bei 1.950<br />
U/min gestiegenen Leistung und einem<br />
von 195 auf 185 g/PSh gesenkten spezifischen<br />
Verbrauch bei Volllast.<br />
Im August 1967 ersetzte der mit diesem<br />
Motor versehene F 231 GT den F 230 GT<br />
und konnte noch bis Ende des Jahres in<br />
750 Exemplaren produziert werden. Für<br />
das Getriebe gab es fortan eine auch als<br />
„Drehmo mentwandler“ bezeichnete Feinstufenschaltung,<br />
welche die Gangzahl auf<br />
16/8 verdoppelte und eine Höchstgeschwindigkeit<br />
von 30 km/h ermöglichte.<br />
Ein auf 165 bar gesteigerter Betriebsdruck<br />
verhalf der Hydraulik zu mehr Leistung.<br />
Die hintere Zapfwelle war nun von 597<br />
auf 1.001 U/min umschaltbar und damit<br />
für die zukünftigen 1.000 U/min-Geräte<br />
gerüstet. Konstruktionsbedingt ergab sich<br />
auch an der vorderen Zapfwelle eine<br />
zweite Drehzahl. Die nur noch selten verlangte<br />
Riemenscheibe war im Durchmesser<br />
vergrößert worden und lief zur Beibehaltung<br />
der Riemengeschwindigkeit mit<br />
reduzierter Drehzahl.<br />
Zu Beginn der 1970er-Jahre konnte<br />
Fendt auf insgesamt 30.000 verkaufte Geräteträger<br />
zurückblicken. Anders als in<br />
Schönebeck endete die Entwicklung in<br />
Marktoberdorf zu diesem Zeitpunkt keineswegs.<br />
Der ab 1970 verkaufte F 250 GT<br />
sah den DDR-Geräteträgern dahingehend<br />
ähnlich, dass auch bei ihm nur die schlanke<br />
Lenksäule zwischen Fahrerplatz und<br />
Geräteanbauraum stand. Allerdings hatte<br />
Fendt den Motor liegend unter der Fahrerplattform<br />
angeordnet.<br />
Ab 1976 krönten Varianten mit integrierter,<br />
schallgedämpfter Kabine das Programm,<br />
und 1983 hielt der Allradantrieb<br />
Einzug, mit dem die sogenannten Freisichtschlepper<br />
auch für schweres Geläuf<br />
taugten. Daneben hielt sich der F 231 GT<br />
bis 1991 im Programm und avancierte mit<br />
fast 20.000 Exemplaren zum meistverkauften<br />
Fendt-Geräteträger aller Zeiten. Die<br />
Idee, durch Fortführung der Fertigung im<br />
Weimar-Werk einen Ersatz für die mittlerweile<br />
in die Jahre kommenden DDR-Geräteträger<br />
zu schaffen, war jedoch nicht Erfolg<br />
gekrönt. Nach zwei Jahren und nur 251<br />
Exemplaren endete das Intermezzo.<br />
Systeme mit System<br />
Im Laufe der Zeit wurde der F 231 GT immer<br />
weniger als klassischer Ackerschlepper,<br />
sondern vielmehr als Spezialmaschine<br />
wahrgenommen, die beispielsweise in<br />
Gärtnereien und auf Plantagen zum Einsatz<br />
gelangte. Das <strong>Traktor</strong>enwerk Schö nebeck<br />
bemühte sich hingegen zu keiner Zeit, seine<br />
Geräteträger in „westlicher“ Manier als<br />
„Schlepper und Geräteträger in einem“ zu<br />
Die Vogelperspektive verdeutlich es:<br />
Auch vom Fahrersitz aus hat man beide<br />
Fahrzeuge gut im Blick.<br />
Im Osten durfte der GT Spezialist sein, im<br />
Westen sollte er den Standardschlepper ersetzen.<br />
XIV<br />
propagieren. Ihr Tätigkeitsfeld beschränkte<br />
sich fast ausschließlich auf Sonderaufgaben.<br />
Transporte und schwere Bodenbearbeitung<br />
überließen sie anderen. So hatten<br />
am Ende beide Systeme die am besten zu<br />
ihnen passenden Systeme: Im Westen gelang<br />
es zumindest Fendt, mit seinen GTs<br />
neue Kundenkreise zu erschließen, im Osten<br />
schuf das <strong>Traktor</strong>enwerk Schönebeck<br />
einen unverzichtbaren Helfer für die weitläufigen<br />
LPGs.<br />
Klaus Tietgens<br />
Technische Daten der Geräteträger<br />
Typ RS 08/15 RS 09, RS 09/122, GT 122 RS 09/124, GT 124<br />
Produktionszeit 1952 – 1956 1957 – 1972 1964 – 1972<br />
Produktionszahl 5.751 zusammen 114.522<br />
Motor AWZ F 8 / II FD 21; ab 1958: FD 21/1; 4 KVD 8 SVL (4 VD 8/8)<br />
ab 1/61: FD 22 (2 KVD 9 SVL)<br />
Zyl./Hubraum (cm 3 ) / 2 / 690 / 15 V2 / 1.021 / 18; V2 / 1.021 / 15; V4 / 1.608 / 25<br />
Leistung (PS) V2 / 1.145 / 16,5 – 18<br />
Länge o/m Pritsche (mm) 3.090 – 3.790 3.163 – 3.420; ab Fahrzeug- 3.528 / 3.758<br />
Nr. 1201: 3.528 – 3.758<br />
Breite (mm) 1.740 1.450 – 1.900 1.450 – 1.900<br />
Höhe (mm) 1.760 1.580 1.760; mit Umsturzrahmen:<br />
2.300<br />
Radstand (mm) 1.390 – 2.090 1.760 – 2.210; ab Fahrzeug- 2.060 – 2.510<br />
Nr. 1201: 2.060 – 2.510<br />
Bodenfreiheit (mm) 475 560 – 800 380<br />
Wendekreis ohne/ 5.000 – 6.000 4.800 – 5.200 (mit) 7.100 / 6.100<br />
mit Lenkbremse (mm)<br />
Spur vorne (mm) 1.250 – 1.600 1.250 – 1.670 1.250 – 1.500<br />
Spur hinten (mm) 1.250 – 1.600 1.250 – 1.670 1.250 – 1.500<br />
Pritsche (mm) 1.600 x 1.350 x 300 1.600 x 1.350 x 300 1.600 x 1.350 x 300<br />
Eigengewicht o/m Pr. 1.330 1.070 1.430-1.500/<br />
1.560-1.630<br />
Zul. Gesamtgewicht 1.450 2.390 – 3.000 3.000<br />
Zul. Vorderachslast 350 1.140 – 1.260 1.260<br />
Zul. Hinterachslast 1.100 1.250 – 1.740 1.740<br />
Vorderachse starr, ungefedert starr, ungefedert starr, ungefedert<br />
Vorderreifen 6.00 – 16 6.00 – 16 6.00 – 16<br />
Hinterreifen 7 – 36 7 – 36; 8 – 36 8 – 36<br />
Getriebe-Gänge 8 / 8 8 / 8 8 / 8<br />
Höchstgeschw. (km/h) 15,3 15,5 15,5 – 18,0<br />
Preis – 15.820 M (1965) 16.620 M (1965)<br />
TRAKTOR CLASSIC EXTRA
F 12 GT F 220 GT F 225 GT F 230 GT F 231 GT F 231 GTW<br />
1957 – 1958 1958 – 1964 1961 – 1965 1964 – 1967 1967 – 1991 1991 – 1993<br />
1.052 7.165 (6.925 + 240) 8.110 6.455 18.782 195 lang + 56 kurz<br />
AKD 112 E AKD 311 Z AKD 112 Z AKD 210,5 D D 308-3; D 325-3; D 327-3 D 327-3<br />
1 / 905 / 12 2 / 1.400 / 19 2 / 1.810 / 25 3 / 2.233 / 30 3 / 2.233 / 32; ab 10/72: 35 3 / 2.827 / 35<br />
3 / 2.552 / 35; 3 / 2.827 / 35<br />
3.100 / 3.300 3.163 – 3.420 3.528 / 3.758 3.658 / 3.888 3.780 – 3.900 / 4.020 4.280 oder 3.600<br />
1-517 – 1.685 1.517 – 1.520 1.564 – 1.742 1.564 – 1.742 1.532 – 1.741 1.530<br />
1.583, 1.580 1.630, 1.630, 1.637; mit Mähwerk 2.025; 2.340;<br />
mit Mähwerk 1.790, mit Mähwerk 2.000, mit Mähwerk 2.000, mit Verdeck 2.210 – 2.346; mit Verdeck 2.410<br />
mit Verdeck 2.150 mit Verdeck 2.175 mit Verdeck 2.175 Auspuff n. oben: 2.260<br />
2.055 2.145 2.246 2.410 2.410 2.780 oder 2.100<br />
380 360 380 380 380 – 415 415<br />
6.600 / 5.200 6.800 / 5.700 7.100 / 6.100 8.340 / 7.100 8.340 / 7.100 9.200/8.000 oder<br />
6.350/5.850<br />
1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500<br />
1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500 1.250 – 1.500<br />
1.600 x 1.350 x 300 1.600 x 1.350 x 300 1.595 x 1.355 x 300 1.575 x 1.350 x 300 1.575 x 1.350 x 300<br />
1.200 / 1.300 1.285 / 1.410 1.430-1.500/ 1.505-1.530 / 1.635-1.650 1.640-1.800 / 1.760-1.920 2.050/2.180 oder<br />
1.560-1.630 2.010/2.140<br />
2.500 2.190 – 2.450 2.240 – 2.500 2.240 – 2.900 3.400 3.400<br />
900 900 900 900 1.050 1.050<br />
1.600 1.290 – 1.550 1.340 – 1.600 1.340 – 2.000 2.800 2.800<br />
starr, ungefedert starr, ungefedert starr, ungefedert starr, ungefedert starr, ungefedert starr, ungefedert<br />
5.00 – 16; 5.50 – 16 5.50 – 16 5.50 – 16 5.50 – 16 5.50 – 16 7.50 – 16<br />
7 – 30 8 – 28 8 – 32; 9 – 30 8 – 32; 9 – 30 9 – 32; 10 – 28 11.2-32; 11.2-28; 12.4-28<br />
6 / 2 6 / 2 8 / 4 8 / 4 8 / 4; a. W. 16 / 8 8 / 4; a. W. 16 / 8<br />
20 20 20 20 20 oder 28 20 – 30<br />
6.295 DM (1957) 8.275 DM (1959) 10.490 DM (1961) 14.495 DM (1964) 16.780 DM (1972) 46.558 DM (1991)<br />
FENDT GT gegen RS 09 und GT 124<br />
XV
Meine Vorteile<br />
✓ Ich spare 40%<br />
(bei Bankeinzug* sogar 42%)!<br />
✓ Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor dem<br />
Erstverkaufstag* bequem nach Hause<br />
und verpasse keine Ausgabe mehr!<br />
✓ Ich kann nach den ersten 3 Ausgaben<br />
jederzeit abbestellen und erhalte zuviel<br />
bezahltes Geld zurück!<br />
GeraMond Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Guten Appetit! Mit dem<br />
neuen TRAKTOR CLASSIC-<br />
Brettchen schmeckt die<br />
Brotzeit noch besser.<br />
Praktisch auch<br />
für unterwegs oder in<br />
der Werkstatt.<br />
GRATIS!<br />
* nur im Inland<br />
Karte gleich abschicken<br />
oder unter www.traktorclassic.de/abo bestellen!
PRIVATE KLEINANZEIGEN KOSTENLOS !<br />
tc_2014_05_u1_u1_Layout 1 13/06/14 15:44 Pagina 1<br />
5,50€<br />
A: €6,30<br />
CH: SFR 11,00<br />
I : €7,45<br />
LUX: €6,50<br />
DAS MAGAZIN FÜR HISTORISCHE LANDMASCHINEN 5/2014 AUG/SEP<br />
HANOMAG<br />
Brillant 600<br />
Drei Jahre lang<br />
restauriert<br />
Expertentipps:<br />
Schraube<br />
abgerissen<br />
– was tun?<br />
Anzeigencoupon bitte senden an:<br />
Anzeigenredaktion TRAKTOR CLASSIC, Postfach 40 02 09,<br />
80702 München, Fax: (089) 13 06 99-100,<br />
Für gewerbliche Anzeigen: Tel.: (089) 13 06 99-520<br />
Anzeigenschluss für die Ausgabe 6/2014 ist der 07.08.2014<br />
Hiermit gebe ich folgende Rubrik-Anzeige/n auf:<br />
JA, ich möchte<br />
die nächste Ausgabe<br />
TRAKTOR CLASSIC<br />
gratis lesen!<br />
<strong>Traktor</strong>-Check:<br />
DEUTZ D 4006<br />
Heute günstig, morgen gesucht:<br />
<strong>Schnäppchen</strong>-<strong>Deutz</strong><br />
Welches Kennzeichen<br />
ist das richtige für Sie?<br />
Hilfe im<br />
Schilder-<br />
Dschungel<br />
Ein Schlepp im Kornfeld<br />
Getreide-Ernte mit Schlütern<br />
Als Dankeschön für meine private Kleinanzeige<br />
erhalte ich die nächste Ausgabe<br />
TRAKTOR CLASSIC gratis frei Haus.<br />
Wenn ich zufrieden bin und nicht abbestelle,<br />
erhalte ich TRAKTOR CLASSIC ab dem zweiten<br />
Heft für EUR 4,41 pro Ausgabe zweimonatlich<br />
frei Haus. Ich kann jederzeit kündigen!<br />
(Fax: 0180 505 18 38 für 14 Cent pro Minute<br />
aus dem Festnetz der Deutschen Telekom;<br />
E-Mail: leserservice@traktorclassic.de)<br />
Bitte senden Sie mein Gratis-Heft an die<br />
unten angegebene Adresse.<br />
__________________________________<br />
Datum<br />
✘<br />
Unterschrift<br />
Bitte die vollständige Adresse angeben und den Coupon deutlich lesbar ausfüllen!<br />
Keine Haftung für eventuelle Übermittlungs- und Satzfehler.<br />
Hagedorn HS 15<br />
Die Anzeige ist: privat gewerblich mit Bild (nur online möglich)<br />
Eine Rarität kehrt heim<br />
EINFACH UND BEQUEM<br />
Private Kleinanzeigen kostenlos<br />
online aufgeben unter www.traktorclassic.de<br />
Der Text soll in die Rubrik: Verkauf <strong>Traktor</strong>, Fabrikat Verkauf Teile/Zubehör Verkauf landw. Gerät<br />
(30 Zeichen je Zeile)t Sonstiges Literatur Suche<br />
✄<br />
Persönliche Angaben:<br />
Name, Firma<br />
Vorname (ausgeschrieben)<br />
Straße, Nr. (kein Postfach)<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon inkl. Vorwahl Fax E-Mail<br />
Einzugsermächtigung (nur bei gewerblichen Anzeigen erforderlich):<br />
Den Betrag von<br />
buchen Sie bitte von meinem Konto ab:<br />
Konto-Nr., Bankleitzahl<br />
Kreditinstitut<br />
Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel, Datum<br />
Definition der Zustandsbeschreibungen<br />
Zustand 1:<br />
Zustand 2:<br />
Zustand 3:<br />
traktorclassic.de 5|2014<br />
Mängelfreier Zustand in Bezug auf Technik und Optik.<br />
Seltene Fahrzeuge der Spitzenklasse.<br />
Fahrzeuge in gutem Zustand. Entweder seltener,<br />
unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert.<br />
Technisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.<br />
Fahrzeuge in gepflegtem, fahrbereitem Gebrauchszustand,<br />
ohne grö ßere technische und optische Mängel.<br />
GEWERBLICHE ANZEIGEN<br />
JETZT nur EUR 13,50<br />
pro Anzeige für 3 Zeilen Fließtext*<br />
s/w bei 42 mm Spaltenbreite<br />
jede weitere Zeile 4,50<br />
+ Bild zzgl. 25,00<br />
zzgl. MwSt<br />
Chiffre-Gebühr entfällt<br />
*keine Nachlässe, Belegexemplare<br />
und Agenturprovision<br />
59
MARKT<br />
Kleinanzeigen<br />
AGRIA<br />
2015, Angemeldet und fahrbereit, Preis: VB<br />
3300 Euro. Tel. 0683881108<br />
Agria 1600 Einachsschlepper mit Radfrontgewichten,<br />
Kotflügel und Agria anhänger.<br />
Zum herrichten und wiederaufbau.<br />
Preis auf Anfrage. Tel. 02631405061<br />
Bührer LF 4 in sehr gutem Allgemeinzustand<br />
zum restaurieren. Verbaut ist ein 4<br />
Zyl. 3,2 Liter Ford Köln Motor mit 40 PS der<br />
mit Benzin, Petrol betrieben wird. Fahrzeugbrief<br />
vorh., keine Fehlteile. Läuft 30<br />
Kmh. PLZ 8, CH. Kontakt: (0041) 76 305 72<br />
32, udorn@gmx.ch<br />
<strong>Deutz</strong> D10006 Allrad 8400 betriebstunden,<br />
2 x hydraulik motor und getriebe sehr<br />
gut, reifen 650/65-38 und 540/65-24.<br />
12.000 Euro. Tel. 0031651034578<br />
<strong>Deutz</strong> F1L514/50 15 PS, Bj. 1951, EZ<br />
17.04.51, aus 3. Hand, 2005/2006 komplett<br />
restauriert: Elektrik vom Bosch Kundendienst<br />
erneuert. Neu: Anlasser, Kupplung,<br />
Lack, Reifen. Lima überholt. 5.250<br />
Euro. Tel. 0160-7977271<br />
DEUTZ<br />
<strong>Deutz</strong> D 40.1 S-NFS, Mit Mähbalken, 38 PS,<br />
Typ F3 L 712, EZ März 1962, TÜV bis Juli<br />
<strong>Deutz</strong> D30 mit Motor F2L812, 28 PS, Bj.<br />
1965 mit gutem Motor + Getriebe in sämtl.<br />
Einzelteilen. Mit Kupplungsschaden. Preis<br />
auf Anfrage. Tel. 0173-5763678<br />
<strong>Deutz</strong> D4005 mit Frontlader mit seltener<br />
Ausstattung wie Frontlader, Hydr. Lenkung<br />
(orig.), Doppelwirkendes Steuergerät.<br />
3.400 Euro. Tel. 0174-9331422<br />
Agria A 6 K Benzin seit 1962 in unserem<br />
Besitz. Da das Fahrzeug nur noch in der<br />
Scheune steht haben wir uns schweren<br />
Herzens zum Veräußern des Schleppers<br />
entschlossen. 1.490 Euro.<br />
Tel. 0176-31636214<br />
BÜHRER<br />
<strong>Deutz</strong> F2L612: Sehr guter Zustand, komplett<br />
restauriert. Neu: Elektrik, Vorderachsbüchsen<br />
und bolzen der Federung, Reifen<br />
hi, Kupplung. Hydraulik funktioniert einwandfrei,<br />
neu abgedichtet, Mähbalken<br />
schneidet sauber, Kat.2 haken neu hinten,<br />
Papiere, 3.750 Euro. Tel. 0177-8528961<br />
Bührer mfd 4/10 35ps 4 zyl. dieselmotor,<br />
springt gut an, wasserpumpe undicht, evtl.<br />
erstatzpumpe vorh., lässt sich gut schalten<br />
+ fahren, geräuschloses Getriebe. Mähwerk,<br />
triplexkupplung. Fahrersitz und 1<br />
Armatur fehlen, Kotflügel + Kühlermaske<br />
haben Dellen, Bleche nicht durchgerostet.<br />
2.000 Euro. Tel. 0031627447018<br />
<strong>Deutz</strong> F2L612, toprestauriert + gewartet<br />
von Landmaschinenmechaniker, neuer<br />
Lack, neu bereift, Verdeck, Ü-Bügel, Hydraulik,<br />
Zapfwelle hi., V4A-Edelstahlauspuff<br />
nach oben, 15 Jahre kein Wald/Acker<br />
gesehen, gegen Höchstgebot abzugeben,<br />
Tel. 0171-818 4420<br />
<strong>Traktor</strong> Bührer MO6 6-Zylinder Opel Kapitänmotor,<br />
Bj.56, extreme Power und Beschleunigung,<br />
55Km/h vergleichbar mit<br />
Köpfli <strong>Traktor</strong>, siehe Oldtimer <strong>Traktor</strong> Markt<br />
11/13. Guter Orginalzustand, selten einer<br />
von 60 gebauten. Kontakt: (0041) 76 305<br />
72 32, udorn@gmx.ch<br />
RESTAURATIONSMATERIAL<br />
Original Farben von Allgaier bis Zettelmeyer für Unimog, Tempo, Landmaschinen und ehem.<br />
Wehrmacht. Tropföler, Klappöler, Drehöler, Schmiernippel aus Messing. Blinker, Rückleuchten,<br />
Rückstrahler, Reflektoren Ø105 mm und Ø130 mm, Tanksiebe, 4fach Kontrollleuchten,<br />
Anzeigeleuchten, Signalschalter, Zündfix, Sicherungsdosen, Faltenbalg, Lenkräder, Schaltknöpfe,<br />
Kugelknöpfe, Fixlenker, Metallschutzschläuche, Panzerkabel, Glühstartschalter, Fernthermometer,<br />
Öldruckmanometer, Typenschilder, Zündschlösser, Tankdeckel, Kühlerdeckel, Haupt-scheinwerfer<br />
für <strong>Deutz</strong>, Porsche, Hanomag, Lanz usw., <strong>Traktor</strong>meter, Zeituhren, Kombiinstrumente, Chromringe,<br />
Blinkerschalter, Haubenhalter aus Gummi und Metall, Zierteile für <strong>Deutz</strong>, Kotflügel 16“ und 20“,<br />
Sitzgestelle, Sitzbügel, Sitzschalen und vieles mehr...<br />
Firma NORBERT JEHLE D-87755 Kirchhaslach Rechbergstr. 36<br />
e-mail: jehle.norbert@t-online.de Internet: www.oldtimer-jehle.de<br />
Katalog kostenlos anfordern<br />
<strong>Deutz</strong> F3L514-6 läuft z.Zt. mit Saisonkennzeichen<br />
als Hobbytraktor, sehr gut in<br />
Schuss. Orig. Pappbrief vorhanden! Bereifung<br />
neuwertig, neue Lichtmaschine, z.Teil<br />
60
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Kleinanzeigen<br />
MARKT<br />
neu lackiert, Bremsen neu belegt, Tüv Nov.<br />
2014, springt super an, läuft und schaltet<br />
einwandfrei, Hydraulik funktioniert auch<br />
gut. 6.500 Euro. Tel. 0176-43171950<br />
Anzeigenschluss für die<br />
Ausgabe 6/2014: 07.08.2014<br />
EICHER<br />
Hydraulik, Super Restaurationsbasis. 4.200<br />
Euro. Tel. +43 664 4247232<br />
rentialsperre, Einzelradbremsen, Doppelspur<br />
(1250/1500), orig. Fahrzeugbrief von<br />
1952, TÜV bis 5/2015. Preis auf Anfrage.<br />
Tel. 08152-397738<br />
<strong>Deutz</strong> Intrac 2004 Bj.1986 , Ps.70 , Trac<br />
mit vollaustattung , FH , FZW , Hydo Oberlenker<br />
, 1x doppelt , 2x einfach Steuergeräte<br />
, Motor und Getribe trocken , allgemeiner<br />
zustand 2, 14000 Euro VHB, PLZ 2. Kontakt:<br />
(04845) 1308 (ab 18 Uhr),<br />
janderbauer@gmx.net<br />
Eicher ED 13 12,5 PS, Bj. 1955 mit Mähbalken<br />
(Abweiser auch noch vorh.) + zusätzl.<br />
Geräteträgerrahmen zwischen den Achsen.<br />
Vor einigen Jahren wieder in Schuss gebracht.<br />
Echtes Liebhaberstück. Springt<br />
ohne Probleme an, läuft sauber rund. 7.500<br />
Euro. Tel. 0175 5921 749<br />
Eicher Panther, 1960, 19 PS, komplett<br />
restauriert, TOP Zustand. 6.799 Euro VB.<br />
Tel. 09826/1711<br />
Fahr D12N, Von 1953–54 nur 930 Stück<br />
gebaut. 2.500 Euro. Tel. 0152-27343915<br />
<strong>Deutz</strong>-Primus P22 mit Brief, einige Neuteile<br />
(Reifen, Düsen, etc.) schaltet, läuft,<br />
kuppelt, hebt, rep. Frostriss, Mähwerk,<br />
Hydraulik, zum ausschlachten oder neu<br />
aufbauen. PLZ 2. Kontakt: (0151)<br />
15363473, lucasneumann2002@yahoo.de<br />
<strong>Deutz</strong> D40.2 zu verkaufen. Technisch &<br />
optisch ok, TÜV 05/11, ist als Hofschlepper<br />
gelaufen. VB 2.400 EUR. Standort 29482.<br />
Kontakt: (0160) 8029185<br />
jan@contratom.de<br />
Eicher ES 400: verkaufe einen seltenen<br />
Eicher ES400 Schmalspurschlepper mit<br />
Anbaubagger (ähnlich Atlas). Der Eicher ist<br />
optisch nicht der schönste, aber technisch<br />
gut in Schuss. 7.800 Euro.<br />
Tel. 0170-6602312<br />
Eicher Königtiger EM 300, Bj. 1965, 3 Zyl.,<br />
komplett Restaurierung 2013, teilweise<br />
Fachwerkstatt, Rechnungsnachweis,<br />
Schnellgang, super Zustand, nächste HU<br />
04.16, Kotflügel hi/vo neu, etc. 8.900<br />
Euro. Tel. 0172-8202788<br />
Eicher EM 200 mit Frontlader<br />
Top-Zustand, 28 PS, Heckhydraulik,<br />
8 Vorwärts- + 4 Rückwärtsgänge. TÜV neu.<br />
Super techn. + opt.! 4.490 Euro.<br />
Tel. 0171-5634023<br />
Eicher Geräteträger ET 20, Bj. 1961, TÜV<br />
neu, topp Zustand. Kontakt: (0160)<br />
96242124<br />
Eicher L28 Luftgekühlt F2L514<br />
30 PS Langhuber! 1.Hd. mit orig Pappbrief!<br />
orig. Zustand und komplett! Bj. 1954; technisch<br />
sofort einsatzbereit! Mähwerk Teile<br />
vorhanden; TÜV und Oldtimergutachten auf<br />
Wunsch neu! PLZ 94072; VB 6500,- Kontakt:<br />
(08537) 919262, chrido@freenet.de<br />
FAHR<br />
Fahr D 177 S, 1960, 32 PS, 28km/h, guter<br />
Zustand, mit Mercedes Motor, Preis auf<br />
Anfrage. Tel. 0160-92119568<br />
Fahr Güldner A3K Leistung 18KW, Baujahr<br />
1981. Zustand siehe Fotos, bei Fragen einfach<br />
anrufen. Kontakt: (08683) 359,<br />
wiki05@gmx.de<br />
Fahr <strong>Traktor</strong> D17, Bj. 55, TÜV 07/14, teilüberholt,<br />
4 neue Reifen, trocken, Standort<br />
bei Braunschweig, VB 3500 Euro.<br />
Kontakt: (05302) 4650, Beate.Reinhard.<br />
Hentschel@t-online.de<br />
<strong>Deutz</strong> F1L 514/51<br />
Bj. 1955, mit TÜV abzugeben. Sehr schöne<br />
Restaurierung. PLZ 4.<br />
Kontakt: (0152) 5316 2958,<br />
Friseur Reinicke Suchomel@t-online.de<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Anzeigen mit Foto online<br />
aufgeben unter www.traktorclassic.de<br />
Eicher Leopard EM 100 1965, 100% fahrbereit,<br />
100% Restauriert, Typenschein<br />
vorhanden, Heck Hydraulik, Reifen NEU!<br />
4.700 Euro. Tel. +43 664 4247232<br />
Eicher EM 215-216, 1958, 100% fahrbereit,<br />
Typenschein nicht vorhanden, Heck<br />
Fahr D160 H, 1954, 25 PS, orig. Zustand,<br />
Motor läuft sauber, Getriebe ohne Probleme<br />
und Nebengeräusche. Elektrik müsste<br />
überarbeitet werden, anschauen lohnt.<br />
Preis auf Anfrage. Tel. 0031622031751<br />
Fahr D172-Zyl., Wasserkühlung, Anhängerkupplung<br />
mit Stecker, Zapfenwelle, Diffe-<br />
Fahr D 130, Bj.55, 2 Zyl. 17PS<br />
luftgek. Reifen neu, Elektrik komplett<br />
erneuert, Tüv neu, sehr guter Zustand,<br />
org. Pappbrief, VB. 3150 Euro.<br />
Kontakt: Wnendtd@Yahoo.de<br />
Fahr D177, 34PS, Bj. 59, kein Rost, guter,<br />
einsatzbereiter Zustand. 3500 Euro.<br />
Standort: PLZ 9. Kontakt: (09575) 981754,<br />
jherold@gmx.net<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
61
MARKT<br />
Kleinanzeigen<br />
Fendt Farmer 2 Dieselross Bj. 1965, TÜV<br />
05/2015, Hydraulikanschluss hinten, sehr<br />
guter Zustand, 21271 Hanstedt-Nordheide.<br />
4.950,00 VB Euro. optional: FAHR Mähwerk,<br />
1,60m, bester Zustand, 990,00 Euro.<br />
Kontakt: (01573) 8161031,<br />
a.evert@online.de<br />
KRAMER<br />
Fahr D17, Bj. 52, 17 PS, 2-Zylinder, original<br />
Fahrzeugbrief von 1952, TÜV bis 05/2015,<br />
springt sofort an und ist direkt einsatzbereit,<br />
Preis VB. Standort: 82229. Kontakt:<br />
(08152) 397738, gableral@bossmail.de<br />
FENDT<br />
Fendt Farmer 3 S Betriebsstd. 10.000,<br />
Baujahr 1972, 35KW/48PS, HU 07/2015,<br />
Letztes Jahr wurden neue Kupplung, Anlasser<br />
und Achsschenkel verbaut. Motor ist<br />
reparaturbedürftig. Bei Fragen einfach<br />
Anrufen. PLZ 8. Kontakt: (08683) 359,<br />
wiki05@gmx.de<br />
Fendt Favorit 610s, Bj. 1973, 1. Hd., MWM<br />
225-6, 5,1 ltr., 85 PS, 11690 Betriebsstd,<br />
Motor, Getriebe und Kupplung sehr gut.<br />
Preis auf Anfrage. Tel. 0177/5676411<br />
Fendt Farmer 200S 35PS Bj. 76, TÜV<br />
4/2016, 1600 Betriebsstunden, sehr guter<br />
Zustand, sofort einsatzbereit. PLZ 9. Kontakt:<br />
(09575) 981754, jherold@gmx.net<br />
Fendt Favorit 10 SA guter originaler Zustand,<br />
keine Durchrostung, Reifen vorne<br />
neuwertig, 6 Zylinder MWM, kein Frostschaden.<br />
6.950 Euro VB, PLZ 3. Kontakt: (0177)<br />
4125274, vario924@web.de<br />
Fendt Favorit 612 LS, 1981, 2 Vorbesitzer,<br />
10050 Betriebsstd, 30km/h, keine Druckluftbremse,<br />
Reifen 20%vorne 10% hinten,<br />
Fahrersitz luftgefedert, Top Zustand. 9.800<br />
Euro. Tel. 0170-8626722<br />
FERGUSON<br />
Ferguson MF 65 pour pieces ou restauration.<br />
2.500 Euro. Tel. 003474058122<br />
Fendt Favorit 10S, 1971, 6 Zylinder, 80PS,<br />
DL, 1xDW-, 1xEW Steuergerät, druckloser<br />
Rücklauf, Zugpendel, Frontgewichte<br />
8.500 Euro. Tel. 01520-7591883<br />
Ferguson TEA20 Bj. 1954, (Pit Bull) mit<br />
Straßenbereifung und TÜV abzugeben.<br />
Sehr schöne Restaurierung. PLZ 4. Kontakt:<br />
(0152) 5316 2958,<br />
Friseur Reinicke Suchomel@t-online.de<br />
Fendt F 24 L Dieselross, Bj. 1954, TÜV bis<br />
05/15, Heckhydraulik, VB 2.500 EUR, PLZ<br />
8. Kontakt: (08054) 908210 oder 0173-<br />
9805684, velvet90@web.de<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
unter www.traktorclassic.de<br />
62
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Kleinanzeigen<br />
MARKT<br />
Anzeigenschluss für die<br />
Ausgabe 6/2014: 07.08.2014<br />
GÜLDNER<br />
Güldner G 30 mit gutem Motor in sämtl.<br />
Einzelteilen. Preis auf Anfrage.<br />
Tel. 0173-5763678<br />
Tausche güldner alk 8, 12 ps, bauj 56,<br />
luftgekült top zustand, reifen neu, restauriert,<br />
mit mähbalken. tausche gegen traktor<br />
mit allrad frontlader verdeck bis 50 ps,<br />
auch defekt, auch aufpreis. plz 8. Kontakt:<br />
(0151) 23997560, pfrank7004@gmx.de<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Anzeigen mit Foto online aufgeben<br />
unter www.traktorclassic.de<br />
Güldner A3K, 1960, 25 PS, mit belgischen<br />
Papieren. 2.500 Euro, Tel. 0032474058122<br />
Hanomag-Ersatzteile<br />
Hans-Heinrich Munk<br />
Schützenstr. 13 a<br />
31719 Wiedensahl<br />
Tel.: 0 57 26 / 706, Fax: 0 57 26 / 14 45<br />
Mo–Do 9:00–17:00 Uhr, Fr 9:00–12:00 Uhr<br />
Besuche und Abholung<br />
von Ersatzteilen nur nach Vereinbarung<br />
HANOMAG<br />
<strong>Traktor</strong> Güldner Toledo, Bj. 1961, PS 34,<br />
TÜV bis 05/2015, gt. Zustand, Daimler-<br />
Benz-Motor (begrenzte Stückzahl), VHB<br />
3.200 Euro. PLZ 7. Kontakt: (0157)<br />
82554014, a.burkhardt@freenet.de<br />
Hanomag Perfekt 300, 1960, 25 PS, mit<br />
voll funktionierenden Frontlader, orig.<br />
Zustand. Lima + Anlasser ok. 2.750 Euro<br />
VB. Tel. 0031622031751<br />
Güldner ADN 8 K 16 PS, BJ 1955, 2-Zyl.,<br />
Wasserkühl., Zapfwelle, sgt.Zustand, Kupplung<br />
neu, Hinterreifen neu, Elektrik + 13-<br />
pol.AHSD neu, TÜV 07/15, H-Gutachten, VB<br />
3.000 Euro, PLZ 72. Kontakt: (07431)<br />
3063780, tb.breitkopf@web.de<br />
Hanomag Perfekt 401 mit Stoll-Frontlader<br />
+ Gabel und Schaufel! + zweiter Satz Hinterräder<br />
mit Felgen. Guter Zustand. Bj<br />
1965. Betriebsstd: ca. 4700. 4.550 Euro.<br />
Tel. 0163-8754509<br />
Güldner G50 AS oder G45 AS, Bj. 66/67 mit<br />
FL-Gabel-Schaufel Hydraulisch. Zustand<br />
Note 2-/1- nur gegen G60/75 S oder<br />
G60/75 AS gleicher Zustand zu Verhandeln.<br />
PLZ 8. Kontakt: (07528) 2836,<br />
Lystenon1978@googlemail.com<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
unter www.traktorclassic.de<br />
Sammlungsauflösung: R 435, Bj .59,<br />
35PS, TÜV 04/15, nagelneue Hinterreifen<br />
13,6-28, Blechdach, Holzlenkrad, Radio,<br />
Hydraulik, Ackerschiene, neue Sitzbank,<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
63
MARKT<br />
Kleinanzeigen<br />
vorne Kotflügel, Elektrik top, Restauration<br />
in 2013/14. PLZ 7. Kontakt: (07153)<br />
42868, akienberger@web.de<br />
Hanomag Perfekt 401, Bj.67, 2005 kompl.<br />
restauriert und lackiert. Einspritzpumpe<br />
überholt, Düsen neu, Ventilschäfte erneuert.<br />
mit etlichen Ersatzteilen auf Wunsch,<br />
bitte anrufen. VB. 2900 Euro. PLZ 6.<br />
Kontakt: (0172) 3028048,<br />
ludwig.stefan@onlinehome.de<br />
Hürlimann D110 zu verkaufen, gut gepflegter<br />
und sofort einsatzbereiter Hürlimann,<br />
mit Fahrzeugausweis, 1. Inverkehrsetzung:<br />
1970, Hubraum 2947m3,<br />
Preis: 7500 Euro. PLZ 4, Schweiz.<br />
Kontakt: grauwiler-frey@bluewin.ch<br />
IHC<br />
Hanomag R27, Bj. 1954, 4.000 Euro VB.<br />
Kontakt: (09106) 1339<br />
IHC 624 TÜV neu. Bj. 1969, VB 4.000 Euro.<br />
Kontakt: (09106) 1339<br />
KRAMER<br />
Hanomag R 217S BJ 61, hier passt das<br />
Preis- Leistungsverhältnis. Keinen Motor-<br />
Getriebe- und keinen Frostschaden mit<br />
Riemenscheibe, Hydraulik, Zapfwelle, Differenzialsperre.<br />
Näheres am Telefon ab<br />
18 Uhr. PLZ 4. Kontakt: (0171) 3170651,<br />
motorclubochtrup@gmx.de<br />
HÜRLIMANN<br />
IHC 624S, Teilrestauriert. Im Nov 2012<br />
Motor komplett überholt, Rechnung vorh.<br />
Seitdem max. 100 Std gelaufen. 6.000<br />
Euro. Tel. 0178-2192712<br />
IHC D430, Bj. 1962, TÜV 5/16, Blechdach,<br />
Reifen 100%, 1. Hd., Technik und Optik<br />
komplett in Werkstatt restauriert, wie neu,<br />
Hydraulik, Zapfwelle orig. 3.553 Stck.<br />
FP 5.500 Euro. Kontakt: (0170) 2101442<br />
JOHN DEERE<br />
Kramer KLD 330, 40 km/h, Neu restauriert,<br />
orig. Pappbrief, neue HU + Oldtimer-Prüfung,<br />
Mähwerk mit hydr. Betätigung,<br />
Kriechgang-Umschaltung Zapfwelle 2<br />
Geschw. (auch gangabhängig), Kotflügel<br />
hi., alle Reifen, kompl. Elektrik, Einspritzdüsen<br />
und vieles mehr neu. Preis auf<br />
Anfrage. Tel. 0151-56384344<br />
Hürlimann D90 SSP rot, Jg: 10.1963, Hubraum:<br />
2640cm3, Gesamtgewicht 1600kg, in<br />
schönem original Zustand, Fahrzeugausweis,<br />
Preis: 3850 Euro. PLZ 4, Schweiz.<br />
Kontakt: grauwier-frey@bluewin.ch<br />
IHC 423 mit Frontlader EZ 16.06.1970,<br />
8996 Stunden, zusätzliche Plegebereifung<br />
hinten, Stoll Frontlader. 4.900 Euro.<br />
Tel. 0172-6173176<br />
Sammlerstück John Deere 1040S, Komplettrestauration<br />
2013/14 mit Dokumentation,<br />
Edelstahlschutzblech ,abs. neuwertige<br />
Reifen, Hydraulik mit Ackerschiene, neu<br />
aufgepolsterte Sitze, Elektrik top. Preis VB<br />
7350 Euro. PLZ 7. Kontakt: (07153) 42868,<br />
akienberger@web.de<br />
Kramer Schwungradtraktor, Bj. 1936,<br />
orig. Zustand, fahrbereit, an Liebhaber zu<br />
verkaufen. Gegen Höchstgebot. PLZ 7.<br />
Kontakt: (07627) 487<br />
LANZ<br />
Lanz Allzw., Bj 41 + Pap. + Primus P22,<br />
Bj. 42, ohne Pap. Zur Restaurierung.<br />
Zusammen FP 15.000 Euro.<br />
Tel. 01522-3726025, PLZ 1.<br />
Hürlimann H12, Benzin, Bj. 1951, mit TÜV<br />
abzugeben. Sehr schöne Restaurierung.<br />
PLZ 4. Kontakt: (0152) 5316 2958,<br />
Friseur Reinicke Suchomel@t-online.de<br />
IHC 844 S mit Comfort 2000 Kabine, Bj<br />
1980, 80Ps, 1 Einfachwirkendessteuergerät,<br />
Allrad, Heizung. 7.500 Euro.<br />
Tel. 0178-1437419<br />
John Deere 5020, 7200 std, ohne Tüv mit<br />
Spanischen Papieren. Preis auf Anfrage.<br />
Tel. 01520 4051428<br />
Lanz Hela D 36, Rarität, Bj. 1957, 3 Zyl. 36<br />
PS, Hydraulik, LUFTGEKÜHLT, MWN-Motor -<br />
läuft sehr gut, sehr gutes Blech, nur die<br />
hinteren Kotflügelspitzen brauchen etwas<br />
Arbeit, Standort NRW, Preis VB. PLZ 4.<br />
Kontakt: (02191) 963187,<br />
RAKolfertz@t-online.de<br />
Hürlimann D60, Bj. 1954 mit TÜV abzugeben.<br />
Sehr schöne Restaurierung. PLZ 4.<br />
Kontakt: (0152) 5316 2958,<br />
Friseur Reinicke Suchomel@t-online.de<br />
IHC <strong>Traktor</strong> D 212, Bj. 1958, TÜB 09/14,<br />
aufwendig restauriert, gestralt, grundiert,<br />
lackiert, Standort bei Braunschweig,<br />
VB 3900 Euro. Kontakt: (05302) 4650,<br />
Beate.Reinhard.Hentschel@t-online.de<br />
John Deere Lanz 510S, Typ 152D22L, 40PS,<br />
2472cm3, EZ '66, defekt, mit Brief, VHB an<br />
Selbstabholer. Kontakt: (04346) 6797,<br />
simooun@gmx.de<br />
Lanz Bulldog, 35 PS, Bj. 37, 6 Gang, Fußbremse,<br />
original Zustand, Nummerngleich<br />
130...., Preis VB. PLZ 9.<br />
Kontakt: Bigblock86@gmx.de<br />
Lanz Bulldog, 4016, Bj. 1957, Preis: VHS.<br />
PLZ 2. Kontakt: (0151) 17075423,<br />
fam.ottersberg@t-online.de<br />
64
MC CORMICK<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Anzeigenschluss für die<br />
Ausgabe 6/2014: 07.08.2014<br />
Motor wurde überholt. Springt sehr gut an.<br />
Überrollbügel (nicht montiert) vorh. Preis<br />
VHB. Kontakt: (06385) 6118 (ab 18 Uhr),<br />
b.goettel@gmx.de<br />
Modelle, Bücher, DVDs und Fanartikel<br />
-shop.de<br />
McCormick D-439, Bj 1963, Springt ziemlich<br />
gut an. Und läuft gut. Qualmt (Einspritzdüsen<br />
überholen) Weiter technisch in<br />
ordnung. Beleuchtung funktioniert. Blechwerk<br />
gut. Nur Kotflügel brauchen etwas<br />
pflege. Reifen sind noch sehr gut.<br />
1.550 Euro, Tel. 0031646530112<br />
Porsche Diesel Standard AP, 22 PS; Bj.<br />
1958; originalgetreu restauriert in mind.<br />
300 Arbeitsst. incl. Doku! Elektrik nach<br />
Schaltplan neu! TÜV+Oldtimergutachten<br />
vorh! Bilder per Mail; keine Anfragen was<br />
letzte Preis! VB 12500.- Euro. PLZ 9.<br />
Kontakt: (08537) 919262,<br />
chrido@freenet.de<br />
UNIMOG<br />
Schlüter Compact 1350<br />
Schuco, 1:32<br />
Best.-Nr. MA33732 € 63,95<br />
Holder A20*<br />
Schuco, 1:32<br />
Best.-Nr. MA33736 € 79,95<br />
Preise inkl. MwSt. – Versandkostenfrei ab € 50,–<br />
innerhalb von Deutschland.<br />
MB trac 65-70 (W440) (1973-1976)<br />
weise-toys, 1:32<br />
Lieferzeit Ende 2014<br />
Best.-Nr. MA33716 € 59,90<br />
E<br />
LIMITED<br />
1.000<br />
D<br />
I<br />
T<br />
N<br />
I O<br />
Mercedes Benz Unimog 401 mit Softtop<br />
Schuco, 1:43<br />
Best.-Nr. MA33750 € 29,95<br />
Fordern Sie<br />
unsere kostenlosen<br />
Kataloge an.<br />
McCormick 523, 1968, 48 PS, Frontlader,<br />
Wetterschutzdach, <strong>Traktor</strong> fährt, Kupplung<br />
rutscht. 5.712 Euro. Tel. 0174-9116278<br />
EILBOTE Boomgaarden Verlag GmbH<br />
Postfach 12 63 · D-21412 Winsen/Luhe<br />
Tel. ++49 (0) 41 71- 78 35 - 99 · Fax 78 35 - 35<br />
verlag@eilbote-online.de · www.eilbote-shop.de<br />
PORSCHE<br />
Porsche Diesel Junior, Typ 108, mit<br />
Hydraulik, TÜV 7/14, 8.000 Euro. PLZ 8.<br />
Kontakt: (08466) 368, Fax 8335<br />
Unimog 421 Cabrio (U 40) neu restauriert,<br />
Verdeck und Einsteckfenster vorhanden, 40<br />
PS, 2.000 ccm, Bj. Juni 1967, 3-Seiten-<br />
Kipper, 15.750 Euro. Tel. 0151-56384344<br />
Porsche Master: Gut laufender unverbastelter<br />
Porsche Master. Preis auf Anfrage.<br />
Tel. 0032 477 42 35 25<br />
UNIMOG 2010 – ex Schweizer Armee, EZ<br />
1951, 53.000 km, sehr guter Zustand, TÜV<br />
neu mit H-Zulassung, 25.500 Euro, PLZ 4.<br />
Kontakt: (0163) 4018064<br />
Porsche-Trecker, Diesel L318, Modellreihe:<br />
Super; 40 PS; Bj. 1960; 247 ccm; Mit Frontlader<br />
Schaufel + Gabel; Erbstück, ist noch<br />
letztes Jahr gefahren. Preis VHS, PLZ 2.<br />
Kontakt: vs28 2000@yahoo.de<br />
UNIMOG 406 Doppelkabine, EZ 1975,<br />
128.547km, Allrad, AHK, Diff.Sperre, Hydraulik,<br />
Standheizung, Bremsen neu, H-<br />
Kz., TÜV neu, Preis: VB 29.800, Euro. PLZ 4.<br />
Kontakt: (0163) 4018064<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Schön restaurierter Junior 108 K, Bj.1959,<br />
TÜV neu, orginal Pappbrief ist vorhanden.<br />
Anzeigen mit Foto online aufgeben<br />
unter www.traktorclassic.de<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014
MARKT<br />
Kleinanzeigen<br />
Unimog 421, BJ 68; 45 PS; 111 Tkm; Doppelseilwinde<br />
mit Polterschild; Zapfwelle<br />
vor/hin/mit; Hydraulikanschl. vor/hin;<br />
Druckluftbr. f. Hänger; Unrestaurierter<br />
Zustand, Rep. bedürftig; VB 10.750. PLZ 6.<br />
Kontakt: (06339) 993344 (ab 19 Uhr),<br />
webklaus@gmx.de<br />
Multicar-Anhänger: Pritsche, groß, top<br />
Zustand, Raum Berlin. Kontakt: (0163)<br />
6286327, skolli@gmx.de<br />
Neuero Abladegebläse top zustand und<br />
viel zubehör, Preis auf Anfrage. Kontakt:<br />
(07455) 939884, nico@123.de<br />
ELEKTRIK<br />
ZUBEHÖR/<br />
ERSATZTEILE<br />
1 Bruns 4to Anhänger, 1 Becker Federzi.-<br />
Grubber + Nachl., 1 Rau Spritze 600 Liter 12<br />
m AB, M38A1 Mot.-Block + Vo.-Achse, 1<br />
Wasserwagen mit Chemo-Fass, MD Claas<br />
Haspel. PLZ 3. Tel. (05346)1602 (bitte öfter<br />
versuchen)<br />
Eicher Winkeldrehpflug mit Steinsicherung<br />
bis auf Farbe und kleine Änderungen<br />
im Originalzustand und funktionsfähig. Typ<br />
AG 105 Z ST. VB 320 Euro. Raum Würzburg.<br />
Weitere Bilder vorh. Kontakt: (09350) 662,<br />
Lejovogt@web.de<br />
Fiat Einspritzpumpe für 312 R oder 315<br />
oder SOM 30 mit 4 Glühkerzen 24 V. Die<br />
pumpe muss überholt werden. Kontakt:<br />
(00352) 621738844, jomacha@pt.lu<br />
PRIVATE KLEINANZEIGEN KOSTENLOS<br />
Anzeigen mit Foto online aufgeben unter www.traktorclassic.de<br />
Reform 2000 Mähmaschine + Schwader<br />
1974, in einem dem Alter entsprechenden<br />
Zustand. Läuft gut, lässt sich gut durchschalten.<br />
Batterie schlecht, muss fremd<br />
gestartet werden. Unrestauriert. 1.280<br />
Euro. Tel. 0162-100 77 76<br />
Oldtimer Kipphänger incl. Aufsatzbracken.<br />
370 Euro. Tel.: 0171-8066632<br />
Anhänger Pöttinger: Reifenzustand gut bis<br />
sehr gut, Profil ca. 80 %; Ladefläche aus<br />
stabilen Mehrschichtplatten, Maße der<br />
Ladefläche: 4,51 * 1,86 m; Achslast 5000<br />
kg, Lichtanlage. PLZ 7. Kontakt:<br />
manfred.artist@gmx.de<br />
Mähbalken für Case IH 523HR, Mähbreite<br />
1700mm, bei Fragen einfach Anrufen. Kontakt:<br />
(08683) 359, wiki05@gmx.de<br />
Tandem-Hydraulikpumpe mit DBV und<br />
Mengenverteiler. Orig. Bosch 0510465322<br />
66
PRIVATE KLEINANZEIGEN<br />
KOSTENLOS<br />
Anzeigenschluss für die<br />
Ausgabe 6/2014: 07.08.2014<br />
Nr. wird ersetzt durch 0510465394<br />
11+8ccm passend für IHC 523, 624, 724,<br />
824, 946, 1046, 1246 Case-IH Nr. 3146446<br />
R93/94, Zustand neu 350 Euro.<br />
Tel. 05675-1615, horst-toelle@web.de<br />
mit Plane und Stützrad, Standort bei<br />
Braunschweig, 1400 Euro.<br />
Kontakt: (05302) 4650,<br />
Beate.Reinhard.Hentschel@t-online.de<br />
BKT Reifen Größe 270/95 R32 oder alte<br />
Bezeichnung 11.2 R32 inkl. neuer Schläuche.<br />
Preis VB 899,-EUR. PLZ 3.<br />
Kontakt: michael@fink-lieberum.de<br />
Unsinn Miststreuer R 4200 ohne Streuwerk<br />
ideal für Transport von Brennholz/<br />
Hackschnitzel. Bj 1970 / 5,7 to Ges.gewicht.<br />
Kontakt: (02625) 4576,<br />
langwiesenhof@hotmail.com<br />
System Bingerseilzug, war auf Schlüter DS<br />
15, passt aber auch z.B. auf Fahr/Fendt.<br />
Preis 150 Euro. PLZ 9.<br />
Kontakt: (09278) 1228<br />
Verkaufe 3-Schar-Volldrehpflug Kwerleland<br />
105. Preis VHS. PLZ 3.<br />
Kontakt: (0177) 31054558<br />
Dach für Hanomag Granit 500 zum Restaurieren<br />
(für Granit o.ä.). VB 60,- nur Selbstabholung,<br />
PLZ 8. Kontakt: (08344) 992578,<br />
Thomas.Wurmser@gmx.net<br />
F+S Stationärmotor mit Doppel-Kolbenpumpe,<br />
Bj. 62, Durchmesser 48, H 54, Pumpe<br />
16 L bei 750 U/min, 10-30 ATM, VB 180<br />
Euro. PLZ 8. Kontakt: (089) 403125<br />
Verkaufe Eicher-Auspuff, Passt für 3-Zyl.<br />
EM 235 und EM 300. Top mit Krümmer in<br />
Ordnung. 100 Euro.<br />
Kontakt: (07253) 23519<br />
McCormick-Mähbinder Rollenketten und<br />
Lakenrollen neu, und McCormick Riemenscheibe<br />
Durchmesser 31 cm, Nr. 7064-D mit<br />
Passfeder. Preis: VHS. PLZ 1. Kontakt:<br />
(039959) 22086 (ab 18 Uhr)<br />
2 <strong>Traktor</strong> Räder 8.3x24 auf Lemmerz-<br />
Felgen, 7x24, Innenring 160 mm, 6-Loch.<br />
Profiltiefe, 2cm, leichte Risse in der Karkasse.<br />
Kontakt: (07371) 961462,<br />
stefan-brauner@bildprojekt.de<br />
<strong>Deutz</strong>-Auspuffkrümmer, F4L 912, Guss,<br />
nach oben, 50 Euro. Kontakt: (04556) 285<br />
Holder Comimäher M7, 150cm Mähbalken,<br />
Aufsitzwagen, Zwillingsbereifung,<br />
Betriebsanleitung. 500 Euro FP, PLZ 8.<br />
Kontakt: (089) 403125<br />
<strong>Traktor</strong> Anlasser John Deere, 12 Volt, 3<br />
KW, 10 Zähne, 2 Loch Befestigung passt in<br />
John Deere 2030 und andere Mit 2 Loch<br />
Befestigungen. Neuwertig Bj. 2013, Nr.<br />
0001358041+0001359016+0001362312<br />
und mehr. Region Eifel, Vers. möglich.<br />
Kontakt: (02653) 205,<br />
amigo1940@web.de<br />
Honda F400: aus 1.Hd. (Nachlass) biete ich<br />
einen Honda F 400 Einachser mit Anhänger<br />
(gebremst), Pflug, Bodenfräse + Zubehör<br />
an. Guter orig. Zust. läuft tadellos. Neue<br />
Bremse am Anh. Orig. Unterlagen. VB 1199<br />
Euro. PLZ 6. Kontakt: (0175) 9050375,<br />
hausen.45@web.de<br />
Viehanhänger, neuwertig, 750 kg ungebremst,<br />
Kastenmaß: 2,50 x 1,25 x1,25 m,<br />
ALLGAIER A-12: zwei originale vordere<br />
Zusatzgewichte für den ALLGAIER Schlepper<br />
Typ A-12. Sie werden an der Vorderachse<br />
montiert und verhindern das schnelle<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
61
MARKT<br />
Kleinanzeigen<br />
VERDECKE/<br />
INSTANDHALTUNG<br />
Treckerplanenservice<br />
Aufbäumen des A-12. Standort Südbayern.<br />
Kontakt: (0151) 52187968,<br />
akr100@yahoo.de<br />
0001369014+ 24 oder 0986016550-093<br />
Einsetzbar für <strong>Deutz</strong> DX Fendt, Kramer,<br />
Renault. Kontakt: (02653) 205,<br />
amigo1940@web.de<br />
Dirk Strank<br />
32469 Petershagen<br />
Treckerplanenanfertigung nach alten<br />
Originalmustern oder nach<br />
Ihren Wünschen und Vorgaben aus<br />
Original Planenstoff.<br />
Reparaturen – Ersatzteile – Service<br />
komplette Verdeckinstandsetzung<br />
www.treckerplanenservice.de<br />
info@treckerplanenservice.de<br />
Tel 05707 / 90 04 44<br />
Biete Mähwerk für Porsche Diesel P133<br />
oder Super bzw. Allgaier A133, Rasspe,<br />
reparaturbedürftig, VB 250,- Suche orig.<br />
Teile für Porsche und Felgen hinten 30 Zoll,<br />
Felgen vorne 20 Zoll. Kontakt: (08537)<br />
919262, chrido@freenet.de<br />
Hanomag: Verkaufe komplettes Mähwerk<br />
für Hanomag R 19. Kontakt: (06638)<br />
919434, markus-kerstin.krueger@gmx.de<br />
KRAMER-Verdampfer K 18 Kolben, Pleuelstange<br />
und Lager (alle Standardmaß) für<br />
KRAMER Verdampfer, auch einzeln, sowie<br />
Nockenwelle und Regler. PLZ 9. Kontakt:<br />
(0151) 52187968, akr100@yahoo.de<br />
Ersatzteilangebot für Famulus: 2 Hinterradfelgen<br />
restauriert,2 Kotflügel leicht<br />
rep.bed. Für Hänger 3 to : 1 Drehkranz, 2<br />
Bremstrommeln, 4Bremsbacken, 2 Felgen,<br />
1 Zuggabel auflaufgebr. Preis alles NVB.<br />
PLZ 0. Kontakt: (035023) 69824,<br />
gherbstel@t-online.de<br />
Bosch Lima IHC 624+Reg. LJ/GEH90/12/<br />
o. FR 15 o. 0101209016+33+43+46+61 +<br />
andere Einsetzbar <strong>Deutz</strong> Fahr, Fendt, Kramer,<br />
John Deere, Schlüter Region Eifel.<br />
Kontakt: (02653) 205,<br />
amigo1940@web.de<br />
Strassendampfmaschine 6'Scale, Modell<br />
1:2 6'Scale Tasker "Little Giant" in England<br />
2003 hergestellt, wie neu, ständig<br />
gepflegt, letzte Dampfkesselprüfung TÜV<br />
Nord 2013 inkl. Hänger und Zusatzteile.<br />
PLZ 2. Kontakt: (04804) 1869133,<br />
p.c.z@t-online.de<br />
Fax 05707 / 90 04 45<br />
TRANSPORTE<br />
*Transportlogistik*<br />
Europaweit -<br />
Ihr Spezialtransportunternehmen<br />
Baumaschinen - Landmaschinen<br />
Gabelstapler - Bauwagen<br />
Anhänger - Forstmaschinen<br />
Hubarbeitsbühnen - Zubehör<br />
Produktionsmaschinen<br />
Werkzeugmaschinen<br />
Anlagentechnik - Container<br />
Telefon:<br />
0 33 62 / 88 575 91<br />
Fax:<br />
0 33 62 / 88 575 92<br />
Tieflader 5To. 25Km/h. Für Schlepperzug.<br />
Neuaufbau. Neue Reifen. In gutem Gesamtzustand.<br />
Zu verkaufen. Standort nähe<br />
Hamburg. Kontakt: (0171) 7710098,<br />
g.wulf@gmx.net<br />
MOTOR-<br />
INSTANDSETZUNG<br />
Bosch-<strong>Traktor</strong>-Anlasser 3-Loch-Befestigung<br />
3,1KW 12 Volt 9 Zähne.Vergl. Nr.<br />
Siku Modelle 1/32 zu verkaufen<br />
Hallo, habe noch eine ganze Menge<br />
Siku, Britains, Ertl, UH, <strong>Traktor</strong>en Modelle<br />
in 1/32 zu verkaufen. Alle neu und<br />
noch in OVP.<br />
Versand kein Problem.<br />
Kontakt: sikufan@freenet.de<br />
LITERATUR<br />
Betriebsanleitung/Ersatzteill. Hanomag<br />
R22, 1952 60 Euro, Claas Super Autom.S,<br />
1967 25 Euro, Güldner Motor 2LD104, 1960<br />
25 Euro, IHC 433-633-Bed.Anl., 1978 25<br />
Euro, Fahr Kreiselheuer KH2/4D, 1972 10<br />
Euro. Alles Orig. u. gut erhalten. Kontakt:<br />
(06245) 8908, ka5329-187@online.de<br />
Suche Bedienungsanleitung für <strong>Traktor</strong><br />
hatz H222 oder Hatz H220. Kontakt:<br />
(02775) 8595, HarleyFlossy@gmail.com<br />
kaufmann-spezialfahrzeuge@web.de<br />
www.kaufmann-spezialfahrzeuge.de<br />
<strong>Traktor</strong> <strong>Classic</strong>: Jahrgänge 2011, 2012,<br />
2013 komplett, gut erhalten, 30 Euro incl.<br />
Porto. Kontakt: (06245) 8908, ka5329-<br />
187@online.de<br />
Verkaufe Schlepperpost ab Nummer<br />
4/2005–2/2013 gegen Gebot.<br />
Kontakt: (0211) 9047340<br />
68
www.traktorclassic.de<br />
Neue Termine<br />
online eintragen unter<br />
Veranstaltungsübersicht<br />
TERMINE<br />
PLZ 0<br />
01.08.–03.08.2014<br />
02796 Jonsdorf<br />
Oldtimertage<br />
Schmalspurbahnhof<br />
Tel. (035873) 22 74<br />
andreas@hertrampf.org<br />
www.historikmobil.de<br />
01.08.–03.08.2014<br />
03253 Lindena<br />
14. <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Hartmut Müller, Tel./Fax (035322) 40 50<br />
bulldogmuelli@web.de<br />
www.lanz-bulldog-club-lindena.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
06542 Allstedt OT Liedersdorf<br />
2. <strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Rosenweg 22<br />
Kuhn's Baumschule & Pflanzenmarkt,<br />
Tel. (034659) 613 09, Fax (034659) 603 99<br />
info@kuhn-baumschule.de<br />
www.kuhn-baumschule.de<br />
24.08.2014<br />
07751 Großpürschütz<br />
<strong>Traktor</strong>treffen mit Leistungsziehen<br />
Rainer Grieser<br />
johannes.grieser@gmx.de<br />
www.gropue.de<br />
24.08.2014<br />
09235 Burkhardtsdorf<br />
17. Bulldogtreffen am Bulldog-Museum<br />
Peter Uhlig, Tel. (03721) 225 84<br />
peter-uhlig@t-online.de<br />
www.bulldog-freunde-erzgebirge.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
02748 Bernstadt-Kemnitz<br />
14. <strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Wolfgang Eichler, Tel. (035874) 231 53<br />
welke01@t-online.de<br />
www.kemnitzer-treckerfreunde.de<br />
05.09.–07.09.2014<br />
06577 Gorsleben<br />
4. <strong>Traktor</strong>en- und Oldtimertreffen<br />
Tel. (034673) 904 85, Fax 15 14 68<br />
traktorenverein-gorsleben@web.de<br />
14.09.2014<br />
07646 Rattelsdorf<br />
3. Schleppertreffen der Schlepperfreunde<br />
Seitentäler<br />
Kevin Rosenkranz<br />
kevin rosenkranz@web.de<br />
PLZ 1<br />
12.07.2014<br />
15913 Schwielochsee-Goyatz<br />
12. Alttechniktreffen<br />
Thomas Rietze, Tel. 0171 275 86 01 oder<br />
0151 58 89 63 08<br />
thomasrietze@t-online.de<br />
09.08.–10.08.2014<br />
14621 Paaren im Glien<br />
<strong>Traktor</strong>treffen mit historischem Feldtag<br />
MAFZ Erlebnispark<br />
kontakt@mafz.de<br />
www.mafz.de<br />
15.08.–16.08.2014<br />
15328 Friedrichsaue<br />
9. Ostbrandenburgisches Bulldogtreffen<br />
Festwiese<br />
Oldtimer- und <strong>Traktor</strong>enfreunde Zechin e.V.<br />
bulldogfreund-zechin@web.de<br />
www.bulldogfreund.de<br />
traktorclassic.de 5|2014<br />
22.08.–23.08.2014<br />
16278 Frauenhagen<br />
Ostuckermärkisches Oldtimer- und<br />
<strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Henry Finger, Tel. 0173 639 05 56<br />
henryfinger@web.de<br />
13.09.–14.09.2014<br />
15518 Steinhöfel, OT Demnitz<br />
10. Oldtimertreffen<br />
Enrico Sturm, Tel. 0172 627 91 57,<br />
Frank Schütze, Tel. 0162 451 97 33<br />
oldtimerfreunde-demnitz@web.de<br />
www.oldtimerfreunde-demnitz.de<br />
13.09.–14.09.2014<br />
19217 Schlagresdorf<br />
Trecker-Treck und Truckpulling<br />
Tel. 0171 186 52 79 oder 0172 666 48 82<br />
10.10.–12.10.2014<br />
16775 Grüneberg<br />
Trecker-Treck<br />
S. Fehlow, Tel. 0172 315 54 74<br />
www.grueneberger-trecker-treck.de<br />
PLZ 2<br />
11.07.–13.07.2014<br />
23715 Hutzfeld<br />
9. Treckertreffen<br />
Jörn Vollmann, Tel. (04527) 97 22 31<br />
oldtimertreff-hutzfeld@t-online.de<br />
12.07.–13.07.2014<br />
27211 Wedehorn/Bassum<br />
Oldtimer-Treckertreffen<br />
Dorfplatz, Horst Husmann<br />
husmann-wedehorn@t-online.de<br />
www.wedehorn.de<br />
12.07.–13.07.2014<br />
25862 Kolkerheide<br />
25. Oldtimertreffen mit Teilemarkt<br />
Hans Günter Thordsen, Tel. (04673) 679<br />
rantzauhoff@t-online.de<br />
www.treckerclub-bredstedt-land.de<br />
13.07.2014<br />
21522 Hittbergen<br />
7. Oldtimertreffen<br />
Hof Röhr, Peter Röhr<br />
PeterRoehr@gmx.de<br />
www.roehrinhittbergen.de/<br />
19.07.–20.07.2014<br />
27619 Wehden<br />
Oldtimertreffen auf der Dorfwiese<br />
Heike Schröder, Tel. (04704) 16 92<br />
geischa02@hotmail.de<br />
www.oldtimer-club-wehden.de<br />
20.07.2014<br />
22959 Linau<br />
L.O.G – Museumsöffnung<br />
Linau-Busch 1c<br />
Andreas Stolt<br />
info@log-linau.de<br />
www.log-linau.de<br />
02.08.–03.08.2014<br />
27321 Wackershausen<br />
8. Feldtag mit Oldtimertreffen<br />
Florian Wulfers, Tel. (04258) 415<br />
florianwulfers@aol.com<br />
03.08.2014<br />
21483 Gülzow<br />
5. Oldtimer-Trecker- und Autotreffen<br />
Dorfplatz<br />
Maik Schmidt, Tel. (04151) 47 86<br />
treckertreff-guelzow@web.de<br />
treckertreff-guelzow.jimdo.com<br />
www.traktorhof.com<br />
03.08.2014<br />
28378 Wittingen/Zasenbeck<br />
11. Oldtimertreffen<br />
Kalle Santelmann<br />
oldtimerclub-zasenbeck@t-online.de<br />
09.08.2014<br />
25569 Bahrenfleth<br />
8. Oldtimertreffen mit historischem Pflügen<br />
Andreas Mohr, Tel. 0151 12 71 30 36<br />
andreas.mohr@trecker-bahrenfleth.de<br />
www.trecker-bahrenfleth.de<br />
16.08.–17.08.2014<br />
27419 Klein-Meckelsen<br />
Oldtimertreffen mit Dreschfest<br />
Heiko Gerken, Tel. 0171 269 33 22<br />
Info@oldtimer-fruenn.de<br />
www.oldtimer-fruenn.de<br />
17.08.2014<br />
27389 Fintel<br />
10. Oldtimertreffen<br />
Am Schützenplatz<br />
Detlef Schweiß, Tel. (04265) 744<br />
oldtimerfreunde.fintel@yahoo.de<br />
www.oldtimerfreunde-fintel.npage.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
29690 Schwarmstedt<br />
12. Oldtimer- und Schleppertreffen<br />
info@oldtimerfreunde-schwarmstedt.de<br />
www.oldtimerfreunde-schwarmstedt.de<br />
24.08.2014<br />
22959 Linau<br />
L.O.G – Oldtimer- und Westerntreffen<br />
Andreas Stolt<br />
info@log-linau.de<br />
www.log-linau.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
23992 Zurow<br />
Stoppelfest<br />
Storchenhof Reinstorf<br />
Fam. Sauer, Tel. (038422) 455 25<br />
reingard1@gmx.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
25451 Quickborn<br />
Oldtimertreffen<br />
Marktstraße<br />
Daniel Hafemann<br />
treffenquickborn@outlook.de<br />
69
TERMINE<br />
Veranstaltungsübersicht<br />
14.09.2014<br />
22959 Linau<br />
L.O.G – Museumsöffnung<br />
Linau-Busch 1c, Andreas Stolt<br />
info@log-linau.de, www.log-linau.de<br />
PLZ 3<br />
12.07.–13.07.2014<br />
35396 Giessen Wieseck<br />
<strong>Traktor</strong>ausstellung<br />
auf dem Kirmesplatz<br />
1vorsitzender@tlg-giessen-wieseck.de<br />
www.tlg-giessen-wieseck.de<br />
13.07.2014<br />
31319 Sehnde OT Wehmingen<br />
Treffen hist. <strong>Traktor</strong>en, Lkw und Busse<br />
Hannoversches Straßenbahn-Museum<br />
besucher@tram-museum.de<br />
www.tram-museum.de<br />
24.07.–26.07.2014<br />
36148 Uttrichshausen<br />
9. Oldtimertreffen<br />
Michael Sauer, Tel. (09742) 18 44<br />
od. 0173 658 78 78<br />
01.08.–03.08.2014<br />
37441 Bad Sachsa-Steina<br />
Trecker- und Unimogtreffen<br />
Erhard Eckstein, Tel. 0175 337 62 34<br />
09.08.–10.08.2014<br />
37359 Effelder<br />
7. Oldtimer- und Schleppertreffen<br />
david-hu@gmx.de, osv-effelder.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
33428 Harsewinkel-Greffen<br />
Großes Oldtimertreffen<br />
Stefan Högemann, Tel. 0172 692 07 21<br />
www.oldtimer-freunde-greffen.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
31606 Warmsen OT Bohnhorst<br />
7. Old- und Youngtimertreffen<br />
oldtimerfreunde@rgbohnhorst.de<br />
www.rgbohnhorst.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
37199 Wulften<br />
Oldtimertreffen und Trecker-Treck<br />
Thomas Mißling, Tel. 0171 533 30 36<br />
gueldnerg40@web.de<br />
www.schlepperfreunde-wulften.de<br />
13.09.2014<br />
38836 Dedeleben<br />
2. Oldtimer- und Techniktreffen<br />
Tim Baronat, Tel. 0173 774 11 08<br />
oldtimer-baronat@web.de<br />
13.09.–14.09.2014<br />
39112 Magdeburg<br />
Stationärmotortreffen<br />
Technikmuseum, Dodendorfer Str. 65<br />
Wolfgang Schäfer, Tel. (0391) 622 39 06<br />
info@technikmuseum-magdeburg.de<br />
14.09.2014<br />
31603 Essern<br />
4. Oldtimerfrühschoppen<br />
Esserner Dorfstr. 8-14<br />
b.doenecke@web.de<br />
www.oldtimerfrühschoppen.de<br />
14.09.2014<br />
31559 Hohnhorst<br />
10 Jahre Treckerclub<br />
Zur Bradtmühle 1, Ohndorf<br />
Heinz Otto Witte, otti-witte@web.de<br />
www.trecker-club.de<br />
PLZ 4<br />
12.07.–13.07.2014<br />
45549 Sprockhövel<br />
10. Treckertreffen und Dittmers Hoffest<br />
Frank Dittmer, Tel. (02339) 92 96 51<br />
fus-dittmer@t-online.de<br />
www.hof-und-treckertreffen-dittmer.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck<br />
Feldtag mit Oldtimer-<strong>Traktor</strong>pulling<br />
Bocketaler Str. 155 bei Holtkamps Deele<br />
Christoph Wesselmann, Tel. 0173 377 77 85<br />
christoph.wesselmann@osnanet.de<br />
25.07.–27.07.2014<br />
47638 Straelen<br />
5. <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Nils Bons, Tel. (02834) 983 26<br />
schlepperfreunde-straelen@web.de<br />
26.07.–27.07.2014<br />
49597 Rieste<br />
5. Dreschfest und Oltimer-Schleppertreffen<br />
Ludger Weglage, Tel. (05464) 58 98<br />
ludger.weglage@gmx.de<br />
16.08.–17.08.2014<br />
47551 Bedburg-Hau<br />
Historische Feldtage und <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Triftstr.<br />
16.08.–17.08.2014<br />
49401 Damme-Rottinghausen<br />
5. Oldtimertreffen<br />
auf dem Dorfplatz<br />
Michael Rechtien, Tel. (05495) 95 26 44<br />
michael.rechtien@raritaetenkommando.de<br />
www.raritaetenkommando.de<br />
31.08.2014<br />
44225 Dortmund<br />
Dreschen und Alte <strong>Traktor</strong>en<br />
Schultenhof, Stockumerstr. 109a<br />
Klaus Rudolf Rose<br />
<strong>Traktor</strong>@HLANZ-Freunde.de<br />
20.09.–21.09.2014<br />
48531 Nordhorn<br />
MB trac- und Unimog-Treffen<br />
Eschweg 99<br />
Hartmut Diekmann, Tel. 0176 22 65 46 45<br />
Hartmut@trac-technik.de<br />
www.trac-technik.de<br />
05.10.2014<br />
48599 Gronau-Epe<br />
Oldtimerhäckseln 2014<br />
Christoph Hörmann<br />
Info@schlepperfreunde-epe.de<br />
www.schlepperfreunde-epe.de<br />
PLZ 5<br />
18.07.–20.07.2014<br />
54552 Kradenbach<br />
11. Veteranen-<strong>Traktor</strong>treffen<br />
Josef Hau, Tel. (06592) 98 02 81<br />
josef.hau@sag.de<br />
www.kradenbach.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
51545 Schönenbach<br />
18. Treckertreffen<br />
Thomas Kardel, Tel. (02291) 33 80 oder<br />
0157 32 63 61 64<br />
tomkar@freenet.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
51789 Lindlar<br />
Großes Dampf- und Treckertreffen<br />
im LVR-Freilichtmuseum<br />
Petra Dittmar, Tel. (02266) 901 00<br />
petra.dittmar@lvr.de<br />
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de<br />
02.08.–03.08.2014<br />
53534 Pomster<br />
Trecker- und Oldtimertreffen<br />
gregor.rausch@Icoud.com<br />
03.08.2014<br />
57074 Siegen<br />
8. Trecker-Tour Siegerland<br />
Jürgen Rompf, Tel. (0271) 359 65 10<br />
info@juergenrompf.de<br />
www.treckerfreunde-si.de<br />
09.08.–10.08.2014<br />
56321 Rhens<br />
10. Clubfest und Oldtimer-Schleppertreffen<br />
Helmut Lauer, Tel. (02628) 81 05<br />
www.oldtimerschlepperfreunde.de<br />
15.08.–17.08.2014<br />
54536 Kröv<br />
14. Oldtimertreffen f. Bulldogs u. <strong>Traktor</strong>en<br />
www.oldtimer-kroev.de<br />
15.08.–17.08.2014<br />
56288 Roth<br />
Oldtimer-Schleppertreffen<br />
Horst Hees, Treckerwaetz@t-online.de<br />
www.Treckerwaetz.de<br />
17.08.2014<br />
56754 Binningen<br />
2. <strong>Traktor</strong>- und Schleppertreffen<br />
Alex Simons, Tel. 0173 590 73 06<br />
also.simons@freenet.de<br />
22.08.–24.08.2014<br />
52388 Nörvenich-Wissersheim<br />
8. Oldtimer-Schlepperfest<br />
Guido Hambach, Tel. (02426) 66 87 und<br />
0172 787 37 68, guido.hambach@gmx.de<br />
www.alte-schlepper-wissersheim.de.vu<br />
22.08.–24.08.2014<br />
56294 Wierschem<br />
<strong>Traktor</strong>treffen der Eicherfreunde Maifeld<br />
Daniel Liesenfeld<br />
dennjel@onlinehome.de<br />
www.eicherfreunde-maifeld.de.vu<br />
23.08.–24.08.2014<br />
55578 Wolfsheim<br />
6. Oldtimer-<strong>Traktor</strong>treffen<br />
Thorsten Schrauth, Tel. (06732) 93 69 60<br />
thorsten.schrauth@nrd-online.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
59581 Warstein-Suttrop<br />
Treckertreffen, Stephan Weber<br />
S3.Weber@t-online.de<br />
www.treckerfreunde-bohnenburg.de<br />
31.08.2014<br />
57290 Neunkirchen-Wiederstein<br />
1. Treckertreffen<br />
treckerfreunde-wiederstein@t-online.de<br />
www.treckerfreundewiederstein.jimdo.com<br />
31.08.2014<br />
50266 Frechen-Hebbelrath<br />
8. Oldtimer- und Treckertreffen<br />
Antoniusstr., Feuerwehrgerätehaus<br />
Franz-Xaver Petz, Tel. (02234) 34 71 oder<br />
0172 173 22 94<br />
franz-xaver.petz@koeln.de<br />
05.09.–07.09.2014<br />
56191 Weitersburg<br />
25-jähriges Jubiläum und Schleppertreffen<br />
Günther Jösch, Tel. (02622) 897 94 39<br />
historschleppWb@t-online.de<br />
07.09.2014<br />
58454 Witten<br />
Dreschen, Hof Bangert, Hörderstr.<br />
Klaus Rudolf Rose<br />
<strong>Traktor</strong>@HLANZ-Freunde.de<br />
07.09.2014<br />
53332 Bornheim-Hersel<br />
Oldtimertreffen<br />
Rheinstr. 200, kath. Kirche<br />
Norbert Zerlett, Tel. (02222) 89 55<br />
Zerlett1-Hersel@t-online.de<br />
12.09.–14.09.2014<br />
59964 Medebach<br />
17. Oldtimertreffen<br />
Kerstin Müller, Tel. 0170 247 29 50<br />
www.oldtimerclub-medebach.de<br />
13.09.–14.09.2014<br />
56575 Weißenthurm<br />
350 Jahre Marktrechte in Weißenthurm<br />
Ludwig Klein, Lubens@gmx.de<br />
www.weissenthurm.de<br />
18.10.2014<br />
50999 Köln-Weiß<br />
7. Almabtrieb mit Schleppertreffen<br />
Am Treidelweg 1<br />
Bernd Lorbach, Tel. 0173 948 82 62<br />
bernd.lorbach@t-online.de<br />
www.hof-lorbach.de<br />
PLZ 6<br />
12.07.–13.07.2014<br />
63826 Omersbach<br />
Land- und Dampfmaschinentreffen<br />
Manfred Staub, Tel. (06024) 24 09<br />
info@die-gusseisernen.de<br />
www.die-gusseisernen.de<br />
13.07.2014<br />
63911 Klingenberg-Trennfurt<br />
16. Bulldog-, Schlepper- u. <strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Ralf Ühlein, Tel. (09372) 23 25<br />
ralf.uehlein@hukvm.de<br />
www.traktorfreunde.12see.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
65468 Trebur-Astheim<br />
Oldtimeraustellung<br />
Gerhard Bender, Tel. (06147) 74 96<br />
gerhardbender@web.de<br />
26.07.–27.07.2014<br />
67346 Speyer<br />
8. Großes Lanz-Bulldog-Treffen<br />
Am Technik Museum 1<br />
Carmen Werre, Tel. (06232) 67 08 66<br />
werre@technik-museum.de<br />
www.technik-museum.de<br />
70
Veranstaltungsübersicht<br />
TERMINE<br />
02.08.–03.08.2014<br />
65555 Offheim<br />
Stoppelfeldfest<br />
Hubert Perscheid, Tel. (06431) 520 20<br />
v-hperscheid@t-online.de<br />
03.08.2014<br />
67346 Speyer<br />
Benzingespräch beim Frühschoppen<br />
Am Technik Museum 1<br />
Corinna Handrich, Tel. (06232) 67 08 68<br />
handrich@technik-museum.de<br />
www.technik-museum.de<br />
03.08.2014<br />
66869 Kusel<br />
<strong>Traktor</strong>en- und Oldtimertreffen<br />
Edeltraud Diehl, Tel. (06381) 35 93<br />
laelia1@gmx.de<br />
09.08.–10.08.2014<br />
64646 Heppenheim-Mittershausen<br />
17. Schleppertreffen und Feldtage<br />
Georg Schork, Tel. (06253) 74 43 od. 0176<br />
70 36 47 50<br />
georgschork@gmx.de<br />
www.hanomag-club.de<br />
16.08.–17.08.2014<br />
68307 Mannheim<br />
Oldtimer- und <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Reit- und Fahrverein, Riedspitze 8<br />
1. Sandhofener Oldtimer- & <strong>Traktor</strong>freunde<br />
2013 e.V., Uwe Schäfer, Tel. 0179 224 17 03<br />
u.schaefer@ws-metallbau.de<br />
16.08.–17.08.2014<br />
65529 Waldems-Niederems<br />
Oldtimer- und <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Robert Amstutz Tel. (06087) 25 23<br />
thilo-rauch@t-online.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
63546 Hammersbach-Marköbel<br />
Die Dampfpflüge kommen<br />
Rüdiger Witzel, Tel. 0174 642 59 00<br />
witzel@ighl.de, www.ighl.de<br />
30.08.–31.08.2014<br />
67728 Münchweiler<br />
10. <strong>Traktor</strong>- und Schleppertreffen<br />
Timo Bogusat, Tel. (06302) 52 57<br />
bulldogclub-muenchweiler@t-online.de<br />
www.muenchweiler-alsenz.de<br />
06.09.–07.09.2014<br />
64823 Groß-Umstadt/Heubach<br />
25 Jahre Lanzfreunde Odenwald e.V.<br />
Tel. (06078) 717 21 oder 0152 53 30 39 85<br />
mail@lanzfreunde.de<br />
www.Lanzfreunde Odenwald.de<br />
PLZ 7<br />
13.07.2014<br />
74379 Ingersheim<br />
10. Schlepper und Oldtimertreffen<br />
Gerd Schwinger, Tel. (07191) 237 10<br />
oder 0170 418 85 63<br />
www.msc-ingersheim.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
72144 Dußlingen<br />
8. Bulldog- und Schleppertreffen<br />
Jürgen Vollmer, Tel./Fax: (07072) 927 94 70<br />
j.vollmer1808@web.de<br />
www.schlepperfreunde-dusslingen.de<br />
20.07.2014<br />
71069 Sindelfingen-Maichingen<br />
Schleppertreffen m. Geschicklichkeitsfahren<br />
Hans Erhardt, Tel. (07031) 80 12 28<br />
info@schlepperfreunde-maichingen.de<br />
25.07.–27.07.2014<br />
71546 Aspach-Röhrach<br />
16. Schleppertreffen<br />
Markus Lachenmaier, Tel. 0172 952 31 39<br />
veteranenfreunde roehrachhof@tonline.de<br />
01.08.–02.08.2014<br />
70839 Gerlingen<br />
8. Oldtimer-<strong>Traktor</strong>- und<br />
Schleppertreffen<br />
Uwe Schediwy, Tel. 0172 823 29 50<br />
uwe-schediwy@freenet.de<br />
02.08.–03.08.2014<br />
76698 Zeutern<br />
Karlheinz Schmitt, Tel. 0172 747 35 84<br />
kh-schmitt@semi-net.de<br />
www.osck.de<br />
08.08.–10.08.2014<br />
76831 Heuchelheim-Klingen<br />
19. Oldtimer-<strong>Traktor</strong>treffen<br />
Dr. Rainer Tempel, Tel. (06349) 32 80<br />
sonjatt@hotmail.com<br />
www.altertruemmer.de<br />
10.08.2014<br />
74889 Sinsheim-Dühren<br />
20. Hist. Erntetag m. Schleppertreffen<br />
Alexander Speer, Tel. (07261) 40 69 28<br />
dreschgem@aol.com<br />
www.dreschgemeinschaft.de<br />
15.08.–17.08.2014<br />
79271 St.Peter<br />
7. Bulldogtreffen<br />
Peter Hummel, Tel. (07660) 849<br />
heidigth@web.de<br />
www.bulldogfreundest-peter.jimdo.com<br />
16.08.–17.08.2014<br />
72660 Beuren<br />
18. Oldtimertreffen, Freilichtmuseum<br />
Eugen Schmid, Tel. (07025) 43 41<br />
unseld.werner@lra-es.de<br />
www.freilichtmuseum-beuren.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
79807 Lottstetten<br />
4. int. Oldtimer-<strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Martin Leininger, Tel. (07745) 86 90<br />
leininger.jestetten@t-online.de<br />
www.traktoren-freunde.de<br />
24.08.2014<br />
76891 Rumbach<br />
7. Oldtimertraktortreffen<br />
Wolfgang Ellerwald, Tel. 0171 236 89 38 oder<br />
(06394) 99 38 60<br />
wolleellerwald@aol.com<br />
30.08.2014<br />
72250 Freudenstadt-Dietersweiler<br />
Schleppertreffen mit Museumsfest<br />
Dorfmuseum Dietersweiler, Pfluggasse 5<br />
Fritz Wolf, Tel. (07441) 840 08<br />
info@f-wolf-elektro.de<br />
www.dietersweiler.de/<br />
veranstaltungen<br />
06.09.–07.09.2014<br />
73569 Eschach-Seifertshofen<br />
33. Lanz Bulldog- und Dampffestival<br />
Tel. (07940) 993 47 20<br />
info@seniorenstift-ingelfingen.de<br />
www.museum-kiemele.de<br />
06.09.–07.09.2014<br />
75045 Walzbachtal<br />
Wössinger Feldtage<br />
Tel. 0172 707 40 77<br />
verwaltung@bulldog-team.de<br />
www.bulldog-team.de<br />
PLZ 8<br />
12.07.2014<br />
82386 Oberhausen<br />
Oldtimer- Bulldogtreffen<br />
Franz Strobl, Tel. (08802) 222<br />
info@hungerbachfestl.de<br />
www.hungerbachfestl.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
87499 Wildpoldsried<br />
Großes Oldtimertreffen für alle Fahrzeuge<br />
Jakob Lanzenberger, Tel. (08315) 73 49 41<br />
nutzfahrzeuge-ke@gmx.de<br />
19.07.2014<br />
83714 Miesbach<br />
1. Historisches Fahrzeugtreffen<br />
Max Kalup, Tel. (08025) 700 00<br />
info@waitzinger-keller.de<br />
www.miesbach.de<br />
20.07.2014<br />
82439 Großweil<br />
<strong>Traktor</strong>entag, Freilichtmuseum Glentleiten<br />
freilichtmuseum@glentleiten.de<br />
www.glentleiten.de<br />
20.07.2014<br />
88316 Großholzleute<br />
16. Oldtimerteffen für <strong>Traktor</strong>en<br />
Tel. (08375) 10 40 od. 0173 214 18 33<br />
www.oldtimertreffen-grossholzleute.de<br />
27.07.2014<br />
86529 Aresing<br />
14. Oldtimertreffen für Bj. bis 1965<br />
Obstwiese der Gemeinde<br />
ulimahl@gmx.de<br />
www.oldtimerfreunde-aresing.de<br />
27.07.2014<br />
85614 Buch<br />
Oldtimertreffen, Feuerwehrhaus<br />
Max Reis, Tel. 0176 55 94 15 63<br />
02.08.2014<br />
88416 Erlenmoos<br />
12. ICH- und Oldtimertraktortreffen<br />
ihcschrochs@arcor.de<br />
www.ihcclub-erlenmoos.de<br />
09.08.–10.08.2014<br />
84130 Dingolfing<br />
2. Historischer Feldtag<br />
Oberholzhausen<br />
Bulldogfreunde Frauenbiburg, Andreas<br />
Meier, Tel. (08731) 83 78, 0160 96 32 52 71,<br />
Fax: (08731) 39 52 98<br />
claudia-elfinger@web.de<br />
10.08.2014<br />
85567 Grafing<br />
Großes Oldtimer- und Bulldogtreffen<br />
beim Wildbräugebäude<br />
Max Josef Schlederer, Tel. (08092) 700 90<br />
info@wildbraeu.de<br />
www.wildbraeu.de<br />
23.08.–24.08.2014<br />
85399 Hallbergmoos<br />
Erntefest mit Eicher-Treffen<br />
Sebastian Hausler, Tel. (0811) 18 30<br />
hausler-hof@t-online.de<br />
www.bayerische-eicher-fahrer.eu<br />
24.08.2014<br />
84326 Falkenberg<br />
Int. Unimog- und MB trac-Treffen<br />
Firmengelände der Fa. Hirl Misch- und<br />
Anlagentechnik GmbH & Co. KG , Mertsee 10<br />
J. Steiner, St. Hirl, Tel. 0173 805 67 20<br />
josef.steiner@t-online.de<br />
www.hirl-technik.de<br />
14.09.2014<br />
82178 Puchheim<br />
19. Bulldogtreffen, Feuerwehrstadel<br />
Puchheimer Bulldogfreunde e.V.,<br />
Tel. (08142) 448 76 74<br />
bulldogfreunde-puchheim@t-online.de<br />
PLZ 9<br />
13.07.2014<br />
96106 Fierst bei Ebern<br />
2. Oldtimer-Bulldogtreffen<br />
jani reuter13@yahoo.de<br />
19.07.–20.07.2014<br />
99706 Sondershausen<br />
OT Immenrode<br />
Oldtimer-<strong>Traktor</strong>entreffen<br />
Hainleite Oldtimer <strong>Traktor</strong>isten,<br />
Tel. (036330) 602 46<br />
19.07.–20.07.2014<br />
97640 Stockheim<br />
13. Oldtimertreffen<br />
Wolfgang Klösel, Tel. (09776) 54 72<br />
w.kloesel@web.de<br />
www.gemeinde-stockheim.de<br />
25.07.–27.07.2014<br />
99880 Hörsel-Aspach<br />
10. <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Lothar Walter, Tel. (03622) 90 72 10<br />
lothar.walter1@gmx.de<br />
www.traktortreffen-aspach.de<br />
03.08.2014<br />
92283 Deinschwang/Lauterhofen<br />
2. Schleppertreffen<br />
Hartmann-baumaschinen@online.de<br />
www.volksschlepperfreundeseiboldstetten.de<br />
03.08.2014<br />
94072 Aigen am Inn<br />
Bulldog-Oldtimertreffen<br />
bulldogfreunde-aigen@web.de<br />
www.bulldogfreunde-aigen.de.tl<br />
09.08.2014<br />
98660 Lengfeld/Thüringen<br />
10. <strong>Traktor</strong>treffen<br />
Jens Zachrich, Tel. 0171 506 49 02<br />
zachrich@online.de<br />
16.08.–17.08.2014<br />
94209 Regen<br />
28. Ostbayerisches Bulldog- und<br />
Oldtimertreffen<br />
Alfons Hof, Tel. 0160 880 88 38<br />
alfons.hof@bulldogschrauber.de<br />
www.bulldogschrauber.de<br />
30.08.2014<br />
91227 Leinburg-Entenberg<br />
Bulldogfest Moritzberg<br />
www.bulldogfreunde-moritzberg.de<br />
06.09.–07.09.2014<br />
99734 Sundhausen<br />
Dreschfest, Lanz Bulldog Club Südharz e.V.,<br />
Tel. (036333) 606 72 oder 0171 604 01 78<br />
RolfBenkstein@web.de<br />
06.09.–07.09.2014<br />
91452 Wilhermsdorf-<br />
Unterulsenbach<br />
Oldtimertreffen<br />
www.oldtimerfreunde-zenngrund.de<br />
Neue Termine<br />
online eintragen unter<br />
www.traktorclassic.de<br />
traktorclassic.de 5|2014<br />
71
SERVICE<br />
Motoreninstandsetzung<br />
PROFESSIONELLE KOMPLETTÜBERHOLUNG EINES MWM-D 308-3<br />
Dichtung<br />
und Wahrheit<br />
Unser MWM D 308-3<br />
nimmt Gestalt an. Die<br />
Kurbelwelle sowie der<br />
Nockenwellentrieb<br />
samt Öl- und Einspritzpumpe<br />
sind an ihrem<br />
Arbeitsplatz. Heute ist<br />
die Kupplungsseite des<br />
Motors dran und die<br />
Montage der Zylinder<br />
wird vorbereitet.<br />
Motoreninstandsetzung<br />
mit dem Profi<br />
In dieser Folge:<br />
- Zusammensetzen<br />
- Montieren<br />
- Abdichten<br />
Dean Rosenplänters Arbeitstag beginnt<br />
mit einer leichten Arbeit,<br />
die dennoch sorgfältig durchgeführt<br />
werden will: die Montage<br />
der Stößelrohr-Halter am Kurbelgehäuse.<br />
Drei Stück muss Dean vorbereiten, bevor<br />
er sie auf das Kurbelgehäuse schrauben<br />
kann. „Damit sie später absolut dicht sind,<br />
72<br />
müssen die Dichtflächen mit Dichtungssilikon<br />
eingestrichen werden“, erklärt der<br />
Motorenprofi. „Besonders wichtig ist<br />
hierbei, dass auch um die Verschraubungslöcher<br />
die Dichtmasse aufgetragen<br />
wird, da hier auch Öl austreten kann.“<br />
Dean weiß, dass viele dies vergessen – mit<br />
ärgerlichen Folgen. Denn wenn die Stö-<br />
ßelrohrhalter im Betrieb undicht werden,<br />
muss der Zylinderkopf runter, um das Teil<br />
demontieren zu können.<br />
Stößelrohr-Halter montieren<br />
Damit das nicht passiert, verstreicht Dean<br />
die Dichtmasse gleichmäßig mit dem Finger<br />
auf der Dichtungsfläche und lässt das<br />
Fotos: M. Schoch
STÖSSELROHR-HALTER MONTIEREN<br />
1. Dean bereitet die Stößelrohr-Halter für<br />
die Montage am Kurbelgehäuse vor und<br />
streicht sie mit Silikondichtmasse ein.<br />
2. Beim Einstreichen achtet Dean darauf,<br />
dass auch um die Schraubenbohrungen Silikondichtmasse<br />
aufgetragen ist.<br />
3. Nach dem Verstreichen der Silikondichtmasse<br />
müssen sie fünf Minuten ablüften,<br />
bevor sie montiert werden können.<br />
4. Die drei Stößelrohr-Halter werden zunächst mit einem Steckschlüssel<br />
mit Nuss handwarm angezogen.<br />
5. Damit es wirklich dicht wird, müssen die drei Stößelrohr-Halter<br />
mit dem Drehmomentschlüssel angezogen werden.<br />
Dichtmittel gut fünf Minuten an der Luft<br />
antrocknen. „Das verhindert, dass durch<br />
den Anpressdruck die Dichtmasse in das<br />
Stößelrohr quillt und so in den Ölkreislauf<br />
kommt“, sagt Dean. Die Montage ist für<br />
Dean reine Routine. Kurz die jeweils zwei<br />
Schrauben mit dem Steckschlüssel hineingedreht<br />
und dann mit dem Drehmomentschlüssel<br />
mit dem vorgeschriebenen<br />
Anzugsmoment festgeschraubt –<br />
fertig!<br />
Gleich daran schraubt unser Maschinenbauer-Geselle<br />
den linken Motorhalter<br />
fest. Eine anstrengende Arbeit, denn das<br />
tig, denn der Motorhalter ist ein hoch beanspruchtes<br />
Teil, da er sämtliche Kräfte<br />
des Motors auf den Rahmen ableiten<br />
muss. „Die Schrauben dürfen sich keinesmassive<br />
Teil wiegt mehrere Kilogramm.<br />
Die M12-Innensechskant-Schrauben, die<br />
Dean bei der Demontage erhebliche<br />
Schwierigkeiten beim Öffnen gemacht haben,<br />
hat er zwischenzeitlich durch neue<br />
ersetzt. Damit sie im Laufe der nächsten<br />
Jahre nicht wieder im Gewinde festrosten,<br />
streicht Dean vorsorglich ihr Gewinde mit<br />
Keramikpaste ein.<br />
Silikon-Dichtmasse muss immer gut fünf Minuten<br />
vor Zusammenbau an der Luft antrocknen.<br />
Da die Schrauben im Motorhalter versenkt<br />
sind, kommt eine besonders schmale<br />
Außensechskant-Nuss zum Einsatz, die<br />
genau in den Schraubenschacht passt.<br />
„Hier ist das Anzugsmoment sehr wich-<br />
MOTORHALTER LINKS<br />
1. Der linke Motorhalter ist schwer. Das<br />
massive Teil wird mit M12-Innensechs kant-<br />
Schrauben am Motorblock verschraubt.<br />
2. Auch der Motorhalter muss zur Sicherheit<br />
mit dem Drehmomentschlüssel fest<br />
verschraubt werden.<br />
3. Die Aufnahme des Ölfilters ist am linken<br />
Motorhalter festgeschraubt. Dean hat sie<br />
bereits montiert.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
73
SERVICE<br />
Motoreninstandsetzung<br />
MONTAGE DES KURBELWELLEN-DICHTFLANSCHES<br />
1. Die Dichtfläche auf dem Kurbelwellenstumpf<br />
muss mit feinem Schmiergelleinen<br />
abgezogen werden. Dann hält sie dichter.<br />
2. Die Dichtfläche zwischen Kurbelwellen-<br />
Dichtflansch und Motorblock muss gründlich<br />
gereinigt werden.<br />
4. Auf die Dichtfläche des<br />
Kurbelwellen-Dichtflansches<br />
muss auch Silikondichtmasse<br />
aufgetragen<br />
werden.<br />
5. Auch hier ist es wichtig,<br />
die Silikondichtmasse<br />
gleichmäßig auf der<br />
Dichtfläche mit dem Finger<br />
zu verstreichen.<br />
6. Dean hat die neun Schrauben<br />
des Kurbelwellen-Dichtflansches<br />
nur handwarm<br />
angezogen, um ihn noch<br />
ausrichten zu können.<br />
7. Erst als der Dicht -<br />
flansch zur Dichtfläche<br />
der Ölwanne ausgerichtet<br />
ist, zieht Dean die Schrau -<br />
ben über Kreuz an.<br />
3. Zur leichteren Montage streicht Dean<br />
die Dichtlippe des Viton-Dichtrings mit<br />
gewöhnlichem Lagerfett ein.<br />
falls im Betrieb losvibrieren“, so Dean und<br />
zieht die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel<br />
fest.<br />
Motorhalter links<br />
Am linken Motorhalter ist auch der Ölfilterflansch<br />
festgeschraubt. Obwohl Dean<br />
den Halter auch bequem später noch<br />
montieren kann, macht er es gleich. „Wieder<br />
ein Teil weniger, das im Teileregal<br />
liegt“, ist sein einziger Kommentar dazu.<br />
Sogleich macht er sich an die Vorbereitung<br />
der Montage des Kurbelwellen-Dichtflansches.<br />
Sie erinnern sich? Der Dichtflansch<br />
wurde bei Ganslmeier umgerüstet<br />
und der alte Filzdichtring durch einen<br />
Wellendichtring aus Viton ersetzt. Jetzt<br />
kommt der Moment, wo sich zeigen wird,<br />
ob er auch wirklich passt. Damit die Dichtfläche<br />
an der Kurbelwelle, auf der der<br />
Wellendichtring läuft, auch wirklich dicht<br />
hält, zieht Dean sie mit einem feinen<br />
Schmirgelleinen leicht ab. Anschließend<br />
reinigt er die Kurbelwellendichtfläche mit<br />
Motorreiniger. Auch die Dichtfläche am<br />
Kurbelgehäuse wischt er bei dieser Gelegenheit<br />
noch einmal ab. Der Motoren-Profi<br />
vergisst auch nicht, die Dichtlippen des<br />
Viton-Dichtrings reichlich mit Lagerfett<br />
einzuschmieren. „Das erleichtert das Aufschieben<br />
des Dichtrings auf die Kurbelwellendichtfläche<br />
ungemein. Und es schützt<br />
den Ring vor Beschädigungen, durch Umknicken<br />
der Dichtfläche“, sagt Dean.<br />
Montage des Kurbelwellen-Dichtflansches<br />
Auch hier trägt er wieder das Silikondichtmittel<br />
auf alle Dichtflächen des Kurbelwellen-Dichtflansches<br />
auf, verstreicht<br />
es gleichmäßig und wartet weitere fünf<br />
Minuten, bis es abgetrocknet ist. Das Aufschieben<br />
auf den Kurbelwellenstumpf ist<br />
kein Problem, jedoch muss Dean den<br />
Dichtflansch noch ausrichten, solange das<br />
Dichtmittel noch nicht abgebunden ist.<br />
„Die untere Seite des Dichtflansches muss<br />
genau mit der Dichtfläche der Ölwanne<br />
Mit Silikon gedichtete Teile müssen nach dem<br />
Zusammenbau sofort ausgerichtet werden.<br />
fluchten“, erklärt er. „Wer hier nicht genau<br />
arbeitet, riskiert eine undichte Ölwanne.“<br />
Zum Ausrichten verwendet Dean eine<br />
Schieblehre, deren absolut gerade Seite er<br />
als Richtmaß zum Ausrichten verwendet.<br />
Erst als das Teil genau sitzt, zieht er die<br />
ersten Schrauben leicht fest. Dabei kontrolliert<br />
er aber immer wieder, ob der Kur-<br />
74
ÖLWANNE ANSCHRAUBEN<br />
1. Die Ölwannendichtfläche muss gründlich<br />
von Schmutz und Fett gereinigt werden,<br />
damit sie dicht wird.<br />
2. Die Dichtung<br />
der<br />
Ölwanne<br />
unseres<br />
MWM-Motors<br />
ist auch<br />
heute noch<br />
problemlos<br />
im Teile -<br />
handel<br />
erhältlich.<br />
3. Dean streicht beide Seiten der Dichtung<br />
mit Silikondichtmasse ein. Das hält dicht<br />
und erleichtert eine spätere Demontage.<br />
4. Damit kein Silikondichtmittel bei der<br />
Montage in den Motor gepresst wird, muss<br />
es dünn verstrichen werden.<br />
5. Zur Sicherheit trägt Dean am Stoß zwischen<br />
Ölwanne und Dichtungsflansch-<br />
Dichtfläche Silikondichtmasse auf.<br />
6. Dünn verstrichen, wird an dieser Stelle<br />
sicherlich in den nächsten Jahren kein<br />
Motoröl heraus tropfen.<br />
7. Mit dem Verschrauben der Ölwanne beginnt Dean, um Verspannungen<br />
zu vermeiden, an ihren Ecken.<br />
8. Die nächsten Schrauben dreht er unmittelbar neben den Eckschrauben<br />
ein. Er zieht sie aber nicht fest.<br />
9. Gleichmäßig über Kreuz zieht er beim<br />
Verschrauben der Ölwanne die Schrauben<br />
allmählich handwarm fest.<br />
10. Im letzten Arbeitsschritt werden alle<br />
Schrauben der Ölwanne mit dem Dreh -<br />
momentschlüssel über Kreuz angezogen.<br />
11. Keinesfalls sollte die Ölablassschraube<br />
vergessen werden. Jetzt ist noch Gelegenheit,<br />
sie bequem einzuschrauben.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
75
SERVICE<br />
Motoreninstandsetzung<br />
MOTORHALTER RECHTS UND KUPPLUNGSGLOCKE ANSCHRAUBEN<br />
1. Die nächsten Montageschritte<br />
erfordern es, dass der Motor<br />
aufgestellt wird. Mit einem<br />
Werkstattkran kein Problem.<br />
2. Noch hängt der Motor am<br />
Werkstattkran. Ansonsten würde<br />
unter dem Gewicht des Motors<br />
die Ölwanne eingedrückt.<br />
3. Dean bereitet die Kupplungsglocke<br />
zur Montage vor und<br />
schleift die Montagefläche mit<br />
feinem Schmirgelleinen ab.<br />
4. Ein Kraftakt: das Anflan schen<br />
der Kupplungsglocke. Zum<br />
leichteren Ansetzen hat Dean<br />
den Motor vorne angehoben.<br />
5. Drei Schrauben sind eingedreht. Dean<br />
kann sie später, wenn der Motor steht, wie<br />
die restlichen Schrauben festziehen.<br />
6. Zur Montage des rechten Motorhalters<br />
muss der Motor nochmals mit dem<br />
Werkstattkran angehoben werden.<br />
7. Beim Anschrauben des rechten Motorhalters<br />
an den Motorblock sind wieder<br />
Deans Muskeln gefragt.<br />
8. Nachdem beide Motorhalter und Kupplungsglocke<br />
vormontiert sind, legt Dean<br />
zum sicheren Stand Holzblöcke unter.<br />
9. Der Motor steht sicher auf zwei Holzblöcken.<br />
Dank Werkstattkran blieb die Ölwanne<br />
unverletzt.<br />
10. Jetzt kann Dean die Innensechskantschrauben<br />
der Motorhalter mit dem Drehmomentschlüssel<br />
fest anziehen.<br />
11. Die Kupplungsglocke sitzt richtig. Die<br />
restlichen Schrauben können per Hand<br />
eingedreht werden.<br />
12. Auch bei der Kupplungsglocke ist es<br />
wichtig, dass die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel<br />
festgezogen werden.<br />
13. Dean ist zufrieden. Da der Motor sicher<br />
steht, kann er jetzt mit der Montage der<br />
Zylinder beginnen.<br />
76
ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN EINLEGEN<br />
1. Zur Dichtung des Zylinderfußes müssen<br />
spezielle O-Ringe in die Nuten der Zylinderfußschächte<br />
eingelegt werden.<br />
2. Sind die O-Ringe richtig montiert, passen<br />
sie sich formtreu in die Nuten der Zylinderfußschächte<br />
ein.<br />
3. Damit der Zylinderfuß bei der Montage<br />
besser über den O-Ring gleitet, werden<br />
alle drei mit Motoröl eingestrichen.<br />
belwellen-Dichtflansch sich doch nicht<br />
verschoben hat.<br />
Nachdem alle Schrauben handwarm<br />
eingeschraubt sind, zieht Dean sie über<br />
Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel<br />
fest. „Jetzt wird es Zeit, die Ölwanne zu<br />
montieren“, kommentiert der Fachmann<br />
seinen nächsten Arbeitsschritt. Auch hier<br />
muss zuerst wieder die Dichtfläche ge -<br />
reinigt und anschließend Dichtmittel<br />
aufgetragen werden. Als er es ebenfalls<br />
verstrichen hat, holt Dean die neue Ölwannen-Dichtung<br />
aus dem Teileregal,<br />
packt sie aus, legt sie auf die eingestrichene<br />
Dichtfläche der Ölwanne und richtet<br />
sie dabei noch ein wenig auf die Verschraubungslöcher<br />
aus. Nach wenigen<br />
Minuten haftet die Dichtung fest auf der<br />
Ölwannendichtfläche. „Sie ist aber nicht<br />
so fest, als dass man sie nicht bei einer<br />
späteren Demontage leicht wieder entfernen<br />
könnte“, sagt Dean. „Ohne Dichtmittel<br />
würde sie jedoch mit den Dichtflächen<br />
im Laufe der Zeit fest verbacken.“<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Ohne Werkstattkran lässt sich der<br />
schwere Motor kaum aufrichten.<br />
Ölwanne anschrauben<br />
Aus diesem Grund streicht Dean auch die<br />
Dichtung noch an ihrer Oberseite mit Silikondichtmittel<br />
ein, bevor er sich daran<br />
macht, die Ölwanne an das Kurbelgehäuse<br />
zu schrauben. Vorher jedoch geht er auf<br />
Nummer sicher und trägt auch etwas Dichtmittel<br />
auf die Stoßfläche von Kurbelwellen-Dichtflansch,<br />
Ölwanne und Kurbelgehäuse<br />
auf. „Obwohl hier alles genau<br />
ausgerichtet ist, empfiehlt es sich, diese<br />
Stelle extra zu dichten, um später Öl-<br />
Schwitzen dort zu vermeiden“, sagt Dean.<br />
Auch die Montage der Ölwanne muss sorgfältig<br />
geschehen. Zuerst schraubt Dean sie<br />
an ihren Ecken handwarm fest. Dann setzt<br />
er die weiteren Schrauben immer kreuzweise<br />
gegenüber, bis er alle verschraubt<br />
hat. „Diese Vorgehensweise verhindert,<br />
dass die Ölwanne sich verspannt“, so unser<br />
Profi-Monteur. Selbstredend werden zum<br />
Schluss noch alle Schrauben – ebenfalls<br />
über Kreuz – mit dem Drehmomentschlüssel<br />
festgezogen.<br />
Da der Motor jetzt unten herum fertig<br />
ist, kann Dean ihn wieder senkrecht stellen.<br />
Mit dem Werkstattkran ist es kein Problem.<br />
Dean muss lediglich darauf achten,<br />
dass der Motor sicher auf zwei Holzbalken<br />
zu liegen kommt, ohne dabei die Ölwanne<br />
zu beschädigen. Damit der Motor<br />
aber nicht umkippt, wenn er die Tragegurte<br />
des Werkstattkrans löst, müssen vorher<br />
noch die Kupplungsglocke und der rechte<br />
Motorhalter angeschraubt werden.<br />
Bevor Dean dies machen kann, schleift<br />
er noch sämtliche Kontaktflächen der<br />
Kupplungsglocke mit Schleifpapier ab.<br />
„Das garantiert, dass die Flächen absolut<br />
glatt sind und das Teil formschlüssig am<br />
Motor verschraubt werden kann“, sagt<br />
Dean. Ein wirklicher Kraftakt ist es, die<br />
Kupplungsglocke an den Motor zu schrauben,<br />
denn Dean muss sie ausrichten und<br />
gleichzeitig festhalten. Nachdem die ersten<br />
drei Schrauben festgezogen sind, wird<br />
Dean die restlichen eindrehen, wenn der<br />
Motor sicher steht. Dann wird er sie auch<br />
mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.<br />
Motorhalter rechts und Kupplungsglocke<br />
Noch fehlt für einen sicheren Stand der<br />
rechte Motorhalter. Zur leichteren Montage<br />
des Teils befestigt unser Maschinenbauer-Geselle<br />
den Motor jetzt im vorderen<br />
Bereich an der Kupplungsglocke und<br />
lupft ihn ein kleines Stück an. Auch der<br />
schwere rechte Halter bereitet bei der<br />
Montage keine Probleme, denn wie bereits<br />
beim linken wurden auch hier die<br />
Schrauben vorher mit Keramikpaste eingestrichen.<br />
Nachdem Dean den Motor auf<br />
den Holzbalken ausgerichtet hat, steht er<br />
endlich wieder sicher. Jetzt kann er gefahrlos<br />
alle Schrauben, auch die des<br />
Motorhalters, mit dem Drehmomentschlüssel<br />
festziehen, um dann die Zylindermontage<br />
vorzubereiten.<br />
Zylinderfußdichtungen einlegen<br />
Da noch eine andere dringende Arbeit auf<br />
dem Programm von Dean steht, will er<br />
uns heute noch die Montage der drei O-<br />
Ringe zur Dichtung der Zylinderfußschächte<br />
zeigen, bevor es morgen weiter<br />
geht. „Damit sie sich beim Setzen der Zylinder<br />
nicht verschieben können, sind jeweils<br />
in den Schächten Nuten eingefräst,<br />
in die die Ringe eingelegt werden müssen.<br />
Dabei muss man darauf achten, dass sie<br />
spannungsfrei in den jeweiligen Nuten zu<br />
liegen kommen und keinesfalls verdreht<br />
sind“, erklärt Dean. Nachdem er sie innerhalb<br />
weniger Minuten eingebaut hat,<br />
bleibt noch, sie mit etwas Motoröl einzustreichen.<br />
Das erleichtert die Zylindermontage,<br />
da später der Zylinderfuß leichter<br />
in den Zylinderfußschacht geschoben<br />
werden kann, ohne dass die O-Ringe sich<br />
sperren oder gar beschädigt werden können.<br />
Für heute ist erstmal wieder Schluss.<br />
Wenn alles klappt, geht es für Dean morgen<br />
mit der Montage der Zylinder und<br />
Köpfe weiter. Wie immer, werden wir ihm<br />
dabei über die Schulter sehen.<br />
Marcel Schoch<br />
77
SERVICE<br />
<strong>Traktor</strong>-Kennzeichen<br />
AMTLICHE KENNZEICHEN – TEIL I<br />
Wegweiser durch<br />
den Schilderwald<br />
Der Gesetzgeber<br />
bietet viele Möglichkeiten,<br />
einen<br />
<strong>Traktor</strong> zuzulassen.<br />
Die Wahl<br />
muss wohlüberlegt<br />
getroffen<br />
werden.<br />
Welches Kennzeichen ist für meinen Schlepper das richtige?<br />
Wer durchblicken will, muss kein Jurist sein, aber<br />
einfach machen es die Behörden einem wahrlich nicht.<br />
Hier der Fahrplan durch den Kennzeichendschungel.<br />
Fotos: M. Schoch<br />
78
Mit einer regulären Zulassung hat man die größten Freiheiten.<br />
Fahrten ins Ausland oder ins Büro sind problemlos möglich.<br />
Klein-<strong>Traktor</strong>en wie dieser Bungartz T8 34 können kostengünstig<br />
mit einem regulären Kennzeichen zugelassen werden.<br />
Wer seinen <strong>Traktor</strong> zum öffentlichen<br />
Straßenverkehr zulassen<br />
möchte, hat die Qual der Wahl,<br />
denn die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung<br />
(StVZO) sieht mehrere<br />
Zulassungsformen vor. Da jede Vor- und<br />
Nachteile hat, haben wir in unserer neuen<br />
Artikelserie alle Informationen zusammengetragen,<br />
um Ihnen die Entscheidung<br />
bei der Zulassung zu erleichtern.<br />
Wer sich auf einem Oldtimertreffen genau<br />
die Kennzeichen ansieht, wird<br />
schnell erkennen, wie viele Möglichkeiten<br />
es gibt, einen <strong>Traktor</strong> für den öffentlichen<br />
Straßenverkehr zuzulassen. Da sieht<br />
man <strong>Traktor</strong>en mit regulären Zulassungen<br />
neben solchen mit H- oder Saisonkennzeichen<br />
stehen – und oft mischt sich sogar<br />
ein grünes Nummernschild darunter.<br />
Fragt man nach, weshalb es gerade diese<br />
oder jene Zulassungsform sein musste,<br />
werden die meisten finanzielle Gründe<br />
nennen. Doch wer nur auf den Geldbeutel<br />
achtet, hat oftmals die falsche Zulassungsform<br />
gewählt. Denn nicht mit jeder Zulassungsform<br />
kann man seinen Klassiker so<br />
ohne weiteres für alles verwenden. Oder<br />
haben Sie gewusst, dass man mit einer H-<br />
Zulassung weder zur Arbeit fahren noch<br />
den <strong>Traktor</strong> gewerblich in der Landwirtschaft<br />
nutzen darf? Noch mehr Einschränkungen<br />
hat das grüne Kennzeichen. Mit<br />
ihm ist es zum Beispiel untersagt, auf ein<br />
Oldtimertreffen zu fahren.<br />
Wer also keinen Ärger mit der Polizei<br />
oder dem Finanzamt bekommen will,<br />
sollte vor der Zulassung genau wissen,<br />
was mit den jeweiligen Zulassungsformen<br />
erlaubt ist und was nicht. Auch über die<br />
Dokumente und Papiere, die man für die<br />
jeweiligen Zulassungsformen benötigt,<br />
sollte man sich vorab genauestens informieren,<br />
damit man sich unnötige Rennereien<br />
erspart.<br />
Bevor wir heute unseren Streifzug<br />
durch den Schilderwald mit der regulären<br />
Zulassung (schwarzes Kennzeichen)<br />
und dem roten Dauerkennzeichen (07-<br />
Kennzeichen) beginnen, noch eine Anmerkung<br />
in eigener Sache. Ganz bewusst<br />
wurden die Kosten für die einzelnen Zulassungsformen,<br />
bis auf wenige Ausnahmen,<br />
weggelassen. Der Grund ist einfach.<br />
Die Zulassungsstellen sind zwar grundsätzlich<br />
an eine Gebührenordnung gebunden,<br />
diese kann aber je nach Bundesland<br />
erheblich variieren. Auch die Preise für<br />
die Kennzeichen können schwanken,<br />
selbst vor Ort, wenn um eine Zulassungsstelle<br />
mehrere Kennzeichen-Präge-Firmen<br />
ansässig sind. Besonders deutlich<br />
werden aber die Preisunterschiede bei<br />
den Versicherungen. Sie können je nach<br />
Wer vor der Zulassung das „Kleingedruckte“<br />
kennt, umgeht Ärger mit Polizei und Finanzamt.<br />
Anbieter, Bundesland, Region und sogar<br />
Wohnort sehr unterschiedlich sein. Für<br />
Sie bedeutet das: In jedem Fall Preise und<br />
Gebühren vergleichen und in die Entscheidung,<br />
wie Sie ihren <strong>Traktor</strong> zulassen<br />
möchten, mit einfließen lassen.<br />
Das kleine Schwarze<br />
Jeder kennt es! Das allseits bekannte<br />
schwarze Kennzeichen. Es ist die häufigste<br />
Zulassungsform in Deutschland.<br />
Grundsätzlich kann damit jedes Fahrzeug<br />
(auch Oldtimer-<strong>Traktor</strong>en), das technisch<br />
den Anforderungen der Straßenverkehrs-<br />
Dieses Pkw-Schild müsste nicht sein. <strong>Traktor</strong>en<br />
bekommen bei der Zulassungsstelle<br />
problemlos das kleine zweizeilige Schild.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Bei luftgekühlten <strong>Traktor</strong>en muss das<br />
Frontnummernschild so angebracht sein,<br />
dass die Kühlung nicht beeinträchtigt wird.<br />
Alte, entwertete Kennzeichen, wie dieses aus<br />
Italien, dürfen in Deutschland nur außerhalb<br />
des StVZO-Bereichs montiert werden.<br />
79
SERVICE<br />
<strong>Traktor</strong>-Kennzeichen<br />
Die Ausführung des 07-Kennzeichens<br />
kann frei gewählt werden. Dieser <strong>Traktor</strong>-<br />
Fan scheint noch Oldtimer-Pkw zu besitzen.<br />
Wer eine <strong>Traktor</strong>ensammlung besitzt,<br />
sollte über ein rotes 07-Kennzeichen<br />
nachdenken. Es ist jedoch<br />
mit Einschränkungen verbunden.<br />
Dokumente für schwarzes Kennzeichen<br />
– (EU)-Zulassungsbescheinigung Teil II (ZB<br />
II; seit 1.10.2005) oder „alter“ (nationaler)<br />
Fahrzeugbrief (nach § 6, Abs. 2 Fahrzeug-<br />
Zulassungsverordnung (FZV)). Gegebenenfalls<br />
noch die alte Abmeldebescheidung<br />
– Bei Ummeldung ist zusätzlich die (EU)-Zulassungsbescheinigung<br />
Teil I (seit<br />
1.10.2005) oder der „alte“ (nationale) Fahrzeugschein<br />
notwendig<br />
– Nachweis einer gültigen HU (Bericht der<br />
letzten Hauptuntersuchung)<br />
– Wenn Pflicht zur Abgasuntersuchung (AU)<br />
besteht, ist auch der Nachweis über eine<br />
gültige AU zu erbringen (Benziner ab dem<br />
1.7.1969, Diesel ab dem 1.1.1977)<br />
– Die „alten“ Kennzeichen (auch bei Ummeldung<br />
eines angemeldeten Fahrzeugs)<br />
– Personalausweis<br />
– eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung)<br />
– Nachweis über ein Girokonto (EC-Karte u.a.)<br />
für die Abbuchung der Kfz-Steuer.<br />
Zulassungsordnung (StVZO) entspricht,<br />
angemeldet werden.<br />
Für die Zulassung eines <strong>Traktor</strong>s oder<br />
Anhängers benötigt die Straßenverkehrsbehörde<br />
die unten im Infokasten aufgeführten<br />
Unterlagen vom Fahrzeughalter.<br />
Zugeteilt wird <strong>Traktor</strong>en das verkleinerte,<br />
zweizeilige Kennzeichen. Die Kennzeichen<br />
für <strong>Traktor</strong>en sind in zwei Ausführungen<br />
erhältlich: 240 x 130 mm und<br />
255 x 130 mm.<br />
Für und Wider<br />
Die reguläre Zulassung mit schwarzem<br />
Nummerschild bietet viele Vorteile. Die<br />
Nutzung des <strong>Traktor</strong>s wird in keiner Weise<br />
eingeschränkt. Man darf auf jeder öffentlichen<br />
Straße fahren. Wird der <strong>Traktor</strong><br />
Wenn Sie Ihren <strong>Traktor</strong> über eine Vertrauensperson,<br />
auf die eigene Firma oder auf einen<br />
Verein zulassen möchten, benötigen Sie zu<br />
den obigen Unterlagen noch die folgenden.<br />
Zulassung über eine Vertrauensperson:<br />
– Ausweis / Pass des Bevollmächtigten<br />
– Schriftliche Vollmacht des Halters (auch bei<br />
Ehegatten erforderlich)<br />
– Ausweis der Person, auf die der <strong>Traktor</strong> zugelassen<br />
werden soll<br />
Zulassung auf eine Firma:<br />
– Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung<br />
und Ausweis der verantwort lichen und laut<br />
Handelsregister unterschriftsberechtigten<br />
Person (zum Beispiel Geschäftsführer)<br />
Zulassung auf einen Verein:<br />
– Vereinsregisterauszug (VR) und Ausweis der<br />
verantwortlichen und laut VR unterschriftsberechtigten<br />
Person (Vorstand)<br />
nachweislich landwirtschaftlich genutzt<br />
(BImSchG § 40, Abs.1), darf mit ihm sogar<br />
in Umweltzonen gefahren werden. Zu<br />
beachten ist jedoch, dass Anhänger, die<br />
von <strong>Traktor</strong>en mit einem schwarzen<br />
Kennzeichen gezogen werden, eine eigene<br />
Zulassung, gültige HU und Versicherung<br />
haben müssen!<br />
Auch steuertechnisch hat diese Zulassungsform<br />
Vorteile: Da <strong>Traktor</strong>en zu den<br />
Nutzfahrzeugen gerechnet werden, kann<br />
bei einer regulären Zulassung mit schwarzem<br />
Nummernschild, abhängig vom zulässigen<br />
Gesamtgewicht des <strong>Traktor</strong>s, eine<br />
geringere jährliche Steuerbelastung anfallen,<br />
als bei anderen Zulassungsformen<br />
(z.B. H-Kennzeichen).<br />
Zur Rentabilitätsberechnung der Kfz-<br />
Steuer bei einer Standardzulassung ist folgender<br />
Link nützlich: www.kfz-steuer.de/<br />
Rotes Dauerkennzeichen<br />
Auch als 07-Kennzeichen oder Sammler-<br />
Nummer bezeichnet: Das rote Dauerkennzeichen<br />
ist ein Wechselkennzeichen, auf<br />
das ein oder mehrere Oldtimer zugelassen<br />
werden können. Voraussetzung für die<br />
Zuteilung dieses Kennzeichens ist seit<br />
dem 1. März 2007 ein weitestgehend originaler<br />
Zustand, ein guter Pflegezustand<br />
und ein Fahrzeugmindestalter von 30 Jahren.<br />
Vor dem 1. März 2007 konnten auch<br />
Fahrzeuge mit einem Mindestalter von 20<br />
Jahren ein rotes 07-Kennzeichen zugeteilt<br />
bekommen. Für diese Fahrzeuge gilt auch<br />
nach dem 1. März 2007 Bestandsschutz<br />
und sie dürfen deshalb heute weiter mit<br />
dem 07er-Kennzeichen betrieben werden.<br />
Probleme kann hier jedoch ein Besitzerwechsel<br />
bereiten, denn der Bestandsschutz<br />
wird oftmals nicht auf den neuen<br />
Besitzer übertragen.<br />
Für die Zuteilung des roten Dauerkennzeichens<br />
benötigt der Antragsteller<br />
80
ei der Zulassungsstelle die im Infokasten<br />
rechts aufgelisteten Papiere.<br />
Abhängig von der Zulassungsstelle<br />
können pro roter 07er-Nummer bis zu<br />
zehn, in anderen Fällen aber auch beliebig<br />
viele Fahrzeuge darauf zugelassen<br />
werden. Möglich sind ebenso mehrere<br />
Kennzeichen mit gleicher Nummer, beispielsweise<br />
ein großes, längliches für Pkw<br />
und ein kleines für <strong>Traktor</strong>en.<br />
Pro und Contra<br />
Mit dem 07-Kennzeichen sind von Seiten<br />
des Gesetzgebers strikte Auflagen zur Nutzung<br />
verbunden. So ist der Halter verpflichtet,<br />
einen Nachweis über alle Fahrten<br />
zu führen (Fahrtenbuch). Darüber<br />
hinaus müssen alle Fahrzeuge, die mit<br />
dem roten Dauerkennzeichen gefahren<br />
werden, der zuständigen Zulassungsstelle<br />
und dem Versicherer gemeldet sein.<br />
Des Weiteren ist bei seiner Nutzung folgendes<br />
zu beachten:<br />
Erlaubt sind:<br />
– An- und Abfahrten zu Oldtimerveranstaltungen<br />
(auch im Ausland)<br />
– Probe- und Überführungsfahrten<br />
– Reparatur- und Wartungsfahrten<br />
Nicht erlaubt sind:<br />
– Alltagseinsatz (z.B.: Fahrten zum und<br />
vom Arbeitsplatz)<br />
– Ausflüge am Wochenende (z.B.: Besuch<br />
einer Gastwirtschaft u.a.)<br />
– Hochzeitsfahrten<br />
– Gewerbliche Fahrten (hierzu zählt auch<br />
landwirtschaftlicher Einsatz)<br />
– Reklamefahrten<br />
– Allgemeine Fahrten ins Ausland<br />
Auch bei einem<br />
07-Kennzeichen<br />
muss auf die ordnungsgemäße<br />
Anbringung<br />
am <strong>Traktor</strong><br />
geachtet werden.<br />
Das 07-Kennzeichen bietet viele Vorteile, doch<br />
der Gesetzgeber fordert strikte Auflagen.<br />
Das rote Dauerkennzeichen rechnet sich<br />
meist aufgrund der eingeschränkten Nutzungsbedingungen<br />
lediglich für Besitzer<br />
größerer <strong>Traktor</strong>sammlungen, die ihre<br />
Fahrzeuge nur selten bewegen. Die Jahressteuer<br />
für ein rotes 07-Kennzeichen beträgt,<br />
unabhängig von der Anzahl der Fahrzeuge,<br />
pauschal 191,73 Euro. Hinzu kommen<br />
aber die Kosten zur Begutachtung der <strong>Traktor</strong>en<br />
zur Erlangung des H-Kennzeichen-<br />
Status nach § 23 StVZO. Sie liegen einmalig<br />
pro <strong>Traktor</strong> bei rund 110 Euro. Das<br />
H-Gutachten stellen TÜV, Dekra oder amtlich<br />
anerkannte Sachverständige bzw. andere<br />
Sachverständigenorganisationen aus.<br />
Dokumente für rotes Kennzeichen<br />
– Personalausweis<br />
– Polizeiliches Führungszeugnis<br />
– Auszug aus dem Flensburger Verkehrszentralregister<br />
(„Punkteregister“) des KBA<br />
– Eine Liste der Fahrzeuge, die mit dem Roten<br />
Dauerkennzeichen betrieben werden sollen.<br />
– Besitz-Nachweis (z.B. Kfz-Brief oder ZB II)<br />
– Gutachten über die Einstufung des Fahrzeuges<br />
als Oldtimer (H-Gutachten nach § 23<br />
StVZO)<br />
– eVB-Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung)<br />
– Nachweis über ein Girokonto (EC-Karte u.a.)<br />
für die Abbuchung der Kfz-Steuer<br />
– Kennzeichen zur Abmeldung bei zugelassenen<br />
Fahrzeugen<br />
Auch hier besteht die Möglichkeit, der Zulassung<br />
über eine Vertrauensperson (siehe<br />
schwarzes Kennzeichen)<br />
Keine HU oder AU!<br />
Interessant ist für viele auch, dass die HU<br />
und AU wegfällt. Der Eigentümer ist für<br />
den technischen Zustand seiner Fahrzeuge<br />
selbst verantwortlich. Bei großen <strong>Traktor</strong>sammlungen<br />
kann das ein erheblicher<br />
finanzieller und organisatorischer Vorteil<br />
sein. Ausnahmen hiervon sind jedoch<br />
nach zuständiger Zulassungsstelle möglich.<br />
Da die Eintragung der Daten im<br />
Fahrzeugschein von der zuständigen amtlichen<br />
Behörde (Zulassungsstelle) vorgenommen<br />
wird, sind Fahrten zu Oldtimertreffen<br />
im Ausland möglich, jedoch kann<br />
es in manchen Ländern zu „Anerkennungsproblemen“<br />
kommen.<br />
Mit beiden Zulassungsformen können<br />
die Bedürfnisse der meisten Oldtimer-<br />
<strong>Traktor</strong>besitzer erfüllt werden. Falls nicht,<br />
kann man auch über eine Kombination<br />
beider Zulassungsformen nachdenken. So<br />
könnten der Lieblingstraktor regulär und<br />
alle anderen <strong>Traktor</strong>en in der Sammlung<br />
mit 07-Kennzeichen gefahren werden.<br />
Dann muss man auch keine Gewissensbisse<br />
haben, wenn man am Wochenende<br />
einfach mal nur so spazieren fährt.<br />
Doch damit ist das Thema noch nicht erschöpft.<br />
In der nächsten Ausgabe von<br />
TRAKTOR CLASSIC stellen wir das H- und<br />
Saisonkennzeichen vor. Marcel Schoch<br />
Bei der Zulassung mit einem 07-Kennzeichen verlangen die Versicherer oft den Nachweis<br />
eines überdachten und abschließbaren Stellplatzes.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Die genehmigungspflichtige Anbringung<br />
des vorderen Nummernschildes auf dem<br />
hinteren Kotflügel ist nur statthaft, wenn<br />
eine Fronthydraulik dies am Bug verhindert.<br />
81
SERVICE<br />
Schrauben und Muttern<br />
SCHRAUBE ABGERISSEN – WAS TUN?<br />
Nach fest<br />
kommt lose …<br />
Schrauben können einen ziemlich<br />
ärgern, wenn sie trotz aller Tricks nicht<br />
aufgehen wollen. Das Ende vom Lied ist<br />
dann oft, dass sie mit einem Schlag<br />
abreißen. Peter Götzinger zeigt, was<br />
dann zu tun ist.<br />
Eine abgerissene Schraube ist kein<br />
Beinbruch und schon gar kein<br />
Grund, sich zu ärgern“, sagt Peter,<br />
unser Materialexperte aus dem<br />
bayerischen Freising. „Man muss jedoch<br />
genau wissen, wie man vorgeht, um nicht<br />
noch größeren Schaden anzurichten.“ In<br />
über 90 Prozent der Fälle reißen Schrauben<br />
ab, die in einem so genannten Sackloch<br />
(auch Kernloch genannt) eingeschraubt<br />
sind. Das bedeutet, dass das Gewinde der<br />
Schraube noch im Bauteil steckt. Um das<br />
Gewinde des Sackloches wieder verwenden<br />
zu können, muss das abgerissene Gewinde<br />
daraus entfernt werden. „Ist der<br />
Schraubenkopf ab, sieht man sich zunächst<br />
die Bruchstelle näher an“, sagt Peter. „Steht<br />
ein Rest des Schraubengewindes noch<br />
über den Rand des Sackloches etwas über,<br />
kann man zuerst versuchen, es mit einer<br />
guten Zange herauszudrehen.“<br />
Das kann tatsächlich funktionieren, da<br />
der Gewindestumpf jetzt nicht mehr unter<br />
Auch Mike Thomas hatte schon seine<br />
liebe Mühe, abgerissene Schrauben<br />
aus einem Sackloch zu entfernen.<br />
ÜBERSTEHENDEN GEWINDEREST HERAUSDREHEN<br />
1. Zwei typische<br />
Fälle: das<br />
Gewinde ist<br />
beinahe flächig<br />
mit dem<br />
Bauteil abgerissen<br />
(oben)<br />
oder beim Herausdrehen<br />
reißt der<br />
Schraubenkopf<br />
ab und ein Gewinderest<br />
steht über.<br />
2. Steht ein Gewinderest über, sollte<br />
zunächst versucht werden, ihn mit einer<br />
guten Zange herauszudrehen.<br />
3. Gute Zangen haben im Zangenrachen<br />
eine Verzahnung. Hier kann die höchste<br />
Haltekraft erzeugt werden.<br />
Fotos: M. Schoch<br />
82
Gekröpfte<br />
Fächerscheiben eignen<br />
sich hervorragend,<br />
überstehende<br />
Gewindereste auf<br />
Bauteilhöhe abzuschleifen.<br />
Um ein Sackloch-<br />
Gewinde zu retten,<br />
ist in vielen Fällen<br />
eine gute Stand -<br />
bohrmaschine un -<br />
umgänglich.<br />
GEWINDEREST AUSBOHREN<br />
Spannung beziehungsweise dem Zug des<br />
Schraubenkopfes steht und sich unter<br />
dem Schlag des plötzlichen Abreißens gelockert<br />
haben kann. Meist hat man jedoch<br />
Pech und nichts geht.<br />
„Bildet der Bruch eine konvexe Struktur,<br />
schleife ich den Gewindestumpf mit<br />
einer gekröpften Schleifscheibe vorsichtig<br />
ab, so dass der Schraubenrest mit dem umgebenden<br />
Bauteil eine glatte Fläche bildet.<br />
„Hierzu ist es ratsam, das Bauteil, in<br />
dem der Schraubenrest steckt, auszubauen,<br />
um es auf der Werkbank besser bearbeiten<br />
zu können. „Das ist auch für den<br />
nächsten Arbeitsschritt wichtig“, erklärt<br />
Peter, „denn zum Ausbohren des Gewinderestes<br />
muss der Bohrer absolut zentrisch<br />
und senkrecht in den Gewinderest<br />
einfahren können.“ Am besten ist es daher,<br />
das Bauteil in eine Standbohrmaschine<br />
einzuspannen und mit einer Wasserwaage<br />
waagrecht zum senkrechten Bohrer<br />
auszurichten.<br />
Mittig körnern<br />
Nicht vergessen sollte man dabei, vorher in<br />
der Mitte des Gewinderestes mit einem Körner<br />
eine Bohrmarkierung einzuschlagen.<br />
„Der Körnerpunkt verhindert, dass der<br />
Bohrer schräg zur Seite läuft, wenn er in<br />
das Material eingefahren wird“, so Peter.<br />
Die Möglichkeit, das Bauteil in eine<br />
Standbohrmaschine einspannen zu können,<br />
ist auch wichtig, wenn der Gewinderest<br />
tief innerhalb des Sackloches abgerissen<br />
ist. „Dann hat man keine Chance, es<br />
genau zu körnern“, so Peter. „Damit der<br />
Bohrer zum Ausbohren des Gewindes genau<br />
zentrisch in den Gewinderest bohrt,<br />
muss ein kleineres Loch vorgebohrt werden.<br />
Für die kleinen Vorbohrer gibt es spezielle<br />
Führungstüllen, die zur Führung in<br />
das Sackloch gesteckt werden können.“<br />
Hierzu ist etwas Erfahrung und Gefühl<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
1. Peter muss frei hand körnern, da der Gewinderest<br />
geringfügig innerhalb des Sackloches<br />
abgerissen ist.<br />
4. Die Bohrung ist zentrisch. Der HSS-E-<br />
Bohrer zieht einen sauberen, gleichmäßigen<br />
Span aus dem Sackloch.<br />
2. Der Körnerpunkt sitzt. Er verhindert,<br />
dass der Bohrer beim Einfahren zur Seite<br />
wegwandern kann.<br />
3. Das Frontgewicht<br />
liegt<br />
waagerecht auf<br />
der Standbohrmaschine.<br />
Vorsichtig<br />
fährt<br />
Peter den Bohrer<br />
in den Gewinderest.<br />
5. Nach dem Bohren zieht Peter den Gewinderest<br />
mit einer Reißnadel aus dem Gewindegang.<br />
83
SERVICE<br />
Schrauben und Muttern<br />
DIE RICHTIGEN BOHRER<br />
Mutternsprenger<br />
braucht<br />
man nur selten.<br />
Ihre Anwendung<br />
ist nicht<br />
ganz risikolos<br />
und will geübt<br />
sein.<br />
1. Richtige HSS-E Bohrer sind mit Kobalt<br />
legiert. Von Kobalt-beschichteten Bohrern<br />
sollte man Abstand nehmen.<br />
GEWINDE MIT LINKSBOHRER AUSBOHREN<br />
2. Für die harten Fälle: hartmetallbestückte<br />
Bohrer. Sie werden unter Profis auch<br />
„Jet-Bohrer“ genannt.<br />
Linksausdreher<br />
sind keine gute<br />
Wahl. Wenn sie<br />
eingesetzt werden,<br />
dann sind die mit<br />
weiten Rillen zu<br />
bevorzugen (l.).<br />
notwendig, da gerade kleine Bohrer, trotz<br />
Führungstülle, auf konvexen Bruchstrukturen<br />
gerne zur Seite ausweichen.<br />
1. Links ein so genannter<br />
Linksbohrer, rechts ein<br />
Standard-Rechtsbohrer.<br />
2. Zum Linksausbohren<br />
benötigt man eine Bohrmaschine<br />
mit Linkslauf.<br />
3. Trotz Linksbohrer wollte<br />
der Gewinderest nicht aus<br />
dem Sackloch kommen.<br />
Leichte Rechnung<br />
Zum eigentlichen Ausbohren des Gewinderestes<br />
ist vor allem die richtige Bohrergröße<br />
wichtig – denn Ziel ist es, das Gewinde<br />
im Kern- bzw. Sackloch zu retten. „Für<br />
die Auswahl des Bohrers gibt es eine Formel“,<br />
erklärt Peter. „Sie lautet: Die Bohrergröße<br />
ist der Durchmesser des Außengewindes<br />
der abgerissenen Schraube minus<br />
der Steigung des Gewindes.“ Hierzu zwei<br />
Beispiele: Handelt es sich bei der abgerissenen<br />
Schraube um eine M6, dann muss die<br />
Steigung – in unserem Fall 1 – abgezogen<br />
werden. Der benötigte Bohrer ist damit ein<br />
5 Millimeter-Bohrer. Bei einer M8-Schraube<br />
ist die Steigung 1,25. Dann benötigt man<br />
einen 6, 8 Millimeter-Bohrer. „Wird das abgerissene<br />
Schraubengewinde genau zentrisch<br />
und senkrecht mit der richtigen Bohrergröße<br />
herausgebohrt, gelingt es, das<br />
stehen gebliebene Gewinde als Draht mit<br />
einer spitzen Zange oder Reißnadel aus<br />
dem Sackloch zu ziehen“, weiß Peter.<br />
4. Um den Gewinderest zu bergen, hebt Peter ihn mit einer Reißnadel vom Gewinde ab,<br />
staucht ihn mit einem Durchtreiber im Sackloch und zieht ihn schließlich mit einer<br />
Reißnadel heraus.<br />
Wichtig! Der richtige Bohrer<br />
Wegen der Genauigkeit der Bohrung darf<br />
deshalb keinesfalls bei der Qualität des<br />
Bohrers gespart werden. Auch muss der<br />
richtige Spiralbohrer-Typ ausgewählt<br />
wer den, da dieser für das Ergebnis der Gewindereparatur<br />
von höchster Bedeutung<br />
ist. Peter verwendet prinzipiell HSS-E<br />
Bohrer. Sie sind mit Kobalt legiert und widerstehen<br />
hohen Beanspruchungen. Bei<br />
84
ANWENDUNG DES SCHRAUBENAUSDREHERS<br />
1. Ein tief im Sackloch abgerissenes Gewinde<br />
ist ein typischer Fall für einen<br />
Schraubenausdreher.<br />
2. Schraubenausdreher sätze mit Spiralbohrer<br />
und Tüllen für die Vorbohrer gibt es in<br />
allen Größen.<br />
3. Passende Bohrer im Ausdrehersatz sind<br />
rund 30 Prozent kleiner als der Gewindedurchmesser.<br />
4. Mit Hilfe der Tüllen kann mit einem<br />
kleinen Bohrer zentrisch vorgebohrt<br />
werden.<br />
5. Die Tiefe des Bohrlochs für den Dorn<br />
muss rund zwei Drittel der Gewinderestlänge<br />
betragen.<br />
6. Möglichst zentrisch schlägt Peter den<br />
Dorn des Schraubenausdrehersatzes in<br />
den Gewinderest.<br />
7. Mit einer speziellen Mutter kann mit<br />
Gabel- oder Ringschlüssel der Gewinderest<br />
herausgedreht werden.<br />
8. Das Herausdrehen des Gewinderestes<br />
sollte mit viel Gefühl erfolgen, damit der<br />
Dorn nicht abreißt.<br />
9. Der Gewinderest ist draußen. Im<br />
Schraubstock kann der Dorn aus dem Gewinderest<br />
gezogen werden.<br />
hoch vergüteten oder gehärteten Schrauben<br />
setzt er so genannte hartmetallbestückte<br />
Bohrer ein. Solche Schrauben<br />
sind bei Oldtimer-<strong>Traktor</strong>en jedoch äußerst<br />
selten.<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Ganz wichtig ist es, auf die richtige Geschwindigkeit<br />
des Bohrers zu achten. Für<br />
Edelstahl lautet die Faustregel: immer halbe<br />
Bohrgeschwindigkeit wie bei gewöhnlichem<br />
Stahl. Wie hoch die Geschwindigkeit<br />
genau sein darf, hängt nicht nur vom<br />
Material, sondern auch von der Bohrergröße<br />
ab. Im Internet findet man aber entsprechende<br />
Bohrgeschwindigkeits-Tabellen<br />
Linksausdreher sind keine gute<br />
Wahl. Ihr Einsatz birgt große Risiken.<br />
(Info: http://www.bünting.com/html/drehzahltabelle.htm).<br />
Wesentlicher Nachteil der oben beschriebenen<br />
Methode ist, dass das Bauteil<br />
demontiert werden muss, um die exakte<br />
Bohrung hinzubekommen. Dass das nicht<br />
immer möglich ist, weiß Peter nur allzu<br />
gut. Deshalb erklärt er uns eine weitere<br />
Methode. Hierzu sind ein so genannter<br />
Linksbohrer und eine Bohrmaschine mit<br />
umschaltbarem Rechts/Links-Lauf notwendig.<br />
Die Vorbereitung ist zunächst<br />
ähnlich wie bei der vorher beschriebenen<br />
Methode, jedoch kann das Bauteil eingebaut<br />
bleiben. Trotzdem kann es auch hier<br />
nötig sein, das abgerissene Gewinde mit<br />
einer gekröpften Schleifscheibe auf Bauteilhöhe<br />
flächig abzuschleifen, um es an-<br />
85
SERVICE<br />
Schrauben und Muttern<br />
LÖSEN MIT FLEXSCHEIBE UND MUTTERNSPRENGER<br />
1. Wenn solche Schraubverbindungen<br />
nicht aufgehen, sind sie ein Fall für die<br />
Flex, nicht für den Mutternsprenger.<br />
3. Mit einem bedachten Meißelschlag<br />
könnte die Mutter jetzt von der Schraube<br />
gesprengt werden.<br />
schließend in der Mitte des Gewindestumpfes<br />
zentrisch mit einem Körner markieren<br />
zu können.<br />
Mit Führungstülle zentrisch<br />
Bei im Sackloch abgerissenen Gewinden<br />
ist die Sache etwas schwieriger, denn<br />
dann muss freihändig und gegebenenfalls<br />
unter Verwendung einer Führungstülle<br />
mit einem sehr kleinen Bohrer versucht<br />
werden, einen kleinen „Krater“ zentrisch<br />
in den Gewindestumpf zu setzen. „Da der<br />
Linksbohrer gut 80 Prozent kleiner als der<br />
Schraubendurchmesser gewählt werden<br />
kann, ist das Risiko bei einem etwas<br />
86<br />
2. Mit einem Minibohrer mit Trennschei -<br />
ben vorsatz muss zum Sprengen ein Spalt in<br />
die Flanke der Mutter geschliffen werden.<br />
4. Besser! Mit dem Muttersprenger lässt<br />
sich die angeschliffene Mutter leicht und<br />
kontrolliert sprengen.<br />
schrägen Bohransatz, das Gewinde zu beschädigen,<br />
geringer. Zudem bewirkt der<br />
Linksbohrer, dass das Gewinde beim<br />
Linksausbohren in der Regel mit herauskommt“,<br />
weiß Peter. „Denn durch das<br />
Mutternsprenger sollten nur bei Muttern bis<br />
zur Gewindegröße M12 eingesetzt werden.<br />
Bohrloch wird Spannung vom Gewindestumpf<br />
genommen und der Gewinderest<br />
lockert sich vom Sacklochgewinde.“<br />
Natürlich kennt Peter noch weitere Methoden:<br />
„Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit,<br />
mit einem so genannten Linksausdreher<br />
den Gewinderest herauszudrehen.<br />
Davon möchte ich jedoch abraten.“ Unser<br />
Materialexperte erklärt auch, warum. „Wie<br />
bei den oben beschriebenen Methoden,<br />
muss man auch beim Einsatz des Linksausdrehers<br />
zunächst möglichst mittig in den<br />
Gewindestumpf ein Loch bohren. Bohrt<br />
man es zu klein, kann man nur einen kleinen<br />
Linksausdreher eindrehen, der dann<br />
gerne mal schnell abbricht.“<br />
Dann hat man ein noch größeres Problem,<br />
denn das sehr spröde Material des<br />
Linksausdrehers lässt sich kaum mehr aus<br />
dem Gewinderest herausbohren. „Bohrt<br />
man das Loch größer, um einen größeren<br />
Linksausdreher zu verwenden, weitet sich<br />
oft das Gewinde des Gewindestumpfes<br />
unter dem konischen Gewinde des Linksausdrehers<br />
radial nach außen auf. Dann<br />
spreizt sich der Gewinderest unter jeder<br />
Umdrehung des Linksausdrehers noch<br />
stärker in das Sacklochgewinde“, so Peter.<br />
Kommt man um die Verwendung eines<br />
Linksausdrehers nicht herum, dann muss<br />
man sehr genau arbeiten. Das fängt bei der<br />
Größe des Bohrlochs an“, sagt Peter. „Bei<br />
M3- und M4-Schrauben darf es maximal<br />
1,8 Millimeter sein. Bei M5- bis M7-<br />
Schrauben nicht größer als 3,3 Millimeter.<br />
Dann hält sich die radiale Ausdehnung des<br />
Gewindestumpfes noch in Grenzen. Bei<br />
größeren Schrauben ist immer vom Einsatz<br />
des Linksausdrehers abzuraten.“ Hier bekommt<br />
man die nötigen Ausdrehkräfte<br />
nicht auf den Gewindestumpf übertragen.<br />
„Auch sollte nur ein Linksausdreher mit<br />
weiten Rillen verwendet werden, da dieser<br />
den Gewindestumpf nicht so stark ausdehnt<br />
wie einer mit engen Rillen“, ergänzt<br />
der Spezialist.<br />
Statt des Linksausdrehers bevorzugt<br />
Peter Schraubenausdrehersätze mit Spiralbohrer,<br />
die er für verschiedene Schraubengrößen<br />
immer zur Hand hat. „Mit dem<br />
speziellen Spiralbohrer wird, wie schon<br />
beschrieben, ein Loch in die Mitte des<br />
Schraubenstumpfes gebohrt“, erklärt unser<br />
Materialexperte die Anwendung.<br />
„Dann wird in das Loch, das rund 30 Prozent<br />
kleiner ist als der Gewinderest, ein<br />
spezieller Dorn mit Verzahnung eingeschlagen,<br />
der sich dann mit einem speziellen<br />
Mutternvorsatz mittels eines Gabel-<br />
oder Ringschlüssels drehen lässt.“<br />
Vorteil dieser Methode ist, dass der Gewindestumpf<br />
nicht radial aufgespreizt<br />
und durch das Bohrloch die Spannung<br />
vom Sacklochgewinde genommen wird.
Auch Muttern können<br />
sich gelegentlich sperren.<br />
Um hier das Gewinde zu retten,<br />
sollte bis zur Mutterngröße<br />
M12 stets ein qualitativ<br />
hochwertiger Mutternsprenger<br />
zum Einsatz kommen. Das<br />
Werkzeug besteht aus einem<br />
Ring, von dem seitlich ein<br />
Keil durch Schraubenkraft in<br />
die Flanke der Mutter getrieben<br />
wird. „Es ist ein sehr brachiales<br />
Werkzeug, das mit Bedacht<br />
verwendet werden will“,<br />
mahnt Peter. „Denn wie sein<br />
Name schon sagt, wird die<br />
Mutter regelrecht aufgesprengt.<br />
Langsames Anziehen des Keils<br />
und ein guter Sitz des Rings auf<br />
der Mutter müssen selbstverständlich<br />
bei seiner Anwendung<br />
beachtet werden.“ Auch<br />
darf man keinesfalls versäumen,<br />
eine Schutzbrille und Handschuhe<br />
anzulegen.<br />
Als Materialexperte weiß Peter Götzinger, wie<br />
man abgerissenen Schrauben beikommt.<br />
Kleines Werkzeug – große Wirkung<br />
Bei Muttern, die größer als M12 sind,<br />
kommt ein so genannter Mini-Bohrer –<br />
auch als Dremel oder Multifunktionswerkzeug<br />
bekannt – mit Trennscheibe<br />
zum Einsatz. „Hier schneidet man mit der<br />
Trennscheibe in die Seite der Mutter bis<br />
knapp über das Gewinde einen durchgängigen<br />
Spalt und sprengt dann<br />
mit einem Meißel, der mit einem<br />
Hammer in den Spalt geschlagen<br />
wird, die Mutter<br />
auf.“ Was Peter in einem Satz<br />
sagt, sollte aber mit Bedacht<br />
gemacht werden. Ist nämlich<br />
der Meißelschlag zu hart,<br />
schlägt dieser oft bis auf das<br />
Gewinde durch und beschädigt<br />
es.<br />
Zum Schluss noch ein<br />
Tipp von Peter: „Ist abzusehen,<br />
dass beim Öffnen die<br />
Schraube abreißt, dann sollte<br />
der Schraubenkopf mit einer<br />
gekröpften Trennscheibe<br />
kontrolliert abgeflext werden.<br />
Die Gefahr, dass die<br />
Schraube tief im Sackloch<br />
abreißt, kann so vermieden<br />
werden. Gleiches gilt für<br />
Muttern. Hier muss man<br />
dann lediglich die Schraubverbindung –<br />
Schraube und Mutter – ersetzen.<br />
In der nächsten Folge wird uns Peter<br />
erklären, was zu tun ist, wenn alles schief<br />
geht und ein neues Gewinde gesetzt werden<br />
muss. Auch hier hat er so einige<br />
Tricks auf Lager.<br />
Marcel Schoch<br />
Anzeige<br />
Mutter, beweg dich!<br />
DAS NEUE CARAMBA SUPER PLUS<br />
Wer kennt nicht den Schrauber-Frust,<br />
wenn eine festkorrodierte Mutter mitsamt<br />
Bolzen unter dem übermächtigen Dreh -<br />
moment abreißt? Wenn Rost der Erzfeind<br />
des Oldtimer-Fans ist, dann ist Caramba<br />
sein treuer Wegbegleiter. Das legendäre<br />
Multiöl made in Germany wirkte schon in<br />
Zeiten, als der Lanz Bulldog noch über<br />
den Acker zog. Im Jahr 2014 hat das Traditionsunternehmen<br />
die Rezeptur noch einmal<br />
überarbeitet. Das neue Caramba Premium<br />
Multiöl trägt das GTÜ-Gütesiegel.<br />
In Bezug auf Kriechvermögen, Korrosions-<br />
und Verschleißschutz wurde der leis -<br />
tungsstarke Alleskönner noch einmal ver -<br />
bessert. Der silikonfreie Spray löst verrostete<br />
Schrauben und Muttern. Er<br />
schmiert bewegliche Teile, beseitigt hartnäckige<br />
Fett- und Harzrückstände, verdrängt<br />
Feuchtigkeit und schützt die<br />
Bordelektrik vor Fehlfunktionen. Die<br />
Anwendung des patenten Helfers ist<br />
denkbar einfach:<br />
dünn aufsprühen,<br />
einwirken lassen,<br />
Schraubverbindung<br />
vorsichtig lö sen und<br />
bei frei gewordenen<br />
Gewindegängen<br />
nachsprühen.<br />
Anschließend bildet<br />
sich ein dünner,<br />
korrosionsabweisender<br />
Schutzfilm. Den<br />
vielseitigen Rostkiller<br />
gibt es in Bau -<br />
märkten, im Einzelhandel<br />
und im Fach -<br />
handel für Auto- und<br />
Zweiradbedarf.<br />
Weitere Informationen<br />
unter<br />
www.caramba.eu<br />
Caramba Super Plus löst<br />
auch hartnäckigen Rost.<br />
Caramba Super Plus<br />
Premium-Multiöl,<br />
100 ml, 3,99 Euro bzw.<br />
300 ml, 5,99 Euro
SERVICE<br />
Die Expertenfrage<br />
LESER FRAGEN –<br />
EXPERTEN ANTWORTEN<br />
Experten von TRAKTOR CLASSIC stehen Rede und Antwort<br />
zu Themen rund um klassische <strong>Traktor</strong>en. Heute gehts um<br />
Ladegeräte und Schweißarbeiten am Dieseltank.<br />
Fragen Sie die Experten<br />
von TRAKTOR CLASSIC!<br />
Sie haben eine Frage zum Thema Wartung,<br />
Pflege, Reparatur, Restaurierung, Zulassung,<br />
Kauf oder Verkauf von historischen Schleppern<br />
oder benötigen weiterführende Infos zu Artikeln<br />
in TRAKTOR CLASSIC? Dann schreiben Sie<br />
uns einfach Ihr Anliegen an:<br />
TRAKTOR CLASSIC, Leserfragen,<br />
Infanteriestr. 11a, 80797 München<br />
oder schicken Sie uns eine E-Mail an:<br />
redaktion@traktorclassic.de<br />
Unsere Experten freuen sich auf Ihre Post!<br />
SICHERHEIT BEI<br />
BATTERIELADEGERÄTEN<br />
Hallo werte Oldtimerfreunde!<br />
ich finde die Artikel in TRAKTOR CLAS-<br />
SIC prima. Zu dem Artikel „Der Energielieferant<br />
unter der Haube“ in der Ausgabe<br />
3/2014 habe ich eine Frage. Ich wollte<br />
über Nacht eine Batterie laden. Dabei ist<br />
das Ladegerät durchgebrannt und geschmolzen.<br />
Beinahe wäre deshalb meine<br />
Werkstatt in Brand geraten. Mein Glück<br />
war jedoch, dass das Feuer wieder von<br />
selbst ausgegangen ist.<br />
Um in Zukunft sicher zu gehen, habe ich<br />
mir dann ein neues Ladegerät von der Firma<br />
Cetek gekauft. Dabei handelt es sich um<br />
das Multi XS 3600. Jedoch bin ich mir nicht<br />
sicher, ob es eine Kurzschlusssicherung beziehungsweise<br />
einen Überhitzungsschutz<br />
hat. Da ich keinen Brand mehr riskieren<br />
möchte, habe ich, wenn ich die Werkstatt<br />
verlasse, auch das neue Ladegerät daher<br />
stets von der Batterie abgeklemmt. Muss ich<br />
das machen? Mit freundlichen Grüßen<br />
Georg Hocher<br />
Sehr geehrter Herr Hocher,<br />
Ihre Frage spricht mir aus der Seele. Um<br />
sie zu beantworten, will ich Ihnen von<br />
meinen eigenen Erfahrungen berichten.<br />
Aber zuerst einmal zu Ihrem Ladegerät –<br />
Ihr Cetek Multi XS 3600 hat laut Hersteller<br />
folgende Sicherheitsmerkmale:<br />
– Elektroniksicher – die empfindliche<br />
Elektronik des Fahrzeugs wird nicht beschädigt.<br />
Die Batterie kann normalerweise<br />
während des Ladevorgangs an das<br />
Fahrzeug angeschlossen bleiben.<br />
– Minimale Gasbildung und ein zum Patent<br />
angemeldetes Funkenschutzsystem.<br />
– Geschützt gegen Kurzschluss und Vertauschen<br />
der Pole.<br />
– Doppelt isoliert.<br />
– Spritzwasser- und staubdicht (IP65). Zugelassen<br />
für Benutzung im Freien.<br />
– Progressiver Temperaturschutz.<br />
– Getestet und zugelassen von Intertec<br />
SEMKO AB. S-Zeichen. Folgende Standards<br />
werden zudem erfüllt: EN 60335-<br />
1, EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN<br />
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,<br />
EN 60555-2.<br />
Das klingt zunächst toll und beruhigt – aber<br />
ein bayerisches Sprichwort besagt: „da Deifi<br />
ist a Eichhörndl“ (zu Deutsch: der Teufel<br />
ist ein Eichhörnchen). Will heißen – trotz<br />
aller dieser Sicherheitsmerkmale ist ein<br />
Defekt nie ganz ausgeschlossen. Ich selbst<br />
besitze ein Cetec-Ladegerät und auch noch<br />
drei verschiedene andere. Wenn ich eine<br />
Batterie lade, geschieht das niemals ohne<br />
Aufsicht, da ich leider auch zu viele Fälle<br />
Auch bei modernen Ladegeräten immer<br />
Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit<br />
nichts Unvorhergesehenes passieren kann.<br />
kenne, wo es zum Brand kam. Aus meinen<br />
Artikeln kennen Sie ja auch die Firma R&R<br />
aus Maisach. Dort ist vor ein paar Jahren<br />
die Lagerhalle wegen eines defekten Ladegerätes<br />
bis auf die Grundmauern abgebrannt.<br />
Es war zwar ein älteres Profi-Ladegerät<br />
ohne besondere elektronische<br />
Sicherheitseinrichtungen – trotzdem lässt<br />
Peter Steger seitdem auch kein modernes<br />
Ladegerät mehr unbeaufsichtigt. Natürlich<br />
heißt das nicht, dass Sie stundenlang auf<br />
einem Stuhl sitzend den Ladevorgang beobachten<br />
müssen – das mache ich auch<br />
nicht! Vielmehr hänge ich die Batterien nur<br />
ans Ladegerät, wenn ich ohnehin was in<br />
meiner Werkstatt zu tun habe. Ist das nicht<br />
der Fall, stelle ich das Ladegerät mit der<br />
Batterie an einen Ort, wo es keinesfalls zu<br />
einem Brand kommen kann, wenn es versagen<br />
sollte. Ich habe so einen Platz bei mir<br />
vor der Werkstatt im Freien gefunden. Dort<br />
sind eine Steckdose und eine Überdachung,<br />
falls es regnet. Zudem ist der Platz<br />
für Unbefugte nicht erreichbar. Wenn es da<br />
zu einem Brand kommen sollte, habe ich<br />
schlimmstenfalls einen schwarzen Fleck<br />
auf dem Beton.<br />
Sie sind sicherlich kein „Reichsbedenkenträger“,<br />
wenn Sie vorsichtig beim Laden<br />
Ihrer Batterien sind, denn Sicherheit<br />
geht in jeder Hinsicht vor. Letztendlich<br />
sind Sie nämlich in der Verantwortung,<br />
wenn es zu einem Brand kommt, denn Sie<br />
haben hinterher immer die Beweislast<br />
und müssen gegenüber der Versicherung<br />
nachweisen, dass Sie nicht fahrlässig oder<br />
fehlerhaft gehandelt haben.<br />
Herzliche Grüße<br />
Ihr Marcel Schoch<br />
DIESELTANK SCHWEISSEN<br />
An die Redaktion,<br />
mein Dieseltank ist minimal undicht.<br />
Man hat mir geraten, ihn mit Sand zu befüllen<br />
und dann zu schweißen. Was halten<br />
Sie davon? Oliver Kunz, Stuttgart<br />
Lieber Herr Kunz,<br />
einen Kraftstofftank zu schweißen, ist immer<br />
mit erheblichen Risiken verbunden.<br />
Sicherlich hilft die Sandmethode, Verpuffungen<br />
zu vermeiden – doch muss hinterher<br />
das Tankinnere komplett gereinigt<br />
werden. Glauben Sie mir, das kann Stunden<br />
dauern, bis der Tank wieder absolut<br />
sandfrei ist.<br />
Einfacher ist es, mit einem der vielen<br />
Tankdichtungsmittel zu arbeiten. Meist<br />
muss hierzu der Tank vorab innen gereinigt<br />
werden. Ein spezieller Reiniger ist in den<br />
Sets dabei. Anschließend wird das Dichtungsmittel<br />
hinein gekippt und der Tank<br />
mit den Händen gedreht, bis alle Stellen im<br />
Tankinneren benetzt sind. Dann heißt es<br />
warten, bis die Dichtungsmasse ausgehärtet<br />
ist. Bei kleinen, punktartigen Durchrostungen<br />
funktioniert das recht gut. Sind die<br />
Durchrostungen größer, sollte man sich<br />
schon wegen der Sicherheit lieber nach einem<br />
neuen oder guten gebrauchten Tank<br />
umsehen.<br />
Herzlichst<br />
Ihr Marcel Schoch<br />
Foto: M. Schoch<br />
88
Ihr Willkommensgeschenk<br />
GRATIS!<br />
Buch »Deutsche <strong>Traktor</strong>en«<br />
Ein kompetenter und bildreicher Überblick über die Vielfalt<br />
der <strong>Traktor</strong>en Made in Germany.<br />
GeraMond Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
✁<br />
✗<br />
❑ JA,<br />
Meine Vorteile<br />
✓ Ich spare 10% (bei Bankeinzug* sogar 12%)!<br />
✓ Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor dem Erstverkaufstag*<br />
bequem nach Hause und verpasse keine Ausgabe<br />
mehr!<br />
✓ Ich kann nach dem ersten Jahr jederzeit abbestellen<br />
Vorname/Nachname<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
und erhalte zuviel bezahltes Geld zurück!<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
Datum/Unterschrift<br />
✗<br />
* nur im Inland<br />
Das TRAKTOR CLASSIC-Vorteilspaket<br />
ich möchte mein TRAKTOR CLASSIC-Vorteilspaket<br />
Bitte schicken Sie mir TRAKTOR CLASSIC ab sofort druckfrisch und mit 10 % Preisvorteil für nur € 4,95* statt € 5,50 pro Heft (Jahrespreis: € 29,70*) zweimonatlich frei Haus.<br />
Ich erhalte als Willkommens geschenk das Buch »Deutsche <strong>Traktor</strong>en«**. Versand erfolgt nach Be zahlung der ersten Rechnung. Ich kann das Abo nach dem ersten Bezugsjahr<br />
jederzeit kündigen.<br />
Ihr Geschenk<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über interessante Sie möchten noch mehr sparen?<br />
WA-Nr. 620TC60543 - 62145675<br />
❑ Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).<br />
Dann zahlen Sie per Bankab bu chung (nur im Inland möglich)<br />
und Sie sparen zusätzlich 2 % des Abopreises!<br />
❑ Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung***<br />
IBAN: DE <br />
Bankname<br />
Bankleitzahl<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an:<br />
TRAKTOR CLASSIC Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilching<br />
oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.)<br />
www.traktorclassic.de/abo<br />
Ich ermächtige die GeraNova Bruckmannn Verlaghaus GmbH, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift<br />
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von GeraNova Bruckmannn Verlaghaus GmbH auf mein<br />
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann innerhalb<br />
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei<br />
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br />
Kontonummer<br />
* Preise inkl. Mwst, im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie<br />
*** Gläubiger-ID DE63ZZZ00000314764
GESCHICHTE<br />
<strong>Deutz</strong>-<strong>Traktor</strong>en<br />
Der erste <strong>Deutz</strong> Diesel-Schlepper MTH 222 bringt<br />
1926 eine Dreschmaschine zur Feldarbeit.<br />
Der F3M 417<br />
war ab 1943<br />
mit 50 PS einer<br />
der stärksten<br />
Schlepper seiner<br />
Zeit.<br />
150 JAHRE DEUTZ<br />
Technikgeschichte<br />
aus Köln<br />
Nicht nur im <strong>Traktor</strong>enbau setzte <strong>Deutz</strong> Akzente. Vor<br />
150 Jahren begann in Köln eine Erfolgsgeschichte, die<br />
dem Verbrennungsmotor weltweit zum Durchbruch<br />
verhalf. Harald Focke begab sich auf Spurensuche.<br />
Das Firmenschild soll gut zu sehen<br />
sein, direkt neben dem Hofeingang<br />
der alten Nikolaus-Ölmühle<br />
in der Kölner Servasgasse. Es wird<br />
genau in Augenhöhe montiert: „N. A.<br />
Otto & Cie.“ Wenige Schritte vom Rheinufer<br />
entfernt eröffnen hier der Kaufmann<br />
und Motorentüftler Nikolaus August Otto<br />
und der Fabrikant Eugen Langen am<br />
31. März 1864 in ihre erste gemeinsame<br />
Werkstatt, die Keimzelle der heutigen<br />
<strong>Deutz</strong> AG, die damit ihren 150.<br />
Geburtstag feiern kann.<br />
Langen investiert 10.000 Taler<br />
– das Vierfache dessen, was Otto beisteuern<br />
kann. Beide wollen eine Maschine<br />
bauen, die in Fabriken arbeitet und<br />
Fahrzeuge antreibt. Der erste Motor ist<br />
1867 fertig. Stolz präsentieren die Kölner<br />
ihn auf der Pariser Weltausstellung. Eine<br />
„Goldene Medaille“ bringen sie mit zurück<br />
an den Rhein und jede Menge Auf-<br />
Der „Elfer-<strong>Deutz</strong>“, offiziell<br />
F1M 414, in der Vorkriegsausführung.<br />
Mit dem „Stahlschlepper“<br />
F2M 315 gelang <strong>Deutz</strong> ein<br />
Erfolg am Markt.<br />
träge. Schon bald ist ihr Betrieb zu klein.<br />
An der Mülheimer Straße in <strong>Deutz</strong> ist ab<br />
1869 viel mehr Platz für Entwicklung und<br />
Fertigung. Und der wird gebraucht, denn<br />
die Firma wächst unaufhaltsam.<br />
Ab 1872 heißt sie Gasmotoren-Fabrik<br />
<strong>Deutz</strong>. Im selben Jahr wird Gottlieb Daimler<br />
ihr Technik-Chef, 1873 folgt ihm Wil-<br />
Fotos: Sammlung H. Focke<br />
90
helm Maybach als Konstrukteur. 1875 entstehen<br />
634 Maschinen an sechs Tagen der<br />
Woche mit jeweils bis zu zwölf Arbeitsstunden.<br />
1876 läuft erstmals Ottos neuer<br />
Viertaktmotor.<br />
Lokomobile floppt<br />
Nach der Jahrhundertwende entdeckt<br />
<strong>Deutz</strong> die Landwirtschaft als Absatzmarkt.<br />
1907 experimentieren die Ingenieure mit<br />
Pfluglokomotiven. Doch die 25 PS starken<br />
Lokomobile erweisen sich als Irrweg und<br />
bleiben Prototypen. 200 Liter Benzin für<br />
zehn Stunden Pflügen – das ist zu viel und<br />
zu teuer. Auf nassen Böden kommt der<br />
Dreitonnen-Koloss ohnehin nicht voran.<br />
Ebenfalls 1907 kommt Ettore Bugatti zu<br />
<strong>Deutz</strong>, um die Kölner ins Autogeschäft zu<br />
bringen. Der spätere Renn- und Traumwagenkonstrukteur<br />
geht schon nach zwei<br />
Jahren. Die Produktion kommt nicht so<br />
recht in Gang.<br />
Aufbauend auf den seit 1897 gebauten<br />
stationären <strong>Deutz</strong>-Diesel gelingt dem Ingenieur<br />
Prosper L’Orange mit seiner Idee des<br />
geteilten Brennraums ein Riesenschritt:<br />
Seine Motoren passen endlich auch in<br />
Fahrzeuge. Der erste <strong>Deutz</strong>-Diesel mit Direkteinspritzung<br />
funktioniert ab 1911.<br />
Erste <strong>Traktor</strong>en<br />
Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs<br />
kommt der „<strong>Deutz</strong>er Trekker“ heraus,<br />
eine 40 PS-Zugmaschine für die<br />
Land- und Forstwirtschaft. Mit 4,40 Meter<br />
Länge und 2,70 Meter Höhe ist auch er<br />
ein schwerfälliges Ungetüm. 1926 beginnt<br />
die Produktion des ersten Diesel-Schleppers<br />
MTH 222 der Motorenfabrik <strong>Deutz</strong> ,<br />
wie die Firma seit 1921 heißt. Der 14 PS-<br />
Einzylinder-Viertakt-Motor mit Verdampfungskühlung<br />
ist überaus genügsam. Ihm<br />
ist es egal, welches Öl man einfüllt, er<br />
läuft und treibt über ein Zweiganggetriebe<br />
mit einer freiliegenden Kette die großen<br />
eisernen Hinterräder an. Auf der Straße<br />
fährt der <strong>Traktor</strong> leidlich gut, doch der<br />
Acker ist nicht sein Revier. Dafür ist er mit<br />
drei Tonnen zu schwer. Immerhin baut<br />
<strong>Deutz</strong> bis 1930 insgesamt 540 Stück.<br />
1929 wird der vielseitige MTZ in drei<br />
Varianten mit 27 bis 36 PS vorgestellt.<br />
1930, im ersten Krisenjahr nach dem Börsenkrach<br />
in New York, schließt sich <strong>Deutz</strong><br />
mit der Maschinenbauanstalt Humboldt<br />
in Köln-Kalk zusammen. 1934 sind die<br />
ersten <strong>Deutz</strong>-Stahlschlepper einsatzbereit.<br />
Anders als ihre Vorgänger sind sie<br />
nicht mehr in Rahmenbauweise konstruiert.<br />
Motor und Getriebe sind nun als<br />
Block verbunden und tragende Elemente.<br />
Ein 35 PS-Zweizylinder und ein 50 PS-<br />
Dreizylinder stehen zur Wahl, ebenso<br />
Stahl- oder Vollgummireifen. Für <strong>Deutz</strong><br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Aus der kleinen Werkstatt der Firma N. A.<br />
Otto & Cie in der Kölner Servasgasse entwickelte<br />
sich die heutige <strong>Deutz</strong> AG.<br />
Der Autopflug von 1907 verbrauchte zu<br />
viel Benzin und bewährte sich nicht auf<br />
nassen Äckern.<br />
Der „<strong>Deutz</strong>er Trekker“ konnte die<br />
Kraft seiner 40 PS besonders in<br />
der Forstwirtschaft ausspielen,<br />
seine Stückzahl blieb aber gering.<br />
bringen diese Typen endlich den großen<br />
Erfolg: 12.000 Stück werden ausgeliefert.<br />
Bis 1936 verkaufen die Kölner insgesamt<br />
fast 20.000 <strong>Traktor</strong>en. Genau in jenem<br />
Jahr kommt der „Elfer“ heraus, der<br />
schon bald populäre „Bauernschlepper“<br />
für nur 2.300 Reichsmark. Für <strong>Deutz</strong> ist er<br />
ein wahrer Markstein der <strong>Traktor</strong>enproduktion.<br />
1936 expandiert der Betrieb zur<br />
Klöckner-Humboldt-<strong>Deutz</strong> AG (KHD).<br />
Mit „Locomobilen“<br />
begann bei <strong>Deutz</strong> um 1900 die<br />
Produktion von Landmaschinen.<br />
Während des Zweiten Weltkriegs bewähren<br />
sich die ab 1944 produzierten<br />
luftgekühlten Motoren aus Köln. Danach<br />
kann <strong>Deutz</strong> in der Landwirtschaft fast<br />
nahtlos an seine Erfolge der 1930er-Jahre<br />
anknüpfen. Schon 1946 erlauben die Alliierten<br />
den Bau von 500 Motoren für den<br />
modernisierten „Bauernschlepper“. Nach<br />
1949 setzt auch die Produktion von Industriemotoren<br />
und Lastwagen wieder ein.<br />
91
GESCHICHTE<br />
<strong>Deutz</strong>-<strong>Traktor</strong>en<br />
Der MTZ 220 als<br />
Zugmaschine auf der Straße.<br />
Der <strong>Deutz</strong> MTZ 320 leistete<br />
1934 beachtliche 36 PS.<br />
Fertigungsstraße<br />
für den<br />
„Bauernschlepper“ in<br />
Köln-Kalk 1946.<br />
Die Produktion<br />
der <strong>Deutz</strong>-<strong>Traktor</strong>en<br />
im 1961<br />
eröffneten<br />
Werk in<br />
Köln-Kalk.<br />
Die 1950er und frühen 1960er sind goldene<br />
Jahre für <strong>Deutz</strong> als Schlepperhersteller.<br />
Nach 19.000 <strong>Traktor</strong>en mit wassergekühlten<br />
Motoren F1M 414 beginnt die Ära<br />
der grünen Trecker mit Luftkühlung. Nun<br />
will KHD Komplettanbieter für landwirtschaftliche<br />
Technik werden.<br />
92<br />
Boomende Geschäfte<br />
Ab 1961 übernehmen die Kölner schrittweise<br />
den renommierten, 1870 gegründeten<br />
Konkurrenten Fahr in Gottmadingen<br />
bei Singen am Bodensee. <strong>Deutz</strong>-Motoren<br />
verwendet er schon lange. 1969 erwerben<br />
die Kölner die Mehrheit bei Ködel & Böhm<br />
(Köla) in Lauingen und steigen damit in<br />
das Mähdreschergeschäft ein. 1972 bringt<br />
<strong>Deutz</strong> den INTRAC mit Schnellkupplungen<br />
für Arbeitsgeräte und Kabinen, Kraftheber<br />
und Frontzapfwellen. 1975 geht die<br />
Lkw-Sparte von KHD an Fiat-Iveco. Mit einem<br />
Teil des Erlöses wird die komplette<br />
Fahr-Übernahme finanziert. Die Landmaschinen<br />
heißen nun <strong>Deutz</strong>-Fahr.<br />
Die seit 1968 gebaute D 06-Typenreihe<br />
wird 1978 durch die durchweg neu konstruierten<br />
DX-<strong>Traktor</strong>en mit 80 bis 200 PS,<br />
vollsynchronisierten Getrieben, Allradantrieb<br />
und elastisch gelagerten Fahrerkabinen<br />
ersetzt. Sie tragen erstmals den<br />
Schriftzug <strong>Deutz</strong>-Fahr an der massiven<br />
Kühlerfront. 1985 kauft KHD die Motorenwerke<br />
Mannheim (MWM) und die<br />
Landmaschinensparte von Allis-Chalmers<br />
in Wisconsin, um mit ihr den riesigen<br />
US-Markt zu erschließen. Das misslingt<br />
gründlich: Bereits fünf Jahre später trennt<br />
Die <strong>Deutz</strong>-Story<br />
Anderthalb Jahrhunderte<br />
bewegter <strong>Deutz</strong>-Geschichte<br />
präsentieren die drei Autoren<br />
vor dem Hintergrund<br />
der Zeit in einem großformatigen<br />
und zudem preisgünstigen<br />
Text-Bildband.<br />
Sie feiern die Erfolge, nennen<br />
aber auch die Krisen und Fehlschläge<br />
eines bedeutenden Unternehmens, das jahrzehntelang<br />
zu den erfolgreichsten <strong>Traktor</strong>enherstellern<br />
in Deutschland gehörte.<br />
Sven Tode/Marco Hölscher/Beate John: Innovation<br />
Motor. Vier Takte bewegen die Welt: 150<br />
Jahre <strong>Deutz</strong> AG, 200 Seiten, 246 Abbildungen,<br />
Format 23,1 x 29,7 cm, Hardcover, ISBN 978-3-<br />
7743-0629-5, Greven-Verlag, Köln, 24,90 €<br />
sich <strong>Deutz</strong> von seinem Fehlkauf.<br />
1989 kommt die <strong>Deutz</strong>-Agrostar-Serie,<br />
1992 verlässt der millionste <strong>Traktor</strong> das<br />
Werk. 1993 beginnt die Produktion in der<br />
Motorenfabrik in Köln-Porz.<br />
<strong>Deutz</strong> im Sinkflug<br />
1994 werden in Deutschland nur noch<br />
148.000 Schlepper abgesetzt. <strong>Deutz</strong> sieht<br />
langfristig zu geringe Ertragschancen in der<br />
Agrotechnik und entschließt sich deshalb<br />
1995, <strong>Deutz</strong>-Fahr an Same zu verkaufen.<br />
Der Markenname bleibt. Teil des Geschäfts<br />
ist die Vereinbarung, weiterhin Motoren an<br />
den italienischen Konzern zu liefern.<br />
Fast so schwer zu verkaufen wie Landtechnik<br />
sind Baumaschinen und Schiffsdiesel.<br />
KHD rutscht in eine tiefe Krise.<br />
Mehrere Fabriken müssen schließen. <strong>Deutz</strong>-<br />
Fahr-<strong>Traktor</strong>en werden seit 1996 im früheren<br />
Köla-Werk in Lauingen hergestellt.<br />
Bilanzfälschungen bei einer Tochterfirma<br />
bescheren KHD 1996 ein „Milliardengrab“,<br />
wie die Zeitungen schreiben. Weitere<br />
Sparten werden abgestoßen und die<br />
Mitarbeiter müssen auf Lohn verzichten.<br />
Seit 1997 heißt die Firma in Köln schlicht<br />
<strong>Deutz</strong> AG. <strong>Traktor</strong>en baut sie nicht mehr.<br />
Harald Focke
DIE GESCHICHTE DES TRECKERS – ZEHNTER TEIL<br />
Schlepper, Typen,<br />
Charakterköpfe<br />
Im Hintergrund läuft der Lanz im Standgas, Ferkel quietschen.<br />
Was folgt, ist ein ungebremster Redeschwall voller Bauern -<br />
schläue, Witz und Ironie. Günther, der Treckerfahrer – hell -<br />
wacher Ferkelzüchter und Gülleproduzent aus Leidenschaft –<br />
nimmt die <strong>Traktor</strong>-Szene mit frecher Zunge aufs Korn.<br />
Foto: Sammlung Kaack<br />
Moin. In den Sechzigern bereinigte<br />
sich der Markt so allmählich,<br />
die kleinen Schrauberbutzen<br />
hatten die Treckerfertigung<br />
allmählich wieder<br />
eingestellt oder waren<br />
gleich pleite gegangen. Außerdem<br />
wuchsen auch die<br />
Ansprüche des Ackerfrisörs so langsam.<br />
Standard wurde das Fritzmeier-Einmannzelt,<br />
damit der Landwirt sich nich<br />
erkältet. Den WK1-Kriegsteilnehmern<br />
reichte ein alter Kartoffelsack auf den<br />
Knien als Wetterschutz oder wenn‘s<br />
plästerte ne Kunstdüngertüte, dann<br />
wurde die Baschlikmütze tiefer in die<br />
Stirn gerissen und weitergepflügt. Seitdem<br />
sich der Bauer aber immer öfter<br />
„Landwirt“ nannte und sich im Rückspiegel<br />
des Treckers den Scheitel nachzog,<br />
musste auch was Protzigeres aufn<br />
Hof. Das konnten aber nur noch die<br />
Großen liefern: Hanomag, <strong>Deutz</strong>,<br />
Schlüter, Güldner und Eicher. Nur einer<br />
von denen hat bis heute überlebt<br />
und auch nich mehr als eigenständige<br />
Firma. Damals in den späten Sechzigern<br />
bis rein in die Siebziger waren sie<br />
aber der feuchte Traum des Junglandwirtes:<br />
Mit zum Teil atemberaubenden<br />
32 km/h bretterten sie über die<br />
Grüner-Plan-Wege, Ladewagen oder Güllefässer<br />
am Haken. Einen fetten Schlüter<br />
konnten sich die wenigsten leisten, die<br />
anderen aber schon. Man brauchte auch<br />
mehr PS, um die immer größeren Maschinen<br />
zu ziehen oder mit Muckis aus der<br />
Zapfwelle zu versorgen. Ohne Frontlader<br />
wurde man den Scheißebergen auf dem<br />
Gehöft nich mehr Herr. Es begann der<br />
Hang zum Zweitschlepper, hauptsächlich<br />
weil man zu faul war, die Anbaugeräte immer<br />
umzustecken oder weil der Grubber<br />
längst mit dem alten Kramer eine Einheit<br />
aus Rost und Wagenschmiere bildete. Der<br />
alte Kleinschlepper blieb fast immer aufn<br />
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
Dietmar Wischmeyers<br />
garstige Trecker-<br />
Kolumne – Teil 10<br />
1993, tragischer Selbstmord eines Schlüters<br />
auf offener Strecke: Soeben hatte er vom Ende<br />
der Schlepperfertigung in Freising gehört.<br />
Hof, wenn der Eicher Wotan 1 oder der<br />
Hanomag Robust 901 AS den Betrieb eroberte.<br />
Keiner hätte damals daran gedacht,<br />
dass dies die letzten<br />
Zuckungen der großen deutschen<br />
Schlepperhersteller werden sollten. Hanomag<br />
erwischte es Anfang der Siebziger,<br />
Eicher machte noch einen auf hellblau angepinselten<br />
Ferguson, Linde-Güldner verwandelte<br />
sich in einen Kühlschrank zurück,<br />
Schlüter rettete sich für kurze Zeit<br />
in die neuen Bundesländer hinein, um<br />
dann endgültig die Kabine für immer<br />
hochzuklappen. Nur <strong>Deutz</strong> mit dem eingemeindeten<br />
Hersteller Fahr ist als Tochter<br />
von Same immer noch am Markt. Von<br />
allen untergegangenen Marken sieht man<br />
heute nach über 40 Jahren noch immer<br />
den einen oder anderen Vertreter aufm<br />
Acker rumwühlen oder mit zwei Rübenhängern<br />
durchs Dorf brettern. Ob man die<br />
GPS-gefickten Plastik-Monster heutiger<br />
Produktion in vierzig Jahren überhaupt<br />
wenigstens noch als Panini-Bild antrifft,<br />
wage ich zu bezweifeln.<br />
In der nächsten Folge die Gewinner<br />
und die Überlebenden: Fendt, John Deere<br />
und Claas.<br />
Erhältlich im Handel und unter www.fsr-shop.de<br />
93
PANORAMA<br />
Quiz/Meinung<br />
Das große<strong>Traktor</strong>-Quiz<br />
Was haben wir denn hier?<br />
Raten Sie mal!<br />
Hinten kantig, vorne rund – nicht ganz alltäglich<br />
ist die Formgebung dieses kleinen<br />
Dieselschleppers. Sieht ein bisschen aus wie<br />
ein Porsche, oder? Ist aber keiner! Ganz sicher<br />
ist: Hierbei handelt es sich ganz<br />
bestimmt nicht um einen Großserientraktor.<br />
Welcher Leser hat die zündende Idee?<br />
Unter den Einsendern<br />
des richtigen Her stellers<br />
und Typs verlosen wir<br />
fünfmal „HANOMAG –<br />
Das Typenbuch“.<br />
Einsendeschluss:<br />
10. August 2014<br />
Foto: M. Miserok<br />
Schicken Sie Ihre Lösung samt voll stän diger<br />
Anschrift per Post an: GeraMond Verlag, Stichwort<br />
<strong>Traktor</strong>-Quiz, Postfach 40 02 09, 80702<br />
München. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an<br />
traktorquiz@geramond.de<br />
!<br />
P. S.: Haben Sie selbst einen seltenen<br />
<strong>Traktor</strong>, der nicht so leicht zu erraten ist?<br />
Schicken Sie uns eine E-Mail mit Bild und<br />
Angaben zu Hersteller, Typ und Baujahr an:<br />
traktorquiz@geramond.de<br />
Die Gewinner des Hanomag-Typenbuchs<br />
aus der letzten Ausgabe heißen:<br />
Stefan L., Augsburg; Kai M., Fredenbeck;<br />
Uwe F., Lütjensee; Robert v. S., Viersen;<br />
Oliver S., Laufen<br />
*Ihre Daten werden zum Zwecke der Gewinnerbenachrichtigung erfasst und gespeichert. Die<br />
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie erhalten künftig per Post oder E-Mail News<br />
aus dem Verlag (bei Nichtinteresse vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Postkarte).<br />
AUFLÖSUNG TRAKTOR-QUIZ 4/2014<br />
Miniatur-Wunderding – Holder B 12<br />
Foto: M. Miserok<br />
Unser letztes Ratebild zeigt einen der<br />
kleinsten, gemessen an den damaligen<br />
Maßstäben dennoch vollwertig motorisierten<br />
und ausgestatteten Vierradschlepper<br />
der 1950er- und 1960er-Jahre. Mit<br />
dem Typ B 12 qualifizierte Holder sich<br />
endgültig als Spezialist für die Mechanisierung<br />
des Wein- und Obstbaues.<br />
Mehr Diesel auf mehr Rädern<br />
Bereits zu Beginn der 1930er-Jahre bauten<br />
die Gebrüder Holder in Metzingen ihren<br />
ersten Einachsschlepper und konnten<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg beinahe<br />
nahtlos an ihre Erfolge auf diesem Gebiet<br />
anknüpfen. Wachsende Ansprüche an Bedienkomfort<br />
und Wirtschaftlichkeit ließen<br />
die Entwicklung bald fortschreiten. Einerseits<br />
bestand die Notwendigkeit, auch die<br />
kleinen Einachser mit Dieselmotoren auszurüsten.<br />
Am 22. Dezember 1950 absolvierte<br />
das erste, unter Federführung der<br />
Konstrukteure Christian und Karl Schaal<br />
entwickelte Exemplar des neuen, ED 500<br />
genannten Antriebes erfolgreich seinen<br />
Prüfstandslauf. Dieser holte aus 503 Ku-<br />
bikzentimetern Hubraum 9,75 PS bei<br />
2.200 U/min und war mit 88,5 kg konkurrenzlos<br />
leicht. Ab 1951 gelangte er in den<br />
schwereren Einachsern und gegen Ende<br />
des Jahres auch im ersten Vierradschlepper<br />
des Hauses – dem Typ B 10 – zum Einsatz.<br />
Als die Kapazitäten bei Holder zu<br />
knapp wurden, ging die Motorenfertigung<br />
1952 nach knapp 7.000 Exemplaren in Li -<br />
zenz an Fichtel & Sachs über.<br />
Mehr Leistung mit mehr Luft<br />
Der Lizenznehmer präsentierte 1957 eine<br />
vergrößerte Variante mit 608 Kubikzentimetern<br />
und 12 PS bei 2.200 U/min. Neben<br />
der wassergekühlten Ausführung gab es<br />
nun eine solche mit Luftkühlung mittels<br />
Axialgebläse. Dieser Typ D 600 L gelangte<br />
ab August 1957 im neuen Vierradschlepper<br />
B 12 zum Einsatz, der dem B 10 neben<br />
der höheren Motorleistung ein Getriebe<br />
mit sechs statt vier Vorwärtsgängen und<br />
entsprechend feinerer Abstufung voraus<br />
hatte. Eigengewicht und Radstand blieben<br />
mit minimal 660 kg und 1.450 mm weitgehend<br />
unverändert. Neben der Standardausführung<br />
stand der Schmalspurschlepper<br />
B 12 S mit von 750 auf 1.000 mm<br />
verstellbarer Spurweite zur Wahl. Mit diesen<br />
Eckdaten war der Holder einer der<br />
kleinsten und mit einem Grundpreis von<br />
4.580 DM auch der billigste Vierradschlepper<br />
auf dem deutschen Markt. Zusammen<br />
mit dem parallel angebotenen Allrad-<br />
Knicklenker A 12 bescherte er seinem Hersteller<br />
gute Verkaufserfolge, die durch Modellpflege<br />
weiter getragen wurden. So<br />
wurde der Motor im März 1960 vom Wirbelkammerverfahren<br />
auf Direkteinspritzung<br />
umgestellt. Die Produktion des B 12<br />
lief Ende 1967 aus. Klaus Tietgens<br />
94
Foto: Alexandra Körber<br />
Zeit-Geister<br />
Als Fendt anlässlich der Agritechnica 1995 seinen<br />
Favorit 926 Vario mit stufenloser Kraftübertragung<br />
präsentierte, kommentierten einige<br />
Betrachter die allgemeine Euphorie gelangweilt<br />
mit der Festellung, dass es so etwas bei Eicher<br />
und IHC schon in den 1960er-Jahren zu kaufen<br />
gab. Ganz ähnlich fielen die Reaktionen aus, als<br />
sich die Standardschlepper vieler Hersteller der<br />
300 PS-Marke näherten. Begeisterung wurde<br />
immer wieder überlagert von dem Einwand,<br />
dass Schlüter zwei Jahrzehnte zuvor schon weiter<br />
war.<br />
Beliebte Schlussfolgerung: Eicher, Schlüter<br />
und manch andere waren ihrer Zeit voraus – und<br />
gingen gerade deshalb unter. Diese These gilt es<br />
zu überprüfen. Die hydrostatische Kraftübertragung<br />
war in den 1960er-Jahren hinlänglich bekannt.<br />
Warum sollte man sie also nicht in einem<br />
Ackerschlepper verwenden? Dieser ließ sich<br />
dann ohne lästige Schaltarbeit fahren, doch<br />
schreckte der hohe Kaufpreis viele Interessenten<br />
ab, und die Zugkraft litt unter dem schlechten<br />
Wirkungsgrad. Gerade auf letzterem Gebiet wurden<br />
– nicht zuletzt durch das Prinzip der Leistungsverzweigung<br />
– entscheidende Fortschritte<br />
gemacht, und erst die heutzutage verfügbare<br />
Elektronik ermöglicht eine optimale Nutzung des<br />
in dieser Technik steckenden Potentials.<br />
Die Konstruktion eines 300 oder gar 500 PS<br />
starken Schleppers stellte bei Verwendung entsprechender<br />
Komponenten schon in den 1970er-<br />
PFLUGBLATT<br />
DER AKTUELLE<br />
KOMMENTAR<br />
Jahren keine unüberwindbare Hürde dar. Nur<br />
wenige Betriebe konnten derartige Kaliber jedoch<br />
wirtschaftlich einsetzen. Folglich blieben<br />
die Verkaufszahlen im Keller, und viel mehr als<br />
ein legendäres Image werden die Großschlepper<br />
ihrem Hersteller nicht eingebracht haben. Heutzutage<br />
würden sie zwar noch immer gehobene<br />
Ansprüche an die Leistung, aber nur bescheidene<br />
Ansprüche an den Bedienkomfort befriedigen.<br />
Ob die genannten Unternehmen ihrer Zeit<br />
voraus waren, erscheint daher fraglich. Die Umsetzung<br />
ihrer Ideen in die Praxis wurde vielmehr<br />
durch die Grenzen des einst technisch und wirtschaftlich<br />
Machbaren erschwert. Dass sie wertvolle<br />
Denkanstöße zur weiteren Entwicklung der<br />
Landtechnik gegeben haben, steht dennoch außer<br />
Frage.<br />
Klaus Tietgens<br />
Der Autor zahl reicher <strong>Traktor</strong>-Bücher<br />
bildet das technische Rück grat unserer Redaktion.<br />
Impressum<br />
Nummer 38 | 5/2014 | Aug./Sep. | 7. Jahrgang<br />
Internet: www.traktorclassic.de<br />
Redaktionsanschrift<br />
TRAKTOR CLASSIC, Infanteriestraße 11a, D-80797 München<br />
Tel.: +49 (0) 89.13 06 99-720, Fax: +49 (0) 89.13 06 99-700<br />
E-Mail: redaktion@traktorclassic.de<br />
Redaktion<br />
Ulf Kaack (Verantwortlicher Redakteur), Alexandra Wurl<br />
Ständige Mitarbeiter<br />
Peter Böhlke, Harald Focke, Bernhard Kramer,<br />
Jens Meyer, Iris Meyer, Birthe Rosenau,<br />
Marcel Schoch, Klaus Tietgens, Bodo Wistinghausen<br />
Chefredakteur Michael Krische<br />
Redaktionsassistenz Brigitte Stuiber<br />
Layout Rico Kummerlöwe<br />
Leserservice<br />
Kundenservice, GeraMond-Programm<br />
Tel.: 0180 – 532 16 17 (14 ct/min)<br />
Fax: 0180 – 532 16 20 (14 ct/min)<br />
E-Mail: leserservice@traktorclassic.de<br />
Gesamtanzeigenleitung<br />
Rudolf Gruber,<br />
Tel. +49 (0) 89.13 06 99-527, rudolf.gruber@verlagshaus.de<br />
Anzeigenleitung<br />
Helmut Gassner,<br />
Tel. +49 (0) 89.13 06 99-520, helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
Medienberatung<br />
MedienAgentur Peter Fabich,<br />
Tel. +49 (0) 6433.94 93 10, peter.fabich@t-online.de<br />
Anzeigenverkauf und Disposition<br />
Johanna Eppert<br />
Tel. +49 (0) 89.13 06 99-130, johanna.eppert@verlagshaus.de<br />
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 9 vom 1.1.2014<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Druckvorstufe Cromika, Verona<br />
Druck Stürtz, Würzburg<br />
Verlag<br />
POSTkasten<br />
Schreiben Sie uns!<br />
Gelungene Restaurierung<br />
Hallo Redaktion von TRAKTOR CLASSIC,<br />
anbei sende ich Ihnen ein Foto von meinem<br />
über den Winter restaurierten Kramer KL 11.<br />
Dabei habe ich einige Veränderungen vorgenommen,<br />
die vom ursprünglichen Zustand<br />
ab Werk abweichen: unter anderem der<br />
Überrollbügel, verschiedene zusätzliche Beleuchtungseinrichtungen,<br />
die vorderen Kotflügel,<br />
die Sitze auf den hinteren Kotflügeln<br />
sowie einige andere Kleinigkeiten. Das entspricht<br />
natürlich nicht dem Original, aber<br />
mir gefällt es so. Da das „Schlepper chen“ ja<br />
nun in Rente ist mit seinen 60 Jahren, soll’s<br />
Redaktion TRAKTOR CLASSIC<br />
Postfach 40 02 09, 80702 München<br />
Fax: +49 (0) 89.13 06 99 700<br />
E-Mail: leserbriefe@traktorclassic.de<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.<br />
es auch gut haben bei mir. Denn es wird bei<br />
mir nur noch für Freizeiteinsätze genutzt. In<br />
Arbeit ist auch der Umbau eines Hängers für<br />
Kremserfahrten. Heinz Plachetka, Schmalkalden<br />
Mehr von IHC<br />
Wertes Team der TRAKTOR CLASSIC,<br />
toll, dass ihr in eurem letzten Heft mal ausführlich<br />
über IHC berichtet habt. Eine interessante<br />
Marke, wie ich finde, mit einem<br />
sehr hohen Verbreitungsgrad in Deutsch -<br />
land. In Zukunft gern mehr Reportagen über<br />
die <strong>Traktor</strong>en aus Neuss.<br />
Gert Sonntag, per Email<br />
Iberischer Schrottplatz<br />
Hallo, der Bericht über den spanischen Treckerfriedhof<br />
hat mir einerseits die Tränen in<br />
die Augen getrieben bei den vielen schönen<br />
Klassikern, die dort unrestauriert vor sich<br />
hinvegetieren. Am liebsten wäre ich gleich<br />
mit einem Tieflader Richtung Süden gedüst.<br />
Andererseits eine tolle Reportage mit Blick<br />
über den Tellerrand und Superfotos obendrein.<br />
Es hätten gern auch vier Seiten mehr<br />
sein dürfen.<br />
Jürgen Kuhlmann, Okel<br />
GeraMond Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
www.geramond.de<br />
Geschäftsführung Clemens Hahn<br />
Herstellungsleitung Sandra Kho<br />
Leitung Marketing und Sales Zeitschriften<br />
Andreas Thorey<br />
Vertriebsleitung Dr. Regine Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung<br />
Bahnhofsbuchhandel, Zeitschriftenhandel:<br />
MZV, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag erscheinen außerdem:<br />
Preise: Einzelheft EUR 5,50 (D), EUR 6,30 (A), sFr 11,00 (CH)<br />
(bei Einzelversand zzgl. Versandkosten); Jahresabopreis (6 Hefte):<br />
Inland: EUR 29,70 inkl. MwSt. und Versandkosten<br />
Ausland: EUR 29,70 inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten<br />
Die Abogebühren werden unter der Gläubiger-Identifikationsnummer<br />
DE63ZZZ00000314764 des GeraNova Bruckmann Verlagshauses eingezogen.<br />
Der Einzug erfolgt jeweils zum Erscheinungstermin der Ausgabe, der mit der<br />
Vorausgabe ankündigt wird. Den aktuellen Abopreis findet der Abonnent<br />
immer hier im Impressum. Die Mandatsreferenznummer ist die auf dem<br />
Adressetikett eingedruckte Kundennummer.<br />
ISSN 1867-9846<br />
Erscheinen und Bezug: TRAKTOR CLASSIC erscheint sechsmal jährlich.<br />
Sie erhalten TRAKTOR CLASSIC in Deutschland, in Österreich<br />
und in der Schweiz im Bahnhofsbuchhandel, an gut sortierten<br />
Zeitschriftenkiosken sowie direkt beim Verlag.<br />
© 2014 by GeraMond Verlag<br />
SCHIFF<strong>Classic</strong><br />
MODELLFAN MILITÄR & GESCHICHTE CLAUSEWITZ<br />
FLUGMODELL SCHIFFSMODELL<br />
BAHN EXTRA LOK MAGAZIN STRASSENBAHN MAGAZIN<br />
Die Zeitschrift und alle ihre enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind<br />
urheberrechtlich geschützt. Durch Annahme eines Manuskripts erwirbt<br />
der Verlag das ausschließliche Recht zur Veröffentlichung. Für unverlangt<br />
eingesandte Fotos und Manuskripte wird keine Haftung übernommen.<br />
Gerichtsstand ist München. Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:<br />
Ulf Kaack; verantwortlich für Anzeigen: Rudolf Gruber,<br />
beide Infanteriestraße 11a, 80797 München.<br />
TRAKTOR CLASSIC 4|2014
GESCHICHTE<br />
Schatztruhe<br />
Auch in der Deutschen<br />
Demokratischen Republik<br />
informierten sich die zumeist<br />
unter dem Dach von Landwirtschaftlichen<br />
Produktionsgenossenschaften<br />
agierenden Bauern auf Agrarmessen über die<br />
neuen Produkte in der Branche. Hier präsentiert<br />
der Hersteller Zetor aus Βrünn, gelegen im heutigen<br />
Tschechien, seine ab 1962 auch im Westen<br />
vertriebene Baureihe 3011/3012 „Major“. Innerhalb<br />
der ersten, bereits im Baukastensystem hergestellten<br />
UR1-Serie markierten diese bis 1968<br />
gebauten Dreizylinder-Dieseltraktoren<br />
mit ihren 35 PS die Mittelklasse<br />
von Zetor. Foto: Sammlung Kaack<br />
Die Schatztruhe<br />
96<br />
Bilder, Prospekte, Dokumente aus vergangener<br />
Zeit – Fundstücke aus unserem Archiv
TRAKTOR CLASSIC 5|2014<br />
97
VORSCHAU<br />
TRAKTOR<br />
CHECK<br />
HANOMAG R 45<br />
Dauerbrenner<br />
aus Hannover<br />
Ende 1950 knüpfte der Hanomag R 45 nahtlos<br />
an den Erfolg des R 40 an. Mit dem hubraumstarken<br />
Vierzylinder-Dieselmotor und<br />
dem Fünfganggetriebe übernahm er wertvolles,<br />
im Detail verfeinertes Erbgut von seinem<br />
Vorgänger, verbarg dieses jedoch hinter einer<br />
dem Zeitgeschmack angepassten Fassade.<br />
Bis 1957 griffen fast 9.000 Käufer zu,<br />
und das Grundkonzept überlebte mit gesteigerter<br />
Leistung sogar bis 1964. Bodo<br />
Wistinghausen rückt dem Hannoverschen<br />
Großkaliber zu Leibe und analysiert sein<br />
bewegtes Innenleben.<br />
MAN 2 F 1<br />
Erfolgstyp aus München<br />
Das MAN-Image stützt sich bis zum heutigen Tag auf die<br />
schweren Vierzylinder mit Allradantrieb, der meistverkaufte<br />
Schlepper des Hauses ist jedoch von ganz anderem Kaliber. Von<br />
1957 bis 1961 spuckte das Werk in München-Allach mehr als<br />
6.000 Exemplare des Typs 2 F 1 aus. Angetrieben wurde dieser<br />
von einem unter Güldners Schützenhilfe entwickelten<br />
Zweizylindermotor mit bescheidenen 13 bis 14 PS, statt<br />
Allradantrieb gab es wahlweise eine Schmalspurversion. Ist das<br />
noch ein echter MAN? Klaus Tietgens hat es untersucht.<br />
AUSTRO JUNIOR<br />
Der Alpen-Porsche<br />
Ab 1956 baute der Hersteller Hofherr-Schrantz in Wien<br />
verschiedene Modelle aus dem Programm der Porsche-<br />
Diesel GmbH in Lizenz. Fast 5.000 wurden bis 1965 – also<br />
noch zwei Jahre über das Produktionsende in Friedrichshafen<br />
hinaus – im Alpenland auf die Räder gestellt. Vor<br />
allem der A 111 und dessen Nachfolger „Austro Junior“<br />
waren bei österreichischen Landwirten äußerst beliebt.<br />
Wir stellen ein hervorragend restauriertes Exemplar des<br />
Einzylinders vor.<br />
NICHT VERPASSEN!<br />
TRAKTOR CLASSIC 6/2014 erscheint am 8. September 2014 …<br />
… oder schon zwei Tage früher im Abonnement mit bis zu 32 Prozent Preis vorteil<br />
und Geschenkprämie. Jetzt bestellen unter: www.traktorclassic.de<br />
98<br />
AUSSERDEM: Motorenmontage: Zylinder und<br />
Zylinderköpfe Schraubverbindungen: Gewinde<br />
ersetzen Ernte: Weinlese<br />
Plus Geschenk<br />
Ihrer Wahl, z. B.<br />
die <strong>Traktor</strong>-<br />
Technikgeschichte<br />
von Albert Mößmer