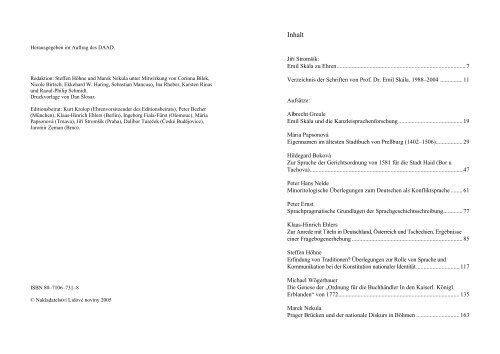2004 - Bohemicum Regensburg-Passau
2004 - Bohemicum Regensburg-Passau
2004 - Bohemicum Regensburg-Passau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Herausgegeben im Auftrag des DAAD.<br />
Redaktion: Steffen Höhne und Marek Nekula unter Mitwirkung von Corinna Bilek,<br />
Nicole Birtsch, Ekkehard W. Haring, Sebastian Mancuso, Ina Rheber, Karsten Rinas<br />
und Raoul-Philip Schmidt.<br />
Druckvorlage von Dan Šlosar.<br />
Editionsbeirat: Kurt Krolop (Ehrenvorsitzender des Editionsbeirats), Peter Becher<br />
(München), Klaas-Hinrich Ehlers (Berlin), Ingeborg Fiala-Fürst (Olomouc), Mária<br />
Papsonová (Trnava), Jiří Stromšík (Praha), Dalibor Tureček (České Budějovice),<br />
Jaromír Zeman (Brno).<br />
ISBN 80–7106–731–8<br />
© Nakladatelství Lidové noviny 2005<br />
Inhalt<br />
Jiří Stromšík:<br />
Emil Skála zu Ehren......................................................................................7<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong> ...............11<br />
Aufsätze:<br />
Albrecht Greule<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung...........................................19<br />
Mária Papsonová<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)..................29<br />
Hildegard Boková<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid (Bor u<br />
Tachova)......................................................................................................47<br />
Peter Hans Nelde<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache ........61<br />
Peter Ernst<br />
Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung.............77<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien. Ergebnisse<br />
einer Fragebogenerhebung ..........................................................................85<br />
Steffen Höhne<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache und<br />
Kommunikation bei der Konstitution nationaler Identität. ............................ 117<br />
Michael Wögerbauer<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler In den Kaiserl. Königl.<br />
Erblanden“ von 1772................................................................................. 135<br />
Marek Nekula<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen ............................. 163
Inhalt<br />
Martin Humpál<br />
Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen..............................187<br />
Mirek Němec<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei (1918–<br />
1938) im Spannungsfeld zwischen Staat und Volksgruppe.......................195<br />
Walter Koschmal<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala .....223<br />
Renata Cornejo<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša<br />
und Ota Filip..............................................................................................251<br />
Literatur- und Forschungsberichte:<br />
Kurt Krolop<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung ..........................................265<br />
Dalibor Zeman<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen –<br />
retrospektiv betrachtet – unter besonderer Berücksichtigung der<br />
österreichischen Varietät ...........................................................................291<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration ..................................317<br />
Neue Literatur:<br />
Hildegard BOKOVÁ (Hg.): Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in<br />
Böhmen, Mähren und der Slowakei. Vorträge der internationalen Tagung<br />
veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der<br />
Südböhmischen Universität. České Budějovice 20.-22. September 2001.<br />
Wien (Edition Praesens) <strong>2004</strong>, 244 S. .......................................................337<br />
Ernst EICHLER (Hg.): Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche<br />
Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster, Hamburg,<br />
London (Lit Verlag) 2003, 228 Seiten.......................................................343<br />
Inhalt<br />
Ingeborg FIALA-FÜRST, Jörg KRAPPMANN (Hgg.): Lexikon<br />
deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci<br />
2002/2003 [Loseblattsammlung]. (= Beiträge zur mährischen<br />
deutschsprachigen Literatur 5) ................................................................... 347<br />
Gero FISCHER (Hg.): Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře<br />
Josefa Pšeničky. / Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen<br />
des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Brno (Nakladatelství<br />
Doplněk) 2001, 174 Seiten........................................................................ 352<br />
Alena KÖLLNER: Buchwesen in Prag. Von Václav Matěj Kramerius bis<br />
Jan Otto (Buchforschung 1). Wien (Edition Praesens) 2000, 177 Seiten,<br />
28 Abb....................................................................................................... 356<br />
Primus-Heinz KUCHER: Ungleichzeitige / verspätete Moderne.<br />
Prosaformen in der österreichischen Literatur 1820–1880. Tübingen,<br />
Basel (Francke) 2002, 464 Seiten.............................................................. 359<br />
Bedřich W. LOEWENSTEIN: Wir und die anderen. Historische und<br />
kultursoziologische Betrachtungen. Dresden (Thelem) 2003, 436 Seiten. 364<br />
Fritz MAUTHNER: Der neue Ahasver. Ein Roman aus Jung-Berlin.<br />
Hrsg. und mit einem Nachwort von Ludger Lütkehaus. Berlin/Wien (Philo)<br />
2001, 387 S. .............................................................................................. 368<br />
Stefan Michael NEWERKLA: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch –<br />
Slowakisch. Frankfurt/Main (Peter Lang) <strong>2004</strong>, 780 Seiten...................... 374<br />
Heinrich PLETICHA (Hg.): Piaristen und Gymnasiasten. Schülerleben im<br />
alten Prag. (Bibliotheca Bohemica Band 40) Prag, Furth (Vitalis) 2001,<br />
102 Seiten.................................................................................................. 377<br />
Dieter WILDE: Der Aspekt des Politischen in der frühen Lyrik Hugo<br />
Sonnenscheins. Frankfurt/Main, Berlin (Lang) 2002, 322 Seiten. ............ 381<br />
Germanistica Pragensia XVI. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3.<br />
Praha: Univerzita Karlova (Karolinum) 2002 [Sonderheft zu Christian<br />
Heinrich Spieß], 104 Seiten. ..................................................................... 385<br />
Adressen ................................................................................................... 388<br />
Stylesheet ................................................................................................. 391
Emil Skála zu Ehren<br />
Wenn der vorliegende Band der BRÜCKEN Emil Skála gewidmet wird, so<br />
entbehrt dieser Akt schon in Bezug auf den Titel unseres Periodikums nicht<br />
einer gewissen Symbolik: ist der Geehrte doch seit Jahrzehnten einer derer,<br />
die, mitten in den bewegten Zeitläuften, zwischen Tschechen und Deutschen,<br />
zwischen ihren Kulturen und Mentalitäten Brücken zu schlagen bemüht<br />
sind – nicht bloß aus gutem Willen oder emotional-philanthropischen<br />
Beweggründen, sondern weil es ihm sein Beruf als Germanist gebot, den er<br />
mit Ernsthaftigkeit als Berufung und Verpflichtung zu unbestechlicher wissenschaftlicher<br />
Erkenntnis der Fakten verstand und ausübte.<br />
Die ideologiefreie Beschäftigung mit der Geschichte beider Völker, besonders<br />
auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei, also die geschichtlichen<br />
Tatsachen selbst, lehrten ihn, wie nicht nur schädlich, sondern auch<br />
sinn- und grundlos die gegenseitige Feindschaft und Verständnislosigkeit<br />
beider Volksgruppen auf einem derart schon geologisch durch die umliegenden<br />
Bergketten geschlossenen und von der Natur gleichsam als Einheit<br />
vorgesehenen Gebiet war. Schon wenn man die Tatsachen vorurteilsfrei,<br />
mit klaren, von guten wie schlechten Absichten ungetrübten Augen sieht,<br />
lehren sie jeden, der sehen will, dass die beiden Völker auf weiten Teilen<br />
dieses Gebiets seit Jahrhunderten in solcher gegenseitigen Verflochtenheit<br />
und Abhängigkeit voneinander lebten, die die besten Voraussetzungen für<br />
ein Zusammenleben, nicht nur für ein Neben- und Gegeneinanderleben boten,<br />
dass also Feindschaft überwindbar ist, unter der Voraussetzung allerdings,<br />
dass man sich selbst sowie einander erkennen und verstehen will.<br />
Wohl wissend, dass das Geschehene nicht ungeschehen und das einander<br />
Angetane nicht ungetan gemacht werden kann, hat Emil Skála in seiner professionellen<br />
Laufbahn das Seine dazu getan, Unverständnis und Feindschaft<br />
in der Gegenwart und für die Zukunft durch Erkenntnis und Wissen nach<br />
Maßgabe des Möglichen abzuschaffen. Es war ihm aber nicht weniger klar,<br />
dass auch geistige Brücken nicht in der Luft – durch schöne, wiewohl gut<br />
gemeinte, allgemeine Reden, Bekenntnisse und Herzensergießungen – gebaut<br />
werden, sondern lediglich aus kleinen, aus Schlacke und Schutt der<br />
Geschichte mühsam ausgegrabenen und bedächtig sortierten Steinen und<br />
Steinchen bestehen können.<br />
Zum Brückenschlagen wie zu mühsamer Grabungsarbeit in den Stollen der<br />
Geschichte dürfte Emil Skála bereits durch seine Herkunft vorbestimmt gewesen<br />
sein. Er wurde am 20. November 1928 in einer Bergmannsfamilie in<br />
Líně/Lihn unweit von Pilsen geboren, einem tschechischen Ort mit einer<br />
deutschen Minderheit, die fast ein Viertel der Bevölkerung bildete. Wer in
8<br />
Jiří Stromšík<br />
den 30er Jahren in einem solchen sprachlich wie national gemischten Gebiet<br />
aufwuchs, wo sich der Fall „von Humanität durch Nationalität zur Bestialität“<br />
in horrender Beschleunigung vollzog, musste die Erfahrung machen,<br />
dass Freundschaft und Feindschaft zwischen Volksgruppen kein Fatum,<br />
sondern eine Sache individueller Entscheidung ist und dass – will man darüber<br />
etwas Vernünftiges sagen – konkrete Falluntersuchungen in diesen<br />
Fragen aussagekräftiger, also nützlicher, sind als spekulative Generalisierungen<br />
oder moralische Appelle.<br />
Nach dem Abitur am Realgymnasium in Pilsen studierte Emil Skála in den<br />
Jahren 1947–1951 Germanistik und Anglistik an der Philosophischen Fakultät<br />
der Karls-Universität in Prag und parallel dazu Geographie und Geologie<br />
an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Wahl der beiden naturwissenschaftlichen<br />
Fächer ist auch für seine spätere wissenschaftliche<br />
Ausrichtung in seinem Hauptfach, der Germanistik, bezeichnend: Skála war<br />
von Anfang an kein Schmalspur-Germanist und wurde sehr früh zu einem<br />
Forscher mit außerordentlich weitem − heute sagt man: interdisziplinärem −<br />
Interessengebiet und geradezu enzyklopädischen Kenntnissen auf mehreren<br />
Feldern; in der Germanistik promovierte der spätere Linguist mit einer literaturwissenschaftlichen<br />
Arbeit über Hans Sachs’ Gesellschaftskritik.<br />
Seine akademische Laufbahn begann er, nach einem Jahr als Mittelschullehrer,<br />
1952 als Assistent an der Philosophischen Fakultät in Prag. Wichtige<br />
Förderung erhielten seine Forschungsinteressen während der Studienzeit in<br />
Leipzig, wo er in den Jahren 1957–1961 das Habilitationsstudium bei<br />
Theodor Frings absolvierte und mit der grundlegenden Studie Die Entwicklung<br />
der Kanzleisprache in Eger 1310 bis 1660 (ersch. 1967) erfolgreich<br />
abschloss.<br />
Nach der Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit in Prag verlief seine akademische<br />
Laufbahn allerdings nicht immer glatt. Als akademischer Lehrer ohne<br />
Parteiausweis war er zwar auch in den schlimmen Zeiten vor und nach 1968<br />
nicht durch Lehrverbot oder sonstige direkte Maßregelungen des Regimes<br />
betroffen, doch wurde seine Karriere von den regimetreuen akademischen<br />
Behörden und Funktionären auch nicht gefördert oder nur erleichtert. Seine<br />
Leipziger Habilitation wurde nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, automatisch<br />
nostrifiziert, sondern er wurde erst 1967 zum Dozenten ernannt, und es<br />
dauerte noch zwei volle Jahrzehnte, bis ihm 1987, erst in der Zeit der Perestrojka,<br />
die Professur zuerkannt wurde.<br />
Unbeschadet der zeitweise wenig fördernden äußeren Bedingungen und<br />
Umstände seiner Forschungen schuf Emil Skála in Jahrzehnten harter, konzentrierter,<br />
selbstloser und oft auch physisch aufreibenden Arbeit ein imposantes<br />
wissenschaftliches Werk. Schon in den ersten Jahren seiner Tätigkeit<br />
an der Prager Germanistik zeichneten sich seine wichtigsten Forschungsge-<br />
Emil Skála zu Ehren<br />
biete ab: er beschäftigte sich vor allem mit der Geschichte der deutschen<br />
Sprache, insbesondere mit der Entwicklung des Frühneuhochdeutschen,<br />
sowie mit der Dialektologie, wobei sein Augenmerk naturgemäß hauptsächlich<br />
auf die Sprache des Egerlandes sowie auf das Prager Deutsch gerichtet<br />
war; als Mitarbeiter des Literarhistorikers und Lexikographen Hugo Siebenschein<br />
wurde er schon 1953 in die Arbeit am großen Tschechisch-<br />
Deutschen Wörterbuch (erschienen 1970) einbezogen; nicht weniger natürlich<br />
ist im Hinblick auf seine Herkunft aus einem zweisprachigen Gebiet<br />
sein seit den 60er Jahren andauerndes Interesse für historische wie theoretische<br />
Aspekte des Bilinguismus; mit seinen naturwissenschaftlichen Studienfächern<br />
hängen seine über die Grenzen der Germanistik hinausgehenden<br />
Forschungen auf dem Gebiet der Onomastik und historischen Sprachgeographie<br />
zusammen.<br />
Es steht mir als Literarhistoriker nicht zu, sein wissenschaftliches Werk zu<br />
beurteilen − dies haben mit voller Kompetenz Sprachwissenschaftler aus<br />
aller Welt wiederholt getan −, doch auch uns Außenstehenden konnten einerseits<br />
das anerkennende Urteil und der Respekt, die ihm in den Fachkreisen<br />
in wachsendem Maß gezollt wurden, andererseits die allgemein wissenschaftlichen<br />
Qualitäten seiner Arbeit nicht verborgen bleiben. Jeder<br />
Historiker, welcher Richtung auch immer, weiß an Emil Skála zu schätzen,<br />
dass er immer ad fontes geht, dass er zuerst eine oft unvorstellbare Masse an<br />
Originaldokumenten und Materialien aufarbeitet, bevor er zur Auswertung<br />
des Materials bzw. zur Formulierung von Schlussfolgerungen und Thesen<br />
übergeht.<br />
Diese Grundeigenschaften und -prinzipien jedes soliden wissenschaftlichen<br />
Arbeitens hat Emil Skála auch an Generationen von Germanistikstudenten<br />
seiner Universität weitergegeben. Und er hat auf die heranwachsende Generation<br />
nicht nur Spezialkenntnisse, sondern auch etwas von der Weite seines<br />
Wissens zu übertragen getrachtet. Da ich die Ehre und das Vergnügen hatte,<br />
einige Jahre neben und mit ihm zu arbeiten, kann ich bezeugen, dass es ihm<br />
bei vielen Studenten auch gelungen ist: sie waren von seinem wissenschaftlichen<br />
Eifer wie von seinem umfassenden Wissen fasziniert, auch wenn sie<br />
sich andere Lebens- und Berufsziele setzten; unvergesslich bleiben ihnen<br />
noch nach Jahren unter anderem die beliebten, ja berühmten „Skála-<br />
Exkursionen“ – kollektive Forschungsreisen in Archive und Museen (von<br />
Böhmen über die Slowakei bis nach Ungarn), bei denen ihnen der Spezialist<br />
und Enzyklopädist Skála vor Ort, an noch nicht erschlossenen Dokumenten,<br />
vormachte, wie packend die wissenschaftliche Arbeit sein kann. Zu dem,<br />
was die Jüngeren von ihm lernen konnten – lange bevor es allgemein akzeptiert<br />
wurde −, gehört nicht zuletzt sein sachliches und selbstbewusstes, von<br />
einseitigen Schuldzuweisungen wie von Minderwertigkeitsgefühlen freies,<br />
9
10<br />
Jiří Stromšík<br />
von der Vergangenheit unbelastetes, weil auf tiefer Kenntnis der Vergangenheit<br />
beruhendes Verhältnis zu den Deutschen und ihrer Kultur.<br />
Emil Skála kann, wie wenige seiner Zunft, mit Stolz und Genugtuung auf<br />
ein erfülltes wissenschaftliches Leben zurückblicken. Möge dieser Band der<br />
BRÜCKEN, als Ausdruck von Respekt und Sympathie seiner Kollegen und<br />
Nachfolger, dies ihm wie uns allen wieder einmal in Erinnerung rufen.<br />
Jiří Stromšík<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála 1988–<strong>2004</strong> 1<br />
1988<br />
Das Frühneuhochdeutsche in den Städten Böhmens. – In: G. Bauer (Hg.),<br />
Stadtsprachenforschung: Unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse<br />
der Stadt Straßburg in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Vorträge<br />
des Symposiums vom 30. März bis 3. April 1987 an der Universität Mannheim<br />
(= Göppinger Arbeiten zur Germanistik 488). Göppingen: Kümmerle,<br />
239–270.<br />
Deutsche und tschechische Fachprosa in Böhmen in der Epoche des Humanismus.<br />
– In: H.–B. Harder (Hg.), Studien zum Humanismus in den böhmischen<br />
Ländern. Köln, Wien: Böhlau, 377–403.<br />
Egerer Urgichtenbuch. – In: O. Reichmann, K. P. Wegera (Hgg.), Frühneuhochdeutsches<br />
Lesebuch. Tübingen: Niemeyer, 61–64.<br />
Gaston van der Elst: Aspekte zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache.<br />
Erlangen 1987. – In: Germanistik 113. [Rezension]<br />
1989<br />
Čeština a němčina v českých zemích [Tschechisch und Deutsch in den<br />
böhmischen Ländern]. – In: Jazykové aktuality 26, Praha, 100–103.<br />
Ein gutes Gewürz. – In: B. U. Biere (Hg.), Institut für Deutsche Sprache: 25<br />
Jahre. Mannheim: IDS, 76–77.<br />
Lexikographie in Böhmen vom 13.–19. Jahrhundert. – In: K. Matzel, H.–G.<br />
Roloff (Hgg.), Festschrift für Herbert Kolb zu seinem 65. Geburtstag. Bern:<br />
Lang, 692–701.<br />
Linguistisches zum Bilinguismus in Böhmen. – In: H.–W. Eroms (Hg.),<br />
Probleme regionaler Sprachen (= Bayreuther Beiträge zur Dialektologie 4).<br />
Hamburg: Buske, 21–36.<br />
Lubomír Drozd in memoriam. – In: Philologica Pragensia. Praha:<br />
Univerzita Karlova, 212–213.<br />
Za profesorem Lubomírem Drozdem [Lubomír Drozd in memoriam]. – In:<br />
Slovo a slovesnost 50, Praha: Academia, 66–67.<br />
1 Durchgesehen von Johanna Gallupová. – Verzeichnis früherer Schriften von Prof. Emil<br />
Skála aus den Jahren 1954 bis 1987 (zusammengestellt von Jitka Míšová) erschien in<br />
Wiesinger, Peter (Hg.) (1988): Studien zum Frühneuhochdeutschen. Emil Skála zum 60.<br />
Geburtstag am 20. November 1988 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik 476). Göppingen:<br />
Kümmerle.
12<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Zur Bedeutung der frühneuhochdeutschen Quellen in der Tschechoslowakei.<br />
– In: Deutsche Quellen aus dem 14. und 15. Jh. in der Tschechoslowakei.<br />
Texte und Analyse. Hiroshima, 1–4.<br />
Die ‚Ackermann‘-Handschriften E (clm 27063) und H (cgm 579). – In: Philologica<br />
Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 61–62. [Rezension]<br />
Gerhard Wolff, Deutsche Sprachgeschichte. – In: Philologica Pragensia.<br />
Praha: Univerzita Karlova, 62–64. [Rezension]<br />
1990<br />
Die Stadtsprachen in Böhmen zwischen Hus und Müntzer. – In: R. Peilicke<br />
(Hg.), Thomas Müntzers deutsches Sprachschaffen: Referate der internationalen<br />
sprachwissenschaftlichen Konferenz, Berlin, 23.–24.10.1989 (= Linguistische<br />
Studien, Reihe A 207). Berlin: Akad. d. Wiss. d. DDR, 228–251.<br />
Linguistisches zum Bilinguismus in Böhmen. – In: Bayreuther Beiträge zur<br />
Dialektologie 4. Hamburg: Buske, 21–36.<br />
Paläographie nichtgenügend. – In: Austria today: quarterly review of trends<br />
and events. Wien, 1.<br />
Wilhelm von Wenden im Kontext der böhmisch-österreichischen Wechselseitigkeit.<br />
– In: Philologica Pragensia 33/1, Praha: Univerzita Karlova, 10–20.<br />
1991<br />
Deutsch und Tschechisch im mitteleuropäischem Sprachbund. – In: E.<br />
Slembek, (Hg.), Culture and Communication (12th International Colloquium<br />
on Speech Communication). Frankfurt/Main: Verlag für interkulturelle<br />
Kommunikation, 49–58.<br />
Richtigstellung zum Aufsatz ‚Unter König Ottokar wurde deutsch gesprochen‘.<br />
– In: Prager Volkszeitung 25. Praha, 12.<br />
1992<br />
Das Deutsche im Kontakt mit dem Tschechischen. – In: E. Iwasaki (Hg.),<br />
Begegnung mit dem ‚Fremden‘. Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Akten<br />
des VIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanische<br />
Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), Tokyo 1990 (Bd. 3). München:<br />
iudicium, 97–103.<br />
Das Frühneuhochdeutsche in den Böhmischen Ländern und in der Slowakei.<br />
– In: Jahrbuch der Brüder-Grimm-Gesellschaft 1 (1991). Kassel: Ges.,<br />
117–123.<br />
Das Prager Deutsch. – In: Jahrbuch (= Bayerische Akademie der Schönen<br />
Künste 5). Schaftlach: Oreos, 130–140.<br />
Der Begriff Sudetendeutsche. – In: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den<br />
Deutschunterricht 1. Praha, 10.<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Der Bilinguismus in Mitteleuropa: die deutsch-tschechische Entwicklung. –<br />
In: A. v. Humboldt-Stiftung. Fachsymposium 1991. Geisteswiss. und Literarisches<br />
Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Sonthofen, 133.<br />
Deutsch und Tschechisch im mitteleuropäischen Sprachbund. – In: brücken.<br />
Germanistisches Jahrbuch. N.F. 1. 1991/92. Berlin, Praha, Prešov, 173–179.<br />
Die Zukunft Europas ist mehrsprachig. Vorstellung neuer Mitglieder. – In:<br />
Jahrbuch 1992 / Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt,<br />
24–27 u. 153–156.<br />
Křestní jméno Česko [Taufname Tschechien; zus. mit anderen Autoren]. –<br />
In: Lidové noviny. Praha (24.7.1992).<br />
Zur Entwicklung der deutschen grammatischen Terminologie. – In: B.<br />
Schaeder (Hg.), Wortarten: Beiträge zur Geschichte eines grammatischen<br />
Problems (= Reihe Germanistische Linguistik 133). Tübingen: Niemeyer<br />
1992, 277–293.<br />
Zur Verbreitung der mittelhochdeutschen Diphthongierung und Monophthongierung.<br />
– In: Germanistica Pragensia 10. Praha: Univerzita Karlova,<br />
7–18.<br />
1993<br />
– Eintrag Emil Skála in W. Kürschner (Hg.), Linguistenhandbuch. Tübingen:<br />
Günther Narr, 1280.<br />
Der Bilinguismus in Mitteleuropa: Die deutsch-tschechische Entwicklung. –<br />
In: A. P. Frank, K.–J. Maaß, F. Paul, H. Turk (Hgg.), Übersetzen, verstehen,<br />
Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im<br />
internationalen Kulturaustausch. Berlin: Erich Schmidt, 766–774.<br />
Die Zweisprachigkeit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. – In: P. Bassola,<br />
R. Hessky, L. Tarnói (Hgg.), Im Zeichen der ungeteilten Philologie.<br />
Festschrift für Karl Mollay zum 80. Geburtstag (= Budapester Beiträge zur<br />
Germanistik 24). Budapest: Elte, 311–319.<br />
Jazyková situace v Čechách v rozmezí let 993–1322 [Die Sprachsituation in<br />
Böhmen in den Jahren 993–1322]. – In: Milénium břevnovského kláštera<br />
993–1993. Praha: Karolinum, 163–171. 2 Karten.<br />
1994<br />
– Eintrag Emil Skála in W. Kürschner (Hg.), Linguistenhandbuch. Biographische<br />
und bibliographische Daten deutschsprachiger Sprachwissenschaftlerinnen<br />
und Sprachwissenschaftler der Gegenwart. Bd. 2 (M-Z). Tübingen:<br />
Narr, 884–885.<br />
A két- és többnyelvüségröl [Von der Zwei- und Mehrsprachigkeit]. – In:<br />
Prágai tükör: kulturális éz közéleti lap. Evf. 2, sz. 3, Budapest: Kalligram<br />
Kiadó, 6–16.<br />
13
14<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Eduardo Goldstücker octogenario ab amicis collegis discipulis oblata (= Acta<br />
Universitatis Carolinae: Philologica, 1993, 3). [Wiss. Herausgeber]. Praha:<br />
Univ. Karlova, 1994.<br />
Lexikographie in Böhmen im 14.–19. Jahrhundert. – In: Germanoslavica.<br />
Zeitschrift für germanoslavische Studien 1, Nr. 1–2. Praha: Slovanský<br />
ústav, 3–10.<br />
Mundartliches in der Egerer Kanzlei. – In: Germanistica Pragensia 11<br />
(1993). Praha: Univerzita Karlova, 13–24.<br />
Tschechische Exonyma im deutschen Sprachgebiet bis zum Dreißigjährigen<br />
Krieg. – In: H.–B. Harder, H. Rothe (Hgg.), Studien zum Humanismus in<br />
den böhmischen Ländern, Bd. 3. Die Bedeutung der humanistischen Topographien<br />
und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder<br />
bis zur Zeit Balbíns. Köln u.a.: Böhlau, 249–256.<br />
Zde nejsou lvi. Jak to vypadá se znalostmi česko-německé historie [Hier<br />
sind keine Löwen. Wie es mit den Kentnissen der tschechisch-deutschen<br />
Geschichte aussieht]. – In: Nedělní Lidové noviny. Praha (15.1.1994), 2.<br />
Zum Prager Deutsch des 14. Jahrhunderts. – In: B. D. Haage (Hg.), Granatapfel.<br />
Festschrift für Gerhard Bauer zum 65. Geburtstag (= Göppinger Arbeiten<br />
zur Germanistik 580). Göppingen: Kümmerle, 13–27.<br />
Zweisprachigkeit und Motivation der mehrsprachigen Erziehung in der<br />
Tschechischen Republik. – In: Thesen, IVth International Conference on<br />
Language and Law. Fribourg 14.–17.9.1994, 286.<br />
1995<br />
Deutsche und tschechische Sprache in den böhmischen Ländern. – In: C.<br />
Gallio, Claudio, B. Heidenreich (Hgg.), Deutsche und Tschechen. Nachbarn<br />
im Herzen Europas. Beiträge zu Kultur und Politik. Köln: Wissenschaft und<br />
Politik, 90–99.<br />
Mundartliches in der Egerer Kanzlei. – In: G. Lerchner, M. Schröder, U.<br />
Fix (Hgg.), Chronologische, areale und situative Varietäten des Deutschen<br />
in der Sprachhistoriographie. Festschrift für Rudolf Große (= Leipziger<br />
Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte 2). Frankfurt/Main,<br />
Berlin u.a.: Lang, 175–184.<br />
1996<br />
Der Begriff Sudetendeutscher. – In: H. L. Arnold u.a. (Hg.), Uferdasein.<br />
Deutschsprachige Literatur in Böhmen. Bautzen: Lusatia, 298–301.<br />
Die Sprachgeschichte des Böhmerwaldes / Jazykové dějiny Šumavy. – In:<br />
V. Maidl (Hg.), Znovuobjevená Šumava / Der wiederentdeckte Böhmerwald.<br />
Eine traditionsreiche europäische Region. Klatovy: Okresní muzeum,<br />
15–29.<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Tschechisch-deutsche Sprachkontakte. – In: Germanistica Pragensia 12.<br />
Praha, 7–27.<br />
Zweisprachigkeit und Motivation zu mehrsprachiger Erziehung in der Tschechischen<br />
Republik. – In: T. Stammen (Hg.), Politik – Bildung – Religion:<br />
Hans Maier zum 65. Geburtstag. Paderborn [u.a.]: Schöningh, 525–531.<br />
1997<br />
Rilkův vztah k české literatuře a básnictví [Rilkes Stellung zur tschechischer<br />
Literatur und Dichtung]. – In: Rainer Maria Rilke. Evropský básník<br />
z Prahy. Sborník z mezinárodní konference. Jinočany: H & H, 55–70.<br />
Zentrum und Peripherie in der Graphie der Lutherzeit. – In: K. J. Mattheier,<br />
H. Nitta, M. Ono (Hgg.), Gesellschaft, Kommunikation und Sprache<br />
Deutschlands in der frühen Neuzeit: Studien des Deutsch-Japanischen Arbeitskreises<br />
für Frühneuhochdeutschforschung. München: iudicium, 11–22.<br />
1998<br />
– Eintrag Emil Skála in: Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století.<br />
Praha: Agentura kdo je kdo, 532.<br />
– Germanist Emil Skála siebzig Jahre. – In: Prager Volkszeitung 48,<br />
4.12.1988, 2.<br />
– Rudolf Bentzinger: Emil Skála zum 70. Geburtstag. – In: Linguistica Pragensia<br />
8/2, 90–93.<br />
Rilkes Stellung zur tschechischen Literatur und Malerei. – In: P. Demetz, J.<br />
W. Storck, H. D. Zimmermann (Hgg.), Rilke – ein europäischer Dichter aus<br />
Prag. Würzburg: Königshausen & Neumann, 45–55.<br />
So eine Art Landarzt. Tagblatt-Gespräch mit Germanistikprofessor Emil<br />
Skála. – In: Prager Tagblatt 2. Praha, 2.<br />
Versuch einer Definition des mitteleuropäischen Sprachbundes. – In: P.<br />
Ernst, F. Patocka (Hgg.), Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Festschrift<br />
für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien: Ed. Praesens, 675–684.<br />
1999<br />
– Eintrag Emil Skála in: J. Tomeš et al.: Český biografický slovník 20. století.<br />
3 Bde, Bd. 3, Praha: Paseka, 130.<br />
– Theodor-Frings-Preis für Prager Germanisten Prof. Emil Skála. Weltweit<br />
einer der führenden Forscher des Frühneuhochdeutschen. – In: Prager<br />
Volkszeitung 19–20, 14.5.1999, 7.<br />
Der mitteleuropäische Sprachbund. – In: J. Scharnhorst (Hg.), Sprachkultur<br />
und Sprachgeschichte: Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein<br />
und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa [Tagung in Berlin, 17.–<br />
18.10.1997]. Frankfurt/Main u.a.: Lang, 125–133.<br />
15
16<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Goethův vztah k češtině [Goethes Stellung zum Tschechischen]. – In: Třebívlice<br />
99. Obec Třebívlice, 75–78.<br />
Was sind böhmische Dörfer. – In: Germanistica Pragensia 14, Praha 1997<br />
[recte 1999], 123–130.<br />
2000<br />
Der Räuber Hotzenplotz. Ortsnamen in Tschechisch Schlesien und ihr<br />
sprachlicher Hintergrund. – In: Prager Volkszeitung 19–20, 12.5.2000, 11.<br />
Deutsche Fachprosa in Böhmen in der Epoche des Humanismus. – In: I.<br />
Barz, U. Fix, M. Schröder, G. Schuppener (Hgg.), Sprachgeschichte als<br />
Textsortengeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gotthard Lerchner.<br />
Frankfurt/Main, Berlin, Bern u.a.: Lang, 113–123.<br />
Deutsche und tschechische Exonyma im mitteleuropäischen Sprachbund. –<br />
In: H. Tiefenbach, H. Löffler (Hg.), Personenname und Ortsname: Basler<br />
Symposion, 6. und 7. Oktober 1997. Heidelberg: Winter, 251–265.<br />
Gibt es Schlesien überhaupt? – In: Prager Volkszeitung 13–14, 31.3.2000, 11.<br />
O původu jmen: Ke vztahu vlastního jména a apelativa [Vom Ursprung der<br />
Namen Skřipel, Skřípová, Skřip a Skřipov: Zur Beziehung des Eigennamens<br />
und Apellativums]. – In: Onomastické práce IV. Sborník rozprav k 70.<br />
narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera. Praha: Ústav pro český jazyk<br />
AV ČR, 439–441.<br />
Stichwörter für die tschechische Enzyklopädie Universum. Buchstaben A-<br />
Ma, Bd. 1–5.<br />
Středoevropský jazykový svaz [Der mitteleuropäische Sprachbund]. – In:<br />
Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova,<br />
77–85.<br />
Was sind böhmische Dörfer? – In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských<br />
studií. Praha: Univerzita Karlova, 87–95.<br />
2001<br />
Das <strong>Regensburg</strong>er und das Prager Deutsch im Mittelalter. – In: A. Greule<br />
(Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext. Beiträge zu einem<br />
internationalen Symposium an der Universität <strong>Regensburg</strong>, 5. bis 7.<br />
Oktober 1999 (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Ed.<br />
Praesens, 51–62.<br />
Die deutsche Sprache in Tschechien an der Jahrtausendwende. – In: R. Bentzinger<br />
u.a. (Hg.), Sprachgeschichte, Dialektologie, Onomastik, Volkskunde.<br />
Beiträge zum Kolloquium am 3./4. Dezember 1999 an der Johannes-<br />
Gutenberg-Universität Mainz. Wolfgang Kleiber zum 70. Geburtstag (= Zeitschrift<br />
für Dialektologie und Linguistik; Beiheft 115). Stuttgart: Steiner, 127–<br />
131.<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Die Stadtbücher in Böhmen bis 1526 und die beteiligten Sprachen. – In: F.<br />
Debus u.a. (Hg.), Stadtbücher als namenkundliche Quelle. Vorträge des<br />
Kolloquiums vom 18.–20. September 1998 (= Akademie der Wissenschaften<br />
und der Literatur Mainz, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen<br />
Klasse 7). Stuttgart: Steiner, 237–245, 1 Abb.<br />
Frühneuhochdeutsche Fachprosa in Böhmen: Die Egerer Forstordnung von<br />
1379. – In: A. Braun u.a. (Hg.), Beiträge zu Linguistik und Phonetik. Festschrift<br />
für Joachim Göschel zum 70. Geburtstag (= Zeitschrift für Dialektologie<br />
und Linguistik; Beiheft 118). Stuttgart: Steiner, 48–57.<br />
Stichwörter für die tschechische Enzyklopädie Universum. Buchstaben Ch-<br />
Ž, Bd. 4–10.<br />
2002<br />
Das <strong>Regensburg</strong>er und das Prager Deutsch. – In: S. Näßl (Hg.), <strong>Regensburg</strong>er<br />
Deutsch: Zwölfhundert Jahre Deutschsprachigkeit in <strong>Regensburg</strong> (= <strong>Regensburg</strong>er<br />
Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe B.<br />
Untersuchungen 80). Frankfurt/Main u.a.: Lang, 153–170.<br />
Der mitteleuropäische Sprachbund. – In: J. Scharnhorst (Hg.), Sprachkultur<br />
und Sprachgeschichte. Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein<br />
und wissenschaftliche Sprachpflege in Europa. Frankfurt/Main u.a.:<br />
Lang, 125–133.<br />
Die Ortsnamen von Böhmen, Mähren und Schlesien als Geschichtsquelle. –<br />
In: Bohemia 43/2, 385–411.<br />
2003<br />
Die Ortsnamen von Böhmen, Mähren und Schlesien als Geschichtsquelle. –<br />
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita<br />
Karlova, 123–148.<br />
Jazyk a nářečí Šumavy [Sprache und Dialekte Böhmerwalds]. – In: Šumava.<br />
Příroda, historie, život. Praha: Baset, 493–498.<br />
Rybniční registr chotěšovského kláštera z let 1743–1782. K dvoujazyčnosti<br />
Stříbrska v 18. století [Das Teichregister des Klosters Chotieschau aus den<br />
Jahren 1743–1782. Zur Zweisprachigkeit der Mieser Gegend im 18. Jahrhundert].<br />
– In: Acta Onomastica 54, Praha: Ústav pro český jazyk AV ČR,<br />
125–130.<br />
<strong>2004</strong><br />
Die ältesten Sprachenkarten Europas. – In: Linguistica Pragensia 14/1. Praha:<br />
Univerzita Karlova, 1–6.<br />
17
18<br />
Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />
Gibt es den Mitteleuropäischen Sprachbund? – In: The Journal of Intercultural<br />
Studies. The Intercultural Research Institute, Kansai Gaidai University<br />
Publication, Nr. 30. Osaka, 22–29.<br />
Vergleichende historische Topographie von Böhmen, Mähren und Schlesien<br />
auf europäischen Karten der frühen Neuzeit. – In: brücken, N.F. 11, Praha:<br />
Lidové noviny, 79–105.<br />
Texte der Frühen Neuzeit aus der Slowakei (= Beiträge zur Editionsphilologie<br />
3). Berlin: Weidler. (Hrsg. zus. mit I. Piirainen)<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />
Albrecht Greule<br />
Der folgende Forschungsüberblick ist in Dankbarkeit Emil Skála zum 75.<br />
Geburtstag gewidmet. Ohne seine Forschungen gäbe es das internationale<br />
Forschungsparadigma „Kanzleisprachen“ nicht, das heute Forscher und<br />
Forscherinnen weit über die Grenzen von Tschechien, der Slowakei und<br />
Deutschland hinaus zusammenführt.<br />
1. ich rede nach der Sechsischen cantzley<br />
Martin Luthers in der Überschrift gekürzt wiedergegebenes Dictum (vgl.<br />
dazu BESCH 1967: 363) ist neben Äußerungen von Niclas von Wyle<br />
(1478), Fabian Frangk (1531), Martin Opitz (1624) und Justus Georg Schottelius<br />
(1663) der bekannteste Hinweis auf den Vorbildcharakter der in den<br />
Kanzleien der frühneuhochdeutschen Zeit geschriebenen Sprache und deren<br />
sprachausgleichende Wirkung (vgl. BENTZINGER 2000: 1665). Konrad<br />
Burdach erhob 1884 mit den Worten: „Eine Geschichte dieser Kanzleisprache<br />
wäre von höchster Wichtigkeit und höchstem Interesse [...]“ (zitiert<br />
nach BENTZINGER 2000: 1666) die Erforschung der Kanzleisprache(n) zu<br />
einem Programm der germanistischen Sprachgeschichtsschreibung (Das<br />
Folgende nach BENTZINGER 2000: 1666). Noch in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts werden Urkundeneditionen und Einzeluntersuchungen zur<br />
Sprache von Kanzleien vor allem des südwestdeutschen, schweizerischen<br />
und schlesisch-lausitzischen Raumes veröffentlicht. In der ersten Hälfte des<br />
20. Jahrhunderts steht der ostmitteldeutsche Raum, insbesondere wegen der<br />
vermuteten Bedeutung der Prager und anderer böhmischer Kanzleien für die<br />
Herausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache, im Vordergrund. Als<br />
bedeutendste Edition wird in diesem Zeitraum (1929) das Corpus der altdeutschen<br />
Originalurkunden bis zum Jahre 1300 begonnen. Nach 1945 greifen<br />
– fast gleichzeitig – Zdeněk Masařík (1966) in Brünn und Emil Skála<br />
(1967) in Prag mutig das Thema der deutschen Kanzleisprachen in Böhmen<br />
und Mähren wieder auf. Ferner werden in beiden Teilen Deutschlands die<br />
Kanzleisprachen des ostmitteldeutschen, ostoberdeutschen und westoberdeutschen<br />
Raumes erforscht. Während des ganzen 20. Jahrhunderts gilt das<br />
Interesse auch den mittelniederdeutsch schreibenden Kanzleien.<br />
Zu einem wirklich grenzüberschreitenden Forschungsparadigma, an dem<br />
tschechische, slowakische, polnische, ungarische, baltische und deutsche<br />
Forscherinnen und Forscher intensiv mitwirken, wird die Kanzleisprachenforschung<br />
erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Der freie Zugang zu<br />
den Archiven und die Möglichkeit ihrer Erschließung ermöglichen nun die
20<br />
Albrecht Greule<br />
Auswertung reichlich fließender Quellen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen<br />
Geschäftsschrifttums vorwiegend durch Sprachwissenschaftlerinnen<br />
und Sprachwissenschaftler vor Ort. Eine besondere Rolle fällt in einer<br />
Geschichte der Kanzleisprachenforschung dem finnischen, in Münster lehrenden<br />
Sprachwissenschaftler und Germanisten Ilpo Tapani Piirainen zu. Er<br />
bildete mit seinen Archivreisen in Osteuropa und zahlreichen Schriften (seit<br />
1970), vor allem zu den deutschen Kanzleisprachen in der Slowakei, während<br />
der Zeit der Teilung Europas eine wichtige Brücke zwischen Ost und<br />
West (vgl. MEIER/ZIEGLER 2001: 15–17, 603–612).<br />
In dem sich in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts international ausprägenden<br />
Paradigma der Erforschung der historischen deutschen Kanzleisprachen<br />
in Mitteleuropa, dessen Summa in einem vor der Ausarbeitung befindlichen<br />
Handbuch ausgebreitet werden wird (siehe unten) und dessen Forum<br />
der 1997 gegründete Internationale Arbeitskreis Kanzleisprachenforschung<br />
ist (mit bislang drei Symposien), fließen verschiedene Forschungstraditionen<br />
und Forschungsneuansätze zusammen und befruchten sich gegenseitig:<br />
Zuerst die Erforschung der volkssprachlichen Urkunden, deren Zahl zuerst<br />
im 13. Jahrhundert beachtliche Dimensionen erreicht (BENTZINGER 2000:<br />
1666–1669). Da aber in den Kanzleien nicht nur Urkunden ausgefertigt<br />
wurden, sondern auch Aktenstücke, Rechts- und Rechnungsbücher, Briefe<br />
usw. (EGGERS 1969: 23), ist es sinnvoll, das in den Kanzleien fixierte<br />
Schrifttum als ‚Geschäftsschrifttum‛ (Geschäftssprache) zu bezeichnen, das<br />
die engen Grenzen der Urkundensprache bei Weitem überschreitet. Eine<br />
Konstante des Forschungsparadigmas Kanzleisprachen ist die Frage ihrer<br />
Rolle beim Sprachausgleich (BENTZINGER 2000: 1669f.). Diese Fragestellung<br />
setzt voraus, dass in den Schriften der kleineren Kanzleien eher als<br />
in jenen der großen sich Dialekte niederschlagen, dass die Kanzleischreiber<br />
sich also mit der gesprochenen Sprache des Territoriums, für das sie zuständig<br />
sind, auseinander setzten. Deutlich aufeinander bezogen sind Kanzleisprachen-<br />
und historische Stadtsprachenforschung (vgl. BENTZINGER<br />
2001: 25–39); letztere wird in neuerer Zeit wesentlich gefördert durch den<br />
Internationalen Arbeitskreis für Stadtsprachenforschung (vgl. z.B. BISTER-<br />
BROOSEN 1999). Gegenüber der auf den Sprachausgleich bezogenen, älteren<br />
Kanzleisprachenforschung treten in jüngster Zeit die städtischen Kanzleien<br />
in den Vordergrund (ZIEGLER 2001: 69–85). Förderliche Impulse<br />
kommen seit Neuestem auch aus der Textsortenlehre (SPÁČILOVÁ 1998,<br />
MEIER 1999: 131–157), aus der (historischen) Soziolinguistik (MEIER<br />
2002: ZIEGLER 2002) und aus der (historischen) Pragmatik (ERNST 1999:<br />
17–31; MEIER 2002).<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />
2. Kanzlei und Kanzleisprache(n)<br />
Es gehört inzwischen zu den Fixa der deutschen Sprachgeschichtsschreibung,<br />
dass es sich bei den Kanzleien um „Zentralstellen der Landes- oder<br />
Stadtverwaltung“ (EGGERS 1969: 23) handelte. Die Kanzlei als größere,<br />
feste Organisation mit einem Kanzler an der Spitze, mit Notaren, mehreren<br />
Schreibern und anderem Hilfspersonal ist freilich eine eher späte und außergewöhnliche<br />
Erscheinung. Die für eine Kanzlei typische Sprache fassen<br />
wir im Geschäftsschrifttum, das im Auftrag eines Königs, eines Fürsten,<br />
einer Stadt, eines Bischofs oder eines Klosters in deren Kanzlei verfasst<br />
wurde, zusammen. Die Klassifikation der Kanzleisprachen in der Abhängigkeit<br />
von der jeweiligen Herrschaft, womit auch der unterschiedliche<br />
Wirkungskreis und der unterschiedliche Einfluss der Kanzleischreibe auf<br />
den Sprachausgleich zusammenhängt, ist in der Forschung längst erkannt.<br />
Es wird durchaus unterschieden zwischen Schrifttum der kaiserlichen, der<br />
kurfürstlichen, herzoglichen, fürstlichen, bischöflichen und städtischen<br />
Kanzleien. In Anbetracht des aus den Archiven zu Tage geförderten Schrifttums<br />
stehen wir mit einer textsortenspezifischen Analyse der Kanzleisprachen<br />
erst am Anfang. Da dort nicht nur Urkunden geschrieben wurden, sondern<br />
auch Briefe, Register, Rechnungsbücher, Salbücher, Stadtbücher,<br />
Amtsbücher, Testamente und Ähnliches (BENTZINGER 2000: 1665), steht<br />
die Forschung auch vor der schwierigen Aufgabe, quantitative und vor allem<br />
qualitative Grenzen zu ziehen.<br />
Ein Kennzeichen der neueren, besonders auf Ostmitteleuropa gerichteten<br />
Kanzleisprachenforschung ist ihre Konzentration auf die städtischen Kanzleien<br />
und das dort produzierte Schrifttum, nachdem für die Forschung die<br />
Sprache sowohl der Kanzlei der Könige und Kaiser als auch die der kursächsischen<br />
Kanzlei über 100 Jahre im Vordergrund stand. So konzentrieren<br />
sich die jüngsten Bemühungen zum Beispiel von Arne Ziegler, das ‚soziopragmatische<br />
Bedingungsgefüge‛, aus dem sich ein kanzleisprachlicher<br />
Diskurs sowie ein kanzleisprachlicher Schreibusus herausgebildet hat<br />
(ZIEGLER 2001: 75) zu beschreiben, bezeichnenderweise auf die Kanzleien<br />
von Städten, besonders auf die der Stadt Preßburg/Bratislava. Ziegler<br />
beschreibt das diskursive Bedingungsgefüge kanzleisprachlicher Faktoren,<br />
das er in einem Schema entfaltet, folgendermaßen:<br />
Die Kanzlei fungiert als institutioneller Rahmen, der einen spezifischen kanzleisprachlichen<br />
Schreibusus überhaupt erst ermöglicht. Dieser Schreibusus prägt die jeweiligen Kanzleitexte,<br />
die wiederum einen kanzleisprachlichen Diskurs formulieren, der seinerseits Rückwirkungen<br />
auf verschiedene Einflussfaktoren hat und somit auch den konkreten historisch-gesellschaftlichen<br />
Diskurs, der die städtische Kommunikationspraxis ermöglicht, mitgestaltet (ZIEGLER<br />
2001: 75).<br />
21
22<br />
Albrecht Greule<br />
3. Forschungsergebnisse<br />
3.1. Zu verschiedenen Regionen<br />
Dank den Forschungen zur Prager Kanzlei Karls IV. und zum ‚Prager<br />
Deutsch‘ (SKÁLA 1994) gebührt Tschechien, genauer Böhmen, ein Vorrang,<br />
wenn es um die Erforschung der Geschichte der deutschen Sprache<br />
außerhalb Deutschlands geht. Insbesondere Emil Skála und seiner Untersuchung<br />
zur Entwicklung der Kanzleisprache in Eger von 1310 bis 1660<br />
(SKÁLA 1967) sind neue Einsichten in die Stellung der Sprache der Prager<br />
Kanzlei zu verdanken. Als Ergebnis kann die Sprachgeschichtsschreibung<br />
deshalb festhalten, dass die Prager Kanzleisprache zwar „ihr besonderes<br />
Gepräge“ hat, dass sie aber keine Prager Eigenschöpfung ist, sondern dass<br />
„auch sie bereits in einer Traditionslinie steht, die sich vorher schon in den<br />
Kanzleien von Nürnberg und Eger und vielleicht sogar in <strong>Regensburg</strong> zeigt“<br />
(EGGERS 1969: 22). Die Forschungen von Hildegard Boková konzentrieren<br />
sich seit 1981 auf die deutschsprachigen Urkunden und Stadtbucheintragungen<br />
Südböhmens im 14. und 15. Jahrhundert mit einem Schwergewicht<br />
auf der Schreibe der Städte und der Adelsfamilie von Rosenberg (z.B.<br />
BOKOVÁ 1998).<br />
Mähren hat Zdeněk Masařík mit zwei Büchern und mehreren Aufsätzen im<br />
Blick (MASAŘÍK 1966, 1985). Unter den mährischen Städten kommt, was<br />
die Überlieferung deutschsprachiger Texte anbelangt, Olmütz/Olomouc<br />
eine besondere Rolle zu. Um die Hebung und Auswertung der Schätze der<br />
Olmützer Stadtkanzlei hat sich vor allem Libuše Spáčilová im Umfeld einer<br />
Habilitationsschrift verdient gemacht (SPÁČILOVÁ 1998). Neben Einzeluntersuchungen<br />
zu weiteren städtischen Kanzleisprachen in Mähren (Opava/Troppau,<br />
Moravská Třebová/Mährisch Trübau, Ostrava/Ostrau) wurde<br />
durch die Arbeiten von Lenka Vaňková das Interesse auf die Sprache der<br />
Stadtbücher des Kuhländchens, einer deutschen Sprachinsel im östlichen<br />
Teil Nordmährens zwischen dem Gesenke und den Beskiden am Oberlauf<br />
der Oder, deren Eintragungen im 16. Jahrhundert beginnen, gerichtet<br />
(VAŇKOVÁ 1999).<br />
Am umfangreichsten sind die Forschungen zu den deutschen Kanzleisprachen<br />
in der Slowakei (vgl. GREULE/MEIER 2003), was nicht zuletzt mit<br />
der großen Energie zusammenhängt, die Ilpo Tapani Piirainen mit seinen<br />
Schülern Jörg Meier und Arne Ziegler seit dreißig Jahren auf die dort produzierte<br />
und archivierte gewaltige Textmenge aufwenden (PIIRAINEN<br />
2001). Diesem Engagement ist es auch zu verdanken, dass für die sprachgeschichtliche<br />
Auswertung des slowakischen Materials auch einheimische<br />
Germanistinnen und Germanisten begeistert werden konnten. Dazu gehören<br />
Mária Papsonová (Prešov) und L’udmila Kretterová (Nitra). Ich kann hier<br />
nur ganz punktuell die slowakischen Kanzleiorte und Quellen auflisten, zu<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />
denen bislang Ergebnisse vorliegen: Banská Štiavnica/Schemnitz (Sándor<br />
Gárdonyi, L. Kretterová), Kremnica/Kremnitz (S. Gárdonyi, I.T. Piirainen),<br />
Stadtwissbuch von Smolník/Schmölnitz (S. Gárdonyi), Stadtrechtsbuch von<br />
Žilina/Sillein (I.T. Piirainen, M. Papsonová), Stadtbuch von Krupina/Karpfen<br />
(Karl-Heinz Grothausmann), Stadtbuch Košice/Kaschau (O.R.<br />
Halaga, I.T. Piirainen), Zipser Willkür (M. Papsonová), Glenica/Göllnitz<br />
(Helmut Protze), Bratislava/Preßburg (Rainer Paul, I.T. Piirainen); Stadtbuch<br />
von Švedlár/Schwedler (I.T. Piirainen/J. Meier), Levoča/Leutschau (J.<br />
Meier, I.T. Piirainen), Kežmarok/Käsmark (I.T. Piirainen/A. Ziegler), Lubica/Leibitz<br />
(I.T. Piirainen). (Bezüglich der genauen bibliographischen Angaben<br />
wird auf die Bibliographie zur Kanzleisprachenforschung, von Jörg<br />
Meier und Arne Ziegler, die im 2003 Praesens Verlag Wien erschienen ist,<br />
verwiesen.)<br />
Die geographische und historische Nähe der slowakischen Hauptstadt Bratislava/Preßburg<br />
zu Wien legt es nahe, hier auch die Forschungen zur Wiener<br />
Stadtsprache im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, die vor allem<br />
von Peter Ernst betrieben werden (z.B. ERNST 1994), in das Spektrum der<br />
mitteleuropäischen Kanzleisprachenforschung einzuordnen. – Noch wenig<br />
ist erstaunlicherweise zu den deutschen Kanzleisprachen in Ungarn bekannt.<br />
Den neuesten Stand der Forschung hält Péter Bassola fest (BASSOLA 2001).<br />
Nebst der Erfassung der Kanzleisprache einiger weniger Schreiborte in<br />
Schlesien (vgl. PIIRAINEN 1994) konzentriert sich das Forschungsinteresse<br />
in Polen bislang auf Krakau und Thorn. Im einen Fall führt Józef Wiktorowicz,<br />
im anderen Fall Józef Grabarek die Forschung an (WIKTORO-<br />
WICZ 1981, GRABAREK 1984).<br />
Fast als terra incognita müssten die Kanzleisprachen in den baltischen Ländern<br />
bezeichnet werden, gäbe es nicht einige Untersuchungen zur deutschen<br />
Kanzleisprache in Lettland (vgl. LELE-ROZENTALE 2001). Die Kanzleisprachen<br />
des Baltikums sind im engen Zusammenhang mit der Entwicklung<br />
der in den Kanzleien Norddeutschlands verwendeten Schreibe und des<br />
Übergangs von der (mittel-)niederdeutschen zur hochdeutschen Schreibsprache<br />
(vgl. RÖSLER 1997) zu sehen.<br />
3.2. Zu den linguistischen Analysebereichen<br />
Das oben nur andeutungsweise skizzierte Bild der bisherigen Forschungsaktivitäten<br />
und Forschungsergebnisse nach Regionen vermittelt noch keinen<br />
Eindruck von der Breite der sprachwissenschaftlichen Perspektiven, unter<br />
denen die Kanzleisprachen untersucht wurden und werden. Größte Bedeutung<br />
kommt zuerst einer Reihe von Editionen kanzleisprachlicher Texte zu,<br />
die von Ilpo Tapani Piirainen und seinen Schülern selbst vorgenommen<br />
oder angeregt wurden und erste sprachwissenschaftliche Auswertungen ent-<br />
23
24<br />
Albrecht Greule<br />
halten. Die Kanzleisprache wird sodann auf allen Ebenen der Sprachstruktur<br />
untersucht: im Bereich von Phonologie, Morphologie, Lexik (auch interferenzielle<br />
Lexik), Lexikographie und Semantik, Phraseologie (besonders die<br />
Formeln), Syntax, Stilistik und Pragmatik. Dabei stehen gewissermaßen im<br />
Nachklang zur Frage des Sprachausgleichs Untersuchungen zum Verhältnis<br />
von Lautung und Schreibung in einzelnen Kanzleien rein zahlenmäßig noch<br />
im Vordergrund. In den variationslinguistischen Bereichen liegen Forschungsergebnisse<br />
zu den Schreibdialekten, zur Schreibgeographie ganzer<br />
Regionen wie Mähren (MASAŘÍK 1985), zu einem Atlas frühmittelniederdeutscher<br />
Schreibsprachen (RÖSLER 2000) und zur Rechtssprache vor,<br />
nicht zuletzt auch solche zur Mehrsprachigkeit in Kanzleitexten. Darüber<br />
hinaus gibt es einzelne Ansätze einer regionspezifischen Sprachgeschichtsschreibung.<br />
Auch hier gehört Emil Skála mit einem Aufsatz zu den Anfängen<br />
der deutschen Schriftsprache in der Slowakei (SKÁLA 1983) zu den<br />
Vorreitern.<br />
4. Gegenwärtige Aktivitäten und Forschungsdesiderate<br />
Ein Resümee der beeindruckenden Aktivitäten und Leistungen zahlreicher<br />
Forscherinnen und Forscher im Paradigma Kanzleisprache(n) lässt gleichzeitig<br />
auch die Lücken und Forschungsdesiderate deutlich hervortreten. Es<br />
sind zunächst ‚territoriale‛ Lücken, die es zu füllen gilt. Auf Forschungslükken<br />
zu den Kanzleisprachen des Baltikums wurde bereits hingewiesen. So<br />
gut wie nichts wissen wir von deutschen Kanzleisprachen in Russland und<br />
auf dem Balkan (Rumänien). Auch in Polen klaffen trotz der beachtlichen<br />
Aktivitäten der dortigen Germanisten noch Forschungslücken, z.B. in<br />
Schlesien. Ähnliches gilt für Böhmen, besonders für Nordböhmen. Für<br />
Böhmen ist – nach Auswertung der Archive (vgl. TIŠEROVÁ 2001) –<br />
durchaus eine Mähren (vgl. MASAŘÍK 1985) vergleichbare frühneuhochdeutsche<br />
Sprachgeographie vorstellbar. Auch die Ansätze zu Wörterbüchern<br />
des Frühneuhochdeutschen in der Slowakei und in Ungarn sollten gefördert<br />
werden. Noch kaum in das hier vorgestellte Paradigma sind die Kanzleien<br />
und Kanzleisprachen im westlichen Mitteleuropa integriert. Ferner gilt es in<br />
der Zukunft, das kanzlei-interne Schrifttum (Kanzleibücher u.ä.) auszuwerten,<br />
um noch mehr über die Vorgänge innerhalb von Kanzleien selbst zu<br />
erfahren.<br />
Durch Symposien zu den Kanzleisprachen in regelmäßiger Abfolge (Bydgoszcz<br />
1997, <strong>Regensburg</strong> 1999, Münster 2001, Bochum 2003) mit den entsprechenden<br />
Publikationen, einer Bibliographie und vor allem einem Handbuch<br />
ist die große Gemeinde der Kanzleisprachenforscherinnen und -forscher<br />
mit großem Engagement bemüht, die genannten und weitere<br />
Forschungslücken sukzessive zu schließen. In dem von Albrecht Greule,<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />
Jörg Meier und Arne Ziegler herausgegebenen Handbuch Kanzleisprachenforschung<br />
wird durch die Mitarbeit der namhaften Fachleute der internationalen<br />
Forschergemeinschaft ein umfassender Überblick über Gegenstand,<br />
Geschichte, wissenschaftliche Voraussetzungen und Stand der Kanzleisprachenforschung<br />
geboten. Den Kern darin bilden Überblicke über die Kanzleien<br />
auf niederdeutschem (Kap. V) und hochdeutschem Sprachgebiet (Kap.<br />
VI) sowie über Kanzleien am Rande und außerhalb des geschlossenen deutschen<br />
Sprachgebiets.<br />
Literaturverzeichnis<br />
BASSOLA, Péter (2001): Zur deutschen Kanzleisprache in Ungarn. – In: A.<br />
Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (= Beiträge<br />
zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 189–201.<br />
BENTZINGER, Rudolf (2000): Die Kanzleisprachen. – In: W. Besch u.a.<br />
(Hg.), Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen<br />
Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollst. neubearb. u. erw. Aufl., 2.<br />
Halbbd., Berlin, New York: de Gruyter, 1665–1673.<br />
BESCH, Werner (1967): Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15.<br />
Jahrhundert. München: Francke.<br />
BISTER-BROOSEN, Helga (1999): Beiträge zur historischen Stadtsprachenforschung<br />
(= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 8). Wien:<br />
Edition Praesens.<br />
BOKOVÁ, Hildegard (1998): Der Schreibstand der deutschsprachigen Urkunden<br />
und Stadtbucheintragungen Südböhmens in vorhussitischer Zeit<br />
(1300–1419). Frankfurt/Main: Lang.<br />
EGGERS, Hans (1969): Deutsche Sprachgeschichte III. Das Frühneuhochdeutsche.<br />
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.<br />
ERNST, Peter (1994): Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache<br />
in Wien (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 3). Wien: Edition<br />
Praesens.<br />
ERNST, Peter (1999): Pragmatische Aspekte der historischen Kanzleisprachenforschung.<br />
– In: A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen<br />
Kontext (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition<br />
Praesens, 17–31.<br />
GRABAREK, Józef (1984): Die Sprache des Schöffenbuchs der Alten Stadt<br />
Toruň. Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Pedag. w Rzeszowie.<br />
25
26<br />
Albrecht Greule<br />
GREULE, Albrecht (Hg.) (2001): Deutsche Kanzleisprachen im europäischen<br />
Kontext (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition<br />
Praesens.<br />
GREULE, Albrecht/MEIER, Jörg (Hg.) (2003): Deutsche Sprache in der<br />
Slowakei. Bilanz und Perspektiven ihrer Erforschung. Wien: Edition Praesens.<br />
LELE-ROZENTALE, Dzintra (2001): Die mittelniederdeutschen Texte aus<br />
der Rigaer Ratskanzlei. Forschungsstand, -desiderate, -möglichkeiten. – In:<br />
A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (=<br />
Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 297–<br />
309.<br />
MASAŘÍK, Zdeněk (1966): Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache<br />
Süd- und Mittelmährens. Brno: Opera Universitatis.<br />
MASAŘÍK, Zdeněk (1985): Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in<br />
Mähren. Brno: Opera Universitatis.<br />
MASAŘÍK, Zdeněk (2001): Die Erforschung der frühneuhochdeutschen<br />
Kanzleisprachen in Mähren. Ergebnisse und Ausblick. – In: A. Greule<br />
(Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (= Beiträge zur<br />
Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 75–84.<br />
MEIER, Jörg (1999): Städtische Textsorten des Frühneuhochdeutschen. Die<br />
Leutschauer Kanzlei im 16. Jahrhundert. – In: H. Bister-Broosen (Hg.), Beiträge<br />
zur historischen Stadtsprachenforschung (= Schriften zur diachronen<br />
Sprachwissenschaft 8). Wien: Edition Praesens, 131–157.<br />
MEIER, Jörg (2002): Städtische Kommunikation in der Frühen Neuzeit.<br />
Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Habil.–Schrift,<br />
Universität Bochum, Druck: Frankfurt/Main: Lang (<strong>2004</strong>).<br />
MEIER, Jörg/ZIEGLER, Arne (Hg.) (2001): Deutsche Sprache in Europa.<br />
Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60.<br />
Geburtstag. Wien: Edition Praesens.<br />
PIIRAINEN, Ilpo Tapani (1994): Erforschung deutschsprachiger Handschriften<br />
des 14.–18. Jahrhunderts in schlesischen Archiven in Polen. – In:<br />
Kwartalnik Neofilologiczny 46, 239–250.<br />
PIIRAINEN, Ilpo Tapani (2001): Dreißig Jahre Forschungen an deutschen<br />
Handschriften in der Slowakei. – In: M. Elmentaler (Hg.), Regionalsprachen,<br />
Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess.<br />
(= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 10). Wien: Edition Praesens,<br />
223–239.<br />
Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />
RÖSLER, Irmtraud (1997): Fürstenkanzlei und lokale Domanialkanzleien –<br />
zwei Ausprägungen herzoglichmecklenburgischer Kanzleien im 16. Jahrhundert.<br />
– In: J. Grabarek (Hg.), Deutschsprachige Kanzleien des Spätmittelalters<br />
und der frühen Neuzeit. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane WSP,<br />
143–157.<br />
RÖSLER, Irmtraud (2000): Das DFG-Projekt „Atlas frühmittelniederdeutscher<br />
Schreibsprachen“: Möglichkeiten der namenkundlichen Auswertung<br />
des Quellenkorpus. – In: F. Debus (Hg.), Stadtbücher als namenkundliche<br />
Quelle (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen<br />
der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Einzelveröffentlichung<br />
Nr. 7, Jahrgang 2000). Mainz, Stuttgart: Franz Steiner, 87–105.<br />
SKÁLA, Emil (1967): Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310–<br />
1660 (= Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen). Berlin:<br />
Deutsche Akademie der Wissenschaften.<br />
SKÁLA, Emil (1983): Die Anfänge der deutschen Schriftsprache in der<br />
Slowakei. – In: Festschrift für Laurits Saltveit zum 70. Geburtstag, hrsg.<br />
von J. O. Askedal u.a.. Oslo, Bergen, Tromsö: Universitetsforlaget, 182–<br />
193.<br />
SKÁLA, Emil (1994): Zum Prager Deutsch des 14. Jahrhunderts. – In: U.<br />
Müller u.a. (Hg.), Granatapfel. Festschrift für Gerhard Bauer zum 65. Geburtstag.<br />
Göppingen: Kümmerle, 13–27.<br />
SPÁČILOVÁ, Libuše (1998): Das Frühneuhochdeutsche in der Olmützer<br />
Stadtkanzlei (bis 1550). Eine textsortengeschichtliche Untersuchung und<br />
linguistische Aspekte. Habil.–Schrift Olomouc, Druck: Berlin: Weidler<br />
(<strong>2004</strong>).<br />
TIŠEROVÁ, Pavla (2001): Deutschsprachige Handschriften und Dokumente<br />
des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den böhmischen Archiven. –<br />
In: A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (=<br />
Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 63–73.<br />
VAŇKOVÁ, Lenka (1999): Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des<br />
Kuhländchens (= Sprache – System und Tätigkeit 27). Frankfurt/Main:<br />
Lang.<br />
WIKTOROWICZ, Józef (1981): System fonologiczny języka niemieckiego<br />
kniąg meijskich Krakowa w XIV wieku. Warszawa: Wydwa Uniw. Warszawskiego.<br />
ZIEGLER, Arne (2001): Orte des Frühneuhochdeutschen. Die Kanzlei. – In:<br />
J. Meier, A. Ziegler (Hg.), Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und<br />
27
28<br />
Albrecht Greule<br />
Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag.<br />
Wien: Edition Praesens, 69–85.<br />
ZIEGLER, Arne (2003): Städtische Kommunikationspraxis im Spätmittelalter.<br />
Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Berlin:<br />
Weidler.<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
Mária Papsonová<br />
1. Einleitung<br />
Im vorliegenden Beitrag soll ein Teil des reichhaltigen Namenguts des ältesten<br />
Stadtbuches von Bratislava/Preßburg vorgestellt werden, das vor allem<br />
Eintragungen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts enthält. Wie man<br />
den Begleittexten der 1999 von Arne Ziegler vorgelegten Edition entnehmen<br />
kann, handelt es sich hierbei um den ersten der 221 umfangreichen, in<br />
deutscher Sprache kontinuierlich bis zum Jahr 1938 aufgezeichneten Bände,<br />
die in der Sammlung Actionale Protocollum im Stadtarchiv von Bratislava<br />
inventarisiert sind (ZIEGLER 1999: 15; PIRAINEN 1996: 233).<br />
Mit dem buchstabengetreuen Abdruck des ältesten Stadtbuches wurde der<br />
Forschung nicht nur ein wichtiges sprachliches Zeugnis des Frühneuhochdeutschen,<br />
sondern auch ein unschätzbares Dokument zur mittelalterlichen<br />
Geschichte der Stadt zugänglich gemacht, das Einblicke in Vermögensverhältnisse<br />
und Beschäftigungsbereiche ihrer Bürger ermöglicht und Schlussfolgerungen<br />
über ihre Kontakte zu anderen Städten sowie über die Urbanisierung<br />
dieses bedeutenden Handelsortes ziehen lässt. Neben Kauf- und<br />
Pachtverträgen enthält das Stadtbuch Eintragungen, die über Testamente,<br />
Erbangelegenheiten, Pfändungen und Bürgschaften Auskunft geben, es<br />
kommen aber auch Beschlüsse des Stadtrates über die Bestrafung von Verbrechern<br />
und Übeltätern vor, darüber hinaus sind auch Satzungen von drei<br />
Zünften (Bäcker, Kürschner und Tuchscherer) ins Stadtbuch eingetragen<br />
worden (vgl. ZIEGLER 1999: 16 f.).<br />
Aus diesen Angaben zum Inhalt lässt sich schlussfolgern – und auf diese<br />
Tatsache weist auch Arne Ziegler in der Einleitung zu seiner Edition hin –,<br />
dass der Preßburger Kodex eine Vielzahl an Namen enthält, denn die vor<br />
dem Stadtrat abgeschlossenen, schriftlich nicht nur für die Zeitgenossen,<br />
sondern auch für die Nachkommen festgehaltenen Rechtshandlungen und<br />
Vereinbarungen beziehen sich auf konkrete Personen und Liegenschaften,<br />
die explizit genannt und lokalisiert werden.<br />
Für die Zwecke der vorliegenden Darstellung wurden die zwischen 1403<br />
und 1411 deutsch verfassten Eintragungen der Folien 5 bis 50 exzerpiert. 1<br />
1 Nicht berücksichtigt wurden die Seiten 1–5, deren Texte infolge starker Beschädigung<br />
inhaltlich kaum zu erschließen sind, sowie die im übrigen Textkorpus immer wieder<br />
vorkommenden lateinischen Eintragungen. Die hinter den Beispielen stehenden Ziffern<br />
geben die Folie der Handschrift bzw. – falls auf einem Blatt mehrere Eintragungen stehen<br />
– die Nummer der Eintragung auf jeweiligem Blatt an.
30<br />
Mária Papsonová<br />
Das in dieser Probe enthaltene namenkundliche Material repräsentiert alle<br />
Gruppen von nomina propria, besonders stark sind jedoch die Personen-<br />
und Flurnamen vertreten, während die eigentlichen Ortsnamen vor allem als<br />
Bestandteil von Personennamen (als Herkunftsnamen und fakultative Zusätze)<br />
nachzuweisen sind.<br />
2. Flurnamen<br />
Zu dieser Gruppe werden neben den Benennungen für Örtlichkeiten außerhalb<br />
der Stadt meist auch die Namen von Ortsteilen gezählt, soweit sie nicht<br />
amtliche Geltung bekommen haben (SCHWARZ 1957: 1557). Bei den außerhalb<br />
der Stadt gelegenen Flurteilen handelt es sich fast ausschließlich um<br />
Weinberge, die vererbt, verkauft oder verpfändet werden, in der Stadt selbst<br />
sind oft Häuser Gegenstand analoger Rechtshandlungen. Um dem Bedürfnis<br />
der Orientierung, der Identifizierung und der Individualisierung im Raum<br />
(AGRICOLA et al. 1970: 718) möglichst genau entgegenzukommen, werden<br />
in den Eintragungen des Preßburger Stadtbuches sowohl bei den Flur- als<br />
auch bei den Ortsteilen mehrere Möglichkeiten genutzt.<br />
2.1. Nur selten wird bei der Lokalisierung der Liegenschaft lediglich eine<br />
Bezeichnung angeführt, z.B.:<br />
[ein Weingarten] geleg(e)n Im Pfaff 5/3, an der fuchsleytten 8, auff der Strass 21, dassein drey<br />
weingarten, Der ain ist Der loffler genant, der ander Rassingrab(e)n, der Dritt Smydel 16,<br />
Drey Weingerten, der ain auff dem woczengrunt vnd der ander Inder poshait vnd der drit im<br />
wurczenpach, Vnd ain haus, gelegen auf Tuna newsidel 24, von eins weing(arten) weg(e)n,<br />
gleg(e)n in den pistriczer 36/3, vnder den Kesten pe(u)men 38/1<br />
[ein Haus] pey sand Michels tor 5/2, auff Schöndorff(er) gassen 9/2, vnd(er) der stieg 22/2.<br />
2.2. Viel öfter ist die Lage der Örtlichkeit durch mindestens eine weitere<br />
Angabe, meist aber durch mehrere Zusätze präzisiert. Die Verbindung vor<br />
der Stat zu prespurch (neben: in der Stat zu prespurch) sowie das Wort<br />
newsidel als zweites Glied der Flurbezeichnung (auf Tuna/Tuenaw newsidel,<br />
auf Spytal newsidel) lassen auf Erweiterung der bewohnten Fläche auch<br />
auf den Raum außerhalb der Stadtmauern schließen. Besonders die Lage der<br />
Weingärten auf der Stat gepiet wird genau angegeben: wie bei den Häusern<br />
werden außer dem Flurnamen oft auch die Besitzer der zu beiden Seiten<br />
liegenden Grundstücke (Weinberge, Häuser) genannt: 2<br />
2 Zur besseren Verständlichkeit wurde in den hier zitierten Proben eine Textsegmentierung<br />
vorgenommen. Da in der Handschrift, folglich auch im buchstabengetreuen Abdruck<br />
jegliche Satzzeichen fehlen, ist es oft mühsam, den Sinn des Textes, besonders<br />
die (Verwandschafts)Beziehungen der genannten Personen, zu erschließen.<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
Setzen wir In, dem vorbenanten Jacob Bisschoff all vnser hab, als hernach nemlich<br />
geschrib(e)n stet: zway hewser, glegen zu prespurch in der Stat vnd ligent peyde gegen den<br />
Fleisch penkchen vber zu prespurch, auch vnser weingarte(n), glegen auf der Stat gepiet: der<br />
ayn ligt an der fuchsleyten, zenest Michels des Salcz(er) weing(arten), anderthalb(e)n zenest<br />
des Muln(er) weing(arten) von pistritz; der ander weing(arten) ligt an der Tuenawleiten, gena(n)t<br />
der Tynir, and(er)thalben zenest Merttenis des protess(er) weing(arten; Der Dritt<br />
weing(arten) jn dem wolffleins grunt zenest vn(d) ist genannt der honigler, zenest Moritz des<br />
Kuellen weing(arten); der vierd weingarte(n) hayst der Gern, ze nest dem weg; der fvmft<br />
weing(arten) heyst der weyntegl, zenest eberharts des wynndeks weing(arten); der Sechst heyst<br />
der Mulslag, zenest Hanns Pertolds weing(arten) mit allen den nutzen vnd rechten, di zu den<br />
obgen(an)t(en) Hewsern vnd Weingarten gehorn 40 hat Im […] zu phanndt geseczt einen ledig(e)n<br />
freyn weing(arten), gleg(e)n Jm Kyenolczgreben, zenest der Hawer czech weing(arten),<br />
anderhalb(e)n zenset (‚zenest‘) Vlreichs des Rokkengeribs Weing(arten) 45/2<br />
[ein Haus] geleg(e)n an der wedricz, als man get In dy sudlukken 8, geleg(e)n In der Stat zu<br />
prespurkch, ainhalb(e)n zenest der Stat Mawr, Anderhalb(e)n zenest des prewssen haws 35/3,<br />
glegen zu prespurch vor der Stat auf Spytal newsidel, aintthalben zenest hannsen des marichekker<br />
haws, anderthalb(e)n zenest hanasen der Berberin Svn haws 44/2, ein Halbs haws,<br />
gleg(e)n vor der Stat zu presburch auf Schondorffer gassen, aintthalb(e)n zenest hannsen des<br />
hyerssen haws, anderthalb(e)n zenest Mendleins des wachsgiesserhaws 46/2, jr haws, gleg(e)n<br />
zu prespurch in der Stat, aintthalb(e)n zenest des veytleins haws, anderthalb(e)n zenest Hannsen<br />
des Rosenwerg(er) haws 49/2.<br />
Diesen Beispielen, die nur eine kleine Auswahl des erhobenen Materials<br />
darstellen, ist zu entnehmen, dass zu Beginn des 15. Jahrhunderts wohl die<br />
meisten Weinberge, bei weitem aber nicht alle Teile der Stadt ihren eigenen<br />
Namen trugen. Zu Orientierungszwecken musste deswegen oft die Nachbarschaft<br />
herangezogen werden (pey/vor sand Michels tor, gegen den fleisch<br />
penkken vber, pey dem Nunnen chloster, u. a., am häufigsten einthalben<br />
zenest ... anderthalben zenest …). Dies ist auch in den wenigen Belegen der<br />
Fall, in denen ein Straßenname erscheint – neben der öfter genannten<br />
Schöndorffer gassen ist einmal von der Sluter gassen, einmal von Messer<br />
gessel die Rede – in der Mehrheit der Fälle sind aber auch die zu beiden<br />
Seiten Wohnenden genannt (s. o. 46/2; mehr dazu s. auch Wohnstattnamen<br />
3.2.2). Für Flurteile, die keinen selbständigen Namen tragen, sondern nach<br />
Nachbarschaft heißen, wurde die Benennung ‚Flurbezeichnungen‘ geprägt<br />
(SCHWARZ 1957: 1557; SONDEREGGER 1985: 2071).<br />
3. Personennamen<br />
Im Rahmen dieser Gruppe sollen die im analysierten Textkorpus vorkommenden<br />
Rufnamen (Männer, Frauen) in Bezug auf ihre Herkunft vorgestellt<br />
werden, eingehender werden die männlichen Beinamen als Vorläufer der<br />
späteren Familiennamen behandelt. Diesen Ausführungen muss jedoch vorausgeschickt<br />
werden, dass zum Vergleich neben den verfügbaren theoretischen<br />
Arbeiten (s. Literaturverzeichnis) nur Teilergebnisse ähnlich ausgerichteter<br />
Untersuchungen herangezogen werden konnten (vgl. NAU-<br />
31
32<br />
Mária Papsonová<br />
MAMNN 2000; SPÁČILOVÁ 2000), nicht aber die bestehenden Namenbücher<br />
bzw. etymologische Namenwörterbücher (vgl. FLEISCHER 1964:<br />
194ff.).<br />
3.1 Rufnamen<br />
Das Bild, das die in Preßburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts bezeugten<br />
Rufnamen bieten, entspricht weitgehend dem der Zentralgebiete, in denen<br />
sich im 15./16. Jh. der Wandel von den Namen germanisch-deutscher Herkunft<br />
zu solchen christlichen Ursprungs vollzieht (AGRICOLA et al. 1970:<br />
654 f.; NAUMANN 2000: 21ff.; SEIBICKE 1982: 135). Zwar sind im<br />
Preßburger Stadtbuch noch verhältnismäßig viele altdeutsche Rufnamen zu<br />
belegen (ihr Verhältnis zu christlichen beträgt bei den Männernamen ca. 4 :<br />
5), die Zahl der Namenträger mit den Fremdnamen ist jedoch beträchtlich<br />
höher.<br />
3.1.1 Von den altdeutschen Rufnamen ist Ulrich 3 mit verschiedenen Varianten<br />
am häufigsten zu belegen, ihm folgen Dietrich, Eberhard und Friedrich.<br />
Das Namenzweitglied der dithematischen Formen ist meist erhalten (Gothart,<br />
Leynhart/Lienhard, Wollfhard/Wolffard, Lamprecht), ahd. -rîch(i) erscheint –<br />
dem oberdeutschen Usus der Preßburger Kanzlei entsprechend – auch diphthongiert<br />
(Vlreich neben Vlrich, Heinreich/Heinrich/Hinrych, Dietreich,<br />
Fridreich). Neben diesen Vollformen stehen einstämmige Kürzungen<br />
(Vl/Vll/Wll), Kontraktionen (Erhard/Erhart neben Eberhart) sowie Namenformen,<br />
„die aus Kürzung und gleichzeitiger Erweiterung der gekürzten Form<br />
um ein Wortbildungssuffix hervorgegangen sind“ (SEIBICKE 1982: 128).<br />
Neben Conrad und dessen Varianten Kuncz/Chuncz sind es vor allem Kurzformen<br />
mit kosendem Charakter, wobei als Ableitungssuffix sowohl -(e)l<br />
(Dietl/Dytel, Fridel), als auch -lein (Kunczlein, Mendl/Mendel/Mendlein,<br />
Rudl/Rudel/Rudlein, Vllein/Wllein) nachzuweisen sind. Allerdings lassen sich<br />
die auch in der Funktion des Beinamens (Beispiele s. u. 3.2.1) belegten<br />
Kurzformen zu Mend- (Mand-?, Meind-) ohne einschlägige Literatur nicht<br />
eindeutig einer bestimmten Vollform zuordnen (vielleicht zu dem als<br />
Zweitname bezeugten Rufnamen Manhard/Menhart), das Gleiche gilt für<br />
den zweimal belegten Rufnamen Ernot (zu Gernot?).<br />
Mit diphthongiertem Stammvokal und apokopiert erscheinen je einmal die<br />
monothematischen Rufnamen Brawn (zu Bruno) und Hawg (zu Hugo).<br />
3 Die in der Handschrift sowohl groß als auch klein geschriebenen Personennamen werden<br />
in diesem Teil des Beitrags mit Majuskeln wiedergegeben. Die sonstige Groß- und<br />
Kleinschreibung entspricht der Originalhandschrift (der Edition).<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
3.1.2 Bei Fremdnamen stehen die seit dem 13. Jahrhundert auch in den Zentralgebieten<br />
beliebten Heiligennamen (Johannes, Nikolaus, Martin, Michael,<br />
Petrus, Andreas, Jakob) an der Spitze (AGRICOLA et al. 1970: 655;<br />
SEIBICKE 1982: 135), die der gleichen Abschleifung und Umgestaltung<br />
unterliegen wie die germanisch-deutschen Rufnamen. In größter Belegdichte<br />
und mit den meisten mundartlichen Varianten kommt Johannes vor, verschiedene<br />
eingedeutschte (umgelautete, Kurz- und Verkleinerungs-) Formen<br />
sind aber auch bei anderen „Standardnamen“ zu finden, so z. B.<br />
Francz, Lorencz, Moritz, Mathes, Paulein neben Paul, Jorig/Jorg/Jorgein<br />
(zu Georg). Vereinzelt sind Augustine, Partel (zu Bartholomäus), Gilgein<br />
(zu Ägidius, vgl. FLEISCHER 1964: 61) und Jobst (zu Jodocus, vielleicht<br />
durch Vermischung mit Hiob, vgl. FLEISCHER 1964: 126) zu belegen.<br />
Wie bei den einheimischen Rufnamen kann der Name ein und derselben<br />
Person innerhalb einer Eintragung in mehreren Varianten und in wechselnder<br />
Schreibweise erscheinen – eine relativ einheitliche Schreibung zeigen<br />
nur Michel (6 mal), Simon/Symon (4 mal) und Philipp (2 mal).<br />
Mit dem slavischen Suffix -usch erscheinen vereinzelt (je einmal) die Diminutivformen<br />
von Johannes und Nikolaus. Der im Unterschied zu deutschen<br />
Gebieten öfter belegte Rufname Stephan (5 mal) / Stephel (6 mal) geht<br />
höchstwahrscheinlich auf den ersten ungarischen König und Landespatron<br />
Ungarns zurück. Nachstehend die verschiedenen Schreibungen, Kurz- und<br />
Koseformen der am häufigsten belegten Heiligennamen:<br />
22 Hans/Hanns, 7 Hansel, 5 Hensel, 2 Johan(n), 2 Henslein, 1 Johannes, 1 Janns, 1 Hanslein,<br />
1 Janusch<br />
12 Peter, 7 Petrein, 1 Petrul<br />
5 Nikel, 4 Niclas/Niklas, 3 Nikl, 2 Niklein/Nyklein, 1 Nikusch<br />
4 Mertein, 3 Mert/Mertt, 1 Martine, 1 Mart, 1 Mertten<br />
10 Jacob, 3 Jakel, 1 Jokel<br />
7 Andre, 1 Anderl, 1 Enderll<br />
3.1.3 Auch bei den weiblichen Namen, die jedoch bei weitem nicht so eine<br />
bunte Skala wie die männlichen zeigen, überwiegen wie in den Zentralgebieten<br />
eindeutig verschiedene Varianten der biblischen Namen Katharina,<br />
Elisabeth, Margarethe, Dorothea, Anna und Agnes, zwei Frauen heißen<br />
Kunigund (geschrieben auch Kvnigund, Chunigund, Chwnigundis), vereinzelt<br />
erscheinen Augustine, Christein, Gerdrawt, Percht und Wentel:<br />
14 Kathrey/Katrey, 1 Katherina, 1 Katherine, 1 Katherey, 1 Gotrein<br />
12 Elsbeth/Elsbet, 4 Elspet, 1 Elisabeth, 1 Ersbeth<br />
2 Margret, 1 Margaretha, 3 Margareth, 1 Margeret<br />
3 Dorothee, 2 Dorothea, 2 Dorothe<br />
4 Agnes, 2 Angnes, 1 Angles<br />
33
34<br />
Mária Papsonová<br />
Nicht zu belegen sind die Namen der neuen Kirchenheiligen Joseph und<br />
Maria, die erst seit dem 16. Jh. an Verbreitung gewinnen (vgl. SCHWARZ<br />
1966: 1571; SEIBICKE 1985: 2156) und in der überwiegend katholischen<br />
Slowakei bis zur Gegenwart an der Spitze der häufigst getragenen Vornamen<br />
stehen (vgl. ĎURČO 2003: 137).<br />
3.2 Beinamen<br />
Als Beinamen werden bei geschichtlicher Betrachtung „solche Namen bezeichnet,<br />
die als zweite Namen zu Rufnamen treten, soweit sie noch individuell<br />
sind, d. h. noch nicht vererbt werden.“ (SCHWARZ 1966: 1574). Man<br />
spricht auch von zusätzlichen Namen, Zu- oder Nachnamen (SEIBICKE<br />
1982: 181). Auch wenn sie zusammen mit Rufnamen seit dem späten Mittelalter<br />
zu Familiennamen werden konnten, kann man in den Beinamen der<br />
untersuchten Zeit noch nicht Familiennamen selbst sehen. Wie bei den Heiligennamen<br />
sind auch in der Annahme der Doppelnamigkeit die oberitalienischen<br />
Städte führend. Über Südfrankreich erfasst diese Erscheinung seit<br />
dem 12. Jh. zuerst die großen rheinischen Städte. Im Laufe der folgenden<br />
drei Jahrhunderte wurde von Westen und Süden aus nach Osten und Norden<br />
fast ganz Deutschland davon erfasst (SCHWARZ 1966: 1573ff.;<br />
FLEISCHER 1964: 84 f.).<br />
Die Beinamen werden aus demselben sprachlichen Material wie die späteren<br />
Familiennamen gebildet, setzen also entweder alte Rufnamen fort oder<br />
verwenden die neuen Heiligennamen, sind Übernamen, Herkunfts- und Berufsnamen.<br />
Der Übergang ist fließend und nicht immer kann entschieden<br />
werden, ob es sich noch um einen individuellen Beinamen oder schon um<br />
einen erblichen Familiennamen handelt. Von diesem kann man erst sprechen,<br />
wenn die Erblichkeit feststeht, wenn also Geschwister denselben<br />
Beinamen tragen (AGRICOLA et al. 1970: 659). Dass dies im Preßburg des<br />
beginnenden 15. Jahrhunderts noch nicht immer der Fall ist, bezeugt eine<br />
Eintragung aus dem Jahre 1409, in der zwei Brüder mit verschiedenen unterscheidenden<br />
Zusätzen (Beinamen) erscheinen:<br />
Jt(em), Es sind fur vns kumen der vppig Janns an aym teil, vnser mitpurger, vnd fraw Katrey,<br />
Michels des Salczer witib an dem andern teil [...] nu hat der obgen(an)t vppig hanns gerugt auf<br />
dy selb(e)n weing(arten), di sein pruder Michel Salczer in der gen(an)t(en) fraw(e)n Katrein<br />
gewalt der arbitt hat. Nu hab wir dem egen(an)t(en) hannsen, des Michels prued(er), di vorben(an)t(en)<br />
erib weing(aren) zugesprochen [...] Vnd halber teil derselben weing(arten) den<br />
egen(an)t(en) vppigen hannsen, des egen(an)t(en) Michels prued(er) vnd auf sein erb(e)n. 37/3<br />
Daneben sind aber auch Geschwister mit dem gleichen Beinamen (Herkunft)<br />
nachzuweisen, um Brüder kann es sich auch in zwei weiteren Belegen<br />
(Herkunft, Beruf) handeln:<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
dassy schuldig sind den erb(ar)n Mathesen von Ach vnd Hansen von Ach [...] peyden geprud(er)n<br />
36/2<br />
das sy schuldig sind [...] gotharten von leyskirchen vnd Ernoten, peyde purg(er) zu Koln an<br />
dem Reyn; dy vorben(an)ten cholner 45/1<br />
Hanns Rvsenwerger [...] vnd sein gesell(e)n hanns vnd Fridreich Fleichschhakker 49/1<br />
Wie diese Textausschnitte zeigen, kann dieselbe Person bisweilen verschieden<br />
bezeichnet werden, da dem Schreiber mehrere Möglichkeiten dafür zur<br />
Verfügung standen, nicht nur der Beiname, sondern auch der Beruf, die<br />
Herkunft, das Verhältnis zu einer anderen Person usw.<br />
Man pflegt die Familiennamen einzuteilen in solche (1) aus Rufnamen, (2)<br />
nach der Wohnstätte, (3) nach der Herkunft, (4) nach dem Beruf, (5) aus<br />
Übernamen.<br />
3.2.1 Familiennamen aus Rufnamen<br />
Diese Gruppe von Doppelnamen im analysierten Textkorpus kann folgendermaßen<br />
charakterisiert werden: Bis auf wenige Ausnahmen (Christan/Cristan/Kristan,<br />
Franczel, Petrein) herrschen unter Zweitnamen eindeutig<br />
die germanisch-deutschen Rufnamen vor. Es handelt sich dabei um<br />
solche Namen, die in beiden Funktionen (als Rufnamen und Beinamen)<br />
überhaupt nicht oder nur vereinzelt (so Christan/Cristan/Kristan, Lamprecht,<br />
Mendel) nachzuweisen sind. Beide Namen stehen syntaktisch ungebunden<br />
und werden zuweilen auch zusammen geschrieben, vgl:<br />
Anderl günther vnd all sein Erb(e)n 5/3, der erber man Andregunther, vnser mitgeswarner<br />
Purg(e)r; den obgenante(n) Andre guntther; derselb andreguntther 37/1, Jacob christan; der<br />
vorbenant Jacobchristan/Jacobkristan 33/3.<br />
Wie bei den Rufnamen sind auch in der Funktion des Beinamens Ableitungen<br />
mit -(e)l und -lein beurkundet. Von der Instabilität des Zweitnamens<br />
zeugen verschiedene für dieselbe Person verwendete Varianten wie paul<br />
Mendel; paul Meindel; des egenan(ten) Paul Meindels; Dem selb(e)n paul<br />
Maindlein 7.<br />
Die Zugehörigkeit zu derselben sprachlichen Kategorie (Namenklasse)<br />
kommt auch darin zum Ausdruck, dass beide Glieder des Doppelnamens in<br />
obliquen Kasus dekliniert werden können, wobei der Vorname meist<br />
schwache Formen aufweist, während beim Nachnamen beide Deklinationsweisen<br />
festzustellen sind. Bei mehrmaliger Nennung derselben Person werden<br />
nicht nur die fakultativen Zusatzelemente (Angehörigkeit zur Stadtgemeinde,<br />
Funktion im Ratsgremium, Wohnort etc.), sondern oft auch ein<br />
Glied des Doppelnamens weggelassen:<br />
35
36<br />
Mária Papsonová<br />
Stephel parchtold, vns(er) mitpurg(er) 10/2, zenest hanns perchtholds haws 35/2, zenest Hanns<br />
Pertolds weing(arten) 40/1, zenest hansen des p(er)chtolden weingarte(n) 43, gelten schullen<br />
Hansen perchtolden 31/1<br />
nikl leopold (Nom.); des obgen(an)t(en) Nikl leopolds hausfr(au); dem vorbenante(n) [...] nikl<br />
leopolden 38/1<br />
dem Erb(ar)n Simon Engelbrecht, purg(er) cze chollen; dem vorgena(n)ten Symon Engelbrecht;<br />
dem selb(e)n Symon 31/2, schuldig ist Symon Engelbrechten Kolner; dem [...] Symon<br />
Engelbrechten; dem egen(an)ten engelbrechten; der vorben(an)t Symon engelbrecht 50/2<br />
Jacob wietreich von koll(e)n; dem obgenant(en) wietreich; der selbig Jacob witreich 34/1<br />
Die mit -man als Zweitglied gebildeten Rufnamen und patronymischen Bildungen<br />
(Ableitungen) können dem vorausgehenden Namen mit dem bestimmten<br />
Artikel angeschlossen werden:<br />
der egenant peter herman; petrein den herman (Akk.) 14/1<br />
Jorig Kunczelman von Dynkkelspurch; derselb Jorig Kunczelman; demselb(e)n Kvnczelman,<br />
Jorig genant; wider den obgen(an)t(en) Kunczelman, Jorig genant 42/2, mit dem [...] Jorigen<br />
dem Kvnczelman; mit dem obgen(an)t(en) Jorigen dem Kvnczelman; dem […] Jorgen dem<br />
chvnczelman 42/3<br />
3.2.1.1. Nur mit einem Namen (Rufnamen) treten in analysierten Texten<br />
fast immer die Pfarrer auf, was nach Schwarz (1966: 1575) jedoch nicht<br />
heißen muss, „dass sie keinen Familiennamen geführt haben, sondern dass<br />
dieser nicht als notwendig empfunden wurde, weil die Beisetzung des Titels<br />
genügte.“ Neben der im nachgestellten Zusatz bestimmten Standeszugehörigkeit<br />
wird dem Einzelnamen das Substantiv her(r), zuweilen auch das Adjektiv<br />
erbar vorangestellt. Solche Angaben, die die gesellschaftliche Stellung<br />
der genannten Person ausdrücken (SPÁČILOVÁ 2000: 93), sind als<br />
Titel vor allem bei Personen zu bezeugen, die ein besonderes Ansehen genießen,<br />
wie Bürgermeister und Geschworene (s. o. 37/1), Bischof, Großrat<br />
(s. u. 3.2.4):<br />
her Erhard, des laytner Capplan czu wyenn 5/1, her(r)en Martem, pharrer czu sand Mertem<br />
(Dat.) 5/2, vor ainem Erb(ar)n priest(er), h(err)n lorenczen, phrwentn(er) czu sand lorenczen<br />
Kirchen, seinem peycht vater, vnd vor and(er)n Erbern Hausgenassen 12, Her Stephan, pawmeister<br />
vnd Korherr zu sand mertten Kirichen zu prespurch, auch pharre zu sand Larenzen<br />
daselbs; der obgen(an)t her Stephan 44/2 zenest hern Stephan, dy zeit pharrer zu sand Michels,<br />
weingarten zu prespurch 47/2, Her Stephan, Korherre vnd pharrer zu sant larenczen Kirichen<br />
von der Stat zu prespurch; der egen(an)t her Stephan 48/1<br />
Nur vereinzelt (bei der Lageangabe) erscheint allein der Titel ohne Namen:<br />
cze negst des phaffen auff dem steyg 33/1, zenest des pharrer weing(arten)<br />
vo(n) sand Mertten 37/1.<br />
3.2.1.2 Wenn die Bürger nur mit einem Namen genannt werden (oft ebenfalls<br />
bei Lagenagabe), handelt es sich um seltene Rufnamen, die als erste<br />
Namenbestandteile nicht nachzuweisen sind, vgl.:<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
czwissen Stephel des Ledror weing(ar)ten vnd des p(er)nhartels; wenn dy Runssen (= FlurN)<br />
Stephel den ledrer vnd den pernharden an gehöret 5/3, Jostel, vnser mit gesworen purg(er) vnd<br />
Fraw Anna, sein haws Fraw; dem egenanten Jostel, Irem chan man; der egenant Jöstel; zu<br />
nechst ainthalb(e)n des hartmans weingarten 13, zu nechst des lienhard(e)n hause 26/1, zu nest<br />
des Waczlab(e)n hause 31/1, La(m)precht, vnser mitpurg(er) vnd katherey, sein Hawsfraw;<br />
dem selbig(e)n lamprecht 31/2, ainthalb(e)n zenest des veytleins haws; zenest des Jobsts<br />
weing(arten) 49/2<br />
Nur mit dem Rufnamen erscheint auch der in einer knappen Eintragung auf<br />
Fol. 21 genannte Übeltäter (Mich(el), vor dem selb(e)n Micheln 21/2).<br />
3.2.1.3 Die Sonderstellung der jüdischen Bürger innerhalb der soziologischen<br />
Schichtung des Spätmittelalters zeigt sich auch darin, dass sie keinen<br />
Beinamen tragen. Bei der Erstnennung wird dem Namen immer die Bezeichnung<br />
„Jude“ beigefügt. In diesem Zusammenhang ist jedoch hervorzuheben,<br />
dass bereits das Stadtprivileg für Preßburg aus dem Jahr 1291 eine<br />
Regelung enthält, laut der die Juden den anderen Bürgern gleichgestellt<br />
werden (vgl. ZIEGLER 1999: 10):<br />
czu nechst des Juden heff 11/1, choler, der Jude; der egen(nannte) Jude; der egen(nannte)<br />
koler, der Jude 13, Eysakch von Galicz, der Jwde, Die czeit cze presspurg gesessen; der obgenan(n)t<br />
Eysakch; der selbig eysakch 33/1<br />
3.2.1.4 Zur Unterscheidung zwischen älterer und jüngerer Generation werden<br />
die flektierten attributiven Zusätze alt und jung verwendet. Diese Zusätze<br />
sind aber nicht auf Rufnamen beschränkt; sie können auch vor andere<br />
Personennamen, so vor Berufsbezeichnungen, treten und sind kaum von<br />
Übernamen mit solchen adjektivischen Attributen zu trennen wie lang, wenig,<br />
üppig (SEIBICKE 1982: 185, Beispiele s. o. 3.2 und u. 3.2.5.1). Als<br />
Übernamen werden auch die mit dem Suffix -er der stark flektierten Adjektive<br />
gebildeten Verbindungen (Junker Petrein) gewertet (AGRICOLA et al.<br />
1970: 667):<br />
ainthalb(e)n czu nechst des Jungen Goczen hause vnd anderthalb(e)n czu nechst der Alten<br />
meindlin hause 7, der Alt gotz vnd Jacob göcz, sein Sun, patron der phrwent 14/1, dem alt(e)n<br />
goczen 26/2, der Alt Gebhard; auf den egen(an)t(en) gebharten 44/1.<br />
Aber: von Junkcher pertleins […] gescheft weg(e)n 44/2, zenest Junkcher petreins Haws 47/1<br />
(unflektiert).<br />
3.2.1. Familiennamen nach der Wohnstätte<br />
Beispiele für diese jüngste Namengruppe (AGRICOLA et al. 1970: 679;<br />
FLEISCHER 1964: 160) sind im analysierten Teil des ältesten Stadtbuchs<br />
von Preßburg nur spärlich zu belegen. Beinamen, die die Lage der Wohnstätte<br />
innerhalb der Stadt angeben, enthalten die Präpositionen an und bei,<br />
37
38<br />
Mária Papsonová<br />
die mit ihnen eingeleiteten attributiven Zusätze werden stets mit dem Artikel<br />
verwendet. Rufname + Präp. + Art. + Örtlichkeitsbezeichnung:<br />
hans, der Merteins sun am markcht; der egenant hans, der Merteins sun amb Markcht 11/2,<br />
Partel pey dem vischer türm(e)l vnd Elsbeth, sein hausfraw; vnd hab(e)n In do fur zu phant<br />
gesatzt Ir hause, geleg(e)n pey dem vischer türm(e)l 19/1, Nikusch bey dem tor, vnser mitpurg(er);<br />
der obgen(an)t Nikusch pey dem tor 50/2<br />
Ohne genaue Lokalkenntnis ist jedoch die Zuordnung von manchen<br />
Beinamen (Wohnlage? Herkunft?) kaum möglich, so z. B.: fridreichs von<br />
Scharfenek 11/1, Eberhart wynndek 42/3, eberhart windek, vns(er) mitburg(er)<br />
44/2, hanns vom Dikch; dem obgen(an)t(en) hansen vom Dikch<br />
41/1, Hanns vom Dikch, purg(er) zu Koln am Rein; des Johanns brief vom<br />
Dikch; Johan vom dikch 44/3.<br />
3.2.2 Familiennamen nach der Herkunft<br />
Häufiger zu belegen sind Beinamen, die Zugezogene nach ihrem Herkunftsort<br />
oder -land bezeichnen. In dieser Gruppe sind Namen vertreten, die<br />
auf einen Volks-, Stammes- oder Ländernamen zurückgehen, und solche, in<br />
denen ein Ortsname enthalten ist.<br />
Benennungen, die die Volks- oder Stammeszugehörigkeit enthalten, stehen<br />
im Nominativ syntaktisch ungebunden, in den obliquen Kasus werden sie<br />
dem Rufnamen mit dem Artikel angeschlossen. Der auf Bayern zurückgehende<br />
Name (29/1) erscheint mit dem Diminutivsuffix -l.<br />
Rufname + (Art.) + abgeleitete Personenbezeichnung:<br />
Nikel swab, Elsbeth, sein hawsfraw 20, zu nechst des lorenczen galicz(er) weing(ar)ten 26/1,<br />
Hansel payerl; hens(e)l payerl vn(d) Dorothea, sein(er) hawsfraw güter 29/1, Jacob walich,<br />
vns(er) mitpurg(er); der vorben(an)t Jacob walich; derselb Jacob 38/2, mit Symon dem vng(er)<br />
42/2, wy das er ein haws v(er)chaufft hat [...] philippen dem Behem, vns(er)m mitp(ur)g(er) zu<br />
prespurch, vnd elspeten, seiner hausfr(au) 44/2, Jorig Behem; den oftgen(an)ten Jorigen 46/1,<br />
Fraw Gerdrawt, weylent hannsen des Frankche(n) hausfr(au) 48/2<br />
3.2.3.2 Unter den Orten, die die Herkunft der benannten Person bezeichnen,<br />
überwiegen die mit dem Grundwort -dorf gebildeten Siedlungsnamen, die<br />
sich höchstwahrscheinlich auf das Einzugsgebiet der Stadt beziehen<br />
(SCHWARZ 1957: 1578). Die Herkunftsangabe wird mit der Präposition<br />
von angeschlossen, daneben stehen aber auch die für das Oberdeutsche charakteristischen<br />
Bildungen mit dem Suffix -er (SEIBICKE 1985: 2159;<br />
FLEISCHER 1964: 109 f.), denen in obliquen Kasus der Artikel vorangestellt<br />
wird.<br />
Rufname + von + Ortsname:<br />
philipp von Schroffendorff, ain geswaren purg(er) 5/2, phillip von Scherffendorff; den<br />
egen(anten) philippen von scherffendorff 10/1, Margareth, hanses von Rorenpach hawsfraw<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
15, philippen von Scharffendorff (Akk.) 16, gelt(e)n schull(e)n hansen von Mayncz; dem hansen<br />
von Maincz vnd dem Arkenstein (Wohnstätte?) 17/2, wll von Cusz Vnd chwnigu(n)dis, sein<br />
hausfraw 32, Hawg von Rupperstorff, di zeit gesessen zu Newnwurch marct (Neuenburg ?);<br />
hincz dem egen(an)t(en) hawge(n) 38/2<br />
Rufname + (Art.) + Einwohnerbezeichnung:<br />
Hanns schonndorffer 26/2, von Hinrrych dem Kollner; der Kolner vorgeschrib(e)n 29/1, peter<br />
Redendorff(er) 38/1, zenest hannsen des marichekker haws 44/2, der erber man fridreich haberstorffer,<br />
Vns(er) mitp(ur)g(er) vnd Margret, sein hausfr(au) 45/1, Fraw Dorothee, lorentz<br />
des Rosenwerg(er) witib, vnser mitp(ur)gerinn 47/1, Hanns Rvsenwerger, vns(er) mitpurg(er)<br />
49/1, anderthalb(e)n zenest Hannsen des Rosenwerg(er) haws 49/2<br />
Nur der vereinzelt belegte Ortsname auf -feld steht syntaktisch ungebunden:<br />
(Rufname + Ortsname):<br />
czu nechst hansen sachsenfeld haus 11/1, Hanns Sachssenfeld, vnser mitpurg(er), vnd elspet,<br />
sein hausfraw 36/2.<br />
Mit der Präposition aus wird der Zusatz aus der Schutt verwendet, der nicht<br />
auf einen Orts-, sondern auf einen Raumnamen zurückgeht (Schütt – zwei<br />
Inseln der Donau zwischen Preßburg und Komorn/Komárno): Caspar aus<br />
der Schut; der egen(nannte) Caspar 9/1, zenest pawrn weing(arten) aus der<br />
Schutt 48/2.<br />
Zu belegen sind aber auch Namen, deren formale Zusammensetzung darauf<br />
hindeutet, dass zur Identifizierung der Personen mindestens zwei der genannten<br />
Bildungsweisen verwendet werden (vgl. auch o. dem hansen von<br />
Maincz vnd dem Arkenstein 17/2):<br />
Nikel pechem von Reykendorff(er) vn(d) Agnes, sein hawsfraw; von dem egenante(n) Nikl pechem<br />
vn(d) Agnes, sein(er) hawsfrawen 23, pravn von lechnich Kolner; der praun; dem praun<br />
25/1, praun von lechnich, dem chölner 25/2, Brawn von lachnik, pug(er) cze Kolle(e)n; dem<br />
obgenan(n)t Brawn Koln(e)r; der obgenan(n)t Brwn 34/2, gegen Hanns Trosperch von Nürnwerch;<br />
derselbe Hanns Trosperch 40/1, dem Augustine lebyczer von olmuncz; der vorbenant<br />
augustine 47/2.<br />
Als fakultativer Zusatz sind schließlich die Angaben zur Herkunft – vor<br />
allem bei der Erstnennung der von weit her Stammenden – bei allen Namengruppen<br />
nachzuweisen.<br />
3.2.4 Familiennamen aus Berufsbezeichnungen<br />
Zusammen mit den Übernamen stellen die Charakteristika, die die soziale<br />
(wirtschaftliche, rechtliche) Position einer Person und ihrer Familie innerhalb<br />
der spätmittelalterlichen Gemeinschaft angeben, die umfangreichste<br />
Gruppe der Beinamen dar. Die beurkundeten, oft speziellen Berufsbezeichnungen<br />
zeugen von der hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstufe der Stadt,<br />
die im Mittelalter zu den wichtigsten Zentren des Handels und der hand-<br />
39
40<br />
Mária Papsonová<br />
werklichen Produktion auf dem Gebiet der heutigen Slowakei zählte<br />
(ŠPIESZ 1972: 21).<br />
3.2.4.1 Echte Berufsbezeichnungen bzw. Beinamen, die andere Erwerbstätigkeiten<br />
bezeichnen, können ohne syntaktische Bindung stehen, oft wird<br />
aber auch noch der Artikel gebraucht, der ursprünglich in den appellativischen<br />
Zusätzen dazugehörte. Dieser wird entweder dem Beinamen oder<br />
dem Gesamtnamen vorangestellt. In den obliquen Kasus können beide<br />
Glieder des Doppelnamens unflektiert stehen, in anderen Fällen wird nur<br />
der Rufname (stark oder schwach) bzw. – viel seltener – nur der Berufsname<br />
(wie das entsprechende Apellativum) dekliniert, es sind aber auch Doppelnamen<br />
zu belegen, deren beide Glieder die starken Genitivflexive aufweisen:<br />
Rufname + Berufsbezeichnung:<br />
von des egen(anten) hansen waldchnecht wegen 12, peter Drescher vnd Chwnigund, sein<br />
hawsfraw 14/2, hans mülier 21, Stephel pinter vnd Agnes, sein hawsfraw 22/2, zu nechst paul<br />
fleischhakker wein(ar)ten 29/1, Lamprecht gurteler; der selbig lamprecht 34/1, Stephan puchler<br />
Vnd Jacob hawer 36/1, Michel Hamwot, vnser mitpurg(er) 39/2, zenest Michels Salcz(er)<br />
weingarte(n) 43, zenest Niklas des alt(e)n wagn(er) haws, anderthalb(e)n zenest Desselb(e)n<br />
Niklas wagn(er) Sun haws 50/1 u. a. m.<br />
(Art.) + Rufname + (Art.) + Berufsbezeichnung:<br />
der Erber man Dyetreich der lainwoter; des egen(anten) Dytel lainwoter 5/1, Mendel der<br />
wachsgiesser; dy fraw Kathrey, des Mendel wachsgiesser hausfraw 9/2, zu nechst hansen des<br />
mülner weingarten 13, herre hans der maurer; der egenant Hans(e)l Nepawer; hansel den<br />
Nepaw(er) 14/1 pet(er) pawer; der pet(er) pawer; czissen (‚zwischen‘) hansen kerner hause<br />
vnd peter pawern hause 29/2, Lamprecht der peysser 35/2, Stephan Wotzner, des egen(anten)<br />
hannsen des Wotzner vater 38/1, aber auch: cze nagst des leynharts waltknechts weingart(e)n<br />
32, czu nechst Mertts des smides weing(ar)ten 22/1.<br />
Wie in anderen Gruppen werden dem Doppelnamen bei der Erstnennung oft<br />
auch fakultative Herkunftsangaben nachgestellt:<br />
Andre der pletner von wyenn vnd Fraw Elsbeth, hanses des waldchnecht, dem got genade<br />
witibe; der egenant Andre pletner 12 Jakob cholbel von gmunden 17/3, hincz hansen haymwach<br />
kolner; derselb Hanns haymwach; vber desselb(e)n hansein des haymwachs geltschult<br />
39/1, hanns heymwach Koln(er); der vorbenant hanns heymwach 41/2, vlreich fleischhakker<br />
von Schakkenstorf; der erber man Rudel pawr, weylent gesessen zu Schakenstorff 39/2.<br />
(Der in zwei Eintragungen bezeugte Zweitname heimwach könnte als<br />
‚Dorfwächter‘, aber auch als ‚Dorfbach‘ gedeutet werden, das letztere würde<br />
demnach eher auf eine Wohnstätte hinweisen.)<br />
Mit Hilfe von solchen Zusätzen werden auch die Besitzer der in der Stadt<br />
bzw. ihrer nächsten Umgebung gelegenen Mühlen unterschieden, vgl. zenest<br />
des Muln(er) weing(arten) von pistritz 40/1, 43 (in beiden Eintragun-<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
gen identisch!), petrvl mulner von musschans dorff 47/1. Davon, dass die zu<br />
Beginn des 15. Jahrhunderts in Preßburg als Beinamen verwendeten Berufsbezeichnungen<br />
eher noch an die einzelne Person und ihre jeweilige Berufstätigkeit<br />
gebunden sind, zeugt auch das auf fol. 21 verzeichnete geschefft,<br />
Ddas hans mülier dem got genade getan hat […] It(em) seinen<br />
chindlein czwain hat er geschafft di mul der weydricz sowie czway tail an<br />
der Tunaw mül vnd den dritten tayl seiner hawsfrawen.<br />
Umgekehrt kann zur Unterscheidung von zwei Personen mit demselben<br />
Beinamen der Beruf als zusätzliche Angabe appositionell nachgestellt werden:<br />
wl kolman, der Visch(er) 30/2, fraw Angles, des alten Kolman, des<br />
pekchen, hausfraw 40/2.<br />
Stellvertretend für weitere zahlreiche Berufe und Berufsbezeichnungen, die<br />
im ältesten Stadtbuch von Preßburg nachzuweisen sind, sollen hier noch<br />
diejenigen Beinamen genannt werden, die mit dem Weinbau und Weinausschank<br />
zusammenhängen und auf die Bedeutung dieser Erwerbstätigkeit in<br />
der Stadt hinweisen:<br />
paul spicz(er) (mhd. spitzer = der die Weinbergpfäle zuspitzt) 6/1, Hanns Dauher 17/2, Vlrich<br />
der dawher 32, Vlrich dawher, vnser mitpurg(er) 39/1, vll Dawher, vnser mitp(ur)g(er) 40/1,<br />
der vorbenant vlreich dawher 43 (mhd. den wîn dûhen = keltern), hans der leitgob; hansen<br />
dem leitgeb 33/2 (mhd. lîtgebe = Schenkwirt), vlreichs [...] des Hongler 36/2, zenest Hannsen<br />
Des Hengeweyner Weing(arten) 46/2 (mhd. hengeler = Weinziher, Weinruffer, Hengler), Peter<br />
weynwachter, vns(er) mitwoner 47/2.<br />
Bei hochgestellten weltlichen und geistlichen Personen wird in der Funktion<br />
des Beinamens das ausgeübte Amt angegeben. Dies betrifft zwei in den Eintragungen<br />
wiederholt als Gläubige auftretende, aus Köln stammende Patrizier,<br />
deren Namen bei der Erstnennung Adjektive und Substantive vorangestellt<br />
werden, die Ehrerbietung ausdrücken. Der fakultative Zusatz zur<br />
Herkunft wird entweder mit den Präpositionen von und zu angeschlossen<br />
oder durch eine Ableitung mit -er ersetzt:<br />
dem Erb(ar)n man Cristan Grossrat, purg(er) zu Chölln an dem Reyn; der egen(nannte) Cristan<br />
19/1, Cristan grossrat, Dem Chölner; der egen(nannte) Cristan 22/1, dem Erb(ar)n<br />
man(n)e Cristan Grossratt, purg(er) von Chollen; der obgena(n)te Cristan greissratt 32;<br />
Jacob Bisscholff von Koln; der obgenant Jacob Bisscholff; derselb Jacob 40/1, dem erbern<br />
mann Jacoben dem pisscholff, p(ur)g(er) zu Koln; derselb Jacob pisscholff 43<br />
3.2.4.2 Zu dieser Gruppe von Beinamen gehören auch die spärlich bezeugten<br />
mittelbaren (metaphorischen, metonymischen) Berufsbezeichnungen wie hansel<br />
molfleysch 14/1, hans(e)l Sygel 14/2 Stephan Spendlein 36/1, fraw Anna,<br />
Seydleins von weyden Witib 48/1, Seydlglymph, vns(er) mitp(ur)g(er) 49/1<br />
sowie der einzige in zwei Eintragungen des analysierten Materials anzutreffende<br />
Satzname: hans eylaussemrokch 33/2, zenest Joh(a)ns des eylausdem<br />
Rokchs haws 47/1.<br />
41
42<br />
Mária Papsonová<br />
Übrigens könnte man die mittelbaren Berufsnamen durchaus auch der<br />
Gruppe 5 zuschlagen: So wie die Übernamen machen sie deutlich, „wie sehr<br />
die Namengebung – oder besser: die Fixierung einer Bezeichnung als Name<br />
für eine Person und deren Familie – von der umgebenden Gemeinschaft<br />
abhing oder zumindest mitbestimmt wurde.“ (SEIBICKE 1982: 191 f.).<br />
3.2.5 Familiennamen aus Übernamen<br />
Sehr bunt ist die Gruppe der Beinamen, die ursprünglich den heutigen<br />
Spitznamen entsprechen und dem Menschen nach seinen auffallenden körperlichen<br />
oder geistigen Eigenschaften von seinen Mitbürgern gegeben<br />
wurden. Bei den dafür benutzten Wortarten überwiegen Substantive und<br />
Adjektive.<br />
3.2.5.1 Die Adjektive werden sowohl attributiv als auch – mit Substantivierung<br />
– in appositioneller Nachstellung mit dem Rufnamen verbunden, wobei<br />
in beiden Positionen auch der Artikel stehen kann. In den obliquen Kasus<br />
flektiert das Adjektiv schwach, nur vereinzelt sind auch unflektierte<br />
oder starkflektierte Formen nachzuweisen.<br />
Adj.–attribut + Rufname:<br />
dy im (nun?) des langen hansleins, des fleysch hakker von Turnaw hawsfraw ist 7, zu nechst<br />
[...] des swarczen wllein weing(ar)ten 20, der wenig hans(e)l; dem wenig(e)n henslein 30/1,<br />
der oftgenant wenig Rudl; hintz dem egenante(n) rudlein dem wenigen 37/1, vppig Janns; den<br />
egen(an)t(en) vppigen hannsen (Dat.) 37/3, dem Schonn Jacobn von wienn 48/2<br />
Rufname + Apposition:<br />
di Nu hansel des slechtn hawsfraw ist 19/2, anderthalben des Jorgen Froleich weingarte(n)<br />
26/2, hanns Swynden, purg(er) zu Koln am Rein (Dat.) 40/1, zenest Moritz des Kuellen<br />
weing(arten) 40/1, zenest Moritzen des chuellen weingarten 43, Hanns Swynnd Kolner; demselben<br />
Hanns Swinden 43, frawn angnesen vater, genant Hanns vneer, vnderkeuffel zu wienn<br />
37/1, Hanns Kraws, vns(er) mitp(ur)g(er) 45/2, zenest Hanns Reynes weing(arten) 46/2<br />
Stets mit Artikel und unflektiert ist das Stoffadjektiv gulden bezeugt:<br />
der Gulden Jorig; der gulden jorig 32, zenest Jorgein des guldein weingarte(n) 36/1, am Andern<br />
teil des guld(en) Jorgeins weing(arten) 37/1.<br />
Nur in appositioneller Nachstellung erscheint das ursprüngliche Partizipium<br />
unverricht:<br />
Hans vnu(er)richt 9/2, cze nagst des vnu(er)richts wey(n)gart(e)n 32.<br />
Sowohl auf ein Adjektiv als auch auf ein schwaches Maskulinum kann der<br />
Zuname Czach (mhd. zâch) zurückgehen: Michel, Des czachen sun von posing;<br />
der egen(nannte) Mich(el) czach, dem […] Micheln Dem czachen 8.<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
3.2.5.2 Unter den als Übernamen beurkundeten Substantiven sind sowohl<br />
Simplizia als auch Ableitungen und Zusammensetzungen vertreten. In den<br />
meisten Fällen werden sie dem Rufnamen syntaktisch ungebunden und unflektiert<br />
nachgestellt, Bildungen wie Stawenantel 22/1, des kaczrwdleins 32,<br />
Hupphel Janusch 35/3, schad enderll/schadenderll 36/3 stellen eher eine<br />
Ausnahme dar:<br />
Reindel der Sneknoll 6/1, hans paskert von chrachau 10/1, der Erber man Vlr(ich) Rauhenworter,<br />
vns(er) Stat Richter; des egen(anten) Vlr(ich) Rauhenworter 10/2, petrein dem hayden 13,<br />
lorencz kappfar 15, hans(e)l Rauhenworter; Elsbeth, die hansel den Rauhenworten zu ainem<br />
chan man gehabt hat 16 (auch 15, 41/1), dem Erb(ar)n man Niclasen dem hundler vnd […]<br />
petrein dem list 11/1, vlr(ich) Kyczmag(e)l 16, 17/1, von peter czetswasser 18/1, dem […]<br />
Mendlein dem Munklein 24, Vlreich Rokkengarb 25/2, dem Erb(ar)n man Mertein dem protess(er)<br />
26/1, des Nikel lamp Witib 30/1, Stephel polpparcz 30/2, hanns straubenpart 31/1<br />
Jacob frawnkind 36/1, Conrad Kyczmagen, di zeit p(ur)germeist(er) 4l/1, Niclas dem pleykroph<br />
42/1, Vlreichs des Rokkengeribs Weing(arten) 45/2, Pet(er) Munich, vns(er)<br />
mitp(ur)g(er) 46/1, zenest hannsen des hyerssen haws 46/2, zenest Nykleins des fullenwolfs<br />
haws 48/1, zenest Michels des Varbueben weing(arten) 49/1 u.a.<br />
Nur vereinzelt ist die Ableitung mit -man (And(re) trautman 15), eine adverbiale<br />
Fügung (zenest des vornneben weing(arten) 46/2) bzw. Satznamen<br />
(Rantschaus 6, Vlreich vanh(er)nwinter 33/1) nachzuweisen, wobei sich bei<br />
dem letztgenannten Beleg auch um einen Herkunfts- oder Wohnstattnamen<br />
handeln könnte. Das gleiche gilt für Beinamen wie Johannes Schachen<br />
(Gen.) 15, Ffrancz lindel 26/1, Steph(e)l wisenring 30/1.<br />
In anderen Fällen können wiederum ein Berufsname und ein Übername<br />
konkurrieren, so z. B.:<br />
hansen dem lachwtel 5/2, hansen dem lachutel 11/1, cze negst des lachhwtleyns haws 33/1<br />
pet(er) aysfandel 9, der Störenvogel czu sand Merteins Kirch(e)n 11/2, Vlreich härtel / vlr(ich)<br />
hart(e)l 23, heinr(ich) Rek von Nürenberg 25, Mert Wadelsnitz(er); vll Smelczel 41/3,<br />
Heinr(ich) dem Fikelscherer, purg(er) zu Nurnwerch 49/1.<br />
Der eindeutigen Erklärung entziehen sich auch Namen wie vlrich, des Schekenhon(er)<br />
Svn von Regenspurgkch 17/3, Jacoben dem oberhoner, Burg(er)<br />
zu Regenspurkch 35/2 u. a. m.<br />
Auch wenn manche Erklärung im gegenwärtigen Stadium noch offen gelassen<br />
werden muss, bestätigen bereits die ersten Untersuchungsergebnisse die<br />
bekannte Tatsache, dass Stadtbücher eine einmalige Quelle für historisch<br />
ausgerichtete onomastische Forschungen darstellen. Das im ältesten Stadtbuch<br />
von Preßburg erhobene Namenmaterial zeichnet sich durch eine große<br />
Variabilität und durch Konkurrenzen verschiedener Art aus. Es zeugt davon,<br />
dass sich im Preßburg des angehenden 15. Jahrhunderts die Zweinamigkeit<br />
durchsetzt, die Beinamen sind jedoch noch nicht fest. Einen über-<br />
43
44<br />
Mária Papsonová<br />
zeugenden Beweis dafür, dass die eigentliche Identifikationsfunktion immer<br />
noch dem Rufnamen zukommt, bringt eine Eintragung auf fol. 18: Der<br />
Mann, der Nikel hieß, sich aber Hensel genannt hat, wird u. A. dafür bestraft,<br />
dass er seinen (Ruf)Namen willkürlich geändert hat. Anstelle des<br />
Beinamens steht einmal ein Rufname (Pal) mit der Herkunftsangabe, einmal<br />
sein Beruf (dies ergibt sich eindeutig aus dem Text; mhd. nâchrichter –<br />
Scharfrichter, Henker; Scherge, Gerichtsdiener), bei dritter Nennung wird<br />
lediglich der Herkunftsort angegeben:<br />
Vonn hensel des Nachrichter weg(e)n, der sich Nikel pal hayst von sigerhartsdorff.<br />
It(em) wir hab(en) Nikel von Sigharczdorff Jn vnser fenknucz gehabt Dar vmb, Das er sich<br />
hensel genennet hat vnd hat gefangen aus gelassen vnd hat sein frumes weib siczen lassen Jn<br />
vns(er) Stat vnd hat offenleichen pey den hurren gewaltiget […] Auch hat er an vnsern will(e)n<br />
di lewte gemaulpaut, geslag(e)n vnd wbel erczogn noch seinem muet wider recht.<br />
Literatur<br />
AGRICOLA et al. (1970): Die deutsche Sprache – Kleine Enzyklopädie.<br />
Hrsg. von E. Agricola, W. Fleischer, H. Protze unter Mitwirkung von W.<br />
Ebert. 2. Band (6. Deutsche Namenkunde). Leipzig: VEB Bibliographisches<br />
Institut, 647–684.<br />
ĎURČO, Peter (2003): Deutsche Familiennamen in der Slowakei oder was<br />
kann ein elektronisches Namenkorpus der Anthroponymieforschung anbieten.<br />
– In: A. Greule, J. Meier (Hrsg): Deutsche Sprache in der Slowakei.<br />
Wien: Edition Prasens, 137–146.<br />
FLEISCHER, Wolfgang (1964): Die deutschen Personennamen. Geschichte,<br />
Bildung und Bedeutung. Berlin: Bibliographisches Institut.<br />
KOSS, Gerhard (2002): Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik.<br />
Tübingen: Niemeyer.<br />
NAUMANN, Horst (2000): Eigennamen im Frühneuhochdeutschen in<br />
Grimma. – In: Germanistisches Jahrbuch Ostrava/Erfurt (Literaturwissenschaft,<br />
Linguistik, Publizistik). Ostrava: Universitas Ostraviensis Facultas<br />
Philosophica, 19–25.<br />
PIIRAINEN, Ilpo Tapani (1996): Das älteste Stadtbuch von Preßburg/Bratislava<br />
aus den Jahren 1402–1506. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen<br />
in der Slowakei. – In: Neuphilologische Mitteilungen 2 XCVII.<br />
Helsinki, 231–236.<br />
Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />
SCHWARZ, Ernst ( 2 1966): Orts- und Personennamen. – In: Deutsche Philologie<br />
in Aufriss. Hrsg. von W. Stammler. Berlin: Erich Schmidt Verlag,<br />
Sp. 1523–1598.<br />
SEIBICKE, Wilfried (1982): Die Personennamen im Deutschen. Berlin/New<br />
York: de Gruyter.<br />
SEIBICKE, Wilfried (1985): Überblick über Geschichte und Typen der<br />
deutschen Personennamen. – In: W. Besch, O. Reichmann, S. Sonderegger<br />
(Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen<br />
Sprache und ihrer Erforschung. 2. Teilb. (Handbücher zur Sprach- und<br />
Kommunikationswissenschaft 2.2). Berlin, New York: de Gruyter, 2148–<br />
2163.<br />
SONDEREGGER, Stefan (1985): Terminologie, Gegenstand und interdisziplinärer<br />
Bezug der Namengeschichte. – In: Handbücher zur Sprach- und<br />
Kommunikationswissenschaft 2.2. Berlin, New York: de Gruyter, 2067–<br />
2087.<br />
SPÁČILOVÁ, Libuše (2000): Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern.<br />
Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren<br />
1416–1566 (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 9). Wien: Edition<br />
Praesens.<br />
ŠPIESZ, Anton (1983): Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku<br />
[Handwerke, Zünfte und Manufakturen in der Slowakei]. Martin: Osveta.<br />
45
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
(Bor u Tachova)<br />
Hildegard Boková<br />
1. Einleitung<br />
In seiner Untersuchung des Egerer Urgichtenbuches schreibt der Jubilar<br />
Emil Skála auf S. LI der Einleitung:<br />
[...] daß [...] Orte in der Tschechoslowakei, große und kleine, im frühneuhochdeutschen Mosaik<br />
zum Gesamtbild dieser Epoche der deutschen Schriftsprache erheblich beitragen können.<br />
Die Tschechoslowakei ist für das Frühneuhochdeutsche ein ideales Land der Mitte zwischen<br />
dem Norden und Süden mit einer dynamischen Entwicklung. (SKÁLA 1972)<br />
Diese Feststellung, inzwischen vielfach bestätigt durch zahlreiche Untersuchungen,<br />
wollen wir erneut bekräftigen, indem wir versuchen, dem oben<br />
genannten Mosaik ein weiteres Steinchen hinzuzufügen.<br />
Gegenstand der vorliegenden Sprachanalyse ist die erst vor kurzem bekannt<br />
gewordene Aufzeichnung der Gerichtsordnung aus dem Jahre 1581 für die<br />
unweit der bayerischen Grenze gelegene westböhmische Stadt Haid (Bor u<br />
Tachova). Die sprachliche Untersuchung der Gerichtsordnung von Haid<br />
erscheint uns deswegen nützlich, weil sie ein amtliches Dokument aus einem<br />
kleinen Ort bearbeitet, der nahe der Stadt Eger/Cheb liegt, deren<br />
Schreibsprache im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit Emil<br />
Skála mehrere Untersuchungen gewidmet hat.<br />
Die Stadt Haid gehörte seit den ersten historischen Erwähnungen im 13.<br />
Jahrhundert dem westböhmischen Herrengeschlecht derer von Schwanberg,<br />
die sie bis zum Jahre 1650 besaßen. Der Ort verdankte seine Prosperität der<br />
günstigen Lage an der Handelsstraße zwischen Nürnberg und Prag. 1 Die<br />
Herren von Schwanberg verliehen ihrer Stadt im Laufe der Jahrhunderte<br />
mehrere Privilegien, von denen die ältesten lateinisch geschrieben waren,<br />
seit dem 16. Jahrhundert deutsch. 2 Die Wahl der deutschen Sprache berücksichtigte<br />
vor allem die deutschsprachige Bevölkerung der Stadt; die weit<br />
verzweigte Familie der Herren von Schwanberg war (trotz ihrem im 13. Jh.<br />
angenommenen modischen deutschen Namen) tschechisch, aber seit dem<br />
16. Jh. haben sich einige ihrer Zweige germanisiert.<br />
1 Die Geschichte von Haid fassen BAHLCKE/EBERHARD/POLÍVKA (1998: 183–184),<br />
in aller Kürze übersichtlich zusammen, dort auch weiterführende Fachliteratur.<br />
2 Verzeichnis und Inhalt (stellenweise auch Wortlaut) der Privilegien für Haid siehe bei<br />
SCHMIDT (1929). Das Original der Gerichtsordnung von 1581, das nach ihrem Wortlaut<br />
von den Ausstellern besiegelt wurde und also eine ähnliche Form wie die übrigen<br />
Privilegien hatte, ist wohl verschollen, denn die genannte Studie erwähnt es nicht.
48<br />
Hildegard Boková<br />
Die fast zeitgenössische Abschrift des nicht erhaltenen Originals der Gerichtsordnung<br />
für Haid aus dem Jahre 1581 wurde erst 2002 entdeckt. In<br />
diesem Jahr wurden alte Drucke aus dem Stadtmuseum von Netolitz (Netolice)<br />
als Dauerleihgabe zur sachgemäßen Bearbeitung und Aufbewahrung<br />
der Südböhmischen Wissenschaftlichen Bibliothek Budweis (Jihočeská vědecká<br />
knihovna v Českých Budějovicích) anvertraut; sie werden jetzt in<br />
ihrer Zweigstelle für historische Bücherfonds in Goldenkron (Zlatá Koruna)<br />
aufbewahrt. 3 Das untersuchte Konvolut, in dem sich die Gerichtsordnung<br />
befindet, trägt hier die Signatur 1 NE R 153. Die Grundlage des Konvoluts<br />
bildet der Druck Das Behmische Rechtt. Wie dasselbe in des Königreichs<br />
Beheim Neüen Stadt Prag in vblichem Brauch gehalten wirdt, Kurtz vnd<br />
rund, auch in ordentlichen Titeln verfasset vnndt verteutschett. Jetzo Zů erst<br />
in offnen druck ausgegeben, Leipzig 1607. Es handelt sich um die deutsche<br />
Übersetzung des bekannten tschechischen Rechtsbuches von Pavel Kristián<br />
von Koldín Práva městská království českého [Die Stadtrechte des böhmischen<br />
Königreichs] Praha 1579. Vor dem Titelblatt des Buches ist die behandelte<br />
Gerichtsordnung eingebunden, nach dem Ende des Buches folgen<br />
weitere eingebundene juristische Dokumente. 4 Der ganze Band diente offensichtlich<br />
amtlichen Bedürfnissen der Stadt als ein Werk, in dem alle<br />
wichtigen Gesetze, gedruckt oder handschriftlich, vereinigt waren und so<br />
zur Verfügung standen. In der rechten unteren Ecke des Druckes befindet<br />
sich der Besitzervermerk ‚Thom. Fabri Tach‘, die Eintragung auf der Rückseite<br />
erhellt die weiteren Schicksale des Buches:<br />
Dieses Buch habe ich vndersunterschriebener nach h. Thomae Fabri seel. Todt zu Tachau von<br />
gesambten Mattheßerischen Erben, bey gehaltener Abtheilung, neben andern büchern mehr,<br />
vor meine grosse gehabte mühewaltung, verehrt bekommen, den 6. May Ao. 1622. Johann<br />
Subeck Stadtschreiber zur Heyd mp.<br />
3 Die Verfasserin des vorliegenden Beitrags bedankt sich herzlich bei der Leitung der<br />
Südböhmischen Wissenschaftlichen Bibliothek, insbesondere bei Herrn Mgr. Jindřich<br />
Špinar, dass er sie auf diesen interessanten deutschen Text aufmerksam machte und sein<br />
Studium ermöglichte.<br />
4 Zuerst folgt auf nur modern mit dem Bleistift nummerierten Seiten 1–18: „Erbeinigung<br />
zwischen der Cron Böhem vnnd Chur Pfaltz auffgericht vnnd Renouirt den 28. Novemb.<br />
Anno Christi 1595“, die Seite 19 ist leer, auf S. 20–35 steht (mit einer anderen<br />
Hand geschrieben) „Extract Oder: Auszug allerley Straffen vnnd Peenen, aus der<br />
Landsordnung der Cron Böheimb, so im 1589. Jahr ausgangen“, auf S. 36–54 „Patientia.<br />
Auszug Allerley Strafen vnnd Peenen aus den StadtRechten dess Königreichs Böhem.<br />
1577.“ (mit der gleichen Hand wie das vorherige Stück) und anschließend auf folgenden<br />
62 Blättern „Der. Röm.Key. auch zu Hungarn vnd Böheimb etc. Königl.<br />
Meyestet. Ferdinandi des Dritten Uber der Neuen Landes Ordtnung des Königreichs<br />
Böheimb Publicirte Königliche Declaratorien Vndt Nouellen. M.D.C.XXXX.“, wobei<br />
das Register zu diesem Werk sich auf dem Rückendeckel des Konvoluts befindet.<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
Die Hand dieses Schreibers findet sich in den handschriftlichen Teilen des<br />
Konvoluts sonst nirgendwo. Ob die Vereinigung von Abschriften der<br />
Rechtsdokumente und des Buches in mehreren Etappen oder, und das<br />
scheint uns wahrscheinlicher, auf einmal erfolgte, lässt sich nicht feststellen;<br />
frühestens ist dies in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts geschehen,<br />
weil das letzte eingebundene Stück sich auf die Zeit nach 1640 bezieht.<br />
Möglicherweise handelte es sich um Schriftstücke, die in der Stadtkanzlei<br />
bereits früher vorhanden waren und nun im Konvolut vereinigt wurden.<br />
Wie es im Text (S. 3) heißt, ist die Gerichtsordnung von „Hannß Georg<br />
Herr Von Schwamberckh, auff RansPurckh, Haeydt, Worlieckh, Röm. Kay.<br />
May. H. Rath, Vnnd Herr Hannß Wilhelmb auch Von Schwamberckh, auf<br />
Haeydt. Klingenberckh. vnd Gesterscham, haubtman deß Pulsner Craeiß“<br />
herausgegeben worden. Es handelt sich um Johann Wilhelm I. /Jan Vilém I.<br />
(† 1590) aus der Hauptlinie der Schwanberger (die Linie von Haid/Bor) und<br />
um Johann Georg/Jan Jiří († 1617) aus der Linie von Ronsperg/Poběžovice.<br />
5 Die Datierungsformel „So beschehen Donnerstag nach S. Andarey<br />
[!] des Heilligen Apostils in 1581 Jahrß“ bereitet einige Schwierigkeiten,<br />
die jedoch für die sprachliche Untersuchung nicht relevant sind. 6<br />
Die Gerichtsordnung von 1581 umfasst insgesamt 14 unnummerierte, von<br />
einer einzigen Hand geschriebene Seiten des Folioformats. Die Seitenzählung<br />
ist modern, mit Bleistift durchgeführt. Die Seiten 1–2 bringen kurze<br />
Inhaltsangaben der 38 Punkte der Gerichtsordnung, sie selbst folgt auf S. 3–<br />
16. Der Charakter der Schrift sowie die Verwendung von Majuskeln und<br />
Minuskeln weisen auf eine Entstehungszeit der Abschrift an der Wende<br />
vom 16. zum 17. Jh. hin. Es ist nicht eindeutig klar, ob die am linken Rand<br />
der Seite 14 von der gleichen Hand geschriebene Jahreszahl 1619 mit dem<br />
Jahr der Entstehung der Abschrift in Zusammenhang steht.<br />
Die Gerichtsordnung für Haid enthält insgesamt 38 nummerierte Artikel,<br />
die einmal die Machtbefugnisse des Richters betreffen und einige Schwurformeln<br />
bringen, zum anderen Strafen für gängige Gesetzesübertretungen<br />
sowie für Verbrechen (aus dem Text ist ersichtlich, dass die Stadt Halsgerichtsbarkeit<br />
hatte) festlegen.<br />
5 Die Stammbäume der Schwanberger Linien siehe bei BĚLOHLÁVEK (1985: 462–<br />
466). Schmidt (1929: 12) verzeichnet nur den Stammbaum der Haidaer Linie.<br />
6 Im Jahre 1581 fiel der Andreas-Tag (30. November) auf einen Donnerstag<br />
(GROTEFEND 1922/1984: Kalendertafel Nr. 5, 146–147). Deshalb ist die im Text vorkommende<br />
Formulierung „beschehen Donnerstag nach S. Andarey (!) des Heilligen<br />
Apostils in 1581“ kaum korrekt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass hier die auf den 9.<br />
Mai fallende Translatio dieses Apostels (GROTEFEND 1922/1984: Namenregister 33)<br />
gemeint war, dann wäre das Datum der Ausstellung 11.5.1581.<br />
49
50<br />
Hildegard Boková<br />
2. Graphematik<br />
Der Text weist einige sich wiederholende Besonderheiten auf: Präfixe, vor<br />
allem ver-, zuweilen auch vn-, sind häufig vom folgenden Wortteil abgesetzt<br />
(wir berücksichtigen dies nicht). Über steht immer ein Schrägstrich<br />
(ú) ohne Umlautwert. hat immer Trema (ÿ).<br />
2.1. Distribution von und <br />
Im alten und neuen Diphthong tritt häufig, aber nicht konsequent auf:<br />
immer in -ley (z.B. aller ley, wesserley), immer in Zwey, zwayfeldige, immer<br />
in drey, 11× in bey – 1× bei, es gibt nur sey (Konj.) – aber immer sein<br />
(Inf., Pron.), 4× schreyen – 1× schreien, freyhaeit – aber freier, freiheit; für<br />
mhd. /i/ wird verwendet bei dryttes, fry, In Sygell, Jacoby (2×), lyset,<br />
Sy; sonst überwiegt in allen Positionen . Die Schreibung erscheint<br />
initial mit Konsonantwert, z.B. Jacoby, Jagdt, Jahr, Die Jönigen, Jungen,<br />
Justitien; bei den mhd. Pronomen mit anlautendem /ie/ überwiegt die gekürzte<br />
Form: Ider (15×), Imandt (6×), nur einmal ist Jetweder belegt.<br />
Initial steht immer für /u/, z.B. vber, vnd, vnder, vnser, vrtheilen, vrttel;<br />
als Konsonantzeichen überwiegt initial , mit Ausnahme von vatters,<br />
Viertten, viehe, vingers; bei mhd. vor zeigt sich Formenvielfalt: vor (28×),<br />
vor tretten – for brengen, zuuor (2×); fast immer erscheint das Präfix ver-,<br />
aber 2× auch uer-; im Fremdwort wird geschrieben: priuilegien, priuilegirtten,<br />
einmal auch in geuettern; wird nur als Konsonantzeichen<br />
verwendet, z.B. wie, wirdt, welche; in hawen, hawer ist es noch erhalten<br />
und dient zur Wiedergabe des Diphthongs, der aber auch anders bezeichnet<br />
wird: ver Trauede, abhauung.<br />
2.2. Längenbezeichnung<br />
Langvokale – sowohl alte mhd. Längen als auch durch frnhd. Dehnung entstandene<br />
– werden unterschiedlich gekennzeichnet. Am seltensten erscheint<br />
Doppelschreibung (insgesamt 5×): baar, gaar (2×), haasen, steetig; Dehnungs-h<br />
ist relativ häufig (insgesamt 68×), z.B. begehre, ehren, fehl, Ihme,<br />
Ihm, Ihnen, Ihr, Jahr, mehr, ohne; es tritt auch da auf, wo es sich in der heutigen<br />
Norm nicht durchgesetzt hat, z.B. gebihrt, Nahmen (4×), behn (mhd.<br />
pên), gefehl (mhd. bevelch – 2×), Plohe (mhd. blâ – 3×), Pöhnfahl, Pöhnfall,<br />
schwehre (schwöre), wehr (Pron.), wohren (Waren); ohne phonisches<br />
Korrelat bzw. ohne Längenwert erscheint in genohmen, gleuch fehls,<br />
Mauhl (2×), Pöhnfahl, schaff fehl (7×), wahrm, Zohl (2×); hat ebenfalls<br />
die Funktion der Längenbezeichnung sowohl für den monophthongierten<br />
mhd. Diphthong als auch für gedehntes mhd. /i:/; ausschließlich erscheinen<br />
wie, die, diese; sie (8×) – aber Sy (1×), weiter wird geschrieben in<br />
dieb, friedt (2×), frietlich, gebieths, hielte, alhie, hiemitt, hierinnen, hiermitt,<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
lieb (2×), schiessen, Vieh(e) (4×), viertten (2×) – aber virtte, wieder (wieder,<br />
wider), Zier; ohne phonetischen Wert erscheint der Digraph in abstiech,<br />
hielff (7×), schieckett; eine besondere Schreibung zeigt Niehemanden, wo<br />
möglicherweise noch ein Reflex des alten Diphthongs zu sehen ist. Einige<br />
mhd. Langvokale haben keine Bezeichnung: Ersten, hoch bzw. hach.<br />
2.3. Kürzenbezeichnung<br />
Die Vokalkürze wird häufig durch Doppelkonsonant bezeichnet (z.B. brennen,<br />
dannen, erkennen, Erkriffen, innern, Pfennig), daneben erscheint Doppelschreibung<br />
nicht selten noch ohne phonetischen Wert – siehe unter 2.6.<br />
2.4. Umlautbezeichnung<br />
Der Primärumlaut wird geschrieben (z.B. bechen, beschediget, lesterung),<br />
das auch für mhd. /æ/ verwendet wird (z.B. Schmehe); der Sekundärumlaut<br />
erscheint als (dreyfältigkeitt, fällen, Pänckhen) 7 , aber auch als<br />
(Necht); der Umlaut der übrigen Vokale wird nur teilweise bezeichnet.<br />
Neben (burgschafft, 2× fruchten, gefuhrt, gehultz, geschudt, thur, vn<br />
Nutze, wurffen, Zuckhen,) steht vereinzelt (müß), es gibt nur <br />
(glaubiger, 10× Hausser), lediglich der Umlaut von mhd. /o, ô/ wird immer<br />
als wiedergegeben (dörffern (6×), höltzern, löblich (4×); gehöret, Grölen,<br />
töddtlichen) 8 . Vor den Suffixen -lich und -nus stehen umgelautete (Bescheulich,<br />
gentzlichen, 2× löblich, tödtlichen; gefengnus) und unumgelautete<br />
(Erbarlich, geburliche, 2× verbruchlich, vngebuhrlich; 6× gefangnus)<br />
Vokale.<br />
2.5. Wiedergabe der alten und neuen Diphthonge<br />
Mhd. /ei/ wird überwiegend (156×), vereinzelt auch (12×) geschrieben<br />
(z.B. algemeiner, drunckenheidt, fleisch, klein; -ley, Zwey – siehe<br />
auch 2.1.), als erscheint es in Kaiserliche, Waiz, als in Haydt,<br />
Kay., zwayfeldige, mit besonderer Schreibung in anhaeimischen, Aeigennes,<br />
Craeiß, freyhaeit, vnhaeil; Haeydt (4×), Aeydt (2×), Kaeysserlich. Mhd. /î/<br />
erscheint überwiegend als (z.B. sein, Zeit), aber auch als : schreyer<br />
(3×), schreyt, sey (9×), drey (7×), bey (9×).<br />
Mhd. /ou/ tritt nur als auf, z.B. auch, augen, kaufen, ebenso wie mhd.<br />
/û/, z.B. haus, auß, auf (16×) – dagegen steht 27× vff.<br />
7 Vgl. SKÁLA (1967: 77): „Die ersten ä-Schreibungen [...] ab 1558 ...“.<br />
8 Vgl. SKÁLA (1972: XX): „[...] mitunter nicht bezeichnet. [...] Die regelmäßige Schreibung<br />
ist ö.“ Ähnlich ist der Befund in Skála (1967: § 4, 28: „[...] häufig unbezeichnet.“<br />
51
52<br />
Hildegard Boková<br />
Mhd. /öu/ ist immer ohne Umlautbezeichnung (z.B. glaubiger, kauffer),<br />
dagegen erscheint mhd. /iu/ meist als (z.B. Euer, freunden, gethreulichen,<br />
heundigen, leuchter, leuthe, steuher) – aber auch 1× Hausser (Plur.).<br />
2.6. Konsonantendopplung und -häufung<br />
In finaler Position wird insgesamt 39× geschrieben, z.B. bekröftigett,<br />
geltt, hatt, -keitt, mitt; medial steht sowohl nach Digraphen als auch<br />
Monographen und ebenfalls nach Konsonanten, insgesamt 65×, z.B. Hachzeitten,<br />
hietten, hitten, leitten, totten, hirtten, Viertten, virtten, vrttel, Zentten;<br />
ist besonders häufig in finaler Position (78×), wobei es durch Synkope<br />
entstanden sein kann (z.B. findt, geschudt, Verwundt, Wirdt), meist<br />
aber nur eine graphische Erscheinung ist (z.B. friedt, schandt), auch unorganisches<br />
t erscheint in dieser Schreibung (Imandt – nur so); einmal findet<br />
sich medial im Ortsnamen Haeydte. 9<br />
Die Schreibung gibt es final insgesamt 51×, vor allem wortgebunden<br />
in dorff, hielff, stroff, schaff, vff – auff; in medialer Position steht einerseits<br />
als Kürzenzeichen (5×): bedröffente, Waffen (3×), andererseits ohne<br />
phonetische Funktion (43×): z.B. geruffen, gestrafft, Herschafft, kauffer,<br />
wurffen; auch initial erscheint es vereinzelt: ffragt. Die Schreibung <br />
zeigt sowohl medial als auch final zum einen Kurzvokal an (Donnerstag,<br />
dann, mann, wann), zum anderen ist sie ohne phonetischen Wert (Aeigennes,<br />
braunne, dennen, 3× gebornne, geschlagenner, geschwornne, 2×<br />
Hannß, hinnauß, Sohnnes, 3× Vnnd, vnderthannen; denn (den), feuerenn,<br />
verbottenn). Für sind insgesamt 50 Belege vertreten, 36× in medialer<br />
Position als Reflex von mhd. /``/, z.B. gassen, grosse, lassen, schiessen,<br />
stossen, fleissig – aber auch fleisich), 13× als Doppelschreibung ohne phonetischen<br />
Wert, z.B. Hausser, hassen (Hasen), krassen (Gräser), Kaeysserlichen,<br />
weissen (Waisen), einmal auch mittelbar final (Krassmath).<br />
2.7. Wiedergabe von mhd. /pf/<br />
Die mhd. Affrikate tritt als initial auf: Pfandt, Pfennig (2×), Pferd; in<br />
medialer Position stehen und neben einander: schepfen –<br />
schepffen, Zappfenbuhrgelt. Andere Graphien sind nicht belegt.<br />
2.8. Wiedergabe von mhd. /s/ und /`/<br />
Sowohl für mhd. /s/ als auch für /`/ wird bzw. geschrieben, wobei<br />
wortgebunden gewisse Vorlieben erkennbar sind: nur waß, 17× daß (Art.) –<br />
1× das, 10× daß (Konj.) – 2× das, 12× auß – 2× aus, 1× auser, als Einzelbe-<br />
9 Vgl. Skála (1972 XXVIf.), wo sowohl für als auch für zahlreiche Belege<br />
angeführt werden. Ebenso in Skála (1967: § 99, 116f.).<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
lege für mhd. /`/ faß, gemeß, 2× graß (groß), Haß, 2× muß, müß (müßig),<br />
Raß; für mhd. /s/ immer biß, 11× alß – 1× als, 8× hauß – 1× haus, 6× -nuß –<br />
1× -nus, als Einzelbeleg Craeiß, 2× graß, Kraß (Gras), 2× Hannß, Zinß – 2×<br />
Zins. Auch Genitivformen haben einige Male : je 1× deß, Herrenß,<br />
Jahrß, manß, Sohnß – 15× des, je 1× Herrns, Herrens, Sohns, Sohnnes. Die<br />
übrigen zahlreichen Genitive und der Fugenlaut im Kompositum sind als<br />
erhalten (z.B. gottes, Weibs; gerichts ordnung, herbergs leitten). Zur<br />
Doppelschreibung siehe auch 2.6. Als Besonderheit erscheint 2×<br />
in wirtzhauß/s. Die Graphie , wird sonst nur für die Affrikata verwendet,<br />
medial und final steht immer (z.B. besetzen, gantze, gehultz,<br />
Parmhertzig – aber Waiz), initial immer (z.B. Zeit, Zol, Zuckhen). Das<br />
ältere ist nicht mehr vertreten.<br />
2.9. Mhd. Auslautverhärtung<br />
Als Reflex der mhd. Auslautverhärtung bzw. als Ausdruck einer gewissen<br />
Unsicherheit könnte die vorherrschende Schreibung angesehen werden<br />
(s. 2.6.), daneben erscheint final (geltt, gedreitt) und altes (4× felt,<br />
frietlich, 4× gelt, Irgent, Jetweder, schult), vereinzelt wird final schon <br />
geschrieben (Aeyd, frid, Radhauß, Schand sowie immer vnd). Mhd. /b/ und<br />
/g/ unterliegen nicht mehr der Auslautverhärtung: z.B. dieb, gab, halb,<br />
Korb; 10 Herberg, obrig, Parmhertzig, Sontag.<br />
2.10. Großschreibung<br />
Majuskeln treten ungeregelt bei unterschiedlichen Wortarten auf: z.B. Von<br />
Schmehe vnd schandt worden; So braunne oder Plohe fleke gefunden; Von<br />
der dryttes gerichtes hielff – Von der Viertten gerichtes hielff; folgt Eines<br />
Richters Aeydt. Konsequent groß geschrieben werden Personen- und Ortsnamen:<br />
z.B. Hannß Georg Herr Von Schwamberckh, auff RansPurckh<br />
Haeydt, Worlieckh, Röm. Kay. May. H. Rath, Vnnd Herr Hannß Wilhelmb<br />
auch von Schwamberckh, auf Haeydt. Klingenberckh. Vnd Gesterscham,<br />
haubtman deß Pulsner Craeiß; dagegen ist die Großschreibung von christlichen<br />
Begriffen nicht immer zu finden: z.B. gottes vatters, Sohns vnd heilligen<br />
geistes; In Nahmen der heilligen dreyfeltigkeitt Amen;<br />
Bestimmte für den Text wichtige Begriffe, wie „Amt“, „Obrigkeit“, „Richter“,<br />
„Stadt“ haben entweder ausschließlich oder überwiegend Majuskeln:<br />
3× Ambt – 2× ambt, 14× Obrigkeith – 2× obrigkeith; immer Richter; 13×<br />
Stadt – 9× stadt.<br />
10 Skála (1972: XXVI) bringt Belege für finales .<br />
53
54<br />
Hildegard Boková<br />
3. Lautstand<br />
3.1. Vokalismus<br />
3.1.1. Diphthongierung und Monophthongierung<br />
Die nhd. Diphthongierung hat sich vollständig durchgesetzt, einzige Ausnahme<br />
ist vff (26×) 11 , dem 18× auf(f) gegenübersteht. Mhd. /ie/ ist weitgehend<br />
graphisch erhalten (vgl. 2.1.); Mhd. /uo/ ist durchgehend monophthongiert<br />
(z.B. buch, bludt, fluchen, fru, geruffen, gnugsamb), nur in<br />
den Formen des Verbs mhd. tuon erscheint auch Digraphie (6× thuen – 5×<br />
thun).<br />
3.1.2. Rundung und Entrundung<br />
Die hohe Frequenz von labialisierten und delabialisierten Schreibungen<br />
deutet auf eine gewisse Unsicherheit in der Aussprache und einen Hang zur<br />
Hyperkorrektheit hin. Mhd. /e/ als ist belegt in bedröffente, bekröftigett,<br />
Die Jönigen, 3 földigkeit, hörbergs – aber 4× herberg, Pödgewandt,<br />
Verdrögen, wörden; mhd. /i/ als , also ohne Umlautbezeichnung, zeigt<br />
sich in besuchdigtt, besuchdigung, buhr, Pulsner Craeiß; 12 mhd. /ei/ bzw.<br />
/î/ wird geschrieben in gleuchen (3×) – aber 2× gleich, gereucht, feuer,<br />
reuchen, streuch, teuch. Entrundete Aussprache 13 wird reflektiert in<br />
für mhd. /iu/ (2× leitten, heiser), in der Schreibung , , für<br />
mhd. /ü/ bzw. /üe/ (fry, gebihrt, gerist, hitten, hiethen, hietten, schietten, zu<br />
drige – aber behutten) sowie in für mhd. /ö/ bzw. /œ/ (ent Plesstt, hehere,<br />
heltzern, heren, kende, mechte, schwehre, Vermeg – aber gehöret, höltzern).<br />
3.1.3. Synkope und Apokope<br />
Nicht apokopierte Formen sind wortgebunden bei einigen Belegen in der<br />
Überzahl, z.B. 7× knechte – 5× knecht (Dat.), 41× solle (Ind.) – 6× sol; weiter<br />
erscheinen sie in 2× deme, gehe (jäh), 4× Ihme, klage, 3× Schmehe, 3×<br />
tage, 4× viehe, 2× vnrechte, 2× zum Tothe; attributive Adjektive und Pronomen<br />
haben die Endung weitgehend erhalten (z.B. braun oder plohe fleke,<br />
daß Zehende schaff, zwayfeldige straff – aber Peinlich recht); Apokope<br />
zeigt sich in 78× dem, nur hilff, nur recht, schadt, nur straff, tag (Pl.), 2× die<br />
wirdt. Das Präfix mhd. ge- ist weitgehend erhalten (z.B. gemein, gericht),<br />
aber vor l und n wird immer synkopiert (glaubiger, gleich, gnade, gnedig,<br />
gnugsamb). In der Endung des Verbs (3. Sg. oder Part. II) sind synkopierte<br />
11 Skála (1972: XXV) hat 71,24 % vff gegen 28,76 % auf.<br />
12 Skála (1967: § 110, 96) führt Pülßen an.<br />
13 Sowohl in Skála (1972: XX, XXI, XXIII) als auch in Skála (1967: § 81, 88; § 89, 100; §<br />
94, 108) gibt es zahlreiche Belege für Entrundung.<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
gegenüber den Vollformen stärker vertreten: 23× -et (z.B. begnadet, beschediget,<br />
er dappet, gehet, schreibet, sitzet, spillet, stehet, verwundet) und<br />
35× -t (z.B. folgt, gehegt, gereucht, 10× gibt – 1× gibet, verkaufft, Verwundt).<br />
Nahezu ausgewogen ist das Auftreten von synkopierten und Vollformen<br />
beim Adjektiv ander: 5× andern, 1× andre – 5× andere.<br />
3.2. Konsonantismus<br />
3.2.1. /s/ vor Konsonant<br />
Einmal kommt alte Schreibung vor (slag), die übrigen Belege haben <br />
(1× geschwornne, 3× Schmehe, 2× Schwamberckh, je 1× schwehre, schweige).<br />
14<br />
3.2.2. Unorganisches t<br />
Entgegen dem heutigen Usus wird t in anderst (3×) angefügt (Skála 1972:<br />
134); Imandt (6×) ist ausschließlich mit belegt, auch Obst hat bereits<br />
, in Predig ist noch kein t angetreten.<br />
3.2.3. Assimilation, Dissimilation<br />
Mhd. /mb/ ist erhalten (4× Ambt, dorumb, 2× vmb, 2× widerumb), wird<br />
auch an etymologisch unberechtigter Stelle geschrieben (13× einemb – 24×<br />
keinem/meinem/seinem/einem, 3× frembten, gnugsamb, 2× kombt, Nemblichen,<br />
Nimbt, versamblet, Wilhelmb) (vgl. SKÁLA 1972: XXVII; 1967: §<br />
97, 113). Das Substantiv mhd. phenninc/phennic erscheint in der dissimilierten<br />
Form: Pfennig.<br />
3.3. Dialektzüge<br />
3.3.1. Bairische Merkmale<br />
a > o: Verdumpfung wird 7× in der Schreibung reflektiert (z.B. Nachtborn,<br />
noch – 13× nach, obwehr – 7× ab, Purgschofft – 29× -schafft, stroff – 2×<br />
straff, sockh), wobei die Formen auf eindeutig überwiegen. 15<br />
o/ô > a: Den leicht überwiegenden -Schreibungen (11 Belege, z.B.<br />
graß, hach, Raß, Wachen) stehen in den gleichen Lexemen Formen auf <br />
gegenüber (8 Belege, z.B. grosse, hoch, Rossen, wochen). Die Vermischung<br />
von lokalem dâr, dâ und temporalem dô zeigt sich sowohl in -Formen<br />
(15×) als auch in solchen auf (10×): z.B. alda, da, damit, darauf, darinnen,<br />
darvon/davon, darzu – do, dorauff , dorumb, dor von.<br />
i > ie: Die für das Bair. typische Graphie vor r ist nur einmal belegt<br />
(wierdt), sonst wird bzw. geschrieben (z.B. wirdt, hirtt; Ihr); das<br />
14 Skála (1972: XXXIII) und Skála (1967) in jüngeren Belegen (§ 107, 139) haben nur .<br />
15 Auch Skála (1967: § 77, 76) bringt zahlreiche Belege für Verdumpfung.<br />
55
56<br />
Hildegard Boková<br />
Numerale vier sowie das Adverb hier schwanken zwischen (2× viertte,<br />
3× hie/r) und (1× virtte, 2× hir).<br />
Sprossvokal: Es gibt keinen Beleg für Sprossvokal an den gewöhnlichen<br />
Stellen (Kirchen). Dafür erscheint einmal a in Pranda wein. 16<br />
mhd. -nisse > -nus/nuß: Es gibt nur Belege auf -nus/-nuß (z.B. gefangnuß,<br />
gefengnus, Verzeichnuß).<br />
Part. Präs. auf -und: Es gibt nur Belege für -end, z.B. folgenden, fressende,<br />
gebuhrende, ligende.<br />
/b/ als : Die Schreibung in initialer und mittelbar initialer Position<br />
erscheint 16× (z.B. Parmhertzig, entPlesstt) dagegen wird 52× geschrieben,<br />
nicht mitgezählt wurden das nur so erscheinende bey und das<br />
Präfix be-. Ausschließlich erscheint in ge-/verbot sowie – mit der einzigen<br />
Ausnahme Pranda wein – vor r (z.B. braun, brechen, brengen, brennen).<br />
Beide Graphien im gleichen Lexem finden sich bei bludt – Plutt,<br />
burgschafft (2×) – Purgschofft und buxen – Puxen (2×). 17<br />
/b/ als und /w/ als ist nicht belegt.<br />
/k/ und /ck/ als : Während initial ausschließlich vorkommt,<br />
wird es medial nur 4× geschrieben (2× aker, 2× fleke); erscheint<br />
medial 6× (drunckenheidt, flecke, hackern, mercklichem, schieckett,<br />
Zuckt) und final 1× (schock). Die für das Bairische typischen Graphien<br />
, , (ähnlich Skála 1967: § 101, 124) treten nur medial<br />
und final auf: abstiech; handtwerckhes, hinweckh, Klingenberckh,<br />
Mürckhen, Pänckhen, RansPurckh, schockh, schreckhlicher, Schwamberckh<br />
(2×), sockh, stuckh, Worlieckh, Zuckhen; bunkhten, Merkhen, Zukhen.<br />
/g/ als : Wortgebunden wird vor r 8× geschrieben in erkreifft (2×),<br />
Erkriffen, Krass/ß (4×), krassen 18 ; insgesamt 11× steht dagegen vor r <br />
(z.B 2× graß, groschen, grosse, grundt).<br />
3.3.2. (Ost)mitteldeutsche Merkmale<br />
o > a in ausgewählten Lexemen (ab, ader, dach, nach, sal, van, wal): Es<br />
erscheinen nur ob, oder, sol, von, wohl; lediglich 4× tritt dach gegen 1×<br />
doch auf.<br />
16 Skála (1967: § 78, 81) hat brandtewein. In Skála (1972: XVII) ist als Sprossvokal <br />
belegt.<br />
17 Sowohl in Skála (1967: § 97, 112) als auch in Skála (1972: XXVI) ist der Befund anders,<br />
es überwiegt dort .<br />
18 Skála (1967: §102, 126) hat ebenfalls Belege für , denn „[...] in der Egerer Mundart<br />
sind beide Gutturale zusammengefallen und k gilt in Egerer Texten anlautend schon Anfang<br />
des 16. Jahrhunderts.“<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
u/ü > o/ö: Vor Nasal hat sich durchgesetzt (besonder, Donnerstag,<br />
sonderlich, 8× sonder(n),3× Sontag – aber 2× besunder).<br />
i > e: Das Verb mhd. bringen hat in seinem einzigen Beleg die md. -<br />
Form (brengen). Das Partizip von mhd. beschrîben erscheint dagegen als<br />
beschriben.<br />
mhd. friunt: Das Substantiv erscheint 2× in der md. Version (frundt, frunden),<br />
einmal ist es diphthongiert (freunden).<br />
e > i in unbetonter Silbe: In unbetonter Silbe wird durchgehend geschrieben,<br />
nur einmal ist belegt (Apostils).<br />
ver- als vor-: Das Präfix ist nur mit belegt. 19<br />
Lenisierung: Mhd. /t/ erscheint als (so auch in SKÁLA 1972:<br />
XXVIII) (insgesamt 32×) häufig nach l (11×) und n (5×): z.B. drey feldigkeitt,<br />
ehengemeldens, scheldens, schulden, schuldig; benandens, erkandnuß,<br />
genanden, heundigen, Winders – aber 34× erscheint nach l : z.B. dreyfeltigkeitt,<br />
dulten, gultig, nur halten, schelten, schultig/schulten. Initial ist <br />
vor allem belegt vor r (10×): z.B. bedrachten, bedretten, bedrift, dreiben,<br />
drunckenheidt, gedragen, gedreitt, Verdrögen, einmal vor Vokal (er dappet);<br />
intervokalisch steht in sanftmudigen, dreimal auch in der Endung<br />
des Verbs (an Zeigede, auf gesetzde, beklagde, ver Trauede) sowie einmal<br />
nach r (garden). 4× hat die Verbendung : bedachte, beschedigten, ent<br />
leibten, hochgelobten, einmal : beklagdten. Dagegen gibt es zwei Fälle<br />
von für mhd. /d/: bette, hatter.<br />
Mhd. /k/ als kommt ganz vereinzelt vor (beklagde).<br />
Mhd. /p/ als 20 wird initial 4× geschrieben in behn, beinlicher, bershon,<br />
bunkhten; dagegen stehen 19 Belege mit (4× Peinlich, 3× Pershon,<br />
Plotz, 7× Pöhn, 4× Predig).<br />
3.3.3. Gemeinsame Merkmale<br />
/â/ als : Verdumpfung ist 5× belegt in Plohe (3×), Plosen, vnderthon –<br />
aber gethan, vnderthannen, dagegen ist wesentlich häufiger erhalten<br />
(insgesamt 33×), z.B. gnaden, Jahrß, massen, Rath, straff, verwahren. 21<br />
4. Dialektzüge auf morphologischer Ebene<br />
4.1. Bairische Merkmale<br />
Die bairischen Kennformen tege, schol, hiet, -und sind in unserm Text<br />
nicht belegt; es erscheinen tage, soll, hette, -ende. 22<br />
19 Dagegen hat Skála (1967: 347) auch vor-.<br />
20 Belege auch in Skála (1967: § 96, 110f.).<br />
21 Ebenso in Skála (1972: XVIIIf.) und in Skála (1967: § 82, 89).<br />
22 Skála (1967: § 175, 251 und § 177, 256) hat ebenfalls nur soll und hette.<br />
57
58<br />
Hildegard Boková<br />
4.2. (Ost)mitteldeutsche Merkmale<br />
Die Kennformen quam und gewest sind nicht belegt; der Text hat kein Präteritum<br />
von mhd. quemen und kein Partizip des verbum substantivum.<br />
5. Besonderheiten im lexikalischen Bereich<br />
Negation: Es überwiegen Formen mit (nicht 24×, Nichtes, Mit nichten);<br />
6× ist nit belegt. Es gibt keine Mehrfachnegation.<br />
unz – bis: nur biß (8×)<br />
immer – alweg: alle weg, 2× alle wege<br />
pferd – ros: Rossen, Raß – Pferdt 23<br />
fleischer: fleisch hacker, fleisch hawer 24<br />
Wochentage: 3× Sontag, Donnerstag<br />
6. Schlussbemerkungen<br />
Die Sprache des analysierten Textes zeigt deutliche Übereinstimmungen mit<br />
den Ergebnissen, die Emil Skála in seinen Untersuchungen zu Egerer<br />
Denkmälern gewonnen hat. Auch unser Text hat neben bairischen Zügen<br />
einige ostmitteldeutsche Schreibformen. Allerdings sind hier die Dialektmerkmale<br />
stellenweise schwächer ausgeprägt als bei den Egerer Texten,<br />
was wohl mit der geringeren Textmenge unseres Denkmals zusammenhängt.<br />
Unser Material fügt sich also gut in das Bild des Egerer Sprachraums<br />
im Untersuchungszeitraum ein.<br />
Literatur<br />
BAHLCKE, Joachim/EBERHARD, Winfried/POLÍVKA, Miroslav (Hgg.)<br />
(1998): Böhmen und Mähren, Handbuch der historischen Stätten. Stuttgart:<br />
Kröner, 183–184.<br />
BĚLOHLÁVEK, Miloslav et al. (Hg.) (1985): Hrady, zámky a tvrze<br />
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Západní Čechy [Burgen, Schlösser und<br />
Vesten in Böhmen, Mähren und Schlesien. Westböhmen]. Praha: Nakladatelství<br />
Svoboda.<br />
GROTEFEND, Hermann (1922/1984): Taschenbuch der Zeitrechnung des<br />
deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 5. Aufl. Hannover 1922: Hahnsche<br />
Buchhandlung. Nachdruck Leipzig 1984.<br />
23 Skála (1967: § 182, 275) und Skála (1972: Register) haben mehr pferd als roß.<br />
24 In Skála (1972: 143) ist fleischhacker belegt.<br />
Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid<br />
SCHMIDT, Georg (1929): Privilegien der Herren von Schwanberg für ihre<br />
Stadt Haid. – In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in<br />
Böhmen 67, 1–36.<br />
SKÁLA, Emil (1967): Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310–<br />
1660. Berlin: Akademie-Verlag.<br />
SKÁLA, Emil (1972): Das Egerer Urgichtenbuch (1543–1579). Berlin:<br />
Akademie-Verlag.<br />
59
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen<br />
als Konfliktsprache<br />
Peter Hans Nelde<br />
Emil Skála hat sich ein Leben lang mit der deutschen Sprache in jeglicher<br />
Hinsicht befasst – diachronisch, synchronisch, sprachgeschichtlich, kontaktlinguistisch.<br />
Germanistische Linguistik ohne seinen Namen ist schlechthin<br />
unvorstellbar. Dafür gebührt ihm Dank, der ihm – aus meiner Sicht – vor<br />
allem deshalb zukommt, weil er als Forscher die Außenperspektive vertritt,<br />
die sich über zahlreiche binnendeutsche Tabus und politische Frustrationen<br />
hinwegsetzen konnte und damit der germanistischen Linguistik zuweilen<br />
unorthodoxe, jedoch stets anregende Impulse verleihen konnte.<br />
Ad multos annos!<br />
1. Ideologie und Sprachpolitik<br />
Wo setzt Sprachideologie an – beim einzelnen Sprecher, seinen Vorurteilen<br />
und Stereotypen, bei Sprachgemeinschaften oder bei denjenigen, die Sprechern<br />
und Sprachgemeinschaften die Regeln ihres sprachpolitischen Handelns<br />
auferlegen? Wie auch immer, Sprachplanung und Sprachpolitik sind<br />
hervorragende Ideologieinstrumentarien, an deren kulturpolitischem Durchsetzungsvermögen<br />
im gegenwärtigen Europa jedoch erhebliche Zweifel<br />
bestehen. Ergebnisse jüngster kontaktlinguistischer Untersuchungen lassen<br />
beispielsweise Zweifel daran aufkommen, dass Sprachgemeinschaften und<br />
Sprecher durch eine extensive Sprachgesetzgebung besser geschützt werden<br />
als durch überlieferte orale Handlungsanweisungen, wie sie in Ländern wie<br />
der multilingualen Schweiz eine staatserhaltende und bürgernahe Rolle<br />
spielen. Aus dieser Sichtweise verlieren sorgfältig ausgearbeitete sprachgebrauchsregulierende<br />
Texte aller demokratischer Herrschaftsformen wie sie<br />
in Verfassungen, Dekreten und Erlässen aller Art ihren Niederschlag finden,<br />
erheblich an Bedeutung und ihre für kleine Sprachgemeinschaften offensichtlich<br />
lebenserhaltende positive Wirkung ist nicht immer nachweisbar.<br />
Aus jüngsten kontaktlinguistischen Projekten zur Sprach- und Kulturpolitik<br />
von Minderheitssprachen und -kulturen wie EUROMOSAIC (The production<br />
and reproduction of the minority language groups in the European Union),<br />
GOTAP (Community development and language planning in the periphery),<br />
ATGEM (A training and consulting programme for community<br />
development for European minorities in the periphery) und NET (New European<br />
Language Policy) lässt sich deshalb folgern:<br />
1) Gesetzgeberisch oktroyierter Schutz von Sprachen und Kulturen hat für<br />
die sprachpolitische Praxis häufig nur deklamatorischen Wert.
62<br />
Peter Hans Nelde<br />
2) Detaillierte Verschriftlichung von Schutzmaßnahmen, Regelsystemen<br />
und daraus folgenden Sanktionen ist keine Garantie für das Überleben<br />
von Sprach- und Kulturgemeinschaften (vgl. die unterschiedliche Minderheitensituation<br />
in der Schweiz und in Frankreich).<br />
3) Sprachpolitik auf ideologischer Basis existiert überall dort, wo neben<br />
der Erstsprache Zweit-, Schul-, Nachbar-, Migranten- und Fremdsprachen<br />
Teil des nationalen Bildungssystems ausmachen, mit der Folge,<br />
dass die jeweilige Sprachpolitik Teil der Bildungspolitik oder sogar mit<br />
ihr kongruent ist. So entspricht der so genannten Fremdsprachenpolitik<br />
in Deutschland, die mit wenigen Ausnahmen das Englische zur Pflichtschulsprache<br />
dekretiert, einer – im soziologischen Sinne – elitären<br />
Sprachpolitik, die, ohne den marktökonomischen Bedarf des Englischen<br />
zu hinterfragen, die Prestigesprache und damit die Sprache der ökonomischen<br />
Elite so sehr in den Vordergrund stellt, dass für die von der Europäischen<br />
Union propagierte Einheit in der Verschiedenheit in der<br />
schulsprachlichen Praxis – und damit in der Bildungs- und Sprachpolitik<br />
des Landes – wenig übrig bleibt.<br />
Eine ähnlich gleichermaßen sprach- wie bildungspolitisch bestimmte Debatte<br />
haben sich die Vereinigten Staaten in der English Only- bzw. English<br />
Plus-Diskussion erlaubt, wobei es hierbei bildungspolitisch um die gänzliche<br />
Abschaffung von Zweitsprachen im höheren Unterricht (Englisch only)<br />
ging. Die Reduzierung des Begriffes Zweisprachigkeit auf die zuweilen<br />
sozial motivierte Kombination Englisch und Spanisch unterstreicht eine<br />
weitere Verengung des amerikanischen Mehrsprachigkeitsbegriffes. Diese<br />
europäischen wie amerikanischen Beispiele zeigen somit, dass Sprachpolitik<br />
auch dort existiert, wo dieser Begriff in der öffentlichen Diskussion<br />
kaum Verwendung findet: Sie tritt umso deutlicher als Bildungspolitik in<br />
Erscheinung.<br />
Diese Unsicherheit im Bereich der Sprachpolitik zeigt sich im europäischen<br />
Kontext bereits in einem hohen Grad an Inkompatibilität in der Terminologie.<br />
Während der größte Teil der europäischen Sprachen zur Abgrenzung<br />
unserer Thematik über drei, teilweise unterschiedlich definierte Begriffe<br />
verfügt (so im Englischen: Language Planning, Language Policy, Language<br />
Politics oder im Niederländischen: taalplanning, taalbeleid, taalpolitiek),<br />
beschränken sich andere Sprachen auf zwei Begriffe (wie das Deutsche:<br />
Sprachplanung, Sprachpolitik) oder gar nur auf einen einzigen Begriff (so<br />
konzentriert sich das Französische auf den modernen Begriff<br />
l’aménagement linguistique, der sicherlich sachdienlicher und europagerechter<br />
ist als die veralteten Termini planification linguistique und politique<br />
linguistique).<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 63<br />
Eine Ideologisierung der Sprachpolitik zeigt sich allerdings nicht nur im<br />
Bildungssystem, sondern vor allem im Bereich der Minderheitenpolitik.<br />
Von den 480 Millionen Einwohnern der Europäischen Union, die sich ungefähr<br />
120 unterschiedlicher Sprachen befleißigen, verteilen sich 80 Sprachen<br />
auf 40 bis 70 Millionen Minderheitensprecher, die häufig als Bewohner peripherer<br />
Regionen zu den Schwachen und politisch wie ökonomisch Unterdrückten<br />
der jeweiligen Staaten gehören. Formen der Benachteiligung dieser<br />
kleinen Sprachgemeinschaften hängen von staatlichen Ideologien ab, die<br />
in Europa als zentralistische oder subsidiäre Konzepte gekennzeichnet werden<br />
können. Benachteiligt von sprachpolitisch zentralistischen, oft aber<br />
auch subtilen subsidiären Maßnahmen fallen die defensiv-partikularistischen<br />
und ethnozentrischen Reaktionen von Minderheiten besonders ins<br />
Auge. Bis in die Forschung hinein lässt sich der fehlende Wille beobachten,<br />
als Schwache, Benachteiligte oder gar Unterdrückte zusammenzuarbeiten:<br />
Autochthone (indigene Minderheiten) und Allochthone (Migranten) weigern<br />
sich, gemeinsam zu forschen und – obwohl sie den gleichen Unterdrückungsmechanismen<br />
ausgesetzt sind – sprachpolitisch gemeinsam zu<br />
agieren. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass zentralistische Konzepte,<br />
wie wir sie im mediterranen Bereich antreffen, weniger minderheitenfreundlich<br />
sind als die subtileren und der Basis näher stehenden subsidiären<br />
Konzepte föderaler Staaten (Deutschland, Skandinavien und teilweise<br />
auch Großbritannien).<br />
2. Kontaktlinguistische Bedingungen der Konfliktanalyse<br />
Von allen sprachwissenschaftlichen Disziplinen scheinen die Kontaktlinguistik<br />
und die Soziolinguistik sich besonders zur Darstellung und Analyse<br />
ideologischer Strukturen in der Sprachpolitik zu eignen. Vornehmlich kontaktlinguistische<br />
Modelle haben sich in letzter Zeit mit ideologisch bedingten<br />
Sprachkonflikten befasst.<br />
Kontaktlinguistik ist per definitionem multidisziplinär, erfasst Sprachkontaktphänomene<br />
unterschiedlichster Art (sprachliche und außersprachliche)<br />
und trägt zur Konfliktanalyse und -lösung bei.<br />
Vier kontaktlinguistische Voraussetzungen scheinen uns bei der Behandlung<br />
von Sprachkonflikten und deren Neutralisierung von Bedeutung:<br />
1) Es gibt keinen Kontakt zwischen Sprachen, sondern nur zwischen<br />
Sprechern und Sprachgemeinschaften (HAARMANN 1980, OKSAAR<br />
1980). Dadurch wird die Vergleichbarkeit von ein und derselben Sprache<br />
in unterschiedlichen Kontexten (z. B. Italienisch in Slowenien und<br />
in der Schweiz) weitgehend eingeschränkt. Sicherlich tragen diese<br />
multikausalen Konflikte unterschiedlichste Formen – vom offenen
64<br />
Peter Hans Nelde<br />
Ausbruch von Feindseligkeiten (Kosovo 1998) bis zur Sublimierung<br />
subkutaner Konflikte in harmoniebedürftigen sozialen Gruppen<br />
(Skandinavien). Eine der Hauptursachen für die Konfliktträchtigkeit<br />
sprachlicher Gemeinschaften aller Arten liegt in der Asymmetrie jeglicher<br />
Form von Mehrsprachigkeit. Es gibt auf dieser Welt keine kongruenten<br />
Sprachgemeinschaften, die die gleiche Zahl von Sprechern<br />
haben, deren Sprachen das gleiche Prestige aufweisen, deren Sozialprodukt<br />
identisch und deren Lebensqualität vergleichbar ist. Deshalb<br />
ist Kontakt ohne Konflikt nur schwer nachzuweisen:<br />
2) Auch wenn die Aussage, es gäbe keinen Sprachkontakt ohne Sprachkonflikt<br />
(„Nelde’s Law“, s. DE BOT 1997) übertrieben erscheinen<br />
mag, so ist im Bereich der europäischen Sprachen gegenwärtig keine<br />
Kontaktsituation denkbar, die sich nicht auch als Sprachkonflikt beschreiben<br />
ließe. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang<br />
auch Mattheiers (1984) Aussage zu frequent vorkommenden Sprachkonflikten<br />
unter monolingualen Sprechern.<br />
3) Die Kontaktlinguistik sieht Sprache gewöhnlich als wesentliches Sekundärsymbol<br />
für zugrunde liegende Konfliktursachen sozioökonomischer,<br />
politischer, religiöser oder historischer Art. Hierdurch erscheint<br />
der Sprachkonflikt gewissermaßen als das ‚kleinere Übel‘, da offensichtlich<br />
sich in vielen Fällen Sprachkonflikte leichter korrigieren und<br />
neutralisieren lassen als primär soziopolitische und andere, außersprachlich<br />
bestimmte Konflikte. Politisierung und Ideologisierung des<br />
Faktors Sprache führen zu zahlreichen Konflikten, bei denen Sprache<br />
oft als nebensächlich erscheint, jedoch leicht als Sekundärsymbol eingesetzt<br />
werden kann. Die Reihe der Beispiele im gegenwärtigen Ost-<br />
und Südosteuropa ist endlos. Bosnien-Herzegowina: Wird neben dem<br />
erst 1992 aufgegebenen Serbokroatisch und den Nachfolgesprachen<br />
Serbisch und Kroatisch eine Sprache ‚Bosnisch‘ entstehen? Moldawien:<br />
Ist die Einheit eines Staates aufrecht zu erhalten, wenn das Land<br />
durch die gleiche Sprache getrennt wird, und zwar in unterschiedliche<br />
Alphabete (lateinisch und kyrillisch) und eine unterschiedliche Lexik?<br />
Weißrussland: Kann eine Sprache in einem jungen Staat überleben,<br />
wenn nur noch 10 % der Schuljugend auf Weißrussisch unterrichtet<br />
wird?<br />
4) Die Kontaktlinguistik macht nicht nur deutlich, dass Konflikte nicht<br />
ausschließlich negativ beurteilt werden sollten, sondern weist zugleich<br />
nach, dass aus Konflikten neue Strukturen entstehen können, die – im<br />
Falle der Minderheitssprecher – günstiger sein können als die vorhergehenden.<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 65<br />
3. ‚Natürliche‘ und ‚künstliche‘ Konflikte<br />
Es gibt neben den traditionellen Sprachkonflikten mit historischen Bezügen<br />
die gegenwärtigen Konflikte zwischen Migranten und einheimischer Bevölkerung,<br />
zwischen Autochthonen und Allochthonen, die für oder gegen ihre<br />
Assimilation, Integration etc. kämpfen. Hier handelt es sich um ‚natürliche‘<br />
Konflikte, die ich von den ‚künstlichen‘ und durch die Schaffung neuer<br />
(sprach)politischer Strukturen selbst erzeugten Konflikten unterscheiden<br />
möchte. Gerade letztere führen zu einem Vergleich des alten Babel mit dem<br />
modernen Brüssel: über 4000 Übersetzer und Dolmetscher, die in der Europäischen<br />
Union in 20 Amts- und Arbeitssprachen arbeiten, häufig beeinflusst<br />
und bedrängt von ein paar Dutzend Minderheitssprachen, von denen<br />
viele um ihr Überleben kämpfen. Fast ein Zahlenspiel: Wenn es neunzehn<br />
Möglichkeiten gibt, zwanzig Sprachen zu verwenden, dann ergeben sich<br />
daraus 380 Kombinationen, eine Vielzahl, die der flämische Maler Pieter<br />
Breughel bei der Anfertigung seines berühmten Gemäldes Der Turmbau zu<br />
Babel wohl noch nicht berücksichtigen konnte, da sein Gebäude nicht die<br />
ausreichende Zahl von Simultandolmetscherkabinen (auf dem Gemälde als<br />
„Fensterhöhlen“) enthält, die die gegenwärtige EU-Kommission benötigt.<br />
Es dürfte deutlich sein, dass auch die Schaffung eines einheitlichen Europas<br />
keine Lösung für natürlich gewachsene oder künstlich geschaffene Konflikte<br />
garantiert.<br />
Welche Lösungsmöglichkeiten bieten sich demnach an?<br />
1) Die Einführung einer Plansprache (Esperanto, Gebärdensprache) etc.;<br />
2) die Übernahme einer starken internationalen Verkehrssprache als lingua<br />
franca (Englisch);<br />
3) die Bevorzugung von wenigen Hauptsprachen (z. Bsp. Deutsch, Französisch<br />
und Englisch);<br />
4) die Beibehaltung des status quo (20 Amts- und Arbeitssprachen).<br />
Kann der gegenwärtige Zustand (Lösungsmöglichkeit 4), d. h. die Akeptanz<br />
der Sprachenvielfalt weiter ausgebaut und fortgesetzt werden? Zur Vermeidung<br />
babylonischer Verhältnisse werden sicherlich Einschränkungen der<br />
Sprachenfreiheit in Kauf genommen werden müssen. Die Erweiterung der<br />
EU wird das Schema der fast automatischen Anerkennung von Nationalsprachen<br />
als Gemeinschaftssprachen durchbrechen müssen und statt der<br />
vierten Lösung die dritte oder eine weitere ins Gespräch bringen.<br />
Die Schwierigkeiten bei der Förderung und Betreuung von Minderheitssprachen<br />
durch eine Amtsstelle der EU, an der Sprachenpolitik für die kleineren<br />
Sprachen und mit den europäischen Minderheiten bereits betrieben<br />
wird (Abteilung Sprachpolitik), zeigt, wie delikat und hindernisreich jegliches<br />
Engagement einer politischen Instanz sich gestaltet.
66<br />
Peter Hans Nelde<br />
Es gibt weder eine Einigung über die Zahl der Minderheitensprachen und<br />
-sprecher in der Union (mindestens 80 Minderheiten in Abhängigkeit von<br />
unterschiedlichen kontaktlinguistischen Definitionen) noch über ihre Bezeichnung<br />
– etwas hilflos und künstlich klingt der Terminus ‚lesser used<br />
languages‘ –, die allerdings im Französischen zu den terminologisch keineswegs<br />
deckungsgleichen ‚langues moins répandues‘ mutieren, noch über<br />
gemeinsame sprachpolitische Richtlinien dieser – wegen ihrer historisch<br />
gewachsenen Sozialstrukturen wohl unvergleichlichen – Sprachgemeinschaften.<br />
Ohne die beispielhafte Zurückhaltung der Minderheitensprachpolitiker<br />
wären neue ‚künstliche‘ Konflikte kaum vermeidbar.<br />
4. Deutsch als Konfliktsprache – ein Beispiel<br />
Obwohl Deutsch mit 95–100 Millionen Sprechern in Europa sicherlich nach<br />
dem Russischen die größte Sprache ist, fällt seine Zweit- und Drittrolle als<br />
Fremdsprache im Unterricht, als Originalsprache für Ausschreibungen und<br />
Erlässe der EU, als Verhandlungssprache in multinationalen Gipfelgesprächen,<br />
als Umgangssprache in den europäischen Institutionen, kurz als internationale<br />
Sprache besonders ins Auge. Dafür mag unter anderem das erhöhte<br />
Konfliktpotential des Deutschen ausschlaggebend sein. Dies sollen einige<br />
Beispiele erläutern:<br />
1) Das Deutsche weist einen hohen Grad von Konfliktgefährdung auf, da<br />
seine Kontaktfrequenz höher ist als die anderer Staaten. Das heutige<br />
Deutschland grenzt an neun Nachbarstaaten; in den meisten Nachbarländern<br />
wird Deutsch (als Minderheits- oder Mehrheitssprache) gesprochen;<br />
in wenigstens fünfzehn Staaten wird deutsch gesprochen.<br />
2) Deutschland kennt im Bereich der allochthonen Minderheiten eine<br />
besonders breite Konfliktdiversifizierung. Man möge sich nur einmal<br />
das Spektrum an Zuwanderern vor Augen führen, die sich in den letzten<br />
zwanzig Jahren um Aufnahme und Integration bemühten. Für den<br />
nicht Eingeweihten ist es sicherlich nicht ganz einfach, die Bezeichnungen<br />
für diese Zuwanderer zu unterscheiden und, falls sie bedeutungsgleich<br />
sind, den unterschiedlichen ideologischen Blickwinkel zu<br />
erkennen, der sich hinter dieser umfassenden Terminologie verbirgt:<br />
Fremdarbeiter, Gastarbeiter, ausländischer Arbeitnehmer, Arbeitsimmigrant,<br />
Arbeitsemigrant, Umsiedler, Aussiedler, Spätaussiedler, Rücksiedler,<br />
Asylant, Asylsucher, Wirtschaftsflüchtling, Migrant, Remigrant<br />
– um nur einige herauszugreifen. Für die interkulturelle Kommunikation<br />
innerhalb Europas kommt als weiteres Missverständnis bzw. als<br />
weiterer Konflikt die Tatsache hinzu, dass die anderen Mitgliedsländer<br />
(mit der Ausnahme Luxemburgs) keinen vergleichbaren Zuwandererschub<br />
kennen und deshalb in Ermangelung eines ähnlichen sachlichen<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 67<br />
und ideologischen Hintergrunds viele Begriffe in ihren eigenen<br />
sprachlichen Kontext nicht übertragen können.<br />
3) Ideologien spielen beim Sprachkontakt mit dem Deutschen offensichtlich<br />
eine besondere Rolle. So kann die Vergangenheit Deutschlands –<br />
und hier vor allem das Dritte Reich mit dem Zweiten Weltkrieg – als<br />
Konflikthypothek gesehen werden. Die „Bildformung“ – wie der ins<br />
Deutsche übertragene niederländische Terminus lautet – oder Stereotypbildung<br />
(BREITENSTEIN 1968) ist zur Genüge aus der medialen<br />
Unterhaltungsindustrie bekannt. Seit den fünfziger Jahren (!) erfolgreiche<br />
Fernsehserien und Sitcoms wie Hogan’s Hero’s/Ein Käfig voller<br />
Helden (in den USA auf vielen Sendern bis heute ausgestrahlt, in Zentraleuropa<br />
seit 2000 werktags täglich auf Kabel 1) oder jüngst Allo, allo<br />
(Großbritannien, seit 1998 auf verschiedenen westeuropäischen<br />
Sendern) sind hervorragende Beispiele einseitiger Schwarzweißdarstellungen,<br />
in denen die deutschen die ‚tumben Tore‘ abgeben – naive,<br />
plumpe Verbrecher, eingefangen mit einem Hauch folkloristisch untermauerter<br />
Sympathie: ein gefundenes Fressen für Attitüden- und Vorurteilsforscher.<br />
Die Folge dieser ‚Vergangenheitsbewältigung‘ ist –<br />
zumindest für Deutschlerner – ein Spracherwerb, der eine außersprachliche<br />
Hypothek mit einschließt und damit wohl den Zugang zum<br />
Deutschen erschwert.<br />
4) Deutsch ist die größte Minderheitensprache im gegenwärtigen Europa,<br />
wird mit völlig unterschiedlichen Staatsauffassungen und politischen<br />
Konzepten, Strukturen und somit Minderheitskonflikten konfrontiert.<br />
Weltanschauliche Symbiosen zwischen der Eigenkultur und der Gastlandkultur<br />
zu finden, zwischen früheren sozialistischen und auf der<br />
anderen Seite westlichen Demokratien, zwischen sozioökonomisch<br />
benachteiligten und am neoliberalen Aufschwung teilhabenden<br />
Staatsmehrheiten dürfte den Deutschen außerhalb der traditionell<br />
deutschsprachigen Staaten nicht immer leicht gefallen sein, wie ein<br />
Blick auf die Liste der wichtigsten Länder beweist, in denen Deutsch<br />
auch heute noch als Minderheitssprache gesprochen wird: Dänemark,<br />
Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Slowakei,<br />
Tschechien, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Russland, Polen.<br />
5) Als Vorurteilskonflikt macht sich ein Lernkonflikt bemerkbar, der davon<br />
ausgeht, dass Deutsch eine besonders schwere Sprache sei. Argumentativ<br />
werden dabei objektive linguistische Kriterien und subjektive<br />
Kriterien vermischt, wie Herbert Christ (1980, 1992) überzeugend<br />
nachgewiesen hat.<br />
6) Obendrein wird sowohl der Erwerb wie die Beherrschung einer deutschen<br />
Standardsprache durch einen Plurizentrikkonflikt erschwert.
68<br />
Peter Hans Nelde<br />
‚Butcher‘ (engl.) und ‚boucher‘ (frz.) haben eben nicht eine, sondern<br />
zahlreiche Entsprechungen, die von allen Deutschsprachigen offensichtlich<br />
verstanden werden, von denen aber nur jeweils eine Entsprechung<br />
zum jeweiligen – aktiv verwendeten – Idiolekt gehört (Schlachter,<br />
Schlächter, Fleischer, Metzger etc.).<br />
7) Schließlich stellt sich das Deutsche als eine potentielle europäische<br />
Konfliktsprache dar, da die qualitative und quantitative internationale<br />
Unterrepräsentierung (vgl. den Gebrauch des Deutschen bei internationalen<br />
Organisationen wie UNO, UNESCO, aber auch bei der EU)<br />
im Falle einer sozioökonomischen oder politischen Benachteiligung<br />
aufgrund des relativ eingeschränkten Mitspracherechts der Deutschen<br />
gegebenenfalls zu Spannungen führen kann. Allerdings legen die<br />
Deutschen zur Zeit eine relativ große Disziplin an den Tag, das heißt,<br />
sie leiten aus der deutschen Förderung und Finanzierung internationaler<br />
Institutionen keine Machtansprüche ab und vermeiden alle aus einer<br />
sprachlichen Hintanstellung eventuell resultierenden Konflikte.<br />
Es wäre wünschenswert, wenn die hier angedeutete ‚Deutsch im Konflikt‘-<br />
Problematik einmal in einer multidisziplinären Gesamtdarstellung analysiert<br />
würde. Daraus ließen sich sicherlich Konfliktvermeidungsstrategien ableiten.<br />
Im europäischen Kontext, der durch zahlreiche Spannungen und Konflikte,<br />
in deren Mittelpunkt häufig unterdrückte, benachteiligte oder einfach<br />
kleine Sprachgemeinschaften (Minderheiten) stehen, soll nunmehr versucht<br />
werden, einige der Strategien, die zur Konfliktneutralisierung beigetragen<br />
haben, zu überprüfen.<br />
5. Ansätze zur Konfliktneutralisierung<br />
Welche Konzepte haben mehrsprachige Staaten in Europa entwickelt und<br />
welche von ihnen haben in mehrsprachigen Sprachgemeinschaften zu einem<br />
friedlicheren Miteinander geführt? Trotz einer zum Teil völlig unterschiedlichen<br />
Ausgangslage lassen sich einige gemeinsame Konzepte herausarbeiten,<br />
zu denen Länder wie Belgien, Luxemburg, aber auch die Schweiz und<br />
die in diesen Ländern verwendeten Konfliktvermeidungsstrategien in besonderer<br />
Weise beigetragen haben.<br />
a) Das Territorialprinzip<br />
Viele Einsprachige stellen sich ein zweisprachiges Land als eines vor, in<br />
dem die Bürger zwei Sprachen sprechen. Zweisprachigkeit kann jedoch<br />
auch bedeuten, dass zwei Sprachen Seite an Seite existieren und beide Sprachen,<br />
zumindest theoretisch, den gleichen Status und gleiche Rechte haben.<br />
Diese sogenannte institutionalisierte Mehrsprachigkeit ist eine Folge des<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 69<br />
Territorialprinzips, das den Bewohner einer Region, die von den zuständigen<br />
Behörden zu einem einsprachigen Gebiet erklärt wurde, zwingt, die<br />
Regionalsprache zumindest in der offiziellen Kommunikation zu gebrauchen.<br />
Das Territorialprinzip muss vom Individualprinzip unterschieden<br />
werden. Letzteres erlaubt jedem Sprecher den Gebrauch seiner Mutter- oder<br />
einer anderen Sprache in allen offiziellen und privaten Domänen unabhängig<br />
von seinem Wohnort.<br />
Obwohl das wenig flexible Territorialprinzip durchaus kritisch gesehen<br />
wird, funktioniert es in verschiedenen mehrsprachigen Ländern, besonders<br />
den reicheren wie Kanada, Belgien und der Schweiz, recht gut. Anfänglich<br />
standen sich die beiden Prinzipien der Mehrsprachigkeit z. B. in Belgien<br />
konträr gegenüber: Das Individualprinzip herrschte bis in die sechziger Jahre<br />
und führte infolge der sprachlichen Asymmetrie im Lande und des daraus<br />
folgenden hohen Prestiges der romanischen Sprache zu weitgehender Französierung<br />
des Landes. Bemerkenswert sind die Folgen des Territorialprinzips<br />
im zweisprachigen Brüssel. Hier wurde die berühmt-berüchtigte ‚liberté<br />
du père (!) de famille‘ (die Wahlmöglichkeit einer der nationalen Sprachen<br />
durch das Familienoberhaupt) erst in den siebziger Jahren aufgegeben. Statt<br />
für eine bilingualisierte Struktur hat sich Brüssel momentan für zwei parallele<br />
einsprachige Systeme in den offiziellen Domänen (Bildung, Verwaltung,<br />
‚Betriebssprache‘) entschieden. Die zwei größten Landesteile sind in<br />
Übereinstimmung mit dem Territorialprinzip mit Ausnahme einiger weniger<br />
Sprachgrenzgemeinden entweder einsprachig Französisch oder Niederländisch.<br />
Diese Anwendung des Territorialprinzips wurde von Außenstehenden<br />
gleichzeitig mit Ablehnung und Bewunderung aufgenommen, da so offenbar<br />
eine kleine mehrsprachige Nation überleben konnte. Die Konsequenzen<br />
für den einzelnen Sprecher sind im Falle Belgiens indes groß: während sozialer<br />
Aufstieg vor der Einführung dieses Konzeptes unabdingbar mit der<br />
Beherrschung zweier Sprachen (zumindest im Fall der flämischen und deutschen<br />
Bevölkerungsgruppen) verbunden war, kann das Leben heute in vielen<br />
Bereichen in einer Sprache verlaufen, nämlich der Sprache des jeweiligen<br />
Gebiets.<br />
Der belgische Staat ist sehr sensibel, was die Beachtung der Rechte der einzelnen<br />
Sprachgruppen im Land angeht. Selbst sehr kleinen Minderheiten<br />
wird ein gleichberechtigter Status eingeräumt. Ein Teil der deutschsprachigen<br />
Minderheit in Ostbelgien, die weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung<br />
ausmacht, profitiert von der Sprachenregelung zwischen den beiden großen<br />
Landesteilen und wird ähnlich behandelt wie die Niederländisch- und Französischsprachigen,<br />
was zur Folge hat, dass Deutsch zur dritten Nationalsprache<br />
landesweit aufgestiegen ist. So sind z.B. alle Hinweisschilder auf
70<br />
Peter Hans Nelde<br />
dem Brüsseler Flughafen viersprachig – die drei offiziellen Sprachen Niederländisch,<br />
Französisch, Deutsch und obendrein – als internationale Luftverkehrssprache<br />
– Englisch und zwar konsequent in dieser Reihenfolge, um<br />
jede Hintansetzung einer Sprachgemeinschaft zu vermeiden. Auch die belgische<br />
Autobahnpolizei berücksichtigt entsprechend alle drei nationalen<br />
Sprachen und wird bei der Verhängung einer Verkehrsstrafe dem Autofahrer<br />
zuerst die Möglichkeit geben, sich zwecks Zahlung einer Strafe für Protokollzwecke<br />
für eine der drei nationalen Sprache zu entscheiden.<br />
Natürlich ist ein solches Vorgehen kostspielig, aber anscheinend im Rahmen<br />
von Sprachkonfliktvermeidungsstrategien doch sinnvoll. Wieviel andere<br />
Länder gestehen einer Sprache mit so wenig Sprechern einen solchen<br />
Status zu? Ohne Zuerkennung eines solchen Status ergäben sich aus dieser<br />
sprachlichen Asymmetrie jedoch auf lange Sicht wohl noch größere Konflikte<br />
und zwar sowohl im wirtschaftlichen wie im politischen Bereich. Die<br />
belgische Konfliktregelung kann mit einigen Einschränkungen somit in<br />
sprachplanerischer Hinsicht als Vorbild für die Europäische Union gelten.<br />
b) Entemotionalisierung<br />
Ein anderes positives Ergebnis des Sprachenstreites in Belgien ist eine gewisse<br />
Entemotionalisierung der Sprachenfrage. Es ist jedoch nicht leicht,<br />
Sprach- und Kulturkonflikten die Emotionen zu ‚entziehen‘ und diese Thematik<br />
zu versachlichen. Mit der Einführung des Territorialprinzips hoffte<br />
der belgische Gesetzgeber, dass eine strenge Sprachenregelung in wenigen<br />
grundsätzlichen Lebensbereichen genug Raum für die größtmögliche Freiheit<br />
des Sprachgebrauchs auf anderen Gebieten lassen würde. Während die durch<br />
das Territorialprinzip geforderte Einsprachigkeit in den meisten mehrsprachigen<br />
Ländern mindestens zwei Domänen betrifft (das Bildungssystem und die<br />
öffentliche Verwaltung), kommt in Belgien die ‚Betriebssprachendomäne‘<br />
hinzu. Wie bereits angedeutet, muss die Sprache des Territoriums in allen<br />
formellen Verträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebraucht<br />
werden. Spannungen, die sich aus sozial determinierter Sprachwahl (wenn<br />
z.B. ein Manager eine andere Sprache als die Gewerkschaftsvertreter gebraucht)<br />
ergeben können, werden dadurch reduziert.<br />
Zusammen mit der Sprachgesetzgebung wurde ein Plan zur Föderalisierung<br />
und Regionalisierung entwickelt, der eine zentralisierte Sprachplanung nach<br />
dem Vorbild Frankreichs verhindern sollte. Da solch regionalisierte Sprachplanung<br />
(in Belgien ‚kommunalisiert‘ genannt) innerhalb der verschiedenen<br />
Sprachgruppen nur in einigen wenigen, aber nichtsdestoweniger entscheidenden<br />
Lebensbereichen angewendet wird, verhält sich der Staat in den übrigen<br />
Domänen überwiegend permissiv und kompensiert Gesetzesstrenge<br />
im sprachlich-kulturellen Bereich mit Liberalität und Toleranz.<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 71<br />
c) Sprachenzählungen<br />
Statt dem Vorbild Nordamerikas und Russlands zu folgen, die ihre Einwohner<br />
in groß angelegten Sprachenzählungen (‚Zensus‘) den vorhandenen<br />
Mehr- und Minderheitensprachen zuordnen, hat Belgien in der demographischen<br />
Erfassung von Minderheiten seinen eigenen Weg eingeschlagen, ausgehend<br />
von dem Prinzip, dass die Rechte und Pflichten einer Mehrheit oder<br />
Minderheit nicht ausschließlich von ihrer zahlenmäßigen Stärke abhängig<br />
seien. Dass die Größe einer Sprachgemeinschaft nicht mehr länger der entscheidende<br />
Faktor im Bereich der Sprachplanung ist, bedeutet, dass Überlegungen<br />
zum Schutz einer Sprachgemeinschaft von der Annahme ausgehen,<br />
dass eine numerische und sozioökonomisch benachteiligte Minderheit mehr<br />
Unterstützung als die mit ihr konfrontierte Mehrheit benötigt, um Gleichberechtigung<br />
zu erlangen. Demzufolge hat der belgische Staat die Sprachenzählung<br />
als Teil der Volkszählung abgeschafft und damit sicher auch beachtlich<br />
zu einer Entemotionalisierung beigetragen.<br />
Da Belgien sich in dieser Hinsicht von den meisten anderen mehrsprachigen<br />
Nationen unterscheidet, wollen wir die besonders konfliktträchtige Frage<br />
der Sprachenzählung etwas genauer betrachten. Wir haben hervorgehoben,<br />
dass Zweisprachigkeit stets asymmetrisch ist, bilinguale Sprecher werden<br />
immer aus dem einen oder anderen Grund in Abhängigkeit von ihrem sozioökonomischen<br />
Status, der kulturellen Identität, etc. eine Sprache bevorzugen.<br />
Deswegen kann die Datensammlung über Bi- oder Multilingualität<br />
in einer Region in Form einer zahlenmäßigen Erfassung der Sprecher kaum<br />
sozial zuverlässige Informationen liefern. So gaben in der Zählung von<br />
1933 in Martelingen, einem kleinen Dorf an der Grenze zwischen Luxemburg<br />
und Belgien, 93 % der Einwohner an, deutschsprachig zu sein, und nur<br />
7 % behaupteten, sie seien frankophon (NELDE 1979). 1947, bei der letzten<br />
amtlichen Volkszählung in Belgien, schien sich die Situation umgekehrt zu<br />
haben: die Mehrheit der Sprecher behauptete, sie seien Frankophone und<br />
nur wenige Prozent sahen sich selbst als Deutschsprecher. Der Grund für<br />
diesen Unterschied liegt auf der Hand: die meisten Dorfbewohner waren zu<br />
Zeiten beider Zählungen zweisprachig, jedoch wurde 1933 Deutsch aus<br />
weltanschaulicher Perspektive (Zeit des Faschismus) eher bevorzugt, während<br />
die gleiche Sprache 1947 – nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg –<br />
wenig beliebt war und es folglich wünschenswert erschien, mehr Französisch<br />
zu sprechen. Deshalb sollten quantitative Daten einer Sprachenzählung<br />
in mehrsprachigen Konfliktsituationen mit Skepsis behandelt werden,<br />
da die Informationen, die sie über Mehrsprachigkeit zu geben scheinen, oft<br />
durch außersprachliche Faktoren verzerrt sind.
72<br />
Peter Hans Nelde<br />
d) Positive Diskriminierung<br />
Als logische Konsequenz aus den Vorüberlegungen zur Entemotionalisierung<br />
und zur Sprachenzählung soll die positive Diskriminierung von<br />
Sprachminderheiten in den Mittelpunkt gerückt werden, ein Aspekt, der von<br />
großem Nutzen für die sprachlichen Minderheiten im zukünftigen Europa<br />
sein könnte. Positive Diskriminierung heißt, dass die Minderheit mehr<br />
Rechte und Vorteile bekommt, als ihr zahlenmäßig nach dem Proporzsystem<br />
zustünden, um ein vergleichbares sprachliches Reproduktionspotential<br />
wie die Mehrheit entwickeln zu können.<br />
Im Falle der hier besprochenen asymmetrischen und insbesondere der institutionalisierten<br />
Mehrsprachigkeit sollte, wenn nötig, die Struktur des Bildungssystems<br />
die Minorität explizit fördern, um zu entsprechenden Ergebnissen<br />
wie die Mehrheit zu gelangen. In der Praxis kann das z.B. bedeuten,<br />
im Schulunterricht kleinere Klassenstärken für kleinere Sprachgruppen zu<br />
akzeptieren, sowie für bessere Bezahlung der Lehrkräfte, an die besondere<br />
Anforderungen gestellt werden, zu sorgen. Minderheitsschüler sollten mehr<br />
Rechte und Vorteile haben, gerade weil sie vom Sozialprestige her und auch<br />
zahlenmäßig oft die schwächere Gruppe sind, damit sie auf lange Sicht die<br />
gleichen sozialen Aufstiegschancen wie die Mehrheitsbevölkerung haben.<br />
Eine andere Form positiver Diskriminierung ist eine Belohnung aller derjenigen,<br />
die in einer zweisprachigen Situation ihren Lebensunterhalt verdienen<br />
müssen. So könnte z.B. ein Briefträger in einer mehrsprachigen Stadt<br />
wegen des erhöhten Arbeitsaufwandes mehr verdienen als sein einsprachiger<br />
Arbeitskollege. Offensichtlich würde das auch zu einer Hebung des Prestiges<br />
und des Status von Zweisprachigen führen.<br />
6. Kontaktlinguistische Evaluierung<br />
Dieser Bereich der kontaktlinguistischen Forschung wächst und verändert<br />
sich ständig. Die Gründe hierfür sind überdeutlich: Erstens lagen die dörflichen<br />
Gemeinschaften, die die Sprache und andere Identitätsmarker ihrer<br />
Minderheit konservierten, oft in der Peripherie der verschiedenen europäischen<br />
Staaten, und aus diesem Grunde wurden sie in der Vergangenheit<br />
häufig als marginal betrachtet. Wenn sie am Wohlstand und ökonomischen<br />
Fortschritt teilhaben wollten, mussten sie sich in den Prozess der Urbanisierung<br />
und Industrialisierung integrieren. Sie verloren während dieses Prozesses<br />
in vielen Fällen ihre Besonderheiten, einschließlich ihrer Sprache. Nun<br />
finden sich eine Reihe dieser Gemeinschaften im Herzen des neuen Europa<br />
wieder, da sie entlang der Grenzen und damit in neuen Kontaktachsen liegen.<br />
Geographisch und geopolitisch sind sie somit nicht länger marginal.<br />
Weiterhin kann es durchaus sein, dass ein übernationales Europa Regionalismus<br />
eher toleriert als die früheren Nationalstaaten. Das bedeutet, dass<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 73<br />
sich diese Gemeinschaften in einem Umschichtungsprozess befinden. Es ist<br />
notwendig, diesen Prozess zu untersuchen. Um zu verstehen, was in einigen<br />
dieser Gemeinschaften bereits passiert ist und noch passieren wird, müssen<br />
wir uns vor allem mit den Sprechergruppen beschäftigen, denen es gelungen<br />
ist, ihre Sprache und Tradition zu erhalten. Minderheitsgruppen wie die Katalanen<br />
geben Aufschluss darüber, was zur Erhaltung und Förderung einer<br />
Minderheitengruppe beitragen kann. Hier verdient die lokale und regionale<br />
Entwicklung mehr Aufmerksamkeit.<br />
Zweitens ist die Mehrsprachigkeit in europäischen Großstädten ein relativ<br />
junges Phänomen. In einigen Fällen wurde sie bereits genauer – empirisch –<br />
unter die Lupe genommen, in anderen Fällen bleibt noch eine Menge zu tun,<br />
um die kontaktlinguistische Entwicklung besser zu verstehen. Es betrifft<br />
hier ein Gebiet, in dem sich Vorurteilsforschung und Linguistik oft berühren<br />
und wo sich Probleme und Konflikte aus multilingualem und multikulturellem<br />
Kontakt ergeben können. Diese erklären sich soziologisch aus Versuchen<br />
der dominanten Gruppe, sozialen Aufstieg für ihre Mitglieder zu<br />
sichern, aber auch aus einem Gefühl der Bedrohung, da sich durch den Zuzug<br />
anderer Gruppen die eigene Identität zu verwischen scheint.<br />
Drittens bleibt das Problem der Sprachen in der Europäischen Union weitgehend<br />
undiskutiert und deshalb ungelöst. Was immer die Lösung sein wird<br />
– drei, vier, elf oder zwanzig Arbeitssprachen – das Europa der Zukunft<br />
wird nicht einsprachig sein. Der Beitritt der skandinavischen Nachbarn –<br />
Länder, die traditionell Englisch als Zweitsprache bevorzugen – und Österreichs<br />
zur Union 1995 komte bereits das bisherige sprachliche Machtgleichgewicht<br />
in Brüssel, Luxemburg und Straßburg verändern und hat bereits<br />
die Debatte neu belebt.<br />
Viertens müssen wir uns mit den Sprachkonflikten entlang der Grenzen der<br />
erweiterten EU im Osten auseinander setzen, wo Sprache mehr und mehr zu<br />
einem Symbol wiedererwachenden Nationalismus zu werden scheint. Hier<br />
muss zwischen Konflikten mit historischen Wurzeln und solchen, die künstlich<br />
– aus Gründen der Grenzverschiebung, der Staatsneugründung oder einfach<br />
aus ideologischen Motiven – entfacht wurden, unterschieden werden.<br />
Mögliche Ursachen für Sprachkonflikte existieren demnach überall in der<br />
Welt wie auch in Europa, die sich häufig als polarisierende Tendenzen bemerkbar<br />
machen: Neben länderübergreifenden Zusammenschlüssen<br />
(NAFTA in Nord- und Mittelamerika, EU in Europa) nehmen gleichzeitig<br />
Nationalismus und Regionalismus zu (Euregio, Alpen-Adria-Regio, Neugründungen<br />
wie Slowenien, Estland u.v.a.). Aus der Geschichte kennen<br />
wir die möglichen Konsequenzen der Unterdrückung von Konflikten. Deshalb<br />
sollten wir als Kontaktlinguisten sinnvolle Beiträge zur Analyse, Beschreibung<br />
und Kontrolle komplexer linguistischer Situationen leisten, wie
74<br />
Peter Hans Nelde<br />
sie sich vor den Augen des Forschers welt- und europaweit tagtäglich abspielen.<br />
7. Schlussbemerkung<br />
Wir haben uns bei unseren Überlegungen zur Sprachideologie von kontaktlinguistischen<br />
Analysen zur Sprachpolitik leiten lassen und dabei auf eine<br />
Grundsatzdiskussion zum Begriff Ideologie in den jeweiligen Sprachräumen<br />
(die englische ‚ideology‘ und die französische ‚idéologie‘ im Gegensatz<br />
zur deutschen ‚Weltanschauung‘) verzichtet. Ideologie als Teil sämtlicher<br />
gegenwärtiger Herrschaftsformen, als Kolonialismus oder als<br />
Postkolonialismus unter dem Feigenblatt der Demokratie, als Teil modernistischer<br />
oder postmodernistischer Gesellschaftsanalysen hat längst in Soziologie<br />
und Kontaktlinguistik Einzug gehalten, wie Louis-Jean Calvets Arbeiten<br />
zum ‚Krieg der Worte‘ und zur ‚Glottophagie‘, in jüngster Zeit aber<br />
auch im modernen Konzept eines Diskurses der Streitkultur (argument culture)<br />
Deborah Tannens zur Genüge gezeigt haben. Eine Verflechtung dieser<br />
unterschiedlichen Ansätze würde die kontaktlinguistische Diskussion um<br />
ideologische Aspekte der Sprachpolitik vermutlich bereichern.<br />
Literatur<br />
DE BOT, Kees (1997): Neldes Law Revisited: Dutch as a Diaspora Language.<br />
– In: W. Wölck, A. de Houwer (Hg.), Recent Studies in Contact Linguistics<br />
(Plurilingua XVIII), Bonn: Dümmler, 51–59.<br />
BREITENSTEIN, Rudolf (1968): Der häßliche Deutsche? München: Beck.<br />
CALVET, Louis-Jean (1987): La guerre des langues et les politiques linguistiques.<br />
Paris: Payot.<br />
CHRIST, Herbert (1980): Fremdsprachenunterricht und Sprachenpolitik.<br />
Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
CHRIST, Herbert (1992): Fremdsprachenunterricht für das Jahr 2000.<br />
Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
GOEBL, Hans/NELDE, Peter et al. (Hg.) (1996): Kontaktlinguistik I. Berlin,<br />
New York: de Gruyter (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft<br />
12).<br />
GOEBL, Hans (1997): Die altösterreichische Sprachenvielfalt und -politik<br />
als Modellfall von heute und morgen. – In: U. Rinaldi, R. Rindler-Schjerve,<br />
M. Metzeltin (Hg.), Sprache und Politik, Wien: Istituto Italiano di Cultura,<br />
103–121.<br />
Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache 75<br />
GRIN, François (1996): The economics of language: survey, assessment<br />
and prospects. – In: International Journal of the Sociology of Language<br />
121, 17–44.<br />
HAARMANN, Harald (1980): Multilingualismus I, II. Tübingen: G. Narr.<br />
MATTHEIER, Klaus (1984): Sprachkonflikte in einsprachigen Ortsgemeinschaften.<br />
Versuch einer Typologie. – In: E. Oksaar (Hg.), Spracherwerb,<br />
Sprachkontakt, Sprachkonflikt. Berlin, New York: de Gruyter, 197–204.<br />
NELDE, Peter (1976): Volkssprache und Kultursprache. Wiesbaden: Steiner.<br />
NELDE, Peter/STRUBELL, Miquel/WILLIAMS, Glyn (1995): Euromosaic<br />
(I) – Produktion und Reproduktion der Minderheiten-Sprachgemeinschaften<br />
in der Europäischen Union. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen<br />
der EG.<br />
NELDE, Peter/STRUBELL, Miquel/WILLIAMS, Glyn (2000): Euromosaic<br />
(II) (unveröffentliches Manuskript).<br />
NELDE, Peter et. al. (2005): Euromosaic (III) (im Druck).<br />
OKSAAR, Els (1980): Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachkonflikt. –<br />
In: P. Nelde (Hg.), Sprachkontakt und Sprachkonflikt. Wiesbaden: Steiner,<br />
43–52.<br />
TANNEN, Deborah/LEAPMAN, Michael (1999): The argument culture:<br />
changing the way we argue and debate. London: Virago.
Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung<br />
Peter Ernst<br />
Der Ruf nach einer „Pragmatisierung der Sprachwissenschaft“ ist nicht neu.<br />
Spätestens seit der ‚Pragmatischen Wende‘ zu Ende der 60er-Jahre des 20.<br />
Jahrhunderts, die die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaften eingefordert<br />
hat, fragt man nach der konkreten kommunikativen Funktion historischer<br />
Sprachen, etwas, das man als ‚Historische Pragmatik‘ oder „Historische<br />
Pragmalinguistik“ bezeichnen könnte, je nachdem, wie weit oder eng<br />
man den Begriff Pragmatik verstehen will. Um diesen Ruf besser verstehen<br />
zu können, sollte man sich das klassische dreistufige Semiotikmodell von<br />
Charles William Morris wieder ins Gedächtnis bringen, das das sprachliche<br />
Zeichen in Beziehung setzt zu anderen sprachlichen Zeichen (Syntaktik), zu<br />
den Designata (Semantik) und schließlich zu den Sprachverwendern (Pragmatik)<br />
(vgl. MORRIS 1938/1972). Grundlage jeglicher sprachpragmatischer<br />
Überlegungen sind also der Zeichenverwender und die konkrete<br />
Situation der Zeichenverwendung.<br />
Wer nun aber gleich einen „Paradigmenwechsel“ in der Historischen<br />
Sprachwissenschaft im Sinne von Kuhns „wissenschaftlicher Revolution“<br />
sehen will (KUHN 1969), sollte nicht vergessen, dass man von Beginn der<br />
modernen Sprachwissenschaft am Anfang des 19. Jahrhunderts auch stets<br />
den Zeichenverwender im Auge hatte und sich nicht scheute, ihn bei der<br />
Sprachbeschreibung mit einzubeziehen – auch wenn man dies natürlich<br />
nicht Sprachpragmatik genannt hat.<br />
1. Aufgaben und Ziele der Historischen Pragmalinguistik<br />
Die Sprachpragmatik betrachtet Sprache bekanntlich als Handeln und handeln<br />
kann man sowohl mit mündlichen als auch mit schriftlichen Sprachformen.<br />
Sprache als Form sozialen Handelns betrifft ihre Einbettung in soziale<br />
und situative Zusammenhänge, wie sie an bestimmten sprachlichen<br />
Mitteln (z.B. der Deixis, dem Ausdruck der Sozialstellung des Sprechers<br />
oder Adressaten u.v.a.m.) auch in historischen Texte greifbar wird<br />
(CHERUBIM 1984: 803).<br />
In diesem Sinne gibt es eine Reihe von Strömungen der historischen<br />
Sprachwissenschaft, die in ihren Grundansichten und ihrer Methodik durchaus<br />
als Vorläufer der Historischen Pragmatik angesehen werden können:
78<br />
Peter Ernst<br />
• die Frage nach den sprachexternen Ursachen von Laut- und Sprachwandel<br />
• kulturgeschichtlich bedingte Änderungen im Wortschatz (historische<br />
Semantik)<br />
• die Verbindung zwischen (lokal)historischen Vorgängen und sprachlichen<br />
Erscheinungen (Theodor Frings)<br />
• der Einfluss der Kultur- und Geistesgeschichte auf die Sprache (Konrad<br />
Burdach)<br />
• die Frage nach der Verwendung bestimmter Gegenstände und ihre Spuren<br />
in der Benennung dieser Gegenstände (‚Wörter und Sachen‘, dazu<br />
PANAGL 1977: 400) u.a.m.<br />
Eine pragmatisch ausgerichtete Sprachgeschichtsschreibung muss über die<br />
Ziele einer reinen historischen Linguistik hinausgehen. Die Ziele der historischen<br />
Pragmalinguistik kann man weiter differenzieren, indem man sucht<br />
nach<br />
• „Sprachgebrauchskonventionen in einer (bestimmten) historischen Sprach(gebrauchs)gemeinschaft“<br />
und<br />
• der „Entwicklung bestimmter Sprachgebrauchskonventionen über einen<br />
bestimmten Zeitraum“ hinweg (vgl. BAX 1983: 3).<br />
Dies kann sich in mehreren konkreten Richtungen äußern wie:<br />
• in den Ansätzen einer pragmatisierten historischen Semantik, die etwa<br />
Bedeutungswandel nicht nur durch die Umprägung von Inhalten erklärt,<br />
sondern das kultur- und geistesgeschichtliche Umfeld sowie die Einwirkung<br />
von Situation und Sprachhandlungselementen mit berücksichtigt;<br />
• einer historischen Sprechakttheorie, die bestimmte Sprachhandlungstypen<br />
aus schriftlichen Dialogstrukturen extrahiert. Es erhebt sich dabei<br />
die Frage, ob Unterschiede zwischen historisch dokumentierten Sprechakten<br />
(etwa der rituellen Beschimpfung des Feindes vor dem Kampf)<br />
und heutigem Sprachgebrauch festgestellt werden können;<br />
• einer historischen Partikelforschung, die derzeit nur in Ansätzen vorliegt;<br />
• einer historisch ausgerichteten Überprüfung der Grice’schen Konversationsmaximen,<br />
etwa ob sie für frühere Zeiten auch gelten bzw. inwieweit<br />
sie modifiziert werden könnten;<br />
• einer historischen Textlinguistik, d. h. einer Textgrammatik, die ihre<br />
Verfahrensweisen an historischen Texten erprobt und gegebenenfalls<br />
modifiziert oder neu formuliert;<br />
• einer historischen Soziolinguistik u. a. m.<br />
Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung<br />
Schließlich kann die pragmatische Sprachgeschichtsforschung wie jede Wissenschaftsdisziplin<br />
als reiner Selbstzweck betrieben werden oder mit konkreten<br />
Applikationsabsichten, etwa als Hilfsmittel, um literarische und andere<br />
Texte aus dem historischen Kontext interpretieren zu können.<br />
2. Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung<br />
Dabei sind prinzipiell mehrere Untersuchungsarten denkbar: Man kann historische<br />
Texte eindimensional auffassen und danach fragen, welche Kommunikationsvorgänge<br />
in einem Text geschildert werden; man kann also<br />
Dialoge (direkte Rede) untersuchen oder Reflexe gesprochener Sprache und<br />
daran die pragmalinguistischen Methoden anwenden.<br />
Es gibt Texte, die gesprochene Sprache, etwa direkte Rede, schriftlich festhalten<br />
analog zur mündlichen Kommunikation. Eine Reihe von Untersuchungen<br />
zur historischen Pragmalinguistik fallen in diese Sparten, etwa jene<br />
von Stefan Sonderegger (1980) über das gesprochene Althochdeutsch oder<br />
von Helmut Henne (1980) zur Rekonstruktion gesprochener Sprache im<br />
18. Jahrhundert. Marcel Bax (1991) hat in historischen Texten wie dem<br />
Hildebrandslied und anderen Werken Dialogstrukturen offen gelegt, Peter<br />
Wiesinger (1996) suchte nach den Reflexen gesprochener Sprache im bairischen<br />
Frühneuhochdeutsch. Allerdings werden auf diese Art nur Sprachhandlungen,<br />
die gleichsam im Text ‚eingefroren‘ sind, dokumentiert. Man<br />
muss aber nicht auf dieser Stufe stehen bleiben. Ein Text interagiert nämlich<br />
auch mit dem Rezipienten, für den er gedacht ist, und zwar im Augenblick<br />
der Rezeption. Das soziale Handeln tritt also aus der Textebene heraus und<br />
wird gleichsam ‚zweidimensional‘. Zu jedem Text gehört aber nicht nur ein<br />
(realer oder fiktiver) Rezipient, sondern natürlich auch ein Textproduzent<br />
oder Autor. Damit tritt eine weitere Dimension hinzu.<br />
Wenn wir die Vorgänge des Textproduzierens und -rezipierens als eigenständige<br />
Stufen ansehen, so müssen sie sich in ihrer Wesensart vom reinen<br />
Text, der gleichsam als ‚Konservierungsmittel‘ dieser Vorgänge dient, unterscheiden.<br />
Dies ist nicht unwesentlich für unser Modell, denn auch diese<br />
Zeit kann auf die Produktion und Rezeption einwirken:<br />
a) auf die Produktion insofern, als ein Text für spätere Rezipienten konzipiert<br />
sein kann oder aber darauf vergessen wird, dass ein Text (auch) zu<br />
einem späteren Zeitpunkt rezipiert wird<br />
b) auf die Rezeption insofern, als die verstrichene Zeit die Rezeption einschränken<br />
oder generell unmöglich machen kann.<br />
3. Ein sprachpragmatisches Textmodell für die Sprachgeschichte<br />
Um keine terminologischen Missverständnisse hervorzurufen und vor allem<br />
um nicht den anachronistischen Verdacht aufkommen zu lassen, die Lingui-<br />
79
80<br />
Peter Ernst<br />
stik fühle sich gegenüber naturwissenschaftlichen Disziplinen benachteiligt<br />
und strebe deswegen die Verwendung ihrer Terminologie an, werden wir im<br />
Folgenden statt des Ausdrucks ‚Dimension‘ den Ausdruck ‚Ebene‘ bevorzugen.<br />
Mit ‚Ebene‘ werden die Textebene und die außersprachliche Ebene<br />
(Produzent und Rezipient) vom linearen Vorgang der Produktion, Rezeption<br />
sowie der Textbezüge (mit ‚Stufe‘ bezeichnet) unterschieden.<br />
Wenn wir die Vorgänge des Textproduzierens und -rezipierens als eigenständige<br />
Stufen ansehen, so müssen sie sich in ihrer Wesensart vom reinen<br />
Text, der gleichsam als Konservierungsmittel dieser Vorgänge dient, unterscheiden.<br />
Wir kommen damit zu folgender Matrix:<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
Produzent Ebene 1 Rezipient<br />
Ebene 2 Text Text Ebene 2<br />
Unter Ebene 1 können die sprachexternen Aspekte von Sprache subsumiert<br />
werden, unter Ebene 2 die sprachinternen. Ebene 1 umfasst damit alles, was<br />
üblicherweise als Kontext bezeichnet wird: Die Umstände der Produktion<br />
(Ebene 1, Stufe 1) und der Rezeption (Ebene 1, Stufe 3). Damit sind die<br />
außersprachlichen Bezüge gemeint wie Situation, Ort und Zeit der Äußerung,<br />
Sozialverhalten der Teilnehmer usw. So wird dieser Teil der Kommunikation<br />
im eigentlichen Sinn pragmalinguistisch, denn einer Tradition seit<br />
Bloomfield folgend, kann man diese sprachexternen Begleitumstände als<br />
‚Bedeutung‘ des sprachlichen Zeichens auffassen:<br />
Genauso sagen wir, dass eine an sich unbedeutende sprachliche Äußerung wichtig ist, weil sie<br />
eine Bedeutung hat: Die Bedeutung besteht aus eben jenen wichtigen Dingen, mit<br />
denen die Sprachäußerung verbunden ist, nämlich den nichtsprachlichen Vorgängen.<br />
(BLOOMFIELD 2001: 54).<br />
Die Stufen 1 bis 3 sind linear aufzufassen, da sie chronologisch aufeinander<br />
folgen: Zuerst muss ein Text verfasst werden, bevor er rezipiert werden<br />
kann. Sie sind aber nicht als synchron zu verstehen, da zwischen dem Produzieren<br />
und dem Rezipieren des Textes eine Zeitspanne verstreichen kann,<br />
die von sprachexternen Faktoren (Qualität des Schreibmaterials) oder<br />
sprachinternen Faktoren (Veränderung des Sprachsystems) determiniert ist.<br />
Dies ist nicht unwesentlich für unser Modell, denn auch diese Zeit kann auf<br />
die Produktion und Rezeption einwirken:<br />
Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung<br />
1. auf die Produktion insofern, als ein Text für spätere Rezipienten konzipiert<br />
sein kann oder aber vergessen wird, dass ein Text (auch) zu einem späteren<br />
Zeitpunkt rezipiert wird;<br />
2. auf die Rezeption insofern, als die verstrichene Zeit die Rezeption einschränken<br />
oder generell unmöglich machen kann.<br />
Diese Produktions- und Rezeptionsvorstellungen werden üblicherweise<br />
auch als Sinn angesprochen. Das Modell hat den Vorteil, nicht nur die Phasen<br />
der Textproduktion und -rezeption besser unterscheiden zu können,<br />
sondern auch sprachpragmatische Aspekte wie die Produzentenintention<br />
und die Rezipientenerwartung einbeziehen zu können:<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
Produzent Ebene 1 Rezipient<br />
Ebene 2 Text Text Ebene 2<br />
Zu den Aufgaben der historischen Pragmalinguistik gehört nicht nur, Phänomene<br />
zu untersuchen, die der zweiten Ebene angehören. Diesem Bereich<br />
entstammt die Textkritik, die seit den Zeiten von Karl Lachmann großartige<br />
Erfolge zu verzeichnen hat. Sie bleibt jedoch immer nur der Textebene verhaftet<br />
in dem Sinn, dass die strenge Lachmann’sche Textkritik von einem<br />
einzigen und einheitlichen Archetyp ausgeht, der durch Handschriftenvergleich<br />
rekonstruiert werden kann. Im Gegensatz dazu kann man den Entstehungsprozess<br />
eines Werks auch als Übergang von Ebene 1 in Ebene 2 verstehen,<br />
an dem nicht nur der Autor, sondern auch die verschiedenen<br />
Schreiber, Redaktoren oder später Setzer und Buchdrucker aktiv und textkonstituierend<br />
beteiligt sind.<br />
Ebene 2 gehören alle Belange an, die die Textinterna betreffen. Kriterium<br />
für ihre Aufrechterhaltung ist die Identität des Kanals; also bleiben auch<br />
Elemente der gesprochenen Sprache, wenn sie im Text ‚eingefroren‘ sind,<br />
in diesem Gegenstandsbereich.<br />
Obwohl die Erkenntnisse aus der zweiten Stufe von Belang sind, erscheint<br />
es wichtiger, die erste und dritte Stufe (auf Ebene 1) zu analysieren. So<br />
kann man in Stufe 1, wie bereits erwähnt, leichter differenzieren zwischen<br />
dem Willen des Autors und dem des Schreibers. Andererseits sind Autoren<br />
bzw. Schreiber durch ihr Wissen und die (wahren oder vermuteten) textkonstitutiven<br />
Merkmale an die Anforderungen ihres Textes gebunden. Dies<br />
81
82<br />
Peter Ernst<br />
wird durch den Pfeil vom Text in Richtung auf den Produzenten symbolisiert.<br />
Auf Stufe 3 wiederum kann die Erwartungshaltung der Rezipienten<br />
auf den Text einwirken. Zu fragen ist nach der Erwartung, die ein Rezipient<br />
an einen Text stellt, was er darin zu finden meint und inwieweit dies zurückwirkt<br />
auf die Produktion des Textes, wenn dem Produzenten die Erwartungshaltung<br />
des Rezipienten bekannt ist (an dieser Stelle möchte ich mich<br />
bei meinem Freund und Kollegen Dr. Arne Ziegler, Münster, herzlich für<br />
die fruchtbaren Diskussionen bedanken).<br />
Die Tauglichkeit dieses Modells sollte sich an praktischen Untersuchungen<br />
erweisen. Auch sollte ein Modell so geartet sein, dass es in entsprechender<br />
Weise abgeändert oder modifiziert werden kann. All dies hat durch die Praxis<br />
pragmatischer Sprachgeschichtsforschung zu erfolgen (vgl. dazu in<br />
ERNST 2001, 2002, <strong>2004</strong> sowie die wichtigen Arbeiten von MEIER <strong>2004</strong><br />
und ZIEGLER 2003). 1<br />
Literaturverzeichnis<br />
BAX, Marcel M. H. (1983): Die lebendige Dimension toter Sprachen. Zur<br />
pragmatischen Analyse von Sprachgebrauch in historischen Kontexten. –<br />
In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 11, 1–21.<br />
BAX, Marcel M. H. (1991): Historische Pragmatik: Eine Herausforderung<br />
für die Zukunft. – In: D. Busse (Hg.), Diachrone Semantik und Pragmatik.<br />
Untersuchungen zur Erklärung und Beschreibung des Sprachwandels (=<br />
Reihe Germanistische Linguistik 113). Tübingen: Niemeyer, 37–65.<br />
BLOOMFIELD, Leonard (2001): Die Sprache. Deutsche Erstausgabe,<br />
übersetzt, kommentiert und herausgegeben von P. Ernst und H. Ch. Luschützky.<br />
Wien: Edition Praesens.<br />
CHERUBIM, Dieter (1984): Sprachgeschichte im Zeichen der linguistischen<br />
Pragmatik. – In: W. Besch, O. Reichmann, S. Sonderegger (Hg.),<br />
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache<br />
und ihrer Erforschung (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft<br />
2.1). Berlin, New York: de Gruyter, 802–815.<br />
ERNST, Peter (1994): Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache<br />
in Wien (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 3). Wien: Edition<br />
Praesens..<br />
1 Siehe hierzu auch die Besprechung von Boková (<strong>2004</strong>) in diesem Bnd.<br />
Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung<br />
ERNST, Peter (1995): Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache<br />
in Wien. – In: Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie 39<br />
Heft 3 (276), 173–188.<br />
ERNST, Peter (2001): Pragmatische Aspekte der historischen Kanzleisprachenforschung.<br />
– In: Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext.<br />
Beiträge zu einem internationalen Symposium an der Universität <strong>Regensburg</strong>,<br />
5. bis 7. Oktober 1999 (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1).<br />
Hrsg. von A. Greule. Wien: Edition Praesens, 17–31.<br />
ERNST, Peter (2002): Pragmalinguistik. Grundlagen, Anwendungen, Probleme.<br />
Berlin, New York: de Gruyter.<br />
ERNST, Peter (<strong>2004</strong>): Kanzleisprachen als Quelle der Historischen Pragmalinguistik.<br />
– In: H. Boková (Hg.), Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen<br />
in Böhmen, Mähren und der Slowakei. Vorträge der internationalen<br />
Tagung veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät<br />
der Südböhmischen Universität. České Budějovice 20.–22. September<br />
2001. Wien: Edition Praesens, 9–19.<br />
HENNE, Helmut (1980): Probleme einer historischen Gesprächsanalyse.<br />
Zur Rekonstruktion gesprochener Sprache im 18. Jahrhundert. – In: H. Sitta<br />
(Hg.), Ansätze zu einer pragmatischen Sprachgeschichte. Zürcher Kolloquium<br />
1978 (= Reihe Germanistische Linguistik 21). Tübingen: Niemeyer,<br />
89–102.<br />
KUHN, Thomas K. (1969): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen.<br />
Frankfurt/Main: Suhrkamp.<br />
MEIER, Jörg (<strong>2004</strong>): Städtische Kommunikation in der Frühen Neuzeit.<br />
Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik (= Deutsche<br />
Sprachgeschichte, Texte und Untersuchungen 2). Frankfurt/Main: Lang.<br />
MORRIS, Charles William (1938): Foundations of the Theory of Signs.<br />
Chicago. (= International Encyclopedia of Unified Science I, Foundations<br />
of the Unity of Science 2). Deutsche Ausgabe: Grundlagen der Zeichentheorie,<br />
Ästhetik der Zeichentheorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1972.<br />
PANAGL, Oswald (1977): Pragmatische Perspektiven in der historischen<br />
Sprachwissenschaft. – In: G. Drachmann (Hg.), Akten der 2. Salzburger<br />
Frühlingstagung für Linguistik. Salzburg vom 29. bis 31. Mai 1975. Tübingen:<br />
Niemeyer, 388–412.<br />
POLENZ, Peter von (1980): Zur Pragmatisierung der Beschreibungssprache<br />
in der Sprachgeschichtsschreibung. – In: H. Sitta (Hg.), Ansätze zu einer<br />
pragmatischen Sprachgeschichte (= Reihe Germanistische Linguistik 21).<br />
Zürcher Kolloquium 1978. Tübingen: Niemeyer, 36–51.<br />
83
84<br />
Peter Ernst<br />
QUASTHOFF, Uta (1975): ‚Homogenität‘ versus ‚Heterogenität‘ als Problem<br />
der historischen Sprachwissenschaft. – In: Beiträge zur Grammatik<br />
und Pragmatik (= Skripten Linguistik und Kommunikationswissenschaft<br />
12). Hrsg. von V. Ehrich und P. Finke. Kronberg/Taunus, 1–21.<br />
SITTA, Horst (1980) (Hg.): Ansätze zu einer pragmatischen Sprachgeschichte.<br />
Zürcher Kolloquium 1978 (= Reihe Germanistische Linguistik 21).<br />
Tübingen: Niemeyer<br />
SONDEREGGER, Stefan (1980): Gesprochene Sprache im Althochdeutschen<br />
und ihre Vergleichbarkeit mit dem Neuhochdeutschen – Das Beispiel<br />
Notkers des Deutschen von St. Gallen. – In: H. Sitta (Hg.), Ansätze zu einer<br />
pragmatischen Sprachgeschichte (= Reihe Germanistische Linguistik 21).<br />
Zürcher Kolloquium 1978. Tübingen: Niemeyer, 71–88.<br />
WIESINGER, Peter (1996): Schreibung und Aussprache im älteren Frühneuhochdeutschen.<br />
Zum Verhältnis von Graphem – Phonem – Phon am bairisch-österreichischen<br />
Beispiel von Andreas Kurzmann um 1400. (= Studia<br />
Linguistica Germanica 42) Berlin, New York: de Gruyter.<br />
ZIEGLER, Arne (2003): Städtische Kommunikationspraxis im Spätmittelalter.<br />
Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik (= Germanistische<br />
Unterischungen zur Sprachgeschichte 2). Berlin: Weidler.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien.<br />
Ergebnisse einer Fragebogenerhebung<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
1. Ziele und Durchführung der Untersuchung<br />
Im folgenden Beitrag möchte ich einige Ergebnisse meiner Untersuchung<br />
zum Anredeverhalten in Deutschland, Österreich und Tschechien vorstellen.<br />
Den Anstoß für diese Untersuchung gaben mir persönliche Erfahrungen<br />
während meines Lektorates in Prag zu Beginn der neunziger Jahre. Ich kam<br />
damals von der Freien Universität aus Berlin, wo wir wenigstens in der Anfangszeit<br />
meines Studiums die Assistenten und einige jüngere Professoren<br />
noch geduzt und mit Vornamen angeredet hatten. In Prag fand ich mich unversehens<br />
in einem universitären Kontext wieder, in dem bei jeder denkbaren<br />
Gelegenheit in der Anrede säuberlich zwischen „pane doktore“, „paní<br />
docentko“ und „pane profesore“ unterschieden wurde. Ein wahrhaft anregendes<br />
Kontrasterlebnis! Ich habe daraufhin gemeinsam mit Magdalena<br />
Kneřová 1992/93 den ersten Teil der Untersuchung durchgeführt, von der<br />
hier berichtet werden soll. 1 Den zweiten Durchlauf dieser Fragebogenerhebung<br />
habe ich in den Jahren 2000/2001 dann allein unternommen.<br />
Was waren die Ziele dieser beiden Erhebungen? Ich wollte erstens empirisch<br />
überprüfen, ob sich die individuellen Erfahrungen meiner Prager Zeit<br />
verallgemeinern lassen. Zum Titelgebrauch im Deutschen gibt es bis heute<br />
bedauerlich wenige Studien, zum Titulieren im Tschechischen noch weniger.<br />
2 Quantitativ wird der Titelgebrauch auch im Deutschen überhaupt nur<br />
in zwei kleineren Arbeiten untersucht. 3 Auch zu anderen Aspekten der An-<br />
1 Vorläufige Ergebnisse dieser Befragung gingen in die von Emil Skála und mir betreute<br />
Diplomarbeit von Magdalena Kneřová ein, die die pronominale Anrede, den Titelgebrauch<br />
und die Verwendung des Vokativs im Tschechischen untersucht (KNEŘOVÁ<br />
1994). Einen kurzen Abriss einiger Ergebnisse geben KNEŘOVÁ (1995) und EHLERS<br />
/ KNEŘOVÁ (1997).<br />
2 Gegenüber der auch in der Öffentlichkeit viel stärker diskutierten pronominalen Anrede<br />
wird die nominale Anrede von der Forschung vergleichsweise wenig bearbeitet. Titel<br />
und Titelgebrauch im Tschechischen behandeln in den letzten Jahren allerdings die informativen<br />
Arbeiten von RATHMAYR (1992), BERGER (1995) und BERGER (2001).<br />
3 FINKENSTAEDT (1981: 25–27) berichtet von einer kleinen Befragung unter 131 Lehrern,<br />
Studenten und Schülern. An dieser Untersuchung haben wir uns in einem Testlauf<br />
zunächst orientiert. Auf die kontrastive Fragebogenuntersuchung von BRÜHL (1982)<br />
mit je 100 dänischen und deutschen Informanten sei hier nur verwiesen, sie konnte aus<br />
sprachlichen Gründen nicht berücksichtigt werden. RATHMAYR (1992: 267) stützt ihre<br />
Darstellung zum Russischen, Serbokroatischen und Tschechischen „auf eigene, in der<br />
ersten Hälfte des Jahres 1991 durchgeführte Umfragen.“ Die Zahl der Befragten bleibt
86<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
rede mangelt es bis heute an deutsch-tschechischen kontrastiven Untersuchungen.<br />
Es musste mir also zweitens und hauptsächlich darum gehen, Einzelheiten<br />
über den Gebrauch vergleichbarer Anredeformen in den beiden Sprechergemeinschaften<br />
zu ermitteln. Welches sind die Normen des Anredeverhaltens<br />
im Deutschen und Tschechischen? Und wie sind die Konventionen des<br />
Sprachgebrauchs über die sozialen Gruppierungen in beiden Sprachgemeinschaften<br />
verteilt? 4 Beim zweiten Durchlauf der Untersuchung habe ich besondere<br />
Aufmerksamkeit auch auf die regionale Differenzierung gelegt.<br />
Einige österreichische Informanten, die uns eher zufällig in die erste Untersuchung<br />
‚gerutscht‘ waren, wichen in ihren Antworten so signifikant von<br />
den bundesdeutschen Ergebnissen ab, so dass ich die Studie fortan als gewissermaßen<br />
dreisprachig deutsch-tschechisch-österreichisch angelegt habe.<br />
Von Beginn an hat mich drittens besonders die Frage interessiert, ob das<br />
tschechische Anredeverhalten auf den gesellschaftlichen Systemwandel<br />
nach der politischen Wende reagiert hat bzw. reagieren wird. Auch innerhalb<br />
des deutschen Anredeverhaltens gibt es meiner eigenen Intuition nach<br />
in der jüngeren Vergangenheit deutliche Verschiebungen, die eine genauere<br />
Beobachtung lohnen. Im Hinblick auf diesen diachronischen Aspekt des<br />
Anredeverhaltens möchte ich meine Untersuchung als Langzeitstudie in<br />
Intervallen von etwa zehn Jahren wieder aufgreifen, um Veränderungen<br />
unter ähnlichen Vorgaben beobachten zu können. Einstweilen ist aber die<br />
Auswertung der bisherigen Ergebnisse noch nicht ganz abgeschlossen.<br />
Als erster Zugang zu dem kaum erforschten Themenbereich scheint mir die<br />
Form einer Fragebogenerhebung sinnvoll. Es ist klar, dass mit einer solchen<br />
Erhebung eher das reflektierte Normbewusstsein der Informanten erfasst<br />
wird als deren tatsächlicher Sprachgebrauch. 5 Ich sehe aber kaum eine an-<br />
bei Rathmayr aber ebenso ungeklärt wie beispielsweise der Aufbau und die Fragestellungen<br />
ihres Erhebungsbogens.<br />
4 Unter Norm soll dabei mit Eugenio Coseriu die usuelle Verwendung der Mittel verstanden<br />
werden, die das Sprachsystem vorgibt (vgl. COSERIU 1979).<br />
5 Es wäre also grundsätzlich denkbar, dass unsere Informanten ihren tatsächlichen Titelgebrauch<br />
in der reflektierten Selbsteinschätzung übertrieben hoch ansetzen. Nach<br />
NEKVAPIL/NEUSTUPNÝ (im Druck: 12) könnte der gesellschaftliche Wandel hin zur<br />
Markwirtschaft bei den Tschechen das Gefühl erzeugt haben, die häufige Verwendung<br />
von Titeln sei nun eigentlich besonders angebracht, auch wenn sie diesem Normbewusstsein<br />
tatsächlich gar nicht nachkommen. Meine eigenen Erfahrungen im deutsch-tschechischen<br />
Kontakt weisen allerdings sehr deutlich darauf hin, dass die Selbsteinschätzung<br />
meiner Informanten den tschechischen Titelgebrauch einigermaßen realistisch<br />
beschreibt. Auch andere Erfahrungsberichte von persönlichen deutsch-tschechischen<br />
Begegnungen belegen, dass der bundesdeutsche und der tschechische Titelgebrauch<br />
stark divergieren. Vgl. z.B. BERGER (2001: 8, Anm. 23). Selbsteinschätzung der Befragten<br />
und ihr tatsächlicher Usus fallen hier also keineswegs weit auseinander.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
dere Möglichkeit, mit vertretbarem Zeitaufwand quantitative Daten zum<br />
Anredeverhalten zu erlangen. Im Unterschied zu älteren Fragebogenerhebungen<br />
zur Anrede in einzelnen Sprachen, die sich meist nur auf kleine,<br />
geschlossene Informantengruppen bezogen, war es mir wichtig, einen möglichst<br />
großen und breit gestreuten Kreis von Sprechern zu befragen, der<br />
auch in Zukunft beliebig zu erweitern ist. Meine Erhebung arbeitet also mit<br />
einem offenen Sample. Die Fragebögen mussten also entsprechend knapp<br />
gefasst und ebenso leicht auszufüllen wie bequem auszuwerten sein.<br />
Die Funktion der Anrede wird in den europäischen Sprachen meist entweder<br />
durch Nomen (wie Namen, Titel, Spitznamen, Kosewörter usw.) oder<br />
durch Pronomen und die entsprechende Personalendung des Verbs ausgefüllt.<br />
Um aus beiden formalen Bereichen wenigstens einen Teilaspekt zu<br />
beleuchten, habe ich einen Bogen zum Duzen/Siezen bzw. tykání und vykání<br />
und einen zweiten zum Gebrauch von Titeln verteilt. Im Folgenden<br />
möchte ich aber aus Raumgründen nur einige Ergebnisse des Titelbogens<br />
vorstellen. Von diesem Bogen haben wir in der ersten Erhebungsphase etwa<br />
700 Exemplare gesammelt. In der zweiten Phase 2000/2001 kamen noch<br />
einmal etwa 600 Exemplare hinzu. Bis heute habe ich genau 1324 Bogen<br />
zum Titelgebrauch ausgewertet: 718 davon aus Deutschland, 475 aus<br />
Tschechien und 131 aus Österreich. Gegenstand dieses Bogens sollte nicht<br />
nur die Verwendung der klassischen akademischen Titel sein, sondern gerade<br />
mit Blick auf die tschechischen Verhältnisse auch Funktionsbezeichnungen<br />
wie „Herr Lehrer“, „Herr Bürgermeister“ oder „Frau Ministerin“.<br />
Ich möchte mich jetzt nicht länger mit detaillierten Vorüberlegungen zu<br />
Wesen und Funktion der Anrede mit derartigen Nomen und dem Vergleich<br />
ihrer Stellung im jeweiligen Sprachsystem aufhalten. Einen wichtigen Punkt<br />
aber, der die Vergleichbarkeit dieser Formen im Deutschen und Tschechischen<br />
gewährleistet, muss ich wenigstens kurz berühren. Anders als die<br />
pronominale Anrede mit Du und Sie bzw. ty und vy werden die Anredenomen<br />
in beiden Sprachen syntaktisch ausgegliedert. Die Anredenomen<br />
fungieren hier nicht als Satzglieder, sondern sie werden dem jeweiligen<br />
Satzzusammenhang vor-, ein- oder nachgeschaltet. Etwa so:<br />
Frau Ministerin, wollen Sie zu der Frage Stellung nehmen?<br />
Wollen Sie, Frau Ministerin, zu der Frage Stellung nehmen?<br />
Wollen Sie zu der Frage Stellung nehmen, Frau Ministerin?<br />
Durch die fehlende syntaktische Einbindung ist die Verwendung von Anredenomen<br />
im Deutschen und Tschechischen gleichermaßen fakultativ. Das<br />
steht im Gegensatz zur pronominalen Anrede, bei der sich die Sprecher beider<br />
Sprachen jederzeit entscheiden müssen, ob sie duzen/tykat oder siezen/vykat<br />
87
88<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Abbildung 1: Fragebogen zum Gebrauch von Titeln und Funktionsbezeichnungen<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
wollen und dieser grammatischen Obligation nur durch umständliche Formen<br />
der Anredevermeidung aus dem Wege gehen können. In solchen Fällen<br />
wird beispielsweise auf Indefinitpronomen oder Passivkonstruktionen ausgewichen:<br />
Könnte mir mal jemand die Tür aufhalten?<br />
Hier darf eigentlich nicht geraucht werden.<br />
Bevor ein Sprecher aus der großen Fülle verschiedener Titel und Funktionsbezeichnungen<br />
auszuwählen hat, steht er vor der Entscheidung, ob er überhaupt<br />
einen Titel verwenden will oder nicht. Und genau an dieser Stelle<br />
setzt unser Fragebogen an.<br />
Der Bogen, den wir in einer deutschen und einer tschechischen Version verteilt<br />
haben, hat drei Abschnitte (vgl. Abbildung 1). Im ersten wenden wir<br />
uns an die Informanten mit der Bitte, in der vorgegebenen Liste von Adressaten<br />
diejenigen zu markieren, die sie mit Titel anreden würden. Da diese<br />
Frage keine Situation konkretisiert, in der die gedachte Anrede vorzustellen<br />
wäre, scheint sie auf den ersten Blick recht unspezifisch. Im Sprachvergleich<br />
zeigte sich jedoch schnell, dass die Ergebnisse mit situativen Parametern<br />
vergleichsweise schwach korreliert sind. Wir hielten also an der unspezifischen<br />
Fragestellung fest, weil sie als tertium comparationis für den<br />
Titelgebrauch in den drei Ländern sehr signifikante Profile von Antworten<br />
erbringt. Die Auswahl der vorgegebenen Adressaten haben wir nach einem<br />
Testlauf des Bogens vor allem im Bereich der nichtakademischen Adressaten<br />
erweitert und im Hinblick auf die Unterschiede im deutschen und tschechischen<br />
Gesundheitssystem ausdifferenziert. 6<br />
Mit der offenen Frage im Mittelteil des Bogens hofften wir, ausdrückliche<br />
Umschreibungen des Normbewusstseins der Informanten zu elizitieren. Tatsächlich<br />
begründen viele Informanten hier ihre Titelvergabe und führen an,<br />
was ihrer Meinung nach das Anredeverhalten beeinflusst. Andere Informanten<br />
bewerten hier den allgemeinen Titelgebrauch aus ihrer subjektiven<br />
Sicht. Da schreibt beispielsweise eine 21–jährige Studentin aus <strong>Regensburg</strong>:<br />
6 Da die Institution des „Hausarztes“ im tschechischen Gesundheitssystem am Anfang der<br />
neunziger Jahre noch unbekannt war und bis heute weniger etabliert ist als im deutschen,<br />
musste die Gruppe der Ärzte so ausdifferenziert werden, dass sich in Teilbereichen<br />
vergleichbare Ergebnisse ergeben würden. Wir haben also auf dem tschechischen<br />
wie auf dem deutschen Bogen zwischen primář/Chefarzt und lékař/Arzt im Krankenhaus<br />
unterschieden und diese Unterscheidung nur auf dem deutschen Bogen zusätzlich<br />
um den Hausarzt ergänzt.<br />
89
90<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Generell spreche ich niemanden mit seinem Titel an. Schließlich hat ja jeder einen Vor- und<br />
Nachnamen.<br />
Ein 25–jähriger Student aus Frankfurt (Oder) hält Titel für „völlig veraltet“,<br />
würde „natürlich aber Herr Doktor zum Arzt sagen, sollte ich nicht seinen<br />
Namen kennen“. Eine 33–jährige Büroangestellte aus Wien hat zwar zehn<br />
der Adressaten für eine Titelanrede markiert, meint aber dennoch: „Die persönliche<br />
Anrede finde ich höflicher.“ Auch wenn bei weitem nicht alle unserer<br />
Informanten auf die Frage im Mittelteil des Fragebogens geantwortet<br />
haben, eröffnen schon die gesammelten Kommentare einen aufschlussreichen<br />
Einblick in verbreitete Einstellungen gegenüber den Titeln und geben<br />
wertvolle Beschreibungen ihrer Semantik und sozialen Funktion. Über die<br />
tatsächlichen Motive der Sprecher/Informanten, einen Titel zu vergeben<br />
oder nicht, vermag eine quantitative Studie naturgemäß nur oberflächliche<br />
Anhaltspunkte zu geben. Hier müsste die Fragebogenerhebung durch gezielte<br />
qualitative Analysen ergänzt werden. Einen möglichen Ausgangspunkt<br />
für derartige vertiefende Untersuchungen könnten beispielsweise die<br />
Antworten auf die offene Frage im Mittelteil meines Fragebogens bieten.<br />
Die systematische Auswertung dieser Antworten steht aber noch aus.<br />
Im unteren Abschnitt des Bogens baten wir die Informanten schließlich um<br />
Angaben zu ihrer Person. Diese Angaben erlaubten uns dann einzelne, nach<br />
sozialen Parametern homogenisierte Vergleichsgruppen aus dem Sample<br />
herauszufiltern. 7<br />
2. Vergleich der drei Ländergruppen<br />
In einem ersten Schritt sollen die drei Ländergruppen als ganze miteinander<br />
verglichen werden. Ich habe dazu sämtliche Antworten aller Informanten<br />
aus dem betreffenden Land zusammengefasst und dann ermittelt, welcher<br />
prozentuale Anteil dieser Antworten positiv, das heißt für eine Titelvergabe<br />
ausgefallen war. Die Ergebnisse dieses Ländervergleichs sind in Tabelle 1<br />
zusammengefasst.<br />
7 Bei der Auswertung der Bogen des ersten Durchlaufs verwendeten wir ein von Pavel<br />
Kneř eigens für unsere Zwecke geschriebenes Programm. Die Ergebnisse des zweiten<br />
Durchlaufs wertete ich mit SPSS aus.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Tabelle 1: Titelgebrauch im Ländervergleich<br />
In X % aller Fälle entschieden sich die Befragten FÜR eine Titelvergabe<br />
N = Gesamtzahl der Befragten<br />
Jahr der Befragung Deutsche Österreicher Tschechen<br />
1992/1993<br />
28,84 %<br />
(N= 438)<br />
68,24 %<br />
(N= 17 !)<br />
68,46 %<br />
(N= 254)<br />
2000/2001<br />
30,75 % 58,94 % 73,94 %<br />
(N= 280) (N= 114) (N= 221)<br />
Die Resultate beider Erhebungen ähneln einander sehr stark. Sie weichen in<br />
den absoluten Prozentwerten nur geringfügig voneinander ab. Damit stimmen<br />
also auch die Relationen zwischen den Ergebnissen aller drei Ländergruppen<br />
in beiden Erhebungen augenfällig überein. 8<br />
Demnach entsprechen die Antworten meiner österreichischen Informanten<br />
viel eher den tschechischen Ergebnissen als den bundesdeutschen. Die<br />
Österreicher vergaben etwa doppelt so häufig einen Titel wie die deutschen<br />
Befragten unter den gleichen Bedingungen. Die Werte der tschechischen<br />
Titelvergabe lagen in beiden Erhebungen sogar noch etwas über den Antworten<br />
der Österreicher. Meine individuellen Erfahrungen mit dem Anredeverhalten<br />
im deutsch-tschechischen Kontrast werden also auf eindrucksvolle<br />
Weise bestätigt. Zudem belegt meine Untersuchung die Existenz einer<br />
bemerkenswert großen Kluft im Anredeverhalten innerhalb des deutschen<br />
Sprachgebietes. Über die österreichische „Titelwut“ (ASSERATE <strong>2004</strong>:<br />
258) finden sich zwar gelegentlich spöttische Bemerkungen in deutschen<br />
Benimmbüchern und auch die Fachliteratur verweist sporadisch auf den<br />
„starke[n] Gebrauch von Titeln aller Art“ (MUHR 1993: 30) in Österreich.<br />
Gerade die für den deutsch (österreichisch) – tschechischen Sprachkontakt<br />
relevante grammatische und anwendungsbezogene Literatur übergeht aber<br />
häufig die Tatsache, dass innerhalb des deutschsprachigen Raumes mit sehr<br />
großen Differenzen im Anredeverhalten zu rechnen ist. In dem zweisprachigen<br />
Leitfaden für die deutsch-tschechische Wirtschaftskommunikation<br />
von Baxant, Rathmayr und Schulmeisterová findet sich beispielsweise die<br />
folgende Aussage:<br />
Sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen redet man Personen mit Herr/Frau und dem<br />
Titel oder Dienstgrad an. [...] Im allgemeinen entsprechen die Titel in der Tschechischen Republik<br />
denen im deutschsprachigen Raum. Einen Unterschied gibt es beim Titel Ingenieur.<br />
(BAXANT/RATHMAYR/SCHULMEISTEROVÁ 1995: 46)<br />
8 Der Wert für die österreichische Ländergruppe des ersten Durchlaufs ist bei nur 17<br />
Befragten allerdings nicht sehr verlässlich.<br />
91
92<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
In dieser Wiener Veröffentlichung wird offensichtlich die österreichische<br />
Perspektive unbesehen als gesamtdeutsche verallgemeinert. 9 Den umgekehrten<br />
Fall dokumentiert die kontrastive deutsch-tschechische Grammatik<br />
von Štícha:<br />
Na rozdíl od češtiny se v němčině obvykle neužívá titulu doktor, docent, profesor při oslovování<br />
kolegy na pracovišti. (ŠTÍCHA 2003: 25)<br />
Im Unterschied zum Tschechischen benutzt man im Deutschen die Titel Doktor, Dozent, Professor<br />
bei der Anrede von Kollegen am Arbeitsplatz gewöhnlich nicht.<br />
Der sehr viel seltenere deutsche Titelgebrauch wird bei Štícha auch für Gesprächssituationen<br />
außerhalb des Arbeitsplatzes, etwa in Interviews mit öffentlichen<br />
Funktionsträgern, belegt. Die hier beschriebenen Konventionen<br />
verallgemeinern aber den bundesdeutschen Sprachgebrauch und wären für<br />
den österreichischen Kontext ganz unangemessen.<br />
Der große Abstand zwischen der deutschen Titelkonvention einerseits und<br />
der österreichischen und tschechischen andererseits war bei der Auswertung<br />
der Fragebogen zumeist schon auf den ersten Blick an der unterschiedlichen<br />
Dichte angekreuzter Adressaten zu erkennen. Während 71,49 % der tschechischen<br />
Informanten und immerhin 48,24 % der österreichischen Informanten<br />
auf ihrem Bogen zehn und mehr Adressaten für eine Titelanrede ankreuzten,<br />
markierten überhaupt nur 7,85 % der bundesdeutschen Informanten<br />
zehn oder mehr der vorgegebenen Adressaten als titelwürdig. 10<br />
3. Titelvergabe gegenüber einzelnen Adressaten des Fragebogens<br />
Um die Ergebnisse des umfassenden Ländervergleichs genauer beurteilen<br />
zu können, müssen sie durch die Vorgabe engerer Auswertungsparameter<br />
differenziert werden. Es soll deshalb überprüft werden, ob sich hinter diesen<br />
Ergebnissen nicht vielleicht Unterschiede im Verhalten gegenüber einzelnen<br />
Adressatengruppen verbergen. So könnte es beispielsweise sein, dass<br />
Deutsche, Österreicher und Tschechen in ihrer Titelvergabe gegenüber<br />
manchen der vorgegebenen Adressaten weitgehend übereinstimmten, Österreicher<br />
und Tschechen aber zusätzlich noch weitere Personen mit Titel bedacht<br />
hatten. Tabelle 2 zeigt, dass diese Vermutung nicht zutrifft.<br />
9 Die den tschechischen Lesern empfohlenen deutschen Mustersätze würden sich in einem<br />
bundesrepublikanischen Kontext entsprechend teilweise sehr exotisch ausnehmen:<br />
„Frau Direktor, ich möchte Ihnen unseren neuen Mitarbeiter, Herrn Ingenieur Hoffmann<br />
vorstellen.“ – „Herr Gouverneur, ich möchte Ihnen Frau Magister Doležalová vorstellen. Frau<br />
Magister wird an den Verhandlungen teilnehmen.“ (BAXANT/RATHMAYR/SCHUL-<br />
MEISTEROVÁ 1995: 50, 51)<br />
10 Diese Werte ergaben sich bei der Erhebung 2000/2001 mit 280 deutschen, 114 österreichischen<br />
und 221 tschechischen Informanten.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Tabelle 2: Ergebnisse für die einzelnen Adressaten des Titel-Fragebogens,<br />
Erhebung 1992/1993<br />
X % der befragten Tschechen bzw. Deutschen entschied sich FÜR einen<br />
Titel<br />
Tschechen<br />
Deutsche<br />
(N= 254)<br />
(N= 438)<br />
Beamter (Stadtverwaltung) 16 % > 5 %<br />
Direktor eines Betriebes 81 % > 18 %<br />
Hausarzt 49 %<br />
Minister 85 % > 39 %<br />
Professor (Universität) 92 % > 49 %<br />
General 68 % > 28 %<br />
Arzt im Krankenhaus 92 % > 62 %<br />
Ingenieur 78 % > 6 %<br />
Polizist 14 % > 7 %<br />
Assistent (Universität) 54 % > 6 %<br />
Chefarzt 93 % > 59 %<br />
(Bundes)präsident 91 % > 58 %<br />
Lehrer am Gymnasium 68 % > 7 %<br />
Bürgermeister 70 % > 24 %<br />
Abgeordneter 51 % > 9 %<br />
Tabelle 2 schlüsselt einmal die Häufigkeit der Titelvergabe für jeden der<br />
Adressaten unseres Bogens einzeln auf. Ich bringe hier die Ergebnisse des<br />
ersten Durchlaufs, bei dem die Österreicher zahlenmäßig noch zu schwach<br />
vertreten waren, als dass verlässliche Werte zu erwarten wären. Im deutschtschechischen<br />
Verhältnis erwies sich, dass sich die tschechischen Informanten<br />
ausnahmslos gegenüber jedem der vorgegebenen Adressaten sehr viel<br />
häufiger für eine Titelvergabe entschieden als die Deutschen. Die Differenzen<br />
im Anredeverhalten beziehen sich also nicht auf einzelne Adressatenkreise,<br />
sie sind zwischen den Ländergruppen adressatenabhängig.<br />
Dabei sind die Unterschiede in der Titelvergabe für die einzelnen Adressaten<br />
zum Teil außerordentlich groß. Die deutschen und die tschechischen<br />
Ergebnisse liegen in drei Fällen sogar über 60 %-Punkte auseinander. Gegenüber<br />
einer Reihe von Personen hielten die tschechischen – wie auch die<br />
österreichischen – Informanten die Verwendung eines Titels gleichsam für<br />
obligatorisch (Professor, Ärzte, Präsident). Hier fielen die Antworten auf<br />
dem Bogen zu über 90 % positiv aus. Deutsche dagegen sehen selbst bei<br />
den meistbetitelten Adressaten immer noch einen sehr großen Ermessensspielraum.<br />
Die Werte erreichen hier kaum einmal die Höhe von 60 %. Das<br />
heißt: Fast die Hälfte der Befragten sieht noch in diesen Fällen keinen unabweisbaren<br />
Anlass für eine Titelvergabe.<br />
93
94<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Derartige Unterschiede im Anredeverhalten werden nicht ohne Folgen für<br />
Situationen interkultureller Kommunikation bleiben. Da Gesprächspartner<br />
mit Anredeformen unter anderem ausdrücken, wie sie ihre persönliche und<br />
soziale Beziehung auffassen, wird ein ‚falsches‘ bzw. unerwartetes Anredeverhalten<br />
nahe liegender Weise als Ereignis auf der Beziehungsebene zwischen<br />
den Kommunikationspartnern interpretiert. Aus der Sicht deutscher<br />
Sprecher muss das tschechische Anredeverhalten als übertriebene Titelei<br />
erscheinen. Aus tschechischer Sicht dürfte das deutsche Verhalten dagegen<br />
als bewusste Verweigerung des gebührenden Titels wahrgenommen werden.<br />
Erfahrungsberichte aus deutsch-tschechischen Jointventure-Unternehmen<br />
deuten darauf hin, dass hier tatsächlich derartige Perspektivübertragungen<br />
die interkulturelle Kommunikation beeinträchtigen. Das ergibt sich<br />
etwa aus der Studie von Nekula und Höhne zur Kooperation von VW und<br />
Škoda. 11<br />
Unglücklicherweise bestätigen die Unterschiede zwischen den sprachpragmatischen<br />
Normen bestehende Negativstereotype über die jeweils andere<br />
Nation: das bis in die Gegenwart bestimmende tschechische Bild von „dem<br />
deutschen Überlegenheitsgefühl, der Arroganz und Expansionslust“ (ŠMÍ-<br />
DOVÁ 2001: 523) der Deutschen. Und auf deutscher Seite stereotype Erfahrungen<br />
mit der angeblichen tschechischen Autoritätsfixiertheit. Die je<br />
nach Perspektive übertriebene oder vorenthaltene Statusanerkennung durch<br />
die Titelanrede ist fatalerweise dazu angetan, den historisch gewachsenen<br />
Fremdstereotypen in aktuellen deutsch-tschechischen Kontaktsituationen<br />
auf kommunikativer Ebene immer wieder neue Evidenz zu verschaffen. 12<br />
Zurück zu den Ergebnissen des Fragebogens. Während also Deutsche und<br />
Tschechen bei allen vorgegebenen Adressaten des Bogens unterschiedlich<br />
oft für eine Titelvergabe votierten, stimmt aber die Rangfolge der Häufigkeit<br />
in beiden Sprechergemeinschaften ganz auffallend überein. Tabelle 3<br />
ordnet die Adressaten unseres Bogens nach der Häufigkeit, mit der sie mit<br />
Titel bedacht wurden, zu einem deutsch-tschechischen ‚Titelranking‘.<br />
11 Die Transkription der Interviews dieser Untersuchung liegt bislang nur als Privatdruck<br />
NEKULA/HÖHNE (1995) vor. Eine Veröffentlichung ist für das Jahr 2005 vorgesehen.<br />
12 Auch im tschechisch-österreichischen Verhältnis gibt es zwischen den Anredekonventionen<br />
und der allgemeinen Fremdwahrnehmung eine auffallende Parallelität: „Die<br />
‚Österreicher‘ werden von den Tschechen oft gar nicht als ‚Deutsche‘ bezeichnet. Auf<br />
der Beliebtheitsskala rangieren sie soziologischen Umfragen zufolge bei der Bevölkerung<br />
in Böhmen und Mähren ganz oben, deutlich vor den ‚deutschen Deutschen‘. Die<br />
Tschechen meinen feststellen zu können, dass ihnen die Österreicher im Charakter näher<br />
sind“ (ŠMÍDOVÁ 2001: 519–520). Die Ähnlichkeit der sprachpragmatischen Normen<br />
könnte auch hier das historisch begründete Gefühl besonderer ‚mentaler‘ Nähe in<br />
Kontaktsituationen kommunikativ bestätigen.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Tabelle 3: Titelvergabe für die einzelnen Adressaten des Titelbogens nach<br />
Häufigkeit geordnet, Erhebung 1992/1993<br />
X % der befragten Deutschen bzw. Tschechen entschied sich FÜR einen<br />
Titel<br />
Rang- Deutsche<br />
Anrede Tschechen<br />
Anrede mit<br />
folge (N= 438)<br />
mit Titel (N= 254)<br />
Titel<br />
1. Arzt im Krankenhaus 62 % Chefarzt 93 %<br />
2. Chefarzt 59 % Arzt im Krankenhaus 92 %<br />
3. Bundespräsident 58 % Professor an der Univ. 92 %<br />
4. Professor an der Univ. 49 % Präsident 91 %<br />
Hausarzt 49 % -<br />
5. Minister 39 % Minister 85 %<br />
6. General 28 % Direktor 81 %<br />
7. Bürgermeister 24 % Ingenieur 78 %<br />
8. Direktor 18 % Bürgermeister 70 %<br />
9. Abgeordneter 9 % General 68 %<br />
10. Lehrer am Gymnasium 7 % Lehrer am Gymnasium 68 %<br />
11. Polizist 7 % Assistent an der Univ. 54 %<br />
12. Assistent an der Univ. 6 % Abgeordneter 51 %<br />
13. Ingenieur 6 % Beamter Stadtverwaltg. 16 %<br />
14. Beamter Stadtverwaltg. 5 % Polizist 14 %<br />
‚Titelhelden‘ waren für die deutschen wie tschechischen Informanten gleichermaßen<br />
die Ärzte. Der Beamte der Stadtverwaltung findet sich hier wie<br />
da am untersten Ende der Rangfolge. 13 In einzelnen Fällen wie beim Minister<br />
und beim Lehrer liegen Adressaten im Titelranking auf derselben Stufe.<br />
Im Übrigen liegen die Plätze hier meist nicht mehr als eine Stufe in der Folge<br />
auseinander. Offensichtlich sind also die Kriterien, nach denen bei Deutschen<br />
und Tschechen Titel vergeben werden, insgesamt sehr ähnlich. Informanten<br />
beider Länder sind sich weitgehend einig, welchen Adressaten<br />
am ehesten eine Titelanrede zukommen würde und welchen eher nicht. Die<br />
Tschechen entschieden sich dann aber in allen Einzelfällen sehr viel häufiger<br />
für einen tatsächlichen Titelgebrauch.<br />
Die Übereinstimmung in der Rangfolge der Titelvergabe deutet auf übereinstimmende<br />
soziale Werte hin. Offenbar besteht zwischen Deutschen und<br />
Tschechen große Einigkeit, welches besonders anerkennenswerte gesellschaftliche<br />
Positionen sind. Interessante Ausnahmen finden wir aber beim<br />
General, dem Abgeordneten und dem Polizisten. Sie lagen im tschechischen<br />
Titelranking jeweils drei Plätze niedriger als im deutschen. Hier bilden sich<br />
1992/93 und auch 2000/2001 wahrscheinlich noch Nachwirkungen der poli-<br />
13 Dies entspricht recht genau den Ergebnissen der Befragung deutscher Lehrer, Studenten<br />
und Schüler bei FINKENSTAEDT (1981).<br />
95
96<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
tischen Vergangenheit Tschechiens ab. Repräsentanten des Staates und seiner<br />
Exekutive sind in Tschechien wohl vergleichsweise schlechter angesehen<br />
als in Deutschland.<br />
4. Abhängigkeit der Ergebnisse vom Alter der Informanten<br />
Nach dem allgemeinen Vergleich der drei Ländergruppen stellt sich nun die<br />
Frage, wie sich der Titelgebrauch über verschiedene soziale Gruppierungen<br />
innerhalb der drei Sprechergemeinschaften verteilt. Am stärksten war die<br />
Verwendung von Titeln vom Alter der Informanten abhängig. Um Vergleichswerte<br />
zu erhalten, habe ich meine Informanten in drei Altersgruppen<br />
eingeteilt: die unter 30–jährigen, die 30– bis 50–jährigen und die über 50–<br />
jährigen. Ich habe dann errechnet, welcher Prozentsatz der vorgegebenen<br />
Anredefälle des Fragebogens von der jeweiligen Vergleichsgruppe mit Titel<br />
bedacht worden ist. Tabelle 4 und 5 stellen die Ergebnisse für die beiden<br />
Erhebungen 1992/1993 und 2000/2001 gesondert dar.<br />
Tabelle 4: Häufigkeit der Titelvergabe in der jeweiligen Altersgruppe, Erhebung<br />
1992/1993<br />
X % aller Entscheidungen der jeweiligen Altergruppen FÜR eine Titelvergabe<br />
1992/1993 bis 30 Jahre 30 – 50 Jahre über 50 Jahre<br />
Tschechen<br />
65,5 %<br />
(N= 139)<br />
65, 76 %<br />
(N= 55)<br />
77,14 %<br />
(N= 60)<br />
Deutsche<br />
25,26 %<br />
(N= 294)<br />
30,26 %<br />
(N= 111)<br />
55,28 %<br />
(N= 41)<br />
Tabelle 5: Häufigkeit der Titelvergabe in der jeweiligen Altersgruppe, Erhebung<br />
2000/2001<br />
X % aller Entscheidungen der jeweiligen Altersgruppe FÜR eine Titelvergabe<br />
2000/2001 bis 30 Jahre 30 – 50 Jahre über 50 Jahre<br />
Tschechen<br />
72,78 %<br />
(N= 162)<br />
74,12 %<br />
(N= 45)<br />
83,26 %<br />
(N= 17)<br />
Österreicher<br />
57,72 %<br />
(N= 82)<br />
56,92 %<br />
(N= 26)<br />
80 %<br />
(N= 5!)<br />
Deutsche<br />
31,40 %<br />
(N= 233)<br />
24,32 %<br />
(N= 37)<br />
41,88 %<br />
(N= 8!)<br />
Es ist vorab festzuhalten, dass sich die eingangs thematisierte Länderrelation<br />
in beiden Befragungsdurchgängen auch für jede der Altersgruppen sehr<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
deutlich bestätigt. In jeder der Spalten beider Tabellen stehen die Werte in<br />
Relationen zueinander, die sich schon beim übergreifenden Ländervergleich<br />
in Abschnitt 2 herausgestellt hatten. Auch innerhalb jeder Altersgruppe entschieden<br />
sich die Österreicher etwa doppelt so häufig für eine Titelvergabe<br />
wie die Deutschen. Und in allen Fällen lagen die Werte der tschechischen<br />
Informanten etwas höher als die der österreichischen Vergleichsgruppe.<br />
Auch hier liegt stets der Wert der tschechischen Antworten noch über den<br />
hohen österreichischen Ergebnissen. Noch die jüngsten Tschechen vergaben<br />
auf diese Weise erheblich häufiger Titel als die ältesten deutschen Informanten.<br />
Es scheint, dass die Länderrelation als solche weitgehend unabhängig<br />
vom Alter der befragten Deutschen, Tschechen und Österreicher ist.<br />
Innerhalb der jeweiligen Sprechergemeinschaften zeigt sich dagegen eine<br />
deutliche Altersabhängigkeit der Titelvergabe. Dies zeigt ein Vergleich der<br />
Ergebniswerte in den einzelnen Zeilen der Tabelle 4 und 5. In allen drei<br />
Ländern entschied sich die älteste Generation viel häufiger für einen Titelgebrauch<br />
als die jüngste Generation ihrer Landsleute. Gleichwohl fügt sich<br />
die Altersabhängigkeit der Titelvergabe nicht zu einer eindeutigen Zuordnung<br />
etwa der Art, dass mit steigendem Alter auch das Titulieren zunähme.<br />
Vielmehr füllte die jüngste und die mittlere Altersgruppe der Tschechen<br />
ihre Fragebogen auffallend ähnlich aus und erst bei den über fünfzigjährigen<br />
Tschechen stieg die Titelvergabe sprunghaft an. Die Ergebnisse für die<br />
österreichischen Informanten zeigen ein ganz ähnliches Profil, wenn auch<br />
auf einem etwas niedrigeren Niveau. Dem Titelgebrauch nach gibt es in<br />
diesen beiden Sprechergemeinschaften eigentlich nur zwei Altersgruppen:<br />
die unter Fünfzigjährigen und die über Fünfzigjährigen.<br />
Ein viel dynamischeres Bild bieten die Antworten der Deutschen. Hier<br />
nahm bei der Befragung am Anfang der 90er Jahre die Häufigkeit der Titelvergabe<br />
mit dem Alter der Informanten stetig zu. Der Sprung zwischen der<br />
mittleren und der ältesten Altersgruppe war allerdings auch hier besonders<br />
groß. Bei der zweiten Erhebung 2000/2001 verwendete die jüngste Generation<br />
der Deutschen dann aber etwas häufiger Titel als die mittlere.<br />
Wenn man das Sprachverhalten der verschiedenen Altersgruppen einer<br />
Sprechergemeinschaft mit Willam Labov als „apparent time“ 14 , also als ein<br />
14 LABOV (1965: 308–309). Diese Interpretation von Daten verschiedener Altersgruppen<br />
ist bekanntlich besonders im Zusammenhang mit der Dialektologie kritisiert worden.<br />
Demnach bildet sich etwa im abnehmenden Gebrauch des Dialekts in der berufstätigen<br />
Generation weniger die Diachronie ab als vielmehr Sprachveränderungen während des<br />
Lebenszyklus des Sprechers, der nach Abschluss seines Berufslebens durchaus wieder<br />
zum Dialekt zurückkehren könne. Ähnlich argumentiert FINKENSTAEDT (1981: 27)<br />
in Bezug auf den Titelgebrauch: die jüngste Altersgruppe auch seiner Informanten verwende<br />
deshalb so wenig Titel, weil sie mit den „Regeln für die Sprachverwendung in<br />
97
98<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
sichtbares Abbild von Prozessen des Sprachwandels interpretiert, dann wäre<br />
die Norm des Titelgebrauchs im Tschechischen und Österreichischen in den<br />
letzten Jahrzehnten recht stabil geblieben. Die Antworten der deutschen<br />
Informanten lassen dagegen auf fortschreitende Veränderungen schließen.<br />
Hier nahm der Gebrauch von Titeln und Funktionsbezeichnungen demnach<br />
in der jüngeren Vergangenheit ständig ab. Die Ergebnisse der letzten Befragung<br />
könnten darauf hindeuten, dass diese Entwicklung ihren tiefsten Punkt<br />
bereits durchschritten hat und neuerdings eine gegenläufige Tendenz wirksam<br />
wird.<br />
5. Titelvergabe und Geschlechtszugehörigkeit der Befragten<br />
Ein sozialer Parameter, der in der Anredeforschung regelmäßig Beachtung<br />
findet, weil er in der Tat für viele Anredesysteme eine wichtige Rolle spielt,<br />
ist die Geschlechtszugehörigkeit der Gesprächspartner. Da unser Fragebogen<br />
die vorgegebenen Adressaten nicht nach dem Geschlecht differenziert,<br />
lässt sich mit seiner Hilfe nur die Frage stellen, ob die Häufigkeit des Titelgebrauchs<br />
von der Geschlechtszugehörigkeit der Befragten abhängig ist.<br />
Schon bei der ersten Erhebung 1992/1993 hatten sich in den Ergebnissen<br />
aber keine besonders klaren Konturen abgezeichnet. Offenkundig geht die<br />
Geschlechtszugehörigkeit der Informanten in allen drei untersuchten Ländern<br />
als Faktor eher untergeordneter Bedeutung in das Anredeverhalten ein<br />
und wird von anderen sozialen Parametern, wie beispielsweise dem Alter,<br />
überlagert. Um eine eventuelle Abhängigkeit zwischen Titelvergabe und<br />
Geschlecht erkennbar zu machen, war es also notwendig, sehr stark sozial<br />
homogenisierte Vergleichsgruppen gegenüber zu stellen. Ich habe aus den<br />
Antworten der Erhebung von 2000/2001 einmal nur solche Informanten<br />
herausgefiltert, die unter 30 Jahre alt waren, in der Großstadt lebten, studierten<br />
und aus dem jeweils angegebenen Land stammten und die dortige<br />
Staatssprache als ihre Muttersprache angegeben hatten. Innerhalb dieses eng<br />
begrenzten Informantensamples habe ich dann die Antworten der Männer<br />
und Frauen gegenübergestellt. Die Ergebnisse dieser Gegenüberstellung<br />
zeigt die Tabelle 6.<br />
konkreten Situationen des Erwachsenenlebens“ noch nicht vertraut sei. Dieser Interpretation<br />
widerspricht mein Befund, dass jedenfalls bei den bundesdeutschen Informanten<br />
die Häufigkeit der Titelverwendung über alle drei herausgegriffenen Altersgruppen<br />
schrittweise zunahm. Auch die tschechischen und österreichischen Werte steigen erst<br />
am Ende der Berufstätigkeit sprunghaft an. Diese Ergebnisprofile sind mit der Wirkung<br />
von Erwachsenenalter oder Berufstätigkeit nicht zu erklären. Für eine diachronische Interpretation<br />
sprechen auch Befunde früherer Zeitstufen, wie sie etwa in Abschnitt 6 und<br />
7 ausgewertet werden.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Tabelle 6: unterschiedlicher Titelgebrauch der Geschlechter?<br />
In X % der vorgegebenen Fällen entschieden sich die Informanten FÜR<br />
eine Titelvergabe<br />
Vergleichsgruppen: Informanten unter 30 Jahren aus der Großstadt, die StudentInnen sind,<br />
aus dem jeweiligen Land stammen und die jeweilige Staatssprache als Muttersprache angaben.<br />
Erhebung 2000/2001<br />
Tschechische<br />
Österreichische<br />
Deutsche<br />
Männer 67,5 % (N= 20)<br />
Frauen 74,52 % (N= 30)<br />
Männer 63,7 % (N= 9!)<br />
Frauen 63,7 % (N= 9!)<br />
Männer 22,36 % (N= 26)<br />
Frauen 26,8 % (N= 50)<br />
Auch hier ist zunächst einmal festzuhalten, dass sich im Verhältnis der hier<br />
betrachteten Vergleichsgruppen wieder sehr deutlich die Länderrelationen<br />
abzeichnen, von denen in Abschnitt 2 und 3 die Rede war. Für die Häufigkeit<br />
der Titelvergabe durch meine Befragten ist offenkundig die Frage sehr<br />
viel bedeutsamer, ob sie in Deutschland, Österreich oder Tschechien aufgewachsen<br />
sind, als die Frage, welches Geschlecht diese Befragten haben.<br />
Die Gegenüberstellung jeweils der männlichen und der weiblichen Informanten<br />
innerhalb der drei Ländergruppen gibt dann aber Anhaltspunkte<br />
dafür, dass die Geschlechtszugehörigkeit eine gewisse Rolle für die Häufigkeit<br />
der Titelvergabe spielt. Besonders die tschechischen Informantinnen<br />
aus dem vereinheitlichten Sample entschieden sich bei meiner Befragung<br />
etwas häufiger für eine Titelvergabe als ihre männlichen Landsleute. Dieses<br />
Verhältnis zwischen den Geschlechtern kehrt, allerdings noch schwächer<br />
ausgeprägt, bei der Gegenüberstellung der bundesdeutschen Geschlechtergruppen<br />
wieder. Die absoluten Zahlen der befragten Österreicher waren in<br />
den sozial vereinheitlichten Vergleichsgruppen leider so niedrig, dass ihren<br />
Antworten keine allgemeinere Aussagekraft zugesprochen werden kann. 15<br />
Auch die Werte der deutschen und tschechischen Geschlechtsgruppen<br />
müssten durch nachfolgende Untersuchungen größeren Umfangs bestätigt<br />
werden, da sie nur wenig profiliert sind. Grundsätzlich dürfte die Tendenz<br />
weiblicher Informanten, sich eher für eine Titelvergabe zu entscheiden als<br />
ihre männlichen Landsleute, darauf zurückgehen, dass Frauen sich in den<br />
fraglichen Gesellschaften bis heute eher in rangniedrigeren Positionen wie-<br />
15 Die Ergebniswerte der jeweils neun Österreicher und Österreicherinnen stimmen hier<br />
nur zufällig überein. Im Einzelnen haben die Informanten durchaus unterschiedliche<br />
Adressaten mit Titel bedacht. Die Werte liegen dabei in beiden Fällen untypisch für diese<br />
Altersgruppe über dem Landesdurchschnitt (vgl. Abschnitt 2) und sind daher kaum<br />
verlässlich.<br />
99
100<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
derfinden und eine Statusanrede ‚nach oben‘ für üblicher halten als männliche<br />
Befragte.<br />
6. Titelgebrauch regional differenziert<br />
Die Gegenüberstellung von Informanten aus Österreich und Deutschland hatte<br />
in den vorangegangenen Abschnitten immer wieder gezeigt, dass innerhalb<br />
des deutschen Sprachgebietes mit großen Differenzen in den Konventionen<br />
des Titelgebrauchs gerechnet werden muss. Es erhebt sich nun die Frage, ob<br />
es auch innerhalb der drei untersuchten Länder regionale Differenzierungen<br />
des Anredeverhaltens gibt. Das bei GROBER-GLÜCK (1994) vorgestellte<br />
Kartenmaterial zeigte ja noch für die Zeit um 1930 jedenfalls für das soziale<br />
Leben außerhalb der Städte eine sehr deutlich gegliederte deutschsprachige<br />
‚Anredelandschaft‘. Die Verfasserin rekonstruiert in ihrem Buch auf der Basis<br />
der damaligen Fragebogenerhebung zum deutschen Volkskundeatlas die Anredeverhältnisse<br />
auf den Bauernhöfen. Demnach war die heute weitgehend<br />
standardisierte Distanzanrede mit Sie und Herr/Frau + Name im agrarischen<br />
Umfeld noch um 1930 deutlich auf Mitteldeutschland begrenzt, während an<br />
den nördlichen und östlichen Rändern des deutschen Sprachgebietes und insbesondere<br />
im süd(west)deutschen Raum um diese Zeit noch Formen wie das<br />
Erzen oder das Ihrzen oder die nominale Anrede beispielsweise mit Bauer/Bäuerin<br />
weite und dominante Verbreitung hatten.<br />
Was die hier interessierende Anrede mit Titeln betrifft, gibt die linguistische<br />
Fachliteratur kaum einmal Hinweise auf regionale Differenzierungen. Eher<br />
noch finden wir in Benimmbüchern und Briefstellern gelegentlich Bemerkungen<br />
zur regionalen Gliederung des Anredegebrauchs. Für die Zeit um<br />
1933 konstatiert etwa das Anstandsbuch von Ilse Meister:<br />
Während man im Ausland längst auch in den höchsten Kreisen jeden mit seinem Namen anredet,<br />
sind wir vorläufig nur in der ersten Gesellschaft Norddeutschlands so weit. Im übrigen<br />
plagen wir uns weiter mit der Titelfrage herum und kommen häufig genug in die peinlichste<br />
Verlegenheit, wenn wir mit jemand sprechen, dessen genauen Titel wir nicht wissen.<br />
(MEISTER zit. nach KRUMREY 1984: 421–422)<br />
Eine Nord-Süd-Gliederung der Titelanrede legt auch das Benimmbuch von<br />
Meissner nahe, das im Jahr 1954 beobachtet, nur noch „im Süden Deutschlands“<br />
seien die „Ehemannstitel für die Gattin“ in Gebrauch, „während im<br />
Norden deren Abschaffung ziemlich allgemein ist“ (MEISSNER 1954:<br />
111). Etwa zur selben Zeit lokalisiert KAMPTZ-BORKEN (1955: 127) den<br />
häufigen Gebrauch von Titeln überhaupt „im Süden des Sprachgebietes<br />
(einschließlich Österreich)“. Bei MUHR (1993: 31) wird für Österreich zusätzlich<br />
„auf ein starkes West-Ost-Gefälle verwiesen“:<br />
Je weiter im Osten Österreichs, um so wichtiger ist der Rang des Gesprächspartners als Kommunikationsfaktor.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Um regionale Unterschiede im Titelgebrauch genauer erfassen zu können,<br />
habe ich beim zweiten Durchlauf meiner Fragebogenerhebung gezielt an<br />
verschiedenen Orten Daten gesammelt. 16 Die Erhebungsorte sollten dabei<br />
zum einen eine Nord-Süd-Dimension von Norddeutschland über Mitteldeutschland,<br />
Tschechien bis Österreich erfassen. Zum anderen sollte quer<br />
zu dieser Achse eine mögliche Ost-West-Differenzierung innerhalb der drei<br />
Länder beobachtet werden können. Die Karte in Abbildung 2 gibt meine<br />
Erhebungsorte in dem untersuchten deutsch-deutschen, deutsch-tschechischen<br />
und deutsch-österreichischen Grenzraum wieder. Es sind dies von Norden<br />
nach Süden: Braunschweig, Berlin, Frankfurt (Oder), Jena, <strong>Regensburg</strong>,<br />
Karlovy Vary, Prag, Hradec Králové, Salzburg und Wien. Um Überschneidungen<br />
mit anderen sozialen Parametern zu vermeiden, habe ich als Vergleichsgruppen<br />
die am jeweiligen Ort ansässigen Muttersprachler unter<br />
dreißig Jahren aus dem Sample herausgefiltert. Leider zeigte sich erst nach<br />
Abschluss der Erhebung, dass selbst diese im Sample eigentlich sehr stark<br />
vertretene Informantengruppe an einigen Erhebungsorten nur schwach bzw.<br />
in Braunschweig sogar gar nicht repräsentiert war. Auch die Differenzen<br />
zwischen den Werten einzelner Regionen sind mitunter so gering, dass sie<br />
eventuell auf andere als regionale Aspekte zurückzuführen sind. Die Ergebnisse<br />
sind also mit großer Vorsicht zu bewerten und müssen durch nachfolgende,<br />
statistisch besser fundierte Untersuchungen abgesichert werden.<br />
16 Hierbei konnte ich mich auf die freundliche Hilfe von ortsansässigen Kolleginnen und<br />
Kollegen stützen, die meine Fragebögen in ihrem Bekanntenkreis und insbesondere an<br />
Hochschulen verteilten. Für ihre Unterstützung danke ich sehr herzlich Ursula Doleschal,<br />
Gudrun Held, Steffen Höhne, Magdalena Kneřová, Marek Nekula, Jiří Nekvapil,<br />
Václav Maidl, Marie Vachková, Jürgen Zeck und Jiří Zeman.<br />
101
102<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Abbildung 2: Titelgebrauch der unter 30–jährigen regional differenziert<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Die in die Karte auf Abbildung 2 eingetragenen Werte fügen sich im Großen<br />
und Ganzen zu folgendem vorläufigen Bild: Innerhalb des deutschösterreichischen<br />
Sprachraumes steigt die Häufigkeit der Titelvergabe von<br />
Nord nach Süd recht deutlich an. Zugleich erhöht sich innerhalb der drei<br />
untersuchten Länder die Häufigkeit der Titelvergabe von West nach Ost.<br />
Dass die Werte für Prag gegenüber Karlovy Vary leicht zurückgehen, erklärt<br />
sich aus der Abhängigkeit der Titelverwendung von der Größe des<br />
Wohnorts der Informanten. In Tschechien und Deutschland wurde in den<br />
großen Städten etwas seltener ein Titel gewählt als auf dem Land. 17<br />
Als Hypothese für eine genauere Untersuchung könnte also die Faustregel<br />
formuliert werden, dass eine Person um so wahrscheinlicher mit einem Titel<br />
angesprochen werden dürfte, je weiter sie sich im deutschen Sprachgebiet in<br />
südöstlicher Richtung fortbewegt. Die Ergebnisse von Abbildung 2 bestätigen<br />
also tendenziell auch für die Gegenwart Befunde zur regionalen Gliederung<br />
des deutschen Titelgebrauchs, wie sie in älteren Benimmbücher gelegentlich<br />
angeführt werden. Für den tschechischen Sprachraum ergibt meine<br />
Erhebung für die West-Ost-Gliederung ein ähnliches Bild leichter Zunahme<br />
der Bereitschaft, Titel zu verwenden.<br />
Dieses Bild einer kontinuierlichen Zunahme darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,<br />
dass sich das zu erwartende Anredeverhalten beim Überschreiten<br />
der Grenzen zwischen den drei Ländern jeweils sprunghaft ändert.<br />
Besonders deutlich wird dies an der deutsch-tschechischen Grenze, wo auf<br />
der Strecke zwischen Jena oder <strong>Regensburg</strong> auf deutscher und Karlovy Vary<br />
auf tschechischer Seite die Häufigkeit der Titelvergabe meiner Informanten<br />
um über 38 %-Punkte anstieg. Aber auch die deutsch-österreichische<br />
Grenze markiert eine sprunghafte Zunahme des Titelgebrauchs. Während<br />
die Informanten in <strong>Regensburg</strong> in einem Drittel aller vorgegebenen Anredefälle<br />
einen Titel wählten, vergab die Vergleichsgruppe aus Salzburg schon<br />
in der Hälfte aller Möglichkeiten einen Titel (und verhielt sich damit übrigens<br />
gewissermaßen erstaunlich ‚unösterreichisch‘, nämlich im Vergleich<br />
mit anderen österreichischen Informanten überaus sparsam in der Titelvergabe).<br />
Ein vergleichender Blick auf die Befragungsergebnisse der drei<br />
Hauptstädte Berlin, Prag und Wien zeigt, dass sich die regionale Variation<br />
innerhalb der drei Länder auf sehr unterschiedlichen Niveaus vollzieht.<br />
17 Die bis 30–jährigen tschechischen Informanten vom Dorf vergaben in 77,31 % der Fälle<br />
einen Titel, die entsprechende Vergleichsgruppe aus der Großstadt nur in 70,42 % der<br />
Fälle. Während der Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen vom Dorf und aus der<br />
Großstadt in Deutschland ganz ähnlich ausfiel (30,25 % gegenüber 24,8 %), waren die<br />
Werte für die Wohnortgröße bei den österreichischen Informanten nahezu ausgeglichen.<br />
103
104<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Tabelle 6: Vergleich der Titelvergabe in den drei Hauptstädten<br />
Bei X % der vorgegebenen Fälle Entscheidungen FÜR einen Titel<br />
aus Berlin<br />
22,71 %<br />
(N= 59)<br />
Muttersprachliche Informanten unter 30 Jahren<br />
aus Wien<br />
58,33 %<br />
(N= 28)<br />
aus Prag<br />
70,14 %<br />
(N= 50)<br />
Hier finden wir in scharfem Kontrast die Länderrelationen wieder, die sich<br />
auch unter Vorgabe anderer Untersuchungsparameter in meinem Datenkorpus<br />
immer wieder abgezeichnet hatten. Welche Parameter auch immer angelegt<br />
wurden, um das Informantensample zu differenzieren, immer kehrten<br />
im Verhältnis der jeweiligen Vergleichsgruppen aus den drei Ländern die<br />
Relationen wieder, die sich schon anfangs beim allgemeinen Ländervergleich<br />
gezeigt hatten. Zwar variiert die Titelvergabe innerhalb der drei<br />
Sprechergemeinschaften je nach dem sozialen Profil oder der regionalen<br />
Herkunft der jeweiligen Informanten, diese Variation vollzieht sich aber bei<br />
Deutschen einerseits und Österreichern wie Tschechen andererseits in einer<br />
sehr unterschiedlichem Bandbreite von Ergebniswerten. Wie immer die sozialen<br />
Rollen des ‚Angeredeten‘ und des ‚Sprechers‘ in der Anrededyade<br />
besetzt waren, die der Fragebogen imaginiert, stets wurden erheblich häufiger<br />
Titel vergeben, wenn die ‚Sprecher‘ Österreicher oder Tschechen waren,<br />
als wenn es sich um deutsche Vergleichspersonen handelte. In die Begrifflichkeit<br />
der Dialektologie könnte man diesen Befund etwa so<br />
übertragen: Die Staatsgrenzen zwischen Deutschland einerseits und Österreich<br />
und Tschechien andererseits markieren den Verlauf einer recht ausgeprägten<br />
pragmatischen Isoglosse.<br />
7. Schlussbetrachtungen: k.u.k. Konventionen?<br />
Ich möchte die Differenzen im Titelgebrauch zwischen den drei Ländern<br />
abschließend auf ein vereinfachtes Schema der politischen Geographie im<br />
Untersuchungsraum projizieren. Mein Untersuchungsgebiet wäre nach<br />
Maßgabe der staatspolitischen Entwicklungen im 20. Jahrhundert sehr grob<br />
in vier Teilgebiete zu unterteilen. Abbildung 3 soll diesen Sachverhalt in<br />
Form einer stark schematisierten geographischen Karte wiedergeben.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
Abbildung 3: der Untersuchungsraum staatspolitisch gegliedert<br />
D (West)<br />
A<br />
D (Ost)<br />
Aus der Perspektive der größten und dominantesten Differenzen in meinen<br />
Fragebogenergebnissen wäre der Untersuchungsraum dagegen in nur zwei<br />
Teilgebiete zu gliedern. Ein Gebiet, in dem man eine Titelvergabe eher für<br />
Ermessenssache und vielfach sogar für ganz unüblich hält. Und ein Gebiet,<br />
in dem der Gebrauch von Titeln und Funktionsbezeichnungen als üblich<br />
und oft sogar als obligatorisch empfunden wird. Das ist etwas überraschend,<br />
da naheliegende Erklärungen für große Unterschiede im Anredeverhalten<br />
offensichtlich nicht oder erst in zweiter Linie greifen.<br />
Was wäre zu erwarten gewesen? Nahe gelegen hätte erstens, dass die Anredekonventionen<br />
sprachspezifisch sind. Während an der Grenze zwischen<br />
Deutschland und Tschechien nicht nur verschiedene Nationalsprachen, sondern<br />
sogar zwei unterschiedliche Sprachzweige aneinander stoßen, trennt<br />
die deutsch-österreichische Grenze nach v. Polenz allenfalls regionale Varietäten<br />
derselben Sprache:<br />
Das österreichische Deutsch nimmt bis heute [...] vollgültig und in allen soziolinguistischen<br />
Hinsichten an der modernisierenden Weiterentwicklung der deutschen Standardsprache teil,<br />
wenn auch mit einigen hundert bewußten eigenen Varianten. (POLENZ 1999: 118) 18<br />
Demnach hätten sich in meinen Ergebnissen zum Titelgebrauch räumliche Verhältnisse<br />
wie in Abbildung 4 mit dem schärfsten Profil abzeichnen müssen.<br />
18 Die Diskussion um den Status des österreichischen Deutsch im Spannungsfeld einer<br />
„österreichisch-nationalen“ und einer „deutsch-integrativen“ Perspektive umreißt<br />
WIESINGER (1995).<br />
CZ<br />
105
106<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Abbildung 4: der Untersuchungsraum sprachlich gegliedert<br />
D (West)<br />
A<br />
D (Ost)<br />
So war es aber nicht. Vielmehr belegen meine Ergebnisse, dass Sprachgebrauch<br />
und Sprachsystem in ihrer räumlichen Erstreckung durchaus nicht<br />
zur Deckung kommen müssen. Die Konventionen des Sprachverhaltens<br />
können den Geltungsbereich einer Nationalsprache sowohl über- als auch<br />
unterschreiten.<br />
Das ist freilich eine Grundeinsicht der Soziolinguistik und auf der Linie der<br />
klassischen soziolinguistischen Anredeforschung hätte denn auch eine zweite,<br />
nahe liegende Erklärung für große Differenzen im Anredeverhalten gelegen.<br />
Seit den Impuls gebenden Arbeiten von Roger Brown und Albert Gilman<br />
aus den frühen sechziger Jahren wurde und wird die Herausbildung<br />
und Entwicklung von Anredekonventionen vorrangig mit ihrem gesellschaftlichen<br />
Kontext in Verbindung gesetzt. Die Auflösung der starren<br />
Standeshierarchie und die zunehmende soziale Mobilität der europäischen<br />
Gesellschaften hat nach Brown und Gilman einen Übergang europäischer<br />
Anredesysteme von der „Machtsemantik“ zu einer „Solidaritätssemantik“<br />
(BROWN / GILMAN 1980: 167ff.) zur Folge gehabt. Insbesondere der Begriff<br />
der Solidarität verbindet sich für heutige Leser mit etwas irreführenden<br />
Konnotationen. Ich würde deshalb in Anlehnung an Angelika Linke den<br />
betreffenden Prozess lieber als einen Übergang von einer (feudalen) Höflichkeit<br />
der vertikalen Distanz zu einer (bürgerlichen) Höflichkeit der horizontalen<br />
Distanz sprechen (vgl. LINKE 1998). Diese Entwicklung drückt<br />
sich nach Brown und Gilman unter anderem in einem Bedeutungswandel<br />
der Anredepronomen vieler europäischer Sprachen aus. 19 Anredepronomen<br />
wie du und Sie oder tu und vous stehen heute nicht mehr für soziale Über-<br />
und Unterordnungsverhältnisse, sondern für unterschiedliche Grade der Di-<br />
19 In der räumlichen und materiellen Gestaltung von Briefen vollzieht sich im Laufe des<br />
19. und 20. Jahrhundert eine parallele Entwicklung, vgl. EHLERS (im Druck).<br />
CZ<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
stanz bzw. Vertrautheit zwischen den Gesprächspartnern. Parallel zu diesem<br />
Bedeutungswandel der Anredepronomen vollzog sich in vielen europäischen<br />
Sprachen ein fortschreitender Abbau des Titelgebrauchs. Die (horizontal)<br />
distanzierte Anrede mit Herr/Frau + Nachname trat auch im Deutschen<br />
mehr und mehr an die Stelle der (vertikal) hierarchisierenden Titel-<br />
oder Funktionsanreden.<br />
Neben diesen sehr langfristigen Wandlungen zeigen aber gerade die deutschen<br />
Verhältnisse, dass Anredekonventionen mitunter auch sehr rasch und<br />
sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren können. Hier wäre<br />
der erdrutschartige Umbruch des Anredeverhaltens an bundesdeutschen<br />
Universitäten nach 1968 zu nennen, der sich dann als so genannte ‚Duzwelle‘<br />
auch auf andere Bereiche der Gesellschaft ausbreitete. In wenigen Jahrzehnten<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg ist außerdem das Fräulein als Anredenomen<br />
so weit außer Gebrauch gekommen, dass es heute wohl endgültig<br />
aus dem System der deutschen Nominalanrede getilgt ist.<br />
Eine derartig sensible Anbindung von Anredekonventionen an gesellschaftliche<br />
Prozesse ließe wohl erwarten, dass sich im Anredeverhalten der Befragten<br />
in deutlicher Weise der Verlauf des Eisernen Vorhangs abzeichnete,<br />
der über mehr als vier Jahrzehnte verschiedene Gesellschaftssysteme trennte<br />
und zugleich den kommunikativen Austausch der Bevölkerungen im Untersuchungsraum<br />
rigide beschränkte. Unter dieser Perspektive wäre also etwa<br />
das folgende Bild wahrscheinlich gewesen:<br />
Abbildung 5: der Untersuchungsraum nach politischer Blockbildung gegliedert<br />
D (West)<br />
A<br />
D (Ost)<br />
Stattdessen heben die Ergebnisse meines Titelbogens in der politischen<br />
Geographie die nordwestlichen Konturen ein Staatsgebildes heraus, das seit<br />
1918 nicht mehr besteht (vgl. Abbildung 6).<br />
CZ<br />
107
108<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
Abbildung 6: der Untersuchungsraum nach Titelgebrauch gegliedert<br />
D (West)<br />
A<br />
D (Ost)<br />
Auf diesem nordwestlichen Gebiet der Donaumonarchie wären also die Titelkonventionen<br />
von dreimaligem politischen Systemwechsel weitgehend<br />
unberührt geblieben: der Zeit der Republiken, der unterschiedlich langen<br />
Phase der nationalsozialistischen Diktatur und der Nachkriegsordnung mit<br />
einer neuen Blockbildung. 20 Auch durch den vierten, neuerlichen Systemumbruch<br />
1989 hat sich augenscheinlich an der Länderrelation im deutschösterreichisch-tschechischen<br />
Titelgebrauch – jedenfalls bislang – grundsätzlich<br />
noch nichts geändert.<br />
Es ist außerordentlich bemerkenswert, dass sich gerade der Titelgebrauch<br />
von einer viereinhalb Jahrzehnte währenden Trennung zwischen kapitalistischer<br />
und sozialistischer Gesellschaftsform offenbar unberührt zeigt. Titel<br />
und Funktionsbezeichnungen beziehen sich explizit auf gesellschaftliche<br />
Rollen und Rangordnungen. Ihre Verwendung erfolgt typischerweise in<br />
nonreziproken, asymmetrischen Anredeverhältnissen, denn diese Formen<br />
akzentuieren gerade die vertikalen sozialen Differenzen zwischen den Gesprächspartnern.<br />
Titelkonventionen wie die tschechische, die in vielen Gesprächssituationen<br />
und mit hoher Frequenz das Bestehen von Statusdifferenzen<br />
zwischen den Gesprächsteilnehmern explizieren, bezeichnet<br />
BERGER (2001: 8) zu recht als „antiegalitär“.<br />
Man säße allerdings einem simplen Widerspiegelungsmodell auf, wollte<br />
man die sozialdeiktische Funktion dieser und anderer Anredeformen so ver-<br />
20 Auch im polnischen Sprachraum werden bis heute Titel- und Funktionsbezeichnungen<br />
sehr häufig benutzt (vgl. z.B. BERGER 2001). Die polnischen Anredeverhältnisse lassen<br />
sich aber nicht ohne Weiteres mit den tschechischen oder deutschen vergleichen,<br />
denn hier ist die nominale Anrede syntaktisch eingebunden und damit konstitutionell<br />
anders determiniert als die fakultative Titelanrede in den beiden anderen Sprachen. Es<br />
wäre im Licht meiner Ergebnisse sehr interessant, die Titelkonventionen in anderen Regionen<br />
der ehemaligen Donaumonarchie zu untersuchen.<br />
CZ<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
stehen, dass sich im Anredeverhalten gesellschaftliche Verhältnisse unmittelbar<br />
abbildeten. Vielmehr drücken die Gesprächspartner durch die Wahl<br />
der Anredeformen aus, welche zwischen ihnen bestehenden sozialen Differenzen<br />
oder Gemeinsamkeiten sie für die jeweils aktuelle Kommunikationssituation<br />
als relevant ansehen. Anredeübergänge, etwa vom Siezen zum Duzen<br />
oder vom Titulieren zur bloßen Verwendung des Namens, die von den<br />
Gesprächspartnern meist metakommunikativ thematisiert werden, zeigen,<br />
dass die Beteiligten die Interpretation ihrer sozialen Beziehung in gewissen<br />
Grenzen gemeinsam aushandeln können. Schon Brown und Gilman sahen<br />
in dem eigentümlichen Anredestil einer Person oder einer Gruppe daher<br />
immer auch den Ausdruck einer „Ideologie“ 21 – im verstärkten Duzen<br />
drücke sich etwa die vorrangige und gewollte Orientierung an Gleichheit<br />
und Gemeinsamkeiten aus. Die spezifischen Anredekonventionen einer<br />
Sprechergruppe bilden also nicht einfach die sozialen Verhältnisse in dieser<br />
Gruppe ab, sondern die Art, wie diese Verhältnisse von dieser Gruppe üblicherweise<br />
interpretiert werden. Die Ergebnisse meiner Untersuchung belegen,<br />
dass zwischen der Entwicklung gesellschaftlicher Machtformationen<br />
und der Entwicklung ihrer kommunikativen Realisierung keine unmittelbaren<br />
Entsprechungen bestehen müssen.<br />
Deutschsprachige Benimmbücher und Briefsteller des 19. Jahrhunderts<br />
vermitteln das Bild einer fortschreitenden „Vereinfachung des aus älterer<br />
Zeit stammenden Titelwesens“ (WAGNER 1875: 328). Damit folgte auch<br />
der deutsche Sprachgebrauch grundsätzlich der gesamteuropäischen Tendenz<br />
zum Titelabbau, von der Brown und Gilman sprachen. Allerdings bedauerten<br />
die Benimmbuchautoren schon im 19. Jahrhundert eine deutliche<br />
Verspätung der deutschen Verhältnisse gegenüber dem Ausland.<br />
Obwohl es zwar wünschenswerth ist, daß die Deutschen mit ihrem Titelwesen die verständige<br />
Einfachheit anderer Nationen, z.B. der Franzosen und Engländer, nachahmen und den höchst<br />
pedantischen Formeln entsagen möchten, so sind wir doch genöthigt, so lange eine Beschränkung<br />
darin nicht allgemein geworden ist, der herrschenden Sitte oder Unsitte zu huldigen,<br />
wenn wir uns nicht eine Verletzung der Höflichkeit schuldig machen wollen. (RAMMLER<br />
1876: 60)<br />
Gerade im gern geübten Vergleich mit England und Frankreich sticht<br />
Deutschland der Anstandsliteratur zu Folge noch bis weit in das 20. Jahrhundert<br />
als „das Land der ‚Doktoren‘, der ‚Räte‘, der ‚Konsulen‘ der Direktoren‘“<br />
(GRAUDENZ 1971: 25) heraus.<br />
Dabei scheinen die deutschsprachigen Benimmbücher lange Zeit keine Unterschiede<br />
zwischen Deutschland und Österreich wahrzunehmen. Erst nach<br />
21 Vgl. den Abschnitt „Semantik, Sozialstruktur und Ideologie“ in BROWN / GILMAN<br />
(1982: 179 ff.).<br />
109
110<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
dem Zweiten Weltkrieg beginnt hier „der Süddeutsche und besonders der<br />
Österreicher“ (KAMPTZ-BORKEN 1955: 127) mit seiner nicht nachlassenden<br />
„Lust am Titel“ (OHEIM 1956: 357) aufzufallen.<br />
Einigermaßen schlimm und schon nicht mehr so ganz in unsere Zeit passend ist es, daß im<br />
Bereich der deutschen Zunge zur Anrede auch noch ein Titel gehört, wenn der Höflichkeit<br />
Genüge getan werden soll. Dies ist zwar bei anderen Kulturnationen auch der Fall, aber der<br />
deutschsprachige Mensch tut in dieser Hinsicht anscheinend doch ein wenig zu viel des Guten,<br />
besonders wenn er im Süden des Sprachgebietes (einschließlich Österreich) siedelt.<br />
(KAMPTZ-BORKEN 1955: 127)<br />
Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg scheint ein Auseinanderdriften des<br />
norddeutschen und des österreichisch-süddeutschen Sprachgebrauchs in<br />
Kontaktsituationen manifest geworden zu sein. So berichtet der Sudetendeutsche<br />
Eugen Lemberg, der sich nach dem Krieg in die „fremde Welt“<br />
der Region Kassel versetzt sah, die sudetendeutschen Flüchtlinge seien hier<br />
„von den Einheimischen wegen unserer österreichischen Höflichkeit als<br />
unterwürfig verachtet“ (LEMBERG 1986: 203) worden. Die altösterreichische<br />
Höflichkeit wirkte also bereits im Nachkriegsdeutschland devot. Daran<br />
dürfte der häufige Titelgebrauch entscheidenden Anteil gehabt haben.<br />
Wo die Divergenz des deutschen und des österreichischen „Titelwesens“<br />
angesprochen wird, werden gern auch Erklärungen für Besonderheiten des<br />
österreichischen Sprachgebrauchs versucht. OHEIM (1956: 357) begründet<br />
die besondere österreichische „Lust am Titel“ beispielsweise als Ausdruck<br />
einer allgemein traditionsorientierten und gleichsam sentimentalen Mentalität:<br />
Der Blick des Österreichers ist rückwärts in die glorreiche Vergangenheit gerichtet. (ebd.)<br />
SPILLNER (2001: 32) verweist auf kulturgeschichtliche Besonderheiten<br />
und sieht einen „Grund für eine mögliche Vorliebe für allerlei Titulierungen“<br />
darin, „dass in Wien lange das spanische Hofprotokoll galt, von dem<br />
Teile alle historischen und politischen Veränderungen überstanden haben.“<br />
TRIFELS (o.J. [1974]: 131) interpretiert das Fortbestehen adliger Titulaturen<br />
als eine Art sozialpsychologischer Trotzreaktion darauf, dass in Österreich<br />
1918 anders als in Deutschland „die Weiterführung der Adelsprädikate<br />
verboten“ wurde. MUHR (1993: 30) erklärt den starken Titelgebrauch<br />
„aus den korporatistischen Strukturen“ der gegenwärtigen Gesellschaft<br />
Österreichs, denen sozialpsychologisch „ein erhebliches Maß an Akzeptanz<br />
von Obrigkeit und Autorität“ korrespondiere.<br />
Die Interpretation der vom deutschen Usus stark abweichenden Titelkonvention<br />
bedient sich also einstweilen der verschiedensten kulturalistischen,<br />
mentalistischen oder historischen Erklärungsmuster. Es ist freilich überhaupt<br />
die Frage, ob eine einzelne sprachliche Form und ihr Gebrauch mit<br />
dem Gesamtzusammenhang von Kultur und Gesellschaft in direkte Bezie-<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
hung gesetzt werden kann. Derartige kulturalistische Kurzschlüsse waren<br />
typisch für die „kulturkundlichen“ Ansätze in der Sprachwissenschaft des<br />
frühen 20. Jahrhunderts. 22 Ein recht deutliches Beispiel für derartige Kurzschlussargumentationen<br />
findet sich für den Bereich der Anrede heute etwa<br />
bei Anna Wierzbicka. Wierzbicka bezeichnet das universell anwendbare<br />
englische you als „very democratic, it is a great social equaliser“<br />
(WIERZBICKA 1991: 47). So wird dieses Pronomen als ein sprachlicher<br />
Reflex der „Anglo-Saxon culture“ angesehen, zu deren zentralen Werten es<br />
gehöre, jedem Menschen eine unverletzliche Privatsphäre zuzubilligen.<br />
Being the great equaliser, the English you keeps everybody at a distance – not a great distance,<br />
but a distance; and it doesn’t allow anybody to come really close. (ebd.: 48)<br />
Das Englische hätte demzufolge „no devices“ (ebd.), besondere Intimität<br />
gegenüber dem Angesprochenen zum Ausdruck zu bringen. Das mag für<br />
die pronominale Anrede als solche richtig beobachtet sein. Selbstverständlich<br />
bieten aber schon die nominalen Anredeformen des Englischen vielfältige<br />
Möglichkeiten ganz ‚undemokratische‘ Statusdifferenzen ebenso wie<br />
engste Intimität (z.B. Kosewörter und -namen) auszudrücken. Bedenkt man<br />
zudem die reichen Differenzierungsmöglichkeiten vertikaler und horizontaler<br />
Distanz auf anderen Sprachebenen des Englischen, muss die Argumentation<br />
Wierzbickas als unhaltbare kulturalistische Überfrachtung der Bedeutung<br />
eines einzelnen sprachlichen Mittels erscheinen.<br />
Ähnlich wäre es sicher verfrüht, den divergierenden Titelgebrauch allein<br />
schon als Indiz kultureller oder mentaler Differenzen zwischen Deutschland<br />
und Österreich-Tschechien zu interpretieren. Bevor von den Konventionen<br />
des Titelgebrauchs auf Kultur und Gesellschaft zu schließen ist, müsste zunächst<br />
geprüft werden, ob diese Konventionen Teil eines verschiedene<br />
sprachliche Ebenen und Kommunikationsdomänen übergreifenden ‚Höflichkeitsstils‘<br />
sind. Zu fragen wäre etwa, ob sich auch jenseits des Titelgebrauchs<br />
in Österreich und Tschechien Züge einer hierarchie-orientierten<br />
Höflichkeit ausmachen ließen, die zumindest in verbaler Kommunikation<br />
im Deutschen nicht oder nicht in gleicher Ausprägung und Frequenz anzutreffen<br />
wären? 23 Im Übrigen dürfte das Fortbestehen sprachlicher Konven-<br />
22 Berüchtigt ist beispielsweise Eugen Lerchs Schluss von der Häufigkeit des „Heischefuturums“<br />
(Verwendung des Futurs in direktiven Sprechakten) im Französischen auf den<br />
impulsiven und rücksichtslosen „französischen Nationalcharakter“, auf den Lerch unter<br />
anderem in seinem Artikel über „Französische Sprache und französische Wesensart“ zurückkommt<br />
(LERCH 1930: 104–107).<br />
23 Die Arbeiten Rudolf Muhrs zum Österreichischen gehen in diese Richtung, vgl. MUHR<br />
(1993) und (1995).<br />
111
112<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
tionen kulturalistischer oder soziologischer Interpretation weniger zugänglich<br />
sein als deren Veränderung.<br />
A (communicative) politeness style can be fossilized and remain unchanged, at least for some<br />
time. (NEKVAPIL / NEUSTUPNÝ (im Druck: 4)<br />
Aus der Sicht der dynamischen Entwicklung der Anrede im (nord)deutschen<br />
Sprachgebrauch und auch vor einem allgemeineren westeuropäischen<br />
Hintergrund könnten die Titelkonventionen in Tschechien und Österreich<br />
tatsächlich als ‚fossilisiert‘ bezeichnet werden. Wie alle ‚Fossilien‘ sagen<br />
uns diese Konventionen mehr über die Vergangenheit als über die Gegenwart.<br />
Literaturverzeichnis<br />
ASSERATE, Asfa-Wossen (<strong>2004</strong>): Manieren. 11. Aufl. Frankfurt/Main:<br />
Eichborn.<br />
BAXANT, Ladislava/RATHMAYR, Renate/SCHULMEISTEROVÁ, Magda<br />
(1995): Verhandeln mit tschechischen Wirtschaftspartnern. Gesprächs- und<br />
Verhaltensstrategien für die interkulturelle Geschäftspraxis. Jednání s<br />
českými obchodními partnery. Wien: Service.<br />
BERGER, Tilman (1995): Versuch einer historischen Typologie ausgewählter<br />
slavischer Anredesysteme. – In: D. Weiss (Hg.), Slavistische Linguistik<br />
1994. Referate des XX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Zürich<br />
20.–22.9.94. München: Sagner, 15–64.<br />
BERGER, Tilman (2001): Semantik der nominalen Anrede im Polnischen<br />
und Tschechischen. – In: V. S. Chrakovskij, M. Grochowski und G. Hentschel<br />
(Hgg.), Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages.<br />
Papers in Honour of Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 70 th<br />
Birthday. Oldenburg: bis, 39–50.<br />
BROWN, Roger / GILMAN, Albert (1982) [1960]: Die Pronomina der<br />
‚Macht‘ und ‚Solidarität‘. – Deutsch in: H. Steger (Hg.), Anwendungsbereiche<br />
der Soziolinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,<br />
163–198.<br />
BRÜHL, B. (1982), En kontrastive analyse af danske og tyske tiltaleformer.<br />
Købnhavn: Universitet.<br />
COSERIU, Eugenio (1979): System, Norm und Rede. – In: Ders., Sprache.<br />
Strukturen und Funktionen. XII Aufsätze zur allgemeinen und romanischen<br />
Sprachwissenschaft. Tübingen: Narr, 45–59.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
EHLERS, Klaas-Hinrich/KNEŘOVÁ, Magdalena (1997): Tschechisch förmlich,<br />
unverschämt deutsch? Arbeitsbericht zu einer kontrastiven Untersuchung<br />
des Anredeverhaltens. – In: S. Höhne, M. Nekula (Hgg.), Sprache,<br />
Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: iudicium,<br />
189–214.<br />
EHLERS, Klaas-Hinrich (im Druck): Raumverhalten auf dem Papier. Der<br />
Untergang eines komplexen Zeichensystems dargestellt an Briefstellern des<br />
19. und 20. Jahrhunderts. – Erscheint in: Zeitschrift für germanistische Linguistik<br />
FINKENSTAEDT, Thomas (1981): Duzen ohne Du. Zur Anrede, vornehmlich<br />
im Deutschen. – In: Jahrbuch für Volkskunde, N.F. 4, 7–30.<br />
GRAUDENZ, Karlheinz (1971): Die Briefetikette. München: Südwest.<br />
GROBER-GLÜCK, Gerda (1994): Die Anrede des Bauern und seiner Frau<br />
durch das Gesinde in Deutschland um 1930. Frankfurt/Main: Lang.<br />
KRUMREY, Horst-Volker (1984): Entwicklungsstrukturen von Verhaltensstandarden.<br />
Eine soziologische Prozeßanalyse auf der Grundlage deutscher<br />
Anstands- und Manierenbücher von 1870 bis 1970. Frankfurt/Main: Suhrkamp<br />
LABOV, William (1965): Zum Mechanismus des Sprachwandels. – In: D.<br />
Cherubim (Hg.), Sprachwandel. Reader zur diachronischen Sprachwissenschaft.<br />
Berlin, New York: de Gruyter, 305–334.<br />
LEMBERG, Eugen (1986): Ein Leben in Grenzzonen und Ambivalenzen.<br />
Erinnerungen, niedergeschrieben 1972, mit einem Nachtrag von 1975. – In:<br />
F. Seibt (Hg.), Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder, Bd. 5:<br />
Eugen Lemberg 1903 – 1976. München: Oldenbourg, 131–278.<br />
LERCH, Eugen (1930): Französische Sprache und französische Wesensart.<br />
– In: Handbuch der Frankreichkunde. 1. Teil. 2. Aufl. Frankfurt/Main: Diesterweg,<br />
69–146.<br />
KAMPTZ-BORKEN, Walther v. (1955): Der gute Ton von heute. Gesellschaftlicher<br />
Ratgeber für alle Lebenslagen. 6. Aufl. Vaduz: Oberrheinische<br />
Verlagsanstalt.<br />
KNEŘOVÁ, Magdalena (1994): Oslovení v němčině a češtině [Die Anrede<br />
im Deutschen und Tschechischen]. Praha: unveröffentlichte Diplomarbeit<br />
[Text deutsch].<br />
KNEŘOVÁ, Magdalena (1995): Ke způsobům oslovování v mluvených<br />
projevech [Zum Anredeverhalten in mündlichen Äußerungen]. – In: Naše<br />
řeč 78, 36–44.<br />
113
114<br />
Klaas-Hinrich Ehlers<br />
LINKE, Angelika (1998): Sprache, Gesellschaft und Geschichte. Überlegungen<br />
zur symbolischen Funktion kommunikativer Praktiken der Distanz.<br />
– In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 26, 135–154.<br />
MEISSNER, Hans-Otto (1954): Man benimmt sich wieder. 11. Aufl.<br />
Giessen: Brühlscher Verlag.<br />
MUHR, Rudolf (1993): Pragmatische Unterschiede in der deutschsprachigen<br />
Kommunikation – Österreich : Deutschland. – In: Ders. (Hg.), Internationale<br />
Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbarsprachlichen<br />
Bezügen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 26–38.<br />
MUHR, Rudolf (1995): Grammatische und pragmatische Merkmale des<br />
Österreichischen Deutsch. – In: R. Muhr, R. Schrodt und P. Wiesinger<br />
(Hgg.), Österreichisches Deutsch. Linguistische, Sozialpsychologische und<br />
sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien:<br />
Hölder-Pichler-Tempsky, 208–234.<br />
NEKULA, Marek/HÖHNE, Steffen (1995): Transkriptionen von Interviews<br />
bei Škoda Mladá Boleslav. Im Rahmen des Projekts Interkulturelle Wirtschaftskommunikation,<br />
tschechisch-deutsche Beziehungen seit 1989. Bd. 1.<br />
Brno / Praha: Privatdruck.<br />
NEKVAPIL, Jiří/NEUSTUPNÝ, Jiří (im Druck): Politeness: The Case of<br />
the Czech Republic. – Erscheint in: L. Hickey, M. Stewart (Hgg.), Politeness<br />
in Europe. (= Multilingual matters 127).<br />
OHEIM, Gustav (1956): Einmaleins des guten Tons. 8. Aufl. Wien: Ullstein.<br />
POLENZ, Peter von (1999): Deutsch als plurinationale Sprache im postnationalistischen<br />
Zeitalter. – In: A. Gardt, U. Haß-Zumkehr, T. Roelcke<br />
(Hgg.), Sprachgeschichte als Kulturgeschichte (= Studia Linguistica Germanica<br />
54). Berlin, New York: de Gruyter: 115–132.<br />
RATHMAYR, Renate (1992): Nominale Anrede im gesprochenen Russischen,<br />
Serbokroatischen und Tschechischen. – In: T. Reuther (Hg.), Slavistische<br />
Linguistik 1991. Referate Referate des XVII. Konstanzer Slavistischen<br />
Arbeitstreffens Klagenfurt – St. Georgen 10. – 14.9.1991. München:<br />
Sagner, 265–309.<br />
RAMMLER, Otto Friedrich (1876): Deutscher Reichs-Universal-<br />
Briefsteller oder Musterbuch zur Abfassung aller in den allgemeinen und<br />
freundschaftlichen Lebensverhältnissen sowie im Geschäftsleben vorkommenden<br />
Briefe, Documente und Aufsätze. [...]. 46. Aufl. von Dr. H. Th.<br />
Traut. Leipzig: Wigand.<br />
Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien<br />
ŠMÍDOVÁ, Olga (2001): Deutsch-tschechische Spiegelbilder. – In: W.<br />
Koschmal, M. Nekula, J. Rogall (Hgg.), Deutsche und Tschechen. Geschichte<br />
– Kultur – Politik. Mit einem Geleitwort von Václav Havel. München:<br />
Beck, 516–527.<br />
SPILLNER, Bernd (2001): Die perfekte Anrede. Schriftlich und mündlich,<br />
formell und informell, national und international. Landsberg (Lech): mi-<br />
Verlag.<br />
ŠTÍCHA, František (2003): Česko-německá srovnávací gramatika [Tschechisch-deutsche<br />
vergleichende Grammatik]. Praha: Argo.<br />
TRIFELS, Dietmar (o.J.) [1974]: Guter Ton heute. Köln: Buch und Zeit.<br />
WAGNER, Fridolin (1875): Die Lehre vom deutschen Stil oder praktische<br />
Anleitung zum richtigen deutschen Gedankenausdrucke [...]. 10. Aufl.<br />
Darmstadt: Johann Philipp Diehl.<br />
WIERZBICKA, Anna (1991): Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics<br />
of Human Interaction. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.<br />
WIESINGER, Peter (1995): Das österreichische Deutsch in der Diskussion.<br />
– In: R. Muhr, R. Schrodt, P. Wiesinger (Hgg.), Österreichisches Deutsch.<br />
Linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen<br />
Varietät des Deutschen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 59–74.<br />
115
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache<br />
und Kommunikation bei der Konstitution nationaler Identität.<br />
Steffen Höhne<br />
Im Kontext der Herausbildung moderner Nationalismen kommt bekanntlich<br />
der Sprache als Identitätsfaktor eine zentrale mobilisierende Bedeutung zu,<br />
was sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts in den Böhmischen Ländern in<br />
einer Vielzahl an politischen Auseinandersetzungen zeigt, an denen sich<br />
harte Machtdivergenzen dokumentieren. Erinnert sei hier nur an die Badeni-<br />
Krise des Jahres 1897,<br />
die wohl schwerste Staatskrise, die die späte Monarchie erschüttert hat, eine Orgie an Gewalt,<br />
Dummheit, antislawischer und antisemitischer Pöbelei in den Straßen und im Parlament, ein<br />
Menetekel, das den von vielen als unvermeidlich gesehenen Untergang eines längst als anachronistisch<br />
empfundenen Staatsgebildes vorwegzunehmen schien [...]. (BURGER 1998:<br />
201) 1<br />
In der Folge der am 5.4.1897 für Böhmen, am 22.4.1897 für Mähren erlassenen<br />
Sprachenverordnungen, mit denen in den Kronländern Böhmen und<br />
Mähren beide Landessprachen „im inneren und äußeren Dienstverkehr der<br />
Behörden einander gleichgestellt“ wurden (HÖNSCH 1992: 393), kam es<br />
zu massiven Ausschreitungen, in deren Folge die Sprachenverordnungen<br />
gekippt wurden und Badeni zurücktreten musste. Dieser Konflikt steht somit<br />
im Zentrum einer Entwicklung, in der das Bestehen zweier oder mehrerer<br />
Sprachen zunehmend nicht als Ausdruck kulturellen Reichtums verstanden<br />
wird und die als Basis für das Ideal einer monolingualen, nationalen<br />
Schulbildung dient.<br />
Dabei ist die seit dem Hochmittelalter in den Böhmischen Ländern vorzufindende<br />
Zweisprachigkeit bei stabilen Sprachgrenzen, darauf hat Emil<br />
Skála in seinen sprachhistorischen Arbeiten explizit hingewiesen, ein wichtiges<br />
kulturkonstitutives Element. Schließlich offenbart sich dem Betrachter<br />
diese Kultur als Ergebnis interdependenter Prozesse oder, nach Palacký, als<br />
‚Ringen mit dem Deutschthum‘ auf fast allen Gebieten des menschlichen<br />
Lebens. Allerdings lässt sich an dem jeweils veränderten Status der einen<br />
oder anderen Sprache schon in vornationaler Zeit der jeweilige Wechsel in<br />
1 Burger unternimmt in ihrem Beitrag den Versuch einer Ehrenrettung Badenis (s.a.<br />
BURGER/WOHNOUT 1995), dessen Sprachenverordnungen auf dem Prinzip sprachlicher<br />
und nationaler Gleichberechtigung basierten (BURGER 1998: 209). Zu den<br />
Sprachreformen siehe auch MACKOVÁ (1998) und MIKUŠEK (1998); ferner Abdruck<br />
der Sprachenverordnungen bei FISCHEL (1910: 246ff.).
118<br />
Steffen Höhne<br />
der politischen Herrschaft ablesen. 2 Auf die partielle Verdrängung der deutschen<br />
Sprache in der Hussitischen Periode folgt mit der Herrschaft der<br />
Habsburger auf dem böhmischen Thron (1526) eine ,Rückkehr‘, nach der<br />
Schlacht am Weißen Berg (Bílá hora) eine zunehmende Dominanz des<br />
Deutschen – neben dem Lateinischen als Bildungssprache – in der öffentlichen<br />
Kommunikation. Ungeachtet der Erneuerten Landesverordnung<br />
(1627/28) (FISCHEL 1910: 10–17), in der die beiden Landessprachen offiziell<br />
gleichgestellt worden waren, wurde das Tschechische zunehmend aus<br />
Schulen und Verwaltung verdrängt, bis die Gegenbewegung im Rahmen der<br />
Nationalen Wiedergeburt die Marginalisierung des Tschechischen als öffentliche<br />
Sprache beendete. 3 Mit den Reformen des Jahres 1867 kam es zur<br />
juristischen Gleichberechtigung der großen Nationen in der Habsburger<br />
Monarchie, in deren Folge viele neue, auch höhere Schulen mit Tschechisch<br />
als Unterrichtssprache gegründet wurden und an deren Ende die Etablierung<br />
einer tschechischen Universität stand, hervorgegangen aus der Teilung der<br />
Prager Carolo Ferdinandea im Jahre 1882. Bezogen auf Böhmen führen<br />
diese langfristigen, sprach- wie bildungshistorischen 4 Entwicklungen seit<br />
dem späten 18. Jahrhundert, als bekanntlich mit Herder die Historisierung<br />
des Denkens einsetzte, 5 zur Herausbildung von unterschiedlich attribuierten<br />
Bildungs- und Kommunikationssystemen und zu einer Koppelung des<br />
sprachhistorischen Prozesses an die Konstitution nationaler Kulturen und<br />
damit Identitäten. Wird bei Wilhelm von Humboldt diese Entwicklung noch<br />
aus einer supranationalen Perspektive analysiert, 6 so kommt es in der Folge<br />
je nach inhaltlicher Bestimmung zur Herausbildung exklusiver Konzepte<br />
von Nation (BÄR 2000), denen unterschiedliche Diskurse zugrunde liegen.<br />
2 Zur Datierung des modernen Nationalismus und seiner Abgrenzung gegenüber früheren<br />
Formen siehe WEHLER (2001) und PLANERT (2002).<br />
3 Auf Residuen der Ausbildung in tschechischer Sprache auch während des ‚Temno‘<br />
(Finsternis), z. B. in den Priesterseminaren, weist ANNA DRABEK (1996) hin.<br />
4 Zur Rolle der Schulvereine in diesem Kontext siehe ZAORAL (1995) und LUFT<br />
(1995).<br />
5 Zum Einfluss Herders auf die tschechische Emanzipationsbewegung siehe SUNDHAUßEN<br />
(1973), DREWS (1990), POVEJŠIL (1996).<br />
6 Wilhelm von Humboldt (1973: 139f.) hat den engen, interdependenten Zusammenhang<br />
von Sprache und Nation erkannt: „Jede Sprache empfängt eine bestimmte Eigentümlichkeit<br />
durch die Nation und wirkt gleichförmig bestimmend auf diese zurück. […] Da<br />
die Entwicklung seiner menschlichen Natur im Menschen von der Sprache abhängt, so<br />
ist durch diese unmittelbar selbst der Begriff der Nation als der eines auf bestimmte<br />
Weise sprachbildenden Menschenhaufens gegeben. Die Sprache aber besitzt auch die<br />
Kraft, zu entfremden und einzuverleiben, und teilt durch sich selbst den nationellen Charakter,<br />
auch bei verschiedenartiger Abstammung, mit.“ [kursiv S.H.]<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
119<br />
a) Aus den Vorstellungen eigenständiger und vor allem unterscheidbarer<br />
Kulturen entsteht ein kulturell determinierter Nationsbegriff, der<br />
kulturelle Artefakte zum Ausdruck und Eigentum des Kollektivs erklärt.<br />
b) Aus dem politischen Diskurs der Aufklärung um ein selbstbestimmtes<br />
Gemeinwesen entwickelt sich ein politisch determinierter Nationsbegriff.<br />
c) Die Vorstellungen von Existenz und Distinktion individueller Sprachen<br />
führen zu einem sprachlichen Nationsbegriff, der, vor allem in<br />
der Zeit der Romantik, mit einer pathetischen Aufwertung der<br />
Volkssprache als Muttersprache verknüpft und mit dem ein monolinguales<br />
Ideal zunehmend als Basis nationaler Identität eingesetzt<br />
wird. 7<br />
d) Annahmen geographischer und klimatischer Einflussgrößen, aus<br />
denen sich ähnliche physische, psychische und/oder intellektuelle<br />
Eigenschaften entwickeln, bilden die Voraussetzung für einen lebensräumlich-charakterlichen<br />
Nationsbegriff.<br />
e) Die Idee gemeinsamer Abstammung schließlich führt zur Herausbildung<br />
eines genetischen Nationsbegriffs.<br />
Es ist eine Gemengelage dieser Konzepte, mit denen die Vorstellungen von<br />
Nation im Verlauf des 19. Jahrhunderts strategisch zur Konstitution nationaler<br />
Selbstbilder von Gruppen und Gesellschaften, die dadurch Tragfähigkeit<br />
und Kontinuität erhalten sollen, eingesetzt werden. Sprache und Kultur gelten<br />
gemäß dieser panlinguistischen Auffassung (v. POLENZ 1998) als konstitutive<br />
Merkmale von Nation und Nationalität. Distinktionsmerkmale<br />
werden semantisch aufgewertet und nationalisiert bzw. ethnisiert, Sprache<br />
und Kultur als Nationalkultur respektive -sprache mutieren zu Trägern kollektiver<br />
Verwurzelung und Selbstvergewisserung. Auf die daraus resultierenden<br />
nationalen Konflikte innerhalb der Habsburger Vielvölkermonarchie<br />
reagierte man mit unterschiedlichen sprachpolitischen Lösungsversuchen,<br />
so der eingangs erwähnte Kasimir Badeni mit seinem Versuch,<br />
durch zweisprachige Amtierung in zweisprachigen Kronländern die vollkommene Gleichberechtigung<br />
beider Landessprachen als äußere und innere Amtssprachen herzustellen und auf<br />
diese Weise eine transnationale Lösung des Nationalitätenproblems gegenüber einer nationalautonomistischen<br />
durchzusetzen. (BURGER 1998: 208) 8<br />
7 Allerdings handelt es sich dabei um einen Prozess, der in Westeuropa deutlich früher als<br />
in Mitteleuropa einsetzt, vgl. TRABANT (1990: 11ff.).<br />
8 Als weiterer sprachpolitischer Lösungsvorschlag lässt sich die so genannte Taaffe-<br />
Stremayr’sche Sprachverordnung für Böhmen ansehen (Verordnung des Ministers des
120<br />
Steffen Höhne<br />
Für die Sprachgeschichte, für die Fragen der Funktion von Sprache im Kontext<br />
gesellschaftlicher Kommunikation an Relevanz gewinnen, ergeben sich<br />
daraus Konsequenzen. Eingebettet in die Geschichte der sozialen Beziehungen<br />
und Prozesse bzw. in die Geschichte der sozio-kommunikativen Beziehungen<br />
verändert sich ihre Perspektive: Sprachgebrauchsgeschichte bzw.<br />
Sprachbewusstseinsgeschichte, Pragmalinguistik, Sprachkontaktgeschichte<br />
rücken in das Zentrum des Interesses (hierzu MATTHEIER 1998). Die Abkehr<br />
von der systemorientierten bzw. -zentrierten Linguistik durch die<br />
kommunikativ-pragmatische Wende der 1970er Jahre und die damit eingeleitete<br />
Hinwendung zu einer kommunikationsorientierten Betrachtung kollektiver<br />
Deutungsmuster einer Sprachgemeinschaft eröffnet darüber hinaus<br />
Möglichkeiten, die Annäherungen an die philologische Methodik erlauben.<br />
Denn Sprachgeschichte, verstanden als Mentalitäts- oder Diskursgeschichte<br />
und auch als Kulturgeschichte, versteht Texte als Äußerungsensemble, mit<br />
dem ein Thema, z. B. die Identifikation der eigenen Gruppe und ihre Abgrenzung<br />
von anderen, verhandelt wird.<br />
In der Perspektive der Diskursgeschichte werden Quellentexte dergestalt zum Gegenstand der<br />
Sprachgeschichte, dass sie wieder zu Gesprächsbeiträgen werden; und zwar dadurch, dass man<br />
sie als Komponenten eines Zeitgespräches auffasst. Wieder eingebettet in die – je rekonstruierten<br />
– diskursiven und historischen Zusammenhänge, deren Teil sie einmal waren, stellen sich<br />
die Quellentexte als die Elemente einer diskursiven Auseinandersetzung dar, in der sich Denken,<br />
Fühlen, Wollen – die Mentalitäten – der historischen Subjekte ebenso artikulieren wie<br />
konstituieren. (HERMANNS 1995: 91)<br />
Im Hinblick auf die Konstitution sprachnationaler Identität sind somit<br />
sprach- und kommunikationsreflexive Texte in den Böhmischen Ländern<br />
der Neuzeit von besonderem Interesse. Nimmt man als Ausgangspunkt die<br />
Zeit der Aufklärung, 9 so dominieren Apologien der Volkssprache, die zu<br />
Innern und der Justiz vom 19. April 1880, L.G.Bl. Nr. 14, betreffend den Gebrauch der<br />
Landessprachen im Verkehre der politischen, Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen<br />
Behörden im Königreiche Böhmen mit den Parteien und autonomen Organen,<br />
FISCHEL 1910: 208f.); ferner wäre an das multilinguale Konzept von Jan Evangelista<br />
Purkyně, Austria Polyglotta, zu denken. Dieses idealistische Manifest empfiehlt Polyglottie<br />
als Lösung nationaler Konflikte: „gesetzlich eingeführt und streng ausgeführt<br />
werde die Erlernung der österreichischen Hauptsprachen an den mittleren und höheren<br />
Schulen, den Realschulen und den Gymnasien.“ (PURKYNĚ 2002: 355)<br />
9 Die so genannte vornationale Zeit reicht in Österreich bis ins 18. Jahrhundert. In dieser<br />
Phase konnte eine gemeinsame Sprache aufgrund der geringen Alphabetisierungsrate,<br />
der Verankerung im Dialekt, der Existenz verschiedener Sprachen und der geringen<br />
Mobilität (Ausnahme: Militärdienst) nicht als Identitätsmerkmal fungieren (hierzu<br />
WIESINGER 2000). Erst als mit den josephinischen Reformen die deutsche Sprache<br />
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts „zum polyfunktionalen Koine der öffentlichen Domänen<br />
der Monarchie geworden“ ist (v. LEEUVEN-TURNOVCOVÁ 2001: 253), setzt<br />
ein Prozess der Aufwertung der so genannten Volkssprachen ein.<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
einer von historischen und sozialen Kontexten losgelösten Größe wird. So<br />
wird z. B. dem Tschechischen eine von den Sprechern unabhängige Natur<br />
mit inhärenten Gesetzmäßigkeiten zugesprochen, die Sprache entsprechend<br />
häufig in organischer (botanischer) Begrifflichkeit beschrieben. Emphatisch<br />
hervorgehoben wird die Nützlichkeit, die Sprache des Volkes zu reden, die<br />
Sprache des Volkes sei zudem, so Balbín (1775), „schön, kernig, kraftvoll,<br />
dabei aber auch zierlich und biegsam im Ausdruck“ (SCHAMSCHULA<br />
1990: 340) und daher dem Griechischen und Lateinischen vergleichbar und<br />
natürlich dem Deutschen überlegen. In diesem Verständnis ist Sprache eine<br />
eigenständige Entität, die auf das Denken, Fühlen und Handeln Einfluss<br />
nimmt und dem individuellen Zugriff zumindest in Teilen entzogen ist<br />
(GARDT 1999: 93).<br />
In der nächsten Generation (in Anlehnung an das Drei-Stufen-Schema von<br />
Miroslav Hroch, dem heuristische Qualitäten nicht abgesprochen werden<br />
können) folgt eine Überblendung des Sprachlichen mit dem Kulturell-<br />
Ethnischen (Sprache als Konstituente zu Volk, Kultur und Nation), Ethisch-<br />
Moralischen (Sprache als Konstituente zu Sitte und Moral), Politischen<br />
(Sprache als Konstituente zu Nation, Reich und Land) und Anthropologischen<br />
(Sprache als Konstituente zu Stamm, Rasse und Volk). Im Resultat<br />
erfolgt eine Identifikation des Sprachcharakters mit dem Volks- oder Nationalcharakter<br />
und seiner Artefakte, dies im Übrigen durch Josef Jungmanns<br />
Gespräche über die tschechische Sprache (Rozmlouvání) bereits im Jahre<br />
1803 (1806 publiziert), also ca. 5 Jahre vor den einschlägigen Texten von<br />
Fichte und Jahn!<br />
Charakteristika für das Lob des Tschechischen – man findet Analogien auch<br />
im Deutschen – sind:<br />
121<br />
a) Hohes Alter und genealogische Reinheit, ein Ideal einer reinen, von<br />
auswärtigen Einflüssen möglichst unberührten Sprache, z. B. über<br />
biblische Legitimation, Urslawen- respektive Germanenmythos etc.;<br />
b) Die Behauptung einer ontologischen (referentiellen) Adäquatheit,<br />
also eine besondere Zuverlässigkeit bei der Abbildung von Welt, z. B.<br />
über die Annahme einer umfassenden onomatopoetischen Motiviertheit<br />
des tschechischen Wortschatzes;<br />
c) Annahme einer inneren Homogenität und Annahme der Existenz<br />
sprachinhärenter Gesetze (GARDT 1999: 93), wobei pragmatische<br />
Bezüge (Arbitrarität, Konventionalität) ausgeblendet bleiben.<br />
Es erscheint da nur zu logisch, dass viele Vertreter der tschechischen Wiedergeburt<br />
sich um Übersetzungen ins Tschechische bzw. um literarisches<br />
Schaffen in Tschechisch bemühten, um so den Nachweis einer Literaturfä-
122<br />
Steffen Höhne<br />
higkeit zu erbringen. Letztlich ging es um die Aufwertung der Sprache insgesamt,<br />
d. h. die Etablierung des Tschechischen, allerdings in einer Situation,<br />
in der das Tschechische im gesellschaftlichen Kontext mit dem Stigma<br />
des Minderwertigen behaftet und die Hierarchien der Sprachen im Habsburger<br />
Herrschaftsgebiet durch Asymmetrien im Bereich der Mehrsprachigkeit<br />
geprägt waren (hierzu BERGER 2000). Für diese mittlere Phase ist<br />
der von Vladimír Macura beschriebene Linguozentrismus kennzeichnend,<br />
die philologische Dimension der tschechischen Wiedergeburtsbewegung<br />
und ihre konstitutive Wirkung, 10 womit nicht nur die ideologische Instrumentalisierung<br />
der Philologie gemeint ist, sondern auch die der Sprachreflexion<br />
als nationalkonstitutives Phänomen. Man stellt sich scheinbar rein<br />
linguistische Fragen, die aber nicht ausschließlich linguistisch beantwortet<br />
werden:<br />
Ve všech těchto případech jazyková skutečnost, svět uměle vytvářený jazykem, vlastně vyvolává<br />
obraz uzavřeného a soběstačného českého území, jehož veškeré vnitřní komunikační vazby<br />
jsou zprostředkovány češtinou. Vůči neútěšné historické realitě, vůči reálným historickým<br />
ztrátám a porážkám je za času vrcholného českého obrození hledána symbolická protiváha ve<br />
vítězstvích dosažených ve sféře jazykové výpovědi. (MACURA 1995: 56)<br />
In all diesen Fällen ruft die sprachliche Wirklichkeit, eine durch die Sprache künstlich geschaffene<br />
Welt, eigentlich das Bild eines geschlossenen und autarken tschechischen Gebietes hervor,<br />
dessen innere kommunikative Verbindungen durch das Tschechische gesteuert werden.<br />
Als Ersatz für die trostlose historische Realität, die realen geschichtlichen Verluste und Niederlagen,<br />
wird in der Hochphase der tschechischen Wiedergeburt ein symbolisches Gegengewicht<br />
in im Bereich des sprachlichen Ausdrucks erreichten Siege gesucht. [Übersetzung von S.H.]<br />
In dieser Phase kommt es zu einer allmählichen Delegitimierung bilingualer<br />
Konzepte von Sprachpolitik, wie sie im Vormärz von Bernard Bolzano<br />
(1810, 1817) oder Joseph Matthias von Thun (1845) formuliert worden wa-<br />
10 „Především z kulturotvorného působení jazyka, z jeho schopnosti vytvářet kolem sebe<br />
zdánlivě plnokrevný svět české kultury pramení filologický ráz českého obrození. Celá<br />
česká kultura má tak v zásadě přímo metajazykový charakter, existuje skrze jazyk, jazyk<br />
slouží jako její model a současně o jazyce přímo vypovídá. Zvlášt nápadná je přímá metajazykovost<br />
značné části obrozenských textů, která souvisí s potřebou chválit ‚v poeziích<br />
jazyk svůj‘ (Nebeský), jazyk se stává bezprostředním tématem básnické výpovědi.“<br />
(MACURA 1995: 57)<br />
Der philologische Charakter der tschechischen Erneuerungsbewegung beruht vor allem<br />
auf der kulturbildenden Wirkung der Sprache, ihrer Fähigkeit, um sich eine scheinbar<br />
vollblütige Welt tschechischer Kultur zu bilden. Die gesamte tschechische Kultur besitzt<br />
somit grundsätzlich einen geradezu metasprachlichen Charakter, sie existiert mittels<br />
Sprache, die Sprache wird zu ihrem Modell und liefert gleichzeitig Aussagen über<br />
die Sprache. Besonders auffällig ist die direkte Metasprachlichkeit der meisten Texte<br />
der Wiedergeburtsperiode, die mit dem Bedürfnis zusammenhängt, ‚in den Gedichten<br />
die eigene Sprache‘ (Nebeský) zu loben; die Sprache wird in der dichterischen Aussage<br />
unmittelbar thematisiert. [Übersetzung von S.H.]<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
ren. František Palacký, der zunächst von der Zweitrangigkeit der Sprache<br />
im Prozess der nationalen Identifikation ausging (und seine Böhmische Geschichte<br />
ja zunächst auf Deutsch verfasste), verweist später in einer Erwiderung<br />
an den Landesausschuss, der eine Fortsetzung der Böhmischen Geschichte<br />
in deutscher Sprache laut einem Erlass vom 30.12.1850 anmahnte,<br />
auf die Notwendigkeit der Gleichberechtigung der Sprachen. Darüber hinaus<br />
wird der Gebrauch des Tschechischen mit sprachimmanenten Gesetzen<br />
begründet, da die „Quellen der böhm. Geschichte seit der Hussitenepoche<br />
vorzugsweise in böhm. Sprache fliessen,“ weshalb ihre „gelegentliche Reproducirung<br />
in derselben Sprache“ dem Werke „mehr Frische, Eigenthümlichkeit<br />
und Kraft verleiht“ (PALACKÝ 1871c: 128). 11<br />
Der nächste Schritt in der Instrumentalisierung von Sprache ist von Assoziationen<br />
der Überlegenheit bzw. Gefährdung durch fremde Sprachen, Völker,<br />
Rassen, Nationen und Kulturen geprägt. Über das Lob der Sprechergemeinschaft<br />
und die Aufwertung der Volkssprache erfolgt die Herausbildung<br />
von Sprachnationalismus per Postulierung der Überlegenheit des Eigenen<br />
und Abwertung des Fremden. Konzepte wechselseitiger kultureller und<br />
sprachlicher Befruchtung werden zugunsten konfrontativer Sichtweisen<br />
zurückgedrängt, aus Palackýs häufig zitiertem ‚stýkání a potýkání‘ der vormärzlichen<br />
Periode wird 1871 in einer Neubestimmung der böhmischen<br />
Geschichtsschreibung ein „fast ununterbrochener Kampf politischer, religiöser<br />
und nationaler Gegensätze“, geleitet von einem „Vordringen und<br />
Zurückstauen übermächtiger deutscher Einflüsse auf slawischem Boden.“<br />
(PALACKÝ 1871a: 1)<br />
Neben diese Aufwertung der Sprache zur Nationalsprache tritt der kommunikationshistorische<br />
Prozess, in dem es – um mit Humboldt zu sprechen –<br />
zu ‚Entfremdung‘ und ‚Einverleibung‘ (siehe Fußnote 6) bzw. eine damit<br />
verknüpfte Aus- und Eingrenzung per Konstitution von Wir-Gruppen<br />
kommt. Damit ist innerhalb der Prozesse sozialer Differenzierung eine Verschiebung<br />
zu einem neuen Modell gesellschaftlicher Loyalität und Legitimität<br />
impliziert, bei dem identitätskonstitutive Texte eine zentrale Rolle einnehmen<br />
sollen.<br />
11 Zuvor hatte PALACKÝ (1871c: 123) den Wechsel der Sprache mit Angriffen nach<br />
seinem Frankfurter Brief an die Paulskirche begründet: „[…] noch heutzutage bin ich<br />
ein Gegenstand des Hasses für Diejenigen, die sich mit deutscher Gesinnung vorzugsweise<br />
brüsten. Dieser kränkende Umstand einerseits, und anderseits der zur Geltung gekommene<br />
Grundsatz nationaler Gleichberechtigung, mussten mich zu dem Entschlusse<br />
drängen, dass ich für immer aus der Reihe der deutschen Historiker schied, und seitdem<br />
mein Werk nur in böhmischer Sprache mehr schreiben kann.“ Für die Übersetzung sah<br />
Palacký Josef Wenzig vor.<br />
123
124<br />
Steffen Höhne<br />
Ein besonderes nationalhistorisches Legitimationspotential besitzen offenkundig,<br />
das belegt ihre Rezeptionsgeschichte, die Königinhofer und Grünberger<br />
Handschriften. Bei dem sogenannten ‚Handschriftenfund‘, mit dessen<br />
Hilfe das Desiderat einer, nicht-existenten, Tradition durch einen<br />
einheits- und identitätsstiftenden Kontext gefüllt werden sollte, um emotionale<br />
Bindungen zu erzeugen und solidarisches Handeln zu fördern, handelt<br />
es sich um ein für Phasen revolutionären Wechsels typisches Phänomen,<br />
welches Eric Hobsbawm als ‚Erfindung von Traditionen‘ beschrieben hat. 12<br />
Die Handschriften sollten in der Folge eine zentrale Bedeutung für das nationale<br />
tschechische Selbstverständnis erhalten und das kollektive Gedächtnis<br />
der Wiedererweckergeneration entscheidend prägen.<br />
Dabei geht es in den folgenden Ausführungen nicht um eine Referierung<br />
des Echtheitsdiskurses um die Handschriften, sondern um eine exemplarische<br />
Analyse ihrer gesellschaftlichen Etablierung und der dabei verwendeten<br />
argumentativen Strukturen. Betrachtet man Sprache als einen permanenten<br />
Transfer von langue (oder Kompetenz) und parole (oder Performanz),<br />
dann lässt sich Bedeutungsgeschichte mit Wittgenstein als Geschichte von<br />
Verwendungsweisen und ihren Konstellationen verstehen. In diesem Kontext<br />
können die Handschriften und ihre Etablierung als Möglichkeit verstanden<br />
werden, eine neue, noch bedrohte kollektive Identität in der Vorstellungswelt<br />
zu verankern, ihr einen tieferen Sinn zu verleihen. Nach Hroch (1999)<br />
waren um 1820 maximal 150 Personen in der Lage auf Tschechisch literarisch<br />
tätig zu sein. Die Ziele der Wiedererwecker mussten sich also auch auf<br />
die Umgestaltung der Varietät in einen polyfunktionalen Standard richten,<br />
mit dessen Hilfe die Eigenständigkeit der tschechischen Literatur, zudem<br />
älteren Datums als die deutsche, bewiesen und der Nachweis hochliterarischer<br />
Kompetenz erbracht werden konnte. 13 Vor diesem Hintergrund lassen<br />
12 Siehe zu dieser Thematik zuletzt KABEN (2003).<br />
13 Václav Hanka, später Kustos und Bibliothekar des Böhmischen Nationalmuseums, war<br />
Slawist und Schriftsteller, spezialisiert auf mittelalterliche tschechische Texte. Handschriftenfälschungen,<br />
die Hanka als alttschechische Pergamente der nationalen Öffentlichkeit<br />
präsentierte (sie wurden angeblich 1817 in einem Kirchturm in Dvůr Kralové,<br />
Königinhof gefunden, daher Königinhofer Handschrift), wurden enthusiastisch aufgenommen,<br />
schienen diese Lieder und Fragmente doch einen Beleg für eine alttschechische<br />
Hochkultur aus vorchristlicher Zeit und zudem eine Kompensation für nicht vorhandene<br />
Heldenepen zu bieten. Weitere Fälschungen wurden der Gesellschaft des<br />
Vaterländischen Museums per Post zugeleitet (sog. Grünberger Handschrift). Diese falschen<br />
Geschichtsquellen verlängerten die tschechische Geschichte insbesondere im<br />
Vergleich zur deutschen. Ihre geistesgeschichtliche Wirkung im Blick auf die Herausbildung<br />
der tschechischen Nationalidee ist von nicht zu unterschätzender Wirkung. Palacký<br />
beispielsweise nutzte sie in seiner Geschichte Böhmens als zentrale Quellen. Wer<br />
ihre Echtheit anzweifelte, wie als erster Josef Dobrovský, geriet in den Verdacht mangelnden<br />
Patriotismus (HEMMERLE 1962). Insbesondere nach dem Tod Dobrovskýs<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
sich die Handschriften und die Kontroversen um ihre Echtheit als Teil einer<br />
Narration der mit Inhalt und damit Sinn zu ‚füllenden‘ Nation bzw. Nationalkultur<br />
verstehen. Mit Hilfe dieser Narration entsteht ein Gefühl von Gemeinsamkeit,<br />
ein gemeinsames Schicksal, welches in Form von Nationalgeschichten<br />
in Literatur, Medien und Alltagskultur vorgetragen wird. Auf<br />
diese Weise konstituiert sich ein Kontext, in dem die Handschriften als Texte<br />
zum Ausdruck nationalen Schicksals avancieren können. Nicht umsonst<br />
hebt Swoboda ihre spezifisch identifikatorisch-emotionale Wirkung hervor:<br />
Hankas glücklicher Fund befriedigte die Sehnsucht, zeigte uns, was auch hierin die Kraft der<br />
Čechen gegolten. Daher die Begeisterung, mit der die seltsam herrliche Erscheinung, das glänzende<br />
Licht aus unserer Vorzeit begrüßt wurde. [...] So braucht der Böhme nicht mehr die<br />
Augen zu senken, er kann sie mit freudigem Stolze erheben; denn er darf dem Besten aller<br />
Zeiten seine Königinhofer Handschrift an die Seite stellen. (SWOBODA 1829: XII)<br />
Darüber hinaus bieten die Handschriften als ‚historische Quelle‘ die Gewähr<br />
für Ursprung, Kontinuität, Tradition und Zeitlosigkeit, konstruiert<br />
wird die Existenz eines frühgeschichtlichen Heldenzeitalters und einer<br />
hochstehenden slawischen Volkskultur. In ihr sind die auf Herders Slawenkapitel<br />
basierenden Topoi einer urslawischen, demokratischen Verfassung<br />
und Rechtsordnung und eines slawisch-germanischen Antagonismus genauso<br />
manifest wie die Idee einer spezifisch slawischen Sendung. Mit Hilfe<br />
dieser Attribute wird eine kollektive Identifikation herbeigeführt, die sich in<br />
einer sinnstiftenden, mythischen Erzählungsform veranschaulichen lässt<br />
und die ihre konsensuelle Etablierung – als historisch verbürgbare Quellen<br />
einer tschechischen Nationalkultur – erlangen wird und somit zu einem zentralen<br />
Teil des historischen Gedächtnisses avanciert. Die ‚Erfindung‘ ermöglicht<br />
zudem, Phasen kultureller Nichtexistenz (mangels Quellen 14 ), zu<br />
kompensieren und symbolisch Ordnung – über ihre bloße Existenz – zu erzeugen.<br />
Als Gründungs- und Ursprungsmythos unterstützen sie zudem in<br />
besonderer Weise die fiktive Idee eines reinen, ursprünglichen Volkes. Reale<br />
Verschiedenheit von Menschen nach sozialen Zuordnungen wie Klasse,<br />
Gender, Religion oder Ethnie (‚Rasse‘) werden durch die Narration überlagert,<br />
eine möglichst homogene nationale Einheit über einen langen Zeit-<br />
1829 zeigte sich eine zunehmende Radikalisierung der Auseinandersetzung für die,<br />
nach Palacký, ‚nationale Missgunst und Feindseligkeit‘ verantwortlich waren, da hierdurch<br />
gängige anti-slawische Stereotype, wonach das barbarische Slawentum von Natur<br />
aus unfähig zur Entwicklung einer von der deutschen unabhängigen, originären Bildung<br />
sei, widerlegt würden.<br />
14 In diesem Kontext sei auf die Schwierigkeiten der Geschichtsschreibung mangels Quellen<br />
verwiesen, auf die Palacký (1871b) in seinen Berichten an den ständischen Landesausschuss<br />
über die Vorarbeiten zur Erstellung einer Böhmischen Geschichte hinweist.<br />
125
126<br />
Steffen Höhne<br />
raum ließe sich somit postulieren. Die realitätskonstitutive Dimension der<br />
Handschriften haben die Apologeten dabei durchaus erkannt, so Palacký in<br />
einem Artikel in dem von Heinrich Sybel herausgegebenen 1. Jahrgang der<br />
HISTORISCHEN ZEITSCHRIFT (1859/III: 87–111):<br />
Wir älteren Zeitgenossen, die wir noch Zeugen und Theilnehmer der vor 1817 gemachten Versuche<br />
waren, die poetische Diction der Böhmen zu gestalten und zu heben, […] wir wissen<br />
davon zu erzählen, wie mit dem Erscheinen der Königinhofer Handschrift plötzlich eine neue<br />
ungeahnte Welt uns sich öffnete, mit welcher Zauberkraft die so ungewohnten und doch congenialen<br />
Laute an unser Herz schlugen, wie schnell in Folge dessen ein höherer und doch natürlicher<br />
Schwung in Phantasie, Bild und Wort den bisherigen künstlichen Fluss der böhmischen<br />
Rede ersetzte und verdrängte. Und nicht nur die unerwartete Fülle neuer kräftiger<br />
Wortformen und Bildungen war es, was uns überraschte: Auch der, im Verhältnis zum neueren,<br />
viel reichere, üppigere und edlere grammatische Bau der Sprache entzückte uns; denn<br />
gleichwie die deutsche Grammatik vor tausend Jahren eine weit reichhaltigere und complicirtere<br />
war, als gegenwärtig, so konnte auch das Böhmische seit etwa vier Jahrhunderten dem<br />
Strome neueuropäischer Simplificierung sich nicht ganz entziehen, obgleich es davon weniger<br />
affectiert wurde, als andere abendländische Sprachen. (PALACKÝ 1974b: 243f.)<br />
Palacký greift hier gängige Assertionen des sprachnationalen Diskurses der<br />
Zeit auf: Der Einfluss der Sprache auf den nationalen Charakter wird genau<br />
so postuliert wie die Notwendigkeit, sich an den höher entwickelten Sprachen<br />
zu orientieren, mit denen Verfall und Verarmung der eigenen beendet<br />
werden könne. Literarisch hochwertige Texte dienten der Aufwertung der<br />
Sprache insgesamt, weshalb die Handschriften-Apologeten von Anfang an<br />
erhobene Zweifel an deren Echtheit beseitigen mussten. Aus diesem Grund<br />
entschlossen sich František Palacký und Pavel Josef Šafařík als führende<br />
Repräsentanten der tschechischen Nationalbewegung zu einer wissenschaftlichen<br />
Expertise, 15 die sich gegen den ernstzunehmendsten Kritiker, Josef<br />
Dobrovský, richtete, der zu seinen Lebzeiten kraft wissenschaftlicher Autorität<br />
eine weitergehende Wirkung der Handschriften unterbinden konnte.<br />
Dobrovský äußerte Zweifel insbesondere an der Grünberger Handschrift,<br />
eine eigens zu dem Zweck vorgenommene Fälschung, um die Echtheit der<br />
Königinhofer Handschrift zu stützen. Die Apologeten der Handschriften<br />
unterstellen in ihrer Gegenstrategie zur Etablierung der Handschriften Dobrovský<br />
einen Missbrauch der fachlichen Autorität aufgrund nationaler<br />
15 So Palacký in einem Artikel in der BOHEMIA, 5., 6. und 10.11.1858 (PALACKÝ 1874a:<br />
217). S.a. die Rezension der Aeltesten Denkmäler der böhmischen Sprache in der Leipziger<br />
ALLGEMEINEN ZEITUNG (9.8.1840: 2413, Rubrik: Oestreich. Prag): „Der bereits<br />
zwanzigjährige gelehrte Streit über die Echtheit des böhmischen Gedichtes von Libussa’s<br />
Gericht dürfte endlich durch diese ausgezeichnete Arbeit zweier Koryphäen der<br />
böhmischen Geschichte und Philologie gelöst [...] sein.“<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
Voreingenommenheit 16 und unzureichende Selbstkritik 17 und konstatierten<br />
ein unwissenschaftliches, durch Krankheit erklärbares Misstrauen, da sich<br />
Dobrovský „in diesem Punkte ungewöhnlich reizbar und leidenschaftlich<br />
zeigte.“ (ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 171) 18 Per Zuschreibung persönlichen<br />
Fehlverhaltens, eine Diskreditierung ad personam, sollte Dobrovskýs<br />
kritische Kompetenz 19 sowie seine wissenschaftliche Redlichkeit erschüttert<br />
werden:<br />
Dass er den damals noch sehr jungen, durch einige poetische Arbeiten von mittelmässigem<br />
Werth bekannten, übrigens durch keine gründliche philologische Bildung ausgezeichneten, im<br />
J. 1834 verstorbenen J. Linda, dass er ferner den, damals kaum noch 26 Jahre alten, der Dichtkunst<br />
und slawischen Sprachkunde zugewandten Hrn. W. Hanka, seinen eigenen dankbaren<br />
Schüler, für fähig hielt, die Rolle ‚eines dichtenden Spassvogels‘ zu spielen, ist leichter zu<br />
begreifen und vielleicht auch zu entschuldigen; dass er aber in diesen unseligen Streit auch J.<br />
Jungmann hineinmischte und diesem, einem bereits damals bejahrten Mann, lediglich deshalb,<br />
weil er das verkannte Fragment in Schutz nahm, einen so ungleichen und unnatürlichen Bund<br />
zu einem Schelmenstreich zumuthete – das mag Gott D. verzeihen! (ŠAFAŘÍK/PALACKÝ<br />
1840:192f.)<br />
In der Argumentation wird versucht, die Leser auf das Deutungsmuster<br />
‚Gemütskrankheit‘ festzulegen. Per (laien)-medizinischer Indikation werden<br />
die Assertionen ‚Befangenheit‘ bzw. ‚Depression und Altersstarrsinn‘ gestützt.<br />
20 Kontrastiert wird die Abwertung Dobrovskýs mit einer positiven<br />
16 Als ein Beispiel sei hier die Reaktion Šafaříks im Brief an Jan Kollár vom 4.12.1828<br />
angeführt: „Dieser Mensch [Dobrovský, S.H.] schämt sich nicht, Diener und Fronarbeiter<br />
der rasenden Deutschen zu sein! Er ist mir Engel und Teufel in einer Person.“ (zit. n.<br />
PLASCHKA 1955: 48)<br />
17 „[...] dass unseres Bedünkens die Kritik [...] gerade die schwächste Seite seiner Leistungen<br />
bildet.“ (ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 194)<br />
18 „Im Sommer 1828 verfiel er aber bekanntlich in seine periodische Gemüthskrankeit,<br />
von welcher er bis zu seinem am 6 Januar 1829 erfolgten Tode nicht mehr ganz erwachte.“<br />
(ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 173)<br />
19 „Jener erschrack über eine Erscheinung, die er nicht begriff, und die viele seiner philologischen<br />
wie historischen Lieblingsansichten umzuwerfen drohte. Doch war er ein Ehrenmann,<br />
der keine Nebenzwecke verfolgte, und daher bei längerem Leben und weiter<br />
fortgeschrittener Wissenschaft ohne allen Zweifel sich mit der Zeit eines Besseren besonnen<br />
und der Erkenntnis der Wahrheit geöffnet hätte.“ (PALACKÝ 1874a: 217) Ähnlich<br />
auch das Urteil in der Biographie (siehe PALACKÝ 1833).<br />
20 „Wer übrigens mit des originellen Mannes Individualität, mit seinen Ansichten über das<br />
slawische Alterthum, mit seiner Unkenntniss der alten und neueren slawischen Volkspoesie,<br />
so wie mit den Verhältnissen, in denen er lebte, und besonders mit seiner periodischen<br />
Gemüthskrankheit näher bekannt ist, der wird es leicht begreiflich finden, wie<br />
es kam, dass ein Gelehrter und Kritiker von seinem Range, nachdem er einmal den falschen<br />
Tritt gethan (bekanntlich hatte er das Fragment, noch bevor er es gesehen, für unecht<br />
erklärt, als er hörte, dass darin der Schaaren ‚Čechs‘ erwähnt wird) und auf der<br />
Streitbahn so weit vorgeschritten war, lieber zu den verzweifeltsten Mitteln der Skepsis<br />
127
128<br />
Steffen Höhne<br />
Selbstdarstellung der Apologeten, wenn z. B. Šafařík und Palacký das loyale<br />
Verhalten Hankas gegenüber Dobrovský und seinen Verdiensten hervorheben:<br />
Herr Hanka, der sich stets als Dobrowský’s dankbarer Schüler schrieb und bewies, verschloss<br />
dem zu Folge das unglückselige Fragment, und wollte es seitdem auch uns nicht mehr sehen<br />
lassen. Er suchte jede Kränkung das alten hochverdienten Mannes zu vermeiden, [...].<br />
(ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 172)<br />
Man konstatiert also auf der einen Seite voreilige Kritik nebst Unfähigkeit<br />
zur Selbstkorrektur, auf der anderen ein präzises und seriöses philologisches<br />
Bemühen, schließlich gelang es Hanka (neben Jungmann) laut Šafařík und<br />
Palacký erst nach langen Studien, die richtige Anordnung in die Spalten des<br />
Manuskriptes zu bringen! Allerdings offenbaren Palacký und Šafařík unwillkürlich<br />
ihre eigene Befangenheit, zum einen wird die Stilisierung jenes<br />
anonymen Briefes hervorgehoben, der der eingesandten Grünberger Handschrift<br />
beigefügt wurde, zum anderen wird gerade dieser Brief als Quelle<br />
einer Charakterstudie genutzt, um nachzuweisen, dass der Einsender aufgrund<br />
fehlender sprachlich-stilistischer Kompetenz kein Fälscher sein könne:<br />
Ein eifriger Patriot, dazu Bücherfreund und selbst Schriftsteller, war er doch weder der böhmischen,<br />
noch der deutschen Sprache vollkommen mächtig, und jedes ächtwissenschaftlichen<br />
Geistes bar und ledig. Das Scheltwort ‚deutscher Michel‘ haben wir in ganz Böhmen nicht zu<br />
hören bekommen, ausser aus seinem Munde. (ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 176) 21<br />
Konsequenterweise wird eine ‚unrichtige‘ Entzifferung Hankas im Manuskript<br />
als ein weiterer Beweis für dessen Unschuld herangezogen:<br />
Ist es nun glaublich, dass die wahren und wirklichen Verfasser ihre eigene Arbeit an den angeführten<br />
Stellen so unrichtig und abweichend vom Original gelesen haben würden?<br />
(ŠAFAŘÍK/PALACKÝ 1840: 193)<br />
Dabei geht es Palacký und auch Šafařík weniger um eine Diskreditierung<br />
Dobrovskýs als vielmehr um ein Verfahren der Dichotomisierung des na-<br />
und Sophistik greifen, als seinen Fehler eingestehen wollte.“ (ŠAFAŘÍK/PALACKÝ<br />
1840: 194)<br />
21 Dabei ist das Ethnonym ‚Michel‘ im deutschen Sprachraum eine durchaus gängige<br />
Bezeichnung in dieser Zeit. Nach HAUFFEN (1918: 53–60) geriet der Topos vom deutschen<br />
Michel zwischen 1815 und 1848 zum Pars-pro-toto des deutschen Kleinbürgers.<br />
„Erst nach der dumpfen Zeit der Enttäuschung und Entsagung [...], erst um 1840, wo die<br />
Verfolgung des Zieles, einer noch unklaren Sehnsucht nach einem freien und mächtigen<br />
deutschen Reich immer mächtiger wurde, erhoben sich zahlreiche Stimmen, besonders<br />
in Gedichten, welche die unendliche Geduld, die Ängstlichkeit und Unentschlossenheit<br />
der überwiegenden Mehrheit beklagten und geißelten. Die Schwäche der Deutschen, ihre<br />
träumerische und weltunläufige Art, die mit Unklugheit gepaarte übergroße Gutmütigkeit,<br />
die den Ausländern besonders auffiel, alle diese Übel wurden nun dem deutschen<br />
Michel aufgepackt, [...].“ (HAUFFEN 1918: 92f.) Siehe ferner RIHA (1991).<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
tionalen Codes: Neben die mit wissenschaftlichem Anspruch vorgebrachte<br />
Apologie der Handschriften tritt eine politisch-nationalistische Instrumentalisierung<br />
durch die Kritik. Die Handschriften gelten in der Lesart der Apologeten<br />
als besonders wertvoll und für die Mitglieder der entstehenden<br />
tschechischen Nationalkultur als wirklichkeitskonstitutiv, schon deshalb<br />
können sie nicht als ‚gefälscht‘ angesehen werden. Darüber hinaus setzen<br />
sie Maßstäbe auch für künftige Generationen, zu Ihrer Legitimierung werden<br />
Mythen über ihre Entstehung verwendet.<br />
Nicht zuletzt die emotionale Härte des Handschriftenstreites zeigt die Bedeutung,<br />
die die Falsifikate für die Herausbildung einer tschechischen Identität<br />
besessen haben und wie konstruktiv und wichtig die spätere Kritik<br />
durch Masaryk, Gebauer, Goll und andere war, ohne dass es ihnen zunächst<br />
gelungen wäre, die Öffentlichkeit von ihrer Position zu überzeugen oder gar<br />
das Fortleben des Handschriften-Mythos beenden zu können. Die Tatsache,<br />
dass der Mythos der Handschriften in die tschechische Kultur und Literatur<br />
inkorporiert wurde, garantierte ihre weitere Rezeption. Einmal mehr zeigt<br />
sich an ihrem Beispiel, dass Traditionen, auch wenn sie auf nichts anderem<br />
als Erfindungen beruhen sollten, dennoch zu realen Größen und damit zu<br />
geschichtswirksamen Faktoren avancieren können. Die Aggressivität, mit<br />
der die Echtheit verteidigt wurde, kann wohl nur mit der Bedeutung erklärt<br />
werden, die Mythen im Hinblick auf die Integration insbesondere bedrohter<br />
Kollektive einnehmen.<br />
Die mythische Erzählung erlaubt es, auch dann noch die Vorstellung einer<br />
übergreifenden und umfassenden Einheit zu erzeugen, wenn sich überkommene<br />
strukturelle Grenzen innerhalb der Gesellschaft faktisch abschwächen,<br />
auflösen oder verschieben. Insofern liegt derartigen identifikatorischen<br />
Entwürfen eine Tendenz zugrunde, soziale, historische, sprachliche und<br />
ethnische Divergenzen innerhalb der eigenkategorisierten Gruppe zu vereinheitlichen.<br />
Die nationale Gruppe wird mit einem Geltungsanspruch auf<br />
Wahrheit als Einheit und Identität attribuiert. Literatur und Geschichtsschreibung<br />
können daher sowohl als kulturelle Selbstvergewisserung einer<br />
schon vorgängig existierenden sozialen Gruppe (= Nation) verstanden werden<br />
wie auch als ein Vorgang, in dem erst diese Identität behauptet, beschrieben<br />
und erschaffen wird.<br />
Literatur:<br />
BÄR, Jochen A. (2000): Nation und Sprache in der Sicht romantischer<br />
Schriftsteller und Sprachtheoretiker. – In: A. Gardt (Hg.): Nation und Sprache.<br />
Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Berlin,<br />
New York: de Gruyter, 199–228.<br />
129
130<br />
Steffen Höhne<br />
BERGER, Tilman (2000): Nation und Sprache: Das Tschechische und das<br />
Slowakische. – In: A. Gardt (Hg.), Nation und Sprache. Die Diskussion ihres<br />
Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart. Berlin, New York: de<br />
Gruyter, 825–864.<br />
BERGER, Tilman (2001): Konzeptionen der Hochsprache bei Tschechen<br />
und Slovaken und ihre praktische Relevanz. – In: K. Ehlich, J. Ossner, H.<br />
Stammerjohann (Hg.), Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft.<br />
Freiburg: Fillibach, 223–240.<br />
BOLZANO, Bernard (1810 [1850]): Über die Vaterlandsliebe. – In: Ders.,<br />
Erbauungsreden Bd. 2, Prag: Wenzel Heß, 145–156.<br />
BOLZANO, Bernard (1816/1849): Über das Verhältnis der beiden Volksstämme<br />
in Böhmen. Drei Vorträge. Wien: Wilhelm Braumüller.<br />
BURGER, Hannelore (1998): Die Badenischen Sprachenverordnungen<br />
1897 – ein Modell für Europa 1997? – In: Die Sprachenfrage und ihre Lösung<br />
in den Böhmischen Ländern nach 1848 (= ACTA Universitatis Purkynianae,<br />
35). Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských studií, 201–<br />
214.<br />
BURGER, Hannelore/WOHNOUT, Helmut (1995): Eine ‚polnische Schufterei‘?<br />
Die Badenischen Sprachenverordnungen für Böhmen und Mähren<br />
1897. – In: M. Gehler, H. Sickinger (Hg.), Politische Affären und Skandale<br />
in Österreich. Von Mayerling bis Waldheim. Thaur, Wien, München: Kulturverlag,<br />
79–98.<br />
DRABEK, Anna (1996): Die Frage der Unterrichtssprache im Königreich<br />
Böhmen im Zeitalter der Aufklärung. – In: Österreichische Osthefte, 329–<br />
355.<br />
DREWS, Peter (1990): Herder und die Slawen. Materialien zur Wirkungsgeschichte<br />
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. München: Sagner.<br />
FICHTE, Johann Gottlieb (1978 [1807/08]): Reden an die deutsche<br />
Nation. 5. Aufl. Hamburg: Felix Meiner.<br />
FISCHEL, Alfred (1910): Das österreichische Sprachenrecht. Eine Quellensammlung.<br />
Brünn: Friedrich Irrgang.<br />
GARDT, Andreas (Hg.) (1999): Sprachpatriotismus und Sprachnationalismus.<br />
Versuch einer historisch-systematischen Bestimmung am Beispiel des<br />
Deutschen. – In: Ders., U. Haß-Zumkehr, Th. Roelcke (Hg.), Sprachgeschichte<br />
als Kulturgeschichte. Berlin, New York: de Gruyter, 89–113.<br />
HAUFFEN, Adolf (1918): Geschichte des deutschen Michel. Prag: Verein<br />
zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
HEMMERLE, Josef (1962): Die tschechische Wiedergeburt und die Fälschungen<br />
nationaler Sprachdenkmäler. – In: Stifter Jahrbuch 7. München:<br />
Adalbert Stifter Verein.<br />
HERMANNS, Fritz (1995): Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte.<br />
Überlegungen zu Sinn und Form und Gegenstand historischer Semantik. –<br />
In: A. Gardt, K. Mattheier, O. Reichmann (Hg.), Sprachgeschichte des<br />
Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien (= RGG 156). Tübingen:<br />
Niemeyer, 69–101.<br />
HÖNSCH, Jochen (1992): Geschichte Böhmens. München: Beck.<br />
HROCH, Miroslav (1999): Na prahu národního obrozeni [An der Schwelle<br />
der nationalen Wiedergeburt]. Praha: Mladá fronta.<br />
HUMBOLDT, Wilhelm von (1973): Über die Verschiedenheit des menschlichen<br />
Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts<br />
(= Einleitung zum Kawi-Werk). – In: Ders., Schriften zur<br />
Sprache. Stuttgart: Reclam, 30–207<br />
KABEN, Gisela (2003): Rukopis královédvorský a zelenohorský – Umfeld<br />
der Entstehung und Rezeption zweier gefälschter Handschriften. – In: brükken<br />
NF 9–10. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 27–39.<br />
LEEUVEN-TURNOVCOVÁ, Jiřina van (2001): Nochmals zur Diglossie in<br />
Böhmen – diesmal auch aus der Gender-Perspektive. – In: Zeitschrift für<br />
Slawistik 46, 251–280.<br />
LUFT, Robert (1995): Die deutschliberale Volksbildung in Böhmen im 19.<br />
und 20. Jahrhundert. – In: Germanoslavica II (VII)/2, 225–239.<br />
MACKOVÁ, Marie (1998): Die Badenischen Sprachenverordnungen und<br />
ihre Auswirkung im Leben der Bezirksstadt Landskron. – In: Die Sprachenfrage<br />
und ihre Lösung in den Böhmischen Ländern nach 1848 (= ACTA<br />
Universitatis Purkynianae 35). Ústí nad Labem: Ústav slovanskogermánských<br />
studií, 135–142.<br />
MACURA, Vladimír (1995): Znamení zrodu. České národní obrození jako<br />
kulturní typ [Zeichen der Geburt. Die tschechische nationale Wiedergeburt<br />
als kultureller Typus]. Prag: H&H.<br />
MATTHEIER, Klaus (1998): Kommunikationsgeschichte des 19. Jahrhunderts.<br />
Überlegungen zum Forschungsstand und zu den Perspektiven der<br />
Forschungsentwicklung. – In: D. Cherubim, S. Grosse, Ders. (Hg.), Sprache<br />
und bürgerliche Nation. Beiträge zur deutschen und europäischen Sprachgeschichte<br />
des 19. Jahrhunderts. Berlin, New York: de Gruyter, 1–45.<br />
131
132<br />
Steffen Höhne<br />
MIKUŠEK Eduard (1998): Der ‚Bänkelsang‘ über die Badenikrise nach den<br />
Obstruktionskarten aus der Leitmeritzer Sammlung. – In: Die Sprachenfrage<br />
und ihre Lösung in den Böhmischen Ländern nach 1848 (= ACTA Universitatis<br />
Purkynianae, 35). Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských<br />
studií, 143–165.<br />
PALACKÝ, František (1833): Joseph Dobrovskýs Leben und gelehrtes<br />
Wirken. Prag: Gottlieb Haase.<br />
PALACKÝ, František (1871a): Anfänge der böhmischen Geschichtsschreibung<br />
der Neuzeit. – In: Ders., Zur Böhmischen Geschichtsschreibung. Actenmässige<br />
Aufschlüsse und Worte der Abwehr. Prag: Tempsky, 1–13.<br />
PALACKÝ, František (1871b): Meine Bericht an den ständischen Landesausschuss<br />
1831–1836. – In: Ders., Zur Böhmischen Geschichtsschreibung.<br />
Actenmässige Aufschlüsse und Worte der Abwehr. Prag: Tempsky,<br />
49–72.<br />
PALACKÝ, František (1871c): Weitere Acten aus den Jahren 1850–1862. –<br />
In: Ders., Zur Böhmischen Geschichtsschreibung. Actenmässige Aufschlüsse<br />
und Worte der Abwehr. Prag: Tempsky, 121–144.<br />
PALACKÝ, František (1874a): Handschriftliche Lügen und palöologische<br />
Wahrheiten. – In: Ders., Gedenkblätter. Auswahl von Denkschriften, Aufsätzen<br />
und Briefen aus den letzten 50 Jahren. Als Beitrag zur Zeitgeschichte.<br />
Prag: Tempsky, 215–231.<br />
PALACKÝ, František (1874b): Die altböhmischen Handschriften und ihre<br />
Kritik. – In: Ders., Gedenkblätter. Auswahl von Denkschriften, Aufsätzen<br />
und Briefen aus den letzten 50 Jahren. Als Beitrag zur Zeitgeschichte. Prag:<br />
Tempsky, 231–259.<br />
PLANERT, Ute (2002): Wann beginnt der ,moderne‘ deutsche Nationalismus?<br />
Plädoyer für eine nationale Sattelzeit. – In: J. Echternkamp, S. Müller<br />
(Hg.), Die Politik der Nation. Deutscher Nationalismus in Krieg und Krisen<br />
1760–1960 (= Beiträge zur Militärgeschichte 56). München: Oldenbourg,<br />
25–59.<br />
PLASCHKA, Richard Georg (1955): Von Palacký bis Pekař. Geschichtsbewußtsein<br />
und Nationalbewußtsein bei den Tschechen (= Wiener Archiv<br />
für Geschichte des Slaventums und Osteuropas 1). Graz, Köln: Böhlau.<br />
POVEJŠIL, Jaromir (1996): Bemerkungen zu Herders Darstellung der Slawen.<br />
– In: Germanoslavica III/1. Prag, 139–141.<br />
POLENZ, Peter v. (1998): Zwischen ‚Staatsnation‘ und ‚Kulturnation‘.<br />
Deutsche Begriffsbesetzungen um 1800. – In: D. Cherubim, S. Grosse, K.<br />
Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache …<br />
Mattheier (Hg.), Sprache und bürgerliche Nation. Beiträge zur deutschen<br />
und europäischen Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin, New<br />
York: de Gruyter, 55–70.<br />
PURKYNĚ, Jan Evanglista (2002): Austria Polyglotta. – In: Tschechische<br />
Philosophen von Hus bis Masaryk. Hrsg. von L. Hagedorn. Stuttgart, München:<br />
DVA, 309–368.<br />
RIHA, Karl (1991): Deutscher Michel. Zur literarischen und karikaturistischen<br />
Ausprägung einer nationalen Allegorie im neunzehnten Jahrhundert.<br />
– In: J. Link, W. Wülfing (Hgg.), Nationale Mythen und Symbole in der<br />
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten<br />
nationaler Identität. Stuttgart: Klett-Cotta, 146–171.<br />
ŠAFAŘÍK, Pavel Josef/PALACKÝ, František (1840): Die ältesten Denkmäler<br />
der böhmischen Sprache. Libusa’s Gericht, Evangelium Johannis,<br />
der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater Verborum. Prag: Kronberger.<br />
SCHAMSCHULA, Walter (1990): Geschichte der tschechischen Literatur<br />
I. Von den Anfängen bis zur Aufklärungszeit. Köln, Wien: Böhlau.<br />
SUNDHAUßEN, Holm (1973): Der Einfluß der Herderschen Ideen auf die<br />
Nationsbildung bei den Völkern der Habsburger Monarchie. München: Oldenbourg.<br />
SVOBODA, Václav (1829): – In: MUSEUMSZEITSCHRIFT Prag, XII.<br />
TRABANT, Jürgen (1990): Traditionen Humboldts. Frankfurt/Main: Suhrkamp.<br />
THUN-HOHENSTEIN, Joseph Mathias Graf (1845): Der Slavismus in<br />
Böhmen. Prag: Calve.<br />
WEHLER, Hans-Ulrich (Hg.) (2001): Nationalismus. Geschichte, Formen,<br />
Folgen. München: Beck.<br />
WIESINGER, Peter (2000): Nation und Sprache in Österreich. – In: A.<br />
Gardt (Hg.), Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte<br />
und Gegenwart. Berlin, New York: de Gruyter, 525–562.<br />
ZAORAL, Roman (1995): Die tschechischen und deutschen Schulvereine<br />
in Böhmen am Ende des 19. Jahrhunderts. – In: Germanoslavica II (VII)/1,<br />
107–115.<br />
133
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler In den Kaiserl.<br />
Königl. Erblanden“ von 1772<br />
Michael Wögerbauer<br />
1. Einleitung 1<br />
Die Entwicklung des Buchhandelsstandes begann in Böhmen erst gegen Ende der Regierung<br />
Maria Theresias, als 1772 eine Buchhandels-Ordnung erlassen wurde, mit welcher die Grundlagen<br />
für die Entwicklung des Buchhandels und des Verlagswesens überhaupt geschaffen wurden.<br />
Vor diesem Jahre können wir nicht von einem Buchhandelsstand in Böhmen sprechen,<br />
denn die Buchhändler waren bis zu dieser Zeit ein Teil der allgemeinen Händlerschaft. (VOLF<br />
1930: 3) 2<br />
Josef Volfs Feststellung ist bezeichnend: Sie konstatiert für ein Kronland<br />
der K. K. Monarchie, was für den gesamten Vielvölkerstaat gilt. Noch deutlicher<br />
ist diese Verengung der Perspektive in György Kókays Geschichte<br />
des Buchhandels in Ungarn; in seiner Charakteristik der Ordo pro bibliopolis<br />
in Hungaria stabiliter manentibus erkennt man unschwer die Grundzüge<br />
der Maria Theresianischen Buchhändler-Ordnung wieder; 3 doch dieser Zusammenhang<br />
und mögliche Unterschiede zwischen der erbländischen 4 und<br />
1 Ich danke Prof. Dr. Peter R. Frank (Heidelberg) für wertvolle Anmerkungen und Hinweise.<br />
Frau Margarita Pertlwieser (Linz) danke ich für das Überlassen des in Anm. 65<br />
zitierten Dokuments aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv (OÖLA) recht herzlich.<br />
2 Die Zitate aus der tschechischprachigen Sekundärliteratur wurden vom Autor übersetzt.<br />
Sämtliche Archivalien wurden diplomatisch, d. h. möglichst buchstabengetreu, wiedergegeben.<br />
Allfällige Anpassungen an die moderne Grammatik und Auflösungen von Abkürzungen<br />
erfolgten allenfalls in eckigen Klammern „[ ]“, um das Textverständnis zu<br />
erleichtern.<br />
3 „Infolge des Aufschwungs, den der Buchhandel in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts<br />
erlebte, wurden mehrere Verfügungen erlassen, die sich mit einzelnen Fragen<br />
des Buchhandels in Ungarn befaßten. Die wichtigste erschien 1772 und enthielt die Bedingungen,<br />
an welche die Tätigkeit der Buchhändler in Ungarn geknüpft war (Ordo pro<br />
bibliopolis in Hungaria stabiliter manentibus). Nach dieser Verordnung wird die Ausübung<br />
des Berufes an sechs Jahre Lehrzeit, vier Jahre Praxis und entsprechende Sprachkenntnisse<br />
sowie an ein gewisses Kapital gebunden.“ (KÓKAY 1990: 89)<br />
4 Um 1770 unterstanden die „K. K. deutschen Erblande“ der 1762 geschaffenen „vereinigten<br />
böhmisch-österreichischen Hofkanzlei“. Unter diesem Titel waren die Länder des<br />
heutigen Österreich, Böhmen, Mähren und Schlesien und Vorderösterreich (neben Tirol<br />
und Vorarlberg auch Freiburg im Breisgau u. a.) sowie Galizien zusammengefasst. Davon<br />
sind die von der ungarischen Hofkammer verwalteten Länder (Ungarn samt Oberungarn/Slowakei<br />
und die Besitzungen auf dem Balkan) und die siebenbürgische Hofkammer<br />
zu unterscheiden.
136<br />
Michael Wögerbauer<br />
der ungarischen Fassung werden mit keinem Wort erwähnt. 5 Umgekehrt gilt<br />
Ähnliches für die meisten Darstellungen, die der deutschen Kultur der<br />
Monarchie gewidmet sind – die (Sprach-)Nation kommt meist vor dem<br />
Staat. 6<br />
Die Erforschung der Maria-Theresianischen Ordnung für die Buchhändler<br />
in den Kaiserl. Königl. Erblanden 7 ist ein gutes Beispiel für dieses Problem<br />
der modernen nationalen Philologien: Der Vielvölkerstaat – wie die Regierung<br />
ihn wahrnahm – übersteigt sie sprachlich, ideologisch und methodisch.<br />
8 Durch ihren Isolationismus sind sie weitgehend unfähig, Parallelentwicklungen<br />
zu erkennen und wissenschaftliche Synergien zu nutzen.<br />
Würden die nationalen Philologien um „komparatistische“ Methoden erweitert,<br />
9 so würden sie viel von ihrer ideologischen Funktionalität (Stiftung von<br />
nationaler Identität, kulturellem Kanon, etc.) verlieren. Für die Zeit des „europäischen<br />
Wiedererwachens“ (VLČEK 1940: 138) ist die Unfähigkeit der<br />
5 Zur Adaptierung der Ordnung für die Buchhändler In den Kaiserl. Königl. Erblanden<br />
für Ungarn, Siebenbürgen und den Banat vgl. unten S. 156.<br />
6 Natürlich gibt es – gerade in neuerer Zeit – auch wichtige Ausnahmen. Stellvertretend<br />
für diese sei Zdeněk Šimečeks Feststellung zitiert, dass „die Forschung in der Sphäre<br />
der Kommunikation und des Buchhandels in der Hauptstadt des böhmischen Königreichs<br />
eine Frage ist, die kompliziert wird durch die Stellung des Landes in der österreichischen<br />
Monarchie, der Beziehung zum Buchhandelszentrum Leipzig, durch die kulturelle<br />
und literarische Situation, die einerseits von einer lateinischen Literatur mit<br />
universell europäischem Anspruch geprägt war, andererseits aber auch durch die sich<br />
nebeneinander entwickelnde deutsche und tschechische Nationalliteratur mit ihren<br />
wechselhaften Beziehungen [...]“ (ŠIMEČEK 1990: 315).<br />
7 So der exakte Titel der Druckfassung, die im OÖLA erhalten ist (Landschaftsakten,<br />
G.I.11., Sch. 685. im Extract deren von der K. K. Landeshauptmannschaft [...] von 1.<br />
Jenner 1770 bis letzten Junii 1772 [...] hinaus gegebenen [...] Patenten und Circular-<br />
Befehlen). Ediert wurde die Buchhändlerordnung u. a. 1899 von Carl Junker, wieder abgedruckt<br />
in JUNKER (2001: 89–91); GIESE (1961: 1183–1186); WIDMANN (1965/II:<br />
74–76). Der Originaltext erschien gedruckt und findet sich noch in zahlreichen Archiven,<br />
so dass nach GIESE (1961: 1118), das „Original“ im ILA, Akten der Studien- und<br />
Zensurkommission, 1761–1776, Fasc. 1; die Endfassung im Manuskript im HKA zu<br />
finden ist, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), fol. 155–164.<br />
8 Die Ideologie des Nationalstaats beruht ebenso auf sprachlicher Einheit wie die Methode<br />
der Nationalphilologie. Beide haben ein vitales Interesse daran, diese Identität zu erhalten<br />
und sich somit aus der Vergangenheit zu begründen. Ignoriert wird dabei weitgehend<br />
a) ob sprachlicher Nationalismus in der gegebenen Zeit eine gesellschaftlich<br />
relevante Rolle gespielt hat und b) ob nicht – etwa staatliche – Rahmenbedingungen gegeben<br />
waren, die notwendigerweise zu parallelen Entwicklungen führen.<br />
9 „Komparatistisch“, ohne tatsächlich etwas vergleichen zu müssen. Es wäre lediglich der<br />
historische Zusammenhang ernst zu nehmen. Einen ersten Ansatz zur Überwindung des<br />
„romantischen Nationalismus“ (Eduard Winter) bzw. der Staatsgrenzen nach 1918 bildet<br />
ein Projekt von Peter R. Frank, in dessen Rahmen eine Topographie aller Buchdrukker,<br />
Buchhändler, Verleger und sonst am Buchwesen Beteiligten erstellt werden soll<br />
(FRANK <strong>2004</strong>).<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
nationalen Philologien zu konstatieren, den Grundzug einer aufgeklärtabsolutistisch<br />
„gelenkten Literatur“ (BODI 1994: 17) als Gemeinsamkeit<br />
aller volkssprachlichen Literaturen der Monarchie 10 zu untersuchen, die die<br />
feudale und klerikale Schriftkultur gegen Ende des 18. Jahrhunderts ablösen.<br />
11<br />
Analysiert man die Genese der Buchhändlerordnung und die Diskussionen<br />
um ihre Endfassung, so wird schnell deutlich, dass die K. K. Verwaltung<br />
weit davon entfernt war, „Literatur“ als jenes ästhetische oder sprachlichnationale<br />
Gebilde zu betrachten, als das sie seit dem 19. Jahrhundert verstanden<br />
wird. Die staatliche Regulierung und Förderung galt vielmehr dem<br />
gesamten Sozialsystem Literatur (S. J. Schmidt) 12 als Subsystem eines angestrebten,<br />
zentral gesteuerten „Universalkommerzes“. Das übergeordnete<br />
Ziel war die „Bildung eines einheitlichen Wirtschaftskörpers aus all den<br />
verschiedenen Teilen der habsburgischen Monarchie, die systematische<br />
Vereinigung der Erbländer durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen“<br />
(PŘIBRAM 1907: 3). Wie konsequent Maria Theresia die Einheit der Erblande<br />
verfolgte, ist beeindruckend: Erst 1761 wurde die gemeinsame böhmisch-österreichische<br />
Hofkammer geschaffen, 1775 schon fielen die Zollschranken.<br />
Für das Schulsystem und die 1775 in Wien und Prag<br />
gegründeten „Normalschul-Buchdruckereien“ gilt Ähnliches. Die ungarische<br />
Reichshälfte freilich blieb bei diesen Integrationsversuchen weitgehend<br />
extra muros.<br />
10 Also z. B. die auf Ungarisch, Deutsch, Jiddisch sowie die in slawischen Sprachen verfassten<br />
Literaturen.<br />
11 Abgesehen von positivistischen, liberal geprägten Literarhistorikern wie Arnošt Kraus<br />
oder Jaroslav Vlček (die aus methodischen Gründen andere Interessen haben), scheint<br />
mir, dass manche der mitteleuropäischen Komparatisten diesen Weg am konsequentesten<br />
gegangen sind, die um 1970 an den „Colloques de Matrafűred“ zum Thema „Les<br />
Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale“ beteiligten (so z. B.<br />
Karol Rosenbaum, László Sziklay, István Fried etc.). Hierbei lag freilich ein Schwerpunkt<br />
auf den slawisch-ungarischen Beziehungen und auch hier wurden staatlicher Dirigismus<br />
und Aufklärung von oben kaum thematisiert, die die Entwicklung unter Maria<br />
Theresia und Joseph II. wesentlich mitgeprägt haben.<br />
12 S. J. Schmidt unterscheidet „Handlungsrollen“, d. h. das Produzieren, Vermitteln (auch<br />
die Hemmung des Vermittelns, das Zensieren gehört hierher), Rezipieren und Verarbeiten<br />
(Rezensieren) von Literatur. (SCHMIDT 1989: 320ff.) Während die Rolle des Rezensenten<br />
neu entsteht, wandeln sich die Tätigkeitsprofile von Autor, Leser, Herausgeber,<br />
Verleger, Buchhändler, Buchdrucker, etc. in der zweiten Hälfte des 18.<br />
Jahrhunderts radikal; dabei kommt es vor allem zu einer Spezialisierung der einzelnen<br />
Handlungsrollen, die von Schmidt systemtheoretisch als (Aus-) Differenzierung beschrieben<br />
wird – was mit Josef Volfs eingangs zitierter Feststellung übereinstimmt, der<br />
Buchhandel habe sich um 1772 aus dem allgemeinen Handel heraus entwickelt. Die<br />
gewerbespezifischen Ordnungen sind daher wesentliche Schritte in diesem Prozess der<br />
Ausdifferenzierung.<br />
137
138<br />
Michael Wögerbauer<br />
Die Herausbildung des Sozialsystems Literatur ist – für alle volkssprachlichen<br />
Literaturen der Monarchie – in den breiteren Kontext der absolutistischen<br />
Reformen zwischen 1740 und 1792 zu stellen, 13 die vor allem nach<br />
dem siebenjährigen Krieg auch literarisch relevante Bereiche berühren: So<br />
wurden ab den 1760er Jahren auf den Universitäten Lehrstühle für Ästhetik<br />
und Poetik eingerichtet 14 und über längere Zeit das gesamte Bildungssystem<br />
auf die neuen Bedürfnisse des Staates hin optimiert und ausgebaut, um<br />
vor allem fähige Beamte heranzubilden und praktisches Wissen zu verbreiten.<br />
15 1764 wurde erstmals die Honorierung gelehrter Autoren vorgeschrieben<br />
(LAVANDIER 1993: 88), der „Reorganisation der Gewerbebehörden<br />
von 1762 folgte 1763/64 eine umfangreiche Neuordnung der Grundlagen<br />
der Handelspolitik“ (CHALOUPEK 1991: 53); was das Buchwesen betrifft,<br />
so wurde im Juni 1771 eine allgemein gültige Ordnung für Buchdruckergesellen<br />
und -jungen verfasst, 16 und schließlich 1772 der Buchhandel – wie<br />
andere Gewerbe auch – inventarisiert 17 und neu geregelt. Der legislative<br />
Rahmen steht dabei in Wechselwirkung mit der raschen Entwicklung der<br />
Praxis: Im Bereich der Literaturvermittlung steigen gleichzeitig Drucker-<br />
Verleger-Buchhändler wie Johann Thomas Edler von Trattner und Joseph<br />
Ritter von Kurzböck in Wien, Trassner in Brünn und Troppau sowie etwas<br />
später Ferdinand Edler von Schönfeld in Prag zu K. K. privilegierten Großunternehmern<br />
auf. Ihnen wird aufgrund ihrer Erfahrung und Stellung eine<br />
13 Explizit stellte diese Forderung für die tschechische Literaturgeschichte Jan JAKUBEC<br />
(1934: 3f.), wobei bei seiner geistesgeschichtlichen Auffassung allerdings die wirtschaftlichen<br />
Reformen – im Gegensatz zu den Reformen des Schulwesens – nirgendwo<br />
direkt in Bezug zur Literatur gebracht werden. Der Buchhandel spielt deswegen für Jakubec<br />
– wie auch die meisten anderen Literarhistoriker Böhmens – kaum eine Rolle.<br />
14 An der für die militärische Ausbildung zuständigen Wiener Neustädter Akademie wirkten<br />
schon in den 1750er Jahren der Gottsched-Schüler Johann Heinrich Justi als Lehrer<br />
der Kameralwissenschaften und des „reinen deutschen Stils“ und der Sprachpurist Johann<br />
Wenzel Pohl als Lehrer des Tschechischen; an den Universitäten fand diese Entwicklung<br />
später statt; so wirkte in Prag ab dem Wintersemester 1763/64 Karl Heinrich<br />
Seibt als außerordentlicher Professor für „schöne Wissenschaften“.<br />
15 „Die Zahl der Grundschulen stieg in Böhmen von 750 im Jahre 1700 auf 1.200 im Jahre<br />
1775 und 2.400 im Jahre 1792, was zur Stabilisierung der Druckereiunternehmen und<br />
der Ausweitung des Handels mit Büchern beitrug.“ (ŠIMEČEK 2002: 36)<br />
16 Ursula Giese nimmt an, „daß Trattner selbst maßgeblich an dem Entwurf zu dieser<br />
Ordnung beteiligt war.“ (GIESE 1961: 1118) Ob das in diesem Fall stimmt, soll hier<br />
nicht diskutiert werden; zu Gieses gleichlautenden Annahmen bezüglich der Buchhändlerordnung<br />
siehe unten.<br />
17 Zur Geschichte dieser sog. Conscription aller befugt- und unbefugten Buchführer von<br />
1772 und das Ergebnis für das Königreich Böhmen vgl. WÖGERBAUER (<strong>2004</strong>). Die<br />
Aufstellung aller Buchhändler in Niederösterreich (Österreich unter der Enns) wurde<br />
von FRIMMEL (2001) veröffentlicht.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
gewisse Einflussnahme auf die gesetzlichen Maßnahmen gewährt; gleichzeitig<br />
sind sie bemüht, in möglichst vielen habsburgischen Provinzen Niederlassungen<br />
zu errichten und so möglichst gesamtstaatliche Bedeutung zu<br />
erlangen – Trattner ließe sich mit über 34 Pressen in der gesamten Monarchie<br />
durchaus als Großunternehmer bezeichnen. In Wechselwirkung von<br />
staatlicher Regulierung und privater Initiative wurde „in Österreich in einem<br />
Zeitraum von knapp dreißig Jahren auch auf dem Gebiet der Literatur<br />
vieles von dem geleistet [...], was im protestantischen Deutschland eine<br />
Zeitdauer von etwa anderthalb Jahrhunderten benötigte. [...] Dies bezieht<br />
sich auch auf die Entwicklung der sprachlichen und stilistischen Ausdrucksmittel“<br />
(BODI 1995: 26) – ebenso wie auf das Buchwesen. Immerhin<br />
stieg Wien, das 1739 in der Buchproduktion noch einen mittleren Platz einnahm,<br />
zwischen 1765 und 1805 hinter Leipzig und Berlin auf Platz drei im<br />
Reich auf (KIESEL/MÜNCH 1977: 184f.). Prag war immerhin die für den<br />
Buchhandel zweitwichtigste Stadt der Monarchie und hatte außerdem durch<br />
seine Nähe zu Leipzig gewisse Vorteile.<br />
Um die Entstehung der Maria-Theresianischen Ordnung für die Buchhändler<br />
In den Kaiserl. Königl. Erblanden richtig einordnen zu können, ist es<br />
notwendig, den Buchhandel im gesamten Heiligen Römischen Reich zu<br />
betrachten: Einerseits befanden sich die großen Zentren des internationalen<br />
Buchhandels außerhalb der österreichischen Monarchie. 18 Gleich nach dem<br />
Ende des Siebenjährigen Krieges, durch den das protestantische Preußen seine<br />
Machtstellung im Reich gefestigt hatte, verließ der einflussreiche Großverleger<br />
und Buchhändler Philipp Emmanuel Reich 1764 die Buchmesse<br />
der Freien Reichsstadt Frankfurt und wechselte ins vom Krieg schwer getroffene<br />
Sachsen, genauer nach Leipzig (vgl. LEHMSTEDT 1989); andere<br />
folgten ihm. Das Zentrum des Buchhandels verlagerte sich in der Folge von<br />
Süddeutschland ins protestantische Mittel- und Norddeutschland; gleichzeitig<br />
gerieten die habsburgischen Verleger durch die von Reich geforderte<br />
Ablösung des Tauschhandels durch den Nettohandel in zunehmende Bedrängnis.<br />
19 Das führte dazu, dass die teuren norddeutschen Werke im Süden<br />
18 Für die deutschsprachigen Länder waren dies vor allem Leipzig, Berlin und Frankfurt,<br />
das allerdings an Bedeutung verlor. Überdies waren auch Amsterdam und Paris bedeutende<br />
europäischen Buchhandelszentren.<br />
19 Während es unter Buchhändlern noch zur Hälfte des 18. Jahrhunderts üblich war, ungebundene<br />
Bücher bogen- oder zentnerweise gegeneinander zu tauschen, ersetzten die<br />
norddeutschen, vor allem die sächsischen Buchhändler den Changehandel nun durch<br />
den Nettohandel, um nicht auf der eingetauschten Ware sitzen zu bleiben. Gleichzeitig<br />
wurde aber der Rabatt für ausländische Händler von 33 % bzw. 25 % auf 16 % abgesenkt,<br />
sodass sich die beschwerliche Anreise zur Leipziger Messe für viele nicht mehr<br />
lohnte (vgl. BACHLEITNER/EYBL/FISCHER 2000: 138f.). Bis 1784 war Wolfgang<br />
139
140<br />
Michael Wögerbauer<br />
immer öfter billiger nachgedruckt wurden. Das war zwar im Sinne Maria<br />
Theresias, war doch die heimische Literaturproduktion in beinahe allen<br />
Teilbereichen, quantitativ und qualitativ äußerst schwach. Deshalb sollte der<br />
Binnenhandel intensiviert und die Einfuhren beschränkt werden. Das Directorium<br />
in Publicis et Cameralibus 20 hatte schon in seinem Bericht vom 25.<br />
Oktober 1751 die schlechte Papierqualität und andere Hindernisse für das<br />
Buchwesen beklagt, doch auch den Mangel an „Scribenten“, worauf die niederösterreichische<br />
Landesregierung in ihrem Gegengutachten bei den Drukkern<br />
die „Unerfahrenheit dieser Leuthen“ angeführt hatte, „dass sie sich nicht<br />
auf den Nachdruck [...] verlegten.“ (BACHLEITNER/ EYBL/FISCHER<br />
2000: 106) Das war eine durchaus logische Konsequenz, da man mit Büchern<br />
handeln wollte, aber im Inland wichtige Voraussetzungen – wie z. B.<br />
Autoren – fehlten.<br />
Einige habsburgische Buchdrucker verlegten sich in der Folge auf den<br />
Nachdruck. Im Inland – mit seinem strukturschwachen Buchhandel und<br />
geringem Käuferpotential – blieben sie auf ihren Erzeugnissen sitzen; sie<br />
suchten also um das allerhöchste Privileg an, die von ihnen verlegten, billigen<br />
Nachdrucke auch mit dem Ausland tauschen zu dürfen – was wiederum<br />
den attraktiven Handel mit ausländischen Büchern innerhalb der Monarchie<br />
ermöglichte. So entstand ein großer Unternehmer wie Trattner – und sein<br />
schlechter Ruf als eines „Nachdruckerfürsten“ (WITTMANN 1991: 131).<br />
Auch die traditionsreiche Dynastie Gehlen erfuhr zu dieser Zeit eine Blüte,<br />
und Schönfeld betrieb noch Anfang des 19. Jahrhunderts am Prager Heuwaagplatz<br />
(Senovážné náměstí) eine Buchhandlung, in der angeblich nur<br />
Nachdrucke zum Verkauf angeboten wurden (VOLF 1921/22: 271). Wie<br />
wir weiter unten sehen werden, klagten jedoch auch habsburgische Drucker-<br />
Verleger über das Risiko, im Rest des Reichs nachgedruckt zu werden – ein<br />
Aspekt, der bisher von der Forschung ignoriert wurde. Die Regierung hatte<br />
jedenfalls gegen den Buchhandel mit dem Ausland so lange nichts einzuwenden,<br />
als der merkantilistische Grundsatz eingehalten wurde, gleich viele<br />
Gerle der einzige Prager Verleger, der die Leipziger Messe besuchte (WITTMANN<br />
1987: 15, VOLF 1930: 3f.).<br />
20 Das Directorium war 1749 als Teil der Haugwitzschen Verwaltungsreform gegründet<br />
worden, um die Stände zu entmachten und die Finanzverwaltung zu zentralisieren. Es<br />
sollte „in Wien die politische und finanzielle Verwaltung in einer Behörde“ zusammenfassen<br />
und „vereinte in sich die Österreichische und Böhmische Hofkanzlei, die für<br />
Österreich Finanzen zuständige Hofkammer, das Universal-Kommerziendirektorium,<br />
das General-Kriegskommissariat und die Deputation.“ (BUCHMANN 2002: 67). Das<br />
für Österreich und Ungarn zuständige Universal-Kommerziendirektorium, nach Buchmann<br />
„ein Vorgänger des Handelsministeriums“, wurde später in den „Kommerzienrat“<br />
umgewandelt, der in unserer Studie eine gewichtige Rolle spielt.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
Bücher außer Landes zu verkaufen bzw. zu tauschen wie einzuführen. 21<br />
Unter dieser Bedingung wurde dem Wiener Buchdrucker Kaliwoda noch<br />
am 23. Juni 1769 22 das Privileg zum Büchertausch mit dem Ausland verliehen.<br />
Als das Drängen in den Verlagsbuchhandel gegen Ende der 1760er<br />
Jahre immer größer wurde, musste eine gesetzliche Regulierung geschaffen<br />
werden.<br />
2. Die Genese der Buchhändler-Ordnung<br />
In einem für die Entstehung der Buchhändlerordnung zentralen Schreiben<br />
des Hofkommerzienrates 23 unter der Leitung Leopold Graf v. Kolowrats 24<br />
an Maria Theresia werden einleitend zwei Fälle erwähnt, die den unmittelbaren<br />
Anlass zu einer Neuregelung des Buchhandels gaben:<br />
Eure Majestät haben bey einer doppelten Gelegenheit den Beyfall gegeben, eine Ordnung für<br />
die Buchhändler in Allerhöchst Dero Erblanden zu entwerfen und allerunterthänigst vorzule-<br />
21 Der Merkantilismus gilt als das erste Wirtschaftssystem der Neuzeit und wurde in<br />
Deutschland in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem von Johann Joachim Becher,<br />
Philipp Wilhelm von Hörnigh und Wilhelm von Schröder verbreitet. In Österreich<br />
fand er allerdings erst unter Maria Theresia in Form der Kameralistik Anwendung. Ein<br />
wichtiger Eckpfeiler des Merkantilismus/Kameralwesens ist eine ausgeglichene oder<br />
positive Handelsbilanz. Gegenstand der Theorie sind laut J. H. G. von Justi Lehren,<br />
„wie das Vermögen des Staates entweder erhalten oder vermehret werden kann.“ Die<br />
Ansicht, die Glückseligkeit des Fürsten und der Untertanen seien voneinander abhängig,<br />
führte zur staatlichen Förderung von Gewerbe und Handel. Dabei wird die Entwicklung<br />
der inländischen Wirtschaft u. a. mit Einfuhrzöllen und -verboten vor der ausländischen<br />
Konkurrenz abgeschirmt. Vgl. MOERCHEL (1979: 4–9).<br />
22 Und zwar war es „dergestalt ertheilet worden, daß er eben so viele fremde Bücher an<br />
Gewicht herein führen darf, als er von eigenem Verlag hinaus führet.“ (HKA, NÖ<br />
Kommerz, 96 ex Aug 771, Protokollauszug des N.Ö. Commercien Consesses vom<br />
18.7.1771, fol. 96–98, hier fol. 97). Dieses unten editierte Dokument wird in der Folge<br />
als „Dokument A“ zitiert. Im Protokollauszug des Hofkommerzienrats an die Kaiserin<br />
vom 5.8.1771 (96 ex Aug 771, fol. 102) ist von „1768“ die Rede; es dürfte sich um das<br />
Jahr des Antrags handeln, wie auch BACHLEITNER/ EYBL/FISCHER (2000: 115),<br />
unter Berufung auf MAYER (1887/2: 27) schreiben. Dort heißt es nicht ganz präzise,<br />
Kaliwoda habe darum angesucht, „im Inland so viele Bücher verkaufen zu dürfen, als er<br />
aus eigener Produktion ins Ausland bringe.“ – Es kann wohl nur Einfuhr und Verkauf<br />
ausländischer Bücher im Inland gemeint sein.<br />
23 Der Consilius Commercialis Aulicus (gegründet als Nachfolger des „Universal-<br />
Kommerziendirektoriums“) war eine Art Wirtschaftsministerium und somit dem Niederösterreichischen<br />
oder allen anderen Kommerzienkonsessen übergeordnet. Der auch<br />
für Wien zuständige nö. Kommerzienkonsess erledigte aber, wie aus den unten zitierten<br />
Dokumenten hervorgeht, die eigentliche Arbeit bei Gesetzesentwürfen.<br />
24 Leopold Graf Kolowrat-Krakowsky (1727–1809), Staatsmann, stand 1772 gemeinsam<br />
mit Karl Friedrich Graf von Hatzfeld an der Spitze der Böhmisch-Österreichischen<br />
Hofkanzlei und des Kais. Königl. Hofkommerzienrats. Vgl. AMTSSCHEMATISMUS<br />
BÖHMEN (1772: 14 bzw. 18). Eigennamen werden in der Folge so geschrieben wie in<br />
zeitgenössischen amtlichen Dokumenten.<br />
141
142<br />
Michael Wögerbauer<br />
gen: die eine, da die dem Bianchi verliehene Freyheit, einige in die Oeconomie einschlagende<br />
Bücher zu verkaufen, wiederruffen wurde; und die andere, da der Buchdrucker Kurzböck um<br />
das Buchhandlungs-Recht anhielte. 25<br />
Zugespitzt könnte man formulieren: Die Buchhändlerordnung wurde in Reflexion<br />
und zur Lösung dieser beiden Ansuchen geschaffen. Zweiterer Fall,<br />
der Antrag des Buchdruckers Kurzböck, ist für unsere Darstellung wesentlich.<br />
Joseph Ritter von Kurzböck hatte studiert und 1755 die Universitätsbuchdruckerei<br />
seines Vaters übernommen (ZEMAN 1977: 107). Am 14.<br />
Februar 1770 stieg er zum privilegierten K. K. Illyrischen und Orientalischen<br />
Hofbuchdrucker auf (GAVRILOVIĆ 1974: 229), das heißt, dass beinahe<br />
alle kyrillischen Bücher, die ab diesem Zeitpunkt in den K. K. Erblanden<br />
gedruckt wurden, aus seiner Wiener Druckerei stammten. Aufgrund der<br />
schlechten sprachlichen Qualität der Bücher, zweier anderer, konfessionell<br />
gebundener Druckereien in Siebenbürgen 26 und der fehlenden buchhändlerischen<br />
Infrastruktur fanden allerdings viele seiner Bücher keinen Absatz<br />
und die Lager füllten sich. 27 Kurzböcks Bitte, Bücher auch mit dem Ausland<br />
tauschen zu dürfen, muss demnach im Zusammenhang mit allen seinen<br />
Tätigkeiten – seiner deutschsprachigen Buchproduktion – gesehen werden.<br />
Für sein Ansuchen fand er Fürsprecher in den Reihen der Verwaltung, vor<br />
allem beim Niederösterreichischen Kommerzienkonsess; das von dessen<br />
Vorsitzenden Locella 28 unterzeichnete Gutachten für Kurzböck 29 soll hier<br />
vollständig abgedruckt werden, weil es einen guten Überblick über die Pro-<br />
25 Fortan als „Dokument B“ zitierter, an die Kaiserin adressierter „Allerunterthänigste[r]<br />
Vortrag Des treu gehorsamsten Hof-Commercien-Rathes Womit die Buchhandlungs-<br />
Ordnung für sämtliche Kais. Königl. Erblande allerunterthänigst vorgeleget wird“ vom<br />
3. Februar 1772. HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 772, fol.<br />
126–128, unterzeichnet von L[eopold] G[raf] Kolowrat und T[haddäus] Fr[reiherr] Reischach,<br />
d.i. Judas Thaddäus Antonius Josephus Freiherr von Reischach (1728–1803),<br />
der nicht nur Kommerzienhofrat, sondern auch Merkantil des niederösterreichischen<br />
Kommerzienkonsesses und Wechselappellations-Präses war, also im Handelswesen der<br />
Monarchie eine bedeutende Stellung inne hatte (vgl. K. u. K. STAATSKALENDER<br />
1772). Das Konzept dieses Dokuments („Unterthänigster Vortrag des Kommerzienrathes“,<br />
ebd., fol. 121–124) ist ebenfalls mit 3.2.1772 datiert.<br />
26 Außer Kurzböck druckten noch eine orthodoxe Druckerei in Hermannstadt und eine<br />
unierte Druckerei in Blaj vor allem kyrillische Gebet- und Schulbücher (vgl.<br />
GAVRILOVIĆ 1974: 230).<br />
27 GAVRILOVIĆ (1974: 230), gibt an, dass Kurzböck insgesamt 151 Bücher in kyrillischen<br />
Lettern gedruckt habe.<br />
28 „Aloysius Freyherr von Locella, Ihro K. K. Ap. Maj. würklicher Commercien-Rath, log.<br />
in der Schulerstraß, in der weissen Rosen.“ Vgl. Abschnitt zum K. K. Nieder-Österr.<br />
Kommerzienkonsessus in: K. u. K. STAATSKALENDER (1772: 137)<br />
29 Dokument A.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
blembereiche und historischen Entwicklungen des habsburgischen Buchhandels<br />
in den 1760er Jahren gibt.<br />
Allerdurchlauchtigste,<br />
In der Nebenlage stellet Joseph Kurzböck K. K. Illyrisch und Orientalischer Hof-Buchdrucker<br />
vor, er sey nunmehr in Stande, den ausländischen Bücher Verlag mit dem inländischen statt<br />
baaren Geld zu bilanciren wie dann die Beylage B. 30 seinen ansehnlich eigenen Bücher-<br />
Vorrath bestättige. Er wäre gegen die Einwendungen der hiesigen Buchhändler gleichsam als<br />
ein Fabricant anzusehen, der sowohl um baare Bezahlung arbeite, als auch [um] seine Leute<br />
nicht müßig gehen zu lassen, aus Mangel der Bestellungen, auf eigene Rechnung druken lassen<br />
müsse. Der hiesige Absaz hier verlegter Bücher sey sehr gering, und die manigfaltigen<br />
Unkosten nicht herauszubringen, wenn nicht der andere Weeg des Tausches erlaubt würde.<br />
Jeder hiesiger Verleger laufe daher Gefahr, daß seine kostbaren Werke im Römischen Reich,<br />
zum empfindlichsten Nachtheil nachgedruket werden, wie er es selbst mit angezeigten Schriften<br />
erfahren müssen, wornach die fremden Nachdruke selbst wieder hereingeführet werden,<br />
und also seine eigenen unverkauft liegen geblieben wären. Da er nun bishero mit unermüdeten<br />
Fleiß und mit eigenen Kosten ohne allen Vorschuß seine Buchdrukerey so sehr empor gebracht<br />
hätte, daß ihm auch aus der K. K. Bibliotheck Manuscripta zum Abdruke anvertrauet würden,<br />
sodann die ausländische Buchhändler sich gar gerne in einen Stichhandel mit ihme einlassen<br />
wollten, auch der Buchdruker Kaliwoda, der doch nicht so viele Verdienste für den Staat als er<br />
hätte, die Freyheit zum Bücher-Tausch erhalten; so bittet er auch, zu noch größerer Beförderung<br />
der Drukerey ihm ebenfalls zu erlauben, seine Bücher gegen andere in die Fremde zu<br />
vertauschen. So gewiß die hiesige[n] Buchhändler, worunter die Hälfte doch Fremde sind,<br />
gegen dergleichen Gesuche der hiesigen Buchdruker wiedersprechend [sic] sind; so richtig ist<br />
es auch daß in ihren Büchergewölben wenigstens 4/5 ausländischer gegen 1/5 inländ. Bücher<br />
zum Verkauf da liegen, und daß bloß aus solche[n] Gattungen die hiesigen Drukereyen beschäftiget<br />
werden, wovon diese Buchhändler schon vorher eines Absazes vergewißet sind,<br />
wozu sie sich dann leicht entschliessen könnten um auch zugleich nicht ganz und gar unthätig<br />
gegen die National Pressen zu scheinen. Inzwischen wird doch durch Eigennuz solcher Bücher-Handlungen<br />
die Beförderung der hiesigen Buchdrukereyen und die Aufmunterung zur<br />
Litteratur schwerlich erreichet werden. Der Buchdruker hat nicht Verschleiß genug, und der<br />
Author keinen Verleger. An den vornehmsten ausländischen Orten sind die jenigen Buchdrukkereyen<br />
die berühmteste[n] und vermöglichste[n], welche zugleich den Baratto Handel 31 ihrer<br />
Verlags Schriften mit anderen treiben. In dieser Rücksicht ist auch schon Ao [1]768 unterm 26<br />
Merzen von Allerhöchsten Orthen den hiesigen Buchdruckern eben so wie den Buchhändlern<br />
ein solcher Handel sehr weißlich zum Vortheil dieses Handlungs Zweiges vergönnt, und kurz<br />
darauf den 23ten Juny [1]769 dem Buchdruker Kaliwoda diese Freyheit dergestalt ertheilet<br />
worden, daß er eben so viele fremde Bücher an Gewicht herein führen darf, als er von eigenem<br />
Verlag hinaus führet, und schon Ao [1]766 ist durch Bericht mit Einverständnis des Abbé Marcij<br />
der allerunterthänigste Antrag gemacht worden, diesen Tausch-Handel zu erleichtern, damit<br />
alle schädliche[n] Privativa zu Verhinderung der schönen Wissenschaften, und der hiesigen<br />
Pressen behoben würden, indem die hiesige[n] einfache[n] Buchhandlungen unsere[n] Buchdrukereyen<br />
fast gar keine Nahrung, viel weniger ein lebhaftes Gewerb verschaffen: Und wann<br />
30 Liegt dem hier wiedergegeben Dokument nicht bei.<br />
31 D. i. wahrscheinlich dasselbe wie „Barathandel, wo Waare gegen Waare gefordert, und<br />
angenommen wird [...]“ Vgl. Josef von Sonnenfels’ Vortrag wider den Nachdruck, gerichtet<br />
an Joseph II. Abgedruckt bei GIESE (1963: 1143.)<br />
143
144<br />
Michael Wögerbauer<br />
auch ein Buchdruker auf eigene Unkösten Bücher verlegt, so weiß er innerlandes mit der ganzen<br />
Auflage keinen Ausweeg, die Buchhändler erkaufen nichts um baares Geld von ihm, auf<br />
dem Verschleiß gegen das Publicum ist keine sichere Rechnung zu machen, in der Fremde<br />
werden sie nachgedruckt, und wegen eines wohlfeileren Preises wird in Angesicht des wahren<br />
und ersten Verlegers in alle Hände verkauft, wodurch die[sem] kein Aequivalenz für die inländische<br />
Waare hereinkommt, die so einmahl hinausgeht, und also die Schriftsteller als Verleger<br />
vom Druke abgeschrökt werden.<br />
Da nun der Supplicant auch seine Verdienste auf verschiedenen Seiten gegen den Staat hat,<br />
sein Gesuch nicht nur für ihn, sondern für alle hiesige Buchdruker von Allerhöchsten Orten<br />
schon seit 3 Jahren als ein Normale zu erfüllen bewilliget, vorgeschrieben, und exemplificiret<br />
worden<br />
VOTUM So trägt man von Seite dieser treugehorsamsten Stelle kein Bedenken für den Supplicanten<br />
gutächtlich dahin einzurathen, daß Ew. Kais. Königl. Apostol. Maitt. ihm Kurzböck<br />
auch Allergnädigst vergönnen möchten, unter Mautämtlicher Ausweisung eben soviel fremde<br />
Bücher an Gewicht herein zu führen, als er an Gewicht von seinen eigenen gedrukten Büchern,<br />
jedoch vermög allerhöchster Resolution vom 26ten Merz 1768 nicht unter 50 fl hinaus führen<br />
wird.<br />
Den 18ten July 1771 Al. Freyh. v. Locella<br />
Franz Martin<br />
Fassen wir zusammen: Schon seit drei Jahren wird das Gesuch des K. K.<br />
Hofbuchdruckers Joseph Kurzböck, ein Privilegium für den Buchhandel zu<br />
erhalten, als normale bearbeitet. Um seine Pressen auslasten zu können,<br />
druckt er nicht nur im Auftrag anderer, sondern verlegt – wie damals durchaus<br />
üblich – auch aus eigener Initiative. Dadurch hat er Bücher auf Lager,<br />
die er über den inländischen Buchhandel nicht abzusetzen vermag. Darüber<br />
hinaus drohte den inländischen Drucker-Verlegern die Gefahr des Nachdrucks<br />
im übrigen Reich – es wäre von der Forschung zu klären, ob es sich<br />
hierbei um eine begründete Befürchtung der österreichischen Unternehmer<br />
handelte. Bisher galten die österreichischen Verleger als die Nachdrucker<br />
par excellence; über den Nachdruck von Werken aus der K. K. Monarchie<br />
in Norddeutschland wurde bislang nicht geforscht. 32 Kurzböck fordert also,<br />
zum Tauschhandel mit nichthabsburgischen Ländern zugelassen zu werden.<br />
Grundsätzlich, d. h. nach den Vorstellungen der herrschenden ökonomischen<br />
Lehre, steht dem laut N.Ö. Kommerzienkonsess nichts entgegen. Die<br />
geforderte „aktive Handelsbilanz“ – laut Otruba das „Zauberwort des Merkantilismus“<br />
(OTRUBA 1963: 123) – wird dabei am Gewicht der Bücher<br />
gemessen und keineswegs an deren Marktwert. Natürlich begibt Kurzböck<br />
sich dadurch in Konkurrenz zu den bereits in Wien tätigen Buchhändlern,<br />
32 Ein mögliches paradigmatisches Untersuchungsobjekt wäre Michael Denis sehr erfolgreiche<br />
Ossian-Übersetzung (Wien 1768/69) und seine Lieder Sineds des Barden (Wien<br />
1772).<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
vor allem den Niederlägern; 33 denen wird aber wiederum vorgeworfen, sie<br />
seien Ausländer und kümmerten sich als solche mehr um den Absatz ausländischer<br />
Druckwerke im Inland als inländischer im In- und Ausland. Eine<br />
Dynamisierung des inländischen Buchhandels sei jedoch der Schlüssel zur<br />
Aufmunterung des gesamten literarischen Lebens: Die Auftragslage von<br />
Druckern, Verlegern und Autoren würde so verbessert, und letztendlich<br />
würden auch die Staatsfinanzen von einem schwungvollen Tauschhandel<br />
mit Druckschriften profitieren. 34<br />
Hofrat Doblhof, der zuständige Referent des Hof-Kommerzienrates, übernimmt<br />
in seinem Referat vom 5. August 1771 die Positionen des untergeordneten<br />
N.Ö. Kommerzienkonsesses; betont wird nochmals, dass eine Intensivierung<br />
der Buchausfuhr wünschenswert wäre, da die vorhandenen<br />
Buchhändler<br />
vielleicht auch wirklich nicht die Mittel besitzen dürften um auch denen letzteren [den Drukkern]<br />
beyzustehen.<br />
Aus dieser Ursache ist man vorhin schon auf den Gedanken verfallen, ob es nicht besser seyn<br />
würde, einem solchen Buchdruker vielmehr den förmlichen Buchhandel einzustehen, und man<br />
hat sogar dem Kalliwoda durch den Cons. anweisen lassen, ein oder die andere der hiesigen auf<br />
dem Verkauf stehenden Buchhandlungen an sich zu lösen, allein es hat sich dieser nicht nur<br />
entschuldiget, daß er die Mittel nicht habe einen grossen Bücher-Vorrath, worunter noch viele<br />
unverkäufliche Werke befindlich seyn dürften, an sich zu lösen; sondern es hat sich auch der<br />
weitere Anstand in dem ergeben, daß der Kalliwoda wirklich nicht die erforderlichen Känntnisse<br />
zu besitzen scheine, die zu Fortführung einer wohl sortirten Buch-Handlung erforderlich<br />
sind; Und bey dem Kurzbök dürften wohl auch diesfals ganz ähnliche Anstände vorwalten.<br />
Gleichwie es aber dennoch sehr hart ist einem der hiesigen Buchdruker die Gelegenheit zu<br />
benehmen seine selbst gedrukten Bücher, welche er hier verkauffen darf, auch ausser Landes<br />
verschleissen zu können; endlich auch zu mehrerer Erhöbung der hiesigen Drukereyen dem<br />
Kalliwoda schon verwilliget worden ist, eben so viel fremde Bücher hieher einführen, als er am<br />
Gewicht von den selbst gedrukten Büchern hinausgeführet zu haben erweisen wird:<br />
33 Solche, auch ‚Niederlagsverwandte‘ genannte Händler waren Ausländer, die in der<br />
Monarchie nur zu Marktzeiten mit Büchern handeln durften und sonst ihre Bestände in<br />
Lagern wegsperren mussten. In Wien waren etwa Bader, Lehmann, Johann Paul Krauss<br />
u.a. tätig, in Prag z. B. die Nürnberger Buchhändlerfamilie Paul und Johann Heinrich<br />
Lochner, der Dresdner Georg Walter (später mit seinem Bruder), die Leipziger Johann<br />
Samuel Heinsius und Johann Heinrich Wolf (VOLF 1921/22: 270f.); Walther durfte<br />
1771 sogar eine ständige Buchhandlung in Prag eröffnen (vgl. ŠIMEČEK 2002: 37).<br />
Vielfach galten sie als „Brückenköpfe“ reichsdeutscher Verleger in der Monarchie; aus<br />
wirtschaftlichen Gründen wurde ihnen verboten, für die österreichischen Länder bestimmte<br />
Werke im Ausland drucken zu lassen (ŠIMEČEK 2002: 34). Diese Regelung<br />
trug tatsächlich stark zur Förderung des erbländischen Buchwesens bei (vgl.<br />
BACHLEITNER/EYBL/FISCHER 2000: 117f.).<br />
34 Der Nettohandel – der Verkauf der Auflage gegen Geld – schien zu diesem Zeitpunkt<br />
nur in dem Fall von wirtschaftlicher Bedeutung zu sein, wenn der habsburgische Buchhandel<br />
nicht genug gleichwertige Ware zum Tausch anbieten konnte.<br />
145
146<br />
Michael Wögerbauer<br />
So hat man mit Prot[okoll] Ausz[ug] Ihrer May. diese Umstände in Unterthänigkeit anzuzeigen,<br />
und sich den A. Befehl zu erbitten, ob nicht nach dem Anrathen des Cons. auch dem<br />
Kurzbök eine gleiche Befugniß, wie solche der Kalliwoda im Jahre [1]768 erhalten hat nämlich<br />
fremde Bücher gegen seine eigene von gleichem Gewicht hereinführen und verkaufen zu können,<br />
ertheillet werden solte. 35<br />
Der Kanzler des Kommerzienrats, Graf Kolowrat, übernahm diese Stellungnahme<br />
ohne Änderungen und leitete sie an die Kaiserin weiter, die dasselbe<br />
Dokument mit folgendem Kommentar zurückgehen ließ:<br />
Dergleichen unvollständige Buchhandlungen gereichen dem Staat zu keiner Ehre, und anderen<br />
privilegirten Buchhändlern zum Schaden. Dahingegen bin Ich geneigt, vorzüglich innländischen<br />
wohl verdienten Buchdruckern, wie der Kurzböck ist, wenn sie sich zu der Handlung mit<br />
einem genugsamen fonds legitimiren, die förmliche Buchhandels-Gerechtigkeit zu verleihen,<br />
und die bisher gedulteten fremden Buchhandlungen so wie die dermaligen Besitzer absterben,<br />
nach und nach einzuziehen.<br />
Es hat Mir demnach der Commercien-Rath über den dermaligen Stand der hiesigen Buchhandlung,<br />
und die bey solcher pro futuro zu treffende bessere Einrichtung ein ausführliches Gutachten<br />
zu erstatten, auch anzuzeigen, was es mit der dem Buchdrucker Kaliwoda eingestandenen<br />
Freyheit fremde Verlags-Bücher zu verschreiben, und feil zu bieten, eigentlich für eine Beschafenheit<br />
habe.<br />
Maria Theresia 36<br />
Die Kaiserin zog demnach ihre – deutlich vom Merkantilismus geprägten –<br />
Schlüsse: Offiziell respektierte sie die vorhandenen Buchhandelsprivilegien,<br />
in Wirklichkeit aber wurden sie zweifach angegriffen: Einerseits konnten<br />
wirtschaftlich starke Druckverleger – wie Kaliwoda oder Kurzböck – mit<br />
einem neuen Privilegium für den Buchhandel mit dem Ausland rechnen,<br />
andererseits sollten ausländische Händler vom erbländischen Markt verdrängt<br />
werden. Um eine solche Neuregelung gezielt durchführen zu können,<br />
war es zu allererst nötig, eine Bestandsaufnahme des status quo vorzunehmen;<br />
dieser Befehl wurde schließlich in Form einer Conscription des berechtigten<br />
und unberechtigten Buchhandels in den K. K. Erblanden vollzogen.<br />
Die Ergebnisse für Böhmen, Mähren, Schlesien, die Steiermark und<br />
Niederösterreich konnten schon aufgefunden werden. 37<br />
35 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 96. ex Augusti 1771, Nro. 280, fol. 100–<br />
101. Protokollauszug des Hofkommerzienrats, gezeichnet Doblhoff (Referent), vom 5.<br />
August 1771.<br />
36 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 96. ex Augusti 1771, fol. 104–105. Nicht<br />
eigenhändige Entschließung Maria Theresias zum Protokollauszug des Hofkommerzienrats<br />
vom 5.8.1771. Gezeichnet Maria Theresia.<br />
37 Zu dieser Conscription und ihren Ergebnissen für Niederösterreich (Österreich unter der<br />
Enns) und Wien vgl. FRIMMEL (2001) und für Böhmen vgl. WÖGERBAUER (<strong>2004</strong>);<br />
die Ergebnisse für Schlesien und die Steiermark sind von geringem Umfang und sollen<br />
im Rahmen der gesamten K. K. Erblande veröffentlicht werden. Die Ergebnisse für<br />
Mähren wurden bereits von Zdeněk Šimeček gefunden, sind aber noch nicht publiziert.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
Die Causa Bianchi wurde in einem Protokollauszug gleichen Datums 38 behandelt<br />
und ebenfalls an die Kaiserin weitergeleitet. Die damit verbundenen<br />
Verwicklungen innerhalb der Administration hat schon Ursula Giese im<br />
Kontext mit dem für das Maria Theresianische Buchwesen zentralen Unternehmer<br />
Trattner dargestellt (GIESE 1961: 1116–1118). Fassen wir kurz<br />
zusammen: Franz Jakob Bianchi war Besitzer des seit 1770 bestehenden<br />
„Comptoirs der Wissenschaften, Künste und Kommerzien“ 39 und Herausgeber<br />
der „K. K. allergnädigst privilegierten Realzeitung der Wissenschaften,<br />
Künste und Kommerzien“; 40 1771 erweiterte er sein Unternehmen um<br />
ein Lektürekabinett und wollte noch Ende desselben Jahres eine „Oeconomisch-,<br />
Mechanisch- und Physicalische, dann Handlungs-Bibliothec errichten“<br />
41 . Dieser Versuch, das Comptoir um eine solche Fachbuchhandlung zu<br />
erweitern, wurde zum Stein des Anstoßes. In der Folge entstand daraus sogar<br />
ein Konflikt zwischen dem Kommerzienrat und der Kaiserin. 42 Ersterer<br />
hatte Bianchi – wie im Falle des Comptoirs – schon vor der Ausstellung des<br />
allerhöchsten Privilegs die Erlaubnis erteilt, auch eine Buchhandlung zu<br />
betreiben (GIESE 1961: 1117). Die Kaiserin gab schließlich den Befehl,<br />
diese Konzession wieder rückgängig zu machen, „da selber weder ein Niederläger,<br />
noch bürgerl. Handelsmann sey“. (JESINGER 1928: 43, FRANC<br />
1952: 38) Der Kommerzienrat legte seine Argumente trotzdem noch einmal<br />
dar, berief sich bezüglich der Leihbibliothek auf die Vorbilder anderer<br />
Großstädte wie Paris oder London und den Vorteil, dass so alle Bürger Zugang<br />
zu teuren Büchern und somit zu Bildung vor allem in technischen und<br />
wirtschaftlichen Belangen hätten. Die Buchhandlung wäre nichts Besonderes<br />
gewesen, da „die Universitaet immer dergleichen kleine Buchhandlun-<br />
38 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 96. ex Augusti 1771, Nro. 280, fol. 101.<br />
Protokollauszug des Hofkommerzienrats, gezeichnet Doblhoff (Referent), vom 5. August<br />
1771.<br />
39 Vgl. die Wiener Dissertation von Lucia FRANC (1952). Für die Erlaubnis, ein Comptoir<br />
zu errichten, bedankte sich Bianchi schon am 30. August 1770 beim Hofkommerzienrat<br />
(HKA, Fasz. 36, 16 ex Sept. 770, zit. FRANC 1952: 44), obwohl er das offizielle<br />
Privileg erst am 2. März 1771 erhielt (FRANC 1952: 42 und 46). Für die Erteilung aller<br />
Genehmigungen für das Comptoir und die Realzeitung waren – wie im hier geschilderten<br />
Fall – der NÖ. Kommerzienkonsess und der Hofkommerzienrat zuständig.<br />
40 Die Realzeitung erschien nach FRANC (1952: 44) erstmals am 5. November 1770.<br />
41 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 96. ex Augusti 1771, gezeichnet Graf<br />
Kolowrat, vom 18.8.1771.<br />
42 FRANC (1952: 38) formuliert sehr ungenau, wenn sie schreibt, das Comptoir „war in<br />
einem Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung, hatte den Verlag neuer inländischer und<br />
die Kommission ausländischer Werke [...]“. Nach der Regelung von 1768 durfte Bianchi<br />
höchstens von ihm selbst verlegte bzw. in Druck gegebene Werke verkaufen, nicht<br />
aber die anderer oder gar ausländischer Verleger.<br />
147
148<br />
Michael Wögerbauer<br />
gen oder Bücherkrämer vermehret, und man fast alle Durchgänge der Häuser,<br />
damit angefüllet sieht“. Schließlich werden noch die Verdienste Bianchis<br />
bei der Herausgabe von heimischen Werken erwähnt und darüber hinaus<br />
die Tatsache, dass er<br />
sich erkläret hatte, die Sammlungen der Agriculturs-Gesellschaften der Erblanden, in Verlag zu<br />
nehmen, und solche, oder andere zum allgemeinen besten bekannt zu machende Wercke, in<br />
weit geringeren, als den gewöhnlichen Preisen an das Publicum zu bringen; diesem wird die<br />
allerunterthänigste Erinnerung beyzufügen seyn, daß der Buchhandel kein bürgerliches Gewerbe,<br />
sondern Theils von der Universitaet, Theils durch besondere Concessionen der Niederlage,<br />
oder eines Schutzes verliehen werde: wie dann auf die leztere Art solchen verschiedene Buchdruckereyen,<br />
als die Trattnerische, Gehlnische, und Kaliwodaische, seit kurzem erhalten hätten,<br />
deswegen aber zu keiner besonderen Abgabe verbunden wären; daß also eine viel eingeschräncktere<br />
Befugniß einem Manne, wie Bianchi wohl anzugönnen sey, der sich ohne<br />
Eigennutz für das gemeine beste verwende, welcher aber in seinen Absichten und sonderlich in<br />
dem Tausch-Handel ohne derselben, nicht fortkommen könnte, und daß überhaupt von der<br />
ruhmvollen Neigung der glorrwürdigsten Monarchin zu den Wissenschaften zu hoffen wäre,<br />
daß die in Absicht habende Erleichterung solchen zu Theil werden würde, die sich mit ihnen<br />
bekannter machen wollten. Dazu aber das Vermögen, oder die Gelegenheit nicht hätten.<br />
In dieser Argumentation wird deutlich, dass nicht nur wirtschaftliche Überlegungen<br />
eine Rolle spielten; ganz deutlich wurde eine auf breitere Schichten<br />
(„Publicum“) zielende Aufklärung als Voraussetzung für den Aufschwung<br />
der Wirtschaft und des Staates gesehen. Dazu war es freilich nötig,<br />
Versuche wie jenen Franz Jakob Bianchis zu fördern, ein Informationszentrum<br />
und eine Art Tauschbörse vor allem für technisches und wirtschaftliches<br />
Wissen zu gründen. Der Kommerzienrat unterstützte derlei Unternehmen<br />
immer wieder als vorbildlich – teilweise gegen den Willen Maria<br />
Theresias und ihrer Berater. An ihnen scheiterte Bianchi auch mit seiner<br />
zweiten, am 6. April 1772 eingebrachten Bitte um ein Buchhandelsprivileg<br />
(FRANC 1952: 56). Das Comptoir und die Realzeitung des bankrotten Bianchi<br />
übernahm übrigens im Laufe des Jahres 1774 dessen Drucker und<br />
ehemaliger Vermieter Joseph Ritter von Kurzböck (FRANC 1952: 39, 58).<br />
1777 übersiedelte es ins Trattnerische Gebäude am Graben, wo es unter<br />
Trattner als neuem Besitzer wieder in Schwung kam (GIESE 1961: 1120).<br />
Der Fall ist auf mehrfache Weise ungewöhnlich: Einerseits darin, dass einem<br />
Bittsteller schon ein positiver Bescheid gegeben war, bevor noch die<br />
Zustimmung der Kaiserin vorlag, die diese daraufhin verweigerte. Den<br />
Grund für die Widerrufung könnte man mit Carl Junker 43 und Ursula Giese<br />
im Einfluss Trattners bei der Kaiserin vermuten, während Bianchi „nur“ im<br />
43 Carl Junker schreibt gar, Maria Theresia hätte die Buchhändlerordnung „für Trattner<br />
und Kurzböck“ in Auftrag gegeben. Vgl. JUNKER (1926: 10), bzw. den Neudruck in<br />
JUNKER (2001).<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
Hofkommerzienrat Gönner hatte (GIESE 1961: 1117). Maria Theresias<br />
Antwort war deutlich:<br />
Es hat bey Meiner Resolution ein für allemal sein Verbleiben, und ist dem Bianchi einiger<br />
Buchhandel keiner Dings zu gestatten, da auch hervorkommt, daß dieser so wichtige Handlungs-Zweig<br />
der Zeit ohne aller Ordnung und Vorschrift sich gleichsam selbst überlassen sey;<br />
so ist von dem Commercien-Rath, unter welchem sämmentliche Buchhandlungen, und Buchdruckereyen,<br />
als obersten Behörde stehen, allenfalls nach Vernehmung der Vornehmsten<br />
Buchhändler, und von anderwärts, wo der Buchhandel am meisten blühet, eingeholte Nachrichten,<br />
eine förmliche Buchhandlungs-Ordnung zu entwerfen, und zu Meiner Bestättigung vorzulegen.<br />
Maria Theresia 44<br />
Somit war die Schaffung der Buchhändlerordnung und die Umwandlung<br />
des Buchhandels in ein bürgerliches Gewerbe seit Ende August 1771 beschlossene<br />
Sache. Falls Gieses Vermutung von Trattners Einflussnahme auf<br />
die Ablehnung Bianchis stimmt, so wirft das ein besonders Licht auf die in<br />
der Entgegnung gewählte Formulierung, vor der Abfassung einer Buchhändler-Ordnung<br />
sei eine „Vernehmung der Vornehmsten Buchhändler“<br />
durchzuführen; demnach hätten diese tatsächlich großen Einfluss auf die<br />
Gesetzgebung gehabt. Die Verfasser der Ordnung konnten nicht ausschließen,<br />
dass Trattner von der Kaiserin um seine Meinung gefragt werden würde,<br />
bevor sie selbst zustimmte.<br />
Diese endgültige Ablehnung im Fall Bianchi wurde am 2. September 1771<br />
an die untergeordneten Ämter weitergeleitet, mit der Anmerkung, „im übrigen<br />
aber eine förmliche Buchhandlungs-Ordnung zu entwerfen, und zur<br />
Begenehmigung einzureichen.“ 45 Am Ende des Monats wurde dann per<br />
Rundschreiben in alle Provinzen ein Zirkular versandt, 46 durch das alleine<br />
den Landeskommerzienkonsessen die Verleihung von Buchhandelsfreiheiten<br />
übertragen wurde; das böhmische Landesgubernium leitete das Schreiben<br />
wie folgt weiter:<br />
Dem Hl. Comm. Insp: seye das anhero gediehene allerhöchste HofDecret dto. 30 9bris 771<br />
Kraft dessen Ihre K. K. Mays. zu entschließen geruhet haben, daß künftig die Bücher Handlungs<br />
Freyheiten ganz allein durch die Comm. Conseße, und zwar bey förml. Buchhandlung<br />
auf Begenehmigung dero unmittelbaren Commercien Raths selbst ertheilet, und keiner hierzu<br />
nicht ausdrücklich befugten Parthey einiger Bücherhandel verstattet, sondern sammentl. der-<br />
44 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 25. ex Sept 771, fol. 109–110. Protokollauszug<br />
des Hofkommerzienrats (gezeichnet Kolowrat) vom 19. August 1771 an Maria<br />
Theresia und mit deren Entscheid. Wird auch zitiert von FRANC (1952: 55f).<br />
45 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 25. ex Sept. 771, fol. 108, Hofkommerzienrath<br />
„An die Nieder-Oesterreichischen Commercien-Consess“, vom 2.9.1771.<br />
46 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 130 ex Sept. 771, fol. 113–116, vom<br />
30.9.1771 (Konzept).<br />
149
150<br />
Michael Wögerbauer<br />
mahlige Conceßierung der mit Bücher Handel treibenden Partheyen Von gedachten Conceßibus<br />
eingesehen werden sollen, zu dem Ende dto. 2 9bris 771 intimiret, damit derselbe in dem<br />
ihme angewisenen Districten die Conceßiones der BücherHandlenden Partheyen einsehen, und<br />
den erhobenen Befund anhero bericht[en] solle. 47<br />
Die Überprüfung der Buchhandelskonzessionen verzögerte sich nicht selten<br />
durch die Nachlässigkeit der damit beauftragten Kreisbehörden und war, um<br />
beim böhmischen Beispiel zu bleiben, am 21. März 1772 noch immer nicht<br />
abgeschlossen. 48 Der Niederösterreichische Kommerzienkonsess hatte hingegen<br />
schon am 4. November gemeldet, dass von ihm „die semmentliche[n]<br />
Buchhändler und Antiquarij vorgefodert worden seyn, und dieselben sich<br />
mit den dgl [?] Concessionen sattsam ausgewiesen hatten. Was die aufgetragene<br />
neue Buchhändler Ordnung betreffe, so werde solche demnächsten<br />
entworffen, und ad approbandum übergeben werden.“ 49<br />
Die Buchhändlerordnung von 1772 entstand also zwischen September 1771<br />
und Anfang März 1772.<br />
Die Formulierung der Buchhändlerordnung war in erster Linie Aufgabe des<br />
Niederösterreichischen Kommerzienkonsesses. 50 Mit der Ausarbeitung eines<br />
ersten Entwurfs wurde der Beamte von Lauben betraut, der schon seit<br />
Juli als Referent für die Angelegenheit Kurzböck zuständig war. 51 Er hielt<br />
also – höchstwahrscheinlich im September und Oktober 1771 – Rücksprache<br />
mit Buchhändlern, und man kann deshalb mit Giese annehmen, „daß<br />
Trattner selbst maßgeblich an dem Entwurf zu dieser Ordnung beteiligt<br />
war“ (GIESE 1961: 1078), was aber auch für andere gelten könnte. Diese<br />
erste buchhandelsspezifische Satzung kommt einem modernen Gewerberecht<br />
schon sehr nahe: Buchhandel, Buchbinderei und Buchdruck werden<br />
getrennt konzessionspflichtig und daher auch in der gewerblichen Praxis<br />
und im Ausbildungsweg differenziert. Auf eine stabile Beziehung zwischen<br />
Lehrherr und Lehrling wird Wert gelegt. Neue Buchhandels-Konzessionen<br />
47 SÚA, ČG, Kommerz, 1755–1772, Sig. H 19 – 13/1772, 407, Kart. 179, 21.3.1772. Bis<br />
auf geringe Abweichnungen wortgleich mit dem Dokument des HKA (vgl. Anm. 46).<br />
48 Ebenda. – Deswegen bezog sich das Gubernium am 21.3.1772 noch einmal auf das<br />
Zirkulare vom 30. September des Vorjahres.<br />
49 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 12 ex Novembri 771, „zum Prot. von 4.<br />
November 771“, fol. 118; in diesem Dokument wird der genannte Protokollauszug zitiert.<br />
50 Als Quelle für die Rekonstruktion dieses Vorgangs dient uns der am 3. Februar 1772 an<br />
die Kaiserin adressierte „Allerunterthänigste[r] Vortrag Des treu gehorsamsten Hof-<br />
Commercien-Rathes Womit die Buchhandlungs-Ordnung für sämtliche Kais. Königl.<br />
Erblande allerunterthänigst vorgeleget wird.“ („Dokument B“).<br />
51 „Joh. Georg von Lauben, Ihro K. Königl. Apost. Maj. würcklicher Commercien-Rath,<br />
log. in der Kärntnerstraße, in dem Schwarzischen Haus.“ Vgl. den Abschnitt zum K. K.<br />
Nieder-Österr. Kommerzienkonsessus, in: K. u. K. STAATSKALENDER (1772: 137).<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
sollten nämlich nur noch Bewerber erhalten, die auf eine sechsjährige Lehre<br />
und vier Jahre praktische Erfahrung als Gesellen verweisen konnten (§1–5).<br />
Neben dieser zehnjährigen Ausbildung wurde „die genugsame Känntniß<br />
von den besten Schriftstellern in den verschiedenen Wissenschaften“ und<br />
ein angemessenes Grundkapital verlangt, das für Wien 10 000 Gulden betrug.<br />
Anderswo wurde seine Höhe von den Kommerzienkonsessen festgelegt.<br />
(§5) Außerdem wurde die Anzahl der Buchhandlungen (§6), der Handelsgegenstand<br />
(§7) und ein Handlungsverbot für Krämer, Buchdrucker und<br />
Buchbinder festgeschrieben (§8). Ausländische Buchhändler durften wie<br />
zuvor auch schon ihre Bücher nur zu Marktzeiten feilbieten (§9) und privilegia<br />
impressoria sollten vor dem Verkauf von Nachdruck-Exemplaren<br />
schützen (§10).<br />
Das Ergebnis übergab von Lauben an den Kommerzienrat und die Böhmisch-Österreichische<br />
Hofkanzlei. Diese wiederum bat die für den Universitätsbuchhandel<br />
zuständige Studienhofkommission um eine Stellungnahme.<br />
Die Studienhofkommission empfahl, dass<br />
nicht nur jene Buchführer, welche dermalen unter der Universitaets-Gerichtsbarkeit würcklich<br />
stehen, dem foro universitatis nicht zu entziehen, sondern auch die universitaet des ihr ex privilegio<br />
gebührenden Rechts, die bestimmte Anzahl Buchführer praestitis aufzunehmen, nicht zu<br />
entsezen wäre. 52<br />
Weiter unterstützte sie „das Bitten der hiesigen Universitaet, sie bey ihrem<br />
wohlhergebrachten und vielfältig, ja sogar in Contradictorio bestättigtem<br />
Privilegio, Catholische Buchhändler in einer bestimmten Zahl aufzunehmen,<br />
allergnädigst zu laßen“. Die Hofkanzlei schloss sich diesem Ratschlag<br />
an.<br />
Mit dieser Bitte sind wir wieder beim Fall des Universitätsbuchdruckers<br />
Joseph Kurzböck. Beispielhaft kann er für den Konflikt zwischen den Zentralisierungsbestrebungen<br />
der kaiserlichen Verwaltung und den Privilegien<br />
anderer Körperschaften stehen; in diesem Fall bestand die Universität auf<br />
ihren Rechten gegenüber dem kaiserlichen Dekret vom 30. September 1771,<br />
das den Hofkommerzienrat zur obersten Instanz für Buchhandelsprivilegien<br />
machte. Kurzböck gehörte als „würcklicher Universitaets-Buchdrucker“<br />
schon dem foro universitatis an und stand dadurch unter der Jurisdiktion der<br />
Universität. Die Hofkanzlei hatte zwar nichts dagegen einzuwenden, ihm<br />
die Buchhandelsgerechtigkeit zu verleihen; in diesem Falle jedoch<br />
würde derselbe in personalibus einer doppelten Jurisdiction, nemlichen als dermaliger Buchdrucker,<br />
und civis academicus dem foro universitatis, und als künftiger Buchhandler dem foro<br />
52 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 1772, Protokollauszug der<br />
Böhmisch- und Österreichischen Hofkanzlei vom 10./11. Jänner 1772, fol. 144.<br />
151
152<br />
Michael Wögerbauer<br />
civico magistratuali unterworfen, andurch aber zu leicht vorsehenden Strittigkeiten, besonders<br />
in prioritatis, und Abhandlungs-Sachen Anlaß gegeben werde. 53<br />
Es galt also einen Kompromiss zu finden, der das Ziel der zentralistischen<br />
Vereinheitlichung nicht unterlief, Kompetenzstreitigkeiten vermied und<br />
trotzdem keinen offenen Bruch mit dem tradierten Recht bedeutete. Der<br />
Vorschlag der Hofkanzlei lautete demnach,<br />
daß in diesem ganz besonderen Falle der Universitaet, obschon die Anzahl ihrer Buchhandler<br />
besezet ist, erlaubet würde, auch den Kurzböck, als Buchhandler, jedoch nur gegen dem aufzunehmen,<br />
daß bey Erledigung einer Universitaets-Buchhandlung solche nicht mehr ersezet werde,<br />
sondern der Kurzböck in die erledigte Stelle ipso facto eintretten solle. 54<br />
Dieser Lösungsvorschlag der Hofkanzlei für den Fall Kurzböck wurde vom<br />
Hofkommerzienrat akzeptiert und in den Entwurf für die Kaiserin übernommen.<br />
Kurzböck hatte dem niederösterreichischen Kommerzienkonsess<br />
schon nachgewiesen, dass er über ein ausreichendes Vermögen verfügte und<br />
deswegen gab es keine Bedenken, „den Antrage der Böhmischen Hof-<br />
Kanzley gemäß dem Kurzböck zum Universitaets-Buchhändler aufzunehmen.“<br />
55<br />
Im Allgemeinen wurde die Ernennung von Universitätsbuchhändlern wie<br />
folgt geregelt:<br />
Es könnte nämblich sowohl der hiesigen als anderen Kais. Königl. Universitaeten, die das<br />
gleiche Privilegii genießen, noch ferner gestattet werden, die vor ihrer Ernennung bestehende<br />
Zahl der Buchhandlungen zu Erledigungs-Falle wieder zu ersezen, jedoch mit der Bedingung,<br />
1 mo daß ihnen daraus kein Privativum erwachse,<br />
2 do daß das aufzunehmende Subject mit denen in der neuen Ordnung vorzuschreibenden Eigenschaften<br />
versehen sey, und endlich<br />
3 tio daß in jedem Falle einer Aufnahme die vorläufige Anzeige dem Consesse mittelst eines an<br />
[die] Regierung gestellten Berichtes geschehe.<br />
Dieser [Konzess] wird bey nicht obhandenen Bedencken durch den nämblichen Weeg der<br />
Regierung die Begenehmigung zu ertheilen, oder aber die sich äußerende[n] Anstände anher zu<br />
berichten haben, damit nicht etwa zu unnöthigen Weiterungen Anlaß gegeben werde. 56<br />
Die Universitäten durften somit zwar noch immer die ihnen zustehende Anzahl<br />
an Universitätsbuchhändlern immatrikulieren, wurden aber wenigstens<br />
in Ernennungsfragen ihrer Autonomie beraubt und de facto zur Gänze von<br />
53 Ebenda – HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 1772, Protokollauszug<br />
der Böhmisch- und Österreichischen Hofkanzlei vom 10./11. Jänner 1772,<br />
fol. 144.<br />
54 Ebenda – HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 1772, Protokollauszug<br />
der Böhmisch-Österreichischen Hofkanzlei vom 10./11. Jänner 1772, fol.<br />
144.<br />
55 Dokument B, fol. 128.<br />
56 Dokument B, fol. 127.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
der neuen Buchhandlungsordnung und der Zustimmung der kaiserlichen<br />
Behörden, nämlich des jeweiligen Landes-Kommerzienkonsesses abhängig.<br />
Die Buchhandlungsordnung wies den Universitäten aber auch eine Aufgabe<br />
zu, nämlich „die Prüfung der Buchhändler in Ansehung der Wißenschafft“,<br />
d. h. eine Prüfung ihrer literarischen Grundkenntnisse. Dafür wurde die<br />
Überprüfung der finanziellen Ausstattung aller Buchhändler den staatlichen<br />
Wechselgerichten übertragen, die diese Aufgabe für alle Handelstreibenden<br />
inne hatten.<br />
Punkt 11 des Entwurfs (später §6 der Buchhändlerordnung) betraf den nicht<br />
stationären Buchverkauf vor allem im Umkreis von Universitäten.<br />
Ad 11um daß leztere [Studienhofkommission] der Meinung, es könnte der Verkauf der alten<br />
Bücher den Standlern und Tandlern noch ferner gestattet werden, da hierauf hierorts nur wenige<br />
Stimmen angetragen.<br />
Es wäre sich aber über diesen Punkt um somehr mit der Meinung der Studienkommission zu<br />
vereinigen, als die Sache von keiner Wichtigkeit, und das Absehen auf die arme Studenten<br />
hauptsächlich gerichtet ist.<br />
Bey diesem Absatze äußert sich jedoch die Verschiedenheit der Meinungen noch in dem, daß<br />
die Studienkommission den Weg, die Ordenshäuser von dem Buchhandel durch die Bedrohung<br />
abzuhalten, daß ihnen im Betrettungsfalle keine Bücher mehr passiret werden würden, nicht für<br />
schicksam, noch bey selben für verfangend ansiehet. Daher sie auf eine arbitrarische Strafe<br />
antraget: welchem auch unter dem beygetretten werden könnte, daß demjenigen, welcher in<br />
einem solchen Handel betretten, oder dessen überwiesen werden würde, nicht nur der dazu<br />
geeignete Vorrath confisciret, sondern auch, beschaffenen Umständen nach, ein solcher noch<br />
mit einer arbitrarischen Strafe beleget werden solle. 57<br />
Es solle die Entschließung des Hofkommerzienrats eingeholt werden, der<br />
auch das Patent zu verfassen und die Buchhandlungsordnung zu entwerfen<br />
habe. Dieser berücksichtigte diese Vorschläge und schickte den Entwurf<br />
von Laubens an die Kaiserin, wobei noch folgendes Gutachten vom 31. Oktober<br />
1771 angeschlossen wurde:<br />
GUTACHTEN<br />
Welch ein so andres Euer Kais. Königl. Apostl. Majtt. von Seite dieser treugehorsamsten Stelle<br />
hiemit allerunterthänigst vorgeleget wird, mit dem Beysatze, daß man von Seiten des Pleni mit<br />
dem Antrag des Referenten vollkommen einverstanden, und nur folgendes dahin abzuändern<br />
des ganz unmaßgeblichen Ermessens wäre: daß ad 2dum in fine des Referats die Privatpersohnen<br />
für die einführende[n] fremde[n] Bücher eben nicht mehr als die Buchhandler Maut bezahlen<br />
sollen, maßen ansonsten dadurch die intentionirte Beförderung der Wissenschaft geschwächt<br />
würde. Ferner<br />
ad 3tium Daß denen Tandlern und Standelweiber zum Behuf des Publici der Verkauf der alten<br />
Bücher nicht benommen werden solle. Dann<br />
ad 5tum Daß sowohl der Kurzböck als andere neu aufzunehmende Buchhandler als Handels-<br />
Leute bey dem Wechselgericht erster Instanz ordentlich protocolliret, und auch als Bürger<br />
57 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105. ex Aprili 772, Extractus Protocolli<br />
Consilii Commercialis Aulici, dd 27ma Januarii 772, fol. 149, 153.<br />
153
154<br />
Michael Wögerbauer<br />
aufgenommen werden, mithin dieser dreyerlei abweichender Wohlmeynungen wegen, die §phi<br />
11. 12. und 14. in der entworfenen Buchhandlungs-Ordnung abzuändern wären, wie auch ad<br />
§phum 11mum dieser Ordnung denen privatis, Klöstern etc. anstatt eines Exemplars von jeder<br />
Materie so viele Exemplarien hereingelassen werden sollen, als ihrem eigenen Gebrauche<br />
angemessen wäre. 58<br />
Auch bei diesen Änderungsvorschlägen ist ersichtlich, dass die drei beteiligten<br />
Gremien (Studienkommission, Hofkanzlei und Hofkommerzienrat) bei<br />
der Formulierung des Dekrets mit der „Beförderung der Wissenschaft“ oder<br />
der Aufklärung der Öffentlichkeit argumentierten – in der Diskussion der<br />
Vorschläge wird nicht zufällig ausdrücklich davon gesprochen, dass es nicht<br />
zielführend sei, Privatpersonen oder Studenten den Zugang zu Büchern zu<br />
erschweren.<br />
Am 8. März 1772 legte schließlich der Kommerzienrat der Kaiserin die fertige<br />
Buchhändlerordnung mit dem Vorschlag vor, diese nicht als Patent,<br />
sondern als Druckschrift den Landesstellen bekannt gemacht werden solle,<br />
welche dieses Papier „den Obrigkeitlichen Behörden, wo sich Buchhändler<br />
befinden, so wie leztere[n] selbst zur genauen Beobachtung vorlegen sollen:<br />
Wie dann auch der hungarischen und siebenbürgischen Hof-Kanzley und<br />
der böhmischen in Ansehung des Banats einige Exemplare zu schiksamer<br />
Adaptirung mitzutheilen wären.“ 59<br />
Die Kaiserin befand die Buchhändlerordnung am 28. März 1772 für gut und<br />
verlangte gleichzeitig, ein „Verzeichnis aller dermalen bestehenden berechtigten<br />
Buchhandlungen vorlegen zu lassen, um sowohl die unbefugten abzustellen,<br />
als auch bey weiteren Freyheitsertheilungen auf die jedesortigen<br />
Umstände den Beacht nehmen zu können.“ 60 Am 30. März gab die Böhmisch-Österreichische<br />
Hofkanzlei den Auftrag, die Ordnung drucken und in<br />
die Erbländer verschicken zu lassen. Inwiefern der Text tatsächlich für Ungarn,<br />
Siebenbürgen und den Banat noch einmal im Detail diskutiert und<br />
abgeändert wurde, wäre noch zu untersuchen.<br />
3. Zusammenfassung und Folgen<br />
Am 19. August 1771 bat Maria Theresia den Niederösterreichischen Kommerzienkonsess<br />
im Zusammenhang mit den Ansuchen von Kurzböck und<br />
Bianchi erstmals um „gutächtliche Erinnerungen [...], wie eine bessere Ein-<br />
58 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 772, vom 31.10.1771,<br />
„Allerdurchlauchtigste...“, gezeichnet Freiherr von Reischach und Franz Martin, fol.<br />
165.<br />
59 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 105 ex Aprili 772, Vortrag des Hof-<br />
Commercien-Rathes vom 8. März 1772 (mit Entwurf vom 3.2.1772, unterzeichnet von<br />
Kolowrat und Reischach) an Maria Theresia.<br />
60 Dokument A, handschriftliche Stellungnahme Maria Theresias, ohne Datum.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
richtung unter den hiesige[n] Buchhandlunge[n] für künfftig getroffen werden<br />
könnte.“ 61 Eine ausdrückliche Anweisung, eine Buchhandlungsordnung<br />
zu entwerfen, gab die Kaiserin vor dem 2. September. Gleichzeitig hatte sie<br />
einen der beiden Anlassfälle, das Gesuch des Franz Jakob Bianchi, Herausgeber<br />
der Wiener „Realzeitung“ und Inhaber des Handels-Comptoirs, auch<br />
mit fremden Büchern handeln zu dürfen, gegen den Widerstand des Hofkommerzienrates<br />
endgültig negativ beschieden. Der Hof- und Universitätsbuchdrucker<br />
Joseph Ritter von Kurzböck bat ebenfalls um die Erlaubnis, die<br />
von ihm verlegten und gedruckten Bücher mit ausländischen Buchhändlern<br />
tauschen und fremde Verlagsprodukte verkaufen zu dürfen. Da Maria Theresia<br />
seinem Ansuchen gegenüber positiv eingestellt war, bestand nur noch<br />
die Frage, welchen Status er innerhalb der Buchhändlerordnung erhalten<br />
würde.<br />
Mit der „Vernehmung der vornehmsten Buchhändler“ – mit Sicherheit war<br />
auch Trattner einbezogen – und dem Entwurf einer Buchhändlerordnung<br />
wurde der niederösterreichische Beamte von Lauben als Referent betraut.<br />
Dessen Vorschlag wurde vom Niederösterreichischen Kommerzienkonsess<br />
an den Hofkommerzienrat und von diesem an die Studienkommission weitergeleitet.<br />
Letztere vertrat in ihrer Stellungnahme vom November 1771 die<br />
Interessen der Universitäten und setzte durch, dass diese wenigstens äußerlich<br />
weiterhin das Recht behielten, die ihnen zustehende Anzahl an Universitätsbuchhändlern<br />
zu inskribieren, die dann dem foro universitatis angehörten<br />
und in persönlichen Belangen dessen Jurisprudenz unterstanden –<br />
Kurzböck, der schon als Buchdrucker der Wiener Universität unterstand,<br />
wurde letztlich auch Universitätsbuchhändler. Derlei Inskriptionen mussten<br />
allerdings von nun an im Einklang mit der neuen Buchhändlerordnung stehen<br />
und waren über die Regierung den Kommerzienkonsessen mitzuteilen,<br />
die schon per Dekret vom 30. September 1771 die einzigen Stellen geworden<br />
waren, welche Buchhandelsgerechtigkeiten vergeben durften. In der<br />
Buchhandlungsordnung wurde in §11 formuliert: „Die Buchhändler sollen<br />
in personalibus ihrem gewöhnlichen Foro, in Handlungssachen aber den<br />
Kaiserl. Königl. Commercial-Consessen, und Wechselgerichtern, gleich<br />
anderen Handelsleuten unterworfen sein.“ Die notwendige Vermögensprüfung<br />
wurde ebenfalls vom Wechselgericht durchgeführt. Von einer Autonomie<br />
der Universitäten bezüglich ‚ihrer‘ Buchhändler konnte somit nicht<br />
mehr die Rede sein. Sie konnten schätzen, wenn sie noch Universitätsbuch-<br />
61 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 96. ex Augusti 1771, fol. 101. Handschriftliche<br />
Stellungnahme Maria Theresias zum Protokollauszug vom 19. August 1771.<br />
155
156<br />
Michael Wögerbauer<br />
händler immatrikulieren durften. 62 „Die alten Privilegien blieben in der Regel<br />
der Form nach bestehen, erhielten aber einen dem absolutistischen Zeitgeist<br />
entsprechenden neuen Inhalt“ – so charakterisiert WERNER OGRIS<br />
(1985: 366) einen auch hier deutlichen Grundzug der Reformen Maria Theresias.<br />
Im Gegenzug wurden die Universitäten beauftragt, den für alle zukünftigen<br />
Buchhändler verpflichtenden Wissenstest abzunehmen.<br />
In der Diskussion wurde von Laubens Entwurf noch dahingehend ergänzt,<br />
dass mobile Buchhändler, sog. Standler und Tandler, zum Nutzen der Studentenschaft<br />
weiterhin mit alten Büchern handeln dürfen sollten; auch dürften<br />
Privatleute nicht mehr Maut für Bücher zahlen müssen als professionelle<br />
Buchhändler. Hier zeigt sich – wie auch im Fall Bianchi –, dass die an der<br />
Legislative beteiligten Beamten durchaus im Sinn der Aufklärung versuchten,<br />
breiteren, und auch bürgerlichen Bevölkerungsschichten den Zugang zu<br />
Druckschriften offen zu halten – schließlich konnte das Sozialsystem auch<br />
ohne ihre Nachfrage nicht funktionieren.<br />
Im März 1772 wurde der Entwurf schließlich Maria Theresia vorgelegt, von<br />
dieser am 28. März genehmigt und am 30. März in Druck gegeben. Obwohl<br />
die Regelung nur für die K. K. Erblande geschaffen worden war, erging<br />
zugleich an die zuständigen Stellen der Befehl, die Buchhändlerordnung für<br />
Ungarn, Siebenbürgen und den Banat entsprechend zu adaptieren.<br />
Eine zu strenge Durchführung der Regelung, ab sofort nur ausgelernten<br />
Buchhändlern die Konzessionen zu belassen, hätte allerdings viele kleinere<br />
Buchdrucker und Buchbinder in Existenznöte gebracht. Ein im oberösterreichischen<br />
Steyr tätiger Buchbinder, Johann Ferdinand Holzmayer, bat<br />
zum Beispiel, ihm den Buchhandel weiterhin zu erlauben. Sein Vater und er<br />
hätten schon siebzig Jahre lang neben ihrem Handwerk Bücher verkauft<br />
(HESS 1950: 115). Sonst gäbe es nur in Enns und Linz eine Buchhandlung,<br />
in Steyr aber keine, Abnehmer hingegen genug. Er versorge in Steyr zwei<br />
Klöster, das Jesuitencollegium und das Gymnasium sowie die Klöster in<br />
Kremsmünster, Garsten, Gleink, St. Florian und Seitenstetten (HESS 1950:<br />
109). Diese Bitte wurde mit der allgemeinen Anordnung beantwortet, „daß<br />
auch den Buchbindern aller ihnen bishero rechtmäßig zugestandene Handel<br />
62 JUNKER (1926: 10) schreibt unmittelbar nach der Erwähnung der Buchhandelsordnung:<br />
„Das Recht der Universität, die Buchhändler aufzunehmen und zu immatrikulieren,<br />
wird von der Regierung aufgehoben, zumal die Buchhändler selbst – kurzsichtig<br />
und undankbar – von der Jurisdiktion der Alma mater ‚erlöst’ werden wollten.“ Dieser<br />
Schritt erfolgte unserer Untersuchung nach 1772 noch nicht, obwohl die Grundtendenz<br />
vorhanden ist, die Universität schrittweise ihrer Rechte zu berauben. Joseph II. hob die<br />
Universitätsgerichtsbarkeit erst 1784 endgültig ab.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
ferners beygelaßen werden solle [...]“. 63 Der Linzer Kommerzienkonsess<br />
betonte daraufhin noch einmal, „daß fast alle hierländige Buchdrucker, und<br />
Buchbinder bisanhero den freyen Handl mit Gebett- und anderen derley<br />
Büchern ungestöhrt geführet haben, und hierwegen ab immemoriabile tempore<br />
in Besitz bestehen.“ 64 Die endgültige Auskunft lautete dann,<br />
„daß in Ruecksicht auf die Erhaltung des Nahrungs-Stands und andere erhebliche umstände die<br />
hierländigen Buchdrucker und Buchbinder in soweith, als sie dermalen in dem Betrieb des<br />
Buchhandels seyen, darbey bis zu ihrem Absterben belassen, inskünftige aber ihren Nachfolgern<br />
kein anderer und mehrerer Handel, als der dennen Buchdruckern und Buchbindern mit<br />
Gebett-Büchern, Nahmen-Bücheln, und Kalendern überhaubts eingestanden ist, verstattet,<br />
sondern in Sachen sich nach Vorschrifft der Neuen Buchhandler-Ordnung dd 28 ten Marty anni<br />
currentis gerichtet werden solle.“ 65<br />
Holzmayer und andere, die zum nebenberuflichen Buchhandel berechtigt<br />
waren, durften das also weiterhin tun. Diese Berechtigung an ihre Nachfolger<br />
weiterzugeben, war allerdings nur möglich, wenn diese das Gewerbe<br />
gelernt hatten. Johann Ferdinand Holzmayer konnte die Buchhändlerordnung<br />
dennoch umgehen, da ihm ein langes Leben beschieden war. Am 20.<br />
August 1788 hob Joseph II. nämlich die Buchhändlerordnung wieder auf,<br />
der Zugang zum Buchhandel wurde erneut zu einem „bloßen Negotium“,<br />
nachdem schon am 9. November 1786 Buchdrucker und Buchhändler<br />
gleichgestellt worden waren (BACHLEITNER/EYBL/FISCHER 2000:<br />
124f.). Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass Holzmayrs Schwiegersohn,<br />
der aus Würzburg stammende Buchbinder Christian Reuther, 1794<br />
in amtlichen Schriften doch als Steyrer „Buchhändler“ bezeichnet wird<br />
(HESS 1952: 118). Die alteingesessenen Buchhändler wehrten sich natürlich<br />
gegen einen offenen Zugang zu ihrem Gewerbe, weil sie darin – besonders<br />
in größeren Städten – ihren Ruin sahen. Es folgte eine zwanzigjährige<br />
„Sturm- und Drangperiode für den österreichischen Buchhandel“ (JUNKER<br />
63 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 119 ex Martio 772, fol. 125, „Dekretum<br />
an den Ob der Ennßl: Commercien-Conseß“ vom 23.3.1772.<br />
64 HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot), 45 ex 7bri 772, fol. 193–194, Ob der<br />
Ennsischer Kommerzienkonsess an die Kaiserin, Linz den 14. Augusti 1772, gezeichnet<br />
Aloysius Graf von Spindler u. a.<br />
65 OÖLA, Patentsammlung Krakowizer 1772, Handschrift Nr. 171, Landshauptmannschaftliches<br />
Circulare vom 26. September 1772. Vgl. das gleichlautende Konzept des<br />
NÖ. Kommerzkonsess-Beamten Taube (HKA, NÖ Kommerz, Fasz. 110, Nr. 240 (rot),<br />
45 ex 7bri 772, Vienna, d. 7. Sept. 1772, gezeichnet Titlbach, fol. 192–198). So ist auch<br />
die missverständliche Formulierung bei BACHLEITNER/EYBL/FISCHER (2000:<br />
115f.) zu verstehen, wo es heißt: als Holzmayer „im fortgeschrittenen Alter bei Magistrat,<br />
Landesregierung und schließlich 1773 [recte 1772!] bei der Kaiserin selbst um<br />
Ausnahmegenehmigung ansucht, wird er abschlägig beschieden: die Söhne sollten den<br />
Buchhandel lernen.“ Er selbst hatte keine solche Ausbildung.<br />
157
158<br />
Michael Wögerbauer<br />
1926: 10), wobei allerdings die Josephinischen Freiheiten schon ab 1792<br />
von seinem Bruder Leopold und noch mehr im Zeichen der Angst vor revolutionärem<br />
Gedankengut wieder zurückgenommen wurden. Am 18. März<br />
1806 erließ der neugekrönte Kaiser von Österreich, Franz I., neuerlich eine<br />
Buchhändlerordnung; diese „unterschied sich nicht wesentlich von der ersten,<br />
die seine Großmutter mehr als dreißig Jahre früher erlassen hatte.“<br />
(JUNKER 1926: 10)<br />
Die Genese der Buchhändlerordnung zeigt, dass die Maria-Theresianische<br />
Staatsverwaltung Interesse daran hatte, den Buchhandel als eigenes Gewerbe<br />
zu regeln und qualitativ und quantitativ zu fördern. Das ökonomische<br />
Interesse verlangte, den Handel mit dem Ausland und die Wissensvermittlung<br />
zu regeln; doch verlangte es auch, die Verbreitung nützlichen Wissens<br />
nicht zu erschweren. Durch zentrale Maßnahmen – wie zum Beispiel die<br />
„Beförderung der hiesigen Buchdrukereyen“ – sollte die „Aufmunterung<br />
zur Litteratur [...] erreichet werden.“ Denn hat „der Buchdruker [...] Verschleiß<br />
genug“, findet der Autor auch einen Verleger 66 – und letztlich profitiert<br />
das ganze Sozialsystem Literatur davon. Wenn die für die Habsburger<br />
Monarchie überlieferten Angaben nur annähernd stimmen, dass „zwischen<br />
1773 und 1793 der Wert der Buchproduktion von 135 000 auf 3 260 000<br />
Gulden“ wuchs, 67 so kann man tatsächlich davon ausgehen, dass auch die<br />
Menge jener rapide anstieg, die immer professioneller Druckschriften produzierten,<br />
vermittelten und rezipierten – kurz: Innerhalb dieser zwanzig<br />
Jahre entstand ein modernes Sozialsystem Literatur, das aufgrund der gegebenen<br />
Umstände immer mehrsprachig war. Regelungen für die Erblande<br />
bzw. die gesamte Monarchie wie die Buchhändlerordnung spielten dabei<br />
eine wichtige Rolle. Dieser einzigartige Aufholprozess in der Monarchie<br />
bildet ohne Zweifel eine notwendige Basis für die neueren volkssprachlichen<br />
Literaturen im Habsburger Reich, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts<br />
dann allmählich zu Nationalliteraturen ausdifferenzierten.<br />
66 Paraphrase auf das oben zitierte Gutachten zu Kurzböck (vgl. Anm. 29).<br />
67 Die beiden hier von BACHLEITNER/EYBL/FISCHER (2000: 123) zitierten Untersuchungen,<br />
nämlich PLACHTA (1994: 75f.) und WINTER (1992: 10), geben unterschiedliche<br />
Währungen an. Während Plachta von „Gulden“ spricht, schreibt Winter „Taler“.<br />
Die angeführten Zahlen sind demnach lediglich relativ zu verstehen. Nach BODI (1994:<br />
441) war ein Reichstaler 1½ Gulden wert, ein Konventionstaler entsprach hingegen<br />
zwei Gulden. Das Jahresverdienst eines Universitätsprofessors betrug 600 Gulden.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
Literatur<br />
AMTSSCHEMATISMUS BÖHMEN (1772): Die im Königreich Böheim<br />
befindliche sowohl Geistliche, als Weltliche Dicasterien, Gerichts-<br />
Instantien und Landesämter. Für das Jahr 1772, 14 bzw. 18. [verwendet<br />
wurde das Exemplar aus dem Státní ústřední archiv, Sign. Amtsschematismen<br />
für die Jahre 1772 – 1778]<br />
BACHLEITNER, Norbert/EYBL, Franz M./FISCHER Ernst (2000): Geschichte<br />
des Buchhandels in Österreich. Wiesbaden: Harrassowitz.<br />
BODI, Leslie (1995): Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen<br />
Aufklärung 1781–1795. 2., erw. Auflage. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.<br />
BUCHMANN, Bertrand Michael (2002): Hof – Regierung – Stadtverwaltung.<br />
Wien als Sitz der österreichischen Zentralverwaltung von den Anfängen<br />
bis zum Untergang der Monarchie. Wien: Verlag für Geschichte und<br />
Politik.<br />
CHALOUPEK, Günter (1991): Die Ära des Merkantilismus. – In: Ders., P.<br />
Eigner, M. Wagner (Hg.), Wiener Wirtschaftsgeschichte 1740–1938. Wien,<br />
München: Jugend & Volk.<br />
FRANC, Lucia (1952): Die Wiener Realzeitung. Ein Beitrag zur Publizistik<br />
der theresianischen Epoche. Wien: Diss. masch.<br />
FRANK, Peter R. (<strong>2004</strong>): Topographie der Buchdrucker, -händler, Verleger<br />
u.a. in der österr.–ungar. Monarchie 1750–1850. – In: Mitteilungen der Gesellschaft<br />
für Geschichte des Buchwesens in Österreich, <strong>2004</strong>–1, 56–58.<br />
FRIMMEL, Johannes (2001): Der Buchhandel in Österreich unter der Enns<br />
um 1770. – In: Mitteilungen der Gesellschaft für Geschichte des Buchwesens<br />
in Österreich, 2001–1, 14–17.<br />
GAVRILOVIĆ, Nikola (1974): Istorija ćirilskih štamparija u Habzburškoj<br />
monarhiji u XVIII veku [Geschichte des kyrillischen Buchdrucks in der<br />
Habsburger Monarchie im 18. Jahrhundert]. Novi Sad: Institut za izučavanje<br />
istorije Vojvodine.<br />
GIESE, Ursula (1963): Johann Thomas Edler von Trattner. Seine Bedeutung<br />
als Buchdrucker, Buchhändler und Herausgeber. – In: Archiv für Geschichte<br />
des Buchwesens, 3 (1961), Sp. 1014–1454.<br />
HESS, Alois (1950): Steyr, eine alte Druckerstadt. Geschichte und Bibliographie.<br />
Wien: Diss. masch.<br />
JAKUBEC, Jan (1934): Dějiny literatury české II. Od osvícenství po družinu<br />
máje [Geschichte der tschechischen Literatur II. Von der Aufklärung bis<br />
zu Máj-Gruppe]. Praha: Jan Laichter.<br />
159
160<br />
Michael Wögerbauer<br />
JESINGER, Alois (1928): Wiener Lekturenkabinette. Wien: Berthold &<br />
Stempel.<br />
JUNKER, Carl (1926): Die geschichtliche Entwicklung des Buchhandels in<br />
Österreich. Wien: Amalthea.<br />
JUNKER, Carl (2001): Zum Buchwesen in Österreich. Hg. v. Murray G.<br />
Hall. Wien: Edition Praesens.<br />
K. u. K. STAATSKALENDER (1772): Kayserlich- und Königlicher wie<br />
auch Erz-Herzoglicher, dann dero Haupt- und Residenz-Stadt Wien Staatsund<br />
Standes-Kalender auf das Gnadenreiche Jahr Jesu Christi<br />
M.DCC.LXXII. Mit einem Schematismo gezieret. Wien: Leopold Johann<br />
Kaliwoda.<br />
KIESEL, Helmut/ MÜNCH, Paul (1977): Gesellschaft und Literatur im 18.<br />
Jahrhundert. Voraussetzungen und Entstehung des literarischen Markts in<br />
Deutschland. München: Beck.<br />
KÓKAY, György (1990): Geschichte des Buchhandels in Ungarn. Wiesbaden:<br />
Harrassowitz.<br />
LAVANDIER, Jean-Pierre (1993): Le livre au temps de Marie-Thérèse.<br />
Code des lois de censure du livre pour les pays austro-bohémiens (1740–<br />
1780). Berlin, Bern: Lang.<br />
LEHMSTEDT, Mark (1989): Philipp Erasmus Reich (1717–1787). Verleger<br />
der Aufklärung und Reformer des deutschen Buchhandels. Leipzig:<br />
Karl-Marx-Universität.<br />
MAYER, Anton (1887): Wiens Buchdruckergeschichte 1482–1882. Bd. 2.<br />
Wien: Frick.<br />
MOERCHEL, Joachim (1979): Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias und<br />
Josephs II. in der Zeit von 1740 bis 1780. München: Minerva Publikation.<br />
OGRIS, Werner (1985): Zwischen Absolutismus und Rechtsstaat. – In: R.<br />
G. Plaschka, Grete Klingenstein (Hg.), Österreich im Europa der Aufklärung.<br />
Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Josephs<br />
II. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,<br />
365–376.<br />
OTRUBA, Gustav (1963): Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias. Wien.<br />
PLACHTA, Bodo (1994): Damnatur – Toleratur – Admittitur. Studien und<br />
Dokumente zur literarischen Zensur im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer.<br />
Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler …<br />
PŘIBRAM, Karl (1907): Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik<br />
von 1740 bis 1860. Erster Band: 1740 bis 1798. Leipzig: Duncker & Humblot.<br />
SCHMIDT, Siegfried J. (1989): Die Selbstorganisation des Sozialsystems<br />
Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt/Main: Suhrkamp.<br />
ŠIMEČEK, Zdeněk (1990): Některé otázky knižního obchodu v Praze 18.<br />
století [Einige Fragen des Buchhandels in Prag im 18. Jahrhundert]. – In:<br />
Documenta Pragensia 10. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 315–326.<br />
ŠIMEČEK, Zdeněk (2002): Geschichte des Buchhandels in Tschechien und<br />
in der Slowakei. Wiesbaden: Harrassowitz.<br />
VLČEK, Jaroslav (1940): Dějiny české literatury. Druhý díl [Geschichte der<br />
tschechischen Literatur. Band 2]. Praha: L. Mazáč.<br />
VOLF, Josef (1921/22): Cizí knihkupci na pražských trzích v 17. a 18. století<br />
[Ausländische Buchhändler auf Prager Märkten im 17. und 18. Jahrhundert].<br />
– In: J. Borecký, A. Wenig (Hg.), Topičův sborník literární a umělecký.<br />
Praha, 266–272.<br />
VOLF, Josef (1930): K vývoji knihkupectví a nakladatelství v Čechách do<br />
roku 1848 [Zum Einfluss der Buchhändler und Verleger in Böhmen seit<br />
dem Jahr 1848]. Praha: Svaz knihkupcův a nakladatelů Č.S.R.<br />
WIDMANN, Hans (Hg.) (1965): Der deutsche Buchhandel in Urkunden<br />
und Quellen. Hamburg: Dr. Ernst Hauswedell & Co.<br />
WINTER, Michael (1992): Georg Philipp Wucherer. Ein Buchhändler und<br />
Verleger oppositioneller Schriften gegen Joseph II. – In: Archiv für Geschichte<br />
des Buchwesens 37, 1–54.<br />
WITTMANN, Reinhard (1987): Soziale und ökonomische Voraussetzungen<br />
des Buch- und Verlagswesens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. –<br />
In: H. Göpfert, G. Koziełek, R. Wittmann (Hg.), Buch- und Verlagswesen<br />
im 18. und 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte der Kommunikation im<br />
Mittel- und Osteuropa. Essen: Hobbing, 5–27.<br />
WITTMANN, Reinhard (1991): Geschichte des deutschen Buchhandels.<br />
München: Beck.<br />
WÖGERBAUER, Michael (<strong>2004</strong>): Das Maria-Theresianische Verzeichnis<br />
aller Buchhändler (1772). Entstehungsgeschichte und Edition eines amtlichen<br />
Referats über Böhmen. – In: Mitteilungen der Gesellschaft für Geschichte<br />
des Buchwesens in Österreich <strong>2004</strong>/1, 5–14.<br />
ZEMAN, Herbert (1977): Der Drucker-Verleger Joseph Ritter von Kurzböck<br />
und seine Bedeutung für die österreichische Literatur des 18. Jahrhun-<br />
161
162<br />
Michael Wögerbauer<br />
derts. – In: H. Göpfert, G. Koziełek, R. Wittmann (Hg.), Buch- und Verlagswesen<br />
im 18. und 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte der Kommunikation<br />
im Mittel- und Osteuropa. Berlin: Ulrich Kamen, 104–129.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
Marek Nekula<br />
Die Brücken gelten als Metapher des Verbindenden. Sie verbinden zwei<br />
Ufer, Stadtteile oder Städte. Sie werden aber auch zwischen Gegenwart und<br />
Vergangenheit, zwischen Kulturen und Nationen geschlagen. So begegnet<br />
man ihnen etwa auf den Banknoten der Europäischen Union, wo die<br />
,Union‘ gerade durch die Brücke(n) symbolisiert wird, während die auf der<br />
Rückseite dargestellten Fenster den ,Einblick‘ ins Fremde der anderen europäischen<br />
Kulturen vermitteln.<br />
Diese Union-Metapher ist aber nicht so einfach. Denn Verbindung setzt<br />
Trennung voraus, an die v.a. die moderne europäische Geschichte der nationalen<br />
Politik und der nationalen Staaten reich ist. In diesem Sinne werde<br />
ich der Brücke in meinem Beitrag nachgehen: Im national polarisierten Prag<br />
und Böhmen des 19. und 20. Jahrhunderts kann man der Brücke als Ort der<br />
nationalen Polarisierung begegnen, als Symbol des Trennenden statt des<br />
Verbindenden.<br />
Die Brücke kann schließlich gar der Ort des Scheiterns und des Todes sein.<br />
Sie wurde als Ort des ,Außerhalb‘ und des ,Zwischen‘ des Öfteren als Hinrichtungsstätte<br />
genutzt. Dies trifft im Mittelalter auch für die Prager Steinerne<br />
Brücke zu, wo anstelle der mitteralterlichen Hinrichtungsstätte seit<br />
1695 die damit motivisch sehr wohl zusammenhängende Pietà von J. Brokof<br />
installiert wurde. Auch die Selbsthinrichtung, der Selbstmord, ist mit<br />
der Brücke nicht nur konkret, sondern auch motivisch 1 und symbolisch aufs<br />
Engste verbunden, wie dies durch einen kurzen Exkurs zu Franz Kafka<br />
deutlich wird.<br />
Die romanische Judithbrücke<br />
Bei dem ersten und vorerst letzten Staatsbesuch des tschechischen Präsidenten<br />
in Deutschland führte ihn der Weg auch nach <strong>Regensburg</strong>. Der damalige<br />
Präsident Václav Havel hob in seiner Rede vor dem bayerischen Ministerpräsidenten<br />
Edmund Stoiber im <strong>Regensburg</strong>er Schloss nicht nur die Projekte<br />
wie den Tandem, das <strong>Bohemicum</strong> oder das Collegium Carolinum hervor,<br />
die gerade auch in <strong>Regensburg</strong> (<strong>Passau</strong>, München etc.) die beiden Völker<br />
einander näher bringen, sondern blickte auch in die Vergangenheit. In den<br />
alten Steinernen Brücken in <strong>Regensburg</strong> und Prag fand er das Symbol der<br />
kulturellen Nähe, des Verbindenden. Die Prager Brücke wurde in der Presse<br />
1 Im Zusammenhang mit der Karlsbrücke vgl. u.a. Nerudas Gedicht „Na tom pražským<br />
mostě...“ (NERUDA 1924: 78).
164<br />
Marek Nekula<br />
gar als Tochter der <strong>Regensburg</strong>er Steinernen Brücke hingestellt (vgl. Fotomontagen<br />
in der Süddeutschen Zeitung oder in der Mittelbayerischen Zeitung<br />
vom 12. Mai 2000).<br />
Dies ist in gewissem Sinne auch nachvollziehbar. Als der Přemyslidenfürst<br />
Vladislav II. im Jahre 1147 von <strong>Regensburg</strong> aus zum erfolglosen Kreuzzug<br />
seines Schwagers, des Kaisers Konrad III., aufbrach, bekam er wie manche<br />
vor, neben und nach ihm die erste (bis heute erhaltene) Steinerne Brücke<br />
Mitteleuropas zu Gesicht. Der französiche Mönch Otto von Deuil hielt 1148<br />
die Teilnahme Ludwigs II. an dem Kreuzzug fest:<br />
Auch der König brach auf, nachdem er den ehrwürdigen Bischof von Arras mit dem Kanzler<br />
und dem Abt von Bertincourt nach <strong>Regensburg</strong> vorausgeschickt hatte wegen der Boten des<br />
Kaisers von Konstantinopel, die dort den König schon lange erwarteten. Bei dieser Stadt überschritten<br />
alle die Donau auf einer vortrefflichen Brücke und fanden eine große Menge von<br />
Schiffen vor, die unser Gepäck und einen Großteil des Volkes bis nach Bulgarien brachten.<br />
(zitiert nach DÜNNINGER 1996: 10)<br />
Dem Bau der Prager Steinernen Brücke ging eine Naturkatastrophe voraus.<br />
Um das Jahr 1158 wurde die alte wohl bereits im Jahre 1118 beschädigte<br />
Holzbrücke in Prag durch ein Hochwasser zerstört. 2 Als dann Vladislav II.<br />
im Jahre 1158 in Begleitung seiner Frau Judith von Thüringen in <strong>Regensburg</strong><br />
für seine militärische Hilfe im Kampf gegen die norditalienischen<br />
Städte (Mailand) von Friedrich I. Barbarossa zum König erhoben wurde,<br />
ließen er und seine Frau ihre neue königliche Würde durch den Bau der<br />
Steinernen Brücke in Prag bildlich festhalten. Die Beförderung des Přemyslidenfürsten<br />
Vladislav II. zum böhmischen König Vladislav I. ist übrigens<br />
durch ein Relief des Krönenden und Gekrönten festgehalten, die der Judithbrücke<br />
entstammt und an der östlichen Fassadenseite des Kleinseitner Turmes<br />
der Karlsbrücke zu sehen sei (KAŠIČKA 1992: 22; NEUBERT/KO-<br />
ŘÁN/SUCHOMEL 1991: 17). Da besonders die Frau des böhmischen<br />
Königs sich für den Bau der Brücke eingesetzt haben soll, wurde die Steinerne<br />
Brücke nach ihr benannt.<br />
Die romanische Judithbrücke, die Tochter der <strong>Regensburg</strong>er Brücke, 3 die<br />
zwischen 1166 und 1169 fertig gestellt wurde, war nach der <strong>Regensburg</strong>er<br />
die zweite repräsentative Steinerne Brücke in Mitteleuropa, wie dies das<br />
Material (Stein), die Ausgestaltung (Relief) und der Zeitpunkt des Baus<br />
2 Vgl. die Erwähnung bei COSMAS (1923: 219), aus der unterschiedliche Datierungen<br />
abgeleitet werden. Vgl. auch WIRTH (2003: 65), LEDVINKA/PEŠEK (2000: 63).<br />
3 Der unmittelbare Anschluss des Baus in Prag an den in <strong>Regensburg</strong>, der rege Austausch<br />
und die Wanderung von Baumeistern und Gesellen sowie Ähnlichkeiten in der Konstruktion<br />
der Steinernen Brücke in <strong>Regensburg</strong> und der Judithbrücke in Prag lassen darauf<br />
schließen, dass die Bauhütte, die die Judithbrücke errichtete, identisch war mit der,<br />
die die <strong>Regensburg</strong>er Brücke schuf (PAULUS 1989: 143).<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
(unmittelbar nach der Erreichen der Königswürde) deutlich machen. Sie<br />
wurde zur Ikone der Stärke und des Autonomieanspruchs der Přemyslidenherrscher,<br />
die jetzt zum zweiten Mal durch den Königstitel geehrt wurden.<br />
Durch diese Entstehungsgeschichte bekommt die Steinerne Brücke in Prag<br />
das Attribut „königlich“, das sie gegenüber der „kaiserlichen“ Brücke 4 in<br />
<strong>Regensburg</strong> abgrenzt und auf das sich die tschechische Kultur noch im 20.<br />
Jahrhundert bezieht.<br />
Die gotische Karlsbrücke<br />
Die romanische Judithbrücke wurde im Jahre 1342 durch ein Hochwasser<br />
derart beschädigt, dass die Naturkatastrophe den Anlass für einen Neubau<br />
gab. Im Jahre 1357 beauftragte Karl IV. Peter Parler mit dem Bau der neuen<br />
gotischen Brücke. Bautechnisch wurde sie durch die Brücke in Koblenz<br />
angeregt (vgl. SEIBT 1995: 130) und sollte – ähnlich wie einst die Judithbrücke<br />
– den neuen Stellenwert des Prager Herrschers dokumentieren, der<br />
im Jahre 1355 in Rom zum Kaiser gekrönt worden war. Prag war nicht nur<br />
Sitz des „deutschen“ (1346) und böhmischen Königs (1347), sondern wurde<br />
nun auch zur Residenzstadt des Kaisers und zum Zentrum des Reiches. Die<br />
neue Steinerne Brücke sollte Sinnbild dieser neuen Rolle und Stärke kaiserlichen<br />
Prags sein (vgl. auch die gotische Büste Karls IV. mit der Kaiserkrone,<br />
die auf dem Altstädter Brückenturm installiert wurde). Damals allerdings<br />
noch ohne Statuen. Die einzige Ausnahme bildete ein Kruzifix aus<br />
dem 14. Jahrhundert (ersetzt im Jahre 1657 durch eine im Jahre 1628 von<br />
Brohn gefertigte Kalvariengruppe aus der Gießerei Hans Hillgers).<br />
Die besondere Rolle der Steinernen Brücke in Prag kommt auch dadurch<br />
zum Ausdruck, dass sie dem heiligen Veit geweiht wurde, dem Patron der<br />
Domkirche auf der Prager Burg, der wichtigsten Kirche Böhmens, in der<br />
4 Der Bau der <strong>Regensburg</strong>er Brücke wird seit dem „bürgerlichen“ 19. Jahrhundert als Ausdruck<br />
des aufstrebenden Bürgertums verstanden, das den Bau der Brücke initiierte<br />
(SCHMID 1985: 7) und hauptsächlich finanzierte, durch die Brücke seine wirtschaftlichen<br />
Interessen stützte und deren Ikonographie prägte. Dies wird etwa durch die Abbildung<br />
Philipps von Schwaben oder Friedrichs II. deutlich, die 1230 und 1245 der Stadt Privilegien<br />
und Freiheitsrechte gewährten (vgl. PAULUS 1989: 40, 156f.). Solche Details dürften<br />
für den königlichen Besuch aus Prag (noch) kaum erkennbar sein. Bei einer solchen Feierlichkeit<br />
stand der Kaiser im Mittelpunkt, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts auch faktisch<br />
in <strong>Regensburg</strong> gegenüber dem bayerischen Herzog und dem <strong>Regensburg</strong>er Bischof<br />
(die Brücke hat keinen Patron!) seinen Einfluss bewusst ausbaute, wie dies auch das Brükkenprivileg<br />
Friedrichs I. aus dem Jahre 1182 und die rechtliche Hoheit des Kaisers über die<br />
Brücke nachvollziehbar machen. Es ist kaum vorstellbar, dass die Brücke, die „das repräsentative<br />
Tor der Stadt Regenburg“ (PAULUS 1993: 49) bildete und jahrhundertelang<br />
beim Einzug der Kaiser, Könige und Erzbischöfe zur Machtpräsentation genutzt wurde<br />
(PAULUS 1993: 50 u.a.), beim feierlichen Einzug des böhmischen Fürsten Vladislav II.,<br />
der über sie von Norden in die Stadt einzog, keine Rolle gespielt haben sollen.<br />
165
166<br />
Marek Nekula<br />
sich in der Wenzelskapelle die böhmischen Kronjuwelen befanden. Die<br />
Brücke ist also nicht nur die schnellste und direkteste Verbindung zwischen<br />
der Burg und den Prager Städten auf dem anderen Ufer der Moldau, sondern<br />
sie ist – durch den heiligen Veit spirituell mit dem Dom verbunden –<br />
auch ein böhmisches Sacrosanctum, das mit 520 m Länge, 10 m Breite und<br />
16 Brückenbögen zugleich zu einem der herrlichsten Attribute der weltlichen<br />
Macht Prags geworden ist. Die Steinerne Brücke wird nicht nur zu<br />
einem der Kronjuwele des Landes, sondern sie wird – als Verbindung zwischen<br />
dem Sitz des ersten böhmischen Königs Vratislav II. auf Vyšehrad,<br />
dessen Bedeutung noch tiefer angelegt ist, und dem aktuellen Sitz des böhmischen<br />
Königs auf dem Hradschin durch Karl IV. gar in die Krönungszeremonie<br />
eingebunden (Wenzel IV.). 5<br />
Auch wenn die Brücke erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts während der<br />
Regierungszeit Wenzels IV. fertig gestellt wurde und erst im Jahre 1464<br />
durch Jiří z Poděbrad/Georg von Poděbrady den spätgotischen Brückenturm<br />
erhielt, verbindet man sie seit dem 19. Jahrhundert mit ihrem Begründer<br />
Karl auch namentlich.<br />
Nach Hugo Rokyta (1995: 251) wurde die „Karlsbrücke“ bis in die 70er<br />
Jahre des 19. Jahrhunderts „Prager Brücke“ oder „Steinerne Brücke“ genannt,<br />
auch wenn Karel Havlíček Borovský – wohl in Reaktion auf die<br />
„deutsche“ Deutung Karls (vgl. Denkmal Karls IV. am rechten Ufer vor der<br />
Brücke aus dem Jahre 1848) – bereits 1848 die Benennung „Karlsbrücke“<br />
vorschlägt (vgl. u.a. WIRTH 2003: 69). Denn bis in die 70er Jahre des 19.<br />
Jahrhunderts gibt es keinen praktischen Grund die Prager Steinerne Brücke<br />
anders zu bezeichnen, sie ist bis ins 19. Jahrhundert hinein die einzige ihrer<br />
Art in Prag. Erst im 19. Jahrhundert werden weitere Brücken errichtet: 1841<br />
die nach Kaiser Franz I. benannte Kettenbrücke (später Legionenbrücke),<br />
die 1868 fertiggestellte Kettenbrücke in Bubny, 1865–1868 die Stahlbrücke<br />
unterhalb des Letná, 1868–1870 die Kettenbrücke bei Klárov (später Mánesbrücke)<br />
und 1871–1872 die Eisenbahnbrücke unterhalb des Vyšehrad.<br />
Diese Brücken waren aus Stahl. 1871 wird der Bau einer zweiten steinernen<br />
(Palacký-)Brücke in Prag geplant, 1876 beginnt die Bautätigkeit, die bereits<br />
zwei Jahre später abgeschlossen wird (vgl. LEDVINKA/PEŠEK 2000:<br />
5 Vgl. u.a. NEKULA (2003a) oder NEUBERT/KOŘÁN/SUCHOMEL (1991: 30). Die<br />
Steinerne Brücke in <strong>Regensburg</strong>, die in ihrer Ikonographie übrigens – wie in Anm. 4<br />
angedeutet – sehr regional ist und bleibt, nimmt nie eine solche Sonderstellung in der<br />
deutschen Kultur ein, wie die Karlsbrücke in der tschechischen Kultur, was den polyzentrischen<br />
Charakter der deutschen Kultur gegenüber dem monozentrischen der tschechischen<br />
sehr wohl illustriert, auch wenn es allein von Alter, Größe, Material und Ort<br />
her gute Anhaltpunkte gäbe.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
494). In der Folge kommt es zur Einbürgerung der Bezeichnung „Karlsbrücke“<br />
für die alte Steinerne Brücke.<br />
Die barocke Brücke als Ikone der Rekatholisierung<br />
Die heutige Gestalt der Karlsbrücke wurde in der Zeit der sog. Rekatholisierung<br />
geprägt. So wurde 1611 durch die <strong>Passau</strong>er zunächst die im dritten<br />
Viertel des 15. Jahrhunderts installierte Reiterstatue Jiří z Poděbrad/Georg<br />
von Poděbrady abgerissen (vgl. u.a. HOJDA/POKORNÝ 1997: 22). Als der<br />
Winterkönig, der die durch den Widerstand der Prager Bürger nicht realisierte<br />
Entfernung des alten Kreuzes veranlasste, 6 Prag über die Karlsbrücke<br />
verließ und nach Schlesien floh, bot sich die Brücke nach der Schlacht am<br />
Weißen Berg zur Demonstration der siegreichen kaiserlichen Macht an. So<br />
wurden hier in Stahlkörben die Köpfe der 1621 hingerichteten böhmischen<br />
protestantischen Stände und Bürger ausgestellt (KAŠIČKA 1992: 52), die<br />
als Anführer der Böhmischen Rebellion verurteilt worden waren. 7 Nach<br />
dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Brücke als die wichtigste Kommunikationsader<br />
der Stadt auch zur Demonstration der nun für alle verbindlichen<br />
und zu verinnerlichenden katholischen Religion genutzt.<br />
Diese wird auf der Brücke durch die barocken Heiligenfiguren versinnbildlicht,<br />
denen 1657 das von Ferdinand III. gespendete und neu installierte<br />
Kruzifix vorausgegangen war (LEDVINKA/PEŠEK 2000: 384; nach NEU-<br />
BERT/KOŘÁN/SUCHOMEL 1991: 39–41 von den Prager Bürgern gekauft).<br />
Zu Mäzenen dieser Kunstwerke gehörten Orden, das Prager Patriziat und<br />
der katholische Adel. Die erste Statue der – so Goll – „siegreichen Allee der<br />
katholischen Gegenreformation“ (vgl. HOJDA/POKORNÝ 1997: 26) war<br />
im Jahre 1683 die von Matthias Gottlieb Wunschwitz, Hauptmann des Kreises<br />
Pilsen (LEDVINKA/PEŠEK 2000: 384), gespendete Statue von Johann<br />
von Nepomuk (von Johann Brokof; gegossen bei J. W. Herold, Nürnberg;<br />
Original aus Holz). Der heilige Johann von Nepomuk, 1729 heilig gesprochen,<br />
avancierte daher später zum Symbol der gewaltsamen und mit vielen<br />
Opfern verbundenen Rekatholisierung der böhmischen Länder. Aus diesem<br />
Grund sowie auch wegen seiner Herkunft (er stammte aus einer Familie<br />
deutscher Kolonisten) wurde er im 19. Jahrhundert von den Tschechen als<br />
ein fremder Heiliger attribuiert (vgl. u.a. RAK 1994: 35–48).<br />
Ihm folgten – durch kirchliche Orden, die Universität (hier zum ersten Mal<br />
aufs Engste mit der Brücke verbunden) und Donatoren – weitere Statuen:<br />
1700 der hl. Wenzel (nicht erhalten), 1707 die hll. Barbara, Margarete und<br />
6 Vgl. u.a. VLNAS (1993: 58).<br />
7 NEUBERT/KOŘÁN/SUCHOMEL (1991: 39) sprechen von der Zinne des Altstädter<br />
Brückenturmes.<br />
167
168<br />
Marek Nekula<br />
Elisabeth von J. Brokof (gestiftet durch den kaiserlichen Rat Johann Wenzel<br />
Obytecký), 1707 der hl. Antonius von Padua von J. U. Mayer (gestiftet<br />
durch die Minoriten), 1707 die hl. Anna Selbdritt von M. W. Jäckel (gestiftet<br />
durf Graf Rudolf von Lisov), 1708 der hl. Augustinus von H. Kohl (gestiftet<br />
durch die Augustiner), 1708 die Madonna mit dem hl. Dominikus und<br />
Thomas von Aquin von M. W. Jäckel (gestiftet durch die Dominikaner),<br />
1708 der hl. Nikolaus von Tolentino von H. Kohl (gestiftet durch die Augustiner),<br />
1708 der hl. Judas Thaddäus von J. U. Mayer (gestiftet durch die<br />
Minoriten), 1708 der hl. Franz von Assisi von Franz ?Preiss (gestiftet durch<br />
Graf Wenzel Adalbert von Sternberg), der hl. Norbert (nicht erhalten) von<br />
F. M. Brokof (gestiftet durch Veith Seipel, Abt des Klosters in Sázava),<br />
1709 Christus mit den hll. Cosmas und Damian von J. U. Mayer (gestiftet<br />
von der Medizinischen Fakultät in Prag), 1709 der hl. Adalbert, die böhmischen<br />
Länder segnend, von J. Brokof (gestiftet vom Prager Stadtrat M. B.<br />
Joanelli), 1709 der hl. Kajetan von F. M. Brokof (gestiftet durch Graf Rudolf<br />
von Lisov), 1709 die Madonna mit dem hl. Bernhard von M. W. Jäckel<br />
(gestiftet durch die Zistenzienser), 1710 die hl. Luitgardis von M. B. Braun<br />
(gestiftet durch die Zistenzienser), 1710 der hl. Franziskus Borgia von F. M.<br />
Brokof (gestiftet durch die Jesuiten), 1711 der hl. Ivo, Patron der Rechtsgelehrten,<br />
von M. B. Braun, 1711 der hl. Ignatius von Loyola von F. M. Brokof<br />
(gestiftet durch die Jesuiten), 1711 der hl. Franziskus Xaverius von F.<br />
M. Brokof (gestiftet durch die Jesuiten), 1712 der hl. Vinzenz Ferraerius mit<br />
dem hl. Prokop von F. M. Brokof (gestiftet durch Graf Romedius J. F.<br />
Thun), 1714 der hl. Veit von F. M. Brokof (gestiftet durch den Vyšehrader<br />
Dechant, Matthäus Macht von Löwenmacht), 1714 die hll. Johann von<br />
Fatha, Felix von Valois und Ivan von F. M. Brokof (gestiftet durch Joseph<br />
Franz Thun), 1714 der hl. Philippus Benitius von M. B. Mandl und 1720 die<br />
hl. Ludmila und der kleine Wenzel von M. B. Braun (auf die Brücke übertragen<br />
1725), der zu dieser Zeit bereits für Graf F. A. Sporck arbeitete.<br />
Die Galerie der Heiligen folgte offensichtlich einem zwar offenen, doch<br />
vorgefertigten Rahmenkonzept, das ursprünglich allein von Brokof-<br />
Werkstatt umgesetzt werden sollte und das offensichtlich vom Jesuitenorden<br />
koordiniert wurde (vgl. NEUBERT/KOŘÁN/SUCHOMEL 1991: 52).<br />
Auch wenn es zu etlichen Abweichungen von diesem Konzept kam, ist das<br />
ideelle Konzept der Galerie relativ einheitlich geblieben. Sie reflektiert und<br />
befördert zugleich die sozialen Prozesse und die Ideologie ihrer Zeit. Es ist<br />
in diesem Zusammenhang nicht zu übersehen, dass am Anfang der<br />
Bauaktivitäten dieser Zeit die von Ferdinand III. angeregte Instalation des<br />
Kreuzes stand. Nicht zu übersehen ist außerdem auch die Tatsache, dass<br />
durch die Galerie der Heiligen als Ganzes die Brücke architektonische und<br />
ideologische Brücken zur Engelsbrücke in Rom als Zentrum des damals<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
sche Brücken zur Engelsbrücke in Rom als Zentrum des damals militanten<br />
Katholizismus schlägt, die die Gestalt der Prager Brücke bestimmte.<br />
Gemeinsam ist den Statuen die Tatsache, dass die Heiligen im Dienste der<br />
Rekatholisierung und Neumissionierung der böhmischen Länder stehen (so<br />
v.a. Ignatius von Loyola oder Franziskus Xaverius), mit den böhmischen<br />
Ländern bis zu diesem Zeitpunkt aber eher weniger zu tun hatten, auch<br />
wenn es hier selbstverständlich Ausnahmen gibt, die der altneuen Ideologie<br />
Legitimität verleihen sollen: hl. Wenzel, hl. Ludmila, hl. Adalbert u.a. (Karel<br />
IV. legte folgende Landesheilige fest: hll. Veith, Wenzel, Adalbertus,<br />
Ludmila, Prokop und Siegmund; im frühen Mittelalter war Verehrung von<br />
Cosmas und Damian lebendig). Zumindest aus der nationalen Perspektive<br />
des 19. Jahrhunderts sind es in der Regel ,fremde‘ Heilige, die in Spanien,<br />
Italien oder Süddeutschland verehrt wurden und im Laufe der Rekatholisierung<br />
– ähnlich wie der Kult von Johann von Nepomuk – mit den neuen katholischen<br />
Eliten nach Böhmen gekommen waren oder erstarkt hatten, 8<br />
während die protestantischen Eliten enteignet und ins Exil getrieben oder<br />
zwangs(re)katholisiert wurden.<br />
Als ,fremd‘ empfindet die Brückenheiligen zumindest der erwachende<br />
tschechische Nationalismus. Hojda/Pokorný (1997: 22f.) zitieren in diesem<br />
Zusammenhang aus der Handschrift von Jan Jeník z Bratřic aus den 1830er<br />
Jahren, der empfiehlt:<br />
[...] na místě těch ničemných cizozemcův, tak nazvaných svatých – (jenž českému národu v<br />
tom nejmenším prospěšni nebyli – ba! i mnohý hňup z nich in sua simplicatate beata, tj. ve své<br />
blahoslavené ničemnosti ani nevěděl, že království České v Evropě se nachází) raději k okrášlení<br />
téhož mostu jakési statue neb sochy našich znamenitých vlastencův, kp. nepřemožitelného<br />
vůdce Táboritů Jana Žižky z Trocnova – našeho nejvýbornějšího krále Jiřího z Poděbrad, –<br />
velmi učeného Adama z Veleslavína, [...] Amos Comeniusa a tak mnoho jiných, – byli [sic!] se<br />
k zasloužilé památce postavili.<br />
[...] anstelle der niederträchtigen Fremdlinge, der so genannten Heiligen – (die der tschechischen<br />
Nation nicht im geringsten vom Nutzen waren – ja! von denen der eine oder der andere<br />
in sua simplicata beata, d. h. in ihrer Niederträchtigkeit gar nicht wussten, das sich das Königreich<br />
Böhmen in Europa befindet) zur Zierung derselben Brücke lieber Statuen oder Skulpturen<br />
unserer ausgezeichneten Patrioten, z.B. des unbesiegbaren Anführer der Taboriten Jan Žižka<br />
von Trocnov – unseres allerbesten Königs Jiří/Georg von Poděbrady, – des sehr gelehrten<br />
Adam z Veleslavína, [...] Amos Comenius’ und vieler anderen, die zur verdienten Erinnerung<br />
aufgestellt werden dürften.<br />
Aus der Perspektive der katholischen Ideologie ist dagegen der hl. Johann<br />
von Nepomuk nahezu genial gewählt. Man glaubt in ihm einen einheimi-<br />
8 Zur Verbreitung des Kults des hl. Johann von Nepomuk vgl. VLNAS (1993: 54), der<br />
ihn für die Zeit mit dem Jesuitenorden (1993: 54), im für uns relevanten Zeitraum mit<br />
Kaiser Karl VI. verbindet (ebd.: 192).<br />
169
170<br />
Marek Nekula<br />
schen, böhmischen und den Dogmen der Kirche gegenüber loyalen Heiligen<br />
zu finden, dem sich die Herzen der Böhmen am ehesten öffnen und durch<br />
den die neue Macht und Ideologie am ehesten Legitimität finden könnte.<br />
Mit dem hl. Johann von Nepomuk knüpft man außerdem bewusst an die<br />
Zeit des frommen, dem Papst und der Kirche ergebenen Karl IV. an, d.h. an<br />
die Zeit und die Werte vor dem „hussitischen Chaos“ und der später einsetzenden<br />
Reformation. Schließlich besetzt Johann von Nepomuk die Rolle,<br />
die einst Jan Hus ausfüllte. Während Jan Hus die Wahrheit Christi (Christus)<br />
und „seine Lehre“ (Evangelium) nicht verleugnete und die Treue<br />
(Loyalität) zu Christus bis zum Tode bewies, blieb Johann von Nepomuk<br />
nach der Legende seinem priesterlichen Gelöbnis (Einhaltung des Beichtgeheimnisses)<br />
und dadurch der Kirche (dem Dogma) bis zum Tode treu. 9<br />
Weil für die beiden das WORT (Evangelium Christi vs. kirchliches Dogma),<br />
an das sie glaubten und dem sie sich verpflichteten, und die ZUNGE,<br />
die das Wort symbolisiert, von zentraler Bedeutung sind, will Ferdinand<br />
Břetislav Mikovec im Jahre 1849 im Kult von Johann von Nepomuk eine<br />
bewusste ideologische Manipulation erkannt haben. 10<br />
Auch der heilige Wenzel wird im Übrigen in Folge seiner ungewollten Instrumentalisierung<br />
während der Rekatholisierung der böhmischen Länder<br />
(Wenzel-Bibel, Verlagsaktivitäten „Wenzels Erbe“...) v.a. in der 2. Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts zum sprachnational fragwürdigen Heiligen (vgl. RAK 1996),<br />
der dieses Image erst allmählich wieder loswerden konnte, wie dies auch die<br />
Parlamentsdebatte über die Einrichtung des staatlichen Feiertages am 28. September<br />
zwischen den Christ- und Sozialdemokraten (Miloš Zeman) deutlich<br />
macht.<br />
Die Palackýbrücke (Polemik gegen die Karlsbrücke)<br />
Doch gerade durch die Symbolik der barocken Statuen von Johann von Nepomuk<br />
und den anderen Heiligen, die allerdings bis ins 19. Jahrhundert hinein<br />
Gegenstand einer aufrichtigen religiösen Verehrung blieben (vgl.<br />
HOJDA/POKORNÝ 1997: 24), ist die Karlsbrücke als ausgeprägtes Zeichen<br />
der Zeit der Finsternis für die tschechische nationale Ideologie des 19.<br />
Jahrhunderts (F. Palacký, T. G. Masaryk, J. Goll) nicht akzeptabel, wie dies<br />
9 Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Beichte<br />
in der Zeit der Rekatholisierung eine neue Bedeutung erhielt und neu auf- bzw. umgewertet<br />
wurde. Die jährliche Pflichtbeichte – gewöhnlich zu Ostern – wurde zur Pflicht.<br />
An den bürokratisch geschickt geführten Listen der Beichtenden wurde der Erfolg der<br />
Rekatholisierung und die individuelle Identifikation mit dem altneuen Glauben gemessen.<br />
– Vgl. VLNAS (1993: 74).<br />
10 So auch die tschechische Publizistik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. – Vgl.<br />
dazu VLNAS (1993: 51, 56).<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
auch bei Jan Neruda zu erkennen ist (vgl. HOJDA/POKORNÝ 1997: 26;<br />
ohne Präzisierung). Die Intensität der Verbindung der Ikonographie der<br />
Karlsbrücke mit der Rekatolisierung, von der das säkulare Zeitalter in bewusster<br />
Polemik nur die äußere und aus der kritischen Perspektive des 19.<br />
Jahrhunderts inhaltlich weitgehend entleerte Hülle – so Jan Neruda in seinem<br />
Gedicht Malostranská povídka (1876) 11 – wahrnimmt, ist auch im<br />
Kontext der Autoren der tschechischen Moderne erkennbar. So inszenierten<br />
etwa Julius Zeyer in seinem Inultus (1895) oder Jiří Karásek ze Lvovic in<br />
seiner Legende Maria Elekta (1922) die Barockzeit und die Rekatholisierung<br />
gerade über die Karlsbrücke (vgl. auch NEKULA <strong>2004</strong>b). Auch Alois<br />
Jirásek evoziert in seinem Roman Temno (Finsternis, 1915) im Zusammenhang<br />
mit dem Kaiser Karl VI. die Zeit der Finsternis kontrastreich über die<br />
großzügig „beleuchtete“ und durch zahlreiche neue Statuen gezierte Karlsbrücke,<br />
der der „mächtige, traurige Schatten“ des Bergs „Žižkov“ (damals<br />
wohl eher noch Vítkov) entgegengesetzt wird, wobei hier Schatten und<br />
Licht ironisch ausgetauscht werden:<br />
Že však byla hustá mlha, mnoho kolem sebe neviděl. V ní ztratila se Vltava na levo a lada při<br />
ní; Žižkov v pravo tyčil se jako ohromný, chmurný stín. (JIRÁSEK 1930: 15)<br />
[...] a na mostě, kdyby věděla, na kamenném mostě jaká krása, co nových statuí, že když byl on<br />
naposledy v Praze před šestnácti lety, že jich bylo jenom asi šest, a teď, že těch statuí plný most<br />
v pravo, v levo, a večer co světel, to že je teď taková novota, také pro ten císařův příjezd, věc<br />
nebývalá, lucerny, na dvě stě luceren, ty že teď každý večer hoří v ulicích od Pražské brány<br />
přes rynk a jezovitskou ulicí a přes kamenný most, Malou Stranou až nahoru na hrad, celou<br />
Ostruhovou ulicí, jistě na dvě stě luceren, lojem a slaninou v nich svítí, ta řada světel na mostě,<br />
to že je tuze pěkné. (JIRÁSEK 1930: 18)<br />
Aber da es dichten Nebel gab, konnte ich nicht viel sehen. In diesem Nebel verschwand die<br />
Moldau auf der linken Seite und die Wiesen um sie herum; Žižkov ragte auf der rechten wie<br />
ein riesiger, trauriger Schatten.<br />
[...] und auf der Brücke, wenn sie wüsste, auf der Steinernen Brücke was für eine Schönheit, so<br />
viele neue Statuen, vor sechzehn Jahren, als er zum letzten Mal in Prag war, gab es nur etwa sechs<br />
davon, und jetzt säumen diese Statuen die Brücke links und rechts, und abends gibt es viele Lichter,<br />
dies ist hier neu, auch durch die Ankunft Kaisers veranlasst, eine ungewöhnliche Sache, die<br />
Laternen, etwa zwei hundert Laternen, die leuchten jetzt jeden Abend in den Straßen vom Prager<br />
Tor über den Ring und die Jesuitenstraße und über die Steinerne Brücke und die Kleinseite bis<br />
hinauf zur Burg, in die Steigbügelstraße, sicher etwa zwei hundert Laternen, in denen Fett verbrannt<br />
und Licht erzeugt wird, diese Reihe von Lichtern auf der Brücke ist sehr schön.<br />
11 Neruda stilisiert darin ein fiktives Gespräch zwischen dem Wanderer und Johann von<br />
Nepomuk über die anschaulich beschriebenen körperlichen Reize von schönen Kleinseitner<br />
(Dienst-)Mädchen, die am Ufer der Moldau (ihre) Wäsche waschen. So vermenschlicht<br />
er Johann von Nepomuk einerseits, markiert aber deutlich seine Distanz zur<br />
überspannten Religiosität und religiösen Symbolik der Barockzeit und der Allee der<br />
Heiligen auf der Karlsbrücke. – Vgl. NERUDA (1924: 233–234).<br />
171
172<br />
Marek Nekula<br />
Die mit der Ikonographie der Karlsbrücke verbundenen Bedenken sind<br />
nicht überraschend. Die tschechische nationale Ideologie des 19. Jahrhunderts<br />
schöpfte nämlich ihr Selbstverständnis aus der antikatholisch, protestantisch<br />
gedeuteten ,nationalen Wiedergeburt‘, die den ,Tod‘ der Nation<br />
nach der Schlacht am Weißen Berg und der anschließenden Rekatholisierung<br />
und Germanisierung – die sog. Zeit der Finsternis – überwunden hätte,<br />
was u.a. auch im Spiel des ,Lichts“ (Burg, Hintergrund) und des ,finsteren<br />
Schattens‘ (Statuen) auf unterschiedlichsten Fotos der Karlsbrücke zum<br />
Ausdruck kommt (vgl. z.B. PLICKA 1969: 12).<br />
Der Namensgeber der Brücke selbst ist ein Doppelgänger, der sowohl als<br />
römischer, ,deutscher‘ Kaiser Karl IV. als auch böhmischer, ,tschechischer‘<br />
König Karel I. als Ikone des Reiches und des Königreiches deutbar ist und<br />
daher zunächst nicht in das tschechoslavische Pantheon integriert wurde. So<br />
taucht er etwa unter den denkwürdigen Gestalten des tschechoslavischen<br />
Slavín in Tupadly gar nicht auf (dazu mehr NEKULA 2003a).<br />
Der tschechische nationale Diskurs wusste Karl IV. als böhmischen König<br />
Karel I. intensiver erst im Zusammenhang mit dem Todesjahr (1278/1878)<br />
und mit der Teilung der Universität (1882) zu entdecken, auch wenn selbstverständlich<br />
auch vorher bei Karl betont wird, dass er ein „römischer Kaiser<br />
und König von Böhmen“ war (vgl. MIKOVEC 1860–6/2: 2 – kursiv von<br />
M.N.). Nach der Teilung der Universität im Jahre 1882 wird aber Karl aus<br />
tschechischer Perspektive zum eindeutig „tschechischen“ Herrscher, der<br />
nicht nur Wenzel getauft wurde, sondern sich auch zur (Přemyslidischen)<br />
Tradition Wenzels bekennt. Der tschechische nationale Diskurs legte allerdings<br />
Betonung auf das Přemyslidische, das Tschechentum, die sprachlich<br />
geprägte Vaterlandsliebe. So heißt es in einer illustrierten Geschichte von<br />
Jan Dolanský aus dem Jahre 1894, die auch in der Tschechoslowakei mehrere<br />
Auflagen erreichte:<br />
Nejkrásnější a nejpožehnanější dobou v dějinách českých jest vladařství Karla I. Od dvou set<br />
let nezasedl na staroslavný stolec Přemyslovců panovník, který by tak vroucně miloval zemi<br />
českou a rodný náš jazyk jako on. Hrd byl povždy na to, že jest potomkem starého rodu Přemyslova,<br />
a vyšší touhy neznal, než prospěti vlasti své a zvelebiti ji.“ (DOLANSKÝ 1894: 182)<br />
Die schönste und gesegnetste Zeit in der tschechischen Geschichte war die Regierungszeit<br />
Karls I. Seit zweihundert Jahren saß auf dem altehrwürdigen Thron der Přemysliden kein Herrscher,<br />
der das tschechische Land und unsere Muttersprache so geliebt hätte wie er. Stolz war er<br />
stets darauf, dass er aus dem alten Geschlecht des Přemysl stammt, und er kannte keine höhere<br />
Sehnsucht, als dem Vaterlande nützlich zu sein und dieses gedeihen zu lassen.<br />
Auch im tschechischen Nationaltheater wird Karl in der königlichen Loge<br />
als König mit der Krone des hl. Wenzel und mit der Gründungsurkunde der<br />
Universität dargestellt.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
Für den nationalen Diskurs wurde Karl – von der ,deutschen‘ Seite – bereits<br />
in den 1840er Jahren entdeckt. Im Zusammenhang mit dem 500. Jubiläum<br />
der Universität (1348/1848) gedenken die deutschen Professoren der Karls-<br />
Universität Karl IV. Sie geben ein (neogotisches) Denkmal Karls IV. in<br />
Auftrag, für das sie Geld sammeln, das von deutschen Künstlern ausgeführt<br />
und das vor dem Altstädter Brückenturm im März 1848 installiert wurde<br />
(mehr dazu vgl. KUNŠTÁT 2000). Dass es nie feierlich enthüllt wurde,<br />
lag es einerseits an Unruhen in Prag, andererseits an der Ausgestaltung des<br />
Denkmals, denn Karls Kaiserkrone auf dem Denkmal entsprach kaum den<br />
böhmischen Autonomiebestrebungen dieser Zeit, hinter denen vor allen die<br />
Repräsentanten der Tschechen standen. Es ist daher kein Wunder, dass die<br />
Karlsbrücke in Prag, die so seit den 1870er Jahren genannt wird, in dieser<br />
Zeit von deutscher Seite als Ikone des Reiches gedeutet und auf tschechischer<br />
Seite im Wesentlichen auch so wahrgenommen wird, auch wenn Karel<br />
Havlíček Borovský bereits im Jahre 1848 einen Vorstoß in eine andere<br />
Richtung versucht hatte.<br />
Sichtbar wird dies an der Konzeption der zweiten steinernen Brücke in<br />
Prag, die in den Jahren 1876–78 (J. Reiter, B. Münzberger, J. V. Myslbek)<br />
zwischen Smíchov und Podskalí erbaut wurde. Ihre Ikonographie trat nämlich<br />
in einen polemischen Dialog mit der Ikonographie der Karlsbrücke. So<br />
wurde die Brücke aus Stein in tschechoslavischen nationalen Farben (weißrot-blau)<br />
12 erbaut (vgl. auch LEDVINKA/PEŠEK 2000: 494), nach Palacký<br />
benannt und in den 1880er und 1890er Jahren mit vier auf Motiven der slavischen<br />
Mythologie basierenden Statuengruppen versehen („Libuše und<br />
Přemysl“ und „Lumír und das Lied“ auf dem linken Brückenkopf, „Ctirad<br />
und Šárka“ und „Záboj und Slavoj“ auf dem rechten Brückenkopf), die auf<br />
die damals noch für echt gehaltenen Grünberger und Königinhofer Handschrift<br />
anspielen. Hier werden Verbindungen zwischen der (tschecho)slavischen<br />
als ,authentische‘ Geschichte verstandenen Mythologie und<br />
der Gegenwart hergestellt. So ist der eine Brückenkopf der Palackýbrücke<br />
mit den Statuen der mythischen Libuše/Libussa und Přemysl geschmückt,<br />
der andere mit dem bereits 1876 geplanten und 1912 aufgerichteten Palacký-Denkmal<br />
von Stanislav Sucharda. František Palacký, der an die Echtheit<br />
der so genannten Handschriften glaubte, zeichnete allerdings auf dieser<br />
Grundlage die (tschecho)slavische Frühgeschichte der Zeit Libussas als<br />
goldenes Zeitalter der liberal-demokratischen Werte und der politischen und<br />
12 Man kann die Protestfarben als Anspielung an die französische Trikolore und die demokratische<br />
Tradition der Französischen Revolution oder eben als Anspielung an die russische<br />
Trikolore und das Slaventums verstehen, jedenfalls als bewusste Absetzung von<br />
den böhmischen Landesfarben, die beide Sprachnationen einschließen.<br />
173
174<br />
Marek Nekula<br />
kulturellen Autonomie, deren Höhepunkt (nach ihm und Masaryk) im Hussitismus<br />
bzw. der anschließenden Reformation erreicht wurde.<br />
Im Böhmen des 19. Jahrhunderts beinhaltete die Proklamation demokratischer<br />
Werte die Forderung nach Gleichberechtigung beider Landessprachen<br />
und -nationen. Palacký projizierte damit ein politisches Programm in die<br />
Vergangenheit, das er in der Gegenwart verwirklicht sehen wollte. Auch<br />
deswegen wurde Palacký zum Patron dieser Brücke. Seine Nachkommen<br />
führten durch seine Brücke, deren Ikonographie mit Heidentum, Husitismus<br />
(Reformation) und Demokratie verbunden ist, 13 eine Polemik mit der Ikonographie<br />
der Karlsbrücke, die zu diesem Zeitpunkt für Dynastie und Katholizismus<br />
stand. Dadurch steht die Ikonographie der Palackýbrücke im<br />
klaren Widerspruch zur Ikonographie der Karlsbrücke. Zugleich ging es in<br />
diesem Diskurs um die Bestimmung Prags und Böhmens, der auch über die<br />
Besetzung und ideologische Ausgestaltung des öffentlichen Raumes ausgetragen<br />
wurde.<br />
Dieser vom tschechisch dominierten Magistrat konsequent geführte Kampf<br />
um den öffentlichen Raum ist auch an der Ausgestaltung der Palackýbrücke<br />
sichtbar. Der Libuše-Kult, der im tschechischen Nationaltheater zu Anfang<br />
der 1880er Jahre durch die innere und äußere Ausgestaltung des Theaters<br />
sowie etwa durch Smetanas Oper Libuše 14 zelebriert wird, wurde auf der<br />
Palackýbrücke von Josef Václav Myslbek aufgegriffen, der ebenfalls an der<br />
Ausgestaltung des tschechischen Nationaltheaters mitwirkte. Libuše, als<br />
,historisch belegbare‘ Begründerin des Přemyslidischen (böhmischen) Staates,<br />
wird verstanden als Quelle und Symbol der böhmischen/tschechischen<br />
politischen und kulturellen Autonomie und Verkörperung von demokratischen<br />
Traditionen der böhmischen/tschechischen Staatlichkeit. Gerade im<br />
Zusammenhang mit der Palackýbrücke bringt dies Jaroslav Vrchlický<br />
(1902: 149, 148) in seinem Zyklus Sochy na mostě Palackého [Statuen auf<br />
der Palackýbrücke], der Josef [Václav] Myslbek gewidmet ist, auf den<br />
Punkt, indem er „unser“ „königliches, großes, berühmtes“ Prag, das durch<br />
die „Fürstin und Mutter der Tschechen“ Libuše gegründet und geheiligt<br />
wurde, mit der „kaiserlichen Reichsstadt“ Prag Karls IV. kontrastiert, wie<br />
Prag und Karl IV. in der deutschböhmischen Literatur seit den 1840er Jahren<br />
bis in das 20. Jahrhundert wiederholt reflektiert wurde. 15<br />
13 Zur ursprünglichen Ausgestaltung des Denkmals vgl. HOJDA/POKORNÝ (1997: 98).<br />
14 Zu Anfang der 1870er Jahre für die geplante und nicht verwirklichte Krönung Franz Josephs<br />
I. komponiert und 1881 uraufgeführt (vgl. z.B. REGLER-BELLINGER/SCHENCK/<br />
WINKING 1983/1996: 385).<br />
15 So etwa bei Hans Watzlik (für diesen Hinweis danke ich Václav Maidl). Die Öffnung<br />
der Palackýbrücke in Richtung Emaus-Kloster Na Slovanech, das von Karl IV. gegrün-<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
Kafkas Čech-Brücke<br />
Diese nationale Polarisierung, die dem Prager Stadtbild wie ein Stempel<br />
aufgedrückt wird, lehnte Franz Kafka – gerade im Zusammenhang mit dem<br />
Palacký-Denkmal – entschieden ab:<br />
Wenn es möglich wäre diese Schande und mutwillig-sinnlose Verarmung Prags und Böhmens<br />
zu beseitigen, daß mittelmäßige Arbeiten wie der Hus von Šaloun oder miserable wie der Palacký<br />
von Sucharda ehrenvoll aufgestellt werden [...]. (BROD/KAFKA 1989/2: 395)<br />
Mit der Frage der Assimilation und des Konformismus, der Akkulturation<br />
zum Deutschtum oder zum Tschechentum, die durch den immer stärker<br />
werdenden deutschen und tschechischen Nationalismus in Böhmen erzwungen<br />
und von der Vätergeneration akzeptiert wurde, setzte sich Kafka bezeichnenderweise<br />
in seiner Erzählung Das Urteil auseinander, in der an zentraler<br />
Stelle das Motiv der Brücke erscheint. Dieser Text entstand im<br />
September 1912, also beinahe zeitgleich mit Kafkas skeptischer Reflektion<br />
des Sprachenkampfes in Böhmen (1911), kurz nach Kafkas jüdischer Wiedergeburt<br />
(1911/1912), und nach der Enthüllung des Palacký-Denkmals am<br />
Brückenkopf der Palackýbrücke am 1. Juli 1912 unter großem politischem<br />
Aufgebot im Anschluss an das 6. Sokol-Treffen. 16 Kafkas Erzählung, in der<br />
man etliche Biographeme erkennen kann, dürfte daher nicht nur als Polemik<br />
gegen den Vater und seinen unentschlossenen Assimilationismus gelesen<br />
werden, sondern auch – durch das Motiv der Brücke – als verdeckte Polemik<br />
gegen die sprachnationalen Selbstentwürfe der Deutschen und Tschechen.<br />
Diesen konnte ein Prager Flaneur (und damit auch Franz Kafka) im damaligen<br />
Prag fast überall, selbst auf den Brücken (Karlsbrücke vs. Palackýbrücke)<br />
begegnen, die sonst – als Verbindung von gegensätzlichen Ufern – das Verbindende<br />
bzw. gar die Verbindung von Gegensätzen konnotieren.<br />
Bei Kafka rückt dagegen im Urteil im Zusammenhang mit der Brücke, die<br />
man als die 1905–1908 erbaute und aus dem assanierten jüdischen Ghetto<br />
führende Čech-Brücke identifizieren kann, 17 das mit der Brücke eng verbundene<br />
Motiv des Scheiterns, des Versagens und des Selbstmordes in den<br />
det und mit slavischer Liturgie verbunden war, lässt sich in diesem Zusammenhang als<br />
Versuch einer alternativen, slavischen Lesart Karls verstehen, die – unter Betonung von<br />
dessen Přemyslidischen Wurzeln – im Zusammenhang mit der Teilung der Universität<br />
stärker geworden ist. Einer anderen Strategie, die das Konzept Karls IV. als römischen<br />
Kaisers deutscher Nation in Frage stellt, begegnet man in Nerudas Romance o Karlu IV.<br />
(Romanze über Karl IV.), in der Karl als Erbe der französischen, jedenfalls nicht deutschen<br />
Kultur darstellt wird. – Vgl. NERUDA (1984).<br />
16 Festredner war Karel Kramář, der bei dieser Gelegenheit die Verwaltungs- und Gesetzesautonomie<br />
für das Königreich Böhmen verlangte. – Vgl. HOJDA/POKORNÝ (1997: 102).<br />
17 Diese Brücke sowie ihren Bau konnte Kafka aus den Fenstern der elterlichen Wohnung<br />
beobachten. Zu Topographie vgl. u.a. BINDER (1979).<br />
175
176<br />
Marek Nekula<br />
Vordergrund. Während die Statuen auf der Karls- und Palackýbrücke gegensätzliche<br />
unbeweglich versteinerte ,nationale‘, in den Straßenkämpfen<br />
,laut‘ vertretene Programme verkörpern und plakativ verbildlicht gegeneinander<br />
stehen, huscht der flüchtige Schatten des Selbstmörders über diese<br />
„jüdische“, ohne Abbildungen des Menschlichen erbaute Brücke, der sich –<br />
ohne fremdes Zutun, wie dies einst bei Johannes von Nepomuk der Fall war<br />
– im „geradezu unendlichen Verkehr“ „leise“ von dem Brückengeländer in<br />
den Fluss hinabfallen lässt (vgl. KAFKA 1994/1: 52). Denn Kafka ist sich<br />
im Unterschied zum lavierenden Vater der Unversöhnlichkeit der nationalen,<br />
selbst über die Brücken ausgetragenen Ideologien, der Unmöglichkeit<br />
einer bedingungslosen einseitigen Loyalität und einer in dieser Welt erwarteten<br />
vollen Assimilation sowie der Unannehmbarkeit des assimilatorischen<br />
Lebensentwurfs seines Vaters im Klaren. Ein Gegenentwurf wird aber nicht<br />
als Ausweg empfunden. Im Hinblick auf die Intensität der nationalen Konflikte<br />
stellte sich – für ihn 18 und andere Juden – das Gefühl der Ausweglosigkeit,<br />
des zwanghaften Scheiterns ein.<br />
Falls das von Rokyta (1995: 257) veröffentlichte Gedicht, das sich auf die<br />
Karlsbrücke bezieht, tatsächlich von Kafka stammt, zeichnet sich im Übrigens<br />
dieses Motiv bei Kafka bereits sehr früh ab:<br />
Menschen, die über dunkle Brücken gehen,<br />
vorüber an Heiligen<br />
mit matten Lichtlein.<br />
Wolken, die über grauen Himmel ziehn<br />
Vorüber an Kirchen<br />
Mit verdämmerten Türmen.<br />
Einer, der an der Quaderbrüstung lehnt<br />
Und in das Abendwasser schaut,<br />
die Hände an alten Steinen.<br />
Franz Kafka, 1903<br />
Kafka kannte übrigens die Topographie und Ikonographie der Prager Brükken<br />
sehr gut. Im Brief an Milena vom 25.–29. Mai 1920 schreibt er:<br />
Vor einigen Jahren war ich viel im Seelentränker (maňas) auf der Moldau, ich ruderte hinauf<br />
und fuhr dann ganz ausgestreckt mit der Strömung hinunter, unter den Brücken durch.<br />
(KAFKA 1998: 21)<br />
Im Zusammenhang mit einer Welle von antisemitischen Pogromen, die in<br />
den Jahren 1918 bis 1920 periodisch wiederkehrten, kommt die Perspektivlosigkeit<br />
der jüdischen Existenz zwischen zwei verfeindeten Nationen in<br />
18 Georg Bendemann scheitert in der Erzählung Das Urteil mit seinem Lebensentwurf<br />
ähnlich wie sein einstiger Freund, der in Russland nicht einmal den Zugang zur „Kolonie<br />
seiner Landsleute“ (KAFKA 1994/1: 39), d.h. wohl der Juden, finden konnte.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
Kafkas Brief an Milena vom 17.–19. November 1920 sehr markant zum<br />
Ausdruck:<br />
Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhaß. „Prašivé plemeno“<br />
habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. (KAFKA 1998: 288)<br />
Das Gespür für nationale Inszenierung des öffentlichen Raums in Prag zeigte<br />
im übrigen Kafka bereits früher (Hradschin vs. Vyšehrad, vgl. NEKULA<br />
2003a, <strong>2004</strong>a). Indem er die Brücken von unten betrachtet, sieht er nicht nur<br />
ihre Kehrseiten, sondern auch die Kehrseiten der Ideologien, die sich hinter<br />
der ideologisch geprägten Ausgestaltung verbergen.<br />
Slavisierung der Karlsbrücke<br />
Die Polarisierung zwischen der Palacký- und der Karlsbrücke entkräftet<br />
sich jedoch im Laufe der Zeit. Infolge des nationalen Diskurses um Karl IV.<br />
bzw. Karl I. und im Hinblick auf die dominante Stellung der Tschechen im<br />
Prager Magistrat erfolgt seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eine allmähliche<br />
Umgestaltung der Karlsbrücke, die zunehmend slavisiert wird.<br />
Anlass für die Neugestaltung der Brücke gab das Jahr 1848. Die Brücke<br />
wurde während des Pfingstaufstandes teilweise zerstört. So wurden u.a. Statuen<br />
und Statuengruppen mit dem hl. Wenzel auf der Brücke installiert, wie<br />
die der hll. Norbert, Wenzel u. Sigismund (1853) oder die des hl. Wenzel<br />
(1858) von J. K. Böhm. Seit den 1880er Jahren, in denen der nationale Diskurs<br />
immer mehr zu einem nationalistischen mutiert, kommt es auf der<br />
Karlsbrücke zu einigen Baumaßnahmen, die den ,antitschechischen‘ Charakter<br />
der durch die Rekatholisierung geprägten Karlsbrücke abschwächen<br />
und den slavischen Charakter stärken.<br />
So wurde im Jahr 1884 die Roland-Statue, der Braunschweiger, der sog.<br />
Bruncvík von L. Šimek neu entworfen und errichtet. Dieser Errichtung folgte<br />
eine Adaptation der spätmittelalterlichen (heraldischen) Legende von<br />
Alois Jirásek in seinen Staré pověsti české (Alttschechische Sagen; mit Illustrationen<br />
von Mikoláš Aleš im Jahre 1894), mit der auch andere tschechische<br />
Sagen evoziert wurden, wie jene über die vom heiligen Wenzel angeführten<br />
Blaník-Ritter, die das von allen Seiten umzingelte Böhmen retten<br />
sollen: 19<br />
A zázračný Bruncvíkův meč?<br />
Ten je pevně a hluboko zazděn v Karlově mostě do pilíře, tam, kde stojí socha Bruncvíkova,<br />
mající u nohou podobu lva. Tam dal Bruncvík před svou smrtí meč tajně zazdíti, tam odpočívá<br />
ta čarovná zbraň již staletí a objeví se, teprve až bude v Českém království nejhůře. Když naše<br />
19 Zur positiven Wahrnehmung der Bruncvík-Statue bei Neruda vgl. HOJDA/POKORNÝ<br />
(1997: 24).<br />
177
178<br />
Marek Nekula<br />
vlast bude nejvíce sklíčena, přitrhnou od Blaníka svatováclavští rytíři na pomoc a sám svatý<br />
dědic české země je povede.<br />
A tu pak pojede po Karlově mostě, zakopne jeho brůna (bělouš) a vyrýpne kopytem z kamení<br />
Bruncvíkův meč. Toho se svatý Václav chopí a v tuhé seči pak jím nad hlavou zatočí a zvolá:<br />
„Všem nepřátelům země české hlavy dolů!“<br />
Tak se stane a bude svatý pokoj v naší vlasti. (JIRÁSEK 2001: 148)<br />
Und Bruncvíks Zauberschwert?<br />
Das ist fest und tief in die Karlsbrücke eingemauert, in denselben Pfeiler, auf dem das Standbild<br />
Bruncvíks, mit dem Löwen zu seinen Füßen, steht.<br />
Dort ließ Bruncvík vor seinem Tod das Schwert heimlich einmauern, dort ruht diese Wunderwaffe<br />
schon Jahrhunderte und wird erst dann wieder ans Licht kommen, wenn es um das Königreich<br />
Böhmen am schlimmsten bestellt sein wird. Wenn unser Vaterland in der höchsten<br />
Not ist, werden ihm aus dem Blaník die St. Wenzelsritter zur Hilfe eilen, und der heilige Wenzel<br />
selbst, der Erbe des Böhmerlandes, wird sie anführen.<br />
Und wenn er dann über die Karlsbrücke reitet, wird sein Schimmel stolpern und mit seinem Hufe<br />
Bruncvíks Schwert aus dem Gestein brechen. Und der heilige Wenzel wird es ergreifen und über<br />
seinem Haupte schwingen und rufen: „Allen Feinden des Heimatlandes die Köpfe ab!“ So wird es<br />
geschehen, und heiliger Friede wird herrschen im Böhmerlande. (JIRÁSEK 1963: 158–159)<br />
Nach dem Hochwasser im Jahre 1890, bei dem die Statue des hl. Ignatius<br />
von Loyola (1711; F. M. Brokof), des Begründers des Jesuitenordens, vom<br />
Wasser ,verschluckt‘ wurde, kehrte diese Statue nicht mehr auf die Karlsbrücke<br />
zurück. An ihrer Stelle platzierte man die Slawenapostel Cyril a Metoděj<br />
(Kyrill und Method) von Karel Dvořák von 1928–1938.<br />
Durch die Aufstellung der Wenzelsstatue (1912, enthüllt 1913) von Josef<br />
Václav Myslbek auf dem Wenzelsplatz, die die 1678 aufgestellte und 1879<br />
entfernte Reiterstatue des hl. Wenzel von J. J. Bendl ersetzt, konnten<br />
schließlich auch die Wenzelsstatuen auf der Karlsbrücke, die zunächst mit<br />
der Rekatholisierung in Zusammenhang gebracht wurden, reinterpretiert<br />
werden. Das Reiterstandbild des bewaffneten Fürsten mit Lanze lässt Wenzel<br />
nun mehr als Schutzpatron der tschechischen Nation und weniger als<br />
Vorkämpfer der Rekatholisierung, mehr als kämpfenden Ritter und weniger<br />
als ,servilen‘ Märtyrer erscheinen, wie er – auch auf Grund der Stilisierung<br />
und Inszenierung im Kontext der frühmittelalterlichen Legenden und der<br />
Rekatholisierung der böhmischen Länder – in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
wahrgenommen wurde.<br />
Statuen des heiligen Johann von Nepomuk, der als Sohn deutscher Kolonisten<br />
in Böhmen und als Symbolfigur der im kollektiven Gedächtnis negativ<br />
empfundenen Rekatholisierung von den Tschechen nicht als nationaler Heiliger<br />
wahrgenommen wurde, wurden in den Jahren 1919–1921 – ähnlich<br />
wie andere Sinnbilder der Habsburgischen (,deutschen‘) Herrschaft – entfernt,<br />
beschädigt oder zerstört (vgl. u.a. HOJDA/POKORNÝ 1997: 30, KALLERT<br />
(2003) u.a.m.). Die Nepomuk-Statue auf der Karlsbrücke, der nach der Entstehung<br />
der Tschechoslowakei ebenfalls der Abriss drohte (vgl. HOJ-<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
DA/POKORNÝ 1997: 26), wurde dadurch – anders als die neu interpretierten<br />
Wenzel-Statuen – isoliert und semiotisch in den Hintergrund gedrängt.<br />
(In diesem Zusammenhang wäre auch die Ersetzung des staatlichen Feiertages<br />
für Johann von Nepomuk durch einen für Jan Hus zu erwähnen.)<br />
Die Karlsbrücke im Protektorat<br />
In Anlehnung an die völkische Ideologie wird Prag in der Protektoratszeit<br />
von Karl Hermann Frank, dem Staatsminister für Böhmen und Mähren,<br />
wiederholt als reichsdeutsche Stadt deklariert. Die nunmehr deutschsprachige<br />
Karlsuniversität (die tschechischen Hochschulen wurden im Jahre 1939<br />
geschlossen) sowie die Karlsbrücke werden propagandistisch als Leistungen<br />
des deutschen bzw. reichsdeutschen Geistes hingestellt. Gerade die Karlsbrücke<br />
wird zur eindrucksvollen und ideologisch ,reinen‘ Kulisse für Inszenierungen<br />
deutscher oder reichsdeutscher Staatsbesuche und -feiern, wie sie<br />
die zeitgenössischen Fotos fixieren (vgl. u.a. KAPLAN/LEDVINKA/ŠLAJ-<br />
CHRT 1999: 15). ,Rein‘ deswegen, weil die Karlsbrücke einer der wenigen<br />
öffentlichen Plätze Prags war, der im 19. und 20. Jahrhundert nur in Details<br />
slavisiert wurde. Die anderen öffentlichen Plätze bekamen in dieser Zeit<br />
eine auf den ersten Blick sichtbare Dominante, die zur tschechischen Nationalkultur<br />
verweist; so etwa der Wenzelsplatz mit der Reiterstatue des slavisch<br />
geprägten hl. Wenzel, der Altstädter Ring mit dem 1915 errichteten<br />
Jan-Hus-Denkmal von Ladislav Šaloun, der Berg Vítkov/Žižkov mit der<br />
riesigen Anlage des Befreiungsdenkmals samt der geplanten und in den<br />
50er Jahren errichteten Reiterstatue von Jan Žižka, das Moldauufer mit dem<br />
im imperialen Neorenaissance-Stil erbauten tschechischen Nationaltheater<br />
in der Nähe der Slaweninsel, die Palackýbrücke mit dem Palacký-Denkmal,<br />
der Platz der Republik mit dem Gemeindehaus und der Allegorie von Prag<br />
als slavischer Libuše usw. Die ,deutschen‘ Denkmäler wurden dagegen in<br />
der Ersten Tschechoslowakischen Republik mehr oder weniger spontan entfernt;<br />
so etwa am 3. November 1918 die 1650 errichtete Mariensäule auf<br />
dem Altstädter Ring, auf dem im Jahre 1621 die Vertreter der aufständischen<br />
Stände hingerichtet wurden, 20 das 1858 enthüllte Radetzky-Denkmal<br />
auf dem Kleinseitner Platz usw. 21<br />
20 HOJDA/POKORNÝ (1997: 28ff.) machen nicht nur auf den Zusammenhang der Aufrichtung<br />
der Mariensäule mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges aufmerksam, sondern<br />
auch auf auf die Schenkung der Marienstatue durch Ferdinand III. als Dank für den<br />
Sieg der Prager über die Schweden in Prag im Jahre 1648. Trotzdem wurde die Mariensäule<br />
im Laufe der Zeit zunehmend als Symbol der Rekatholisierung verstanden.<br />
21 Laut HOJDA/NOVOTNÝ (1997: 52f.) sollte das Denkmal im Jahre 1941 wieder installiert<br />
werden, wozu es schließlich nicht gekommen ist.<br />
179
180<br />
Marek Nekula<br />
Auf der Karlsbrücke als Insel der „reichsdeutschen“ Kultur in Prag, das seit<br />
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ethnisch und ikonographisch immer<br />
deutlicher tschechisch-slavisch geprägt wurde, ließen sich daher nicht nur<br />
offizielle Besuche, sondern etwa auch der Trauerzug für Reinhard Heydrich<br />
inszenieren (vgl. u.a. KAPLAN/NOSARZEWSKA 1997: 240n.). In dieser<br />
Inszenierung könnte man eine bewusste Polemik mit dem Begräbnis von T.<br />
G. Masaryk sehen. Masaryk wurde beim Begräbnis u.a. auch dadurch geehrt,<br />
dass der Trauerzug zwar in entgegensetzter Richtung, doch gerade bis<br />
hin zur Karlsbrücke dem von Karl IV. institutionalisierten Königs- und<br />
Krönungsweg folgte (vgl. BOLTON 2005). Durch Heydrichs „reichsdeutsches“<br />
Begräbnis wollte man die „königliche“ Inszenierung und Interpretation<br />
des Begräbnisses von T. G. Masaryk überschreiben. Dies zeigt die Bedeutung,<br />
welche der Tradition des Kaisers Karl IV. – in Opposition zur<br />
tschechischen Tradition des Königs Karel I. – im Protektorat beigemessen<br />
wurde. Dies wird auch bei dem Diskurs über die Karls-Universität deutlich.<br />
Eine repräsentative deutsche Publikation über die Karls-Universität aus dem<br />
Jahre 1943, benannt Prag und das Reich (vgl. WOLMAR 1943), deklariert<br />
die Karls-Universität als eine reichsdeutsche Universität, deren „wahrer“<br />
Charakter im Volkstumkampf gegen die tschechischen Nationalisten verteidigt<br />
werden musste. Das Buch ist übrigens „dem im Kampf um die Sicherung<br />
der historischen Reichslande Böhmen und Mähren gefallenen SS-<br />
Obergruppenführer Reinhard Heydrich“ gewidmet.<br />
Nun wurde hier gesagt, dass die Person Karls und dadurch die Bezeichnung<br />
„Karlsbrücke“ zwei Deutungen zuließ: „kaiserlich“, aus der Perspektive des<br />
19. Jahrhunderts „reichsdeutsch“ (Karl IV.), und „königlich“, „böhmisch“<br />
(Karel I.). Diesem Attribut „königlich“, „böhmisch“ sind wir am Anfang<br />
dieses Beitrags im Zusammenhang mit der Judithbrücke, der „Steinernen<br />
Brücke“ begegnet.<br />
Mit der Bezeichnung „Kamenný most“ (Steinerne Brücke) für die Karlsbrücke,<br />
die so viel bedeutet wie die „königliche“, „böhmische“ – oder eben<br />
auch „tschechische“ – Brücke, tritt die tschechische Kunst in die Auseinandersetzung<br />
mit der völkischen Propaganda und später mit der offiziellen<br />
Propaganda des Staatsministers für Böhmen und Mähren ein. In die Steinerne<br />
Brücke und in das steinerne Prag, die der Zeit widerstehen und sich<br />
als nicht vergänglich erweisen, wird die Hoffnung projiziert, dass die tschechische<br />
Nation und Kultur dem Ansturm der „Reiter der Apokalypse“ – so<br />
František Halas in seinem Gedicht Praze (An Prag) aus Torso naděje (Torso<br />
der Hoffnung, 1938) – widerstehen werden, ähnlich wie die Brücke und die<br />
Stadt, die als Leistungen des tschechischen Geistes wahrgenommen werden,<br />
der Zeit widerstehen.<br />
Von der im Protektorat greifenden Zensur wurde diese ablehnende Haltung<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
gegenüber der völkischen Propaganda nicht erkannt, von den Lesern schon.<br />
Indem man sich zum steinernen Prag und zur königlichen Steinernen Brükke<br />
bekennt, die als integraler Teil der eigenen Geschichte und Kultur und<br />
als Ausdruck der kulturellen und politischen Autonomie wahrgenommen<br />
wird, beschränken Halas und andere mehr die Wertschätzung Karls auf den<br />
böhmischen, „tschechischen“ König, 22 was als Ablehnung der völkischen<br />
Ideologie zu deuten ist, die Kaiser Karl IV. als Ikone des „Reiches“ deutet.<br />
So erklärt sich, dass von František Halas’ Gedichtband Torso naděje (Torso<br />
der Hoffnung) mit dem Gedicht Praze (An Prag) im Protektorat etwa<br />
10.000 Exemplare verkauft wurden und dass Jaroslav Seiferts Gedichtband<br />
Kamenný most (Steinerne Brücke, 1944) siebenmal illegal nachgedruckt<br />
wurde (vgl. DOLEŽAL 1996: 136).<br />
Ausblick<br />
Die Brücken, in denen wir im Zusammenhang mit der Europäischen Union<br />
die Metapher des Verbindenden erkannt haben, zeigten sich im Böhmen des<br />
ausgehenden 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Orte, an denen<br />
die deutsch-tschechische sprachnationale Polarisierung besonders sichtbar<br />
wurde. Dies war auch der Grund, warum Franz Kafka gerade die Brücke als<br />
Ort des Scheiterns möglicher (jüdischer) Gegenentwürfe wahrnahm.<br />
Im Laufe des 20. Jahrhunderts verändern sich die Prager Brücken. Die nationale<br />
Polarisierung prägt sie immer weniger. Die Karlsbrücke wird allmählich<br />
slavisiert und mit der Vertreibung der Deutschen werden Träger<br />
einer Gegenlektüre bzw. einer komplexeren Lektüre Karls und der Karlsbrücke<br />
sowie der böhmischen Geschichte gewaltsam verdrängt (zu einer<br />
etwas weiter aufgefassten Tradition Karls IV. bekennen sich zumindest<br />
durch den Namen etwa das Collegium Carolinum oder der Europäische<br />
Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft). Die Palackýbrücke<br />
verliert im Jahre 1946 durch die Entfernung der 1945 beschädigten Statuen,<br />
die auf den Vyšehrad überführt wurden, ihre tschechoslavisch-nationale<br />
Emblematik, wodurch sich die Polarisierung zwischen Palackýbrücke und<br />
Karlsbrücke auflöst.<br />
So wird die Karlsbrücke nach der Wende im Jahre 1989 gar zum Symbol<br />
des deutsch-tschechischen Zusammenlebens, wie auf dem Umschlag des<br />
Bandes Deutsche und Tschechen (Abbildung der Menschenmenge auf der<br />
hell beleuchteten Karlsbrücke; vgl. KOSCHMAL/NEKULA/ROGALL<br />
2003) oder auf dem Umschlag des deutschen und tschechischen Jahresbe-<br />
22 In diesen Kontext gehört auch die demostrative Ausgabe der tschechischen Übersetzung<br />
von Vita Caroli, in der sich Karl zur Přemyslidischen Tradition bekennt. – Vgl. PASÁK<br />
(1999: 256)<br />
181
182<br />
Marek Nekula<br />
richtes des Automobilwerks Škoda-Auto aus dem Jahr 1993. So wird ein<br />
Škoda, die traditionelle „tschechische“ Automobilmarke, die im Jahr 1991<br />
vom deutschen Konzern Volkswagen Group übernommen wurde, auf dem<br />
Umschlag des Jahresberichtes vor der Karlsbrücke aufgenommen. Die<br />
Doppelgestalt Karls und der Karlsbrücke als der kaiserlichen („deutschen“)<br />
und der königlichen („tschechischen“) Brücke kommt hier sehr wohl zum<br />
Tragen, im Unterschied zur früheren Zeit tritt jedoch die Semantik der<br />
Brücke als Symbol des Verbindenden in den Vordergrund. In Karl und in<br />
der Karlsbrücke wird die „böhmische“ Synthese der beiden sprachnationalen<br />
Kulturen erkannt und versinnbildlicht. Als solche Synthese versucht sich<br />
auch das Automobilwerk Škoda zu präsentieren, in dem sich der traditionelle<br />
„tschechische“ Automobilhersteller und der „deutsche“ Konzern zusammengefunden<br />
haben, um in einem symmetrisch und harmonisch dargestellten<br />
Unternehmen mit Synergieeffekten ein gemeinsames Produkt<br />
herzustellen. Auch hier steht die Brücke für das Verbindende, auf das auch<br />
die Ikonographie der Europäischen Union zurückgreift. Es bleibt nur die<br />
Hoffnung, dass das Trennende in jeder Hinsicht überwunden wird und<br />
überwunden bleibt.<br />
Literatur<br />
ADLHOCH, Gabriele/JOIST, Christa/KAMP, Michael (1986): Die Einzüge.<br />
– In: K. Möseneder (Hg.), Feste in <strong>Regensburg</strong>. Von der Reformation<br />
bis in die Gegenwart. <strong>Regensburg</strong>: Mittelbayerische Druck- und Verlagsgesellschaft,<br />
31–42.<br />
ASSMANN, Aleida/HARTH, Dietrich (Hgg.) (1991): Kultur als Lebenswelt<br />
und Monument. Frankfurt/Main: Fischer Wissenschaft.<br />
BERNING, Benita (2001): Die böhmischen Königskrönungen in der<br />
Frühen Neuzeit im Spannungsfeld von Dynastie, Ständemacht und Konfession.<br />
München: Historisches Seminar der LMU (Magisterarbeit).<br />
BINDER, Hartmut (1975/1986): Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen.<br />
München: Winkler Verlag.<br />
BOLTON, Jonathan (2005): Mourning Becomes the Nation: The Funeral of<br />
Tomáš Masaryk in 1937. – In: Bohemia 46, 2005, Manuskript.<br />
BROD, Max /KAFKA, Franz (1989): Eine Freundschaft. Briefwechsel. Hg.<br />
v. M. Pasley. Bd. 2. Frankfurt/Main: S. Fischer.<br />
COSMAS (1923): Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Hg. v.<br />
Bertold Bretholz. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
COSMAS (1885): Des Dekans Cosmas Chronik von Böhmen. Übers. v. Georg<br />
Grandauer. Leipzig: Verlag von franz Duncker.<br />
COSMAS (1950): Kosmova Kronika česká. Praha: Melantrich.<br />
DOLANSKÝ, Jan (1894): Obrázkové dějiny národa českého [Bildgeschichte<br />
der tschechischen Nation]. Praha: J. R. Vilímek.<br />
DOLEŽAL, Jiří (1996): Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví,<br />
kinematografie. [Die tschechische Kultur während des Protektorats.<br />
Schulwesen, Schrifttum, Kinematographie]. Praha: Národní filmový archiv.<br />
DÜNNINGER, Eberhard (1996): Weltwunder Steinerne Brücke. Texte und<br />
Ansichten aus 850 Jahren. Amberg: Buch- und Kunstverlag.<br />
FRANK, Karl Hermann (1936): Sudetendeutschtum in Kampf und Not. Ein<br />
Bildbericht. Kassel: Bärenreiter Verlag.<br />
FRANK, Karl Hermann ( 2 1942): Böhmen und Mähren im Reich. Prag: Volk<br />
und Reich Verlag.<br />
FRANK, Karl Hermann (1994): Mein Leben für Böhmen. Als Staatsminister<br />
im Protektorat. Hg. v. E. Frank. Kiel: Arndt.<br />
FRANK, Ernst ( 4 1971): K. H. Frank. Staatsminister im Protektorat. Heusenstamm:<br />
Orion-Heimreiter-Verlag.<br />
FREITAG, Matthias (1999): Kleine <strong>Regensburg</strong>er Stadtgeschichte. <strong>Regensburg</strong>:<br />
Verlag Pustet.<br />
HAHNOVÁ, Eva/HANS, Hans Henning (2002): Sudetoněmecká vzpomínání<br />
a zapomínání [Sudetendeutsches Erinnern und Vergessen]. Olomouc:<br />
Votobia.<br />
HALAS, František (1938/1968): Torso naděje [Torso der Hoffnung]. Praha:<br />
Svoboda.<br />
HOJDA, Zdeněk/POKORNÝ, Jiří ( 2 1997): Pomníky a zapomníky [Denkmäler<br />
und Antidenkmäler]. Praha, Litomyšl: Paseka.<br />
HÖNSCH, Jörg K. (1997): Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme<br />
bis zur Gegenwart. München: Beck.<br />
JIRÁSEK, Alois ( 20 1930): Temno, Historický obraz [Finsternis. Historisches<br />
Bild]. Praha: J. Otto.<br />
JIRÁSEK, Alois (1894/2001): Staré pověsti české. Praha: Nakladatelství<br />
Lidové noviny. (Deutsch in: A.J. (1963): Böhmens alte Sagen. Übers. v.<br />
Hans Gaertner. Praha: Artia.)<br />
183
184<br />
Marek Nekula<br />
KAFKA, Franz (1994/1): Ein Landarzt und andere Drucke zu Lebzeiten.<br />
Hg.v. H.–G. Koch. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag.<br />
KAFKA, Franz (1994/Rtg): Reisetagebücher in der Fassung der Handschrift.<br />
Hg.v. H.–G. Koch. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag.<br />
KAFKA, Franz (1998): Briefe an Milena. Erweiterte Neuausgabe. Hg. v. J.<br />
Born u. M. Müller. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag.<br />
KALLERT, Kristina ( 2 2003): Landesheilige in Böhmen: Das Denkmal und<br />
die Denkmäler. – In: W. Koschmal, M. Nekula. J. Rogall (Hgg.), Deutsche<br />
und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München: Beck, 162–178.<br />
KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří (1922): Legenda o ctihodné sestře Marii<br />
Elektě z Ježíše. Praha-Královské Vinohrady: Ladislav Kuncíř. (Deutsch in:<br />
P. Demetz (Hg.) (<strong>2004</strong>): Fin de siècle. München: Deutsche Verlags-Anstalt,<br />
165–240.)<br />
KAŠIČKA, František (1992): Charles Bridge – Karlsbrücke – Ponte Carlo.<br />
Praha: Naše vojsko.<br />
KAPLAN, Jan/LEDVINKA, Václav/ŠLAJCHRT, Viktor (1999): Praha<br />
1900–2000. Sto roků stověžatého města. Praha: gallery.<br />
KAPLAN, Jan/NOSARZEWSKA, Krystyna (1997): Praha – Prag – Prague.<br />
Köln: Könemann.<br />
KOSCHMAL, Walter/NEKULA, Marek/ROGALL, Joachim (Hgg.)<br />
( 2 2003): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München:<br />
Beck.<br />
KUNŠTÁT, Miroslav (2000): Monumentum fundatoris. Pomník císaře Karla<br />
IV. k 500. výročí založení pražské univerzity. [Das Denkmal Kaiser Karl<br />
IV. Zum 500. Jahrestag der Gründung der Prager Universität]. – In: Acta<br />
Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis XL,<br />
Nr. 1–2, 39–51.<br />
LEDVINKA, Václav/PEŠEK, Jiří (2000): Prag. Praha: Nakladatelství Lidové<br />
noviny.<br />
LEMBERG, Hans (2003): Universität oder Universitäten in Prag – und der<br />
Wandel der Lehrsprache. – In: H. Lemberg (Hg.), Universitäten in nationaler<br />
Konkurenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20.<br />
Jahrhundert. München: Oldenbourg, 1–8.<br />
MAREK, Michaela (1995): „Monumentalsbauten“ und Städtebau als Spiegel<br />
des gesellschaftlichen Wandels in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. –<br />
In: F. Seibt (Hg.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Frankfurt/Main, Berlin:<br />
Propyläen, 149–233, 390–411.<br />
Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen<br />
MIKOVEC, Ferdinand Břetislav (Hg.) (1849): Briefe des Johannes Hus:<br />
geschrieben zu Konstanz 1414–15. Nach dem böhmichen Urtext hg. und mit<br />
Anmerkungen versehen von. Leipzig: T.O Weigel.<br />
MIKOVEC, Ferdinand Břetislav (1860–6): Alterthümer und Denkwürdigkeiten<br />
Böhmens. 2 sv. Prag: Kober & Markgraf.<br />
Národní divadlo – historie a současnost budovy. History and Present Day<br />
of the Building. Geschichte und Gegewart des Hauses. Hg. v. Z. Benešová<br />
et al. Praha: Národní divadlo 1999.<br />
NEKULA; Marek (2003a): Die deutsche Walhalla und der tschechische<br />
Slavín. – In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien–Slowakei. NF<br />
9, 61–79.<br />
NEKULA, Marek (2003b): Franz Kafkas Sprachen. „...in einem Stockwerk<br />
des innern babylonischen Turmes...“. Tübingen: Niemeyer.<br />
NEKULA, Marek (<strong>2004</strong>a): Franz Kafkas Sprachen und Identität. – In: M.<br />
Nekula, W. Koschmal (Hgg.), Juden zwischen Deutschen und Tschechen.<br />
Sprachliche, literarische und kulturelle Identitäten. München: Oldenbourg,<br />
147–172.<br />
NEKULA, Marek (<strong>2004</strong>b): Traum vom Tod und Reich des Schönen. – In:<br />
P. Demetz (Hg.), Fin de siècle. München: Deutsche Verlags-Anstalt (=<br />
Tschechische Bibliothek), 241–257.<br />
NERUDA, Jan (1924): Druhá kniha básní [Das zweite Gedichtbuch]. (Dílo<br />
Jana Nerudy VI) Praha: Kvasnička a Hampl.<br />
NERUDA, Jan (1984): Romance o Karlu IV [Romanze über Karl IV.]. – In:<br />
Ders., Ve lví stopě. Praha: Československý spisovatel, 226–228.<br />
NEUBERT, Karel/KOŘÁN, Ivo/SUCHOMEL, Miloš (1991): Karlsbrücke.<br />
Praha: Galerie der Hauptstadt Prag.<br />
PASÁK, Tomáš (1997): JUDr. Emil Hácha 1938–1945. Praha: Horizont.<br />
PASÁK, Tomáš (1999): Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–<br />
1945 [Tschechischer Faschismus 1922–1945 und Kollaboration 1939–<br />
1945]. Praha: Práh.<br />
PAULUS, Helmut-Eberhard (1989): Die steinerne Brücke in <strong>Regensburg</strong>. –<br />
In: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 40 (hg. v . Bayerischem Landesamt<br />
für Denkmalpflege), München, 143–168.<br />
PAULUS, Helmut-Eberhard (1993): Steinerne Brücke. Mit <strong>Regensburg</strong>er<br />
und Amberger Salzstadel und einem Ausflug zur historischen Wurstküche.<br />
<strong>Regensburg</strong>: Mittelbayerischer Druck- und Verlagsgesellschaft.<br />
185
186<br />
Marek Nekula<br />
PLICKA; Karel (1969): Pražský hrad [Prager Burg]. Praha: Orbis.<br />
POSNER, Roland (1991): Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation<br />
kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe. – In: A. Assmann, D.<br />
Harth (Hgg.), Kultur als Lebenswelt und Monument. Frankfurt/Main: Fischer<br />
Wissenschaft, 37–74.<br />
RAK, Jiří (1996): Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy. [Es<br />
waren einmal die Tschechen... Tschechische historische Mythen und<br />
Stereotypen]. Jinočany: H & H.<br />
REGLER-BELLINGER, Brigitte/SCHENCK, Wolfgang/WINKING, Hans<br />
(1983/1996): Opera. Velká encyklopedie. [Die Oper. Eine große Enzyklopädie].<br />
Praha: Mladá fronta.<br />
ROKYTA, Hugo ( 2 1995): Die Böhmischen Länder. Prag. Praha: Vitalis.<br />
SCHMID, Peter (1985): Das Ringen der <strong>Regensburg</strong>er Bürger um die<br />
Stadtherrschaft. – In: Studien und Quellen zur Geschichte <strong>Regensburg</strong>s. Hg.<br />
v. Museen und Archiv der Stadt <strong>Regensburg</strong>. <strong>Regensburg</strong>: Mittelbayerischer<br />
Druck- und Verlagsgesellschaft, 7–23.<br />
SEIBT, Ferdinand ( 2 1995): Deutschland und die Tschechen. Geschichte<br />
einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. München: Piper.<br />
SEIFERT, Jaroslav (1944/1968): Kamenný most [Die Steinerne Brücke]. –<br />
In: J.S., Zpěvy o Praze. Praha: Československý spisovatel, 39–86.<br />
Škoda automobilová, a.s. Výroční zpráva 1993. Mladá Boleslav 1994.<br />
VRCHLICKÝ, Jaroslav (1902): Má vlast. Básně Jaroslava Vrchlického<br />
1885–1902 [Mein Vaterland. Jaroslav Vrchlickýs Gedichte 1885–1902].<br />
Praha: J. Otto.<br />
WIRTH, Zdeněk (2003): Zmizelá Praha 5: Opevnění, Vltava a ztráty na<br />
památkách 1945 [Verlorenes Prag 5. Befestigung, Moldau und Verluste an<br />
Denkmälern im Jahre 1945]. Praha, Litomyšl: Paseka.<br />
WOLMAR, Wolfgang Wolfram von (1943): Prag und das Reich. 600 Jahre<br />
Kampf deutscher Studenten. Dresden: Franz Müller Verlag.<br />
ZEYER, Julius (1894/1922): Inultus. – In: Ders., Tři legendy o krucifixu.<br />
Dům U tonoucí hvězdy. Bd. 24. Praha: Nakladatelství České grafické Unie,<br />
5–35. (Deutsch in: P. Demetz (Hg.) (<strong>2004</strong>): Fin de siècle. München: Deutsche<br />
Verlags-Anstalt, 85–115.)<br />
Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen<br />
Martin Humpál<br />
Arnošt Kraus’ Arbeit auf dem Gebiet der Nordistik ist sehr vielfältig. Seine<br />
skandinavischen Studien und Artikel erstrecken sich thematisch von Linguistik<br />
und Musik- und Literaturgeschichte bis hin zu Ökonomie und Landwirtschaft.<br />
Als begeisterter Propagandist des Nordens wurde Kraus nicht<br />
nur als Wissenschaftler und Pädagoge berühmt, sondern auch durch Veröffentlichungen<br />
von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, als Übersetzer und<br />
Organisator verschiedener Veranstaltungen, die mit Skandinavien in Zusammenhang<br />
standen, wie zum Beispiel ein Ausflug tschechischer Landwirte<br />
nach Dänemark oder aktive Mitarbeit in der Tschechoslowakischdänischen<br />
Gesellschaft. In den nordischen Ländern war er als unermüdlicher<br />
Propagandist der Tschechoslowakei berühmt, einerseits während seiner<br />
Tätigkeit als tschechoslowakischer Botschafter kurz nach dem Ersten Weltkrieg,<br />
andererseits durch seine Vorträge und publizistische Aktivität. Sein<br />
Bestreben um allseitige Annäherung der Tschechoslowakei und der nordischen<br />
Länder wurde von Dänemark und Norwegen durch die Verleihung<br />
von Verdienstorden – des dänischen „Dannebrogsorden“ und des norwegischen<br />
„St. Olavs Orden“ – anerkannt. Die drei bedeutendsten nordistischen<br />
Arbeiten Kraus’ sind: Dánsko, jeho hmotná a duševní kultura (1908, Dänemark,<br />
seine materielle und geistige Kultur), Bjørnson a Ibsen (1913,<br />
Bjørnson und Ibsen) und Smetana v Göteborgu (1925, Smetana in Göteborg).<br />
Das zweite der genannten Werke ist der wichtigste Beitrag Kraus’<br />
zum tschechischen Studium der nordischen Literatur.<br />
Aus heutiger Sicht ist das Buch Bjørnson und Ibsen ein typisches Produkt<br />
seiner Zeit, als die Auffassung von Literatur immer noch durch die Errungenschaften<br />
positivistischer und biographischer Methoden des 19. Jahrhunderts<br />
bestimmt war. Im Mittelpunkt des Interesses der Literaturwissenschaftler<br />
stand nicht das Werk als autonomer Gegenstand der Forschung,<br />
sondern eher die Persönlichkeit des Autors als Schöpfer einer gewissen Projektion<br />
der gesellschaftlichen Realität. Diese Orientierung bestimmt den<br />
ganzen Charakter der Studie Kraus’ und, wie wir später sehen werden, auch<br />
deren Schlussfolgerungen.<br />
Die Monographie umfasst das ganze Leben beider Schriftsteller und diesem<br />
wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet als ihrem Werk. Davon, dass im Mittelpunkt<br />
von Kraus’ Interesse in erster Reihe der Schriftsteller als solcher<br />
steht, zeugen seine ständigen Hinweise auf biographische Details und gegenwärtige<br />
sowie zeitlich entferntere historische Ereignisse. Es scheint, als<br />
solle die Studie vor allem zeigen, wie Geschichte und Gesellschaft die Per-
188<br />
Martin Humpál<br />
sönlichkeit des Autors formen. Diese Auffassung ist schon im ersten der<br />
insgesamt sechs Kapitel der Studie bemerkbar, welches sich umfangreich<br />
mit der Geschichte Norwegens mit dem Ziel befasst, sozusagen einen historischen<br />
Geist des norwegischen Volkes bis zur Zeit der Geburt Bjørnsons<br />
und Ibsens aufzuzeichnen. Der Leser erfährt vieles über Wikinger, mittelalterliche<br />
Herrscher, Natur und die geographische Lage Norwegens, inklusive<br />
der Angaben über geographische Breiten und Längen. Ähnlich detailverliebt<br />
beschreibt Kraus auch die Lebensstationen, wie Geburt, Kindheit und<br />
Schuljahre der beiden Schriftsteller, was bisweilen beinahe komisch wirkt.<br />
Zum Beispiel reicht Bjørnsons Stammbaum bis ins Jahr 1676, also mehr als<br />
anderthalb Jahrhunderte vor seiner Geburt, zurück und von Ibsen erfahren<br />
wir unter anderem, dass er als Kind „s věže kostelní díval se na město z<br />
náručí chůvy a zděsil matku“ [vom Kirchturm in den Armen seiner Amme<br />
auf die Stadt blickte und seine Mutter erschreckte] (16).<br />
Mit diesen Beispielen will ich die detaillierte Zeitbeschreibung nicht gering<br />
schätzen und dies nicht nur deshalb, weil sie im Ganzen gut begründet ist<br />
und von bemerkenswert breiten Kenntnissen zeugt. In einer allgemeinen<br />
Monographie über Bjørnson und Ibsen ist eine detaillierte Beschreibung des<br />
gesellschaftlichen Hintergrunds durchaus wichtig. Beide Autoren lebten und<br />
schrieben schließlich in einer Epoche, die für ihr Land einzigartig war. Im<br />
Jahre 1814 befreite sich Norwegen von der dänischen Vorherrschaft, die<br />
mehr als vier Jahrhunderte angedauert hatte, bekam eine eigene Verfassung,<br />
Autonomie innerhalb der Union mit Schweden und wurde dann endlich im<br />
Jahr 1905 selbstständig. Bjørnson und Ibsen, beide um 1830 geboren<br />
(Bjørnson 1832, Ibsen 1828) und bald nach 1905 verstorben (Bjørnson<br />
1910, Ibsen 1906), lebten und schrieben in der Zeit der norwegischen nationalen<br />
Wiedergeburt, der Suche norwegischer kultureller Identität und der<br />
Schaffung eines modernen politischen Systems, mit anderen Worten, in einer<br />
Zeit stürmischer historischer Entwicklung, während der das vergleichsweise<br />
provinzielle Norwegen bemüht war, in mehrerer Hinsicht Europa einzuholen.<br />
Der Einfluss dieser Ereignisse auf das Schaffen beider<br />
Schriftsteller ist enorm. Kraus behauptet sogar, dass diese Situation sie mit<br />
der besonderen Aufgabe beauftragt hätte „spasiti norský lid“ [das norwegische<br />
Volk zu erlösen] (KRAUS 1913: 142). Das ist selbstverständlich übertrieben,<br />
aber es sagt viel über die Position norwegischer Schriftsteller in<br />
dieser Zeit aus. Die Bedeutung der Werke Bjørnsons und Ibsens können wir<br />
deshalb ohne ausreichende Kenntnisse über ihr Leben und die damaligen<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht vollständig begreifen. Zum Beispiel<br />
können Informationen über die soziale Aufgabe des Theaters in dieser Epoche<br />
den Wandel der Themen sowie formale Änderungen in den Werken von<br />
Bjørnson und Ibsen erklären. Bjørnsons frühe Prosa ist von dem ehemaligen<br />
Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen<br />
Streit um die Gestaltung der norwegischen Schriftsprache nicht wegzudenken.<br />
Wir können Bjørnsons Bedeutung für die norwegische Literatur nicht<br />
entsprechend einschätzen, ohne seine politische und überhaupt seine öffentliche<br />
Tätigkeit in Betracht zu ziehen. Ibsens langes freiwilliges Exil, während<br />
dessen er manche seiner besten Werke geschrieben hat, hängt in großem<br />
Maße mit seiner Enttäuschung über die Ereignisse des Jahres 1864<br />
zusammen, als Norwegen und Schweden im Krieg um Schleswig und Holstein<br />
Dänemark nicht halfen, obwohl Norwegen bis zu diesem Zeitpunkt<br />
von der Idee des Skandinavismus geradezu berauscht war. Von all dem<br />
schreibt Kraus und lässt kein wesentliches historisches Ereignis aus, er stellt<br />
somit ein adäquates Bild dieser Zeit und ihres formenden Einflusses auf<br />
beide Schriftsteller zusammen. 1<br />
Die Studie ist weitgehend chronologisch, aber der Autor bewegt sich frei,<br />
nach eigenem Urteil und Bedarf, zwischen den einzelnen Themen, was nicht<br />
immer ideal ist, da seine Hinweise manchmal für den uneingeweihten Leser<br />
schwer verständlich sind. Diese Methode ist jedoch produktiv, sobald Kraus<br />
die direkten Parallelen und Unterschiede zwischen den Autoren behandelt.<br />
Der Vergleich Bjørnsons mit Ibsen und umgekehrt ist sehr aufschlussreich,<br />
denn beide behandelten oft zur gleichen Zeit dasselbe Thema jedoch in unterschiedlicher<br />
Art und Weise. Der Vergleich ist umso interessanter, da ihre<br />
Persönlichkeiten ausgesprochene Gegenpole sind. Offensichtlich ist diese<br />
Methode gerade deshalb sehr illustrativ und für den Leser attraktiv. Norwegische<br />
Literaturgeschichten unterlassen es nie, die grundsätzlichen Charakterunterschiede<br />
beider Autoren zu erwähnen: Bjørnson ist extrovertiert, optimistisch,<br />
eine öffentliche Person, ein Mann der Tat, dessen Werke oft die<br />
Lösung gesellschaftlicher Probleme andeuten, während Ibsen introvertiert,<br />
pessimistisch, auf das Privatleben orientiert ist, der in seinen Werken Fragen<br />
stellt, ohne Antworten anzudeuten. Kraus bietet diese Parallele ebenfalls an.<br />
Als Kulturhistoriographie ist die Studie also im Allgemeinen gelungen.<br />
Wenn Kraus die Werke Bjørnsons und Ibsens analysiert, weist er richtig auf<br />
die Idealisierung der Bauern in Bjørnsons frühen Texten hin (KRAUS 1913:<br />
34); widmet dem Einfluss der Sagaerzählung auf frühe Arbeiten beider Autoren<br />
viel Aufmerksamkeit (KRAUS 1913: 34, 42); findet eine Parallele<br />
zwischen dem politischen Kampf in Ibsens historischem Drama Kongs-<br />
1 In manchen seiner Behauptungen irrt sich Kraus aber. Als Beispiel kann seine verborgene<br />
Befürchtung dienen, dass „riksmål“, basierend auf norwegisiertem Dänisch, in<br />
welchem Bjørnson schrieb, in Zukunft durch „landsmål“, heutiges „nynorsk“, einer<br />
künstlich auf der Basis norwegischer Dialekte gebildeten Hochsprache, verdrängt wird<br />
(KRAUS 1913: 129). Die Entwicklung gab Kraus nicht recht, der Prozess verlief eher<br />
umgekehrt: das heutige „bokmål“, eine Weiterentwicklung des „riksmål“, verdrängt<br />
„nynorsk“ langsam.<br />
189
190<br />
Martin Humpál<br />
emnerne (Die Kronprätendenten) und Ibsens eigenem künstlerischen<br />
Kampf. Beim Vergleich von Ibsens Nora (aus Ein Puppenheim – Et dukkehjem)<br />
und Bjørnsons Leonarda (aus Leonarda) vertritt er die Meinung, dass<br />
Nora eben nicht in gleichem Maße den Typus einer absolut positiven und<br />
idealisierten Frau repräsentiert wie Leonarda. Die Qualität von Ibsens Drama<br />
sieht er gerade darin, dass es eine realistischere Schilderung der Stellung der<br />
Frau in der damaligen Gesellschaft bietet, indem es aufzeigt, wie diese Gesellschaft<br />
die Frau nach ihren Vorstellungen gestaltet (KRAUS 1913: 80, 82).<br />
Trotz vieler Vorzüge dieser Art befriedigen jedoch die Interpretationen<br />
mancher Werke nicht. Zu oft geht es nur um eine Nacherzählung der Handlung,<br />
eventuell um die Erwähnung der Reaktionen des damaligen Publikums.<br />
2 Die kritischen Urteile von Kraus sind manchmal sehr subjektiv, ohne<br />
fundierte Argumente. Er behauptet z. B., dass Ibsen im Drama De unges<br />
forbund (Der Bund der Jugend) „tolik plýtval motivy“ [so viele Motive verschwendete]<br />
(KRAUS 1913: 81), ohne dies genauer auszuführen. Verblüffend<br />
ist Kraus’ Interpretation von Ibsens Die Komödie der Liebe (Kjærlighedens<br />
komedie): „Terčem této satiry není nikdo menší než láska sama –<br />
nebo: zamilovanost jako živel společenský – nebo bereme-li Komedii lásky<br />
za první článek v řadě dramat: Láska v Norsku“ [Die Zielscheibe dieser<br />
Satire ist niemand geringerer als die Liebe selbst – oder: Das Verliebtsein<br />
als gesellschaftliches Element – oder, wenn wir die Komödie der Liebe als<br />
erstes Glied in der Reihe der Dramen auffassen: Die Liebe in Norwegen]<br />
(KRAUS 1913: 72). Wie Votavová (1973: 23) richtig bemerkt, begeht<br />
Kraus hier „hrubé zjednodušení, zevšeobecnění, které není na místě. Vždyť<br />
přece láska jako taková, či zamilovanost neposkytují důvod k ostré kritice<br />
a reformě“ [eine grobe Vereinfachung, Generalisierung, die fehl am Platze<br />
ist. Die Liebe an sich, oder das Verliebtsein liefern doch keinen Grund zur<br />
scharfen Kritik und Reform]. Es stimmt zwar, dass das Drama unter anderem<br />
den Anspruch auf absolute Liebe ironisiert (siehe z. B. NORTHAM<br />
1973: 10–31), aber die Liebe an sich ist kaum die Zielscheibe von Ibsens<br />
Satire. Ibsens Drama Vildanden (Die Wildente) gibt Kraus (1913: 89) die<br />
dubiose Bezeichnung „Komödie“. Dieses Drama beinhaltet gewiss viele<br />
2 Vom tschechischen Standpunkt aus ist Kraus’ Anmerkung, wie Ibsens Drama En folkefiende<br />
(Ein Volksfeind) auf Grund des Kampfes um die Anerkennung der Unechtheit der<br />
Handschriften Rukopis královédvorský a zelenohorský in Prag angenommen wurde, interessant:<br />
„Boj Stockmannův (…) je tak obecný, že při provozování v Praze s pravým<br />
úžasem jsme poznávali boj rukopisný v boji o očistu lázní, z něhož vzchází boj o očistu<br />
celé společnosti“ [Stockmanns Kampf (...) ist so allgemein, dass wir bei der Aufführung<br />
in Prag mit wahrem Staunen den Handschriftenkampf im Kampf um die Säuberung des<br />
Bades erkannten, woraus der Kampf um die Säuberung der ganzen Gesellschaft hervorgeht]<br />
(KRAUS 1913: 86).<br />
Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen<br />
komische Elemente und deshalb kann in gewissem Sinne von einer Tragikomödie<br />
die Rede sein. Das Ende des Stücks ist allerdings eindeutig tragisch,<br />
es endet mit dem Tod eines unschuldigen Kindes und deshalb muss<br />
man Young zustimmen, nach dessen Meinung Die Wildente „cannot in any<br />
acceptable sense be described as a comedy“ (YOUNG 1994: 65). Laut einem<br />
weiteren fraglichen Urteil von Kraus (1913: 90) in Ibsens Drama Rosmersholm<br />
„není (…) symbolu“ [gibt es kein (...) Symbol]. Rosmersholm ist<br />
eines der kompliziertesten Dramen Ibsens, das zu seiner Zeit mit großer<br />
Ratlosigkeit aufgenommen wurde, das man heute aber für eines seiner modernsten<br />
Dramen hält, welches komplexe Symbole beinhaltet, die auf die<br />
Psychologie des Unbewussten hinweisen.<br />
Dies sind einige konkrete Probleme zur Interpretation einzelner Dramen.<br />
Was die Arbeit als Ganzes betrifft, kann man sagen, dass ihr eine generelle<br />
Erfassung der Werke beider Schriftsteller im Rahmen des literarhistorischen<br />
Begriffssystems fehlt. Deshalb kann man kaum ein Kriterium finden, wonach<br />
Kraus einzelnen Werken hier mehr, da weniger Aufmerksamkeit widmet.<br />
Am frappantesten fällt dies im Falle von Ibsens Drama Peer Gynt auf,<br />
das im Kanon der norwegischen Literatur einen ähnlichen Status hat wie<br />
Goethes Faust in der deutschen Literatur, dem aber Kraus nur einen Absatz<br />
widmet (KRAUS 1913: 65–66), während er andere, schwächere Werke auf<br />
mehreren Seiten analysiert. Was Ibsens späte Produktion der neunziger Jahre<br />
betrifft, nach Hedda Gabler, da ist sich Kraus des Unterschiedes gegenüber<br />
der vorherigen Produktion Ibsens bewusst, aber er ist sich nicht ganz<br />
sicher, wie er sie klassifizieren soll. Das könnte man allerdings dadurch erklären,<br />
dass er sich mit einer relativ jungen Vergangenheit auseinander<br />
setzt; außerdem muss man gestehen, dass die Literaturwissenschaftler sich<br />
bis heute streiten, wie der späte Ibsen zu klassifizieren ist.<br />
In der Arbeit fehlt allerdings eine Abhandlung über die Ästhetik des dramatischen<br />
Realismus und Ibsens innovativen Beitrag auf diesem Gebiet. Dieser<br />
Mangel verursacht eine kontroverse literarische Einordnung beider Autoren:<br />
Bjørnson ist laut Kraus Realist, während er in Ibsen einen Romantiker sieht<br />
(KRAUS 1913: 94–95). Die Bezeichnung Romantiker für Ibsen ist das problematischste<br />
Element in Kraus’ Studie. Obwohl man manche frühen Werke<br />
Ibsens für romantisch halten kann und obwohl manche seiner späteren Dramen<br />
romantische Elemente enthalten, kann man den Hauptteil seines Werkes,<br />
den Teil, der ihn berühmt machte und bis heute lebendig ist, schwer für romantisch<br />
halten. Sogar die zwei bedeutendsten vorrealistischen Dramen<br />
Brand und Peer Gynt halten manche Kritiker für stark antiromantisch. 3 Was<br />
führt also Kraus zu einer solchen Etikettierung von Ibsen?<br />
3 Siehe z. B. BEYER (1980: 62, 66, 78, 80). Beyer behauptet, dass Ibsen sich schon im<br />
191
192<br />
Martin Humpál<br />
Das einzige konkrete Argument, welches Kraus anbietet, lautet folgendermaßen:<br />
In einer Reihe von Gegenwartsdramen, die eine kritische Stellung<br />
zu gesellschaftlichen Problemen haben, unterscheiden sich Bjørnsons Stükke<br />
von Ibsens<br />
prostotou děje, hlavně nedostatkem minulosti, která se teprv odhaluje. U Ibsena […] skoro<br />
vždy za dějem, který se tak zázračně přirozeně odehrává před námi, je romantika, dobrodružství,<br />
tajná historie, která se odhaluje a je neobyčejná. (KRAUS 1913: 94)<br />
durch die Einfachheit der Handlung, vor allem durch den Mangel an Vergangenem, das erst<br />
enthüllt wird. Bei Ibsen [...] stehen Romantik, Abenteuer, eine geheimnisvolle Geschichte, die<br />
sich enthüllt und ungewöhnlich ist, fast immer hinter der Handlung, die sich so wunderbar<br />
natürlich vor uns abspielt.<br />
Dies ist zwar eine richtige Bemerkung, kann aber nicht als Argument dienen,<br />
Ibsens Werk als romantisch zu bezeichnen. Eine bloße Identifikation<br />
der Romantik mit „Abenteuer“ und „Geheimnis“ genügt nicht zur Definition<br />
der Romantik als literarhistorischen Begriff. Außerdem sind in Ibsens<br />
realistischen Dramen romantische Elemente tatsächlich eher „hinter der<br />
Handlung“, wie Kraus selbst bemerkt, als dass sie ein entscheidender Faktor<br />
der literarischen Klassifizierung dieser Dramen sein könnten.<br />
Kraus’ Kategorisierung stützt sich jedoch meiner Meinung nach nicht auf<br />
dieses schwache Argument, die eigentliche Begründung ist auf den letzten<br />
Seiten der Studie zu finden, in denen Kraus seine Gesamtansicht zu beiden<br />
Autoren zusammenfasst:<br />
Ibsen měl od začátku nedosažitelný cíl, a proto neomezil se ani v požadavku individuální svobody,<br />
[…], každá hodnota společenská musí se mu zpovídat a klást účet ze své existence a<br />
málokterá obstojí, vlastně žádná […]. Tak Ibsen […] stává se velkým osvobozovatelem, velkým<br />
kritikem společnosti evropské, ba lidské, velkým tazatelem, velkým bořitelem […].<br />
Björnson [sic] má dosažitelný cíl […]. [J]eho boje mají ráz dobrovolného omezení, utkvění na<br />
dosažitelném, smíru s neodčinitelným. (KRAUS 1913: 142)<br />
Ibsen hatte von Anfang an ein unerreichbares Ziel, daher beschränkte er sich nicht einmal in<br />
dem Anspruch auf individuelle Freiheit [...], jeder gemeinschaftliche Wert wird von ihm hinterfragt<br />
und muss über seine Existenz Rechenschaft ablegen, und nur wenige bestehen, eigentlich<br />
keiner [...]. So wird Ibsen [...] zum großen Befreier, zum großen Kritiker der europäischen, gar<br />
der menschlichen Gesellschaft, zum großen Fragesteller, zum großen Zerstörer [...]. Björnson<br />
[sic] hat ein erreichbares Ziel [...]. Seine Kämpfe haben den Charakter von freiwilliger Einschränkung,<br />
von Haften am Erreichbaren, von Aussöhnung mit dem Nichtwiedergutzumachenden.<br />
Gerade in dieser Schlussbewertung sollte man die Ursache dessen suchen,<br />
warum Kraus Ibsen als Romantiker und Bjørnson als Realisten bezeichnet.<br />
Jahr 1864, d.h. vor der Entstehung von Brand und Peer Gynt, völlig gegen die skandinavische<br />
Romantik stellt („his now total opposition to Scandinavian romanticism“,<br />
BEYER 1980: 50).<br />
Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen<br />
Wie ich am Anfang zur Methode bemerkt habe, definiert Kraus im Buch<br />
vor allem die Persönlichkeiten der Schriftsteller, nicht ihre Werke an sich.<br />
Diese Tatsache wird auch aus dem vorherigen Zitat ersichtlich. Es handelt<br />
sich hier nicht um eine Klassifizierung von literarischen Strömungen oder<br />
Methoden, sondern um eine Definition der persönlichen Stellungnahme<br />
beider Autoren: Unter Romantik versteht Kraus hier übermäßigen Idealismus,<br />
während er unter Realismus eine nüchterne, vielleicht pragmatische<br />
Einstellung zur Welt versteht. Es stimmt, dass wir die Wörter „Romantiker“<br />
und „Realist“ üblicherweise in diesem Sinne gebrauchen und dass, als Beschreibung<br />
der persönlichen Eigenschaften beider Autoren, diese Charakteristiken<br />
in gewissem Maße berechtigt sind (obwohl optimistische Lösungen<br />
gesellschaftlicher Probleme, die in Bjørnsons Werk angedeutet werden eher<br />
dafür sprechen, ihn als Idealisten zu bezeichnen) 4 . Dennoch zeigt gerade<br />
diese Kategorisierung von Kraus am besten die Schwächen der überwiegend<br />
biographisch orientierten Studie: Als literarhistorische Fachausdrücke<br />
sind die so definierten Begriffe Romantik und Realismus gänzlich irreführend.<br />
Ohne Zweifel gilt der bedeutendste Teil von Ibsens Werk als Eckpfeiler<br />
des realistischen Dramas. Bjørnson ist ebenfalls überwiegend Realist,<br />
jedoch nicht deshalb, weil er „erreichbare Ziele“ beschreibt, sondern aufgrund<br />
seiner realistischen Methode. Deshalb sind die Abwesenheit einer<br />
operativen Definition des Realismus, als literarische Strömung oder Methode,<br />
und die folglich unpassende Bezeichnung Ibsens als Romantiker zweifellos<br />
der bedeutendste Mangel der ansonsten gelungenen Monographie von<br />
Arnošt Kraus.<br />
Literatur<br />
BEYER, Edvard (1980): Ibsen: The Man and His Work. Übers. Marie<br />
Wells. New York: Taplinger.<br />
KRAUS, Arnošt (1913): Björnson [sic!] a Ibsen. Prag: Otto.<br />
NORTHAM, John (1973): Ibsen: A Critical Study. Cambridge: Cambridge<br />
University Press.<br />
ROSSEL, Sven H. (1982): A History of Scandinavian Literature 1870–<br />
1980. Übers. Anne C. Ulmer. Minneapolis: University of Minnesota Press.<br />
4 Bjørnsons Idealismus stellen viele fest. Rossel (1982: 31) behauptet sogar: „Because of<br />
the idealism in his work, he was the first Scandinavian to receive the Nobel Prize for literature<br />
in 1903“.<br />
193
194<br />
Martin Humpál<br />
VOTAVOVÁ, Anna (1973): Arnošt Kraus a počátky české skandinavistiky.<br />
[Arnošt Kraus und die Anfänge der tschechischen Skandinavistik]. Magisterarbeit<br />
an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität.<br />
YOUNG, Robin (1994): Ibsen and Comedy. – In: James McFarlane (Hg.),<br />
The Cambridge Companion to Ibsen. Cambridge: Cambridge University<br />
Press, 58–67.<br />
Aus dem Tschechischen von Barbara Bresslau<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei<br />
(1918–1938) im Spannungsfeld zwischen Staat und Volksgruppe<br />
Mirek Němec<br />
1. Einleitung<br />
In der neueren Nationalismusforschung wird der Institution Schule ein entscheidender<br />
Stellenwert für die Entstehung und Ausformung einer „imagined<br />
community“ eingeräumt (ANDERSON 1993, vor allem S. 76 und 115–141;<br />
HOBSBAWM 1992, hier vor allem S.110f. und 115.). Eine Untersuchung der<br />
Affinitäten zwischen Schule und nationaler Idee kann beitragen, das Verhältnis<br />
zwischen Vielvölkerstaat und ethnischen Minderheiten zu beleuchten.<br />
Es ist überraschend, dass dieser Forschungsansatz zwar in mehreren<br />
Arbeiten über die österreichisch-ungarische Monarchie zur Geltung kam 1 ,<br />
aber bei der Erforschung der nach dem Zerfall des Habsburgerstaates entstandenen,<br />
ebenfalls multinationalen und multikulturellen Staaten Ost- und<br />
Mitteleuropas nur wenig berücksichtigt wurde. Dieser Befund gilt auch für<br />
die wissenschaftlichen Arbeiten zur ersten Tschechoslowakischen Republik<br />
(ČSR). 2 Nur wenige wissenschaftliche Abhandlungen behandeln das Schulwesen<br />
der Elementar- und Sekundärstufe in Böhmen, Mähren und Schlesien<br />
der Zwischenkriegszeit, 3 wobei sie sich entweder mit der Organisation und<br />
Form des deutschen Schulwesens befassen oder statistische Daten aufführen<br />
mit dem Ziel, die staatliche Schulpolitik und ihre Auswirkungen auf die<br />
ethnischen Minderheiten qualitativ zu bewerten. Dagegen gibt es so gut wie<br />
keine sozialgeschichtlich orientierte Arbeit, die sich mit dem Thema Schulwesen<br />
auseinander setzte, obwohl gerade die Schule als identitätsbildender<br />
staatlich gelenkter Integrationsfaktor in den Auseinandersetzungen multi-<br />
1 Zur Schulfrage in Österreich–Ungarn siehe vor allem BURGER (1995) und<br />
PUTTKAMER (2003).<br />
2 Hier standen bisher vor allem die beiden Prager Universitäten im Mittelpunkt der aktuellen<br />
historischen Forschung. Vgl. LEMBERG (2003), MAREK (2001),<br />
GLETTLER/MÍŠKOVÁ (2001).<br />
3 Das deutsche Schulwesen wird aus sudetendeutscher Sicht beschrieben im Sammelband<br />
von KEIL (1967). Neue Aufsätze deutscher Historiker siehe (REICH 1995: 19–38). In<br />
diesem Artikel wird vom Autor der Akzent auf die tschechoslowakische Gesetzgebung<br />
und ihre Auswirkung auf die deutschen Schulen in der ersten Tschechoslowakischen<br />
Republik gelegt (MITTER 1988: 82–94; 1991: 211–232). Mit den deutschen Lehrerverbänden<br />
in der ČSR beschäftigte sich IRGANG (1977: 273–287). Von tschechischer Seite<br />
wurde das Thema des deutschen Schulwesens in der ČSR erst in den letzten Jahren<br />
aufgegriffen – vgl. PODLAHOVÁ (1996, 1999 und 2002).
196<br />
Mirek Němec<br />
ethnischer Gemeinschaften seit dem 19. Jahrhundert eine zentrale Instanz<br />
darstellt.<br />
2. Zur Methode, Quellenauswahl und Fragestellung<br />
Wolfgang Mitter plädiert in seinem sehr aufschlussreichen Aufsatz für „eine<br />
Einbeziehung der Alltagswirklichkeit der einzelnen Schulen“ in den Diskurs<br />
um das Bildungswesen in der ČSR, was seiner Meinung nach zur Konkretisierung<br />
der Analysen beitragen würde (MITTER 1988: 94).<br />
In meiner Abhandlung möchte ich versuchen, diese nicht leichte Aufgabe<br />
zu erfüllen, wobei ich mich stark auf die deutschen Mittelschulen 4 konzentriere.<br />
Vor allem ist es die Frage nach geeigneten Quellen, die eine solche<br />
Untersuchung kompliziert. Es besteht die Gefahr der Geschichtsklitterung,<br />
denn die wenigen erhaltenen Quellen geben nur bedingt Aufschluss über die<br />
alltäglichen Probleme an den Schulen. Ich stütze mich vor allem auf 49<br />
Zeitzeugenberichte, die ich durch eine im Jahre 2003 durchgeführte Umfrage<br />
unter Sudetendeutschen gewonnen hatte. 5 Dieses Korpus von Aussagen<br />
der nun mehr als 70 Jahre alten ehemaligen Schüler 6 , die individuelle Erinnerungen<br />
an vor mehr als 60 Jahre zurückliegende Ereignisse vermitteln,<br />
wird durch gedruckte und veröffentlichte Memoiren damaliger Schüler ergänzt.<br />
7 Im Hinblick auf den Schulalltag stellen solche Erzählungen die ausführlichste<br />
und aufschlussreichste Quellenart dar, wobei ich mir der Gefahr<br />
bewusst bin, welche in der „Oral-History“ steckt. Die autobiographischen<br />
Erinnerungen erzählen nur eine „Wahrheit“ und befinden sich, ähnlich wie<br />
das Gruppengedächtnis, in ständiger Entwicklung, sind der Dialektik des<br />
Erinnerns und Vergessens unterworfen. Sie stellen eine Art aktueller Konstruktion<br />
dar, können deformiert und manipuliert werden, wobei der Erzähler<br />
um diesen Prozess nicht wissen muss (vgl. NORA 1998, 13f.).<br />
Die Einsicht in die archivarischen Quellen – vor allem waren es die kurzgefassten<br />
Jahresberichte einzelner Mittelschulen und einige in den tschechischen<br />
Archiven vorhandene Schulakten – erlaubte, manche Aussagen der<br />
Zeitzeugen zu ergänzen oder gar in einem anderen Lichte erscheinen zu<br />
4 Zu den Mittelschulen gehörten nach der alt-österreichischen Tradition neben allen Typen<br />
von Gymnasien (humanistische Gymnasien, Realgymnasien, Reformrealgymnasien)<br />
noch die Realschulen und Lehrerbildungsanstalten (LBA).<br />
5 Zur Jahreswende 2002/03 bat ich die Sudetendeutsche Zeitung sowie 17 Redaktionen<br />
verschiedener in Deutschland herausgegebener Heimatblätter der Sudetendeutschen um<br />
Veröffentlichung meiner Umfrage, die sich an ehemalige Schüler der deutschen Mittelschulen<br />
in der Ersten Tschechoslowakischen Republik wandte. Vgl. z.B.<br />
6<br />
SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG vom 31.1.2003, Leserbriefe Seite 6.<br />
Der älteste Teilnehmer an meiner Umfrage war Jahrgang 1909, der jüngste 1929.<br />
7 Liste der eingegangenen Briefberichte als Anhang.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 197<br />
lassen. 8 Auf eine vollständige kritische Gegenüberstellung von Erinnerungen<br />
und archivarischen Quellen musste in diesem Beitrag allerdings verzichtet<br />
werden. Lediglich dann, wenn die durchgesehenen archivarischen<br />
Quellen eine Aussage völlig revidierten, wurde eine solche Aussage nicht<br />
erwähnt.<br />
Von den 83 staatlichen und acht privaten deutschen höheren Schulen (Mittelschulen)<br />
in der ČSR 9 stehen Zeitzeugenberichte von 24 staatlichen und<br />
von einer privaten Mittelschule zur Verfügung, außerdem werden zwölf<br />
Bürgerschulen und vier Volksschulen einbezogen. Das ganze Gebiet der<br />
böhmischen Länder – von Eger/Cheb über Prag/Praha bis nach Znaim/Znojmo<br />
und von Troppau/Opava bis nach Krumau/Krumlov – wird damit abgedeckt.<br />
Ebenfalls kann die gesamte Dauer der Ersten Tschechoslowakischen<br />
Republik von 1918 bis 1938 durch die ausgewerteten Berichte und die veröffentlichen<br />
Erinnerungen dokumentiert werden, wobei die meisten Darstellungen<br />
über die Situation in den 1930er Jahren berichten.<br />
Durch die Art der verwendeten Quellen rückt die Schülerperspektive in den<br />
Mittelpunkt meiner Betrachtung. Dabei stehen drei Fragen im Zentrum: Wie<br />
wurde die deutsche Schule in der ČSR mit den Augen deutscher Schüler im<br />
Hinblick auf das deutsch-tschechische Zusammenleben gesehen? Ob und<br />
wie wurde versucht, in der deutschen Mittelschule eine tschechoslowakische<br />
staatsbürgerliche Erziehung und eine – auf die deutsche Kultur bezogene –<br />
„volksbürgerliche“ umzusetzen? Welche Rolle spielte die deutsche Mittelschule<br />
im damals sich vollziehenden Prozess der Herausbildung der sudetendeutschen<br />
Identität bei den Deutschen der böhmischen Länder nach 1918?<br />
3. Zum sozialen Umfeld der Schüler<br />
Die Ergebnisse zum sozialen Umfeld der deutschen Schüler können nur<br />
beschränkt als repräsentativ interpretiert werden, denn die Zahl der Berichterstatter<br />
war zu gering. Ein Vergleich der statistischen Daten einiger Mittelschulen<br />
verifiziert allerdings folgende Ergebnisse.<br />
Die Anzahl der Mittelschüler aus den ländlichen Gebieten entspricht der<br />
Zahl der Mittelschüler aus der (Klein-)Stadt. Nicht selten konnten die Schüler<br />
aus den ländlichen Gebieten in der Stadt im Schulinternat oder unter der<br />
8 Hier handelt es sich vor allem um die pflichtgemäß gedruckten und meist vom Direktor<br />
niedergeschriebenen Jahresberichte. In manchen wurde Archivmaterial aus tschechischen<br />
Archiven hinzugezogen. SÚA Archiv Praha [Staatliches Zentralarchiv Prag],<br />
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích [Staatliches Bezirksarchiv<br />
Leitmeritz mit Sitz in Lobositz], Zemský archiv v Opavě, [Landesarchiv Troppau].<br />
9 Angabe für das Jahr 1932/33 nach Jahrbuch des Reichsverbandes Deutscher Mittelschullehrer<br />
in der Tschechoslowakischen Republik 6, Leitmeritz 1933.
198<br />
Mirek Němec<br />
Woche in Gastfamilien Kost und Logis beziehen. Die Lehrbücher konnten<br />
den Ärmeren aus den Schulbibliotheken ausgeliehen werden. Ein System<br />
von Stipendien und finanziellen Unterstützungen stand den Schülern ebenfalls<br />
zur Verfügung. Dennoch ist zu bemerken, dass nur wenige der damaligen<br />
Mittelschüler einer Bauern- oder Arbeiterfamilie entstammten.<br />
In den Knabenschulen wurden nach der Gründung der Tschechoslowakischen<br />
Republik auch Mädchen als ordentliche Schüler zugelassen. Trotz der<br />
eingeführten Koedukation stellten in den nun gemischten Mittelschulen die<br />
Mädchen bis zur Zerschlagung der Republik im Jahre 1938 eine Minderheit<br />
dar. 10 Dies spiegelt sich auch in meiner Befragung wider. Während im<br />
Elementarschulwesen die Bilanz – acht Mädchen gegenüber acht Jungen –<br />
ausgeglichen ausfällt, zeichnet sich bei den weiterführenden Mittelschulen<br />
eine deutliche Ungleichheit ab. Nur elf Mädchen (davon zwei von Mädchen-Reform-Real-Gymnasien)<br />
nahmen an meiner Umfrage teil, gegenüber<br />
27 Jungen.<br />
4. Schulalltag<br />
Es stellte sich heraus, dass der Schulalltag, in fast allen Berichten einhellig<br />
als „die Fortsetzung der guten alten österreichischen Tradition im neuen<br />
Gewand“ 11 erinnert wird. Die österreichische Tradition sei erst, als „die<br />
deutschen Gebiete 1938 an Deutschland kamen, gebrochen worden, indem<br />
sofort ein anderes Schulsystem eingeführt“ wurde (Bericht Josef Lares).<br />
Freilich führte das neue (tschechoslowakische) Gewand zunächst zu Protestaktionen.<br />
Eugen Lemberg, 1919 Quintaner am Gymnasium in Leitmeritz/Litoměřice,<br />
erinnert sich:<br />
Aus diesem Promenadenweg kamen wir Schüler nach den Osterferien 1919 hervorgeströmt,<br />
um den täglichen Schultrott seufzend wieder aufzunehmen. Aber da prallten wir entsetzt zurück:<br />
vom Fahnenmast wehte eine tschechoslowakische Flagge: rot – weiß – mit einem allen<br />
Vorschriften der Heraldik widersprechenden blauen Keil. Das durfte doch nicht sein! Waren<br />
wir schon, ohne befragt zu werden, in einem uns fremden Staat eingegliedert worden: unsere<br />
Schule war deutsch und sollte es bleiben! Eine tschechische Fahne konnten wir nicht hinnehmen.<br />
Solange sie da oben hing, würden wir das Haus nicht betreten. Der Schülerstrom staute<br />
sich, von den Oberklassen ging niemand hinein, die ‚Kleinen‛ aus den unteren Jahrgängen<br />
wurden, soweit schon im Haus ... herausgeholt, an den protestierenden Lehrern vorbei, die um<br />
ihre Staatsbeamtenstellen bangten. Aber dies eben erhöhte den Reiz der Sache. (LEMBERG<br />
1986: 154)<br />
10 Das Troppauer Gymnasium besuchten im Schuljahr 1937/38 519 Schüler, davon waren<br />
147 Mädchen, also 28,5 % (Jahresbericht des Deutschen Staatsgymnasiums in Troppau.<br />
Schuljahr 1937/38).<br />
11 Unveröffentlichtes Manuskript verfasst von dem 2002 verstorbenen Dr. Franz Wischin<br />
[Višín]; zur Verfügung gestellt von Frau Charlotte Birnbaum (Ulm), beide hatten das<br />
Gymnasium in Krumau besucht.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 199<br />
Die Erinnerung Lembergs ist in Manchem ungenau 12 , zeigt jedoch sehr gut<br />
das Unbehagen der Schüler über die politische Situation des Jahres 1919<br />
und die Probleme der deutschen Mittelschule in der ČSR. Freilich konnte<br />
dieser Schülerstreik nichts bewegen, wie Lemberg weiter bemerkt: „Die<br />
deutsche Freiheit war nicht gerettet, die Tschechoslowakei war nicht zugrundegegangen...“<br />
Einige Tage später ging man „normal in die Schule“, die<br />
Fahne hatte man inzwischen wohlweislich vom Mast entfernt. Trotzdem<br />
wurde täglich jedem Schüler die neue politische Realität vor Augen geführt.<br />
In den Klassenräumen hing neben dem Kreuz und anstelle des bis 1918 obligatorischen<br />
Kaiserportraits nun ein Bild von T.G. Masaryk – dem ersten<br />
tschechoslowakischen Präsidenten (Bericht Richard Laube).<br />
Mit der Gründung tschechischer Gymnasien in mehrheitlich deutschen Gebieten<br />
verließen viele tschechischsprachige Schüler die deutschen Mittelschulen,<br />
welche in dieser Hinsicht in ihrem deutschen Charakter gestärkt<br />
wurden. 13 In den meisten Schulanstalten nahmen mehrere deutschsprachige<br />
Schüler mosaischer Religion (jüdischen Glaubens) am Unterricht teil. Vor<br />
allem in den großen Landeshauptstädten war der Anteil der jüdischen Schüler<br />
besonders hoch. 14 Im Prager Stephans-Gymnasium dürften sogar in der<br />
Klasse von Marianne Winder, der Tochter des Schriftstellers Ludwig Winder,<br />
von 42 Schülern 36 jüdischer Herkunft gewesen sein. Judenfeindliche<br />
Anspielungen gab es hier, wie sie berichtet, selten (vgl. BINDER 2000: 65).<br />
Auch im nordböhmischen Aussig/Ústí nad Labem sollen sich aus dem Zusammenleben<br />
bis zum Schuljahr 1938/39 keine Probleme ergeben haben,<br />
wie zwei veröffentlichte Erinnerungen an das deutsche Gymnasium in den<br />
späten 30er Jahren vermerken (HERZOGENBERG 2000: 273 und ROHAN<br />
2001: 53–64.)<br />
12 Der Schülerstreik begann nicht zu Ostern, sondern am Freitag den 2. Mai, nach dem die<br />
Schulanstalt am 1. Mai beflaggt sein sollte. Aus dem Protokoll geht auch hervor, dass<br />
über dem Gebäude nicht die von Lemberg eindrucksvoll beschriebene tschechoslowakische<br />
Fahne wehte, sondern, da eine solche noch nicht zur Verfügung stand, eine in den<br />
„böhmischen Landesfarben“, also eine weiß-rote (SOA Litoměřice, Nĕmecké státní<br />
gymnázium, Karton 3./ 1919, Konferenzprotokoll Nr. XXII. vom 12. Mai 1919).<br />
13 In Litomĕřice/Leitmeritz und Duchcov/Dux wurden 1919 die ersten zwei tschechischen<br />
Gymnasien in überwiegend deutschen Städten gegründet. Die deutsche Staatsrealschule<br />
in Leitmeritz besuchten im Jahre 1919 noch 18 Schüler mit tschechischer Muttersprache,<br />
im Jahre 1924 lediglich 2, das deutsche Leitmeritzer Gymnasium in diesem Jahr<br />
sogar keiner mehr (Jahresberichte der Deutschen Realschule und des Deutschen Gymnasiums<br />
in Leitmeritz).<br />
14 Am Brünner Masaryk-Gymnasium (Brno) bekannten sich im Schuljahr 1937/38 von<br />
441 Schülern 65 (14,9 %) zur mosaischen Religion (Jahresbericht des Deutschen Masaryk-Gymnasiums<br />
in Brünn für das Schuljahr 1937/38, Brünn 1938). Auch in Preßburg/Bratislava<br />
und Prag war der Anteil der jüdischen Mittelschüler an deutschen<br />
Schulanstalten relativ hoch.
200<br />
Mirek Němec<br />
Eine andere Erfahrung machte während der politisch angespannten Atmosphäre<br />
am Ende des Schuljahres 1937/38 jedoch Peter Demetz, der ein<br />
Schüler des Deutschen Masaryk-Gymnasiums in Brünn war. Er und „eine<br />
ganze Gruppe von ehemals deutschen Schülern“ jüdischer Herkunft wechselten<br />
zum 1.9.1938, um den Schikanen der von nationalsozialistischer Propaganda<br />
angestachelten Mitschüler und Lehrer zu entkommen, in das tschechische<br />
Gymnasium (DEMETZ 1996: 133).<br />
So wie die Schüler bekannten sich auch die Lehrer, abgesehen von wenigen<br />
Ausnahmen, zur deutschen Nationalität. 15 Es ist nicht überraschend, dass<br />
die Lehrer in großer Mehrheit „deutsch fühlten“ (Bericht Gustav Scharm),<br />
was auch für die, welche jüdischer Herkunft waren, galt. Dabei ist auf die<br />
Tatsache hinzuweisen, dass gerade unter den Tschechischlehrern mehrere<br />
jüdischer Herkunft waren. 16<br />
Die Lehrer trugen wesentlich dazu bei, dass die österreichische Tradition im<br />
tschechoslowakischen Schulwesen beibehalten wurde, schließlich waren sie<br />
alle „geborene Österreicher“ (Bericht Roland Hoffmann). Zur Zeit der<br />
Monarchie hatten sie ihr Studium absolviert, in der Regel an der deutschen<br />
Prager Universität oder der Wiener Universität. „Die Monarchie steckte<br />
ihnen noch in den Knochen.“ (Bericht Günther Schallich ) urteilt ein Schüler<br />
des Realgymnasiums in Neutitschein/Nový Jičín der späteren 1930er Jahre.<br />
In der angesprochenen deutschen Gesinnung einiger Lehrer kann man unter<br />
den Bedingungen der Tschechoslowakischen Republik eine Spannung zwischen<br />
den Loyalitätsbindungen erkennen, die aber nur äußerst selten zu einem<br />
offenen Konflikt eskalierte. „Die Lehrer hielten sich peinlichst genau<br />
an die behördlichen Weisungen“ (Bericht Hans Brunner), verbargen oft vor<br />
den Schülern ihre politische Einstellung und verhielten sich meist nach dem<br />
Motto: „Wessen Brot ich esse, des Lied ich singe!“ (Bericht Maria Oliwa)<br />
Die Umfrage brachte die Bemühung der Lehrer aller Schultypen ans Licht,<br />
einen politischen Kommentar oder eine Äußerung zu aktuellen Fragen des<br />
deutsch-tschechischen Zusammenlebens auf dem Boden der Schule mög-<br />
15 Gerda Keil (Mädchenreformrealgymnasium Troppau) erinnerte sich, dass erst in den<br />
späten 20er Jahren ein deutsch-tschechisches Ehepaar kam, das Sport und Tschechisch<br />
unterrichtete (wahrscheinlich handelt es sich um Ehepaar Nitsch-Nawratil). Herr Gustav<br />
Scharm sollte seinen Religionsunterricht im Arnauer Gymnasium von einem tschechischen<br />
Priester Prof. Langner erhalten, und der Zeichenlehrer am Brünner Gymnasium<br />
hieß Bedö und soll Ungar gewesen sein. Meines Erachtens handelt es sich aber mit<br />
größter Wahrscheinlichkeit um Beispiele dafür, wie schwierig es in manchen Fällen<br />
war, die Nationalität tatsächlich zu bestimmen. Vgl. Exkurs Josef Brtek im Text.<br />
16 Vgl. Berichte: Buzek, Anton, Heller Viktor, Hertl, Hanns, Dr. Wischin, Krumau; u.a.<br />
Jiří Kosta erinnerte sich in seinen Memoiren, dass auch sein Vater – Mathematik- und<br />
Physiklehrer an einem Prager Gymnasium – Tschechisch unterrichtete, da er als Prager<br />
jüdischer Herkunft beide Landessprachen beherrschte (KOSTA 2001: 34).<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 201<br />
lichst zu vermeiden. „Die Lehrer versuchten, dem Staate gegenüber neutral<br />
zu sein. Eine Liebe oder Achtung zur ČSR haben sie uns nicht beigebracht“<br />
(Bericht Gustav Scharm), so charakterisiert ein ehemaliger Schüler des Realgymnasiums<br />
in Arnau/Hostinné die Haltung seiner Mittelschullehrer. Und<br />
ein damaliger Schüler des Troppauer Gymnasiums (Opava) in den 20er Jahren<br />
erinnert sich zwar daran, dass sein Tschechischlehrer „für die (italienischen)<br />
Fas-cisten, [wie er es aussprach], [...] schwärmte“, aber „keine Turbulenzen<br />
auf Grund des alltäglichen Nationalitätsproblems“ aufkommen<br />
lassen wollte. Und er fährt fort: „sie [die Lehrer] standen loyal zum ungeliebten<br />
Staat. ... Im Schulalltag merkte man [von den ständigen Reibungen<br />
zwischen den Deutschen und Tschechen] kaum etwas.“ (Bericht Ernst<br />
Kraus) Soll man die politischen Äußerungen der Lehrer charakterisieren, so<br />
ist eine allgemeine Zurückhaltung zu konstatieren, was sogar für<br />
angespannte Situationen wie den 4. März 1919 in Mies/Stříbro gilt (hierzu<br />
BRAUN 1996). Nach der Erinnerung von Josef Hanika wurden die unteren<br />
sechs Klassen des Gymnasiums um zehn Uhr nach Hause geschickt, der<br />
Lehrkörper bestand aber darauf, „dass die beiden obersten Klassen während<br />
der [schon früher angekündigten; M.N.] Kundgebung in einem Klassenzimmer<br />
unter Aufsicht eines Lehrers zurückbleiben“ (HANIKA 1962:<br />
133f.). Die Angst der staatlichen Beamten, die einen Eid geleistet hatten,<br />
vor Komplikationen ist offensichtlich. Andererseits bestraften die Pädagogen<br />
die Schüler nicht, die eigenmächtig die Klasse verließen, als sie Schüsse<br />
und Schreie auf dem Marktplatz hörten (HANIKA 1962: 135).<br />
Dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler ihre politischen Einsichten entsprechend<br />
der tschechoslowakischen Schulordnung 17 zurückhielten, hatte<br />
sich auf den Ausgleich zwischen Volks- und Staatserziehung in der Schule<br />
positiv ausgewirkt. Lediglich in zwei Berichten wird von angeblicher<br />
Illoyalität gegenüber dem tschechoslowakischen Staat berichtet.<br />
Der erste und wohl schwerwiegendste Vorfall betraf einen Deutschlehrer<br />
des Troppauer Gymnasiums. Ende des Jahres 1933 „wurde er verhaftet und<br />
musste wegen „Irridenta“ [sic!] ein Strafverfahren über sich ergehen lassen.“<br />
18 Vom Dienst wurde er suspendiert und 1936 zu vier Jahren Haft ver-<br />
17 Im § 22 der Schulordnung wird „Jedwede politische Agitation in der Schule“ als „unzulässig“<br />
erklärt, „ebenso ist jede politische Parteilichkeit von der Schule auszuscheiden“.<br />
Siehe die Schulordnung für die Mittelschulen der Čechoslovakischen Republik (1919<br />
und 1935), S. 8.<br />
18 Es handelt sich wohl um den größten Prozess gegen einen Mittelschulprofessor in der<br />
Tschechoslowakei. Die Einzelheiten sind bis heute unklar. „Patscheider sollte Führer<br />
der radikal-nationalen ‚Bereitschaft‘, ein Gegenspieler des Kameradschaftsbundes sein.<br />
Im Zusammenhang mit den Richtungskämpfen, Feindseligkeiten und Denunziationen<br />
im sogenannten völkischen Lager wurde er wegen staatsfeindlicher Betätigung verur-
202<br />
Mirek Němec<br />
urteilt. Die Schüler erfuhren in der Schule über den Prozess, welcher<br />
Schlagzeilen auf den Titelseiten der damaligen deutschen Presse machte, 19<br />
keine Einzelheiten. 20 Der Berichterstatter, welcher damals sein Schüler war,<br />
erinnerte sich im Nachhinein nicht, dass der Lehrer „nazistische oder judenfeindliche<br />
Äußerungen gemacht hatte.“ (Bericht Wilhelm E. Leubner).<br />
Ebenfalls die Aussagen der ehemaligen Schüler von Dr. Patscheider, die als<br />
Zeugen vor das Gericht vorgeladen wurden, sollten Patscheider ein durchaus<br />
günstiges Zeugnis ausstellen (DEUTSCHE ZEITUNG BOHEMIA, Nr. 294,<br />
vom 18.12.1935, 2). Der Staatsanwalt kam jedoch zu einem anderen<br />
Schluss, berief sich dabei auf einige beschlagnahmte Hausarbeiten von Patscheiders<br />
Schülern der 7. Klasse aus dem Schuljahre 1931–32, in denen<br />
großdeutsches und antitschechoslowakisches Gedankengut entdeckt und ein<br />
„das dritte Reich“ verherrlicht wurde. 21<br />
Über einen weniger spektakulären Fall berichtete ein Znaimer Schüler. Der<br />
tschechische (!) Schuldiener des deutschen Realgymnasiums hätte die Republik<br />
retten wollen, indem er einen 17–jährigen Schüler, welcher am Klavier<br />
das Deutschlandlied zu spielen begann, anzeigte. Der Schüler wurde<br />
auf Anordnung der Schulbehörde vom Gymnasium verwiesen (Bericht<br />
Hans Brunner).<br />
Beide Ereignisse scheinen eher Ausnahmeerscheinungen zu sein. Sie zeigen<br />
jedoch, wie ein unerwünschtes Verhalten in der Schule nach 1933 mit harten<br />
Strafen unterbunden wurde.<br />
5. Geschichtsunterricht<br />
Dass die Lehrer politisch brisante Themen zu umgehen suchten, spürt man<br />
auch in den Äußerungen der ehemaligen Schüler über den Geschichtsunter-<br />
teilt, nach drei Jahren vorzeitig entlassen und zog nach München um“ (Nittner 1984:<br />
340). Nach meinen Recherchen wurde dem Angeklagten vorgeworfen, unter der Schülerschaft<br />
„den großdeutschen Gedanken nicht nur kulturell, sondern auch auf der Grundlage<br />
des Bodenraumes zu propagieren“, gegen den Staat Feindschaft zu schüren und<br />
Schriften von Schönerer zu verbreiten. Im Laufe des Prozesses wurden über 20 Personen<br />
angeklagt, unter ihnen einige ehemalige Schüler des Gymnasiums und der bekannte<br />
„Volksbildner“ Dr. Emil Lehmann, welcher früher Mittelschulprofessor in<br />
Landskron/Lanškroun war. Lehmann wurde, wie Patscheider, verurteilt, da er aber aus<br />
der Republik flüchtete, nicht inhaftiert. (Slezský zemský archiv Opava, Fond SZ Ostrava,<br />
Karton 27, St.3479 / 34/3).<br />
19 Über den Prozess berichtete ausführlich die DEUTSCHE ZEITUNG BOHEMIA, Dezember<br />
1935–Februar 1936.<br />
20 Nicht einmal der Jahresbericht informiert über sein Schicksal, obwohl es üblich war,<br />
über das Ausscheiden von Professoren aus dem Lehrkörper, sowie ihre weitere Tätigkeit<br />
zu berichten. Interessant, dass auch die damalige Troppauer Presse diesem Vorfall nur<br />
eine kleine Notiz widmete.<br />
21 Zemský archiv Opava: Fond: SZ Ostrava, Karton Nr. 27, sign. 3722/33/6.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 203<br />
richt. Dieses Unterrichtsfach ist für eine Ideologisierung, sei es seitens der<br />
Staatsmacht oder einer Minorität, besonders anfällig. Dies reflektiert in seinen<br />
Erinnerungen der aus dem Riesengebirge stammende Schriftsteller<br />
Franz Fühmann, welcher von 1932–1936 zuerst ein Wiener Klostergymnasium<br />
und von 1936–1939 das Reichenberger Realgymnasium besuchte:<br />
Mein Problem ist das Kontinuum. Etwa der Geschichtsunterricht: ... auf der Volksschule lernten<br />
wir noch keine Geschichte; in Kalksburg [Jesuitengymnasium in Wien] lernte ich habsburgische<br />
Geschichte; auf dem Realgymnasium [Reichenberg/Liberec] dann eine Art frankophiler<br />
europäischer Geschichte tschechischer Prägung, vorgetragen von den deutschen Nationalisten,<br />
dann preußische Geschichte und Rassenlehre; fünf Jahre später dann historischen Materialismus,<br />
wie man ihn zur Ära Stalins lehrte. (FÜHMANN 1983: 172f)<br />
Wie andere Staaten versuchte auch die Tschechoslowakei den Geschichtsunterricht<br />
nach der Vorgabe der nationalen Geschichtsschreibung zu reformieren.<br />
Die österreichischen Geschichtslehrbücher wurden als erste aussortiert,<br />
die österreichischen Geschichtslehrpläne wurden früher als die von<br />
anderen Fächern bereits im Frühjahr 1919 geändert. Die tschechoslowakischen<br />
Lehrpläne sahen vor, dass „erhöhte Sorgfalt insbesondere der Geschichte<br />
der Hussitenzeit und der böhmischen Reformation zu widmen“ sei.<br />
Dabei sei „neben der Geschichte Böhmens auch die Geschichte der anderen<br />
Slawen gründlicher zu behandeln, dafür die deutsche und österreichische<br />
Geschichte einzuschränken“ (REBHANN/HEVLER 1929: 28).<br />
Der von den deutschen Pädagogen selbst gestaltete Unterrichtsverlauf, bei<br />
dem zwar nur vom Schulministerium approbierte, jedoch von deutschen<br />
Pädagogen verfasste Lehrbücher eingesetzt wurden, konnte einer ständigen<br />
Kontrolle nicht unterzogen werden. Nur die Erinnerungen können klären,<br />
wie sich die deutschen Pädagogen mit den Anforderungen des tschechoslowakischen<br />
Ministeriums auseinandersetzten.<br />
Vergleichsweise ohne Schwierigkeiten gingen die Pädagogen im Primarschulwesen<br />
mit den Vorgaben des tschechoslowakischen Schulministeriums<br />
um. An den Volks- und Bürgerschulen wurde nach dem mehrmals ausgesprochenen<br />
Grundsatz der sudetendeutschen Schulmänner verfahren: „Alle<br />
staatsbürgerliche Erziehung hat an die volksbürgerliche Erziehung anzuknüpfen<br />
und muß durch diese hindurchgehen.“ 22 In der Praxis wurde dies<br />
so umgesetzt, dass die Schüler nach dem Grundsatz unterrichtet wurden:<br />
‚Lerne erst deine Heimat kennen und dann die Welt!‘ Auf diese Weise<br />
schufen die Lehrer einen Spielraum, in dem sie im Unterricht lediglich die<br />
engere, meist deutsche Heimat behandelten und die „weite“ Welt – also<br />
auch die benachbarte tschechische – auf die höheren Klassen verschoben.<br />
22 Diese Parole wurde von den deutschen Pädagogen mehrmals wiederholt, siehe z.B.<br />
PREISSLER (1930: 17f.).
204<br />
Mirek Němec<br />
Natürlich konnte eine solche Ausweichtaktik in den Mittelschulen nur beschränkt<br />
aufrechterhalten werden, ein Interessenkonflikt zwischen Lehrplan<br />
und nationaler Loyalität bei den Lehrern war vorprogrammiert. Ein ehemaliger<br />
Prager Mittelschüler erinnert sich daran, „dass wir fast ausschließlich<br />
böhmische Geschichte gelernt haben, und diese mit einer Lücke von 1618–<br />
1918.“ (Bericht Hans Wiener )<br />
Nun stellt sich die Frage, aus welchem Grunde der Geschichtslehrer die<br />
‚Zeit der Finsternis‘, das Temno ausgelassen hatte? Hatte er kein Interesse<br />
daran, die Märtyrerrolle der Tschechen unter dem Joch der Habsburger zu<br />
verherrlichen oder aber erklärte er sich den vorgegebenen Lehrplan so, indem<br />
er eine ungebrochene Linie der Entwicklung der tschechischen Nation<br />
von den Slawenaposteln über die Hussiten bis zur Gründung des modernen<br />
tschechoslowakischen Staates noch zu zeichnen versuchte, ohne die vermeintliche<br />
Niedergangsphase der tschechischen Nation ansprechen zu müssen?<br />
Diese Frage bleibt leider unbeantwortet.<br />
Außer dem oben beschriebenen radikalen Schnitt gab es noch andere Möglichkeiten,<br />
den Geschichtsunterricht trotz der im Lehrplan veröffentlichen<br />
Anforderungen der tschechoslowakischen Regierung nach eigenen Vorstellungen<br />
zu gestalten.<br />
Die folgende Aussage dokumentiert nicht nur das Bestreben des tschechoslowakischen<br />
Schulministeriums um die Instrumentalisierung des Geschichtsunterrichtes,<br />
sondern auch die Ausweichstrategie eines in Böhmisch<br />
Leipa/Česká Lípa tätigen Geschichtslehrers, welcher Mitglied der DNSAP<br />
gewesen sein soll:<br />
Im Geschichtsunterricht war der Ablauf der Geschichte Österreichs und der böhmischen Länder<br />
ganz im Sinne der tschechischen Geschichtsauffassung dargestellt, Österreich-Ungarn als<br />
Völkerkerker beschrieben, die Gründung der ČSR als „Befreiung“. ... Den Stoff [über die<br />
Gründung ČSR] vorzutragen und zu prüfen, war für den Prof. unangenehm ... deshalb zog er<br />
den Unterricht des 19. Jahrhunderts so in die Länge, ... dass man am Ende des Schuljahres<br />
keine oder wenig Zeit fand. Der Vortrag erfolgte dann im Schnelltempo, ohne den Stoff zu<br />
prüfen, weil die Notenkonferenz schon vorbei war. (Bericht Viktor Heller)<br />
Dies war nur eine von mehreren Methoden, welche man im Schulalltag anwenden<br />
konnte, um konfliktgeladene Themen zu vermeiden. Es gab noch<br />
andere Möglichkeiten, den Zwiespalt zwischen staatsbürgerlicher Loyalität<br />
und nationalen Interessen zu überbrücken. An der Lehrerbildungsanstalt<br />
(LBA) in Komotau/Chomutov musste der als „gewissenhafter Pädagoge“<br />
charakterisierte Geschichtslehrer selbstverständlich „großen Wert auf die<br />
böhmische [heißt: tschechische] Geschichte legen, ganz besonders auf die<br />
Gründung der ČSR. Alle Ortsnamen mussten uns auch tschechisch geläufig<br />
sein (Bericht Irmtraut Endisch). Dieser Unterricht wurde jedoch noch ergänzt,<br />
denn die „deutsche Geschichte [wurde] parallel mit der tschechischen<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 205<br />
[behandelt] und in der Geographie lagen die Schwerpunkte in Mitteleuropa<br />
– also in Böhmen [also Tschechoslowakei] und Deutschland.“ (Bericht Roland<br />
Hoffmann) Wenn man bedenkt, welchen Einfluss die Geschichte auf<br />
die Herausbildung der nationalen Identität der heranwachsenden Jugend<br />
haben kann und in der (optimistischen) Annahme, dass der Unterricht ohne<br />
jegliche Ressentiments abgehalten wurde, kann man schlussfolgern, dass<br />
ein solcher Unterricht in einer multinationalen Republik gerade der richtige<br />
war. Dabei handelte es sich wohl in Komotau um keinen Einzelfall, was<br />
eine weitere Aussage belegt:<br />
Unsere Geographie- und Geschichtslehrerin [...] bemühte sich in ihrem Unterrichte auf geschichtliche<br />
Verbindungen von Tschechen und Deutschen hinzuweisen. Sie vermochte uns<br />
klarzumachen, dass uns seit Jahrhunderten eine gemeinsame Geschichte verband. Im Erdkundeunterricht<br />
legte sie höchsten Wert darauf, dass wir alle Ortsnamen in Tschechisch und<br />
Deutsch kannten. (Bericht Gerda Keil)<br />
Betrachtet man die Aussagen der ehemaligen Schüler, kommt man zum<br />
Schluss, dass mancherorts eine Nische gefunden wurde, in der Lehrinhalte<br />
vermittelt wurden, die eine deutsche nationale Identität stärken sollten, ohne<br />
die Staatsloyalität in Frage stellen zu müssen.<br />
6. Feier- und Gedenktage<br />
Eine identitätsstiftende Funktion hatten die in jedem Schuljahr gefeierten<br />
Gedenktage, die als Ausdruck nationaler oder staatlicher Gemeinsamkeit zu<br />
verstehen sind. Zwar konnte ich durch die Auswertung der Jahresberichte<br />
ganz genau feststellen, welche Jubiläen und Jahrestage in den Schulen gefeiert<br />
wurden, doch fehlt mir das Bild über den Verlauf und den Eindruck,<br />
welche solche staatlich oktroyierten Feierlichkeiten hinterließen, sowie die<br />
Resonanz auf sie. Ferner wurde erfragt, ob außer den vorgeschriebenen<br />
auch andere, möglicherweise geheim oder symbolisch abgehaltene Feierlichkeiten<br />
im Schulalltag vorkamen?<br />
Aus der Reihe der Gedenktage, mit denen an für den tschechoslowakischen<br />
Staat bedeutende Ereignisse sowie an Persönlichkeiten, die sich um die<br />
tschechoslowakische Nation verdient gemacht hatten, gedacht wurde, erinnerten<br />
sich die Befragten in der Regel nur an zwei: an die alljährlichen Feierlichkeiten<br />
anlässlich der Gründung der Republik am 28.10. und an den am<br />
7. März jedes Jahres würdig begangenen Geburtstag Masaryks. An die Feier<br />
anlässlich der Geburtstage des zweiten Präsidenten Edvard Beneš (28.5.)<br />
sowie an den Tag der tschechoslowakisch-rumänischen und tschechoslowakisch-jugoslawischen<br />
Freundschaft, an weitere kleinere Schulfeiern und in<br />
der Schule gefeierte Jubiläen, wie etwa an den Comenius-Tag, erinnerten<br />
sich die Befragten erst nach Rückversicherung in einem Jahresbericht oder<br />
einer Schulzeitung.
206<br />
Mirek Němec<br />
An den Feiertagen wurde „im Rahmen von Feierstunden, an die Herkunft,<br />
die Durchsetzung und die Leistung der Gefeierten gedacht (Bericht Roland<br />
Hoffmann) bzw. die Bedeutung des Ereignisses für den Tschechoslowakischen<br />
Staat in Vorträgen hervorgehoben. In einigen Fällen wurden Anordnungen<br />
des Ministeriums betreffs des Verlaufs der Gedenkstunde bzw. des<br />
Gedenktages an die Schuldirektionen gesandt. Wie solche Vorträge durchgeführt<br />
wurden, dokumentiert der folgende ausführliche Bericht aus dem<br />
Leipaer Realgymnasium:<br />
In der Schule gab es ein Buch, das die Schüler scherzhaft ‚Tante‘ nannten. Es war in erster<br />
Linie dazu bestimmt, Anordnungen des Direktors den Schülern bekanntzumachen. [...] Dieses<br />
wurde dann während der Unterrichtsstunden von Schulzimmer zu Schulzimmer weitergegeben.<br />
Der jeweils unterrichtende Lehrer verlas die Anordnung, machte über diese Verlesung einen<br />
Vermerk [...] und ließ das Buch in die nächste Klasse tragen. Stand nun ein Gedenktag bevor,<br />
der nicht in einer Gesamtveranstaltung begangen wurde, schrieb der Direktor etwas über den<br />
Gedenktag in die Tante und ließ diese [...] umlaufen. Diese Verlesung erscheint dann im Jahresbericht<br />
als ‚Vortrag‘.(Bericht Viktor Heller)<br />
Die Resonanz auf ein solches Fest hielt sich selbstverständlich in Grenzen.<br />
„Die Lehrer blieben bei den Feiertagen sachlich neutral“ (Bericht Karl Ertel).<br />
Heikel war es mit den Gedenktagen, die die ganze Schule an einem<br />
sonst schulfreien Tag zu begehen hatte, bei denen aber nicht immer alle<br />
Schüler und Lehrer erschienen (Bericht Gerda Keil). Im nordböhmischen<br />
Böhmisch Leipa sahen Gedenkfeiern in den 30er Jahren etwa so aus:<br />
Die Gesamtveranstaltungen [alle Schüler und Lehrer] der Anstalt fanden in der Jahn-Turnhalle<br />
[!] statt. Die Redner sahen diese Tätigkeit als etwas besonders Unangenehmes an, weil etwas<br />
gefeiert werden mußte, was man im Innersten mißbilligte. Deswegen versuchte jeder Lehrer,<br />
sich davor zu drücken, solange er nur konnte. (Bericht Viktor Heller)<br />
Und nicht nur die Lehrer des Leipaer Realgymnasiums hatten mit solchen<br />
Feierstunden, die gar „in den letzten Jahren vor 1938 von der Kriminalpolizei<br />
überwacht“ wurden, ihre Schwierigkeiten.<br />
Besondere Sorgen machte dem Direktor das Absingen der Staatshymne, die niemand mitsingen<br />
wollte. Bei den Klassen von der dritten aufwärts versuchte er es gar nicht, weil alle Schüler<br />
ihren Stimmbruch als Begründung angaben. [...] Der jämmerliche Gesang der Staatshymne<br />
wurde dann durch die Lautstärke des Schülerorchesters ausgeglichen. (Bericht Viktor Heller)<br />
Aus den Aussagen ist ersichtlich, dass die Staatshymne „mit Ingrimm gesungen,<br />
da als Zwang empfunden“ (Bericht Herta Anders) wurde. Andererseits<br />
wurden solche Feiern wohl nicht immer in ihrer politischen Konnotation<br />
verstanden:<br />
Wir freuten uns über das Absingen der slowakischen Hymne: Ob der Tatra blitzt es und dröhnt<br />
des Donners Krachen. Dabei stießen wir mit den Füssen gegen unsere Sitzbänke, um das Grollen<br />
des Donners auch glaubhaft zu machen. (Bericht Wilhelm E. Leubner)<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 207<br />
Die Staatshymne wurde mehreren Aussagen nach an den Volksschulen bis<br />
1937 auf deutsch gesungen, danach „mußte der Text tschechisch gekonnt<br />
werden, obwohl wir kein Wort Tschechisch in der Volksschule lernten.“<br />
(Bericht Maria Oliwa ) An einigen Bürgerschulen wurden außer der tschechoslowakischen<br />
seit 1937 „auch die rumänische und jugoslawische Hymne“<br />
gelernt. 23<br />
An den Mittelschulen mussten die Schüler die tschechoslowakische Hymne<br />
auf deutsch und auf tschechisch singen können, woran sich einige der Befragten<br />
aber nicht erinnerten: „Ich kann mich nicht erinnern, daß am Gymnasium<br />
jemals die Nationalhymne auf deutsch gesungen wurde, die ich bereits<br />
an der Volksschule gelernt hatte.“ (Bericht Hans Witzku)<br />
Eine besondere Bedeutung unter den jährlich zelebrierten Jahrestagen stellte<br />
Masaryks Geburtstag dar. Dora Müller (sie besuchte das Masaryk-<br />
Gymnasium in Brünn von 1930–1938) beschreibt in ihrem Essay die Schulfeier<br />
anlässlich Masaryks 80. Geburtstag:<br />
Schüler und Lehrer hatten sich um 9 Uhr vormittags in der Aula versammelt. Mitten im Blumen-<br />
und Pflanzenschmuck stand Masaryks Bild, das Werk des akademischen Malers Oskar<br />
Spielmann, eines ehemaligen Schülers der Anstalt. Das Schülerorchester eröffnete unter Leitung<br />
von Prof. Dr. Josef Peschek die Feier mit dem Priestermarsch aus Mozarts Zauberflöte.<br />
Ein Schüler der VI. Klasse, Wolfgang Weithofer, Sohn des beliebten Brünner Kinderarztes,<br />
trug ein von Prof. Dr. Karl Kreisler verfasstes Festgedicht An T. G. Masaryk vor. [...] Es folgten<br />
weitere Vorträge. U.a. sprach Prof. Dr. Karl Teller zu dem aktuellen Thema T. G. Masaryk<br />
und die Jugend.<br />
Ihren Höhepunkt erreichte die Feier, als der Landesschulinspektor, Min. Rat Dr. Karl Zirngast,<br />
die Mitteilung machte, dass der Minister für Schulwesen und Volkskultur mit Erlass vom 3.<br />
März 1930 dem deutschen Gymnasium in Brünn, beginnend mit dem 7. März 1930, dem 80.<br />
Geburtstag des Herrn Präsidenten, den Ehrennamen MASARYKOVO NĚMECKÉ STÁTNÍ<br />
GYMNÁSIUM V BRNĚ, in Übersetzung DEUTSCHES MASARYKSTAATSGYMNASIUM<br />
IN BRÜNN verliehen habe. (MÜLLER 2003)<br />
Das hier ausgedrückte wohl freiwillige Engagement einiger Lehrer des<br />
Brünner Masaryk-Gymnasiums und die spürbar positive Aufnahme der Feier<br />
bei zumindest einigen Schülern lassen sich auch an anderen Schulen beobachten.<br />
Der erste Präsident der Tschechoslowakei wurde von vielen deutschen<br />
Pädagogen und Schülern geschätzt. Diese Sympathien für den<br />
„wahrhaftig[en] Vater des Staates“ (Bericht Hans Wiener ) erläutert ein<br />
ehemaliger Schüler:<br />
Durch seinen Ursprung geprägt – die Mutter Deutsche und der Vater Slowake<br />
– „strebte Masaryk ein gedeihliches Zusammenleben der Völker an“<br />
23 Berichte Beywl, Elisabeth Katharina und Schneider, Herbert. Schneider fügt sogar hinzu,<br />
dass die beiden Hymnen der verbündeten Staaten der Tschechoslowakei im Original<br />
gesungen werden mussten!
208<br />
Mirek Němec<br />
(Bericht Friedrich Christian Otto Schlögl). Zu Masaryks Popularität trugen<br />
seine Herkunft, sein deutscher Ausbildungsweg 24 und vor allem seine Absagen<br />
an die Adresse tschechischer Chauvinisten sowie seine zwar ambivalente,<br />
jedoch nicht ablehnende Haltung gegenüber den Deutschen bei<br />
(HAHN 1999: 214–242, bes. 239ff.).<br />
Die Sympathiebekundungen für den ersten Präsidenten fanden ihren Höhepunkt<br />
in den Trauerreden anlässlich seines Todes 1937. Noch einmal ein<br />
Auszug aus dem Essay von Dora Müller:<br />
Am 17. September 1937 versammelten sich Schüler und Lehrer abermals im Festsaal, um Masaryks<br />
zu gedenken. Hinter der verhüllten Bühne trug das Schülerorchester wieder Mozarts<br />
Priestermarsch vor. Ein Chor sang Flemings Integer vitae, der Direktor hielt die Trauerrede,<br />
erhaben tönten Griegs Trauerklänge Ases Tod und mit der Staatshymne schloss die Totenfeier.<br />
(MÜLLER, 2003)<br />
Und ein anderer Schüler des Brünner Gymnasiums fasst zusammen:<br />
Der Tod von Masaryk wurde an unserer Schule ehrlich betrauert. Aber Beneš war vielen von<br />
uns sehr unsympathisch. (Bericht Hanns Hertl)<br />
Wahrlich zollte das Schulvolk seinem Nachfolger im Amte Edvard Beneš<br />
keine großen Sympathien. Überhaupt erfreute sich der ehemalige Außenminister,<br />
welcher die Tschechoslowakei bei den Friedensverhandlungen in Pariser<br />
Vororten 1919–20 vertrat, bei den durch eine erstarkte völkische Propaganda<br />
beeinflussten Sudetendeutschen keiner Beliebtheit. Zwar wurde dem neuen<br />
Präsidenten immer noch zugejubelt, doch dieser Jubel war kein aufrichtiger,<br />
sondern aus Zwang und Pflicht:<br />
Am 7.Mai 1937 hatte der Staatspräsident Dr. Edvard Beneš auf seiner Südböhmenreise auch<br />
Krumau besucht. Es wurde ein für die Stadt angeordneter Festtag veranstaltet. [...] Die Schülerschaft<br />
hatte unter Führung aller Professoren in der Vorstadt Latron mit turnerisch strammen<br />
Anmarsche [sic] Aufstellung genommen und konnte hier den Herrn Präsidenten bei seinen<br />
Vorüberfahrten dreimal begrüßen.<br />
Nach einem Jahr, im Oktober 1938, hielt Hitler in der Stadt seinen Einzug und laut des Jahresberichts<br />
wurde ihm von denselben Schülern und Lehrern, die vorher pflichtgemäß Dr. Benes<br />
gehuldigt hatten, grenzenlos zugejubelt.<br />
Es hat sich gezeigt, dass die durchgeführten Schulfeiern keine nachhaltigen<br />
Veränderungen im kulturellen Gedächtnis der Sudetendeutschen bewirkten.<br />
Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass in keinem Fall ein (sudeten-)deutscher<br />
Feiertag in der Schule zelebriert wurde. An „Böhmerlands bluti-<br />
24 Alle Schulen von der Volksschule bis zur Wiener Universität, die Masaryk besuchte,<br />
waren deutschsprachige Bildungsanstalten.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 209<br />
ger Gedenktag“ 25 wurde nicht erinnert, mehrere Befragte gaben zu, von den<br />
Ereignissen des 4. März 1919 erst nach 1938 bzw. 1945 erfahren zu haben.<br />
7. Tschechischunterricht<br />
Im Falle des im Schuljahre 1923/24 an den deutschen Mittelschulen eingeführten<br />
obligatorischen Tschechischunterrichts gilt es zu überprüfen, welche<br />
Rolle „der Tribut an die Republik“ (BECHER 1990: 31) im Schulalltag einnahm.<br />
Wurde er von den Schülern als Zwangs- und Tschechisierungsmaßnahme<br />
oder als Chance betrachtet? Wie hoch war die Bereitschaft zum Erlernen<br />
der tschechischen Sprache? Wichtig waren zugleich Hinweise, die<br />
einen Aufschluss über den potentiellen Lernerfolg geben konnten.<br />
Insgesamt ist festzuhalten, dass der obligatorische Tschechischunterricht<br />
neutral oder gar positiv – also „wie andere Fremdsprachen (Latein und<br />
Französisch)“ akzeptiert wurde (Bericht Gustav Scharm). Diese vielleicht<br />
doch überraschende Feststellung gilt es nun nicht nur zu dokumentieren,<br />
sondern auch zu hinterfragen. Warum konnten die aus der Monarchie Zeit<br />
geerbten Ressentiments gegenüber der durch mehrere Vorurteile belasteten<br />
Sprache, welche unter den Deutschen in Böhmen vor 1918, wie Eugen<br />
Lemberg zutreffend bemerkte, oft als feindliche Haus- und Landschaftsmundart<br />
empfunden wurde (LEMBERG 1937: 6), überwunden werden?<br />
Die wenigen Zeugnisse über Antipathien gegenüber dem Tschechischunterricht<br />
stammen meist von ehemaligen Schülern einer Bürgerschule. Eine<br />
Informantin aus dem Egerland räumte ein, sie hätte „den Tschechischunterricht<br />
mit Widerwillen besucht.“ Ihre Meinung begründete sie mit dem nicht<br />
untypischen Topos der ‚kleinen Sprache‛: „Ich hätte viel lieber englisch<br />
oder französisch gelernt, denn die Kenntnis der tschechischen Sprache<br />
endete an unserer [tschechoslowakischen] Grenze [...] Außerdem war es die<br />
Sprache unserer Peiniger, die unsere Eltern gegen ihren Willen in ihren<br />
Staat gezwungen haben“ (Bericht Gertrud Träger). Ein Schüler der Tetschener/Děčíner<br />
Bürgerschule vermerkt, dass Tschechisch zwar ungern gelernt<br />
wurde, zumindest besuchte er trotzdem einen Abendkurs (Bericht Richard<br />
Laube). Und ein Nordmährer fügt über die möglichen Motivationen hinzu:„Der<br />
Tschechischunterricht wurde [...] als notwendiges Übel hingenommen.“<br />
Allerdings bemerkt er auch: „Aus Angst vor einer schlechten Note“<br />
oder durch „die Hoffnung an [auf] einen beruflichen Vorteil“ beflügelt,<br />
mussten wir Tschechischunterricht sogar noch „im Dritten Reich absolvieren“<br />
(Bericht Karl Ertel)<br />
25 So bezeichnete den 4. März 1919 die in Stuttgart herausgegebene Zeitschrift DER<br />
AUSLANDDEUTSCHE (1927), Nr. 20, Jg. X., .hier 681f.
210<br />
Mirek Němec<br />
Die Bereitschaft zum Tschechischlernen beruhte auf eher pragmatischen<br />
Gründen. Um eigene Rechte durchsetzen zu können, wäre die Kenntnis der<br />
nun neuen Staatssprache von erheblichem Vorteil. Die Eltern sorgten meist<br />
dafür, dass Tschechisch gelernt wurde. „Kinder lernt tschechisch, damit sie<br />
euch nicht verkaufen können, wir müssen nun in dem Staat leben! (Bericht<br />
Waltraud Meyer) motivierte ein Vater seine Tochter – Bürgerschülerin –<br />
zum Besuch der nichtobligatorischen Nachmittagsstunden, die von einer<br />
Tschechin erteilt wurden. Um die andere Landessprache wirklich zu erlernen,<br />
verbrachte sie sechsmal ein paar Wochen während der Ferien „im<br />
Tschechischen“ (Bericht Waltraud Meyer).<br />
Dieser Brauch des Schüleraustausches – „na handl“ oder „na vexl“ genannt<br />
– war ein Erbe der Habsburger Monarchie, welches, wie Erich Illmann feststellte,<br />
nach 1918 eine Fortsetzung fand (ILLMANN: 2002). Diesen Befund<br />
bestätigte auch meine Umfrage.<br />
Durch den Schüleraustausch konnten vor allem die in der Schule nicht geübten<br />
kommunikativen Kompetenzen verbessert werden. So erläuterte eine<br />
damalige Schülerin aus Troppau:<br />
Der Unterricht im Tschechischen befähigte kaum zur Kommunikation mit Tschechen. Wenn<br />
jemand nicht privat Tschechen kannte, hatte er kaum eine Chance, Tschechisch zu sprechen.<br />
Die Schule regte es an, in den Ferien in tschechischsprachige Gebiete zu fahren, unterstützte<br />
dies Vorhaben aber auf keinerlei Weise. (Bericht Gerda Keil)<br />
Ein anderer Troppauer veranschaulicht den Unterricht im Gymnasium: „Der<br />
Leitspruch war ‚Hojně číst [viel lesen]‘, es gab aber keinen Kontakt zu den<br />
tschechischen Schülern“ (Bericht Wilhelm E. Leubner). Ein Schüler des<br />
Braunauer (Broumov) Gymnasiums, welcher durch Umzüge nach Gablonz<br />
an der Neiße (Jablonec nad Nisou) und schließlich nach Karlsbad (Karlovy<br />
Vary) drei Gymnasien besuchte, berichtet: „In Braunau, wenn die erste<br />
Stunde Tschechisch war, wurde der morgige Vaterunser von allen katholischen<br />
Schülern auf tschechisch gesprochen.“ Doch auch er beanstandet<br />
„den nicht besonders großen Lerneffekt, trotz des redlichen Bemühens des<br />
Tschechischlehrers.“ Zugleich sucht er nach den möglichen Gründen:<br />
Ich empfand es immer in allen meinen Schulen als einen großen Nachteil, dass der Lehrer für<br />
Tschechisch kein Tscheche war. […] [In Gablonz] machten wir uns lustig über den Tschechischlehrer,<br />
weil er mit einem so deutlich egerländisch-deutschem Akzent sprach. [...] Er<br />
bekam [deshalb] einen Spitznamen. 26<br />
Mit dem Tschechischen hatten also einige Tschechischlehrer ihre Probleme,<br />
wobei ihre Herkunft eine wesentliche Rolle spielte. Die Schüler, welche<br />
26 Anstatt „Kdybych byl ...“ sprach der aus dem Egerlande stammende Lehrer „Kdipich<br />
...“ deshalb bekam er den Spitznamen „Pich“: Bericht Schlögl, Friedrich Christian Otto.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 211<br />
keine Kontakte zu den Tschechen hatten, wurden benachteiligt. In Brünn<br />
waren es meist die aus Südmähren, in Komotau die aus dem Egerlande und<br />
in Budweis die aus dem Böhmerwald. Es war daher für benachteilige Schüler<br />
ein Glück, wenn der Lehrer darauf Rücksicht nahm: „Unser Tschechischprofessor<br />
Dr. Leo Herz war äußerst beliebt. [...] Er hatte so viel<br />
Nachsicht mit uns Böhmerwäldlern, dass er unsere Schularbeiten großzügiger<br />
benotete als die der Budweiser Klassenkameraden, die ja zweisprachig<br />
aufwuchsen.“ (Bericht Anton Buzek)<br />
Als ein Verdienst des fakultativen Tschechischunterrichts im Elementarschulwesen<br />
galt, „da in allen anderen Fächern der deutschen Volksschulen<br />
ausschließlich „Kurrentschrift“ gebraucht wurde, dass wir als erstes lateinische<br />
Schreibschrift lernen mußten.“ (Bericht Herbert Schneider)<br />
Der oft beklagte „Verlust der Mehrsprachigkeit“ (BURGER 1997: 35–49)<br />
vor allem bei den Deutschen in Böhmen, welcher die Endphase der Österreichisch-<br />
Ungarischen Monarchie charakterisierte, konnte in der Tschechoslowakei<br />
in Ansätzen überwunden werden. Die meisten Sudetendeutschen<br />
erkannten, welche Chance ihnen die Kenntnis der Staatssprache eröffnete.<br />
Die Zusammenarbeit beim Spracherwerb zwischen Tschechen und Deutschen<br />
ging aber über die private Initiative nicht hinaus.<br />
Der Tschechischunterricht bot, liest man die Erinnerung Max Brods an seine<br />
relativ obligaten Tschechischstunden am Prager Stephans-Gymnasium,<br />
durchaus die Chance, die tschechische Kultur, vor allem die Literatur, unter<br />
den Deutschen zu popularisieren (BINDER 2000: 128). Doch keiner von<br />
den mir bekannten Berichten über das obligate ‚Tschechoslowakisch‘ bestätigt<br />
diese Vermutung.<br />
Exkurs Prof. Brtek:<br />
Unter den Tschechischlehrern ist noch über einen besonderen Ausnahmefall<br />
zu berichten. Es handelt sich um den Leipaer Josef Brtek, der gemeinsam<br />
mit seinem tschechischen Kollegen Vojtěch Hulík Lehrbücher für den<br />
Tschechischunterricht an den deutschen Mittelschulen verfasste. In einem<br />
seiner Lehrbücher findet sich das von Josef Václav Frič während der ersten<br />
Wenzelsbadversammlung in der Revolution von 1848 ausgesprochene Urteil:<br />
Náš stát je republika. Čech i Němec jsou tu stejně doma. Jejich rod je často půl český a půl<br />
německý. Proto jsou i jejich tělo i jejich duch velmi podobné. Mnohý Čech mluví německy<br />
jako česky, mnohý Němec mluví česky jako německy. 27<br />
27 Unser Staat ist eine Republik. Der Tscheche und der Deutsche sind hier genauso zu<br />
Hause. Ihre Abstammung ist oft halb tschechisch und halb deutsch. Deswegen sind auch<br />
ihre Körper und Seelen sehr ähnlich. Viele Tschechen sprechen deutsch genauso gut
212<br />
Mirek Němec<br />
Die hier angesprochene Ähnlichkeit beider Nationalitäten führte einerseits<br />
zu einem Abbau der gegenseitigen Ressentiments, andererseits ermöglichte<br />
er einen Wechsel der Nationalität. Josef Brtek sollte davon nach 1938 Gebrauch<br />
machen. Nach dem Münchner Abkommen bekannte sich Brtek zur<br />
tschechischen Nationalität, damit sein Sohn nicht zur Wehrmacht einbezogen<br />
wurde. Dieses Bekenntnis sollte ihn vor der Vertreibung nach dem<br />
Krieg retten (Bericht Viktor Heller und Maria Fritzsche).<br />
8. Schluss<br />
Aus der Schülerperspektive erschien die deutsche Schule in der Tschechoslowakei<br />
trotz spürbarer Veränderungen wie etwa der Beeinflussung der<br />
Lehrpläne für Geschichte, die Einführung des Tschechischunterrichtes oder<br />
die erzwungene Gestaltung von Gedenkstunden und Gedenktagen nicht als<br />
bloßes Instrument der tschechoslowakischen Politik. Obwohl die vermittelten<br />
Lehrinhalte und Leitbilder dem tschechischen Staatsverständnis entsprechen<br />
mussten, wurde die deutsche Schule in keinem der Berichte als Instrument<br />
einer Entnationalisierung betrachtet.<br />
Als Tschechisierungsmaßnahme und unfaire Konkurrenz wurden die neuen<br />
tschechischen Volksschulen in den deutschsprachigen Randgebieten der<br />
Tschechoslowakei betrachtet. Sie wurden als Minderheitenvolksschulen<br />
bezeichnet, da sie der hier lebenden tschechischen Minderheit zur Verfügung<br />
stehen sollten. In rein deutschen Orten genossen aber in einem meist<br />
neu gebauten, modernen Schulgebäude öfters lediglich ein paar tschechische<br />
Kinder der zugezogenen Staatsbeamten den Unterricht. Die Deutschen<br />
versuchte man, entweder durch materielle Vorteile oder unter Androhung,<br />
den Arbeitsplatz zu verlieren, dazu zu bewegen, die eigenen Kinder in diese<br />
tschechischen Schulen zu schicken. „Der Verein Pošumavská jednota<br />
[Böhmerwaldbund – M.N.] war in der Anwerbung deutscher Kinder für die<br />
tschechische Schule sehr aktiv,“ urteilt eine Böhmerwäldlerin (Bericht Rosa<br />
Tahedl).<br />
Der Kampf um die Schulkinder besaß in den böhmischen Ländern Tradition<br />
(vgl. BURGER 1995, 211–221; ZAORAL 1995 ) und gerade die regional<br />
wirkenden nationalistischen Schutzvereine – z.B. in Südböhmen der Pošumavská<br />
jednota – betätigten sich auf diesem Gebiet. (RABL 1959: 43;<br />
REICH 1995: 29f.). Nur in wenigen Fällen soll ein solches Anwerben durch<br />
Androhung oder Vergünstigung tatsächlich erfolgreich gewesen sein<br />
(MÄHNER 1999: 88–92). Einen nicht geringen Einfluss auf die Entscheidung<br />
übte letztendlich die deutsche Umgebung aus. Ein Neutitscheiner<br />
wie tschechisch, viele Deutsche sprechen tschechisch genauso gut wie deutsch (zit. nach<br />
BRTEK/HULÍK 1921).<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 213<br />
Schüler, den der Vater in die tschechische Bürgerschule geschickt hatte,<br />
erinnert sich: „Vielleicht wäre ich noch länger in die tschechische Schule<br />
gegangen, aber die deutschen ,Geschäftsfreunde‘ meines Vaters drohten<br />
ihm mit Boykott“ (Bericht Günther Schalich). Deshalb wechselte er nach<br />
einem Jahr an das deutsche Gymnasium. Ähnliches erfuhr ebenfalls Wilma<br />
Iggers. Als sie von der deutschen Volksschule in die tschechische Bürgerschule<br />
in Bischofsteinitz/Horšovský Týn wechselte und sich die langen<br />
Zöpfe abschneiden ließ, um einem tschechischen Jungen zu gefallen, urteilte<br />
gar ihr ehemaliger deutscher Lehrer: „Jetzt bist du kein deutsches Mädel<br />
mehr.“ (IGGERS 2002: 23)<br />
Die tschechoslowakische Schulpolitik betonte, wie die Mehrheit der europäischen<br />
Staaten in der Zwischenkriegszeit, 28 den nationalen Aspekt. Im<br />
Lehrplan war die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern nie<br />
berücksichtigt worden, es wurde nie erwirkt, dass ein Gedenktag an eine<br />
deutsche Persönlichkeit aus dem böhmisch-mährischen Raum gefeiert wurde.<br />
Der Versuch des tschechoslowakischen Schulministeriums ist offensichtlich,<br />
das gewünschte Wertesystem unter die deutschen Mittelschüler zu<br />
bringen, doch das Ministerium bediente sich dabei keinerlei auffälliger repressiver<br />
Zwangsmaßnahmen, welche von den Mittelschülern registriert<br />
werden konnten. Den sudetendeutschen Pädagogen konnte es ohne größere<br />
Schwierigkeiten gelingen, die breiten Freiräume in der Gestaltung des Unterrichtsprozess<br />
zu nutzen. Es wurden daher nicht nur die vom tschechoslowakischen<br />
Ministerium geforderten Lehrinhalte, sondern auch Kenntnisse,<br />
die auf die deutsche Kultur bezogen waren, vermittelt.<br />
In gewisser Weise war damit eine Synthese zwischen der volks- und staatsbürgerlichen<br />
Erziehung gefunden. Somit trug die deutsche Mittelschule in<br />
der Tschechoslowakei zur Herausbildung einer sudetendeutschen Sonderkultur<br />
bei, ohne aber das politisch geladene Wort ‚sudetendeutsch‘ im Unterricht<br />
zu gebrauchen (Bericht Waltraud Meyer). Übereinstimmend behaupten<br />
deshalb die Respondenten: „Eine Herausbildung einer sudetendeutschen<br />
Identität hat es nicht gegeben.“ In mehreren Berichten wurde<br />
akzentuiert, der Unterricht wäre unpolitisch und neutral, sogar „die Sudetenkrise<br />
im September 1938 war im Unterricht kein Thema“ (Bericht Hans<br />
Witzku). Daher ist eine Aussage eines Gymnasiasten, Mitglied im Deutschen<br />
Turnverband und Sudetendeutschen Wandervogel, nicht gerade überraschend:<br />
„Wesentlich für die Herausbildung einer sudetendeutschen Identität<br />
war nicht die Mittelschule [...] entscheidend in diesen Jahren [1933–38]<br />
war die Jugendbewegung.“ Bestimmt boten beide Organisationen für die<br />
28 Vgl. zu Österreich ENGELBRECHT (1976: 203–229), zu Deutschland ROESSLER<br />
(1976: 17–38).
214<br />
Mirek Němec<br />
Mehrheit der deutschen Jugendlichen in diesen Jahren ein attraktiveres und<br />
zugleich verführerischeres Geschichtsbild als das, was ihnen in der Schule<br />
vermittelt wurde. Es stärkte ihre nationale Identität und half, hoffnungsvolle<br />
Zukunftsperspektiven auf nationaler Basis zu entwickeln (LUH 1986: 281–<br />
305).<br />
Als ein Manko tschechoslowakischer Schulpolitik ist das Fehlen jeglichen<br />
Versuchs anzusehen, die wechselseitige nationale Abschottung zu überwinden.<br />
Kooperation zwischen tschechischen und deutschen Schulen blieb<br />
weitgehend ungenutzt. In einigen Städten kam es zu überhaupt keinen Kontakten<br />
zwischen den deutschen und tschechischen Gymnasiasten. Als Beispiel<br />
zitiere ich die Aussage eines Troppauer Gymnasiasten:<br />
Wir, die deutschen Schüler, sie die tschechischen Schüler waren zwei monolithische Blöcke,<br />
die nicht die geringsten Gemeinsamkeiten hatten. [...] Wir gingen grußlos an ihnen vorbei, wir<br />
belästigen sie nicht, sie verhielten sich uns gegenüber ebenfalls tadellos. (Bericht Wilhelm E.<br />
Leubner)<br />
In anderen Schulstädten stifteten einzelne Lehrer dagegen Freundschaften<br />
zwischen den deutschen und tschechischen Schülern. Die erste Brücke wurde<br />
meistens mit Hilfe sportlicher Aktivitäten gebaut. In Böhmisch Leipa<br />
wurde auf Initiative der jungen Turnlehrer noch in den späten 30er Jahren<br />
gegeneinander Fußball gespielt (Bericht Viktor Heller) und im südmährischen<br />
Znaim kam es zu Wettkämpfen in Leichtathletik und Eishockeyspielen<br />
(Bericht Hans Brunner). Allerdings ist es fraglich, ob ein sportlicher<br />
Wettkampf tatsächlich zu einer Freundschaft beitragen kann. 29 Von staatlicher<br />
Seite jedenfalls wurden keinerlei Initiativen entwickelt, die Kontakte<br />
zwischen den tschechischen und deutschen Schülern hätten fördern können.<br />
Die Weichen wurden gestellt, die deutsche Schule verlor seitdem allmählich<br />
ihre Chance, die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien zu loyalen<br />
deutschsprachigen Staatsbürgern der Tschechoslowakei zu erziehen.<br />
Literatur<br />
ANDERSON, Benedict ( 2 1993): Die Erfindung der Nation. Zur Karriere<br />
eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt/Main, New York: Campus.<br />
DER AUSLANDDEUTSCHE. (1927), Nr. 20, Jg. X., Stuttgart.<br />
29 Günther Schallich berichtet: „Das deutsche und tschechische Gymnasium veranstalteten<br />
einmal im Jahr einen leichtathletischen Wettkampf, aber das war ja eher ein Gegeneinader<br />
als ein Miteinander.“ Doch auch er macht darauf aufmerksam, dass außerhalb der<br />
Schule, beim Fußball auf den Wiesen sich Kontakte zwischen deutschen und tschechischen<br />
Kindern... entwickelten.“<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 215<br />
BECHER, Walter (1990): Zeitzeuge. Ein Lebensbericht. München: Langen<br />
Müller.<br />
BINDER, Hartmut (2000): Paul Eisners dreifaches Ghetto. Deutsche, Juden<br />
und Tschechen in Prag. – In: M. Reffet (Hg.), Le monde de Franz Werfel et<br />
la morale des nations. Die Welt Franz Werfels und die Moral der Völker.<br />
Bern, Frankfurt/Main et al.: Lang, 17–138.<br />
BRAUN, Karl (1996): Der 4. März 1919. Zur Herausbildung sudetendeutscher<br />
Identität. – In: Bohemia 37/2, 353–380.<br />
BRTEK, Josef/HULÍK, Adalbert (Vojtěch) (1921): Übungsstücke zum<br />
Übersetzen aus dem Deutschen ins Tschechische. Prag: Staatliche Verlagsanstalt.<br />
BURGER, Hannelore (1995): Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im<br />
österreichischen Unterrichtswesen 1867–1918. Wien: Verlag der österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften.<br />
BURGER, Hannelore (1997): Die Vertreibung der Mehrsprachigkeit am<br />
Beispiel Österreichs 1867–1918. – In: G. Hentschel (Hg.), Über Muttersprachen<br />
und Vaterländer. Frankfurt/Main: Lang, 35–49.<br />
DEMETZ, Peter (1996): Ein Flaneur in Brünn: 1938. – In: Ders., Böhmische<br />
Sonne Mährischer Mond. Essays und Erinnerungen. Wien: Deuticke,<br />
129–142.<br />
DEUTSCHE ZEITUNG BOHEMIA, Jg. 108 und 109, 1935 und 1936.<br />
FÜHMANN, Franz (1983): Den Katzenartigen wollten wir verbrennen. Ein<br />
Lesebuch. Hrsg. mit einem Nachwort von H.–J. Schmitt. Hamburg: Hoffmann<br />
und Campe.<br />
ENGELBRECHT, Helmut (1976): Tendenzen der österreichischen Schulpolitik<br />
in der Zwischenkriegszeit. – In: M. Heinemann (Hg.), Sozialisation<br />
und Bildungswesen in der Weimarer Republik. Stuttgart: Klett, 203–230.<br />
GLETTLER, Monika/MÍŠKOVÁ, Alena (Hgg.) (2001): Prager Professoren<br />
1938–1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen: Klartext.<br />
HAHN, Eva ( 2 1999): Jak vnímají Češi Němce? Příklad T. G. Masaryka<br />
[Wie nehmen Tschechen Deutsche wahr? Beispiel T.G.Masaryk]. – In:<br />
Dies., Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí [Sudetendeutsches<br />
Problem: Schwieriger Abschied von der Vergangenheit] Ústí nad Labem:<br />
Albis international, 214–242.<br />
HANIKA, Josef (1962): Der 4. März 1919 in der Bergstadt Mies. Erinnerungsberichte<br />
zur Zeitgeschichte. – In: Stifter-Jahrbuch 7. München, 131–<br />
135.
216<br />
Mirek Němec<br />
HERZOGENBERG, Johanna von (2000): Schulalltag mit jüdischen Lehrern<br />
und Mitschülern. – In: Juden im Sudetenland. Židé v Sudetech. Praha: Česká<br />
křesťanká akademie, 273–276.<br />
HOBSBAWM, Eric (1992): Nationen und Nationalismus: Mythos und Realität<br />
seit 1780. 2. Auflage. Frankfurt/Main: Campus.<br />
IGGERS, Wilma/IGGERS, Georg (2002): Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht<br />
aus unruhigen Zeiten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
ILLMANN, Erich (2002): Der Schüleraustausch in der 1. Tschechoslowakischen<br />
Republik 1918–1938. Ein Beispiel für deutsch-tschechisches Miteinander.<br />
Mainz: Caritas-Druckerei (Selbstverlag).<br />
IRGANG, Norbert (1977): Die deutschen Lehrerverbände in der Tschechoslowakei<br />
1918–1938. – In: M. Heinemann (Hg.), Der Lehrer und seine Organisation.<br />
Stuttgart: Klett, 273–287.<br />
Jahrbuch des Reichsverbandes Deutscher Mittelschullehrer in der Tschechoslowakischen<br />
Republik 6 (1933). Leitmeritz: Druck- und Verlagsanstalt<br />
Leitmeritz.<br />
Jahresbericht des Deutschen Masaryk-Gymnasiums in Brünn für das Schuljahr<br />
1937/38. Brünn: Selbstverlag 1938.<br />
Jahresberichte der Deutschen Realschule in Leitmeritz 1919–1928. Leitmeritz:<br />
Selbstverlag 1919–1928.<br />
Jahresberichte des Deutschen Gymnasiums in Leitmeritz 1921–1928. Leitmeritz:<br />
Selbstverlag 1921–1928.<br />
KEIL, Theo (Hg.) (1967): Die deutsche Schule in den Sudetenländern.<br />
München: Verlag Robert Lerche.<br />
KOSTA, Jiří (2001): Nie aufgeben! Ein Leben zwischen Bangen und Hoffen.<br />
Berlin. Wien: Philo.<br />
LEMBERG, Eugen (1937): Die Bereitschaft zum Tschechischlernen. – In:<br />
Zeitschrift für den Tschechischunterricht 1, Heft 1, 5–13.<br />
LEMBERG, Eugen (1986): Ein Leben in Grenzzonen und Ambivalenzen.<br />
Erinnerungen, niedergeschrieben 1972 mit einem Nachtrag von 1975 (Erstveröffentlichung).<br />
– In: F. Seibt (Hg.), Lebensbilder zur Geschichte der<br />
böhmischen Länder 5. Eugen Lemberg 1903–1976. München: Oldenbourg,<br />
132–278.<br />
LEMBERG, Hans (Hg.) (2003): Universitäten in nationaler Konkurrenz.<br />
Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert. München:<br />
Oldenbourg.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 217<br />
LUH, Andreas (1986): Geschichtsbild und Geschichtsbewußtsein im Deutschen<br />
Turnverband in seiner Entwicklung vom Turnvereinsbetrieb zur<br />
volkspolitischen Bewegung. – In: F. Seibt (Hg.), Vereinswesen und Geschichtspflege<br />
in den böhmischen Ländern. München: Oldenbourg, 281–<br />
306.<br />
MÄHNER, Peter (1999): Grenze als Lebenswelt. Gnadlersdorf (Hnanice),<br />
ein südmährisches Dorf an der Grenze. – In: P. Haslinger (Hg.), Grenze im<br />
Kopf. Frankfurt/Main: Lang, 67–102. (= Wiener Osteuropa Studien 11)<br />
MAREK, Michaela (2001): Universität als Monument und Politikum. Die<br />
Repräsentationsbauten der Prager Universitäten 1900–1935 und der politische<br />
Konflikt zwischen ‚konservativer‘ und ‚moderner‘ Architektur. München:<br />
Oldenbourg.<br />
MITTER, Wolfgang (1988): Das Deutschsprachige Schulwesen in der<br />
Tschechoslowakei im Spannungsfeld zwischen Staat und Volksgruppe<br />
(1918–1938). – In: H. Lemberg (Hg.), Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte,<br />
Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und in Europa.<br />
Festschrift für Jan Havránek. München: Verlag für Geschichte und Politik,<br />
82–94.<br />
MITTER, Wolfgang (1991): German Schools in Czechoslovakia 1918–<br />
1938. – In: J. Tomiak, Schooling, Educational Policy and Ethnic Identity.<br />
Aldershot: Dartmouth, 211–232.<br />
MÜLLER, Dora (2003): Hier nahmen Masaryks Studien ihren Anfang. – In:<br />
Landeszeitung 08/03 vom 15. April 2003, www.landeszeitung.cz/0803q01.htm.<br />
Letzter Zugriff am 30.6.<strong>2004</strong>.<br />
NITTNER, Ernst (1984): Hitlers Machtergreifung. – In: Bohemia 25, 333–<br />
361.<br />
NORA, Pierre (1998): Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt/Main:<br />
Fischer.<br />
PODLAHOVÁ, Libuše (Hg.) (1996, 1999): Význam německé střední odborné<br />
školy při multikulturním rozvoji Moravy I-II. Olomouc: Univerzita<br />
Palackého.<br />
PODLAHOVÁ, Libuše (Hg.) (2002): Německá škola v českých zemích. Význam<br />
německého školství pro multikulturní rozvoj našich zemí. Olomouc:<br />
Univerzita Palackého.<br />
PREIßLER, Gottfried (1930): Kulturaufgaben der Mittelschule. – In: Sammlung<br />
der gemeinnützigen Vorträge, Nr. 616. Prag: Verlag vom Deutschen<br />
Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag.
218<br />
Mirek Němec<br />
PUTTKAMER, Joachim v. (2003): Schulalltag und nationale Integration in<br />
Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung<br />
mit der ungarischen Staatsidee 1867–1914. München: Oldenbourg.<br />
RABL, Kurt (1959): Staatsbürgerliche Loyalität im Nationalitätenstaat.<br />
München: Lerche.<br />
REBHANN, Andreas/HEVLER, Viktor (1929): Lehrpläne für die deutschen<br />
Mittelschulen der Čechoslovakischen Republik. Prag: Staatliche Verlagsanstalt<br />
in Prag.<br />
REICH, Andreas (1995): Das Tschechoslowakische Bildungswesen vor<br />
dem Hintergrund des Deutsch-Tschechischen Nationalitätenproblems. – In:<br />
Bohemia 36/1, 19–38.<br />
ROEßLER, Wilhelm (1976): Schichtspezifische Sozialisation in der Weimarer<br />
Republik. – In: M. Heinemann (Hg.), Sozialisation und Bildungswesen<br />
in der Weimarer Republik. Stuttgart: Klett, 17–38.<br />
ROHAN, Bedřich (2001): Aussiger Schoulet. Ústí nad Labem: Albis international.<br />
SCHULORDNUNG für die Mittelschulen der Čechoslovakischen Republik<br />
(1919), Prag: Staatliche Verlagsanstalt.<br />
ZAORAL, Roman (1995): Die tschechischen und deutschen Schulvereine<br />
in Böhmen am Ende des 19. Jahrhunderts. – In: Germanoslavica. Zeitschrift<br />
für germano-slawische Studien II (VII.), Nr.1, 107–115.<br />
Liste der Informanten<br />
1) Nitsche, Ewald, Volksschule Böhmischdorf/Česká Ves, Zeitraum fehlt;<br />
Brief vom 10.02.2003.<br />
2) Karpstein, Rita, Volksschule Senftleben/Ženklava, Zeitraum fehlt; Brief<br />
vom 18.6.2003.<br />
3) Eiter, Kamilla, Volksschule Zeislitz/Cejslice 1932–?; Brief vom<br />
13.2.2003.<br />
4) Pruy, Eleonore, Volksschule und Bürgerschule im Erzgebirge (geboren<br />
Böhm. Wiesenthal/Loučná) 1922–1933; Brief vom 25.11.2003.<br />
5) Oliwa, Maria, Bürgerschule in Freiwaldau/Jeseník 1937–1941; Briefe<br />
vom 11.4.2003 und 25.5.2003.<br />
6) Beywl, Elisabeth Katharina, Bürgerschule Hartmanitz/Hartmanice<br />
1936–1940; Brief vom 18.3.2003.<br />
7) Beywl, Zephyrin Gustav, Bürgerschule Hartmanitz/Hartmanice 1934–<br />
1937; Brief vom 20.3.2003.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 219<br />
8) Keller, Irmgard, Bürgerschule Hartmanitz/Hartmanice 1936–1940;<br />
Brief vom 3.2.2003.<br />
9) Bschoch, Erwin, tschechische Bürgerschule Komotau/Chomutov 1935–<br />
1938; e-mail vom 18. und 22.3.2003.<br />
10) Träger, Gertrud, Bürgerschule Luditz/Žlutice 1934–1937; Brief vom<br />
3.3.2003.<br />
11) Meyer, Waltraud, Bürgerschule Reichenberg/Liberec (1931–1935);<br />
Brief vom 24. 2.2003.<br />
12) Lares, Josef, Bürgerschule in Neutitschein/Nový Jičín 1934–1937;<br />
Brief vom 15.3.2003.<br />
13) Schneider, Herbert, Bürgerschule Oberleutensdorf/Litvínov 193?-1941;<br />
Brief vom 4.2.2003.<br />
14) Bauer, Karl, Bürgerschule in Staab bei Pilsen/Stod u Plzně beendet<br />
1936; Brief vom Brief undatiert.<br />
15) Laube, Richard, Bürgerschule in Tetschen a.d.E./Děčín 1920–1924;<br />
Brief vom 13.12.2003<br />
16) Behrbalk, Erhard, Bürgerschule Weipert/Vejprty um 1938; Brief vom<br />
5.5.2003.<br />
17) Scharm, Gustav, Realgymnasium Arnau/Hostinné 1933–1941; Brief<br />
vom 25.2.2003.<br />
18) Heller, Viktor, Realschule Böhmisch Leipa/Č. Lípa 1932–1934, Realgymnasium<br />
B. Leipa 1934–38; Brief vom 5.3.2003.<br />
19) Fritzsche, Maria, Realgymnasium Böhmisch Leipa/Č. Lípa 1939–?;<br />
Brief vom 19.2.2003 und Interview im Mai 2003.<br />
20) Schlögl, Friedrich, Gymnasium Braunau/Broumov, Gablonz/Jablonec<br />
n.Nisou und RG Karlsbad/Karlovy Vary 1929–1936; Briefe vom 14.4.,<br />
4.5., 3.6., 10.7.2003.<br />
21) Hertl, Hanns, Realschule Brünn/Brno 1934–35 u. Masaryk-Gymnasium<br />
Brünn 1935–1941; Brief vom 4.4.2003.<br />
22) Dittrich, Heinz, Realgymnasium Brünn/Brno 1930–1939; Brief vom<br />
5.6.2003.<br />
23) Bouzek, Anton, Realgymnasium Budweis/Č. Budějovice 1934–1942;<br />
Brief vom 13.2.2003.<br />
24) Witzku, Hans, Realgymnasium Budweis/Č. Budějovice 1936–1940;<br />
Brief vom 15.2.2003.<br />
25) Tahedl, Rosa, LBA Budweis/Č. Budějovice 1932–1936; Brief vom<br />
12.3.2003.<br />
26) Putz, Karl, Staatsgymnasium Eger/Cheb, von 1937–?; Brief vom<br />
29.7.2003.<br />
27) Hart, Illuminata Margareta – Privat LBA der Schwestern vom hl. Kreuz<br />
in Eger/Cheb 1926–1930; Brief vom 5.1.<strong>2004</strong>.
220<br />
Mirek Němec<br />
28) Leischner, Anton, Gymnasium Freiwaldau/Jeseník – sicher 1925/26;<br />
Brief vom 20.11.2003<br />
29) Arndt, Anna, Reformrealgymnasium Iglau/Jihlava 1937–1942; Brief<br />
vom 26.6.2003.<br />
30) Wied, Ernst R., Realgymnasium Karlsbad/Karlovy Vary 1923–1927;<br />
Brief vom 3.5.2003.<br />
31) Anders, Herta, Realgymnasium Karlsbad/Karlovy Vary 1933–1938;<br />
Brief vom 2.2.2003.<br />
32) Hoffmann, Roland, LBA Komotau/Chomutov 1924–1928; Brief vom<br />
21.1.2003 und Anruf am 12.3.2003.<br />
33) Endisch, Irmtraut, LBA Komotau/Chomutov 1934–1938; Brief vom<br />
20.5.2003.<br />
34) Kreißl, Ottmar, Realgymnasium in Komotau/Chomutov 1934–1942;<br />
Brief vom 9.11.2003.<br />
35) Wischin (Višín), Franz (1922 – 1930); verstorben 2002. Seine Erinnerungen<br />
an das Gymnasium Krumau/Krumlov vermittelt durch Frau<br />
Charlotte Birnbaum; Brief vom 2.4.2003 und 3.3.2003.<br />
36) Hederer, Josef, Gymnasium Mies/Štříbro, 1938–1940, Brief vom<br />
20.11.2003.<br />
37) Ertel, Karl, Reformrealgymnasium Neutitschein/Nový Jičín 1933–<br />
1941; Brief vom 5.3.2003 und 26.3.2003.<br />
38) Schalich, Günther, Reformrealgymnasium Neutitschein/Nový Jičín<br />
1936–1942; Brief vom 3.12.2003 und 16.2.<strong>2004</strong>.<br />
39) Gerstenbrand, Franz, Realgymnasium Nikolsburg / Mikulov 1934–<br />
1942; Brief vom 22.02.<strong>2004</strong>.<br />
40) Wiener, Hans, Realgymnasium in Prag-Smíchov ?-1938 (Jg.1925); email<br />
vom 25.2.2003.<br />
41) Haferkorn, Wolfgang, Staatsrealgymnasium Reichenberg/Liberec<br />
1934–?; Brief vom 28.11.2003.<br />
42) Großmann, Anton, Gymnasium Teplitz/Teplice 1935–1943; Brief vom<br />
17.2.2003.<br />
43) Kuhn, Luise Gertrud, Mädchenreformrealgymnasium Troppau/Opava<br />
1923–1931; Brief vom 25.3.2003.<br />
44) Keil, Gerda, Mädchenreformrealgymnasium Troppau/Opava 1923–<br />
1931; e-mail vom 23.3.2003.<br />
45) Kraus, Ernst, Gymnasium Troppau/Opava 1920–1929; Brief vom<br />
3.3.2003.<br />
46) Leubner, Wilhelm E., Gymnasium Troppau/Opava 1926–1935; Brief<br />
vom 9.4.2003.<br />
47) Groth, Helga, Gymnasium Troppau/Opava (1930–1938); Brief vom<br />
30.6.2003 und Interview am 27.9.2003.<br />
Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei … 221<br />
48) Brunner, Hans, Reformrealgymnasium in Znaim/Znojmo 1930–1938;<br />
Brief vom 4.2.2003 und 18.3.2003.<br />
49) Bornemann, Hellmut, Reformrealgymnasium Znaim/Znojmo 1933–<br />
1941; Brief vom 18.1.2003.
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik<br />
der Kabbala<br />
Walter Koschmal<br />
Es gibt Forschungsthemen, die als Lücken in der Forschungslandschaft erkannt<br />
und bald darauf auch geschlossen, weiße Flecken, die auf der Landkarte<br />
der Forschung getilgt werden. Darin sehen Forscherinnen und Forscher<br />
ihre hauptsächliche Aufgabe.<br />
Es gibt aber auch Forschungslücken, die noch gar nicht als Lücken erkannt<br />
worden sind. Je intensiver die Wissenschaft grenzüberschreitend, das heißt<br />
interdisziplinär forscht, desto mehr dieser Lücken dürfte sie als solche identifizieren.<br />
Es handelt sich dabei um ein unentdeckt schlummerndes Forschungspotenzial.<br />
In der Slavistik haben sich so zahlreiche neue Forschungsfelder aufgetan,<br />
vor allem durch den interdisziplinären Vergleich. Damit vollzieht sich aktuell<br />
wohl ein Paradigmenwechsel. Gedeih oder Verderb so mancher slavistischer<br />
Forschung, wird wohl auch davon abhängen, ob Slavistinnen und Slavisten<br />
diesen Weg einschlagen. In jedem Fall verlangt er eine Ausweitung<br />
des disziplinären Blicks.<br />
Eine Forschungslücke, die – vor allem in ihrer Breite und Tiefe – wohl noch<br />
nicht als solche identifiziert sein dürfte, stellt ein tschechischer Dichter des<br />
20. Jahrhunderts dar, Jiří Mordechaj Langer. Sein Name kommt in einschlägigen<br />
Überblicksdarstellungen zur tschechischen Literatur bzw. in Literaturgeschichten<br />
kaum vor oder Langer wird in ganz wenigen Sätzen<br />
(LEHÁR/STICH/JANÁČKOVÁ/HOLÝ 1998: 535) abgehandelt. Die wenigen<br />
neueren und neuesten Beiträge zu ihm (DAGAN 1991; VÍZDALOVÁ<br />
2002) machen zwar auf ihn aufmerksam, bleiben aber im Allgemeinen, zum<br />
Teil Bekannten stecken und lassen sich nicht auf seine Texte ein. Langer ist<br />
der letzte Prager Dichter, der in Hebräisch gedichtet hat. Mit dem Vordringen<br />
der Nationalsozialisten im Jahre 1939 sah er sich gezwungen, seiner<br />
Heimat endgültig den Rücken zu kehren und nach Palästina auszuwandern,<br />
wo er im März 1943 wohl recht einsam starb. Bis zuletzt glaubte der Chasside<br />
Langer, ein Händedruck seines Zaddik, dem Rebbe von Belz (Bels),<br />
würde ihn umgehend gesund werden lassen.<br />
Die Gründe dafür, dass Langer kaum wahrgenommen wurde und wird, sind<br />
zahlreich. Zunächst einmal war er als Mensch und Dichter ein Außenseiter,<br />
ein chassidischer Jude, der mal in Prag, mal unter Ostjuden in der heutigen<br />
Ukraine, mal in Ungarn lebte. Schließlich ging er ins Exil und starb wegen<br />
der beschwerlichen Reise bald darauf. Mit derart ,unsteten‘, nomadisierenden<br />
Literaten wie Langer hat die klassische Literaturgeschichte ihre liebe Not.
224<br />
Walter Koschmal<br />
Langer lässt sich kaum einer Literatur oder Kultur, ja nicht einmal einer Sprache<br />
eindeutig zuordnen. Diese Schwierigkeiten sollten allerdings vor allem<br />
das Konzept nationaler Literaturgeschichtsschreibung in Frage stellen.<br />
Langers Wahrnehmung mag es aber auch geschadet haben, dass er einen so<br />
bekannten, ihm in Art und – eher bürgerlichem – Judentum diametral entgegen<br />
gesetzten (DAGAN 1991) Schriftsteller-Bruder hatte: František Langer<br />
ist einer der wichtigen tschechischen Dramenautoren des 20. Jahrhunderts.<br />
Noch in der neuesten „Geschichte der tschechischen Literatur“ (Band<br />
3, 2003) von Walter Schamschula wird diese höchst unterschiedliche Rezeption<br />
deutlich: Den vielen Seiten, die František Langer gewidmet sind,<br />
stehen die wenigen Zeilen gegenüber, die Jiří Mordechaj Langer gelten.<br />
In der langen Reihe der Gründe für die Nicht-Wahrnehmung Langers soll<br />
nur noch ein letzter genannt werden, nämlich die verzögerte Rezeption. J.<br />
M. Langer hat zahlreiche Sprachen beherrscht, aktiv wie passiv, so u. a.<br />
Aramäisch. Er hat aber auch in drei Sprachen Bücher geschrieben, nämlich<br />
in Tschechisch, Deutsch und Hebräisch. Den tschechischen Rezipienten<br />
wurde sein religionsphilosophisches Werk Die Erotik der Kabbala erst<br />
knapp 70 Jahre nach seinem Erscheinen in ihrer Sprache zugänglich (1923<br />
bzw. 1991). Zuvor war es jedoch nach der ersten deutschsprachigen Ausgabe<br />
im Jahre 1923 schon in einer zweiten deutschsprachigen Ausgabe mit<br />
dem Titel Liebesmystik der Kabbala und einem Vorwort von Alfons Rosenberg<br />
erschienen. Rosenberg hatte den Text allerdings völlig unzulässig gekürzt<br />
und auch darüber hinaus verändert, aus philologischem Blickwinkel<br />
eine Katastrophe. Unangemessen ist natürlich auch der völlig in die Irre<br />
führende Titel Liebesmystik der Kabbala. Der Originaltitel Langers war<br />
Rosenberg zu „drastisch“ (1956: 11). Also änderte er ihn kurzerhand.<br />
Langers tschechisch geschriebenes erzählerisches Hauptwerk Devět bran<br />
(Die neun Tore) haben die Nationalsozialisten vernichtet, so dass hier die<br />
tschechische Rezeption mit einer Verzögerung von fast dreißig Jahren erfolgt.<br />
In Wahrheit hat sie aber wegen der totalitären politischen Verhältnisse<br />
nach 1968 erst in den späteren 80er Jahren stattgefunden. Also konnte sie<br />
auch in diesem Fall erst mit etwa einem halben Jahrhundert Verzögerung<br />
beginnen. Die deutsche Rezeption dagegen setzte frühzeitig ein, weil das<br />
Werk in der freilich ungebührlich kürzenden und bearbeitenden Übersetzung<br />
Friedrich Thiebergers unter dem Titel Neun Tore und einer Einleitung<br />
von Gershom Scholem 1959 im gleichen Verlag (Otto Wilhelm Barth Verlag)<br />
in München-Planegg erschienen ist. 1<br />
1 Avigdor Dagan (1991: 192) erwähnt nur die deutsche Edition von 1959 und eine englische<br />
von 1961 („Also published in German in 1959 and in English in 1961“), ohne auf<br />
die erheblichen Streichungen und die gänzlich inadäquate Übersetzung zu verweisen. Er<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
Langers hebräisch geschriebene Gedichte aber waren schon wegen der<br />
Sprache nur einem sehr eingeschränkten Kreis von Rezipienten zugänglich.<br />
Zu Übersetzungen ins Tschechische kam es nur zum Teil und erst spät. War<br />
dies zunächst politisch nicht opportun, so ist bis heute die Erforschung jüdischer<br />
Dichter, zudem eines chassidischen, nicht gerade in Mode. Durch die<br />
politischen Veränderungen ändert sich diese Einstellung in der Wissenschaft<br />
im heutigen Tschechien nach und nach. Damit ist Langer, der noch<br />
im 19. Jahrhundert geboren wurde, fast überraschend zu einem gleichsam<br />
zeitgenössischen Dichter geworden.<br />
Man kann nicht behaupten, dass ihn die Forschung, insbesondere die philologische,<br />
vergessen hat: Sie hat ihn vielmehr nie wirklich entdeckt. Das mag<br />
auch noch einen weiteren Grund haben. Langers einziges tschechisch geschriebenes<br />
literarisches Werk, Devět bran, umfasst chassidische Erzählungen,<br />
Legenden und Anekdoten. Dieses Genre ist im 20. Jahrhundert so sehr<br />
von einer Person, von Martin Buber und seiner Sammlung chassidischer<br />
Legenden, geprägt worden, man möchte fast von einem Alleinvertretungsanspruch<br />
sprechen, dass Langer in Bubers Schatten fast zwangsläufig<br />
gleichsam unsichtbar bleiben musste.<br />
Das Beispiel J. M. Langers macht somit eines deutlich. Dort wo sich Judaisten<br />
oder Religionsphilosophen nur mit hebräischen Texten beschäftigen,<br />
Theologen nur mit religiösen Schriften, Slavisten nur mit slavischsprachiger<br />
Literatur, dort bleibt ein Dichter wie Langer unbemerkt. 2 Der Dichter und<br />
erwähnt auch nicht die weiteren Editionen, ebenso wenig die frühere der Erotik der<br />
Kabbala (1923). Bereits 1983 wurden die Neun Tore erneut herausgegeben, wieder mit<br />
dem Vorwort von Gershom Scholem, jedoch wurde die „Vorbemerkung des Übersetzers“<br />
jetzt unter dem Titel „Zur deutschen Übersetzung“ an das Ende gestellt. Der Verfasser<br />
des Textes fehlt. Der Text selbst ist um mehr als die Hälfte gekürzt. Der Leser erfährt<br />
1983 nicht mehr, dass der Übersetzer das Original ebenfalls gekürzt hat. Die 1983<br />
benutzte Übersetzung ist aber erneut jene Thiebergers, wobei sein Name – ebenso wie<br />
1959 – weiterhin falsch als „Thierberger“ geführt wird. In der Ausgabe von 1983 werden<br />
auch noch weitere Umstellungen vorgenommen, das erste Kapitel etwa wandert an<br />
das Ende, wird in zwei Teile geteilt und erhält zwei völlig neue Titel (vgl. 207 und 231).<br />
Geradezu fatal und entstellend sind die nun überwiegend an Personen orientierten neuen<br />
Kapitelüberschriften, da Langers Unterteilung in Neun Tore damit hinfällig wird. Insofern<br />
ist es eine logische Konsequenz, dass der neue Buchtitel die „Neun Tore“ ebenfalls<br />
tilgt. Unter dem Titel Der Rabbi, über den der Himmel lachte. Die schönsten Geschichten<br />
der Chassidim, Autor Georg Langer, lässt sich das Werk nur mehr schwer mit dem<br />
tschechischen Original in Verbindung bringen.<br />
2 Die wechselnde Namengebung bzw. Schreibung des Dichternamens hat ebenfalls zur<br />
Verwirrung beigetragen. Die Erotik der Kabbala führt M. D. Georg Langer als Autor,<br />
ebenso die Ausgabe von 1956. Neun Tore von 1959 nennen „Georg M. Langer“ als Autor,<br />
die Ausgabe von 1983 Georg Langer. Avigdor Dagan nennt zudem die wechselnden<br />
Namen des Autors in den hebräischen Publikationen nämlich Mordechai Georg, Mordechai<br />
Gerog oder Mordechai Dov Georgo Langer. Das zunächst überraschende „D“ beim<br />
Autor der Erotik der Kabbala löst sich auf als „Dov“, so dass der Autor als Mordechai<br />
225
226<br />
Walter Koschmal<br />
Mensch Langer verschwindet dann aus dem kulturellen Gedächtnis. Dort<br />
aber wo interdisziplinäre Forschungsansätze versucht werden, wo eine vergleichende,<br />
auf Dialog ausgerichtete Forschungsperspektive eingenommen<br />
wird, hat auch ein so vielschichtiger Autor wie Langer die Chance, in das<br />
kulturelle Gedächtnis zurückgeholt zu werden. J. M. Langer ist eine zweifellos<br />
selten rätselhafte, schillernde Figur in der tschechischen Kultur und<br />
Literatur. Man wird dieses Rätsel nur mit Geduld lösen können, sicher nicht<br />
in einem knappen, gleichsam ersten Forschungsbeitrag. Doch Wege zur<br />
Lösung sollten nach und nach aufgezeigt werden.<br />
Deshalb handelt der Beitrag im Weiteren auch nur von einem Aspekt seines<br />
Schaffens, von J. M. Langers in deutscher Sprache geschriebenem Werk<br />
Die Erotik der Kabbala. Dieses soll erstmals in jenes kulturelle und intertextuelle<br />
Koordinatensystem gestellt werden, das zu einem besseren Verständnis<br />
beitragen sollte. Dabei geht es nur darum, erste grobe Fäden zu<br />
knüpfen. Vielleicht lassen sich dadurch andere dazu anregen, an diesem<br />
Netz, das letztlich nur in interdisziplinärer Kooperation zwischen Bohemisten,<br />
Psychologen, Philosophen, Theologen und Judaisten zu knüpfen sein<br />
wird, mitzuarbeiten.<br />
Langer und die Tradition der Kabbala<br />
Kabbala heißt nichts anderes als Tradition oder Überlieferung. Gershom<br />
Scholem (1897–1982) gesteht in seinem Werk Zur Kabbala und ihrer Symbolik<br />
(1960), dass seine Generation der Kabbala „verständnislos“ gegenüberstand.<br />
Denn die Kabbala sei letztlich der europäischen Kultur der Aufklärung<br />
„geopfert“ worden (SCHOLEM 1960: 9). J. M. Langer hat diesen<br />
Gedanken schon erheblich früher formuliert, doch sich dazu des Freudschen<br />
Begriffs der „Verdrängung“ bedient. 3 Die Mystik der Kabbala sei immer<br />
zwischen einem konservativ-bewahrenden und einem revolutionärvorwärtsstrebenden<br />
Ansatz geschwankt.<br />
Diese Spannung habe sich u.a. in den einander diametral entgegengesetzten<br />
Interpreten der heiligen Schrift, der Thora, niedergeschlagen. Das so genannte<br />
„Gesetzesjudentum“, das später „rabbinisches Judentum“ heißt<br />
(SCHOLEM 1960: 127), tendierte zu einer normativen Auslegung der Kabbala.<br />
Die rabbinischen Juden beriefen sich dabei auf die Schriftlichkeit, auf<br />
Dov Georg Langer figuriert, also eine Mischung aus hebräischer und deutscher Namengebung.<br />
3 Alfons Rosenberg, der die Liebesmystik der Kabbala bezeichnenderweise in seiner<br />
Schriftenreihe „Dokumente religiöser Erfahrung“ herausgibt, rechtfertigt seine Kürzungen<br />
und seine Überarbeitung, die angeblich „niemals das Wesentliche“ berühren<br />
(ROSENBERG 1956: 13), unter anderem mit der Notwendigkeit, eine Reihe „allzu einseitiger<br />
Freudianismen zu berichtigen und auszumerzen“ (ROSENBERG 1956: 14).<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
die schriftliche Thora (SCHOLEM 1960: 68). Die Tradition spürte man vor<br />
allem in schriftlichen Dokumenten, nicht im Leben auf. Die sich in den<br />
Schriften niederschlagenden Gesetze erschienen hingegen zutiefst „unmythisch“.<br />
Scholems Geständnis, dass er der Kabbala „verständnislos“ gegenüberstand,<br />
ergibt sich wohl daraus, dass er wesentlich von diesen Schriften<br />
geprägt war.<br />
Eine andere Tradition zeigte sich hingegen von der „mündlichen Thora“<br />
geprägt. Die mündliche Thora war immer eng mit dem Volk, seinem Glauben<br />
und Aberglauben verbunden. Die Tradition wurde in diesem Fall nicht<br />
als schriftliche fixiert, sondern als gelebte, vom Einzelnen erfahrene Tradition<br />
aufgefasst. Schon deshalb wird in diesem Traditionsverständnis die<br />
Emotionalität der Religion und der Kabbala betont. Schriftliche und mündliche<br />
Thora sind aber in der Kabbala als komplementär zu sehen<br />
(SCHOLEM 1960: 68). Insofern bedeutet die mündliche Thora, wie sie J.<br />
M. Langer ziemlich unvermittelt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in<br />
einem tschechischen Kontext in deutscher Sprache propagiert, eine Remythisierung<br />
der Thora. Die von ihren emotionalen Wurzeln gelöste Thora,<br />
die von der ursprünglichen Emotionalität getrennten Gesetze und Rituale<br />
(SCHOLEM 1960: 127) werden wieder auf diese zurückgeführt.<br />
Das was Scholem als „Opferung“ dieser mündlich-mythischen Dimension<br />
der Kabbala bezeichnet, klassifiziert Langer ganz entschieden mit der Sprache<br />
der Psychoanalyse als „Verdrängung“. Diese Parallele drängt sich ihm<br />
nicht zufällig auf, sie ist ein wesentliches Moment seines Denkansatzes.<br />
Die Kabbala lässt sich laut Scholem als die „historische Psychologie“ des<br />
Judentums (SCHOLEM 1960: 8) verstehen. Psychologischer und historischer<br />
Ansatz schaffen demnach die „Einheit“ der kabbalistischen Theosophie.<br />
Langer geht es letztlich um die Wiederherstellung dieser verloren gegangenen<br />
Einheit (SCHOLEM 1960: 137). Dabei können alle Symbole der<br />
Kabbala nach Scholem historisch wie psychologisch verstanden und ausgedeutet<br />
werden. Für dieses doppelte Verständnis der Kabbala könnte Scholem<br />
durchaus schon bei Langer einen Impuls erhalten haben. Scholem<br />
schätzte Langer offensichtlich sehr, war es doch auch er, der Thieberger<br />
dazu anregte, Langers Erzählsammlung Neun Tore aus dem Tschechischen<br />
ins Deutsche zu übersetzen. Eine Beeinflussung Scholems durch Langer<br />
nachzuweisen dürfte aber schwierig sein. Tatsache ist zumindest, dass<br />
Scholem Langer intensiv rezipiert hat (s. Vorwort Thiebergers).<br />
Außerdem hat Langer im 20. Jahrhundert als einer der ersten die Kabbala<br />
mit seinem Werk Die Erotik der Kabbala in den Mittelpunkt des Interesses<br />
gerückt. Vor allem aber hat Langer die Kabbala in ganz aktuelle, sich in<br />
jener Zeit erst entwickelnde Diskurse eingebunden, nämlich in jene der<br />
Psychoanalyse. Die Kabbala wird bei Langer wohl erstmals mit der Termi-<br />
227
228<br />
Walter Koschmal<br />
nologie und dem Begriffsapparat Freuds und seiner Schüler dargestellt.<br />
Gershom Scholems Betonung der psychologischen Dimension der Kabbala<br />
könnte von Langer herrühren. Diese Frage müssen aber wohl Vertreter anderer<br />
wissenschaftlicher Disziplinen definitiv zu beantworten suchen.<br />
Die Semantik der Kabbala ist hochgradig hierarchisch geordnet<br />
(SCHOLEM 1960: 72). Es herrscht ein „Dualismus“ der Bedeutungen, vorrangig<br />
jener von „äußerem“ und innerem allegorischem Sinn. Der äußere<br />
Wortsinn steht dabei dem allegorisch-mystischen Sinn gegenüber. Doch ist<br />
die Zahl der tatsächlichen „Sinnschichten“ höher. Auch deren Struktur ist<br />
hierarchisch angelegt. Das heißt, die tiefste Sinnschicht ist die eigentlich<br />
geheime, jene, die am tiefsten verborgen bleibt (SCHOLEM 1960: 23). Im<br />
Grunde verfügt die Thora über unendlich viele „Sinnschichten“. Meist wird<br />
aber von vier Schichten ausgegangen. Neben dem Wortsinn sind dies die<br />
allegorische, die religiös-talmudische und schließlich die eigentlich mystische<br />
Sinnschicht. Eine bisweilen angenommene fünfte Sinnschicht basiert<br />
auf geheimen Buchstabenkombinationen (SCHOLEM 1960: 57, 80), die so<br />
genannte „Gematria“. Diese fünfte Sinnschicht kann es nur im Hebräischen<br />
geben, da hier die Buchstaben, ähnlich wie in der Glagolica und Kyrillica<br />
(MAREŠ 1986: 16f.), auch über einen Zahlenwert verfügen.<br />
Die Hierarchie der „Sinnschichten“ geht – nicht nur bei Langer – mit einer<br />
Hierarchie der Sprachen einher. Das Hebräische ist aufgrund seiner besonderen<br />
Sakralität – etwa im Unterschied zum Jiddischen – traditionell die<br />
hierarchisch übergeordnete Sprache. Langer bedient sich in seinen Werken<br />
dreier verschiedener Sprachen. Deutsch schreibt er Die Erotik der Kabbala,<br />
tschechisch chassidische Erzählungen unter dem Titel Devět bran (Neun<br />
Tore) und schließlich hebräisch Gedichte. Die frühen Gedichte gehen auf<br />
sein Interesse als Fünfzehnjähriger für mystische jüdische Poesie zurück.<br />
Damals lernte Langer bereits Hebräisch. Im Jahre 1929 erscheinen in Prag<br />
bereits seine im religiösen Stil gehaltenen Gedichte und Lieder der Freundschaft.<br />
Im Jahre 1937 und bereits in der zweiten Auflage 1939 erschien ein<br />
schmales Bändchen seiner Übersetzungen hebräischer Lyrik (Zpěvy zavřených,<br />
2000). Schließlich erscheinen schon in Tel Aviv (1943; 2. Auflage<br />
1984) seine eher an moderner europäischer Lyrik orientierten Gedichte<br />
Meat Zori Davar (VÍZDALOVÁ 2002).<br />
Das Tschechische, die tschechische Literatur sieht sich damit unvermittelt<br />
in einem ungewohnten Kontext, der zutiefst hierarchisch strukturiert ist und<br />
in dem das Tschechische selbst zumindest nicht den höchsten Wert markiert,<br />
da hier nicht nationale, sondern religiöse Kriterien angelegt werden.<br />
Der Gebrauch des Tschechischen ist hier kein gleichsam natürlicher, unmarkierter.<br />
Die Wahl der Sprache ist bei Langer markiert, da sie immer in<br />
der Relation zu den beiden nicht gewählten Sprachen zu sehen ist. Damit<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
nimmt Langer zweifellos eine Sonderstellung in der gesamten tschechischen<br />
Literatur ein. 4<br />
Die Remythisierung der Kabbala, die Scholem als notwendig ansieht, die<br />
aber Langer bereits praktiziert, erwächst wesentlich aus einer komplexen<br />
Reoralisierung der Kabbala bei Langer. Er bindet die Kabbala vor allem<br />
über die Mündlichkeit, die gesprochene Sprache wieder an seine „emotionalen<br />
Wurzeln“ zurück (SCHOLEM 1960: 127). Langer setzt der Schriftlichkeit<br />
der Rabbiner die Mündlichkeit der Kabbala, vor allem aber die Mündlichkeit<br />
der Chassidim entgegen, unter denen er lange Jahre lebt, ehe er Die<br />
Erotik der Kabbala schreibt. Mit dem „rabbinischen Judentum“ der schriftlichen<br />
Thora sah sich Langer auch durch die Juden von Prag konfrontiert.<br />
Dort war er auch lange als Lehrer tätig.<br />
Als einer der ganz wenigen Tschechen wählt er den anderen jüdischen Weg,<br />
jenen der Chassidim und damit auch jenen eines mythischen (Ost-)Judentums.<br />
Martin Buber (2001: 55), der Langer so sehr schätzte und der auf Einladung<br />
der jüdischen Hochschulgemeinde Bar Kochba am 20.1.1909 einen<br />
Vortrag zum Sinn des Judentums in Prag hielt, erinnert sich später, dass „die<br />
Feindschaft zwischen Ostjuden und Westjuden in Deutschland und Österreich<br />
von 1900 bis 1914“ besonders ausgeprägt gewesen sei. Dies gilt auch<br />
für Prag. In J. M. Langer stoßen diese beiden Strömungen – im Übrigen<br />
ähnlich wie bei Buber – direkt, auch biographisch – durch den Bruder František<br />
– aufeinander.<br />
Den in der Tradition der Kabbala fortwährend bestehenden „Kampf zwischen<br />
dem begrifflich-diskursiven und dem bildhaft-symbolischen Denken“<br />
(SCHOLEM 1960: 128–129) entscheidet Langer zugunsten des letzteren<br />
Pols. Er trifft diese Entscheidung auch deshalb so, weil er sich in Prag als<br />
chassidischer Ostjude mit der Vorherrschaft des rabbinischen Judentums<br />
konfrontiert sieht. In Bezug auf das Prager Judentum rückt er damit eine –<br />
in seiner Terminologie – „verdrängte“ Linie des Judentums wieder ins Be-<br />
4 In dieser abweichenden Einstellung zu den Sprachen unterscheidet sich Langer grundlegend<br />
von einem Dichter in seinem Umfeld, dem er Hebräisch beigebracht hat, mit dem<br />
er sich auch Hebräisch verständigt hat und der ihn wiederholt erwähnt, nämlich Franz<br />
Kafka (vgl. dazu BINDER 1967). Kafka schreibt keine hebräischsprachige Literatur.<br />
Seine einzige Literatursprache ist das Deutsche. Dennoch bediente sich Kafka auch des<br />
Tschechischen und benutzte es bisweilen im Alltag. Diese tschechischsprachige Dimension<br />
Kafkas wird durch die jüngsten Forschungen der letzten fünf Jahre von Marek Nekula<br />
erstmals angemessen in die Forschung eingebracht (vgl. dazu die Bibliographie in<br />
NEKULA 2002). Dies hindert Reiner Stach in seiner voluminösen Monographie Kafka.<br />
Die Jahre der Entscheidungen (2002) nicht daran, diese tschechische Dimension Kafkas<br />
in einer durchaus hartnäckigen germanistischen Tradition auch weiterhin zu ignorieren.<br />
Milan Tvrdík (2000) befasst sich in jüngster Zeit mit dem Verhältnis von Kafka und<br />
Langer.<br />
229
230<br />
Walter Koschmal<br />
wusstsein. Es ist jene der mündlichen Thora, der Emotionalität von Religion.<br />
Langer trägt damit wesentlich zur Ganzheitlichkeit der jüdischkabbalistischen<br />
Tradition in Prag bei. Die Parallele zwischen der Aufhebung<br />
der Verdrängung, indem das Verdrängte ins Bewusstein ,gehoben‘<br />
wird und der Betonung des für Buber „unterirdischen Judentums“ [sic!] als<br />
Gegengewicht gegen das „bewusste“ und offensichtliche Gesetzesjudentum<br />
ist dabei für das Denken Langers besonders wichtig. 5<br />
Während im Sohar, jener frühen kabbalistischen Schrift, deren Titel im<br />
Deutschen etwa als „Glanz“ zu übertragen ist, das Licht als symbolische<br />
Repräsentation des amorphen Mystischen in den Mittelpunkt gerückt wird,<br />
tritt bei Langer an die Stelle des Lichts vor allem der Laut. Licht und Laut<br />
erscheinen schon in der Kabbala gleichermaßen als symbolische Repräsentanten<br />
eines amorph Mystischen. Die Emanation der „göttlichen Energie“<br />
lässt sich in der Kabbala deshalb auch als Entfaltung göttlicher Sprache verstehen.<br />
Die verborgene, geheime Welt des Göttlichen komme in der Welt<br />
der Sprache (SCHOLEM 1960: 54) zum Ausdruck. Es ist vor allem der in<br />
der Thora verschlüsselt gegebene göttliche Name, der auf diesem Wege<br />
entschlüsselt wird. Deshalb ist jeder Laut in der Thora voller Energie, voll<br />
unbegrenzter „Sinnfülle“. Gerade in der Mündlichkeit des Lauts komme es<br />
zu einer extremen „Konzentration von Energie“. Diese in der Kabbala bereits<br />
angelegte hohe Wertschätzung von schriftlicher und vor allem mündlicher<br />
Sprache rückt in den Mittelpunkt von Langers Konzeption der Erotik<br />
der Kabbala. Diese Hochschätzung hat letztlich mystische Gründe.<br />
Die Betonung der mündlichen Thora und der Mündlichkeit der Offenbarung<br />
unterstreicht die Wichtigkeit der Kommunikation. Dieser lange Zeit vor<br />
allem durch die Europäisierung der Aufklärung verdrängte Aspekt der Thora<br />
rückt im Chassidismus ins Zentrum. Die Kabbala unterstreicht in erster<br />
Linie die rezeptive Seite dieser Kommunikation. Das Auditive legitimiere<br />
den Mystiker stärker (SCHOLEM 1960: 33) als Schriftlichkeit. Der Mystiker<br />
leitet also seine Legitimation aus der emotional-mündlichen Dimension<br />
der Kabbala ab. Deshalb sei im Hebräischen der Konsonant „Aleph“ so zentral.<br />
Das Aleph war der erste Laut, den das Volk Israel bzw. Moses als<br />
„Deuter der göttlichen Stimme für das Volk“ (SCHOLEM 1960: 47) hörte.<br />
„Aleph“ ist der „laryngale Stimmeinsatz“ (vgl. „spiritus lenis“), der den<br />
5 Martin Treml (2001) schreibt über Bubers Die Geschichten des Rabbi Nachman: „Den<br />
Chassidismus selbst bestimmte Buber als eine Form der Mystik und volkstümlichen<br />
Weisheit, die gegen die ,Gesetzesherrschaft‘ der rabbinischen Tradition ,Führer‘ und<br />
,Gemeinde‘ schuf. In ihm ,siegte für eine Weile das unterirdische Judentum, dessen Geschichte<br />
man erzählt und dessen Wesen man in gemeinverständlichen Formeln fasst‘“.<br />
Buber verwendet also den Begriff des ‚unterirdischen Judentums‘.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
„Übergang“ zur auditiv wahrnehmbaren Sprache bilde. Das „Aleph“ markiert<br />
also den Beginn auditiv wahrnehmbarer Sprache.<br />
Dieses mündliche Prinzip der Thora sei – so Scholem – vor allem vom<br />
Chassidismus aufgegriffen worden. Das rabbinische Judentum habe es hingegen<br />
„geopfert“, als es sich von den emotionalen und mythischen Wurzeln<br />
entfernt habe. Die Vertreter dieser Richtung waren meist weniger schriftkundige<br />
Gelehrte. Scholem (1960: 42) bezeichnet sie als „Laienmystiker“.<br />
Als „Muster“ dieses Typus nennt er den Begründer des Chassidismus in<br />
Polen, Baal Schem. Im Unterschied zu den Rabbinern habe er über „wenig<br />
rabbinisches Wissen verfügt“. Man habe ihn und seine Richtung gar als „antirabbinisch“<br />
kritisiert, was sich allerdings aus der damals aktuellen Verdrängung<br />
der mündlich-emotionalen Dimension der Thora ergibt.<br />
Diese eher zurückhaltende Bewertung des so sehr im Volk verankerten Baal<br />
Schem steht seiner euphorischen Hochschätzung durch Langer gegenüber.<br />
Langer begrüßt Baal Schem (ca. 1700–1760) als den schlichtweg „genialen“<br />
Begründer des Chassidismus. Für Martin Buber war Baal Schem vor allem<br />
ein gottbegeisterter Ekstatiker, für den Historiker des Judentums Heinrich<br />
Graetz der „Vertreter einer finsteren Unvernunft“ (GRÖZINGER 1997:<br />
IXf.), ein Mann zwischen Sozialrevolutionär und homo religiosus. Erst seit<br />
jüngster Zeit wissen wir (GRÖZINGER 1997: XII), dass der Bescht in Polen<br />
als Wunderheiler in einem Kabbalistenzirkel lebte und von der Gemeinde<br />
finanziert wurde. Langers Werk Die Erotik der Kabbala belegt aber vor<br />
allem seine Wertung der Genialität. Darin ist es zuallererst ein antirabbinisches<br />
Buch. Damit rückt es aber auch die chassidische Bevorzugung der<br />
mündlich-emotionalen Dimension der Kabbala und ihrer Volksnähe in den<br />
Mittelpunkt.<br />
Sakralisierung des Eros<br />
J. M. Langers Werk Die Erotik der Kabbala ist im Jahre 1923 in deutscher<br />
Sprache erschienen. Eine tschechischsprachige Fassung gibt es nicht. Erst<br />
1991 ist das Werk auch tschechisch erschienen. Langer verfasste außer diesem<br />
Buch auch mehrere Aufsätze zum Judentum in deutscher Sprache, unter<br />
anderem für Sigmund Freuds Zeitschrift Imago.<br />
Langer erläutert in Die Erotik der Kabbala den „Grundgedanken der Kabbala“<br />
aus seinem Blickwinkel. Zwischen dem begrenzten menschlichen Dasein<br />
und dem unendlichen existieren danach zahllose „Zwischenstufen“,<br />
„geistige Wände“. Durch diese Wände falle ein „Strahl“ in die diesseitige<br />
Welt. Die dabei entstehenden Funken bildeten jeweils „eine Welt für sich“.<br />
Mit diesen „Oberen Welten“ beschäftige sich die Kabbala. Dadurch gelange<br />
der Mensch zur Vollkommenheit. Dank dieser Verbindung von metaphysischer<br />
und physischer Welt sieht Langer die Wesenheit der Kabbala in einer<br />
231
232<br />
Walter Koschmal<br />
„Lebens-Metaphysik“ (LANGER 1923: 13). Diese könne nicht gelehrt,<br />
sondern nur gelebt, nachempfunden werden. Langer unterscheidet zwei Methoden<br />
der Erforschung der Kabbala, eine „quasi-logische Reflexion“ und<br />
eine „psychologische Methode“.<br />
Mag er sich in diesem spannungsvollen Dualismus von begrifflichem und<br />
bildhaft-psychologischem Denken noch mit Scholems Dualismus von äußerem<br />
und innerem Wortsinn verbinden lassen, so wird der Unterschied zu<br />
dessen Darstellung der Kabbala im Weiteren recht deutlich. Langer geht es<br />
vor allem darum zu zeigen, wie der Mensch „eins“ werden kann. Er unterstreicht,<br />
dass der Kern, die Wurzel der Kabbala im Eros liege. Die Aussage<br />
des „Sohar“, wonach der Mensch eins werde, „wenn sich Mann und Frau in<br />
geschlechtlicher Verbindung befinden“, legt Langer (1923: 24) so aus: „Der<br />
Gedanke des sexuellen Aktes in seiner höchsten Reinheit ist der geheime<br />
Urgrund der Thora und der Offenbarung Gottes“. Damit bilde das Erotische<br />
den „ganz zentralen Grund“ des Judentums. Dieses sei durch eine „geheiligte<br />
Sinnlichkeit“ (LANGER 1923: 28) gekennzeichnet. Die göttliche Schöpfung<br />
sei zu Beginn in zwei Teile geteilt gewesen, in einen männlichen und<br />
einen weiblichen. Daraus erwachse die „Wunderkraft des Eros“.<br />
Warum betont Langer diesen Aspekt so sehr? Ganz im Sinne von Scholems<br />
Konzeption von der Opferung des Mythischen im Judentum ist Die Erotik<br />
der Kabbala ein Antibuch, ein Buch gegen Verdrängung. Es gebe genügend<br />
„kabbalistische Moralistenliteratur“, meist bürgerlicher Juden, die die Erotik<br />
„zu verdrängen“ wisse (LANGER 1923: 32). Langer aber will das Verdrängte,<br />
in der Terminologie Scholems das der europäischen Aufklärung<br />
,Geopferte‘, zurück in das Bewusstsein holen. Dass sich Langer dabei der<br />
Terminologie der zeitgenössischen Psychoanalyse bedient, ist kein Zufall.<br />
Er eröffnet der Kabbala und ihrer Erforschung damit eine neue disziplinäre<br />
und diskursive Dimension. Die Psychoanalyse erscheint ihm als die sich<br />
gerade herausbildende, angemessene Methode, um die „geopferte“, „verdrängte“<br />
Kabbala des „unterirdischen Judentums“ (M. Buber) wieder zu<br />
Bewusstsein zu bringen.<br />
Doch prägen nicht nur Terminologie, Methoden und Schriften der Psychoanalyse<br />
die „Erotik der Kabbala“. Die Erotik erscheint plötzlich in zweierlei<br />
Hinsicht verdrängt. Zum einen ist sie – im Freudschen Kontext – eine verdrängte<br />
Sexualität, zum andern, im religionshistorischen Kontext, die verdrängte<br />
mündliche Thora, die ins Bewusstsein zurückgeholt wird. Die Verankerung<br />
Langers in der Psychoanalyse darzustellen, ist nicht Ziel dieses<br />
Beitrags. Zu vielfältig dürften die Verbindungslinien sein, spielt doch auch<br />
Freuds Werk zur Traumdeutung eine bedeutende Rolle für ihn. Wesentlich<br />
ist aber vor allem die Parallelisierung von Kabbala, von kabbalistischer<br />
Theosophie und psychoanalytisch konzipierter Erotik. Indem Langer die<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
Erotik in den Mittelpunkt der Kabbala rückt und deren Stellenwert mit den<br />
von der Wissenschaft, der Psychoanalyse entwickelten Methoden und Verfahren<br />
untersucht, schafft er zweifellos etwas Neues. Aus der synthetischen,<br />
gleichsam interdisziplinären, psychoanalytisch-theosophischen Behandlung<br />
erwächst eine spezifische Sakralisierung des Eros, deren Wurzeln bei einer<br />
Beschränkung auf die Lektüre Langers, ohne seine eigenen Leseerfahrungen<br />
einzubeziehen, dennoch weitgehend im Dunklen bleiben. 6<br />
Die Terminologie, der Freudsche Denkansatz in Langers Die Erotik der<br />
Kabbala ist offensichtlich. Der Autor verweist auch explizit auf Freud.<br />
Dennoch überrascht die intertextuelle Situierung des Werks. Viele Begriffe<br />
und Überlegungen erscheinen zunächst fremd. Sie lassen sich schwerlich in<br />
einen genuin tschechischen Kontext stellen. Darin liegt auch ein Grund dafür,<br />
dass dieses Werk deutsch geschrieben wurde.<br />
Aber auch der Chassidismus, dem Langer anhängt, die Schriften Martin<br />
Bubers, die er zum Teil kannte und den er auch ausdrücklich mit Die Legende<br />
des Baal-Schem erwähnt (LANGER 1923: 69), schaffen keinen auch<br />
nur annähernd befriedigenden intertextuellen Rahmen für diese recht eigene<br />
Schrift. Buber hat die Einführung zu diesem Text im Jahre 1907 verfasst<br />
(TREML 2001: 15). 7<br />
Aber auch die Gnostik, insbesondere wieder jene, die auch Buber intensiv<br />
beschäftigte, vor allem die Mystiker, Meister Eckhart (um 1260–1328), auf<br />
6 Alfons Rosenberg spricht der Erotik der Kabbala die Wissenschaftlichkeit ab (1956:<br />
12f.): „Ist aber Langer ein Wissenschaftler? Trägt er seinen so lebendigen Kommentar<br />
mit wissenschaftlicher und historischer Akribie vor? Keinesfalls.“ Im Weiteren lobt er<br />
zwar, dass Langer „die talmudischen und kabbalistischen Überlieferungen auf eine stupende<br />
Weise“ kenne, doch gebe er sie nicht als Wissenschaftler, „sondern als ein Ergriffener<br />
und als ein Mensch der Erfahrungen weiter.“ Er sei ein „Brotspender“, er spende<br />
lebendigen Glauben und „klare Einsicht“: Dabei gelange er selbst zu Einsichten, die<br />
dem „bloßen Historiker und Systematiker der Religion verborgen bleiben müssen“<br />
(1956: 13). Eine solche Charakterisierung des Werks fügte dies bestens in die Schriftenreihe<br />
„Dokumente religiöser Erfahrung“ ein, in der es erschien. Die religiösen Erfahrungen<br />
Langers fließen aber in weit höherem Maße in die „Neun Tore“ ein. Zudem ist<br />
ihm Chassidismus und Kabbala ohnehin nur eine zu erfahrende Religion. Seine Wissenschaftskritik<br />
ist nicht nur deshalb skeptisch zu beurteilen, haben wir doch von einem<br />
Wissenschaftsbegriff vom Anfang des 20. Jahrhunderts auszugehen.<br />
7 Langer könnte an Buber auch sein biographischer Werdegang bzw. der Wandel in seiner<br />
Einschätzung des Judentums angezogen haben. Das Prager Umfeld mag dies befördert<br />
haben, denn in der Prager Vereinigung jüdischer Hochschüler „Bar Kochba“ hatte<br />
Buber zahlreiche glühende Verehrer (TREML 2001: 18). Deshalb lud man ihn auch<br />
zum Vortrag ein. Bubers Selbstcharakterisierung als „polnischer Jude“ aus einer „Familie<br />
von Aufklärern“ (TREML 2001: 22) hätte Langer auf seine eigene tschechische Situation<br />
übertragen können. Durch den aufklärerischen Ausgangspunkt kam Buber von<br />
einer anfänglichen Ablehnung des Ostjudentums und des Chassidismus erst später zu<br />
dessen Hochschätzung. Wieder ist sein Weg jenem Langers vergleichbar.<br />
233
234<br />
Walter Koschmal<br />
den er explizit hinweist (LANGER 1923: 74) und Jakob Böhme (1575–<br />
1624), gehören zu Langers Anknüpfungspunkten. Selbst die besondere<br />
Wertschätzung für Dichter wie Stefan George teilt er mit Buber.<br />
Die Gnosis befindet sich laut Scholem (1960: 131) in „historischer Berührung“<br />
mit der Kabbala und stellt zugleich eine „psychologische und strukturale<br />
Parallelentwicklung“ zur Kabbala dar. Scholem bezeichnet deshalb Jakob<br />
Böhme als Bindeglied. Gnosis und Chassidismus, zwei im Volk tief<br />
verankerte Denkrichtungen, wenden sich auf der gemeinsamen Grundlage<br />
des Neuplatonismus gegen ein „antimythisches Judentum“.<br />
Doch auch weitere Knoten im intertextuellen Netz Bubers tun sich auf. Bubers<br />
,Lehrer‘ Achad Haam, der Kulturzionist aus Odessa, führt in jene Region<br />
des Ostjudentums, in der Langer die ihn prägenden Lebensjahre verbrachte.<br />
T. G. Masaryk hatte Achad Haam durch die positive Besprechung<br />
seiner deutsch erschienen Schriften bereits zu Beginn des Jahrhunderts in<br />
einen tschechischen jüdischen Zusammenhang gestellt. 8 Da Langer selbst<br />
viele Jahre beim Rabbi von Bels gelebt hat, kann es beim derzeitigen Stand<br />
der Forschung zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass Langer auch<br />
eine direkte Verbindung zu Achad Haam hatte, ob persönlich oder über die<br />
Lektüre von Schriften. In jedem Fall stellt sie sich indirekt über den zunächst<br />
in Lemberg lebenden Buber her, der Friedrich Nietzsches Also<br />
sprach Zarathustra in Teilen ins Polnische übersetzt.<br />
Die Erotik der Kabbala steht in der Tradition der reichen kabbalistischen<br />
Kommentarliteratur. Traditionelle Verfahren solcher Werke, die meist aus<br />
autoritativen Quellen, d.h. aus den ersten Büchern der Kabbala wie dem<br />
Bahir und dem späteren Sohar, stammen, übernimmt auch Langer. Seine<br />
Erotik der Kabbala basiert in wesentlichen Teilen auf Zitaten aus dem Sohar,<br />
die – je nach gattungsspezifischer Erwartungshaltung – zunächst irritieren<br />
mögen. Bei einem Originaltext eines Dichters des 20. Jahrhunderts würde<br />
man kaum eine solche Fülle von Zitaten erwarten. Es bleibt jedoch<br />
unklar, ob Langer eine Übersetzung benutzt oder selbst übersetzt hat. Die<br />
von ihm später rezensierte Übersetzung des Urtextes Der Sohar, die Ernst<br />
Müller herausgegeben hat (Wien 1932), ist – wie ein Vergleich ausgewähl-<br />
8 Masaryk bespricht in der von ihm redigierten Zeitschrift Naše doba (Unsere Zeit, 1905)<br />
die ins Deutsche übersetzten Werke des „russisch-hebräischen Philosophen“ Achad<br />
Haam. Als Gegner des westeuropäischen Judentums predige Haam – so Masaryk – dennoch<br />
keine Abkehr, sondern die Aneignung der europäischen Kultur unter Bewahrung<br />
des jüdischen „nationalen Charakters“. Achad Haam habe sich gegen jene Juden gestellt,<br />
die unter Nietzsches Einfluss alles Jüdische für wertlos erklärten. Masaryk<br />
schreibt: „er kämpft gegen Nietzsche und den Individualismus.“ Haam verlange die<br />
„geistig religiöse Wiedergeburt“ des Judentums. Auf diesem Weg dürfte Langer Haam<br />
näher stehen als vermutet.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
ter, von Langer in Die Erotik der Kabbala zitierter Passagen zeigt – gänzlich<br />
abweichend übersetzt. Langer zitiert wohl nach dem Original, waren<br />
doch wesentliche Teile des Sohar aramäisch geschrieben, eine Sprache, derer<br />
er mächtig war.<br />
Der intertextuelle Rahmen, vor allem der tschechische für die Erotik der<br />
Kabbala bleibt lückenhaft. Das Werk steht wohl sprachlich und inhaltlich<br />
außerhalb bzw. am Rande des tschechischen Schrifttums. Langer wird ohnehin<br />
nur selten erwähnt. In dem voluminösen Sammelwerk Masaryk und<br />
das Judentum, das Ernst Rychnovsky in deutscher Sprache im Jahre 1931 in<br />
Prag herausgibt, kommt Langer nicht vor. Das erstaunt um so mehr, als das<br />
Werk unter Mitwirkung von „Prof. Dr. Friedrich Thieberger“ herausgegeben<br />
wird, der – ebenso wie Langer – Kafkas Hebräischkenntnisse verbessern<br />
half. Thieberger hat zudem Langers chassidische Legenden unter dem<br />
Titel Neun Tore. Das Geheimnis der Chassidim (1959) in Übersetzung herausgebracht.<br />
Die Einleitung stammt von Gershom Scholem. Sie ist fast<br />
gleichzeitig mit seinem Buch Zur Kabbala und ihrer Symbolik entstanden.<br />
Scholem stellt darin Langers Werk auf eine Stufe mit den chassidischen<br />
Erzählungen Martin Bubers. Er lobt es als „eine der wertvollsten Darstellungen<br />
des chassidischen Lebens und der chassidischen Denkweise“. Thieberger,<br />
der in dieser Übersetzung aber in der Folge leider allzu häufig falsch<br />
als „Thierberger“ zitiert wird, stirbt unmittelbar nach Beendigung dieser<br />
Übersetzung in Jerusalem. Er hat nicht nur an dem Band Masaryk und das<br />
Judentum mitgewirkt, sondern im Jahre 1952 auch sein Hauptwerk Die<br />
Glaubensstufen des Judentums veröffentlicht. Auch dort findet Langer keine<br />
Erwähnung. Martin Buber hingegen, dem sich Thieberger in der Vorbemerkung<br />
des Buchs besonders verpflichtet weiß, spielt eine zentrale Rolle. 9<br />
Langer hat auch hebräische Lyrik verfasst. Auch mit seinen Gedichten stellt<br />
sich Langer außerhalb der tschechischen Dichtung, schreibt er doch als letzter<br />
– bewusst – in dieser Sprache. Er steht damit in der biblisch-jüdischen<br />
Tradition des religiösen Lieds, das „zugleich dem persönlichen Gefühl des<br />
einzelnen und der Stimmung einer Gemeinschaft und der kosmischen Gewalt<br />
der Gott geschaffenen Welt Ausdruck gab“ (THIEBERGER 1952: 73).<br />
Das lyrische Schaffen wird als das ursprüngliche gesehen, das jeder anderen<br />
Sprachkunst vorausgeht.<br />
9 Im Aufsatz Masaryks Credo und die jüdische Religion (1931: 34–66) macht Thieberger<br />
eigentlich nur deutlich, dass sich Masaryk nie über das Thema Religion äußern wollte,<br />
weil dies zum Intimsten des Menschen gehöre. Das Judentum habe ihn vor allem als soziales<br />
Phänomen interessiert. Thieberger betont aber Masaryks Vorstellung von einem<br />
europäischen Judentum, das seinen nationalen Charakter bewahrt. Zu diesem Zweck zitiert<br />
er Masaryks Besprechung von Achad Haam aus der Zeitschrift Naše doba (1905).<br />
Masaryk gehört damit auch in das weitere Umfeld Langers.<br />
235
236<br />
Walter Koschmal<br />
Langer – obgleich ein Einzelgänger – verändert, verschiebt das Koordinatensystem<br />
der tschechischen Literatur und Kultur, vor allem aber jenes des<br />
Prager Judentums, auch wenn er mit Max Brod befreundet war. Wo also<br />
liegen die Wurzeln dieses ungewöhnlichen Werkes, der Erotik der Kabbala<br />
in deutscher Sprache?<br />
Kultur aus dem gleichgeschlechtlichen männlichen Eros: Hans Blüher<br />
und J. M. Langer<br />
Langer erwähnt im Grunde die zentrale Quelle seines Werks selbst. Doch er<br />
tut dies eher beiläufig, so dass man deren wahre, nämlich herausragende<br />
Bedeutung für die Erotik der Kabbala erst nach eingehender Lektüre erkennt.<br />
Schon deshalb überrascht es nicht, dass man diese Quelle bislang in<br />
ihrer umfassenden Bedeutung nicht erkannt hat. Um welches Werk handelt<br />
es sich? Gemeint ist Hans Blühers in den Jahren 1917–1919 bei Eugen Diederichs<br />
in Jena erschienene Schrift Die Rolle der Erotik in der männlichen<br />
Gesellschaft.<br />
Hans Blüher (1888–1955) aus Schlesien, der wesentlich von Friedrich<br />
Nietzsche beeinflusst war, wirkte entscheidend auf die so genannte „Wandervogelbewegung“.<br />
Vor allem in dem genannten zweibändigen Werk analysiert<br />
Blüher homoerotisch gebundene Männergesellschaften von der griechischen<br />
Antike bis zur Gegenwart. Das heftig umstrittene Buch brachte<br />
ziemlich umgehend Gegenschriften wie den Anti-B. Affen- oder Männerbund<br />
von J. Plenge hervor. Langer hinderte dies nicht daran, nur wenige<br />
Jahre später eine Schrift in enger Nachfolge Blühers zu verfassen, nämlich<br />
Die Erotik der Kabbala. Blüher dürfte diese aber kaum zur Kenntnis genommen<br />
haben. In seinem ausführlichen Vorwort (1949) zur Neuauflage<br />
seines Werks im Jahre 1962 klingt zumindest nichts dergleichen an. Langer<br />
folgt Blüher – ungeachtet allen Widerstands gegen diesen – in einem Maße,<br />
wie dies die nur wenigen Verweise auf Blüher kaum vermuten lassen. Diese<br />
Nachfolge erstreckt sich ebenso auf die Terminologie wie auf grundlegende<br />
Ideen Blühers. 10<br />
Blühers Werk verbindet – wesentlich an Freud und seinen Schülern orientierte<br />
– sexualwissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophischen Fragestellungen.<br />
Bei Langer steht hingegen die Verknüpfung von psychoanalytischem<br />
und theologischem Ansatz im Mittelpunkt. Daraus erwächst die<br />
10 Langer ist damit auch im Kontext der Homosexualität innerhalb der tschechischen Literatur<br />
zu sehen. Er dürfte hier ganz entscheidende Impulse gesetzt haben. Das Thema der<br />
Homosexualität in der tschechischen Literatur war – trotz seiner Relevanz – bis vor kurzem<br />
kaum aufgegriffen worden. Dank der in der Zeitschrift Neon veröffentlichten Arbeiten<br />
von Martin C. Putna (2000) hat es aber damit ein Ende. Putna (2000/5: 47) weist<br />
zumindest in einem Satz auch auf Blüher hin.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
spezifische, bizarr anmutende Diskursmischung der Erotik der Kabbala.<br />
Blüher geht von folgender „theoretischer Grundthesis“ aus:<br />
Außer dem Gesellungsprinzip der Familie, das aus der Quelle des mannweiblichen<br />
Eros gespeist wird, wirkt im Menschengeschlecht noch ein zweites,<br />
die „männliche Gesellschaft“, die ihr Dasein dem mann-männlichen Eros<br />
verdankt, und sich in den Männerbünden auswirkt. (BLÜHER 1917: 7)<br />
Während aber der Eros bei der Familie „offen“ zutage trete, sei er bei der<br />
männlichen Gesellschaft „unter die Bewußtseinsschwelle gedrückt“, also im<br />
Sinne Blühers und Langers verdrängt und sei ein „vollkommen verschwiegenes<br />
Gebilde“. Daraus aber ergibt sich für Langer eine Parallele zur Kabbala.<br />
Ihre emotional-mündliche Dimension wurde ähnlich „verdrängt“ („geopfert“),<br />
vergessen bzw. verschwiegen.<br />
Um aber Blühers Intention angemessen zu verstehen, muss eine zweite<br />
Hauptthese ergänzt werden. Die sexuelle „Energie“ könne sich „nach oben“<br />
in „Leistung“ oder „nach unten“ in Krankheit (BLÜHER 1917: 32) transformieren.<br />
Leistung aber stehe im Dienste der Kultur. Für Blüher sind es<br />
allein die Männergesellschaften, ist es allein der „mann-männliche Eros“,<br />
nicht aber der „mann-weibliche“, der letztlich Kultur schafft. Langer übernimmt<br />
diese Terminologie zur Gänze von Blüher, ohne auf seine Quelle<br />
bzw. den Zitatcharakter seiner Termini zu verweisen. Hans-Joachim<br />
Schoeps (1962: 5) formuliert Blühers Hauptthese so, dass für ihn „der auf<br />
die menschliche Staatenbildung hin angelegte Männerbund eine klar aufweisbare<br />
Funktion im Haushalt der Natur habe“. Blühers „eigentliche Bedeutung“<br />
(SCHOEPS 1962: 6) liege „wohl darin, daß er das Erosproblem<br />
aus dem medizinischen Niveau unter Anknüpfung an die alte platonische<br />
Erosidee in die der philosophischen Betrachtung erhoben“ habe. Das heißt,<br />
für Blüher (1917: 32) bringt nur der von ihm – und in der Folge auch von<br />
Langer – so genannte „Typus inversus“, den Blüher vom Homosexuellen<br />
unterscheidet, Kultur und damit auch den Staat hervor.<br />
Sexualität vs. Erotik<br />
Blüher selbst rechnet es sich als Verdienst an, dass er Sexualität und Erotik<br />
erstmals deutlich voneinander geschieden hat. Der Begriff Erotik ist für ihn der<br />
grundlegende. Zwischen Sexualität und Erotik verlaufe auch die Grenze von<br />
philosophischer Ausrichtung und „psychiatrischer“ (BLÜHER 1917: 226). Der<br />
„Typus inversus“, der schon bei Weininger angelegt sei, ist für Blüher noch ein<br />
„sexueller Charakter“. Doch anders als die Sexualität sei die Erotik „schon<br />
keine einfache Größe mehr. Es ist also überhaupt kein strenger sexuologischer<br />
Begriff, sondern es steckt in ihm schon Kultur.“ (BLÜHER 1917: 37). Zwar<br />
komme reine Sexualität beim Menschen nicht vor, doch sei Erotik „aufs innigste“<br />
„mit den geistigen Angelegenheiten“ verbunden. Der Typus inversus ver-<br />
237
238<br />
Walter Koschmal<br />
dränge bloß sexuelle Gedanken und sei als Mann immer auf „die ganze Gestalt<br />
des Mannes“ gerichtet (BLÜHER 1917: 66). Durch die „Hemmung“ der Sexualität<br />
entstehe „die psychische Grundlage der Kultur“. „Sublimierung ist<br />
transformierte Sexualität“ (BLÜHER 1917: 76).<br />
Eros ist jedoch für Blüher etwas anderes als Sexualität. Eros sei vielmehr das,<br />
„was der Sexualität ihren Sinn gibt. Sinn, nicht Zweck.“ „Eros ist die Bejahung<br />
des Menschen abgesehen von seinem Wert.“ (BLÜHER 1917: 226). Ein<br />
vom Eros „befallener“ Mensch, also der Liebende, stehe „in einem geweihten<br />
Zusammenhang“. Daran kann Langer anknüpfen, geht es ihm doch – anders<br />
als Blüher – wesentlich um die religiöse Dimension des Eros. Bewusst setzt<br />
Blüher seinen um den Sinn des Eros erweiterten Eros-Begriff einem von ihm<br />
verengten Logos-Begriff gegenüber. Denn der Eros sei nicht nur „irrational<br />
sondern geradezu antirational“ (BLÜHER 1917: 230). Der „schöpferische<br />
Geist“ schaffe „in ganz enger Verschwisterung mit dem Eros“ (BLÜHER<br />
1917: 235) und sei vom „Formwillen des Eros“ durchtränkt. Werner Achelis<br />
(BLÜHER 1962: 328) beschreibt Blühers Erosbegriff so, dass dieser Eros den<br />
Menschen über sich hinaushebe. Der Mensch zeigt sich dem Eros verfallen,<br />
kann durch ihn erkranken. In diesem Verfallensein sei der Eros eine „tragische<br />
Angelegenheit“. Diese platonische Erosidee werde aber von Blüher<br />
„zum Mittelpunkt eines philosophischen Systems“, zu einer Theorie erhoben.<br />
Damit schaffe er „etwas Neues“ (ACHELIS 1962: 329).<br />
Langer stellt den Erosbegriff Blühers ebenfalls in den Mittelpunkt seines<br />
Werks. Doch verlagert er ihn in die Religionsphilosophie. Damit schafft<br />
auch er für die Kabbala und ihre Auslegung wohl etwas gänzlich Neues.<br />
Dass er Blühers Erosbegriff nicht nur im Titel verankert, sondern darauf<br />
auch seine Grundthese aufbaut, macht deutlich, wie sehr sich Langer Blüher<br />
verpflichtet weiß. Auch darin mag ein Grund dafür liegen, dass er ihn so<br />
zurückhaltend zitiert.<br />
Langer stellt den Eros vor allem in den Kontext der Kabbala. Dort schaffe der<br />
Eros – ganz wie in Blühers Vorstellung, wonach der Eros den Menschen über<br />
sich hinaushebe – den „Übergang vom Irdischen zum Göttlichen“ (LANGER<br />
1923: 86f.). Der Eros verbinde zwar „mann-männliche“ und „mannweibliche“<br />
erotische Beziehungen – hier bedient sich Langer Blühers Terminologie,<br />
auch wenn er von „Inversion“ spricht, ohne auf das Zitat hinzuweisen.<br />
Doch bleibe beim Eros ein Widerspruch bestehen. Es komme immer<br />
wieder zum „unbewußten Kampfe beider erotischer Richtungen“ (LANGER<br />
1923: 91): Der Eros bilde insofern eine „contradictio in adiecto“. Er konnte<br />
deshalb von den Juden nie als Gott betrachtet werden.<br />
Eros als Sinn des Eros, in diesem Verständnis ist der Eros für Blüher und<br />
Langer gleichermaßen kulturstiftend. Verwehrt sich Blüher gegen jede<br />
Zweckbestimmtheit des Eros, so weist auch Langer (1923: 90) die Relevanz<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
biologischer „Nützlichkeitskategorien“ des Eros zurück. Beide unterstreichen<br />
die Nähe, ja Identität von Eros und Schöpfertum, wobei sich Langers Konzeptionen<br />
ebenso von Blüher wie von der Kabbala ableiten. Langer schreibt Blüher<br />
religionsphilosophisch um und fort. Sieht Blüher den „schöpferischen<br />
Geist“ mit dem „Formwillen des Eros“ verschwistert, so zitiert Langer die<br />
Kabbala, wenn er den Eros (I’sod) als den Grund der Schöpfung bezeichnet.<br />
Jede geschlechtliche Verbindung geschehe durch I’sod.<br />
Der „mann-männliche Eros“, die männliche „Inversion“ gehöre zu einer<br />
tieferen Schicht als die weibliche. In der Geschichte habe zwar die Heterosexualität<br />
quantitativ immer überwogen, doch sei die mann-männliche<br />
Richtung „intensiver“ (LANGER 1923: 97). Der Eros sei der Bote Gottes.<br />
So wie die „Gesetze“ der Kabbala „aus den Tiefen des Unbewußten“<br />
(LANGER 1923: 94) aufsteigen, komme auch der Eros aus dieser Tiefe, aus<br />
der Zeit vor der Offenbarung der Thora-Gesetze (LANGER 1923: 94; 97).<br />
In jüdischen Schriften schlage sich wiederholt der „Sieg männlicher Erotik“<br />
nieder (LANGER 1923: 97). Damit aber wird deutlich – und Langer vermerkt<br />
dies explizit –, dass die Rolle der Erotik in Kabbala und Psychoanalyse<br />
vergleichbar, parallel sei. Diese entspreche der „jüdischen Überlieferung“<br />
ebenso wie „der modernen psychoanalytischen Forschung“, die<br />
Langer auch über Blüher rezipiert. Damit schafft Langer – ganz in der Tradition<br />
der Kabbalisten – neue strukturelle Parallelen, hier jene für das 20.<br />
Jahrhundert und ihn spezifische zwischen Kabbala und Psychoanalyse. Die<br />
Verdrängung der Sexualität, der sich die Psychoanalyse annimmt, die Verdrängung<br />
des „mann-männlichen Eros“ und die „Verdrängung“ („Opferung“)<br />
der Emotionalität und der mythischen Grundlage der Kabbala fließen<br />
hier in Eins. Langer nennt seine sakral transformierte „Erotik“ auch die<br />
„Wunderkraft der Erotik“ (LANGER 1923: 32). Es gebe aus seiner Sicht<br />
genügend „kabbalistische Moralistenliteratur“, die die Erotik „zu verdrängen“<br />
weiß. Der Verdrängung der Erotik bei Blüher (1917: 7f.), wo die Erotik,<br />
insbesondere jene des „typus inversus“, „unter die Bewußtseinsschwelle<br />
gedrückt“ werde, entspricht als Parallele die Verdrängung der Erotik in der<br />
Kabbala. Blüher wie Langer wollen das jeweils Verdrängte wieder ins Bewusstsein<br />
rücken. Diese Synthese von philosophischem und religiösem<br />
Denken, aber auch diese Synthese von wissenschaftlichen Disziplinen ermöglichte<br />
gerade zu diesem historischen Zeitpunkt die Entstehung der Psychoanalyse.<br />
Damit aber tun sich auch weitere, von Langer keineswegs explizit<br />
ausgeführte Parallelen auf.<br />
Analog zur inneren und äußeren Bedeutung des Wortes unterscheidet Langer<br />
(nach ihm, vielleicht sogar von ihm beeinflusst auch G. Scholem) die<br />
„innere“ und äußere Geschichte des Judentums. Wilhelm von Humboldts<br />
„innere Sprachform“, die Harmonie von lautlichem Ausdruck und Sinn, und<br />
239
240<br />
Walter Koschmal<br />
damit die von Hermann Bekh so bezeichnete „Lautetymologie“, dürfte hier<br />
Pate gestanden haben. Scholem nennt die von Langer so bezeichnete „innere<br />
Geschichte“ die „psychologische Geschichte“ des Judentums. Langer<br />
unterscheidet auch bei den Juden, insbesondere den Chassiden zwischen<br />
dem äußeren, biologischen Alter und dem inneren Alter. Mit letzterem<br />
meint er den Grad der menschlichen Reife. Langer führt weiter aus: „Die<br />
ganze innere Geschichte des ewigen Volkes“ sei von den Kämpfen der beiden<br />
Richtungen bestimmt, nämlich jenen, die Scholem als Gesetzesjudentum<br />
(rabbinisches Judentum) und mythisches, bei Langer vor allem chassidisches<br />
Judentum, im Auge hat:<br />
Dabei greift der von Freud sogenannte „Ödipus-Komplex“ und der Todesgedanke mächtig ein<br />
und so ist die gesamte jüdische Gesetzgebung eigentlich vom Eros präformiert, ehe sie durch<br />
die Offenbarung die göttliche Sanktion erhielt. (LANGER 1923: 92)<br />
Der Kampf zwischen innerer und äußerer Bedeutung, mythisch verankerter<br />
Kabbala und Gesetzesjudentum verbindet sich bei Langer mit dem Kampf<br />
zwischen Eros und Logos. Diesen Kampf bezeichnet Blüher (1917: 236) gar<br />
als „Todfehde“. Die Auseinandersetzung um die Kabbala wird ins Allgemeine<br />
gehoben und überschreitet damit die Grenzen des Religiösen.<br />
Langers Standort in diesem Kampf, dieser „Todfehde“, ist eindeutig. Es ist<br />
vor allem und zunächst jener des Chassidismus, der die mann-männliche<br />
Richtung repräsentiert. Der Chassidismus steht bei Langer für jene verdrängte<br />
„mann-männliche“ Linie der Erotik, für jenes sinnliche Judentum,<br />
das – dank der Lehren Freuds und Blühers – nun im richtigen Licht dargestellt<br />
werden kann. Es ist auch die Sinnlichkeit der Mündlichkeit und der<br />
Sprache. Langer spricht auch von der Sinnlichkeit des Judentums.<br />
Aus der Gemeinschaft der Chassiden bleiben die Frauen „völlig ausgeschlossen“<br />
(LANGER 1923: 82). Man spricht nicht mit Frauen, schaut ihnen<br />
nicht ins Gesicht und speist nicht mit ihnen. Hingegen betont Langer<br />
die unter Chassiden immer wieder aufkeimende Liebe zwischen Männern<br />
(LANGER 1923: 83), zwischen „süßen Brüdern“. Er beschreibt u.a., wie<br />
nachts im „Haus des Forschens“ (Bejshamidresch) zwei Freunde, die immer<br />
aus derselben Schüssel essen (LANGER 1923: 76) „eng umschlungen“ lernen.<br />
Verlässt der Sohn, der selbständig zu denken gelernt hat und zum Rabbi<br />
geführt wird, für immer das elterliche Haus, so schmiege er sich an den<br />
Rabbi an („dowek“ sein). Es sei ihm eine besondere Ehre, eine Speise zu<br />
erhalten, die der Rabbi durch seinen Mund geheiligt habe. Selbst die Beziehung<br />
zum Rabbi ist voll Eros.<br />
Damit stellt der Chassidismus aus der Sicht Langers mit seiner ausschließlichen<br />
Propagierung der mann-männlichen Erotik jene Strömung der Kabbala<br />
dar, die diese wieder zu ihren verdrängten mythischen Wurzeln, zu ihrer<br />
gefühlsbetonten Dimension, die in der Geschichte geopfert und verdrängt<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
wurde, zurückführt. Die Erotik der Kabbala ist vor allem die Erotik des<br />
Chassidismus, die Wiedergeburt der „inneren Geschichte“ der Kabbala. Die<br />
fehlende Rationalität des Eros und des Chassidismus finden sich in einer<br />
überraschenden Ähnlichkeitsbeziehung wieder. Für Blüher (1917: 230) ist<br />
der Eros gar „antirational“.<br />
Damit dominiert die mann-männliche Linie auch in der Pädagogik. Denn<br />
die eng umschlungen lernenden Chassidim bilden das typische Lerntandem<br />
der Chassidim. Man lernt immer mit einem Freund (1923: 78), insbesondere<br />
im „Haus des Forschens“. Dies rückt der Chassidismus an die Stelle der<br />
Heschibah, der Universität. Diese „freie Lehrmethode“, die gemeinsames,<br />
sich im Dialog mit dem Freund austauschendes Lernen ist, erziele „kolossale<br />
Erfolge“. Dabei dürften die beiden Freunde aber in ihrem „inneren Alter“,<br />
d.h. in ihrer Reife nicht zu weit auseinander sein. Grundsätzlich vereint<br />
aber schon die Volksschule, die „Cheder“, verschiedene Altersklassen, also<br />
unterschiedliche Stufen des äußeren Alters, das sich vom inneren unterscheiden<br />
kann. Darin liege der Vorteil der chassidischen Pädagogik.<br />
Es mag überraschen, dass Langer auch in dieser angeblich so jüdischen<br />
Konzeption der Pädagogik auf Blüher zurückgegriffen haben dürfte. Denn<br />
Blüher (1917: 218) propagiert seinerseits das diesem ganz ähnliche Erziehungssystem<br />
der Antike, in dem ebenfalls der Typus inversus die Erziehung<br />
übernommen habe. Er lehnt wie Langer das heutige Erziehungssystem ab,<br />
weil die Jugend „durch das System der Altersklassen zersprengt“ sei. Die<br />
antike Art der Erziehung sei die naturgegebene gewesen. Langer sieht in der<br />
chassidischen „Lehr- und Erziehungsmethode“ ebenso „manche Vorzüge“,<br />
weil es „keine so genaue Differenzierung der Altersklassen“ gebe (LAN-<br />
GER 1923: 77). Während aber für Blüher (1917: 223) die von ihm initiierte<br />
Wandervogelbewegung, die Langer unerwähnt lässt, „ein gewaltsamer und<br />
gelungener Durchbrechungsversuch des Systems der Altersklassen“ darstellt,<br />
durchbricht für Langer das chassidische Judentum dieses System.<br />
Chassidismus und Wandervogelbewegung geraten in eine überraschende<br />
Nachbarschaft. Auch für Langer gilt aber Blühers Behauptung: „Und diese<br />
Durchbrechung wurde von Männern unternommen, die dem Typus inversus<br />
und seinen Abwandlungen angehörten.“ Dabei lehnte Langer allerdings die<br />
Antike als Lehrmeister des Judentums ab und sah die Beeinflussung eher in<br />
der umgekehrten Richtung, vom Judentum auf die Antike. An dieser Stelle<br />
wird deutlich, wie zwei parallele Positionen bewusst und absichtlich nebeneinander<br />
etabliert wurden.<br />
241
242<br />
Walter Koschmal<br />
Die Erotik der Sprache 11<br />
Blüher setzt den Geist dem Eros entgegen, Langer das rabbinische Gesetzesjudentum,<br />
das die Gesetze aus der schriftlichen Thora ableitet, dem<br />
Chassidismus, der an die mündliche Thora anknüpft. Eros und mündliches<br />
Wort machen aber bereits bei Blüher (1917: 235) den „Formwillen des<br />
Eros“ aus. Der Geist zwinge „Laute vom Impulse des Eros hervorgedrängt<br />
zu Worten“ (BLÜHER 1917: 230f.). Schöpfertum ist damit für Blüher vor<br />
allem auch Sprachschöpfung.<br />
Während aber der Geist das Allgemeine gegenüber dem Einzelnen betont,<br />
also das „Primat der Allgemeinheit der Begriffe“, mache es der Eros „gerade<br />
umgekehrt“ (BLÜHER 1917: 236). Der einzelne Mensch, das Einzelne<br />
könne nur bejaht werden, weil es einzeln sei. Damit sei der Eros „die Philosophie<br />
der Besonderung“. Die mündliche, die gesprochene Sprache sei Teil<br />
dieser Philosophie. Die gesprochene Sprache liegt somit bei Blüher und<br />
Langer gleichermaßen als primäre zugrunde. Das Wort bestehe aus „zwei<br />
Teilen“, aus „Laut“ und „Sinn“ (BLÜHER 1917: 239). Die Bedeutung dieser<br />
beiden Elemente für die Sprache ist jener der mann-männlichen und<br />
mann-weiblichen Richtung für die Erotik vergleichbar.<br />
Diese Analogie ergibt sich aber nicht zufällig, geht doch schon Blüher vom<br />
sexuellen Ursprung der Sprache aus. Dabei beruft er sich allerdings auf eine<br />
Theorie des Freudschülers Hans Sperber, die dieser im ersten Band von<br />
Imago (1912) veröffentlicht hat. Sperber (1912: 406) will vor allem beweisen,<br />
dass „schon bei der Entstehung der Sprache sexuelle Momente eine<br />
wichtige Rolle gespielt haben müssen“. Auf Sperber beruft sich Langer<br />
zwar nicht explizit, doch hat er ihn wohl direkt rezipiert und nicht nur über<br />
Blüher (1917: 239) kennen gelernt. Schließlich hat Langer auch selbst in<br />
Imago publiziert. Sperber (1912: 407) stellt wie Langer die „Lautsprache“<br />
in den Mittelpunkt, die gesprochene Sprache, mit ihr die von Langer so verstandene<br />
sinnliche Mündlichkeit. Die von Langer jedoch darüber hinaus<br />
aufgestellten Hypothesen über psychoanalytische Hintergründe der Entstehung<br />
der Schrift fehlen bei Sperber. 12<br />
11 Dieser Aspekt wird ausführlich in einem mit den folgenden Ausführungen zum Teil<br />
identischen Beitrag behandelt, vgl. Koschmal (<strong>2004</strong>).<br />
12 Für Langer bedeutet das „einfache senkrechte Keilzeichen“ der Keilschrift den Mann.<br />
Es symbolisiere das „senkrecht gestellte Glied“. Die Frau werde ihrerseits – etwa in der<br />
hebräischen Meruba-Schrift – durch ein „beinahe rechtwinkliges Dreieck mit einem<br />
kurzen Strich in der Mitte“ symbolisiert. Deshalb ordneten auch die Kabbalisten die<br />
schlanken Buchstaben eher den Männern, die breiten den Frauen zu (LANGER 1923:<br />
107f.). Diese auf „Ähnlichkeit“ von Sprachzeichen und Abgebildetem basierenden Hieroglyphen<br />
seien heute durch „sinnlose“ Zeichnungen „verdrängt“, die „nur mit Hilfe der<br />
Psychoanalyse durch eine Art von Zwangshandlungen der Schreiber zu erklären“ seien<br />
(LANGER 1923: 105f.).<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
Sperber (1912: 410) führt aus, dass sich bei der Begattung „die sexuelle<br />
Erregung des Männchens“ in Tönen Luft mache, im Brunstruf. Der „Lockruf“<br />
ist ihm die „älteste Sprachäußerung“: „Wie mir scheint, weisen also<br />
alle Anzeichen darauf hin, daß wir in der Sexualität eine, oder wohl eher die<br />
Hauptwurzel der Sprache zu erkennen haben“ (SPERBER 1912: 453).<br />
Für Sperber (1912: 411) ist die „sexuelle Erregung“ nicht nur eine, sondern<br />
„die Hauptquelle“ „der ersten Sprachäußerungen“. Allerdings bezieht Sperber<br />
dies im Weiteren – abweichend von Langer, der die Lautlichkeit der<br />
Sprache akzentuiert – auf das „Wortschatzproblem“. Für Sperber hat die<br />
„Tätigkeit der Werkzeuge“ des Menschen (z.B. der Pflug im Acker) eine<br />
„Ähnlichkeit“ mit der Tätigkeit der Geschlechtsorgane. Das Denken in<br />
strukturellen Parallelen und Ähnlichkeitsrelationen entspricht Langer und<br />
dem Denken der Kabbalisten. So betont Langer (1923: 105) im Kontext der<br />
Schrift gerade die „Ähnlichkeit“ „zwischen Sprachzeichen und Abgebildetem“,<br />
auch die „zufällige phonetische Ähnlichkeit“. Sperber (1912: 412)<br />
spricht in diesem Zusammenhang wiederholt von „sexueller Betontheit“.<br />
Danach drücken sich für ihn „sexuelle Vorstellungen“ (1912: 415) auch in<br />
Lauten aus. Die Sinnlichkeit der Sprache und die Sinnlichkeit eines mündlich<br />
verankerten Judentums bei Langer gehen Hand in Hand.<br />
Sperber (1912: 408) sieht bei der Entstehung von Sprache das Moment der<br />
„Spannung“ im Mittelpunkt: Die „Entstehung der Sprache“ gründe auf der<br />
„Fähigkeit, die Stimme zur Entladung seelischer Spannung zu benutzen“.<br />
Der Sprachpsychologe verstehe dies so, dass der hervorgebrachte Laut dazu<br />
dient, einen „psychischen Inhalt von einem Individuum auf das andere zu<br />
übertragen“. Dieser kommunikativ-dialogische Aspekt des für Sperber<br />
(1912: 408) so zentralen „Affekts“ spielt bei Langer keine Rolle. Es geht<br />
ihm nicht um „Mitteilung“, um Dialog. Den Begriff der „Spannung“ dürfte<br />
Langer bei Sperber direkt adaptiert haben. Blüher benutzt ihn nicht. Langer<br />
hat also wohl die umfangreiche Studie Sperbers als unmittelbare Quelle<br />
herangezogen, nicht aber deren Darstellung durch Blüher, von dem er sich<br />
in diesem Zusammenhang sogar absetzt.<br />
Für Langer (1923: 111) bringt der Mensch sein „innerstes Leben“ nicht so<br />
sehr in der Schrift als in dem „kraftvolleren Verständigungsmittel“ des „gesprochenen<br />
Wortes“ zum Ausdruck. „Durch sukzessives Trennen und Differenzieren<br />
der Laute durch Verschiebungen und Verdrängungen ihrer ursprünglichen<br />
sexuellen Bedeutungen“ sei die gesprochene Sprache<br />
entstanden. Mündliche Sprache und Schrift sind demnach beide ein Resultat<br />
von Verdrängung. Das Alphabet ersetze die Sprache als notwendige graphische<br />
Darstellung eines „tiefen psychischen Differenzierungsvorganges“<br />
(LANGER 1923: 112). Langer bezieht sich aber – anders als Blüher und<br />
anders als Sperber – sogleich auf die besondere Sprache, das Hebräische.<br />
243
244<br />
Walter Koschmal<br />
Blüher und Langer verstehen den Eros als die „Philosophie der Besonderung“.<br />
Bei Langer äußert sich dies in der Bejahung der einen, der heiligen<br />
Sprache des Judentums, des Hebräischen. In dieser Schrift Blühers spielt<br />
das Jüdische hingegen ebenso wenig eine Rolle wie bei Sperber. 13<br />
Langer ist es aber erneut, der konsequent in kabbalistischer Manier die Ähnlichkeiten<br />
und Parallelen zwischen Judentum und Psychoanalyse betont:<br />
Denn die Talmudisten – so Langer – hätten schon immer einen engen Zusammenhang<br />
von Sprache und Eros gesehen. Im siebten Kapitel der Erotik<br />
der Kabbala mit dem Titel Die Erotik der Schrift und der Sprache betont<br />
Langer (1923: 102f.) die „unbegreiflich hohe Verehrung, die Sprache und<br />
Buchstabe in der Kabbala genießen“.<br />
Das sexuelle Chaos des Urschreis, von dem bei Blüher und Sperber die Rede<br />
ist, bezieht Langer nur mehr auf die Konsonanten, fehlen im Hebräischen<br />
doch die Vokale. Die Konsonanten seien die „Kristalle des ursprünglich<br />
chaotisch einheitlichen Geschreies des Eros“ (LANGER 1923: 112). Jeder<br />
Konsonant habe „eine bestimmte Valenz der sexuellen Ausdrucksenergie“,<br />
der einer bestimmten „inneren Lustspannung“ entspreche. Die „Verschiedenheit<br />
in den einzelnen Energiegraden“, die zur Erzeugung der Konsonanten<br />
erforderlich seien, setzten „verschieden hohe erotische Lustspannungen“<br />
voraus. Ließen sich die Spannungen messen (A+B+C), so fände man Worte<br />
mit vergleichbaren Spannungsinhalten. Deshalb müsse es zu einer „Graduierung<br />
der Konsonanten nach der Schwierigkeit ihrer Aussprache“<br />
(LANGER 1923: 113) kommen: die Buchstaben am Anfang des hebräischen<br />
Alphabets seien leichter auszusprechen als die davon am weitesten<br />
entfernten.<br />
Wesentlich ist also der „Energieaufwand“ bei der Aussprache der Konsonanten,<br />
aber auch die „phonetische Nachahmung erotischer Handlungen“<br />
(LANGER 1923: 112). Die Begriffe „Energieaufwand“ und „sexuelle Ausdrucksenergie“<br />
dürften auf Blüher (1917: 32) zurückgehen, für den sich<br />
„sexuelle Energie“ „nach oben“ in Leistung sublimiert. Wir können somit<br />
13 Blüher spricht in Deutsches Reich, Judentum und Sozialismus (1919) davon, dass dem<br />
deutschen Volk kein Volk „verwandter ist als die Juden“ (1919: 7). In unseren Tagen<br />
erleben wir das „dritte Geschichtswunder“ (9). Die Juden selbst beginnen die Diaspora<br />
zu beenden und die „Rasse der Juden“ beginne wieder „Volk zu werden“. Blüher nähert<br />
sich fast einem Kulturzionismus an, wenn er diesen hier u.a. deshalb so positiv bewertet,<br />
weil die Juden – ähnlich den Germanen, dem „Stamm Levi unter den Deutschen“,<br />
Kultur geschaffen haben (1919: 11). Einige „ganz große Leistungen der Wissenschaft<br />
dieser Tage“ stammten von Juden wie S. Freud. Diese Juden haben „statt der bloßen<br />
Assimilation an den Geist der Gastvölker“ eine wirkliche Synthese in sich zustande gebracht“<br />
(1919: 17). Auch Martin Buber und Gustav Landauer mit seinem „Aufruf zum<br />
Sozialismus“ (1919: 22) seien jene „Zionisten“, die den Deutschen „die tiefsten Beziehungen<br />
zum Probleme des Sozialismus“ bringen.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
nicht nur allgemein von der Erotik der Sprache sprechen, sondern im Lichte<br />
der „Philosophie der Besonderung“ können wir bei Langer auch von einer<br />
Erotik der Phonetik ausgehen. Die gesprochene und gehörte Sprache entwickelt<br />
für Langer ein hohes Maß an erotischer Sinnlichkeit, das sich für<br />
ihn mit der Sinnlichkeit des Judentums, vor allem mit jenem der Chassiden,<br />
verbindet.<br />
Das Hebräische verfügt aber dank des Zahlenwertes der Laute und Schriftzeichen<br />
über eine fünfte Sinnschicht. Worte von gleichem Zahlenwert werden<br />
dabei häufig gegeneinander ausgetauscht. Diese „Gematria“ hebt das so<br />
lange verdrängte Unbewusste der Kabbalisten nach oben, auf die sprachliche<br />
Ebene. Die Gematria ersetzt „Lautausdrücke“ von „gleichem erotischen<br />
Spannungsgrad, ausgedrückt in der Valenz-Skala des Alphabets“ wechselseitig.<br />
Der hierarchischen Ordnung der „Sinnschichten“ in der Kabbala<br />
(SCHOLEM 1960: 72) entspricht bei Langer damit eine hierarchische Ordnung<br />
der erotischen Spannung bei der Aussprache von Lauten. Denn die<br />
Laute, die näher am Anfang des Alphabets stehen, weisen eine höhere Lustspannung,<br />
eine höhere Erotik auf als jene, die vom Anfang weiter entfernt<br />
sind. Diese Graduierung mag durchaus in ihrer strukturellen Ähnlichkeit zu<br />
den „geistigen Wänden“ gesehen werden, durch die das amorphe Metaphysische,<br />
d.h. Gott, sich in Die Erotik der Kabbala gleichfalls in unterschiedlichem<br />
Maße Geltung verschafft. Dem Sprachlaut kommt dabei als Repräsentanten<br />
des amorphen Metaphysischen aber schon in der Kabbala eine<br />
Schlüsselposition zu. Die Emanation göttlicher „Energie“, auch dieser Begriff<br />
findet parallel und unabhängig voneinander in der Kabbala und bei<br />
Blüher Verwendung, realisiert sich in der Kabbala als Entfaltung der Sprache.<br />
Diese Emanation bzw. Entfaltung schlägt sich ihrerseits in der „Graduierung<br />
der Konsonanten nach der Schwierigkeit der Aussprache“ und nach<br />
dem Grad der Lustspannung nieder.<br />
Die in der Kabbala parallelen geheimen Welten von Gottheit und Sprache<br />
(SCHOLEM 1960: 54) verdichten sich im göttlichen Namen. Der Name<br />
Gottes falte sich in der Thora analog zur Entfaltung der Sprache auseinander.<br />
Hans Sperber misst dem Namen, vor allem dank seiner magischen<br />
Funktion, durch die er per se Realität schafft, eine hohe Bedeutung bei.<br />
Sperber (1912: 417; 419) spricht von der numinos anmutenden „seltsamen<br />
Macht des Namens“. „Das Wort“ – nur die Nennung des Namens hat „Zauberkraft“.<br />
Sperber beruft sich dabei auf Sigmund Freud, für den die höchsten<br />
Errungenschaften des menschlichen Geistes (etwa die Kunst) mit unausgelebten<br />
sexuellen Impulsen zu tun haben.<br />
Diesen hohen Stellenwert des Namens in seiner Theorie der Entstehung der<br />
Sprache verbindet erst Langer (1923: 102) mit dem hohen Stellenwert des<br />
Namens für die Kabbala. Er begreift die 22 Buchstaben des hebräischen<br />
245
246<br />
Walter Koschmal<br />
Alphabets als „lebendige überirdische Wesen, die mit Gott sprechen können“.<br />
Jeder Buchstabe deute in der Kabbala erneut auf seine besondere<br />
[sic!] Weise „auf den vierbuchstäbigen Gottesnamen hin“. Jeder Konsonant<br />
habe „einen eigenen, abstrakten Sinn“, sei „Urelement der Sprache“. 14 Diese<br />
komplexen Zusammenhänge konnte Langer kommentierendwissenschaftlich<br />
nur in der Sprache jener Diskurse darstellen, in der sie in<br />
seiner Zeit (bei Blüher, Freud, Sperber u.a.) vorwiegend geführt wurden, in<br />
Deutsch. Die literarische Umsetzung hingegen erfolgte erneut in wohl überlegter<br />
hierarchischer Distribuierung der Sprachen in dem von ihm geschaffenen<br />
Schrifttum. Die fünfte Sinnschicht und damit die höchste Nähe zum<br />
Mythos konnte Langer aber nur im Hebräischen finden. Deshalb schrieb er<br />
seine Gedichte allein in dieser heiligen Sprache.<br />
Wird die Rolle des Eros in der Kabbala vor allem darin gesehen, dass er<br />
einen Übergang zum Göttlichen schaffe, so gelangt Blüher in seinen Überlegungen<br />
zum verdrängten mann-männlichen Eros zu einer parallelen Sicht<br />
und Wertung. J. M. Langer ist es aber, der diese Parallelen zwischen Geschichte<br />
und theologischem System des Judentums, vor allem aber mit einem<br />
im Mythos verankerten Judentum, wie es für ihn der Chassidismus ist,<br />
herstellt. Der Eros schaffe den Übergang zum Göttlichen. Das Wesentliche<br />
des göttlichen Namens aber liegt – laut Kabbala – in seinem ersten Laut, im<br />
„Aleph“. Dem ersten Laut misst Langer den höchsten erotischen Grad zu.<br />
Parallel und analog zum Eros, der den „Übergang“ zum Göttlichen schafft,<br />
stellt somit das „Aleph“ den Übergang zur vernehmbaren Sprache, zur<br />
Mündlichkeit her. Im Chassidismus werden Mündlichkeit und mannmännliche<br />
Erotik in gleicher Weise besonders hoch geschätzt und – anders<br />
als im schriftlich ausgerichteten Gesetzesjudentum – nicht länger verdrängt.<br />
Sprachlautlichkeit und Eros bilden für Langer eine untrennbare, eine religiöse<br />
Einheit, in der sich der Kern seines eigenen Lebens und Wirkens in<br />
nuce – in jenem in der Kabbala so zentralen Bild der Nuss – wiederfinden<br />
dürfte. Hätte es den Chassidimus nicht gegeben, Langer hätte ihn wohl erfinden<br />
müssen.<br />
14 Langer (1923: 102) spricht an dieser Stelle davon, dass die „Methode der Buchstabenkombinationen“<br />
„eine Art chemischer Analyse“ sei. Der Chemiker Justus Liebig<br />
schreibt schon im 19. Jahrhundert vom Alphabet der chemischen Prozesse und von deren<br />
„Universalgrammatik“.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
Literatur<br />
ACHELIS, Werner (1962): Über Blühers Eros-Begriff. – In: H. Blüher, Die<br />
Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. Eine Theorie der menschlichen<br />
Staatsbildung nach Wesen und Wert. Stuttgart: Klett, 327–333.<br />
AVIGDOR, Dagan (1991): The Czech-German-Jewish Symbiosis of Prague.<br />
The Langer Brothers. – In: Cross Currents No. 10, 180–193.<br />
AVIGDOR, Dagan (1988): Bratři Langrové [Die Brüder Langer]. – In:<br />
Proměny 25, Nr. 2.<br />
Die Geschichten des Ba’al Schem Tov. Schivche ha-Bescht. Teil 1: Hebräisch<br />
mit deutscher Übersetzung, Teil 2: Jiddisch mit deutscher Übersetzung.<br />
Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Karl E. Grözinger. Wiesbaden:<br />
Harrassowitz 1997 .<br />
BINDER, Hartmut (1967): Kafkas Hebräischstudien. Ein biographischinterpretatorischer<br />
Versuch. – In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft<br />
11, 527–556.<br />
BLÜHER, Hans (1917, 1919): Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.<br />
2 Bde. Jena: E. Diederich.<br />
BLÜHER, Hans (1919): Deutsches Reich, Judentum und Sozialismus. Eine<br />
Rede an die freideutsche Jugend. München: Steinicke.<br />
BLÜHER, Hans (1962): Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.<br />
Eine Theorie der menschlichen Staatsbildung nach Wesen und Wert.<br />
Stuttgart: Klett.<br />
BUBER, Martin (2001): Werkausgabe. Bd. 1: Frühe kulturkritische und<br />
philosophische Schriften 1891–1924. Bearbeitet, eingeleitet und kommentiert<br />
von Martin Treml. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.<br />
ELIOR, Rachel (1997): Der Ba’al Schem Tov zwischen Magie und Mystik.<br />
– In: K. E. Grözinger (Hg.), Die Geschichten vom Ba’al Schem Tov. Schivche<br />
ha-Bescht. Wiesbaden: Harrassowitz, XXXV-LV.<br />
GRÖZINGER, Karl E. (1997): Der Ba’al Schem Tov – Legende oder Wirklichkeit.<br />
– In: Ders. (Hg.), Die Geschichten vom Ba’al Schem Tov. Schivche<br />
ha-Bescht. Teil 1: Hebräisch mit deutscher Übersetzung, Teil 2: Jiddisch<br />
mit deutscher Übersetzung. Wiesbaden: Harrassowitz, IX-XXXIV.<br />
KILCHER, Andreas (1999): Kafka, Scholem und die Politik der jüdischen<br />
Sprachen. – In: Ch. Miething (Hg.), Politik und Religion im Judentum. Tübingen:<br />
Niemeyer, 79–115.<br />
247
248<br />
Walter Koschmal<br />
KOSCHMAL, Walter (<strong>2004</strong>): Zu den sexuellen Ursprüngen der Sprache.<br />
Jiří Mordechaj Langers ‚Erotik der Kabbala‘. – In: M. Okuka, U. Schweier<br />
(Hgg.), Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum<br />
65. Geburtstag. München: Sagner, 417–426.<br />
LANGER, František (1963): Můj bratr Jiří [Mein Bruder Jiří]. – In: Ders.,<br />
Byli a bylo [Es war einmal...]. – Praha: Československý spisovatel, 181–<br />
203.<br />
LANGER, Georg (1928): Zur Funktion der jüdischen Türpfostenrolle. – In:<br />
Imago 14, 457–468.<br />
LANGER, Georg M. (1959): Neun Tore. Das Geheimnis der Chassidim.<br />
München-Planegg: O.W. Barth.<br />
LANGER, Georg (1983): Der Rabbi, über den der Himmel lachte. Die<br />
schönsten Geschichten der Chassidim. Bern u.a.: Scherz.<br />
LANGER, Jiří (1996): Devět bran [Neun Tore]. Praha: Sefer.<br />
LANGER, Jiří (2000): Zpěvy zavřených. Malá antologie hebrejského<br />
básnictví X.–XIX. století [Lieder der Versperrten. Kleine Anthologie der<br />
hebräischen Dichtung des X.–XIX. Jahrhunderts]. Praha: Vyšehrad.<br />
LANGER, M. D. Georg (1923): Die Erotik der Kabbala. Prag: Josef Flesch.<br />
LANGER, M. D. Georg (1956): Liebesmystik der Kabbala. München-<br />
Planegg: O.W. Barth.<br />
LEHÁR, Jan/STICH, Alexander/JANÁČKOVÁ, Jaroslava/HOLÝ, Jiří<br />
(1998): Česká literatura od počátků k dnešku. [Die tschechische Literatur<br />
von den Anfängen bis heute]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.<br />
MAREŠ, František Václav (1986): Vom Urslavischen zum Kirchenslavischen.<br />
– In: P. Rehder (Hg.), Einführung in die slavischen Sprachen. Darmstadt:<br />
WBG, 1–19.<br />
NEKULA, Marek (2002): Die Juden in den böhmischen Ländern im 19.<br />
und 20. Jahrhundert und die Familie Kafka. – In: brücken. Germanistisches<br />
Jahrbuch Tschechien – Slowakei, NF 8, 89–128.<br />
PĚKNÝ, Tomáš (1996): Trojí řeč Jiřího Mordechaje Langra. [Die drei<br />
Sprachen des Jiří Mordechaj Langer]. – In: J. Langer, Devět bran. Praha:<br />
Sefer, 297–232.<br />
PUTNA, Martin C. (2000): Poetika homosexuality v české literatuře. [Die<br />
Poetik der Homosexualität in der tschechischen Literatur]. – In: Neon H. 3,<br />
37–41; H. 4, 41–45; H. 5, 43–48; H. 6, 49–53.<br />
Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala<br />
ROSENBERG, Alfons (1956): Einleitung. – In: M. D. G. Langer, Liebesmystik<br />
der Kabbala. München-Planegg: O.W. Barth, 5–14.<br />
RYCHNOVSKY, Ernst (Hg.) (1931): Masaryk und das Judentum. Praha:<br />
Marsverlagsgesellschaft.<br />
SCHAMSCHULA, Walter (<strong>2004</strong>): Geschichte der tschechischen Literatur.<br />
Von der Gründung der 1. Republik bis zur Gegenwart. Köln, Weimar,<br />
Wien: Böhlau.<br />
SCHOLEM, Gershom (1960): Zur Kabbala und ihrer Symbolik. Zürich:<br />
Rhein Verlag.<br />
SERKE, Jürgen (1987): Böhmische Dörfer. Wien, Hamburg: Zsolnay.<br />
Der Sohar. Das heilige Buch der Kabbala. Nach dem Urtext herausgegeben<br />
von Ernst Müller. Wien: Verlag Dr. Heinrich Glanz 1932.<br />
SPERBER, Hans (1912): Über den sexuellen Ursprung der Sprache. – Imago<br />
1, 405–453.<br />
STACH, Reiner (2002): Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt/M.:<br />
Fischer.<br />
THIEBERGER, Friedrich (1952): Die Glaubensstufen des Judentums.<br />
Stuttgart: W. Spemann.<br />
THIEBERGER, Friedrich (1995): Kafka und die Thiebergers. – In: H.–G.<br />
Koch (Hg.), „Als Kafka mir entgegenkam...“ Erinnerungen an Franz Kafka.<br />
Berlin: Wagenbach, 121–127.<br />
TREML, Martin (2001): Einleitung. – In: M. Buber, Werkausgabe 1: Frühe<br />
kulturkritische und philosophische Schriften 1891–1924. Bearbeitet, eingeleitet<br />
und kommentiert von Martin Treml. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus,<br />
13–19.<br />
TVRDÍK, Milan (2000): Franz Kafka und Jiří (Georg) Langer. Zur Problematik<br />
des Verhältnisses Kafkas zur tschechischen Kultur. – In: K. Schenk<br />
(Hg.), Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur. Tübingen,<br />
Basel: Francke Verlag, 189–199.<br />
VÍZDALOVÁ, Ivana (2002): Jiří Mordechaj Langer und seine Tore zur<br />
Identität. – In: A. A. Wallas (Hg.), Jüdische Identitäten in Mitteleuropa.<br />
Literarische Modelle der Identitätskonstruktion. Tübingen: Niemeyer, 111–<br />
117.<br />
249
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří<br />
Gruša und Ota Filip<br />
Renata Cornejo<br />
Es gibt Autoren, die ihr Tschechisch im Grunde genommen konservieren, indem sie [...] die<br />
vermeintliche Einzigartigkeit des Tschechischen gleichsam sinnlich auskosten und ein sprachliches<br />
Hochamt zelebrieren. Es gibt auch solche, die an ihrem Ringen mit der Sprache letztendlich<br />
zerbrechen [...]. Andere wiederum hören gänzlich auf, auf Tschechisch zu schreiben [...].<br />
Fälle, wo es gelingt, auf eine Fremdsprache umzusatteln, [...] bleiben lediglich recht seltene<br />
Ausnahmen. Viel häufiger ist eine Kompromisslösung: Man beteiligt sich aktiv am Zustandekommen<br />
von fremdsprachlichen Fassungen der eigenen Werke [...]. (GRUŠA 2000: 69f.)<br />
Fragen der Übersetzung stellten sich Exilschriftsteller, die ihre Literatursprache<br />
gewechselt haben genauso wie diejenigen, die weiterhin in ihrer<br />
Muttersprache schrieben. Für die deutsch schreibenden Autoren Jiří Gruša,<br />
Ota Filip und Libuše Moníková, die nach den Ereignissen des Prager Frühlings<br />
1968 und der darauffolgenden Normalisierungszeit der 70er Jahre ihren<br />
Wohnsitz in die Bundesrepublik Deutschland verlegten, bedeutete der<br />
Sprachwechsel eine Herausforderung, die ihnen sowohl eine Auseinandersetzung<br />
mit der Gastkultur aus deren Sprachsystem heraus als auch den distanzierten<br />
Blick von außen auf die eigene Sprache und Kultur ermöglichte.<br />
Der Prozess des Übersetzens muttersprachlicher Werke war für sie daher<br />
ein langsames und vorsichtiges Sich-Herantasten an den Sprachwechsel, der<br />
die häufig unbefriedigende Fremdübersetzung vermeiden half (vgl. Jiří<br />
Gruša). Für andere entwickelte sich die Autor-Übersetzung, in der die Relation<br />
von Übersetzerpersönlichkeit und Autor aufgehoben ist, zu einer tragbaren<br />
Alternative, die es erlaubte, in beiden Sprachen unterschiedliche Intentionen<br />
zu verfolgen und die ausgangssprachliche Version des Textes im<br />
Hinblick auf den Adressatenkreis bewusst umzugestalten (vgl. Ota Filip).<br />
Jiří Gruša – der im „Stummland“ Verstummte meldet sich zu Wort<br />
Für den 1938 geborenen Dichter, Schriftsteller und Politiker Jiří Gruša<br />
schien 1980, als er in die Bundesrepublik Deutschland kam, der Weg des<br />
Kompromisses durch seine Kompetenz als Übersetzer vorgegeben. 1962<br />
debütierte er als Lyriker, „im Tauwetter, nach Stalins Tod“ (GRUŠA 2000:<br />
8), mit dem Gedichtband Torna, zwei Jahre später folgte der Gedichtband<br />
Světlá lhůta (Helle Frist). Seinen literarischen Standpunkt, von dem er nie<br />
abwich, legte er Anfang der 60er-Jahre in der Zeitschrift TVÁŘ (Das Gesicht)<br />
dar, die er gemeinsam mit seinem Freund Jiří Pištora gegründet hatte.<br />
Es ging darum, Gesicht zu zeigen:
252<br />
Renata Cornejo<br />
Ein Dichter ist nur dann ein wahrer Dichter, wenn er sich niemals auf eine ideologische Form<br />
des Schaffens einlässt. In der Poesie geht es um die Poesie. Entweder du bist ein Propagandist,<br />
dann bist du ein Politiker – oder du verlässt dich auf deine ureigene Fähigkeit, die Realität zu<br />
eröffnen, sie neu zu schaffen. (SERKE 1982: 146)<br />
Solche Äußerungen sowie ein kritischer Artikel über die Lyrik der 50er-<br />
Jahre lösten die ersten Auseinandersetzungen mit der Kommunistischen<br />
Partei aus, die schließlich nach der Niederschlagung des Prager Frühlings<br />
zu einem öffentlichen Redeverbot des Autors führten. Nachdem sein erster<br />
Roman Mimner oder das Tier der Trauer (tsch. 1974, dt. 1986), der sich in<br />
metaphorischer Form mit dem Einmarsch der Sowjetischen Armee auseinandersetzt,<br />
1970 zunächst in der Zeitschrift SEŠITY (Hefte) unter dem Pseudonym<br />
Samuel Lewis veröffentlicht werden konnte, wurde er wegen vermeintlicher<br />
Verbreitung von Pornographie kurz darauf verboten. 1978<br />
erschien in der Edition PETLICE 1 Grušas zweiter Roman Dotazník aneb<br />
modlitba za jedno město a přítele (dt. Der 16. Fragebogen 1979), in dem<br />
die Geschichte der Tschechoslowakei von der nazistischen Okkupation<br />
1938 bis zum sowjetischen Einmarsch 1968 geschildert wird. Dieses Buch<br />
wurde zum Anlass einer strafrechtlichen Verfolgung des Schriftstellers und<br />
dessen Inhaftierung im August 1978. Auf Grund westlicher Proteste und der<br />
persönlichen Intervention von Heinrich Böll wurde Gruša zwar aus dem<br />
Gefängnis entlassen, jedoch weiter von den Behörden überwacht. Während<br />
eines dreimonatigen Studienaufenthaltes in den USA 1980 wurde ihm die<br />
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt. Noch im Dezember desselben<br />
Jahres kam Gruša in die Bundesrepublik Deutschland, die für ihn zur<br />
neuen Heimat wurde.<br />
Gruša, der sich schon seit der frühesten Jugend literarisch orientierte,<br />
fremdsprachige Literatur las und nach seinem Berufsverbot als Übersetzer<br />
arbeitete, tendiert in seinen Werken zum Bi- bzw. Multilingualen. 2 Als mittlerweile<br />
bekannter Autor und Übersetzer wirkte er selbst an der deutschsprachigen<br />
Fassung seiner Romane mit 3 und gestaltete als Autorübersetzer<br />
die Originalversion des noch in der Tschechoslowakei entstandenen Ro-<br />
1 Der Untergrundverlag EDICE PETLICE wurde 1973 von Jiří Gruša und Ludvík Vaculík<br />
gegründet. Als unlizenzierter Verlag existierte er nur auf Basis der Arbeit eines kleinen<br />
Kreises von Autoren, die verbotene Bücher lektorierten, abtippten und weiter verbreiteten.<br />
2 Z.B endet Grušas Erzählung Dámský gambit mit einem deutsch-tschechischen Text.<br />
Häufig verwendet er aber auch ungarische, italienische, lateinische oder altgriechische<br />
Elemente in seinen Werken, in seinem Roman Mimner kreiert er gar eine eigene Fantasiesprache<br />
–„Alchadokisch“.<br />
3 Sein 1981 erschienener Roman Doktor Kokeš – Mistr Panny [Ackermann aus Böheim]<br />
wurde 1984 auf Deutsch unter dem Titel Janinka veröffentlicht, 1986 erschien die deutsche<br />
Übersetzung Mimner oder das Tier der Trauer.<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 253<br />
mans Mimner oder das Tier der Trauer im Hinblick auf das deutsche Publikum<br />
und seine neue Situation um. Während der Ich-Erzähler in der tschechischen<br />
Fassung eingangs einen Albtraum hat, in dem er einen unaussprechlichen<br />
Ekel vor riesigen, ihm entgegen rollenden Brotlaiben erlebt,<br />
deren Oberfläche er sich zu berühren fürchtet, träumt der Ich-Erzähler der<br />
deutschen Fassung von einer furchterregenden Grenzkontrolle im totalitären<br />
utopischen Staat Alchadokien. Die konstatierte „Passlosigkeit“ ist das metaphorische<br />
Äquivalent, die deutsche Autorübersetzung der konkret erlebten<br />
und sprachlich bildhaft umgesetzten Exilsituation.<br />
1968 ist das Jahr, in dem Gruša durch ein öffentliches Redeverbot zum<br />
Schweigen gebracht wurde: „So wie ich einst als ‚Gesicht‘ 4 in die Gesichtslosigkeit<br />
geraten war, schlüpfte ich jetzt als ‚Schriftsteller‘ in die Sprachlosigkeit<br />
hinein.“ (GRUŠA 2000: 33f.) Gruša, der den Topos „Heimat im<br />
Wort“ in seiner sprachthematischen tschechischen Lyrik wiederholt aufgegriffen<br />
hat, wird nun mit der dilemmatischen Situation eines Dichters im<br />
„Sprachexil“ konfrontiert – im Sprachexil, in dem man ein „Rein-mit-der-<br />
Sprache-Spiel“ mit den unerwünschten Autoren trieb. „Böhmische Kochrezepte“<br />
nannte er später diese Umgangsart in seinem gleichnamigen Gedicht:<br />
Das Rein-mit-der-Sprache-Spiel<br />
(Böhmische Kochrezepte)<br />
Man friert sie ein,<br />
die sprache<br />
eben aufgeblüht<br />
noch halbwegs in der kehle<br />
man lässt sie gut bereifen<br />
und knetet sie zum zapfen<br />
etwa mannshoch<br />
dann drückt man sie<br />
zurück<br />
bis blut und scheiß<br />
darunter<br />
wörtchen für wörtchen.<br />
(GRUŠA 1988:27)<br />
In diesem „böhmischen Kochrezept“ aus seiner ersten Sammlung deutscher<br />
Gedichte Der Babylonwald (GRUŠA 1991) reflektiert der Autor expressiv<br />
den schwierigen Prozess des Spracherwerbs. Das „eben aufgeblühte“<br />
Sprachhandwerk, das er zu beherrschen gelernt hat, muss eingefroren und<br />
ein schriftstellerischer Neuanfang in der fremden Sprache gewagt werden.<br />
4 Als Mitbegründer der Zeitschrift GESICHT (Tvář) wurde Gruša von der Staatssicherheit<br />
überwacht und in deren Akte auch unter dem Decknamen „Gesicht“ geführt.
254<br />
Renata Cornejo<br />
Die neuen Wörter, unter „blut und scheiß“ hart erarbeitet, werden wie Teig<br />
zusammengeknetet und müssen der sich sträubenden Kehle erst abgetrotzt<br />
werden. Der Titel Babylonwald impliziert einerseits Reminiszenzen an eine<br />
waldreiche Region in Nordböhmen, wo sich Gruša vor seiner Ausreise aufhielt<br />
und seine Manuskripte aufbewahrte, andererseits eine Anspielung auf<br />
das biblische Babylon als Ursprungsort der Mehrsprachigkeit (der Turm<br />
von Babel): „Und vielleicht ist das Babylon in Böhmen kein Zufall, sondern<br />
der gemeinsame Ursprung – auch sprachlich ein Bruder der Sümpfe in Mesopotamien!<br />
Darum wählte ich diesen Namen für mein deutsches Buch.“<br />
(SERKE 1982: 52) Zu diesem Zeitpunkt lag das Erscheinen seines letzten<br />
Gedichtbandes in tschechischer Sprache bereits 20 Jahre zurück. Für Gruša,<br />
der auch im Exil bis 1985 auf Tschechisch schrieb, gehört der geglückte<br />
Sprachwechsel zur fünften der sieben „axiomatischen Absurditäten“ seines<br />
Lebens (GRUŠA 2000: 43), wie er merkwürdige, miteinander in Zusammenhang<br />
stehende Begebenheiten in seinem Leben nennt. 5 Er sieht einen<br />
unmittelbaren Zusammenhang (die dritte „axiomatische Absurdität) zwischen<br />
der Szene aus dem letzten, auf Tschechisch verfassten Werk Doktor<br />
Kokeš – Mistr Panny, in dem er das Genus des deutschen Lexems „Tod“<br />
ausführlich behandelte, und einem Hirnschlag nach dem Erscheinen der<br />
deutschen Übersetzung dieses Romans (dt. Janinka), der seinen Tod hätte<br />
bedeuten können:<br />
Ich habe bis 1985 weiter auf Tschechisch geschrieben, aber bei verschiedenen Gelegenheiten<br />
immer mehr deutsche Texte verfasst, bis ich nach der Krankheit plötzlich nicht mehr tschechisch<br />
schrieb. Die Krankheit hing wahrscheinlich mit diesem Sprachwechsel zusammen […].<br />
(PFOB 2001: 7f)<br />
Nach dem Hirnschlag, der eine vorübergehende Erblindung zur Folge hatte,<br />
stand er vor einem beinah unlösbaren Problem als Schriftsteller – die Muttersprache<br />
ist ihm abhanden gekommen. So ist es für ihn als Schriftsteller<br />
paradoxerweise erst durch die Krankheit ermöglicht worden, von der einen<br />
in die andere Sprachwelt zu wechseln: „Ich komprimierte meine Gedichte,<br />
machte sie außersprachlich. [...] Und lauschte der Sprache der Deutschen.<br />
Weil die Augen lädiert waren, wurde das Gehör schärfer.“ (GRUŠA 2000:<br />
49) Der fast blinde Schriftsteller brachte sich als vereinfachte Abbildung<br />
5 Als erste „axiomatische Absurdität“ bezeichnet Gruša die Tatsache, dass er in seiner<br />
Geburtstadt Pardubice als kleiner Junge versucht hat, aus dem Kloster der Salesianer<br />
Schauspieltexte zu entwenden und dass er an diesen Ort nach fast 40 Jahren zurückkehrte,<br />
um seine von der tschechoslowakischen Staatssicherheit angelegte Akte einzusehen.<br />
Die zweite „axiomatische Absurdität“ erkennt er darin, dass er gemeinsam mit seinem<br />
Freund Jiří Pištora bei einer Schauspielaufführung in Pardubice erstmalig vor Publikum<br />
sprach und dass er an Pištoras Grab, wieder in Pardubice, dies letztmalig tun konnte,<br />
bevor ihm ein öffentliches Redeverbot erteilt wurde.<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 255<br />
von Worten große Ideogramme bei, die sich immer mehr verkleinerten, bis<br />
sie wieder zu Buchstaben wurden, die deutsche Worte bildeten: „Ich notierte<br />
das Deutsche plötzlich wie einst das Tschechische.“ (GRUŠA 2000: 51)<br />
Diese Phase der Zeichendarstellung seiner Gedichte in der Form von Ideogrammen<br />
versteht Gruša als eine Zwischenstufe im Prozess seines Sprachwechsels,<br />
die zwischen einer Vor- und Nachsprache liegt. Der unterschwellig<br />
verlaufende Sprachwechsel fand seine äußerliche physische<br />
Entsprechung in der körperlichen Einschränkung 6 und im psychischen Zusammenbruch.<br />
Der Sprachkonflikt wird als Identitätskonflikt ausgetragen,<br />
der Wahrnehmungsveränderungen verursachen und zur Auflösung der bis<br />
dahin klaren Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem führen kann.<br />
Als Ergebnis der inneren Zerrissenheit tritt an die Stelle der Dianoia die<br />
Paranoia:<br />
Es kamen Worte zu mir, die ich nicht mehr verlernen sollte. Ich fing an, sie als Tatsachen zu<br />
spüren – so wie einst auf Tschechisch. War einst meine tschechische Poetik als Dia-Noia erworben,<br />
so wäre jetzt ihre deutsche Schwester als Para-Noia zu verstehen. (GRUŠA 2002:<br />
66f.)<br />
Diese Lebenskrise bedeutete für den Autor den endgültigen Sprachwechsel,<br />
den künstlerischen Durchbruch in der deutschen Sprache und auch die<br />
Rückkehr zur Lyrik. Seine zweite deutsche Gedichtsammlung Die Wandersteine<br />
(1994) ist von Motiven wie Sprachverweigerung und Sprachverlust<br />
bis hin zum Verstummen bestimmt. Im Gedicht Wortschaft hat das lyrische<br />
Ich seine Sprache erst im „Stummland“ (wortwörtliche Übersetzung des<br />
tschechischen Lexems „Německo“ [Deutschland]) verloren und erst im<br />
Verstummen die Bedeutung des Unaussprechlichen verstanden. Die Vertreibung<br />
in die Sprachlosigkeit und der daraus resultierende Sprachverlust<br />
wird als universelle Erfahrung des Verlorenseins empfunden. Trotzdem ist<br />
und bleibt die Sprache für das lyrische Ich die einzige Möglichkeit, im<br />
„Stummland“ zu überleben, indem es sich eine neue sprachliche Identität<br />
zulegt. Dorthin führte ein langer Weg, der an den zwischen 1973 und 1989<br />
entstandenen tschechischen und deutschen Gedichten ablesbar ist, die 2001<br />
unter dem Titel Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto herausgegeben<br />
wurden. Der Sprachwechsel wird häufig innerhalb eines Gedichtes realisiert.<br />
7 Diese Texte zeigen, dass sich Gruša v.a. als „Übersetzer“ und Vermittler<br />
zwischen den beiden Sprachen und Kulturen versteht, wie auch seine<br />
6 Die Metapher der körperlichen Einschränkung benutzt Libuše Moníková in ihrem Roman<br />
Pavane für eine verstorbene Infantin, in dem sie die Emigrantin in einen Rollstuhl<br />
setzt, als Symbol der Ohnmacht des Exilschriftstellers.<br />
7 Im Gedicht Ich rede wahrhaftig ist der Titel deutsch, der gesamte Text jedoch tschechisch,<br />
in Thamyrisovy texty ist die erste Strophe deutsch, die zweite tschechisch.
256<br />
Renata Cornejo<br />
politische Tätigkeit nach 1990 hinreichend beweist. 8 Dieser „Übersetzungsprozess“,<br />
der auch eine kulturelle Grenzüberschreitung bedeutet, gestaltet<br />
sich äußerst schwierig, denn der Sprachwechsel wird als ein ambivalenter,<br />
lustvoll-schmerzhafter Lernprozess mit psychischen und physischen Verletzungen<br />
erfahren: „Wundgelesen/ bei so vielen zeichen/ bist du verwirrt“<br />
(GRUŠA 1994: 39). Der Voltairsche Garten lässt sich sprachlich-poetisch<br />
nicht leicht bestellen: „all das liegt hinter dir/ vor dir/ der garten/ du darin/<br />
mitten im übersetzen“ (GRUŠA 2001:75) heißt es im Gedicht Geschehen,<br />
das in beiden Sprachen vorliegt.<br />
Zum „Über-Setzer“ im doppelten Sinne (Schriftsteller und Diplomat) wurde<br />
Gruša nicht erst nach dem politischen Wechsel in der ČSSR durch die<br />
Übernahme politischer Funktionen, sondern er setzte sich schon als Dissident<br />
für die Einhaltung der Menschenrechte ein und war einer der Ersten,<br />
die die Charta 77 mitinitiierten und unterschrieben – Gruša als der Fährmann,<br />
der mit Hilfe seiner Literatur zwischen zwei Sprachen, Sprachkulturen<br />
und -welten von einem Ufer an das andere übersetzt, in dem er übersetzt.<br />
Ota Filips siebenter Lebenslauf<br />
Der aus einer polnisch-deutsch-tschechischen Familie stammende Ota Filip<br />
(*1930) konnte sich in den 60er-Jahren nach seinem Journalistikstudium<br />
nicht lange seinem Beruf widmen. Wegen der „nicht richtigen Kaderabstimmung“,<br />
wegen dekadenter und sozialdemokratischer Tendenzen wurde<br />
er 1960 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und musste sich bis<br />
zum „Prager Frühling“ als Bau- und Hilfsarbeiter durchschlagen. Nach einem<br />
kurzen Intermezzo beim PROFILVERLAG wurde er 1969 wegen angeblicher<br />
staatsfeindlicher Betätigung mehrmals verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe<br />
verurteilt. 1974 wanderte er mit seiner Familie als politischer<br />
Flüchtling nach Bayern aus, wurde ausgebürgert und bekam 1978 die deutsche<br />
Staatsbürgerschaft. Trotz der Änderung der politischen Verhältnisse<br />
nach 1989 lebt er weiter im bayrischen Murnau und beabsichtigt nicht zurückzukehren.<br />
Den endgültigen Sprachwechsel hat der Journalist und Schriftsteller Filip<br />
nie konsequent vollzogen, obwohl er aus einer mehrsprachigen Familie<br />
stammt und von dem Kultur- und Sprachgemisch der in ihr lebenden Nationalitäten,<br />
der tschechischen, deutsch-jüdischen und der polnischen, stark<br />
beeinflusst war. Ähnlich wie Libuše Moníková studierte er später u.a. Ger-<br />
8 Jiří Gruša war nach 1990 tschechoslowakischer, später tschechischer Botschafter in der<br />
BRD, 1997/98 tschechischer Kultusminister, seit 1998 vertritt er sein Heimatland als<br />
Botschafter in Wien.<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 257<br />
manistik und hatte demzufolge sehr gute sprachliche Voraussetzungen für<br />
einen Sprachwechsel, den er selbst für die einzig mögliche Konsequenz seines<br />
Exils hielt und den er nicht als ein Provisorium verstanden haben wollte.<br />
Seine Laufbahn als Prosaautor begann 1968 mit der Veröffentlichung<br />
des Romans Cesta ke hřbitovu (Der Weg zum Friedhof), als sich die politische<br />
Situation in der Tschechoslowakei vorübergehend liberalisierte. Seine<br />
drei weiteren, auf Tschechisch geschriebenen Romane konnten aus politischen<br />
Gründen in seiner damaligen Heimat nicht mehr erscheinen und wurden<br />
zwischen 1969 und 1975 im Fischer-Verlag in deutscher Übersetzung<br />
herausgegeben. 9 Die Sprachkonversion resultierte, seiner eigenen Aussage<br />
nach, überwiegend daraus, dass ihn die deutschen Übersetzungen der vor<br />
dem Exil verfassten Werke nicht zufrieden gestellt hatten (vgl. FILIP 1992:<br />
62), obwohl sie von der deutschen Literaturkritik sehr positiv aufgenommen<br />
wurden.<br />
Ich habe angefangen deutsch zu schreiben, weil ich in Deutschland lebe und meine Leser<br />
deutschsprachige Menschen sind. [...] Diese beiden sachlichen Überlegungen: Ich lebe für<br />
immer in Deutschland, meine Leser sind Deutsche, ich lebe vom Schreiben, also muß ich für<br />
die Leser in der Sprache schreiben, die sie verstehen – das war der Grund, [...]. (FILIP 1992:<br />
62)<br />
Obwohl er von der Ausbildung her Germanist war und schon seit einigen<br />
Jahren in der Bundesrepublik Deutschland als Journalist arbeitete, wagte er<br />
lange nicht, sich die deutsche Sprache als Autorsprache anzueignen, die<br />
vorgegebene Sprach- und Kulturgrenze zu überschreiten. Erst als seine<br />
Kommentare und Reportagen für die FAZ ohne Korrektur der Frankfurter<br />
Redaktion akzeptiert wurden, gewann er nach und nach an Selbstvertrauen<br />
und begann, seinen ersten Roman auf Deutsch zu schreiben. Erschienen ist<br />
er im Jahre 1981, sieben Jahre nach seiner Emigration, unter dem Titel<br />
Großvater und die Kanone und setzt sich thematisch mit der Absurdität des<br />
Krieges vor dem Hintergrund der Kulisse des 1. Weltkrieges auseinander.<br />
Der Sprachwechsel bedeutete zugleich einen thematischen Wechsel. Während<br />
die in der Tschechoslowakei verfassten Romane die Okkupationsjahre<br />
1938–1945 und die Zeit des realen Sozialismus zur historischen Kulisse<br />
werden lassen, auf der die persönlichen Erfahrungen des Autors filtriert und<br />
bewältigt werden, setzt sich Filip in seinen Exilromanen mit historischen,<br />
9 In der Übersetzung von Josephine Spitzer sind die Romane Das Café an der Straße zum<br />
Friedhof (1968), Ein Narr für jede Stadt (1969), Die Himmelsfahrt des Lojzek Lapáček<br />
aus Schlesisch-Ostrau (1975) und Zweikämpfe (1977) erschienen. Der Roman Maiandacht,<br />
an dem Filip zum Teil noch in der Tschechoslowakei, zum Teil schon in der<br />
„Exilheimat“ BRD arbeitete, erschien im Jahre1977 und sein erster im Exil geschriebener<br />
Roman Wallenstein und Lukretia 1978 – beide in der Übersetzung von Marianne<br />
Pasetti-Swoboda.
258<br />
Renata Cornejo<br />
moralischen und philosophischen Themen im weiteren Sinne auseinander.<br />
Die Geschichte wird als „Geschichte ihrer zahlreichen Interpretationen“<br />
(JORDAN 1998: 2) wahrgenommen, den thematischen Mittelpunkt bilden<br />
die ideologische Manipulation der objektiven Wirklichkeit und das Spiel,<br />
die Komödie des Machtapparats und dessen Handlanger. Mit dem Sprachwechsel<br />
scheint auch die Modifizierung seines literarischen Stils eng zusammenzuhängen,<br />
meint Jürgen Jacobs (JACOBS 1988: 22), eine These,<br />
der Filip zustimmt:<br />
In den slawischen Sprachen, so auch im Tschechischen, ist es möglich, locker zu schwärmen,<br />
man kann vieles schön und poetischer sagen, vor allem das Adjektiv und den Nebensatz aufspielen,<br />
ohne dabei auf die Genauigkeit der informellen Aussage viel achten zu müssen […] Im<br />
Deutschen, und das ist mir beim Schreiben des Romans in zwei Sprachen aufgefallen, ist man<br />
doch mit der Tradition verbunden, mit der Tradition der exakten Denker und des genauen<br />
sprachlichen Ausdrucks. Das Deutsche zwang sogar eine andere Atmosphäre auf. (MOSER<br />
1989: 4)<br />
Filip bezieht sich mit dieser Beobachtung auf seinen letzten Roman Der<br />
Siebente Lebenslauf, der in zweierlei Hinsicht eine Sonderstellung in seinem<br />
bisherigen Schaffen einnimmt. Erstens kehrt Filip thematisch wieder<br />
zur eigenen Familiengeschichte und zu persönlichen Erfahrungen zurück<br />
wie in seinen früheren tschechischen Romanen, diesmal jedoch verzichtet er<br />
weitgehend auf eine Fabulierung zu Gunsten der Autobiographie. 10 Zweitens<br />
veröffentlicht er diesen Roman sowohl in deutscher als auch in tschechischer<br />
Sprache, wobei es sich keineswegs um eine direkte Übersetzung<br />
(1:1) handelt, sondern um zwei verschiedene Fassungen desselben Romans.<br />
„Ich habe mich nicht tschechisch übersetzt, sondern ich habe mich tschechisch<br />
neu erzählt“, so Filip und fügt hinzu, dass die um ca. 150 Seiten kürzere<br />
tschechische Fassung aus finanziellen Gründen entstanden sei. Dass er<br />
damals auf eine entsprechende Anforderung des Brünner Verlags eingegangen<br />
war, bezeichnet er rückblickend als einen großen Fehler. (HÝBLOVÁ<br />
2002: 85) Obwohl Der siebente Lebenslauf zunächst auf Deutsch während<br />
eines Stipendienaufenthalts 1999 in Rom entstanden war, erschien die<br />
tschechische Version im Brünner Verlag Host bereits im Jahre 2000, d.h.<br />
ein Jahr vor der Herausgabe der deutschen Urfassung. Der siebente Lebenslauf<br />
mit dem Untertitel „Autobiographischer Roman“ präsentiert die kleine<br />
individuelle Geschichte unter dem Druck der großen mitteleuropäischen<br />
zwischen den Jahren 1939–1953 und ist zugleich als eine Lebensbeichte des<br />
10 Stark autobiographische Züge weisen die Romane Café an der Straße zum Friedhof<br />
1968 (Kindheit und Jugend in Schlesisch-Ostrau), Die Himmelsfahrt des Lojzek Lapáček<br />
aus Schlesisch-Ostrau 1975, Zweikämpfe 1977 (der Junge muss die Position des<br />
Vaters übernehmen) und Sehnsucht nach Procida 1988 (Leben des Autors in der BRD,<br />
Problem der Emigration) auf.<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 259<br />
Schriftstellers zu verstehen, der öffentlich bezichtigt worden war, ein Agent<br />
der Staatssicherheitspolizei gewesen zu sein, die bereits in den Jahren<br />
1951–52 eine Akte über ihn geführt hatte. Diesem Vorwurf folgte eine<br />
durch den Dokumentarfilm Der lachende Barbar ausgelöste mediale Hetze,<br />
der Filips Sohn nicht gewachsen war und sich deshalb 1998 das Leben<br />
nahm. Der vorzeitige Tod seines Sohnes als Folge der Vorwürfe, dass er in<br />
den 50er-Jahren ein informeller Mitarbeiter der StB gewesen sein soll, war<br />
der entscheidende Beweggrund für die Entstehung seines Romans, den er<br />
seinem verstorbenen Sohn Pavel widmete: „Der Anlass war der tragische<br />
Tod meines Sohnes. Das andere war, dass ich beschuldigt worden bin, ein<br />
Agent der Staatsgeheimpolizei zu sein. Ich versuche das im Siebenten Lebenslauf<br />
zu erklären.” (HÝBLOVÁ 2002: 84) Filip versucht, sich dabei an<br />
Tatsachen und Dokumente zu halten, die er zur Einsicht bekam und kopierte<br />
und die ohne sein Wissen (so zumindest behauptet er), über ihn geführt<br />
worden sind: „Und aus diesen Dokumenten gibt es meinen Siebenten Lebenslauf,<br />
von dem ich nicht gewusst habe, dass es ihn überhaupt gibt. Ich<br />
habe mich erst auf Grund der Dokumente entdeckt.“ (HÝBLOVÁ 2002: 85)<br />
Den Titel seines Romans bezieht er also auf sein „Leben“ in den Akten des<br />
tschechoslowakischen Nachrichtendienstes, das am 13. Juli 1951 „zu laufen“<br />
beginnt, als über ihn, den vermeintlichen englischen Agenten, eine Akte<br />
angelegt und sein Leben von da an unauffällig im Hintergrund organisiert<br />
und überwacht wird. Filip unterscheidet den wirklichen Lebenslauf, den er<br />
lebt, einen gekürzten, den er „für die Behörden, für fremden Gebrauch und<br />
andere sinnlose Zwecke“ (FILIP 2001: 9) schreibt und vier weitere Lebensläufe,<br />
die er in seinen autobiographisch geprägten Romanen (vgl. Anm. 10)<br />
verschlüsselt hat. Die Geschichte, die Personen, Tatsachen und Dokumente<br />
in seiner „Lebensbeichte“ sind dieselben, manche Episoden fehlen jedoch in<br />
der einen oder anderen Fassung, andere wurden hinzugefügt. Entscheidend<br />
scheint für Filip dabei gewesen zu sein, an welches Lesepublikum sich sein<br />
Lebensbericht wendet.<br />
In der tschechischen Fassung wurde die dem Roman vorangestellte Widmung<br />
an den verstorbenen Sohn weggelassen, was nicht der einzige formale<br />
Unterschied ist. Sie wurde um historisch-politische Anmerkungen, um eine<br />
Zeittafel der historischen Entwicklung der Tschechoslowakei von 1918 bis<br />
1953 und um das letzte Kapitel „Der Steinbruch“ reduziert, in dem die Folgen<br />
der misslungenen Flucht über die Staatsgrenze in den Westen geschildert<br />
werden und mit dem die tschechische Fassung seines nächsten Romans<br />
Der achte Lebenslauf eingeleitet werden soll. Interessanter sind jedoch die<br />
inhaltlichen und sprachlichen Unterschiede seines Siebenten Lebenslaufs. In<br />
der deutschen Fassung meidet er bewusst Ereignisse und Namen, die möglicherweise<br />
eine kritischere Haltung zu den tschechisch-deutschen Beziehun-
260<br />
Renata Cornejo<br />
gen evozieren oder für den deutschen Leser schwer verständlich sein könnten.<br />
So lässt er z.B. den Namen Göring sowie die Geschichte vom Hausmeister<br />
Vorlička weg, der im Mai 1945 als ‚gerechte‘ Vergeltung und aus Rache<br />
die Frau eines deutschen Soldaten mit ihrem Baby erschießt und noch<br />
stolz auf seine Tat ist, oder die Schilderung der begeisterten Begrüßung der<br />
sowjetischen Befreiungsarmee durch die tschechische Bevölkerung am<br />
Kriegsende. Der Hauptunterschied besteht, wie erwähnt, in der Kürzung der<br />
tschechischen Fassung um das letzte Kapitel, in dem von den Folgen (Gefängnis)<br />
des gescheiterten Fluchtversuches in den Westen berichtet wird<br />
und dass dem Roman durch die glückliche Heirat des Protagonisten am Ende<br />
märchenhafte Züge verliehen werden. Mit der abrupten Unterbrechung<br />
von Filips Lebensgeschichte nach der Festnahme 1953 (sie endet mit dem<br />
Gerichtsurteil der jungen Soldaten, die gemeinsam mit Filip den Fluchtversuch<br />
in den Westen geplant hatten. Dieser konnte jedoch auf Grund der Information<br />
von Filips Onkel, dem sich der Neffe mit seinem Vorhaben anvertraut<br />
hatte, vereitelt werden) bleibt ein klärendes Ende, das Bekenntnis<br />
und Hinterfragen der eigenen Schuld, auf halbem Wege stecken. Es ist die<br />
Schlussfrage der deutschen Fassung, die die eigene, offen eingestandene<br />
Schuld relativiert, indem sie sie in kausale und geschichtliche Zusammenhänge<br />
stellt. Das eigene „klägliche Versagen”, die eigene Schuld und Mitschuld,<br />
in der der Schriftsteller sein Leben lang gefangen bleibt (vgl. FILIP<br />
2001: 350), kann erst aufgearbeitet werden, wenn Filip dem eigenen Vater,<br />
der ein Nazikollaborateur war, vergeben kann, so wie er sich Vergebung<br />
und Verständnis vom eigenen, inzwischen verstorbenen Sohn gewünscht<br />
hätte:<br />
Eine dritte Generation wird es in unserer Familie nach Pavels Selbstmord nicht mehr geben.<br />
Wer wird, da ich keine Enkelkinder und keine Kinder meiner Enkelkinder erwarten kann, bis<br />
ins dritte Glied, damit sich das biblische Wort und der Wille Gottes erfülle, für Vater Bohumils<br />
Sünden, für meine Sünden und für mein Versagen im einundzwanzigsten Jahrhundert nach<br />
Christi Geburt büßen? (FILIP 2001: 432)<br />
In dieser fehlenden Relativierung und dem ausgebliebenen offenen Schuldbekenntnis<br />
in der tschechischen Fassung sehe ich einen der wichtigsten<br />
Gründe dafür, warum die tschechische Kritik mit dem Autor so hart ins Gericht<br />
ging. Während die deutsche Literaturkritik Filips literarisches Können<br />
sachlich analysiert und die Selbstironie des Autors schätzt, der seine<br />
Schwächen und Fehler selbstkritisch und aufrichtig offen legt, zeigen die<br />
tschechischen Kritiker nur wenig Verständnis für Filips „Verteidigungsbericht“,<br />
den sie als „Wiedergutmachungsversuch“ und ein Sich-reinwaschen-Wollen<br />
interpretieren. In seiner Rezension Půvab a bída fabulace<br />
(Der Liebreiz und das Elend des Fabulierens) beschäftigt sich Lubor Dohnal<br />
mit dem Problem der Grenze zwischen einer literarischen Fiktion und einem<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 261<br />
autobiographischen Roman und kritisiert in diesem Zusammenhang Ota<br />
Filip u.a. dafür, dass er einerseits in seinem Roman genaue Daten über den<br />
misslungenen Fluchtversuch im dokumentarischen Stil präsentiert, um damit<br />
die Illusion der Wahrhaftigkeit und Echtheit beim Leser hervorzurufen,<br />
andererseits aber diese Daten ‚zurecht schneidet‘, um ihnen einen symbolischen<br />
Nachdruck zu verleihen (so wird z.B. der vereitelte Fluchtversuch<br />
vom 17.6.1952 aus der deutschen Fassung in der tschechischen auf den<br />
symbolträchtigen Freitag, den 13., vorverlegt, der das Misslingen der bevorstehenden<br />
Republikflucht signalisiert) und sich somit bewusst einer Mystifizierung<br />
bzw. einer Lüge bedient (vgl. DOHNAL 2000: 28). Es scheint<br />
Dohnal unmoralisch, das Schicksal noch lebender, damals involvierter und<br />
betroffener Personen als literarischen Stoff zu ge- bzw. missbrauchen, da<br />
hier bagatellisiert und manipuliert werde: „Niemand, auch nicht ein Schriftsteller<br />
hat Recht, so mit dem menschlichen Schicksal der Lebenden umzugehen“,<br />
urteilt der Literaturkritiker Dohnal hart (DOHNAL 2000: 28), was<br />
Filip als Einschränkung schriftstellerischer Freiheit und als Anmaßung interpretiert,<br />
da diese „Zurechtweisung“ häufig von Menschen komme, die<br />
selbst in das frühere Regime involviert waren:<br />
Er ist meine Freiheit, das zu schreiben, was ich weiß und was ich meine.[...] Vor allem lehne<br />
ich ab, dass mich Literaturkritiker, die selbst in der schlimmsten Zeit der Stalinisten die größten<br />
Prediger waren, über die Demokratie belehren. [...] Ich will nicht belehrt werden, was ich in<br />
der Literatur kann und was nicht, von Leuten, die selbst nichts geschrieben haben.<br />
(HÝBLOVÁ 2002: 87)<br />
Tschechische Kritiker beschuldigen Filip, es ginge ihm primär um die eigene<br />
Freisprechung und den Versuch einer Katharsis beim Leser (vgl. LUKEŠ<br />
2000) − ein Ziel, für welches er bereit sei, die innere Logik des Textes aufzugeben,<br />
die Fakten zu opfern und durch das Fabulieren zu verdrehen. Im<br />
Vordergrund aller tschechischen Besprechungen steht eindeutig die moralische<br />
Frage, die Frage nach der Berechtigung einer Rechtfertigung eigener<br />
Schuld und um Schuldzuweisung, von der er übereinstimmend nicht freigesprochen<br />
wird (vgl. DOSTÁL 2000; LUKEŠ 2000). Die deutsche Kritik<br />
wertet dagegen den Roman als einen gelungenen Beitrag zum Verständnis<br />
der komplizierten Beziehungen und der verwickelten Zusammenhänge während<br />
des kommunistischen Regimes (vgl. OPLATKA 2001), die für das<br />
deutsche Lesepublikum aus der Außenperspektive nur schwer nachvollziehbar<br />
seien. Ota Filip kommentierte diese deutlich widersprüchliche Aufnahme<br />
und markante Missgunst der tschechischen Litraturkritik kulturspezifisch:<br />
„In der deutschen Kritik geht es immer um die Sache. In der<br />
tschechischen Kritik geht es darum, gegen jemanden sich aufzuspielen, ihn<br />
unmöglich zu machen.” (HÝBLOVÁ 2000: 90)
262<br />
Renata Cornejo<br />
Die Gründe für eine so unterschiedliche Rezeption sind nicht zuletzt auch<br />
die sprachlichen und stilistischen Differenzen beider Fassungen, die es Filip<br />
erlaubt haben, Gedankengänge und Gefühle in der für ihn poetischeren und<br />
klangvolleren tschechischen Sprache emotionaler und eindringlicher zu<br />
vermitteln und atmosphärischer zu gestalten:<br />
Im Tschechischen läßt es sich herrlich schwärmen. Es ist eine Sprache mit einem vitalen Adjektiv<br />
und mit Verben, die zum Spielen einladen. Ihre Nebensätze fließen frei und ohne Hindernisse.<br />
Das Deutsch ist eine genaue Sprache, manchmal im Ausdruck etwas zu hart [...]. Es<br />
ist eine Sprache exakter Denker und Techniker. (FILIP 1992: 63f.)<br />
Manche Sachkenntnisse werden beim tschechischen Lesepublikum vorausgesetzt<br />
und erlauben dem Autor ausführlichere Naturschilderungen oder<br />
Schilderungen des eigenen Gemütszustandes. In der tschechischen Fassung<br />
deklariert er offen seine schriftstellerische Intention – nämlich die Sünde<br />
aus sich herauszuschreien, sie mit anderen zu teilen, denn so wird sie nicht<br />
so schwer zu tragen sein und vielleicht sogar auch „tragbar“ werden (FILIP<br />
2000: 13). Auch die Frage des Gewissens wird anders behandelt. In der<br />
deutschen Fassung heißt es: „Mein Gewissen schweigt, allerdings auf eine<br />
seltsame Art und Weise: Je länger und geduldiger es schweigt, umso mehr<br />
reizt und beunruhigt es mich.“ (FILIP 2001: 16) Das tschechische Äquivalent<br />
spricht von Angst und Grauen vor dem Gewissen, das ihn Tag und<br />
Nacht beunruhigt (FILIP 2000: 14) – man ist versucht „verfolgt“ zu übersetzen.<br />
Filip selbst gesteht, dass ihm die deutsche Sprache als Sprache der<br />
Philosophen und Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts Genauigkeit abverlangt<br />
und er daher in der deutschen Fassung genauere Zeitangaben macht,<br />
die nicht unbedingt mit authentischen Daten übereinstimmen müssen. Zugleich<br />
bedeutet für ihn die deutsche Sprache eine Möglichkeit, Abstand von<br />
der eigenen Geschichte zu gewinnen und eine selbstkritische Distanz und<br />
Sachlichkeit zu bewahren.<br />
Zweifelsohne hat Ota Filip mit den Fassungen desselben Romans in zwei<br />
Sprachen einen neuen und ungewohnten Weg in seinem literarischen Schaffen<br />
eingeschlagen und auf seine Art und Weise die Frage des Sprachwechsels<br />
originell gelöst. Auch seine zwei nächsten, bis jetzt noch nicht veröffentlichten<br />
Romane Der achte Lebenslauf und Haus am Berg wurden auf<br />
Deutsch und Tschechisch verfasst und liegen zur Zeit in zweisprachigen<br />
Versionen vor.<br />
Die Ambivalenz des sprachlichen Grenzgängertums, das für beide Autoren<br />
zur Lebenshaltung wurde, hat am zutreffendsten Jiří Gruša zum Ausdruck<br />
gebracht, als er sich im gleichnamigen Essayband Glücklich heimatlos<br />
nannte. Denn obwohl beide Autoren, wie Seilkünstler, dem ständigen Balancieren<br />
auf den deutsch-tschechischen Sprachgrenzen ausgesetzt sind,<br />
Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša … 263<br />
haben sie im ‚Stummland‘ zu einer Sprache gefunden, in der sie als Schriftsteller<br />
für immer beheimatet bleiben werden.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
DOHNAL, Lubor (2000): Půvab a bída fabulace. – In: Lidové noviny<br />
7.12.2000, 28.<br />
DOSTÁL, Petr (1998): Taková zbytečná smrt. – In: Právo 17.1.1998.<br />
FILIP, Ota (1992): K západu jsem optimistický. – In: Hvížďala, Karel: České<br />
rozhovory ve světě. Praha, 1992, 59–82.<br />
FILIP, Ota (2000): Sedmý životopis. Brno: Host.<br />
FILIP, Ota (2001): Der siebente Lebenslauf. München: Herbig.<br />
GRUŠA, Jiří (1988): Der Babylonwald. Stuttgart: DVA.<br />
GRUŠA, Jiří (1994): Wandersteine. Stuttgart: DVA.<br />
GRUŠA, Jiří (2000): Das Gesicht – der Schriftsteller – der Fall. Vorlesungen<br />
über die Prätention der Dichter, die Kompetenz und das Präsenz als<br />
Zeitform der Lyrik. Dresden: Thelem.<br />
GRUŠA Jiří (2001): Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto. Praha,<br />
Litomyšl: Paseka.<br />
GRUŠA, Jiří (2002): Glücklich heimatlos. Einblicke und Rückblicke eines<br />
tschechischen Nachbarn. Stuttgart, Leipzig: Hohenheim.<br />
HÝBLOVÁ, Klára (2002): Interview mit Ota Filip in Murnau am<br />
11.7.2001. – In: Dies., Ota Filip – „Der siebente Lebenslauf“. Ústí nad Labem:<br />
UJEP (Diplomarbeit), 84–102.<br />
JACOBS, Jürgen (1988): Mitten unter Mördern. – In: FAZ, 23.8.1988, 22.<br />
JORDAN, James (1998): Ota Filip. – In: KLG – 10/98, 1–8.<br />
LUKEŠ, E.: Doznání Oty Filipa. – In: Tvar 21/2000, 20.<br />
MOSER, Dietz Rüdiger (1989): Brückenschlag nach Prag. Gespräch mit<br />
Ota Filip. – In: Literatur in Bayern. München, H. 17, 2–10.<br />
PFOB, Julia (2001): Jiří Gruša – Interview mit dem Kosmopoliten. Interview<br />
von Julia Pfob am 21.8.2001. – In: Dies., Jiří Gruša – Dichter,<br />
Schriftsteller und Politiker. Zittau: Hochschule Zittau Görlitz (Diplomarbeit).
264<br />
Renata Cornejo<br />
OPLATKA, Andreas (2001): Der Fall, der keiner war. Ota Filip fordert Gerechtigkeit<br />
und verdient sie auch. – In: Neue Zürcher Zeitung 29.8.2001,<br />
33–34.<br />
SERKE, Jürgen (1982): Die verbannten Dichter: Berichte und Bilder einer<br />
neuen Vertreibung. Marburg: Albrecht Knaus.<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
Kurt Krolop<br />
Josef Körner: Philologische Schriften und Briefe. Hrsg. von Ralf Klausnitzer. Mit einem Vorwort<br />
von Hans Eichner (= Marbacher Wissenschaftsgeschichte 1). Göttingen: Wallstein 2001.<br />
480 S.<br />
1. Eine neue wissenschaftshistorische Schriftenreihe – und ihr Start mit<br />
der Edition von Schriften Josef Körners<br />
Es ist eine wohl nicht ohne Bedacht getroffene Entscheidung der beiden<br />
Herausgeber Christoph König und Ulrich Ott gewesen, ihre neue Schriftenreihe<br />
der Arbeitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik<br />
im Deutschen Literaturarchiv Marbach gerade mit einem Band Philologische<br />
Schriften und Briefe von Josef Körner (1888–1950) zu eröffnen, einem<br />
Germanisten also, dessen Name über einen engeren Kreis von kundigen<br />
Romantikforschern hinaus wohl nur mehr als der des Verfassers jenes berühmten,<br />
seinerzeit unentbehrlichen und auch heute noch immer mit Gewinn<br />
zu lesenden (keineswegs nur ‚anzublätternden’) Bibliographischen<br />
Handbuchs des deutschen Schrifttums (KÖRNER 1949) allgemeiner geläufig<br />
sein dürfte.<br />
Als Herausgeber, Kommentator, Bio- und Bibliograph dieses mit einem<br />
würdigenden und empfehlenden Vorwort von Hans Eichner einleiteten<br />
Bandes zeichnet Ralf Klausnitzer, fachkompetent ausgewiesen vor allem<br />
durch eine wissenschaftsgeschichtlich wichtige Monographie über Romantikforschung<br />
und -forscher in der Ära des Nationalsozialismus (KLAUSNITZER<br />
1999).<br />
Die Publikation ist in vier Hauptteile gegliedert. „(Philologische) Schriften“<br />
(KÖRNER 2001: 9–185) bezieht sich als Sammeltitel auf eine knappe<br />
Auswahl von 14 Texten aus einer Gesamtmasse von rund 350 Titeln, welche<br />
ein (leider nicht durchnummeriertes) „Verzeichnis der Veröffentlichungen<br />
Josef Körners“ (ebd.: 351–384) einzeln aufzählt (einschließlich nicht<br />
immer vollständiger Listen von Rezensionen der selbständig erschienenen<br />
Schriften). Diese Bibliographie macht die erste Abteilung eines „Anhangs“<br />
(ebd.: 349–476) aus, dessen zweite Abteilung ein „Nachwort“ einnimmt, in<br />
dem der Herausgeber Ralf Klausnitzer unter der programmatischen Überschrift<br />
„Josef Körner – Philologe zwischen den Zeiten und Schulen. Ein<br />
biographischer Umriß“ (ebd.: 385–461) eine lebens- und werkgeschichtliche<br />
Gesamtwürdigung in zeit- und wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhängen<br />
zu bieten unternimmt. Den Abschluss bildet ein „Personenregister“<br />
(ebd.: 463–476), das sich allerdings an das eingangs gegebene
266<br />
Kurt Krolop<br />
Versprechen, „alle Personen“ zu erfassen, die im Text sowie im Anmerkungsapparat<br />
der Schriften, Briefe und des Nachworts erwähnt werden“<br />
(ebd.: 473), nicht nur nicht hält, sondern auch bei manchen erfassten Personen<br />
keineswegs alle Erwähnungen berücksichtigt.<br />
Etwa den gleichen Raum wie die Auswahl von „Schriften“ nimmt, an diese<br />
unmittelbar anschließend, eine Abteilung „Briefe“ (ebd.: 187–348) ein, in<br />
der an die 65 Schreiben abgedruckt sind, die Josef Körner von Anfang Januar<br />
1946 bis Anfang Mai 1950 von seinem „Tomi“ (ebd.: 289) Roztoky<br />
bei Prag aus an die seit November 1934 im schwedischen Exil zu Göteborg<br />
als Sprachlehrerin im Schuldienst lebende bedeutende deutschjüdische Literaturwissenschaftlerin<br />
und -theoretikerin Käte Hamburger (1896–1992) gerichtet<br />
hat, deren Lebenslauf der Herausgeber offenbar für so allgemein bekannt<br />
gehalten zu haben scheint, dass er meint, dem Leser keinerlei biographische<br />
Informationen preisgeben zu müssen, nicht einmal Geburts- und<br />
Sterbejahr.<br />
Am chronologischen Leitfaden des „biographischen Umrisses“ sei im Folgenden<br />
eine kritisch referierende Würdigung dieses thematisch so überaus<br />
wichtigen Bandes vorzunehmen versucht.<br />
2. Zur Herkunft, weltanschaulichen Orientierung und akademischen<br />
Ausbildung Körners<br />
Das ein wenig pompös mit „Herkunft und universitäre Sozialisation“ (ebd.:<br />
389–399) überschriebene erste Kapitel des biographischen Umrisses ist den<br />
mährischen Kindheits- und Schuljahren sowie den Wiener Studienjahren<br />
Josef Körners gewidmet.<br />
In Hinblick auf vermeintlich analoge „Ausgangsbedingungen“ (und wohl<br />
nicht nur auf die Gleichheit der Vornamen) hat der Herausgeber an späterer<br />
Stelle eine Parallele zwischen Josef Körner und Josef Nadler zu ziehen versucht:<br />
In ihren Geburtsjahrgängen nur vier Jahre voneinander getrennt und dem tschechischen Teil<br />
der k. u. k. Monarchie entstammend, erfuhren beide Germanisten ihre universitäre Sozialisation<br />
durch die spätpositivistische Philologie österreichischer Prägung. (ebd.: 439–440)<br />
Nicht in jedem dieser Punkte kann man indessen von Parallelen sprechen.<br />
Gewiss kamen beide Josefs aus den böhmischen Ländern, aber schon die<br />
Behauptung, beide wären „dem tschechischen Teil der k. u. k. Monarchie“<br />
entstammt, ist irreführend. Körner stammte aus dem südostmährischen Dorf<br />
Rohatec (Rohatetz) bei Hodonín (Göding), das – ähnlich wie die Gymnasialstadt<br />
Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch) – in einer kompakt tschechischsprachigen<br />
Region lag, die nur eine verschwindend geringe deutschsprachige<br />
Minderheit aufwies; genau umgekehrt lagen die Dinge bei Nadler,<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
der in einer kompakt deutschsprachigen Gegend mit einer verschwindend<br />
geringen tschechischsprachigen Minderheit aufwuchs. „Josef Nadler wurde<br />
1884 im nordböhmischen Neudörfl [!] geboren“ (ebd.: 440), stellt da eine<br />
sehr unpräzise Information dar; denn allein „nordböhmische Neudörf(e)l“<br />
dieses Ortsnamens gab es nicht weniger als ein halbes Dutzend, von denen<br />
Nadlers Geburtsort, die 200–Seelen-Dorfgemeinde „Neudörfel“ (so die offiziell<br />
korrekte Schreibweise) bei Hainspach, im sogenannten ‚Böhmischen<br />
Niederland‘ ganz dicht an der böhmisch-sächsischen Grenze zur Oberlausitz<br />
gelegen, fast ausschließlich deutsche Einwohner hatte.<br />
Die sogenannte „universitäre Sozialisation“ vollzog sich dann gleichsam<br />
umgekehrt kontrastiv: bei Körner im so gut wie kompakt deutschsprachigen<br />
Wien, bei Nadler innerhalb der Enklave eines deutschsprachigen „Städtchens“<br />
(ebd.: 55) inmitten der „slawischen Großstadt“ (ebd.: 55) Prag.<br />
Während die Kindheits- und Gymnasialjahre wie auch die Anfänge der<br />
Universitätslaufbahn Josef Nadlers bis hin zu seiner Berufung nach Königsberg<br />
(1925) stark konfessionell-katholisch geprägt oder zumindest mitbestimmt<br />
waren, dürfte Körner schon sehr früh einen nicht nur konfessionell,<br />
sondern auch allgemein religiös indifferenten, rein „anthropologischen“<br />
bzw. anthropozentrischen Standpunkt eingenommen haben, wie er dann in<br />
den Briefen an Käte Hamburger mit wiederholtem Nachdruck dargelegt ist.<br />
Diesen Sachverhalt verkennt der Herausgeber, wenn er schreibt, Körner<br />
habe den „Glauben seiner Vorfahren“ (ebd.: 390, Hervorhebung K. K.)<br />
nicht verleugnet. Woraus Körner nach eigenem Bekenntnis nie ein Hehl<br />
gemacht hat, das war seine jüdische „Abstammung“ (ebd.: 189), seine<br />
„Herkunft“ (ebd.: 189), aber jegliche „Gottesfiktion“ (ebd.: 239), also auch<br />
deren jüdisch-mosaische Spielart, war für ihn eine nicht mehr nachvollziehbare<br />
„ideelle Kinderei“ (ebd.: 216), ein „Atavismus des theologischen Zeitalters“<br />
(ebd.: 196), das endgültig vergangen sei.<br />
Das nationale Identitätsbewusstsein Körners, seines Elternhauses wie seiner<br />
später in nazistischen Vernichtungslagern ermordeten Geschwister Erna<br />
Körner (1893–1941) und Dr. Max Körner (1882–1943) scheint sich nicht<br />
nur im Festhalten an der „deutschen Sprache und Kultur“ (ebd.: 389) manifestiert,<br />
sondern in einem zwar nicht „deutschradikalen“, wohl aber<br />
„deutschliberalen“ Sinne auch eine historisch-politische Dimension umfasst<br />
zu haben. So schließt etwa die ausdrücklich den „geliebten Geschwistern Erna<br />
und Max“ gewidmete Schrift Das Nibelungenlied (Leipzig 1921) mit einem<br />
rezeptionsgeschichtlichen Rück- und Ausblick, der zugleich ein Geschichts-<br />
und Zeitgeschichtsbild erkennen lässt, das sonore Töne eines auch politisch<br />
instrumentierten nationalen Pathos keineswegs scheut und vermeidet:<br />
Fragt man sich, [...] wie ein Werk von solcher Tiefe der Empfindung [...] dem eigenen Volk<br />
Jahrhunderte lang so gut wie verloren sein konnte, dann muss der Hinweis auf den tragischen<br />
267
268<br />
Kurt Krolop<br />
Verlauf der deutschen Geschichte zur Antwort dienen, der innere Zusammenbruch der Nation<br />
im 16. und 17. Jahrhundert, durch den mit der politischen Macht auch die geistige Kultur des<br />
Volkes verschüttet ward. Beide sind glanzvoll wieder erstanden, und aus dem Nibelungenlied<br />
nicht zuletzt haben Kraft und Stolz und Zuversicht jene Männer gesogen, die am Beginn des<br />
19. Jahrhunderts dem deutschen Geist und dem deutschen Schwert die ruhmvollen Wege wiesen,<br />
die bis ans Ende des Säkulums immer höher und höher hinanführten. Hat eine trauervolle<br />
Gegenwart die Nation von dieser schon schwindligen Höhe nun jäh hinabgestürzt, – ihre geistigen<br />
Güter, die kein Feind rauben kann, sind ihr geblieben; die zu halten und zu hegen, an<br />
ihnen sich zu erraffen, sich zu erheben ist die Forderung des Tages. Wieder kann werden, was<br />
einst war, und zum andernmal an dem alten Gedichte sich ein Feuer entzünden, das alle Gewalt-<br />
und Fremdherrschaft vernichtet. (KÖRNER 1921: 121–122, Hervorhebungen K. K.).<br />
Nach Kenntnisnahme solcher Sätze erscheint einem die wenige Jahre später<br />
von August Sauer kolportierte Bezichtigung, bei Körner handle es sich um<br />
ein „übelbeleumdetes anationales Individuum“ (ebd.: 425 und 439) als eine<br />
besonders böswillige Verleumdung.<br />
Besonderen Wert hat Josef Körner stets auf die Feststellung gelegt, als Philologe<br />
und Literarhistoriker aus der Schule Jakob Minors (1855–1912) hervorgegangen<br />
zu sein, in seinen Studien „vornehmlich von Jakob Minor geleitet,<br />
als dessen letzter namhafter Schüler er zu bezeichnen ist“, wie die<br />
offenbar auf Körner selbst zurückgehende Formulierung in der ersten Auflage<br />
des Deutschen Literatur-Lexikons von Wilhelm Kosch (1928: Sp.<br />
1254) deutlich genug lautet. Und der dem Wirken Minors gewidmete Passus<br />
in der wissenschaftsgeschichtlichen Darstellung „Deutsche Philologie“,<br />
die Josef Körner für den von Eduard Castle betreuten dritten Band der<br />
Deutsch-Österreichischen Literaturgeschichte (1930: 48–89) beigesteuert<br />
hat, bietet nicht nur eine Charakteristik der germanistischen Leistungen,<br />
sondern auch eine einlässliche Schilderung der Vorlesungspraxis und Vortragsweise<br />
des verehrten akademischen Lehrers aus eigener Hörererfahrung.<br />
Wie Jonas Fränkel (1879–1965), der Verfasser eines bedeutsamen Nachrufs<br />
(KÖRNER 1949: 528) auf Jakob Minor, so sah auch Josef Körner die Tugenden,<br />
Ansprüche und Leistungsmöglichkeiten des spezifisch Philologischen<br />
von Poetik und Historik in Minors Lehr- und Forschungstätigkeit<br />
weithin musterhaft erfüllt. Nicht ohne Staunen wird man bei Körner – ein<br />
Jahr vor seinem frühen Tode – einen aus dieser Tradition heraus zu verstehenden<br />
Satz lesen können, der Schlegelsche Gedanken von der Philologie<br />
als Universalwissenschaft erneuern zu wollen scheint:<br />
[...] jedenfalls kann es nicht Aufgabe der Poetik sein, irgendeine [...] ‚Philosophie‘ auf das<br />
Gebiet der Dichtung anzuwenden [...], vielmehr hat der Poetiker, als Erforscher der dichtesten<br />
und deutlichsten menschlichen Ausdrucksgebilde, eher selbst den Philosophen zu belehren.<br />
(KÖRNER 2001: 315)<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
3. Zu Körners Beschäftigung mit der zeitgenössischen Gegenwartsliteratur.<br />
3.1. „Entdeckung der Gegenwartsliteratur“<br />
„Als Redakteur der Zeitschrift Donauland in Wien: Entdeckung der Gegenwartsliteratur“<br />
(ebd.: 399–413) ist der „zweite Abschnitt“ (ebd.: 388)<br />
des „biographischen Umrisses“ überschrieben.<br />
„Entdeckung der Gegenwartsliteratur“ bezeichnet hier einen Sachverhalt,<br />
mit dem Körner sich ebenfalls als Fortsetzer eines Wirkungsbereichs Jakob<br />
Minors (und des von diesem habilitierten Oskar Walzel) empfinden konnte.<br />
„Minors lebhaftes Interesse für das dichterische Schaffen der Gegenwart“<br />
hatte Jonas Fränkel 1912 in seinem Nekrolog für die NEUE ZÜRCHER<br />
ZEITUNG 1 mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, während dieses „lebhafte<br />
Interesse“ schon ein Jahrzehnt vorher von Karl Kraus in der FACKEL<br />
satirisch glossiert worden war als der Ehrgeiz des Wiener Ordinarius, „im<br />
Germanistenseminar moderne Literatur zu züchten und als Minordomus der<br />
deutsch-österreichischen Literatur seines Amtes zu walten.“ (KRAUS<br />
1901/87: 25)<br />
Der als erstes Zeugnis eines solchen lebhaften Interesses vom Herausgeber<br />
in seine Textauswahl aufgenommene Aufsatz Dichter und Dichtung aus<br />
dem deutschen Prag (KÖRNER 2001: 55–66) vom September 1917 darf<br />
zwar als Beleg dafür gelten, dass Körner in der Tat als „einer der ersten Literaturwissenschaftler<br />
[...] die Bedeutung Franz Kafkas […] erkannte und<br />
benannte“ (ebd.: 386): aber eben nur als einer von ihnen, und nicht einmal<br />
als der allererste; in der Priorität war ihm da bereits mehr als ein Jahr zuvor<br />
sein Mentor Oskar Walzel mit dem Aufsatz Logik im Wunderbaren im<br />
BERLINER TAGEBLATT 2 vom 6. Juli 1916 bahnbrechend vorangegangen.<br />
Auch das an Körners Aufsatz so heftig von Max Brod gerügte Gruppierungsverfahren,<br />
ihn selbst zum „Führer“ (ebd.: 63) eines „Brodschen Kreises“<br />
(ebd.: 65) Prager Autoren zu erklären, war alles andere als neu; schon<br />
das PRAGER TAGBLATT vom 10. Februar 1912 hatte die Zeitschrift HERDER-<br />
BLÄTTER (1911/1912) definiert als „Organ der jungen Prager Dichter, die<br />
um Max Brod sich schließen“, ohne damit bei diesem auf Widerspruch zu<br />
stoßen. Ungewöhnlicher wirkte da schon die Erwähnung eines etwas peripheren<br />
Autors wie Hans bzw. Johannes Thummerer (1888–1921) im Kontext<br />
der Prager Werfel-Generation; aber absolute Priorität darf erst die meines<br />
Wissens allererste und gleich auch sehr nachdrückliche öffentliche<br />
Erwähnung und Hervorhebung eines Prager Salons für sich beanspruchen,<br />
1 Die auch heute noch so heißt, nicht NEUE ZÜRICHER ZEITUNG, wie auf Seite 376 zu<br />
lesen.<br />
2 Das wiederum so hieß und nicht BERLINER TAGBLATT (57).<br />
269
270<br />
Kurt Krolop<br />
der seither wiederholt von sich reden gemacht hat (vgl. zuletzt GIMPL<br />
2001):<br />
Einigte vordem in Berlin der Verein ‚Durch‘ die Vorkämpfer des Naturalismus, blühte das<br />
junge Wien in der Treibhausluft des Café Griensteidl auf, so fanden Prags jugendliche Dichter<br />
vornehmlich in dem bescheidenen Salon einer hochgebildeten Dame den beliebten Treffpunkt.<br />
Hugo Bergmann, der Herrin des Hauses nahestehend, ein tüchtiger philosophischer Kopf und<br />
wahrer Edelmensch, führte dort (der Krieg hat ja manches verändert) die geistvollen Debatten<br />
und von seinem Wort und Wesen empfingen die versammelten Literaten mehr Anregung als<br />
Fernstehende ahnen mögen. So geht etwa Max Brods bisher reifste Schöpfung, der Roman<br />
Tycho de [sic!] Brahes Weg zu Gott in der Grundidee auf eine Studie des bibelkundigen Philosophen<br />
zurück. (KÖRNER 2001:63)<br />
Die hier so rühmend erwähnte, wenn auch nicht beim Namen genannte<br />
„hochgebildete Dame“ war die Apothekersgattin Bert(h)a Fanta (1865–<br />
1918), welcher der „tüchtige philosophische Kopf und wahre Edelmensch“<br />
Hugo Bergmann (1883–1975), einstiger Klassenkamerad Franz Kafkas und<br />
späterer erster Direktor der National- und Universitätsbibliothek in Jerusalem,<br />
als Schwiegersohn besonders nahe stand. Bergmanns Abhandlung Die<br />
Heiligung des Namens (Kiddusch haschem) in dem Sammelbuch Vom Judentum<br />
(Leipzig 1913) hat Max Brod (1960: 355) selbst in seiner Autobiographie<br />
Streitbares Leben als ein „Schriftwerk“ bezeichnet, das wie kaum<br />
ein anderes auf ihn einen „erleuchtenden Eindruck“ gemacht habe, gerade<br />
in Bezug auf Tycho Brahes Weg zu Gott – nicht Tycho de Brahes Weg zu<br />
Gott, wie das offenbar schon Körner unterlaufene, vom Herausgeber kommentarlos<br />
übernommene Fehlzitat des Romantitels lautet.<br />
Solche Errata vermögen bei aller Geringfügigkeit gleichwohl als warnende<br />
Exempel dafür zu dienen, dass man selbst Texte des mit Recht immer wieder<br />
als besonders akribisch gerühmten Josef Körner nicht ohne kritische<br />
Wachsamkeit und Überprüfung einfach nachdrucken kann, als seien sie gegen<br />
Fehlleistungen oder auch sachliche Irrtümer grundsätzlich gefeit. Ab<br />
und zu wäre – analog zu dem Körnerschen „Hier irrt Schlegel“ (KÖRNER<br />
2001: 144) – auch ein „Hier irrt Körner“ angebracht gewesen: so etwa,<br />
wenn es in dem hier erörterten Aufsatz heißt, „Männer wie Karl Egon Ebert<br />
und Siegfried Kapper“ hätten „in beiden Landeszungen Zwiesprache mit<br />
ihrer Muse“ (ebd.: 55) gehalten (übrigens eines der nicht ganz seltenen Beispiele<br />
für den „lebhaft bildernden [...] Stil“ (ebd.: 87) des frühen Körner,<br />
den dieser wenig später mit Recht der Schreibweise Josef Nadlers nachsagen<br />
wird.) In „beiden Landeszungen“ (also deutsch und tschechisch) hat<br />
indessen nicht schon Karl Egon Ebert (1801–1882), sondern erst Siegfried<br />
Kapper (1821–1879) publiziert; Friedrich Adler (1857–1938) erhielt keineswegs<br />
als der „einzige Österreicher Aufnahme in [...] die Modernen Dichtercharaktere“<br />
(ebd.: 58), sondern er war neben Richard Kralik (1852–<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
1934), Fritz Lemmermeyer (1857–1932) und Josef Winter (1857–1916) der<br />
vierte und, wenn man den aus dem Deutschen Reich ‚zugereisten‘, in Wien<br />
wohnhaften Oskar Hansen hinzurechnet, sogar der fünfte Autor aus Österreich<br />
unter den insgesamt 21 Beiträgern der Modernen Dichter-Charaktere<br />
von 1885; deren Mitherausgeber hieß nicht „Henckel“ (ebd.: 58), sondern<br />
Henckell, und zwar war es Karl Henckell (1864–1929), nicht aber „Henkkel,<br />
Wilhelm“ (ebd.: 467), wie eine – leider nicht vereinzelte – Fehlattribuierung<br />
des „Personenregisters“ behauptet.<br />
Zwar lautete der Titel der ersten Gedichtsammlung von Paul Leppin Glokken,<br />
die im Dunkeln rufen (1903), aber sein „Prager Gespensterbuch“ von<br />
1914 hieß nicht Severins Gang ins Dunkle (ebd.: 61), sondern Severins<br />
Gang in die Finsternis: eine Titelkontamination, wie sie Körner gelegentlich<br />
auch sonst unterlaufen ist, etwa in dem Brief an Käte Hamburger vom<br />
6. April 1948, wo der Titel der Schrift Umgang mit Dichtung (1936) von<br />
Johannes Pfeiffer (1902–1970) kontaminiert erscheint mit den Gedanken<br />
über die Dichtung (1941) von Gerhard Storz (1898–1983), dem dann auch<br />
die so entstandene Mischung Umgang mit der Dichtung (ebd.: 276) als Autor<br />
(vom Herausgeber ebenfalls unbemerkt und unberichtigt) zugeschrieben<br />
wird.<br />
Gewiss ist in dem Aufsatz Dichter und Dichtung aus dem deutschen Prag<br />
(wie auch in den übrigen thematisch verwandten Donauland-Artikeln) von<br />
einem „Kulturkampf gegen die tschechischen Einwohner der Moldaumetropole<br />
[...] nichts zu spüren“ (ebd.: 401), doch sind die nationalen Stereotype<br />
deutschliberaler Sichtweise des tschechisch-deutschen Neben- und Gegeneinander<br />
gleichwohl allerorten präsent: von Prag als Stadt der „ersten deutschen<br />
Universität“ (ebd.: 55) über die Bewertung der siebziger Jahre des 19.<br />
Jahrhunderts als die „verhängnisvollen Jahre“, welche die „deutsche Stadt“<br />
Prag „endgültig zur slawischen Metropole wandelten“ (ebd.: 60) und die<br />
Rede von einer dort einsetzenden „tatsächlichen Bedrängnis des Volkstums“<br />
(ebd.: 56) bis hin zur Charakteristik von Fritz Mauthners Grenzlandroman<br />
Der letzte Deutsche von Blatna (1887) als „typische Geschichte der<br />
Verdrängung der Deutschen aus altangestammten Sitzen“ (ebd.: 57).<br />
Mit dem markigen Vokabular von Feststellungen wie der, dass auch im<br />
„deutschen Prag“ als Literaturstadt „mit deutschem Wesen allzeit deutsche<br />
Dichtung vereint bleibt“ (ebd.: 56), wird nicht nur der Programmatik des<br />
Donauland, „heimisches Schrifttum und Heimatkunst zu pflegen und hochzuhalten“<br />
(wie es in einem Werbetext der Zeitschrift ausdrücklich heißt),<br />
dienstpflichtgemäß Rechnung getragen, es scheint darüber hinaus schon mit<br />
dem Titel „Dichter und Dichtung aus dem deutschen Prag“ auch ein kontrastiver<br />
Bezug auf Das jüdische Prag beabsichtigt gewesen zu sein – Titel<br />
einer wenige Monate zuvor, an der Jahreswende 1916/17 erschienenen, von<br />
271
272<br />
Kurt Krolop<br />
der Prager zionistischen Zeitung Selbstwehr herausgegebenen repräsentativen<br />
Sammelschrift, in der bereits die meisten derjenigen Namen vertreten<br />
gewesen waren, die nun bei Körner als Autoren des „deutschen Prag“ nahezu<br />
vollzählig figurierten: Alfred Klaar, Fritz Mauthner, Auguste Hauschner,<br />
Friedrich Adler, Hugo Salus, Oskar Wiener, Oskar Baum, Hugo Bergmann,<br />
Franz Kafka, Max Brod, Otto Pick, Rudolf Fuchs und Franz Werfel.<br />
3.2. Dienstzeit im k. u. k. Kriegsarchiv<br />
„Der zweite Abschnitt beleuchtet Körners Tätigkeit als Redakteur der Monatszeitschrift<br />
Donauland zwischen 1916 und 1919“ (ebd.: 388) resümiert<br />
der Herausgeber, meint damit aber wohl Körners gesamte dreijährige<br />
Dienstzeit im k. u. k. Kriegsarchiv; denn als Redakteur der ILLUSTRIERTEN<br />
MONATSSCHRIFT konnte er erst ab März 1917 tätig werden, als das erste<br />
Heft des DONAULAND erschien.<br />
Außer der recht wenig besagenden Feststellung, dass er im Kriegsarchiv<br />
„Kanzleiarbeiten“ (ebd.: 399) zu leisten hatte, wird von Körners Arbeit im<br />
Kriegsarchiv so gut wie nichts „beleuchtet“, obwohl er ja bereits „Anfang<br />
1916“ (399) in diese „Heldenbeschreibungsanstalt“, wie Kraus sie in einem<br />
Brief an Sidonie von Nádherny verächtlich nannte, versetzt worden war,<br />
also genau zur gleichen Zeit wie Rainer Maria Rilke, der in einem „arg bekümmerten“<br />
Brief vom 15. Februar 1916 an seinen Verleger Anton Kippenberg<br />
über den dortigen „Dicht-Dienst“ des „Heldenfrisierens“ zu berichten<br />
hatte. Der ehrgeizige und umtriebige Oberst Alois Veltzé (1864–1927),<br />
in Personalunion Mitherausgeber des Donauland und Vorstand der „Schriftenabteilung“<br />
des k. u. k. Kriegsarchivs, leitete auch deren Unterabteilung,<br />
die so genannte „Literarische Gruppe“, der im Laufe der Kriegsjahre zahlreiche<br />
namhafte Schriftsteller und erfolgreiche Journalisten angehörten, u.<br />
a. Rudolf Hans Bartsch, Franz Karl Ginzkey, Paul Stefan Grünfeld, Geza<br />
Silberer (Sil-Vara), Alfred Polgar, Franz Theodor Csokor und nicht zuletzt<br />
der „Titularfeldwebel“ Stefan Zweig, den Körner wohl erst seit dieser Zeit<br />
„mein Freund“ (219) titulieren konnte.<br />
Unbedingt bemerkt zu werden hätte auch verdient, dass DONAULAND schon<br />
wenige Wochen nach seinem ersten Erscheinen, bereits Mitte Mai 1917,<br />
zum Merkziel der Satire in der FACKEL von Karl Kraus geworden war und<br />
das bis in die ersten Nachkriegsjahre hinein auch leitmotivisch blieb. „Donauland“,<br />
so lautet gleich eingangs die satirische Definition dieser Zeitschrift<br />
in der Glosse „Literaten unterm Doppelaar“, „Donauland betitelt<br />
sich die Kriegsdienstleistung der zur Literatur Untauglichen, die jetzt in<br />
einem Bureau der Mariahilferstraße – man gönnt's ihnen – die Zukunft<br />
Österreichs nebbich schmieden.“ (KRAUS 1917: 22) Es darf vermutet werden,<br />
dass der FACKEL-Leser Franz Kafka diese Kriegs-, Literatur- und<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
Kriegsliteratursatire zu Kenntnis genommen hatte, als er Ende 1917 eine<br />
Mitarbeit an dieser Zeitschrift ablehnte (KÖRNER 2001: 403, Anm. 44.).<br />
Zu den Gründen solcher Ablehnung gehörte auch, was er bereits Anfang<br />
1917 in einem Briefentwurf zum Ausdruck gebracht hatte:<br />
ich bin nämlich nicht imstande, mir ein im Geiste irgendwie einheitliches Groß-Österreich<br />
klarzumachen und noch weniger allerdings, mich diesem Geistigen ganz eingefügt zu denken,<br />
vor einer solchen Entscheidung schrecke ich zurück. (KAFKA 1993: 336f.)<br />
3.3. Studien zu Arthur Schnitzler<br />
Nicht in der – erst 1925 von Willy Haas begründeten – LITERARISCHEN<br />
WELT (KÖRNER 2001: 405), wie es in diesem zweiten Abschnitt des „biographischen<br />
Umrisses“ irrtümlich heißt, sondern in Ernst Heilborns<br />
LITERARISCHEM ECHO (wie die dazugehörige Anmerkung 49, ebd., richtig<br />
ausweist), ist am 1. April 1917 Josef Körners erster Text zum Thema Arthur<br />
Schnitzler erschienen, die kritische Studie „Arthur Schnitzler und Siegmund<br />
[!] Freud“ (ebd.: 357). Sie sowie eine Ende 1917 im DONAULAND veröffentlichte<br />
Besprechung der Schnitzlerschen Komödie Fink und Fliederbusch<br />
(ebd.: 374) und schließlich die Ende 1918 ebenfalls im DONAULAND publizierte,<br />
vom Herausgeber in seine „Schriften“-Auswahl aufgenommene Abhandlung<br />
„Arthur Schnitzlers Gestalten und Probleme“ (ebd.: 67–83) waren<br />
die „Aufsätze“, die nach Josef Körners – ebenfalls in die Auswahl aufgenommenen<br />
– späteren „Persönlichen Erinnerungen an Arthur Schnitzler“<br />
(ebd.: 133–136) „dann zu einem umfänglicheren Buche zusammenflossen,<br />
das zufällig im Jahre seines 60. Geburtstages herauskam.“ (ebd.: 133).<br />
Es hätte laut Vorankündigung als XXIII. Band der Amalthea-Bücherei bereits<br />
im Herbst 1921 erscheinen sollen, wurde dann aber doch erst im März<br />
1922 ausgeliefert, also annähernd sechs Monate vor der erst im September<br />
1922 vorliegenden, Thomas Mann gewidmeten und von diesem empfohlenen,<br />
von Josef Körner jedoch kritisch „abgelehnten“ (KÖRNER 1949: 502)<br />
Studie des mit Arthur Schnitzler eng befreundeten Richard Specht, Arthur<br />
Schnitzler. Der Dichter und sein Werk, so dass es als der Festbeitrag zum<br />
bevorstehenden Geburtstag des Dichters (13. Mai 1922) gelten konnte. Die<br />
Bibliographie, die es nicht unter diesem „Jahre des 60. Geburtstages“, also<br />
nicht unter 1922, sondern nach dem Copyright-Vermerk unter 1921 verzeichnet<br />
(KÖRNER 2001: 359), lässt solche Zusammenhänge nicht erkennen,<br />
zumal zu diesem Werk – anders als bei der Mehrzahl der übrigen –<br />
kein Verzeichnis von Rezensionen angefügt ist.<br />
Generell macht sich in dem bibliographischen „Verzeichnis der Veröffentlichungen<br />
Josef Körners“ (ebd.: 351–384) wie auch im Anmerkungsapparat<br />
des „biographischen Umrisses“ (ebd.: 385–461) bisweilen ärgerlich störend<br />
bemerkbar, dass Texte, die in Periodica erschienen sind, fast stets nur mit<br />
273
274<br />
Kurt Krolop<br />
Seitenangaben innerhalb des jeweiligen Jahres-, Halbjahres- oder Quartalsbandes<br />
registriert werden und darüber hinaus eine noch präzisere Datierung,<br />
die oft sehr kontextrelevant sein könnte, bedauerlicherweise nicht erlauben.<br />
Während z. B. Josef Körner selbst in seinem Handbuch (KÖRNER 1949:<br />
502) die oben erwähnte Rezension der Schnitzler-Monographie von Richard<br />
Specht in den Preußischen Jahrbüchern konkret „November 1923“ datiert,<br />
muss man bei Klausnitzer aus der Quartalbandangabe „Oktober-Dezember<br />
1923“ (KÖRNER 2001: 376) den Monat erraten, ohne sicher sein zu können,<br />
ihn auch richtig getroffen zu haben.<br />
Wie in der Reproduktion des Aufsatzes Dichtung und Dichter im deutschen<br />
Prag (ebd.: 55–66) so sind auch im Abdruck der Studie Arthur Schnitzlers<br />
Gestalten und Probleme (ebd.: 67–83) aus dem Donauland offenbar bereits<br />
dort unterlaufene Fehlzitate vom Herausgeber unkorrigiert übernommen<br />
worden, also z. B. Seite 74 Doktor Gräßler anstatt Doktor Gräsler oder Seite<br />
78 Frau Berta und ihr Sohn anstatt Frau Beate und ihr Sohn; ferner Seite<br />
81–82 Abweichungen in Schnitzler-Zitaten von deren Textvorlage.<br />
Mit der auf Wertungen (etwa der Dichtersprache Schnitzlers) keineswegs<br />
verzichtenden Reminiszenz „Persönliche Erinnerungen an Arthur Schnitzler“<br />
(ebd.: 133–136) fanden nicht nur die Schnitzler-Studien Josef Körners,<br />
sondern auch dessen publizierte Beiträge zum Bereich des „Gegenwartsschrifttums“<br />
(ebd.: 364) ihren Abschluss. Klausnitzer hat versucht, den<br />
Standpunkt, von dem aus Josef Körner seine Wertungen zeitgenössischer<br />
Literatur vornahm, als Erscheinungsform einer allgemeineren Generationssymptomatik<br />
zu deuten:<br />
Als Angehöriger dieser Generation [der zwischen 1880 und 1890 Geborenen, K. K.], die sich<br />
nach dem expressionistischen Aufbruch in unterschiedlichen Lagern des politischen Spektrums<br />
wiederfand, partizipierte Körner aber weit eher an religiös begründeten Reintegrationsbemühungen<br />
als an den exklusiven Entdifferenzierungsprojekten der völkischen Bewegung. (ebd.: 411)<br />
Deutlich werde das in Körners Aufsatz über Zacharias Werner, „der eine<br />
Parallele zwischen romantischen und expressionistisch-gegenwärtigen<br />
Heilserwartungen zog“ (ebd.: 411).<br />
Dass Körner diese Parallele zog, besagt indessen keineswegs, dass er an<br />
einem der beiden Heilserwartungsphänomene, zwischen denen diese Parallele<br />
gezogen wurde, in irgendeiner Form „partizipiert“ hätte. In Schnitzlers<br />
Tagebuch findet sich unter dem 22. Dezember 1924 die Notiz: „Prof. Körner<br />
[...] über die Gottsucher (und dass ich ‚Gott sei Dank‘ keiner bin).“ Und<br />
im gleichen Sinne wird es in einem Brief an Käte Hamburger zwei Jahrzehnte<br />
später explizit heißen:<br />
Weder Werfels theologische Reaktion gegen den ‚naturalistischen Nihilismus‘ unserer Zeit,<br />
noch Th. Manns areligiöse Religiosität halte ich für mögliche Rettungen aus einem (scheinbaren<br />
oder wirklichen) geistig-sittlichen Chaos. Wir können nicht zurück (der klassische Versuch<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
dieser Art innerhalb der deutschen Geistesgeschichte heißt Friedrich Schlegel, und wie sehr<br />
spricht dieser dagegen!), wir müssen weiter voran [...] Die Gottesfiktion ist unhaltbar geworden<br />
[...], und darum gibt es kein Zurück zur Theologie, sondern nur ein resolutes Weiterschreiten<br />
innerhalb der Anthropologie. (ebd.: 238f.)<br />
Klarer lässt sich die Ablehnung jeglicher Teilhabe an „religiös begründeten<br />
Reintegrationsbemühungen“ wohl kaum formulieren.<br />
4. Zu Körners Forschung und Lehre 1919–1939<br />
Den umfangreichsten Teil des „biographischen Umrisses“ nimmt mit Recht<br />
dessen „dritter Abschnitt“ ein, überschrieben: „Gymnasialprofessor und<br />
Hochschullehrer in Prag: Produktive Jahre 1919–1939“ (ebd.: 413–449).<br />
Zwischen der Schilderung der „Bemühungen um Friedrich Schlegel“ (ebd.:<br />
415–423), d. h. vor allem um eine bereits 1928 in Aussicht gestellte „kritische<br />
Gesamtausgabe“ dieses Autors, und dem Bericht über den im Sommer<br />
1929 geglückten „Fund von Coppet“ (ebd.: 446–449), dem auch ein in die<br />
Textauswahl aufgenommener Artikel Körners in den MÜNCHNER (nicht:<br />
MÜNCHENER!) NEUESTEN NACHRICHTEN gilt (ebd.: 117–121: „Auferstehende<br />
Romantik!“), steht im Zentrum die ausführlichste Darstellung, die<br />
Josef Körners „Zweifacher Habilitationsversuch“ (ebd.: 423–445) an der<br />
Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag bisher in der Sekundärliteratur<br />
erfahren hat. Überaus wertvolle Ergänzungen des zu diesem<br />
Thema – vor allem im Jubiläumsheft 1/1994 des EUPHORION – wissenschaftsgeschichtlich<br />
bereits Recherchierten und Interpretierten erbringt hier<br />
vor allem die Auswertung einschlägigen Materials aus dem Archiv der Prager<br />
Karls-Universität.<br />
In der genetischen Darlegung dieser hochschulpolitisch so besonders symptomatischen<br />
Affaire hätte ganz gewiss auch Erwähnung (und entsprechende<br />
Berücksichtigung im „Personenregister“) der nicht unwesentliche Umstand<br />
verdient, dass der im Zusammenhang mit Körners erstem<br />
Habilitationsversuch von 1924/25 mehrfach erwähnte „Dekan“ (vgl. ebd.:<br />
430, Anm. 115–116; 430, Anm. 120–122) der führende Slavist der Prager<br />
deutschen Universität gewesen ist, Franz Spina (1868–1938), der dann von<br />
1926 bis 1938 auch als Minister der tschechoslowakischen Regierung angehörte,<br />
während es sich bei dem „Dekan“ (ebd.: 445), der nach dem Eintreten<br />
des Philosophen Oskar Kraus (1872–1942), des klassischen Philologen<br />
Siegfried Reiter (1863–1943) sowie des weltberühmten Orientalisten und<br />
Indologen Moritz Winternitz (1863–1937) für Josef Körner im Sommer<br />
1929 die Wiederaufnahme von dessen Habilitationsverfahren verfügte, um<br />
Arthur Stein (1871–1950) handelte, der in Briefen an Käte Hamburger als<br />
„Althistoriker“ (ebd.: 303) und „einer der vordersten, wenn nicht überhaupt<br />
der vorderste Epigraphiker unserer Zeit“ (ebd.: 292) auftauchen wird, ohne<br />
275
276<br />
Kurt Krolop<br />
beim Namen genannt, vom Herausgeber aber auch nicht identifiziert und<br />
attribuiert zu werden, so dass er im „Personenregister“ ebenfalls nicht angeführt<br />
erscheint.<br />
Zu den bedauerlichsten Lücken im Verzeichnis der Rezensionen wie auch<br />
im Kontext des „biographischen Umrisses“ gehört in diesem Zusammenhang<br />
das Fehlen der ungewöhnlich ausführlichen, sechs besonders kompress<br />
gedruckte Seiten umfassenden Besprechung, die der germanistische<br />
Ordinarius der Prager tschechischen Karls-Universität Josef Janko (1869–<br />
1947, nicht Janke, wie auf Seite 359 zu lesen!) in dem von ihm mitgeleiteten<br />
Neophilologen-Organ ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII im Juni 1926,<br />
also noch zu Lebzeiten August Sauers, der von Josef Körner 1924 auch als<br />
erste Habilitationsschrift vorgelegten Monographie Klassiker und Romantiker<br />
gewidmet hat. Mit dieser vorbehaltlos zustimmenden Rezension, mit<br />
den gleichfalls durchwegs positiven Würdigungen Josef Körners durch den<br />
jüngeren literarhistorischen Ordinarius Otokar Fischer (1883–1938) sowie<br />
dessen „Kronprinzen“ Vojtěch Jirát (1902–1945, vgl. z. B. die vom Herausgeber<br />
ebenfalls nicht erfasste Anzeige der „Krisenjahre“ in der Tageszeitung<br />
ČESKÉ SLOVO vom 4. Februar 1937) war die Solidarität der Prager<br />
tschechischen Germanistik mit Körner in dessen Kontroversen sowohl mit<br />
August Sauer als auch mit Sauers Prager Nachfolger Herbert Cysarz deutlich<br />
genug markiert und artikuliert.<br />
Gleichwohl wird man dem vom Herausgeber übernommenen Urteil Konstanze<br />
Fliedls, die in Hinblick gerade auf August Sauer von einer „kaum<br />
noch verhüllten antisemitischen Prager Institutspolitik“ (ebd.: 425) gesprochen<br />
hat, so generell nicht zustimmen können; denn schließlich war der von<br />
Sauer ganz dezidiert bevorzugte Habilitationsanwärter Georg Stefansky<br />
(1897–1957) ebenso jüdischer Herkunft wie der ein Jahrzehnt ältere Körner<br />
und Sauer selbst galt bei völkischen Studenten wo nicht geradezu als Jude,<br />
so doch als eindeutig philosemitisch. Auch das Fehlurteil, Sauers Werbungsruf<br />
von 1907 „Deutsche Studenten – nach Prag!“ (ebd.: 439) als Appell<br />
eines „nationalkonservativen Aktivisten“ (ebd.: 439) zu interpretieren,<br />
zeugt von einer gründlichen Verkennung der Prager politischen Konstellation<br />
um 1900, in der die Losung der radikalsten nationalistischen „Aktivisten“<br />
– in bewusster Analogie zum antiklerikalen „Los von Rom!“ – vielmehr<br />
„Los von Prag!“ lautete, weil man die Hauptstadt Böhmens nicht nur<br />
wegen ihrer erdrückenden tschechischen Bevölkerungsmehrheit, sondern<br />
auch wegen der nach wie vor ungebrochen liberalen kommunalpolitischen<br />
Dominanz innerhalb der deutschsprachigen (weithin deutschjüdischen)<br />
Minderheit jederzeit preiszugeben bereit war zugunsten eines Universitätsstandorts<br />
in einer kompakt deutschsprachigen Region.<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
In einem Abschnitt des „biographischen Umrisses“, dessen Überschrift mit<br />
der Berufsbezeichnung „Gymnasialprofessor“ beginnt, hätte man gern auch<br />
etwas über die im „Verzeichnis der Veröffentlichungen“ durch mehrere<br />
Beiträge ausgewiesene Wirksamkeit des Philologen als Lehrer, Methodiker<br />
und Didaktiker im „höheren Schulwesen“ erfahren, z. B. über den auf Seite<br />
365 verzeichneten Aufsatz Der Schüler Gerber wird gerächt, mit dem Körner<br />
in die Debatten um Friedrich Torbergs unmittelbar vorher erschienenen,<br />
auf Prager Realien beruhenden, vieldiskutierten Erstlingsroman Der Schüler<br />
Gerber hat absolviert (1930) eingegriffen hat.<br />
In einem Brief Josef Körners an Käte Hamburger vom 25. Februar 1949<br />
heißt es auf bezeichnende Weise: „einst war mir Vortragen höchste Lust,<br />
ich verstand, Zuhörerschaft in Bann zu schlagen und das Bewußtsein solcher<br />
Beherrschung der Masse zu genießen.“ (ebd.: 312). In der im Goethe-<br />
Jahr 1932 gehaltenen, unter dem Titel Goethe und Ihr in der „Staatlichen<br />
Verlagsanstalt“ (nicht Versicherungsanstalt, wie es auf Seite 367 unbegreiflicherweise<br />
heißt) veröffentlichten „Rede an die studierende Jugend“ (gemeint<br />
ist hier nicht die Universitätsstudentenschaft, sondern nach gesamtösterreichischem<br />
und auch tschechischem Sprachgebrauch die Schuljugend<br />
höherer Lehranstalten) liegt in Gestalt einer Gedenk- und Festansprache ein<br />
Zeugnis der Rhetorik gymnasialprofessoralen „Vortragens“ vor, das als offensichtlich<br />
einzige überlieferte Probe dieser Textsorte schon deshalb (aber<br />
auch wegen des begrenzten Umfangs) Aufnahme in die notgedrungen<br />
knappe Textauswahl des Bandes verdient hätte, zumal da hier schon die in<br />
jedem Sinne „tiefe Skepsis“ (ebd.: 190) zum Ausdruck kommt, mit der<br />
Körner bereits 1932 und seither immer „realistischer“ (ebd.: 220) die zeitgeschichtlichen<br />
Vorgänge auf dem abendländischen Kontinent beobachtet,<br />
beurteilt und selber erlitten hat, „in dieser Epoche der Rebarbarisierung Europas,<br />
der Atempause zwischen einem die europäische Gesittung untergrabenden<br />
Weltkrieg und einem schon herandonnernden künftigen, der sie, ja<br />
die physische Existenz der Kulturmenschheit überhaupt zu vernichten<br />
droht.“ (KÖRNER 1932: 4)<br />
Nach Erlangung der venia docendi im August 1930 nahm Körner mit dem<br />
Sommersemester 1931 als Privatdozent und Titularprofessor am Seminar<br />
für deutsche Philologie der Deutschen Universität in Prag seine nicht ganz<br />
16 Semester währende Lehrtätigkeit auf, die bereits vor Abschluss des Wintersemesters<br />
1938/39 ihr erzwungenes Ende fand. Als einziger Germanist<br />
jüdischer Herkunft unter seinen Seminarkollegen war er von der wenige<br />
Wochen nach dem Diktat von München (30. September 1938) einsetzenden<br />
nazistischen Gleichschaltung der Prager Deutschen Universität unmittelbar<br />
betroffen und wurde schon „im Herbst 1938, als das Reich deren Verwaltung<br />
übernahm, auf Grund des Arierparagraphs [sic] aus dem Lehrkörper<br />
277
278<br />
Kurt Krolop<br />
ausgeschieden“ (KÖRNER 2001: 283), also keineswegs erst nach dem<br />
„Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Prag am 15. März 1939“ (ebd.:<br />
449), wie der Herausgeber im Widerspruch zu dem von ihm edierten Text<br />
behauptet. Nicht bloß eine „böse Vorahnung des Kommenden“ (ebd.: 453,<br />
Hervorhebung K. K.) musste demnach „den Prager Germanisten erfüllt haben“<br />
(ebd.: 453), als er Mitte November 1938 seine „Autobibliographie<br />
1911–1938“ als resümierenden „Schaffensbericht“ verfasste, sondern bereits<br />
die schmerzliche Gewissheit des vorzeitigen Endes einer ohnehin<br />
missgünstig verzögerten und behinderten akademischen Laufbahn. Der Periodisierungseinschnitt,<br />
von dem an der Herausgeber Josef Körners „Bittere<br />
Jahre 1939–1950“ (ebd: 449) beginnen lässt, wäre infolgedessen auf 1938<br />
vorzuverlegen.<br />
„Literaturgeschichtliche Übersichtsvorlesungen lehnte Körner ab“ (ebd.:<br />
446) stellt Klausnitzer unter Hinweis auf einen Brief an Bernhard Blume<br />
vom 15. Mai 1948 summarisch fest. Dass Körner solche „Übersichtsvorlesungen“<br />
nicht sehr hoch schätzte, besagt jedoch keineswegs, dass sie in seinem<br />
Lehrveranstaltungsangebot gänzlich gefehlt hätten. Vielmehr las er<br />
gleich in den ersten vier Semestern seiner Privatdozentur (Sommersemester<br />
1931 bis Wintersemester 1932/33) über die Geschichte des deutschen Romans<br />
im 18. und 19. Jahrhundert und für die Wintersemester 1936/37 sowie<br />
1938/39 war ein Kolleg über die „Geschichte der deutschen Romantik in<br />
weltliterarischer Sicht“ angekündigt: Lehrveranstaltungen also, denen man<br />
den Charakter von „literaturgeschichtlichen Übersichtsvorlesungen“ kaum<br />
wird absprechen können.<br />
5. Zu Körners Isolation und Verfolgung 1938–1945<br />
Hatte Körner alle Aussicht auf ein akademisches Lehramt endgültig durch<br />
den Beschluss der tschechoslowakischen Regierung vom 27. Januar 1939<br />
verloren, der die Zwangsentlassung aller Staatsbediensteten jüdischer Herkunft<br />
verfügte, so war er durch die bereits am 17. März 1939 erfolgte Übernahme<br />
aller seit 1933 angeordneten antijüdischen Diskriminierungs- und<br />
Restriktionsvorschriften des Hitler-Regimes durch die Protektoratsregierung<br />
darüber hinaus auch noch, wie Herbert Cysarz es überaus euphemistisch<br />
formulierte, „in die einsame Studierstube gescheucht“ (ebd.: 452), d. h.,<br />
weniger verblümt ausgedrückt, von nun an – genau wie sein Dresdener Kollege<br />
und Korrespondenzpartner Victor Klemperer – ebenfalls vor allem dem<br />
im „Großdeutschen Reich“ bereits Ende 1938 erlassenen Verbot der Benutzung<br />
von Bibliotheken, Archiven und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
unterworfen.<br />
Dank seiner nichtjüdischen tschechischen Ehefrau, die ihn nicht verließ,<br />
blieb Josef Körner – anders als seine Fakultätskollegen Siegfried Reiter,<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
Arthur Stein und Emil Utitz, der „Goedeke“-Bibliograph Alfred Rosenbaum,<br />
der „letzte große Meister deutscher Bücherkunde“ (KÖRNER 1949:<br />
5) sowie der Nestor der Prager tschechischen Germanistik Arnošt Kraus –<br />
von einer Deportation nach Theresienstadt einstweilen noch verschont und<br />
wurde erst am 4. Februar 1945 – zusammen mit anderen jüdischen Partnern<br />
sogenannter „Mischehen“ – von dem zweiten der insgesamt neun „Arbeitseinsatztransporte“<br />
(„AE“) erfasst, die zwischen Ende Januar und Mitte<br />
März aus Prag, Mährisch Ostrau (Ostrava), Olmütz (Olomouc) und Lípa<br />
nach Theresienstadt abgingen, ohne dass es dann noch zu einem Weitertransport<br />
der „arisch Versippten“ (wie der LTI-Terminus lautete) in ein<br />
Vernichtungslager gekommen wäre. Erst am Tage des Waffenstillstands,<br />
dem 8. Mai 1945, wurden Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt<br />
durch sowjetische Truppen auf deren Vormarsch nach Prag befreit.<br />
Seine Feststellung, dass „nach 1939 die offene Erinnerung an die Leistungen<br />
des als Juden [sic] aus dem akademischen Diskurs ausgegrenzten Körner<br />
unmöglich geworden war“ (KÖRNER 2001: 453), hat der Herausgeber<br />
selbst durch die Anmerkung relativiert, dass Bernard von Brentanos 1943<br />
erschienene August-Wilhelm-Schlegel-Biographie eine „Würdigung des<br />
Prager Philologen“ sowie Hinweise auf „Körners Briefausgaben und Monographien“<br />
(ebd.: 454) enthalte. Keineswegs systematisch angestellte Stichproben<br />
vermögen darüber hinaus nachzuweisen, dass in dieser Zeit auch<br />
andernorts auf Josef Körner mit voller Namensnennung Bezug genommen<br />
wurde, so z. B. durch Benno von Wiese im Kommentarband seiner Hebbel-<br />
Ausgabe (HEBBEL 1941: 273) oder durch Julius Petersen in seiner Methodenlehre<br />
Die Wissenschaft von der Dichtung (1939), auch noch in deren von<br />
Erich Trunz besorgten 2. Auflage (PETERSEN 1944: 97, 169). Es gehörte<br />
dazu offenbar nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als ein gewisses<br />
Mindestmaß an intellektueller Redlichkeit und Zivilcourage, das freilich die<br />
Mehrzahl der Zunftgenossen nach Körners harter, aber gerechter Einschätzung<br />
damals vermissen ließ.<br />
Bewundernswert und unvergessen verdient die geistige Energie und Aktivität<br />
zu bleiben, die Josef Körner sich selbst unter den extremsten Bedingungen<br />
repressiver Ab- und Ausgesperrtheit gleichwohl noch bewahrt hat.<br />
Zu der Arbeit an einer „geplanten großen Poetik“ (KÖRNER 2001: 209),<br />
die bereits 1937 unter ihrem hinfort beibehaltenen Titel „Dichtung als Ausdrucksgebilde“<br />
in der methodologischen „Einleitung“ zu der Übungstextsammlung<br />
„Wortkunst ohne Namen“ (Prag 1937: 11) als „demnächst“ erscheinend<br />
angekündigt worden war, gesellten sich weitere Buchprojekte<br />
von zum Teil ganz erstaunlicher Weite und Vielfalt des Gegenstandsbereichs<br />
wie der Themenstellung: allen voran der Plan eines „Wertebuchs“<br />
(KÖRNER 2001: 238), dessen Obertitel schon 1942 „ziemlich fest“ (ebd.:<br />
279
280<br />
Kurt Krolop<br />
454) stand, so dass er 1946, lediglich ergänzt durch einen erläuternden Untertitel,<br />
in unverändertem Wortlaut von neuem angeführt werden konnte:<br />
„Wert und Werturteil in Wirtschaft, Wissenschaft, Sittlichkeit und Kunst.<br />
Versuch einer Grundlegung von Ökonomik, Poetik, Ethik und Ästhetik“<br />
(ebd.: 194); ferner „noch ein anderer Plan: ‚Technik und Politik, ein Versuch<br />
über den Lebenswert der Geisteswissenschaften‘“ (ebd.: 194), dem<br />
nach Kriegsende noch eine weitere „‚Staats‘-Schrift“ (ebd.: 267) vorangehen<br />
sollte, eine „politische Schrift“ (ebd.: 266) mit dem sprechenden Titel<br />
„Schuld und Sühne“, in mancher Hinsicht wohl eine Vorwegnahme dessen,<br />
was Theodor W. Adorno später als „Aufarbeitung der Vergangenheit“ thematisiert<br />
und reflektiert hat.<br />
An spezifisch literarhistorisch-monographischen, wie die „große Poetik“<br />
ebenfalls bereits in die Zwischenkriegsjahre zurückweisenden Arbeiten hat<br />
Körner neben dem ältesten, bereits 1922 angekündigten Projekt dieser Art,<br />
„Der Dichter der Lucinde / Friedrich Schlegel als Poet und Poetiker“ (ebd.:<br />
200; vgl. auch KÖRNER 1949: 313), vor allem auf sein geplantes „Heine-<br />
Buch“ (ebd.: 273) verwiesen sowie auf ein „Schillerbuch“ (ebd.: 206) unter<br />
dem in Aussicht genommenen Titel „Der unvollendete Schiller“ (ebd.: 193),<br />
von dem Körner noch in seinem letzten Lebensjahr die Arbeit an einem<br />
Problemkomplex beschäftigte, der die Überschrift erhalten sollte: „Die ästhetische<br />
Erlösung. Schillers Denken und Dichten vom Lebenswert der<br />
Kunst“ (ebd.: 326).<br />
Alle diese größeren literaturwissenschaftlichen Arbeiten standen im Zeichen,<br />
ja, man darf wohl sagen geradezu im Dienste von Bestrebungen, das<br />
Verfahren einer „integralen Motivanalyse“ (ebd.: 344) als die via regia literarischer<br />
Interpretation und Wertung zu erweisen und zu erproben. Ein klärendes<br />
Wort darüber, was Körner eigentlich begrifflich verstanden wissen<br />
wollte, wenn er diese Methode als „meine Motivanalyse“ (ebd.: 277, Hervorhebung<br />
K. K.) bezeichnete, wäre wohl im Nachwort am Platze gewesen,<br />
eventuell auch die Aufnahme der ihrem Verfasser methodisch besonders<br />
„wichtigen Einleitung“ (ebd.: 192) zu dem Band „Wortkunst ohne Namen“<br />
in die Textauswahl.<br />
6. Zu Körners letzten Lebens- und Schaffensjahren<br />
Von den „Briefen an Käte Hamburger“ (ebd.: 189–348) heißt es, sie gäben<br />
über die letzten fünf Lebens- und Schaffensjahre Körners „bessere Auskunft<br />
als jeder historische Berichterstatter es könnte“ (ebd.: 458). Das trifft wohl<br />
zu, allerdings unter einer wichtigen Voraussetzung, die der erfahrene Herausgeber<br />
Körner gelegentlich der umfangreichsten seiner eigenen Briefeditionen,<br />
der „Krisenjahre der Frühromantik“, gemacht hat, dass nämlich deren<br />
„Textbände unverständlich und wissenschaftlich unbenützbar“ (ebd.:<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
193) seien ohne einen umfassenden und zuverlässigen Kommentar: eine<br />
Voraussetzung, die in dieser Briefedition, wie an zahlreichen Beispielen zu<br />
zeigen wäre und an einigen wenigen auch gezeigt werden soll, leider nur<br />
sehr unzureichend gegeben ist.<br />
Insgesamt gehören diese Briefe ohne Zweifel zu den lebens-, zeit- und wissenschaftsgeschichtlich<br />
aufschlussreichsten, aber auch bestürzendsten und<br />
erschütterndsten Zeugnissen aus den ersten Prager (und nicht nur Prager)<br />
Nachkriegsjahren, die zugleich Körners letzte Lebensjahre gewesen sind.<br />
Sie berichten davon, wie nach Kriegsende „die radikale Lösung der Deutschenfrage<br />
hierzulande rücksichtslos auch die (sei’s noch so antinazistisch<br />
gesinnten und tätigen) Juden deutscher Kulturzugehörigkeit einbegreifen“<br />
wollte, was den Briefschreiber und „die (nichtjüdische, tschechische) Gattin<br />
ernstlich an Selbstmord denken ließ“ (ebd.: 191); wie die Tschechen nach<br />
Aufhebung der Deutschen Universität Prag „von den paar überlebenden<br />
jüdischen Dozenten [...] aus allen möglichen (natürlich lauter unsachlichen<br />
Gründen) niemanden an die Karlsuniversität übernommen“ hätten (ebd.:<br />
283); dass „der tschechische Nazismus, wie er seit Kriegsende hier wütet<br />
[...], gewiß nicht so brutal wie der deutsche, aber moralisch und intellektuell<br />
von derselben Faktur, [...] mit seinem Deutschen- und Magyarenhaß jede<br />
europäische Friedens- und Zukunftspolitik im voraus illusorisch“ mache<br />
(ebd.: 249).<br />
Im Unterschied zu seinem Prager Fakultätskollegen und Theresienstädter<br />
Schicksalsgenossen Emil Utitz haben bei Josef Körner die Leidenserfahrungen<br />
von Krieg und Verfolgung zu keinerlei linksorientierten Sympathien für<br />
sozialistische oder gar kommunistische Gesellschaftskonzepte geführt. Mit<br />
den „ausgezeichneten Schriften von Ludwig v. Mises“ (1881–1973) war für<br />
ihn der „theoretische Nachweis der Unhaltbarkeit sämtlicher sozialistischer<br />
Doktrinen, der tatsächlichen Undurchführbarkeit ihrer nicht durchdachten,<br />
aber umso verführerischen [sic! muss wohl heißen: verführerischeren] Programme“<br />
(ebd.: 221) schon längst unwiderleglich erbracht, und dass bei der<br />
„Neueinrichtung der ČSR“ (ebd.: 247) nicht rechtzeitig Sorge getragen<br />
wurde, dass nicht „die Fahrt unter stürmischem Wind schon jäh in die Totalität“<br />
(ebd.: 266) des Kommunismus führe, erschien ihm kaum weniger bedrohlich<br />
als der militärisch überwundene, aber nach Körners Überzeugung<br />
aus den Köpfen noch keineswegs verschwundene Geist des nazistischen<br />
Totalitarismus.<br />
Wenn Körner 1948 die italienischen Wahlen zu den „schweren Prüfungen“<br />
(ebd.: 274) zählt, dann ist die darin enthaltene Wertung nicht so zu verstehen<br />
und zu erläutern, wie Klausnitzer das in seiner einschlägigen Anmerkung<br />
getan hat, nämlich dass die Christdemokraten mit 48,5 % der Stimmen<br />
die Mehrheit erzielten, während Sozialisten und Kommunisten „zusammen<br />
281
282<br />
Kurt Krolop<br />
nur auf 31 %“ (ebd.: 274, Hervorhebung K. K.) gekommen seien, sondern<br />
aus Körners Sicht mit genau der entgegen gesetzten Akzentuierung: dass<br />
nämlich die Christdemokraten mit nur 48,5 % die absolute Mehrheit verfehlt<br />
haben, während es der linken Volksfront gelungen ist, einen bedrohlich<br />
hohen Stimmenanteil von 31 % zu erringen – nur so ergibt das den von dem<br />
dezidierten Antikommunisten mit den „schweren Prüfungen“ gemeinten<br />
Sinn.<br />
Neben solchen Sinnverfehlungen stößt man, wie bei dieser Gelegenheit<br />
vermerkt sei, auch auf Pseudokommentare des Herausgebers, die Informationen<br />
bieten, welche mit dem zu erläuternden Sachverhalt unmittelbar<br />
überhaupt nichts zu tun haben, wie z. B. die Mitteilung, dass Léon Blum<br />
1936/37 „der erste sozialistische (und jüdische) Premierminister Frankreichs“<br />
(ebd.: 232) gewesen sei, nicht das Geringste zur Erklärung des am<br />
31. August 1946 geschriebenen Satzes beiträgt: „Eben lese ich Blums Niederlage“<br />
(ebd.: 232). Und auch die Information, dass Thomas Mann 1949 in<br />
Frankfurt am Main und Weimar gefeiert worden sei, ist völlig irrelevant für<br />
die Erläuterung des Stichworts „Mann-Promotion“ (ebd.: 329), womit vielmehr<br />
die Promotion Manns zum Ehrendoktor der schwedischen Universität<br />
Lund am 27. Mai 1949 gemeint ist.<br />
Gänzlich unkommentiert bleibt darüber hinaus die Mehrzahl der Hinweise<br />
und Anspielungen auf aktuelle weltpolitische Ereignisse des ersten Nachkriegsjahrfünfts,<br />
die dem Briefschreiber Körner zum Anlass seiner äußerst<br />
skeptischen Zeitgeschichtsdiagnosen und -prognosen gedient haben, wie<br />
zum Beispiel am 04.05.1946 der „Beginn der Pariser Pourparlers“ (ebd.:<br />
211); am 16.07.1946 „die in mancher Hinsicht noch die Nazis übertreffenden<br />
Judenmassaker in Polen“ (ebd.: 225); am 24.08.1946 „die Radio-<br />
Nachricht, dass Tito das amerikanische Ultimatum abgelehnt hat“ (ebd.:<br />
229); am 29.09.1946 „Churchill in Zürich“ (ebd.: 242); am 02.10.1946 das<br />
„geradezu furchtbare Ereignis der Wallace-Rede“ (ebd.: 246); am<br />
16.01.1947 „die Moskauer Konferenz“ (ebd.: 253) und die „Montgomery-<br />
Reise“ (ebd.: 253); am 05.11.1948 „Trumans überraschende Wiederwahl“<br />
(ebd.: 302) oder am 09.01.1949 der „unerwartete, in den Auswirkungen<br />
noch unabsehbare Sieg Frankreichs in der Ruhrfrage“ (ebd.: 305).<br />
Abgesehen davon, dass manche der in den Brieftexten erwähnten Personen<br />
wie z. B. Eudo C. Mason (ebd.: 318, s. KÖRNER 1949: 488 und 489) oder<br />
Charlotte Bühler (ebd.: 339, s. KÖRNER 1949: 72) vom „Personenregister“<br />
gar nicht erfasst sind, kommt es dort auch zu einigen Fehlidentifikationen<br />
bzw. -attribuierungen. 3 Eine „Editorische Notiz“ (ebd.: 188) zum Abdruck<br />
3 So handelt es sich etwa bei „Ebbinghaus“ (KÖRNER 2001: 231 u. 233) mit Sicherheit<br />
nicht um „Ebbinghaus, Ernst A.“ (ebd.: 465), sondern um den angesehenen Marburger<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
der Briefe an Käte Hamburger spricht davon, es sei dabei eine „Behebung<br />
offenkundiger Schreibfehler“ erfolgt. Entweder ist das nicht konsequent<br />
genug geschehen oder aber es sind neue Fehler begangen worden, die auf<br />
das Konto des Herausgebers gehen. 4 Auch den Übersetzungskünsten des<br />
Herausgebers ist nicht ungeprüft über die Gasse zu trauen 5 .<br />
Juristen und Hochschulpolitiker Julius Ebbinghaus (1885–1981); die „Festschrift für<br />
Singer“ (ebd.: 258) galt nicht „Singer, Herbert“ (ebd.: 474), sondern dem aus Wien<br />
stammenden Berner Altgermanisten Samuel Singer (1860–1948, s. KÖRNER 1949:<br />
11); Verfasser des von Körner in besonders hohem Maße wertgeschätzten Buches Die<br />
Revolution des Nihilismus (1938, s. KÖRNER 1949: 534) war nicht ein „Hermann<br />
Rauschnigg“ (KÖRNER 2001: 276 u. 472), sondern der durch seine umstrittenen Gespräche<br />
mit Hitler (1940) weltberühmt gewordene Hermann Rauschning (1887–1982);<br />
Autor der Schrift Hitler’s Professors (1946) nicht ein „Max Weinrich“ (ebd.: 240 und<br />
476, so irrtümlich auch in KÖRNER 1949: 538), sondern der Linguist und Soziologe<br />
Max Weinreich (1894–1969). Bei Körner selbst (KÖRNER 2001: 137) wie auch im<br />
„Verzeichnis der Veröffentlichungen Josef Körners“ (ebd.: 352) lautet der Name des<br />
Mitherausgebers der Sammlung Die Brüder Schlegel im Briefwechsel mit Schiller und<br />
Goethe (1926) durchaus korrekt „Ernst Wieneke“, während Klausnitzer in seinen eigenen<br />
Texten sich generell für die Schreibung „Wienecke“ (ebd.: 418, Anm. 83–84 und<br />
476) entschieden hat. Analog dazu verwandelt das „Personenregister“ den im Körnerschen<br />
Text erwähnten polnischen Germanisten „S. v. Lempicki“ (ebd.: 171) in einen<br />
„Lempecki, Siegmund von“ (ebd.: 470). Die von Körner in seiner Nadler-Rezension<br />
(84) korrekt datierte Sauersche Rektoratsrede „Literaturgeschichte und Volkskunde“<br />
(1907) erscheint in Klausnitzers Darstellung nicht nur umdatiert auf 1906, sondern auch<br />
umgetauft in „Literaturwissenschaft und Volkskunde“ (ebd.: 438, Hervorhebung K. K.).<br />
Auch dem Titel des bekannten Sammelwerks Juden im deutschen Kulturbereich blieb<br />
eine – fast schon ungewollt parodistisch wirkende – Verballhornung nicht erspart: er<br />
lautet nun „Juden im deutschen Kulturbetrieb“ (ebd.: 390 u. 438, Anm. 14, Hervorhebung<br />
K. K.).<br />
4 So wird z. B. die auf Seite 300 beabsichtigte Antithese zum „idealistischen Phrasenrausch“<br />
nicht in einem „bestialischen Nachtrausch“ (KÖRNER 2001: 300) zu suchen<br />
sein, sondern in einem ebensolchen „Machtrausch“ erblickt werden müssen; und der<br />
Kontrast zu der witzig-aktualisierenden Wortbildung „Verunanständigung“ (ebd.: 311)<br />
muss natürlich „Veranständigung“ lauten, kann also nicht eine völlig witzlose „Verständigung“<br />
(ebd.: 311) sein; dass die Menschheit untergehen müsse, „solange der Haß<br />
das summum bonum diskutiert“ (ebd.: 306, Hervorhebung K. K.), dürfte Körner kaum<br />
so zu Papier gebracht, auf keinen Fall aber so gemeint haben, intendiert war wohl eher<br />
„diktiert“ oder „dekretiert“; und wenn Körner tatsächlich das Wort „querulanterisch“<br />
(ebd.: 252) geschrieben oder getippt haben sollte (was nicht viel an Wahrscheinlichkeit<br />
für sich hat), dann wäre das ebenso als „Schreib-fehler“ zu „beheben“ gewesen wie z.<br />
B. der aparte Infinitiv „exspektorieren“ (ebd.: 321), zumal Körner selbst nachweislich<br />
nicht „Exspektoration“, sondern durchaus normgerecht „Expektoration“ (ebd.: 142) geschrieben<br />
hat. Damit scheint das Problem eines etymologisch und/oder orthographisch<br />
recht eigenwilligen Umgangs mit Fremdwörtern in Zusammenhang zu stehen, wie es in<br />
des Herausgebers eigenen Texten etwa an Formen wie „obstinant“ (ebd.: 408 und 457),<br />
„Provinienz“ (ebd.: 394) oder „promt“ (ebd.: 421) punktuell sichtbar wird. Von geradezu<br />
ärgerlicher Häufigkeit sind Fälle, wo es zu mitunter höchst sinnstörenden Wechselvertauschungen<br />
von „sie“ bzw. „ihr“ mit großzuschreibendem „Sie“ bzw. „Ihr“ (als<br />
Höflichkeitsanrede) gekommen ist (ebd.: 124–125, 257, 279, 293, 312, 314, 345, 347).<br />
Zwei Beispiele für viele: Wenn Körner im Brief vom 25.02.1949 über seine Tochter<br />
283
284<br />
Kurt Krolop<br />
7. Zur Edition und Kommentierung der Briefe Körners<br />
Mitteilungen wie „es ist der 5. Brief, den ich heute zu fertigen habe“ (ebd.:<br />
272), oder „dies ist heut mein 8. Brief“ (ebd.: 274) vermitteln eine Vorstellung<br />
von der kaum glaublichen Extensität und Intensität der „weltweiten<br />
Korrespondenz“ (ebd.: 262), die Körner in den ersten Nachkriegsjahren (natürlich<br />
nicht „Nachkriegsjahrzehnten“, wie es auf Seite 344 heißt) neben<br />
seiner mühsamen Forschungs- und Manuskriptherstellungsarbeit noch weiterzuführen<br />
vermochte und von deren Gesamtumfang man außer dem Abdruck<br />
der Briefe an Käte Hamburger und gelegentlichen Hinweisen auf<br />
wichtige Korrespondenzpartner wie Oskar Walzel, Arthur Schnitzler, Karl<br />
Vossler, Walther Küchler, Paul Kluckhohn, Bernhard Blume, Erik Lunding,<br />
Wolfgang Paulsen und einen vielzitierten „E. Groosz“ 6 (ebd.: 391, 455,<br />
456, 457), dessen vollständigen Vornamen nicht einmal das „Personenregister“<br />
(ebd.: 466) verrät, leider nirgends einen zusammenfassenden Überblick<br />
erhält, der z. B. auch Victor Klemperers Tagebucheintragung vom 26.<br />
Januar 1947 einbeziehen könnte: „Ich schrieb [...] an Josef Körner in Prag,<br />
der mich im ‚Aufbau‘ entdeckt u. über die Aufbauredaktion zum Überleben<br />
beglückwünscht hat.“ (KLEMPERER 1999: 346)<br />
Erklärungsbedarf ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der „Editorischen<br />
Notiz“ (KÖRNER 2001: 188) zum Abdruck der Briefe an Käte Hamburger.<br />
Wenn es dort heißt: „Die im Deutschen Literaturarchiv Marbach lagernden<br />
Pauline an Käte Hamburger schreibt: „Paulinchen, (die ihren Namen sehr wohl weiß)“<br />
(ebd.: 314), dann soll damit natürlich nicht mitgeteilt werden, dass Paulinchen „ihren<br />
Namen“ (d. h. ihren eigenen) „sehr wohl weiß“, sondern vielmehr „Ihren Namen“ (d. h.<br />
den der Adressatin Käte Hamburger). Und umgekehrt: Wenn von Walther Küchlers<br />
französischer Ehefrau die Rede ist, dann darf es nicht heißen: „Und Ihre reizenden [...]<br />
Briefe“ (ebd.: 345); denn das wären ja dann die Briefe der Adressatin Käte Hamburger),<br />
sondern es ist zu textieren: „Und ihre reizenden [...] Briefe“.<br />
5 Abgesehen von Hispanismen im französischen Originaltext eines Briefes von August<br />
Wilhelm Schlegel wie „los bannières“ (ebd.: 144) und „los Methodistes“ (sic!, ebd.:<br />
145) wäre ein Missgriff wie die Übertragung von „par un missionaire des frères moraves“<br />
(ebd.: 144) durch „von einem Missionar der moravischen [!] Brüder“ (ebd.: 145)<br />
allein schon durch einen Blick auf die vorhergehende Seite zu vermeiden gewesen, wo<br />
Körner selber in einer Fußnote die „mährischen Brüder“ (ebd.: 144, Anm. 17) erwähnt.<br />
Die Wiedergabe der Wendung „pour calciner les statues antiques“ (ebd.: 145) durch<br />
„um die antiken Statuen zu verkohlen“ (ebd.: 146, Hervorhebung K. K.) bietet einen unfreiwilligen<br />
Berolinismus von gewiss ebenso unfreiwilliger Komik. Einen Höhepunkt<br />
solcher Fehlleistungen liefert der Schlusssatz dieses Briefzitats, wo der Passus „au nom<br />
des pitoyables et mesquines conceptions que [...] des âmes étroites se sont forgées de la<br />
Vérité Divine“ (ebd.: 145) wiedergegeben erscheint mit „im Namen der armseligen und<br />
bornierten Auffassungen, welche sich [...] eingeengte Seelen über die göttliche Wahrheit<br />
ausgehext haben“ (sic! Ebd.: 147, Hervorhebung K. K.).<br />
6 Vermutlich handelt es sich um den Bibliothekar und Historiker Hofrat Edmund Groag<br />
(1873–1945).<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
Briefe Josef Körners an Käte Hamburger sind nicht als Originale, sondern<br />
als Durchschläge im Nachlass Hamburger enthalten“, dann wäre zu diesem<br />
doch keineswegs selbstverständlichen Sachverhalt wohl ein Wort der Erläuterung<br />
am Platze gewesen, und bei der Feststellung: „Bis auf die Briefe vom<br />
21.VII.1946, 28.IX.1949 und 5.V.1950 [...] sind alle Briefe maschinenschriftlich<br />
abgefasst“ wäre zu fragen, ob diese drei genannten Ausnahmen<br />
originalhandschriftlich vorliegen oder aber vielleicht ebenfalls als Durchschriften;<br />
wobei noch anzumerken bliebe, dass es einen Brief vom<br />
„21.VII.1946“ unter den hier abgedruckten Schreiben nicht gibt.<br />
Auf den Seiten 272–273 wird ein undatierter Brief abgedruckt mit dem<br />
Herausgebervermerk: „Ohne Ort und Datum; in der Reihenfolge nach Brief<br />
vom 15.III.1948 und vor Brief vom 8.IV.1948“ (ebd.: 272). Was immer hier<br />
unter „Reihenfolge“ verstanden worden sein mag, die chronologische „Reihenfolge“<br />
ist es nicht; nach ihr gehört dieser Brief nicht in das Frühjahr<br />
1948, sondern in den Frühling 1946, wie nicht nur inhaltlich-thematische<br />
Parallelen belegen, sondern vor allem auch die Anrede „Liebe Frau Doktor“<br />
(ebd.: 272), die nach dem 23.II.1946 das förmlichere „Sehr verehrte Frau<br />
Doktor“ (ebd.: 195) ablöste, bis auch sie 1947 nach dem Prager Sommerbesuch<br />
Käte Hamburgers endgültig durch „Liebe Freundin“ (ebd.: 254) ersetzt<br />
wurde. „Liebe Frau Doktor“ wäre demnach im Jahre 1948 ein völlig unmotivierter<br />
Rückfall auf eine längst überwundene Zwischenstufe von Anredeförmlichkeit<br />
gewesen.<br />
Über Käte Hamburger, die Adressatin der abgedruckten Briefe, werden, wie<br />
bereits angedeutet, außer Titeln einiger – keineswegs aller – erwähnten Bücher<br />
und Aufsätze keinerlei Auskünfte geboten, nicht einmal einschlägige<br />
Hinweise auf Helmut Müsseners umfassende Monographie Exil in Schweden<br />
(1974), wo Leben und Schaffen der Literaturwissenschaftlerin im<br />
schwedischen Exil bereits vor nahezu drei Jahrzehnten detailliert und exemplarisch<br />
dargestellt worden sind. 7 „Im Handbuch sind so ziemlich alle<br />
Ihre Arbeiten angeführt. Sie werden etwa 7 mal zitiert; aber nicht etwa aus<br />
‚Freundschaft‘, sondern aus Pflicht“ (ebd.: 314), heißt es in Körners Brief<br />
vom 25. Februar 1949 an Käte Hamburger, ohne dass der Herausgeber sich<br />
auch nur bemüßigt gefühlt hätte, „aus Pflicht“ diese sieben Titel ausfindig<br />
zu machen und im „Handbuch“ nachzuweisen (KÖRNER 1949: 277, 316,<br />
324, 509, 518, 519, 524).<br />
Der ausdrücklich als „Körners bester Freund“ (KÖRNER 2001: 229, Anm.<br />
19) bezeichnete Walther Küchler (1877–1953) wird ebenso beharrlich wie<br />
7 Siehe bei Müssener (1974: 473) auch den Verweis auf eine „vollständige Bibliographie<br />
der Schriften und größeren Zeitschriftenpublikationen Käte Hamburgers“ in der Stifts-<br />
und Landesbibliothek von Västerås.<br />
285
286<br />
Kurt Krolop<br />
irreführend auf die Kennzeichnung „Wiener Romanist“ (ebd.: 229 und 445)<br />
festgelegt, obwohl Küchlers fünfjährige Wiener Lehrtätigkeit (1922–1927)<br />
nur die Zwischenstation einer akademischen Laufbahn darstellte, die den<br />
aus Essen stammenden Romanisten von Gießen und Würzburg über Wien<br />
schließlich 1927 auf einen „Hamburger Lehrstuhl“ (ebd.: 217) führte, von<br />
dem er dann 1933 zwangsweise entfernt wurde, weshalb er nach 1945 von<br />
seinem Wohnsitz Benediktbeuern (nicht „Benediktbeuren“, wie auf Seite<br />
256) aus „die Rückkehr auf seinen Hamburger Lehrstuhl“ (ebd.: 217) betrieb.<br />
Die Wichtigkeit des Korrespondenzpartners Paul Neuburger (1881–1959)<br />
für den Bibliographen Josef Körner bestand wohl nicht so sehr darin, dass<br />
er der Verfasser der Dissertation „Die Verseinlage in der Prosadichtung der<br />
Romantik“ (ebd.: 189 und KÖRNER 1949: 309) sowie der Bearbeiter des<br />
als „trefflich“ gerühmten Registerbandes zu der zehnbändigen Walzelschen<br />
Heine-Ausgabe im Insel-Verlag gewesen war (1920, vgl. KÖRNER 1949:<br />
372), als vielmehr in dem Umstand, dass er als Inhaber und Leiter des 1924<br />
gegründeten Genfer wissenschaftlichen Nachrichtendienstes „Pallas“ gerade<br />
auch für bibliographische Zwecke zumal in den ersten Nachkriegsjahren<br />
eine schlechthin unentbehrliche Informationsquelle darstellte.<br />
Rein gar nichts – nicht einmal die Abkürzung eines Vornamens – erfährt<br />
man über Carl Emil Lang (1876–1963), der auch im „Personenregister“<br />
(KÖRNER 2001: 469) lediglich als vornamenloser „Lang, Dr.“ figuriert,<br />
obwohl er doch ebendort als eine der meistgenannten Personen ausgewiesen<br />
ist und sicherlich das Hauptverdienst um die Betreuung der im Francke Verlag<br />
Bern erschienenen Titel Körners gehabt hat, auch und gerade um die<br />
ganz besonders arbeitsaufwendige und kostspielige postume Edition des<br />
dritten, des „Kommentar“-Bandes der „Krisenjahre der Frühromantik“<br />
(1958). Ein von Körner mit solchem Nachdruck als „ein so feiner und bewundernswert<br />
sachlicher Mensch“ (ebd.: 284) gerühmter leitender Verlagsmitarbeiter<br />
hätte ein kommentierendes Wort ganz gewiss verdient.<br />
Nicht unwichtig wäre es gewesen, Karl Schultze-Jahde nicht erst als die<br />
Person zu entschlüsseln, die auf Seite 347 hinter der Abkürzung „Sch.-J.“<br />
steht, sondern schon als den „Görlitzer Freund“ (ebd.: 242) zu identifizieren<br />
(und im „Personenregister“ auch auszuweisen), der im Herbst 1941 „auf<br />
dem Höhepunkt der Nazi-Erfolge darüber sein bißchen Verstand verlor“<br />
(ebd.: 242) sowie auch als den „Dr. Karl S.“ (ebd.: 339), dessen Görlitzer<br />
Adresse Körner seiner Korrespondenzpartnerin mitteilt. Der von Körner als<br />
Schriftsteller wie als Literaturwissenschaftler (nicht zuletzt als Theoretiker<br />
und Praktiker der „Motivanalyse“) geschätzte Schultze-Jahde wird im<br />
Handbuch mit nicht weniger als fünf Titeln erwähnt (KÖRNER 1949: 26,<br />
67, 451); laut einer Tagebucheintragung vom 3. September 1947 ist auch<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
Victor Klemperer dem „Görlitzer Studienrat“ anlässlich eines Vortrags am<br />
dortigen Gymnasium begegnet.<br />
8. Zum Verzeichnis der Schriften Körners<br />
Das „Verzeichnis der Veröffentlichungen Josef Körners“ (KÖRNER 2001:<br />
351–384), das sich für den Zeitraum bis Herbst 1938 auf die Körnersche<br />
„Autobibliographie 1911–1938“ (ebd.: 453, s. auch 192, 196, 231, 233)<br />
stützen konnte und wohl auch gestützt hat, scheint im Wesentlichen vollständig<br />
zu sein, zumindest in dem von Körner gemeinten Sinne, dass an<br />
Primärtexten „kaum etwas Wichtiges“ (ebd.: 453) übersehen ist. Erwähnung<br />
hätte allenfalls noch verdient, dass der Körnersche Artikel „Konzeption“ in<br />
einer bearbeiteten Fassung des von Körner als „Motivanalytiker“ hoch geschätzten<br />
Willy Krogmann (1905–1967) Eingang auch in den 1. Band der 2.<br />
Auflage des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte<br />
(KÖRNER/KROGMANN 1958: 883–884) gefunden hat.<br />
Bei der postumen Neuausgabe der „Wortkunst ohne Namen“ (siehe<br />
KÖRNER 1954) ist die bloße Angabe „2., erw. Aufl. Bern: Francke 1954“<br />
(KÖRNER 2001: 369) auf missverständliche Weise unvollständig. Denn es<br />
handelt sich hier erst um „Heft 1: Gegenstücke“ dieser beträchtlich erweiterten<br />
Auflage, dem laut Ankündigung des Herausgebers Wolfgang Kayser<br />
(1906–1960) noch zwei weitere folgen sollten: „Heft 2: Doppelfassungen“<br />
und „Heft 3: Übertragungen“ – wozu es dann allerdings nicht mehr gekommen<br />
ist.<br />
Lücken weisen die den selbständigen Titeln angefügten Verzeichnisse der<br />
Rezensionen auf. Das gilt, abgesehen davon, dass bei der Schnitzler-<br />
Monographie, wie schon erwähnt, ein solches Verzeichnis gänzlich fehlt<br />
(vgl. ebd. 359), vor allem für den Zeitraum, der durch die „Autobibliographie<br />
1911–1938“ nicht mehr abgedeckt ist. So fehlen z. B. nicht wenige<br />
Rezensionen des „Bibliographischen Handbuchs“ (vgl. ebd.: 371) und alle<br />
der „Marginalien“ (vgl. ebd.), obwohl es dazu im letzten der Briefe Josef<br />
Körners an Käte Hamburger vom 5. Mai 1950 bereits ausdrücklich heißt:<br />
„es sind auch schon Rezensionen erschienen“ (ebd.: 348). Verzeichnet ist<br />
nicht einmal die „Anzeige der ‚Poetik‘“ (ebd.: 330), für die Körner bei deren<br />
Verfasserin Käte Hamburger sich so herzlich bedankt. Dass darüber<br />
hinaus die „Einführung in die Poetik“ nur noch eine einzige Rezension erfahren<br />
haben soll (ebd.: 371), erscheint als in hohem Grade unwahrscheinlich.<br />
Ganz gewiss nicht ohne kritisches Echo ist der 1958 postum erschienene<br />
Kommentarband zu den Krisenjahren der Frühromantik (KÖRNER<br />
1958) geblieben oder die 1969 von Francke vorgelegte 2. Auflage der Textbände<br />
1 und 2, wahrscheinlich ebenso wenig wie die Reprints des Bibliographischen<br />
Handbuchs (KÖRNER [1966]), der Nibelungenforschungen<br />
287
288<br />
Kurt Krolop<br />
(KÖRNER 1968), der Botschaft der deutschen Romantik an Europa<br />
(KÖRNER 1969) und der Romantiker und Klassiker (KÖRNER 1971). Als<br />
Beispiel ausführlicher Würdigung sei lediglich auf Rainer Gruenters Rezension<br />
des 1. Heftes der 2. Auflage von Wortkunst ohne Namen (KÖRNER<br />
1954) im EUPHORION (50/1956: 234–236) verwiesen, die Körners Gedanken<br />
zur Gehalts-, Motiv- und Formanalyse auf überzeugende Weise in den<br />
wissenschaftsgeschichtlichen Kontext wertend einordnet.<br />
9. Fazit<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Entschluss zu einer kommentierten<br />
Edition des Bandes Philologische Schriften und Briefe von Josef<br />
Körner als Eröffnungsband einer Schriftenreihe zur Erforschung der Geschichte<br />
der Germanistik ein Pionierprojekt gewesen ist, das unter anderem<br />
höchst geeignet gewesen wäre, einen Bereich zu erschließen und zu erhellen,<br />
der aus zeitbedingten Gründen lange sozusagen im toten Winkel wissenschaftsgeschichtlichen<br />
Forschungsinteresses geblieben war: Lage, Befindlichkeit,<br />
Mentalität und Identitätsbewusstsein Prager jüdischer<br />
Wissenschaftler und Hochschullehrer „deutscher Kulturzugehörigkeit“<br />
(KÖRNER 2001: 191) in einer durch Besatzung, Krieg, Holocaust und Vertreibung<br />
weitgehend monokulturell gewordenen, einer neuen „Totalität“<br />
(ebd.: 266) unaufhaltsam zutreibenden Prager tschechischen Nachkriegsrealität.<br />
Leider ist aus diesem – auch in manch anderer Richtung wegweisenden –<br />
Pionierprojekt nicht auch eine Pionierleistung von uneingeschränkter wissenschaftlicher<br />
Brauch- und Benutzbarkeit geworden. Dem durch eine verbesserte<br />
und überarbeitete Neuauflage dieser in ihren Intentionen so begrüßenswerten<br />
Publikation wirksam abzuhelfen, wäre ein Ziel, aufs Innigste zu<br />
wünschen.<br />
Literatur:<br />
BROD, Max (1960): Streitbares Leben. Autobiographie. München: Kindler.<br />
CASTLE, Eduard (Hg.) (1930): Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte.<br />
Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn.<br />
Hrsg. von J.W. Nagl und J. Zeidler. Bd. 3: Von 1848 bis<br />
1890. Wien u.a.: Fromme.<br />
GIMPL, Georg (2001): Weil der Boden selbst hier brennt ... Aus dem Prager<br />
Salon der Berta Fanta (1865–1918). Furth im Wald/Prag: Vitalis.<br />
Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung<br />
HEBBEL, Friedrich (1941): Werke. 9 Bände. Bd. 9. Nach der historischkritischen<br />
Ausgabe von R.M. Werner systematisch geordnet von Benno von<br />
Wiese. Leipzig: Bibliographisches Institut.<br />
KAFKA, Franz (1993): Nachgelassene Schriften und Fragmente. Bd. 1.<br />
Frankfurt/Main: S. Fischer.<br />
KLAUSNITZER, Ralf (1999): Blaue Blume unterm Hakenkreuz. Die Rezeption<br />
der deutschen literarischen Romantik im Dritten Reich. Paderborn<br />
u.a.: Schöningh.<br />
KLEMPERER, Victor (1999): So sitze ich denn zwischen allen Stühlen.<br />
Tagebücher 1945–1949. Hrsg. von Walter Nowojski unter Mitarbeit von<br />
Christian Löser. Berlin: Aufbau.<br />
KÖRNER, Josef (1921): Das Nibelungenlied. Leipzig u.a.: Teubner.<br />
KÖRNER, Josef (1932): Goethe und Ihr. Prag: Staatliche Verlagsanstalt.<br />
KÖRNER, Josef (1949): Bibliographisches Handbuch des deutschen<br />
Schrifttums. 3. völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage Bern<br />
u.a.: Francke. Nachdruck der 3. Aufl. Bern u.a. Francke [1966].<br />
KÖRNER, Josef (1954): Wortkunst ohne Namen. Übungstexte zu Gehalt-,<br />
Motiv- und Formenanalyse. 2. erw. Aufl. Heft 1: Gegenstücke. Bern u.a.:<br />
Francke.<br />
KÖRNER, Josef (1958): Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem<br />
Schlegelkreis. Kommentarband. Bern u.a.: Francke.<br />
KÖRNER, Josef/KROGMANN, Willy (1958): Konzeption. – In: Reallexikon<br />
der deutschen Literaturgeschichte. Begründet von P. Merker und W.<br />
Stammler. 2. Aufl. hrsg. von W. Kohlschmidt und W. Mohr. Bd. 1 A-K.<br />
Berlin, New York: de Gruyter, 883–884.<br />
KÖRNER, Josef (1968): Nibelungenforschungen in der deutschen Romantik.<br />
2. reprograf. Auflage der 1. Aufl. Leipzig: Hassel [1911]. Darmstadt:<br />
WBG.<br />
KÖRNER, Josef (1969): Die Botschaft der deutschen Romantik an Europa.<br />
Nachdruck der Ausgabe Augsburg u.a.: Filser [1929]. Bern: Lang.<br />
KÖRNER, Josef (1971): Romantiker und Klassiker. Die Brüder Schlegel in<br />
ihren Beziehungen zu Schiller und Goethe. Unveränd. Nachdruck der Ausgabe<br />
Berlin: Askanische Verl. [1924]. Darmstadt: WBG.<br />
KOSCH, Wilhelm (1928): Deutsches Literatur-Lexikon. Bd. 1. Halle: Max<br />
Neimeyer Verlag.<br />
KRAUS, Karl (1901): Die Fackel III. Jahr. Nr. 87. Wien: Verlag „Die Fackel“.<br />
289
290<br />
Kurt Krolop<br />
KRAUS, Karl (1917): Die Fackel XIX Jahr. Nr. 457–461, Wien: Verlag<br />
„Die Fackel“.<br />
MÜSSENER, Helmut (1974): Exil in Schweden. Politische und kulturelle<br />
Emigration nach 1933. München: Hanser.<br />
PETERSEN, Julius (1944): Die Wissenschaft von der Dichtung. System und<br />
Methodenlehre der Literaturwissenschaft. 2. Aufl. hrsg. von E. Trunz. Berlin:<br />
Junker und Dünnhaupt.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
– retrospektiv betrachtet – unter besonderer Berücksichtigung<br />
der österreichischen Varietät<br />
Dalibor Zeman<br />
Es ist eine geläufige Beobachtung, dass im Rahmen einer plurizentrischen<br />
Betrachtung der deutschen Standardsprache Österreich einen wichtigen<br />
Platz einnimmt. Das österreichische Deutsch ist demnach ein „festes Faktum“,<br />
das sich auf allen linguistischen Beschreibungsebenen, und zwar auf<br />
der phonetisch-phonologischen, morphologischen und syntaktischen sowie<br />
lexikalischen Ebene manifestiert. Von Belang erscheint auch die pragmatische<br />
Ebene, deren Behandlung man in der österreichischen Germanistik<br />
eine besondere Bedeutung beimisst. Pionierarbeit hat diesbezüglich insbesondere<br />
Rudolf Muhr geleistet, auf den hier verwiesen sei (vgl. MUHR<br />
1993b, 1995). Es geht im Folgenden nun nicht um eine Analyse der Eigentümlichkeiten<br />
des österreichischen Deutsch – diese wurden bereits bei Peter<br />
Wiesinger Das österreichische Deutsch (WIESINGER 1988) und in zahlreichen<br />
weiteren Arbeiten zum österreichischen Deutsch ausführlich behandelt.<br />
Vielmehr greift der vorliegende Beitrag die Problematik der nationalen<br />
Varietäten des Deutschen auf. Das Hauptaugenmerk ist dabei nicht nur auf<br />
die in den 1980er Jahren begonnene Diskussion um nationale Varietäten des<br />
Deutschen gerichtet, sondern vor allem auf die Kontroversen, die sich innerhalb<br />
der so genannten plurizentrischen Richtung abspielen. Dabei stehen<br />
die widersprüchlichen Auffassungen über den ideologischen Status der<br />
österreichischen Varietät im Vordergrund. 1<br />
Bis in die Mitte der 1980er Jahre vertrat man in der deutschen Sprachwissenschaft,<br />
besonders in der damaligen Bundesrepublik Deutschland, bezüglich<br />
der für alle deutschsprachigen Länder verbindlichen deutschen Schriftsprache<br />
und ihrer Norm einen monozentrischen Standpunkt (vgl. MOSER<br />
1985: 1687ff.). Nach dieser Position galt die in der damaligen Bundesrepublik<br />
Deutschland, besonders aber in ihren nördlichen Teilen geltende<br />
Sprachform, das so genannte Binnendeutsch, als verbindliche Hauptform.<br />
Dass der kleinere Teil Deutschlands, die bis 1990 existierende Deutsche<br />
Demokratische Republik, sowohl politisch-gesellschaftlich als auch sprachgeographisch<br />
bedingt schriftsprachlich eigene Wege zu beschreiten begann<br />
1 Soziale Einstellungen und voluntative Komponenten sind Gründe dafür, dass die wissenschaftliche<br />
Diskussion um das österreichische Deutsch politisch und, wenn man so<br />
will, ideologisch bestimmt ist, so Hermann Scheuringer (2001: 102), der von der politisch-ideologischen<br />
Handhabung des österreichischen Deutsch spricht.
292<br />
Dalibor Zeman<br />
und über eine andere, doch gleichberechtigte Varietät der deutschen Sprache<br />
verfügte – insbesondere der DDR-spezifische Wortschatz bzw. das Vokabular<br />
des Marxismus-Leninismus (vgl. KINNE/STRUBE-EDELMANN<br />
1981: 5ff. und FLEISCHER 1987: 13ff.) – spielte in der sprachhistorischen<br />
Diskussion der Bundesrepublik nur eine marginale Rolle. Das DDR-<br />
Deutsch wurde als Nebenform der in der Bundesrepublik gültigen Hauptform<br />
des Binnendeutschen betrachtet.<br />
Ähnlich beurteilt wurden auch die als Außen- oder Randdeutsch eingestuften<br />
deutschen Varietäten in Ostbelgien, Luxemburg, Lothringen und dem<br />
Elsass, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich, die geographisch im Westen<br />
und Süden an den binnendeutschen Raum anschließen und mit diesem<br />
das geschlossene, auf mehrere Staaten verteilte deutsche Sprachgebiet mit<br />
teilweise weiteren Staatssprachen bilden.<br />
Die schon in den sechziger Jahren begonnene und vor allem in den siebziger<br />
und frühen achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts intensivierte Erforschung<br />
sprachlicher Eigenheiten sowohl in der damaligen DDR als auch in den<br />
„randdeutschen“ Ländern, die ihre Sprachvarietäten schon bald nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg als gleichberechtigte schriftsprachliche Formen aufwerteten<br />
und dabei trotz Abweichungen vom Binnendeutschen keineswegs die<br />
Konnotation eines unkorrekten Sprachgebrauchs besaßen, sensibilisierte zunehmend<br />
für einzelne sprachliche Unterschiede im Gesamtdeutschen<br />
(WIESINGER 1997: 1f.). Aus der Erforschung der sprachlichen Eigentümlichkeiten<br />
nicht nur in der damaligen DDR, sondern auch in der Schweiz<br />
entstanden neue Wörterbücher zum DDR-spezifischen (vgl. KINNE/STRU-<br />
BE-EDELMANN 1981) und zum schweizerischen Wortschatz. Auch der<br />
im Bibliographischen Institut in Mannheim erscheinende Duden nahm mehr<br />
und mehr süddeutsche, schweizerische und österreichische Eigenheiten auf,<br />
die als solche markiert wurden (DUDEN 1990: 1993–95). Die Republik<br />
Österreich hatte schon 1951 das für die Schulen verbindliche Österreichische<br />
Wörterbuch herausgebracht, das in der 35. Auflage (1979) sogar viele<br />
dialektale Ausdrücke, doch meist ohne entsprechende Kennzeichnung, aufnahm.<br />
Es ist aber auch Tatsache, dass bereits die früheren Auflagen des<br />
Österreichischen Wörterbuchs zahlreiche allgemein verwendete Wörter der<br />
österreichischen Umgangssprache und der österreichischen Mundarten enthielten,<br />
wenngleich keine Wörter in mundartlicher Schreibung. In der umstrittenen<br />
35. Auflage wurden solche mundartliche Ausdrücke berücksichtigt,<br />
die in der österreichischen Literatur eine Rolle spielen, in Zeitungen<br />
verwendet werden oder im Rundfunk zu hören sind (vgl. ÖWB 1979). So<br />
wird die Intention der 35. Auflage nicht primär die gewesen sein, sich von<br />
der schriftsprachlichen Norm abzusetzen, sondern möglichst viele, vor allem<br />
an Wien gebundene Ausdrücke einzubeziehen, die in der öffentlichen<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
Kommunikation eine gewisse Relevanz haben, zumal sie zum Teil von da<br />
aus weiter verbreitet wurden. Das Österreichische Wörterbuch kann aber<br />
nach Reiffenstein kein historisches Wörterbuch sein und erst recht darf es<br />
kein Dialekt-Wörterbuch sein. Wörter wie Ergetag (Dienstag), Safaladi<br />
(Wurstart) etc. sollten ersatzlos gestrichen werden. Sie haben ihren legitimen<br />
Platz im Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich, nicht<br />
aber in einem standardsprachlichen Wörterbuch des Deutschen in Österreich<br />
(REIFFENSTEIN 1995: 161f.). Die Lemma-Auswahl kommentiert<br />
Reiffenstein wie folgt:<br />
Die Herausgeber des Österreichischen Wörterbuchs sollten m.E. bemüht sein, in erster Linie<br />
den aktuellen und den allgemein üblichen Wortschatz der Österreicher abzubilden. Das Wörterbuch<br />
sollte sichtbar machen, dass es nicht nur kein einheitliches Deutsch, sondern dass es<br />
auch kein einheitliches österreichisches Deutsch gibt. Die regionalen Besonderheiten haben<br />
gleiches Recht, die österreichischen innerhalb des Deutschen, aber nicht weniger die westösterreichischen<br />
innerhalb des österreichischen Deutsch. […] Freilich ist dann aber auch streng auf<br />
regionale Ausgewogenheit zu achten, die derzeit keineswegs gegeben ist. […] Ich ziehe aus<br />
meinen Überlegungen das folgende Fazit: Das Österreichische Wörterbuch ist ein brauchbares<br />
und, leider nur in einem begrenzten Bereich, notwendiges Buch. Es ließe sich ohne strukturelle<br />
Eingriffe freilich erheblich verbessern. (REIFFENSTEIN 1995: 161ff.)<br />
Die vermehrte Aufnahme mundartlicher Lexeme wurde aufgrund kritischer<br />
Einwände in der 36. Auflage von 1985 revidiert. Mitte der achtziger Jahre<br />
erfolgte auch in der Sprachwissenschaft ein Paradigmenwechsel. Den unmittelbaren<br />
Anstoß gab der australische Sprachwissenschaftler Michael<br />
Clyne, der 1984 einer bis dahin monozentrischen Betrachtung der deutschen<br />
Sprache eine plurizentrische entgegensetzte. Nach Clyne darf keine deutsche<br />
Sprachvarietät Anspruch auf alleinige normgerechte Korrektheit erheben<br />
und Bewertungsmaßstab für alle anderen Varietäten sein (vgl. CLYNE<br />
1984, 1993). Vielmehr setze sich die deutsche Gesamtsprache aus mehreren<br />
Erscheinungsformen zusammen, die gleichberechtigt die deutsche Schriftsprache<br />
bilden. Dabei kommt den staatsgebundenen Varietäten der ehemals<br />
zwei deutschen Staaten, der Schweiz und Österreich als den großen deutschen<br />
Sprachgebieten eine besondere Bedeutung zu, da diese durch die<br />
Verbindung von Staatsterritorium, Nation und Sprache als „nationale Varietäten“<br />
betrachtet werden (WIESINGER 1997: 1f.). Diese Ansicht scheint<br />
sich heute allgemein durchgesetzt zu haben, so dass sich sprachwissenschaftliche<br />
Kontroversen innerhalb der plurizentrischen Richtung abspielen,<br />
wobei sich drei unterschiedliche Positionen artikulieren:<br />
Der von Wiesinger so genannte „österreichisch-nationale Standpunkt“, nach<br />
dem das österreichische Deutsch als eine eigene Sprache „Österreichisch“<br />
verstanden wird: „Gegenüber den sprachlichen Verselbständigungsbestrebungen<br />
als Aufbau eines Gegensatzes von Österreichisch gegenüber Bundesdeutsch<br />
bzw. einer verselbständigenden nationalen Varietät Österrei-<br />
293
294<br />
Dalibor Zeman<br />
chisch, wie sie R. Muhr und andere betreiben, [...]“ (WIESINGER 1995:<br />
68). Wiesinger distanziert sich insbesondere von sprachpolitischen Seperationstendenzen.<br />
[...] Rudolf Muhr, wenn er zwar die deutsche Sprache in Österreich als eine Varietät des Deutschen<br />
gelten lässt, sie aber bewusst als Österreichisch bezeichnet, um damit weitere sprachpolitische<br />
Ziele anzusteuern. (WIESINGER 1995: 65)<br />
Als Vertreter dieser Richtung werden Anatoli Domaschnew, Michael Clyne,<br />
Hermann Möcker, Rudolf Muhr, Wolfgang Pollak und Ruth Wodak genannt,<br />
ferner der Kreis der Bearbeiter des Österreichischen Wörterbuchs.<br />
Stellvertretend für diesen Kreis erscheint bei Rudolf Schrodt Ernst Pacolt<br />
(SCHRODT 1997: 14), den Peter Wiesinger nicht erwähnt, da er sich zu<br />
dieser Problematik nie expressiv geäußert hat.<br />
Vor allem sprachpolitische Äußerungen von Muhr sorgten in den letzten<br />
Jahren für eine lebhafte Diskussion. Muhr spricht in seinem Beitrag von der<br />
Idee eines Europas der Regionen, hinter der er ein neues großdeutsches Hegemoniestreben<br />
erkennt:<br />
[…] die Wiedervereinigung Deutschlands war nicht nur ein Sieg über den Kommunismus,<br />
auch der Traum eines deutschen Europas, das alle deutschen Gebiete im größten Land Europas<br />
vereinigt […]. Die Idee des Europas der Regionen gewann in den Hinterköpfen mancher plötzlich<br />
eine neue Bedeutung und auf der Basis des alten Konzeptes der Sprachnation eine neue<br />
Stoßrichtung. All dies lässt sich unter dem Stichwort ‚Entnationalisierungstendenzen‛ und<br />
‚Entsolidarisierungstendenzen‛ zusammenfassen, die sich in verschiedensten Schattierungen<br />
zeigen und durch die Globalisierung der Weltwirtschaft massiv verstärkt werden (MUHR<br />
1996: 13).<br />
Hermann Scheuringer scheint der erwähnte Ansatz von Muhr unangemessen,<br />
insbesondere im Hinblick auf die Beschreibung der österreichischen<br />
Varietät.<br />
Deutschnationalismus, so wie ihn Rudolf Muhr und Rudolf de Cillia im Einklang mit den meisten<br />
Österreichern verstehen dürften, letztendlich das Bestreben, alle Deutschsprachigen in<br />
einem Staat zu vereinigen, ist ein nicht nur anachronistisches, sondern auch diskreditiertes<br />
Konzept nicht nur für Österreich, wo Deutschnationalismus ja geradewegs das Gegenstück<br />
zum österreichischen Staat und zur österreichischen Nation darstellt bzw. darstellen muss,<br />
sondern im deutschsprachigen Raum überhaupt; die jüngere Geschichte in Gestalt des Dritten<br />
Reiches, deren Nachfolger im Sinne gemeinsamer Verantwortung gleichermaßen die Bundesrepublik<br />
Deutschland wie Österreich sind, hat das Konzept pervertiert und ihm den verdienten<br />
Garaus bereitet – zumindest bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Dass man mit<br />
dem Konzept einmal auch Gutes verbinden konnte, nämlich Demokratisierung und Emanzipierung,<br />
mag historisch berechtigt sein. Die Geschichte hat es mit sich gebracht, und die gegenwärtige<br />
Entwicklung in Europa trägt es mit sich, dass man mit dem Konzept nichts Gutes mehr<br />
verbinden kann. (SCHEURINGER 1996: 6)<br />
In Rudolf Muhrs Beitrag von 1996 Österreichisches deutsch – nationalismus?<br />
Einige argumente wider den zeitgeist – Eine klarstellung stößt man<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
häufig auf Argumente, mit denen eine Diskreditierung des Österreichischen<br />
behauptet wird.<br />
Die Förderung einer nationalen Variante kann, wie gesagt, nicht bedeuten, dass alles andere<br />
ausgeschlossen wird. Zugleich kann es aber auch nicht heißen, dass die eigene Sprache, wie<br />
das in Österreich vielfach geschieht, gegenüber anderen Varianten als Dialekt und damit als<br />
minderwertig angesehen wird. (MUHR 1996: 17)<br />
Peter Wiesinger, Hermann Scheuringer, Jakob Ebner u.a. kritisieren solche<br />
Äußerungen als der sprachlichen Realität nicht gerecht.<br />
Ich kann österreichische Vertreter dieses dogmatischen plurizentrischen Konzepts eben nicht<br />
verstehen, wenn sie, wie Rudolf Muhr und auch Rudolf de Cillia, immer und überall Dominanz<br />
und Vereinnahmung orten, ständig das Wort minderwertig anführen und behaupten, das Deutsche<br />
in Österreich werde so eingeschätzt, einen Widerstandskampf gegen Deutschland aufbauen<br />
und jeden, der nicht die staatsorientierte plurizentrische Linie teilen will, ins Lager der geradezu<br />
unverbesserlichen Monozentristen abschieben. (SCHEURINGER 1996: 7)<br />
Auch der bereits erwähnte Beitrag von Peter Wiesinger Das österreichische<br />
Deutsch in der Diskussion (WIESINGER 1995) gibt Aufschluss über Rudolf<br />
Muhrs Auffassungen und dessen sprachpolitische Ziele. Bereits im ersten<br />
Beitrag von 1982 Österreichisch. Anmerkungen zur linguistischen<br />
Schizophrenie einer Nation fragt Muhr nach dem Verhältnis von Nation und<br />
Sprache. Ausgangspunkt ist dabei der Ansatz Herders, der angesichts einer<br />
im 18. Jahrhundert fehlenden politischen Einheit Kultur und Sprache zur<br />
Kategorie politischer Identifikation erhob. Ergänzt wurden solche Ansätze<br />
im 19. Jahrhundert um die Territorialität, so dass schließlich eine Nation als<br />
Einheit von Nationalvolk, Territorium, Sprache und Kultur definiert wurde<br />
(MUHR 1982: 306ff.). Einen solchen Nationalbegriff überträgt Muhr auf<br />
den selbständigen Staat Österreich und seine Staatsbürger und empfindet es<br />
als ein problematisches Desiderat, dass die heute zweifellos vorhandene,<br />
vom Volk anerkannte und in der Volksmeinung fest verankerte österreichische<br />
Nationalität keine ihr spezifische Nationalsprache haben soll, denn die<br />
heimische gesprochene und die außerhalb des Staates kodifizierte, geregelte<br />
Schriftsprache würden auseinanderklaffen und in weiten Bevölkerungskreisen<br />
Kommunikationshemmungen mit sprachlichen und sozialen Minderwertigkeitsgefühlen<br />
auslösen (WIESINGER 1995: 65). Daraus ergebe sich nun für<br />
Muhr die zwingende Notwendigkeit nach einer Verbindung von Sprache,<br />
Sprachgebrauch und Nation, um so ein eigenständiges Österreichisch herauszubilden.<br />
In seinen Aufsatz von 1987 Deutsch in Österreich – Österreichisch. Zur<br />
Begriffsbestimmung und Normfeststellung der Standardsprache in Österreich<br />
konzipiert Muhr zwei neue Begriffe von Standardsprache, den „Standard<br />
nach außen“ und den „Standard nach innen“. Als „Standard nach außen“<br />
wird die herkömmliche Standardsprache verstanden, die man als<br />
295
296<br />
Dalibor Zeman<br />
Vortrags- und Vorleseprache und im Umgang mit Nichtmuttersprachlern<br />
gebrauche, die aber für einen Großteil der Österreicher eine fremdartige<br />
„Norm des Uneigentlichseins“ darstelle, eine Einstufung, die, wie soziolinguistische<br />
Erhebungen zeigen, dem Status und der Einschätzung der Standardsprache<br />
nicht entsprechen (MUHR 1987: 1ff.). Demgegenüber sei der<br />
„Standard nach innen“ die unter Österreichern in Alltagssituationen verwendete<br />
Sprachform als vertraute „Norm des Eigentlichseins“, die für „ungefährdete,<br />
entspannte Normalität“ sorge, weil hier Ungezwungenheit gegeben<br />
sei bzw. keine Sanktionen bei Normverstößen erfolgten. Dabei wird<br />
das gängige Gliederungsmodell der gesprochenen Sprache, Standardsprache,<br />
Umgangssprache, Dialekt aufgegeben. Stattdessen werden die Sprachebenen<br />
der Umgangssprache und des Dialekts, also der sogenannten Substandards,<br />
zum Standard und damit zur Standardsprache in Österreich<br />
erklärt und entsprechend als Österreichisch benannt. Auch in dem Beitrag<br />
von 1989 Deutsch und Österreich(isch): Gespaltene Sprache – Gespaltenes<br />
Bewusstsein – Gespaltene Identität stellt Muhr die Hypothese auf, es handle<br />
sich bei Deutsch und Österreichisch um eine „gespaltene Sprache“ bzw.<br />
sogar um zwei Sprachen, weshalb Muhr auch die Bezeichnung österreichischer<br />
Spracheigenheiten als Austriazismen ablehnt, da diese den Bezug zur<br />
deutschen Sprache und ihre Einordnung als Varianten zu dieser voraussetzen.<br />
Solange nun diese sprachliche Trennung durch die wichtige Verselbständigung<br />
des Österreichischen nicht vollzogen sei, leide der Österreicher<br />
an einem gespaltenen Bewusstsein, an einer gespaltenen Identität (MUHR<br />
1989: 74ff.). Einige weitere Beiträge Rudolf Muhrs aus den neunziger Jahren<br />
stellen Apologien dar, vor allem die Reaktion auf Wiesingers kritischen<br />
Aufsatz Das österreichische Deutsch in der Diskussion (WIESINGER<br />
1995) bzw. auch auf Scheuringers Beiträge. 2 Davon zeugt der bereits erwähnte<br />
Text Österreichisches deutsch – nationalismus? Einige argumente<br />
wider den zeitgeist – Eine klarstellung.<br />
Es besteht ein Vorwurf, die Verwendung des Ausdrucks ‚Österreichisch‛ deute darauf hin, dass<br />
man das österreichische Deutsch als eigenständige Sprache betrachte, was ein Zeichen sprachnationalistischer<br />
Einstellung und Absichten sei. Zugleich zeige das, dass das Herdersche Konzept<br />
der Sprachnation verfolgt werde, derzufolge eine Nation als Einheit von Volk, Territorium,<br />
Sprache und Kultur definiert werde und ich angeblich einen solchen Nationsbegriff<br />
ebenfalls für Österreich anstrebe. 3<br />
Behauptet wird dies entgegen besseren Wissens, weil ich in der Diskussion<br />
des entsprechenden Referats bereits klarstellte, dass das ‚Österreichische‛<br />
2 Mittlerweile sind alle an der Diskussion beteiligten Sprachwissenschaftler (Wiesinger,<br />
Scheuringer, Muhr) bestrebt, sprachpolitische Bewertungen zu vermeiden.<br />
3 MUHR (1995: 66) verweist hier auf Wiesinger.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
für mich nie etwas anderes war und ist als eine ‚nationale Variante‛ des<br />
Deutschen und der Ausdruck nur wegen seiner handhabbareren Form verwendet<br />
wurde. Das habe ich auch in einer Reihe von Artikeln immer wieder<br />
betont. Der Zweck solcher, hartnäckig aus derselben Ecke kommender und<br />
faktenwidriger Verfahrensweisen ist es wohl nur, meine angeblich ‚sprachnationalistischen<br />
Absichten‛ zu untermauern, um mich als Separatisten ausgrenzen<br />
zu können (MUHR 1996: 16).<br />
Darüber hinaus betont Muhr in einem seiner neueren Aufsätze, dass die Bezeichnungen<br />
der österreichischen Varietät des Deutschen „Österreichisches<br />
Deutsch“ vs. „Österreichisch“ synonym zu gebrauchen und dass damit die<br />
„nationale Varietät des Österreichischen Deutsch“ und nicht eine eigenständige,<br />
österreichische „Nationalsprache“ gemeint sei. Insofern lasse sich die<br />
Verwendung dieses Begriffs nicht als Beleg eines angeblichen Sprachnationalismus<br />
deuten (MUHR 1997: 49f.).<br />
Was das „Binnendeutsche“ anbelangt, so wird mit diesem Terminus das<br />
Deutsche in Deutschland bezeichnet. Nach Peter v. Polenz umfasst das Binnendeutsche<br />
„im neuen Sinne“ mindestens die drei Staaten aus dem historischen<br />
Erbe des Vor-Bismarckschen Deutschland, also die Bundesrepublik<br />
Deutschland, die DDR und Österreich (mehr dazu POLENZ 1988: 209). Es<br />
sei deshalb sehr zu bedauern, dass noch 1985 Hugo Moser dieses „Binnendeutsch“<br />
als „Hauptform“ (bestehend aus der „Hauptvariante Bundesrepublik“<br />
und der „Variante DDR“) den „Regionalen Varianten“ gegenübergestellt<br />
hat, zu denen er die österreichische und schweizerische Variante<br />
ebenso wie Lëtzebuergesch, Elsässisch, Belgiendeutsch usw. sowie „Überseevarianten“<br />
rechnet (MOSER 1985: 1687). Eine solche Gleichstufung des<br />
heutigen österreichischen Deutsch als „Regional-“ und (implizit: „Neben-“)<br />
Variante mit Letzebuergesch, Elsässisch usw. ist nicht nur soziolinguistisch<br />
und sprachpolitisch unzutreffend, sie erscheint auch für frühere Zeiten als<br />
höchst fragwürdig, vor allem wenn man an die frühere Rolle der in Zentren<br />
wie Wien, Prag, Budapest gesprochenen, geschriebenen und gedruckten<br />
deutschen Standardsprache in der Habsburgermonarchie denkt, an die bis<br />
heute wirkende Bedeutung des Deutschen als lingua franca in Südosteuropa,<br />
an den bedeutenden Beitrag von Wien und Prag zur deutschsprachigen Literatur<br />
und Wissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts (POLENZ 1988: 208).<br />
Demzufolge sollte der Mosersche Begriff „Binnendeutsch“ relativiert werden.<br />
Muhr hingegen hält „Binnendeutsch“ überhaupt für veraltet (MUHR<br />
1997: 50), er schlägt bereits in seinem Beitrag von 1993 Österreichisch –<br />
Bundesdeutsch – Schweizerisch. Zur Didaktik des Deutschen als plurizentrische<br />
Sprache Termini wie „deutschländisch“ bzw. „Deutschlandismus“<br />
oder „Teutonismus“ vor:<br />
297
298<br />
Dalibor Zeman<br />
[...], dass die deutsche Standardsprache nicht die Sprache des größten Landes plus einiger<br />
sogenannter ‚Austriazismen‛ und ‚Helvetismen‛ ist, sondern die Schnittmenge aus diesen drei<br />
gleichberechtigten Varianten. Die Begriffe ‚Austriazismus‛ oder ‚Helvetismus‛ sind daher<br />
entweder aufzugeben oder es ist diesen noch ein Dritter hinzuzufügen, nämlich der des ‚Teutonismus/Deutschlandismus‛,<br />
der jene sprachlichen Erscheinungen kennzeichnet, die nur in<br />
Deutschland vorkommen. (MUHR 1993: 113f.)<br />
Auch dem Beitrag von 1997 ist zu entnehmen, dass die wissenschaftliche<br />
Beschreibung der staatsbezogenen Varianten im Deutschen auf der Basis<br />
des plurizentrischen Konzepts eine entsprechende Terminologie erfordert.<br />
Demnach nennt Muhr die Bezeichnungen der Haupterscheinungsformen des<br />
Deutschen „Deutschländisch“ oder „Bundesdeutsch“ (für das Deutsche in<br />
Deutschland), „Österreichisches Deutsch“ oder „Österreichisch“ (für das<br />
Deutsche in Österreich) bzw. „Schweizerisches Deutsch“ oder Schweizerisch<br />
(für das Deutsche in der Schweiz). Die Bezeichnungen für die Varianten<br />
der einzelnen Vollvarietäten des Deutschen nennt er ,Deutschlandismen‘<br />
(Varianten des Deutschländischen), Austriazismen (Varianten des österreichischen<br />
Deutsch) bzw. Helvetismen (Varianten des schweizerischen<br />
Deutsch). Ungeeignet seien die Begriffe Germanismus bzw. Teutonismus,<br />
da ersterer Sprachmerkmale bezeichnet, die Interferenzen zwischen dem<br />
Gesamtdeutschen und anderen Sprachen darstellen, während der zweite negativ<br />
konnotiert ist (MUHR 1997: 49f.). In diesem Sinne hat z.B. Hermann<br />
Möcker vorgeschlagen, man solle im Verhältnis zu „österreichisch“ und<br />
„schweizerisch“ nicht in missverständlicher Weise von „deutsch“ reden,<br />
sondern von „deutschländisch“ und bezüglich der deutschen Staatszugehörigkeit<br />
nicht von „Deutschen“, sondern von „Deutschländern“ (MÖCKER<br />
1992: 236ff.). Auch Scheuringer ist mit der semantischen Vielfalt des Wortes<br />
„deutsch“ nicht glücklich und würde als Adjektiv zu „Deutschland“ lieber<br />
„deutschländisch“ sehen (SCHEURINGER 1996: 7).<br />
Aus weiteren Ausführungen des bereits erwähnten Beitrags von Muhr<br />
(1996) geht allerdings eine radikalere sprachpolitische Gesinnung hervor.<br />
Muhr spricht von der sprachlichen Verselbständigung Österreichs, die befürchtet<br />
würde, und davon, dass alle europäischen Staaten zugleich Sprachnationen<br />
seien. Das Konzept der österreichischen Staatsnation sei der einzig<br />
mögliche Weg, um dessen Existenz aufrechtzuerhalten. Allerdings:<br />
Was an dem Konzept der österreichischen Sprachnation an sich schlecht sein sollte (wenn es<br />
sie gäbe), müsste doch einmal erklärt werden; denn alle europäischen Nationalstaaten sind<br />
zugleich Sprachnationen. Warum also ist dieses Konzept für Österreich abzulehnen? Wohl nur,<br />
weil die sprachliche Verselbständigung Österreichs, aus welchen Motiven immer, gefürchtet<br />
wird. Dass diese Angst völlig unbegründet ist und viel eher eine ständige Angleichung stattfindet,<br />
wird von den Kritikern völlig ignoriert. (MUHR 1996: 16)<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
Muhr wirft seinen Kritikern eine unreflektierte Haltung vor. „Wäre ich ein<br />
österreichischer Sprachnationalist, dann wären die Kritiker wohl nur großdeutsche/deutschnationale<br />
Sprachnationalisten“ (MUHR 1996: 16).<br />
Nicht einmal Wolfgang Pollak, der ebenfalls zu der Gruppe der Forscher<br />
gehört, die den österreichisch-nationalen Standpunkt vertreten, artikuliert<br />
sich so radikal. In seinem 1992 veröffentlichten Band mit dem Titel Was<br />
halten die Österreicher von ihrem Deutsch? Eine sprachpolitische und soziosemiotische<br />
Analyse der sprachlichen Identität der Österreicher wird<br />
betont, dass es die deutsche Sprache sei, die Österreich mit dem deutschen<br />
Sprach- und Kulturraum verbinde. Diese Verbindung weise insofern einen<br />
dialektalen Charakter auf, als diese fundamentale Partizipation zugleich auf<br />
der Anerkennung der staatsnationalen Varietät des österreichischen Deutsch<br />
und der spezifischen historischen und kulturellen Tradition Österreichs beruhe,<br />
wobei auf das heutige Österreich bezogen, Nation keine ethnischsprachnationale<br />
Kategorie im Sinne Herders sei (POLLAK 1992: 103f.).<br />
Die Rolle der Sprache als wesentlichem Konstituens der deutschen Nation<br />
beruhe auf dem unizentrisch-norddeutsch geprägten Homogenitätspostulat<br />
des Hochdeutschen:<br />
Seit der Anerkennung des plurizentrischen Modells hat das Verhältnis von Sprache und Nation<br />
eine andere Bezugsqualität bekommen. Die Standardsprache gewährleistet, insbesondere als<br />
schriftlich konstituiertes Medium, die weitgehende sprachliche Einheitlichkeit der deutschen<br />
Kommunikationsgemeinschaft. Andererseits wurden wir sogar in diesem Bereich für gewisse<br />
Varianten sensibilisiert, die mehr qualitativ als quantitativ als identitätsstiftende Signale fungieren.<br />
Es geht also um die medial sehr variable Dialektik zwischen Einheit und Vielfalt, und<br />
ich finde, daß man diese nicht gegeneinander ausspielen sollte, sondern in dieser Dialektik eine<br />
Bereicherung und ein wesentliches identitätsförderndes Moment sehen sollte. (POLLAK 1992:<br />
104)<br />
Die zweite Position, die Wiesinger behandelt, bezeichnet er als deutschintegrativen<br />
Standpunkt: Es gebe keine österreichischen Spracheigentümlichkeiten<br />
im eigentlichen Sinne, wenn man die Verbreitung der Varianten<br />
mit dem österreichischen Staatsgebiet vergleicht: Viele Austriazismen gehören<br />
entweder auch dem Süddeutschen an oder sie sind in Westösterreich<br />
unbekannt oder ungebräuchlich (WIESINGER 1995: 68f.). Eine Ausnahme<br />
bildet nur der amtliche Sprachgebrauch, da die staatliche Verwaltung eine<br />
eigene Terminologie hervorgebracht hat (z.B. Bezeichnungen für Behörden<br />
und Ämter). Analog könne man von einem gesamtösterreichischen Wortschatz<br />
sprechen (WIESINGER 1988: 25ff.). Wiesinger nennt als Vertreter<br />
dieser Richtung Hermann Scheuringer und Norbert Richard Wolf. Hermann<br />
Scheuringer lehnt die Bezeichnung einer „plurizentrischen Sprache“ für das<br />
Deutsche grundsätzlich ab und spricht lieber von einer „pluriarealen Sprache“,<br />
weil „plurizentrisch“ die Existenz von nationalen oder staatlich ein-<br />
299
300<br />
Dalibor Zeman<br />
heitlichen Varietäten des Deutschen in relativ strikter Abgrenzung voneinander<br />
suggeriere, „die es so nicht gibt“. Scheuringer sieht die Staatlichkeit<br />
als ein Räumlichkeitsmuster unter vielen, hält sie aber bezogen auf das<br />
österreichische Deutsch für eine Randgröße.<br />
Immer mehr hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass der Terminus ‚plurizentrisch‛ den arealen<br />
Mustern des deutschen Sprachgebiets nicht gerecht werden kann. Er hat zwar anfänglich<br />
durchaus positiv dazu beitragen können, dass [...] die historisch unsinnige, auf Herrschaftsansprüchen<br />
basierende unizentrische Sicht auf die deutsche Hochsprache mit der Bevorzugung<br />
einer ‚binnendeutschen‛ de facto mittel- und norddeutschen Norm ad acta gelegt wurde, doch<br />
hat seine Umlegung auf deutschsprachige Staaten nicht Pluralismus gebracht, sondern lediglich<br />
mehrfachen Zentralismus: So wie ‚plurizentrisch‛ in der Diskussion verwendet wurde und<br />
wird, suggeriert es national oder staatlich einheitliche Varietäten des Deutschen in relativ strikter<br />
Abgrenzung voneinander, die es so nicht gibt. Plurizentrisch ist eigentlich pluriunizentrisch.<br />
(SCHEURINGER 1996b: 151f.)<br />
Scheuringer betont insbesondere die Irrelevanz der Begriffsbildung „plurizentrisch“:<br />
Die Diskussion ums österreichische Deutsch und in weiterer Folge ums Deutsche als sogenannte<br />
plurizentrische Sprache ist leider in diesem Fahrwasser gelandet, indem der Terminus plurizentrisch,<br />
der von seiner Grundbedeutung her eigentlich nichts anderes sagt als ‚mehrere Zentren<br />
habend‛ und mir insofern fürs Deutsche als gut verwendbar erschiene, de facto auf Staaten<br />
umgelegt, also Zentrum mit Staat gleichgesetzt wird. Dem entspricht in keinem der deutschsprachigen<br />
Staaten die sprachliche Realität. Die in meinen Augen geradezu dogmatische<br />
Handhabung des Terminus verhindert den Blick auf die wahre Plurizentrizität des Deutschen,<br />
in deren Rahmen die staatliche Ebene nur eine von vielen ist und nur kleine Teile des Sprachsystems<br />
betrifft. [...] Und ich wüsste auch nicht, warum ich mich nicht als Deutschen sehen<br />
sollte, weil mein <strong>Passau</strong>sstellungsland ebenso zufällig Österreich heißt, wie es Deutschland für<br />
jemand heißt, der in meiner Heimatregion zufällig ein paar Kilometer weiter seine zufällige<br />
deutsche Staatsangehörigkeit erhalten hat, sonst aber genauso ist wie ich in allen seinen kulturellen<br />
Traditionen. (SCHEURINGER 1996a: 7)<br />
Wie aus den Aussagen Scheuringers ersichtlich, ist für die Bestimmung der<br />
Varietäten des Deutschen die Standardsprache der Ausgangspunkt. Der Beschreibungsrahmen<br />
wird durch kodifizierte Normen definiert. Gefragt wird<br />
zuerst, ob die Ausdrücke den kodifizierten Schrift- und Standardsprachennormen<br />
entsprechen oder davon abweichen, ob sie regional und geschrieben<br />
oder nur gesprochen vorkommen. Was die Definition der Standardsprache<br />
angeht, so bildet sie eine überall gültige Form der kodifizierten deutschen<br />
Schriftsprache einschließlich einer geringen Anzahl österreichischer und<br />
schweizerischer Spezifika. Länder, Regionen und soziale Gruppen werden<br />
von der Standardsprache überdacht. Die darunter liegenden Varietäten gehen<br />
nicht mit Staatsgrenzen konform, daher wird von arealen und nicht von<br />
staatlichen Varietäten gesprochen (vgl. SCHEURINGER 2001: 102).<br />
Scheuringer, steht mit seinem Konzept auf dem Standpunkt, und das grenzt<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
ihn am deutlichsten von Muhr ab, dass innerhalb des gesamten deutschen<br />
Sprachraums (vor allem in Bezug auf die areale Verteilung des Wortschatzes)<br />
Begriffe wie ‚nationale Varianten‘ oder ‚Plurizentrizität‘ nicht angemessen<br />
seien, weil sie die Existenz von nationalen oder staatlich einheitlichen<br />
Formen des Deutschen suggerierten, die es aber nicht gebe. Der<br />
eigentliche Streitpunkt besteht meines Erachtens darin, dass das österreichisch-nationale<br />
Konzept den Schwerpunkt auf das Vorhandensein mehrerer<br />
staatlicher Einheiten legt, die für den Sprecher als soziale Bezugspunkte<br />
dienen, während beim deutsch-integrativen Standpunkt das nationale Moment<br />
sozusagen heruntergespielt wird.<br />
Was aber an Scheuringers Konzept bzw. dessen Schlussfolgerungen unklar<br />
bleibt, ist die Behauptung, dass der Terminus ‚plurizentrisch‘ den arealen<br />
Mustern des deutschen Sprachgebiets nicht gerecht werde. Auch der Einwand,<br />
dass die Bezeichnung „plurizentrisch“ zu einer Sprachraumbetrachtung<br />
mit staatlich eingeengtem Horizont führe, stellt keine plausible Erklärung<br />
dar. Zumal Wiesinger in seinem Band Das österreichische Deutsch<br />
(1988) deutlich gemacht hat, dass insbesondere auf der Ebene des Wortschatzes<br />
das österreichische Deutsch seine auffälligsten Eigenheiten zeigt<br />
und dennoch keine Einheit bildet. Vielmehr weist der Wortschatz in Form<br />
unterschiedlicher Bezeichnungen auf eine fünffache räumliche Gliederung<br />
(WIESINGER 1988: 25ff.). Bereits in seinem 1983 erschienenen Beitrag<br />
Sprachschichten und Sprachgebrauch in Österreich spricht Wiesinger von<br />
einem österreichischen Wortschatz, der sich jeweils in unterschiedlicher<br />
Verbreitung nur im Osten und vielfach auch im Süden Österreichs durchgesetzt<br />
hat, so dass ein deutlicher innerösterreichischer Ost-West-Gegensatz<br />
entsteht (vgl. WIESINGER 1983: 192), wobei die Grenze zwischen beiden<br />
von einem breiten Raum gebildet wird, der je nach Lexem variiert und als<br />
dessen westlicher Teil die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg (teilweise)<br />
und Oberösterreich (teilweise) gelten können. In einzelnen Fällen<br />
nimmt zudem das Bundesland Vorarlberg auf Grund seiner basisdialektal<br />
alemannischen Grundlage eine besondere Position ein (vgl. EICHHOFF:<br />
Bände 1/2/3/4). Es ist offensichtlich, dass in Bezug auf die räumliche<br />
Verbreitung keine Homogenität des österreichischen Wortschatzes gegeben<br />
ist. Daher ist es auch nicht angemessen, eine dogmatische Handhabung des<br />
Terminus Plurizentrismus zu konstatieren, nur weil das plurizentrische<br />
Konzept das staatliche Territorium, im vorliegenden Fall das österreichische<br />
Gebiet, als Ausgangspunkt der Beschreibung der jeweiligen nationalen Varietät<br />
verwendet. Immerhin weist das österreichische Deutsch eine Reihe<br />
von so genannten echten Austriazismen auf, die nur in Österreich existieren.<br />
Diese werden allerdings von einem deutsch-integrativen Konzept bagatelli-<br />
301
302<br />
Dalibor Zeman<br />
siert. Dabei korrespondiert die Ansicht einer fünffachen räumlichen Gliederung,<br />
so Wiesinger, in gewisser Weise mit Scheuringer:<br />
[...] wahre Plurizentrizität des Deutschen, in deren Rahmen die staatliche Ebene nur eine von<br />
vielen ist und nur kleine Teile des Sprachsystems betrifft [...]. (SCHEURINGER 1996: 7) [Hervorhebung<br />
von D.Z.]<br />
Eine teilweise Übereinstimmung äußert sich in der ähnlichen Auffassung<br />
beider Forscher, dass die Mehrzahl der Varianten in erster Linie areal verteilt<br />
ist, was als wahrscheinlich erscheinen lässt, dass in diatopischer Sicht<br />
Österreich eine Reihe von Arealen (Räumlichkeitsmustern) zeigt. Wiesinger<br />
geht mit Scheuringer insofern konform, als das österreichische Deutsch vor<br />
allem bei Berücksichtigung der phonetisch-akzentuellen und lexikalischen<br />
Eigenschaften keine Einheit bildet, sondern in sich mehrfach gegliedert ist,<br />
so dass sich die Bezeichnung Österreichisch im Sinne einer staatlich gebundenen,<br />
spezifischen Sprachform verbietet. Bei Klassifizierung des im österreichischen<br />
Deutsch gebräuchlichen besonderen Wortschatzes lassen sich<br />
fünf Gruppen feststellen (vgl. WIESINGER 1983: 192f.), die das areale<br />
Moment sehr wohl nahe legen.<br />
In einem früheren Beitrag macht Scheuringer deutlich (SCHEURINGER<br />
1988), dass die sprachliche Vielgestaltigkeit nicht zu verurteilen ist. Sprachliche<br />
Regionalisierung innerhalb des Deutschen heißt ohnehin schon seit<br />
langem Regionalisierung nach Staaten, allerdings werden dem österreichischen<br />
Deutsch bestimmte sprachliche Besonderheiten aufgezwungen:<br />
Die Existenz einer spezifischen österreichischen Variante stand stets außer Frage. Sie bedarf<br />
keiner hochoffiziellen Patronanz oder gar Forcierung. Es ist unbestritten, dass der Verwaltungsstaat<br />
mit Hilfe seiner Beamten und mit Hilfe seiner Lehrer gewollt oder ungewollt die<br />
Ausbildung großlandschaftlicher Varianten fördert. Die zusätzliche Aufoktroyierung sprachlicher<br />
Besonderheiten durch staatliche Zentralstellen muss Gegenreaktionen herausfordern.<br />
(SCHEURINGER 1988: 66) [Hervorhebungen von D.Z.]<br />
Die dritte Position in dieser Diskussion ergibt sich aus einer kritischen Auseinandersetzung<br />
mit den beiden zuvor thematisierten Standpunkten. In der<br />
Forschung spricht man von einem „österreichisch-integralen Standpunkt“<br />
(SCHRODT 1997: 15). Dessen Kernthese lautet, dass die deutsche Sprache<br />
auch in Österreich „gültig“ sei. Das österreichische Deutsch bestehe aus „eine[r]<br />
Summe von einzelnen, doch geographisch wechselnden Erscheinungen,<br />
denen aber insgesamt normative Gültigkeit in Österreich zukommt“<br />
(WIESINGER 1996: 69; EBNER 1989: 88ff.; SCHRODT 1997: 14). Das<br />
österreichische Deutsch sei keine nationale Varietät, zumal der Begriff der<br />
Nation eine Einheitlichkeit voraussetzt, die schon auf sprachlicher Ebene<br />
nicht existiert. Als nationale Varietät würde das österreichische Deutsch nur<br />
dann gelten können, wenn man „die territorialen und pragmatischen Momente<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
seiner Gültigkeit und Verwendung in Österreich zu den alleinigen Kriterien<br />
macht“ (WIESINGER 1995: 69f.). Mit dem Terminus „österreichischintegral“<br />
wird die Eigenständigkeit des österreichischen Deutsch in der Summe<br />
seiner Abweichungen von anderen Varietäten betrachtet und an seinem<br />
Anspruch, als eigenständige Norm zu gelten, festgehalten, allerdings ohne<br />
Bezug auf nationale oder areale Konzepte. Diese österreichisch-integrale Position<br />
vertreten neben Peter Wiesinger auch die von ihm erwähnten Jakob<br />
Ebner und Ingo Reiffenstein. Reiffensteins Aussagen scheinen allerdings in<br />
Bezug auf eine normgerechte bzw. legitime Anerkennung der nationalen<br />
österreichischen Variante der deutschen Hochsprache nicht zu überzeugen:<br />
Ein unbestrittenes Faktum aber ist auch, dass die deutsche Hochsprache in Österreich in einigen<br />
Punkten von der z.B. in der BRD gültigen Norm abweicht, vor allem im Lexikon, aber<br />
auch in der Hochlautung. Soweit diese Abweichungen in den Normbüchern [...] kodifiziert<br />
sind, reichen sie meines Erachtens nicht aus, von einer nationalen österreichischen Variante der<br />
deutschen Hochsprache zu reden, zumal es landschaftliche Wortschatzunterschiede ja auch<br />
sonst im Binnendeutschen gibt. (REIFFENSTEIN 1982: 12)<br />
Im Folgenden sollen die beiden Konzepte, die sich seit 1994/95 herauskristallisiert<br />
haben, das plurizentrische und das pluriareale, paradigmatisch<br />
gegenübergestellt werden.<br />
Der „pluriareale-normbezogene/normorientierte Ansatz“, so Muhr (MUHR<br />
1997), nimmt als Ausgangspunkt die deutsche Sprache als Gesamterscheinung<br />
und betont die überregionale Gültigkeit der deutschen Standardsprache,<br />
zugleich aber auch die sprachliche Uneinheitlichkeit der einzelnen nationalen<br />
Varietäten des Deutschen. Dieser Ansatz versteht Gemeinsamkeiten<br />
der einzelnen nationalen Varietäten im Wortschatz hinsichtlich<br />
Verbreitung und aktivem Gebrauch nur in der Verwaltungsterminologie und<br />
bei einem geringen Teil des Verkehrswortschatzes tatsächlich als staatsgebunden.<br />
Demgegenüber trete meist ein größerer Verkehrswortschatz entweder<br />
nur in Teilgebieten der deutschsprachigen Staaten oder grenzüberschreitend<br />
auf, so dass die Mehrzahl der Varianten nicht national, sondern einfach<br />
areal verteilt ist. Damit soll gesagt werden, dass in diatopischer Sicht Österreich<br />
eine ganze Reihe von Räumlichkeitsmustern zeigt. Basisdialektal ist<br />
das Land Teil der beiden großen oberdeutschen Dialekträume des Bairischen<br />
und des Alemannischen; der allergrößte Teil Österreichs gehört dabei<br />
zum bairischen Raum. Im räumlichen Anschluss an das bairische Dialektgebiet<br />
Bayerns sind dies im Grunde acht der neun Bundesländer, nämlich<br />
Oberösterreich, Niederösterreich mit Wien, das Burgenland, die Steiermark,<br />
Kärnten, Salzburg und Tirol, wobei Tirol in seinem Westen und insbesondere<br />
Nordwesten auch schon alemannische Dialekte kennt. Der Zahl ihrer<br />
Sprecher nach dürften mehr Menschen in Österreich muttersprachlich bairische<br />
Dialekte bzw. auf diesen aufbauende Nonstandard-Varietäten sprechen<br />
303
304<br />
Dalibor Zeman<br />
als in Bayern selbst (SCHEURINGER 2001: 98). Daher ist es für die Vertreter<br />
des pluriarealen Ansatzes angebracht, eher von einer arealen Verteilung<br />
des Lexikons bzw. den einzelnen regionalen Varianten zu sprechen,<br />
weil die Homogenität des österreichischen Wortschatzes in Bezug auf die<br />
diatopische Verbreitung nicht gegeben ist und weil das Attribut ‚national‛<br />
Staatlichkeit impliziert.<br />
Es wird auf die angeblich geringe Zahl von Austriazismen verwiesen (in der<br />
neuesten Auflage des Wörterbuchs von Jakob Ebner Wie sagt man in Österreich<br />
1998 ist allerdings die Anzahl der angeführten Austriazismen auf etwa<br />
8 000 nahezu verdoppelt). Weiter wird postuliert, dass der Begriff plurizentrisch<br />
zu einer „Sprachraumbetrachtung mit staatlich eingeengtem Horizont“<br />
führe (SCHEURINGER 1996b: 150). U.a. ist damit der Vorwurf eines<br />
so genannten Nationalvarietätenpurismus verbunden (vgl. AMMON<br />
1995 und MUHR 1997: 47), da z.B. das Österreichische Wörterbuch bundesdeutsche<br />
Ausdrücke mit einem Sternchen markiert, was als Hinweis an<br />
die Wörterbuch-Benutzer zu verstehen ist, diese Wörter in Österreich nicht<br />
unbesehen zu verwenden da die eigene nationale Varietät vor dem Eindringen<br />
von Varianten aus einer anderen nationalen Varietät zu schützen sei.<br />
Wie schon weiter oben erwähnt, beruht das pluriareale Paradigma vor allem<br />
auf zwei Hypothesen: dem so genannten „Uneinheitlichkeitsargument“ und<br />
dem „Überschneidungsargument“. Es gibt einige empirische Daten, die es<br />
möglich machen, beide Behauptungen wenigstens annäherungsweise einer<br />
Überprüfung zu unterziehen (vgl. GLAUNINGER 1997; EICHHOFF<br />
1977/1978 und MUHR 1997).<br />
Im Rahmen des Uneinheitlichkeitsarguments ist es wichtig zu beachten, wie<br />
groß die innerösterreichischen Unterschiede überhaupt sind. Die Untersuchung<br />
von Glauninger liefert hierzu erstmals umfassende und stichhaltige<br />
Daten (GLAUNINGER 1997). Die Ergebnisse der lexikalischen Übereinstimmung<br />
zwischen den Landeshauptstädten im mündlichen Gebrauch belegen,<br />
dass der Grad der Übereinstimmung nirgendwo geringer als 76 %<br />
liegt. Lediglich bei fünf von 36 Vergleichspaaren beträgt die Übereinstimmung<br />
weniger als 80 %, und zwar zwischen Bregenz im Vergleich zu Linz,<br />
Klagenfurt, St. Pölten, Wien und Eisenstadt (GLAUNINGER 1997: 258ff).<br />
Man kann somit von einem sehr hohen Homogenitätsgrad des untersuchten<br />
Lexikons sprechen. Unterstützt werden Glauningers Ergebnisse auch durch<br />
die Daten in den Karten von Jürgen Eichhoff (1977/1978). Die von Muhr<br />
vorgenommene Auszählung von 112 Karten ergab auch dort ein hohes Maß<br />
sprachlicher Kongruenz zwischen den Regionen. Bei 86 der 112 Begriffe<br />
(77 %) ist der Sprachgebrauch in ganz Österreich einheitlich. Bei 26 von<br />
112 Begriffen (23 %) besteht innerhalb Österreichs eine deutliche Varianz,<br />
wobei in den meisten Fällen ein einheitliches österreichisches Lexikon dem<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
westösterreichischen gegenübersteht. Ausschließlich in Österreich kommen<br />
zwölf der 112 Begriffe (11 %) vor (MUHR 1997: 55). Die Untersuchungen<br />
von Glauninger und Muhr machen deutlich, dass es zwischen dem Osten<br />
und Westen Österreichs sehr wohl sprachliche Unterschiede gibt. Diese sind<br />
aber laut Muhr, zumindest im Lexikon, geringer als bislang angenommen.<br />
Auch das bereits erwähnte Überschneidungsargument beruht auf dem pluriarealen<br />
Konzept. Dieses Argument besagt, dass es zwischen Österreich<br />
und Bayern (aber auch mit der Schweiz) zahlreiche Ähnlichkeiten im<br />
Sprachgebrauch gibt und vor allem viele üblicherweise als Austriazismen<br />
bezeichnete Wörter auch in Bayern verwendet werden. Dieser Umstand<br />
ließe es nicht angebracht erscheinen, von einer „nationalen“ Variante des<br />
österreichischen Deutsch zu sprechen, da diese damit über keine sprachlichen<br />
Spezifika verfüge (MUHR 1997: 56). Die dahinter stehende Idee ist,<br />
dass eine „nationale Varietät“ durch massive linguistische Unterschiede<br />
gekennzeichnet und ihr Sprachgebiet mit der Staatsgrenze identisch sein<br />
müsste. Allerdings verwechselt man dabei die Begriffe „Varietät“ und<br />
„Sprache“, da nur eine „Sprache“ üblicherweise mit den Staatsgrenzen<br />
weitgehend deckungsgleich ist. Es liegt im Wesen einer plurizentrischen<br />
Sprache und deren Varietäten, dass diese untereinander mehr Gemeinsamkeiten<br />
als Unterschiede nennen, da sie sonst im linguistischen Sinne tatsächlich<br />
als Sprachen anzusehen wären (MUHR 1997: 56). Weiterhin wird<br />
übersehen, dass das Bairische nur in einem Teilgebiet Deutschlands gesprochen<br />
wird und durch das übrige „Binnendeutsche“ überdacht wird. Die Beschreibung<br />
der nationalen Varietäten muss daher auch den Status der jeweiligen<br />
Variante berücksichtigen. Es genügt nicht, das Vorhandensein eines<br />
Ausdrucks bloß zu konstatieren, erst der soziolinguistische Stellenwert entscheidet<br />
über seinen Gebrauch und seine kommunikative Relevanz. Nach<br />
Muhr wird dieser soziolinguistische Stellenwert bzw. Aspekt von den Vertretern<br />
des pluriarealen Konzepts vernachlässigt.<br />
Ulrich Ammon widmet in seinem Band Die deutsche Sprache in Deutschland,<br />
Österreich und der Schweiz (AMMON 1995) der Typologie und Beschreibung<br />
der nationalen Sprachvarianten einen verhältnismäßig langen<br />
Abschnitt, in dem sich wichtige, diese Fragestellungen betreffende theoretische<br />
Erwägungen finden, die implizit auch das Überschneidungsargument<br />
aufgreifen. Ammon unterscheidet zunächst zwischen solchen nationalen<br />
Varianten, deren Standardsprachlichkeit im Sprachkodex des betreffenden<br />
nationalen Zentrums ausgewiesen ist, und solchen, die nur nach Maßgabe<br />
anderer Komponenten des sprachlichen Kräftefeldes einer Sprachvarietät<br />
standardsprachlich sind (vgl. AMMON, 1995: 102). Die erste typologische<br />
Differenzierung ist also die zwischen kodifizierten und nichtkodifizierten<br />
nationalen Varianten.<br />
305
306<br />
Dalibor Zeman<br />
Eine weitere bedeutsame Aufteilung nationaler Varianten ist danach möglich,<br />
ob sie nur in demjenigen nationalen Zentrum bekannt sind, in dem sie<br />
gelten, oder ob sie darüber hinaus auch in anderen Zentren der betreffenden<br />
Sprache bekannt sind, in denen sie nicht gelten. Terminologisch lässt sich<br />
diese Differenzierung fassen, indem man zwischen nationalen Varianten<br />
nach Geltung und Bekanntheit unterscheidet (AMMON 1995: 103). Ein<br />
Beispiel für eine nationale Variante nur nach Geltung, und zwar ein „Teutonismus“,<br />
bildet das Wort Sahne, das auch in Österreich und der Schweiz<br />
bekannt ist (vgl. dazu EICHHOFF 2000: Karte 4–29; KÖNIG 2001: 222;<br />
SCHEURINGER 1988: 65 4 ). Es erscheint sogar in den Sprachkodizes beider<br />
Zentren, ist dort aber als „binnendeutsch“ markiert (vgl. ÖWB 2000). Es<br />
handelt sich somit bei Sahne um einen Teutonismus nur nach Geltung (Geltung<br />
nur in Deutschland), nicht nach Bekanntheit (Bekanntheit nicht nur in<br />
Deutschland).<br />
Nationale Varianten können ferner unterschieden werden in solche, die situationsunabhängig<br />
sind (absolute nationale Variante), d.h. unabhängig von<br />
der Situation, in der sie Verwendung finden, und in solche, die nur situationsabhängig<br />
(stilistische nationale Variante) als solche definiert werden<br />
können (AMMON 1995: 104).<br />
In einem vierten Differenzierungsschritt lassen sich nationale Varianten, die<br />
innerhalb des eigenen Zentrums in Variation stehen mit einer auch in einem<br />
anderen Zentrum geltenden oder einer gemeindeutschen Variante, unterscheiden<br />
von solchen, bei denen dies nicht der Fall ist, die also innerhalb<br />
ihres Zentrums in dieser Hinsicht invariant sind. Die ersteren sind demnach<br />
beim Sprechen und Schreiben substituierbar (austauschbare nationale Variante)<br />
– jedenfalls unter rein denotativem Aspekt –, die letzteren dagegen<br />
nicht (AMMON 1995: 104). Terminologisch lassen sich diese Unterschiede<br />
in austauschbare und nicht austauschbare bzw. zentrumsintern variable und<br />
zentrumsintern invariable nationale Varianten differenzieren. Ein Beispiel<br />
für eine austauschbare nationale Variante in Österreich ist das Lexem Paradeiser,<br />
neben dem in Österreich auch das gemeindeutsche Lexem Tomate<br />
gilt (ÖWB 1995; AMMON 1995: 104). Nach Wiesinger wäre in diatopischer<br />
Sicht gerade dieses Beispiel dem gesamtösterreichischen Wortschatz<br />
zuzuordnen, das sich von der Bundeshauptstadt Wien, teilweise erst in den<br />
letzten Jahrzehnten, in ganz Österreich durchgesetzt hat und geographisch<br />
zumindest im Gegensatz zu den in Bayern gebräuchlichen Bezeichnungen<br />
steht (mehr dazu WIESINGER 1983: 192; ähnlich auch KÖNIG 2001:<br />
224). Dagegen ist das Wort Karfiol ein nicht austauschbarer Austriazismus,<br />
denn seine lexikalische Entsprechung in den anderen Zentren, Blumenkohl,<br />
4 Weitere Beispiele verzeichnet WIESINGER (1983: 192f., 1988: 25ff.).<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
gilt in Österreich nicht. An dieser Stelle wollen wir noch erwähnen, dass<br />
bezüglich einer präzisen regionalen Differenzierung des österreichischen<br />
Wortschatzes unterschiedliche Auffassungen anzutreffen sind. In einem<br />
früheren Beitrag von Wolfgang Dressler und Ruth Wodak scheint das die<br />
diatopische Einordnung des Lexems Paradeiser in Frage gestellt worden zu<br />
sein.<br />
Paradeiser ist eben weithin in Österreich in der sozialen Bewertung so sehr gesunken, dass es<br />
nur für eine partielle Gruppe von (standardsprachlich) bewusst Österreichisch Redenden bzw.<br />
Dialektsprechern die separative Sprachfunktion erfüllen kann. (DRESSLER/WODAK 1983:<br />
253)<br />
Auch aus einer neueren empirischen Untersuchung geht hervor, dass sich<br />
auch in Ostösterreich von Wien und den anderen Städten ausgehend, umgangssprachlich<br />
zunehmend das Lexem Tomate durchsetzt und Paradeiser<br />
auf dialektale Ebene verdrängt (WIESINGER 2002).<br />
Die typologische Unterscheidung nationaler Varianten lässt sich noch weiter<br />
führen. Es existieren einerseits solche nationale Varianten, die in der<br />
gesamten Region gelten, im Gegensatz zu solchen, die nur in einem Teil des<br />
Zentrums gelten. So erstreckt sich insbesondere die Geltung mancher Austriazismen<br />
nur auf Ostösterreich und die Geltung vieler Teutonismen nur<br />
auf Norddeutschland. Fleischhauer oder Fleischhacker sind nur ostösterreichisch<br />
(ÖWB 2000, EBNER 1998, KÖNIG 2001: 196, WIESINGER 1983:<br />
192, 1988: 25ff.), westösterreichisch heißt es Metzger. Dagegen gelten Lexeme<br />
wie Abitur, Matura (Matura ist nach Wiesinger [1983, 1988] dem<br />
gesamtösterreichischen Wortschatz zuzuordnen) oder Flugpost in ganz<br />
Deutschland bzw. Österreich. Eine dementsprechend geeignete terminologische<br />
Differenzierung ist die in nationale Varianten einer Teilregion im Gegensatz<br />
zu nationalen Varianten der Gesamtregion des jeweiligen Zentrums<br />
(AMMON 1995: 106). Man könnte zunächst meinen, solche Varianten, die<br />
nicht einmal in der ganzen Region gelten, müssten auf jeden Fall Spezifika,<br />
also nationale Varianten nur dieser Region sein. Dass dies jedoch keineswegs<br />
immer zutrifft, zeigt die weitere typologische Differenzierung zwischen<br />
solchen nationalen Varianten, die lediglich in einer einzigen nationalen<br />
Region gelten, und solchen, deren Geltungsbereich sich auf mehr als<br />
eine nationale Region erstreckt. Beispiele des erstgenannten Typs sind die<br />
Lexeme Marille (Aprikose) in Österreich oder Velo (Fahrrad) in der<br />
Schweiz; sie gelten jeweils nur in der betreffenden Region. Beispiele für<br />
den letzteren Typ sind das Lexem Erdapfel (Kartoffel), das in Österreich<br />
und in der Schweiz gilt (aber nicht in Deutschland), oder das Wort Aprikose,<br />
das in Deutschland und in der Schweiz gilt (aber nicht in Österreich)<br />
(KÖNIG 2001: 206). Es liegt nahe, hier terminologisch zu unterscheiden<br />
zwischen spezifischen und unspezifischen nationalen Varianten. Aprikose<br />
307
308<br />
Dalibor Zeman<br />
ist demnach eine unspezifische nationale Variante Deutschlands wie auch<br />
der Schweiz. Ihre Entsprechung, Marille, ist dagegen eine spezifische nationale<br />
Variante Österreichs (AMMON 1995: 106). Man könnte nun bei den<br />
unspezifischen nationalen Varianten weiter differenzieren nach Geltung nur<br />
in einer Teilregion oder in der Gesamtregion, und zwar sowohl in Bezug auf<br />
die eigene als auch die jeweils andere Region. Es gibt aber auch Varianten,<br />
die außer in zwei Regionen noch in einer dritten Teilregion gelten. Ein Beispiel<br />
ist die Perfektbildung mit sein bei Verben wie liegen, sitzen, stehen,<br />
die nicht nur in Österreich und in der Schweiz, sondern überdies auch noch<br />
in Süddeutschland gilt (AMMON 1995: 108). In der Literatur werden jedoch<br />
diese Perfektformen mit sein als nationale Varianten Österreichs klassifiziert<br />
(TATZREITER 1988: 94).<br />
Das plurizentrische-kommunikationsorientierte Paradigma legt den<br />
Schwerpunkt auf das Vorhandensein mehrerer staatlicher Einheiten, die für<br />
den einzelnen Sprecher als soziale Bezugspunkte und als Handlungsrahmen<br />
dienen und daher auch Kommunikationsgemeinschaften mit eigenen pragmatischen<br />
kommunikativen Normen darstellen (MUHR 1997: 48). Das<br />
staatliche Territorium dient als Ausgangspunkt der Beschreibung von Sprache<br />
und Kommunikation des jeweiligen Landes bzw. der jeweiligen Varietät,<br />
die in einem weiteren Schritt zu den anderen Varietäten in Bezug gesetzt<br />
und mit diesen verglichen wird. Jede Varietät ist zuerst für sich zu<br />
beschreiben und aus sich heraus zu definieren, womit gewährleistet wird,<br />
dass die Normen der jeweiligen nationalen Varietät korrekt erfasst werden.<br />
Als einer nationalen Varietät zugehörig wird die Summe aller nichtstandardsprachlichen<br />
und standardsprachlichen Formen betrachtet, die es auf dem Territorium<br />
eines (z.B. deutschsprachigen) Landes gibt (MUHR 1997: 48) 5 . Davon<br />
stehen wiederum jene im Mittelpunkt der Beschreibung, die entweder<br />
überregionale oder wenigstens großregionale Verbreitung und/oder besondere<br />
soziale Relevanz haben, wobei nicht nur das Vorkommen linguistischer<br />
Ausdrücke, sondern auch ihr kommunikativer Gebrauch und ihre soziale<br />
Funktion als Mittel zum Ausdruck regionaler, sozialer und/oder<br />
nationaler Zugehörigkeit beschrieben wird.<br />
Abschließend ist noch hervorzuheben, dass für den plurizentrischen Ansatz<br />
die deutsche Standardsprache als Schnittmenge der drei Vollvarietäten betrachtet<br />
wird, während das pluriareale Konzept die überregionale Gültigkeit<br />
der deutschen Standardsprache betont.<br />
5 Ähnlich wie bei Ulrich Ammon „kodifizierte“ und „nichtkodifizierte“ nationale Varianten.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
Zusammenfassung<br />
Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ist eine heftige Diskussion über<br />
den Stellenwert nationaler Varietäten im Gange. Eine monozentrische Sicht<br />
wird mittlerweile von niemandem mehr ernsthaft vertreten. Angemessener<br />
scheint ein plurizentrisches Verständnis des Deutschen als Sprache mit drei<br />
nationalen Varietäten, mit dem die Existenz staatsbezogener Variationen<br />
akzeptiert und der bundesdeutsche Alleinvertretungsanspruch relativiert<br />
wird. Dieser Auffassung, dass jedes deutschsprachige Land eine selbständige<br />
sprachliche Region bildet, wurde zuerst in der damaligen Deutschen<br />
Demokratischen Republik mit der Darstellung des DDR-Wortschatzes entsprochen<br />
(FLEISCHER 1987). In Österreich entwickelten sich in der Diskussion<br />
der folgenden Jahre drei unterschiedliche Standpunkte, wobei das<br />
pluriareale Konzept der Sprachrealität am nächsten kommen dürfte, zumal<br />
viele Merkmale nicht mit Staatsgrenzen, sondern mit historisch gewachsenen<br />
Dialektverbänden in Zusammenhang stehen.<br />
Es wird zunehmend deutlich, dass in den letzten Jahren in der früher zum<br />
Teil emotional geführten Debatte um das österreichische Deutsch zwar unterschiedliche<br />
Standpunkte bestehen, jedoch Sachlichkeit und Nüchternheit<br />
in Sicht zu sein scheinen. Dies stellt z.B. Muhrs Beitrag von 1997 unter Beweis,<br />
in dem wichtige terminologische und theoretische Überlegungen angestellt<br />
werden. Auch Scheuringer ist bestrebt, den nüchternen Tatsachen möglichst<br />
objektiv gerecht zu werden und, wie er selbst sagt, sprachpolitische<br />
Bewertungen unbedingt zu vermeiden. Obschon viele in unserem Beitrag erwähnte<br />
Texte nicht den Gegenstand an sich behandeln, sondern eher den Charakter<br />
sprachpolitischer Ideologien haben, sollte auf diese Aspekte und Bewertungen,<br />
die wohl mehr mit gesellschaftlichen und politischen Einstellungen<br />
verbunden sind, nicht verzichtet werden, denn auch solche Momente<br />
gehören unseres Erachtens zu einer wissenschaftlichen Diskussion.<br />
Dass die regionalen und nationalen Ausprägungen des österreichischen<br />
Deutsch nicht bloße Anhängsel an eine an Deutschland orientierte Norm<br />
darstellen, sondern als gleichwertige Varietäten anzusehen sind, beweisen u. a.<br />
die 1994 begonnenen österreichischen EU-Beitrittsverhandlungen, im Rahmen<br />
derer 23 spezifisch österreichische Lexeme aus dem Bereich des Lebensmittelrechts<br />
EU-primärrechtlich verankert wurden (vgl. de CILLIA<br />
1995). Das konkrete Resultat dieser sprachpolitischen Auseinandersetzungen<br />
um den österreichischen EU-Beitritt war das so genannte Protokoll Nr.<br />
10, das in gewissem Sinne eine erste Anerkennung der eigenen österreichischen<br />
Variante der deutschen Sprache in internationalen Verträgen darstellt.<br />
Die Regelung verpflichtet zur Verwendung dieser Austriazismen, indem sie<br />
in der deutschen Sprachfassung neuer Rechtsakte den in Deutschland verwendeten<br />
Ausdrücken in geeigneter Form hinzugefügt werden. Es handelt<br />
309
310<br />
Dalibor Zeman<br />
sich also ausschließlich um eine Angelegenheit des EU-Rechtes und zukünftiger<br />
Rechtspapiere der EU. Sie betrifft aber nicht die landeseigene<br />
Rechtspraxis und nicht die alltägliche deutsche Sprachpraxis (vgl. WIESIN-<br />
GER 2002). Daher können, da es sich bei den genannten Ausdrücken nur<br />
um Lebensmittelbezeichnungen handelt, in Österreich sowohl im landeseigenen<br />
Lebensmittelrecht als auch im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie<br />
darüber hinausgehende weitere Bezeichnungen uneingeschränkt<br />
verwendet werden. Die Reaktionen auf diese Sprachregelung waren unterschiedlich.<br />
Kritisch wurde vermerkt, dass im Protokoll Nr. 10 die österreichische<br />
Varietät auf lediglich 23 Wörter reduziert wird, weshalb der Vertreter<br />
des „österreichisch-nationalen Standpunktes“ Wolfgang Pollak eine<br />
uneingeschränkte Anerkennung aller Austriazismen forderte (vgl. POLLAK<br />
1994).<br />
Bei diesen Lexemen des österreichischen Deutsch ist einerseits aus sprachgeographischer<br />
und sprachsoziologischer Sicht zu fragen, inwieweit sie auf<br />
den Ebenen der Umgangssprache und der Schrift- und Standardsprache in<br />
ganz Österreich oder nur in Teilgebieten verwendet werden und inwieweit<br />
sie in der Alltagskommunikation unterschiedliche Markierungen aufweisen.<br />
Exakte Ergebnisse bringt Peter Wiesinger (WIESINGER 2002), der in seiner<br />
neuesten Studie der Frage nachgeht, inwieweit die im Protokoll Nr. 10<br />
festgelegten Ausdrücke im österreichischen Handel und in der Gastronomie<br />
verwendet werden, bzw. ob auch andere, vor allem die bundesdeutschen<br />
Bezeichnungen anzutreffen sind. Wiesinger stellt fest, dass dort, wo die Alltagssprache<br />
in ganz Österreich einheitliche Bezeichnungen aufweist, diesen<br />
auch die Bezeichnungen im Handel folgen. Wo aber in größeren Teilen des<br />
Landes regionale Verschiedenheit besteht wie z. B bei Ribisel vs. Johannisbeere,<br />
dominiert die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung (vgl.<br />
WIESINGER 2002). Im Einzelnen geht es um folgende 23 österreichische<br />
Bezeichnungen:<br />
Beiried, Eierschwammerl, Erdäpfel, Faschiertes, Fisolen, Grammeln, Hüferl, Karfiol, Kohlsprossen,<br />
Kren, Lungenbraten, Marillen, Melanzani, Nuss, Obers, Paradeiser, Powidl, Ribisel,<br />
Rostbraten, Schlögel, Topfen, Vogerlsalat, Weichseln.<br />
So zeichnet sich die Frage ab, welche Verwendung die Austriazismen künftig<br />
in der österreichischen Sprachpraxis finden werden bzw. ob und inwiefern<br />
sich die österreichischen Sprachverhältnisse im vereinten Europa ändern<br />
werden. 6<br />
6 Für wertvolle Hinweise bin ich Peter Wiesinger von der Universität Wien zu Dank<br />
verpflichtet.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
Literaturverzeichnis<br />
AMMON, Ulrich (1995a): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich<br />
und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten. Berlin,<br />
New York: de Gruyter.<br />
AMMON, Ulrich (1995b): Vorschläge zur Typologie nationaler Zentren<br />
und nationaler Varianten bei plurinationalen Sprachen – am Beispiel des<br />
Deutschen. – In: R. Muhr, R. Schrodt, P. Wiesinger (Hgg.), Österreichisches<br />
Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachliche Aspekte<br />
einer nationalen Variante des Deutschen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky,<br />
110–120.<br />
CILLIA, Rudolf de (1995): Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat: Österreichisches<br />
Deutsch und EU-Beitritt. – In: R. Muhr, R. Schrodt, P. Wiesinger<br />
(Hg.), Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und<br />
sprachliche Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky,<br />
121–131.<br />
CILLIA, Rudolf de (1996): Deutsche Sprache und österreichische Identität.<br />
– In: tribüne 2, 2–11.<br />
CLYNE, Michael (1984): Language and Society in the German-speaking<br />
Countries. Cambridge: Cambridge Univ. Press.<br />
CLYNE, Michael (1993): Die österreichische Varietät des Deutschen im<br />
wandelnden internationalen Kontext. – In: R. Muhr (Hg.), Internationale<br />
Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbarschaftlichen Bezügen.<br />
Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 1–6.<br />
DRESSLER, Wolfgang/WODAK, Ruth (1983): Soziolinguistische Überlegungen<br />
zum Österreichischen Wörterbuch. – In: Parallela. Akten des 2.<br />
Österreichisch-italienischen Linguistentreffens. Atti del 2° convegno italoaustriaco<br />
SLI. Roma, 1.–4. 2. 1982. Hrsg. von M. Dardono, W. Dressler, G.<br />
Held. Tübingen: Niemeyer, 247–260.<br />
DOMASCHNEW, Anatoli (1993): Zum Problem der terminologischen Interpretation<br />
des Deutschen in Österreich. – In: R. Muhr (Hg.), Internationale<br />
Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbarsprachlichen<br />
Bezügen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 7–20.<br />
DUDEN (1993–1995): Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 8.<br />
Bde., 2. Aufl., Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.<br />
DUDEN (1989): Deutsches Universalwörterbuch. 2., völlig neu bearbeitete<br />
Aufl., Mannheim: Dudenverlag.<br />
311
312<br />
Dalibor Zeman<br />
EBNER, Jakob (1989): Österreichisches Deutsch – ein Thema für die Didaktik.<br />
– In: Informationen zur Deutschdidaktik 13/2, 88–98.<br />
EBNER, Jakob (1998): Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen<br />
Deutsch. 3., vollständig überarb. Aufl. Mannheim, Leipzig,<br />
Wien, Zürich: Dudenverlag.<br />
EICHLER, Ernst (1965): Deutsch-tschechische Beziehungen im Wortschatz.<br />
– In: Forschung und Fortschritte 39, 268–270.<br />
EICHHOFF, Jürgen (1977/1978/1993/2000): Wortatlas der deutschen Umgangssprache.<br />
Bd. 1. Bern, München: France 1977; Bd. 2. ebd. 1978; Bd. 3.<br />
München, New Providence, London, Paris, Bern: K.G. Saur. 1993; Bd. 4.<br />
Bern, München: K.S. Verlag.<br />
FLEISCHER, Wolfgang (1987): Wortschatz der deutschen Sprache in der<br />
DDR. Fragen seines Aufbaus und seiner Verwendungsweise. Leipzig: Bibliogr.<br />
Institut.<br />
GLAUNINGER, Manfred (1997): Untersuchungen zum Wortschatz des<br />
Österreichischen Deutsch. Diplomarbeit an der Geisteswissenschaftlichen<br />
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz.<br />
KINNE, Michael/STRUBE-EDELMANN, Birgit (1981): Kleines Wörterbuch<br />
des DDR-Wortschatzes. Düsseldorf: Schwann.<br />
MÖCKER, Hermann (1992): Aprikosenklöße? – Nein danke! „Österreichisches<br />
Deutsch“ – „Deutschländisches Deutsch“. – In: Österreich in Geschichte<br />
und Literatur 36, 236–249.<br />
MOSER, Hans (1985): Die Entwicklung der deutschen Sprache seit 1945. –<br />
In: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache<br />
und ihrer Erforschung. Hrsg. von W. Besch. Berlin, New York: de Gruyter,<br />
1678–1707.<br />
MUHR, Rudolf (1982): Österreichisch. Anmerkungen zur linguistischen<br />
Schizophrenie einer Nation. – In: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft<br />
8, 306–319.<br />
MUHR, Rudolf (1987): Deutsch in Österreich – Österreichisch. Zur Begriffsbestimmung<br />
und Normfeststellung der Standardsprache in Österreich.<br />
–In: Grazer Arbeiten zu Deutsch als Fremdsprache und Deutsch in Österreich<br />
1, 1–23.<br />
MUHR, Rudolf (1989): Deutsch und Österreich(isch): Gespaltene Sprache<br />
– Gespaltenes Bewußtsein – Gespaltene Identität. – In: Informationen zur<br />
Deutschdidaktik 13/2, 74–87.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
MUHR, Rudolf (1993a): Österreichisch – Bundesdeutsch – Schweizerisch.<br />
Zur Didaktik des Deutschen als plurizentrische Sprache. – In: Ders. (Hg.),<br />
Internationale Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbarsprachlichen<br />
Bezügen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 108–123.<br />
MUHR, Rudolf (1993b): Pragmatische Unterschiede in der deutschsprachigen<br />
Kommunikation – Österreich : Deutschland. – In: Ders. (Hg.), Internationale<br />
Arbeiten zum österreichischen Deutsch und seinen nachbarsprachlichen<br />
Bezügen.Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 26–38.<br />
MUHR, Rudolf (1995): Grammatische und pragmatische Merkmale des<br />
österreichischen Deutsch. – In: Ders., R. Schrodt, P. Wiesinger (Hgg.),<br />
Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachliche<br />
Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien: Hölder-<br />
Pichler-Tempsky, 208–234.<br />
MUHR, Rudolf (1996): Österreichisches deutsch – nationalismus? Einige<br />
argumente wider den zeitgeist – Eine klarstellung. – In: tribüne. Heft<br />
1996/1: 12–18.<br />
MUHR, Rudolf (1997): Zur Terminologie und Methode der Beschreibung<br />
plurizentrischer Sprachen und deren Varietäten am Beispiel des Deutschen.<br />
– In: Ders., R. Schrodt (Hgg.), Österreichisches Deutsch und andere<br />
nationale Varietäten plurizentrischer Sprachen in Europa. Empirische<br />
Analysen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 40–65.<br />
ÖSTERREICHISCHES WÖRTERBUCH. Hrsg. im Auftrag des Bundesministeriums<br />
für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 38. Auflage, Nachdruck<br />
2000 (1,02) von Otto Back, Erich Benedikt, Karl Blüml, Jakob Ebner, Maria<br />
Hornung, Hermann Möcker, Ernst Pacolt, Herbert Tatzreiter. Wien: Jugend<br />
& Volk.<br />
POHL, Heinz Dieter (1997): Gedanken zum österreichischen Deutsch (als<br />
Teil der ‚pluriarealen‘ deutschen Sprache). – In: R. Muhr, R. Schrodt<br />
(Hgg.), Österreichisches Deutsch und andere nationale Varietäten plurizentrischer<br />
Sprachen in Europa. Empirische Analysen. Wien: Hölder-Pichler-<br />
Tempsky, 67–88.<br />
POLENZ, Peter von (1988): ‚Binnendeutsch‘ oder plurizentrische Sprachkultur?<br />
Ein Plädoyer für Normalisierung in der Frage der ‚nationalen‘ Varianten.<br />
– In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 16, 198–218.<br />
POLLAK, Wolfgang (1992): Was halten die Österreicher von ihrem<br />
Deutsch? Eine sprachpolitische und soziosemiotische Analyse der sprachlichen<br />
Identität der Österreicher. Wien: ÖGS/ISSS.<br />
313
314<br />
Dalibor Zeman<br />
POLLAK, Wolfgang (1994): Österreich und Europa. Sprachkulturelle und<br />
nationale Identität. Wien: ÖGS/ISSS.<br />
REIFFENSTEIN, Ingo (1982): Hochsprachliche Norm und regionale Varianten<br />
der Hochsprache: Deutsch in Österreich. – In: H. Moser (Hgg.), Zur<br />
Situation des Deutschen in Südtirol. Innsbruck: H. Kowatsch, 9–18. (=<br />
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Germanistische Reihe 13).<br />
REIFFENSTEIN, Ingo (1995): Das österreichische Wörterbuch: Zielsetzung<br />
und Funktionen. – In: R. Muhr, R. Schrodt, P. Wiesinger (Hg.), Österreichisches<br />
Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachliche<br />
Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien: Hölder-Pichler-<br />
Tempsky, 158–165.<br />
SCHEURINGER, Hermann (1988): Powidldatschkerl oder Die kakanische<br />
Sicht aufs Österreichische. – In: Internationales Jahrbuch für Germanistik<br />
20/1, 63–70.<br />
SCHEURINGER, Hermann (1996a): Deutsch in Österreich – unterschiedliche<br />
Standpunkte, und wohl auch kein Kompromiß in Sicht. – In: tribüne.<br />
Heft 1996/4, 5–8.<br />
SCHEURINGER, Hermann (1996b): Das Deutsche als pluriareale Sprache:<br />
Ein Beitrag gegen staatlich begrenzte Horizonte in der Diskussion um die<br />
deutsche Sprache in Österreich. – In: Unterrichtspraxis/Teaching German.<br />
Zeitschrift des amerikanischen Deutschlehrerverbandes 2/96, 147–154.<br />
SCHEURINGER, Hermann (2001): Die deutsche Sprache in Österreich. –<br />
In: E. Knipf-Komlósi, N. Berend (Hgg.), Regionale Standards. Sprachvariationen<br />
in den deutschsprachigen Ländern. Budapest, Pésc: Dialóg Campus<br />
Kaidó.<br />
SCHRODT, Rudolf (1997): Nationale Varianten, areale Unterschiede und<br />
der ‚Substandard‘: An den Quellen des Österreichischen Deutsch. – In: R.<br />
Muhr, Ders. (Hgg.), Österreichisches Deutsch und andere nationale Varietäten<br />
plurizentrischer Sprachen in Europa. Empirische Analysen. Wien:<br />
Hölder-Pichler-Tempsky, 12–40.<br />
TATZREITER, Herbert (1988): Besonderheiten in der Morphologie der<br />
deutschen Sprache in Österreich. – In: P: Wiesinger (Hg.), Das österreichische<br />
Deutsch. Wien, Graz: Böhlau, 71–98.<br />
WIESINGER, Peter (1980): Zum Wortschatz im ‚Österreichischen Wörterbuch‘.<br />
– In: Österreich in Geschichte und Literatur 24, 367–397.<br />
WIESINGER, Peter (1983): Sprachschichten und Sprachgebrauch in Österreich.<br />
– In: Zeitschrift für Germanistik 4, 184–195.<br />
Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen<br />
WIESINGER, Peter (1985): Die Entwicklung des Verhältnisses von Mundart<br />
und Standardsprache in Österreich. – In: W. Besch u.a. (Hg.), Sprachgeschichte.<br />
Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer<br />
Erforschung. Berlin: de Gruyter, 1939–1949.<br />
WIESINGER, Peter (1988): Die deutsche Sprache in Österreich. Eine Einführung.<br />
– In: Ders., Das österreichische Deutsch. Wien, Graz: Böhlau, 9–<br />
30.<br />
WIESINGER, Peter (1995a): Das österreichische Deutsch in der Diskussion.<br />
– In: R. Muhr, R. Schrodt, Ders. (Hgg.), Österreichisches Deutsch. Linguistische,<br />
sozialpsychologische und sprachliche Aspekte einer nationalen<br />
Variante des Deutschen. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky, 59–75.<br />
WIESINGER, Peter (1997): Das österreichische Deutsch. – In: Germanistische<br />
Mitteilungen. Brüssel: Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband<br />
(BGDV), 1–9.<br />
WIESINGER, Peter (2000): Zum ‚Österreichischen Wörterbuch‘. Aus Anlaß<br />
der 38. Neubearbeiteten Auflage (1997). – In: Zeitschrift für germanistische<br />
Linguistik 28, 41–64.<br />
WIESINGER, Peter (2001): Das Deutsch in Österreich. – In: G. Helbig, L.<br />
Götze, G. Henrici, H. J. Krumm (Hgg.), Deutsch als Fremdsprache. Ein<br />
internationales Handbuch. Halbbd. 1. Berlin, New York: de Gruyter, 481–<br />
491.<br />
WIESINGER, Peter (2002): Austriazismen als Politikum. – In: W. Ágel, A.<br />
Gardt, U. Haß-Zumkehr, T. Roelcke (Hgg.), Das Wort. Seine strukturelle<br />
und kulturelle Dimension. Festschrift für Oskar Reichmann zum 65. Geburtstag.<br />
Tübingen: Niemeyer, 159–182.<br />
315
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen<br />
der Bundesrepublik Deutschland zu den MOE-Ländern haben nach 1989<br />
eine neue Dynamik bekommen. Durch Kooperationen, Direktinvestitionen<br />
und Verlagerung der Produktion ist im Laufe der Zeit eine Reihe von großen,<br />
mittleren und kleinen Unternehmen entstanden, die in unterschiedlicher<br />
Form und in unterschiedlichem Ausmaß als ‚gemischt‘ gelten können. Das<br />
hier präsentierte Projekt „Osteuropäische Sprachen als Faktor der wirtschaftlichen<br />
Kommunikation“ (2003–2005), das im Rahmen des FOROST-Verbundes<br />
durch das Bayerische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und<br />
Kunst finanziert wird und am <strong>Bohemicum</strong> angesiedelt ist, befasst sich mit der<br />
Kommunikation in solchen Unternehmen. Die Unternehmenskommunikation<br />
wird im Kontext der Organisationskommunikation analysiert und als ein<br />
Netz von intendierten/erwarteten Interaktionen verstanden, die nach innen<br />
und außen ein strukturiertes Ganzes ergeben und die in konkreten Kommunikationsereignissen<br />
eingelöst/nicht eingelöst werden. Bei der Analyse liegt<br />
der Fokus auf deutschen, österreichischen und schweizerischen Unternehmen,<br />
die in der Tschechischen Republik Niederlassungen, Tochtergesellschaften,<br />
Joint ventures oder neue Unternehmen gründeten und dadurch in<br />
einen interkulturellen Kontext traten.<br />
Dabei kommt es bei einer Organisation zunächst nicht auf konkrete Individuen,<br />
sondern auf die Rollen oder auf die Stellen und ihre Aufgabenbereiche<br />
an, die sich in interaktivem Verhältnis zu anderen Rollen definieren<br />
lassen und die alle zusammen eine ‚Ganzheit‘ (ein strukturiertes Ganzes)<br />
bilden, die intern wie extern agieren soll. Um die Organisation agieren lassen<br />
zu können, werden diese Stellen durch Individuen besetzt, die ihre Rollen<br />
(Stellen) im idealen Fall ‚ausfüllen‘. Das heißt, dass die Individuen fähig<br />
sind, die Interaktionen auszuführen, die für ihre Rollen erwartet werden<br />
bzw. relevant sind. Diese Interaktionen setzen sie konkret in der Kommunikation<br />
um. Überspitzt formuliert könnte man auch Unternehmen als Organisationen<br />
definieren, wobei die Organisation als Ganzheit von Interaktionen<br />
verstanden werden könnte, die ihre Mitglieder v.a. in der internen, aber<br />
auch in der externen Kommunikation ausführen (MAST 2003).<br />
Allein auf Grund der Definition des Unternehmens als Organisation wird<br />
also deutlich, dass die Frage der Kommunikation für die Unternehmen von<br />
existentieller Bedeutung ist. Es überrascht nicht, dass dies für die interkultu-
318<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
rell agierenden Unternehmen in ganz besonderem Maße zutrifft, da diese<br />
durch die geeignete Wahl des gemeinsamen sprachlichen Kodes eine<br />
Kommunikation zunächst überhaupt möglich machen müssen.<br />
Grundsätzlich gibt es in der interkulturellen Kommunikation bei der Wahl<br />
des Kodes, der Sprache – sowohl zwischen den Unternehmen als auch innerhalb<br />
des Unternehmens (vgl. auch VANDERMEEREN 1998) – drei Varianten:<br />
die Nicht-Adaptation, die Adaptation und die Standardisierung. (1)<br />
Im Falle der Nicht-Adaptation fehlt ein gemeinsamer Kode, so dass auf<br />
Übersetzer- und Dolmetscherdienstleistungen zurückgegriffen werden<br />
muss. (2) Bei der Adaptation geht ein Kommunikationsteilnehmer – passiv<br />
oder auch aktiv – auf die Muttersprache des Anderen ein, die für ihn in der<br />
Regel eine Fremdsprache ist. Im Falle, dass eine solche Adaptation in beiden<br />
Richtungen erfolgt, nennen wir sie symmetrisch, nur in einer Richtung<br />
erfolgend ist sie als asymmetrisch zu charakterisieren. Die asymmetrische<br />
Adaptation droht in der konkreten Kommunikation sowie innerhalb des Unternehmens<br />
in eine kommunikative Dominanz (der Muttersprachler) und<br />
Subdominanz (der Nichtmuttersprachler) überzugehen, so dass die interkulturelle<br />
Kommunikation durch Neutralisierungsstrategien entlastet werden<br />
muss wie etwa die paritätische Besetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates,<br />
die Einrichtung von Tandems u.a.m. (vgl. NEKULA 2002, auch<br />
HÖHNE 1995, 1997). (3) Unter Standardisierung versteht man in der interkulturellen<br />
Kommunikation die Wahl einer dritten Sprache, in deutschtschechischen<br />
Unternehmen etwa des Englischen (vgl. NEKVAPIL 2000,<br />
VOLLSTEDT 2002), in niederländisch-tschechischen Unternehmen oft des<br />
Deutschen, in Osteuropa immer noch auch des Russischen usw. Die angesprochenen<br />
Varianten werden im Konkreten kombiniert.<br />
Die Aufgabe des oben erwähnten Projektes ist es, festzustellen, welcher Kode<br />
bzw. welche Kodes wie und unter welchen Bedingungen sowie unter welchem<br />
Kostenaufwand und mit welchen Konsequenzen in den deutschtschechischen<br />
Unternehmen in der Tschechischen Republik gewählt werden.<br />
Wenn man den Kostenaufwand am Beispiel der deutsch-tschechischen Unternehmen<br />
berechnen bzw. diesen Kostenaufwand zumindest andeuten will,<br />
kann dieser grundsätzlich positiv oder negativ abgegrenzt werden. Der positive<br />
Wert ist die Investition in die Qualifikation der Arbeitskräfte, der negative<br />
Wert sind die anfallenden Kosten bei fehlender Qualifikation derselben.<br />
Das Attribut ‚positiv‘ in ‚positiver Wert‘ macht dabei deutlich, dass die Kosten<br />
für eine Sprachausbildung bzw. eine Ausbildung in der interkulturellen<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Handlungskompetenz sowie die Mehrausgaben für entsprechend ausgebildete<br />
Fachkräfte als (eine Art) Investition verstanden werden kann, die für<br />
das Unternehmen zumindest mittelfristig einen Mehrwert bringt. Dass dies<br />
tatsächlich so ist, zeigt die Tatsache, dass die richtige Sprachqualifikation<br />
nicht nur die Kosten für Dolmetscher- und Übersetzerdienstleistungen senkt,<br />
sondern die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens steigert. Vandermeeren<br />
(1998) macht dies im Hinblick auf deren Außenhandel nachvollziehbar.<br />
Die Investitionen in die Fremdsprachenausbildung bringen aber in<br />
den interkulturell gebildeten und agierenden Unternehmen einen Mehrwert<br />
auch im Hinblick auf die Arbeitsproduktivität.<br />
Das Attribut ‚negativ‘ in ‚negativer Wert‘ macht deutlich, dass die Kosten<br />
für interne wie externe Dolmetscher- und Übersetzungsdienstleistungen<br />
sowie Sprachassistenten als laufend anfallende Kosten zu verstehen sind.<br />
Außerdem sind darunter auch Verluste bzw. Folgekosten zu verstehen, die<br />
durch fehlende Kontrolle der Kommunikation (etwa bei Einführung neuer<br />
Technologien oder bei Geschäftsverhandlungen und Schließen von Verträgen)<br />
oder nicht erzielte Kostenoptimierung durch Steigerung der Arbeitsproduktivität<br />
zustande kommen, die durch weiche Faktoren wie etwa<br />
Kommunikationsklima bzw. Identifikation mit dem Unternehmen durchaus<br />
steuerbar ist.<br />
Obwohl die zentrale Bedeutung der Kommunikation und des Kommunikationsmanagements<br />
für ein Unternehmen im Allgemeinen und für ein interkulturell<br />
agierendes Unternehmen im Besonderen deutlich geworden ist,<br />
scheint die genaue Berechnung des negativen und positiven Wertes des<br />
Sprachfaktors (der Sprachqualifikation) keine einfache Aufgabe zu sein.<br />
Daher haben wir uns in unserem Beitrag im Prinzip nur auf den negativen<br />
Wert beschränkt, in dessen Rahmen sich die sog. Nicht-Adaptations-Fälle<br />
mit DOLMETSCHEN und ÜBERSETZEN quantitativ erfassen lassen.<br />
Die Wirkung der symmetrischen und asymmetrischen Adaptation bzw. auch<br />
der Standardisierung, die im Hinblick auf ihren positiven wie auch negativen<br />
Wert eher über qualitative Methoden fassbar gemacht werden kann<br />
(Motivation u.a. durch Interviews), lassen wir in diesem Beitrag weitgehend<br />
außer Acht.<br />
So wurde in der ersten Phase unseres Projektes in den Jahren 2002 und<br />
2003 durch eine Fragebogenbefragung die Belastung der Unternehmen<br />
durch Einschaltung von Sprachvermittlung im Hinblick auf spezifische<br />
Domänen innerhalb der Unternehmen erhoben und – wenigstens teilweise –<br />
berechenbar gemacht. Dabei wurden die Unternehmen zunächst durch eine<br />
319
320<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Anzeige in der Zeitschrift der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer<br />
PLUS angesprochen, dann wurden die deutschen, österreichischen<br />
und schweizerischen Unternehmen angeschrieben, die in der Tschechischen<br />
Republik aktiv sind und bei der DTIHK Prag, bei der AHST der<br />
Österreichischen Botschaft bzw. bei der HST der Handelskammer Schweiz<br />
registriert sind.<br />
Der Fragebogen besteht aus 10 weiter gegliederten Fragen, die neben der<br />
Unternehmensgröße, der Vertretung des Unternehmens an den mittel- und<br />
osteuropäischen Märkten und der Unternehmensbranche auch Informationen<br />
über Firmensprache, Tschechischkenntnisse der ausländischen Mitarbeiter,<br />
Dolmetscher- und Übersetzereinsätze und Förderung des Fremdsprachenerwerbes<br />
der Mitarbeiter des Unternehmens erfassen. Der Fragebogen<br />
wurde extern begutachtet und an einer kleinen Probegruppe von 5 Unternehmen<br />
weiter geschärft.<br />
Auf diese Weise wurden ca. 2.000 Unternehmen angesprochen, wobei die<br />
Rücklaufquote bei ca. 17 % lag. Bei einem solchen Rücklauf – sowie auch<br />
im Hinblick darauf, dass die Unternehmen bezüglich Größe 1 und Branche<br />
proportional zur Wirtschaftsstruktur der Tschechischen Republik vertreten<br />
sind – lassen sich nach Auswertung der Fragebögen mit gebotener Vorsicht<br />
gewisse Tendenzen aufzeigen, auf deren Grundlagen auch der ‚Wert‘ des<br />
Sprachfaktors (der Sprachqualifikation) in diesen Unternehmen quantitativ<br />
bestimmt werden kann.<br />
Mit der wachsenden Globalisierung der wirtschaftlichen Kontakte und der<br />
Unternehmenstätigkeit haben einige, vor allem die großen im internationalen<br />
Bereich agierenden Unternehmen in ihre Satzungen oder in die Beschreibung<br />
ihrer Unternehmenspolitik auch die Frage der offiziellen Firmensprache<br />
miteinbezogen.<br />
1 Hinsichtlich ihrer Größe werden Unternehmen in drei Gruppen gegliedert: klein, mittelgroß,<br />
groß. Die Größe wird entweder nach dem Firmenumsatz oder nach der Zahl der<br />
Beschäftigten definiert. Wir haben für die Bestimmung der Größenklasse die Mitarbeiterzahl<br />
herangezogen und bezeichnen ein Unternehmen als klein, wenn es weniger als<br />
10 Beschäftigte hat, als mittelgroß wenn es über 10 bis 499 Mitarbeiter verfügt. Zu den<br />
Großunternehmen zählen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Diese Definition<br />
richtet sich nach den Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie<br />
(1997/98). Nach MÖLLER/BRANDMEIER (2002: 42).<br />
52%<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Vorgabe der Firmensprache<br />
10%<br />
38%<br />
keine Angaben<br />
nein<br />
ja<br />
Aus der Statistik geht hervor, dass mehr als die Hälfte aller Unternehmen<br />
eine offizielle Firmensprache vorsieht (in den großen Unternehmen sind es<br />
ungefähr zwei Drittel). Wenn man von solchen Antworten wie „offiziell<br />
zwar Deutsch, tatsächlich Tschechisch“ oder „Englisch, aber verwendet<br />
wird Deutsch“ zunächst absieht, kann man folgende Verteilung der Sprachen<br />
feststellen: in den meisten Unternehmen mit einer offiziellen Firmensprache<br />
ist die Firmensprache Deutsch (55 %). Wenn man die Angaben, wo<br />
Deutsch als eine der zwei offiziellen Firmensprachen fungiert, dazurechnet,<br />
steigt die Zahl beträchtlich. Tschechisch als alleinige Firmensprache haben<br />
9 % der Befragten angegeben.<br />
15%<br />
5%<br />
55%<br />
Firmensprache<br />
16%<br />
9%<br />
Englisch<br />
Tschechisch<br />
Deutsch<br />
Englisch+Deutsch<br />
Tschechisch+Deutsch<br />
Im Vergleich mit einer älteren Studie, in der die Kommunikationssprache in<br />
solchen Unternehmen erfragt wurde (vgl. SCHMITZ/PHILIPP 1996), ist<br />
eine weitere Stärkung der Fremdsprachen, besonders des Englischen, sicht-<br />
321
322<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
bar. Trotzdem wird in dem Diagramm auf den ersten Blick deutlich, dass<br />
sich das Deutsche in der Tschechischen Republik in solchen Unternehmen<br />
sehr wohl vor dem Englischen behaupten kann, wofür es in Tschechien wie<br />
im übrigen Osteuropa immer noch relativ gute strukturelle Voraussetzungen<br />
gibt (vgl. NEKULA <strong>2004</strong>), da das Deutsche neben dem Englischen immer<br />
noch zu den meistunterrichteten Fremdsprachen gehört:<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
1991/92<br />
1992/93<br />
Fremdsprachen an tschechischen Gymnasien<br />
(nach statistischen Angaben des MŠMT)<br />
1993/94<br />
1994/95<br />
1995/96<br />
1996/97<br />
1997/98<br />
1998/99<br />
1999/00<br />
2000/01<br />
2001/02<br />
2002/2003<br />
Englisch<br />
Deutsch<br />
Französisch<br />
Russisch<br />
Spanisch<br />
Nach dem Bericht eines Meinungsforschungsinstituts, in dem die Fremdsprachenkenntnisse<br />
in der Tschechischen Republik ausgewertet wurden, lag<br />
Deutsch im Mai 2003 mit 40 % deutlich vor Russisch mit 29 % und Englisch<br />
mit 27 % (vgl. NEKULA <strong>2004</strong>).<br />
Latein<br />
Andere Angaben lassen jedoch eine leise Skepsis im Hinblick auf das Niveau<br />
dieser Kompetenz aufkommen:<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Noch schlechter sieht es an den Grundschulen aus:<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Fremdsprachenqualifikation der Lehrer an Gymnasien<br />
(nach Nekvapil 2003) in %<br />
1995/96 1996/97<br />
qualifiziert<br />
nicht qualifiziert<br />
Diagramm 7: Fremdsprachenqualifikation der Lehrer an den<br />
Grund- und Hauptschulen (nach Nekvapil 2003) in %<br />
1995/96 1996/97<br />
So besagt die Angabe einer offiziellen Firmensprache wohl nichts über die<br />
tatsächliche Kommunikationssprache. Die tatsächliche Sprachwirklichkeit<br />
in den Unternehmen sieht offensichtlich anders aus als die, die offiziell intendiert<br />
wird. Auch wenn wir die Unternehmen von Deutschland aus konsequent<br />
zweisprachig angeschrieben haben, wurden in der Regel die tschechischen<br />
Fragebögen zurückgeschickt:<br />
323<br />
qualifiziert<br />
nicht qualifiziert
324<br />
66%<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Sprachversion<br />
der zurückgesandten Fragebögen<br />
5%<br />
29%<br />
deutsche Version<br />
tschechische Version<br />
beide Versionen<br />
Dieses Bild wird durch Angaben über den Umfang des Dolmetschens und<br />
Übersetzens in deutsch-tschechischen Unternehmen bestätigt. So ist festzustellen,<br />
dass in 18 % der Unternehmen fest angestellte Sprachvermittler arbeiten,<br />
wobei die Prozentzahl bei großen Unternehmen auf 40 % steigt. In<br />
43 % der Unternehmen, die Sprachvermittler fest anstellen, arbeitet mehr<br />
als eine Person als Dolmetscher, Übersetzer oder Sprachassistent. Beispielsweise<br />
wurden in einem Automobilwerk im Jahre 2003 laut der Dolmetscherabteilung<br />
etwa 80 ausländische Experten, 9 interne und bis zu 60<br />
externe Sprachvermittler beschäftigt.<br />
Fest angestellte Sprachvermittler<br />
(insgesamt)<br />
82%<br />
18%<br />
fest angestellt<br />
keine oder keine<br />
Angaben<br />
Ein Beweis dafür, dass man mit den deklarierten Firmensprachen Deutsch<br />
und Englisch nicht überall zurecht kommt, ist auch die Zahl der Unternehmen,<br />
die keinen eigens für die Übersetzung fest angestellten Sprachvermittler<br />
haben, sondern nach eigenen Angaben für den unternehmerischen All-<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
tag, d.h. sowohl für die gesprochene als auch für die geschriebene Kommunikation<br />
regelmäßig externe Dolmetscher und Übersetzer benötigen. Insgesamt<br />
sind es 58 % (47 % der kleinen Unternehmen, 66 % der mittelgroßen<br />
Unternehmen und 70 % der großen Unternehmen).<br />
Externe Sprachvermittler<br />
42%<br />
58%<br />
externe Sprachvermittler<br />
keine oder keine Angaben<br />
Zusammengerechnet sind es 71 % der Unternehmen, die explizit angegeben<br />
haben, Sprachvermittler fest angestellt zu haben oder freiberuflich zu beschäftigen,<br />
bzw. für solche Personen finanzielle Ausgaben zu haben:<br />
29%<br />
Sprachvermittler JA X NEIN<br />
(insgesamt)<br />
71%<br />
JA, extern und/oder<br />
intern<br />
NEIN, keine (oder keine<br />
Angaben)<br />
Die Zahl der Unternehmen, welche die Tätigkeit der Sprachvermittler bestätigen,<br />
ist jedoch viel größer (80 %, bei großen Unternehmen sogar 95 %!).<br />
Einige Unternehmen, welche die Frage nach Inanspruchnahme von Sprach-<br />
325
326<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
vermittlern mit ‚nein‘ beantwortet haben, haben ihre Angaben in weiteren<br />
Antworten korrigiert, indem sie die Dienstleistungen der Sprachvermittler<br />
bei Übersetzungstätigkeiten beschrieben und somit indirekt angegeben haben.<br />
Unklar ist, ob man in solchen Unternehmen doch interne oder externe<br />
Sprachvermittler beschäftigt oder ob anderweitig beschäftigte Mitarbeiter<br />
für diese Tätigkeiten eingesetzt werden.<br />
20%<br />
Tatsächliche Inanspruchnahme der<br />
Sprachvermittler<br />
80%<br />
JA<br />
NEIN (oder keine<br />
Angaben)<br />
An dieser Stelle ist es interessant, sich die Unternehmen anzusehen, die keine<br />
Sprachvermittler brauchen bzw. die davon ausgehen, keine Sprachvermittler<br />
zu benötigen. So gibt ein Maschinenhersteller mit 8.300 Beschäftigten an,<br />
dass er in Tschechien 9 Mitarbeiter beschäftigt, wobei in Deutschland 4 Mitarbeiter<br />
für Tschechien zuständig sind. Eine ähnliche Konstellation findet<br />
man auch bei einer Bank mit 3.000 Beschäftigten, bei der in Deutschland 4<br />
Mitarbeiter für Tschechien zuständig sind und die in Tschechien 3 Mitarbeiter<br />
angestellt hat. Auf Grund weiterer Angaben ist dies ein klares Beispiel dafür,<br />
dass die tschechischen Mitarbeiter neben den Marketing- und anderen Aufgaben<br />
auch die Rolle der Sprachvermittler gegenüber der Zentrale übernehmen<br />
müssen, da die Mitarbeiter in Tschechien über keine Entscheidungsbefugnisse<br />
und die Mitarbeiter in der Zentrale über keine Tschechischkenntnisse<br />
verfügen. Ähnlich sieht es bei einem Unternehmen aus, welches Hopfen<br />
vertreibt und in Deutschland etwa 50, in Tschechien einen Mitarbeiter<br />
beschäftigt, oder bei anderen Unternehmen, zum Beispiel einem internationalen<br />
Speditionsunternehmen, einem Reifenhandelsunternehmen usw. Auch<br />
hier besteht ein Teil der Arbeitsaufgaben tschechischer Mitarbeiter in der<br />
Sprach- oder der auf der Landessprache basierenden Wissensvermittlung für<br />
die Entscheidungsträger. Dies trifft auf weitere Unternehmen zu, deren Inhaber<br />
oder Management über keine Tschechischkenntnisse verfügen und bei<br />
Entscheidungen sowie bei der Kommunikation mit Handelspartnern, Kunden<br />
und Behörden auf die Vermittlung der deutsch und englisch sprechen-<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
den tschechischen Mitarbeiter angewiesen sind. Insgesamt handelt es sich<br />
um weitere ca. 7 % der Unternehmen, oft aus den Branchen Finanz- und<br />
Beratungsunternehmen und Handel, in denen die Sprach- und Wissensvermittlung<br />
zwar nicht als solche reflektiert wird, in denen jedoch auf Grund<br />
der Verteilung von Entscheidungskompetenzen eine solche Tätigkeit im<br />
Arbeitsalltag von tschechischen Mitarbeitern regelmäßig durchgeführt werden<br />
muss, damit die deutschsprachige Leitung Entscheidungen treffen kann.<br />
Das Verhältnis sieht dann folgendermaßen aus:<br />
13%<br />
Sprachvermittlertätigkeit<br />
87%<br />
JA<br />
KEINE (oder keine<br />
Angaben)<br />
Die Umfrage hat ergeben, dass in den meisten Unternehmen, nämlich in 87<br />
%, entweder professionelle Sprachvermittler oder in einer anderen Position<br />
beschäftigte Mitarbeiter als Sprachvermittler eingesetzt werden. Das ist 15<br />
Jahre nach der Wende und unmittelbar nach der EU-Osterweiterung ein<br />
eher bescheidenes Ergebnis.<br />
Das Ausmaß der Belastung, die durch Dolmetschen und Übersetzen entsteht,<br />
ist schon deswegen schwer zu bestimmen, weil die Angaben in den<br />
Fragebögen auf der Selbsteinschätzung der Unternehmen beruhen, die sehr<br />
subjektiv sein kann. Einer der Befragten bemerkt zu der Frage, ob in seinem<br />
Unternehmen gedolmetscht wird, Folgendes: „Nein, meine Mitarbeiter übersetzen,<br />
wenn ich an Besprechungen teilnehme.“ In diesem Fall weiß man<br />
augenscheinlich, dass ein Teil der unmittelbaren Mitarbeiter des deutschen<br />
Leiters kein Deutsch bzw. Englisch beherrscht und dass in diesem Unternehmen<br />
gedolmetscht wird, und zwar auch innerhalb des Unternehmens,<br />
nicht nur bei Verhandlungen mit Behörden, Kunden und Zulieferern. Da der<br />
deutsche Manager ohne Tschechischkenntnisse arbeitet und eine Produktion<br />
mit 60 tschechischen Mitarbeitern leitet, ist davon auszugehen, dass man in<br />
diesem Unternehmen beim konsekutiven Dolmetschen wöchentlich mehrere<br />
327
328<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Stunden verliert, die man an anderer Stelle einsetzen könnte. Dieser Fall ist<br />
trotz der zitierten Selbsteinschätzung eindeutig. Es ist sicher nicht falsch,<br />
wenn man davon ausgeht, dass die Situation anderer Unternehmen ähnlich<br />
gelagert ist.<br />
Dennoch kann die Belastung durch das Dolmetschen und Übersetzen in<br />
gewissem Maß quantifiziert werden. Hier beschränken wir uns auf die etwa<br />
80 % der Unternehmen, die dazu eindeutige Aussagen gemacht haben.<br />
Im Hinblick auf die qualitative Bestimmung des negativen Wertes des<br />
Sprachfaktors (der Sprachausbildung) ist die Verteilung der Dolmetscher-<br />
und Übersetzerdienste in der Unternehmenskommunikation von Interesse.<br />
47 % der Befragten (bei großen Unternehmen sind es 60 %), die dolmetschen<br />
und/oder übersetzen lassen müssen, tun dies innerhalb des Unternehmens.<br />
53%<br />
Übersetzen und/oder Dolmetschen INTERN<br />
47%<br />
ja<br />
nein (oder keine<br />
Angaben)<br />
Im Hinblick auf die quantitative Berechnung der anfallenden Kosten stellen<br />
wir fest, dass 54 % monatlich, 6 % wöchentlich und 36 % der Unternehmen<br />
täglich dolmetschen und/oder übersetzen lassen müssen.<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Übersetzen und/oder Dolmetschen<br />
INTERN<br />
54%<br />
4%<br />
6%<br />
36%<br />
täglich wöchentlich<br />
monatlich keine Angaben<br />
Sehen wir uns das interne tägliche Übersetzen/Dolmetschen an, stellen wir<br />
fest, dass in 44 % dieser Unternehmen bis zu 2 Stunden täglich und in ganzen<br />
56 % der Unternehmen mehr als 2 Stunden täglich Sprachvermittlertätigkeiten<br />
ausgeübt werden.<br />
Tägliches Übersetzen und/oder<br />
Dolmetschen INTERN<br />
56%<br />
44%<br />
bis zu 2 Std. täglich mehr als 2 Std. täglich<br />
Noch größer ist die Zahl der Unternehmen, die Dolmetscher- und/oder<br />
Übersetzungstätigkeiten nach außen richten: an Kunden, Behörden, Ge-<br />
329
330<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
schäftspartner und Lieferanten. Hier sind es 76 %. Die Frequenz des täglichen<br />
Dolmetschens/Übersetzens liegt aber in diesem Fall deutlich niedriger,<br />
d.h. täglich wird in 5 %, wöchentlich in 23 % der Unternehmen übersetzt.<br />
Übersetzen und/oder Dolmetschen<br />
NACH AUSSEN<br />
24%<br />
76%<br />
ja<br />
nein (oder<br />
keine<br />
Angaben)<br />
So zeigt sich, dass das Unternehmen in der Tat als Ganzheit von Interaktionen<br />
verstanden werden kann, die ihre Mitglieder v.a. in der internen Kommunikation<br />
ausführen. Die Angaben zum täglichen Dolmetschen und Übersetzen,<br />
wobei die Frage der Standardisierung und der symmetrischen oder<br />
asymmetrischen Adaptation der Mitarbeiter in der interkulturellen Kommunikation<br />
hier außer Acht gelassen wird, verdeutlichen dies noch einmal.<br />
Wenn man dann allein die Angaben zum täglichen Dolmetschen berechnet,<br />
kommt man bei ca. 2000 deutsch-tschechischen Unternehmen zum Ergebnis,<br />
dass in 576 Unternehmen täglich gedolmetscht wird. Rechnen wir pro<br />
Unternehmen nur einen Sprachvermittler und zwei Mitarbeiter, für die gedolmetscht<br />
werden muss, und nur eine Stunde pro Arbeitstag, die durch<br />
konsekutives Dolmetschen verloren geht, sind es je nach Länge der Arbeitswoche<br />
6 bis 7 Arbeitswochen pro deutschen und tschechischen Mitarbeiter<br />
und pro Dolmetscher im Jahr, die man an Zeit für eine Übersetzung<br />
des Dolmetschers aufbringt. Gehen wir von einem Gehalt von 30.000<br />
Kč/monatlich für den tschechischen Mitarbeiter, von 5.000 Euro/monatlich<br />
für den deutschen Mitarbeiter und von 40.000 Kč/monatlich für den Dolmetscher,<br />
ergibt dies ca. 400.000 Kč bzw. 13.500 Euro pro Unternehmen,<br />
die für dieses Warten pro Jahr ausgegeben werden. Bei 576 Unternehmen<br />
sind es ca. 232.000.000 Kč bzw. 8. Mio. Euro pro Jahr, seit der Wende ca.<br />
3,25 Mrd. Kč bzw. 110 Mio. Euro. Bei einer zusätzlichen Stunde pro Tag<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
verdoppelt sich diese Summe. Im Fall der großen Unternehmen könnten die<br />
nach den oben angeführten Angaben berechneten Kosten allein im erwähnten<br />
Automobilwerk bei ca. 113 Mio. Kč bzw. 3,8 Mio. Euro pro Jahr bzw.<br />
bei ca. 1,6 Mrd. Kč bzw. 53 Mio. Euro seit der Wende liegen. Dabei sind<br />
gerade die großen Unternehmen, die oft mehrere Dolmetscher in der internen<br />
und externen Kommunikation beschäftigen, am stärksten unter denen<br />
vertreten, die von einem solchen Service täglich Gebrauch machen, so dass<br />
die Angaben für die Tschechische Republik kräftig nach oben korrigiert<br />
werden müssten:<br />
28%<br />
5%<br />
Größe der Tochter-Unternehmen<br />
8%<br />
59%<br />
groß<br />
mittel<br />
klein<br />
keine Angaben<br />
Zu 8 % haben wir es mit 160 großen Unternehmen zu tun. Eingangs wurde<br />
gesagt, dass 95 % der großen Unternehmen den Einsatz von Sprachvermittlern<br />
bestätigen, 60 % dieser Unternehmen setzen sie intern ein. Das wären<br />
96 Unternehmen. Gerade diese großen Unternehmen, die die Sprachvermittler<br />
für die interne Kommunikation benötigen, weil ihre Organisation und<br />
damit auch die Kommunikation sehr komplex ist, nehmen die Übersetzungs-<br />
und Dolmetscherdienstleistungen in der Regel täglich in Anspruch.<br />
Und auch wenn die Größe und Komplexität der Prozesse in diesen Unternehmen<br />
nicht unbedingt immer mit der des besagten Automobilwerkes vergleichbar<br />
ist, sind die Kosten, die sich hier abzeichnen (gegen 100 Mrd.<br />
Kronen bzw. 3,3 Mrd. Euro seit der Wende) atemberaubend. Diese Summe<br />
ist übrigens gar nicht so unrealistisch, wie es auf den ersten Blick erscheint,<br />
denn wir sind bisher jeweils von einer Stunde pro Tag ausgegangen, die<br />
durch konsekutives Dolmetschen verloren geht.<br />
Selbst diese teilweise Berechnung für Tschechien macht also deutlich, dass<br />
die gemischten Unternehmen allein durch die Sprachvermittlung finanziell<br />
beträchtlich belastet werden, denn wir haben nur die berechenbaren Kosten<br />
einbezogen: Verluste durch fehlende kommunikative Kontrolle bei geschäftlichen<br />
Verhandlungen nach außen, Verluste bei Desinterpretation<br />
331
332<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
durch Dolmetscher in der ‚Produktion‘, Verluste durch Demotivation usw.<br />
sind hier nicht eingeschlossen. Diese Belastung der Wirtschaft, die etwa<br />
durch niedrigere Lohnkosten oder durch Steueranreize selbstverständlich<br />
bei weitem ausgeglichen wird, wird noch deutlicher, wenn man diese Berechnung<br />
auf den gesamten ostmitteleuropäischen Raum projiziert. Die<br />
Auswertung für die ‚deutsch-tschechischen‘ Unternehmen macht damit die<br />
unmittelbare ökonomische Bedeutung des Kommunikationsmanagements in<br />
den Unternehmen und der bewussten und gezielten Fremdsprachenpolitik<br />
der mitteleuropäischen Staaten auch im Hinblick auf den Bedarf im Wirtschaftssektor<br />
sichtbar. Daher sollte zugunsten der Wirtschaft interveniert<br />
werden. Wenn man nur einen Teil des so errechneten negativen Wertes (d.h.<br />
der ständig anfallenden Kosten fürs Dolmetschen und Übersetzen) in die<br />
Sprachqualifizierung bereits während der Ausbildung positiv investieren<br />
würde, wäre schon viel getan. Ganz abgesehen von positiven Auswirkungen<br />
derselben auf den Außenhandel (vgl. VANDERMEEREN 1998), das Arbeitsklima<br />
und Arbeitsproduktivität usw.<br />
Wie bereits oben erwähnt, geht aus der Fragebogenbefragung hervor, dass<br />
beinahe 2/3 der gemischten Unternehmen allein Deutsch als Firmensprache<br />
vorsehen, während nur in 14 % der Unternehmen Tschechisch bzw. Tschechisch<br />
und Deutsch als Firmensprache zugelassen werden. Präferiert wird<br />
also eine asymmetrische Adaptation auf das Deutsche (die Standardisierungsvariante<br />
mit Englisch ist mit 15 % vertreten). Die Sprachpolitik des<br />
Unternehmens richtet sich somit – zumindest in großen Unternehmen –<br />
nach den Machtverhältnissen. Die Richtung des Investitions-, Technologie-,<br />
Wissenstransfers sowie die Dominierung der Chefetage bzw. des Managements<br />
durch ausländische Mitarbeiter bestimmt in der Regel auch die Firmensprache.<br />
So verbindet sich die Sprache mit der Statuskategorie und wird<br />
selbst zum Statusmerkmal. Die Wahl des Deutschen als Firmensprachen in<br />
den gemischten Unternehmen führt zudem zur sog. kommunikativen Dominanz<br />
(des Muttersprachlers) und Subdominanz (des Fremdsprachlers), was<br />
die Hierarchisierung in diesen Unternehmen verhärten und bis hin zur negativen<br />
sprachlich-ethnischen Stereotypisierung führen kann. Dies ist für ein<br />
positives Klima in den Unternehmen sowie für die Arbeitsproduktivität derselben<br />
nicht zuträglich, denn die Unternehmen sind, wie wir eingangs erwähnt<br />
haben, Organisationen, die als Ganzheit von Interaktionen verstanden<br />
werden können, die ihre Mitglieder v.a. in der internen, aber auch in der<br />
externen Kommunikation ausführen. Die Kommunikation, in denen sich<br />
diese Interaktionen konkret umsetzen, ist von ganz zentraler Bedeutung. Für<br />
die interkulturellen Unternehmen gilt dies doppelt.<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
Auf der Basis der in der zweiten Phase unseres Projektes in den Unternehmen<br />
durchgeführten Interviews sollen Wege aufgezeigt werden, wie eine<br />
kommunikative Polarisierung in der interkulturellen Kommunikation wahrgenommen<br />
wird, ob und wie dabei die sprachlich-ethnische Komponente<br />
eine Rolle spielt, ob und wie diese mit anderen sozialen Kategorien kombiniert<br />
werden und ob und wie eine Hierarchisierung (Asymmetrie) entsteht<br />
und wie dieser entgegengewirkt werden kann. Die bereits durchgeführten<br />
und bisher nur teilweise ausgewerteten Interviews zeigen, dass die Neutralisierungsstrategien<br />
sehr vielfältig sind. In kleineren Unternehmen, in bestimmten<br />
Fällen auch in großen, wird die symmetrische Adaptation oder<br />
Standardisierung als Neutralisierungsstrategie eingesetzt, bei der zwar<br />
sprachlich-ethnische Kategorien in der interkulturellen Kommunikation<br />
durch die Sprache (phonetische, grammatische, pragmatische Besonderheiten)<br />
ebenfalls aktualisiert, nicht aber hierarchisiert werden (jeweils in der<br />
Fremdsprache). Die Symmetrie, die bei der asymmetrischen (mit Status<br />
kombinierten) Adaptation fehlt, kann durch paritätische Besetzung von<br />
Vorstand und Aufsichtsrat, durch Schaffung von deklariert symmetrischen<br />
Tandems oder durch Aufrechterhaltung der tschechischen Merkmale im<br />
Logo nach innen und nach außen kommuniziert werden. Auch die Bevorzugung<br />
von kooperativen statt konfrontativen Tandems wurde appliziert, in<br />
denen die kommunikative Polarisierung und damit auch die ethnische Polarisierung<br />
und Stereotypisierung geschwächt werden konnte. Bewusst überwunden<br />
wird die Aktualisierung von ethnischen Kategorien und Stereotypen<br />
durch kollegiale Kategorisierungen usw. All diese Neutralisierungsstrategien<br />
können beim integrierten Kommunikationsmanagement bewusst zusammengefasst<br />
werden.<br />
In kleineren gemischten Unternehmen, wo man intensiver aufeinander angewiesen<br />
ist und wo die Aufteilung in die Domänen ‚Management‘ und<br />
‚Produktion‘ nicht so stark ausgeprägt ist, trägt übrigens die Unternehmenspolitik<br />
der tatsächlichen Sprachwirklichkeit Rechnung. Nicht allein die<br />
tschechischen Mitarbeiter sollen sich an das Deutsche anpassen, wünschenswert<br />
und nötig sind ebenso Tschechisch-Kenntnisse der deutschen<br />
Mitarbeiter, was sich dann auch in der personellen Arbeit kleinerer Unternehmen<br />
bemerkbar macht (vgl. NEKULA 2002).<br />
Die Wege und Methoden im Hinblick auf die Größe des Unternehmens und<br />
die Komplexität der Produktion sind also unterschiedlich, doch ist das Ziel<br />
identisch: die Unternehmenskommunikation zu optimieren, die Spannungen,<br />
die sich auf die interne Interaktion negativ auswirken können, zu minimalisieren,<br />
die direkten negativen Kosten zu senken. Ein bewusstes<br />
333
334<br />
Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />
Kommunikationsmanagement in den Unternehmen sowie eine vorausschauende<br />
Sprachpolitik der mitteleuropäischen Staaten können hierzu einen<br />
wichtigen Beitrag leisten.<br />
Literatur<br />
HÖHNE, Steffen (1995): Vom kontrastiven Management zum interkulturellen.<br />
Ein Überblick über kontrastive und interkulturelle Management-<br />
Analysen. – In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 21, 75–106.<br />
HÖHNE, Steffen (1997): Von asymmetrischer zu kooperativer Kommunikation.<br />
Beobachtungen zu kulturbedingten Divergenzen bei Kommunikations-<br />
und Personalinstrumenten in deutsch-tschechischen Joint ventures. –<br />
In: S. Höhne, M. Nekula (Hgg.), Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und<br />
Tschechen in Interaktion. München: Iudicium, 99–125.<br />
MAST, Claudia (2002): Unternehmenskommunikation. Stuttgart: Lucius &<br />
Lucius.<br />
MÖLLER, Joachim/BRANDMEIER, Michael (2002): Der Aufbau der<br />
Wirtschaftsbeziehungen zu Mittelosteuropa – Ergebnisse einer Befragung<br />
ostbayerischer Unternehmen. – In: J. Möller, M. Nekula (Hgg.), Wirtschaft<br />
und Kommunikation. Beitrage zu den deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen.<br />
München: Iudicium, 29–50.<br />
NEKULA; Marek (2002): Kommunikationsführung in deutschtschechischen<br />
Firmen. – In: J. Möller, M. Nekula (Hgg.), Wirtschaft und<br />
Kommunikation. Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen.<br />
München: Iudicium, 65–83.<br />
NEKULA, Marek (<strong>2004</strong>): Deutsch als Europasprache aus tschechischer<br />
Sicht. – In: Ch. Lohse (Hg.), Die deutsche Sprache in der Europäischen<br />
Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht.<br />
Baden-Baden: Nomos, 129–144.<br />
NEKVAPIL, Jiří (2000): On Non-Self-Evident Relationships between Language<br />
and Ethnicity: How Germans Do Not Speak German, and Czechs Do<br />
Not Speak Czech. – In: Multilingua 19, 37–53.<br />
NEKVAPIL, Jiří (2003): On the Role of the Languages of Adjacent States<br />
and the Languages of Ethnic Minorities in Multilingual Europe: the Case of<br />
the Czech Republic. – In: J. Besters-Dilger, R. die Cillia, H.–J. Krumm, R.<br />
Rindler Schjerve (eds.), Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen<br />
Union / Multilingualism in the enlarged European Union / Multilingualisme<br />
dans l’Union Européenne élargie. Klagenfurt: Drava, 76–94.<br />
Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration<br />
SCHMITZ, Norbert/PHILIPP, Christine (1996): Interkulturelles Management.<br />
Die Zusammenarbeit von Tschechen und Deutschen: Ergebnisse einer<br />
Kienbaumstudie. Unveröffentlichtes Manuskript.<br />
Statistická ročenka ČR 2003. Praha: Český statistický úřad. (www.czso.cz)<br />
VOLLSTEDT, Marina (2002): Sprachenplanung in der internen Kommunikation<br />
internationaler Unternehmen. Studien zur Umstellung der Unternehmenssprache<br />
auf das Englische. Hildesheim: Olms.<br />
VANDERMEEREN, Sonja (1998): Fremdsprachen in europäischen Unternehmen.<br />
Untersuchungen zu Bestand und Bedarf im Geschäftsalltag mit<br />
Empfehlungen für Sprachenpolitik und Sprachunterricht. Waldsteinberg:<br />
Heidrun Popp.<br />
335
Hildegard BOKOVÁ (Hg.): Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in<br />
Böhmen, Mähren und der Slowakei. Vorträge der internationalen Tagung<br />
veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der<br />
Südböhmischen Universität. České Budějovice 20.-22. September 2001.<br />
Wien (Edition Praesens) <strong>2004</strong>, 244 S.<br />
Im vorliegenden Tagungsband sind insgesamt vierzehn Beiträge veröffentlicht,<br />
die den bisherigen Stand der Erforschung des Frühneuhochdeutschen<br />
in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, Tschechien und in der<br />
Slowakei skizzieren. Im Vordergrund der Untersuchungen standen hauptsächlich<br />
Texte aus den so genannten Randgebieten, d.h. Texte, die auf dem<br />
Gebiet Böhmens, Mährens, Schlesiens und der Slowakei entstanden sind.<br />
Die Textauswahl ist an diesem Sammelband besonders hervorzuheben,<br />
denn als Untersuchungsmaterialien standen den Forschern nicht nur Urkunden,<br />
Stadt- und Findbücher oder Stadt- und Privatkorrespondenz zur Verfügung,<br />
sondern auch medizinische Fachliteratur, Materialien aus dem Bereich<br />
der juristischen Literatur oder Gesangbücher. In den Beiträgen wurden<br />
diese Textsorten und Texttypen unter dem Aspekt der historischen Pragmalinguistik<br />
und der Textlinguistik analysiert. In einigen Aufsätzen wurden<br />
darüber hinaus auch neue Forschungsansätze auf dem Gebiet des Frühneuhochdeutschen<br />
angedeutet und vorgeschlagen.<br />
Einen interessanten Ansatz zur Erforschung der Kanzleisprachen bietet Peter<br />
Ernst, 1 der sich mit der Frage nach der kommunikativen Funktion historischer<br />
Sprachen befasst. Er definiert Ziele und Aufgaben der historischen<br />
Pragmalinguistik und bietet mehrere Untersuchungsmöglichkeiten an, anhand<br />
derer man sich unter diesem Aspekt mit einem historischen Text beschäftigen<br />
kann. Am Beispiel der historischen Texte aus dem Bereich der<br />
Kanzleisprachen versuchte er die Frage „Wer kommuniziert mit wem worüber<br />
zu welchem Zweck?“ zu beantworten und nachzuweisen, in welchem<br />
Verhältnis das Gesprochene und das Geschriebene zueinander stehen. Als<br />
Quelle für seine Untersuchung dienten 20 Urkunden aus Südböhmen aus<br />
den Jahren 1333 bis 1412. 2 Dabei stellte Ernst fest, dass man bei der Frage<br />
nach der kommunikativen Funktion der Urkunden zwischen dem ‚Inhalt‘<br />
1 Ernst, Peter: Kanzleisprachen als Quellen der Historischen Pragmalinguistik,<br />
9–19.<br />
2 Es handelt sich um Texte, mit denen sich Hildegard Boková beschäftigt und<br />
im Anhang ihrer Arbeit im vollen Wortlaut präsentiert hat. Dazu: Boková,<br />
Hildegard (1998): Der Schreibstand der deutschsprachigen Urkunden und<br />
Stadtbucheintragungen Südböhmens aus vorhussitischer Zeit (1300–1419).<br />
Frankfurt/Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien.
338<br />
Neue Literatur<br />
und der ‚kommunikativen Aufgabe‘ unterscheiden muss. Diesbezüglich<br />
betont er den perlokutionären Charakter des kommunikativen Vorgangs.<br />
Anhand seiner Untersuchungen verdeutlicht er, dass die mündliche und die<br />
schriftliche Sprache einander ergänzen.<br />
In den Bereich der historischen Pragmatik fällt auch der Beitrag von Mario<br />
Hrašna, 3 der sich mit einigen Aspekten von J. L. Austins Sprechakttheorie<br />
auseinander setzt. In seiner Studie vergleicht er von diesem theoretischen<br />
Ansatz ausgehend zwei Textsorten, und zwar das stark konventionalisierte<br />
und institutionalisierte Urkundenformular und den wesentlich vereinfachten<br />
und daher an Sprechakttypen ärmeren Privatbrief. Als Ausgangsquelle für<br />
die Untersuchung standen dem Autor fünfzehn Briefe von Jan Jiskra von<br />
Brandýs aus dem Zeitraum 1442–1457 zur Verfügung. Auf Basis der Textanalyse<br />
beschreibt er, welche Formularteile im Brief beibehalten wurden,<br />
welche verschwunden sind und wie diese Entwicklung verlief. Weiter interessiert<br />
er sich dafür, welche grammatischen, lexikalischen und syntaktischen<br />
Mittel verwendet wurden. Der Aufsatz ist ein Hinweis darauf, dass<br />
die Sprechakttheorie für die diachrone Sprachwissenschaft neue Anregungen<br />
bringen kann.<br />
Eine komparative Studie bietet auch Arne Ziegler. 4 Seine Untersuchungen<br />
legen ihren Fokus auf den Durchsetzungsprozess der deutschen Sprache in<br />
der städtischen Kommunikationspraxis. Im Vordergrund steht für ihn dabei<br />
die Frage, wann dieser Prozess einsetzte und zu welchem Zeitpunkt die Ablösung<br />
von der in der Regel lateinischen Sprache erfolgte. Als Quelle standen<br />
ihm Briefe und Urkunden der städtischen Überlieferung aus den Jahren<br />
1245–1500 zur Verfügung, die im ersten Findbuch des Stadtarchivs Bratislava<br />
verzeichnet wurden. Im Rahmen seiner Analyse vergleicht er die Zunahme<br />
deutscher Texte und versucht den Zeitpunkt zu bestimmen, wann<br />
sich das Deutsche in den städtischen Urkunden, hier am Beispiel von Bratislava<br />
aufgezeigt, gegenüber dem Lateinischen durchsetzt. Ziegler geht dabei<br />
von der quantitativ-linguistischen Methode aus. Seine Thesen zum Ablösungsprozess<br />
dokumentiert er mit zahlreichen Abbildungen und Graphiken.<br />
Die beiden darauffolgenden Beiträge haben einen eher informativen Charakter.<br />
Sie bieten einen Überblick über den Forschungsstand und die Perspektiven<br />
der Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Tschechien und in<br />
3 Hrašna, Mario: Sprechakte und Formular, 21–32.<br />
4 Ziegler, Arne: Sprachliche Ablösungsprozesse im historischen Sprachkontakt.<br />
Lateinische und deutsche Schriftlichkeit in städtischer Kommunikation im<br />
Spätmittelalter, 33–54.<br />
Neue Literatur<br />
der Slowakei. Hildegard Boková 5 stellt eine Übersicht überlieferter deutscher<br />
Texte auf dem Gebiet Südböhmens zusammen, die bereits in der historischen<br />
Sprachwissenschaft bearbeitet wurden. Es handelt sich um Texte<br />
geistlichen Inhalts, literarische Texte weltlichen Inhalts, fachsprachliche<br />
und kanzleisprachliche Texte. Im Weiteren informiert sie über methodologische<br />
Ansätze und Forschungsinteressen in der älteren und neueren Historiolinguistik<br />
im Bezug auf südböhmische Texte. Von Bedeutung ist dieser<br />
Beitrag auch deshalb, weil dort weitere Perspektiven der frühneuhochdeutschen<br />
Forschung mit Ausblick auf die dortigen bis jetzt noch nicht erschlossenen<br />
Archivmaterialien verdeutlicht werden.<br />
Jörg Meier 6 schildert in seinem Aufsatz Möglichkeiten und Perspektiven<br />
der Erforschung bisher unbekannter frühneuhochdeutscher Texte auf dem<br />
Gebiet der Slowakei. Einen wichtigen Punkt stellt die Präsentation des Bochumer<br />
Forschungprojekts dar, das – unter der Leitung von Klaus-Peter<br />
Wegera, Ilpo Tapani Piirainen und Jörg Meier sowie Juraj Spiritza auf slowakischer<br />
Seite – die Erfassung und Erschließung der deutschsprachigen<br />
Bestände in den Archiven der Slowakischen Republik zum Ziel hat. Von<br />
besonderem Wert ist auch der Anhang, in dem sich ausführliche Informationen<br />
über die Archive mit Adressen und Bestandangaben befinden.<br />
Eine interessante Quelle für die Erforschung des Frühneuhochdeutschen<br />
stellt zweifelsohne auch die medizinische Fachliteratur dar. Seit dem Mittelalter<br />
erschienen auf dem Gebiet Böhmens und Mährens einige bemerkenswerte<br />
Schriften, die bereits Gegenstand der Forschung geworden sind.<br />
Gundolf Keil 7 präsentiert eine medizinische Schrift Lanfranks von Mailand<br />
unter dem Titel Die Kleine Chirurgie, die von einem böhmischen Translator,<br />
wahrscheinlich einem Wundarzt, ins Deutsche übersetzt wurde. Da die<br />
Schrift in Böhmen lediglich in einer einzigen Abschrift erhalten ist, geht es<br />
in der Studie darum, die Stellung der Chirurgia-parva-Fassungen in der<br />
böhmischen Fachprosa sichtbar zu machen, sie in den Kontext der chirurgischen<br />
Literatur einzuordnen und mit der lateinischen Vorlage zu vergleichen.<br />
Von besonderem Interesse ist darüber hinaus die Qualität der Übersetzung.<br />
Das Ergebnis der Analyse weist nach, dass der Übersetzer<br />
Probleme mit der Darstellung des Inhaltlichen hatte und an einzelnen Fachtermini<br />
gescheitert ist. In dem Text treten auch viele Schreibfehler auf, so-<br />
5 Boková, Hildegard: Zur Erforschung frühneuhochdeutscher Texte aus Südböhmen,<br />
55–74.<br />
6 Meier, Jörg: Deutschsprachige Handschriften und Dokumente des Mittelalters<br />
und der Frühen Neuzeit in slowakischen Archiven. Bericht über ein interdisziplinäres<br />
Projekt, 75–87.<br />
7 Keil, Gundolf: Die ‚Kleine Chirurgie‘ Lanfranks von Mailand, 89–110.<br />
339
340<br />
Neue Literatur<br />
dass man voraussetzen kann, dass es sich hier nicht um die Urschrift, sondern<br />
um eine Abschrift handelt. Schwierigkeiten bereitete dem Übersetzer<br />
auch der „Schreibdialekt“.<br />
Einen weiteren Beitrag zum Thema medizinische Fachliteratur leistet auch<br />
Hilde-Marie Groß. 8 Sie befasst sich mit dem kriegschirurgischen Feldbuch<br />
Die Prager Wundarznei, eine Handschrift, die im 14. Jahrhundert im mährisch-schlesischen<br />
Raum entstanden ist und bis vor kurzem noch unbekannt<br />
war. Die Aufmerksamkeit wird zuerst der inhaltlichen Gliederung der<br />
damaligen Lehrbücher dieser Art gewidmet, unter denen das untersuchte<br />
Werk, was die Struktur betrifft, eine Ausnahme darstellt. Die Schrift wurde<br />
nicht wie üblich nach topographisch-anatomischen Kategorien geordnet,<br />
sondern nach Verletzungsarten strukturiert. Sehr wertvoll ist auch die begleitende<br />
Textanalyse, die sich vor allem auf Sprachgebrauch, Beschreibung<br />
und Funktion von Verben, Adjektiven, Adverbien und anderen Stilmitteln<br />
konzentriert. Die Untersuchung zeugt auch davon, wie fachlich und sprachlich<br />
gewandt der Verfasser dieses interessanten Werkes war.<br />
Sehr bereichernd ist der Beitrag von Lenka Vaňková, 9 die für ihre Forschung<br />
über die Syntax der historischen Fachsprachen ebenfalls die medizinische<br />
Fachliteratur nutzte. Als Quellen verwendet sie vier handschriftliche<br />
Texte des so genannten ‚Olmützer medizinischen Korpus‘, die aus dem 15.<br />
Jahrhundert stammen. Es handelt sich um ein Rezeptar, ein Kräuterbuch,<br />
ein Kompendium, ein wunderärztliches Traktat und eine iatromedizinische<br />
Abhandlung. Die Aufmerksamkeit lenkt die Autorin auf die Struktur des<br />
Satzes, wobei sie den Schwerpunkt auf die Gestaltung von Satzgefügen legt.<br />
Mit Hilfe der Satzanalyse wird untersucht, ob sich die Textsorten-Varianz<br />
der untersuchten Texte in ihrer Struktur widerspiegelt oder ob den Fachtexten<br />
aus dem medizinischen Bereich im Wesentlichen einheitliche syntaktische<br />
Strukturen zugrunde liegen. In Bezug auf die Analyse sollen dann die<br />
vorkommenden Unterschiede und Übereinstimmungen erschlossen werden.<br />
Dabei werden auch der Autor und der Adressat berücksichtigt.<br />
Ilpo Tapani Piirainen 10 weist in seinem Beitrag auf eine interessante, in der<br />
deutschen Historiographie bislang nicht erwähnte Quelle hin. Es handelt<br />
sich um eine Handschrift des 15. Jahrhunderts, die in Georgenberg (Spišská<br />
8 Groß, Hilde-Marie: Die ‚Prager Wundarznei‘ – Ein Feldbuch der Kriegschirurgie<br />
als Beispiel frühneuhochdeutschen medizinisch-naturwissenschaftlichen<br />
Schrifttums im mährisch-schlesischen Raum, 111–126.<br />
9 Vaňková, Lenka: Zur Syntax der frühneuhochdeutschen medizinischen Fachprosa<br />
anhand des Olmützer Quellenkorpus, 127–142.<br />
10 Piirainen, Ilpo Tapani: Die Zipser Chronik aus dem 15. Jahrhundert. Ein Beitrag<br />
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei, 143–170.<br />
Neue Literatur<br />
Sobota) entstanden ist. In der Studie widmet sich der Autor den wichtigsten<br />
Aspekten der Chronikliteratur und ihrer Erforschung. Um den zeitgenössischen<br />
Bezug zum Inhalt des Chroniktextes zu ermöglichen, liefert er einen<br />
kurzen Einblick in die Geschichte Ungarns. Den wichtigsten und wertvollsten<br />
Teil stellt eine kritische und buchstabentreue Edition des Textes dar.<br />
Zu den fachsprachlichen Materialien, die neue Perspektiven für die Erforschung<br />
des Frühneuhochdeutschen anbieten, gehören auch Strafgerichtsordnungen<br />
und Rechtsbücher. Diese Quellen wurden insbesondere unter<br />
dem lexikalischen Aspekt untersucht, so wie es in ihrem Beitrag Libuše<br />
Spáčilová 11 ausführlich darstellt. Sie leitet ihre Studie mit einer allgemeinen<br />
Charakteristik der Rechtssituation in Olmütz im Mittelalter und in der frühen<br />
Neuzeit ein. Gegenstand ihrer Untersuchungen war die Gerichtsordnung<br />
von Heinrich Polan aus dem Jahre 1550. Da es sich um Fachliteratur<br />
handelt, wird die Aufmerksamkeit auch der allgemeinen Charakteristik der<br />
deutschen Rechtssprache gewidmet. Das Interesse der Autorin richtet sich<br />
auf das Vokabular der Gerichtsordnung und dessen Spezifika. Im Rahmen<br />
der Analyse konzentriert sie sich vor allem auf die Verwendung von Paarformeln,<br />
mehrgliedrigen Wortketten, Attributen und Synonymen. Im Text<br />
werden deutsche Rechtstermini, deutsche Formeln mit deutschen Komponenten<br />
(synonymen und nicht synonymen), lateinische Rechtsbegriffe, Personenbezeichnungen,<br />
lateinische Rechtstermini für Rechtsverhandlungen<br />
und Formeln mit lateinischen Komponenten untersucht. Um die Vielfältigkeit<br />
des Vokabulars der Olmützer Gerichtsordnung zu zeigen, bietet die<br />
Autorin zum Schluss ihrer Studie einen Vergleich mit dem Rechtswortschatz<br />
der ‚Peinlichen Gerichtsordnung‘ Kaiser Karls V. (Carolina) aus dem<br />
Jahre 1532. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Olmützer Gerichtsordnung<br />
wesentlich reicher an lateinischen Rechtstermini war. Den Grund dafür<br />
sieht sie hauptsächlich in der Person des Verfassers und dessen Ausbildung.<br />
Eine komparative Studie auf dem Gebiet der historischen Rechtsfachsprache<br />
bietet Mária Papsonová. 12 Für die Untersuchung steht ihr die in Sillein<br />
(Žilina) niedergeschriebene Rechtskompilation aus dem Jahre 1378 zur Verfügung,<br />
die auf den landrechtlichen Teil des Sachsenspiegels zurückgreift.<br />
Als Wortschatzbeispiel wählte die Autorin folgende Begriffe: das Heergewäte,<br />
die Gerade, die Morgengabe und zuletzt Gedinge (Leibgedinge, Leib-<br />
11 Spáčilová, Libuše: Zum Vokabular der Olmützer Gerichtsordnung aus dem<br />
Jahre 1550, 171–192.<br />
12 Papsonová, Maria: Iclich weyb erbet czweier wegene – Wörter aus dem Bereich<br />
des Erbrechts, ihre Verwendung und Übersetzung im Silleiner Rechtsbuch,<br />
193–204.<br />
341
342<br />
Neue Literatur<br />
zucht). Es handelt sich um Rechtswörter, die zur Bezeichnung der Erbfolge<br />
in Sondervermögen dienten. Die Bedeutung dieser Ausdrücke wird weiter<br />
eingehend erläutert. Sehr interessant ist vor allem der Vergleich mit der<br />
1473 angefertigten Übersetzung des landrechtlichen Teiles der obengenannten<br />
deutschen Vorlage ins Tschechische. Die Untersuchungen weisen nach,<br />
dass die Übersetzer auf große Schwierigkeiten gestoßen sind, die sich aus<br />
der Inkongruenz der Ausgangs- und Zielsprache ergeben haben, und dass<br />
sie mit fremden Rechtszuständen konfrontiert wurden, die dem einheimischen<br />
Recht nicht entsprachen, weshalb auch die notwendigen lexikalischen<br />
Äquivalente fehlten. Darum wurden für einen Begriff oft mehrere Übersetzungen<br />
verwendet wie z.B. für das Wort Morgengabe die Ausdrücke wieno,<br />
Pl. wiena, von frawenmorgen gob, o zenach a o gegich wienach.<br />
Mit der Sprache der Rechtsquellen befasst sich auch Ľudmila Kretterová. 13<br />
Den Gegenstand ihrer Untersuchungen stellt eine Handschrift aus der zweiten<br />
Hälfte des 16. Jahrhunderts dar. Es handelt sich um ein Gerichtsprotokoll.<br />
Die Autorin konzentriert sich bei der Analyse der Sprache auf die mhd.<br />
kurzen Vokale, mhd. langen Vokale und mhd. Konsonanten und deren<br />
Schreibvarianten. Die Untersuchungen im Bereich des Vokalismus und Konsonantismus<br />
sollen weiterhin nachweisen, welchem Dialekt der Text zuzuordnen<br />
ist. Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass in dieser Handschrift<br />
die Einflüsse des Ostoberdeutschen überwiegen.<br />
Mit zwei anderen und für die Erforschung des Frühneuhochdeutschen nicht<br />
desto weniger interessanten und Erkenntnis bringenden Quellen beschäftigen<br />
sich die letzten beiden Beiträge. Jana Kusová 14 macht in ihrer Studie auf die<br />
Textsorte ‚Säulenbuch‘ aufmerksam, indem sie das architekturtheoretische<br />
Traktat von Gabriel Krammer einer Textanalyse unterzieht. Die Autorin konzentriert<br />
sich auf stereotype Textkomponenten des vorliegenden Geometrie-<br />
und Architekturtraktates, auf die Terminologie, die als Grundlage der Fachsprache<br />
diente, und analysiert die unter dem fachsprachlichen Einfluss in<br />
dem Text auftretenden Paarformeln. Im Rahmen dieser Untersuchung wird<br />
das Interesse darauf gelegt, ob eine Wortverbindung als Paarformel bezeichnet<br />
werden kann oder ob es sich um die Beschreibung eines Sachverhalts<br />
oder Gegenstands handelt. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Benutzungsfrequenz<br />
der Paarformeln, ihre sprachliche Zusammensetzung und<br />
13 Kretterová, Ľudmila: Zur Sprache der Gerichtsprotokolls gegen die Kindesmörderin<br />
Dorothea Gilg in Diln/Banská Belá aus dem Jahre 1561, 205–212.<br />
14 Kusová, Jana: Zur Textsorte „Säulenbuch“. Gabriel Krammer „Architectvra.<br />
Von den Fvnf Seülen Sambt Iren Ornamenten Vnd Zierden“, Prag 1600, 213–<br />
227.<br />
Neue Literatur<br />
die Zugehörigkeit zum terminologischen System der Architektur und Geometrie.<br />
Albrecht Greule 15 widmet sich der Problematik der Erforschung der Textsorte<br />
‚Kirchenlied und Gesangbuch‘, die bis jetzt in der historischen Sprachwissenschaft<br />
nur peripher behandelt wurde. Aus diesem Grund setzt er sich<br />
zunächst mit den Fragestellungen der Forschungen zum Frühneuhochdeutschen<br />
auseinander, wobei er die Untersuchung der Kirchenlieder als<br />
eine perspektivenreiche Quelle hervorhebt. Greule weist auf die methodischen<br />
Probleme der sprachwissenschaftlichen Kirchenliedforschung und<br />
stellt mögliche Vorgehensweisen bei der Analyse eines geistlichen Liedes<br />
dar. Seine Entwürfe verdeutlicht er anhand einer exemplarischen Analyse<br />
und eines Sprachvergleichs.<br />
Der vorliegende Tagungsband zeugt davon, dass die Untersuchungen der<br />
älteren deutschen Texte auf dem Gebiet Tschechiens und der Slowakei von<br />
großer Bedeutung sein können. Denn auch sie können einen wichtigen Beitrag<br />
zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen leisten und deren Ergebnisse<br />
ergänzen, bestätigen und erweitern. Es ist zu begrüßen, dass hier nicht<br />
nur neue Quellen und Materialien, sondern auch interessante methodologische<br />
Ansätze vorgestellt wurden.<br />
343<br />
Miroslava Durajová<br />
Ernst EICHLER (Hg.): Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche<br />
Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster, Hamburg, London<br />
(Lit Verlag) 2003, 228 Seiten.<br />
Der rezensierte Sammelband erschien als der sechste Band der von Ernst<br />
Eichler, Hubert Rösel und Herbert Zeman herausgegebenen Reihe „Erträge<br />
Böhmisch-Mährischer Forschungen“, die Hubert Rösels Monographien Die<br />
deutsche Slavistik und ihre Geschichte an der Universität Prag (1995) und<br />
Die Familiennamen von Rettendorf (1995), Ernst Eichlers und Gerhard<br />
Schröters Sammelband Deutsch-tschechischer Wissenschaftsdialog im Lichte<br />
der Korrespondenz zwischen Wilhelm Streitberg und Josef Zubatý 1891–<br />
1915 (1999), Andrea Hohlmeyers Darstellung der deutschsprachigen Dichtung<br />
in den böhmischen Ländern der Jahre 1895 bis 1945 ,Böhmischen Volkes<br />
Weisen‘ (2002) und Franz Kaipers 1935 entstandene und von Eichler<br />
15 Greule, Albrecht: Gesangbücher als Quelle des Frühneuhochdeutschen in<br />
Böhmen, 229– 242.
344<br />
Neue Literatur<br />
nun herausgebene Promotion Die tschechischen Ortsnamen des Kreises<br />
Königinhof a.d. Elbe (2001) einschließt.<br />
Nicht nur erscheint der Sammelband im Kontext einer interessanten Reihe,<br />
mit dem Untertitel seines Bandes spielt der Herausgeber auch auf die von<br />
Bohuslav Havránek und Rudolph Fischer herausgegebenen Klassiker der<br />
deutsch-tschechischen Sprachkontaktforschung an, in denen im Übrigen<br />
Eichlers Arbeiten nicht fehlten. Damit stellt sich die Frage, inwieweit sich<br />
der rezensierte Sammelband in der Bedeutung mit den wirkungsvollen<br />
Sammelbänden der 60er Jahre messen kann. Auch wenn Eichler durch den<br />
Haupttitel seines Bandes durchaus Bescheidenheit anmeldet und Erwartungen<br />
bremst, ist festzustellen, dass sein Sammelband – im sprachwissenschaftlichen<br />
Teil etwa durch die Beiträge Tilman Bergers und Stanislava<br />
Kloferovás – für die deutsch-tschechische Sprachkontaktforschung eine<br />
wegweisende Rolle haben dürfte.<br />
Wie bereits angedeutet, gliedert sich der Sammelband in zwei Abschnitte,<br />
den sprach- und den literaturwissenschaftlichen bzw. kulturgeschichtlichen.<br />
Der sprachwissenschaftliche Teil wird durch Tilman Bergers Beitrag Gibt<br />
es Alternativen zur herkömmlichen Beschreibung der tschechischen Lautgeschichte?<br />
(9–37) eröffnet, in dem sich der Autor – unter Hinweis auf die<br />
Klassiker der deutsch-tschechischen Sprachkontaktforschung (Gebauer,<br />
Trávníček, Komárek, Lamprecht, Trost, Skála, Povejšil u.a.), seine früheren<br />
Arbeiten und die Arbeiten von Jakobson und v.a. von Thomason und<br />
Kaufman – zunächst allgemein mit der Fragen der internen und externen<br />
Faktoren des Sprach-, insbesondere Lautwandels auseinandersetzt. V.a. die<br />
allgemeinen Überlegungen im Hinblick auf den Sprachwechsel der „Deutschen“<br />
vom Deutschen zum Tschechischen in der zweiten Hälfte des 14.<br />
und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der auf der phonologischen<br />
Ebene etwa beim Verlust der Mouillierungskorrelation sowie bei anderen<br />
Sprachwandelerscheinungen eine Grundvoraussetzung für die Beeinflussung<br />
des Tschechischen durch das Deutsche darstellt, sind sehr anregend.<br />
Dies verdeutlicht Bergers Hinweis auf das Sorbische bzw. auf das Slowenische,<br />
wo ein vergleichbarer Sprachwechsel und damit auch eine vergleichbare<br />
Beeinflussung auf der phonologischen Ebene fehlen. Daran ändert<br />
nicht einmal die Tatsache etwas, dass die Phonologisierung von f und die<br />
anschließende Verschiebung des bilabialen w zum labiodentalen v und damit<br />
auch die Herausbildung des labiodentalen, durch Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit<br />
differenzierten Paares f – v, welche auf den deutschtschechischen<br />
Bilingualismus der Tschechen und die lexikalischen Entlehnungen<br />
und nicht unbedingt auf den Sprachwechsel vom Deutschen zum<br />
Tschechischen zurückgehen, die generelle Geltung dieses phonologischen<br />
Lautwandelmodells in Frage stellt. Die Begründung für den deutsch-<br />
Neue Literatur<br />
tschechischen Bilingualismus im 10./11. Jahrhundert, dem der Sprachwechsel<br />
vom Deutschen zum Tschechischen und in diesem Zusammenhang auch<br />
die Depalatalisierung als erste Phase beim Verlust der Mouillierungskorrelation<br />
folgen sollte, durch den Hinweis auf Cosmas’ Böhmische Chronik scheint<br />
dagegen weniger überzeugend zu sein, da sich Cosmas’ Aussage zwar auf das<br />
10. Jahrhundert bezieht, in Wirklichkeit aber wohl vom zeitgenössischen<br />
Sprachverhalten im 12. Jahrhundert ausgeht. Außerdem ist Cosmas’ Zeugnis<br />
ein Beweis dafür, dass der deutsch-tschechische Bilingualismus zu diesem<br />
Zeitpunkt nur bei der adeligen Elite ausgeprägt war, was die Verbindung<br />
der Depalatalisierung mit dem Sprachwechsel vom Deutschen zum<br />
Tschechischen noch zusätzlich problematisiert, denn dieser dürfte vor diesem<br />
Hintergrund kaum eine durchgreifende soziale Erscheinung sein, die<br />
einen Lautwandel initiieren konnte. Ungeachtet dessen ist Bergers Beitrag<br />
eine wesentliche Bereicherung in der Untersuchung des deutschtschechischen<br />
Sprachkontakts auf der phonologischen Ebene, die der Forschung<br />
neue Perspektiven eröffnet.<br />
Auch der Beitrag Sprachatlanten im Kontakt – Tschechisch-Deutsch von<br />
Kloferová eröffnet neue Perspektiven in der deutsch-tschechischen Sprachkontaktforschung.<br />
Kloferová versucht allein auf der Grundlage der Sprachatlanten<br />
als sprachgeographische Projektion des mundartlichen Materials,<br />
ohne dass sie auf die sprachliche Realität im Detail eingeht, deutschtschechische<br />
Sprachkontakterscheinungen zu hinterfragen. Die beiden von<br />
ihr verwendeten Beispiele, d.h. „Art, wie die Kartoffeln/Rüben aufbewahrt<br />
werden“ und „Bezeichnungen für Scheune“, sprechen für die Plausibilität<br />
der verwendeten Methode. So gelingt es Kloferová vor dem Hintergrund<br />
der sprachgeographischen Darstellungen (in den an das tschechische<br />
Sprachgebiet angrenzenden deutschen Dialekten kommen andere Lexeme<br />
vor), das tschechische dialektale krecht (Gracht) als Terminus zu präsentieren,<br />
der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der<br />
Landwirtschaft aus dem Deutschen künstlich entlehnt und eingeführt wurde.<br />
Die in den tschechischen Dialekten früher gängigen Bezeichnungen wurden<br />
dadurch verdrängt. Dagegen geht die Reihe Scheune – Stadel – Tenne in der<br />
Brünner und Wischauer Sprachinsel auf die ursprüngliche Polysemie des<br />
tschechischen mlat/humno zurück, die sich im Dialekt dieses Gebiets länger<br />
halten konnte und im Laufe der Zeit generell durch die Bezeichnung stodola<br />
(von stadall/Stadel) verdrängt wurde.<br />
In den Arbeiten von Marie Janečková Entlehnungen aus dem Deutschen und<br />
den österreichisch-bairischen Dialekten im Wortschatz der südböhmischen<br />
Dialektregion, die ihre Ausführungen zu lexikalischen, teilweise auch phraseologischen<br />
Entlehnungen in der südböhmischen Dialektregion in einen weiteren<br />
Kontext stellt, aber auch in den Arbeiten von Alena Jaklová Germanis-<br />
345
346<br />
Neue Literatur<br />
men als Flurnamen in Südböhmen (Namen von Grundstücken, Hydronyma,<br />
Oronyma) und „Germanismen in den südböhmischen Slangs“ (Flößerslang,<br />
Bierbrauerslang, Glasbläserslang, Fischerslang) stehen lexikalische Entlehnungen<br />
aus unterschiedlichen Wortschatzbereichen sowie ihre Variation und<br />
Adaptation im Vordergrund. Der Beitrag Tschechisch-deutsches Lehngut im<br />
historischen Argot und neueren Gefängnisslang in Böhmen von Jiřina van<br />
Leeuwen-Turnovcová befasst sich neben den quantitativen Aspekten der<br />
Lehnkontakte (sinkende Bedeutung der hebr.-jidd. Etyma und steigende Anzahl<br />
der Romani-Etyma) mit der Frage des Biligualismus und dessen Rolle<br />
für die Form der Entlehnung (verbreiteter deutsch-tschechischer Bilingualismus,<br />
fehlender romani-tschechischer Bilingualismus) und fasst das in ihren<br />
früheren Arbeiten gewonnene soziolektale Material jenseits des deutschen<br />
Rotwelsch sowie vor dem Hintergrund des deutschen Rotwelschs zusammen.<br />
Im Zusammenhang mit der Adaptation der Entlehnungen geht die Verfasserin<br />
nicht nur auf traditionelle Weise auf die Adaptation der Lautform und die Derivation<br />
ein, sondern bespricht gerade in diesem Kontext besonders relevante<br />
semantische Transformationen: Semantisierung und Resemantisierung.<br />
Im literaturwissenschaftlichen Teil befasst sich Hans Rothe in seinem Aufsatz<br />
Biblia Slavica – Die paulinische Lehre von der einen Sünde und den<br />
vielen Lastern – Lesekörner 4–7 mit (alttschechischer) Konzeptualisierung<br />
von Sünde und Ludger Udolph in seinem Beitrag Zur Funktion der Heiligenverehrung<br />
in Böhmen im 17. Jahrhundert mit der Instrumentalisierung<br />
von Landesheiligen, die als Beweis zur Zugehörigkeit des Landes zur wahren<br />
Kirche diene. Václav Boks Aufsatz ist mit Einige Beobachtungen zur<br />
lateinischen Legende über Agnes von Prag zu ihren mittelalterlichen deutschen<br />
und tschechischen Übertragungen betitelt, während Karlheinz Hengst<br />
in seinem Aufsatz Lehrwerke zum Tschechischen aus der Zeit des Humanismus<br />
in Sachsen das lateinisch-tschechisch-deutsche Vokabular (1514–<br />
42) und Lehrwerke von Klatovský (1567), der in den letzten brücken eingehender<br />
besprochen wurde, sowie von Gelenius (1544), Gessner (1555), Daniel<br />
Adam z Veleslavína (1579), Megiser (1603), Loderecker (1605) u.a.<br />
beschreibt. In seinem Beitrag Fritz Walter Nielsen als Nachdichter tschechischer<br />
Poesie oder: Anmerkungen zur appellativen Funktion der literarischen<br />
Übersetzung verfolgt Manfred Jähnichen die deutsch-tschechischen<br />
Kulturbeziehungen.<br />
Auch wenn offen bleibt, ob der rezensierte Band eine mit den Klassikern<br />
deutsch-tschechischer Sprachkontaktforschung vergleichbare Wirkungsgeschichte<br />
haben wird, lässt sich bereits sagen, dass er eine Reihe von wichtigen<br />
Ansätzen und Aufsätzen enthält, die dafür die besten Voraussetzungen liefern.<br />
Marek Nekula<br />
Neue Literatur<br />
Ingeborg FIALA-FÜRST, Jörg KRAPPMANN (Hgg.): Lexikon deutschmährischer<br />
Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2002/2003 [Loseblattsammlung].<br />
(= Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur 5)<br />
Die tschechische Germanistik zeigt seit einiger Zeit ein verstärktes regionalhistorisches<br />
Interesse an den deutschsprachigen Autoren des Landes, die<br />
lange Zeit im Schatten der Prager deutschen Literatur standen. Gleich ob es<br />
sich um Arbeiten zur deutschsprachigen Literatur des Böhmerwaldes oder<br />
zum so genannten Grenzlandroman handelt, offenkundig stößt man, bedingt<br />
durch die Öffnung des Jahres 1989 und eine damit ermöglichte Wiederentdeckung<br />
und Neubewertung historischer Traditionen, auf ein vielfältiges,<br />
oft vergessenes und verdrängtes Erbe, welches aus der engen nationalliterarischen<br />
Perspektive ausgeschlossen blieb. Die Gründe hierfür sind nicht nur<br />
in einer kommunistisch geprägten Kulturpolitik zu sehen, kam es doch unmittelbar<br />
nach 1945 angesichts der in deutschem Namen begangenen<br />
Verbrechen zu einer massiven Verdrängung der ‚deutschen‘ kulturellen<br />
Wurzeln in ganz Mittel- und Osteuropa.<br />
Und wenn auch zu konzedieren ist, dass unter ästhetischen Kriterien ein<br />
großer Teil dieser regionalen Literatur zu recht in Vergessenheit geriet, so<br />
kann doch der kulturhistorische Nutzen einer lexikalischen Erfassung von<br />
Texten auch zweit- oder drittklassiger Autoren nicht ernsthaft bestritten<br />
werden, auch wenn das Fernziel, eine territoriale Kulturgeschichte Böhmens<br />
und Mährens, „die die geistigen Erzeugnisse aller auf diesem Gebiet lebenden<br />
Bevölkerungsgruppen mit einbezieht, ohne die historisch-politischen<br />
Rahmenbedingungen außer acht zu lassen“ (Vorwort 3), offenkundig weniger<br />
aus methodischen denn aus arbeitskapazitären Gründen zunächst nicht<br />
verfolgt wird. Allerdings stellt sich die Frage, weshalb überhaupt der Anspruch<br />
erhoben wird, Literatur eben nicht bzw. nicht in erster Linie auf der<br />
Basis der sprachnationalen Kategorisierung zu behandeln, wenn dann doch<br />
in letzter Konsequenz eine selbstgewählte Beschränkung des Lexikons auf<br />
das deutschmährische literarische Schaffen erfolgt. Territorialisierung als<br />
Ausweg aus den Beschränkungen der Nationalliteratur kann ja wohl erfolgreich<br />
nur aus einer übernationalen, die Sprachen übergreifenden Perspektive<br />
erfolgen.<br />
Dabei ist eine sprachnationale Eingrenzung durchaus zu legitimieren – insbesondere<br />
aus der Perspektive neuzeitlicher Literaturgeschichtsschreibung,<br />
schließlich ist seit dem 19. Jahrhundert die konstitutive Rolle gerade der<br />
Schriftsteller am Prozess der Nationalisierung unübersehbar, ein Prozess,<br />
der eben nicht nur ein rezeptives Phänomen darstellt, wie auf Seite 7 des<br />
Vorwortes suggeriert wird. Gerade die Autoren sind maßgeblich an der Entstehung<br />
der ‚Nation‘, verstanden als modernes soziales Konstrukt, beteiligt.<br />
347
348<br />
Neue Literatur<br />
Insofern sind Aussagen, nach denen der „böhmische Landespatriotismus“<br />
als die „vornehme Haltung der Intellektuellen“ um die Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
zu verstehen sei (Vorwort 1f.) missverständlich, wird hiermit doch<br />
eine fortgesetzte übernationale Orientierung gerade bei den Schichten assoziiert,<br />
die zu diesem Zeitpunkt in ihrer überwältigenden Mehrheit eine eindeutige<br />
nationale Identifikation besaßen. Einen fortdauernden Landespatriotismus<br />
findet man gerade in den intellektuellen Schichten bestenfalls<br />
vereinzelt, der öffentliche Diskurs ist um 1848/49 eindeutig national konnotiert.<br />
Dem Manko einer umfassenden Darstellung zur deutschmährischen Literatur<br />
begegnet nun das vorliegende Lexikon, als Loseblattsammlung konzipiert<br />
und somit offen für künftige Entdeckungen und Erweiterungen. Ein<br />
zunächst lobenswertes Unterfangen, wird doch eine wichtige Basis für künftige<br />
Arbeiten zur deutschmährischen Literatur geschaffen. Aus einer Datenbank<br />
mit 1216 Autoren und ca. 2000 „Verfassern wissenschaftlicher oder<br />
allgemein nichtfiktiver Abhandlungen“ (Vorwort 5) wurden für das Lexikon<br />
ca. 10 % ausgewählt (Vorwort 8). Man wird also zunächst gespannt sein,<br />
nach welchen Kriterien die Aufnahme in das Lexikon deutschmährischer<br />
Autoren erfolgt, da offenkundig enzyklopädische Vollständigkeit nicht intendiert<br />
ist, andererseits neben Literaten auch Wissenschaftler und Philosophen<br />
aufgenommen wurden. Ein zentrales Kriterium der Verfasser bildet<br />
die Genealogie, die Abstammung der jeweiligen Autoren. Allerdings wird<br />
dieses Kriterium offenkundig nicht stringent durchgehalten, müsste man<br />
sich doch sonst über die Erfassung von Autoren wie Karl Brand verwundern,<br />
der zwar 1895 in der Nähe von Mährisch Ostrau geboren wurde, aber<br />
schon 1896 mit der Familie nach Prag verzog. Ein anderes Beispiel stellt<br />
der 1909 in Iglau geborene Louis Fürnberg dar, der seit 1911 in Karlsbad<br />
lebte. Das „Mährische“ müsse sich im Werk widerspiegeln, so lautet eine<br />
weitere inhaltliche Bestimmung, deren nähere Spezifizierung die Verfasser<br />
allerdings vermeiden. Und so erscheint selbst die Klassifikation von Ludwig<br />
Winder und Ernst Weiß als deutschmährische Autoren wohl nicht unproblematisch,<br />
da offenkundig als Kriterien vor allem essentialistische Bestimmungen<br />
wie Geburt und Sprache herangezogen werden, man über das<br />
„Mährische“ im Werk selbst in den jeweiligen Artikeln leider nichts erfährt.<br />
Dabei könnten gerade die „lebens-, werk- und zeitgeschichtlichen Parallelerfahrungen<br />
und -entwicklungen“ bei Winder und Weiß einen Zugang zum<br />
postulierten ‚Mährischen‘ eröffnen (KROLOP 1992: 60).<br />
Bekanntlich hatte Otto Pick (1927: 12) als einer der ersten auf Gemeinsamkeiten<br />
der mährischen Dichter hingewiesen. Im Vergleich zu den böhmischen<br />
und Prager Autoren zeigen sich Eigenarten der mährischen im<br />
„schwermütigere[n] Unterton ihrer Schöpfungen“, in der „Neigung zum<br />
Neue Literatur<br />
Exakten, zur Sachlichkeit, zur prägnanten Objektivität“ und in einem „klare[n]<br />
Zurückschauen auf leidvolle Kindheitserlebnisse.“ Es wäre sicher<br />
spannend gewesen, diese Überlegungen aufzugreifen und im Hinblick auf<br />
die Gesamtkonzeption des Lexikons weiter zu verfolgen.<br />
Schlichtweg von Unkenntnis zeugen Behauptungen, wonach „sich die Germanistik<br />
in Deutschland keine Sorgen mit regionalen und nationalen Abgrenzungen<br />
macht und sich auf das Kriterium der einheitlichen Sprache<br />
zurückzieht“ (Vorwort 5). Im Rahmen der Renaissance der territorialen Literaturgeschichtsschreibung,<br />
gleich ob bayerischer, österreichischer oder<br />
rheinischer Couleur, wurden immer auch methodische Fragen erörtert.<br />
Und wieso es leichter sei, „das Werk Kafkas hermeneutisch zu interpretieren,<br />
als es im komplizierten böhmischen (d.h. deutsch-tschechisch-jüdischen Umfeld)<br />
zu begreifen“ (Vorwort 2) bleibt angesichts der Dichte und Tiefe des<br />
Kafkaschen Œvres, an dem sich schon viele Interpreten abgearbeitet haben,<br />
ein Geheimnis der Herausgeber.<br />
Schauen wir uns nun punktuell einzelne Artikel an. Als positives Beispiel<br />
sei der Ungar-Artikel von Dieter Sudhoff hervorgehoben, der gleichermaßen<br />
Aspekte der Biographie wie solche des Werkes kenntnisreich vermittelt<br />
und dem eine überzeugende Einordnung in die Zeit gelingt. 1 In diesem Artikel<br />
findet der Leser eine fundierte biographische Verankerung und literarhistorische<br />
Einordnung sowohl in den regionalen Kontext als auch den der<br />
Epoche, der Leser erhält eine genaue Einführung in das Werk Ungars.<br />
Bei anderen Artikeln sind dagegen leider nicht zu selten formale und inhaltliche<br />
Mängel zu konstatieren. Dies betrifft unerlässliche Aktualisierungen,<br />
in der Bibliographie zu Ernst Weiß fehlen beispielsweise die wichtige Studie<br />
von Margita Pazi (2001) sowie die im Aufbau Verlag erschienenen<br />
Textausgaben. Problematisch erscheint eine unkommentierte Aussage bei<br />
Ludwig Winder (3) zur Erfahrung des Dichters mit einem auf Mähren konzentrierten<br />
Antisemitismus, wird doch von Ausschreitungen auch in Prag<br />
immer wieder berichtet, sei es von Moritz Hartmann aus dem Jahre 1848,<br />
sei es von Max Brod aus der Zeit der Badeni-Unruhen 1897 oder von F.C.<br />
Weiskopf (1931) zu den so genannten ‚Prager Ereignissen‘ vom 16.-<br />
19.11.1920. Schon legendär sind bekanntlich Kafkas Worte an Milena in<br />
einem Brief aus diesen Tagen:<br />
1 Ludwig Winder: „Ungars Prag ist gespenstischer als Meyrinks gespenstische<br />
Stadt: gespenstisch in der Nüchternheit eines mörderischen Alltags, der die<br />
großen Wunder [?] und Verbrechen mit dem Schall gleichzeitig vorbeihastenden<br />
Stadtlärms verbirgt.“ (6) [zitiert nach: L.W. (Ludwig Winder): Erzähler.<br />
In: DEUTSCHE ZEITUNG BOHEMIA 96, Nr. 24 (31.1.1923), 2]<br />
349
350<br />
Neue Literatur<br />
Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen und bade im Judenhaß. ‚Prašivé plemeno‘<br />
habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. (KAFKA 1998: 288)<br />
Manche Artikel sind sehr kurz geraten und gehen nicht über rudimentärstes<br />
Lexikonwissen hinaus, so die Artikel zu Thomas Brey, der nur 7 ½ Zeilen<br />
umfasst, zu Joseph Leonard Knoll, zu Fritz Koberg oder zu Paul Lamatsch<br />
von Warnemünde, bei denen lediglich lexikographische Daten geboten<br />
werden. Wenigstens eine Einschätzung der Werke, die über die bloße Nennung<br />
der Titel hinausgeht, sollte doch als Mindeststandard geboten werden.<br />
Handelt es sich bei den zuvor genannten um Persönlichkeiten, die nicht im<br />
Zentrum der geisteskulturellen Entwicklungen standen, so sollte der Eintrag<br />
zur Familie Lichnowsky die Bedeutung dieser für Mähren wie für die Österreichische<br />
Monarchie insgesamt wichtigen Familie pointiert hervorheben.<br />
Doch auch hier erhält der Leser eine weitgehend additive Aufzählung von<br />
z. T. oberflächlichen Fakten. So erfährt man lediglich von Karl Alois Lichnowskys<br />
Korrespondenz mit A. G. Forster, dass daraus die „hohe Anerkennung“<br />
(1) für Lichnowsky hervorgehe und Forster ihn [?] mit wichtigen<br />
Persönlichkeiten des damaligen Wien bekannt gemacht habe, eine kulturhistorische<br />
Einschätzung dieser Korrespondenz fehlt leider. Gleichermaßen<br />
wird zwar die Freundschaft mit Goethe vermerkt, Karl Alois Lichnowsky<br />
eröffnete Kontakte zum Wiener Hof, aber auch hier fehlt eine weitergehende<br />
geisteshistorische Einordnung dieses so bedeutenden Zeitgenossen (und<br />
Förderer Beethovens). In diesem Zusammenhang sei auch gleich eine kompetente<br />
inhaltliche und stilistisch-syntaktische Redigierung der Texte eingefordert:<br />
Nach der Ermordung des Fürsten Lichnowsky als eines rechtsorientierten Abgeordneten des<br />
Frankfurter Parlaments durch die aufständischen Truppen in Frankfurt 1848, wurde Weerth der<br />
Verleumdung [Felix] Lichnowskys angeklagt, seine Behauptung, daß er in seinem Werk keine<br />
konkrete Person gestaltet hat, wurde von der Justiz abgelehnt [Herv. S.H.]. (4) 2<br />
Formulierungen wie die im Artikel zu Louis Fürnberg, der „[...] mit dem<br />
Song ... [Herv. S.H.] Die Partei, die Partei, die hat immer recht .... [...] sein<br />
Gewissen zu beruhigen“ (4) suchte, erscheinen in einem Lexikon mit wissenschaftlichem<br />
Anspruch doch etwas fehl am Platz.<br />
2 Siehe Weerth, Georg: Leben und Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski.<br />
Ähnlich vage die Formulierung zu Felix Lichnowsky, dem Freund Franz<br />
Liszts: „Die Kontakte Felix Lichnowskys zu Franz Liszt verhalfen zum<br />
Durchbruch des romantischen Stils in der Troppauer und Teschener Region,<br />
der dann durch spätere Aufenthalte Cosima Wagners in Grätz bei Troppau<br />
neuen Anstoß bekam.“ (5) Der Erkenntnisgewinn solcher nicht weiter ausgeführter<br />
Thesen darf wohl als dürftig bezeichnet werden.<br />
Neue Literatur<br />
Unverständlich bleibt nur, wieso gerade Autoren, bei denen das sicher näher<br />
zu spezifizierende ‚Mährische‘ – die Thematisierung regionaler oder mentaler<br />
‚mährischer‘ Aspekte bzw. ein biographischer Bezug zur Region – außer<br />
Frage stehen dürfte, eher knapp abgehandelt werden, so Marie von Ebner-<br />
Eschenbach auf nur sechs Seiten, Jakob Julius David auf nur vier und Ferdinand<br />
von Saar auf gerade mal drei Seiten!<br />
Offenkundig hat man den Autoren der einzelnen Beiträge kein Style sheet<br />
zur Hand gegeben oder auf eine Schlussredaktion verzichtet, wie sonst sind<br />
die unterschiedlichsten Bibliographieregelungen zu erklären? Hier das Ergebnis<br />
einer Stichprobe: Im Artikel Sealsfield wird die Sekundärliteratur<br />
alphabetisch in der Reihenfolge Vorname (ausgeschrieben), Nachname angeordnet,<br />
bei Bratranek wird der Vorname abgekürzt. Bei Richard Schaukal<br />
finden wir dagegen eine chronologische Anordnung der Sekundärliteratur.<br />
Der Artikel zu Ferdinand von Saar verzichtet bei der Primärliteratur auf<br />
Erscheinungsort, Auflage und Verlagsangabe (bis auf Ausnahmen), die Sekundärliteratur<br />
wird in der Reihenfolge Nachname, Vorname angeordnet.<br />
Soll das als Handbuch konzipierte Lexikon deutschmährischer Autoren seiner<br />
Aufgabe gerecht werden, eine Basis für künftige wissenschaftliche Arbeiten<br />
zur deutschmährischen Literatur und Kultur zu bieten, dann müssen<br />
Kriterien wie Vollständigkeit, Genauigkeit und Vergleichbarkeit der bibliographischen<br />
Angaben als Mindeststandard berücksichtigt werden. Erst die<br />
Präzision derartiger Angaben bietet die Gewähr für das Hauptanliegen solcher<br />
Lexika: das der Reliabilität.<br />
Für eine Überarbeitung dieses ohne Zweifel wichtigen Nachschlagewerkes<br />
bleibt also einiges zu tun, was insbesondere die inhaltliche Konzeption des<br />
Vorwortes betreffen sollte. 3<br />
Literatur<br />
KAFKA, Franz (1998): Briefe an Milena. Erweiterte Neuausgabe. Frankfurt/Main:<br />
Fischer.<br />
KROLOP, Kurt (1992): Ernst Weiß und das ‚expressionistische Jahrzehnt‘<br />
in Prag. – In: Ernst Weiß – Seelenanalytiker und Erzähler von europäischem<br />
Rang. Beiträge zum Ersten Internationalen Ernst-Weiß-Symposium<br />
3 Von völliger Unkenntnis wissenschaftlicher Institutionen im engeren Fachkontext<br />
zeugt beispielsweise, wenn eine Zusammenarbeit mit den „unterschiedlichen<br />
Institutionen der Vertriebenen“ ausdrücklich nicht abgelehnt<br />
wird und man dies mit einem Hinweis auf die Mitgliedschaft des Leiters der<br />
Arbeitsstelle, Ludvík Václavek, im Collegium Carolinum meint begründen zu<br />
müssen!<br />
351
352<br />
Neue Literatur<br />
aus Anlaß des 50. Todestages - Hamburg 1990. Hg. v. P. Engel u. H.-H.<br />
Müller. Bern, Berlin u.a.: Lang, 52–66. (= Jahrbuch für Internationale Germanistik.<br />
Reihe A – Kongreßberichte 31)<br />
PAZI, Margita (2001): Franz Kafka und Ernst Weiß. – In: Dies., Staub und<br />
Sterne. Aufsätze zur deutsch-jüdischen Literatur. Hrsg. von S. Bauschinger,<br />
P. M. Lützeler. Göttingen: Wallstein Verlag.<br />
PICK, Otto (1927): Deutsche Dichter in Brünn und im mährischen Gebiet. –<br />
In: Prager Presse 7/333 (4.12.1927). Beilage: Brünn, die Hauptstadt von<br />
Mähren.<br />
WEISKOPF, Franz Carl (1931): Das Slawenlied. Berlin: Kiepenheuer.<br />
Steffen Höhne<br />
Gero FISCHER (Hg.): Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa<br />
Pšeničky. / Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen des tschechischen<br />
Schmiedes Josef Pšenička. Brno (Nakladatelství Doplněk) 2001, 174 Seiten.<br />
Dieses Buch enthält die Lebenserinnerungen des Schmieds Josef Pšenička,<br />
der 1854 im böhmischen Lečice geboren wurde und seit 1872 in Wien lebte,<br />
wo er 1941 starb. Sie reichen bis zum Jahre 1925, dem Todesjahr von Pšeničkas<br />
Frau.<br />
Pšenička verfasste seine Erinnerungen handschriftlich auf Wunsch seiner<br />
Tochter Anna, und zwar in tschechischer Sprache. Seine jüngere Tochter<br />
Hermine fertigte hierzu – ebenfalls handschriftlich – die deutsche Übersetzung<br />
an. Beide Handschriften wurden von Pšeničkas Enkelin zur Buchveröffentlichung<br />
freigegeben, welche von dem Slavisten Gero Fischer besorgt<br />
wurde.<br />
Die Ausgabe umfasst drei jeweils auf Deutsch und Tschechisch abgedruckte<br />
einführende Texte: eine Einleitung von Gero Fischer (6–11), einen Text<br />
über Tschechen in Wien von Jana Pospíšilová (12–16) und den Text Studienreisen<br />
zum Kennenlernen Österreichs und seiner Kultur von Miroslav<br />
Válka (16–19). Den Hauptteil bilden Pšeničkas tschechisch verfasste Erinnerungen<br />
(20–82) und deren deutsche Übersetzung (83–158). Eine Bildbeilage<br />
(158–174), u.a. auch mit Faksimiles von Auszügen der beiden Handschriften,<br />
runden den Band ab.<br />
Pšeničkas Text stellt ein sozialgeschichtlich bemerkenswertes Dokument<br />
dar, eine Biographie ‚von unten‘, die Biographie eines wandernden Handwerkers,<br />
der sich mühsam emporarbeiten musste. So verwundert es nicht,<br />
dass Pšenička gerade den Schilderungen finanzieller Schwierigkeiten viel<br />
Neue Literatur<br />
Raum widmet, nicht selten mit sehr konkreten Angaben. Es handelt sich<br />
eben um die Erinnerungen eines Menschen, der mit jedem Kreuzer rechnen<br />
musste. Des Weiteren bietet Pšenička Beschreibungen seiner Arbeits- und<br />
Wohnbedingungen sowie politischer und familiärer Umstände.<br />
Es bietet sich an, Pšeničkas Erinnerungen mit denen des deutsch-jüdischen<br />
Schriftstellers Fritz Mauthner (1849–1923) zu vergleichen (MAUTHNER<br />
1918), denn zumindest bei oberflächlicher Betrachtung zeigen sich einige<br />
Parallelen: Die Autoren gehören derselben Generation an, beide stammen<br />
aus Böhmen, beide sind von dort ausgewandert, Pšenička nach Wien,<br />
Mauthner (im Jahre 1876) nach Berlin. Doch trotz dieser Parallelen scheinen<br />
Pšeničkas und Mauthners Erinnerungen zwei verschiedenen Welten<br />
anzugehören. Mauthner, der Sohn eines wohlhabenden Industriellen, thematisiert<br />
seine finanzielle Situation überhaupt nicht und konzentriert sich statt<br />
dessen ganz auf seine persönliche, v.a. seine intellektuelle Entwicklung. Bei<br />
Pšenička hingegen erfahren wir nur recht wenig über seine Ausbildung.<br />
Mauthner verrät – wenn auch ironisch distanziert – einiges über seine frühen<br />
Liebschaften und andere persönliche Beziehungen. Pšenička äußert sich<br />
nur eher knapp und beiläufig über persönliche und familiäre Bindungen,<br />
allerdings mit einer Ausnahme: Die ausführlichen Darlegungen über den<br />
Tod seiner Frau (145–150) lassen erkennen, wie tief ihn dieser getroffen<br />
haben muss.<br />
Bezeichnend ist auch, dass Pšenička nur sehr knapp darauf eingeht, wann<br />
und wie er Deutsch gelernt hat (108–110, vgl. auch die Bemerkungen von<br />
Pospíšilová, 15f.), während der nachmalige Sprachphilosoph Mauthner intensiv<br />
über seine Tschechisch- und andere Sprachstudien referiert.<br />
Es lässt sich somit konstatieren, dass Pšeničkas Erinnerungen gerade in sozialgeschichtlicher<br />
Hinsicht sehr aufschlussreich sind. Sie sind aber noch<br />
aus einer anderen Sicht hochinteressant, und zwar aus sprachlichen Gründen.<br />
Im tschechischen Text Pšeničkas sind nämlich mehrere sprachliche<br />
Register in einer geradezu abenteuerlichen Weise kombiniert: Neben Dialektausdrücken<br />
und Elementen der Umgangssprache finden sich zahlreiche<br />
Germanismen, deren Verwendung zumindest teilweise gewiss damit zu erklären<br />
ist, dass Pšenička einen großen Teil seines Lebens in deutschsprachiger<br />
Umgebung zugebracht hat. Zudem ist der Text in einer sehr eigenwilligen<br />
Orthographie abgefasst. Die deutsche Übersetzung wiederum weist<br />
teilweise erhebliche Interferenzen aus dem Tschechischen auf. Inwieweit<br />
diese Interferenzen dem Umstand geschuldet sind, dass es sich hierbei eben<br />
um eine Übersetzung handelt und inwieweit Pšeničkas Tochter Hermine<br />
auch sonst in ihrem Deutsch tschechische Interferenzen verwendete, ist natürlich<br />
schwer zu entscheiden. Auf jeden Fall sind diese beiden Texte eine<br />
wahre Fundgrube für die Kontaktlinguistik.<br />
353
354<br />
Neue Literatur<br />
Die Spezifik dieser beiden Texte soll hier zumindest an einem Beispiel illustriert<br />
werden. Zunächst ein Auszug aus dem tschechischen Text:<br />
Ten měsic po žnech, než začnou posvíceni, tak jsou v Roudnici dva ročni velké trhy (Jahrmarkt)<br />
na tyto dni dostavala veškerá čeládka jejich slůžebné, též měly ten den frei, na tyto dva<br />
trhy šel každý si něco koupit a to žádný dříve neoblekl až na posvíceni.<br />
Hned v neděly ráno, když bylo krásné počasy, byly jíž na návsi postavený krámy s cukrovim a<br />
všelijaké hračky, kolo (Ringelspiel) komedianti zde zase byla bouda kde prý divotvorná panna<br />
z červenýmy oči a byle vlasy až nazem ta za 5 kr. každému prý uhádla co se mu stalo a co se<br />
mu ještě příště stane, flašinety hrály na všech stranach a žebráku jak by je byl někdo ze všech<br />
stran zbubnoval, hoste přijížděly na vozech ksedlákum a ktěm chudšim přišly pěšky, mezi to ta<br />
hudba od těch děti, jeden hrál na mundharmonyku, druhý na trumpetku a píštalu a mezi to se se<br />
všemy zvony zvonilo do kostela, tak větší radosti nemohlo být. (36)<br />
Die entsprechende deutsche Übersetzung lautet:<br />
Der Monat nach der Ernte wo die Kirtage beginnen sind in Raudnitz 2 große Jahrmärkte, da<br />
bekamen meistens die Dienstboten ihren Lohn, denn diesen Tag bekamen sie frei. Auf diesen 2<br />
Jahrmärkten ging ein jeder sich etwas zu kaufen und das hat keiner früher angezogen bis am<br />
Kirtag.<br />
Gleich Sonntag früh wenn es schönes Wetter gab, waren auf der Straße die Buden aufgestellt,<br />
mit Zuckerwaren und verschiedenen Bäckereien Spielereien, ein Ringelspiel, eine Komödiantenbude<br />
war auch darunter eine Frau mit roten Augen und weißen Haaren bis zur Erde reichend<br />
für 6 Kreuzer hat sie jedem erraten was früher war und was die Zukunft bringt. Werkel spielte<br />
an allen Enden und Bettler waren so viel als wie wenn sie von allen Seiten zusammengetrommelt<br />
worden wären. Gäste kamen per Wagen zu den Bauern und zu den ärmeren zu Fuß. Unter<br />
denen die Musik von den Kindern, der eine spielte auf der Mundharmonika der andere auf der<br />
Trompete oder Pfeiferl unterdem läuteten sie mit allen Glocken in die Kirche, so konnte es<br />
keine größere Freude geben. (103)<br />
Eine ausführliche linguistische Analyse dieser Passagen kann hier nicht gegeben<br />
werden, doch ist wohl unschwer zu erkennen, wie ergiebig diese ausfallen<br />
könnte.<br />
Die Beispiele zeigen auch, dass der Herausgeber die ursprüngliche Orthographie<br />
der Handschriften beibehalten hat, „um die Authentizität und Originalität<br />
zu wahren“ (9). Gerade auch aus kontaktlinguistischer Sicht ist diese<br />
Entscheidung zu begrüßen. Man kann sich allerdings auch vorstellen, wie<br />
mühsam die Anfertigung einer alle orthographischen Eigenheiten bewahrenden<br />
Buchvorlage gewesen sein muss. Dieses Vorhaben scheint nicht<br />
vollauf gelungen. Zumindest finden sich im deutschen Text diverse Fehler,<br />
die vermutlich reine Tippfehler darstellen und nicht im Manuskript vorkommen<br />
dürften, z.B. Reichspat statt „Reichsrat“ (129), Maht statt „Macht“<br />
(129), Bumen statt „Blumen“ (139), Soren statt „Sorgen“ (148) u.a. Sollte es<br />
eine weitere Auflage dieses Texts geben – was zu hoffen ist – so sollte dieser<br />
noch einmal Korrektur gelesen werden.<br />
Neue Literatur<br />
Die einführenden Texte sind recht unterschiedlichen Charakters. Am informativsten<br />
ist die Einleitung von Fischer; sie gibt über die Entstehungs- und<br />
Editionsgeschichte von Pšeničkas Erinnerungen sowie über deren sprachliche<br />
Besonderheiten Auskunft. Der Text von Pospíšilová ist ebenfalls durchaus<br />
interessant, v.a. die Ausführungen zu Studien über Tschechen in Wien.<br />
Allerdings beschränkt sich Pospíšilová hier auf die Nennung von Forscherpersönlichkeiten,<br />
ohne deren einschlägige Werke zu zitieren. Meines Erachtens<br />
wäre es sinnvoll gewesen, diesen Text um eine Bibliographie zu ergänzen;<br />
zumindest Standardwerke wie GLETTLER (1972) oder BROUSEK<br />
(1980) hätten aufgeführt werden sollen. Nicht ganz nachvollziehbar ist,<br />
warum der Text von Válka in das Buch aufgenommen wurde. Válka berichtet<br />
lediglich über Studienreisen von Pädagogen und Studenten der Brünner<br />
Masaryk-Universität nach Österreich; ein Zusammenhang zu Pšeničkas Erinnerungen<br />
ist nicht erkennbar.<br />
In jedem Falle ist aber die Herausgabe von Pšeničkas Erinnerungen sehr zu<br />
begrüßen. Insbesondere die deutsch-tschechische Sprachkontakt-Forschung<br />
– vgl. zu dieser POVEJŠIL (1997) – wird hiermit durch sehr interessantes<br />
Material bereichert. Gero Fischer ist daher zuzustimmen, wenn er diese Erinnerungen<br />
folgendermaßen charakterisiert:<br />
Das tschechische Original ist wie die deutsche Übersetzung ein Gradmesser für den Stand der<br />
sprachlichen Integration bzw. Assimilation der ersten bzw. der zweiten Generation. Beide<br />
Texte lassen sich als authentische Quellen für Assimilation und Sprachverlust analysieren. (11)<br />
Literatur<br />
BROUSEK, Karl M. (1980): Wien und seine Tschechen. München: Oldenbourg.<br />
GLETTLER, Monika (1972): Die Wiener Tschechen um 1900. (= Veröffentlichungen<br />
des Collegium Carolinum. Bd. 28.) München, Wien: Oldenbourg.<br />
MAUTHNER, Fritz (1918): Erinnerungen. I. Prager Jugendjahre. München:<br />
Georg Müller.<br />
POVEJŠIL, Jaromír (1997): Tschechisch-Deutsch. – In: H. Goebl, P. H. Nelde,<br />
Z. Starý, W. Wölck (Hgg.), Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch<br />
zeitgenössischer Forschung. Bd. 2. Berlin, New York: de Gruyter, 1656–<br />
1662.<br />
355<br />
Karsten Rinas
356<br />
Neue Literatur<br />
Alena KÖLLNER: Buchwesen in Prag. Von Václav Matěj Kramerius bis Jan<br />
Otto (Buchforschung 1). Wien (Edition Praesens) 2000, 177 Seiten, 28 Abb.<br />
Ein Emigrantenschicksal war der erweiterteren Diplomarbeit der Wahlwienerin<br />
Alena Kadlecová-Köllner über das Buchwesen in Prag bisher beschieden:<br />
Während sie im deutschen Sprachraum einige Beachtung fand, 1<br />
blieb es in der Tschechischen Republik bei einer einzigen, kurzen Besprechung.<br />
2 Mangelndes Interesse ist noch keine Kritik; es zeugt lediglich von<br />
einer schwachen Forschungsdynamik. Das ist bedauerlich, denn eine kritische<br />
Auseinandersetzung – auch mit einem nicht allseitig gelungenen Buch<br />
– kann zu Diskussionen führen und anregend wirken.<br />
Alena Köllners Band über Prag eröffnet die Reihe „Buchforschung. Beiträge<br />
zum Buchwesen in Österreich“, die von Murray G. Hall und Peter R. Frank<br />
herausgegeben wird. 3 Dem Band kommt deshalb auch programmatische Bedeutung<br />
zu, lässt sich doch am Beispiel Prags auf exemplarische Weise die<br />
Entwicklung jenes mehrsprachigen Kulturlebens untersuchen, das die Habsburger<br />
Monarchie im „langen 19. Jahrhundert“ prägte. Hier wird sichtbar, wie<br />
die verschiedenen Sprachkulturen während des Prozesses ihrer Emanzipation<br />
gar keine andere Möglichkeit hatten, als sich Infrastrukturen (wie z. B. Buchwesen,<br />
Bildungswesen und die ökonomische Infrastruktur) zu teilen, die<br />
ebenfalls erst im Aufbau begriffen waren und einheitlich reguliert wurden.<br />
Diese Verstricktheit wurde von den nationalen Forschern im Nachhinein oft<br />
ignoriert, um möglichst schon dort eine „nationale Eigenständigkeit“ zu deklarieren,<br />
wo eine solche noch kaum angestrebt wurde oder erst im Entstehen<br />
war. Eine solche Wissenschaft im Dienste der nationalen Ideologie ist heute<br />
nicht mehr nötig; so kann man daran gehen, die langsame Ausdifferenzierung<br />
1 Besprechungen erschienen von Irmgard Heidler (auf HABSBURG , November 2001),<br />
Stephan Niedermeier (Bohemia 2002/1, 273f.) und Joachim Bahlcke (Zeitschrift<br />
für Siebenbürgische Landeskunde 25, 2002, H. 2, 276f.).<br />
2 Die Besprechung stammt von Jiří Pokorný. – In: Český časopis historický 99<br />
(2001), 638–639.<br />
3 In der schön ausgestatteten Reihe ‚Buchforschung‘ bei der Wiener Edition<br />
Präsens sind übrigens schon weitere Bände erschienen. Im Jahr 2001 Carl<br />
Junkers Studien Zum Buchwesen in Österreich. Gesammelte Schriften (1896–<br />
1927) (Band 2) und als Band 3 Ingeborg Jaklins Studie über Das österreichische<br />
Schulbuch im 18. Jahrhundert aus dem Wiener Verlag Trattner und dem<br />
Schulbuchverlag (2003). Im Herbst 2005 soll ein Band über das Buchwessen<br />
in Wien erscheinen. Außerdem zeichnen die Herausgeber auch für die Zeitschrift<br />
„Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung des Buchwesens in<br />
Österreich“ (www.buchforschung.at) verantwortlich.<br />
Neue Literatur<br />
der national-kulturellen Eigenständigkeit aus den Strukturen zu untersuchen,<br />
die allen Völkern der Monarchie im 18. Jahrhundert gemeinsam waren. 4<br />
Der Titel „Buchwesen in Prag“ deutet Inhalt und Aufbau ganz gut an: Es<br />
geht um eine klare regionale Abgrenzung, innerhalb derer die Manipulation<br />
mit Büchern thematisiert werden soll. Die Mehrsprachigkeit Prags wird dadurch<br />
in das Thema einbezogen, was der Arbeit einen großen Vorzug gegenüber<br />
der Methode bisheriger, oft sprachlich-national orientierter Forschungen<br />
verschafft. Der Untertitel weist darauf hin, dass es um keine<br />
wissenschaftliche Untersuchung, sondern vielmehr um einen historischen<br />
Überblick geht, der durch die Namen zweier Unternehmer begrenzt wird.<br />
Einschlägig interessierte Leser werden diese Personen bzw. ihre Firmen<br />
kennen, andere, zumal deutschsprachige, vielleicht nicht; die Wahl des Titels<br />
ist in dieser Hinsicht nicht sehr glücklich. Doch weist er auch auf die<br />
Hauptschwäche des Buches hin: Das Prager Buchwesen ab den 1780er Jahren<br />
wird in einem personengeschichtlichen Panorama dargestellt, wobei<br />
Kramerius und Otto im Vordergrund stehen, während ihren einzelnen Kollegen<br />
kaum mehr Raum zugestanden wird, als dem Wörtchen „bis“ im Titel<br />
entspricht. Es stellt sich die Frage, ob man dieses daher nicht besser durch<br />
„und“ ersetzt hätte. Die Perspektive der Arbeit wird schließlich dadurch<br />
bestimmt, dass die Entwicklung des Prager Buchwesens in den Kontext des<br />
tschechischen „nationalen Wiedererwachens“ gestellt wird.<br />
Kramerius und Otto stehen für zwei Abschnitte dieser Entwicklung und<br />
gleichzeitig für die zwei Großkapitel, in die das Buch aufgeteilt ist. Im Zentrum<br />
des ersten Kapitels steht also das frühe „nationale Wiedererwachen“ mit<br />
Kramerius’ Versuch, einen auf tschechischsprachige Bücher spezialisierten<br />
Verlag zu gründen und wirtschaftlich am Leben zu erhalten. Alena Köllner<br />
versucht zu Beginn, einen Eindruck von der Komplexität der Prager Kultur<br />
am Ende des 18. Jahrhunderts vermitteln. Es gelingt ihr dabei nicht immer,<br />
aus der großen Menge angesammelten Materials die für ihre Absicht wichtigen<br />
Angaben herauszufiltern und deren Funktion deutlich zu machen. So erscheint<br />
die Schulproblematik eindeutig übergewichtet gegenüber für das<br />
Buchwesen ungleich bedeutenderen Abschnitte über literaturvermittelnde<br />
Institutionen wie Bibliotheken, Leihbüchereien und Kaffeehäuser, die wiederum<br />
zu kurz kommen gegenüber dem Verlagsbuchhandel. Außerdem isoliert<br />
die Autorin diese Vermittlungsinstanzen in separaten Kapiteln, während<br />
4 Das habsburgische Buchwesen in seiner Gesamtheit darzustellen unternimmt<br />
das von Peter R. Frank initiierte Projekt „Topographie der Buchdrucker,<br />
-händler, Verleger u.a. in der österr.-ungar. Monarchie 1750–1850. Status,<br />
Fortschritt, Probleme“, das vorgestellt wurde in: Mitteilungen der Gesellschaft<br />
für Buchforschung in Österreich, <strong>2004</strong>/1, 56–58.<br />
357
358<br />
Neue Literatur<br />
sie in dieser Frühphase des modernen Buchwesens tatsächlich in einem engen<br />
funktionalen, ökonomischen und auch personellen Zusammenhang miteinander<br />
standen. Letztlich führt das zu einer Anhäufung von Fakten, die in der<br />
chronologisch-biographischen Auflistung von „Buchdruckern, die gleichzeitig<br />
Buchhändler und Verleger waren“, „Buchdrucker und Verleger (ohne Sortiment)“<br />
und „Buchdrucker, Verleger und Antiquare (ohne Druckerei)“ gipfelt.<br />
Diese Kategorisierung hätte man ohne Verluste mit dem als Anhang<br />
abgedruckten „Verzeichnis der Prager Buchdrucker, Buchhändler und Verleger“<br />
verschmelzen können, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. Im<br />
Gegenzug hätte man den Inhalt durch eine anschaulichere Darstellung von<br />
Zusammenhängen ergänzen können. Ein komplexeres Bild ergibt sich letztlich<br />
nur für Kramerius und Otto.<br />
Kramerius’ Versuch, einen Verlag zu gründen, der auf tschechischsprachige<br />
Publikationen spezialisiert ist, war nach dem Ableben seines Gründers zum<br />
Scheitern verurteilt. Das hatte zur Folge, dass die deutschböhmische und<br />
tschechischsprachige Literatur bis zur Jahrhundertmitte von den selben Verlagen<br />
publiziert wird. Diese werden von Köllner im Rahmen des Gremiums<br />
der Prager Buchhändler behandelt, wobei diese fünfzig Jahre in enzyklopädischer<br />
Form gerafft dargestellt werden. Die Darstellung von Zusammenhängen<br />
und die Einbettung in die politischen, ökonomischen und literarischen<br />
Verhältnisse kommt deswegen zu kurz. Erst in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts waren endlich die Voraussetzungen für eine Autonomie<br />
des tschechischen Buchwesens gegeben. Alena Köllner widmet sich Jan<br />
Otto als dem bekanntesten und am besten erforschten Vertreter dieser Epoche.<br />
In diesem Zusammenhang ist vor allem mit Köllner noch einmal auf<br />
Jaroslavs Švehlas Quellenstudie über Jan Otto hinzuweisen, die nach 1948<br />
ungedruckt im Archiv in Staré Hrady liegen blieb. Es ist bedauerlich, dass<br />
Švehla bis heute weder gedruckt ist noch einen Nachfolger gefunden hat.<br />
Der schon erwähnte Anhang bringt ein „Verzeichnis der Prager Buchdrucker,<br />
Buchhändler und Verleger“ in Form einer gedruckten Datenbank. Ausgewertet<br />
wurde jedoch nur die im Literaturverzeichnis angegebene deutsch- und<br />
tschechischsprachige Sekundärliteratur zum Prager Buchwesen. Damit ist<br />
gleichzeitig auch das große Positivum dieser Auflistung verbunden, da sie<br />
gewissermaßen ein aktuelles Register darstellt, über das man nicht nur die<br />
wichtigsten Daten nachschlagen, sondern auch Verweise auf vorhandene Sekundärliteratur<br />
zu einem Unternehmer erhält. Leider ist die Bibliografie<br />
durchaus nicht vollständig – das wäre wohl auch zu viel verlangt für eine Diplomarbeit.<br />
Doch fallen leider auch grundlegende Forschungen wie Karel<br />
Bezděks Dissertation über Krameriova Česká Expedice (Praha 1951; ein Exemplar<br />
befindet sich im Prager Ústav pro českou literaturu). Sie kann also nur<br />
als Ausgangspunkt für vertiefende Forschungen dienen.<br />
Neue Literatur<br />
Ein anderes Beispiel zu Andreas Gerle: Bei ihm wird nur angegeben, er sei<br />
Buchhändler gewesen, doch war er offensichtlich auch Leihbibliothekar –<br />
darauf weist zumindest die zeitgenössische Quelle Beobachtungen in und<br />
über Prag, von einem reisenden Ausländer hin, die 1787 von Andreas’ Bruder<br />
Wolfgang Gerle verlegt wurde. Obwohl Köllner diese Quelle in ihrem<br />
„Literaturverzeichnis“ (und auch im „Verzeichnis der Illustrationen“) auflistet,<br />
fehlt unter „Andreas Gerle“ der Verweis auf sie. Bei der Forschungsliteratur<br />
verhält es sich ähnlich: im Fall Andreas Gerle vermisst man zum<br />
Beispiel Josef Volfs kleinen Aufsatz „Knihkupci pražští Volfg. Gerle a Jan<br />
Herrl” (In: Zvon, 23/1922, 100), in dem der Dobrovský-Briefwechsel anhand<br />
von Zubrs Register auf die Gebrüder Gerle durchgesehen wird. Doch<br />
auch Josef Dobrovský bzw. seinen Briefwechsel sucht man im Literaturverzeichnis<br />
Alena Köllners vergeblich. Es wäre also notwendig, die gesamte<br />
(und besonders auch die zeitgenössische) Literatur zum Prager Buchwesen<br />
zu berücksichtigen und vor allem auch den darin enthaltenen Verweisen<br />
auf die ältere Literatur konsequent nachzugehen.<br />
Die Arbeit über Buchwesen in Prag von Václav Matěj Kramerius bis Jan<br />
Otto kann als Anstoß in viele Richtungen interpretiert werden. Sowohl ihre<br />
zahlreichen Mängel als auch der Versuch, einem deutschsprachigen Publikum<br />
auf einer zweisprachigen Quellenbasis die Komplexität der Prager<br />
Verhältnisse zu vermitteln sowie zwei ihrer herausragenden Vertreter vorzustellen,<br />
verlangen nach einer Fortsetzung, nach weiteren Forschungen,<br />
nach gründlicheren und systematischeren Darstellungen; auch würde es<br />
nicht schaden, den Zeitrahmen gerade dann bescheidener anzulegen, wenn<br />
nur 170 Seiten zur Verfügung stehen. Wer immer diese zukünftige Studie<br />
verfasst, wird trotzdem gut daran tun, auch dieses Buch zur Hand zu nehmen<br />
und kritisch darauf zurückzugreifen.<br />
359<br />
Michael Wögerbauer<br />
Primus-Heinz KUCHER: Ungleichzeitige / verspätete Moderne. Prosaformen<br />
in der österreichischen Literatur 1820–1880. Tübingen, Basel (Francke)<br />
2002, 464 Seiten.<br />
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit zu Prosaformen der Literatur in<br />
Österreich ist das auch von zeitgenössischen Beobachtern (Seidlitz, Lorm)<br />
wahrgenommene, literarische Modernisierungsdefizit, sieht man einmal von<br />
markanten, wenn auch nicht unumstrittenen Ausnahmen wie Stifter und<br />
Sealsfield ab.<br />
Den offensichtlichen Widerstand gegen Modernisierung (im deutschen Verständnis), faßbar an
360<br />
Neue Literatur<br />
der skeptischen Distanz zur industriellen Massenware ‚Roman‘, und begleitet von der Gefährdung<br />
des dichterischen Autonomieanspruchs durch eine entstehende ‚Tauschwertabstraktion,<br />
einem Zur-Ware-Werden der Menschen und Dinge‘, steht ein sowohl unvermitteltes, selbstgenügsames<br />
als auch auf beides (Modernisierung und Ökonomisierung) ironisch reflektierendes<br />
Textpanorama gegenüber. (4)<br />
Verstärkt wird diese Distanz gegenüber der ‚Moderne‘ durch die einem<br />
amalgamierenden teleologischen Konzept von Nationalität entgegenstehende<br />
Heterogenität der österreichischen Regionen und Landschaften, durch<br />
die eine wesentlich größere Binnendifferenzierung entstand, als man sie im<br />
übrigen deutschen Sprachraum vorfinden konnte.<br />
Die vorliegende Arbeit versteht sich somit als ein Beitrag zur Diskussion<br />
über den widerspruchsvollen Komplex ‚Restauration-Vormärz-Nachmärz‘<br />
(9) in seiner „ungleichzeitigen Mehrsträngigkeit“. Ausgangspunkt ist die<br />
Frage nach dem Zustand der Roman- und Erzählprosa im Kontext der Gattungsdiskussion,<br />
aber auch unter den Bedingungen von öffentlicher Produktion<br />
und Rezeption. Dabei geht es um den Einsatz von Romantheorie und<br />
Romanpraxis, die, auf die ‚Darstellung des menschlichen Lebens als eines<br />
großen Abenteuers‘ abzielend (Hillebrand), in eine „Art Kulturgeschichte<br />
bürgerlicher Bewußtheit“ münden (21).<br />
Angesichts von Autorenkontrolle, Zensur, Selbstbeschränkung sind – greift<br />
man das Stichwort Literatur und Öffentlichkeit auf – die Erfahrungen der<br />
Autoren von Willkür und Obskurantismus; Rückzug, Resignation, Anpassung<br />
geprägt, Kucher konstatiert zu Recht Selbstaufgabe als Haltung (67).<br />
Die Außenwahrnehmung Österreichs als europäisches China, als eine „ausgeklügelte<br />
Maschinerie aus Unterdrückung und Zivilisation“ (223) – so<br />
Ludwig Börne in den Schüchternen Bemerkungen über Österreich und<br />
Preußen (1818) – prägt das Bild der Monarchie und ihrer Literatur zu weiten<br />
Teilen. Neben den Befund der Stagnation und mangelnden Dynamik<br />
tritt ferner die plurinationale (Leser-)Struktur, die nach Groß-Hoffinger einer<br />
selbständigen österreichischen Literatur im Wege stehe (76). Kuchers<br />
Fazit: „Öffentlichkeit hat sich zu einem komplexen, von unterschiedlicher<br />
Binnendynamik geprägten polykulturellen bzw. plurinationalen Phänomen<br />
entwickelt, das sich nationalsprachlich zunehmend verselbständigt, [...].“ (84)<br />
Im zweiten Abschnitt wird mit Hilfe eines gattungstypologischen Zugangs<br />
die Herausbildung der modernen Prosa untersucht. In den Reiseberichten<br />
findet um 1800 ein markanter Paradigmenwechsel von gelehrt-wissenschaftlich-enzyklopädischer<br />
zu subjektiv-literarischer Beschreibungsform<br />
statt. Die Etablierung der Gattung per ästhetischer Aufwertung erfolgt vor<br />
allem durch Goethe und Forster. Insbesondere nach 1819 erhält der österreichische<br />
Reisebericht kompensatorische Funktion durch die Möglichkeit<br />
neuartiger Zugriffe auf Wirklichkeit und durch die Möglichkeit der Integra-<br />
Neue Literatur<br />
tion literarischer und politischer Diskurse. Berichtendes Reisen als Ort literarischer<br />
und gesellschaftlicher Selbstverständigung leistet einen zentralen<br />
Beitrag zur literarischen Kommunikation. Als Besonderheit für Österreich<br />
konstatiert Kucher auf der stofflichen Ebene die Exploration der Peripherie,<br />
auf der ästhetisch-literarischen die Mischform aus Reise-, Genre- und<br />
Stadtprosa (168). Erwartungsgemäß tritt Sealsfields Austria-Schrift ins Zentrum<br />
der Betrachtung, 1 man findet ferner Analysen zu Anton Johann Groß-<br />
Hoffinger (Österreich wie es ist, 1833), Willibald Alexis (Wiener Bilder,<br />
1833), Franz E. Pipitz (Fragmente aus Österreich, 1839), Viktor von Andrian-Werburg<br />
(Österreich und dessen Zukunft, 1842), 2 Adalbert Stifter<br />
(Wien und die Wiener, 1844), Josef Tuvora (Briefe aus Wien, 1844) und zu<br />
dem wahrscheinlich von Uffo Horn verfassten Reisebericht Oestreich. Städte,<br />
Länder, Personen und Zustände (1842), der hier fälschlich Franz Schuselka<br />
zugeschrieben wird. 3 Zentrale Themen dieser Texte sind die Kleinstaaterei,<br />
die nationale Problematik Österreichs, die staatliche Überwachung,<br />
die soziale Frage (Bauern), die Unterschiede zwischen Metropole<br />
und Peripherie, die Selbstdarstellung des höfischen Systems und die Reflexion<br />
literarisch-kultureller Öffentlichkeit. In Adalbert Stifters Wien-Bilder-<br />
Zyklus, eine „Apologie biedermeierlicher Lebenshaltung“ (213), erscheinen<br />
die „faszinierenden und beunruhigenden Triebkräfte des Sozialen und der<br />
Modernisierung, die Wien als Großstadt ausweisen [...] zwar nochmals gebannt“<br />
(213), weisen aber bereits auf die unumkehrbaren Prozesse der Modernisierung.<br />
1 Kucher hatte vor einigen Jahren eine sehr verdienstvolle Textausgabe vorgelegt:<br />
Sealsfield, Charles [= Karl Postl] (1928 [1994]): Austria as it is or Sketches<br />
of continental courts by an eye-witness. London [= Österreich wie es ist<br />
oder Skizzen von Fürstenhöfen des Kontinents, Wien 1919]. Eine kommentierte<br />
Textedition. Hrsg. von Primus-Heinz Kucher), Wien, Köln, Weimar:<br />
Böhlau.<br />
2 Siehe hierzu die aktuelle Textausgabe von Madeleine Rietra (Hg.) (2001):<br />
Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte. Viktor von Andrian-Werburgs Rezeption<br />
im Vormärz. Eine Dokumentation mit Einleitung, Kommentar und einer<br />
Neuausgabe von Österreich und dessen Zukunft (1843). Amsterdam, Atlanta:<br />
Rodopi (= Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 143).<br />
3 Sowohl das Deutsche Anonymenlexikon als auch F. Fellner (Franz Schuselka.<br />
Ein Lebensbild. Diss. Wien 1948: 22f.) vermerken zwar Schuselka als Verfasser<br />
von Österreich, Städte, Länder, Personen und Zustände (Hamburg: Hoffmann<br />
& Campe). Allerdings widerspricht die positive Darstellung der emanzipatorischen<br />
Bestrebungen der österreichischen Slawen grundlegend der<br />
Einstellung, die Schuselka in seinen Vormärzbroschüren vertrat, so dass seine<br />
Autorschaft mehr als zweifelhaft erscheint.<br />
361
362<br />
Neue Literatur<br />
Im dritten Abschnitt wendet sich Kucher dem Roman zu. Der neue Blick<br />
auf die Geschichte seit Herder weist dem historischen Roman eine neue<br />
Funktion zu: konstatiert wird die Tendenz zur dokumentarisch-deskriptiven<br />
Eingrenzung der epischen Potentiale zugunsten ideologisch unterlegter ‚Authentizität‘,<br />
eine Historisierung der Fiktion (276). Politische Diskursebenen<br />
beispielsweise bei Carl Herloßsohn (Der Ungar) sind die Konflikte zwischen<br />
Loyalität verlangender feudaler Tugend und den auf Autonomie abzielenden<br />
historisch-staatsrechtlichen Partikularinteressen (293), ein „Plädoyer<br />
für eine vernunftorientierte, unterschiedliche regionale, nationale und<br />
kulturelle Interessen berücksichtigende Herrschaftspraxis“ (296) lässt sich<br />
im Werk erkennen.<br />
Geschichte wird im Roman als ständiger Einbruch der Gewalt, als von oben willkürlich praktizierte<br />
Herrschaft vorgeführt und zugleich in einer Gegenbewegung als dialogischer Prozeß<br />
skizziert. (296)<br />
Die Aktualität von Herloßsohn zeigt sich dann, wenn Geschichte in Willkür<br />
umschlägt, wenn das Prinzip des Dialogs, des rationalen Interessenausgleichs,<br />
nicht berücksichtigt wird, womit auch die Forderung nach kritischer<br />
Überprüfung des Verhältnisses von Zentrum und Peripherie verknüpft wird.<br />
Im Nachmärz setzen sich dann Schwunderfahrung und Entpolitisierung<br />
durch, ein „Relevanzverlust der Literatur in der zunehmend publizistisch definierten<br />
literarischen Öffentlichkeit“ (367). Die neuen Formen sind das Feuilleton<br />
und die Unterhaltungsblätter. „Gerade das Österreich der Nach-48er<br />
Periode kann als Paradefall vielfältiger Strategien der Resignation und gesuchter<br />
Anpassungen an die neuen alten Verhältnisse gesehen werden.“ (368)<br />
Im Ergebnis lassen sich für den literarischen Modernisierungsprozess in<br />
Österreich folgende übergreifende Parameter erkennen:<br />
1. Das österreichische Literatursystem stellt sich als ein äußerst heterogenes<br />
Konzept ‚gleichzeitig und nebeneinander existierender nationalkultureller<br />
Systeme‘ dar, die Dominanz der deutschsprachigen Öffentlichkeit gerät ab<br />
1830 zunehmend unter Druck der aufstrebenden ‚slawo-hungarischen‘<br />
Sphären (429). Daraus folgt die Notwendigkeit, die Unterschiede zur deutschen<br />
Literaturproduktion angemessen zu würdigen, Kucher plädiert sinnvollerweise<br />
für eine offene Literaturgeschichtsschreibung.<br />
2. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigt sich das deutschsprachige Literatursystem<br />
Österreichs ziemlich ausdifferenziert und ‚überraschend paradox<br />
strukturiert‘ (430). Allerdings erfolgt ein Bedeutungsverlust Wiens nach<br />
1815/1830, ein „unaufholbares strukturelles Hintertreffen“ (430) gegenüber<br />
den neuen deutschen Zentren Leipzig, Hamburg und Stuttgart und angesichts<br />
neuer Binnenkonkurrenz vor allem in Budapest und Prag. Wien sank<br />
Neue Literatur<br />
im Vormärz „auf die Funktion einer Erfahrungsepisode für jüngere Autoren<br />
herab.“ (430) Als weiterer Aspekt wird das Verhältnis des deutschsprachigen<br />
Literatursystems Österreichs zu dem sich entfaltenden nationalkulturellen<br />
System der Monarchie betrachtet, wobei sich „überraschend gute, offene,<br />
keineswegs nur einseitige Beziehungen, auch nach 1848, zur<br />
ungarischen Öffentlichkeit“ (431) entwickelten. Für Böhmen kommt es zu<br />
keinem vergleichbaren Dialog, was auch mit der Exilsituation vieler<br />
deutschsprachiger Böhmen erklärt wird.<br />
3. Das Rollenprofil der österreichischen Autoren weist insofern markante<br />
Spezifika auf, da sich die im deutschen und westeuropäischen Raum etablierende<br />
Figur des freien Schriftstellers in Österreich nicht durchsetzen<br />
konnte. Die Optionen waren hier der beamtete Dichter oder eben die Emigration.<br />
4. Dies hatte nach Kucher weitere Konsequenzen für das Rollenprofil, welches<br />
von Sublimierungen und der Verdrängung von Widersprüchen (Bsp.<br />
Grillparzer, Der arme Spielmann) oder der strategischen Anpassung an den<br />
Markt geprägt ist, wofür die Journalprosa bei „gleichzeitiger penibler Ausblendung<br />
relevanter gesellschaftlich-politischer Konfliktebenen (nationale<br />
Frage, Zensur)“ (432) als Beispiel dienen mag. Auffällig ist aber, in welchem<br />
Maße Autoren wie Grillparzer, Stifter oder Sealsfield Referenzen für<br />
die Vertreter der Moderne boten (Nietzsche, Benjamin, Kafka, Musil).<br />
5. Auf dem Gebiet der Romanprosa konstatiert Kucher Zurückhaltung. Die<br />
Modernität der österreichischen Prosa entfaltete sich in den „kleinen, hybriden<br />
Formen, Skizzen, Studien, Genrebildern und Dorfgeschichten,“ (433)<br />
während der Roman in Deutschland – verspätet zwar – um 1820 bereits gefestigt<br />
und präsent war (23).<br />
Die vorliegende Studie darf zweifelsohne als ein Meilenstein in der Analyse<br />
des literarischen Systems der Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert bezeichnet<br />
werden, wird hier doch der die nationalen Literaturen überschreitende<br />
Anspruch nicht nur postuliert, sondern auch erfüllt. Weitergehende<br />
Studien zu anderen Textsorten und Kunstgattungen, mit denen sich das spezifisch<br />
Mitteleuropäische dieser Region genauer erfassen lassen müsste,<br />
sollten sich anschließen.<br />
363<br />
Steffen Höhne
364<br />
Neue Literatur<br />
Bedřich W. LOEWENSTEIN: Wir und die anderen. Historische und kultursoziologische<br />
Betrachtungen. Dresden (Thelem) 2003, 436 Seiten.<br />
In dem nach 1989 neu entfachten Diskurs um europäische Traditionen und<br />
Integrationen nehmen die Beiträge von Bedřich Loewenstein zumeist eine<br />
zentrale Rolle ein. Es ist insofern ein glücklicher Umstand, dass eine Auswahl<br />
aus Loewensteins Essays – meist aus den 1990er Jahren – nun leicht<br />
zugänglich als Sammelband beim Dresdner Universitätsverlag Thelem erschienen<br />
ist. Die vier zentralen, thematischen Blöcke umfassen:<br />
– Arbeiten zur (nationalen) Konstitution von Wir-Gruppen<br />
– Arbeiten zur tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts, deren Spezifik<br />
Loewenstein in einer kompensatorischen Funktion angesichts fehlender<br />
staatlicher Selbstbestimmung erkennt<br />
– Arbeiten zu Masaryk<br />
– Arbeiten zur Revolution in Europa, verbunden mit einer fundamentalen<br />
Kritik an der Revolutionsromantik – Loewenstein schlägt hier eine<br />
durchaus bedenkenswerte begriffliche Substitution vor: statt von<br />
Revolution von Krise zu sprechen<br />
Hinzu kommen weitere Einzelstudien biographischer Natur und – gewissermaßen<br />
als humoresker Abschluss – zum politischen Witz. 1 Die Texte<br />
sind als ideengeschichtliche, kulturanthropologische und biographische<br />
Studien geprägt von der Authentizität eines Historikers und Sozialtheoretikers,<br />
der – so Bernd Ulrich im Nachwort – die „Brüche des 20. Jahrhunderts<br />
buchstäblich am eigenen Leibe erfahren hat.“ (431)<br />
Ausführlicher soll hier der erste thematische Block vorgestellt werden, der<br />
sich im weitesten Sinne der Konstituierung von Gruppen und deren Gemeinschaftscodes<br />
und Symbolik widmet. Die Notwendigkeit sozialer Identität,<br />
ein uraltes „Bedürfnis nach kollektiver Selbstbestätigung und Verwurzelung<br />
in idealistischen Vergangenheiten“ (51) auf der einen Seite, geht auf<br />
der anderen einher mit Verleugnungspraktiken, Ausgrenzungen, Ex-post-<br />
Aufwertungen der eigenen Gruppe. Es ist diese Pseudologik, die der Bildung<br />
von Gruppenbewusstsein, dem immer schon das „Fiktive, Projektive<br />
und Willensmäßige […] (50)“ eigen war, zugrunde liegt und die auch bei<br />
der Bildung von Nationalbewusstsein eine zentrale Rolle spielt: „Jeder Nationalismus<br />
erfindet falsche Ahnen und projiziert die eigene Gruppe, vor<br />
allem deren Vorzüge, in die Vergangenheit, die von diesen nicht unbedingt<br />
etwas wußte, und so gehen auch andere Kollektive vor.“ 2 Nation wird somit<br />
1 Die Geschichte und das Lachen. Eine sozialpsychologische Betrachtung, insbesondere<br />
das Witzeerzählen unter Diktaturen, 413–430.<br />
2 Identitäten – Vergangenheiten – Verdrängungen, 45–55, 51.<br />
Neue Literatur<br />
eher als Produkt sozialer Kommunikation verstanden denn als Ergebnis aus<br />
Modernitätsdefiziten. Dabei sind kollektive Emanzipationsbewegungen<br />
nicht automatisch freiheitlich in einem „tragfähig-konstruktiven“ Sinne,<br />
Loewenstein beklagt ihr retardierendes Element (die Rückfälle ins Mythische,<br />
in „moralisch-topographische Geschlossenheit der Clanmentalität“ 3 ,<br />
eine, wenn man so will, anthropologische Konstante, die sich auf die metaphorische<br />
Dimension des Hauses zurückführen lässt:<br />
Das Haus kann als Urform der Unterscheidung von Innen und Außen interpretiert werden, von<br />
Vertrautem und Fremdem, Mein und Dein. Es stattet sozusagen unser schwaches Ich mit identitätsstützenden<br />
Schalen aus, die Geborgenheit, Ansehen, Anerkennung vermitteln. (60)<br />
Eine solcherart anthropologisch fundierte Denkfigur lässt sich auf das Dilemma<br />
der Vielvölkermonarchie Habsburg übertragen: „man baute ins gemeinsame<br />
Haus Mitteleuropa lauter kleine Häuser mit geheiligten Innenräumen,<br />
denen leider die gothischen Wasserspeier fehlten, um die Dämonen<br />
herauszulassen, aber immer mit Mauern und Zäunen gegen die verdächtigen<br />
Anderen, die das gleiche taten.“ (239) Gerade die Analogien zur Ethologie<br />
scheinen auf universale Gesetzmäßigkeiten sozialen Agierens zu weisen:<br />
die Abgrenzung von Gruppen, ihre territoriale Verteilung, die Herstellung<br />
von Rangordnungen mit aggressiven Regungen nach innen und außen, Imponiergehabe,<br />
submissive Beschwichtigungen, Unterdrückung von Außenseitern.<br />
Das darin erkennbare Konzept des ambivalenten Anderen, welches<br />
zum bedrohlichen Anderen mutiert, macht sich offenkundig der moderne<br />
Nationalismus zu Nutze. Aus den Vorstellungen von Nation entsteht eine<br />
„hochemotionale Gemeinschaftsideologie“ (70). Die nationale Identität ist<br />
dabei selbst nicht frei von Ambivalenzen, sie bietet einerseits den Menschen<br />
Halt, vermittelt Sinn, strukturiert politisches Handeln, andererseits schafft<br />
sie unüberwindliche Grenzen, erzeugt Feinde und schafft somit die „Hörigkeit<br />
geschlossener Kollektive“. Unterstützt durch Kollektivsymbolik entsteht<br />
ein Schichten übergreifendes Wir-Gefühl, mit dessen Hilfe letztlich<br />
ein Anspruch auf Geltung einer bestimmten Denk- und Verhaltensweise<br />
erhoben wird.<br />
Aus diversen Erinnerungsschichten, heterogenen Traditionsbeständen, lokalen<br />
Mythen entsteht eine Integrationsideologie mit hoher Mobilisierungsfähigkeit;<br />
sie vermittelt kollektive Identität, suggeriert ein gemeinschaftliches<br />
Schicksal auf der Basis vermeintlicher gemeinsamer Herkunft, fordert<br />
sprachlich-kulturelle Homogenität (103).<br />
Loewenstein, dem es um eine andere Art von Geschichte im Sinne einer<br />
„Vergegenwärtigung vergangener Chancen“ (52) geht, betrachtet Xenopho-<br />
3 Wir und die anderen, 57–74, 59<br />
365
366<br />
Neue Literatur<br />
bie und Xenophilie als biologisch vorgegebene Möglichkeiten, nicht als<br />
zwangsläufige Determinanten.<br />
Ein besonderes Augenmerk gilt dem patriotischen Diskurs, 4 der sich seit<br />
dem späten 18. Jahrhundert herausbildet. Die josephinischen Reformen,<br />
also die Erschaffung eines Wohlfahrts-, Macht- und Erziehungsstaates, der<br />
Vernunft und Nutzen als einzige Maximen anerkennen soll und in dessen<br />
Kontext auch das Sprachedikt von 1784 zu sehen ist, motiviert aus der<br />
Überzeugung, Vielsprachigkeit als etwas Überkommenes, als Hindernis<br />
gesellschaftlicher Entwicklung zu verstehen, 5 rufen partikulare landespatriotische<br />
Interessen auf den Plan, die in eine Reihe von Initiativen der Aristokratie<br />
münden: die Landesgewerbeausstellung im Clementinum 1791,<br />
die Mitwirkung des landespatriotischen Adels bei der Königlich böhmischen<br />
Gesellschaft der Wissenschaften, der Gründung diverser Institutionen<br />
wie dem Prager Polytechnikum (1806), dem Verein patriotischer Kunstfreunde<br />
(1806), dem Prager Konservatorium (1811), der Böhmischen Sparkassa<br />
(1825), dem Verein zur Ermunterung des Gewerbegeistes (1833),<br />
dem Vaterländischen Museumsverein (1818). Allerdings zeigte sich bald<br />
eine nur geringe Reichweite dieser Initiativen, die sich in „dieser krisenhaften<br />
Zeit als letztlich nicht attraktiv genug für die in Bewegung geratenen<br />
mittleren und unteren Bevölkerungsschichten“ (181) erwiesen. Der Patriotismusdiskurs<br />
in Mitteleuropa blieb – anders als in England – folgenlos<br />
(145). Eine Spaltung der böhmischen Gesellschaft entlang emotionalisierter<br />
Sprachgrenzen ist somit das Ergebnis, allerdings eben nicht als ein zwangsläufiges:<br />
Jede geschichtliche, jede geistige Bewegung ist die Resultante vieler Faktoren und muß aus<br />
ihren Bedingungen, allerdings auch in ihrer Kontingenz, ihrer Nicht-Selbstverständlichkeit,<br />
gedeutet werden. (156)<br />
Der zweite thematische Block, der hier ausführlicher gewürdigt werden soll,<br />
betreibt Mythendestruktion. Widerlegt wird die Legende vom ausgeprägten<br />
tschechischen Demokratismus, vom fehlenden Antisemitismus und von der<br />
Unmöglichkeit von Antisemitismus in marxistisch geprägten Gesellschaften.<br />
Bezogen auf die Nationalkultur ergibt sich das Problem von Kultur als Widerspiegelung<br />
gesellschaftlicher Wirklichkeit. In der tschechischen Gesellschaft<br />
kam der ‚Kultur‘ angesichts des Desiderats hochkultureller Muster<br />
und Produkte eher eine kompensatorische Funktion zu, was sich insbesondere<br />
in Idee und Umsetzung eines Nationaltheaters dokumentieren sollte. In<br />
4 Von den ‚patriotischen Tugenden‘ zum Kult des Volkes. Der Patriotismus<br />
zwischen Aufklärung und Frühromantik, 135–156, 141.<br />
5 Bernard Bolzano: Patriotismus – ein offenes Projekt, 173–182, 175.<br />
Neue Literatur<br />
Zeiten politischer Ohnmacht wird eine kulturelle Gegenwelt benötigt, die<br />
ihr Vorbild in Deutschland und der deutschen Kultur fand, von der man sich<br />
ja gerade abgrenzen wollte. Darin erkennt Loewenstein die grundlegende<br />
Ambivalenz des Nationalismus, einmal als „Werkzeug potentieller Egalisierung,<br />
Solidarisierung und Aktivierung“, dann als „Ausdruck einer Sakralisierung<br />
des Vaterlands und der Nation, also einer Rücknahme des modernen,<br />
säkularen Individualismus zugunsten des geheiligten Ganzen,“ 6 und<br />
damit einer Abwehr der kosmopolitischen Moderne. Loewenstein erkennt<br />
gar eine gebrochene Beziehung der tschechischen Nationalkultur zur bürgerlichen<br />
Lebensform (222). Zwar kommt es in der nachrevolutionären Ära<br />
Bach zu Versuchen, „die zentralisierende und entpolitisierende Wirkung<br />
wirtschaftlicher und persönlicher Freizügigkeit in Kombination mit fester<br />
staatlicher Autorität“ als ein „quasi-bonapartistisches Herrschaftsinstrument“<br />
7 einzusetzen und somit durch eine Reduktion des Staatsgedankens<br />
eine Entfremdung der Völker vom Staat zu verhindern, ab den 1860ern wird<br />
dieser Prozess jedoch durch eine zunehmende Verbreitung der nationalen<br />
Agitation unterminiert, auch wenn es sich dabei um keine zwangsläufige<br />
Entwicklung handelt, wie die vorhandene historische „Chance einer attraktiven<br />
Reichsidee“ belegt, „die den zentrifugalen nationalen Integrationsbewegungen<br />
mehr als bürokratisch-polizeiliche Penetration, nämlich Identifikation,<br />
Partizipation, Aufstieg, Schutz, Gerechtigkeit geboten und<br />
Hoffnungen geweckt hätte.“ (200) In diesem Kontext problematisiert Loewenstein<br />
den unterstellten Zusammenhang zwischen Modernisierung bzw.<br />
Industrialisierung und Sprachnationalismus:<br />
Nicht in erster Linie nüchterne Unternehmer- und Marktinteressen, sondern ‚kulturnationale‘<br />
Kommunikation durch Schule, Universität, Bücher, Zeitschriften, Kongresse, Vereine standen<br />
vor 1848 im Vordergrund [...]. (195)<br />
Loewenstein konstatiert eine Dominanz der ideologischen Orientierung bestimmter<br />
Elitegruppen, keinen zwingenden Zusammenhang mit Prozessen<br />
der Modernisierung. Interessant erscheint hier der Hinweis auf Thuns Konzept<br />
einer Trennung in sprachnationale und sachpolitische Bereiche (196),<br />
ähnlich auch von Klácel vertreten. Aber letztlich steht im Ergebnis doch die<br />
Chancenlosigkeit des bilingualen Landespatriotismus gegenüber dem ansteigenden<br />
intransigenten Sprachnationalismus (201).<br />
6 Theatralik, Historismus, bürgerliche Repräsentation. Aspekte der tschechischen<br />
Kultur im 19. Jahrhundert, 203–223, 209.<br />
7 Bürgerliche Bewegung und nationaler Orientierung um die Jahrhundertmitte.<br />
Einige Überlegungen, 183–201, 191.<br />
367
368<br />
Neue Literatur<br />
Dem Diktum Prečans, der Loewenstein im Nachwort als einen grenzüberschreitenden<br />
Vermittler – zwischen den Disziplinen und zwischen den Kulturen,<br />
insbesondere Deutschen und Tschechen – charakterisiert und der dabei<br />
immer eine europäische Dimension berücksichtigt, ist angesichts der<br />
intellektuellen Qualität und Tiefe der Loewensteinschen Essays nichts weiter<br />
hinzuzufügen.<br />
Steffen Höhne<br />
Fritz MAUTHNER: Der neue Ahasver. Ein Roman aus Jung-Berlin. Hrsg.<br />
und mit einem Nachwort von Ludger Lütkehaus. Berlin, Wien (Philo) 2001,<br />
387 S.<br />
Das Werk des in Prag aufgewachsenen deutsch-jüdischen Journalisten,<br />
Schriftstellers und Sprachphilosophen Fritz Mauthner (1849–1923) findet in<br />
den letzten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit. Dies dokumentiert sich etwa<br />
in Publikationen wie LEINFELLNER & SCHLEICHERT (1995) oder<br />
HENNE & KAISER (2000), des weiteren in der Neuherausgabe seiner<br />
wichtigsten philosophischen Werke im Rahmen der Wiener Mauthner-<br />
Ausgabe (1997ff.). Auch die Neuherausgabe des 1881 als Fortsetzungsroman<br />
und 1882 in Buchform veröffentlichten Romans Der neue Ahasver ist<br />
im Rahmen dieser ‚Mauthner-Renaissance‘ zu sehen.<br />
Das Thema dieses Romans ist die Auseinandersetzung mit antisemitischen<br />
Tendenzen, die seit den ausgehenden 70er Jahren des 19. Jahrhunderts im<br />
Deutschen Reich an Boden gewannen, auch in Intellektuellen-Kreisen. 1<br />
Mauthner legt seine ‚anti-antisemitische‘ Haltung bereits im – Theodor<br />
Mommsen zugedachten – Vorwort dar (5–8).<br />
Der Inhalt des autobiographisch geprägten Romans sei hier kurz referiert:<br />
Der Protagonist Heinrich Wolf, aus Böhmen stammender Jude, lässt sich<br />
nach seinem Medizinstudium in Berlin als Arzt nieder. Seiner jüdischen<br />
Herkunft und dem jüdischen Glauben entfremdet und dem Deutschen Reich<br />
zugewandt, gelingt es ihm, in der Gesellschaft Berlins Fuß zu fassen. Er<br />
verkehrt in adligen Kreisen und verliebt sich in Clemence von Auenheim.<br />
Sein Wunsch, Clemence zu heiraten, wird bewilligt, doch muss Heinrich<br />
zwei Bedingungen erfüllen: Er soll sich für ein Jahr von Clemence trennen,<br />
und er soll zum Christentum konvertieren. Die Trennungszeit verbringt<br />
Heinrich in Afrika. Bei seiner Rückkehr nach Berlin muss er schockiert<br />
1 Zu den historischen Hintergründen vgl. VIERHUFE (2000: 147–149).<br />
Neue Literatur<br />
feststellen, dass sich im Deutschen Reich eine massiv antisemitische Stimmung<br />
breit gemacht hat und die ‚Judenfrage‘ zur Tagesfrage geworden ist.<br />
Unter diesen Umständen wird es Heinrich unmöglich, zum Christentum<br />
überzutreten:<br />
Mein Gefühl verbietet mir in diesem Augenblicke, um Einlaß ins Christentum zu bitten. Alle<br />
Gründe sind ohnmächtig gegen dieses Gefühl. Wenn es nur das kleine Rudel wahnsinniger<br />
Friedensstörer wäre, welches die alte Schmach der christlichen Völker erneuert, wenn das<br />
deutsche Volk sich so wie Du verächtlich oder auch nur lachend abwenden würde, glaube mir,<br />
mein Victor, auch ich hätte Mannesmut genug, unbeirrt meinen Weg zu schreiten. Aber so ...<br />
(333)<br />
Dieser Verzicht auf Konversion ist um so tragischer, als Heinrich sich als<br />
Christ empfindet:<br />
Ich bin ein Christ, seitdem ich denken kann, und früher sollte doch niemand für sein Leben<br />
verantwortlich gemacht werden. Ich bin ein Christ, wenn schon ein Wort aussprechen soll, was<br />
besser unausgesprochen bliebe. Und gerade darum, weil ich der großen Christenheit durch freie<br />
Wahl angehöre mit jedem Zuckern meiner Wimpern, gerade darum fühle ich doppelt die Qual,<br />
sagen zu müssen: Ich kann in diesen Zeiten den äußeren Übertritt zum Christentum nicht vollziehen.<br />
Wäre ich Jude, ein Jude noch dazu, wie er jetzt von unberufenen Fingern an alle Wände<br />
gemalt wird, so würde ich mich weigern, aber ich wäre mit ganzer Seele auf Seiten des Judentums,<br />
wäre einig mit mir selbst. So aber muß ich eine Tat unterlassen, nach der ich mich sehne,<br />
wahrhaftig wie nach Erlösung! (328)<br />
Die Handlung des Romans mündet in eine Katastrophe: Bei antisemitischen<br />
Ausschreitungen wird Clemence getötet. Heinrich duelliert sich mit seinem<br />
Widersacher, dem Intriganten Kurt von Egge, und kommt dabei zu Tode.<br />
Schon diese kurze Inhaltswiedergabe lässt erkennen, dass der Roman<br />
durchaus triviale Züge besitzt. Vierhufe (2000: 146) spricht von einer „tragischen,<br />
wenn auch in gängigen Klischees der Unterhaltungsliteratur dargebotenen<br />
Handlung.“ Auch Ludger Lütkehaus gelangt in seinem Nachwort<br />
zum Roman zu einer kritischen Einschätzung:<br />
Die gesellschaftlichen Typen aus Adel, Bürgertum und Unterschicht sind mehr oder minder<br />
klischiert, die Charaktere, vor allem die weiblichen, nur schwach konturiert, Gut und Böse auf<br />
das Erkennbarste einander entgegengestellt. (377)<br />
Zudem weist Lütkehaus mit Recht auf bedenkliche antislawische und antinegroide<br />
Elemente in Mauthners Roman hin (380).<br />
Mauthners Hang zur grotesken Übertreibung, der sich auch in anderen seiner<br />
Romane zeigt, verleiht gerade dem Ahasver-Roman eine beklemmendprophetische<br />
Dimension: Einem heutigen Leser dürfte es kaum möglich<br />
sein, die von Mauthner grell überzeichneten, ad absurdum getriebenen antisemitischen<br />
Hetzreden zu rezipieren, ohne dabei an die an den Juden verübten<br />
nationalsozialistischen Verbrechen zu denken. In diesem Sinne äußert<br />
sich auch Vierhufe (2000: 159):<br />
369
370<br />
Neue Literatur<br />
Die ästhetische, poetische Form des Romans mag mißlungen sein. Die parodistische, vor allem<br />
die satirische Darstellung der Entstehung des politischen, rassistisch argumentierenden Antisemitismus<br />
im Deutschland des späten 19. Jahrhunderts zeigt jedoch Mauthners Fähigkeit,<br />
politische Phänomene zu analysieren und zu deuten.<br />
Natürlich berücksichtigt auch Lütkehaus in seinem Nachwort diesen<br />
Aspekt, doch neigt er hier bei einigen Passagen des Romans zur Überinterpretation.<br />
Wenn etwa der reiche Kaufmann Bumcke eine antisemitische<br />
Versammlung finanziell fördert und auf dieses ‚Verdienst‘ aufmerksam<br />
macht mit den Worten: „Wer zahlt den Gas! (Rufe: ‚Das Gas heißt es,<br />
Bumcke!‘) Einerlei, den Gas oder das Gas! Wer’s zahlt, ist Bumcke!“ (344),<br />
so ist dies nach Lütkehaus eines der „atemverschlagenden Details“, die dem<br />
Roman „seinen abgründig-prophetischen Charakter“ verleihen (382). Hier<br />
aber eine auch noch so leise Andeutung oder Vorwegnahme von Gaskammern<br />
zu vermuten, ist schlicht verfehlt. Inhaltlich gesehen geht es hier lediglich<br />
um die ‚Energieversorgung‘ der Versammlung, stilistisch gesehen<br />
manifestiert sich hier die von Mauthner häufiger praktizierte Technik, Figuren<br />
durch sprachliche Fehler bzw. Besonderheiten zu charakterisieren, vgl.<br />
etwa auch die fehlerhafte Wiedergabe von Fremdwörtern durch den jüdischen<br />
Schneider Oswald Fränkel (150, 152, 311 u.ö.) (vgl. VIERHUFE<br />
2000: 151f.); zudem greift Mauthner hier – gewissermaßen in verschiedenen<br />
Variationen – die Fremdwortthematik auf, die dann vor allem im Kapitel<br />
XVII, beim Vergleich der Juden mit Fremdwörtern, fruchtbar gemacht<br />
wird (306f., vgl. hierzu das Nachwort, 384f.). 2<br />
Lütkehaus versucht den Roman partiell gegen die zeitgenössische Kritik in<br />
Schutz zu nehmen. Dabei argumentiert er in teilweise irreführender Weise,<br />
insbesondere in seinen Ausführungen zu Eduard Engel. Lütkehaus verweist<br />
auf Mauthners (1910/11) Beschäftigung mit assimilierten Internationalismen<br />
im Deutschen (und anderen europäischen Sprachen):<br />
Mit kaum verhohlenem Hohn auf den Nationalpurismus, wie ihn etwa der ‚Entwelscher‘ Eduard<br />
Engel vertrat [...] werden hier [...] alle ‚Urigkeiten‘ zumal arischer, aber auch dogmatischorthodoxer<br />
Provenienz einem sprachkritischen Exerzitium in Internationalismus unterzogen<br />
(385) 3<br />
2 Zum Fremdwort Gas – einem Lieblingsbeispiel Mauthners – vgl. auch<br />
MAUTHNER (1923/II: 265f., III: 135). Wiederholt wird das Beispiel auch in<br />
MAUTHNER (1910/11) verwendet; vgl. v.a. die Stichwörter ‚Geist I.‘ (375f.)<br />
und ‚Einfluß‘ (236); ferner etwa Seite 380 u. 623.<br />
3 ‚Entwelscher‘ spielt hierbei auf den Titel von Engels ‚Verdeutschungswörterbuch‘<br />
(ENGEL 1918) an sowie allgemein auf sein Eintreten gegen Fremdwörter,<br />
wie es etwa auch in seiner Stillehre (ENGEL 1914) zum Ausdruck<br />
kommt.<br />
Neue Literatur<br />
Diese Haltung konstatiert Lütkehaus (384) auch für den Ahasver-Roman,<br />
vor allem für das Kapitel XVII, in welchem die Juden mit Fremdwörtern<br />
verglichen werden. Es handle sich hierbei um die Formulierung eines Programms,<br />
das dem „xenophoben Sprachpurismus jede Geschäftsgrundlage<br />
entzieht – das Programm des assimilierten Sprachkritikers Mauthner“ (385).<br />
Angesichts dieser antipuristischen Haltung Mauthners erscheint es denn<br />
natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass der Roman von „dem<br />
Sprachpuristen und ‚Entwelscher‘ Eduard Engel [...] mit einem Verriß“ bedacht<br />
wird (378) (vgl. ENGEL 1882).<br />
Hier wird allerdings eine Konfliktsituation konstruiert, die es so nie gegeben<br />
hat. Tatsächlich stehen Mauthner und Engel (der im übrigen ebenfalls<br />
jüdischer Abstammung war) 4 sich in ihren Auffassungen zur Fremdwortfrage<br />
viel näher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Zwar unterscheiden<br />
sich Engels und Mauthners Ansichten diametral, wenn es um die Einschätzung<br />
der Wichtigkeit der ‚Fremdwortfrage‘ geht:<br />
Für das kostbarste Seelengut eine Volkes, für die Sprache, aus der alles tiefste Geistesleben<br />
sprießt, gibt es keine größere Gefahr als das Massengewelsch, wie es in Deutschland seit dem<br />
Jahrhundert der nachäffenden Humanisterei bis auf diesen Tag getrieben wird. (ENGEL<br />
1914:286)<br />
Dagegen Mauthner (1920: 17)<br />
Ich glaube: die Zeiten sind vorüber, in denen die Sprachreinigung eine Lebensfrage des deutschen<br />
Volkes war.<br />
Aber im Hinblick auf die Bewertung älterer Lehnwörter und neuerer, modischer<br />
Übernahmen aus fremden Sprachen stehen sie sich in ihren Auffassungen<br />
sehr nahe:<br />
Die Aneignung fremder Wörter und Begriffe ist in der Geschichte jeder Sprache nachzuweisen.<br />
[...] Niemand sieht oder hört es mehr, daß ‚Kirche‘ ursprünglich ein griechisches Wort war,<br />
‚Kreuz‘ ein lateinisches. Dem Irdischen ging es nicht anders als dem Überirdischen; hundert<br />
Küchenausdrücke sind ebenfalls bis zur Unkenntlichkeit eingedeutscht worden: Kohl, Radieschen<br />
usw. Dazu kamen freilich auch lächerliche Modeausdrücke, gegen welche dem Deutschen<br />
Sprachverein ein eiserner Besen zu wünschen wäre. (MAUTHNER 1920:16)<br />
Aus fremden Sprachschätzen entlehnt hat das Deutsche, wie alle neueren Sprachen, seit unvordenklichen<br />
Zeiten. [...] Aus dem griechischen Kyriaké wurde mit der Zeit Kirche, aus coróna<br />
Krone [...] L e h n w ö r t e r heißen diese durch gewaltsame Umbildung völlig eingebürgerten<br />
Fremdlinge [...] Nie hat ein vernünftiger Freund der deutschen Sprache und ihrer Reinheit<br />
gegen diese Lehnwörter etwas eingewandt [...] Lehnwörter sind eine unentbehrliche Bereicherung<br />
unsrer Sprache, und wären die neueren Fremdwörter von gleicher oder ähnlicher Art, so<br />
gäbe es überhaupt keine Fremdwörterfrage. (ENGEL 1914:167)<br />
4 Hierzu und zu einer differenzierteren Bewertung von Engel und seinem Werk<br />
vgl. ICKLER (1988), SAUTER (2000) und STIRNEMANN (2003).<br />
371
372<br />
Neue Literatur<br />
Tatsächlich ist es auch keineswegs der Fremdwortpassus im Ahasver-<br />
Roman, der Engels Widerspruch erregt. Im Gegenteil: Gerade diese Stelle<br />
wird von Engel (1882: 239) ausdrücklich als eine der wenigen gelungenen<br />
hervorgehoben! Trotz seiner ästhetischen Mängel ist Mauthners Roman aus<br />
mehreren Gründen lesenswert. Mauthner (1918: 52f.) schildert eindrücklich<br />
sein Gefühl, nirgends verwurzelt zu sein:<br />
Wie ich keine rechte Muttersprache besaß als Jude in einem zweisprachigen Lande, so hatte ich<br />
auch keine Mutterreligion, als Sohn einer völlig konfessionslosen Judenfamilie.<br />
Eben dieses Gefühl wird auch im Ahasver-Roman sehr detailliert dargestellt<br />
(vgl. auch VIERHUFE 2000: 149–153). Darüber hinaus besitzt Mauthners<br />
Roman eine deutliche autobiographische Prägung. Sie zeigt sich etwa in den<br />
starken biographischen Parallelen zwischen dem Protagonisten Wolf und<br />
Mauthner (vgl. VIERHUFE 2000: 149), aber auch etwa im Kapitel XIII, das<br />
die Arbeit in einer Redaktion am Tag des Bekanntwerdens der Katastrophe<br />
des Panzerschiffs „Großer Kurfürst“ und des Attentats auf den Kaiser Wilhelm<br />
I. (d.h. am 2.6.1878) schildert. Dieser Schilderung liegen offenkundig<br />
eigene Erlebnisse Mauthners zugrunde (vgl. MAUTHNER 1919: 360f.).<br />
Aus biographischer Sicht interessant ist der Ahasver-Roman auch deshalb,<br />
weil er gewissermaßen eine Ergänzung zu Mauthners Erinnerungen darstellt,<br />
in denen seine Berliner Jahre nicht mehr behandelt werden. Zudem<br />
tauchen typische Themen Mauthners immer wieder auf, so etwa Reflexionen<br />
über die Sprache oder auch über deutsch-tschechische Beziehungen.<br />
Die Textfassung des Romans macht leider keinen sehr ausgereiften Eindruck;<br />
bedauerlicherweise finden sich zahlreiche Druckfehler. Hier nur eine<br />
kleine Blütenlese: „Ich werden noch eine kurze Zeit leiden“ (136); „ein<br />
Schwiegersohn mit einer bürgerliche Tätigkeit“ (137); „ein Welt von Abenteuern“<br />
(142); „nehme auch ich vielleicht Dienste in der Türke“ (336). 5<br />
Leider blieb auch Lütkehaus’ Nachwort nicht vom Druckfehlerteufel verschont,<br />
wobei zwei Fehler besonders unangenehm auffallen:<br />
Fritz Mauthner wurde in ‚Hořice‘ geboren oder – bei deutscher Schreibung<br />
– in ‚Horzitz‘ (vgl. MAUTHNER 1918: 12f.) oder – wie es manchmal auch<br />
heißt – in ‚Horitz‘ (vgl. etwa KILLY 1990: 20), keinesfalls aber in „Horzotz“<br />
(375). In seinem sprachphilosophischen Werk, insbesondere in seinem<br />
Wörterbuch der Philosophie, beschäftigt sich Mauthner intensiv mit Lehnübersetzungen,<br />
nicht aber mit „Lehrübersetzungen“ (385).<br />
5 Interessanterweise kommen diese Fehler auch in der elektronischen Fassung des<br />
Ahasver-Romans des Projekts Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/mauthner/ahasver/ahasver.htm)<br />
vor.<br />
Neue Literatur<br />
Trotz der kleineren ‚Schönheitsfehler‘ darf konstatiert werden, dass die<br />
Herausgabe dieses Romans eine verdienstvolle Tat für die Mauthner-<br />
Forschung darstellt. Wertvoll ist auch die dem Nachwort angehängte Bibliographie.<br />
6<br />
Literatur<br />
ENGEL, Eduard (1882): Fritz Mauthner: ‚Der neue Ahasver‘. – In: Das<br />
Magazin für Litteratur. 51. Jg., Nr. 18, 237–240.<br />
ENGEL, Eduard (1914): Deutsche Stilkunst. 22.-24. Aufl. Wien, Leipzig:<br />
Tempsy & Freytag.<br />
ENGEL, Eduard (1918): Entwelschung. Verdeutschungswörterbuch für<br />
Amt, Schule, Haus und Leben. Leipzig: Hesse & Becker.<br />
HENNE, Helmut/KAISER, Christine (Hg.) (2000): Fritz Mauthner – Sprache,<br />
Literatur, Kritik. Tübingen: Niemeyer.<br />
ICKLER, Theodor (1988): Arthur Schopenhauer als Meister und Muster in<br />
Eduard Engels ‚Deutscher Stilkunst‘. – In: Muttersprache 4. Bd. 98, 297–<br />
313.<br />
KILLY, Walther (Hg.) (1990): Literatur Lexikon Bd. 8. Gütersloh, München:<br />
Bertelsmann.<br />
LEINFELLNER, Elisabeth/SCHLEICHERT, Hubert (Hg.) (1995): Fritz<br />
Mauthner. Das Werk eines kritischen Denkers. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.<br />
MAUTHNER, Fritz (1910/11): Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge<br />
zu einer Kritik der Sprache. 2. Bände. München, Leipzig: G. Müller.<br />
MAUTHNER, Fritz (1918): Erinnerungen I. Prager Jugendjahre. München:<br />
Georg Müller.<br />
MAUTHNER, Fritz (1919): Ausgewählte Schriften. Bd. 1. Stuttgart, Berlin:<br />
DVA.<br />
MAUTHNER, Fritz (1920): Muttersprache und Vaterland. Leipzig: Dürr &<br />
Weber.<br />
MAUTHNER, Fritz (1923): Beiträge zu einer Kritik der Sprache. 3 Bände.<br />
3. Aufl. Leipzig: Meiner.<br />
6 Vgl. aber auch die ausführliche Bibliographie in VIERHUFE (2000: 160f.).<br />
373
374<br />
Neue Literatur<br />
MAUTHNER, Fritz (1923/24): Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge<br />
zu einer Kritik der Sprache 3. Bände. 2. vermehrte Auflage. Leipzig: Meiner.<br />
SAUTER, Anke (2000): Eduard Engel. Literaturhistoriker, Stillehrer,<br />
Sprachreiniger. Bamberg: Collibri.<br />
STIRNEMANN, Stefan (2003): Das gestohlene Buch. Eduard Engels<br />
‚Deutsche Stilkunst‘ und Ludwig Reiners. – In: Schweizer Monatshefte 83.<br />
Jg., Heft 8/9, 50–52.<br />
VIERHUFE, Almut (2000): Politische Satire? Fritz Mauthners Roman ‚Der<br />
neue Ahasver‘ und der Berliner Antisemitismusstreit. – In: H. Henne, Ch.<br />
Kaiser (Hg.): Fritz Mauthner – Sprache, Literatur, Kritik. Tübingen: Niemeyer,<br />
145–161.<br />
Karsten Rinas<br />
Stefan Michael NEWERKLA: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch.<br />
Frankfurt/Main (Peter Lang) <strong>2004</strong>, 780 Seiten.<br />
In der Einleitung zu seinem Buch Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch –<br />
Slowakisch weist Newerkla auf die lange Tradition in der Reflektion der<br />
deutschen Elemente im Tschechischen hin, die bis auf Jan Hus’ spontane<br />
Deutung in Výklad viery... (Auslegung des Glaubensbekentnisses...) bzw.<br />
auf Dobrovskýs Überlegungen zurückgehen, und vermisst eine Monographie,<br />
die auf den deutsch-tschechischen Sprachkontakt umfassend eingehen<br />
würde. Auch sein Buch, in dem viele wichtige Hinweise auf einzelne Themen<br />
in erster Linie des deutsch-tschechischen, weniger des deutschslowakischen<br />
Sprachkontakts enthalten sind, schließt diese Lücke nicht<br />
schon allein deswegen, da im Zentrum seines Buches der Wortschatz, genauer<br />
gesagt, die ca. 3 500 wichtigsten deutschen Lehnwörter im Tschechischen<br />
und Slowakischen (mit 15 000 Wortformen) stehen, während die anderen<br />
Entlehnungen, einschließlich der semantischen, im einführenden Teil<br />
nur in Auswahl erwähnt werden und mit Hinweis zur ausgewählten weiterführenden<br />
Literatur versehen sind. Dabei wäre gerade im Hinblick auf die<br />
Behandlung der Lexik die Fragestellung nach der Bedeutungsstruktur von<br />
polysemen Lexemen (Parallelen in der Metaphorik und den Wortfeldern<br />
sowie in der Wortbildung) als Resultat des Sprachkontaktes von besonderem<br />
Interesse, wie dies etwa in Martin Sandhops Buch Von Abend bis Zunge:<br />
Lexikalische Semantik des Deutschen, Tschechischen, Englischen und<br />
Französischen im Vergleich (2003) deutlich wird. Ähnliches gilt von der<br />
Phraseologie.<br />
Neue Literatur<br />
Die Terminologie der Beschreibung der deutschen Lehnwörter und deren<br />
Adaptation im tschechischen und slowakischen Wortschatz wird im allgemeinen<br />
Hauptteil (17–98) aufbereitet, die Zusammenstellung der deutschen<br />
Lehnwörter und ihrer Wortformen im Tschechischen und Slowakischen, die<br />
nicht vollständig ist und kaum vollständig sein kann, sowie eine einfache<br />
semantisch-etymologische Deutung einschließlich der Hinweise zum Erstbeleg<br />
und zur Quellenliteratur werden im speziellen Hauptteil (99–612)<br />
vorgenommen, der den beeindruckend umfangreichen Kern des verdienstvollen<br />
Wörterbuches bildet. So enthält jeder Eintrag des „eigentlichen Materialteils“<br />
– so Newerkla – die Angabe von Grundform, Bedeutung<br />
(manchmal mit übertragenen Bedeutungen, manchmal nicht, vgl. etwa šoupat<br />
vs. šukat), Herkunft, Variation, Parallelen in anderen – vornehmlich<br />
westslavischen – Sprachen, Erstbelegen, Quellen-, gegebenenfalls auch<br />
ausgewählter Sekundärliteratur. Einer guten und schnellen Orientierung in<br />
der vorliegenden Arbeit, die in sich ein auf deutsch-tschechischen Sprachkontakt<br />
spezialisiertes etymologisches Wörterbuch darstellt, dienen ein Abkürzungsverzeichnis,<br />
ein Siglenverzeichnis der Quellen, ein ausführliches<br />
Literaturverzeichnis und ein Autoren- sowie jeweils ein Wortregister für das<br />
Tschechische und für das Slowakische (613–780).<br />
Im allgemeinen Hauptteil geht Newerkla etwa auf die Frage der Klassifikation<br />
von Entlehnungen, der Adaptation in der Lautung, Morpho(no)logie,<br />
Wortbildung und Semantik sowie auf Richtung und Zeitpunkt kultureller<br />
Strömungen ein, die sich in den Entlehnungen spiegeln und die seine Ausführungen<br />
zum Wortschatz vorbereiten. Zu betonen ist hier v.a. die in Anlehnung<br />
auf Bellmann vorgenommene Unterscheidung von Lehnwörtern<br />
des Typs A, die bisher unbekannte Gegenstände und Kategorien bezeichnen<br />
(Kulturlehnwörter) und die die besten Chancen auf volle Integration ins<br />
Tschechische oder Slowakische haben, und denen des Typs B, die als Alternativen<br />
zum tschechischen und slowakischen Wortgut verstanden werden<br />
können und das Tschechische und Slowakische semantisch, vor allem aber<br />
stilistisch bereichern. Durch die sonst sinnvolle Unterscheidung von „Geber-“<br />
und „Ursprungssprache“ (33), durch die der Autor die für seine Fragestelltung<br />
in Frage kommende Unterscheidung „echte“ und „unechte Germanismen“<br />
ablöst, wird jedoch in Newerklas Wörterbuch, das sich als „ein<br />
vollständiges etymologisches Wörterbuch“ (32) versteht, das Konzept der<br />
mehrfachen Etymologie und die Unterscheidung zwischen genetischer, primärhistorischer<br />
und historischer Quelle von Sekundärentlehnungen etwas<br />
verkürzt dargestellt.<br />
In ergänzenden Exkursen setzt er sich mit den in der Sekundärliteratur<br />
mehrmals angesprochenen Fragen phonologischer Sprachwandelprozesse<br />
und des Sprachkontakts, des andernorts wiederholt ausführlicher behandel-<br />
375
376<br />
Neue Literatur<br />
ten mitteleuropäischen Sprachbundes, der Verdrängung von Lehnwörtern<br />
(Sprachpurismus) sowie der Frage des Tschechischen als Vermittler von<br />
deutschen Lehnwörtern ins Polnische und Slowakische auseinander. Gerade<br />
diese Exkurse machen deutlich, dass im Zentrum von Newerklas Interesse<br />
eindeutig die Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch stehen. Das im Titel<br />
des Buches erwähnte Slowakische ist nicht direkt, sondern über den besonderen<br />
alphabetischen Register (zum Tschechischen und) zum Slowakischen<br />
erschließbar.<br />
Im „speziellen Hauptteil“ bzw. im „eigentlichen Materialteil“ unterscheidet<br />
Newerkla zwischen den „Entlehnungen“ und „vermeintlichen Entlehnungen“,<br />
im Rahmen der „Entlehnungen“ geht er zunächst chronologisch vor,<br />
d.h. es werden alphabetisch Entlehnungen aus dem Germanischen/Westgermanischen,<br />
dem Gotischen, dem frühen Althochdeutschen, dem Althochdeutschen,<br />
dem Altsächsischen, dem Mittelhochdeutschen, dem älteren<br />
Frühneuhochdeutschen, den oberdeutschen Dialekten (nach 1350), den mitteldeutschen<br />
Dialekten (nach 1350), dem Mittelniederdeutschen (bis 1650)<br />
bzw. Niederdeutschen, dem jüngeren Frühneuhochdeutschen, Neuhochdeutschen<br />
zusammengestellt. Innerhalb dieser Sektionen wird alphabetisch geordnet.<br />
Vor diesem Hintergrund erscheint die Erstellung des Wortregisters,<br />
das eine Orientierung quer durch genannte Sektionen überhaupt möglich<br />
macht, sehr vorteilhaft.<br />
Allein durch den Hinweis auf Newerklas Gliederung wird neben der Frage<br />
von Varietäten und diesbezüglichen Quellen, die nur partiell berücksichtigt<br />
wurden, auch das Problem angesprochen, wie das Material zu gliedern ist,<br />
das auf unterschiedlichen Wegen ins Tschechische und Slowakische gelangte.<br />
Im Hinblick darauf, dass Newerklas Perspektive vorrangig eine diachrone<br />
ist (vgl. etwa Angaben zum Erstbeleg im Tschechischen/Slowakischen,<br />
u.a.), ist aber seine Gliederung durchaus nachvollziehbar, auch wenn im<br />
Rahmen des „Neuhochdeutschen“ (417–518) „Entlehnungen vornehmlich<br />
österreichischer bzw. bairisch-österreichischer Herkunft“ (401–417) auffallend<br />
bescheiden ausfallen und die Frage der Varietäten noch einmal dringend<br />
vor Augen führen. Würden wir Newerklas Unterscheidung von Geber-<br />
und Urpsrungssprachen auf die Varietäten übertragen, entspricht die schwache<br />
Vertretung von „Entlehnungen vornehmlich österreichischer bzw. bairisch-österreichischer<br />
Herkunft“ kaum der Realität. Die schwache Vertretung<br />
von „Entlehnungen vornehmlich österreichischer bzw. bairischösterreichischer<br />
Herkunft“ hat dabei unterschiedliche Gründe. Einerseits<br />
fehlen hier manche Lexeme, andererseits werden sie unter Entlehnungen<br />
aus dem Neuhochdeutschen eingereiht, auch wenn diese von der Aussprache,<br />
der Form, der Frequenz und dem Umfang der Vorkommensweisen oder<br />
der Bedeutung doch eher dem Süddeutschen zuzuordnen sind bzw. über das<br />
Neue Literatur<br />
Süddeutsche gekommen sind: aušus, ešus; vuřt, frajle, hajzl, lajtnant, vikslajvant;<br />
hic, šprot, punc, kvinde, knop, jeminkote/jesuskote, pešunk, perkamt,<br />
piglovat, plenta, putyka; šuple; fusekle, grešle, grundle, kaprle, kapsle,<br />
koprle, kramle, mašle; fajn(ový); sesle, kajzrrok, prýglpatent, štrúdl,<br />
štrycle... Die süddeutsche Vermittlung müsste auch bei Entlehnungen wie<br />
kilo, minuta, lupa, perón... berücksichtigt werden.<br />
Newerklas Gliederung wirft außerdem auch die Frage auf, wo Entlehnungen<br />
zu platzieren und zu suchen sind, bei denen z.B. das Altbairische eine Rolle<br />
spielte, das etwa Šlosar im Zusammenhang mit dem lat. organa – abai. argana<br />
– tschech. varhana, varhany erwähnt. Newerkla löst diese Frage dadurch,<br />
dass er die altbairische Vermittlung von varhany gar nicht erwähnt<br />
und dieses unter Lehnwörter einreiht, „die vielmehr Entlehnungen aus dem<br />
Lateinischen bzw. den romanischen Sprachen sind“, auch wenn damit wohl<br />
kaum ernsthaft behauptet werden kann, dass diese nicht durch das sie bereits<br />
integrierende „Deutsche“ vermittelt bzw. dass diese nicht aus dem sie<br />
bereits integrierenden „Deutschen“ entlehnt wurden.<br />
Diese Bemerkungen mindern aber nicht die Bedeutung des rezensierten<br />
Wörterbuches deutsch-tschechischer (und -slowakischer) Lehnwörter, das<br />
auf den Arbeiten von J. Beneš, E. Eichler, B. Havránek, J. Janko, M. Jelínek,<br />
I. Němec, E. Rippl, V. Šmilauer, D. Šlosar, E. Skála, P. Trost u.a.m.<br />
sowie den verdienstvollen dialektologisch oder soziolinguistisch ausgerichteten<br />
Arbeiten von S. Kloferová, S. Utěšený, J. Ernst, J. van Leeuwen-<br />
Turnovcová u.a. aufbaut, sie konkretisiert und in beachtlicher Fülle erweitert.<br />
So bildet dieses Wörterbuch zweifellos eine wichtige Grundlage für<br />
weitere Forschung zum Sprach- und Kultukontakt im mitteleuropäischen<br />
Kontext nicht nur für Linguisten.<br />
377<br />
Marek Nekula<br />
Heinrich PLETICHA (Hg.): Piaristen und Gymnasiasten. Schülerleben im<br />
alten Prag. (Bibliotheca Bohemica Band 40) Prag, Furth (Vitalis) 2001, 102<br />
Seiten.<br />
Dieser Sammelband bietet Texte, in denen in Prag aufgewachsene Autoren<br />
über ihre dort verbrachte Schulzeit berichten. Er enthält einen kurzen Passus<br />
über das Piaristengymnasium aus Fritz Mauthners Erinnerungen (11–20) (=<br />
MAUTHNER 1918: 37–47), einen Auszug aus dem Kapitel „Die Piaristenschule“<br />
aus E.E. Kischs Abenteuern in Prag (21–25) (= KISCH 1968<br />
[1920]: 359–362), das Gedicht Erster Schultag von Franz Werfel (27–30)<br />
und als Hauptstück das 1888 verfasste humoristische ‚Schul-Epos‘ Die
378<br />
Neue Literatur<br />
Meyeriade von Oskar Kraus (31–84) nebst dem nachträglich von Kraus verfassten<br />
25. Gesang (91–99) sowie einigen Bemerkungen zur Meyeriade von<br />
Kisch (85–90) (= KISCH 1968 [1920]: 403–407). Informationen über die<br />
Texte und deren Autoren finden sich in Pletichas Vorwort (7–10) sowie in<br />
den biographischen Hinweisen (101f.).<br />
Der aus Nordböhmen stammende Historiker Heinrich Pleticha hat schon<br />
früher Arbeiten zur Geschichte der Pädagogik ‚aus der Schülerperspektive‘<br />
veröffentlicht. In seinem Jugendbuch Ihnen ging es auch nicht besser<br />
(PLETICHA 1965) lässt er in fiktiven, aber auf Quellenstudien basierenden<br />
Berichten Schüler aus vier Jahrzehnten über ihren Alltag berichten. Und in<br />
dem von ihm herausgegebenen Band Die Kinderwelt der Donaumonarchie<br />
(PLETICHA 1995) werden u.a. auch Schule und Erziehung im alten Österreich<br />
behandelt, v.a. im Beitrag von Winfried Böhm (1995). Des Weiteren<br />
findet sich in letzterem Werk ebenfalls ein Passus aus Fritz Mauthners Erinnerungen,<br />
in welchem dieser über den Tschechischunterricht berichtet<br />
(PLETICHA 1995: 127f. = MAUTHNER 1918: 128–130).<br />
Pletichas Vorwort zum Sammelband ist recht knapp gehalten. Wirklich informativ<br />
ist es lediglich im Hinblick auf die Meyeriade, ansonsten sind die<br />
Ausführungen teilweise oberflächlich. Dies gilt namentlich für die Bemerkungen<br />
zu Mauthners Bericht. Pleticha beschränkt sich auf die Feststellung,<br />
dass dieser „voll ätzender Schärfe [ist], geprägt wohl von der sozialen Stellung<br />
des ehemaligen Schülers und sicher etwas zu einseitig; denn sonst hätten<br />
wohl kaum so viele angesehene Familien ihre Kinder an die Piaristen-<br />
Schulen geschickt“ (8). Dies mag stimmen, doch vermisst man hier weitergehende<br />
Informationen darüber, warum Mauthners Bericht so scharf ausfällt.<br />
Hier ist zunächst einmal hervorzuheben, dass es sich gerade bei<br />
Mauthners Ausführungen keineswegs um beiläufig hingeschriebene Erinnerungsfragmente<br />
handelt. Vielmehr wird gerade die Schulzeit in Mauthners<br />
erstem Teil seiner Erinnerungen – weitere Teile sind nicht erschienen – in<br />
aller Ausführlichkeit behandelt, was Mauthner auch im Vorwort gewissermaßen<br />
programmatisch begründet:<br />
Eines aber sollte jeder, so gut er es versteht, niederschreiben und veröffentlichen: seine eigenen<br />
Schulerinnerungen. Denn die Schule hat seit mehr als hundert Jahren, eigentlich langsam schon<br />
seit dem Aufkommen der mittelalterlichen Gelehrtenschule, eine solche Macht gewonnen, eine<br />
Macht über die Entwicklung des jungen Menschen, daß das Schicksal des künftigen Geschlechtes<br />
in hohem Grade davon abhängig ist, ob wir taugliche oder untaugliche Schuleinrichtungen<br />
besitzen. (MAUTHNER 1918: 8)<br />
Bereits hier kommen Mauthners reformpädagogische Interessen zum Ausdruck,<br />
noch deutlicher aber in folgendem Passus:<br />
Gerade in den letzten Jahren konnte das jeder vernehmen, der seine Ohren nicht verschloß für<br />
die zu einer Anklage angewachsenen Klagen gegen die alte Schule. In den sehr lesenswerten<br />
Neue Literatur<br />
Beratungen über die Einrichtung einer einheitlichen Zukunftsschule, einer Neuschule, die die<br />
Kinder aus den Fesseln einer rückständigen Pädagogik befreien soll, hörte man immer wieder<br />
in fast tragischen Tönen ein Verdammungsurteil über die Schulzeit der jetzt führenden Lehrer<br />
und gewiß über die Schulnot just der begabtesten Knaben. [...] Es soll mir recht sein, wenn sich<br />
die jungen Lehrer auch auf mich alten Herrn werden berufen können. (MAUTHNER 1918: 10)<br />
Derlei Bekundungen stehen in Mauthners Werk keineswegs vereinzelt da.<br />
Vor allem der Artikel „Schule“ seines Wörterbuchs der Philosophie<br />
(MAUTHNER 1911: 388–398 bzw. MAUTHNER 1924: 151–164) stellt<br />
ein leidenschaftliches Pamphlet gegen das traditionelle Schulsystem dar, in<br />
welchem u.a. die schablonenhafte Gleichbehandlung aller Schüler – auch<br />
der besonders Begabten –, der militärische Drill, das sture Auswendiglernen<br />
ohne eigenständiges Denken und die Korruption an den Schulen kritisiert<br />
werden. Und gerade Mauthners Erinnerungen können als Exemplifizierung<br />
dieser Ausführungen gelesen werden. Meines Erachtens wäre es angebracht<br />
gewesen, in der Einleitung zum Sammelband auf diesen Hintergrund hinzuweisen.<br />
Das Thema Schule interessierte Mauthner aber nicht nur in reformpädagogischer<br />
Hinsicht. Vielmehr war es für ihn – wie für viele Deutschböhmen<br />
jener Zeit – auch ein nationales ‚Reizthema‘. Mauthner selbst spricht von<br />
der „Erbitterung, mit welcher in Böhmen noch gegenwärtig um Sprache und<br />
Schule gekämpft wird“ (MAUTHNER 1918: 126). Dass gerade die Schulfrage<br />
in den nationalen Konflikten zwischen Deutschen und Tschechen ein<br />
besonders heikles Thema war, ist auch in der modernen Geschichtsschreibung<br />
unumstritten (vgl. SEIBT 1993: 279f.). Mauthner hat dieses Thema<br />
auch in seinen – deutlich antitschechisch geprägten – ‚böhmischen Novellen‘<br />
Der letzte Deutsche von Blatna (1887) und Die böhmische Handschrift<br />
(1897) aufgegriffen.<br />
Die Schule als Gegenstand deutsch-tschechischer Konflikte wird von Pleticha<br />
nicht behandelt. Sowohl Pletichas Ausführungen als auch seine Textauswahl<br />
wirken diesbezüglich vielmehr stark ‚geglättet‘. So ist es durchaus bezeichnend,<br />
dass der zitierte Bericht Mauthners nicht – wie behauptet (101) – das<br />
ganze Kapitel V aus Mauthners Erinnerungen bietet, sondern dass vielmehr<br />
der Schluss-Passus fehlt, in welchem Mauthner gegen die tschechische Ausrichtung<br />
des Piaristen-Gymnasiums polemisiert (MAUTHNER 1918: 47f.).<br />
Der weggelassene Passus beginnt folgendermaßen:<br />
Die tschechische Gesinnung der Lehrer, die sich von Jahr zu Jahr offener und gehässiger äußern<br />
durfte, hatte nun wieder üble Folgen für die Behandlung der Schüler. (MAUTHNER<br />
1918: 47)<br />
Weiter heißt es:<br />
Schlimmer war es schon, daß diese geistlichen Herren [d.h. die Lehrer] für alle nationalen<br />
Unternehmungen der Anhänger von Johannes Hus die wärmsten Gefühle äußerten und zu<br />
379
380<br />
Neue Literatur<br />
wecken suchten; am schlimmsten aber, daß die Knaben aus den rein deutsch gebliebenen Zipfeln<br />
Böhmens für ihre Unkenntnis der tschechischen Sprache bei jeder Gelegenheit gehänselt<br />
und zurückgesetzt wurden. Eine theatralische Begeisterung für die Hussitenkriege in einem<br />
katholischen Klostergymnasium, da stimmte etwas nicht. (MAUTHNER 1918: 47f.)<br />
Auch die im Sammelband zitierten Erinnerungen Kischs brechen recht<br />
abrupt ab. Unter anderem fehlt folgender Abschnitt:<br />
Vor dem Schulgebäude fingen oft Tschechen mit uns Streit an, es waren Buben aus der<br />
Übungsschule der Lehrerbildungsanstalt von nebenan [...] Sie griffen uns nur an, weil das nationale<br />
Pflicht war, dabei hatten sie wahrscheinlich mehr Angst als meine Mitschüler. (KISCH<br />
1968 [1920]: 363)<br />
Es muss verwundern, dass dieser Aspekt in Pletichas Sammelband unberücksichtigt<br />
geblieben ist. Das Schülerleben im alten Prag beschränkte sich<br />
keineswegs auf das Aushecken von Streichen und den Umgang mit Lehrer-<br />
Originalen.<br />
Des Weiteren ist es bedauerlich, dass Pleticha nicht auf weiter führende<br />
Literatur verweist. Gerade der – von Pleticha selbst herausgegebene – Beitrag<br />
von Böhm (1995) wäre hier durchaus der Erwähnung wert gewesen.<br />
Dennoch ist die Herausgabe dieses Sammelbandes durchaus verdienstvoll.<br />
Namentlich die Wiederveröffentlichung der Meyeriade ist zu begrüßen,<br />
handelt es sich doch hierbei nicht nur um eine sehr vergnügliche, sondern<br />
auch kulturhistorisch reizvolle Lektüre.<br />
Literatur<br />
BÖHM, Winfried (1995): Kindergarten, Volksschule, Schulreform und<br />
pädagogische Ideen. – In: H. Pleticha (Hg.), Die Kinderwelt der Donaumonarchie.<br />
Wien: Ueberreuter, 129–151.<br />
KISCH, Egon Erwin (1968 [1920]): Die Abenteuer in Prag. – In: Ders.,<br />
Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. II, 1: Aus Prager Gassen und<br />
Nächten / Prager Kinder / Die Abenteuer in Prag. Hg. v. Bodo Uhse & Gisela<br />
Kisch. Berlin, Weimar: Aufbau, 323–582. [Erstveröffentlichung 1920]<br />
MAUTHNER, Fritz (1887): Der letzte Deutsche von Blatna. Erzählung aus<br />
Böhmen. Dresden, Leipzig: Minden.<br />
MAUTHNER, Fritz (1897): Die böhmische Handschrift. Roman. Paris,<br />
Leipzig, München: Langen.<br />
MAUTHNER, Fritz (1911): Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu<br />
einer Kritik der Sprache. 2. Band. München, Leipzig: G. Müller.<br />
Neue Literatur<br />
MAUTHNER, Fritz (1918): Erinnerungen I. Prager Jugendjahre. München:<br />
Georg Müller.<br />
MAUTHNER, Fritz (1924): Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu<br />
einer Kritik der Sprache 3. Band. 2. vermehrte Auflage. Leipzig: Meiner.<br />
PLETICHA, Heinrich (1965): Ihnen ging es auch nicht besser. Schule und<br />
Schüler in vier Jahrtausenden. Würzburg: Arena.<br />
PLETICHA, Heinrich (Hg.) (1995): Die Kinderwelt der Donaumonarchie.<br />
Wien: Ueberreuter.<br />
SEIBT, Ferdinand (1993): Deutschland und die Tschechen. München, Zürich:<br />
Piper.<br />
381<br />
Karsten Rinas<br />
Dieter WILDE: Der Aspekt des Politischen in der frühen Lyrik Hugo Sonnenscheins.<br />
Frankfurt/Main, Berlin (Lang) 2002, 322 Seiten.<br />
Dieter Wilde legt eine Publikation vor (zugleich Dissertation, Wien 2002),<br />
deren überzeugendste Stärke auf den ersten Blick sichtbar ist: Akribie, Präzision,<br />
höchste Zuverlässigkeit angegebener Fakten, die in unermüdlicher<br />
Recherche aller möglichen zugänglichen Quellen zusammengetragen wurden.<br />
Man ist feuilletonistisch versucht zu kommentieren, dass jeder polizeiliche<br />
Meldezettel, jeder beschlagnahmte Koffer Sonnenscheins, jeder Erinnerungsblitz<br />
der Zeitgenossen und Nachkommen, jede Briefzeile<br />
ausgewertet wurde (und wenn Wilde konstatiert, dass er zu diesem und jenem<br />
Umstand in Sonnenscheins Leben keine Belege gefunden hätte, dann<br />
kann man getrost davon ausgehen, dass es sie endgültig nicht gibt), so dass<br />
das Bild des südmährischen Rebellen-Dichters plastisch und zugleich historisch<br />
verankert und wissenschaftlich zuverlässig vor den Augen des Lesers<br />
entsteht. Die minuziöse Akribie ist gerade um Hugo Sonnenschein nötig,<br />
denn selten wurde in der böhmisch-mährischen Literaturgeschichte ein Dichter<br />
mit einem so dichten Netz an ideologisierten Spekulationen, überstürzten<br />
politischen Zuweisungen, an schlichtweg falschen und unsinnigen Darlegungen<br />
überzogen wie Sonnenschein. Wilde fasst in seiner Studie die vielen literaturgeschichtlichen<br />
Mythen um Sonnenschein zusammen (wobei die einflussreichsten<br />
wohl von Serke stammen) und korrigiert sie überzeugend.<br />
Ob diesem archivarischen Aufwand (häufig ist der Umfang der erklärenden<br />
und belegenden Fußnoten viel größer als der des Fließtextes, wobei die Studie<br />
aber an Leserlichkeit und Spannung nichts einbüßt) ist man allerdings<br />
geneigt ein Bedauern auszusprechen, dass Wilde nicht dem kompletten
382<br />
Neue Literatur<br />
Werk und Lebenslauf Sonnenscheins sich zugewendet hat, sondern dezidiert<br />
nur den frühen Phasen vor dem 1. Weltkrieg. 1 Hätte er das Ganze umfasst,<br />
wäre zwar bei seiner Arbeitsweise eine Studie von wohl tausendseitigem<br />
Umfang entstanden, andererseits wäre das Thema Sonnenschein für die<br />
Literaturgeschichte ein für allemal ‚abgehakt‘. Es bleibt zu hoffen, daß Wilde<br />
einen zweiten Teil nachliefert.<br />
Neben dem hohen heuristischen Wert der Arbeit ist deren methodischer<br />
Ansatz hoch zu schätzen. Gemeint sind nicht etwa die theoretischen Ausführungen<br />
über Kontextualität, den „New Historism und Cultural Materialism“<br />
im Einführungskapitel Theoretische Prämissen/ Begrifflichkeit (38ff),<br />
denn dieses Kapitel hätte sich der Autor getrost sparen können: Die – zwar<br />
sehr richtigen – Resultate der theoretischen Überlegungen (S. 54f) gehören<br />
nämlich zum literaturtheoretischen Allgemeingut, zur technischen Grundausrüstung<br />
(„Wellek hat’s auch schon gewußt“) und hätten auch ohne die<br />
vorangehenden Theorie-Fanfaren und -Paukenschläge formuliert werden<br />
können, 2 zumal nach der Parade so mancher moderner und postmoderner<br />
theoretischer Denkansätze in den folgenden, Sonnenscheins Werk gewidmeten<br />
Kapiteln sowieso der alte gute interpretatorische Eklektizismus, der<br />
Motivanalyse, hermeneutische Techniken und intertextuelle Ansätze auf<br />
dem Hintergrund der kulturgeschichtlichen Methode vereint, angewendet<br />
wird – denn so ist es ja am Sinnvollsten.<br />
Gemeint ist vielmehr der methodische Ansatz Wildes – der als solcher zwar<br />
nicht explizit benannt, dafür umso dezidierter praktisch ausgeführt wird –<br />
die deutschbömhische/ deutschmährische Literatur auf der Grundlage des<br />
territorialen Prinzips zu untersuchen, d.h. vereinfacht, sie im Kontext der<br />
parallel existierenden tschechischen Literatur zu behandeln. Denn obwohl<br />
es in der Geschichte der deutschböhmischen Literatur nur noch wenige<br />
Dichter gibt, die in den tschechischen literarischen und politischen Kontext<br />
so stark eingebunden wären wie Sonnenschein, ist die territoriale Methode<br />
(die sich über Sprachgrenzen und Grenzen nationaler Gruppierungen hinwegsetzt)<br />
allgemein die einzig sinnvolle für diesen national und ethnisch<br />
durchmischten Raum. Freilich fordert die Anwendung dieser Methode vom<br />
Forscher eine nicht alltägliche Ausrüstung: Sprachkompetenz in beiden<br />
Idiomen, tiefen Einblick in historische, kultur- und literaturhistorische Zusammenhänge,<br />
Spürsinn für Mentalitätseigenheiten. Von allen diesen Fertigkeiten<br />
macht Wilde souverän Gebrauch, die Einbindung des Sonnen-<br />
1 Allerdings weist Wilde häufig auch auf spätere Texte und weitere Lebensschicksale<br />
Sonnenscheins.<br />
2 Andererseits ist mir bewusst, daß die Textsorte Dissertation ein solches theoretisches<br />
Kapitel wohl verlangt.<br />
Neue Literatur<br />
scheinschen Werkes in den tschechischen literarischen Kontext seiner Zeit<br />
stellt die größte Leistung der Studie dar und weist womöglich weiteren Forschern<br />
den Weg: Der Einfluss Březinas, Bezručs, der ‚buřiči‘ und weiterer<br />
tschechischer Dichter fand in der bisherigen Erforschung der deutschböhmischen<br />
Literatur nur vereinzelt Erwähnung.<br />
Ob der gelungenen intertextuellen Vergleiche der Lyrik Sonnenscheins und<br />
der tschechischen Dichter müsste eigentlich der kritische Einwand, dass<br />
nämlich der andere Kontext, der Kontext der deutschen (und österreichischen<br />
und Prager deutschen) präexpressionistischen Lyrik eher stiefmütterlich behandelt<br />
wird, unter etwas plakativer Anwendung einer wenig repräsentativen<br />
und wenig zutreffenden Textauswahl leidet und eher unbefriedigende<br />
Resultate zeitigt, verstummen – genauso wie gelegentliche andere kritische<br />
Bemerkungen. Doch seien einige hier – der Vollständigkeit halber und der<br />
Textsorte einer Rezension zu Ehren – angeführt:<br />
Im – stark subjektiven – interpretatorischen Bereich scheinen mir Wildes<br />
wiederholte Betonungen der „semantischen Widersprüche“ (94) und „miteinander<br />
konkurrierenden Konzepte“ (78) in Sonnenscheins Darstellung des<br />
dichterischen Ich etwas übertrieben zu sein: Beide Pole des Ich, das starke,<br />
revoltierende, führende, verachtende einerseits und das leidende, ausgestoßene,<br />
verhöhnte andererseits lassen sich genausogut als komplementäre Figuren<br />
einer in sich stimmigen, stilisierten lyrischen Rolle/Masche auffassen<br />
(zumal Sonnenschein – was Wilde weiss – zur Autostilisierung häufig neigte):<br />
Die größere Leidenschaftsfähigkeit, das bessere Leiden-Können berechtigt<br />
das stilisierte Dichter-Ich erst zum elitären Führer-Gehabe.<br />
Allgemein scheint mir, dass Wilde seinen Dichter, dessen Aussagen zum<br />
Politisch-Sozialen streckenweise „etwas zu ernst nimmt“. Häufig ist Sonnenscheins<br />
wilde Rebellen-Gebärde eben nur eine Geste, ein literarisches<br />
Programm, häufig auch nur eine Antwort auf ebenso wilde (aber ebenso<br />
wenig ernst gemeinte) Gebärden seiner tschechischen Anarchisten-Freunde.<br />
Das „Lumpenproletariat“ wird von Sonka so häufig auch wegen dessen exotischer<br />
und provozierender (also rein rezeptiv-literarischer) Qualitäten dargestellt.<br />
Ob des Einzielens auf „ernsthafte“ politische Inhalte in der Lyrik<br />
Sonnenscheins, überliest Wilde manchmal die Selbstironie der Gedichte, hat<br />
kein Ohr für deren urwüchsige Fröhlichkeit, für deren – am mährischen<br />
Volkslied geschulten – klangmalerischen, rhythmischen Qualitäten, die<br />
Sonnenschein häufig Grund genug sind, ein Gedicht zu verfassen, die politischen<br />
Inhalte gesellen sich sozusagen automatisch versatzstückartig hinzu.<br />
Auch aus diesem Grunde scheint mir das Messen der Sonnenscheinschen<br />
Dichtungen an anarchistischen Theorien seiner Zeit (Tolstoj, Landauer,<br />
Kropotkin, Stirner, 247ff) problematisch, obwohl die Werke dieser Denker<br />
geeint im beschlagnahmten Koffer Sonnenscheins aufgefunden wurden.<br />
383
384<br />
Neue Literatur<br />
Im Bereich des Jüdischen ist Wildes nachvollziehbare, faktenreiche und<br />
trotzdem übersichtliche Darstellung der problematischen Lage des Judentums<br />
zwischen den beiden nationalen Lagern zu loben, mit besonderem<br />
Nachdruck vor allem sein Versuch, auf die (sonst wenig beachteten) Unterschiede<br />
zwischen Böhmen und Mähren hinzuweisen. Nur eine kleine Korrektur<br />
sei mir erlaubt: Die mährischen Juden haben sich nicht etwa deshalb<br />
in einem viel geringerem Maße an das Tschechische assimiliert als die<br />
böhmischen Juden (Wilde gibt 15,34 % für Mähren und 54 % für Böhmen/Kolín<br />
um die Jahrhundertwende an), weil „der tschechische Antisemitismus<br />
zu Beginn des Jahrhunderts gerade in Mähren seine Hofburg“ hätte<br />
(197), sondern weil – historisch bedingt – die Siedlungsstruktur in Mähren<br />
anders war als in Böhmen. Hier nämlich geschlossene, intakte jüdische<br />
Stadtviertel mit deutschsprachiger Infrastruktur, dort zersprengte einzelne<br />
Niederlassungen im tschechischen Umfeld. (Diese Darstellung gilt freilich<br />
für das böhmische ‚flache Land‘, nicht für Prag.)<br />
Im Bereich der jüdischen Motivik wäre noch ein Kritikpunkt anzumelden,<br />
daß Wilde nämlich am Anfang seiner Studie etwas überstürzt die vielen<br />
Messias-Gestalten Sonnenscheins mit der Christus-Figur identifiziert (67,<br />
70), wobei gerade Gedichte wie Des Menschen Sohn und Der Heiland viel<br />
eher auf die jüdische, alttestamentliche Messiah-Tradition referieren – welches<br />
Zugeständnis der Leser aber erst nach hundert Seiten findet (172).<br />
Im Bereich der historisch-ethnographischen Darstellungen schließlich<br />
möchte ich meine Hochachtung vor Wildes Bemühung aussprechen, das<br />
‚Mährisch-Slowakische‘ (das in den Gedichten Sonnenscheins häufig verkürzt,<br />
nur als ‚slowakisch/Slowake‘ vorkommt) im Einflussbereich zwischen<br />
dem (Österreichisch-)Böhmisch-Mährischen und dem eigentlich (Ungarisch-)Slowakischen<br />
richtig zu orten. Trotzdem fürchte ich, daß eben die<br />
Heranziehung der ungarisch-slowakischen Problematik (die sich von der<br />
Situation in den österreichisch verwalteten Ländern der Böhmischen Krone<br />
doch gravierend unterschied) die Erklärung eher vernebelt und dass – besonders<br />
ein deutscher Leser – nicht ‚klug wird‘ aus dieser Darstellung.<br />
Wie jedes wissenschaftliche Buch wird auch Wildes Studie keinen sehr<br />
breiten Leserkreis finden, doch die Handvoll von Fachleuten, die sich entweder<br />
mit deutschböhmischer Literatur, mit dem Anarchismus um die Jahrhundertwende,<br />
oder mit jüdischen Lebenswelten beschäftigen, werden seine<br />
Leistung zu würdigen wissen.<br />
Ingeborg Fiala-Fürst<br />
Neue Literatur<br />
Germanistica Pragensia XVI. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3.<br />
Praha: Univerzita Karlova (Karolinum) 2002 [Sonderheft zu Christian Heinrich<br />
Spieß], 104 Seiten.<br />
Im November 1999 fand anlässlich des 200. Todestages im Prager Franz-<br />
Kafka-Zentrum eine vom Prager Germanisten Václav Maidl organisierte<br />
Konferenz zu Christian Heinrich Spieß und seiner Zeit statt, geleitet von<br />
dem Anspruch, die vielfältigen Aktivitäten dieses für seine Zeit nicht unbedeutenden<br />
‚Trivialautors‘ interdisziplinär zu beleuchten. Den nun vorliegenden<br />
Konferenzbeiträgen entnimmt man ein vielschichtiges Bild eines<br />
Künstlers, der zwar nicht zu den großen seiner Zeit zählt, der aber, wie Michael<br />
Titzmann zeigt, „durchaus an den zentralen ideologischen Diskursen<br />
der Epoche sich auf seine – bescheidene – Weise beteiligt hat.“ 1<br />
Der Autor Spieß wurde dabei schon von der folgenden Generation verworfen,<br />
wie Josef Kamarýts Einwände in einem Brief an František Ladislav<br />
Čelakovský belegen, seien doch die Leser durch die Lektüre von Spieß<br />
‚verdorben‘ und deshalb nicht imstande, ‚Schillers wahre Kunst‘ wahrzunehmen.<br />
2 Der Verdacht gegen das Populäre dürfe aber nicht die heutige<br />
Beschäftigung mit Spieß verbieten, der als „Bestseller-Autor seiner Zeit [...]<br />
zum einen konsequent die inhaltlichen und formalen Wege, die zum sicheren<br />
Erfolg bei seinem Lesepublikum führten“, nutzte und somit durchaus<br />
Modernität bewies, während er andererseits inhaltlich mit seinen Texten<br />
hinter die Positionen der Aufklärung zurückging, wenn er den „Menschen<br />
als Spielball nicht über die Ratio beherrschbarer Kräfte präsentiert.“ 3 Es ist<br />
gerade das Zwiespältige in den Texten von Spieß, welches einen Zugriff auf<br />
die Zeit ermöglicht:<br />
Die Analyse seines Werkes vermittelt nicht nur Erkenntnisse über den beim Leser erfolgreichsten<br />
Zweig der deutschsprachigen Literatur aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sie<br />
gewährt auch Einblicke in die Entwicklung und die bis heute wirkungsvollen Mechanismen der<br />
Unterhaltungskunst. (Hartje 2002: 31)<br />
Gerne hätte man allerdings etwas darüber erfahren, ob Spieß mit seinen<br />
Texten nicht schon Aspekte der romantischen Aufklärungskritik antizipierte.<br />
1 Titzmann, Michael: Die Erzähltexte von Christian Heinrich Spieß und ihr<br />
Beitrag zur Anthropologie der Goethezeit, 9–18, 17.<br />
2 Maidl, Václav: Die Rezeption von Christian Heinrich Spieß in den böhmischen<br />
Ländern, 43–53, 44.<br />
3 Hartje, Ulrich: Der Romanautor Christian Heinrich Spieß im Kontext populärer<br />
Unterhaltungsliteratur, 19–32, 30.<br />
385
386<br />
Neue Literatur<br />
Spieß und seine Zeit werden gemäß interdisziplinärem Ansatz der Konferenz<br />
in einem breiten kulturhistorischen Kontext betrachtet. Die Situation<br />
des Theaters und damit die Rolle des Schauspielers und Dramenautors<br />
Spieß finden genau so Berücksichtigung wie die Rolle der Prager Universität,<br />
die sich in der Folge der theresianischen Schulreformen aus der kirchlich-jesuitischen<br />
Aufsicht herauslöst und in eine staatliche überführt wird. 4<br />
Insofern ist es konsequent, dass ein weiterer Beitrag sich mit einem wichtigen<br />
Zeitgenossen von Spieß, mit Karl Heinrich Seibt, beschäftigt, der ja als<br />
erster Nichtjesuit und späterer Rektor eng mit der Reform der Prager Universität<br />
verbunden war. 5 Gerade die Schüler Seibts, u.a. Josef Dobrovský,<br />
Josef Jungmann und Bernard Bolzano, sollten in den Folgejahren das intellektuelle<br />
Leben in Prag maßgeblich beeinflussen.<br />
Die vorliegenden Beiträge schließen somit eine wichtige Lücke der germanistischen<br />
Forschung zum späten 18. Jahrhundert, ist doch das Wirken von<br />
Christian Heinrich Spieß lange Zeit in der Fachdiskussion unberücksichtigt<br />
geblieben.<br />
Steffen Höhne<br />
4 Jacubcová, Alena: Das Theater in Prag zur Zeit von Christian Heinrich Spieß,<br />
61–74; Čornejová, Ivana: Die Prager Universität in der zweiten Hälfte des 18.<br />
Jahrhunderts, 75–82.<br />
5 Seibt, Ferdinand: Karl Heinrich Seibt (1735–1806), 83–96.<br />
Adressen der Herausgeber<br />
Neue Literatur<br />
Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc. Univerzita Jana Ámosa Komenského<br />
Pedagogická fakulta<br />
Račianska 59<br />
SK-821 07 Bratislava<br />
ivan.cvrkal@fedu.uniba.sk<br />
Prof. Dr. Steffen Höhne Hochschule für Musik FRANZ LISZT<br />
Studiengang Kulturmanagement<br />
Platz der Demokratie 2/3<br />
D-99423 Weimar<br />
steffen.hoehne@hfm-weimar.de<br />
Prof. Dr. Marek Nekula Universität <strong>Regensburg</strong><br />
<strong>Bohemicum</strong> <strong>Regensburg</strong>-<strong>Passau</strong><br />
D-93040 <strong>Regensburg</strong><br />
marek.nekula@sprachlit.uni-regensburg.de<br />
Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Univerzita Karlova<br />
Ústav germánských studií FF<br />
Nám. Jana Palacha 2<br />
CZ-116 38 Praha 1<br />
milan.tvrdik@ff.cuni.cz<br />
387
388<br />
Adressen der Autoren<br />
Adressen<br />
Doc. Dr. Hildegard Boková Katedra germanistiky PF JU<br />
Jeronýmova 10<br />
CZ-371 15 České Budějovice<br />
bokova@pf.jcu.cz<br />
Mgr. Renata Cornejo Univerzita J. E. Purkyně<br />
Katedra germanistiky PF<br />
Ul. České mládeže 8<br />
CZ-400 96 Ústí nad Labem<br />
cornejo@pf.ujep.cz<br />
Mgr. Miroslava Durajová Südböhmische Universität<br />
Pädagogische Fakultät<br />
Institut für Germanistik<br />
Jeronýmova 10<br />
CZ-371 15 České Budějovice<br />
PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers Danckelmannstr. 15<br />
D-14059 Berlin<br />
klaashinrich.ehlers@freenet.de<br />
Prof. Dr. Peter Ernst Institut für Germanistik der Universtät Wien<br />
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1<br />
A-1010 Wien<br />
peter.ernst@univie.ac.at<br />
Prof. Dr. Ingeborg Fiala-Fürst Katedra germanistiky FF UP<br />
Křížkovského 10<br />
CZ-771 80 Olomouc<br />
ingeborg.fialova@centrum.cz<br />
Mgr. Johana Gallupová Glaszeile 53<br />
D-14165 Berlin<br />
jgallup@volny.cz<br />
Prof. Dr. Albrecht Greule Deutsche Sprachwissenschaft<br />
Universität <strong>Regensburg</strong><br />
D-93040 <strong>Regensburg</strong><br />
albrecht.greule@sprachlit.uni-regensburg.de<br />
Adressen<br />
Martin Humpál, Ph.D. Univerzita Karlova<br />
Ústav germánských studií<br />
Nám. Jana Palacha 2<br />
CZ-116 38 Praha 1<br />
humpal@ff.cuni.cz<br />
Prof. Dr. Walter Koschmal Universität <strong>Regensburg</strong><br />
Institut für Slavistik<br />
D-93040 <strong>Regensburg</strong><br />
walter.koschmal@sprachlit.uni-regensburg.de<br />
Prof. Dr. Kurt Krolop Na Hřebenkách 4a<br />
CZ-150 00 Praha 5<br />
krolop-fam@gmx.net<br />
Prof. Dr. Peter Hans Nelde K.U. Brussel<br />
Vrijheidslaan 17<br />
B-1081 Brussel, België<br />
peter.nelde@kubrussel.ac.be<br />
Mirek Němec, M.A. Univerzita J. E. Purkyně<br />
Ústav slovansko-germánských studií<br />
B rněnská 2<br />
CZ-400 96 Ústí nad Labem<br />
mireknemec@hotmail.com<br />
PhDr. Mária Papsonová, CSc. Prešovská Univerzita<br />
FF – Kat. Germanistiky<br />
Ul. 17. novembra 1<br />
SK-080 78 Prešov<br />
papsonova@stonline.sk<br />
PhDr. Karsten Rinas Slezská univerzita v Opavě<br />
Filozoficko-přírodovědecká fakulta<br />
Bezručovo náměstí 13<br />
CZ-746 01 Opava<br />
karsten.rinas@fpf.slu.cz<br />
Mgr. Kateřina Šichová Universität <strong>Regensburg</strong><br />
<strong>Bohemicum</strong> <strong>Regensburg</strong>-<strong>Passau</strong><br />
D-93040 <strong>Regensburg</strong><br />
389
390<br />
Adressen<br />
katerina.sichova@sprachlit.uni-regensburg.de<br />
Prof. Dr. Jiří Stromšík, CSc. Univerzita Karlova<br />
Ústav germánských studií FF<br />
Nám. Jana Palacha 2<br />
CZ-116 38 Praha 1<br />
jiristromsik@hotmail.com<br />
Michael Wögerbauer, M.A. Gottschalkgasse 1/19<br />
A-1110 Wien<br />
michael.woegerbauer@gmx.net<br />
PhDr. Dalibor Zeman, PhD. Vysoká škola ekonomická v Praze<br />
Fakulta mezinárodních vztahů<br />
Katedra nĕmeckého jazyka<br />
Nám. W. Churchilla 4<br />
CZ-130 67 Praha 3 – Žižkov<br />
masenb@seznam.cz<br />
Stylesheet<br />
Formale Gestaltung der Beiträge (Ausdruck + Word-Datei,<br />
*.doc; *.rtf)<br />
Seite<br />
Seiteneinrichtung: oben, links, rechts 2,5; unten 2<br />
Überschriften<br />
Titel Beitrag: 16er Times New Roman, danach ein Absatz<br />
Unter Beitragstitel: Vorname und Name des Verfassers in 14er Times New<br />
Roman (danach ein Absatz)<br />
Zwischentitel: 14er Times New Roman Fett, arabische Zahlen, ggf. Untergliederung,<br />
z. B. 1.2. (vorher ein Absatz, kein Absatz zum folgenden Text)<br />
Text<br />
Laufender Text ohne Einrückungen, 14er Times New Roman, Zeilenabstand:<br />
genau 18 pt.<br />
Kürzere Zitate im laufenden Text: doppelte Anführungszeichen.<br />
Längere Zitate als Block: kein Einzug (Ausnahme: Zitate von lyrischen und<br />
dramatischen Texten: Einzug links: 1,25).<br />
Abstand vor Zitatblock: 6pt; Abstand nach Zitatblock: 6pt; Zeilenabstand:<br />
einfach; 12er Times New Roman ohne Anführungszeichen.<br />
Kurzzitation im laufenden Text und in den Fußnoten: „Zeitungen und Zeitschriften“<br />
(LENGAUER 1989: 14f.). Keine Ebd.-Verweise.<br />
Übersetzungen tschechischer/slowakischer Zitate in eckigen Klammern hinter<br />
dem Zitat (kurze Zitate) oder unter dem Zitat (längere Zitate).<br />
Sonstige Markierungen im laufenden Text: Titel von Zeitschriften/Periodika:<br />
KAPITÄLCHEN; Bezeichnungen von Institutionen, Titel von<br />
Büchern etc.: Kursiv; Zitationen: „doppelte Anführungszeichen“; einfache<br />
Markierungen, Hervorhebung von Wörtern: ,einfache Anführungszeichen‘:<br />
Auslassungen in Zitaten in eckigen Klammern: „Kafkas Schreiben [...] war“<br />
Fußnoten<br />
Fußnoten, keine Endnoten. Nach Fußnotenzeichen: ein Tabulatur, nicht<br />
hängend; 12er Times New Roman; Abstand nach jeder Fußnote: 6pt.<br />
Bibliographie<br />
RIETRA, Madelaine (1980): Jung-Österreich. Dokumente und Materialien<br />
zur liberalen österreichischen Opposition 1835 – 1848. Amsterdam: Rodopi.<br />
391
392<br />
Stylesheet<br />
BUSSE, Dietrich/HERMANNS, Fritz/TEUBERT, Wolfgang (Hgg.) (1994):<br />
Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse<br />
der historischen Semantik. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
SEIBT, Ferdinand (Hg.) (1983): Die Juden in den böhmischen Ländern.<br />
München: Oldenbourg.<br />
BROD, Max (1918a): Das große Wagnis. Leipzig, Wien: Kurt Wolff.<br />
LENGAUER, Hubert (1990): Literarisch-politische Opposition aus Prag.<br />
Ein Beitrag zur ,österreichischen‘ Vormärzliteratur. – In: Philologica Pragensia<br />
33, 28–42.<br />
LENGAUER, Hubert (1982): Kulturelle und nationale Identität. Die<br />
deutsch-österreichische Problematik im Spiegel von Literatur und Publizistik<br />
der liberalen Ära (1848 – 1873). – In: H. Lutz, H. Rumpler (Hgg.),<br />
Österreich und die deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert. München:<br />
Oldenbourg, 189–211.<br />
Zeilenabstand: einfach. Abstand nach jeder Angabe: 6pt.