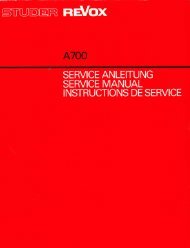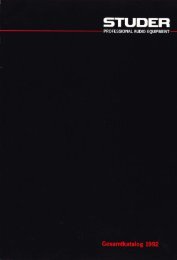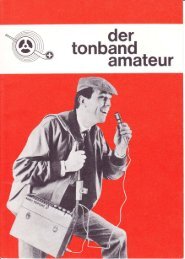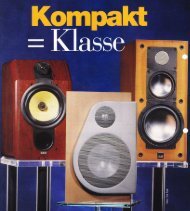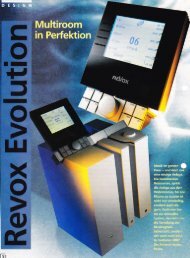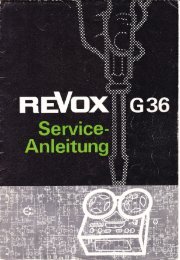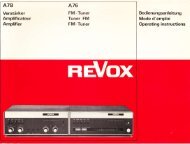Die magnetische Schallaufzeichnung (PDF, 24MB) - AVC-Studio
Die magnetische Schallaufzeichnung (PDF, 24MB) - AVC-Studio
Die magnetische Schallaufzeichnung (PDF, 24MB) - AVC-Studio
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
15.000 r{2, besser aber bis 200 kHz. sein Eingangswiderstand soll über 1 Mohm<br />
liegen, um auch hochohmige Quellen ohne zusätzliche Belastung messen zu<br />
können. 3. Ein strom- und spannungsmesser für Gleich- und wechselstrom<br />
zum Überprüfen der Betriebsspannungen und -ströme der verstärker. 4. sehr<br />
zrveckmäßig, aber nicht unbedingt erforderlich ist ein oszillograph mit hohem<br />
Enigangsrvriderstand (größer 1 Mohm), riessen Meßbereich bis in das HF-<br />
Gebiet reicht (über 100 kHz).<br />
Messung der Kopfinduklivilälen<br />
Zur Messung der Induktivität der Köpfe genügt es im allgemeinen, die<br />
Induktivität aus einer strom- und spannung'smessung bei der gewünschten<br />
Frequenz zu ermitteln.<br />
Der Strom<br />
stand der Spule<br />
ist nach Abb. 83 u i =<br />
!4 : U" , wenn der Ohm,sch,e Wider-<br />
R ar,<br />
vernachlässigbar ist gegenüber dem induktiven Widerstand.<br />
Man erhält daraus die Induktivität L - U-t . Ä . *nnh man die Fre-<br />
Un 2nf<br />
enottz z; B. 1000 Hz, so wird 2 a f : 6300. Wird ein Widerstand von der<br />
gleichen Größe R -<br />
6300 Ohm verwendet, so vereinfacht,sich die Gleichung zu<br />
Ilr<br />
1 -<br />
2, wenn f - 1000 Hz und R - 6300 Ohm.<br />
(60)<br />
fIn<br />
Stellt man nun z. B. die Spannung Us auf 1, 10, 100 mV. . . aiso auf<br />
Potenzen von 10 ein, so ergibt u1 unmittelbar ohne Rechnung den Induktivitätswert<br />
für den gewünschten und im Betrieb herrschenden Magnetisierungs-<br />
U-<br />
strom i : Ti<br />
an. <strong>Die</strong> in der Tabelle 5 angegebenen Kopfinduktivitäten wul-den<br />
bei 1000 Hz nach dieser Methode gemessen. Bei hochohmigen Köpfen ist R<br />
entsprechend zu vergrößern, um den Meßfehler durch den vernachlässigten<br />
Gleichstromwiderstand der Spu1e klein zu halten. Auf die gleiche Art kann<br />
auch die Impedanz der Eingangsübertrager gemessen werden.<br />
Beslimmung der Ausgangsimpedanz eines Verslärkers (Ouellwiderstand)<br />
Um einen nachfolgendtn Verstärker an den Ausgang eines Verstärkers<br />
richtig anschließen zu können, ist die Kenntnis des Quellwiderstandes des<br />
ersteren notwendig und dessen Frequenzatrhängigkeit. Zu diesem Zweck wird<br />
der Verstärker mit einem Tongeneratoi' gespeist und die Leerlaufspannung<br />
am Ausgang des Verstär'kers bei einer bestimmten Frequenz gemessen. Dann<br />
wird der Augang mit einem veränderbaren Widerstand so belastet, daß die<br />
Ausgangsspannung auf den halben Wert sinkt. Der Belastungswiderstand<br />
ist nunm,ehr gleich dem gesuchten Innenwiderstand (Quellwiderstand) des<br />
Verstärkers. (Vergl. Abb, 83b). Wird diese Messung bei verschiedenen Frequenzen<br />
durchgeführt, so erhält man die Frequenzabhängigkeit des'Quellwiderstandes.<br />
Um die E i n g.a n g s i m p e d a n z zu bestimmen, wird in Serie<br />
mit dem Eingang ein veränderbarer Widerstand R geschaltet und so lange<br />
198