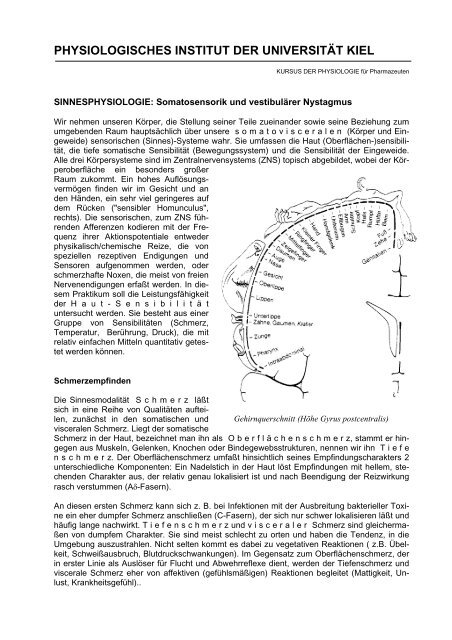SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...
SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...
SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT KIEL<br />
KURSUS DER PHYSIOLOGIE für Pharmazeuten<br />
<strong>SINNESPHYSIOLOGIE</strong>: Somatosensorik und vestibulärer Nystagmus<br />
Wir nehmen unseren Körper, die Stellung seiner Teile zueinander sowie seine Beziehung zum<br />
umgebenden Raum hauptsächlich über unsere s o m a t o v i s c e r a l e n (Körper und Eingeweide)<br />
sensorischen (Sinnes)-Systeme wahr. Sie umfassen die Haut (Oberflächen-)sensibilität,<br />
die tiefe somatische Sensibilität (Bewegungssystem) und die Sensibilität der Eingeweide.<br />
Alle drei Körpersysteme sind im Zentralnervensystems (ZNS) topisch abgebildet, wobei der Körperoberfläche<br />
ein besonders großer<br />
Raum zukommt. Ein hohes Auflösungsvermögen<br />
finden wir im Gesicht und an<br />
den Händen, ein sehr viel geringeres auf<br />
dem Rücken ("sensibler Homunculus",<br />
rechts). Die sensorischen, zum ZNS führenden<br />
Afferenzen kodieren mit der Frequenz<br />
ihrer Aktionspotentiale entweder<br />
physikalisch/chemische Reize, die von<br />
speziellen rezeptiven Endigungen und<br />
Sensoren aufgenommen werden, oder<br />
schmerzhafte Noxen, die meist von freien<br />
Nervenendigungen erfaßt werden. In diesem<br />
Praktikum soll die Leistungsfähigkeit<br />
der H a u t - S e n s i b i l i t ä t<br />
untersucht werden. Sie besteht aus einer<br />
Gruppe von Sensibilitäten (Schmerz,<br />
Temperatur, Berührung, Druck), die mit<br />
relativ einfachen Mitteln quantitativ getestet<br />
werden können.<br />
Schmerzempfinden<br />
Die Sinnesmodalität S c h m e r z läßt<br />
sich in eine Reihe von Qualitäten aufteilen,<br />
zunächst in den somatischen und Gehirnquerschnitt (Höhe Gyrus postcentralis)<br />
visceralen Schmerz. Liegt der somatische<br />
Schmerz in der Haut, bezeichnet man ihn als O b e r f l ä c h e n s c h m e r z, stammt er hingegen<br />
aus Muskeln, Gelenken, Knochen oder Bindegewebsstrukturen, nennen wir ihn T i e f e<br />
n s c h m e r z. Der Oberflächenschmerz umfaßt hinsichtlich seines Empfindungscharakters 2<br />
unterschiedliche Komponenten: Ein Nadelstich in der Haut löst Empfindungen mit hellem, stechenden<br />
Charakter aus, der relativ genau lokalisiert ist und nach Beendigung der Reizwirkung<br />
rasch verstummen (Aδ-Fasern).<br />
An diesen ersten Schmerz kann sich z. B. bei Infektionen mit der Ausbreitung bakterieller Toxine<br />
ein eher dumpfer Schmerz anschließen (C-Fasern), der sich nur schwer lokalisieren läßt und<br />
häufig lange nachwirkt. T i e f e n s c h m e r z und v i s c e r a l e r Schmerz sind gleichermaßen<br />
von dumpfem Charakter. Sie sind meist schlecht zu orten und haben die Tendenz, in die<br />
Umgebung auszustrahlen. Nicht selten kommt es dabei zu vegetativen Reaktionen ( z.B. Übelkeit,<br />
Schweißausbruch, Blutdruckschwankungen). Im Gegensatz zum Oberflächenschmerz, der<br />
in erster Linie als Auslöser für Flucht und Abwehrreflexe dient, werden der Tiefenschmerz und<br />
viscerale Schmerz eher von affektiven (gefühlsmäßigen) Reaktionen begleitet (Mattigkeit, Unlust,<br />
Krankheitsgefühl)..
SCHMERZ<br />
somatisch<br />
visceral<br />
Oberflächenschmerz<br />
Tiefenschmerz<br />
Eingeweideschmerz<br />
1. Schmerz<br />
2. Schmerz<br />
Haut<br />
Nadelstich, Quetschen<br />
Bindegewebe<br />
Muskeln<br />
Knochen, Gelenke<br />
Muskelkrampf, Kopfschmerz<br />
Eingeweide<br />
Gallenkolik, Magengeschwür<br />
1. Berührung<br />
a) Bestimmung der Berührungsschwellen in verschiedenen Hautgebieten<br />
Die Untersuchung mit VON FREY'schen Tasthaaren oder sog. Monofilamenten wird verwendet,<br />
um Störungen der Oberflächensensibilität (z. B. Hypästhesie, Allodynie) genauer zu beschreiben.<br />
Zur Bestimmung der Berührungsschwellen werden Haare verschiedener Stärke benutzt.<br />
Wenn Sie das an einem Griff befestigte Haar senkrecht auf die Haut aufsetzen und bis zu<br />
einer Durchbiegung von 1-2 mm belasten, so gibt die auf dem Griff angegebene Zahl die Kraft<br />
in mN (1 mN ≈ 100 mg) an, mit der das Haar auf die Unterlage drückt.<br />
Zur Bestimmung der Berührungsschwellen setzen Sie die Haare in willkürlicher Folge auf die in<br />
Tabelle 1 aufgeführten Hautgebiete auf. Wiederholen sie den Test pro Hautgebiet und Haar<br />
fünfmal. Die Ergebnisse jedes Berührungsreizes ("-" für keine Empfindung, "+" für Tastempfindung)<br />
sind in Tabelle 1 einzutragen, d.h. 5 Eintragungen pro Kästchen. Gehen Sie mit dem<br />
käuflichen Testset 4 sehr vorsichtig um, denn die Filamente (Glasfasern) können insbesondere<br />
bei unvorsichtigem Abziehen und Aufsetzen der Kappen leicht abbrechen !<br />
Praktische Hinweise: Der Proband darf natürlich nicht auf das Hautgebiet schauen. Ferner sollen<br />
die Berührungen in unregelmäßigen Abständen und ohne Ankündigung erfolgen, um realistische<br />
Ergebnisse zu erzielen.<br />
Zeigefingerbeere<br />
Lippe<br />
Rücken<br />
Tabelle 1 Auflagekraft in mN<br />
Schwelle<br />
in<br />
mN<br />
b) S i m u l t a n e Raumschwelle des Tastsinnes (Zweipunktschwelle)<br />
Mit Hilfe eines Tastzirkels, dessen Spitzen auf unterschiedliche Abstände eingestellt werden,<br />
wird das räumliche Auflösungsvermögen für zwei gleichzeitig dargebotene Reize in verschiedenen<br />
Hautgebieten getestet (siehe Tabelle 2). Beide Spitzen des Zirkels sind g l e i c h z e i t i g<br />
unter leichtem Druck für etwa 2 s auf die Haut aufzusetzen. Die Versuchsergebnisse sind in
Tabelle 2 einzutragen ("+" wenn die Versuchsperson beide Reize räumlich getrennt wahrnimmt,<br />
"-" wenn sie nur einen Reiz wahrnimmt). Zwischendurch müssen Kontrollen (Aufsetzen nur einer<br />
Zirkelspitze) durchgeführt werden. Überlegen Sie sich sinnvolle Abstände der Zirkelspitzen.<br />
Diese sind in willkürlicher Folge einzustellen und jeweils mehrfach zu prüfen.<br />
Tabelle 2 Abstand der Zirkelspitzen (mm)<br />
Zweipunktschwelle<br />
in<br />
mm<br />
Fingerbeere<br />
Rücken<br />
2. VIBRATION<br />
Vibrationsempfindungen werden vorwiegend durch Reizung von Pacini-Körperchen ausgelöst,<br />
bei niedrigen Frequenzen auch von Meißner-Körperchen. Die schnell adaptierenden Mechanosensoren<br />
werden auch durch gleitendes Betasten von Gegenständen aktiviert; sie sind an der<br />
taktilen Erkennung von Oberflächenstrukturen beteiligt.<br />
a) Prüfung mit der Stimmgabel<br />
Die Prüfung der Vibrationsempfindung (Pallästhesie) ist zur Erkennung von Störungen der peripheren<br />
Nerven (z.B. bei Polyneuropathie) und der Hinterstränge des Rückenmarks geeignet. In<br />
der klinischen Routine wird eine auf 64 Hz gedämpfte Stimmgabel (nach RYDEL-SEIFFER)<br />
benutzt. Das Dreieck auf der Achtel-Skala ist bei grober Schwingung unscharf zu sehen. Je<br />
geringer die Schwingung wird, desto höher wandert die sichtbare Spitze des Dreiecks. Testen<br />
Sie sich g e g e n s e i t i g; beim Selbstversuch spürt man stets die Schwingungen der Stimmgabel<br />
an den haltenden Fingern (Fehlerquelle !). Prüfen Sie also das Vibrationsempfinden bei<br />
geschlossenen Augen der Versuchsperson durch Aufsetzen der Stimmgabel an verschiedenen<br />
Knochenpunkten und notieren Sie die Werte, bei denen die Empfindung der Vibration verschwindet<br />
(Angabe in Achteln; 1/8 = unempfindlich, 8/8 = sehr empfindlich).:<br />
Fingergrundgelenk (MCP 2 ) ......./8 Zehengrundgelenk (MTP 1) ................/8<br />
Proc. styloideus radii ................../8 Malleollus medialis ............................../8<br />
Olecranon ................................../8 Tuberositas tibiae .............................../8<br />
b) Bestimmung der Frequenzgrenzen des Vibrationssinnes<br />
Die für die folgenden Versuche benutzte Anordnung besteht aus einem Frequenzgenerator,<br />
dessen Schwingungsfrequenz und Amplitude unabhängig voneinander regelbar sind, sowie<br />
einer Lautsprechermembran. Zur Ausschaltung störender Höreindrücke müssen Schutzkopfhörer<br />
aufgesetzt werden. An dem Wechselstromgenerator werden eine mittlere Frequenz von etwa<br />
200 Hz und eine deutlich überschwellige Amplitude eingestellt. Die Versuchsperson stellt mit<br />
den Fingerspitzen eine intensive Vibrationsempfindung fest. Die Frequenz wird nun bis zum<br />
Verschwinden der Vibrationsempfindung vermindert und dann wieder bis zum Auftauchen erhöht.<br />
Der Mittelwert beider Messungen gibt die untere Frequenzgrenze des Vibrationssinnes<br />
an; bei der Bestimmung der oberen Frequenzgrenze wird entsprechend verfahren.
Tabelle 3 Ermittlung/Berechnung Mittelwert<br />
untere Frequenzgrenze Hz Hz<br />
obere Frequenzgrenze Hz Hz<br />
c) Bestimmung der Frequenzabhängigkeit der Intensitätsschwellen<br />
Analog zur Hörschwellenkurve kann für den Vibrationssinn eine Intensitätsschwellenkurve in<br />
Abhängigkeit von der Frequenz aufgenommen werden. Im Bereich von 30 bis 900 Hz sollen die<br />
Werte der Intensitätsschwellen in festgelegten Schritten bestimmt werden (siehe Tabelle 4).<br />
Erhöhen Sie jeweils die Intensität bis zum Auftauchen der Empfindung (Vers. 1) und vermindern<br />
sie sie bis zu deren Verschwinden (Vers. 2). Die Intensitätswerte werden auf der Ordinate (y-<br />
Achse), die Frequenzwerte auf der Abszisse (x-Achse) des doppelt-logarithmischen Koordinatensystems<br />
abgetragen. Überlegen Sie sich eine sinnvolle Einteilung der Achsen
3. TEMPERATURSINN<br />
Thermosensoren haben Proportional-Differential (PD) Eigenschaften. Eine Temperaturänderung<br />
führt also vorübergehend zu einer deutlichen Erhöhung (bzw. Abnahme) der Aktionspotentialfrequenz,<br />
die danach wieder zurückgeht (Adaptation). Warmsensoren bilden Aktionspotentiale<br />
im Bereich von 30–45°C und werden vorwiegend von marklosen Nervenfasern der Gruppe C<br />
versorgt. Kaltsensoren (Bereich 10–35°C) werden teils von C-Fasern, teils schwach myelinisierten<br />
Aδ-Fasern versorgt.<br />
Dynamisches Temperaturempfinden und thermische Schmerzschwellen<br />
Das benutzte Gerät „Thermal Sensory Analyzer“ TSA 2001 (Firma medoc®) wird auch in der<br />
klinischen Diagnostik (Neurologie) benutzt. Eine wassergekühlte Thermode wird von Peltier-<br />
Elementen (siehe Physik-Lehrbücher) computergesteuert erwärmt bzw. gekühlt und die Temperatur<br />
wird fortlaufend gemessen. Die Versuchsperson nimmt auf dem Stuhl Platz, legt den rechten<br />
Unterarm bequem in die Schiene und den rechten Daumenballen auf die Thermode auf. Die<br />
linke Hand hält den Schalter mit dem blauen Antwortknopf („Y“). Zur Vermeidung störender Ablenkung<br />
sollen während des Versuchs Lärmschutzkappen getragen und die Augen geschlossen<br />
gehalten werden.<br />
a) Test 1: Wahrnehmung von Temperaturänderungen (Programm „Limits 2“)<br />
Ausgehend von einer Indifferenztemperatur von 32°C wird die Thermode um 1°C pro Sekunde<br />
erwärmt. Die Versuchsperson drückt den Knopf, sobald sie die Erwärmung zu spüren beginnt.<br />
Der Test wird fünfmal wiederholt. Dann wird die Thermode unter 32°C abgekühlt (-1°C / s).<br />
Jetzt erfolgt der Knopfdruck beim ersten Empfinden der Abkühlung, wiederum mit fünffacher<br />
Wiederholung. Notieren Sie die Ergebnisse (mittlere Schwellen „A v g“ und Änderung „D“):<br />
Dynamisches Temperaturempfinden; Ausgangstemperatur 32°C am rechten Thenar:<br />
Wahrnehmungsschwelle Erwärmung<br />
Avg = .......... °C<br />
Änderung D = +..........°C<br />
Normbereich 20-30jährige: 32,4 - 34,9 °C (Mittelwert 33,6°C)<br />
Wahrnehmungsschwelle Abkühlung<br />
Avg = ........ °C,<br />
Änderung D = −.......°C<br />
Normbereich 20-30jährige: 28,7 – 31,9 °C (Mittelwert 30,4°C)<br />
b) Test 1: Hitze- und Kälteschmerz (Programm „Limits 3“)<br />
Ausgehend von 32°C wird die Thermode um 1,5 °C pro Sekunde erwärmt. Die Versuchsperson<br />
drückt den Knopf erst dann, wenn sie beginnt, Hitzeschmerz am rechten Daumenballen zu spüren.<br />
Diese Empfindung wird vor allem durch C-Fasern, aber auch durch Aδ-Fasern vermittelt.<br />
Hitzeempfindliche und polymodale Nozisensoren (Schmerzrezeptoren) reagieren ab einer Erwärmung<br />
der Haut über etwa 45 °C. Nach Knopfdruck sinkt die Temperatur sofort rasch. Ein<br />
Erwärmen der Thermode über 53 °C ist aus Sicherheitsgründen unmöglich. Der Versuch wird<br />
vom Programm fünfmal wiederholt. Bestimmen Sie den mittleren (Avg) Temperaturwert der<br />
Schmerzschwelle. Schätzen Sie als Proband/in Ihre durchschnittlich empfundene Schmerzstärke<br />
mit dem Lineal ein (rot-gelbe Schmerzskala) und lesen Sie den Wert auf der Rückseite ab<br />
(Bereich 0-100, notieren !).
In gleicher Weise erfolgt die Bestimmung der Kälteschmerz-Schwelle. Hier soll die Versuchsperson<br />
durch Knopfdruck angeben, wann die Kälteempfindung beginnt, schmerzhaft zu werden.<br />
Notieren Sie die Ergebnisse (Mittelwerte „Avg“). Beurteilen Sie auch hier wieder die verspürte<br />
Schmerzhaftigkeit mit der Schmerzskala.<br />
H i t z e s c h m e r z bei ........ °C (Avg),<br />
dabei verspürte Schmerzstärke: ............ [0 - 100]<br />
K ä l t e s c h m e r z bei ......... °C (Avg),<br />
dabei verspürte Schmerzstärke: ............ [0 - 100]<br />
4. GLEICHGEWICHTSSINN (Vestibularapparat)<br />
Das Vestibularorgan besteht aus den Maculaorganen (Macula utriculi, macula sacculi) und<br />
den drei Bogengangsorganen. Die Bogengangsorgane messen Drehbeschleunigungen bei<br />
zentrischen und exzentrischen Drehungen des Kopfes. Die Maculaorgane messen Linearbeschleunigungen<br />
(z.B. die Gravitation). Durch Verrechnung dieser Erregungen gewinnt das ZNS<br />
Informationen über die Stellung des Körpers im dreidimensionalen Raum und kann dementsprechend<br />
die B l i c k m o t o r i k und die S t ü t z m o t o r i k steuern. K i n e t o s e n Bewegungskrankheiten)<br />
treten nach besonders starken oder ungewöhnlichen Reizen auf, das<br />
bekannteste Beispiel ist die Seekrankheit und die (Welt-)Raumkrankheit mit Schwindelanfällen<br />
und Brechgefühl. .<br />
Aufgaben zum vestibulären Nystagmus<br />
Eine Versuchsperson wird im Drehstuhl um die vertikale Achse gedreht. Um einen rein horizontalen<br />
Nystagmus zu erreichen und die Reizung vertikaler Bogengänge zu vermeiden, muß die<br />
Versuchsperson im Drehstuhl den Kopf um etwa 30° nach vorn neigen.<br />
Die Auslösung des o p t o k i n e t i s c h e n Nystagmus durch Verschieben des Gesichtsfeldes<br />
wird durch Aufsetzen einer “Frenzel’schen” Brille mit Konvexlinsen von 15 - 20 dpt und Innenbeleuchtung<br />
verhindert. Bei Rechtsdrehung tritt ein rechtsgerichteter horizontaler Nystagmus<br />
auf, der bei gleichmäßiger Fortdauer der Bewegung erlischt. Nach plötzlicher Beendigung<br />
der Drehbewegungen tritt erneut ein horizontaler Nystagmus auf, der jetzt aber nach links gerichtet<br />
ist.<br />
Es werden abschließend verschiedene Formen der Beeinträchtigung von postrotatorischen Zeige-<br />
und Gehversuchen demonstriert (z.B. Nasenzeigeversuch, Gehversuch, Aufstehen nach<br />
Reizung des vertikalen Bogengangsystems).<br />
SomSensGro07