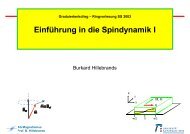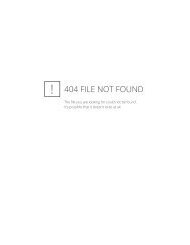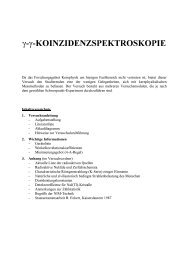Sensorik/Aktorik
Sensorik/Aktorik
Sensorik/Aktorik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
• Zwar haben Halbleiter den höheren Seebeck-Koeffizient, Metalle sind aber unproblematischer<br />
(größerer Temperaturbereich, keine bei hohen Temperaturen störanfällige Metall-HL-Kontakte)<br />
• Beispiele: NiCr/Ni, Fe/CuNi (hohe Empfindlichkeit), für hohe Temperaturen PtRh30/PtRh6 (bis<br />
1820 ◦ C), bei niedrigen Temperaturen Chromel/Konstantan, Cu-Konstantan, Fe-Konstantan<br />
• Gütezahl Z = α 2 /ρκ: Verhältnis Seebeck-Koeffizient zu Wärmeleitung und elektrischem Widerstand<br />
• Alterung besonders an dünnen Drähten problematisch<br />
• Mantelthermoelemente lösen Probleme mit der mechanischen Stabilität dünner Drähte und Korrosion<br />
(Aufbau S. 51), dafür schlechteres dynamisches Verhalten (Ansprechzeiten bis in den<br />
Minutenbereich)<br />
• Gefügeänderungen im Dauerbetrieb → vor Einsatz tempern<br />
• Vorteile: Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität und gute Reproduzierbarkeit<br />
• Nachteile: niedrige Signalpegel, Störeinflüsse des Kontaktpotentials, Referenztemperatur<br />
• Alterung durch Ausheilen von Gitterdefekten oder Rekristallisation<br />
4.3.5 Mikrothermoelemente<br />
• Ansprechzeit abhängig von Wärmekapazität und Wärmeableitung → Drahtdurchmesser möglichst<br />
klein (bis 5 µm)<br />
• Isolierung erhöht Antwortzeit<br />
• Dünnschichtlösungen zeigen nicht die volle Thermokraft<br />
• Lösung: Erhöhung der Empfindlichkeit durch Thermopiles (Thermosäulen, siehe S. 55)<br />
• Anwendung: Bolometer, Strömungssensoren, Hochfrequenzmessung<br />
4.4 Referenztemperatur<br />
• temperaturabhängiger Widerstand und Stromquelle heizen isothermen Block auf konstante Temperatur<br />
(alternativ Eisbad)<br />
• die Kontaktstellen von den Meßdrähten zum Thermopaar liegen auf diesem Block<br />
• alternativ: Thermopaar AB an Meßstelle, Thermopaar BA in Eiswasser, danach gehen zwei Drähte<br />
aus B zum isothermen Block (Bild 61 auf Seite 53)<br />
4.5 <strong>Aktorik</strong><br />
Stromerzeugung: z.B. Isotopenbatterie, einige Watt/kg (Voyager-Satellit); Beispiele: PbSnTe, BiSbTe<br />
Peltierkühler: bis 60K/Stufe; Parallelanordnung (Nachteil: hohe Ströme) oder seriell, p- und n-dotierte<br />
Gebiete wechseln sich ab (Skript S. 58)<br />
4.6 Metall-Widerstandsthermometer<br />
• resistive Sensoren (also Feldstromanteil der Stromdichtegleichung)<br />
• Temperaturkoeffizient α = 1/R ∂R<br />
∂T<br />
bei Metallen positiv: Elektronendichte ändert sich nur wenig<br />
mit steigender Temperatur (die Fermiverteilung weicht auf, deshalb effektiv etwas mehr bewegliche<br />
Ladungsträger), dafür nimmt die Beweglichkeit wegen Streuung ab → erhöhter Widerstand<br />
– α = 0, 3%/K bei Platin (R(T) fast linear, besonders bei Kupfer)<br />
– α = 0 bei 45% Cu, 55% Ni (Konstantan)<br />
– Nichtlinearitäten bei ferroelektrischen Materialien (Nickel), vor allem an der Curie-Temperatur,<br />
oder bei Phasenänderungen<br />
– verwendete Metalle: Pt, Ni, für hohe Temperaturen Mo, W<br />
• Pt sehr genau, 1 mK, Linearität 0,2%, 100Ω-Eichwiderstände<br />
• Legierungen: ρ Leg = ρ 1 + ρ 2 (mit Massenanteil gewichtet??? Gilt aber auch nicht immer, z.B.<br />
CuNi)<br />
9