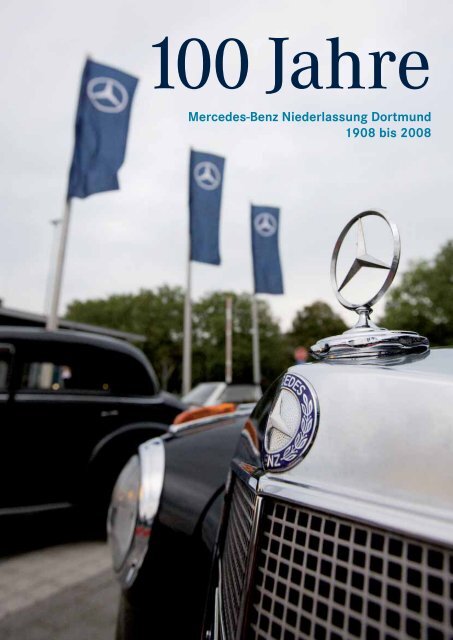100 Jahre - Mercedes-Benz Niederlassung Dortmund
100 Jahre - Mercedes-Benz Niederlassung Dortmund
100 Jahre - Mercedes-Benz Niederlassung Dortmund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>100</strong> <strong>Jahre</strong><br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
1908 bis 2008
2 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Christa Thoben<br />
Wirtschaftsministerin NRW<br />
Aus Stuttgart zugeschaltet:<br />
Dr. Dieter Zetsche<br />
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG<br />
Dr. Gerhard Langemeyer, OB <strong>Dortmund</strong><br />
Udo Dolezych, IHK Präsident<br />
Danke Barbara, danke Gerd!<br />
Barbara Schöneberger, Moderatorin.<br />
Haral Schuff, Vorsitzender der Geschäftsleitung<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong>en Deutschland.
Liebe Freunde von <strong>Mercedes</strong>,<br />
<strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> sind eine lange Zeit. Das Großartige<br />
am Älterwerden ist, dass die Jubiläen sich<br />
häufen. Den kleinen Nachteil hat die berühmte<br />
amerikanische Schauspielerin Katharine Hepburn<br />
prägnant formuliert: „Je älter man wird, desto<br />
mehr ähnelt die Geburtstagstorte einem Fackelzug“.<br />
Damit hat sie zwar Recht, aber <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> kann diesen Fackelzug einfach genießen.<br />
Seit <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong>n gibt es <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> in<br />
<strong>Dortmund</strong>, und damit ist <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
die älteste <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong><br />
Deutschlands.<br />
<strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> sind eine lange Zeit. Dies gilt für den Automobilbau, für den Automobilhandel<br />
und für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region wie die rund um<br />
<strong>Dortmund</strong>, in der wir seit einem Jahrhundert tätig sind. Heute beschäftigen wir<br />
in unserer <strong>Niederlassung</strong> 520 Mitarbeiter, darunter 50 Auszubildende. Mit vier<br />
Betrieben in <strong>Dortmund</strong> und eigenen Centern in Unna und Lünen. Im letzten Jahr<br />
haben wir nahezu 8.000 Pkw, Transporter und LKW an unsere Kunden geliefert und<br />
einen Umsatz von über 300 Millionen Euro getätigt. Insgesamt betreuen wir nahezu<br />
60.000 Kunden in den Bereichen Vertrieb und Service. Unterstützt werden wir dabei<br />
von leistungsstarken Vertragswerkstätten.<br />
Unser Erfolg basiert auf drei Säulen: 1. die Kunden, 2. die Region <strong>Dortmund</strong>/Unna/<br />
Lünen, die seit <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong>n die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen liefert, und<br />
3. unsere Mitarbeiter und unsere Produkte.<br />
Kompetenz und Flexibilität verlangt in sehr hohem Maße auch unsere Nutzfahrzeug-Kundschaft.<br />
Im Transportgewerbe spielt Zeit eine große Rolle. Unproduktive<br />
Standzeiten der Fahrzeuge kann sich im harten Wettbewerb des Transportgewerbes<br />
keiner leisten. Wir sprechen heute nicht mehr von Standtagen bei der Reparatur<br />
und Wartung, sondern von Standstunden. Die eigentliche Reparaturzeit ist nicht das<br />
Maß der Dinge. Es ist vielmehr die Standzeit, die Zeit, die das Fahrzeug unproduktiv<br />
in der Werkstatt steht. Dienstleistungspakete wie Serviceverträge und ein großer<br />
Pool von Vermietfahrzeugen sind Bausteine unseres Mobilitätskonzepts. Wir wollen<br />
unseren Kunden „Service mit Stern“ bieten, wollen Dienstleister sein, und wir möchten,<br />
dass Sie sagen: „Es war richtig, einen <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> zu kaufen.“<br />
Wir befinden uns hier in einer industriellen Kernregion Europas. Stahl, Kohle und<br />
Bier waren Jahrzehnte Garanten für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.<br />
Nach der Blütezeit des Ruhrgebiets und der darauf folgenden Strukturkrise ist der<br />
Wandel inzwischen gelungen: Neue Wirtschaftszweige haben sich angesiedelt, das<br />
„neue“ <strong>Dortmund</strong> hat sich zu einem bedeutenden Technologie- und Logistikstandort<br />
entwickelt. Wir fühlen uns mehr denn je als Unternehmen dieser Region, als Teil<br />
eines weltweit operierenden Konzerns. Und bei allen Veränderungen – <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> steht damals wie heute vor allem für eins: für die Faszination Automobil. Und<br />
deshalb schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft. Halten Sie uns weiter die Treue<br />
und begleiten uns auf dem Weg in die Zukunft.<br />
<strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> sind eine lange Zeit. Dieses Magazin lässt die vergangenen <strong>Jahre</strong> Revue<br />
passieren. Wir hoffen, dass es Sie erheitert, Erinnerungen weckt und Träume<br />
beflügelt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Gerd Hewing<br />
Inhalt<br />
2 Bilder von der<br />
Geburtstagsfeier<br />
4 Schneller als die<br />
<strong>Dortmund</strong>er Borussia<br />
6 Kleine Mannschaft und<br />
überschaubare Anfänge<br />
8 Schwarzer Freitag und<br />
„weiße Elefanten“<br />
10 Harte Zeiten: Krieg und<br />
Wiederaufbau<br />
12 Von Rosemarie Nitribitt,<br />
Willi Daume und Konrad<br />
Adenauer<br />
14 Béla Barényi und<br />
Innovation als Tradition<br />
16 Der W123 und ein<br />
Massen-Phänomen<br />
18 Der erste „Baby-<strong>Benz</strong>“ und<br />
Strukturwandel auf allen<br />
Ebenen<br />
20 Grenzenlose Kopffreiheit<br />
oder: Ein Kurzer auch für<br />
Lange<br />
22 Neue Maßstäbe – neue<br />
<strong>Niederlassung</strong><br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong><br />
<strong>Dortmund</strong><br />
Wittekindstraße 99<br />
44139 <strong>Dortmund</strong><br />
Redaktion<br />
BleekerPress<br />
Rolf-Peter Bleeker<br />
Sichelstraße 27<br />
44229 <strong>Dortmund</strong><br />
Tel: 0231 737838<br />
BleekerPress@aol.com<br />
Druckvorstufe<br />
Satz · Bild · Grafik<br />
Marohn<br />
Druck<br />
DruckVerlag Kettler,<br />
59199 Bönen<br />
3
4 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Schneller als die<br />
<strong>Dortmund</strong>er Borussia<br />
Sie waren schnell, schneller noch als<br />
Borussia: Als die Fußballer anno 1909 am<br />
Borsigplatz den Ballspielverein Borussia 09<br />
<strong>Dortmund</strong> gründeten, war <strong>Benz</strong> schon<br />
längst da. Am 11. August 1908 wurde<br />
die „<strong>Benz</strong> & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik“<br />
aus der Taufe gehoben. Nicht<br />
in Berlin, in Stuttgart oder in München<br />
– nein, <strong>Dortmund</strong> wurde zur ersten<br />
<strong>Benz</strong>-<strong>Niederlassung</strong> Deutschlands. Die<br />
ersten Geschäftsräume in der Löwenstrasse<br />
9-11 wurden von der Stadt gemietet, und<br />
wenig später erfolgte der Umzug zum<br />
Hiltropwall 7. Im Januar 1911 siedelte<br />
sich auch Gottlieb Daimler in <strong>Dortmund</strong><br />
an und eröffnete eine <strong>Niederlassung</strong><br />
der „Daimler Motorengesellschaft“. Die<br />
Werkstatt der Firma „<strong>Benz</strong> & Cie.“ wurde<br />
aus Platzgründen zum Heiligen Weg und<br />
1912 zur Märkischen Straße verlegt, die<br />
Büros folgten 1915. Die ersten 25 Exemplare<br />
des <strong>Mercedes</strong> Typ 28/95 PS wurden<br />
1914 ausgeliefert. Sie repräsentierten die<br />
ersten „großen“ <strong>Mercedes</strong>-Wagen. Mitten<br />
im Krieg zog die „<strong>Benz</strong> & Cie.“ 1917 zum<br />
Ostenhellweg um.<br />
Der Anfang vom Anfang<br />
Die Geschichte von <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> ist die<br />
Geschichte von drei genialen Erfindern:<br />
Karl <strong>Benz</strong>, Gottlieb Daimler und Wilhelm<br />
Maybach. Wie schreibt er sich richtig?<br />
Mit „K“ oder mit „C“? Karl <strong>Benz</strong> wurde<br />
am 25. November 1844 als Karl Friedrich<br />
Michael Wailend, uneheliches Kind der<br />
Josephine Wailend in Mühlburg geboren.<br />
Ein Jahr nach der Geburt heiratete seine<br />
Mutter den Vater Johann Georg <strong>Benz</strong>,<br />
und Karl änderte seinen Vornamen Carl<br />
<strong>Benz</strong>. <strong>Benz</strong> gründete 1883 die „<strong>Benz</strong> &<br />
Co. Rheinische Gasmotorenfabrik Mannheim“<br />
(seit 1899 Aktiengesellschaft),<br />
die um 1900 die größte Automobilfabrik<br />
der Welt war. 1903 schied <strong>Benz</strong> aus dem<br />
aktiven Dienst aus.<br />
1885 baute er das erste Auto, ein<br />
dreirädriges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor<br />
und elektrischer Zündung,<br />
das 1886 erstmals in Mannheim fuhr.<br />
Es hatte 0,8 PS und erreichte 18 km/h<br />
Höchstgeschwindigkeit betrug. Am 29.<br />
Januar 1886 schrieb Carl <strong>Benz</strong> Industriegeschichte,<br />
indem er beim Reichspatentamt<br />
unter der Nummer 37435<br />
Erfolge bei internationalen Autorennen<br />
stellten sich schon früh ein. Autos der<br />
Firma <strong>Benz</strong>, die mal unter dem Namen<br />
„<strong>Benz</strong>“, mal unter dem Namen „<strong>Mercedes</strong>“<br />
teilnahmen, waren bald in aller Munde. Im<br />
Juli 1908 siegte Christian Lautenschlager<br />
auf einem <strong>Mercedes</strong> 140 PS beim Grand<br />
Prix von Frankreich in Dieppe. Die Plätze<br />
2 und 3 belegen Victor Héméry und René<br />
Hanriot auf <strong>Benz</strong>. Im April 1911 erreichte<br />
Bob Burmann auf der Rennstrecke in<br />
Daytona Beach mit einem <strong>Benz</strong> 200 PS<br />
über die Meile mit fliegendem Start<br />
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von<br />
228,1 km/h über die Meile mit fliegendem<br />
Start. Dieser Geschwindigkeits-Weltrekord<br />
hielt immerhin bis 1924.<br />
dieses Fahrzeug zum Patent anmeldete.<br />
Dieses war die Geburtsstunde des ersten<br />
Automobils der Welt. In der Öffentlichkeit<br />
erntete Carl <strong>Benz</strong> für seine Arbeit<br />
viel Spott. Es wurde als „ein Wagen ohne<br />
Pferde“ belächelt. Andererseits meinte<br />
der „Generalanzeiger der Stadt Mannheim“<br />
im September 1886, „dass dieses<br />
Fuhrwerk eine gute Zukunft haben<br />
wird“, weil es „ohne viele Umstände<br />
in Gebrauch gesetzt werden kann und<br />
weil es, bei möglichster Schnelligkeit,<br />
das billigste Beförderungsmittel für<br />
Geschäftsreisende, eventuell auch für<br />
Touristen werden wird“. Carl <strong>Benz</strong> sah<br />
dies ähnlich: Er gründete 1906 mit<br />
seinen Söhnen in Ladenburg die Firma<br />
„Carl <strong>Benz</strong> Söhne“, die sich auf den Fahrzeugbau<br />
spezialisierte. 1926 vereinigten<br />
sich die Firmen „<strong>Benz</strong> & Co. Rheinische<br />
Gasmotorenfabrik Mannheim“ und<br />
„Daimler Motorengesellschaft“ zur<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG.<br />
Gottlieb Daimler, der zusammen mit<br />
seinem Freund Wilhelm Maybach 1885<br />
in Cannstatt den „Reitwagen“, das<br />
erste Motorrad mit <strong>Benz</strong>inmotor fahren<br />
ließ, hat <strong>Benz</strong> nie persönlich kennen<br />
gelernt. Tatsächlich hat Daimler gegen<br />
<strong>Benz</strong>‘ Firma wegen Verletzung seines<br />
Glührohrpatents geklagt und gewonnen.<br />
Daimler war als technischer Direktor der<br />
Gasmotorenfabrik in Köln-Deutz für die<br />
Produktion von atmosphärischen Gasmotoren<br />
zuständig. Nach seinem Ausscheiden<br />
aus dem Unternehmen baute er sich<br />
1882 eine eigene Versuchswerkstatt im<br />
Garten seiner Villa in Cannstatt, in der<br />
er zusammen mit dem Konstrukteur Wilhelm<br />
Maybach das Viertaktprinzip des<br />
Ottomotors optimierte. 1886 installierten<br />
die beiden den kompakten Motor in<br />
einem vierrädrigen Automobil – parallel<br />
zu den Forschungen von Carl <strong>Benz</strong>.<br />
Für den Vertrieb der neu entwickelten<br />
Motoren ließ Daimler in den <strong>Jahre</strong>n 1886<br />
bis 1889 einen Motorwagen von Maybach<br />
konstruieren, der auf der Pariser<br />
Weltausstellung vorgeführt wurde. 1890<br />
geriet die Firma in Schwierigkeiten, da<br />
der Absatz stockte. Zur Sanierung des<br />
Betriebs gründete Daimler die Daimler-<br />
Motoren-Gesellschaft, an der neben ihm<br />
und Wilhelm Maybach die Industriellen<br />
Max Duttenhofer und Wilhelm Lorenz<br />
beteiligt waren.
1908 bis 1918<br />
Der <strong>Mercedes</strong> Typ 28 mit 95 PS aus dem Jahr 1914.<br />
Die Reise der Bertha <strong>Benz</strong><br />
Bertha <strong>Benz</strong>, die Ehefrau von Carl <strong>Benz</strong><br />
litt. Es musste etwas geschehen, denn<br />
der Motorwagen ihres Gatten fand<br />
nicht die notwendige Akzeptanz beim<br />
zahlenden Publikum. So beschloss<br />
Bertha, die Zuverlässigkeit des Autos<br />
auf einer bis dato einmaligen Fernfahrt<br />
zu beweisen. Am 5. August 1888 schlich<br />
sie sich in aller Frühe in die Werkstatt<br />
ihres Mannes und „borgte“ sich den<br />
Wagen aus. Mit ihren beiden 15- und<br />
13-jährigen Söhnen Richard und Eugen<br />
fuhr Bertha <strong>Benz</strong> die 108 Kilometer<br />
von Mannheim nach Pforzheim. Dies<br />
war die erste erfolgreiche Fernfahrt<br />
mit einem Automobil. Diese Fahrt trug<br />
wesentlich dazu bei, die noch bestehenden<br />
Vorbehalte der damals dünn<br />
gesäten Kundschaft zu zerstreuen und<br />
ermöglichte den wirtschaftlichen Erfolg<br />
der Firma. Damit hatte Bertha <strong>Benz</strong> als<br />
erster Mensch der Welt eine Fernfahrt<br />
bewältigt und der Erfindung ihres Mannes<br />
zum Durchbruch verholfen. <strong>Benz</strong><br />
schlief an jenem Tag des Starts noch<br />
und fand später in der Küche einen<br />
Zettel mit der Nachricht: „Wir sind zur<br />
Oma nach Pforzheim gefahren“. Später<br />
gestand er ein, dass es ohne diese Tour<br />
seiner Frau wohl sehr schwer geworden<br />
wäre: „Sie war wagemutiger als ich<br />
und hat eine für die Weiterentwicklung<br />
des Motorwagens entscheidende Fahrt<br />
unternommen“.<br />
Auch die Stadtapotheke in Wiesloch bei<br />
Heidelberg kam zu Ruhm, da Bertha<br />
<strong>Benz</strong> dort den nötigen Treibstoffnachschub<br />
„Ligroin“ einkaufte. Bis weit ins<br />
20. Jahrhundert konnte man <strong>Benz</strong>in und<br />
andere Treibstoffe nur in der Apotheke<br />
kaufen, und somit gilt diese als die<br />
erste Tankstelle der Welt. Bertha <strong>Benz</strong><br />
starb am 5. Mai 1944 im Alter von 95<br />
<strong>Jahre</strong>n in Ladenburg, wo auch die erste<br />
Werkstätte von Carl <strong>Benz</strong> gestanden<br />
hatte.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1908 – 1918<br />
Das erste Länderspiel einer deutschen<br />
Fußballnationalelf endet am 5. April<br />
1908 mit einer 3:5 Niederlage gegen<br />
die schweizerische Nationalmannschaft.<br />
Im Juli 1908 finden die Olympischen<br />
Sommerspiele in London statt.<br />
5<br />
18 junge Männer des Jünglingvereins<br />
„Dreifaltigkeit“ gründen am 9. Dezember<br />
1909 den Fußballklub Borussia<br />
<strong>Dortmund</strong> und heben den Klub aus<br />
der Taufe, um sich dem Fußball zu<br />
widmen, der in dieser Zeit nicht gut<br />
angesehen war.<br />
Die Olympischen Spiele finden im<br />
Sommer 1912 in Stockholm statt. Die<br />
Goldmedaille im <strong>100</strong>-Meter-Lauf holt<br />
der Amerikaner Ralph Cook Craig in<br />
10,8 Sekunden.<br />
Der Norweger Roald Amundsen<br />
entscheidet am 14. Dezember 1911<br />
den Wettlauf zum Pol vor Robert Scott<br />
und ist als erster Mensch am Südpol.<br />
Der als unsinkbar geltende Passagierdampfer<br />
„Titanic“ rammt in der Nacht<br />
zum 15. April 1912 einen Eisberg und<br />
geht unter. 1.513 Menschen nimmt er<br />
mit sich in die Tiefe.<br />
Nach fünfjähriger Bauphase wird<br />
am 12. Juli 1913 die Möhnetalsperre<br />
eingeweiht. Die Staumauer misst 35<br />
Meter und der Stauinhalt beträgt 135<br />
Millionen Kubikmeter.<br />
Benjamin David Goodman, genannt<br />
„Benny“, erblickt das Licht der Welt<br />
und wird im Laufe der <strong>Jahre</strong> einer der<br />
wichtigsten Jazzmusiker.<br />
Leonardo da Vincis berühmtes<br />
Ge mälde „Mona Lisa“ wird am 22.<br />
August 1911 aus dem Pariser Museum<br />
Louvre gestohlen und taucht im<br />
Dezember 1913 in Florenz wieder auf.<br />
Der Maler Vicenzo Perugia gesteht,<br />
das Gemälde entwendet zu haben.<br />
Der <strong>Benz</strong>inpreis wird am 13. März<br />
1916 auf zwei Mark pro Liter erhöht.<br />
Die Einwohnerzahl Deutschlands ist<br />
1914 auf 65 Millionen gestiegen.<br />
Im Dezember 1918 erhält Max Planck<br />
den Physik Nobelpreis für seine Forschung<br />
in der Quantenphysik.
6 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Kleine Mannschaft und<br />
überschaubare Anfänge<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1919 beginnen Verhandlungen<br />
zwischen „<strong>Benz</strong>&Cie.“ aus Mannheim und<br />
der „Daimler Motorengesellschaft“ aus<br />
Untertürkheim mit dem Ziel, die Interessen<br />
beider Unternehmen zu bündeln<br />
und zukünftige Typenprogramme<br />
untereinander abzustimmen. Bereits<br />
1924 schließen die in <strong>Dortmund</strong> bis<br />
dahin konkurrierenden Firmen sich zu<br />
einer Interessengemeinschaft zusammen.<br />
Verkauf, Werkstatt und Verwaltung<br />
werden in der Löwenstraße (Foto unten)<br />
zusammengefasst, die Ausstellungsräume<br />
bleiben am Ostenhellweg. Insgesamt<br />
16 Mitarbeiter sorgen sich um Verkauf,<br />
Service und Verwaltung – ein recht<br />
überschaubarer Mitarbeiterstamm. Im<br />
<strong>Jahre</strong> 1925 wächst die Zahl der Mitarbeiter<br />
auf 18 Angestellte und 56 Arbeiter bei<br />
der „<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-Verkaufsstelle“ – so<br />
wurde die <strong>Niederlassung</strong> früher genannt.<br />
Die Hauptversammlung der Firmen<br />
Daimler und <strong>Benz</strong> am 26. Juni 1926<br />
beschließt den Zusammenschluss ihrer<br />
Unternehmen und beendet die funktionierende<br />
Interessengemeinschaft. Jetzt geht<br />
es unter ein gemeinsames Dach: Namen<br />
und Zeichen der Firmen werden zu einem<br />
neuen Markenzeichen zusammengeführt.<br />
Die neue Marke heißt „<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>“.<br />
Handelsrechtlich firmiert das Unternehmen<br />
künftig als Daimler-<strong>Benz</strong> AG.<br />
1926 wird das erste gemeinsame<br />
Daimler-<strong>Benz</strong>-Programm auf der Berliner<br />
Automobil-Ausstellung präsentiert: der neu<br />
entwickelte Typ 8/38 PS Zweiliterwagen,<br />
der nach Modifizierung 1928 in „Typ<br />
Stuttgart“ und der Dreiliterwagen in „Typ<br />
Mannheim“ umbenannt wird. 1926 ist<br />
auch das Geburtsjahr der legendären<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> S. Die zwei- und viersitzigen<br />
offenen Fahrzeuge wurden auf<br />
dem langen Fahrgestell mit 3,40 Meter<br />
Radstand aufgebaut. Von den anderen<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-Modellen waren sie – wie<br />
das Schwestermodell K – durch drei auf der<br />
rechten Seite des Motorraums austretende,<br />
nach unten führende Abgasschläuche zu<br />
unterscheiden. Die Sechszylinder-OHV-<br />
Motoren mit 6,8 Litern Hubraum und<br />
einem Verdichtungsverhältnis von 4,7:1<br />
entwickeln 120 PS bei 3.000/min. Das vorn<br />
angebaute Roots-Gebläse kann die Leistung<br />
kurzfristig auf 180 PS steigern. Daher rührt<br />
auch die ebenfalls gängige Modellbezeichnung<br />
26/120/180 PS. Die Fahrzeuge haben<br />
ein unsynchronisiertes Vierganggetriebe<br />
mit Mittelschaltung, das die Motorkraft an<br />
die Hinterräder weiterleitet. Sie erreichen<br />
eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h.<br />
Die Fahrzeuge verfügen über einen<br />
Pressstahlrahmen aus U-Profilen und ein<br />
Fahrwerk mit Starrachsen hinten und<br />
vorn, die an halbelliptischen Blattfedern<br />
aufgehängt sind. Alle vier Räder haben<br />
Seilzugbremsen.<br />
1927 folgt der berühmte <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
SSK, von dem insgesamt nicht einmal 50<br />
Fahrzeuge gebaut werden. Aber Zahlen<br />
allein zählen nicht: Noch heute fällt vielen<br />
Leuten bei der Buchstabenkombination<br />
‚SSK‘ <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> ein, die quasi als<br />
Produktbeschreibung dienen: S = Super,<br />
S = Sport, K = Kurz. Das bedeutet<br />
30 Zentimeter weniger Radstand und etwa<br />
150 Kilogramm weniger Gewicht. 1927
1919 bis 1928<br />
ist auch die Glanzzeit der Kompressormotoren:<br />
Tritt man bei einem großvolumigen<br />
Motor bei einer bestimmten Drehzahl auf<br />
das Gaspedal, schaltet sich laut kreischend<br />
der Kompressor ein.<br />
Erst 1924 darf ein deutsches Werksteam<br />
nach den Beschränkungen des Ersten<br />
Seien wir froh, dass Emil Jellinek seine<br />
Tochter nicht Clothilde genannt hat.<br />
Vor 120 <strong>Jahre</strong>n war das ein ebenso<br />
gängiger Name wie <strong>Mercedes</strong>. Aber<br />
weil Emil Jellinek sich für <strong>Mercedes</strong><br />
entschied, heißen die Automobile mit<br />
dem Stern heute auch <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
– und nicht Clothilde-<strong>Benz</strong>. Im letzten<br />
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war<br />
Jellinek Generalkonsul der k.u.k.-<br />
Monarchie in Nizza und las eines<br />
Tages von den Automobilen der<br />
Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG)<br />
von Daimler und Maybach. Jellinek<br />
reiste nach Cannstatt und kaufte dort<br />
sein erstes Automobil, dessen Leistung<br />
ihm allerdings schnell als zu schwach<br />
erschien. Also beauftragte er Wilhelm<br />
Maybach mit derKonstruktion stärkerer<br />
Fahrzeuge und Motoren. Jellinek<br />
orderte für 550.000 Goldmark 36<br />
Kraftwagen und legte damit den Grundstein<br />
für die Automarke <strong>Mercedes</strong>. In<br />
Nizza lief der Verkauf seiner Autos, mit<br />
denen Jellinek auch Motorsport betrieb,<br />
äußerst erfolgreich. Als während des<br />
Bergrennens Nizza–La Turbie im<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Typ 8/38<br />
Weltkrieges wieder Rennen fahren. Bis<br />
1929 bildet sich ein äußerst erfolgreiches<br />
Team mehrerer Werksfahrer. Am 19. Juni<br />
1927 kommt es zum ersten Einsatz des<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Typ „S“ beim „Großen<br />
Preis von Deutschland“. Das Rennen<br />
endet mit dem Sieg einer Legende: Rudolf<br />
Caracciola.<br />
Die Geschichte von „<strong>Mercedes</strong>“<br />
Jahr 1900 der Fahrer eines Daimler<br />
Phoenix-Rennwagens verunglückte,<br />
forderte Jellinek von Maybach einen<br />
Rennwagen mit den Eigenschaften,<br />
die auch heute noch das Credo jedes<br />
Tuners sind und die Herzen der Fans<br />
höher schlagen lassen: tiefer, schneller,<br />
breiter. Für das Fahrzeug vereinbarten<br />
die DMG und Emil Jellinek am 2. April<br />
1900 den gemeinsamen Vertrieb unter<br />
dem Namen <strong>Mercedes</strong>. So hieß seine<br />
damals zehn <strong>Jahre</strong> alte Tochter, die er<br />
über alles liebte. Am 22. November trat<br />
der erste <strong>Mercedes</strong> mit 35 PS die Reise<br />
von Cannstatt nach Nizza an, und mit<br />
diesem Fahrzeug gewann Wilhelm<br />
Werner im März 1901 die Rennen<br />
Nizza–Aix–Salon–Nizza und Nizza–La<br />
Turbie.<br />
Juristisch gesichert wurde der Name<br />
<strong>Mercedes</strong> im September 1902, als<br />
„<strong>Mercedes</strong>“ als Warenzeichen gesetzlich<br />
geschützt wurde. 1926 kam es<br />
zur Fusion mit der <strong>Benz</strong> & Cie. zur<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG, aus <strong>Mercedes</strong> wurde<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1919 – 1928<br />
Dr. Otto Pelzer gewinnt am 11. September<br />
1926 in Berlin den 1500-<br />
Meter-Lauf mit neuem Weltrekord<br />
gegen die besten Läufer der Gegenwart,<br />
darunter der finnische Wunderläufer<br />
Paavo Nurmi.<br />
Im Februar 1928 finden die Olympischen<br />
Winterspiele in St. Moritz<br />
statt. Zum ersten Mal nach dem<br />
ersten Weltkrieg nimmt wieder eine<br />
deutsche Mannschaft teil.<br />
7<br />
Bei den Olympischen Sommerspielen<br />
im Juli und August 1928 gewinnen<br />
die deutschen Sportler 10 Goldmedaillen<br />
und erreichen damit den zweiten<br />
Platz in der Nationenwertung hinter<br />
den USA.<br />
Wegen der noch unsicheren politischen<br />
Lage in Berlin wird die verfassungsgebendeNationalversammlung<br />
am 6. Februar 1919 in Weimar<br />
eröffnet. Der erste demokratische<br />
Staat in Deutschland wird geboren<br />
und geht als „Weimarer Republik“ in<br />
die Geschichte ein.<br />
Mit der Aufführung von „Jedermann“<br />
am 22. August 1920 werden in<br />
Salzburg die Festspiele zum ersten<br />
Male durchgeführt.<br />
Die Inflation von 1923 führt am 16.<br />
November 1923 zur ersten Währungsreform.<br />
Die Deutsche Rentenbank<br />
beginnt mit der Ausgabe der neuen<br />
Rentenmark. Für eine Billion Mark<br />
wird eine Rentenmark ausgezahlt.<br />
Im Januar 1927 berichten die „Münchener<br />
Neuesten Nachrichten“ über<br />
die Vorstellungen des Amerikaners<br />
Goddard und des Deutschen Oberth<br />
mit Raketen ins All zu fliegen und auf<br />
anderen Planeten zu landen.<br />
Seit dem 1. Juni 1927 fährt man mit<br />
der Bahn nach Sylt. Der Hindenburgdamm<br />
verbindet Westerland mit den<br />
Festland. Die 11 Kilometer lange<br />
Linie fördert die Zukunft Sylts als<br />
Ferieninsel.
8 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Schwarzer Freitag<br />
und „weiße Elefanten“<br />
Der schwarze Freitag! In New York<br />
brechen die Aktienkurse in noch nicht<br />
gekanntem Ausmaße ein. Man schreibt<br />
den 25. Oktober 1929, der Tag an dem<br />
Milliardenwerte vernichtet werden.<br />
Der Börsenkrach bleibt nicht auf die<br />
USA beschränkt. Die internationale<br />
Verflechtung von Kredit- und Zahlungsmechanismen<br />
trifft Europa hart und das<br />
empfindliche Deutschland noch härter.<br />
Die Wirtschaftskrise erreicht in den<br />
<strong>Jahre</strong>n 1931 bis 1933 ihren Höhepunkt<br />
und löst dauerhafte Veränderungen in der<br />
Automobilindustrie aus. Sie wirkt aber<br />
auch bereinigend, ineffektive Unternehmen<br />
verschwinden vom Markt, die leistungsfähigen<br />
Firmen überleben und sehen<br />
sich nach dem Ende der Krise einem<br />
erneut wachsenden Markt gegenüber. Im<br />
Februar 1933 beschäftigt die Verkaufs-<br />
stelle in <strong>Dortmund</strong> 16 Angestellte und 51<br />
Arbeiter, und infolge der Belebung des<br />
Verkaufs- und Reparaturgeschäfts kann<br />
zum Ende des <strong>Jahre</strong>s die Mitarbeiterzahl<br />
auf 22 Angestellte und 60 Arbeiter erhöht<br />
werden. Im März 1935 eröffnet <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> im September ein großes Ausstellungslokal<br />
in der Betenstrasse 16 (Foto<br />
unten). Hunderte von Menschen drücken<br />
sich im Dezember 1935 an den Fenstern<br />
dieser Ausstellungsräume die Nasen platt:<br />
Die erste Rennwagenschau in <strong>Dortmund</strong><br />
zeigt die erfolgreichen <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-<br />
Rennwagen aus nächster Nähe. Durch<br />
die weiter wachsende Nachfrage nach<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-Modellen erwägen die<br />
Verantwortlichen einen Neubau der<br />
<strong>Niederlassung</strong>. In Körne werden über<br />
13.000 Quadratmeter erworben, doch<br />
die vorgesehene Bebauung wird von<br />
der Baubehörde nicht genehmigt. Bis<br />
Ende 1938 wächst die Belegschaft in der<br />
Löwenstrasse auf 133 Mitarbeiter.<br />
Im Sommer 1929 stellt <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> den<br />
Typ Nürburg 460 (W08) vor, den ersten<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> mit einem Achtzylinder-<br />
Reihenmotor. Papst Pius XI. erhält 1930<br />
ein solches Fahrzeug als Geschenk. Die<br />
richtige Antwort auf die Weltwirtschaftskrise<br />
ist der kleinste Personenwagen der<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG, der Typ 170, der im<br />
Oktober 1931 auf dem Pariser Salon seine<br />
Weltpremiere erlebt. Zu den technischen<br />
Innovationen gehört die Einzelradaufhängung<br />
an allen vier Rädern. 1936 präsentiert<br />
die Daimler-<strong>Benz</strong> AG auf der Berliner<br />
Automobilausstellung mit dem Typ 260<br />
D den ersten serienmäßigen Diesel-PKW<br />
der Welt. Der Vierzylindermotor leistet
1929 bis 1938<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Typ SSK 31<br />
45 PS bei 3.500/min und erzielt damit<br />
eine Höchstgeschwindigkeit von 97 km/h.<br />
Der Verbrauch von 9,5 Liter Diesel pro<br />
<strong>100</strong> Kilometer war für die Zeit geradezu<br />
vorbildlich.<br />
Die <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Modelle „S“, „SS“;<br />
„SSK“ und „SSKL“ sind die herausragenden<br />
Sportwagen der 30er <strong>Jahre</strong> und<br />
werden liebevoll „Die weißen Elefanten“<br />
genannt. Der Typ „SS“ ist die vom Typ „S“<br />
abgeleitete stärkere Version mit einem<br />
Sieben-Liter-Kompressormotor, der zwei<br />
Leistungsstufen enthält: 140 PS ohne und<br />
200 PS mit Kompressor. Der Typ „SSK“ ist<br />
eine Weiterentwicklung, und der Motor<br />
leistet bei gleichem Hubraum 225 PS mit<br />
Kompressor.<br />
Rudolf Caracciola gewinnt 1931 mit einem<br />
SSKL die Mille Miglia. Mit zahlreichen<br />
Siegen auf dem <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> SSK hatte<br />
er 1930 schon den Titel „Europameister<br />
für Sportwagen“ errungen. Manfred von<br />
Brauchitsch siegt auf <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
SSKL im Mai 1932 beim AVUS-Rennen<br />
in Berlin und stellt mit 200 km/h einen<br />
Klassenweltrekord auf. Der „SSKL“<br />
(„Super-Sport-Kurz-Leicht“) ist die letzte<br />
Entwicklungsstufe der „S“ Reihe und wird<br />
nur als Rennsportwagen gebaut.<br />
Mit der neu eingeführten Formel für<br />
Grand-Prix-Rennen, die nicht mehr als 750<br />
Kilogramm wiegen durften, beginnt 1934<br />
die Zeit der „Silberpfeile“. Den Namen<br />
bekamen sie wegen blank polierten<br />
Aluminiumkarosserie: Der W25 wog bei<br />
der technischen Abnahme zum Eifelrennen<br />
auf dem Nürburgring am 3. Juni<br />
1934 nicht 750, sondern 751 Kilogramm.<br />
Rennleiter Alfred Neubauers Ausspruch<br />
„Nun sind wir die Gelackmeierten“ soll<br />
Fahrer Manfred von Brauchitsch auf die<br />
Idee gebracht haben, den weißen Lack<br />
abzuschleifen, um das Gewicht auf das<br />
zulässige Limit zu verringern. Dabei sei<br />
das silbern glänzende Aluminiumblech<br />
zum Vorschein gekommen, das dem<br />
W25 und seinen Nachfolgern den Namen<br />
„Silberpfeil“ gab. Im Januar 1938 erreicht<br />
Rudolf Caracciola auf der Autobahn<br />
Frankfurt – Darmstadt eine Geschwindigkeit<br />
von 432,7 km/h. Dieser auf einer<br />
öffentlichen Straße erzielte Rekord gilt bis<br />
zum heutigen Tag.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Typ 170<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1929 – 1938<br />
9<br />
Max Schmeling besiegt am 12. Juni<br />
1930 den Amerikaner Jack Sharkey<br />
und wird als erster Europäer Boxweltmeister<br />
aller Klassen. 1936 besiegt er<br />
Joe Louis ebenfalls in New York durch<br />
Knockout in der 12. Runde.<br />
Das Internationale Olympische Komitee<br />
(IOC) vergibt im Mai 1931 die<br />
Olympischen Spiele 1936 nach Berlin.<br />
Der 1. FC Nürnberg gewinnt am<br />
8. Dezember 1935 als erste Mannschaft<br />
den neu eingerichteten Pokalwettbewerb<br />
im Fußball.<br />
Am 1. August 1936 werden in Berlin<br />
die Olympischen Spiele eröffnet. Jesse<br />
Owens gewinnt vier Goldmedaillen<br />
und wird der herausragende Sportler<br />
dieser Spiele.<br />
Im bisher größten Bankenzusammenschluss<br />
am 26. September 1929<br />
fusionieren die Deutsche Bank und<br />
die Disconto-Gesellschaft. Man erhofft<br />
dadurch Rationalisierungseffekte.<br />
Der „Schwarze Freitag“ am 25. Oktober<br />
1929 an der New Yorker Börse<br />
leitet die Weltwirtschaftskrise ein.<br />
Die Inflation in Deutschland erreicht<br />
ständig neue Rekordhöhen, bis die<br />
Rentenmark die wertlose Reichsmark<br />
als allgemeines Zahlungsmittel ablöst.<br />
In Berlin wird am 12. März 1929 der<br />
erste abendfüllende deutsche Tonfilm<br />
„Melodie der Welt“ uraufgeführt.<br />
Maria Magdalena von Losch wird<br />
über Nacht berühmt. In der Rolle der<br />
Chansonette Lola verzaubert Marlene<br />
Dietrich, wie ihr Künstlername war,<br />
nach der Uraufführung am 6. August<br />
1932 die ganze Welt.<br />
In Berlin wird am 22. März 1935 das<br />
erste regelmäßige Fernsehprogramm<br />
der Welt ausgestrahlt. Ein fahrbarer<br />
Sender überträgt drei Mal in der<br />
Woche eine 90minütige Sendung in<br />
öffentliche Fernsehstuben.<br />
Der legendäre Passagierdampfer<br />
„Queen Mary“ läuft am 26. September<br />
1934 vom Stapel. Die „Queen Mary“<br />
ist das größte Schiff der Welt.<br />
Das Luftschiff LZ 129 „Hindenburg“<br />
explodiert am 6. Mai 1937 kurz vor<br />
der Landung in Lakehurst (New<br />
Jersey). 36 Menschen kommen ums<br />
Leben. Diese Katastrophe läutet das<br />
Ende der Luftschiffzeitalters ein.
10 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Harte Zeiten:<br />
Krieg und Wiederaufbau<br />
Mit Kriegsbeginn im September 1939<br />
kommt der PKW-Verkauf in <strong>Dortmund</strong><br />
fast zum Erliegen. Lastwagen werden<br />
nur noch gegen Bezugsschein für<br />
kriegswichtige Betriebe ausgeliefert.<br />
Immerhin umfasst die Belegschaft noch<br />
37 Angestellte und 98 Arbeiter. Mit<br />
zunehmender Kriegsdauer wird das<br />
Kommunal- und Feuerwehrgeschäft<br />
immer wichtiger. Im Vordergrund steht<br />
die Hygiene in der Stadt. Man braucht<br />
Müll- und Fäkalienwagen. Ein Großteil<br />
der Belegschaft wird zum Wehrdienst<br />
eingezogen und der Reparaturbetrieb wird<br />
„Wehrmachtsstätte“ und arbeitet fast nur<br />
noch für den Heimat-Kraftfahrpark (HKP),<br />
also für Kommunal-, Regierungs- und<br />
Wehrmachtfahrzeuge. Private Fahrzeuge<br />
werden kaum noch repariert und ab 1941<br />
schläft auch das Reparaturgeschäft völlig<br />
ein. Nach Anordnung des Vorstandes<br />
heißen die bisherigen Verkaufsstellen<br />
nunmehr <strong>Niederlassung</strong>. Die vom März<br />
bis Juni 1943 dauernde „Ruhr-Offensive“<br />
der Alliierten legt fast alle Zentren im<br />
Ruhrgebiet in Trümmer. Durch Bomben<br />
und Luftminen werden im Oktober 1944<br />
auch die verbliebenen Geschäftsräume<br />
restlos zerstört. Doch der härteste Schlag<br />
folgt noch: Am 12. März 1945 bombardieren<br />
1.107 Lancaster- und Halifax-Bomber<br />
die Stadt <strong>Dortmund</strong>. Dies ist der schwerste<br />
Luftangriff, die je eine europäische Stadt<br />
erlebt hat.<br />
Die <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> ist ohne<br />
Geschäfts- und Werkstatträume. Mit den<br />
verbliebenen Werkzeugen und Ersatzteilen<br />
fahren die Monteure zum Kunden und<br />
reparieren an Ort und Stelle. Die nötige<br />
Büroarbeit erledigen die Mitarbeiter in<br />
ihren privaten Wohnungen.<br />
Bereits im Juni 1945 werden von der<br />
<strong>Niederlassung</strong> provisorische Räume in<br />
Marten angemietet. Durch weitere Zumietung<br />
von Grundstücken und Gebäuden<br />
und kontinuierlichen Ausbau in den<br />
Folgejahren entsteht in der Schulte-Heuthausstraße<br />
23 eine zwar unzureichende,<br />
aber funktionsfähige <strong>Niederlassung</strong>. Im<br />
Oktober 1945 startet <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
mit 13 Angestellten, 11 Arbeitern und<br />
9 Lehrlingen. Die Umsätze durch das<br />
Reparaturgeschäft sind gering, und der<br />
Verkauf kann keine Fahrzeuge anbieten.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Typ 770 F von 1942 mit acht Zylindern und 230 PS.<br />
Die ersten LKW werden 1946 wiederum<br />
gegen Bezugsschein verkauft, die staatliche<br />
und kommunale Behörden erteilen.<br />
Ab 1947 folgt langsam der Aufbau des<br />
PKW-Verkaufs. Nach der Währungsreform<br />
im Juni 1948 zieht die Nachfrage nach<br />
Fahrzeugen wieder an, und der Verkauf<br />
beginnt im Juli 1948 nach Freigabe der<br />
Produktion durch die Amerikaner.<br />
Die Daimler-<strong>Benz</strong> AG stellt im März 1940<br />
auf Kriegsproduktion um: Als PKW bleibt<br />
allein der Typ 170 V im Programm, von<br />
dem im Monat 1.400 Stück mit unterschiedlichsten<br />
Aufbauten gefertigt werden.<br />
Die sich verschärfende Treibstofflage<br />
zwingt die Konstruktionsabteilung zur<br />
Entwicklung und Bau von Kohlegeneratoren.<br />
Nach Abschluss der Testphase<br />
werden Ende 1942 fünfzig PKW und LKW<br />
mit Kohlegeneratoren ausgerüstet. Im<br />
September 1943 stellt die Daimler-<strong>Benz</strong><br />
AG einen PKW-Holzgasgenerator für den<br />
Typ 170 V vor, der mit einer Füllung von<br />
24 Kilogramm Holzkohle eine Reichweite<br />
von <strong>100</strong> bis 130 Kilometer ermöglicht.
1939 bis 1948<br />
Bei schweren Luftangriffen im September<br />
1944 wird das Werk Untertürkheim<br />
zu 70 Prozent zerstört. Doch schon am<br />
20. Mai 1945 – nur zwölf Tage nach<br />
der bedingungslosen Kapitulation<br />
des Dritten Reiches – beginnen 1.240<br />
Arbeiter mit dem Wiederaufbau der<br />
Produktionshallen. Bereits im Februar<br />
1946 werden wieder Motoren des Typs<br />
170 V, ein 1,7-Liter-Vierzylinder, gefertigt,<br />
und die Serienproduktion des 170 V als<br />
viertürige Limousine läuft im Juli 1947<br />
wieder an. Dieses für die damalige Zeit<br />
recht sparsame Auto – der Verbrauch<br />
liegt bei etwa 9,7 Liter auf <strong>100</strong> Kilometer<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 170 V Pritsche von 1946.<br />
– kostet 1948 stolze 8.180 DM und bleibt<br />
deshalb für die meisten Bundesbürger ein<br />
unerschwinglicher Traum.<br />
Die Motorsportgeschichte dieser Dekade<br />
ist kurz erzählt: Hermann Lang und<br />
Rudolf Caracciola holen am 7. Mai<br />
1939 einen Doppelsieg beim ersten und<br />
einzigen Start des 1,5-Liter-Formelrennwagens<br />
in Tripolis. Hermann Lang wird<br />
im September des <strong>Jahre</strong>s Europameister<br />
und Deutscher Bergmeister. Im Herbst<br />
feiert der großartige Rudolf Caracciola<br />
sein 25jähriges Jubiläum als Rennfahrer<br />
bei der Daimler-<strong>Benz</strong> AG.<br />
… was noch geschah<br />
1939 – 1948<br />
11<br />
• Die deutsche Fußballnationalmannschaft<br />
trägt am 22. November 1942<br />
ihr vorerst letztes Spiel aus. Sie<br />
gewinnt gegen die Slowakei mit 5:2.<br />
Das nächste Länderspiel findet erst<br />
1950 in Stuttgart gegen die Schweiz<br />
statt. Deutschland gewinnt 1:0 durch<br />
Handelfmeter.<br />
• Christl Schulz kommt beim Weitsprung<br />
als erste Frau über sechs<br />
Meter. In Berlin stellt sie am 30. Juli<br />
1939 mit 6,12 Meter einen neuen<br />
Weltrekord auf.<br />
• Im noblen Schweizer Wintersportort<br />
Sankt Moritz beginnen am 30. Januar<br />
1948 – erstmals nach 1936 – die<br />
Olympischen Winterspiele.<br />
• Mit dem Einmarsch der Deutschen<br />
Wehrmacht in Polen am 1. September<br />
1939 beginnt der Zweite Weltkrieg.<br />
• Amerikaner, Kanadier und Briten landen<br />
am 6. Juni 1944 in der Normandie.<br />
Die Invasion (D-Day) beginnt.<br />
• Der Zweite Weltkrieg endet am 8. Mai<br />
1945 mit der bedingungslosen Kapitulation<br />
aller deutschen Streitkräfte<br />
zu Lande, zu Wasser und in der Luft.<br />
• In San Francisco wird am 26. Juni<br />
1945 mit Unterzeichnung der UN-<br />
Charta die UNO offiziell gegründet.<br />
• Am 17. Juli 1946 wird das Land<br />
Nordrhein-Westfalen gegründet.<br />
Hauptstadt wird Düsseldorf.<br />
• Der amerikanische Posaunist Glenn<br />
Miller nimmt am 1. August 1939 den<br />
Titel „In the Mood“ auf und schafft<br />
damit einen Millionenhit.<br />
• Der Grafiker und Maler Paul Klee<br />
stirbt am 29. Juni 1940. Er gehörte<br />
zum Künstlerkreis „Blauer Reiter“.<br />
• Hermann Hesse erhält am 14.<br />
November 1946 den Nobelpreis für<br />
Literatur. Er ist in diesem Jahr der<br />
einzige Preisträger, der nicht aus den<br />
USA stammt.<br />
•<br />
Die Währungsreform vom 20. Juni<br />
1948 gewährt jedem Bürger der Westzonen<br />
40 DM.<br />
• In Lhasa wird am 22. Februar 1940<br />
der erst fünf <strong>Jahre</strong> alte Tenzin Gyatso<br />
als neuer Dalai Lama inthronisiert.<br />
•<br />
60 Prozent der bayerischen Eltern<br />
sprechen sich im Juni 1947 für die<br />
Wiedereinführung der Prügelstrafe<br />
aus.
12 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Von Rosemarie Nitribitt,<br />
Willi Daume und Konrad Adenauer<br />
Nach den guten Erfolgen nach der<br />
Wiederaufnahme des Verkaufs erhält die<br />
<strong>Niederlassung</strong> im November 1949 den<br />
Auftrag, ein geeignetes Grundstück in<br />
guter Verkehrslage zu suchen. Man wird<br />
schnell fündig und kauft im Oktober 1950<br />
einige unbebaute Grundstücke zwischen<br />
Rheinlanddamm und Wittekindstrasse.<br />
Hier ist ein Schnittpunkt zweier wichtiger<br />
Verkehrswege und ein Tor zur Stadt.<br />
Auch das Reparaturgeschäft legt ständig<br />
zu und ermöglicht die Wiedereinführung<br />
der 48-Stunden-Woche. Am <strong>Jahre</strong>sende<br />
1950 ist die Belegschaft bereits auf 82<br />
Mitarbeiter gewachsen. Die Internationale<br />
Automobilausstellung (IAA) in<br />
Frankfurt im April 1951 beflügelt den<br />
Verkauf, und die Absatzzahlen erreichen<br />
neue Rekordhöhen. 1952 verkauft die<br />
<strong>Niederlassung</strong> 1.975 PKW und 722 LKW.<br />
Allerdings erfordert der Neuwagenverkauf<br />
zunehmend auch die Rücknahme von Alt-<br />
fahrzeugen. Bisher wurden Gebrauchtfahrzeuge<br />
von Neukunden nur in Kommission<br />
weiterverkauft, nun wird ein Festpreis als<br />
Inzahlungnahme eingeführt.<br />
Die guten Geschäftszahlen unterstützen<br />
den Beschluss zum Bau einer neuen<br />
<strong>Niederlassung</strong> an der Wittekindstrasse.<br />
Somit ist die <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
die erste, die nach dem Krieg in einen<br />
kompletten Neubau zieht. Insbesondere<br />
die Werkstatt soll neueste Erkenntnisse<br />
optimaler Arbeitsabläufe umsetzen, um<br />
zeit- und kostensparende Reparaturen und<br />
Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Im Jahr<br />
1953 werden immerhin 8.603 PKW und<br />
2.055 LKW repariert oder gewartet.<br />
Am 18. Mai 1953 ist Baubeginn, und der<br />
Richtkranz hängt im September. Auf ein<br />
Richtfest wird verzichtet. Stattdessen<br />
erhalten die am Bau beteiligten Arbeiter<br />
eine Barvergütung. 64 Angestellte<br />
und 91 Arbeiter bilden<br />
Ende 1953 die Belegschaft.<br />
Der Neubau wird am 23. Juni<br />
1954 feierlich eingeweiht und<br />
in Betrieb genommen. Reparaturhalle,<br />
Schau- und Kundendiensträume setzen<br />
neue Maßstäbe für die Kunden und<br />
Mitarbeiter, die die <strong>Niederlassung</strong> sofort<br />
gut annehmen. Auch der wirtschaftliche<br />
Erfolg wird davon beflügelt: Ende 1954<br />
umfasst die Belegschaft 246 Mitarbeiter,<br />
davon 36 im Verkauf.<br />
Um über das Stadtgebiet von <strong>Dortmund</strong><br />
hinaus präsent zu sein und der<br />
boomenden Region gerecht zu werden,<br />
entscheidet <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> sich im<br />
November 1957 zum Ankauf von über<br />
3.000 Quadratmeter Gewerbeflächen<br />
in Unna. Dort soll in Zukunft ein neuer<br />
Zweigbetrieb die Kunden in der Region<br />
betreuen.<br />
Das wiederhergestellte Werk in Sindelfingen<br />
erreicht im Februar 1949 erstmals<br />
nach dem Kriege eine Monatsproduktion<br />
von 1.000 PKW. Nachdem die erste<br />
Wiederaufbauphase beendet ist, werden<br />
im April 1951 auf der Internationalen<br />
Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt<br />
die beiden Sechszylinder-PKW Typ 220<br />
und Typ 300 vorgestellt. Da<br />
sich Prominente aus Politik<br />
und Industrie und auch der<br />
erste Bundeskanzler mit<br />
dem Typ 300 chauffieren
1949 bis 1958<br />
ließen, wird der 300er im Volksmund<br />
später „Adenauer-Wagen“ genannt. Eines<br />
der erfolgreichsten Fahrzeuge dieser Zeit<br />
kommt im September 1953 auf den Markt:<br />
Der Typ 180 ist der erste <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
mit selbsttragender Karosserie in Pontonform.<br />
1954 ein weiterer Meilenstein in der<br />
Automobilgeschichte: Der Mythos SL wird<br />
in New York geboren. Dort präsentieren<br />
die Stuttgarter im Februar 1954 auf<br />
der „International Motor Sports Show“<br />
gleich zwei der heute längst legendären<br />
SL-Modelle: Das Flügeltürer-Coupé 300<br />
SL und den offenen 190 SL. Der 300<br />
SL begeistert das Publikum mit seinen<br />
markanten „Gullwings“ und dem Temperament<br />
eines reinrassigen Rennsportwagens.<br />
215 PS leistet der 300 SL-Motor, der<br />
als erster Viertaktmotor serienmäßig mit<br />
einer Bosch Einspritzanlage ausgestattet<br />
ist. Die Serienproduktion beginnt im<br />
August 1954 (300 SL), im Mai 1955 läuft<br />
der 190 SL vom Band. Von den 1.000 bis<br />
Ende 1956 gebauten <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 300<br />
SL werden 930 ins Ausland verkauft.<br />
Zwei aber bleiben im Land: Der 190 SL der<br />
Frankfurter Edel-Prostituierten Rosemarie<br />
Nitribitt und der Renner von Willi Daume,<br />
dem späteren Präsidenten des Nationalen<br />
Olympischen Komitees. Daume, der eine<br />
Eisengießerei im <strong>Dortmund</strong>er Hafen<br />
Auferstehung: Die neue Ära der Silberpfeile beginnt.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 180 mit der Ponton-Karosserie von 1953.<br />
betrieb, blieb <strong>Dortmund</strong> sein Leben lang<br />
treu – und damit auch der <strong>Niederlassung</strong>,<br />
die seinen Wagen betreute.<br />
Im Juli 1954 engagiert sich die Daimler-<br />
<strong>Benz</strong> AG wieder im Formel-1-Rennsport<br />
und beginnt mit einem Paukenschlag:<br />
Der erste Einsatz des neuen W 196 beim<br />
GP von Frankreich in Reims bringt einen<br />
Doppelsieg von Juan Manuel Fangio<br />
und Karl Kling. Fangio wird Formel-1-<br />
Weltmeister der <strong>Jahre</strong> 1954 und 1955<br />
und <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> gewinnt die Markenweltmeisterschaft<br />
1955. Zum <strong>Jahre</strong>sende<br />
1955 beschließt die Daimler-<strong>Benz</strong> AG,<br />
sich aus dem Grand-Prix-Rennsport zu<br />
verabschieden.<br />
Der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> SL Roaster von Willi Daume<br />
wurde . von der <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> betreut.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1949 – 1958<br />
13<br />
In einem Kampf um die Deutsche<br />
Boxmeisterschaft schlägt Peter Müller<br />
am 8. Juni 1952 den Ringrichter k.o.<br />
Das Wunder von Bern: Die Deutsche<br />
Fußballnationalmannschaft besiegt<br />
am 4. Juli 1954 im Wankdorfstadion<br />
die hoch favorisierten Ungarn mit 3:2<br />
und wird Weltmeister.<br />
Im Olympiastadion von Berlin besiegt<br />
am 24. Juni 1956 Borussia <strong>Dortmund</strong><br />
vor 70.000 Zuschauern den Karlsruher<br />
SC mit 4:2 und wird Deutscher<br />
Meister. Im Jahr darauf gelingt die<br />
erneute Deutsche Meisterschaft mit<br />
der identischen Aufstellung. Der HSV<br />
wird mit 4:1 besiegt.<br />
Durch die feierliche Verkündigung<br />
des Grundgesetzes am 23. Mai 1949<br />
tritt dieses in Kraft.<br />
Am 2. Oktober 1954 beschließt die<br />
Außenministerkonferenz in London<br />
die Aufnahme Deutschlands in die<br />
NATO.<br />
Sechs Staaten unterschreiben am<br />
25. März 1957 in Rom den EWG-Vertrag,<br />
heute als Europäische Union<br />
(EU) bekannt.<br />
Der Film „Die Sünderin“ mit<br />
Hildegard Knef sorgt im Januar 1951<br />
für einen Skandal. Der Streifen zeigt<br />
einige Nacktszenen und wird zum<br />
Kassenschlager.<br />
Der Rock’n-Roll-Star Elvis Presley<br />
wird am 24. März 1958 zur Armee<br />
eingezogen und absolviert nach der<br />
Grundausbildung seinen Dienst in<br />
Deutschland.<br />
Bundespräsident Heuss eröffnet am<br />
19. April 1951 die erste Internationale<br />
Automobilausstellung (IAA) in<br />
Frankfurt.<br />
In Deutschland sind am 1. Dezember<br />
1958 eine Million Fernseher zugelassen.<br />
Am 29. Mai 1953 schaffen der Neuseeländer<br />
Edmund Hillary und sein<br />
Sherpa Tenzing Norgay die Erstbesteigung<br />
des Mount Everest.<br />
Der Bundestag beschließt am<br />
11. Oktober 1956 die Einführung<br />
einer Verkehrssünderkartei zum<br />
2. Januar 1958.
14 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Béla Barényi und<br />
Innovation als Tradition<br />
Die <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> entwickelt<br />
sich in diesen <strong>Jahre</strong>n zu einer über die<br />
Grenzen hinaus bekannten Anlaufstelle<br />
für Freunde der Marke <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>.<br />
Das so genannte „Wirtschaftswunder“<br />
nimmt unaufhaltsam seinen Lauf und<br />
beschert dem neuen Standort ständig neue<br />
Kunden und steigende Verkaufszahlen.<br />
Die Bedeutung dieser <strong>Niederlassung</strong> als<br />
zentraler Verkaufsstandort geht weit<br />
über das Stadtgebiet hinaus und reicht<br />
vom Münster- und Sauerland bis nach<br />
Ostwestfalen. Nach kurzer Bauphase<br />
öffnet am 13. März 1961 der Zweigbetrieb<br />
in Unna mit etwa 30 Mitarbeitern seine<br />
Tore für die Kunden. Im Mai 1964 folgt<br />
Wirtschaftswunderzeit: Handwäsche in der <strong>Niederlassung</strong>.<br />
der Zweigbetrieb in Lünen, der mit 37<br />
Mitarbeitern beginnt.<br />
Die 60er <strong>Jahre</strong> werden geprägt durch<br />
eine Reihe von Neuentwicklungen der<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG. Fast im <strong>Jahre</strong>s-Rhythmus<br />
bringt das Werk neue Modelle in<br />
die Verkaufsräume. Den Journalisten<br />
werden im August 1959 die neuen Sechszylindertypen<br />
220, 220 S und 220 SE<br />
mit Heckflossenkarosserie vorgestellt.<br />
Diese Typenreihe bringt Daimler-<strong>Benz</strong> die<br />
Marktführerschaft in der oberen Mittelklasse.<br />
Auf der Internationalen Automobil<br />
Ausstellung (IAA) in Frankfurt 1961 zeigt<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> die neuen PKW-Typen<br />
190, 190 D, das neue 220 SE Cabriolet<br />
sowie den 300 SE. Alle neuen Modelle<br />
sind mit neuen Motoren bestückt. 1962<br />
folgen im März die Typen 300 SE Coupé<br />
und das Cabriolet.<br />
Ein Meilenstein im Sportwagenbau gelingt<br />
im März 1963 mit der Vorstellung des<br />
230 SL auf dem Genfer Automobilsalon.<br />
Mit seinem charakteristischen Pagodendach<br />
löst er die Typen 190 SL und 300 SL<br />
ab. Erstmals verfügt ein Sportwagen<br />
über eine Sicherheitskarosserie, die<br />
von Béla Barényi entwickelt wurde. Der<br />
geniale Konstrukteur bringt noch eine<br />
Vielzahl von Neuerungen, sodass er<br />
schließlich in Deutschland bis heute als<br />
„Sicherheitspapst“ gilt. Auf der IAA 1963<br />
debütierte der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 600, das<br />
repräsentative Spitzenmodell. Die knapp<br />
zwei Meter breite und 5,54 Meter lange<br />
Limousine, in der Pullman- und sechstürigen<br />
Version 6,24 Meter lang, ist heute<br />
noch eine eindrucksvolle Erscheinung und<br />
für viele der Inbegriff der repräsentativen<br />
Staatskarosse. Beim 600 wurde Wert auf<br />
innere Schlichtheit gelegt. Man konnte<br />
aus mehreren Holzarten, wie zum Beispiel<br />
Walnuss-Wurzelholz oder schlichtem<br />
Furnier wählen. Jedes Auto wurde speziell<br />
für den Besteller gefertigt, sodass es kaum<br />
zwei gleiche Exemplare geben dürfte.<br />
Geld hat <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> mit dem 600er<br />
nie verdient. 1964 kostete der 600er<br />
mit Luftfederung, Automatikgetriebe,<br />
Servolenkung und Servobremsen ab<br />
56.500 DM, und darin enthalten waren
1959 bis 1968<br />
allein 37.000 DM Entwicklungskosten. So<br />
war der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 600 über seine<br />
gesamte Bauzeit stets ein Zuschussgeschäft,<br />
das Daimler-<strong>Benz</strong> vor allem aus<br />
Imagegründen betrieb.<br />
Im Januar 1968 wurde in Hockenheim<br />
die „Neue <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Generation“<br />
vorgestellt. Die neue Mittelklasse-Baureihe<br />
mit den Typen 200 D, 220 D und<br />
den <strong>Benz</strong>inern 200, 220 sowie 230 und<br />
250 sollte die Erfolgsreihe der Stuttgarter<br />
werden. Diese Baureihe wird später im<br />
Schon in den 50er <strong>Jahre</strong>n begann<br />
man bei Daimler-<strong>Benz</strong> frühzeitig mit<br />
der Unfallforschung. Systematische<br />
Crashtest beginnen 1959 vorerst noch<br />
unter freiem Himmel. Professor Béla<br />
Barényi, der seit 1939 in der Vorentwicklung<br />
bei der Daimler-<strong>Benz</strong> AG tätig<br />
war, schuf mit seinen 2.500 Patenten<br />
die Voraussetzung für die Entwicklung<br />
der passiven Sicherheit im Automobilbau.<br />
Er entwickelte früh Visionen mit<br />
zukunftsweisenden Karosserieentwürfen.<br />
So entstanden die Sicherheitskarosserie<br />
mit stabiler Fahrgastzelle und<br />
Knautschzonen (1951), die Sicherheitslenksäule<br />
und das Sicherheitslenkrad<br />
mit Pralltopf (1963). 1978 wird das<br />
gemeinsam mit Bosch entwickelte<br />
Anti-Blockier-System (ABS) serienreif<br />
und ist zunächst in den Limousinen der<br />
Zuschussgeschäft und Technologieträger: Der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 600.<br />
Die Innovationsfabrik<br />
Volksmund als „Strich Acht“ bezeichnet,<br />
ein Typenzusatz, der auf das Erscheinungsjahr<br />
der Baureihe hinweisen soll.<br />
Im Motorsport konzentriert sich das Werk<br />
auf Unterstützung des Rallye-Sports und<br />
auf die Tourenwagen-Meisterschaften. So<br />
holt ein Privatteam im Januar 1960 den<br />
ersten Gesamtsieg bei der Rallye Monte<br />
Carlo mit einem 220 SE. Ebenfalls auf<br />
einem 220 SE gewinnt <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> im<br />
November 1964 den Großen Straßenpreis<br />
von Argentinien für Tourenwagen.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> S-Klasse auf den Markt<br />
gebracht. Heute ist ABS weltweit eine<br />
serienmäßige Selbstverständlichkeit.<br />
Airbag und Elektronisches Stabilitäts-Programm<br />
(ESP) sind ebenfalls<br />
Erfindungen der Marke <strong>Mercedes</strong>.<br />
Mit dem vorausschauenden Pre-Safe-<br />
System, dem Nachtsichtassistenten,<br />
dem Ermüdungswarner und weiteren<br />
technischen Details ist die Daimler-<strong>Benz</strong><br />
AG auch heute noch Schrittmacher auf<br />
dem Gebiet der Fahrzeugsicherheit.<br />
Die Evolution in alternative Antriebe<br />
und Kraftstoffe wird weiter zielstrebig<br />
verfolgt. Der Umweltgedanke findet in<br />
den neuen BlueTec-Modellen mit abgasärmeren<br />
Fahrzeugen seinen Raum und<br />
wird weiter entwickelt. So wurde bei<br />
der Daimler-<strong>Benz</strong> AG Innovation schon<br />
frühzeitig als Tradition verstanden.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1959 – 1968<br />
15<br />
Der Deutsche Fußball Bund beschließt<br />
am 3. Oktober 1962 die Bildung einer<br />
aus 16 Vereinen bestehenden Fußball<br />
Bundesliga, die in der Saison 63/64<br />
den Betrieb aufnehmen soll.<br />
Marika Kilius und Hans-Jürgen<br />
Bäumler erringen am 28. März 1963<br />
in Cortina d`Ampezzo die Weltmeisterschaft<br />
im Eiskunstlauf der Paare.<br />
Im letzten Endspiel um die Deutsche<br />
Fußballmeisterschaft gewinnt am<br />
29. Juni 1963 Borussia <strong>Dortmund</strong><br />
gegen den 1. FC Köln mit 3:1.<br />
Borussia <strong>Dortmund</strong> gewinnt am<br />
5. Mai 1966 als erste deutsche Mannschaft<br />
einen Europapokal. Durch<br />
einen 2:1 Sieg gegen den FC Liverpool<br />
holt der BVB im Hampden Park in<br />
im schottischen Glasgow Cup der<br />
Pokalsieger.<br />
Mauerbau: Am 13. August 1961 wird<br />
der Ostsektor von Berlin mit Stacheldraht,<br />
Sperrzäunen, Betonteilen und<br />
einem großen Aufgebot an Volkspolizisten<br />
abgeriegelt.<br />
Der amerikanische Präsident John F.<br />
Kennedy wird am 22. November 1963<br />
in Dallas erschossen.<br />
In Kassel eröffnet am 11. Juli 1959<br />
die documenta II. Sie zeigt zeitgenössische<br />
Kunst der Nachkriegszeit.<br />
Am 1. April 1963 nimmt das Zweite<br />
Deutsche Fernsehen den Sendebetrieb<br />
auf.<br />
Das Deutsche Fernsehen beginnt am<br />
25. August 1967 als erstes europäisches<br />
Land mit der regelmäßigen<br />
Ausstrahlung von Sendungen in<br />
Farbe.<br />
In Neckarsulm stellt der Ingenieur<br />
Felix Wankel am 24. November 1959<br />
seinen neuen Kreiskolbenmotor vor.<br />
In <strong>Dortmund</strong> wird am 30. April 1959<br />
die Bundesgartenschau eröffnet.<br />
Der sowjetische Major Juri Gagarin<br />
umkreist am 12. April 1961 als erster<br />
Mensch im Weltall mit einem Raumschiff<br />
die Erde.<br />
Die Gentlemen bitten zur Kasse:<br />
Bei einem Überfall auf den Postzug<br />
von Glasgow nach London am 8.<br />
August 1963 erbeuten die Täter die<br />
Rekordsumme von umgerechnet 28,5<br />
Millionen Mark.
16 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Der W123 und<br />
ein Massen-Phänomen<br />
Seit Beginn der Kohlekrise im Jahr 1958<br />
befindet sich das Ruhrgebiet in einer<br />
anhaltenden Phase des Strukturwandels.<br />
Zechen und auch Brauereien verschwinden<br />
nach und nach aus <strong>Dortmund</strong>. Für die<br />
verbleibende Wirtschaft heißt es, sich auf<br />
die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen.<br />
Die <strong>Niederlassung</strong> in <strong>Dortmund</strong><br />
verdichtet und verbessert Ende der 60er<br />
<strong>Jahre</strong> das Kundendienstnetz und erweitert<br />
es in den 70er <strong>Jahre</strong>n erheblich. Mehr<br />
als 5.000 Pkw und Nutzfahrzeuge (neu<br />
und gebraucht) werden hier jährlich an<br />
die Kunden übergeben. Im Gesamtgebiet<br />
der <strong>Niederlassung</strong> beträgt der Neuwagenabsatz<br />
9.000 Personenwagen und 4.000<br />
Nutzfahrzeuge im Jahr.<br />
Das Jahr 1978 setzt eine weitere<br />
Landmarke an der Wittekindstrasse.<br />
Die <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> bekommt<br />
ein neues Verkaufsgebäude mit einer<br />
Ausstellungsfläche von ca. 5.000 Quadratmeter<br />
und wird damit der immer noch<br />
steigenden Nachfrage nach hochwertigen<br />
Fahrzeugen gerecht. Inzwischen arbeiten<br />
in <strong>Dortmund</strong> 600 Mitarbeiter, davon 450<br />
im Servicebereich, im Zeichen des Sterns.<br />
Das Grundstück ist 58.000 Quadratmeter<br />
groß und die bebaute Fläche beträgt<br />
24.000 Quadratmeter. Allein die Werkstatt<br />
belegt rund 11.000 Quadratmeter.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> konzentriert<br />
sich in dieser Zeit<br />
auf<br />
die Entwicklung von Experimentalfahrzeugen.<br />
Dabei stehen Versuche mit<br />
alternativen Kraftstoffen wie Erdgas und<br />
Strom und Entwicklungen zur Erhöhung<br />
der Sicherheit ganz oben auf der Liste der<br />
Prioritäten. Im Dezember 1970 stellt man<br />
das gemeinsam mit Teldix entwickelte<br />
Antiblockiersystem (ABS) der ersten<br />
Generation vor und meldet im Oktober<br />
1971 das Airbag-System zum Patent an.<br />
Im September 1972 wird die Tradition der<br />
Oberklasse durch Vorstellung der neuen<br />
Baureihe W116 fortgesetzt. Die Modelle<br />
280 S, 280 SE und 350 SE heißen jetzt<br />
auch offiziell S-Klasse und werden fast<br />
auf der Stelle als Synonym für technische<br />
Spitzenklasse, Fahrleistung, Ausstattung,<br />
Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit<br />
verstanden. Damals wie heute werden<br />
viele richtungweisende technische<br />
Innovationen in der S-Klasse erstmals<br />
dem allgemeinen Publikum zugänglich<br />
gemacht wie zum Beispiel ABS, Airbags<br />
oder der Bremsassistent. Bis<br />
heute dient die S-Klasse mit<br />
jeder neuen Generation<br />
als Technologieträger<br />
und nimmt eine Vorreiterrolle im<br />
Automobilbau ein.<br />
Die neue Baureihe W123 wird im Januar<br />
1976 der Öffentlichkeit gezeigt. Der W123<br />
soll besonders den Privatkunden der<br />
oberen Mittelschicht ansprechen – was<br />
er auch tat. Die Lieferzeiten beim neuen<br />
W123 betrugen bis zu drei <strong>Jahre</strong> an, was<br />
dazu führte, dass für Kaufverträge von<br />
Neuwagen teilweise mehr als 5.000 Mark<br />
über Listenpreis bezahlt wurde, um<br />
schneller an das begehrte Modell zu<br />
kommen. Auch <strong>Jahre</strong>swagen wurden mit<br />
Preisaufschlägen weiterverkauft. Dies<br />
hat sich in der westdeutschen Automobilgeschichte<br />
bei Großserienfahrzeugen<br />
bis heute nicht wiederholt. Ein weiterer<br />
Beleg für den Riesenerfolg der Baureihe<br />
ist die Tatsache, dass der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
W123 als einziges Fahrzeug den VW<br />
Golf von Platz 1 der Zulassungsstatistik<br />
W123 Coupé<br />
W123 Limousine<br />
Millionen-Seller mal drei.<br />
W123 T-Modell
1969 bis 1978<br />
Standpunkte:<br />
Wittekindstraße (rechts),<br />
IWO-Hochhaus (unten)<br />
und die Werkstatt<br />
verdrängen konnte: 1980 erreichte<br />
der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> W123 genau<br />
202.252, der VW Golf nur 200.892<br />
Zulassungen. Die Baureihe W123<br />
wurde – erstmals bei <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> – in drei Karosserievarianten<br />
hergestellt: als klassische Limousine<br />
mit Stufenheck, als Coupé<br />
mit leicht verkürztem Radstand und als<br />
T-Modell.<br />
Der <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> C 111 mit Dreischeiben-Wankelmotor<br />
wird auf der IAA 1969<br />
gezeigt, im März 1970 wird er bereits von<br />
seinem Nachfolger, dem C 111 mit Vierscheiben-Wankelmotor<br />
abgelöst. Dieses<br />
„rollende Versuchslabor“ beschleunigt von<br />
0 auf <strong>100</strong> km/h in atemberaubenden 4,8<br />
Sekunden. Die weiterentwickelten Brüder<br />
des C 111 erringen Bestleistungen und<br />
Weltrekorde am laufenden Band. So erzielt<br />
der C 111-II mit einem 190 PS starken<br />
Dieselmotor nach 64 Stunden Rekordfahrt<br />
auf dem Hochgeschwindigkeitsoval im<br />
italienischen Nardo im 12. Juni 1976 drei<br />
Weltrekorde und 16 Klassenrekorde.<br />
Der Motorsport hat in diesen <strong>Jahre</strong>n nur<br />
eine untergeordnete Bedeutung. Zwar<br />
belegen private Teams mit <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> Fahrzeugen Top-Platzierungen bei<br />
Straßenrennen, so gibt es im August 1978<br />
einen Fünffach-Erfolg beim großen Straßenpreis<br />
von Argentinien. Erst Ende der<br />
70er <strong>Jahre</strong> besinnt sich die Daimler-<strong>Benz</strong><br />
AG auf ihre Motorsporterfolge zurück und<br />
startet mit der Werksunterstützung im<br />
Rallye-Sport.<br />
Ab 1972 heißt die <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> S-Klasse auch offiziell S-Klasse.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1969 – 1978<br />
Deutschland wird im Endspiel gegen<br />
die Niederlande am 7. Juli 1974 Fußballweltmeister.<br />
Thriller in Manila: Muhammad Ali<br />
verteidigt am 1. Oktober 1975 zum<br />
13. Mal den Weltmeistertitel in<br />
Manila gegen Joe Frazier.<br />
Rosi Mittermaier holt am 8. Februar<br />
1976 olympisches Gold im Abfahrtslauf<br />
und am 11. Februar auch noch<br />
Gold im Slalom.<br />
17<br />
Die Handballmannschaft der Bundesrepublik<br />
wird am 5. Februar 1978<br />
Weltmeister.<br />
Gustav Heinemann wird am 5. März<br />
1969 mit nur 6 Stimmen Vorsprung<br />
zum Bundespräsidenten gewählt.<br />
Willy Brandt wird am 21. Oktober<br />
1969 zum Bundeskanzler gewählt.<br />
Andreas Baader und andere Bandenmitglieder<br />
werden am 2. Juni 1972 in<br />
Frankfurt verhaftet.<br />
Durch Ölknappheit nach der Nahostkrise<br />
kommt es am 25. November<br />
1973 zum ersten von drei autofreien<br />
Sonntagen in Deutschland.<br />
Paul McCartney gibt am 10. April<br />
1970 die endgültige Trennung von<br />
den Beatles bekannt. Die erfolgreichste<br />
Gruppe aller Zeiten existiert<br />
nicht mehr.<br />
Die Stadt Mainz erwirbt bei einer<br />
Auktion in New York im April 1978<br />
eine Gutenbergbibel für vier Millionen<br />
Mark.<br />
Am 2. März 1969 findet der Jungfernflug<br />
des französisch-englischen Überschall-Verkehrsflugzeugs<br />
„Concorde“<br />
statt.<br />
US-Astronaut Neil A. Armstrong<br />
betritt am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr<br />
MEZ als erster Mensch den Mond.<br />
Die Deutsche Bundesbahn startet am<br />
26. September 1971 den Intercity-<br />
Verkehr zwischen 33 Großstädten.<br />
Die US-Raumfähre „Space-Shuttle“<br />
besteht am 12. August 1977 ihren<br />
ersten freien Testflug.<br />
In der Schweiz wird im Februar 1971<br />
das Frauenstimmrecht eingeführt.<br />
Im Alter von 42 <strong>Jahre</strong>n stirbt am 16.<br />
August 1977 „The King“ Elvis Presley<br />
an einer Herzattacke.
18 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Der erste „Baby-<strong>Benz</strong>“ und<br />
Strukturwandel auf allen Ebenen<br />
Die Infrastruktur in der durch Zechenschließungen<br />
und Stilllegung von<br />
Hoch öfen negativ geprägten Region im<br />
östlichen Ruhrgebiet hat sich mittlerweile<br />
ernorm verbessert. Durch die Fertigstellung<br />
der Autobahnen A44 (<strong>Dortmund</strong><br />
– Kassel) und der A45 (Sauerlandlinie)<br />
eröffnen sich neue Absatzmärkte im<br />
Umland. Der Strukturwandel setzt<br />
seine ersten positiven Zeichen, auch<br />
durch Gründung des Technologieparks<br />
<strong>Dortmund</strong> im Jahr 1988 auf dem Universitätsgelände.<br />
Hier wird jungen Unternehmen<br />
aus der High-Tech-Branche eine<br />
Startmöglichkeit geboten. 1980 beginnt<br />
die <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-<strong>Niederlassung</strong> in Unna<br />
mit einem neuen Zweigbetrieb und baut<br />
1986 ein neues Verkaufshaus.<br />
In der <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> wird<br />
das Service-Angebot deutlich erweitert.<br />
Wartung und Instandsetzung, Pflege und<br />
Reparatur, Lackierung, Untersuchung und<br />
Abnahmen umfasst das Komplett-Angebot.<br />
Diesem verbesserten Angebot wird ebenfalls<br />
das Ersatzteillager angepasst. 45.000<br />
unterschiedliche Positionen werden vorgehalten,<br />
um die Reparaturdauer so gering<br />
wie nötig zu halten. Damit die Qualität in<br />
der Verwaltung und im Servicebereich<br />
auch in Zukunft gewährleistet bleibt,<br />
bildet <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> in <strong>Dortmund</strong> jedes<br />
Jahr etwa <strong>100</strong> junge Leute aus.<br />
Die lange Tradition der Geländefahrzeuge<br />
setzt die Daimler-<strong>Benz</strong> AG 1979 mit der<br />
Einführung der G-Klasse fort. Gemeinsam<br />
entwickelt von Daimler-<strong>Benz</strong> AG mit Steyr-<br />
Daimler-Puch stehen vier Modelle der<br />
Reihe 460 mit zwei Radständen und fünf<br />
unterschiedlichen Aufbauvarianten zur<br />
Wahl. Bis heute genießt dieser unverwüstliche<br />
Geländewagen die höchste Anerkennung<br />
und Zuneigung seiner Fans, von<br />
denen er eine beachtliche Menge besitzt.<br />
Die Neudefinition der S-Klasse beginnt auf<br />
der Internationalen Automobil Ausstellung<br />
(IAA) in Frankfurt im September 1979. Die<br />
S-Klasse stellt traditionell das Flaggschiff<br />
der guten Sterne aus Schwaben und gilt<br />
als Referenzgröße für die internationale<br />
Luxusklasse. Ebenso debütiert der Typ<br />
300 TD Turbodiesel. Im März 1980 folgen<br />
auf dem Automobilsalon in Genf die neuen<br />
Typen 380 SL/SLC und 500 SL/SLC mit<br />
Achtzylinder-Leichtmetallmotoren.<br />
Im Dezember 1982 ergänzt die Daimler-<br />
<strong>Benz</strong> AG das Pkw-Programm mit der<br />
Kompaktklasse um eine völlig neue<br />
Baureihe. Der 190, im Volksmund liebevoll<br />
„Baby-<strong>Benz</strong>“ genannt, erweitert die<br />
Produktpalette und setzt neue Maßstäbe<br />
auf dem Gebiet des Fahrkomforts und der<br />
Fahrpräzision. Erreicht wird das durch<br />
Einstieg in eine neue Klasse: <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> 190, der erste „Baby-<strong>Benz</strong>“.
1979 bis 1988<br />
eine neue Dämpferbein-Vorderachse und<br />
ein neues Hinterachskonzept in Form der<br />
patentierten <strong>Mercedes</strong>-Raumlenker-Achse.<br />
Baby‘s Face passte nicht nur perfekt zur<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-Familie, es zeigte auch<br />
jene zeitlos-klassischen Linien, die den<br />
Betrachter zwar nicht auf den ersten<br />
Blick umwerfen, die man sich dafür aber<br />
auch zehn <strong>Jahre</strong> später noch wohlgefällig<br />
anschauen kann. Genau dies gilt auch<br />
für die neu entwickelte Generation der<br />
E-Klasse, die Typenreihe W124 mit<br />
den Modellen 200 D bis 300 E, die im<br />
November 1984 in Sevilla vorgestellt und<br />
im Dezember zu den Händlern kommen.<br />
Sie unterstreichen die Kompetenz der<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG im mittleren und<br />
höheren Fahrzeugsegment. Im März 1987<br />
folgen die Coupés 230 CE und 300 CE.<br />
Bei der Bandama-Rallye Elfenbeinküste<br />
1979 erringen die Fahrerteams Mikkola /<br />
Hertz, Waldegaard / Thorszelius, Cowan /<br />
Kaiser und Preston jr. / Doughty einen<br />
grandiosen Vierfachsieg auf Fahrzeugen<br />
vom Typ 450 SLC 5.0. Bei der gleichen<br />
Rallye im Dezember 1980, jetzt offiziell<br />
als „Rallye Cote d´Ivoire“ bezeichnet,<br />
erringen die Teams Waldegaard / Thorszelius<br />
und Recalde / Straimel mit einem 500<br />
SLC einen Doppelerfolg. Damit endet die<br />
Rallyebeteiligung des Werkes. Die Gesamtwertung<br />
der legendären Rallye Paris-Dakar<br />
gewinnt im Januar 1983 ein <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> 280 GE. Bei der LKW-Wertung liegt<br />
ein <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> Allrad-Kipper vom Typ<br />
1936 AK vorn. Im Januar 1988 beschließt<br />
das Werk, sich wieder am Formel-Motorsport<br />
zu beteiligen. Damit wird die dritte<br />
„Silberpfeil-Ära“ eingeleitet.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1979 – 1988<br />
19<br />
Die Deutsche Fußball-Nationalelf wird<br />
am 22. Juni 1980 in Italien Europameister<br />
nach einem 2:1 über Belgien.<br />
Am 12. August 1984 enden die<br />
Olympischen Spiele von Los Angeles.<br />
Zum zweiten Mal nach 1972 gewinnt<br />
Ulrike Meyfarth Gold im Hochsprung.<br />
Sensation in Wimbledon: Der 17-jährige<br />
Boris Becker aus Leimen gewinnt<br />
am 7. Juli 1985 das Endspiel.<br />
In den neun Mitgliedsländern der<br />
Europäischen Gemeinschaft finden<br />
vom 7. – 10. Juni 1979 die ersten<br />
Direktwahlen zum Europäischen<br />
Parlament statt.<br />
Der Deutsche Bundestag wählt am<br />
1. Oktober 1982 Helmut Kohl zum<br />
6. Bundeskanzler der BRD.<br />
Der Beatle John Lennon wird am<br />
8. Dezember 1980 in New York auf<br />
offener Straße erschossen.<br />
Das Gemälde „Schwertlilien“ von<br />
Vincent van Gogh wird am 11.<br />
November 1987 für 90 Millionen DM<br />
versteigert und ist damit das teuerste<br />
Bild der Welt.<br />
Als erster Bundesbürger fliegt am<br />
28. November 1983 der Physiker Ulf<br />
Merbold ins All.<br />
Das Bundeskabinett entscheidet sich<br />
am 19. November 1985 gegen die Einführung<br />
eines generellen Tempolimits<br />
von <strong>100</strong> km/h.<br />
Das Bundeskabinett beschließt am<br />
11. Mai 1988 die Postreform und<br />
macht dadurch den Weg zur Privatisierung<br />
der Bereiche Post, Postbank<br />
und Telekom frei.<br />
In der Bundesrepublik wird am<br />
6. April 1980 erstmals die Sommerzeit<br />
eingeführt. Sie dauert bis Ende<br />
September.<br />
Großbritanniens Thronfolger Charles<br />
heiratet am 29. Juli 1981 in London<br />
Lady Diana Spencer.<br />
Den „Grand Prix Eurovision de la<br />
Chanson” gewinnt am 24. April<br />
1982 die deutsche Sängerin Nicole<br />
Hohloch.
20 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Grenzenlose Kopffreiheit oder:<br />
Ein Kurzer auch für Lange<br />
Das Ende für Kohle und Stahl bedeutet<br />
auch für die <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong> ein<br />
Umdenken und zwingt zur Anpassung<br />
an die neue Situation. Es gilt, auf die<br />
wachsende Logistikbranche zu reagieren<br />
und für Kleintransporter und Lkw stärker<br />
präsent zu sein. So entsteht 1995 am<br />
Niedersachsenweg das Nutzfahrzeug<br />
Gebrauchtwagen Center, heute als Truck-<br />
Store bekannt. Im Jahr 1996 eröffnet die<br />
<strong>Niederlassung</strong> eines der modernsten Nutzfahrzeug-Center<br />
Deutschlands. Verkauf<br />
und Service ziehen in den Neubau am<br />
Sunderweg. Mit Kompetenz und Flexibilität<br />
entspricht das Leistungsangebot den<br />
Bedürfnissen des Transportgewerbes. Um<br />
unproduktive Standzeiten zu vermeiden,<br />
ist die Werkstatt für Nutzfahrzeuge bis<br />
22.00 Uhr geöffnet.<br />
Neue Modelle gibt es en masse: Der SL<br />
debütiert im März 1989 auf dem Genfer<br />
Autosalon. 1991 kommt die S-Klasse auf<br />
den Markt, im Juni 1993 folgt die neue<br />
kompakte C-Klasse, auf den Monat genau<br />
smart fortwo<br />
zwei <strong>Jahre</strong> später sorgt<br />
die vollkommen neu<br />
konstruierte E-Klasse<br />
mit ihren vier Augen<br />
und markantem<br />
Design für Aufsehen.<br />
Auf dem Genfer<br />
Automobil-Salon 1997<br />
feiert die A-Klasse<br />
ihre Weltpremiere,<br />
und im Mai 1997<br />
wird die M-Klasse,<br />
ein großes SUV, in den USA erstmals<br />
gezeigt. Die Kooperation von Swatch® mit<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> bringt im Oktober 1998<br />
das City-Coupé „smart“ auf den Markt.<br />
Das Highlight aber erblickt im April<br />
1996 das Licht der Öffentlichkeit: Der<br />
Roadster SLK wird auf dem Turiner Salon,<br />
traditionell „die“ Messe des europäischen<br />
Auto-Designs, vorgestellt. Vor Ort beginnt<br />
das Gedränge bereits eine halbe Stunde<br />
vor der Weltpremiere der drei Versalien<br />
„SLK“, und wer sich mutig in das interna-<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> SLK<br />
tionale Geschiebe hineinbegab, der wurde<br />
belohnt. Er erlebte die Geburtsstunde<br />
eines neuen Stars. Der Container, in dem<br />
sich der Bolide befand, wurde eröffnet<br />
von Signore Enrico Pedersoli, besser<br />
bekannt als Bud Spencer und langjähriger<br />
Partner von Terence Hill in zahllosen<br />
Action-Filmen. Mika Häkkinen, damals<br />
noch als Formel-1-Pilot in Diensten von<br />
McLaren-<strong>Mercedes</strong>, lenkte den Boliden<br />
aus dem Container heraus auf die Rampe<br />
und hinunter unters Volk der rund<br />
400 Journalisten und Fotografen aus<br />
aller Welt, die sich intensiv des neuen<br />
Sternträgers SLK annahmen.<br />
Der „Kurze“ passte mit seiner grenzenlosen<br />
Kopffreiheit und großzügigen<br />
Sitzposition perfekt auch für Lange.<br />
Erinnerungen an die glorreichen 50er und<br />
60er <strong>Jahre</strong> weckten sehr markant die weiß<br />
unterlegten Skalen und schwarzen Ziffern<br />
der chromberingten Rundinstrumente.<br />
Auch die Schalter für Heizung und Klimaanlage<br />
drehten sich auf einem weißen Skalenkranz.<br />
Kein Stilbruch trübte die reine<br />
Freude, denn all diese instrumentarischen<br />
Memorabilia kann man sich damals wie<br />
heute nicht nur in dem üblichen grauen<br />
Kunststoff moderner Interieurs, sondern<br />
auch in Leder beinahe jedweder Couleur<br />
ordern. Motto: Farbig sei der Innenraum,<br />
ledern und voll moderner, doch nostalgischer<br />
Perfektion. Das Verdecksystem,<br />
das die Schwaben „Vario-Dach“ getauft<br />
haben, funktionierte geradezu genial.
1989 bis 1998<br />
Das Hardtop steckte platzsparend und<br />
elektrisch aktivierbar im Kofferraum.<br />
Per Knopfdruck durchlebt der SLK in<br />
25 Sekunden die Metamorphose vom<br />
wetterfesten Coupé zur offenen Schönheit<br />
mit grenzenloser Kopffreiheit. Zwischen<br />
und auf die beiden kleinen Überrollbügel<br />
hinter den Kopfstützen passt das<br />
Windschott, das wie ein Nylonstrumpf<br />
aus seinem Versteck herausgezogen und<br />
einfach übergestreift wird.<br />
Zwei bekannte Motoren bot <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong> für den SLK damals an: den 2,0 Liter<br />
mit 136 PS und den 2,3 Liter Kompressor<br />
mit 193 PS. Die Fahrleistungen beider<br />
SLK genügen den Anforderungen, die<br />
der Roadster-Fan an sein Fahrzeug stellt:<br />
0-<strong>100</strong> km/h in 9,7 bzw. 7,6 Sekunden,<br />
Höchstgeschwindigkeit 208 bzw. 231 km/h.<br />
Außerdem war der SLK der erste<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>, der ohne herkömmliches<br />
Reserverad ausgeliefert wurde: Tirefit, ein<br />
neuartiges Dichtungssystem, das Dunlop<br />
für <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> entwickelte, machte es<br />
möglich. Die neue SLK-Version, die derzeit<br />
auf dem Markt ist, beweist eigentlich nur<br />
eines: Nichts ist so gut,<br />
dass man es nicht noch<br />
besser machen könnte.<br />
Auch sportlich lief es<br />
ordentlich. Die Silberpfeile<br />
der neuen Generation,<br />
die Sauber-<strong>Mercedes</strong> C9,<br />
errangen bei dem 24-Stunden-Rennen<br />
von Le Mans<br />
einen Doppelsieg und im selben Jahr<br />
sowohl die Marken- als auch die Fahrerweltmeisterschaft.<br />
Die Unterstützung bei<br />
der Deutschen Touren-Wagen-Meisterschaft<br />
(DTM) zahlte sich für das Werk aus:<br />
Alle drei Podiumsplätze belegen im Jahr<br />
1992 AMG-<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>. Der Champion<br />
heißt Klaus Ludwig, der diesen Erfolg<br />
1994 wiederholt. Im Frühjahr 1994 kehrt<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> nach 40 <strong>Jahre</strong>n in die<br />
Formel-1 zurück und liefert V-10-Motoren<br />
für das Sauber-Team. Im Oktober 1994<br />
wird ein neues Konzept für die Formel-1<br />
vorgestellt – der neue Partner ist McLaren.<br />
Ab 1997 starten die „McLaren-<strong>Mercedes</strong>“<br />
in der Traditionsfarbe Silber, und David<br />
Coulthard und Mika Häkkinen gewinnen<br />
die GPs von Australien (Melbourne),<br />
Italien (Monza) und Europa (Jerez). In die<br />
Formel-1 Saison 1998 startet das McLaren-<br />
<strong>Mercedes</strong>-Team mit zwei Doppelerfolgen<br />
in Australien und Brasilien. Weltmeister<br />
wird Mika Häkkinen mit insgesamt acht<br />
Siegen. Das McLaren-<strong>Mercedes</strong>-Team<br />
erringt die Konstrukteur-Weltmeisterschaft.<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> A-Klasse<br />
<strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> M-Klasse<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
… was noch geschah<br />
1989 – 1998<br />
21<br />
Borussia <strong>Dortmund</strong> wird am 17. Juni<br />
1995 zum ersten Mal nach 32 <strong>Jahre</strong>n<br />
wieder Deutscher Fußballmeister<br />
und wiederholt den Titelgewinn am<br />
18. Mai 1996. Durch ein 3:1 über<br />
Juventus Turin gewinnt der BVB am<br />
28. Mai 1997 die Champions League.<br />
Mit einem Doppelerfolg deutscher Tennisspieler<br />
enden am 9. Juli 1989 die<br />
All-England-Tennismeisterschaften.<br />
Steffi Graf und Boris Becker gewinnen<br />
ihre Endspiele in Wimbledon.<br />
In Rom wird die Deutsche Fußball-<br />
Nationalmannschaft unter Teamchef<br />
Franz Beckenbauer am 8. Juli 1990<br />
Weltmeister. Sie gewinnt gegen<br />
Argentinien mit 1:0.<br />
9. November 1989: Die Deutschen<br />
sind nicht mehr getrennt – Stacheldraht<br />
und Mauer fallen.<br />
Gerhard Schröder wird am 27. Oktober<br />
1998 zum siebten deutschen<br />
Bundeskanzler gewählt.<br />
Die Berliner Philharmoniker wählen<br />
am 8. Oktober 1989 Claudio Abbado<br />
als Nachfolger von Herbert von Karajan<br />
zu ihrem neuen Chefdirigenten.<br />
Durch Ministererlaubnis vom 8. September<br />
1989 wird die Fusion der<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG mit MBB ermöglicht<br />
– die größte Unternehmensfusion in<br />
der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Die Automobilunternehmen Daimler-<strong>Benz</strong><br />
und Chrysler kündigen am<br />
7. Mai 1998 ihre Fusion an. Es ist der<br />
bisher größte Industriezusammenschluss<br />
der Welt.<br />
Unter dem Ärmelkanal gelingt am<br />
22. Mai 1991 der Durchbruch für eine<br />
von zwei Eisenbahnröhren.<br />
In der Bundesrepublik wird am 1. Juli<br />
1993 die vierstellige Postleitzahl<br />
durch eine neue fünfstellige Kombination<br />
abgelöst.<br />
Seit dem 3. November 1996 dürfen<br />
nach Aufhebung des Sonntagsbackverbots<br />
die Bäcker sonntags frische<br />
Brötchen verkaufen.<br />
Die Grünen plädieren in ihrem Wahlprogramm<br />
am 7. März 1998 für eine<br />
Anhebung des <strong>Benz</strong>inpreises auf 5<br />
Deutsche Mark pro Liter im Verlauf<br />
der nächsten 10 <strong>Jahre</strong>.
22 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong><br />
Neue Maßstäbe –<br />
neue <strong>Niederlassung</strong><br />
Der Strukturwandel in der Region <strong>Dortmund</strong><br />
ist fast vollständig vollzogen, und<br />
so bieten sich der <strong>Dortmund</strong>er <strong>Mercedes</strong>-<br />
<strong>Benz</strong>-<strong>Niederlassung</strong> weitere Absatzpotentiale.<br />
Um diese auch tatsächlich erreichen<br />
zu können, beschließt <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong><br />
den Bau eines neuen Verkaufshauses an<br />
der Wittekindstrasse, das auch architektonisch<br />
neue Maßstäbe setzen soll. Im<br />
Herbst 2001 nimmt das hochmoderne<br />
Lack- und Karosseriecenter den Betrieb<br />
auf. Der Startschuss für den Neubau der<br />
<strong>Niederlassung</strong> fällt im September 2002.<br />
Das Richtfest im Rohbau ist am 6. Mai<br />
2003, und nach nur eineinhalbjähriger<br />
Bauzeit zieht die Belegschaft im Juni<br />
2004 in das repräsentative Gebäude ein.<br />
Als vorläufig letztes Schmuckstück der<br />
<strong>Niederlassung</strong> wird 2006 das Smart-Center<br />
eröffnet. Mit einem grandiosen Festakt<br />
begeht <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> am 22. September<br />
2008 das einhundertjährige Bestehen der<br />
<strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong>.<br />
Ohne Klingel, aber mit Stern radeln anno<br />
2000 rund 50 New Yorker Streifenpolizisten<br />
durch die größte Stadt der USA. Dank<br />
einer vorweihnachtlichen Spende der<br />
Stuttgarter können sie ihren Dienst auf<br />
Edel-Fahrrädern mit dem Markenzeichen<br />
von <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> auf dem Rahmen versehen.<br />
Auf Klingeln hat die Polizeiverwaltung<br />
bewusst verzichtet. Die würde im New<br />
Yorker Verkehrslärm sowieso niemand<br />
hören, hieß es zur Begründung. Ansonsten<br />
gilt die Ausstattung als perfekt. Jedes<br />
einzelne der Mountain Bikes wurde in<br />
Handarbeit von dem Daimler-Tochterunternehmen<br />
AMP in Laguna Hills (Kalifornien)<br />
hergestellt. Das dürfte das Selbstwertgefühl<br />
der radelnden „Cops“ heben: Im Laden<br />
beginnen die Preise für die Edel-Bikes bei<br />
1.795 Dollar (rund 4.000 Mark (!). Für<br />
diese Summe müssen untere Dienstgrade<br />
fast einen Monat Streife gehen.<br />
Im Mai 2000 kommt die<br />
dritte Generation der<br />
C-Klasse in die Verkaufsräume,<br />
die mit jugendlich-sportlichemErscheinungsbild<br />
bei hohem<br />
Fahrkomfort und großer<br />
Fahrsicherheit besticht.<br />
Die neue E-Klasse, die<br />
die Baureihe 210 ablöst,<br />
erscheint im März 2002<br />
und ist die mittlerweile<br />
achte Generation. Sieben<br />
Motorisierungen stehen<br />
bei der Neuauflage der<br />
„A-Klasse“ zur Verfügung<br />
– die 3. Generation zeigt<br />
sich im Frühjahr 2008.<br />
S-Klasse und M-Klasse debütieren 2005,<br />
und im Sommer jenes <strong>Jahre</strong>s feiert die<br />
B-Klasse ihre Marktpremiere, und die<br />
IAA 2005 erlebt die Weltpremiere der<br />
R-Klasse. Diese Neuentwicklung vereinigt<br />
die Vorzüge von Limousine, Kombi, Van<br />
und Offroader. Im Frühjahr 2007 steht<br />
die vierte Generation der C-Klasse in<br />
den Verkaufsräumen, die mittlerweile<br />
meistverkaufte Modellreihe. Ebenfalls in<br />
2007 bringt MicroCompactCar (MCC) den<br />
gründlich überarbeiteten smart fortwo auf<br />
den Markt.<br />
Pünktlich zum Jubiläum der <strong>Niederlassung</strong><br />
erscheint die GLK-Klasse am Start.<br />
Stilistisch orientiert sich der GLK an der<br />
robusten G-Klasse, mit vielen vertikalen<br />
Linien, einer steilen Front sowie nahezu<br />
senkrechter Frontscheibe und sowie<br />
einem fast lotrecht abfallenden Heck.<br />
Seine eindrucksvollen Radläufe, die<br />
großen Böschungswinkel und die gute<br />
Bodenfreiheit zeugen von den Fähigkeiten<br />
des Fahrzeugs abseits befestigter Straßen.<br />
Dass der GLK Verbindungen zwischen<br />
Fahrzeugklassen schafft, zeigt schon sein<br />
Name. „G“ gibt einen Hinweis auf den<br />
Urvater aller Geländewagen, „L“ repräsentiert<br />
Luxus und das „K“ steht wie bei<br />
anderen <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong>-Modellreihen für<br />
Kompaktheit. Trotz seiner Verwandtschaft<br />
zur G-Klasse ist der GLK ein Typ, der auf<br />
der Straße eine gute Figur macht. Die hervorragende<br />
Übersichtlichkeit der Karosserie<br />
und die gute Rundumsicht im Verbund<br />
mit der erhabenen Sitzposition erhöhen<br />
die Alltagstauglichkeit und sorgen für<br />
ein entspanntes Fahren auch im dichten<br />
Stadtverkehr. Seine hochstabile Karosserie<br />
bildet das Rückgrat und sichert auch<br />
andere wichtige Kennwerte: Fahrstabilität,<br />
Schwingungs- und Geräuschkomfort<br />
überzeugen unter allen Bedingungen, die<br />
passive Sicherheit liegt markentypisch auf<br />
höchstem Level.<br />
Im Motorsport konzentriert sich die<br />
Daimler-<strong>Benz</strong> AG auf die Deutsche<br />
Tourenwagen Masters (DTM) und die<br />
Formel-1. Nach vierjähriger Pause<br />
startet die <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> im Jahr 2000<br />
ein grandioses Comeback. Mit Bernd<br />
Schneider als Fahrer gewinnt das Team
1999 bis 2008<br />
Architektonischer Maßstab: Die neue <strong>Niederlassung</strong> an der Wittekindstraße.<br />
die Meisterschaft 2000 und 2001 auf dem<br />
CLK. Die Fahrerweltmeisterschaft 1999<br />
in der Formel-1 gewinnt der Finne Mika<br />
Häkkinen für das McLaren-<strong>Mercedes</strong>-<br />
Team. Die Zeit bis 2007 wurde durch<br />
Michael Schumacher geprägt, der seine<br />
Rennausbildung seinerzeit im <strong>Mercedes</strong>-<br />
Junior-Team bekam. Die Saison 2007 war<br />
die erfolgreichste seit Langem: McLaren-<br />
<strong>Mercedes</strong> erringt die Konstrukteurs-WM<br />
und stellt mit Kimi Räikkonen den<br />
Fahrerweltmeister.<br />
Eine der größten Nutzfahrzeug-Standorte: Die <strong>Niederlassung</strong> am Sunderweg.<br />
… was noch geschah<br />
1999 – 2008<br />
23<br />
• Der Skispringer Sven Hannawald<br />
gewinnt am 6. Februar 2002 die Vierschanzentournee<br />
und hat erstmals in<br />
der Geschichte alle vier Springen für<br />
sich entscheiden können.<br />
• Borussia <strong>Dortmund</strong> ist nach einem<br />
2:1 über Werder Bremen am 4. Mai<br />
2002 zum sechsten Mal deutscher<br />
Fußballmeister.<br />
• Völlig überraschend gewinnt<br />
Griechenland unter dem deutschen<br />
Trainer Otto Rehhagel am 4. Juli 2004<br />
die Fußball-Europameisterschaft in<br />
Portugal.<br />
• Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft<br />
gewinnt am 30.<br />
September 2007 mit 2:0 gegen Brasilien<br />
die Weltmeisterschaft ohne ein<br />
Gegentor bei diesem Turnier.<br />
• Der deutsche Kardinal Ratzinger wird<br />
am 19. April 2005 zum neuen Pabst<br />
gewählt. Er gibt sich den Namen<br />
Benedikt XVI.<br />
• Die Abgeordneten des Bundestages<br />
wählen am 22. November 2005<br />
Angela Merkel zur Bundeskanzlerin<br />
einer großen Koalition.<br />
•<br />
Weimar wird am 19. Februar 1999<br />
„Kulturhauptstadt Europas“. Höhepunkt<br />
sind die Feiern zum 250.<br />
Geburtstag von Johann Wolfgang von<br />
Goethe am 28. August.<br />
• Zum 1. Januar 2000 erweist sich die<br />
Angst vor einem Computer-Chaos als<br />
unbegründet.<br />
• Mit der Ausgabe der EURO-Banknoten<br />
und -Münzen in 12 europäischen<br />
Staaten ist am 1. Januar 2002 die<br />
Währungsunion abgeschlossen.<br />
• Zum 1. Januar 2007 erhöht sich die<br />
Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent<br />
– die größte Steuererhöhung in<br />
der Geschichte der Bundesrepublik.<br />
• Die Weltbevölkerung übersteigt<br />
(offiziell am 12. Oktober 1999) die<br />
Sechs-Milliarden-Marke.<br />
• Nach aufwendiger Restauration wird<br />
am 3. Oktober 2002 das Brandenburger<br />
Tor wieder enthüllt.<br />
• Seit dem 19. Mai 2004 können im<br />
Hamburger Elbtunnel alle vier Röhren<br />
gleichzeitig befahren werden.<br />
• Die CSU-Politikerin Gabriele Pauli<br />
fordert am 19. September 2007,<br />
dass Ehen nur noch auf sieben <strong>Jahre</strong><br />
befristet geschlossen werden sollten.
24 <strong>100</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Mercedes</strong>-<strong>Benz</strong> <strong>Niederlassung</strong> <strong>Dortmund</strong>