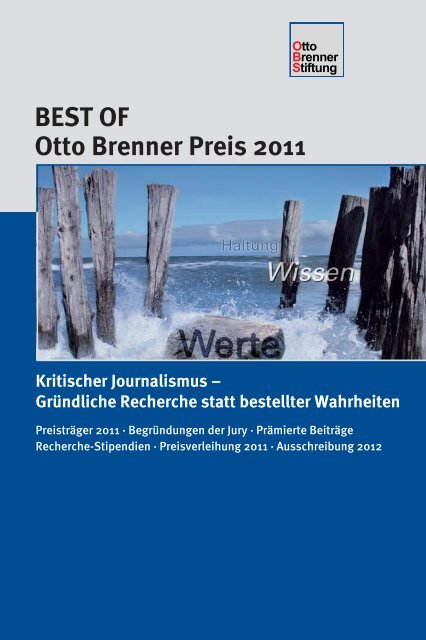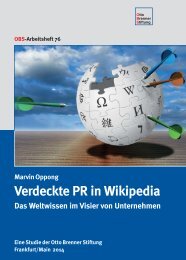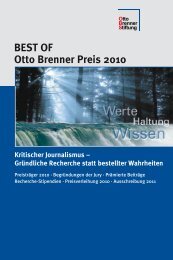BEST OF Otto Brenner Preis 2011 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2011 - Otto Brenner Shop
BEST OF Otto Brenner Preis 2011 - Otto Brenner Shop
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2011</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten<br />
<strong>Preis</strong>träger <strong>2011</strong> · Begründungen der Jury · Prämierte Beiträge<br />
Recherche-Stipendien · <strong>Preis</strong>verleihung <strong>2011</strong> · Ausschreibung 2012
<strong>BEST</strong> <strong>OF</strong><br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2011</strong><br />
Kritischer Journalismus –<br />
Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten
INHALT
Vorwort<br />
5 Jupp Legrand<br />
Eröffnung<br />
8 Berthold Huber<br />
Festrede<br />
16 Prof. Dr. Norbert Lammert<br />
<strong>Preis</strong>träger <strong>2011</strong><br />
1. <strong>Preis</strong><br />
29 Volker ter Haseborg,<br />
Lars-Marten Nagel<br />
Artikelserie über den<br />
„Gagfah-Skandal“<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
43 Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch,<br />
Jörg Schmitt<br />
Artikelserie<br />
„HSH Nordbank-Affäre“<br />
3. <strong>Preis</strong><br />
61 Ursel Sieber<br />
„Gesunder Zweifel“<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
67 Katja Thimm<br />
„Vaters Zeit“<br />
Newcomerpreis<br />
97 Jonathan Stock<br />
„Peters Traum“<br />
Medienprojektpreis<br />
113 Sebastian Pantel<br />
Artikelserie<br />
„Jugend und Kriminalität“<br />
Recherche-Stipendien I<br />
122 Matthias Dell<br />
„Tea Party Time.<br />
Die Rechtsbewegung der Bürger“<br />
124 Urs Spindler<br />
„Eulex-Mission im Kosovo:<br />
Ein Rechtsstaat im rechtsfreien<br />
Raum“<br />
Recherche-Stipendien II<br />
(Ergebnisse abgeschlossener Stipendien)<br />
128 Marvin Oppong<br />
135 Frank Brunner<br />
140 Gordon Repinski<br />
Medienpolitische Tagung<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Einführung in die Tagung<br />
156 Jupp Legrand<br />
20 Thesen zum deutschen<br />
Medienjournalismus<br />
162 Hans-Jürgen Jakobs<br />
174 Die Jury<br />
180 Daten und Fakten<br />
zum <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2011</strong><br />
181 <strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
186 Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für<br />
kritischen Journalismus 2012<br />
3
VORWORT<br />
4
Das Internet-Portal www.journalistenpreise.de listet aktuell über 420 <strong>Preis</strong>e, die<br />
– allein im deutschsprachigen Raum – jährlich an Journalisten vergeben werden.<br />
Unternehmen, Vereinigungen, Verbände und Lobbygruppen, aber auch Privatpersonen,<br />
Sponsoren und Stiftungen initiieren Journalistenpreise, prämieren<br />
„ihre“ <strong>Preis</strong>träger und schaffen so Öffentlichkeit für ihr Anliegen. Viele Ausschreibungen<br />
kaschieren dabei kaum noch ihre wahren Absichten: statt Qualitätsjournalismus<br />
zu unterstützen, wird PR ausgezeichnet.<br />
Die noch kurze, aber erfolgreiche Geschichte des „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es für<br />
kritischen Journalismus“ steht für den Anspruch, nur Beiträge zu prämieren,<br />
die in der breiten Masse durch eigenständige und intensive Recherche auffallen,<br />
durch die Themenwahl überzeugen und sich durch besondere journalistische<br />
Qualität auszeichnen.<br />
Die überwältigende Resonanz, auf die die Ausschreibungen zum „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
<strong>Preis</strong>“ seit Jahren stoßen, unterstreicht, dass die professionelle Arbeit der ehrenamtlich<br />
tätigen Fach-Jury hohes Ansehen genießt und der Journalistenpreis der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung eine breite Wertschätzung erfährt. Jeweils über 500 Be werbungen<br />
in den vergangenen Jahren sind ein Beleg für den guten Ruf, den sich der<br />
„<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>“ inzwischen erworben hat.<br />
Dieses Vertrauen in den „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>“, seine Jury und die Stiftung ist uns<br />
Verpflichtung, auch künftig investigative Recherche zu prämieren, hohes jour -<br />
nalistisches Können auszuzeichnen und zum Veröffentlichen von unbequemen<br />
Wahrheiten in der deutschen Medienlandschaft zu ermutigen.<br />
Bewerbungen für den „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus 2012“<br />
nehmen wir vom 1. April bis zum 31. Juli an. Die <strong>Preis</strong>verleihung findet am<br />
30. Oktober in Berlin statt.<br />
Jupp Legrand, Geschäftsführer der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
5
ERÖFFNUNG
Berthold Huber<br />
Rede zur Verleihung der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für<br />
kritischen Journalismus <strong>2011</strong>
Sehr geehrter Herr Bundestags -<br />
präsident Prof. Dr. Lammert!<br />
Liebe <strong>Preis</strong>trägerinnen und <strong>Preis</strong>träger,<br />
liebe Gäste der <strong>Preis</strong>träger,<br />
liebe Mitglieder der <strong>Preis</strong>-Jury,<br />
meine sehr geehrten<br />
Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
herzlich willkommen zur „Verleihung<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e <strong>2011</strong> für kritischen<br />
Journalismus“. 2005 sind wir<br />
mit 135 Bewerbungen gestartet, dieses<br />
Jahr waren es fast 550. Zum vierten Mal<br />
in Folge wurden mehr als 500 Be werbungen<br />
eingereicht. Dieses hohe<br />
Niveau bedeutet für mich zweierlei:<br />
Erstens: Der <strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong> genießt<br />
hohe Wertschätzung und hat sich im<br />
Reigen der wichtigen Journalistenpreise<br />
etabliert.<br />
Zweitens: Der <strong>Preis</strong> hat sein eigenes<br />
Profil und ist zu einer Marke geworden.<br />
„Gründliche Recherche statt bestellter<br />
Wahrheiten“ – mit diesem Motto un terstreichen<br />
wir, dass wir kritischen<br />
Journalismus auszeichnen und keine<br />
PR-Ar beiten prämieren. Journalistische<br />
Qualität, hartnäckige Recherche,<br />
unabhängige Perspektive – das sind<br />
Kriterien, nach denen die Jury jedes<br />
Jahr die <strong>Preis</strong>träger auswählt.<br />
Für unsere Jury gilt: sie hat Profil, sie<br />
bündelt Kompetenz, ihre Unabhängigkeit<br />
ist unbestritten und ihr Sachverstand<br />
führt zu überzeugenden Entscheidungen.<br />
Meine sehr geehrten<br />
Damen und Herren!<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
es ist mir eine große Freude, die Mitglieder<br />
der Jury begrüßen zu können.<br />
Liebe Frau Mikich, herzlich willkommen<br />
und ganz herzlichen Dank für Ihre<br />
engagierte Mitarbeit in der „<strong>Brenner</strong>“-<br />
Jury! Frau Mikich, „Frontfrau“ von<br />
Monitor, ist seit einigen Wochen auch<br />
„Leiterin der Programmgruppe Inland<br />
des WDR-Fernsehens“ – wie es wohl<br />
korrekt im „Anstaltsdeutsch“ heißt.<br />
Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg<br />
und freuen uns sehr, dass Sie heute<br />
Nachmittag wieder mit Elan und Eleganz<br />
durch unsere <strong>Preis</strong>verleihung führen.<br />
Herzlich willkommen, lieber Herr<br />
Schumann! Vielen Dank, dass Sie Ihr<br />
8
eites Wissen einbringen und uns an<br />
Ihrer großen Erfahrung teilhaben lassen.<br />
Herr Schumann sorgt in der Jury mit<br />
dafür, dass wir unseren Blick immer<br />
wieder auch auf kritische Berichterstattungen<br />
zu Finanz- und Wirtschaftsfragen<br />
lenken.<br />
Lieber Herr Prof. Dr. Prantl! Herzlich<br />
willkommen bei der OBS und vielen<br />
Dank für Ihr Engagement. Es mag den<br />
einen oder anderen stören, mich persönlich<br />
freut es aber, dass Sie auch als<br />
Mitglied der Chefredaktion noch genügend<br />
Zeit finden für Ihre unverwechselbaren<br />
Beiträge und kritischen Kommentare<br />
auf der SZ-Meinungsseite.<br />
Lieber Herr Prof. Dr. Lilienthal! Ich<br />
heiße auch Sie herzlich willkommen.<br />
Wir sind sehr froh darüber, dass der<br />
einzige Professor in Deutschland für<br />
– ich zitiere – „die Praxis des Qualitätsjournalismus“<br />
aktiv und engagiert in<br />
der „<strong>Brenner</strong>“-Jury mitarbeitet.<br />
Lieber Prof. Dr. Thomas Leif! Herzlich<br />
willkommen bei der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
Stiftung!<br />
Vielen Dank dafür, dass Sie sich von<br />
Anfang an stark für unseren <strong>Preis</strong><br />
engagiert haben und entscheidend<br />
mit dazu beitragen, dass Newcomer<br />
unterstützt und der journalistische<br />
Nachwuchs gefördert werden.<br />
Verehrte Gäste!<br />
Höhepunkt der jährlichen Ausschreibung<br />
ist unsere <strong>Preis</strong>verleihung. Ich<br />
freue mich, dass auch wieder zahlreiche<br />
Medienvertreter von Redaktionen und<br />
Sendern gekommen sind, die heute<br />
keine <strong>Preis</strong>e bekommen. Aber besonders<br />
freut es uns, dass der journalis -<br />
tische Nachwuchs den „<strong>Brenner</strong>-<strong>Preis</strong>“<br />
und unsere <strong>Preis</strong>verleihung zu schätzen<br />
weiß.<br />
Aus München ist die Kompaktklasse<br />
der Deutschen Journalistenschule, die<br />
Anfang des Monats ihre Ausbildung<br />
begonnen hat, angereist. Ich darf den<br />
Leiter der Deutschen Journalistenschule,<br />
Herrn Jörg Sadrozinski, und den neuen<br />
Jahrgang ganz herzlich im Namen der<br />
Stiftung und der Jury begrüßen.<br />
Herzlich willkommen!<br />
Für die Schülerinnen und Schüler der<br />
Evangelischen Journalistenschule hier<br />
in Berlin war die Anreise nicht ganz so<br />
weit. Aber ich heiße auch sie alle mit<br />
ihrem Leiter, Herrn Oscar Tiefenthal,<br />
9
ganz herzlich bei unserer <strong>Preis</strong>ver -<br />
leihung willkommen!<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
es ist mir persönlich eine Ehre und für<br />
die Stiftung eine Freude, den heutigen<br />
Festredner begrüßen zu können. Herr<br />
Bundestagspräsident Prof. Dr. Lammert!<br />
Ganz herzlich willkommen bei der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung und unserer<br />
diesjährigen <strong>Preis</strong>verleihung.<br />
Erstmals haben wir einen aktiven<br />
Politiker um die Festrede gebeten.<br />
Dass der oberste Repräsentant des<br />
Deutschen Bundestages heute zu<br />
uns spricht, ist allerdings kein Zufall.<br />
Sie, Herr Lammert, haben sich in den<br />
letzten Jahren immer wieder klar und<br />
deutlich, pointiert und kritisch zu<br />
medienpolitischen Fragen geäußert.<br />
So ist zum Beispiel in der „Talkshow-<br />
Studie“ der OBS nachzulesen, dass<br />
Sie wenig von dem Geplauder in diesen<br />
Gesprächsrunden halten.<br />
Für Sie – das lassen Sie unmissverständlich<br />
die Volksvertreter wissen –<br />
ist der Deutsche Bundestag der zentrale<br />
Ort für politische Auseinandersetzungen<br />
und das Parlament der öffentliche<br />
Platz für das Ringen um politische<br />
Entscheidungen – nicht die vielen<br />
Plauderstunden im Fernsehen.<br />
Im Programm des heutigen Abends<br />
ist Prof. Lammert als „Festredner“<br />
angekündigt. Er hat uns wissen lassen,<br />
dass seine Rede wahrscheinlich nicht<br />
durchgängig festlichen Ansprüchen<br />
genügen wird. Lieber Herr Lammert,<br />
wir haben diesen Hinweis nicht als<br />
Bedrohung empfunden. Im Gegenteil:<br />
er hat unsere Neugierde auf Ihre<br />
Ausführungen nur noch zusätzlich<br />
gesteigert.<br />
Meine sehr geehrten<br />
Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
heute Nachmittag stand das Thema<br />
„Medienkritik“ im Mittelpunkt unserer<br />
Arbeitstagung. Es wurde klar, wie<br />
wichtig eine funktionierende Medienkritik<br />
nicht nur für die Medien selbst<br />
ist, sondern auch für eine lebendige<br />
Zivilgesellschaft und das demokratische<br />
System insgesamt. Medienkritik ist für<br />
mich eine Seite der Medaille, wenn es<br />
um Fragen der Qualitätssicherung in<br />
unserer Mediengesellschaft geht.<br />
10
Gesellschaftliche Kontrolle durch<br />
engagierte Gremienarbeit ist die zweite,<br />
kaum diskutierte Seite, zu der ich einige<br />
Anmerkungen machen möchte.<br />
65 Jahre nach der Gründung des<br />
öffentlich-rechtlichen Rundfunks<br />
Realität tatsächlich noch abbilden.<br />
Ich möchte auf drei Punkte aufmerksam<br />
machen:<br />
Erstens:<br />
Die Integrationsleistung des Bundes<br />
der Vertriebenen, beispielsweise beim<br />
muss meines Erachtens überprüft<br />
werden, ob die Zusammensetzungen<br />
der Gremien die gesellschaftliche<br />
Aufbau der Bundesrepublik nach dem<br />
zweiten Weltkrieg, steht außer Zweifel.<br />
Daraus noch heute die Berechtigung<br />
11
abzuleiten, im Fernsehrat des ZDF vertreten<br />
zu sein, ist jedoch schwer zu<br />
vermitteln.<br />
Zweitens:<br />
Gremien von ARD und ZDF ignorieren<br />
– bis auf wenige Ausnahmen – wichtige<br />
Gruppen: z. B. Migranten, Menschen mit<br />
Behinderung oder Religionsgruppen.<br />
Obwohl diese, wie alle anderen auch,<br />
Rundfunkgebühren bezahlen, sind sie<br />
von der Kontrolle und Selbstverwaltung<br />
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks<br />
faktisch ausgeschlossen – zumindest<br />
nicht offiziell vertreten.<br />
Drittens:<br />
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen<br />
hat in vielen Fällen die Jugend verloren<br />
– einige Intendanten räumen diesen<br />
„Generationenabriss“ selbstkritisch ein<br />
und drängen auf Gegenmaßnahmen.<br />
Doch wie sieht es eigentlich in den<br />
Gremien aus? Auch hier muss man<br />
jüngere Menschen mit der Lupe suchen.<br />
Wenn aber der öffentlich-rechtliche<br />
Rundfunk die Jugend wieder gewinnen<br />
will und von jungen Menschen weiter<br />
auch als „ihr Medium“ wahrgenommen<br />
werden soll, muss sich das ändern.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
die Gewerkschaften haben schon vor<br />
einem Jahr auf eine Problematik aufmerksam<br />
gemacht, die meines Erachtens<br />
in der Diskussion zu kurz kommt.<br />
Durch die digitale Entwicklung und die<br />
damit einhergehende mediale Konvergenz<br />
sind neue Konkurrenzsituationen<br />
entstanden. Die Verlegerverbände<br />
sind – wie die Journalistengewerkschaften<br />
– traditionell in den Gremien<br />
von ARD und ZDF vertreten.<br />
Doch nun klagen die Zeitungsverleger<br />
gegen die „Tagesschau“-App der ARD,<br />
fordern ihre Verbände lautstark von<br />
der Politik weiter Beschränkungen<br />
für ARD und ZDF in der digitalen Welt.<br />
Das tun sie öffentlich – aber sitzen<br />
gleichzeitig in deren Gremien.<br />
Beim Westdeutschen Rundfunk ist seit<br />
einiger Zeit der Telekommunikationsund<br />
Neue Medien-Verband BITKOM<br />
im Rundfunkrat vertreten – auch keine<br />
ganz einfache Beziehung. Ich weiß,<br />
dass in vielen Rundfunkräten engagiert<br />
Gremienarbeit geleistet wird. Aber es<br />
ist auch nicht zu übersehen, dass sie<br />
immer häufiger an Grenzen stößt.<br />
12
Verehrte Gäste!<br />
Meine Damen und Herren!<br />
Staatsferne und unabhängiger,<br />
kritischer Journalismus im öffentlichrechtlichen<br />
Programm sind die Garanten<br />
für dessen Glaubwürdigkeit. Doch<br />
einige Gremien stehen – nicht ganz zu<br />
unrecht – unter dem Generalverdacht,<br />
dass zu oft Parteibücher mitentscheiden.<br />
Nach dem erzwungenen Ab schied<br />
des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus<br />
Brender überprüft jetzt das Bundesverfassungsgericht<br />
die Zusammen -<br />
setzung der Gremien. Unabhängig von<br />
der Entscheidung steht für mich fest:<br />
Die Parteien, aber auch die entsendenden<br />
Verbände und gesellschaft -<br />
lichen Gruppen gefährden die Glaubwürdigkeit<br />
der öffentlich-rechtlichen<br />
Sender, wenn parteipolitisches Denken<br />
weiter das Handeln bestimmt.<br />
Voraussetzung für wirkungsvolle<br />
Gremienarbeit ist Fachkompetenz,<br />
gute Vorbereitung, Themensicherheit<br />
und auch Mut, Fehlentwicklungen als<br />
solche klar anzusprechen. Aber auch<br />
Beharrlichkeit ist gefragt – und Hartnäckigkeit<br />
wird gebraucht!<br />
Verehrte Gäste!<br />
Ich wünsche uns allen eine spannende<br />
<strong>Preis</strong>verleihung und einen schönen<br />
Abend!<br />
Ich danke für die Aufmerksamkeit!<br />
Herr Bundestagspräsident Prof.<br />
Lammert! Sie haben das Wort –<br />
wir freuen uns auf Ihre Festrede!<br />
Im Kern muss es bei Gremienbesetzungen<br />
und deren Arbeit um etwas<br />
anderes gehen: Im Vordergrund<br />
müssen Begleitung, Kontrolle und<br />
Weiterentwicklung des öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunks im Geiste<br />
kritischer Loyalität stehen.<br />
Berthold Huber, Verwaltungsratsvorsitzender<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung und Jury-Mitglied<br />
13
FESTREDE
Prof. Dr. Norbert Lammert<br />
Festrede zur Verleihung der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für<br />
kritischen Journalismus <strong>2011</strong>
Sehr geehrter Herr Huber,<br />
meine Damen und Herren,<br />
ich bedanke mich für die freundliche<br />
Einladung, die liebenswürdige Begrüßung<br />
und ganz besonders für die Großzügigkeit,<br />
eine Festrede 1 anzukündigen,<br />
die Sie eigentlich gar nicht erwarten.<br />
Das macht mir den Einstieg leichter,<br />
denn die Anfrage in der damaligen<br />
Ein ladung, ob ich „einige medien -<br />
politische oder medienkritische Be -<br />
merkungen“ bei der Verleihung des<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>es machen könnte,<br />
war ohne größeres Nachdenken positiv<br />
zu be scheiden – die gleichzeitige<br />
Vor stellung, das in den Rahmen einer<br />
Festrede zu bringen, ist beinahe in -<br />
kompatibel. Ich bitte Sie um Nachsicht,<br />
wenn ich selber jedenfalls nicht<br />
mehr ankündigen und versprechen<br />
möchte als zwei, drei aus gewählte<br />
medien politische und damit notwendigerweise<br />
natürlich auch kritische<br />
Anmerkungen, die das, was man zur<br />
Rolle von Medien in einer modernen<br />
Gesellschaft und zum Verhältnis von<br />
Medien und Politik vielleicht sagen<br />
könnte und vielleicht bei anderer<br />
Gele genheit auch sagen müsste,<br />
natürlich nicht annähernd vollständig<br />
zum Ausdruck bringen.<br />
Ich will mich im Wesentlichen auf zwei<br />
Aspekte konzentrieren, die beide eine<br />
auch selbstkritische Betrachtungsweise<br />
lohnen. Den einen Aspekt hat Herr<br />
Huber in seiner Begrüßung bereits<br />
angesprochen, nämlich die direkten<br />
und indirekten Wirkungen, die sich<br />
aus der gründlichen Veränderung der<br />
Medienlandschaft der letzten Jahre<br />
ganz offensichtlich – und an manchen<br />
Stellen vielleicht auch nicht ganz so<br />
offensichtlich – ergeben. Und der<br />
andere Aspekt, zu dem ich ein paar<br />
Bemerkungen machen möchte, betrifft<br />
das besonders schöne, sicher delikate,<br />
ganz gewiss nicht spannungsfreie Verhältnis<br />
von Politik und Medien, auch<br />
und gerade unter dem Gesichtspunkt<br />
des Verhältnisses von Politikern zu<br />
Journalisten.<br />
Die Veränderung<br />
der Medienlandschaft<br />
Zur Veränderung der Medienlandschaft<br />
muss nicht mehr vorgetragen<br />
werden, dass sich mit der Digitalisierung<br />
von Daten und mit der Etablie-<br />
1 Wir danken Prof. Dr. Norbert Lammert für die Abdruckgenehmigung seiner Rede aus Anlass der Verleihung der<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e <strong>2011</strong><br />
16
ung des Internets zu einem bis dahin<br />
so nicht bekannten, schon gar nicht<br />
verfügbaren Medium, die Medienlandschaft<br />
grundlegend verändert hat, und<br />
dass sich seit dieser Zeit nicht nur Proportionen<br />
im Angebot und in der Nachfrage<br />
signifikant verschoben haben und<br />
dies weiter tun werden. Diese gründlich<br />
veränderte Wettbewerbssituation<br />
zwischen verschiedenen Medien hat<br />
erhebliche Folgen nicht nur für die je -<br />
nigen, die Medienangebote machen<br />
und für diejenigen, die Medienangebote<br />
nutzen, sondern auch und gerade für<br />
das Informationsniveau und das Urteilsvermögen<br />
einer Gesellschaft. Der letztere<br />
Punkt scheint mir nicht in gleicher<br />
Weise regelmäßiger Gegenstand all -<br />
gemeiner Aufmerksamkeit zu sein,<br />
weswegen ich dazu ein paar Bemerkungen<br />
machen will.<br />
Ich beginne mit dem statistischen Hinweis,<br />
dass wir inzwischen eine Internetnutzung<br />
in Deutschland haben, die die<br />
80-Prozent-Marke überschritten hat.<br />
Und dass von den vier Fünfteln der in<br />
diesem Land lebenden Menschen, die<br />
überhaupt das Internet nutzen, etwa<br />
60 Prozent täglich von diesen Ange -<br />
boten Gebrauch machen. Dass wir<br />
uns dabei in einer außerordentlich<br />
dynamischen Entwicklung befinden,<br />
wird auch daran deutlich, dass sich die<br />
tägliche Internet-Nutzungsdauer eines<br />
Erwachsenen in den letzten zehn Jahren<br />
von durchschnittlich 30 Minuten auf<br />
jetzt 95 Minuten pro Erwachsen und Tag<br />
mehr als verdreifacht hat. Für diesen<br />
Durchschnitt gilt das, was für jedes<br />
statistische Mittel gilt: Jedem fallen<br />
Beispiele ein, die deutlich davon ab weichen.<br />
Auch wenn man berücksichtigt,<br />
dass die Internetnutzer vielleicht über<br />
eine noch ausgeprägtere Begabung zu<br />
gleichzeitiger Nutzung verschiedener<br />
Medien verfügen, gibt es irgendwo<br />
natürliche Kapazitätsgrenzen, vor allem<br />
unter dem Gesichtspunkt des ernsthaften<br />
Umgangs mit denselben, sodass<br />
sich folgerichtig mit dem Ausdehnen<br />
der Nutzung des Mediums Internet die<br />
Relationen mit Blick auf andere Medien<br />
verschoben haben. Und am meisten<br />
ausgeprägt ist die Verschiebung, die<br />
es zwischen den elektronischen Medien<br />
auf der einen Seite und den Printmedien<br />
auf der anderen Seite gegeben hat.<br />
Informationsverhalten<br />
und Urteilsvermögen<br />
Spannender finde ich die Frage, ob<br />
dies für das Informationsniveau und<br />
damit auch das Urteilsvermögen einer<br />
17
Gesellschaft wie unserer eher nachrangig<br />
oder doch eher signifikant ist.<br />
Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass<br />
diese Veränderung in der Nutzung verschiedener<br />
Medien signifikante Wirkungen<br />
für das Informationsverhalten<br />
hat – und damit tendenziell auch für<br />
das Urteilsvermögen unserer Gesellschaft.<br />
Deswegen hat es nicht nur ganz<br />
offenkundig beachtliche kommerzielle<br />
Implikationen, es hat auch erhebliche<br />
politische Implikationen, was sich im<br />
Übrigen durch das ja wiederum auffällig<br />
starke Nutzungsverhalten der jüngeren<br />
Generationen mit Blick auf die elektronischen<br />
Medien im Allgemeinen, das<br />
Internet im Besonderen, tendenziell<br />
eher verstärkt und keineswegs abbaut.<br />
Der wesentliche Unterschied, auf den<br />
ich aufmerksam machen möchte, ist<br />
die Art des Nutzerverhaltens. Wer das<br />
Internet als seine Quelle für das Be -<br />
schaffen von Informationen nutzt, der<br />
hat einen prinzipiell anderen Zugang<br />
zu Informationen als beispielsweise<br />
der klassische Zeitungsleser oder Zeitschriftenleser.<br />
Der Nutzer des Internets<br />
nutzt dieses Medium, um sich Dingen<br />
zu widmen, an denen er Interesse hat.<br />
Er findet mit Stichworten eine in zunehmendem<br />
Maße gigan tische Zahl von<br />
Fundstellen, die nach bestimmten,<br />
eher quantitativ für relevant gehaltenen<br />
Kriterien für ihn sortiert werden, mit<br />
denen er sein Informations- und oder<br />
Unterhaltungsbedürfnis bedient. Um<br />
den Aspekt der Festrede mindestens<br />
im Charakter zu wahren, erspare ich<br />
uns den Hinweis, für welche Art von<br />
Informationen die Recherchen besonders<br />
häufig genutzt werden.<br />
Der typische Leser einer Tageszeitung<br />
nutzt ein Medium in der Erwartung,<br />
mindestens in der akzeptierten Vermutung,<br />
mit Informationen konfrontiert<br />
zu werden, die andere für wichtig<br />
halten. Mir kommt es im Augenblick<br />
gar nicht darauf an, ob man das Eine<br />
für anachronistisch und das Andere für<br />
modern hält, das Eine für sympathisch<br />
und das Andere für unsympathisch.<br />
Ich will schlicht darauf hinweisen: Es<br />
ist nicht dasselbe, ob ich auf dem einen<br />
oder anderen Wege meine Informa -<br />
tionen suche und beziehe. Ich glaube,<br />
dass es auch kein unfreund licher Akt<br />
gegenüber dem einen oder anderen<br />
Medium ist, wenn man darauf hinweist,<br />
dass das Internet da, wo es sorgfältig<br />
ist, eher lexikalisch als analytisch ist,<br />
während umgekehrt eine Zeitung, wenn<br />
sie sorgfältig arbeitet, eher analytisch<br />
als lexikalisch ihre Nutzer erreicht.<br />
18
Noch einmal: Man kann das eine oder<br />
andere spannender finden – dass es<br />
nicht dasselbe ist, halte ich für offensichtlich.<br />
Deswegen ist es naheliegend,<br />
dass es Folgen für das Informations -<br />
niveau und damit tendenziell für das<br />
Urteilsvermögen einer Gesellschaft hat,<br />
ob die Art der Informationsbeschaffung<br />
ganz oder überwiegend sich durch das<br />
eine oder das andere Medium oder<br />
durch beide gleichzeitig und in welchen<br />
Relationen zueinander vollzieht.<br />
Zu den Veränderungen, die mit dem<br />
Internet die Medienlandschaft – natürlich<br />
nicht nur in Deutschland, sondern<br />
weltweit – betreffen, gehört, dass sich<br />
damit die Wettbewerbsbedingungen<br />
im Allgemeinen einmal mehr, und zwar<br />
gründlich, verändert haben. Zu den Veränderungen<br />
gehört genauso, dass nicht<br />
mehr länger die Printmedien die Wettbewerbsbedingungen<br />
der Medienwelt<br />
bestimmen, sondern die elektronischen<br />
Medien dies tun. Was wiederum – unter<br />
vielen anderen Aspekten, die auch<br />
spannend sein mögen – zur Folge hat,<br />
dass die Präferenzen, die die elektronischen<br />
Medien gegenüber den Printmedien<br />
haben, zunehmend von dem<br />
einen auch auf das andere Medium<br />
durchschlagen.<br />
Bild vor Text,<br />
Personen vor Sachverhalten,<br />
Schnelligkeit vor Gründlichkeit<br />
Weil ich ausdrücklich zu medien -<br />
kritischen Anmerkungen eingeladen<br />
worden bin, will ich nun sagen, was<br />
mich als Mediennutzer besorgt,<br />
gelegentlich nervt und manchmal<br />
auch ärgert: Es gibt in meiner Wahrnehmung<br />
eine Reihe großer Trends,<br />
die wie mir scheint, mit dem Internet<br />
als Medium in einer ursächlichen Weise<br />
zusammenhängen und sich über die<br />
elektronischen Medien – und ihren<br />
naturgemäß besonders starken Verflechtungen<br />
mit dem Internet – auf<br />
die Medienlandschaft im Ganzen<br />
niederschlagen.<br />
Da ist zum Beispiel der Trend des<br />
zunehmenden Vorrangs von Bildern<br />
gegenüber Texten. Es ist der schwer<br />
übersehbare Trend des Vorranges von<br />
knappen Botschaften gegenüber ausführlichen<br />
Analysen, von Schlagzeilen<br />
gegenüber Sachverhalten. Es gibt seit<br />
langem den Trend zur Personalisierung<br />
von allem und jedem, und richtig schön<br />
medienwirksam ist ein Thema, wenn<br />
es sich mit Personen verbinden lässt.<br />
Ohne Personalisierung fehlt ihm tatsächlich<br />
oder scheinbar die Mindest-<br />
19
attraktivität, die mediale Verwendungsoptionen<br />
brauchen. Es gibt – in einer<br />
nach meiner Wahrnehmung auffällig<br />
gesteigerten Form in Verbindung mit<br />
dem Triumphzug des Internets quer<br />
durch die Medienlandschaft – den<br />
immer stärkeren Vorrang der Schnelligkeit<br />
gegenüber der Gründlichkeit der<br />
Informationsbeschaffung und Infor -<br />
mationsvermittlung. Den Luxus, eine<br />
Information auf ihre Richtigkeit zu<br />
prüfen, bevor man sie potenziellen<br />
Nutzern anbietet, glauben sich immer<br />
mehr Journalisten gar nicht mehr erlauben<br />
zu können, weil die Konkurrenzbedingungen<br />
so sind, wie sie sind.<br />
Und das Ganze ist schließlich verbunden<br />
mit einer geradezu gnadenlosen<br />
Dominanz der Unterhaltung gegenüber<br />
der Information, die sich quer durch<br />
die Medienlandschaft beobachten<br />
lässt. Und sie ist natürlich im elektronischen<br />
Bereich ausgeprägter als im<br />
Printbereich. Dass sie dort nicht zu<br />
beobachten sei, scheint mir eine allerdings<br />
verharmlosende Vermutung.<br />
Die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung hat neben<br />
anderen Verdiensten den lobenswerten<br />
Vorzug, sich immer wieder mit besonders<br />
relevanten Fragestellungen unserer<br />
Medienwelt auseinanderzusetzen.<br />
Und dazu gehört etwa aus diesem Jahr<br />
nicht nur die interessante Studie über<br />
Talkshows und deren Prominenz und<br />
Relevanz, sondern auch über die Entwicklung<br />
von Nachrichten im Fernsehen.<br />
Im Ergebnis dieser Studie steht die<br />
ebenso plausible wie – für mich jedenfalls<br />
erschreckende – Demonstration<br />
einer zunehmenden Entpolitisierung<br />
auch von Nachrichtensendungen.<br />
Wobei mir niemand erläutern muss,<br />
dass nicht alles, was politisch ist, eo<br />
ipso nachrichtenrelevant sein muss,<br />
und umgekehrt in Nachrichten nichts<br />
Unpolitisches vorkommen dürfe. Aber<br />
wenn man davon ausgeht, dass Nachrichten<br />
eigentlich ein klassisches<br />
Format für die Vermittlung politisch<br />
relevanter Sachverhalte sein könnten,<br />
vielleicht auch sein sollten, finde ich<br />
schon nicht unerheblich, dass nach<br />
Medienanalysen, die nicht ich angestellt<br />
habe, der mit Abstand größte<br />
Politik-Anteil in einer deutschen Fernsehnachrichtensendung<br />
bei lediglich<br />
48 Prozent liegt. Selbst bei keinem<br />
öffentlich-rechtlichen Medium haben<br />
wir in den Nachrichtensendungen einen<br />
Politik-Anteil, der die 50 Prozent-Grenze<br />
erreichte oder gar überböte. Bei den<br />
privaten Anbietern liegt dieser Anteil<br />
bei unter 20, teilweise sogar bei unter<br />
20
10 Prozent. Dass die bei der jungen<br />
Generation am stärksten gesehene<br />
Nachrichtensendung nicht mehr von<br />
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten<br />
angeboten wird, komplettiert das Bild.<br />
Der Vorrang der Unterhaltung<br />
Ich halte mich natürlich nicht für einen<br />
unbefangenen oder gar neutralen Be -<br />
oba chter der Szene. Jeder hat seine<br />
besonderen Empfindlichkeiten, das<br />
will ich nicht bestreiten. Aber zu der<br />
immer noch nicht ganzen Wahrheit der<br />
Medienentwicklung der letzten Jahre<br />
gehört, dass aufgrund des Wettbewerbs<br />
auch und gerade öffentlich-rechtliche<br />
Rundfunk- und Fernsehanstalten sich<br />
aus den besonderen Verpflichtungen,<br />
die sich aus ihrer Gebührenfinanzierung<br />
ergeben, weitgehend zurückgezogen<br />
haben. Oder aber entsprechende An -<br />
gebote in Nischenprogramme outgesourct<br />
haben, um die Hauptprogramme<br />
für den Wettbewerb freizubekommen,<br />
denen man sich unter den gegebenen<br />
Bedingungen unserer Mediengesellschaft<br />
stellen zu müssen glaubt.<br />
Heute, am 22. November <strong>2011</strong>, ist es<br />
auf den Tag genau sechs Jahre her, dass<br />
mit Angela Merkel die erste Frau in<br />
das Amt der Bundeskanzlerin gewählt<br />
wurde. Wiederum heute auf den Tag<br />
genau vor 21 Jahren trat die erste<br />
britische Premierministerin von diesem<br />
Amt zurück. Und vor 48 Jahren, 1963,<br />
wurde John F. Kennedy in Dallas<br />
ermordet. Alles herausragende Politik -<br />
ereignisse, die natürlich auch und<br />
gerade die Medien begleitet und verfolgt<br />
haben. Mit einem vergleichbaren<br />
Ereignis kann und will die Politik heute<br />
sicher nicht dienen. Aber heute Morgen<br />
hat beispielsweise im Deutschen<br />
Bundes tag die Debatte über die Frage<br />
stattgefunden: Wie geht eigentlich<br />
dieses Land in Gestalt seiner verantwortlichen<br />
politischen Institutionen<br />
mit dieser ebenso unglaublichen<br />
wie unerträglichen Serie von Mord -<br />
anschlägen einer neonazistischen<br />
Bande um? Natürlich hat, wie in der<br />
Regel, Phoenix Bundestagsdebatten<br />
im Programm. Bei ARD und ZDF findet<br />
„business as usual“ statt: „Rote Rosen“,<br />
Folge 1.152, war heute morgen in<br />
der ARD zu sehen, während sich der<br />
Deutsche Bundestag mit einem Thema<br />
beschäftigt, das nun wiederum nach<br />
der überwiegenden Mehrheit der<br />
deutschen Medienprominenz eigentlich<br />
das zentrale Thema dieser Republik<br />
sein müsste. Das ZDF brachte „Volle<br />
Kanne“ und lässt sich auch nicht<br />
21
weiter irritieren. Und so setzt diese<br />
Gesellschaft in Gestalt ihrer Medien<br />
die Prioritäten, die sie für richtig hält.<br />
Um nicht missverstanden zu werden:<br />
Ich halte ausdrücklich an dem Prinzip<br />
fest, dass über die Relevanz auch und<br />
gerade von Nachrichten nicht die Politik<br />
zu entscheiden hat. Aber ich erlaube<br />
mir den Hinweis, dass man sich nicht<br />
über das politische Bewusstsein einer<br />
Gesellschaft beklagen soll, wenn man<br />
selber als Medienvertreter die Priori -<br />
täten so setzt und der Unterhaltung<br />
einen gnadenlosen Vorrang gegenüber<br />
allem und jedem gewährt.<br />
Mir ist zugegebenermaßen auch erst<br />
vor ein paar Jahren die Weisheit eines<br />
schlichten Satzes von Neil Postman aus<br />
seinem 1986 erschienenen und damals<br />
viel zitierten Bestseller „Wir amüsieren<br />
uns zu Tode“ so richtig zu Bewusstsein<br />
gekommen: „Das Problem des Fern -<br />
sehens ist nicht, dass es zu viel Unterhaltung<br />
bringt. Das Problem des Fernsehens<br />
ist, dass es aus allem und<br />
jedem Unterhaltung macht.“ Die Talkshows<br />
sind für mich gewissermaßen die<br />
An wendung dieses Prinzips auf alles<br />
und jedes, beispielsweise auf die<br />
Politik. Und ich widerstehe jetzt tapfer<br />
der Ver suchung, meine ohnehin hinreichend<br />
bekannte „Begeisterung“ für<br />
dieses bekannte Format einmal mehr in<br />
ganzer Pracht und Schönheit auszubreiten.<br />
Ich begnüge mich mit einem<br />
einzigen, wiederum statistischen Be -<br />
fund. Die vom öffentlich-rechtlichen<br />
Fernsehen in Deutschland im Hauptprogramm<br />
im Jahr übertragenen Bundestagsdebatten<br />
machten addiert im vergangenen<br />
Jahr 28 Stunden aus. Das ist<br />
etwa eine halbe Stunde pro Woche. Die<br />
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen pro<br />
Woche angebotenen Talkshows ma chen<br />
22 Stunden aus, über das Vierzigfache,<br />
zusammen 1.000 Stunden im Jahr.<br />
Noch einmal: Dürfen die das? Ja, die<br />
dürfen das! Für eine Errungenschaft<br />
halte ich das aber nicht. Zumal ja jeder<br />
seine eigenen Beobachtungen machen<br />
kann, im Übrigen auch machen muss,<br />
welche Aussichten durch diese Formate<br />
für die Erläuterung, Vermittlung gerade<br />
auch zunehmend komplexer Sachverhalte<br />
gegeben sind.<br />
Das Verhältnis von<br />
Politikern und Journalisten<br />
Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens<br />
beschränke ich mich auf einige wenige<br />
Bemerkungen zum Verhältnis von Politikern<br />
und Journalisten: Dass dieses<br />
ein ganz besonderes ist, muss nicht<br />
22
erläutert werden. Dass diese beiden<br />
Berufe eine Reihe von erkennbaren<br />
Unterschieden aufweisen, ist auch im<br />
Einzelnen nicht erläuterungsbedürftig.<br />
Dass es auf der anderen Seite auch<br />
eine Reihe von Gemeinsamkeiten gibt,<br />
sollte mindestens nicht unterschlagen<br />
werden. Das gilt beispielsweise mit<br />
Blick auf das jeweils relativ ausgeprägte<br />
Selbstbewusstsein. Weder bei meinen<br />
Kolleginnen und Kollegen in der Politik,<br />
noch bei den Journalisten, treffe ich<br />
regelmäßig auf ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe.<br />
Beide scheinen<br />
mir gelegentlich, die Politiker wie die<br />
Journalisten, von der Versuchung ge -<br />
plagt, sich für eine besondere Kategorie<br />
der Menschheit zu halten, denen<br />
Dinge, die für den Rest der Menschheit<br />
gelten, eigentlich nicht zugemutet<br />
werden dürfen. Und zu den Gemeinsamkeiten<br />
gehört auch, dass sie beide<br />
interessanterweise einen relativ hohen<br />
Einfluss und beide einen relativ<br />
schlechten Ruf haben. Beides ist grob<br />
ungerecht, wie sich versteht – das<br />
muss ich nicht erläutern. Mein größter<br />
Trost, wenn ich diese konstant gleich<br />
deprimierenden Reputationsskalen<br />
lese, besteht darin, dass noch hinter<br />
Journalisten und Politikern, inzwischen<br />
nicht nur Banker rangieren, was ich ja<br />
fast verstehe, sondern auch Buchhändler,<br />
was ich völlig unbegreiflich<br />
finde. Und da ich mir das überhaupt<br />
nur mit einem frei schwebenden Ressentiment<br />
erklären kann, neige ich<br />
dazu, die ganze Untersuchung für<br />
offenkundig unseriös zu halten, um<br />
mit auf diesem Wege gestärkten<br />
Selbstbewusstsein den übertragenen<br />
Aufgaben weiter nachzukommen.<br />
Ich möchte Sie jedoch gerne auf einen<br />
interessanten Befund aufmerksam<br />
machen, den ich in einer Studie von<br />
Hans Matthias Kepplinger vor einiger<br />
Zeit gefunden habe, in der er dieses<br />
natürlich spannungsreiche Verhältnis<br />
zwischen Politikern und Journalisten<br />
untersucht. Er kommt dabei unter<br />
anderem zu dem Ergebnis, dass fast<br />
die Hälfte der Journalisten beklagt,<br />
es sei kaum noch möglich, etwas über<br />
die Ziele von Politikern zu erfahren,<br />
während fast die Hälfte der Politiker<br />
findet, es werde regelmäßig falsch<br />
berichtet. Dabei gehen fast 80 Prozent<br />
der befragten Journalisten und Politiker<br />
davon aus, dass die jeweils andere<br />
Gruppe ohnehin nur eigene Interessen<br />
verfolgt. Politiker verfolgen persönliche<br />
Interessen und Parteiinteressen, Journalisten<br />
hätten nur Auflage und Quote<br />
23
im Blick. Die Hälfte der Politiker meint,<br />
Journalisten sei jedes Mittel recht.<br />
48 Prozent der Journalisten, also wiederum<br />
fast präzise die gleiche Größenordnung,<br />
hingegen halten Politiker<br />
für skrupellos. Nun ist das sicherlich,<br />
meine Damen und Herren, nicht frei<br />
erfunden; es scheint durchaus möglich,<br />
dafür jeweils Anhaltspunkte im<br />
wirklichen Leben zu finden. Ich halte<br />
den Befund in seiner Verallgemeinerung<br />
dennoch für falsch, mindestens<br />
für stark übertrieben, denn ich kenne<br />
eine Reihe von Journalisten, denen zur<br />
Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung<br />
nicht jedes Mittel recht<br />
ist. Und vielleicht kennt der eine oder<br />
andere von Ihnen einzelne Politiker, die<br />
er nicht für skrupellos hält. Es könnte<br />
nicht schaden, wenn das gelegentlich<br />
auch deutlich würde. Das wäre umso<br />
begrüßenswerter, als dass das Bewusstsein<br />
der Öffentlichkeit im Umgang mit<br />
Sachverhalten durch die Wahrnehmung<br />
der Wirklichkeit geprägt ist, die sich<br />
– ich neige fast zu sagen – immer weniger<br />
empirisch durch eigene Erfahrung,<br />
sondern immer häufiger und immer<br />
exklusiver über Medien vollzieht. Umso<br />
mehr macht es Sinn, sich immer wieder<br />
– im doppelten Wortsinn – um einen<br />
kritischen Journalismus zu bemühen.<br />
Einen auch selbstkritischen Journa -<br />
lismus zu bemühen, der in dem, was<br />
Gegenstand des täglichen Geschäfts<br />
ist, auch die eigene Rolle reflektiert.<br />
Und der die Wirkungen, die mit dem,<br />
was man vermittelt – oder eben nicht<br />
vermittelt – und der Art und Weise,<br />
in der man es vermittelt, zum Gegenstand<br />
des eigenen beruflichen Ethos<br />
macht. Deshalb verbinde ich meinen<br />
herzlichen Dank für die freundliche<br />
Einladung mit einer ebenso herzlichen<br />
Gratulation an die <strong>Preis</strong>träger, die nachher<br />
dafür gepriesen werden, dass sie<br />
solchen Ansprüchen mindestens einmal<br />
in auffälliger Weise genügt haben<br />
und verbinde damit die leise Hoffnung,<br />
dass es mit und ohne <strong>Preis</strong>e dauerhaft<br />
so bleibt.<br />
Prof. Dr. Norbert Lammert ist Präsident des<br />
Deutschen Bundestags.<br />
24
1<br />
1 Berthold Huber gratuliert Volker ter<br />
Haseborg und Lars-Marten Nagel zum<br />
1. <strong>Preis</strong> 2 Bundestagspräsident Prof.<br />
Dr. Nobert Lammert, Festredner <strong>2011</strong><br />
3 Jury-Mitglied Harald Schumann bei<br />
einer Laudatio 4 <strong>Preis</strong>trägerin<br />
Ursel Sieber mit Laudator Schumann,<br />
Berthold Huber und Jupp Legrand<br />
5 <strong>Preis</strong>träger <strong>2011</strong> verfolgen gespannt<br />
die <strong>Preis</strong> verleihung aus der 1. Reihe<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
25
DIE PREISTRÄGER <strong>2011</strong>
Volker ter Haseborg und<br />
Lars-Marten Nagel<br />
Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und<br />
Jörg Schmitt<br />
Ursel Sieber<br />
Katja Thimm<br />
Jonathan Stock<br />
Sebastian Pantel
1. <strong>Preis</strong>
29<br />
Volker ter Haseborg<br />
Lars-Marten Nagel
Artikelserie über den „Gagfah-Skandal“<br />
(Hamburger Abendblatt, 19.04. – 17.07.<strong>2011</strong>)<br />
Volker ter Haseborg<br />
geboren 1979 in Hamburg<br />
Werdegang:<br />
seit 2010 Reporter beim Hamburger Abendblatt<br />
2008-2009 Reporter im Ressort „Thema des Tages“, Münchner Abendzeitung<br />
2006-2008 Politik- und Wirtschaftsredakteur bei der Münchner Abendzeitung<br />
2001-2005 Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen Journalistenschule<br />
2000-2006 Studium<br />
Auszeichnungen:<br />
<strong>2011</strong> Auszeichnung für eine „Herausragende Leistung“ beim Axel-Springer-<strong>Preis</strong><br />
2010 Deutscher Reporterpreis<br />
Lars-Marten Nagel<br />
geboren 1980 in Magdeburg<br />
Werdegang:<br />
seit <strong>2011</strong> freier Reporter/Rechercheur beim Hamburger Abendblatt und<br />
Trainer für Datenjournalismus<br />
2008-2010 Redakteur bei der dpa<br />
2005-2006 Fulbright-Stipendiat in Missouri und Washington D.C.<br />
2004-2005 Volontariat bei der Magdeburger Volksstimme<br />
2000-2007 Studium<br />
Veröffentlichung:<br />
Bedingt Ermittlungsbereit – Investigativer Journalismus in Deutschland und in den USA.<br />
Reihe: Recherche-Journalismus und kritische Medienpolitik, Bd. 6, 2007<br />
30
Begründung der Jury<br />
Stachybotrys oder Aspergillus – das sind Schimmelpilze, eklig und gefährlich. Sie sollen<br />
nicht mit dem Menschen wohnen, denn sie machen krank. Sie lösen Allergien aus. Sie<br />
lösten in Hamburg eine grandiose Recherche, einen Skandal, einen Widerstand aus.<br />
Die Autoren Volker ter Haseborg und Lars-Marten Nagel sezieren den Niedergang ganzer<br />
Wohnviertel – aus ökonomischer, kommunalpolitischer und menschlicher Perspektive.<br />
Sie analysieren wie ein amerikanischer Hedgefonds aus ehemals staatlichem Immobilienbesitz<br />
größtmögliche Profite herausschlägt – auf Kosten der Bewohner. Sie nennen<br />
diesen Prozess scharfsinnig RAUBBAU. Ich bin sehr überzeugt von dieser Serie, denn<br />
sie wirft ein gleißendes Licht auf Probleme, die Hunderttausende Menschen in diesem<br />
Land umtreiben. Ein Aufreger-Thema mitten aus dem Leben, von größter Relevanz.<br />
Die Autoren mussten „nur“ recherchieren, am Ort hingucken, um klar benennen zu<br />
können, wie Markt-Macht missbraucht wird.<br />
Ein Unternehmen mit Wohnimmobilien muss im Schnitt 12-15 Euro pro Quadratmeter<br />
jährlich ausgeben, um die Substanz ordentlich zu erhalten. Die Gagfah senkte diese<br />
Investitionen von neun auf sechs Euro. Renditen wurden gerettet, nicht morsche Balkone.<br />
Und Mieter sahen hilflos zu wie aus einem Viertel ... Verfall wurde.<br />
RAUBBAU: Die Gagfah gehört einem amerikanischen Hedgefonds, der auf der Privatisierungswelle<br />
in deutsche Wohnstuben gespült wurde. Kommunen stießen in Milliardenhöhe<br />
ihr Tafelsilber ab, um leere Kassen zu füllen. Aber auch, weil das Gemeinschaftliche,<br />
das Soziale irgendwie spießig wurden. Man trug jetzt „Privatisierung“, „Profit“,<br />
„Professionalität“. Ein Paradigmenwechsel. Auf den Schimmel in der Wohnung von<br />
Familie Dohrwardt heruntergebrochen heißt das: „Sie lüften und heizen nicht richtig“<br />
– so kann ein Vermieter natürlich auch seine Mieter mundtot machen, die sich<br />
beschweren.<br />
Die Autoren erklären sehr anschaulich, wie eingeschüchterte Mieter mit kaputten<br />
Auf zügen, alten Leitungen und maroden Fassaden leben müssen – ohne Aussicht<br />
auf Verbesserung, insbesondere sozial Schwache und Zuwanderer trauen sich<br />
kaum aufzumucken. Wissen nicht, was ein Mieterverein ist.<br />
31
Ter Haseborg und Nagel zeigen den komplexen Weg der Millionengewinne, die aus<br />
der Misere vor Ort geschöpft werden. Sie kritisieren die Hilflosigkeit der Politiker.<br />
Sie recherchieren den Insiderhandel der Konzernmanager. Und: sie berichten, wie<br />
sich Mieter gegen den RAUBBAU wehren. Sehr beiläufig ist die Serie auch ein Plädoyer<br />
für den sozialen Wohnungsbau. Solide, seriös, bürgerlich. Nicht von Gier getrieben<br />
sondern vom Grundsatz: Es muss in einer reichen Gesellschaft das Grundrecht auf<br />
anständiges, bezahlbares Wohnen geben.<br />
Das ist der Kammerton der Artikelserie über den Wohnungskonzern Gagfah im Hamburger<br />
Abendblatt. Mit knapp 160.000 Wohnungen im ganzen Bundesgebiet ist die<br />
Gagfah zum Symbol falsch gelaufener Privatisierung geworden und so weist diese<br />
Lokalberichterstattung weit über die Grenzen Hamburgs hinaus. Kopf und Herz des<br />
Lesers werden angesprochen. Die Artikelserie ist ein Vorbild für engagierten Journalismus,<br />
der aufklären und politisch bewegen will.<br />
Vorgetragen von Sonia Seymour Mikich<br />
32
Raubbau – Die Akte Gagfah<br />
(Hamburger Abendblatt, 19.04.<strong>2011</strong>)<br />
Früher konnte man hier gut leben – heute verschimmeln und verfallen viele<br />
Hamburger Mietshäuser der Wohnungsgesellschaft Gagfah. Der Eigentümer<br />
– ein US-Hedgefonds – investiert kaum in den Wohnungsbestand. Eine Geschichte<br />
über Gier – und über das Grauen in den eigenen vier Wänden.<br />
Die Finanzkrise ist lautlos in die Wohnung der Familie Dohrwardt gekommen.<br />
Ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer der Kinder und vor allem ins Badezimmer.<br />
Die Finanzkrise streut grüne Schimmelflecken, manchmal färbt sie Wände schwarz.<br />
Sie riecht muffelig und verbreitet ein klammes Gefühl. Marcel Dohrwardt ist 15,<br />
er schläft neben dem Schimmel. Seine Mutter Birgit sagt, dass Marcel häufig krank<br />
ist. Im Zimmer seiner Schwester Miriam zieht es. Das 25 Jahre alte Fenster schließt<br />
nicht mehr richtig, Wind und Regen kommen durch die Ritzen. Am schlimmsten<br />
ist es aber im Badezimmer. An der Decke klebt der Schimmel in grünen Flecken,<br />
an der Wand in braunen. Die Tapete blättert ab. Wenn die Dohrwardts duschen,<br />
fällt ihnen häufig Schimmel vor die Füße.<br />
Die Dohrwardts aus dem Fritz-Flinte-Ring 49, fünfter Stock, in Steilshoop haben<br />
bei der Finanzkrise kein eigenes Vermögen verloren. Zu Verlierern wurden sie aber<br />
trotzdem. Verlierer der Übernahme der ehemals staatlichen Wohnungs gesellschaft<br />
Gagfah durch einen amerikanischen Hedgefonds, der in der Finanzkrise<br />
unter Druck geraten war.<br />
Die Geschichte der „Gemeinnützigen Aktien-Gesellschaft für Angestellten-<br />
Heimstätten“ handelt von Naivität, von Gier und von Hilflosigkeit. Sie handelt<br />
vom Raubbau an einem Unternehmen mit knapp 160.000 Wohnungen in<br />
Deutschland. In Hamburg gehören 9.375 Wohnungen zur Gagfah, davon 2.100 in<br />
Steilshoop und 1.300 in Wilhelmsburg, die übrigen Wohnungen verteilen sich auf<br />
die meisten Stadtteile der Hansestadt. Etwas mehr als ein Drittel dieser Wohnungen<br />
sind Sozialwohnungen.<br />
Um diese Geschichte zu erzählen, hat das Abendblatt Dutzende Mieter besucht<br />
und mit Politikern, Aktionärsvertretern und Ehemaligen der Gagfah gesprochen.<br />
33
Das Unternehmen wurde mit dem Ergebnis der Recherchen konfrontiert. Das<br />
Abendblatt wollte auch mit dem Chef der Gagfah, William J. Brennan, in Luxemburg<br />
sprechen. Seine Sprecherin teilte mit: „Für ein Interview steht Ihnen Herr<br />
Brennan nicht zur Verfügung.“<br />
Familie Dohrwardt wohnt seit einem Vierteljahrhundert in ihrer Steilshooper<br />
Wohnung. Für 103 Quadratmeter zahlt sie 772,16 Euro warm im Monat, der <strong>Preis</strong><br />
ist für eine Vier-Zimmer-Wohnung in Ordnung. Bis zum Verkauf der Gagfah gab<br />
es keine Probleme. „Der Hausmeister war immer erreichbar. Wenn etwas kaputt<br />
war, wurde es sofort repariert.“, sagt Holger Dohrwardt. 2004 wurde die Gagfah<br />
an den US-Finanzinvestor Fortress verkauft. Kurz danach hatten die Dohrwardts<br />
Schimmel in der Wohnung.<br />
Holger Dohrwardt schrieb den Vermieter an. Mehrere Gagfah-Fachleute besichtigten<br />
den Schaden. Nichts passierte. Seine Frau Birgit versuchte selbst, den Schimmel<br />
zu entfernen, vergebens. Sowohl der Mieterverein zu Hamburg als auch der Verein<br />
Mieter helfen Mietern bezeichnen Gagfah-Häuser als so marode, dass die<br />
Wände schimmeln müssen. Die meisten hätten keine Wärmedämmung, die Feuchtigkeit<br />
schlägt sich deshalb an den kältesten Stellen nieder.<br />
Vor wenigen Tagen schickte die Wohngesellschaft den Dohrwardts einen Brief.<br />
Darin stellte sie fest, „dass sich der Schimmel auf Grund falschen Heiz- und<br />
Lüftungsverhalten gebildet hat“. Auch im Umschlag befand sich die bunte<br />
Broschüre mit dem Titel „Feuchtigkeit in der Wohnung“.<br />
Familie Dohrwardt ist nur ein Beispiel von vielen in Hamburg. Yvonne Taskiran<br />
wohnt in Wilhelmsburg, Wittestraße 1, im dritten Stock eines Altbaus. Seit Jahren<br />
schon bröckelt die Fassade, im März fielen Trümmer von den Balkonen des ersten<br />
Stockwerks. Nebenan spielen Kinder eines Kindergartens. Taskirans Sohn Elikey<br />
ist drei Jahre alt. Die Balkone werden auf Anordnung des Bezirksamts Mitte mit<br />
Stahlträgern abgestützt, um die Anwohner zu schützen. „Ich würde lieber heute<br />
als morgen raus hier. Aber in derselben <strong>Preis</strong>lage gibt es nichts“, sagt Yvonne<br />
34
Taskiran. Für ihre Drei-Zimmer-Wohnung mit 58 Quadratmetern zahlt sie<br />
506 Euro warm.<br />
Die Fassaden der Hochhäuser an der Korallusstraße in Wilhelmsburg sind grau.<br />
Fenster sind zerbrochen, die Haustüren stehen offen, Klingelschilder sind demoliert,<br />
Lampen in den Hausfluren sind kaputt. In den Treppenhäusern stinkt es<br />
nach Müll. Die Aufzüge sind häufig defekt.<br />
Zegbi Ameti, er wohnt im neunten Stock, Korallusstraße 8, bekommt den<br />
Schimmel nicht mehr aus seiner Vier-Zimmer-Wohnung. 690 Euro kostet die<br />
Warmmiete für die 88 Quadratmeter. Seit drei Jahren schimmelt es im Kinderzimmer.<br />
„Mein Sohn hat Angst davor, hier zu schlafen“, sagt Ameti.<br />
Torsten Wietzki wohnt mit seiner Familie in Bahrenfeld, Silcher Straße 7b, erster<br />
Stock, in einem Acht-Parteien-Haus. „Jeden Winter, wenn die Temperaturen unter<br />
null Grad fallen, fällt auch die Heizung aus“, sagt er. Seit sieben Jahren hat Wietzki<br />
ein Schimmel-Problem. Seine Söhne Magnus und Tjorben sind vier und acht Jahre<br />
alt. „Ich weiß, wie gesundheitsschädlich Schimmel ist. Deshalb haben meine Frau<br />
und ich ihn selbst entfernt“, sagt Wietzki. Für die Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung,<br />
83 Quadratmeter, zahlen die Wietzkis 787 Euro Warmmiete.<br />
In fast allen Hamburger Bezirken gibt es Beschwerden von Gagfah-Mietern. Die<br />
Fälle sind den Bezirksämtern bekannt. Ab und an sind die Behörden aktiv ge -<br />
worden, wie in Wilhelmsburg. „Mehrere Häuser sind in schlechtem Zustand.<br />
Seit Juli versuchen wir, deshalb Gespräche mit der Gagfah zu führen. Doch die<br />
hat immer abgelehnt. Das ist ärgerlich“, sagt Lars Schmidt-von Koss, Sprecher<br />
des Bezirks Mitte.<br />
Viele Betroffene schweigen. Weil sie überfordert sind mit der Situation, die deutsche<br />
Sprache nicht beherrschen – oder weil sie sich einfach schämen für ihren<br />
Schimmel.<br />
35
Lange Zeit galt die Gagfah als vorbildlicher Vermieter. Gegründet wurde sie 1918,<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte sie der Bundesversicherungsanstalt für<br />
Angestellte (BfA). BfA – das klingt nach Seriosität, nach Geborgenheit, vielleicht<br />
auch nach Spießigkeit. Aber genau diese biederen Eigenschaften wünschen<br />
sich viele Mieter von ihrem Vermieter.<br />
Unter der Kohl-Regierung hatte es erstmals Überlegungen gegeben, die Wohnungsbestände<br />
zu verkaufen, um mit frischem Geld die Rente zu sichern. Schon damals<br />
warnten Mietervereine davor, dass da ein solides und soziales Unternehmen zum<br />
Spielball von Spekulanten werden könnte. Die rot-grüne Regierung von Gerhard<br />
Schröder erlag trotzdem der Versuchung. Privatisierungen waren in Mode und<br />
die Rentenkasse war leer.<br />
3,5 Milliarden Euro zahlte die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Fortress<br />
Investment Group für zunächst 80.000 Gagfah-Wohnungen. Hinter Fortress<br />
stehen große angelsächsische Pensionsfonds und reiche Privatleute, „Private<br />
Equity“ eben.<br />
Zunächst lief alles prima. Nach dem Eigentümerwechsel setzte die deutsche<br />
Führung der Gagfah auf Wachstum – auch in Hamburg. 2005 kaufte sie der<br />
Norddeutschen Landesbank die Tochtergesellschaft Nileg ab. Diese verwaltete<br />
mehr als 30.000 Wohnungen, 5.000 davon in Hamburg. Die Banker hätten<br />
guten Grund gehabt, sich zu betrinken, sagt ein ehemaliger Nileg-Mitarbeiter.<br />
„Viele Häuser waren in keinem guten Zustand. Viele Nachkriegsbauten und<br />
Eisenbahnerwohnungen, die in die Jahre gekommen waren.“<br />
Die Amerikaner schien das nicht zu stören. Sie hatten ein großes Ziel: Sie wollten<br />
an die Börse. Der Mann, der das Unternehmen ab 2006 dafür fit machen sollte,<br />
heißt Burkhard Drescher, ehemaliger Oberbürgermeister von Oberhausen,<br />
Sozialdemokrat. Zumindest verbal bekam er den Spagat zwischen Hedgefonds<br />
und Mieterschutz gut hin. „Bei Wohnungen, die ja ein intimer Lebensraum für<br />
Menschen sind, darf man die soziale Brille auf keinen Fall vergessen“, sagte er.<br />
36
Und es schien zu funktionieren, in Dresden kaufte die Gagfah große Wohnungsbestände<br />
und begann zu sanieren. Auch für Hamburg wurden Pläne gemacht – für<br />
30 Millionen Euro. Für Steilshoop waren sie sehr konkret, sagen Ex-Gagfah-Leute.<br />
Anstatt das Unternehmen, das ausschließlich in Deutschland tätig ist und an der<br />
Frankfurter Börse gehandelt wird, hierzulande anzusiedeln, wurde als Dach gesellschaft<br />
die Gagfah S.A. in Luxemburg gegründet. Nach deutschem Aktienrecht muss<br />
ein Vorstand nicht den Weisungen des Aufsichtsrats folgen – beim Modell der S.A.<br />
in Luxemburg schon. Im Aufsichtsrat in Luxemburg, dem „Board of Directors“,<br />
sitzen Fortress-Leute. Sie haben damit bei der Gagfah das Sagen.<br />
Doch auch die amerikanischen Hedgefonds-Manager konnten die Finanzkrise<br />
nicht vorhersehen. 2008 implodierte in den USA der Immobilienmarkt. Fortress<br />
verlor Milliarden. Und Dreschers „soziale Brille“ war plötzlich nicht mehr gefragt.<br />
Bei der Gagfah ging es jetzt um zwei Dinge: Kürzen bei der Instandhaltung und<br />
Retten bei der Rendite. Denn auf die wollten die Aktionäre nicht verzichten. 60 bis<br />
70 Prozent der Aktien stecken in Fonds, die Fortress managt und sich dafür gut<br />
bezahlen lässt. 30 bis 40 Prozent der Aktien werden frei in der Börse gehandelt.<br />
Bei der Kommunikation ihrer neuen Strategie waren die Amerikaner zurückhaltend,<br />
der gute Ruf der Gesellschaft sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden. „Da gibt es<br />
keine Schriftstücke, alles nur mündlich“, sagt ein ehemaliges Mitglied der Führungsriege.<br />
Für Hamburg bedeutete die neue Strategie des Unternehmens das Aus für den<br />
30-Millionen-Plan.<br />
Für jene, die im Unternehmen Widerstand leisten, wurde es ruppig. Hauptverantwortliche<br />
verließen die Gagfah. Drescher wurde durch William J. Brennan ersetzt.<br />
Der Amerikaner ist eine Art Anti-Drescher. Er kommt aus dem Londoner Fortress-<br />
Büro, hat viel Erfahrung im Bereich Hochfinanz, aber wenig in der deutschen<br />
Wohnungswirtschaft.<br />
37
Spricht man mit ehemaligen Führungskräften über Gründe, die Gagfah zu verlassen,<br />
dann fallen Sätze wie: „Sie lutschen das Unternehmen aus.“ Oder: „Die fahren<br />
das Ding gegen die Wand.“ Oder: „Für die Typen wollte ich nicht einsitzen.“<br />
Dem Abendblatt liegt eine interne Liste mit 510 sogenannten „Verkehrssicherungsmaßnahmen“<br />
für das Jahr 2009 vor. Dabei handelt es sich um dringende Reparaturen.<br />
Von den Schäden geht Gefahr für Leib und Leben aus. „Abbröckelnde<br />
Betonteile“ oder „fehlende Brandschotts“ sind für Hamburger Wohnungen<br />
notiert. Einige Schäden waren offenbar seit 2004 bekannt, behoben wurden<br />
sie jahrelang nicht.<br />
425.000 Euro sollte zum Beispiel die Reparatur einiger Balkone einer Hamburger<br />
Immobilie kosten. Der Zustand wird so beschrieben: „Balkonplatten stark be -<br />
schädigt, Tragfähigkeit nicht gewährleistet.“ Bekannt ist das seit Mai 2006.<br />
Aber im Feld „Bemerkungen“ der Tabelle steht nur: „Keine dringenden Arbeiten<br />
erforderlich.“ Reparaturausgaben? Fehlanzeige.<br />
Für 700.000 Euro hätten seit 2006 in einem anderen Hamburger Objekt die alten<br />
Bleileitungen ausgetauscht werden müssen, weil die Grenzwerte der giftigen<br />
Substanz überschritten wurden. Ob noch jemand in dem Haus lebt und sich<br />
langsam vergiftet, steht nicht in der Liste. Dafür aber der Hinweis, dass den<br />
Mietern „Schadensersatzanspruch“ zustehe.<br />
Die Liste verzeichnet präzise, was die einzelnen Reparaturen kosten würden<br />
und was ausgegeben wurde. Alle Sofortreparaturen zusammen hätten demnach<br />
72,9 Millionen Euro gekostet. Ausgegeben wurden der Liste zufolge 10,2 Millionen<br />
Euro – also ein Siebtel.<br />
Die Gagfah dementiert die Existenz der Liste nicht ausdrücklich, beharrt aber<br />
darauf, dass die Schäden nicht akut waren: „Sofern Verkehrssicherungen auch<br />
als diese identifiziert werden und akuter Handlungsbedarf besteht, erfolgt um -<br />
gehend die Beseitigung des Risikos“, sagt die Sprecherin.<br />
38
Fest steht: Es wird extrem gespart. Während ein Unternehmen mit Wohnimmobilien<br />
normalerweise 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter und Jahr für Sanierungen aufbringt,<br />
hat die Gagfah diesen Betrag bewusst gesenkt, von neun Euro auf sechs<br />
Euro. Auch verkauft wird offenbar immer mehr. 1,1 Milliarden Euro verzeichnet<br />
der Punkt „Einzahlungen aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen<br />
Immobilien“ im Geschäftsbericht für die Jahre 2009 und 2010. In den beiden<br />
Jahren zuvor standen dort 400 Millionen Euro.<br />
Die Gagfah investiert nicht in ihre Häuser und verkauft die Filetstücke – der Un ternehmenswert<br />
sinkt. Trotzdem zahlt das Unternehmen weiter hohe Renditen. Der<br />
Blick in die Bilanz zeigt: Während der Aktienkurs zwei Jahre nach Erstausgabe von<br />
19 Euro auf fast zwei Euro abstürzte – heute liegt er um die sechs Euro –, machte<br />
die Dividende einen Sprung von 17 auf 20 Cent je Aktie – im Quartal. Phasenweise<br />
liegt die Dividendenrendite bei 20 Prozent. Diese Kennziffer zeigt, wie hoch die<br />
Ausschüttung je Aktie war. Nach der Ausschüttung an Aktionäre ist das Geld für<br />
das Unternehmen verloren. Zwei ehemalige Führungskräfte, sie wollen anonym<br />
bleiben, haben dem Abendblatt unabhängig voneinander vorgerechnet, dass<br />
ziemlich exakt jene Gelder, die an die Investoren abfließen, für die Reparaturen<br />
benötigt würden.<br />
Die Gagfah wehrt alle Kritiker ab. Erforderliche Reparaturen würden durchgeführt.<br />
Die persönliche Kundenbetreuung sei im Notfall rund um die Uhr erreichbar. Man<br />
verfolge eine langfristige Bestandhaltungs- und Vermietungsstrategie. Auf Abendblatt-Anfrage<br />
verspricht die Gagfah Investitionen von neun bis zehn Euro pro<br />
Quadratmeter für das Jahr <strong>2011</strong>.<br />
Helmut Kecskes kann daran nur schwer glauben. Er hat 27 Jahre bei der Gagfah<br />
gearbeitet. Er hat selbst in Steilshoop gewohnt, in einer Gagfah-Wohnung, später<br />
war er für die Mieterbetreuung und Instandhaltung in seinem Viertel zuständig.<br />
Er kannte viele Mieter, nicht nur als Kunden, sondern auch als Nachbarn. Als<br />
das Unternehmen sich noch in öffentlicher Hand befand, saß das Geld lockerer.<br />
Die Gagfah spendierte den Mietern Sommerfeste. In dieser Zeit sei genügend<br />
39
Geld für die Instandhaltung ausgegeben worden. Kecskes sagt, er habe die<br />
Gagfah sehr gerne vertreten. Damals.<br />
Im vergangenen Jahr hat er die Gagfah verlassen. Es sei zu viel für ihn gewesen,<br />
sagt er. „Ich konnte die Leute nicht mehr mit erfundenen Argumenten vertrösten<br />
und sie anlügen.“ Die Gagfah-Mitarbeiter in den Stadtvierteln wurden für ihren<br />
Einsatz mit den Mietern in Konflikt-Management-Kursen und von einem Karate-<br />
Trainer in Selbstverteidigungskursen geschult, sagt Kecskes. Das war wohl<br />
nötig. „Uns blieb nichts anderes übrig, als die Instandhaltung gezielt heraus -<br />
zuzögern.“<br />
Mal sei es bestelltes Material gewesen, das auf sich warten ließ. Mal der Antrag,<br />
der nicht genehmigt wird. Mal die falsche Jahreszeit für Außenarbeiten. Mal sei<br />
die Kundenbetreuung nicht zuständig, mal der ausgegliederte Hausmeister service<br />
nicht. „Einer schiebt die Schuld auf den anderen, der Mieter kommt nicht weiter<br />
– und die Gagfah gibt kein Geld aus“, sagt Kecskes.<br />
Er hätte Druck von oben bekommen, gegen den Leerstand anzukämpfen, sagt<br />
er. „Wir konnten nicht mehr darauf achten, wen wir in die Wohnungen einziehen<br />
lassen.“ So seien vor allem sozial Schwache und Zuwanderer eingezogen. „Der<br />
Vorteil war, dass sich diese Menschen nicht über den Zustand ihrer Wohnungen<br />
beschwert haben“, sagt er. „Dieses Unternehmen hat für mich nichts mehr mit<br />
vernünftiger Wohnungswirtschaft zu tun.“<br />
Kecskes hat die Seiten gewechselt und berät jetzt Mieter, die Probleme mit<br />
diesem Vermieter haben. Der wiederum fand den Seitenwechsel nicht so gut:<br />
Kecskes erhielt bundesweit Hausverbot. Auch juristisch setzte sich die Gesellschaft<br />
zur Wehr, als Kecskes im Namen von Mietern die Miete kürzte. Gagfah-Leute<br />
bezeichneten seinen Einsatz in Mieter-Sprechstunden als kriminell. Doch der<br />
Überläufer hat sich mit „Mieter helfen Mietern“ zusammengetan – Kecskes ist<br />
jetzt der Kontaktmann in Steilshoop, Juristen des Vereins erledigen den Rest.<br />
40
Die Gagfah sieht keine Probleme bei der Betreuung. „Unsere Mieter wohnen<br />
gerne in unseren Wohnungen, weil wir viel dafür tun, dass sie sich bei uns wohlfühlen“,<br />
sagt die Sprecherin aus der Unternehmenskommunikation in Mülheim<br />
an der Ruhr. Wie viele Mitarbeiter für die Betreuung der Hamburger Mieter<br />
zuständig sind, will sie nicht mitteilen.<br />
Ob die Gagfah wirklich vor dem Ruin steht, wie Kritiker behaupten, wird sich wohl<br />
2013 zeigen. Dann muss das Unternehmen Kredite in Höhe von mehr als fünf<br />
Milliarden Euro entweder den Banken zurückzahlen oder durch neue Kredite<br />
ersetzen. Einige Ex-Führungskräfte glauben, dass die Gagfah sich frisches Geld<br />
mit deutlich höheren Zinsen erkaufen müsse. Gelingt das, muss noch mehr ge -<br />
spart werden. Gelingt es nicht, könnte es der Steuerzahler sein, der mit seinem<br />
Geld die maroden Gagfah-Viertel retten muss.<br />
Martin Kersting, Sprecher des Stadtteilbeirates Steilshoop, hat mitbekommen,<br />
wie die Gagfah ihre Investitionspläne bekannt gab und wie sie die Politiker und<br />
Bürger immer wieder vertröstete – bis die Investitionspläne schließlich ganz fallen<br />
gelassen wurden. Sein Stadtteil sei immer ein sozialer Brennpunkt ge wesen,<br />
sagt er, jedoch habe es durch gute Stadtentwicklungspolitik einen Erholungs prozess<br />
gegeben. Damit ist Schluss. „Jetzt herrschen wieder Verhältnisse wie 1980“,<br />
sagt Kersting. Regelmäßig macht er Führungen durch sein Viertel. Ein Spiel für<br />
die Teilnehmer gehörte zu jedem Rundgang: Gagfah-Häuser raten. Doch das,<br />
sagt Kersting, mache heute keinen Spaß mehr. Die grauen Häuser sind zu einfach<br />
zu erkennen.<br />
41
2. <strong>Preis</strong>
43<br />
Jürgen Dahlkamp<br />
Gunther Latsch<br />
Jörg Schmitt
Artikelserie „HSH Nordbank-Affäre“<br />
(DER SPIEGEL, 30.08.2010 – 21.03.<strong>2011</strong>)<br />
Jürgen Dahlkamp<br />
geboren 1969 in Stockum (heute Werne)<br />
Werdegang:<br />
seit 1998 DER SPIEGEL<br />
1992-1998 Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
1985-1987 und 1989-1991 Studium der Journalistik an der Universität Dortmund<br />
1984 Abitur in Werne<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
2010 Henri-Nannen-<strong>Preis</strong> (Investigation)<br />
2002 Leuchtturm-<strong>Preis</strong> des netzwerk recherche<br />
1996 Theodor-Wolff-<strong>Preis</strong><br />
1996 Wächterpreis der Tagespresse<br />
Gunther Latsch<br />
geboren 1960 in Hamburg<br />
Werdegang:<br />
seit 1997 DER SPIEGEL<br />
1989-1997 SPIEGEL TV<br />
1987-1989 NDR<br />
1980-1986 Studium<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
<strong>2011</strong> Nominierung Henri-Nannen-<strong>Preis</strong> (beste investigative Leistung)<br />
2010 Henri-Nannen-<strong>Preis</strong> (beste investigative Leistung)<br />
44
Jörg Schmitt<br />
geboren 1967 in Marburg<br />
Werdegang:<br />
seit 2003 Wirtschaftsredaktion DER SPIEGEL<br />
2000-2003 Redakteur Manager Magazin<br />
1995-2000 Wirtschaftsredaktion STERN<br />
1994-1995 Wirtschaftsredaktion Forbes<br />
1989-1994 Studium<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
<strong>2011</strong> 2. Platz Wirtschaftsjournalist des Jahres<br />
2010 Henri-Nannen-<strong>Preis</strong> Investigation<br />
2008 Friedrich Vogel <strong>Preis</strong><br />
45
Begründung der Jury<br />
Stellen Sie sich vor, der Chef eines Unternehmens, das wegen einer Reihe von Fehl -<br />
investitionen ums Überleben kämpft, hat Ärger mit der Presse und entwickelt darum<br />
paranoide Züge. Also heuert er eine große Detektei an, die Journalisten und andere<br />
Kritiker ausspähen soll. Weil er außerdem einen Vorstandskollegen verdächtigt, der<br />
hätte geheime Informationen an die Medien weitergeleitet, setzen der Boss und sein<br />
Justiziar ihren Privatgeheimdienst auf ihn an, um ihn auszuforschen. Und als dessen<br />
Agenten nichts finden, akquirieren die privaten Ermittler einen technisch versierten<br />
Handlanger, der eine E-Mail so frisiert, dass es so aussieht, als hätte der Mann tatsächlich<br />
Firmengeheimnisse verraten. Der Unternehmenschef geht damit zum Aufsichtsrat,<br />
und der zu Unrecht verdächtigte Manager verliert daraufhin seinen Job.<br />
Aber er ist nicht das einzige Opfer der Paranoia in der Chefetage. Auch der Leiter der<br />
New Yorker Filiale ist dem Boss im Wege. Darum setzt er einen skrupellosen Privatschnüffler<br />
auf ihn an, der dem Mann kurzerhand Kinderpornos auf seinen Computer<br />
speichert, die bei einer von der Konzernleitung angeordneten Durchsuchung auch<br />
prompt gefunden werden. Natürlich wird auch der Manager in New York gefeuert.<br />
Und mit dem Vorwurf, ein Kinderschänder zu sein, ist sein Leben gleich ganz ruiniert.<br />
Das alles klingt so plump, dass es als Plot für einen Krimi vermutlich nicht durchgehen<br />
würde. Aber bei der staatseigenen HSH-Nordbank passierte unter Leitung ihres außer<br />
Kontrolle geratenen Chefs Dirk Jens Nonnenmacher genau das. Zum Glück hatten die<br />
beiden Opfer den Rechtsstaat auf ihrer Seite. Beide wurden rehabilitiert und – auf<br />
Kosten der Steuerzahler – mit hohen Millionenbeträgen entschädigt.<br />
Aber, und das war der fast genauso große Skandal: Wäre es nach den Verantwortlichen<br />
der Landesregierungen in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden<br />
Hilmar Kopper gegangen, dann hätte die Öffentlichkeit von den ungeheuerlichen<br />
Vorgängen vielleicht nie oder nur unzureichend erfahren und Nonnenmacher<br />
wäre womöglich gar nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Dass sie damit nicht<br />
durchkamen, das verdanken wir den drei Kollegen Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch<br />
und Jörg Schmitt vom SPIEGEL. Sie haben mit einer wahrlich grandiosen Recherche -<br />
arbeit den Wahn von Nonnenmacher und die Machenschaften seiner Helfershelfer in<br />
46
einer Serie von insgesamt 12 Artikeln Stück für Stück an die Öffentlichkeit gebracht<br />
und damit den Druck auf die Aufseher aus den Landesregierungen so erhöht, dass sie<br />
Nonnenmacher schließlich fallen lassen mussten.<br />
Und obwohl ich die Bezeichnung „investigativer Journalismus“ gar nicht mag, weil in<br />
Deutschland schon jeder Journalist als investigativ gilt, der nur seine Arbeit ordentlich<br />
macht: In diesem Fall trifft der Begriff wirklich zu. Dieses Team war wirklich investigativ<br />
unterwegs. Denn diese Recherche erforderte einen Einsatz, den nur wenige Kollegen<br />
leisten. Da fanden konspirative Treffen in Wohnungen statt, die man nur getrennt<br />
betreten und verlassen durfte, und die von neutralen Unbeteiligten gemietet werden<br />
mussten. Da traf man sich nachts auf Parkbänken und Friedhöfen mit zweifelhaften<br />
Gestalten, die auch gut hätten eine Falle stellen können. Oder sie wurden per SMS<br />
des Nachts in ein Hotelzimmer gerufen, wo sie dann sechs Stunden lang einen in eng -<br />
lischer Juristensprache abgefassten geheimen Untersuchungsbericht der einschlägig<br />
bekannten Anwaltskanzlei WilmerHale auf Band diktieren durften. Denn Kopieren war<br />
zu riskant, weil jedes Exemplar so gekennzeichnet war, dass der Urheber des Lecks<br />
identifizierbar gewesen wäre.<br />
Das sind nur die Highlights, und ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Chapeau,<br />
liebe Kollegen, dieser <strong>Preis</strong> ist mehr als verdient.<br />
Vorgetragen von Harald Schumann<br />
47
Moralischer Bankrott<br />
(DER SPIEGEL, 30.08.2010)<br />
Die HSH Nordbank und ihr Chef Dirk Jens Nonnenmacher stehen unter einem ungeheuerlichen<br />
Verdacht: Hat ein HSH-Team eine Kinderporno-Spur gelegt, damit<br />
die Bank den Leiter der New Yorker Filiale billig loswerden konnte? US-Fahnder<br />
und deutsche Bankenaufsicht ermitteln.<br />
Die Mitteilung kam vom Vorstand, Freitag, 20. August, 16.18 Uhr, sie lief durchs<br />
ganze Haus, sie ging an die „Lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, und wer<br />
sie heute noch mal liest, muss sich fragen, was eigentlich schockierender an diesen<br />
22 Zeilen ist. Die Chuzpe, mit der die HSH Nordbank ihre Mitarbeiter für dumm verkaufte.<br />
Oder der Zynismus zu behaupten, dass diese Bank ihre Mitarbeiter liebt.<br />
Ausgerechnet eine Bank, die, wie es aussieht, keine Skrupel kannte, Mitarbeiter<br />
fertigzumachen. Beruflich. Und auch sonst.<br />
Mit der Haus-Info bereitete die HSH-Spitze ihre Belegschaft darauf vor, dass der<br />
SPIEGEL am folgenden Montag eine Geschichte bringen würde: Bevor die Bank<br />
im April 2009 ihren Vorstand Frank Roth feuerte, fristlos, ohne Abfindung, jenen<br />
Frank Roth also, den Vorstandschef Dirk Jens Nonnenmacher schon lange hatte<br />
loswerden wollen, soll ein Abhörspezialist Roths Büro verwanzt haben, sogar in<br />
dessen Privatwohnung eingebrochen sein. Und: Die Beweise, die zum Sofortrauswurf<br />
führten, nämlich dass Roth Bankgeheimnisse an die Presse verraten habe,<br />
waren vermutlich falsch, gefälscht, waren ihm angehängt worden.<br />
Von solchen Vorwürfen, so das Rundschreiben, habe auch die Hausspitze erst<br />
vor 14 Tagen erfahren, aber jetzt werde geprüft.<br />
Doch der HSH-Sumpf scheint noch viel schlimmer: Es gibt noch einen Fall, in<br />
dem der Verdacht besteht, dass die Bank einen weiteren Top-Mann rauswerfen<br />
wollte. Diesmal mit der schmutzigsten aller Methoden.<br />
Das geht aus einem Bericht der Anwaltskanzlei WilmerHale hervor, den die Bank<br />
selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach läuft bei der New Yorker Staatsanwaltschaft<br />
dazu ein Strafermittlungsverfahren gegen Mitglieder eines HSH-Teams,<br />
darunter dem Justitiar der Bank. Sie waren an einer Razzia in der Filiale in<br />
48
Manhattan beteiligt. Zielperson: der Leiter der HSH New York, Roland K., von<br />
dem sich die Bank trennen wollte.<br />
Bei der Durchsuchung am 17. September 2009 wurde der HSH-Trupp prompt<br />
fündig: Er entdeckte Kinderporno-Bilder, die er bei der New Yorker Polizei ab -<br />
lieferte. Das hätte Roland K. nicht nur um eine Millionenabfindung gebracht,<br />
sondern ihn in jeder Beziehung ruinieren können. Doch die Ermittlungen kippten<br />
überraschend in die andere Richtung. Aus Sicht der US-Fahnder, so WilmerHale,<br />
ist Roland K. vermutlich das Opfer einer Verschwörung. Und hinter allem soll<br />
sein Arbeitgeber stehen. Auch für die WilmerHale-Anwälte spricht vieles dafür,<br />
dass die Kinderporno-Spur vor der Razzia gezielt gelegt wurde.<br />
Ein Desaster für die Bank: Die Staatsanwaltschaft New York führt nicht nur Justitiar<br />
Gößmann als Verdächtigen, sondern auch Bankchef Nonnenmacher. Die Bankenaufsicht<br />
BaFin hat in dieser Sache am Montag vergangener Woche eine Sonderprüfung<br />
eingeleitet. Auch der Staatsanwaltschaft Hamburg liegt der rund hundertseitige<br />
„Vorläufige Untersuchungsbericht“ der US-Kanzlei vor; die Strafverfolger<br />
in Kiel interessieren sich ebenso dafür.<br />
Es sollen daher auch erste Vorabergebnisse aus diesem Report gewesen sein,<br />
die zur Entscheidung führten, Justitiar Gößmann freizustellen – ein Zusammenhang,<br />
den Gößmann bestreitet. Jedenfalls sollte die Öffentlichkeit vom New-York-<br />
Verfahren aber nichts erfahren. Kein Wort dazu im Schreiben an die lieben Mitarbeiter,<br />
einzig zur Roth-Sache. Die war ohnehin nicht mehr geheim zu halten.<br />
Natürlich rückt nun die amerikanische Affäre auch den Roth-Rauswurf in ein neues<br />
Licht – und in das Visier der Ermittler. Roland K., Frank Roth. Ist es dasselbe Muster,<br />
dieselbe Methode? Eine schmutzige Intrige, die möglicherweise hoch bis zu<br />
Nonnenmacher reicht, um einen Mitarbeiter auf so billige wie bösartige Weise<br />
zu schassen?<br />
Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Roth eingestellt – sie sah<br />
keine hinreichenden Verdachtsmomente, dass Roth der Presse tatsächlich ge -<br />
heime Bankinformationen zugespielt hatte. Nun steigen die Fahnder wieder ein,<br />
nur diesmal mit einem anderen Blick: Hat die HSH die Beweise gegen Roth fingiert?<br />
49
Was dafür sprechen könnte: dieselben Namen in beiden Verfahren. Bei der Razzia<br />
in New York half eine Juristin aus der Kanzlei des Potsdamer Anwalts Joachim Erbe<br />
mit. Den aber hatte auch Frank Roth schon kennengelernt: Anwalt Erbe führte<br />
Protokoll, als die Bank ihm mitteilte, er sei gefeuert. Erbe arbeitet zudem eng mit<br />
der Münchner Sicherheitsfirma Prevent zusammen, die mit ehemaligen Polizeiführungskräften<br />
gespickt ist und von der HSH millionenschwere Aufträge bekommt.<br />
Und auch diese Prevent spielt in beiden Fällen eine Rolle – in den USA, bei der<br />
Razzia, aber genauso bei Roth: Ein Subunternehmer der Prevent, Arndt Umbach,<br />
hatte sich, so mehrere Zeugen, selbst bezichtigt, Roths Büro verwanzt zu haben<br />
und in dessen Privatwohnung eingebrochen zu sein. Als Umbach am Sonntag<br />
vor zwei Wochen plötzlich bestritt, je so etwas gesagt oder gar getan zu haben,<br />
war es die Prevent, die seine Erklärung kurz danach verbreitete.<br />
Man muss schon einen Moment innehalten: Ist das wirklich alles vorstellbar?<br />
Bei einer deutschen Bank, hervorgegangen aus zwei Landesbanken, immer<br />
noch zu 85,5 Prozent im Besitz der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein?<br />
Sicher, dass die HSH Nordbank eine HSH Notbank geworden ist, dass sie am<br />
Abgrund stand, das wusste jeder. Drei Milliarden Euro mussten die beiden<br />
Länder für das Überleben der Bank zahlen, weil sich deren Manager verspekuliert<br />
hatten, 40 Milliarden Euro Bürgschaften kamen noch dazu. Aber während die<br />
staatlichen Anteilseigner voller Panik in den Abgrund starrten und gerade noch<br />
verhinderten, dass ihre Bank hineinstürzte, hat keiner von ihnen gemerkt, dass<br />
die HSH noch ganz anders pleitezugehen drohte. Moralisch. Und vielleicht wollte<br />
das auch keiner merken.<br />
So groß war nämlich die Not, dass sich die Kontrolleure der Bank bedingungslos<br />
dem Vorstandschef Nonnenmacher ausgeliefert hatten – um seiner Fachkompetenz<br />
willen, seiner angeblichen Fähigkeit, die Bank zu retten. Vor allem einer, der Aufsichtsratschef<br />
Hilmar Kopper, verschweißte sein Schicksal mit dem von Nonnenmacher:<br />
Wenn Nonnenmacher gehe, dann er mit, sagte Kopper, der damit vom<br />
Aufpasser zum Mitmacher wurde. Dass Nonnenmacher, der Mathematikprofessor,<br />
50
Analytiker, Zahlenmann, einen besorgniserregenden blinden Fleck hatten in der<br />
Frage, was sich gehört und was nicht, nahmen die Aufseher in Kauf. Er beharrte<br />
auf seiner Sonderzahlung von 2,9 Millionen Euro, ohne Rücksicht darauf, dass<br />
er damit Regierungskrisen in Hamburg und Schleswig-Holstein auslöste und tiefen<br />
Frust unter allen in der Bank, denen er selbst den Bonus in der Krise zusammenstreichen<br />
ließ.<br />
Nonnenmacher geht so etwas vermutlich nicht sonderlich nahe, weil er kaum<br />
einen nahe an sich herankommen lässt. Er fremdelt mit Menschen, mag sich nicht<br />
öffnen, er muss sich zu Fototerminen quälen und sieht deshalb auf Fotos auch<br />
genauso aus. Nicht mal engen Mitarbeitern erzählte er, dass er zwischenzeitlich<br />
Vater geworden war; er hält Distanz, und vor allem: Er misstraut. „Geradezu<br />
pathologisch“, sagt ein Bankmanager.<br />
Schon im vergangenen Frühjahr hieß es im „Manager Magazin“, er wolle alle<br />
anderen Vorstände austauschen; einer, der ihn erlebt hat, sagt auch: Er hat dann<br />
keine Hand für das, was Banker ein Settlement nennen, eine Einigung im Guten,<br />
im Frieden, mit Handschlag.<br />
War der Bank in solchen Fällen tatsächlich alles recht, jedes Unrecht, hat sie dann<br />
wirklich ihren Machtapparat, insbesondere die Münchner Sicherheitsfirma Prevent<br />
und deren Zuarbeiter, hemmungslos auf Nonnenmachers Rausschmisskandidaten<br />
angesetzt? Die HSH Nordbank und Rechtsanwalt Erbe mochten sich dazu vergangenen<br />
Freitag auf Anfrage nicht äußern, Prevent nur insoweit, dass die Fragen in<br />
mehreren Punkten von „unrichtigen Voraussetzungen“ ausgingen und sie aufgrund<br />
der Komplexität des Themas mehr Zeit benötige. Der von seiner Arbeit<br />
befreite Gößmann ließ schließlich ausrichten, er sei an keiner Aktion beteiligt<br />
gewesen, bei der es darum gegangen sein sollte, dem New Yorker Filialleiter<br />
Kinderporno-Material unterzuschieben. Das sei „abwegig und unzutreffend“.<br />
Klar ist: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt immer die Unschuldsvermutung.<br />
Aber sollte es gleichwohl zu der Operation gekommen sein, dann würde<br />
das bei der HSH Nordbank, mit Nonnenmacher an der Spitze, zumindest weniger<br />
verwundern als anderswo.<br />
51
Roland K., US-Amerikaner, war seit 2002 der Leiter der New Yorker Filiale. Als<br />
er dort 2007 Stellen abbauen sollte, mussten zwei Mitarbeiter gehen. Doch die<br />
wehrten sich mit Sex-Vorwürfen gegen K. Er habe sich nur gegen sie und für eine<br />
Kollegin entschieden, weil er mit ihr eine Affäre gehabt habe.<br />
Die Bank ließ den Fall zweimal von Anwaltskanzleien untersuchen, beide Male<br />
mit dem Ergebnis, dass K. die geschassten Kollegen nicht diskriminiert habe.<br />
Mancher hielt die Gutachten damals für Reinwaschaktionen, andererseits: Eines<br />
der beiden Verfahren ist mittlerweile in den USA mit demselben Ergebnis zu Ende<br />
gegangen.<br />
Die Lage für K. änderte sich, als im Mai 2009 deutsche Medien über die laufenden<br />
Gerichtsverfahren der beiden Ex-Mitarbeiter in den USA berichteten – und über<br />
Sex-Eskapaden in der Bank. Roland K. wurde zur Belastung. Eine neue Untersuchung,<br />
von der Prüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PWC), zielte vor<br />
allem auf Spesenrechnungen. Eine Reise mit Kunden zum Skifahren nach Wyoming<br />
sei auffällig teuer gewesen, so der Verdacht, aber wieder sah es am Ende<br />
so aus, als würde nichts dabei herauskommen. Das wäre nun eine schmerzhafte<br />
Niederlage für Nonnenmacher gewesen.<br />
Folgt man dem streng geheimen WilmerHale-Bericht, wurde es jetzt grob: Schon<br />
im Mai 2009, als sich abzeichnete, dass PWC und eine weitere Kanzlei nicht genug<br />
Munition besorgen könnten, traf sich demnach HSH-Justitiar Gößmann mit Mitarbeitern<br />
der Sicherheitsfirma Prevent. Es war der Beginn des „Projekts Liberty“,<br />
das sich die Bank gut 900.000 Euro kosten lassen sollte. Das Ziel von „Liberty“,<br />
so soll Gößmann später reichlich unverblümt zu WilmerHale gesagt haben: Prevent<br />
sollte mehr Tempo machen, schneller ein Ergebnis liefern als PWC. Dazu stünden<br />
Prevent doch auch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Möglichkeiten, von<br />
denen er besser nichts wissen wolle, um seinen guten Glauben nicht zu verlieren.<br />
Gegenüber dem SPIEGEL bestreitet Gößmann so eine Aussage. Außerdem habe<br />
sich die Ermittlung nicht gegen Roland K. gerichtet. Vielmehr sei es eine „neutrale<br />
und ergebnisoffene Untersuchung der Spesenpraxis der New Yorker Niederlassung“<br />
gewesen.<br />
52
Auch Nonnenmacher traf sich, WilmerHale zufolge, früh mit dem damaligen<br />
Prevent-Vorstand Thorsten Mehles, um zu erfahren, wie es bei „Liberty“ stand;<br />
später drängte er auf Resultate, unzufrieden darüber, dass auch Prevent nichts<br />
Handfestes gegen Roland K. zu finden schien. „Liberty“ sollte die Bank von K.<br />
befreien; es war Nonnenmachers Projekt, ein Geheimprojekt, von dem Vorstandskollegen<br />
wie Peter Rieck nichts erfahren sollten.<br />
Am 17. September 2009 war es so weit. Wie es bei WilmerHale hieß, hatte Nonnenmacher<br />
für zehn Uhr eine Videokonferenz mit K. angesetzt, um sicherzugehen,<br />
dass der im Büro sein würde. Gleichzeitig rückte ein 13-köpfiges HSH-Rollkommando<br />
in die New Yorker Filiale ein. An der Spitze Gößmann und der Personalchef<br />
Stefan B., dazu eine Partnerin aus der Rechtsanwaltskanzlei Erbe, der<br />
Prevent-Mann Mehles mit vier Mitarbeitern, außerdem Computerspezialisten<br />
einer IT-Firma, Sicherheitsleute.<br />
WilmerHale schildert nun folgenden Ablauf: Roland K. war zwar doch nicht im<br />
Büro, aber das Team begann damit, das Chefzimmer zu durchsuchen, alles wie<br />
geplant. Gleich zu Beginn schlug ein Prevent-Mann vor, sich doch mal die Bilderrahmen<br />
im Zimmer genauer anzuschauen. So ein Rahmen sei ja ein beliebtes<br />
Versteck. Und tatsächlich: Als die Erbe-Anwältin den Rahmen mit dem Bild von<br />
K.s Tochter aufdrückte, fand sie einen Aufkleber mit einer E-Mail-Adresse, in der<br />
das Wort „kid“, Kind, vorkam. Daneben stand ein Begriff, der ein Passwort sein<br />
könnte, „000ROBI“.<br />
Eine Information, mit der die IT-Spezialisten, die sich gerade am Arbeitsrechner<br />
von K. zu schaffen machten, schnell etwas anfangen konnten. Sie hatten zwei<br />
dubiose Mails eines „Jan Nowak“ gefunden, in einer tauchte auch die E-Mail-<br />
Adresse von der Rückseite des Kinderfotos auf. Mit dem Passwort vom Aufkleber<br />
meldeten sie sich dort an und stießen gleich auf eine Mail mit Kinderporno-Bildern,<br />
Absender jener „Jan Nowak“.<br />
Umgehend, so WilmerHale, reichte das Team alles an die New Yorker Polizei<br />
weiter, die ein Ermittlungsverfahren einleitete, wegen der Kinderporno-Fotos.<br />
Doch am 22. April meldeten sich die Ermittler bei Anwälten der Bank mit dem<br />
Ergebnis zurück: Aus ihrer Sicht sei Roland K. das Opfer einer Intrige geworden.<br />
53
Noch ist nicht klar, was die New Yorker Polizei so deutlich zu dieser Einschätzung<br />
hat kommen lassen. Gerüchten zufolge könnte sich ein Mitglied des Teams<br />
US-Fahndern anvertraut haben; bei WilmerHale findet sich darauf allerdings kein<br />
Hinweis. Doch was die grundsätzliche Bewertung angeht, folgt auch der Report<br />
den New Yorker Staatsanwälten: „Es gibt keinen belastbaren Beweis dafür, dass<br />
Herr K. die kinderpornografischen Bilder aus dem E-Mail-Account auf seinem<br />
Bürorechner angeschaut hat. Dagegen gibt es aber belastbare Indizien, dass<br />
Herrn K. eine Falle gestellt wurde. Dass der E-Mail-Account von jemand anderem<br />
erzeugt wurde. Dass der Aufkleber auf der Rückseite des Fotos von Herrn K.s<br />
Tochter ebenso wie die E-Mails des Jan Nowak platziert wurden.“<br />
Das Ziel laut WilmerHale: den „falschen Eindruck zu erzeugen“, K. sei der Eigentümer<br />
des E-Mail-Postfachs mit den Kinderporno-Bildern. Doch wenn es eine Falle<br />
war, dann schnappte sie nicht zu. Unter anderem weil ein Unbekannter aus einem<br />
Internetcafé eine Mail von dieser E-Mail-Adresse abgesetzt hatte, als K. nachweisbar<br />
ganz woanders war. So schnappt die Falle jetzt nach denen, die sie vermutlich<br />
aufgestellt hatten.<br />
Kaum hatte die Bank erfahren, dass die New Yorker Staatsanwälte Roland K. für<br />
das Opfer, nicht den Täter hielten, erklärten die Teammitglieder ihre Unschuld:<br />
Nein, sie wüssten nichts von einer solchen Verleumdungskampagne, schon gar<br />
nicht seien sie daran beteiligt gewesen. Anwalt Erbe hatte das Massendementi<br />
organisiert; nur einer aus dem Team schwieg lieber.<br />
So mussten sich die internen Ermittler am Ende zwar damit zufriedengeben,<br />
niemanden eindeutig überführen zu können. Dennoch notierten sie Bemerkenswertes:<br />
Laut WilmerHale hat Gößmann schon am 22. April erfahren, dass die<br />
New Yorker Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt, aber erst am 28. April Martin<br />
van Gemmeren darüber informiert, den für den Fall zuständigen Vorstand. In der<br />
Zwischenzeit, vermutlich am 23. April, habe Gößmann seinen Laptop reparieren<br />
lassen – danach seien alle Daten gelöscht gewesen.<br />
Gößmann dementiert diesen Vorgang komplett. Erst durch van Gemmeren habe<br />
er von den Ermittlungen in New York erfahren. „Die Unterstellung“, er habe<br />
„bewusst Daten gelöscht beziehungsweise löschen lassen“, sei abenteuerlich.<br />
54
Vor allem aber Prevent-Ermittler Mehles, früher mal Abteilungsleiter im Hamburger<br />
Landeskriminalamt, bekommt mit dem WilmerHale-Bericht ein Glaubwürdigkeitsproblem.<br />
Während Mehles behauptet, es sei nicht seine Entscheidung gewesen,<br />
mit den Porno-Fotos zur New Yorker Polizei zu gehen, steht in der E-Mail eines Mitarbeiters<br />
das glatte Gegenteil. Und während Mehles angab, erst im August von<br />
Kinderporno-Gerüchten um Roland K. gehört zu haben, sagten Nonnenmacher und<br />
Gößmann, das habe ihnen der Security-Mann doch schon im Juni oder Juli erzählt.<br />
Das würde dann auch für die Vermutung im Zwischenbericht sprechen, dass es<br />
bereits lange vor der Razzia im Team eine geheime Absprache darüber gegeben<br />
habe, wonach sie tatsächlich suchen wollten: nicht nach Spesenbelegen, sondern<br />
nach Kinderporno-Spuren. Nur dann nämlich, so WilmerHale, ergebe das<br />
Zerlegen von Bilderrahmen einen Sinn.<br />
Doch woher wollte Mehles eigentlich von Kinderporno-Gerüchten um K. im fernen<br />
New York gehört haben? Vom FBI, sagte Nonnenmacher; das habe ihm Mehles<br />
jedenfalls gesagt. Falsch, aus der deutschen Presseszene, so Mehles zu Wilmer-<br />
Hale. Ständig neue Widersprüche.<br />
Fest steht: Aus dem mutmaßlichen Versuch, Roland K. billig loszuwerden, wurde<br />
nun die wohl kostspieligste Trennung der Firmengeschichte. Auf 2,49 Millionen<br />
Dollar Abfindung klagte K., und noch mal auf 10 Millionen Schadensersatz. Kürzlich<br />
einigte sich die Bank mit ihm angeblich auf 7,5 Millionen Dollar, eine Summe<br />
irgendwo zwischen Schuldeingeständnis und Schweigegeld. Zusätzlich soll die<br />
Bank eine Million für seinen Anwalt gezahlt haben; zusammen mit dem, was all<br />
die eigenen Prüfer und Anwälte noch so gekostet haben, schätzt ein Insider das<br />
Paket auf 18,5 Millionen Dollar. „Und das nur, weil Nonnenmacher sich nicht<br />
vernünftig mit Leuten einigen kann“, heißt es aus der Bank.<br />
Selbst wenn unklar bleibt, welche Rolle Nonnenmacher in der von WilmerHale<br />
skizzierten Intrige spielte: Seit die Anwälte ihren Report präsentiert haben, ist<br />
er als Chef einer Krisenbank, die auf das Vertrauen ihrer Kunden und noch mehr<br />
auf das der öffentlichen Hand angewiesen ist, eigentlich nicht mehr zu halten.<br />
Aber die HSH wäre nicht die HSH, wenn sie es nicht doch versuchen würde.<br />
55
Schon vergangene Woche ließ der Aufsichtsrat wissen, er halte Nonnenmacher<br />
für entlastet; der Report bescheinige ihm, „jederzeit pflichtgemäß gehandelt zu<br />
haben“. Wer bei WilmerHale nach so einer Aussage sucht, scheitert jedoch.<br />
Auch Gößmann genoss Schonung. Obwohl freigestellt, behielt er nach eigener<br />
Auskunft Zugangskarte und Diensthandy. So blieb er zumindest für Nonnenmacher<br />
noch erreichbar, nachdem er sich in eine Klinik abgemeldet hatte.<br />
Erst als die Bank meinte, auf öffentlichen Druck reagieren zu müssen, machte<br />
der Vorstand im Haus bekannt, dass Gößmann vorerst kaltgestellt war. Die Rettungsstrategie<br />
lautete nun offenbar: New York geheim halten, gleichzeitig im<br />
Fall Roth die Vorwürfe mit aller Macht zerstreuen. Also vor allem den Vorwurf,<br />
der Abhörspezialist Arndt Umbach habe Roth für die Bank bespitzelt, sei in<br />
dessen Wohnung eingebrochen, habe Beweise gegen ihn gefälscht.<br />
Die Bank bestreitet, Druck auf Umbach gemacht zu haben. Doch Zufall oder nicht:<br />
Noch bevor der SPIEGEL vor einer Woche herauskam, fand Umbach an einem Sonntag<br />
einen Notar, um dort schriftlich zu erklären, er habe nie etwas Illegales getan<br />
und so etwas auch nie behauptet. Eine Kehrtwende, die der Bank gelegen kam.<br />
Tatsächlich sind die Umstände im Fall Umbach aber nicht so, dass der Schwenk<br />
entlastend wirkt. Zu viel spricht dagegen, dass er jetzt die Wahrheit sagt. Und<br />
zu viel dafür, dass Roth übel mitgespielt wurde, dass auch er, wie K., offenbar<br />
das Opfer einer Bank außer Kontrolle ist.<br />
So wie Konzernjustitiar Gößmann diesen Fall im Ermittlungsverfahren gegen Roth<br />
2009 darstellte, hatte Nonnenmacher Ende 2008 darüber geklagt, dass geheime<br />
Informationen aus der Bank nach draußen sickerten. In Vieraugengesprächen<br />
hätten sie entschieden, dem Maulwurf eine Falle zu stellen, mit einer Vorstandsunterlage.<br />
Jeder Empfänger würde eine etwas anders markierte Kopie erhalten.<br />
Sollte das Papier an die Presse gehen und dann zurück an die Bank, wäre klar,<br />
wer Geheimnisse durchgesteckt hatte.<br />
Wem aber sollte man die Falle stellen? Glaubt man Gößmann, und das ist bei<br />
Nonnenmachers Charakter durchaus plausibel, vermutete der Vorstandschef,<br />
56
dass der Maulwurf nicht der Bank schaden wollte, sondern nur ihm. Das traute<br />
er am ehesten seinen Vorstandskollegen zu. Auf Platz eins der Verdächtigenliste:<br />
Roth, weil „Herr Roth weiß, dass ich ihn loswerden will“, zitierte Gößmann in<br />
der Vernehmung Nonnenmacher.<br />
Das Präparieren der Papiere übernahm Wim de Jong-Niehoff, ein Spezialist für<br />
die Untersuchung von Handschriften. An einem Abend im Februar, gegen 21 Uhr,<br />
tütete Gößmann mit Nonnenmacher vier minimal veränderte Exemplare für die<br />
anderen Vorstandsmitglieder ein. Er selbst habe die Kopien angereicht, Nonnenmacher<br />
sie in weiße Umschläge gesteckt und die Kuverts danach beschriftet.<br />
Gut drei Wochen später, offenbar war das Papier nicht bei der Presse gelandet,<br />
will Gößmann dann einen zweiten Versuch gestartet haben, diesmal mit einer<br />
Vorstandsunterlage, die per E-Mail verschickt wurde.<br />
Und tatsächlich: Jetzt habe es das gewünschte Echo gegeben, einen anonymen<br />
Brief aus England an Nonnenmacher, darin: die erste Seite der Vorstandsunterlage<br />
aus dem Februar und das jüngst per E-Mail nachgeschobene Papier. In einem<br />
Begleitschreiben behauptete der Unbekannte, offenbar Journalist, er habe die<br />
Blätter bekommen, um sie zu veröffentlichen. Aber da die Papiere Geschäfts -<br />
geheimnisse der HSH enthielten, schicke er sie doch lieber an den Vorstandschef.<br />
Die Markierungen, so Gößmann, hätten klar ergeben, dass es sich um die Unterlagen<br />
für Frank Roth gehandelt habe. Ein Arndt Umbach aber taucht in Gößmanns<br />
Version nicht auf.<br />
Was so eindeutig wirkt, ist in Wahrheit so absurd, dass auch die Kieler Staatsanwaltschaft<br />
das Verfahren gegen Roth wegen Geheimnisverrat längst eingestellt<br />
hat. Zu der Jagd nach einem unbekannten Maulwurf passt das ganze Vorgehen<br />
nämlich nicht, wohl aber dazu, etwas gegen genau eine Person in die Hand zu<br />
bekommen: Roth. Gut möglich, so die Staatsanwälte, dass Roth also Opfer einer<br />
gezielt gelegten Spur geworden sei. Allein schon, wie der Verdächtigenkreis<br />
begrenzt wurde: Die Aufsichtsräte, die Manager der zweiten Ebene – alle hätten<br />
auch das Leck sein können, doch sie erhielten keine markierten Dokumente.<br />
Nur die Vorstände.<br />
57
Schon das passt alles nicht zusammen, aber am wenigsten das, was Justitiar<br />
Gößmann über den zweiten Köder aussagte, die Vorstandsvorlage, die per E-Mail<br />
auf den Weg ging. Auch sie, so Gößmann, habe Wim de Jong-Niehoff präpariert.<br />
Dagegen de Jong-Niehoff in seiner Aussage bei der Kripo Kiel: „Ich kann ausschließen,<br />
dass der Vorfall von uns bearbeitet wurde.“<br />
Wer war es dann?<br />
Die markierte Mail erhielten die Vorstände von der damaligen Kommunikationschefin<br />
Michaela Fischer-Zernin Anfang März. Gößmann hatte sie zuvor eingeweiht,<br />
dass man versuchen wolle, eine undichte Stelle zu finden; auch Nonnenmacher<br />
hatte mit ihr gesprochen. Die Vorlage bekam sie dafür zugemailt. Ein<br />
Unbekannter präparierte sie dann in nicht mal einer Stunde. Wer konnte das,<br />
wenn es de Jong-Niehoff nicht gewesen ist?<br />
Knapp fünf Monate später, am 29. Juli, traf sich Arndt Umbach in einer Hamburger<br />
Kanzlei mit den HSH-Aufsichtsräten Olaf Behm und Rieka Meetz-Schawaller sowie<br />
dem früheren Leiter der HSH-Konzernsicherheit. Glaubt man dem Protokoll, gab<br />
Umbach zu, er habe im Auftrag der Bank auch diese Mail präpariert und verschickt.<br />
Dazu stand Umbach noch am Freitag vorletzter Woche. Aber er sprach da auch<br />
schon von Geld, das er brauche, um unterzutauchen. Zwei Tage später, am<br />
Sonntag, änderte er seine Darstellung, seitdem ist er unauffindbar.<br />
Seine neue Version hat ein gravierendes Glaubwürdigkeitsproblem: Schließlich<br />
sind die Teilnehmer des Treffens nicht die einzigen Zeugen. Direkt danach fuhr<br />
Umbach nach Kiel zur Staatsanwaltschaft, zusammen mit dem früheren HSH-<br />
Sicherheitsexperten.<br />
Eine Stunde lang saßen drei Staatsanwälte Umbach und seinem Anwalt gegenüber,<br />
es ging immer wieder um die Frage, ob Umbach bei einem Geständnis<br />
straffrei davonkomme. Zu einer Vernehmung kam es nicht, auch weil Kiel die<br />
58
Sache an die Hamburger Staatsanwaltschaft abgab. Aber warum sollte jemand<br />
über Straffreiheit verhandeln, wenn er gar nichts Strafbares getan hat? „Umbachs<br />
Rückzieher hat für uns kein Gewicht“, heißt es deshalb bei Hamburger Ermittlern,<br />
und die Kollegen in Kiel prüfen jetzt sogar, ob sie ein Verfahren einleiten gegen<br />
Verantwortliche der Bank, wegen falscher Verdächtigung von Roth.<br />
Diesem Vorwurf müsste auch noch ein anderer dringend nachgehen: Hilmar<br />
Kopper, der Aufsichtsratsvorsitzende. Doch Kopper steht, in Treue erstarrt,<br />
wo er immer schon stand: hinter Nonnenmacher. „Der Aufsichtsrat hat unein -<br />
geschränktes Vertrauen in die Entschlossenheit des Vorstandsvorsitzenden,<br />
derartigen rechtswidrigen Machenschaften Einhalt zu gebieten“, ließ der Aufsichtsrat<br />
am Donnerstag nach einer Sitzung des Präsidialausschusses mitteilen.<br />
Er gehe davon aus, dass auch Gößmann nach allen Überprüfungen „vollständig<br />
rehabilitiert“ sein werde.<br />
Wieder muss man einen Moment innehalten: Haben Kopper und die anderen den<br />
WilmerHale-Bericht nicht gelesen? Oder hoffen sie nur, sie seien die Einzigen,<br />
die ihn jemals zu lesen bekommen? Und: Wäre das Vernichten von Existenzen<br />
durch getürkte Kinderporno-Vorwürfe in ihren Augen nur so ein Kollateralschaden<br />
des Krisenbankings?<br />
Er habe auch nach wie vor keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass Roth Bankinterna<br />
an die Presse weitergegeben habe, hatte Kopper schon einige Tage zuvor bockig<br />
behauptet. Dass Nonnenmacher in Amerika als Verdächtiger geführt wird und<br />
WilmerHale das Vorgehen gegen Roland K. und Frank Roth ausdrücklich als Parallelfälle<br />
bewertet, erwähnte Kopper erst gar nicht. So wenig wie die Tatsache, dass<br />
Nonnenmacher gegen deutsches Aktienrecht verstoßen haben könnte, als er<br />
seinen Mitvorständen Fallen stellte, ohne den Aufsichtsrat zu informieren. Dass<br />
er sie überging, ihre Kontrolle ausschaltete – für die Aufseher offenbar alles verschmerzbar,<br />
verzeihbar.<br />
Nein, nie war diese Bank so am Ende wie heute.<br />
59
3. <strong>Preis</strong>
61<br />
Ursel Sieber
Gesunder Zweifel<br />
(Berlin Verlag, 04.09.2010)<br />
Ursel Sieber<br />
geboren 1958 in Schorndorf-Oberberken<br />
Werdegang:<br />
seit 1990 Autorin für die ARD-Magazine Monitor und Kontraste<br />
1987-1990 Parlamentskorrespondentin der taz in Bonn<br />
1984-1987 Redakteurin der taz in Berlin<br />
1979-1984 Studium<br />
1976-1978 Auslandsaufenthalte in Frankreich und USA<br />
1976 Abitur<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
2010 Ernst-Schneider-<strong>Preis</strong> für „Endstation Chaos“<br />
2002 Helmut-Schmidt-Journalistenpreis für „Pleiten ohne Ende“<br />
62
Begründung der Jury<br />
Es gibt Skandale, die nur deshalb nicht als solche wahrgenommen werden, weil sie<br />
schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten anhalten und sowohl die Politik als auch die<br />
Medien es im Grunde aufgegeben haben, dagegen vorzugehen.<br />
Ein solcher Dauer-Skandal ist die Plünderung der Beitragszahler der gesetzlichen<br />
Krankenkassen in Deutschland durch die Medizin-Industrie. Jeder halbwegs auf merksame<br />
Zeitungsleser weiß, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da ein<br />
Kartell aus Konzern-Lobbyisten und Verbands-Funktionären jenseits echter öffentlicher<br />
Kontrollen die Verteilung von dreistelligen Milliardenbeträgen unter sich aushandelt,<br />
und dass es dabei in erster Linie um wirtschaftliche Interessen und Macht geht und<br />
eher selten um das Wohl der Patienten oder erst recht nicht die beste Medizin auf der<br />
Höhe der bekannten ärztlichen Kunst. Da werden Mondpreise für angeblich innovative<br />
Medikamente bezahlt, deren Nutzen gar nicht belegt ist. Da werden massenhaft teure<br />
Untersuchungen durchgeführt, nur um die teuren Geräte auszulasten, welche die Hersteller<br />
in viel zu großer Zahl an Krankenhäuser und Ärzte vertickt haben. Usw. usf.<br />
Über diese Missstände wird zwar immer wieder mal berichtet, aber es passiert nichts,<br />
nicht zuletzt, weil die meisten kritischen Journalisten bei diesem Thema eher kurzatmig<br />
sind. Immer wieder mal wird diese Korruption und jene Selbstbedienung aufgedeckt,<br />
aber das war es dann zumeist auch. Die Strukturen dahinter, die solche Verschwendung<br />
überhaupt erst möglich machen, werden kaum benannt und schon gar werden nicht<br />
die wirklich Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.<br />
Aber es gibt Ausnahmen von der Regel. Eine solche Ausnahme – auf Seiten des Apparats<br />
– ist der Mediziner und leidenschaftliche Arzt Peter Sawicki. Und eine weitere<br />
Ausnahme – auf Seiten der Medien – ist Ursel Sieber.<br />
Als Sawicki 2004 zum Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen<br />
berufen wurde, da schien es, als seien Reformen doch möglich. Denn Sawicki<br />
tat wirklich, was ihm aufgetragen war: Er prüfte mit seinen Mitarbeitern Medikamente<br />
und Therapien auf ihren wissenschaftlich belegbaren Nutzen. Und wenn es einen solchen<br />
nicht gab, dann empfahl er, sie nicht als Kassenleistung anzuerkennen. Und er wurde<br />
63
immer häufiger fündig. Tatsächlich gibt es für 80 Prozent aller Kassenleistungen bisher<br />
keinen wissenschaftlich sauberen Nachweis über deren Nutzen. Und bei dieser Arbeit<br />
war Sawicki absolut unbestechlich und kompromisslos – eine Eigenschaft, die mit<br />
den Gepflogenheiten im deutschen Gesundheitswesen offensichtlich nicht vereinbar<br />
war. Darum wurde er über eine von langer Hand geplante Intrige im Januar 2010<br />
schließlich abgelöst.<br />
Das wurde berichtet, abgehakt – und vergessen. Aber Ursel Sieber wollte sich damit<br />
nicht abfinden. Zu lange und viel zu oft hatte sie schon über das Gesundheitsunwesen<br />
berichtet. Darum wollte sie verhindern, dass mit Sawicki die bisher größte Reformhoffnung<br />
sang- und klanglos einfach verschwindet. Und das ist ihr hervorragend<br />
gelungen. Ihr Buch „Gesunder Zweifel“ beschreibt eben nicht nur einzelne Fehlent -<br />
wicklungen, sondern es erklärt an Hand des Falles Sawicki minutiös und doch leicht<br />
zu lesen, was im deutschen Medizinbetrieb strukturell falsch läuft. Wenn Sie denken,<br />
das wissen Sie alles schon, ich versichere Ihnen, Sie irren sich. Nach der Lektüre von<br />
Siebers Buch sind Sie schlauer. Sollten dereinst mal wieder echte Reformer im<br />
Gesundheitsministerium Einzug halten, hier können sie nachlesen, wo es lang geht.<br />
Sie müssen genau da weitermachen, wo Sawicki aufhören musste.<br />
Darum freue ich mich, dass Ursel Sieber diesen <strong>Preis</strong> heute bekommt und hoffe,<br />
es macht ihr Mut, das Thema trotz aller Frustration nicht aufzugeben.<br />
Vorgetragen von Harald Schumann<br />
64
Gesunder Zweifel<br />
Einsichten eines Pharmakritikers – Peter Sawicki<br />
und sein Kampf für eine unabhängige Medizin<br />
In Gesunder Zweifel zeichnet die Journalistin Ursel Sieber den Einsatz von Peter<br />
Sawicki für eine unabhängige Medizin nach. Sie zeigt, wie sich aus politischen<br />
und wirtschaftlichen Gründen Hindernisse auftürmen, wo medizinische Fehl behandlungen<br />
erheblichen Schaden anrichten und warum er und das Institut für<br />
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Deutschland<br />
beschimpft werden, obwohl beide international hohes Ansehen genießen. Ein<br />
Blick hinter die Kulissen des Medizinbetriebs.<br />
Am 31. August 2010 scheidet Peter Sawicki als Leiter des Instituts für Qualität<br />
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) aus. Unter seiner Führung<br />
bewertet das IQWiG seit 2004 den Nutzen von Arzneimitteln und kämpft um eine<br />
wissenschaftlich begründete Anwendung von Medikamenten und Therapien.<br />
Widerstand aus Gesundheitsindustrie und schwarz-gelber Politik hat eine Verlängerung<br />
seines Vertrags unmöglich gemacht.<br />
In Gesunder Zweifel schildert die Medizinjournalistin Ursel Sieber die Widerstände,<br />
auf die Sawicki bei Pharma-Lobbys, Krankenhaus-Vertretern und wirtschaftsfreundlichen<br />
Politikern gestoßen ist. Auf Basis sorgfältiger Recherchen wirft sie<br />
einen Blick hinter die Kulissen des Gesundheitswesens: Neu am Markt eingeführte<br />
Medikamente sind teurer und dadurch einträglich für die Industrie – haben aber<br />
oftmals keinen Zusatznutzen und schaden manchmal sogar den Patienten.<br />
Detailliert und anhand gut dokumentierter Beispiele aus der Therapie von<br />
Diabetes, Demenz und Krebs berichtet Ursel Sieber von Peter Sawickis Kampf<br />
gegen Wirtschafts- und Standesinteressen und für die Einführung einer evidenzbasierten<br />
Medizin.<br />
Bereits vor Erscheinen sorgte Gesunder Zweifel für große Aufmerksamkeit in<br />
den Medien: So berichtete Der Spiegel unter Berufung auf dieses Buch über<br />
die frühe Einmischung des Kanzleramtes in die Personalie Sawicki.<br />
65
Spezial-<strong>Preis</strong>
67<br />
Katja Thimm
Vaters Zeit<br />
(DER SPIEGEL, 11.04.<strong>2011</strong>)<br />
Katja Thimm<br />
geboren 1969 in Köln<br />
Werdegang:<br />
seit 2009 Reporterin im Ressort Kultur/DER SPIEGEL<br />
2000-2009 Redakteurin im Wissenschaftsressort/DER SPIEGEL<br />
1998-2000 Redakteurin beim NDR-Fernsehen und im Auslandsressort des Stern<br />
1995-1998 Henri-Nannen-Journalistenschule Hamburg; Rundfunkvolontariat beim NDR<br />
1988-1995 Studium<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
2009 Henri Nannen <strong>Preis</strong> in der Kategorie Reportage (Egon-Erwin-Kirsch-<strong>Preis</strong>)<br />
2001 Heureka <strong>Preis</strong> für Wissenschaftsjournalismus<br />
68
Begründung der Jury<br />
Es war in der Zeit, in der die Zahnärzte noch Dentisten hießen und sich noch nicht jeder<br />
Deutsche die dritten Zähne leisten konnte: Wenn meine Tanten damals der Großmutter<br />
ihre neugeborenen Enkelkinder präsentierten, dachte die alte Frau, Jahrgang 1877,<br />
anschließend über eine anthropo-biologische Frage nach: Wie es denn komme, so<br />
sinnierte sie, dass man gemeinhin die kleinen Kinder ohne Zähne als possierlich, die<br />
zahnlosen Alten aber als hässlich betrachte? Die Zahnlosigkeit der Alten akzeptierte<br />
sie unter Bezugnahme auf das Bibelwort „wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr<br />
nicht ins Himmelreich eingehen“ als eschatologische Notwendigkeit; und so war,<br />
theologisch höchst fragwürdig, aber für meine Großmutter sehr befriedigend, der<br />
körperliche Verfall erklärt und eingebettet in die Volksfrömmigkeit.<br />
Großmutter ist, nach einem Leben in der Großfamilie, 1962 gestorben. Sie war 77.<br />
Seitdem hat sich unendlich viel geändert in der Gesellschaft. Die Menschen sind älter<br />
geworden. Es sind wohl in der letzten Zeit mehr Altersheime als Kindergärten gebaut<br />
worden. Die Generation nach meiner Großmutter, die Kriegsgeneration, stirbt im Altersheim.<br />
Das ist das Thema von Katja Thimm. Der Vater der Autorin gehört zur Generation<br />
der traumatisierten Kriegskinder; er war als kleiner Junge mit seiner Schwester Teil<br />
eines ostpreußischen Flüchtlingstrecks. Über die Furchtbarkeiten, die er dabei erlebte,<br />
hat er nie geredet. Jetzt, im hohen Alter, bricht alles aus ihm heraus, weil der mentale<br />
Widerstand gegen diese Erinnerung zerbrochen ist. Katja Thimm schreibt das auf, sie<br />
schreibt zart, leidenschaftlich und präzise, sie schreibt empfindsam und sachlich; sie<br />
schafft es, die Schwierigkeiten, die sie bei der Pflege ihres eigenen Vaters erlebt hat,<br />
zu verweben mit den Grundproblemen des demographischen Wandels.<br />
Im Jahr 2050 werden in Deutschland mehr als vier Millionen Menschen pflegebedürftig<br />
sein: Wie soll dann funktionieren, was schon heute, bei knapp halb so hohen Zahlen,<br />
nicht funktioniert? Der Umgang mit den Alten ist das Megathema unserer Gesellschaft.<br />
Katja Thimm führt uns in dieses Thema ein in einer Weise, für die man ihr unendlich<br />
dankbar ist: Aus dem Stapel von einschlägigen neueren Veröffentlichungen ragt ihr<br />
Beitrag nicht nur deswegen heraus, weil er ein wunderbares Beispiel für die Poetik<br />
des Journalismus ist, sondern weil sie die Probleme der Pflege der alten Menschen<br />
verbindet mit der Erinnerungslast der Kriegsgeneration; sie schreibt vom schweren<br />
69
Alltag und der Pflege des alten Vaters und von den schwärenden Erinnerungen an die<br />
Kriegs- und Fluchtzeit, von den inneren Verletzungen, die nie vergehen.<br />
Ich muss gestehen, ich habe eigentlich einen gewissen Überdruss an Ich-Reportagen,<br />
an Erlebnis-Erzählungen, an einem Journalismus, der die Person des Autors ins Zentrum<br />
stellt. Katja Thimms Beitrag wurzelt nun zwar in persönlichen Erlebnissen und eigenen<br />
Erfahrungen. Aber ihr Essay ist nicht nur ein glänzendes journalistisches Gemälde all<br />
dieser Nöte. Es ist nicht nur ein exemplarisches, ein in all seiner Individualität allgemeingültiger<br />
Text. Katja Thimms Geschichte ist von einer Eindringlichkeit, wie sie<br />
– aus einer ganz anderen Zeit stammend – die Bilder von Käthe Kollwitz vermitteln<br />
können. Ihr Text ist ein Kunstwerk, das vom Umgang der Generationen miteinander<br />
handelt. Dazu gratuliere ich Ihr mit Respekt und Bewunderung.<br />
Vorgetragen von Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
70
Vaters Zeit<br />
Wenn Eltern alt und hilflos werden, vertauschen sich die Rollen: Die erwachsenen<br />
Kinder übernehmen Verantwortung und treffen Entscheidungen für das Leben<br />
von Mutter und Vater. Die Generationen lernen einander neu kennen. Ein Erfahrungsbericht.<br />
Als der Rundfunkpfarrer im Radio zum gekreuzigten Jesus betet, zieht mein Vater<br />
um. Es ist Karfreitag, im März 2005, die Sonne scheint, und Vögel zwitschern.<br />
Ich steuere das Auto entlang der stuckverspielten Villen mit ihren Rosen und<br />
Rondellen in den Vorgärten. Die meisten Beamten und Minister leben mittlerweile<br />
in Berlin. Eine gediegene Behäbigkeit ist Bad Godesberg geblieben.<br />
Mehr als dreißig Jahre lang arbeitete mein Vater in diesem Bonner Stadtteil, grüßte<br />
morgens um acht den Pförtner des Ministeriums, das, war wieder einmal eine<br />
Wahl vorüber, wieder einmal anders hieß. „Er arbeitet im BMJFG“, so plapperte<br />
ich in der Grundschule, stolz, mir dieses Ungetüm gemerkt zu haben. „Im Bundesministerium<br />
für Jugend, Familie und Gesundheit.“ Irgendwann trug es auch die<br />
„Frauen“ im Namen, irgendwann waren mein Vater und sein Minister nur noch<br />
zuständig für „Gesundheit“.<br />
Manchmal, wenn er meinte, auch auf das eigene Wohlergehen achten zu müssen,<br />
fuhr er mit dem Fahrrad ins Ministerium und setzte mit der Fähre über den Rhein.<br />
Er besaß eine orangefarbene Pelerine, die er bei Regen überstreifte, und es störte<br />
ihn nicht, dass sie hässlich war. Er fand sie praktisch. Meist aber nahm er das<br />
Auto. Er brauste los im Siebengebirge und stand auf der Brücke über dem Fluss<br />
im Stau, denn Hunderte andere Beamte der Bonner Republik hielten es wie er.<br />
Was er genau tat in seinem Ministerium verstand ich nicht. Er ärgerte sich über<br />
Frau Focke, Frau Huber, Frau Fuchs und Herrn Geißler – gesichtslose Namen meiner<br />
Kindheit, doch mächtig genug, ein Wochenende zu verdüstern. Als 1994 die Ab -<br />
geordneten den Umzug der Regierung nach Berlin beschlossen, wäre er, inzwischen<br />
dreiundsechzig Jahre alt, gern mitgezogen. Er liebte Berlin. „Schade, dass du<br />
zu alt bist“, sagte ich leichthin, als er die Absage erhielt; ich würde bald selbst<br />
71
arbeiten. Besuchte ich meine Eltern in den Semesterferien, konnte wie früher<br />
ein Minister das Wochenende verdüstern, er hieß nun Seehofer und mit Vornamen<br />
wie mein Vater, der, auch das hatte sich nicht geändert, abends wortkarg zum<br />
Gongklang der Nachrichten aus dem Ministerium nach Hause kam. Horst Thimm<br />
mochte es nicht, wenn jemand redete, während der Fernsehmann das Weltgeschehen<br />
verlas.<br />
„Lasset uns beten“, spricht der Pfarrer im Radio. In ein paar Minuten werden im<br />
Godesberger Villenviertel die Kirchenglocken läuten, und der Westdeutsche Rundfunk<br />
wird Nachrichten senden. Ich höre gern Nachrichten und lasse mich ungern dabei<br />
stören. „Lasset uns beten für alle, die sich der Last ihres Lebens nicht gewachsen<br />
fühlen, ewiger Gott, wir bitten dich.“ Auf dem Autorücksitz klappern in den Kartons<br />
Bilderrahmen und Geschirr, dreimal Gedeck, dreimal Besteck, zwei Gläser für Bier,<br />
vier für Wein, vier für Wasser. Ein scharfes Messer. Der Lieferwagen des polnischen<br />
Kleinunternehmers, der beim Umzug hilft, ist bereits am Ziel. Er hat zwei Sessel<br />
transportiert, das Bett, einen Stuhl, einen Tisch, die Regale, die Bücher. Es ist Karfreitag,<br />
die Sonne scheint, Vögel zwitschern, und mein Vater wird fortan im Seniorenheim<br />
leben. Im Garten dieser Unterkunft blühen violette Krokusse.<br />
Demografischer Wandel. Pflegenotstand. Medinizischer Dienst der Krankenversicherungen.<br />
Es werden viele Vokabeln aus dem unfassbaren Nachrichtenfluss<br />
handgreiflich, wenn der eigene Vater in ein Heim umzieht. Vorangegangen waren<br />
Monate der Suche.<br />
Es wäre mir lieber gewesen, er hätte zu denen zählen können, die zu Hause Pflege<br />
und Hilfe erhalten. Es sind dies fast so viele wie in Hamburg wohnen, 1,8 Millionen.<br />
Es war nicht möglich. So lebt er in einer Einrichtung, und Altenpfleger, Köche,<br />
Putzhilfen, Wäschefrauen und Sozialpädagogen teilen im Schichtdienst seinen<br />
Alltag. Sie helfen den Bewohnern auf die Toilettenbrille, bewegen sie mit einer<br />
elektrischen Hebehilfe vom Bett in den Rollstuhl, versehen Kleidung mit Namensschildern,<br />
leeren Mülleimer, assistieren beim Essen oder spielen mit den Alten<br />
Mensch ärgere Dich nicht. Es leben mehr Menschen in Deutschland in einer solchen<br />
Einrichtung als in Frankfurt am Main, 720.000.<br />
72
Als es immer schwieriger wurde, allein in seiner Wohnung, gehörte mein Vater<br />
zu einer Gruppe, so zahlreich wie die Einwohner von Stuttgart. Die meisten Menschen<br />
gehören irgendwann einmal zu Stuttgart. Sie brauchen noch keine Pflege,<br />
doch Unterstützung, denn sie scheitern an Bankgeschäften, Kleiderkäufen und<br />
der durchgebrannten Glühbirne ganz oben in der Deckenlampe. Noch in den<br />
ersten zwei Jahren im Altersheim zählte mein Vater zu Stuttgart.<br />
Nie zuvor wurden in diesem Land so viele Menschen so alt. Frauen, die in diesen<br />
Tagen ihren achtzigsten Geburtstag feiern, begehen aller Wahrscheinlichkeit nach<br />
auch noch den neunundachtzigsten, Männer den siebenundachtzigsten. Die Zahl<br />
der Pflegebedürftigen wird sich in vierzig Jahren auf 4,4 Millionen verdoppelt haben,<br />
die der Demenzkranken auf 2,5 Millionen. Einmal Sachsen, einmal Brandenburg.<br />
So lauten die Prognosen.<br />
Nie zuvor wurden in diesem Land so wenige Menschen geboren. Sollte ich achtzig<br />
Jahre alt werden, so alt, wie mein Vater inzwischen ist, werden mir in den Statistiken<br />
nur noch fünf Deutsche gegenüberstehen, die jünger sein werden als ich.<br />
Das Geld aus der Pflegeversicherung reicht, ohne eine Beitragserhöhung, noch<br />
drei Jahre. Es deckt schon jetzt nicht alle Kosten; mancher zahlt allein für die<br />
Pflege, die er benötigt, im Monat siebenhundert Euro selbst. Und jene, die das<br />
nicht können, weil dann nichts bliebe für Miete und Mahlzeiten, benötigen „Hilfe<br />
zur Pflege“, eine Art Hartz IV für Alte. Es sind bereits so viele, wie in Freiburg<br />
wohnen, 220.000.<br />
Der hundertfach verplätscherte Appell aus Talkshows und Sonntagsreden dröhnt,<br />
wenn plötzlich der eigene Vater, die eigene Mutter nicht mehr können: Der demografische<br />
Wandel ist die dringlichste Aufgabe unserer Gesellschaft! Er ist ein Gradmesser<br />
für ihre Menschlichkeit! Mit einem Mal redet man genauso.<br />
Und blickt um sich und sucht Unterstützung.<br />
73
Da ist Kristina Schröder; die Familienministerin will eine „Familienpflegezeit“ einführen,<br />
jeder soll zwei Jahre lang die Arbeit auf fünfzehn Stunden in der Woche<br />
reduzieren können, um sich den alten Eltern zu widmen. Da ist Philipp Rösler, der<br />
Gesundheitsminister, er hat <strong>2011</strong> zum „Jahr der Pflege“ erklärt und will reformieren.<br />
Ginge es nach ihm, sollte jeder in einer Art Lebensversicherung zusätzliche Rücklagen<br />
für die drohende Gebrechlichkeit bilden. Auch die Frage, wer eigentlich<br />
pflegebedürftig ist, will er neu beantworten. Noch addiert ein Gutachter die Minuten,<br />
die es dauert, einem alten Menschen bei den notwendigen Verrichtungen<br />
zur Hand zu gehen – Hilfe beim Zähneputzen, Hilfe beim Ankleiden mit Schuhen,<br />
Hilfe beim Ankleiden ohne Schuhe. Eineinhalb Stunden am Tag ergeben Pflegestufe<br />
1, drei Stunden Stufe 2, fünf Stunden die dritte. Doch die Not und Verlorenheit,<br />
die Vergessen und Demenz mit sich bringen, berücksichtigen diese Rechnungen<br />
kaum. Vor zwei Jahren schlug ein Expertenbeirat im Auftrag des Gesundheitsministeriums<br />
Reformen vor, um das zu ändern. Sie fanden viel Zustimmung.<br />
Seither ruhen sie.<br />
Ohnehin ahnt jeder, dessen Eltern plötzlich nicht mehr können, dass diese<br />
Herausforderung, dieser demografische Wandel allein staatlich finanziert und<br />
gelenkt nie wird bewältigt werden können. Es kann nur gelingen, wenn jeder<br />
Verantwortung übernimmt. Alle.<br />
Längst kümmern sich mindestens vier Millionen Frauen und Männer um ihre alten<br />
Angehörigen, bis zu 37 Stunden in der Woche. Und die Anzahl der Ehrenamtlichen,<br />
die Senioren betreuen, steigt. Doch in der Öffentlichkeit wird selten davon ge -<br />
sprochen. Vor allem die berufstätigen Angehörigen schweigen. Es gilt nicht als<br />
karrierefördernd, zwischen zwei Geschäftsterminen die Windel der Mutter zu<br />
erneuern oder eine Wechseldruckmatratze für den Vater zu besorgen.<br />
Zu Zwei Dritteln sind es die Frauen, die Sorge tragen, es ist die alte eingeübte<br />
Rolle. Doch der Anteil der Männer nimmt zu, und auch die Zahl jener eher jungen<br />
erwachsenen Kinder, wie ich eines bin, wächst. Viele sind kaum vierzig Jahre alt,<br />
manche selbst erst Eltern geworden, sie arbeiten – und plötzlich ist da noch eine<br />
74
Verantwortung. Familie und Beruf zu vereinbaren, heißt mit einem Mal, auch den<br />
Vater, die Mutter zu versorgen.<br />
Meist, und vielleicht birgt das die größte Schwierigkeit, sind sie wenig vertraut<br />
mit dem Innenleben dieser Eltern. Der Vater war immer der Vater, die Mutter<br />
immer die Mutter. Nun sind sie bedürftige Wesen und werden von mächtigen<br />
Erinnerungen bestimmt, die sie von ihren Kindern stets ferngehalten haben.<br />
Auch ich wusste nichts von der jahrelangen Haft meines Vaters in einem Zuchthaus<br />
der DDR, nichts von den Leichen, die er in Brandenburg aus den Kriegstrümmern<br />
barg, nichts von seiner Flucht aus Ostpreußen. Jedenfalls wusste ich<br />
nichts Genaues über die Biografie von Horst Hubert Werner Thimm, Jahrgang 1931.<br />
Ich fand ihn oft unverständlich wie seine Arbeit im Ministerium; er war karg und<br />
großzügig, strikt und liebevoll, prinzipientreu und stur, immer zuverlässig und<br />
manchmal schrecklich anstrengend.<br />
Es ist die Generation der Kriegskinder, die da gerade alt wird, jene zwischen 1929<br />
und 1945 geborenen Männer und Frauen, deren frühes Leben von Bomben, Tod,<br />
Hunger, Flucht, Vertreibung oder der Furcht vor Vergewaltigung bestimmt war.<br />
Zu alt, um der 68er-Bewegung anzugehören, und zu jung, um die Gräuel des<br />
Nationalsozialismus zu verantworten, waren sie lange kein Thema gesellschaftlicher<br />
Debatten. Sie selbst hatten früh gelernt, zu schweigen. In der Kindheit war<br />
ihnen eine Härte gegen sich selbst gepredigt worden, die der von Krupp-Stahl<br />
gleichen sollte. Und als alles vorüber war, und sie ihren Platz im Leben gefunden<br />
hatten, schwiegen sie fort. Achtzig Prozent der ehemaligen Kinder dieses Krieges<br />
haben nie von jener Zeit erzählt.<br />
Allerdings – wer hätte ihre Geschichten auch hören wollen? Mir hätten sie noch<br />
vor einigen Jahren nicht gefallen. Geboren 1969, wuchs ich auf mit der nationalsozialistischen<br />
Vergangenheit Deutschlands. Ein friedensbewegter Pastor konfirmierte<br />
mich, meine Lehrer berichteten von 1968 und linksintellektuelle Professoren<br />
nahmen meine Universitätsprüfungen ab. Ich interessierte mich nicht für<br />
deutsche Kriegskinder. Ich hätte es revanchistisch gefunden, mich für die Söhne<br />
und Töchter der Täter zu interessieren. Aber sie waren Kinder. Mitten im Krieg.<br />
75
„Es fehlt uns eine vorbehaltlose vertraute Nähe zueinander“, sagt Hartmut<br />
Radebold, der 75 Jahre alt ist und selbst ein Kriegskind. Seit Jahren forscht er<br />
über die späten Folgen des Zweiten Weltkriegs. Der Professor für Klinische<br />
Psychologie kennt das feinnervige Verhältnis zwischen beiden Generationen<br />
auch aus der eigenen Familie. „Wir Kriegskinder haben unseren Töchtern und<br />
Söhnen eine äußerlich sichere Kindheit zur Verfügung gestellt“, sagt er. „Taschengeld,<br />
Spielzeug, Reisen – all das, was wir nicht hatten. Aber wir haben sie nach<br />
Normen erzogen, die ihnen unzugäglich waren und die sie nicht verstehen konnten,<br />
weil wir uns nie geöffnet haben.“<br />
Iss den Teller leer. Geh sorgsam mit den Sachen um. Sei sparsam. Hüte dich vor<br />
Fremden.<br />
„Viele dieser nun erwachsenen Kinder haben uns Eltern früher so erlebt, als hätten<br />
wir ihre alltäglichen Sorgen nicht ernst genommen“, sagt Hartmut Radebold.<br />
„Den Ärger in der Schule, den Streit mit den Freunden. Und wahrscheinlich haben<br />
wir ihnen auch unbewusst zu verstehen gegeben, dass sie mit solchen Kleinigkeiten<br />
allein klarkommen müssen. Wir hatten schließlich einen Krieg überlebt.<br />
Aber irgendwann erzählten auch die Kinder nichts mehr von ihrem Kummer. So<br />
wussten beide Seiten oft nicht voneinander, was sie wirklich beschäftigt.“<br />
Als sich abzeichnete, dass die Zeit für eine letzte große Reise gekommen war,<br />
besuchten mein Vater und ich Masuren. Umgeben von den Seen seiner Kindheit,<br />
hörte ich schließlich zu. Und er erzählte. Von dem Försterjungen, der er einmal<br />
war, der mit der kleinen Schwester auf einen Schlitten stieg, in Kulk am Lenksee,<br />
und sich in einen Treck einreihte, im Januar 1945. Dreizehn Jahre alt und ohne<br />
die Eltern, der Vater war Soldat, die Mutter bei der sterbenden Großmutter im<br />
brandenburgischen Eberswalde. Spiegelglatte Landstraßen, Hunderttausende<br />
Flüchtlinge. Verendende Pferde, verendende Menschen.<br />
„Und auf der Nehrung, da entluden sie alle ihre Wagen, um auf dem sandigen<br />
Untergrund leichter voranzukommen. Überall standen Körbe mit Kochtöpfen und<br />
Wäsche, und dazwischen Großmütter, tot, mit dem Rücken hingesetzt an einen<br />
Kiefernbaum. Und die Kinder, Ersttagskinder, geboren auf der Flucht. Lebend<br />
76
ließ man sie hinunterfallen, weil die Mütter keine Kraft zum Stillen hatten, und<br />
der nächste fuhr darüber hinweg. Manchmal legte sich ein Pferd zum Sterben<br />
lang, die Fußgänger schnitten das Fleisch aus dem noch lebenden Tier. Und die<br />
Pferde, die hatten so einen Gesichtsausdruck, als wollten sie es nicht glauben.“<br />
„Was hast du damals gedacht?“<br />
„Ich habe nicht viel gedacht. Man muss hier durch, irgendwie. Es war ja auch<br />
nicht möglich, mal eben zu wenden und zurückzufahren. Der Treck hatte eine<br />
Eigendynamik, er sah aus wie eine Ziehharmonika, kilometerlang, die irgendwo<br />
in der Ungewissheit enden würde. Immerhin, unsere Sehnsucht, das alles zu<br />
meistern, hatte ein Ziel: Treffpunkt Eberswalde! Da wartet die Mutter, und wenn<br />
er den Rückzug schafft, auch der Vater. Die Brüder. Und die ältere Schwester.<br />
Tatsächlich war sie zu dem Zeitpunkt bereits tot.“<br />
„Wie lange warst du unterwegs?“<br />
„Am 21. Januar, am späten Nachmittag, sind wir losgezogen. Mitte März kamen<br />
wir in Eberswalde an.“<br />
„Und dann?“<br />
„Dann habe ich erst einmal gebadet. Allen Dreck wollte ich loswerden. So ein Bad<br />
ist ja doch ein kleines Therapeutikum.“<br />
Eine Wanne wäre schön“, sagt mein Vater, wenige Wochen vor dem Umzug in<br />
das Altersheim. Er liegt in einem Krankenhaus, und ich sitze neben seinem Bett,<br />
zornig, traurig über seine Badefreuden. Am Abend zuvor hat er es nicht mehr<br />
herausgeschafft, aus der Badewanne in seiner Wohnung, immer wieder sank<br />
sein schwerer Körper zurück. Das Wasser wurde lau, er gab warmes hinzu, doch<br />
das Becken war bald randvoll und der Abflusspfropfen unerreichbar. So fand<br />
ihn am Morgen die Zugehfrau.<br />
77
Ein Zimmer mit zwei Betten, ein Holzkreuz mit dem geschundenen Leib Christi,<br />
das Haus steht in katholischer Tradition. Auf dem Nachttisch eine Karte, die Klinikverwaltung<br />
wünscht einen guten Aufenthalt. Aus einem Schlauch tröpfelt Flüssigkeit<br />
in seinen Arm. „Eine Wanne“, verlangt mein Vater. „Eine Wanne haben wir<br />
nicht“, erwidert die Krankenschwester, und er sinkt zurück in die Unruhe seiner<br />
Träume, fuchtelt in dem Luftraum über seinem Gesicht, ruft, er wolle fort, endlich<br />
entkommen!<br />
„Papa“, sage ich, und die Schwester sagt: „Aber Herr Thimm.“ Als er die Augen<br />
öffnet, blickt er mich an. Er scheint mich nicht zu sehen. „Wo ist mein Sohn?<br />
Meine Frau? Sie müssen sich beeilen.“<br />
Er fürchtet den Tod, denke ich. Er will sie um sich wissen.<br />
Doch mein Vater ringt nicht allein mit jenem Tod, mit dem sein septischer Körper<br />
gerade ringt. Er sucht auch dem Tod zu entkommen, dem er als Kind entkam.<br />
Das Krankenbett, der Schlauch, die Kanüle schließen Erinnerungen auf. Nun, da<br />
der Körper schwach ist und der Geist erschöpft, da er sich ausgeliefert fühlt wie<br />
der heranwachsende Junge im Flüchtlingstreck, ist er den vergessen geglaubten<br />
Empfindungen preisgegeben. Die alten bösen Bilder erwachen. Mein Vater ist<br />
der Wagenlenker, ein Kind noch, das um das Leben der ihm Anvertrauten bangt.<br />
„Sie haben nicht mehr viel Zeit“, sagt er. „Ich habe nicht mehr viel Zeit.“ Dann<br />
legt er die Hand auf meinen Unterarm. „Lange ist dies hier nicht mehr zu halten.<br />
Erkennst du die Demarkationslinie?“<br />
Ich rufe meine Mutter und meinen Bruder an. Sie unternehmen eine Reise und<br />
können erst am kommenden Tag zurückkehren. „Sie sind auf dem Weg“, sage ich.<br />
„Wo sind sie?“, fragt er, richtet sich auf, schöpft nach Luft. Ich drücke ihn aufs<br />
Bett, die Hände auf seinem Brustkorb, der sich kaum bewegt beim Atmen, er soll<br />
liegen bleiben, ausruhen. „Wie kannst du mich zurückhalten?“, herrscht er mich<br />
an. „Siehst du nicht, was hier los ist?“<br />
78
„Papa“, sage ich, und er wehrt meinen Griff ab, „lass!“, flüsternd nun, und seine<br />
Finger umklammern meinen Arm. „Da drüben. Nicht bewegen. Leise. Gefahr.“<br />
Er sei im Krankenhaus, „in Sicherheit!“, sage ich. Meine Mutter und mein Bruder,<br />
„in Sicherheit!“<br />
„Gift! , schreit mein Vater und reißt an dem Infusionsschlauch.<br />
Das Krankenhausbett eine Kampfzone. Um uns herum der Tod.<br />
„Du brauchst die Infusion zum Überleben.“<br />
„Weißt alles besser! Meinst, du habest alles im Griff. Doch das hier hat niemand<br />
im Griff.“ Seine Stimme überschlägt sich, als er schreit, ich solle nicht weitergehen,<br />
nicht über diese Linie; Männer! Plünderer! Vergewaltiger! Und flüsternd fragt<br />
er, wo der Sohn bleibe und die Frau.<br />
„Sie schaffen es. Und wir auch.“<br />
„Na hoffentlich.“ Dann schimpft er über meine Leichtgläubigkeit.<br />
Die Krankenschwester, die ich hole, sagt: „Aber Herr Thimm!“ Der junge Arzt<br />
fühlt den Puls und blickt auf die Fieberkurve. Im Morgengrauen legt mein Vater<br />
den Kopf auf das Kissen. Seine Finger umklammern meinen Arm. Er schläft.<br />
Die Erinnerung an die Flucht, das verstehe ich in in dieser Nacht, ist ein Dämon, der<br />
meinen Vater beherrscht. All die Jahre hat er den Dämon bezähmt, zog eine Schutzschicht<br />
über die Erinnerungen und erfand merkwürdige Rituale der Versicherung.<br />
Verreisten wir, lud er am Abend zuvor die leeren Koffer und Taschen ins Auto,<br />
und in die Zwischenräume stopfte er Decken und Schuhe. „Probepacken“ nannte<br />
er die Prozedur, und wir scherzten müde, „Papa, wir gehen nicht auf die Flucht.“<br />
79
Hatte alles, was wir mitnehmen wollten, theoretisch Platz gefunden, entspannten<br />
sich seine Gesichtszüge. Er nahm die leeren Koffer und Taschen aus dem Auto,<br />
und wir verstauten Kleidung, Bücher und Stofftiere darin. Wochentags brachte<br />
er Brot mit nach Hause, der Laib war oft noch warm, er schwärmte für den Duft,<br />
die frische Kruste. Gegessen hat er sie nie. Immer war da der kostbare Rest vom<br />
Vortag. So wurde alles Brot altbackener Vorrat. Aber es lag genug im Küchenfach.<br />
Wohin, warum, wie lange, fragte er, wenn ein Familienmitglied das Haus verließ,<br />
und ich wütete über seine Kontrolle. Erst Jahre später verstand ich, dass ihn die<br />
Angst trieb, uns zu verlieren, wie er den Vater und die Schwester im Krieg verlor.<br />
Ausweise, Impfpass, Adressbuch, alles trug er stets bei sich, als müsse er im<br />
nächsten Augenblick aufbrechen. Die braune Umhängetasche begleitete ihn in den<br />
Skiurlaub und an die See; sie baumelte an seinem Hals, als er die Studenten -<br />
zimmer seiner Kinder besuchte, er trug sie unter dem Anorak, sie schien seinen<br />
Brustkorb auszubeulen, ich fand sie peinlich. Er hütet es immer noch, dieses<br />
abgegriffene Leder. „Papas Täschchen“ nennen es mein Bruder und ich heute,<br />
und meist klingt es zärtlich. Papas Täschchen ist eine Reliquie. An manchen<br />
Tagen findet sich nun ein Butterbrot darin, das mein Vater für den Notfall hortet.<br />
Es ist an der Zeit, Hartmut Radebold noch einmal zu befragen. „Das sind typische<br />
Verhaltensweisen von Kriegskindern, die sie für völlig selbstverständlich halten“,<br />
sagt der Professor für Klinische Psychologie. „Sie verwahren, was sich noch einmal<br />
verwenden lassen könnte, alte Fäden, gebrauchtes Geschenkpapier; sie essen<br />
alles auf, sie suchen in fremden Umgebungen den Notausgang.“ Äußerlich freundlich,<br />
bleiben sie lebenslang misstrauisch. Der Argwohn, der nächste Augenblick<br />
könne schlimmes Unheil bereithalten, verlässt sie nie.<br />
Dreißig Prozent dieser Generation gelten als traumatisiert. „Diese Männer und<br />
Frauen tragen eine Decke aus Beton in sich“, sagt Hartmut Radebold. „Sobald<br />
sie sich bedroht oder abhängig fühlen, bröckelt der Beton. Oft überfluten sie<br />
dann Angst und Panik.“<br />
80
Ein schwerer Unfall kann der Auslöser sein, der Verlust eines Verwandten, ein<br />
Krankenhausaufenthalt. Auch Demenz bereitet dem Schrecken Einlass; das kranke<br />
Gehirn verliert zunehmend die Fähigkeit, die verdrängten Erinnerungen zu zähmen.<br />
Dann genügen manchmal schon ein Geräusch oder ein Fernsehbild der zerstörten<br />
Dresdner Frauenkirche, um Angst und Panik zu entfachen. Und es kann bereits<br />
einen Schutz bedeuten, wenn die Menschen drum herum weiche Schuhsohlen<br />
tragen statt harter Absätze, deren Klang an Stechschritte erinnern.<br />
„Ihr Vater ist früh dran“, sagt Hartmut Radebold. „Den meisten Kriegskindern steht<br />
die Hilfsbedürftigkeit noch bevor. Sie sind jetzt zwischen 66 und 81 Jahre alt,<br />
und Hinfälligkeit beginnt überwiegend erst nach dem achtzigsten Geburtstag.“<br />
Viele wird die Gebrechlichkeit mit einer Wucht treffen, die sie nie für möglich<br />
gehalten haben. Ihr Körper hat immer funktioniert, bei bitterem Mangel, unter<br />
größten Strapazen, sie kennen ihn als eine funktionierende Maschine, die sich<br />
mit Medikamenten ölen lässt. Nun, mitten in Frieden und Wohlstand, verlieren<br />
sie ihn als Verbündeten. Sie werden abhängig, sie wehren sich. Die Hilflosigkeit<br />
früherer Zeit soll sie nie mehr einholen.<br />
An einem Morgen im Frühling 2008 klingelt in meinen Schlaf das Telefon. Ein<br />
Angestellter des Altersheims teilt mir mit, dass ein Notarzt Horst Thimm in ein<br />
Krankenhaus eingeliefert habe. „Nichts Schlimmes“, sagt er. „Aber der Mann<br />
braucht mehr Betreuung.“<br />
Mein Vater wird entlassen, bevor ich ihn besuchen kann. „Ich bin weiterhin gegen<br />
eine Pflegestufe“, erklärt er, als wir telefonieren. „Je mehr Hilfe man bekommt,<br />
desto mehr Hilfe braucht man.“<br />
Ich muss arbeiten, mein Bruder lebt in der Schweiz, meine Mutter kann meinen<br />
Vater nicht betreuen – aber so geht es nicht weiter. Am Wochenende, da können<br />
wir uns treffen, beratschlagen, wenigstens ein Anfang. Er kommt uns zuvor. Wieder<br />
leuchtet die Bonner Vorwahl auf dem Display, diesmal ist es eine der Schwestern<br />
des ambulanten Pflegedienstes, die ihn morgens, mittags und abends mit Medi-<br />
81
kamenten versorgen. Sie hat ihn bäuchlings auf dem Teppichboden vorgefunden<br />
und am Vortag nass und ausgekühlt im Duschraum. Die Schwester klagt mich an.<br />
„Ihr Vater war sehr traurig. Er hat gefroren, er hat nicht getrunken. Er hat sich nicht<br />
angezogen, er hat nicht gefrühstückt. Station 2“, sagt die Schwester, „er muss<br />
endlich auf Station 2.“<br />
Station 2 ist der Pflegebereich im zweiten Stock des Heims, da wachen Schwestern<br />
und Pfleger Tag und Nacht über die Bewohner. Mein Vater hat einmal den Aufzug<br />
genommen und Station 2 besichtigt. Eine Frau lebt dort, die dauernd auf einen<br />
Tisch klopft. Eine andere stöhnt pausenlos, eine dritte webt immerzu mit dem<br />
Kopf. „Holen Sie mich weg!“, ruft diese Frau, sobald sie einen Menschen erblickt.<br />
Es gibt auch einen Mann auf Station 2. Er scheint niemanden wahrzunehmen.<br />
Mein Vater wehrt sich. Er bittet um Aufschub. Er spricht von Würde. Wir argumentieren<br />
stundenlang.<br />
Ich erinnere mich an seine Erleichterung, als er die Hürde in das Altersheim ge -<br />
nommen hatte, an die Entschlossenheit, diese Bleibe aber wirklich erst wieder<br />
zu verlassen, wenn man ihn mit den Füßen zuerst hinaustrage. Er glaubte damals,<br />
nie mehr aus seinen beiden Zimmern ausziehen zu müssen. Zweimal noch fahren<br />
ihn Sanitäter in ein Krankenhaus, bevor Blaulicht und Notaufnahmen seinen<br />
Widerstand ermatten. „Antrag auf Feststellung einer Pflegestufe“, heißt das<br />
Formular, das wir dann ausfüllen. Doch das Versprechen, die vertrauten Zimmer<br />
weiterhin bewohnen zu können, nimmt mir mein Vater ab.<br />
Als der Tag gekommen ist, den er so lange abgewehrt hat, wirkt er vergnügt.<br />
Trotz des warmen Sommers hat er ein Jackett in gedecktem Grau gewählt und<br />
eine Krawatte umgebunden. Aufrecht wartet er im Sessel auf die Ärztin vom<br />
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Das Signal, das er so darbietet,<br />
ist unübersehbar: Herr Horst Thimm ist ohne Zweifel in der Lage, mit vollem<br />
Einsatz um die nächste Partie seines Lebens zu spielen.<br />
82
Ob die Ärztin es wohl als Bestechung auffassen könne, wenn er ihr einen Kaffee<br />
anbiete, fragt er mich. Oder einen doppelten Espresso. Wie die meisten Bewohner<br />
hat er die Formeln modernen Kaffeetrinkens erst in der Caféteria des Altersheims<br />
kennengelernt. „Oder dieses Milchkaffeegesöff? Wie heißt das gleich?“<br />
„Cappuccino.“<br />
„Nee, das andere.“<br />
„Latte macchiato?“<br />
„Genau. Russisch Kakao gibt es ja leider nicht.“<br />
„Der wird ja auch mit Alkohol zubereitet.“<br />
„Und Alkohol ist nichts für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung.<br />
Aber wenn das Hauptgeschäft hier erledigt ist, können wir zwei in der Rheinaue<br />
Russisch Kakao trinken.“ Er überlegt, dies gleich anfangs kundzutun, um den<br />
Termin zu beschränken.<br />
„Ich möchte dich nicht desillusionieren“, sage ich. „Aber wenn die Ärztin da<br />
war, kommt die Schwester mit der Insulinspritze, und dann ist Abendbrotzeit.“<br />
Unverständnis zieht über sein Gesicht. Solch kleinkarierte Einwände an solch<br />
einem Tag. „Du bist doch sonst nicht so unflexibel“, antwortet er mir.<br />
Die Ärztin möchte keinen Kaffee. Keinen Cappuccino, keinen Latte macchiato.<br />
Nicht einmal Wasser mag sie trinken, dabei ist die Temperatur draußen auf über<br />
dreißig Grad gestiegen.<br />
„Herr Thimm, wie lange wohnen Sie schon hier?“<br />
83
Als wolle er sie unterhalten wie ein Conférencier, holt mein Vater aus. Wie er bei<br />
sibirischen Minusgraden nachts in den Rabatten vor seiner alten Wohnung gelegen<br />
habe, ausgerutscht. Wie es dort, nach einigen Stunden, doch sehr kalt wurde.<br />
Wie ein Arzt ihn im Krankenhaus entgegen aller Erwartungen wieder hinbekommen<br />
habe, zum zweiten Mal. „Und seither wohne ich hier“, schließt er und lächelt sie<br />
an. „Und genieße den Blick auf den Baum vor dem Fenster.“<br />
„Brauchen Sie, neben dem Spritzen des Insulins, noch andere Hilfe?“<br />
„Die Schwestern haben es übernommen, die Gummistrümpfe anzuziehen und<br />
auszuziehen.“<br />
„Können Sie stehen?“<br />
„Ich kann stehen. Es kommt allerdings schnell der Moment, in dem ich wieder sitze.“<br />
„Klingeln Sie um Hilfe?“<br />
„Nein. Wenn ich falle, hangele ich mich an einem Band am Bettpfosten hoch.<br />
Ich habe da ein eigenes System entwickelt.“<br />
Die Ärztin erkundigt sich nach den Medikamenten. Er hat die Frage erwartet und<br />
zieht ein Blatt Papier aus der Brusttasche. „Meine Güte“, sagt sie, als sie die Liste<br />
überflogen hat. „Man wird ein Medikamentenlagerhaus“, erwidert mein Vater.<br />
„Das ist der Schatz des alten Mitmenschen.“ Dann erhebt er sich, mühsam,<br />
aber ohne innezuhalten, nickt ihr zu und kramt in einem der Kartons im Regal.<br />
„Wäre für Sie denn wohl ein weißer Burgunder gut?“, fragt er schließlich.<br />
„Ja, der wäre gut“, entgegnet die Ärztin. „Aber ich nehme ihn nicht. Ein Gutachter,<br />
der eine Flasche Wein mit nach Hause nimmt, der wäre das Letzte.“<br />
84
Bevor sie sich verabschiedet, teilt sie ihm das Ergebnis mit. „Pflegestufe 1. Der<br />
Bedarf ist gegeben, dass jemand für Sie da ist, wenn Sie ihn brauchen, und Ihnen<br />
außerdem morgens und abends beim Waschen und Ankleiden hilft. Wie lange<br />
sich das in diesen Räumen realisieren lässt, ist eine andere Geschichte. Das<br />
müssen Sie leider selbst organisieren.“<br />
„Keine unangenehme Person“, sagt mein Vater, als sie gegangen ist. „Und mit<br />
dem Wein, da wollte ich sie ein bisschen testen.“<br />
Mein Vater schläft an diesem Abend mit dem Gefühl ein, das Spiel des Lebens<br />
doch noch irgendwie zu meistern. Schließlich hat die Ärztin nicht von Station 2<br />
gesprochen. Ratlos betrachte ich, wie er die ersten Vorbereitungen für die Nachtruhe<br />
trifft, wie er mit dem rechten großen Zeh die Socke vom linken Fuß schiebt,<br />
so hat er es sich angewöhnt, seit ihm das Bücken schwerfällt. Ich weiß nicht,<br />
wer dieser jemand sein soll, morgens und abends und allzeit abrufbereit. Die<br />
Schwestern vom ambulanten Pflegedienst jedenfalls können es nicht leisten.<br />
Wir werden suchen müssen.<br />
Als ich ihm eine gute Nacht wünsche, bedankt er sich für alle Unterstützung.<br />
„Nur eines noch“, sagt er dann. „Die tägliche Körperpflege, die würde ich schon<br />
gern weiterhin allein regeln.“<br />
Wie machen es nur die anderen? Henning Scherf, der frühere Bremer Bürgermeister,<br />
und seine Frau haben sich in einer Wohngemeinschaft mit Freunden<br />
zusammengeschlossen. Er ist 72. Seine Kinder sollen ihm den Vogel gezeigt<br />
haben, aber die Freunde wollen sich, so lange es geht, gegenseitig unterstützen.<br />
Andere ziehen gleich mit jungen Menschen in ein Mehrgenerationenhaus. Doch<br />
noch ist das ein seltenes Modell.<br />
Die meisten alten Frauen und Männer harren bis zum letzten Moment in ihrem<br />
vertrauten Zuhause aus. Es geht in vielen Heimen weniger freundlich zu als in<br />
der Bleibe meines Vaters. In manchen Einrichtungen werden die Alten mit Medi-<br />
85
kamenten ruhiggestellt, damit sie nicht verwirrt umherlaufen. Es wird das Bettzeug<br />
nicht regelmäßig gewechselt, es reagiert niemand auf den Notruf. Und<br />
immer wieder überfordern die Erinnerungen der alten Menschen die Pfleger und<br />
Schwestern, die aus Polen und aus Weißrussland stammen, aus Ecuador, der<br />
Ukraine oder der Türkei. Sie kennen andere Erzählungen vom Krieg als jene,<br />
die ihre Schutzbefohlenen in sich tragen, ihre Verwandten haben auf anderen<br />
Seiten gekämpft, Begriffe wie Haff oder Bomben gehören nicht zu ihrem Sprachschatz.<br />
Nicht jedem gelingt es, die bösen Bilder mit Herzlichkeit zu durchdringen.<br />
Ein Psychologe, der sich mit der Seele alter Menschen auskennt, ist, obwohl un -<br />
umstritten wichtig, selten im Stellenplan eines Heims vorgesehen.<br />
Oft sind nicht einmal die sieben Mindestanforderungen erfüllt, die der Sozial -<br />
pädagoge Claus Fussek formuliert hat, ein lautstarker Kritiker der Zustände:<br />
Nahrung und Flüssigkeit nach Wunsch und Bedarf. Angemessene Unterstützung<br />
bei den Ausscheidungen. Angemessene Körperpflege. Aufenthalte an der frischen<br />
Luft. Freie Wahl des Zimmernachbarn. Anrede in der Muttersprache. Die Sicherheit,<br />
dass in der Todesstunde jemand die Hand hält.<br />
Eigentlich nicht zu viel verlangt.<br />
Eine Frau kenne ich, 57 Jahre alt, die hat ihre Mutter aus einem Heim einfach<br />
wieder herausgeholt. „Wäre sie noch dort, sie wäre längst erstickt“, sagt diese<br />
Tochter. Die Mutter erhielt damals Nahrung durch eine Magensonde, dauernd<br />
erbrach sie, ständig war der Rachen verschleimt. Seit zwei Jahren lebt die alte<br />
Dame wieder auf ihrem Bauernhof. Sie isst und trinkt und feierte vor zehn Wochen<br />
ihren zweiundneunzigsten Geburtstag.<br />
Die Tochter hat eine Agentur in Polen beauftragt, sie zahlt monatlich 260 Euro<br />
Gebühr und 1200 Euro an die Frau, die bei der Mutter wohnt. Es sind zwei Polinnen,<br />
alle acht Wochen wechseln sie sich ab. Offiziell gelten sie als Haushälterinnen.<br />
Denn pflegen dürfen sie als unqualifizierte Arbeitskraft nicht.<br />
86
Die Tochter lebt und arbeitet in einer Großstadt, zwei Stunden Autofahrt entfernt,<br />
sie fährt beinahe jedes Wochenende. Manchmal ist dann der Garten umgestaltet,<br />
oder die altbewährten Handwerker sind verärgert. Dann bewundert die Tochter<br />
gefasst die neuen Ziersträucher und verkneift sich auch die Frage nach den un -<br />
erledigten Reparaturen. „Die Polinnen sind jetzt die Herrinnen im Haus“, sagt<br />
sie. „Aber ich brauchte eine Lösung – und ein Heim sollte es nie wieder sein.“<br />
Einen Sohn kenne ich, 58 Jahre alt, der in der Zeit der Studentenproteste mit<br />
seinem Vater gebrochen hat. Nun streitet dieser Sohn dagegen, für den Vater<br />
aufzukommen. Nicht selten bestimmen die alten Konflikte zwischen 68ern und<br />
ihren Eltern noch das Alter.<br />
Die meisten erwachsenen Kinder aber sagen, dass sie die Eltern am liebsten in<br />
einer häuslichen Umgebung betreut wissen wollen. Es ist auch volkswirtschaftlich<br />
die günstigste Lösung – jedenfalls so lange die Pflegenden durchhalten. Mehr<br />
als der Hälfte schmerzt der Rücken. Ein Viertel leidet an Schlafstörungen, ein<br />
Fünftel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an Magenproblemen. Die Zahlen<br />
gelten bereits für Vierzigjährige.<br />
Viele verlieren Freunde und Bekannte. Sie finden wenig Zeit für Kaffeestündchen<br />
oder ausgiebige Telefonate. Allein den monatlichen Schriftverkehr zu erledigen,<br />
Widersprüche, Abrechnungen, zehrt einen Sonntagnachmittag auf. Und auch<br />
der Urlaub ist oft Pflegezeit.<br />
Achtzig Prozent der pflegenden Töchter und Söhne fühlen sich „sehr belastet“.<br />
Sie sagen, das Gefühl dauernder Zeitnot und die emotional schwierigen Situationen<br />
bedrückten sie am meisten. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt,<br />
seelischer oder körperlicher, gegen alte Menschen liegt bei mindestens zehn<br />
Prozent. Es ist schwer auszuhalten, wenn einer, der einem nahesteht, inmitten<br />
seiner Hilflosigkeit schreit, schlägt und spuckt. Manchmal überwiegt das Gefühl<br />
von Überforderung derart, dass ein Platz im Altersheim doch die beste Lösung<br />
für alle bedeutet. Aber selbst wenn die eigentliche Pflege, das Betten, Waschen,<br />
87
Ankleiden, andere leisten, reihen sich die schwierigen Momente aneinander. Es<br />
ist auch schwer auszuhalten, wenn einer gerade in jenen Stunden, die man sich<br />
mühsam für ihn freihält, schlecht gelaunt ist oder in einer fernen Welt des Vergessens<br />
weilt.<br />
Der Umgang mit den bedürftigen Eltern verlangt Tugenden, die jedem durch -<br />
geplanten Alltag widersprechen: Zeit, Muße und die Geduld, zu ertragen, was<br />
eigentlich gerade unerträglich ist. Jeder Moment hängt von der Tagesform ab –<br />
und je hinfälliger ein Mensch wird, je mehr sich vielleicht auch eine Demenz entwickelt,<br />
desto weniger ist diese Tagesform zu beeinflussen oder vorherzusehen.<br />
An einem Abend, ich will nicht lange bleiben, ich habe noch etwas vor, bittet<br />
mein Vater mich um einen Pullover. Inzwischen, im Dezember 2008, bewohnt er<br />
ein Zimmer im zweiten Stock. Es gehört zu Station 2.<br />
Er trägt einen Schlafanzug und liegt bereits im Bett. „Den blauen Pullover“, sagt er,<br />
„den will ich anziehen.“<br />
„Ist dir denn kalt?“<br />
„Nee. Aber ich muss ja noch rüber zu mir, über die Straße.“<br />
„Das musst du doch gar nicht.“<br />
„Natürlich.“ Unwirsch strampelt er die Bettdecke weg.<br />
„Aber Papa, guck dich mal um. Was siehst du?“<br />
„Eine Wand.“<br />
„Und daran?“<br />
88
„Bilder.“<br />
„Deine Bilder.“<br />
„Natürlich meine Bilder. Sie zeigen Kulk am Lenksee.“<br />
„Das bedeutet doch, dass du in deinem Zimmer bist. Wo sollten sie denn sonst<br />
hängen? Möchtest du vielleicht den Fernseher anschalten, für die Nachrichten.“<br />
„Nee.“<br />
„Gibt es noch etwas, was ich für dich tun kann?“<br />
„Ja, den Pullover.“<br />
Ich denke an Schnupfen, Lungenentzündung, Krankenhaus und beginne von vorn.<br />
Ich bin nicht in der Lage, anders zu reagieren.<br />
„Ist dir doch kalt?“<br />
Seine Stimme wird laut. „Nein. Ich möchte ihn haben. Und, Herrgott sakra,<br />
ich kann ihn mir nicht allein holen. Du weißt das.“<br />
Ich reiche ihm den Pullover. „Ich will etwas am Körper haben“, sagt er, während<br />
er versucht, ihn über den Kopf zu ziehen.<br />
„Dann ist dir doch kühl?“<br />
„Ja“, sagt er. „Ja!“<br />
Ich helfe ihm in den Pullover. Bloß kein Krankenhaus. Mein Vater streicht über<br />
den wollenen Stoff. „Eine Hose habe ich aber noch nicht“, sagt er dann.<br />
89
„Aber die brauchst du im Bett doch wirklich nicht.“<br />
„Im Bett nicht. Auf der Straße schon.“<br />
Mein Vater schiebt die Beine aus dem Bett. Die Luft in seiner Matratze schaukelt,<br />
wenn er sich bewegt, sie ist für Menschen gedacht, die viele Stunden am Tag<br />
liegen. Bei heftigen Bewegungen verursacht die gequetschte Luft Geräusche.<br />
Sie klingt immer lauter an diesem Abend.<br />
Wir auch.<br />
„Papa, bitte! Es ist doch Schlafenszeit!“<br />
„Ja, eben! Deshalb muss ich hier raus!“<br />
„Ja, eben nicht! Wenn Schlafenszeit ist, bleibt man im Bett! Und ich muss da jetzt<br />
auch hin, und deshalb verabschiede ich mich.“<br />
„Du willst gehen? Und ich soll hierbleiben?“<br />
„Das ist doch dein Zimmer.“<br />
„Ich kann diesen Quatsch nicht mehr hören. Du wirst mir ja wohl nicht die Möglichkeit<br />
verwehren, am Ende des Tages in meine Wohnung zurückzukehren.“<br />
Die Nachtschwester rettet uns. Es ist eine von den resoluten. Sie trägt einen strähnigen<br />
Pferdeschwanz, ihr Kittel riecht nach Arbeit, und sie findet den richtigen Ton.<br />
„Na, Herr Thimm, wo wollen Sie denn hin?“, fragt sie.<br />
„Na, in meine Zimmer“, antwortet er.<br />
90
„Sie sind doch hier zu Hause, in Ihrem Bett, in Ihrem Zimmer.“<br />
„Also ich kann mich mit dieser Interpretation nicht anfreunden“, entgegnet ihr<br />
mein Vater. „Ich meine, ich gehöre ins Erdgeschoss.“<br />
„Sie müssen sich nicht ins Erdgeschoss begeben, Herr Thimm. Heute geht es<br />
nirgendwo mehr hin.“<br />
Als er nach der braunen Umhängetasche greift, die er auf dem Nachttisch verwahrt,<br />
greift auch die Schwester zu. „Geben Sie mal her“, sagt sie. „Die lege ich hier auf<br />
den Tisch. Sonst erhängen Sie sich nachts noch damit. Und erhängte Leichen am<br />
Morgen hab ich nicht so gern.“<br />
„Dann kriegen Sie einen Schreck“, sagt mein Vater. „Wenn einer der liebenswürdigsten<br />
Bewohner sich an der eigenen Tasche aufhängt.“<br />
Erleichtert schließe ich die Tür. Und fliehe aus dem Altersheim.<br />
Die Politik verliert sich in Profilierungskämpfen“ sagt Jürgen Gohde. „Aber das<br />
Thema eignet sich nicht für Machtspielchen. Wir reden über Menschen.“<br />
Der Theologe sitzt dem Kuratorium Deutsche Altershilfe vor und leitete auch jenen<br />
Beirat, der vor zwei Jahren die Reformvorschläge an das Gesundheitsministerium<br />
übergab. Er ist überzeugt, dass sich das Leben von Pflegebedürftigen und ihren<br />
Angehörigen mit Hilfe der vorliegenden Konzepte besser gestalten ließe. „Es<br />
müssen nur alle wollen.“<br />
An Absichtsbekundungen mangelt es nicht. Auch Männer sollten gezielt an den<br />
Pflegeberuf herangeführt werden, sagt zum Beispiel der Gesundheitsminister, er<br />
hofft auf den neuen Bundesfreiwilligendienst. Und er will all jene besser stellen,<br />
die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Ihr Einsatz solle bei der Bemessung der<br />
Rente berücksichtigt werden, findet er.<br />
91
„Wir müssen die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern“, sagt Ursula Lehr.<br />
„Dann kann der demografische Wandel gelingen. Ich baue zudem auf die Männer<br />
und rechne damit, dass die neuen wickelnden Väter auch pflegende Söhne sind.“<br />
Die Altersforscherin war im Kabinett von Helmut Kohl Familienministerin und ist<br />
nun, achtzig Jahre alt, Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft von<br />
mehr als hundert Seniorenorganisationen. Sie trägt einen pinkfarbenen Blazer<br />
und schweren Silberschmuck, sie hält noch beinahe täglich einen Vortrag, und<br />
sie weiß alle Daten auswendig.<br />
Seit 1997 ist die Zahl derjenigen, die wegen eines hilfsbedürftigen Familien mitglieds<br />
weniger arbeiten, von 26 auf 36 Prozent gestiegen. 47 Prozent der Pflegenden<br />
sind überhaupt nicht erwerbstätig. Das aber, sagt Ursula Lehr, könne in Zeiten<br />
des Fachkräftemangels doch dauerhaft kein Weg sein. „Außerdem zeigen die<br />
Studien, dass Angehörige eine bessere Lebensqualität behalten, wenn sie intensiv<br />
auch andere Aufgaben wahrnehmen.“<br />
So ist die Frage, welchen Platz diese Gesellschaft den Alten einräumt, auch eine<br />
an die Arbeitgeber. Ursula Lehr schlägt ihnen vor, das Kantinenessen an die alten<br />
Eltern ihrer Mitarbeiter liefern zu lassen, und sie kann sich Seniorentagesstätten<br />
vorstellen, die an ein Unternehmen angebunden sind wie ein Betriebskindergarten.<br />
Auch die „Familienpflegezeit“, das Projekt der heutigen Familienministerin, hält<br />
sie für sinnvoll. Wie ein Sabbatical sollten Arbeitgeber diese Phase handhaben,<br />
meint Kristina Schröder. Der Angestellte bezieht zwei Drittel seines Lohns, und<br />
wenn er wieder mit voller Stundenzahl arbeitet, verdient er so lange weniger, bis<br />
sein Gehaltskonto ausgeglichen ist. Sie ist beschimpft worden für ihren Vorschlag.<br />
Unzumutbar für Arbeitgeber, fanden die einen, völlig unzureichend, meinten die<br />
anderen. Eine Pflege sei doch nicht planbar nach zwei Jahren beendet. Außerdem<br />
müsse man solch eine Familienleistung ähnlich vergüten wie die Elternzeit. Und<br />
überhaupt: Wo stehe denn geschrieben, dass sich jeder um die alten Eltern kümmern<br />
wolle? Aus der Sicht jener aber, die es wollen, ist die Idee verlockend. Immerhin<br />
ließen sich so unbelastet vom Arbeitsalltag beste Lösungen und eine neue<br />
Routine finden.<br />
92
Einige Arbeitgeber bieten ihren Angestellten bereits andere familienfreundliche<br />
Leistungen – auch weil sie Gedanken, Engagement und Kraft im Unternehmen<br />
halten wollen. Sie kaufen „Eldercare“ bei Dienstleistungsfirmen ein, Seniorenbetreuung<br />
im Paket. Ganze Abteilungen in diesen Firmen sind damit beschäftigt,<br />
häusliche Pflege zu organisieren, Widerspruch gegen Versicherungsbescheide<br />
einzulegen, geeignete Altersheime zu suchen oder eine Putzhilfe, die mit der<br />
wunderlichen Mutter zurechtkommt. Der „pme Familienservice“ beispielsweise<br />
versorgt 370 Firmen mit „Eldercare“, darunter den Norddeutschen Rundfunk,<br />
Ikea und H&M. „Wir haben Anfragen von Menschen in Lübeck, deren Eltern im<br />
Bayerischen Wald wohnen“, sagt die koordinierende Psychologin Christine Jordan.<br />
„Wir beraten dann die Kinder in Lübeck, und unsere Zweigstelle im Bayerischen<br />
Wald forscht nach der entsprechenden Hilfe.“<br />
Auch neue Arten des Wohnens könnten Angehörige entlasten, vor allem in jener<br />
Phase, in der alte Menschen noch keine Pflege, aber Unterstützung brauchen.<br />
Eine Lieblingsidee von Ursula Lehr ist der Gemeinschaftsraum in jedem Mehrfamilienhaus.<br />
Ein Tisch und ein Kühlschrank mit Bier und Saft sollten sich darin finden,<br />
Kreide und eine Schreibtafel: Morgen kaufe ich ein, wem soll ich was mitbringen?<br />
Ich muss am Samstag um drei zum Zug, fährt jemand Richtung Bahnhof? Mir fehlt<br />
die Glühbirne im Deckenlicht, kann die jemand einschrauben?<br />
„Wir werden niemals ohne professionelle Pfleger auskommen und auch nicht ohne<br />
Altersheime“, sagt Jürgen Gohde. Im Gegenteil: Schon weil die Zahl der kinderlosen,<br />
auf sich gestellten Paare zunimmt, wird der Bedarf steigen. „Aber wir dürfen<br />
uns nicht allein auf Institutionen verlassen. Wir müssen um jeden Nachbarn, um<br />
jeden Ehrenamtlichen werben.“ Nur sie können das Unbezahlbare geben – Zeit.<br />
„Wir brauchen den Menschen in der Pflege“, sagt Jürgen Gohde.<br />
Der Organismus ist an seinem Ende angelangt“, erklärt der Hausarzt an einem<br />
freundlichen Tag im Sommer 2009. „Wir machen jetzt nur noch palliativ.“<br />
93
Die Frau, die sich im Altersheim um Palliativpatienten kümmert, kommt mit einem<br />
Golden Retriever. Der Hund ist ausgebildet für den Dienst, den er leisten soll. Er<br />
klettert auf einen Stuhl, damit Horst Thimm ihn besser sehen kann, und schiebt<br />
den Kopf in dessen Hand. Dann schließt mein Vater die Augen.<br />
Zweieinhalb Tage lang bewegt er sich nicht. Er liegt da, in ein hellblaues T-Shirt<br />
gekleidet, das weiße Haar noch immer dicht, er atmet flach und bewegt sich nicht.<br />
Meine Mutter und ich wechseln uns ab. Als er sich räuspert, nach zweieinhalb<br />
Tagen, ist es gerade meine Zeit. „Katja“, sagt er. „Gibst du mir etwas zu trinken?<br />
Ich habe schrecklichen Durst.“<br />
Seither hatte mein Vater gute und schlechte Tage, er sagt, sie halten sich die<br />
Waage. Er weint oft, und er lächelt oft, und anders als in meiner Kindheit zeigt<br />
sich sein Gemüt meist so weich, wie es ist. Viele Stunden lang liegt er in seinem<br />
Bett, und jeden Tag erlebt er sein Leben. Besuche ich ihn, kann es passieren,<br />
dass er mich ungeduldig und freudig empfängt. Aber möglich ist auch, dass er<br />
mich wieder wegschickt. Einmal störte ich mitten in einer Dienstsitzung. Angetan<br />
mit einem gebügelten Hemd, saß er im Rollstuhl vor dem Fernsehapparat. Mit<br />
einer ausholenden Handbewegung wies er auf mich. „Meine Tochter“, so stellte<br />
er mich einer imaginären Runde vor.<br />
Ja doch, antwortete er gleich darauf in meine Richtung, eine Birnensaftschorle<br />
nehme er gern, aber dann müsse ich mich wirklich verabschieden. „Wie du siehst,<br />
werden hier gerade Konzepte für eine Erweiterung des Jugendschutzgesetzes<br />
verhandelt. Nimm es nicht persönlich, aber die Versammlung braucht Ruhe.“<br />
Mit der gleichen Ernsthaftigkeit beobachtet er Scharfschützen auf den Zinnen<br />
am Haus gegenüber. Dann kann es geschehen, dass er weint, wenn ich ihn be -<br />
suche, weil er mich eben noch tot auf dem Boden liegen sah, erwürgt von Partisanenkämpfern,<br />
und im Sessel, unter der rot-weiß-gestreiften Decke, zerschossen<br />
meinen Bruder. Ich reiche ihm in solchen Augenblicken seine Brille. Nicht<br />
94
immer lässt er sich davon ablenken. Aber manchmal sagt er doch, er müsse<br />
wohl dringend mal einen Optiker aufsuchen.<br />
Häufig bemühen wir die unbeschwerten Jahre seiner Kindheit. Ich habe mich<br />
verbündet mit Ostpreußen, jener Gegend, die ich früher nicht beim Namen<br />
nennen wollte, weil es so heimatvertrieben klang. Beim Online-Versandhandel<br />
werde ich nun als „lieber Freund einer vergessenen Vergangenheit“ geführt,<br />
doch meinem Vater helfen die Bildbände und CDs, die Erinnerungen zu finden,<br />
die ihn bergen.<br />
Immer noch lebt er an vielen Tagen in der Wirklichkeit des Augenblicks. Bei<br />
Sonnenschein zupft er manchmal vom Rollstuhl aus ein wenig Unkraut auf<br />
dem hochgelegenen Beet gegenüber dem Goldfischteich. Der Gärtner des<br />
Altersheims hat dort Kräuter ausgesät, und samstags kommt ein Küchenjunge<br />
und schneidet für den Eintopf Maggikraut. Am Abend, bei den Vorbereitungen<br />
zur Nachtruhe, erzählt mein Vater den Schwestern schon mal von der Arbeit im<br />
Garten. „Die macht ja auch ein bisschen müde“, sagt er zu ihnen.<br />
Er hat es nie so haben wollen: Pflegeschwestern, die ihn reinigen; ein grüner<br />
Herr, der ihn ehrenamtlich unterhält; ehemalige Kollegen, die ihn treu besuchen;<br />
Kinder, denen er Mühe bereitet; eine Frau, die nun ihm in den Mantel hilft.<br />
Er hat es nie so haben wollen, doch er hätte es jederzeit verteidigt. Das ist der<br />
Kleister, der unsere Gesellschaft zusammenhält, hätte er gesagt.<br />
95
Newcomerpreis
97<br />
Jonathan Stock
Peters Traum<br />
(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 03.07.<strong>2011</strong>, Nr. 26, S. 2)<br />
Jonathan Stock<br />
geboren 1983 in Eutin<br />
Werdegang:<br />
<strong>2011</strong> Auslands- und Krisenreporter bei SPIEGEL Online, jetzt freier Journalist<br />
in Berlin<br />
2010 Textredakteur bei GeoEpoche<br />
2009 Henri-Nannen-Schule, 32. Lehrgang<br />
2008 Magisterabschluss European History am University College London<br />
2007 Geschichts- und Literaturstudium an der Edinburgh University<br />
2003-2006 Geschichtsstudium<br />
Auszeichnungen:<br />
<strong>2011</strong> Shortlist Henri-Nannen-<strong>Preis</strong> für „Wien – ein Schauspiel in sechs Akten“<br />
98
Begründung der Jury<br />
Jonathan Stock – dieser Newcomer scheint ein früh Vollendeter zu sein. Mit literarischer<br />
Eleganz und journalistischer Präzision zeichnet er das Bild eines deutschen Konvertiten,<br />
der in Pakistan zum Dschihadisten wurde, heute in Hamburg scheinbar harmlos lebt<br />
und sich doch aufgrund seines Gefährderstatus zweimal wöchentlich bei der Polizei<br />
melden muss.<br />
Stock hat seinem Porträt den märchenhaft anmutenden Titel „Peters Traum“ gegeben.<br />
Der urdeutsche Vorname signalisiert, dass Peter einer von uns ist: ein Deutscher, der<br />
sich nicht nur eine andere Religion als das in Deutschland vorherrschende Christentum<br />
wählte, sondern der am liebsten sofort gegen alle Ungläubigen mit Gewalt vorgehen<br />
würde. Und der doch brav den Küchentisch im Hamburger Reihenhaus abräumt, denn:<br />
„Wenn die Mutter nicht zufrieden mit einem ist, kommt man nicht ins Paradies.“<br />
Doch nicht nur wegen Peters Widersprüche wirkt dieses erstklassige Porträt eines uns<br />
Fremden so verstörend. Es ist vor allem Kaltblütigkeit, mit der sich Stock seinem Objekt<br />
nähert: Nahezu wertungsfrei wird Peters wirres Leben – vom Kriminellen zum Dschihadisten<br />
– beschrieben, und gerade diese radikale Nüchternheit des Beobachters zwingt<br />
uns als Leser, die bizarre Andersartigkeit religiös motivierter Aggressivität mitten unter<br />
uns zur Kenntnis zu nehmen, ja: uns ihr auszusetzen, um besser zu verstehen. Jonathan<br />
Stock hat hiermit eine erstklassige Dolmetscherleistung vorgelegt – eine, die die multikulturelle,<br />
multireligiöse Gesellschaft dringend und vielfach braucht.<br />
Allein schon, dass es Stock gelungen ist, den misstrauischen Dschihadisten Peter zu<br />
Gesprächen mit einem Journalisten zu bewegen, ist eine große Leistung. Erst recht die<br />
inhaltliche und stilistische Formvollendung, mit der der 28-jährige Jonathan Stock sein<br />
Porträt geschrieben hat, ist aller Ehren wert. Von diesem Newcomer wird man noch<br />
vieles hören, garantiert.<br />
Vorgetragen von Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
99
Peters Traum<br />
Zweimal die Woche Meldepflicht bei der Polizei, laufende Ermittlungen wegen<br />
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Überwachung durch den<br />
Verfassungsschutz: Wie lebt es sich als Dschihadist in Deutschland?<br />
In ihm gärt es, er ist ein labiles Gemüt: Das sagen Verfassungsschützer, die ihn<br />
seit sechs Jahren beobachten. „Gilt als gewalttätig und Betäubungsmittelkonsument“,<br />
steht in einer Akte des Bundeskriminalamtes. Er hat Schutzgeld eingetrieben,<br />
geklaut, geschlagen: Das sagt er selbst. Viermal war er zur erkennungsdienstlichen<br />
Behandlung beim LKA Hamburg, dort wird er als „Gefährder“ geführt.<br />
Er sagt, in die Hölle zu kommen sei leicht. Man müsse nur seinen Begierden folgen.<br />
In den Himmel zu kommen ist schwer. Dafür muss man den Spott ertragen, das<br />
Unverständnis, die Versuchung und die Strafen.<br />
Seinen Namen und sein Gesicht will er nicht in der Zeitung sehen. Er hat als Alias<br />
„Mr. X“ vorgeschlagen, aber sein Vorname klingt so deutsch wie „Peter“. Also Peter.<br />
Einer, der Peters Gespräche abhören kann, sagt, solche Leute seien halbgescheiterte<br />
Hanswürste, die unendlich viel Blödsinn reden. Irrationaler Kinderkram,<br />
meint er, verblasen, anmaßend, zu dusselig, sich ‘ne Scheibe Brot abzuschneiden.<br />
Aber: „Man hat irgendwann mal den Eindruck, man versteht diesen Typ – so ein<br />
rigides, geschlossenes, sehr kleinkariertes Weltbild.“<br />
Peter sagt, die schlechten Träume schickt der Teufel, der Schaitan. Erzählen darf<br />
man sie nicht, es ist besser über die linke Schulter zu spucken und Zuflucht zu<br />
suchen bei Gott. Aber gute Träume, die schickt Allah. „Rein statistisch gesehen<br />
ist es so“, sagt ein Verfassungsschützer, „Hamburg hat 130.000 Muslime, davon<br />
sind nur 2.000 Islamisten, weniger als 2 Prozent also. Von diesen 2.000 sind<br />
wieder nur 200 gewaltbereit. Und 40 gibt es, die ordnen wir als Dschihadisten<br />
ein. Die sind unsere Priorität.“ Es sind Menschen, die den Dschihad unterstützen,<br />
den bewaffneten heiligen Krieg. Peter ist einer von ihnen.<br />
100
Seinem Ziel am nächsten fühlte er sich in einer Zelle in Peschawar, wo die Sonne<br />
nicht schien und er die Vögel nur hören konnte. Es war zwischen Morgengrauen<br />
und Sonnenaufgang, die Stunde von Fajr, dem Frühgebet, die beste Zeit für Träume.<br />
Er lag auf dem Boden eines pakistanischen Gefängnisses, aber im Schlaf fuhr er<br />
BMW, 6er-Coupé, tiefergelegt, mit schwarzen Felgen, erzählt er später. Er fährt<br />
die Straße entlang, schnell und cool, bis der Asphalt sich wandelt zu stählernen<br />
Gleisen. Das Auto rattert, Masten und Stromkästen wachsen aus dem Boden wie<br />
Hindernisse in einem Computerspiel. Er reißt das Steuerrad herum, umkurvt alles,<br />
die Schiene wird zur Rampe, er rast sie hoch, die Reifen haben keinen Halt mehr.<br />
Er fliegt, immer weiter, dem Himmel entgegen. Dann wacht er auf.<br />
„Jeder muss seine Träume selber deuten“, meint Peter. Den Traum mit dem BMW<br />
deutet er so: Das Fliegen, dieses Licht, das ihn ausfüllte, ein Gefühl stärker als<br />
jeder Orgasmus, das muss der Tod als Märtyrer sein. Das Fahren um Hindernisse<br />
aber, dieses mühsame Hin und Her: Das ist das Leben.<br />
Zwei Monate war er im Gefängnis. Er hatte viele Träume in seiner Zelle, aber<br />
dieser war ihm immer der liebste, der größte Traum seines Lebens, auch jetzt<br />
noch, zwei Jahre später in einem kleinen Reihenhaus in Hamburg-Wandsbek<br />
mit Stiefmütterchen im Garten und einem gelben Duftbaum im Flur.<br />
Wer Peter heutzutage trifft, der muss sich an der Haustür etwas Zeit lassen,<br />
damit Peter seine Zweitfrau ins Schlafzimmer bringen kann. Er hat Margeriten<br />
gekauft, weil sie Bauchschmerzen hat. Und dann hat er für seine erste Frau<br />
auch Margeriten gekauft. Das befiehlt sein Gesetz, die Scharia: Alle Ehefrauen<br />
müssen gleich behandelt werden.<br />
Seine Mutter hat gekocht, sie tischt Borschtsch auf, was Peter sehr liebt. Er nimmt<br />
auf dem Sofa Platz, ein ruhiger, 30 Jahre alter Mann mit wachen, grün-grauen<br />
Augen und einer kleinen Tochter.<br />
Meldepflicht bei der Polizei: zweimal die Woche, mittwochs und samstags.<br />
101
Pass eingezogen laut Passgesetz, Paragraph 7 Absatz 1, da Peter „die innere<br />
oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik<br />
Deutschland“ gefährden könne.<br />
Wanzen, die er vermutet: vier (Telefon, Wohnung, Moschee und Auto). „Aber nur<br />
Allah sieht alles“, sagt er.<br />
Narben: 1. Eine Stichwunde am linken Oberschenkel. 2. Eine Brandwunde am<br />
linken Arm. 3. Etwa 100 Rasierklingenschnitte am Bauch. 4. Eine Schnittwunde<br />
am linken Daumen.<br />
Sie erzählen sein Leben.<br />
Die älteste Narbe trägt er am Oberschenkel, die Stichwunde eines Messerkampfes.<br />
„Wenn du ein Mann bist, dann kämpfst du“, hatte der Russe zu ihm gesagt, also<br />
kämpfte er. Das war noch in der Zeit der Unwissenheit, der Dschhiliyya, bevor er<br />
Muslim wurde, als er weder den einzigen Gott kannte noch den Propheten oder<br />
das Gesetz.<br />
Schutzgeld trieben sie für die Russenmafia ein, 15 000 Kilometer fuhr er im Monat<br />
durch Deutschland. Mehrmals saß er im Knast wegen Raubes. Er weiß nicht mehr<br />
genau, wie lange. Insgesamt zwei bis drei Jahre, schätzt er. Für den Schutzgeldjob<br />
ist er nie angeklagt worden. Sie hätten, sagt er, immer sehr sauber gearbeitet.<br />
Reeperbahn, Frauen, Klamotten, Uhren, Autos, Alkohol, Kiffen, Kokain. „Das war<br />
mein Leben, verstehst du? Nur Spaß. Niemals habe ich mir etwas sagen lassen.“<br />
Gefeiert hätten sie, wie in einer Familie, das Geld geteilt, sich Brüder genannt.<br />
Manche kommen mit so einem Leben ganz gut klar. Andere nehmen Drogen,<br />
wenn sie ins Grübeln kommen. Peter schien trotz der Drogen etwas zu fehlen,<br />
auch wenn er lange nicht sagen konnte, was.<br />
Bei einer Tour fragte er seinen Kumpel Hermann: „Gibt es eigentlich etwas,<br />
wofür du sterben würdest?“ Es muss doch etwas geben, überlegte Peter, für das<br />
102
man alles geben würde, sogar sein eigenes Leben. Etwas, was man seinen Kindern<br />
beibringen könnte. Denn so, wie er gerade lebte: Das mochte er seinen Kindern<br />
nicht wünschen. „Also ist das falsch, oder?“<br />
Was Hermann antwortete, weiß Peter nicht mehr genau, aber viel später kam er<br />
noch einmal zu ihm, da war Peter schon Muslim. „Dein Dach ist weg. Du bist im<br />
Knast verrückt geworden“, meinte er nur. Es war ihr letztes Gespräch.<br />
Die zweitälteste Narbe trägt Peter am linken Arm. Da schlängeln sich die Reste<br />
eines Tribal-Tatoos in großen, blauen Rauten die Schulter empor. „Es ist haram“,<br />
sagt Peter, verboten. Tatoos sind Veränderungen des Körpers, den Allah erschaffen<br />
hat. Der Schaitan verführt Menschen, die Schöpfung zu ändern. „Also habe<br />
ich es mir herausgebrannt“, sagt Peter.<br />
Er hat seine Vergangenheit herausgebrannt mit einer Chemikalie, die er Marganzowka<br />
nennt, einer Lösung aus Kaliumpermanganat mit Glycerin. Sieben Minuten<br />
lang hat sie sich durch seine Haut gefressen. Eine große, rote Brandkruste blieb<br />
übrig.<br />
Haram: verboten. Halal: erlaubt. Peter lernt den Unterschied bei seinem letzten<br />
Gefängnisaufenthalt in Deutschland. Er sitzt, weil er gegen die Bewährungsauflage<br />
verstoßen hat. Er will keine Drogen mehr nehmen. Er ist 25, er liest das Tao,<br />
die Bibel, den Koran.<br />
Die Bibel gefällt ihm, er trägt ein Kreuz um den Hals, aber eines versteht er nicht.<br />
„Wenn meine rechte Wange geschlagen wird, warum soll ich dann die linke hinhalten?<br />
Was ist das für eine Religion?“ Er redet mit dem Pastor, der will ihn vor<br />
seinen Mitgefangenen taufen, Peter will lieber nicht. Dann sieht er eine Reportage<br />
über den Islam im Fernsehen. „Vielleicht sollte ich Muslim werden“, sagt er sich.<br />
Und dann weiß er nicht, was er machen soll. Er betet einfach. „Gott, Allah, gib<br />
mir, was du willst, gib mir das, was das Beste ist. Ich weiß nicht, was richtig ist.“<br />
103
Ein Mithäftling ist Muslim, er erklärt ihm den Koran, es ist dunkel, er liest den<br />
Thronvers. Manche Muslime weinen, wenn der Iman ihn rezitiert. „Es füllt sein<br />
Thron / Die Weite Himmels und der Erde, / Und ihn beschwert nicht die Behütung<br />
beider, / Er ist der Hohe, Große.“ Und in diesem Moment, sagt Peter, bekommt<br />
er eine Gänsehaut, sein ganzer Rücken kribbelt. Er meint, es war ein Malaika,<br />
ein Engel, der ihn umarmt, ihn umhüllt wie eine Decke. Da wusste er: Das ist es.<br />
Er fastet, fängt an zu laufen, er geht im Winter mit kurzen Hosen raus und reibt<br />
sich mit Schnee ab, schwimmt, macht Sport. „Ich habe damals schon angefangen<br />
zu trainieren, ohne zu wissen, dass das richtig ist.“ Trainieren für den Dschihad.<br />
Denn das, was er mache, sagt Peter, mache er immer zu hundert Prozent, und<br />
Dschihad sei auf jeden Fall hundert Prozent.<br />
Als er aus dem Gefängnis kommt, 2005, beobachtet ihn bald der Verfassungsschutz.<br />
Sie wissen von seiner Konvertierung. Es sei nicht ungewöhnlich, dass<br />
einer so versuche, von den Drogen wegzukommen. Seine Glaubensbrüder aber<br />
sagen nicht, dass er konvertiert sei. Sie sagen, dass Peter zu Allah zurückgekehrt<br />
sei. Alle sind von Geburt an Muslime. Es wisse nur nicht jeder.<br />
Hundert Prozent, das ist für Peter auch die Al-Quds-Moschee, die Moschee, in<br />
der auch die Attentäter des 11. September beteten. Weltbekannt unter Islamisten,<br />
ein historischer Ort für Sympathisanten. Viele ihrer Mitglieder sahen sie als einzig<br />
wahre Moschee Hamburgs. Dort lernt er 2008 Rami Makanesi kennen, der im<br />
Mai <strong>2011</strong> wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt<br />
wurde. Damals wollten er und andere in ein Ausbildungslager nach Wasiristan,<br />
das Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan.<br />
Wenn man Peter nach Gründen dafür fragt, dann erzählt er von Videos und Berichten<br />
aus Tschetschenien und Afghanistan, von den Untaten der Ungläubigen:<br />
Frauen die Brüste abschneiden. Das Kind im Leib der Mutter töten. Soldaten,<br />
die in langen Schlangen vor der Vergewaltigung anstehen, und Offiziere, die<br />
darauf achten, dass jeder drankommt. Und dass Frauen die Zähne ausgeschlagen<br />
werden, damit sie Männer besser oral befriedigen können.<br />
104
„Wir können doch nicht nur Tee trinken und warten“, sagt er, „wir müssen etwas<br />
machen.“ Der Dschihad ist für ihn ein Befreiungskampf gegen die Besatzer, sein<br />
Kampf ein Kampf für seine Glaubensbrüder. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes<br />
war der Entschluss und die Planung eine Sache von wenigen Wochen.<br />
Seiner Frau und seiner Mutter sagte Peter nicht Bescheid. „Sie weiß, dass ich<br />
oft weg bin“, meint er.<br />
Am 11. März 2009 um halb neun morgens hatte er am Flughafen von Wien-Schwechat<br />
für den Flug QR-94 sein Gepäck eingecheckt, als die österreichische Polizei<br />
ihn fragte, wohin er denn wolle. – Nach Pakistan, Teppiche kaufen. Und zu einer<br />
Hochzeit. – Sie müssen ihn weiterfliegen lassen. Die pakistanische Polizei hat<br />
weniger Bedenken, stülpt ihm einen Sack über den Kopf und sperrt ihn ein. Über<br />
seine Mithäftlinge in Pakistan, langbärtige Krieger aus den Bergen, sagt er: „Das<br />
waren die besten Männer.“ In Deutschland hat er im Knast nur Verbrecher getroffen.<br />
Zwei Monate später wird er nach Deutschland abgeschoben.<br />
Die dritte Narbe hat er am Bauch über der Leber, 2010. Er hat sich selbst geschröpft.<br />
Hijama heißt die arabische Heilmethode, die schon der Prophet angewandt haben<br />
soll. Er ritzt sich seine Haut mit einer Rasierklinge viele Dutzend Male ein. Dann<br />
dreht er Papier zu kleinen Rollen, zündet die an und wirft sie in ein großes Glas.<br />
Das drückt er auf die Haut. Der Unterdruck im Glas zieht das Blut heraus. Das<br />
schlechte Blut, meint er. Rauch, Asche und Blut bilden ein trübes, schwarzes<br />
Gemisch.<br />
Peter schneidet sich die Haut auf, weil er so leben will wie Mohammed. Deshalb<br />
isst er auch seinen Teller leer, denn das ist Sunna, so hat es auch der Prophet<br />
gemacht. Er benutzt keine Zahnbürste, denn in Zahnpasta ist Rattengift der Un -<br />
gläubigen. Er benutzt Salz oder den Miswak, ein Wurzelstück des Zahnbürstenbaumes,<br />
wie der Prophet. Er schläft auf dem Fußboden, wie der Prophet.<br />
Wer auf seinem Blümchensofa Platz nimmt, bekommt die Welt erklärt:<br />
Die Aldi-Brüder seien Juden, und die Besitzer von Lidl und Netto und Burger<br />
105
King. Auch Arnold Schwarzenegger. Hollywood-Schauspieler, Ex-Gouverneur,<br />
Ehemann einer Kennedytochter: Wie könne der kein Jude sein? Der Vater von<br />
Präsident Obama sei Jude. Angela Merkel? „Mich würde es nicht wundern.“<br />
Die Schaitane, die kleinen Brüder des Teufels, leben im Schmutz unter den<br />
Fingernägeln, deshalb muss man sie kurz schneiden. Wenn man gähnt, muss<br />
man die Hand vor den Mund halten, sonst kommt der Teufel hinein. Er ist geschickt,<br />
benutzt alles als Tor in den Körper. Die Teufel versuchen auch, in den Himmel zu<br />
kommen, um die Gespräche der Engel zu belauschen. Deshalb werfen die Engel<br />
mit Steinen nach ihnen, das sind die Sternschnuppen. Der Kampf gegen die Teufel<br />
ist anstrengend, aber wer ihn erfolgreich führt, dem wird das Größte geschenkt:<br />
das Paradies.<br />
Am letzten Tag der Al-Quds-Moschee, im August 2010, bevor der Hamburger<br />
Innensenator sie schließen ließ, erzählt Peter bei einem Glas Tee vom Paradies.<br />
Er sieht müde aus, er hat wieder Blut geschröpft, diesmal am Kopf. Manchmal<br />
streift sein Blick einen Glaubensbruder, der Geschirr abwäscht, am nächsten<br />
Tag hält der den Polizisten, die das Schloss der Moschee aufbohren lassen,<br />
den Mittelfinger entgegen.<br />
Eigentlich weiß man ja, dass das Paradies eine große Sache für Dschihadisten ist,<br />
aber wenn man Peter reden hört, denkt man, es vorher wohl doch nicht gewusst<br />
zu haben. Peter spricht ernsthaft und sehr konkret darüber. Für ihn ist das Paradies<br />
keine Ahnung in den Wolken, sondern Wirklichkeit. Wein gibt es dort, der bei<br />
jedem Schluck besser schmeckt, und Frauen, so schön, dass man danach die<br />
schönste Frau dieser Welt zum Kotzen findet. Siebzig Jahre würde man allein bei<br />
der ersten Umarmung verbringen. Sein Glaubensbruder ruft: „Alles, was hier verboten<br />
ist, gibt es da. Da gibt es Parties, ich will dahin mit Lichtgeschwindigkeit.“<br />
600 Meter südwestlich wirbt ein Pornoladen mit Spielcasino mit der Aufschrift:<br />
„Hier spielt das Leben“. Nebenan glänzt die Alster in der schönsten Abendsonne,<br />
Jugendliche grillen eine Wiese weiter und lassen bei einem Bier die Beine ins<br />
106
Wasser baumeln. Peter könnte hingehen, den Rausch sofort haben. Aber das<br />
will er nicht.<br />
Warum nicht?<br />
Im Mai <strong>2011</strong> fährt Peter mit einem Volkswagen an einem Park in Wandsbek<br />
entlang. Er hat es satt, den Verfassungsschutz, den fehlenden Pass, die Wanze<br />
in seinem Wagen, die Meldepflicht zweimal die Woche, das Gefühl, verfolgt zu<br />
werden. Dann sagt er: „Was ist das alles hier?“<br />
Hier, das ist eine Wiese im Frühlingslicht, das Bellen eines Hundes, Lindenduft<br />
und eine Frau mit blondem Haar.<br />
Für Peter ist es das nicht. „Guck mal“, sagt er, „Was ist das für ein Leben? Die Frau<br />
geht mit dem Hund spazieren und dann muss sie zur Arbeit, sie freut sich auf<br />
Weihnachten, und dann ist Weihnachten vorbei. Stell dir vor, man lebt 10.000 Jahre,<br />
aber diese 10.000 Jahre werden trotzdem vergehen.“ Das Paradies jedoch nehme<br />
kein Ende.<br />
Das erklärt vielleicht manche Missverständnisse, wie der Abend, als Peter zum<br />
V-Mann gemacht werden sollte. Er war zurück aus Pakistan, 2009, zwei Monate<br />
hatte der Gefängnisaufenthalt gedauert. Vorwerfen konnte man ihm nicht wirklich<br />
etwas, er behauptete ja, dass er zu einer Hochzeit und mit Teppichen handeln<br />
wollte.<br />
Ein paar Wochen später klingelte es an der Tür und ein kleiner Mann stand davor,<br />
Mitte 30, vermutet Peter. Ob der Mann vom LKA kommt oder vom Verfassungsschutz,<br />
kann Peter später nicht sagen. Das LKA will sich dazu nicht äußern, ein<br />
Verfassungsschützer sagt, er schließe „bei diesen Leuten“ gar nichts aus.<br />
Der Mann fragt höflich, ob er hereinkommen könne, es gebe da ein Angebot. Als<br />
sie in Peters Zimmer sitzen, erzählt er von einem Haus und Geld und einem neuen<br />
Reisepass. „Aber“, sagt der Mann, „es ist ein Geben und Nehmen.“ Er müsse als<br />
107
V-Mann arbeiten. „Nein“, sagt Peter. Er müsse sich ja nicht sofort entscheiden,<br />
sagt der Mann, er solle in Ruhe darüber nachdenken. „Ich bin Muslim“, sagt Peter.<br />
„Ich will ins Paradies. Was kannst du mir geben?“ Der Mann sagt: „Spitzel hat es<br />
immer gegeben.“ Peter erwidert: „Und es wird sie immer geben, bis zum Jüngsten<br />
Gericht.“<br />
Wer Spitzel ist, der ist ein Heuchler, ein Munafiq. Und die Munafiqun sind für Peter<br />
schlimmer als die schlimmsten Feinde des Islam, schlimmer als die Un gläubigen.<br />
Im untersten Grund des Höllenfeuers brennen sie, so steht es im Koran, in der<br />
vierten Sure, im 145. Vers. Dort wo aus der Wurzel des Feuerbrandes heraus der<br />
Baum Zakum wächst, dessen Früchte wie die Köpfe des Teufels sind, Früchte,<br />
die im Magen der Heuchler deren Eingeweide kauen.<br />
Das wusste der kleine Mann nicht.<br />
Die jüngste Narbe hat Peter am linken Daumen, eine Schnittwunde, etwa einen<br />
halben Zentimeter tief. Das Klappmesser trägt er immer am Gürtel. Es ist kein<br />
Schwert, wie der Prophet es hatte. Aber wir leben in Deutschland, wir müssen<br />
uns integrieren, meint Peter. Die Wunde kommt vom Messerkampf-Training.<br />
Peter kann nicht in Pakistan üben, weil ihm sein Pass abgenommen wurde, also<br />
trainiert er in Hamburg-Lohbrügge, gegenüber von Netto. Andere Muslime trainieren<br />
mit ihm. Die Kopfhaut des Trainers sieht aus, als hätte jemand versucht, einen<br />
Haufen Tischtennisbälle darunter zu verstecken. Er hat für die Bundeswehr ausgebildet.<br />
Der Fernmeldezug des Feldjägerbataillons 151 aus Neubrandenburg kennt<br />
ihn. „Mit Dank und Erinnerung“ steht an der Wand des kleinen Trainingsraums.<br />
Er lässt Peter und die anderen auf Fäusten Liegestütze machen, drei Minuten<br />
lang, manchmal länger, dann geht er herum und tritt ihnen in den Bauch, den<br />
Oberschenkel oder die Brust. Keiner beklagt sich. Danach läuft er ihnen über den<br />
Bauch, bevor sich die Schüler die Nerven an den Unterarmen kaputtschlagen.<br />
Dann Messerkampf, Faustkampf, einer gegen zwei, einer gegen drei.<br />
108
Die gleichen Schüler umarmen sich später, scherzen, lachen sich kaputt.<br />
An der Wand ist ein Gladiator aus rotem Nebel gemalt, daneben König Leonidas<br />
aus dem Film „300“ mit einem Schwert in der Hand und einem Pfeil, der durch<br />
die rechte Brustwarze eintritt und durch die linke wieder raus.<br />
Wenn Peter kämpft, dann grinst er. Wenn er Schläge eingesteckt hat oder austeilt,<br />
schaut er nach unten, und seine Augen werden größer. Er trainiert länger und härter<br />
als alle anderen. Nachdem alle schon gegangen sind, macht er noch 70 Liegestütze<br />
und 30 Klimmzüge.<br />
Er sagt: „Disziplin ist alles, ob beim Lernen oder beim Training. Man muss<br />
Disziplin haben. Man braucht einen Plan.“<br />
Seine Religion hält alles zusammen. Wenn er Hijama macht, das Blutschröpfen,<br />
seien das Wichtigste die „grundlegenden Hygieneregeln“. Nach dem Gebet geht<br />
er herum und macht das Licht aus. Dass in der Al-Quds-Moschee ein Schild stand:<br />
„Bitte keine Fahrräder abstellen, –onst werden ebendiese entfernt – der Vorstand“,<br />
fand er richtig. Er sagt: „Scheiße sagt man nicht.“<br />
Am Eingang ihres Trainingsraums haben Peter und seine Glaubensbrüder<br />
27 Zeitungsartikel an die Wand geklebt, mit Klebegummi, so dass die Tapete<br />
nicht kaputtgeht: Amokläufe, Brunner-Mord, das Todesprotokoll der Loveparade.<br />
„Es reicht!“ steht dort, „Endlich Knast für 20-Cent-Killer“, „Das ist der Vergewaltiger<br />
von Melanie“, „Tatort Neustadt: Schon wieder eine Nacht der Gewalt“.<br />
27 Artikel über eine kaputte Welt. Peter steht davor, liest sich die Sachen durch<br />
und schüttelt den Kopf. „Das ist, damit die Menschen wissen, was draußen<br />
passiert, weißt du? Das sind alles Originalfälle“, sagt er.<br />
Wenn die Stadt das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft feiert, geht Peter in die<br />
Moschee. Während die anderen glauben, dass Peter in der falschen Welt lebt,<br />
glaubt er das Gegenteil. Während die anderen glauben, Peter sei verloren, fühlt<br />
er sich errettet, endlich.<br />
109
Später, unten im Trainingskeller, stimmt einer der Brüder die Sure Al-Fatiha an.<br />
Hell und klar klingt es zwischen den Reckstangen und Hanteln. Peter betet so,<br />
wie er kämpft: wie ein Soldat, mit genauen Bewegungen. Schulter an Schulter,<br />
die Füße berühren die Füße der Nachbarn, alle Zehen in einer Linie, damit der<br />
Schaitan nicht durchkommt. Peter lässt sich zuerst auf die Knie fallen, dann erst<br />
folgen die Hände, so ist es gottgefälliger.<br />
„Ich müsste eigentlich schon lange weg sein“, meint er danach, in der U-Bahn.<br />
„Weg“ ist Pakistan. Der Dschihad, sagt Peter, sei seine Lebensversicherung, für<br />
ihn und für seine Familie, tausendmal würde es ihm im Paradies zurückbezahlt.<br />
Er will zurück, sobald er seinen Pass wieder hat.<br />
Eric Breininger, ein Dschihadist, der in Wasiristan starb, hatte ein Lächeln auf<br />
den Lippen, als er erschossen wurde, erzählt Peter. Sie hätten seine Leiche mit<br />
Säure übergossen, weil sie nicht wollten, dass er andere mit seinem Lächeln<br />
anstifte, doch die Leiche verweste nicht, roch nach Moschus zwei Wochen lang.<br />
Er hatte einen Ständer und einen Samenerguss. Die Huris, die Engel aus dem<br />
Paradies, sind ihm begegnet.<br />
„Die Reise“, sagt Peter, „beginnt sofort.“<br />
Kann man Peter aufhalten? Wie nimmt man einem Mann das Paradies?<br />
Welche Worte setzt man dem Gott in seinem Kopf entgegen?<br />
Wenn die Behörden Moscheen schließen, entstehen woanders neue, in Pinneberg<br />
oder in Harburg. Die neuste, die der Verfassungsschutz noch nicht erwähnen will,<br />
in Borgfelde. Von außen erkennt man sie manchmal nicht, selbst die Nachbarn<br />
wissen es oft nicht. Es ist eine Welt der Hinterhöfe. Drückt man das Ohr auf den<br />
Teppichboden in der Assalam-Moschee, in der er manchmal betet, hört man das<br />
leise Murmeln der Betenden und die Autos in der Tiefgarage darunter.<br />
110
Wenn Peter Wichtiges zu erzählen hat, wie Reiserouten oder Finanzierung, lässt<br />
er sein Handy zu Hause und geht an der Alster spazieren. Er legt den Finger auf<br />
den Mund und nimmt für Unausgesprochenes Gesten. Die Bewegung, mit der er<br />
eine Kalaschnikow hält, ist das Zeichen für den Dschihad.<br />
Seit Peter zum Islam konvertierte, ist seine Mutter, eine herzliche, gastfreundliche<br />
Frau, sehr zufrieden mit ihm. Es klingt merkwürdig, aber in den letzten Jahren hat<br />
es Peter vorangebracht in seinem Leben. Der Glaube hat ihn ruhiger gemacht.<br />
Seine Mutter sagt: „Allah hat mir einen neuen Sohn geschenkt, Alhamdullilah,<br />
er war nicht immer so wie jetzt.“<br />
Wer ihn nachts anruft und um einen Schlafplatz bittet, den lässt er ein. Wer<br />
arbeitslos geworden ist, dem verschafft er einen neuen Job. Wenn die Briefträgerin<br />
ihren Wagen auf dem Gehweg schiebt, macht Peter Platz. „Danke“, sagt sie.<br />
„Bitte“, sagt er. Er kauft Überraschungseier für die Kinder von Freunden, weil die<br />
sich so freuen, und er lacht mit ihnen. Er empfiehlt Hohes C und Granini, wegen<br />
der guten Qualität. Er hat den Hauptschulabschluss nachgemacht. Drogen hat<br />
er nicht mehr genommen, aber Arbeit gefunden im Großmarkt Hamburg, Abteilung<br />
Obst und Gemüse.<br />
Er wischt den Tisch ab, nachdem er gegessen hat. „Wenn die Mutter nicht<br />
zufrieden mit einem ist, kommt man nicht ins Paradies“, meint er.<br />
Ein Gefühl stärker als jeder Orgasmus, das muss der Tod als Märtyrer sein.<br />
Rauch, Asche und Blut bilden ein trübes, schwarzes Gemisch.<br />
Seine Mutter sagt: „Allah hat mir einen neuen Sohn geschenkt, Alhamdulillah.“<br />
111
Medienprojektpreis
113<br />
Sebastian Pantel
Artikelserie „Jugend und Kriminalität“<br />
(SÜDKURIER, 04.05. bis 15.06.<strong>2011</strong>)<br />
Sebastian Pantel<br />
geboren 1979 in Wuppertal<br />
Werdegang:<br />
seit März 2010 Regionalreporter beim SÜDKURIER<br />
2008-2010 Newsmanager Online beim SÜDKURIER in Friedrichshafen<br />
2007-2008 Volontariat beim SÜDKURIER<br />
2000-2006 Studium<br />
Auszeichnungen, u. a.:<br />
<strong>2011</strong> Diakonie Journalistenpreis in Baden und Württemberg<br />
2009 Erich-Schairer-<strong>Preis</strong> (1. <strong>Preis</strong>)<br />
114
Begründung der Jury<br />
Zunächst einmal muss ich einem Gerücht entgegentreten. Der <strong>Preis</strong>träger Sebastian<br />
Pantel heißt zwar fast genau so wie ich, aber mit Heribert Prantl ist er weder verwandt<br />
noch verschwägert. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute einen jungen<br />
Kollegen auszeichnen kann, der nicht nur fast so heißt wie ich – sondern auch eine<br />
glänzende Serie im Südkurier gestaltet und geschrieben hat. Es ist dies eine Serie<br />
über Jugendkriminalität, also über ein brennendes Problem, das viel zu viel als ein<br />
Problem von Paragrafen und viel zu wenig als ein Problem der Gesellschaft wahr -<br />
genommen wird. Deshalb haben wir Sebastian Pantel zum <strong>Preis</strong>träger gekürt, deshalb<br />
laudiere ich seine Leistung herzlich gerne. So ein wichtiges, aber zu wenig beachtetes<br />
Thema in einer Regionalzeitung wie dem Südkurier so gründlich auszuleuchten – das<br />
ist bemerkenswert, nein mehr: das ist spektakulär.<br />
Das Strafrecht ist der Seismograph der Gesellschaft; das Jugendstrafrecht ist ein<br />
ganz besonders empfindliches seismographisches Instrument: Sebastian Pantel hat<br />
sorgfältig damit gemessen und seine Erkenntnisse erstens penibel, zweitens packend<br />
und drittens lehrreich beschrieben. Er hat sieben straffällige Jugendliche befragt, er<br />
schildert ihre Taten, ihre Strafen, ihre Lebensverhältnisse, ihre Erfahrungen mit Erziehungsmaßnahmen,<br />
mit pädagogischen Projekten und mit dem Jugendarrest. Es kommt<br />
ein Jugendrichter, ein Strafrechtsprofessor, ein Gefängnisdirektor, es kommen Sozialarbeiter<br />
zu Wort. Daraus entsteht eine Artikelserie, die Maßstäbe setzt. Im letzten Teil<br />
der Serie stellt der Autor „uns“, die Gesellschaft also, fiktiv vor Gericht – und lässt den<br />
Richter fragen , warum die Gesellschaft ihr Heil in immer schärferen Strafen sucht,<br />
statt den viel klügeren Weg der Prävention zu gehen.<br />
Die Serie, die im „Südkurier“ erschienen ist, schürft tief und rüttelt auf; sie widerlegt<br />
die gängigen Vorurteile von einer angeblich immer krimineller werdenden Jugend; und<br />
sie zeigt Wege auf, wie man mit Jugendkriminalität besser als bisher umgehen kann. Die<br />
von Sebastian Pantel zusammengestellte und geschriebene Serie ist ein systemrelevantes<br />
Medienprojekt von herausragender Qualität. Sie ist ein Spitzenprodukt der journalistischen<br />
Aufklärung. Sebastian Pantel ist ein Aufklärer. Daher zeichnen wir ihn aus!<br />
Vorgetragen von Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
115
Weniger junge Straftäter<br />
(SÜDKURIER, 04.05.<strong>2011</strong>)<br />
Stuttgart – Zunächst einmal klingt das nach einer guten Nachricht: Die Jugendkriminalität<br />
im Land geht zurück. Von einer „positiven Entwicklung“ sprach<br />
Innenminister Heribert Rech (CDU) gestern bei der Vorstellung der Polizeistatistik.<br />
Bei einem schnellen Blick auf die Statistik möchte man ihm zustimmen. Die Zahl<br />
der Tatverdächtigen unter 21 Jahren ist um drei Prozent gesunken. Bei Sach beschädigung,<br />
Gewalt an Schulen und schweren Fällen von Körperverletzung – typischen<br />
Feldern von Jugendkriminalität also – gehen die Zahlen ebenfalls zurück,<br />
zum Teil im zweistelligen Prozentbereich. Der scheidende Innenminister führt<br />
das vor allem auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von Schulen und Polizei bei<br />
der Prävention zurück. Auch das Konzept, sich junger Schwellentäter anzunehmen,<br />
also Jugendlicher, die in kriminelle Karrieren abzugleiten drohen, habe sich be -<br />
währt, sagt Rech. Doch ihre Zahl erscheint mit gut vierhundert im Vergleich zu<br />
insgesamt fast 64.000 Tatverdächtigen eher niedrig.<br />
Zunahme bei Ausländern<br />
Überhaupt lassen sich im Zahlenwerk eine ganze Reihe Punkte finden, die Anlass<br />
zu Sorge geben. So ist beispielsweise der Anteil ausländischer Tatverdächtiger<br />
ähnlich wie im Vorjahr um fünf Prozent gestiegen. Konkret: Von 100.000 Kindern,<br />
Jugendlichen und Heranwachsenden zwischen acht und 21 Jahren hat die Polizei<br />
bei Nicht-Deutschen rund 8.300 Tatverdächtige ermittelt. Das sind mehr als doppelt<br />
so viele wie in der Gruppe der Deutschen. Allerdings beinhaltet die Statistik auch<br />
Straftaten, die unter Deutschen und Nichtdeutschen nicht zu vergleichen sind.<br />
So umfassen sie auch Verstöße gegen das Ausländerrecht, die nun einmal ausschließlich<br />
von Ausländern begangen werden können.<br />
Über Möglichkeiten, dieses Problem in den Griff zu bekommen, schweigt der<br />
Bericht sich jedoch aus.<br />
Anders beim Thema Alkohol. Nach wie vor ist ein Drittel der jungen Gewalttäter<br />
während der Tat betrunken. Mit millionenschweren Förderprogrammen und dem<br />
Einsatz jugendlicher Testkäufer versucht das Land, dies zu ändern. Dass solche<br />
Anstrengungen nicht immer fruchten, macht der Bericht, wenn auch in wortreichen<br />
Textpassagen versteckt, deutlich. Die Prävention habe im vergangenen Jahr sehr<br />
unter der hohen Arbeitsbelastung der Polizei gelitten, heißt es. Auch wird beklagt,<br />
116
dass viele Kommunen in Zeiten klammer Kassen ihr Engagement bei der Jugendhilfe<br />
zurückfahren. Gerade den Institutionen Polizei und Jugendamt würden um -<br />
gekehrt junge Menschen immer weniger Respekt entgegenbringen. Von „üblen<br />
Beleidigungen gegen Polizeibeamte“ und „offener Ablehnung“ spricht der Bericht.<br />
Anlass zu Sorge geben auch die Zahlen bei Raub und Vergewaltigung – hier stieg<br />
die Zahl der jungen Tatverdächtigen um neun beziehungsweise 14 Prozent.<br />
Opfer dieser Delikte sind – auch das zeigt die Statistik überdeutlich – wiederum<br />
vor allem Jugendliche.<br />
Ab kommender Woche beleuchten wir das Thema Jugendkriminalität in einer<br />
großen Serie. Wir stellen junge Straftäter vor, berichten über ihre Erfahrungen<br />
vor Gericht, im Gefängnis und bei der Rückkehr ins Leben. Zudem kommen zahlreiche<br />
Experten zu Wort, die mit Vorurteilen aufräumen und erklären, was man<br />
gegen Jugendkriminalität tun kann.<br />
Dauerbaustellen<br />
(SÜDKURIER, 04.05.<strong>2011</strong>)<br />
Zum Abschied ein Schulterklopfen. Der scheidende Innenminister Heribert Rech<br />
stellt den Bericht zur Jugendkriminalität im Land vor und spricht von „positiven<br />
Entwicklungen“, die der Lohn einer „auf Dauer angelegten Strategie“ seien.<br />
Dabei hat seine eigene Behörde ihm die ungelösten Dauerbaustellen deutlich ins<br />
fast hundertseitige Papier geschrieben. Immer noch werden Ausländer mehr als<br />
doppelt so oft kriminell wie Deutsche – was an verbauten (Bildungs-) Chancen<br />
liegt und nicht an kulturellen Unterschieden, egal was die Stammtische dazu<br />
meinen. Immer noch hängen Jugendgewalt und Alkohol unheilvoll zusammen.<br />
Immer noch holen Mädchen und junge Frauen auf, was kriminelle Energie angeht.<br />
Wenn, wie der Bericht nahelegt, in dieser Lage richtige Ansätze wie Pävention<br />
und kommunale Jugendarbeit nicht ausgebaut werden, sondern zurückstecken<br />
müssen, weil Personal und Geld fehlen, dann stimmt wohl mit der gelobten<br />
„Strategie“ etwas nicht.<br />
117
1 2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1 Jury-Mitglied Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
im Gespräch mit Sandro Mattioli, Gewinner<br />
eines Recherchestipendiums 2009<br />
2 Festredner Prof. Lammert und<br />
OBS-Geschäftsführer Wolf Jürgen Röder<br />
würdigen das Programmheft zur <strong>Preis</strong>verleihung<br />
3 <strong>Preis</strong>träger <strong>2011</strong> und<br />
Publikum danken für eine gelungene<br />
<strong>Preis</strong>verleihung 4 Jury-Mitglied und<br />
Moderatorin Sonia Seymour Mikich im<br />
Gespräch mit den Spiegel-Redakteuren,<br />
die mit dem 2. <strong>Preis</strong> ausgezeichnet<br />
wurden 5 „Spezial“-<strong>Preis</strong>trägerin<br />
Katja Thimm mit Laudator Prof. Dr.<br />
Heribert Prantl und OBS-Vertretern<br />
118
1<br />
1 Jury-Mitglied und Moderatorin<br />
Sonia Seymour Mikich gratuliert<br />
Jonathan Stock, Gewinner des<br />
Newcomerpreises 2 Jury-Mitglied<br />
Prof. Dr. Volker Lilienthal bei einer<br />
Laudatio 3 Mehr als 350 Gäste<br />
verfolgen mit den <strong>Preis</strong>trägern die<br />
<strong>Preis</strong>verleihung 4 Jury-Mitglied<br />
und Laudator Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
5 Sebastian Pantel, Gewinner des<br />
Medienprojektpreises, steht<br />
Sonia Seymour Mikich Rede und Antwort<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
119
Recherche-Stipendien I<br />
Dotiert mit 5.000 Euro
Matthias Dell<br />
Urs Spindler
Aus der Würdigung der Jury<br />
Über die „Tea Party“, diese rechtskonservative Protestbewegung in den USA, ist auch<br />
in Deutschland viel geschrieben worden. Matthias Dell will es genauer wissen und diese<br />
politische Entwicklung auch intellektuell durchdringen. Wird da ein Muster erkennbar,<br />
das auf Deutschland übergreifen könnte? Das ist ein analytischer und antizipativer<br />
Rechercheansatz, den die Jury unbedingt fördern möchte.<br />
122
Matthias Dell<br />
(Der Freitag)<br />
„Tea Party Time. Die Rechtsbewegung der Bürger“<br />
Ausgangspunkt der Recherche ist die US-amerikanische „Tea Party“-Bewegung.<br />
Abgebildet werden soll das Verhältnis der „Tea Party“-Anhänger zum Staat vor<br />
allem am Beispiel Steuerpolitik. Die Einordnung der Recherchen zur „Tea Party“<br />
mit Blick auf soziale Bewegungen schafft einen Hintergrund, vor dem in einem<br />
zweiten Schritt auf die Situation in Deutschland fokussiert werden kann.<br />
Matthias Dell<br />
geboren 1976 in Erfurt<br />
Werdegang:<br />
Seit 2007 Kulturredakteur bei der Wochenzeitung „Der Freitag“, Berlin<br />
2006 Praktikant am Goethe-Institut Shanghai, China<br />
1997-2006 Studium der Theaterwissenschaft und Komparatistik an der FU Berlin<br />
und der Université Paris 8/Université Sorbonne Nouvelle Paris 3<br />
2004-2006 Kulturredakteursvertretung bei der Wochenzeitung und „Der Freitag“<br />
123
Aus der Würdigung der Jury<br />
Der junge Journalist Urs Spindler wundert sich: Europäische Polizisten und Justizbeamte<br />
sollten Ordnung schaffen im oft noch immer chaotischen Raum. Ein Rechtsstaat im<br />
rechtsfreien Raum – geht das überhaupt? Spindler will das scheinbare Paradoxon un -<br />
mittelbar vor Ort überprüfen. Die Jury möchte dem jungen Auslandsreporter dabei helfen.<br />
124
Urs Spindler<br />
(freier Journalist)<br />
„Eulex-Mission im Kosovo:<br />
Ein Rechtsstaat im rechtsfreien Raum“<br />
Die Lage auf dem Balkan ist und bleibt seit Jahrzehnten vertrackt – vielleicht ist das der<br />
Grund, warum den Entwicklungen in der ehemaligen serbischen Provinz so wenig Beachtung<br />
geschenkt wird. Aber wie kann die Europäische Union Demokratie und Rechtsstaatlichkeit<br />
„exportieren“, wenn es nicht mal in der direkten Nachbarschaft klappt?<br />
Urs Spindler<br />
geboren 1988 in Bielefeld<br />
Werdegang:<br />
seit Juni <strong>2011</strong> freie Mitarbeit SPIEGEL ONLINE<br />
seit Mai <strong>2011</strong> freie Mitarbeit Erdgeschoss Verlag (Text und Lektorat)<br />
seit 2010 Studium Journalistik und Kommunikationswissenschaft,<br />
Universität Hamburg<br />
Mai 2008 bis Mai 2010 www.blickwinkel-muenster.de (Text und Radio)<br />
2008-2010 freie Mitarbeit Münstersche Zeitung Zeitung<br />
2007-2010 Studium der Kommunikationswissenschaft,<br />
Westfälische-Wilhelms-Universität Münster<br />
125
Recherche-Stipendien II
Ergebnisse<br />
abgeschlossener<br />
Stipendien<br />
Marvin Oppong<br />
Frank Brunner<br />
Gordon Repinski
Marvin Oppong<br />
Marvin Oppong<br />
geboren 1982 in Münster<br />
Werdegang:<br />
Seit 2005 Studium der Rechtswissenschaft an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität Bonn, Schwerpunkt Völker- und Europarecht<br />
2004-2005 Studium an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne im Rahmen des<br />
Sokrates-Programms der Europäischen Union<br />
2002-2004 Studium der Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Seit 2000 Tätigkeit als freier Journalist (u. a. für Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung)<br />
<strong>Preis</strong>e:<br />
2009 Grimme Online Award in der Kategorie „Information“ mit dem Blog „CARTA“<br />
Veröffentlichungen:<br />
Migranten in der deutschen Politik (Hrsg.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden,<br />
Juni <strong>2011</strong><br />
Informationsfreiheitsgesetz und Kommunikationskultur. Warum ein Journalist den WDR<br />
verklagt – Protokoll eines Testberichts, in: Johannes Ludwig (Hrsg.), Sind ARD und ZDF<br />
noch zu retten? – Tabuzonen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 2009<br />
Finger weg von der Justiz – Für eine Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft,<br />
in: Zeitschrift für Rechtspolitik, 42. Jahrgang 2009, Heft 1, S. 22 f., 2009<br />
Brauchen wir ein Europäisches Strafregister?, in: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht,<br />
155. Jahrgang 2008, Heft 9, S. 575-583.<br />
128
Wikipedia oder Wahrheit<br />
(DIE ZEIT, Nr. 49, 01.12.<strong>2011</strong>)<br />
Wikipedia ist ein demokratisches Medium. Damit sich auf der Online-Enzyklopädie<br />
die Wahrheit durchsetzt, darf sich jeder einmischen – unabhängig davon, ob er<br />
schon volljährig ist oder jenseits der neunzig, ob er gebildet ist, Geld oder Kontakte<br />
besitzt. Bei Wikipedia sind alle gleich, das bessere Argument zählt. Das ist das<br />
Prinzip.<br />
Und doch haben manche Autoren mehr Einfluss als andere. Sie haben sich Respekt<br />
erarbeitet, durch ihren Fleiß und ihr gutes Händchen, eine Diskussion zu einem<br />
fruchtbaren Ergebnis zu führen. Sie können aufsteigen und Administrator werden.<br />
Dann haben sie nicht nur die Macht des Arguments auf ihrer Seite, sondern auch<br />
die Macht des Systems. Sie dürfen dann Einträge löschen und andere Teilnehmer<br />
maßregeln.<br />
Was aber, wenn einer dieser Administratoren seine Macht missbraucht? Was,<br />
wenn er möglicherweise Öffentlichkeitsarbeiter von Firmen in die Lage versetzt<br />
hat, Beiträge zu schönen? Und wenn der Staat das Ganze womöglich auch<br />
gefördert hat?<br />
Dann ist der Ruf eines Mediums in Gefahr, das sich anschickt, ein digitales<br />
Weltkulturerbe zu werden. Und dann muss sich Achim Raschka erklären. Doch<br />
Raschka will nicht wirklich. „Ich habe weder die Zeit noch die Lust, Ihnen die<br />
dringend benötigte Nachhilfe zu erteilen“, schreibt er. Dabei würde ein bisschen<br />
Aufklärung schon reichen.<br />
Raschka war so ein besonderer Autor, ein Administrator, ein Hüter der virtuellen<br />
Wahrheit gewesen, ein Freiwilliger, der Wikipedia-Einträge überprüft, kommentiert<br />
und löscht.<br />
Der Gedanke einer demokratischen Wissensentstehung ist schön, nur leider steht<br />
nicht immer die Wahrheit im Vordergrund. Eine Plattform, die allein in der deutschen<br />
Version täglich achtzig Millionen Besucher hat, beeinflusst den Blick der<br />
Deutschen auf Produkte, Marken – Kontroversen. Etwas Unangenehmes zu<br />
129
verschweigen, die Vergangenheit ein bisschen schöner zu formulieren – das kann<br />
sich für Unternehmen lohnen.<br />
Wie oft das gelingt, kann niemand sagen. Achim Raschka mag vielleicht eine<br />
Ahnung davon haben. Der Biologe hat mehr als 65.000 Mal in Artikel eingegriffen.<br />
Er war 2004 nach eigenen Angaben dabei, als Wikimedia gegründet wurde, ein<br />
Verein, der die deutsche Wikipedia betreibt und pflegt. Raschka war dort mal<br />
auf diesem, mal auf jenem Posten tätig, zuletzt war er im Ressort Qualität und<br />
saß als Beisitzer im Vorstand.<br />
Achim Raschka war auch aktiv dabei, als vor vier Jahren das Projekt „Nachwachsende<br />
Rohstoffe“, kurz Nawaro, startete. Es war eines der größten Schreibprojekte<br />
der deutschen Wikipedia. Innerhalb von drei Jahren sollten über hundert neue<br />
Einträge entstehen, von Bioenergie über Kunststoffe bis hin zu Rohstoffpflanzen.<br />
Das Projekt zog von Anfang an keine klare Grenze zwischen Privatwirtschaft und<br />
Gemeininteresse. Nawaro war eine Zusammenarbeit zwischen Wikimedia und<br />
dem Unternehmen Nova-Institut, das in der privaten Forschung für unterschiedliche<br />
Auftraggeber tätig ist. Das Verbindungsglied war der Mann, der bei beiden<br />
arbeitete: Achim Raschka. Ihm wurde die Leitung des Projekts übertragen.<br />
Das ist, als würde ein Autor Thema und Schreibstil bestimmten, redigieren und<br />
sich dabei selbst kritisch beobachten. Obendrein erhielt das Projekt eine staatliche<br />
Förderung. 234.820 Euro flossen aus den Mitteln des Verbraucher ministeriums<br />
– in der Zeit der CSU-Bundesminister Horst Seehofer und Ilse Aigner – über<br />
den Verein Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) direkt an das Nova-Institut.<br />
Das Gemenge von staatlicher Finanzierung und privatwirtschaftlicher Beteiligung<br />
ging auch einzelnen Nutzern der Wikipedia-Community zu weit. Sie fürchteten,<br />
andere Unternehmen könnten sich an Nawaro ein Beispiel nehmen und<br />
sich ebenfalls über Projekte in die Wikipedia einklinken.<br />
Benutzer Heizer etwa unkte: „Das Institut firmiert als ‘nova-Institut GmbH’.<br />
Wenn das Projekt ein Erfolg wird, dürften ja sicher noch andere staatliche Auftrag-<br />
130
geber Interesse haben, die Wikipedia in ihre Public-Relations-Kampagnen<br />
einzubinden. Ebenso die Privatwirtschaft.“<br />
Der langjährige Wikipedianer und frühere Administrator Simplicius, Hauptverantwortlicher<br />
des Diderot-Clubs bei Wikipedia und ein scharfer Kritiker Raschkas,<br />
definiert sich seiner Benutzerseite zufolge als „unabhängiger Wikipedianer“<br />
und fühlt sich „durch Wikimedia Deutschland e. V. nicht vertreten“. Simplicius<br />
findet, das Projekt Nawaro habe ein „Geschmäckle“. Er meint, die öffentliche<br />
Förderung des Projekts in Höhe von knapp einer Viertelmillion Euro sei „gigantisch,<br />
gemessen an der Anzahl der Artikel“ und „absolut ungewöhnlich“. Letztlich entsprach<br />
die Förderung pro bearbeitetem Artikel rund 540 Euro, während die Mitarbeit<br />
bei Wikipedia normalerweise unvergütet ist. „Ich habe 3.000 Artikel angelegt,<br />
dann müsste ich jetzt ja eine Finca auf Malle haben mit Pool“, meint Simplicius.<br />
Wikimedia beantwortet schriftlich eingereichte Fragen zu diesem Komplex nicht.<br />
Das Nova-Institut ließ sich von der Kritik ohnehin nicht stören. Die miteinander<br />
abgestimmten Parallelstrukturen von Wikimedia und dem Institut seien „vor allem<br />
in der Anfangsphase nicht aktiv zu kommunizieren“, so formuliert es ein Projektbericht.<br />
Und wer waren nun die Autoren, die für Nawaro geschrieben haben, und wer hat<br />
sie bezahlt? Auf Anfrage der ZEIT wollte oder konnte das Nova-Institut nicht antworten.<br />
Wikimedia nahm zu diesen Fragen nach mehrfacher Aufforderung wieder<br />
nicht Stellung.<br />
Eines ist sicher: Die Autoren kamen nicht alle vom Projekt selbst. Im Abschlussbericht<br />
von Nawaro kann man lesen, es seien „bezahlte Kräfte „ von „interessierten<br />
Einrichtungen“ gewesen, die an der „Erstellung von Artikeln“ mitgewirkt hätten.<br />
Die Fachagentur, die für das Bundesministerium das Geld verteilt, findet das<br />
nicht weiter verwerflich. Dort heißt es auf Anfrage arglos, es sei durchaus möglich,<br />
dass einige der Autoren von Firmen kämen.<br />
131
In der Praxis geschah unter anderem Folgendes: Zwei Mitarbeiter des Verbands<br />
der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland besuchen eine Autorenschulung.<br />
Danach schreiben sie einen Wikipedia-Artikel über ihren eigenen Verein.<br />
Eine andere interessierte Firma hieß FKuR. Das Unternehmen ist ein Kunststoffriese,<br />
der Plastiktüten herstellt, aber auch Burgerverpackungen oder Einwegbesteck. Häufig<br />
wird dafür der Kunststoff PLA verwendet. Weil beim Abbau von PLA durch Kompostierung<br />
sehr viel CO2 freigesetzt wird, kritisieren Umweltverbände das Material.<br />
Plötzlich tauchen im Jahr 2009 Fotos von FKuR-Kugelschreibern, -Einwegbesteck<br />
und -Plastiktüten in den neu entstandenen Artikeln über nachwachsende Rohstoffe<br />
auf. Sogar der Markenname steht unter den Fotos. Bis in die italienischsprachige<br />
Wikipedia setzt sich die PR durch, auch auf die Inhalte dehnt sie sich<br />
aus. Ein anonymer Nutzer setzt im Text einen Link zu einem Positionspapier auf<br />
der Homepage von FKuR. Darin steht zum Beispiel, FKuR verwende einen Kunststoff,<br />
der zu 100 Prozent natürliche Materialien wie PLA enthalte. Die Firma FKuR<br />
äußert sich zu diesen Dingen auf schriftliche Nachfrage nicht.<br />
Wer also setzte den Link? Raschka sagt dazu: „Ich bin nicht bereit, Ihnen Klarnamen<br />
von Wikipedia-Benutzern zu nennen – dies verstößt gegen die Gepflogenheiten<br />
der Wikipedia, und Benutzer, die dies tun, werden sehr berechtigt dafür gesperrt.“<br />
Fakt ist: Kurz bevor der Link gesetzt wurde, waren Mitarbeiter des Projekts Nawaro<br />
beim Unternehmen FKuR zu Besuch. Es fand ein Seminar statt, und Raschka war<br />
als Referent vorgesehen. Offenbar waren die Mitarbeiter der Firma danach in der<br />
Lage, Änderungen an Artikeln vorzunehmen, und das sei auch so geschehen,<br />
sagt ein Projektbericht.<br />
Was hat ein öffentlich gefördertes Schreibprojekt in den Räumen eines Kunststoffunternehmens<br />
zu suchen? Und nicht nur dort: Nawaro gab weitere Seminare.<br />
In Bonn fand eine Tagung statt, bei der auch ein Vortrag mit dem Titel Wikipedia<br />
als PR-Instrument? gehalten wird. Und wieder entsteht danach ein neuer Eintrag<br />
in der Online.Enzyklopädie, diesmal über den Lobbyverband des Brennstoffes<br />
132
Holzpellet. Mitarbeiter des Verbands der Holzpellet-Industrie hatten am Seminar<br />
teilgenommen.<br />
Das Projekt Nawaro endete im Jahr 2010. Da war Raschka über das Online-Karriereportal<br />
Xing bestens vernetzt. Außerdem bot er mittlerweile private und kostenpflichtige<br />
Seminare für Organisationen und Unternehmen an. Unter anderem war<br />
er auch bei RWE. Dort sei es unter anderem um die „Möglichkeiten einer inhaltlichen<br />
Beteiligung im Sinne der Wikipedia-Philosophie“ gegangen, wie er selbst<br />
formuliert. Zu diesem Zeitpunkt ist er weiter bei Wikimedia aktiv, erst Mitte Juli<br />
tritt er wegen internen Unstimmigkeiten aus dem Verein aus.<br />
Die Artikel, die bei Nawaro entstanden, wurden alle von der Fachagentur Nachwachsende<br />
Rohstoffe im Namen des Verbraucherministeriums abgenommen<br />
und genehmigt.<br />
Was geschrieben wurde, ist jetzt Teil des Wissens der Welt. Man darf fragen:<br />
Wie schlimm ist so ein Einfluss? Jeder weiß, dass Wikipedia keine verlässliche<br />
Quelle ist. Aber es ist auch keine Firmenhomepage und kein Werbeprospekt,<br />
es soll in Theorie und Praxis nicht zu kaufen sein und nicht zu manipulieren.<br />
Darauf beruht das Vertrauen der Nutzer in Wikipedia. Angesichts der Macht der<br />
Unternehmen, die da anklopfen, wirkt der Glaube an die Durchsetzungskraft der<br />
Wahrheit, an das Gute im Menschen, manchmal naiv.<br />
Ein einziger Nutzer, BJ Axel, hat damals gegen die seltsamen Markennamen in<br />
den Artikeln über nachwachsende Rohstoffe aufbegehrt und sie gelöscht. Diese<br />
Löschungen wurden von Raschka mehrfach rückgängig gemacht. Raschka hat<br />
sich schriftlich zu einigen Fragen geäußert und sie teilweise auf seinem Blog<br />
öffentlich beantwortet. Zur Aufklärung hat er damit wenig beigetragen.<br />
Und so bleibt die zentrale Frage: Hat Achim Raschka, der Internet-Aktivist, der<br />
Wikipedia geschadet?<br />
133
Heimliche Einflussnahme<br />
Beispiele, wie Unternehmen ihr Image aufpolieren wollen, sind auf der Seite<br />
WikiScanner zu finden: Anhaltspunkte dafür liefern die sogenannten IP-Nummern.<br />
Das sind im übertragenen Sinne die Telefonnummern von Computern im Internet.<br />
Sie erlauben den zuverlässigen Datenverkehr von einem Adressaten zum anderen.<br />
WikiScanner registrierte nun: Ein Nutzer hat aus dem „Störfall“ des Atomkraftwerks<br />
Biblis ein harmloses „meldepflichtiges Ereignis“ gemacht. Von derselben IP-Nummer<br />
aus wurde hinzugefügt, dass „Biblis Meilenstein in puncto Sicherheit“ sei. Aus<br />
dem „Export von Atommüll“ wurde schlicht die „Rückführung von Brennstäben“. Der<br />
Nutzer, der die Änderungen eintrug, kam von RWE. Eine IP-Adresse von der Firma<br />
Boehringer Ingelheim löschte die Lieferung von Agent Orange an die USA aus der<br />
Firmenvergangenheit. Der Hersteller eines Ginkgo-Gedächtnis-Präparats entfernte<br />
einen kritischen Kommentar zur Wirksamkeit aus dem Artikel. MOP<br />
Recherche-Stipendien der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Seit 2005 lobt die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung in Zusammenarbeit mit „netzwerk recherche“<br />
jährlich jeweils drei Stipendien aus. Eine Übersicht zu allen Stipendien, die seit 2005 vergeben<br />
worden sind, finden Sie auf S. 184 / 185 in diesem „Best of“.<br />
Auf der <strong>Preis</strong>seite www.otto-brenner-preis.de können die Ergebnisse aller abgeschlossenen<br />
Recherchestipendien nachgelesen werden.<br />
Dem „Best of“ liegt der aktuelle Ausschreibungsflyer für den „<strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 2012“ bei<br />
– mit Beispielen für erfolgreich abgeschlossene Stipendien. Der Flyer kann über die Homepage<br />
der Stiftung und/oder über die <strong>Preis</strong>seite bestellt werden.<br />
(Die Redaktion)<br />
134
Frank Brunner<br />
Frank Brunner<br />
geboren 1972 in Karl-Marx-Stadt (jetzt Chemnitz)<br />
Werdegang:<br />
Seit <strong>2011</strong> freier Journalist im Berliner Journalistenbüro Schön&Gut,<br />
u. a. für Spiegel-Online, Zeit-Online, taz sowie als Textchef für<br />
den W. Bertelsmann Verlag<br />
2009-2010 Redakteur bei der jungen Welt<br />
2007-2009 freier Autor, u. a. für Berliner Zeitung, Tagesspiegel<br />
2003-2009 Studium der Politikwissenschaft und der Publizistik an der FU Berlin<br />
2001-2002 Studium der Philosophie an der TU Chemnitz<br />
2000-2001 Abitur<br />
Veröffentlichungen:<br />
„Die NPD in Berlin: Geschichte und Gegenwart eines Landesverbandes der<br />
rechts -extremen Partei“ (2009)<br />
135
Im Körper des Feindes<br />
(die tageszeitung, 13. / 14.08.<strong>2011</strong>)<br />
Wie sich bekannte Journalisten vor den Karren der privaten PR-Hochschule<br />
Quadriga spannen lassen. Und darüber eher einsilbig Auskunft geben.<br />
Den Clou hat sich Susanne Wegerhoff für den Schluss aufgehoben. „Das, was<br />
man in den Medien über Opel liest, ist zu 87 Prozent von uns gesteuert“, sagt<br />
die Chefin der Konzernkommunikation des Autobauers vor knapp zwei Dutzend<br />
Studenten der privaten Quadriga-Hochschule in Berlin.<br />
Es ist kurz nach 20 Uhr an diesem Freitag im Mai <strong>2011</strong>. „Über sieben Brücken<br />
musst du gehen: Vom kommunikativen Krisenmanagement zur aktiven Image -<br />
gestaltung“, hat Gastdozentin Wegerhoff die Stunde überschrieben. Es geht um<br />
Werksschließungen, Entlassungen, einen widerspenstigen Betriebsratschef und<br />
um Medien, die monatelang ein düsteres Bild von Opel gezeichnet hatten.<br />
Die Stimmung im Unterrichtsraum dagegen ist heiter; schon während des Vortrags<br />
gibt es Bier. Wegerhoff zeigt viele bunte Diagramme, deren Kurven erst abwärts,<br />
später aufwärts zeigen und erklärt dazu sehr kurzweilig, wie man Journalisten<br />
motiviert, eine Firma mit angekratztem Renommee in ein besseres Licht zu<br />
rücken.<br />
Hilfsbereite Journalisten<br />
Dass Pressesprecher Medien für ihre Zwecke einzuspannen versuchen, ist Teil<br />
ihres Berufs. Zumindest erklärungsbedürftig ist es aber, wenn Journalisten dabei<br />
helfen, die PR-Profis jener Firmen, Organisationen oder Verbände auszubilden,<br />
die sie eigentlich kontrollieren sollen. Sieben prominente Medienvertreter engagieren<br />
sich für die Hochschule: im Kuratorium, als Mentoren der Studierenden<br />
oder Berater der Lehrbeauftragten.<br />
Die Hochschule gehört zum Firmenkonglomerat um die Helios Media GmbH von<br />
Rudolf Hetzel. Der 37-Jährige hat mit Magazinen, Seminaren, Tagungen und <strong>Preis</strong>verleihungen<br />
eine Art Kontakthof für Abgeordnete, Pressesprecher, Lobbyisten<br />
und Journalisten etabliert. Sein Helios-Verlag (Politik & Kommunikation, Presse-<br />
136
sprecher) veranstaltet mit viel Pomp und Prominenz jährlich einen Politik- und<br />
einen Kommunikationskongress.<br />
Die 2009 gegründete Quadriga ist Hetzels neuestes Projekt. Bis zu 26.000 Euro<br />
kostet die 18-monatige Ausbildung zum Kommunikationsmanager. Präsident<br />
der Hochschule ist Peter Voß. Der langjährige SWR-Intendant hat dafür einige<br />
Kritik einstecken müssen. Der Hamburger Journalistikprofessor Volker Lilienthal<br />
zeigte sich „überrascht“ ob dieses Engagements.<br />
Voß sieht darin keinen Widerspruch. Pressearbeit sei zwar ein wichtiger Teil des<br />
Berufes, spiele aber in den Studiengängen keine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt<br />
der Lehre stünden die Kommunikation mit Mitarbeitern oder Investoren.<br />
Für Lilienthal ist das schwer nachvollziehbar. „Falls Pressearbeit tatsächlich nachrangig<br />
ist, stellt sich die Frage, wieso dann überhaupt Journalisten engagiert wurden“,<br />
sagte Lilienthal der taz.<br />
Strategie und Spielregeln<br />
In der Vorlesung von Opel-Sprecherin Wegerhoff im Studiengang „Public Affairs<br />
& Leadership“ geht es ausschließlich um Pressearbeit. „Wochenlang war nur Be -<br />
triebs ratschef Klaus Franz in den Medien präsent, die Konzernspitze kam praktisch<br />
nicht vor“, sagt die 54 Jahre alte Wirtschaftshistorikerin. Der US-Konzern<br />
General Motors hatte Opel ungebremst an die Wand gefahren. Die finanzielle<br />
Lage war prekär, ein Verkauf gescheitert und Opel-Chef Nick Reilly hatte den<br />
Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen angekündigt. „Wir waren für viele Redakteure<br />
nicht mehr als eine billige Headline“, sagt Wegerhoff. Dann präsentiert die<br />
Managerin ihre Gegenstrategie, die sie „Entgiftung“ nennt.<br />
Quadriga-Präsident Voß spricht lieber von ethischen Standards wie dem Transparenzgebot,<br />
das an der Einrichtung gelehrt werde. Dafür, so Voß, stehen die im<br />
Kuratorium vertretenen Journalisten. Die reagieren auf Nachfragen zu ihrem<br />
Engagement jedoch meist einsilbig.<br />
137
Christoph Lanz, Fernsehdirektor der Deutschen Welle, erklärt, er könne an der<br />
Quadriga seine „journalistischen Erfahrungen sehr gut einbringen“. Und Thomas<br />
Schmid, Herausgeber der Welt-Gruppe, sagte der taz: „Ich habe diese Aufgabe<br />
angenommen, da ich es nicht für problematisch, sondern für sehr sinnvoll halte,<br />
wenn angehende PR-Leute lernen, was professionellen Journalismus ausmacht<br />
und was dessen Spielregeln sind.“<br />
Namen als Schmuck<br />
Verena Wiedemann ist keine Journalistin, war aber bis zum 30. Juni General sekretärin<br />
der ARD. Einen Interessenkonflikt zwischen ihrer Funktion als leitende An -<br />
ge stellte eines öffentlich-rechtlichen Senders und dem Einsatz für eine private<br />
PR-Hochschule sieht sie nicht. Sie habe zu keiner Zeit redaktionelle Verantwortung<br />
für Programme der ARD getragen, begründet das die Medienrechtlerin gegenüber<br />
der taz. Den Vorwurf, dass sich die Quadriga mit dem Namen einer ARD-Generalsekretärin<br />
nur schmücken will, um Seriosität zu suggerieren, kann Wiedemann<br />
nicht nachvollziehen.<br />
Einige Journalisten wollen über ihr Engagement an der Quadriga gar nicht sprechen.<br />
Sven Gösmann, Chefredakteur der Rheinischen Post, teilt mit, dass sich Voß zu<br />
dieser Problematik „gern und erschöpfend“ äußere und er dem „wenig bis nichts<br />
hinzuzufügen“ hat. MDR-Chefredakteur Wolfgang Kenntemich erklärt, er sei derzeit<br />
nicht an der Quadriga engagiert und werde deshalb keine Fragen beantworten.<br />
Auch Peter Limbourg, langjähriger Nachrichtenchef von Sat.1 und N24, ist nach<br />
eigener Aussage nicht mehr im Kuratorium vertreten. Zu den Gründen möchte er<br />
sich nicht äußern.<br />
Einsilbige Journalisten<br />
Die Quadriga wirbt auf ihrer Internetseite allerdings bis heute mit Kenntemich<br />
und Limbourg. Laut Rene Seidenglanz, Vizepräsident der Quadriga, sind beide<br />
Journalisten auch weiter an der Hochschule engagiert. Für eine Nachfrage der<br />
taz zu diesem Widerspruch waren Kenntemich und Limbourg nicht zu erreichen.<br />
Der Chefredakteur der Financial Times Deutschland, Steffen Klusmann, reagierte<br />
auf Anfragen erst gar nicht.<br />
138
Dafür erläutert Präsident Voß seine Sicht auf das Verhältnis von Journalismus<br />
und PR. „Kenntnis und Verständnis der anderen Seite können von Vorteil sein“,<br />
so Voß. Denn nur so könnten beide Seiten ihre Anforderungen artikulieren. Für<br />
den Medienexperten Lilienthal profitiert von diesem Austausch einzig die PR-<br />
Branche, „weil sie besser versteht, wie Journalisten ticken“. „Namhafte Journalisten,<br />
die ihren Erfahrungsschatz weitergeben wollen, erwarte ich in der Journalistenausbildung,<br />
da werden sie bitter benötigt.“<br />
Dass Offenheit nicht zwangsläufig zum Handwerkszeug von Pressesprechern<br />
und PR-Profis gehört, demonstriert Opel-Frau Wegerhoff. „Regelmäßig haben<br />
wir ausgewählte Journalisten zu diskreten Treffen eingeladen“, erklärt sie den<br />
Studierenden. Vertreter überregionaler Zeitungen wurden zu exklusiven Runden<br />
mit Opel-Chef Reilly mit Oldtimern am Bahnhof abgeholt. „Männer mögen das“,<br />
weiß Wegerhoff. „Diese Gespräche waren streng vertraulich – daran haben sich<br />
auch alle gehalten.“<br />
Die Medien würden nun deutlich positiver berichten als vor anderthalb Jahren.<br />
Nur ein Student ist von der Markenpolitur noch nicht restlos überzeugt. „Von<br />
einem Imagewechsel habe ich nichts mitbekommen“, sagt der junge Mann.<br />
Doch davon lässt sich Wegerhoff nicht provozieren. Lächelnd hält sie die aktuelle<br />
Ausgabe einer großen Tageszeitung hoch. Darin: ein Kommentar zu Opel.<br />
„Besser“, so die PR-Expertin, „hätte ich das auch nicht schreiben können“.<br />
Der Beitrag ist Teil einer Recherche über „PR und Medien“. Mit einer Recherche-Skizze zu diesem<br />
Thema gehörte der Autor 2010 zu den Gewinnern beim jährlich ausgeschriebenen <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong><br />
<strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus. Die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung hat die Recherche mit einem Stipendium<br />
gefördert; das „netzwerk recherche“ hat sie inhaltlich begleitet.<br />
139
Gordon Repinski<br />
Gordon Repinski<br />
geboren 1977 in Hannover<br />
Werdegang:<br />
Seit 2010 Parlamentskorrespondent der „taz“ in Berlin, zuständig für SPD,<br />
Verteidigungs- und Entwicklungspolitik<br />
2008/09 Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen Journalistenschule München<br />
2004-2007 Arbeit als Berater für Entwicklungsprojekte in Afrika und Asien,<br />
Traineeprogramm am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn<br />
1998-2003 Studium der Volkswirtschaftslehre in Hamburg, Berlin, Paris und<br />
Kopenhagen<br />
Veröffentlichungen:<br />
Poverty and poverty reduction strategies in the East African Community (EAC), 2005,<br />
Co-Autor H.-M. Stahl, 153 Seiten<br />
Corporate social and environmental responsibilityin India – Assessing the UN Global<br />
Compact’s Role, 2007, mit T. Chahoud / J. Emmerling / D. Kolb / I. Kubina / C. Schläger<br />
140
Und es ward nicht<br />
ATOM Es ist eine wunderbare Vision: Wer das Prinzip der Sonne kopiert, erhält<br />
un endlich viel Energie. Die EU pumpt Milliarden in ein Projekt, das diese Kernfusion<br />
schaffen soll. Erfolge? Bisher kaum. Nun soll ein niederländischer Ingenieur das<br />
Vorhaben retten.<br />
An einem heißen Apriltag steht Remmelt Haange an seiner Baugrube in Südfrankreich<br />
und schwitzt. Die Sonne knallt ihm auf die Stirn, die Wangen leuchten, das<br />
Gesicht glüht. Aber das stört ihn nicht. Haange mag die Sonne. Er setzt auf sie.<br />
Manche sagen: Was die Sonne angeht, ist Haange der beste Mann der Welt. Er<br />
soll sie hierherholen, nach Cadarache in Südfrankreich.<br />
„Da drüben soll die Sonne stehen“, sagt Remmelt Haange, 66 Jahre. Er zeigt zu<br />
einem Ort am Ende der Baustelle. Ein Erdloch, so groß, dass man zwei Modelle<br />
des Airbus A 380 darin versenken könnte, des größten Passagierflugzeugs der<br />
Welt. Einige Kräne ragen in den blauen Himmel. Hier hat Haanges Mission vor<br />
wenigen Monaten begonnen. Es kommt jetzt auf ihn an.<br />
Für die Baugrube in Cadarache ist der Niederländer die letzte Hoffnung. Er soll nicht<br />
weniger tun, als die Prozesse der Sonne mit einem Kernfusionsexperiment zu imitieren.<br />
In einem Reaktorgebäude könnte dann 100 Millionen Grad heißes Plasma um<br />
eine Magnetspule wabern, die im Innern minus 269 Grad kalt ist. Atomkerne sollen<br />
verschmelzen und unendlich viel Energie fast ohne Risiko und Rückstände bringen.<br />
Es ist die Vision von einer wundervollen Zukunft, und es gäbe nur einen Weg dorthin.<br />
Er führt über Haanges Baugrube, über den „Internationalen Thermonuklearen<br />
Experimentellen Reaktor“. Den Iter.<br />
Ronald Reagan und Michail Gorbatschow haben dieses gigantische Gemeinschaftsprojekt<br />
1985 beschlossen. Es sollte den Kalten Krieg genauso überwinden wie<br />
alle Energiesorgen der Menschheit. Auch heute, auch nach der Katastrophe von<br />
Fukushima klingt Iter für die Forscher noch nach Zukunft. Er soll die bessere<br />
Atomtechnik schaffen.<br />
141
Der Iter ist eines der größten Forschungsprojekte weltweit geworden. Mit 45 Pro zent<br />
zahlt die EU den größten Anteil der Mittel, daneben beteiligen sich die USA, Russland,<br />
Japan, China, Indien und Südkorea. Über eigene Logistikagenturen werden<br />
weltweit die Aufträge abgewickelt. Neue Straßen müssen gebaut, komplizierte<br />
Bau teile erfunden werden. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung zahlt mit<br />
ihren Steuern das Riesenprojekt. Alles am Iter ist gigantisch.<br />
Außer den Erfolgen. Den Fortschritten. Den Perspektiven.<br />
Bisher ist in Südfrankreich nur präzise planierter Lehmboden auf der Fläche<br />
eines ganzen Dorfes zu besichtigen. Von der Sonne auf Erden zeugt höchstens<br />
die Rö tung in Remmelt Haanges Gesicht.<br />
Das Projekt wurde immer wieder verschoben. Zuletzt verdreifachten sich die<br />
er warteten Kosten auf 16 Milliarden Euro. Das Management wurde fast vollständig<br />
ausgetauscht. Der Erfolg ist ungewiss, die Finanzierung aus dem aktuellen EU-Haushalt<br />
nicht geklärt. Selbst ehemalige Befürworter wenden sich ab. „Wir wollen zu -<br />
rück zu den alten Zahlen“, sagt der Europapolitiker Jorgo Chatzimarkakis von<br />
der forschungsfreundlichen FDP. Es klingt fast verzweifelt.<br />
Niemand weiß genau, ob Menschen die Kernfusion jemals dauerhaft gelingen<br />
kann. Die wichtigsten technischen Fragen sind offen. Und dass die Fusion die<br />
Energie- und Klimaprobleme der näheren Zukunft lösen könnte, behaupten<br />
nicht einmal ihre größten Fürsprecher. Im Energiekonzept der Bundesregierung<br />
bis 2050 steht kein Wort von der Kernfusion. Sie sei „eine langfristige Option für<br />
die Energieversorgung“, sagt Forschungsstaatssekretär Georg Schütte. Und mit<br />
der sei vor 2050 „nicht zu rechnen“.<br />
Aber die Welt nach Fukushima sucht einen Weg aus dem globalen Energie -<br />
dilemma. Eine Lösung muss bis Mitte des Jahrhunderts gefunden sein. Nicht<br />
irgendwann.<br />
142
Haange ist seit dem 17. Januar der Technische Direktor des Iter. Er steht wie<br />
niemand sonst für die Hoffnungen, Probleme und internationalen Verflechtungen<br />
der Kernfusion. Sein Leben lang beschäftigt er sich mit Reaktoren und deren<br />
Innenleben. Er hat außer in Frankreich schon in Japan, Großbritannien und<br />
Deutschland gearbeitet. Wo immer ein wichtiges Kernfusionsprojekt läuft,<br />
steht Haange an der Baustelle und guckt, was klappt.<br />
In nüchternem Ton vergleicht er die Kernfusion mit dem Traum vom Automobil –<br />
„daran hat ja auch keiner geglaubt“ – oder mit der Raumfahrt. Er weiß, dass seine<br />
Gegner in der Politik das Projekt beenden wollen, bevor die Schwertransporte<br />
auf das Gelände in Cadarache rollen.<br />
Haange hat in Greifswald den deutschen Ableger des Kernfusionsprojekts aus<br />
dem Chaos geführt. Jetzt soll er den Fusionierern der Welt ihr Projekt retten.<br />
Zu all den Problemen, die es ohnehin schon gibt, kommt nun auch noch „dieses<br />
Desaster da in Japan“, muss Haange feststellen. Alles werde in einen Topf ge worfen,<br />
„Kernfusion“ klingt für Laien plötzlich gefährlich. Das bedroht die Baustelle<br />
zusätzlich. „Eine heikle Lage“, sagt Haange.<br />
Der Traum von der Kernfusion beginnt, als Remmelt Haange 8 Jahre alt ist, Schüler<br />
in einem kleinen Ort an einem niederländischen Naturpark. Am 1. November 1952<br />
um 7.15 Uhr explodiert auf der Pazifikinsel Elugelab eine Wasserstoffbombe. „Ivy<br />
Mike“ ist die stärkste Kernwaffe der Welt, ihre Wucht 800-mal so groß wie die<br />
der Atombombe von Hiroshima. Kilometerweit fegt die Detonation alles davon.<br />
Die Insel Elugelab verdampft, die Forscher jubeln.<br />
„Ivy Mike“ explodiert und liefert die Idee<br />
Während Remmelt die Grundrechenarten lernt, denken in den Forschungszentren<br />
der Welt die Wissenschaftler darüber nach, wie sich so viel Energie nutzen lässt.<br />
Wie es theoretisch funktioniert, wissen sie: Die Wasserstoffisotope Tritium und<br />
143
Deuterium müssen zuerst auf 100 Millionen Grad Celsius erhitzt werden und so<br />
den sogenannten vierten Zustand der Materie erreichen. Die Isotope sind dann<br />
nicht fest, flüssig oder gasförmig – sondern ionisiert. In diesem Zustand bildet<br />
sich ein Plasma, in dem die Teilchen durcheinanderfliegen; sie kollidieren miteinander<br />
und verschmelzen zu Helium.<br />
Das Ergebnis: Energie im Überfluss. Ein Gramm Wasserstoff entspricht der Leistung<br />
von elf Tonnen Kohle. Es war das Märchen von den unendlichen Ressourcen.<br />
Es fühlte sich an, als wäre man auf Ozeane voller Öl gestoßen. Der Durchbruch<br />
schien greifbar. Und das alles ohne die Gefahr eines GAUs. Bei einer Störung<br />
würde sich der Reaktor sofort abkühlen.<br />
In den Sechzigern geht Remmelt Haange zum Studieren nach Deutschland,<br />
Maschinenbau an der RWTH Aachen. Nach dem Studium zieht er weiter nach<br />
England. Sein erster Job in einem Hochtemperaturreaktor. „Damals hieß es: Es<br />
sind noch 25 Jahre“, erinnert er sich. „Hurraideen passten in die Zeit“, sagt die<br />
Vorsitzende der Grünenfraktion im Europäischen Parlament, Rebecca Harms.<br />
Über Jahre feuerten die Forscher Unmengen Energie in den Ofen, um die 100 Millionen<br />
Grad Betriebstemperatur zu erreichen. Heraus kam nichts. Kaum hatte man<br />
die Teilchenverschmelzung einmal geschafft, fiel sie wieder in sich zusammen<br />
wie ein Ballon, aus dem man die Luft lässt. Denn das widerspenstige Plasma<br />
verflüchtigt sich in Sekundenbruchteilen, berührt die Wände des Reaktors –<br />
und kühlt sich ab.<br />
Auch riesige Magnetspulen, die in den Reaktor hineingebastelt sind, können<br />
das Plasma nicht kontrollieren. Der Reaktor Tokamak, der auch im Iter verwendet<br />
werden soll, muss andauernd weitergeheizt werden. Als wollte man einen<br />
nassen Baum mit dem Feuerzeug anzünden. 1991, Haange arbeitete jetzt für<br />
das Projekt Jet, den Vorgänger des Iter, gelang der Prozess für zwei Sekunden<br />
im britischen Culham. Dann war der Sonnenofen wieder aus.<br />
144
Damals glaubten Physiker, es werde drei Jahrzehnte dauern, bis man endlich Strom<br />
erzeugen könne. Nichts ist in all den Jahren der Forschung so stabil wie die Zeit,<br />
die angeblich jeweils noch bis zur kommerziellen Nutzung der Zauberenergie<br />
gebraucht wird. Es sind immer drei bis vier Jahrzehnte. Dafür ist ein zynisches<br />
geflügeltes Wort entstanden: die Fusionskonstante.<br />
Immer größer – der Eisbär gilt als Vorbild<br />
Die technischen Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass im Laufe der Jahre<br />
immer neue Materialien und Verfahren gebraucht wurden. Die neuen Stoffe<br />
brachten neue Probleme. Bis heute ist kein Material für eine Reaktorinnenwand<br />
gefunden, die 100 Millionen Grad erträgt, ohne zu schwächeln. Es gibt auch<br />
noch keine Magnetspule, die bei mehr als minus 269 Grad funktioniert.<br />
Ideen haben die Forscher immer gleich mitgeliefert. Um das Problem mit dem<br />
widerspenstige Plasma zu lösen, werde nur ein größerer Reaktor benötigt, sagten<br />
sie stets. Darin würde sich die Ionensuppe nicht so schnell abkühlen. Fusionierer<br />
wie Haange erzählen gern die Geschichte vom Eisbären. Der könne am Nordpol<br />
auch nur überleben, weil er dank seiner Größe nicht so viel Wärme abgebe.<br />
Am Ende bedeutet das: Wenn so ein Gerät in 60 Jahren erst zwei Sekunden lang<br />
funktioniert hat, findet sich immer noch eine Schraube, eine Spule oder Stütze,<br />
die sich verbessern lässt. Und jede dieser Ideen wird ein Unikat und kostet sehr<br />
viel Geld. Wenn man das Geld anderswo einsparen will, kostet das Zeit. Und<br />
diese Zeit kostet dann wieder Geld.<br />
So wurde der Iter im Laufe der Jahre immer teurer, der Start immer weiter verscho<br />
ben. 1986, als Reagan und Gorbatschow das Projekt planten, wollten sie<br />
in den neunziger Jahren fertig sein. Mittlerweile muss man im Kalender für den<br />
Betriebs start bis 2026 blättern.<br />
Erreicht wäre dann noch nicht viel. Denn nach dem Iter müsste ein Nachfolgemodell,<br />
ein Demonstrationskraftwerk, gebaut werden. Erst danach könnte ein Kraftwerk<br />
folgen, das ans Netz geht. Ein einziges würde noch einmal so viel kosten wie der Iter.<br />
145
Doch allein für den Iter steigen die Kosten mit fast jeder Projektrevision. Waren<br />
vor zehn Jahren in den Planungen noch 5 Milliarden Euro für den Bau angesetzt,<br />
sind es nun 16 Milliarden Euro, mehr als dreimal so viel. Die Schätzung für Euro -<br />
pas Anteil hat sich in der Zeit auf 7,2 Milliarden Euro erhöht. „Das ist eine gigantische<br />
Geldvernichtung“, sagt der Pariser Energiefachmann Mycle Schneider,<br />
„ein Beschäftigungsprogramm für arbeitslose Physiker.“<br />
Erst 2010 hatten die Europäer von den Kostensteigerungen genug und begrenzten<br />
den eigenen Anteil auf 6,6 Milliarden Euro.<br />
Am Tag, als Remmelt Haange sich an der Baugrube in Cadarache einen Sonnenbrand<br />
holt, beraten die Beamten der EU-Kommission gerade, wie die Mehrkosten<br />
des Iter aufgefangen werden können. In dem provisorischen Verwaltungscontainer<br />
auf dem Gelände hetzt Haange von Krisenrunde zu Krisenrunde, zwischendurch<br />
klingelt das Telefon. Es sind unangenehme Gespräche. Das Verständnis für die<br />
dauernden Kostensteigerungen in Cadarache – für 2012 und 2013 allein sind es<br />
1,3 Milliarden Euro – sinkt allmählich. Haange meint wohl auch das, wenn er<br />
von einer „heiklen Lage“ spricht.<br />
Die EU-Kommission, das geht aus internen Entwürfen hervor, will nicht genutzte<br />
Landwirtschaftsmittel verwenden und mit anderen Forschungsmitteln die übrigen<br />
Löcher im Budget stopfen. Welche, darüber gibt die Kommission keine Auskunft.<br />
„Der Iter kannibalisiert andere Forschungsvorhaben“, sagt die Grüne Rebecca<br />
Harms.<br />
Zum Beispiel die regenerativen Energien. Jährlich werden etwa 130 Millionen Euro<br />
in die deutschen Fusionszentren gesteckt – ein Drittel des Energieforschungsetats.<br />
In Europa fließen nach offiziellen Angaben der EU-Kommission allein in den Jahren<br />
2012 und 2013 zwei Milliarden Euro in die Kernfusion. In die Erforschung der<br />
regenerativen Energien steckt die EU auch etwas mehr als zwei Milliarden – in<br />
sieben Jahren.<br />
146
1.700 Kilometer nordöstlich von Cadarache, im Gewerbegebiet der Stadt<br />
Greifswald, lässt Thomas Klinger seinen Gefühlen freien Lauf. Der Turbulenz -<br />
plasmaphysiker steht mit gehärteten Spezialschuhen und Schutzhelm in der<br />
Produktionshalle des Max-Planck-Instituts vor seinem unfertigen Fusionsex<br />
periment. Ein Schwerlastkran fährt mit seinen gelben Greifarmen an der<br />
Decke entlang.<br />
Klinger ist der Chef hier in Greifswald, vor seinen Augen vollzieht sich ein entscheidender<br />
Montageschritt. Alles sieht aus, als würde gerade ein U-Boot verschraubt.<br />
Doch bei den vermeintlichen Bullaugen handelt es sich um Einlasslöcher<br />
für empfindliche Messgeräte. Hier entsteht der Vorzeigereaktor der deutschen<br />
Fusionscommunity, der Wendelstein 7-X.<br />
Wie eine Niederkunft“, sagt der Plasmaphysiker<br />
Ein Stück gebogene Metallschale, groß wie ein Hausdach, wird mit einem Spezialkran<br />
auf den Wendelstein 7-X hinabgelassen. Darauf sitzen zwei Ingenieure und<br />
lassen sich mit verladen. Nur von oben können sie sehen, ob die Schale exakt<br />
auf den Testreaktor passt. Der Kran surrt. Klinger schaut zu. Er ist immer dabei,<br />
wenn so etwas passiert.<br />
Mit seinen Kupferadern und Schräubchen habe der Wendelstein 7-X etwas von<br />
Gunther von Hagens’ Körperwelten. „Faszinierend“, sagt Klinger. Während die<br />
Schale sinkt, wird er euphorisch. „Es ist wie eine Niederkunft“, sagt er, die vielen<br />
Magnetspulen sind wie Kinder: „Jede ist anders.“<br />
Viele Jahre hat Remmelt Haange den deutschen Ableger des Fusionsprojekts mit<br />
Klinger geleitet. Jetzt hat Haange Klinger verlassen, weil er in Cadarache dringender<br />
gebraucht wird. Klinger nennt Haange den Red Adair der Fusionstechnologie.<br />
Adair war ein Feuerwehrmann, spezialisiert auf brennende Ölfelder.<br />
Der Wendelstein 7-X ist so etwas wie das Gegenprojekt zum Iter geworden. Sein<br />
Reaktortyp Stellarator hat gegenüber dem in Frankreich geplanten Tokamak-Mo dell<br />
147
den Vorteil, dass er durchgängig laufen soll und nicht immer wieder neu gezündet<br />
werden müsste. Der Nachteil: Der Stellarator hat zwanzig Jahre Forschungsrückstand.<br />
Deswegen wird er wohl nur in Greifswald gebaut – danach nirgends mehr.<br />
Trotzdem kostet er rund eine halbe Milliarde Euro, überwiegend vom Bund be zahlt.<br />
Angela Merkel nennt den Wendelstein 7-X „ein Zukunftsprojekt“.<br />
Wer sich nun fragt, warum es dieses Projekt auch noch geben muss, landet wieder<br />
beim Iter. Die meisten Länder haben sich nur unter der Bedingung daran beteiligt,<br />
dass die eigenen Forschungsvorhaben profitieren. Frankreich musste in Europa<br />
deshalb am meisten Überzeugungsarbeit leisten. Der Iter ist nicht nur ein großer<br />
Energietraum, sondern auch ein milliardenschweres Konjunkturprogramm für die<br />
Region Provence. In einer französischen Karikatur von 2007 jubelte der damalige<br />
Präsident Jacques Chirac nach dem Zuschlag für Cadarache als Standort seinem<br />
Premier Dominique de Villepin zu. „Wir haben das Ding – nun sagen Sie mir,<br />
was es bringt, Villepin!“<br />
Die Antwort findet sich in den Statistiken, die Frankreich regelmäßig herausgibt.<br />
Sie zeigen, wie viel von den internationalen Iter-Geldern im eigenen Land landen.<br />
Im Moment sind es bei einem Projekt, für das die halbe Weltbevölkerung zahlt,<br />
bemerkenswerte 46 Prozent. Deutschlands Unternehmen dagegen verlieren<br />
langsam die Lust an den Ausschreibungen, ihr Anteil an den vergebenen Aufträgen<br />
ist derzeit zwei Prozent. Wirtschaftsvertreter schimpfen auf die Verfahren, sie<br />
seien „vordemokratisch“.<br />
Deutschland wurde damit geködert, dass die EU den Greifswalder Wendelstein 7-X<br />
zu einem Drittel mitfinanziert. Spanien bekam die Behörde „Fusion for Energy“,<br />
China Unterstützung für ein Hybrid-Kraftwerk, in dem Atome erst fusioniert und<br />
dann gespalten werden. Die USA schließlich erhalten Förderung für ihre Laser -<br />
fusionstechnik, mit der sie militärische Tests imitieren, weil im Pazifik keine<br />
Bombentests mehr erlaubt sind.<br />
Das Ergebnis: Gigantische Mehrausgaben durch Ausgleichsgeschäfte, die noch<br />
nicht einmal im Iter-Budget auftauchen. Die Steuerzahler müssen dafür trotzdem<br />
aufkommen, sie merken es nur nicht.<br />
148
Dass in diesem Gemeinschaftsprojekt alle ganz besonders auf sich selbst achten,<br />
hat noch mehr kuriose Folgen: Per Vertrag wurde festgelegt, dass alle Länder<br />
befähigt werden, alle Elemente des Reaktors bauen zu können – unabhängig<br />
von der technischen Vorbildung der Fachleute.<br />
Wie soll Haange das bloß alles löschen?<br />
So werden die 18 Toroidalfeldspulen in sechs verschie denen Ländern gefertigt.<br />
Die riesenhaften Spulen, die eines Tages aussehen wie haushohe, kupferfarbene<br />
Torbögen, sollen einmal das Plasma im Reaktorkern einschließen. Ohne sie<br />
läuft nichts.<br />
Wenn die Spulen später, aus aller Welt kommend, in Südfrankreich zusammengeschraubt<br />
werden, kann schon eine Millimeterabweichung ausreichen, und<br />
der gesamte Reaktor funktioniert schlechter oder gar nicht mehr. Doch Toroidalfeldspule<br />
Nummer eins wird in Japan gebaut, Nummer zwei in Europa, Nummer<br />
drei in den USA. Das sei sicher nicht optimal, urteilen Fachleute.<br />
Man fragt sich, wie Remmelt Haange das alles löschen soll – es brennt so viel.<br />
Nur nicht seine Sonne.<br />
EU-Staaten stehen vor dem Bankrott, es müssen Rettungsschirme gespannt,<br />
Staatshaushalte gerettet werden. Und trotzdem fließen weiter Milliarden in ein<br />
Projekt, das bisher nicht viel mehr als eine Idee ist. Rechtfertigt die Hoffnung<br />
von der Kernfusion all diese Investitionen, die Verstrickungen und Absurditäten?<br />
Oder muss man sich irgendwann vom Iter verabschieden?<br />
Als der Streit über die fehlenden Haushaltsmittel im vergangenen Jahr eskalierte,<br />
ließ die EU-Kommission die Folgen eines Ausstiegs errechnen. Das Ergebnis:<br />
Allein durch Verträge mit Baufirmen und dem eigenen Personal wären für die EU<br />
im Fall eines Abbruchs knapp 4,5 Milliarden fällig.<br />
Das erinnert an das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Als die Proteste eskalierten,<br />
präsentierte die Deutsche Bahn ein Gutachten. Der Ausstieg koste 1,5 Milliarden<br />
149
Euro. In Stuttgart wurde so eine besondere Atmosphäre geschaffen, eine Atmos -<br />
phäre der Ausweglosigkeit.<br />
So argumentiert auch das Papier der EU-Kommission: Diese Schätzung schließe<br />
„mög liche Schadenersatzklagen Dritter ein“ nicht ein, schreiben die Autoren,<br />
ge nau so wenig das bereits ausgegebene Geld von „mehr als einer weiteren<br />
Milliarde Euro“.<br />
Die Zahl 4,5 Milliarden wird von den Fraktionen im Europäischen Parlament mittlerweile<br />
als unverrückbarer Fakt hingenommen. Von einem Gegengutachten ist<br />
nichts bekannt.<br />
Selbst wenn die Bundesregierung die immensen Ausstiegskosten aber hinnehmen<br />
wollte: Es wäre ungeheuer kompliziert. Deutschland beteiligt sich nicht als Land<br />
an der Finanzierung des Iter, sondern über Beiträge an der EU-Unterorganisation<br />
Euratom. Damit Euratom aus dem Projekt aussteigt, müsste Deutschland Länder<br />
wie Frankreich und Spanien überzeugen. „Wenn das Ding in den USA stehen würde,<br />
könnten wir sagen, wir steigen aus“, klagt ein Insider. „Die Internationalisierung<br />
ist der letzte Trick der Fusionierer“, stellt Energieexperte Mycle Schneider fest.<br />
Kein EU-Land will der Spielverderber sein<br />
Der Spielverderber zu sein traut sich in der Staatengemeinschaften niemand.<br />
Dann lieber weiter Geld ausgeben.<br />
Der Iter wirkt wie ein Monstertruck, der ohne Bremsen einen Berg hinunterrauscht.<br />
Aussteigen unmöglich.<br />
Ans Steuer dieses Trucks haben sie jetzt Remmelt Haange gesetzt, der versuchen<br />
muss, doch noch eine Kurve zu kriegen.<br />
Während draußen die Planierraupen über die Erde rollen, diskutiert er dann in<br />
seinem Verwaltungscontainer mit den Ingenieuren, die wieder einen Plan um werfen<br />
wollen. „Die haben jeden Tag eine neue Idee“, sagt er. Er muss sie ihnen ausreden.<br />
150
Alternativlos, sagt Angela Merkel, wenn sie etwas durchsetzen will. Basta, sagte<br />
Gerhard Schröder. Der Iter wurde von Anfang an als alternativloses Basta-Vorhaben<br />
vorgestellt.<br />
„Den jungen Politikern wurde von den älteren klargemacht, dass es sich um ein<br />
langfristiges Projekt handle, an dem nichts geändert werden kann“, erinnert sich<br />
der SPD-Politiker René Röspel an seine ersten Sitzungen im Forschungsausschuss<br />
im Jahr 1998. Er wunderte sich damals über die astronomischen Summen bei der<br />
Kernfusion. Die Details der einzelnen Projekte zu verstehen, würde einen Abgeordneten<br />
und seine Mitarbeiter allerdings viele Nächte kosten.<br />
Und wenn sich bei einem Projekt kaum jemand auskennt, es kaum Öffentlichkeit<br />
gibt und ein möglicher Ausstieg extrem teuer scheint, dann haben es die Lobbyisten<br />
leicht. Alle paar Wochen treffen sich die Vertreter der interessierten Wirtschaftskreise,<br />
dem Iter Industrie Forum, zusammen mit den Fusionsforschern und<br />
den Spitzenbeamten im Bonner Bundesministerium und besprechen die Lage.<br />
Dann werden zwischen Politik, Forschung und Wirtschaft in vertrauter Atmosphäre<br />
die aktuellen Fragen geklärt. Es ist ein geschlossener Kreis.<br />
Während sie hinter verschlossenen Türen diskutieren, muss Remmelt Haange<br />
jetzt den Eindruck vermitteln, als könnte er die Sache in den Griff bekommen.<br />
In diesem Jahr muss der Haushalt durchs Parlament, vor allem in diesem einen<br />
Jahr müssen die Zahlen stehen. Sind die Mauern des Reaktors erst einmal hochgezogen,<br />
wird ein Abbruch noch unwahrscheinlicher.<br />
Wenn man Haange fragt, was er machen würde, sollte der Iter doch teurer werden,<br />
sagt er deshalb: „Es gibt jetzt die Deckelung der Kosten, also halten wir sie ein.<br />
Basta!“ Kann Grundlagenforschung mit Deckelung funktionieren? „Nein“, sagt<br />
Haange. Aber nun muss sie eben. Auch wenn es gar nicht geht.<br />
Da steht Remmelt Haange also an der Baugrube in Südfrankreich. Die Sonne auf<br />
dem Kopf, dem grauweißen Haarkranz, auf dem schwarzen Anzug.<br />
151
Hat er manchmal Zweifel, dass der große Traum Wirklichkeit wird?<br />
„Nein, gar nicht“, sagt Haange.<br />
„Wissen Sie, Fusion ist doch naturgegeben. Es gibt sie milliardenmal, milliardenmal“,<br />
wiederholt er. „Überall, auf der Sonne, auf jedem Stern gibt es sie.“<br />
Er dreht sich um, er muss jetzt weg. Sein Büro hat angerufen. Es gibt wieder Ärger.<br />
Gordon Repinski, 33, ist Parlamentskorrespondent der taz. Seine Recherche<br />
zum Iter hat die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung gefördert: Mit einer Recherche-Skizze<br />
gehörte der Autor 2010 zu den Gewinnern beim jährlich ausgeschriebenen<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus“. Das Projekt wurde vom<br />
„netzwerk recherche“ unterstützt und begleitet.<br />
152
1 2<br />
3 4<br />
1 Jupp Legrand, OBS-Geschäftsführer, bei<br />
der Begrüßung zur „Medienpolitischen<br />
Tagung der OBS“ 2 Anja Reschke, NDR:<br />
Moderationen, die ins „Schwarze“ treffen<br />
3 Jörg Wagner, rbb 4 Brigitte Baetz, DLF<br />
5 Ulrike Simon, freie Journalistin und<br />
Impulsgeber Hans-Jürgen Jakobs, SZ<br />
6 Das Publikum verfolgt interessiert die<br />
Podiumsdiskussion<br />
(im Großbild: Christian Meier, meedia)<br />
5<br />
6<br />
153
MEDIENPOLITISCHE TAGUNG<br />
DER OTTO BRENNER STIFTUNG
Jupp Legrand<br />
Hans-Jürgen Jakobs
Jupp Legrand<br />
Geschäftsführer der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Eröffnung der Medienpolitischen Tagung<br />
der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Verehrte Gäste!<br />
Im Titel der Veranstaltung fragen wir, ob Medienkritiker einsame Rufer sind oder<br />
zahnlose Tiger? Andere sehen in ihnen „zentrale Randpersonen“ im Medien geschäft.<br />
Manche sprechen vom Elend der Medienkritik. Zuweilen wird den Medienkritikern<br />
auch klägliches Versagen bescheinigt.<br />
Ich möchte Ihnen zur Einstimmung auf die Tagung 1 drei kleine Geschichten erzählen.<br />
Geschichten, die alle um die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung kreisen. Die Geschichten<br />
geben keine Antwort auf das Fragezeichen der Veranstaltung. Sie zeigen sicher<br />
auch nur Ausschnitte unseres Thema. Aber sie können einen ersten Eindruck von<br />
dem geben, was zu diskutieren ist.<br />
Die erste Geschichte geht so!<br />
Anfang April erschien auf der Medienseite der Süddeutschen Zeitung eine<br />
Rezension der OBS-Studie über die BILD-Zeitung. Hans Leyendecker, der Autor<br />
1 <strong>2011</strong> verband die OBS ihre Verleihung der „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong>e für kritischen Journalismus“ erstmals mit einer<br />
Medienpolitischen Tagung. Ihr Titel: „Einsame Rufer oder zahnlose Tiger? – Vom Wirken und Versagen der Medienkritik“.<br />
Hier dokumentieren wir, gekürzt und für das „Best of“ bearbeitet, die Eröffnung der Tagung.<br />
156
des SZ-Beitrags, ordnete die Studie in die lange Reihe der BILD-Kritik ein, lobte<br />
neues am Forschungsansatz, wägte Stärken und Schwächen ab und kam insgesamt<br />
zu einer ersten, recht fairen Deutung – so zumindest die Einschätzung von<br />
Autoren und Stiftung. So weit, so gut – das dachten auch wir.<br />
Kaum war die SZ an diesem Tag erschienen, gab es auch schon Meldungen,<br />
Berichte und weitere Beiträge zu der BILD-Studie. Das „Verblüffende“: Die Studie<br />
war bis dahin noch garnicht erschienen, unsere Webseite www.bild-studie.de<br />
mit weiteren Infos noch nicht frei geschaltet. Wir rieben uns erstaunt die Augen<br />
und wollten es erst gar nicht glauben! Nur auf der Basis der ersten SZ-Deutung<br />
tobten sich Teile der Medienkritik aus. Nur Varianten dessen, was in der SZ stand,<br />
wurde in den nächsten Tagen breit getreten.<br />
Es heißt ja gelegentlich, Medienkritiker schrieben nur für Medienkritiker. Mein<br />
Eindruck ist: Sie scheinen gelegentlich auch noch voneinander abzuschreiben!<br />
Gute Medienkritik sieht anders aus! Medienkritiker sollten mehr Ehrgeiz haben,<br />
als nur für Medienkritiker zu schreiben oder sich mit der Deutung eines Kollegen<br />
zu befassen.<br />
Meine zweite Geschichte geht so!<br />
Noch bevor die Johanna-Quandt-Stiftung offiziell die Träger des Herbert-Quandt-<br />
Medienpreises <strong>2011</strong> bekannt gab, verkündete bild-online bereits die Meldung:<br />
„BILD-Redakteure erhalten für Griechenland-Story Journalistenpreis!“ Wir rieben uns<br />
erneut und erstaunt die Augen und wollten es erst nicht glauben: BILD be kommt<br />
einen renommierten und hoch dotierten Journalistenpreis! Und das für eine Serie,<br />
die nicht nur in der OBS-Studie scharf kritisiert worden war, sondern die Michael<br />
Spreng, Ex-„Bild am Sonntag“-Chef, an der Grenze zur Volksverhetzung sah.<br />
Kaum war die Meldung im Umlauf, wurde die Entscheidung der Jury, in der drei<br />
profilierte Leute vom Fach sitzen, scharf kritisiert. Allerdings nur in Blogs und<br />
157
durch Mediendienste im Netz – aber dafür heftig, pointiert, sehr subjektiv, teilweise<br />
auch aggressiv, aber immer meinungsstark und überwiegend faktensicher.<br />
Für Printmedien, von Hörfunk und TV ganz zu schweigen, war das kein Thema.<br />
Erinnern wir uns, welche Wellen der Nannen-<strong>Preis</strong> für einen Spiegel-Reporter<br />
schlug, der NICHT im Keller und bei Seehofers Modelleisenbahn war – obwohl<br />
seine ausgezeichnete Reportage dies vermuten ließ. Tagelang war die Jury-Entscheidung<br />
bzw. die <strong>Preis</strong>-Rückgabe kontroverses Thema der Medienseiten und im<br />
Feuilleton. Die wirklich skandalöse Prämierung einer unsäglichen BILD-Berichterstattung<br />
und die ganzen Ungereimtheiten rund um den Quandt-<strong>Preis</strong> waren<br />
dagegen keiner großen Zeitung eine einzige Zeile wert. Hier hat sich – meines<br />
Erachtens – die Medienkritik in Deutschland einen Bärendienst erwiesen.<br />
Es gab – das füge ich gerne hinzu – eine Ausnahme. Nach der <strong>Preis</strong>verleihung<br />
erschien ein „Standpunkt“ in einem Fachorgan. Im MediumMagazin war zu<br />
lesen: „Wie nie zuvor hat der Herbert-Quandt-Medienpreis (...) journalistische<br />
und andere Gemüter bewegt, hat diese Auszeichnung irritiert und polarisiert.<br />
Auch mich hat diese Auszeichnung bewegt, ja geärgert. Sie sendet die falschen<br />
Signale. Sind Verallgemeinerungen guter Journalismus? Darf nationalistische<br />
Hetze auch noch prämiert werden?“<br />
Autor des Artikels ist Claus Döring – seit 11 Jahren Chefredakteur der „Börsen-<br />
Zeitung“. Der Chefredakteur der Börsen-Zeitung als Sperrspitze der Medienkritik<br />
in Deutschland? – Diese Deutung ist natürlich völlig übertrieben und überzogen.<br />
Aber dieser Vorgang wirft einige ernste Fragen auf: Erstens: Warum ist auf den<br />
Medienseiten der großen Zeitungen generell so wenig über andere Zeitungen zu<br />
lesen? Zweitens: Haben Regionalzeitungen Beißhemmungen, wenn es etwa um<br />
BILD geht, weil sie das Springer-Blatt längst als Leitmedium akzeptiert haben,<br />
als Story-Geber nutzen und Agenda-Setter ausschlachten? Drittens: Gibt es bei<br />
Print eine Schere im Kopf, wenn es um wirtschaftliche Verflechtungen geht oder<br />
um finanzstarke Familienclans und große Wirtschaftsunternehmen?<br />
158
Eines zeigt für mich diese Episode um den Quandt-Medienpreis in jedem Fall:<br />
Die Defizite der Medienkritik in den sogenannten traditionellen Medien schaffen<br />
Raum für neue Akteure, innovative Konzepte und andere Formen im Netz. Spannend<br />
ist die Frage, ob dies mittelfristig nur eine mehr oder weniger sinnvolle Ergänzung<br />
bleibt, oder ob sich die Medienkritik gänzlich in Blogs verflüchtigt. Dann droht<br />
– soviel dürfte sicher sein – die qualitative Medienbeobachtung in Print und TV<br />
endgültig zu einer nur noch geduldeten Randerscheinung zu verkommen!<br />
Ich komme zu meiner dritten Geschichte.<br />
Anfang Juli erschien, in Zusammenarbeit mit „netzwerk recherche“, bei der OBS eine<br />
Studie zum Informationsanteil von TV-Sendungen. Im Untertitel heißt die Studie<br />
„Interessant geht vor relevant!“ Wir sollten bald erkennen, wie treffend er ist! Denn<br />
kaum waren unsere Pressemitteilung zur Info-Studie von Fritz Wolf auf dem Markt<br />
und die ersten Exemplare der Studie ausgeliefert, reagierte auch schon das Erste!<br />
Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, gab eine Pressemitteilung<br />
heraus, die im Netz schnell und breit Aufmerksamkeit erzielte. Überschrift:<br />
„ARD weist Behauptungen der OBS-Studie entschieden zurück“! Das<br />
verblüffend Irritierende für Autor und Stiftung: Keine der Behauptungen, die hier<br />
von der ARD offiziell und entschieden zurück gewiesen wurden, wurde in der<br />
Studie aufgestellt. Wir rieben uns ein weiteres Mal erstaunt die Augen und<br />
beobachteten zwei Tage lang verwundert das Treiben.<br />
Ergebnis: Die ARD-Mitteilung wurde fast immer wörtlich übernommen, die Aussagen<br />
wurden nicht überprüft, über die tatsächlichen Inhalte der Studie war fast<br />
nichts zu lesen. Wir wollten für Abhilfe sorgen und schrieben dann auf zwei Seiten<br />
zusammen, welche offiziellen Daten von ARD und ZDF ausgewertet worden waren,<br />
was die wesentlichen Erkenntnisse der Studie sind und welche Entwicklungen<br />
sie kritisiert und welche konkreten Vorschläge sie macht – alles sachlich, nüchtern,<br />
an Fakten orientiert und zum konstruktiven Dialog bereit. Umso unglaublicher<br />
waren für uns die Reaktionen auf unsere Stellungnahme:<br />
159
Nur drei Kostproben aus Agenturmeldungen und Mediendiensten: „<strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
kontert ARD-Programmchef Herres!“ – „Herres-Kritik: Stiftung keilt zurück!“<br />
– „<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung legt im Krach mit ARD nach!“<br />
Meines Erachtens kann man an diesem Vorgang gut verdeutlichen, dass auch<br />
seriöse Medienkritik nicht ohne intensive Recherche auskommt. Die schnelle<br />
Meldung mit reißerischer Überschrift scheint zuweilen das Wichtigste zu sein.<br />
Wer macht noch die Kärnerarbeit der ernsthaften Prüfung und klugen Ein ordnung<br />
mit klarer Haltung? Selbstverständlich versuchen die großen überregionalen Qualitätsblätter,<br />
mit ihren Medienseiten auch eigene Akzente zu setzen, Themen zu<br />
entdecken, Hintergründiges zu veröffentlichen.<br />
Dennoch bleiben Fragen. Erstens: Welche Ressourcen stellen die großen Agenturen<br />
für professionelle Medienkritik zur Verfügung? Zweitens: Und wie sieht „Medienkritik“<br />
bei den Regional- oder Lokalzeitungen aus, die auf die Zuarbeit der Agenturen<br />
und von Mediendiensten angewiesen sind?<br />
Vermutlich führt die Medienkritik hier – wenn überhaupt – ein kümmerliches<br />
Schattendasein, das nur noch von den privaten Hörfunk- und Fernsehsendern unterboten<br />
wird, die kein Format für Selbstreflexion und Medienkritik entwickelt haben.<br />
Medienkritiker gelten schnell als Nestbeschmutzer! Blick nach innen und Transparenz<br />
in der Medienwelt: beides ist nicht gefragt. Medienkritiker, oft Freie, werden<br />
schlecht bezahlt. Und Kritik am eigenen Sender, Verlag oder Medium wird ihnen<br />
allzuoft und allzu schnell als Nachteil im Standort-Wettbewerb ausgelegt.<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
ist es also, unterm Strich, doch schlecht bestellt um die Medienkritik bei uns?<br />
Wir haben Medienkritiker und Fachleute eingeladen, uns ihre Sicht der Dinge zu<br />
160
erläutern, über Stärken und Schwächen der Medienkritik zu reden, über Wirken<br />
und Versagen der Medienkritik zu diskutieren, für uns Schneisen der Erkenntnis<br />
durch das Gestrüpp der Vermutungen zu schlagen.<br />
Ich danke Herrn Jakobs von der SZ, dass er in das Thema einführt und unser<br />
gebildetes Halbwissen mit Erkenntnissen des professionellen Akteurs bereichert.<br />
Und ich freue mich, dass wir Anja Reschke für die Moderation gewinnen konnten.<br />
Liebe Frau Reschke, herzlich willkommen bei der OBS. Frau Reschke hat sich als<br />
Moderatorin von Panorama einen Namen gemacht. Sie arbeitet auch bei ZAPP,<br />
dem aktuell einzigen TV-Medienmagazin. Auf der Webseite von ZAPP heißt es,<br />
dass ihre Moderationen „fast immer ins Schwarze“ treffen.<br />
„Fast immer ins Schwarze treffen!“ Angesichts der Sendetermine – morgen z. B.<br />
kurz vor Mitternacht um 23.20 Uhr – ein Bild, das hoffentlich keine Rückschlüsse<br />
auf die Zuschauerzahlen der Sendung zulässt.<br />
Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende<br />
Veranstaltung.<br />
Die in der Begrüßung erwähnten Studien der OBS („Bild“-Studie und „Info“-Studie) und weitere<br />
aktuelle Ausarbeitungen zu medienkritischen Fragen (wie etwa die „Talkshow“-Studie) sind –<br />
solange der Vorrat reicht – über die Homepage der Stiftung (www.otto-brenner-stiftung.de) kostenlos<br />
abrufbar.<br />
(Die Redaktion)<br />
161
Hans-Jürgen Jakobs<br />
20 Thesen zum deutschen Medienjournalismus<br />
Der aktuelle Medienjournalismus 1 wirft einige Fragen auf. Sind dort einsame Rufer<br />
aktiv? Einsam sind sie vielleicht, ja, alle prügeln auf Medienjournalisten ein. Aber<br />
rufen? Nach was? Nach einer neuer Medienordnung? Nach einem angemessenen<br />
Rahmen für die digitale Revolution? Nach einer besseren Definition für „Öffentlich-<br />
Rechtlich“? Nach Korrekturen im zentralen Markt der Media-Agenturen, wo ein<br />
Unternehmen 40 Prozent der deutschen Werbegelder kontrolliert und vier Unternehmen<br />
rund 80 Prozent?<br />
Oder nach weniger Abhängigkeit von amerikanischen Datensammelstellen wie<br />
Facebook und Google? Nach Widerstand gegen den Ausverkauf von Seiten oder<br />
Themen an Werbungtreibende oder PR-Agenturen? Und was ist mit der Behauptung<br />
von den „zahnlosen Tigern“, die sich da abmühen? Wo wird denn wenigstens<br />
einmal versucht, zuzubeißen?<br />
Bei Thomas Gottschalk, der den Deutschen erst das Fernsehen, dann die Gesellschaft<br />
und nun sogar den Glauben erklären will, wo er sich doch nur an sich selbst<br />
1 Wir dokumentieren hier die vom Autor gekürzte und für das „Best of“ bearbeitete Einführungsrede der OBS-Tagung<br />
„Einsame Rufer oder zahnlose Tiger? – Vom Wirken und Versagen der Medienkritik“.<br />
Eröffnung, Einführung und anschließende Diskussion sind auch unter www.otto-brenner-stiftung.de zugänglich.<br />
Hans-Jürgen Jakobs, u. a. langjähriger Chef der Medienseite der Süddeutschen Zeitung, ist heute Ressortleiter<br />
„Wirtschaft“ der SZ, München<br />
162
abarbeitet und hofft, dass endlich einmal ein Format außerhalb von Wetten,<br />
dass...? funktionieren wird? Bei Liz Mohn, der Eigentümerin von Bertelsmann,<br />
die unter Nichtbeachtung wesentlicher Grundsätze ihres verstorbenen Mannes,<br />
den Konzern dominiert und verändert, nicht immer zum Guten?<br />
Wie oft ist es Medienjournalisten in den vergangenen Jahren wirklich gelungen,<br />
Themen zu setzen? Wenn es immer heißt: mehr Selbstreflexion ist vonnöten,<br />
kann das nicht bedeuten: mehr Selbstreferenz oder auch mehr Selbstbeweihräucherung.<br />
Sondern Selbstkritik.<br />
Und die Selbstkritik besagt, grosso modo und ehrlicherweise: Medienjournalismus<br />
hat dramatisch an Relevanz verloren. Seine Themen erscheinen eher willkürlich.<br />
Oft leiten sie sich von dem ab, was das TV-Programm und PR-Agenten und das<br />
eigene Netzwerk der Eitelkeiten hergibt. Es fehlt an kontinuierlicher Begleitung<br />
von Vorgängen. Es gibt zu wenig Recherche.<br />
Medienjournalismus droht, zu einem Es-gibt-das-auch-noch-Ressort zu werden.<br />
Es ist zuweilen nicht einmal „nice to have“. Es müsste aber sein: „must to have“.<br />
„Aus unseren Kreisen“, so hieß Anfang der sechziger Jahre der erste medienkritische<br />
Dienst von Waldemar Schweitzer, dem „DM“-Erfinder. In unseren Kreisen können<br />
bei näherer Betrachtung 20 Befunde festgestellt werden.<br />
I.<br />
Medienjournalismus ist nur so gut wie Journalismus selbst. Und Journalismus<br />
ist nur so gut wie die Gesellschaft, in der er wirkt. Aber das heißt nicht, dass er<br />
nicht besser zu machen ist.<br />
Wir alle wissen: Die Bedingungen sind schlechter geworden. Der Pressefreiheit<br />
geht das Geld aus. Neue Sponsoren werden gesucht, manchmal auch nur Mäzene.<br />
Aber noch reicht es für die meisten. Genau in einer solchen Situation braucht<br />
man den engagierten Warner, nicht den ängstlichen Stummen.<br />
163
II.<br />
So wie die Medienpolitik nach der Zäsur der achtziger Jahre zerfallen ist bis hin<br />
in die Bedeutungslosigkeit, so muss der Medienjournalismus kämpfen gegen den<br />
Niedergang. Das Sinnbild für die Krise einer ganzen Branche ist die Institution der<br />
Elefantenrunde des Medienkongresses, die ihre Wichtigkeit nur noch behauptet.<br />
Der Medienjournalismus kommt von der TV-Programmbesprechung. An Bedeutung<br />
gewann er in den 80er und 90er Jahren, mit dem Aufkommen des privaten Rundfunks,<br />
mit dem Kampf um Lizenzen und die Medienvielfalt, mit dem Duell Leo Kirch<br />
gegen Bertelsmann, wo ein einzelner Decoder der Schlüssel zur Zukunft zu sein<br />
schien.<br />
Und heute: Medienjournalismus ist mit dem digitalen Wandel nicht im entscheidenden<br />
Ausmaß mitgegangen. Wo sind die kontinuierlichen Stücke über Apps, Twitter,<br />
Blogs, Google, E-Tablets, Facebook? Das, was Mohn und Kirch für den Medienjournalismus<br />
der analogen Welt waren, sind heute Mark Zuckerberg und Larry Page.<br />
Der deutsche Medienjournalismus ist provinziell. Er fängt internationale Entwicklungen<br />
zu selten ein. Der deutsche Medienjournalismus ist, zweitens, wenn man<br />
so will in der Holzklasse der Publizistik stecken geblieben. Wo sind die Abhandlungen<br />
über „digitale Brücken“? Wo wird im Medienjournalismus zwischen Print<br />
und Online kombiniert? Welche Arbeitsteilung erleben wir?<br />
III.<br />
Der Medienjournalismus alter Prägung hatte seine Hochzeit in der Beschreibung<br />
von wilden Verteilungs- und Eroberungskämpfen rund um die Etablierung des<br />
privaten Rundfunks in Deutschland. Die neuen Verteilungskämpfe spielen sich<br />
in der digitalen Wirtschaft zwischen amerikanischen Konzernen ab. Hierbei findet<br />
der deutsche Medienjournalismus so gut wie nicht statt.<br />
Den Umbruch von der analogen in die digitale Welt ist an vielen Medienseiten zwar<br />
nicht spurlos vorübergegangen, jedoch hat sich das Themenangebot nicht aus-<br />
164
eichend gewandelt. Vielleicht liegt es daran, dass die Spezialisten mit dem Herstellen<br />
von iPad-Ausgaben beschäftigt sind, die ihr Publikum noch finden müssen.<br />
Erforderlich ist die systematische Hinwendung zu Usern in Social Networks. Das<br />
hat die Debatte über die ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein bei der WM<br />
2010 („innerer Reichsparteitag“) gezeigt. Auch haben autonome Wissenschaftsblogs<br />
die Schleichwerbegeschäfte von Hademar Bankhofer enthüllt, die dazu<br />
geführt haben, dass er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr auftritt.<br />
IV.<br />
Es gehört zum eher tristen Erscheinungsbild, dass wichtige Phänomene auf<br />
Medien seiten ausgespart bleiben. Die Norm ist das Erwartbare. Man hat genug<br />
damit zu tun, Termine abzuarbeiten.<br />
Was fehlt? Zum Beispiel Analysen über die Machtkonzentration auf dem Markt<br />
der Media-Agenturen, die doch über die Finanzierung der elektronischen Medien<br />
und der Presse maßgeblich mitentscheiden. Im Fall des Themas Media-Agenturen<br />
spielt wohl auch eine Rolle, die noch vorhandenen Werbeerlösquellen nicht zu<br />
gefährden. Aber auch andere Mega-Trendthemen werden unzureichend erfasst.<br />
Zum Beispiel die Vorgänge im Presse-Grosso, dem noch neutralen Verteil system<br />
für Zeitungen und Zeitschriften, das womöglich bald in der Hand von „Bild“ und<br />
der Bauer-Zeitschriften sein wird.<br />
Das Thema Wikileaks ging an Feuilleton oder Politik. Berlusconi und seine Medienmacht,<br />
das gibt reichlich Anlass für medienjournalistische Begleitung. Wo war das<br />
akribisch recherchierte Stück rund um die Entmachtung des Nikolaus Brender<br />
beim ZDF? Wo wird der Einfluss der Lobbys auf Themen betrachtet?<br />
Es dominiert der Hickhack des täglichen Einerleis, zu wenig große Trends und<br />
Entwicklungen fließen in den Medienjournalismus ein. Das Geschäft wird zu wenig<br />
erklärt. Zu lesen gibt es viele Fernsehthemen. Sie drängen Medienökonomie<br />
und Medienpolitik ab. Es gibt kaum Verbindung der Medienpublizistik mit den<br />
Wissen schaften zum Thema.<br />
165
V.<br />
Die Schwäche des Medienjournalismus ist, dass zu viele glauben, man käme<br />
ohne tiefe Recherche aus. Nur zu oft genügt der Augenschein, die Wirkung eines<br />
Fernsehbildes, die geschmückt wird durch schnelle Thesenhaftigkeit.<br />
Entscheidend für Qualität ist aber: Zusammenhänge herstellen, Hintergründe<br />
aufzeigen, überraschende Analogien ziehen. Für Transparenz sorgen. Wo bleibt<br />
die Aufklärung im aktuellen Medienjournalismus?<br />
Ein bekannter Verleger sagte über Medienseiten: „Wenn es sie gibt, müssen sie<br />
auch gefüllt werden.“ Was er meinte: „Wenn es sie nicht gibt, müssen sie nicht<br />
gefüllt werden.“ Seine Konsequenz: Es schaffte sie ab – und damit die Existenz<br />
von Themen, die für Verleger unangenehm sind.<br />
VI.<br />
Medienseiten sind in Zeitungen und Zeitschriften gelegentlich zur Manövriermasse<br />
geworden. Die Frage ist, wem überhaupt auffällt, wenn sie einmal ausfallen oder<br />
ganz aus dem Angebot genommen werden. Von größeren Protesten ist nichts<br />
bekannt. Das muss zu denken geben.<br />
Die Alarmzeichen in der Branche sind doch gar nicht mehr zu übersehen. Die<br />
Anzeigen sind über viele Jahre drastisch zurückgegangen, höhere Vertriebserlöse<br />
über höhere Vertriebspreise sowie additive Online-Umsätze können den Verlust<br />
nicht ausgleichen. Papier wird zur knappen Ressource.<br />
Das Ressort „Medien“ muss sich behaupten gegen andere Ressorts aus der<br />
zweiten Reihe, die nicht Kernangebot sind wie Politik, Wirtschaft, Feuilleton,<br />
Sport und Lokales. Aber: mit was?<br />
VII.<br />
Der Reiz des Themas Medien ist die Vielfalt der Sichtweisen, das Interdisziplinäre.<br />
Der Reiz ist aber auch die Gefahr. Was als Querschnitt interessant sein kann, lässt<br />
166
sich leicht in seine Einzelbestandteile zerlegen. Medienthemen können in Kultur,<br />
Wissenschaft, Wirtschaft, Sport und Politik leicht nachvollziehbar gut aufbereitet<br />
werden. Eine eigene Medienseite braucht eine besondere Begründung, um relevant<br />
zu sein. Man muss sie als Kompetenzzentrum begreifen.<br />
Kompetenzzentrum: heißt einbringen in andere Ressorts. Heißt anstrengen.<br />
Heißt, Ressourcen nicht schrumpfen lassen.<br />
VIII.<br />
Medienseiten sind überall. Sie sind in der Ausgabe der Bild-Zeitung, die sich mit<br />
„netzwerk recherche“ beschäftigt, und auf der Panorama-Seite des Wiesbadener<br />
Kurier, der sich des Bushido-Bambi-Skandals annimmt. Medienkritik ist auch in<br />
der heute-show zu finden oder bei Harald Schmidt.<br />
Es kommt darauf an, sich durch Regelmäßigkeit und Wissen abzusetzen.<br />
IX.<br />
Medienjournalismus ist wichtig, weil er hilft, die Qualität der Medien zu sichern.<br />
Man muss sich nur darauf einlassen. Er ist wichtiger Teil der Selbstkontrolle der<br />
Branche.<br />
X.<br />
Man braucht alle Aufmerksamkeit dafür, um festzustellen, wie Aufmerksamkeit<br />
in Medien gemacht wird.<br />
XI.<br />
Es ist aberwitzig, dass jeder von Mediengesellschaft redet, man einer geordneten,<br />
kompetenten publizistischen Begleitung dieses Phänomens aber nicht das Wort<br />
reden will.<br />
Guter Medienjournalismus ist auch immer politisch. Er widmet sich der Frage,<br />
wie Themen und Personen inszeniert werden, wie Bilder und Kampagnen<br />
167
gemacht werden. Er legt die Mechanismen bloß, mit denen ein Politiker wie<br />
Karl-Theodor zu Guttenberg zum gefallenen „Star“ wurde, der auch sein Comeback<br />
dank der Medienpartnerschaft mit der „Zeit“ zum Ereignis macht.<br />
XII.<br />
Da sich in den kommenden Jahren verstärkt die Frage nach der Finanzierung von<br />
Qualitätsjournalismus stellen wird, und damit nach öffentlichen Geldern, muss<br />
der Medienjournalismus ganz neu Fragen nach der Legitimation und den Verfahrensweisen<br />
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellen. Der Medienjournalist<br />
wird hier Sachwalter der gesellschaftlichen Interessen. Er muss frei sein vom<br />
Lobbyismus einer elektronischen Beteiligungs-Publizistik, die im Niederschreiben<br />
angeblicher Rivalen womöglich ein Mittel des Marketings sieht.<br />
ARD und ZDF können selbst mehr tun. Eine TV-Sendung „Zapp“ reicht nicht, ein<br />
weniger bissiges „Zapp“ würde erst recht nicht reichen.<br />
XIII.<br />
Wie souverän ein Medium ist, sieht man an seiner Medienseite. Wem also alles<br />
Platz eingeräumt wird. Und wem nicht.<br />
XIV.<br />
Zum Status quo gehört, dass viele Medienfachtitel inzwischen oft publizistisch<br />
irrelevant sind, das Angebot im Fernsehen und Hörfunk dürftig ist, und sich im<br />
Internet erst langsam eine Vielfaltskultur entwickelt.<br />
XV.<br />
Der aktuelle Journalismus versucht, ausgehend von den USA, Journalisten als Marken<br />
zu profilieren. Wer aber ist im Medienjournalismus zu einer „Marke“ geworden?<br />
Was ist davon zu halten, dass ein Medienjournalist einen Film macht bei einem<br />
Sender, über den er schreibt? Oder ein anderer eine Entertainerin berät oder<br />
Moderationstexte für eine der großen Branchenselbstbeweihräucherungsabende<br />
168
schreibt? Oder ein politischer Journalist einer großen Zeitung als Co-Autor des<br />
Buches des Kanzlerkandidaten auftritt?<br />
Die Unabhängigkeit ist durch eigene Rollenverwechslung viel stärker gefährdet<br />
als durch übereifrige Staatsanwälte oder große PR-Brigaden. Das größte Problem<br />
ist die Haltung, die fehlt.<br />
XV.<br />
Nichts ist merkwürdiger, als wenn Medienjournalisten Medienjournalisten<br />
Medienjournalisten nennen. Kurzum: Es gibt zu viel Selbstbeschäftigung und<br />
eine Immunisierung gegen Kritik.<br />
XVI.<br />
Medienjournalismus ist die schwierigste Form des Gewerbes, weil er einerseits<br />
Phänomene der Massenkultur für viele aufbereitet, also den Star an sich, die<br />
Show, das Quotenformat in den Mittelpunkt stellt, andererseits aber das Fachpublikum<br />
der Multiplikatoren anspricht, das an der hintergründigen, auch aufklärerischen<br />
Aufbereitung komplexer Themen interessiert ist. Die Zielgruppe ist<br />
gespalten. Sich aber nur auf eine konzentrieren zu wollen, wäre tödlich.<br />
XVII.<br />
Medienjournalisten stehen in der verführerischen Situation, von Verlagen und<br />
Sender und Internet-Firmen als viel besser bezahlte Kommunikationsspezialisten<br />
in der Presseabteilung arbeiten zu können. Das ist nichts Branchenspezifisches.<br />
Das geht Journalisten in Ressorts wie Wirtschaft oder Politik genauso. Besonders<br />
aber ist, dass Medienjournalisten permanent über potentielle journalistische<br />
Arbeitgeber schreiben.<br />
Es braucht hier eine besondere moralische Qualifikation.<br />
XVIII.<br />
Chefredakteure tendieren prinzipiell zum gegenseitigen Nichtangriffspakt.<br />
169
Chefredakteuren geht es nicht anders wie Oligopolisten: Sie wissen, dass man<br />
sich im Extremfall gegenseitig sehr schädigen könnte und dass es von daher<br />
besser ist, es nicht zu tun. Die Summe der gemeinsamen Verluste wird für höher<br />
erachtet als die Zahl individueller Erfolge.<br />
Das Problem ist nur mit präziser Recherche, guten Geschichten und Beharrlichkeit<br />
zu lösen. Zur Beruhigung sei gesagt: Das Phänomen hat aber nachgelassen. Seine<br />
Hochkonjunktur erlebte es vor einigen Jahren in der Allianz des Springer-Chefs<br />
Mathias Döpfner mit dem FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher und dem seinerzeitigen<br />
Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust. Hier sollte nicht nur die Rechtschreibreform<br />
gestoppt, sondern auch mal kurz eine neue politische Kultur eingeführt werden,<br />
mit der Generalreformerin Angela Merkel in der Form der frühen Jahre vor 2005.<br />
Der vermeintlich kluge Chefredakteur lebt täglich mit einer persönlichen Kosten-<br />
Nutzen-Abwägung. Was bringt beispielsweise eine Geschichte, die Stasi-Verbindungen<br />
eines Mitglieds der Bild-Chefredaktion aufdeckt – an Reputation, Zita -<br />
tionen, Lesern? Ist der Nutzen größer als der Ärger mit Springer? Die dann einmal<br />
zurückschlagen werden? Die größte Angst eines bestimmten Typus Chefredakteur<br />
ist, als „Verlierer des Tages“ in der Bild-Zeitung von Kai Diekmann aufzutauchen.<br />
Das ist der Rache-Platz für offene und versteckte Medienkriege. Und so sagt sich<br />
mancher Chefredakteur: „Wegen einer solchen Geschichte riskiere ich keinen<br />
Ärger mit Diekmann.“<br />
Und Johannes B. Kerner konnte aus seiner Sicht jahrelang berechtigterweise<br />
damit kalkulieren, vom Spiegel in Hamburg nicht in die Pfanne gehauen zu werden,<br />
weil Spiegel-TV seine Talk-Sendung produziert hat. Es geht hier um das Denken<br />
in journalistischen Deals. Solche Deals haben im Journalismus nichts verloren.<br />
XIX.<br />
Medienjournalismus steht unter dem Generalverdacht, parteiisch zu sein – nett<br />
zu den Freunden, gemein zu den anderen. Die Unabhängigkeit muss hier mit<br />
besonderer Aufmerksamkeit gesichert werden, aber es lohnt sich.<br />
170
XX.<br />
Die in der ökonomischen Krise des einstigen Superwachstumsmarkts Medien<br />
und Kommunikation zu beobachtende Verzichtskultur der Redaktionen führt<br />
gerade auf Medienseiten zu einer Selbstentlarvung des Mediums, da die Leser,<br />
insbesondere die Spezialisten, hier von Ausfallerscheinungen induktiv auf das<br />
Ganze erschließen.<br />
Deswegen die Verpflichtung, es gerade hier besonders gut zu machen.<br />
Medienseiten und Mediensendungen gehören zur guten Unternehmenskultur<br />
von Verlagen und Sendern. Sie müssen einhergehen mit anderen Maßnahmen<br />
und Angeboten, etwa mit einem breiten Leserforum, mit dem Selbstausweis von<br />
Korrekturen, mit Social-Media-Aktivitäten, mit einem Ombudsmann oder einer<br />
Ombudsfrau, mit der Publizierung der Presserat-Wertungen.<br />
Den Medienjournalismus ernst zu nehmen, gehört zur Glaubwürdigkeit von Zeitungen,<br />
Zeitschriften und Sendern. Glaubwürdigkeit ist aber der größte Trumpf, den<br />
Medien im verschärften Wettbewerb haben. Man braucht lange, um sie zu erwerben,<br />
und kann sie in sehr kurzer Zeit verspielen. Medienjournalismus entstand einst<br />
auch, weil sich niemand über den „blinden Fleck“ mokieren sollte, über das Verschweigen<br />
von Themen mit Eigen Bezug. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen<br />
Bedrohung und großer Umbrüche wird es wichtiger, hier souverän zu bleiben.<br />
Conclusio<br />
Man muss Medienseiten ganz neu denken – oder es damit sein lassen. Die<br />
Alternative kann nur sein: Richtig oder gar nicht. Keine halben Sachen.<br />
Zeitungen werden mit dem Nachrichtenjournalismus alter Prägung ohnehin in<br />
ein paar Jahren verloren sein, wenn sie nicht Magazinelemente stärker fördern.<br />
Journalistische Medienkompetenz kann dabei ein Differenzierungsmerkmal sein.<br />
Mit dem Vorwurf Nestbeschmutzer lässt sich dann einfacher leben.<br />
171
DIE JURY
Sonia Seymour Mikich<br />
Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
Harald Schumann<br />
Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Berthold Huber
Sonia Seymour Mikich<br />
Geboren 1951<br />
Redaktionsleitung des ARD-Magazins Monitor und<br />
Leiterin der Programmgruppe Inland-WDR-Fernsehen<br />
Werdegang<br />
2004 - April 2007: Redaktionsleitung der ARD/WDR-Dokumentationsreihe „die story“<br />
Seit Januar 2002: Redaktionsleitung und Moderatorin des ARD-Magazins Monitor, WDR Köln<br />
1998 - 2001: Korrespondentin und Studioleitung des Deutschen Fernsehens in Paris<br />
1992 - 98: Korrespondentin des Deutschen Fernsehens in Moskau (ab 1995: Studioleitung)<br />
1982 - 84: Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk, Redakteurin und Reporterin<br />
1979 - 81: wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arnold-Gehlen-Forschungsgruppe am Institut<br />
für Soziologie an der RWTH Aachen. Freie Journalistin für Zeitschriften, Tageszeitungen und<br />
Aufsatzsammlungen<br />
1972 - 79: Studium Politologie, Soziologie und Philosophie an der RWTH Aachen mit<br />
Magisterabschluss Februar 1979<br />
1970 - 72: Volontariat bei der Aachener Volkszeitung<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Telestar als Beste Reporterin (1996); Bundesverdienstkreuz (1998); Deutscher Kritikerpreis für<br />
Auslandsberichterstattung (2001); Marler Fernsehpreis für Menschenrechte (2007); ASF-<strong>Preis</strong><br />
Rote Rose (<strong>2011</strong>)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Der Wille zum Glück. Lesebuch über Simone de Beauvoir, Reinbek 1986; Planet Moskau.<br />
Geschichten aus dem neuen Rußland, Köln 1998<br />
174
Prof. Dr. Heribert Prantl<br />
Geboren 1953<br />
Ressortchef Innenpolitik und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung<br />
Werdegang<br />
Seit <strong>2011</strong>: Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung<br />
Seit 1995: Ressortchef Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung<br />
Seit 1988: Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung<br />
1981 - 87: Richter an verschiedenen bayerischen Amts- und Landgerichten sowie Staatsanwalt<br />
Studium der Philosophie, der Geschichte und der Rechtswissenschaften. Erstes und Zweites<br />
Juristisches Staatsexamen, juristische Promotion, juristisches Referendariat. Parallel dazu<br />
journalistische Ausbildung<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Geschwister-Scholl-<strong>Preis</strong> (1994); Kurt-Tucholsky-<strong>Preis</strong> (1996); Siebenpfeiffer-<strong>Preis</strong> (1998/99);<br />
Theodor-Wolff-<strong>Preis</strong> (2001); Rhetorikpreis für die Rede des Jahres 2004 der Eberhard-Karls-<br />
Universität Tübingen; Erich-Fromm-<strong>Preis</strong> (2006); Arnold-Freymuth-<strong>Preis</strong> (2006); Roman-Herzog-<br />
Medienpreis (2007); Justizmedaille des Freistaats Bayern (2009); Wilhelm-Hoegner-<strong>Preis</strong> (<strong>2011</strong>)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Kein schöner Land. Die Zerstörung der sozialen Gerechtigkeit, München 2005; Der Terrorist als<br />
Gesetzgeber. Wie man Politik mit Angst macht, München 2008; Der Zorn Gottes. Denkanstöße zu<br />
den Feiertagen, München <strong>2011</strong>; Die Welt als Leitartikel. Zur Zukunft des Journalismus, Wien 2012<br />
175
Harald Schumann<br />
Geboren 1957<br />
Redakteur für besondere Aufgaben bei „Der Tagesspiegel“, Berlin<br />
Werdegang<br />
Seit 10. 2004: Redakteur „Der Tagesspiegel“ Berlin<br />
2003 - 04: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
2000 - 02: Ressortleiter Politik bei SPIEGEL ONLINE<br />
1992 - 2000: Redakteur im Berliner Büro des SPIEGEL<br />
1990 - 91: Leitender Redakteur beim Ost-Berliner „Morgen“<br />
1986 - 90: Wissenschaftsredakteur beim SPIEGEL<br />
1984 - 86: Redakteur für Umwelt und Wissenschaft bei der Berliner tageszeitung, Studium<br />
der Sozialwissenschaften in Marburg, Landschaftsplanung an der TU Berlin, Abschluss als<br />
Diplom-Ingenieur<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Bruno-Kreisky-<strong>Preis</strong> für das politische Buch (1997); Medienpreis Entwicklungspolitik (2004);<br />
Gregor Louisoder-<strong>Preis</strong> für Umweltjournalismus (2007); „Das politische Buch“, Friedrich-Ebert-<br />
Stiftung (2009); „Der Lange Atem“, Journalistenverband Berlin-Brandenburg (2010)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Futtermittel und Welthunger, Reinbek 1986; Die Globalisierungsfalle (gemeinsam mit Hans-Peter<br />
Martin), Reinbek 1996; attac – Was wollen die Globalisierungskritiker? (mit Christiane Grefe und<br />
Mathias Greffrath), Berlin 2002; Der globale Countdown, Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung –<br />
die Zukunft der Globalisierung (gemeinsam mit Christiane Grefe), Köln 2008<br />
176
Prof. Dr. Volker Lilienthal<br />
Geboren 1959<br />
Inhaber der Rudolf Augstein Stiftungsprofessur für „Praxis des Qualitätsjournalismus“ (Uni Hamburg)<br />
Mitherausgeber von message – Internationale Zeitschrit für Journalismus<br />
Werdegang<br />
2005 - 2009: Verantwortlicher Redakteur von „epd medien“<br />
1997 - 2005: stellv. Ressortleiter „epd medien“<br />
Seit 1989: Redakteur beim Evangelischen Pressedienst (epd)<br />
1999: Lehrbeauftragter für Medienkritik und Medienjournalismus an der Universität Frankfurt/M.<br />
1996 - 98: journalistischer Berater und Autor der Wochenzeitung „DIE ZEIT“<br />
1988: Redakteur von „COPY“ (Handelsblatt-Verlag)<br />
1987: Dr. phil. in Germanistik der Universität-GH Siegen<br />
1983: Diplom-Journalist der Universität Dortmund<br />
Auszeichnungen, u. a.<br />
Leipziger <strong>Preis</strong> für die Freiheit und Zukunft der Medien (2006); Nominierung zum Henri Nannen<br />
<strong>Preis</strong> in der Sparte „Bestes investigatives Stück“ (2006); „Fachjournalist des Jahres“ (2005);<br />
„Reporter des Jahres“ (2005); „Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen“ der Journalistenvereinigung<br />
„netzwerk recherche e. V.“ (2004); zweiter <strong>Preis</strong> „Bester wissenschaftlicher Zeitschriftenaufsatz“<br />
der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft<br />
(DGPuK) (2004); „Besondere Ehrung“ beim Bert-Donnepp-<strong>Preis</strong> für Medienpublizistik (2002);<br />
Hans-Bausch-Mediapreis des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart (1997)<br />
Veröffentlichungen, u. a.<br />
Professionalisierung der Medienaufsicht (Hrsg., Wiesbaden 2009); Literaturkritik als politische<br />
Lektüre, Am Beispiel der Rezeption der ,Ästhetik des Widerstands’ von Peter Weiss (Berlin 1988);<br />
Sendefertig abgesetzt. ZDF. SAT.1 und der Soldatenmord von Lebach (Berlin 2001); TV-Dokumentation<br />
„Der Giftschrank des deutschen Fernsehens“ 1994 auf VOX/DCTP<br />
177
Prof. Dr. Thomas Leif<br />
Geboren 1959<br />
Chefreporter Fernsehen, SWR, Mainz<br />
Werdegang<br />
Seit 2009: Moderator von „2+Leif“ (SWR); www.2plusleif.de<br />
Seit Januar 1997: Chefreporter Fernsehen beim SWR in Mainz<br />
Seit März 1995: Redakteur/Reporter beim SWR-Fernsehen<br />
Seit Mai 1985: fester freier Mitarbeiter beim Südwestrundfunk Mainz in den<br />
Redaktionen Politik, ARD Aktuell, Report u. a.<br />
1978 - 85: Studium der Politikwissenschaft, Publizistik und Pädagogik an der<br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Bis 1989: Promotion an der<br />
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt / Main<br />
Veröffentlichungen, u.a.<br />
Die strategische (Ohn)-Macht der Friedensbewegung. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen<br />
in den achtziger Jahren (Opladen 1990); Rudolf Scharping, die SPD und die Macht (zus. mit<br />
Joachim Raschke) (Reinbek 1994); Leidenschaft: Recherche. Skandal-Geschichten und Enthüllungs-<br />
Berichte (Hrsg.) (Opladen 1998); Mehr Leidenschaft: Recherche. Skandal-Geschichten und Enthüllungsberichte.<br />
Ein Handbuch zu Recherche und Informationsbeschaffung (Hrsg.) (Opladen 2003);<br />
Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland (Hrsg.) (Wiesbaden 2006); Beraten und Verkauft.<br />
McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater (Gütersloh 2007); 10. Auflage; Aktua -<br />
lisierte Neuauflage; (München 2008) (Taschenbuch); Angepasst und Ausgebrannt. Die Parteien<br />
in der Nachwuchsfalle (München 2009)<br />
178
Berthold Huber<br />
Geboren 1950<br />
Erster Vorsitzender der IG Metall und<br />
Präsident des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes (IMB),<br />
Vorsitzender des Verwaltungsrates der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Werdegang<br />
Seit 2007: Erster Vorsitzender der IG Metall<br />
2003 - 2007: Zweiter Vorsitzender der IG Metall<br />
1998 - 2003: Bezirksleiter für Baden-Württemberg<br />
1993 - 1998: Koordinierender Abteilungsleiter<br />
1991 - 1993: Abteilungsleiter<br />
ab 1990: Hauptamtliche Tätigkeit bei der IG Metall in Ostdeutschland<br />
1985: Studium der Geschichte und Philosophie an der Universität Frankfurt<br />
1978: Betriebsrats- und Gesamtbetriebsratsvorsitzender<br />
1971: Ausbildung zum Werkzeugmacher und Tätigkeit bei der Firma Kässbohrer<br />
(heute Evo-Bus) in Ulm<br />
Aufsichtsratmandate<br />
Audi AG, Ingolstadt (stellvertretender Vorsitzender); Siemens AG, München (stellvertretender<br />
Vorsitzender); Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart; Volkswagen AG, Wolfsburg (stellvertretender<br />
Vorsitzender)<br />
179
Daten und Fakten zum <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> <strong>2011</strong><br />
Termine<br />
Bewerbungszeitraum 01.04. - 15.08.<strong>2011</strong><br />
Jury-Sitzung<br />
28.09.<strong>2011</strong> Frankfurt<br />
<strong>Preis</strong>verleihung 22.11.<strong>2011</strong><br />
Eingereichte Bewerbungen 546<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 398<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> Spezial 47<br />
Medienprojektpreis 16<br />
Newcomerpreis 65<br />
Recherche-Stipendium 20<br />
<strong>Preis</strong>gelder<br />
52.000 Euro (insgesamt)<br />
1. <strong>Preis</strong> 10.000 Euro<br />
2. <strong>Preis</strong> 5.000 Euro<br />
3. <strong>Preis</strong> 3.000 Euro<br />
„Spezial“-<strong>Preis</strong><br />
Medienprojektpreis<br />
Newcomerpreis<br />
vier Recherche-Stipendien<br />
10.000 Euro<br />
2.000 Euro<br />
2.000 Euro<br />
je 5.000 Euro<br />
<strong>Preis</strong>träger<br />
Medienprojektpreis<br />
Sebastian Pantel (SÜDKURIER)<br />
Newcomerpreis<br />
Jonathan Stock (freier Journalist)<br />
Matthias Dell (Der Freitag)<br />
Recherche-Stipendien *<br />
Urs Spindler (freier Journalist)<br />
N.N.*<br />
N.N.*<br />
1. <strong>Preis</strong><br />
Volker ter Haseborg, Lars-Marten Nagel<br />
(Hamburger Abendblatt)<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und<br />
Jörg Schmitt (DER SPIEGEL)<br />
3. <strong>Preis</strong> Ursel Sieber (freie Autorin)<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
Katja Thimm (DER SPIEGEL)<br />
* Die Namen dieser <strong>Preis</strong>träger <strong>2011</strong> werden erst mit dem Abschluss der Stipendien öffentlich gemacht, damit der Erfolg<br />
der Recherche nicht gefährdet wird.<br />
180
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
2010 Willi Winkler (freier Autor, Süddeutsche Zeitung)<br />
für seine Beiträge als Gesellschaftskritiker, der sich von der Diktatur des<br />
Aktuellen und Modischen nicht beeindrucken lässt<br />
2009 Christian Semler (freier Autor, taz.die tageszeitung)<br />
für seine Beiträge zu Demokratie und Bürgerrechten;<br />
Würdigung seines journalistischen Gesamtwerkes<br />
2008 Christian Bommarius (Berliner Zeitung)<br />
Gesamtwürdigung für Kommentare, Leitartikel, Meinungsbeiträge<br />
2007 Tom Schimmeck (freier Autor und Publizist)<br />
„Angst am Dovenfleet“ (taz.die tageszeitung, 30. Dezember 2006)<br />
2006 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2005 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
1. <strong>Preis</strong><br />
2010 Carolin Emcke (Publizistin und Reporterin)<br />
„Liberaler Rassismus“ (DIE ZEIT, Nr. 9/2010)<br />
2009 Marc Thörner<br />
„Wir respektieren die Kultur – Im deutsch kontrollierten Norden<br />
Afghanistans“ (Deutschlandfunk, 6. Februar 2009)<br />
2008 Anita Blasberg und Marian Blasberg<br />
„Abschiebeflug FHE 6842“ (DIE ZEIT – Magazin Leben, Nr. 03/2008)<br />
2007 Michaela Schießl<br />
„Not für die Welt“ (DER SPIEGEL, 19/2007)<br />
2006 Redaktion „Der Tag“ (HR)<br />
für Radiobeiträge „Der Tag – hr2“<br />
2005 Marcus Rohwetter<br />
„Ihr Wort wird Gesetz“ (DIE ZEIT, 6. Oktober 2005)<br />
181
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
2. <strong>Preis</strong><br />
2010 Christoph Lütgert und das Redaktions-Team „Panorama – Die Reporter“, NDR<br />
„Die Kik-Story“ (ARD-exclusiv, 4. August 2010)<br />
2009 Ulrike Brödermann und Michael Strompen<br />
„Der gläserne Deutsche –wie wir Bürger ausgespäht werden“(ZDF, 7. April 2009)<br />
2008 Jürgen Döschner<br />
„Fire and Forget – Krieg als Geschäft“ (WDR 5, 21. März 2008)<br />
2007 Ingolf Gritschneder<br />
„Profit um jeden <strong>Preis</strong> – Markt ohne Moral“ (WDR, 28. Februar 2007)<br />
2006 Frank Jansen<br />
Gesamtwürdigung für Langzeit-Reportagen über die Opfer rechtsextremer<br />
Gewalt in Deutschland<br />
2005 Nikola Sellmair<br />
„Kollege Angst“ (Stern, 31. März 2005)<br />
3. <strong>Preis</strong><br />
2010 Markus Metz und Georg Seeßlen<br />
„Von der Demokratie zur Postdemokratie“ (Bayern 2, 8. August 2010)<br />
2009 Simone Sälzer<br />
„Leben in Würde“ (Passauer Neue Presse, Artikelserie 21. Februar - 25. Mai 2009)<br />
2008 Steffen Judzikowski und Hans Koberstein<br />
„Das Kartell – Deutschland im Griff der Energiekonzerne“<br />
(ZDF, Frontal 21, 14. August 2007)<br />
2007 Markus Grill<br />
Gesamtwürdigung für pharmakritische Berichterstattung<br />
2006 Redaktion „ZAPP“ (NDR)<br />
„Verdeckt, versteckt, verboten – Schleichwerbung und PR in den Medien“<br />
(NDR, 2. November 2005)<br />
2005 Brigitte Baetz<br />
„Meinung für Millionen – Wie Interessengruppen die öffentliche<br />
Meinungsbildung beeinflussen“ (Deutschlandfunk, 26. August 2005)<br />
182
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
Newcomerpreis<br />
2010 Karin Prummer und Domink Stawski<br />
Artikelserie zu Missbrauchsfällen in der Katholischen Kirche<br />
(Süddeutsche Zeitung, März 2010)<br />
2009 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2008 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2007 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2006 Lutz Mükke<br />
„Der Parlamentsbroker“ (Medienmagazin Message, 4. Quartal 2005)<br />
2005 Maximilian Popp<br />
„Passauer Neue Mitte“ (Schülerzeitung „Rückenwind“, März 2005)<br />
2010 Alfons Pieper<br />
„Wir in NRW – Das Blog“<br />
Medienprojektpreis<br />
2009 Attac Deutschland<br />
für Plagiat der Wochenzeitung „DIE ZEIT“<br />
2008 Andrea Röpke<br />
für „langwierige und schwierige Recherchen in der Neonazi-Szene“<br />
2007 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2006 Keine Vergabe des <strong>Preis</strong>es<br />
2005 Andreas Hamann und Gudrun Giese<br />
„Schwarzbuch Lidl“<br />
183
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
Recherche-Stipendien<br />
2010 Marvin Oppong (freier Journalist)<br />
„Wikipedia oder Wahrheit“, DIE ZEIT, 1. Dezember <strong>2011</strong><br />
Frank Brunner (freier Journalist)<br />
„Im Körper des Feindes“, taz.die tageszeitung, 13. August <strong>2011</strong><br />
Gordon Repinski (taz.die tageszeitung)<br />
„Gigantische Kostenexplosion“, taz.die tageszeitung, 7./8. Mai <strong>2011</strong><br />
2009 Sandro Mattioli (freier Journalist)<br />
„Dreckige Geschäfte“<br />
(Erschienen in: Kontext: Wochenzeitung, www.kontextwochenzeitung.de,<br />
07. September <strong>2011</strong>)<br />
Tina Groll<br />
„Angepumpt und abgezockt“<br />
(Erschienen in: DIE ZEIT – online, 02. September 2010)<br />
Marianne Wendt, Maren-Kea Freese<br />
„Immer im Verborgenen – Als Analphabet in einer Welt der Schriftkultur“<br />
(gesendet in: RBB Kulturradio, 8. Dezember 2010)<br />
2008 Veronica Frenzel<br />
„Das Geschäft mit illegalen Einwanderern“<br />
(Erschienen in: E+Z, 50. Jahrgang, Ausgabe 6/2009, S. 234-236)<br />
Clemens Hoffmann<br />
„Verkaufte Kinder – Kinderhandel in der Ukraine“<br />
(Recherche wurde abgebrochen)<br />
Günter Bartsch<br />
„Helios Media: Das Geschäft mit der Eitelkeit“<br />
(Erschienen in: Günter Bartsch: Seit an Seit – Helios Media und die Berliner<br />
Lobby-Wirtschaft. In: Bernd Hüttner / Christoph Nitz (Hg.): Weltweit Medien<br />
nutzen – Medienwelt gestalten (Dokumentation der 7. Linken Medienakademie<br />
2010), Hamburg 2010, S. 111-117)<br />
184
<strong>Preis</strong>träger 2005 - 2010<br />
„<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> für kritischen Journalismus – Gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten“<br />
2007 Katrin Blum<br />
„Was kostet das Leben – oder sind wir vor dem Tod wirklich alle gleich?“<br />
(Recherche wurde abgebrochen)<br />
Thomas Schuler<br />
„Softpower – zum Einfluss der Stiftungen in Deutschland“<br />
(Thomas Schuler: Bertelsmannrepublik Deutschland – Eine Stiftung<br />
macht Politik, Campus Verlag, Frankfurt 2010)<br />
Martin Sehmisch<br />
„Unkontrollierte Macht? Wie die Monopolstellung einer lokalen Tageszeitung<br />
die politische Landschaft verändert – und wie sich Widerstand formiert“<br />
(Recherche wurde abgebrochen)<br />
2006 Boris Kartheuser<br />
„Beispiel: RFID-chips“ (Recherche im Bereich „Datenschutz“)<br />
(Erschienen in: DIE ZEIT, 7. Februar 2008)<br />
Thomas Schnedler<br />
„Stell mich an!“ (Selbstversuch im Bereich „Leiharbeit“)<br />
(Erschienen in: ZEIT-Campus 03/2008, Mai/Juni 2008)<br />
Melanie Zerahn<br />
„Beispiel: Studenten-Praktikum“<br />
(Erschienen in: taz.die tageszeitung, 31. Januar 2007)<br />
2005 Golineh Atai<br />
„Auslandsadoptionen im Globalen Kindermarkt“<br />
(Erschienen in: WDR, Weltweit, 22. September 2009)<br />
Julia Friedrichs<br />
„McKinsey und ich“ (Erschienen in: DIE ZEIT, 18. Mai 2006)<br />
Astrid Geisler<br />
„Das vergessene Land? Über den leisen und stetigen Aufstieg der<br />
Rechtsextremen in Ostvorpommern“<br />
(Erschienen in: taz.die tageszeitung, 8./9. April 2006)<br />
185
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong><br />
für kritischen Journalismus 2012
„Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht,<br />
sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit.“ (<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> 1968)<br />
Ausschreibung<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> 2012<br />
Es werden Beiträge prämiert, die für einen kritischen Journalismus<br />
vorbildlich und beispielhaft sind und die für demokratische und gesellschaftspolitische<br />
Verantwortung im Sinne von <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> stehen.<br />
Vorausgesetzt werden gründliche Recherche und eingehende Analyse.<br />
Der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> ist mit einem <strong>Preis</strong>geld<br />
von 47.000 Euro dotiert, das sich wie folgt aufteilt:<br />
1. <strong>Preis</strong> 10.000 Euro<br />
2. <strong>Preis</strong> 5.000 Euro<br />
3. <strong>Preis</strong> 3.000 Euro<br />
Zusätzlich vergibt die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung:<br />
für die beste Analyse (Leitartikel, Kommentar, Essay)<br />
den <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> <strong>Preis</strong> „Spezial“<br />
10.000 Euro<br />
in Zusammenarbeit mit „netzwerk recherche e. V.“<br />
drei Recherche-Stipendien von je<br />
5.000 Euro<br />
für Nachwuchsjournalisten<br />
den „Newcomerpreis“<br />
und für Medienprojekte<br />
den „Medienprojektpreis“<br />
2.000 Euro<br />
2.000 Euro<br />
Einsendeschluss: 31. Juli 2012<br />
Die Bewerbungsbögen mit allen erforderlichen Informationen erhalten Sie unter:<br />
www.otto-brenner-preis.de<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
E-mail: info@otto-brenner-preis.de<br />
Tel.: 069 / 6693 - 2576<br />
Fax: 069 / 6693 - 2786
Spendenkonten der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Die <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung ist die gemeinnützige Wissenschaftsstiftung der IG Metall mit Sitz in<br />
Frankfurt/Main. Als Forum für gesellschaftliche Diskurse und Einrichtung der Forschungsförderung<br />
ist sie dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet. Besonderes Augenmerk gilt dabei<br />
dem Ausgleich zwischen Ost und West.<br />
Sie ist zuletzt durch Bescheid des Finanzamtes Frankfurt/M. V-Höchst vom 6. Dezember <strong>2011</strong> als<br />
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig anerkannt worden.<br />
Aufgrund der Gemeinnützigkeit der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung sind Spenden steuerlich absetzbar<br />
bzw. begünstigt.<br />
Geben Sie bitte Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger an, damit wir Ihnen nach<br />
Eingang der Spende eine Spendenbescheinigung zusenden können oder bitten Sie in einem kurzen<br />
Schreiben an die Stiftung unter Angabe der Zahlungsmodalitäten um eine Spendenbescheinigung.<br />
Spenden erfolgen nicht in den Vermögensstock der Stiftung, sie werden ausschließlich für Projekte<br />
entsprechend des Verwendungszwecks genutzt.<br />
Bitte nutzen Sie folgende Spendenkonten<br />
Für Spenden mit zweckgebundenem Verwendungszweck zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung zu den Schwerpunkten:<br />
– Förderung der internationalen Gesinnung und des Völkerverständigungsgedankens<br />
Konto: 905 460 03 Konto: 161 010 000 0<br />
BLZ: 500 500 00 oder BLZ: 500 101 11<br />
Bank: HELABA Frankfurt/Main Bank: SEB Bank Frankfurt/Main<br />
Für Spenden mit zweckgebundenem Verwendungszweck zur Förderung von<br />
Wissenschaft und Forschung zu den Schwerpunkten:<br />
– Angleichung der Arbeits- und Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland<br />
(einschließlich des Umweltschutzes),<br />
– Entwicklung demokratischer Arbeitsbeziehungen in Mittel- und Osteuropa,<br />
– Verfolgung des Zieles der sozialen Gerechtigkeit.<br />
Konto: 905 460 11 Konto: 198 736 390 0<br />
BLZ: 500 500 00<br />
oder<br />
BLZ: 100 101 11<br />
Bank: HELABA Frankfurt/Main Bank: SEB-Bank Berlin<br />
Verwaltungsrat und Geschäftsführung der <strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung danken für die finanzielle<br />
Unterstützung und versichern, dass die Spenden ausschließlich für den gewünschten<br />
Verwendungszweck genutzt werden.<br />
188
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Brenner</strong> Stiftung<br />
Wilhelm-Leuschner-Str. 79<br />
60329 Frankfurt / Main<br />
Verantwortlich<br />
Jupp Legrand<br />
Redaktion<br />
Jan Burzinski, Jupp Legrand<br />
und Karin Scharf<br />
Fotonachweis<br />
Bild Katja Thimm: Ralf Baumgart;<br />
Fotos S. 11, 25, 118, 119 u. 153:<br />
Dany Hunger, Köln © OBS<br />
Artwork<br />
N. Faber de.sign, Wiesbaden<br />
Druck<br />
ColorDruck Leimen<br />
Redaktionsschluss<br />
5. März 2012
www.otto-brenner-preis.de<br />
www.otto-brenner-stiftung.de