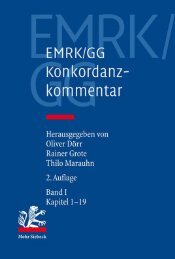Praxis und Politik - Michael Oakeshott im Dialog - Mohr Siebeck ...
Praxis und Politik - Michael Oakeshott im Dialog - Mohr Siebeck ...
Praxis und Politik - Michael Oakeshott im Dialog - Mohr Siebeck ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
POLITIKA<br />
herausgegeben von<br />
Rolf Gröschner <strong>und</strong> Oliver W. Lembcke<br />
8
<strong>Praxis</strong> <strong>und</strong> <strong>Politik</strong> –<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong><br />
herausgegeben von<br />
<strong>Michael</strong> Henkel <strong>und</strong> Oliver W. Lembcke<br />
<strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong>
<strong>Michael</strong> Henkel, geboren 1967; Studium der <strong>Politik</strong>wissenschaft, Soziologie, Rechtswissenschaft<br />
<strong>und</strong> Philosophie in Mainz <strong>und</strong> Bonn; 1997 Promotion; 2009 Habilitation; gegenwärtig<br />
Vertreter der Professur für Ethik, <strong>Politik</strong>, Rhetorik am Institut für <strong>Politik</strong>wissenschaft<br />
der Universität Leipzig.<br />
Oliver W. Lembcke, geboren 1969; Studium der <strong>Politik</strong>wissenschaft, Rechtswissenschaft <strong>und</strong><br />
Geschichte in Kiel <strong>und</strong> Cambridge/Mass.; 1995 Magister artium; 2004 Promotion; derzeit<br />
Vertretungsprofessur für Vergleichende Regierungslehre an der B<strong>und</strong>eswehr-Universität<br />
Hamburg.<br />
Redaktion: Anja Borkam<br />
ISBN 978-3-16-152522-3<br />
ISSN 1867-1349 (POLITIKA)<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio<br />
graphie; detaillierte bibliographische Daten sind <strong>im</strong> Internet über http://dnb.dnb.de<br />
abrufbar.<br />
© 2013 <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> Tübingen. www.mohr.de<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zust<strong>im</strong>mung des Verlags<br />
unzulässig <strong>und</strong> strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
<strong>und</strong> die Einspeicherung <strong>und</strong> Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen aus der Bembo gesetzt, auf alterungs beständiges<br />
Werkdruckpapier gedruckt <strong>und</strong> geb<strong>und</strong>en.
Einleitung der Herausgeber<br />
Als der englische Philosoph <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> nach einem langen Gelehrtenleben<br />
1990 starb, waren <strong>im</strong> englischen Sprachraum, in Osteuropa <strong>und</strong><br />
anderen Ländern des europäischen Kontinents erste Ansätze einer eingehenden<br />
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit seinem Werk erkennbar. 1<br />
Diese Diskussion konnte in den folgenden Jahren rasch an Breite <strong>und</strong> Tiefe<br />
gewinnen <strong>und</strong> hat mittlerweile die Forschungsliteratur beträchtlich anschwellen<br />
lassen. 2 Angesichts des Umstandes, daß <strong>Oakeshott</strong>s Arbeit vor<br />
allem in den beiden Jahrzehnten nach seinem Ausscheiden aus dem Universitätsbetrieb,<br />
also in den 1970er <strong>und</strong> 80er Jahren, kaum Beachtung gef<strong>und</strong>en<br />
hatte, stellt sich die Frage nach den Gründen hinter dem neuerwachten Interesse.<br />
Eine Erklärung dürfte in den mittel- <strong>und</strong> osteuropäischen Verfassungsdiskussionen<br />
der 1990er Jahre liegen, in denen sich die (bürgerlichen)<br />
Freiheitsbewegungen <strong>im</strong> Zuge der nationalen Selbstverständigung nach<br />
Ende des Ost-West-Konflikts westlichen Freiheitsdenkern wie Friedrich<br />
August von Hayek, Milton Friedman, Hannah Arendt oder auch <strong>Oakeshott</strong><br />
zuwandten – Gelehrten also, die den Totalitarismus <strong>und</strong> seine ideologischen<br />
Doktrinen bekämpft <strong>und</strong> sich die Verteidigung der Gr<strong>und</strong>lagen einer freien<br />
Gesellschaft <strong>und</strong> ihrer Verfassung der Freiheit zur Aufgabe gemacht hatten.<br />
Die Auswirkungen des welthistorischen Umbruchs blieben indes nicht auf<br />
Osteuropa beschränkt; angesichts neuer Herausforderungen kreisen auch<br />
die philosophischen <strong>und</strong> politiktheoretischen Debatten Westeuropas <strong>und</strong><br />
der USA um eine neuerliche Suche nach Orientierungspunkten ihrer politisch-kulturellen<br />
Identität. 3 In solchen Diskussionszusammenhängen erlangt<br />
das Werk <strong>Oakeshott</strong>s seinen Stellenwert für die Gegenwart der praktischen<br />
Philosophie wie der <strong>Politik</strong>wissenschaft, indem es über den Kontext des<br />
1<br />
Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die Gründung der international tätigen,<br />
in den USA registrierten <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> Association <strong>im</strong> Jahre 1999.<br />
2<br />
Siehe aus der angelsächsischen Literatur exemplarisch Abel 2010; Abel/Fuller 2005;<br />
McIntyre 2004; Perret 2004; Marsh 2001 sowie jüngst die Edition eines <strong>Oakeshott</strong>-Readers<br />
(Podoksik 2012). Zum mittel- <strong>und</strong> osteuropäischen Diskurs etwa Tibor 2002 <strong>und</strong><br />
Fulop 2000, 2004. Eine ungarische Übersetzung von <strong>Oakeshott</strong>s »Rationalism in Politics«<br />
erschien in Budapest <strong>im</strong> Jahre 2001; zur Rezeption in Spanien etwa Lopez Atanes<br />
2010, für Portugal Cardoso 2004.<br />
3<br />
Exemplarisch mag für die USA auf Huntington 2004, für Deutschland auf Lammert<br />
2006 hingewiesen werden.
VI<br />
Einleitung der Herausgeber<br />
Ost-West-Konfliktes <strong>und</strong> dessen ideologische Gr<strong>und</strong>lagen hinausführt <strong>und</strong><br />
Impulse zur Beantwortung aktueller Fragen liefert.<br />
<strong>Praxis</strong> <strong>und</strong> <strong>Politik</strong>: <strong>Oakeshott</strong>s Anliegen<br />
Das Anliegen <strong>Oakeshott</strong>s läßt sich in der Frage nach der Vernunft der <strong>Praxis</strong><br />
<strong>und</strong> der <strong>Praxis</strong> der Vernunft zusammenfassen. Es ist diese Frage, die seinem<br />
Werk zugr<strong>und</strong>e liegt. Im Ausgang früher Studien über die Modi der Erfahrung<br />
4 unternahm er es, die Eigenart menschlicher Rationalität auf den<br />
theoretischen Begriff zu bringen <strong>und</strong> setzte sich dabei vor allem auch mit<br />
der Frage nach Vernunft <strong>und</strong> Widervernunft in der modernen <strong>Politik</strong> auseinander.<br />
5 Ein wesentliches Resultat seiner Forschungen besteht unter anderem<br />
<strong>im</strong> Aufweisen des Umstandes, daß rationale <strong>Praxis</strong> den <strong>im</strong> ethischen<br />
Sinne humanen Umgang der Menschen miteinander ausmacht, während ein<br />
solcher Umgang stets gefährdet ist, wenn sich menschliche <strong>Praxis</strong> an theoretisch<br />
entwickelten Doktrinen <strong>und</strong> Ideologien orientiert: Der Versuch, das<br />
Zusammenleben der Menschen vorgefaßten Entwürfen unterzuordnen,<br />
läuft demnach Gefahr, den Respekt gegenüber der Wirklichkeit – <strong>und</strong> das<br />
heißt nicht zuletzt gegenüber der konkreten Person – zu verlieren.<br />
<strong>Oakeshott</strong> hat zeit seines Lebens Konzeptionen einer theoretisch best<strong>im</strong>mten<br />
<strong>Praxis</strong> – zumal vorbest<strong>im</strong>mten, geplanten <strong>und</strong> methodengeleiteten<br />
<strong>Praxis</strong> – mißtraut <strong>und</strong> ihnen die Einsicht gegenübergestellt, daß <strong>im</strong> Streben<br />
der Menschen <strong>und</strong> in der Organisation menschlichen Zusammenlebens<br />
das Verfügen über eine <strong>Praxis</strong>, »das Können« noch vor aller Zielsetzung <strong>und</strong><br />
Planung steht: Erst aus einem entsprechenden Können vermögen überhaupt<br />
Zielsetzungen <strong>und</strong> Problemformulierungen zu erwachsen. <strong>Oakeshott</strong> veranschaulicht<br />
dies unter anderem am Beispiel wissenschaftlicher <strong>Praxis</strong>, also<br />
anhand desjenigen Bereichs, der in besonderer Weise von Methodenbewußtsein<br />
<strong>und</strong> theoretisch-abstrakter Problemformulierung geprägt zu sein<br />
scheint:<br />
Man muß wissen, wie eine Aufgabe anzufassen ist (d. h. man muß schon in der Tätigkeit<br />
sein), bevor man sich auf eine best<strong>im</strong>mte Aufgabe einläßt. Die gleichen Voraussetzungen<br />
sind für die Formulierung einer Aufgabe notwendig. Eine besondere Handlung<br />
beginnt [. . .] niemals in ihrer Besonderheit, sondern <strong>im</strong>mer innerhalb gefestigter, spezifischer<br />
Verhaltensweisen oder der Tradition einer Tätigkeit. Wer nicht schon ein Wissenschaftler<br />
ist, kann nicht einmal ein wissenschaftliches Problem formulieren; vielmehr<br />
wird er etwas formulieren, was der Kenner sofort als ›unwissenschaftliches‹ Pro-<br />
4<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1933.<br />
5<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1975; <strong>Oakeshott</strong> 1962/1991a; <strong>Oakeshott</strong> 1996.
Einleitung der Herausgeber<br />
VII<br />
blem bezeichnet, weil es einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise nicht zugänglich<br />
ist. So sieht ein Kenner historischer Forschung die Frage ›War die Französische Revolution<br />
ein Fehler?‹ als unhistorische Frage an. 6<br />
Schon dieses Beispiel stellt klar, daß es bei <strong>Oakeshott</strong>s Überlegungen nicht<br />
allein darum geht, an die Unverzichtbarkeit alltagspraktischer Rationalität<br />
zu erinnern. 7 Seine Überlegungen reichen darüber hinaus <strong>und</strong> führen zu<br />
der Einsicht, »daß es sogar unmöglich ist, den Zweck einer Tätigkeit vor<br />
dieser selbst zu best<strong>im</strong>men« 8 – eine Provokation gerade für die politische <strong>Praxis</strong>,<br />
zu deren heute vorherrschendem Selbstverständnis die Aufgabe gehört,<br />
Pläne <strong>und</strong> Programme zu entwerfen <strong>und</strong> zu realisieren, um Teilbereiche der<br />
Gesellschaft (oder diese insgesamt) zu reformieren. Zugleich wird man jedoch<br />
kaum übersehen können, daß die Krise eines solchen technisch geprägten<br />
<strong>Politik</strong>verständnisses zum Aufleben neuerlicher Diskussionen um<br />
die praktische Vernunft beigetragen hat. Das Dilemma eines technischen<br />
Begriffs der <strong>Politik</strong> besteht <strong>im</strong> Kern darin, daß er von der Fülle der Realität<br />
absieht <strong>und</strong> absehen muß: So ist die Frage nach einem angemessenen Verständnis<br />
politischer <strong>Praxis</strong> <strong>im</strong>mer auch diejenige nach dem Verhältnis von<br />
(sozialer) Realität <strong>und</strong> <strong>Politik</strong>. Wer nur die Sachfragen der <strong>Politik</strong> in den<br />
Blick n<strong>im</strong>mt, verfehlt notwendig die personalen Bezüge, die mit der Sache<br />
stets verb<strong>und</strong>en sind. Jede Sache ist bekanntlich jemandes Sache – eine für<br />
jegliche Theorie der <strong>Politik</strong> zentrale Einsicht, die aber in den gegenwärtigen<br />
Theoriediskussionen nur selten reflektiert wird. Angesichts der Grenzen<br />
staatlicher Steuerung etwa des Arbeitsmarktes oder der sozialstaatlichen<br />
Umverteilung scheint jedoch eine selbstkritische Aufklärung der Realitätsgehalte<br />
der <strong>Politik</strong>, <strong>und</strong> zwar sowohl in der Theorie wie in der <strong>Praxis</strong>, geboten<br />
zu sein. 9 Einen Weg, die oftmals durch defizitäre politiktheoretische<br />
Konzepte aufgestellten Rationalitätsfallen technischer Allzuständigkeit zu<br />
vermeiden, weist <strong>Oakeshott</strong>s praktische Philosophie als Diagnose <strong>und</strong> Therapie<br />
des latenten Irrationalismus <strong>im</strong> Rationalismus.<br />
6<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1966c, S. 110 f.<br />
7<br />
Der zufolge man beispielsweise nicht dadurch schw<strong>im</strong>men lernt, daß man Bücher<br />
darüber liest, sondern nur: indem man ins Wasser geht <strong>und</strong> sich in die Tätigkeit des<br />
Schw<strong>im</strong>mens einübt.<br />
8<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1966c, S. 110.<br />
9<br />
Es ist vierzig Jahre her, daß man es für wert befand, die Frage nach der politischen<br />
Realität zum Gegenstand einer politiktheoretischen Diskussion zu machen: Auf der<br />
Tagung der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft von 1965 standen die<br />
Hauptreferate Eric Voegelins <strong>und</strong> Otto H. von der Gablentz’ unter dem Titel »Was ist<br />
politische Realität?« Allerdings vermochten es diese Beiträge nicht, eine tiefergehende<br />
Diskussion über die Sache anzustoßen.
VIII<br />
Einleitung der Herausgeber<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ist <strong>Oakeshott</strong> einerseits in die Reihe derjenigen<br />
liberalen Kritiker zu stellen, die in der Epoche zwischen 1945 <strong>und</strong> 1989 die<br />
despotischen Konsequenzen ideologischen Denkens anprangerten <strong>und</strong> von<br />
dieser Perspektive aus die Freiheit des Westens gegen ihre totalitäre Bedrohung<br />
verteidigten. Andererseits aber widmete er sich <strong>im</strong> Unterschied zu<br />
anderen liberalen Ideologiekritikern – wie seinem langjährigen Kollegen an<br />
der London School of Economics, Karl R. Popper – auch der Ambivalenz<br />
des modernen Liberalismus <strong>und</strong> des diesem zugr<strong>und</strong>e liegenden aufklärerischen<br />
Rationalismus. 10 Damit weist das Anliegen seiner praktischen Philosophie<br />
über die politischen Auseinandersetzungen der Zeit des Ost-West-<br />
Konfliktes hinaus: Gerade nach dem vermeintlichen historischen »Sieg« des<br />
Liberalismus werden die von <strong>Oakeshott</strong> stets klar benannten dogmatischen<br />
<strong>und</strong> illiberalen Tendenzen offenk<strong>und</strong>ig, die sich in Phänomenen wie dem<br />
wirtschaftsliberalen Doktrinarismus äußern, der sich gegen jede Kritik zu<br />
<strong>im</strong>munisieren sucht. 11<br />
Einer in solchen Erscheinungen zum Ausdruck kommenden Ideologie der<br />
Freiheit stand <strong>Oakeshott</strong> nicht weniger skeptisch gegenüber als anderen<br />
Ideologien. Er setzte ihr eine Besinnung auf die praktische Ratio, auf den<br />
»ges<strong>und</strong>en Menschenverstand« entgegen, dessen Rationalität nicht-doktrinär<br />
<strong>und</strong> daher geeignet ist, den Selbstverständnissen konkreter Menschen<br />
ebenso gerecht zu werden wie den Gegebenheiten der jeweiligen Situation.<br />
Es ist nicht zuletzt dieses Programm – die Reformulierung des Konzeptes<br />
praktischer Rationalität –, das in den zwei Jahrzehnten seit seinem Tode zu<br />
dem angesprochenen Interesse an <strong>Oakeshott</strong>s Denken geführt hat.<br />
<strong>Oakeshott</strong>-Rezeption in Deutschland<br />
Während <strong>Oakeshott</strong>s Werk in der englischsprachigen Welt <strong>und</strong> anderswo<br />
diskutiert wird, sind seine Schriften in Deutschland bisher nur einer kleinen<br />
wissenschaftlichen Gemeinde vertraut. Zunächst war es Wilhelm Hennis,<br />
der sich um die Publikation von Arbeiten <strong>Oakeshott</strong>s in deutscher Übersetzung<br />
verdient gemacht hat, so in den 1960er Jahren mit »Rationalism in<br />
Politics« 12 als der bekanntesten Untersuchung sowie mit der einige Zeit spä-<br />
10<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991b.<br />
11<br />
Die Tendenz der Auto<strong>im</strong>munisierung liberaler Gesellschaft ist vor allem von Derrida<br />
2006 in den letzten Jahren zum Thema gemacht worden; eine Sichtweise, die jener<br />
<strong>Oakeshott</strong>s nicht unähnlich ist.<br />
12<br />
Siehe <strong>Oakeshott</strong> 1966a. Die dieser Übertragung zugr<strong>und</strong>e liegende Aufsatzsamm-
Einleitung der Herausgeber<br />
IX<br />
ter folgenden Studie über »Faith and Scepticism«. 13 In seinen eigenen Arbeiten<br />
bezog sich Hennis gelegentlich auf <strong>Oakeshott</strong>, doch blieb der englische<br />
Denker sowohl in der deutschen <strong>Politik</strong>wissenschaft wie auch in der Philosophie<br />
eine kaum wahrgenommene Randfigur. Immerhin hat in den letzten<br />
Jahren eine intensivere Rezeption eingesetzt; sie vollzieht sich jedoch – verglichen<br />
etwa mit jener in Mittel- <strong>und</strong> Osteuropa – nach wie vor langsam:<br />
Zu den wenigen Arbeiten in deutscher Sprache zählen aus jüngerer Zeit die<br />
von Becker, Henkel, Schmidt <strong>und</strong> monographisch nunmehr Kinzel sowie<br />
Kapetanovic. 14<br />
Daß <strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong> die internationale <strong>Oakeshott</strong>-Forschung hierzulande<br />
bisher wenig Resonanz finden, ist besonders irritierend angesichts der Tatsache,<br />
daß über das Erbe totalitärer Reg<strong>im</strong>e gerade <strong>im</strong> deutschsprachigen<br />
Raum nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft ausführlich<br />
diskutiert wurde <strong>und</strong> wird. Aber weder in diesen Diskursen mit<br />
ihrem Schwerpunkt Anfang bis Mitte der 1990er Jahre noch in den anschließenden<br />
Kontroversen über die Selbstverständigung liberaler Verfassungsstaatlichkeit<br />
<strong>und</strong> republikanischer Gemeinschaftlichkeit taucht <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Name auf. Es scheint, als werde er, wenn überhaupt, so vornehmlich<br />
als Ideologiekritiker, namentlich als Kritiker sozialistischer <strong>Politik</strong> betrachtet,<br />
dessen Denken auf den Zusammenhang der sozialistischen Nachkriegspolitik<br />
des Vereinigten Königreichs bzw. auf geistesgeschichtliche Kontexte<br />
des Ost-West-Konfliktes bezogen bleibe. Daß die aktuellen Aspekte seines<br />
Denkens in einer solchen Interpretation weithin ausgeblendet werden, liegt<br />
auf der Hand. Dabei sind es gerade jene Schlüsselthemen, um die <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Denken kreist, die hierzulande gegenwärtig intensiv diskutiert werden – sowohl<br />
in der <strong>Politik</strong>wissenschaft als auch in der Philosophie: Das neuerliche<br />
Interesse an praktischer Vernunft, mittlerweile sogar wieder als »Klugheit«<br />
bezeichnet, ist kaum zu übersehen; davon zeugen die gleichnamigen Veröffentlichungen<br />
wie etwa die Habilitationsschrift von Luckner <strong>und</strong> ein von<br />
Wolfgang Kersting herausgegebener Sammelband 15 ebenso wie die Tagungen<br />
der staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Erfurt zum<br />
Thema »Kluges Entscheiden« 16 oder die zahlreichen Studien, die sich der<br />
lung <strong>Oakeshott</strong> 1962 erschien in einer erweiterten Ausgabe <strong>im</strong> Jahre 1991 (<strong>Oakeshott</strong><br />
1991a).<br />
13<br />
Siehe <strong>Oakeshott</strong> 2000. Hennis 2000 verfaßte für diese Ausgabe ein Vorwort. Siehe<br />
zum Buch Bahners 2000.<br />
14<br />
Becker 2002; Henkel 2004; Schmidt 2007; Kinzel 2007; Kapetanovic 2010. Zuvor<br />
stand die Dissertation von Starp 1993 lange allein auf weiter Flur.<br />
15<br />
Luckner 2005; Kersting 2005.<br />
16<br />
Scherzberg 2006.
X<br />
Einleitung der Herausgeber<br />
praktischen Urteilskraft 17 , vor allem in kantischer Tradition zuwenden 18 .<br />
Was hier insgesamt zur Sprache gebracht wird, geht deutlich über das vor<br />
r<strong>und</strong> vierzig Jahren noch eher defensiv vorgetragene Anliegen hinaus, die<br />
praktische Philosophie zu »rehabilitieren«. 19 Mittlerweile ist mit Händen zu<br />
greifen 20 , daß Probleme des gelingenden Zusammenlebens nicht technizistisch<br />
verengt werden dürfen, sondern nur von einer praktischen Ratio bewältigt<br />
werden können, die vor den komplexen Zusammenhängen der Bereiche<br />
<strong>Politik</strong>, Recht <strong>und</strong> Ethik nicht zurückscheut. 21 Und es dürfte ebenfalls<br />
klar sein, daß einer solchen Ratio nur in einem interdisziplinären, wenn<br />
nicht transdisziplinären Zusammengehen der unterschiedlichen Wissenschaften<br />
auf die Spur zu kommen ist. Die Perspektiven <strong>und</strong> Erkenntnisse,<br />
die das Werk <strong>Oakeshott</strong>s für die angesprochenen Diskussionen bietet, werden<br />
in den hier vorgelegten Beiträgen sichtbar.<br />
Die <strong>im</strong> deutschsprachigen Raum mangelnde Resonanz auf <strong>Oakeshott</strong> befremdet<br />
noch aus einem zweiten Gr<strong>und</strong>: Seit längerer Zeit ist der deutsche<br />
Idealismus Gegenstand eines intensiven internationalen philosophischen Interesses<br />
gerade auch in den angelsächsischen Ländern, die dem Idealismus<br />
traditionell mit einer gewissen Skepsis begegnen. Doch während sich dieser<br />
Diskurs dort keineswegs auf die deutschen Klassiker beschränkt, sondern<br />
besonders auch die Vertreter des Britischen Idealismus von Thomas Hill<br />
Green <strong>und</strong> Francis Herbert Bradley über Edward Caird <strong>und</strong> Bernard Bosanquet<br />
bis hin zu John Ellis McTaggart <strong>und</strong> John H. Muirhead in den Fokus<br />
ihrer Forschung gerückt hat 22 , blendet man <strong>im</strong> »Mutterland« des modernen<br />
Idealismus diesen Zweig der jüngeren Philosophiegeschichte nahezu vollständig<br />
aus – ein Phänomen, in dem vielleicht lange gepflegte Vorbehalte<br />
gegenüber der angelsächsischen Philosophie nachwirken. Öffnete sich die<br />
deutsche Diskussion um den Idealismus gegenüber dessen englischsprachigen<br />
Vertretern, so geriete auch von dieser Perspektive aus das Werk <strong>Oakeshott</strong>s<br />
in den Blick. Dessen Denken läßt sich zwar nicht ohne weiteres als<br />
idealistisch qualifizieren, <strong>und</strong> er selbst hätte eine entsprechende Einordnung<br />
vermutlich skeptisch betrachtet. Gleichwohl steht er unzweifelhaft in der<br />
17<br />
Z. B. Rodi 2003; Enskat 2006.<br />
18<br />
Z. B. Wieland 2001.<br />
19<br />
Riedel 1972/74.<br />
20<br />
Siehe etwa vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer Bestandsaufnahme zur Entwicklung des<br />
deutschen Parteiensystems die Hinweise bei Walter 2008, S. 252 f.<br />
21<br />
Z. B. Koller 2005.<br />
22<br />
So sind etwa in den vergangenen Jahren von Peter Nicholson eine erweiterte Neuausgabe<br />
der Werke T. H. Greens oder von William Sweet erstmals eine Gesamtausgabe<br />
der Schriften Bernard Bosanquets besorgt worden. Für die Forschung zum Britischen<br />
Idealismus siehe exemplarisch Nicholson 1990; Sweet 2010 oder Mander 2011.
Einleitung der Herausgeber<br />
XI<br />
Tradition des Britischen Idealismus <strong>und</strong> wird keineswegs zu Unrecht als<br />
Vertreter einer dritten Generation Britischer Idealisten genannt. 23<br />
Mit den Britischen Idealisten teilt <strong>Oakeshott</strong> unter anderem ein Interesse<br />
an der deutschen Philosophie des ausgehenden 18. <strong>und</strong> frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
insbesondere an Hegel. Ein solches Interesse ist für die angelsächsischen<br />
Denktraditionen keineswegs selbstverständlich. Indes hat es bei <strong>Oakeshott</strong><br />
bewirkt, daß er in der Zwischenkriegszeit in Deutschland studierte<br />
<strong>und</strong> sich gründlich mit dem deutschen Geistesleben <strong>und</strong> seiner Geschichte<br />
auseinandersetzte. So kann es nicht verw<strong>und</strong>ern, daß sich in seinem Werk,<br />
das so sehr dem britischen Denken verhaftet ist, ein meist <strong>im</strong>pliziter, bisweilen<br />
aber auch expliziter <strong>Dialog</strong> mit deutschen Denktraditionen identifizieren<br />
läßt. Ein Resultat dieses <strong>Dialog</strong>s besteht in zahlreichen, bisweilen verblüffenden<br />
Übereinst<strong>im</strong>mungen mit den Überlegungen deutschsprachiger<br />
Denker. Und dies gilt insbesondere mit Blick auf seine Konzeption des Charakters<br />
praktischer Vernunft.<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong><br />
In einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten konvergieren <strong>Oakeshott</strong>s Arbeiten<br />
mit dem für die deutsche Philosophie einflußreichen Denken, das<br />
sich insbesondere mit den Namen Hans-Georg Gadamer <strong>und</strong> Hannah<br />
Arendt, ferner Martin Heidegger, Georg S<strong>im</strong>mel, Friedrich A. von Hayek<br />
sowie – mit einigen Abstrichen – auch Leo Strauss verbindet; allesamt deutsche<br />
bzw. deutschstämmige Gelehrte, deren Werk in der Diskussion um die<br />
praktische Philosophie hierzulande seit einigen Jahren einen Zuwachs an<br />
Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Beiträge <strong>im</strong> zweiten Teil des vorliegenden<br />
Bandes nehmen diese Beziehungen in den Blick <strong>und</strong> gehen daran, die<br />
inhaltlichen Konvergenzen, aber auch Unterschiede nachzuzeichnen. Diese<br />
Betrachtungen, die <strong>Oakeshott</strong> gewissermaßen in einen deutsch-englischen<br />
<strong>Dialog</strong> stellen, ermöglichen zugleich einen systematischen Zuschnitt der<br />
Frage nach der Tragfähigkeit <strong>und</strong> Reichweite einer Theorie der <strong>Praxis</strong>, namentlich<br />
einer Theorie der politischen <strong>Praxis</strong>.<br />
Dementsprechend zielen auch die vergleichenden geisteswissenschaftlichen<br />
Beiträge in kritisch-konstruktiver Absicht auf systematische Aspekte,<br />
die <strong>im</strong> ersten Teil behandelt werden. Es geht um eine Verständigung darüber,<br />
ob <strong>und</strong> inwieweit Spielräume für einen nicht technisch verstandenen<br />
<strong>Politik</strong>begriff in der Moderne bestehen <strong>und</strong> in dieser Perspektive um das<br />
23<br />
Sweet 2009, S. 12 ff.
XII<br />
Einleitung der Herausgeber<br />
Ausloten der Möglichkeiten eines wissenschaftlichen Austausches über vortheoretische<br />
Praktiken. Insoweit geraten Begriffe <strong>und</strong> Konzepte des Modus,<br />
der Erfahrung <strong>und</strong> der Klugheit in den Blick, die bei <strong>Oakeshott</strong> eine gewichtige<br />
Rolle spielen. Dabei erweist sich auch <strong>Oakeshott</strong>s Sichtweise auf<br />
die Ästhetik als fruchtbar für das Verstehen von Angemessenheit <strong>im</strong> Denken<br />
<strong>und</strong> Handeln.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der systematischen <strong>und</strong> geistesgeschichtlichen Beiträge<br />
konzentriert sich der dritte Teil des Bandes auf einige der, aus <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Blickwinkel betrachtet, zentralen Herausforderungen für ein gelingendes<br />
Zusammenleben <strong>im</strong> 21. Jahrh<strong>und</strong>ert. Dazu gehören etwa Fragen<br />
nach den Voraussetzungen eines angemessenen Bürgerverständnisses in einer<br />
liberalen Gesellschaft ebenso wie Fragen nach dem Schicksal von Macht<br />
<strong>und</strong> Autorität in Gesellschaften, in denen die Individualisierung progressiv<br />
voranschreitet <strong>und</strong> sich <strong>im</strong>mer mehr Menschen nicht mehr für gemeinsame<br />
Belange zu interessieren scheinen. Auch verdient Beachtung, welche Bedeutung<br />
dem Krieg für moderne liberale Gesellschaften aus <strong>Oakeshott</strong>s Perspektive<br />
beizumessen ist.<br />
Auf diese Weise wird <strong>Oakeshott</strong>s Werk in einen <strong>Dialog</strong> um Gegenwartsfragen<br />
der <strong>Politik</strong>wissenschaft <strong>und</strong> der praktischen Philosophie gestellt, in<br />
einen <strong>Dialog</strong> indessen, der letztlich über die Wissenschaft <strong>und</strong> den akademischen<br />
Diskurs hinausweist: Eine humane <strong>Praxis</strong> <strong>im</strong> Zusammenleben <strong>und</strong><br />
eine <strong>Politik</strong>, die sich <strong>im</strong>mer wieder neu um einen angemessenen Rahmen<br />
für eine solche <strong>Praxis</strong> bemüht, sind praktische Anliegen, die jede Bürgerin<br />
<strong>und</strong> jeden Bürger – <strong>und</strong> damit auch die <strong>im</strong> Verfassungsstaat politisch Verantwortlichen<br />
– betreffen. Insofern geht es um den bürgerschaftlichen <strong>Dialog</strong>.<br />
In Deutschland war <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>s St<strong>im</strong>me in diesem <strong>Dialog</strong> bisher<br />
kaum zu vernehmen. Es ist die Absicht des vorliegenden Bandes, ihr<br />
Gehör zu verschaffen <strong>und</strong> damit zugleich einschlägige deutsche Debatten<br />
mit einer international geführten Diskussion zu verknüpfen.<br />
Der vorliegende Sammelband wurde angeregt durch eine Tagung über<br />
»<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> on Ethics and Reason«, die die Herausgeber <strong>im</strong> Dezember<br />
2007 für das Hellmuth-Loening-Zentrum für Staatswissenschaften e. V.<br />
in Jena veranstalteten <strong>und</strong> an der Wissenschaftler aus elf Nationen teilnahmen.<br />
Die Tagung wurde von der Fritz Thyssen Stiftung Köln großzügig<br />
finanziell gefördert, wofür wir an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.
Einleitung der Herausgeber<br />
XIII<br />
Literatur<br />
Abel, Corey (Hrsg.) (2010): The Meanings of <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>’s Conservatism. Exeter<br />
u. a.<br />
Abel, Corey/Fuller, T<strong>im</strong>othy (Hrsg.) (2005): The Intellectual Legacy of <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>.<br />
Exeter u. a.<br />
Bahners, Patrick (2000): Übern<strong>im</strong>m dich nur nicht, Onkel Staat. <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>s<br />
ungläubige <strong>Politik</strong>. In: FAZ vom 17. 10. 2000.<br />
Becker, <strong>Michael</strong> (2002): Die Politische Theorie des Konservativismus: <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>.<br />
In: Brodocz, André/Schaal, Gary S. (Hrsg.): Politische Theorien der Gegenwart.<br />
Bd. I. Opladen, S. 221–251.<br />
Cardoso, Catarina Figueiredo (2004): A Filosofia Politica de <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>. Da Conduta<br />
Humano ao Estado. Lissabon.<br />
Derrida, Jacques (2006): Schurken. Zwei Essays über die Vernunft. Übersetzt von Horst<br />
Brühmann. Frankfurt a. M.<br />
Enskat, Rainer (2006): Bedingungen der Aufklärung. Philosophische Untersuchungen<br />
zu einer Aufgabe der Urteilskraft. Weilerswist.<br />
Fulop, Endre (2000): The Meaning of Traditionalism. Hayek, Cecil and <strong>Oakeshott</strong> on<br />
Conservatism. In: Valóság 43, S. 1–11.<br />
Ders. (2004): Argument, Disput, and Conversation. <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> and the Possibility<br />
of Persuasion in Politics. In: Világosság 44, S. 71–74.<br />
Grant, Robert (1990): <strong>Oakeshott</strong>. London.<br />
Hayek, Friedrich A. von (1996): Die verhängnisvolle Anmaßung. Die Irrtümer des Sozialismus.<br />
Tübingen.<br />
Henkel, <strong>Michael</strong> (2004): Vom Sinn einer philosophischen Theorie der <strong>Politik</strong>. Bemerkungen<br />
zum Theoriebegriff bei Hans Buchhe<strong>im</strong> <strong>und</strong> <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>. In: Politisches<br />
Denken. Jahrbuch, S. 167–187.<br />
Hennis, Wilhelm (2000): Vorwort. In: <strong>Oakeshott</strong>, <strong>Michael</strong>: Zuversicht <strong>und</strong> Skepsis.<br />
Zwei Prinzipien neuzeitlicher <strong>Politik</strong>. Übersetzt von Christiana Goldmann. Hrsg.<br />
von T<strong>im</strong>othy Fuller. Berlin, S. 7–14.<br />
Huntington, Samuel P. (2004): Who Are We? The Challenges to America’s National<br />
Identity. New York u. a.<br />
Kapetanovic, Pit (2010): Intellektuelle Abenteuer. Philosophie, Geschichte <strong>und</strong> Erziehung<br />
bei <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>. Hamburg.<br />
Kersting, Wolfgang (Hrsg.) (2005): Klugheit. Weilerswist.<br />
Kinzel, Till (2007): <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>. Philosoph der <strong>Politik</strong>. Schnellroda.<br />
Koller, Peter (2005): Klugheit, praktische Vernunft <strong>und</strong> Moral. In: Byrd, Sharon/Joerden,<br />
Jan C. (Hrsg.): Philosophia practica universalis. Festschrift für Joach<strong>im</strong> Hruschka<br />
zum 70. Geburtstag. Berlin, S. 221–235.<br />
Lammert, Norbert (2006): Verfassung, Patriotismus, Leitkultur. Was unsere Gesellschaft<br />
zusammenhält. Hamburg.<br />
López Atanes, Francisco Javier (2010): Conducta humana y sociedad civil. Introduccion a<br />
la filosofia politica de M. <strong>Oakeshott</strong>. Madrid.<br />
Luckner, Andreas (2005): Klugheit. Berlin u. a.<br />
Mander, William J. (2011): British Idealism. A History. Oxford u. a.<br />
Marsh, Leslie (Hrsg.) (2001): <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> Philosopher. A Commemoration of the<br />
Centenary of <strong>Oakeshott</strong>’s Birth. London.
XIV<br />
Einleitung der Herausgeber<br />
McIntyre, Kenneth B. (2004): The L<strong>im</strong>its of Political Theory. <strong>Oakeshott</strong>’s Philosophy of<br />
Civil Association. Exeter u. a.<br />
Nicholson, Peter P. (1990): The Political Philosophy of the British Idealists. Selected Studies.<br />
Cambridge u. a.<br />
<strong>Oakeshott</strong>, <strong>Michael</strong> (1933): Experience and Its Modes. Cambridge.<br />
Ders. (1962): Rationalism in Politics and Other Essays. London u. a.<br />
Ders. (1966a): Rationalismus in der <strong>Politik</strong>. Neuwied u. a.<br />
Ders. (1966b): Der Turm zu Babel. In: Ders.: Rationalismus in der <strong>Politik</strong>. Neuwied<br />
u. a., S. 69–89.<br />
Ders. (1966c): Rationales Verhalten. In: Ders.: Rationalismus in der <strong>Politik</strong>. Neuwied<br />
u. a., S. 91–121.<br />
Ders. (1975): On Human Conduct. Oxford u. a.<br />
Ders. (1991a): Rationalism in Politics and Other Essays. Neuauflage. Indianapolis.<br />
Ders. (1991b): Rationalism in Politics. In: Ders.: Rationalism in Politics and Other Essays.<br />
Neuauflage. Indianapolis, S. 5–42.<br />
Ders. (1996): The Politics of Faith and the Politics of Scepticism. New Haven u. a.<br />
Ders. (2000): Zuversicht <strong>und</strong> Skepsis. Zwei Prinzipien neuzeitlicher <strong>Politik</strong>. Übersetzt<br />
von Christiana Goldmann. Hrsg. von T<strong>im</strong>othy Fuller. Berlin.<br />
Perret, Quentin (2004): <strong>Oakeshott</strong>. Le scepticisme en politique. Paris.<br />
Podoksik, Efra<strong>im</strong> (Hrsg.) (2012): The Cambridge Companion to <strong>Oakeshott</strong>. Cambridge<br />
u. a.<br />
Riedel, Manfred (Hrsg.) (1972/74): Rehabilitierung der praktischen Philosophie. 2 Bde.<br />
Freiburg i. B.<br />
Rodi, Frithjof (Hrsg.) (2003): Urteilskraft <strong>und</strong> Heuristik in den Wissenschaften. Beiträge<br />
zur Entstehung des Neuen. Weilerswist.<br />
Scherzberg, Arno (Hrsg.) (2006): Kluges Entscheiden. Disziplinäre Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> interdisziplinäre<br />
Verknüpfungen. Tübingen.<br />
Schmidt, Rainer (2007): Das perfekte System? <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> über die Pferderennbahn<br />
als Schule des Politischen. In: Berliner Debatte Initial 17, S. 103 ff.<br />
Starp, Oliver M. (1993): Politischer Skeptizismus oder In den Untiefen des Idealismus<br />
von <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>. Diss. Mannhe<strong>im</strong>.<br />
Sweet, William (2009): Introduction. Idealism, Ethics, and Social and Political Thought.<br />
In: Ders. (Hrsg.): The Moral, Social and Political Philosophy of the British Idealists.<br />
Exeter u. a., S. 1–30.<br />
Ders. (Hrsg.) (2010): Biographical Encyclopedia of British Idealism. London u. a.<br />
Tibor, Mandi (2002): <strong>Oakeshott</strong> és Hayek. A modern konzervativizmus Janus-arca. In:<br />
<strong>Politik</strong>atudományi Szemle 3–4, S. 199–212.<br />
Walter, Franz (2008): Baustelle Deutschland. <strong>Politik</strong> ohne Lagerbindung. Frankfurt<br />
a. M.<br />
Wieland, Wolfgang (2001): Urteil <strong>und</strong> Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft. Göttingen.
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort der Herausgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
V<br />
Martyn P. Thompson<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung . . . 1<br />
Vernünftige <strong>Praxis</strong> <strong>im</strong> Denken <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Judith A. Swanson<br />
Prudence and Human Conduct.<br />
A Comparison of Aristotle and <strong>Oakeshott</strong> . . . . . . . . . . . . . 21<br />
Wendell John Coats, Jr.<br />
Practical Implications of <strong>Oakeshott</strong>’s Poetic Conception<br />
of Human Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
Josiah Lee Auspitz<br />
Deciding versus Choosing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
Rainer Schmidt<br />
Schildkröten <strong>und</strong> Heublumen.<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>s Rationalismuskritik <strong>im</strong> Vergleich<br />
mit Hannah Arendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
Silviya Lechner<br />
Morality and History in <strong>Oakeshott</strong>’s System of Ideas . . . . . . . . 77<br />
<strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong> die praktische Philosophie in Deutschland<br />
Efra<strong>im</strong> Podoksik<br />
From Difference to Fragmentation.<br />
<strong>Oakeshott</strong>, S<strong>im</strong>mel and Worlds of Experience . . . . . . . . . . . 97
XVI<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Michael</strong> Großhe<strong>im</strong><br />
Das Pr<strong>im</strong>at der <strong>Praxis</strong> <strong>und</strong> die Grenzen der Theorie.<br />
<strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong> Heidegger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119<br />
<strong>Michael</strong> Becker<br />
Überlegen – Überzeugen – Überreden.<br />
Sprache <strong>und</strong> <strong>Politik</strong> bei <strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong> Arendt . . . . . . . . . . . 141<br />
<strong>Michael</strong> Henkel/Oliver W. Lembcke<br />
<strong>Oakeshott</strong>s unplatonische Moderne <strong>und</strong> der politische Platonismus<br />
bei Voegelin <strong>und</strong> Strauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />
Kenneth B. McIntyre<br />
Prejudice, Tradition, and the Critique of Ideology.<br />
Gadamer and <strong>Oakeshott</strong> on Practical Reason . . . . . . . . . . . . 177<br />
Hans Jörg Hennecke<br />
Konservative Erfahrung <strong>und</strong> liberale Evolution.<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong> Friedrich August von Hayek . . . . . . . . 201<br />
Herausforderungen der Moderne in <strong>Oakeshott</strong>scher Perspektive<br />
Bart van Klink/Oliver W. Lembcke<br />
What Rules the Rule of Law?<br />
A Comparison between <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong> and Hans Kelsen . . . . 225<br />
Suvi Soininen<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Freedom, State and Politics . . . . . . . . . . 247<br />
Steven A. Gerencser<br />
Civis or Gentleman?<br />
Personae in the Civil Condition as Liberal Democracy . . . . . . . 265<br />
Peter Finn<br />
The Challenge of War and Emergency to Nomocracy<br />
in <strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>’s Political Thought . . . . . . . . . . . . . 283<br />
Jürgen Gebhardt<br />
Politische Philosophie <strong>im</strong> »Zeitalter der Extreme« . . . . . . . . . 301
Inhaltsverzeichnis<br />
XVII<br />
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319<br />
Anliegen der Reihe POLITIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
Martyn P. Thompson<br />
Die in diesem Band gesammelten Aufsätze <strong>und</strong> die Konferenz in Jena <strong>im</strong><br />
Dezember 2007, für die sie ursprünglich gedacht waren, eröffnen ein neues<br />
<strong>und</strong> wichtiges Kapitel der kritischen Rezeption des Werkes von <strong>Michael</strong><br />
Oake shott. Wie es der Zufall wollte, fiel die Konferenz in Jena zeitlich mit<br />
der Publikation der ersten Monographie zusammen, die sich in deutscher<br />
Sprache ausschließlich mit <strong>Oakeshott</strong>s politischer Philosophie auseinandersetzt.<br />
Till Kinzels erhellende Arbeit »<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Philosoph der <strong>Politik</strong>«<br />
wurde ungefähr vierzig Kilometer von Jena entfernt in Schnellroda<br />
veröffentlicht. Es mag Zufall sein, daß diese Ereignisse <strong>im</strong> Herzen Mitteleuropas<br />
stattfanden, aber diese Lage ist symbolträchtig. Sie unterstreicht<br />
nämlich, wie eng <strong>Oakeshott</strong>s Denken mit den großen deutschen intellektuellen<br />
<strong>und</strong> kulturellen Traditionen verwoben ist, die mit Jena <strong>und</strong> We<strong>im</strong>ar<br />
assoziiert werden. Hätte <strong>Oakeshott</strong> Zeuge der Konferenz in Jena <strong>und</strong> der<br />
Veröffentlichung von Kinzels Buch werden können, hätte er vielleicht so<br />
etwas wie den Beginn einer »intellektuellen He<strong>im</strong>kehr« empf<strong>und</strong>en. Denn<br />
beides, die Jenaer Tagung <strong>und</strong> Kinzels Buch, verfolgen die Absicht, <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Denken der <strong>Politik</strong>wissenschaft <strong>und</strong> der Philosophie in Deutschland<br />
näher zu bringen <strong>und</strong> darüber hinaus einige seiner wichtigsten philosophischen<br />
Wurzeln zu entdecken <strong>und</strong> herauszuarbeiten. Aber vielleicht hätte er<br />
sich auch einen ganz anderen Re<strong>im</strong> auf die Dinge gemacht. So war der<br />
Mann: Man konnte nie voraussagen, was er sagen würde, gleichgültig bei<br />
welchem Anlaß.<br />
Es besteht kein Zweifel darüber, daß <strong>Oakeshott</strong>s Bew<strong>und</strong>erung für Hegel,<br />
die deutsche Romantik <strong>und</strong> die deutsche Klassik weit zurückreichte.<br />
Seine erste Begegnung mit Hegel hatte er bereits als Schuljunge. Öfter,<br />
selbst noch in unserem letzten Briefwechsel hat er darüber gesprochen, wie<br />
lebhaft seine Erinnerungen an seine Studienzeit in Deutschland, besonders<br />
in Tübingen, noch <strong>im</strong>mer seien. Dort hatte er sich Mitte der 1920er Jahre<br />
die Hegel-Ausgabe von Georg Lasson gekauft; dort hat er Hölderlin, Goethe,<br />
Schiller <strong>und</strong> Novalis gelesen, <strong>und</strong> zwar besonders an Sonntagen, während<br />
er durch die Wälder <strong>und</strong> Dörfer r<strong>und</strong> um Tübingen wanderte.
2 Martyn P. Thompson<br />
Ich weiß nicht, ob er in Hegels Fußstapfen trat <strong>und</strong> nach Jena reiste. Aber<br />
es kann kein Zweifel daran bestehen, daß er Jena ebenso w<strong>und</strong>ervoll gef<strong>und</strong>en<br />
hätte, wie das Tübingen der 1920er Jahre, über das er in einem seiner<br />
Briefe schrieb: Es war »ein Ort außerhalb der Welt, nur Philosophie <strong>und</strong><br />
Theologie«. Dennoch wurden Tübingen, Jena <strong>und</strong> all die anderen w<strong>und</strong>erbaren<br />
»Nicht-von-dieser-Welt-Orte« unaufhaltsam Teil dieser Welt. Sie alle<br />
erlagen (manche mehr, manche weniger) dem unerbittlichen Druck der<br />
Modernisierung <strong>und</strong> Innovation. <strong>Oakeshott</strong>s Liebe zu ihnen schwand folglich.<br />
In seiner Erinnerung aber blieben sie so lebhaft wie damals. Doch er<br />
empfand vielleicht leidenschaftlicher als die meisten anderen einen tiefen<br />
Verlust, als sich die von ihm so geschätzte Vertrautheit der Welt unweigerlich<br />
in etwas anderes verwandelte, etwas Neues. Gelegentlich wurde er bei<br />
diesen Erinnerungen etwas sent<strong>im</strong>ental, doch war da selbstverständlich<br />
mehr als Sent<strong>im</strong>entalität.<br />
Im Sinne einer Hinführung zum ernsthaften Studium der Ideen <strong>Oakeshott</strong>s<br />
möchte ich einige Aspekte ansprechen, die mir für das Denken von<br />
<strong>Oakeshott</strong> bedeutsam erscheinen; <strong>und</strong> ich werde dabei versuchen, verschiedene<br />
Mißverständnisse aufzuklären, die sowohl bei Fre<strong>und</strong>en als auch bei<br />
Gegnern zu Fehlinterpretationen geführt haben.<br />
I.<br />
Zunächst geht es mir um die Natur des oft genannten <strong>Oakeshott</strong>schen<br />
»Konservativismus«. Viele, die von <strong>Oakeshott</strong> gehört (ihn aber nie sorgfältig<br />
gelesen) haben, glauben, daß sein gesamtes Œuvre einer politisch konservativen<br />
Ausrichtung verpflichtet sei. So ist es beispielsweise üblich geworden,<br />
<strong>Oakeshott</strong> für seine philosophische Gr<strong>und</strong>lagenarbeit zu loben oder zu tadeln,<br />
die er angeblich parteipolitischen Konzepten wie beispielsweise Margaret<br />
Thatchers »Konservativismus« angedient hätte. Das ist Unfug. Viel<br />
wurde auch darüber geschrieben, ob man <strong>Oakeshott</strong> als Konservativen oder<br />
als Liberalen klassifizieren solle, ob er ein Verteidiger oder ein Gegner der<br />
repräsentativen Demokratie sei, ob man ihn als Republikaner bezeichnen<br />
könne, ob er die <strong>Politik</strong> des »Austarierens« (tr<strong>im</strong>ming) vertreten habe usw.<br />
Aber all diese Spekulationen lenken von der eigentlichen Bedeutung seines<br />
Werkes eher ab – <strong>und</strong> verdunkeln die Sache mehr, als sie zu erhellen. Demgegenüber<br />
gilt es, zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen verfehlte<br />
Sichtweisen namhaft zu machen: Es ist erstens irrig, daß der politische Konservativismus<br />
sein gesamtes Denken durchdrungen habe; <strong>und</strong> es ist zweitens<br />
ebenso falsch, daß die Essenz seiner Arbeit in einer konservativen Kritik der
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
3<br />
Moderne bestehe. Ich werde auf beide Sichtweisen eingehen, indem ich das<br />
erläutere, was er über Konservativismus, praktische <strong>Politik</strong> <strong>und</strong> politische<br />
Bildung zu sagen hatte.<br />
Gewiß kann man <strong>Oakeshott</strong> in mancher Hinsicht als konservativ bezeichnen.<br />
Aber er veröffentlichte bemerkenswert wenig über den Konservativismus.<br />
Sein großer Aufsatz »On Being Conservative« (1956) vermeidet explizit<br />
den Versuch, Konservativismus als politisches »Bekenntnis« oder politische<br />
»Doktrin« zu best<strong>im</strong>men. Es wäre sicher möglich, so schreibt er, die<br />
generellen Prinzipien des Konservativismus aus dem Verhalten anerkannter<br />
Konservativer abzuleiten. Aber es würde kaum die Mühe lohnen. Anstelle<br />
der politischen Doktrin untersucht <strong>Oakeshott</strong> das, was er konservative »Einstellung«<br />
(disposition) nennt, eine Einstellung, die <strong>im</strong> »zeitgenössischen Charakter<br />
erscheint«. 1 Ausdruck einer solchen Einstellung sind bekanntlich weder<br />
Nützlichkeitserwägungen noch der Glaube an überkommene Formen,<br />
sondern die Vertrautheit mit der Welt. Und wenn <strong>Oakeshott</strong> <strong>im</strong> letzten Teil<br />
seines Aufsatzes betrachtet, wie sich die konservative Einstellung in der <strong>Politik</strong><br />
manifestiert, argumentiert er gegen jede Berufung auf angeblich gr<strong>und</strong>legende<br />
Überzeugungen, die aus Moral, Religion, Philosophie oder anderen<br />
F<strong>und</strong>gruben von Auffassungen über »die Welt <strong>im</strong> allgemeinen« abzuleiten<br />
wären. Alles, was man brauche, sei etwas viel weniger Grandioses,<br />
nämlich die Verteidigung »unserer gegenwärtigen Lebensweise«, während<br />
wir zugleich dem Glauben (tatsächlich eher einer »Hypothese«) anhängen,<br />
daß »Regieren eine besondere <strong>und</strong> begrenzte Tätigkeit sei: Bereitstellung<br />
<strong>und</strong> Überwachung best<strong>im</strong>mter Regeln des Verhaltens«. 2 Diese Auffassung<br />
einer begrenzten Regierungstätigkeit ist einer konservativen Haltung<br />
durchaus angemessen. Sie begnügt sich mit der Aufrechterhaltung genereller<br />
Regeln des sozialen, politischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Umgangs – Regeln,<br />
deren Effektivität dramatisch sinkt, je öfter sie geändert werden.<br />
Der Aufsatz ist höchst ausgefallen <strong>und</strong> zumindest in der englischsprachigen<br />
Welt hat er mittlerweile den Status eines weniger bedeutsamen Klassikers<br />
der konservativen politischen Theorie. Aber ich bin der Auffassung,<br />
daß auch dies den springenden Punkt verfehlt. Es ist sicher richtig, daß sich<br />
<strong>Oakeshott</strong>s Verständnis von politischem Konservativismus deutlich von früheren<br />
<strong>und</strong> heutigen konventionellen Auffassungen der Vergangenheit wie<br />
der Gegenwart unterscheidet. Quintin Hogg, einige Zeit konservativer<br />
Vorsitzender des britischen Oberhauses, später Lordkanzler <strong>und</strong> Autor solch<br />
griffiger Titel wie »The Left was Never Right« (1945), veröffentlichte 1947<br />
1<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 407.<br />
2<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 423 f.
4 Martyn P. Thompson<br />
sein berühmtes Buch »The Case for Conservatism« – nur kurz bevor <strong>Oakeshott</strong><br />
»On Being Conservative« schrieb. Hoggs Buch beginnt mit einem<br />
ziemlich großspurigen Kapitel unter dem Titel »The Philosophy of Conservatism«.<br />
Nachdem er sich dort durch ein paar Seiten durchgewurstelt hat,<br />
fühlt sich Hogg allerdings verpflichtet festzuhalten, daß »Konservativismus<br />
weniger eine Philosophie als vielmehr eine Einstellung« sei. 3 Und obwohl<br />
diese Meinung ein <strong>Oakeshott</strong>sches Nicken des Einverständnisses hätte hervorlocken<br />
können, wäre dies mit Blick auf Hoggs weitere Ausführungen<br />
nicht der Fall. Denn Hogg wendet sich sofort den »gr<strong>und</strong>legenden konservativen<br />
Ideen« zu. Sein Ergebnis: Es existieren demnach nicht weniger als<br />
vier<strong>und</strong>zwanzig solcher Ideen, darunter unter anderem die Religion, die<br />
organische Theorie der Gesellschaft, die Autorität, die Beständigkeit <strong>und</strong><br />
das Naturrecht. Aber Hogg zählt dazu ebenso Fortschritt, Unternehmergeist,<br />
Profitstreben sowie zwei Dinge, die er etwas mysteriös die liberale <strong>und</strong><br />
die sozialistische »Häresie« nennt. Anders formuliert: Zwar verspricht Hogg<br />
(wie so viele andere auch) eine grandiose philosophische Analyse des Konservativismus,<br />
bietet aber schließlich wenig mehr als ein Durcheinander diverser<br />
inkompatibler <strong>und</strong> unvereinbarer abstrakter Ideen.<br />
Ich denke, dieses Beispiel illustriert einen der zu häufig übersehenen zentralen<br />
Punkte von <strong>Oakeshott</strong>s »On Being Conservative«. Es ist aus intellektueller<br />
Sicht kaum der Mühe wert, die generellen Prinzipien des politischen<br />
Konservativismus aus der konservativen politischen <strong>Praxis</strong> abzuleiten, denn<br />
dies ist einfach nur die Fortführung der <strong>Praxis</strong> selbst, lediglich auf einem<br />
abstrakteren Level. Wie in Hoggs Fall, aber noch allgemeiner, bedeutet die<br />
Präsentation einer »konservativen« politischen Theorie stets, daß man die<br />
Theorie der <strong>Praxis</strong> opfert. 4 Weiterhin ist intellektuelles Durcheinander garantiert,<br />
wenn wir – wie Hogg – glauben, daß solch generelle Prinzipien<br />
eine best<strong>im</strong>mte politische <strong>Praxis</strong> »verursachten« oder »ihre Gr<strong>und</strong>lage« wären.<br />
<strong>Oakeshott</strong> dagegen bemerkt 1955 in einem Beitrag für The Listener:<br />
»Jede moderne politische Handlung hat als ihre Entsprechung irgendeine<br />
Doktrin«, aber generell »sind politische Ideen nicht die ›Ursache‹ oder die<br />
›Gr<strong>und</strong>lage‹ von Verhalten; sie sind das Verhalten selbst in einem anderen<br />
Idiom«. 5 Und aus Gründen, die ich gleich erklären werde, fand <strong>Oakeshott</strong><br />
die Aussicht, sich mit dieser Art Verhalten zu beschäftigen, kaum vielversprechend.<br />
3<br />
Hogg 1947, S. 13.<br />
4<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 206 f.<br />
5<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1993, S. 117 f.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
5<br />
<strong>Oakeshott</strong> schenkte praktischen politischen Lehren selten größere Aufmerksamkeit.<br />
Aber wenn er es tat, wurde schnell deutlich, warum er sie alle<br />
so wirr <strong>und</strong> relativ uninteressant fand. Aus seinem Buch »The Social and<br />
Political Doctrines of Contemporary Europe« von 1940 lernen wir, daß die<br />
Vermehrung von miteinander konkurrierenden sozialen <strong>und</strong> politischen<br />
Lehren in Europa seit der Französischen Revolution »in einem gewissen<br />
Maß der entsetzlichen Gewohnheit moderner Gesellschaften geschuldet ist,<br />
für ihre <strong>Politik</strong>, ihre Ambitionen <strong>und</strong> ihre Exper<strong>im</strong>ente Zust<strong>im</strong>mung zu<br />
suchen, indem sie diese zu Prinzipien erheben, [. . .] eine Mode, die zur fixen<br />
Idee geworden ist«. Aber für unseren Zusammenhang ist viel wichtiger, daß<br />
<strong>Oakeshott</strong> die Ausbreitung politischer Doktrinen zum Anlaß n<strong>im</strong>mt, um<br />
über eine wachsende Unzufriedenheit mit dem Liberalismus <strong>und</strong> dessen<br />
partieller Entfaltung in Form der repräsentativen Demokratie nachzudenken,<br />
eine Unzufriedenheit besonders mit der Reduktion des <strong>im</strong> frühliberalen<br />
Denken aufgekommenen, durchaus tiefgründigen Konzepts des Individualismus<br />
auf einen nunmehr »plumpen <strong>und</strong> negativen Individualismus, der<br />
mit dem Liberalismus assoziiert werden konnte«. 6<br />
Gewiß betrachtete <strong>Oakeshott</strong> einige dieser Lehren als f<strong>und</strong>ierter <strong>und</strong> »inhaltsreicher«<br />
denn andere. Und dabei schnitt die repräsentative Demokratie<br />
am besten ab. 7 Jede von ihnen stand ferner für ein Charakteristikum der<br />
westlichen Zivilisation. Deshalb wäre es, wie er sagte, zwecklos, wenn auch<br />
vielleicht »heroisch«, ihre Existenz zu »bedauern«, denn das würde zum Bedauern<br />
darüber führen, daß wir zu jenen geworden sind, die wir sind. Aber<br />
sein Hauptargument ist, daß keine dieser Doktrinen von philosophischer<br />
Substanz sei. Sicher konnten ihre Vertreter es sich »nicht versagen, Ausflüge<br />
in die Philosophie zu unternehmen«, nur waren diese Exkurse »bemerkenswert<br />
unbefriedigend«. Kurz gesagt legt <strong>Oakeshott</strong> nahe, daß politische Doktrinen<br />
tendenziell entweder Konstruktionen von schlichten Gemütern oder<br />
von intellektuellen Hochstaplern sind: Die Unbedarften wissen es nicht besser,<br />
die Unredlichen wissen es besser. Aber die Logik eines praktischen politischen<br />
Arguments unterscheidet sich von der Logik einer philosophischen<br />
Erklärung, <strong>und</strong> daher sollten beide niemals vermischt werden. Das nützlichste,<br />
was ein »philosophischer Kritiker« mit solchen Doktrinen tun kann,<br />
besteht darin, sie »von der Belastung mit diesen überwiegend parasitären<br />
philosophischen <strong>und</strong> pseudo-philosophischen Ideen« 8 zu befreien.<br />
6<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1940, S. xi f., xvii.<br />
7<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1940, S. xviii.<br />
8<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1940, S. xvi.
6 Martyn P. Thompson<br />
Es verw<strong>und</strong>ert folglich wenig, daß <strong>Oakeshott</strong> nie solche Doktrinen verteidigte,<br />
konservative Lehren eingeschlossen. Der Konservativismus bekam<br />
in dem Buch über die sozialen <strong>und</strong> politischen Doktrinen der Gegenwart<br />
nie den Status einer Lehre comme les autres. Diejenigen, die er dazurechnete,<br />
waren die repräsentative Demokratie, der Katholizismus, der Kommunismus,<br />
der Faschismus <strong>und</strong> der Nationalsozialismus. Alles, was er in dem Buch<br />
über Konservativismus zu sagen hatte, war, daß (soweit es England betraf)<br />
»viele der Prinzipien, die zur überkommenen Doktrin des Konservativismus<br />
gehören, genauso in der katholischen Lehre gef<strong>und</strong>en werden können«, eine<br />
Lehre, die sich größtenteils nicht mit der heutigen Welt in Einklang finde. 9<br />
Statt des Konservativismus sei es eigentlich »die Lehre von der repräsentativen<br />
oder parlamentarischen Demokratie«, die (»was unser Land angeht«)<br />
jene Tradition darstellt, welche »<strong>im</strong> Geist unserer Gesetze zum Ausdruck<br />
kommt«. 10<br />
Im Sinne des Essays über Konservativismus ebenso wie in jenem der Einführung,<br />
die <strong>Oakeshott</strong> für eine Neuausgabe von Reginald Bassetts »The<br />
Essentials of Parliamentary Democracy« schrieb, ermöglicht die repräsentative<br />
Demokratie die heutige Art <strong>und</strong> Weise des politischen Zusammenlebens.<br />
Daher ist es für Engländer, welcher politischen Partei sie auch angehören<br />
mögen, angemessen, sich mit Blick auf den Parlamentarismus konservativ<br />
zu verhalten. Und so kam es, daß <strong>Oakeshott</strong> Bassett (der ein ehemaliger<br />
Unterstützer der britischen Labour Party <strong>und</strong> ein Anhänger Ramsey Mac<br />
Donalds in den 1930er Jahren war) für seine Ansichten über den Charakter<br />
der britischen parlamentarischen Demokratie lobte. Die Praktiken, die die<br />
parlamentarische Demokratie konstituierten, seien eine historische Erscheinung<br />
<strong>und</strong> sie seien bedroht »wann <strong>im</strong>mer man einer Hoffnung, einer Unternehmung<br />
oder einem Programm stärker verpflichtet sei als der die parlamentarische<br />
Demokratie auszeichnenden Art des Regierens oder des Regiertwerdens«.<br />
Sowohl <strong>Oakeshott</strong> als auch Bassett hatten (in <strong>Oakeshott</strong>s Worten),<br />
was britische parlamentarische Demokratie genannt wird, nicht als eine Annäherung an<br />
irgendeine ideale Art von »demokratischem« Regierungssystem verstanden, sondern als<br />
ein Instrument von bemerkenswerter Feinheit <strong>und</strong> Änderungsfähigkeit, das <strong>im</strong> Laufe<br />
unserer politischen Geschichte aufgekommen <strong>und</strong> fähig ist, die Bestrebungen von Eiferern<br />
erträglich zu machen. 11<br />
Wenn man vom Vertrauen der britischen Öffentlichkeit in ihr parlamentarisches<br />
System <strong>und</strong> vom Überhandnehmen des politischen Fanatismus <strong>im</strong><br />
9<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1940, S. xix f.<br />
10<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1940, S. xviii.<br />
11<br />
Bassett 1964, S. xxiv.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
7<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>ert ausgeht, ist es durchaus verständlich, daß Autoren, die sonst<br />
anders als Bassett <strong>und</strong> <strong>Oakeshott</strong> dachten, sich verpflichtet fühlten, auf die<br />
ein oder andere Weise das politische System zu erhalten, das sie als eine<br />
wertvolle Erbschaft anerkannten.<br />
Aber nichts davon mußte zur Folge haben, sich selbst politisch zu engagieren<br />
oder irgendeine spezifische <strong>Politik</strong> oder ein spezielles Programm zu unterstützen.<br />
Es war für die Beobachter von 1930 bis 1960 nicht weniger offensichtlich<br />
als für uns, daß konservative <strong>Politik</strong>er durchaus dogmatisch<br />
Hoffnungen, Unternehmungen <strong>und</strong> politischen Programmen anhängen<br />
können, während sozialistische <strong>Politik</strong>er fähig sind, sich über die eingespielte<br />
Art des Regierens <strong>und</strong> des Regiertwerdens hinwegzusetzen, die in modernen<br />
parlamentarischen oder repräsentativen Systemen aufgekommen ist.<br />
Aber am wichtigsten ist, daß <strong>Oakeshott</strong> der Meinung war, <strong>Politik</strong> sei in der<br />
modernen Welt eine erheblich überbewertete Aktivität. Im alten Athen<br />
wurde<br />
»<strong>Politik</strong>« als »poetische« Aktivität verstanden, bei der das Sprechen (nicht nur, um andere<br />
zu überzeugen, sondern um einprägsame bildhafte Wendungen zu schaffen) den Vorrang<br />
besaß <strong>und</strong> bei der Taten dem »Ruhm« <strong>und</strong> der »Größe« dienten – eine Auffassung,<br />
die noch aus den Zeilen des Machiavelli spricht. 12<br />
In der modernen Welt aber wurde die <strong>Politik</strong> verdorben <strong>und</strong> auf eine zweckorientierte<br />
Aktivität reduziert. Den provokativen Wendungen von »The<br />
Cla<strong>im</strong>s of Politics« (1939) zufolge wurde die moderne <strong>Politik</strong> »eine hoch<br />
spezialisierte <strong>und</strong> abstrakte Form gemeinschaftlichen Handelns, [. . .] die auf<br />
der Oberfläche des gesellschaftlichen Lebens betrieben wurde«. Die Ergebnisse<br />
waren entmutigend:<br />
Die Dinge, die politisches Handeln erreichen kann, sind oft nützlich, aber ich glaube<br />
nicht, daß sie die nützlichsten Dinge <strong>im</strong> gemeinschaftlichen Leben einer Gesellschaft<br />
darstellen. Mit politischer Aktivität ist untrennbar eine Trübung des Blicks verb<strong>und</strong>en,<br />
der zwar klar <strong>und</strong> praktisch erscheint, aber der auf wenig mehr hinaus läuft als auf mentalen<br />
Nebel. Politische Aktivität umfaßt einen fixierten, gegenüber allen subtilen Unterscheidungen<br />
stumpfen Geist, emotionale <strong>und</strong> intellektuelle Gewohnheiten, die durch<br />
ständige Wiederholung <strong>und</strong> mangelhafte Überprüfung leer geworden sind, <strong>und</strong> verlogene<br />
Loyalitäten, trügerische Absichten <strong>und</strong> falsche Prioritäten. Und das ist nicht deswegen<br />
so, weil die politischen Akteure der Notwendigkeit gehorchen, die Begriffsstutzigen<br />
überzeugen zu müssen, bevor ihre Aktivität erfolgreich sein kann; die geistige<br />
Unempfindlichkeit, die politisches Handeln beinhaltet, gehört zum Charakter der <strong>Politik</strong><br />
<strong>und</strong> folgt aus der Natur dessen, was politisch erreicht werden kann. Politische Tätigkeit<br />
beinhaltet geistige Vulgarität, nicht nur, weil sie die Zust<strong>im</strong>mung <strong>und</strong> die Unterstützung<br />
derer mit sich bringt, die von gewöhnlichem Intellekt sind, sondern auch we<br />
12<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 493 f. Fn. 1.
8 Martyn P. Thompson<br />
gen der falschen S<strong>im</strong>plifizierung des menschlichen Lebens, die sogar den besten ihrer<br />
Absichten <strong>im</strong>plizit ist. 13<br />
Diese reduktionistischen Trends moderner <strong>Politik</strong> in Richtung ideologischer<br />
Rigidität, geistiger Stumpfheit <strong>und</strong> der Übers<strong>im</strong>plifizierung der hohen<br />
Komplexität des menschlichen Lebens sind allesamt Erscheinungsformen<br />
der intellektuellen Mode, die in <strong>Oakeshott</strong>s Augen zunehmend charakteristisch<br />
für die politische Welt jener Epochen ist, die auf die Renaissance<br />
folgten <strong>und</strong> in denen er den »Rationalismus in der <strong>Politik</strong>« am Werke sah.<br />
Kein moderner politischer Akteur <strong>und</strong> nur wenige Theoretiker konnten<br />
sich dessen unechten Reizen entziehen. In seinem bekannten Aufsatz »Rationalism<br />
in Politics« wird auch die Gründung des amerikanischen politischen<br />
Systems als rationalistisch bezeichnet; 14 <strong>Oakeshott</strong> beschließt diesen<br />
Aufsatz mit folgendem Urteil über den bedauerlichen Zustand der zeitgenössischen<br />
britischen <strong>Politik</strong>:<br />
Neben vielem anderen, das verdorben <strong>und</strong> unges<strong>und</strong> ist, erleben wir das Schauspiel einer<br />
Gruppe scheinheiliger rationalistischer <strong>Politik</strong>er. Sie predigen eine Ideologie der<br />
Selbstlosigkeit <strong>und</strong> staatlicher Versorgungsleistungen einer Bevölkerung, deren einzige<br />
noch nicht versiegte Quelle sittlichen Handelns sie <strong>und</strong> ihre Vorgänger nach besten<br />
Kräften zu zerstören sich bemüht haben. Ihnen leistet eine andere Gruppe von <strong>Politik</strong>ern<br />
Widerstand, der es darum geht, uns mit Hilfe einer neuen Vereinfachung unserer<br />
politischen Traditionen vom Rationalismus zu erlösen. 15<br />
Es wäre nicht <strong>Oakeshott</strong>s Art gewesen, sich unter solchen Umständen politisch<br />
für die Aufrechterhaltung »unserer gegenwärtigen Lebensweise«, inklusive<br />
der Art <strong>und</strong> Weise, wie wir politisch zusammenleben, zu engagieren.<br />
II.<br />
Wenn also praktische Teilnahme an konservativer <strong>Politik</strong> indiskutabel war<br />
<strong>und</strong> wenn die theoretische Auseinandersetzung mit der Lehre des sozialen<br />
<strong>und</strong> politischen Konservativismus überhaupt kaum <strong>im</strong> Fokus von <strong>Oakeshott</strong>s<br />
Konservativismus stand, was dann? Ich denke, die Antwort ist klar: Es<br />
ist nichts Geringeres als die Hinwendung zu den Traditionen der westlichen<br />
13<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 93.<br />
14<br />
<strong>Oakeshott</strong> gilt übrigens auch ein bekanntes <strong>und</strong> einflußreiches Werk des Rationalismuskritikers<br />
Friedrich von Hayek, nämlich dessen »Road to Serfdom« von 1944, als<br />
Ausdruck rationalistischen Denkens. Siehe für einen Vergleich zwischen <strong>Oakeshott</strong> <strong>und</strong><br />
Hayek den Beitrag von Hennecke in diesem Band.<br />
15<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 41 f.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
9<br />
Zivilisation. Und hier waren politische Traditionen nur eine Gruppe unter<br />
anderen <strong>und</strong> dabei keineswegs die wichtigste, worauf <strong>Oakeshott</strong> <strong>im</strong> Aufsatz<br />
»The Cla<strong>im</strong>s of Politics« besteht. Als die persona, für die es mit Blick auf die<br />
Zivilisation angemessen ist, konservativ zu sein, gilt ihm der Philosoph; <strong>und</strong><br />
die geeignete institutionelle He<strong>im</strong>at für eine entsprechende Pflege <strong>und</strong><br />
Wahrung der Zivilisation ist die Universität <strong>im</strong> Humboldtschen Sinne. Immer<br />
wieder betont <strong>Oakeshott</strong> in seinen Schriften über Erziehung die Besonderheit<br />
der universitären Bildung. Eine Universität, so pflegte er stets zu<br />
sagen, ist die einzige Institution, die wir haben, um<br />
uns um das gesamte geistige Kapital zu sorgen <strong>und</strong> es zu pflegen, das eine Zivilisation<br />
ausmacht. Ihr geht es nicht nur darum, ein geistiges Erbe zu verwalten, Verlorenes ständig<br />
wiederzufinden, Vernachlässigtes wieder herzurichten, Verstreutes zu sammeln,<br />
Verdorbenes wieder instand zu setzen, erneut zu untersuchen, in neue Formen zu bringen,<br />
neu zu ordnen, verständlicher zu machen, neu zu edieren <strong>und</strong> wieder zu investieren.<br />
16<br />
Und solche Aufrechterhaltung, Wiederherstellung <strong>und</strong> Neuauflage, so<br />
Oake shott, muß »ohne Ablenkung durch praktische Belange« erfolgen. 17<br />
Vermutlich aber sind die Universitäten in der modernen Welt mehr als in<br />
früheren Zeiten unerbittlich praktisch-politischen, finanziellen, utilitaristischen,<br />
religiösen oder anderen äußeren Ansprüchen ausgesetzt worden. Daß<br />
er sich diesem Druck widersetzte, schien die irrige Einordnung <strong>Oakeshott</strong>s<br />
als eines konservativen Kritikers der Moderne zu bestätigen <strong>und</strong> zu untermauern.<br />
Um es klarzustellen: Es gab einiges in der modernen Welt, das<br />
<strong>Oakeshott</strong> als oberflächlich, widersprüchlich <strong>und</strong> als eine Verfälschung der<br />
Realität erkannte. Alles, was er über modernen Rationalismus sagte, deutet<br />
in diese Richtung. Aber dies ist als eine negative Kritik an der Moderne<br />
mißverstanden worden, <strong>und</strong> zwar in doppelter Weise, indem man die Kritik<br />
als einseitige, politisch konservative Kritik verstand. Und der Gr<strong>und</strong> dafür<br />
ist sehr einfach. »Modernität« ist ein Konstrukt moderner Köpfe, eben so,<br />
wie unsere sozialen <strong>und</strong> politischen Lehren es sind; die »Moderne« wurde<br />
konstruiert, indem einige Eigenschaften der modernen Welt herausgegriffen<br />
<strong>und</strong> diese zu einem mehr oder weniger, aber nie vollständig kohärenten<br />
Konzept zusammengefügt wurden. Die »Kritik an der Moderne« gehört<br />
indes genauso zur modernen Welt wie die Konstruktion der »Moderne«<br />
selbst. Von <strong>Oakeshott</strong>s Standpunkt aus sind daher so großartige Werke wie<br />
T. S. Eliots »The Waste Land« (1922) ebenso künstlerischer Ausdruck der<br />
Moderne wie sie eine Kritik daran darstellen. Und <strong>Oakeshott</strong>s Arbeit selbst<br />
16<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 194.<br />
17<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 194.
10 Martyn P. Thompson<br />
ist genauso eine Feier der modernen Welt, wie es auch eine philosophische<br />
Kritik eines Teils von ihr darstellt. 18<br />
Aber wie helfen die von praktischen Belangen ungestörte Bewahrung<br />
<strong>und</strong> die Neuinvestition des gesamten Kapitals unserer Zivilisation dabei, die<br />
überkommene Weise des Regierens <strong>und</strong> des Regiertwerdens, die politischen<br />
Aspekte unserer »gegenwärtigen Lebensweise« zu erhalten? Um dies<br />
zu beantworten, muß ich einen zentralen Aspekt von <strong>Oakeshott</strong>s Erziehungsphilosophie<br />
skizzieren.<br />
Nach <strong>Oakeshott</strong> ist Bildung <strong>im</strong> weitesten Verständnis des Begriffs der<br />
»Prozeß des Erlernens, wie man sich <strong>im</strong> Wechselspiel von Führung <strong>und</strong> Fügung<br />
selbst erkennt <strong>und</strong> etwas aus sich macht«. 19 Er beginnt mit der Geburt<br />
<strong>und</strong> endet mit dem Tod. In westlichen Gesellschaften wird er vor allem als<br />
das Erlernen des Sprechens, des Lesens <strong>und</strong> Schreibens einer Vielzahl von<br />
»Sprachen« verstanden. Daher die offensichtliche Notwendigkeit, sich anleiten<br />
zu lassen <strong>und</strong> sich einzufügen. Die verfügbaren Sprachen <strong>und</strong> die in<br />
ihnen verfaßte Literatur enthalten unsere Zivilisation. Also bedeutet Lernen,<br />
sich selbst zu erkennen <strong>und</strong> etwas aus sich zu machen, ein kompetenterer<br />
Sprecher der uns verfügbaren Sprachen der Zivilisation zu werden. Alle<br />
unsere Institutionen haben bildende Funktion. Aber unter ihnen gibt es<br />
spezifische Institutionen (Schulen, Colleges, Universitäten), die in erster Linie<br />
zu Zwecken der Bildung eingerichtet wurden. <strong>Oakeshott</strong> hat zu diesen<br />
manch bekannte <strong>und</strong> einige sehr kontroverse Dinge zu sagen.<br />
Es gibt drei Stufen der Bildung: den Kindergarten, die Schule <strong>und</strong> die<br />
Einrichtungen der höheren Bildung (Colleges <strong>und</strong> Universitäten). Im Kindergarten<br />
beginnt das Kind zu lernen, <strong>im</strong> wesentlichen durch das Spielen,<br />
»um sich in der natürlich-künstlichen Welt, in die es geboren wurde, he<strong>im</strong>isch<br />
zu fühlen«. 20 In der Schule, <strong>im</strong> disziplinierteren Lernumfeld der<br />
Gr<strong>und</strong>schule <strong>und</strong> der weiterführenden Schule, fangen die Kinder an, die<br />
Literatur <strong>und</strong> einiges von den Sprachen ihrer Zivilisation (Mathematik, Naturwissenschaft,<br />
Geschichte, Kunst, Geographie, Fremdsprachen usw.) zu<br />
lernen. Aber dies tun sie, wie gesagt, <strong>im</strong> Wechselspiel von Führung <strong>und</strong><br />
Fügung. Sie müssen auf best<strong>im</strong>mte Literatur in ausgewählten Sprachen hingewiesen<br />
werden, über die sie sich nur schemenhaft <strong>im</strong> klaren sind. Sowohl<br />
in der ersten als auch in der zweiten Bildungsstufe liegt der Schwerpunkt auf<br />
dem Erlernen von Gr<strong>und</strong>fähigkeiten <strong>und</strong> darauf, die Kinder mit der sie<br />
umgebenden vergangenen <strong>und</strong> gegenwärtigen Welt vertraut zu machen.<br />
18<br />
Siehe in diesem Zusammenhang auch den Beitrag von Henkel/Lembcke in diesem<br />
Band.<br />
19<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 187.<br />
20<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 188.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
11<br />
Die Schule befaßt sich nicht mit individuellen Talenten, Begabungen oder<br />
Neigungen. »In der Schule«, so <strong>Oakeshott</strong>, »haben wir nicht die Erlaubnis,<br />
unseren eigenen Neigungen zu folgen«. 21 Aber all dies ändert sich auf der<br />
dritten Stufe der Bildung, von der es zwei Arten gibt: »Berufsausbildung«<br />
<strong>und</strong> »universitäre Ausbildung«. Die Berufsausbildung beinhaltet das Erlernen<br />
einer Fertigkeit für den unmittelbaren Gebrauch. Sie ist hochspezialisiert<br />
<strong>und</strong> ausschließlich an praktischer Anwendung orientiert. Es ist diese<br />
Art der Bildung, die Ärzten, Rechtsanwälten, Sozialarbeitern, Klempnern,<br />
Mechanikern usw. die Fertigkeiten vermittelt, die sie notwendigerweise<br />
brauchen, um ihren Rollen in der »Lebensweise der Gegenwart« gerecht<br />
werden zu können. Sie ist ausschließlich mit dem aktuellen Zustand dieser<br />
verschiedenen praktischen Fertigkeiten <strong>und</strong> Wissenschaften befaßt. Sie beschäftigt<br />
sich nicht damit, wie dieser Zustand so wurde, wie er ist, oder<br />
damit, den intellektuellen Status des Wissens zu hinterfragen, von dem gegenwärtig<br />
angenommen wird, es wäre für die erfolgreiche Ausübung der<br />
Fertigkeiten vonnöten. Um eine Analogie zu benutzen, die <strong>Oakeshott</strong> <strong>im</strong>mer<br />
wieder gebraucht: Die Berufsausbildung beschäftigt sich nicht mit dem<br />
Studium einer »Sprache«, verstanden als Denkweise, sondern mit »Literatur«<br />
oder »Texten«, verstanden als dasjenige, was dann bisweilen in einer »Sprache«<br />
gesagt wird. 22<br />
»Universitäre Bildung« dagegen »ist eher eine Erziehung in ›Sprachen‹ als<br />
in ›Literatur‹.« Sie beschäftigt sich in erster Linie »mit dem Gebrauch <strong>und</strong> der<br />
Handhabung explikatorischer Sprachen [. . .] <strong>und</strong> nicht mit Anweisungen«. 23<br />
Unter explikatorischen bzw. erläuternden oder erklärenden Sprachen verstand<br />
<strong>Oakeshott</strong> Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaften <strong>und</strong> Mathematik,<br />
die Gewandtheit in dem, was ein umfassendes Verständnis <strong>und</strong> eine<br />
Erklärung der Errungenschaften der westlichen Zivilisationen ermöglicht.<br />
Die einzigartige Rolle der Universität war, wie wir gesehen haben, daß sie<br />
die einzige Bildungseinrichtung ist, die sich der Bewahrung <strong>und</strong> Bereicherung<br />
der Errungenschaften <strong>und</strong> erläuternden Quellen widmet, dabei allein<br />
geleitet von akademischen Überlegungen <strong>und</strong> ungestört durch außer ihr<br />
liegende <strong>und</strong> daher irrelevante praktische Interessen. 24<br />
Studenten sind »geachtete Zuschauer« dieser Aktivitäten. Ihre Ausbildung<br />
besteht aus dem, was sie vermittels ihrer Beobachtungen, ihrer Reflexionen<br />
<strong>und</strong> ihrer Studien aus sich selbst machen. Die universitäre Lehre umfaßt die<br />
Weitergabe eines Verständnisses einer oder mehrerer erläuternder Sprachen<br />
21<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 190.<br />
22<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 192.<br />
23<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 193.<br />
24<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 194.
12 Martyn P. Thompson<br />
durch die Bezugnahme auf die einschlägige Literatur. 25 Daher müssen auch<br />
Studenten so frei wie möglich von den Störungen durch praktische Belange<br />
sein. Das Studium an der Universität bietet Studenten ein »Inter<strong>im</strong>« zwischen<br />
dem Ende der Schule <strong>und</strong> der Aufnahme der ernsten Lasten des praktischen<br />
Lebens. 26 Und während dieser Inter<strong>im</strong>szeit haben sie die seltensten<br />
<strong>und</strong> wertvollsten aller Möglichkeiten, die Möglichkeit, sich selbst <strong>im</strong> Sinne<br />
der Zivilisation verstehen zu lernen, von der sie unvermeidlich einen Teil<br />
darstellen.<br />
Nun sind diese Unterscheidungen verschiedener Arten der Bildung bis zu<br />
einem gewissen Grade bekannt. Und offensichtlich klingen sie altmodisch,<br />
vielleicht sogar von romantischer Nostalgie gefärbt. Aber solche Bewertungen<br />
verfehlen <strong>Oakeshott</strong>s Argument. Er war sich völlig darüber <strong>im</strong> klaren,<br />
daß Kinder-Genies bisweilen erkannt werden, daß ihre Erziehung vom<br />
Kindergarten an diszipliniert verläuft <strong>und</strong> auf ihre Begabungen <strong>und</strong> Neigungen<br />
hin ausgerichtet wird. Es war ihm auch selbstverständlich, daß Spezialisierung,<br />
Berufsausbildung <strong>und</strong> eine Reihe anderer erfahrungsgegründeter<br />
Tätigkeiten Eingang in die Gr<strong>und</strong>schul- <strong>und</strong> in die weitere Ausbildung<br />
gef<strong>und</strong>en haben. Und er wußte natürlich, daß der wachsende Bedarf<br />
an multikultureller Bildung in den westlichen Gesellschaften <strong>und</strong> anderswo<br />
zu parallelem Schulunterricht in verschiedenen Muttersprachen geführt hat.<br />
Er war mit dem Umstand vertraut, daß die Berufsausbildung in Form von<br />
business schools, law schools, schools of social work, Abschlüsse in »Rechnungswesen«,<br />
business studies usw. feste Größen in den meisten Universitäten geworden<br />
sind. Er hätte sich sicher gegen die derzeitige Mode des service-learning an<br />
amerikanischen Universitäten ausgesprochen. Aber sein Anliegen bestand<br />
nicht darin, die Bildungspraxis, die er beobachtete, zu beschreiben oder sie<br />
zu verallgemeinern. Es ging ihm mehr darum, die von ihm beobachtete<br />
<strong>Praxis</strong> zu analysieren, um die charakteristischen Prinzipien zu best<strong>im</strong>men,<br />
die in jeder von ihr wirksam waren. Das Ergebnis bestand in einer Konstruktion<br />
von Idealtypen moderner Bildung. <strong>Oakeshott</strong>s Anspruch besteht<br />
also darin, die unterschiedlichen Prinzipien der Bildung best<strong>im</strong>mt zu haben,<br />
die <strong>im</strong> Kindergarten, in der Schule, der Berufsausbildung <strong>und</strong> in der universitären<br />
Ausbildung wirken.<br />
25<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 196–199.<br />
26<br />
<strong>Oakeshott</strong> 2001, S. 102, 128.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
13<br />
III.<br />
Die Unterschiede zwischen ihnen deuten nachdrücklich darauf hin, daß für<br />
sie dementsprechend verschiedene Arten politischer Bildung angemessen<br />
sein werden. <strong>Oakeshott</strong> zog daraus folgende Schlüsse: Politische Bildung ist<br />
<strong>im</strong> Kindergarten kaum notwendig, aber sie ist es in der Schule, besonders in<br />
einer demokratischen Gesellschaft, in der <strong>Politik</strong> potentiell »Sache eines jeden«<br />
ist. 27 Als eine Art von »Gemeinschaftsk<strong>und</strong>e« oder »Gegenwartsk<strong>und</strong>e«<br />
kann sie eine angemessene Einführung in Aspekte derjenigen Zivilisation<br />
(nämlich in die politischen Institutionen <strong>und</strong> Ideen) darstellen, in der die<br />
Schüler aufwachsen. Dies kann dann einem wachsenden Interesse an den<br />
öffentlichen Angelegenheiten dienen. Aber es wäre unangemessen, auf dieser<br />
Stufe der politischen Bildung irgendwelche prof<strong>und</strong>en Resultate zu erwarten.<br />
Denn die Schüler erlernen erst die Literatur, die in einer oder mehreren<br />
Sprachen geschrieben ist, die sie gerade erst zu verstehen begonnen<br />
haben. Weil sie bei weitem noch nicht sprachgewandt sind, kann man auch<br />
nicht erwarten, daß sie etwas Bedeutsames zu diesen Sprachen beizutragen<br />
hätten.<br />
Eine politische (Berufs-)Ausbildung dagegen leitet ihren Charakter aus<br />
dem Umstand ab, daß sie »eine Anzahl verläßlicher <strong>und</strong> für die erfolgreiche<br />
Ausübung einer mehr oder weniger detaillierten Tätigkeit notwendiger<br />
Fakten vermitteln soll«, etwa für ein politisches Engagement als Bürger, als<br />
Ehrenamtlicher, als Verwaltungsfachmann oder als Berufspolitiker. 28 Diese<br />
Art Bildung existiert sicher, <strong>und</strong> es gibt keinen Gr<strong>und</strong> zu glauben, daß sie in<br />
ihrer beschränkten Art <strong>und</strong> Weise nicht erfolgreich sein kann. Tatsächlich<br />
dachte <strong>Oakeshott</strong>, daß diese Form der Bildung die dominante Form der<br />
politischen Ausbildung auf allen Bildungsstufen <strong>im</strong> kommunistischen China<br />
ebenso wie in der Sowjetunion <strong>und</strong> in den USA sei <strong>und</strong> daß sie in beträchtlichem<br />
Umfang auch Eingang in Universitäten anderer Länder gef<strong>und</strong>en<br />
hätte. 29 Praktisch die gesamte moderne politikwissenschaftliche Literatur<br />
stellt eine Literatur dar, die sich nur für eine berufliche Ausbildung eignete.<br />
Im allgemeinen war (<strong>und</strong> ist) sie sehr langweilig oder tendenziös. Aber wie<br />
<strong>Oakeshott</strong> erkannte, besteht ihr eigentliches Problem in ihrer intellektuellen<br />
Konfusion. Sie brachte <strong>und</strong> bringt noch <strong>im</strong>mer ihren eigenen Anspruch auf<br />
einen Status streng wissenschaftlicher Erklärung mit ihren lediglich deskriptiven<br />
<strong>und</strong> präskriptiven Resultaten durcheinander. Das Ergebnis ist eine<br />
27<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 200.<br />
28<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 201 f.<br />
29<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 207.
14 Martyn P. Thompson<br />
ganz <strong>und</strong> gar zusammengewürfelte Diktion. Die fachtechnische Ausdrucksweise<br />
der wissenschaftlichen <strong>und</strong> pseudowissenschaftlichen Sprache kollidiert<br />
ständig mit verbreiteten Vorurteilen, beschränkten Vorannahmen <strong>und</strong><br />
modischen Präferenzen der jeweils gegenwärtigen Sprache der praktischen<br />
<strong>Politik</strong>.<br />
Eine universitäre Ausbildung in der <strong>Politik</strong> dagegen verlangt nach etwas<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich anderem. <strong>Oakeshott</strong> legt diesen Punkt folgendermaßen auseinander:<br />
Die Sprache unseres politischen Lebens zu lehren, ist ein wesentlicher Bestandteil einer<br />
politischen »Berufs«-Ausbildung, da Fertigkeit <strong>im</strong> Gebrauch dieser Sprache <strong>und</strong> Vertrautheit<br />
mit der Denkweise, die sie verkörpert, wesentlicher Teil einer politischen Tätigkeit<br />
ist. Aber diese Sprache besitzt nicht den Charakter der »Sprachen«, die meinem<br />
Vorschlag zufolge ein Universitätsstudium dem Studenten vermitteln soll. Alle »Sprachen«<br />
– die »Sprachen« der Geschichte, der Philosophie, der Naturwissenschaft <strong>und</strong> der<br />
Mathematik – sind erklärende Sprachen; jede einzelne repräsentiert eine best<strong>im</strong>mte Art<br />
<strong>und</strong> Weise des Erklärens. Aber die Sprache der <strong>Politik</strong> ist keine erklärende Sprache,<br />
ebensowenig ist das die Sprache der Kunst oder die Sprache sittlichen Handelns. [. . .]<br />
Falls es eine Denk- <strong>und</strong> Sprechweise gibt, die man zu Recht »politisch« nennen kann, ist<br />
es nicht Aufgabe der Universität, sie zu verwenden oder ihre Anwendung zu lehren. Die<br />
Universität muß sie vielmehr erklären – das heißt, eine oder mehrere der anerkannten<br />
Erklärungsweisen auf sie anwenden. 30<br />
In Ermangelung einer <strong>Politik</strong>wissenschaft <strong>im</strong> Sinne einer »strengen« (Natur-)Wissenschaft<br />
sind damit philosophische <strong>und</strong> historische Erklärungen<br />
gemeint. Würde es je eine <strong>Politik</strong>wissenschaft <strong>im</strong> strengen (naturwissenschaftlichen)<br />
Sinne geben (was <strong>Oakeshott</strong> aus gutem Gr<strong>und</strong> für unmöglich<br />
hielt), dann würden ihr die wissenschaftlichen Erklärungen hinzugefügt<br />
werden. Die Frage, um die es bei »beruflicher Ausbildung« geht, lautet: »Wie<br />
benutze ich die Sprache der derzeitigen <strong>Politik</strong> geschickt <strong>und</strong> effektiv?« Die<br />
Fragen, um die es in der »universitären Bildung« geht, sind dagegen: »Wie<br />
erkläre ich politische Tätigkeit? In welche explikatorische ›Sprache‹ oder<br />
›Sprachen‹ sollte ich sie übersetzen?« 31<br />
Diesen Überlegungen liegen zwei Prinzipien zugr<strong>und</strong>e: Universitäten<br />
sind erstens die einzigen Bildungseinrichtungen, die wir haben, um uns um<br />
»das gesamte geistige Kapital zu sorgen <strong>und</strong> es zu pflegen, das eine Zivilisation<br />
ausmacht«. Zweitens können wir eine Zivilisation nur verstehen, wenn<br />
wir ihre »erklärenden« Sprachen (explanatory languages) beherrschen. Auf<br />
keinen Fall wird sich jeder einzelne Student mit den erklärenden Sprachen<br />
auseinandersetzen wollen. Jene, die es nicht vorhaben, begehen deshalb<br />
30<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 211 f.<br />
31<br />
<strong>Oakeshott</strong> 1991, S. 212.
<strong>Michael</strong> <strong>Oakeshott</strong>: Konservativismus <strong>und</strong> politische Bildung<br />
15<br />
nichts Falsches oder Mangelhaftes. Diejenigen aber, die dies tun wollen <strong>und</strong><br />
die am Studium der <strong>Politik</strong> interessiert sind, werden eine universitäre politische<br />
Bildung für sich als richtig ansehen. Und diejenigen, die dies nicht<br />
wollen, die ein überwiegend praktisches Interesse am Studium der <strong>Politik</strong><br />
haben, werden eine berufliche politische Ausbildung als für sie angemessen<br />
empfinden. Mir scheint, daß dies der Kern von <strong>Oakeshott</strong>s Argument ist.<br />
Gewiß hatte <strong>Oakeshott</strong> kein Interesse daran, sich an der berufsorientierten<br />
politischen Bildung zu versuchen. Seine Bedenken ihr gegenüber bestanden<br />
nicht nur darin, daß diese Art der Bildung Charakteristika politischer<br />
Indoktrination aufweisen wird. Natürlich tut sie das. Das ist ja ihre<br />
Pointe. Alles an ihr ist auf die gegenwärtigen politischen Präferenzen <strong>und</strong><br />
die aktuellen »Probleme« ausgerichtet. Aber die Eigenart dieser Präferenzen<br />
<strong>und</strong> Probleme ist gewissermaßen dergestalt, daß für jedes Buch darüber, wie<br />
man Zivilgesellschaft <strong>und</strong> Demokratie stärkt, auch eines darüber erscheint,<br />
wie man die Monarchie wiederherstellt. <strong>Oakeshott</strong>s gr<strong>und</strong>legender Einwand<br />
war, daß die Universität nicht der richtige Ort für eine solche Ausbildung<br />
sei. Die Berufsausbildung ist unweigerlich kulturell spezifisch <strong>und</strong> historisch<br />
begrenzt; sie hat – wenn überhaupt – nur herzlich wenig mit dem<br />
Verstehen <strong>und</strong> der Kultivierung einer Zivilisation zu tun. Politische Krisen<br />
kommen <strong>und</strong> gehen, <strong>und</strong> die politische Mode dieser Saison ist in der nächsten<br />
schon wieder passé. Das Streben nach Verständnis einer Zivilisation<br />
kann von der Forderung, sich in der begrenzten <strong>und</strong> selbstbeschränkenden<br />
Arena der praktischen <strong>Politik</strong> zu »engagieren«, bloß verwirrt werden.<br />
Was hat es dann mit der Alternative der von <strong>Oakeshott</strong> beschriebenen<br />
»universitären politischen Bildung« eigentlich auf sich? Wie kann eine Erziehung,<br />
die so konzipiert ist, daß sie keine direkte praktische Auswirkung<br />
hat, zur Bewahrung der gegenwärtigen Art <strong>und</strong> Weise des politischen Zusammenlebens<br />
beitragen? <strong>Oakeshott</strong>s Antwort darauf schloß <strong>im</strong>mer den<br />
Hinweis auf eine sehr wertvolle indirekte Wirkung ein. Er verteidigte nicht<br />
die Idee der Universität als »Elfenbeinturm«, obwohl er gegen die Auffassung<br />
war, die Universität sollte eine politische oder soziale »Heilanstalt« sein.<br />
Am intellektuellen Erbe einer Zivilisation teilnehmen, es kultivieren <strong>und</strong><br />
erweitern <strong>und</strong> die Studenten lehren, sich selbst innerhalb des Kontexts ihrer<br />
Zivilisation zu verstehen, lief kaum darauf hinaus, sich von der Welt abzuwenden.<br />
Im Gegenteil ist es ein unabdingbarer Dienst, der für die Ges<strong>und</strong>heit<br />
einer jeden zivilisierten Gemeinschaft notwendig ist.<br />
Aber für das Studium der <strong>Politik</strong> sei charakteristischer, daß die »Früchte<br />
der politischen Bildung jeweils der Art <strong>und</strong> Weise entsprechen werden, in<br />
der wir über <strong>Politik</strong> denken <strong>und</strong> sprechen <strong>und</strong> vielleicht der Art <strong>und</strong> Weise,<br />
in der wir unsere politischen Tätigkeiten betreiben«. Je mehr wir von <strong>Politik</strong>
Autorenverzeichnis<br />
Josiah Lee Auspitz,<br />
Somerville (MA),<br />
josiahleeauspitz@yahoo.com<br />
<strong>Michael</strong> Becker,<br />
Würzburg,<br />
michael.becker@uni-wuerzburg.de<br />
Wendell John Coats Jr.,<br />
New London (CT),<br />
wjcoa@conncoll.edu<br />
Peter D. Finn,<br />
Kenosha (WI),<br />
finn@uwp.edu<br />
Jürgen Gebhardt,<br />
Erlangen,<br />
jngebhar@extern.lrz-muenchen.de<br />
Steven A. Gerencser,<br />
South Bend (IN),<br />
sgerencs@iusb.edu<br />
<strong>Michael</strong> Großhe<strong>im</strong>,<br />
Rostock,<br />
michael.grosshe<strong>im</strong>@uni-rostock.de<br />
<strong>Michael</strong> Henkel,<br />
Leipzig,<br />
michael.henkel@uni-leipzig.de<br />
Hans Jörg Hennecke,<br />
Düsseldorf,<br />
hans-joerg.hennecke@hwk-duesseldorf.de
320 Autorenverzeichnis<br />
Bart van Klink,<br />
Amsterdam,<br />
b.van.klink@vu.nl<br />
Silviya Lechner,<br />
London,<br />
silviya.lechner@kcl.ac.uk<br />
Oliver W. Lembcke,<br />
Hamburg/Jena,<br />
oliver.lembcke@uni-jena.de<br />
Kenneth B. McIntyre,<br />
Huntsville (TX),<br />
kmcintyre@shsu.edu<br />
Efra<strong>im</strong> Podoksik,<br />
Jerusalem,<br />
podoksik@mscc.huji.ac.il<br />
Rainer Schmidt,<br />
Dresden/Sao Paulo,<br />
rainer.schmidt@tu.dresden.de<br />
Suvi Soininen,<br />
Jyväskylä,<br />
suvi.m.soininen@jyu.fi<br />
Judith A. Swanson,<br />
Boston (MA),<br />
jswanson@bu.edu<br />
Martyn P. Thompson,<br />
New Orleans (LA),<br />
mpt@tulane.edu
Anliegen der Reihe POLITIKA<br />
herausgegeben von<br />
Rolf Gröschner <strong>und</strong> Oliver W. Lembcke<br />
POLITIKA mit K. Damit erinnert der Titel dieser Reihe an die aristotelischen<br />
»politika« <strong>und</strong> deren Anliegen, die Belange der Bürgerschaft zu verstehen,<br />
<strong>und</strong> zwar in wissenschaftlicher Absicht. So verschieden die gesellschaftlichen<br />
Bedingungen der Gegenwart gegenüber der griechischen Antike<br />
sind, so vergleichbar ist die Frage nach dem Gelingen des Lebens in einer<br />
Gemeinschaft freier <strong>und</strong> gleicher Bürger. Der Vergleich verlangt eine Vergegenwärtigung<br />
alteuropäischer Traditionen politischen oder – <strong>im</strong> lateinischen<br />
Traditionsstrang synonym – republikanischen Denkens.<br />
Eine Republik, die diesen Namen verdient, lebt vom Verweisungszusammenhang<br />
zwischen Freiheit <strong>und</strong> Ordnung. Herausgefordert durch den Humanismus<br />
der italienischen Renaissance, verwirklicht <strong>im</strong> Gewissen der<br />
christlichen Reformation <strong>und</strong> verstärkt durch die Menschenrechte der neuzeitlichen<br />
Revolutionen sind die individuellen Freiheiten der Bürger in ein<br />
spannungsreiches Verhältnis zur institutionellen Freiheit der bürgerschaftlichen<br />
Ordnung als ganzer getreten. Die Publikationen der POLITIKA haben<br />
dieses Spannungsverhältnis zum Thema. Gemeinsam ist ihnen das Bestreben,<br />
Voraussetzungen <strong>und</strong> Möglichkeiten der Organisation eines dynamischen<br />
Gleichgewichts zu begreifen: zwischen der Freiheit aller <strong>und</strong> der<br />
Freiheit aller Einzelnen.<br />
Für freiheitliche Ordnungen stellt sich die Aufgabe stetiger Stabilisierung<br />
eines solchen Gleichgewichts nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet <strong>und</strong><br />
nicht allein <strong>im</strong> Nationalstaat, sondern auf allen Gebieten der <strong>Politik</strong>, allen<br />
Ebenen nationaler, supranationaler <strong>und</strong> internationaler Organisationen <strong>und</strong><br />
für alle Wissenschaften, die sich mit dem Phänomen des Politischen beschäftigen.<br />
Die Dogmatik des Öffentlichen Rechts wird sich daher um die Wiedergewinnung<br />
ihres politischen Horizonts <strong>und</strong> die Weiterentwicklung des<br />
ius publicum zum ius politicum bemühen müssen. In der Tradition der politischen<br />
Philosophie bleibt aber auch den innovativen Kultur- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften<br />
das Gr<strong>und</strong>problem der guten Ordnung erhalten. Es n<strong>im</strong>mt<br />
sie in die Verantwortung, <strong>im</strong> Bewußtsein der Rechtsprinzipien verfaßter<br />
Gemeinschaften Sinn für normative Strukturen zu bewahren. Einer ent
322 Anliegen der Reihe POLITIKA<br />
sprechenden Vielfalt an Theorien <strong>und</strong> Methoden bieten die POLITIKA ihr<br />
Forum – möglichst interdisziplinär <strong>im</strong> <strong>Dialog</strong> <strong>und</strong> möglichst transdisziplinär<br />
<strong>im</strong> Ergebnis.