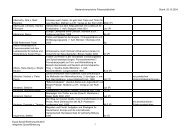Download
Download
Download
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutsch (lernen) auf dem Schulhof?<br />
Konzeptionelle Mündlichkeit als Basis der Entwicklung schriftsprachlicher<br />
Kompetenz in der Zweitsprache<br />
Gesa Siebert-Ott (Universität Siegen)<br />
1. Einleitung: Man spricht Deutsch – man spricht (nicht nur) Deutsch<br />
Die Frage, wie Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund am besten die Landessprache<br />
lernen, beschäftigt eine bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit in<br />
Deutschland ebenso wie in den europäischen Nachbarländern, aber auch in traditionellen<br />
Einwanderungsländern wie Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien oder<br />
Neuseeland bereits seit geraumer Zeit. Die international vergleichende Bildungsforschung<br />
zeigt, dass hier grundsätzlich ähnliche Probleme bestehen – Kinder aus Familien<br />
mit Migrationshintergrund bleiben in ihren schulischen Leistungen überproportional<br />
häufig hinter ihren einheimischen Mitschülern zurück – allerdings unterscheiden<br />
sich die nationalen Bildungssysteme hinsichtlich des Ausmaßes solcher Leistungsunterschiede<br />
zum Teil erheblich, über die Gründe hierfür wird nach wie vor kontrovers<br />
diskutiert (Auernheimer, G. (Hg.) 2003; Baker, C. 3 2001; Heinze 2001; Hopf<br />
2005; Reich & Roth 2001; Thürmann 2001). Eine zentrale Frage, die in diesem Zusammenhang<br />
sowohl in der einschlägigen Forschung als auch in bildungspolitischen<br />
Diskursen immer wieder diskutiert wird, ist die Frage nach der Bedeutung des<br />
Gebrauchs der Muttersprache in Familie, peer group und Schule für die Entwicklung<br />
sprachlicher Kompetenz in der Zweitsprache. Ein Argument, das in diesem Zusammenhang<br />
immer wieder vorgetragen wird, ist die time on task-Hypothese: Je mehr<br />
Zeit die Lerner für die Aufgabe, die Zweitsprache zu erlernen, verwenden, desto erfolgreicher<br />
werden sie sein (zustimmend hierzu zuletzt Hopf 2005, kritisch dagegen<br />
Cummins in verschiedenen Publikationen).<br />
Diese time on task-Hypothese wird auch als ein Grund für die Einführung der deutschen<br />
Sprache als verpflichtendes Kommunikationsmittel an einer Berliner Realschu-
le angeführt: „ Die Schulsprache unserer Schule ist Deutsch, die Amtssprache der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Jeder Schüler ist verpflichtet, sich im Geltungsbereich<br />
der Schule nur in dieser Sprache zu verständigen“, lautet der entsprechende Passus<br />
der Hausordnung. Die Deutschpflicht erweitere den Raum, in dem die Schüler dem<br />
Deutschen ausgesetzt seien und sei als Teil der pädagogischen Schwerpunktbildung<br />
Deutsch zu verstehen, wird die Schulleiterin in der Presse zitiert (Lau 2006a). In einer<br />
Pressemitteilung vom 24.01.2006 unter der Überschrift Deutschpflicht an Schulen<br />
sollte Schule machen begrüßt die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Integration<br />
und Flüchtlinge, Maria Böhm, diese Regelung mit einer ähnlichen Argumentation,<br />
dass gerade an Schulen mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern durch<br />
eine solche Sprachregelung Deutsch im Alltag dieser Kinder stärker verankert werde<br />
und dadurch auch ihr sprachliches Lernumfeld erweitert werde. Weiter wird diese<br />
Sprachregelung als eine Maßnahme zur Verbesserung der Integration von Kindern<br />
aus Familien mit Migrationshintergrund angesehen. Sie ermögliche – so die Argumentation<br />
– nicht nur eine bessere Verständigung von Schülern unterschiedlicher<br />
Muttersprache untereinander, sondern verbessere auch deren Bildungschancen:<br />
„Spracherwerb findet nicht allein im Unterricht statt. Der Beschluss von Berliner<br />
Schulen, Deutsch auf dem gesamten Schulgelände vorzuschreiben, ist daher<br />
eine begrüßenswerte Maßnahme, die meine Unterstützung findet. Gerade an<br />
Schulen mit hohem Anteil von Migrantenkindern ist diese Selbstverpflichtung<br />
angemessen, um das sprachliche Lernumfeld zu erweitern und Deutsch im Alltag<br />
der Schülerinnen und Schüler stärker zu verankern. Ja zu Deutsch im gesamten<br />
schulischen Leben heißt auch ja zur Integration. Gute Deutschkenntnisse<br />
sind nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Verständigung von Kindern<br />
und Jugendlichen mit unterschiedlicher Familiensprache untereinander, sie stellen<br />
auch eine bessere Bildung sicher. Dass hier ein richtiger Weg beschritten<br />
wird, zeigt die Akzeptanz dieser Regelung bei den Schülerinnen und Schülern<br />
wie bei den Eltern. Ich würde mich freuen, wenn dieses Beispiel Schule macht.“<br />
Die Debatte über das Thema ‚Deutsch auf dem Schulhof’ findet gegenwärtig erhebliche<br />
Resonanz in den Medien. Die Meinungen darüber, ob durch eine solche Maßnahme<br />
die Sprachkompetenz in der Zweitsprache Deutsch und in Verbindung damit<br />
die gesellschaftliche Integration von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund<br />
nachhaltig gefördert werden könne, gehen aber weit auseinander. So finden sich in<br />
einer großen deutschen Wochenzeitung, die dieser Fragestellung seit etlichen Jahren<br />
regelmäßig umfangreichere Beiträge widmet (vgl. dazu u.a. Zimmer 1996,<br />
Zimmer 1998, Spiewak 2000 und Gaschke 2001) aktuell drei Beiträge unter den Ti-
teln „Man spricht Deutsch“ (Lau 2006a), „Deutschstunden“ (Lau 2006b) und – in<br />
Auseinandersetzung mit der von Lau vertretenen Position – „Man spricht (nicht nur)<br />
Deutsch“ (Spiewak 2006). Die Untertitel zu diesen Beiträgen zeigen bereits, dass die<br />
beiden Autoren in der Bewertung der Deutschpflicht auf dem Schulhof offenbar konträre<br />
Positionen vertreten: „Eine Realschule bemüht sich um Integration. Nun ist die<br />
Empörung groß.“ (Lau 2006a); „Asad Suleman kämpft für die deutsche Sprache auf<br />
seinem Schulhof in Berlin-Wedding. Plötzlich steht er im Mittelpunkt einer Debatte,<br />
die das Land verändern kann.“ (Lau 2006b); “Warum gilt Türkisch nur als Makel und<br />
nicht als Schatz? Wo lernen Lehrer, Kinder aus fremden Kulturen zu unterrichten?<br />
Ein Drittel der Schüler in Deutschland stammt aus Migrantenfamilien. Die Schulen<br />
haben darauf kaum reagiert.“ (Spiewak 2006).<br />
Lernen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund am besten die Zweitsprache<br />
Deutsch, wenn ihre Herkunftssprachen aus den Schulen ferngehalten werden und<br />
behindert die Förderung interkulturellen Lernens in den Schulen am Ende nur die Integration<br />
dieser Kinder? Spiewak weist in seinem Beitrag am Beispiel einer Hamburger<br />
Grundschule darauf hin, dass aktuell im Grundschulbereich Konzepte zweisprachiger<br />
Erziehung erprobt werden, und zitiert eine Lehrerin dieser deutsch-türkischen<br />
Grundschule mit den Worten „Beide Sprachen und Kulturen sollen möglichst gleichberechtigt<br />
sein.“ Für den Autor stehen solche zweisprachigen Bildungskonzepte,<br />
wozu er auch das Angebot von muttersprachlichem Unterricht in verschiedenen Herkunftssprachen<br />
rechnet, wie er – wenn auch deutlich reduziert – in einigen Bundesländern<br />
noch immer angeboten wird, in deutlichem Widerspruch zu dem oben beschriebenen<br />
Konzept einer dominant einsprachigen Erziehung in der Zweitsprache.<br />
Ein Widerspruch entsteht für den Autor nicht nur durch die unterschiedliche Bewertung<br />
von Sprachen und Kulturen durch die Betonung der Gleichwertigkeit von zwei<br />
Sprachen und Kulturen im pädagogischen Programm der einen Schule und die Förderung<br />
der Dominanz der deutschen Sprache und Kultur im pädagogischen Programm<br />
der anderen Schule. Spiewak weist außerdem auch auf Widersprüche in den<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen hin, mit denen die Einführung solcher Modelle häufig<br />
begründet wird. So nennt er zum einen die oben bereits erwähnte time-on-task-<br />
Hypothese und zitiert in diesem Zusammenhang Hopf mit den Worten, dass jede Minute<br />
Deutsch sinnvoller als eine Minute Türkisch sei. Zum anderen erwähnt er die<br />
These, dass Einwandererkinder dann am besten Deutsch lernten, wenn sie Lesen
und Schreiben parallel in ihrer Muttersprache beigebracht bekommen, außerdem –<br />
so zitiert er den Sprachwissenschaftler Ludger Hoffmann – erlerne man in der Muttersprache<br />
„die Grundbegriffe, den Zugang zur Welt, auf den die neuen Sprachen<br />
aufbauen“ (Spiewak 2006). Muttersprachliche Kompetenz bildet nach diesen Überlegungen<br />
also offenbar das Fundament für einen erfolgreichen Erwerb weiterer Sprachen<br />
in Wort und Schrift.<br />
Der Autor verweist außerdem auf die wissenschaftliche Kontroverse über die Aussagekraft<br />
empirischer Untersuchungen zur Effektivität unterschiedlicher Schulmodelle<br />
für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Sind gute Kenntnisse in der<br />
Zweitsprache und Bildungserfolg eher mit Hilfe von Unterrichtsangeboten zu erzielen,<br />
die einsprachig in der Zweitsprache erziehen, oder sind zweisprachige Angebote, die<br />
gute sprachliche Kompetenz in Herkunftssprache und Landessprache vermitteln wollen,<br />
solchen einsprachigen Modellen im Hinblick auf die Vermittlung von Sprachkompetenz<br />
und die Herstellung von Chancengleichheit erkennbar überlegen? Bildungspolitiker<br />
– so Spiewak – können bei ihrer Entscheidungsfindung weder auf valide<br />
empirische Untersuchungen noch auf methodisch sauber belegte wissenschaftliche<br />
Hypothesen aufbauen. Der Autor schließt seinen Bericht mit einem Hinweis auf eine<br />
im Berliner Wissenschaftszentrum entstandene Metanalyse empirischer Studien zur<br />
Effektivität einsprachiger und zweisprachiger Unterrichtsmodelle. Ihr Fazit: „Weder<br />
gebe es Belege, dass die Instruktion in der Heimatsprache den Schulleistungen<br />
nützt, noch, dass sie ihnen schadet.“ (Spiewak 2006). Die bildungspolitische Debatte<br />
tritt – so scheint es – auf der Stelle. Aber können Sprachwissenschaft und Sprachpädagogik<br />
hier wirklich keinen Ausweg aus dem Dilemma weisen?<br />
2. Kennen Sie Cummins? – Experten- und Laiendiskurse über Modelle zweisprachiger<br />
Erziehung<br />
In einem Bericht über muttersprachlichen Unterricht an Schulen in Amsterdam wird<br />
die Hypothese zitiert, dass Unterricht in der Muttersprache nicht nur die Fertigkeiten<br />
in dieser Sprache fördere, sondern indirekt auch das Erlernen der Zweitsprache positiv<br />
beeinflusse. In diesem Zusammenhang wird explizit auf „den kanadischen Sprach-
wissenschaftler“ Jim Cummins und die von ihm formulierte Interdependenzhypothese<br />
verwiesen, die im folgenden Zitat als ‚Abhängigkeitshypothese’ bezeichnet wird :<br />
„Seine ‚Abhängigkeitshypothese’ geht davon aus, daß ein Kind erst eine Sprache<br />
richtig lernen sollte, um sein so erworbenes Wissen dann auf die Zweitsprache<br />
zu transferieren. Seit 15 Jahren hält Cummins damit die Welt der Sprachwissenschaftler<br />
auf Trab. Umstritten ist Cummins radikales Konzept, wonach<br />
Kinder von Einwanderern im Gastland möglichst eine Weile nur ihre Erstsprache<br />
lernen sollten, vor allem seit im US-Staat Kalifornien der muttersprachliche Unterricht<br />
im vergangenen Jahr per Volksentscheid abgeschafft wurde.“ (Goddar<br />
1999)<br />
Eine ähnliche Darstellung findet sich in einem Artikel des Wissenschaftsjounalisten<br />
Dieter E. Zimmer aus dem Jahr 1998. Unter dem Titel ‚Lieber gleich ins kalte Wasser’<br />
stellt er – ebenfalls unter Bezug auf den kalifornischen Volksentscheid – verschiedene<br />
Bildungsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in den Vereinigten<br />
Staaten vor: Submersion als eine Form der Versenkung in ein Sprachbad, bei<br />
dem die fremdsprachigen Kinder sofort in landessprachliche Klassen aufgenommen<br />
werden und selber zusehen müssen, „ob sie schwimmen oder untergehen“. Als weitere<br />
Möglichkeit nennt Zimmer die Immersion, das Eintauchen in ein Sprachbad, hier<br />
findet – um im Bilde zu bleiben – das Schwimmenlernen mit gezielter schulischer Unterstützung<br />
statt, die folgendermaßen dargestellt wird:<br />
„Sprachausländerkinder werden zunächst in Spezialklassen zusammengefasst,<br />
die ganz auf ihr Sprachkönnen zugeschnitten sind, erhalten dort aber den gesamten<br />
Unterricht in der Landessprache, bis sie nach längstens zwei Jahren in<br />
normale Klassen entlassen werden können. Verschiedene Varianten der Immersion<br />
werden unter anderem in Kanada mit großem Erfolg praktiziert, und eine<br />
Variante (die einjährige Immersion) soll nach dem Willen der kalifornischen<br />
Bevölkerung jetzt dort die Regel werden.“ (Zimmer 1998)<br />
Als ein weiteres Unterrichtsangebot für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />
in den Vereinigten Staaten nennt Zimmer die transitorische bilinguale Erziehung,<br />
die er als „konterintuitives, ja intuitiv absurdes sprachdidaktisches Konzept“<br />
bezeichnet. „Eine seltsame Theorie“, so führt Zimmer aus, stecke hinter diesem Unterrichtsmodell,<br />
denn Kinder von Einwanderern lernten danach „die Landessprache<br />
angeblich dann am besten, wenn sie ihnen zugunsten der Muttersprache möglichst<br />
lange vorenthalten werde.“ Ebenso wie Spiewak, weist Zimmer auf Metaanalysen<br />
von empirischen Untersuchungen zur Effizienz einsprachiger (in der Zweitsprache)
und zweisprachiger Unterrichtsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />
hin, die Metaanalyse von Christine Rossell und die Metaanalyse von Jay P.<br />
Greene. Metaanalysen bewerten die Aussagekraft einzelner empirischer Studien u.a.<br />
im Hinblick auf die Zahl der Versuchspersonen, den Zeitraum der Beobachtung, die<br />
Art und Qualität der beobachteten Programme und die Frage, ob in diese Studien<br />
auch Vergleichsgruppen einbezogen wurden. Dass diese Fragen eminent wichtig<br />
sind für die Bewertung der Aussagekraft solcher Studien ist unstrittig (vgl. dazu etwa<br />
Baker 3 2001; Reich & Roth 2002; Siebert-Ott 2001 und Wode 1995).<br />
Allerdings begeht auch Zimmer selbst den von ihm ausdrücklich kritisierten Fehler,<br />
nicht sauber zwischen der Art und Qualität der beschriebenen Programme zu trennen:<br />
Während es sich bei den in den Vereinigten Staaten praktizierten structured<br />
immersion-Programmen um einsprachige Programme handelt, deren Ziel es ist, Kindern<br />
aus Einwandererfamilien gezielt die sprachlichen Kompetenzen in der Zweitsprache<br />
zu vermitteln, die für eine erfolgreiche Beteiligung am Regelunterricht erforderlich<br />
sind, ist die überwiegende Zahl der kanadischen Immersionsprogramme auf<br />
die Vermittlung von Zweisprachigkeit angelegt. Zielgruppe dieser kanadischen Immersionsprogramme<br />
waren zunächst auch keineswegs Kinder aus Einwandererfamilien,<br />
sondern Kindern aus bildungsorientierten Familien im anglophonen Teil Kanadas,<br />
denen auf diese Weise – auf Wunsch ihrer Eltern – zusätzlich besonders gute<br />
Kompetenzen in der französischen Sprache vermittelt werden sollten. Diese Programme,<br />
die seit den 1960’er Jahren existieren, haben sich in zahlreichen empirischen<br />
Untersuchungen als deutlich effektiver erwiesen als der traditionelle Fremdsprachenunterricht.<br />
Zu ähnlichen Resultaten kommen empirische Untersuchungen<br />
bilingualer Programme an europäischen Schulen (Siebert-Ott 2001; Wode 1995).<br />
Die kanadischen Immersionsprogramme unterscheiden sich sowohl im Hinblick auf<br />
ihren Beginn (Vorschule bzw. erste Klasse; zu einem späteren Zeitpunkt während der<br />
Primarschulzeit oder erst in den Sekundarschulen) als auch im Hinblick auf den Umfang,<br />
in dem beide Sprachen unterrichtet werden. Die später einsetzenden Programme<br />
sind in der Regel zweisprachig. Bei den in der Vorschule oder zu Beginn der<br />
Primarstufe einsetzenden Programmen gibt es aber auch sehr erfolgreiche Programme<br />
– die sogenannten early total immersion-Programme – , die zunächst für die<br />
Dauer von zwei bis drei Schuljahren nur in der Fremdsprache unterrichten und erst
danach auch die Muttersprache als Unterrichtssprache und als Unterrichtsfach einführen.<br />
Im Allgemeinen gilt für diese Programme, dass sie zunächst für eine homogene<br />
Sprachgruppe eingerichtet wurden – also etwa ausschließlich für anglophone<br />
Schüler, die Französisch auf hohem Niveau lernen sollten. So ist es auch in early total<br />
immersion-Programmen durch den Einsatz von kompetent zweisprachigen Lehrern<br />
möglich, dass die Schüler bei Verständnisproblemen jederzeit auf ihre Muttersprache<br />
zurückgreifen können. Außerdem wird in diesen Programmen die Immersionssprache<br />
Französisch nur im Unterricht verwendet. Außerhalb des Klassenzimmers<br />
ist das Verständigungsmittel innerhalb und außerhalb der Schule weiterhin<br />
Englisch, d.h. die Erstsprache der Schüler (Siebert-Ott 2001; Wode 1995). Das Fazit,<br />
das Zimmer in seinem Beitrag Lieber gleich ins kalte Wasser zieht, bezieht sich<br />
zwar auf Erkenntnisse der einschlägigen Forschung, verleitet den Leser aber eher zu<br />
falschen Schlüssen im Hinblick auf die diskutierte Frage, ob sich grundsätzlich einsprachige<br />
oder zweisprachige Schulangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />
besser eignen:<br />
„ Nie im Leben, so scheint es heute, lernt man eine zweite Sprache so leicht und<br />
schnell wie in dem Alter, wenn sich gerade das Sprachvermögen herausgebildet<br />
hat, nach dem fünften Lebensjahr. In dieser Zeit behindert der ständige Rückgriff<br />
auf die Muttersprache, die das Kind ja zu Hause ohnehin weiterspricht, das<br />
Fremdsprachenlernen nur. Erst nach etwa drei Jahren, wenn die Fremdsprache<br />
sitzt, schadet er nicht mehr. Womit Cummins’ Theorie auf dem Kopf steht: Die<br />
besten, nämlich integrativsten Ergebnisse sind nicht von möglichst langem,<br />
sondern von möglichst kurzem Einführungsunterricht in der Herkunftssprache zu<br />
erwarten, der sich nach Monaten, nicht nach Jahren bemisst. Danach müssten<br />
die Kinder einige Jahre lang so intensiv wie möglich der Zweitsprache ausgesetzt<br />
sein. Und wenn wirklich Bilingualität das Ziel ist, kann nach drei Jahren<br />
muttersprachlicher Ergänzungsunterricht einsetzen.“ (Zimmer 1998)<br />
Korrekt an dieser Darstellung ist, dass early partial immersion-Programme sich nicht<br />
als early total immersion-Programmen überlegen erwiesen haben, d.h. Fünfjährige,<br />
die in der Vorschule und in den ersten Grundschuljahren zunächst nur in der Fremdsprache<br />
unterrichtet worden waren und zunächst auch nur in den Fremdsprache alphabetisiert<br />
worden waren, holten die Rückstände in ihrer Muttersprache in aller Regel<br />
recht schnell wieder auf, nachdem das Programm nach zwei bis drei Unterrichtsjahren<br />
in ein partial immersion-Programm umgewandelt worden war. Gleichzeitig erwiesen<br />
sich die early total immersion-Programme im Hinblick auf den Erwerb fremdsprachlich<br />
Kompetenz als effektiver (Wode 1995).
Die Rolle der Erstsprache in kanadischen Immersionsprogrammen, speziell auch in<br />
early total immersion-Programmen, wird – wie oben bereits dargelegt – bei Zimmer<br />
aber nicht korrekt wiedergegeben. Sein Hinweis, dass beim frühen Fremdsprachenlernen<br />
der ständige Rückgriff auf die Muttersprache den Lernerfolg nur behindere, ist<br />
in dieser Form für den Laien zumindest äußerst missverständlich: Der für den bilingualen<br />
Unterricht ausgebildete kompetent zweisprachige Lehrer in einem kanadischen<br />
Immersionsprogramm, der mit einer sprachlich homogenen anglophonen<br />
Gruppe arbeitet und sich in seinem Unterricht aus methodisch-didaktischen Gründen<br />
um weitgehende Einsprachigkeit in der Fremdsprache bemüht, steht vor einer anderen<br />
Situation als die Klassenlehrerin einer Grundschulklasse, die einer sprachlich und<br />
kulturell heterogenen Lerngruppe Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben erteilen<br />
soll und sich mit einem Teil ihrer Schülerinnen und Schüler kaum oder gar nicht verständigen<br />
kann. Im ersten Fall kann jederzeit, wenn es dem Lehrer aus methodischdidaktischen<br />
Gründen sinnvoll erscheint, auf die Muttersprache zurückgegriffen werden,<br />
im zweiten Fall ist das nicht möglich.<br />
‚Zweisprachiges Aufwachsen’ kann sich also ausschließlich auf die Unterrichtssituation<br />
beziehen ohne entsprechende Möglichkeiten zum Gebrauch der Fremdsprache<br />
im Alltag des Kindes. Auch ein Kind, das in Familie und Schule mit zwei unterschiedlichen<br />
Sprachen konfrontiert wird, wird als zweisprachig aufwachsendes Kind bezeichnet.<br />
Ein Kind kann aber durchaus auch durchgängig in einem zweisprachigen<br />
Umfeld leben, d.h. sowohl in der Familie als auch in der Schule eine zweisprachige<br />
Erziehung erhalten und außerdem im Alltag genügend Gelegenheiten zum Gebrauch<br />
beider Sprachen haben, etwa im Kontakt mit Gleichaltrigen, bei der Nutzung verschiedener<br />
Medien, beim Freizeitangebot usw. Das Ausmaß, in dem zweisprachig<br />
aufwachsende Kinder in der Familie und außerhalb der Familie mit den beiden Sprachen<br />
in Kontakt kommen, kann sich also im Einzelfall erheblich unterscheiden, ebenso<br />
das Ausmaß der Unterstützung, die die Kinder bei der Entwicklung ihrer Zweisprachigkeit<br />
– einschließlich der Fähigkeit zum Lesen und Schreiben in den beiden<br />
Sprachen (Biliteracy) – in Familie und Schule erhalten. Die sprachlichen Anregungen,<br />
die zweisprachig aufwachsende Kinder erhalten, und die Voraussetzungen, die sie<br />
für das institutionelle Sprachenlernen mitbringen, können sich also ganz erheblich<br />
unterscheiden.
So äußern sich Reich & Roth (2002) in ihrer Studie zum Spracherwerb zweisprachig<br />
aufwachsender Kinder und Jugendlicher, in der sie einen Überblick über den Stand<br />
der nationalen und internationalen Forschung geben, insgesamt auch recht vorsichtig<br />
zu den gesicherten Erkenntnissen der international vergleichenden Schulforschung<br />
zur Effektivität unterschiedlicher Bildungsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund.<br />
Die folgenden Aussagen können nach Einschätzung dieser Autoren<br />
als derzeitiger Konsens in der Forschung zu Zweisprachigkeit und zweisprachiger<br />
Bildung gelten:<br />
1. „Individuelle und gesellschaftliche Zwei- und Mehrsprachigkeit sind, weltweit<br />
und weltgeschichtlich betrachtet, eine Normalität […]<br />
2. Individuelle Zweisprachigkeit stellt keine intellektuelle Überforderung dar […]<br />
3. Die Erstsprache und die Zweitsprache zweisprachiger Kinder und Jugendlicher beeinflussen<br />
sich im Entwicklungsprozess gegenseitig im Sinne von Transfereffekten<br />
[…]<br />
4. Persönliche Probleme mit der Zweisprachigkeit haben Ursachen im engeren und weiteren<br />
sozialen Umfeld. Diese können vielfältig und komplex sein […]<br />
5. Schulische Erfolge und Misserfolge zweisprachiger Schülerinnen und Schüler sind<br />
Ergebnisse von Interaktionsgeschichten zwischen der Schule und Schülerinnen und<br />
Schülern […]<br />
6. Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sind die Sozialschichtzugehörigkeit und die<br />
Beherrschung der Unterrichtssprache die beiden einflussreichsten Faktoren.<br />
7. Auf Seiten der Schule ist das Verhältnis der Einflussfaktoren nicht geklärt […]. In Betracht<br />
zu ziehen sind das Schulklima, die Passung des Curriculums und die Qualität<br />
des Unterrichts, welche ihrerseits von der sprachlichen und didaktischen Qualifikation<br />
der Lehrkräfte abhängt […] (Reich & Roth 2002, 41)<br />
Reich & Roth betonen ausdrücklich, dass die vorliegenden empirischen Erkenntnisse zur institutionellen<br />
Förderung von Zweisprachigkeit, bzw. zur institutionellen Förderung zweisprachig<br />
aufwachsender Kinder noch recht eng an bestimmte nationale Bildungssysteme geknüpft<br />
sind. Sie heben dabei ausdrücklich die US-amerikanischen Untersuchungen hervor,<br />
die an Umfang und Methode den Untersuchungen in anderen nationalen Kontexten voraus<br />
seien. Diese Untersuchungen lassen nach Reich & Roth erkennen, dass die Erfüllung pädagogischer<br />
Qualitätskriterien wichtiger sei als die Entscheidung für die eine oder andere<br />
schul- oder unterrichtsorganisatorische Option, mit dieser Einschränkung kommen die Autoren<br />
allerdings zu der Einschätzung:
„Unterricht im Medium beider Sprachen ist ein starkes Instrument zur Verbesserung des<br />
Schulerfolgs zweisprachiger Schülerinnen und Schüler und kann, wenn weitere Qualitätskriterien<br />
erfüllt sind, zur Chancengleichheit mit einsprachigen Schülerinnen und<br />
Schüler führen.“ (Reich & Roth 2002,42)<br />
Nach Einschätzung von Hopf (2005, 241) lassen die vorliegenden Erkenntnisse der nationalen<br />
und der internationalen Forschung, zu denen er auch die Ergebnisse des von Reich &<br />
Roth vorgelegten Forschungsberichts rechnet, einen solchen Schluss nicht zu. Nach seiner<br />
Ansicht zeige sich vielmehr, dass den Herkunftssprachen „keine fördernde Wirkung für das<br />
Erlernen der Verkehrssprache zukommt.“ Die von Spiewak (2006) erwähnte, im Berliner<br />
Wissenschaftszentrum entstandene Metanalyse empirischer Studien zur Effektivität<br />
einsprachiger und zweisprachiger Unterrichtsmodelle kommt allerdings zu dem Ergebnis,<br />
dass dem Unterricht in den Herkunftssprachen auch keine negative Wirkung<br />
für das Erlernen der Verkehrssprache zukommt.<br />
Sollten bildungspolitische Entscheidungsfindungsprozesse künftig die vorliegenden<br />
Erkenntnisse empirischer Forschung unberücksichtigt lassen, sollten die Ergebnisse<br />
weiterer, methodisch zuverlässigerer empirischer Studien abgewartet werden oder<br />
sollten die bereits verfügbaren Studien zunächst einmal gründlicher gelesen werden?<br />
Meiner Ansicht nach müssen alle drei Wege ernsthaft in Erwägung gezogen werden.<br />
So ist zum einen zu überlegen, inwieweit bildungspolitische Entscheidungen für oder<br />
gegen eine zweisprachige Erziehung gegenwärtig überhaupt sinnvoll mit wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen begründet werden können. Wenn es zutrifft, dass den<br />
Herkunftssprachen der Schüler weder eine eindeutig fördernde Wirkung noch eine<br />
eindeutig abträgliche Wirkung für das Erlernen der Verkehrssprache beigemessen<br />
werden kann, so kann die oben erwähnte time on task-Hypothese weder als Argument<br />
für die Einführung einer Deutschpflicht auf dem Schulhof noch als Argument für<br />
die Abschaffung des muttersprachlichen Unterrichts verwendet werden. Diese Hypothese<br />
kann aber auch nicht als Argument von Eltern verwendet werden, die ihre Kinder<br />
möglichst lange einsprachig in der Muttersprache erziehen möchten, um den<br />
Zweitspracherwerb auf eine solide muttersprachliche Basis zu stellen (zur Rolle der<br />
Familiensprache für die Entwicklung von Lesekompetenz siehe auch Stanat &<br />
Schneider 2004, 272).
Zum anderen wäre es beim gegenwärtigen Kenntnisstand zweifellos nicht sinnvoll,<br />
sich auf ein einziges Unterrichtsmodell für die Bildung und Erziehung zweisprachig<br />
aufwachsender Kinder festzulegen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, neben einsprachigen<br />
auch unterschiedliche international erprobte zweisprachige Unterrichtsmodelle<br />
anzubieten und hierfür eine wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluation zu<br />
etablieren.<br />
Zum anderen wäre es sinnvoll, die bereits verfügbaren wissenschaftlichen Studien<br />
gründlicher auszuwerten. Das gilt auch für die wissenschaftlichen Publikationen des<br />
kanadischen Wissenschaftlers Jim Cummins zur sprachlichen Entwicklung von Kindern,<br />
die in mehrsprachiger Umgebung aufwachsen, und zu Problemen zweisprachiger<br />
Erziehung. Die Thesen von Cummins bilden, wie oben bereits angedeutet, in der<br />
Diskussion um eine angemessene Förderung zweisprachig aufwachsender Kinder<br />
häufig einen Bezugspunkt, entweder als theoretisches Fundament für die Begründung<br />
der Einrichtung eines zweisprachigen Unterrichtsangebots für Kinder aus Familien<br />
mit Migrationshintergrund, wie im Falle der oben zitierten Darstellung von Goddard,<br />
oder als Ansatzpunkt für die Kritik an bereits existierenden zweisprachigen Unterrichtsprogrammen,<br />
wie im Falle der oben zitierten Darstellung von Zimmer. Die<br />
wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere die neueren Publikationen von<br />
Cummins gehören aber offenbar zugleich auch zu den selten gründlich gelesenen<br />
Arbeiten zu diesem Thema. So werden die älteren Arbeiten, insbesondere der häufig<br />
zitierte Aufsatz Linguistic Interdependence and the Educational Development auf Bilingual<br />
Children aus dem Jahr 1979, häufig nur indirekt zitiert oder es werden Cummins<br />
zugeschriebene Thesen ohne Angabe von Quellen zitiert. Neuere Arbeiten von<br />
Cummins werden trotz der Breite und Vielzahl seiner Publikationen überhaupt nur<br />
selten zitiert.<br />
Die von Baker und Hornberger 2001 herausgegebene Sammlung, die Aufsätze und<br />
Auszüge aus Monographien von Cummins aus den siebziger, achtziger und neunziger<br />
Jahren enthält, könnte hier Abhilfe schaffen. Ihr ist ein Verzeichnis der wissenschaftlichen<br />
Arbeiten sowie eine Einleitung mit biographischen Notizen zum Leben<br />
und zum wissenschaftlichen Werk von Cummins beigegeben. Aus beidem wird nicht<br />
nur die Breite seines Forschungsinteresses und der interdisziplinäre Ansatz in seinen<br />
wissenschaftlichen Arbeiten deutlich, sondern auch sein bildungspolitisches Enga-
gement: So finden sich hier neben wissenschaftlichen Texten, die sich an ein Fachpublikum<br />
wenden, informierende Texte z.B. zu Fragen zweisprachiger Erziehung, die<br />
sich an interessierte Eltern wenden, sowie Texte, in denen zu in der Öffentlichkeit<br />
kontrovers diskutierten bildungspolitischen Fragen engagiert Stellung genommen<br />
wird. Diese kritischen Stellungnahmen beziehen sich überwiegend auf die bereits<br />
mehrfach erwähnte Debatte in den Vereinigten Staaten über Probleme und Chancen<br />
zweisprachiger Erziehung. Die unterschiedliche öffentliche Unterstützung für zweisprachige<br />
Erziehung in Kanada und in den Vereinigten Staaten kann nach Auffassung<br />
von Cummins nicht mit Unterschieden in den Ergebnissen empirischer Forschung<br />
in den beiden Ländern, sondern muss mit Unterschieden in der Bewertung<br />
dieser Ergebnisse sowie mit Unterschieden in der Darstellung der Ergebnisse wissenschaftlicher<br />
Forschung in der Öffentlichkeit erklärt werden.<br />
Auch die Rezeption der wissenschaftlichen Arbeiten von Cummins bietet hierfür ein<br />
Beispiel. In seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch Language, Power and Pedagogy:<br />
Bilingual Children in the Crossfire widerspricht Cummins einigen gängigen Annahmen<br />
über die Notwendigkeit der schulischen Förderung der Erstsprache zweisprachig<br />
aufwachsender Kinder, die sich auf die von ihm formulierte Interdependenzund<br />
Schwellenhypothese berufen:<br />
„As noted above, both advocates and opponents of bilingual education have<br />
sometimes conflated the threshold and interdependence hypotheses and drawn<br />
inappropriate conclusions as a result […] Some advocates of bilingual programs<br />
have also interpreted the threshold and interdependence hypotheses as implying<br />
that instruction for bilingual students should be virtually all through the medium<br />
of L1 with English reading instruction delayed for as long as possible.”<br />
(Cummins 2000, 193f.)<br />
Nach diesen Klarstellungen von Cummins ist sowohl die Darstellung seiner Thesen<br />
in den Ausführungen von Zimmer als auch in den Ausführungen von Goddard unzutreffend:<br />
Cummins plädiert demnach keineswegs dafür, Kinder aus Familien mit<br />
Migrationshintergrund möglichst lange ausschließlich in ihrer Erstsprache zu unterrichten<br />
und sie insbesondere zunächst in ihrer Muttersprache zu alphabetisieren. Die<br />
Rezeption der Arbeiten von Cummins kann zumindest in ihrer gegenwärtigen Form<br />
weder Befürwortern noch Gegnern einer zweisprachigen Erziehung als solide Argumentationsgrundlage<br />
dienen.
In welcher Richtung eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Jim<br />
Cummins Anstöße für die aktuelle bildungspolitische Diskussion geben könnte, soll<br />
an einer für seine wissenschaftlichen Arbeiten zentralen These dargelegt werden, der<br />
These, dass erfolgreiche Schulprogramme auf die individuellen Voraussetzungen der<br />
Schüler – und hier speziell auf die Verfügbarkeit von Vorläuferfertigkeiten für den<br />
Schriftspracherwerb – abgestimmt sein müssen. Das klingt zunächst banal, ist aber<br />
der Grundgedanke, der hinter der Formulierung von Interdependenz- und Schwellenhypothese<br />
steht.<br />
Cummins macht ja in seinem viel zitierten Aufsatz Linguistic Interdependence and<br />
the Educational Development of Bilingual Children selbst ausdrücklich auf Widersprüche<br />
in den Ergebnissen empirischer Untersuchungen der Resultate von Immersionsprogrammen<br />
aufmerksam, die einen zeitweiligen Wechsel in der Unterrichtssprache<br />
beinhalten: Während bestimmte Gruppen von Schülern von einem solchen<br />
Wechsel im Hinblick auf den Erwerb fremdsprachlicher Kompetenz deutlich profitieren,<br />
ohne dass die Entwicklung ihrer muttersprachlichen Kompetenz oder ihr Schulerfolg<br />
von diesem Sprachwechsel beeinträchtigt werden, macht sich bei anderen<br />
Gruppen von Schülern ein solcher Sprachwechsel nachteilig bemerkbar sowohl im<br />
Hinblick auf die Entwicklung ihrer Sprachkompetenz als auch im Hinblick auf ihren<br />
Schulerfolg. Cummins vertritt die These, dass es ganz offensichtlich Kinder aus bildungsnahen<br />
Milieus sind, die über die notwendigen Vorläuferfertigkeiten für einen<br />
erfolgreichen Schriftspracherwerb verfügen, die einen solchen Sprachwechsel problemlos<br />
meistern:<br />
„It might be objected, that the middle-class immersion child has very little knowledge<br />
of the vocabulary and syntax of L2 when L2 reading instruction is begun.<br />
However, in contrast to the low SES minority child, the immersion child is likely<br />
both to have developed a certain degree of facility in processing decontextualized<br />
information and also to have acquired or to be quickly capable of acquiring,<br />
the insights that print is meaningful and that written language is different from<br />
speech. In addition, through their L1 experience they are likely to have developed<br />
an understanding of most of the concepts they will encounter in their early<br />
reading of L2 […] The fact, that, in comparison to middle-class children, low SES<br />
minority language children may be more dependent on the school to provide the<br />
prerequisites for the acquisition of literacy skills does not imply that these children’s<br />
basic cognitive abilities are in a sense deficient nor that their command of<br />
the linguistic system of their L1 is necessary inadequate. It does imply, however,<br />
that the school program must be geared to the needs of individual children […]<br />
(Cummins 2001a, 83)
Die Beobachtung, dass Kinder sehr unterschiedliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen<br />
Schriftspracherwerb mitbringen, wird von der neueren Schriftlichkeitsforschung<br />
ausdrücklich bestätigt (Scheerer-Neumann 2003¸ Schneider 2004, Hurrelmann<br />
2004). Vorschulische Schrifterfahrungen in der Familie vermitteln Kindern nicht<br />
nur konkrete Vorkenntnisse, wie das Erkennen und Schreiben einzelner Buchstaben<br />
oder Wörter, in Verbindung damit haben sie wichtige Einsichten in die kommunikative<br />
Funktion von Schrift gewonnen sowie erste Einsichten in den Aufbau einer alphabetischen<br />
Schriftsprache und – damit verknüpft – eine beginnende phonologische Bewusstheit<br />
(Scheerer-Neumann 2003, 513f.; Schneider 2004). Die Beobachtung<br />
schwedischer Wissenschaftler, dass finnische Einwandererkinder, die in einem späteren<br />
Alter nach Schweden einwanderten, eine höhere Sprachkompetenz im Schwedischen<br />
und im Finnischen erreichten und schulisch erfolgreicher waren als die Kinder<br />
finnischer Einwanderer, die ihre gesamte Schulzeit an schwedischen Schulen<br />
verbrachten, wird nach Cummins durch die Beobachtung bei kanadischen Einwandererkindern<br />
aus ländlichen Gebieten Südeuropas relativiert, bei denen die Beobachtung<br />
eines Zusammenhangs zwischen höherem Einreisealter, besserer sprachlicher<br />
Entwicklung und größerem Schulerfolg nicht zutraf (zur Bedeutung des Einreisealters<br />
für die Entwicklung von Lesekompetenz in der Zweitsprache vgl. auch Stanat &<br />
Schneider 2004). Cummins führt das auf die unterschiedlichen schulischen Vorerfahrungen<br />
dieser beiden Schülergruppen zurück:<br />
„Thus, the schooling experiences of the adolescent immigrants may not have<br />
been effective in developing the type of linguistic competence necessary to allow<br />
them to quickly learn L2 and adapt to a highly abstract school curriculum. In<br />
contrast, Finland is a highly industrialized country whose educational system is<br />
equivalent to that of Sweden.” (Cummins 2001a, 77)<br />
Es ist also offenbar eine gute Schulbildung in der Erstsprache, die eine erfolgreiche<br />
Teilnahme am Unterricht in einer Fremdsprache und damit den Schulerfolg von sog.<br />
Quereinsteigern begünstigt und es ist die Verfügbarkeit von Vorläuferfertigkeiten für<br />
den Schriftspracherwerb, die eine erfolgreiche Alphabetisierung im Medium einer<br />
Fremdsprache begünstigt.<br />
Es stellt sich dann die Frage, ob ein Unterrichtsangebot in der Fremdsprache, das<br />
die Probleme zweisprachig aufwachsender Schüler nicht global in ihren mangelnden
Sprachkenntnissen in der Unterrichtssprache vermutet, sondern gezielt die Entwicklung<br />
der notwendigen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb fördert, nicht bei<br />
Kindern aus bildungsfernen Familien ebenso erfolgreich sein könnte, wie bei Kindern<br />
aus bildungsorientierten Familien. Genauso stellt sich die Frage, ob eine spezielle<br />
Förderung der Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb bereits im Elementarbereich<br />
eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in einer Fremd-/Zweitsprache<br />
erkennbar erleichtert.<br />
Solchen Fragen geht Cummins in seinem zuerst 1999 publizierten Aufsatz Alternative<br />
Paradigms in Bilingual Education Research: Does Theory Have a Place? nach.<br />
Hier stellt er zunächst die Resultate dreier Metaanalysen von empirischen Untersuchungen<br />
zur Effektivität unterschiedlicher Programme zur zweisprachigen Erziehung<br />
vor (August & Hakuta 1997; Greene 1998; Rossell & Baker 1996) und knüpft daran<br />
die Überlegung, inwiefern die Resultate dieser Metaanalysen, bzw. die Resultate der<br />
empirischen Studien, die die Grundlagen dieser Metaanalysen bilden, als Basis für<br />
bildungspolitische Entscheidungsfindungsprozesse dienen können. Dazu formuliert<br />
er die folgenden vier Fragen(Cummins 2001c, 337f.):<br />
1. Does bilingual education work?<br />
2. Does bilingual education work better than English-only instructional programs?<br />
3. Will students suffer academically if they are introduced to reading in their second<br />
language?<br />
4. Will greater amounts of English instruction (time-on-task) result in greater<br />
English achievement?<br />
Auf der Basis der genannten empirischen Untersuchungen lassen sich nach Cummins<br />
die beiden letztgenannten Fragen klar mit nein und die erstgenannte Frage klar<br />
mit ja beantworten. Die zweite Frage lässt sich dagegen nicht eindeutig mit ja oder<br />
nein beantworten; zumindest bestimmte Formen zweisprachiger Programme scheinen<br />
aber erfolgreicher zu arbeiten als die sogenannten english only- Programme. Die<br />
Antworten, die auf der Basis der Resultate der oben erwähnten empirischen Studien,<br />
bzw. der Metaanalysen zu diesen Studien auf die vier von Cummins formulierten<br />
Fragen gegeben werden können, sprechen alle nicht gegen die Einrichtung zwei-
sprachiger Unterrichtsprogramme. Allerdings sprechen sie auch nicht eindeutig für<br />
die Einrichtung zweisprachiger Unterrichtsprogramme in dem Sinne, dass zweisprachige<br />
Programme als eine hinreichende oder eine notwendige Voraussetzung für<br />
den Bildungserfolg von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund anzusehen<br />
sind. Aus den Resultaten der genannten empirischen Studien lassen sich also nicht<br />
zwingend bestimmte bildungspolitische Entscheidungen herleiten, es lässt sich aber<br />
– unter wissenschaftlichen Aspekten – zumindest der mögliche Nutzen einer Maßnahme<br />
im Hinblick auf das Erreichen einer bestimmten Zielsetzung abschätzen:<br />
Im Hinblick auf die oben diskutierte Frage, ob von der Regelung, Deutsch auf dem<br />
Schulhof als verbindliche Umgangssprache zu vereinbaren, eine Verbesserung der<br />
Deutschkenntnisse der Schüler zu erwarten ist, kann man auf der Grundlage der<br />
vorgetragenen Überlegungen vorhersagen, dass der mögliche Nutzen dieser Maßnahme<br />
eher gering ausfallen wird. Dafür sprechen zwei gewichtige Gründe, zum einen<br />
gibt es entgegen den Ausführungen von Hopf offenbar doch nicht genügend Anhaltspunkte<br />
dafür, dass die time on task-Hypothese zutreffend ist. Wenn Deutsch Unterrichtssprache<br />
ist, so geht vom Gebrauch der Muttersprache während der ja zeitlich<br />
sehr begrenzten Pausengespräche offenbar keine nachteilige Wirkung auf das<br />
Deutschlernen aus. Zum anderen liegen die Probleme der Schüler – wie dargelegt –<br />
ja gerade nicht im Bereich der Alltagskommunikation in der Fremdsprache, sondern<br />
im Gebrauch der Standard- bzw. Literatursprache. Für die Entwicklung der Fähigkeit,<br />
sprachlich anspruchsvolle Texte zu verstehen, bzw. solche Texte selbst zu verfassen,<br />
sind von dieser Regelung ebenfalls keinerlei nachhaltige Wirkungen zu erwarten.<br />
Hierzu wären gezielte Maßnahmen zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen<br />
der Schüler im Rahmen des Unterrichts erforderlich. Diese Erkenntnis ist allerdings<br />
auch nicht besonders neu. Es war nicht zuletzt die öffentliche Diskussion der<br />
Resultate der PISA-Studie im Hinblick auf die Lesefähigkeit von Kindern aus bildungsfernen<br />
Schichten, und zwar sowohl von monolingual deutschsprachigen wie<br />
auch von zweisprachig aufwachsenden Kindern, die den Anstoß zu einer breiten<br />
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskussion über Möglichkeiten zur Verbesserung<br />
der Lesekompetenzen dieser Kinder angestoßen hat (siehe dazu auch<br />
Schiefele u.a. (Hg.) 2004).
Welche Rolle die Zweisprachigkeit der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />
bei der Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen spielen sollte, lässt<br />
sich auf der Basis der hier vorgetragenen Überlegungen nicht eindeutig entscheiden.<br />
Die Antwort auf die von Cummins formulierte Frage, Will students suffer academically<br />
if they are introduced to reading in their second language?, ist nach seiner eigenen<br />
Einschätzung eindeutig negativ. Er verwahrt sich – wie dargelegt – in neueren<br />
Arbeiten sogar ausdrücklich gegen eine Auslegung der von ihm formulierten Interdependenz-<br />
und Schwellenhypothese in dem Sinn, dass Kinder aus Familien mit<br />
Migrationshintergrund zunächst in ihrer Muttersprache lesen lernen sollten, um sie<br />
vor schulischen Misserfolgen zu bewahren (Siebert-Ott 2001; Siebert-Ott 2003b;<br />
Wode 1995).<br />
Allerdings sprechen nach den vorgetragenen Überlegungen auch keine Gründe dagegen,<br />
Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund ebenso wie Kindern aus einsprachig<br />
deutschen Elternhäusern zweisprachige Unterrichtsprogramme anzubieten.<br />
Speziell two way immersion-Programme scheinen, sofern sie bestimmten Qualitätsansprüchen<br />
genügen, grundsätzlich in der Lage, Kindern gute sprachliche Kompetenzen<br />
in zwei Sprachen (einschließlich guter Lese- und Schreibfähigkeiten in der<br />
Zweit- bzw. Fremdsprache) zu vermitteln. Die von Spiewak (2005) in seinem Artikel<br />
Man spricht (nicht nur) Deutsch im Hinblick auf die vorgestellte bilinguale deutschtürkische<br />
Grundschule in Hamburg vorgetragene Skepsis, ob ein solches Angebot<br />
auf Dauer Bestand haben könne, ist daher zumindest aus fachwissenschaftlicher<br />
Sicht unbegründet.<br />
3. Fazit: Wer bekommt den Schwarzen Peter? – Die wissenschaftlichen Grundlagen<br />
bildungspolitischer Entscheidungen<br />
Die vorangehenden Ausführungen hatten das Ziel zu zeigen, dass es nicht an einem<br />
Mangel an verfügbarem fachwissenschaftlichem und fachdidaktischen Wissen liegt,<br />
wenn die bildungspolitische Diskussion im Hinblick auf die Entscheidung über geeignete<br />
Maßnahmen zur Förderung von zweisprachig aufwachsenden Kindern aus bildungsfernen<br />
Schichten auf der Stelle tritt. Es gibt – wie dargelegt – genügend gesicherte<br />
Erkenntnisse, die in diesen Fragen als Grundlage für bildungspolitische Ent-
scheidungen dienen können. Die Bildungspolitik bekommt also in diesen Fragen den<br />
Schwarzen Peter zurück.<br />
Wenn eine Entscheidung gegen ein zweisprachiges Bildungsangebot oder eine Entscheidung<br />
für eine Sprachenregelung auf dem Schulhof, die den Gebrauch der<br />
deutschen Sprache vorschreibt, mit sprachwissenschaftlichen oder sprachdidaktischen<br />
Erkenntnissen begründet wird, dann müsste gleichzeitig deutlich gemacht<br />
werden, dass nicht allein die fachwissenschaftlichen Gründe für eine solche Entscheidung<br />
ausschlaggebend waren. Aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer<br />
Sicht gibt es nämlich durchaus auch gute Gründe, die Entwicklung von Zweisprachigkeit<br />
auf hohem Niveau durch ein verstärktes Angebot zweisprachiger Bildungsgänge<br />
zu fördern. Ebenso gibt es aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer<br />
Sicht auch gute Gründe, die Sprachenwahl außerhalb des Unterrichts auf dem<br />
Schulgelände nicht in der beschriebenen Weise zu reglementieren.<br />
Eine differenziertere Argumentation von Seiten der bildungspolitisch Verantwortlichen<br />
könnte einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der öffentlichen Debatte in diesen<br />
Fragen und womöglich auch zur Verbesserung der Qualität bildungspolitischer Entscheidungen<br />
leisten.<br />
4. Literatur<br />
Auernheimer, Georg (Hg.). 2003. PISA – Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung<br />
der Migrantenkinder. Opladen.<br />
Baker, Colin. 3 2001. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon.<br />
Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001. An Introductory Reader to the Writings<br />
of Jim Cummins. Clevedon.<br />
Berkemeier, Anne. 2003. Schrifterwerb im mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula<br />
u.a. (Hg.). Bd.1, 30-41.<br />
Bredel, Ursula; Günther, Hartmut; Klotz, Peter; Ossner, Jacob & Siebert-Ott, Gesa.<br />
2003. (Hg.). Didaktik der deutschen Sprache. Ein Handbuch. 2 Bde. Paderborn.<br />
Cummins, Jim. 1979 (2001a). Linguistic Interdependence and the Educational Development<br />
of Bilingual Children. In: Review of Educational Research 49, 222-
251. (Wieder abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001, 63-<br />
95.)<br />
Cummins, Jim. 1988 (2001b). The Role and Use of Educational Theory in Formulating<br />
Language Policy. In: TESL (Wieder abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger,<br />
Nancy (eds.) 2001, 240-247.)<br />
Cummins, Jim. 1999 (2001c). Alternative Paradigms in Bilingual Education Research:<br />
Does Theory Have a Place? In: Educational Researcher 28/7, 26-32 (Wieder<br />
abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001, 326-341.)<br />
Cummins, Jim. 2000. Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the<br />
Crossfire. Clevedon.<br />
Ehlers, Swantje. 2004. Mono- und biliterate Erwerbsprozesse bei Migrantenkindern.<br />
In. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 15/1, 3-29.<br />
Felix, Sascha W. 1993. Psycholinguistische Untersuchungen zur zweisprachigen Alphabetisierung.<br />
Gutachten im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Schule,<br />
Berufsbildung und Sport. Passau.<br />
Gaschke, Susanne. 2001. Sprachlos bunt. Das Deutsch vieler Einwandererkinder ist<br />
schlechter denn je. Wenn die Eltern nicht mithelfen, sind Kindergärten und<br />
Schulen machtlos. In: DIE ZEIT Nr.21.<br />
Goddar, Jeanette. 1999. Rechnen auf Türkisch. Wer zuerst die eigene Sprache richtig<br />
lernt, hat insgesamt bessere Lernerfolge. In: Süddeutsche Zeitung<br />
(20.5.1999).<br />
Günther, Hartmut. 1993. Erziehung zur Schriftlichkeit. In: Eisenberg, Peter & Klotz,<br />
Peter (Hg.). Sprache gebrauchen – Sprachwissen erwerben. Stuttgart, 85-95.<br />
Günther, Hartmut & Ludwig, Otto (Hg.) 1994. Schrift und Schriftlichkeit. Writing and<br />
Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. An Interdisciplinary<br />
Handbook of International Research. 1. Halbband / Volume 1. Berlin.<br />
Günther, Hartmut & Ludwig, Otto (Hg.) 1996. Schrift und Schriftlichkeit. Writing and<br />
Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. An Interdisciplinary<br />
Handbook of International Research. 2. Halbband / Volume 2. Berlin.<br />
Heinemann, Karl-Heinz. 1999. Viele Migrantenkinder sitzen im Sprachbad. Eine<br />
Fachtagung in Soest beschäftigt sich mit der Frage, wie Schüler nichtdeutscher<br />
Herkunft am besten Deutsch lernen. In: Frankfurter Rundschau (29.7.1999).
Heinze, Andreas. 2001. Erfolgsstory oder Sackgasse – Zur Kontroverse um zweisprachige<br />
Erziehung in den USA. In: DJI-Projekt ‚Kulturenvielfalt’ (Hg.). Treffpunkt<br />
deutsche Sprache. München, 33-47.<br />
Hopf, Diether. 2005. Zweisprachigkeit und Schulleistung bei Migrantenkindern. In:<br />
Zeitschrift für Pädagogik. 2, 236-251.<br />
Huntington, Samuel. 1993. Im Kampf der Kulturen. Noch spielen die Nationalstaaten<br />
ihre Rolle. Aber die Kraftfelder auf dem Globus verschieben sich. In: DIE ZEIT<br />
Nr.33.<br />
Hurrelmann, Bettina. 2004. Sozialisation der Lesekompetenz. In: Schiefele, Ulrich<br />
u.a. (Hg.), 37-60.<br />
Lau, Jörg. 2006a. Man spricht Deutsch. Eine Realschule in Berlin bemüht sich um Integration.<br />
Nun ist die Empörung groß. In: DIE ZEIT Nr.5.<br />
Lau, Jörg. 2006b. Deutschstunden. Asad Suleiman kämpft für die deutsche Sprache<br />
auf seinem Schulhof in Berlin-Wedding. Plötzlich steht er im Mittelpunkt einer<br />
Debatte, die das Land verändern kann. In: DIE ZEIT Nr.6.<br />
Oomen-Welke, Ingelore. 2003. Entwicklung sprachlichen Wissens und Bewusstseins<br />
im mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 452-463.<br />
Reich Hans H. & Roth, Hans-Joachim. 2002. Zum Stand der nationalen und internationalen<br />
Forschung zum Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und<br />
Jugendlicher. Hamburg.<br />
Riegel, Enja. 2002. Mit den Eltern Klartext reden. Eine stetig wachsende Zahl von<br />
Kindern und Jugendlichen kann nur noch schlecht oder fast gar nicht mehr lesen<br />
und schreiben. In: Der Spiegel, Nr.22.<br />
Röber-Siekmeyer, Christa. 2003. Die Entwicklung orthographischer Fähigkeiten im<br />
mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 392-403.<br />
Schaaf, Julia. 2005. Krieg der Köpfe. Warum sind Bildungschancen so ungerecht<br />
verteilt? Neue Ergebnisse der Pisa-Studie befeuern alte Debatten über das<br />
Schulsystem. Dabei ist die Lösung doch so einfach: Der Unterricht muss besser<br />
werden. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr.44.<br />
Scheerer-Neumann, Gerheid. 2003. Entwicklung der basalen Lesefähigkeit. In: Bredel,<br />
Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 513-524.<br />
Schiefele, Ulrich; Artelt, Cordula; Schneider, Wolfgang & Stanat, Petra (Hg.). 2004.<br />
Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen<br />
im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden.
Schneider, Wolfgang. 2004. Frühe Entwicklung der Lesekompetenz: Zur Relevanz<br />
vorschulischer Sprachkompetenzen. In Schiefele, Ulrich (Hg.), 13-36.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 1997. Frühe Mehrsprachigkeit – Problem und Chance. In: Dürscheid,<br />
Christa; Ramers, Karl Heinz & Schwarz, Monika (Hrg.). Sprache im Fokus.<br />
Tübingen. 457-471.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 2001. Frühe Mehrsprachigkeit. Probleme des Grammatikerwerbs<br />
in multilingualen und multikulturellen Kontexten. Tübingen.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 2003a. Muttersprachendidaktik – Zweitsprachendidaktik – Fremdsprachendidaktik<br />
– Multilingualität. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 30-41.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 2003b. Entwicklung der Lesefähigkeiten im mehrsprachigen Kontext.<br />
In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 536-547.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 2003c. Muttersprachlicher Unterricht – Segregation oder Chance?<br />
In: Schulverwaltung spezial. Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und<br />
SchulKultur Sonderausgabe 3, 24-26.<br />
Siebert-Ott, Gesa 2003d. Mehrsprachigkeit und Bildungserfolg. In: Auernheimer, Georg<br />
(Hg.), 161-176.<br />
Siebert-Ott, Gesa. 2004. Schulerfolg und Mehrsprachigkeit – eine unendliche Geschichte?<br />
In: IZA – Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit 3/4 , 27-31.<br />
Spiewak, Martin. 2000. Gefangen im Ghetto. Ausländische Jugendliche sind die Verlierer<br />
von morgen. Die Schule sieht hilflos zu. In: DIE ZEIT Nr.16.<br />
Spiewak, Martin. 2006. Man spricht (nicht nur) Deutsch. Warum gilt Türkisch nur als<br />
Makel und nicht als Schatz? Wo lernen Lehrer, Kinder aus fremden Kulturen zu<br />
unterrichten? Ein Drittel der Schüler in Deutschland stammt aus Migrantenfamilien.<br />
Die Schulen haben darauf kaum reagiert. In: DIE ZEIT Nr.8.<br />
Stanat, Petra & Schneider, Wolfgang. 2004. Schwache Leser unter 15-jährigen<br />
Schülerinnen und Schülern in Deutschland: Beschreibung einer Risikogruppe. In<br />
Schiefele, Ulrich u.a. (Hg.), 243-2743.<br />
Thürmann, Eike. 2001. Streit um (schul-)sprachenpolitische Grundentscheidungen:<br />
Das amerikanische Beispiel. In: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung<br />
(Hg.). Zweisprachigkeit und Schulerfolg. Bönen, 47-67.<br />
Wintersteiner, Werner. 2003. Muttersprachenunterricht - Zweitsprachenunterricht –<br />
Fremdsprachenunterricht. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.2, 602-614.<br />
Wode, Henning. 1995. Lernen in der Fremdsprache: Grundzüge von Immersion und<br />
bilingualem Unterricht. Ismaning.
Zimmer, Dieter. 1998. Lieber gleich ins kalte Wasser. Die zweisprachige Erziehung in<br />
den USA ist ein Lehrstück dafür, wie leicht sich vermeintlicher Fortschritt verrennt.<br />
In: DIE ZEIT Nr.47.<br />
Zimmer, Dieter. 1996. Io trinko, io esso. Zu Hause in zwei Sprachen. Wie wird der<br />
Kinderkopf damit fertig? In: DIE ZEIT Nr. 50.