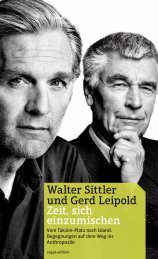Leseprobe - Abschied von 1001 Nacht
Die autobiografische Geschichte eines Journalistenlebens im Orient: Ulrich Kienzle spannt einen Bogen über 40 Jahre Nahostkonflikt. Er vermittelt einen ebenso fesselenden wie persönlichen EInblick in die arabische Welt und erklärt den "Arabischen Frühling" aus der Entwicklung der Konflikte im Nahen Osten heraus. Gleichzeitig beschreibt er den Alltag eines Kriegsreporters: erschütternde und berührende Erlebnisse, Zeugnisse faszinierender Mediengeschichte. Fesselnd, humorvoll, provokant - ein echter Kienzle. Das persönliche Resümee eines großen Journalisten.
Die autobiografische Geschichte eines Journalistenlebens im Orient: Ulrich Kienzle spannt einen Bogen über 40 Jahre Nahostkonflikt. Er vermittelt einen ebenso fesselenden wie persönlichen EInblick in die arabische Welt und erklärt den "Arabischen Frühling" aus der Entwicklung der Konflikte im Nahen Osten heraus. Gleichzeitig beschreibt er den Alltag eines Kriegsreporters: erschütternde und berührende Erlebnisse, Zeugnisse faszinierender Mediengeschichte.
Fesselnd, humorvoll, provokant - ein echter Kienzle.
Das persönliche Resümee eines großen Journalisten.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
SELBSTMORD MIT CHAMPAGNER UND KAVIAR<br />
Der Anflug auf Beirut war immer ein Abenteuer. Bei Waffenstillstand<br />
waren wir abgeflogen – jetzt, bei unserer Rückkehr,<br />
war der Krieg längst in der nächsten Runde. Der Flughafen<br />
war zum Glück noch geöffnet. Zwar hatten alle europäischen<br />
Airlines den Flugbetrieb eingestellt, noch wurde<br />
Beirut aber <strong>von</strong> der »Middle East Airlines« an ge flo gen. Die<br />
letzten Kilometer glitt die Maschine über West beirut und<br />
über die Palästinenserlager Sabra und Schatila, in wenigen<br />
Hundert Metern Höhe. Unten herrschten neue Spannungen.<br />
Die Versuchung für Desperados jeglicher Couleur war<br />
sicher groß, eines der Flugzeuge vom Himmel zu holen.<br />
Entsprechend groß war meine Sorge. Ein Pilot der »Middle<br />
East Airlines« hatte mich einmal beruhigt und mir versichert,<br />
dass er selbst nie Angst habe: Die RPGGranaten<br />
seien völlig ungeeignet, um Flugzeugen gefährlich zu<br />
211
werden: »In dem Augenblick, wenn sie auf uns zielen, sind<br />
wir schon einige Hundert Meter weiter. Ein Treffer wäre<br />
rei ner Zufall.« Richtig überzeugend fand ich das nicht. Irgendwie<br />
hatte ich bei jedem Anflug Angst und beruhigte<br />
mich erst, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen<br />
hatte.<br />
Der Flughafen befand sich im muslimischen Westen<br />
der Stadt. Unsere Wohnung aber lag in Hazmieh, im christlichen<br />
Osten. Im Kriegszustand galten die vertrauten Spielregeln:<br />
Die Green Line war unpassierbar. Da meine Frau<br />
befürchtete, ich würde mit unserem am Flughafen abgestellten<br />
Dienstwagen nichts ahnend nach Hause fahren,<br />
hatte sie beschlossen, mich mit ihrem »Mini Cooper« abzuholen<br />
– und sich dabei selbst in Gefahr begeben. Sie hatte<br />
darauf spekuliert, dass die Kriegsparteien wie üblich ihre<br />
Mittagspause einhielten. Mittags hatten in Beirut die meisten<br />
Geschäfte geschlossen, da machte das bestflorierende,<br />
der Krieg, keine Ausnahme. Diese Kampfpause wollte sie<br />
zur Überwindung der Green Line nutzen. Noch an der<br />
Tankstelle unseres Viertels wurde sie vom Tankwart gewarnt:<br />
»Sie sind verrückt, Frau Kienzle! Das ist Selbstmord!<br />
Sie können nicht zum Flughafen!« Sie aber war <strong>von</strong><br />
ihrem Vorhaben nicht abzubringen. So startete sie mit vollem<br />
Tank. Nichts bewegte sich in der prallen Mittags hitze,<br />
kein Vogel war zu hören. Sie fuhr den Berg hoch nach<br />
Baabda, am Präsidentenpalast vorbei – unser Schleichweg<br />
zum Flughafen. Sie war ganz allein, kein Mensch, kein anderes<br />
Auto auf der Straße. Allmählich wurde ihr der eigene<br />
Plan unheimlich. Als sie die Residenz des Präsidenten hinter<br />
sich gelassen und den Buckel passiert hatte, nachdem<br />
212
sie aus dem Wäldchen gefahren war, die kurvige, enge<br />
Straße steil bergab – hörte sie Schüsse. Es war klar, dass<br />
auf sie geschossen wurde, außer ihr war niemand unterwegs.<br />
Sie raste wie eine Wahnsinnige den Buckel hinunter.<br />
Wir waren durch den Krieg allerhand gewohnt und wussten:<br />
Wenn irgendetwas passierte, Vollgas geben und im<br />
Zweifelsfall Zickzack fahren! In der Talsohle entdeckte<br />
meine Frau ein Haus. Mit blauen Fensterläden, die geschlossen<br />
waren. Sie stoppte direkt davor, öffnete die<br />
Fahrertür, warf sich im Schutz ihres »Minis« auf den Boden<br />
und begann jämmerlich zu weinen. Die Situation erschien<br />
ihr aussichtslos.<br />
Da verstummten die Schüsse. Nur das Zirpen der Zikaden<br />
war noch zu hören. Nach einigen Minuten, die ihr wie<br />
eine Ewigkeit vorkamen, hörte sie das Geräusch eines Lastwagens,<br />
voll besetzt mit bewaffneten Soldaten. In panischer<br />
Angst begann meine Frau auf die Männer einzureden, in ihrem<br />
gebrochenen Arabisch: »Ana aruch al matar! Ich muss<br />
zum Flughafen! Ich muss meinen Mann abholen.« Die Männer<br />
lachten sich halbtot, als sie die Sätze hörten und meine<br />
Frau sahen, wie sie in Todesangst auf sie einschrie. Was sie<br />
nicht erwartet hatte: Die jungen Männer beruhigten sie, sagten,<br />
dass sie selbst vom Flughafen kämen. Und dass die<br />
Strecke sicher sei. So raste sie weiter.<br />
Der Flughafen war voller Soldaten. Meine Frau fragte<br />
im Direktionsbüro, ob sie dort warten könne. Die Situation<br />
im Terminal war ihr unheimlich. Als wir endlich angekommen<br />
waren, fuhren wir zurück in die Stadt. Nicht über die<br />
Green Line ins Christenviertel, sondern, wie immer wenn<br />
der Krieg auf Touren kam: ins Hotel. Und dieses Mal blieben<br />
213
wir für immer dort. Die Tage unserer Wohnung nämlich<br />
waren endgültig gezählt.<br />
Als wir beim nächsten Waffenstillstand nach Hause<br />
wollten, waren wir überrascht: Wir wurden in unseren eigenen<br />
vier Wänden als Gäste empfangen. Die Phalangisten<br />
hatten in unsere Wohnung eine Flüchtlingsfamilie aus einem<br />
christlichen Dorf einquartiert. Die neuen Bewohner<br />
– nur Frauen, die Männer waren bei der Miliz – begrüßten<br />
uns mit dem traditionellen »Ahlan wa Sahlan« 1 und waren<br />
sehr freundlich. Die Situation war ihnen sichtlich unangenehm.<br />
Unsere Möbel standen noch an den gewohnten Plätzen,<br />
nur in den Schränken herrschte ein wenig Unordnung.<br />
Als die Dame des Hauses den obligaten Kaffee servieren<br />
wollte, war sie unschlüssig, welche Tassen sie benutzen<br />
sollte. Meine Frau war behilflich und empfahl ihr diejenigen<br />
aus dem Wohnzimmerschrank. Natürlich war die Stimmung<br />
angespannt. Am meisten ärgerte mich, dass mein ganzer<br />
Vorrat an Ksara Rosé verschwunden war. Letztlich war die<br />
Frage ungeklärt, wer das Feld räumen musste: Besitzer oder<br />
Besetzer? Auch das Schicksal unserer Möbel stand in den<br />
Sternen. Wo es weder eine funktionierende Staatsautorität<br />
noch eine Ordnungsmacht gab, waren Rechtsfragen obsolet.<br />
Schließlich verabschiedeten wir uns freundlich und traten<br />
erst einmal den Rückzug an.<br />
Beirut beging Selbstmord. Zielstrebig. Das Leben in der<br />
Stadt war zum Albtraum geworden. Die meisten Ausländer,<br />
aber auch Hunderttausende Libanesen, waren geflüchtet.<br />
Viele unserer Bekannten hatten die Stadt verlassen. »Ma<br />
1 Herzlich willkommen<br />
214
schek«, das Hotel, in dem wir unsere ersten Monate in Beirut<br />
verbracht hatten, war ausgebrannt, eine Ruine. Und Maschek<br />
selbst, der österreichische Abenteurer, saß an der<br />
Côte d’Azur, betrieb dort ein Café und versuchte sich im<br />
Diamantenhandel. Er wartete darauf, dass sich der Libanon<br />
beruhigen würde.<br />
Auch das »Rheingold«, die deutsche Bar, war jetzt geschlossen.<br />
Vor dem Krieg war sie ein beliebter Treffpunkt<br />
der Journalisten gewesen, immer rappelvoll. Der ältere<br />
Herr, der die Kneipe mit seiner deutschen Lebensgefährtin<br />
führte, war nicht unsympathisch. Ich hatte ihn schon in<br />
den ersten Wochen in Beirut kennengelernt. Ein echtes<br />
Original – und ein sehr erfahrener Orientkenner. Seit fast<br />
30 Jahren lebte er hier. Er wusste mehr über die Verhältnisse<br />
in der Levante als viele Libanesen. Deshalb besuchte<br />
ich ihn oft und unterhielt mich mit ihm. Er war nicht nur<br />
bestens über die Historie informiert, er kannte sich auch in<br />
der verwirrenden Tagespolitik aus. Die ständig wechselnden<br />
Machtkämpfe der einzelnen Clans, die Ränkespiele<br />
der libanesischen Politik – er wusste Bescheid. Und Informationen<br />
<strong>von</strong> ihm waren immer interessant. In seiner<br />
Kneipe brodelte die Gerüchte küche, hier wurden bei Whiskey<br />
und Bier Meinungen ausgetauscht und Informationen<br />
verhökert. Seit Kriegsbeginn lag die Bar direkt an der<br />
Green Line. Manchmal war sie tagelang unter Dauerbeschuss.<br />
Schutt wohin das Auge reichte. Nur noch selten,<br />
bei einem Waffen stillstand, verirrte sich ein Gast jetzt noch<br />
zu dem alten Haudegen. Ein gut gehendes Geschäft war<br />
seine Kneipe schon lange nicht mehr. Aber er blieb. Er<br />
konnte nicht nach Deutschland zurück. Fast zwei Jahre<br />
215
lang überlebte er die ständigen Schießereien direkt an der<br />
Front. Irgendwann musste er die Schnauze voll gehabt haben.<br />
Eines Tages, mitten im Krieg, trat er mit erhobenen<br />
Händen aus seinem Haus und marschierte in Richtung<br />
Front. Er hatte sich vorgenommen, Frieden zu machen, auf<br />
eigene Rechnung. Er ließ sich durch Schüsse nicht aufhalten<br />
und marschierte in den sicheren Tod. Ein Selbstmord<br />
mithilfe der Milizen.<br />
Dass er ein alter Nazi war, habe ich erst später erfah ren.<br />
Direkt nach dem Krieg war er nach Beirut gekommen und<br />
hier untergetaucht. Seine politische Vergangenheit störte<br />
im Libanon niemanden. Pierre Gemayel, der Phalan gistenführer,<br />
war selbst <strong>von</strong> den Nazis fasziniert. Aber auch<br />
PLO-Leute, eigentlich links einzuordnen, fanden an einer<br />
solchen Biografie nichts Anrüchiges. Mich irritierte und<br />
verwirrte dieser unreflektierte Umgang mit der deutschen<br />
Vergangenheit. Immer wieder wurde ich auch bei Linken<br />
mit »Heil Hitler« begrüßt. Das war entsetzlich. »Der Feind<br />
meines Feindes ist mein Freund.« Hitler hatte unter den<br />
Arabern viele Bewunderer, weil er Millionen <strong>von</strong> Juden hatte<br />
vergasen lassen. Diskussionen waren sinnlos.<br />
Immer einsamer waren mittlerweile die Übriggebliebenen<br />
in dieser traurigen Stadt. Viele hatten keine Alternative<br />
– wohin sollten sie gehen? Andere warteten noch<br />
ab. Manche brachten einfach die Kraft nicht auf, die sterbende<br />
Stadt zu verlassen. Eine Melange aus all diesen<br />
Gründen hielt wohl auch eine Österreicherin in Beirut fest.<br />
Wir hatten sie schon vor dem Krieg kennengelernt. Sie<br />
lebte allein in einer stattlichen Villa, mit Blick aufs Meer.<br />
Ihr Mann, ein Libanese, war nicht mehr am Leben. Wir<br />
216
esuchten sie manchmal, sie wohnte nicht weit <strong>von</strong> uns<br />
entfernt. An einem dieser Abende verriet sie uns das<br />
Geheimnis ihres Reichtums, sie erzählte vom Schicksal<br />
ihres Mannes.<br />
Sie war mit einem »Abadai« verheiratet gewesen. Der<br />
»Abadai« war eine besondere Beiruter Spezialität: ein professioneller<br />
Diplomatenkiller. Wenn bestimmte arabische<br />
Länder Probleme mit Politikern hatten, wurden diese als<br />
Diplomaten nach Beirut versetzt. Schon während unserer<br />
ersten Monate dort hatte ich mich gewundert, dass auf der<br />
Hamra, der berühmten Flaniermeile, immer wieder Leute<br />
erschossen wurden. Und in aller Regel waren die Opfer<br />
Diplomaten. Als ich damals zum ersten Mal <strong>von</strong> den<br />
»Abadai« hörte, konnte ich es kaum glauben. Aber sie waren<br />
Teil der Beiruter Realität. Ein gefährlicher, aber lukrativer<br />
Berufszweig. Als uns jetzt diese Österreicherin die Geschichte<br />
ihres Mannes erzählte, hatte sie keinen Grund zu<br />
lügen. Er hatte sich im Lauf der Jahre ein prachtvolles Anwesen<br />
zusammengeschossen. In Ausübung seines Berufs<br />
war er ums Leben gekommen. Jetzt saß sie mutterseelenallein<br />
in ihrer Villa, mitten im Bürgerkrieg, und war dankbar,<br />
dass sie jemandem ihre Geschichte erzählen konnte.<br />
Ein ungewöhnliches Schicksal in Beirut.<br />
Die letzte moralische Autorität des Libanon war ein<br />
Radiomoderator: Sharief Achawe. In seinen täglichen Sendungen<br />
beschimpfte er die Politiker, die in ihren Villen in<br />
den Bergen hockten, während die Stadt kollabierte. Er<br />
nannte sie Feiglinge. Er mahnte und drohte. Seine Sendungen<br />
waren das beliebteste Radioprogramm des Libanon. Einmal<br />
wurde er abgesetzt – und nach heftigen Protesten aus<br />
217
der Bevölkerung wieder ans Mikrofon zurückgeholt. Sharief<br />
Achawe hatte ein eigenes Informantennetz aufgebaut. Er<br />
warnte vor gefährlichen Straßen in Beirut und rettete damit<br />
vielen Menschen das Leben. Schnell wurde er zum Idol der<br />
schweigenden Mehrheit, <strong>von</strong> Moslems und Christen gleichermaßen<br />
geschätzt.<br />
Irgendwann rief er seine Hörer <strong>von</strong> »Radio Liban« zum<br />
Widerstand gegen die Milizen auf: »Wir sind das Volk!«<br />
Diesen mittlerweile historischen Satz habe ich zum ersten<br />
Mal im Libanon gehört. 13 Jahre vor dem Fall der Berliner<br />
Mauer. Auf Arabisch. »Lasst uns diesen unsinnigen Krieg<br />
stoppen! Morgen treffen wir uns in Chiah – und <strong>von</strong> dort<br />
aus machen wir Frieden in der ganzen Stadt. Die Stadt<br />
gehört uns und nicht den Milizen!« Er hatte mit der Armee<br />
gesprochen, und die hatte versprochen, seine Aktion zu<br />
schützen.<br />
Am nächsten Morgen fuhren wir in die genannte<br />
Straße in Chiah, nicht weit <strong>von</strong> unserem zerstörten Büro<br />
entfernt. Direkt an der Green Line. Und tatsächlich stand<br />
da Sharief Achawe, mit einem Megafon in der Hand. Und<br />
um ihn herum einige gepanzerte Fahrzeuge der libanesischen<br />
Armee. Gegen die verschlossenen Fenster und Türen<br />
der Häuser rief der Rundfunkmoderator: »Brüder und<br />
Schwestern, kommt aus euren Wohnungen! Lasst uns Frieden<br />
schließen! Habt keine Angst!« Minuten verstrichen.<br />
Zunächst passierte gar nichts. Nach einigen Minuten aber<br />
kamen die Ersten vorsichtig aus ihren Stellungen. Ich kam<br />
mir vor wie bei »High Noon«: Von beiden Seiten marschierten<br />
bewaffnete Mili zionäre aufeinander zu. Misstrauisch<br />
zuerst, dann fassten sie Vertrauen. Aber ich war mir<br />
218
sicher: Schon eine Kleinigkeit hätte genügt, um eine Katastrophe<br />
auszulösen. Immer mehr Menschen kamen zusammen,<br />
Beirutis, die sich lange nicht gesehen hatten. Sie<br />
umarmten sich, Frauen jubelten, manche weinten, Reis<br />
wurde aus den Fenstern geworfen. Ein Friedensfest. Und<br />
Sharief Achawe rief in sein Megafon: »Wir sind doch alle<br />
Libanesen. Wir alle sind Menschen. Und wir wollen alle<br />
überleben. Wir wollen diesen Krieg nicht!« Ich bekam es<br />
mit der Angst zu tun. Irgendwann schießt einer, dachte<br />
ich, und dann gibt es hier kein Entkommen. Aber die Stimmung<br />
blieb euphorisch – und friedlich. Nach zwei Stunden<br />
Frieden feiern zog Sharief Achawe weiter, in die<br />
nächste Straße. Wir folgten ihm und dort passierte das<br />
Gleiche. Vier, fünf Straßen. Immer das gleiche Ritual, bis<br />
zum Nachmittag.<br />
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit brach er seine Aktion<br />
ab, und ich fuhr, etwas nachdenklich geworden, nach<br />
Hause. Achawe war die Stimme des Libanon. Die letzte konfessionsübergreifende,<br />
gemeinsame Institution. Als ich die<br />
erste Straße passieren wollte, die wir am Morgen befriedet<br />
hatten, musste ich das Gaspedal durchtreten: Dort, wo vor<br />
wenigen Stunden noch Reis aus den Fenstern geworfen<br />
wurde, hatten die Milizen das Kommando wieder übernommen.<br />
Es wurde wieder geschossen. Der Traum vom Frieden<br />
war ein kurzer Traum geblieben.<br />
Die Situation in Beirut wurde täglich bizarrer. Die<br />
Maroniten planten einen eigenen Flughafen. Wenn sie ins<br />
Ausland wollten, mussten sie über den Seeweg nach Zypern,<br />
um dort ein Flugzeug zu erreichen. Den Flughafen im<br />
muslimischen Westbeirut konnten sie nicht nutzen. Nichts<br />
219
funktionierte mehr, Beirut hatte seine wichtigste Rolle als<br />
»Tor zur Arabischen Welt« verloren. Noch immer erschienen<br />
täglich ein Dutzend Zeitungen, aber eine normale journalistische<br />
Arbeit war nicht mehr möglich. Es war nur noch<br />
eine Frage der Zeit, bis wir das Büro schließen mussten.<br />
Und tat sächlich wurde schon bald die letzte Klappe für das<br />
»ARD«-Büro in Beirut geschlagen.<br />
Ich hatte wieder einmal einen Tipp <strong>von</strong> Paula bekommen.<br />
Im Südlibanon war ein israelischer Vasallenstaat im<br />
Entstehen. Ein brisantes Thema. Die Israelis rüsteten eine<br />
Miliz hoch, die ihre Interessen im Libanon vertreten sollte:<br />
die Südlibanesische Armee. Beweise dafür gab es bislang<br />
keine. Nur Gerüchte. Ich wollte selbst herausfinden, was es<br />
damit auf sich hatte. Und so fuhren wir in den Südlibanon,<br />
an die libanesisch-israelische Grenze, nach Marjayoun und<br />
<strong>von</strong> dort weiter Richtung Berge. Irgendwann hörte die<br />
Straße auf, wir mussten die Ausrüstung schultern und das<br />
letzte Stück über die Berge zu Fuß weiter, über alte, unbefestigte<br />
Schmugglerpfade. Ich hatte mir einige Tage zuvor<br />
neue Stiefel gekauft – italienische, wie sich das in Beirut<br />
gehörte. Mit einem längeren Fußmarsch hatte ich gerechnet.<br />
In meiner Naivität hatte ich geglaubt, mit den neuen<br />
Schuhen gut voranzukommen. Ein fürchterlicher Irrtum:<br />
Meine Füße waren bereits auf halber Strecke voller Blasen<br />
und schon deshalb werde ich diesen Trip nie vergessen.<br />
Als wir die letzte Bergkuppe erreichten, bot sich uns eine<br />
unwirkliche Szenerie: In der Ferne sahen wir libanesische<br />
Milizionäre und israelische Soldaten, gemeinsam schafften<br />
sie Material über den Grenzzaun – Kisten und Kanister,<br />
eine groß angelegte Aktion. Wir näherten uns dem Camp<br />
220
und dort empfing uns der Chef selbst: Major Saad Haddad.<br />
Als er hörte, dass wir vom westdeutschen Fernsehen waren,<br />
ließ er uns drehen. Wir filmten Kisten mit israelischer<br />
Aufschrift, Zelte und israelische Waffen. An den Grenzzaun<br />
aber durften wir nicht. Dann wurde Haddad ans Feldtelefon<br />
gerufen, offensichtlich ein Anruf <strong>von</strong> israelischer<br />
Seite. Er kam mit einem klaren Befehl zurück: »Khallas!<br />
Khallas! Schluss, aus!« Wir mussten abbrechen und das gedrehte<br />
Material abliefern. In dieser Situation half ein alter<br />
Trick: Mike Condé zog un belichtetes Material aus seinem<br />
schwarzen Wechselsack und lieferte dem Major einen Rohfilm<br />
ab. Den belichteten konnten wir retten.<br />
Wir hatten brisantes Material im Kasten – und daraus<br />
machte ich einen »Weltspiegel«-Beitrag. Was ich nicht<br />
mehr in Bildern zeigen konnte, erklärte ich in meinem Aufsager.<br />
Eine legitime journalistische Methode: Ich berichtete,<br />
was ich mit eigenen Augen gesehen hatte, aber nicht<br />
drehen durfte. Der »Weltspiegel« lief und kurze Zeit später<br />
erreich te mich wieder einmal ein Anruf des Intendanten:<br />
»Herr Kienzle, was haben Sie denn da um Gottes Willen angestellt?<br />
Die Israelische Botschaft hat sich bei mir gemeldet.<br />
Die sagen: Sie verbreiten Märchen. Das ist völlig indiskutabel,<br />
was Sie da aus dem Südlibanon berichten!«<br />
Bausch faltete mich am Telefon zusammen – nach allen Regeln<br />
der Hierarchie. Ich versuchte ihm zu erklären, dass<br />
nicht nur ich diese merkwürdige Kooperation zwischen<br />
Maroniten und Israelis gesehen hatte, sondern das ganze<br />
Team. Er hörte sich das an, dann legte er auf.<br />
Kritik aus Jerusalem gehörte zum Alltag eines Korrespondenten<br />
in der Arabischen Welt. Das war fast Routine.<br />
221
Und die Methoden waren nicht immer die feinsten. Innerhalb<br />
der »ARD« begann eine Kampagne gegen mich – ich sei<br />
propalästinensisch und antiisraelisch. Man versuchte, meinen<br />
Ruf zu ruinieren. Wieder einmal wurde mir ein Ortswechsel<br />
nahegelegt – und die Korrespondentenstelle im<br />
südlichen Afrika angeboten.<br />
Die Luft war dünn geworden. Und ich bekam noch einen<br />
Anruf, einen Tag nach der Ausstrahlung. Carl Buchalla,<br />
der Korrespondent der »Süddeutschen Zeitung«, war in der<br />
Leitung. »Ihr müsst hier sofort raus!«, sagte er todernst.<br />
»Der israelische Rundfunk berichtet <strong>von</strong> deinem ›Weltspiegel‹-Beitrag.«<br />
Für die israelischen Rundfunkkollegen<br />
war unsere Enthüllung, die Unterstützung der maronitischen<br />
Milizen durch Israel, eine Topnachricht. Und auch<br />
den libanesischen Maroniten kam die Veröffentlichung<br />
dieses Deals denkbar ungelegen: Ihr Kontakt mit Israel<br />
war auf geflogen. Buchalla empfahl mir, nach Amman zu<br />
verschwinden, auf jeden Fall raus aus dem Libanon, bis<br />
Gras über die Sache gewachsen war. In Windeseile packten<br />
wir unsere Sachen und machten uns auf die vertraute Strecke<br />
über die Bekaa-Ebene und Damaskus nach Amman.<br />
Ins »Interconti«. Viele Kollegen der internationalen Presse<br />
folgten später unserem Beispiel. Sie wollten einfach für<br />
einige Nächte Ruhe haben und nicht ständig damit rechnen<br />
müssen, über den Haufen geschossen zu werden. Eine<br />
Zeitlang betreuten wir den Nahen Osten jetzt <strong>von</strong> Amman<br />
aus, auch in Beirut drehten wir bald wieder. Aber schnell<br />
wurde klar: Amman kam als Standort für den Korrespondentenplatz<br />
nicht infrage. Selbst im Krieg war Beirut als<br />
Informationsbörse wichtiger als die jordanische Haupt<br />
222
stadt im Frieden. Gleichzeitig aber war es einfach unmöglich<br />
geworden, weiterhin in Beirut zu leben. So kam Kairo<br />
wieder ins Spiel. Die Metropole am Nil war seit Jahrhunderten<br />
das wichtigste politische Zentrum in der Arabischen<br />
Welt. Siemens hatte einen Großauftrag zur Modernisierung<br />
des maroden Kairoer Telefonnetzes erhalten.<br />
Und Anwar as-Sadat hatte eine Liberalisierung der Pressefreiheit<br />
eingeleitet. In Kairo konnte man jetzt unter professionellen<br />
Bedingungen arbeiten.<br />
Es galt, <strong>Abschied</strong> zu nehmen. Wir lösten das Büro im<br />
»Concorde« auf und veranlassten den Umzug. Unsere privaten<br />
Möbel aber standen noch immer in unserer Wohnung in<br />
Hazmieh – darunter Dinge, an denen wir durchaus hingen.<br />
Im Suq hatte ich alte libanesische Truhen gekauft und an<br />
der Corniche, ganz in der Nähe des Hotels »Saint George«,<br />
einen ungewöhnlichen Schrank. Er war mit Teppichmotiven<br />
bemalt und mit Koranversen verziert. Eine teure Auftragsarbeit<br />
für einen Scheich vom Golf. Ich hatte das Schmuckstück<br />
während des Krieges preiswert bekommen. Wenige<br />
Tage nach meinem Kauf war der Laden bei einem Bombenanschlag<br />
in die Luft geflogen. Auch Bücher und alte Fotos<br />
waren noch in unserer Wohnung – das alles wollten wir<br />
nicht einfach zurücklassen.<br />
Es war Alain Debos, der uns den Tipp gab: Die Französische<br />
Botschaft hatte ein Umzugsunternehmen der ganz<br />
besonderen Art an der Hand. Kurze Zeit später standen<br />
einige martialisch aussehende französische Muskelmänner<br />
in unserem Hotel und verhandelten mit uns die Konditionen<br />
des Geschäfts. »Morgen früh um fünf holen wir Ihre Sachen.<br />
Da schlafen die alle. Das muss schnell gehen.« Per<br />
223
Handschlag wurden wir uns einig. Und am nächsten<br />
Morgen, pünktlich um fünf, fuhren meine Frau und die<br />
fran zö sischen Abenteurer über die Green Line hoch nach<br />
Hazmieh. Die Spe diteure waren offensichtlich kriegserfahren.<br />
Und nicht sehr auskunftsfreudig. Wahrscheinlich waren<br />
sie <strong>von</strong> der Fremdenlegion angeheuert worden. Mehr<br />
Umzugskommando als Umzugsunternehmen. Ihr Lkw war<br />
mit modernstem Kriegsgerät ausgestattet.<br />
In Hazmieh verzichteten sie darauf, den Klingelknopf<br />
zu benutzen. Sie jagten die neuen Bewohner aus unseren<br />
Betten und hielten sie in einem Zimmer in Schach. Als sie<br />
begannen, einzelne Möbelstücke in Windeseile in Richtung<br />
Balkon zu schleppen, protestierte die Hausherrin – sie bestand<br />
darauf, dass die Betten zur Wohnung gehörten. Auch<br />
ein Tisch, einige Schränke und selbstverständlich Geschirr<br />
und Besteck. Die Möbelpacker fackelten nicht lange. Sie<br />
hängten – im zweiten Stock – in blitzartiger Geschwindigkeit<br />
die uns wichtigen Möbel an einen Flaschenzug und verfrachteten<br />
sie in ihren Lkw. In wenig mehr als einer Stunde<br />
war der Umzug erledigt und die Möbel gingen auf dem Landweg<br />
nach Deutschland.<br />
Dann verkauften wir den »Mini Cooper« meiner Frau.<br />
Unseren Dienstwagen aber wollte ich einfach in Beirut stehen<br />
lassen – irgendwo zwischen den Ruinen, neben all den<br />
anderen zerschossenen und ausgebombten Wracks. Er war<br />
völlig perforiert. In Deutschland wäre man damit sofort aus<br />
dem Verkehr gezogen worden. Ich konnte mir nicht vorstellen,<br />
dass irgendjemand bereit war, dafür auch nur ein Pfund<br />
zu bezahlen. Die Einschüsse hatte der Wagen bei der Wahl<br />
des Präsidenten Sarkis am 8. Mai 1976 abbekommen. Diese<br />
224
Wahl war die bleihaltigste in der libanesischen Geschichte.<br />
Antisyrische Kräfte hatten damals versucht, den Urnengang<br />
zu verhindern und am Wahltag das Parlament mit Granaten<br />
und Mörsern beschossen. Viele der Abgeordneten kamen<br />
<strong>von</strong> Leibwächtern geschützt, andere wurden im Mörserhagel<br />
mit vorgehaltener Pistole ins Notparlament an der<br />
Green Line geschleppt. Immer wieder mussten wir Deckung<br />
suchen. Mit viel Glück überstanden alle diesen Tag unbeschadet.<br />
Kein Abgeordneter wurde verletzt, und auch wir<br />
waren mit dem Schrecken da<strong>von</strong> gekommen. Nur unser<br />
Wagen war Opfer eines Mörsereinschlags geworden – die<br />
linke Karosserieseite war seitdem völlig durchlöchert.<br />
Alain Debos, das französische Schlitzohr, aber wusste<br />
auch hier, was ich nicht wusste: Gebrauchte Autos mit<br />
Kennzeichen und Zulassung waren im Beirut dieser Tage<br />
gefragte Objekte. Denn die Zulassungsbehörden hatten<br />
geschlossen. Man konnte in Beirut schon seit Längerem<br />
kein Auto mehr anmelden. Also behalf man sich mit gebrauchten<br />
Kennzeichen, die man notfalls auch mit dem<br />
dazu gehörigen Auto kaufte. Und so war die Schlussepiso de<br />
unserer Beirutzeit <strong>von</strong> typisch libanesischer Dramatik. Und<br />
entsprechen dem Charme.<br />
Ich muss gestehen: Warum die libanesischen Kfz-Besitzer<br />
mitten in der Anarchie des Krieges ausgerechnet auf<br />
gültige Kennzeichen Wert legten, ist mir bis heute schleierhaft.<br />
Womit sich die Polizei, wenn sie überhaupt in Erscheinung<br />
trat, in Beirut damals beschäftigte, wusste niemand so<br />
genau. Dass sie jemals Kennzeichen kontrolliert hätte, erscheint<br />
mir eher zweifelhaft. Es gab nur einen verständlichen<br />
Grund für diese ungewöhnliche Ordnungsliebe: die<br />
225
PLO. Diese eigentliche Ordnungsmacht in Westbeirut konfiszierte<br />
bei Kontrollen jedes Fahrzeug, dessen Papiere nicht<br />
in Ordnung waren.<br />
Alain Debos fand einen solventen Kaufinteressenten<br />
und schleppte uns beide zu einem Notar. Auch das überraschte<br />
mich: Inmitten dieses Chaos amtierte noch ein<br />
Notar! 5 000 Pfund, also 5 000 D-Mark, bot der Käufer. Ich<br />
war völlig perplex. Der Notar begann, seine Protokollarien<br />
herunterzubeten und beide Vertragsparteien über ihre<br />
Rechte und Pflichten zu informieren. Plötzlich wurde die<br />
Tür aufgestoßen. Ein Mann stand im Türrahmen, mit einer<br />
Pistole im Anschlag. »Der Wagen gehört mir!«, schrie er.<br />
Und wir erstarrten. Schnell aber stellte sich heraus, dass<br />
der Mann nicht beabsichtigte, unser Auto zu stehlen. Er<br />
wollte es rechtmäßig erwerben. Mit Brief und Siegel. Der<br />
Notar war verblüfft, der Käufer war verblüfft, ich war verblüfft.<br />
Nur Alain Debos reagierte geistesgegenwärtig. Er<br />
sagte: »Hier wurden 5 000 Pfund geboten. Was bieten Sie?«<br />
Da sagte der Pistolero: »5 500!« Der Erstinteressent erwachte<br />
aus seiner Lethargie und begann zu protestieren:<br />
»Na hören Sie mal! Ich habe den Zuschlag bereits erhalten!«<br />
Nun war Alain Debos in seinem Element: »5 500! Wer bietet<br />
mehr?« So entbrannte der skurrilste Handel, den ich je<br />
in meinem Leben erlebt habe. Unvorstellbar: Die beiden<br />
Kaufwilligen begannen sich wortreich auf Arabisch zu<br />
überbieten, wobei der eine noch immer mit seiner Pistole<br />
fuchtelte. Wäre die Pistole nicht gewesen und damit verbunden<br />
die Sorge, dass der Bewaffnete im Zweifelsfall das<br />
Verfahren abbrechen und sich auf das im Libanon wohlbekannte<br />
Recht des Stärken besinnen könnte – ich hätte noch<br />
226
länger staunend das Spektakel verfolgt. Denn innerhalb<br />
weniger Minuten lag der Wert des »Mercedes« bei immerhin<br />
9 500 Pfund. Ich unterbrach die Bieterei und sagte zu<br />
Alain: »Lass uns schnell unterschreiben und verschwinden,<br />
bevor hier noch etwas schiefgeht!« Der Pistolero<br />
unterschrieb tatsächlich den Vertrag und blätterte 9 500<br />
Libanesische Pfund auf den Tisch des Notars. Wir schnappten<br />
das Geld und machten uns da<strong>von</strong>. Der irrste Auto <br />
verkauf meines Lebens. Beirut hatte mich bis zuletzt nicht<br />
enttäuscht.<br />
An diesem Abend beschloss ich, Alain Debos ein fürstliches<br />
Menü zu spendieren. Immerhin hatte er dem knausrigen<br />
schwäbischen Sender viel Geld in die Kasse gespült.<br />
Also rechnete ich mit der Stuttgarter Abteilung »Honorare<br />
und Lizenzen« nur 9 000 D-Mark ab – und habe bis heute<br />
deswegen nie ein schlechtes Gewissen verspürt. Für 500<br />
Pfund speisten wir im Restaurant »Nasr« an der Steilküste<br />
der Corniche. Wie die Kalifen. Bis zum Schluss gab es in<br />
Beirut alle Delikatessen der Welt – wenn man Geld hatte.<br />
Beirut ging stilvoll unter. Mit französischem Champagner<br />
und iranischem Kaviar.<br />
Später, als ich längst Korrespondent in Südafrika war,<br />
gab der israelische Ministerpräsident Menachem Begin<br />
eine Pressekonferenz. Er trat die Flucht nach vorn an und<br />
informierte die israelische Öffentlichkeit nun ganz offiziell<br />
über die Zusammenarbeit der Israelis mit der Südlibanesischen<br />
Armee. Der Druck der israelischen und internationalen<br />
Medien war zu groß geworden. Meine Recherchen<br />
waren damit bestätigt. Ich rief »SDR«-Chefredakteur Emil<br />
Obermann an: »Was sagen Sie jetzt? Ich hatte Recht!«<br />
227
Darauf sagte er lapidar: »Do hosch halt Glick g’hett!« 2 Mehr<br />
bekam ich <strong>von</strong> ihm nicht zu hören. Ein Zynismus, über den<br />
ich mich heute noch ärgern kann. Wenn politischer Druck<br />
ausgeübt wurde, stand man als Journalist allein. Ohne<br />
Rückendeckung vom Sender. Eine schlimme Lektion im<br />
Journalismus.<br />
2 Da hast du halt Glück gehabt!<br />
228