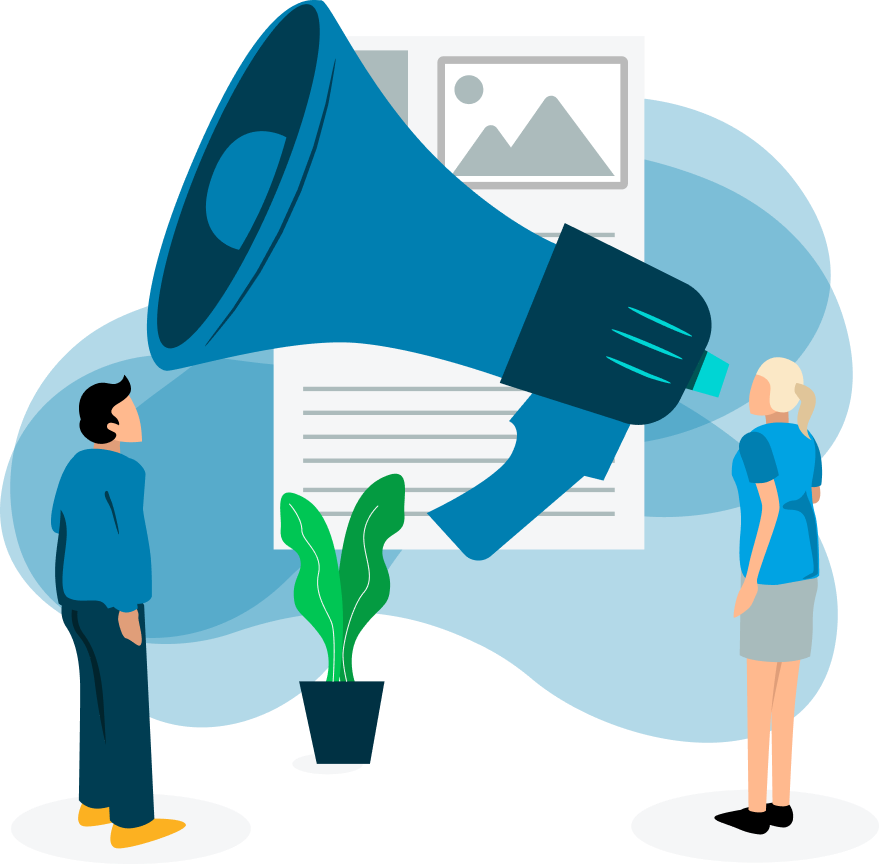Pfarrer Manuel Neumann, Meerholz-Hailer
Pfarrer Manuel Neumann, Meerholz-Hailer
Pfarrer Manuel Neumann, Meerholz-Hailer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dieses Manuskript stimmt nicht unbedingt mit dem Wortlaut der Sendung überein.<br />
Es darf nur zur Presse- und Hörerinformation verwendet<br />
und nicht vervielfältigt werden,<br />
auch nicht in Auszügen.<br />
Eine Verwendung des Manuskripts für Lehrzwecke<br />
sowie seine Vervielfältigung und Weitergabe als Lehrmaterial<br />
sind nur mit Zustimmung der Autorin/des Autors zulässig.<br />
<strong>Pfarrer</strong> <strong>Manuel</strong> <strong>Neumann</strong>, <strong>Meerholz</strong>-<strong>Hailer</strong><br />
hr1 Feiertagsgedanken<br />
26. Dezember 2013<br />
„Die Insel der Seligen – Vertreibung aus dem Paradies“<br />
Mich als <strong>Pfarrer</strong> zu haben, ist für meine Gemeinde nicht immer ganz einfach. Das denke<br />
ich zumindest manchmal. Denn ich neige bisweilen zu überraschenden Aktionen, fordere<br />
heraus oder provoziere hin und wieder sogar.<br />
Gleich zum Einstieg in den Advent in diesem Jahr war es mal wieder soweit. Etwa zwanzig<br />
Christen waren frühmorgens zum Gottesdienst bei Kerzenschein gekommen. Das ist<br />
normalerweise eine recht beschauliche und gemütliche Angelegenheit: Da werden die<br />
bekannten Adventslieder gesungen, die Kerzenbeleuchtung sorgt für eine gemütliche und<br />
adventliche Atmosphäre.<br />
Und dann kam ich.<br />
Ich hatte in der Kirche eine Leinwand aufgebaut und habe den Gottesdienstbesuchern<br />
einen kurzen Ausschnitt aus einem Film vorgespielt. Der beginnt zunächst in völliger<br />
Dunkelheit und in absoluter Stille.<br />
Auf eine dunkle, stille Leinwand zu schauen – das schürt natürlich Erwartungen. Was<br />
kommt jetzt? Vielleicht der Weihnachtsstern, der in der Finsternis aufleuchtet? Oder geht<br />
es um die Schöpfungsgeschichte – und Gott spricht gleich das „Es werde Licht“?<br />
Mitten in diese gespannte Erwartung hinein erscheint auf der Leinwand ein heller<br />
Schimmer. Von irgendwo dringt Sonnenlicht durch das Schwarz und wandelt es in erdiges<br />
Braun. Und mit dem Licht kommen auch die Klänge: Erst ist es nur ein leises Rauschen,<br />
ein Gluckern und Pochen, das immer mehr anschwillt zum Dröhnen und Donnern.<br />
Plötzlich ist klar: Die Kamera befindet sich unter Wasser. Doch die Sonne durchleuchtet<br />
hier nicht das Chaos der Urflut – obwohl hier sich durchaus die Urgewalt der Natur ihre<br />
Bahn bricht. Vielmehr richtet die Kamera den Blick auf eine junge Frau. Sie kämpft sich<br />
aus den wirbelnden Fluten an die Oberfläche. Wasser und Trümmer sind überall. Hilflos<br />
klammert sie sich an eine Palme und schreit mit letzter Kraft gegen die gewaltige<br />
Katastrophe an, die da über sie hereingebrochen ist.<br />
Die Szene stammt aus dem Film „The Impossible“ – zu Deutsch: „Das Unmögliche“.<br />
Erzählt wird die wahre Geschichte einer Familie, die am Zweiten Weihnachtsfeiertag 2004<br />
von dem schweren Tsunami in Thailand getroffen wird. Das „Unmögliche“ des Filmtitels<br />
besteht darin, dass die ganze Familie gegen jede Hoffnung die Katastrophe überlebt.<br />
Die Bilder vom Tsunami sind wirklich furchteinflößend. Gerade weil die Kamera so dicht an<br />
der Hauptdarstellerin bleibt, entwickelt der Film eine emotionale Wucht, der man sich nur<br />
schwer entziehen kann.<br />
Damit werden die Kräfte der Natur, die Gewalttätigkeit des Ereignisses und auch die<br />
Torturen dieser Frau schon beim bloßen Zusehen fast körperlich spürbar.
Das ist schwer zu ertragen – erst recht am frühen Morgen und mitten im Advent.<br />
Entsprechend geplättet waren auch die Gottesdienstbesucher. Ich hatte sie überrollt –<br />
geradezu mit der Wucht eines Tsunamis.<br />
Nein – manchmal hat es meine Gemeinde wirklich nicht leicht mit mir.<br />
Denn ich konnte nach der Filmszene fast das Fragezeichen in den Gesichtern der<br />
Gläubigen sehen: „Bitte – was sollte das denn jetzt?“<br />
Beim gemeinsamen Frühstück nach dem Gottesdienst bricht es geradezu aus einer<br />
Teilnehmerin heraus: „Also – so was brauche ich ja am frühen Morgen nun wirklich nicht!“<br />
Und auch die Anderen am Tisch stehen noch ganz unter dem Eindruck des Gesehenen<br />
und fühlen sich teils in ihrer adventlichen Stimmung empfindlich gestört. Das war etwas zu<br />
viel auf nüchternen Magen.<br />
Und für einen kurzen Augenblick denke ich: Bin ich zu weit gegangen? Habe ich die<br />
Gottesdienstbesucher total überfordert?<br />
Doch dann kontere ich: Darum geht es doch gerade – ich werde als Mensch ja auch nicht<br />
gefragt, ob mir diese oder jene Katastrophe gerade in den Kram passt. Die Urlauber in<br />
Thailand vor neun Jahren sind auch nicht gefragt worden, ob sie von einem Tsunami<br />
getroffen werden wollen oder nicht. Schicksalsschläge kündigen sich selten vorher an.<br />
Das Leben schreibt genügend Geschichten, die auch schwere Kost sind. Krankheiten und<br />
Unfälle, kleine und große Katastrophen, Scheitern und Unglück – es gibt doch wirklich<br />
mehr als genug Dinge, an dem viele Menschen zu knabbern haben.<br />
Aber muss ich als <strong>Pfarrer</strong> nun auch noch hergehen und die Gemeinde damit sogar noch<br />
im Gottesdienst so schonungslos konfrontieren?<br />
Und die Antwort auf diese Frage kann letztlich nur lauten: Ja – zumindest manchmal muss<br />
das sein. Denn was wäre die Alternative? Die christliche Gemeinde würde sich<br />
zurückziehen – fort von der bösen Welt auf die sprichwörtliche Insel der Seligen. Doch<br />
diese Insel der Seligen existiert nicht. Auch ihre Strände werden von Tsunamis überrollt,<br />
ihre Hänge von Erdbeben erschüttert, und auch vor ihren Einwohnern machen<br />
Krankheiten und Unfälle nicht Halt. Die Insel der Seligen ist ein trügerisches Paradies, aus<br />
dem schon viele vertrieben wurden.<br />
Dabei ist es durchaus verständlich: Niemand setzt sich freiwillig oder gar gerne mit dem<br />
Leiden und dem Tod auseinander. Manche Menschen scheinen einfach darauf zu hoffen,<br />
dass schon irgendwie alles gutgehen wird. Wenn kleine Kinder Verstecken spielen, halten<br />
sie sich die Hände vor die Augen. Sie denken: Wenn ich den Anderen nicht mehr sehe,<br />
kann er mich auch nicht mehr sehen. Ganz ähnlich glauben auch Menschen, dass der Tod<br />
sie schon in Ruhe lassen wird, wenn sie ihn einfach ignorieren. Die Bemühungen gleichen<br />
sich – und sind gleichermaßen fruchtlos.<br />
Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb erscheint die Insel der Seligen immer<br />
wieder so verlockend. Und so gibt es auch im christlichen Glauben die Versuchung, solche<br />
Inseln der Seligen zu bilden. Das Böse, das Unbeherrschbare und das Gescheiterte sollen<br />
sich von dieser Insel dann – bitteschön – fernhalten.<br />
Damit aber verliert der Glaube den Kontakt zur Wirklichkeit. Der Gottesdienst einer<br />
solchen Glaubensgemeinschaft wird zum heiligen Schauspiel, das in mystisches Erleben<br />
oder spirituelle Begeisterung entrückt – und dabei die Bodenhaftung mutwillig aufgibt.<br />
Der christliche Gottesdienst aber findet mitten in der Welt statt – mit allen Konsequenzen.<br />
Da kann, da darf, ja da muss der Gottesdienst bisweilen auch mal zur Zumutung werden.<br />
Bleibt nur die Frage: Muss das denn unbedingt in der besinnlichen Advents- und<br />
Weihnachtszeit sein?
Gerade an einem Zweiten Weihnachtsfeiertag kam vor ein paar Jahren eine<br />
Krankenschwester nach dem Gottesdienst auf mich zu. Sie war einigermaßen frustriert:<br />
„Jetzt habe ich an Heiligabend und am ersten Feiertag Dienst gehabt. Ich habe mich so<br />
auf den Gottesdienst am zweiten Feiertag gefreut. Und dann kommt so was!“<br />
Mit „so was“ meinte sie die biblischen Lesungen des Tages. Anders als die Evangelische<br />
Kirche feiert die Katholische Kirche am 26. Dezember das Fest des heiligen Stephanus. In<br />
den Schriftlesungen ist von Betlehem, von Hirten und Engeln keine Rede mehr –<br />
stattdessen geht es um Mord und Totschlag: Stephanus gehörte zu den ersten sieben<br />
Diakonen der Kirche – ein Diener, würden wir heute sagen – für Ärmsten der Gemeinde,<br />
für die Kranken und die Schwachen. Die Diakone sorgten in der Urkirche dafür, dass die<br />
christliche Gemeinde geerdet blieb und nicht zum vergeistigten Halleluja-Verein wurde.<br />
Doch die erfolgreiche Arbeit in der Nachfolge Christi war nicht ungefährlich und brachte<br />
Stephanus vor den Hohen Rat. Sein Auftreten dort und sein Bekenntnis zu Jesus Christus<br />
ließen die Situation eskalieren. Eine wütende Menschenmenge trieb ihn schließlich aus<br />
der Stadt hinaus und steinigte ihn.<br />
Das ist schon eine unsanfte Landung: Erst die schöne und vertraute<br />
Weihnachtsgeschichte mit den Hirten, den Engeln und dem Kind in der Krippe – und dann<br />
gleich am nächsten Tag im katholischen Gottesdienst dieser Bericht über einen<br />
Menschen, der wegen seines Glaubens umgebracht wird.<br />
Ich kann einerseits die Krankenschwester gut verstehen. Sie ist mit ganz anderer<br />
Erwartung in den Gottesdienst gekommen. Sie hat sich auf ein frohes Weihnachtsfest<br />
gefreut. Sie wollte ein wenig ausruhen von ihrem anstrengenden und manchmal<br />
aufreibenden Beruf. Sie wollte die Weihnachtsbotschaft hören – und bekam etwas ganz<br />
Anderes zu hören. Und so kann ich auch meine etwas überforderte Gemeinde im ersten<br />
Adventsgottesdienst verstehen. Auch da klafften Erwartung und erlebte Wirklichkeit<br />
auseinander.<br />
Andererseits empfinde ich in die Konfrontation der Gemeinde mit der oft rauen Wirklichkeit<br />
als notwendiges Korrektiv. Was Christen feiern und was sie leben – das gehört untrennbar<br />
zusammen und darf nicht getrennt werden. Und die Feier muss auch einem Tsunami,<br />
einem Erdbeben oder jeder großen oder kleinen Tragödie standhalten. Der Tsunami 2004<br />
hat viele Menschen mitten in der besinnlichen Weihnachtszeit aufgeschreckt. Das Fest<br />
des Heiligen Stephanus erinnert mitten in der Weihnachtsfreude daran, dass das Leben<br />
des Christen so wie das jedes anderen Menschen kein Zuckerschlecken ist. Das Fest ist<br />
darum unverzichtbar. Denn das vernichtendste Urteil über einen christlichen Gottesdienst<br />
wäre wohl: „Das war schön, hatte aber mit dem Leben nichts zu tun.“<br />
Das jedenfalls kann meine Gemeinde nicht behaupten: Wir feiern unseren Glauben mitten<br />
im Leben – komme, was da wolle.