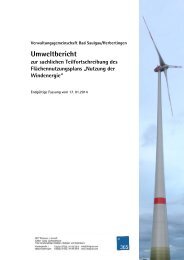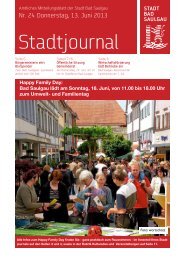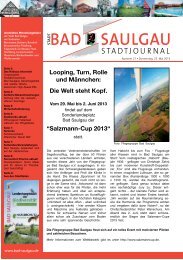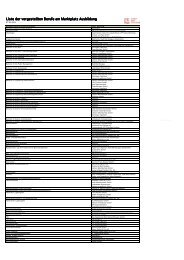UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau
UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau
UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
STADT BAD SAULGAU<br />
Landkreis Sigmaringen<br />
Bebauungsplan “Krumme Äcker 3“<br />
<strong>UMWELTBERICHT</strong><br />
in der Fassung Juni 2013
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Vorbemerkung<br />
2. Beschreibung der Planung<br />
2.1 Lage des Plangebietes<br />
2.2 Inhalt und Festsetzungen des Bebauungsplanes (Kurzdarstellung)<br />
2.3 Umweltschutzziele gem. Fachgesetze und übergeordneten Planungen<br />
3. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten<br />
3.1 Standortalternativen<br />
4. Methoden der Umweltprüfung<br />
4.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung<br />
4.2 Untersuchungsmethoden für Schutzgüter<br />
4.3 Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie<br />
5. Wirkfaktoren der Bauleitplanung<br />
5.1 Baubedingte Auswirkungen<br />
5.2 Anlagebedingte Auswirkungen<br />
5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen<br />
6. Beschreibung, Bewertung der Schutzgüter, Auswirkungen der Planung<br />
6.1.1 Mensch<br />
6.1.2 Tiere, Pflanzen, Biotopfunktion<br />
6.1.3 Geologie und Boden<br />
6.1.3.1 Bewertung vor dem Eingriff<br />
6.1.3.2 Bewertung nach dem Eingriff<br />
6.1.3.3 Berechnung des Kompensationsbedarfs<br />
6.1.4 Wasser<br />
6.1.5 Klima/Luft<br />
6.1.6 Landschaft<br />
6.1.7 Kultur- und Sachgüter<br />
6.2 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern<br />
6.3 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter<br />
7. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes<br />
7.1 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung<br />
7.2 Prognose bei Durchführung der Planung<br />
8. Maßnahmen zur Minimierung der negativen Auswirkungen<br />
8.1 Maßnahmen bez. betriebsbedingte Auswirkungen<br />
8.1.1 Emissionen<br />
8.1.2 Abfälle, Abwasser<br />
8.1.3 Energie<br />
8.2 Allg. Maßnahmen gegen negative Auswirkungen<br />
8.2.1 Bodenbelastung<br />
8.2.2 Beläge<br />
8.2.3 Einfriedungen<br />
9. Ökolog. Bewertung u. Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffs- /Ausgleichsbilanz der Biotopfunktion<br />
9.1 Ökologische Bewertung der Biotopfunktion<br />
9.1.1 Bewertung vor der Maßnahme<br />
9.1.2 Bewertung nach der Maßnahme<br />
9.2 Ausgleichsmaßnahmen<br />
9.2.1 Ausgleich Schutzgut „Biotopfunktion“<br />
9.2.2 Ausgleich Schutzgut „Boden“<br />
9.3 Fazit Eingriffs- / Ausgleichsbilanz<br />
10. Zusammenfassung
1. Vorbemerkung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> beabsichtigt, in der Kernstadt den Bebauungsplan „Krumme<br />
Äcker 3“ für Wohnbauzwecke aufzustellen. Das Plangebiet soll als Allgemeines<br />
Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen werden.<br />
Die rechtlichen Vorgaben des Umweltberichts ergeben sich aus dem novellierten<br />
Baugesetzbuch vom 20. Juli 2004, § 2 Abs. 4. Danach ist bei allen Aufstellungen,<br />
Änderungen oder Ergänzungen von Bebauungsplänen eine Umweltprüfung<br />
durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des<br />
Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 (Mensch, Boden,<br />
Wasser, Luft / Klima, Tiere / Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild und<br />
Kultur- und Sachgüter, Emissionen) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht<br />
dargestellt. Dieser ist Bestandteil der Begründung des Bebauungsplanes.<br />
2. Beschreibung der Planung<br />
2.1 Lage des Plangebietes<br />
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am südlichen Ortsrand von<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong>, angrenzend an das bestehende Wohngebiet Krumme Äcker 2, stellt<br />
also den unmittelbaren Anschluss an die bestehende Wohnbebauung im Norden dar.<br />
Von Nord nach Süd und von West nach Ost steigt das Gelände an. Die topografische<br />
Höhe des Geländes liegt zwischen 605 m und 622 m über NN.<br />
Das Plangebiet gehört naturräumlich zur Großlandschaft des oberschwäbischen<br />
Hügellandes. Die anstehenden Schichten werden zur oberen Meeresmolasse<br />
gerechnet und sind überdeckt von einer mehr oder weniger gering mächtigen<br />
Hangschuttdecke.<br />
Die Fläche des Plangebietes teilt sich zurzeit wie folgt auf:<br />
Mehr als 90 % der Fläche (23.863 qm) wird intensiv ackerbaulich genutzt.<br />
Entlang der Paradiesstraße stehen auf einem intensiv genutzten Wiesenstreifen von<br />
1.500 qm sieben ältere Obst-Hochstämme.<br />
Die Fläche der bituminös befestigten Paradiesstraße beträgt ca. 812 qm.<br />
Die restliche Fläche besteht aus Graswegen und Grünbanketten (ca. 1.016 qm).<br />
Asphaltierte Fahrbahnen<br />
Bankette<br />
Wirtschaftswege<br />
Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />
Ackerland<br />
Gesamtfläche:<br />
812 qm<br />
461 qm<br />
555 qm<br />
1.500 qm<br />
22.363 qm<br />
25.691 qm<br />
Es sind keine ökologisch bedeutsamen oder nach § 32 NatSchG geschützten<br />
Pflanzen- und Tierarten vorhanden.
2.2 Inhalt und Festsetzungen des Bebauungsplans (Kurzdarstellung)<br />
Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO zum Bau von<br />
Familienheimen.<br />
Allgemeines Wohngebiet<br />
Es ist eine Bebauung in offener Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO mit ein- bis<br />
zweigeschossigen Einzel- oder Doppelhäusern vorgesehen, wie sie bereits im<br />
nördlich angrenzenden Baugebiet vorhanden ist. Die Grundflächenzahl beträgt<br />
gemäß § 16 BauNVO 0,4 und die Geschossflächenzahl nach § 16 BauNVO 0,8.<br />
Die mittlere Baugrundstücksgröße des Allgemeinen Wohngebietes beträgt 500 – 700<br />
qm. Dächer sind als Sattel-, Walm-, Zelt-, Pult- oder Flachdach herzustellen. Bei<br />
einer Dachneigung von mehr als 15 Grad sind die Dächer mit rotem oder<br />
dunkelfarbigem, nicht glänzenden Material zu decken.<br />
Nebenanlagen als Gebäude gemäß § 2 Abs. 2 LBO oder Gewächshäuser dürfen<br />
höchstens 40 cbm Rauminhalt haben. Nicht zulässig sind Nebenanlagen in<br />
Pflanzgebotsflächen sowie in einem drei Meter breiten Streifen entlang öffentlicher<br />
Straßen. Die Firsthöhe der Häuser darf 9,00 m und die der Garagen und<br />
überdachten Stellplätze 5,50 m nicht überschreiten.<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Die Strom- und Wasserleitungen des bestehenden, angrenzenden Wohngebietes<br />
können entsprechend verlängert werden.<br />
Entwässert wird über ein Trennsystem (siehe Kapitel 6.1.4).<br />
Wird Dachflächenwasser von Metalldächern versickert, müssen diese mit z.B. Lack<br />
oder Kunststoff beschichtet sein.<br />
Die Ausrichtung des Plangebietes und der Gebäude sind geeignet für eine aktive und<br />
passive Nutzung der Sonnenenergie.<br />
Details sind den textlichen Festsetzungen und Begründungen zum Bebauungsplan<br />
zu entnehmen.<br />
Erschließung<br />
Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz erfolgt über die Paradiesstraße.<br />
2.3 Umweltschutzziele, die in Fachgesetzen und übergeordneten Planungen<br />
festgelegt und für das Vorhaben relevant sind<br />
Grundlage zur Aufstellung von Umweltberichten sind Umweltfachgesetze und<br />
übergeordnete Planungen.<br />
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3<br />
BauGB in Verbindung mit dem BNatSchG §§ 18, 19 und dem NatSchG für <strong>Bad</strong>en-<br />
Württemberg zu beachten. Im vorliegenden Umweltbericht wird sie durch die
Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation von<br />
Eingriffen berücksichtigt. Ziele und allgemeine Grundsätze der relevanten<br />
Schutzgüter wurden geprüft und mit den allgemeinen Grundsätzen der Fachgesetze<br />
abgeglichen.<br />
Auf das Wohngebiet einwirkende Emissionen wie Lärm oder Schadstoffe regelt das<br />
Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen (16.<br />
BimSchV – Verkehrslärm) sowie die DIN 18005.<br />
Den Umgang mit Regenwasser regelt das Wassergesetz für <strong>Bad</strong>en-Württemberg in<br />
der aktuellen Fassung.<br />
Da von der Planung keine geschützten Biotope betroffen sind, ist hier das NatSchG<br />
§ 32 nicht relevant.<br />
Fachplanungen<br />
Umweltplan <strong>Bad</strong>en-Württemberg<br />
Schonung natürlicher Ressourcen<br />
Als Ziel wird im Umweltplan des Landes <strong>Bad</strong>en-Württemberg (Umweltministerium<br />
2007) formuliert, natürliche Ressourcen zu schonen sowie die Inanspruchnahme<br />
unbebauter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2012 deutlich<br />
zurückzufahren, da der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen im Land bis 2006<br />
auf 13,8 % der Landesfläche angewachsen ist. Der tägliche Zuwachs dieser Flächen<br />
soll bis 2020 auf bundesweit maximal 30 Hektar gesenkt werden, um die weitere<br />
Zersiedlung der Landschaft zu begrenzen. Die Schließung von Baulücken im<br />
Innenbereich und die Revitalisierung von Gewerbebrachen sollen dem steigenden<br />
Flächenbrauch entgegenwirken.<br />
Kyoto-Verpflichtung zum Klimaschutz<br />
Als Beitrag zur Kyoto-Verpflichtung strebt die Landesregierung an, durch eigene<br />
Maßnahmen und Initiativen den Kohlendioxidausstoß um zwei bis vier Millionen<br />
Tonnen zu vermindern. Sowohl verkehrsbedingte Emissionen als auch die bis zum<br />
Jahr 2010 angestrebte Verdopplung (bezogen auf 1997) des Anteils erneuerbarer<br />
Energien sollen zum ausgegebenen Ziel führen. Bis 2020 sollen die erneuerbaren<br />
Energien 20 % des Stromverbrauchs decken.<br />
Landesentwicklungsplan<br />
Im Landesentwicklungsplan (LEP 2002) ist <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> dem ländlichen Raum<br />
zugeordnet und stellt ein Mittelzentrum in der Landesentwicklungsachse<br />
Friedrichshafen / Ravensburg / Weingarten nach Tübingen / Reutlingen dar.<br />
An diese Entwicklungsachsen soll sich die Siedlungsentwicklung orientieren und auf<br />
zentrale Orte, Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentrieren. Neben<br />
der Nähe zu öffentlichen Verkehre sind die Siedlungsstrukturen zudem fahrrad- und<br />
fußgängerfreundlich zu gestalten.<br />
Nach der Raumordnung <strong>Bad</strong>en-Württemberg ist die Siedlungsentwicklung im Land<br />
vorrangig am Bestand auszurichten. Hier sind Verdichtung, Arrondierung, Baulücken,
Baulandreserve zu berücksichtigen und Brach-, Konversion- und Altlastenflächen<br />
neuen Nutzungen zuzuführen.<br />
Unvermeidbare Neubauflächen sollen nur am konkret absehbaren<br />
Neubauflächenbedarf bemessen und möglichst Flächen sparend und Ressourcen<br />
schonend ausgewiesen werden. Dies wird insbesondere durch eine angemessen<br />
hohe bauliche Dichte und eine rationelle Erschließung erreicht.<br />
Regionalplan<br />
Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (1996) wird <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> als<br />
Siedlungsbereich mit Schwerpunkt auf Dienstleistungseinrichtungen, Industrie,<br />
Gewerbe sowie Wohnungsbau genannt. Die <strong>Stadt</strong> zählt zum<br />
Fremdenverkehrsbereich Oberschwäbische Bäder und ist insbesondere durch ihren<br />
Heilquellenkurbetrieb bedeutsam.<br />
Es bestehen für das Plangebiet keine speziellen Zielvorstellungen.<br />
Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen im<br />
unmittelbaren Umfeld keine Vorrangbereiche.<br />
Von der Planung sind unmittelbar keine Grundwasserschutzbereiche oder<br />
Wasserschutzgebiete betroffen. Im Südwesten des Gebietes grenzt die Zone 3 des<br />
Wasserschutzgebietes „Albergasse“ an.
Flächennutzungsplan und Landschaftsplan<br />
Das Plangebiet wurde aus dem seit 25.08.2011 rechtsgültigen Flächennutzungsplan<br />
der Verwaltungsgemeinschaft <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> / Herbertingen entwickelt.<br />
Das Plangebiet ist Umweltbericht des Flächennutzungsplanes in etwas größerer<br />
Ausdehnung enthalten und wird dort wie folgt beschrieben:<br />
9180.3 Wohnbaugebiet „Krumme Äcker 3“<br />
Landschaftsbeschreibung<br />
Nutzung: intensive Ackerflächen<br />
Erholung: -<br />
Landschaftsbild: Sanft ansteigende rechte Talseite des Seewattenbaches<br />
Biotope und Arten: Allee aus älteren Apfelbäumen auf beiden Seiten des<br />
Wilfertsweilerweges.<br />
Bodenertragsfunktion: mittel<br />
Filter- und Pufferfunktion: fast ausschließlich hoch<br />
Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: überwiegend mittel, z.T. hoch<br />
Funktion als Standort für die natürliche Vegetation: gering<br />
Grundwasser: Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis mittlerer<br />
Grundwasserführung<br />
Oberflächengewässer: -<br />
Klima: hohe Bedeutung für Kaltluftentstehung, siedlungsklimatisch bedeutsam<br />
Minderungsmaßnahmen<br />
• Baumallee erhalten<br />
Ausgleichsmaßnahmen<br />
• Renaturierung des Seewattenbaches: naturnahe Umgestaltung, Schaffung von<br />
Gewässerrandstreifen, punktuelle Bepflanzung<br />
Beurteilung<br />
Geringes Konfliktpotenzial.
Schutz- und Vorranggebiete<br />
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Wasserschutz-, Naturschutz-,<br />
Landschaftsschutz-, FFH- oder Europäischen Vogelschutzgebieten. Im Plangebiet<br />
selbst befinden sich keine nach § 32 NatSchG geschützten Biotope.<br />
3. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten<br />
3.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl<br />
Das Bebauungsplangebiet ist Bestandteil des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes<br />
vom 25.08.2011. Ziel ist es, den Wohnbaubedarf vor allem einheimischer<br />
Interessenten zu decken und günstige Wohnbauflächen für Familien zu erschließen.<br />
Freie Bauplätze sind in der Kernstadt nur noch wenig verfügbar. Zudem sind die<br />
Flächen des Plangebietes in städtischem Eigentum, was die Umsetzung des<br />
Vorhabens wesentlich erleichtert. Das geplante Baugebiet stellt eine Fortsetzung der<br />
bestehenden Wohnbaubebauung dar und birgt bezüglich der Umweltschutzgüter nur<br />
geringes Konfliktpotenzial in sich, weshalb schließlich auch dieser Standort<br />
ausgewählt wurde.<br />
4. Methoden der Umweltprüfung<br />
4.1. Räumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsgebietes<br />
Das Untersuchungsgebiet entspricht mindestens dem räumlichen Geltungsbereich<br />
des Bebauungsplanes und geht teilweise, falls erforderlich, darüber hinaus. Alle<br />
naturschutzrechtlich relevanten Belange (Boden, Wasser, Luft / Klima, Tiere /<br />
Pflanzen, Biotopfunktion, Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter inkl.<br />
Wechselwirkungen) werden im Umweltbericht in Bezug auf das Vorhaben geprüft.<br />
4.2 Untersuchungsmethoden für Schutzgüter<br />
Mensch<br />
Betrachtet werden die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Wohnumfeld, Wohlbefinden<br />
und Erholungsfunktion.<br />
Boden<br />
Die Bodenfunktionen wurden gemäß des Bundesbodenschutzgesetzes mit Hilfe des<br />
Leitfadens der LUBW „Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ ermittelt.<br />
ermittelt. Grundlage der Daten zum Schutzgut „Boden“ ist die<br />
Reichsbodenschätzung.<br />
Wasser (Oberflächenwasser, Grundwasser)<br />
Untersucht werden die Funktionen für den Wasserhaushalt. Die Bedeutung und<br />
Empfindlichkeit der Grundwasservorkommen werden abgeschätzt und eventuelle
Wasserschutzgebiete erfasst. Grundlage ist u.a. die Bodenkarte von <strong>Bad</strong>en-<br />
Württemberg.<br />
Pflanzen und Tiere, Biotoptypen<br />
Die Daten beruhen auf eigenen Bestandsaufnahmen sowie nach Bedarf auf die<br />
§ 32-Biotopkartierung NatSchG des Landkreises Sigmaringen. Aussagen zur Tierwelt<br />
orientieren sich am Biotoptyp, die Ermittlung der Biotoptypen nach dem LfU-<br />
Schlüssel. Die Biotoptypbewertung orientiert sich am Modell des Landkreises<br />
Sigmaringen.<br />
Klima, Luft<br />
Es werden die Auswirkungen der Planung auf die lokalklimatischen Verhältnisse und<br />
Wechselwirkungen auf Mensch, Pflanzen und Tieren sowie Geruchsemissionen aus<br />
landwirtschaftlichen Betrieben betrachtet. Grundlagen hierzu sind die Topografische<br />
Karte und der Klimaatlas <strong>Bad</strong>en-Württemberg.<br />
Landschaft<br />
Zur Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes werden die Ausstattung mit<br />
naturraumtypischen Strukturmustern sowie das Ausmaß vorhandener Störungen<br />
bzw. die Störempfindlichkeit herangezogen. Es gilt, die Eigenart, Vielfalt und<br />
Schönheit des Landschaftsbildes zu erhalten sowie die landschaftsästhetische<br />
Funktion zu betrachten. Ebenso ist es Ziel, ausreichend große Landschaftsräume<br />
unzerschnitten zu erhalten. Zu beachten sind hier die grundlegenden Ziele des<br />
Landschaftsplanes.<br />
Kulturgüter<br />
Kulturgüter sind vom Menschen gestaltete Landschaftsteile die von geschichtlichem,<br />
wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die<br />
Kulturlandschaft prägendem Wert. Dies können beispielsweise Gebäude,<br />
gärtnerische Anlagen wie Parks oder Friedhöfe sein oder im Boden verborgene<br />
Anlagen.<br />
4.3 Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie<br />
Größere Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie haben sich nicht ergeben.<br />
Klimatische und lufthygienische Auswirkungen sowie hydrogeologische<br />
Beeinträchtigungen können nicht quantifiziert werden. Die Angaben beruhen auf<br />
allgemeine Annahmen auf Basis der Geologischen Karte.<br />
Eine exakte faunistische sowie floristische Bestandsaufnahme wurde nicht<br />
durchgeführt, da es keine Hinweise auf seltene oder bedrohte Arten gibt.
5. Wirkfaktoren der Bauleitplanung<br />
Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes mit<br />
umweltrelevanten Auswirkungen, bedingt durch Bau, Anlage und Betrieb sind zu<br />
beschreiben.<br />
Flächenversiegelung des Vorhabens insgesamt (siehe auch Kapitel 9):<br />
Nutzung Überbauung Versiegelung<br />
überbaubare Wohnbaufläche<br />
inkl. Nebenanlagen<br />
(Grundflächenzahl 0,4) + 8.286 qm + 8.286 qm<br />
Öffentliche Verkehrsflächen + 4.976 qm + 4.976 qm<br />
maximale Versiegelung 13.262 qm 13.262 qm<br />
bereits versiegelt (Bestand) - 812 qm - 812 qm<br />
12.450 qm 12.450 qm<br />
Die maximale Neuversiegelung beträgt 12.450 qm.<br />
5.1 Baubedingte Auswirkungen<br />
Baubedingte Auswirkungen auf die Schutzfaktoren Mensch, Tier, Pflanze, Boden,<br />
Wasser, Klima/Luft, Landschaft sind:<br />
Baustelleneinrichtungen, Baustraßen, Lagern von Baumaterial;<br />
Abbau, Lagern und Transport von Bodenmaterial;<br />
Bodenverdichtungen, Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterung durch<br />
Baumaßnahmen.<br />
Die Auswirkungen sind in der Regel jedoch auf die Zeit der Baumaßnahmen<br />
beschränkt und nicht längerfristiger Natur.<br />
5.2 Anlagebedingte Auswirkungen<br />
Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzfaktoren Mensch, Tier, Pflanze,<br />
Biotopfunktion, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sind:<br />
Flächeninanspruchnahme insgesamt, Entfernung von Biotopstrukturen, Gebäude<br />
und Verkehrsflächen und Störung der Wechselwirkung zwischen Schutzgütern.<br />
5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen<br />
Es entstehen durch zusätzlichen Anliegerverkehr sowie Licht-, Lärm- und<br />
Schadstoffemissionen betriebsbedingte Auswirkungen je nach Abstand zur<br />
Immissionsquelle in geringem Umfang.
6. Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter im<br />
Zusammenhang mit der Planung sowie die Auswirkungen der<br />
Planung<br />
Fachpläne mit relevanten Umweltschutzzielen existieren für das Plangebiet nicht<br />
oder tangieren das Plangebiet nicht. Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet<br />
sich der Oberlauf des Seewattenbachs, der Bestandteil des<br />
Gewässerentwicklungsplanes ist, der durch einen existierenden Schotter-Feldweg<br />
vom Plangebiet getrennt und dessen Einzugsgebiet durch einen breiten Grünstreifen<br />
innerhalb des Plangebietes, direkt angrenzend an den Weg aufgewertet werden soll.<br />
Grundlage der Planung ist der rechtsgültige Flächennutzungsplan inklusive<br />
Umweltbericht und Landschaftsplan.<br />
6.1. Beschreibung der Schutzgüter (Umweltbelange), deren Funktion,<br />
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter<br />
6.1.1 Mensch<br />
Allgemeines<br />
Betrachtet werden die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Wohnumfeld, Wohlbefinden<br />
und Erholungsfunktion.<br />
Bestand<br />
Die Flächennutzung stellt sich wie folgt dar:<br />
Asphaltierte Fahrbahnen<br />
Bankette<br />
Wirtschaftswege<br />
Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />
Ackerland<br />
Gesamtfläche:<br />
812 qm<br />
461 qm<br />
555 qm<br />
1.500 qm<br />
22.363 qm<br />
25.691 qm<br />
Das Plangebiet wird zurzeit zu ca. 90 % intensiv ackerbaulich genutzt. Der Rest<br />
besteht aus wassergebundenen Banketten, Wirtschaftswegen, asphaltierten<br />
Fahrbahnflächen sowie einem intensiv genutzten Wiesenstreifen mit sieben älteren<br />
Obstbäumen (siehe Kapitel 6.1.2. und Kapitel 9).<br />
Vorbelastung,Bedeutung und Empfindlichkeit<br />
Für die öffentliche Naherholung hat das Plangebiet selbst nur wenig Bedeutung, da<br />
das Gebiet zurzeit einen ausgeräumten Landschaftsbestandteil darstellt und an das<br />
bestehende Baugebiet „Krumme Äcker 2“ angrenzt. Die das Plangebiet umgebenden<br />
landwirtschaftlichen Flächen werden zum Großteil ebenfalls sehr intensiv genutzt und<br />
haben deswegen einen geringen Erholungswert.<br />
Zur Naherholung stehen weiterhin der nordöstlich bestehende Obstbaumlehrpfad mit<br />
mehr als 100 Sorten, 500 Meter südlich ein Hochpunkt mit ansprechender Aussicht,
das ebenfalls 500 Meter südlich beginnende Waldgebiet „Haidener Stöckle“, die<br />
vielseitig strukturierte Landschaft und das topografisch abwechslungsreiche,<br />
eiszeitlich geprägte Gebiet rund um Bogenweiler zur Verfügung. Das Gebiet kann in<br />
einem gut ausgeschilderten Wanderwegenetz mit vielen verschiedenen Attraktionen<br />
und Besonderheiten erkundet werden.<br />
Lärm- und Verkehrsbelastung<br />
Das Plangebiet selbst ist auf der Ostseite durch die nicht sehr stark frequentierte<br />
Paradiesstraße begrenzt und deshalb nur in begrenztem Umfang Lärmemissionen<br />
durch den Straßenverkehr ausgesetzt.<br />
Die angrenzende Wohnbebauung „Krumme Äcker 2“ erfährt durch den<br />
Anliegerverkehr zusätzlich eine geringfügige Lärm- und Verkehrsbelastung.<br />
Ebenso ist eine Lärmbelastung durch die Bewirtschaftung angrenzender<br />
landwirtschaftlicher Flächen in geringem Umfang zu erwarten.<br />
Geruchsemissionen<br />
Die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der an das Plangebiet grenzenden<br />
Flächen führt temporär zu Geruchsemissionen, die sich jedoch aller<br />
Wahrscheinlichkeit nach unterhalb den VDI-Richtwerten für allgemeine Wohngebiete<br />
bewegen. Eine dauerhafte Belastung durch Geruchsemissionen landwirtschaftlicher<br />
Betriebe (z.B. bei Bogenweiler) ist auf Grund der Einhaltung vorgeschriebener<br />
Abstandsradien (VDI-Richtlinie) nicht zu erwarten.<br />
6.1.2 Tiere und Pflanzen, Biotopfunktion<br />
Allgemeines<br />
Im Vordergrund stehen der Schutz der Tier- und Pflanzenarten und ihrer<br />
Lebensgemeinschaft in ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt sowie der<br />
Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen. Einher gehen die Betrachtung<br />
der Biotopfunktion und die Funktion der Biotopvernetzung. Besonders geschützte<br />
Gebiete wie FFH-Gebiete nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB bzw. § 32<br />
NatSchG sowie die biologische Vielfalt nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB,<br />
falls vorhanden, finden besondere Berücksichtigung.<br />
Die natürliche Vegetation in diesem Bereich wäre ein Mischwald aus Esche, Buche,<br />
Eiche, Ahorn und Fichte.<br />
Bestand (siehe auch Kapitel 9)<br />
Auf Grund der landwirtschaftlich intensiven Nutzung sind im Plangebiet keine<br />
besonders geschützten Tierarten und geschützten krautigen -, gras- oder<br />
gehölzartigen Pflanzenarten oder -gesellschaften vorhanden.<br />
Der 1.500 qm große, allerdings intensiv genutzte Wiesenstreifen entlang der<br />
Paradiesstraße mit sieben hochstämmigen, älteren Obstbäumen hat Biotopfunktion<br />
für Insekten, Sing- und Greifvögel.<br />
Schützenswerte Landschaftsbestandteile, nach § 32 BNatSchG geschützte Biotope,<br />
Naturschutzgebiete oder FFH- bzw. Vogelschutzgebiete sind im Plangebiet nicht<br />
existent.
Ebenso befindet sich das Plangebiet nicht in einem Wasserschutzgebiet.<br />
Etwa 500 Meter südlich des Plangebietes befindet sich ein Hochpunkt mit einer<br />
Ruhebank und einer alten Eiche, dahinter beginnt ein Waldgebiet. 150 Meter nördlich<br />
beginnt der städtische Obstbaumlehrpfad mit etwa 100 Kern- und Steinobstsorten.<br />
Vorbelastung<br />
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind durch ihre Lage im direkten<br />
Wohnumfeld durch Eutrophierung (z.B. Hundekot) nicht bzw. nur gering belastet.<br />
Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die Umsetzung<br />
Im Zuge der Bebauung werden die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen<br />
sowie die Restflächen umgestaltet, das heißt, teilweise versiegelt, teils gärtnerisch<br />
genutzt und teilweise durch Pflanzung heimischer Feldgehölze ökologisch<br />
aufgewertet. Die sieben Obstbäume im Osten des Plangebietes werden<br />
voraussichtlich inklusive des Wiesenstreifens im Zuge der Baumaßnahmen weichen<br />
müssen.<br />
Da mit Ausnahme der sieben Obstgehölze keine ökologisch Pflanzenarten und auch<br />
keine bedeutsamen Tierarten im Plangebiet vorhanden sind, gibt es nur sehr geringe<br />
ökologische Einschränkungen bezüglich der Pflanzen- und Tierwelt.<br />
6.1.3 Geologie und Boden<br />
Allgemeines<br />
Das Schutzgut Boden erfüllt Funktionen für den Naturhaushalt, ist Lebensgrundlage<br />
für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus sind die<br />
Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,<br />
Grundwasserschutzfunktion und die Funktion als Archiv der Natur- und<br />
Kulturgeschichte zu schützen.<br />
Vorbelastung<br />
Für das Plangebiet besteht kein Altlastenverdacht (Historische Erkundung im Auftrag<br />
des Landratsamtes Sigmaringen: IUT, Ingenieurgesellschaft für Umwelttechnik<br />
1998).<br />
Eine erhebliche Vorbelastung der Böden durch Schad- und Nährstoffeinträge aus der<br />
Landwirtschaft ist unwahrscheinlich.<br />
Auswirkung durch Umsetzung des Vorhabens<br />
Durch Überbauung und Versiegelung gehen sämtliche Bodenfunktionen auf einer<br />
Fläche von maximal 13.262 qm (Neuversiegelung maximal 12.450 qm) verloren.<br />
Deshalb ist die Empfindlichkeit der Böden diesbezüglich generell hoch einzustufen.<br />
Die Böden werden durch Verdichtung, Umlagerung und Veränderung des<br />
Bodenaufbaus besonders während der Bauphase beeinträchtigt.<br />
Bei Umsetzung der Maßnahme wird darauf geachtet, dass der Bodenaushub<br />
möglichst vor Ort verwendet wird. Der Oberboden wird abgeschoben und seitlich<br />
gelagert. Der restliche Bodenaushub wird ebenfalls seitlich gelagert und teilweise auf<br />
den Baugrundstücken verwendet.
Bedeutung und Bewertung der Bodenfunktionen vor und nach dem Eingriff<br />
inklusive Kompensationsbedarf<br />
6.1.3.1 Bewertung vor dem Eingriff<br />
Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt gemäß des Leitfadens der LUBW<br />
„Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ auf Basis der<br />
Reichsbodenschätzung.<br />
Für das Plangebiet liegt ein geotechnisches Gutachten des Büros „BauGrund<br />
Süd – Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH“ vor.<br />
Im Planungsbereich bildet der Mutterboden die oberste natürliche Schicht. Die<br />
Mächtigkeit schwankt zwischen 20 und 40 cm. Unter dem Mutterboden folgt<br />
eine durchgehende Verwitterungsdecke, deren Schichtunterkante zwischen 0,9<br />
und 1,1 m unter Geländeoberkante liegt. Unter der Verwitterungsdecke folgen<br />
Meeresmolasseschichten.<br />
Bei der Verwitterungsdecke steht schwach toniger bis toniger, feinsandiger<br />
vereinzelt feinkiesiger Schluff (sandiger Lehm, Entstehungsart Diluvium =<br />
eiszeitlicher und Tertiärboden) an. Die Böden der Meeresmolasse bestehen aus<br />
Wechsellagerungen von stark feinsandigem Schluff, schwach schluffige bis<br />
schluffige Fein- bis Mittelsande und Sedimentgemische aus Schluff und<br />
Feinsand. Stellenweise sind oft Kalk- und Sandsteinverhärtungen in<br />
Knollenform bzw. dünne Sandsteinbänke eingelagert.<br />
Eine Versickerungsmöglichkeit ist bei den anstehenden Bodenarten nicht oder<br />
nur stark eingeschränkt gegeben. Auch bieten die untersten Bodenschichten<br />
keine Versickerungsstrecken an.<br />
Die ackerbauliche Zustandsstufe ist in den Karten der Bodenschätzung mit den<br />
Kennzahlen "4 und 5" angegeben. Die Bodenzahl der Reichsbodenschätzung<br />
beträgt für die betroffenen landwirtschaftlichen Flächen 55, die Ackerzahl 48<br />
(siehe Auszug aus Liegenschaftskataster des Landratsamtes Sigmaringen –<br />
nächste Seite).
Auszug aus Liegenschaftskataster, Quelle Landratsamt Sigmaringen,<br />
Vermessungsbehörde, erstellt am 17.06.2013:
Laut Leitfaden zur "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit",<br />
herausgegeben von der LUBW ergibt sich für die vom Bebauungsplan "Krumme<br />
Äcker 3" betroffenen Flächen nachfolgend aufgeführte Bewertung der<br />
Bodenfunktionen:<br />
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />
Die Bodenzahl von 55 entspricht für die Grünland, Ackerland und<br />
Gebäudefreiflächen bzw. Gartenland einem Standort der Bewertungsklasse „2“.<br />
Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />
Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
Asphaltierte Fahrbahnen 0,0812 ha 1 0,0812<br />
Bankette 0,0461 ha 2 0,0922<br />
Wirtschaftswege 0,0555 ha 2 0,1110<br />
Wiese mit 7 Obstbäumen 0,1500 ha 2 0,3000<br />
Ackerland 2,2363 ha 2 4,4726<br />
Gesamtfläche: 2,5691 ha 5,0570<br />
Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />
Allgemein:<br />
Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt durchlässigen Untergrund und<br />
einen ausreichenden Abstand zu der Grundwasseroberfläche voraus. Der<br />
Untergrund muss die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen können.<br />
Die Versickerung kann direkt erfolgen oder das Wasser kann über ein<br />
ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sickeranlage mit<br />
verzögerter Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugeführt<br />
werden. Nach dem ATV-Arbeitsblatt A 138 muss der Durchlässigkeitsbeiwert<br />
des Bodens, in dem die Versickerung stattfinden soll zwischen Kf = 5,0 x 10 -3<br />
und Kf = 5,0 x 10 -6 m/s liegen. Als ausreichender Abstand zur<br />
Grundwasseroberfläche werden für Versickerungsbecken 2,5 m über dem<br />
höchsten zu erwartenden Grundwasserstand angegeben. In der Praxis sind<br />
jedoch auch kleinere Durchlässigkeiten und geringere Abstände machbar.<br />
Zustandsbeschreibung:<br />
Eine Versickerungsmöglichkeit ist lt. vorliegendem Geogutachten bei den<br />
anstehenden Bodenarten jedoch nicht oder nur stark eingeschränkt gegeben.<br />
Auch bieten die untersten Bodenschichten keine Versickerungsstrecken an.<br />
Sämtliche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorkommenden Böden<br />
haben laut Bodenschätzung die Zustandsstufen 4 und 5. Bei sandigen<br />
Lehmböden (sL), Entstehungsart Diluvium und einem Grundwasserabstand von
mehr als 20 dm ergibt dies eine Zuordnung zu der Bewertungsklasse "2", was<br />
einer geringen Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt entspricht.<br />
Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />
Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
Asphaltierte Fahrbahnen 0,0812 ha 1 0,0812<br />
Bankette 0,0461 ha 2 0,0922<br />
Wirtschaftswege 0,0555 ha 2 0,1110<br />
Wiese mit 7 Obstbäumen 0,1500 ha 2 0,3000<br />
Ackerland 2,2363 ha 2 4,4726<br />
Gesamtfläche: 2,5691 ha 5,0570<br />
Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />
Der größte Teil des Plangebietes besteht aus Böden der Zustandsstufe 4, der<br />
Entstehungsart Diluvium sowie der Bodenart sandiger Lehm (sL), ein kleiner<br />
Teil aus Böden der Zustandsstufe 5, der Entstehungsart Diluvium und der<br />
Bodenart Lehm (L). Beide Bodenarten können der Bewertungsklasse "3"<br />
zugeordnet werden.<br />
Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />
Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
Asphaltierte Fahrbahnen ca. 0,0812 ha 1 0,0812<br />
Bankette ca. 0,0461 ha 2 0,0922<br />
Wirtschaftswege ca. 0,0555 ha 2 0,1110<br />
Wiese mit 7 Obstbäumen ca. 0,1500 ha 3 0,4500<br />
Ackerland ca. 2,2363 ha 3 5,2363<br />
Gesamtfläche: ca. 2,5691 ha 5,9707<br />
Standort für die natürliche Vegetation:<br />
Die Bedeutung für die natürliche Vegetation ist häufig negativ korreliert mit der<br />
Ertragsfähigkeit für Kulturpflanzen und deshalb im Plangebiet von eher geringer<br />
Bedeutung.<br />
Die Ackerzahl von 48 entspricht einem Standort von geringer Eignung<br />
(Bewertungsklasse 2) für die natürliche Vegetation.<br />
Diese Bodenfunktion wird für die Berechnung des Kompensationsbedarfs nicht<br />
herangezogen.
6.1.3.2 Bewertung nach dem Eingriff<br />
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />
Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
versiegelte Flächen:<br />
überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />
öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />
unversiegelte Flächen:<br />
Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 2 2,4858<br />
zusammen: 2,5691 ha 3,8102<br />
Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />
Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
versiegelte Flächen:<br />
überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />
öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />
unversiegelte Flächen:<br />
Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 2 2,4858<br />
zusammen: 2,5691 ha 3,8102<br />
Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />
Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />
versiegelte Flächen:<br />
überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />
öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />
unversiegelte Flächen:<br />
Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 3 3,7287<br />
zusammen: 2,5691 ha 5,0531
6.1.3.3 Berechnung des Kompensationsbedarfs aus 6.1.3.1 und 6.1.3.2:<br />
Bewertung vor Eingriff – Bewertung nach Eingriff = Kompensationsbedarf<br />
BvE (haWe) – BnE (haWe) = KB (haWe)<br />
Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />
5,0570 haWe – 3,8102 haWe = 1,2468 KB haWe<br />
Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />
5,0570 haWe – 3,8102 haWe = 1,2468 KB haWe<br />
Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />
5,9707 haWe – 5,0531 haWe = 0,9176 KB haWe<br />
Saldo:<br />
Zusammengefasst ergibt dies 3,4112 KB haWe<br />
Nach dem Modell des Landratsamtes Sigmaringen ergibt dies gemittelt 1,14 haWe,<br />
die auszugleichen sind.
Kompensation:<br />
Die Kompensation errechnet sich wie folgt:<br />
Es sind 1,14 haWe auszugleichen.<br />
Obstbaumlehrpfad: Vom Intensivacker zur Extensivfläche<br />
Städtischer Obstbaumlehrpfad an der Paradiesstraße<br />
Die <strong>Stadt</strong> legte in den letzten Jahren etwa 500 Meter südlich einen 1 km langen<br />
beschilderten Obstbaumlehrpfad (rundweg) entlang der Paradiesstraße und<br />
Zeppelinstraße mit einer Fläche von ca. 15.000 qm an. Ein Teil der Fläche ist<br />
städtisch, über die Restfläche existiert eine Vereinbarung mit dem Eigentümer.<br />
Die Fläche wurde zuvor landwirtschaftlich intensiv als Acker genutzt und wird jetzt als<br />
Grünland extensiv bewirtschaftet. Der Obstbaumlehrpfad besteht aus ausschließlich<br />
älteren, standortgerechten Sorten. Es sind etwa 100 Stein- und Kernobstsorten<br />
vertreten.<br />
Durch die jetzt extensive Nutzung werden Bodeneigenschaften erheblich verbessert.<br />
Kompensiert werden müssen 1,14 haWe. Mit den beschriebenen<br />
Renaturierungsmaßnahmen (Einrichtung eines extensiv bewirtschafteten<br />
Obstbaumlehrpfades auf ehemals intensiv genutzter Ackerfläche) ist die<br />
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden ausgeglichen.
6.1.4 Wasser<br />
Für den Wasserhaushalt sind die Aspekte Grundwasser und Oberflächenwasser zu<br />
betrachten.<br />
Grundwasser<br />
Bezugnehmend auf das angrenzende Baugebiet kann von einem ausreichend<br />
großen Flurabstand zum Grundwasser ausgegangen werden.<br />
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem oder in unmittelbarer Nähe eines<br />
Wasserschutzgebietes.<br />
Oberflächengewässer sind im Plangebiet keine vorhanden. Südlich angrenzend an<br />
das Plangebiet befindet sich der Oberlauf des kleinen Seewattenbachs.<br />
Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />
Die Grundwasserneubildungsrate wird etwas verringert: Der Seewattenbach wird<br />
unterläufig mit Regenwasser aus versiegelten und Dachflächen beaufschlagt.<br />
Entwässerung<br />
Das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Für das Plangebiet ist der<br />
direkte Anschluss über Kanalisationsleitungen an die Sammelkläranlage möglich.<br />
Jedes Grundstück soll einen Schmutzwasser- und einen Regenwasseranschlusskanalanschluss<br />
erhalten.<br />
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist das anfallende Oberflächenwasser entweder zu<br />
versickern oder dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen. Da die Böden des<br />
Gebietes keine ausreichende Versickerung ermöglichen, werden für die Ableitung<br />
des Oberflächenwassers Sammelleitungen mit Einleitung des Wassers über ein<br />
vorhandenes Retentionsfilterbecken in das vorhandene offene Bachbett im Talgrund<br />
verlegt. Die Rückhaltung von Niederschlagwasser der Dächer in Zisternen wird in<br />
den örtlichen Bauvorschriften empfohlen<br />
Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />
Die Grundwasserneubildungsrate ist im Plangebiet durch Neuversiegelung und die<br />
mangelhafte Versickerungsmöglichkeiten eingeschränkt (siehe Kapitel 6.1.3).<br />
6.1.5 Klima/Luft<br />
Die Offenlandfläche des Plangebietes dient unter anderem der Kaltluftbildung und<br />
des Kaltluftabflusses in Richtung bestehendes Baugebiet.<br />
Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens<br />
Trotz der geplanten Bebauung und der damit verbunden Behinderung des<br />
Kaltluftabflusses ist jedoch eine wesentliche lokalklimatische Beeinträchtigung nicht<br />
zu erwarten.<br />
Bei Einhaltung der Auflagen des Immissionsschutzrechts (Wärmedämmung,<br />
Heizungsanlagen ...) sind keine erheblichen Auswirkungen durch
Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringfügige Verschlechterung der<br />
Luftqualität durch Abgase des Anliegerverkehrs ist möglich.<br />
6.1.6 Landschaft, Landschaftsbild<br />
Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind geprägt von intensiver<br />
ackerbaulicher Nutzung. Die etwa 50 Meter und 200 Meter südlich des Plangebietes<br />
liegenden nach § 32 NatSchG geschützten Sickerquellen (siehe 6.1.2) mit Röhrichtund<br />
Sauergrasbeständen sowie die in der Nähe befindlichen Streuobstbäume prägen<br />
die Landschaft.<br />
Bedeutung und Empfindlichkeit<br />
Für das Landschaftsbild hat das Plangebiet selbst kaum Bedeutung, da es keine<br />
prägenden Elemente besitzt.<br />
Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />
Durch die im Bebauungsplan geforderten Begrünungsmaßnahmen ist das Schutzgut<br />
Landschaft nur mäßig beeinträchtigt.<br />
Eine landschaftlich negative Auswirkung auf die Sickerquellgebiete und die in der<br />
Nähe befindlichen Streuobstbestände entsteht auf Grund der Entfernung zum<br />
Plangebiet und der bereits vorhandenen, an das Plangebiet angrenzenden<br />
Bebauung, nur bedingt.<br />
Das Plangebiet selbst ist auf Grund der topografischen Verhältnisse im Wesentlichen<br />
von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen, der Paradiesstraße, vom Wald „Haidener<br />
Stöckle“ und landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie von der angrenzenden<br />
Bebauung einsehbar.<br />
Durch Pflanzung von Gehölzen und Stauden im Plangebiet besteht sogar die<br />
Möglichkeit, ein ökologisch interessanteres Landschaftsbild zu bekommen.<br />
6.1.7 Kultur- und Sachgüter<br />
Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden.<br />
6.2 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Umweltbelangen)<br />
Hier geht es um Wirkungen, die durch gegenseitige Beeinflussung der<br />
Umweltbelange entstehen.<br />
Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Acker- und Grünlandes des<br />
Plangebietes treten derzeit Wechselwirkungen zwischen den Schützgütern Tiere,<br />
Pflanzen, Biotopfunktion, Mensch und Boden in nur geringerem Umfang auf.
Durch die Umsetzung des Vorhabens sind negative Wechselwirkungen in geringem<br />
Umfang durch die Bodenversiegelung sowie die Ableitung des Regenwassers aus<br />
dem Gebiet zu erwarten.<br />
Vergleichsweise positiv werden sich das Straßenbegleitgrün, die vorgeschriebenen<br />
Gehölzanpflanzungen und die vielfältige gärtnerische Gestaltung der Hausgärten<br />
auswirken.<br />
6.3 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter<br />
Die Planung hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, da durch<br />
Überbauung und Versiegelung sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen. Mutterund<br />
Oberboden verbleiben jedoch größtenteils auf dem Grundstück. Das Schutzgut<br />
Wasser ist durch die Ableitung des Regenwassers sowie durch die Reduzierung der<br />
Grundwasserneubildungsrate mäßig beeinflusst. Auf die Schutzgüter Mensch, Tiere,<br />
Pflanzen, Biotopfunktion, Klima/Luft, Landschaft wirkt sich das Vorhaben nur wenig<br />
aus. Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen.<br />
7. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes<br />
7.1 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung<br />
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine Fortführung der landwirtschaftlich<br />
intensiven Nutzung des Ackerlandes gegeben. Der Grünstreifen mit den sieben<br />
hochstämmigen Obstbäumen an der Paradiesstraße hätte weiter Bestand.<br />
Die ökologische Wertigkeit der Gesamtfläche bliebe entsprechend gering.<br />
7.2 Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung<br />
Nach § 1 Abs. 6 Sätze 7a, c und d Bau GB sind die Umweltauswirkungen auf die<br />
vorgenannten Schutzgüter sowie auf das Wirkungsgefüge zwischen ihnen zu<br />
untersuchen. Ebenso sind auch die sonstigen Belange nach § 1 Abs. 6 Sätze 7 b, e<br />
– i BauGB und nach § 1 a Abs. 2 und 3 BauGB zu untersuchen.<br />
Ergebnisse der Auswirkungen können aus dem vorherigen Kapitel entnommen<br />
werden.
8. Maßnahmen zur Minimierung der negativen Auswirkungen<br />
8.1 Maßnahmen zur Minimierung der betriebsbedingten Auswirkungen<br />
8.1.1 Vermeidung von Emissionen<br />
Die gültigen Wärmestandards des Immissionsschutzrechts sowie moderner<br />
Heizanlagen müssen eingehalten werden. Daher sind keine erheblichen<br />
Auswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringe Erhöhung der<br />
Belastung durch Abgase des Anliegerverkehrs ist möglich.<br />
8.1.2 Abfälle, Abwasser<br />
Abfälle werden gemäß des Kreislaufwirtschaftsgesetztes sowie der gültigen<br />
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises und der zusätzlichen<br />
Entsorgungsalternativen der <strong>Stadt</strong> entsorgt.<br />
Das Abwasser wird im Trennsystem der Sammelkläranlage <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> zugeleitet,<br />
das Niederschlagswasser wird über die nördlich vorhandenen Retentionsfilterbecken<br />
dem Seewattenbach zugeleitet (siehe Kapitel 6.1.4).<br />
8.1.3 Energie<br />
Empfohlen wird neben der Nutzung alternativer Energien durch Photovoltaik-,<br />
thermische Solaranlagen und Erdwärme auch die energetisch gesehen optimale<br />
Ausrichtung der Gebäude sowie der Bau von „Passivhäusern“ zur Minimierung des<br />
Energieverbrauchs.<br />
8.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen<br />
Auswirkungen<br />
8.2.1 Bodenbelastung<br />
Bei Baumaßnahmen ist der Oberboden getrennt vom Unterboden fachgerecht<br />
abzutragen (BodSchG § 1). Der Oberboden soll in Mieten von maximal einem Meter<br />
Höhe zwischengelagert werden. Nach den Baumaßnahmen wird er in einer Stärke<br />
von ca. 0,4 m wieder aufgetragen und gelockert. Eventuell vorhandene<br />
Bodenverdichtungen sind zu beseitigen.<br />
Die Bodenfunktionen sollen so weitgehend erhalten bleiben.<br />
8.2.2 Beläge<br />
Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasen-,<br />
Dränpflaster, Kies-/Sandgemische o.ä.) herzustellen.<br />
Dadurch wird der Oberflächenabfluss reduziert.
8.2.3 Einfriedungen<br />
Mit Einfriedigungen ist von Fahrbahnrändern ein Abstand von mind. 0,5 Meter<br />
einzuhalten. Im 3 Meter breiten Streifen entlang von öffentlichen Straßen und Wegen<br />
dürfen tote und lebende Einfriedigungen nicht mehr als 1,5 Meter hoch sein.<br />
Geschlossene Wände wie z.B. Mauern, Gabionen oder Holz-/Metallwände, sind<br />
straßenseitig entweder mit Kletterpflanzen zu begrünen oder nach längstens 4 Meter<br />
durch Rücksprünge und einer Bepflanzung von mind. 40 cm Breite zu ergänzen oder<br />
durch eine mind. 40 cm breite Bepflanzung zu unterbrechen.
9. Ökologische Bewertung und Gegenüberstellung des Ist-Zustandes und des<br />
Zustandes nach Umsetzung des Vorhabens<br />
- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen<br />
- Eingriffs-/Ausgleichsbilanz der Biotopfunktion<br />
Im Plangebiet sind die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten<br />
und dauernd zu unterhalten.<br />
Auf jedem Grundstück sind zwei höher wachsende, langlebige, einheimische<br />
Laubbäume neu zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die Art muss in der von<br />
der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> herausgegebener „Liste einheimischer Gehölze“<br />
enthalten sein.<br />
Die Pflanzinseln innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mit<br />
niederwachsenden, standortgerechten Stauden und je Pflanzinsel mit einem höher<br />
wachsenden, langlebigen, einheimischen Laubbaum zu bepflanzen und dauernd zu<br />
unterhalten.<br />
9.1 Ökologische Bewertung der Biotopfunktion<br />
Nach dem ökologischen Bewertungsschema des Landkreises Sigmaringen können<br />
den aktuellen und zukünftigen Nutzungsformen auf dem Gebiet des Bebauungsplans<br />
„Krumme Äcker 3“ folgende Wertstufen zugeordnet werden.<br />
Folgende Angaben zum Bestand und zur Planung liegen der ökologischen<br />
Bewertung zugrunde:<br />
Bestand:<br />
Die Flächennutzung stellt sich wie folgt dar:<br />
Asphaltierte Fahrbahnen<br />
Bankette<br />
Wirtschaftswege<br />
Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />
Ackerland<br />
Gesamtfläche:<br />
812 qm<br />
461 qm<br />
555 qm<br />
1.500 qm<br />
22.363 qm<br />
25.691 qm<br />
Planung:<br />
Überbaubare Wohnfläche (versiegelt)<br />
Öffentliche Straßenfläche (versiegelt)<br />
Nicht überbaubare Flächen<br />
Zusammen:<br />
8.286 qm<br />
4.976 qm<br />
12.429 qm<br />
25.691qm
9.1.1 Bewertung vor der Maßnahme (Bestand):<br />
Asphaltierte Fahrbahnen: 812 qm x 0 Wertpunkte = 0 Wertpunkte<br />
Bankette: 461qm x 1 Wertpunkt = 461 Wertpunkte<br />
Wirtschaftswege: 555 qm x 1 Wertpunkt = 550 Wertpunkte<br />
Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen: 1.500 qm x 3 Wp =<br />
4.500 Wertpunkte<br />
Intensivacker: 22.363 qm x 1 Wertpunkt = 22.363 Wertpunkte<br />
zusammen: 25.691 qm = 27.874 Wertpunkte<br />
9.1.2 Bewertung nach der Maßnahme:<br />
Überbaubare Wohnfläche 8.286 qm x 0 Wertpunkte =<br />
Öffentliche Straßenfläche 4.976 qm x 0 Wertpunkte =<br />
0 Wertpunkte<br />
0 Wertpunkte<br />
Nicht überbaubare Flächen 12.429 qm:<br />
davon 69 % Nutzgarten, Gras …: 8.576 qm x 2 Wp = 17.152 Wertpunkte<br />
30 % Gartenbiotope (Bäume, Hecken, Stauden …):<br />
3.729 qm x 3 Wertpunkte = 11.187 Wertpunkte<br />
1 % Straßenbegleitgrün mit heimischen Stauden …:<br />
124 qm x 3 Wertpunkte = 372 Wertpunkte<br />
zusammen: 25.691qm<br />
28.711 Wertpunkte<br />
Saldo Biotopfunktion:<br />
Nachher – vorher: 28.711 Wertpunkte - 27.874 Wertpunkte = + 837 Wertpunkte<br />
Es entsteht ein ökologisches Plus der Biotopfunktion in Höhe von 837 Wertpunkten.<br />
Die Einschränkungen der Biotopfunktion durch die Baumaßnahmen können<br />
innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Für die „Biotopfunktion“ ist<br />
deshalb kein weiterer Ausgleich außerhalb des Plangebietes notwendig.
9.2 Ausgleichsmaßnahmen<br />
9.2.1 Ausgleich Schutzgut „Biotopfunktion“<br />
Das Schutzgut „Biotopfunktion“ kann innerhalb des Plangebietes ausgeglichen<br />
werden.<br />
9.2.2 Ausgleich Schutzgut „Boden“<br />
Eingriffs-/Ausgleichbilanz siehe Kapitel 6.1.3.<br />
Oberboden sowie restlicher Aushub werden seitlich gelagert und verbleiben<br />
möglichst im Plangebiet.<br />
Die Beeinträchtigung des Schutzgutes „Boden“ wird über die Anlage des in der Nähe<br />
befindlichen, jetzt extensiv genutzten städtischen Obstbaumlehrpfades (früher<br />
Intensivacker) ausgeglichen (siehe Kapitel 6.1.3.3).<br />
9.3 Fazit Eingriffs- / Ausgleichsbilanz<br />
Durch die momentan überwiegend intensive Ackernutzung des Plangebietes<br />
(Monokulturen, Pflanzenschutz und Mineraldüngung) errechnet sich für die Fläche für<br />
das Schutzgut „Biotopfunktion“ keine hohe ökologische Wertigkeit. Die relativ kleine<br />
Wiesenfläche mit sieben Obstbäumen entlang der Paradiesstraße wirkt sich dabei<br />
nicht entscheidend auf das Punktekonto aus. Die Bestandsbewertung beläuft sich<br />
deshalb auf 27.874 Wertpunkte.<br />
Bei Umsetzung der Maßnahme erfährt das Plangebiet durch relativ große<br />
Hausgartenflächen im Vergleich zur momentan intensiven landwirtschaftlichen<br />
Nutzung eine ökologische Aufwertung (28.711 Wertpunkte).<br />
Es ergibt sich ein Plus von 837 Wertpunkten.<br />
Mit dieser Maßnahme sind die durch die Planung vorgesehenen Eingriffe in den<br />
Naturhaushalt ausgeglichen. Weitere Maßnahmen sind für das Schutzgut<br />
„Biotopfunktion“ deshalb nicht erforderlich.<br />
Der Ausgleich für das Schutzgut „Boden“ erfolgt über die Anlage des sich 500 Meter<br />
nördlich des Plangebietes befindlichen städtischen, extensiv genutzten 15.000 qm<br />
großen Obstbaulehrpfad (siehe Kapitel 6.1.3.3).<br />
10. Zusammenfassung<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> beabsichtigt, in der Kernstadt den Bebauungsplan „Krumme<br />
Äcker 3“ für Wohnbauzwecke (allgemeines Wohngebiet) aufzustellen.<br />
Das Gebiet mit einer Gesamtfläche von 2,5691 ha befindet sich am südlichen<br />
<strong>Stadt</strong>rand auf nördlich und östlich ansteigendem Gelände, direkt südlich<br />
anschließend an ein bestehendes Wohngebiet (Krumme Äcker 2).<br />
Das Plangebiet wird zurzeit zu ca. 90 % landwirtschaftlich intensiv als Ackerland<br />
genutzt.
Untersucht wurde die Auswirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, Tiere<br />
und Pflanzen sowie Biotopfunktion, Geologie und Boden, Wasser, Klima/Luft,<br />
Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern<br />
(Umweltbelangen).<br />
Die Planung hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, da durch<br />
Überbauung und Versiegelung sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen. Das<br />
Schutzgut Wasser ist durch die Ableitung des Regenwassers sowie durch die<br />
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate mäßig beeinflusst. Auf die restlichen<br />
Schutzgüter wirkt sich das Vorhaben nur wenig bzw. nicht aus.<br />
Nach dem ökologischen Bewertungssystem des Landkreises Sigmaringen entsteht<br />
bei Umsetzung des Vorhabens für das Schutzgut „Biotopfunktion“ auf Grund der<br />
vielfältigen Gestaltung der Hausgärten ein ökologisches Plus, so dass keine weiteren<br />
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes<br />
„Boden“ kann durch den extensiv genutzten städtischen Obstbaumlehrpfad, der sich<br />
in unmittelbarer Nähe befindet, ausgeglichen werden.<br />
Aufgestellt: <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong>, im Juni 2013<br />
STADTVERWALTUNG BAD SAULGAU<br />
Fachbereich 3.1 – <strong>Stadt</strong>planung<br />
Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter