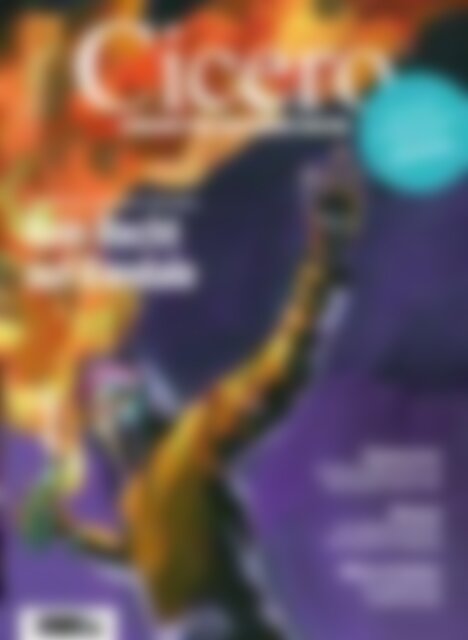Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nº03<br />
MÄRZ<br />
2014<br />
€ 8.50<br />
CHF 13<br />
JETZT!<br />
ZUR LEIPZIGER BUCHMESSE:<br />
UNSERE BEILAGE<br />
Literaturen<br />
Gewaltpartys in deutschen Großstädten<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong><br />
<strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
Österreich: 8.50 €, Benelux: 9.50 €, Italien: 9.50 €<br />
Spanien: 9.50 € , Finnland: 12.80 €<br />
03<br />
Stabwechsel<br />
Die Berliner Philharmoniker und<br />
Simon Rattles schweres Erbe<br />
Weckruf<br />
Franz Müntefering über die<br />
Rentensünden der Regierung<br />
Mütter &Töchter<br />
Das komplizierteste<br />
Verhältnis der Welt<br />
4 196392 008505
Perfekt ablesbar Tag für Tag.<br />
Die GROSSE LANGE 1 in<br />
18 Karat Weißgold.<br />
Mit ihren dezentralen, überschneidungsfreien Anzeigen und dem charakteristischen<br />
Großdatum steht die Lange 1 für beste Ablesbarkeit. Bei der<br />
neuen Grossen Lange 1 in Weißgold gilt dies auch für die Nachtstunden,<br />
denn ihre Indizes und Zeiger leuchten in der Dunkelheit. Bei der <strong>auf</strong> 200<br />
Exemplare limitierten Grossen Lange 1 „Lumen“ lässt sich erstmals auch<br />
das Großdatum im Dunkeln ablesen. Damit es auch dann noch leuchtet,<br />
wenn beim Datumswechsel um Mitternacht die neuen Ziffern erscheinen,<br />
ist ein Teil des Zifferblatts aus halbtransparentem Saphirglas gefertigt.
Perfekt ablesbar Nacht für Nacht.<br />
Die GROSSE LANGE 1 „Lumen“<br />
in Platin.<br />
Dieses lässt das unsichtbare UV-Licht passieren, wodurch sich die Leuchtmasse<br />
der Datumsscheiben auch unterhalb des Zifferblatts <strong>auf</strong>laden kann.<br />
Da der sichtbare Teil des Lichts das Glas kaum durchdringt, erscheint<br />
das Zifferblatt stark abgedunkelt. So kann das Großdatum auch am Tag<br />
kontrastreich abgelesen werden. Gleichzeitig ist es möglich, einen Blick<br />
<strong>auf</strong> die sonst im Verborgenen liegende, <strong>auf</strong>wendig perlierte Datumsplatine<br />
und <strong>auf</strong> die Mechanik des Großdatums zu werfen, das nun Tag für Tag<br />
und Nacht für Nacht betrachtet werden kann. www.lange-soehne.com
Weil wir die beste<br />
Bank für den Mittelstand<br />
bleiben wollen.<br />
Mittelstandsbank
ATTICUS<br />
N°-3<br />
NICHT LUSTIG<br />
Titelbild: Felix Gephart; Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Manche Begriffe gehen einem nach der<br />
Lektüre eines Textes nicht mehr aus<br />
dem Kopf, weil sie so treffend sind – oder<br />
so sperrig. Oder beides <strong>auf</strong> einmal. „Erlebnisund<br />
gewaltorientierte Jugendliche“ ist ein<br />
solcher Begriff aus Alexander Marguiers<br />
Titelgeschichte über Gewaltausbrüche in<br />
deutschen Großstädten. So nennt die<br />
Polizei offiziell jene Testosteron‐Touristen,<br />
die sich schwarz einkleiden und zu den<br />
Prügelpartys der Republik tingeln.<br />
Vor Weihnachten versammelten sich<br />
die Spaßschläger in Hamburg und prügelten<br />
sich mit der Polizei, angeblich zur<br />
Rettung des Kulturzentrums „Rote Flora“.<br />
In Berlin werden sie zum 1. Mai wieder<br />
einfallen, um so zum Spaß Sch<strong>auf</strong>ensterscheiben<br />
einschmeißen zu können, das<br />
Ganze verbrämt als politischer Kampf für<br />
die armen unterdrückten Arbeiter.<br />
Man hat sich an dieses Phänomen<br />
schon beinahe schleichend gewöhnt.<br />
Alle Jahre wieder die Heimsuchung der<br />
Hirnverbrannten. Dieses Magazin fühlt<br />
sich der politischen Kultur verpflichtet,<br />
und deshalb sagt <strong>Cicero</strong>: Es gibt kein <strong>Recht</strong><br />
<strong>auf</strong> <strong>Randale</strong>. Es gibt keine Legitimationsgrundlage<br />
für rechtsfreie Räume der<br />
Gewalt. Das Monopol der Gewalt liegt<br />
beim Staat und nur dort. In dieser Ausgabe<br />
geben wir daher auch den Polizisten Raum,<br />
denjenigen, die buchstäblich den Kopf<br />
hinhalten müssen für den perversen Spaß<br />
der Partyschläger ( Seite 26 ). Nicht nur<br />
nebenbei macht der oberste Interessenvertreter<br />
der Polizisten, Oliver Malchow,<br />
deutlich, wer die Party am Ende bezahlt<br />
( Seite 28 ). Frank A. Meyer, ein Freund<br />
klarer Worte, hat seinen eigenen Begriff<br />
für erlebnis- und gewaltorientierte Jugendliche.<br />
Er nennt sie: „Pack“ ( Seite 30 ).<br />
Wir bei <strong>Cicero</strong> lieben den Spaß.<br />
Aber hier verstehen wir keinen. Das ist<br />
eine Frage des Prinzips.<br />
Ums Prinzip geht es auch bei der<br />
sogenannten Rente mit 63. Wir fragten<br />
den Vater der Rente mit 67, ob er nicht<br />
seine Meinung zur Rentenpolitik der<br />
Großen Koalition <strong>auf</strong>schreiben wolle.<br />
Eines Mittwochs klingelte es dann an der<br />
Tür der Redaktion. Ein Mann mit rotem<br />
Schal um den Hals stand davor, hatte<br />
einen hellbraunen Umschlag dabei, darin<br />
ein Manuskript, <strong>auf</strong> seiner berühmten<br />
„Gabriele“ geschrieben und von Hand<br />
hie und da korrigiert. Darüber stand unterstrichen:<br />
„für CICERO, Franz Müntefering,<br />
8. 2. 14“. Ab Seite 82 können Sie nachlesen,<br />
was der frühere Vizekanzler von<br />
der Rentenpolitik seiner früheren Regierungschefin<br />
Merkel und seinen beiden<br />
Parteifreunden Sigmar Gabriel und<br />
Andrea Nahles hält. Ungefähr so viel<br />
wie wir von Gewaltpartys.<br />
Mit besten Grüßen<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Chefredakteur<br />
5<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
INHALT<br />
TITELTHEMA<br />
16<br />
EIN GEWALTIGER SPASS<br />
Krawall in Berlin,<br />
Hamburg, Köln: Eine Reise<br />
an die Grenzen des <strong>Recht</strong>sstaats<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
Foto: Schaube/face to face<br />
26<br />
„ALLES WAR VERBRANNT“<br />
Die Kugelbombe, der Knall,<br />
die Folgen: Ein verletzter Polizist<br />
erzählt seinen Fall<br />
Von CONSTANTIN MAGNIS<br />
28<br />
„AGGRESSIV OHNE ANLASS“<br />
Oliver Malchow, Chef der<br />
Polizeigewerkschaft,<br />
über No-go-Areas in Deutschland<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
30<br />
KEIN HIRN<br />
UNTER DEN KAPUZEN<br />
Die Schläger<br />
sind nicht links, sondern Pack<br />
Von FRANK A. MEYER<br />
7<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
32 EIN JURIST ÜBERZIEHT<br />
Von Wulff zu Edathy: Hannovers<br />
Oberstaatsanwalt Jörg Fröhlich und<br />
seine Behörde geben kein gutes Bild ab<br />
Von ANDREAS FÖRSTER<br />
50 KANN DENN SPRUDEL<br />
SÜNDE SEIN?<br />
Die Schauspielerin Scarlett<br />
Johansson ist in die Fallstricke<br />
des Nahostkonflikts geraten<br />
Von SYLKE TEMPEL<br />
68 DER MACHTWÄCHTER<br />
Andreas Mundt leitet das<br />
Bundeskartellamt. Er findet, dass die<br />
Bahn mehr Wettbewerb verträgt<br />
Von CAROLA SONNET<br />
34 IN DER MANEGE<br />
Der neue Justizminister Heiko<br />
Maas zwischen schnuckeligem<br />
Schwalbach und biestigem Berlin<br />
Von CHRISTOPHE BRAUN<br />
36 BRUMMIS UND GEZWITSCHER<br />
Dorothee Bär von der CSU zeigt, wie<br />
Kontraste eine Politikerin stark machen<br />
Von CHRISTOPH SEILS<br />
38 EWIG UNZUFRIEDEN<br />
Einzug ins EU-Parlament? Dürfte die<br />
AfD schaffen. Ende der Querelen? Eher<br />
nicht. Anatomie einer Protestpartei<br />
Von ANDREAS THEYSSEN<br />
42 SIE WAREN ANDERS<br />
Hitler ließ seine Eltern ermorden.<br />
Die Geschichte des Sohnes Hans<br />
Coppi und was sie über den<br />
Begriff des Verrats erzählt<br />
Von GEORG LÖWISCH<br />
47 FRAU FRIED FRAGT SICH ...<br />
…ob Politiker-Liebschaften<br />
Privatsache sind<br />
Von AMELIE FRIED<br />
42<br />
Verrätersohn? Heldensohn?<br />
Sohn.<br />
52 HERRN FICOS GESPÜR<br />
FÜR MACHT<br />
Robert Fico will die Slowakei ganz<br />
beherrschen und deshalb nach dem<br />
Amt des Premiers die Präsidentschaft<br />
Von VINZENZ GREINER<br />
54 MUTTER COURAGE<br />
Chatherine Samba-Panza<br />
soll die Zentralafrikanische<br />
Republik befrieden. Sie hofft<br />
<strong>auf</strong> Hilfe aus Berlin<br />
Von DIRKE KÖPP<br />
56 GERNEKLEIN IN DER<br />
MITTE DER WELT<br />
Das Schweizer Nein zur<br />
Zuwanderung empört und zeigt<br />
zugleich die Scheinheiligkeit der EU<br />
Von ADOLF MUSCHG<br />
60 DIE RETTUNG DES VERSTANDES<br />
Ist Alzheimer zu heilen? Ein<br />
Neurologe hat sich <strong>auf</strong>gemacht,<br />
in den kolumbianischen Anden<br />
die Lösung zu finden<br />
Von CLAAS RELOTIUS<br />
60<br />
Alzheimer. Die Tochter bangt<br />
um ihre Mutter<br />
70 MEISTERIN DES EXPERIMENTS<br />
Die Forscherin Esther Duflo testet,<br />
was wirklich gegen Armut hilft.<br />
Bekommt sie den Nobelpreis?<br />
Von CHRISTINE MATTAUCH<br />
72 WER IST DER MITTELSTAND?<br />
„The Mittelstand“ – das Ausland<br />
beneidet uns um ihn, seine Lobby<br />
klagt. Was ist sein einender<br />
Geist? Eine Rundreise<br />
Von TIL KNIPPER<br />
80 „ICH POLTERE NICHT<br />
IN TALKSHOWS“<br />
Der neue Arbeitgeberpräsident Ingo<br />
Kramer im Interview über das Niveau<br />
von Löhnen und Stammtischen<br />
82 DAS IST IGNORANT!<br />
Die Rentenpolitik der Regierung<br />
ist vielleicht populistisch<br />
brauchbar, aber unehrlich<br />
Von FRANZ MÜNTEFERING<br />
72<br />
Patriarch & Söhne.<br />
Mittelstand ist vererbbar<br />
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong>, Claas Relotius für <strong>Cicero</strong>; Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein<br />
8<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
SALON<br />
CICERO<br />
STANDARDS<br />
86 HAUTENGE TRADITION<br />
Annette Roeckl rettete ein altes<br />
Handwerk und erfindet Produkte<br />
für eine neue Kundschaft<br />
Von PAUL-PHILIPP HANSKE<br />
88 DER BANKER UND SEINE TASSEN<br />
Erst als Unternehmer und Retter<br />
einer Porzellan-Manufaktur wurde<br />
Jörg Woltmann glücklich<br />
Von ERWIN KOCH<br />
96 MÜTTER UND TÖCHTER<br />
Die Fotografin Julia Fullerton-<br />
Batten lässt in ihren Bildern Mütter<br />
und Töchter <strong>auf</strong>einandertreffen<br />
106 WARUM ICH TRAGE,<br />
WAS ICH TRAGE<br />
Ey, du kleine süße Praline<br />
Von BARBARA SCHÖNEBERGER<br />
96<br />
Mutter und Tochter:<br />
ein Spannungsverhältnis<br />
108 ALICE SCHWARZER<br />
WAR GESTERN<br />
Die Publizistin Birgit Kelle streitet<br />
für einen neuen Feminismus<br />
Von KATHARINA SCHMITZ<br />
110 SIE WILL DAS WAGNIS<br />
Die Schauspielerin Nina Hoss<br />
sucht Chaos an der Schaubühne<br />
Von IRENE BAZINGER<br />
112 FREMD IN DER HEIMAT<br />
Der Schriftsteller David Hwang ist der<br />
erfolgreichste Dramatiker der USA<br />
Von SEBASTIAN MOLL<br />
114 STURZFAHRT OHNE KOMPASS<br />
Die Berliner Philharmoniker brauchen<br />
einen neuen Chefdirigenten. Was<br />
die Suche über die Klassik erzählt<br />
Von AXEL BRÜGGEMANN<br />
122 MAN SIEHT NUR,<br />
WAS MAN SUCHT<br />
Max Liebermanns Atelier und die<br />
Debatte um Raubkunst und Restitution<br />
Von BEAT WYSS<br />
124 GROSSVATERS KRIEG<br />
Was aßen die Soldaten? Eine Collage<br />
aus dem Ersten Weltkrieg und<br />
eine persönliche Spurensuche<br />
Von PAUL MAAR<br />
130 HOPES WELT<br />
Mit Bach wäre das nicht passiert<br />
Von DANIEL HOPE<br />
132 BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
Für den Unternehmensberater Brun-<br />
Hagen Hennerkes ist Literatur die<br />
Herzmitte aller Begeisterung<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
5 ATTICUS<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
10 STADTGESPRÄCH<br />
12 FORUM<br />
14 IMPRESSUM<br />
138 POSTSCRIPTUM<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
Der Titelkünstler<br />
Die Titelillustration dieser<br />
Ausgabe zeigt einen<br />
Krawalltouristen mit<br />
loderndem Brandsatz. <br />
Der Stil des Berliner<br />
Künstlers Felix Gephart<br />
passt dazu: kraftvolle<br />
Farbigkeit, klare Kontraste.<br />
Gephart, 37, gestaltet<br />
regelmäßig für <strong>Cicero</strong>. <br />
Mal ist es Acryl <strong>auf</strong><br />
Leinwand wie diese<br />
Titelillustration, mal sind<br />
es colorierte Strichzeichnungen,<br />
die er sehr<br />
detailreich gestaltet. <br />
So wie bei der Bestie, die<br />
im Ressort Kapital der<br />
vorigen Ausgabe einen<br />
Bitcoin hielt, jene<br />
Inter net währung, die <br />
auch bei Kriminellen<br />
beliebt ist. Bevor Gephart<br />
erste Skizzen anlegt,<br />
arbeitet er sich in die<br />
<strong>Cicero</strong>-Themen ein. <br />
Er liest, denkt nach,<br />
sucht nach einer Idee.<br />
So entstehen seine<br />
Illustrationen, deren<br />
Kennzeichen Tiefe und<br />
Entschlossenheit sind.<br />
Fotos: Julia Fullerton-Batten, Privat<br />
136 DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
Rom sehen und sterben<br />
Von MICHAEL TRIEGEL<br />
9<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Ein Minister scheut fremde Kappen, ein Präsident verteidigt die deutsche<br />
Sprache, ein Wolf ist hungrig und ein Berliner macht Autofahrern Hoffnung<br />
Minister ohne Kappe:<br />
Unverwechselbar<br />
Im Namen der Muttersprache:<br />
Deutsch statt Denglish<br />
Gescheiterte Polit-Promis:<br />
Im Abklingbecken<br />
Nicht jeder, der Gerd Müller heißt,<br />
ist so bekannt wie der einstige<br />
Fußballstar gleichen Namens. Der<br />
CSU-Politiker Gerd Müller hat das<br />
schon oft in seinem Leben erfahren.<br />
Inzwischen ist er zwar Chef des Bundesentwicklungministeriums,<br />
aber<br />
so richtig bekannt ist er immer noch<br />
nicht. Während der Koalitionsklausur<br />
im brandenburgischen Meseberg hatte<br />
er für ein Interview das streng abgeschirmte<br />
Tagungsgelände verlassen.<br />
Danach hatte er große Mühe, dem Sicherheitspersonal<br />
klarzumachen, dass<br />
er wirklich der Minister Müller ist.<br />
<strong>Kein</strong> Wunder also, dass der CSU-Mann<br />
jetzt nach Unverwechselbarkeit strebt.<br />
Als man ihm beim Einzug in sein neues<br />
Ministerbüro einen Karton voller Bundeswehr-Schirmmützen<br />
seines Vorgängers<br />
Dirk Niebel zeigte, entschied<br />
der Minister, ohne zu zögern: „Die gehen<br />
alle in den Müll!“ Er will nicht<br />
verwechselt werden – und mit Niebel<br />
schon gar nicht. tz<br />
Nicht immer trägt der Bundestagspräsident<br />
den Spitznamen „Norbert<br />
jammert“ zu <strong>Recht</strong>. Nun aber war<br />
wieder ein Tag, an dem es schwerfiel,<br />
die Jeremiade zu vermeiden. Unter dem<br />
bizarren Titel „Deutsch 3.0“ wollen das<br />
Goethe-Institut, das Institut für deutsche<br />
Sprache, der Stifterverband für die<br />
Deutsche Wissenschaft und knapp 30<br />
weitere Organisationen der Muttersprache<br />
bis Jahresende einen Schub verleihen.<br />
Schirmherr ist Norbert Lammert,<br />
der schon viele solcher Schirme trägt<br />
und selber gerne geschliffen formuliert.<br />
Zum Auftakt der deutschlandweiten<br />
Veranstaltungsreihe schalt der Bundestagspräsident<br />
das „passive Verhalten<br />
der Eliten“. Diese ließen sich den „Statusverlust<br />
der deutschen Sprache als<br />
Wissenschaftssprache“ zu leicht abhandeln.<br />
Schlimm sei auch die „Evaluierung<br />
germanistischer Projekte <strong>auf</strong> Englisch“.<br />
Wo er recht hat, hat er recht, der<br />
eilige Norbert. kis<br />
Wie gut, dass es eine Welt außerhalb<br />
Deutschlands gibt. Viele gescheiterte<br />
Bundespolitiker wissen das<br />
zu schätzen und haben sich ins Ausland<br />
abgesetzt: Karl-Theodor zu Guttenberg<br />
(USA), Philipp Rösler (Weltwirtschaftsforum,<br />
Schweiz), David McAllister (Europaparlament,<br />
Straßburg), Daniel Bahr<br />
(Berater für Gesundheitspolitik, USA),<br />
Annette Schavan (Botschafterin, Vatikan).<br />
So unterschiedlich die Gründe ihres<br />
Scheiterns auch waren – allen gemeinsam<br />
war offenbar die Erkenntnis,<br />
dass es ratsam ist, das Land zu meiden,<br />
in dem die Kultur der zweiten Chance<br />
nicht sehr gepflegt wird. Wie lange aber<br />
muss einer im Abklingbecken ausharren?<br />
Wann verfliegt die toxische Wirkung<br />
der Niederlage? Grünen-Chef<br />
Cem Özdemir schaffte die Rückkehr<br />
aus dem EU-Parlament relativ schnell.<br />
Bei zu Guttenberg dauert es länger. Als<br />
der kürzlich in München <strong>auf</strong>tauchte, erklärte<br />
er vorsorglich, dies sei nicht sein<br />
„367. Comeback-Versuch“. ink<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
10<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Blockade der Wilhelmstraße:<br />
Bald wieder freie Fahrt?<br />
Die britische Botschaft bereitet den<br />
Berlinern doppelten Verdruss. Zum<br />
einen stehen die diplomatischen Vertreter<br />
Ihrer Majestät unter dem – bislang<br />
nicht entkräfteten – Verdacht, die Immobilie<br />
im Zentrum der Stadt zu Spionagezwecken<br />
zu nutzen. Zum anderen<br />
ist wegen der Botschaft aus Sicherheitsgründen<br />
ein Teil der Wilhelmstraße mit<br />
Pollern abgeriegelt und somit für Autos<br />
gesperrt: „Wenn wir für die Briten<br />
schon eine ganze Straße dichtmachen,<br />
dann sollen sie wenigstens <strong>auf</strong>hören,<br />
unsere Telefongespräche von dort abzuhören“,<br />
lästert der Berliner Grünen-<br />
Politiker Benedikt Lux.<br />
Noch ärgerlicher aber finden vor<br />
allem die Autofahrer, dass eine der<br />
wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen<br />
der Stadt seit elf Jahren abgeklemmt<br />
ist und sie sich über Umwege quälen<br />
müssen. Zumindest dieses Übel könnte<br />
bald gelindert werden. Verkehrs- und<br />
Sicherheitspolitiker der Stadt verhandeln<br />
seit ein paar Wochen intensiv und<br />
diskret mit Spitzenbeamten der zuständigen<br />
Bundesministerien darüber, ob<br />
und wie die Totalsperrung gelockert<br />
werden könnte.<br />
Frühere Gespräche waren am Veto<br />
der Sicherheitskräfte gescheitert. Das<br />
könnte sich jetzt ändern. „Die Chancen,<br />
dass wir es diesmal schaffen, sind<br />
besser als je zuvor“, sagt der Berliner<br />
CDU-Politiker Oliver Friederici. Geprüft<br />
werde nämlich, ob man die Botschaft<br />
durch Poller in der Straßenmitte<br />
sichern und dann die gegenüber der<br />
Botschaft liegende Straßenseite als Einbahnstraße<br />
wieder öffnen kann. hp<br />
Machtkampf in Südwest:<br />
Hungrige Wölfe<br />
Baden-Württembergs Landtagspräsident<br />
Guido Wolf präsentiert sich im<br />
Internet unter www.der-wolf-im-revier.<br />
de. Als es kürzlich darum ging, dass im<br />
Südwesten der Republik bald wieder<br />
Wölfe heimisch werden könnten, versprach<br />
der CDU-Politiker umgehend,<br />
er werde für das erste Exemplar eine<br />
Patenschaft übernehmen. Kurz: Guido<br />
Wolf liebt seinen Namen.<br />
Und er ist ehrgeizig. Er würde sicher<br />
gerne 2016 für das Amt des Ministerpräsidenten<br />
kandidieren, will die<br />
Entscheidung aber, solange es geht, offenhalten.<br />
Einstweilen antichambriert<br />
er bei der CDU-Basis und belustigt Narrenzünfte<br />
mit selbst gereimten Gedichten.<br />
Wenn wir in Wolfs Namenswitzwelt<br />
einstiegen, könnten wir sagen: Der<br />
Wolf streicht hungrig um die Herde.<br />
Es gibt zwei andere, die Appetit<br />
haben und Beute machen wollen. Peter<br />
Hauk, Chef der Landtagsfraktion, und<br />
Thomas Strobl, Chef des Landesverbands.<br />
Hauk will am 8. April von seiner<br />
Fraktion wiedergewählt werden, aber<br />
er ist umstritten. Das böte Wolf die<br />
Chance, gegen ihn anzutreten und ihn,<br />
nun ja, wegzubeißen. Als Fraktionsund<br />
damit Oppositionschef könnte er<br />
Ministerpräsident Winfried Kretschmann<br />
direkt anbellen. Strobl hat intern<br />
lange vor einer Beißerei gewarnt. Das<br />
Rudel müsse vor den Kommunalwahlen<br />
Ende Mai einig sein. Er ist an einem<br />
neuen siegreichen Fraktionschef nicht<br />
interessiert. Besser es gibt weiter zwei<br />
kleine Landtagswölfe. Dann wäre er<br />
nämlich der Leitwolf im Revier. löw<br />
Aufsteiger Binninger:<br />
Listige Ausrede<br />
Der Aufstieg des Böblinger CDU-<br />
Bundestagsabgeordneten Clemens<br />
Binninger ins Amt des Vorsitzenden<br />
der Parlamentarischen Kontrollkommission<br />
war mit einem bemerkenswerten<br />
Wechsel seiner landsmannschaftlichen<br />
Identität verbunden.<br />
Nachdem ihn die Süddeutsche<br />
Zeitung irrtümlich als tüchtigen<br />
„Schwaben“ vorgestellt hatte, sah sich<br />
der CDU-Politiker zu einer persönlichen<br />
Klarstellung gezwungen. Er ist<br />
nämlich kein „Schwoob“. Wohl aber<br />
hat er seinen Wahlkreis im urschwäbischen<br />
Böblingen. Das war einst die<br />
politische Heimat der früheren CDU-<br />
Schatzmeisterin Brigitte Baumeister,<br />
die Binninger schon 2002 in einem<br />
damals bundesweit beachteten<br />
Kraftakt als Direktkandidatin verdrängt<br />
und abgelöst hatte. Da man so<br />
etwas eigentlich nur einem waschechten<br />
Schwaben zugetraut hätte, galt er<br />
seitdem als ein solcher.<br />
Zur Rede gestellt, versuchte sich<br />
der CDU-Politiker nun augenzwinkernd<br />
mit einer listigen Auskunft herauszureden:<br />
Er sei ein „südbadischer<br />
Schwabe“, behauptete er. Allerdings<br />
war diese Spezies bisher im Südwesten<br />
der Republik nicht bekannt.<br />
Tatsächlich ist Binninger in Bonndorf<br />
geboren, einem kleinen Städtchen<br />
im Zentrum des Südschwarzwalds und<br />
somit ein freisinniger, badischer Uralemanne.<br />
Seine schwäbischen Wähler<br />
scheint das nicht zu stören. Bei der<br />
letzten Bundestagswahl sammelte er<br />
sensationelle 54,3 Prozent der Erststimmen<br />
ein. tz<br />
11<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
FORUM<br />
Es geht um Armutsmigration, die Herrschaft<br />
von Maschinen und um zwei Päpste<br />
Zum Thema Armutsmigration mit den Beiträgen „Das Gespenst der armen EU-Migranten“<br />
von Klaus J. Bade, „Die Arbeiter der Integration“ von Frank A. Meyer und dem Interview mit<br />
der Neuköllner Stadträtin Franziska Giffey „Da rollt was <strong>auf</strong> uns zu“, Februar 2014<br />
„Umerziehung des Volkes? Besser nicht!“<br />
Besser konnten die drei obigen Beiträge – in e i n e r Ausgabe nicht platziert<br />
werden. Da schwadroniert Herr Bade über Zahlen der Gegenwart, die keinen<br />
Anlass zur Sorge gäben. Die Kommunen sollten für Fortbildung sorgen, ansonsten<br />
ist Zuversicht angesagt. Frau Giffey, Stadträtin in Neukölln, wird schon<br />
genauer, bleibt aber korrekt vorsichtig. Herr Meyer stellt aber die Kernfrage:<br />
„Wer ist bei uns Arbeiter der Integration?“ Auf wessen Schultern liegt also<br />
die Last der Integration? Mit Geld für die Kommunen ist es nicht getan. Herr<br />
Meyer sagt es: Kulturelle, religiöse und ethnische Widersprüche lassen sich mit<br />
Geld nicht lösen …Eine große Mehrheit des Volkes will die Armutseinwanderung<br />
von Kulturen, Religionen und Ethnien eben nicht. Der Versuch einer Umerziehung<br />
des Volkes ist sehr riskant. Und kann schiefgehen. Besser nicht!<br />
Peter Wolter, Leonberg<br />
Latent fremdenfeindlich<br />
Oh <strong>Cicero</strong>! „Überfordern Armutsmigranten<br />
den Sozialstaat?“ Nein,<br />
natürlich nicht. Aber das deutsche<br />
Wesen ist von jeher obrigkeitshörig,<br />
arbeitsam und latent fremdenfeindlich.<br />
Das war schon immer so, das<br />
ist so und das wird so lange noch so<br />
bleiben, bis der letzte „Deutsche“<br />
verschwunden ist.<br />
Stefan Leicht, Radolfzell<br />
Politisch korrekt<br />
Wenn Herr Bade von „sogenannten“<br />
Armutswanderern spricht, dann<br />
mag das wohl politisch korrekt sein,<br />
aber der Wahrheit entspricht das<br />
wohl nicht. Es gibt Armutszuwanderer<br />
tatsächlich. Dem Beitrag von<br />
Frank A. Meyer kann ich nur vorbehaltlos<br />
zustimmen. Wir sollten alles<br />
Mögliche tun, damit die Südstaaten<br />
nicht ihre Sorgenkinder hierzulande<br />
entsorgen. Die EU trägt Verantwortung,<br />
dass die Länder auch<br />
ihrer Verantwortung für bessere Lebensverhältnisse<br />
gerecht werden.<br />
Alfred Keck, Landshut<br />
Mangel an Selbstreflexion<br />
Es zeugt von einem eklatanten Mangel<br />
an Selbstreflexion, dass Frank<br />
A. Meyer der Linken Borniertheit<br />
unterstellt, davon aber selbst nicht<br />
frei ist. Wenn er die „wohlbestallten<br />
Angestellten von Kirchen und<br />
Sozialbehörden“ den Krankenschwestern<br />
gegenüberstellt, zeigt<br />
sich dabei seine eigene Engstirnigkeit.<br />
Die Mitarbeiterinnen in den<br />
Eingangszonen der Jobcenter können<br />
mit oft nur 1600 Euro brutto für<br />
eine Vollzeitstelle von einem Krankenschwesterngehalt<br />
nur träumen.<br />
Doch das passt nicht ins Bild von<br />
Frank A. Meyer, für den Sozialarbeiter<br />
prinzipiell böse, weil im Zweifelsfall<br />
links sind.<br />
Tilman Weigel, Schwabach<br />
Im Elfenbeinturm<br />
Endlose Konjunktive und Hypothesen,<br />
was noch zu tun sei, schallen<br />
aus Herrn Bades Elfenbeinturm.<br />
Sollte er die Ausgangssituation<br />
seiner Forschung vernachlässigt<br />
haben, oder ignoriert er sie aus<br />
ideologischer Rücksicht? „Die Arbeiter<br />
der Integration“ und ihren<br />
Frust (F. A. Meyer) und die Tendenz<br />
einiger Staaten, ihre „Problembürger“<br />
anderen EU-Ländern <strong>auf</strong>zubürden,<br />
beschreibt Franziska Giffey<br />
(„Da rollt was <strong>auf</strong> uns zu“). Italiens<br />
Probleme sind – auch, nicht allein! –<br />
Teil dieser Politik. Sollten diese Tatsachen<br />
Herrn Bades Forschungen<br />
etwa entgangen sein?<br />
Ich widerspreche jedoch der<br />
mehrfach in diesen Artikeln geäußerten<br />
Meinung, dass die Folgen unserer<br />
(deutschen und europäischen)<br />
Politik die Bürger in das „rechte Lager“<br />
treiben wird. Stattdessen wird<br />
sich „die stumme Mehrheit“ aus<br />
Frustration über die Unfähigkeit der<br />
Regierungen noch stärker von der<br />
Wahlurne fernhalten.<br />
Dr. Volkmar v. Bruchhausen, Wiesbaden<br />
Unsinnige Wortbildung<br />
Im Wesentlichen ist der Artikel von<br />
Frank A. Meyer die notwendige<br />
Antwort <strong>auf</strong> die einseitige Darstellung<br />
von Klaus J. Bade. Bade spricht<br />
wiederholt von „sogenannter Armutswanderung“.<br />
Er suggeriert damit,<br />
dass die Armutswanderung nur<br />
ein Gespenst ist, das wir uns einbilden.<br />
Er scheut jedoch die Aussage<br />
„Es gibt keine Armutswanderung“,<br />
wohl weil er weiß, dass es fraglos<br />
eine Armutswanderung gibt.<br />
Bade spricht gerne von Kulturrassismus,<br />
es ist wohl seine Wortschöpfung.<br />
Diese Wortbildung ist<br />
nicht nur diskriminierend, sondern<br />
auch unsinnig. Diskriminierend,<br />
weil sie Kulturkritikern Rassismus<br />
unterstellt. Sprachlich unsinnig,<br />
weil es nun einmal keine kulturellen<br />
Rassen gibt.<br />
Dr. Karl-Friedrich Lammers, München<br />
12<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Für Verwaltungsmodernisierer.<br />
Parteiengründer. Europaexperten.<br />
Prozessinnovatoren.<br />
Entwicklungshelfer. Privatisierer.<br />
Verstaatlicher. Wahlforscher.<br />
Public-Policy-Experten.<br />
UN-Bürokraten. Stiftungsmanager.<br />
Öffentliche Güter-Produzenten.<br />
Sozialunternehmer.<br />
Non-Profit-Manager.<br />
Master in Politics, Administration & International Relations.<br />
Mit dem Master-Stipendium der ZU.<br />
Nächster<br />
Studienstart:<br />
01. September 2014<br />
Bewerben bis<br />
zum 01. Juli<br />
Zwei Jahre. Vollzeit. Praxistauglich durch Forschungsorientierung. Verwaltungs- und Politikwissenschaft<br />
und alles, was man wirklich braucht – für ein Management von Transformation in Verwaltung, Staat und Politik.<br />
Für Politikwissenschaftler und Andersdenkende. Mit den Tracks „Internationale Beziehungen“, „Politische<br />
Soziologie“ und „Public Management“ als Spezialisierung und Modulen für individualisierte Forschung.<br />
Die Zeppelin Universität ist eine private Stiftungsuniversität am Bodensee, die als Uni zwischen Wirtschaft,<br />
Kultur und Politik konsequent interdisziplinär, individualisiert und international lehrt und forscht. Weitere<br />
Informationen zu diesem Master-Studiengang wie auch zu den Master-Studiengängen in Kommunikationsund<br />
Kulturwissenschaften und in Wirtschaftswissenschaften sowie der Bewerbung unter zu.de/cicero
IMPRESSUM<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexander Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
CHEFIN VOM DIENST Kerstin Schröer<br />
RESSORTLEITER Lena Bergmann ( Stil ),<br />
Judith Hart ( Weltbühne ), Dr. Alexander Kissler ( Salon ),<br />
Til Knipper ( Kapital ), Constantin Magnis<br />
( Reportagen ), Dr. Frauke Meyer-Gosau ( Literaturen )<br />
CICERO ONLINE Christoph Seils ( Leitung ),<br />
Petra Sorge, Timo Stein<br />
POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT<br />
Hartmut Palmer<br />
ASSISTENTIN DES CHEFREDAKTEURS<br />
Monika de Roche<br />
REDAKTIONSASSISTENTIN Sonja Vinco<br />
ART DIRECTOR Viola Schmieskors<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Michael Voss<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
VERTRIEBSLOGISTIK Ingmar Sacher<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Roland Winkler<br />
DRUCK/LITHO Neef+Stumme,<br />
premium printing GmbH & Co.KG,<br />
Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu<br />
einer <strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen<br />
gerne weiter. Sie erreichen uns werktags von 7:30 Uhr bis<br />
20:00 Uhr und samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
TELEFON 030 3 46 46 56 56<br />
TELEFAX 030 3 46 46 56 65<br />
E-MAIL abo@cicero.de<br />
ONLINE www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-MAIL info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. Abopreise inkl. gesetzlicher MwSt.<br />
und Versand im Inland, Auslandspreise <strong>auf</strong> Anfrage. Der Export und Vertrieb<br />
von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln<br />
ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
ANZEIGENLEITUNG<br />
( verantw. für den Inhalt der Anzeigen )<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
STELLVERTRETENDE ANZEIGENLEITUNG<br />
Sven Bär<br />
ANZEIGENVERKAUF<br />
Svenja Zölch, Jacqueline Ziob, Stefan Seliger ( online )<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski (PremiumContentMedia)<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 83 317 ( IVW Q4/2013 )<br />
LAE 2013 122 000 Entscheider<br />
REICHWEITE 380 000 Leser ( AWA 2013 )<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: + 49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
VERLAG Tel.: + 49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
ANZEIGEN Tel.: + 49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER<br />
Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle <strong>Recht</strong>e vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung<br />
<strong>auf</strong> Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur<br />
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2014, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION DER RINGIER GRUPPE<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,50 €, CH: 13,– CHF, A: 8,50 €<br />
JAHRESABONNEMENT ( ZWÖLF AUSGABEN )<br />
D: 93,– €, CH: 144,– CHF, A: 96,– €<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €<br />
KOMBIABONNEMENT MIT MONOPOL<br />
D: 138,– €, CH: 198,– CHF, A: 147,– €<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen. Falls<br />
Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler nicht<br />
erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei seinem<br />
Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist dann in der<br />
Regel am Folgetag erhältlich.<br />
Zum Beitrag „APPokalypse now“ von<br />
Lena Bergmann, Februar 2014<br />
„Flüchtlingsgespräche“<br />
Lena Bergmann fragt sich: „Hat dieses<br />
Dauer-Entertainment das Nachdenken<br />
verdrängt?“ Die Gefahr<br />
besteht sicher, ist jedoch nicht notwendigerweise<br />
Folge der Smartphone-Benutzung.<br />
Frau Bergmann<br />
schildert zutreffend, dass ein Smartphone<br />
effektiv ist, also Zeit spart.<br />
Die so eingesparte Zeit kann ja,<br />
wenn gewünscht, zum Nachdenken<br />
verwendet werden.<br />
Dem steht das Verlangen nach<br />
Entertainment entgegen, aber auch<br />
der Wunsch nach ständiger Kommunikation.<br />
Hierzu Peter Sloterdijk<br />
in seinen Notizen („Zeilen und<br />
Tage“) am 8. 10. 2008: „Es könnte<br />
sein, dass ein gut Teil der Kommunikationen<br />
zwischen Menschen nichts<br />
anderes ist als der Verkehr zwischen<br />
Leuten, die sich selber meiden, wobei<br />
sie unweigerlich <strong>auf</strong> andere Sich-<br />
Ausweichende treffen. Das ergibt<br />
Flüchtlingsgespräche ohne Ende,<br />
denn Selbstausweichler haben einander<br />
viel zu sagen.“<br />
Armgard Rosenberger, München<br />
Mehr Zeit zum Denken<br />
Sie schildern sehr schön die Effektivität<br />
der Maschine. Diese Effektivität<br />
erspart uns Zeit, sie schenkt<br />
uns also Zeit. Die Maschine verdrängt<br />
also nicht das Nachdenken,<br />
sondern sie schenkt uns frei<br />
verfügbare Zeit, die wir, wenn wir<br />
wollen, auch zum Nachdenken verwenden<br />
können.<br />
Sie sagen von der Maschine:<br />
„Sie lässt uns eine umfassende Allgemeinbildung<br />
mit den Fingerspitzen<br />
abrufen.“ Bildung ist das, was<br />
bleibt, wenn man Wissen ausklammert.<br />
Der Brockhaus und auch Wikipedia<br />
bieten Definitionen für den<br />
Begriff Bildung an, zum Beispiel<br />
die von Bernward Hoffmann: „Entfaltung<br />
und Entwicklung der geistig-seelischen<br />
Werte und Anlagen<br />
eines Menschen durch Formung<br />
und Erziehung“. Kann das die Maschine?<br />
Da habe ich Zweifel.<br />
Kurd Geerken, Dörpen<br />
14<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
Missbrauch ist möglich<br />
Im Titel wird darüber geklagt, „wie<br />
uns das Smartphone versklavt“,<br />
aber Lena Bergmann zeigt in dem<br />
Artikel „APPokalypse now“, dass<br />
ein Smartphone bei sinnvollem Gebrauch<br />
nicht versklavt, sondern<br />
nützt, und nur eine unsinnige Verwendung<br />
Probleme bereitet. Vorschlag<br />
für die grüne Partei: Auf<br />
Smartphones und allen anderen<br />
Gebrauchsgegenständen den Aufdruck<br />
anbringen lassen: „Vorsicht.<br />
Missbrauch ist möglich.“<br />
Gunda Heuer, Frankfurt<br />
Karikatur: Hauck & Bauer<br />
„Ontologische Panik“<br />
Lena Bergmann freut sich über die<br />
Effektivität ihrer „Maschine“, die<br />
„unser persönlichstes Erleben“ archiviert.<br />
Nicht wenige stellen das<br />
so archivierte persönlichste Erleben<br />
ins Netz. Ich habe dies für Exhibitionismus<br />
gehalten und nicht so recht<br />
verstanden.<br />
Die wohl zutreffendere Begründung<br />
für dieses Phänomen fand ich<br />
jetzt bei Peter Sloterdijk: „Unzählige<br />
spüren, wie wenig es genügt, in<br />
der Gegenwart herumzuhängen, um<br />
‚wirklich‘, das heißt <strong>auf</strong> dokumentierte<br />
Weise, da zu sein. Sie möchten<br />
sich einen Platz <strong>auf</strong> den Bildschirmen,<br />
in der Mediasphäre, im<br />
Archiv erobern. Um jetzt zu existieren,<br />
müssen sie sich darum sorgen,<br />
dass sie nie da gewesen sein<br />
werden – manche stellen schon ihre<br />
täglichen Blutdruckwerte ins Netz …<br />
Was man für Exhibitionismus hält,<br />
ist ontologische Panik. Wir sind so<br />
schwache Kandidaten fürs wirkliche<br />
Dasein, dass uns jedes Mittel recht<br />
ist, unsere Existenz zu beweisen.“<br />
Susanne Schweer, Berlin<br />
Nicht wenige<br />
archivieren ihr<br />
persönlichstes<br />
Erleben und<br />
stellen es ins Netz<br />
Zum Beitrag „Als Josef nach der Kälte<br />
ging, Armut war ein weltlich’ Ding“ von<br />
Beat Wyss, Januar 2014<br />
Himmlische Hosen<br />
Herr Wyss schwadroniert über die<br />
„Windel Jesu, geschneidert aus Josefs<br />
Hosen“. Josef habe das Christkind<br />
mit seinem Beinkleid bedeckt,<br />
damit es nicht friert. Nun sind in<br />
Aachener Mundart „Hosen“ ( ho’se )<br />
Fußlappen, keine Beinkleider. Und<br />
„ho’se striche“ bedeutete dort noch<br />
in der Mitte des letzten Jahrhunderts<br />
„Socken bügeln“.<br />
Hans Multscher hat also nur<br />
dargestellt, was er kannte und so<br />
die (leseunkundigen) Gläubigen visualisierte<br />
biblische Geschichte<br />
nachvollziehen lassen. Josef bedeckte<br />
das Christkind mit seinem<br />
„Beinkleid“. Richtig. Im 15. Jahrhundert<br />
waren das beim Adel ( vereinzelt<br />
) Socken/Strümpfe, nicht Hosen<br />
( = Fußlappen ). Vielleicht wollte<br />
Multscher damit dem Christkind sogar<br />
etwas an Insignie und Würde geben,<br />
das es nicht hatte. Etwas Königliches.<br />
Ein Aha-Erlebnis für den<br />
einfachen Gläubigen.<br />
Dr. Walter Schmitz, Berlin<br />
Zum Interview „Die Jubler werden sich<br />
wundern“ mit Georg Gänswein,<br />
Januar 2014<br />
Doch recht unterschiedlich<br />
Zwei Punkte sind mir besonders<br />
<strong>auf</strong>gefallen: Gesten wirken im unmittelbaren<br />
Augenblick besser als<br />
Worte. Da hat Erzbischof Gänswein<br />
recht. Dies zeigt, dass Benedikt und<br />
Franziskus doch einen recht unterschiedlichen<br />
Stil an den Tag legen.<br />
Und das, obwohl immer betont wird,<br />
wie nahe sich die beiden Päpste inhaltlich<br />
stehen. Da kann man nur<br />
hoffen, dass Franziskus den guten<br />
Taten auch noch die rechten Worte<br />
folgen lassen wird.<br />
Auch mit der Einschätzung der<br />
Situation der Kirche in Deutschland,<br />
so im Fall Limburg, liegt Gänswein<br />
ganz richtig. Hier kann kein Sonderweg<br />
beschritten werden.<br />
Es gibt keine katholischen Nationalkirchen!<br />
Das müssen endlich<br />
auch einmal die deutschen Katholiken<br />
akzeptieren.<br />
Dr. Gisela Seitschek, München<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.<br />
Wünsche, Anregungen und Meinungsäußerungen<br />
senden Sie bitte an redaktion@cicero.de<br />
15<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
HAMBURG 21/12/2013 Bei einer Demo zum Erhalt<br />
der „Roten Flora“ kommt es zur Straßenschlacht<br />
16<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
EIN<br />
GEWALTIGER<br />
SPASS<br />
Die linksextreme Szene rüstet <strong>auf</strong>, bei Krawallen<br />
wie jüngst in Hamburg stellt sie ihre Militanz unter<br />
Beweis. Unterstützt werden die Autonomen dabei<br />
von Jugendlichen, die einfach nur den Kick suchen.<br />
Eine Exkursion an die Grenzen des <strong>Recht</strong>sstaats<br />
Von ALEXANDER MARGUIER
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
Ein ohrenbetäubendes Gebrüll,<br />
zwischendurch immer wieder<br />
lautes Knallen und die Geräusche<br />
von splitterndem Glas.<br />
Der Lärm ist so groß, dass die<br />
Durchsagen aus dem Lautsprecherwagen<br />
der Demonstranten kaum zu verstehen<br />
sind – nur einzelne Satzfetzen wie<br />
„<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Stadt“ oder „Bleiberecht für<br />
alle, wirklich alle“.<br />
Weiß behelmte Polizisten in schwarzen<br />
Schutzanzügen rennen in kleinen<br />
Gruppen entlang der Straße vor Hamburgs<br />
„Roter Flora“ <strong>auf</strong> vermummte Protestierer<br />
zu, begleitet vom Strahl eines<br />
Wasserwerfers. Ein Mann mit schwarzer<br />
Kapuze über dem Kopf schleudert<br />
einem Einsatzbeamten mit aller Kraft<br />
eine Holzlatte ans Visier. Es fliegen Flaschen<br />
und Böller, die gegnerischen Lager<br />
verharren kurz, um einen Überblick<br />
zu gewinnen. Dann rücken die Polizisten<br />
ein Stück weiter vor, aber der Geländegewinn<br />
währt unter dem Hagel von Steinen<br />
und Feuerwerkskörpern nur kurz. Plötzlich<br />
wird aus den Reihen der Randalierer<br />
eine Leuchtrakete <strong>auf</strong> die Polizei gefeuert;<br />
sie trifft einen Beamten an der<br />
Brust und prallt von dort zu Boden. Eine<br />
Gruppe von vier oder fünf Kapuzenträgern<br />
reißt ein Verkehrsschild aus der Verankerung<br />
und schleudert es in Richtung<br />
der Polizeikette.<br />
Was sich an diesem Nachmittag des<br />
21. Dezember 2013 im Schanzenviertel<br />
und in dem angrenzenden St. Pauli abspielt,<br />
ist eine Eskalation der Gewalt,<br />
wie sie die Hansestadt seit 25 Jahren<br />
nicht mehr erlebt hat. Am Ende sind<br />
171 Polizistinnen und Polizisten verletzt,<br />
22 davon schwer. Die Demonstranten<br />
sprechen hinterher von 460 Verletzten<br />
in ihren Reihen, belegen lässt<br />
sich diese Zahl nicht.<br />
Sicher ist dagegen, dass 56 Einsatzfahrzeuge<br />
der Hamburger Polizei<br />
beschädigt wurden, davon 15 bis zur<br />
Fahruntüchtigkeit. Von zerborstenen<br />
Sch<strong>auf</strong>ensterscheiben, zerstörten Autos<br />
und demolierten Gebäuden ganz zu<br />
schweigen. Das örtliche Büro der SPD<br />
an der Clemens-Schultz-Straße ist noch<br />
Wochen später nur notdürftig mit Brettern<br />
verrammelt – als sei es von seinen<br />
Bewohnern <strong>auf</strong>gegeben worden. Es<br />
wirkt wie ein Mahnmal. Oder wie eine<br />
Kapitulationserklärung.<br />
Vom Ausmaß der Brutalität bei den<br />
Hamburger Krawallen kann sich jeder<br />
selbst ein Bild machen; im Internet finden<br />
sich Video<strong>auf</strong>nahmen in Hülle und Fülle.<br />
Das Problem ist nur: Zur Erforschung der<br />
Ursachen für diesen vorweihnachtlichen<br />
Exzess helfen solche Filmschnipselchen<br />
nicht weiter. Wer in ihnen den Beleg für<br />
die harte Vorgehensweise der Staatsmacht<br />
erkennen will, wird sich genauso<br />
bestätigt sehen wie jene, die vor einer zunehmenden<br />
Militanz der linksextremen<br />
Szene warnen. Auf einschlägigen Internetplattformen<br />
wie „Indymedia“ empören<br />
sich Demo-Teilnehmer über den Polizeieinsatz,<br />
während sich andere ihrer<br />
eigenen Schlagkraft rühmen: „Bulleneinheiten<br />
wurden durch die Straßen gejagt“,<br />
heißt es dort zum Beispiel stolz.<br />
In Behördensprache klingt die Nachbetrachtung<br />
der Ereignisse aus gegnerischer<br />
Sicht naturgemäß nüchterner: „Der<br />
Gesamtverl<strong>auf</strong> des Protests am 21. 12. 13<br />
wurde von weiten Teilen der Szene als<br />
Mobilisierungserfolg bewertet, auch die<br />
meisten Einzelaktionen (Steinwürfe und<br />
Böller <strong>auf</strong> Polizisten, Sachbeschädigungen<br />
bei vielen Unternehmen und Einrichtungen)<br />
wurden nicht ernstlich kritisiert.<br />
Dass es zu massiven Ausschreitungen<br />
kam, wurde in vielen öffentlichen Stellungnahmen<br />
auch dem Verhalten der Polizei<br />
(Aufstoppen und frühzeitiges Auflösen<br />
der Demonstration) angelastet. Im<br />
Nachgang fanden sich im Internet mehrere<br />
Beiträge, deren Autoren in Gewaltfantasien<br />
schwelgten, die sich vor<br />
allem gegen die Polizei richteten.“ So<br />
steht es in einem Bericht des Hamburger<br />
Verfassungsschutzes.<br />
Wie es überhaupt so weit kommen<br />
konnte, darüber rätseln immer noch viele<br />
in der Hansestadt. Fest steht nur, dass<br />
gleichzeitig mehrere Themen hochkochten,<br />
die im Lager der Linksextremisten<br />
einen besonderen Stellenwert haben.<br />
Schon länger schwelt ein Streit über den<br />
Umgang mit Flüchtlingen aus Afrika, die<br />
über Lampedusa nach Hamburg gekommen<br />
sind und denen der Senat kein Bleiberecht<br />
einräumen will.<br />
Außerdem sollte ein b<strong>auf</strong>älliger<br />
Wohnkomplex, die sogenannten Esso-<br />
Häuser an der Reeperbahn, wegen Einsturzgefahr<br />
geräumt werden – aus Sicht<br />
der linken Szene ein weiterer Schritt zur<br />
Gentrifizierung des Viertels. Und dann<br />
kursierten auch noch Gerüchte über<br />
die bevorstehende Räumung der „Roten<br />
Flora“: Das ehemalige Theater im<br />
BERLIN 01/05/2013 Bei der „revolutionären Demo zum 1. Mai“ treten vermummte<br />
Teilnehmer die Scheibe einer Sparkassenfiliale ein<br />
18<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Fotos: Malte Christians/Picture Alliance/dpa (Seiten 16 bis 17), Thielker/Ullstein Bild<br />
Schanzenviertel ist seit 1989 besetzt und<br />
dient seither als „autonomes Zentrum“.<br />
Für die Autonomen ist die Flora ungefähr<br />
so symbolträchtig wie der Kölner Dom<br />
für rheinländische Katholiken.<br />
HAMBURG<br />
An Anlässen für eine Kraftprobe mit der<br />
Hamburger Regierung herrschte also kein<br />
Mangel. Und dass sich etwas zusammenbraute,<br />
dafür gab es deutliche Zeichen.<br />
Zum Beispiel den Angriff einer Gruppe<br />
von etwa 150 Leuten <strong>auf</strong> die berühmte<br />
Davidwache am Vorabend der Demonstration,<br />
bei der Fenster und Polizeiautos<br />
beschädigt wurden. Die Zeichen standen<br />
unverkennbar <strong>auf</strong> Sturm, doch aus dem<br />
Sturm wurde am nächsten Tag ein Orkan:<br />
Rund 7000 Menschen hatten sich zusammengefunden,<br />
um zu demonstrieren – darunter<br />
nach heutiger Erkenntnis des Verfassungsschutzes<br />
4000 Gewaltbereite.<br />
Dass solche Zahlen immer mit Vorsicht<br />
zu genießen sind, liegt <strong>auf</strong> der Hand.<br />
Ziemlich sicher ist allerdings, dass wesentlich<br />
mehr Krawallmacher <strong>auf</strong>marschiert<br />
waren, als die Hamburger Linksextremisten<br />
zu bieten haben. Unklar ist<br />
nach wie vor, woher sie alle kamen. Denn<br />
nur aus anderen Städten angereiste Gesinnungsgenossen<br />
können es nicht gewesen<br />
sein – so viele gibt das militante Reservoir<br />
an Linksradikalen kaum her.<br />
Die Polizei musste jedenfalls feststellen,<br />
dass etliche in Gewahrsam genommene<br />
Gewalttäter zuvor noch nie<br />
als politische Extremisten <strong>auf</strong>gefallen<br />
waren. Für sie existiert sogar ein offizieller<br />
Begriff: „gewalt- und erlebnisorientierte<br />
Jugendliche“. Das klingt ziemlich<br />
abstrakt. Ein Ermittler, der sich mit dieser<br />
Klientel auskennt, sagt es deutlicher:<br />
„Das sind Feierabend-Krawallos, die unter<br />
der Woche Bausparverträge in der<br />
Provinz verk<strong>auf</strong>en.“<br />
Michael Neumann, 43 Jahre alt, ist<br />
Hamburger Innensenator. Er war Zeitsoldat<br />
und hat bei der Bundeswehr studiert.<br />
Neumann pflegt bei aller Freundlichkeit<br />
ein militärisch-forsches Auftreten, das<br />
Gespräch in seinem Amtszimmer eröffnet<br />
der Sozialdemokrat mit der Anekdote,<br />
soeben habe er sich im Internet<br />
die Domainadresse www.roter-sheriff.<br />
de reserviert. Diesen Beinamen hat er<br />
sich durch sein Law-and-Order-Image<br />
verdient, jetzt kokettiert er ein bisschen<br />
„Da war eine<br />
Wut <strong>auf</strong><br />
den Staat zu<br />
spüren, die uns<br />
Polizisten als<br />
Ersatzziel mit<br />
voller Wucht<br />
getroffen hat“<br />
damit. Er gibt den Unnachgiebigen. Ob<br />
Neumann nach dem Exzess vom 21. Dezember<br />
im Dialog mit den Autonomen<br />
von der „Roten Flora“ stehe? „Man kann<br />
von mir als Innensenator nicht erwarten,<br />
dass ich mich mit Leuten an einen Tisch<br />
setze, die der Gewalt das Wort reden und<br />
Straftaten begehen.“<br />
Die Hamburger SPD-Regierung<br />
steckt wegen der „Roten Flora“ in einem<br />
Dilemma. Einerseits weiß sie, dass<br />
die Autonomen besonders in den linksliberalen<br />
Wählerschichten der Stadt durchaus<br />
Sympathisanten haben. Andererseits<br />
ging der SPD im Jahr 2001 auch deshalb<br />
die Macht verloren, weil sie in Fragen der<br />
inneren Sicherheit die Zügel hatte schleifen<br />
lassen.<br />
Und dem Innensenator ist natürlich<br />
klar, dass es bei dem Konflikt mit<br />
den „Floristen“ um weit mehr geht als<br />
um eine kommunalpolitische Angelegenheit.<br />
Nämlich um den <strong>Recht</strong>sstaat.<br />
Um die Frage, ob sich die Bürgerschaft<br />
von gewaltbereiten Demonstranten unter<br />
Druck setzen lassen darf. Neumann<br />
findet, das darf nicht sein. Er sagt: „Ich<br />
erlebe immer öfter, dass es Menschen<br />
gibt, die die kulturelle Errungenschaft<br />
des gesellschaftlichen Gewaltmonopols<br />
überhaupt nicht mehr begreifen. Das<br />
gilt nicht nur für politische Extremisten,<br />
sondern zum Beispiel auch für Teile<br />
der Fußballfan-Szene – eigentlich ganz<br />
normale Leute.“<br />
Ob sich die Autonomen von solchen<br />
Bekenntnissen beeindrucken lassen, ist<br />
die andere Frage. Sie haben am 21. Dezember<br />
die Muskeln spielen lassen und<br />
ihr Mobilisierungspotenzial unter Beweis<br />
gestellt. Dass die linksextreme<br />
Szene dabei von ideologiefernen Jugendlichen<br />
unterstützt wurde, für die<br />
das Steinewerfen <strong>auf</strong> Polizisten ein adrenalinsteigerndes<br />
Freizeitvergnügen ist,<br />
dürfte sie kaum gestört haben. Und dass<br />
die Hansestadt die „Rote Flora“ jetzt sogar<br />
von einem Immobilienunternehmer<br />
zurückk<strong>auf</strong>en will, dem sie das Gebäude<br />
2001 zu einem Spottpreis überlassen<br />
hatte, können die Autonomen durchaus<br />
als Erfolg verbuchen. Immerhin käme<br />
der Rückk<strong>auf</strong> einem Bestandsschutz für<br />
das heruntergekommene Zentrum gleich.<br />
Da soll noch einer sagen, dass sich Gewalt<br />
nicht lohnt.<br />
Anfang Februar, im großen Sitzungssaal<br />
des Hamburger Polizeipräsidiums.<br />
An die 200 Beamte haben sich versammelt,<br />
um noch einmal über die Brutalität<br />
der Dezember-Demo zu diskutieren; Innensenator<br />
Neumann ist ebenfalls anwesend.<br />
Einige Polizisten, die meisten kaum<br />
älter als Mitte zwanzig, berichten, was<br />
sie an diesem Tag erlebt haben. Von einer<br />
„verheerenden Zerstörungswut“ ist<br />
die Rede. „So eine Gewaltbereitschaft<br />
unter den Demonstranten habe ich noch<br />
nie erlebt“, berichtet einer. Der aus Autonomen<br />
bestehende „schwarze Block“<br />
habe sich ersichtlich austoben wollen.<br />
„Da war eine Wut <strong>auf</strong> den Staat zu spüren,<br />
die uns als erklärtes Ersatzziel mit<br />
voller Wucht getroffen hat.“<br />
Auch der Kriminologe Christian<br />
Pfeiffer aus Hannover ist angereist, sein<br />
Institut hat eine umfangreiche Studie<br />
über Gewalt gegen Polizisten erarbeitet.<br />
Demnach stieg die Zahl der Übergriffe<br />
allein zwischen den Jahren 2005<br />
und 2009 um 82 Prozent. Und es sei nicht<br />
davon auszugehen, dass sich an diesem<br />
Trend bis heute etwas geändert habe, sagt<br />
Pfeiffer. Die Polizisten applaudieren, sie<br />
fühlen sich verstanden. Oft passiert ihnen<br />
das nicht.<br />
Man würde ja gern einmal mit den<br />
Autonomen über ihr Verhältnis zur Gewalt<br />
reden. Aber weil diese Gruppen mit<br />
der Presse grundsätzlich nicht sprechen,<br />
ist das eben schwierig. Auch der Anwalt<br />
der „Floristen“ beantwortet keine E-<br />
Mails. Stattdessen pflegt die Szene einen<br />
regen Austausch im Internet – und das<br />
Thema Militanz spielt dort eine große<br />
Rolle. Ein Manifest mit dem Titel „Bau<br />
19<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
BERLIN 21/12/2012 Der Oranienplatz in<br />
Kreuzberg dient seither als Flüchtlingscamp<br />
20<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
was!“, erschienen im Jahr 2010, offenbart<br />
eine recht unverstellte Haltung zur<br />
Gewalt: „Permanentes Angreifen ist eine<br />
wichtige Sache, um unsere Gegner_innen<br />
klar zu benennen, zu treffen, und auch<br />
zu zeigen, dass es Möglichkeiten der Verwundbarkeit<br />
gibt. Es geht auch darum,<br />
Wut freizusetzen.“ Der „Militanzanstieg“<br />
wird zwar als „Grund zur Freude“ gefeiert,<br />
aber was Gewalt gegen Personen<br />
angeht, herrscht eine gewisse Zurückhaltung.<br />
Doch nach den Hamburger Ausschreitungen<br />
vom Dezember wird auch<br />
da der Ton rauer: „Irgendwann werden<br />
wir schießen müssen“, schrieb ein Diskutant<br />
in seinem Beitrag für das linksextreme<br />
„Indymedia“-Portal.<br />
Simone Buchholz lebt seit vielen Jahren<br />
in St. Pauli. Die Krimiautorin ist Mutter<br />
eines fünfjährigen Sohnes und steht<br />
politisch eher links. Gegen die „Rote<br />
Flora“ in ihrer Nachbarschaft hatte sie<br />
nie etwas einzuwenden, im Gegenteil.<br />
Dann kam der 21. Dezember, als „die Autonomen<br />
unser Viertel zu Klump gehauen<br />
haben“. Bevor es mit den Krawallen losging,<br />
war sie noch im Kindertheater. Auf<br />
einmal tauchten die ersten Demonstranten<br />
in ihrer Straße <strong>auf</strong>, „martialisch und<br />
böse“. Es folgte die Polizei, nach dem<br />
Eindruck von Simone Buchholz nicht<br />
minder martialisch. Wenig später spielten<br />
sich vor ihrer Haustür bürgerkriegsähnliche<br />
Szenen ab – „erklären Sie das<br />
mal einem kleinen Kind!“ Anfang Januar<br />
hat sie zwei junge Autonome angesprochen,<br />
die gerade an ihre Hauswand<br />
pinkelten. „Warum tut ihr uns das an?“,<br />
wollte sie von ihnen wissen. Deren Antwort:<br />
„Damit deine Kinder später frei<br />
sein können.“<br />
BERLIN<br />
Die Gegend rund um den Oranienplatz<br />
in Berlin-Kreuzberg ist eher bürgerlich<br />
geprägt: Gründerzeithäuser, Cafés, Restaurants,<br />
hippe Läden, demnächst soll<br />
dort ein neues Hotel entstehen – alle Zutaten<br />
zur Gentrifizierung sind vorhanden.<br />
Nur der Platz selbst fällt aus dem<br />
Rahmen. Seit anderthalb Jahren wird er<br />
von Lampedusa-Flüchtlingen besetzt gehalten,<br />
die dort in zwei Dutzend Zelten,<br />
Holzbuden oder Bretterverschlägen ausharren<br />
und gegen ihre Abschiebung protestieren.<br />
Es ist kein Geheimnis, dass sie<br />
dabei von der linksautonomen Kreuzberger<br />
Szene unterstützt werden. Und genau<br />
damit wird die Sache zu einem Politikum,<br />
das mit der Flüchtlingsproblematik<br />
KÖLN 31/03/2011 Jugendliche protestieren im Stadtteil Kalk gegen die geplante<br />
Räumung eines besetzten Hauses, das sie als „Autonomes Kulturzentrum“ nutzen<br />
nur noch wenig zu tun hat. Dafür umso<br />
mehr mit der Frage, wer in dem Kiez das<br />
Sagen hat.<br />
In der Bezirksverordnetenversammlung<br />
von Friedrichshain-Kreuzberg sind<br />
die Grünen mit Abstand stärkste Partei,<br />
mit Monika Herrmann stellen sie auch<br />
die Bezirksbürgermeisterin. Die 49-Jährige<br />
ist erst seit kurzem im Amt, aber<br />
die Kreuzberger Verhältnisse kennt<br />
sie genau: eine über Jahre gewachsene<br />
Melange aus Migranten, linksliberaler<br />
Boheme, zugezogenen Besserverdienern,<br />
den Resten kleinbürgerlicher Milieus<br />
– und linksradikalen Gruppierungen,<br />
die jedes Jahr zur Demo am 1. Mai<br />
Flagge zeigen, Krawalle inklusive. Die<br />
Autonomen gehören hier gewissermaßen<br />
zum Lokalkolorit, und Kreuzbergs<br />
Grüne – innerhalb der Partei ohnehin<br />
am linken Rand stehend – betreiben dieser<br />
Szene gegenüber eine konsequente<br />
Appeasement-Politik.<br />
Von der Bezirksregierung wird die<br />
Besetzung des Oranienplatzes geduldet,<br />
Anwohnerbeschwerden und desolaten<br />
hygienischen Zuständen zum Trotz.<br />
Als im November ein Ausweichquartier<br />
für die campierenden Flüchtlinge gefunden<br />
wurde, war der Platz über Nacht<br />
von neuen Flüchtlingen belagert; in der<br />
Stadtverwaltung bestehen wenig Zweifel<br />
daran, dass dieser Nachzug maßgeblich<br />
von Autonomen organisiert wurde,<br />
um die Freifläche an der Oranienstraße<br />
als symbolischen Ort zu etablieren. Monika<br />
Herrmann nahm auch dies wohlwollend<br />
hin.<br />
Die Besetzung einer nahe gelegenen<br />
ehemaligen Schule wird von der Bezirksbürgermeisterin<br />
ebenfalls geduldet. Das<br />
leer stehende Gebäude war ursprünglich<br />
für Sozial- und Kulturprojekte vorgesehen,<br />
seit Herbst 2012 leben dort außer<br />
Flüchtlingen zunehmend auch Roma-Familien<br />
und Obdachlose. Die Kriminalität<br />
rund um die Schule hat zugenommen,<br />
Messerstechereien und Drogenhandel<br />
sind aktenkundig; die Polizei musste<br />
wegen mehrerer Fälle von Vergewaltigung<br />
ermitteln.<br />
Inzwischen finanziert der Bezirk einen<br />
privaten Sicherheitsdienst, die Kosten<br />
wegen der Besetzung gehen in die<br />
Hunderttausende. Unlängst wurde sogar<br />
ein Baugerüst errichtet, um Sozialarbeiter<br />
vor aus den Fenstern geworfenen<br />
Fotos: Laurin Schmid/Picture Alliance/dpa (Seiten 20 bis 21), Oliver Berg/Picture Alliance/dpa<br />
22<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Gegenständen zu schützen. Aus Sicht der<br />
Polizei bedeutet die besetzte Schule eine<br />
„erhöhte Gefährdungslage“, Einsätze<br />
könnten nur mit großen Mannschaften<br />
erfolgen. Sobald Beamte dort <strong>auf</strong>tauchten,<br />
sei wenige Minuten später ein Aufgebot<br />
von linksautonomen Unterstützern<br />
am Ort. Die Drohkulisse zeigt Wirkung.<br />
An einem Dienstagnachmittag im Februar<br />
sammelt ein Mittdreißiger im Hof<br />
der besetzten Schule den Müll zusammen.<br />
Für den nächsten Tag seien Hygienekontrollen<br />
angekündigt, und man<br />
wolle keinen Vorwand zur Räumung liefern,<br />
sagt er. Der Mann trägt schwarze<br />
Kleidung und eine Hipster-Brille, er bezeichnet<br />
sich selbst als „Unterstützer“.<br />
Ob es stimme, dass Nachbarn sich wegen<br />
des Lärms und des Drecks beschwert<br />
hätten? „Schon möglich.“ Ob die Autonomen<br />
etwas mit der besetzten Schule<br />
zu tun hätten? „Es gibt keine Autonomen.“<br />
Wie bitte? „Weil man in Deutschland<br />
nicht autonom leben kann, gibt es<br />
auch keine Autonomen.“ Und was ist mit<br />
den „schwarzen Blocks“ bei Demonstrationen?<br />
„Das sind militante Linke.“<br />
Feste Strukturen, so viel macht<br />
schon diese Begegnung deutlich, sind im<br />
linksradikalen Lager verpönt. Laut Verfassungsschutz<br />
zeichnen sich die Autonomen<br />
durch Gewaltbereitschaft sowie eine<br />
„Organisations- und Hierarchiefeindlichkeit“<br />
aus. Aber wenn es dr<strong>auf</strong> ankommt,<br />
ist mit ihrer Organisationskraft allemal<br />
zu rechnen. Das wissen auch die Kreuzberger<br />
Grünen.<br />
„Je länger wir<br />
warten, desto<br />
mehr glauben<br />
die Autonomen,<br />
es sei ihr Platz,<br />
den sie verteidigen<br />
müssen“<br />
Kurt Wansner, Jahrgang 1947, verkörpert<br />
das Gegenmodell zur linken<br />
Laisser-faire-Bourgeoisie. Der kleine,<br />
drahtige Mann ist gelernter Maurer und<br />
Kreisvorsitzender der CDU in Friedrichshain-Kreuzberg.<br />
Die Bezirksbürgermeisterin<br />
ist seine erklärte Gegnerin, vor einigen<br />
Wochen hat er Anzeige gegen sie<br />
erstattet. Monika Herrmann habe sich<br />
der Untreue strafbar gemacht, glaubt<br />
Wansner, weil sie den Besetzern die im<br />
öffentlichen Eigentum befindliche Schule<br />
kostenlos zur Verfügung gestellt habe.<br />
„Für die Linksextremen ist unser Bezirk<br />
ein rechtsfreier Raum, in dem sie meinen,<br />
machen zu können, was sie wollen.“<br />
Auch der Oranienplatz hätte sofort<br />
geräumt werden müssen: „Jetzt ist er<br />
für die Autonomen zum Prestigeobjekt<br />
geworden. Und je länger wir warten,<br />
desto mehr glauben sie, es sei ihr Platz,<br />
den sie verteidigen müssen.“ Wansner behauptet,<br />
es gebe „massenhaft Beschwerden“<br />
von Anwohnern und umliegenden<br />
Ladenbesitzern. „Aber es traut sich keiner,<br />
das auch öffentlich zu sagen, weil sie<br />
Angriffe durch die Autonomen fürchten.“<br />
Sein eigenes Haus wurde vor einem Dreivierteljahr<br />
mit Farbbeuteln beworfen, in<br />
einem Bekennerschreiben hieß es, das<br />
Gebäude sei „markiert“ worden. „Wie<br />
im Dritten Reich“, sagt Wansner.<br />
Die linksradikale Szene aus Kreuzberg-Friedrichshain<br />
scheint ziemlich entschlossen,<br />
bei einer Räumung des Platzes<br />
oder der Schule den Kriegszustand<br />
auszurufen. „Räumung des Camps am<br />
Oranienplatz zum Desaster machen“,<br />
lautet ein Aufruf <strong>auf</strong> „Indymedia“, der<br />
einschlägigen Kommunikationsplattform<br />
im Internet.<br />
„Es würde im Fall einer Räumung mit<br />
Sicherheit zu Gegenreaktionen kommen.<br />
Aber die Polizei hat in ähnlichen Situationen<br />
bewiesen, dass sie damit umgehen<br />
kann. Hamburger Verhältnisse befürchte<br />
ich nicht“, beschwichtigt der Berliner Innensenator<br />
Frank Henkel von der CDU.<br />
Allerdings hat die Berliner Polizei die zunehmende<br />
Gewaltbereitschaft der linksradikalen<br />
Szene in der Vergangenheit<br />
schon deutlich zu spüren bekommen:<br />
Im April wurde eine Polizeistation in<br />
Friedrichshain mit Brandsätzen beworfen;<br />
Anfang 2012 wurden Beamte bei<br />
einem Einsatz in einem besetzten Haus<br />
Anzeige<br />
ERDGAS – Lösungen für die Zukunft<br />
Der wirtschaftliche Weg<br />
zur Sanierung beginnt<br />
im Heizungskeller.<br />
Günstig die Heizung modernisieren: mit ERDGAS.<br />
Die Energiewende hat begonnen. Die Klimaschutzziele sind ehrgeizig. ERDGAS kann dazu beitragen, diese<br />
Ziele zu erreichen – auch ohne die Kosten aus den Augen zu verlieren. Denn moderne Erdgas-Technologien<br />
ermöglichen dank ihrer Effizienz hohe CO 2<br />
-Einsparungen ohne großen Investitions<strong>auf</strong>wand. Das hilft bezahlbare<br />
Mieten bei der energetischen Sanierung zu sichern. Dazu bietet ERDGAS als Partner der erneuerbaren<br />
Energien eine hohe Zukunftssicherheit. Mit anderen Worten: Klimaschutz und Sozialverträglichkeit<br />
müssen sich nicht ausschließen – mit ERDGAS.<br />
Mehr Informationen finden Sie unter:<br />
www.zukunft-erdgas.info
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
HAMBURG 21/12/2013 Die Krawalle in der Hansestadt<br />
sind die schwersten seit 25 Jahren<br />
24<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
„VOM KNÖCHEL BIS ZUM GESÄSS<br />
WAR ALLES VERBRANNT“<br />
Wie ist es für einen Polizisten, ein Opfer des Krawalls zu werden?<br />
Hauptkommissar Olaf H., 51, aus Berlin hat es erlebt<br />
Die Sache mit der Kugelbombe, das war im<br />
Juni 2010, in Berlin, bei einer Großdemo<br />
gegen das Sparpaket der Regierung. Die<br />
Demo wurde von der Linken, Gewerkschaften<br />
und vielen anderen Gruppen organisiert, die<br />
meisten davon friedlich. Es waren zwar auch<br />
einige Hundert Leute aus dem sogenannten<br />
schwarzen, linksautonomen Block dabei,<br />
aber eigentlich wissen wir, wie die sich<br />
verhalten, und können uns dar<strong>auf</strong> einstellen.<br />
Ich war damals schon 30 Jahre bei der<br />
Bereitschaftspolizei, in den Achtzigern<br />
wurde mir bei einer Hausbesetzerdemo der<br />
Arm ausgekugelt, und seit 1987 war ich bei<br />
jedem 1. Mai dabei. Da kriegt man immer ein<br />
paar Schnittverletzungen oder Quetschwunden<br />
durch Steine oder Schläge ab. Das<br />
gehört dazu, man kann ja nicht immer wie<br />
ein Ritter rumrennen. Der aggressive<br />
schwarze Block damals in Berlin hat mich<br />
also nicht besonders nervös gemacht.<br />
An der Ecke Torstraße wurde es dann<br />
schlimmer, als wir an einem Balkon mit<br />
Deutschlandflagge vorbeikamen. Da flogen<br />
die ersten Böller, und der Einsatzleiter<br />
hat uns an den Aufzug geschickt, um die<br />
Autonomen Schulter an Schulter zu<br />
begleiten. Ein Lautsprecherwagen hat die<br />
Stimmung angeheizt, und plötzlich sah ich,<br />
wie weiter vorne mit Fahnenstangen und<br />
Holzlatten <strong>auf</strong> Kollegen eingeprügelt wurde,<br />
obwohl wir alle noch keine Helme<br />
<strong>auf</strong>hatten.<br />
Also habe ich mich mit meiner Gruppe<br />
an den Straßenrand zurückgezogen, um<br />
Helme <strong>auf</strong>zusetzen. Plötzlich sehe ich aus<br />
dem Augenwinkel, wie irgendetwas<br />
Qualmendes geflogen kommt. Das prallte<br />
erst von der Schulter einer Kollegin ab und<br />
fiel mir dann zwischen die Beine. Ich dachte<br />
noch: Schon wieder so eine Rauchbombe –<br />
und hab einfach nur die Luft angehalten.<br />
Dann gab es einen Schlag, und ich lag zehn<br />
Meter weiter hinten <strong>auf</strong> dem Asphalt.<br />
<strong>Kein</strong>e Ahnung, wie ich da hingekommen bin,<br />
es hatte mich einfach weggeschleudert.<br />
Ich hab mich wieder <strong>auf</strong>gerappelt und bin<br />
davongehumpelt. Die Beine taten etwas<br />
weh, aber vor lauter Adrenalin hab ich das<br />
kaum gespürt. Erst als ich meine Gruppe<br />
wieder gesammelt habe, merkte ich: Das<br />
brennt ganz schön an den Beinen. Dann sah<br />
ich, dass meine Hose zerfetzt und<br />
blutverschmiert war, obwohl unsere Anzüge<br />
extrem stabil und schnittfest sind.<br />
Ich bin trotzdem erst mal weitergel<strong>auf</strong>en<br />
und hab mich später entschuldigt, um mir<br />
kurz ein Pflaster zu holen. Als ich schließlich<br />
meine Hose <strong>auf</strong>gemacht habe, wurde mir<br />
übel: Die Wade war sieben Zentimeter weit<br />
<strong>auf</strong>gerissen und ungefähr genauso tief im<br />
Fleisch steckten Splitter. Vom Knöchel bis<br />
zum Gesäß war alles verbrannt und<br />
zer schnitten. Ich kam ins Krankenhaus und<br />
bin <strong>auf</strong> der Stelle operiert worden.<br />
Später erfuhr ich: Unter mir war eine<br />
sogenannte Kugelbombe hochgegangen,<br />
ein Feuerwerkskörper der höchsten<br />
Gefahrenstufe. Dem Auto hinter mir hat<br />
es Kotflügel und Motorhaube beschädigt,<br />
dahinter stand eine Frau mit Kind, nicht<br />
auszudenken, was hätte passieren können.<br />
Eine Kugelbombe <strong>auf</strong> Gesichtshöhe wäre<br />
tödlich gewesen.<br />
Nach vier Tagen im Krankenhaus wurde<br />
ich entlassen, zum Glück nur mit Narben<br />
und einem Knalltrauma <strong>auf</strong> dem rechten<br />
Ohr. Mein Sohn war damals fünf Jahre alt.<br />
Als ich nach zwei Monaten zum ersten<br />
Mal wieder arbeiten gegangen bin, hat er<br />
gefragt: „Tun die bösen Männer Papa heute<br />
wieder weh?“ Wegen dieser Geschichte<br />
hat mein Direktionsleiter mich sofort aus<br />
dem Schichtdienst herausgenommen und<br />
mir eine Stelle im Innendienst angeboten.<br />
Ich habe sie angenommen.<br />
Aufgezeichnet von CONSTANTIN MAGNIS<br />
Foto: Schaube/face to face (Seiten 24 bis 25), Gerrit Hahn<br />
26<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Foto: Andrej Dallmann (Autor)<br />
mit Eisenstangen traktiert; Mitte 2012<br />
kam es mitten in Kreuzberg zu einem<br />
Angriff <strong>auf</strong> einen Streifenwagen, bei dem<br />
ein brennendes bengalisches Feuer <strong>auf</strong><br />
dem Rücksitz landete. Im Juni vergangenen<br />
Jahres wurde ebenfalls in Kreuzberg<br />
ein Einsatzwagen mit einem Molotowcocktail<br />
attackiert, der eine Polizistin<br />
nur knapp verfehlte.<br />
„Es wundert mich, dass bei dieser Art<br />
von Taten noch niemand zu Tode gekommen<br />
ist“, sagt ein Mitarbeiter des Berliner<br />
Verfassungsschutzes. Die wachsennde<br />
Brutalität habe auch damit zu tun,<br />
dass es Linksautonomen immer schwerer<br />
falle, junge Leute mit einem gewissen<br />
Bildungsniveau zu rekrutieren: „Da<br />
mischen zunehmend gewöhnliche Hooligans<br />
mit.“<br />
„Wir können doch nicht zu einem Zustand<br />
kommen, wo Menschen, die besonders<br />
rabiat <strong>auf</strong>treten, gegenüber anderen<br />
bevorzugt werden“, empört sich auch der<br />
Berliner Innensenator mit Blick <strong>auf</strong> die<br />
Duldungsstarre der Kreuzberger Bezirksregierung.<br />
Allerdings hat Henkel bisher<br />
wenig daran ändern können. Um dort gegen<br />
die örtlichen Grünen durchzugreifen,<br />
bräuchte er zumindest die Einwilligung<br />
seiner sozialdemokratischen Koalitionspartner.<br />
Und die Wowereit-SPD ist derzeit<br />
mit allerlei Skandalen schon beschäftigt<br />
genug – Straßenschlachten sind so<br />
ziemlich das Letzte, was der Regierende<br />
Bürgermeister jetzt gebrauchen kann.<br />
Um Zeit zu gewinnen, wurde deshalb<br />
die Integrationssenatorin Dilek<br />
Kolat be<strong>auf</strong>tragt, wegen des Camps am<br />
Oranienplatz und der besetzten Schule<br />
zwischen den Beteiligten zu vermitteln.<br />
Viel ist bis jetzt noch nicht dabei herausgekommen.<br />
Kurt Wansner, der Kreuzberger<br />
CDU-Chef, ist ohnehin davon<br />
überzeugt, dass die Autonomen kein Interesse<br />
an einer Verhandlungslösung haben:<br />
„Ich fürchte, das läuft am Ende <strong>auf</strong><br />
einen gewaltsamen Konflikt hinaus.“<br />
KÖLN<br />
Auch in Köln lief es im Sommer des vergangenen<br />
Jahres <strong>auf</strong> einen gewaltsamen<br />
Konflikt hinaus. Mitte April 2010 hatten<br />
vornehmlich Jugendliche aus dem autonomen<br />
Spektrum die ehemalige Betriebskantine<br />
des Maschinenherstellers Klöckner-Humboldt-Deutz<br />
im Stadtteil Kalk<br />
besetzt und in ein Kulturzentrum verwandelt.<br />
Ein mit der örtlichen Sparkasse<br />
abgeschlossener Nutzungsvertrag wurde<br />
jedoch im Juni 2013 gekündigt, weil die<br />
Stadt das Gelände als Ausweichquartier<br />
wegen einer Schulsanierung benötigt.<br />
Die drohende Räumung des Zentrums<br />
brachte dessen Nutzer <strong>auf</strong> die Barrikaden.<br />
Mit allen Mitteln würde man<br />
das Gebäude verteidigen, lautete eine<br />
im Internet verbreitete Drohung. Dann<br />
wurde es ernst: Autonome beschädigten<br />
die Büros von Kölner SPD-Politikern, beschmierten<br />
deren Privathäuser und drohten<br />
unverhohlen mit Gewalt. Kölns Oberbürgermeister<br />
Jürgen Roters, SPD, sah<br />
sich gezwungen, Polizeischutz zu beantragen.<br />
In der Sache aber blieb seine Partei<br />
hart – gegen den Willen der Koalitionspartner<br />
von den Grünen.<br />
Auch Martin Börschel, SPD-Fraktionschef<br />
im Kölner Stadtrat, war vom autonomen<br />
Lager als Ziel militanter Aktionen<br />
auserkoren worden. In den Straßen<br />
rund um sein Haus hingen eines Morgens<br />
„Fahndungsplakate“, die den 41 Jahre alten<br />
Politiker als gesuchten Verbrecher<br />
stigmatisieren sollten. Im Internet gab es<br />
ebenfalls unmissverständliche Hinweise:<br />
Sei vorsichtig, wir wissen, wo du wohnst!<br />
Ihn selbst habe das nicht einmal sonderlich<br />
berührt, erzählt Börschel. „Eigentlich<br />
ist mir erst durch Reaktionen anderer<br />
bewusst geworden, dass hier ein Tabu<br />
gebrochen wurde.“<br />
Als die Autonomen dann auch noch<br />
in einem Brief öffentlich verkündeten, sie<br />
würden ihre Aktionen gegen die SPD erst<br />
einstellen, wenn die Stadt <strong>auf</strong> eine Räumung<br />
des Kulturzentrums verzichte, war<br />
das Maß endgültig voll. Börschel: „Ich<br />
habe diesen Brief nicht beantwortet. Sondern<br />
stattdessen in einer öffentlichen<br />
Ratssitzung deutlich gemacht: Wenn<br />
dieser Erpressungsversuch nicht bedingungslos<br />
zurückgenommen wird, wird<br />
die Räumung stattfinden. Das Gewaltmonopol<br />
liegt einzig und allein beim Staat.“<br />
Leicht dürfte es den Kölner Autonomen<br />
nicht gefallen sein, dieses Ultimatum<br />
zu schlucken. Nach vielen internen<br />
Diskussionen haben sie dann aber doch<br />
öffentlich erklärt, <strong>auf</strong> Gewalt zu verzichten<br />
– und so den Weg für eine Verhandlungslösung<br />
mit der Stadt frei gemacht.<br />
Mit einem leer stehenden, ehemaligen<br />
Verwaltungsgebäude ist inzwischen sogar<br />
ein Ausweichquartier gefunden worden:<br />
Bis Ende 2014 darf das autonome Kulturzentrum<br />
dort in relativ zentraler Lage am<br />
Eifelwall Quartier beziehen. Danach will<br />
die Stadt für vier weitere Jahre eine andere<br />
Liegenschaft zur Verfügung stellen.<br />
Aber auch das nur vorübergehend, damit<br />
sich in Köln erst gar kein rechtsfreier<br />
Raum <strong>auf</strong> Dauer etablieren kann. Berlin<br />
und Hamburg lassen grüßen.<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur<br />
von <strong>Cicero</strong>. Er ist<br />
in Berlin auch schon bei der<br />
1.-Mai-Demo mitgel<strong>auf</strong>en<br />
Anzeige<br />
Terrorzelle Salafismus –<br />
Klischee oder Wirklichkeit?<br />
Ulrich Kraetzer bringt die Gefahren des Salafismus <strong>auf</strong> den Punkt,<br />
erklärt die Wurzeln, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede<br />
salafistischer Strömungen in Deutschland und gibt Empfehlungen<br />
zum Umgang mit radikalen Salafisten. Das Zerrbild von bösen<br />
bärtigen Männern bedient er nicht – sein Buch nähert sich<br />
einem komplexen Thema mit unverstelltem Blick.<br />
Ulrich Kraetzer<br />
SALAFISTEN<br />
Bedrohung für Deutschland?<br />
288 S. / geb. mit Schutzumschlag<br />
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A) / CHF* 28,50<br />
ISBN 978-3-579-07064-3<br />
www.gtvh.de<br />
GÜTERSLOHER<br />
VERLAGSHAUS<br />
*empf. Verk<strong>auf</strong>spreis
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
„ AGGRESSIV OHNE ANLASS “<br />
Oliver Malchow, Chef der Gewerkschaft der Polizei, über steigende<br />
Gewalt gegen seine Kollegen und No-go-Areas in Deutschland<br />
Herr Malchow, bei den Hamburger Krawallen<br />
im Dezember wegen der Roten<br />
Flora wurden 120 Polizisten verletzt.<br />
Wie konnte es überhaupt so weit<br />
kommen?<br />
Oliver Malchow: Da hatte sich ja in<br />
Hamburg die Antifa-Szene aus ganz Europa<br />
versammelt. Denen ging es nicht<br />
um eine Demonstration, sondern ganz<br />
gezielt um Ausschreitungen, mit denen<br />
sie beweisen wollten, dass sie noch in<br />
der Lage sind, den öffentlichen Raum<br />
zu beherrschen.<br />
Hätte diese Situation nicht trotzdem<br />
deeskaliert werden können?<br />
Das wäre nur gegangen, wenn man<br />
vorher Kontakt zu diesen Gruppen hätte<br />
<strong>auf</strong>bauen können. Bei Demonstrationen<br />
gibt es ja die Verpflichtung der Polizei,<br />
im Vorfeld sogenannte Kooperationsgespräche<br />
mit allen Beteiligten zu führen.<br />
Aber die Szene hatte überhaupt kein Interesse<br />
an solchen Gesprächen.<br />
Das heißt, der Ausbruch von Gewalt war<br />
unvermeidbar?<br />
Das hängt davon ab, ob es in Hamburg<br />
politisch vermeidbar gewesen wäre,<br />
dass zur gleichen Zeit der Konflikt um<br />
drei Brennpunkte entflammt. Es ging<br />
ja nicht nur um die Rote Flora, sondern<br />
auch um die Räumung der b<strong>auf</strong>älligen<br />
Esso-Häuser und um Flüchtlinge. Für<br />
die linke Szene sind das alles wichtige<br />
Themen.<br />
Wenn zum Beispiel ein Haus geräumt<br />
werden soll, das schon seit vielen Jahren<br />
besetzt ist, glauben die Besetzer natürlich,<br />
im <strong>Recht</strong> zu sein. Das verschärft<br />
am Ende den Konflikt und steigert die<br />
Gewaltbereitschaft.<br />
Mehrere Erhebungen kommen zu dem<br />
Ergebnis, dass die Gewaltbereitschaft<br />
gegenüber Polizisten in den vergangenen<br />
Jahren gestiegen ist. Wie macht<br />
sich das bemerkbar?<br />
Daran, dass praktisch alle Polizistinnen<br />
und Polizisten im Dienst schon Opfer<br />
von Gewalt geworden sind. Einschüchterungsversuche<br />
und Anpöbelungen gehören<br />
ohnehin zum polizeilichen Alltag.<br />
Kollegen, die schon länger im Dienst sind,<br />
stellen fest, dass ihnen immer öfter und<br />
ohne konkreten Anlass mit Aggressivität<br />
begegnet wird. Polizisten werden auch<br />
deutlich häufiger als früher getreten, geschlagen<br />
und mit Waffen bedroht.<br />
Gibt es Milieus, die besonders aggressiv<br />
<strong>auf</strong> Polizeibeamte reagieren?<br />
Das sind naturgemäß politische Extremisten<br />
von links oder von rechts. In<br />
Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil<br />
kann es auch vorkommen, dass plötzlich<br />
die Straße voll von aggressiven Menschen<br />
ist, nur weil Beamte etwa eine Personenkontrolle<br />
bei zwei Jugendlichen durchführen<br />
müssen. Unabhängig von ihrer<br />
Herkunft gilt zudem, dass Jugendliche<br />
zunehmend aggressiv <strong>auf</strong>treten.<br />
Existieren in Deutschland No-go-Areas<br />
für Polizisten?<br />
Es gibt zumindest Wohnbereiche, in<br />
denen die Polizei nur noch in Gruppenstärke<br />
fährt, weil es für einen Streifenwagen<br />
allein zu gefährlich wäre. Da haben<br />
sich Strukturen entwickelt, wo zumindest<br />
ein Teil der Bewohner das staatliche<br />
Gewaltmonopol nicht akzeptiert.<br />
Beispiel?<br />
Das gilt natürlich für viele der hinreichend<br />
bekannten Problemgebiete in<br />
den Großstädten. Aber auch für manche<br />
ländlichen Gegenden etwa Mecklenburg-<br />
Vorpommerns, wo <strong>Recht</strong>sextremisten in<br />
die Lücken stoßen, die staatliche oder gesellschaftliche<br />
Institutionen hinterlassen<br />
haben.<br />
Wenn Polizisten in manchen Stadtvierteln<br />
nur noch in Gruppenstärke <strong>auf</strong>treten<br />
können, heißt das doch auch, dass<br />
diese Beamte an anderer Stelle fehlen.<br />
Natürlich. Diese Leute fehlen dann<br />
in der allgemeinen Verbrechensbekämpfung<br />
oder in der Ermittlungsarbeit beispielsweise<br />
nach Wohnungseinbrüchen.<br />
Foto: Reiner Zensen/Caro Fotoagentur<br />
Die Polizisten waren demnach Leidtragende<br />
einer Politik, die das Konfliktpotenzial<br />
nicht erkannt hat?<br />
Das ist ja häufig der Fall. Aber es<br />
ist nun einmal Aufgabe der Polizei, für<br />
<strong>Recht</strong> und Ordnung zu sorgen, wenn<br />
man <strong>auf</strong> politischem Weg nicht weiterkommt.<br />
Allerdings wird für meine Kolleginnen<br />
und Kollegen eine rechtswidrige<br />
Situation umso problematischer, je länger<br />
sie von der Politik geduldet wurde.<br />
Zur Person<br />
Oliver Malchow, 50, trat mit<br />
20 Jahren in den Polizeidienst ein.<br />
Seit Mai 2013 ist er Vorsitzender<br />
der Gewerkschaft der Polizei<br />
Wie viele Ihrer Kollegen werden eigentlich<br />
durch die Absicherung von Sportereignissen<br />
gebunden?<br />
Eine sehr große Zahl. Statistisch<br />
ist es so, dass ein Drittel aller Bereitschaftspolizisten<br />
in Deutschland allein<br />
für Fußballeinsätze benötigt wird. Das<br />
entspricht nahezu 1,3 Millionen Arbeitsstunden<br />
im Jahr.<br />
Das Gespräch führte<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
28<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Endlich mehr Zeit<br />
für das Wesentliche<br />
<strong>Cicero</strong><br />
Abo<br />
Ich abonniere <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis.<br />
Bitte senden Sie mir <strong>Cicero</strong> monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit nur 7,75 Euro/5,– Euro<br />
(für Studenten bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung) pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,50 Euro<br />
im Einzelverk<strong>auf</strong>). *Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können<br />
das Abonnement jederzeit kündigen. *Preis im Inland inkl. MwSt. und Versand, Abrechnung als<br />
Jahresrechnung über zwölf Ausgaben, Auslandspreise <strong>auf</strong> Anfrage. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der<br />
Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Michael Voss.<br />
Meine Adresse<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Name<br />
Straße<br />
Hausnummer<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Bei Bezahlung per Bankeinzug erhalten Sie eine weitere Ausgabe gratis.<br />
Kontonummer<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Ich bin Student.<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden<br />
einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit<br />
widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Vorzugspreis<br />
Ohne Risiko<br />
Mehr Inhalt<br />
Frei Haus<br />
Mit einem Abo<br />
sparen Sie gegenüber<br />
dem Einzelk<strong>auf</strong>.<br />
Sie gehen kein Risiko ein<br />
und können Ihr Abonnement<br />
jederzeit kündigen.<br />
Monatlich mit Literaturen<br />
und zweimal im Jahr als<br />
Extra-Beilage.<br />
Sie erhalten Ihre <strong>Cicero</strong>-<br />
Ausgabe druckfrisch frei<br />
Haus geliefert.<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong> abonnieren!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/lesen<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1140026<br />
Bestellnr.: 946132 (Student)
TITEL<br />
<strong>Kein</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Randale</strong><br />
PACK<br />
Die Schläger mit den schwarzen Kapuzen halten sich für links.<br />
Dabei ist ihr Krawall gar nicht politisch – und wirkt darum politisch<br />
Von FRANK A. MEYER<br />
Wofür halten sich die randalierenden<br />
Demonstranten von<br />
Hamburg oder Berlin oder<br />
Wien oder Zürich?<br />
Sie halten sich für Linke. Sie bestehen<br />
dar<strong>auf</strong>, dass sie Widerstand leisten:<br />
gegen die Zerstörung eines Kulturzentrums;<br />
gegen die Räumung eines Flüchtlingscamps;<br />
gegen die Wiener Ballnacht<br />
von <strong>Recht</strong>sradikalen; gegen die Macht<br />
der Zürcher Bahnhofstraße.<br />
Was kann ehrenwerter sein als solcher<br />
Widerstand, denken sich die Widerständler<br />
– und zählen dar<strong>auf</strong>, dass sie als<br />
ehrenwert anerkannt werden im linken<br />
Bürgertum, wor<strong>auf</strong> dieses bereitwillig<br />
hereinfällt, geht es doch stets irgendwie<br />
ums Große, Ganze, Gute.<br />
Eine militante Macht der Straße hat<br />
sich da etabliert, schwarz uniformiert:<br />
schwarze Kapuzen über schwarzen Jacken.<br />
Schwarze Helme, schwarze Gesichtstücher.<br />
Schwarze Vermummung!<br />
Rote Gesinnung?<br />
Der Aufzug soll Furcht erregen. Erst<br />
fliegen Fäuste, dann Steine, schließlich<br />
Brandsätze. Scheiben in Scherben, Fahrzeuge<br />
in Flammen – Fanal „des kommenden<br />
Aufstands“, wie der Titel eines<br />
schwarzen Buches lautet, verfasst von einem<br />
„unsichtbaren Komitee“, das 2007<br />
Dem schwarzen<br />
Block sind die<br />
Polizisten<br />
Hassobjekt: der<br />
Mensch als<br />
Objekt, <strong>auf</strong> das<br />
man einschlägt<br />
das baldige Ende der kapitalistischen<br />
Ordnung prophezeite.<br />
Die Avantgarde der Revolte marschiert<br />
mit Vorliebe und Stolz unter dem<br />
Namen „schwarzer Block“. In Wien orchestrierte<br />
eine international kampferfahrene<br />
Genossin den schwarzen Block,<br />
getarnt durch das Pseudonym „schwarze<br />
Katze“. Ihr sarkastisches Credo: „Welches<br />
autoritäre System wurde bisher<br />
weggekuschelt?“<br />
In Zürich befand der Polizeivorsteher<br />
Richard Wolff, in der Stadtregierung<br />
Vertreter der linksalternativen Szene, der<br />
schwarze Block sei „eine interessante<br />
Ergänzung“ des politischen Lebens. Er<br />
wurde im Februar wiedergewählt.<br />
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf<br />
Scholz, ein Sozialdemokrat, sieht’s genau<br />
umgekehrt: „Ich bin liberal, aber nicht<br />
doof“ – und befahl die Polizei in drei<br />
Stadtteile, die er als „Gefahrengebiete“<br />
systematisch kontrollieren ließ. Die Süddeutsche<br />
Zeitung ernannte den Sozialdemokraten<br />
zum „roten Sheriff“.<br />
Roter Sheriff gegen rote Randalierer.<br />
Das ist unschön.<br />
Wie rot sind eigentlich die Krawallanten,<br />
die von weither in die Städte strömen,<br />
wenn wieder mal die gerechte Sache ruft?<br />
Ihre Uniformfarbe ist Schwarz. Wie<br />
die Uniform von Mussolinis „ Camicie<br />
nere“. Oder die der „Milice française“<br />
des Nazi-Kollaborateurs Pétain im besetzten<br />
Frankreich.<br />
Ja, der Faschismus hat vorgemacht,<br />
wie das geht: Gewalt als Manifestation<br />
politischer Macht. Tief sitzen die Bilder<br />
im kollektiven Gedächtnis der europäischen<br />
Demokratien.<br />
Warum also Schwarz für die roten<br />
Schlägerkolonnen? Könnte es sein, dass<br />
da – les extrêmes se touchent – Verwandtschaft<br />
vorliegt?<br />
Kurt Schumacher, der erste SPD-<br />
Vorsitzende nach der Nazizeit, prägte<br />
den Begriff vom „roten Faschismus“;<br />
Jürgen Habermas, Meisterdenker der<br />
deutschen Demokratie, sprach von<br />
„Linksfaschismus“.<br />
Könnte es sein, dass den gewaltverliebten<br />
Kohorten nur die schwarz-weißroten<br />
Fahnen und die kahl geschorenen<br />
Schädel der Neonazis fehlen, damit wir<br />
sie erkennen?<br />
Wem’s dann immer noch nicht dämmert,<br />
der sollte den Blick <strong>auf</strong> die Opfer<br />
der Schlägertrupps richten, die Polizisten!<br />
Was sind Polizisten? „Bullen“ oder<br />
„Schweine“, wie es ihnen aus den marodierenden<br />
Reihen entgegenschallt?<br />
Polizisten sind Arbeitnehmer, häufig<br />
Gewerkschafter, nicht selten Sozialdemokraten,<br />
also Bürger mit linken Anliegen.<br />
Den schwarzen Rotten sind sie der Feind,<br />
das Hassobjekt – genau: Objekt.<br />
Der Mensch als Objekt – entmenschlicht,<br />
damit man umso gewissenloser<br />
<strong>auf</strong> ihn einschlagen kann. Was ist an einer<br />
solchen Haltung noch antifaschistisch<br />
– ein Label, mit dem man sich in<br />
diesen Kreisen ja ganz besonders gerne<br />
schmückt?<br />
<strong>Recht</strong>es Pack? Linkes Pack? Einerlei.<br />
Denn letztlich ist dieses Pack gar nicht<br />
politisch, obgleich es sich selbst politisch<br />
wähnt. Indem die Schlägertrupps den Unterschied<br />
zwischen links und rechts im<br />
Nebel der Gewalt verschwinden lassen,<br />
wirken sie destruktiv – weit über den materiellen<br />
Schaden hinaus.<br />
Und genau das ist die Gefahr: Immer<br />
wieder in der Geschichte verlieh der Gewaltrausch<br />
autoritären politischen Kräften<br />
Vorwand und Schubkraft – zur Zerstörung<br />
der Demokratie.<br />
FRANK A. MEYER<br />
ist Journalist und Gastgeber<br />
der politischen Sendung<br />
„Vis-à-vis“ in 3sat<br />
Foto: Privat<br />
30<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
„ Wir haben in einem<br />
riesigen Tempo Leute<br />
gesammelt. Darunter<br />
sind Leute, die<br />
nicht pragmatisch<br />
zusammenarbeiten,<br />
die einander nicht<br />
riechen können – und<br />
das leben sie aus “<br />
Alexander Gauland, stellvertretender Sprecher der Alternative<br />
für Deutschland, Report <strong>auf</strong> Seite 38<br />
31<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
EIN JURIST ÜBERZIEHT<br />
Nach den exzessiven Wulff-Ermittlungen sollte Jörg Fröhlich die Staatsanwaltschaft<br />
Hannover beruhigen. Doch dann kam der Fall Edathy <strong>auf</strong> den Tisch des Chefermittlers<br />
Von ANDREAS FÖRSTER<br />
Jörg Fröhlich ist nicht nur Staatsanwalt,<br />
sondern auch Marathonläufer.<br />
Redner benutzen diesen Umstand<br />
gern dafür, Elogen <strong>auf</strong> den 53 Jahre alten<br />
Juristen einen launigen Anstrich zu<br />
verleihen. So war es auch Ende Oktober<br />
vergangenen Jahres, als ihn die niedersächsische<br />
Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz<br />
in sein neues Amt als<br />
Leiter der Hannoveraner Staatsanwaltschaft<br />
einführte. Die Grünen-Politikerin<br />
hob Fröhlichs Verdienste als Richter<br />
und Staatsanwalt hervor, die ihn aus<br />
ihrer Sicht für die neue Aufgabe in der<br />
Landeshauptstadt prädestinieren. Dann<br />
kam der unvermeidliche Vergleich: „Sicher<br />
werden Sie als Marathonläufer ausreichend<br />
Ausdauervermögen mitbringen,<br />
um auch diesen neuen Weg vorbildlich zu<br />
beschreiten“, sagte die Ministerin.<br />
Wohl keiner der damals Anwesenden<br />
ahnte, dass schon eine Woche später<br />
jene dünne Akte <strong>auf</strong> Fröhlichs Schreibtisch<br />
landen sollte, die sich nun als Karrierestopper<br />
für den Aufsteiger entpuppen<br />
könnte. Es war ein Vermerk des Bundeskriminalamts<br />
über die Auswertung von<br />
insgesamt 31 Videos und Fotosets von<br />
unbekleideten Jungen, die der aus Niedersachsen<br />
stammende SPD-Bundestagsabgeordnete<br />
Sebastian Edathy Jahre zuvor<br />
bei einer kanadischen Firma bestellt<br />
hatte. Vier Monate später, am 6. Februar,<br />
eröffnete Fröhlich ein Ermittlungsverfahren<br />
gegen den bis dahin angesehenen<br />
Politiker und gab eine Woche später<br />
<strong>auf</strong> einer Pressekonferenz detailliert<br />
Auskunft über den Inhalt des Verfahrens<br />
mit dem Aktenzeichen 3714 Js 9585/14.<br />
Die Pressekonferenz hat Fröhlich<br />
nun selbst ein Aktenzeichen eingebracht.<br />
Edathys Berliner Anwalt Christian Noll<br />
reichte im Justizministerium eine Dienst<strong>auf</strong>sichtsbeschwerde<br />
seines Mandanten<br />
gegen den Chef der Staatsanwaltschaft<br />
ein. In dem elfseitigen Schreiben wird<br />
Fröhlich der Lüge und des <strong>Recht</strong>sbruchs<br />
geziehen. Das ist starker Tobak für einen<br />
bis dahin untadeligen Juristen.<br />
Der Vater von drei Kindern und passionierte<br />
Schlagzeuger hat in Münster<br />
Jura studiert. In den neunziger Jahren<br />
war er Richter am Amtsgericht Hannover,<br />
dann wurde er Staatsanwalt. Zwölf<br />
Jahre, bis 2012, war er bei der Generalstaatsanwaltschaft<br />
in Celle tätig, zuletzt<br />
als Sprecher und Vizechef der Behörde.<br />
In diesen Jahren wurde die Landespolitik<br />
<strong>auf</strong> den promovierten Juristen <strong>auf</strong>merksam.<br />
Zur Fußball-WM 2006 wählte<br />
ihn die Landesregierung als Koordinator<br />
in Sicherheitsfragen aus, er organisierte<br />
eine norddeutsche Sicherheitskonferenz<br />
und später die niedersächsischen Staatsanwaltstage.<br />
Nach einem Gastspiel an der<br />
Spitze der Staatsanwaltschaft in Verden<br />
übernahm er vor knapp fünf Monaten<br />
die Ermittlungsbehörde in Hannover, es<br />
ist die größte Niedersachsens.<br />
FRÖHLICH ERSCHIEN ALS der Richtige,<br />
um die Staatsanwaltschaft der Landeshauptstadt<br />
in ruhiges Fahrwasser zu lenken<br />
und ihr ein besseres Image zu verpassen.<br />
Die Behörde hatte sich zuvor viel<br />
Kritik wegen ihrer exzessiven Ermittlungen<br />
gegen den früheren Bundespräsidenten<br />
Christian Wulff eingehandelt. Dessen<br />
Anwälte hatten den Hannoveraner<br />
Staatsanwälten nicht ganz grundlos „Verfolgungswahn“<br />
vorgeworfen. Das mächtige<br />
graue Gebäude im Bahnhofsviertel<br />
wurde von den Medien als „Jagdbehörde“<br />
verspottet.<br />
Fröhlich sollte all das vergessen machen<br />
und sein Haus, wäre der Wulff-<br />
Prozess erst einmal vorbei, endlich aus<br />
den Negativ-Schlagzeilen holen. Dieses<br />
Ziel scheint ferner denn je, nachdem sich<br />
Fröhlich selbst in die Politaffäre Edathy<br />
hineinmanövriert hat. Zu allem Überfluss<br />
hat er nun auch noch die Dienst<strong>auf</strong>sichtsbeschwerde<br />
am Hals, die er nicht so<br />
einfach loswerden wird. Denn nicht nur<br />
Fachleute fragten sich nach dem Presse<strong>auf</strong>tritt,<br />
was den Mann bewog, sich als<br />
Ermittler in einem l<strong>auf</strong>enden Verfahren<br />
so weit aus dem Fenster zu lehnen.<br />
Selbstüberschätzung? Eitelkeit? Naivität?<br />
Es hätte gereicht, Ermittlungen gegen<br />
Edathy und die Durchsuchung von<br />
dessen Wohn- und Arbeitsräumen zu<br />
bestätigen. Fröhlich hätte sagen müssen,<br />
dass man bislang keine Belege für ein<br />
strafbares Verhalten des Beschuldigten<br />
habe und es die Unschuldsvermutung daher<br />
gebiete, den Persönlichkeitsrechten<br />
Edathys Vorrang vor dem Informationsinteresse<br />
der Öffentlichkeit einzuräumen.<br />
Nach fünf Minuten wäre die Pressekonferenz<br />
vorbei gewesen. Aber Fröhlich<br />
blieb eine Stunde länger und kostete den<br />
Auftritt vor den Kameras sichtlich aus.<br />
Er überzog. Er beschrieb, wo Edathy<br />
Fotos bestellt und wie er sie erhalten<br />
hatte, er unterstellte ihm konspiratives<br />
Verhalten und legte nahe, der Abgeordnete<br />
habe Computer und Festplatten beiseitegeschafft.<br />
Über solche Details muss<br />
ein Staatsanwalt in einer so frühen Phase<br />
der Ermittlungen, die noch nicht mal ein<br />
strafbares Verhalten des Beschuldigten<br />
zutage gefördert haben, schweigen.<br />
Fröhlichs Beteuerungen, dass seine<br />
Behörde sich der „hohen Verantwortung<br />
für den Schutz der Persönlichkeitsrechte<br />
von Herrn Edathy“ bewusst sei, klingen<br />
da wie Hohn. Der Marathonläufer Jörg<br />
Fröhlich wird mehr als Ausdauer benötigen,<br />
um diese Affäre zu überstehen.<br />
ANDREAS FÖRSTER ist freier Reporter in<br />
Berlin. Er beschäftigt sich vor allem mit<br />
Geheimdiensten, Polizei und Justiz<br />
Foto: Julian Stratenschulte/Picture Alliance/dpa<br />
32<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
IN DER MANEGE<br />
„Bei uns im Saarland ist es schnuckelig“, sagt die Mutter von Heiko Maas. Für seinen<br />
neuen Dienstort gilt das nicht gerade. Aber der neue Bundesminister der Justiz ist zäh<br />
Von CHRISTOPHE BRAUN<br />
Wäre die Politik ein Zirkus, dann<br />
wäre Sigmar Gabriel der Direktor,<br />
Gregor Gysi der Clown<br />
und Ursula von der Leyen die stärkste<br />
Frau der Welt. Heiko Maas war bisher<br />
der Kartenabreißer, einer, der nicht selbst<br />
im Rampenlicht steht, sondern am Rande<br />
des Spektakels seine Arbeit tut. Maas, 47,<br />
Jurist, zwei Kinder, galt als penibel und<br />
freundlich – der un<strong>auf</strong>fällige SPD-Chef<br />
aus dem Saarland im Eck der Republik.<br />
Jedenfalls bis vor ein paar Wochen.<br />
Seit dem 17. Dezember ist er Justizund<br />
Verbraucherschutzminister in Angela<br />
Merkels drittem Kabinett. Der Kartenabreißer<br />
steht jetzt in der Manege.<br />
Welche Nummer wird er dort vorführen?<br />
Noch kann er frei wählen.<br />
Maas stammt aus Schwalbach im<br />
Saarland. Von dort aus wirkt zuweilen<br />
schon Rheinland-Pfalz wie ein Kontinent.<br />
Berlin ist eine andere Welt. An einem<br />
milden Winterabend steht er im Schwalbacher<br />
Rathaus. Seine Eltern sind da,<br />
seine Frau, seine Cousine auch, sie arbeitet<br />
im Büro des Bürgermeisters. Die<br />
anderen kennen ihn spätestens, seit er als<br />
Student die SPD-Wahlkampfzeitung verteilt<br />
hat. Schwalbach, erklärt der Bürgermeister,<br />
sei stolz, dass „einer von ihnen<br />
bei der Angela Merkel mit am Tisch sitzt“.<br />
Die Saarländer freuen sich über Stars<br />
wie den Illusionskünstler Lafontaine<br />
oder den Geschichtenerzähler Altmaier.<br />
Aber das heißt nicht, dass die Berühmtheiten<br />
sich zu Hause <strong>auf</strong>spielen dürften.<br />
Im Gegenteil: Understatement kommt an.<br />
Als Peter Altmaier die Gemeinde voriges<br />
Jahr besuchte, ließ er sich vom Fahrer einige<br />
Hundert Meter vor dem Rathaus absetzen<br />
unter dem Vorwand, er wolle Geld<br />
abheben. Dann lief er den Rest zu Fuß.<br />
Auch Heiko Maas kennt die Bedeutung<br />
kleiner Gesten. Nachdem der Bürgermeister<br />
geendet hat, räumt er ein,<br />
dass es „schon komisch“ sei, von der eigenen<br />
Cousine als „sehr geehrter Herr<br />
Minister“ angeredet zu werden. Ins Ehrenbuch<br />
schreibt der frisch gebackene<br />
Minister: „Hier bin ich daheim.“<br />
„Wie ist es denn so in Berlin?“,<br />
möchte sein Vater wissen.<br />
Maas kneift die Augen zusammen.<br />
„Alles ein bisschen distanzierter.“<br />
Seine Mutter nickt. „Bei uns ist es<br />
halt doch schnuckelig.“<br />
Maas ist in der SPD früh <strong>auf</strong>gestiegen,<br />
gefördert von Lafontaine: Eintritt<br />
mit 23, Juso-Landeschef mit 26, zwei<br />
Jahre später im Landtag, dann Staatssekretär,<br />
schließlich, mit 31 Jahren, Minister<br />
für Umwelt und Verkehr – der seinerzeit<br />
jüngste Landesminister der Republik.<br />
Ein Jahr später flog die SPD aus<br />
der Regierung. Es folgten zwölf magere<br />
Jahre: Maas verlor eine Wahl nach der<br />
anderen, schlug sich mit der Linkspartei<br />
herum und trat schließlich 2012 als<br />
Vize-Regierungschef in eine Große Koalition<br />
unter Annegret Kramp-Karrenbauer<br />
ein. Lange schien er eine glänzende<br />
Zukunft nicht vor, sondern hinter<br />
sich zu haben. Er war derjenige, der immer<br />
kämpft und immer verliert und trotzdem<br />
immer weitermacht.<br />
Diese Erfahrung könnte ihm in Berlin<br />
helfen: Maas ist zäh. Sein Sport ist der<br />
Triathlon, jene Kombination aus L<strong>auf</strong>en,<br />
Radfahren und Schwimmen. Wer bestehen<br />
will, muss Schmerzen verkraften und<br />
Rückschläge einstecken können.<br />
Dass er nicht vorhat, ein un<strong>auf</strong>fälliges<br />
Kabinettsmitglied zu sein, hat Maas<br />
Anfang Januar klargemacht, als er erklärte,<br />
er werde das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung<br />
nicht umsetzen, ehe<br />
der Europäische Gerichtshof darüber entschieden<br />
hat. Mit der Äußerung besetzte<br />
er das Thema Bürgerrechte – ein Feld, das<br />
traditionell von Grünen und Liberalen<br />
beansprucht wird. „Als Justizminister<br />
muss Heiko Maas ein Gegengewicht sein<br />
zu den bürgerrechtsfeindlichen Tendenzen<br />
in der Union“, sagt Gerhart Baum, ein<br />
Grandseigneur der FDP und einst Bundesinnenminister.<br />
„Seine ersten öffentlichen<br />
Äußerungen haben mich hier ganz<br />
zuversichtlich gestimmt.“<br />
Inzwischen hat Maas einen Gesetzesentwurf<br />
zur Verbesserung des Adoptionsrechts<br />
homosexueller Paare vorgelegt;<br />
noch ein Thema, das in der Regierung<br />
umstritten ist. Dass er im Strafrecht die<br />
Definition von Mord und Totschlag überarbeiten<br />
will, hat er auch schon angekündigt.<br />
<strong>Kein</strong> einfaches Kunststück.<br />
Zurück nach Schwalbach. Nachdem<br />
er sich ins Ehrenbuch eingetragen<br />
hat, besucht der Minister eine SPD-Veranstaltung.<br />
Ein paar Hundert Leute sitzen<br />
in der Mehrzweckhalle vor Bier und<br />
Salzgebäck und roten Rosen. Auf der<br />
Bühne singen „De Hüütcha“. Als sie fertig<br />
sind, knöpft der Justizminister sein<br />
Sakko <strong>auf</strong> und eilt ans Rednerpult. Der<br />
Beginn der Großen Koalition sei „rumpelig“<br />
gewesen, sagt er; einen „nicht unwesentlichen<br />
Teil“ habe er selbst dazu<br />
beigetragen. Er meint das mit der Vorratsdatenspeicherung.<br />
Aber: „Die Leute<br />
wissen jetzt wenigstens, dass ich die Arbeit<br />
in der Großen Koalition <strong>auf</strong>genommen<br />
habe!“ Applaus.<br />
Es ist, als prüfe der Kartenabreißer,<br />
der in der Manege gelandet ist, wie er als<br />
Messerwerfer ankäme. Sind die Klingen<br />
spitz? Der Aufschrei, die Entrüstung und<br />
die wütenden Kommentare, die <strong>auf</strong> seine<br />
Äußerungen folgten, beweisen: Um Gummiklingen<br />
handelt es sich jedenfalls nicht.<br />
CHRISTOPHE BRAUN beeindruckte, dass<br />
die Hüütcha auch mit Peter Altmaier <strong>auf</strong><br />
der Bühne standen: Er trällerte mit ihnen<br />
den „Energiewende-Song“<br />
Foto: Werner Schüring/imagetrust<br />
34<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
BRUMMIS UND GEZWITSCHER<br />
Sie wurde schon heimliche Internetministerin genannt. Aber nun soll sich Dorothee Bär<br />
erst mal um Lkw-Fahrer kümmern. <strong>Kein</strong> Problem. Die CSU-Politikerin liebt Kontraste<br />
Von CHRISTOPH SEILS<br />
Foto: Stefan Thomas Kröger/laif<br />
Sie stahl sich davon. In Berlin wurde<br />
noch um letzte Details des Koalitionsvertrags<br />
gerungen, aber <strong>auf</strong><br />
dass Depeche-Mode-Konzert wollte Dorothee<br />
Bär nicht verzichten. Elektropop<br />
statt Mütterrente. Also half im November<br />
nur eine kleine Ausflucht, eine vorgeschobene<br />
Terminnot. Die CSU-Politikerin<br />
sang mit, klatschte, feierte mit<br />
15 000 anderen Fans. Auch wenn Dave<br />
Gahan und Martin Gore ihren Lieblingssong<br />
„Somebody“ nicht anstimmten.<br />
Zu einer konservativen Hoffnungsträgerin<br />
passt so ein Ausflug nicht so<br />
recht. Dorothee Bär weiß das. Aber sie<br />
spielt mit solchen Gegensätzen. Sie gefällt<br />
sich in der Rolle der „CSU-Piratin“, die<br />
sich für Netzneutralität und gegen Vorratsdatenspeicherung<br />
engagiert. Dann<br />
ist sie wieder wortgewaltige Kämpferin<br />
für ein traditionelles Familienbild. Mal<br />
trägt sie im Büro eine Lederjacke, mal<br />
ein biederes Kostüm. Mal reflektiert sie<br />
nachdenklich über die Frauenquote, dann<br />
wettert sie wieder gegen „sozialistische<br />
Weltverbesserer“. „Ich war als Jugendliche<br />
Fan von Campino von den Toten<br />
Hosen“, sagt sie und fügt schnell hinzu:<br />
„aber auch von Reinhard Fendrich.“<br />
Dorothee Bär hat erkannt: Die Gegensätze<br />
stärken sie. Je krasser die Kontraste,<br />
desto interessanter. Auch wenn<br />
diesmal noch verdiente Herren der Partei<br />
zum Zuge kamen, Gerd Müller als<br />
Entwicklungs- oder Christian Schmidt<br />
als Landwirtschaftsminister: Bär ist eine<br />
Antwort dar<strong>auf</strong>, wie die CSU in Zukunft<br />
aussehen könnte.<br />
Kleine Irritationen bei Parteisenioren,<br />
die sie gelegentlich als „Twittertussi“<br />
verspotten, gehören zum Spiel. Aus der<br />
Netzpolitik hat sie einen Markenkern<br />
gemacht. Betreuungsgeld kann jeder in<br />
der CSU, aber wer durchdenkt schon<br />
das Internet? Früh hat sie die politische<br />
Dimension des Netzes erkannt. Und sie<br />
zwitscherte und postete früh in den sozialen<br />
Netzwerken. Sie begriff, dass Twitter<br />
und Facebook ihrer Politik eine persönliche<br />
Note geben können, ohne dass sie<br />
dem Boulevard die Haustür öffnen muss.<br />
Wenn andere abends Bier trinken gehen,<br />
spielt sie zur Entspannung Counterstrike,<br />
Grand Theft Auto oder Quiz up.<br />
Für ihre 35 Jahre hat sie es weit gebracht.<br />
Mit 14 trat sie im fränkischen<br />
Ebelsbach in die Junge Union ein, mit 16<br />
in die CSU, mit 21 war sie bayerische Vorsitzende<br />
des Ringes Christlich‐Demokratischer<br />
Studenten. 2002 kam sie in den<br />
Bundestag, mit 24, die jüngste CSU-Abgeordnete<br />
aller Zeiten. So jung war Dorothee<br />
Bär, dass sie drei Wahlperioden lang<br />
das Küken der CSU im Bundestag blieb.<br />
ALTE MÄNNER, die verstanden haben,<br />
dass die CSU keine Männerpartei bleiben<br />
darf, bahnten ihr den Weg. Edmund<br />
Stoiber hat ihr Talent einst entdeckt,<br />
Horst Seehofer sie viele Jahre gefördert.<br />
„Wertkonservativ“ – das war ihr Ticket in<br />
die Politik. Den rechten CDU-Haudegen<br />
Norbert Geis wählte sie zu ihrem Vorbild.<br />
„Die Partei hat immer recht“, so steht<br />
es <strong>auf</strong> einer Postkarte, die an der Tür ihres<br />
Bundestagsbüros klebt. Oder vielleicht<br />
doch nicht? Bei der Vorratsdatenspeicherung<br />
und der Frauenquote war es<br />
anders. Auch bei der Frage, ob die Pille<br />
danach ohne Rezept abgegeben werden<br />
sollte, wirkt Bär nachdenklicher als die<br />
Parteilinie. Und 2017 wäre ein Bündnis<br />
mit den Grünen für sie „keine große<br />
Überraschung“ mehr. Ihre Mitarbeiter<br />
hätten gespottet, „je älter desto liberaler“,<br />
erzählt Dorothee Bär, und etwas erschrocken<br />
war sie da schon. „Ich bin lieber<br />
eine Konservative“, sagt sie.<br />
Sie hat ihre Karriere organisiert,<br />
scheinbar nebenbei Politikwissenschaft<br />
studiert und drei Kinder bekommen. In<br />
den vergangenen vier Jahren war sie stellvertretende<br />
CSU-Generalsekretärin hinter<br />
Alexander Dobrindt. Die Belobigung<br />
folgte am 17. Dezember 2013, als sie parlamentarische<br />
Staatssekretärin wurde im<br />
Bundesministerium für Verkehr und digitale<br />
Infrastruktur – wieder bei Dobrindt.<br />
Häufig ist der Job hinter dem Minister für<br />
Politiker eine Sackgasse. Bei Bär ist das<br />
anders, sie hat noch etwas vor.<br />
Weil sie sich mit der neuen Zuständigkeit<br />
des Ressorts auskennt, wurde<br />
sie bereits die heimliche Internetministerin<br />
genannt. Die Idee, alle netzpolitischen<br />
Aktivitäten der Regierung in einem<br />
Haus zu bündeln, hat etwas Bestechendes.<br />
Doch daraus wird nichts. Um die Netzpolitik<br />
rangeln gleich vier Ministerien: Innen<br />
und Justiz, Wirtschaft und Verkehr.<br />
Selbst das Bildungsministerium will bei<br />
der Digitalen Agenda mitreden.<br />
Dorothee Bär hat gleich noch einen<br />
Job bekommen, im Januar wurde sie zur<br />
Logistikbe<strong>auf</strong>tragten der Bundesregierung<br />
ernannt. Leergewicht und Nutzlast<br />
statt Bits und Bytes. Da sitzt sie nun in<br />
einem der schweren schwarzen Sessel in<br />
ihrem neuen Berliner Büro. Die Franz-<br />
Josef-Strauß-Büste im Regal wirkt etwas<br />
verloren. Aber sie schwärmt von der<br />
neuen Aufgabe, diese mache ihr „viel<br />
Spaß“, werde „völlig unterschätzt“. Ganz<br />
so, als habe sie nie etwas anderes machen<br />
wollen, als sich um Trucker und Brummis,<br />
um Stellplätze und Verkehrsleitsysteme<br />
zu kümmern, um eine Welt, die von<br />
Kerlen dominiert wird. Das schreckt sie<br />
nicht: „Das kenn ich aus der Politik nicht<br />
anders.“ Auch nicht aus der CSU.<br />
CHRISTOPH SEILS ist Ressortleiter von<br />
<strong>Cicero</strong> Online. Er twittert längst nicht so<br />
viel wie @dorobaer<br />
37<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Report<br />
EWIG<br />
UNZUFRIEDEN<br />
Die AfD dürfte im<br />
Mai erstmals in das<br />
Europaparlament<br />
einziehen. Dennoch<br />
könnte die Partei scheitern<br />
– an eben jener<br />
Unzufriedenheit, die zu<br />
ihrer Gründung führte<br />
Von ANDREAS THEYSSEN<br />
38<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Illustration: Florian Bayer<br />
Der Schrecken der deutschen Politik sitzt heute<br />
im Oberstübchen. Der Raum im Dachgeschoss<br />
des Restaurants Alter Stadtwächter in Potsdam<br />
ist karg. Um den Tisch haben sich rund 20 Leute versammelt,<br />
in der Mehrzahl Männer, einige über 60, andere<br />
sind nur halb so alt. Eine Frau hat Sohn und Tochter<br />
mitgebracht, beide in den Zwanzigern. Auf dem<br />
Tisch: Getränke, Bierdeckel, Stimmkarten. Und die<br />
Satzung. Das Regelwerk für den Kreisverband Potsdam<br />
der Alternative für Deutschland, der sich an diesem<br />
Abend gründet.<br />
In Paragraf 11, Absatz 1, so bittet ein Teilnehmer,<br />
sei doch das Wort „Stimmberechtigte“ zu streichen.<br />
In Absatz 3 möge man bitte auch noch etwas korrigieren.<br />
Und so weiter, und so fort. Auch wenn man<br />
die Parteienlandschaft <strong>auf</strong>mischt, sind Regularien und<br />
die Details der Regularien wichtig. Wir sind schließlich<br />
in Deutschland.<br />
Die AfD hat die deutsche Politik durcheinandergebracht.<br />
Erst im Frühjahr 2013 unter der Führung<br />
des Hamburger Wirtschaftsprofessors Bernd Lucke<br />
gegründet, scheiterte sie im Herbst bei der Bundestagswahl<br />
mit 4,7 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-<br />
Hürde. Mit ihrem europakritischen Kurs gelang es ihr<br />
nicht nur, Union und FDP Wähler wegzunehmen, sondern<br />
auch der Linkspartei. Als Reaktion hat CSU-Chef<br />
Horst Seehofer sogar den Eurokritiker Peter Gauweiler<br />
in seinen Vorstand geholt.<br />
2014 kann das Jahr werden, in dem sich die AfD<br />
im deutschen Parteiensystem etabliert. Dass sie am<br />
25. Mai ins Europaparlament einzieht, ist wahrscheinlich.<br />
Bei der Wahl gilt nur eine Drei-Prozent-Hürde,<br />
und in Umfragen kommt die Partei je nach Institut <strong>auf</strong><br />
5, 6 oder 7 Prozent. Dass der frühere Chef des Bundesverbands<br />
der Deutschen Industrie und Talkshow-Dauergast<br />
Hans-Olaf Henkel einer der Spitzenkandidaten<br />
ist, dürfte den Aufschwung beflügeln. Er sei „eine Person,<br />
die an wirtschaftlicher Erfahrung und politischer<br />
Kompetenz ihresgleichen sucht“, sagt Parteichef Lucke.<br />
Ende August sind Landtagswahlen in Sachsen,<br />
Brandenburg und Thüringen. Dort hat die AfD bei<br />
der Bundestagswahl jeweils mindestens 6 Prozent der<br />
Stimmen geholt und somit Chancen, in die Parlamente<br />
in Dresden, Potsdam und Erfurt einzuziehen.<br />
Die AfD ist ein Phänomen. Einerseits, weil sie in<br />
Deutschland ein Stück europäische Normalität herstellen<br />
könnte: Mit ihr säße eine europakritische Partei<br />
in den Parlamenten – genau wie in Frankreich, Großbritannien,<br />
den Niederlanden oder Finnland. Und die<br />
AfD ist ein Phänomen, weil sie trotz des Wählerinteresses<br />
scheitern könnte – an sich selber wie zuvor Statt-<br />
Partei, Schill-Partei oder die Piraten.<br />
Der Meinungsforscher Manfred Güllner hat die<br />
Wähler und Sympathisanten der AfD analysiert. Die<br />
überwiegende Mehrheit stammt demnach aus dem<br />
Kleinbürgertum, 70 Prozent ihrer Anhänger sind Männer,<br />
die meisten über 60 Jahre alt, gut situiert und von<br />
Verlustängsten geprägt. Überproportional viele von ihnen<br />
haben schon einmal rechte Parteien gewählt. Güllner,<br />
Chef des Instituts Forsa, sagt, dass die AfD das<br />
gleiche Wählerpotenzial anzieht wie in den achtziger<br />
und neunziger Jahren die rechtsextremen „Republikaner“.<br />
Mit ausländerfeindlichen Parolen hatten die<br />
es in viele Landtage geschafft. Heute spielt die Partei<br />
keine Rolle mehr, erhielt bei der Bundestagswahl gerade<br />
einmal 92 000 Stimmen. Doch ihr Wählerpotenzial<br />
existiert noch: Protestwähler. Das ist freilich nur<br />
ein Schlagwort. Wer genau sich in der AfD warum engagiert,<br />
lässt sich vor Ort besichtigen.<br />
Potsdam, Alter Stadtwächter. Die Kandidaten für<br />
den Kreisvorstand stellen sich vor. Da ist Thomas Jung,<br />
der später zum Kreisvorsitzenden gewählt wird. Anwalt,<br />
sonore Stimme, etwas spröde Ausstrahlung. Er<br />
gehörte dem Wirtschaftsrat der CDU an, wie er erzählt,<br />
dann war er ein Dreivierteljahr bei der rechten<br />
Splitterpartei „Die Freiheit“. „Danach suchte ich eine<br />
neue Partei“, sagt er, „liebäugelte zunächst mit den<br />
Freien Wählern und bin seit März 2013 bei der AfD.“<br />
Jung verkörpert eines der Probleme, mit denen die<br />
Partei zu kämpfen hat: mit der Abgrenzung gegenüber<br />
Radikalen. Ihr Vormann Bernd Lucke hat angeordnet,<br />
keine Ex-Mitglieder der „Freiheit“ <strong>auf</strong>zunehmen. Er<br />
fürchtet, dass die AfD in den Ruch gerät, Radikale<br />
in ihren Reihen zu haben. Dabei knöpft er sich sogar<br />
die CSU vor, um zu demonstrieren, dass seine Partei<br />
weder rechtspopulistisch noch ausländerfeindlich<br />
ist. Deren Slogan „Wer betrügt, der fliegt“, mit dem<br />
die Bayern Stimmung gegen zuwandernde Bulgaren<br />
und Rumänen machten, attestiert Lucke eine „in dieser<br />
Verkürzung <strong>auf</strong>bauschende Wirkung“.<br />
IM FALL DER PARTEI „FREIHEIT“ ist seine Sorge berechtigt.<br />
Gegründet wurde sie im Herbst 2010 von dem<br />
ehemaligen Berliner CDU-Abgeordneten René Stadtkewitz,<br />
der einen islamfeindlichen Kurs fuhr und den<br />
niederländischen <strong>Recht</strong>spopulisten Geert Wilders zu<br />
Wahlveranstaltungen einlud. Seit einem Jahr beobachtet<br />
der Verfassungsschutz den bayerischen Landesverband<br />
der „Freiheit“. Im Herbst rief Stadtkewitz seine<br />
Parteifreunde <strong>auf</strong>, alle landes- und bundespolitischen<br />
Aktivitäten zugunsten der AfD einzustellen. Lucke reagierte<br />
alarmiert. Doch selbst im Parteivorstand hat<br />
er nicht genügend Rückhalt für diese Haltung. Alexander<br />
Gauland, einer von Luckes Stellvertretern, sagt:<br />
„Wir haben zum Beispiel in Brandenburg ehemalige<br />
,Freiheit‘-Leute, mit denen ich gut zusammenarbeite.<br />
Und insgesamt sind es in der Partei so wenige, dass<br />
ich sie für ungefährlich halte.“<br />
Im Vorstand des neuen Kreisverbands Potsdam<br />
sind es schon zwei. Wilfried Rammelt stellt sich im Alten<br />
Stadtwächter vor. Er nähert sich dem Rentenalter<br />
und kandidiert für einen Beisitzerposten. Er engagiere<br />
sich, „weil ich möchte, dass meine Enkel noch ein ordentliches<br />
Land vorfinden“, erklärt er mit vor Ärger<br />
39<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Report<br />
bebender Stimme. In der Wendezeit 1989 ist er der<br />
SDP beigetreten, den DDR-Sozialdemokraten. „Als<br />
der Euro kam, war mir klar: Da läuft schon wieder<br />
etwas schief“, sagt er mit Blick <strong>auf</strong> seine Erfahrungen<br />
in der Honecker-DDR. Ein Dreivierteljahr war er Mitglied<br />
der „Freiheit“, dann kam er zur AfD.<br />
Da ist auch Lothar Wellmann, 38, Verwaltungswissenschaftler.<br />
Fast 20 Jahre lang war er in der CDU,<br />
seit einem Vierteljahr ist er bei der AfD. Er findet, dass<br />
„dieses Land es verdient, besser regiert zu werden“.<br />
Über sich selber sagt er: „Ich bin ein Renegat.“ Seine<br />
Lust an der Provokation ist unüberhörbar. Er wird zum<br />
stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt.<br />
Da ist Ingelore Lichtenberg-Lippert, die für das<br />
Amt der Rechnungsprüferin kandidiert und ihren<br />
Mann mitgebracht hat, ein Fördermitglied. „Ich war<br />
Kleinunternehmerin“, sagt die ältere Dame, „habe<br />
lange CDU gewählt, bin später der FDP beigetreten.<br />
Doch nach der Aktion Schäffler bin ich wieder ausgetreten.“<br />
Wie die FDP-Führung damals mit dem liberalen<br />
Eurokritiker Frank Schäffler umging, das passte<br />
ihr nicht. Schäffler hatte die FDP 2011 fast gespalten,<br />
als er <strong>auf</strong> eigene Faust einen Mitgliederentscheid initiierte,<br />
um die deutsche Beteiligung an der Eurorettung<br />
zu stoppen. Lichtenberg-Lippert kam danach zur AfD.<br />
Sie ist stolz <strong>auf</strong> ihre niedrige Mitgliedsnummer, die 459.<br />
Die AfD ist eine Partei der Suchenden. Sie sind irgendwie<br />
unzufrieden. Mit dem Euro. Mit der Zuwanderung.<br />
Mit der Aufwertung homosexueller Lebenspartnerschaften.<br />
Mit der politischen Klasse. Sie finden, dass<br />
es zu viel Europa gibt und zu wenig Nationalstaat. Sie<br />
hätten gerne die D-Mark wieder und dass Ehe und Familie<br />
vom Staat wieder den exklusiven Stellenwert erhalten,<br />
den sie einmal hatten. Auf der Suche nach Zufriedenheit<br />
irrlichtern sie durch die Parteien.<br />
EINER DIESER SUCHENDEN ist Alexander Gauland, Luckes<br />
Stellvertreter und einer der Männer an der Parteispitze,<br />
die der AfD ein seriöses Image verleihen. Der<br />
73-Jährige war einmal Staatssekretär in Hessen, galt<br />
in der Ära Helmut Kohl als einer der liberalen Geister<br />
der CDU. Die Partei hat er mittlerweile verlassen:<br />
„Nach Merkel ist die CDU eine leere Hülle“, sagt er.<br />
Gauland ist einer der drei Autoren des AfD-Programmentwurfs<br />
für die Europawahl. „Früher habe ich<br />
mehr an Europa geglaubt“, sagt er über sich. „Heute<br />
sehe ich, dass es aber nicht funktioniert.“ Beim Verfassen<br />
des Programms hat ihn noch ein anderer Gedanke<br />
geleitet. „Für die AfD reicht der Anti-Euro-Kurs nicht<br />
mehr. Wir müssen auch <strong>auf</strong> Feldern wie Türkei-Beitritt<br />
oder Asylrecht Punkte setzen, und dabei stellt sich die<br />
Frage: Wie populistisch kann man <strong>auf</strong>treten?“ Das sei<br />
allerdings nicht einfach, da man bei diesem Ritt <strong>auf</strong><br />
der Rasierklinge leicht runterfalle.<br />
Das Prinzip Rasierklinge war nach dem Nein der<br />
Schweizer zu ihrem Zuwanderungsrecht zu beobachten.<br />
Lucke versicherte zwar, Deutschland brauche<br />
Wie viel<br />
<strong>Recht</strong>spopulismus<br />
darf es denn sein?<br />
Für die AfD ist der<br />
Wahlkampf<br />
ein Ritt <strong>auf</strong> der<br />
Rasierklinge<br />
qualifizierte Zuwanderer. Zugleich empfahl er aber<br />
auch hierzulande eine Volksabstimmung, „die eine<br />
Einwanderung in unsere Sozialsysteme wirksam unterbindet“,<br />
und wandte sich dagegen, „abfällig über<br />
die Partei zu reden, die die Volksabstimmung durchsetzt“.<br />
Gemeint war die rechtspopulistische Schweizerische<br />
Volkspartei.<br />
Auf dieser scharfen Kante reitet die AfD gen Europa.<br />
Der Euro soll durch die Zulassung kleinerer Währungsverbünde<br />
de facto abgeschafft werden. <strong>Kein</strong>e<br />
Erweiterung der EU. <strong>Kein</strong>e europäische Wirtschaftsregierung.<br />
<strong>Kein</strong>e weitere Abtretung nationaler Kompetenzen<br />
an Brüssel. Sozialhilfen für Zuwanderer aus<br />
EU-Ländern soll es nur in der Höhe geben, die sie auch<br />
in ihren Heimatländern erhalten würden.<br />
In anderen EU-Ländern haben es Parteien mit<br />
solchen Parolen längst in die Parlamente geschafft,<br />
auch ins Europaparlament. Marine Le Pen, Chefin der<br />
rechtsradikalen Front National aus Frankreich, und der<br />
niederländische <strong>Recht</strong>spopulist Geert Wilders haben<br />
eine Kooperation <strong>auf</strong> europäischer Ebene vereinbart.<br />
Doch die AfD will sich ihnen nicht anschließen. „Wir<br />
werden mit keiner Partei zusammenarbeiten, die ausländerfeindlich<br />
ist“, sagt Hans-Olaf Henkel. Im Moment<br />
gibt es keine Kooperationen. „Das kann und wird<br />
sich aber ändern“, sagt Gauland. Auch Parteichef Lucke<br />
kann sich eine Zusammenarbeit mit manchen eurokritischen<br />
Parteien aus Osteuropa vorstellen. Noch<br />
lässt er offen, welche das sein könnten.<br />
Dass es nach dem Einzug ins Europaparlament Kooperationen<br />
geben wird, davon ist auszugehen. Denn<br />
die Begründung, warum sie derzeit angeblich nicht<br />
gehen, klingt reichlich bemüht. Man müsse erst sehen,<br />
was die jeweiligen Parteien in ihren Heimatländern für<br />
eine nationale Politik betreiben, sagt Gauland. „Da gilt<br />
derzeit äußerste Vorsicht.“ Beurteilen könne man sie<br />
erst, wenn man im Europaparlament sitze.<br />
Nun ist es ziemlich gleich, ob man in Brüssel, Potsdam<br />
oder Wanne-Eickel sitzt. Allein durch Googeln<br />
lässt sich leicht herausfinden, was die anderen eurokritischen<br />
Parteien so treiben. Auch Gauland, der sich<br />
40<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Foto: Privat<br />
dem Internet komplett verweigert, hat zu etlichen Parteien<br />
eine klare Meinung. Eine Zusammenarbeit mit Le<br />
Pen und Wilders: „Ich glaube, das geht nicht.“ Le Pen:<br />
„Da war mal ein Bezug zum Antisemitismus.“ Wilders:<br />
„Hat ein Islamproblem.“ Mit den britischen Tories hingegen<br />
hält Gauland eine Zusammenarbeit für denkbar.<br />
Die stellen im Europaparlament die Hälfte der<br />
EU-kritischen konservativen Fraktion, den Rest füllen<br />
Abgeordnete der tschechischen ODS, der polnischen<br />
Kaczynski-Partei PiS und Unabhängige.<br />
So viel Zurückhaltung passt nicht jedem in der<br />
Partei. Ende vergangenen Jahres reisten die AfD-Landeschefs<br />
von Brandenburg und Sachsen-Anhalt nach<br />
Wien, trafen sich mit Vertretern des BZÖ, der Partei<br />
des verstorbenen österreichischen <strong>Recht</strong>spopulisten<br />
Jörg Haider. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz<br />
verlangten sie eine Zusammenarbeit mit der BZÖ.<br />
Der Bundesvorstand rüffelte die Aktion der zwei<br />
Landeschefs, die dar<strong>auf</strong>hin erst zurück- und dann<br />
aus der Partei austraten. „Wir sind ratlos“, sagt Gauland,<br />
als er im Alten Stadtwächter den Mitgliedern des<br />
Kreisverbands Potsdam davon berichtet. Er erntet kollektives<br />
Kopfschütteln. „Das ist ja ein Ding“, sagt einer.<br />
„Dieses Kleinklein“, stöhnt ein anderer.<br />
DABEI SIND SOLCHE QUERELEN der Normalzustand.<br />
In Nordrhein-Westfalen tobt ein Richtungsstreit. In<br />
Niedersachsen klagte der neue Landeschef, der Ex-<br />
ARD-Korrespondent Armin-Paul Hampel, über Beleidigungen<br />
und Denunziationen: „Zum Kotzen.“ Zwei<br />
Vorstandsmitglieder mussten dort wegen öffentlich bekundeter<br />
Sympathien für NS-Gedankengut abtreten.<br />
In Göttingen veruntreute der Schatzmeister 6000 Euro.<br />
Besonders turbulent geht es in Hessen zu. Erst zerlegte<br />
sich der Landesvorstand, eine Neuwahl scheiterte,<br />
weil der Parteitag nicht beschlussfähig war. Kaum war<br />
Mitte Dezember ein neuer Vorstand gewählt, stellte<br />
sich heraus, dass der Landesvorsitzende seine akademischen<br />
Titel zu Unrecht führte. Ein Parteiausschlussverfahren<br />
wurde eingeleitet, dem der falsche Professor<br />
durch Austritt zuvorkam. Der Landesschatzmeister<br />
wurde gefeuert, weil er im Zusammenhang mit kriminellen<br />
Migranten das Wort Ungeziefer benutzt hatte.<br />
Gauland hat inzwischen den Brandenburger Landesvorsitz<br />
selber übernommen. Die Querelen nerven<br />
ihn. „Wir haben in einem riesigen Tempo Leute gesammelt.<br />
Darunter sind Leute, die nicht pragmatisch zusammenarbeiten,<br />
die einander nicht riechen können –<br />
und das leben sie aus“, analysiert er. Hinzu kommt in<br />
seinen Augen ein Spannungsverhältnis zwischen Mitgliedern,<br />
die aus volkswirtschaftlichen Gründen gegen<br />
die Europolitik sind, und Protestwählern. Diese kommen<br />
vornehmlich zur AfD, weil sie Zuwanderer und<br />
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ablehnen.<br />
Diese beiden Gruppen – hier die Intellektuellen, dort<br />
die ehemaligen „Republikaner“-Wähler – sind schwer<br />
zusammenzubringen.<br />
So droht die Partei ausgerechnet an dem zu scheitern,<br />
was ihr so viel Zul<strong>auf</strong> brachte: der notorischen<br />
Neigung ihrer Mitglieder, unzufrieden zu sein. Gauland<br />
setzt deshalb große Hoffnungen <strong>auf</strong> die Europawahl<br />
und den Einzug in das Brüsseler Parlament.<br />
„Nach der Bundestagswahl kam eine Delle, weil sich<br />
die Leute untereinander bekriegten. Doch durch einen<br />
Sieg bei der Europawahl ist das geheilt.“<br />
Oder auch nicht. Denn im Falle eines Wahlsiegs<br />
werden noch mehr Menschen in die Partei eintreten:<br />
Unzufriedene, die sie noch heterogener machen.<br />
ANDREAS THEYSSEN, freier Autor, stieß<br />
bei der Recherche <strong>auf</strong> Bekannte: Mit AfD-<br />
Landeschef Hampel berichtete er über einen<br />
Merkel-Besuch in Indien, AfD-Vize Gauland<br />
schrieb früher wie Theyssen für Die Woche<br />
Anzeige<br />
LUCERNE FESTIVAL ZU OSTERN<br />
5. – 13. April 2014<br />
Glanzvoller Auftakt in die Festivalsaison<br />
Sa, 5.4.<br />
Mi, 9.4.<br />
Fr, 11.4.<br />
Sa, 12.4.<br />
Bernard Haitink | Chamber Orchestra of Europe | Gautier Capuçon<br />
Schumann Sinfonien Nr. 1 und 4 | Cellokonzert<br />
András Schiff | Cappella Andrea Barca | Solisten<br />
Beethoven Missa solemnis<br />
Gustavo Dudamel | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks<br />
Beethoven Sinfonie Nr. 6 Pastorale | Strawinsky Le Sacre du Printemps<br />
Andris Nelsons | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks | Solisten<br />
Wagner Parsifal. Konzertante Aufführung des dritten Aufzugs<br />
Karten und Informationen: +41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch<br />
Foto: Vern Evans<br />
Tickets für das<br />
Sommer-Festival 2014<br />
erhältlich ab<br />
10. März 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
SIE WAREN<br />
ANDERS<br />
Von GEORG LÖWISCH<br />
Hitler machte Hans Coppi zum Waisenkind, als er noch<br />
ein Baby war. Die DDR erklärte ihn zum Heldensohn,<br />
die Bundesrepublik zum Sohn von Verrätern.<br />
Aber er wollte wissen, wer seine Eltern wirklich waren.<br />
Geschichte einer historischen Suche<br />
Dreieinhalb Wochen nach<br />
Hans Coppis Geburt wird<br />
sein Vater ermordet. Nur<br />
einmal hat er den Sohn sehen<br />
dürfen, begrüßen, bestaunen,<br />
berühren.<br />
Das Papier, in dem der Mord am Vater<br />
dokumentiert wird, ist voller Nummern<br />
und Kürzel. Geheime Kommandosache!<br />
21 Abdrucke. Reichskriegsgericht,<br />
2. Senat. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat,<br />
Feindbegünstigung und Spionage<br />
wird der Mann, der gerade eben Vater<br />
geworden ist, zum Tode verurteilt. Am<br />
19. Dezember 1942.<br />
Acht Monate nach Hans Coppis Geburt<br />
wird seine Mutter hingerichtet. Sie<br />
hat ihn im Gefängnis noch stillen dürfen.<br />
Dann wird ihr der Sohn genommen.<br />
Und dem Sohn die Mutter.<br />
Der Beschluss, der dazu führt, dass<br />
der Junge ein Waisenkind wird, ist <strong>auf</strong><br />
zwei Schreibmaschinenseiten festgehalten.<br />
Gnadensachen. 17 Verurteilte. Führerhauptquartier,<br />
21. Juli 1943: „Ehefrau<br />
Hilda Coppi, Urteil vom 20. 1. 1943, wegen<br />
Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit<br />
mit Feindbegünstigung, Spionage<br />
und Rundfunkverbrechen.“ Vor ihren<br />
Namen ist handschriftlich ein Häkchen<br />
gesetzt worden. Es stammt von Adolf<br />
Hitler, er hat das Papier selbst unterzeichnet<br />
und damit ihr Gnadengesuch<br />
abgelehnt. Systematisch hat er die Liste<br />
seiner Gegner abgehakt, Name für Name,<br />
Leben für Leben.<br />
Hans Coppi steht in seiner Wohnküche,<br />
die Sonne scheint herein. Berlin-<br />
Mitte, ein kleiner Plattenbau, sechster<br />
Stock. An der Wand hängen Gemälde,<br />
Stillleben und eine Landschaft, die Stimmung<br />
angenehm ruhig, die Farben gedeckt,<br />
die Töne gebrochen. Seine Frau<br />
ist Galeristin.<br />
Er ist ein schlaksiger Mann. Schwarze<br />
Jeans, kariertes Hemd, die Haare eher<br />
braun als grau. Er sieht etwas jünger aus<br />
als seine 71 Jahre, nicht nach dem Geburtsjahr<br />
1942, in dem er in Berlin im<br />
Gefängnis zur Welt kam. Sein Gesicht hat<br />
eine gesunde Farbe, um die Augen liegen<br />
Kränze aus Lachfältchen. Er gießt Orangensaft<br />
ein.<br />
Die Eltern gehörten zu einem Freundeskreis,<br />
den Hitlers Geheime Staatspolizei<br />
zur sogenannten Roten Kapelle<br />
zählte. Es war ein Sammelbegriff der<br />
Nazis für Widerstandsgruppen in Berlin,<br />
Brüssel und Paris, teilweise waren ihre<br />
Mitglieder befreundet, teilweise standen<br />
sie gar nicht miteinander in Verbindung.<br />
Sie verfassten Flugblätter und nahmen<br />
Kontakt mit dem kommunistischen<br />
Russland <strong>auf</strong>. Wie die Weiße Rose oder<br />
die Offiziere um Claus Schenk Graf von<br />
St<strong>auf</strong>fenberg wollten sie Hitler stürzen.<br />
Mehr als 50 Menschen, die von den Nazis<br />
als Mitglieder der Roten Kapelle verhaftet<br />
wurden, starben.<br />
Was ist ein Verräter?<br />
Hans Coppi spricht behutsam. Er ist<br />
sich seiner Sache sicher, er will nur genau<br />
sein. „Edward Snowden, Bradley Manning<br />
– da haben meine Eltern etwas ganz<br />
Ähnliches gemacht: Geheimnisse weitergegeben<br />
und Dinge angeprangert.“<br />
Was für ein Vergleich. Obama hat<br />
doch nichts mit Hitler gemein. Aber es<br />
geht Coppi ja auch gar nicht um einen<br />
direkten Vergleich, sondern um Begriffe,<br />
„Es ist keine Hornhaut<br />
gewachsen.“ – Hans Coppi<br />
im Februar 2014 in Berlin.<br />
Seine Eltern waren Gegner<br />
des Naziregimes<br />
42<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
43<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
<strong>auf</strong> die er einen besonderen Blick hat<br />
und die auch heute noch benutzt werden:<br />
Landesverräter, Kriegsverräter,<br />
Hochverräter. Wer wird wann von wem<br />
so genannt? Die Frage, was Heldentum<br />
ist und was Verrat, möchten immer und<br />
überall die Mächtigen bestimmen. Hans<br />
Coppi beschäftigen die Begriffe ein Leben<br />
lang, weil seine Eltern beides genannt<br />
wurden. In der DDR galten sie als<br />
Helden, als Verräter im Westen Deutschlands.<br />
Auch noch lange nach Kriegsende,<br />
denn der Antikommunismus beherrschte<br />
dort den Blick <strong>auf</strong> das Gestern.<br />
Und heute werden also Snowden und<br />
Manning von den USA als Verräter verfolgt.<br />
Wenn das Wort in der Gegenwart<br />
<strong>auf</strong>taucht, sucht Coppi Anknüpfungspunkte<br />
in der Vergangenheit. Er will<br />
seine Eltern und ihre Geschichte aus jedem<br />
Blickwinkel heraus betrachten und<br />
sie verstehen: als Menschen, nicht als Figuren.<br />
Er will ihnen näher kommen. Die<br />
Geschichte von Hans Coppi ist auch eine<br />
über die Suche eines Sohnes nach Vater<br />
und Mutter. Als sie starben, war es für<br />
ihn zu früh, etwas im Gedächtnis zu behalten.<br />
Seine Erinnerung beginnt später.<br />
Er wächst bei den Großeltern <strong>auf</strong>.<br />
Das Sagen hat Frieda, die Mutter seines<br />
Vaters, starke Arme, das Haar nach hinten<br />
gesteckt. Der Junge weiß vom Tod<br />
der Eltern. Die Großmutter erzählt Geschichten<br />
aus deren Leben: Dass sie alle<br />
in der Kleingartenkolonie Waldessaum<br />
wohnten, dass sie dort einen Eisladen<br />
führten, dass einmal die Katze etwas<br />
vom Essen stibitzte. „Aber der Schluss<br />
ihres Lebens hat immer die Erzählung<br />
überlagert“, sagt er heute.<br />
In der ersten Klasse fragt der Religionslehrer,<br />
wer an seinem Unterricht<br />
teilnimmt. Als Hans ablehnt, erwidert<br />
der Lehrer, er werde mal mit den Eltern<br />
sprechen. „Ich habe keine Eltern mehr“,<br />
sagt der Junge. „Meine Großeltern glauben<br />
auch nicht an Gott. Weil, wenn es<br />
einen geben würde, hätte ich meine Eltern<br />
noch.“<br />
Viele Jahrzehnte später liegt <strong>auf</strong><br />
dem Tisch in der Wohnküche im sechsten<br />
Stock eine Schwarz-Weiß-Aufnahme.<br />
Hans Coppi sieht sie sich an. Das Foto<br />
zeigt ihn in einem Garten, Lederlatzhose,<br />
die Haare gut gekämmt. Es muss der Gedenktag<br />
für die Opfer des Faschismus im<br />
September gewesen sein. Der Junge hält<br />
Links: Hans Coppi in der<br />
Kleingartenanlage<br />
Waldessaum in Berlin. Hier<br />
waren seine Eltern<br />
miteinander glücklich<br />
<strong>Recht</strong>s: Seine Eltern Hilde<br />
und Hans <strong>auf</strong> Bildern der<br />
Gestapo 1942. Die Mutter<br />
wurde mit 34 hingerichtet,<br />
der Vater mit 26 Jahren<br />
einen Blumenstrauß, im Hintergrund ist<br />
eine Gedenktafel mit den Namen seiner<br />
Eltern zu sehen. Der Nachbarsjunge<br />
reicht ihm die Hand. Als ob er ihm sein<br />
Beileid ausspricht. Hans hat sich ein wenig<br />
zur Seite gedreht. Verlegen sieht er<br />
aus, fast beschämt.<br />
Er trägt den Namen seines Vaters.<br />
Hans Coppi, der Sohn von Hilde und<br />
Hans Coppi, ihr Erbe.<br />
Sie wohnen in Ostberlin. Wenn der<br />
Junge Kirschen klaut, sagt die Großmutter:<br />
„Hans, du musst daran denken, dass<br />
deine Eltern bekannt sind.“<br />
Mit 13 stößt er <strong>auf</strong> ein ihm gewidmetes<br />
Buch. Die Journalistin Elfriede Brüning<br />
hat es 1949 veröffentlicht, es heißt:<br />
„Damit du weiterlebst“. Seine Eltern sind<br />
Helden in dem Buch, es ist ein Roman<br />
und dann wieder nicht. Denn Brüning<br />
zitiert seitenweise aus Briefen, die Hans<br />
und Hilde Coppi im Gefängnis einander<br />
und ihren Eltern schrieben, sie hat sie<br />
von der Großmutter bekommen. „Werdet,<br />
44<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong> (Seiten 43 bis 44), Weisenborn Nachlass/AdK<br />
soweit es angeht, glücklich mit unserem<br />
Kind, das einer großen Liebe entsprossen<br />
ist“, schreibt Hilde Coppi am Tag ihrer<br />
Hinrichtung an ihre Mutter. „Diese große<br />
Liebe, die uns vereint hat, geben wir jetzt<br />
weiter an Euch, Eure Hilde.“<br />
Brüning arbeitet aber nicht nur mit<br />
den Briefen. Sie hat auch Zitate erfunden,<br />
die oft theatralisch klingen. An einer<br />
Stelle legt sie Hilde Coppi einen ungeheuerlichen<br />
Satz in den Mund: „Vielleicht<br />
werde ich das Kind eines Tages um unserer<br />
Sache willen opfern müssen.“<br />
Hans Coppi sagt heute, das Buch<br />
habe ihn damals verstört. Als er es vor<br />
zwei, drei Jahren noch einmal las, habe<br />
er sich geärgert. „Da find ich meine Mutter<br />
nicht wieder. Meine Eltern wollten<br />
weiterleben.“<br />
5. August 2013, kurz nach 17 Uhr.<br />
Hans Coppi steht vor einem Mietshaus<br />
in Berlin-Kreuzberg, <strong>auf</strong> den Tag genau<br />
70 Jahre, nachdem seine Mutter im Hinrichtungsschuppen<br />
von Plötzensee starb.<br />
In dem Mietshaus hat Ursula Götze gewohnt.<br />
Sie wurde am selben Tag ermordet,<br />
zwölf Minuten vor Hilde Coppi.<br />
Die Berliner Vereinigung der Verfolgten<br />
des Naziregimes, deren Vorsitzender<br />
Coppi ist, hat zu einer Gedenkfeier<br />
eingeladen. 50 Leute versammeln<br />
sich, eine Frau hält eine blau-weiß-rote<br />
Fahne der Vereinigung, ein Fernsehteam<br />
vom Rundfunk Berlin-Brandenburg dreht<br />
Bilder. Coppis Frau Helle ist auch da, im<br />
Vorgarten blühen gelbe Blumen.<br />
Hans Coppi steht vor einem Mikrofonständer.<br />
Er hält sein Manuskript mit<br />
beiden Händen fest. Er spricht über Ursula<br />
Götze und die anderen.<br />
Ein Mann schiebt sein Mountainbike<br />
aus dem Hauseingang, ein junges<br />
Paar mit zwei Eistüten schlendert vorbei,<br />
eine Feuerwehr rast die Yorkstraße entlang,<br />
das Martinshorn gellt. Coppi presst<br />
die Lippen zusammen. Er wartet. Irgendwann<br />
ebbt der Lärm ab. „Heute würde<br />
man die Frauen und Männer Whistleblower<br />
nennen“, sagt er ins Mikrofon. „Das<br />
war kein Landesverrat.“<br />
Die Begriffe Verräter und Whistleblower<br />
sind wie ungleiche Brüder. Der<br />
eine ist böse, der andere gut. Der eine<br />
verletzt das Vertrauen, ist illoyal, beschmutzt<br />
das eigene Nest. Der andere<br />
bläst die Trillerpfeife, schlägt Alarm, gibt<br />
Geheimnisse preis, um ein Verbrechen<br />
<strong>auf</strong>zudecken, um weitere zu verhindern.<br />
Für den Whistleblower gibt es im Deutschen<br />
kein präzises Wort.<br />
Coppi, vor dem Mietshaus, nennt den<br />
Namen Edward Snowdens, dessen Enthüllungen<br />
das Ausmaß der Überwachung<br />
durch die USA zeigen. Er fordert ein dauerhaftes,<br />
sicheres Bleiberecht für ihn.<br />
Als er fertig ist und die Lesebrille in<br />
die Brusttasche steckt, zittert seine Hand.<br />
Er müsste das nicht machen, nicht an diesem<br />
Tag. Aber er will nicht, dass andere<br />
seine Eltern und ihre Freunde erklären.<br />
Davon hat er genug.<br />
Als er in Ostberlin <strong>auf</strong>wächst, ist die<br />
Rote Kapelle im Westen Deutschlands<br />
verhasst: Ihre Mitglieder gelten als kommunistische<br />
Spione, die kriegswichtige<br />
Geheimnisse von Hitler-Deutschland<br />
an Stalins Russland gefunkt haben. Ein<br />
Krieg im Äther. Eine rote Vereinigung,<br />
an der Spitze Harro Schulze-Boysen,<br />
Oberleutnant im Luftfahrtministerium,<br />
und Arvid Harnack, Oberregierungsrat<br />
Anzeige<br />
Gerhard<br />
Schröder<br />
Klare Worte:<br />
Über Mut, Macht<br />
und unsere Zukunft.<br />
Gerhard Schröder<br />
KLARE WORTE.<br />
Im Gespräch mit Georg Meck<br />
Über Macht, Mut und unsere Zukunft<br />
224 Seiten<br />
Gebunden mit Schutzumschlag<br />
€ 19,99<br />
ISBN 978-3-451-30760-7<br />
› Typisch Gerhard Schröder:<br />
nachdenklich, schlagfertig,<br />
engagiert<br />
› »Der Mann, der Deutsch<br />
lands Wirtschaft rettete.«<br />
Wall Street Journal<br />
Neu in allen Buchhandlungen<br />
oder unter www.herder.de<br />
70.<br />
Geburtstag<br />
am 7. April<br />
45<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
im Reichswirtschaftsministerium, dirigiert<br />
von Strategen in Moskau. Die<br />
Schlachten im Osten – verloren wegen<br />
feindlicher Spione im eigenen Land. Es<br />
ist eine Art neue Dolchstoßlegende.<br />
Nach dem Krieg hat Hans Coppi mit<br />
seinen Großeltern noch eine kurze Zeit in<br />
Tegel gewohnt, im Westteil Berlins. Dort<br />
wird gleich nach dem Krieg die Hatzfeldtallee<br />
in Hans‐und‐Hilde‐Coppi‐Allee<br />
umbenannt. Aber bald wird das wieder<br />
rückgängig gemacht: Nach Verrätern darf<br />
keine Straße heißen. Die Coppis ziehen<br />
in den Osten.<br />
Das Bild von den roten Verrätern<br />
entspringt den Berichten der ehemaligen<br />
Geheimpolizisten, der Staatsanwälte und<br />
Richter. Als sie noch herrschen, haben sie<br />
ein Interesse, ihren Ermittlungserfolg so<br />
groß wie möglich erscheinen zu lassen.<br />
Als der Führer besiegt ist, wollen sie sich<br />
damit rechtfertigen.<br />
Hitlers Chefankläger Manfred<br />
Roeder verbreitet im Westen seine Sicht.<br />
Er ist der Mann, der Hans und Hilde<br />
Coppi angeklagt hat. 1951 druckt der<br />
Stern eine Artikelserie über die Rote Kapelle.<br />
„Rote Agenten unter uns“, lautet<br />
der Titel. Es erscheint auch ein ausführlicher<br />
Brief Roeders an den Herausgeber<br />
Henri Nannen. Darin klagt der Täter<br />
seine Opfer noch einmal öffentlich an.<br />
Es ist die Zeit, als die Bundesrepublik<br />
<strong>auf</strong>gebaut wird, als sich noch deutsche<br />
Soldaten in sowjetischer Gefangenschaft<br />
befinden. Der Kalte Krieg hat längst begonnen.<br />
Bis zum ersten Auschwitz-Prozess<br />
wird es noch über zehn Jahre dauern.<br />
Die Justiz schont viele Verbrecher<br />
des Naziregimes, auch Ermittlungen gegen<br />
Roeder werden eingestellt.<br />
Verrat ist Verrat, ganz gleich, ob er<br />
sich gegen ein verbrecherisches Regime<br />
richtet, so geht die Logik. So argumentiert<br />
auch Roeder. Im Stern schreibt er,<br />
in den USA drohe Spionen doch auch die<br />
Todesstrafe. Alle Kulturstaaten bestraften<br />
schließlich den Verrat.<br />
„Kulturstaaten“ – er benutzt tatsächlich<br />
dieses Wort.<br />
1952 veröffentlicht Roeder eine<br />
Broschüre zur Roten Kapelle, in der er<br />
schreibt: „Wie viele Witwen und Waisen<br />
des Krieges werden die Frage stellen,<br />
wurde auch dein Liebstes Opfer des<br />
Krieges im Äther?“ Die Antwort liefert<br />
er selbst: Die deutsche Abwehr sei von<br />
„Hans, denk daran, dass<br />
deine Eltern bekannt<br />
sind.“ – Ein Nachbarsjunge<br />
überreicht Coppi (rechts) an<br />
einem Gedenktag Blumen<br />
200 000 Opfern der Spione ausgegangen.<br />
Die Schuldzuweisung gehört zum Gedankenkonstrukt<br />
des Verrats: Der Blick<br />
wird <strong>auf</strong> unschuldige Opfer gelenkt, die<br />
Motive der Verräter geraten in den Hintergrund.<br />
Es ist eine Technik, die Geheimdienste<br />
bis heute anwenden.<br />
Roeder, den Hitler vor Kriegsende<br />
zum Generalrichter befördert hatte, wird<br />
später in Glashütten im Taunus in den<br />
Gemeindevorstand gewählt. Noch bis<br />
kurz vor seinem Tod 1971 unterzeichnete<br />
er mit „Generalrichter a. D.“.<br />
Erst 2009 wird der Bundestag alle<br />
Urteile der NS-Justiz wegen Kriegsverrats<br />
<strong>auf</strong>heben. 64 Jahre nach dem Ende<br />
des Krieges werden die Menschen, die<br />
sich gegen Hitler <strong>auf</strong>lehnten, endlich<br />
doch rehabilitiert.<br />
Foto: Privat<br />
46<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Als Hans Coppi <strong>auf</strong>wächst, hört er,<br />
dass Roeder unbehelligt im Westen lebt.<br />
Greta Kuckhoff, für die der Jurist das Todesurteil<br />
gefordert hatte, erzählt ihm davon.<br />
Ihr Mann, der Dichter Adam Kuckhoff,<br />
starb in Plötzensee ebenfalls am<br />
5. August 1943, 18 Minuten vor Hilde<br />
Coppi.<br />
Greta Kuckhoff kannte die Coppis<br />
gar nicht. „Sie hat ja meine Mutter nur<br />
einmal gesehen“, sagt der Sohn in seiner<br />
Wohnung in Berlin. „Als sie vom Alexanderplatz<br />
zur ersten Vernehmung mit<br />
dem Roeder gefahren sind.“<br />
Er spricht noch behutsamer, wenn er<br />
so etwas erzählt. Mal macht er lange Pausen,<br />
dann zieht er das Sprechtempo an,<br />
als wolle er rasch ein anderes Thema erreichen.<br />
Er wirkt, als liege ein frischer<br />
Schmerz unter einer sehr dünnen Schicht.<br />
Er weiß das. „Eine Hornhaut ist nicht gewachsen“,<br />
sagt er. „Gut, ich habe ja schon<br />
oft über sie gesprochen. Aber es berührt<br />
mich immer noch. Stärker als früher.“<br />
In den fünfziger Jahren ist Greta<br />
Kuckhoff Präsidentin der Notenbank der<br />
DDR. Sie wird Hans Coppis Vormund.<br />
Die Wochenenden mit ihr bedeuten ihm<br />
neue Horizonte, sie liest ihm Homer und<br />
Boccaccio vor. Wenn sie über Harro und<br />
Libertas Schulze-Boysen spricht, über<br />
Arvid und Mildred Harnack, über seine<br />
Eltern, dann klingt das menschlich. Dann<br />
sind sie für den Moment keine unerreichbaren<br />
Helden.<br />
Aber er ist der Heldensohn. Das System<br />
macht ihn dazu. In der DDR sind<br />
Antifaschisten Märtyrer, ihrer wird mit<br />
Fackeln gedacht, mit Fahnenappellen und<br />
flammenden Opferschalen. Als er 25 ist,<br />
schreibt Hans Coppi einen Artikel in der<br />
Jungen Welt, der <strong>auf</strong>lagenstarken Zeitung<br />
der FDJ.<br />
Er berichtet, sein Vater sei 1,96 Meter<br />
groß gewesen. „Den Langen möchte<br />
ich euch vorstellen. Es ist Hans Coppi,<br />
mein Vater.“<br />
Er schreibt, wie der Vater <strong>auf</strong> der<br />
Berliner Schulfarm Scharfenberg eine<br />
Gruppe des Kommunistischen Jugendverbands<br />
gründete, wie ihn ein Schulfreund<br />
mit Harro Schulze-Boysen bekannt<br />
machte, wie er der Funker der<br />
Widerstandsgruppe wurde.<br />
Auch der Sohn gibt den Eltern eine<br />
wichtige Rolle im Krieg. „Sie halfen<br />
der Roten Armee, sich besser <strong>auf</strong> den<br />
FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… ob Politiker-Liebschaften Privatsache sind<br />
Geht es uns irgendetwas an, wenn Bill Clinton was mit einer<br />
Praktikantin hat, Horst Seehofer seine Geliebte schwängert<br />
oder François Hollande seine Lebensgefährtin betrügt?<br />
Nein. Geht uns absolut nichts an. Interessiert uns aber brennend.<br />
Wir Menschen sind neugierig und fantasiebegabt. Meldungen dieser<br />
Art lösen Gedanken aus, gegen die wir uns nicht wehren können.<br />
So fragte ich mich im Falle Hollandes, warum ein Typ mit der Ausstrahlung<br />
eines altbackenen Baguettes solche Frauen abgreift. Erst<br />
die attraktive und kluge Ségolène Royal, dann die schöne und ebenfalls<br />
kluge Valérie Trierweiler, nun die Schauspielerin Julie Gayet,<br />
über deren Intellekt ich nichts weiß, die aber zweifellos auch sehr gut<br />
aussieht. Die Frage, was Hollande so erfolgreich bei Frauen sein lässt,<br />
erscheint plötzlich spannender als seine Meinung zum Mindestlohn.<br />
Darin liegt das Risiko, das Politiker mit erotischen Affären eingehen:<br />
Sie müssen mit einem Autoritätsverlust rechnen. So wie <strong>auf</strong>geregte<br />
Abiturienten angehalten werden, sich ihre Prüfer im Pyjama<br />
vorzustellen, stellen wir uns sexuell enthemmte Volksvertreter ohne<br />
Pyjama vor, was sie um einiges weniger beeindruckend erscheinen<br />
lässt. Ihre politischen Entscheidungen werden überlagert von der<br />
Frage, ob ein Blowjob Sex ist ( Clinton ), welchen Namen das Kind<br />
der Geliebten tragen wird ( Seehofer ) und was Hollande seiner Valérie<br />
erzählt hat, um die Motorrollerfahrten zum Stelldichein mit der<br />
Gelieb ten zu bemänteln. Kurz: Der Politiker, den eine Mehrheit für<br />
ehrlich hielt, tritt mit seiner privaten Verfehlung den Gegenbeweis<br />
an. Warum sollen wir dem haltlosen Gesellen noch trauen? Selbst<br />
wenn wir es richtig finden, Person und Position zu trennen – es fällt<br />
uns schwer.<br />
Was erotische Politiker-Eskapaden beim Wahlvolk anrichten<br />
können, durfte ich einst in Kentucky / USA beobachten: Die Gast-<br />
Großmutter ( als Einzige ihrer Familie bei den Demokraten registriert<br />
), verfiel bei der Ankündigung, Bill Clinton käme in den Ort, in<br />
Entzücken und seufzte: „Der Mann ist so sexy, für den würde ich<br />
jede Sünde begehen.“ Auf meine Frage, ob sie ihn denn auch wieder<br />
wählen würde, sagte sie empört: „Niemals!“<br />
AMELIE FRIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin.<br />
Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über Männer, Frauen und was das Leben<br />
sonst noch an Fragen <strong>auf</strong>wirft<br />
47<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Reportage<br />
Aggressor einzustellen und den Vormarsch<br />
der Faschisten zu stoppen.“<br />
Er wiederholt in dieser Zeit, was andere<br />
über seine Eltern sagen. Er übernimmt<br />
das fremde Bild und zieht eine gerade<br />
Linie von den Kommunisteneltern<br />
zum Sozialistensohn. Natürlich wird er<br />
SED-Mitglied.<br />
In den sechziger Jahren darf er nach<br />
Westberlin zu einer Gedenkveranstaltung<br />
fahren. Er nutzt die Gelegenheit,<br />
um Harald Poelchau in Zehlendorf zu<br />
treffen, den Gefängnispfarrer, der vor<br />
der Hinrichtung für seine Eltern da war.<br />
Poelchau erinnert sich nicht an Details.<br />
Er hat so viele Menschen in den Schuppen<br />
in Plötzensee begleitet.<br />
Mit Ende zwanzig begegnet Hans<br />
Coppi Vater und Mutter im Kino. Ein<br />
Defa-Spielfilm in Starbesetzung, Premiere<br />
im Kosmos an der Karl-Marx-Allee.<br />
Der Film heißt „KLK an PTX“, das sollen<br />
die Rufzeichen gewesen sein, mit denen<br />
sich die Rote Kapelle bei ihren Agentenführern<br />
meldete. Der Funker im Film,<br />
das ist sein Vater Hans Coppi, treu und<br />
zuverlässig, Stimme und Ohr der Berliner<br />
Kommunisten. Seine Eltern küssen sich<br />
in einer verschneiten Landschaft. In der<br />
gemeinsamen Wohnung sitzt der Vater<br />
mit Kopfhörern. Er tippt die Morsetaste,<br />
unablässig, der rote Pianist in der Roten<br />
Kapelle. Sein Gerät blinkt und piept<br />
und sendet und blinkt. Die Informationen<br />
fließen nach Moskau. „Das Ausmaß<br />
ist unvorstellbar, die Wirkung ist verheerend“,<br />
sagt ein Mann von der Gestapo.<br />
In der DDR-Darstellung ist die Rote<br />
Kapelle so mächtig wie im Westen, nur<br />
nicht böse, sondern gut. Verräter und<br />
Helden. In beiden Begriffen steckt die<br />
Vorstellung, dass ein Mensch einem Land<br />
gehört, einer Regierung oder einer Sache.<br />
Mitte der achtziger Jahre ist Hans<br />
Coppi selbst Vater, er hat drei Töchter.<br />
Aus dem Außenhandel ist er in die<br />
SED-Bezirksleitung gewechselt. Er soll<br />
in Betrieben herausfinden, was die Arbeiterschaft<br />
denkt, um daraus Argumentationen<br />
abzuleiten. Doch er stellt fest,<br />
dass die Oberen gar keine Meinungen<br />
von unten hören wollen. Er hadert.<br />
Ein Freund seines Vaters spricht ihn<br />
an, Heinrich Scheel, Historiker und Vizepräsident<br />
der Akademie der Wissenschaften<br />
der DDR. Ob er nicht nachforschen<br />
will, wie das mit der Roten Kapelle<br />
Hans Coppi wuchs bei der<br />
Großmutter <strong>auf</strong>. „Werdet<br />
glücklich mit unserem<br />
Kind“, schrieb seine Mutter<br />
am Tag ihrer Ermordung<br />
im Detail war? Scheel richtet eine Forschungsstelle<br />
ein. Dort fängt Coppi an.<br />
Es ist der Beginn einer systematischen<br />
Suche nach den Spuren seiner<br />
Eltern.<br />
Er sichtet Dokumente, gleicht Daten<br />
ab, betrachtet Fotos. Die DDR geht<br />
unter, Coppi macht weiter. Er promoviert<br />
an der Technischen Universität in<br />
Westberlin mit einer biografischen Studie<br />
über den Widerstandskämpfer Harro<br />
Schulze-Boysen.<br />
Er stößt <strong>auf</strong> Widersprüche. Das<br />
Funkgerät seines Vaters soll <strong>auf</strong> eine<br />
Empfangsstation in Minsk ausgerichtet<br />
gewesen sein. Aber Minsk hatten die<br />
Deutschen schon Tage nach dem Überfall<br />
<strong>auf</strong> die Sowjetunion erobert. Er fährt<br />
nach Moskau, er sucht die Funksprüche<br />
des Vaters. Es gibt andere, aus Brüssel,<br />
aus der Schweiz, aber nicht aus Berlin.<br />
Ein Mann vom Geheimdienst in Moskau<br />
schaut für ihn nach, aber da ist nichts.<br />
Nur eine Testmeldung vom 26. Juni 1941:<br />
„Tausend Grüße allen Freunden!“<br />
Kann das stimmen? Aber warum<br />
sollten die Russen den Erfolg ihrer Verbündeten<br />
in Berlin kleinreden? Ein erfolgreiches<br />
Spionagenetz in Hitlers<br />
Hauptstadt, das wäre doch die ruhmreichere<br />
Geschichte in den Annalen des<br />
Geheimdiensts.<br />
Coppi sucht immer weiter. Er findet<br />
Fotos von Ausflügen, vom Zeltplatz,<br />
von Touren mit dem Faltboot. Er sieht<br />
ein glückliches Leben, nicht nur einen<br />
schrecklichen Tod. Endlich sind sie nicht<br />
mehr nur die Ikonen, deren Gesichter die<br />
DDR <strong>auf</strong> Briefmarken druckte.<br />
In einer Karteikarte des Naziapparats<br />
ist die Körpergröße seines Vaters<br />
vermerkt. Der Lange maß gar nicht 1,96,<br />
sondern bloß 1,86 Meter. Hans, der Vater,<br />
war nur so groß wie Hans, der Sohn.<br />
Er kommt ihm auch dadurch näher, fast<br />
<strong>auf</strong> Augenhöhe.<br />
Er recherchiert Details, veröffentlicht<br />
Studien. Seine Arbeit bringt ihn in<br />
die Gedenkstätte Deutscher Widerstand,<br />
in der die Rote Kapelle seit 1987 behandelt<br />
wird und zu einem Forschungsschwerpunkt<br />
geworden ist. Er gewinnt<br />
den Eindruck, dass seine Eltern nicht von<br />
Aufträgen aus Moskau lebten, sondern<br />
dass sie von ihren eigenen Gedanken und<br />
Gefühlen angetrieben wurden.<br />
Er findet einen Zettel, den die Widerstandsgruppe<br />
an Hauswände klebte.<br />
Die Nazis hatten in der Ausstellung „Das<br />
Sowjetparadies“ im Berliner Lustgarten<br />
den Feind verächtlich gemacht. Auf dem<br />
Klebezettel stand: „Das Nazi-Paradies –<br />
Krieg – Hunger – Lüge – Gestapo. Wie<br />
lange noch?“<br />
Nur eine Zettelaktion, aber kein Mythos,<br />
kein Gerücht. Und eine Zettelaktion<br />
gegen Hitler ist 1942 sehr viel.<br />
Das Geschichtsbild hat sich verändert.<br />
Die Verräter sind Menschen, die sich von<br />
der Mehrheit in Nazideutschland unterschieden.<br />
Sie waren anders. Hans Coppi<br />
hat Anteil an dem neuen Bild. Er spricht<br />
an Schulen und erzählt den Schülern von<br />
seinen Eltern. Er macht das gern, vor Kindern<br />
fällt es ihm leichter als sonst.<br />
Hans Coppi sitzt an seinem Küchentisch,<br />
<strong>auf</strong> dem Tisch das Foto von<br />
dem Jungen mit dem Blumenstrauß in<br />
der Hand. Wenn seine Eltern nicht mehr<br />
als Verräter verunglimpft werden, bleibt<br />
dann das Heldenbild? „Als Helden und<br />
Märtyrer waren sie mir immer sehr entrückt“,<br />
sagt er.<br />
Jetzt sind sie einfach seine Eltern geworden,<br />
Vater und Mutter.<br />
GEORG LÖWISCH ist<br />
Textchef von <strong>Cicero</strong>. Als<br />
Student in Leipzig fragte er<br />
sich am Coppi-Platz, woher<br />
der Name wohl stammt<br />
Fotos: Privat, Andrej Dallmann (Autor)<br />
48<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
„ Wahrscheinlich<br />
verfügen wir längst<br />
über die richtigen<br />
Waffen gegen die<br />
Krankheit. Nur konnten<br />
wir sie bislang immer<br />
erst dann einsetzen,<br />
wenn es bei den<br />
Betroffenen schon viel<br />
zu spät war “<br />
Der Neurologe Francisco Lopera sucht in den Anden nach<br />
einem Heilmittel gegen Alzheimer, Seite 60<br />
49<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
KANN DENN SPRUDEL SÜNDE SEIN?<br />
Ein Hollywoodstar zwischen den Fronten des Nahostkonflikts: Weil Scarlett Johansson<br />
für die israelische Firma Sodastream warb, wurde die Hilfsorganisation Oxfam sauer<br />
Von SYLKE TEMPEL<br />
Foto: Txema Yeste/Trunk Archive<br />
Zunächst ging es nur um Flaschen.<br />
Scarlett Johansson, 29, ist, wie sie<br />
sagt, „süchtig“ nach Softdrinks.<br />
Nach jenen Erfrischungsgetränken, die in<br />
Plastikflaschen abgefüllt werden, die wiederum<br />
als riesige schwimmende Müllinseln<br />
die Weltmeere verschmutzen. Dass<br />
ihre eher unschuldige Sucht sie zwischen<br />
die Fronten des Nahostkonflikts katapultieren<br />
würde, das hätte die Schauspielerin<br />
wohl nicht für möglich gehalten.<br />
Der Reihe nach. Johansson ist jedenfalls<br />
nicht nur ein Bubble-Junkie, sondern<br />
auch ein umweltbewusster Mensch.<br />
In ihrer Familie gehört es seit jeher zum<br />
Selbstverständnis, sich für die Allgemeinheit<br />
zu engagieren. Botschafterin<br />
für die britische Hilfs- und Entwicklungsorganisation<br />
Oxfam zu werden, war daher<br />
für die amerikanische Schauspielerin<br />
mehr als nur eine Prestigefrage. Es<br />
war eine Möglichkeit, ihre Berühmtheit<br />
zu nutzen, um <strong>auf</strong> Wichtigeres als Hollywood<br />
<strong>auf</strong>merksam zu machen. Auf einer<br />
Reise als Oxfam-Botschafterin nach<br />
Somalia und Äthiopien wurde der Schauspielerin<br />
klar: Das ist keine politische,<br />
sondern eine Umweltkrise. „Ich glaube“,<br />
sagte sie damals, „dass es wichtig ist zu<br />
zeigen, wie sehr sich der Klimawandel<br />
schon <strong>auf</strong> diese Menschen auswirkt.“<br />
Sodastream ist eine umweltbewusste<br />
Firma. Sie macht Plastikflaschen überflüssig,<br />
weil sich mit ihren Geräten aus<br />
Leitungswasser Sprudelwasser herstellen<br />
lässt. Es hätte also eigentlich nicht<br />
besser kommen können: Schauspielerin,<br />
Oxfam-Botschafterin und zweifache<br />
„sexiest woman alive“ wirbt während<br />
des Superbowls – dem größten<br />
US-Sportspektakel, bei dem Millionen<br />
Zuschauer während des Footballspiels<br />
Millionen Liter Softgetränke konsumieren<br />
– lasziv am Strohhalm saugend für<br />
ein umweltfreundliches Produkt.<br />
Hätte. Wäre Sodastream nicht ein<br />
israelisches Unternehmen, das eine<br />
Produktionsstätte in der Westbank-<br />
Siedlung Maale Adumim hat. Was seit<br />
Jahren schon der Fall war, aber niemandem<br />
<strong>auf</strong>fiel, ist, seit Johansson im Januar<br />
das Werbegesicht der Firma wurde, ein<br />
Politikum. Inzwischen ist nämlich die<br />
„Boycott, Divestment and Sanctions“-<br />
Kampagne ins Rollen gekommen, die<br />
zu einem Boykott israelischer Produkte<br />
und Sanktionen gegen Israel <strong>auf</strong>ruft. Einer<br />
der vehementesten Unterstützer dieser<br />
Boykott <strong>auf</strong>rufe ist Oxfam, das 1942<br />
gegründet wurde, um den unter der deutschen<br />
Blockade leidenden griechischen<br />
Kindern zu helfen.<br />
EINE OXFAM-BOTSCHAFTERIN, die für<br />
ein in den Siedlungen hergestelltes Produkt<br />
wirbt? Unmöglich. So wies Oxfam<br />
die Schauspielerin an, ihr Engagement<br />
für Sodastream „noch einmal zu überdenken“.<br />
Hat Johansson auch. Aber mit<br />
für Oxfam unerwartetem Ergebnis: Sodastream<br />
wolle „eine Brücke zum Frieden<br />
zwischen Israel und Palästina bauen“,<br />
teilte sie in einer knappen Presseerklärung<br />
mit. Sie setze sich für eine Zwei-<br />
Staaten-Lösung ein, ebenso sei sie sich –<br />
nicht zuletzt wegen ihrer Arbeit für<br />
Oxfam – bewusst, was Kooperation bewirke.<br />
„In der Fabrik arbeiten Menschen<br />
Seite an Seite, die den gleichen Lohn erhalten<br />
und gleiche <strong>Recht</strong>e genießen.“ Im<br />
Übrigen glaube sie an einen bewussten<br />
Konsum und an Transparenz; „ich vertraue<br />
dar<strong>auf</strong>, dass der Verbraucher die für<br />
ihn richtige Entscheidung treffen wird.“<br />
So ziehe sie es vor, <strong>auf</strong> ihre Tätigkeit als<br />
Oxfam-Botschafterin zu verzichten.<br />
Nun könnte man denken, Johansson<br />
seien schnöde Werbemillionen wichtiger<br />
als ein politisches Gewissen. Oder: Ein<br />
naives Hollywood-Blondchen habe sich<br />
in den Fallstricken des Nahostkonflikts<br />
verfangen und reagiere nun pampig.<br />
Sie habe sich nie besonders für Geld<br />
interessiert, sagt Johansson. Was sich natürlich<br />
leicht sagen lässt, wenn man sehr<br />
jung und schon sehr reich ist. Politisch<br />
naiv aber ist die Tochter eines dänischen<br />
Vaters und einer amerikanischen Mutter<br />
sicherlich nicht. Sowohl die Großmutter<br />
als auch ihre Mutter haben sich ehrenamtlich<br />
in zahlreichen lokalen Ausschüssen<br />
und Stadträten in New York engagiert.<br />
Wählen zu gehen, Klein-Scarlett samt ihrer<br />
fünf Geschwister ins Wahllokal mitzunehmen<br />
und mit dem Nachwuchs über<br />
Politik zu diskutieren, gehörte zum Alltag<br />
in der Familie Johansson. „Wir haben<br />
verstanden, dass Politik wichtig ist, und<br />
wir Verantwortung tragen.“<br />
Wie ihre Eltern und ihre Großmutter,<br />
ist auch Scarlett Johansson das, was<br />
man in den USA einen „Liberal“ und in<br />
Deutschland eine „Linke“ nennt. Sie hat<br />
„mit Leidenschaft“ Wahlkampf gemacht<br />
für die Demokraten – erst für John Kerry,<br />
später auch für Barack Obama. Durch<br />
ihre Berühmtheit habe sie das Glück, die<br />
Aufmerksamkeit <strong>auf</strong> etwas zu lenken,<br />
„was ich wichtig finde. Aber ich habe den<br />
Leuten nie gesagt, was sie wählen sollen.“<br />
Scarlett Johansson ist ein seltenes<br />
Exemplar einer politisch Linken – eine<br />
ohne pädagogischen Anspruch. Eine, die<br />
glaubt, „dass eine Kampagne nicht geeignet<br />
ist, um politische Veränderungen zu<br />
bewirken“. Eine, die Aufmerksamkeit <strong>auf</strong><br />
komplexe Themen lenkt – um deren Bewertung<br />
dann jedem selbst zu überlassen.<br />
Eine, die sich nicht unter Druck setzen<br />
lässt – auch nicht von Oxfam.<br />
SYLKE TEMPEL ist Chefredakteurin der<br />
Zeitschrift Internationale Politik.<br />
Sie schätzt Politik ohne pädagogischen<br />
Anspruch<br />
51<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
HERRN FICOS GESPÜR FÜR MACHT<br />
Er regiert mit absoluter Mehrheit, seine Seilschaften reichen bis in die höchsten<br />
Justizämter. Robert Fico, Premier der Slowakei, will jetzt Staatspräsident werden<br />
Von VINZENZ GREINER<br />
Die Frage musste kommen. Robert<br />
Fico hat sie erwartet. Wie jeder<br />
der Journalisten im Raum. Wie<br />
die ganze Slowakische Republik. Verlöre<br />
er, der mächtige Premier, nicht ein gutes<br />
Stück Macht, wenn er Präsident würde?<br />
Es ist das einzige Mal, dass Fico ungehalten<br />
wird. Er lächelt, lacht beinahe seine<br />
Antwort: „Lesen Sie sich die Verfassung<br />
durch und urteilen Sie dann.“ Der Ton<br />
sagt mehr als die Worte: Darin schwingt<br />
vor allem Freude über seinen Coup, der<br />
ihn zum mächtigsten Mann machen soll,<br />
den es in der Slowakei je gegeben hat.<br />
Nach der Verfassung des Landes<br />
wird der Präsident direkt gewählt, er<br />
vertritt die Slowakei nach außen und ist<br />
Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Gesetzesvorhaben<br />
kann er nur verzögern.<br />
Das Land regieren vor allem der Premierminister<br />
und sein Kabinett – aber das<br />
reicht Fico nicht.<br />
Wer die Strategie dieses Mannes verstehen<br />
will, muss in seine Vergangenheit<br />
blicken. Im Oktober 2011 soll das slowakische<br />
Parlament der Erweiterung des<br />
Euro-Rettungsschirms zustimmen. Ficos<br />
Sozialdemokraten sind damals in der<br />
Opposition. Eigentlich hat er sich für den<br />
Rettungsschirm ausgesprochen. Als aber<br />
klar wird, dass die Regierung keine eigene<br />
Mehrheit hat, ändert Fico seine Linie<br />
und setzt sie in der Partei durch. Das<br />
Nein der Sozialdemokraten zwingt die<br />
Regierung zu Verhandlungen. Fico winkt<br />
die Erweiterung erst durch, als die Regierung<br />
ihm etwas zusagt: Neuwahlen.<br />
Im März 2012 gewinnt er die absolute<br />
Mehrheit im Parlament. Fico ist am Ziel.<br />
Sein Gespür für die Machttektonik und<br />
die Stimmung im Volk hat ihn nicht getäuscht.<br />
Es hat ihn noch nie getäuscht.<br />
Bereits zu Beginn seiner politischen<br />
L<strong>auf</strong>bahn weiß Fico seine Möglichkeiten<br />
kalt abzuwägen. Mitte der Neunziger ist<br />
er einer der Hoffnungsträger der reformierten<br />
kommunistischen Partei, ahnt<br />
aber, dass sie ihm keine Perspektiven bietet.<br />
Er gründet 1999 Smer („Richtung“),<br />
die 2005 als Smer-SD alle linken Parteien<br />
<strong>auf</strong>gesogen haben wird. Ein Jahr<br />
später schmiedet er eine Koalition mit<br />
der rechtsextremen Nationalpartei und<br />
den Nationalkonservativen. Eine Allianz,<br />
die jenseits der slowakischen Grenzen<br />
<strong>auf</strong> Kritik stößt. Die Sozialdemokraten<br />
im EU-Parlament schließen die Smer-<br />
SD aus ihrer Fraktion aus. Fico rührt<br />
das nicht. Er erkennt, dass romafeindliche<br />
Töne und Hetze gegen die ungarische<br />
Minderheit bei den Wählern größere Zustimmung<br />
finden als Europa und Freiheit.<br />
EIN IDEOLOGE IST FICO NICHT. Er erkennt<br />
nur Möglichkeiten und nutzt sie.<br />
Im Fußball brauchen Stürmer dieses Gespür<br />
für Chancen – und Durchsetzungsstärke.<br />
Der fußballbegeisterte Premier<br />
hat beides. Auf dem Platz wie in der Politik<br />
greift er an. Als Kind hat er jede<br />
freie Minute beim Bolzen verbracht.<br />
Heute sagt er: „Fußball ist der Sport eines<br />
Burschen vom Dorf.“<br />
Fico ist der Dorfjunge geblieben. In<br />
ungeschliffenem Slowakisch spricht er<br />
nicht von erfolgreichem Regieren, sondern<br />
von „gemachten Haus<strong>auf</strong>gaben“.<br />
Ständig ist er unterwegs, um Alte zu herzen,<br />
Arbeiterhände zu schütteln und, wie<br />
er sagt, „irgendwelche Grundsteine“ zu<br />
legen. Aus den schwachen ländlichen Regionen<br />
zieht er seine Stärke. Ficos Mantra<br />
von Sicherheit und paternalistischem<br />
Staat bedient die Sehnsüchte vieler Slowaken.<br />
Er versteht die kleinen Leute, er<br />
betrachtet sich als einen der Ihren – einen,<br />
der es geschafft hat.<br />
Gegen Ficos Populismus haben<br />
seine Gegner – Konservative, Intellektuelle<br />
und liberale Medien – kein Mittel<br />
gefunden. Jeder ihrer Angriffe ist am<br />
49-Jährigen abgeprallt. Zwar gibt es ein<br />
Abhörprotokoll, das den Verdacht nahelegt,<br />
Fico sei in den größten Korruptionsskandal<br />
des Landes verwickelt – beweisen<br />
konnte man ihm nichts. Auch dass<br />
Fico zwei seiner Vertrauten in Schlüsselpositionen<br />
des Staates platziert hat – den<br />
einen als Generalstaatsanwalt, den anderen<br />
als Präsidenten des Obersten Gerichtshofs<br />
–, war ganz legal. Ohnmächtig<br />
sehen Ficos Widersacher seiner jüngsten<br />
Volte zu: sein plötzliches Bekenntnis zu<br />
seiner „starken katholischen Prägung“.<br />
Scheinheilig sei das, rufen sie.<br />
Fico verachtet seine Gegner: die Eliten,<br />
die Städter. Er hat nicht vergessen,<br />
wie hart er als zweites von drei Arbeiterkindern<br />
kämpfen musste, um in Bratislava<br />
Jura studieren zu können. Bei den<br />
vermeintlich Privilegierten, denen „Tennis<br />
wichtiger als <strong>Recht</strong>“ war. Wie können<br />
ausgerechnet diese Leute es wagen,<br />
sein „starkes soziales Empfinden“ infrage<br />
zu stellen?, empört er sich. Das ist,<br />
als wäre die gegnerische Mannschaft in<br />
seinen Strafraum eingedrungen – aber er<br />
kontert und beschimpft die Gegner.<br />
Nun die Kehrtwende. Seit Wochen<br />
vermeidet Fico Konfrontationen. Nichts<br />
soll seinen wichtigsten Spielzug gefährden:<br />
Sein Zögling und Vertrauter, Innenminister<br />
Robert Kalinák, steht bereit, die<br />
Regierung in Ficos Sinne weiterzuführen.<br />
Seine Freunde hat er bereits in der Justiz<br />
postiert. Es fehlt nur noch der Einzug in<br />
den Präsidentenpalast. Wenn seine Strategie<br />
<strong>auf</strong>geht, wird er nach dem 15. März<br />
alle Gewalt in der Slowakei – formell<br />
oder informell – in den Händen halten.<br />
VINZENZ GREINER ist Volontär bei<br />
<strong>Cicero</strong>. Als er 2010 in Bratislava studierte,<br />
galt es an der Uni als schick, Robert Fico<br />
herunterzumachen<br />
Foto: Charlie BIBBY/Financial Times/REA/laif<br />
52<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
MUTTER COURAGE<br />
„Meine Kinder“, so nennt Catherine Samba-Panza die verfeindeten Lager in der Zentralafrikanischen<br />
Republik. Als Präsidentin des Übergangs soll sie den Frieden bringen<br />
Von DIRKE KÖPP<br />
Foto: Ugo Lucio Borga/Echo Photo Agency<br />
Sie wird es nicht leicht haben. Die<br />
Welt erwartet von Catherine<br />
Samba-Panza nicht weniger als<br />
ein Wunder: Binnen zwölf Monaten soll<br />
die zentralafrikanische Übergangspräsidentin<br />
ihr Land befrieden, die Menschen<br />
miteinander versöhnen und freie, demokratische<br />
Wahlen organisieren. Sie selbst<br />
wird dann nicht wieder antreten. Das geltende<br />
<strong>Recht</strong> schließt aus, dass die Übergangspräsidentin<br />
selbst kandidiert.<br />
Seit einem Putsch im März 2013<br />
herrscht in der Zentralafrikanischen Republik<br />
die pure Gewalt. Immer wieder<br />
ist von einem Religionskrieg die Rede:<br />
Christen gegen Muslime. Das ist jedoch<br />
nicht präzise.<br />
Catherine Samba-Panzas Land, das<br />
4,5 Millionen Einwohner hat und flächenmäßig<br />
doppelt so groß ist wie Deutschland,<br />
hat viele Bevölkerungsgruppen, die<br />
sich nicht nur durch ihre Religion, sondern<br />
auch kulturell und ethnisch unterscheiden.<br />
Zudem haben das Land seit der<br />
Unabhängigkeit von Frankreich 1960<br />
starke Verwerfungen geprägt – am bekanntesten<br />
ist die Zeit unter dem Diktator<br />
Jean-Bédel Bokassa, der sich 1976<br />
zum Kaiser krönen ließ.<br />
10 bis 15 Prozent der Zentralafrikaner<br />
sind Muslime, die großteils im<br />
vernachlässigten Norden leben. Vor<br />
knapp einem Jahr stürzte ein vornehmlich<br />
muslimisches Rebellenbündnis, die<br />
Seleka, den damaligen Präsidenten. Es<br />
ging nicht um Religion, sondern um die<br />
Ungleichbehandlung einer Region. Gegen<br />
Plünderungen und Gewalt formierten<br />
sich sogenannte Anti-Balaka, Gruppen,<br />
die gegen die Seleka kämpften. Es<br />
kam zu Angriffen und Gegenangriffen,<br />
Racheakten und Kriminalität. Die Milizen<br />
verloren die Kontrolle über ihre Mitglieder,<br />
oft arbeitslose junge Männer, die<br />
jenseits der bewaffneten Gruppen kaum<br />
Perspektiven haben. Mehr als eine Million<br />
Menschen sind inzwischen <strong>auf</strong> der<br />
Flucht. Die Gesellschaft ist entzweit.<br />
Catherine Samba-Panza soll es nun<br />
richten. Die hohen Erwartungen schrecken<br />
die 59-Jährige nicht. Die Mutter<br />
von drei erwachsenen Kindern war in<br />
den vergangenen Monaten Bürgermeisterin<br />
der Hauptstadt Bangui, davor arbeitete<br />
sie als Geschäftsfrau und Anwältin.<br />
Ihr Vater stammt aus Kamerun, die Mutter<br />
aus Zentralafrika. Aufgewachsen ist<br />
sie im Tschad, studiert hat sie in Frankreich.<br />
Samba-Panza ist Christin. Doch<br />
sie scheint auch von Rebellen des Seleka-<br />
Bündnisses anerkannt zu sein. Politisch<br />
gilt sie als relativ unbeschriebenes Blatt.<br />
In der Krise könnte das von Vorteil sein.<br />
SAMBA-PANZA WIRKT pragmatisch und<br />
erfrischend direkt. Sie sagt, was sie denkt.<br />
Mögliche Kritik an der neuen Übergangsregierung<br />
nahm sie vorweg, bevor Namen<br />
oder die politische Zugehörigkeit<br />
der Minister bekannt waren: „Seien wir<br />
realistisch. Wir sind hier in einem politischen<br />
Kontext, da muss man bestimmte<br />
Sensibilitäten und Strömungen beachten.<br />
Wer ausgeschlossen ist, ist frustriert und<br />
fühlt sich vielleicht bewogen, wieder zu<br />
den Waffen zu greifen.“ So war es für<br />
sie nur folgerichtig, dass in ihrem Kabinett<br />
sowohl Anhänger der Anti-Balaka<br />
als auch der Seleka sitzen.<br />
Sie wird sich aber nicht verstecken.<br />
Am Tag ihrer Wahl zur Übergangspräsidentin<br />
trug sie ein Kostüm in schreiendem<br />
Pink – schrill in der Farbe, aber sicher<br />
im Stil.<br />
Misstrauisch machte anfangs das<br />
Wissen, dass Michel Djotodia, der Putschistenführer<br />
vom März 2013, der sich<br />
zum Präsidenten machte und erst unter<br />
internationalem Druck zurücktrat, sie<br />
ins Amt der Bürgermeisterin gebracht<br />
hatte. Doch Samba-Panza erwarb sich<br />
dank ihres Rufes, unbestechlich zu sein,<br />
schnell das Ansehen der Bürger von Bangui.<br />
Auch dass sie sich als Vizepräsidentin<br />
eines Komitees um den politischen<br />
Dialog bemüht und sich für Frauenrechte<br />
eingesetzt hatte, galt als Pluspunkt.<br />
Schon am Tag ihrer Wahl appellierte<br />
die Präsidentin an die bewaffneten Gruppen.<br />
Zwar gab sie sich mütterlich, doch<br />
die Botschaft war klar: „An meine Kinder,<br />
die Anti-Balaka: Legt eure Waffen<br />
nieder, als Reaktion <strong>auf</strong> meine Wahl. Und<br />
an meine Kinder, die Seleka-Rebellen:<br />
Auch ihr sollt die Waffen niederlegen.“<br />
Ihre mütterliche Art allein wird nicht<br />
reichen, um das Land zu befrieden. Das<br />
weiß sie selbst und fordert Unterstützung:<br />
„Die Dinge sind außer Kontrolle geraten,<br />
bevor ich an die Staatsspitze gewählt<br />
wurde. Aber mit der Hilfe der internationalen<br />
Gemeinschaft werden wir Verteidigungs-<br />
und Sicherheitskräfte <strong>auf</strong>stellen,<br />
denen es gelingt, die Ordnung wiederherzustellen.“<br />
Dabei sieht sie auch Berlin<br />
in der Pflicht. „Von Deutschland erwarte<br />
ich eine bedeutende Unterstützung: im<br />
humanitären Sektor, was die Sicherheit<br />
angeht und auch finanziell.“<br />
„Maire Courage“ – Bürgermeisterin<br />
Courage – wurde sie in der frankophonen<br />
Presse bisweilen genannt, in Anspielung<br />
<strong>auf</strong> das im Französischen gleichklingende<br />
Wort für „Mutter“ (mère). Eine „Mutter<br />
Courage“ im Sinne Bertolt Brechts aber<br />
ist sie wohl nicht: Zwar hat Samba-Panza<br />
wie die „Mutter Courage“ drei Kinder<br />
und ist Geschäftsfrau. Dass sie wie die<br />
Theaterfigur mit dem Krieg Geschäfte<br />
macht, ist hoffentlich auszuschließen.<br />
DIRKE KÖPP leitet die Redaktion für das<br />
francophone Afrika bei der Deutschen<br />
Welle. Sie wünscht sich mehr Frauen an<br />
Afrikas Staatsspitzen, die nicht an der<br />
Macht festhalten<br />
55<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
GERNEKLEIN IN DER<br />
MITTE DER WELT<br />
Die Schweiz sieht<br />
sich als bedrohtes<br />
Hirtenvolk. Das Nein<br />
zur Zuwanderung<br />
führt aber auch die<br />
Scheinheiligkeit der<br />
EU vor und zwingt<br />
diese, sich endlich<br />
ehrlich zu machen<br />
Von ADOLF MUSCHG<br />
Die Schweiz ist ein Kleinstaat<br />
– was Fläche und Einwohnerzahl<br />
betrifft. Im<br />
Atlas der Globalisierung<br />
machen sie die Kennzahlen,<br />
die für Handel und Wohlstand von<br />
Belang sind, zur verschwiegenen Großmacht,<br />
deren Bruttosozialprodukt dasjenige<br />
armer Kontinente <strong>auf</strong>wiegt und ihr<br />
Schicksal mitbestimmt. Diese Inkongruenz<br />
hat interessante Folgen für das<br />
Selbstverständnis der Schweizer. Sie fühlen<br />
sich wahlweise – wozu sind sie eine<br />
direkte Demokratie! – als Volk der Hirten<br />
und als professionelle Exportnation,<br />
als Gerneklein und als Mitte der Welt,<br />
und unter allen Umständen als Sonderfall.<br />
Ganz sicher ist nur: Die Wahrnehmung<br />
der andern ist diesem Sonderfall<br />
nicht adäquat. Das gilt besonders für<br />
die Deutschen, die das übliche Nachbarschaftsverhältnis<br />
in Reinkultur darstellen:<br />
Man braucht sie am meisten, und<br />
man will ihnen am wenigsten schuldig<br />
sein. Noch in meiner Kindheit galt die<br />
Regel: Mit Nachbarn redet man über den<br />
Zaun, aber man besucht sie nicht.<br />
Zwischen Deutschen und Schweizern<br />
steht eine lange Geschichte komplizierter<br />
Gemeinsamkeit, die der kleinere<br />
Nachbar – immer wieder zum Erstaunen<br />
des größeren – einseitig verleugnet. Das<br />
56<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
Illustration: Simon Prades<br />
fing keineswegs mit Hitler an und hörte<br />
auch nicht mit ihm <strong>auf</strong>. Dazu gehört auch<br />
der einseitige Besuch: Der Kleine erwartet<br />
ihn, immer in den Grenzen des Tourismus,<br />
aber er erwidert ihn nicht. Es<br />
ist eine neue Entwicklung, dass Busse<br />
voll Schweizer nach Nürnberg <strong>auf</strong> den<br />
Christkindlmarkt, nach Berlin oder gar<br />
an die Ostsee fahren. Der Geografielehrer<br />
ließ uns 1947 darüber abstimmen, ob<br />
wir England oder Deutschland „durchnehmen“<br />
sollten. Der Ausgang war klar:<br />
mit der Folge, dass mir die deutsche Topografie<br />
lange weniger geläufig war als<br />
die australische.<br />
Die freie Wahl des blinden Fleckes,<br />
der die Wahrnehmung ersetzt, gehört zu<br />
den Müsterchen direkter Demokratie, an<br />
denen ich schon als Unmündiger teilnehmen<br />
durfte. Doch Ja-Nein-Entscheidungen<br />
angesichts komplexer Verhältnisse<br />
pflegen schon im Ansatz kindlich zu sein.<br />
Der „Bauch“ hat das letzte Wort, und<br />
man kann nur hoffen, dass die Summe<br />
der Bäuche die Entscheidung des Einzelnen<br />
korrigiert. Oft genug stehen am Ende<br />
die Köpfe, die dazugehören, selbst ratlos<br />
vor dem Resultat, das hinten herausgekommen<br />
ist. Aber es gehört zum Komment<br />
der Demokratie, auch im Kuriosesten<br />
so etwas wie ein Orakel zu erkennen;<br />
man versteht es zwar nicht, aber gültig<br />
bleibt es <strong>auf</strong> jeden Fall.<br />
Die deutsch-schweizerische Beziehung<br />
hat sich durch einen weiteren Faktor<br />
kompliziert: den europapolitischen.<br />
Wie der Schweizer Schriftsteller Peter<br />
Bichsel schon vor Jahren festgestellt<br />
hat: Wenn die Deutschschweizer (nicht<br />
die Romands!) von „Europa“ reden, meinen<br />
sie die Deutschen. Das kam nicht von<br />
ungefähr, als das westliche Deutschland<br />
selbst seine Identität zugunsten Europas<br />
suspendiert hatte. Seit das vereinigte<br />
Deutschland zur faktischen, wenn<br />
auch immer noch widerwilligen Vormacht<br />
der Union geworden ist, gilt es erst<br />
recht. Das Stück deutscher Unbefangenheit,<br />
das seither zurückgekehrt ist, kann<br />
böser Wille leicht mit der Großmannssucht<br />
von vorgestern verwechseln. Die<br />
deutschen Nachbarn sind uns Deutschschweizern<br />
schon als Garanten unserer<br />
Identität unentbehrlich.<br />
Natürlich ist Deutschland davon,<br />
dass wir es im Geografieunterricht nicht<br />
durchnahmen, nicht weggegangen;<br />
Ja-Nein-<br />
Entscheidungen<br />
in komplexen<br />
Fragen pflegen<br />
schon im Ansatz<br />
kindlich zu sein.<br />
Der „Bauch“ hat<br />
das letzte Wort<br />
ebenso wenig geht heute „Europa“ davon<br />
weg, dass wir uns ihm nicht anschließen.<br />
Man möchte sagen: im Gegenteil. Als<br />
neuer Garant schweizerischer Identität<br />
beherrscht es geradezu den Diskurs über<br />
diese, muss allerdings, wie ein Schwarzes<br />
Loch, das uns nicht verschlingen<br />
darf, auch sorgfältig in Rechnung gestellt<br />
sein. Nähme die pragmatische Schweiz<br />
der ideologischen dieses Rechnungswesen<br />
nicht ab, existierten bald beide real<br />
nicht mehr. Nur nimmt der Pragmatismus<br />
die Rücksicht, für das Überhandnehmen<br />
der Vernunft den Notfall abzuwarten,<br />
den die ideologische Schweiz – darf<br />
man sagen: glücklicherweise? – ohnehin<br />
als Normalfall betrachtet.<br />
DIE SCHWEIZ FÜRCHTET gerne das<br />
Schlimmste, um sich zu attestieren, das<br />
Beste daraus gemacht zu haben. In der<br />
Not entdeckt sie ihre Tugend, und der<br />
vorsorglichen Angst entspricht die nachträgliche<br />
Selbstgratulation. Das stimmt<br />
zur Mentalität der Grenzbesetzung, mit<br />
welcher die Volksseele gut gefahren zu<br />
sein glaubt und darum auch so weiterfahren<br />
will, in die beängstigend offene<br />
Zukunft hinein.<br />
So spielt der andere für den Binnenhaushalt<br />
der Exportnation mit ihrer<br />
Fremdenindustrie eine zugleich ungeliebte<br />
und tragende Rolle. Die Schweiz<br />
hat mehr europapolitisch relevante<br />
Volksabstimmungen hinter sich als jedes<br />
EU-Land. Die meisten resultierten, willig<br />
oder nicht, in der Anerkennung unserer<br />
Zugehörigkeit zu Europa – mit Ausnahme<br />
der grundsätzlichen.<br />
Eine institutionelle Zugehörigkeit<br />
zum europäischen Wirtschaftsraum hat<br />
die Blocher-Partei 1992 fast im Alleingang<br />
(nicht ohne grünen Zuzug) erledigt<br />
und die Regierung zum Anzetteln eines<br />
komplizierten „bilateralen“ Vertragswerks<br />
genötigt, bei dessen Zustandekommen<br />
man, im Vertrauen <strong>auf</strong> die eigenen<br />
Trümpfe wie die Gotthard-Passage, den<br />
Goodwill der Gegenseite nicht allzu nötig<br />
zu haben glaubte.<br />
Politisch wollte die Fiktion kultiviert<br />
sein, dass die eigene Seite immer noch<br />
selbstbestimmt agiere. Dazu fanden sich<br />
denkwürdige Formulierungen wie diejenige<br />
eines Bundesrats, „man müsse beitrittsfähig<br />
sein, um nicht beitreten zu<br />
müssen“ – bei Ulbricht hieß das: den<br />
Klassenfeind überholen, ohne ihn einzuholen.<br />
Solche Finessen waren unumgänglich,<br />
nachdem die Regierung in einer<br />
unvorsichtigen Stunde ein Beitrittsgesuch<br />
in Brüssel hinterlegt hatte; danach<br />
musste sie für das Eis besorgt sein, <strong>auf</strong><br />
welches das Projekt gelegt werden wollte.<br />
Um ein Eidgenosse zu bleiben, musste der<br />
Bundesrat schwören, den verhängnisvollen<br />
Schritt nur getan zu haben, um ihn<br />
nicht wirklich tun zu müssen.<br />
Dass er davon nicht glaubwürdiger<br />
wurde, war die innenpolitische Marktchance<br />
der Nationalkonservativen, die<br />
sie weidlich nutzten: Sie bekamen den<br />
Schatten kostenlos geliefert, gegen den<br />
sie wählerwirksam boxen konnten. Der<br />
globale Unternehmer Christoph Blocher<br />
an ihrer Spitze trieb das Doppelspiel,<br />
das er Wirtschaft und Regierung<br />
<strong>auf</strong>gezwungen hatte, bei weitem pfiffiger<br />
als diese. Als besserem Patrioten<br />
(ausgesprochen) und besserem Unternehmer<br />
(unausgesprochen) hatte ihm<br />
die verachtete „Classe politique“ eine<br />
57<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
Win-win-Situation beschert, die er am<br />
9. Februar dazu verwendete, den Regierenden<br />
auch das Verhandlungskunstwerk<br />
der „Bilateralen“ aus der Hand zu schlagen,<br />
das sie sich ohne seine Opposition<br />
hätten sparen können.<br />
EINE HAUCHDÜNNE MEHRHEIT des<br />
Stimmvolks erteilte gut demokratisch<br />
der „politischen Klasse“ und ihrer Wirtschaft<br />
– und außerdem der EU und der<br />
ganzen Welt – eine Lektion. Sie räumte<br />
<strong>auf</strong> unter denen, die unliebsame Tatsachen<br />
personifizieren und ihr Unglück, an dem<br />
wir nicht schuld sein wollen, bei uns einschleppen.<br />
Brauchen wir Fremde, die den<br />
nationalen Lebensraum unsicher machen,<br />
Züge verstopfen, Betonwüsten verbreiten,<br />
heimische Sitten verderben, kinderreiche<br />
Familien nachziehen, unsere Sozialwerke<br />
belasten? „Dichte stress“ – es ist das hässliche<br />
Gesicht der Globalisierung, zu dem<br />
man als guter Schweizer nur Nein sagen<br />
kann, darum stimmt man gegen „Masseneinwanderung“.<br />
Wer täte es nicht?<br />
Diesmal fühlt man sich in Gesellschaft<br />
der Anständigen aller Länder. Sie<br />
applaudieren denn auch in den „sozialen<br />
Medien“ und gratulieren den Schweizern,<br />
die wenigstens gefragt werden müssen,<br />
zu ihrer mutigen Entscheidung. Die<br />
Enteigneten, in ihrem Anspruch <strong>auf</strong> Heimat<br />
im eigenen Land Verhöhnten drohen,<br />
sich die Schweiz zum Muster zu nehmen.<br />
Schon bei den Europawahlen im Mai werden<br />
sie es ihren ohnmächtig Mächtigen<br />
zeigen: So geht es nicht weiter!<br />
Das dumpfe Gefühl ist ja nur zu berechtigt,<br />
dass die laut Thomas L. Friedman<br />
„flache Welt“ ihren Bewohnern Raum und<br />
Zeit stiehlt, dass sie ein Feind des Heimischen<br />
und Einheimischen ist. Da man<br />
ihrem Überhandnehmen keine Grenzen<br />
setzen kann, verlangt man, dass es wenigstens<br />
vor den eigenen Grenzen haltmache.<br />
Gerade aus der Verzweiflung an seiner<br />
Unerfüllbarkeit zieht dieser Wunsch<br />
seine Legitimation – und seine Aggressivität.<br />
Sie muss blind sein, um nicht zu sehen,<br />
dass sie selbst Teil des Problems ist,<br />
dessen Abschaffung sie verlangt – im Bild<br />
des Fremden, des anderen, den man wenigstens<br />
ausschaffen kann.<br />
Faktisch zeigt eine Abstimmung wie<br />
diejenige gegen „Masseneinwanderung“<br />
nicht nur ein fast genau in der Mitte gespaltenes<br />
Volk. Sie spaltet auch nicht nur<br />
Für die<br />
verfolgte Unschuld<br />
ist es quasi<br />
befreiend, zur<br />
verfolgenden zu<br />
werden<br />
die urbane Schweiz von der ländlichen<br />
oder die französische Schweiz von der<br />
deutschen (und italienischen) – was für<br />
den Zusammenhalt der Schweiz schon fatal<br />
genug wäre, auch wenn das die triumphierende<br />
„Volkspartei“ einstweilen<br />
nicht kümmert. Die Spaltung geht vielmehr<br />
durch jeden einzelnen Stimmbürger,<br />
und das Nein, mit dem er sie leugnet,<br />
ist eine Form von Autoaggression, denn<br />
da ist ja keiner, gerade in der hoch begünstigten<br />
Schweiz, der an der verdammten<br />
Globalisierung nicht partizipierte.<br />
Aber nur ihre Verlierer bekommen<br />
die Ungleichheit, die sie produziert, als<br />
leibhafte Entwürdigung zu spüren. Sie<br />
reagieren <strong>auf</strong> eine Bedrohung, die sie<br />
nicht verdient haben, und drohen zurück;<br />
für die verfolgte Unschuld ist es quasi befreiend,<br />
zur verfolgenden zu werden und<br />
Schuldige dingfest zu machen. Nicht nur<br />
in der Physik setzt die Kernspaltung unkontrollierbare<br />
Energie frei. In der Politik<br />
wirkt sie als polarisierende Kraft und<br />
fließt demjenigen zu, der die Spaltung in<br />
der Realität fortzusetzen weiß. Die Teilung<br />
der Welt in Schwarz und Weiß, Gut<br />
und Böse, wir und sie ist das wirksamste<br />
Verfahren, Schwäche in Stärke – oder<br />
ihre Illusion – zu transformieren. Wird<br />
die Grenze nach außen verlagert, lässt<br />
sie die eigene Grenze vergessen. Auf andere<br />
einzuschlagen, ist die beste Anästhesie<br />
in eigener Sache. Wo mein Revier<br />
<strong>auf</strong> dem Spiel steht, darf ich herzlos sein,<br />
da ist Hassen nicht nur geboten, sondern<br />
erlaubt. Der gerechte Hass ersetzt eine<br />
untragbare Realität durch eine übersichtliche.<br />
Wer diese eine Fiktion nennt, wird<br />
als Feind behandelt.<br />
NATÜRLICH SCHAFFEN FIKTIONEN ihre<br />
eigene Realität. Man kann als Schweizer<br />
eine Art melancholische Genugtuung<br />
empfinden, wenn – nach dem weltweiten<br />
Kopfschütteln über das Minarettverbot –<br />
eine schweizerische Volksabstimmung im<br />
Ausland ernst genommen wird. Bald steht<br />
der Schweiz die nächste ins Haus, welche<br />
eine noch schärfere Begrenzung der Zuwanderung<br />
verlangt, und die Geschlagenen<br />
vom 9. Februar trösten sich mit der<br />
Hoffnung, dass der Beelzebub des Neins<br />
zur „Masseneinwanderung“ wenigstens<br />
den Teufel der „Ecopop“-Initiative wirksam<br />
ausgetrieben habe. Diese nämlich<br />
stellt die Personenfreizügigkeit grundsätzlich<br />
und für alle Länder infrage. Sie<br />
steht <strong>auf</strong> dem Standpunkt, dass die weltweite<br />
Migration nicht erst ihre Zielländer<br />
belaste, sondern vor allem ihre Ursprungsgebiete.<br />
Die Armutsflüchtlinge<br />
gehörten zu jener immer noch vergleichsweise<br />
privilegierten Gruppe, die sich<br />
überhaupt bewegen könne, und gerade<br />
ihr Potenzial würde zu Hause am dringendsten<br />
benötigt. Vor Ort in ihre Entwicklung<br />
zu investieren, sei vernünftiger,<br />
billiger und ökologisch verantwortlicher,<br />
als das weltweite Ungleichgewicht durch<br />
Völkerwanderungen zu verstärken, die<br />
Armut der Ursprungsländer irreparabel<br />
zu machen und die Zielländer mit unlösbaren<br />
Integrationsproblemen zu belasten.<br />
Das ist gewiss diskutabel – und sprengt<br />
ebenso gewiss den Rahmen und die Kapazität<br />
eines einzelnen Landes. Diesmal darf<br />
man – zuversichtlich oder bedauernd – unterstellen,<br />
dass in der Schweiz keine Mehrheit<br />
dafür zu finden ist.<br />
Aber wie wäre es, wenn die Europäische<br />
Union den Stachel, den ihr die<br />
58<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Anzeige<br />
Eine elegante<br />
Sammlung<br />
Illustration: Simon Prades; Foto: Picture Alliance/dpa<br />
nationalkonservative Bedrohung ins<br />
Fleisch setzt, zur Wiederbelebung ihres<br />
eigenen Projekts verwendete? Seine<br />
friedenspolitische Grundlage bedarf<br />
dringend einer Auffrischung, wenn die<br />
jüngeren Generationen durch eigene Erfahrung<br />
erleben sollen, wovon Europa<br />
handelt, und wofür es sich eigentlich<br />
vereinigt hat. Die Anzeichen, dass die<br />
Verwaltung des Status quo nicht mehr<br />
genügt, häufen sich, und dass man mit<br />
Regulieren und Deregulieren keine Bürgerherzen<br />
gewinnt, bedarf keiner Ausführung<br />
mehr. Wachstum ins Weite und<br />
Breite ist als Raison d’être nicht ausreichend<br />
tragfähig.<br />
Dass eine im Kern egoistische und<br />
opportunistische Maxime nicht ausreicht,<br />
um die Mitgliedstaaten zusammenzuhalten,<br />
ganz im Gegenteil, belegt die Misere<br />
der PIIGS – um die Schuldnerstaaten Portugal,<br />
Italien, Irland, Griechenland und<br />
Spanien mit jener abscheulichen Kürzel<br />
zu belegen, die über ihre Gläubiger mehr<br />
aussagt als über sie. Sollte nächstens ein<br />
F wie Frankreich mitbuchstabiert werden<br />
müssen, ginge der EU mehr verloren<br />
als ein kleiner Sprachwitz: Es könnte<br />
dem Bündnis sogar sein historischer Sinn<br />
abhandenkommen.<br />
Wie, wenn es die Nord-Süd-Spaltung,<br />
die es im Lebendigsten, seiner Glaubwürdigkeit,<br />
bedroht, durch eine einvernehmliche<br />
Arbeitsteilung ersetzte, indem sich<br />
die Mitglieder nicht nur mit verschiedener<br />
Geschwindigkeit, sondern auch<br />
in verschiedene, durch ihre Geschichte<br />
vorgezeichnete Richtungen bewegten?<br />
Wenn es seine unerledigten Geschäfte<br />
in Afrika oder im Nahen Osten dort<br />
wieder <strong>auf</strong>nähme, wo sie der Kolonialismus<br />
liegen und seine Hinterbliebenen<br />
im Stich gelassen hat? Das „chinesische<br />
Afrika“ ist längst Realität: Muss sich das<br />
Engagement Europas <strong>auf</strong> punktuelle militärische<br />
Interventionen beschränken?<br />
Muss die „Mittelmeerunion“ so tot bleiben,<br />
wie sie das deutsche Veto leider gemacht<br />
hat? Könnte sie nicht bewirken<br />
helfen, dass arabische Frühlinge kommen,<br />
ohne gleich wieder zu gehen? Hat<br />
Europa im Nahen Osten nicht einen Unfrieden<br />
hinterlassen, dem es politische<br />
Nacharbeit schuldig ist?<br />
Der Ostseerat hat einen Brückenschlag<br />
über historische Klüfte angefangen,<br />
wie er vor einem halben Jahrhundert in<br />
Westeuropa gelungen ist. Hier wie dort<br />
ist die Interessengemeinschaft nicht nur<br />
ökonomisch, sondern kulturell begründet.<br />
Darum lebt sie wieder <strong>auf</strong> und beweist<br />
Zukunftsfähigkeit. Die Ukraine würde<br />
zwanglos ein europäisches Land, wenn sie<br />
nicht mehr zwischen der EU oder Russland<br />
wählen müsste. Und St. Petersburg<br />
ist nicht weniger europäisch als Venedig,<br />
so wahr Russland nicht nur ein europäisches<br />
Land ist – auch das hat es übrigens<br />
mit England und Portugal gemeinsam.<br />
Oder auch mit der Schweiz. Eine EU,<br />
die ihrerseits die Grenzen dichtmacht,<br />
hat dem gernekleinen Land nichts vorzuwerfen.<br />
Das Flüchtlingselend vor Lampedusa<br />
oder in der Ägäis wird durch einen<br />
Exzess ratlos-verschämten Mitleids<br />
nicht gelindert. Ehrlich machen könnte<br />
es sich nur durch das europäische Engagement<br />
in den Herkunftsländern des<br />
Elends, statt dieses – etwa durch eine<br />
rein egoistische Agrarpolitik – weiter<br />
zu verschulden.<br />
DIE SCHWEIZ hat mit ihrem Votum Fragen<br />
<strong>auf</strong>geworfen, die sie nicht allein<br />
beantworten kann; gerade das hat sie<br />
mit der EU gemeinsam. Auch diese benötigt<br />
einen neuen Umgang mit ihren<br />
Grenzen. Es wäre eine schöne List der<br />
Vernunft, wenn das Votum der Schweiz<br />
Anlass gäbe, dass sich die Europäische<br />
Union den Fragen, die sie nicht beantwortet,<br />
stellt.<br />
Dann führte die Union das weiter,<br />
was Jean Monnet einmal beginnen<br />
wollte: nicht mit Kohle und Stahl, sondern<br />
bei der Kultur. Kultur soll heißen:<br />
sensibler Umgang mit dem andern, denn<br />
im andern steckt immer das Beste – und<br />
das Schlimmste – von uns selbst. Darum<br />
ist der andere der verleugnete, aber zuverlässige<br />
Maßstab und Treuhänder unserer<br />
Identität. In der Fiktion, mit der<br />
das eidgenössische Stimmvolk die andern<br />
von sich fernhalten will, steckt so<br />
viel Wahres, dass es mit Abmahnung<br />
nicht getan ist. Sie wäre als Reaktion<br />
fast so kurzsichtig wie ein Glückwunsch<br />
zum schweizerischen Eigen-Sinn.<br />
ADOLF MUSCHG ist<br />
einer der renommiertesten<br />
Autoren der Schweiz. Zuletzt<br />
erschien sein Essay-Band „Im<br />
Erlebensfall“ ( C. H. Beck )<br />
Der Original-<strong>Cicero</strong>-Sammelschuber<br />
JETZT<br />
BESTELLEN!<br />
Nur 15,– Euro*<br />
Die exklusive Art, einen kompletten Jahrgang<br />
<strong>Cicero</strong> <strong>auf</strong>zubewahren: Der stabile, in Brillianta-<br />
Leinen gefasste Sam melschuber trägt <strong>auf</strong> den<br />
Seiten und <strong>auf</strong> dem Rücken das elegante<br />
<strong>Cicero</strong>-Logo.<br />
Ich bestelle Expl. des Sammelschubers<br />
für nur 15,– Euro* pro Exemplar.<br />
*Preis zzgl. 2,95 Euro Versandkosten. Angebot und Preis gelten im Inland,<br />
Auslandspreis <strong>auf</strong> Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Ich bezahle bequem per Bankeinzug.<br />
Kontonummer<br />
BLZ<br />
Geldinstitut<br />
Hier direkt bestellen:<br />
Telefon: 030 3464656 56<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/shop<br />
Geburtstag<br />
Nr.<br />
Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.<br />
Ja, ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich<br />
künftig per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags informieren.<br />
Vorstehende Einwilligung kann durch Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder<br />
postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 544103<br />
59<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Reportage<br />
DIE RETTUNG<br />
DES VERSTANDES<br />
Wie kann Alzheimer besiegt werden? In abgeschiedenen<br />
Bergdörfern der kolumbianischen Anden erkrankt jeder<br />
zweite Mensch an dem Hirnleiden. Dort wagt ein Neurologe<br />
ein kompliziertes, aber vielversprechendes Experiment<br />
Von CLAAS RELOTIUS<br />
60<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Laura, 16, versorgt<br />
seit einem Jahr ihre<br />
Mutter. Die ist <strong>auf</strong><br />
37 Kilo abgemagert,<br />
kann das Bett nicht<br />
verlassen. Diagnose:<br />
Alzheimer im<br />
Endstadium. Der Vater<br />
ist bereits infolge der<br />
Krankheit gestorben
WELTBÜHNE<br />
Reportage<br />
Vielleicht kann schwarzer Humor<br />
nicht schaden <strong>auf</strong> dieser<br />
Reise zu einer tödlichen<br />
Krankheit. Also lehnt sich<br />
der Neurologe Francisco<br />
Lopera vom Beifahrersitz nach hinten<br />
und erzählt einen Witz. „Sagt ein Arzt<br />
zum Patienten: Es tut mir leid, aber Sie<br />
haben Krebs und Alzheimer. Antwortet<br />
der Patient: Ich verstehe, na immerhin<br />
kein Krebs!“<br />
Seine vier Forschungsassistenten<br />
im schaukelnden Jeep ringen sich ein<br />
Schmunzeln ab. Sie sind angespannt an<br />
diesem Tag, <strong>auf</strong> den sie mehr als zehn<br />
Jahre hingearbeitet haben. Er ist der Auftakt<br />
für eine Reihe von Tests und Studien,<br />
an deren Ende sie das zu finden hoffen,<br />
was Wissenschaftler <strong>auf</strong> der ganzen Welt<br />
seit Jahrzehnten suchen – ein Mittel im<br />
Kampf gegen Alzheimer.<br />
Das Hochland von Antioquia, vier<br />
Autostunden von Kolumbiens zweitgrößter<br />
Metropole Medellín entfernt, zieren<br />
steile Berge und saftiges Grün. Echte<br />
Straßen gibt es nicht, also ruckelt der<br />
Geländewagen im Schneckentempo das<br />
2400 Meter hohe Tal hin<strong>auf</strong>, nach ganz<br />
oben, dorthin, wo die Paísa wohnen. Die<br />
weit abgeschieden von der städtischen<br />
Zivilisation lebenden Andenbauern sollen<br />
als Testpersonen dienen für Medikamente,<br />
die eines Tages Alzheimer hinauszögern<br />
oder sogar verhindern könnten.<br />
Was die Paísa für den Neurologen<br />
Francisco Lopera, 62, und sein Team der<br />
Universität von Antioquia so interessant<br />
macht: In vielen Dörfern wird jeder<br />
Zweite von ihnen schon mit Anfang 40<br />
von erblicher Demenz dahingerafft. Es<br />
ist eine besonders tragische und seltene<br />
Form der Alzheimer-Krankheit, gerade<br />
6000 Fälle sind weltweit bekannt. Allein<br />
5000 davon in den Bergen Kolumbiens,<br />
wo sich der Gendefekt, der die Krankheit<br />
auslöst, innerhalb weit verzweigter Familienclans<br />
über drei Jahrhunderte so unbemerkt<br />
verbreiten konnte, dass Experten<br />
heute von der „Paísa“-Mutation sprechen.<br />
Auf der Passhöhe lichtet sich der<br />
Morgennebel. Der Blick fällt <strong>auf</strong> endlose<br />
Täler und eine bunt bemalte Finca<br />
am Gipfel. Das Zuhause der Familie Poscero,<br />
seit Jahrzehnten im Hochland verwurzelt<br />
und seit Generationen von einem<br />
Leiden verfolgt, das die Paísa bis heute<br />
la bobera, die Torheit, nennen, weil es<br />
Inmitten der endlosen Täler von<br />
Antioquia steht die Finca der<br />
Posceros. Seit Generationen<br />
leiden die Familienmitglieder an<br />
der Krankheit, die Einheimische<br />
la bobera, die Torheit, nennen<br />
den Menschen den Verstand zu rauben<br />
scheint. Oscar Poscero, der mit leerem<br />
Blick in einem Schaukelstuhl vor dem<br />
Haus sitzen bleibt, während sein alter Vater<br />
die Forscher mit einer Umarmung begrüßt,<br />
war erst 39 und stand in der Mitte<br />
seines Lebens, als es passierte.<br />
ES BEGANN MIT KLEINEN DINGEN. An<br />
manchen Tagen vergaß er die Kühe zu<br />
melken, an anderen erinnerte er sich<br />
nicht mehr an die Namen der Bauern, mit<br />
denen er Geschäfte machte. Eines Morgens<br />
brachte er seine kleine Tochter Valeria<br />
zur Schule in das Nachbardorf und<br />
verschwand. Die Bauern fanden ihn zwei<br />
Nächte später in einem Kartoffelfeld hockend,<br />
die Arme so krampfhaft über seinem<br />
Kopf verschränkt, als würde sich darin<br />
ein schmerzhafter Kampf abspielen.<br />
Als sie Oscar wieder nach Hause fuhren,<br />
stand sein Vater Don Eligio mit bibberndem<br />
Kinn in der Tür und wusste Bescheid.<br />
Er hatte es schon bei seiner Frau<br />
sowie zwei anderen Söhnen und Töchtern<br />
erlebt. Vor Oscar waren bereits<br />
vier seiner neun Kinder bobo geworden.<br />
Sie alle sind mittlerweile tot. Nur seine<br />
74-jährige Frau Berta, die er rund um die<br />
Uhr pflegen muss, ist noch am Leben.<br />
Aus ihrer Familienlinie stammt das<br />
Gen, das, dominant vererbt, jedem zweiten<br />
Nachkommen die Krankheit bringt.<br />
Eine seltene Mutation <strong>auf</strong> Chromosom 14<br />
ist schuld, dass schon ihr Vater und Großvater<br />
an Alzheimer litten. Jetzt hat es Oscar,<br />
ihren letzten Sohn, getroffen. Wird<br />
dessen Schwester Olga, 38, das jüngste<br />
Kind Bertas und Don Eligios, die Nächste<br />
sein?<br />
Doktor Lopera, der die Familie<br />
schon seit Jahren begleitet, weiß es nicht,<br />
und wenn, dann würde er es nicht sagen.<br />
Zu wichtig ist für seine Studie, dass keine<br />
der Testpersonen Phantom-Merkmale einer<br />
Krankheit entwickelt, an der sie womöglich<br />
gar nicht leidet.<br />
Olga, langes Haar, tiefbraune Augen,<br />
ist eine von 300 noch gesunden<br />
Paísa im Alter von 30 bis 60 Jahren, die<br />
sich bereit erklärt haben, an den Versuchen<br />
teilzunehmen, und deren Körper für<br />
Lopera „medizinische Schatzkammern“<br />
sind. Der Grund: Viele von ihnen tragen<br />
das Gen in sich und werden in absehbarer<br />
Zeit erkranken. Das ist für die Betroffenen<br />
tragisch, aber es bedeutet auch:<br />
Erstmals lassen sich vorbeugende Alzheimer-Wirkstoffe<br />
an Patienten testen,<br />
lange bevor bei diesen Symptome der<br />
Demenz <strong>auf</strong>treten.<br />
Neurologen weltweit sind sich einig,<br />
dass sich hierdurch die Erfolgschancen<br />
Fotos: Claas Relotius für <strong>Cicero</strong> (Seiten 60 bis 62)<br />
62<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
um ein Vielfaches erhöhen, da bei Alzheimer<br />
die ersten Veränderungen im<br />
Gehirn bereits Jahre vor dem erkennbaren<br />
Ausbruch der Krankheit einsetzen.<br />
„Wenn wir <strong>auf</strong> diese Weise ein Mittel finden,<br />
das bei Olga und den anderen anschlägt<br />
und der Demenz vorbeugt, dann<br />
muss das gleiche Mittel mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
auch bei der klassischen<br />
Alzheimer-Form wirken“, sagt Lopera.<br />
Ausgerechnet das schwere Schicksal<br />
der Paísa könnte der Wissenschaft zum<br />
Durchbruch verhelfen und in Zukunft<br />
Millionen Menschen <strong>auf</strong> der ganzen Welt<br />
vor der Krankheit bewahren.<br />
Doch die Tests sind nicht ohne Risiken.<br />
In den USA erlitten Teilnehmer<br />
vergleichbarer Studien bereits Nervenschäden<br />
und Hirnhautentzündungen,<br />
ihre Zeugungsfähigkeit nahm ab, einige<br />
starben. Olga will das nicht hören. „Hört<br />
<strong>auf</strong>!“, unterbricht sie Lopera, als dieser<br />
sie mit seinen Assistenten ein letztes Mal<br />
<strong>auf</strong>klären will. „Was habe ich denn davon,<br />
wenn ich lebe und irgendwann auch<br />
den Verstand verliere wie mein Bruder?“<br />
Alzheimer ist eine tückische, tragische<br />
Krankheit. Was ist es für ein Gefühl,<br />
diese ein Leben lang wie einen dunklen<br />
Fels, der jede Erinnerung und nicht zuletzt<br />
die eigene Persönlichkeit begraben<br />
wird, <strong>auf</strong> sich zurollen zu sehen?<br />
OLGA HAT SICH ENTSCHIEDEN, dagegen<br />
anzukämpfen. Während ihr Großvater<br />
unruhig vor der Finca <strong>auf</strong> und ab geht,<br />
verstauen Loperas Assistenten die Tasche<br />
mit Olgas Kleidern im Wagen. Das Team<br />
ist gekommen, um sie abzuholen und in<br />
die Stadt zu bringen. In die Uniklinik<br />
von Medellín, wo sie die nächsten Wochen<br />
bleiben und schon bald den ersten<br />
Wirkstoff bekommen wird. Crenezumab<br />
heißt das Medikament. Es wird unter die<br />
Haut gespritzt und soll die Bildung von<br />
Plaques um das Protein Beta-Amyloid im<br />
Gehirn verhindern, da diese zum langsamen<br />
Absterben der Nervenzellen führen.<br />
Experten vermuten, dass hierin der<br />
Ursprung von Alzheimer liegen könnte.<br />
„Wahrscheinlich verfügen wir längst<br />
über die richtigen Waffen gegen die<br />
Krankheit“, sagt Lopera. „Nur konnten<br />
wir sie bislang immer erst dann einsetzen,<br />
Vor 31 Jahren begann der<br />
Neurologe Francisco Lopera mit<br />
seiner Forschung. Heute sagt er:<br />
„Wahrscheinlich verfügen wir längst<br />
über die richtigen Waffen gegen<br />
die Krankheit. Nur konnten wir sie<br />
bislang immer erst dann einsetzen,<br />
wenn es bei den Betroffenen schon<br />
viel zu spät war“<br />
wenn es bei den Betroffenen schon viel<br />
zu spät war.“ Es ist kein Zufall, dass von<br />
„Waffen“ die Rede ist, wenn Lopera<br />
über Medikamente spricht. Die Suche<br />
nach einem Mittel gegen Alzheimer ist<br />
ein Kampf, über dem sein einst dunkles<br />
Haar schlohweiß wurde und der ihn<br />
schon sein ganzes Forscherleben antreibt.<br />
Er begann vor 31 Jahren.<br />
Lopera hatte gerade erst sein Studium<br />
beendet und eine Stelle als Assistenzarzt<br />
angenommen, als eine Frau aus<br />
dem Hochland mit ihrem Mann in seine<br />
Sprechstunde kam und um Hilfe bat. Der<br />
Mann war erst 50, doch verwirrt wie ein<br />
Greis. Er nässte ein, konnte <strong>auf</strong> Fragen<br />
nach seinem Namen keine Antwort geben<br />
und schien jede Kontrolle über seinen<br />
Körper verloren zu haben. Lopera<br />
wurde stutzig. Es waren alle Symptome<br />
einer Demenz vorhanden, aber wie<br />
konnte diese so früh <strong>auf</strong>treten? Als die<br />
Frau des Mannes beiläufig erwähnte, dies<br />
sei nicht der erste Fall in der Familie, und<br />
es habe in jeder Generation mehrere Verrückte<br />
gegeben, beschloss der Arzt, dem<br />
Phänomen <strong>auf</strong> den Grund zu gehen.<br />
Er fuhr in die Berge, befragte ganze<br />
Clans nach ihren Verwandten und verbrachte<br />
jeden freien Tag bei den Bauern,<br />
um ihre Hirnleistung zu testen. Die meisten<br />
Menschen, die er besuchte, wussten<br />
Foto: Todd Heisler/The New York Times/Redux/laif<br />
63<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
WELTBÜHNE<br />
Reportage<br />
nichts von einer Krankheit. Sie glaubten<br />
an einen bösen Fluch und sprachen vom<br />
„Geist von Antioquia“, der von ihren Angehörigen<br />
Besitz ergreife.<br />
Viele Bauernhöfe lagen so abgeschieden,<br />
dass Lopera sie erst nach stundenlanger<br />
Reise zu Fuß oder zu Pferd erreichte.<br />
Das hielt ihn aber genauso wenig<br />
ab wie die Kämpfer der Farc, die sich in<br />
den achtziger Jahren noch zu Tausenden<br />
im Hochland versteckten. Eines Tages<br />
entführten ihn fünf bewaffnete Guerilleros.<br />
Er fürchtete nicht um sein Leben,<br />
sondern allein um die Blutplasma-Proben<br />
und Aufzeichnungen, die er gemacht<br />
hatte. „Macht mit mir, was ihr wollt“,<br />
sagte er, „doch sorgt dafür, dass alles<br />
davon in die Stadt kommt.“<br />
Zwei Tage später, die Entführer hatten<br />
die Proben in einem Bach gekühlt,<br />
nahm einer von ihnen Lopera die Fesseln<br />
ab und sagte, er müsse unbedingt weiterarbeiten.<br />
Sein jüngerer Bruder, keine<br />
40 Jahre alt, werde vom „Geist von Antioquia“<br />
verfolgt und nur er, der Doktor,<br />
der den Geist jage, könne ihm helfen.<br />
ES DAUERTE ZEHN JAHRE, bis Lopera<br />
mit seinen Nachforschungen zu einem<br />
eindeutigen Befund kam. Was ihm half,<br />
waren die Kirchenbücher von Yarumal,<br />
einer kleinen Paísa-Gemeinde nördlich<br />
Eines Morgens brachte Oscar<br />
Poscero seine kleine Tochter<br />
Valeria zur Schule in das<br />
Nachbardorf und verschwand.<br />
Zwei Tage später fanden ihn<br />
Bauern orientierungslos und völlig<br />
verwirrt in einem Kartoffelfeld<br />
von Medellín. Im Pfarrhaus fand er eine<br />
Kiste mit Dokumenten, durch die Lopera<br />
sämtliche Geburten, Eheschließungen<br />
und Sterbefälle über Jahrhunderte bis<br />
ins Detail zurückverfolgen konnte. Beim<br />
Blick <strong>auf</strong> die Stammbäume wurde deutlich:<br />
Alle 25 Familien, in der die bobera<br />
regelmäßig <strong>auf</strong>tauchte, gingen aus Javier<br />
San Pedro Gómez und María Luisa Chavarriaga<br />
Mejía hervor, einem Paar spanischer<br />
Abstammung, das 1757 in Yarumal<br />
heiratete. Für Lopera ließ dies nur<br />
einen Schluss zu: Die Krankheit, von der<br />
er glaubte, sie sei Alzheimer, musste erblich<br />
und somit genetisch bedingt sein.<br />
Die Straße von Medellín nach Yarumal<br />
gleicht einer Spirale, die sich steil<br />
ins Hochland windet. Matasanos, „tötet<br />
Gesunde“, nennen sie die Einheimischen,<br />
weil jeden Monat Fahrzeuge durch die<br />
Begrenzungszäune krachen und ins Tal<br />
stürzen. Die Verunglückten stammen fast<br />
immer von außerhalb. Den Menschen aus<br />
Yarumal fehlt das Geld für Autos.<br />
Rund 30 000 Bauern leben hier, und<br />
die meisten sind arm. Die erbliche Alzheimer-Krankheit,<br />
die sich an keinem anderen<br />
Ort Antioquias so dicht ausbreiten<br />
konnte wie in Yarumal, hat auch ihre<br />
wirtschaftlichen Spuren hinterlassen.<br />
Kinder müssen ihre Eltern pflegen, Eltern<br />
ihre Kinder. Zeit für den Besuch einer<br />
Schule oder die Arbeit <strong>auf</strong> den Feldern<br />
bleibt wenigen. Hinzu kommt die psychische<br />
Belastung. Viele, die sich gleich<br />
um mehrere Angehörige kümmern, leiden<br />
an Depressionen, sind alkoholabhängig.<br />
Andere nehmen sich schon in jungen<br />
Jahren das Leben, um der Krankheit<br />
zuvorzukommen.<br />
Lopera sagt: „Wer 20 oder 30 wird,<br />
für den werden die Zweifel meist unerträglich.“<br />
Schon die alltägliche Vergesslichkeit<br />
werde häufig als dunkle Vorbotin<br />
der Krankheit interpretiert. Sogar Kinder<br />
und Jugendliche fragten sich: Wie viel<br />
Zeit bleibt mir noch? Wer wird mich einmal<br />
pflegen?<br />
Die 16-jährige Laura hat noch <strong>auf</strong><br />
keine dieser Fragen eine Antwort. In einer<br />
einfachen Holzhütte am Rande Yarumals<br />
lebend, muss sie vor allem sehen,<br />
wie sie ihre Familie über die Runden bekommt.<br />
Vor der Baracke verk<strong>auf</strong>t sie<br />
Foto: Claas Relotius für <strong>Cicero</strong><br />
64<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Guten Tag, Frau Ministerin. Hallo,<br />
Herr Ministerialrat. Grüß Gott,<br />
liebes Mitglied des Bundestages.<br />
Moin, Herr Hauptgeschäftsführer,<br />
und einen guten Tag, liebe Mitbürger.<br />
Wir haben etwas ganz<br />
Besonderes für Sie: Tagesspiegel<br />
Agenda. Der erste Lokalteil für die<br />
Berliner Republik – nur dienstags<br />
in der Sitzungswoche und nur im<br />
Tagesspiegel.<br />
Ab sofort bekommen Sie im Tagesspiegel noch mehr Hintergründe aus Parlament und Politik. In jeder Sitzungswoche<br />
des Bundestages erscheint am Dienstag Tagesspiegel Agenda. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, raten wir<br />
zu einer Eingabe an unsere Abonnement-Abteilung. Sie wird unbürokratisch bearbeitet und garantiert positiv beschieden.<br />
leserservice@tagesspiegel.de · Tel: (030) 290 21- 290 47 · tagesspiegel.de/abo-agenda
WELTBÜHNE<br />
Reportage<br />
täglich Holzschmuck an vorbeifahrende<br />
Händler. Das Geschäft bringt wenig ein,<br />
aber es erlaubt Laura, immer zu Hause<br />
zu sein. Bei ihrem kleinen Bruder Lucos,<br />
9, der zur Schule geht. Vor allem<br />
aber bei ihrer Mutter Roselia, die seit einem<br />
Jahr das Bett nicht mehr verlassen<br />
hat und kaum mehr in der Lage ist, ein<br />
Wort zu sprechen. Wie ein ängstliches<br />
Kind, die Decke bis zum Hals hochgezogen,<br />
liegt die 40-Jährige <strong>auf</strong> einer Pritsche<br />
in der Hütte und starrt mit <strong>auf</strong>gerissenen<br />
Augen an die Wand. Ihre Mutter<br />
sei früher eine schöne und kräftige Frau<br />
gewesen, erzählt Laura. Heute wiege sie<br />
noch 37 Kilo. Die Ärzte nennen es die<br />
„dritte und letzte Phase“, Alzheimer im<br />
Endstadium.<br />
Laura, die für ihr Alter erstaunlich<br />
reif wirkt, erzählt, dass sie sich manchmal<br />
zu ihrer Mutter legt und ihr von Neuigkeiten<br />
berichtet. „Auch wenn ich weiß,<br />
dass sie niemals reagieren wird.“ Dass<br />
Kinder schon in jungen Jahren ihre Eltern<br />
verlieren, ist in Yarumal keine Ausnahme.<br />
Wenn ihre Mutter stirbt, werden<br />
Laura und ihr Bruder Vollwaisen sein.<br />
Den Vater hat ihnen die Krankheit schon<br />
genommen. Bei ihm, einem Taxifahrer,<br />
ging es ganz schnell. Mit Ende 30, sagen<br />
die Nachbarn, verfuhr er sich plötzlich<br />
immer häufiger in der Gemeinde. Ein<br />
Jahr später war er tot.<br />
Seine Gehirnmasse lagert heute<br />
im Labor der Universität von Antioquia<br />
in Medellín. Loperas Team konnte<br />
in den vergangenen 20 Jahren mehr als<br />
200 Paísa-Familien überreden, die Gehirne<br />
ihrer verstorbenen Angehörigen<br />
der Wissenschaft zu spenden. Einige werden<br />
in Formalin <strong>auf</strong>bewahrt, die meisten<br />
in meterhohen Eisschränken. Schicksale,<br />
für die Ewigkeit heruntergekühlt <strong>auf</strong> minus<br />
80 Grad Celsius und mit großer Bedeutung<br />
für die Nachwelt. Solange ein<br />
Mensch lebt, ist Alzheimer nur eine Diagnose.<br />
Echte Gewissheit lässt sich allein<br />
durch die Analyse offenliegender Hirnstrukturen<br />
erlangen.<br />
Anhand der gespendeten Organe<br />
konnte Lopera vor einigen Jahren zeigen,<br />
dass sich bei allen Verstorbenen genau<br />
jene eiweißhaltigen Plaques <strong>auf</strong> den<br />
Nervenzellen im Gehirn abgelagert hatten,<br />
die ein Jahrhundert zuvor schon<br />
Alois Alzheimer als typische Merkmale<br />
der Krankheit beschrieb. Erst damit war<br />
„Wir wollen<br />
nicht, dass die<br />
Paísa sich in<br />
ihrer Not<br />
ausgebeutet<br />
fühlen“<br />
Francisco Lopera<br />
der Beweis erbracht, dass es sich bei dem<br />
erblichen Leiden der Andenbauern um<br />
Alzheimer handelt.<br />
Seitdem ist die internationale Forschergemeinde<br />
<strong>auf</strong> die Paísa und ihre<br />
besondere genetische Veranlagung <strong>auf</strong>merksam<br />
geworden. Rund 5000 Kilometer<br />
nördlich von Antioquia, in Phoenix,<br />
Arizona, hatten Wissenschaftler des Banner<br />
Alzheimer’s Institute schon seit Jahrzehnten<br />
nach Menschen mit genetisch<br />
bedingter Demenz gesucht. Amerikas<br />
führendes Forschungslabor für Alzheimer-Prävention<br />
ist heute der wichtigste<br />
Förderer der 100 Millionen Dollar teuren<br />
Studie in Medellín.<br />
Mittels Gentests konnte Loperas<br />
Team ermitteln, wer die Mutation in<br />
sich trägt und wer nicht. 100 Teilnehmer,<br />
die Träger der Mutation sind, erhalten<br />
nun den Wirkstoff, 100 weitere<br />
mit den gleichen Erbanlagen nur ein Placebo.<br />
Hinzu kommt eine Kontrollgruppe<br />
aus 100 Paísa, die die Mutation nicht tragen,<br />
es aber nicht wissen und ebenfalls<br />
ein Placebo erhalten, um keine Rückschlüsse<br />
<strong>auf</strong> andere Familienmitglieder<br />
zuzulassen. Parallel dazu werden 150<br />
ältere Menschen in den USA, die eine<br />
erhöhte Wahrscheinlichkeit mitbringen,<br />
bald an Alzheimer zu erkranken, mit<br />
den gleichen Medikamenten behandelt.<br />
Es sei wichtig, dass die Chancen und Risiken<br />
mit Familien in den USA geteilt<br />
werden, sagt Lopera. „Wir wollen nicht,<br />
dass die Paísa sich in ihrer Not ausgebeutet<br />
fühlen.“<br />
Die Studie soll fünf Jahre lang l<strong>auf</strong>en.<br />
Die Leiter des Banner Alzheimer’s<br />
Institute hoffen schon nach zwei bis drei<br />
Jahren <strong>auf</strong> erste Ergebnisse. Es geht<br />
vor allem um die Frage, ob und inwieweit<br />
sich die Hirnleistung der Probanden<br />
im direkten Vergleich zueinander<br />
verschlechtert.<br />
Lopera ist zuversichtlich, dass einer<br />
der insgesamt 18 Wirkstoffe, die im<br />
L<strong>auf</strong>e der Studie zum Einsatz kommen<br />
könnten, den Amyloid-Befall im Gehirn<br />
der Patienten stoppen und damit auch die<br />
Krankheit hinauszögern oder gar verhindern<br />
werde. Doch was, wenn die winzigen<br />
Plaques um das Protein Beta-Amyloid<br />
überhaupt nicht die Auslöser von<br />
Alzheimer sind? „Dann wissen wir zumindest,<br />
dass wir in einer Sackgasse stecken<br />
und ganz von vorn anfangen müssen<br />
– auch das wäre in gewisser Hinsicht<br />
ein Erfolg“, sagt Lopera.<br />
Ein Sonntagnachmittag in Yarumal.<br />
Zwei Dutzend Menschen, vor allem<br />
Alte und Kinder, ziehen mit Gitarrenmusik<br />
und einem blumenverzierten Sarg<br />
durch die Straßen. Es ist die Totenfeier<br />
für eine Frau, die mit 46 Jahren der Alzheimer-Krankheit<br />
erlegen ist. Der Zug<br />
marschiert <strong>auf</strong> einen großen, hölzernen<br />
Torbogen zu, der am Ortseingang erbaut<br />
wurde. Er stammt von einem Mann, der<br />
bei allem Leid bis heute den ganzen Stolz<br />
der Menschen in Yarumal begründet. Die<br />
kleine, abgeschiedene Gemeinde hat einen<br />
85-jährigen Sohn, den die ganze Welt<br />
kennt: Der große Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger<br />
Gabriel García<br />
Márquez hat hier einen Teil seiner Jugend<br />
verbracht. Er ließ vor knapp zwei<br />
Jahren ein Heiligenkreuz und die Aufschrift<br />
„Möge der Geist von Antioquia<br />
eines Tages Heilung erfahren und für immer<br />
ruhen“ in den Bogen eingravieren.<br />
Es sollte den Menschen seiner Heimat<br />
Hoffnung geben.<br />
Danach wurde es seltsam still um<br />
den Autor. <strong>Kein</strong>e Bücher, keine Auftritte<br />
im Fernsehen, keine Interviews in Zeitungen<br />
mehr. Im Herbst 2012 brach sein<br />
Bruder das Schweigen und erklärte: Es<br />
sei Zeit für Kolumbien, sich von seinem<br />
Nationalhelden zu verabschieden – Gabriel<br />
García Márquez leide an Alzheimer.<br />
CLAAS RELOTIUS ist<br />
Reporter. Er verbrachte neun<br />
Tage im kolumbianischen<br />
Hochland, um das Leben<br />
der Paísa zu erkunden<br />
Foto: Philipp Wieland<br />
66<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
„ Meine Langhaarige<br />
k<strong>auf</strong>te die Tomaten – und<br />
ich die Gärtnerei “<br />
Heinz Schelwat, Unternehmer aus Trappenkamp in Schleswig-<br />
Holstein, erklärt, wie er zum Algenzüchter wurde, Seite 72<br />
67<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
DER MACHTWÄCHTER<br />
Ob Biertrinker oder Brillenträger – der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt<br />
schützt die Verbraucher. Nun nimmt er sich ein Staatsunternehmen vor: die Bahn<br />
Von CAROLA SONNET<br />
Foto: Marcus Gloger für <strong>Cicero</strong><br />
Man kennt sich, man hilft sich.<br />
Diese rheinische Weisheit ist<br />
auch dem gebürtigen Bonner<br />
Andreas Mundt geläufig. In seiner Funktion<br />
als Präsident des Bundeskartellamts<br />
stellt diese Mentalität für ihn allerdings<br />
ein Problem dar. Denn wenn sich Konkurrenten<br />
zu gut kennen und sich durch<br />
Preisabsprachen zu sehr helfen, ist der<br />
Wettbewerb in Gefahr, den Andreas<br />
Mundt schützen soll. Die von ihm geleitete,<br />
in Bonn ansässige Behörde verhängt<br />
dazu Bußgelder gegen Kartelle,<br />
kontrolliert Fusionen und schreitet ein,<br />
wenn Unternehmen ihre Marktmacht<br />
missbrauchen.<br />
Dabei wirkt Deutschlands oberster<br />
Wettbewerbshüter überhaupt nicht wie<br />
ein harter Hund. Mundt lacht sehr gerne<br />
und bezeichnet sich selbst als positiven<br />
Menschen. Wenn er erzählt, hört man<br />
aber, wie ernst er seine Aufgabe nimmt.<br />
Er kann hartnäckig sein, wenn es dar<strong>auf</strong><br />
ankommt.<br />
Aktuell sorgt Mundt für Schlagzeilen,<br />
weil er ein Missbrauchsverfahren gegen<br />
die Deutsche Bahn eingeleitet hat. Die<br />
Bundesbehörde nimmt sich nun ein Unternehmen<br />
vor, das zu 100 Prozent dem<br />
Bund gehört.<br />
„Wir wollen wissen, warum die Kunden<br />
in der Regel im Bahnhof keine Tickets<br />
der Wettbewerber k<strong>auf</strong>en können.<br />
Das gilt besonders für den Fernverkehr“,<br />
sagt er. Denn hier beherrscht die Deutsche<br />
Bahn 98 Prozent des Marktes, im<br />
Nahverkehr sind es ebenfalls über 70 Prozent.<br />
„Ohne den Zugang zum Fahrkartenverk<strong>auf</strong><br />
funktioniert der Wettbewerb<br />
<strong>auf</strong> der Schiene nicht. Denn viele Leute<br />
k<strong>auf</strong>en ihre Fahrkarten nach wie vor erst,<br />
wenn sie in den Bahnhof kommen.“<br />
Die Deutsche Bahn argumentiert,<br />
die Lufthansa müsse schließlich auch<br />
keine Tickets von Easyjet und Ryanair<br />
an ihren Schaltern verk<strong>auf</strong>en. Doch der<br />
Vergleich ist schief, weil die Lufthansa<br />
auch nicht alleinige Eigentümerin der<br />
Flughäfen ist und jede Fluggesellschaft<br />
ihre Kunden in der Schalterhalle ohne<br />
Einschränkungen bedienen kann: „Genau<br />
das funktioniert an deutschen Bahnhöfen<br />
nicht“, sagt Mundt, da die Bahn<br />
eben nicht ausreichend über den Wettbewerb<br />
reguliert werde.<br />
MUNDTS CREDO heißt daher: Wettbewerb<br />
ist der beste Verbraucherschutz.<br />
Manchmal zweifelt er daran, ob diese<br />
Botschaft in der breiten Öffentlichkeit<br />
der Konsensrepublik Deutschland schon<br />
überall angekommen ist: „Man tut hier<br />
immer so, als sei Wettbewerb nur eine<br />
Frage des survival of the fittest: Der<br />
Starke überlebt, der Schwache stirbt.<br />
Diese Ansicht habe ich nie geteilt.“ Für<br />
ihn ist Wettbewerb ein Spiel, bei dem<br />
sich die Teilnehmer gegenseitig anspornen.<br />
Und er ist der Schiedsrichter.<br />
Die Aufgabe von Mundt und seinen<br />
340 Mitarbeitern, die gesamte deutsche<br />
Wirtschaft zu kontrollieren, scheint<br />
<strong>auf</strong> den ersten Blick riesig, aber Kronzeugenregelungen<br />
und anonyme Informanten<br />
erleichtern die Arbeit der Wettbewerbshüter.<br />
Das Kartellamt arbeitet<br />
effizient und trifft für eine deutsche Behörde<br />
verhältnismäßig schnelle Entscheidungen<br />
dank flacher Hierachien.<br />
Trotz seiner Macht ist Mundt bescheiden<br />
geblieben. Seit vier Jahren steht<br />
er an der Spitze des Amtes, ernannt vom<br />
damaligen Wirtschaftsminister Rainer<br />
Brüderle. Er war der erste Präsident, der<br />
nicht direkt aus dem Wirtschaftsministerium<br />
kam, sondern sich schon vorher jahrelang<br />
als Experte im Amt profiliert hatte.<br />
Beruflich hat es der Kartellamtschef<br />
weit gebracht – geografisch eher<br />
nicht. Er hat in Bonn Jura studiert und<br />
als Referent für die FDP-Fraktion gearbeitet.<br />
Vor 14 Jahren fing er beim Kartellamt<br />
an. Mit seiner Frau und den beiden<br />
Töchtern wohnt der 53-Jährige in<br />
Bad Godesberg.<br />
In einem der schönsten Büros der<br />
Stadt, in der Villa des ehemaligen Bundespräsidialamts<br />
am Rhein, in dem schon<br />
Theodor Heuss seinen Amtsgeschäften<br />
nachging, sinniert Mundt heute über die<br />
Instrumente, die er gegen Wettbewerbsverstöße<br />
in der Hand hat. „Es wird immer<br />
Absprachen geben“, sagt er. Auch<br />
mit höheren Strafen könne man Kartelle<br />
nie ganz verhindern. „Aber mit unserer<br />
Arbeit in den vergangenen Jahren ist das<br />
Thema so nach vorne gerückt, dass viele<br />
sich das inzwischen echt gut überlegen.“<br />
Bußgelder in dreistelliger Millionenhöhe<br />
haben eine abschreckende Wirkung:<br />
Das Bier-Kartell: 106,5 Millionen<br />
Euro. Das Brillengläser-Kartell: 115 Millionen<br />
Euro. Das Kaffeeröster-Kartell:<br />
160 Millionen Euro. Die Teilnehmer<br />
dieser Hardcore-Kartelle trafen weitreichende<br />
Vereinbarungen über Preise, Gebiete,<br />
Kunden und Verk<strong>auf</strong>squoten. „Das<br />
sind die schädlichsten Formen, weil die<br />
Auswirkungen <strong>auf</strong> die Verbraucher so<br />
gravierend sind“, sagt Mundt.<br />
Der Bahn droht zwar kein Bußgeld,<br />
aber auch ein Missbrauchsverfahren<br />
kratzt am Image. An anderer Stelle profitiert<br />
das Staatsunternehmen sogar gerade<br />
von Mundts Arbeit. Das Amt hat ein<br />
Kartell von Schienenherstellern <strong>auf</strong>gedeckt.<br />
Dadurch kann die Bahn Schadenersatz<br />
von den beteiligten Unternehmen<br />
verlangen. Bei weiter Auslegung auch ein<br />
Fall von: Man kennt sich, man hilft sich.<br />
CAROLA SONNET ist ebenfalls gebürtige<br />
Bonnerin, hat als Wirtschaftsjournalistin<br />
aber auch schon außerhalb ihrer<br />
Heimatstadt gearbeitet<br />
69<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
MEISTERIN DES EXPERIMENTS<br />
Was wirkt gegen Krankheit und Armut? Esther Duflo testet das systematisch. Anfangs<br />
stieß ihre Methodik <strong>auf</strong> Widerstand. Nun wird sie für den Nobelpreis gehandelt<br />
Von CHRISTINE MATTAUCH<br />
Klein. Frau. Französin. In der von<br />
großen, meist männlichen Egos<br />
geprägten Welt der amerikanischen<br />
Ökonomen ist Esther Duflo exotisch.<br />
Zumal sie über Armut forscht – für<br />
ehrgeizige US-Jungakademiker ähnlich<br />
attraktiv wie beten.<br />
Aber Duflo hat die Außenseiterdisziplin<br />
Entwicklungsökonomie mit ihrer<br />
Arbeit revolutioniert. Bill Gates liest ihre<br />
Bücher, Weltbank-Chef Jim Yong Kim gehört<br />
zu ihren Fans – und U2-Sänger Bono<br />
gratulierte persönlich zum 10. Jubiläum<br />
des von Duflo gegründeten Poverty Action<br />
Lab am Massachussets Institute of<br />
Technology im vergangenen Dezember.<br />
Das Besondere an Duflo ist, dass sie<br />
in einem vorher von Theoretikern und<br />
Ideologen beherrschten Fach einfache<br />
Fragen stellt und mit empirischen Experimenten<br />
die Antworten liefert: Wie verbessere<br />
ich den Impfschutz in indischen<br />
Dörfern? Wie stoppe ich die Verbreitung<br />
von Malaria? Was muss ich machen, damit<br />
mehr Schüler in Kenia die Schule<br />
besuchen?<br />
Für ihre Experimente wendet Duflo<br />
eine seit Jahrzehnten in der Arzneimittelforschung<br />
bewährte Methode an, Zufallstests<br />
mit Kontrollgruppen. Sie teilt<br />
die Bevölkerung einer Region in zwei<br />
Gruppen ein, die eine bekommt die „Behandlung“<br />
– geschenkte Moskitonetze,<br />
Gratisimpfungen oder neue Schulbücher<br />
–, die Kontrollgruppe muss dafür<br />
bezahlen oder bekommt gar keine Behandlung,<br />
je nach Ausgestaltung des Versuchs.<br />
Auf diese Weise kann Duflo messen,<br />
ob Spenden und Hilfsmaßnahmen<br />
überhaupt wirken. Das ist ziemlich <strong>auf</strong>wendig<br />
und unbequem – und führt immer<br />
wieder zu überraschenden Ergebnissen.<br />
Ein Test in Kenia ergab, dass ausgerechnet<br />
Wurmkuren das beste Mittel waren,<br />
um den Schulbesuch von Kindern zu<br />
fördern – die Impfungen brachten mehr<br />
als kostenlose Schulbücher oder Zusatzlehrer.<br />
In Indien war es ein geschenktes<br />
Paket Linsen, das die Eltern dazu brachte,<br />
ihre Kinder zur Impfstation zu bringen.<br />
Bei den Moskitonetzen stellte sich heraus,<br />
dass die Gruppe, die sie gegen einen<br />
Gutschein umsonst in der Apotheke bekam,<br />
am häufigsten die Netze benutzte<br />
und außerdem bereit war, ein Jahr später<br />
weitere Netze zu k<strong>auf</strong>en. In den Kontrollgruppen,<br />
die nur einen Rabatt erhielten,<br />
besorgten sich viel weniger der Probanden<br />
überhaupt ein Netz. Mit dem Experiment<br />
war widerlegt, dass geschenkte<br />
Netze nicht benutzt würden und eine Almosenmentalität<br />
förderten.<br />
DUFLO SAGT SELBSTBEWUSST: „Wir beenden<br />
das Rätselraten über die Wirksamkeit<br />
von Hilfsmaßnahmen.“ In der Entwicklungshilfecommunity<br />
hat sie sich<br />
mit ihrer Methode anfangs allerdings<br />
nicht besonders beliebt gemacht. NGOs<br />
waren beleidigt, dass sie ihre gut gemeinten<br />
Hilfsprogramme anzweifelte und<br />
warfen ihr vor, sie mache Menschen zu<br />
Versuchskaninchen. Dabei ging es Duflo<br />
immer nur darum, knappe Mittel effizient<br />
einzusetzen – gerade in der Hilfe<br />
für die Armen. Deswegen widerspricht<br />
sie auch dem Mantra von Jeffrey Sachs,<br />
lange Zeit der Entwicklungshilfepapst<br />
von der New Yorker Columbia University,<br />
Armut lasse sich nur mit mehr Geld<br />
wirksam bekämpfen. In Vorträgen präsentiert<br />
sie dazu gerne ein Chart, das<br />
zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt pro<br />
Kopf in Afrika seit 50 Jahren beinahe<br />
konstant geblieben ist, obwohl die Entwicklungshilfe<br />
immer weiter steigt.<br />
Schon als Kind sah sich die Tochter<br />
einer Pariser Intellektuellenfamilie<br />
mit Armut konfrontiert: Ihre Mutter<br />
Violaine, eine Kinderärztin, half bei<br />
Projekten in der Dritten Welt. „Armut<br />
erschien mir als das größte Problem der<br />
Welt“, sagt Duflo. Als sie 1998 ans MIT<br />
kam und Abhijit Banerjees Vorlesungen<br />
über Entwicklungsökonomie hörte, war<br />
das für sie Erleuchtung und Berufung zugleich.<br />
Banerjee ist heute ihr Lebensgefährte<br />
und Mitbegründer des Poverty Action<br />
Lab, das inzwischen als weltweites<br />
Netzwerk mit fast 100 Wissenschaftlern<br />
in 54 Ländern vertreten ist.<br />
Bei der Feier zum Jubiläum des Instituts<br />
sitzt Duflo still in der ersten Reihe:<br />
schwarze Jeans, schwarzer Blazer, wie<br />
üblich kein Schmuck. Es ist ihr Tag, sie<br />
könnte strahlen und triumphieren, aber<br />
sie steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist<br />
eher unprätentiös. Später <strong>auf</strong> der Bühne,<br />
gefragt nach ihrem größten Erfolg, antwortet<br />
sie nur: „Kaum jemand stellt noch<br />
infrage, dass unsere Methode funktioniert.“<br />
Ihre zahlreichen Auszeichnungen,<br />
wie die „John Bates Clark Medal“,<br />
die in der Zunft als Warteschleife für den<br />
Nobelpreis gilt, oder ihre Bücher, die in<br />
der französischen Heimat Bestseller sind,<br />
erwähnt die 41-Jährige gar nicht.<br />
Was sie viel mehr beschäftigt: Beim<br />
Kampf um öffentliche Mittel hat sie einen<br />
schweren Stand, weil ihre Tests mehrere<br />
Jahre dauern – zu lange für Amtsträger,<br />
die Wählern schnelle Erfolge präsentieren<br />
wollen: „Wir müssen uns <strong>auf</strong> das Timing<br />
der Politik einstellen und überlegen,<br />
wie wir trotzdem zum Zuge kommen<br />
können.“ Da hilft es, dass sie einen guten<br />
Draht zu Bill Gates hat, dem Duflos<br />
datenbasierter Ansatz von Anfang an gefiel.<br />
Schon nach dem ersten Treffen sagte<br />
er zu ihr: „Wir müssen dich fördern.“<br />
CHRISTINE MATTAUCH traf Duflo bei<br />
der Jubiläumsfeier des Poverty Action Lab<br />
in Boston<br />
Foto: Ryan Pfluger/AUGUST<br />
70<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
72<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Reportage<br />
WER IST DER<br />
MITTELSTAND?<br />
Die Politik umgarnt ihn, das Ausland beneidet uns<br />
um „The Mittelstand“. Was will er? Welcher Geist<br />
eint ihn? Eine Reise vom findigen Algenzüchter<br />
in Trappenkamp über den Mainzer Schuhputzmittel-<br />
Millionär bis zum Perfektionisten am Tegernsee,<br />
der Hollywood mit Papier beliefert<br />
Von TIL KNIPPER<br />
Illustration MIRIAM MIGLIAZZI & MART KLEIN<br />
73<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Reportage<br />
Die 3300 versammelten Mittelständler<br />
hängen an den<br />
Lippen von Gregor Gysi.<br />
Es ist Mitte Februar, der<br />
Bundesverband der mittelständischen<br />
Wirtschaft hat zum Neujahrsempfang<br />
geladen. Der große Saal<br />
des Berliner Maritim-Hotels ist bis <strong>auf</strong><br />
den letzten Platz gefüllt. Gregor Gysi,<br />
angekündigt als Oppositionsführer im<br />
Bundestag, steht <strong>auf</strong> der Bühne und gefällt<br />
sich. Was für eine Geschichte! Die<br />
deutsche Linke und der deutsche Mittelstand,<br />
die Klassenfeinde von gestern, die<br />
Freunde von heute. Gysi sagt: „Wenn ich<br />
Ihnen das 1990 prophezeit hätte, hätten<br />
Sie mich in die Psychiatrie einweisen lassen,<br />
und ich hätte mich wahrscheinlich<br />
nicht mal dagegen gewehrt.“<br />
Er nennt seine Partei die letzte überlebende<br />
Mittelstandspartei im Bundestag.<br />
Gelächter. Er kritisiert die Rente mit 63<br />
und fordert, dass in Zukunft auch Selbstständige<br />
und Beamte in die Rentenversicherung<br />
einzahlen sollen. Beifall. Er plädiert<br />
für eine Reform des Schulsystems,<br />
die Absenkung der Stromsteuer und eine<br />
Wirtschaftspolitik, die nicht nur die Interessen<br />
der Konzerne und ihrer Lobbyisten<br />
im Blick hat. Donnernder Applaus,<br />
der länger anhält als bei seinen<br />
Vorrednern, dem Kanzleramtschef Peter<br />
Altmaier, dem EU-Kommissar Günther<br />
Oettinger und dem Außenminister<br />
Frank-Walter Steinmeier.<br />
Auch der Gastgeber sieht zufrieden<br />
aus. Mario Ohoven ist der Präsident des<br />
Mittelstandsverbands, dunkler Anzug,<br />
Hemd mit weißem Kragen und Manschetten,<br />
das Einstecktuch farblich <strong>auf</strong><br />
die Krawatte abgestimmt. Neben ihm in<br />
der ersten Reihe sitzt seine Frau Ute, bekannt<br />
als Charitylady und Unesco-Botschafterin.<br />
Ohoven, 67, hat Bankk<strong>auf</strong>mann<br />
gelernt. Als Anlageberater für<br />
Steuersparmodelle verdiente er Millionen.<br />
Jetzt leitet er einen Verband, der<br />
nach eigenen Angaben 270 000 Unternehmer<br />
vertritt. Wenn Deutschlands<br />
Mittelständler kleine Fürsten sind, dann<br />
ist Ohoven ihr Kaiser.<br />
An diesem Tag hält er im Maritim-<br />
Hotel Hof. Die kleine Geste liegt ihm<br />
nicht so, er bevorzugt den dramatischen<br />
Auftritt, um Aufmerksamkeit zu erheischen.<br />
Befragt nach seiner Motivation,<br />
hat er einmal gesagt: „Es geht mir darum,<br />
Definition Mittelstand<br />
Der Mittelstand ist<br />
wahlweise das Rückgrat<br />
oder das Herz der<br />
deutschen Wirtschaft,<br />
eine eindeutige Definition<br />
des Begriffs gibt es aber<br />
nicht. Nach den Regeln<br />
des Instituts für Mittelstands<br />
forschung in Bonn<br />
zählen zum Mittelstand<br />
alle Unternehmen, die<br />
weniger als 500 Mitarbeiter<br />
beschäftigen und<br />
deren Umsatz unter<br />
50 Millionen Euro liegt.<br />
Auf EU-Ebene dürfen es<br />
dagegen nur 250 Mitarbeiter<br />
sein<br />
dass der Mittelstand in Deutschland die<br />
Anerkennung bekommt, die er verdient.“<br />
Wenn Ohoven das Wort ergreift und<br />
ausmalt, in welcher Gefahr der deutsche<br />
Mittelstand schwebt, klingt das etwa so<br />
alarmiert, als drohe die Erde mit einem<br />
anderen Planeten zusammenzustoßen.<br />
Schleichende Deindustrialisierung, steigende<br />
Sozialabgaben, explodierende<br />
Energiekosten. Und die Eurokrise erst:<br />
Wenn Deutschland dieses Problem einfach<br />
weiter vor sich herschiebe, ruft<br />
Ohoven in den Saal, seien alle anderen<br />
Probleme, wie der drohende Fachkräftemangel,<br />
die Nachfolgeprobleme bei Mittelständlern,<br />
die hohe Abgabenlast oder<br />
die Rentengeschenke der Bundesregierung<br />
gar nicht mehr relevant. „Bei einer<br />
drohenden Entwertung des Euro hilft nur<br />
noch beten.“<br />
Vielleicht passt Gysi so gut hierher,<br />
weil es der Linkspartei auch traditionell<br />
um Anerkennung geht und weil für sie<br />
das Glas auch eher halb leer ist.<br />
Aber kann das stimmen? Wie real bedrohlich<br />
ist die Lage des Mittelstands?<br />
Wie wenig Anerkennung wird ihm tatsächlich<br />
entgegengebracht? Was ist sein<br />
einender Geist?<br />
Die Litanei des Präsidenten Ohoven<br />
passt eigentlich gar nicht zum weltweit<br />
verbreiteten Image des „German Mittelstand“,<br />
der Begriff wird ja längst als<br />
Lehnwort <strong>auf</strong> Englisch, Französisch und<br />
Spanisch verwendet. Der deutsche Mittelstand<br />
gilt als krisenfest, anpassungsfähig,<br />
flexibel, traditionsbewusst, innovativ,<br />
lokal in der Region verwurzelt. Die<br />
Firmen sind Weltmarktführer im eigenen<br />
Segment, hochspezialisiert und international<br />
unterwegs.<br />
Spätestens seit der Finanzkrise soll<br />
der Mittelstand außerdem die bessere<br />
Form des Kapitalismus sein. Anders als<br />
die börsennotierten Großkonzerne, die<br />
quartalsweise die Gier ihrer Aktionäre<br />
bedienen müssen, denken Deutschlands<br />
inhabergeführte Familienunternehmen<br />
aus dem Mittelstand in Generationen.<br />
Wenn es sein muss, sponsern sie an ihrem<br />
Standort auch den Fußballverein<br />
oder spendieren das Spanferkel beim Fest<br />
der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist nur<br />
ein Bruchteil der gängigen Klischees über<br />
den Mittelstand, die deswegen aber noch<br />
lange nicht falsch sein müssen.<br />
DIE BEDEUTUNG für die deutsche Wirtschaft<br />
ist groß. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums<br />
gehören<br />
über 99 Prozent aller Unternehmen in<br />
Deutschland zum Mittelstand, zusammen<br />
erzielen sie mehr als die Hälfte der<br />
Wertschöpfung. Sie stellen 60 Prozent<br />
aller Arbeitsplätze und beschäftigen<br />
83 Prozent aller Auszubildenden.<br />
Aber Zahlen sind bei den Definitionsversuchen<br />
des Begriffs Mittelstand<br />
nicht alles: „Der Mittelstand ist viel stärker<br />
ausgeprägt durch seine Gesinnung<br />
und Haltung im gesellschaftswirtschaftlichen<br />
und politischen Prozess“, sagte<br />
1956 schon Ludwig Erhard. Da verwundert<br />
es auch nicht, dass sich selbst konzernartige<br />
Familienunternehmen wie<br />
der Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen,<br />
der Schraubenkönig Würth in Künzelsau<br />
oder der Dübelhersteller Fischer<br />
im schwäbischen Waldachtal trotz ihrer<br />
74<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Fotos: Silke Borek, Sea & Sun, Berlin Heart<br />
Milliardenumsätze selbst als Mittelständler<br />
bezeichnen. Aber wie passen Klagen,<br />
Klischees und Fakten dieses heterogenen,<br />
typisch deutschen Phänomens zusammen?<br />
Wer ist der Mittelstand? Eine<br />
Reise zum besseren Verständnis eines<br />
deutschen Mythos.<br />
HEINZ SCHELWAT ZÜCHTET Algen. Unter<br />
anderem. Er hat bei der Radio- und Fernsehtechnik<br />
angefangen und ist inzwischen<br />
bei der Meerestechnologie und der<br />
Solarenergie angekommen. Sea & Sun<br />
Technology heißt seine Firma in Trappenkamp<br />
nicht weit von Kiel. Zu dem, was<br />
seine Firma heute herstellt, ist er durch<br />
eine Verkettung von Zufällen oder präziser:<br />
von Gelegenheiten gelangt. Denn<br />
Schelwat ist findig, er kann sich anpassen.<br />
Wenn er ins Reden kommt und es<br />
genügend Bier gibt, folgt eine Story der<br />
nächsten. Er duzt jeden. Auf seiner Visitenkarte<br />
steht neben dem Firmennamen<br />
und seiner Handynummer nur: Heinzi.<br />
Die Kurzfassung geht so: Das Unternehmen<br />
für Meerestechnik, bei dem er<br />
angestellt war, ging 1998 pleite. „Es gab<br />
aber noch eine Million D-Mark Fördergeld<br />
von der EU für die Entwicklung einer<br />
Sonde.“ Damit könne man ja schon<br />
mal was machen, dachte er, gründete<br />
selbst ein Unternehmen und stellte drei<br />
seiner alten Kollegen ein. Für die EU-<br />
Förderung waren sie dann aber doch zu<br />
klein. „Da war die Million wieder weg“,<br />
bemerkt er lakonisch, aber er wollte wieder<br />
das Beste aus der Situation machen.<br />
Er hatte immerhin ein Unternehmen<br />
und entwickelte einfach weiter Sonden.<br />
Heute kann man mit Heinzis Geräten in<br />
mehr als 6000 Meter Tiefe Messungen<br />
vornehmen, die bis <strong>auf</strong> ein Tausendstel<br />
genau sind. Temperatur, Zusammensetzung<br />
des Wassers, Sauerstoffgehalt. Was<br />
die Sonde kann, richtet sich nach den<br />
Wünschen des Kunden.<br />
Den Verk<strong>auf</strong> von Fotovoltaik-Anlagen<br />
hatte er schon vorher begonnen:<br />
„Das habe ich nebenher gemacht, weil ich<br />
schon wusste, dass es in der alten Firma<br />
kriselt.“ Er habe damit „gute Taler“ verdient.<br />
Seit die staatliche Förderung gekürzt<br />
wurde und sich das Geschäft für<br />
ihn in Deutschland nicht mehr lohnt, verk<strong>auf</strong>t<br />
er seine Anlagen <strong>auf</strong> die Seychellen<br />
und die Malediven. Gekoppelt mit einem<br />
Konzept, das Öl- und Gaskraftwerke in<br />
Mario Ohoven<br />
Der Präsident des Bundesverbands<br />
mittelständische<br />
Wirtschaft vertritt nach<br />
eigenen Angaben die<br />
Interessen von 270 000 Mitgliedsunternehmen<br />
Heinz Schelwat<br />
Ein buntes Portfolio bietet<br />
der Inhaber von Sea & Sun<br />
Technology in Schleswig-<br />
Holstein an: Meerestechnik,<br />
Solarenergie und Algenzucht.<br />
Mit 40 Mitarbeitern erzielt er<br />
6 bis 7 Millionen Euro Umsatz<br />
Dirk Lauscher<br />
Als Geschäftsführer der<br />
Medizintechnikfirma Berlin<br />
Heart beschäftigt Lauscher<br />
200 Mitarbeiter. Der<br />
Jahresumsatz des weltweiten<br />
Monopolisten für<br />
künstliche Kinderherzen<br />
liegt bei 30 Millionen Euro<br />
den beiden Inselrepubliken komplett<br />
überflüssig macht. Energiewende made<br />
in Trappenkamp. Außerdem: „Es gibt<br />
schlimmere Orte zum Arbeiten.“<br />
Wenn Schelwat erzählt, entsteht ein<br />
eigentümlicher Gegensatz zu dem Bild<br />
der Bedrohung, das der Mittelstandspräsident<br />
Ohoven zeichnet. Aus jedem Problem<br />
macht Schelwat eine Lösung, aus<br />
jedem Rückschlag eine Idee. Heinzi jammert<br />
nie.<br />
Ach so, die Algen. Schelwat muss<br />
kurz ausholen. Seine Langhaarige, so<br />
nennt er seine Lebensgefährtin, wollte<br />
vor drei Jahren samstags Tomaten k<strong>auf</strong>en.<br />
Sie fuhren mit dem Rad zur Gärtnerei<br />
und, um die Geschichte abzukürzen:<br />
„Sie k<strong>auf</strong>te die Tomaten und ich die Gärtnerei.“<br />
Um ganz korrekt zu sein, die insolvente<br />
Gärtnerei mit ihren Gewächshäusern<br />
nebenan.<br />
Er wusste da noch nicht genau, wozu<br />
er sie brauchen würde. Ein Forscher von<br />
der Fachhochschule Flensburg fragte,<br />
ob er in einem der Gewächshäuser zu<br />
Forschungszwecken Algen anbauen<br />
könne. Heinzi sah ein Geschäftsmodell.<br />
Er stellte Biologen ein, entwickelte mit<br />
zwei anderen Unternehmern aus der Region<br />
Bioreaktoren zur Algenzucht. Seine<br />
Sonden messen das Wasser, die Energie<br />
kommt vom Dach aus seinen Solarzellen,<br />
und aus der Hae matococcus-Alge<br />
will Heinzi den Wirkstoff Astaxanthin<br />
gewinnen. Veredelt in Pillenform als<br />
Nahrungsergänzungsmittel hat ein Kilogramm<br />
Astaxanthin einen Marktwert<br />
von 100 000 Euro. „Das ist wie legales<br />
Kokain“, sagt der Chef.<br />
Von der Wirkung des Astaxanthins<br />
ist Heinz Schelwat überzeugt. Das Mittel<br />
soll vor zu starker UV-Strahlung schützen,<br />
Herzkrankheiten vorbeugen und<br />
chronische Entzündungen lindern. Mehr<br />
als 2,5 Millionen Euro hat er gemeinsam<br />
mit einem Investor in das Projekt gesteckt.<br />
Es gibt nur zwei Wettbewerber<br />
<strong>auf</strong> der Welt, einen in Israel und einen<br />
<strong>auf</strong> Hawaii, die beide ihre Algen in Meerwasser<br />
züchten. „Ich mache hier deutsches<br />
Reinheitsgebot, Algen in Trinkwasser<br />
gezüchtet“, sagt Schelwat. Er überlegt<br />
schon weiter. Ob er nicht auch Lachse in<br />
der Aquakultur züchten könne, mit deren<br />
Abwasser er die Algenlarven düngt.<br />
Oder die Tomaten der Langhaarigen.<br />
Ende der Kurzfassung.<br />
75<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Reportage<br />
Wer sich in der Welt der Mittelstandspolitik<br />
in Berlin bewegt, trifft häufig<br />
<strong>auf</strong> dieselben Stichworte und noch<br />
häufiger <strong>auf</strong> Mario Ohoven. Diesmal ist<br />
es Mitte Januar, es sind noch etwa vier<br />
Wochen bis zum Empfang mit Gysi im<br />
Maritim. M. O., wie ihn seine Mitarbeiter<br />
leicht ehrfürchtig nennen, hat seinen<br />
Sitz am Leipziger Platz in Berlin. Wer<br />
ihn in seinem Büro trifft, ist ihm <strong>auf</strong> dem<br />
Weg dahin schon mehrfach begegnet. Im<br />
Flur der Verbandszentrale lächelt aus jedem<br />
Rahmen der Chef. M. O. mit Bärbel<br />
Höhn, M. O. mit Bill Clinton, M. O. mit<br />
Papst Benedikt.<br />
DER TAG DES PRÄSIDENTEN ist durchgetaktet.<br />
Es ist nicht so, dass Ohoven nur<br />
mit Berliner Politikern und Lobbyisten<br />
konferiert, seine Verbandswelt und die<br />
Betriebswelt treffen schon auch zusammen.<br />
An diesem Morgen besichtigt er<br />
im Rahmen der Reihe „Ohoven vor Ort“<br />
das Medizintechnikunternehmen „Berlin<br />
Heart“ in Steglitz. Die Ausgründung aus<br />
dem Deutschen Herzzentrum Berlin ist<br />
der einzige Hersteller weltweit, der Pumpen<br />
für herzkranke Kinder produziert.<br />
Weltweit der erste, weltweit der einzige,<br />
das ist typisch Mittelstand.<br />
Mithilfe der Pumpen können jedes<br />
Jahr etwa 300 Kinder gerettet werden.<br />
Der Geschäftsführer Dirk Lauscher zeigt<br />
den Gästen die Reinräume, wo die künstlichen<br />
Herzen produziert werden, und erklärt<br />
das Wartungssystem für die Akkus.<br />
Die sehen je nach Entwicklungsstufe aus<br />
wie mittelgroße Bürokopierer oder wie<br />
einer dieser Eink<strong>auf</strong>swagen, die ältere<br />
Damen in Steglitz <strong>auf</strong> dem Weg zum Eink<strong>auf</strong><br />
hinter sich herziehen.<br />
Ohoven will wissen, wo er helfen<br />
könnte? Fachkräfte? „Es ist nicht einfach,<br />
aber der attraktive Standort Berlin hilft“,<br />
sagt Lauscher. Energiekosten? „Die Klimaanlagen<br />
für die Reinräume verschlingen<br />
viel Strom“, antwortet der Geschäftsführer.<br />
Ein echtes Problem scheint dies in<br />
der nicht so preisempfindlichen Medizintechnikbranche<br />
aber nicht zu sein. <strong>Kein</strong><br />
Grund zur Aufregung.<br />
Ohoven muss zurück in die Zentrale,<br />
wo die Sitzung des politischen Beirats <strong>auf</strong><br />
ihn wartet. Abends steht der parlamentarische<br />
Abend des Verbands an. Dort<br />
wird er eine Studie zum neuen Energiekonzept<br />
seines Verbands vorstellen,<br />
Walter Niederstätter<br />
hat die Wiesbadener Kalle<br />
GmbH zum Weltmarktführer<br />
für Wursthüllen gemacht<br />
und den Umsatz seit 1997 <strong>auf</strong><br />
250 Millionen Euro verdoppelt.<br />
Mitarbeiterzahl: 1700<br />
Marie-Christine Ostermann<br />
hat sich mit ihrem<br />
Lebensmittelgroßhandel<br />
Rullko in Hamm <strong>auf</strong> die<br />
Belieferung von Altersheimen<br />
und Krankenhäusern<br />
spezialisiert. 150 Mitarbeiter<br />
erzielen einen Jahresumsatz<br />
von 75 Millionen Euro<br />
zusammen mit seinem Vorstandskollegen<br />
Walter Niederstätter, dem Chef der<br />
Kalle GmbH aus Wiesbaden, dem Weltmarktführer<br />
für industrielle Wursthüllen.<br />
Der, sagt Ohoven <strong>auf</strong> der Fahrt in<br />
sein Büro, habe wegen der hohen Energiekosten<br />
gerade geplante Investitionen<br />
in die USA und nach Osteuropa verlegt.<br />
Da ist sie wieder, die schleichende<br />
Deindustrialisierung.<br />
Jetzt sitzt er in seinem Büro, hinter<br />
dem Schreibtisch stehen eine Deutschland-<br />
und eine Europaflagge. Er spricht<br />
über das Unternehmertum in Deutschland<br />
und über die Nachfolgeproblematik<br />
im Mittelstand. Er macht sich große<br />
Sorgen um den Unternehmernachwuchs:<br />
„Die jungen Leute heute sind nicht mehr<br />
so standortgebunden und traditionsbewusst,<br />
die gehen dahin, wo die besten<br />
Rahmenbedingungen sind. Dagegen<br />
kommen Sie schwer an.“<br />
Die Nachfolgefrage wird seit Jahrzehnten<br />
als eines der größten Probleme<br />
des Mittelstands gesehen. Vielleicht liegt<br />
das auch daran, dass zu dem Mythos die<br />
Geschichten der großen Patriarchen<br />
beitragen.<br />
GESCHICHTEN WIE die des Schraubenkönigs<br />
Reinhold Würth. Der 78-Jährige, der<br />
aus dem väterlichen Laden einen Milliardenkonzern<br />
geformt hat, war berüchtigt<br />
für seinen Führungsstil und seine Motivationsbriefe<br />
an die Mitarbeiter des Außendiensts:<br />
„Nachdem Würth weder ein<br />
zweites Arbeitsamt noch ein Sozialinstitut<br />
ist, bitte ich um Verständnis, dass<br />
wir die Zusammenarbeit nur fortsetzen<br />
können, wenn Sie ganz kurzfristig und<br />
zackig die Zahl der selbst getätigten Aufträge<br />
pro Arbeitstag erhöhen.“<br />
Heute würde man so etwas Investitionsstau<br />
bei der Mitarbeiterführung<br />
nennen.<br />
Patriarchen, die nicht loslassen können<br />
und seit Jahrzehnten keinen Widerspruch<br />
gehört haben, können für mittelständische<br />
Unternehmen beim Übergang<br />
<strong>auf</strong> die nächste Generation zu einem Problem<br />
werden. Nach einer Studie des Instituts<br />
für Mittelstandsforschung in Bonn<br />
wird in den kommenden fünf Jahren für<br />
135 000 Unternehmen ein Nachfolger gesucht.<br />
Etwa zwei Millionen Arbeitsplätze<br />
sind davon betroffen. Ist das Erfolgsmodell<br />
Mittelstand dadurch gefährdet?<br />
Fotos: Frank Röth/F. A. Z. Foto, Frauke Schumann/Rullko<br />
76<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Anzeige<br />
Die Grenzen der<br />
Meinungsfreiheit<br />
Wie der Übergang <strong>auf</strong> die nächste<br />
Generation erfolgreich klappt, zeigt der<br />
Lebensmittelgroßhandel Rullko im westfälischen<br />
Hamm. Im Foyer des Unternehmens<br />
würden sich Ohoven und Würth<br />
wohlfühlen. In alten Ledersesseln, umgeben<br />
von riesigen Aschenbechern kann<br />
man in dem Vierziger-Jahre-Bau noch<br />
Wirtschaftswunderluft schnuppern und<br />
würde sich nicht wundern, wenn Ludwig<br />
Erhard um die Ecke käme, die Zigarre<br />
im Mund.<br />
Einen alten Patriarchen, der das Unternehmen<br />
lange Zeit per Basta-Politik<br />
geführt hat, gibt es hier auch: Carl-Dieter<br />
Ostermann. Aber seit 2006 teilt er sich<br />
die Geschäftsführung mit seiner Tochter<br />
Marie-Christine und zieht sich immer<br />
mehr aus dem Tagesgeschäft zurück.<br />
Marie-Christine Ostermann wusste<br />
schon mit 16 Jahren, dass sie das Unternehmen<br />
später in vierter Generation<br />
übernehmen wollte. „Priorität hat für<br />
mich immer, dass es dem Unternehmen<br />
gut geht“, sagt sie.<br />
Dieses Verantwortungsgefühl für<br />
die Firma und ihre Mitarbeiter ist typisch<br />
für Mittelständler. Wenn eine<br />
34-Jährige sich dazu bekennt, klingt<br />
das trotzdem ungewohnt.<br />
Ostermann weiß nicht genau, warum<br />
sie sich so früh so sicher war, dass sie<br />
den Lebensmittelgroßhandel übernehmen<br />
wird. „Mein Herz schlägt einfach<br />
für das Unternehmertum“, sagt sie. Daran<br />
haben auch die Lehre bei der Commerzbank,<br />
das BWL-Studium in St. Gallen<br />
und das Trainee-Programm bei Aldi<br />
nichts geändert. Von ihren damaligen<br />
Kommilitonen, die fast alle Investmentbanker<br />
oder Unternehmensberater werden<br />
wollten, wurde sie dafür manchmal<br />
belächelt.<br />
Die Unternehmensberater würden<br />
ihr wahrscheinlich auch empfehlen, nicht<br />
mehr jeden Morgen den eigenen Rullko-<br />
Kaffee frisch rösten zu lassen, weil die<br />
Firma damit kaum noch Geld verdient.<br />
Aber damit hat einmal alles angefangen,<br />
und Ostermann leistet sich die Pflege dieser<br />
Tradition gerne. „Die Kunden, die<br />
Mitarbeiter und mein Vater hängen daran“,<br />
sagt sie.<br />
Mit diesem Traditionsbewusstsein<br />
und ihrer Beharrlichkeit hat sich Ostermann<br />
sowohl den Respekt ihres Vaters<br />
als auch der 150 Mitarbeiter erarbeitet.<br />
Und sie hat ehrgeizige Pläne: Die Spezialisierung<br />
Rullkos <strong>auf</strong> die Belieferung<br />
von Großküchen in Seniorenheimen und<br />
Krankenhäusern will sie noch weiter vorantreiben.<br />
Aufgrund des demografischen<br />
Wandels ein wachsender Markt, meint<br />
Ostermann. Und eine Nische, die von<br />
Wettbewerbern wie der Metro nicht so<br />
zielgenau bedient wird.<br />
Außerdem hat sie bereits die Logistikprozesse<br />
neu organisiert, plant den<br />
Bau einer neuen Kühlhalle und will<br />
Rullko von einem regionalen zu einem<br />
nationalen Lieferanten ausbauen. Um die<br />
Mitarbeiter für die Veränderungen zu begeistern,<br />
setzt sie <strong>auf</strong> einen anderen Führungsstil<br />
als der Vater. „Ich kommuniziere<br />
viel, um Bedenken zu zerstreuen,<br />
wichtige Entscheidungen treffe ich zusammen<br />
mit einem Team von Führungskräften“,<br />
sagt sie. Die Nachfolge scheint<br />
geglückt in Hamm.<br />
FRIEDERIKE WELTER WUNDERT das nicht.<br />
Die Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung<br />
in Bonn sagt: „Wenn die<br />
ökonomischen Voraussetzungen stimmen<br />
und man sich frühzeitig und konsequent<br />
um seine Nachfolge kümmert, gibt<br />
es selten Probleme.“ Überhaupt betrachtet<br />
sie ihr Forschungsgebiet, den Mittelstand,<br />
akademisch nüchtern. Poltern oder<br />
gar Jammern, das liegt Friederike Welter<br />
fern. Sie ist eine Art Anti-Ohoven.<br />
Die Probleme des Mittelstands sieht<br />
sie auch, aber sie sucht lieber nach Lösungen,<br />
eigentlich ein sehr unternehmerisches<br />
Vorgehen. Statt über hohe Energiekosten<br />
zu klagen, sollten Mittelständler<br />
überlegen, wie sie erneuerbare Energien<br />
in ihren Unternehmen nutzen oder sogar<br />
selbst zu Energieproduzenten werden<br />
könnten, sagt Welter: „Daraus können<br />
ganz neue Geschäftsmodelle entstehen.“<br />
Bei Werner & Mertz in Mainz ist man<br />
schon so weit. Die 2010 fertiggestellte<br />
neue Hauptverwaltung erzeugt mittels<br />
Windkraft, Fotovoltaik und geothermischer<br />
Grundwassernutzung 20 Prozent<br />
mehr Energie, als für den l<strong>auf</strong>enden Betrieb<br />
benötigt wird. „Das ist das ideale<br />
Haus für uns als nachhaltiger Nischenwertschöpfer“,<br />
sagt der geschäftsführende<br />
Gesellschafter Reinhard Schneider.<br />
Mit seinen Marken Frosch, Erdal und<br />
Tana ist er der letzte große Mittelständler<br />
im Putz- und Reinigungsmittelgeschäft.<br />
© Foto Meyer: Antje Berghäuser; © Foto Sarrazin: Tanja Schnitzler, c/o Bildschön<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, stellvertretender<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur, im Gespräch<br />
mit Thilo Sarrazin.<br />
Sonntag, 02. März 2014, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28 40 81 55<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
02. MÄRZ<br />
Thilo<br />
Sarrazin<br />
Berliner<br />
Ensemble<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
77<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Reportage<br />
Auf die Frage, wie er im Wettbewerb<br />
mit Henkel, Unilever und Procter<br />
& Gamble überleben kann, antwortet<br />
er spöttisch: „Wir halten uns doch ganz<br />
gut im Kampf gegen diese Garagenfirmen.<br />
Aber im Ernst: Wir sind innovativer<br />
als die Großkonzerne.“<br />
Da ist es wieder, das Stichwort der<br />
Innovationskraft des Mittelstands. Sofort<br />
kommt Schneider ins Erzählen: Als sein<br />
Unternehmen das Segment Bio-Rohrreiniger<br />
neu erfinden wollte, half Schneider<br />
die Erinnerung an seine Jugend: „Meine<br />
zwei Schwestern haben immer diese Enthaarungsmittel<br />
benutzt, was die sich <strong>auf</strong><br />
die Haut schmierten, musste ja bio sein.“<br />
Da er wusste, dass Haare der häufigste<br />
Grund für blockierte Abflüsse sind, ließ<br />
er seine Entwickler Enthaarungswirkstoffe<br />
für den neuen Rohrreiniger Rorax<br />
Bio testen. Mit Erfolg. Das neue Mittel<br />
erreichte binnen weniger Monate einen<br />
Marktanteil von mehr als 5 Prozent.<br />
„Versuchen Sie mal, so eine Idee in einem<br />
Konzern durchzusetzen, das blockt<br />
die zuständige Abteilung sofort ab, weil<br />
sonst ihre Existenz infrage gestellt wird.“<br />
Schneider muss es wissen, weil er<br />
vor dem Einstieg ins Familienunternehmen<br />
Produktmanager bei Nestlé war. Im<br />
Wettbewerb mit den Konzernen setzt er<br />
heute <strong>auf</strong> Markendehnung. Es gibt jetzt<br />
auch Raumerfrischer und Seife mit dem<br />
Frosch-Logo. „Das funktioniert, weil unsere<br />
Kunden Frosch inzwischen mit Sauberkeit<br />
und Wohlfühlen verbinden.“<br />
Andersherum funktioniert es nicht.<br />
Henkel ist mit seinem Ökoreiniger Tara<br />
kläglich gescheitert, weil die Kunden bei<br />
Nachhaltigkeitsstrategien von Großkonzernen<br />
skeptisch sind.<br />
ANFANG MÄRZ bei der Oscar-Verleihung<br />
wird die Welt wieder <strong>auf</strong> „Büttenpapier<br />
made in Gmund am Tegernsee“ gucken.<br />
Florian Kohler, Inhaber der Büttenpapierfabrik<br />
im bayerischen Gmund, produziert<br />
das goldene Papier für die Umschläge<br />
und die Karten, <strong>auf</strong> denen sich<br />
die Namen der Gewinner des Filmpreises<br />
befinden. „Das klingt jetzt vielleicht<br />
etwas frech, aber: Wir machen das beste<br />
Papier der Welt, weil wir die Ästhetik<br />
<strong>auf</strong> die Spitze treiben“, sagt der 52-Jährige<br />
bei einem Rundgang durch sein Unternehmen.<br />
„Deswegen geben wir auch<br />
keine Rabatte.“ Besser als mit diesen zwei<br />
Friederike Welter<br />
ist Präsidentin des Instituts<br />
für Mittelstandsforschung<br />
in Bonn und Professorin an<br />
der Uni Siegen. Seit 2006<br />
berät die Ökonomin das Bundeswirtschaftsministerium<br />
Reinhard Schneider<br />
ist geschäftsführender<br />
Gesellschafter bei Werner &<br />
Mertz in Mainz. Das Unternehmen,<br />
bekannt durch die<br />
Marken Frosch und Erdal,<br />
erzielt mit seinen 900 Mitarbeitern<br />
einen Umsatz von<br />
300 Millionen Euro<br />
Florian Kohler<br />
In der Büttenpapierfabrik<br />
Gmund am Tegernsee<br />
arbeiten 123 Mitarbeiter für<br />
ihn, der das Familienunternehmen<br />
in der vierten<br />
Generation führt. Zu<br />
Umsatzzahlen macht Gmund<br />
keine Angaben<br />
Sätzen lässt sich die Philosophie seines<br />
Unternehmens nicht zusammenfassen.<br />
Dabei ist Kohler keineswegs arrogant,<br />
er ist nur sehr überzeugt von dem,<br />
was er und seine 123 Mitarbeiter tun. Zu<br />
seinen Kunden gehören BMW, Champagnerhersteller,<br />
Pralinenproduzenten – drei<br />
Viertel der Ware gehen in den Export. In<br />
der Musterabteilung gibt es 100 000 verschiedene<br />
Papiere in verschiedenen Gewichtungen,<br />
Prägungen und Oberflächen.<br />
Kohler verabscheut die Begriffe<br />
Nische und Luxus. Das klingt für ihn so,<br />
als produziere er überflüssige Ware für<br />
reiche Spinner. Ihm ist es wichtig, dass<br />
sein Papier als Verpackung, als Visitenkarte<br />
oder als Geschäftsbericht den Kunden<br />
einen Mehrwert bietet. Sein Umsatz<br />
wächst jedes Jahr zweistellig.<br />
WENN ES um die Energiepreise geht,<br />
kann sich Kohler in Rage reden. „Wir<br />
haben Glück, dass wir unsere Energie<br />
per Wasserkraft selbst herstellen können,<br />
sonst wäre der Standort hier kritisch“,<br />
sagt er. Ohoven jammert nicht alleine.<br />
Aber vielleicht ist genau dies das eigentliche<br />
Geheimrezept des deutschen<br />
Mittelstands, sozusagen die Grundvoraussetzung<br />
für erfolgreiches Unternehmertum.<br />
Wer immer <strong>auf</strong> der Suche nach<br />
Ideen ist, ständig die Produktion verbessern<br />
und den Kontakt zum Kunden pflegen<br />
muss, darf nie ganz zufrieden sein.<br />
Das würde auch erklären, warum das<br />
Erfolgsmodell nicht <strong>auf</strong> andere Länder<br />
übertragbar ist: Es fehlt ihnen die notwendige<br />
deutsche Grundunzufriedenheit.<br />
Da ist es wohl kein Zufall, dass das<br />
Wort Mittelstand als soziologischer Begriff<br />
erstmals 1695 in einer Klageschrift<br />
<strong>auf</strong>tauchte, in der sich die Königlichen<br />
Erbfürstentümer und Städte des Landes<br />
Schlesien beim Königshaus darüber beschwerten,<br />
dass Klerus, Adel und Beamte<br />
von der neuen Kopfsteuer befreit seien,<br />
und diese nur „dem Mittelstande und der<br />
Armut <strong>auf</strong> dem Halse gelassen wird“.<br />
Dafür, dass die Benachteiligung<br />
durch den Staat schon so lange währt,<br />
geht es dem Mittelstand blendend.<br />
TIL KNIPPER leitet das<br />
Ressort Kapital bei <strong>Cicero</strong>. Ihn<br />
überraschte bei der Recherche,<br />
wie oft deutsche Unternehmer<br />
nach der Hilfe des Staates rufen<br />
Fotos: IFM Bonn, Werner & Mertz, Gmund, Privat (Autor)<br />
78<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Anzeige<br />
Amrai Coen, New York<br />
Ich schreibe für<br />
DIE ZEIT<br />
Wer Amrai Coen treffen möchte, der muss ihr hinterherreisen. Wir verabreden uns in New York und begegnen einer Journalistin, die<br />
ihren Beruf kritisch reflektiert. Das Reisen, erklärt sie uns, sei mit Abstand der schönste Teil ihres Jobs – das Schreiben der schwerste.<br />
Vielleicht, weil ihre Zeilen den Menschen, von denen sie berichtet, so nahekommen? Ihre Artikel sind selbst kleine Reisen und<br />
entführen uns in alle Teile der Welt – wobei die Ferne für Amrai Coen vermutlich nur der Anlass ist, um am Ende über das ganz Nahe<br />
zu schreiben: über das zutiefst Menschliche. Eigentlich treibe uns doch alle die Suche nach einem Sinn, sagt sie. Im Film verrät sie,<br />
welchem sie gerade folgt.<br />
Autoren der ZEIT im Filmporträt<br />
www.fuer-die-zeit.de
KAPITAL<br />
Interview<br />
„ICH POLTERE NICHT IN TALKSHOWS“<br />
Der neue Arbeitgeberpräsident<br />
Ingo Kramer über<br />
Rentenpolitik, die<br />
Gewerkschaften<br />
und seinen geerbten<br />
Gestaltungsdrang<br />
Herr Kramer, sind Sie seit November<br />
der mächtigste Mittelständler<br />
Deutschlands?<br />
Ingo Kramer: Nein, mein Unternehmen<br />
in Bremerhaven ist genauso groß<br />
wie vorher. Als neuer Arbeitgeberpräsident<br />
muss ich ohnehin die Interessen aller<br />
Mitglieder der BDA vertreten, also<br />
auch die der großen Konzerne, aber ich<br />
bringe natürlich den Blick des Familienunternehmers<br />
mit nach Berlin.<br />
Was ist am Mittelstand so besonders?<br />
Es gibt verschiedene Definitionen<br />
für dieses deutsche Phänomen, die sich<br />
nach Größe, Mitarbeiterzahl oder Umsatz<br />
richten. Entscheidender als solche<br />
Kennzahlen ist für mich, dass es im Mittelstand<br />
viele inhabergeführte Unternehmen<br />
gibt, die langfristig denken. Charakteristisch<br />
ist auch das Miteinander von<br />
Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den<br />
Betrieben. Das gibt es so in anderen Ländern<br />
nicht, wo ich häufig <strong>auf</strong> den „German<br />
Mittelstand“ angesprochen werde.<br />
Stand es für Sie immer fest, dass Sie<br />
das Familienunternehmen übernehmen<br />
wollen?<br />
Nein, es gab auch keinen Druck von<br />
meinem Vater. Aber er hat mein Interesse<br />
geweckt, indem er mich ins Unternehmen<br />
mitgenommen und mir alles gezeigt<br />
hat. So mache ich es mit meinen<br />
Kindern auch. An seinem 75. Geburtstag<br />
wollte mein Vater eine Entscheidung von<br />
mir haben. Ich bin dann Anfang der achtziger<br />
Jahre als 29-Jähriger eingestiegen.<br />
Zur Person<br />
Ingo Kramer, 61, ist seit Mitte<br />
November Arbeitgeberpräsident<br />
der Bundesvereinigung<br />
Deutscher Arbeitgeberverbände<br />
als Nachfolger von Dieter Hundt.<br />
In Bremerhaven führt er die von<br />
seinem Großvater gegründete<br />
Firmengruppe J. H. K. Die<br />
260 Mitarbeiter machen einen<br />
Jahresumsatz von rund<br />
35 Millionen Euro durch die<br />
Einzelfertigung von Maschinen<br />
und Anlagen, unter anderem für<br />
die Petrochemie, die Energiewirtschaft<br />
und den Schiffbau<br />
Was wäre die Alternative gewesen?<br />
Ich habe auch mal mit einer Konzernkarriere<br />
geliebäugelt, weil Konzerne<br />
Berufseinsteigern attraktive Jobs<br />
anbieten können. Allerdings musste<br />
ich feststellen, dass mir die vielen Hierarchieebenen<br />
und der hohe Abstimmungsbedarf<br />
nicht liegen. Dafür ist bei<br />
mir die Neigung zum selbständigen Unternehmertum,<br />
wo ich Entscheidungen<br />
treffe, für die ich dann auch selbst geradestehen<br />
muss, wohl doch zu stark<br />
ausgeprägt.<br />
Foto: BDA<br />
80<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Ist die fortschreitende Globalisierung<br />
eine Gefahr für den Mittelstand?<br />
Nein, konjunkturell gesehen geht es<br />
den deutschen Unternehmen im Moment<br />
recht gut. Der Mittelstand muss sich auch<br />
<strong>auf</strong> den internationalen Märkten nicht<br />
hinter den Konzernen verstecken, weil<br />
er <strong>auf</strong>grund seiner flexiblen Strukturen<br />
viele Innovationen hervorbringt.<br />
Also ruhige Zeiten für Sie als Arbeit -<br />
geberpräsident?<br />
Nein, überhaupt nicht. Die Schwäche<br />
Europas ist weiterhin gefährlich, gerade<br />
auch für den Mittelstand, weil 70 Prozent<br />
der deutschen Exporte nach Europa gehen.<br />
Wir können nicht alle nach China<br />
ausweichen. Insofern sieht die europäische<br />
Staatsschuldenkrise aus der Sicht<br />
eines Unternehmers etwas anders aus<br />
als aus der Perspektive des Stammtischs<br />
oder der Europaskeptiker.<br />
Dann gehen wir doch auch die anderen<br />
aktuellen Themen einmal durch: Wie<br />
halten Sie es mit dem Mindestlohn?<br />
Der Mindestlohn wird die deutsche<br />
Volkswirtschaft nicht in ihren Grundfesten<br />
erschüttern. Das war ein Wahlkampfthema,<br />
aber die Wahlen liegen<br />
jetzt fast ein halbes Jahr hinter uns.<br />
Es gibt 42 Millionen Erwerbstätige in<br />
Deutschland, von denen nur rund zwei<br />
Millionen Arbeitnehmer mit einem Vollzeitjob<br />
weniger als 8,50 Euro verdienen.<br />
Es gibt nur 41 von 15 000 Tarifverträgen,<br />
bei denen in den untersten Lohngruppen<br />
weniger als 8,50 Euro bezahlt wird. Wir<br />
müssen <strong>auf</strong>hören, den Eindruck zu erwecken,<br />
dass wir ein Land von Niedriglöhnern<br />
sind. Das stimmt einfach nicht.<br />
Also können Sie mit 8,50 Euro leben.<br />
Aber warum ist das Gezeter in der Wirtschaft<br />
dann so groß?<br />
Es kommt <strong>auf</strong> die konkrete Ausgestaltung<br />
des Mindestlohns an. Wir wollen,<br />
dass Lösungen gefunden werden, die<br />
möglichst wenig Arbeitsplätze vernichten.<br />
Dafür brauchen wir Ausnahmeregelungen,<br />
nicht nur für Saisonarbeiter, sondern<br />
zum Beispiel auch für Praktikanten,<br />
Langzeitarbeitslose oder junge Leute mit<br />
geringer Qualifikation. Die Große Koalition<br />
kann kein Interesse daran haben,<br />
diesen Leuten den Eintritt in den Arbeitsmarkt<br />
zu erschweren.<br />
„Die deutsche<br />
Wirtschaft wird<br />
durch den<br />
Mindestlohn<br />
nicht in ihren<br />
Grundfesten<br />
erschüttert“<br />
Die Arbeitgeberverbände sollen demnächst<br />
zusammen mit den Gewerkschaften<br />
bestimmen, wie hoch der Mindestlohn<br />
in Zukunft ausfallen soll. Stehen Sie<br />
für solch eine Kommission zur Verfügung?<br />
Ich nehme für mich in Anspruch,<br />
kein polternder Talkshowideologe zu<br />
sein. Ich suche lieber nach Lösungen,<br />
statt <strong>auf</strong> Konfrontationskurs zu gehen.<br />
Daher wird sich die BDA bei der Mindestlohnkommission<br />
beteiligen. Es gibt in der<br />
Politik, in den Gewerkschaften und bei<br />
den Arbeitgebern genügend vernünftige<br />
Leute, die auch beim Thema Mindestlohn<br />
Lösungen finden werden, die über Talkshowniveau<br />
liegen werden. Für die Arbeit<br />
der Kommission wird es entscheidend<br />
sein, dass wir uns <strong>auf</strong> einen von<br />
beiden Seiten akzeptierten Vorsitzenden<br />
einigen, der bei einem Patt die entscheidende<br />
Stimme hat. Einen alle zwei Jahre<br />
wechselnden Vorsitz halte ich für problematisch,<br />
weil dann die jeweils andere<br />
Seite nach zwei Jahren zurücknimmt,<br />
was vorher beschlossen wurde.<br />
zurück zur alten Frühverrentungspolitik.<br />
Sie unterläuft die Anstrengungen,<br />
die Beschäftigung Älterer zu erhöhen.<br />
Welche Akzente wollen Sie in Ihrer ersten<br />
Amtszeit noch setzen?<br />
Die Politik muss das Prinzip der Tarifeinheit<br />
wiederherstellen, das durch<br />
die Änderung der <strong>Recht</strong>sprechung des<br />
Bundesarbeitsgerichts 2010 von heute<br />
<strong>auf</strong> morgen abgeschafft wurde. Wenn in<br />
einem Betrieb mehr als ein Tarifvertrag<br />
gilt, werden wir große Probleme bekommen,<br />
weil dann ständig gestreikt werden<br />
kann. In Großbritannien hat das in<br />
den siebziger Jahren zur Deindustrialisierung<br />
des Landes geführt. Das ist ein<br />
Rad, das sie nicht mehr zurückdrehen<br />
können, sobald es sich einmal in Bewegung<br />
gesetzt hat.<br />
Was muss die Politik gegen den drohenden<br />
Fachkräftemangel tun?<br />
Wir müssen uns alle für ein besseres<br />
Bildungssystem engagieren, das die<br />
Chancengleichheit erhöht. Schlechte<br />
Aufstiegschancen für Kinder aus Hartz-<br />
IV-Familien können wir uns nicht leisten.<br />
Und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz.<br />
Wir müssen gut qualifizierten<br />
Fachkräften signalisieren, dass sie<br />
in Deutschland willkommen sind und<br />
dringend benötigt werden. Das Schüren<br />
populistischer Ressentiments und<br />
übertriebene Befürchtungen über massenhafte<br />
Zuwanderung in unsere Sozialsysteme<br />
sind ein Skandal. Deswegen<br />
habe ich mich kürzlich gemeinsam mit<br />
DGB-Chef Michael Sommer vehement<br />
dagegen ausgesprochen.<br />
Bleibt denn bei Ihrem Engagement als<br />
Arbeitgeberpräsident noch genug Zeit<br />
für das eigene Unternehmen?<br />
Ich kann Sie beruhigen, weder das<br />
Unternehmen noch die Familie leiden,<br />
weil ich andere Ämter niedergelegt<br />
habe. Im Übrigen habe ich mich schon zu<br />
Schulzeiten und als Student immer über<br />
meine eigentliche Tätigkeit hinaus engagiert.<br />
Ich bin da familiär vorbelastet. Bei<br />
uns zu Hause hieß es schon immer: „Lieber<br />
mitarbeiten als hinten in der Etappe<br />
meckern!“ Das liegt mir mehr, weil ich<br />
gerne gestalte.<br />
Was halten Sie von den Rentenplänen<br />
von Bundesarbeitsministerin Andrea<br />
Nahles?<br />
Das sehe ich sehr kritisch, weil das<br />
geplante Rentenpaket eine teure Mehrbelastung<br />
für die Beitragszahler schafft.<br />
Die Kosten von 160 Milliarden Euro bis<br />
zum Jahr 2030 liegen deutlich höher als<br />
die Entlastungen der Rente mit 67 bis dahin.<br />
Das belastet die kommenden Generationen.<br />
Die abschlagsfreie Rente mit<br />
63 ist ein Schritt in die falsche Richtung, Das Gespräch führte TIL KNIPPER<br />
81<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Kommentar<br />
DAS IST IGNORANT!<br />
Von FRANZ MÜNTEFERING<br />
Die Rente mit 63 und die Lebensleistungsrente<br />
sind Irrwege. Die Große Koalition handelt populistisch<br />
statt verantwortlich<br />
82<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Foto: Benno Kraehahn/photoselection<br />
Der Sozialdemokrat Franz Müntefering,<br />
74, steht wie kein anderer deutscher<br />
Politiker für die beiden zentralen<br />
Re formwerke des vergangenen<br />
Jahrzehnts.<br />
Ohne Müntefering hätte<br />
Bundeskanzler Gerhard Schröder<br />
seine Agenda 2010 nie durchgebracht.<br />
„Münte“, der Traditionssozi, half<br />
Schröder, dem „Genossen der Bosse“,<br />
die Agenda durchzusetzen. Er tingelte<br />
durch Deutschland und erklärte der<br />
SPD-Basis, warum ausgerechnet ihre<br />
Partei Sozialabbau betreiben soll.<br />
Schröder wusste genau, warum er<br />
seinem Fraktionschef nach dessen<br />
Rede in der entscheidenden<br />
Plenarsitzung im Bundestag einen<br />
großen Blumenstrauß überreichte.<br />
Neue Konstellation, gleiche Rolle:<br />
In der ersten Großen Koalition von<br />
Angela Merkel fiel Franz Müntefering<br />
als Arbeitsminister und Vizekanzler<br />
die Aufgabe zu, die Rente mit 67<br />
durchzusetzen. Auch das zog er durch,<br />
abermals gegen den Widerstand von<br />
SPD und Gewerkschaften. In der<br />
aktuellen Rentenpolitik der Koalition<br />
und seiner früheren Widersacherin<br />
Andrea Nahles, heute Sozialministerin,<br />
sieht der frühere SPD-Vorsitzende eine<br />
Katastrophe, weil sie die Errungenschaften<br />
vergangener Jahre<br />
zurückdreht. swn<br />
<strong>Kein</strong> Zweifel: Nach diesem<br />
Wahlergebnis vom 22. September<br />
2013 ist diese Koalition<br />
<strong>auf</strong> Bundesebene sinnvoll.<br />
Sie hat auch wichtige<br />
Vorhaben vereinbart und es bleibt Anlass<br />
und Zeit, weitere wichtige Zukunftsausgaben<br />
anzugehen.<br />
Aber nicht alle Maßnahmen zum Bereich<br />
Alterssicherung und Rente, die angekündigt<br />
sind, sind nützlich, einige sind<br />
falsch. Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit<br />
der Alterssicherungssysteme entsteht<br />
mit ihnen nicht. Kann man noch<br />
<strong>auf</strong> Einsicht hoffen?<br />
Wer in die gesetzliche Rentenversicherung<br />
einzahlt, versichert sich und die<br />
anderen, die auch einzahlen. Der Staat<br />
organisiert das und hat die Langfristerfordernisse<br />
auszubalancieren.<br />
Die zentralen Parameter sind bekannt:<br />
Das Äquivalenzprinzip, das sich<br />
in Beitragsumfang und Rentenanspruch<br />
ausdrückt, kann nur gerecht sein, wenn<br />
die Rahmenbedingungen dazu passen.<br />
Die Beitragshöhe soll immer auskömmliche<br />
Rente für die jeweiligen Rentenempfänger<br />
sichern, darf aber gleichzeitig die<br />
jeweiligen Beitragszahler, also die Arbeitnehmer<br />
und Arbeitgeber nicht überfordern.<br />
Wenn die Zahlen der Beitragszahler<br />
und die der Rentenempfänger sich<br />
in ihrer Relation nachhaltig verändern,<br />
tangiert das das System erheblich. Jedes<br />
Individuum ist anders und jeder Arbeitsplatz<br />
auch.<br />
Die Formel des Erfolgs heißt: Sichere<br />
Arbeit + gute Löhne + humane Arbeitswelt<br />
+ stabiler Altenquotient = ausreichende<br />
Alterssicherung. Aber diese<br />
Formel erfüllt sich zurzeit in mancherlei<br />
Hinsicht nicht. Das muss keine Panik<br />
auslösen und auch das Beschwören eines<br />
Generationenkonflikts ist überflüssig.<br />
Aber nun dürfen nicht auch noch die<br />
Weichen falsch gestellt werden. Genau<br />
das passiert aber!<br />
Positiv ist, dass die, vor allem demografiebedingten<br />
Rentengesetze von<br />
Rot-Grün und von der 2005er Großen<br />
Koalition von dieser Koalition nicht infrage<br />
gestellt werden: Begrenzung des<br />
Beitragssatzes, Senkung des Rentenniveaus<br />
mit Interventionspflicht, verstärkter<br />
Zuschuss aus dem Steuertopf an die<br />
Rentenkasse, schrittweise Anhebung des<br />
faktischen Rentenalters und des gesetzlichen<br />
Renteneintrittsalters <strong>auf</strong> 67 Jahre<br />
bis zum Jahre 2029 und der Anspruch<br />
<strong>auf</strong> eine abschlagsfreie Rente mit 65 Jahren<br />
bei mindestens 45 Beitragsjahren. Es<br />
wäre gut, wenn das auch ausdrücklich gesagt<br />
und in der Debatte nicht vernuschelt<br />
würde. Es auszusprechen, führt an die<br />
Realitäten heran.<br />
Positiv auch: der flächendeckende<br />
gesetzliche Mindestlohn. Wichtig ist<br />
die dringliche Forderung nach gleichem<br />
Lohn für gleiche Arbeit und nach einem<br />
angemessenen Lohn für Berufe, in denen<br />
vor allem Frauen tätig sind. Beide<br />
Felder sind bisher schwere Hypotheken<br />
für die Zukunftsfähigkeit des Rentensystems.<br />
Das gilt auch für die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf generell, bei Alleinerziehenden<br />
im Besonderen. Da bewegt<br />
sich was.<br />
Aber: Die in rot-grüner Zeit geschaffene<br />
Grundsicherung, also die Aufstockung<br />
von Minirenten bis zur Höhe des<br />
Existenzminimums und Freistellung der<br />
Kinder von Zuzahlungspflichten hierzu,<br />
immerhin mit vier bis fünf Milliarden<br />
Euro jährlich aus der Steuerkasse bezahlt,<br />
soll „fortentwickelt“ werden. Die<br />
von der jetzigen Großen Koalition dafür<br />
gefundene Formel von der „Lebensleistungsrente“<br />
ist vielleicht populistisch<br />
brauchbar, aber unehrlich, denn sie ignoriert<br />
das Prinzip unseres Rentensystems.<br />
Die Rente berechnet sich nicht nach Lebensleistung,<br />
sondern nach der Beteiligung<br />
an der Rentenversicherung. Nette<br />
Formeln helfen da nicht weiter, sondern<br />
lösen letztlich Verwirrung und Enttäuschung<br />
aus. Wie soll man denn die Lebensleistung<br />
in einer umlagebasierten<br />
Versicherung bemessen?<br />
Der Dank für gesellschaftlich relevante<br />
Lebensleistung ist gut. Den Ehrenamtlichen<br />
sollten wir zum Beispiel besser<br />
danken. Und es fallen einem dazu auch<br />
Elternzeiten und Pflegezeiten ein. Aber<br />
das ist nicht die Aufgabe der Rentenversicherung.<br />
Das muss aus der Steuerkasse<br />
geleistet werden. Und wenn die das nicht<br />
hergibt, muss sie <strong>auf</strong>gefüllt werden mittels<br />
gerechter Steuerpolitik. Die Leistungen<br />
dürfen nicht zulasten der nachwachsenden<br />
Rentenversicherten abgewickelt<br />
werden, nur weil es da heute den geringsten<br />
Widerstand gibt.<br />
83<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
KAPITAL<br />
Kommentar<br />
Die Volte hin zum Maßstab Lebensleistung<br />
berührt das System im Kern: Mit<br />
dieser Ausrichtung verlieren Löhne und<br />
Beiträge weiter an Gewicht und der eingeschlagene<br />
Weg sieht sehr aus nach einem<br />
Einstieg in die allgemeine Grundrente.<br />
Ich hoffe, niemand in der Koalition<br />
will diesen Weg wirklich beschreiten.<br />
Sonst sollte man es sagen. So ist es ein<br />
Spiel mit dem Feuer.<br />
Vergleichbar fragwürdig ist die Absicht,<br />
ab 2014 für 63-Jährige mit mindestens<br />
45 Beitragsjahren (plus Sonderregelung)<br />
die abschlagsfreie Rente<br />
zu garantieren – die sie nach geltendem<br />
<strong>Recht</strong> seit 2012 mit 65 Jahren erhalten.<br />
Mit dieser neuen 63er Regelung<br />
wird eine bizarre Sonderregelung erfunden.<br />
65 ist das seit über 100 Jahren bekannte<br />
Renteneintrittsalter. Als dieses<br />
<strong>auf</strong> 67 Jahre geändert wurde, haben wir<br />
bei 65 Jahren eine Grenze gezogen für<br />
die, die früh ins Erwerbsleben eingetreten<br />
sind. Für sie blieb es bei der alten Regelung.<br />
Eine Art Vertrauensschutz.<br />
Nun soll das absolute Rentenalter<br />
für eine sehr kurze Zeitspanne <strong>auf</strong><br />
63 Jahre gesenkt werden (Allzeitrekord).<br />
Ein einziger Jahrgang erhält einen Zwei-<br />
Jahres-Vorteil, nämlich eine abschlagsfreie<br />
Rente schon im Alter von 63 Jahren<br />
statt mit 65. Dann schrumpft dieser<br />
Vorteil, parallel zum Anstieg des Rentenalters<br />
für die folgenden Geburtenjahrgänge<br />
(1952 bis 1963) Schritt für Schritt.<br />
2029 gilt das schon bestehende Gesetz<br />
des Renteneintritts mit 67 oder 65 Jahren<br />
dann für alle. Eine – freundlich gesagt<br />
– sehr vertrackte Art von Gerechtigkeit,<br />
deren Kosten überdies <strong>auf</strong> die<br />
Jungen geschoben werden.<br />
FALSCH IST DIE FIXIERUNG <strong>auf</strong> die Versicherungsjahre.<br />
Die andere Seite der<br />
Medaille, die Lebenserwartung, also<br />
die voraussichtliche Dauer der Rentenzahlung,<br />
bleibt dabei unbeachtet. Das<br />
ist ignorant. In Deutschland erhalten<br />
wir unsere Renten nicht mehr über einen<br />
Zeitraum von zehn Jahren, sondern<br />
inzwischen von 19, bald von 22 Jahren.<br />
Heute ist nicht mehr nur ein Zehntel der<br />
Bevölkerung 65 Jahre oder älter, sondern<br />
bereits 20 Prozent und bald werden<br />
es 30 Prozent sein. Mitte der sechziger<br />
Jahre wurden in Deutschland jährlich 1,2<br />
Die Illusion<br />
von der<br />
Frühverrentung<br />
darf nicht<br />
gefördert<br />
werden<br />
bis 1,3 Millionen Kinder geboren, 2012<br />
waren es weniger als 700 000. Was bedeutet<br />
das für uns heute? Welche Folgen<br />
hat das in 20 bis 30 Jahren? Macht alles<br />
nichts? Sollen wir einfach mal abwarten?<br />
Abgesehen von all dem bleibt schleierhaft,<br />
weshalb trotz der <strong>auf</strong>ziehenden<br />
Arbeits- und Fachkräfteproblematik die<br />
63-jährigen Facharbeiter, die in erster Linie<br />
von der Regel erfasst würden, geradezu<br />
hinauskomplimentiert werden aus<br />
dem Berufsleben. Die meisten von ihnen<br />
haben Wissen, Können und Engagement.<br />
So, wie es im Entwurf des Arbeitsministeriums<br />
angekündigt ist, ist das Vorhaben<br />
renten- und arbeitsmarktpolitisch<br />
ein Irrweg.<br />
Das jahrelange, erfolgreiche Bemühen,<br />
Schritt für Schritt die Mentalität<br />
zur Frühverrentung umzukehren, wird<br />
konterkariert.<br />
Auf jeden Fall sind hierzu zwei Komplexe<br />
zügig anzugehen:<br />
Bei einem Berufseinstieg mit 21 Jahren<br />
und einer Lebenserwartung von 82,<br />
bald 85 Jahren, ist es für die Kohorte<br />
zwischen 22 und 65 beziehungsweise<br />
67 Jahren schwer, Wohlstand und soziale<br />
Sicherheit für das ganze Land zu erwirtschaften.<br />
Die Anstrengung aller ist<br />
nötig. Eine Flexibilisierung des Renteneintritts<br />
durch Erwerbsminderung oder<br />
Altersteilzeit kann die individuellen Potenziale<br />
angemessener als bisher beachten,<br />
darf aber nicht die Illusion von der<br />
Frühverrentung fördern, sondern muss<br />
über 65/67 hinausweisen.<br />
Dazu gehört es, stärker als bisher Berufswechsel<br />
in einem langen Leben populär,<br />
organisierbar und finanzierbar zu<br />
machen. Weshalb sollte die letzte Berufsdekade<br />
nicht immer öfter eine mit<br />
weniger Druck und Belastung sein und<br />
der ballistischen Kurve der körperlichen<br />
Kräfte folgen. Ja, das könnte sich auch<br />
<strong>auf</strong> die Lohnhöhe auswirken. Das Senioritätsprinzip<br />
darf da kein Hindernis sein.<br />
Lebensqualität hat viele Gesichter.<br />
Wer länger aktiv bleiben kann, hat auch<br />
länger was von seinem dann höheren<br />
Rentenanspruch.<br />
Dass bei all dem betriebliche und individuelle<br />
Altersvorsorge und demografiebetonte<br />
Tarifverträge wichtig, ausb<strong>auf</strong>ähig<br />
und förderungswürdig bleiben, sei<br />
nur als Stichwort erwähnt.<br />
Endlich: Eine Rentenversicherung,<br />
die keine verbesserte Pflegeversicherung<br />
an ihrer Seite hat, kann keine ausreichende<br />
Altersversicherung sein. Das<br />
kostet auch mehr Geld, ja. Es geht um<br />
Zeit und Zeit kostet Geld. Bei Hospizund<br />
Palliativdiensten ist es gut eingesetzt.<br />
Die Pflegeversicherung ist seit<br />
Mitte der neunziger Jahre ein wichtiges<br />
Standbein der sozialen Sicherung geworden.<br />
Sie ist aber Zuschussversicherung<br />
und garantiert nicht die volle Pflegekostenerstattung,<br />
verhindert also nicht die<br />
Inanspruchnahme der Kinder-Familie für<br />
ungedeckte Pflegekosten. Wie wird diese<br />
anwachsende Problematik angegangen?<br />
Bei der Pflegereform müssen die Kommunen<br />
verantwortlich eingebunden und<br />
auch entsprechend ausgestattet sein. Die<br />
Koalition ist am Zuge.<br />
Bundeskanzler Gerhard Schröder<br />
hat seinerzeit den „Rat für Nachhaltige<br />
Entwicklung“ eingesetzt, um die Regierung<br />
beraten zu lassen. Seit 2004 gibt<br />
es auch den Parlamentarischen Beirat<br />
für nachhaltige Entwicklung, der sich<br />
im Parlament bemüht, den Debatten um<br />
Nachhaltigkeit Aufmerksamkeit und verlässlichere<br />
Strukturen zu verschaffen.<br />
Man darf gespannt sein, ob sich da zu<br />
unserem Thema etwas tut.<br />
In Sachen Ökologie ist begriffen,<br />
dass falsches Handeln heute Hochwasser<br />
und Dürre für morgen bedeutet. Im<br />
Sozialen ist das im Prinzip nicht anders.<br />
Eine Politik, die erkennbar auch hier <strong>auf</strong><br />
Zukunftsfähigkeit ausgerichtet ist, würde<br />
das Vertrauen aller Generationen in unsere<br />
soziale Sicherheit dauerhaft deutlich<br />
stabilisieren. Und das wäre gut.<br />
84<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
„ Ständig kommt<br />
irgendwer und will was<br />
<strong>auf</strong> dich dr<strong>auf</strong>sprühen.<br />
Wegstehende Haare<br />
werden notfalls<br />
ausgerissen, Hauptsache,<br />
es entsteht nie der<br />
Eindruck, dass da die<br />
Natur am Wirken ist “<br />
Barbara Schöneberger in der Rubrik<br />
„Warum ich trage, was ich trage“, Seite 106<br />
85<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Porträt<br />
HAUTENGE TRADITION<br />
Wie einst ihre Ahnen stellt Annette Roeckl Handschuhe her. Sie rettet ein altes Handwerk<br />
und fasziniert damit ausgerechnet die smartphoneversessene urbane Oberschicht<br />
Von PAUL-PHILIPP HANSKE<br />
Annette Roeckl bittet den jungen<br />
Gesellen Johannes Teuscher mit<br />
mütterlichem Stolz: „Zeigen Sie<br />
doch mal, wie man einen Handschuh<br />
macht.“ Der geht ans Werk. Er braucht<br />
dazu nicht mehr als eine Schere, die<br />
scharfe Kante des 130-jährigen Eichentischs<br />
aus der alten Manufaktur, ein Lineal<br />
in französisch Zoll und seinen Fingernagel,<br />
mit dem er die Maße in das<br />
weiche, dunkle Leder ritzt. Drei bis acht<br />
Stunden wird er brauchen, bis das Musterpaar<br />
fertig ist. Dass die Firma nach 20 Jahren<br />
überhaupt wieder Handschuhmacher<br />
ausbildet, ist ein Verdienst der Unternehmertochter,<br />
die 2003 die Leitung des Familienbetriebs<br />
von ihrem Vater übernahm.<br />
Annette Roeckl verkörpert die sympathische<br />
Version von München: geerdet,<br />
freundlich und trotz aller Wohlsituiertheit<br />
nicht prahlerisch. Sie spricht ein warmes<br />
Bayerisch, das oft von einem herzlichen<br />
Lachen unterbrochen wird, sitzt<br />
entspannt und hat doch eine Körperspannung,<br />
die Ausdauer vermuten lässt. Die<br />
un<strong>auf</strong>geregte Kleidung passt zum Firmensitz<br />
des Traditionsunternehmens:<br />
ein Hochhaus aus den siebziger Jahren<br />
mit Waschbeton-Fassade.<br />
Es befindet sich südlich der Münchener<br />
Innenstadt, im Dreimühlenviertel,<br />
eine dieser Gegenden, die gerade<br />
schwer in Mode sind. Die Spielplätze<br />
sind übervoll mit Kindern und deren Eltern,<br />
die noch schnell eine Mail in ihr<br />
Smartphone tippen. In den Erdgeschossen<br />
der Gründerzeithäuser befinden sich<br />
kleine Cafés, die warmen Kuchen anbieten,<br />
und Boutiquen mit selbst genähter<br />
Kinderkleidung. Wo heute die urbane<br />
Oberschicht wuselt, führte vor 130 Jahren<br />
die südliche Staubstraße durch Äcker,<br />
Wiesen und die Auen der nahen Isar. Die<br />
Stadt war weit entfernt. So weit, dass die<br />
Roeckls davor gewarnt wurden, hier die<br />
Handschuh-Manufaktur zu errichten und<br />
gefragt wurden, wie denn bitteschön die<br />
Arbeiter hierher kommen sollten.<br />
Heute ist nicht nur der beliebte Platz,<br />
an dem sich das Unternehmen befindet,<br />
nach dem Firmengründer benannt –<br />
Roecklplatz –, sondern es befindet sich<br />
auch noch in Familienbesitz, inzwischen<br />
in der sechsten Generation.<br />
Die Urururenkelin des Gründers Jakob<br />
Roeckl erzählt die Firmengeschichte<br />
stockend, als wundere sie sich darüber,<br />
nun selbst an der Spitze zu stehen. In<br />
ihrer Jugend habe sie mit all dem nicht<br />
viel am Hut gehabt: „Das war mir zu verstaubt,<br />
zu beladen mit Tradition. Allein<br />
schon der Name wog schwer.“ In dieser<br />
Zeit hat sie aus Prinzip keine Handschuhe<br />
getragen. Straßenarbeiterin oder<br />
Goldschmiedin wollte sie damals werden.<br />
Doch dann wurde sie schwanger, mit 21.<br />
Sie blieb zunächst zu Hause bei ihrem<br />
Kind. Als sie mit 25 eine Ausbildung zur<br />
Handelsfachwirtin beginnen wollte, ging<br />
das gut im elterlichen Unternehmen, wo<br />
sie halbtags arbeiten und nachmittags bei<br />
ihrem Sohn sein konnte.<br />
IRGENDWANN GAB ES einen Moment, der<br />
sie emotional mit dem Unternehmen verband:<br />
Als sie eine Werbekampagne vorbereitete,<br />
stieß sie im Archiv <strong>auf</strong> alte Dokumente,<br />
die ihr mehr über die Motive<br />
des Gründers verrieten. „Jakob Roeckl<br />
war bayerischer Patriot. Er störte sich<br />
daran, dass alle feinen Handschuhe aus<br />
Frankreich kamen“, erzählt sie. Also<br />
nähte er selbst welche aus feinem Hirschleder<br />
und stieg bald zum königlichen Hoflieferanten<br />
<strong>auf</strong>, was Roeckl noch heute<br />
in seinem Wappen deutlich macht: Dort<br />
halten zwei Löwen eine Krone über einen<br />
Handschuh.<br />
Die Entwürfe entstehen immer<br />
noch in München, gefertigt wird im<br />
rumänischen Temeswar, ebenfalls von<br />
Hand. „Wir arbeiten technisch wie vor<br />
100 Jahren“, sagt Roeckl.<br />
Die Kunden gucken immer genauer<br />
hin: Seit der Bankenkrise erlebte das<br />
Handwerk einen ungeheuren Image-Aufschwung.<br />
Kurz nach der Lehman-Pleite<br />
warb der Luxuswarenhersteller Louis<br />
Vuitton mit Bildern von Handwerkern,<br />
inzwischen boomen die „guten, alten<br />
Dinge“. Gerade die wohlsituierten Urbanen<br />
in den Cafés unten im Viertel sind <strong>auf</strong><br />
Retro-Qualität versessen.<br />
Über Handschuhe redet Roeckl inzwischen<br />
richtig gerne: „Wie das Auge<br />
ist die Hand Ausdruck von Persönlichkeit.<br />
Der Handschuh, der wie eine zweite<br />
Haut anliegt, nimmt die Persönlichkeit<br />
<strong>auf</strong>.“ Sie weiß viel zu erzählen, über die<br />
Rolle des Handschuhs in der europäischen<br />
Kulturgeschichte vom Minnehandschuh<br />
über den Fehdehandschuh bis zum<br />
Handschuh des Königs.<br />
„Mein Vater übte übrigens keinen<br />
Druck <strong>auf</strong> uns Geschwister aus, zu übernehmen.<br />
Unbewusst gab es den natürlich<br />
schon. Nach fünf Generationen kann<br />
man nicht <strong>auf</strong>hören.“ Ihr Sohn Daniel ist<br />
25. Wird er weitermachen? Da lacht sie<br />
und sagt: „Das haben wir noch vor uns.“<br />
Dann sagt Roeckl noch einen Satz,<br />
der nach einem Kalenderspruch klingt,<br />
den sie aber begründen kann: „Tradition<br />
kann es nur geben, wenn es auch Innovation<br />
gibt.“ Für sie löst dieses Versprechen<br />
der Roeckl‐Touch ein: In das Model sind<br />
zarte Silberfäden eingewoben, die den<br />
Spielplatz-Eltern auch im Winter erlauben,<br />
ihr Smartphone mit warmer Hand<br />
zu bedienen.<br />
PAUL-PHILIPP HANSKE lebt in<br />
München und schreibt als freier Autor für<br />
verschiedene Magazine. Er schwört <strong>auf</strong><br />
seine Roeckl-Handschuhe aus Walkstoff<br />
Foto: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
86<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Reportage<br />
DER BANKER UND<br />
SEINE TASSEN<br />
Von ERWIN KOCH<br />
Fotos ACHIM HATZIUS<br />
88<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
150 Jahre gehörte die<br />
Berliner Porzellan-<br />
Manufaktur den<br />
Königen. Dann dem<br />
Staat. Und jetzt Jörg<br />
Woltmann. Der Bankier<br />
stopfte den Betrieb<br />
mit Millionen. Warum<br />
bloß? Besuch bei<br />
einem glücklichen<br />
Unternehmer<br />
Endlich führt er die Pretiose<br />
zum Mund, hält sie mit ruhigen<br />
bleichen Fingern, eine Bürotasse<br />
Kurland, blauer Fond<br />
und Goldrand, 24 Karat, geadelt<br />
mit zwei schwarzen Lettern: JW.<br />
Und Jörg Woltmann, Krawatte und<br />
Einstecktuch, schwört im Besprechungsraum<br />
seiner Königlichen Porzellan-Manufaktur<br />
Berlin GmbH: Selbst der Tee<br />
schmeckt aus unseren Tassen besser, der<br />
Kaffee sowieso.<br />
Herr Woltmann!<br />
Übertreibung sei nicht sein Fach,<br />
spricht der Mann aus glattem Gesicht,<br />
diese Haptik!, großartig!, einmalig!, maschinell<br />
kriege man den Rand einer Tasse<br />
so dünn und fein nicht hin.<br />
Das macht den Kaffee besser?<br />
Woltmann nickt.<br />
Also trinkt man im Himmel aus Tassen<br />
von KPM?<br />
„Davon gehe ich aus“, knurrt er.<br />
Und in der Hölle aus Ikea?<br />
Herr Woltmann lächelt und schweigt,<br />
blickt hinüber zu Friedrich dem Großen<br />
in Öl, Gründervater der Manufaktur,<br />
1763, 19. September.<br />
„Muss ich dar<strong>auf</strong> antworten?“<br />
Dass Jörg Franz Fritz Woltmann, geboren<br />
nach einer Nacht, die so kalt war,<br />
dass in Berlin viele Menschen erfroren,<br />
89<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Reportage<br />
8. Februar 1947, heute besitzt, was der<br />
große Fritz begann, dankt er einem Gefühl,<br />
das er furchtlos Patriotismus nennt.<br />
Es sei ihm, einem Banker aus Leidenschaft,<br />
nie ein Herzenswunsch gewesen,<br />
Eigentümer der KPM zu werden, wohl<br />
aber eine Herzenspflicht, sie vor dem Untergang<br />
zu bewahren. Gern zückt er auch<br />
den Spruch, die KPM sei keine Konservenfabrik,<br />
sondern ein Kulturgut. „Ich<br />
habe das einzige Unternehmen <strong>auf</strong> dieser<br />
Welt, das zuvor sieben Königen und<br />
Kaisern gehörte.“<br />
Wieder führt er seine Tasse zum<br />
Mund, Durchmesser 120 Millimeter,<br />
Höhe 77, Inhalt 4 Deziliter, Darjeeling<br />
mit Milch, er nippt, noch einmal, und<br />
stellt den Behälter, als wäre er aus feinstem<br />
Glas, sorgsam zurück <strong>auf</strong> den langen<br />
Tisch.<br />
„Wie war die letzte Frage?“<br />
Ihre früheste Erinnerung?<br />
Jörg Woltmann, dunkler Anzug, gestreifte<br />
Weste, legt eine Hand <strong>auf</strong> die<br />
andere.<br />
„Meine früheste Erinnerung? Na ja.<br />
Vielleicht die: Wie meine Mutter nachts<br />
an der Nähmaschine sitzt, mit Handschuhen<br />
ohne Fingerlinge, und friert.“<br />
Nur Tage vor seiner Geburt hatte sie<br />
sich scheiden lassen, allein zog sie ihre<br />
zwei Knaben <strong>auf</strong>, Frank und Jörg, der<br />
größere drei Jahre älter als der kleine.<br />
Sie nähte Röcke, Mäntel, Blusen, Damenoberbekleidung,<br />
verk<strong>auf</strong>te sie Bekannten,<br />
die ihre Ware sehr lobten und empfahlen.<br />
Schließlich, als die Bestellungen immer<br />
mehr wurden, holte sie Näherinnen<br />
in die Wohnung in Berlin-Moabit.<br />
Herr Woltmann, hätten Sie denn,<br />
wenn Meißen zu k<strong>auf</strong>en gewesen wäre,<br />
auch Meißen gek<strong>auf</strong>t?<br />
Heftig schüttelt er den Kopf. „Weder<br />
Meißen noch sonst eine andere<br />
Manufaktur.“<br />
Aber eine andere Luxusmarke?<br />
„Ich k<strong>auf</strong>te die KPM, weil ich Berliner<br />
bin, die KPM gehört zu meiner Stadt<br />
wie das Brandenburger Tor.“<br />
Am liebsten saß er in der Nähe der<br />
Mutter und schob, zufrieden mit seiner<br />
Welt, blecherne Züge über den alten Teppich.<br />
Anders als der Bruder ging Jörg<br />
nicht zum Fußball, selten zog er durch<br />
die Trümmer von Moabit, dem Kleinen<br />
gefiel die Einsamkeit – doch wenn Mama<br />
ihn bat, rannte er los, brachte Schecks<br />
Handgemaltes Blumenmuster<br />
<strong>auf</strong> einem Teller, angelehnt an<br />
historische Motive der<br />
botanischen Blumenmalerei<br />
Seinen Kaffee trinkt Woltmann<br />
besonders gerne aus der<br />
schwarzen Jubiläums-Edition des<br />
Kurland-Service (Seite 88)<br />
zur nahen Bank. Dort stand er am Schalter<br />
und wartete, staunte und wartete und<br />
rieb seine Lippen, bis der Beamte ihn rief,<br />
am glatten, vornehmen Holz.<br />
Bis vor einigen Jahren noch, sagt<br />
Jörg Woltmann im Besprechungsraum<br />
seiner Königlichen Porzellan-Manufaktur,<br />
die er, seit sie seine ist, mit 40 Millionen<br />
Euro stopfte, bis vor wenigen Jahren<br />
noch habe er im Mund ab und an den<br />
Geschmack seines ersten Schalters verspürt,<br />
seltsam und immer wieder.<br />
Herr Woltmann, Ihren Vater haben<br />
Sie nie vermisst?<br />
„Nie!“, sagt er und schweigt.<br />
90<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Manchmal stapelte er die Groschen,<br />
die er besaß, zu schlanken Türmen, er<br />
zählte sein Geld, dachte aus, was damit<br />
zu k<strong>auf</strong>en wäre, vielleicht die halbe Welt<br />
oder die Wohnung gegenüber, die einen<br />
großen Ofen besaß.<br />
Was ist ein guter Unternehmer?<br />
Woltmann, kein Schnellredner, härtet<br />
Satz nach Satz. „Jemand, der langfristig<br />
denkt. Der eine hohe soziale Kompetenz<br />
besitzt – davon gibt es immer weniger. Einer,<br />
der die Grundsätze des ordentlichen<br />
K<strong>auf</strong>manns lebt.“<br />
Die da wären? „Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit,<br />
Pflichtbewusstsein. Denn man<br />
hat <strong>auf</strong> Erden eine bestimmte Aufgabe,<br />
und die muss man ordentlich lösen, mit<br />
Anstand und mit Maß.“<br />
Das sagt ausgerechnet ein Banker!<br />
„Ach“, stöhnt Jörg Franz Fritz Woltmann<br />
im 68. Jahr seines Lebens, Vorstandsvorsitzender<br />
und Alleinaktionär der Allgemeinen<br />
Beamten Kasse Kreditbank AG,<br />
Alleingesellschafter der Königlichen Porzellan-Manufaktur<br />
Berlin GmbH, „mittlerweile<br />
habe ich mehr Respekt vor einem<br />
Unternehmer, der für eine Million<br />
Euro eine neue Maschine k<strong>auf</strong>t und<br />
nicht weiß, ob sich das am Ende wirklich<br />
lohnt, als vor einem Banker. Banker,<br />
mit Verlaub, sind nur die Vermittler zwischen<br />
Vor- und Nachsparer.“<br />
Was war das Schlimmste Ihrer Kindheit?<br />
Er schnaubt. Es gab nichts, was diesen<br />
Namen verdient. Der Bruder lieferte<br />
die Mäntel, Röcke, Blusen aus, Jörg trug<br />
die Schecks zur Bank. Einmal, allein<br />
zu Hause, öffnete er eine schwere Dose<br />
Apri kosen, verschlang drei, vier, fünf<br />
mit Lust, aß dann, um das Verbrechen<br />
zu vollenden, die ganze Dose leer – und<br />
danach, ein halbes Jahrhundert lang,<br />
keine einzige Aprikose mehr. Lustlos<br />
ging er zur Schule, gähnte sich durch<br />
den Unterricht, die Lehrer luden Jörgs<br />
Mutter vor, mahnten, warnten, hofften.<br />
Werktags befahl sie ihren Söhnen, den<br />
Tisch zu decken, das Geschirr zu waschen<br />
und zu trocknen, sonntags verbot<br />
sie es, sonntags holte die Mutter ewige<br />
Werte aus dem Schrank, Schüsseln und<br />
Teller von KPM, das berühmte Kurland-<br />
Service der Königlichen Porzellan-Manufaktur<br />
zu Berlin. „Noch ein Tässchen<br />
Kaffee?“<br />
„Übrigens, das Schlimmste meiner<br />
Kindheit war wohl, dass ich, der Kleinere,<br />
oft nur die Kleider meines großen<br />
Bruders bekam – dann aber endlich eine<br />
eigene blaue samtene Hose, genäht von<br />
meiner Mama nur für mich, Weihnachten<br />
vor einer Ewigkeit.“<br />
1957 zog die Familie nach Lichterfelde-West,<br />
die Mutter, mit ihrer Näherei<br />
zu Geld gekommen, k<strong>auf</strong>te ein Haus,<br />
Jörg wurde Gymnasiast, plagte sich<br />
durch die Fächer, war als Schüler weder<br />
gut noch schlecht, aber gern allein und<br />
anders. Er gefiel sich in Anzug und Krawatte,<br />
ging darin zur Schule, setzte sich<br />
darin zu Hause an den Tisch.<br />
Wann, Herr Woltmann, war Ihre<br />
letzte schlaflose Nacht? „Heute“, sagt er<br />
und blickt zu Friedrich. „Doch was heißt<br />
schon schlaflos?“, knurrt er jetzt, „man<br />
liegt im Bett und denkt nach, überlegt<br />
hin und her, hin und her, man entwirft,<br />
verwirft, entwirft, verwirft.“<br />
Denn selbst zu Hause, selbst im Bett,<br />
bleibe man Unternehmer, suche Mittel<br />
und Wege, im Wettbewerb zu bestehen,<br />
dieser Eifer, diese Spannung löse sich<br />
kaum je <strong>auf</strong>, sie bestimme sein Wesen,<br />
ob er dies wolle oder nicht.<br />
1965, zur Freude der Mutter, bestand<br />
Woltmann das Abitur und begann<br />
im Bankhaus Lampe eine Lehre. Vier<br />
91<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Reportage<br />
92<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
03/2014<br />
MÄRZ<br />
EURO 9,00 / SFR 14,50<br />
WWW.MONOPOL-MAGAZIN.DE<br />
Anzeige<br />
Jahre später, 1969, schrieb er sich an der<br />
Fachhochschule für Wirtschaft ein, studierte<br />
Betriebswirtschaft, wohnte noch<br />
bei der Mutter in Lichterfelde-West und<br />
suchte Mittel, Mama nicht länger zu belasten.<br />
Also gründete er, 23 Jahre alt, mit<br />
einem Partner ein erstes Unternehmen,<br />
An- und Verk<strong>auf</strong> von Gebrauchtwagen.<br />
Jeden Morgen um sechs verließ er das<br />
Haus der Mutter, fuhr ins Geschäft, teilte<br />
die Arbeit ein, lief zur nahen Hochschule,<br />
blieb dort bis zwei Uhr nachmittags, lief<br />
zurück ins Autohaus, k<strong>auf</strong>te, verk<strong>auf</strong>te,<br />
blieb bis zum Abend, fuhr schließlich zur<br />
Mutter, krümmte sich über die Bücher.<br />
Er glaube, sagt Jörg Woltmann, als<br />
Unternehmer sei er immer mutig gewesen,<br />
aber nie leichtsinnig.<br />
Das Studium der Betriebswirtschaft<br />
durchlief er in kurzen sechs Semestern,<br />
dann war Ölkrise, die Gelegenheit so<br />
günstig, Woltmann k<strong>auf</strong>te und k<strong>auf</strong>te,<br />
war schließlich, bevor er sein Autohaus<br />
1974 verk<strong>auf</strong>te, in Berlin an vier Orten<br />
zu finden. Mit einem Teil des Geldes, das<br />
er gewann, tat er sich Gutes, Jörg Woltmann<br />
erstand ein schönes neues Automobil,<br />
eine schöne teure Uhr – und das<br />
Service Kurland der Königlichen Porzellan-Manufaktur<br />
für acht Personen,<br />
70 Teile, jenes Geschirr, das sonntags <strong>auf</strong><br />
dem Tisch der Mutter gestanden hatte.<br />
Aber das Auto ist längst kaputt, die<br />
Uhr ist weg, nur das Kurland ist noch da,<br />
so schön und edel wie ehedem.<br />
„Und das ist mein Problem. Dass,<br />
wer einmal KPM besitzt, nichts Besseres<br />
mehr besitzen kann.“<br />
1974 gründete er mit einem Partner<br />
ein neues Institut, Finanzdienstleistung<br />
und Unternehmensberatung. Die<br />
Geschäfte liefen, aus der Firma erwuchs<br />
Verschiedene Gipsformen zur<br />
Porzellan-Herstellung kann man<br />
heute in der alten Ofenhalle der<br />
Manufaktur besichtigen<br />
eine Bank, Allgemeine Beamten Kasse,<br />
Jörg Woltmann, 32 Jahre, jüngster Banker<br />
Deutschlands, besaß zwei Drittel davon.<br />
Eine Bank für Beamte?<br />
Er schließt kurz die Augen. Er und<br />
sein Partner, damals, hätten sich die<br />
Frage gestellt, wo und wie im Bankenwesen<br />
noch Geld zu verdienen sei.<br />
Wie?<br />
„Mit Privatkunden, Endverbrauchern,<br />
nicht mit Institutionen. Unsere<br />
nächste Frage war dann: Wo finden wir<br />
Privatkunden in sicheren Verhältnissen,<br />
Kunden, die uns ein geringes Risiko sind?<br />
Dort, wo die Arbeitsplätze sicher sind, im<br />
öffentlichen Dienst.“ Sie gründeten eine<br />
Bank, die sich um Beamte kümmert, deren<br />
Geld verwaltet, ihnen Kredite gibt.<br />
„Man muss sich“, sagt Jörg Woltmann,<br />
„im Leben die wichtigen Fragen<br />
stellen.“<br />
Was ist die wichtigste Frage<br />
überhaupt?<br />
„Uff“, knurrt Woltmann, „jetzt wird’s<br />
fast religiös. Muss ich dar<strong>auf</strong> antworten?“<br />
Müssen Sie nicht.<br />
„Die wichtigste Frage vielleicht, ganz<br />
banal, ist die: Ist es gut, was ich mache?<br />
Ist es richtig? Die führt leider zu meinen<br />
schlaflosen Nächten, immer wieder,<br />
entwerfen, verwerfen, entwerfen,<br />
verwerfen.“<br />
Was sagt dann Ihre Frau?<br />
Woltmann lacht <strong>auf</strong>. „Gib doch mal<br />
Ruhe!“<br />
1981 begann sie ihre Lehre bei der<br />
Allgemeinen Beamten Kasse und verliebte<br />
sich, 17 Jahre jünger, schnell in deren<br />
Besitzer, JW, es dauerte zwei Weihnachtsessen,<br />
bis der Chef entbrannte.<br />
Was ist das Beste an ihr?<br />
„Ihre Fröhlichkeit.“<br />
Was kann sie besser als Sie?<br />
„Fröhlich sein.“<br />
Was noch?<br />
„Kochen.“<br />
1985 gebar Kerstin Woltmann eine<br />
Tochter, Sandra Sophie, der Vater war<br />
bei der Geburt nicht dabei, Woltmann<br />
hatte zu tun.<br />
Bedauern Sie das?<br />
„Das Leben ist oft nicht so, wie man<br />
es gern hätte. Nun bin ich Großvater seit<br />
einigen Monaten, glücklich und stolz <strong>auf</strong><br />
meine Enkelin Florentina.“<br />
Ende 2004 las Jörg Woltmann, der<br />
sich mit dem Gedanken trug, in wenigen<br />
Ihr Monopol<br />
<strong>auf</strong> die Kunst<br />
Stopp! Warum sich der Kunstmarkt ändern muss / Dürfen wir, Mademoiselle?<br />
Im Haus von Coco Chanel / Exklusiv Noch nie gezeigte Fotografien von Helen Levitt<br />
Bitte<br />
lächeln<br />
Künstler als Models: Nur ein<br />
harmloser Flirt – oder eine<br />
Liaison dangereuse?<br />
Ein Modeheft<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst und<br />
Leben, den internationalen Kunstbetrieb<br />
wider. Herausragende Porträts<br />
und Ausstellungsrezensionen, spannende<br />
Debatten und Neuigkeiten aus<br />
der Kunstwelt, alles in einer unverwechselbaren<br />
Optik.<br />
Hier bestellen:<br />
MAGAZIN FÜR KUNST UND LEBEN<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 1140045<br />
93<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Reportage<br />
Jahren das Tagesgeschäft seiner Allgemeinen<br />
Beamten Kasse Kreditbank AG,<br />
die ihm mittlerweile allein gehörte, Jüngeren<br />
zu überlassen, in der Zeitung, das<br />
Land Berlin habe vor, seine Königliche<br />
Porzellan-Manufaktur, die nichts als<br />
Schulden mache, zu privatisieren. Tage<br />
später, ein Zufall, saßen zwei Herren in<br />
seinem Büro, sie seien, sagten sie, Teil<br />
eines Konsortiums, dem auch Franz<br />
Wilhelm Prinz von Preußen angehöre,<br />
Urenkel des letzten deutschen Kaisers,<br />
entschlossen, die KPM zu übernehmen,<br />
so er, Jörg Woltmann, sie finanziell begleite.<br />
Woltmann, höflich wie immer,<br />
lehnte ab, derartige Kredite entsprächen<br />
nicht dem Gebaren seiner Bank.<br />
Wieder Tage später kam ihm zu Ohren,<br />
sehr wahrscheinlich gehe die KPM,<br />
wenn das Konsortium des Prinzen nicht<br />
den Zuschlag erhalte, an chinesische<br />
Investoren.<br />
„Das wollte ich nicht!“<br />
„Die KPM gehört nach Berlin, nicht<br />
nach Peking oder Schanghai. Und also<br />
begann ich zu rechnen und kam zum<br />
Schluss, dass das Risiko, falls ich einige<br />
Sicherheiten bekäme, unter anderem die<br />
Namensrechte an der KPM, tragbar sei.“<br />
„Schließlich“, sagt Woltmann, beide<br />
Hände an der großen Tasse, „schließlich<br />
legte ich den Kredit heraus, drei Millionen<br />
Euro für den Produktionsbetrieb,<br />
fünf Millionen Betriebsmittelkredit.“<br />
Doch noch in der Nacht nach der<br />
Unterzeichnung der Verträge hätten die<br />
neuen Eigentümer der KPM sich überworfen<br />
und das Chaos angeschoben – bereits<br />
neun Monate später, im September<br />
2005, sei die Königliche Porzellan-Manufaktur<br />
vor der Insolvenz gestanden.<br />
Was nun?<br />
„Es war“, zitiert Herr Woltmann<br />
Herrn Woltmann, „nie mein Herzenswunsch,<br />
Eigentümer der KPM zu werden,<br />
aber eine Herzenspflicht, sie vor dem Untergang<br />
zu retten.“<br />
Dieses Kulturgut, Teil der Berliner<br />
Identität, das älteste produzierende Unternehmen<br />
der Stadt. Gegründet von<br />
Friedrich dem Großen, 1763. Der in seinem<br />
Betrieb die Kinderarbeit verbot, geregelte<br />
Arbeitszeiten einführte, sichere<br />
Renten. Der sich selbst der beste Kunde<br />
war und für jedes seiner 21 Schlösser<br />
ein Tafelservice bestellte, manche aus<br />
450 Teilen. Und damit den Neid des<br />
„Die KPM muss<br />
nicht die größte<br />
Manufaktur der<br />
Welt sein.<br />
Ich bin zufrieden,<br />
wenn sie die<br />
beste ist“<br />
Jörg Woltmann<br />
Adels weckte, des gehobenen Bürgertums,<br />
das sich fortan mit Figuren, Vasen,<br />
Geschirr der königlichen Manufaktur<br />
beschenkte.<br />
Gut 150 Jahre lang, bis 1918, blieb<br />
die KPM im Besitz der Könige und der<br />
Kaiser, dann war sie Eigentum des jeweiligen<br />
Staates, seit dem Zweiten Weltkrieg<br />
des Landes Berlin.<br />
Ach, klagt Jörg Woltmann über den<br />
Tisch, die jüngere Geschichte der KPM<br />
sei eine Geschichte für sich, keine erbauliche,<br />
zumal sie ein Panoptikum dessen<br />
liefere, wie ein Staat mit einem Unternehmen<br />
nicht umgehen sollte. Bis 1989<br />
sei die Manufaktur ein Eigenbetrieb des<br />
Landes Berlin gewesen, angesiedelt im<br />
Bereich Kultur, als wäre sie ein Opernhaus<br />
oder ein Theater, am Leben gehalten<br />
mit zehn Millionen aus dem Kulturhaushalt,<br />
Jahr für Jahr. 1989 habe Berlin<br />
seine Eigenbetriebe in Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung umgewandelt, die<br />
hohen Verluste der KPM seien ans Licht<br />
gekommen, wor<strong>auf</strong> Berlin ratzfatz beschlossen<br />
habe, die Manufaktur zu verk<strong>auf</strong>en<br />
– und sie der Investitionsbank<br />
Berlin verk<strong>auf</strong>t habe, die, man sehe und<br />
stutze, zu 100 Prozent dem Land Berlin<br />
gehörte. Diese Investitionsbank wiederum,<br />
<strong>auf</strong>geschreckt von den roten Zahlen<br />
der Neuerwerbung, habe der KPM, um<br />
Schulden abzubauen, befohlen, ihr weites<br />
Gelände am Rand des Tiergartens zu<br />
veräußern. Folgsam habe die KPM die<br />
Immobilie der Gewerbesiedlungsgesellschaft<br />
verk<strong>auf</strong>t, die, man sehe und stutze,<br />
zu 100 Prozent dem Land Berlin gehörte.<br />
„Ein Klüngel!“, schimpft Woltmann.<br />
Die KPM war nun Mieter im vormals<br />
eigenen Haus. Und unfähig, diese Miete<br />
zu erwirtschaften. Deshalb entschied das<br />
Land Berlin, den Produktionsbetrieb der<br />
Königlichen Porzellan-Manufaktur endgültig<br />
zu privatisieren, Ende 2004 verk<strong>auf</strong>te<br />
sie ihn, ohne Gelände, jenem Konsortium<br />
des Prinzen, das sich Stunden<br />
nach dem K<strong>auf</strong> ins Gemenge kam.<br />
Woltmann, plötzlich bleich, holt tief<br />
Luft.<br />
„In den zwölf Jahren, bevor ich die<br />
KPM und ihre 170 Mitarbeiter übernahm,<br />
waren hier neun verschiedene Geschäftsführer<br />
am Werk gewesen.“<br />
Sie k<strong>auf</strong>ten dann zu welchem Preis?<br />
„13,5 Millionen Euro.“<br />
Er k<strong>auf</strong>te sie am Freitag, dem 24. Februar<br />
2006, und wies die Telefonistinnen<br />
an, sich fortan nicht mehr mit dem billigen<br />
Kürzel KPM zu melden, sondern mit<br />
dem vollen und schweren Namen: Königliche<br />
Porzellan-Manufaktur Berlin.<br />
Seine Frau tröstete er mit dem Scherz:<br />
Wenn’s nicht klappt, nennen wir die KPM<br />
Kerstins Porzellan-Manufaktur.<br />
Woltmann fuhr jetzt täglich an den<br />
Rand des Tiergartens, er richtete sich ein<br />
Büro ein, streute seine Strategie: Nur allerbeste<br />
hochpreisige Ware, kein Ramsch,<br />
keine Rabatte, keine Zweitlinien, haben<br />
wir alles nicht nötig, wir sind königlich.<br />
„Die KPM muss nicht die größte Manufaktur<br />
der Welt sein, ich bin zufrieden,<br />
wenn sie die beste ist.“<br />
94<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
<strong>Cicero</strong>-<br />
Hotel<br />
Foto: Marcel K<strong>auf</strong>mann (Autor)<br />
Ihren K<strong>auf</strong> haben Sie nie bereut?<br />
„Nie!“<br />
Und auch noch nie daran gedacht,<br />
die KPM wieder zu verk<strong>auf</strong>en?<br />
„Nie!“<br />
Die alte Ofenhalle machte er zur<br />
Verk<strong>auf</strong>sgalerie, daneben baute er ein<br />
Haus, die KPM-Welt, belebt mit einer<br />
Dauerausstellung und einem Café, Montag<br />
bis Samstag, 10 bis 18 Uhr. Er schuf<br />
Läden am Berliner Kurfürstendamm, in<br />
der Friedrichstraße, im KaDeWe und<br />
in den Hackeschen Höfen, in Potsdam,<br />
Hamburg, Köln, Schanghai, Taiwan, er<br />
tat sich zusammen mit Marken von Weltruf,<br />
Bugatti, Bottega Veneta. Zum 60. Geburtstag<br />
schenkte ihm die Belegschaft<br />
einen Woltmann in Porzellan, vielleicht<br />
40 Zentimeter hoch, heimlich hergestellt<br />
in 240 Stunden Freizeit.<br />
„Da hab ich geweint“, flüstert Jörg<br />
Woltmann.<br />
Seit acht Jahren bereits sitzt er vormittags<br />
in seiner Königlichen Porzellan-<br />
Manufaktur Berlin GmbH, die zu haben<br />
nie sein Herzenswunsch war, und wechselt<br />
kurz nach zwölf in die Allgemeine<br />
Beamten Kasse Kreditbank AG, bleibt<br />
bis sechs, bringt auch dort den Gedanken<br />
ans Porzellan nicht aus dem Kopf.<br />
„Als wär’s eine Sucht“, sagt<br />
Woltmann.<br />
Wann schreibt Ihre KPM endlich<br />
schwarze Zahlen?<br />
„Bald, schon bald!“, verspricht er<br />
und blickt zu Friedrich in Öl. Denn<br />
die Saat sei im Begriff <strong>auf</strong>zugehen, die<br />
Menschen hätten verstanden, dass es<br />
keine Blümchenmalerei sei, was man<br />
hier mache, sondern ein Luxusprodukt,<br />
ein Menschheitsgut, eines der schönsten<br />
und besten <strong>auf</strong> Erden.<br />
Er schaut <strong>auf</strong> die Uhr an seinem Arm.<br />
Herr Woltmann, mit welchen Worten,<br />
wenn es einst so weit ist, bitten Sie Sankt<br />
Petrus um Einlass ins Himmelreich?<br />
Jörg Franz Fritz Woltmann schweigt<br />
und schweigt, sein Gesicht hellt <strong>auf</strong>, wird<br />
jetzt breit und spitz, dann platzt es aus<br />
ihm: „Das neue Kurland ist da!“<br />
ERWIN KOCH, Reporter<br />
und Schriftsteller, fällt es<br />
noch schwer, die Differenz<br />
von Kaffee in einer Tasse<br />
Kurland herauszuschmecken<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch<br />
in diesen exklusiven Hotels<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan/Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger Hotel<br />
Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach:<br />
Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Brandenburger Hof, Grand Hotel<br />
Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel,<br />
The Mandala Suites, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel, Savoy Berlin, Sofitel Berlin<br />
Kurfürstendamm · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle:<br />
Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel <strong>auf</strong> der<br />
Wartburg · Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof,<br />
Kempinski Hotel Gravenbruch · Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,<br />
Hotel Atlantic Kempinski, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel,<br />
Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel Adler ·<br />
Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im Taunus: Falkenstein<br />
Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger Grandhotel Petersberg ·<br />
Konstanz: Steigenberger Inselhotel Magdeburg: Herrenkrug Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz:<br />
Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München: King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel<br />
München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg · Nürnberg: Le Méridien ·<br />
Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart:<br />
Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran:<br />
Hotel Castel · ÖSTERREICH Wien: Das Triest · SCHWEIZ Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel<br />
& Spa · Lugano: Splendide Royale · Luzern: Palace Luzern St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House ·<br />
Weggis: Post Hotel Weggis · Zermatt: Boutique Hotel Alex<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de<br />
Sofitel Berlin Kurfürstendamm<br />
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin<br />
Telefon +49 (0)30 800 999 0<br />
www.sofitel-berlin-kurfuerstendamm.com<br />
»Berlin verfügt über eine unvergleichbare Kunst- und<br />
Kulturlandschaft. Auch im Sofitel Berlin Kurfürstendamm<br />
werden Liebhaber zeitgenössischer Kunst einige Schätze<br />
entdecken – Werke von Dietrich Klinge, Junior Toscanelli<br />
oder Katrin Kampmann. Architektur, Einrichtung und<br />
Kunst gehen hier eine enge Verbindung ein. Mit <strong>Cicero</strong><br />
bieten wir jedem unserer Gäste ein besonders hochwertiges<br />
Magazin, das den hohen Ansprüchen an Information<br />
und Kultur entspricht.«<br />
Carsten Colmorgen, General Manager
STIL<br />
Fotoessay<br />
MÜTTER UND<br />
TÖCHTER<br />
96<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Die herausfordernde Beziehung zwischen<br />
Müttern und Töchtern ist ein Lebensthema der<br />
Fotografin Julia Fullerton-Batten. Zum internationalen<br />
Frauentag zeigen wir einen Teil ihrer<br />
Serie „Mothers and Daughters“ und fragen die<br />
Künstlerin nach ihrer Inspiration
Vorhergehende Seiten – zum Bild<br />
The Divorce sagt die Fotografin:<br />
„Ich erinnere mich gut an das Gespräch,<br />
in dem meine Mutter mir<br />
ihre Trennung von meinem Vater<br />
mitteilte. Sie machte mir Mut. Sie<br />
selbst hatte zu diesem Zeitpunkt<br />
eine Affäre, zu der sie auch stand.<br />
Daher ihre Stärke“<br />
The Rehearsal „Meine Mutter<br />
zwang mich zum Klavierspiel, auch<br />
zu Auftritten. War es nur Machtdemonstration?<br />
Von der sie eigentlich<br />
selbst gelangweilt war?“<br />
98<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Memories „Irgendwann saß ich mit<br />
meiner Mutter über alten Familienalben.<br />
Sie hatte endlich ihr eigenes<br />
Leben, in Wien, mit einem anderen<br />
Mann. Wir lebten bei unserem Vater.<br />
Als wir die Bilder sahen, wussten<br />
wir beide, dass es früher besser<br />
gewesen war. Auch wenn wir es<br />
nicht aussprachen. Sie hatte verloren,<br />
nicht gewonnen, obwohl sie<br />
jetzt freier war“
Alabaster Doll „Meine Mutter hat<br />
uns Kleider genäht und teilweise,<br />
wie hier, ihre eigenen Kleider für<br />
uns umgenäht. Für mich hat es sich<br />
angefühlt, als wollte sie mir mit den<br />
Kleidern ihre Identität überstülpen.<br />
Eine Identität aus einer anderen<br />
Zeit, mit der falschen Farbe“<br />
102<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Pretty New Thing „Mutter und<br />
Tochter in den Toilettenräumen eines<br />
Theaters. Für die Mutter ist ein<br />
Theaterbesuch ein seltener Ausflug<br />
aus der häuslichen Welt. Hier spiegeln<br />
sich Unsicherheiten, die beide<br />
zu überspielen versuchen, die Mutter<br />
eingeschüchtert von der erwachenden<br />
Sexualität und Schönheit<br />
ihrer Tochter“<br />
The Wedding Day „Meine Mutter<br />
musste heiraten, da sie schwanger<br />
war. Viel zu jung, obwohl sie meinen<br />
Vater kaum kannte. Dies wiederholte<br />
sich bei meiner Schwester.<br />
Diese Szene zeigt einen Augenblick,<br />
in dem sich Mutter und Tochter<br />
nahe sind und vertrauen. Die Mutter<br />
leidet mit der Tochter, an deren<br />
Hochzeitstag es diesen Moment des<br />
Innehaltens gibt. Beide sind von der<br />
eigenen Machtlosigkeit gelähmt“<br />
Frauen sind komplexe Wesen. Das wird ihnen sogar<br />
manchmal zum Verhängnis“, sagt die Fotografin<br />
Julia Fullerton-Batten. Besonders innerhalb der<br />
eigenen Familie würde dies deutlich, innerhalb der<br />
eigenen vier Wände, wo sich das wechselhafte, hochemotionale<br />
Verhältnis zwischen Mutter und Tochter<br />
über Jahre hinweg manifestiert.<br />
Dort, wo man einander am stärksten ausgeliefert<br />
ist, entstehen Szenen, die zwischen Idealisierung und<br />
Verachtung schwanken, zwischen Abhängigkeit und<br />
Befreiung, zwischen gegenseitiger Stärkung und oft<br />
ein Leben lang erinnerter Kränkung. Im Idealfall steht<br />
man sich am Ende dieses gemeinsamen Leidenswegs,<br />
der seinen expressiven Höhepunkt meist in der töchterlichen<br />
Pubertät findet, als geliebte Komplizin wie<br />
auch empathische Kritikerin gegenüber. Wenn alles<br />
gut läuft, werden aus Projektionsflächen allmählich<br />
Individuen.<br />
Julia Fullerton-Batten, 40, und ihrer eigenen Mutter,<br />
68, ist dies geglückt. In „Mothers and Daughters“,<br />
der bisher persönlichsten Arbeit der Fotografin, hat sie<br />
<strong>auf</strong> 20 Bildern „Stationen“ arrangiert, die das ambivalente<br />
Mutter-Tochter-Verhältnis chronologisch dokumentieren:<br />
vom Säugling über die sexuell Erwachende<br />
in der Pubertät, deren Mutter sie skeptisch-neidischstolz<br />
begutachtet, bis hin zur müden Greisin, die sich<br />
im inzwischen gütigen Blick ihrer erwachsenen Tochter<br />
spiegelt.<br />
Fullerton-Battens Protagonistinnen, die auch jenseits<br />
der inszenierten Realität <strong>auf</strong> den Bildern Mütter<br />
und Töchter sind, wurden im eigenen Zuhause fotografiert.<br />
Wie sie zueinander ausgerichtet sind, welche<br />
Emotionen ihre Gesichter prägen, wie auch Kleidung<br />
und die Dekoration legte Fullerton-Batten dagegen akribisch<br />
fest. Die einzelnen Motive dokumentieren tiefe<br />
persönliche Erinnerungen, Schlüsselmomente ihrer eigenen<br />
Biografie. Fullerton-Batten wurde in Bremen<br />
geboren, wuchs in der Nähe von Frankfurt und nach<br />
der Trennung der Eltern in den Vereinigten Staaten<br />
<strong>auf</strong>. Inzwischen lebt sie in London.<br />
Das Artifizielle der Bilder, das kontrastierende<br />
Licht und die reduzierten Farbspektren verbreiten ein<br />
ominös durchscheinendes Unbehagen, während die Interaktionen<br />
von Müttern und Töchtern, gefangen im<br />
Hier und Jetzt, beinahe klaustrophobische Zustände<br />
erzeugen. Wer hat die Kontrolle? Wer ist die Stärkere?<br />
Als fragil und volatil kann man den Gemütszustand der<br />
Frauen lesen, auch als stolz und überlegen – wenn die<br />
Mutter scheinbar verschwindet, auch wenn der Körper<br />
noch da ist.<br />
Derzeit zeigt die Ausstellung „Staged Reality“ im<br />
Stockholmer Fotomuseum Fotografiska fünf umfangreiche<br />
Serien der Fotografin, unter anderem „Mothers<br />
and Daughters“. Sie läuft bis zum 4. Mai.<br />
LENA BERGMANN<br />
Third Time around „Eine Frau und ihr<br />
drittes Kind. Alles von vorne. Sie ist<br />
gelangweilt von ihrer Rolle als Hausfrau<br />
und Mutter. Für das Kind ist sie<br />
der Fels in der Brandung. Sie selbst<br />
würde mit ihren hohen Schuhen lieber<br />
Teil einer anderen Welt sein“<br />
105<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
STIL<br />
Kleiderordnung<br />
Foto: Thomas Kierok für <strong>Cicero</strong><br />
BARBARA SCHÖNEBERGER<br />
Ich bin ja diese Superfrau. Zumindest<br />
denkt man das von mir. Doch gerade<br />
beim Thema Kleidung fühle ich mich<br />
kein Stückchen so. Dieses ewige Suchen<br />
und Finden von Dingen, die einem passen<br />
oder stehen, empfinde ich als ständigen<br />
Kampf. 20 Jahre habe ich gebraucht,<br />
um zu sagen: Das ist es jetzt. Ich mache<br />
keine Experimente mehr.<br />
Als ich zu studieren anfing, habe ich<br />
Schwarz getragen. Das habe ich zehn<br />
Jahre lang so beibehalten. Ich fand einfach,<br />
dass das die sachlichste Möglichkeit<br />
ist, mich zu präsentieren. Auf den ersten<br />
Blick wollte ich nicht wie dieses Mädchen<br />
wirken mit dem blonden Wallehaar, dem<br />
großen Busen, so lieblich. Ich sah so unsachlich<br />
aus. Es ist nicht so, dass ich mich<br />
nicht ernst genommen gefühlt hätte. Niemand<br />
kam zu mir und hat gesagt, ey, du<br />
kleine süße Praline … Aber genauso habe<br />
ich mich gefühlt. Das Schwarz war also<br />
vielmehr ein vorauseilender Gehorsam.<br />
Eine vorbeugende Maßnahme.<br />
Beim Fernsehen sollte dann plötzlich<br />
alles bunt sein, pink, türkis, gelb,<br />
am besten noch mit Blümchen dr<strong>auf</strong>. Das<br />
macht etwas völlig anderes aus dir. Ich<br />
kam mir vor wie ein Bonbon. Mein Körper<br />
braucht eine klare Linie. Das habe<br />
ich jetzt verstanden. Ich habe auch <strong>auf</strong>gehört,<br />
meinen Busen wegdenken zu wollen.<br />
Ich kann ja gar nicht anders, als mich<br />
mit ihm einigermaßen zu arrangieren.<br />
Manchmal erschrecke ich schon, wenn<br />
ich Fotos von mir sehe. An diese riesige<br />
Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung<br />
kann ich mich nur schwer<br />
gewöhnen.<br />
Heute trage ich im Grunde immer<br />
das Gleiche. An mir kann sich kein Fashionberater<br />
mehr abarbeiten. Und was<br />
habe ich schon Stylisten verschlissen …<br />
Barbara Schöneberger, 40,<br />
ist Fernsehmoderatorin,<br />
Schauspielerin und Sängerin.<br />
Im Mai geht sie mit ihrem<br />
neuen Album <strong>auf</strong> Konzertreise<br />
Am liebsten ja schwarze Rollkragenpullover.<br />
Damit kann einem keiner was. Und<br />
das finde ich gut.<br />
Gutes Aussehen bedeutet für mich<br />
Natürlichkeit, die ich im Fernsehen zunehmend<br />
vermisse. Manchmal habe ich<br />
das Gefühl, dass man uns zu Sch<strong>auf</strong>ensterpuppen<br />
machen will. Ständig kommt<br />
irgendwer und will was <strong>auf</strong> dich dr<strong>auf</strong>sprühen.<br />
Wegstehende Haare werden<br />
notfalls ausgerissen, Hauptsache, es entsteht<br />
nie der Eindruck, dass da die Natur<br />
am Wirken ist. Deswegen bin ich immer<br />
froh, wenn mir Menschen begegnen, die<br />
selbst gemacht aussehen.<br />
Privat mache ich modisch keine<br />
großen Sprünge. Zu Hause l<strong>auf</strong>e ich supergammelig<br />
rum. Ich brauche diesen<br />
Kontrast. Je älter ich werde, desto konservativer<br />
werde ich. Und das ist okay für<br />
mich, da es letztlich der Bequemlichkeit<br />
Rechnung trägt. Wenn ich mit den Kindern<br />
unterwegs bin, kann ich nicht ständig<br />
in Stöckelschuhen durch die Gegend<br />
rennen. Das mache ich nicht mehr. Das<br />
ist es mir nicht wert.<br />
Aufgezeichnet von SARAH MARIA DECKERT<br />
106<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
„ Das Private<br />
ist nicht politisch “<br />
Die Publizistin Birgit Kelle über die Chancen eines neuen Feminismus und<br />
die Einmischung des Staates in Familienangelegenheiten, Seite 108
SALON<br />
Porträt<br />
ALICE SCHWARZER WAR GESTERN<br />
Kinder, Küche, keine Krippe: Die Publizistin Birgit Kelle verkörpert einen neuen<br />
Feminismus, der von den alten Frontstellungen der Geschlechter nichts wissen will<br />
Von KATHARINA SCHMITZ<br />
Im Hauptberuf Mutter – ist das noch<br />
rückständig oder schon wieder modern?<br />
Birgit Kelle jedenfalls hat morgens<br />
um zehn die Frühschicht bereits<br />
hinter sich. Die vier Kinder im Alter<br />
zwischen fünf und 14 Jahren sind versorgt,<br />
das Haus nahe der niederländischen<br />
Grenze, wo sie mit der Familie<br />
wohnt, hat sie nach dem Frühstück verlassen.<br />
Ländlich ist es dort, man ist umgeben<br />
von Schafen und hat „die Illusion,<br />
dass die Kinder sicher <strong>auf</strong>wachsen“. Sagt<br />
Birgit Kelle, als wir uns in Köln treffen.<br />
Sofort fällt die kräftige Stimme <strong>auf</strong>, die<br />
rasch in einen Talkshow-Modus gerät.<br />
Um den Kindern gerecht zu werden, arbeitet<br />
die freie Journalistin oft abends<br />
und am Wochenende, immer zu Hause.<br />
Birgit Kelle ist Vorsitzende von „Frau<br />
2000plus“, eines eingetragenen Vereins,<br />
der laut Selbstdarstellung für ein „neues<br />
Frauenbild jenseits der alten feministischen<br />
Vorstellung“ kämpft. Insbesondere<br />
sollen „Frausein und Mutterrolle“, anders<br />
als im bisherigen, im Alice-Schwarzer-Feminismus,<br />
nicht als Gegensatz verstanden<br />
werden. Das neue Rollenmodell<br />
ist nicht die kinderlose, männerskeptische<br />
Karrieristin, sondern die Frau, die<br />
frei wählt. Und sich nicht von anderen<br />
Frauen als unselbständig beschimpfen<br />
lassen will, wenn sie sich für ein Leben<br />
als Hausfrau und Mutter entscheidet.<br />
Kelle benötigt selbst morgens um zehn<br />
nur ein Stichwort, um in Fahrt zu kommen.<br />
Die „Herdprämie“, zum Beispiel. Es sei<br />
skandalös, dass in Deutschland arbeitende<br />
Eltern Subventionen erhielten, die traditionelle<br />
Familie aber diskriminiert werde.<br />
Dabei gebe es sehr viele Eltern, die das Alleinverdienermodell<br />
lebten – aus Überzeugung.<br />
„Der Krippenplatz ist die teuerste<br />
Art, Kinder großzuziehen. Das ist doch paradox!“<br />
Auf schlimmste Weise neoliberal<br />
sei es, gebildete Mütter, die ihre Kinder<br />
erziehen und sie nicht vom Staat betreuen<br />
lassen, als „vergeudetes Potenzial“ zu diffamieren.<br />
„Das macht mich alles wahnsinnig!“,<br />
ruft Kelle. Von der Frauenquote hält<br />
sie auch nichts.<br />
Ihren Furor kompensierte Kelle mit<br />
einem Sachbuch unter dem Titel „Dann<br />
mach doch die Bluse zu“. Der Klappenteil<br />
zeigt die 39-jährige Autorin in leicht<br />
lasziver Pose. Das Buch verk<strong>auf</strong>t sich<br />
gut. Sogar die taz äußerte sich lobend.<br />
Ihr gleichnamiger Online-Kommentar<br />
zur Sexismus-Debatte wurde im Netz<br />
der Renner. Das Magazin Werben und<br />
Verk<strong>auf</strong>en kürte ihn zum Social-Media-<br />
Phänomen des Jahres 2013.<br />
BIRGIT KELLES MARKENKERN sind Plädoyers<br />
für Kinder und Familie im Stakkato.<br />
Bei Youtube sind eindrückliche Beispiele<br />
zu sehen, etwa aus „Maybrit Illner“, wo<br />
sie zu Beginn ihrer Karriere als Wutmutter<br />
einen Auftritt hatte. Familienministerin<br />
Kristina Schröder fehlten die<br />
Worte, Cem Özdemir schaute nachdenklich.<br />
Unlängst kreuzte sie die Klingen mit<br />
der stellvertretenden Vorsitzenden von<br />
Femen Deutschland. Bei „Menschen bei<br />
Maischberger“ warf sie sich für die traditionelle<br />
Ehe in die Bresche und kritisierte<br />
den baden-württembergischen Bildungsplan<br />
zugunsten „sexueller Vielfalt“,<br />
der Toleranz mit Akzeptanz verwechsle.<br />
Ihr Mann, Journalist wie sie, hält ihr den<br />
Rücken frei, „selbstverständlich“.<br />
Sie provoziert einen Satz, den bisher<br />
Eva Hermann, Christa Müller, Thilo<br />
Sarrazin abonniert hatten: Endlich sagt<br />
es mal eine(r)! Ihre Ansichten versteckt<br />
sie nicht, hat eine Kolumne bei The European,<br />
schreibt für Focus, Die Welt und<br />
das konservative Portal Freie Welt. Ja,<br />
sie hält nichts von der gleichgeschlechtlichen<br />
Ehe. Findet es problematisch, dass<br />
Schwangerschaftsabbrüche Normalität<br />
in Deutschland sind. Nennt die Idee<br />
„perfide“, Abtreibung als „so genanntes<br />
Frauenrecht“ <strong>auf</strong> europäischer Ebene<br />
einzuführen.<br />
Im Gespräch wehrt sie sich: „Nein.<br />
Ich bin nicht konservativ, ich bin liberal.“<br />
Der Staat mische sich zu sehr ein.<br />
Es gehe ihr um die Freiheit, selbst entscheiden<br />
zu dürfen, wie man sein Leben<br />
gestaltet. „Das Private ist nicht politisch“,<br />
sagt sie und leitet zum Feminismus über.<br />
Spricht von einer Diktatur und lässt die<br />
Gender-Fraktion wissen, sie brauche<br />
keine Gleichstellungsbe<strong>auf</strong>tragte für<br />
ihre Ehe, „Frau Schwesig geht es nichts<br />
an, wer bei uns den Müll runterträgt“.<br />
Könnte sie sich ein politisches Amt vorstellen?<br />
Anfragen gab es. Die CDU-Wählerin<br />
und CSU-Sympathisantin, die vom<br />
evangelischen Glauben zum Katholizismus<br />
konvertierte, winkt ab. „Als Publizistin<br />
kann ich schreiben, was ich will.“<br />
Birgit Kelle hat Jura studiert, dann<br />
abgebrochen und mit Anfang zwanzig<br />
beim Badischen Verlag in Freiburg volontiert,<br />
wo sie ihren Mann kennenlernte.<br />
Sie wurde schwanger.<br />
Plötzlich galt das Mädchen, das mit<br />
neun Jahren aus dem rumänischen Siebenbürgen<br />
nach Deutschland kam, immer<br />
eine große Klappe hatte und sich<br />
qua Geschlecht nie benachteiligt gefühlt<br />
hatte, im Kreis der <strong>auf</strong>stiegsorientierten<br />
Kolleginnen als bemitleidenswert. Weil<br />
sie Mutter wurde und die nächsten Jahre<br />
mit Erziehung beschäftigt war. „Ich bin<br />
ja ein Doppelopfer: Frau und Migrationshintergrund!“,<br />
sagt sie und lacht kräftig.<br />
Dann muss sie los. Die Jüngste hat sich<br />
heute Nudeln ohne Sauce gewünscht.<br />
KATHARINA SCHMITZ lebt mit ihrer<br />
Familie in Berlin. Die beiden Söhne essen<br />
anders als im Hause Kelle lieber Nudeln<br />
mit Sauce<br />
Foto: Henning Ross für <strong>Cicero</strong><br />
108<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
SIE WILL DAS WAGNIS<br />
Mit Nina Hoss kommt dem Deutschen Theater in Berlin der letzte Glanz abhanden.<br />
Die Schauspielerin ist zur Schaubühne gegangen, weil sie neues Chaos sucht<br />
Von IRENE BAZINGER<br />
Foto: Mark Mattingly<br />
Als sie bei den Salzburger Festspielen<br />
2005 und 2006 in das rote<br />
Kleid der Buhlschaft schlüpfte,<br />
Jedermanns Geliebte, wurde Nina Hoss<br />
die „Coolschaft“ genannt. So kann’s gehen,<br />
wenn man als Schauspielerin nicht<br />
nur sein Gesicht den Figuren zu leihen<br />
versteht, sondern auch noch einen eigenen<br />
Kopf hat.<br />
Trotzdem ist cool jener Begriff, der<br />
einem im Gespräch mit Nina Hoss am<br />
wenigsten in den Sinn kommt. Dass sie<br />
zu den gefragten Schauspielerinnen des<br />
Landes zählt, ausgezeichnet mit Grimme-<br />
Preis, Deutschem Filmpreis, dem Silbernen<br />
Bären der Berlinale 2007 als beste<br />
Darstellerin in „Yella“ und dem Gertrud-<br />
Eysoldt-Ring für ihre Interpretation von<br />
Euripides’ „Medea“ am Deutschen Theater<br />
Berlin, merkt man ihr nicht an. Sie<br />
wirkt unkompliziert.<br />
Nina Hoss lebt gern in Berlin, auch<br />
weil man sie dort in Ruhe lässt. Sie ist seit<br />
Jahren mit dem walisischen Musikproduzenten<br />
Alex Silva liiert. Sie scheut das<br />
Licht der Öffentlichkeit lieber, als sich in<br />
ihm zu sonnen. In der Auswahl ihrer Rollen<br />
ist sie anspruchsvoll und geschmackssicher.<br />
Kommerz? Fernsehunterhaltung?<br />
Promipartys? Nicht ihr Fall: „Wozu soll<br />
ich <strong>auf</strong> tausend Hochzeiten tanzen, wenn<br />
ich dort gar nichts zu tun habe?“<br />
Bei ihren Figuren sucht sie Wagnis<br />
und Entgrenzung, Unschärfen und Abgründe.<br />
Zu beobachten ist dies etwa in<br />
den fünf Filmen, die sie seit 2001 mit<br />
Christian Petzold gedreht hat. In ihrer<br />
ersten gemeinsamen Produktion, „Toter<br />
Mann“, entpuppte sich die von ihr gespielte<br />
un<strong>auf</strong>fällige Leyla nach und nach<br />
als schwer verletzte Rachegöttin. Zuletzt<br />
realisierten die beiden „Barbara“ über<br />
eine ausreisewillige DDR-Ärztin. Petzold<br />
bekam dafür 2012 bei der Berlinale den<br />
Silbernen Bären. Mit Thomas Arslan zog<br />
es Nina Hoss acht Wochen ins abgelegene<br />
Kanada, wo sie für seinen Auswandererfilm<br />
„Gold“ reiten lernte und dann als<br />
Frau, mit der man Pferde stehlen kann,<br />
hoch zu Ross zu neuen Ufern <strong>auf</strong>brach.<br />
Dass es Zeit für einen Aufbruch auch<br />
in anderer Hinsicht ist, gestand sie sich<br />
nach 13 Jahren am Deutschen Theater<br />
ein, wo sie Inszenierungen von Michael<br />
Thalheimer, Barbara Frey, Stephan Kimmig<br />
und Stefan Pucher geprägt hatte. Seit<br />
dieser Spielzeit ist sie an der Schaubühne<br />
am Kurfürstendamm engagiert: „Dieser<br />
Wechsel hatte hauptsächlich mit den<br />
Möglichkeiten für meine eigene Entwicklung<br />
zu tun, nichts mit den zwei Häusern.<br />
Ich brauche einfach neue Einflüsse, neue<br />
Risiken und eine produktive Verunsicherung,<br />
die mich wach hält. Ich habe Lust<br />
<strong>auf</strong> Chaos!“<br />
WECHSELNDE ARBEITSVERHÄLTNISSE<br />
sind an jedem Theater üblich, obwohl<br />
Ulrich Khuon, der zunehmend glücklose<br />
Intendant des Deutschen Theaters, Nina<br />
Hoss gern weiterbeschäftigt hätte, wie er<br />
offen zugab. Sie war neben Ulrich Matthes<br />
der einzige Star in seinem zwar großen,<br />
aber wenig prominenten Ensemble.<br />
Dem Traditionshaus ist der künstlerische<br />
wie intellektuelle Glanz abhandengekommen.<br />
Nach und nach verabschieden<br />
sich auch die überragenden Schauspieler,<br />
weil sie an anderen Berliner Bühnen<br />
oder bei Film und Fernsehen sich besser<br />
<strong>auf</strong>gehoben fühlen. <strong>Kein</strong> Wunder, wirken<br />
doch sowohl die Spielpläne wie die<br />
Regisseure des Deutschen Theaters unplausibel,<br />
beliebig, schlicht nicht hauptstädtisch<br />
genug.<br />
Dass man sich hingegen an der<br />
Schaubühne unter Intendant Thomas<br />
Ostermeier intensiv mit gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen auseinandersetzt,<br />
hat Nina Hoss sehr interessiert. Denn<br />
sie ist nicht bloß eine mündige Künstlerin,<br />
sondern eine ebensolche Staatsbürgerin.<br />
So schickten die Grünen die<br />
Tochter der Schauspielerin Heidemarie<br />
Rohweder und des Grünen-Mitbegründers<br />
und Daimler-Betriebsrats<br />
Willi Hoss 2004 und 2010 als Mitglied<br />
der Bundesversammlung zur Wahl des<br />
Bundespräsidenten.<br />
All diese Erfahrungen hat sie nun<br />
für ihr Debüt an der Schaubühne genutzt.<br />
Ihre Bankiersgattin Regina Giddens<br />
in Lillian Hellmans „Die kleinen<br />
Füchse“ ist eine unzufriedene Lady, die<br />
sich aus der amerikanischen Südstaatenprovinz<br />
in das liberale New York retten<br />
will. Als sie die Gelegenheit wittert, nutzt<br />
sie wie ihre männlichen Konkurrenten<br />
alle Tricks und Tücken.<br />
Tallulah Bankhead verkörperte die<br />
eiskalte Kämpferin einst bei der Ur<strong>auf</strong>führung<br />
am Broadway 1939, wo das<br />
Stück über 400 Mal lief, Bette Davis später<br />
im Kino. Für Nina Hoss ist diese einerseits<br />
unterdrückte, andererseits privilegierte,<br />
schließlich skrupellose Frau<br />
weder nur gut noch nur böse, vielmehr<br />
von dem Gefühl beherrscht, dass ihr das<br />
Leben etwas schuldet. Ihre subtile Darstellung<br />
dieser listig taktierenden Regina,<br />
die am Ende die versammelte Männerwelt<br />
in die Knie zwingt, gefiel Publikum<br />
wie Kritik.<br />
Sie hatte es damit wieder geschafft,<br />
keine klaren Festlegungen zu zeigen,<br />
sondern Widersprüche, „weil unser ganzes<br />
Dasein so widersprüchlich ist“. Deshalb<br />
sind die Figuren der Nina Hoss komplex<br />
und kaum zu fassen, bleiben freilich<br />
umso stärker im Gedächtnis haften.<br />
IRENE BAZINGER ist Theaterkritikerin<br />
und verfolgt das Spiel der Nina Hoss nicht<br />
nur <strong>auf</strong> der Bühne, sondern auch in ihren<br />
Filmen mit Leidenschaft<br />
111<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
FREMD IN DER HEIMAT<br />
Der Schriftsteller David Henry Hwang zählt zu den wichtigsten Dramatikern der<br />
Vereinigten Staaten. Trotz aller Erfolge erfährt er die Grenzen der Integration<br />
Von SEBASTIAN MOLL<br />
Das zweite Stockwerk des Signature<br />
Theatre ist zum Bersten gefüllt<br />
an diesem Donnerstagnachmittag.<br />
Studenten sitzen an Tischen,<br />
trinken Kaffee und nutzen den hohen<br />
Raum an der 42. Straße, um Seminararbeiten<br />
zu schreiben. Ein Hauch von<br />
Mensa weht durch die von Frank Gehry<br />
gestaltete Halle, die sich am Abend dann<br />
in das Foyer einer der bedeutendsten dramatischen<br />
Bühnen New Yorks verwandeln<br />
wird. Mitten unter den jungen Menschen<br />
sitzt David Henry Hwang in Jeans<br />
und Sneakers und saugt einen Erdbeermilchshake<br />
durch einen Strohhalm. Verrieten<br />
die silbernen Haarsträhnen nicht<br />
seine 55 Jahre, fiele Hwang nicht weiter<br />
<strong>auf</strong>.<br />
Es ist typisch für den sinoamerikanischen<br />
Bühnenschriftsteller, sich so einzufügen.<br />
Er fällt nicht gerne <strong>auf</strong>. Dabei<br />
ist er hier gewissermaßen der Hausherr.<br />
Für ein Jahr hat das Theater seine Bühne<br />
an Hwang abgetreten, er darf nach Herzenslust<br />
proben, produzieren und <strong>auf</strong>führen.<br />
Es ist eine der höchsten Ehrungen im<br />
amerikanischen Theater, zu seinen Vorgängern<br />
am Signature gehören Arthur<br />
Miller, Edward Albee und Sam Shepard.<br />
Hwang ist einer der bedeutendsten<br />
amerikanischen Bühnenschriftsteller der<br />
Gegenwart. Vor 25 Jahren eroberte der<br />
Sohn eines Einwanderers aus Schanghai<br />
mit „M Butterfly“ den Broadway. Das<br />
Stück soll 30 Millionen Dollar eingespielt<br />
haben und wurde von David Cronenberg<br />
mit Jeremy Irons und Barbara<br />
Sukowa verfilmt. Wenn das amerikanische<br />
Feuilleton von Hwang spricht, dann<br />
spricht es jedoch trotz beeindruckender<br />
Erfolge nie von einem großen amerikanischen<br />
Dramatiker. Immer muss Hwang<br />
den Zusatz des „asiatisch-amerikanischen“<br />
Künstlers ertragen, obwohl er in<br />
Kalifornien <strong>auf</strong>gewachsen ist und seine<br />
Mandarin-Kenntnisse bestenfalls rudimentär<br />
sind.<br />
Daran, dass Hwang im Bewusstsein<br />
der US-Öffentlichkeit die Stimme der asiatischen<br />
Minderheit und das Gesicht der<br />
asiatisch-amerikanischen Literatur ist, ist<br />
er freilich nicht unschuldig. Seit er Ende<br />
der siebziger Jahre vor Kommilitonen<br />
sein erstes Stück „FOB“ über neu angekommene<br />
Einwanderer <strong>auf</strong>führte, kreisen<br />
seine Stücke darum, was es bedeutet,<br />
ein asiatisch-stämmiger Amerikaner<br />
zu sein. „Ich glaube, das Mysterium der<br />
Identität ist nicht da, um entschlüsselt zu<br />
werden“, sagt er. Nicht zuletzt deshalb<br />
geht er das Thema selten direkt an. Seine<br />
Stücke bewegen sich fast immer <strong>auf</strong> der<br />
Metaebene. Sie drehen sich darum, wie<br />
Identitäten konstruiert werden, anstatt<br />
Identitäten direkt zu erforschen. „Mich<br />
interessiert es, wie man zwischen Vorurteilen<br />
und Klischees ein authentisches<br />
Selbst finden kann.“<br />
DAMIT STÖSST HWANG <strong>auf</strong> das Kernproblem<br />
der asiatisch-stämmigen Minderheit<br />
in den USA – der am schnellsten<br />
wachsenden Gruppe der Einwanderernation.<br />
„Wir sind die ewigen Fremden, auch<br />
wenn wir hier <strong>auf</strong>gewachsen sind. Das<br />
Einfachste für die meisten von uns ist es,<br />
sich in das zu fügen, was von uns erwartet<br />
wird“, sagt er. So, wie etwa in die<br />
Rolle des Un<strong>auf</strong>fälligen, in der Hwang<br />
sich am wohlsten fühlt.<br />
Seine künstlerische Strategie, die bedrängenden<br />
ethnischen Klischees zu entkräften,<br />
ist es, sie zu dekonstruieren, da<br />
ist Hwang ganz Kind der achtziger Jahre,<br />
als Debatten um Multikulturalismus und<br />
französische Theorie das intellektuelle<br />
Klima bestimmten. „Ich will zeigen, wie<br />
nutzlos in unserer Welt Kategorien von<br />
Rasse und Ethnizität sind, wenn es um<br />
die Beurteilung von Menschen geht.“<br />
Deshalb zeigt er in seinen Stücken, wie<br />
diese Kategorien scheitern.<br />
In „M Butterfly“ etwa glaubt der<br />
französische Diplomat René Gallimard,<br />
sich in eine unterwürfige chinesische<br />
Frau zu verlieben. Am Ende des Stückes<br />
stellt diese sich jedoch als männlicher<br />
Spion heraus: „Ich habe eine Lüge<br />
geliebt“, sagt ein völlig zerstörter Gallimard,<br />
ehe er sich umbringt.<br />
Sein jüngster Broadway-Erfolg,<br />
„Chinglish“, weidet sich an den Verhandlungen<br />
zwischen einem amerikanischen<br />
Geschäftsmann und einem chinesischen<br />
Provinzpolitiker, bei denen sprachliche<br />
und kulturelle Übersetzungsfehler zu<br />
immer wilderen Verflechtungen führen.<br />
Wie schon bei „M Butterfly“ kippen diese<br />
Fehlübersetzungen vom Komischen ins<br />
Tragische, als es um die Liebe geht. Die<br />
Liebe als Schlachtfeld der größten und<br />
folgenreichsten Missverständnisse im Leben<br />
– dieses Thema lässt Hwang ebenso<br />
wenig los. Gewiss liefert ihm dazu seine<br />
17 Jahre währende Ehe mit der amerikanischen<br />
Schauspielerin Kathryn Layng<br />
reichlich Stoff.<br />
Sein derzeitiges Projekt, ein Tanzund<br />
Musikstück über Bruce Lee, feierte<br />
Anfang Februar 2014 im Signature Premiere.<br />
Warum Bruce Lee? „Er hat das<br />
Bild des asiatischen Mannes grundlegend<br />
geändert. Er hat ihm Eier gegeben.“<br />
Das Foyer des Signature Theaters hat<br />
sich geleert. Hwangs Milchshake ist ausgetrunken,<br />
er entsorgt den leeren Becher<br />
und verabschiedet sich höflich. Dann entschwindet<br />
er in die anonyme Menschenmasse,<br />
die sich die 42. Straße hinunter in<br />
Richtung Times Square wälzt.<br />
SEBASTIAN MOLL lebt seit 15 Jahren in<br />
New York. Wie Hwang fasziniert es ihn,<br />
wie in diesem Schmelztiegel Identitäten<br />
konstruiert werden<br />
Foto: Kai Nedden für <strong>Cicero</strong><br />
112<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Report<br />
STURZFAHRT<br />
OHNE<br />
KOMPASS<br />
Von AXEL BRÜGGEMANN<br />
Illustrationen ANDREA VENTURA<br />
In vier Jahren verlässt Sir Simon Rattle die Berliner<br />
Philharmoniker. Bis 2015 will das Orchester seinen<br />
Nachfolger bestimmen. Die Wahl wird zeigen, welche<br />
gesellschaftliche Bedeutung klassische Musik in der<br />
Spätmoderne noch haben kann<br />
114<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Report<br />
Jetzt haben sie Zeit. Sehr viel Zeit. Und die wollen<br />
die Berliner Philharmoniker nutzen. Die 128 Musiker<br />
sind Weltklasse, wenn sie in ihren Konzerten<br />
zu einem großen, wogenden Ganzen verschmelzen.<br />
Dann verstehen sie sich blind. Doch wenn die Musik<br />
verklingt, sind sie wieder 128 eigensinnige Köpfe. Einige<br />
widmen ihr Leben bedingungslos dem Orchester, andere<br />
haben sich ein zusätzliches Standbein <strong>auf</strong>gebaut: Sie<br />
arbeiten als Professoren, verfolgen ihre Solokarrieren oder<br />
finden Abwechslung in kammermusikalischen Ensembles.<br />
Innerhalb der Berliner Philharmoniker gibt es unterschiedliche<br />
Vorstellungen über die eigene Arbeit. Die einen leiden<br />
unter dem Verlust ihres alten Klanges, dieses düsteren,<br />
romantischen Berliner Sounds. Die anderen wollen noch<br />
mehr Öffnung, mehr Fortschritt, mehr Alte Musik, mehr<br />
Ur<strong>auf</strong>führungen und mehr jüngere Künstler.<br />
Einige haben <strong>auf</strong>geatmet, als Simon Rattle ankündigte,<br />
das Orchester 2018 zu verlassen, für andere wird es ein<br />
schwerer Abschied. Öffentlich beschwören die Berliner Einheit,<br />
aber hinter den Kulissen wird um Macht gerungen, um<br />
die Zukunft des Ensembles, das längst nicht mehr das beste<br />
der Welt ist, sondern nur noch eines der fünf oder sechs<br />
globalen Spitzenorchester. Bis 2015 wollen die Musiker einen<br />
neuen Dirigenten finden. Bis dahin haben sie sich Stillschweigen<br />
<strong>auf</strong>erlegt. Eine Orchesterversammlung soll das<br />
Procedere der Wahl festlegen, dann will man die Sache für<br />
eine Weile zu den Akten legen, Gastdirigenten prüfen und<br />
irgendwann in die inhaltliche Diskussion eintreten, sagt<br />
Orchestervorstand Peter Riegelbauer. Hört sich ausgeruht<br />
und harmonisch an. Ist es aber nicht.<br />
Die Philharmoniker teilen sich in Traditionalisten, von<br />
denen manche schon unter Vorgänger Claudio Abbado dienten,<br />
und jene Fraktion, die von Simon Rattle ins Ensemble<br />
Im Zeitalter der<br />
Globalisierung<br />
dominiert der<br />
polierte Sound<br />
aus den USA<br />
geholt wurde. Die einen kennen noch die alte Arbeit am typischen<br />
Philharmoniker-Klang, die anderen sind wegen des<br />
Aufbruchs gekommen – sie wollen an komplett neuen Ufern<br />
musizieren. Schon als Simon Rattle 1999 gewählt wurde,<br />
war das Orchester gespalten. Ein hauchdünner Vorsprung<br />
habe den Ausschlag gegeben, erzählen Musiker. Rattle<br />
zwang das Orchester später mit den Mitteln eines Machtpolitikers<br />
zum Nibelungenschwur: Noch vor Abl<strong>auf</strong> seiner<br />
Verhandlungsfrist bat er sie 2008 um Bestätigung. Eine Abwahl<br />
wäre ein Affront gewesen. Der Vertrag wurde dann<br />
offiziell bis 2018 verlängert.<br />
Die Frage um den Kurs des bekanntesten deutschen Orchesters<br />
ist auch eine Frage der klassischen Musik an sich:<br />
Was macht ein Orchester im 21. Jahrhundert aus? Wie positioniert<br />
es sich in der Klassik-Krise? Welche Traditionen<br />
bewahrt es, welche wirft es über Bord? Wie sollen Beethoven,<br />
Brahms und Bruckner klingen? Wie gehen Ensembles<br />
mit der Diversifizierung der Musik um: mit historisch informierter<br />
Aufführungspraxis, Gegenwartsmusik und Repertoireerweiterung?<br />
Wollen sie Experten <strong>auf</strong> einem Feld<br />
sein oder alle musikalischen Felder gleichzeitig bedienen?<br />
Sir Simon Rattle hat sich für Letzteres entschieden. Seine<br />
Auffassung eines modernen Orchesters ist die des Allrounders.<br />
Die Philharmoniker haben von der Barockmusik <strong>auf</strong><br />
historischen Instrumenten bis zu Ur<strong>auf</strong>führungen alles im<br />
Repertoire. Sie verstehen sich nicht nur als traditioneller<br />
Klangkörper, sondern auch als pädagogische Institution und<br />
als Technikpionier im Internetzeitalter.<br />
Nun nimmt der Chef den Hut. Vielleicht auch, weil er<br />
spürt, dass sein Kurs nicht mehr mehrheitsfähig ist. „Man<br />
muss sich als Dirigent daran gewöhnen“, sagt Rattles Kollege<br />
Daniel Barenboim, „dass mindestens die Hälfte eines<br />
Orchesters gegen den Dirigenten ist. Wer das nicht aushält,<br />
ist fehl am Platz.“ Das ist bei den Berliner Philharmonikern<br />
ebenso wie in allen anderen Orchestern. Aber als einer der<br />
wenigen Klangkörper halten die Berliner ihre Zukunft selbst<br />
in der Hand. Das Orchester wählt per Abstimmung sein eigenes<br />
Oberhaupt – die Mehrheit setzt sich durch.<br />
Die Berliner Philharmoniker sind so etwas wie der Vatikan<br />
der klassischen Musik. Regelmäßig treffen die Musiker<br />
sich zum Konklave und küren den besten Dirigenten<br />
zum Tonpapst seiner Zeit. Der Klang der Berliner Philharmoniker<br />
ist eine Weltanschauung. Das Orchester spielt den<br />
Soundtrack des weltpolitischen Zeitgeists, stets nach dem<br />
Motto: „Sag mir, wie die Berliner klingen, und ich sage dir,<br />
wie sich unsere Zeit anhört.“ Wer Nachfolger von Simon<br />
Rattle wird, ist also auch eine Entscheidung über die Zukunft<br />
der klassischen Musik weit über Berlin hinaus.<br />
Wilhelm Furtwängler manövrierte das Orchester mit<br />
viel Pathos und einigen Schlingerkurven durch das Dritte<br />
Reich und den Wieder<strong>auf</strong>bau Deutschlands. Herbert von<br />
Karajan etablierte einen <strong>auf</strong> Hochglanz polierten Wirtschaftswunder-Sound.<br />
Pünktlich zum Fall der Mauer kam<br />
der jüngst verstorbene Italiener Claudio Abbado und öffnete<br />
das Orchester neuen Welten: Junge Musiker wurden<br />
verpflichtet, Ur<strong>auf</strong>führungen einstudiert. Nebenbei wurde<br />
am Update des dunklen, großen Orchesterklangs gebastelt.<br />
116<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Das Konklave von 1999 war zerstritten gewesen: Altmeister<br />
Daniel Barenboim oder Jungstar Simon Rattle? Die<br />
Stimmung war gereizt, die Klangkardinäle waren uneinig.<br />
Am Ende fiel die Wahl <strong>auf</strong> den wilden Neudenker. Ein Signal<br />
an die internationale Orchesterlandschaft: Die Tradition<br />
hatte ausgedient, das Neue sollte eine Chance bekommen!<br />
Rattle hatte sich zuvor in der Arbeiterstadt Birmingham<br />
einen Namen gemacht. Durch Charisma, mutige Programme,<br />
präzise Arbeit und erzieherische Mitmachprogramme<br />
für das Publikum stellte er die Musik als aktive<br />
gesellschaftliche Kraft unter Beweis. Er war der Musikdemokrat,<br />
der mit der Machtmusik alter Maestri <strong>auf</strong>räumte.<br />
Er überwand in Berlin den musikmilitärischen Habitus eines<br />
Herbert von Karajan. Als die beiden einmal miteinander<br />
telefonierten und über Mozart-Interpretationen aneinandergerieten,<br />
kam Karajan dem Briten vor wie „General<br />
Patton oder irgend ein anderer knurriger Soldat“.<br />
Auch bei seinen Pressekonferenzen wehte ein neuer<br />
Wind. Rattle biss gern in einen Apfel, legte seine Stirn in<br />
Sorgenfalten, lächelte und zeigte sich als furchtloser Erneuerer.<br />
Der Sir schien der richtige Mann zu sein, ein Orchester<br />
in einer Stadt umzubauen, in der gerade jede Straßenkreuzung<br />
<strong>auf</strong>gerissen wurde. Er erweiterte die deutschtümelnde<br />
Klangzone der Philharmoniker, indem er das Kernrepertoire<br />
mit Alter Musik und klingender Avantgarde durchmischte.<br />
Damals war das modern. Besonders die historisch<br />
informierte Aufführungspraxis war bis dahin bei Experten<br />
und ihren eigenen, hoch spezialisierten Klangkörpern<br />
zu Hause. Nikolaus Harnoncourt feierte Erfolge mit seinem<br />
Concentus Musicus, René Jacobs mit der Schola Cantorum<br />
Basiliensis und Roger Norrington mit der Camerata<br />
Salzburg. Simon Rattle wollte den Beweis antreten, dass<br />
auch ein großer philharmonischer Dampfer den innovativen<br />
Geist des Alten verkörpern kann.<br />
Gleichzeitig läutete er die Postmoderne ein, holte<br />
seine Musiker sogar aus Venezuela und lud britische Gegenwartskomponisten<br />
ein. Sein Ziel war es, die Philharmonie<br />
nicht nur der Welt, sondern auch der Nachbarschaft zu<br />
öffnen. Sein Musiktempel sollte ein offenes Haus werden.<br />
Mit Lunch-Konzerten wurden Angestellte aus den Bürotempeln<br />
am Potsdamer Platz gelockt, mit Jugendprojekten die<br />
Dönerbuden-Besitzer und ihre Kinder aus Kreuzberg. Wer<br />
Rattle fragte, wo all das enden würde, bekam zur Antwort:<br />
„Das weiß ich nicht. Schließlich sind die spannendsten Wege<br />
jene, bei denen man das Ziel nicht kennt.“ Bis heute bedient<br />
er dieses Bild gebetsmühlenhaft – über die konkrete<br />
Entwicklung des Klanges, über die musikästhetische Ausrichtung,<br />
die Rolle der Klassik in unserer Zeit redet er ungern.<br />
Auch dem <strong>Cicero</strong> gegenüber will er sich diesen Fragen<br />
nicht stellen.<br />
Dabei sind sie längst überfällig. Die Globalisierung<br />
macht vor dem Klang von Orchestern nicht halt. Musiker<br />
werden nur noch selten an einem Ort ausgebildet. Es gehört<br />
zum internationalen Orchesteralltag, dass Japaner in<br />
New York von russischen Lehrern unterrichtet werden, um<br />
dann unter einem englischen Dirigenten in einem deutschen<br />
Orchester zu spielen. Lange Zeit war der Gleichklang der<br />
Anzeige<br />
Bildnachweise: Matthias von Gunten, Chris Janik, Valeria Heintges, Nicolas Aebi, Gunter Glücklich, Zlil Landesmann, Jerzy Pirecki, Susanne Schleyer, Milena Schlösser<br />
LEIPZIG LIEST 2014:<br />
JÜDISCHE<br />
LEBENSWELTEN<br />
Im Ariowitsch-Haus, Hinrichsenstr. 14 / 04105 Leipzig<br />
Veranstalter: Der Club Bertelsmann, <strong>Cicero</strong> – Magazin<br />
für politische Kultur und Stanford University<br />
DONNERSTAG, 13. MÄRZ 2014<br />
16:00 Bettina Spoeri: Konzert für die<br />
Unerschrockenen. Braumüller Verlag<br />
17:00 Abraham Jehoschua: Spanische<br />
Barmherzigkeit. Suhrkamp<br />
18:00 Thomas Medicus: Heimat.<br />
Rowohlt Berlin<br />
19:00 Thomas Meyer: Wolkenbruchs<br />
wunderliche Reise. Diogenes<br />
20:00 Benjamin Stein: Das Alphabet<br />
des Rabbi Löw. Verbrecher Verlag<br />
Moderation: Alexander Kissler, <strong>Cicero</strong><br />
21:00 Eliyah Havemann: Wie werde ich<br />
Jude? Und wenn ja, warum? Ludwig<br />
Moderation: Alexander Kissler, <strong>Cicero</strong><br />
FREITAG, 14. MÄRZ 2014<br />
16:00 Marita Kijowska: Das Leben<br />
des Jan Karski. C.H.Beck<br />
17:00 Michael Guggenheimer:<br />
Tel Aviv. Edition clandestin<br />
18:00 Katja Petrowskaja:<br />
Vielleicht Esther. Suhrkamp<br />
Moderation: Alexander Kissler, <strong>Cicero</strong><br />
19:00 Urs Faes: Sommer in<br />
Brandenburg. Suhrkamp<br />
20:00 Kathrin Gerlof: Das ist eine<br />
Geschichte. Aufbau<br />
21:00 Grigori Kanowitsch: Ewiger<br />
Sabbat. Die Andere Bibliothek<br />
SAMSTAG, 15. MÄRZ 2014<br />
16:00 Marianne Brentzel:<br />
Mir kann doch nichts geschehen.<br />
Edition Ebersbach<br />
17:00 Hannah Dübgen: Strom. dtv<br />
18:00 Yuval Noah Harari:<br />
Eine kurze Geschichte der<br />
Menschheit. DVA<br />
19:00 Jutta Ditfurth: Der Baron, die<br />
Juden und die Nazis.<br />
Hoffmann + Campe<br />
20:00 Andreas Altmann:<br />
Verdammtes Land. Piper
SALON<br />
Report<br />
Ensembles <strong>auf</strong> die USA beschränkt. Die amerikanischen Orchester<br />
hatten nur eine kurze Tradition und waren Einwanderungsensembles:<br />
Statt sich um einen traditionellen Sound<br />
zu kümmern, strebten sie Perfektion und Schönklang an.<br />
Sie engagierten in allen Instrumentengruppen Virtuosen.<br />
So entstand der polierte US-Sound. Dieses Klangideal hat<br />
inzwischen auch die europäischen Traditionsorchester erreicht.<br />
Auch sie entfernen sich immer weiter von ihren einstigen<br />
Musikdirektoren wie Richard Strauss, Gustav Mahler<br />
oder – im Falle der Berliner Philharmoniker – Wilhelm<br />
Furtwängler und internationalisieren ihre Musiksprache, indem<br />
sie weltweit Musiker eink<strong>auf</strong>en und Dirigenten ohne<br />
Bezug zur eigenen Klangtradition engagieren.<br />
Auch deshalb dürfte Kent Nagano an der Bayerischen<br />
Staatsoper gescheitert sein. Seine bewusst neutönenden Dirigate<br />
hatten nur wenig mit dem Klang seiner Vorgänger,<br />
mit Hans von Bülow, Richard Strauss, Bruno Walter, Hans<br />
Knappertsbusch, Ferenc Fricsay oder Wolfgang Sawallisch<br />
zu tun. Nagano wird nun nach Hamburg ziehen, wo seine<br />
Vorgängerin Simone Young daran gescheitert ist, das philharmonische<br />
Erbe von Eugen Jochum, Joseph Keilberth,<br />
Wolfgang Sawallisch, Christoph von Dohnányi und Gerd<br />
Albrecht zu übernehmen. Auch dass der globetrottende Jet-<br />
Set-Maestro Valery Gergiev nun bei den Münchner Philharmonikern<br />
in die Fußstapfen von Felix Weingartner, Sergiu<br />
Celibidache und Christian Thielemann treten wird, ist ein<br />
Zeichen, dass die Traditionsensembles bereit sind, ihren lokalen,<br />
historischen Klang gegen einen internationalisierten<br />
Sound einzutauschen.<br />
Hinzu kommt die Mode, sogenannte Shootingstars zu<br />
großen Ensembles zu holen, um sie experimentieren zu<br />
lassen: Der 35-jährige Andris Nelsons, einer der Favoriten<br />
der Rattle-Nachfolge, wird nach Houston gehen, der<br />
Simon Rattle hat<br />
den Klang der<br />
Philharmoniker<br />
grundlegend<br />
verändert<br />
38-jährige Daniel Harding ist beim Schwedischen Radiosinfonieorchester<br />
gelandet, der 37-jährige Vasily Petrenko<br />
bei den Oslo Philharmonics, der 36-jährige Andrés Orozco-<br />
Estrada wird vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich<br />
zum Houston Symphony Orchestra und zum hr-Sinfonieorchester<br />
gehen. Mit der alten Ochsentour durch Opernorchester<br />
und Stadttheater haben sie nichts am Hut. Sie beginnen<br />
ihre Karrieren jung und <strong>auf</strong> internationalem Parkett.<br />
In seinen zwölf Jahren seit 2002 hat Rattle den Klang<br />
des Orchesters grundlegend verändert. Der Weg der Philharmoniker<br />
ist verschlungener geworden, die Seitenwege<br />
wurden zu Hauptwegen ausgebaut, ein konkretes Ziel ist<br />
nicht in Sicht. Aber wie kein anderer Dirigent hat er die gesellschaftliche<br />
Kraft der Musik unter Beweis gestellt. Ein<br />
Orchester ist für ihn nicht nur Klangkörper, sondern soziale<br />
Einheit und Teil einer sich wandelnden Welt. Heute<br />
sind die Markenzeichen der Philharmoniker ihre Education-Programme<br />
und die Digital Concert Hall. Mit Filmen<br />
wie „Rhythm is it“ und der Übertragung von Konzerten<br />
ins Internet und in die Kinos sind sie zu Vorreitern für viele<br />
deutsche Orchester geworden.<br />
ALL DAS DIENT bei genauem Hinsehen eher der Orchester-<br />
PR als den Beteiligten: Was aus den Kindern von „Rhythm<br />
is it“ geworden ist, wissen wir nicht, ebenso wenig lässt sich<br />
der Erfolg der pädagogischen Programme messen. Kreuzberg<br />
und Neukölln gehören gewiss noch immer nicht zum<br />
Abo-Publikum. Sicher ist, dass die „Digital Concert Hall“<br />
bis heute nur durch millionenschwere Subventionen der<br />
Deutschen Bank überlebt und dass Kino-Übertragungen<br />
aus der Met in New York weitaus erfolgreicher sind als die<br />
der Berliner Philharmoniker. Dennoch sind gerade <strong>auf</strong> dem<br />
multimedialen Feld die Hauptstädter Pioniere. Dass Medienpartner<br />
Sony nun eine Berlin-Phil-App <strong>auf</strong> jeden Smart-TV<br />
vorinstalliert, könnte ein entscheidender Zukunftsvorteil<br />
sein, wenn es darum geht, den Konzertsaal in die Wohnzimmer<br />
zu bringen. Die Begleitmusik dieser multimedialen<br />
Ausrichtung besteht übrigens darin, dass Rattles Plattenfirma<br />
EMI mit den Berlinern kaum noch ein großer Erfolgsschlager<br />
gelungen ist. Die CD, Herbert von Karajans Domäne,<br />
wurde von Simon Rattle vernachlässigt.<br />
Die Musiker wissen, dass ein modernes Orchester nicht<br />
im 19. Jahrhundert stehen bleiben kann. Aber sie merken<br />
auch, dass andere Ensembles längst ihren Platz eingenommen<br />
haben, wenn es um die Exegese von Beethoven,<br />
Brahms, Bruckner und Mahler geht. Heute bestechen die<br />
Berliner Philharmoniker durch eine Aufführung der Matthäus-Passion.<br />
Die deutsche Musiktradition hingegen wird<br />
andernorts besser gepflegt.<br />
Der Autor dieser Zeilen regte vor zehn Jahren eine Debatte<br />
über den „Deutschen Klang“ an. Damals galt es als<br />
Affront, die Arbeit in Berlin und den Verlust der musikalischen<br />
Tradition zu hinterfragen. Heute scheint es Allgemeingut,<br />
dass Rattle nicht viel an diesem Klang liegt, der<br />
sich durch Erdigkeit, philosophische Schwere, Schwelgerei<br />
und Dunkelheit auszeichnet. Rattle hielt diesen Sound für<br />
unzeitgemäß und tauschte ihn gegen ein internationales,<br />
118<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Report<br />
lichteres, sachlicheres Spiel ein. Das war eine bewusste Entscheidung<br />
der Berliner, mit der sie sich neues Repertoire erarbeitet<br />
haben. Zuletzt war es im Silvesterkonzert mit Lang<br />
Lang zu hören: die perfekte Technik ist noch immer existent,<br />
aber unter Rattle ist das Epische dem Rhythmus zum Opfer<br />
gefallen, das Grüblerische dem Effekt. Mit ihrem neuen<br />
Ton haben die Berliner eher unfreiwillig eine Marktlücke<br />
für andere Ensembles geöffnet, die sich besser um die sogenannte<br />
deutsche Tradition gekümmert und sie zu ihrem<br />
Markenzeichen gemacht haben: Daniel Barenboim hat mit<br />
seiner Staatskapelle Berlin, also in direkter Nachbarschaft,<br />
einen satten, bombastischen, dunklen Klang geformt. Christian<br />
Thielemann setzt mit der Staatskapelle Dresden <strong>auf</strong> ein<br />
Orchester, das sich durch die eingeschränkte Reisefreiheit<br />
in der DDR einen Sound der sechziger und siebziger Jahre<br />
bewahrt hat. Beide Ensembles widersetzen sich der musikalischen<br />
Globalisierung – und sind damit sehr erfolgreich.<br />
Vielleicht haben die Berliner dieses Phänomen unterschätzt.<br />
Im internationalen Vergleich schneiden das Concertgebouw-Orchester<br />
in Amsterdam und das Symphonieorchester<br />
des Bayerischen Rundfunks, beide unter Mariss Jansons,<br />
und die Wiener Philharmoniker, seit Jahren ohne Chef am<br />
Pult, in Kritiker-Rankings oft besser ab als die Berliner<br />
Philharmoniker. Diese setzen derweil gern auch <strong>auf</strong> medial<br />
leicht verk<strong>auf</strong>bare Showprogramme mit Tasten-Clown<br />
Lang Lang oder suchen die Nähe zum venezolanischen Medienliebling<br />
Gustavo Dudamel. Die einstigen Gralshüter<br />
der Klassik flirten mit den Prinzipien des Pop. Ihre Position<br />
als Vatikan des Klanges haben die Berliner Philharmoniker<br />
unter Papst Simon verloren. Ein Fakt, der einige Musiker<br />
nicht ruhen lässt.<br />
Dabei sind die Orchestermitglieder an diesem Trend<br />
zum Teil selber schuld. Die Berliner Philharmoniker spielen<br />
zwar nicht mehr wie vor zehn Jahren, haben sich aber<br />
die Attitüde des goldenen Zeitalters der Klassik bewahrt.<br />
Früher profitierte davon Herbert von Karajan persönlich,<br />
jetzt wollen die Musiker selber mitverdienen. Der Umgang<br />
mit Konzertvermarktung, Fernsehrechten und Gagen wird<br />
von ihnen selbst organisiert. Seit Simon Rattle die Berliner<br />
übernommen hat, scheint dem Orchester das schnelle Geld<br />
oft wichtiger zu sein als die eigene Tradition.<br />
DIE BERLINER FORDERTEN NEUE VERTRÄGE für die Übertragung<br />
des Silvesterkonzerts vom ZDF und scheiterten mit<br />
ihren Vorstellungen. Man wanderte zur ARD ab, die ihre<br />
eigenen öffentlich-rechtlichen Orchester links liegen ließ<br />
und Millionen für die Berliner ausgab. Das ZDF engagierte<br />
Christian Thielemann und die Staatskapelle Dresden, die<br />
im direkten Vergleich quotentechnisch besser abschneiden.<br />
Ähnlich unverfroren gingen die Philharmoniker mit ihrem<br />
Gastspiel bei den von Herbert von Karajan gegründeten<br />
Osterfestspielen in Salzburg und mit dessen überrumpelten<br />
Intendanten Peter Alward um. Kurzfristig entschied sich<br />
der Vorstand, nach Baden-Baden umzusiedeln, wo mehr<br />
Geld lockte. Salzburg engagierte dar<strong>auf</strong>hin ebenfalls Thielemann<br />
und die Staatskapelle, die in den Feuilletons für ihren<br />
„Parsifal“ und Bruckner Lob erhielten, während Rattles<br />
Schnelles<br />
Geld ist dem<br />
Orchester<br />
wichtiger als<br />
die eigene<br />
Tradition<br />
„Zauberflöte“ in Baden-Baden als bestenfalls solide Klangarbeit<br />
bewertet wurde.<br />
2011 sagten die Berliner ein hoch dotiertes Gastspiel<br />
in Abu Dhabi zu, obwohl Dubais Polizeichef Dahi Khalfan<br />
Tamim damit drohte, Israelis bei der Einreise zu erkennen<br />
und zu liquidieren. Damals spielten fünf Musiker mit israelischem<br />
Pass im Orchester, ihnen wurde die Reise vom Orchestervorstand<br />
freigestellt. Konzertmeister Guy Braunstein<br />
blieb zu Hause, andere fuhren mit und sollen sich<br />
während der Reise nur im Hotelzimmer <strong>auf</strong>gehalten haben.<br />
Dass ein Orchester, das sich immer wieder seiner nationalsozialistischen<br />
Vergangenheit stellen will, <strong>auf</strong> einen solchen<br />
Deal mit der arabischen Regierung eingelassen hat, erklärt<br />
Intendant Martin Hoffmann so: „Das ist ein sehr sensibles<br />
Thema. Was wir vereinbart haben, muss unter dem Siegel<br />
der Verschwiegenheit stehen – wir haben uns <strong>auf</strong> Heimlichkeit<br />
geeinigt.“ Eine Einigung, die nicht von allen Orchestermitgliedern<br />
gutgeheißen wurde. Das Geld der Scheichs<br />
war am Ende wichtiger.<br />
Die Fälle zeigen, dass die Berliner Philharmoniker unter<br />
Simon Rattle eben auch ein Intendanten-Problem hatten:<br />
Drei Chefs haben seine Amtszeit begleitet. Der Musikmanager<br />
Franz Xaver Ohnesorg bereitete dem Dirigenten ein<br />
öffentlichkeitswirksames Entree, bevor er <strong>auf</strong> Druck des<br />
Orchesters geschasst wurde. Mit Pamela Rosenberg holten<br />
sich die Berliner dann eine eher unscheinbare Frau, und<br />
inzwischen agiert Ex-Sat1-Mann Martin Hoffmann als Intendant.<br />
Seine Stärke liegt nicht in der musikalischen Ausrichtung<br />
des Ensembles, sondern in dessen multimedialer<br />
Vermarktung. Simon Rattle, der Machtmusiker, hat es stets<br />
vermieden, sich einen Berater an die Seite zu holen, der seinen<br />
Weg ins Irgendwo infrage hätte stellen können.<br />
120<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Anzeige<br />
Illustrationen: Andrea Ventura/2 agenten (Seiten 114 bis 119); Foto: Privat<br />
Das Orchester ist, was die multimediale Präsenz betrifft,<br />
bestens positioniert. Wenn Simon Rattle nun, ähnlich<br />
wie Papst Benedikt XVI., das Heiligtum freiwillig verlässt,<br />
muss es wieder um den Inhalt gehen. Die jungen Kräfte im<br />
Berliner Klang-Vatikan setzen <strong>auf</strong> die Fortsetzung der Erneuerung,<br />
etwa durch den venezolanischen Dirigenten Gustavo<br />
Dudamel oder durch Andris Nelsons. Traditionalisten<br />
hoffen eher <strong>auf</strong> Christian Thielemann, dessen Faible für<br />
Wagner, Brahms, Beethoven, Bruckner und seinen schwelgerischen<br />
Klang sich mit der alten Berliner Tradition deckt.<br />
Selbst Daniel Barenboim könnte als Interimslösung noch<br />
einmal ins Gespräch kommen, ebenso wie die eher konventionelle<br />
Lösung mit dem Leipziger Gewandhaus-Chef Riccardo<br />
Chailly. Sicher ist: Mit ihrer Wahl setzen die Berliner<br />
auch ein Zeichen für die internationale Orchesterkultur.<br />
Als sie Sir Simon kürten, hatten sie nur wenig Zeit.<br />
Das Verhältnis mit Claudio Abbado war zerrüttet, der Italiener<br />
hatte die Proben vernachlässigt und fand im Ensemble<br />
keine Rückendeckung für seine intellektuelle Haltung.<br />
Damals erschien Rattle wie ein großes Versprechen, das bis<br />
heute nur teilweise eingelöst wurde. Seinen eigenen Rücktritt<br />
gab Rattle in einer Zeit bekannt, da die Stimmung gegen<br />
ihn umschlug. Die Berliner Philharmoniker haben nun<br />
genügend Zeit, über ihre Zukunft nachzudenken und müssen<br />
ihren Frust nicht am Chef auslassen.<br />
Nach Abbados Rücktritt dauerte es nicht lange, bis er<br />
nach Berlin zurückkehrte. Er wurde zum unangefochtenen<br />
Lieblingsgast der Philharmoniker. Vielleicht auch deshalb,<br />
weil viele große Dirigenten sich mit der Administration<br />
und Organisation großer philharmonischer Tanker nicht<br />
mehr <strong>auf</strong>halten wollen. Sie stellen die Frage, ob Philharmonische<br />
Orchester überhaupt zeitgemäß sind. Sind kleine,<br />
selbst verwaltete Ensembles wie die Kammerphilharmonie<br />
Bremen nicht viel flexibler und darum die besseren Task<br />
Forces der Klassik? Abbado verzichtete <strong>auf</strong> jeden Fall dar<strong>auf</strong>,<br />
noch einmal ein ähnliches Engagement wie in Berlin<br />
anzunehmen. Nikolaus Harnoncourt hat kein großes philharmonisches<br />
Orchester je übernommen. Simon Rattle versuchte<br />
es immerhin.<br />
Er ist seit 34 Jahren ununterbrochen Chef von Orchestern.<br />
Gut möglich, dass er seine Freiheit demnächst genießen<br />
will, sich wieder mehr der Oper zuwendet, seine Arbeit<br />
mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment intensiviert<br />
– und sicherlich regelmäßig als Gast nach Berlin zurückkehrt.<br />
Dann kann er sich, ganz unbeschwert von administrativen<br />
Aufgaben, besser um das kümmern, was er<br />
bislang vernachlässigt hat: um musikalische Visionen. Die<br />
Positionierung des Berliner Klanges in einer Welt, die sich<br />
längst schon wieder weitergedreht hat, in der das Alte und<br />
die Tradition wieder modern geworden sind, muss dann jemand<br />
anderes vornehmen.<br />
„Der<br />
Jahrhundertfälscher.”<br />
Der Spiegel<br />
Idee<br />
Buch<br />
Verlag<br />
Leser<br />
„Ist er<br />
ein Rockstar?”<br />
Vanity Fair<br />
„Ich habe eine so<br />
einfühlsame Täuschung<br />
noch nie gesehen.<br />
Beltracchi ist ein genialer<br />
Klon von Max Ernst.”<br />
Werner Spieß, Kunsthistoriker<br />
Ein Film von Arne Birkenstock<br />
www.beltracchi.senator.de<br />
AB 6. MÄRZ IM KINO!<br />
Beltracchi_Anz_84x133.indd 2 13.02.14 18:16<br />
an genug gewartet. Jetzt ist de<br />
dlich zu handeln<br />
Wir veröffentlichen Ihr Buch.<br />
Wagner Verlag GmbH<br />
Langgasse 2<br />
D-63571 Gelnhausen<br />
06051/ 88381-11<br />
info@wagner-verlag.de<br />
www.wagner-verlag.de<br />
AXEL BRÜGGEMANN ist Musikkritiker, Moderator<br />
und Buchautor ( „Das Leben des Richard Wagner“ ).<br />
Vor zehn Jahren stieß er die Debatte über den<br />
„Deutschen Klang“ an. Die Berliner Philharmoniker<br />
hat er weltweit <strong>auf</strong> zahlreichen Konzerten erlebt<br />
Besuchen Sie uns <strong>auf</strong> der<br />
13. – 16. März 2014<br />
Halle 4.0 - Stand C 214
SALON<br />
Man sieht nur, was man sucht<br />
Deutsche KULTUR, deutsches GLAS,<br />
wie leicht bricht das Von BEAT WYSS<br />
Das Berliner Atelier Max Liebermanns zeigt den<br />
Künstler als Meister der Vergänglichkeit – und<br />
führt zur Debatte um Raubkunst und Restitution<br />
122<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Fotos: Sebastian Stadler/Kunstmuseum St.Gallen/Ernst Schürpf-Stiftung (erworben 1951), Peter Rigaud (Autor)<br />
Im Herbst 1902 malt Max Liebermann<br />
die Kunstsammlung im Atelier<br />
seines Hauses am Pariser Platz<br />
zu Berlin. Das Interieur gibt Zeugnis<br />
bürgerlichen Wohlstands und familiärer<br />
Harmonie. Auf dem Sofa sitzen,<br />
vertieft in ihre Lektüre, Gattin Martha<br />
Liebermann-Marckwald und Tochter Käthe.<br />
Verdeckt von einem Bilderrahmen<br />
im Vordergrund links, da, im Spiegel,<br />
blitzt der Maler im weißen Kittel <strong>auf</strong>.<br />
Eine stille, konzentrierte Stimmung ist<br />
eingefangen zusammen mit dem milchigen<br />
Tageslicht, das vom verglasten Tonnengewölbe<br />
herunterrieselt.<br />
Die formlose Zweckmäßigkeit eines<br />
Ateliers mit Schausammlung macht eine<br />
raffinierte kunsthistorische Referenz. Im<br />
Sommer 1902 hatten die Liebermanns in<br />
der römischen Galleria Doria Pamphilj<br />
das Porträt des Papstes Innozenz X. von<br />
Diego Velázquez bewundert. Wohl ein<br />
Öldruck des Brustbilds, Souvenir von der<br />
Reise, hängt über den sitzenden Frauen.<br />
Velázquez rechnet zu den großen Meistern<br />
des Barocks, der damals, zur Jahrhundertwende,<br />
wiederentdeckt wurde.<br />
Liebermann inszeniert sich als Velázquez’<br />
Nachfahre, der die Malerei virtuos<br />
in Szene setzte und sie zugleich als eitlen<br />
Schein entzauberte. Im Sinne der Vanitas<br />
rückt der Künstler den Arbeitstisch<br />
vor unsere Augen: Wir sollen sie sehen,<br />
die Skizzenblätter, den Farbkasten, zerdrückte<br />
Tuben und die Flasche mit dem<br />
streng riechenden Verdünner, schnöden<br />
Stoff, aus dem die lichten Träume der Malerei<br />
gemacht sind. Unter den Utensilien<br />
zieht sich ein großer Teppich – wie loses<br />
Farbgewölk aus Rot und Blau.<br />
Es handelt sich um jenen Teppich, der<br />
in der Beschlagnahmeliste der Gestapo<br />
vom Sommer 1943 als „Smyrna-Teppich,<br />
Max Liebermann, „Atelier des<br />
Künstlers am Brandenburger Tor in<br />
Berlin 1902“, Öl <strong>auf</strong> Leinwand<br />
ca. 4 x 5,10m“ <strong>auf</strong> 4000 Reichsmark geschätzt<br />
wurde. Damit wechseln wir das<br />
Thema so abrupt, wie es der jüdischen<br />
Familie Schicksal wurde. Nachzulesen<br />
sind die Fakten in der neuen Monografie<br />
„Max Liebermann. Die Kunstsammlung“,<br />
herausgegeben von Bärbel Hedinger,<br />
Michael Diers und Jürgen Müller.<br />
Als nach dem Wahlsieg der NSDAP<br />
im Januar 1933 rund 25 000 Anhänger<br />
der Bewegung durchs Brandenburger<br />
Tor zogen, hallten die Parolen ungefiltert<br />
durch das einfach verglaste Atelier. „Ick<br />
kann jar nich so ville fressen, wie ick kotzen<br />
möchte“, war Liebermanns viel zitierter<br />
Kommentar zur Machtergreifung.<br />
Der Ehrenbürger der Stadt starb,<br />
vom offiziellen Berlin ignoriert, am 8. Februar<br />
1935. Tochter Käthe und ihrem<br />
Mann, Kurt Riezler, gelang die Flucht<br />
nach New York. Mutter Marthas Entschluss<br />
auszuwandern kam zu spät. Ihr<br />
wurde ein „Heimeink<strong>auf</strong>svertrag“ <strong>auf</strong>gezwungen,<br />
der sie verpflichtete, sich in<br />
Theresienstadt einzuk<strong>auf</strong>en. Die Umnutzung<br />
der böhmischen Garnisonsstadt zur<br />
„Mustersiedlung“ für prominente Juden<br />
wurde 1942 anlässlich der Wannseekonferenz<br />
in der Villa Marnier beschlossen,<br />
sechs Gehminuten entfernt vom Sommerhaus<br />
der Familie Liebermann, beide<br />
Gebäude von Paul Baumgarten entworfen.<br />
Die Witwe musste ihr Haus am<br />
Wannsee an die Deutsche Reichspost verk<strong>auf</strong>en.<br />
Am 10. März 1943 entzog sich<br />
die 84-Jährige der Deportation mithilfe<br />
einer Überdosis Veronal.<br />
14 Kunstwerke von Manet, Degas,<br />
Cézanne, Daumier, Renoir und Monet<br />
hatte Liebermann vor dem Zugriff der<br />
Nazis retten können, indem er sie dem<br />
Kunsthaus Zürich in Verwahrung gab.<br />
Ein großer Rest ist verschollen, wie der<br />
Smyrna-Teppich, der wohl in Gestapokreisen<br />
versilbert wurde.<br />
Die neue Monografie hat ein detailliertes<br />
Verzeichnis der Liebermann’schen<br />
Kunstsammlung angelegt. Der Nachweis<br />
von Provenienz, der Besitzerfolge<br />
eines Werkes, gehört zum Kerngeschäft<br />
Zum Autor<br />
BEAT WYSS<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt Kunstwissenschaft<br />
und Medienphilosophie an der<br />
Staatlichen Hochschule für<br />
Gestaltung in Karlsruhe und<br />
schreibt jeden Monat in <strong>Cicero</strong><br />
über ein Bild und dessen<br />
Geschichte<br />
der Kunsthistorik. Der Provenienzforschung<br />
ist mit der Restitutionsforschung<br />
aber Konkurrenz erwachsen. Bei beiden<br />
Forschungsinteressen steht außer Frage,<br />
dass geschädigten Vorbesitzern Genugtuung<br />
widerfahren muss – zu lange ist das<br />
Thema in Deutschland verdrängt worden.<br />
Mit der Restitutionsforschung tritt<br />
neben die Geschädigten und die Nutznießer<br />
mutmaßlicher Enteignung eine<br />
dritte Partei: Anwälte, die mit spekulativen<br />
Methoden, einer Art juristischem<br />
fracking, an der Wiedergutmachung mitverdienen<br />
wollen. Sie verschleiern ihre<br />
finanziellen Interessen, indem sie das<br />
schlechte Gewissen der Deutschen in Regress<br />
nehmen. Ob dieses Gewinnstreben<br />
angesichts der Opfer ethisch vertretbar<br />
ist, wage ich zu bezweifeln.<br />
123<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Collage<br />
GROSSVATERS KRIEG<br />
Von PAUL MAAR<br />
Geschossen wurde, gelitten und gestorben. Was aber aßen die<br />
Soldaten? Eine Collage aus der Zeit des Ersten Weltkriegs – und<br />
eine persönliche Spurensuche in der eigenen Familie<br />
Foto: Picture Alliance/dpa/ZB [M]<br />
124<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Mein neuer Großvater zog<br />
beim Gehen das rechte<br />
Bein etwas nach. Er<br />
schnappte, wie man im<br />
Fränkischen sagt. Weiter<br />
nördlich hätte man es als Hinken bezeichnet.<br />
Ich hatte ihn erst richtig kennengelernt,<br />
als ich fünf Jahre alt war,<br />
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs.<br />
Zwei Jahre nach dem frühen Tod<br />
meiner Mutter hatte nämlich mein Vater<br />
wieder geheiratet. Kurz dar<strong>auf</strong> war<br />
er zum Militär einberufen worden, und<br />
meine neue Mutter zog mit mir zurück zu<br />
ihren Eltern in ein fränkisches Dorf. Ihr<br />
Vater arbeitete dort als Büttnermeister.<br />
Ich saß gerne bei ihm in der Werkstatt,<br />
in der es angenehm nach Harz und<br />
frischem Holz roch. Und ich fragte ihn<br />
aus. Schließlich wollte ich alles über ihn<br />
wissen: „Opa, warum gehst du so?“ Ich<br />
demonstrierte es, indem ich übertrieben<br />
hinkend durch die Werkstatt trabte.<br />
„So stark, wie du es vormachst,<br />
schnappe ich nicht!“, sagte er lachend.<br />
„Ich gehe so, weil ich einen Schuss in die<br />
Hüfte gekriegt habe.“ „Wer hat <strong>auf</strong> dich<br />
geschossen?“ „Irgendein Franzose.“ Er<br />
schien nicht empört zu sein. „Der hat<br />
nur seine Pflicht getan. Wie die Unsrigen.“<br />
Ein Franzose, dessen Pflicht es war,<br />
meinem Opa in die Hüfte zu schießen?<br />
Er spürte mein Staunen und fügte<br />
hinzu: „Es war im Krieg.“ Das steigerte<br />
meine Zweifel. Mein Vater war damals<br />
gerade im Krieg. Er war Marinesoldat<br />
im fernen Cherbourg. Großvater trug<br />
keine Uniform und war auch nicht <strong>auf</strong><br />
Heimaturlaub. „Es gab schon mal einen<br />
Krieg, anno vierzehn-achtzehn“, erklärte<br />
er mir. „Da ist es passiert.“ Von diesem<br />
Krieg hatte ich noch nie gehört.<br />
„Gegen wen haben wir da gekämpft?“,<br />
fragte ich. „Gegen die Gleichen wie jetzt:<br />
Franzosen, Russen, Engländer und Amerikaner.“<br />
„Wer hat gewonnen?“, wollte<br />
ich wissen. „Die anderen“, antwortete<br />
er, wandte sich abrupt der Hobelbank zu.<br />
Unsere Unterhaltung war damit beendet.<br />
Hungrig an der Ostfront:<br />
Deutsche Soldaten 1915 bei einer<br />
Frühstückspause<br />
Viel später, als ich mir unser Gespräch<br />
in Erinnerung rief, begriff ich,<br />
dass er sich bremsen musste, um nicht<br />
hinzuzufügen: „Und genau so wird es<br />
auch diesmal ausgehen!“<br />
Eine Aussage wie diese war damals<br />
lebensgefährlich. Er musste ja befürchten,<br />
dass ein kleiner Junge unbefangen<br />
ausplaudern könnte, was sein Opa da geäußert<br />
hatte.<br />
Jahrzehnte später sprachen wir noch<br />
einmal von Großvaters Krieg. In den<br />
sechziger Jahren kehrte ich – inzwischen<br />
Kunststudent – wieder einmal ins Dorf<br />
zurück. Ein gemeinsamer Bekannter<br />
war gestorben, und ich begleitete meine<br />
Großeltern zum kleinen Friedhof. Nach<br />
der Beerdigung, Großmutter war schon<br />
nach Hause gegangen, blieb Großvater<br />
vor einem Denkmal nahe der Friedhofsmauer<br />
stehen. Eine steinerne Stele von<br />
viereckigem Grundriss, die oben in einer<br />
stumpfen Pyramide endete.<br />
An drei ihrer Seiten waren gusseiserne<br />
Tafeln befestigt. Auf der einen<br />
stand in goldbronzierten Lettern: „Zum<br />
Gedenken an die Gefallenen des Krieges<br />
1914-1918“. Als man diese Tafel angebracht<br />
hatte, sprach man noch nicht<br />
vom „Ersten Weltkrieg“. Man konnte<br />
damals nicht ahnen, dass ein nicht minder<br />
schrecklicher folgen würde.<br />
„Da hätte auch mein Name stehen<br />
können“, sagte Großvater. „Ich hatte<br />
mehr Glück als diese hier.“ Auf den beiden<br />
anderen Tafeln gedachte man der<br />
„Gefallenen des Zweiten Weltkriegs“.<br />
Großvater ging langsam um die Stele<br />
herum. „Eine Seite ist noch frei“, sagte<br />
er. „Geb’s Gott, dass sie nie beschriftet<br />
werden muss.“<br />
Auf dem Heimweg vom Friedhof erzählte<br />
er zum ersten Mal ausführlich<br />
von seinen Kriegserlebnissen. Vom Grabenkrieg,<br />
wo man monatelang um zwei<br />
Meter Bodengewinn gekämpft hatte.<br />
Vom Giftgas. Einige aus seiner Kompanie,<br />
die es nicht geschafft hatten, sich<br />
rechtzeitig die Gasmaske überzustülpen,<br />
waren für immer erblindet. Man konnte<br />
die Situation nur aushalten, wenn man<br />
mit dem Leben abgeschlossen hatte und<br />
nichts mehr erwartete als vielleicht ein<br />
letztes warmes Essen. Das war das letzte<br />
Mal, dass er von seinen Kriegserlebnissen<br />
erzählte.<br />
Wenige Jahre später, nach seinem<br />
Tod, sah ich Großvater bei der Leichenwäsche<br />
zum ersten Mal nackt. Die trichterförmige<br />
Narbe an seiner Hüfte war<br />
deutlich zu erkennen. Damals nahm ich<br />
mir vor, seiner Lebensgeschichte nachzugehen.<br />
Dazu gehörte auch, dass ich alles<br />
über „seinen Krieg“, über den Ersten<br />
Weltkrieg, erfahren wollte. Ich las „Im<br />
Westen nichts Neues“, und ich war erschüttert<br />
über die Radikalität, mit der<br />
Stanley Kubrick in seinem Film „Wege<br />
zum Ruhm“ den Grabenkrieg inszeniert<br />
hatte.<br />
Durch den bevorstehenden 100. Jahrestag<br />
des Kriegsbeginns und die Veröffentlichungen<br />
darüber fühlte ich mich<br />
meinem Großvater neu verbunden. Ich<br />
begann, Dutzende von im Internet, etwa<br />
im „Archiv der Zeitzeugen“, dokumentierten<br />
Tagebüchern, Kriegsbriefen und<br />
Feldpostkarten zu lesen. Dabei fiel mir<br />
<strong>auf</strong>: Das eigentliche Kriegsgeschehen<br />
wurde ganz sachlich, geradezu stoisch<br />
festgehalten. Man nahm es fast unkommentiert<br />
zur Kenntnis.<br />
Ganz anders dagegen die nie fehlenden<br />
Schilderungen der täglichen Mahlzeit.<br />
Da wurde ausführlich, geradezu<br />
herzlich, mit großer Zuneigung von den<br />
Essensportionen erzählt, von heimlich<br />
<strong>auf</strong>gegessenen Notrationen, von wohlschmeckenden<br />
Suppen und von warmem<br />
Kaffee.<br />
Das hat mich bewogen, eine Collage<br />
zu verfassen, bei der Notate über<br />
das Kampfgeschehen konfrontiert werden<br />
mit Niederschriften, die das Essen<br />
betreffen. Dabei folgte ich der Chronologie<br />
des Krieges. Vom optimistischen Aufbruch<br />
1914 mit Reis, Fleisch und feiner<br />
Soße, bis hin zur resignierten Erkenntnis,<br />
dass der Krieg nicht zu gewinnen sei,<br />
und der entsprechenden Klage über den<br />
Schweinefraß, der ausgerechnet an Kaisers<br />
Geburtstag verabreicht worden sei.<br />
125<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Collage<br />
UNSER TÄGLICH BROT<br />
Ein leiser Pfiff des Führers ließ uns<br />
halten. Er schien etwas entdeckt zu haben<br />
und wies mit der Hand nach halb<br />
rechts, wo nach seiner Fantasie ein russischer<br />
Doppelposten stehen sollte. Alles<br />
legte nach der angegebenen Richtung<br />
hin an, und er kommandierte „Feuer“.<br />
Gleich dar<strong>auf</strong> ging die Hölle los. Der<br />
Russe gab, in der Annahme, ein deutscher<br />
Angriff stände bevor, ein lebhaftes<br />
Schnellfeuer ab.<br />
Das Essen bestand aus Klöpsen mit<br />
Nudeln und Sauce und war sehr schmackhaft<br />
zubereitet.<br />
Der Angstschweiß trat mir <strong>auf</strong> die<br />
Stirn, und ich hielt mein Ende für gekommen.<br />
Ich flog mehr als ich ging in<br />
ein Granatloch, während der Essenkübel<br />
in weitem Bogen über mich hinwegflog.<br />
Das Unglück wollte, dass der Trichter mit<br />
Stacheldraht gefüllt war, mir die Hände<br />
<strong>auf</strong>riss und die Kleidung zerfetzte.<br />
Es wurde Essen ( Kohlsuppe )<br />
verabfolgt.<br />
Das Kämpfen und das Essen.<br />
Der Kinderbuchautor Paul Maar hat Zitate aus<br />
Tagebüchern und Briefen von Soldaten collagiert<br />
Es kam Nachricht, dass am Abend<br />
der Transport abgehen sollte. Eine<br />
gehobene, ja freudige Stimmung lagerte<br />
<strong>auf</strong> dem ganzen Bilde. Ein unbeschreiblicher<br />
Reiz ging von dem Ganzen<br />
aus, man sieht sich vielleicht zuletzt, man<br />
könnte sich auch eventuell wiedersehen.<br />
Das ist Schicksal.<br />
Der Abend rückte heran, es war<br />
längst dunkel. Ein kräftiges, aus Reis und<br />
viel Rindfleisch bestehendes Abschiedsessen<br />
stärkte noch den Transport.<br />
Wie lähmte uns aber der Schreck die<br />
Glieder, als gegen zehn Uhr am Morgen<br />
des folgenden Tages mit unheimlichem<br />
Zischen und Heulen das schwere Geschoss<br />
einer Mörserbatterie in die hinter<br />
Westfront mit Kaffee: Offiziere<br />
am gedeckten Tisch in einem<br />
Unterstand, ebenfalls 1915<br />
uns zwischen Landstraße und Anhöhe<br />
befindliche Schlucht einschlug. Einige<br />
Tote und Verwundete waren die Opfer,<br />
während wir angenommen hatten, uns<br />
noch in ziemlicher Entfernung von der<br />
Front zu befinden.<br />
Einem jeden von uns wurde von einer<br />
Schwester des Roten Kreuzes eine<br />
ganze geräucherte Wurst und ein Trinkbecher<br />
Kaffee ausgehändigt. Mit dankbaren<br />
Blicken wurde die Delikatesse dem<br />
Magen einverleibt.<br />
Einen Augenblick war ich starr vor<br />
Schreck und nahm an, es sei ein Blindgänger,<br />
als aber an derselben Stelle ein<br />
weißlicher Dunst <strong>auf</strong>stieg, schrie ich aus<br />
Leibeskräften „Gas“, um meine Kameraden<br />
zu warnen, und stülpte mit der größten<br />
Behändigkeit die eigene Maske, welche<br />
laut Befehl stets gebrauchsfertig am<br />
Knopf des Waffenrockes befestigt war,<br />
über den Kopf.<br />
Die Verpflegung ließ nichts zu wünschen<br />
übrig und war sehr reichlich. Infolge<br />
reichlicher Zufuhren von Schweinefleisch<br />
aus der rumänischen Offensive.<br />
Unter großen Anstrengungen gelang<br />
es mir, die erste Linie zurückzuschlagen,<br />
doch ehe wir einige Zeit gewannen<br />
zum Atemschöpfen, näherte sich schon<br />
die zweite. Der Anführer musste wohl<br />
das Kommando zum Vormarsch gegeben<br />
haben, denn deutlich unterschieden<br />
wir die angstverzerrten Gesichter der<br />
Franzmänner. Sei es, dass dem Befehl<br />
nicht Folge geleistet wurde, oder es gab<br />
einen anderen Grund, den ich nie erfahren<br />
habe, kurz: der Anführer wandte sich<br />
um und erschoss zwei seiner Landsleute.<br />
Doch nicht lange sollte sich der energische<br />
Offizier seiner Tat freuen, kurze Zeit<br />
danach sehen wir ihn von den Kugeln<br />
Foto: SZ Photo [M]<br />
126<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
seiner eigenen Leute zusammensinken.<br />
Es schien, als ob alle <strong>auf</strong> den Tod des Führers<br />
gewartet hätten, kaum sah man ihn<br />
fallen, so stürzte die ganze Horde, die<br />
Gewehre fortwerfend, mit erhobenen Armen<br />
<strong>auf</strong> unsere Stellung zu.<br />
Des nächsten Morgens erhielt man<br />
einen Becher Fleischbrühe und ein Stückchen<br />
Brot zum Frühstück, ein warmes<br />
Mittagessen und Kaffee am Nachmittag.<br />
Anzeige<br />
Drei Monate<br />
<strong>Cicero</strong> Probe lesen<br />
<strong>Cicero</strong><br />
zur Probe<br />
An der Linken, etwa acht Meter hohen,<br />
steil emporschießenden Wand der<br />
Schlucht hatten die Artilleristen sich<br />
in dem leichten gelben Sand notdürftig<br />
eingebaut und erzählten mit noch schreckensbleichen<br />
Gesichtern, dass am selben<br />
Tag eine Batterie einen Volltreffer<br />
erhalten hatte, welcher sämtliche Geschütze<br />
und Bedienungen zerriss und<br />
eine der schweren Haubitzen 100 Meter<br />
weit ins Feld schleuderte. Lange hielt ich<br />
mich nicht an dem grausigen Ort <strong>auf</strong>. Aus<br />
einem Dickicht zur Linken strömte ein<br />
pestilenzartiger Geruch, der vollkommen<br />
jegliche Atmung unmöglich machte,<br />
war es Mensch, war es Tier …?<br />
Die Büchsenwurst war eine Art falscher<br />
Hahn, die man gleich <strong>auf</strong>essen<br />
musste, da sie sich nicht bis zum anderen<br />
Tage hielt.<br />
Die Feldlazarette hatten alle Hände<br />
voll zu tun und immer weiter wurden namentlich<br />
Leichtverwundete nach hinten<br />
abgeschoben, um den Schwerverletzten<br />
Platz zu machen. Am Marktplatz eines<br />
Dorfes saß einer an beiden Händen verwundet<br />
und wimmerte wie ein kleines<br />
Kind.<br />
Vor dem Haupteingang zum Bahnhof<br />
dampften drei riesige Kessel mit Essen.<br />
Ich hatte anfangs die Meinung, es<br />
wurde hier Teer zur Ausfüllung des Straßenpflasters<br />
gekocht. Nebenbei gesagt<br />
hatte übrigens dieses Mittagessen noch<br />
den angenehmsten Geschmack von sämtlichen<br />
bisher in diesem Lande eingenommenen<br />
Speisen.<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo<br />
sparen Sie gegenüber<br />
dem Einzelk<strong>auf</strong>.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 18,– Euro* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 18,– Euro* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts<br />
weiter zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,75 Euro pro Ausgabe inkl. MwSt.<br />
(statt 8,50 Euro im Einzelverk<strong>auf</strong>). Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen<br />
nach Erhalt der dritten Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement<br />
jederzeit kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer<br />
Michael Voss. *Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise <strong>auf</strong> Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Ohne Risiko<br />
Sie gehen kein Risiko ein<br />
und können Ihr Abonnement<br />
jederzeit kündigen.<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
18,– Euro*<br />
Mehr Inhalt<br />
Monatlich mit Literaturen<br />
und zweimal im Jahr als<br />
Extra-Beilage.<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Allerhand Kriegsgerät lag umher,<br />
und an den <strong>auf</strong>gepflanzten noch mit Blut<br />
bedeckten Bajonetten war zu erkennen,<br />
dass erst ganz kürzlich ein Nahkampf<br />
stattgefunden hatte.<br />
Der Mittag kam heran, aber von der<br />
Gulaschkanone war keine Spur zu<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3464656 56<br />
Telefax: 030 3464656 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1140025<br />
Unterschrift
SALON<br />
Collage<br />
entdecken. Erst gegen drei Uhr ertönte<br />
der heiß ersehnte Ruf „Essen holen“.<br />
Zu unserem Leidwesen fiel die ausgeteilte<br />
Portion noch schmaler aus als wie<br />
gewöhnlich, sodass die eine Stunde später<br />
verabreichte Brotportion nebst Fettigkeiten<br />
restlos daran glauben musste.<br />
Große feindliche Fliegergeschwader<br />
hatten die Anmarschstraße unsicher gemacht,<br />
ganze Kolonnen vernichtet, tote<br />
Pferde und zerstörte Wagen lagen rechts<br />
und links von der Straße, Erstere verursachten<br />
eine erstickende Luft.<br />
Man wollte uns mit Maissuppe füttern.<br />
Das war einem Kameraden aus Köln<br />
denn doch zu viel. Seine feine Nase entdeckte<br />
bald, dass in dem Schuppen, an<br />
welchem wir Aufstellung genommen hatten,<br />
unzählige Speckseiten hingen.<br />
Seit wir in Stellung sind, hat unser<br />
Regiment schon viel Verluste gehabt, von<br />
meiner Kompagnie sind allein acht Mann<br />
an einem Tag weggekommen, tot, verwundet<br />
und verschüttet.<br />
Noch nie war mir der Gedanke gekommen,<br />
die sogenannte eiserne Portion,<br />
welche nur in allerhöchster Not <strong>auf</strong><br />
Befehl angebrochen werden durfte, zu<br />
verzehren. Nun zögerte ich nicht lange<br />
und holte das kostbare Kleinod aus dem<br />
Brotbeutel hervor und hatte einen vollen<br />
Genuss. Selten hat mir eine Mahlzeit so<br />
herrlich gemundet wie diese unerlaubte<br />
und strafbare.<br />
Als wir nach vorne kamen, sahen<br />
wir, was der Amerikaner geleistet hatte.<br />
Alles, was sich in der ersten Linie befand<br />
und nicht rechtzeitig nach hinten konnte,<br />
war erstochen und mit dem Kolben niedergeschlagen.<br />
16 Mann und ein Leutnant<br />
von den Minenwerfern, die gerade<br />
schliefen, waren sämtlich von den Amerikanern<br />
erstochen, sie haben keine Gefangenen<br />
gemacht.<br />
Einige Kameraden hatten sich das<br />
Mehl, welches seitens des Regiments<br />
zwecks Absendung an die Angehörigen<br />
in der Heimat verteilt wurde, an<br />
die eigene Adresse senden lassen und<br />
Die Sau ist tot: Eine deutsche<br />
Soldatenkompanie bereitet Ende<br />
1915 ein Festmahl vor<br />
schmorten und backten nun am Schützengrabenofen,<br />
was das Zeug halten<br />
konnte.<br />
Die gewaltige Kanonade war verstummt.<br />
Dafür feuerten die Franzosen<br />
Gasgranaten. Dieses leichte Zischen,<br />
die schwachen Detonationen, der betäubende<br />
Geruch machte einen halb wahnsinnig.<br />
Stunde um Stunde hörte man<br />
nur dieses entsetzliche leise Pfeifen. Ich<br />
brauchte die Gasmaske.<br />
Verpflegung gab es auch jetzt noch<br />
nicht, sodass die Rindfleischportion vom<br />
eisernen Bestand daran glauben musste.<br />
Das Gelände, das wir durchquerten,<br />
war bedeckt mit Leichen, Pferdekadavern,<br />
Munition und allerhand Ausrüstungsgegenständen.<br />
Allem Anschein<br />
nach waren die Engländer fluchtartig<br />
zurückgegangen, denn sonst hätten sie<br />
doch wenigstens die gefallenen Kameraden<br />
mitgenommen.<br />
Bald hatten wir entdeckt, dass <strong>auf</strong><br />
nicht weit entferntem Acker Kartoffeln<br />
gepflanzt waren, die wir uns nach Bedarf<br />
wieder aus dem Erdreich herausholten.<br />
Auf diese Weise bereiteten wir<br />
uns am Abend Bratkartoffeln, etwas<br />
junges Gemüse machte die Sache noch<br />
schmackhafter.<br />
Fotos: Picture Alliance/dpa/ZB [M], Jörg Schwalfenberg/Oetinger (AUTOR)<br />
Unwillkürlich kam über uns das Gefühl<br />
des Verlassenseins, allein <strong>auf</strong> weiter<br />
Flur, was sich von der Zeit an auch immer<br />
mehr stärkte, zumal wir die immer<br />
drückender werdende Überlegenheit der<br />
Feinde an Material und Truppen von Tag<br />
zu Tag mehr und mehr erkennen mussten.<br />
Hier tauchte bei der Mehrzahl der<br />
Truppen erstmals das Gefühl <strong>auf</strong>, dass<br />
der Krieg für uns verloren sei, denn der<br />
Mangel an Reserven war deutlich fühlbar<br />
und das Munitionsmaterial und so weiter<br />
wurde immer mangelhafter.<br />
Ende Januar, sogar am Geburtstag<br />
des Kaisers!, gab es Sauerkohl ohne<br />
Fleisch und Kartoffeln! Es war ein regelrechtes<br />
Schweinefutter, welches uns da<br />
verabfolgt wurde.<br />
PAUL MAAR ist Kinder- und<br />
Jugendbuchautor. Er erfand<br />
das „Sams“ ebenso wie „Herrn<br />
Bello“, „Die Opodeldoks“ und<br />
den Träumer „Lippel“<br />
128<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
´<br />
148 Seiten Inspiration. Jeden Monat neu!<br />
www.emotion.de<br />
01/14<br />
ZEIT FÜR NEUE GEDANKEN<br />
02/14<br />
2014<br />
PERSÖNLICHKEIT<br />
ICH MACH DAS JETZT! BeNeLux 6,20 € Italien 7,20 € Spanien 7,20 €<br />
www.emotion.de<br />
LIEBE<br />
MUT ZUM<br />
GEHEIMNIS<br />
ZEIT FÜR NEUE GEDANKEN<br />
WECKT ER DIE<br />
BESTEN SEITEN<br />
IN MIR?<br />
Bloß nicht immer<br />
alles verraten!<br />
DA S G I BT M I R E N E RG I E !<br />
GESELL SCHAFT<br />
MUTTER MIT 43<br />
Warum das späte<br />
Glück provoziert<br />
ONLINE-DATING<br />
KANN ICH<br />
MEINEN<br />
GEFÜHLEN<br />
TRAUEN?<br />
BeNeLux 6,20 € Italien 7,20 € Spanien 7,20 €<br />
JA! ICH STEH' ZU MIR BeNeLux 6,20 € Italien 7,20 € Spanien 7,20 €<br />
D O S S I E R<br />
DAS GIBT MIR<br />
DOSSIER<br />
03/14<br />
www.emotion.de<br />
EXKLUSIV<br />
URSULA KARVEN<br />
»Verdrängung<br />
finde ich super«<br />
ZEIT FÜR NEUE GEDANKEN<br />
PSYCHOLOGIE<br />
KENNEN SIE<br />
IHREN<br />
LIEBESCODE?<br />
NATUR<br />
MAGIER<br />
DER NACHT<br />
Wie der Mond<br />
uns beeinflusst<br />
FORSCHUNG<br />
IN JEDEM<br />
STECKT EIN<br />
OPTIMIST<br />
DOSSIER<br />
Ja!<br />
ICH MACH<br />
DAS JETZT!<br />
WI E M AN ZU SE I N E N TR ÄUM E N J A SAGT<br />
ROADMAP ZUM GLÜCK So treffen Sie die richtige Entscheidung<br />
FRAUEN UND IHR NEUSTART Schluss mit dem „Was wäre, wenn“<br />
ISABELLA ROSSELLINI Aufbruch als Lebenselixier<br />
JANUAR 2014<br />
JOB-FRAGE<br />
MEHR GELD<br />
ODER<br />
MEHR ZEIT?<br />
EXKLUSIV<br />
» Halb perfekt<br />
ist auch sehr<br />
schön «<br />
TAGESTHEMEN-MODERATORIN<br />
CAREN MIOSGA<br />
ENERGIE!<br />
WIE SIE IHR LEBEN WIEDER IN SCHWUNG BRINGEN<br />
IMPULSE Kluge Tipps vom Zen-Meister bis zur Ernährungsexpertin<br />
TEST Wo stecken meine Energieräuber?<br />
NEUANFANG So kommt Ihr Kraftkonto ins Plus<br />
FEBRUAR 2014<br />
PSYCHOLOGIE<br />
WIRD SCHON!<br />
Unsicheren Zeiten<br />
gelassen begegnen<br />
WOHNEN<br />
ASIA-TREND<br />
Klarheit für<br />
die Seele<br />
DEUTSCHLAND 4 , 90 €<br />
ÖSTERREICH 5,90 €<br />
SCHWEIZ 9,50 SFR<br />
EXKLUSIV<br />
» Ich will<br />
mindestens 7 Mal<br />
am Tag über<br />
mich lachen«<br />
COMEDIAN<br />
MÄRZ 2014<br />
MARTINA HILL<br />
GESELL SCHAFT<br />
DAS GROSSE<br />
JAHRES-<br />
HOROSKOP<br />
DIE GROSSE<br />
ACHTSAMKEITS-<br />
LÜGE<br />
ICH STEH ZU MIR<br />
DA S B E S O N D E R E A N S I C H E N T D EC K E N U N D L I E B E N<br />
LEBENSFREUDE Weniger Fassade, mehr Nähe<br />
INDIVIDUALITÄT Frauen über ihr Glück, etwas anders zu sein<br />
TIPPS FÜRS ICH So begegnen Sie Widerständen von außen<br />
Besonderes<br />
ABO-ANGEBOT<br />
D E U TS C H L A N D 4 , 9 0 €<br />
ÖSTERREICH 5,90 €<br />
SCHWEIZ 9,50 SFR<br />
für<br />
<strong>Cicero</strong>-Leser<br />
4 1 9 7 0 8 3 1 0 4 9 0 2 0 3<br />
www.emotion.de<br />
Möchten Sie EMOTION kennenlernen?<br />
QR-Code scannen und als <strong>Cicero</strong>-Leser drei Ausgaben mit 42% Rabatt für nur 8,50 Euro testen.
SALON<br />
Hopes Welt<br />
MIT BACH WÄRE DAS NICHT PASSIERT<br />
Wie ich einmal im Badezimmer an Mendelssohn scheiterte<br />
und mich dennoch in eine Melodie verliebte<br />
Von DANIEL HOPE<br />
Bei meinem letzten Stopp in Berlin besuchte<br />
ich Mendelssohn. Der große Komponist<br />
liegt <strong>auf</strong> dem Friedhof am Halleschen Tor<br />
in Kreuzberg. Im Gegensatz zu anderen opulenten<br />
Denkstätten ist dieser Ort trist und umkreist<br />
von Wohnhäusern, die <strong>auf</strong> Legenden herunterschauen,<br />
ohne es zu ahnen.<br />
Felix Mendelssohn Bartholdys himmlische<br />
Musik fasziniert mich nicht weniger als sein<br />
ungeheures Arbeits- und Reisepensum. In Berlin<br />
wuchs er <strong>auf</strong>, Düsseldorf bot ihm die erste<br />
Anstel lung, in Frankfurt am Main fand er seine<br />
Frau, Leipzig mit dem Gewandhaus wurde neben<br />
London die wichtigste Wirkungsstätte. Ende<br />
zwanzig – da er schon lange komponierte und als<br />
Pianist Aufsehen erregte, da er Goethe in<br />
Erstaunen versetzt hatte, von Cherubini in Paris<br />
als außergewöhnliche Begabung erkannt worden<br />
war – schrieb er sein Violinkonzert.<br />
Meine erste Begegnung mit dem Konzert<br />
war nicht einfach. Mit acht Jahren vertraute ich<br />
meinem Zimmergenossen Ikki im Musikinternat<br />
in England an, dass ich lieber als alles andere<br />
dieses Werk spielen würde. Yehudi Menuhin hatte<br />
mit sieben Beethovens Violinkonzert gespielt, <br />
ich würde Mendelssohn meistern – dachte ich<br />
mir. Ich musste nur einen Ort finden, wo ich<br />
unentdeckt üben konnte. Meine Lehrer würden<br />
nicht einverstanden sein, wenn ich ein Stück<br />
spielte, das viel zu schwierig für mich war.<br />
Das Badezimmer <strong>auf</strong> dem Gang schien mir<br />
ideal. Ich kam kaum über ein paar Takte hinaus.<br />
Es muss geklungen haben, als strangulierte<br />
jemand mehrere Katzen gleichzeitig. Aber es war<br />
ein Akt der Befreiung, ich fühlte mich wie ein<br />
Vollblutmusiker.<br />
Ich war durchdrungen von dieser wunderbaren<br />
e‐Moll-Melodie am Anfang des Konzerts, <br />
als ich plötzlich erstarrte. Es hatte laut geklopft.<br />
„Würdest du bitte die Tür öffnen“, hörte ich die<br />
Hausmutter mit ihrem strengen irischen Akzent.<br />
„Was um alles in der Welt fällt dir ein?“, fuhr sie<br />
mich an. Sie zerrte mich am Ohr und schnappte<br />
sich gleichzeitig meinen Notenständer, den ich in<br />
die Badewanne gestellt hatte. Draußen hatten<br />
sich schon meine Mitschüler feixend versammelt.<br />
Einige Tage später wurde ich zum Musikdirektor<br />
gerufen und war erstaunt, meine Eltern<br />
dort vorzufinden. „Mr. und Mrs. Hope“, begann<br />
der Direktor, „ich habe Sie aus London hierhergeholt,<br />
weil ich Ihnen leider mitteilen muss, dass<br />
Ihr Sohn ohne Erlaubnis das Mendelssohn-Konzert<br />
geübt hat. Er wurde ertappt – im Badezimmer.<br />
Bach soll er üben, nicht Mendelssohn!“ Wie sagte<br />
einst Mendelssohn: „Es wird so viel über Musik<br />
gesprochen und so wenig gesagt. Ich glaube<br />
überhaupt, die Worte reichen nicht hinzu, und<br />
fände ich, dass sie hinreichten, würde ich am<br />
Ende keine Musik mehr machen.“<br />
Zwei Wochen später verließ ich das Internat<br />
und wechselte meinen Geigenlehrer. Das erste<br />
Stück, das ich mit dem neuen Lehrer erarbeitete,<br />
war das Violinkonzert von Mendelssohn. Seitdem<br />
ist dieses Meisterwerk mein ständiger<br />
Begleiter. Außer im Badezimmer.<br />
DANIEL HOPE ist Violinist von Weltrang und<br />
schreibt jeden Monat im <strong>Cicero</strong>. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt<br />
erschienen sein Buch „Toi, toi, toi! – Pannen und<br />
Katastrophen in der Musik“ ( Rowohlt ) und<br />
die CD „The Romantic Violinist“. Er lebt in Wien<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
130<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Marta Hentschel, taz-Leserin, Berlin, Geschäftsführerin einer Modefirma<br />
Ich teile<br />
mir die taz<br />
mit 13.500<br />
anderen.<br />
Mehr als 13.500 Genossinnen und<br />
Genossen sichern die publizistische<br />
und ökonomische Unabhängigkeit<br />
ihrer Zeitung. Wer einen Anteil von<br />
500 €* zeichnet, kann GenossIn<br />
werden.<br />
taz.de/genossenschaft<br />
geno@taz.de<br />
T (030) 25 90 22 13<br />
*auch in 20 Raten zahlbar
SALON<br />
Bibliotheksporträt<br />
LASST VIELE<br />
BRUNNEN FLIESSEN<br />
Für den Unternehmensberater und Gründer der<br />
„Stiftung Familienunternehmen“, Brun-Hagen Hennerkes,<br />
ist Literatur die Herzmitte aller Begeisterung<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
Krambambuli! Wie bitte? Krambambuli, der Hund! Mein Gesicht wird<br />
zu einem Fragezeichen. Noch ehe ich etwas sagen kann, ist Brun-Hagen<br />
Hennerkes <strong>auf</strong>gesprungen, hat das Wohnzimmer in seinem Stuttgarter Eigenheim<br />
verlassen, das eine Villa zu nennen nicht schwerfällt. Es liegt oberhalb<br />
des Talkessels, in Degerloch. Der Hausherr ruft mir aus der Bibliothek<br />
munter zu: Er habe die Geschichte von Krambambuli seinen Enkeln<br />
geschenkt. So ergriffen seien diese gewesen, dass sie weinten. Ach, es ist<br />
eine herrliche Erzählung!<br />
So wird es mir noch viele Male ergehen an diesem verregneten Vormittag.<br />
Brun-Hagen Hennerkes, Anwalt, Unternehmensberater, Gründer der<br />
„Stiftung Familienunternehmen“, Professor Doktor Doktor honoris causa,<br />
hat auch in seinem 75. Lebensjahr die Lebendigkeit eines Kobolds und die<br />
Heiterkeit eines Jünglings. Liegt es an den Büchern, die er liest oder sich<br />
vorlesen lässt?<br />
Gerade waren es die 15 CDs von Joseph Roths „Radetzkymarsch“,<br />
eine Wiederbegegnung nach der Erstlektüre vor zehn Jahren. Von Joseph<br />
Roth kam Hennerkes fast zwangsläufig zu Soma Morgenstern. Er springt<br />
<strong>auf</strong> und holt die Lebensbeschreibung des Freundes von Roth aus der Bibliothek.<br />
„Funken im Abgrund“ heißt das einst von Marcel Reich-Ranicki<br />
lebhaft empfohlene Buch. Schon oft verschenkte er es weiter. Von Soma<br />
wiederum ist der Weg nicht weit zu Selma, ist es nur ein phonetischer und<br />
gedanklicher Sprung, ein winziger Buchstabentausch, um bei der ersten<br />
weiblichen Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf zu landen. Brun-<br />
Hagen Hennerkes eilt ein drittes Mal ins Lesezimmer nebenan. „Die Lichtflamme“,<br />
„Gösta Berling“ – nie gehört?<br />
Da ist also, erläutert mir der im Reden zunehmend selbst entflammte<br />
Hausherr, dieser Ritter, der mit Gottfried von Bouillon Jerusalem erobert.<br />
Als Zeichen seiner Abkehr vom Lotterleben entzündet er dort eine Kerze<br />
am Altar und verspricht, die „Lichtflamme“ zur Muttergottes nach Florenz<br />
zu bringen. Nie möge sie verlöschen, „und was soll ich Ihnen sagen?<br />
Es klappt! Eine der schönsten Novellen von Lagerlöf“. Höchstens „Gösta<br />
133<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Berling“ vermag ihr das Wasser zu reichen, die Geschichte eines prunksüchtigen<br />
evangelischen Pfarrers, zwischen Traum und Realität changierend.<br />
Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass er sie erstmals las, eine Läuterungsgeschichte<br />
auch sie. Jedes Jahr liest er sie <strong>auf</strong>s Neue.<br />
Hennerkes besuchte ebenso die Region des Geschehens, Värmland in<br />
Schweden, wie später das Galizien des Joseph Roth. Ein ums andere Mal<br />
lockten ihn Bücher hinaus in die Welt, wurde Kunst zur Landkarte des Lebens.<br />
Gibt es einen größeren Vertrauensbeweis für Literatur, als sich ihr<br />
leibhaft auszusetzen? Dass es nordische Regionen sind, in die es ihn lesend<br />
zieht, sei Zufall, „ich bin kein systematischer Leser“. Als Kind habe er sich<br />
begeistert für den katholischen Jugendschriftsteller Nonni Svensson aus Island.<br />
Später war er begeistert von Max Tau, 1951 Friedenspreisträger des<br />
deutschen Buchhandels, der für die norwegische Literatur focht.<br />
Der Knabe Brun-Hagen, Zahnarztsohn, geboren „<strong>auf</strong> der Durchreise“<br />
im sächsischen Siebenlehn, <strong>auf</strong>gewachsen in Westfalen, war so begeisterungsfähig,<br />
begeisterungsselig wie heute. Begeisterung ist das Zentralwort<br />
unseres Gesprächs, „begeistert bin ich auch bei der Arbeit für die Stiftung“.<br />
Begeistert habe ihn unlängst Hans Pleschinskis Thomas-Mann-Roman „Königsallee“.<br />
Die Lesung von Manns „Zauberberg“ hörte er schon viermal,<br />
selbst „Joseph und seine Brüder“, hochkomplex und sehr, sehr lang, zweimal.<br />
Energisch trommelt er mit den Fingerkuppen <strong>auf</strong> ein Buch über einen<br />
anderen Dichtertitan. Es enthält die Vorlesungen Hermann Grimms zu Goethe<br />
von 1870. Faszinierend sei das Geflecht der Personen, das Grimm enthülle,<br />
„und diese Sprache: einfach herrlich“. Grimm schrieb „‚Noch dies,<br />
Spinoza anlangend.‘ Über diese Formulierung habe ich mich sehr gefreut.<br />
‚Noch dies‘ …“ Brun-Hagen Hennerkes blickt <strong>auf</strong>, strahlt, schaut in das Buch.<br />
Die Liebe zur Literatur begann im Elternhaus und wuchs in der Schule.<br />
Acht Jahre am Gymnasium Marianum in Warburg, während denen er als<br />
externer Internatsschüler am Erzbischöflichen Konvikt wohnte, prägten<br />
ihn. „Unser Direktor sprach fließend Latein und Griechisch. Wir mussten<br />
viel auswendig lernen, auch Tacitus.“ Flugs zitiert er aus „Dreizehnlinden“<br />
von Friedrich Wilhelm Weber: „Wonnig ist’s, in Frühlingstagen / nach dem<br />
Wanderstab zu greifen / und, den Blumenstrauß am Hute, / Gottes Garten zu<br />
durchstreifen“ – und bricht ab, „ist ein bisschen kitschig“. Auch über den<br />
„Knaben im Moor“ der Annette von Droste-Hülshoff ging die Zeit hinweg:<br />
„O schaurig ist’s übers Moor zu gehn, / Wenn es wimmelt vom Heiderauche“.<br />
1960 folgte das Abitur.<br />
Vor diesem gymnasialen Hintergrund war das Studium der alten Sprachen<br />
folgerichtig. Doch nach zwei Semestern in Saarbrücken wechselte er<br />
zur Jurisprudenz. „Ich war einfach nicht gut genug.“ Nach sieben weiteren<br />
Semestern in Hamburg und Freiburg gelang ihm das Examen, die rechtswissenschaftliche<br />
Dissertation folgte 1966 <strong>auf</strong> dem Fuß. Über eine Annonce<br />
der „Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl“ verschlug es ihn nach Düsseldorf<br />
zu Mannesmann. Er wurde in jungen Jahren Assistent des Generaldirektors<br />
Egon Overbeck. Die Liebe zu den Büchern hatte sich ausgezahlt.<br />
134<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014<br />
Foto: Andy Ridder für <strong>Cicero</strong>
Teil des Bewerbungsverfahrens war nämlich eine freie Rede zu einem vorgegebenen<br />
Thema gewesen. „Das kannte ich aus dem Griechisch-Unterricht.<br />
Ich ging streng nach dem Muster These – Antithese – Synthese vor.“<br />
Sosehr er auch die Zeit danach in der Stuttgarter Sozietät Carl Böttchers<br />
genoss, die Familienunternehmen beriet, so leidenschaftlich er diese<br />
Arbeit fortsetzte, als er 1981 alleiniger Seniorpartner wurde und die Kanzlei<br />
umbenannte, so zehrend es auch war, knapp 100 Aufsichtsräten anzugehören<br />
und in dieser Funktion Unternehmen zum Börsengang zu verhelfen,<br />
darunter Hugo Boss, Bijou Brigitte und Edding, so stolz er <strong>auf</strong> seine<br />
Stiftung sein mag und <strong>auf</strong> sein Standardwerk von 2004 über „die Familie<br />
und ihr Unternehmen“, das er gerade überarbeitet, aber auch <strong>auf</strong> die Mitherausgeberschaft<br />
des prominent besetzten, 600 Seiten starken Sammelbands<br />
„Wertewandel mitgestalten: Gut handeln in Gesellschaft und Wirtschaft“<br />
aus dem Jahr 2012: Literatur ist die Herzmitte aller Begeisterung.<br />
Darum liest er mit frühlingsfrischer Stimme Hugo von Hofmannsthals<br />
Liebesgedicht „Die beiden“, „denn beide bebten sie so sehr, / dass keine<br />
Hand die andre fand. / Und dunkler Wein am Boden rollte.“ Darum beschäftigte<br />
er sich einst, als einem seiner beiden Söhne diese Abitur<strong>auf</strong>gabe<br />
gestellt worden war, zwei Wochen lang mit Peter Huchels „An taube Ohren<br />
der Geschlechter“, kontaktierte auch die Witwe des Dichters. Er entnimmt<br />
die Parabel demselben Gedichtband, der nun schon <strong>auf</strong> dem Tisch<br />
liegt, ihm lieb und teuer. „Siebzehn Tage und Nächte brannte Troja, das<br />
wusste ich nicht. Hören Sie: ‚Es war ein Land mit hundert Brunnen. / Nehmt<br />
für zwei Wochen Wasser mit. / Der Weg ist leer, der Baum verbrannt. / Die<br />
Öde saugt den Atem aus‘.“ Darum auch beginnt sein Buch über die Familienunternehmen<br />
mit einer philologischen Exkursion. Familienunternehmer<br />
wüssten sich oft „immer noch in der Pflicht“. Dieser Begriff sei zu Unrecht<br />
verpönt, denn die Herkunftsgeschichte lehre: „Ob Pflicht nun in römischstoischer<br />
Tradition als Officium verstanden wurde, in christlicher Überlieferung<br />
als Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes oder im Zuge der Aufklärung<br />
als Bindung an das Vernunftgesetz – stets wurde sie als Ordnung<br />
und Gesetz begriffen, die es den Menschen erst ermöglichen, Freiheit zu<br />
verwirklichen.“ Freiheiten, heißt das, brauchen Pflichten.<br />
Beim letzten Blick zurück in das Stuttgarter Wohnzimmer und die ebenfalls<br />
holzgetäfelte Bibliothek im alpenländischen Stil drückt er mir „Krambambuli“<br />
in die Hand. Wenige Seiten umfasst die traurige Geschichte eines<br />
treuen Hundes. Sie stammt von Marie von Ebner-Eschenbach und beginnt<br />
so: „Vorliebe empfindet der Mensch für allerlei Gegenstände. Liebe, die<br />
echte, unvergängliche, die lernt er – wenn überhaupt – nur einmal kennen.“<br />
Draußen regnet es stark. „Krambambuli“ ruht in meiner Tasche. Es ist<br />
keine Läuterungsgeschichte. Der Lebensgang des begeisterten Lesers Brun-<br />
Hagen Hennerkes zeigt: Nicht der Mensch sucht sich seine Bücher aus. Die<br />
Bücher suchen sich ihre Menschen.<br />
ALEXANDER KISSLER leitet den Salon und genoss sein Germanistikstudium<br />
135<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
SALON<br />
Die letzten 24 Stunden<br />
Rom sehen und<br />
sterben, Goethe<br />
<strong>auf</strong> den Lippen,<br />
Dionysos im Sinn<br />
MICHAEL<br />
TRIEGEL<br />
Michael Triegel<br />
Der 1968 in Erfurt geborene<br />
Maler gilt als würdiger<br />
Nachfahre der Meister der<br />
Spätrenaissance. Sein Porträt<br />
von Papst Benedikt XVI. sorgte<br />
2012 für Furore<br />
Als Maler habe ich das große<br />
Privileg, durch meine Arbeit<br />
über die Schrecknisse<br />
des Todes nachdenken zu<br />
können. Ich versuche, mit<br />
dem Motiv der Kreuzigung Jesu oder<br />
durch die Darstellung der Todesqualen<br />
unterschiedlicher christlicher, aber auch<br />
antiker Märtyrer dem Tod jenen Sinn abzuringen,<br />
den er für mich selbst, weil ich<br />
kein Christ bin, nicht hat. Aber naturgemäß<br />
ist all das zum Scheitern verurteilt.<br />
Eine andere Methode, den Tod zu<br />
bannen, ist es, das Grauen so darzustellen,<br />
dass es etwas Apotropäisches<br />
bekommt. Oder noch eine andere, den<br />
Tod durch die Darstellung von Figuren<br />
zu überwinden, die gerade im Sterben<br />
auch physisch ungeheuer schön sein sollen.<br />
Bei all dem ist mir völlig klar, dass<br />
dadurch die Tatsache, sterben zu müssen,<br />
nicht <strong>auf</strong>gehoben werden kann.<br />
Was die Frage nach meinen eigenen<br />
letzten 24 Stunden angeht, so möchte<br />
ich zu Protokoll geben, dass dieser Frage<br />
etwas zutiefst Eitles innewohnt. Sie beruht<br />
<strong>auf</strong> der Annahme, man hätte, ganz<br />
selbstbestimmt, auch das eigene Sterben<br />
noch im Griff. Dem ist vermutlich nicht<br />
so. Und ich bin mir nicht sicher, ob man<br />
das bedauern sollte.<br />
Wie also sterben wollen? Möchte<br />
ich, dass mich wie bei Hofmannsthal<br />
der schöne stille Gott Hermes als Psychopompos<br />
in die Unterwelt geleitet? Oder<br />
soll ein Verkündigungsengel kommen,<br />
der mir eine große Sanduhr als Sinnbild<br />
dafür hinstellt, dass mein Leben nun un<strong>auf</strong>haltsam<br />
verrinnt?<br />
Meine immer etwas vorlaute Ratio<br />
sagt mir jedoch: Vermutlich kommt eine<br />
ganz andere weiße Figur. Ein Arzt, der<br />
mir mitteilt, dass mir am Ende meiner<br />
Krankheit nicht mehr viel Zeit bleibe. Ich<br />
hoffe, er wird mir als Meister seines Faches<br />
dann so viel Morphium geben, dass<br />
mir große Schmerzen erspart bleiben.<br />
Sollte es aber tatsächlich so sein,<br />
dass ich in meinen letzten 24 Stunden<br />
im Vollbesitz meiner Kräfte wäre,<br />
dann würde ich einen Flug nach Rom<br />
buchen und mich zusammen mit Frau<br />
und Tochter noch einmal im Pantheon<br />
vor Raffaels Grab stellen, noch einmal<br />
in Sant’Agostino Caravaggios „Madonna<br />
der Pilger“ anschauen, um dann nach einem<br />
Gang zur Cestius-Pyramide dort mit<br />
Goethe sagen zu können: „Dulde mich,<br />
Jupiter, hier, und Hermes führe mich später,<br />
Cestius’ Mal vorbei, leise zum Orkus<br />
hinab.“ All das wäre natürlich schön.<br />
Aber auch viel zu pathetisch. Sosehr ich<br />
Pathos als Kunstmittel schätze, im eigenen<br />
Leben neige ich nicht dazu.<br />
Dennoch wäre es freundlich, wenn<br />
der Tod im Frühling käme, gegen Abend,<br />
und mir noch Zeit ließe, mit den Worten<br />
eines Alten <strong>auf</strong> den Lippen, „Untergehend<br />
sogar ist’s immer dieselbige<br />
Sonne“, zu sterben. Vielleicht habe ich<br />
vorher noch die Kraft, mich hinzusetzen<br />
und ein Selbstporträt zu zeichnen. Um so<br />
für mich zu untersuchen, wie nicht nur<br />
das hypothetische, sondern das konkrete<br />
Wissen um den nahen Tod sich <strong>auf</strong> meinem<br />
Gesicht niederschlägt. Das wäre<br />
dann wohl der klassische Malertod.<br />
Von allen Mythen ist mir der Ariadne-Mythos<br />
beinahe der liebste. Darin<br />
sehnt sich die von Theseus verlassene<br />
Ariadne nach dem Tod. Sie erwartet Hermes<br />
als erlösenden Seelenführer. Doch<br />
als ein Gott kommt und Ariadne sich<br />
prompt in ihn verliebt, muss sie schließlich<br />
feststellen, dass er nicht der erhoffte<br />
Hermes ist, sondern Dionysos. Also das<br />
absolute Gegenteil. Denn Dionysos verkörpert<br />
die Entgrenzung, das Leben.<br />
In diesem Sinne durch den und im Tod<br />
verwandelt zu werden: Das wäre für<br />
mich eine wunderbare Hoffnung. Aber<br />
schmerzfrei zu sterben, wäre wohl mein<br />
größter Wunsch.<br />
Aufgezeichnet von INGO LANGNER<br />
136<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
Foto: Christoph Busse für <strong>Cicero</strong><br />
137<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
POSTSCRIPTUM<br />
N°-3<br />
SARRAZIN<br />
Thilo Sarrazin hat ein neues Buch geschrieben,<br />
weil er sich geärgert hat.<br />
Diesmal gewissermaßen in eigener Sache,<br />
denn den ehemaligen Berliner Finanzsenator<br />
wurmt es offensichtlich immer noch<br />
ganz gewaltig, dass insbesondere<br />
„Deutschland schafft sich ab“ von vielen<br />
Medien kritisiert wurde ( was, nebenbei<br />
gesagt, den außergewöhnlichen Erfolg<br />
dieses Werkes überhaupt erst ermöglicht<br />
haben dürfte ). Kurzum: Sarrazin sieht sich<br />
als Opfer einer medialen Diffamierungskampagne<br />
– oder, um seine eigene, titelgebende<br />
Wortwahl zu gebrauchen, als Opfer<br />
eines „neuen Tugendterrors“.<br />
Wer sind diese neuartigen Tugendterroristen?<br />
Das sind vor allem jene, die ihre<br />
Macht dazu missbrauchen, um Sarrazin<br />
fertigzumachen, indem sie – mit welchen<br />
Argumenten auch immer – Kritik an seinen<br />
Thesen üben. Also Journalisten. Ihnen<br />
wirft Thilo Sarrazin vor, seine Schriften<br />
entweder nicht gelesen oder nicht verstanden<br />
oder absichtlich missverstanden zu<br />
haben. „Ich glaube, dass aktuell eine<br />
herrschsüchtige, ideologisierte Medienklasse<br />
ganz informell und ohne großen<br />
Plan zusammenwirkt mit einer opportunistischen<br />
und geistig recht wenig profilierten<br />
Politikerklasse“, heißt es in seinem Buch.<br />
Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert.<br />
Erstens macht sich Sarrazin mit einem<br />
solchen Satz eine Methode zu eigen, die er<br />
ausgerechnet seinen Gegnern stets vorhält,<br />
nämlich das Fällen von empirisch nicht<br />
unterfütterten Pauschalurteilen. Und<br />
zweitens zitiert er ständig irgendwelche<br />
Passagen aus Zeitungen und Magazinen,<br />
die genau das bestätigen, was Sarrazin<br />
denkt. Ein Medienkomplott stellt man sich<br />
wahrlich anders vor, aber egal.<br />
Wichtiger ist die Frage, warum die<br />
Tugendterroristen in den Medien einen<br />
solch unbändigen Hass gegen Thilo<br />
Sarrazin hegen. Ganz einfach: Weil sie<br />
alle politisch links der Mitte stehen und<br />
als Linke dem Kult der Gleichmacherei<br />
frönen. Dies wiederum aus Neid: „90 <br />
Prozent der Medienberichte über Ungerechtig<br />
keiten der Einkommens- und<br />
Vermögensverteilung oder das Fehlverhalten<br />
sogenannter Reicher sind Ausfluss<br />
von Neid“, schreibt Sarrazin allen Ernstes.<br />
Dass diese Zahl der blanke Unfug ist,<br />
liegt <strong>auf</strong> der Hand, denn wie will man so<br />
etwas je messen? Damit schürt Sarrazin<br />
vielmehr den Verdacht, es mit der Empirie<br />
auch sonst nicht allzu genau zu nehmen.<br />
Er dekonstruiert sich also selbst.<br />
„Der neue Tugendterror“ will Ressentiments<br />
entlarven, doch dies gelingt vor<br />
allem in Bezug <strong>auf</strong> den Autor selbst. Vielleicht<br />
war das in dem Fall unvermeidlich.<br />
Schade ist es trotzdem.<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur<br />
von <strong>Cicero</strong><br />
DIE NÄCHSTE CICERO-AUSGABE ERSCHEINT AM 27. MÄRZ<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
138<br />
<strong>Cicero</strong> – 3. 2014
NEU<br />
Jetzt auch als App<br />
für iPad, Android<br />
sowie für PC/Mac.<br />
Hier testen:<br />
spiegel-geschichte.<br />
de/digital<br />
ATHOS Die Mönche vom heiligen Berg<br />
EROBERUNG Der Siegeszug der Osmanen<br />
RAVENNA Die Pracht byzantinischer Mosaiken<br />
www.spiegel-geschichte.de