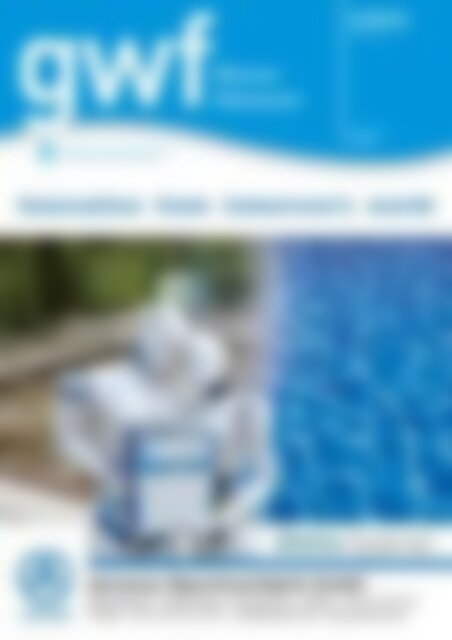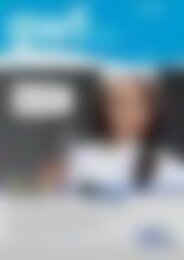gwf Wasser/Abwasser Wasserversorgung (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3/2012<br />
Jahrgang 153<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Innovation from tomorrow’s world<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH<br />
Reherweg 28 . 31855 Aerzen / Deutschland . Telefon: + 49 / 51 54 / 8 10<br />
Telefax: + 49 / 51 54 / 81 91 91 . info@aerzener.de . www.aerzener.de
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> + <strong>gwf</strong> Gas Erdgas<br />
im Kombi-Bezug<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlosklassische<br />
Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium fü r Computer,<br />
Tablet-PC oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere<br />
Aboplus-Kombination ideal zum<br />
Lesen und zum Archivieren<br />
+<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> und <strong>gwf</strong> Gas Erdgas erscheinen in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 Mü nchen<br />
Oldenbourg-Industrieverlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bin clever und bestelle fü r ein Jahr die Fachmagazine <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> und <strong>gwf</strong> Gas Erdgas<br />
(jeweils 12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug<br />
□ als Heft fü r € 510,- zzgl. Versand (Deutschland: € 60,- / Ausland: € 70,-)<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) fü r € 510,-<br />
□ als Heft + ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) fü r € 723,- (Deutschland) / € 733,- (Ausland)<br />
Vorzugspreis fü r Schü ler und Studenten (gegen Nachweis)<br />
□ als Heft fü r € 255,- zzgl. Versand (Deutschland: € 60,- / Ausland: € 70,-)<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) fü r € 255,-<br />
□ als Heft + ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) fü r € 391,50,- (Deutschland) / € 401,50 (Ausland)<br />
Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen vor Bezugsjahresende kü ndige, verlängert sich der Bezug um ein Jahr.<br />
Die sichere, pü nktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,-<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>gwf</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW0112<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>gwf</strong>, Franz-Horn-Str. 2, 97082 Wü rzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante, fachspezifi sche Medien- und Informations angebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann<br />
ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen
Standpunkt<br />
Entscheidungsfähigkeit der Kommunen<br />
bei <strong>Wasser</strong> erhalten<br />
Die <strong>Wasser</strong>versorgung in Deutschland<br />
ist seit jeher ein bedeutender Bestandteil<br />
der Daseinsvorsorge und damit<br />
eine Aufgabe mit großem Gemeinwohlbezug.<br />
Die sichere und qualitativ hochwertige Versorgung<br />
von Haushalten, Handwerk, Gewerbe<br />
und Industrie ist ohne Wenn und Aber viel zu<br />
wichtig, um sie ordnungspolitischen Experimenten<br />
mit ungewissem Ausgang und fragwürdigen<br />
Folgen auszusetzen.<br />
Genau so ein ordnungspolitisches Experiment<br />
hat allerdings die Europäische Kommission<br />
im Dezember 2011 gestartet, als sie<br />
einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie zu Konzessionsvergaben<br />
vorlegte. Der Richtlinien-<br />
Entwurf soll ein eigenes Vergaberecht für<br />
Konzessionen beinhalten. Der Wirtschaftsausschuss<br />
des Deutschen Bundestages hat sich<br />
Anfang Februar 2012 zu diesem Vorhaben<br />
positioniert und damit ein wichtiges Signal an<br />
Bundesregierung und Europäische Kommission<br />
gesendet: Bei einer EU-weiten Ausschreibung<br />
sei zu befürchten, so der Wirtschaftsausschuss,<br />
dass der hohe und europaweit führende<br />
Qualitätsstandard des Trinkwassers in<br />
Deutschland zum Nachteil der Verbraucher<br />
signifikant sinkt. Der Ausschuss hat die Bundesregierung<br />
deshalb in einem Entschließungsantrag<br />
gebeten, bei den Verhandlungen<br />
in Brüssel den besonderen Belangen der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft angemessen Rechnung zu<br />
tragen.<br />
Warum sehen <strong>Wasser</strong>wirtschaft und die<br />
Politik in Deutschland das Vorhaben der Europäischen<br />
Kommission so kritisch?<br />
Im Kern geht es darum, ob die Städte und<br />
Gemeinden so wie bisher auch über die Vergabe<br />
der Dienstleistungskonzessionen bei<br />
<strong>Wasser</strong> entscheiden können. Die aktuellen<br />
Pläne der Kommission würden dagegen die<br />
Handlungsfreiheit der Kommunen einschränken<br />
und damit Artikel 28 des Grundgesetzes<br />
verletzen. Zusammen mit dem Europäischen<br />
Parlament und dem Bundesrat sind wir der<br />
Ansicht, dass die Initiative der Kommission<br />
nicht notwendig ist. Die bestehenden Regelungen<br />
sind vollkommen ausreichend.<br />
Der Vorschlag der Kommission würde aus<br />
Sicht des BDEW zu erheblich verschärften<br />
Regelungen für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
führen. Die meisten im Zusammenhang mit<br />
der Trinkwasserversorgung zu beschaffenden<br />
Leistungen würden entweder in den Anwendungsbereich<br />
der Konzessionsrichtlinie fallen<br />
oder als Dienstleistungsaufträge nach dem<br />
noch strengeren Vergaberecht der EU-Vergaberichtlinien<br />
behandelt werden. Weitergehende<br />
EU-rechtliche Vorgaben würden<br />
aber nicht zu einem Mehr an Rechtssicherheit,<br />
sondern allenfalls zu einer Verrechtlichung<br />
der Dienstleistungskonzessionen führen. Das<br />
würde zu einer unangemessenen Einschränkung<br />
organisatorischer Handlungsspielräume<br />
der Kommunen führen, die sich in der Vergangenheit<br />
bewährt haben. Hier muss die kommunale<br />
Gestaltungsfreiheit in ihrer jetzigen<br />
Form erhalten bleiben.<br />
Der hohe und europaweit führende Qualitätsstandard<br />
in Deutschland ist das Resultat<br />
dieser kommunal abgesicherten, gleichwohl<br />
strukturell vielseitigen <strong>Wasser</strong>versorgung und<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung. Die Brüsseler Politik<br />
sollte alles dafür tun, diesen Standard zu<br />
erhalten, statt ihn mit ordnungspolitischen<br />
Experimenten in Frage zu stellen.<br />
Wulf Abke<br />
Geschäftsführer der Hessenwasser GmbH<br />
und Vizepräsident <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> des<br />
Bundesverbandes der Energie- und<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft (BDEW)<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 221
INhalt<br />
Auf der 10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftlichen Jahrestagung vom<br />
07. bis 08. November 2011 in Berlin diskutierten Vertreter<br />
aus Politik und <strong>Wasser</strong>wirtschaft über mögliche Wege in<br />
eine zukunftsfähige <strong>Wasser</strong>wirtschaft. Ab Seite 290<br />
Wie der Nachweis über geringe Messunsicherheit<br />
bei einem Prüfstand für Kaltwasserzähler erbracht wird,<br />
lesen Sie ab Seite 278<br />
Fachberichte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
278 M. Kestner<br />
Moderner Kaltwasserzähler-Prüfstand<br />
mit geringer Messunsicherheit<br />
Modern Test bench for Cold Water Meters<br />
with Small Measurement Uncertainty<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
284 S. Gonka und Th. Bruderhofer<br />
Präqualifikation und Bewertung<br />
von Dienstleistungsfirmen am<br />
Beispiel eines Energieversorgers<br />
Prequalification and Evaluation of Service Companies<br />
Using the Example of an Energy Provider<br />
Tagungsbericht<br />
290 Ch. Ziegler<br />
<strong>Wasser</strong>branche auf dem richtigen<br />
Weg? – Tagungsbericht zur 10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftlichen<br />
Jahrestagung<br />
The Water Sector on the Right Track?<br />
Praxis<br />
300 H. Stark<br />
Fokus<br />
Lebenszykluskosten in der<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung – Teil 1:<br />
Betriebs- und Instandhaltungskosten<br />
minimieren durch optimale<br />
Pumpenkonfiguration<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
226 Nachhaltige <strong>Abwasser</strong>reinigung in der<br />
Teeproduktion der Martin Bauer Group<br />
228 Ultrafiltrationsanlagen planen mit neuer<br />
UF-Projektierungs-Software<br />
229 Robuste Filtergeräte von Siemens –<br />
Trinkwasser für Menschen weitab von<br />
Infrastruktur<br />
230 Mikrosiebung in der<br />
<strong>Abwasser</strong>aufbereitung – Optimierte<br />
Filtermedien für die Feinstfiltration<br />
232 Kläranlage mit MBR-Technik für<br />
Krankenhausabwasser<br />
234 DIBt-Zulassung für innovative<br />
Filtersubstratrinne<br />
236 Hauswasserfilter schnell montiert<br />
März 2012<br />
222 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Im Fokus: Filtration und Membrantechnik bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung und der<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung. Ab Seite 226<br />
Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen legt<br />
Fortsetzungsbericht „Reine Ruhr“ vor. Ab Seite 242<br />
Netzwerk Wissen<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
251 Der neue Studiengang „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“ an der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt<br />
252 Bei uns wird Employability wirklich gelebt<br />
– Prof. Dr.-Ing. Cziesla über den neuen<br />
Studiengang und die Wichtigkeit des<br />
Praxisbezugs<br />
254 Neue Wege betreten – mit Weitblick,<br />
Kreativität und dem Willen zur Veränderung<br />
256 Weit mehr als ein kleiner Ausflug in die<br />
Arbeitswelt – Spannende Perspektiven im<br />
Praxissemester „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“<br />
257 Vom Studenten zum Experten –<br />
Praxissemester bietet erste Einblicke<br />
in die Arbeitswelt<br />
258 Big City Life auf Chinesisch – Was gibt’s<br />
Neues an der Hochschule Hamm-Lippstadt?<br />
Der HSHL-Blog berichtet direkt vom Puls<br />
der Hochschule<br />
260 Weltoffen, anspruchsvoll – und nah dran an<br />
der Wirtschaft – Die Hochschule Hamm-<br />
Lippstadt stellt sich vor<br />
261 Wachstum, das die Zukunft bestimmt<br />
264 Felchenarten rücken genetisch zusammen<br />
– Seendüngung lässt Fischarten weiter<br />
verschwinden<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
238 Schmerzmittel belasten deutsche Gewässer<br />
– Jährlich mehrere hundert Tonnen an<br />
Arzneimitteln im <strong>Abwasser</strong><br />
240 SAUBER+ ist mehr als nur sauberes <strong>Wasser</strong> –<br />
Neues interdisziplinäres Projekt zur<br />
separaten Behandlung von Abwässern aus<br />
Einrichtungen des Gesundheitswesens<br />
241 VKU zur Revision der Liste prioritärer Stoffe<br />
im Bereich der <strong>Wasser</strong>politik<br />
242 Umweltministerium legt Fortsetzungsbericht<br />
„Reine Ruhr“ vor<br />
244 Studie zum neuen „<strong>Wasser</strong>cent“ in Sachsen-<br />
Anhalt zeigt Mehrwert und Schwächen<br />
245 EU-Kommissar Oettinger meint: Keine<br />
schärferen Gesetze zum Fracking nötig<br />
246 Goldener Kanaldeckel zum 10. Mal<br />
verliehen<br />
248 Private <strong>Abwasser</strong>leitungen auf Dichtheit<br />
überprüfen – <strong>Abwasser</strong>fachleute für<br />
einheitliche und klare Regelungen<br />
249 Sicherer Einbau von Kunststoffrohrsystemen<br />
– KRV legt Einbauanleitungen neu auf<br />
250 Alles strömt – die Gelsenwasser AG feiert<br />
125-jähriges Firmenjubiläum<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 223
INhalt<br />
Veranstaltungsempfehlungen<br />
2012<br />
ab Seite 266<br />
Netzwerk Wissen: Der neue Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
an der Hochschule Hamm-Lippstadt im Porträt. Ab Seite 251<br />
Veranstaltungen<br />
266 Premiere Live Lab – analytica 2012 entführt<br />
Besucher in die Welt des Labors<br />
267 UrbanTec im Jahresturnus: Zukunftsthema<br />
„Urbanisierung“ wird am Standort Köln<br />
weiter forciert<br />
268 Schulung zur dynamischen Simulation von<br />
<strong>Abwasser</strong>systemen mit SIMBA<br />
268 BARTHAUER on Tour – Deutschlandweite<br />
Vorstellung des Netzinformationssystem<br />
„BaSYS“<br />
269 Trink- und Badebeckenwasser:<br />
Toxische Desinfektions-Nebenprodukte<br />
unter Kontrolle?<br />
Leute<br />
270 Klaus R. Imhoff 80 Jahre<br />
270 Arnd Böhme zum 75. Geburtstag<br />
271 Neuer Abteilungsleiter in der<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
Recht und Regelwerk<br />
272 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
273 Ankündigung zur Fortschreibung des<br />
DVGW-Regelwerks<br />
273 DVGW-Zurückgezogene Regelwerke<br />
273 DWA – Vorhabensbeschreibung<br />
274 DWA – Neue Merkblätter erschienen<br />
275 RSV Merkblatt 6.2 Schachtsanierung<br />
im Gelbdruck veröffentlicht<br />
276 Neuer RSV-Arbeitskreis soll<br />
Standardleistungstexte erarbeiten<br />
Praxis<br />
306 Preis für innovativ durchgeführte Baumaßnahme<br />
in grabenloser Bauweise<br />
308 Sanierung eines Betonkanals mit GFK-<br />
Sonderprofilen – Insituform GmbH verbaut<br />
in Basel HOBAS NC Line Profile für<br />
eiförmigen Entlastungskanal<br />
Produkte und Verfahren<br />
310 Innovative, dreifach exzentrische Klappe für<br />
Anwendungen mit großen Nennweiten:<br />
RMI Dubex<br />
311 aimPort mobile: Ein GeoPortal für unterwgs<br />
312 AFRISO Druckmittler MD 52, MD 56 und<br />
MD 63 mit EHEDG Zertifikat<br />
312 Regelarmatur bleibt bei Fehler in aktueller<br />
Position – Mit „Fail in Place“ lassen sich<br />
digitale Stellungsregler 8049 auf Versorgungssicherheit<br />
abstimmen<br />
März 2012<br />
224 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe erneuern auf insgesamt<br />
4 km Länge die Anbindung der Rohwasserleitungen<br />
an das <strong>Wasser</strong>werk Berlin-Tiefwerder. Ab Seite 306<br />
313 Moderne Fernwartungstechnik<br />
in Kläranlagen – GO-Serie ermöglicht<br />
flexiblen Einsatz<br />
Information<br />
283, 305 Buchbesprechungen<br />
315 Impressum<br />
316 Termine<br />
Dieses Heft enthält folgende Beilagen:<br />
– Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg<br />
– pigadi GmbH, Berlin<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> im April 2012<br />
u. a. mit diesen Fachbeiträgen :<br />
Überprüfung einer dezentralen Meerwasserentsalzungsanlage<br />
nach dem Prinzip der<br />
Multi-Effekt-Destillaltion (MED) zur<br />
Trinkwasserproduktion<br />
Vergleich der Wirksamkeit natürlicher und<br />
synthetischer Flockungsmittel mit Blick auf<br />
das Düngemittelgesetz<br />
Auslegung von Hebeanlagen – Technik, Auslegung<br />
und Trends der europäischen Normung<br />
Erscheinungstermin: 20.04.2012<br />
Anzeigenschluss: 22.03.2012
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
Nachhaltige <strong>Abwasser</strong>reinigung in der<br />
Teeproduktion der Martin Bauer Group<br />
Aquantis liefert anaerobe Vorbehandlung und Membranbioreaktor<br />
Die Martin Bauer Group, weltweit führender Hersteller von Kräuter- und Früchtetees sowie Teeextrakten,<br />
investiert in eine umweltverträgliche und energieeffiziente <strong>Abwasser</strong>reinigung am Standort Vestenbergsgreuth<br />
in Mittelfranken. Die in der Produktion anfallenden Prozessabwässer sollen in einer neuen <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlage<br />
bis auf Direkteinleiterqualität gereinigt werden. Aquantis, ein Tochterunternehmen von Veolia<br />
Water Solutions & Technologies, hat den Auftrag für die verfahrenstechnischen Kernkomponenten anaerobe<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung sowie getauchte Ultrafiltration erhalten.<br />
Beim Teeproduzenten Martin Bauer wird eine <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
gebaut, die das <strong>Abwasser</strong> umweltverträglich<br />
reinigt und dabei energiereiches Biogas erzeugt.<br />
Die Martin Bauer Group ist<br />
Anbieter von Kräuter- und<br />
Früchtetees, Arzneitees, Schwarzund<br />
Grüntees, Aromen, Extrakten<br />
und phytopharmazeutischen Wirkstoffen.<br />
Das Portfolio umfasst mehr<br />
als 200 Rohstoffe, die zu hochwertigen<br />
pflanzlichen Produkten verarbeitet<br />
werden. Wesentliche Bedingungen<br />
für die Modernisierung der<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung waren für das<br />
Unternehmen eine hohe Ablaufqualität,<br />
eine optimierte Energieeffizienz<br />
und eine Minimierung von<br />
Umweltemissionen z. B. von CO 2 .<br />
Nach umfangreichen Pilotversuchen<br />
hatte sich eine anaerobe<br />
BIOBED®-Vorbehandlung, gefolgt<br />
von einem Membranbioreaktor,<br />
sowohl in betriebswirtschaftlicher<br />
als auch verfahrenstechnischer Hinsicht<br />
als optimale Lösung erwiesen.<br />
Der Bau der geplanten Großanlage,<br />
der in einer Kooperation mit dem<br />
<strong>Abwasser</strong>technikunternehmen KG-<br />
Nellingen und nach der Planung<br />
des Büros Dr. Resch und Partner<br />
erfolgt, soll 2012 abgeschlossen<br />
werden.<br />
Die anaerobe Stufe besteht aus<br />
einem vielfach bewährten BIOBED®-<br />
Reaktor sowie einem Biogas-System<br />
inkl. Gasspeicher und Entschwefelung.<br />
Das bei der Vorbehandlung<br />
produzierte Biogas wird in einem<br />
Blockheizkraftwerk (BHKW) bzw.<br />
einem Heizkessel genutzt. Somit<br />
wird aus dem <strong>Abwasser</strong> ein energiereicher<br />
Wertstoff gewonnen, der<br />
wesentlich zur Reduzierung der<br />
Betriebskosten und der CO 2 -Emissionen<br />
beiträgt. Nach der anaeroben<br />
Im BIOBED ® -Reaktor wird die anaerobe Vorbehandlung<br />
des <strong>Abwasser</strong>s umweltverträglich erfolgen.<br />
Zur Abtrennung der Biomasse wird ein Membranbioreaktor (MBR)<br />
eingesetzt.<br />
März 2012<br />
226 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Filtration und Membrantechnik<br />
FOKUS<br />
Vorbehandlung folgt als weitere<br />
Behandlungsstufe ein Membranbioreaktor<br />
(MBR). Hierbei handelt es<br />
sich um eine Kombination aus<br />
Belebtschlammverfahren und einer<br />
Ultrafiltrationsmembran. Dabei<br />
werden anstelle der klassischen<br />
Verfahren moderne Membranfiltrationen<br />
zur Abtrennung der Biomasse<br />
genutzt. Die Anordnung<br />
getauchter Unterdruck-Membranen<br />
erfolgt in einer externen Einheit mit<br />
einer Rezirkulation. Durch den MBR<br />
wird eine sehr hohe Ablaufqualität<br />
erreicht. Es erfolgt ein weitestgehender<br />
Keimrückhalt und das<br />
<strong>Abwasser</strong> wird hygienisiert. Ein<br />
Ablauf dieser Qualität kann sowohl<br />
direkt in Gewässer eingeleitet als<br />
auch zur Bewässerung oder innerbetrieblich<br />
als Prozesswasser<br />
genutzt werden.<br />
Kontakt:<br />
Aquantis GmbH,<br />
Dr. Martin Brockmann,<br />
Lise-Meitner-Straße 4a,<br />
D-40878 Ratingen,<br />
Tel. (02102) 99754-0,<br />
Fax (02102) 99754-89,<br />
E-Mail: aquantis@veoliawater.com,<br />
www.vws-aquantis.com<br />
DUKTILE GUSSROHRSYSTEME<br />
mit längskraftschlüssiger BLS®/VRS®-T-Steckmuffenverbindung.<br />
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.duktus.com<br />
Besuchen Sie uns auf der IFAT in Halle A1, Stand 333!<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 227
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
Ultrafiltrationsanlagen planen mit neuer<br />
UF-Projektierungs-Software<br />
Die für Ultrafiltrationstechnologien bekannte deutsche inge GmbH – als hundertprozentige Tochter zum Water-<br />
Solutions-Geschäft der BASF gehörend – bringt neben ihren selbst entwickelten und produzierten Ultrafiltrationsmodulen<br />
und -membranen nun auch eine Software-Innovation auf den Markt: Mit „inge System Design“,<br />
einer im Hause inge entwickelten Projektierungs-Software, lassen sich UF-Anlagen schnell und professionell<br />
planen.<br />
Die Auslegung von Ultrafiltrationssystemen<br />
wird dank der<br />
neuen, von der inge GmbH entwickelten<br />
Projektierungs-Software<br />
„inge System Design“ künftig<br />
wesentlich leichter: Nach der Eingabe<br />
von Basisdaten wie <strong>Wasser</strong>typ,<br />
<strong>Wasser</strong>qualität und Aufbereitungskapazität<br />
erhält der Nutzer in nur<br />
wenigen Schritten eine Standardauslegung.<br />
Die Spezifizierung<br />
erfolgt durch Anpassung weiterer<br />
Parameter, wie z. B. Anzahl der<br />
Racks, Filtrationsflux, Filtrations-<br />
und Rückspülzeiten etc. In verschiedenen<br />
Betriebsszenarien können<br />
Varianten durchgespielt und damit<br />
eine optimale Auslegung gefunden<br />
werden.<br />
Das neue Programm von inge<br />
bietet den Kunden einige Leistungsmerkmale,<br />
die es heute auf dem<br />
Markt so noch nicht gibt: So lassen<br />
sich beispielsweise die Einsatzmenge<br />
von Chemikalien sowie der<br />
Energieverbrauch berechnen; das<br />
Dosierpumpendesign kann auf die<br />
<strong>Wasser</strong>qualität und den gewünschten<br />
Ziel-pH-Wert abgestimmt werden.<br />
Dabei ist es möglich, das System<br />
flexibel an die individuellen<br />
Anforderungen anzupassen. Die<br />
Programmierung in Visual Basic und<br />
die Nutzerfreundlichkeit machen<br />
die Software zu einem idealen<br />
Werkzeug für die Projektauslegung<br />
und im Anlagenbau.<br />
Weitere Informationen & Software<br />
Download unter: www.inge.<br />
ag/index.php?section=software&pi<br />
c=produkte<br />
Kontakt:<br />
inge GmbH,<br />
Flurstraße 27,<br />
D-86926 Greifenberg,<br />
Tel. (08192) 997-700,<br />
Fax (08192) 997-999,<br />
E-Mail: info@inge.ag,<br />
www.inge.ag<br />
UF-Projektierungs-Software „inge System Design“.<br />
Weitere Informationen zur Geschäftseinheit<br />
Water Solutions unter<br />
www.watersolutions.basf.com<br />
(englischsprachig)<br />
Über die inge GmbH<br />
Die inge GmbH mit Sitz in Greifenberg am Ammersee (Bayern) beschäftigt über 80 Mitarbeiter und ist ein weltweit führender<br />
Technologieanbieter für Ultrafiltrationstechnologie, einem Membranverfahren zur Aufbereitung von Trink-, Prozess-, Ab- und<br />
Meerwasser.<br />
Das Unternehmen ist weltweit direkt oder über Partner aktiv und hat zahlreiche Referenzprojekte rund um den Globus mit<br />
seiner Technologie ausgerüstet. Seit August 2011 ist die inge Teil der BASF, dem weltweit führenden Chemie-Unternehmen.<br />
Das Produktspektrum umfasst leistungsfähige Ultrafiltrationsmodule und kostengünstige, platzsparende Rack-Konstruktionen<br />
als Kernkomponenten einer <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage sowie technische Unterstützung des Kunden.<br />
Alle Produkte basieren auf der selbstentwickelten, patentgeschützten Multibore ® Membran-Technologie und entsprechen<br />
höchstem Qualitätsstandard „Made in Germany“. Die extrem kleinporigen Filter der Multibore ® Membran halten neben Partikeln<br />
selbst Mikroorganismen wie Bakterien und Viren zuverlässig zurück und sorgen so für sauberes <strong>Wasser</strong>. Gegenüber herkömmlichen<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsverfahren bietet der Einsatz der inge-Technologie viele Vorteile: Die Membranen sind extrem<br />
belastbar und stabil, die Module sind schnell und leicht einzubauen. Die <strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlage kann dadurch einfach<br />
geplant, kostengünstig installiert und betrieben werden. Dabei ist eine dauerhafte Zuverlässigkeit garantiert.<br />
März 2012<br />
228 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Filtration und Membrantechnik<br />
FOKUS<br />
Trinkwasser für Menschen weitab von Infrastruktur<br />
Robuste Filtergeräte von Siemens<br />
erzeugen Trinkwasser in Slums<br />
oder an Orten ohne Infrastruktur.<br />
Der Skyhydrant nutzt modernste<br />
Filtermembranen, braucht weder<br />
Strom noch Chemikalien und ist<br />
einfach zu bedienen. Das etwa eineinhalb<br />
Meter hohe und zwölf Kilo<br />
schwere Gerät kostet 3500 US-Dollar<br />
und reinigt jeden Tag 10 000 Liter<br />
<strong>Wasser</strong>. Wie die aktuelle Ausgabe<br />
der Zeitschrift „Pictures of the<br />
Future“ berichtet, gibt es inzwischen<br />
ein vollautomatisches Nachfolgegerät.<br />
Der 7000 US-Dollar teure<br />
AquaVendor basiert ebenfalls auf<br />
Membranfiltern, kann jedoch 25 000<br />
Liter <strong>Wasser</strong> pro Tag aufbereiten. Er<br />
braucht Strom für seine Steuerungseinheit<br />
und den Lüfter, der zur Reinigung<br />
alle 20 bis 30 Minuten Luft<br />
in den Membranfilter presst. Die<br />
mobile Anlage ist für Wohngebäude,<br />
Hotels oder kleine Industriebetriebe<br />
in strukturschwachen<br />
Gebieten gedacht.<br />
Weltweit haben rund 900 Millionen<br />
Menschen keinen Zugang zu<br />
sauberem <strong>Wasser</strong>. Laut Weltgesundheitsorganisation<br />
sterben pro Jahr<br />
etwa 1,8 Millionen von ihnen an<br />
Durchfall. Ohne Zugang zu Trinkwasser<br />
sind die Menschen oft krank,<br />
brauchen teure Medikamente und<br />
verpassen unzählige Arbeits- oder<br />
Schultage. Ingenieure von Siemens<br />
Water Technologies in Australien<br />
haben mit dem Skyhydranten eine<br />
Lösung entwickelt, mit der Laien<br />
praktisch überall verschmutztes<br />
<strong>Wasser</strong> reinigen können. Er basiert<br />
auf denselben High-Tech-Membranfiltern,<br />
die Siemens in Anlagen<br />
für <strong>Wasser</strong>werke oder für die Industrie<br />
einsetzt. Herzstück des Filters ist<br />
ein senkrecht hängender Zylinder,<br />
der rund 10 000, etwa einen Meter<br />
lange, millimeterdünne Röhrchen<br />
mit Membranwänden enthält. Die<br />
Löcher der Membranen sind ein<br />
zehntausendstel Millimeter klein<br />
und lassen weder Schwebstoffe<br />
noch Bakterien durch. Auch Viren<br />
werden ausgefiltert, weil sie immer<br />
an anderen, größeren Organismen<br />
hängen. Während die schmutzige<br />
Flüssigkeit entlang der Außenseiten<br />
der Röhrchen nach unten läuft, wird<br />
das saubere <strong>Wasser</strong> durch die Membran<br />
in die Röhrchen gedrückt und<br />
abgeleitet. Einmal im Monat wird<br />
der Skyhydrant zur Reinigung mit<br />
klarem <strong>Wasser</strong> rückgespült. In<br />
einem Slum im indonesischen<br />
Jakarta beliefert ein Skyhydrant 180<br />
Familien seit vier Jahren zuverlässig<br />
mit sauberem <strong>Wasser</strong>. Die Siemens<br />
Stiftung baute in einem Dorf in<br />
Kenia mit Skyhydranten sogenannte<br />
Safe-Water-Kioske auf. Die<br />
Kioskbetreiber reinigen das schmutzige<br />
Flusswasser und verkaufen<br />
Trinkwasser an die Dorfbewohner.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.siemens.com/water<br />
Der Skyhydrant nutzt modernste Filtermembranen.<br />
Wir lüften den Vorhang für die neue<br />
TORNADO ® Drehkolbenpumpe<br />
Kommen Sie auf<br />
unseren Stand zur<br />
7.–11. Mai 2012, Messe München<br />
Halle A6 – Stand 145/244<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 229
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
Mikrosiebung in der <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Optimierte Filtermedien für die Feinstfiltration<br />
Von Hans Schlebusch<br />
Steigende Anforderungen an Kapazität, Reinigungsleistung sowie Kosten- und Energieeffizienz kennzeichnen<br />
die Situation der Kläranlagen weltweit. Eine Folge ist die wachsende Nachfrage nach mechanischer <strong>Abwasser</strong>reinigung.<br />
Gängige Filterapparate für diese Anwendung sind Scheibenfilter. Ob zur nachgeschalteten Filtration<br />
von Rohabwasser, zur Aufbereitung von Kreislauf- oder Brauchwasser für die Industrie oder im Rahmen der<br />
Trinkwassergewinnung zur Vorfiltration vor der Membranabscheidung: Unabdingbare Voraussetzung für einen<br />
störungsfreien Betrieb ist die zuverlässige Abscheidung von Feinstpartikeln. Die Größe der abzuscheidenden<br />
Partikel und der verbleibende Feststoffgehalt stellen dabei Betreiber und Anlagenhersteller vor immer höhere<br />
Herausforderungen. Viele Anwendungen erfordern Abscheideraten bis zu einem Bereich von 10 μm. Optimierte<br />
Tressen (ODW) der GKD – Gebr. Kufferath AG gewinnen hier zunehmend an Bedeutung. Mit diesen<br />
Medien zur Oberflächenfiltration bietet der Hersteller technischer Gewebe aus Metallen und anderen verwebbaren<br />
Materialien einen vielfach bewährten Schlüssel zu deutlich verbesserter Ablaufqualität und Effizienz<br />
von Kläranlagen.<br />
Scheibenfilter zur Mikro siebung.<br />
Eingebaute ODW 10μm Filterelemente.<br />
Anspruchsvolle Vorgaben<br />
Mechanische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
mit Abscheidung von Feinstpartikeln,<br />
auch Mikrosiebung genannt,<br />
trägt dazu bei, die Ablaufqualität<br />
von Kläranlagen deutlich zu verbessern.<br />
Nachgeschaltete Ultrafiltrationsanlagen<br />
bleiben so beispielsweise<br />
nahezu feststofffrei und<br />
geklärte Abwässer können ohne<br />
weitere Aufbereitung zur Bewässerung<br />
von Feldern oder Grünanlagen<br />
genutzt werden. Die eingesetzten<br />
Scheibenfilter reinigen auch sehr<br />
große <strong>Abwasser</strong>mengen schnell<br />
und wirtschaftlich. Sie laufen kontinuierlich<br />
und mit integrierter Rückspülung.<br />
Besondere Herausforderung<br />
an die Filteranlagen ist die<br />
in diesen Anwendungen typischen<br />
Eigenschaft der Schmutzpartikel,<br />
einen kompressiblen Filterkuchen<br />
zu bilden. Der Einsatz höherer Drücke<br />
ist daher in dieser Filtration<br />
praktisch nicht möglich.<br />
„Treibende Kraft“ der Filtration<br />
ist daher nur der hydrostatische<br />
Druck innerhalb der Anlagen,<br />
wodurch die zur Verfügung stehende<br />
Energie gering ist. Zur Erreichung<br />
der erforderlichen Durchsatzmengen<br />
sind auf Grund der<br />
begrenzten Filterfläche Filtermedien<br />
gefragt, die die benötigten<br />
Feinheiten von 10 μm mit hohen<br />
Durchsatzleistungen und Standzeiten<br />
kombinieren. Gleichzeitig<br />
müssen sie gut zu reinigen sein und<br />
dürfen nicht verstopfen. Die regelmäßige<br />
Rückspülung erfordert eine<br />
dauerhafte mechanische Robustheit<br />
des Filtermediums. Entscheidend<br />
für seine Effizienz sind jedoch<br />
genaue, definierte Trenngrenzen. In<br />
der Praxis zeigt sich, dass diese Vorgabe<br />
gerade im Bereich der Feinstfiltration<br />
< 50 μm keineswegs von<br />
allen am Markt verfügbaren Filtermedien<br />
erfüllt wird.<br />
Überlegene Eigenschaften<br />
Optimierte Tressen (ODW) von GKD<br />
erfüllen alle diese speziellen Anforderungen<br />
und werden deshalb auf<br />
zahlreichen Scheibenfiltern in der<br />
<strong>Abwasser</strong>filtration eingesetzt. Basis<br />
für ihre Leistungsfähigkeit ist die<br />
besondere Konstruktion der Edelstahlgewebe.<br />
Die schlitzartigen<br />
Porengeometrien an der Gewebeoberfläche<br />
sind kleiner als die Poren<br />
im Gewebeinneren, so dass Partikel<br />
der geforderten Trenngrenze komplett<br />
abgeschieden werden. Kleinere<br />
Partikel hingegen passieren<br />
die größeren inneren Poren problemlos,<br />
ohne diese zu verstopfen.<br />
Das bedingt die gute Schmutzaufnahmekapazität<br />
der optimierten<br />
Tressen.<br />
Die eingesetzte Webtechnik<br />
gewährleistet, dass die spezifische<br />
Gewebegeometrie sehr präzise und<br />
jederzeit reproduzierbar ist. Dadurch<br />
werden die Erwartungen an Trenngrenzen<br />
und -schärfe in der Mikro-<br />
März 2012<br />
230 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Filtration und Membrantechnik<br />
FOKUS<br />
siebung dauerhaft erfüllt. Diese<br />
Präzision bei Rückhaltegrad und<br />
Porengeometrie sowie die geringe<br />
Neigung zur Verblockung machen<br />
die optimierten Tressen deshalb<br />
auch gegenüber Kunststoffgeweben<br />
in der Mikrosiebung weit<br />
überlegen. Die an der Oberfläche<br />
abgeschiedenen Partikel lassen sich<br />
im Regenerationszyklus einfach<br />
entfernen und sichern so einen<br />
langen, problemlosen Betrieb des<br />
Scheibenfilters. Erheblich höher als<br />
bei anderen Filtermedien dieser<br />
Feinheit sind zudem die Durchsatzleistung<br />
und die Schmutzaufnahmekapazität<br />
der optimierten Tressen.<br />
Diese hohe Permeabilität ist<br />
die Voraussetzung für ökonomisch<br />
sinnvolle Filterapparate bei den<br />
gegebenen Filterflächen. Die Gewebekonstruktion<br />
aus Edelstahl 1.4404<br />
gewährleistet neben Korrosionsbeständigkeit<br />
eine mechanische Festigkeit,<br />
die bei Filtermedien mit vergleichbaren<br />
Durchsatzleistungen<br />
unerreicht ist. Das macht Filterbespannungen<br />
mit optimierten<br />
Tressen auch im Langzeitbetrieb<br />
deutlich verlässlicher, effizienter<br />
und präziser als Kunststoffgewebe.<br />
Auf andere Anwendungen<br />
übertragbar<br />
Die Bandbreite des Leistungsspektrums<br />
qualifiziert optimierte Tressen<br />
nicht nur für den vielfach<br />
bewährten Einsatz auf Scheibenfiltern<br />
zur <strong>Abwasser</strong>aufbereitung.<br />
Analoge Anforderungen sind auch<br />
auf zahlreiche weitere Filterapparate<br />
übertragbar. Überall dort,<br />
wo feine, zuverlässige Filtermedien<br />
mit hoher Permeabilität und guten<br />
Rückspüleigenschaften gefragt sind,<br />
erschließen optimierte Tressen von<br />
GKD deshalb richtungweisende<br />
Möglichkeiten.<br />
Kontakt:<br />
GKD – Gebr. Kufferath AG,<br />
Metallweberstraße 46,<br />
D-52353 Düren<br />
Tel. (02421) 803-0,<br />
Fax (02421) 803-211,<br />
E-Mail: info@gkd.de,<br />
www.gkd.de<br />
Filter in der Kläranlage.<br />
ODW (Optimierte Fressen).<br />
Im Fokus:<br />
Erneuerbare Energien und<br />
Ressourcenschonung<br />
Der beste Treffpunkt für<br />
alle SHK-Profis.<br />
Entdecken Sie Lösungen, Produkte<br />
und Dienstleistungen der gesamten SHK-Branche.<br />
Planen Sie Ihren Besuch fest ein.<br />
Sie profitieren und werden begeistert sein.<br />
Jetzt online Ihr Ticket mit Preisvorteil sichern:<br />
www.ifh-intherm.de/profi<br />
18. – 21. April 2012<br />
Messezentrum Nürnberg<br />
IFH12_GG_Anzeige_GWF-<strong>Wasser</strong>-Abwasert_3-12_SHK_176x123mm.indd 1 17.02.2012 16:44:25
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
Kläranlage mit MBR-Technik für<br />
Krankenhausabwasser<br />
Bild 1. Modul Typ BC400.<br />
Bild 2. Schema<br />
der Anlage.<br />
In der <strong>Abwasser</strong>behandlung be -<br />
gegnet man heutzutage einer Vielzahl<br />
wirtschaftlicher und umweltbezogener<br />
Herausforderungen. Neben<br />
dem Streben nach Kosteneffizienz<br />
im globalen Umfeld erschweren<br />
auch immer stringenter werdende<br />
umweltpolitische Regularien die<br />
langfristige Existenz der Anlagen.<br />
Infolgedessen ist die MBR-Technologie<br />
mit ihrer hochwertigen Ab -<br />
laufqualität eine sehr willkommene<br />
Lösung für <strong>Abwasser</strong>anlagen speziell<br />
bei hochbelasteten Abwässern<br />
wie in Krankenhäusern. Die MBR Re -<br />
ferenz im Marienhospital in Gelsenkirchen<br />
stellt ein gutes Beispiel für<br />
eine <strong>Abwasser</strong>anlage dar, welche<br />
MBR aufgrund ihrer hohen <strong>Abwasser</strong>qualitätsanforderungen<br />
einsetzt.<br />
Im Juli 2011 wurde am Marienhospital<br />
Gelsenkirchen eine Kläranlage<br />
in Betrieb genommen, mit der<br />
Krankenhaus-Abwässer punktbezogen<br />
gereinigt und von Spurenstoffen<br />
befreit werden. Die Anlage ist im<br />
Rahmen des EU-Projekt „PILLS“<br />
(Pharmaceutical Input and Elimination<br />
from Local Sources) unter<br />
Federführung der Emschergenossenschaft<br />
gebaut worden.<br />
Das Ziel des Projektes ist es, Spurenstoffe<br />
im <strong>Abwasser</strong>, wie sie be -<br />
sonders in Krankenhäusern als<br />
Rückstände von Arzneimitteln und<br />
Röntgenkontrastmitteln anfallen,<br />
de zentral am Entstehungsort zu eliminieren.<br />
Im Marienhospital werden rund<br />
75 000 Patienten pro Jahr von etwa<br />
1200 Mitarbeitern versorgt. Dabei<br />
fallen rund 200 m³/d <strong>Abwasser</strong> an,<br />
die bisher über die städtische Kanalisation<br />
in den nahen Schwarzbach<br />
eingeleitet wurden. Dieser Bach<br />
fungiert derzeit noch als offener<br />
Schmutzwasserlauf, soll aber im<br />
Zuge des Umbaus des Emschersystems<br />
renaturiert und abwasserfrei<br />
betrieben werden. Er wird unter<br />
anderem dann auch das gereinigte<br />
<strong>Wasser</strong> aus der neuen Kläranlage<br />
aufnehmen.<br />
Die neue Kläranlage verfügt<br />
neben einer mechanischen und biologischen<br />
Klärung über weitere Reinigungsstufen<br />
wie eine Ultrafiltration<br />
mit getauchten Modulen, eine<br />
Ozonierung und eine Aktivkohlefiltration.<br />
Zur Ultrafiltration sind drei<br />
getauchte Module vom Typ BC400<br />
der Microdyn-Nadir GmbH installiert.<br />
Sie verfügen über insgesamt<br />
1200 m² Membranfläche, durch die<br />
das biologisch gereinigte <strong>Abwasser</strong><br />
aus dem Belebungsbecken abgezogen<br />
wird (Bild 1).<br />
Bild 2 zeigt die schematische<br />
Darstellung der Anlage.<br />
Die Ultrafiltration mit den BIO-<br />
CEL Modulen BC400 ist ausgelegt<br />
auf einen durchschnittlichen<br />
<strong>Abwasser</strong>zulauf von 202 m³/d. Der<br />
Maximale Zulauf beträgt 25 m³/h.<br />
Sind alle drei Straßen in Betrieb, so<br />
beträgt der Flux 20,8 L/(m²*h). Sollten<br />
nur zwei der drei Straßen in<br />
Betrieb sein, so beträgt der Auslegungsflux<br />
31,2 L/(m²*h). Der mittlere<br />
spezifische Filtrationsfluss liegt<br />
demnach zwischen 7,0 L/(m²*h)<br />
und 10,5 L/(m²*h) – je nach Betriebsbedingungen.<br />
In Schwachlastphasen<br />
können einzelne Filtrationsstraßen<br />
abgeschaltet werden. Da in den<br />
nicht betriebenen Straßen nicht nur<br />
die Filtration, sondern auch die feinblasige<br />
Belüftung gestoppt wird,<br />
kann so der Energieverbrauch drastisch<br />
reduziert werden.<br />
Die BC400 Module sind im Nitrifikationsbereich<br />
installiert.<br />
Das Permeat der Ultrafiltration,<br />
das frei von Partikeln und Bakterien<br />
ist, wird anschließend einer Ozonierung<br />
und einer Aktivkohlefiltration<br />
zugeführt. Ozon bewirkt als starkes<br />
Oxidationsmittel das Aufbrechen<br />
der gelösten Spurenstoffmoleküle<br />
und wandelt sie in unbedenkliche<br />
Stoffe um. Alternativ dazu werden<br />
Spurenschadstoffe an pulverisierter<br />
Aktivkohle adsorbiert, die dann mitsamt<br />
diesen Stoffen filtriert wird.<br />
Kontakt:<br />
MICRODYN-NADIR GmbH,<br />
Kalle Albert Industriepark,<br />
Rheingaustrasse 190-196,<br />
D-65203 Wiesbaden,<br />
E-Mail: info@microdyn-nadir.de,<br />
www.microdyn-nadir.de<br />
März 2012<br />
232 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Flüssigkeiten exakt analysieren.<br />
Einer für alle – alle für einen<br />
Endress+Hauser unterstützt die Prozesse seiner Kunden mit exzellenten Produkten und<br />
zukunftsweisenden Dienstleistungen und Lösungen. Der Multikanal-Messumformer<br />
Liquiline CM442/CM444/CM448 kann mit maximal acht Kanälen bis zu zwölf Parameter<br />
messen. Die digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll werden einfach angeschlossen,<br />
automatisch erkannt und liefern sofort verlässliche Werte, wobei die Messparameter<br />
während des Betriebs, ohne Neustart des Systems, gewechselt werden können.<br />
• Einheitliches Anschluss- und Softwarekonzept über alle Parameter hinweg<br />
• Kinderleichte Bedienung und Wartung für maximale Sicherheit<br />
• Bei Ausbau oder Anpassung werden die standardisierten Module automatisch erkannt<br />
und eingebunden<br />
• Memocheck Qualifizierungstool ermöglicht einfache Qualifizierung bzw. Überprüfung<br />
der Grenzwerte<br />
www.de.endress.com/liquiline-cm442<br />
Halle 11<br />
Stand C39<br />
Endress+Hauser<br />
Messtechnik GmbH+Co. KG<br />
Colmarer Straße 6<br />
79576 Weil am Rhein<br />
Telefon 0 800 EHVERTRIEB<br />
oder 0 800 348 37 87<br />
Telefax 0 800 EHFAXEN<br />
oder 0 800 343 29 36
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
DIBt-Zulassung für innovative Filtersubstratrinne<br />
Drainfix Clean sorgt für Nachhaltigkeit bei der Niederschlagswasserbehandlung<br />
Das Deutsche Institut für Bautechnik<br />
DIBt hat Hauraton für<br />
die neuartige Filtersubstratrinne<br />
Drainfix Clean die allgemeine bauaufsichtliche<br />
Zulassung erteilt.<br />
Damit steht das innovative Entwässerungssystem<br />
jetzt bei allen deutschen<br />
Bauvorhaben ohne jeweilige<br />
Einzelprüfung zur Verfügung.<br />
Ökologisch: Reinigen plus<br />
Versickern vor Ort<br />
Wirkungsvolle Lösungen für die Niederschlagsreinigung<br />
von Schadstoffen<br />
vor Ort sowie die anschließende<br />
Versickerung, wie es der Gesetzgeber<br />
im <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz (WHG)<br />
empfiehlt, sind bisher rar gesät.<br />
„Diese Lücke füllt die neuartige Filtersubstratrinne<br />
Drainfix Clean“, sagt<br />
Dr. Bernd Schiller, Leiter Forschung<br />
und Entwicklung des Rastatter<br />
Experten für Entwässerungstechnik.<br />
Das belastete Regenwasser wird<br />
zunächst von der definierten Verkehrsfläche<br />
in eine Entwässerungsrinne<br />
gesammelt und läuft dann<br />
durch ein speziell für diese Anwendung<br />
entwickeltes Filtersubstrat.<br />
„Dank der exzellenten Frost-Tausalz-Beständigkeit<br />
und seiner dauerhaften<br />
Strukturstabilität bleibt<br />
das Substrat über viele Jahre hoch<br />
wirksam. So können weit über 90 %<br />
der im Regenabfluss enthaltenen<br />
Schadstoffe langfristig und sicher<br />
zurückgehalten werden. Wartungsarbeiten<br />
fallen in der Regel erst<br />
nach über 20 Jahren an“, erläutert<br />
Schiller. Anschließend wird das von<br />
den Schadstoffen befreite Regenwasser<br />
am Boden der Rinne durch<br />
ein Drainagerohr zur Versickerungsanlage<br />
geleitet.<br />
Nachhaltige Niederschlagsbehandlung mit DRAIN-<br />
FIX CLEAN: Simulationsansicht der Filtersubstratrinne<br />
aus faserbewehrtem Beton, dem Filtersubstrat<br />
Carbotec 60 und dem Drainagerohr aus Kunststoff.<br />
Die innovative Filtersubstratrinne DRAINFIX CLEAN<br />
passt sich optisch der Flächengestaltung an. Bei der<br />
Errichtung einer klimafreundlichen Passivhaussiedlung<br />
im badischen Walldorf wurde sie in die gepflasterten<br />
Gehwege integriert.<br />
Info<br />
Das Rastatter Unternehmen HAURATON ist seit fast 60 Jahren erfolgreich<br />
auf dem Markt. Mit heute weltweit 17 Niederlassungen und Vertrieb<br />
in über 50 Länder gehört HAURATON zu den Marktführern auf<br />
dem Gebiet der Entwässerungs- und Versickerungssysteme. In den<br />
vier Leistungsbereichen Tiefbau, Galabau, Aquabau und Sportbau bietet<br />
HAURATON über 1200 verschiedene Produkte an, wobei das Sortiment<br />
kontinuierlich ausgebaut wird. Mit der Einführung der Kunststoffrinnen<br />
und des SIDE-LOCK-Arretierungssystems sowie einem<br />
individualisierten Katalog im Internet gilt HAURATON als Innovationsführer<br />
der Branche. Auf der Referenzliste stehen internationale<br />
Projekte wie der Formel 1 Kurs in Abu Dhabi, der Heathrow Airport<br />
und das Fußballstadion des FC Arsenal in London, das Mercedes-<br />
Benz Museum in Stuttgart oder der neue Berliner Hauptbahnhof.<br />
Mit der Filtersubstratrinne DRAINFIX CLEAN werden<br />
Regen- und Schmutzwasser effektiv gereinigt.<br />
Die Rinnen bieten aufgrund ihrer Größe ausreichend<br />
Rückstaureserve, um große <strong>Wasser</strong>mengen aufzunehmen.<br />
In Walldorf wurde das Substrat während<br />
der Bauphase für zusätzlichen Schutz mit einem<br />
Geotextil abgedeckt.<br />
Querschnittansicht des Rinnenkörpers beim Einbau der<br />
Filtersubstratrinne DRAINFIX CLEAN auf einer Zufahrtsstraße zur<br />
klimafreundlichen Passivhaussiedlung im badischen Walldorf.<br />
März 2012<br />
234 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Filtration und Membrantechnik<br />
FOKUS<br />
Die Versickerungsrigolen werden eingebaut. Der tonige Boden im<br />
badischen Walldorf – ein Trinkwasserschutzgebiet der Schutzzone 3 –<br />
stellt erschwerte Bedingungen an das Entwässerungs- und<br />
Reinigungssystem. DRAINFIX CLEAN meistert die geo logischen<br />
Herausforderungen und erfüllt höchste ökologische Anforderungen. <br />
Überzeugende<br />
wissen schaftliche Tests<br />
Drainfix Clean ist das Ergebnis ausführlicher<br />
wissenschaftlicher Tests<br />
in einer süddeutschen Versuchsanlage<br />
unter denkbar schweren Bedingungen.<br />
Deren Auswertung war so<br />
überzeugend, dass die badische<br />
Gemeinde Walldorf sich beim Entwässerungssystem<br />
für ein Neubaugebiet<br />
im Süden der Stadt bereits<br />
für den Einbau der innovativen Filtersubstratrinne<br />
entschieden hatte,<br />
ohne dass die DIBt-Zulassung vorlag.<br />
Ob Parkplätze, Hofflächen,<br />
Gewerbegebiete oder stark befahrene<br />
Straßen: Mit der jetzt erteilten<br />
bauaufsichtlichen Zulassung können<br />
Planer und Entscheider im<br />
gesamten Bundesgebiet sicher sein,<br />
dass mit Drainfix Clean ein optimal<br />
wirksames, robustes System für die<br />
naturnahe Regenwasser-Bewirtschaftung<br />
bereitsteht.<br />
Kontakt:<br />
HAURATON GmbH & Co. KG,<br />
Werkstraße 13,<br />
D-76437 Rastatt,<br />
Tel. (07222) 958-0,<br />
Fax (07222) 958-100,<br />
E-Mail: info@hauraton.com,<br />
www.hauraton.com<br />
Aushebung des Retentionsraumes. Nach der<br />
Rei nigung des Regenwassers in der Filtersubstratrinne<br />
DRAINFIX CLEAN wird es im Rigolensystem<br />
(DRAINFIX BLOC) gesammelt, zurückgehalten und<br />
kann nach und nach versickern. Das Baugelände<br />
befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet der<br />
Schutzzone 3.<br />
Trinkwasserbehälter<br />
In bewährter Wiedemanntechnik sanieren wir jedes Jahr nahezu<br />
100 Trinkwasserbehälter, seit 1947, Jahr für Jahr.<br />
Von der Zustandsanalyse, Beratung und Ausarbeitung des<br />
Sanierungs kon zeptes bis zur fix und fertigen Ausführung.<br />
Abdichtung<br />
Betoninstandsetzung<br />
Rissinjektion<br />
Stahlkorrosionsschutz<br />
Statische Verstärkung -CFK-Lamellen-<br />
Vergelung<br />
Spritzbeton / Spritzmörtel<br />
Mineralische Beschichtung<br />
Unsere Fachleuchte sind für Sie da, rufen Sie an!<br />
Maßgeschneidertes, weiches<br />
<strong>Wasser</strong> wird Wirklichkeit !<br />
Die erste und einzige, intelligente,<br />
vollautomatische Enthärtungsanlage<br />
— weltweit !<br />
• Intelligent: konstant<br />
weiches <strong>Wasser</strong> – rund<br />
um die Uhr<br />
• Individuell: Wunschwasser<br />
per Knopfdruck<br />
• Hygienisch: stagnationsfreie<br />
Betriebszustände,<br />
automatischer Desinfektionsprozess<br />
Zentrale<br />
65189 Wiesbaden<br />
Weidenbornstr. 7-9<br />
Tel. 0611/7908-0<br />
Fax 0611/761185<br />
Niederlassung<br />
01159 Dresden<br />
Ebertplatz 7-9<br />
Tel. 0651/42441-0<br />
Fax 0351/42441-11<br />
WIEDEMANN<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.wiedemann-gmbh.com<br />
Zertifiziert nach<br />
DIN EN ISO 9001:2008<br />
seit 1947<br />
judo.eu<br />
Mit innovativen Anlagen zur Filtration,<br />
Enthärtung, Entsalzung<br />
und Dosierung von Trinkwasser<br />
ist JUDO immer einen Schritt<br />
voraus – seit über 75 Jahren.<br />
JUDO <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Postfach 380 · D-71351 Winnenden<br />
Tel. 0 18 05 - 6 92- 0 01* · e-mail: info@judo.eu<br />
*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend<br />
Instandsetzung und Schutz von Betonbauwerken<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 235<br />
ANZ_i_soft_123x86_sw_version3.indd 1 23.02.12 15:53
Fokus<br />
Filtration und Membrantechnik<br />
Hauswasserfilter schnell montiert<br />
Wenige Sekunden dauert der<br />
Vorgang – schon sind die<br />
neuen Trinkwasserschutzfilter der<br />
Keimschutzklasse montiert. Ab<br />
sofort genügt eine einzige<br />
Schraube, um den PROFI-QC und<br />
den PROMI-QC sicher an dem<br />
Flansch zu befestigen. Ein großes<br />
Plus an Komfort für die Filterreihe<br />
von JUDO <strong>Wasser</strong>aufbereitung, die<br />
bisher bereits für ihr patentiertes<br />
Blitzschnelle Montage durch die neue QUICK CON-<br />
NECTION-Anschlusstechnik mit nur einer Schraube.<br />
Silbersieb und dessen punktuelle<br />
Abreinigung bekannt ist.<br />
Revolutionär an dieser neuen<br />
Anschlusstechnik von JUDO ist<br />
nicht nur, dass lediglich eine<br />
Schraube benötigt wird, sondern<br />
auch, dass diese von der Gehäusevorderseite<br />
aus angezogen wird.<br />
Die Montage erfolgt besonders<br />
bequem und extrem schnell: Einfach<br />
den Filter an den bewährten<br />
JUDO QUICKSET Einbau-Drehflansch<br />
mit Bajonett-Anschluss setzen,<br />
ausrichten, die Schraube mit<br />
einem Innensechskant-Schlüssel<br />
anziehen – schon fertig! Die QC-Filter<br />
der Keimschutzklasse passen<br />
übrigens auch an alle bereits montierten<br />
JUDO QUICKSET-E mit Bajonettanschluss<br />
(3/4“ – 1 1/4“).<br />
Damit ist die bisher übliche<br />
Anschlusstechnik überholt, bei der<br />
vier Schrauben mühsam von der<br />
Rückseite aus festgezogen wurden.<br />
Doch auch aus einem anderen<br />
Grund überzeugen die Rückspül-<br />
Schutzfilter der Keimschutzklasse –<br />
und das schon seit Jahren: Ein<br />
patentierter, versilberter Dauerfilter-Siebeinsatz<br />
aus Edelstahl<br />
sorgt für eine optimale Keimschutz-Prophylaxe.<br />
Dieses Silbersieb<br />
ist im EU-Land Spanien schon<br />
Pflicht – das spanische Gesundheitsministerium<br />
schreibt die Verwendung<br />
per Gesetz vor!<br />
Rückspül-Schutzfilter und<br />
Hauswasserstation<br />
Die Filter der JUDO Keimschutzklasse<br />
gibt es in unterschiedlichen<br />
Ausführungen: den zuverlässigen<br />
Rückspül-Schutzfilter JUDO PROFI-<br />
QC mit Nachdruck- und Temperaturanzeige<br />
sowie die PROMI-QC Hauswasserstation,<br />
die neben der Filtration<br />
auch den <strong>Wasser</strong>druck reguliert<br />
und Rückfluss in das öffentliche<br />
Netz verhindert. Damit ist der<br />
zusätzliche Einbau eines Rückflussverhinderers<br />
überflüssig. Zusätzlich<br />
können am PROMI-QC Vor- und<br />
Nachdruck abgelesen werden.<br />
PROMI- und PROFI-QC gibt es<br />
jeweils auch als Automatik-Version<br />
mit komfortabler Rückspülautomatik.<br />
Bequemer geht es nicht: Der<br />
Zeitpunkt der Rückspülung wird<br />
optional über eine Zeitvorgabe<br />
oder – technisch optimal – automatisch<br />
über den Verschmutzungsgrad<br />
ermittelt und ausgelöst.<br />
Effektive Abreinigung<br />
nach dem JUDO Punkt-<br />
Rotations-System<br />
In den Filtern der Keimschutzklasse<br />
fließt das <strong>Wasser</strong> von außen nach<br />
innen – alle grob- und feinkörnigen<br />
Verunreinigungen werden zurückgehalten.<br />
Der Grad der Verschmutzung<br />
kann von außen durch das<br />
Schauglas kontrolliert werden.<br />
Alle zwei Monate reinigt der<br />
Hausbesitzer den Siebeinsatz mit<br />
wenigen Handgriffen nach dem<br />
JUDO Punkt-Rotations-System.<br />
Dabei wird Punkt für Punkt die Sieboberfläche<br />
durch Rückspülung<br />
(Spülung im Gegenstrom) mit filtriertem<br />
<strong>Wasser</strong> gereinigt, ohne<br />
dass die <strong>Wasser</strong>versorgung unterbrochen<br />
wird.<br />
JUDO <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
JUDO wurde vor 75 Jahren in<br />
Deutschland gegründet und agiert<br />
heute weltweit. Als Pionier der Was-<br />
Die Hauswasserstation JUDO PROMI-QC (links) und<br />
den Rückspül-Schutzfilter JUDO PROFI-QC (rechts)<br />
gibt es jeweils auch als Automatik-Version sowie<br />
optional mit Leckageschutz PRO-SAFE.<br />
JUDO Punkt-Rotations-System: effektive Reinigung mit filtriertem <strong>Wasser</strong>.<br />
März 2012<br />
236 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Filtration und Membrantechnik<br />
FOKUS<br />
seraufbereitung bietet JUDO mit<br />
zahlreichen Innovationen immer<br />
wieder neue Perspektiven für den<br />
verantwortungsvollen Einsatz von<br />
<strong>Wasser</strong> in der Haus- und Gebäudetechnik.<br />
Das Unternehmen entwickelt<br />
Anlagen und Produkte zur Filtration,<br />
Enthärtung, Entsalzung und<br />
Dosierung von Trinkwasser – für<br />
eine optimale Trinkwasserhygiene,<br />
Heizungswasserbehandlung und<br />
für die Schwimmbadtechnik.<br />
Kontakt:<br />
JUDO <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH,<br />
Postfach 380,<br />
D-71351 Winnenden,<br />
Tel. (07195) 692-0, Fax (07195) 692-110,<br />
E-Mail: info@judo.eu, www.judo.eu<br />
<strong>Wasser</strong>_de_140x195_2c.qxp 10.02.2012 10:12 Uhr Seite 1<br />
Einfach integriert<br />
Integrierte Systeme von Festo machen es Ihnen<br />
einfacher. Alles passt, Sie sparen Zeit bei<br />
Planung und Bau. Im Betrieb sind sie zuverlässig,<br />
energieeffizient und kostensparend. Besuchen<br />
Sie uns auf der IFAT 2012 – es lohnt sich!<br />
07. – 11. Mai 2012<br />
München<br />
Halle A4, Stand 335/434<br />
www.festo.de/wasser<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 237
Nachrichten<br />
Branche<br />
Schmerzmittel belasten deutsche Gewässer<br />
Jährlich mehrere hundert Tonnen an Arzneimitteln im <strong>Abwasser</strong><br />
In deutschen Gewässern und Böden lassen sich Arzneimittelrückstände mittlerweile immer häufiger nachweisen.<br />
Das belegen aktuelle Daten aus Forschungsprojekten und der Gewässerüberwachung. Jeden Tag<br />
gelangen mehrere Tonnen an Arzneimittelwirkstoffen in die Umwelt, hauptsächlich durch die menschliche<br />
Ausscheidung, mehrere hundert Tonnen pro Jahr zusätzlich durch die unsachgemäße Entsorgung von Altmedikamenten<br />
über die Toilette. Wie sich diese Substanzen auf die Umwelt auswirken, wird derzeit nicht<br />
systematisch untersucht. Diese Lücke muss nach Auffassung des Umweltbundesamtes (UBA) ein zulassungsbegleitendes<br />
Umweltmonitoring schließen. „Die Vorsorge beim Umgang mit Arzneimittelrückständen muss<br />
verbessert werden, denn diese Stoffe können problematisch für die Umwelt sein. Eine bessere Überwachung<br />
soll helfen, Belastungsschwerpunkte und ökologische Auswirkungen von Medikamenten zu erkennen und die<br />
medizi nische Versorgung umweltverträglicher zu gestalten.“, erklärt UBA-Präsident Jochen Flasbarth.<br />
© Andrea Damm/<br />
pixelio.de<br />
Vorkommen und Auswirkungen<br />
von Arzneimitteln in der<br />
Umwelt werden nach Meinung des<br />
Umweltbundesamtes unterschätzt.<br />
Wegen des demografischen Wandels<br />
unserer Gesellschaft wird die<br />
Konzentration von Humanarzneimitteln<br />
in der Umwelt vermutlich<br />
noch weiter zunehmen. Jochen<br />
Flasbarth: „Das UBA empfiehlt<br />
daher, ein Umweltmonitoring für<br />
Arzneimittel einzuführen. Es soll<br />
bereits im Zulassungsprozess für<br />
Medikamente verankert werden.<br />
Dadurch kann der Schutz der<br />
Umwelt gestärkt und die Versorgung<br />
der Patienten umweltverträglicher<br />
gestaltet werden.“<br />
Eine aktuelle Literaturstudie, die<br />
im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
durchgeführt wurde, führt<br />
die aus Umweltsicht besonders problematischen<br />
Arzneimittel auf. Die<br />
Studie enthält Daten zu Verhalten<br />
und Vorkommen von Arzneimitteln<br />
in der Umwelt, priorisiert nach Verbrauchsmenge,<br />
Umweltkonzentration<br />
und umweltschädigendem<br />
Potenzial. Von den 156 in Deutschland<br />
in verschiedenen Umweltmedien<br />
nachgewiesenen Arzneimittelwirkstoffen<br />
wurden 24 mit hoher<br />
Priorität eingestuft. Das bedeutet,<br />
dass diese Stoffe ein hohes Potenzial<br />
haben, Umweltorganismen zu<br />
schädigen. Einer dieser Wirkstoffe<br />
ist das weit verbreitete Schmerzmittel<br />
„Diclofenac“, welches Nierenschäden<br />
in Fischen hervorrufen<br />
kann und mittlerweile in sehr vielen<br />
Gewässern zu finden ist. Es steht<br />
deshalb auch auf der EU-Kandidatenliste<br />
für neue sogenannte prioritäre<br />
Stoffe zur EG-<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie.<br />
Arzneimittel gelangen hauptsächlich<br />
mit dem häuslichen <strong>Abwasser</strong><br />
in die Umwelt. Die meisten<br />
Stoffe werden nach der Einnahme –<br />
oft unverändert – wieder ausgeschieden.<br />
Schätzungsweise mehrere<br />
hundert Tonnen pro Jahr nicht<br />
verbrauchter Medikamente entsorgen<br />
viele Bürger unsachgemäß<br />
direkt über Spüle oder Toilette. Da<br />
viele Kläranlagen heute noch nicht<br />
in der Lage sind, alle Stoffe rückstandslos<br />
abzubauen oder zurückzuhalten,<br />
erreicht der Rest, wenn<br />
auch stark verdünnt, die Flüsse und<br />
kann dort besonders empfindliche<br />
Organismen wie Fische dauerhaft<br />
schädigen. Um gezielt Minderungsmaßnahmen<br />
bei der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
in Kläranlagen ergreifen zu<br />
können, muss die Belastungssituation<br />
mit solchen Problemsubstanzen<br />
jetzt identifiziert werden.<br />
Selbst im Trinkwasser können<br />
sehr geringe Konzentrationen enthalten<br />
sein. Pro Liter <strong>Wasser</strong> handelt<br />
es sich dabei um Bruchteile von<br />
Mikrogramm. Zur Demonstration:<br />
Ein Mikrogramm pro Liter entspricht<br />
etwa der Zuckerkonzentration in<br />
einem 50-m-Schwimmbecken, in<br />
dem ein Stück Würfelzucker aufgelöst<br />
wurde. Trinkwasserhygienisch<br />
sind diese Arzneimittelspuren zwar<br />
März 2012<br />
238 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
unerwünscht, für den Menschen<br />
besteht dadurch aber keine<br />
Gesundheitsgefahr. Alle jetzt zu<br />
treffenden Maßnahmen zum Schutz<br />
des Trinkwassers dienen deshalb<br />
der Vorsorge und langfristigen Versorgungssicherheit,<br />
nicht der<br />
Abwehr konkreter Risiken.<br />
Weitere Informationen<br />
und Links<br />
Die Prüfung der Umweltwirkungen<br />
von Arzneimitteln ist EU-weit fester<br />
Bestandteil der Zulassungsverfahren.<br />
In Deutschland ist das<br />
Umweltbundesamt seit 1998 für die<br />
Umwelt risikobewertung von Humanund<br />
Tierarzneimitteln zuständig. Im<br />
Falle eines Umweltrisikos kann das<br />
Umweltbundesamt Auflagen zur<br />
Risikominderung erwirken oder bei<br />
Tierarzneimitteln sogar die Zulassung<br />
verweigern. Die Umweltrisikobewertung<br />
bei der Zulassung<br />
beruht u. a. auf berechneten Um -<br />
weltkonzentrationen. Ein systematisches<br />
Monitoring der tatsächlichen<br />
Umweltkonzentrationen gibt es bisher<br />
nicht. Das soll sich nach Wunsch<br />
des Umweltbundesamtes in Zu -<br />
kunft ändern. Ein an die Zulassung<br />
gekoppeltes Monitoring kann dazu<br />
beitragen, die tatsächlichen Um -<br />
weltkonzentrationen von als kritisch<br />
eingeschätzten Arzneimitteln<br />
zu bestimmen und das Umweltrisiko<br />
besser einzuschätzen.<br />
Gutachten „Zusammenstellung von<br />
Monitoringdaten zu Umweltkonzentrationen<br />
von Arzneimitteln“:<br />
http://www.uba.de/uba-info-medien/<br />
4188.html<br />
Ergebnisse des Workshops „Monitoring von<br />
Arzneimitteln in der Umwelt –<br />
Notwendigkeit, Erfahrungen und Perspektiven<br />
für die Arzneimittelzulassung“:<br />
http://www.umweltbundesamt.de/<br />
chemikalien/arzneimittel/workshop_<br />
monitoring_arzneimittel.htm<br />
Das Umweltbundesamt hat vor Kurzem eine<br />
Empfehlung für praktische Minderungsmaßnahmen<br />
zum Schutz des Trinkwassers<br />
herausgegeben, die bereits am Beginn der<br />
Verschmutzungskette ansetzen:<br />
http://www.umweltdaten.de/wasser/<br />
themen/trinkwasserkommission/<br />
massnahmeempfehlung_hamr.pdf<br />
Publikation des Umweltbundesamtes und<br />
des Instituts für Sozialökologie in Frankfurt/<br />
Main: Handlungsmöglichkeiten zur Minderung<br />
des Eintrags von Humanarzneimitteln<br />
und ihren Rückständen in das Roh- und<br />
Trinkwasser:<br />
http://www.umweltbundesamt.de/<br />
uba-info-medien/4024.html<br />
Breeze Druckrohrspülanlagen<br />
Mehr als nur gute Luft!<br />
Bei langen Aufenthaltszeiten von <strong>Abwasser</strong> in Druckleitungen müssen diese gezielt gespült<br />
werden. Ein Kompressor drückt Luft in die Leitung, um die Fließgeschwindigkeit des <strong>Abwasser</strong>s<br />
zu erhöhen und damit Ablagerungen zu lösen. Durch den Eintrag von Sauerstoff werden<br />
Fäulnisprozesse und Geruchsbildung vermindert.<br />
JUNG PUMPEN GmbH · 33803 Steinhagen · Tel. +49 (0)5204-170 · w ww.jung-pumpen.de
Nachrichten<br />
Branche<br />
SAUBER+ ist mehr als nur sauberes <strong>Wasser</strong><br />
Neues inter diszi plinäres Projekt zur separaten Behandlung von Abwässern<br />
aus Einrichtungen des Gesund heitswesens<br />
Es ist zu erwarten, dass der Arzneimittelverbrauch<br />
zunimmt,<br />
u. a. bedingt durch den demografischen<br />
Wandel. Dies führt zu einem<br />
Anstieg von Medikamentenrückständen<br />
in allen <strong>Abwasser</strong>strömen,<br />
insbesondere aus Einrichtungen<br />
des Gesundheitswesens, wie<br />
Krankenhäusern, Pflege heimen,<br />
Ärztehäusern etc. Sie gelangen<br />
daher zusehends in das Blickfeld der<br />
öffentlichen Wahr nehmung. Diese<br />
Abwässer enthalten zum einen<br />
pharmazeutische Wirkstoffe, die oft<br />
in konventionellen Kläranlagen nur<br />
unzureichend eliminiert werden<br />
und so im <strong>Wasser</strong> kreislauf verbleiben.<br />
Für viele solche Stoffe werden<br />
Wirkungen für Mensch und Umwelt<br />
vermutet bzw. wurden bereits<br />
nachgewiesen. Zum anderen sind<br />
im <strong>Abwasser</strong> aus Einrichtungen<br />
des Gesundheitswesens auch<br />
Krankheits erreger enthalten. Offene<br />
Fragen bestehen hinsichtlich der<br />
jeweiligen Wirkstoffmengen und<br />
der Inter aktionen dieser Erreger mit<br />
den im <strong>Abwasser</strong> enthaltenen Medikamentenrückständen,<br />
der Bildung<br />
von multiresistenten Keimen und<br />
der Reinigungsmöglichkeiten der<br />
entsprechenden Abwässer.<br />
Zur Untersuchung dieser Fragestellungen<br />
startete mit einer Auftaktveranstaltung<br />
am 17. Januar das<br />
Verbundprojekt „SAUBER+ – Innovative<br />
Konzepte und Technologien<br />
für die separate Behandlung von<br />
<strong>Abwasser</strong> aus Einrichtungen des<br />
Gesundheitswesens“. Das dreijährige<br />
Projekt unter der Leitung des<br />
Instituts für Siedlungswasserwirtschaft<br />
(ISA) der RWTH Aachen University<br />
(Prof. Johannes Pinnekamp)<br />
wird vom Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung im Rahmen<br />
der Fördermaßnahme RiSKWa „Risikomanagement<br />
von neuen Schadstoffen<br />
und Krankheitserregern im<br />
<strong>Wasser</strong>kreislauf“ mit rund 3 Millionen<br />
Euro gefördert.<br />
Zentrale Bausteine des Projekts<br />
SAUBER+ sind:<br />
""<br />
die transdisziplinäre Risikocharakteri<br />
sierung der <strong>Abwasser</strong>ströme<br />
aus Pflegeeinrichtungen,<br />
Senioren residenzen, Hospizen,<br />
Ärztehäusern und Kliniken für<br />
Mensch und Umwelt<br />
""<br />
die Untersuchung und Optimierung<br />
von Technologien zur Elimination<br />
von Medikamenten und<br />
Keimen aus diesen <strong>Abwasser</strong>strömen<br />
""<br />
sowie innovative Kommunikations-<br />
und Bil dungs maß nah men<br />
zur Verbreitung der Erkenntnisse<br />
und Sensibilisierung aller beteiligten<br />
Akteure (Ärzte, Apotheker,<br />
Pflegekräfte, Patienten, Angehörige,<br />
etc.).<br />
Als Ergebnisse werden einrichtungs-,<br />
einzugs gebiets- und zielgruppenspezifische<br />
Maßnahmen<br />
zur Vermeidung des Eintrags von<br />
pharmazeutischen Wirkstoffen und<br />
Krankheitserregern in die Umwelt<br />
anhand konkreter Anwendungsfälle<br />
entwickelt. Darauf aufbauend werden<br />
Empfehlungen für innovative<br />
Konzepte und Technologien für die<br />
sepa rate Behandlung von <strong>Abwasser</strong><br />
aus Ein richtungen des Gesundheitswesens<br />
und Veränderungen in der<br />
Organisation des Betriebs formuliert.<br />
Das interdisziplinäre Projektteam<br />
setzt sich aus Experten von<br />
sechs Forschungseinrichtungen<br />
und fünf Praxis partnern zusammen:<br />
Neben dem ISA arbeiten das Institut<br />
für Nachhaltige Chemie und<br />
Umweltchemie (INUC, Leuphana<br />
Universität Lüneburg) und das Institut<br />
für Umwelt medizin und Krankenhaushygiene<br />
(IUK, Universitätsklinikum<br />
Freiburg) aus dem naturwissen<br />
schaftlichen Bereich im<br />
Projekt. Die vorrangig sozialwissenschaftlich<br />
ausgerichteten Projektaufgaben<br />
werden vom ISOE-Institut<br />
für sozial-ökologische Forschung<br />
(Frankfurt am Main), dem Institut<br />
für Umweltkommunikation (INFU,<br />
Leuphana Universität Lüneburg)<br />
und der DIALOGIK gemein nützigen<br />
Gesellschaft für Kommunikationsund<br />
Kooperations forschung (Stuttgart)<br />
bearbeitet. Zu den Praxispartnern<br />
gehören die Emschergenossenschaft<br />
aus Essen, das Ortenau<br />
Klinikum sowie die Industrieunternehmen<br />
Carbon Services and<br />
Consulting GmbH (Vettweiß), Microdyn-Nadir<br />
GmbH (Wiesbaden)<br />
und UMEX GmbH (Dresden). Durch<br />
eine kontinuierliche Einbindung<br />
wichtiger Akteure aus Gesundheitswesen,<br />
Wissenschaft, Wirtschaft<br />
und Gesellschaft in das Verbundprojekt<br />
werden die Praktikabilität<br />
und Akzeptanz der entwickelten<br />
Lösungen sowie die Verbreitung der<br />
Projektergebnisse stark erhöht.<br />
Weitere Information:<br />
www.sauberplus.de<br />
März 2012<br />
240 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
VKU zur Revision der Liste<br />
prioritärer Stoffe im Bereich<br />
der <strong>Wasser</strong>politik<br />
Die Europäische Kommission hat im Januar 2012 die Revision<br />
der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der <strong>Wasser</strong>politik<br />
veröffentlicht. Ziel ist, die Liste an aktuelle wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse und wasserwirtschaftliche Erfordernisse an -<br />
zupassen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU)<br />
begrüßt die Überprüfung und die Aufnahme weiterer Stoffe,<br />
wenn diese relevant und die abgeleiteten Umweltqualitätsnormen<br />
hinreichend belastbar sind. „Die Verantwortung für die<br />
Sicherung der <strong>Wasser</strong>qualität darf jedoch nicht ausschließlich<br />
bei den <strong>Wasser</strong>ver- und <strong>Abwasser</strong>ent sorgern abgeladen<br />
werden“, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck.<br />
„Der vorsorgende Gewässerschutz und das Verur sacherprinzip<br />
müssen auf allen Ebenen und durch alle Verursacher sichergestellt<br />
werden, um das Einleiten prioritärer Stoffe an der<br />
Quelle zu beenden oder schrittweise einzustellen.“<br />
„<strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>beseitigung sind in<br />
Deutschland Kernaufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge“,<br />
so Reck. Dabei handelt es sich um Leistungen, die mit besonderen<br />
Gemeinwohl verpflichtungen verbunden sind und im Interesse<br />
der Allgemeinheit von kommunalen Unternehmen<br />
erbracht werden. „<strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>beseitigung<br />
sind daher in besonderem Maße auch dem Nachhaltigkeitsgedanken<br />
sowie dem Umweltschutz verpflichtet. Die<br />
Träger dieser Auf gaben nehmen auch Maßnahmen wahr, die<br />
dem Schutz der Gewässer und damit dem Schutz der lebensnotwendigen<br />
Ressource Trinkwasser dienen.“<br />
Die Liste der prioritären Stoffe wurde 2001 zunächst als<br />
Anhang in die <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie eingefügt. 2008 wurde sie<br />
durch die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen im Bereich der<br />
<strong>Wasser</strong>politik näher ausgestaltet. Ziel der Richt linie ist, das Einleiten<br />
besonders gefährlicher Stoffe – beispielsweise Industriechemikalien,<br />
Pflanzenschutzmittel oder Schwermetalle – in Oberflächengewässer<br />
schrittweise einzustellen oder zu beenden. Derzeit<br />
bestehen für 33 Sub stanzen Umweltqualitätsnormen.<br />
The World Filtration<br />
Congress 2012<br />
Lifts you up to a higher<br />
level of technology<br />
Weitere Informationen: www.vku.de<br />
© Rolf von Melis/pixelio.de<br />
Lift featured is the Schloßberg Lift in Graz<br />
11th World Filtration<br />
Congress & Exhibition<br />
April 16-20, 2012 · Graz · Austria<br />
www.wfc11.at
Nachrichten<br />
Branche<br />
Umweltministerium legt Fortsetzungsbericht<br />
„Reine Ruhr“ vor<br />
Maßnahmen gegen Mikroschadstoffe angekündigt<br />
Trinkwasserbrunnen<br />
im Ruhrtal<br />
bei Essen.<br />
© Simplicius<br />
Wikipedia<br />
Die Landesregierung will noch in<br />
diesem Jahr einen Masterplan<br />
<strong>Wasser</strong> vorlegen und damit intensiver<br />
gegen Belastungen von <strong>Wasser</strong><br />
mit Mikroschadstoffen vorgehen.<br />
„In den kommenden Jahren<br />
müssen wir unsere Anstrengungen<br />
in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft weiter<br />
intensivieren. Hierzu zählt neben<br />
der Umsetzung der EU-Was serrahmenricht<br />
linie auch die Erarbeitung<br />
eines ‚Masterplans <strong>Wasser</strong>’“,<br />
sagte NRW-Umweltminister Johannes<br />
Remmel. Eines der Ziele müsse<br />
es dabei sein, durch Beseitigung<br />
von Mikroschadstoffen eine umfassende<br />
Verbesserung der Gewässerqualität<br />
zu erreichen.<br />
Gerade der <strong>Wasser</strong>qualität entlang<br />
der Ruhr kommt dabei eine<br />
besondere Bedeutung zu. Denn die<br />
Ruhr ist Grundlage der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
für etwa fünf Millionen<br />
Menschen in NRW. Zu diesem<br />
Zweck wurde jetzt der Fortsetzungsbericht<br />
„Reine Ruhr“ vorgelegt.<br />
Remmel: „Mit der Fortschreibung<br />
des Berichts wird die Datengrundlage<br />
für die notwendigen<br />
Maßnahmen im Vorgehen gegen<br />
Mikroschadstoffe gelegt und ein<br />
technologischer Standard für die<br />
Aufbereitung von Trinkwasser nachweisbar.“<br />
Das Programm „Reine Ruhr“ startete<br />
im Juni 2008. Der nun vorliegende<br />
Statusbericht des Programms<br />
„Reine Ruhr“ beruht auf der<br />
gemeinsamen Arbeit der Expertenkommission<br />
„Reine Ruhr“, des<br />
Umweltministeriums und des Landesamtes<br />
für Natur, Umwelt und<br />
Verbraucherschutz (LANUV). Die<br />
Expertenkommission hat die Arbeiten<br />
zur Gestaltung und Umsetzung<br />
des Programms „Reine Ruhr“ wissenschaftlich<br />
begleitet und die entwickelte<br />
Strategie sowie die getroffenen<br />
und zu treffenden Maßnahmen<br />
unabhängig beurteilt. Der<br />
Statusbericht baut auf den Ergebnissen,<br />
die im ersten Zwischenbericht<br />
„Reine Ruhr“ (04/2009) enthalten<br />
sind, auf. Zielsetzung des Programms<br />
sind die Vermeidung und<br />
der weitgehende Rückhalt von<br />
Mikroschadstoffen. Die vorliegenden<br />
Erkenntnisse aus einer umfassenden<br />
Bestandsaufnahme und<br />
einer Reihe von durchgeführten<br />
wissenschaftlichen Untersuchungen<br />
zeigen, dass es eines Multi-Barrieren-Schutzes<br />
bedarf. Dazu gehören<br />
sowohl Maßnahmen zur Vermeidung<br />
und Maßnahmen zur<br />
Verminderung an der Quelle der<br />
Industrieeinleitung, zur Ertüchtigung<br />
kommunaler Kläranlagen<br />
sowie Maßnahmen bei der Trinkwasseraufbereitung.<br />
Auf der Basis<br />
der vorliegenden Erkenntnisse soll<br />
das Programm Reine Ruhr weiterentwickelt<br />
werden.<br />
„Der Eintrag anthropogener<br />
Spurenstoffe in die Umwelt nimmt<br />
weiter zu“, stellte Minister Remmel<br />
fest. So steige beispielsweise der<br />
März 2012<br />
242 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Arzneimittelkonsum, auch aufgrund<br />
einer älter werdenden Gesellschaft<br />
und des medizinischen Fortschritts<br />
kontinuierlich. Die teilweise<br />
allgegenwärtige Verwendung dieser<br />
Mikroschadstoffe führe so zu<br />
nachweisbaren Belastungen der<br />
Gewässer.<br />
Anthropogene Spurenstoffe<br />
sind organische Schadstoffe wie<br />
Human- und Tierpharmaka, Industriechemikalien,<br />
Körperpflegemittel,<br />
Waschmittelinhaltsstoffe, Nahrungsmittelzusatzstoffe,<br />
Additive in<br />
der <strong>Abwasser</strong>- und Klärschlammbehandlung,<br />
Pflanzenbehandlungsund<br />
Schädlingsbekämpfungsmittel<br />
sowie Futterzusatzstoffe. Der Rat<br />
von Sachverständigen für Umweltfragen<br />
hat rund 5000 Substanzen<br />
als potenziell umweltrelevant eingestuft.<br />
Die europäische Chemikalienagentur<br />
hat 2010 den Nachweis<br />
über den Einsatz von mehr als 400<br />
gesundheitsgefährdenden, krebserregenden<br />
Chemikalien in verschiedenen<br />
Produkten erbracht.<br />
Wie das Expertengremium für<br />
den Bericht „Reine Ruhr“ bestätigte,<br />
gilt für die überwiegende Mehrzahl<br />
von Mikroschadstoffen, dass sie<br />
einer allgegenwärtigen Verwendung<br />
unterliegen und auch über<br />
kommunale Kläranlagen in die<br />
Gewässer eingetragen werden. Die<br />
Ertüchtigung der kommunalen Kläranlagen<br />
stellt deshalb eine effiziente<br />
Methode dar, die Verunreinigung<br />
von Gewässer mit Mikroschadstoffen<br />
zu reduzieren. Erste<br />
Erfahrungen mit den beiden Eliminationstechnologien<br />
Aktivkohle<br />
und Ozonierung von auf freiwilliger<br />
Basis ertüchtigten Anlagen in NRW<br />
liegen vor. Anhand der Ergebnisse<br />
können nun Kosten- und Gebührenbelastungen<br />
abgeschätzt und die<br />
Verhältnismäßigkeit entsprechender<br />
Maßnahmen dokumentiert<br />
werden.<br />
Zur Beseitigung von Mikroschadstoffen<br />
hat sich in den vergangenen<br />
Jahrzehnten in Deutschland<br />
das Multi-Barrieren-System etabliert,<br />
bestehend aus dem vorrangigen<br />
Schutz der Ressource vor Ver-<br />
unreinigungen und der an die Rohwasserverhältnisse<br />
angepassten<br />
Trinkwasseraufbereitung bewährt.<br />
Das Ministerium wird daher in Kürze<br />
Gespräche mit Bezirksregierungen,<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern und Kommunen<br />
starten.<br />
Auch für Steig- und Fallrohr:<br />
HYDRUS misst smarter.<br />
Ab Sommer 2012 ist HYDRUS als Kurzbaulänge lieferbar für<br />
den Einbau in Steig- und Fallrohren – wahlweise in Nenngröße<br />
DN 25, 32, 40 oder 50. Mit dem erweiterten Sortiment<br />
gibt es den passenden Ultraschall-<strong>Wasser</strong>zähler für<br />
jede Anforderung. Für höchste Präzision im Dynamikbereich<br />
bis 1:400, zugelassen nach MID.<br />
Die innovative Kombination von Ultraschall und integrierter<br />
Kommunikation macht HYDRUS zur perfekten Datenbasis<br />
für Systemtechnik und Smart Metering.<br />
HYDRUS – der smarte Ultraschall-<strong>Wasser</strong>zähler.<br />
Weitere Informationen unter: www.hydrometer.de<br />
Besuchen Sie uns auf der IFAT / Stand 416<br />
Weitere Informationen zum Thema „<strong>Wasser</strong><br />
und wassergefährdende Stoffe“ sowie der<br />
Bericht „Vom Programm ‚Reine Ruhr’ zur<br />
Strategie einer nachhaltigen Verbesserung<br />
der Gewässer- und Trinkwasserqualität in<br />
Nordrhein-Westfalen“ sind zu finden unter<br />
www.umwelt.nrw.de<br />
I_<strong>gwf</strong>_HYDRUS_Steig Fallrohr.indd 1 20.02.2012 09:37:46<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 243
Nachrichten<br />
Branche<br />
Studie zum neuen „<strong>Wasser</strong>cent“ in Sachsen-Anhalt<br />
zeigt Mehrwert und Schwächen<br />
Tilo Arnhold<br />
Das neue <strong>Wasser</strong>entnahmeentgelt in Sachsen-Anhalt fügt sich sinnvoll in die Klimaanpassungsstrategie des<br />
Landes ein und ist ein finanzpolitisch richtiger Schritt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung<br />
des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), die das neue Instrument auf den Prüfstand gestellt hat.<br />
Kritisch sehen die Wissenschaftler dagegen, dass beim sogenannten <strong>Wasser</strong>cent nach Verwendungszweck<br />
unterschieden wird und umfangreiche Ausnahmen gelten. Da <strong>Wasser</strong>entnahmeabgaben in die Kompetenz der<br />
Länder fallen, existieren in der Mehrzahl der Bundesländer sehr unterschiedliche Regelungen. Künftig sei es<br />
jedoch wichtig, diese bundesweit anzugleichen.<br />
Die UFZ-Forscher hatten bereits<br />
2011 im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
eine Studie über die<br />
Chancen und Grenzen von <strong>Wasser</strong>nutzungsabgaben<br />
in Deutschland<br />
vorgelegt. Die aktuelle Untersuchung<br />
zu Sachsen-Anhalt wird im<br />
März 2012 in der Fachzeitschrift<br />
„<strong>Wasser</strong> und Abfall“ erscheinen.<br />
Sachsen-Anhalt hat zum Jahresbeginn<br />
als zwölftes Bundesland<br />
eine Abgabe auf das Entnehmen<br />
von <strong>Wasser</strong> aus dem natürlichen<br />
<strong>Wasser</strong>haushalt eingeführt. Neben<br />
der Erzielung von Einnahmen, die<br />
zweckgebunden für wasserwirtschaftliche<br />
Zwecke eingesetzt werden,<br />
verfolgen diese Entgelte auch<br />
Sachsen-Anhalt hat zum Jahresbeginn als zwölftes<br />
Bundesland eine Abgabe auf das Entnehmen<br />
von <strong>Wasser</strong> aus dem natürlichen <strong>Wasser</strong>haushalt<br />
eingeführt. Neben der Erzielung von Einnahmen, die<br />
zweckgebunden für wasserwirtschaftliche Zwecke<br />
eingesetzt werden, verfolgen diese Entgelte auch das<br />
Ziel, Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften.<br />
© André Künzelmann/UFZ<br />
das Ziel, Gewässer nachhaltig zu<br />
bewirtschaften: Nach dem Vorsorgeprinzip<br />
soll auf effiziente Weise<br />
verhindert werden, dass <strong>Wasser</strong>körper<br />
nicht übernutzt werden. „Vorsorgend<br />
sparsam und effizient mit<br />
unseren <strong>Wasser</strong>ressourcen umzugehen,<br />
ist nicht zuletzt angesichts des<br />
bereits offensichtlichen Klimawandels<br />
in der Region ein ressourcenund<br />
klimapolitisches Gebot der Vernunft“,<br />
erläutert Prof. Erik Gawel,<br />
Umweltökonom an der Universität<br />
Leipzig und zudem <strong>Wasser</strong>experte<br />
am UFZ. Bereits jetzt besteht in einigen<br />
Landesteilen eine negative klimatische<br />
<strong>Wasser</strong>bilanz, die sich weiter<br />
verschlechtern wird.<br />
<strong>Wasser</strong>entnahmeentgelte signalisieren<br />
den Entnehmern von <strong>Wasser</strong><br />
aus dem natürlichen <strong>Wasser</strong>kreislauf<br />
– sowie den Käufern wasserintensiver<br />
Produkte –, dass Roh wasser<br />
ein ökonomisch knappes Gut ist.<br />
Dies drückt sich etwa im sogenannten<br />
<strong>Wasser</strong>stress der Ökosysteme<br />
aus und darf nicht mit „<strong>Wasser</strong>mangel“<br />
verwechselt werden. „Auch an<br />
Mobiltelefonen oder Brot herrscht<br />
in Deutschland gewiss kein Mangel“,<br />
erläutert Gawel. „Diese Güter<br />
tragen aber zu Recht ihren jeweiligen<br />
Knappheitspreis.“ Nichts anderes<br />
gelte für das wertvolle Gut unserer<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen.<br />
Für das drittgrößte Nehmerland<br />
im Länderfinanzausgleich, das<br />
durch verbindliche Maßnahmenprogramme<br />
zum Gewässerschutz,<br />
mittelfristig auslaufende Solidarpakt-Mittel<br />
und die anstehende<br />
verfassungsrechtliche „Schuldenbremse“<br />
finanzpolitisch stark gefordert<br />
ist, bedeutet die Einführung<br />
einer Verursacherabgabe jedoch<br />
auch finanzpolitisch einen richtigen<br />
Schritt. „Für diese Zwecke Mittel<br />
gerade aus einer Verursacherabgabe<br />
bereitzustellen, ist legitim und<br />
richtig“, stellt Gawel klar. „Lenkung<br />
und Finanzierung sind gar kein<br />
Widerspruch, sondern zwei Seiten<br />
derselben Medaille.“<br />
Sachsen-Anhalt hat insgesamt<br />
eine <strong>Wasser</strong>entnahmeabgabe ge -<br />
schaffen, die sich eng an die bisherigen<br />
Länderregelungen anlehnt.<br />
Damit dürften kritische Hinweise<br />
auf angeblich gefährdete Wettbewerbsfähigkeit<br />
von gewerblichen<br />
<strong>Wasser</strong>entnehmern oder mangelnde<br />
Tragbarkeit der Belastungen<br />
für private Haushalte kaum durchgreifen.<br />
„Die Belastungen sind tragbar<br />
und bewegen sich im üblichen<br />
Rahmen“, betont Gawel. Für private<br />
Verbraucher wird von zwei bis drei<br />
Euro im Jahr für die Trinkwasserversorgung<br />
ausgegangen. Das Wirtschaftsministerium<br />
des Landes<br />
rechnet pro Jahr mit etwa elf Millionen<br />
Euro Einnahmen aus der neuen<br />
Abgabe. Damit könnte jährlich je<br />
nach Verwendung des Aufkommens<br />
zusätzlich ein Mehrfaches an<br />
EU- oder Bundesmitteln für das<br />
Land akquiriert werden.<br />
Allerdings wurden in Sachsen-<br />
Anhalt auch einige Schwachstellen<br />
der bisherigen Länder-Regelungen<br />
reproduziert: Dies betrifft die ressourcenpolitisch<br />
fragwürdige Differenzierung<br />
der Abgabesätze nach<br />
Verwendungszweck – so wird die<br />
März 2012<br />
244 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
öffentliche <strong>Wasser</strong>versorgung mit<br />
einem 50 % höheren Satz belegt als<br />
Gewerbe und Industrie. Ebenso ins<br />
Auge fallen die umfangreichen Ausnahmen<br />
und großzügigen Härtefallklauseln,<br />
die das Verursacherprinzip<br />
durchbrechen. Anders als NRW hält<br />
Sachsen-Anhalt schließlich auch am<br />
gewässerschutzpolitisch fragwürdigen<br />
Bergbauprivileg fest, das die<br />
Gewinnung von Bodenschätzen<br />
trotz erheblicher Eingriffe in den<br />
<strong>Wasser</strong>haushalt komplett von der<br />
Abgabepflicht freistellt. Die Einführung<br />
der Abgabe in Sachsen-Anhalt<br />
ist ein Schritt in die richtige Richtung,<br />
resümiert die Studie. „Eine<br />
konsequente Weiterentwicklung<br />
des Instruments, insbesondere eine<br />
Harmonisierung zwischen den Bundesländern<br />
und eine klare Ausrichtung<br />
auf den verursacherbezogenen<br />
Ressourcenschutz müssen aber<br />
auf der rechtspolitischen Agenda<br />
bleiben“, fordert Gawel.<br />
Kontakt:<br />
Prof. Dr. Erik Gawel, Department Ökonomie,<br />
Helmholtz-Zentrum für<br />
Umweltforschung (UFZ), Tel. (0341) 235-1255,<br />
http://www.ufz.de<br />
und Professur für VWL/<br />
Institutionenökonomische Umweltforschung,<br />
Universität Leipzig<br />
Die Einführung der Abgabe in Sachsen-Anhalt ist<br />
trotz einiger Schwächen ein Schritt in die richtige<br />
Richtung, resümiert die neue Studie. © Tilo Arnhold/UFZ<br />
EU-Kommissar Oettinger meint:<br />
Keine schärferen Gesetze zum Fracking nötig<br />
EU-Energiekommissar<br />
Günther<br />
Oettinger (CDU) hält schärfere<br />
Gesetze für die umstrittene Förderung<br />
von Schiefergas aus tiefen<br />
Gesteinsschichten derzeit nicht für<br />
nötig. Die EU-Kommission stellte in<br />
Brüssel eine externe Studie zum<br />
Thema vor. Schiefergas, mit dem die<br />
EU bei der Energieversorgung unabhängiger<br />
werden will, etwa von russischem<br />
Gas, lagert tief im Gestein.<br />
Die zur Förderung nötige Fracking-<br />
Technik ist in Deutschland heftig<br />
umstritten: Dabei werden <strong>Wasser</strong>,<br />
Sand und Chemikalien unter hohem<br />
Druck in das Gestein gepresst, in<br />
dem das Gas gebunden ist.<br />
Vor allem in Niedersachsen und<br />
Nordrhein-Westfalen gibt es wegen<br />
Umweltbedenken starken Widerstand<br />
gegen das Verfahren. Bund und<br />
Länder prüfen derzeit härtere<br />
Umweltauflagen. Befürchtet wird,<br />
dass die eingesetzten Chemikalien<br />
das Trinkwasser verseuchen könnten.<br />
Eine Beraterfirma hat nun im<br />
Auftrag der EU-Kommission untersucht,<br />
ob die EU-Umweltgesetzgebung<br />
den möglichen Risiken der<br />
Schiefergas-Förderung gerecht<br />
wird. „Die rechtliche Untersuchung<br />
bestätigt, dass es keine unmittelbare<br />
Notwendigkeit gibt, unsere<br />
EU-Gesetzgebung zu ändern“, teilte<br />
Oettinger mit. Dies gelte aber nur<br />
für die Erkundung der Vorkommen.<br />
Deutschland kann aber selbst festlegen,<br />
ob es seine Gesetze beim<br />
Fracking verschärfen will.<br />
In Europa gibt es nach Angaben<br />
der EU-Kommission derzeit 20 bis<br />
30 Probebohrungen – die Hälfte<br />
davon in Polen. In Schweden, Frankreich<br />
und Großbritannien wurden<br />
Felder erkundet. In Deutschland gab<br />
es laut Umweltbundesamt fünf Probebohrungen<br />
in Niedersachsen,<br />
Unternehmen haben weitere<br />
Genehmigungen für Baden-Württemberg,<br />
Nordrhein-Westfalen,<br />
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Für<br />
den Abbau hätten die Behörden bisher<br />
keine Genehmigungen erteilt.<br />
Für die Studie hat die Beraterfirma<br />
die Situation in Deutschland,<br />
Frankreich, Schweden und Polen<br />
untersucht. Eine der Schlussfolgerungen:<br />
Wenn die Bevölkerung<br />
rechtzeitig informiert und nach<br />
ihrer Meinung gefragt werde, würden<br />
Bohrungen eher akzeptiert.<br />
Doch das geschehe nicht flächendeckend:<br />
„Die Teilnahme der<br />
Öffentlichkeit ist ziemlich begrenzt“,<br />
heißt es dazu in dem Papier.<br />
Dabei sieht die EU-Umweltgesetzgebung<br />
vor, dass die Bevölkerung<br />
eingebunden wird. Größere<br />
Bauvorhaben müssen auf ihre<br />
Umweltverträglichkeit abgeklopft<br />
werden, dabei soll auch die Meinung<br />
der Öffentlichkeit eingeholt<br />
werden. Wie und wann das geschehen<br />
soll, bleibt aber den Gesetzgebern<br />
in den EU-Staaten überlassen.<br />
In Deutschland beispielsweise<br />
ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
laut Studie erst ab einer<br />
Fördermenge von 500 000 Kubikmetern<br />
pro Tag vorgeschrieben.<br />
EU-Energiekommissar Günther Oettinger. © EU<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 245
Nachrichten<br />
Branche<br />
Goldener Kanaldeckel zum 10. Mal verliehen<br />
Freut sich über den ersten Platz: Rolf Kemper-<br />
Böninghausen (links) von der Emschergenossenschaft<br />
hat einen Vermessungsroboter entwickelt.<br />
Für ihr System zur Zustandserfassung und -bewertung<br />
von Schächten: Juliane Schenk von den Göttinger<br />
Entwässerungsbetrieben erhält den zweiten Preis.<br />
Mit dem dritten Preis gewürdigt: Wulf Riedel (links)<br />
hat das „Solinger Modell“ zur Vermeidung von<br />
Fremdwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
entwickelt.<br />
Das IKT – Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur hat zum<br />
zehnten Mal den Preis „Goldener<br />
Kanaldeckel“ vergeben. Im Rahmen<br />
des IKT-Forums „Klima, Energie und<br />
Kanalisation 2012“ wurden drei<br />
Mitarbeiter von Kanalnetzbetreibern<br />
für ihr herausragendes Engagement<br />
und vorbildhafte Projekte<br />
im Bereich der Kanalinfrastruktur<br />
geehrt.<br />
Neuer Messroboter<br />
entlastet die Mitarbeiter<br />
Den ersten Platz belegt Rolf Kemper-Böninghausen<br />
aus der Abteilung<br />
Bergtechnik und Vermessung<br />
der Emschergenossenschaft. Er<br />
erhielt den Goldenen Kanaldeckel<br />
und ein Preisgeld von 2000 Euro für<br />
die Entwicklung eines alternativen<br />
Verfahrens zur Kontrollvermessung<br />
von Rohrvortrieben. Durch den Einsatz<br />
eines autonomen Messroboters<br />
wurde der Gesundheitsschutz verbessert<br />
und die Vortriebsleistung<br />
durch verkürzte Messzeiten ge -<br />
steigert.<br />
Aus eigener Erfahrung wusste<br />
Kemper-Böninghausen, dass die<br />
Arbeit in Rohrdurchmessern ab DN<br />
1400 in Kombination mit Haltungslängen<br />
von bis zu 1200 Metern für<br />
das Messpersonal eine sehr hohe<br />
körperliche Belastung darstellt. Aus<br />
der ersten Idee, die Vortriebsvermessung<br />
mit Hilfe eines Rollstuhls<br />
zu vereinfachen, entstand zunächst<br />
ein bemanntes Fahrzeug. Dieser<br />
Schritt brachte bereits eine große<br />
körperliche Entlastung der Mitarbeiter<br />
und eine Zeitersparnis von<br />
etwa 30 % mit sich.<br />
Weitere Entwicklungsschritte<br />
führten schließlich zum Bau eines<br />
autonomen Messroboters. Dieses<br />
Gerät, bestückt mit den notwe n-<br />
digen technischen Einrichtungen,<br />
hat in seiner aktuellen Version die<br />
Erwartungen voll erfüllt. Messpersonal<br />
ist im Rohrstrang nicht mehr<br />
erforderlich und die Zeitersparnis<br />
gegenüber der herkömmlichen Vermessung<br />
liegt bei 75 %, mit entsprechender<br />
Reduzierung der Baustillstandszeiten.<br />
Schachtkreislauf von<br />
Inspektion, Bewertung und<br />
Sanierung<br />
Mit dem zweiten Platz und einem<br />
Preisgeld von 1000 Euro wurde die<br />
Leistung von Dipl.-Ing. (FH) Juliane<br />
Schenk von den Göttinger Entsorgungsbetrieben<br />
gewürdigt. Sie hat<br />
eine Datenbank zur Bewertung von<br />
Schachtbauwerken initiiert und ist<br />
für deren Umsetzung und Weiterentwicklung<br />
verantwortlich. Durch<br />
die Programmierung und Nutzung<br />
der Schachtbewertungsdatenbank<br />
„SCHABE“ entsteht ein digitaler<br />
Kreislauf von Inspektion, Bewertung<br />
und Sanierung.<br />
In SCHABE werden die bisher<br />
getrennt gehandhabten Bausteine<br />
Schachtinspektion, Schachtbewertung<br />
und Schachtsanierung zusammengefasst.<br />
So werden der Zustand<br />
sowie der Sanierungsbedarf der<br />
Göttinger Schächte digital abgebildet<br />
und für alle Beteiligten transparent<br />
gemacht. Es entstand ein Kreislauf,<br />
der Teil des Qualitätsmanagement-Systems<br />
ist und in das<br />
Göttinger Kanalsanierungskonzept<br />
integriert ist.<br />
Mithilfe modernster Schachtaufnahmetechniken<br />
wird nach und<br />
nach der Zustand aller Schächte in<br />
Göttingen erfasst. Die neue Technologie<br />
ermöglichte es Frau Schenk,<br />
ganz neue Bewertungsvorgaben zu<br />
erarbeiten. Daraus lassen sich direkt<br />
Sanierungsaufträge erstellen und<br />
effizient beauftragen.<br />
Modell zur Dichtheitsprüfung<br />
privater <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
Als dritter Preisträger wurde Wulf<br />
Riedel von den Technischen Betrieben<br />
Solingen mit der Trophäe und<br />
500 Euro Preisgeld ausgezeichnet.<br />
Er war maßgeblich für die Konzeption<br />
und Implementierung des<br />
März 2012<br />
246 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Anzeige Membran_neu_Layout 1 15.02.12 12:46 Seite 1<br />
Branche<br />
Nachrichten<br />
„Solinger Modells“ zur Umsetzung<br />
der Dichtheitsprüfung privater<br />
<strong>Abwasser</strong>anlagen verantwortlich.<br />
In Solingen konnte der Schutz<br />
einer Kläranlage vor Fremdwasser<br />
nicht allein durch Baumaßnahmen<br />
im öffentlichen Kanalnetz gewährleistet<br />
werden. Riedel entwickelte<br />
eine Strategie, die betroffenen<br />
Hauseigentümer, die Kommunalpolitik<br />
und die Aufsichtsbehörden<br />
in eine Gesamtkonzeption einzubinden.<br />
Maßgeblich für die<br />
erfolgreiche Umsetzung waren die<br />
seriöse Beratung und vertrauensvolle<br />
Begleitung der betroffenen<br />
Bürger.<br />
Riedel hat eine Systematik zur<br />
Auswertung vorhandener Daten<br />
entwickelt, um eine Einteilung<br />
nach Priorität zu ermöglichen.<br />
Zusätzlich wurden immer dort, wo<br />
Fremd wasser oder drückendes<br />
Hangwasser vorlag, alternative<br />
Erdrinnen konzipiert. Diese „neuen<br />
Stadtgewässer“ haben nicht nur<br />
die Flora und Fauna im Umfeld<br />
gestärkt, sondern auch eine Entlastung<br />
bei Stark regen bewirkt.<br />
Die Preisträger im Überblick<br />
Erster Platz<br />
""<br />
Preisträger: Rolf Kemper-Böninghausen, Emschergenossenschaft<br />
Projekt: Auf dem Weg zum autonom messenden Roboter –<br />
Neue Messverfahren für Kontrollmessungen bei<br />
Rohrvortriebsarbeiten<br />
Zweiter Platz<br />
""<br />
Preisträger: Dipl.-Ing. (FH) Juliane Schenk,<br />
Göttinger Entsorgungsbetriebe<br />
Projekt: Erstellung eines digitalen Schachtkreislaufs<br />
durch Programmierung und Nutzung der<br />
SCHAchtBEwertungsdatenbank „SCHABE“<br />
Dritter Platz<br />
""<br />
Preisträger: Wulf Riedel, Technische Betriebe Solingen<br />
Projekt: „Solinger Modell“ zur Umsetzung der<br />
Dichtheitsprüfung privater <strong>Abwasser</strong>anlagen<br />
Kontakt:<br />
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur,<br />
Exterbruch 1, D-45886 Gelsenkirchen, Tel. (0209) 17806-0, Fax (0209) 17806-88,<br />
E-Mail: info@ikt.de, www.ikt.de<br />
Höchste Ablaufqualität<br />
und <strong>Wasser</strong>recycling...<br />
... wenn Sie <strong>Abwasser</strong> weiter, besser und<br />
effizienter reinigen<br />
Umfassende Produkt- und Verfahrenslösungen<br />
aus den Bereichen:<br />
➤ Membrantechnik<br />
➤ Filtrationsverfahren<br />
➤ Fein- und Feinstsiebanlagen<br />
➤ Schlammbehandlung<br />
Besuchen Sie uns auf der IFAT<br />
ENTSORGA vom 7.–11. Mai 2012<br />
Halle A2, Stand 333<br />
info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
WASTE WATER Solutions<br />
„Oscar“ der Kanalbranche: Jedes Jahr verleiht das IKT<br />
den Goldenen Kanaldeckel.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 247
Nachrichten<br />
Branche<br />
Private <strong>Abwasser</strong>leitungen auf Dichtheit überprüfen<br />
<strong>Abwasser</strong>fachleute für einheitliche und klare Regelungen<br />
Alle <strong>Abwasser</strong>leitungen – private wie öffentliche – sollen dicht sein und sich in einem ordnungsgemäßen<br />
Zustand befinden. „Es bedarf klarer und sachgerechter Regelungen auch für die Überprüfung und Sanierung<br />
der privaten Leitungen. Dabei muss dem Grundwasserschutz in <strong>Wasser</strong>schutzgebieten eine hohe Priorität eingeräumt<br />
werden. Bestehende gesetzliche Standards sollten nicht aufgeweicht werden“, fordert Dipl.-Ing. Otto<br />
Schaaf, Präsident der Deutschen Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall (DWA).<br />
© Umweltministerium<br />
NRW,<br />
www.umwelt.<br />
nrw.de<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen müssen<br />
dicht sein<br />
<strong>Abwasser</strong>anlagen sind ein beträchtlicher<br />
Teil des öffentlichen Vermögens.<br />
Daher haben Betreiber – in<br />
der Regel öffentliche Einrichtungen,<br />
Kommunen – wie Bürger ein Interesse<br />
daran, dass diese funktionsfähig<br />
sind, sich auf hohem technischem<br />
Stand befinden und in ihrer<br />
Substanz erhalten bleiben. Auf<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen bezogen, be -<br />
deutet das unter anderem, dass<br />
diese dicht sein sollen. Dementsprechend<br />
gilt es auch, das bestehende<br />
private Leitungsnetz mit einer<br />
geschätzten Länge von rund einer<br />
Million Kilometern auf seine Dichtheit<br />
hin zu überprüfen.<br />
Aus Gründen des Boden- und<br />
Gewässerschutzes setzt sich die DWA<br />
nachdrücklich für klare und sachgerechte<br />
Regelungen für die Überprüfung<br />
und Sanierung der öffentlichen<br />
Kanäle und privaten <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
ein. Besondere Bedeutung hat<br />
dies für <strong>Wasser</strong>schutzgebiete. Die<br />
DWA macht darauf aufmerksam, dass<br />
diese Problematik im öffentlichen<br />
Bereich systematisch angegangen<br />
wird, dass aber bei privaten Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
nicht<br />
immer in ausreichendem Maß Handlungsbedarf<br />
gesehen wird.<br />
Grundwasser und Boden<br />
können verunreinigt werden<br />
Durch undichte <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
kann <strong>Abwasser</strong> in Boden und<br />
Grundwasser gelangen und dieses<br />
verunreinigen. Häusliches <strong>Abwasser</strong><br />
enthält coliforme Keime, Haushaltschemikalien<br />
und Medikamentenrückstände,<br />
die, wenn sie in das<br />
Grundwasser gelangen, ein Risiko<br />
für den Menschen darstellen. Durch<br />
undichte Grundstücksentwässerungsleitungen<br />
kann, ebenso wie<br />
bei undichten öffentlichen Kanälen,<br />
Grundwasser in die Kanalisation<br />
eindringen (infiltrieren). Dieses infiltrierte<br />
Grundwasser ist dann<br />
„Fremdwasser“, was die Kläranlagen<br />
zusätzlich belastet, deren Leistung<br />
senkt und zu einer unnötigen<br />
Gewässerbelastung führt. Zudem<br />
verursacht Fremdwasser einen<br />
erhöhten Energie- und Kosteneinsatz<br />
bei der <strong>Abwasser</strong>reinigung,<br />
zum Beispiel durch erhöhten Bedarf<br />
an Pumpleistung. Undichte Leitungen<br />
können zu Ausschwemmungen<br />
von Bodenmaterial führen, die<br />
Gelände- oder Gebäudeabsackungen<br />
und Straßeneinbrüche zur<br />
Folge haben können. Dies ist ein<br />
nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial,<br />
wie die Erfahrung<br />
immer wieder gezeigt hat. Nicht nur<br />
im Sinne eines umfassenden<br />
Umweltschutzes ist es notwendig,<br />
die Funktionsfähigkeit der privaten<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen sicherzustellen.<br />
Es ist auch im Interesse der Grundstückseigentümer,<br />
den Wert ihrer<br />
Immobilien zu erhalten.<br />
Kosten sind vertretbar<br />
Die Kosten der Dichtheitsprüfung<br />
sind durchaus überschaubar: Erfahrungsgemäß<br />
liegen die Kosten der<br />
Untersuchung kleiner Anlagen<br />
(Länge unter zehn Meter) zwischen<br />
300 und 550 Euro je Grundstück.<br />
Die Kosten der gegebenenfalls<br />
erforderlichen Sanierung hängen<br />
von der Schwere der jeweiligen<br />
Schäden ab. Nicht jede Beschädigung<br />
der Leitung macht eine<br />
sofortige Sanierung erforderlich.<br />
Wann und wie umfassend Sanierungsmaßnahmen<br />
durchzuführen<br />
sind, gilt es im Einzelfall sachgerecht<br />
festzulegen. Aus wirtschaftlichen<br />
Gründen ist es sinnvoll, die Untersuchung<br />
und Sanierung öffentlicher<br />
Kanäle und privater Leitungen aufeinander<br />
abzustimmen.<br />
Weitere Informationen: www.dwa.de<br />
März 2012<br />
248 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Sicherer Einbau von Kunststoffrohrsystemen<br />
KRV legt Einbauanleitungen neu auf<br />
Der Einbau spielt neben der Produktqualität<br />
von Rohrleitungssystemen<br />
für ihre Funktionalität<br />
eine entscheidende Rolle. Im Interesse<br />
höchstmöglicher Einbauqualität<br />
erdverlegter Kunststoffrohrsysteme<br />
hat der KRV jetzt fünf Einbauanleitungen<br />
neu aufgelegt. Sie<br />
liefern sowohl dem Bauausführenden<br />
Informationen zum Umgang<br />
mit Kunststoffrohrsystemen als<br />
auch dem Bauherren eine Hilfestellung<br />
zur Abschätzung der Einbauqualität.<br />
Die Einbauanleitung „Wärmetauschersysteme<br />
aus Polyolefinen für<br />
geothermische Anlagen, bestehend<br />
aus Rohren, Formstücken und Bauteilen“<br />
wird der Fachwelt als Neuerscheinung<br />
vorgelegt. Ausgehend<br />
von der Kontrolle der Bauteile bei<br />
Anlieferung auf der Baustelle bis<br />
zur Inbetriebnahme der Anlage<br />
beschreibt sie alle maßgeblichen<br />
Einbauschritte. Mit besonderem<br />
Augenmerk auf die Dichtheitsprüfung<br />
der Erdwärmesonde trägt sie<br />
in Verbindung mit einem demnächst<br />
bei DIN CERTCO erscheinenden<br />
Zertifizierungsprogramm we -<br />
sentlich zur Einbauqualität und<br />
-sicherheit von Geothermieanlagen<br />
bei.<br />
Auf den neuesten Stand wurden<br />
außerdem die Verlegeanleitungen<br />
für erdverlegte Kabelschutzrohre<br />
aus den Werkstoffen PE-HD, PP<br />
sowie PVC-U gebracht und zudem<br />
eine normenübergreifende Anleitung<br />
für sogenannte „Microduct<br />
Mono“ Einzelrohre in der Telekommunikation<br />
aufgelegt.<br />
Alle Einbauanleitungen kostenlos als<br />
Download unter:<br />
http://www.krv.de/home/publikationen/<br />
downloads.html abrufbar oder im Druck<br />
(Preise auf Anfrage) zu beziehen<br />
Stellenanzeige<br />
Mit rund 1.000 Mitgliedsunternehmen ist die figawa der Verband der Hersteller und Errichter für die Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Durch F+E-Projekte, Standardisierungs- und Normungsarbeit, Seminare und Kongresse stellen wir die Weichen für die sichere,<br />
wirtschaftliche und umweltverträgliche Versorgung mit Gas und <strong>Wasser</strong> auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene<br />
und für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Mitglieder.<br />
Für unsere Geschäftsstelle in Köln suchen wir einen Dipl. Ing. (TU, FH) oder Naturwissenschaftler (w/m) als<br />
Geschäftsführer/-in in spe<br />
zur eigenständigen Betreuung von Gremien und Projekten im Bereich <strong>Wasser</strong> und Rohrleitungen, zur Identifikation und zielgruppengerechten<br />
Aufbereitung aktueller Informationen und Themen der Branche und zur Beratung unserer Mitgliedsunternehmen.<br />
Unsere Anforderungen:<br />
• Erfolgreich abgeschlossenes ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium<br />
• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in Unternehmen oder Verbänden<br />
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative, ausgeprägte Fähigkeiten im Networking<br />
• Verständnis für infrastrukturgebundene Technologien<br />
• Ausgeprägte Serviceorientierung, verhandlungssicheres Englisch und Deutsch<br />
• Erfahrungen im Marketing/Vertrieb, in der Normungsarbeit und der Zusammenarbeit<br />
mit europäischen Partnern sind von Vorteil<br />
Neben der engen Zusammenarbeit mit marktführenden Unternehmen bieten wir anspruchsvolle, mit großer Eigenständigkeit zu<br />
erledigende Aufgaben. Nach gründlicher Einarbeitung ist bei Bewährung im Jahr 2014 die Berufung zum Geschäftsführer der<br />
figawa vorgesehen.<br />
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellungen schriftlich oder per E-Mail an<br />
den Hauptgeschäftsführer der figawa e. V., Herrn Gotthard Graß, Marienburger Straße 15, 50968 Köln, E-Mail: gf1@figawa.de.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 249
Nachrichten<br />
Branche<br />
Alles strömt – die Gelsenwasser AG feiert<br />
125-jähriges Firmenjubiläum<br />
Als die „Aktiengesellschaft <strong>Wasser</strong>werk für das nördliche westfälische Kohlenrevier“ – die spätere GELSEN-<br />
WASSER AG – am 28. Januar 1887 in Castrop von Friedrich Grillo und anderen gegründet wurde, war das Ziel,<br />
die <strong>Wasser</strong>versorgung der Zechen in der Phase der Industrialisierung zu verbessern und die stark wachsende<br />
Bevölkerung an der Ruhr zuverlässig mit Trinkwasser zu beliefern. Diese Aufgabe ist noch heute Kerngeschäft<br />
des Gelsenkirchener Traditionsunternehmens.<br />
Brunnenbau – 125 Jahre Ruhrgebietsgeschichte.<br />
125 spannende Jahre<br />
Ruhrgebietsgeschichte<br />
Pünktlich zum Jubiläum erscheint<br />
die Firmengeschichte im Buch,<br />
aufgearbeitet von den drei Historikern<br />
Beate Olmer, Stefan Nies und<br />
Jürgen Büschenfeld. Dazu der<br />
Vorstandsvorsitzende Henning R.<br />
Deters: „In der 125-jährigen<br />
Geschichte hat sich GELSENWASSER<br />
einige Tugenden angeeignet, mit<br />
denen wir auch zukünftig erfolgreich<br />
sein können: Große technische<br />
Kompetenz, Offenheit und<br />
Mut für Neues und das Verständnis,<br />
Teil der Region und Partner für die<br />
Kommunen zu sein.“<br />
Vom ersten Firmensitz in Castrop<br />
zog das Unternehmen noch Ende<br />
1887 nach Schalke, nachdem es die<br />
AG Gelsenkirchen-Schalker Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>werke erworben hatte.<br />
Damit verdreifachte sich das Kapital<br />
des Unternehmens auf 4,5 Millionen<br />
Mark. Anfang der 1890er Jahre<br />
stand die Verlängerung des <strong>Wasser</strong>lieferungsvertrags<br />
mit der Stadt<br />
Gelsenkirchen an, die ein großes<br />
Interesse daran hatte, die Steuern<br />
des potenten Schalker Versorgungsunternehmens<br />
dem eigenen Etat<br />
zuzuführen. Deshalb machte die<br />
Stadt es zur Bedingung, dass der<br />
Firmensitz nach Gelsenkirchen verlegt<br />
wird. Das <strong>Wasser</strong>werk akzeptierte<br />
dies schließlich, um nicht im<br />
Kern seines Versorgungsgebiets<br />
einen Konkurrenten dulden zu<br />
müssen und verlegte Ende 1893<br />
die Hauptverwaltung nach Gelsenkirchen.<br />
Die positive Bilanz des Unternehmens<br />
wurde 1901 jäh unterbrochen:<br />
Im Vorsorgungsgebiet brach<br />
der Typhus aus, in den Quellen werden<br />
bis zu 5000 Infektionen und bis<br />
zu 350 Todesopfer genannt. Der niederschlagsarme<br />
Sommer hatte die<br />
Probleme vieler Ruhrwasserwerke,<br />
genügend <strong>Wasser</strong> zur Befriedigung<br />
der ständig steigenden Nachfrage<br />
bereitzustellen, weiter verschärft.<br />
Wie die Untersuchungen zeigten,<br />
griffen deshalb verschiedene<br />
<strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr zu fragwürdigen<br />
Gewinnungsmethoden,<br />
zu denen auch die Beimischung<br />
unfiltrierten Flusswassers gehörte.<br />
So waren Typhuskeime ins Leitungsnetz<br />
gelangt. In der Folge gründete<br />
das <strong>Wasser</strong>werk für das nördliche<br />
westfälische Kohlenrevier das von<br />
Robert Koch angeregte Hygiene-<br />
Instituts des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen<br />
mit.<br />
Seit den 70er Jahren zeichnete<br />
sich durch den Rückgang des Kohlebergbaus<br />
und der Stahlindustrie<br />
auch eine Verminderung des <strong>Wasser</strong>absatzes<br />
ab. Das 1973 in GELSEN-<br />
WASSER AG umbenannte Unternehmen<br />
begann früh mit der Erweiterung<br />
des Geschäftsfeldes auf die<br />
Energieversorgung, Beteiligungen<br />
an Stadtwerken, auf die <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
und auf verschiedene<br />
Dienstleistungen in diesen Bereichen.<br />
„Wer die GELSENWASSER-<br />
Ge schichte liest, bemerkt, dass in<br />
diesem Unternehmen kontinuierlich<br />
vorausschauende Entscheidungen<br />
getroffen wurden, die teilweise<br />
mit weitreichenden Veränderungen<br />
in eine weiter erfolgreiche Zukunft<br />
führten – eng verwoben mit der<br />
Region. Das Buch ist deshalb auch<br />
eine spannende Lektüre zur<br />
Geschichte des Ruhrgebiets“, so<br />
Henning R. Deters.<br />
Die 125-jährige Unternehmensgeschichte<br />
begeht GELSENWASSER<br />
mit verschiedenen Feierlichkeiten.<br />
Am Jubiläumstag, dem 28. Januar<br />
2012, fand der offizielle Festakt mit<br />
geladenen Gästen im Musiktheater<br />
im Revier in Gelsenkirchen statt. Bei<br />
einem großen Mitarbeiterfest am<br />
4. Mai feiert die blau-grüne Mannschaft.<br />
Seit dem 28. Januar 2012 gibt es<br />
auf der GELSENWASSER-Homepage<br />
www.gelsenwasser.de ein großes<br />
Gewinnspiel mit 125 hochwertigen<br />
Preisen. Das Buch ist für 19,90 Euro<br />
über den GELSENWASSER-Shop im<br />
Internet erhältlich unter www.gelsenwasser-shop.de<br />
Kontakt:<br />
GELSENWASSER AG,<br />
Willy-Brandt-Allee 26,<br />
D-45891 Gelsenkirchen,<br />
Tel. (0209) 708-0,<br />
Fax (0209) 708-650,<br />
www.gelsenwasser.de<br />
März 2012<br />
250 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
NETZWERK WISSEN<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
Foto: Paul-Georg Meister/pixelio.de<br />
Der neue Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
an der Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
""<br />
Interview mit Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla<br />
""<br />
Der neue Studiengang im Porträt<br />
""<br />
Praxissemester bietet weit mehr als einen kleinen Ausflug in die Arbeitswelt<br />
""<br />
Vom Studenten zum Experten – Praxissemester in der Unternehmensberatung<br />
""<br />
Big City Life auf Chinesisch<br />
""<br />
Die Hochschule Hamm-Lippstadt stellt sich vor<br />
""<br />
Leben und Studieren auf zwei Campus<br />
Forschungsvorhaben und Ergebnisse<br />
""<br />
Felchenarten rücken genetisch zusammen
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Bei uns wird Employability wirklich gelebt<br />
Prof. Dr.-Ing. Cziesla über den neuen Studiengang und die Wichtigkeit des Praxisbezugs<br />
Seit kurzem bietet die junge Hochschule Hamm-Lippstadt den neuen Studiengang „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“ an. Im Gespräch mit <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> spricht Studiengangsleiter Professor<br />
Dr.-Ing. Torsten Cziesla über Erwartungen, Herausforderungen und Ziele sowie die besondere Rolle des<br />
Praxis semesters.<br />
<strong>gwf</strong>: Herr Prof. Cziesla, Sie haben viele<br />
Jahre in der Wirtschaft gearbeitet,<br />
unter anderem für VEW, E.ON und<br />
Degussa-Hüls. Was hat Sie dazu<br />
bewogen, von der Industrie an die<br />
Hochschule zu wechseln?<br />
Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla: Die<br />
Arbeit in der Industrie hat mir<br />
großen Spaß gemacht, und ich habe<br />
viel dabei gelernt. Ich hatte aber für<br />
meine Berufslaufbahn immer schon<br />
perspektivisch das Ziel vor Augen,<br />
in die Lehre zu gehen. Das Wissen,<br />
das ich mir angeeignet hatte, wollte<br />
ich weitergeben, und dabei die<br />
Studierenden in den Mittelpunkt<br />
stellen. Als Studiengangsleiter<br />
„Ener gietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
und einer der ersten<br />
Professoren an der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt hatte ich hier<br />
ideale Möglichkeiten: ein Neustart<br />
auf der grünen Wiese, wo man all<br />
seine Ideen einfließen lassen und<br />
Lehre aktiv mitgestalten kann. Die<br />
Hochschule ist vergleichbar mit<br />
einem Start-Up-Unternehmen, das<br />
sich zunächst etablieren muss, das<br />
aber auch ein Höchstmaß an Kreativität<br />
und Mitwirkung zulässt, ohne<br />
tradierte hierarchische Strukturen.<br />
<strong>gwf</strong>: Sind Ihre Erwartungen an die<br />
Professorentätigkeit erfüllt worden?<br />
Wie sieht die Praxis an der Hochschule<br />
aus?<br />
Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla:<br />
Meine Erwartungen sind auf jeden<br />
Fall erfüllt worden. Wobei einen bei<br />
aller Theorie und vorausschauender<br />
Planung die Realität dann doch<br />
immer wieder überrascht und neue,<br />
kreative Lösungswege erfordert.<br />
Kein Tag ist wie der andere, und<br />
ständig ergeben sich neue Dinge,<br />
die es anzupacken gilt. Für meinen<br />
Studiengang „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“ war die<br />
Entwicklung auf jeden Fall sehr<br />
erfreulich: Wir sind wenige Monate<br />
nach der Hochschulgründung 2009<br />
mit 40 Studierenden gestartet, ein<br />
Jahr später waren es 80 Studienanfänger,<br />
und im Herbst haben<br />
120 junge Menschen das Studium<br />
bei uns aufgenommen. Das ist<br />
schon ein schönes Gefühl, wenn<br />
man in seiner Arbeit so bestätigt<br />
wird. Die Hochschule hat generell<br />
sehr schnell „an Luft gewonnen“<br />
und großen Zuspruch erfahren –<br />
mit jetzt bereits mehr als 1100 Studierenden<br />
in sechs Studiengängen.<br />
Wir haben aber noch längst nicht<br />
die Reiseflughöhe erreicht, um in<br />
dem Bild zu bleiben. Bis zum Erreichen<br />
der Endausbaustufe mit rund<br />
4000 Studierenden, die dann an<br />
beiden Standorten in nagelneuen<br />
Campusgebäuden unterrichtet werden,<br />
haben wir noch viel Entwicklungsarbeit<br />
vor uns, und ich habe<br />
auch noch viele Ideen, die ich<br />
umsetzen möchte.<br />
Das mögliche Studienobjekt künftiger Absolventen: Turbinen eines <strong>Wasser</strong>kraftwerks.<br />
© F. Gopp/pixelio.de<br />
<strong>gwf</strong>: Ganz konkret gefragt: Wie nutzen<br />
Sie die einmalige Chance, einen<br />
Studiengang ganz neu zu entwickeln?<br />
Welche Ziele verfolgen Sie beim<br />
Aufbau von „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“?<br />
Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla: Das<br />
wichtigste Stichwort hier heißt<br />
Employa bility. Wir bringen Fachkräfte<br />
hervor, die alle in der Wirt-<br />
März 2012<br />
252 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
schaft so dringend benötigten<br />
Kompetenzen mitbringen. Und<br />
zwar nicht nur Fachwissen, sondern<br />
auch soziale Fähig keiten, denen wir<br />
in Lehrveranstaltungen im Bereich<br />
der sogenannten Steuerungskompetenzen<br />
viel Raum geben. Die Praxisnähe,<br />
die sich ja alle Fachhochschulen<br />
auf die Fahnen schreiben,<br />
wird bei uns wirklich gelebt. Wir<br />
laden vom ersten Semester an<br />
Unternehmen in die Hochschule ein<br />
für Gastvorträge und Gesprächsrunden<br />
zu künftigen Berufsfeldern, wir<br />
besuchen mit unseren Studierenden<br />
potenzielle Arbeitgeber und<br />
wir lassen unsere eigenen Berufserfahrungen<br />
ständig in die Lehre mit<br />
einfließen. Ganz besonders wichtig<br />
aber ist das Praxissemester, das alle<br />
Studierenden im fünften Semester<br />
absolvieren müssen: Fest im Lehrplan<br />
integriert, haben sie die Gelegenheit,<br />
mehrere Monate lang in<br />
einem Unternehmen im In- oder<br />
Ausland zu arbeiten oder an einer<br />
internationalen Hochschule zu studieren.<br />
Der erste Jahrgang kehrt<br />
jetzt gerade aus den Firmen auf den<br />
Campus zurück, und für viele von<br />
ihnen ist der Idealfall eingetroffen:<br />
Sie haben im Prak tikum die richtigen<br />
Kontakte geknüpft und ein<br />
spannendes Thema gefunden, um<br />
ihre Projekt- und später auch ihre<br />
Bachelorarbeit in dem Unternehmen<br />
schreiben zu können.<br />
<strong>gwf</strong>: Bis zur Bachelorarbeit ist es für<br />
die „Pioniere“ unter den Studierenden<br />
gar nicht mehr lange hin. Wie geht es<br />
jetzt weiter, was sind Ihre Erwartungen<br />
an die Zukunft?<br />
Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla: Es<br />
macht mich stolz, dass wir jetzt bald<br />
die ersten Absolventinnen und<br />
Absolventen verabschieden können,<br />
in weniger als einem Jahr. Es<br />
zeigt einem aber auch, wie schnell<br />
die Zeit vergangen ist seit dem Tag,<br />
an dem man an die fast noch leere<br />
Hochschule gekommen ist. Mein<br />
Büro war eines der ersten, beim Aufstellen<br />
der Möbel habe ich noch<br />
selbst mit angepackt. Jetzt wird es<br />
schon auf der dritten Etage langsam<br />
eng, so schnell wachsen wir. Dabei<br />
Prof. Dr.-Ing. Torsten Cziesla<br />
Begeisterung für innovative Technologien zu fördern<br />
und gleichzeitig deren Zusammenspiel mit<br />
Marktentwicklungen und Ressourceneinsatz verständlich<br />
zu machen - dieses Anliegen liegt Prof.<br />
Dr.-Ing. Torsten Cziesla am Herz. Nach langjähriger<br />
leitender Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen<br />
der Energieversorgungswirtschaft wechselte<br />
er 2009 an die Hochschule Hamm-Lippstadt wo er<br />
den neuen Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
praxisbezogen ausrichtet<br />
und aufbaut.<br />
Prof. Dr.-Ing. Cziesla studierte in seiner<br />
Geburtsstadt Bochum an der Ruhr-Universität<br />
Maschinenbau mit energietechnischem Schwerpunkt.<br />
Anschließend arbeitete er als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am dortigen Institut für Thermound<br />
Fluiddynamik und promovierte auf dem<br />
Gebiet der Strömungssimulation.<br />
Nach seinem Wechsel in die Industrie arbeitete<br />
Prof. Dr.-Ing. Cziesla zunächst in der technischen<br />
Planung bei der ehemaligen VEW Energie AG, heute RWE, bevor er Projektleiter beim<br />
Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen Infracor GmbH im Degussa-Konzern,<br />
heute Evonik Industries, wurde. In dieser Funktion verantwortete er die Entwicklung<br />
und den Aufbau von Systemen zur Verbesserung des Energiemanagements im Chemiepark<br />
Marl, einem bedeutenden Standort der Prozessindustrie. In seiner nächsten beruflichen<br />
Station bei Mark-E war er nach verschiedenen Funktionen zuletzt als Abteilungsleiter<br />
im Bereich Energiehandel tätig. Anschließend wechselte er als Abteilungsleiter<br />
zur Speichergesellschaft EGS im E.ON-Konzern und widmete sich dort Fragestellungen<br />
zu energiewirtschaftlichen Infrastrukturprojekten. Neben seinen hauptberuflichen Aktivitäten<br />
war Prof. Dr.-Ing. Cziesla auch langjähriger Lehrbeauftragter in der Studienrichtung<br />
„Zukunftsenergien“ an der Technischen Fachhochschule Georg Agricola zu<br />
Bochum.<br />
Kontakt:<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt,<br />
Marker Allee 76–78, 59063 Hamm,<br />
Tel. +49 (0)2381 8789-404, E-Mail: torsten.cziesla@hshl.de<br />
gilt es auf jeden Fall, den Kreativgeist<br />
der Anfangszeiten weiter zu<br />
erhalten und weiterhin als Team so<br />
gut zu funktionieren. Auf das Feedback<br />
der Arbeitgeber, die unsere<br />
Studierenden einstellen, bin ich<br />
sehr gespannt, hier gibt es sicher<br />
viele neue Anregungen für die<br />
Lehre. Und natürlich freue ich mich<br />
auch auf die Berichte der Studierenden<br />
selbst, wenn sie ihre ersten<br />
Erfahrungen in der Arbeitswelt<br />
machen. Perspektivisch wünsche<br />
ich mir, dass sich unser guter Ruf<br />
weiter rumspricht, und dass der Studiengang<br />
„Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
in der deutschen<br />
Hochschullandschaft eine<br />
der ersten Anlaufstellen wird für<br />
alle, die sich eine zukunftsorientierte<br />
und praxisnahe Ausbildung in<br />
diesem Themenfeld wünschen,<br />
bzw. für Unternehmen, die auf der<br />
Suche nach hervorragend ausgebildeten<br />
Fachkräften sind.<br />
<strong>gwf</strong>: Herr Prof. Cziesla, vielen Dank<br />
für das Interview.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 253
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Der Praxisbezug<br />
steht<br />
immer im<br />
Mittelpunkt:<br />
In kleinen aber<br />
intensiven<br />
Gruppen bringt<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Cziesla seinen<br />
Studierenden<br />
die Studieninhalte<br />
näher.<br />
© HSHL<br />
Neue Wege betreten – mit Weitblick, Kreativität<br />
und dem Willen zur Veränderung<br />
Der neue Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
In den kommenden Jahren wird der Energiebedarf weiter massiv steigen. Denn immer mehr Menschen brauchen<br />
immer mehr Energie. Woher soll sie aber kommen, wenn die natürlichen Quellen wie Erdöl schon in naher<br />
Zukunft erschöpft sein werden? Wie vertragen sich Pipelines, Kraftwerke, Windräder und Sonnenkollektoren<br />
mit der Umwelt und dem menschlichen Grundbedürfnis nach zuverlässiger und effizienter Versorgung? Der<br />
neue Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt klärt, wie<br />
Energie optimal bereitgestellt und genutzt werden kann, wie neue Techniken in bestehende Strukturen und<br />
Märkte integriert werden und wie sich der bevorstehende Wandel in der Versorgungslandschaft managen lässt.<br />
Der Studiengang „Energietechnik<br />
und Ressourcenoptimierung“<br />
bietet eine breit gefächerte Ausbildung<br />
mit technischen und fachübergreifenden<br />
Inhalten für junge<br />
Führungskräfte von morgen, die mit<br />
Weitblick und Kreativität, vernetztem<br />
Denken und dem Willen zur Veränderung<br />
neue Wege beschreiten<br />
möchten. Ob in der Gebäudetechnik,<br />
bei Energieanlagen und Infrastruktursystemen<br />
oder bei regenerativen<br />
Energien: Zusammen mit<br />
modernen Kommunikations- und<br />
Informationstechnologien bringen<br />
Ingenieurinnen und Ingenieure<br />
innovative, intelligente und effiziente<br />
Versorgungssysteme hervor.<br />
Der Bachelor of Engineering<br />
Jeweils zum Wintersemester bietet<br />
die Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
den Studiengang „Energietechnik<br />
und Ressourcenoptimierung“ als<br />
Bachelor- Studium auf dem Campus<br />
Hamm mit einer Regelstudienzeit<br />
von sieben Semestern und dem<br />
Abschluss „Bachelor of Engineering<br />
Energietechnik und Ressourcenoptimierung“.<br />
Mit dem Abschluss<br />
„Bachelor“ erwirbt der Studierende<br />
den ersten akademischen Grad an<br />
der Hochschule Hamm-Lippstadt.<br />
Der Zusatz „of Engineering“ verweist<br />
auf den Bereich der angewandten<br />
Ingenieurwissenschaften,<br />
im Gegensatz zum „Bachelor of<br />
Science“. Bis zur letzten großen Studienreform<br />
in Deutschland lautete<br />
der übliche Studienabschluss noch<br />
„Diplom-Ingenieur“. Seitdem verschwindet<br />
diese Bezeichnung allerdings<br />
immer mehr, um künftig<br />
durch den international anerkannten<br />
„Bachelor“ ersetzt zu werden.<br />
Auch im Studienaufbau hat sich<br />
zudem einiges verändert.<br />
Mit guten Leistungen und<br />
Credit Points zum Ziel<br />
Ein Bachelor-Studium setzt sich aus<br />
verschiedenen Themen-Bausteinen,<br />
den sogenannten Modulen, zusammen.<br />
Jedes Modul fasst eine oder<br />
mehrere Lehrveranstaltungen aus<br />
einem gemeinsamen Kompetenzfeld<br />
zusammen. Im Studiengang<br />
„Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
besuchen Studentinnen<br />
und Studenten im ersten Semester<br />
Seminare, Übungen und Vorlesungen<br />
in Technischen Grundlagen,<br />
Naturwissenschaften und Mathematik.<br />
Gleichzeitig trainieren sie für<br />
die spätere Praxis fachübergreifende<br />
Module wie zum Beispiel<br />
März 2012<br />
254 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Steuerungskompetenzen, Projektmanagement<br />
sowie Informationsund<br />
Kommunikationstechnik. Ein<br />
speziell konzipiertes Einführungsmodul<br />
klärt die wesentlichen<br />
Aspekte einer nachhaltigkeitsorientierten<br />
Energieversorgung, sodass<br />
die Studierenden schon ab der ersten<br />
Studienwoche durch anschauliche<br />
Beispiele mit ihren künftigen<br />
Arbeitsgebieten und Einsatzmöglichkeiten<br />
vertraut werden. Am<br />
Ende des Semesters testen mündliche<br />
oder schriftliche Prüfungen<br />
oder eine Mischung das Erlernte.<br />
Jedes Modul ist mit Credit Points<br />
versehen. Ein Credit Point steht für<br />
einen Zeitaufwand von 30 Stunden,<br />
der sich aus Anwesenheit bei Lehrveranstaltungen,<br />
Praxiszeiten und<br />
Lernphasen für Prüfungsvorbereitungen<br />
zusammensetzt. In den sieben<br />
Semestern Regelstudienzeit<br />
sammeln die Studierenden insgesamt<br />
210 Credit Points, gleichmäßig<br />
über den gesamten Zeitraum verteilt.<br />
Parallel dazu spezialisieren sich<br />
die Studierenden ab dem vierten<br />
Semester auf die Schwerpunkte<br />
Regenerative Energien, Energieanlagen<br />
und Infrastruktursysteme<br />
oder Gebäudetechnik. Im fünften<br />
Semester bietet sich dann die Möglichkeit,<br />
ein Praxissemester im Inoder<br />
Ausland zu verbringen und<br />
wertvolle praktische Erfahrungen<br />
Das Turbinenrad eines<br />
<strong>Wasser</strong>kraftwerks.<br />
© Paul-Georg Meister/pixelio.de<br />
zu sammeln. Am Ende des Studiums<br />
stehen die Bachelor-Arbeit und die<br />
Abschlussprüfungen.<br />
Teamplayer erwünscht<br />
Von einem jungen „Bachelor of<br />
Engineering“ erwartet der Arbeitsmarkt<br />
ganz selbstverständlich<br />
bestimmte fachliche Fähigkeiten:<br />
naturwissenschaftliche Kenntnisse<br />
wie Physik, Chemie und Mathematik<br />
sowie ingenieurwissenschaftliches<br />
Know-how wie Energiesysteme<br />
oder Anlagentechnik. Ebenso<br />
wichtig sind Managementfähigkeiten.<br />
Hierzu zählen betriebswirtschaftliches<br />
und strategisches<br />
Know-how ebenso wie Kenntnisse<br />
in Produktgestaltung und Dienstleistungsmanagement.<br />
Darüber<br />
hinaus sind individuelle, persönliche<br />
Stärken ein wichtiges Argument.<br />
Denn in „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“ geht es<br />
um Projektmanagement, und hier<br />
ist klar: Nur Teamplayer sind erfolgreiche<br />
„Bachelor of Engineering“. Sie<br />
verstehen es, in einer Gruppe zu<br />
agieren, Kolleginnen und Kollegen<br />
zu motivieren, um gemeinsam Prozesse<br />
kreativ zu gestalten. Auf die<br />
Stärkung solcher sozialen Kompetenzen<br />
legt die Hochschule Hamm-<br />
Lippstadt von Anfang an großen<br />
Wert. So stehen neben den naturwissenschaftlichen<br />
Fächern auch<br />
Seminare in Projektmanagement,<br />
Teamarbeit und interkulturellem<br />
Arbeiten auf dem Programm.<br />
Förderung für<br />
gute Leistungen<br />
Das Studium an der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt ist gebührenfrei,<br />
lediglich der Semesterbeitrag ist<br />
halbjährlich zu entrichten. Aus diesem<br />
Beitrag wird zum Beispiel das<br />
NRW-Semesterticket finanziert. Darüber<br />
hinaus besteht für Studierende<br />
der Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
die Möglichkeit, sich um ein Stipendium<br />
zu bewerben. Finanziert werden<br />
Stipendien vom Land Nordrhein-Westfalen,<br />
von der Akademischen<br />
Gesellschaft Hamm, von der<br />
Akademischen Gesellschaft Lippstadt<br />
sowie von Unternehmen aus<br />
der Region. Zu beachten ist allerdings,<br />
dass die Anzahl der Stipendien<br />
begrenzt ist und keine Garantie<br />
auf die Gewährung einer finanziellen<br />
Unterstützung besteht.<br />
Abschluss mit Zukunft<br />
Der erfolgreiche Abschluss als<br />
„Bachelor of Engineering“ öffnet ein<br />
weites Feld an Möglichkeiten. Der<br />
Absolvent kann mit einem Master-<br />
Studium seine wissenschaftliche<br />
Karriere fortführen, oder in der Praxis<br />
als Ingenieurin oder Ingenieur<br />
durchstarten, zum Beispiel in Bereichen<br />
wie Bau, Betrieb oder Genehmigung<br />
umweltgerechter Energieanlagen<br />
oder in der Optimierung<br />
bei der Energiebeschaffung für<br />
Industrie, Gewerbe und Kommunen.<br />
Auch die Steuerung eines effizienten<br />
und ressourcenschonenden<br />
Energieeinsatzes in Produktionsprozessen<br />
oder die Entwicklung innovativer<br />
Vermarktungsmodelle von<br />
Energiedienstleistungen sind typische<br />
Tätigkeiten. Ob als Energiemanagerin<br />
oder Energiemanager<br />
in Versorgungsunternehmen, bei<br />
Energiedienstleistern, in öffentlichen<br />
Bereichen, bei Beratungsunternehmen,<br />
in Planungsbüros oder<br />
in der Wissenschaft – dem „Bachelor<br />
of Engineering“ stehen alle Wege<br />
offen.<br />
Weitere Informationen<br />
Der Studiengang „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
wird an der Hochschule Hamm-<br />
Lippstadt auf dem Campus Hamm gelehrt. Dort<br />
gibt es Beratungsangebote für Studieninteressierte:<br />
Allgemeine Studienberatung im Campus Office Hamm<br />
Öffnungszeiten:<br />
montags, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr<br />
und von 13 bis 16 Uhr oder nach individueller Absprache<br />
Ehemalige Paracelsus-Kaserne,<br />
Peter-Röttgen-Platz 10,<br />
59063 Hamm,<br />
Tel. +49 (0) 2381 8789-211,<br />
E-Mail: campusoffice@hshl.de<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 255
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Weit mehr als ein kleiner Ausflug in die Arbeitswelt<br />
Spannende Perspektiven im Praxissemester „Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung“<br />
Studium mit Praxisbezug – das ist die Maxime der Hochschule Hamm-Lippstadt. Nicht nur in den Vorlesungen<br />
wird der Anwendungsbezug hervorgehoben, auch ein ganzes Semester ist eigens für den Schritt in die<br />
echte Arbeitswelt reserviert. So betreute der angehende Energietechniker Tobias Lodenkemper im Praktikum<br />
die innovative Anlage zur Wärmegewinnung in Walstedde.<br />
Tobias Lodenkemper (2. v. re.) im Praxissemester bei der Stadt Drensteinfurt. © HSHL<br />
Es war vor allem das einzigartige<br />
Projekt zur Wärmegewinnung an<br />
der Walstedder Pumpstation, das<br />
Tobias Lodenkemper in seinem Praxissemester<br />
bei der Stadt Drensteinfurt<br />
faszinierte. Die Anlage kombiniert<br />
eine thermische Solaranlage<br />
mit einer Hybridwärmepumpe, die<br />
aus der Temperatur des <strong>Abwasser</strong>s<br />
und der Abluft der Kompressoren<br />
im Pumpwerk Energie gewinnt.<br />
Diese Energie wird für Heizung und<br />
Brauchwasser in der angrenzenden<br />
Sportanlage sowie zukünftig im<br />
Feuerwehrgerätehaus genutzt. Der<br />
Praktikumsbetreuer Prof. Dr. Marcus<br />
Kiuntke erklärt: „Die gleichzeitige<br />
Nutzung von drei verschiedenen<br />
Energiequellen macht die Anlage zu<br />
einem innovativen Pilotprojekt, welches<br />
die Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
wissenschaftlich begleitet. Ich<br />
freue mich, dass wir mit Herrn<br />
Lodenkemper einen engagierten<br />
Studenten für dieses Projekt gewinnen<br />
konnten.“<br />
Für den 22-jährigen angehenden<br />
Ingenieur aus Ahlen waren die<br />
unterschiedlichen Bestandteile der<br />
Anlage zunächst eine Herausforderung:<br />
„Hier waren nicht nur die<br />
Inhalte einer einzigen Vorlesung<br />
gefragt. Ich musste gedankliche<br />
Zusammenhänge zwischen ganz<br />
verschiedenen Fächern herstellen<br />
und die Anlage als Ganzes verstehen<br />
lernen. Erst dann kann man die<br />
Komponenten sinnvoll steuern.“<br />
Seine Aufgabe war es, die aufgezeichneten<br />
Mess- und Temperaturdaten<br />
auszuwerten und den Betrieb<br />
der Anlage zu optimieren. Abhängig<br />
von Außentemperatur und<br />
anderen Bedingungen gilt es,<br />
Schwellenwerte zu definieren, die<br />
grundlegend für die automatische<br />
Regelung der Anlage sind. Reicht<br />
zum Beispiel die Leistung der Solaranlage<br />
im Winter durch das wenige<br />
Sonnenlicht nicht aus, muss stärker<br />
auf die Hybridwärmepumpe zu -<br />
rückgegriffen werden. Die Programmierung<br />
der Anlage wird so auf<br />
Grundlage der Messdaten immer<br />
weiter verfeinert und ihr Wirkungsgrad<br />
erhöht.<br />
Einer von vielen Effekten<br />
Die fachliche Weiterbildung ist aber<br />
für Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing.<br />
Torsten Cziesla nur einer von vielen<br />
positiven Effekten des Praxissemesters:<br />
„Die Zeit im Unternehmen gibt<br />
den Studierenden einen ersten Einblick<br />
in ihr späteres Berufsfeld. Es<br />
dient natürlich der Vertiefung<br />
erlernter Inhalte. Aber es ist auch<br />
ganz pragmatisch der oftmals erste<br />
Kontakt mit der Arbeitswelt. Erfahrungen<br />
mit der Zusammenarbeit im<br />
Team, mit der Organisation von<br />
Arbeitsabläufen und Projekten und<br />
mit dem ganz normalen Berufsalltag<br />
spielen eine wichtige Rolle<br />
bei der Vorbereitung auf die Zeit<br />
nach dem Abschluss.“ Darüber hinaus<br />
ist das Praxissemester nicht nur<br />
als Ausflug in die Arbeitswelt zu verstehen,<br />
der nach einem Semester<br />
beendet ist. Im Idealfall wird das<br />
Engagement im Anschluss fortgesetzt<br />
und das Thema in Projektarbeiten<br />
und gegebenenfalls sogar<br />
in der abschließenden Bachelor-<br />
März 2012<br />
256 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
arbeit aufgegriffen. Auch Tobias<br />
Lodenkemper kann sich vorstellen,<br />
nach dem Ende seines Praktikums<br />
weiter an dem Projekt zu arbeiten:<br />
„Im Sommer herrschen ganz andere<br />
Bedingungen für den Betrieb der<br />
Anlage. Die Daten müssen mindestens<br />
über eine Messperiode von<br />
einem Jahr ausgewertet werden,<br />
um eine optimale Programmierung<br />
und sinnvolle Ansteuerung der<br />
Energiequellen zu ermöglichen. Ich<br />
möchte hier gerne noch weiter mitmachen,<br />
weil ich das Thema spannend<br />
finde.“ Paul Berlage, Bürgermeister<br />
von Drensteinfurt, freut sich<br />
auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit<br />
von Stadt und Hochschule:<br />
„Das Projekt hat viel Potenzial,<br />
und gemeinsam können wir<br />
hier echte Pionierarbeit leisten.“<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.hshl.de<br />
Vom Studenten zum Experten<br />
Praxissemester bietet erste Einblicke in die Arbeitswelt<br />
Als einer der ersten Studierenden in „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“ verbrachte der angehende<br />
Energietechniker Alexander Harbach sein Praxissemester bei der Unternehmensberatung B.A.U.M. Consult<br />
und beriet Unternehmen in Sachen Energiemanagement.<br />
Alexander Harbach ist die Nummer<br />
Eins – so steht es zumindest<br />
auf seinem Studentenausweis.<br />
Er war 2009 der allererste Student,<br />
der sich im Studiengang „Energietechnik<br />
und Ressourcenoptimierung“<br />
der HSHL eingeschrieben<br />
hatte. Genau wie seine Kommilitoninnen<br />
und Kommilitonen gehört<br />
er daher zu den „Pionieren“ auf dem<br />
Campus, die gerade das fünfte<br />
Semester vollenden und die im<br />
Lehrplan vorgesehene Praxisphase<br />
abschließen. Der 22-jährige Hammer<br />
hat für den Schritt von der Theorie<br />
zur Praxis eine Unternehmensberatung<br />
gewählt, die sich Fragen<br />
der Energie und Nachhaltigkeit widmet:<br />
die Niederlassung der B.A.U.M.<br />
Consult GmbH in Hamm. Bereits im<br />
ersten Semester, als Johannes Auge,<br />
Geschäftsführer von B.A.U.M. Consult,<br />
zum Gastvortrag in eine Vorlesung<br />
kam, entdeckte Alexander<br />
Harbach das Unternehmen als mögliche<br />
Perspektive für sich. Zwei Jahre<br />
später bewarb er sich mit Erfolg für<br />
ein Praktikum.<br />
Die Entscheidung hat der angehende<br />
Energietechniker nicht<br />
bereut. „Ich möchte kein typischer<br />
Ingenieur werden, der hauptsächlich<br />
an Sachen rumschraubt. Mich<br />
haben die betriebswirtschaftlichen<br />
Zusammenhänge und der Mehrwert<br />
für die Unternehmen interessiert.<br />
Die Tätigkeit in der Unternehmensberatung<br />
ist daher genau das<br />
Richtige für mich“, erklärt Harbach.<br />
Konkret arbeitete der Student in<br />
einer Projektgruppe mit, die Unternehmen<br />
bei der Umsetzung der<br />
sogenannten ISO 50001 berät. Diese<br />
internationale Norm sieht die Einführung<br />
eines betrieblichen Energiemanagement-Systems<br />
zur Erlangung<br />
von Steuervorteilen vor. Rund<br />
zweimal wöchentlich war er im Rahmen<br />
des Projekts in Unternehmen<br />
vor Ort, konnte so einen unmittelbaren<br />
Eindruck von der Praxis<br />
bekommen und viele Kontakte<br />
knüpfen. Dabei machte er auch die<br />
Erfahrung, dass der Fachkräftemangel<br />
bereits Auswirkungen zeigt: Die<br />
Unternehmen kamen auf ihn zu, um<br />
sich als potenzielle Arbeitgeber vorzustellen.<br />
Die Zusammenarbeit<br />
wird fortgesetzt<br />
Durch das Studium fühlte Alexander<br />
Harbach sich gut vorbereitet für das<br />
Praktikum: „Die technischen Grund-<br />
Von links:<br />
Maura<br />
Schnappauf,<br />
Marketing<br />
B.A.U.M.<br />
Consult GmbH,<br />
Alexander<br />
Harbach und<br />
Johannes<br />
Auge,<br />
Geschäftsführer<br />
B.A.U.M.<br />
Consult GmbH.<br />
© HSHL<br />
<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 257
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Über die ISO 50001<br />
Energiemanagement bedeutet die systematische<br />
Planung, Durchführung und Optimierung des<br />
Energieeinsatzes im Unternehmen mit dem Ziel<br />
einer kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz<br />
und der Reduzierung der Energiekosten<br />
und Umweltbelastungen. Mit einem Energiemanagementsystem<br />
nach ISO 50001 bzw. DIN 16001<br />
wird das Energiemanagement um erforderliche<br />
Organisations- und Informationsstrukturen, einschließlich<br />
der hierzu benötigten technischen<br />
Hilfsmittel wie Hard- und Software, ergänzt.<br />
Ziel ist es, die Energieeffizienz mittels einer<br />
übergeordneten Organisationsstruktur zu steigern,<br />
die Außendarstellung gegenüber Kunden<br />
und Abnehmern zu verbessern und einen Imagegewinn<br />
zu erzielen.<br />
lagen waren natürlich wichtig für<br />
mich. Aber auch die Soft Skills, die<br />
ich in den Veranstaltungen aus dem<br />
Bereich Steuerungskompetenzen<br />
erlernt habe, konnte ich gut gebrauchen.“<br />
Dazu gehören zum Beispiel<br />
technisches Englisch sowie die<br />
Umgangstipps aus den verschiedenen<br />
Workshops zur Berufsvorbereitung.<br />
Geschäftsführer Johannes<br />
Auge war von der Arbeit des Studenten<br />
so überzeugt, dass er ihm eine<br />
Fortsetzung der Zusammenarbeit<br />
angeboten hat. Die Projektarbeit, die<br />
im sechsten Semester ansteht, wird<br />
Alexander Harbach daher über die<br />
Vorteile für Firmen bei der Einführung<br />
von Energiemanagement-Systemen<br />
schreiben und sich weiter in<br />
dem Projekt engagieren.<br />
Die Partnerschaft zwischen<br />
B.A.U.M. Consult und der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt, die sich<br />
bereits im Rahmen der Ökoprofit-<br />
Zertifizierung bewährt hat, wird so<br />
künftig weiter vertieft. Johannes<br />
Auge: „Wer bei uns arbeitet, ist bisher<br />
meist Quereinsteiger. Mit dem<br />
Studiengang ‚Energietechnik und<br />
Ressourcenoptimierung‘ werden<br />
aber jetzt direkt vor Ort Spezialisten<br />
ausgebildet, die gut zu uns passen.<br />
Die Vernetzung zwischen<br />
Hochschule und unserem Unternehmen<br />
bietet daher Vorteile für<br />
beide Seiten.“<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.hshl.de<br />
Big City Life auf Chinesisch<br />
Was gibt‘s Neues an der Hochschule Hamm-Lippstadt? Der HSHL-Blog berichtet direkt<br />
vom Puls der Hochschule<br />
Innovativ, dynamisch, jung – auch online präsentiert sich die Hochschule Hamm-Lippstadt mit spannenden<br />
Projekten, News und einem eigenen Blog. Hier können Studierende, Dozenten und Interessierte neueste Entwicklungen<br />
und persönliche Eindrücke online verfolgen. Gebloggt wird über Studienausflüge, internationale<br />
Kooperationen und Aktuelles aus dem Unternehmensnetzwerk, direkt aus dem Praxissemester ebenso wie<br />
über Auslandsaufenthalte zum Beispiel in China. Im Folgenden ein Auszug aus dem Erlebnisbericht des<br />
Studenten „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“, Peter Swietek, der zusammen mit vier weiteren<br />
Kommilitonen Auslandserfahrungen in Chongqing sammelte.<br />
Die ersten vier Wochen China liegen<br />
hinter uns – Zeit für einen<br />
Bericht, wie es uns ergangen ist.<br />
Nach mehr oder weniger tränenreichem<br />
Abschied am Hammer Bahnhof<br />
ging es los nach Düsseldorf und<br />
von dort mit dem Flieger über<br />
Umwege nach Chongqing. Schlaflose<br />
19 Stunden später verließen<br />
wir das Flugzeug und wurden von<br />
runden 40 °C und gefühlten<br />
100 % Luftfeuchtigkeit empfangen.<br />
Alex, unser chinesischer Ansprechpartner,<br />
und sein Fahrer warteten<br />
schon. Die Fahrt im Bulli zur Universität<br />
als abenteuerlich zu bezeichnen,<br />
wäre untertrieben: Das Einzige,<br />
was auf chinesischen Straßen gilt,<br />
ist die Klang- und die Lichthupe.<br />
Wer sie benutzt, darf alles: rechts<br />
überholen, links überholen – egal.<br />
Die Skyline<br />
von<br />
Chongquing.<br />
© Klaus-Uwe<br />
Gerhardt<br />
pixelio.de<br />
Die erste Mahlzeit:<br />
Entensuppe am Stück<br />
So eine Fahrt macht hungrig, wir<br />
hielten an, um uns zu stärken. Alex<br />
bestellte für uns Entensuppe: In der<br />
Mitte ein Topf mit Suppe und zwei<br />
Enten (Kopf und Füße waren noch<br />
März 2012<br />
258 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
vorhanden), dann warf man ganz<br />
viel Gemüse und andere unbekannten<br />
Lebensmittel hinein, zehn Minuten<br />
kochen lassen und fertig war die<br />
erste Mahlzeit in China. Man muss<br />
sagen, es war eigentlich ziemlich<br />
lecker, aber natürlich wie fast alles<br />
andere hier sehr scharf.<br />
An der Uni angekommen, halfen<br />
uns vier chinesische Studenten,<br />
unsere Koffer in die dritte Etage des<br />
Wohnheims zu tragen – unter Beobachtung<br />
hunderter chinesischer<br />
Augenpaare. Ausländische Studierende<br />
sind hier echte Exoten. Beeindruckt<br />
waren wir vom Campus. Die<br />
Universität besteht schon seit 1950<br />
und muss Freizeitmöglichkeiten für<br />
ca. 20 000 Studenten bieten. Daher<br />
ist sie ausgestattet mit Basketball-,<br />
Badminton-, Tennisfeldern, einer<br />
PingPong-Halle, einem großem<br />
Fußballfeld und einem Kletterpark.<br />
Ein kleiner See rundet das schöne<br />
Gelände ab. Besinnlich wird es aber<br />
eher selten: Alle Studierenden müssen<br />
im Wohnheim leben, das heißt,<br />
dass man von morgens bis abends<br />
durchgehend von sehr vielen Menschen<br />
umgeben ist.<br />
Do you understand mich?<br />
Die erste Nacht endete unsanft – wir<br />
wurden von lauten militärischen<br />
Rufen geweckt. Man muss wissen:<br />
Alle neuen Studierenden müssen<br />
hier die ersten 14 Tage Disziplin und<br />
Gehorsam lernen, in dem sie den<br />
ganzen Tag marschieren, parieren<br />
und Kampfübungen ausführen. Erst<br />
danach fängt das Studium richtig<br />
an. Wir mussten zum Glück nicht<br />
daran teilnehmen und kümmerten<br />
uns zunächst mal um einen Internetzugang<br />
für die Verbindung nach<br />
„good old Germany“.<br />
Nach drei Tagen begann auch<br />
schon unser erster Deutschunterricht.<br />
Jeder von uns bekam zwei<br />
Klassen, die er dreimal wöchentlich<br />
in Phonetik (Hörverstehen) unterrichten<br />
muss. Die Klassen bestehen<br />
aus bis zu 20 Studierenden, die<br />
schon ein bis zwei Jahre Deutsch<br />
gelernt haben. Trotzdem ist die Verständigung<br />
für uns nicht leicht: mit<br />
einem Mix aus Deutsch und Englisch,<br />
also Denglisch, haben wir es<br />
bisher aber immer geschafft, unsere<br />
Aufgaben zu erklären.<br />
Rettungsinsel Pizza Hut<br />
Nach zwei Wochen im Mikrokosmos<br />
Uni fühlten wir uns dann bereit für<br />
die große Stadt und machten uns<br />
erstmals auf in die City von<br />
Chongqing. Also wieder ab in den<br />
Bulli, diesmal begleitet von Bruno,<br />
einem unserer Schüler. Man weiß als<br />
Deutscher nicht, wie das funktionieren<br />
soll, aber hier in China schafft<br />
man es, aus einer dreispurigen<br />
Hauptstraße eine achtspurige zu<br />
machen, ohne mehr oder weniger<br />
den Verkehr lahm zu legen. In<br />
Chongqing angekommen, machten<br />
wir uns auf zur kulinarischen Rettungsinsel<br />
„Pizza Hut“ und aßen uns<br />
richtig satt. Dann besichtigten wir<br />
die Stelle, die ausschlaggebend war<br />
für die Errichtung der Stadt: Die Einmündung<br />
des Jialing in den Jangtsekiang.<br />
Zwei große Flüsse, die sich<br />
am westlichen Rand der Innenstadt<br />
treffen. Einige touristische Sehenswürdigkeiten<br />
später nahmen wir<br />
ein Taxi zurück zum Wohnheim – da<br />
die Eindrücke doch recht überwältigend<br />
waren, waren wir froh, als wir<br />
schließlich in unseren Betten lagen.<br />
Besonders gefällt uns an China,<br />
dass die Menschen so freundlich<br />
und hilfsbereit sind. Hier wird alles<br />
dafür getan, dass wir uns wohlfühlen.<br />
Deshalb freuen wir uns auf die<br />
nächsten Monate und auf alles, was<br />
wir hier noch erleben werden. Und<br />
wenn man erst einmal weiß, was<br />
man wo essen kann, fällt es auch<br />
leichter, sich auf andere Dinge als<br />
Nahrungsaufnahme zu konzentrieren<br />
und das Leben in China zu<br />
genießen.<br />
Fünf Studenten der „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
in China (von links): Jens Serowy,<br />
Peter Swietek, Michael Martin, Jan Spieckerhoff und<br />
Sefan Arslan erkunden Chongqing. © HSHL<br />
Student Jan Spieckerhoff testet das Klangerlebnis<br />
eines typisch chinesischen Schlaginstruments.<br />
© HSHL<br />
Ausländische Studierende sind in China echte<br />
Exoten. © HSHL<br />
Wie die Geschichte<br />
weitergeht?<br />
Die Erlebnisse der HSHL-Studenten in<br />
China und viele weitere spannende<br />
Berichte aus dem Leben in und um die<br />
HSHL herum, finden sich unter www.<br />
hshl.de/hshl-blog. Ein Blick lohnt<br />
immer, denn die Blogs werden regelmäßig<br />
und in kurzen Abständen aktualisiert.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.hshl.de/hshl-blog<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 259
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Weltoffen, anspruchsvoll – und nah dran<br />
an der Wirtschaft<br />
Die Hochschule Hamm-Lippstadt stellt sich vor<br />
Im Jahr 2009 gegründet, zählt die junge Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) zu den insgesamt drei neuen<br />
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Praxisorientiert und in kleinen Gruppen absolvieren Studierende<br />
hier ihr Studium auf hohem Niveau.<br />
Die Lehre der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt ist nah dran<br />
an den Anforderungen des Marktes,<br />
das Team der Professorinnen und<br />
Professoren ist praxiserfahren und<br />
jung. Interdisziplinär aufgestellt,<br />
konzentrieren sich die Lehre auf die<br />
Förderung individueller Stärken<br />
und die Vermittlung sozialer Kompetenzen.<br />
Projektorientiertes Arbeiten<br />
hat von Anfang an einen hohen<br />
Stellenwert. Nicht zuletzt sind Kreativität<br />
und Kommunikation wichtige<br />
Faktoren, um Ingenieurinnen<br />
und Ingenieure auf die Zukunft vorzubereiten.<br />
Offenheit und Toleranz, An -<br />
spruch und Teamgeist werden hier<br />
großgeschrieben. Das junge Hochschulteam<br />
blickt über den Tellerrand,<br />
nimmt Herausforderungen als<br />
kreative Aufgabe und freut sich auf<br />
einen intensiven, partnerschaftlichen<br />
Austausch mit der Wirtschaft.<br />
Die schlanke Organisation bietet in<br />
allen Bereichen einen schnellen,<br />
unkomplizierten Service. Sportliche<br />
Angebote und Unterstützung für<br />
junge Familien eröffnen viele Möglichkeiten.<br />
Die eigene e-Bibliothek<br />
ist 24 Stunden am Tag an 365 Tagen<br />
im Jahr von jedem Ort der Welt aus<br />
erreichbar.<br />
Die Studiengänge<br />
Neben „Energietechnik und Ressourcenoptimierung“<br />
bietet die<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt derzeit<br />
folgende Studiengänge an:<br />
""<br />
„Biomedizinische Technologie“<br />
""<br />
„Wirtschaftsingenieurwesen“<br />
""<br />
„Mechatronik“ (auch dual studierbar)<br />
""<br />
„Technisches Management und<br />
Marketing“<br />
""<br />
„Computervisualistik und<br />
Design“<br />
Das Team<br />
Das stetig wachsende Team der<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt wird<br />
vom Präsidium geleitet: Präsident<br />
ist Prof. Dr. Klaus Zeppenfeld, er gibt<br />
die inhaltliche Richtung vor und ist<br />
Ansprechpartner für alle Fragen<br />
rund um Lehre, Forschung und<br />
Transfer. Karl-Heinz Sandknop ist als<br />
Vizepräsident für die gesamte Verwaltung<br />
und alle organisatorischen<br />
Fragen verantwortlich.<br />
Die Hochschule<br />
wächst weiter<br />
Neue Studiengänge, die das bisherige<br />
Angebot ergänzen, werden<br />
derzeit entwickelt. Gleichzeitig werden<br />
in Hamm und in Lippstadt Neubauten<br />
für 2500 Studienplätze<br />
errichtet. Mit Beginn des Wintersemesters<br />
2013/14 wird der Studienbetrieb<br />
dann in den neuen Campusbauten<br />
starten. Ob als Bachelor<br />
und Master oder Professional, also<br />
berufsbegleitende Weiterbildung:<br />
Die Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
bringt junge, kreative und hochqualifizierte<br />
Ingenieurinnen und Ingenieure<br />
hervor, die dank ihrer praxisnahen<br />
Kompetenzen von besten<br />
Karrierechancen profitieren.<br />
Weitere Informationen bei:<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt,<br />
Tel. +49 (0) 2381 8789-0,<br />
E-Mail: info@hshl.de<br />
Innovativ und zukunftsnah: Prof. Cziesla erklärt Studierenden<br />
die Stromtankstelle des Campus für das hochschuleigene<br />
Elektroauto, das auch in der Lehre eingesetzt wird. © HSHL<br />
Mit jedem Semester wächst die Hochschule weiter. Immer<br />
mehr Studenten lauschen gebannt den Vorlesungen und<br />
Vorträgen. © HSHL<br />
März 2012<br />
260 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Wachstum, das die Zukunft bestimmt<br />
Das Leben und Studieren an der Hochschule Hamm-Lippstadt erstreckt sich auf zwei Campus, zum einen in<br />
Hamm, zum anderen in Lippstadt. Ein kurzer Überblick:<br />
Der Campus in Hamm:<br />
Auf dem weitläufigen und grünen<br />
Gelände des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses<br />
in Hamm entstehen<br />
derzeit Neubauten für bis zu<br />
2000 Studierende. Dabei orientieren<br />
sich Architektur und Raumprogramm<br />
an den Anforderungen<br />
eines modernen Bildungs- und Forschungsinstitutes:<br />
Lernwelten spiegeln<br />
die praxisorientierten Studiengänge<br />
wider; die bewusst offen<br />
<br />
Dieser Entwurf zeigt, wie das<br />
endgültige Campusgelände in<br />
Hamm aussehen soll. © HSHL<br />
Die Lehrenden des Bereichs Energietechnik stellen sich vor<br />
Prof. Dr. Peter Britz<br />
Professur<br />
Rationelle Energieverwendung<br />
Arbeits- und<br />
Forschungsschwerpunkte:<br />
Rationelle<br />
Energieverwendung<br />
Energieberatung<br />
Zukunftstechnologien<br />
Energieeffizienztechnologien<br />
Prof. Dr. Peter Britz studierte Technische Chemie an der<br />
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)<br />
Aachen und promovierte anschließend am Max-Planck-Institut<br />
für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr an im<br />
Bereich der Katalysatorentwicklung für Brennstoffzellen.<br />
Sein beruflicher Werdegang führte ihn in den Automotiveund<br />
Energietechnikbereich, wo er sich der Entwicklung der<br />
Brennstoffzellentechnologie für die automobile Anwendung<br />
und der Einsatzmöglichkeit dieser Technologie als<br />
Kraft-Wärmeanlagen widmete. Darüber hinaus gehörte die<br />
Entwicklung neuer Verfahren und Apparate zur dezentralen,<br />
energieeffizienten Gewinnung von <strong>Wasser</strong>stoff im stationären<br />
Bereich zu seinen Aufgabenfeldern.<br />
Am 1. Oktober 2011 übernahm er die Professur „Rationelle<br />
Energieverwendung“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt.<br />
Prof. Dr. Dieter Bryniok<br />
Professur<br />
Umweltbiotechnologie<br />
Arbeits- und<br />
Forschungsschwerpunkte:<br />
Bioenergie<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Stoffkreisläufe<br />
Biologischer Schadstoffabbau und Biokatalyse<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung und <strong>Wasser</strong>management<br />
Abluftreinigung, <strong>Abwasser</strong>reinigung, Bodenund<br />
Grundwassersanierung<br />
Prof. Dr. Dieter Bryniok absolvierte sein Diplomstudium der<br />
Physik und Biologie an der Universität Tübingen und legte dort<br />
anschließend seine Promotion ab. Beruflich widmet er sich am<br />
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik<br />
(IGB) seit Jahren dem Fachgebiet Umweltbiotechnologie. So<br />
war er am IGB u. a. zuständig für den Aufbau des Fraunhofer<br />
Center for Energy and Environment im US-amerikanischen<br />
Pittsburg und Leiter des Fraunhofer Demonstrationszentrums<br />
für Prozesse integrierter Umwelttechnik in Stuttgart. Seit 2007<br />
ist er Geschäftsführer der Fraunhofer-Allianz Sys<strong>Wasser</strong>. Mit<br />
seiner Expertise steht er seit dem 1. September 2010 zusätzlich<br />
den Studierenden der Hochschule Hamm-Lippstadt als Professor<br />
für Umweltbiotechnologie zur Verfügung.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 261
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
angelegten Kommunikationszonen<br />
sind Treffpunkte für Lehrende und<br />
Studierende.<br />
Schon seit dem Start der<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt im Mai<br />
2009 werden Räume auf dem<br />
Gelände der ehemaligen Paracelcus-<br />
Kaserne genutzt. Zudem steht hier<br />
eine Mensa, die während der Vorlesungszeiten<br />
Snacks und täglich<br />
wechselnde warme Gerichte bietet.<br />
Ab dem Wintersemester 2013/2014<br />
wird der neue Campus auf dem<br />
Gelände des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses<br />
an der Marker<br />
Allee schrittweise bezogen. Die<br />
Abbrucharbeiten des alten Gebäudes<br />
wurden 2011 beendet, sodass im<br />
Frühjahr 2012 mit dem ersten Spatenstich<br />
der Baubeginn gefeiert wird.<br />
Den Generalplaner-Wettbewerb<br />
für den neuen Campus<br />
Hamm entschied das pbr Planungsbüro<br />
Rohling aus Osnabrück<br />
im Juni 2010 für sich. Der Wettbewerb<br />
war vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br />
(BLB) NRW Soest als<br />
Bauherr in enger Abstimmung mit<br />
der Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
und der Stadt Hamm ausgeschrieben<br />
worden.<br />
Auf dem neuen Campus Hamm<br />
entstehen:<br />
""<br />
ca. 400 studentische<br />
Arbeitsplätze<br />
""<br />
Hörsäle und Seminarräume<br />
""<br />
Büros und Arbeitswelten inkl.<br />
großer Kommunikationsflächen<br />
für die Departments<br />
""<br />
Grundlagenlabore mit<br />
Com puter-Pool und physikalisch-technische<br />
Labore<br />
""<br />
Technikum und Hallen<br />
""<br />
Laborpool für Lehre und<br />
Forschung mit Lager usw.<br />
""<br />
Medienzentrum,<br />
Rechenzentrum und Bibliothek<br />
""<br />
Zentrale Infrastruktur, Metallund<br />
Elektrowerkstätten<br />
""<br />
Zentrale Verwaltungsräume<br />
und Campus Office<br />
""<br />
Fläche für Deans, AStA,<br />
Fachschaften<br />
""<br />
Mensa<br />
Die Lehrenden des Bereichs Energietechnik stellen sich vor<br />
Prof. Dr.-Ing. Marcus Kiuntke<br />
Professur<br />
Bioenergieingenieurwesen<br />
mit Schwerpunkt Biogas<br />
Arbeits- und<br />
Forschungsschwerpunkte:<br />
Biogas: Anlagentechnik<br />
und Prozessoptimierung<br />
Beratung zum Thema regenerative<br />
Energiesysteme<br />
Anwendungen von Strömungsmaschinen<br />
in der Energietechnik<br />
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen<br />
Rohrleitungsgebundene Infrastruktursysteme<br />
Prof. Dr.-Ing. Marcus Kiuntke absolvierte sein Diplomstudium<br />
zum Verfahrensingenieur mit dem Schwerpunkt<br />
mechanische und biologische Verfahrenstechnik an der<br />
Technischen Universität Clausthal, wo er später auch<br />
seine Dissertation vorlegte. Als Experte mit jahrelanger<br />
Berufserfahrung im Anlagenbau und in der Entwicklung<br />
von Verfahrenstechniken in den Bereichen Biogas, Gülleund<br />
Gärsubstrate-Verarbeitung verantwortete er zuletzt als<br />
Technischer Leiter die Projektplanung und Produktentwicklung<br />
von Biogasanlagen bei der Firma BD Agro Renewables<br />
GmbH & Co. KG, die zur international operierenden<br />
Unternehmensgruppe Big Dutchman gehört. Zum 1.<br />
Januar 2011 hat er die Professur „Bioenergieingenieurwesen<br />
mit Schwerpunkt Biogas“ an der Hochschule Hamm-<br />
Lippstadt angetreten.<br />
Prof. Dr.-Ing. Uwe Neumann<br />
Professur Elektrische<br />
Energieversorgung und<br />
Smart Grids<br />
Arbeits- und<br />
Forschungsschwerpunkte:<br />
Elektrische Energieversorgungsnetze<br />
Auswirkungen dezentraler (regenerativer)<br />
Energieerzeugung auf Versorgungsnetze<br />
Infrastruktursysteme in der Energieversorgung (insb. Smart<br />
Grids)<br />
Integration von Speichertechnologien<br />
und Elektromobilität<br />
Workforce Management<br />
(Strategisches) Asset Management<br />
Prof. Dr.-Ing. Uwe Neumann studierte Elektrotechnik mit<br />
Schwerpunkt Energietechnik an der Universität Dortmund<br />
und promovierte dort am Lehrstuhl für elektrische Energieversorgung.<br />
Anschließend war er bei IBM als Managing Consultant<br />
im Bereich der Versorgungsunternehmen tätig und hier vor<br />
allem zuständig für die Einführung von Instandhaltungsmanagementsystemen<br />
und die Überwachung der Prozesse im<br />
technischen Netzbetrieb. Als Senior Project Manager bei E.ON<br />
Inhouse Consulting war er verantwortlich für die internen<br />
Bereiche „Netz“ und „Versorgung“. Außerdem gehörte hier<br />
auch das Themenfeld der Smart Grids zu seinem Zuständigkeitsgebiet.<br />
Zum 1. September 2010 übernahm er die Professur<br />
„Elektrische Energieversorgung und Smart Grids“ an der<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt.<br />
März 2012<br />
262 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Der Campus in Lippstadt:<br />
In der Nähe zur historischen Altstadt<br />
mit ihren Kulturangeboten,<br />
Restaurants, Kneipen und Geschäften<br />
wird der geplante Neubau der<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt zentral<br />
und doch im Grünen liegen. In<br />
direkter Nachbarschaft hat der weltweit<br />
tätige Automobilzulieferer<br />
Hella seinen Sitz. Mit rund 6.000<br />
Beschäftigten ist dieses High-Tech-<br />
Unternehmen der größte Arbeitgeber<br />
der Stadt und bietet den Studierenden<br />
schon während des Studiums<br />
beste berufliche Aussichten,<br />
zum Beispiel als Partner im dualen<br />
Studium „Mechatronik“. Der Bahnhof<br />
ist gerade Mal zehn Minuten<br />
Fußweg entfernt. Über die B55 lässt<br />
sich die Autobahn in kurzer Distanz<br />
erreichen. Zudem befindet sich in<br />
Paderborn-Lippstadt ein internationaler<br />
Flughafen.<br />
Am Standort Erwitter Straße, im<br />
Technologiezentrum CARTEC, nutzt<br />
die Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
Räumlichkeiten für den Studiengang<br />
Mechatronik. In einem Gebäude der<br />
Hella an der Lüningstraße finden<br />
Vorlesungen und Übungen der Studiengänge<br />
„Wirtschaftsingenieurwesen“<br />
sowie „Computervisualistik und<br />
Design“ statt. In einem weiteren<br />
separaten Gebäude befinden sich<br />
zahlreiche interdisziplinäre Einrichtungen<br />
und am Standort Südstraße<br />
gegenüber des CARTEC verschiedene<br />
Labore für Forschung und<br />
Lehre. Hier steht zum Beispiel das<br />
Rasterelektronenmikroskop. Zum<br />
Wintersemester 2013/2014 wird der<br />
neue Campus Lippstadt auf der Fläche<br />
des sogenannten „Himmelreich“<br />
eröffnet. Der Baubeginn ist im Frühjahr<br />
2012 vorgesehen.<br />
Den Generalplaner-Wettbewerb<br />
für den neuen Campus Lippstadt<br />
entschied im Juni 2010 das Büro<br />
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky<br />
aus Düsseldorf für sich. Der Wettbewerb<br />
war vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br />
(BLB) NRW Soest als<br />
Bauherr in enger Abstimmung mit<br />
der Hochschule Hamm-Lippstadt<br />
und der Stadt Lippstadt ausgelobt<br />
worden.<br />
Auf dem neuen Campus Lippstadt<br />
entstehen:<br />
""<br />
Hörsäle und Seminarräume<br />
""<br />
ca. 400 studentische<br />
Arbeitsplätze<br />
""<br />
Büros und Arbeitswelten inkl.<br />
großer Kommunikationsflächen<br />
für die Departments<br />
""<br />
Grundlagenlabore mit Computer-Pool<br />
und physikalischtechnische<br />
Labore<br />
""<br />
Technikum und Hallen<br />
""<br />
Laborpool für Lehre und<br />
Forschung mit Lager usw.<br />
""<br />
Medienzentrum,<br />
Rechenzentrum und Bibliothek<br />
""<br />
zentrale Infrastruktur und<br />
Metall- und Elektrowerkstätten<br />
""<br />
zentrale Verwaltungsräume<br />
und Campus Office<br />
""<br />
Räume für Deans, AStA und<br />
Fachschaften<br />
""<br />
Mensa<br />
Weitere Informationen bei:<br />
Hochschule Hamm-Lippstadt,<br />
Tel. +49 (0) 2381 8789-0,<br />
E-Mail: info@hshl.de<br />
Sehen, ausprobieren, verstehen mit dem<br />
„Fahrenden Hörsaal“<br />
Die Hochschule als attraktiven Lebensraum erfahrbar<br />
machen, Berührungsängste gegenüber technischen<br />
und naturwissenschaftlichen Fächern<br />
abbauen, naturwissenschaftliche Disziplinen vernetzen<br />
sowie Nachwuchs fördern und begeistern:<br />
Das sind Aufgaben und Ziele des „Zukunft durch<br />
Innovation“ (zdi)-Laborprogramms der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt. Dabei dreht sich alles um das<br />
stationäre Labor an der Hochschule und den MINT-<br />
Labortruck.<br />
Der „Fahrende Hörsaal“ macht Leben und<br />
Studieren an der HSHL buchstäblich<br />
erfahrbar. © HSHL<br />
Der MINT-Labortruck ist ein mit Sitzplätzen und<br />
Laboreinrichtung ausgestattetes „fahrendes Klassenzimmer“<br />
und besucht auf Wunsch Schulen der<br />
Region. Schülerinnen und Schüler aller Schulformen<br />
können hier ihre naturwissenschaftliche<br />
Neugier und ihr technisches Talent entdecken. In<br />
Demonstrationsvorträgen und Experimenten<br />
erfahren die Kinder und Jugendlichen mehr über<br />
naturwissenschaftliche Phänomene und stellen<br />
Bezüge zu ihrem alltäglichen Umfeld her.<br />
Im Labortruck stellen die Professorinnen, Professoren<br />
und wissenschaftlichen Mitarbeiter die<br />
Fächer Mathematik (M), Informatik (I), Naturwissenschaften<br />
(N) und Technik (T) in ingenieurwissenschaftliche<br />
Zusammenhänge und führen an<br />
die Bachelor-Studiengänge der Hochschule<br />
Hamm-Lippstadt heran.<br />
Immer was los ist auf dem Campus der HSHL – wie hier beim<br />
Lippstädter Pappboot rennen, wobei sich Lehrende mit Studie renden<br />
im ganz realen Umgang mit <strong>Wasser</strong> messen. © HSHL<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.hshl.de/zdi-schuelerlabor/<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 263
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Felchenarten rücken genetisch zusammen<br />
Seendüngung lässt Fischarten weiter verschwinden<br />
Die Überdüngung der Schweizer Seen hat die Zahl der einzigartigen einheimischen Felchenarten in kurzer<br />
Zeit um fast 40 % reduziert. Nur in tiefen und von der übermäßigen Nährstoffzufuhr weniger betroffenen<br />
Alpenrandseen konnten sich die historisch belegten Arten halten. Doch auch sie sind genetisch gesehen näher<br />
zusammengerückt. Das weist eine in der „Nature“ publizierte Studie der Eawag und der Universität Bern nach.<br />
Weitere<br />
Informationen<br />
unter:<br />
www.eawag.ch/<br />
medien/bulletin/<br />
index<br />
Als Speisefisch<br />
sehr beliebt:<br />
der Felchen.<br />
© wrw pixelio.de<br />
Die Vielfalt der Felchenarten<br />
wurde nicht bloß durch den<br />
Verlust an Lebensraum reduziert.<br />
Vielmehr wurde das Artensterben<br />
zum großen Teil durch die Vermischung<br />
einst eigenständiger Arten<br />
verursacht. Verantwortlich dafür war<br />
– so fanden Wissenschaftler der<br />
Eawag und der Universität Bern heraus<br />
– die Überdüngung der Schweizer<br />
Seen zwischen 1950 und 1990:<br />
Weil viele Seen am Grund und im<br />
tiefen <strong>Wasser</strong> kaum noch Sauerstoff<br />
enthielten, fehlten Nischen für Spezialisten,<br />
die in größeren Tiefen fressen<br />
oder sich fortpflanzen. Sie mussten<br />
in seichteres <strong>Wasser</strong> ausweichen.<br />
Dort kreuzten sie sich mit verwandten<br />
Arten und verloren innerhalb<br />
weniger Generationen ihre genetische<br />
und funktionale Einzigartigkeit,<br />
ein Prozess, der auch als „Umkehr<br />
der Artentstehung“ bezeichnet wird.<br />
Ein aktuell in „Nature“ publizierter<br />
Artikel weist nach, dass das Ausmaß<br />
der Düngung nicht nur den Artenrückgang<br />
erklärt, sondern auch dafür<br />
verantwortlich ist, dass die noch<br />
erhaltenen Arten weniger verschieden<br />
wurden. Je höher die Phosphorkonzentrationen<br />
in den 17 untersuchten<br />
Seen kletterten, desto mehr<br />
gingen unter den verbliebenen Felchenarten<br />
die genetische Vielfalt<br />
sowie Spezialisierungen verloren.<br />
„Offensichtlich ist die Umkehr<br />
der Artentstehung deutlich häufiger<br />
als bisher angenommen“, sagt Evolutionsbiologe<br />
Ole Seehausen, Leiter<br />
der Studie. „In kurzer Zeit verschwinden<br />
dabei Arten, die sich<br />
zuvor über Jahrtausende durch<br />
Anpassung an spezielle ökologische<br />
Bedingungen entwickelt haben.“ Für<br />
den Schutz der Biodiversität heißt es<br />
also, nicht nur die bestehenden<br />
Arten zu erhalten, sondern auch die<br />
ökologischen und evolutionären<br />
Prozesse, welche den Spezialisten<br />
das Überleben sichern und zur Entstehung<br />
neuer Arten beitragen.<br />
Felchen unter der Lupe<br />
Das Besondere an den Felchen ist,<br />
dass es im Alpenraum mindestens<br />
25 Seen gibt, in denen eine oder<br />
mehrere endemische Arten leben.<br />
Zudem sind von diesen Felchen<br />
zahlreiche historische Daten und<br />
Gewebeproben erhalten. Nicht nur<br />
weil es begehrte Speisefische sind,<br />
sondern vor allem weil vor 60 Jahren<br />
eine detaillierte Studie die Felchen<br />
aus 17 dieser Seen wissenschaftlich<br />
untersuchte.<br />
Dieselben Seen wurden nun von<br />
Seehausens Doktoranden Pascal<br />
Vonlanthen (Eawag und Universität<br />
Bern) erneut unter die Lupe genommen:<br />
Im Mittel ist die Zahl der<br />
Felchenarten um 38 % zurückgegangen.<br />
In sieben Seen sind die ursprünglichen<br />
Felchenpopula tionen heute<br />
Auch im Bodensee leben<br />
nur noch vier von ehemals<br />
fünf Felchenarten. © Peter Wetzel pixelio.de<br />
gar ganz ausgestorben und wurden<br />
durch eingesetzte Fische ersetzt.<br />
Keinen Artenrückgang hinnehmen<br />
mussten einzig die tiefen und von der<br />
Überdüngung weniger stark betroffenen<br />
Alpenrandseen. Im Bodensee<br />
etwa wurden noch vier von ehemals<br />
fünf Arten nachgewiesen.<br />
„Wir müssen davon ausgehen,<br />
dass die Düngung der Seen auch<br />
bei anderen Fischen, vielleicht auch<br />
bei den Fischnährtieren, ähnliche<br />
Verluste der Vielfalt bewirkt haben“,<br />
sagt Seehausen. Der Forscher sieht<br />
in der aktuellen Studie auch eine<br />
Warnung an diejenigen, die neuerdings<br />
in der Hoffnung auf höhere<br />
Fischfangerträge eine Drosselung<br />
der Phosphorelimination in Kläranlagen<br />
fordern: „Schon eine geringfügige<br />
Nährstoffanreicherung über<br />
den natürlichen Zustand eines Sees<br />
hinaus hat Auswirkungen auf die<br />
Artenvielfalt. Und sind endemische<br />
Arten als Folge der Düngung einmal<br />
aus einem See verschwunden, lässt<br />
sich dieser Prozess nicht mehr<br />
umkehren“. Gerade die nährstoffarmen<br />
Seen seien daher als einzigartige<br />
Artenreservoire und als Orte,<br />
wo neue Arten entstehen können,<br />
besonders schützenswert.<br />
Quelle: Eawag<br />
März 2012<br />
264 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Jetzt<br />
doppelt sparen:<br />
Edition<br />
15% Rabatt<br />
<strong>gwf</strong> Praxiswissen<br />
im Fortsetzungsbezug<br />
20% Rabatt<br />
für <strong>gwf</strong>-Abonnenten<br />
Diese Buchreihe präsentiert kompakt aufbereitete Fokusthemen aus der <strong>Wasser</strong>branche und Fachberichte<br />
von anerkannten Experten zum aktuellen Stand der Technik. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen individuelle<br />
Lösungen und vermitteln praktisches Know-how für ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Konzepte.<br />
Band I – Regenwasserbewirtschaftung<br />
Ausführliche Informationen für die Planung und Ausführung von Anlagen zur Regenwasserbwirtschaftung<br />
mit gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Anwendungsbeispielen aus der Praxis.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, 184 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band II – Messen • Steuern • Regeln<br />
Grundlageninformationen über Automatisierungstechnologien, die dabei helfen, <strong>Wasser</strong> effizienter<br />
zu nutzen, <strong>Abwasser</strong> nachhaltiger zu behandeln und Sicherheitsrisiken besser zu kontrollieren.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band III – Energie aus <strong>Abwasser</strong><br />
Abwärme aus dem Kanal und Strom aus der Kläranlage: Wie aus großen Energieverbrauchern<br />
Energieerzeuger werden. Methoden und Technologien zur nachhaltigen <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Band IV – Trinkwasserbehälter<br />
Grundlagen zu Planung, Bauausführung, Instandhaltung und Reinigung sowie Sanierung von<br />
Trinkwasserbehältern. Materialien, Beschichtungssysteme und technische Ausrüstung.<br />
Hrsg. C. Ziegler, 1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Buch + Bonusmaterial für € 54,90 € 46,70<br />
Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 69,90 € 59,40<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
VORTEILSANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle die Fachbuchreihe <strong>gwf</strong> Praxiswissen im günstigen Fortsetzungsbezug,<br />
verpasse keinen Band und spare 15%. Ich wünsche die<br />
Lieferung beginnend ab Band<br />
als Buch + Bonusmaterial für € 46,70 (<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 37,30)<br />
als Buch + Bonusmaterial + eBook auf DVD für € 59,40<br />
(<strong>gwf</strong>-Abonnenten: € 47,50)<br />
Wir beziehen <strong>gwf</strong> im Abonnement nicht im Abonnement<br />
Jeder aktuelle Band wird zum Erscheinungstermin ausgeliefert und<br />
separat berechnet. Die Anforderung gilt bis zum schriftlichen Widerruf.<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAGWFP2011<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Nachrichten<br />
Veranstaltungen<br />
Premiere Live Lab – analytica 2012 entführt<br />
Besucher in die Welt des Labors<br />
17. bis 20. April 2012 Neue Messe München<br />
Erstmals entstehen in Teilbereichen der analytica Hallen B1, B2 und A3 echte Laborumgebungen. Internationale<br />
Unternehmen präsentieren auf Laborzeilen ihre Geräte im Live-Betrieb. Tägliche Experimentalvorträge<br />
informieren die Besucher zu den Schwerpunkthemen Forensik und Klinische Diagnostik, Kunststoffanalytik<br />
sowie Lebensmittel- und <strong>Wasser</strong>analytik.<br />
Projektleiterin Katja Stolle: „Mit<br />
dem Live Lab schaffen wir neue<br />
Elemente, die es dem Besucher<br />
ermöglichen, sich vor Ort mit dem<br />
Hersteller unter tatsächlichen<br />
Arbeitsbedingungen über Produkte<br />
auszutauschen und individuelle<br />
Anwendungsfälle zu diskutieren.“<br />
Darüber hinaus greifen Experten<br />
aus Industrie und Wissenschaft in<br />
täglichen Live-Vorführungen zu<br />
den Themen Forensik und Klinische<br />
Diagnostik, Kunststoffanalytik sowie<br />
Lebensmittel- und <strong>Wasser</strong>analytik<br />
aktuelle Fragestellungen auf und<br />
stellen innovative Methoden und<br />
Verfahren vor.<br />
Um am Ende den Täter zu fassen,<br />
ist die Analytik ein unerlässlicher<br />
Bestandteil bei der Spurensuche<br />
geworden. Aber nicht nur in der<br />
Forensik, auch in der Klinischen Diagnostik<br />
sind moderne Analyseverfahren<br />
und molekularbiologische<br />
Methoden essenziell. Vor der Kulisse<br />
des Live Lab erhalten die Besucher<br />
Einblicke in die neuesten Entwicklungen<br />
wie der Doping- und Atemgasanalytik.<br />
Einer der Höhepunkte<br />
ist der Auftritt von Deutschlands<br />
bekanntestem Kriminalbiologen<br />
Mark Benecke am ersten Messetag.<br />
Er trifft mit Hilfe von DNA-Analytik<br />
Rückschlüsse auf fiktive Verbrechen<br />
und Täter.<br />
Im Bereich Lebensmittel- und<br />
<strong>Wasser</strong>analytik gehen Experten<br />
unter anderem der Frage nach, wie<br />
sicher Nahrungsmittel sind. Bei der<br />
Qualitätskontrolle kann auf analytische<br />
Verfahren längst nicht mehr<br />
verzichtet werden, um Pestizide<br />
oder toxische Rückstände zu charakterisieren<br />
und quantitativ zu<br />
erfassen. Darüber hinaus wird erörtert,<br />
wie Chemikalien auf Mensch<br />
und Umwelt wirken und welche<br />
Rolle dabei das interdisziplinäre<br />
Entwickeln von Gerätesystemen<br />
und Methoden in den Umweltwissenschaften<br />
spielt.<br />
Moderne Werkstoffe und Funktionsmaterialien<br />
werden mittlerweile<br />
in vielen Bereichen eingesetzt – von<br />
der Medizin bis hin zur Elektronik –<br />
und Automobilindustrie. Das Live<br />
Lab mit dem Schwerpunkt Kunststoffanalytik<br />
stellt die Polymeranalytik<br />
in den Mittelpunkt und zeigt<br />
Entwicklungen aus den Bereichen<br />
Probenvorbereitung, Permeationsmessungen<br />
und Blendanalytik auf.<br />
Unterstützt wird das Live Lab<br />
von Agilent, Analytik Jena, Andreas<br />
Hettich, Bernd Kraft, BioTek, Bruker,<br />
Carl Zeiss, Elga, Eppendorf, GE<br />
Healthcare, Gilson, Hirschmann,<br />
Hohenloher, HT-CON Unternehmerberatung,<br />
Mettler Toledo, Netzsch,<br />
Q-LAB, Retsch, SGE, Shimadzu,<br />
Waldner und Waters. Zudem unterstützen<br />
das Bayerische Landesamt<br />
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit<br />
(LGL) Bayern und das Institut<br />
für <strong>Wasser</strong>chemie und Chemische<br />
Balneologie der TU München<br />
fachlich den Bereich Lebensmittelund<br />
<strong>Wasser</strong>analytik. Der Schwerpunkt<br />
Kunststoffanalytik wird ge -<br />
fördert vom Deutschen Kunststoffinstitut.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.analytica.de<br />
www.wassertermine.de<br />
März 2012<br />
266 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
UrbanTec im Jahresturnus: Zukunftsthema „Urbanisierung“<br />
wird am Standort Köln weiter forciert<br />
24. bis 26. Oktober 2012, Koelnmesse<br />
Die Koelnmesse will das Zu -<br />
kunftsthema „Urbanisierung“<br />
noch stärker vorantreiben und wird<br />
die UrbanTec als jährliche Kongressmesse<br />
im Markt positionieren.<br />
Daher wird die Veranstaltung vom<br />
24. bis 26. Oktober 2012 wieder am<br />
Standort Köln durchgeführt. Als<br />
einziges, eigenständiges Messeformat<br />
thematisiert die UrbanTec<br />
branchenübergreifende Lösungen<br />
und Systeme zur Bewältigung urbaner<br />
Herausforderungen. „Die vielversprechende<br />
Premiere der Urban-<br />
Tec im Oktober 2011 und die zahlreichen<br />
Gespräche, die wir im<br />
Nachgang zur Veranstaltung mit<br />
Entscheidern aus Industrie, Politik<br />
sowie nationalen und internationalen<br />
Verwaltungen geführt haben,<br />
bestätigen uns in der Einschätzung,<br />
die Kongressmesse im Jahresrhythmus<br />
zu realisieren“, erklärt Dr. Christian<br />
Glasmacher, Mitglied der<br />
Geschäftsleitung und Geschäftsbereichsleiter<br />
Unternehmensentwicklung<br />
der Koelnmesse. „Nur ein permanenter<br />
Austausch und Dialog auf<br />
allen Ebenen kann nachhaltig dazu<br />
beitragen, die wirtschafts- und<br />
gesellschaftspolitischen Folgen des<br />
zunehmenden Urbanisierungsprozesses<br />
erfolgreich zu lösen.“ Unterstützt<br />
wird die Koelnmesse dabei<br />
wieder vom Bundesverband der<br />
Deutschen Industrie (BDI) e.V. als<br />
Partner der UrbanTec.<br />
Bereits zur ersten UrbanTec im<br />
Oktober 2011 beteiligten sich 55<br />
ausstellende Unternehmen aus vier<br />
Ländern und rund 900 Kongressteilnehmer<br />
und Messebesucher aus<br />
20 Ländern. Im Ausstellungsbereich<br />
des Kölner Messegeländes präsentierten<br />
sich unter anderem mit Siemens,<br />
Lanxess, Bayer MaterialScience,<br />
Daimler AG, Strabag Real<br />
Estate, TÜV Rheinland, TÜV Nord<br />
Cert, RWE, E.ON, RAG Aktiengesellschaft,<br />
DHL und PWC zwölf Top-Konzerne<br />
der deutschen Industrie. Darüber<br />
hinaus waren Gemeinschaftsbeteiligungen<br />
aus Brasilien, Russland,<br />
der Schweiz, der Landesregierung<br />
NRW und der Fraunhofer Gesellschaft<br />
in Köln vertreten. Gezeigt<br />
wurden technologische Lösungen<br />
für die Bereiche urbanen Lebens – so<br />
aus den Schwerpunkten Bautechnik,<br />
Energie, <strong>Wasser</strong> management, Luftreinhaltung<br />
& Gesundheit, Mobilität<br />
& Logistik, Waste Management &<br />
Technology, Information & Kommunikation<br />
sowie verbundene Dienstleistungen.<br />
Auf Besucherseite waren nationale<br />
und internationale Entscheider<br />
aus den Bereichen öffentliche Verwaltung<br />
(staatlich und kommunal),<br />
private und öffentliche Infrastrukturbetreiber<br />
sowie Planer, Projektierer<br />
und Umsetzer in Köln anwesend<br />
– u. a. auch Besucherdelegationen<br />
aus China, Brasilien und Russland.<br />
Auf internationalem Top-Niveau<br />
präsentierte sich das Kongressprogramm<br />
zur UrbanTec. Hier formulierten<br />
namhafte Experten aus der<br />
ganzen Welt die globalen Auswirkungen<br />
der Urbanisierung und diskutierten<br />
die politischen Rahmenbedingungen<br />
für die Realisierung<br />
technischer Lösungsansätze.<br />
Weitere Informationen: www.urbantec.de<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
Halle A3, Stand 112<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
7.–11. Mai 2012<br />
Messe München
Nachrichten<br />
Veranstaltungen<br />
Schulung zur dynamischen Simulation von<br />
<strong>Abwasser</strong>systemen mit SIMBA<br />
03. bis 04. April 2012, ifak – Institut für Automation und Kommunikation e. V., Magdeburg<br />
Ziel der Schulung ist eine Einführung<br />
in die Simulation von<br />
<strong>Abwasser</strong>systemen mit SIMBA. Die<br />
Schulung ist zugeschnitten auf<br />
Anfänger der Simulation, die einen<br />
effektiven Einstieg in die anspruchsvolle<br />
Thematik suchen und den<br />
Umgang mit SIMBA erlernen wollen.<br />
Die Schulung richtet sich an<br />
Mitarbeiter von Universitäten,<br />
Hochschulen, Forschungseinrichtungen,<br />
Ingenieurbüros, Kommunen,<br />
Aufsichtsbehörden und Betreibern,<br />
die selbst Simulationsrechnungen<br />
mit SIMBA durchführen<br />
wollen oder diese beauftragen und<br />
bewerten und die Vorkenntnisse zu<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigungssystemen mitbringen.<br />
Neben Vorträgen und<br />
Präsentationen zu den unterschiedlichen<br />
Anwendungsgebieten der<br />
Simulation von <strong>Abwasser</strong>systemen<br />
steht die aktive Mitarbeit der Teilnehmer<br />
an praktischen Übungsbeispielen<br />
im Mittelpunkt. Das Schulungsmaterial<br />
vermittelt einen kurzen<br />
Überblick zu den Grundlagen<br />
und der Vorgehensweise beim Aufbau<br />
von Simulationsmodellen und<br />
enthält viele Übungen und die<br />
dazu gehörigen Lösungen.<br />
Weitere<br />
Veranstaltungs termine:<br />
17. bis 18.04.2012, Weimar<br />
SIMBA-Anwendertreffen mit<br />
Biogas-Workshop<br />
Kontakt:<br />
ifak – Institut für Automation und<br />
Kommunikation e. V. Magdeburg,<br />
Nancy Bärwinkel,<br />
Werner-Heisenberg-Straße 1,<br />
D-39106 Magdeburg,<br />
Tel. (0391) 9901481, Fax (0391) 9901590,<br />
E-Mail: nancy.baerwinkel@ifak.eu,<br />
www.ifak.eu<br />
BARTHAUER on Tour<br />
Deutschlandweite Vorstellung des Netzinformationssystem „BaSYS“<br />
Im März 2012 ging die Barthauer Software GmbH erneut auf Tour durch Deutschland. Vom 13. bis 21. März<br />
2012 wurden in verschiedenen deutschen Städten die Einsatzmöglichkeiten des Netzinformationssystem<br />
BaSYS im Bereich <strong>Abwasser</strong> kompakt und praxisnah vorgestellt.<br />
Neben einer sicheren Datenhaltung<br />
erfordern der reibungslose<br />
Betrieb und die effiziente Verwaltung<br />
von Infrastruktur-Netzen intelligente<br />
skalierbare Werkzeuge der Infrainformatik.<br />
BaSYS, das BARTHAUER<br />
System, bietet weit mehr als das.<br />
BARTHAUER präsentierte mit<br />
praxisnahen Demos die neuesten<br />
Werkzeuge ihrer Software-Lösung<br />
BaSYS bei Roadshows in Hamburg,<br />
Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart<br />
und Potsdam (letzter Termin). Mitarbeiter<br />
aus Ingenieur- und Planungsbüros,<br />
Netzbetreiber von<br />
kleinen, mittleren und großen Verund<br />
Entsorgungsbetrieben sowie<br />
kommunale Betriebe waren eingeladen,<br />
sich die Neuheiten in den<br />
verschiedenen Anwendungsbereichen<br />
anzuschauen und so ihre<br />
Workflows noch effizienter zu<br />
gestalten.<br />
Die Teilnahme an der BART-<br />
HAUER Roadshow ist kostenfrei.<br />
Neben informativen Unterlagen zu<br />
den Software-Lösungen der Barthauer<br />
Software GmbH bestand für<br />
die Teilnehmer die Möglichkeit,<br />
beim gemeinsamen Get-Together<br />
zum Ende der Veranstaltung neue<br />
Kontakte zu knüpfen und das<br />
eigene Netzwerk zu erweitern.<br />
Letzter Termin:<br />
""<br />
21. März 2012:<br />
Potsdam, Pots damer Centrum<br />
für Technologie<br />
Kontakt:<br />
Barthauer Software GmbH,<br />
Pillaustraße 1a,<br />
D-38126 Braunschweig,<br />
Tel. (0531) 23533-0, Fax (0531) 23533-99,<br />
E-Mail: vertrieb@barthauer.de,<br />
www.barthauer.de<br />
März 2012<br />
268 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Trink- und Badebeckenwasser: Toxische<br />
Desinfektions-Nebenprodukte unter Kontrolle?<br />
08. Mai 2012, Seminarveranstaltung des IWW Zentrum <strong>Wasser</strong>,<br />
Stadthalle Mülheim an der Ruhr<br />
Bei der Desinfektion von Badebeckenwasser<br />
in Schwimmbädern<br />
und bei der Trinkwasseraufbereitung<br />
können toxische Stoffe<br />
ent stehen. Sie entstehen aus der<br />
Reaktion von Desinfektionsmitteln<br />
Chlor, Chlordioxid und Ozon mit<br />
einzelnen <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffen bei<br />
der Herstellung oder Lagerung. Zu<br />
den sogenannten Desinfektionsnebenprodukten<br />
(DNP) gehören Bromat,<br />
Perchlorate und andere chlororganische<br />
Verbindungen, die in<br />
höheren Konzentrationen auch<br />
krebserregend sein können.<br />
Warum DNP bei der<br />
Aufbereitung kontrollieren?<br />
DNP können sich je nach vorliegender<br />
Konzentration nachteilig auf<br />
die menschliche Gesundheit auswirken.<br />
Zum Schutz der Gesundheit<br />
sind entsprechende Anforderungen<br />
in rechtlichen und technischen<br />
Regelwerken einzuhalten.<br />
Ein Eintrag von DNP in Trink- und<br />
Badebeckenwasser ist bei der Desinfektion<br />
nicht gänzlich zu vermeiden.<br />
Mit dem Einsatz der geeigneten<br />
Aufbereitungstechnologie, dem<br />
fachgerechtem Betrieb der Anlage<br />
und dem richtigen Umgang mit<br />
dem Desinfektionsmittel kann die<br />
Belastung bis auf ein technisch<br />
unvermeidliches Maß minimiert<br />
werden.<br />
Was ist aktuell?<br />
""<br />
Mit der Neufassung der DIN<br />
19643 ff: (Entwurf 2011): „Aufbereitung<br />
von Schwimm- und<br />
Badebeckenwasser“ wird erstmals<br />
ein Richtwert für Chlorat<br />
festgelegt. Derzeit wird in vielen<br />
Schwimmbädern, die Hypochlorit<br />
zur Desinfektion einsetzen,<br />
der zukünftige Richtwert nicht<br />
eingehalten.<br />
Ursachen und technische<br />
Lösungen werden in dem Seminar<br />
aufgezeigt.<br />
""<br />
Bei dem Einsatz von Desinfektionsverfahren<br />
sind die Anforderungen<br />
der Trinkwasserverordnung<br />
an die DNP Chlorit, Chlorat<br />
und Bromat einzuhalten. Mit der<br />
Änderung der TrinkwV im<br />
November 2011 können Verstöße<br />
gegen die Anforderungen<br />
nach § 11 als Straftat geahndet<br />
werden.<br />
""<br />
Wie können die Verantwortlichen<br />
die gesetzlichen Anforderungen<br />
erfüllen?<br />
""<br />
International ist die gesundheitliche<br />
Relevanz erhöhter Perchlorat-Konzentrationen<br />
im Trinkund<br />
Grundwasser seit Jahren in<br />
der Diskussion.<br />
""<br />
Ist Perchlorat auch in Deutschland<br />
ein Problem? Wie kann die<br />
Bildung von Perchlorat in Badebeckenwässern<br />
bei der Chlor-<br />
Elektrolyse beherrscht werden?<br />
Zielgruppe<br />
""<br />
<strong>Wasser</strong>versorger<br />
""<br />
Badbetreiber<br />
""<br />
Überwachende Behörden<br />
""<br />
Untersuchungslaboratorien<br />
Das vollständige Programm unter<br />
www.iww-online.de<br />
(Veranstaltung/Weiterbildung)<br />
Kontakt:<br />
Frau Servatius,<br />
E-Mail: h.servatius@iww-online.de,<br />
Frau Bonorden,<br />
E-Mail: s.bonorden@iww-online.de,<br />
Tel. (0208) 40303-102 bzw. 101,<br />
www.iww-online.de<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 269
Nachrichten<br />
Leute<br />
Klaus R. Imhoff 80 Jahre<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
E. h. Klaus R.<br />
Imhoff.<br />
Der ehemalige technische Vorstand<br />
des Ruhrverbands, Prof.<br />
Dr.-Ing. E. h. Klaus R. Imhoff, vollendete<br />
am 17. Januar 2012 sein<br />
80. Lebensjahr. Der gebürtige Essener<br />
trat nach seinem Studium des<br />
Bauingenieurwesens mit der Vertiefung<br />
<strong>Wasser</strong>bau im Jahr 1961 als<br />
Bauassessor in den Dienst des Ruhrverbands.<br />
Dort war er unter anderem<br />
als Abteilungsleiter der <strong>Abwasser</strong>abteilung<br />
Essen-Duisburg und<br />
als <strong>Abwasser</strong>dezernent tätig, ehe er<br />
1974 vom Vorstand des Ruhrverbands<br />
und des Ruhrtalsperrenvereins<br />
zum technischen Geschäftsführer<br />
beider Verbände bestellt<br />
wurde.<br />
Nach der Neuordnung des Ruhrverbands<br />
durch das Ruhrverbandsgesetz<br />
von 1990 erfolgte die Bestellung<br />
zum Vorstand Technik und<br />
zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden<br />
des Ruhrverbands.<br />
Ende Januar 1997 trat Prof. Klaus<br />
R. Imhoff in den Ruhestand.<br />
Während seiner mehr als dreieinhalb<br />
Jahrzehnte währenden Tätigkeit<br />
für den Ruhrverband hat sich<br />
Prof. Imhoff auf unterschiedliche<br />
Weise um die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
des Ruhrgebiets und die Reinhaltung<br />
der Ruhr verdient gemacht.<br />
Auf seine Initiative geht beispielsweise<br />
der seit 1973 jährlich erscheinende<br />
Ruhrgütebericht zurück, der<br />
im Jahr 2010 auf dem Weltwasserkongress<br />
im kanadischen Montreal<br />
die Marketing-Auszeichnung „Best<br />
promoted water protection activity“<br />
der International Water Association<br />
(IWA) erhielt.<br />
Neben seinem Wirken für den<br />
Ruhrverband ließ Prof. Imhoff durch<br />
seine rege Veröffentlichungstätigkeit<br />
die Fachwelt an seinem reichen<br />
Wissens- und Erfahrungsschatz teilhaben.<br />
Darüber hinaus führte er ab<br />
1965 das zuvor von seinem Vater,<br />
dem <strong>Abwasser</strong>pionier Dr. Karl<br />
Imhoff, herausgegebene „Taschenbuch<br />
der Stadtentwässerung“ weiter,<br />
das Ingenieuren der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
seit mehreren Generationen<br />
als bewährte Arbeitshilfe dient. Es<br />
wurde in etliche Sprachen übersetzt<br />
und ist mittlerweile in der 31. Auflage<br />
erschienen.<br />
Klaus R. Imhoff erhielt 1979 die<br />
Ehrendoktorwürde der Technischen<br />
Universität Karlsruhe und wurde<br />
1982 zum Honorarprofessor an der<br />
RWTH Aachen berufen, wo er bis zu<br />
seiner Pensionierung einen Lehrauftrag<br />
wahrnahm. Neben seinem<br />
Engagement in weiteren nationalen<br />
und internationalen <strong>Wasser</strong>verbänden<br />
war er zehn Jahre lang Präsident<br />
der <strong>Abwasser</strong>technischen Vereinigung<br />
(ATV), der heutigen DWA.<br />
In seine Amtszeit fiel die deutsche<br />
Wiedervereinigung und damit die<br />
Ausweitung der Aktivitäten der<br />
DWA auf die neuen Bundesländer,<br />
an der Prof. Klaus R. Imhoff nicht nur<br />
als Präsident, sondern auch als fachkundiger<br />
Berater von Entscheidungsträgern<br />
in Politik und Verwaltung<br />
seinen Anteil hatte.<br />
Zu den Ehrungen, die Prof.<br />
Imhoff zuteil wurden, gehören das<br />
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens<br />
der Bundesrepublik<br />
Deutschland und der Verdienstorden<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen.<br />
Außerdem wurde er 1996 mit<br />
der Dunbar-Medaille der European<br />
Water Pollution Control Association<br />
(EWPCA, heute European Water<br />
Association – EWA) geehrt und<br />
erhielt 2008 die Max-Prüß-Medaille<br />
der DWA. Diese Auszeichnungen<br />
würdigen seine besonderen Leistungen<br />
für die Belange der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und damit zum Wohl der<br />
Allgemeinheit.<br />
Arnd Böhme.<br />
Arnd Böhme zum 75. Geburtstag<br />
Am 16. Januar 2012 vollendete<br />
Dipl.-Ing. Arnd Böhme, in<br />
Dresden geborener, langjähriger<br />
Geschäftsführer der figawa (Bundesvereinigung<br />
der Firmen im Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>fach), Hauptgeschäftsführer<br />
des RBV (Rohrleitungsbauverband)<br />
und Geschäftsführer des<br />
BRBV (Berufsförderungs werkes des<br />
RBV) sein 75. Lebensjahr.<br />
Nach seinem Bauingenieurstudium<br />
an der TH Darmstadt und<br />
einer fünfjährigen leitenden Tätigkeit<br />
im Ingenieurbüro Kocks, Frankfurt/Main,<br />
wechselte Böhme 1971<br />
zur figawa und zum RBV, wo er bis<br />
zu seiner Pensionierung im Jahr<br />
2002 wirkte.<br />
Durch die Neustrukturierung der<br />
Fachgruppen und Arbeitskreise in<br />
der figawa seit 1971 wurde die<br />
Mitarbeit der Verbandsmitglieder<br />
intensiviert. Viele neue Mitglieder<br />
konnten in dieser Zeit gewonnen<br />
werden. Ein besonderes Anliegen<br />
von Arnd Böhme war stets die<br />
Zusammenarbeit mit allen Fachverbänden<br />
– insbesondere mit DVGW,<br />
DIN, DWA und anderen.<br />
Als Hauptgeschäftsführer des<br />
RBV sah er seine Hauptaufgaben in<br />
der Mitglieder betreuung in zehn<br />
Landesgruppen, darunter die Einbeziehung<br />
der Mitglieder in den<br />
östlichen Bundesländern nach der<br />
Wende sowie die Förderung und<br />
Sicherung des seit über 50 Jahren<br />
bestehenden DVGW-Qualifikationsverfahrens<br />
für Rohrleitungsbauunternehmen<br />
nach GW 301.<br />
Bereits im Jahr 1981 wurden auf<br />
Anregung von Böhme mit der Gründung<br />
des BRBV für die Aus- und<br />
Fortbildung im Rohrleitungsbau<br />
neue Maßstäbe gesetzt.<br />
Sein großes Engagement in den<br />
Gremien der Fachverbände im Inund<br />
Ausland wurde durch hohe<br />
März 2012<br />
270 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Leute<br />
Nachrichten<br />
Auszeichnungen anerkannt. Arnd<br />
Böhme ist Träger des Verdienstkreuzes<br />
am Bande des Verdienstordens<br />
der Bundesrepublik Deutschland,<br />
Inhaber der Beuth-Gedenkmünze<br />
des DIN, der Morton Klein-Ehrenmedaille<br />
der Internationalen Ozon<br />
Vereinigung (IOA), Ehrenmitglied<br />
und Ehrenringträger des DVGW,<br />
Ehrenmitglied des ÖVGW, des<br />
SVGW und der Ungarischen Hydrologischen<br />
Gesellschaft, Inhaber der<br />
Ehrenplakette der IHK Dresden und<br />
Köln.<br />
Nach seiner Pensionierung widmet<br />
sich Arnd Böhme als Geschäftsführer<br />
des Vereins WASSER BERLIN<br />
der erfolgreichen und weltweit<br />
bekannten Fachmesse mit Kongress<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL,<br />
die er bereits im Jahr 1973 mitinitiiert<br />
hat.<br />
Ehrenamtlich engagiert sich<br />
Böhme in den Fördervereinen für<br />
die Frauenkirche in Dresden und für<br />
den Wiederaufbau des Berliner<br />
Schlosses.<br />
Neuer Abteilungsleiter in der DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
Der Geoökologe Dr. Friedrich<br />
Hetzel (45) ist seit dem 01. Februar<br />
2012 Leiter der neuen Ab -<br />
teilung „<strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft“<br />
in der Bundesgeschäftsstelle<br />
der Deutschen Vereinigung für<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V. (DWA). Die neue Abteilung<br />
ist entstanden durch Zusammenlegung<br />
der bisherigen Abteilungen<br />
„Ab wasser und Gewässerschutz“<br />
sowie „<strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Abfall und Boden“.<br />
Friedrich Hetzel studierte in Bayreuth<br />
und Karlsruhe Geoökologie.<br />
1998 promovierte er an der Universität<br />
Göttingen mit der Arbeit<br />
„The Nutrient and Water Cycle in a<br />
Tropical Rain Forest and a Cocoa<br />
Plantation in Côte d’Ivoire“. Danach<br />
blieb er zunächst für weitere zehn<br />
Monate an der Universität Göttingen,<br />
wo er unter anderem einen<br />
Sonderforschungsbereich zu Indonesien<br />
vorbereitete. Von 1999 bis<br />
2005 schloss sich eine Tätigkeit für<br />
die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe<br />
in Köln, zunächst als Leiter<br />
eines <strong>Wasser</strong>bau- und Basisgesundheitsprogramms,<br />
später als<br />
Berater für Entwicklungsvorhaben<br />
in der Diözese im Südwesten Madagaskars<br />
an.<br />
Von 2005 bis Ende 2007 war er<br />
bei der GeoInformationsdienst<br />
GmbH in Rosdorf bei Göttingen als<br />
Abteilungsleiter unter anderem verantwortlich<br />
für die Abstimmung<br />
und Koordination der Auslandsprojekte<br />
des Unternehmens. 2008<br />
wechselte er schließlich zur Bundesanstalt<br />
für Geowissenschaften und<br />
Rohstoffe in Hannover. Friedrich<br />
Hetzel arbeitete hier an Vorhaben<br />
der technischen Zusammenarbeit<br />
mit Afrika, beriet verschiedene Bundesministerien<br />
zu Fragen bezüglich<br />
Grundwasser und natürlichen Rohstoffen<br />
und übernahm die Vertretung<br />
der Referatsleitung „Afrikareferat“.<br />
Nach vier Monaten wurde er an<br />
das Bundesministerium für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und<br />
Entwicklung (BMZ) als Leiter des<br />
Sektorvorhabens „Politikberatung<br />
Grundwasser – Ressourcen und<br />
Management“ abgeordnet. In den<br />
dreieinhalb Jahren vertrat er das<br />
BMZ auf zahlreichen internationalen<br />
und nationalen Veranstaltungen<br />
und Konferenzen, arbeitete an<br />
Schwerpunktstrategien mit und<br />
begleitete die Leitung des BMZ bei<br />
unterschiedlichen wasser- und<br />
abfallbezogenen entwicklungspolitischen<br />
Anlässen. In Abstimmungsprozesse<br />
mit den verschiedenen<br />
Ressorts der Bundesregierung war<br />
er themenspezifisch einbezogen<br />
und beriet die Kollegen der<br />
Regional- und Sektorreferate im<br />
BMZ. Fachlich hielt er engen Kontakt<br />
zu den Vorfeldorganisationen<br />
und tauschte sich mit zahlreichen<br />
Verbänden und Vereinigungen zu<br />
<strong>Wasser</strong>- und Abfallthemen aus.<br />
Im Oktober 2011 trat Friedrich<br />
Hetzel die Stelle „Senior Project<br />
Manager für Siedlungswasserwirtschaft<br />
in Subsahara Afrika“ bei der<br />
KfW Entwicklungsbank in Frankfurt<br />
am Main an. Die Herausforderung,<br />
als Abteilungsleiter in der DWA tätig<br />
werden zu können, bewogen ihn,<br />
seine verantwortungsvolle Tätigkeit<br />
bei der KfW Entwicklungsbank niederzulegen<br />
und im Februar 2012<br />
bei der DWA in Hennef seine weitere<br />
berufliche Zukunft aufzunehmen.<br />
Dieser Schritt ermöglichte es<br />
Friedrich Hetzel, wieder ganz zu<br />
seiner Familie nach Bonn zurückzukehren,<br />
was für ihn privat von großer<br />
Bedeutung ist. Friedrich Hetzel<br />
ist verheiratet und hat zwei Kinder<br />
im Alter von sechs und neun Jahren.<br />
Er liebt Jazzmusik und Sport.<br />
Die Leiterin der bisherigen<br />
Abteilung „<strong>Abwasser</strong> und Gewässerschutz“,<br />
Dipl.-Biol. Sabine Thaler,<br />
hat in der DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
die Leitung der neuen Stabsstelle<br />
„Forschung und Innovation“<br />
übernommen. Dipl.-Geogr. Georg<br />
Schrenk, Leiter der bisherigen<br />
Abteilung „<strong>Wasser</strong>wirtschaft, Abfall<br />
und Boden“, wird weiterhin vorrangig<br />
die Fachgremien im Bereich<br />
<strong>Wasser</strong>bau und <strong>Wasser</strong>kraft be -<br />
treuen.<br />
Dr. Friedrich<br />
Hetzel.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 271
Recht und Regelwerk<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 307: Verfüllung des Ringraumes zwischen Mantel- und Produktrohren<br />
bei der Kreuzung von Bahnanlagen; Straßen und <strong>Wasser</strong>straßen, 2/2012<br />
Der Weißdruck von DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 307 „Verfüllung<br />
des Ringraums zwischen Mantelund<br />
Produktrohren bei der Kreuzung<br />
von Bahnanlagen‚ Straßen und<br />
<strong>Wasser</strong>straßen“ bestätigt den Gelbdruck<br />
(Entwurf) fast unverändert.<br />
Kreuzungen von unterirdischen<br />
Druckrohrleitungen mit Verkehrswegen<br />
werden unterschiedlich hergestellt,<br />
mit und ohne Mantelrohre,<br />
bei Mantelrohren mit und ohne<br />
Verfüllung. Gründe hierfür sind u. a.<br />
unterschiedliche Umgebungsbedingungen,<br />
Werkstoffe und Verbindungstechniken<br />
der Produktrohre<br />
und daraus resultierende statische,<br />
korrosionsschutztechnische und<br />
betriebstechnische Aspekte.<br />
Das Vorwort der W 307 sagt nun<br />
noch deutlicher: Die Entscheidung,<br />
ob und wie eine Ringraumverfüllung<br />
realisiert wird, liegt grundsätzlich<br />
beim Anwender. Für den Fall der<br />
Ring raumverfüllung bietet W 307 eine<br />
Grundlage zur Planung und Ausführung,<br />
einschließlich der Wahl geeigneter<br />
Verfüllstoffe und deren Prüfung.<br />
Gegenüber dem Entwurf besteht<br />
für Verfüllstoff-Bindemittel auf Ze -<br />
mentbasis nun auch die Alternative<br />
auf der Basis von gebranntem<br />
Schiefer, die Zusammensetzung<br />
muss DIN EN 197-1 oder einer<br />
gleichwertigen allgemeinen bauaufsichtlichen<br />
Zulassung des DIBt<br />
entsprechen. Im Übrigen wurde der<br />
Entwurf komplett bestätigt.<br />
Die Vorgängerfassung des<br />
Arbeitsblatts von 1977 wurde 2005<br />
aus Gründen mangelnder Aktualität<br />
zurückgezogen. Gegenüber der<br />
Vorgängerfassung von 1977 erfolgten<br />
insbesondere folgende Änderungen:<br />
""<br />
Wegfall von Ausführungen<br />
zu Aspekten, die über die<br />
Verfüllung hinausgehen und<br />
in anderen technische Regeln<br />
hinreichend enthalten sind<br />
""<br />
Wegfall der Einschränkung<br />
auf Bahngelände<br />
""<br />
Wegfall der Einschränkung<br />
auf bestimmte Werkstoffe<br />
""<br />
Verallgemeinerung von<br />
Anforderungen anhand<br />
funktionaler Leistungsmerkmale<br />
und Schutzziele<br />
Wesentliche Inhalte des Arbeitsblattes<br />
sind:<br />
""<br />
Ziel der Ringraumverfüllung<br />
""<br />
Rahmenbedingungen des<br />
Korrosionsschutzes bei<br />
metallischen Bauteilen<br />
""<br />
Ausführung der Ringraumverfüllung<br />
""<br />
Anforderungen zum Verfüllstoff<br />
von der Herstellung bis zur<br />
Verarbeitung (Ausgangsstoffe,<br />
Bindemittel, Zugabewasser,<br />
Zusatzstoffe/-mittel, Suspension/Mischung,<br />
<strong>Wasser</strong>/<br />
Bindemittel-Wert, Dichte,<br />
Fließverhalten, Sedimentation,<br />
Verarbeitungszeit/-temperatur,<br />
Hydratationswärme)<br />
""<br />
Anforderungen zum erhärteten<br />
Verfüllstoff (Druckfestigkeit,<br />
pH-Wert, <strong>Wasser</strong>durchlässigkeit,<br />
spezifischer elektrischer Widerstand,<br />
Durchbruchspotential<br />
und Passivstromdichte)<br />
""<br />
Nachweise vor und nach der<br />
Verfüllung (einschließlich<br />
Muster-Baustellenprotokoll),<br />
technische Spezifikation des<br />
Verfüllstoffs, Verarbeitungshinweis,<br />
Dokumentation<br />
Preis:<br />
€ 20,59 für Mitglieder;<br />
€ 27,45 für Nichtmitglieder.<br />
W 543-B1: Beiblatt zu DVGW-Arbeitsblatt W 543 „Druckfeste flexible Schlauchleitungen<br />
für Trinkwasser-Installationen; Anforderungen und Prüfungen, 12/2011<br />
Die Erarbeitung des Beiblatt 1<br />
zum DVGW W 543 (A) Druckfeste<br />
flexible Schlauchleitungen für<br />
Trinkwasser-Installationen; Anforderungen<br />
und Prüfungen wurde im<br />
Projektkreis „Flexible Schlauchleitungen“<br />
abgeschlossen.<br />
Es dient als Grundlage für die<br />
Zertifizierung und Vergabe des<br />
DVGW-Zertifizierungszeichens für<br />
flexible Schlauchleitungen aus Silikonkautschuk.<br />
Das Beiblatt ergänzt<br />
die bisher im DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 543 aufgeführten Werkstoffe um<br />
Silikonkautschuk als Schlauchlinerwerkstoff.<br />
Es werden zusätzlich zu<br />
allgemeinen Grundanforderungen,<br />
Anforderungen an Werkstoffkennwerte,<br />
thermische Stabilität sowie<br />
die Veränderung der Härte nach<br />
Warmlagerung festgelegt. Die Durchführung<br />
entsprechender Prüfungen<br />
und deren Umfang werden in dem<br />
Beiblatt ebenfalls beschrieben.<br />
Preis:<br />
€ 15,97 für Mitglieder;<br />
€ 21,29 für Nichtmitglieder.<br />
März 2012<br />
272 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
W 578 Prüfgrundlage: Kombinations-Eckventil mit Geräteanschluss –<br />
Anforderungen und Prüfungen, 2/2012<br />
Die vorläufige DVGW – Prüfgrundlage<br />
W 578 (VP) regelt die<br />
Anforderungen an Kombinationseckventile<br />
mit Geräteanschluss.<br />
Kombinationseckventile bestehend<br />
aus einem Absperrventil und<br />
Regulierventilen nach DIN 3227,<br />
einem Auslaufventil nach DIN 3509<br />
sowie einer Sicherungskombination<br />
HD nach DIN EN 15096 werden in<br />
der Regel zum gleichzeitigen<br />
Anschluss von Küchenspülen und<br />
Spülmaschinen eingesetzt.<br />
Um die technischen und hygienischen<br />
Anforderungen für diese<br />
Ventile zu definieren wurde durch<br />
den Projektkreis „Armaturen“ im<br />
technischen Komitee „Armaturen<br />
und Apparate“ die vorläufige Prüfgrundlage<br />
W 578 (VP) erarbeitet.<br />
Preis:<br />
€ 15,97 für Mitglieder;<br />
€ 21,29 für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3, D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40, Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Ankündigung zur Fortschreibung des DVGW-Regelwerks<br />
Ankündigung zur Erarbeitung von Regelwerken gemäß GW 100<br />
""<br />
W 535 P: Metallene Rohrverbinder<br />
und Rohrverbindungen<br />
im Bereich Kaltwasser<br />
der Trinkwasser-Installation<br />
Rückfragen:<br />
DVGW,<br />
Josef-Wirmer-Straße 1–3, D-53123 Bonn,<br />
www.dvgw.de<br />
Recht und Regelwerk<br />
Zurückgezogene Regelwerke<br />
Folgendes Regelwerk wurde zurückgezogen:<br />
W 106<br />
Klemm- und Steckverbinder aus Kunststoffen zum Verbinden<br />
von PE-Rohren in der <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
04/1991 ersatzlos<br />
Vorhabensbeschreibung<br />
Unterdruckentwässerung – Überarbeitung des Arbeitsblattes DWA-A 116-1 „Besondere<br />
Entwässerungsverfahren; Teil 1: Unterdruckentwässerung außerhalb von Gebäuden“<br />
Das Arbeitsblatt DWA-A 116-1<br />
ergänzt die DIN EN 1091 „Druckentwässerungssysteme<br />
außerhalb<br />
von Gebäuden“ und gilt nur in<br />
Verbindung mit dieser Norm für<br />
Planung, Bau und Betrieb von<br />
Unterdruckentwässerungssystemen.<br />
Es enthält hinsichtlich der europäischen<br />
Normung weitergehende<br />
Regelungen und Hinweise.<br />
Da sich der Stand der Technik<br />
in den Jahren seit Veröffentlichung<br />
des Arbeitsblattes weiterentwickelt<br />
hat, wird das Arbeitsblatt<br />
überarbeitet. Bei der Überarbeitung<br />
sollen Ergänzungen zu technischen<br />
Anforderungen in das<br />
Arbeitsblatt eingearbeitet und die<br />
Inhalte des Arbeitsblattes aktualisiert<br />
werden.<br />
Das Arbeitsblatt soll durch die<br />
bestehende Arbeitsgruppe ES-2.3<br />
„Besondere Entwässerungsverfahren“<br />
(Sprecher: Dipl.-Ing. Jens Jedlitschka)<br />
im FA ES-2 „Systembezogene<br />
Planung“ (Obmann: Prof. Dr.-<br />
Ing. Theo G. Schmitt) überarbeitet<br />
werden.<br />
Hinweise für die Bearbeitung<br />
nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
entgegen. An der Mitarbeit<br />
interessierte Fachleute werden<br />
ebenfalls gebeten, sich an die<br />
Bundesgeschäftstelle der DWA zu<br />
wenden.<br />
Hinweise für die Bearbeitung:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dipl.-Ing. Christian Berger,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-126, Fax (02242) 872-184,<br />
E-Mail: berger@dwa.de<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 273
Recht und Regelwerk<br />
Neue Merkblätter erschienen<br />
Merkblatt DWA-M 221: Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb<br />
von Kleinkläranlagen mit aerober biologischer Reinigungsstufe<br />
Kleinkläranlagen dienen der<br />
aeroben biologischen Behandlung<br />
häuslichen Schmutzwassers<br />
mit dem Reinigungsziel der Kohlenstoffelimination<br />
gemäß Anhang 1<br />
der <strong>Abwasser</strong>verordnung. Das vorliegende<br />
Merkblatt gilt für einstufige<br />
Tropfkörperanlagen, Rotationstauchkörperanlagen,<br />
Anlagen mit<br />
getauchtem Festbett, Anlagen mit<br />
frei beweglichen Aufwuchsträgern,<br />
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb<br />
(SBR), Kombinationsanlagen<br />
und Teichkläranlagen. Es enthält<br />
Bemessungsregeln für Kleinkläranlagen<br />
mit <strong>Abwasser</strong>belüftung<br />
gemäß DIN EN 12566 „Kleinkläranlagen<br />
für bis zu 50 EW“. Vorbehandlung<br />
und Nachklärung sind hierbei<br />
eingeschlossen.<br />
Bei Kleinkläranlagen steht eine<br />
große Auswahl unterschiedlicher<br />
Reinigungsverfahren für die Anwendung<br />
zur Verfügung. Art und Menge<br />
des behandelten <strong>Abwasser</strong>s hat<br />
entscheidenden Einfluss auf die<br />
Wahl des Reinigungsverfahrens und<br />
die Auswahl der Kleinkläranlage.<br />
Das Merkblatt DWA-M 221 bietet<br />
hierzu eine Hilfestellung.<br />
Darüber hinaus sind in dem<br />
Merkblatt Qualitätskriterien für den<br />
Einbau, Betrieb, die Wartung,<br />
Instandhaltung und Überwachung<br />
von Kleinkläranlagen festgelegt.<br />
Ergänzend werden Empfehlungen<br />
zur inhaltlichen Gestaltung von<br />
Wartungsverträgen gegeben und<br />
Anforderungen an die rechtlichen<br />
und technischen Grundkenntnissen<br />
von Personen spezifiziert, die Wartungsarbeiten<br />
durchführen.<br />
Das Merkblatt richtet sich<br />
sowohl an die für die Überwachung<br />
zuständigen Ämter und Behörden<br />
als auch an die Betreiber von Kleinkläranlagen.<br />
Information:<br />
Februar 2012, 35 Seiten,<br />
ISBN 978-3-942964-23-4,<br />
Ladenpreis 39,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder 31,20 Euro.<br />
Merkblatt DWA-M 275: Rohrleitungssysteme für den Bereich der technischen<br />
Ausrüstung von Kläranlagen<br />
Rohrleitungssysteme<br />
bilden<br />
einen Schwerpunkt in der technischen<br />
Ausrüstung von Kläranlagen.<br />
Sie dienen der Förderung der<br />
zu behandelnden und verwendeten<br />
Medien (Flüssigkeiten mit und ohne<br />
Feststoffanteile, Gase) und sind in<br />
allen Bereichen der technischen<br />
Ausrüstung von Kläranlagen anzutreffen.<br />
Rohrleitungen können vielfältigen<br />
Beanspruchungen durch Kräfte<br />
(statisch und dynamisch), Korro sion<br />
(bewirkt durch das Medium und/<br />
oder die Umwelt), Abrasion, Erosion,<br />
Temperatur (Wärme, Kälte)<br />
usw. unterliegen. Die Auswahl der<br />
Rohrleitungswerkstoffe und die<br />
Bemessung der Leitungen hinsichtlich<br />
Durchmesser und Wanddicke<br />
erfordern ein hohes Maß an Sachkenntnis,<br />
vor allem be züglich der<br />
Beanspruchungsarten, der Materialkennwerte,<br />
der Verarbeitungsmöglichkeiten<br />
und nicht zuletzt der mit<br />
diesen Bereichen verbundenen,<br />
umfangreichen Normen und Vorschriften.<br />
Mit dem Merkblatt DWA-M 275<br />
soll Planern, Ausschreibenden und<br />
Entscheidungsträgern eine Hilfestellung<br />
zur Erzielung fachgerechter<br />
und wirtschaftlicher Lösungen<br />
gegeben werden. Neben der Empfehlung<br />
bewährter Verfahren wird<br />
auf technische Unterlagen und Vorschriften<br />
verwiesen, um aus den<br />
jeweiligen Anforderungen sachgerechte<br />
Standards für die Ausschreibung<br />
und die Umsetzung im Anlagenbau<br />
zu entwickeln.<br />
Im Merkblatt sind Informationen<br />
zur Auswahl geeigneter Rohrleitungsmaterialien<br />
in Abhängigkeit<br />
vom Einsatzbereich sowie Vorgaben<br />
zur fachgerechten Bemessung, Verlegung<br />
und Prüfung der Rohrleitungen<br />
nach Stand der Technik enthalten.<br />
Daneben wird gerade die<br />
Handhabung der umfangreichen<br />
Normen und Richtlinien durch die<br />
Beschränkung auf die kläranlagenspezifischen<br />
Anwendungsfälle für<br />
den Praktiker erleichtert. Insbesondere<br />
für diesen Bereich wurden<br />
umfangreiche Aktualisierungen im<br />
Merkblatt durchgeführt.<br />
Information:<br />
Februar 2012,<br />
39 Seiten,<br />
ISBN 978-3-942964-23-1,<br />
Ladenpreis 45,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder 36,00 Euro.<br />
Bezug:<br />
DWA Deutsche Vereinigung für<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V.,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-333,<br />
Fax (02242) 872-100,<br />
E-Mail: info@dwa.de,<br />
DWA-Shop: www.dwa.de/shop<br />
März 2012<br />
274 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
Merkblatt DWA-M 708: <strong>Abwasser</strong> aus der Milchverarbeitung<br />
Empfehlungen zur Behandlung<br />
von <strong>Abwasser</strong> aus Milch verarbeitenden<br />
Betrieben wurden erstmals<br />
im Dezember 1994 im damaligen<br />
Merkblatt ATV-M 708 mit dem<br />
Titel „<strong>Abwasser</strong> aus der Milchverarbeitung“<br />
veröffentlicht. Seither hat<br />
sich die Technologie im Bereich der<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung fortentwickelt.<br />
Das vorliegende gleichnamige<br />
Merkblatt DWA-M 708 stellt<br />
eine Aktualisierung und Erweiterung<br />
des bisherigen Merkblattes<br />
dar, insbesondere ist eine integrierte<br />
Betrachtung aller Umweltmedien<br />
erfolgt. Es ersetzt die erste Fassung<br />
vom Dezember 1994.<br />
Das Merkblatt wird seit 1994 in<br />
enger Kooperation zwischen der<br />
DWA und dem Verband der Deutschen<br />
Milchwirtschaft – VDM erarbeitet<br />
und dient als Ergänzung der<br />
VDM-Richtlinien für <strong>Wasser</strong> und<br />
<strong>Abwasser</strong> in Molkereien“ (VDM<br />
2003) und des „Leitfaden Umweltschutz<br />
und Stand der Molkereitechnik“<br />
(VDM 2008).<br />
Das Merkblatt beschreibt Verfahren<br />
zur Vermeidung, Verminderung<br />
und Behandlung von <strong>Abwasser</strong> aus<br />
milchverarbeitenden Betrieben<br />
nach dem Stand der Technik gemäß<br />
§ 57 <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz und des<br />
Anhangs 3 der <strong>Abwasser</strong>verordnung.<br />
Zudem werden Stoffströme<br />
sowie innerbetriebliche Maßnahmen<br />
zur Vermeidung und Verminderung<br />
von Emissionen nach BVT-<br />
Merkblatt „Nahrungsmittelindustrie“<br />
dargestellt.<br />
Zu den Milch verarbeitenden<br />
Betrieben gehören Molkereien, Meiereien,<br />
Milchwerke und Milchindustriebetriebe,<br />
die synonyme regionale<br />
Bezeichnungen darstellen, sowie<br />
Käsereien und Trocknungswerke.<br />
Das Merkblatt vermittelt einen<br />
fachspezifischen Überblick und<br />
richtet sich insbesondere an Fachbehörden<br />
der <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft,<br />
Verbände, Planer von<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitungs- oder <strong>Abwasser</strong>reinigungsanlagen<br />
und die einschlägigen<br />
Betriebe.<br />
Information:<br />
Oktober 2011, 66 Seiten,<br />
ISBN 978-3-941897-95-3,<br />
Ladenpreis 63,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mit glieder 50,40 Euro.<br />
Herausgeber und Vertrieb:<br />
DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
<strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V.,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-333,<br />
Fax (02242) 872-100,<br />
E-Mail: info@dwa.de,<br />
DWA-Shop: www.dwa.de/shop<br />
RSV Merkblatt 6.2 Schachtsanierung<br />
im Gelbdruck veröffentlicht<br />
Fachleute werden gebeten bis zum 15. Mai 2012 zum Gelbdruck Schachtsanierung<br />
ihre Einsprüche beim RSV einzureichen<br />
Es gibt rund 10 Millionen Schachtbauwerke<br />
in Deutschland. Sie<br />
sind damit ein wesentlicher<br />
Bestandteil bei der Errichtung und<br />
der Nutzung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen.<br />
Die Bedeutung, Funktion und<br />
Erhaltung von Schächten ist ge -<br />
nauso wichtig wie die des Kanals.<br />
Vielmehr noch sind Schächte weitaus<br />
stärkeren Beanspruchungen<br />
ausgesetzt als der im Erdreich liegende<br />
Kanal, denn über die<br />
Schachtabdeckung werden oft<br />
direkt Kräfte in den Schacht eingeleitet,<br />
darauf verweist Wolf-Michael<br />
Sturm (RSV-Obmann).<br />
Der RSV hat es sich seit November<br />
2009 zur Aufgabe gemacht, ein<br />
neues Merkblatt zu erarbeiten mit<br />
einem ganzheitlichen Ansatz, in<br />
dem Informationen von der Planung<br />
über die Zustandserfassung,<br />
statische Berechnungen und bis<br />
hin zu Entscheidungshilfen zur Auswahl<br />
eines sinnvollen Sanierungsverfahrens<br />
enthalten sind.<br />
Über die verschiedenen Werkstoffe<br />
gelangt das Merkblatt zu den<br />
einzelnen Verfahren. Die Werkstoffe<br />
werden in die Gruppen mineralischer,<br />
elastischer Werkstoff und PE<br />
und GFK eingeteilt. Alle Werkstoffe<br />
werden mit den gleichen Unterpunkten<br />
abgehandelt und dadurch<br />
vergleichbar.<br />
Bei dem Kapitel „Prüfungen im<br />
eingebauten Zustand“ werden u. a.<br />
Aussagen getroffen, wann ein<br />
Schacht dicht ist. Unterschieden<br />
wird nach der Einteilung „Altschacht“<br />
und „sanierter“ Schacht<br />
und dabei wiederum nach Reparatur<br />
und Renovierung.<br />
<br />
Optische Inspektion durch eine Schachtkamera.<br />
© STURM-BERLIN<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 275
Recht und Regelwerk<br />
Manuelle Beschichtung mit mineralischem<br />
Werkstoff. © STURM-BERLIN<br />
Die Sanierung von Schächten<br />
hat schon immer stattgefunden.<br />
Aus diesem Grund denken auch<br />
viele, die sich mit dem Metier auskennen,<br />
so schwer kann das doch<br />
nicht sein. Auch vermeintlich erfahrene<br />
Anwender machen immer<br />
wieder Fehler, so Horst Zech (RSV-<br />
Geschäftsführer). So müssen u. U.<br />
Produkte aus einer Werkstoffgruppe,<br />
die vom Anschein her<br />
nahezu identisch sind, ganz unterschiedlich<br />
verarbeitet werden.<br />
Der Einzige, der sich mit einem<br />
Produkt richtig auskennt, ist der<br />
Hersteller. Die Hersteller in jeder<br />
Phase der Planung, Ausschreibung<br />
und Ausführung mit zu beteiligen,<br />
ohne sich frühzeitig auf ein Verfahren<br />
und später auf ein Produkt festzulegen,<br />
vermeidet viele Fehler.<br />
Hier soll das neue RSV Merkblatt 6.2<br />
Schachtsanierung ein Leitfaden<br />
sein.<br />
Unter www.rsv-ev.de ist jetzt der<br />
Gelbdruck veröffentlicht worden.<br />
Die Einspruchsfrist für Einsprüche,<br />
Änderungen und Ergänzungen<br />
endet am 15. Mai diesen Jahres.<br />
Kontakt:<br />
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e. V.,<br />
Eidechsenweg 2,<br />
D-49811 Lingen (Ems),<br />
Tel. (05963) 9 81 08 77,<br />
Fax (05963) 9 81 08 78,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de,<br />
www.rsv-ev.de<br />
Neuer RSV-Arbeitskreis soll<br />
Standardleistungstexte erarbeiten<br />
Im Dezember 2011 fand in Hannover die konstituierende Sitzung<br />
des neuen Arbeitskreises „Standardleistungstexte“ statt<br />
Da die Bestandserhaltung der<br />
Infrastruktureinrichtungen eine<br />
der größten und wichtigsten<br />
Zukunftsaufgaben der Netzbetreiber<br />
darstellt, müssen vor dem Hintergrund<br />
einer angespannten<br />
Finanzlage optimale Konzepte in<br />
technischer und wirtschaftlicher<br />
Hinsicht gefunden und umgesetzt<br />
werden. Grabenlose Verfahren sind<br />
oft die bessere Lösung.<br />
Netzbetreiber können heute aus<br />
einer Vielzahl von Sanierungsverfahren<br />
auswählen. Vorteile ergeben<br />
sich nicht nur in wirtschaftlicher<br />
Hinsicht. Die Einbauzeit ist meist<br />
kürzer und im Gegensatz zur offenen<br />
Bauweise sind die Beeinträchtigungen<br />
für die Anwohner sowie<br />
den Fußgänger- und Straßenverkehr<br />
akzeptabel.<br />
Das gute Image der Sanierungsverfahren<br />
kann aber durch Planungsfehler<br />
gestört werden. Diese<br />
können dann zu Ausführungsfehlern<br />
führen, die durchaus einen<br />
enormen volkswirtschaftlichen<br />
Schaden annehmen können. Aus<br />
diesem Grunde sind zielgerichtete<br />
und technisch ausgereifte Ausschreibungen<br />
erforderlich, berichtet<br />
RSV – Geschäftsführer Dipl.-<br />
Volkswirt Horst Zech.<br />
Dem Netzbetreiber und Planer<br />
soll mit den Standardleistungstexten<br />
des RSV eine praktikable<br />
Unterstützung geboten werden, um<br />
ein Sanierungsprojekt neutral und<br />
fachlich korrekt zu beschreiben.<br />
Der RSV plant daher die Standardleistungstexte<br />
für die Renovierungsverfahren<br />
in einer einfachen<br />
und VOB-gerechten Gliederung zu<br />
erstellen. Begonnen wird die Arbeit<br />
mit den Renovierungsverfahren,<br />
gegliedert nach Europa Norm DIN<br />
EN 15885 und dem RSV-Regelwerk.<br />
Die grabenlosen Erneuerungsverfahren<br />
und die Druckrohrverfahren<br />
sollen dann folgen.<br />
Als Obmann des Arbeitskreises<br />
wurde mit Dipl.-Ing. Jörg Brunecker,<br />
ein erfahrener Fachmann gewonnen,<br />
der in den unterschiedlichen<br />
Sanierungsverfahren bewandert<br />
und zudem in der nationalen wie<br />
internationalen<br />
tätig ist.<br />
Standardisierung<br />
Förderung durch den RSV<br />
Durch die Erstellung von Standardleistungstexten<br />
soll der Einsatz von<br />
modernen Sanierungsverfahren ge -<br />
fördert werden. Die Standardleistungstexte<br />
stellen den aktuellen<br />
Stand der Technik dar und können<br />
deshalb nur als Bearbeitungsstand<br />
angesehen werden, der durch permanente<br />
Weiterentwicklung den<br />
Änderungen des Marktes angepasst<br />
werden muss.<br />
Fachleute, die an einer Mitarbeit<br />
in dem neuen Arbeitskreis interessiert<br />
sind, werden gebeten, Kontakt<br />
mit der RSV-Geschäftsstelle aufzunehmen.<br />
Kontakt:<br />
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e. V.,<br />
Eidechsenweg 2, D-49811 Lingen (Ems),<br />
Tel. (05963) 9 81 08 77,<br />
Fax (05963) 9 81 08 78,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de,<br />
www.rsv-ev.de<br />
März 2012<br />
276 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Know-how für<br />
Trinkwasser-Experten<br />
Mikrobiologie des Trinkwassers<br />
Grundlegendes Fachwissen zum Betrieb einer seuchenhygienisch<br />
einwandfreien Trinkwasserversorgung<br />
Grundlagenwerk mit den gesammelten Erkenntnissen zur hygienisch einwandfreien<br />
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser.<br />
Um eine seuchenhygienisch zuverlässige Trinkwasserversorgung betreiben<br />
zu können, erfordert dies Kenntnisse über Risiken durch Krankheitserreger, deren<br />
Vorkommen und Ausbreitung mit dem <strong>Wasser</strong>. Es werden allgemein verständlich<br />
Kenntnisse zum Betrieb einer zuverlässigen <strong>Wasser</strong>versorgung vermittelt, die sich<br />
aus Beobachtungen von Epidemien und ähnlichen<br />
Zwischenfällen ableiten.<br />
D. Schoenen<br />
1. Auflage 2011, ca. 250 Seiten, Hardcover<br />
Trinkwasserdesinfektion<br />
Vorstellung aller relevanten Verfahren, Anlagen und Geräte, die<br />
zur Trinkwasserdesinfektion und -kontrolle eingesetzt werden.<br />
Neben der Desinfektion mit chemischen Mitteln wie Chlor, Chlordioxid<br />
und Ozon werden auch die praxisrelevanten physikalischen Verfahren wie<br />
UV-Bestrahlung und Membranfiltration behandelt. Übersichtliche Ergebnisdarstellungen<br />
mit Tabellen zur Beurteilung nach Trinkwasserverordnung<br />
und abschließendem Kostenvergleich.<br />
W. Roeske<br />
3. Auflage 2011, ca. 200 Seiten, Hardcover<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle auf Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex.<br />
Mikrobiologie des Trinkwassers<br />
Fachbuch (ISBN: 978-3-8356-3247-9)<br />
1. Auflage 2011 für € 149,90 (zzgl. Versand)<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Ex.<br />
Trinkwasserdesinfektion<br />
Fachbuch (ISBN: 978-3-8356-3251-6)<br />
1. Auflage 2010 für € 49,90 (zzgl. Versand)<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAMBTW2011<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Moderner Kaltwasserzähler-Prüfstand<br />
mit geringer Messunsicherheit<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Kaltwasserzähler-Prüfstand, Messunsicherheit,<br />
DKD-Kalibrierlaboratorium<br />
Martin Kestner<br />
Die Metegra GmbH betreibt einen modernen, sehr<br />
wirtschaftlich arbeitenden Prüfstand für Kaltwasserzähler.<br />
Der Prüfstand besitzt eine vergleichsweise<br />
geringe Messunsicherheit, die im Rahmen der<br />
Akkreditierung des Unternehmens als DKD-Kalibrierlaboratorium<br />
nachgewiesen wurde.<br />
Modern Test bench for Cold Water Meters with Small<br />
Measurement Uncertainty<br />
Metegra GmbH runs a modern test bench for cold<br />
water meters which is very profitable. The test bench<br />
has a comparable small measurement uncertainty<br />
which has been proven by the accreditation of the<br />
company as DKD Calibration Laboratory.<br />
1. Einführung<br />
Die staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für<br />
<strong>Wasser</strong> (WG 21) der Metegra GmbH betreibt seit Ende<br />
des Jahres 2005 einen modernen Kaltwasserzählerprüfstand<br />
für die Reihenprüfung von Hauswasserzählern.<br />
Der Prüfstand wurde von der Firma Walter<br />
Boysen GmbH & Co. KG entwickelt, konstruiert und bei<br />
der Metegra GmbH in Laatzen aufgebaut und in Betrieb<br />
genommen. Im Sommer 2009 wurde der Prüfstand<br />
durch die Firma Inotech GmbH grundlegend überarbeitet<br />
und um zehn Messplätze erweitert [1], sodass<br />
bis zu 20 <strong>Wasser</strong>zähler in Reihe geprüft werden können.<br />
Der Prüfstand weist eine geringe Messunsicherheit auf,<br />
die im Rahmen der Akkreditierung als DKD-Kalibrierlaboratorium<br />
nach DIN EN 17025 verifiziert wurde. Die<br />
Bild 1. Kaltwasserzählerprüfstand WZP 1.<br />
Unsicherheit wurde außerdem vor Kurzem durch die<br />
Monte Carlo Methode validiert.<br />
2. Beschreibung des Prüfstands<br />
Der Prüfstand, Kurzbezeichnung WZP 1, wird mit Frischwasser<br />
aus dem städtischen Trinkwassernetz betrieben,<br />
das je nach Volumenstrom über eine Hydrophore oder<br />
über eine Kreisel-Pumpe eingespeist wird. Die realisierbaren<br />
Durchflüsse liegen im Bereich von 6 L/h bis<br />
12 m³/h.<br />
Es handelt sich um einen gravimetrischen Prüfstand<br />
mit statischer Wägung. Bild 1 zeigt die Prüfanlage. Für<br />
die Erfassung der relevanten Messgrößen verfügt der<br />
Prüfstand über ein zentrales Messdatenerfassungssystem,<br />
an dem ein PC angeschlossen ist. Zur Steuerung<br />
des Prüfablaufs und zur Auswertung der Messungen wird<br />
die Hersteller-Software der Firma Inotech verwendet.<br />
Der schematische Aufbau des Prüfstands ist in Bild 2<br />
dargestellt.<br />
Der Prüfstand besteht aus zwei Reihenprüfstrecken,<br />
die je nach Prüfdurchfluss in Reihe oder parallel geschaltet<br />
werden können. In jede Prüfreihe können bis zu<br />
10 Prüflinge eingespannt werden. Das <strong>Wasser</strong> durchströmt<br />
die Prüflinge und anschließend einen der<br />
drei magnetisch-induktiven Referenzzähler (MID 1 bis<br />
MID 3). Danach gelangt das <strong>Wasser</strong> über Durchflussregelventile<br />
und ein Schauglas zur Umschwenkvorrichtung.<br />
Die Umschwenkvorrichtung besteht aus einer<br />
pneumatisch angetriebenen Schwenkschaufel, mit der<br />
der <strong>Wasser</strong>strom zu Beginn der Messung von freiem<br />
Auslauf (Regenwasserkanal) auf Einlauf in den Wägebehälter<br />
umgeschwenkt wird. Am Ende der Messung<br />
wird wieder auf den freien Auslauf zurückgeschwenkt.<br />
März 2012<br />
278 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Umschwenk-<br />
vorrichtung<br />
Steuer- und<br />
Auswerte -PC<br />
Schauglas<br />
F (%)<br />
Imp.<br />
123,456 kg<br />
Waage<br />
Durchflussregelventile<br />
T2 T1 T3<br />
T6<br />
Laserabtastung<br />
T7<br />
P4<br />
Kanal<br />
P5<br />
MID<br />
2<br />
MID<br />
1<br />
MID<br />
3<br />
Referenzzähler<br />
P23<br />
11<br />
Prüfreihe 2<br />
20<br />
Spannzylinder<br />
Kompensator<br />
T5<br />
n 11 n 20<br />
Technikraum<br />
Druckluft<br />
n 10<br />
10<br />
T1 … T7: Temperaturmessstellen<br />
P1 …P5: Druckmessstellen<br />
Laserabtastung<br />
Prüfreihe 1<br />
n 1<br />
1<br />
T4<br />
P1<br />
Druckkessel<br />
Speise -<br />
Pumpe<br />
Spannzylinder<br />
Haupt-<br />
Pumpe<br />
Druckluft<br />
Trinkwasser<br />
(Stadtnetz)<br />
Bild 2. Schematischer Aufbau des Prüfstands.<br />
Zu den wesentlichen Vorteilen des Prüfstands<br />
gehören:<br />
""<br />
eine sehr genaue Waage<br />
(bis 300 kg, Anzeigeauflösung: 2 g)<br />
""<br />
Laserabtastung von Anlaufstern bzw. Zeiger<br />
des Prüflings<br />
""<br />
insgesamt sieben Temperaturmessstellen mit<br />
Pt 100 Sensoren, die für die Dichteberechnung<br />
des <strong>Wasser</strong>s verwendet werden<br />
""<br />
eine sehr symmetrisch arbeitende Umschwenkvorrichtung<br />
mit kleiner Unsicherheit<br />
""<br />
eine gute Entlüftung der Prüflinge durch Drehbarkeit<br />
der gesamten Prüfreihe im eingespannten<br />
Zustand, während sie durchströmt wird<br />
""<br />
vollautomatischer Betrieb.<br />
3. Kalibrierverfahren<br />
Die Prüfanlage arbeitet wahlweise mit magnetischinduktiven<br />
Durchflussmessgeräten (MID) oder einer<br />
Waage als Gebrauchsnormal.<br />
Die MID-Gebrauchsnormale werden wöchentlich<br />
gegen die Waage kalibriert. Die dabei gewogene<br />
<strong>Wasser</strong>menge wird durch die (temperaturabhängige)<br />
Dichte des <strong>Wasser</strong>s dividiert und um den Luftauftrieb<br />
korrigiert. So erhält man das Sollvolumen. Der zu kalibrierende<br />
Referenzzähler gibt hochfrequente, volumenproportionale<br />
Impulse ab. Aus Impulszahl und Impulswertigkeit<br />
ergibt sich das Istvolumen, aus Ist- und Sollvolumen<br />
die Messabweichung F MID des MID, die in der<br />
Prüfstandssoftware hinterlegt wird.<br />
Die Volumenerfassung eines <strong>Wasser</strong>zählers erfolgt<br />
über einen Impulsabgriff. Dies geschieht mittels Laserlichtschranke<br />
am Anlaufstern bzw. am Zeiger mit der<br />
größten Volumenauflösung oder über die Anzeige des<br />
Prüflings (z. B. bei <strong>Wasser</strong>zählern mit elektronischer<br />
Anzeige).<br />
Bedingt durch die Auflösung des Prüflings erhält<br />
man unterschiedliche Messzeiten für Prüfling und<br />
Normal. Daher wird der Durchfluss so lange konstant<br />
gehalten, bis sowohl das Normal wie auch der Prüfling<br />
mit der Messung fertig sind. Das Referenzvolumen wird<br />
durch die Messzeit auf den Prüfling korrigiert (Doppelstoppuhr-Methode).<br />
Üblicherweise wird mit fliegendem Start-Stopp-<br />
Betrieb gearbeitet. Bei stehendem Start-Stopp-Betrieb<br />
werden die Zählwerksstände des Prüflings am Beginn<br />
und am Ende der Messung abgelesen und über einen<br />
Handheld-Computer in den Prüfrechner eingegeben.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 279
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
4. Bestimmung der Messunsicherheit<br />
Die Bestimmung der Messunsicherheit des Prüfstands<br />
Imp MID,W Impulse des MID während der Messzeit<br />
gegenüber Waage<br />
erfolgte im Rahmen der Akkreditierung auf der Grundlage<br />
Iw MID Impulswertigkeit der MID-Impulse<br />
des „Guide to the Expression of Uncertainty in<br />
Measurement“ (GUM, [2]). Dafür wurden alle in Frage Das Sollvolumen ⎛ V des MID erhält man für den Fall der<br />
MID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
kommenden Unsicherheitsquellen analysiert und gravimetrischen FMID<br />
= ⎜<br />
V<br />
Messung ⎟ in Anlehnung an [3],<br />
⎝ MID soll ⎠<br />
100<br />
,<br />
bewertet. Für die Berechnung wurde das Programm Anhang ⎛ V 8.6, aus folgender Gleichung:<br />
MID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
„GUM Workbench“, Ver. 2.4, der Firma Metrodata FMID<br />
= ⎜<br />
V<br />
⎟<br />
⎝ MID soll W ⎠<br />
100<br />
,<br />
VP<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
− g<br />
verwendet.<br />
VMID,<br />
soll<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 ⋅<br />
ρWM<br />
, ID<br />
100 V<br />
V<br />
Nachfolgend sind die wesentlichen Modellgleichungen<br />
angegeben, um für vier verschiedene Durch-<br />
VMID,<br />
soll<br />
W VP<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
− g<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 ⋅ (3)<br />
flüsse und Prüfvolumina die Messunsicherheit des Prüfstands<br />
zu ermitteln. Beispielhaft sind einige Ergebnisse<br />
δVρ<br />
KlWM<br />
, ID<br />
100 V<br />
V<br />
V<br />
⎛ VMID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
δV<br />
der Messunsicherheitsermittlung für den Durchfluss<br />
Kl<br />
W<br />
FMID<br />
= ⎜ Wägewert,<br />
δV<br />
V<br />
⎟<br />
⎝<br />
korrigiert<br />
MID soll ⎠<br />
100<br />
,<br />
2,5 m³/h angegeben.<br />
V g<br />
ρ W,MID ⎛ V Dichte des Prüfwassers im MID bei der<br />
MID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
FV<br />
MID<br />
= ⎜ Temperatur θ<br />
δV<br />
WV<br />
⎟<br />
⎝<br />
MID<br />
MID soll V⎠<br />
100<br />
,<br />
g<br />
P<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
− g<br />
4.1 Kalibrierung des Referenzzählers<br />
KV<br />
MID LA , soll<br />
= Luftauftriebskorrektur<br />
⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 ⋅<br />
V<br />
ρWM<br />
, ID<br />
100 τVMID<br />
V<br />
Die prozentuale Messabweichung des Referenzzählers VW P<br />
= ( WA−FWaage<br />
Prüfvolumen − δFWaage<br />
)⋅ + δWflex + δWVer +<br />
WSpr<br />
W VP<br />
δτ<br />
V<br />
δV<br />
Wa Kl<br />
− g<br />
wird nach folgender, wohlbekannter Formel ermittelt: VMID,<br />
soll<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 ⋅<br />
δV<br />
τ<br />
Kl<br />
ρWM<br />
, ID MID 100 V<br />
V<br />
W = ( WA−FWaage<br />
− δrelative FWaage<br />
)⋅ Volumenmessabweichung + δWflex + δWVer + δWSpr<br />
durch<br />
⎛ VMID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
FMID<br />
= ⎜<br />
⎝ V<br />
⎟<br />
MID soll ⎠<br />
V<br />
100 (1)<br />
⎛ VPist<br />
,<br />
−V<br />
⎞<br />
Psoll ,<br />
FP<br />
= ⎜<br />
F<br />
p<br />
,<br />
⎝ V<br />
⎟<br />
Ps , oll ⎠<br />
τWa<br />
die Umschwenkvorrichtung 100 + δ<br />
(in %)<br />
δV<br />
⎛ VMID ist<br />
−V<br />
⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
Re<br />
F Kl<br />
MID<br />
= dV<br />
⎛<br />
F MID Messabweichung des Referenzzählers<br />
V<br />
δ<br />
⎜ ZR Volumenmessabweichung durch das<br />
Vg<br />
Pist<br />
−VV<br />
⎟<br />
⎝ MID⎞<br />
soll<br />
, Psoll ,<br />
FP<br />
=<br />
W VP<br />
δV<br />
δV<br />
⎜<br />
p<br />
Kl<br />
− g<br />
VMID,<br />
soll<br />
= (MID) ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 V<br />
⎟ F<br />
Ps , oll<br />
⋅<br />
⎝ ⎠<br />
⎠<br />
100<br />
,<br />
Zwischenrohr<br />
V<br />
100 δ<br />
Re<br />
⎛ FMID<br />
+ δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
τP<br />
V ρWM<br />
, ID<br />
100 V<br />
V<br />
Vδ<br />
Psoll<br />
V, g = WVMID, ist2<br />
⋅ −<br />
MID,ist1 Istvolumen, das durch den MID während<br />
⎝<br />
⎜1<br />
V ⎟ ⋅ ⋅<br />
P<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
100 ⎠<br />
− g<br />
V<br />
relative Volumenmessabweichung<br />
τ<br />
ρwP5<br />
τMID<br />
durch<br />
MID,<br />
soll<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 MID<br />
der Messzeit gegen Waage geströmt ist W = ( ⋅<br />
V ρWM<br />
, A⎛−ID<br />
FWaage<br />
Gasblasen F −<br />
MID<br />
+ 100 δ<br />
F Waage MID(in ⎞<br />
V)⋅ ρppm)<br />
+ δ<br />
wMID<br />
τW δW δW<br />
P flex<br />
+ V<br />
Ver<br />
+<br />
Spr<br />
VPsoll<br />
,<br />
= VMID , ist2<br />
⋅ −<br />
Vδ<br />
MID,soll<br />
VKl<br />
Sollvolumen, das durch den MID<br />
⎝<br />
⎜1<br />
⎟ ⋅ τWa<br />
⋅<br />
100 ⎠ ρwP5<br />
τMID<br />
V geströmt ist<br />
δ<br />
τMID<br />
Für<br />
VKl<br />
Wdie = ( Dichteberechnung WA−FWaage<br />
− δFWaage<br />
)⋅ wird + die δWFormel flex<br />
+ δWVer von + δBettin<br />
WSpr<br />
⎛ VPist<br />
,<br />
−V<br />
⎞<br />
Psoll ,<br />
FP<br />
=<br />
F<br />
p<br />
Das δIstvolumen V<br />
⎜<br />
g<br />
des MID wird aus den Impulsen und der ⎝ V<br />
⎟<br />
Ps , oll ⎠<br />
100 +<br />
τWa<br />
und V Spieweck verwendet [4]. δ Der Wägewert wird wie<br />
Re<br />
folgt korrigiert:<br />
Impulswertigkeit V<br />
δVg<br />
⎛ V<br />
des MID ermittelt:<br />
Pist<br />
−V<br />
⎞<br />
, Psoll ,<br />
FP<br />
= ⎜<br />
V<br />
⎟ F<br />
p<br />
⎝ Ps , oll ⎛ ⎠<br />
100<br />
FMID<br />
+<br />
δ<br />
Re<br />
V<br />
W δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
τP<br />
V<br />
τ<br />
V<br />
=<br />
Psoll ,<br />
= VMID , ist2<br />
⋅ −<br />
MID<br />
W MID,ist1 = ( W= A− Imp FWaage<br />
MID,W − δ· FIw Waage MID )⋅ (2)<br />
+ δWflex + δWVer + δW<br />
⎝<br />
⎜1<br />
⎟ ⋅ ⋅<br />
100 ⎠ ρwP5<br />
τMID<br />
Spr<br />
τWa<br />
⎛ F<br />
τ<br />
MID<br />
+<br />
MID<br />
W = δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
τP<br />
V( WA− Psoll ,<br />
=<br />
FWaage<br />
V<br />
− δ<br />
MID, ist2<br />
⋅<br />
FWaage<br />
−<br />
⎝<br />
⎜1<br />
)⋅ + δW ⎟ ⋅flex + δW ⋅<br />
Ver<br />
+ δWSpr<br />
(4)<br />
100<br />
τWa<br />
⎠ ρwP5<br />
τMID<br />
⎛ VPist<br />
,<br />
−V<br />
⎞<br />
Tabelle<br />
Psoll ,<br />
FP<br />
= 1. Erweiterte Messunsicherheit<br />
⎜<br />
F<br />
p<br />
⎝ V<br />
⎟<br />
Ps , oll ⎠<br />
100 + δ der Kalibrierung<br />
W A Wägewert der <strong>Wasser</strong>menge<br />
Re<br />
⎛ VPist<br />
−V<br />
⎞<br />
des Referenzzählers.<br />
, Psoll ,<br />
FP<br />
=<br />
(Anzeige<br />
⎜<br />
V<br />
⎟ F<br />
p<br />
⎝ Ps , oll ⎠<br />
100 + δder Waage)<br />
Re<br />
F Waage Messabweichung der Waage<br />
Ergebnisse:<br />
⎛ FMID<br />
+ δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
τ<br />
dF<br />
P<br />
Waage Langzeitdrift der Waage zwischen zwei<br />
Größe VPsoll<br />
,<br />
= V Wert<br />
MID, ist2<br />
⋅ −<br />
⎝<br />
⎜1<br />
Erw. Messunsicherheit<br />
P<br />
⎟ ⋅ ⋅Erweiterungs-<br />
VPsoll<br />
,<br />
100 ⎠ ρwP5<br />
τ<br />
⎛ Kalibrierungen FMID<br />
+ δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
τ<br />
MIDfaktor<br />
= VMID , ist2<br />
⋅ −<br />
⎝<br />
⎜1<br />
⎟ ⋅ ⋅<br />
τ Wa Messzeit 100der Waage ⎠ ρwP5<br />
τMID<br />
F MID –0,506 % 0,031% 2,00<br />
τ MID Messzeit des MID<br />
V MIDsoll 120,741 L 0,038 L 2,00<br />
dW flex Messabweichung durch flexible<br />
Anschlüsse am Wägebehälter<br />
dW Ver Masseverluste durch Verdunstung<br />
Tabelle 2. Relative Anteile an der erweiterten Messunsicherheit<br />
dW Spr Masseverluste durch Spritzwasser<br />
bei der Kalibrierung des<br />
Referenzzählers.<br />
Größe<br />
relativer Anteil an der<br />
erw. Messunsicherheit<br />
von F MID (in %)<br />
Änderung der Luftdichte 79,1<br />
angezeigter Wägewert 14,0<br />
Umschwenkvorrichtung 3,3<br />
Gasblasen im Prüfwasser 1,5<br />
Sonstiges 2,1<br />
Nach Eingabe der ermittelten Messwerte bzw. geeigneter<br />
Abschätzungen für alle Eingangsgrößen in das<br />
Programm „GUM Workbench“ erhält man ein detailliertes<br />
Messunsicherheitsbudget, von dem die wichtigsten<br />
Ergebnisse in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst<br />
sind.<br />
Die Gesamtunsicherheit von 0,031 % ist relativ klein.<br />
Den Hauptanteil der Unsicherheit von F MID stellt die<br />
großzügig abgeschätzte mögliche Änderung der<br />
März 2012<br />
280 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
F<br />
MID<br />
⎛ V<br />
= ⎜<br />
⎝<br />
V<br />
−V<br />
MID, ist1<br />
MID,<br />
soll<br />
MID,<br />
soll<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
⋅ 100<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
W VP<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
− g<br />
VMID,<br />
soll<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 6 ⋅<br />
ρWM<br />
, ID<br />
100 V<br />
V<br />
Luftdichte bei der Kalibrierung der Waage dar. Die<br />
Umschwenkvorrichtung hat nur 3,3 % Anteil an der<br />
δVKl<br />
Gesamtunsicherheit.<br />
V<br />
4.2 δKalibrierung V<br />
von <strong>Wasser</strong>zählern<br />
g<br />
(fliegender Start-Stopp)<br />
V<br />
Die prozentuale Messabweichung eines <strong>Wasser</strong>zählers<br />
(Prüfling) ergibt sich analog zu τ Gleichung (1) und einem<br />
MID<br />
Summanden,<br />
W = ( WA−FWaage<br />
der die<br />
− δF Wiederholstreuung Waage )⋅ + δWflex + δ<br />
τ<br />
des<br />
WVer Prüflings<br />
+ δWSpr<br />
Wa<br />
enthält:<br />
F<br />
P<br />
⎛ V<br />
= ⎜<br />
⎝<br />
−V<br />
V<br />
Pist , Psoll ,<br />
Ps , oll<br />
⎞<br />
⎟ F<br />
⎠<br />
⋅ 100 + δ<br />
Rep<br />
F P<br />
V ⎛ FMID<br />
+ δFMID<br />
⎞ ρwMID<br />
Psoll P,ist ,<br />
= VMID , ist2<br />
⋅ −<br />
⎝<br />
⎜1<br />
⎟ ⋅ ⋅<br />
geströmt ist 100 ⎠ ρwP5<br />
V P,soll<br />
(5)<br />
Messabweichung des Prüflings<br />
Istvolumen, das durch den Prüfling τP<br />
τMID<br />
Sollvolumen des Prüflings (das durch<br />
die Referenz [MID] gemessene und auf<br />
⎛ VMIDden ist<br />
−VEinbauort ⎞<br />
, 1 MID,<br />
soll<br />
F<br />
des Prüflings bezogene<br />
MID<br />
= ⎜<br />
Volumen) V<br />
⎟<br />
⎝ MID soll ⎠<br />
⋅ 100<br />
,<br />
dF Rep Unsicherheit der Wiederholbarkeit<br />
W(Repeatability) V der Prüflingsmessung<br />
P<br />
δV<br />
δV<br />
Kl<br />
− g<br />
VMID,<br />
soll<br />
= ⋅ K<br />
LA<br />
+ ⋅ + δVZR<br />
+ VP<br />
⋅10 6 ⋅<br />
ρWM<br />
, ID<br />
100 V<br />
V<br />
Das Istvolumen des Prüflings wird aus den Impulsen und<br />
der δImpulswertigkeit V<br />
des Prüflings ermittelt:<br />
Kl<br />
V<br />
V P,ist = Imp P · Iw P (6)<br />
δVg<br />
Imp V P Impulse des Prüflings während der<br />
Messzeit<br />
Iw P Impulswertigkeit τMIDdes Prüflings<br />
W = ( WA−FWaage<br />
− δFWaage<br />
)⋅ + δWflex + δWVer + δWSpr<br />
τWa<br />
Das Sollvolumen des Prüflings erhält man aus folgender<br />
Gleichung ⎛ V (dabei wird als „worst case“ der Zähler<br />
Pist<br />
−V<br />
⎞<br />
, Psoll ,<br />
betrachtet, FP<br />
= ⎜<br />
V<br />
der am ⎟ weitesten F<br />
p von den Druck- und<br />
⎝ Ps , oll ⎠<br />
⋅ 100 + δ<br />
Re<br />
Temperaturmessstellen entfernt ist, also Prüfling 5):<br />
V<br />
⎛<br />
F<br />
+ δF<br />
⎞<br />
ρ<br />
τ<br />
τ<br />
MID MID wMID P<br />
Psoll ,<br />
= VMID , ist2<br />
⋅ −<br />
⎝<br />
⎜1<br />
⎟ ⋅ ⋅<br />
100 ⎠ ρwP5<br />
MID<br />
mit:<br />
(7)<br />
V MID,ist2 = Imp MID,P · Iw MID (8)<br />
V MID,ist2<br />
Istvolumen, das durch den MID<br />
während der Messzeit gegen Prüfling<br />
geströmt ist<br />
Imp MID,P Impulse des MID während der Messzeit<br />
gegenüber Prüfling<br />
Iw MID Impulswertigkeit der MID-Impulse<br />
F MID Messabweichung des Referenzzählers<br />
(MID), s. 4.1<br />
dF MID zeitliche Drift des MID zwischen zwei<br />
Kalibrierungen<br />
r wP5 Dichte des <strong>Wasser</strong>s in Prüfling 5<br />
τ MID Messzeit am MID<br />
Messzeit am Prüfling<br />
τ P<br />
Tabelle 3. Erweiterte Messunsicherheit der Kalibrierung<br />
von <strong>Wasser</strong>zählern.<br />
Ergebnisse:<br />
Größe Wert Erw. Messunsicherheit<br />
Erweiterungsfaktor<br />
F P –0,532 % 0,074% 2,00<br />
θ P5 11,355 °C 0,033 °C 2,00<br />
Tabelle 4. Relative Anteile an der erweiterten Messunsicherheit<br />
bei der Kalibrierung von <strong>Wasser</strong>zählern.<br />
Größe<br />
relativer Anteil an der<br />
erw. Messunsicherheit<br />
von F P (in %)<br />
Wiederholbarkeit des Prüflings 68,7<br />
Fehler des MID 17,3<br />
Drift des MID 13,6<br />
Sonstiges 0,4<br />
Tabelle 5. Kleinste angebbare Messunsicherheiten des<br />
DKD-Kalibrierlaboratoriums.<br />
Durchfluss<br />
erw. Messunsicherheit<br />
6 L/h … 600 L/h 0,30 %<br />
> 600 L/h … 12 m 3 /h 0,15 %<br />
Als Prüflinge wurden messbeständige Ringkolbenzähler<br />
der Größe Q n 2,5 m³/h gewählt. Nach Einsetzen der<br />
Messwerte bzw. Abschätzungen in die „GUM Workbench“<br />
erhält man die in den Tabellen 3 und 4 dargestellten<br />
Ergebnisse.<br />
Die erweiterte Messunsicherheit von F P liegt mit<br />
0,074 % deutlich unter dem eichrechtlich maximal<br />
zulässigen Wert von 0,40 %. Die Wiederholbarkeit des<br />
Prüflings und der Fehler des MID stellen die Hauptanteile<br />
der Unsicherheit von F P dar.<br />
Bei den anderen drei untersuchten Durchflüssen<br />
ergaben sich zum Teil etwas höhere Messunsicherheiten.<br />
Als kleinste angebbare Messunsicherheiten des<br />
Kalibrierlaboratoriums in Abhängigkeit vom Durchflussbereich<br />
wurden im Rahmen der Akkreditierung die<br />
Werte gemäß Tabelle 5 festgelegt.<br />
5. Validierung der Messunsicherheitsermittlung<br />
durch die Monte Carlo Methode<br />
Die Messunsicherheitsermittlung nach GUM setzt voraus,<br />
dass man mit linearen Modellgleichungen arbeitet.<br />
Dies ist in unserem Fall nicht gegeben. Die Monte Carlo<br />
Methode ist an diese Restriktion der Linearität nicht<br />
gebunden.<br />
Bei der Monte Carlo Methode werden die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen<br />
der Eingangsgrößen<br />
durch das mathematische Modell hindurch fortgepflanzt.<br />
Dies geschieht unter Verwendung von<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 281
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Für die Ergebnisgröße F P , die Messabweichung des<br />
Prüflings, ergibt sich nach Monte Carlo in guter Näherung<br />
eine Normalverteilung (s. Bild 4). Daher sind die<br />
Unsicherheitsintervalle der Monte Carlo Methode (blau<br />
gepunktet) nahezu identisch mit denen nach GUM (rot<br />
gestrichelt).<br />
Bild 3. Monte Carlo Simulation für F MID .<br />
6. Zusammenfassung<br />
Die Metegra GmbH verfügt über einen modernen und<br />
sehr wirtschaftlich arbeitenden Hauswasserzählerprüfstand<br />
mit geringer Messunsicherheit. Der Nachweis<br />
wurde im Rahmen der Akkreditierung als DKD-Kalibrierlaboratorium<br />
erbracht. Mit Hilfe der Monte Carlo<br />
Methode konnten die Ergebnisse der Messunsicherheitsbetrachtungen<br />
validiert werden.<br />
Bild 4. Monte Carlo Simulation für F P .<br />
Zufallszahlen, mit denen man die Messaufgabe virtuell<br />
sehr oft wiederholt. Weitere Angaben zum Verfahren<br />
sind unter [5] und [6] zu finden.<br />
In dem untersuchten Fall wurden 10 000 000 Durchläufe<br />
mit Zufallszahlen durchgeführt. Wie man in Bild 3<br />
sieht, liegt für die Ergebnisgröße F MID eine Mischung aus<br />
trapezförmiger Verteilung und Normalverteilung vor.<br />
Das Unsicherheitsintervall der Monte Carlo Methode<br />
(senkrecht, blau gepunktet) ist etwas kleiner als das<br />
Intervall nach GUM (senkrecht, rot gestrichelt), da das<br />
Verfahren nach GUM bei einem Freiheitsgrad größer<br />
als 20 stets von einer Normalverteilung ausgeht (mit<br />
langen roten Strichen angedeutet).<br />
Literatur<br />
[1] Reiser, S.: Betrieb und Wartung für <strong>Wasser</strong>zähler-Prüfan lagen.<br />
Inotech GmbH, 2009.<br />
[2] ISO, Guide to the expression of uncertainty in measurement.<br />
International Organisation for Standardisation, 1993, 2008.<br />
[3] Richtlinie für die Eichung von Volumenmessgeräten für strömendes<br />
<strong>Wasser</strong> und Anforderungen an Normale, Teil 1, Kaltwasserzähler,<br />
Eichbehörden der Länder, 08. November 2001.<br />
[4] Bettin, H. und Spieweck, F.: Die Dichte des <strong>Wasser</strong>s als Funktion<br />
der Temperatur nach Einführung der Internationalen<br />
Temperaturskala von 1990. PTB-Mitteilungen 100 (1990),<br />
S. 195–196.<br />
[5] Zeier, M.: Der ISO-GUM erhält Verstärkung. METinfo 15 (2008)<br />
Nr. 3.<br />
[6] BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML, Evaluation of<br />
measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the<br />
expression of uncertainty in measurement” – Propagation of<br />
distributions using a Monte Carlo method. JCGM 101:2008.<br />
Autor<br />
Eingereicht: 13.09.2011<br />
Korrektur: –<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Dipl.-Ing. Martin Kestner<br />
E-Mail: martin.kestner@metegra.de |<br />
Leiter der staatl. anerkannten Prüfstelle für Messgeräte für<br />
<strong>Wasser</strong> (WG 21) und Leiter Kalibrierlaboratorium DKD-K-49401 |<br />
Metegra GmbH |<br />
Peiner Straße 47 |<br />
D-30880 Laatzen<br />
März 2012<br />
282 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Buchbesprechung<br />
Buchbesprechung<br />
Lagerung und Transport<br />
wassergefährdender Stoffe<br />
Ergänzbares Handbuch der rechtlichen,<br />
technischen und naturwissenschaftlichen<br />
Grundlagen für Betrieb und Verwaltung<br />
Von Dr. Ernst-W. Diesel†, ehemals Regierungsdirektor<br />
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktorsicherheit und Prof. Dr.-Ing.<br />
Hans-Peter Lühr, HPL-Umwelt-Consult GmbH und<br />
Technische Universität Berlin. Berlin, Bielefeld,<br />
München: Erich Schmidt Verlag 2012. Loseblattwerk,<br />
11560 Seiten in 6 Ordnern, Preis: € 268,00,<br />
ISBN 978-3-503-01990-8.<br />
Das Praktiker-Handbuch!<br />
Ein Großteil der Stoffe, die in Industrie, Gewerbe<br />
oder im privaten Bereich zum Einsatz kommen,<br />
sind wassergefährdend. Geraten diese in Boden,<br />
Grundwasser oder Oberflächengewässer, kann dies<br />
das Trinkwasser beeinträchtigen oder zu ökologischen<br />
Katastrophen führen. Anlagen zur<br />
Lagerung wassergefährdender Stoffe müssen deshalb<br />
so betrieben werden, dass Störfälle sicher vermieden<br />
werden. Auch der sichere Umgang und<br />
Transport wassergefährdender Stoffe muss gewährleistet<br />
sein.<br />
Folgende Inhalte stehen zur Verfügung:<br />
alle relevanten Anforderungen, Grundlagen,<br />
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften,<br />
Richtlinien, Technischen Regeln u. v. m.<br />
ergänzende Informationen zu wichtigen<br />
Randgebieten sowie<br />
Ausführungen zum Technischen Recht der<br />
Europäischen Union, das auch für die Praxis in<br />
Deutschland immer bedeutsamer wird.<br />
Mit der ersten Ergänzung 2012 werden<br />
aktualisiert:<br />
Auf der Ebene des Bundes – werden die<br />
OberflächengewässerVO, die EntsorgungsfachbetriebeVO<br />
und die BiomasseVO neu<br />
aufgenommen.<br />
Auf der Ebene der Länder – wird die VAwS<br />
von Mecklenburg-Vorpommern aktualisiert.<br />
Auf der Ebene der Technischen<br />
Regeln – werden die<br />
Güte- und Prüfbestimmungen<br />
von Tanklägern<br />
(GP 121) neu aufgenommen.<br />
Bestellmöglichkeit online<br />
www.ESV.info/978 3 503 01990 8<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 3/2012 lesen Sie u. a. folgende Beiträge:<br />
Schmitt Weiterentwicklung des DWA-Regelwerkes für Regenwetterabflüsse –<br />
Werkstattbericht<br />
Popp u.a. Fremdwassermesskonzept –<br />
Fremdwasser und Infiltrationsrate geben Schwerpunkte für die Kanalsanierung vor<br />
Beckermann/Kopmann<br />
Vu u.a.<br />
Langenohl<br />
Beauftragte Personen in Kläranlagen<br />
nachweis von Pulveraktivkohle in Abwässern mithilfe der Thermogravimetrie<br />
landwirtschaftliche Klärschlammverwertung: Aktuelle und zukünftige<br />
Anforderungen der Klärschlamm- und Düngemittelverordnung<br />
Gawel/Fälsch Zur Lenkungswirkung von <strong>Wasser</strong>entnahmeentgelten –<br />
Teil 2: Substitutionswirkungen sowie Markt- und Preiseffekte<br />
Scheier/Nisipeanu<br />
landesrechtliche Versuche einer Bewertung von Bauschutt und Bodenmaterial<br />
als „gefährlicher“ Abfall – zugleich ein Beitrag zur Auslegung und Anwendung<br />
der Abfallverzeichnis-Verordnung<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 283
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
Präqualifikation und Bewertung<br />
von Dienstleistungsfirmen am Beispiel<br />
eines Energieversorgers<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze, Qualifizierungsverfahren, Präqualifikation, Eignungsprüfung,<br />
lieferantenbewertung, Verrichtungsgehilfe<br />
Sandra Gonka und Thomas Bruderhofer<br />
Durch die zunehmende Verlagerung der Wertschöpfung<br />
gewinnt die Lieferantenauswahl als Erfolgsfaktor<br />
an Bedeutung. Als Ursache wird die unzureichende<br />
Kenntnis hinsichtlich Fachkompetenz, Leistungsfähigkeit<br />
und Eignung der Lieferanten sowie<br />
das Interesse der Auftraggeber, sich gegen Haftungsansprüche<br />
im Schadensfall abzusichern, gesehen.<br />
Zudem besteht für die Energieversorger eine gesetzliche<br />
Verpflichtung, die Qualifikation der beauftragten<br />
Dienstleistungsfirmen zu prüfen und über eine<br />
entsprechende Nachweisdokumentation zu verfügen.<br />
Ziel der Implementierung des Präqualifikations- und<br />
Bewertungsverfahrens für die EnBW Regional AG ist<br />
es, ein detailliertes Bild über die Bewerberfirmen zu<br />
gewinnen und einen Pool an qualifizierten Lieferanten<br />
aufzubauen. Zusätzlich dient ein solches<br />
Verfahren zur Verringerung von Qualitätsmängeln<br />
verursacht durch die eingesetzten Lieferanten, zur<br />
Identifizierung von Ansatzpunkten der Lieferantenentwicklung,<br />
um Kosten- und Aufwand zu reduzieren.<br />
Prequalification and Evaluation of Service Companies<br />
Using the Example of an Energy Provider<br />
Due to the increasing displacement of added value,<br />
the supplier selection as a factor of success becomes<br />
more important. The reason is the insufficient knowledge<br />
of the professional competence, efficiency and<br />
qualification of the suppliers as well as the interest of<br />
the principal to protect himself against liability<br />
claims in case of loss. In addition to this exists a legal<br />
obligation for energy providers to check the qualification<br />
of the assigned service companies and to command<br />
analysis documentation. The aim of launching<br />
such a prequalification- and evaluation system for<br />
the EnBW Regional AG is to gain an explicit image of<br />
the service companies and of course to establish a<br />
pool of qualified suppliers. In addition to that such a<br />
system conduces to compensation of quality defects<br />
caused by suppliers; identifies starting points for the<br />
supplier improvement in order to reduce costs and<br />
complexity.<br />
1. Einführung<br />
Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen<br />
zu Lieferanten gewinnen für viele Unternehmen<br />
zunehmend an Bedeutung und werden damit<br />
zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor [1]. Ursache<br />
dafür sind die zunehmende Dynamik im internationalen<br />
Wettbewerbsumfeld, eine Konfrontation mit erheblichem<br />
Kostendruck [2], abnehmenden Stückzahlen und<br />
eine höhere Produktkomplexität. Dieser Entwicklung<br />
begegnen die Unternehmen mit einer Konzentration<br />
auf die Kernkompetenzen. Daraus resultiert eine wachsende<br />
Wertschöpfungsverlagerung an die Lieferanten<br />
[3]. Als Ergebnis sehen sich die Unternehmungen einer<br />
immer weiter steigenden Anzahl an Dienstleistungsunternehmen<br />
gegenüber [4].<br />
Dabei entsteht für die Unternehmen das Problem<br />
der unzureichenden Kenntnis hinsichtlich Fachkompetenz,<br />
Leistungsfähigkeit und Eignung der Lieferanten.<br />
Erschwerend kommen höhere Sicherheitsstandards,<br />
verschärfte Umweltvorschriften und zunehmende Qualitätsanforderungen<br />
hinzu, die von den eingesetzten<br />
Lieferanten zu beachten sind [5]. Diese Informationen<br />
sind allerdings für die richtige Lieferantenauswahl von<br />
essenzieller Bedeutung [6]. Gleichzeitig besitzen die<br />
Auftraggeber ein Interesse daran, sich gegen Haftungsansprüche<br />
im Schadensfall abzusichern. Aus diesem<br />
Grund sind die beauftragenden Unternehmen ge -<br />
zwungen, im Vorfeld einer Auftragsvergabe sich durch<br />
eine sorgfältige Lieferantenauswahl, durch spezielle<br />
Auswahl- und Analyseverfahren [7] abzusichern [8]. Im<br />
Rahmen der Lieferantenauswahl sind diejenigen Lieferanten<br />
zu identifizieren, welche die spezifischen<br />
Bedürfnisse der Unternehmung am besten erfüllen [1].<br />
Dies unterstreicht eine Benchmark-Studie [9] bei<br />
410 Einkaufsverantwortlichen der wichtigsten Industriebranchen<br />
[10] aus neun europäischen Ländern, wonach<br />
März 2012<br />
284 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
Fachberichte<br />
79 % der Einkäufer die enorme Bedeutung des Lieferantenmanagements<br />
erkannten, allerdings setzen dies<br />
bisher lediglich 19 % der Befragten um [11].<br />
Bislang mussten die Lieferanten in jedem Vergabeverfahren<br />
bestimmte Nachweise für ihre Eignung<br />
erbringen [12]. Folge war ein erheblicher Kosten- und<br />
Zeitaufwand für Bewerberunternehmen und Auftraggeber.<br />
Um Aufschluss über die Kompetenz der Lieferanten<br />
zu erhalten, kann daher die Einführung von<br />
Präqualifikationsverfahren zweckdienlich sein [13]. Die<br />
Herausforderung für die Unternehmen besteht in einer<br />
möglichst effizienten Gestaltung eines solchen Verfahrens.<br />
Demgegenüber kann die richtige Lieferantenauswahl<br />
Kosten einsparen. Dies belegt eine Studie im<br />
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und<br />
Arbeit. Diese Studie kam nach einer quantitativen<br />
Schätzung zu dem Ergebnis, dass deutsche Unternehmungen<br />
durch die Implementierung von Präqualifikationsverfahren<br />
eine Kostenreduzierung von etwa 2 %<br />
des Vergabevolumens [14] realisieren können [15].<br />
Die Energiebranche ist genau mit diesen Problematiken<br />
konfrontiert. So sind die Energieversorger<br />
gesetzlich dazu verpflichtet, eine Überprüfung der<br />
Qualifik ation und Leistungsfähigkeit der beauftragten<br />
Dienstleistungsfirmen vorzunehmen und über eine entsprechende<br />
Nachweisdokumentation zu verfügen [13].<br />
Bei der Implementierung von Präqualifizierungsverfahren<br />
sind in dieser Branche spezielle Vorschriften zu<br />
beachten.<br />
Vor diesem Hintergrund hat sich bei der EnBW<br />
Re gional AG mit der Einführung des Präqualifikationsund<br />
Bewertungsverfahrens für Dienstleistungsunternehmen<br />
ein umfangreiches, an den Bedürfnissen der<br />
EnBW Regional AG sowie an gesetzlichen Regelungen<br />
ausgerichtetes Qualifizierungsverfahren etabliert.<br />
2. Grundlagen der Präqualifikation<br />
Das Beschaffungsamt des Inneren versteht unter einem<br />
Präqualifikationsverfahren eine vorwettbewerbliche<br />
Eignungsprüfung, die eine „(…) auftragsunabhängige<br />
Prüfung und Zertifizierung von Eignungsnachweisen (…)“<br />
[16] darstellt. Somit müssen bei der Vergabe öffentlicher<br />
Aufträge Bescheinigungen über die Fachkompetenz<br />
und Leistungsfähigkeit durch den potenziellen Auftragnehmer<br />
erbracht werden. Ausgangspunkt für die Einführung<br />
von Eignungsprüfungen ist der § 831 des Bürgerlichen<br />
Gesetzbuches (BGB). Gemäß § 831 BGB ist ein<br />
Unternehmen, das ein anderes Unternehmen (Verrichtungsgehilfe)<br />
zur Verrichtung einer Tätigkeit bestellt hat,<br />
zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der Verrichtungsgehilfe<br />
in Ausführung der Verrichtung einem<br />
Dritten widerrechtlich zuführt [17]. Diese Ersatzpflicht<br />
tritt nicht ein, wenn der Auftraggeber bei der Auswahl<br />
des Verrichtungsgehilfen und, „(…) sofern er Vorrichtungen<br />
oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung<br />
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung<br />
oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt<br />
beobachtet (…)“ [17]. Tritt dennoch eine Schädigung<br />
dritter Personen ein, unterstellt der Gesetzgeber dem<br />
Geschäftsherrn eine Nachlässigkeit bezüglich der gehörigen<br />
Überwachung und Belehrung des Gehilfen. Daher<br />
hat der Geschäftsherr unabhängig von der Verantwortlichkeit<br />
des Gehilfen für den von diesem verursachten<br />
Schaden aufzukommen. Jedoch wird dem Auftraggeber<br />
die Möglichkeit eingeräumt, diese Verschuldensvermutung<br />
zu widerlegen. Gelingt es dem Auftraggeber nachzuweisen,<br />
dass er sorgfältig ausgewählt und gewissenhaft<br />
überwacht hat, kommt er von der Haftung frei [18].<br />
Hilfreich für diesen Nachweis ist eine entsprechende<br />
Dokumentation, welche der Auftraggeber im Rahmen<br />
eines Präqualifizierungsverfahrens erzeugen kann.<br />
Unternehmen aus dem Versorgungsbereich unterliegen<br />
im Vergleich zu öffentlichen Auftraggebern<br />
strengeren Haftungsgrundsätzen. Diese ergeben sich<br />
vorrangig aus der Versorgungssicherheit sowie dem<br />
Gefährdungspotenzial der Leistung. Neben dem § 831<br />
BGB gelten für die Versorgungsunternehmen unabhängig<br />
vom Schwellenwert zusätzliche Vorschriften, die<br />
sich aus der Haftung des Netzbetreibers nach § 18<br />
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) für den<br />
Bereich Strom und § 18 Niederdruckanschlussverordnung<br />
(NDAV) für den Bereich Gas sowie aus der Haftung<br />
bei Störungen der Netznutzung nach § 5 Energiewirtschaftsgesetz<br />
(EnWG) [19] ergeben. Anliegen des § 18<br />
NAV beziehungsweise § 18 NDAV ist die Verschärfung<br />
der Haftung des Netzbetreibers bei Netzstörungen, wie<br />
beispielsweise Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten.<br />
In diesem Rahmen wurde dem Netzbetreiber die<br />
Beweislast auferlegt, dass er Sach- und Vermögensschäden<br />
nicht schuldhaft verursacht hat (Beweislastumkehr).<br />
Ist der Netzbetreiber nicht in der Lage, die<br />
entsprechenden Nachweise zu erbringen, ist er zum<br />
Schadensersatz verpflichtet. Diese Regelung gilt auch,<br />
wenn den Netzbetreiber tatsächlich kein Verschulden<br />
trifft. Demzufolge trägt der Netzbetreiber das Risiko des<br />
fehlenden Nachweises. Als Konsequenz hieraus sollte<br />
der Netzbetreiber eine Vorsorge für die Nachweisführung<br />
im Schadensfall treffen. Um Nachweise der<br />
Unschuld im Schadensfall erbringen zu können, kann<br />
der Netzbetreiber entsprechende Nachweise und<br />
Nachweisverfahren in seiner Unternehmung implementieren<br />
[20].<br />
3. Die EnBW Regional AG<br />
Die EnBW Regional AG ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft<br />
der EnBW AG. In Baden-Württemberg ist diese<br />
Gesellschaft der größte Verteilnetzbetreiber. Sie nutzt<br />
das konzernweit vorhandene Know-how der EnBW in<br />
Sachen Energie und Netzdienstleistungen sowie Infrastruktur,<br />
IT-Services und Management und schnürt<br />
daraus attraktive Dienstleistungspakete für Kommunen<br />
und Stadtwerke in Baden-Württemberg. Die Kernauf-<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 285
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
gaben der EnBW Regional AG sind das Management des<br />
Netzzugangs, die Erbringung und der Vertrieb von<br />
Dienstleistungen sowie das Kooperations- und Beteiligungsmanagement.<br />
4. Umsetzung des Präqualifikationsverfahrens<br />
bei der EnBW Regional AG<br />
Dem Präqualifikationsverfahren unterliegen alle eingesetzten<br />
Dienstleistungsfirmen, damit eine ausreichende<br />
Qualifikation durch die EnBW gewährleistet werden<br />
kann. Für Arbeiten in den Netzen der EnBW Regional AG<br />
sind also ausschließlich präqualifizierte Dienstleistungsfirmen<br />
zugelassen.<br />
Das Präqualifikationsverfahren umfasst bei der EnBW<br />
Regional AG die Lieferantenanalyse anhand einer<br />
Selbstauskunft sowie die Lieferantenauswahl, welche<br />
durch eine Begehung vor Ort bei den Lieferanten den<br />
Auswahlprozess unterstützt. Hat eine Firma diese<br />
beiden Phasen erfolgreich abgeschlossen, so gilt sie als<br />
präqualifiziert und kann anschließend für Arbeiten in<br />
den Netzen der EnBW beauftragt werden. Die Firmen<br />
werden durch regelmäßig durchgeführte Baustellenbegehungen<br />
kontrolliert. Hierbei werden Lieferantenbewertungen<br />
nach vorgegebenem Zyklus durchgeführt<br />
und dokumentiert. Alle Arbeiten in den Netzen der<br />
EnBW Regional AG sind von den beauftragten Dienstleistungsfirmen<br />
unter Einhaltung der jeweils zutreffenden<br />
technischen Vorschriften und Regelwerke mit<br />
hinreichend qualifizierten Mitarbeitern sowie der Verwendung<br />
zweckmäßiger Hilfsmittel in der geforderten<br />
Qualität auszuführen.<br />
Bild 1. Präqualifikationsprozess.<br />
Das Präqualifikations- und Bewertungsverfahren bei<br />
der EnBW Regional AG stellt demzufolge sowohl ein<br />
Steuerungs- als auch gleichzeitig ein Kontrollinstrument<br />
dar.<br />
5. Zielsetzung des Präqualifikationsund<br />
Bewertungsverfahrens<br />
Durch das Präqualifikations- und Bewertungsverfahren<br />
möchte die EnBW Regional AG ein detailliertes, stichhaltiges<br />
und umfassendes Bild über das Bewerberunternehmen<br />
gewinnen. Zu diesem Zweck erfolgt die Pflege<br />
einer Datenbank, in der alle bisher eingesetzten Dienstleistungsfirmen<br />
geführt sind. Durch ein derartiges Verzeichnis<br />
besteht für die EnBW die Möglichkeit, auch<br />
kurzfristig auf qualifizierte Unternehmen zuzugreifen,<br />
welche bereits die erforderlichen Nachweise erbracht<br />
haben [13]. Ein weiteres Ziel für den Energieversorger ist<br />
die Steigerung der Leistungs- und Qualitätsfähigkeit der<br />
eingesetzten Dienstleistungsfirmen im Wettbewerb.<br />
6. Präqualifikationsprozess<br />
Der Präqualifikationsprozess setzt sich aus den Teilprozessen<br />
„Selbstauskunft“ und „Vor-Ort-Begehung“<br />
zusammen.<br />
Bild 1 gibt eine Übersicht über den Präqualifi -<br />
kationsprozess bei der EnBW Regional AG.<br />
Der Prozess zur Selbstauskunft kann entweder durch<br />
ein neues Dienstleistungsunternehmen im Rahmen<br />
eines anstehenden Auftrags oder durch eine überholte<br />
Lieferantenselbstauskunft (älter als drei Jahre) ausgelöst<br />
werden. Im ersten Schritt erhält das Bewerberunternehmen<br />
einen Fragebogen zur Selbstauskunft. Nachdem<br />
die Bewerberfirma den ausgefüllten Fragebogen in -<br />
klusive der geforderten Anlagen zurückgesendet hat,<br />
werden die Daten durch den Einkauf in einer Datenbank<br />
erfasst. Gleichzeitig wird die Erfüllung der hinterlegten<br />
K.O.-Kriterien durch die Datenbank kontrolliert wie beispielsweise<br />
die Fragen nach erfolgreicher Teilnahme der<br />
Erdbaumaschinenführer an einer Schulung nach DVGW<br />
Hinweis GW 129, nach einer DVGW GW 301 Zulassung<br />
oder nach einer Befähigung zur Durchführung von<br />
Arbeiten nach DIN VDE 0105. Sind alle Kriterien erfüllt,<br />
d. h. das Unternehmen hat alle erforderlichen Dokumente<br />
eingereicht, so erfolgt im nächsten Schritt die<br />
Vor-Ort-Begehung. Basis für die Beurteilung der Firmen<br />
während der Begehung vor Ort sind die Informationen<br />
aus der Selbstauskunft und (sofern bereits vorhanden)<br />
der Status aus der Lieferantenkontrolle. Bei der Begehung<br />
vor Ort erfolgt eine stichprobenartige Überprüfung<br />
der Angaben aus dem Fragebogen zur Selbstauskunft.<br />
Können alle erforderlichen Nachweise innerhalb<br />
der Begehung erbracht werden, so wird anschließend<br />
das Begehungsprotokoll vom EnBW-Verantwortlichen<br />
und dem Unternehmensverantwortlichen unterzeichnet.<br />
Damit erhält die Dienstleistungsfirma den Status<br />
„präqualifiziert“ und kann am Wettbewerb teilnehmen.<br />
März 2012<br />
286 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
Fachberichte<br />
Zusätzlich erhält der Lieferant einen Präqualifikationsnachweis.<br />
7. Lieferantenbewertungsprozess<br />
Der Lieferantenbewertungsprozess zielt auf die Kontrolle<br />
der erstellten Leistung von beauftragten Dienstleistungsfirmen.<br />
Bevor die einzelnen Prozessschritte<br />
beschrieben werden, erfolgt im ersten Schritt die<br />
Darstellung der Auslöser des Prozesses. Die Bewertung<br />
einer Dienstleistungsfirma muss erfolgen, wenn mindestens<br />
eines der festgelegten Bewertungskriterien<br />
gegeben ist (siehe Bild 2).<br />
Der Lieferantenbewertungsprozess startet mit der<br />
Prüfung der Arbeitsergebnisse und deren Ausführung.<br />
Zur Unterstützung existiert bei der EnBW Regional AG<br />
ein Erhebungsbogen, welcher in der Regel von den<br />
Baubeauftragten oder einer anderen verantwortlichen<br />
Person bei der Baustellenbegehung auszufüllen ist. Der<br />
Erhebungsbogen beinhaltet verschiedene Fragen zu<br />
der von der beauftragten Firma erbrachten Dienstleistung.<br />
Das Beantworten der Fragen setzt entsprechendes<br />
Fachwissen voraus. Bringt die Kontrolle auf der<br />
Baustelle keine Beanstandungen hervor, so wird der<br />
Erhebungsbogen durch die zuständige Fachabteilung<br />
in die softwaregestützte Datenbank eingepflegt. Treten<br />
im Rahmen der Baustellenprüfung Mängel auf, so werden<br />
diese durch den Baubeauftragten direkt beim Auftragnehmer<br />
reklamiert mit der Anweisung, den Mangel<br />
unverzüglich zu beheben. Anhand der Datenbank kann<br />
die Bewertung einer Dienstleistung einer gesamten<br />
Unternehmung, die Leistung einzelner Kolonnen oder<br />
auch einer einzelnen Baumaßnahme erfolgen. Zusätzlich<br />
ist auch die Beurteilung der Arbeitsqualität über<br />
einen bestimmten Zeitraum oder in einem definierten<br />
Netzgebiet möglich. Mit der Dokumentation eines<br />
Mangels in die Lieferantenbewertungsdatenbank, wird<br />
gleichzeitig eine Mail an die betroffenen operativen<br />
Einheiten generiert. Diese Informationsmail wird als<br />
„kleine Mangelmeldung“ bezeichnet. Bei Vorliegen von<br />
einem bis maximal zwei Mängeln obliegt es dem<br />
zuständigen Fachbereich, ein Gespräch mit der Fremdfirma<br />
zu führen. Wird durch den verantwortlichen Fachbereich<br />
ein Lieferantengespräch geführt, muss dieses<br />
in der Lieferantenbewertungsdatenbank protokolliert<br />
werden. Erfolgt der Eintrag des dritten Mangels innerhalb<br />
einer Frist von einem Jahr, erfolgt automatisch die<br />
Generierung einer entsprechenden Mail an den Einkauf<br />
sowie die betroffenen operativen Einheiten. Dieser<br />
Vorgang wird als „große Mangelmeldung“ bezeichnet.<br />
Damit ist als zwingender Handlungsbedarf die Durchführung<br />
eines Lieferantengesprächs bzw. eine Begründung,<br />
weshalb kein Lieferantengespräch stattfindet,<br />
verbunden. In das Lieferantengespräch sind neben dem<br />
Einkauf die betroffenen operativen Einheiten involviert.<br />
Die Dokumentation erfolgt in der Lieferantenbewertungsdatenbank.<br />
Ziel eines derartigen Gesprächs ist die<br />
Bild 2. Auslöser Bewertungskriterien.<br />
Klärung der Weiterbeschäftigung des Lieferanten sowie<br />
der Konditionen, unter denen eine weitere Zusammenarbeit<br />
möglich ist. Als Maßnahmen können beispielsweise<br />
die Personalschulung, Erwerb neuer Geräte, Sperrung<br />
einzelner Kolonnen oder der Austausch von Aufsichtspersonal<br />
dem Dienstleister auferlegt werden. Im<br />
Zuge dessen wird die beauftragte Firma in den Status<br />
„Bewährung“ gesetzt, was eine verschärfte Beobachtung<br />
durch die zuständigen Fachbereiche zur Folge hat.<br />
Eine Sperrung dieser Firma kann dann erfolgen, wenn<br />
sie die im Lieferantengespräch vereinbarten Auflagen<br />
für eine Weiterbeschäftigung verletzt. In besonders<br />
gravierenden Fällen führen Mängelbewertungen zum<br />
Ausschluss einer Firma. Diese Fremdfirmendaten<br />
werden bei der EnBW entsprechend des Datenschutzes<br />
korrekt behandelt.<br />
8. Nutzen von Präqualifikationsverfahren<br />
Das Präqualifizierungsverfahren besitzt die Eignung,<br />
einen an den Anforderungen der EnBW Regional AG<br />
ausgerichteten Pool an qualifizierten Dienstleistungsunternehmen<br />
aufzubauen. Da das Verfahren als Aufruf<br />
zum Wettbewerb bekannt gemacht wurde, verfügt die<br />
EnBW Regional AG über einen kurzfristigen Zugriff auf<br />
eine Vielzahl an qualifizierten Dienstleistungsfirmen.<br />
Bei einer anstehenden Auftragsvergabe können sofort<br />
Angebote der präqualifizierten Lieferanten eingeholt<br />
werden, ohne zuvor den gesamten Lieferantenauswahlund<br />
Bewertungsprozess erneut zu durchlaufen. Dies<br />
gestattet der EnBW Regional AG eine hohe Flexibilität<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 287
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
und Reaktionsgeschwindigkeit auf die Marktanforderungen.<br />
Gleichzeitig kann der Aufwand bei der<br />
Auftragsvergabe reduziert werden. Eine positive Wirkung<br />
ergibt sich auch aus dem Einsatz standardisierter<br />
Checklisten, Datenbanken und Formblätter. Dies führt<br />
zu einer transparenten und nachvollziehbaren Auswahlentscheidung<br />
für alle Prozessbeteiligten. Eine ebenso<br />
bedeutende Rolle nimmt die Entwicklung der eingesetzten<br />
Dienstleistungsunternehmen ein. Durch die<br />
gewonnenen Informationen aus dem Präqualifikationsund<br />
Bewertungssystem können Fremdfirmen gezielt<br />
weiterentwickelt werden. Darüber hinaus kann eine<br />
entsprechende Leistungsqualität durch den im Bewertungssystem<br />
verankerten Soll-Ist-Vergleich gewährleistet<br />
werden. Werden entsprechende Vorgaben nicht<br />
eingehalten oder treten Mängel bei der Leistungserstellung<br />
auf, so verfügt die EnBW Regional AG über<br />
ein wirksames Sanktionsverfahren.<br />
Das Präqalifikations- und Bewertungsverfahren trägt<br />
zudem den Gesetzesanforderungen Rechnung. Durch<br />
die Lieferantenselbstauskunft und die Begehung vor<br />
Ort, welche in der Präqualifikations-Datenbank dokumentiert<br />
werden, erfüllt die EnBW Regional AG die ihr<br />
auferlegte Sorgfaltspflicht aus § 831 BGB. Darüber<br />
hinaus wird auch die Beweislastumkehr aus § 18 NAV,<br />
§ 18 NDAV und § 5 EnWG durch eine lückenlose Dokumentation<br />
adäquat berücksichtigt. So kann im Schadensfall<br />
die Nachweisführung über die erforderliche<br />
Sorgfaltspflicht durch die archivierten Dokumente<br />
erbracht werden.<br />
Betrachtet man das Präqualifikations- und Bewertungsverfahren<br />
unter dem Qualitätsaspekt, so zeigt<br />
sich, dass seit der Einführung dieses Verfahrens eine<br />
Reduzierung der aufgetretenen Mängel zwischen 2007<br />
und 2010 um 4 % zu verzeichnen ist. Analog ist der<br />
Anteil von Bewertungen ohne Beanstandungen und<br />
verbesserungsfähige Punkte zwischen 2007 und 2010<br />
um 14 % angestiegen. Daraus lässt sich schließen, dass<br />
die Einführung dieses Verfahrens zu einer Verbesserung<br />
der Leistungsqualität der beauftragten Dienstleistungsunternehmen<br />
geführt hat.<br />
9. Präqualifikation und Bewertung –<br />
nur ein Mittel zum Zweck?<br />
Es konnte gezeigt werden, dass das Präqualifizierungsund<br />
Bewertungsverfahren geeignet ist, einen an den<br />
Anforderungen der EnBW Regional AG ausgerichteten<br />
Pool an qualifizierten Dienstleistungsunternehmen aufzubauen.<br />
Darüber hinaus kann durch die vorliegende<br />
Dokumentation der Beweislastumkehr aus § 18 NAV<br />
und § 18 NDAV Rechnung getragen werden. Entscheidet<br />
sich ein Unternehmen zur Implementierung eines<br />
Präqualifizierungs- oder Prüfungssystems, so müssen<br />
innerhalb des Verfahrens standardisierte Methoden und<br />
Instrumente (wie etwa Checklisten und Fragebögen)<br />
sowie eine unternehmensindividuelle IT-Unterstützung<br />
zugrunde gelegt werden. Die Entwicklung und Aufrechterhaltung<br />
eines solchen Systems ist mit entsprechenden<br />
Personalressourcen verbunden. Auf der<br />
anderen Seite kann ein solches System wie beim Beispiel<br />
der EnBW Regional AG zur Verringerung von Qualitätsmängeln<br />
verursacht durch die eingesetzten Lieferanten<br />
führen, was resultierende Folgekosten senkt. Ein implementiertes<br />
Bewertungssystem als Soll-Ist-Vergleich<br />
bietet darüber hinaus Ansatzpunkte zur Lieferantenentwicklung.<br />
Im Vorfeld der Selbstauskunft und der Durchführung<br />
einer Vor-Ort-Begehung ist es notwendig, eine entsprechende<br />
Vorselektion von potenziellen Lieferanten<br />
durchzuführen.<br />
Durch die zunehmende Verlagerung der Wertschöpfung<br />
gewinnt die Lieferantenauswahl als Erfolgsfaktor<br />
an Bedeutung. Damit steigt auch der Anreiz für Unternehmen,<br />
ein Präqualifizierungs- und Bewertungsverfahren<br />
einzusetzen. Unternehmungen, die heute<br />
nicht das Fundament für den Einsatz eines solchen<br />
Präquali fizierungs- und Bewertungsverfahren für die<br />
eingesetzten Dienstleistungsunternehmen legen und<br />
bereit sind, dieses kontinuierlich weiterzuentwickeln,<br />
werden gegenüber den Best-Practice-Unternehmen<br />
immer mehr das Nachsehen haben.<br />
Literatur<br />
[1] Wagner, S.: Strategisches Lieferantenmanagement in Industrieunternehmen.<br />
Eine empirische Untersuchung von<br />
Gestaltungskonzepten. Dissertation Nr. 2478, 2000. St. Gallen:<br />
Peter Lang GmbH.<br />
[2] Fließ, S.: Dienstleistungsmanagement. Kundenintegration<br />
gestalten und steuern. 1. Auflage, 2009. Wiesbaden: Gabler.<br />
[3] Arnold, B.: Strategische Lieferantenintegration. Ein Modell<br />
zur Entscheidungsunterstützung für die Automobilindustrie<br />
und den Maschinenbau. Berlin: Deutscher Universitäts-<br />
Verlag, 2004.<br />
[4] Haller, S.: Dienstleistungsmanagement. Grundlagen – Konzepte<br />
– Instrumente. 3. Auflage, 2005. Wiesbaden: Gabler.<br />
[5] Im Versorgungsbereich sind z. B. Vorschriften für die Entsorgung<br />
gefährlicher Abfälle, die durch Tiefbauarbeiten (z. B.<br />
teerhaltiger Straßenaufbruch) bei der Instandhaltung von<br />
Versorgungsnetzen anfallen können, zu beachten.<br />
[6] Wildemann, H.: Produktionscontrolling – Systemorientiertes<br />
Controlling schlanker Produktionsstrukturen. München:<br />
Transfer-Centrum-Verlag, 1995.<br />
[7] Conte, A. and Renneke, F.: Supplier Risk Rating. Lieferantenrating<br />
bei der T-Mobile Deutschland. Controlling-Case Study.<br />
In: Controlling (2008) Nr. 2, S. 97–107.<br />
[8] Harting, D.: Lieferanten-Wertanalyse. Ein Arbeitsbuch mit<br />
Checklisten und Arbeitsblättern für Auswahl, Bewertung<br />
und Kontrolle von Zulieferern. 2. völlig überarbeitete und<br />
erweiterte Auflage, 1994. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.<br />
[9] Durchgeführt wurde diese Studie von der Universität<br />
Duisburg in Kooperation mit der Unternehmensberatung<br />
Droege & Comp.<br />
[10] Befragt wurden zusätzlich weitere Branchen wie zum<br />
Beispiel Banken, Versicherungen, Entsorgungsbetriebe,<br />
Transportunternehmen, Medienunternehmen.<br />
März 2012<br />
288 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgungsnetze<br />
Fachberichte<br />
[11] Barth, K. und Eger, M.: Beschaffungsmanagement in Europa.<br />
Erfolgsfaktoren, Barrieren, Best Practices. In: Beschaffung<br />
aktuell (2000) Nr. 4, S. 42–47.<br />
[12] Braun, P. und Petersen, Z.: Präqualifikation und Prüfungssysteme.<br />
Zeitschrift für das gesamte Vergaberecht. Band 10,<br />
2010. Köln: Werner Verlag. S. 433–441.<br />
[13] DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches<br />
e.V.: Gas/<strong>Wasser</strong> Information Nr. 18. Leitfaden zum Nachweis<br />
der Qualifikation von Dienstleistungsfirmen im Tief- und<br />
Leitungsbau – Qualifikationskriterien. Bonn, 2006.<br />
[14] Dies entspricht im Bereich öffentlicher Bauvergaben beispielsweise<br />
einer Kostenentlastung von circa 600 Millionen<br />
Euro.<br />
[15] Plewina, M. und Antweiler, C.: Abschlussbericht Studie.<br />
Öffentliches Vergabewesen – Bürokratieabbau durch Präqualifikation?<br />
Projekt 12/03. Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Arbeit (Hrsg.). (WWW-Seite, Stand: 30.01.2004)<br />
Zugriff: 02.10.2010, 8.10 MEZ. http://web43.d2-1066.ncsrv.<br />
de/2-04/praequalifikation-berichtbearing-point-01-2004.<br />
pdf<br />
[16] Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern:<br />
Präqualifikation für Unternehmen, in Beschaffungsamt-<br />
Bund-Homepage (WWW-Seite, Stand: 2008) Zugriff:<br />
07.07.2010, 13.20 MEZ. http://www.bescha.bund.de/<br />
nn_663638/DE/Beschaffung/Praequalifizierung/node.html<br />
[17] Bürgerliches Gesetzbuch: 62. überarbeitete Auflage. Stand:<br />
11. Juli 2008. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.<br />
Beck-Texte, 2008.<br />
[18] Förschler, H.: Privat- und Prozessrecht. In: Führungswissen für<br />
kleine und mittlere Unternehmen. Band 5. Förschler; Hümer;<br />
Rössle; Stark (Hrsg.). 7. Auflage. Bad Wörishofen: Holzmann<br />
Buchverlag, 2003.<br />
[19] Der §5 EnWG 2010 bezieht sich auf die „Haftung bei Störungen<br />
der Netznutzung“. Die Regelungen des §18 NDAV<br />
gelten entsprechend für Haftungen bei Störungen der Netznutzung.<br />
Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil I Nr. 47<br />
(2010): Verordnung zur Neufassung und Änderung von Vorschriften<br />
auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts sowie<br />
des Bergrechts. Bonn: 08.September 2010.<br />
[20] Dies können Nachweise über: die Qualifikation der eigenen<br />
Mitarbeiter, der eingesetzten Lieferanten, des eingesetzten<br />
Fremd-Personals; die Einhaltung technischer Normen,<br />
Regelwerke, Vorschriften und sonstiger Arbeitsanweisungen;<br />
eine ausreichende Baukontrolle sowie die Dokumentation<br />
der Arbeitserledigung, bei Störungen des Störungsablaufs<br />
sein.<br />
Autoren<br />
Dipl. oec. Sandra Gonka<br />
E-Mail: s.gonka@enbw.com |<br />
EnBW Regional AG |<br />
Technischer Netzservice|<br />
Projekt Strom |<br />
Kriegsbergstraße 32 |<br />
D-70174 Stuttgart<br />
Eingereicht: 18.01.2012<br />
Korrektur: 06.02.2012<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Thomas Bruderhofer<br />
E-Mail: t.bruderhofer@enbw.com |<br />
EnBW Regional AG |<br />
Technisches Anlagenmanagement |<br />
Technische Steuerung |<br />
Prozesscontrolling |<br />
Kriegsbergstraße 32 |<br />
D-70174 Stuttgart<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 289
FachberichtE Tagungsbericht<br />
<strong>Wasser</strong>branche auf dem richtigen Weg?<br />
Tagungsbericht zur 10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftlichen Jahrestagung<br />
Christine Ziegler<br />
Auf der 10. <strong>Wasser</strong>wirtschaftlichen Jahrestagung vom 07. bis 08. November 2011 im Steigenberger Hotel in<br />
Berlin diskutierten Vertreter aus Politik und <strong>Wasser</strong>wirtschaft über mögliche Wege in eine zukunftsfähige <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Unter der Tagungsleitung von Reinhold Hüls, Geschäftsführer der Veolia <strong>Wasser</strong> GmbH, wurden<br />
Initiativen der <strong>Wasser</strong>branche wie das Benchmarking betrachtet, für mehr Transparenz und bessere Kommunikation<br />
mit der Öffentlichkeit geworben sowie erörtert, welche Rolle der <strong>Wasser</strong>wirtschaft bei der Energiewende<br />
zukommt. Wichtiges Thema, welches die <strong>Wasser</strong>branche nach wie vor intensiv beschäftigt, war der<br />
Umgang mit der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang, welche<br />
Möglichkeiten es gibt, kostenbewusst zu handeln, aber auch die Leistungsfähigkeit der <strong>Wasser</strong>wirtschaft überzeugend<br />
darzustellen. Abgerundet wurde das Programm durch Referate zu neuen Umweltverordnungen wie<br />
der Oberflächengewässerverordnung und der Trinkwasserverordnung.<br />
Positionen<br />
Dr. Bernhard Heitzer, Staatssekretär im Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Technologie, stellte in seinem<br />
Grußwort einführend fest, dass die Zukunftsfähigkeit<br />
der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft davon abhänge, wie sie<br />
sich den veränderten und gestiegenen umwelt-, wirtschafts-,<br />
aber auch gesellschaftspolitischen Anforderungen<br />
stellen werde.<br />
Eines der anstehenden Themen sei die EU-Initiative<br />
zu Dienstleistungskonzessionen, so der Staatssekretär.<br />
Zum Richtlinienentwurf habe sich der BDEW bereits<br />
frühzeitig geäußert. Die Bedenken des Verbandes würden<br />
ernst genommen, etwa die Befürchtung wachsender<br />
Bürokratie und Einschränkung kommunaler Handlungsspielräume.<br />
Allerdings biete das geplante EU-Vorhaben<br />
auch Chancen für mehr Transparenz und<br />
Dr. Bernhard Heitzer, Bundeswirtschaftsministerium.<br />
Wettbewerb bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen<br />
– gerade auch für die deutsche <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
– wenn die neuen Regeln denn entsprechend<br />
gestaltet würden. Er sei optimistisch, dass die Organisationshoheit<br />
der Kommunen nicht angetastet würde,<br />
denn auch in Zukunft müsse es den Kommunen freistehen,<br />
Aufgaben selbst zu erbringen oder an private<br />
Dritte zu vergeben. Die vorrangige Aufgabe bestehe<br />
nun darin, sich in Brüssel für dieses Ziel stark zu machen.<br />
Die kartellrechtlichen Verfahren auf nationaler Ebene<br />
hätten dazu geführt, dass sich die <strong>Wasser</strong>versorger verstärkt<br />
mit ihren Kosten und Preisen beschäftigt und<br />
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen hätten.<br />
Dies sei ein Beitrag zur Modernisierung der Branche und<br />
sichere ihre Zukunftsfähigkeit. Transparenz und Kundenorientierung<br />
seien wichtig und ganz im Sinne der<br />
Verbraucher, dadurch könnten aber kartellrechtliche<br />
Prüfungen nicht ersetzt werden.<br />
Aktuell seien zwei laufende kartellrechtliche Verfahren<br />
von besonderem Interesse: das Verfahren zur Prüfung<br />
der Berliner Trinkwasserpreise durch das Bundeskartellamt<br />
und das Klageverfahren der Energie Calw<br />
gegen die Landeskartellbehörde Baden-Württemberg.<br />
Vom Verfahren in Berlin erwarte man sich die Klärung<br />
interessanter Rechtsfragen zur Missbrauchsaufsicht. Ein<br />
umfangreicher Datenpool, den die Behörde dazu angelegt<br />
hat, gebe einen fundierten Überblick über wichtige<br />
Zahlen der großen <strong>Wasser</strong>versorger. Im baden-württembergischen<br />
Fall hat das OLG Stuttgart gegen die<br />
Kartellbehörde entschieden. Es sah deren Methodik, nur<br />
einzelne Kostenpositionen zu überprüfen, anstatt das<br />
Vergleichsmarktprinzip anzuwenden, als unzulässig an.<br />
Allerdings erkannte das Gericht an, dass ein Missbrauchsverfahren<br />
gerechtfertigt war. Die zuständige<br />
März 2012<br />
290 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
Kartellbehörde lässt den Fall nun höchstrichterlich vor<br />
dem BGH klären. Staatssekretär Heitzer äußerte Zweifel<br />
an der Methodik, Kosten und Kalkulationen zur Prüfung<br />
heranzuziehen, auch wenn die <strong>Wasser</strong>branche diesen<br />
Weg favorisiere. Das Kartellrecht sollte seiner Meinung<br />
nach nicht zu einer „Quasi-Regulierung“ führen. Eine<br />
analoge Anwendung von Regulierungsregelungen wie<br />
bei Strom und Gas hält er für nicht zielführend. Das<br />
gleiche gelte für Kalkulationsleitfäden, die von den Kartellbehörden<br />
„abgesegnet“ werden.<br />
Die Rufe nach einer Regulierung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
würden lauter. So hätten sich die Monopolkommission<br />
und der Präsident der Bundesnetzagentur,<br />
Matthias Kurth, für eine sektorspezifische Anreizregulierung<br />
ausgesprochen. Dabei würde jedoch übersehen,<br />
meinte der Staatssekretär, dass es im Gegensatz zu den<br />
Bereichen Telekommunikation, Strom, Gas und Eisenbahn<br />
bei der <strong>Wasser</strong>versorgung nicht um den Zugang<br />
zum Netz gehe. Auch eine Durchleitung sei aus technischen<br />
Gründen nicht möglich. Die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
sei nun einmal ein natürliches Monopol.<br />
Schließlich solle eine Regulierung auch nicht dazu<br />
dienen, die Endverbraucherpreise zu kontrollieren. Das<br />
Instrument der verschärften Missbrauchsaufsicht sei<br />
trotz dieser Äußerungen seiner Auffassung nach für den<br />
<strong>Wasser</strong>bereich ausreichend, erklärte Dr. Heitzer. Das<br />
setze aber auch voraus, dass die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht<br />
weiterhin wirkungsvoll sei und flächendeckend<br />
greife.<br />
Wulf Abke, Vize-Präsident des BDEW, begrüßte auf<br />
der Jahrestagung, dass sich die Politik in den vergangenen<br />
Monaten ganz aktuell klar für eine Kontrolle von<br />
<strong>Wasser</strong>preisen und -gebühren durch Kartellämter beziehungsweise<br />
Kommunal aufsichts behörden und gegen<br />
eine Regulierung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft ausgesprochen<br />
habe, auch wenn der Präsident der Bundesnetzagentur<br />
diesen Faden nochmals aufgenommen hat. Er gab zu<br />
bedenken, dass der ökonomische Ansatz allein nicht<br />
reiche, denn zu Faktoren wie Qualität des Trinkwassers,<br />
Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Kundenzufriedenheit<br />
dürfe keine Schieflage durch einseitiges<br />
Betonen der Ökonomisierung entstehen. Aus der inhaltlichen<br />
Übereinstimmung zwischen Politik und Branche<br />
gegen eine Regulierung müsse für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
aber auch die Verpflichtung erwachsen, ihre Anstrengungen<br />
für mehr Transparenz bei den <strong>Wasser</strong>preisen<br />
voranzutreiben und Benchmarking-Projekte weiter auszubauen.<br />
Die Kunden verlangten heute nach mehr<br />
Transparenz, wollten die unterschiedlich hohen Preisen<br />
erklärt bekommen. Für Abke ist die Kundenbilanz ein<br />
hierfür geeignetes Instrument. Mit der Kundenbilanz<br />
könne jedes <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen ausweisen,<br />
welche Leistung und Qualität es unter den jeweiligen<br />
örtlichen Bedingungen sichert und den Kunden<br />
die damit möglicherweise verbundenen Preisunterschiede<br />
erläutern.<br />
Dr. Franz Otillinger, Stadtwerke Augsburg.<br />
Auch das Benchmarking, also den Leistungsvergleich<br />
zwischen Unternehmen, wolle der BDEW weiter<br />
ausbauen. Es sei positiv zu bewerten, dass man sich in<br />
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aktiv für das<br />
Benchmarking beziehungsweise für eine Kombination<br />
mit der Kundenbilanz ausgesprochen habe und dieses<br />
Instrumentarium gegenüber kartellrechtlichen Maßnahmen<br />
vorzöge. Allerdings gälte es, mehr Teilnehmer<br />
für diese Leistungsvergleiche zu gewinnen.<br />
Benchmarking in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft –<br />
braucht die Branche eine Selbstverpflichtung?<br />
Dr. Franz Otillinger, Betriebsdirektor der Stadtwerke<br />
Augsburg <strong>Wasser</strong> GmbH, gab einen Überblick über den<br />
Stand der Benchmarking-Aktivitäten in der deutschen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft. Dabei stellte er in den Vordergrund,<br />
dass Sinn und Zweck des Benchmarking in erster Linie<br />
sei, die Wünsche der Kunden zu befriedigen. Für die Kunden<br />
stehe an erster Stelle eine hohe Qualität des Trinkwassers,<br />
an zweiter eine sichere <strong>Wasser</strong>versorgung und<br />
erst an dritter Stelle stünden faire und günstige Preise.<br />
Benchmarking ziele also nicht ausschließlich auf Wirtschaftlichkeit,<br />
sondern, wie im DVGW-Hinweis W 1100<br />
aufgeführt, auch auf Sicherheit, Qualität, Kundenservice<br />
und Nachhaltigkeit in der <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Die Initiative zur Modernisierung in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
sei in den letzten Jahren von der Politik immer<br />
unterstützt worden – von allen Koalitionen – allerdings<br />
mit der klaren Aufforderung, eine deutliche Bewegung<br />
nach vorn zu zeigen.<br />
Ein wichtiger Markstein sei in dieser Hinsicht die Verbändeerklärung<br />
zum Benchmarking <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
gewesen. Im inzwischen zum vierten Mal aufgelegten<br />
Branchenbild der deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft würde<br />
die Leistungsfähigkeit der Branche augenscheinlich dargestellt.<br />
Und betrachte man die Entwicklung der Pro-<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 291
FachberichtE Tagungsbericht<br />
Kopf-Ausgaben für Trinkwasser im Vergleich zum Inflationsindex<br />
der letzten zehn Jahre, so Otillinger, sei offensichtlich,<br />
dass die Modernisierung Erfolge zeitige. Leider<br />
würden noch nicht alle <strong>Wasser</strong>versorger Benchmarking-<br />
Projekte durchführen. Gerade in den südlichen Bundesländern<br />
sei der Prozentsatz der Beteiligung vergleichsweise<br />
gering. Um den Einstieg zu erleichtern, könne<br />
Benchmarking auch mit einfacheren Modulen begonnen<br />
werden. In den Ländern würden entsprechende<br />
Projekte zur Anpassung und Weiterentwicklung durchgeführt<br />
mit Impulsen von sogenannten „runden<br />
Tischen“, an denen sich neben <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
und Anbietern von Benchmarking-<br />
Dienstleistungen auch Ministerien, Landes- und kommunale<br />
Spitzenverbände beteiligen.<br />
Wichtig sei jedoch, glaubt Otillinger, mehr Verbindlichkeit<br />
zu schaffen, beispielsweise durch einen Branchenstandard<br />
zur Transparenz in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft –<br />
von der Branche für die Branche – ähnlich wie er bereits<br />
im technischen Bereich durch das technische Regelwerk<br />
der Verbände erarbeitet worden sei. Nur mit Selbstverpflichtung,<br />
da ist sich Otillinger sicher, bleibe die Branche<br />
in den Augen von Politik und Verbrauchern glaubwürdig.<br />
Sonst sei damit zu rechnen, dass der <strong>Wasser</strong>branche<br />
durch Interessensgruppen unsinnige Maßnahmen diktiert<br />
würden.<br />
Dr. Fritz Holzwarth, Bundesumweltministerium.<br />
Wege zu mehr Transparenz in der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Dr. Fritz Holzwarth, Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit, merkte an, dass<br />
durch die Kartellverfahren Bewegung in die Branche<br />
gekommen sei. Allerdings sollte nun vermieden werden,<br />
dass die <strong>Wasser</strong>wirtschaft Gegenstand von Regulierungsbestrebungen<br />
würde.<br />
Dazu ein kritischer Rückblick: Die größten Defizite in<br />
der Argumentation der <strong>Wasser</strong>versorger bei den Kartellverfahren<br />
hätten bei den Vorsorgeleistungen im<br />
Umwelt- und Gesundheitsschutz als Bestandteil der<br />
Daseinsvorsorge bestanden, daraus folgend beim<br />
Thema Transparenz, dort wo sich die vorhandenen Kostenstrukturen<br />
nicht hätten untermauern lassen. Transparenz<br />
bedeute jedoch aus Sicht des Umweltministeriums,<br />
dass die Vorleistungen der <strong>Wasser</strong>versorger für das<br />
Allgemeinwohl, für den Umwelt- und Gesundheitsschutz,<br />
die über die Trinkwasserversorgung hinausgehen,<br />
sehr wohl deutlich gemacht werden müssten.<br />
Denn die Kostendiskussion dürfe nicht zu Lasten der<br />
Vorsorge geführt werden. Kosten, die durch den vorsorgenden<br />
Gewässerschutz entstehen, müssten also transparent<br />
und nachvollziehbar dargestellt werden.<br />
Beim Thema „Pflicht zu kostendeckenden <strong>Wasser</strong>preisen<br />
unter Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenkosten<br />
(URK)“ im Rahmen der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
– auch vor dem Hintergrund des laufenden<br />
Vertragsverletzungsverfahrens – gebe es, so Holzwarth,<br />
in der Bundesrepublik keinen Nachholbedarf.<br />
Wege zur Transparenz: Das Branchenbild der deutschen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft habe sicher für andere europäische<br />
Staaten Vorbildcharakter. Als Kommunikationsinstrument<br />
in Richtung Politik sei es gut geeignet, allerdings<br />
weniger für eine Verständigung mit der breiten<br />
Öffentlichkeit. Insgesamt sei die <strong>Wasser</strong>wirtschaft aber<br />
mit den drei Stufen Branchenbild, Transparenzinitiative<br />
Kundenbilanz und Benchmarking gut aufgestellt. Das<br />
Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt<br />
unterstützten die Entwicklung der Kundenbilanz, versicherte<br />
Holzwarth, allerdings würden die Belange der<br />
Umwelt und des Gesundheitsschutzes darin noch nicht<br />
genügend aufgearbeitet. Deshalb müsse eine Weiterentwicklung<br />
der Methode und der Durchführung in der<br />
Praxis vorangetrieben werden (Stichwort: Höhere Beteiligung).<br />
Der Fokus beim Benchmarking sei bislang auf das<br />
Prozess-Benchmarking gerichtet worden, also in der<br />
Hauptsache auf die Frage möglicher Effizienzsteigerungen<br />
und weniger auf Umweltbelange. Bundesumweltministerium<br />
und Umweltbundesamt greifen den Ansatz<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft nun im Rahmen eines Forschungsvorhabens<br />
auf, Benchmarking inhaltlich weiterzuentwickeln<br />
und mit den Vorsorgeanliegen im Umwelt- und<br />
Gesundheitsschutz zu koppeln.<br />
Ein Fazit, das sich nach den kartellrechtlichen Verfahren<br />
in Hessen ziehen ließe, sei, dass die vorsorgenden<br />
Leistungen der <strong>Wasser</strong>versorger besser herausgearbeitet,<br />
dargestellt und kommuniziert sowie mit den entsprechenden<br />
Kosten belegt werden müssten. Des Weiteren<br />
gebe es beim Benchmarking zwar viele Länderinitiativen,<br />
aber die länderübergreifende Vergleichbarkeit<br />
ließe noch sehr zu wünschen übrig. Aufgabe sei es, zu<br />
verbindlichen Lösungen zu kommen, mit einer wirklich<br />
überprüfbaren Selbstverpflichtung, um einer gesetzlichen<br />
Regelung zuvorzukommen.<br />
März 2012<br />
292 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
Tue Gutes und rede darüber –<br />
Kommunikation gegenüber Politik,<br />
Presse und Verbrauchern<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln, sprach über<br />
das Thema Kommunikationsaufgaben in der <strong>Wasser</strong>branche.<br />
So berichtete er über die Öffentlichkeitsarbeit<br />
anlässlich der Veröffentlichung des Branchenbildes der<br />
deutschen <strong>Wasser</strong>wirtschaft am 21. März 2011. Bundeswirtschaftsministerium<br />
und sechs Branchenverbände<br />
hatten darüber eine gemeinsame Erklärung an die<br />
Presse gegeben sowie mehr als 800 hochrangige politische<br />
Ansprechpartner in Deutschland informiert.<br />
Im Mittelpunkt der kommunikativen Bemühungen<br />
stünde natürlich der <strong>Wasser</strong>kunde – um seine Bedürfnisse<br />
abzufragen, sei das BDEW-Kundenbarometer entwickelt<br />
worden. Mittels repräsentativer Befragung<br />
konnte, so Schmitt, ein Stimmungsbild der Kunden im<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>bereich erhoben werden. Die<br />
Ergebnisse für 2011 im Überblick: Das Image der <strong>Wasser</strong>ver-<br />
und <strong>Abwasser</strong>entsorger sei nach wie vor gut. Als<br />
Stärken würden Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit<br />
im Kundenkontakt, Freundlichkeit des Personals, die<br />
Bedeutung als regional aufgestelltes Unternehmen<br />
sowie die gute Trinkwasserqualität gesehen. Schwächen,<br />
die das Kundenbarometer aufzeigte, seien Preise<br />
beziehungsweise Gebühren, auch habe sich laut der<br />
Umfrage die Kundenzufriedenheit insgesamt verschlechtert,<br />
was vermutlich mit der wahrgenommenen<br />
Nähe zu Strom- und Gasversorgern liege. Immerhin<br />
hätte die Kundenbindung mit 75 Prozent noch einen<br />
recht hohen Wert. Überraschend sei jedoch, wie wenige<br />
Kunden den tatsächlich bezahlten <strong>Wasser</strong>preis benennen<br />
könnten. Hier sei es wichtig, weitere Kommunikationsarbeit<br />
zu leisten.<br />
Zu diesem Zweck sei das Projekt „Gemeinschaftsaktion<br />
<strong>Wasser</strong>“ ins Leben gerufen worden mit dem Ziel, die<br />
Kommunikation zu stärken, das Image des Trinkwassers<br />
zu verbessern und die vorhandene Kundenzufriedenheit<br />
zu stabilisieren und auszubauen. Im Angebot sei<br />
ein Baukasten mit verschiedenen Konzepten und Materialien,<br />
berichtete Schmitt, mit denen in Schulen und<br />
Vorschulen, aber auch bei interessierten Kunden und<br />
nicht zuletzt in Politik und Medien für Trinkwasser zielgruppengerecht<br />
geworben werden könnte. Mit der<br />
Transparenzinitiative der <strong>Wasser</strong>wirtschaft beispielsweise<br />
könne dem Kunden augenscheinlich erklärt werden,<br />
wie <strong>Wasser</strong>preise zustande kommen. Dazu gehöre<br />
auch, darauf hinzuweisen, dass sich die <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
in ihrem regionalen Umfeld für Ressourcen- und<br />
Klimaschutz engagiere.<br />
Die Energiewende – Rolle der<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Für Horst Meierhofer, Deutscher Bundestag, Berlin,<br />
schafft die Energiewende eine Reihe von Herausforderungen<br />
– gerade auch für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft – die es<br />
zu meistern gilt. <strong>Wasser</strong> sei einer der wichtigsten Energieträger<br />
unter den „Erneuerbaren“, das führe aber beim<br />
Neubau von <strong>Wasser</strong>kraftwerken oftmals zu Schwierigkeiten<br />
mit Umweltschützern. Ebenso bei der Errichtung<br />
von Pumpspeicherkraftwerken, einer nach Auffassung<br />
Meierhofers bewährten Technologie zur Speicherung<br />
von Energieüberschüssen.<br />
Doch durch <strong>Wasser</strong>kraft ließe sich nicht nur Strom<br />
produzieren, bei <strong>Wasser</strong>versorgung und <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
würden umgekehrt auch gewaltige Energiemengen<br />
verbraucht. Hier bestehe aber die Hoffnung,<br />
durch Effizienzsteigerungen Einsparpotenziale heben<br />
zu können, ohne dabei die Trinkwasserqualität zu beeinträchtigen.<br />
Die Nutzung von Biomasse sei hinsichtlich des<br />
Grundwasserschutzes weiterhin ein strittiges Thema,<br />
ebenso CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) und<br />
Fracking. Zu CCS sei ein Entwurf vorgelegt worden, der<br />
einerseits die Anwendung ermöglichen, andererseits<br />
die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen wolle. Herausgekommen<br />
sei nun eher ein „CCS-Verhinderungsgesetz“.<br />
Der Speicherung von CO 2 im Untergrund, meinte<br />
Meierhofer, würden hierzulande zu viele Vorbehalte entgegen<br />
gebracht. Einzelne Bundesländer hätten bereits<br />
für sich entschieden, auf CSS verzichten zu wollen. Diese<br />
Technologie sei jedoch notwendig, um die CO 2 -Bilanz<br />
zu verbessern und die gesteckten Klimaziele zu erreichen<br />
und auch um die Nutzung fossiler Rohstoffe in<br />
Schwellenländern ausgleichen zu können. Selbstverständlich<br />
dürften durch CCS die Trinkwasservorkommen<br />
nicht beeinträchtigt, der Grundwasserschutz nicht<br />
vernachlässigt werden. Natürlich müsse auch genügend<br />
Akzeptanz für diese Technologie in der Bevölkerung<br />
vorhanden sein.<br />
Beim Fracking, dem Einpressen technischer Flüssigkeiten<br />
in den Untergrund zur Förderung insbesondere<br />
von Schiefergas, würde nach Bergrecht vorgegangen.<br />
Horst Meierhofer,<br />
MdB.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 293
FachberichtE Tagungsbericht<br />
Deshalb, erläuterte Meierhofer, seien wenige Regelungen<br />
zum <strong>Wasser</strong>schutz vorhanden. Der Umweltschutz<br />
sei bei dieser Technologie, die schon seit vielen Jahren<br />
zur Gasförderung eingesetzt würde, bisher insgesamt<br />
zu kurz gekommen. Wichtig sei es nun, klare Vorgaben<br />
zu machen, beispielsweise die Verursacher von Umweltschäden<br />
in Haftung zu nehmen, Fracking-Projekte entweder<br />
nicht mehr in Trinkwasserschutzgebieten zuzulassen<br />
oder zumindest Umweltverträglichkeitsprüfungen<br />
zu verlangen und <strong>Wasser</strong>experten einzuschalten.<br />
Meierhofer ist sich sicher: Prinzipiell solle man auf diese<br />
Technologie nicht verzichten, doch nur wenn Technik<br />
und Durchführung sicher genug seien, zudem die<br />
Bevölkerung frühzeitig eingebunden würde, bestehe<br />
die Möglichkeit, Fracking-Projekte tatsächlich zu verwirklichen.<br />
Ökobilanz Trinkwasser<br />
Gerhard Moser, Fernwasserversorgung Franken, Uffenheim,<br />
stellte mehrere Thesen rund um die BDEW-Studie<br />
Ökobilanz Trinkwasser dreier unabhängiger Institute<br />
auf. Er zitierte den Zukunftsforscher Matthias Horx,<br />
nachdem wir derzeit in einem „grünen Zeitalter“ leben.<br />
Umwelt und Nachhaltigkeit seien Megathemen,<br />
Umweltauswirkungen menschlichen Handelns rückten<br />
in den Fokus der Öffentlichkeit. Vertreter eines gesunden<br />
und nachhaltigen Lebensstils seien eine wichtige<br />
und wachsende gesellschaftliche Gruppe. Leider, konstatierte<br />
Moser, würde Trinkwasser in der Bevölkerung<br />
nicht als Naturprodukt wahrgenommen, sondern als<br />
industriell gefertigte Ware betrachtet. Vom „Biotrend“<br />
könne Trinkwasser bedauerlicherweise nicht profitieren.<br />
Nur 56 Prozent der Verbraucher würden laut Umfrage<br />
<strong>Wasser</strong>versorger als umweltorientiert charakterisieren.<br />
(Im Jahr 2009 waren es noch 72 Prozent.)<br />
Die Studie Ökobilanz Trinkwasser diene der ökologischen<br />
Standortbestimmung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Umwelteigenschaften in der gesamten Prozesskette,<br />
CO 2 -Bilanz und auch der Vergleich zu Mineralwasser<br />
seien dabei in Betracht gezogen worden, erklärte Moser.<br />
Festgestellt wurde unter anderem, dass der Treibhauseffekt<br />
zu 48 Prozent aus der regionalen Verteilung, zu<br />
24 Prozent aus der Aufbereitung, zu 15 Prozent aus der<br />
Gewinnung und zu 13 Prozent aus Speicherung und<br />
Ferntransport von Trinkwasser resultiere. Wie nicht<br />
anders erwartet, sei ein wesentlicher Faktor der Bilanz<br />
der Stromverbrauch bei den einzelnen Prozessschritten.<br />
Aus den Ergebnissen ließen sich etliche Ansatzpunkte<br />
zur Optimierung, vor allem beim Aufspüren von Energieeinsparmöglichkeiten,<br />
ermitteln.<br />
Trinkwasser sei gegenüber der Bereitstellung von<br />
stillem Mineralwasser „ökologisch vorteilhaft“, die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
basiere auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit.<br />
Die Frage sei nun zu beantworten, wie sich dieses<br />
Umweltthema von <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
kommunikativ nutzen und positiv besetzen lasse.<br />
Energiewende: Wie stellen sich die Anforderungen<br />
aus Sicht der <strong>Wasser</strong>wirtschaft dar?<br />
Ulrich Peterwitz, Gelsenwasser AG, zeigte in seinem Vortrag<br />
auf, wie wichtig es ist, die Rahmenbedingungen für<br />
Technologien, die im Zuge der Diskussion um den Klimawandel<br />
und der Energiewende in den Fokus rücken,<br />
unter Berücksichtigung der <strong>Wasser</strong>wirtschaft neu zu<br />
justieren. Biogaserzeugung und Gasgewinnung aus<br />
unkonventionellen Lagerstätten seien Beispiele dafür,<br />
wie die Belange der <strong>Wasser</strong>- und der Energiewirtschaft<br />
im Gegensatz zueinander stünden.<br />
Längst bekannt sei der Interessenskonflikt zwischen<br />
Grundwasserschutz und landwirtschaftlicher Nutzung,<br />
die in erheblichem Maße zu Überdüngung und damit<br />
zu Grundwasserverunreinigung in Nordrhein-Westfalen<br />
geführt habe. Aber auch Altlasten, beispielsweise TNT<br />
aus ehemaligen Sprengstofflagern, müssten aufwändig<br />
saniert werden, möglichst bevor sie ins Grundwasser<br />
gerieten, denn dann seien Maßnahmen zur Sanierung<br />
allemal schwierig und langwierig.<br />
Verunreinigungen von Oberflächengewässern wirkten<br />
sich dagegen oft sehr viel schneller aus, zum Beispiel<br />
beim PFT-Schaden an der Ruhr im Jahr 2006, als<br />
die Chemikalie von zwei Feldern aus die gesamte Ruhr<br />
kontaminierte.<br />
Aus diesem Grunde sei eine grundlegende<br />
Zwei-Wege-Strategie entwickelt worden, einmal der<br />
vorbeugende Umwelt- und Gewässerschutz, also die<br />
Vermeidung, und zum zweiten die weitergehende Aufbereitung,<br />
also die Reparatur von Schäden. Zur Vorbeugung<br />
seien in der Vergangenheit Abkommen mit der<br />
Landwirtschaft und mit dem Steinkohleabbau getroffen<br />
worden.<br />
Ein neues Problemfeld würde sich nun mit der Biogaserzeugung<br />
eröffnen, erklärte Peterwitz. Im letzten<br />
Jahrzehnt sei die Zahl der Anlagen rapide angestiegen,<br />
mit einem weiteren Anstieg sei im Rahmen der Energiewende<br />
zu rechnen. In Gegenden, in denen bereits große<br />
Flächen zur Viehwirtschaft genutzt würden, stünde die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft durch die zusätzliche Nutzung von<br />
Flächen zur Energieerzeugung vor einem Nitrat-Problem.<br />
Um die Grenzwerte der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
einhalten zu können, nach denen Grundwasser mit<br />
mehr als 50 mg/L Nitrat in einem „schlechten Zustand“<br />
ist, dürften jedoch, so eine Studie für einen Betrachtungsraum<br />
am Niederrhein, weit weniger Flächen<br />
genutzt werden, als aus landwirtschaftlicher oder energiepolitischer<br />
Sicht möglich, wenn die Überschüsse<br />
nicht aus dem Gebiet wegtransportiert werden könnten.<br />
Die Biogaserzeugung müsse prinzipiell, führte<br />
Peterwitz aus, mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell<br />
betrieben werden – vor allem CO 2 -neutral hinsichtlich<br />
der Gärrestaufbereitung und des Gärresttransports.<br />
Ein zweites Problemfeld für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft sei<br />
das Fracking, so Peterwitz. Aufsuchungsgebiete befänden<br />
sich in Nordrhein-Westfalen im Bereich von <strong>Wasser</strong>-<br />
März 2012<br />
294 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
schutzgebieten aus denen mehrere Millionen Menschen<br />
mit Trinkwasser versorgt werden. Der nicht transparente<br />
Einsatz von Chemikalien bereite den<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern Kopfzerbrechen, die Zerstörung von<br />
Deckschichten im Boden, aber auch ein hoher <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
bei den Bohrungen sowie ungelöste Fragen<br />
bei der <strong>Abwasser</strong>reinigung, beispielsweise durch die<br />
Belastung des Frackwassers mit Schwermetallen, Kohlenwasserstoffen<br />
und Radionukliden.<br />
Peterwitz zählte die Forderungen der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
auf: Umweltverträglichkeitsprüfungen sollten<br />
obligatorisch sein, in <strong>Wasser</strong>schutzgebieten dürften<br />
keine Bohrungen niedergebracht werden, <strong>Abwasser</strong><br />
müsste fachgerecht behandelt werden und Deckschichten<br />
sollten unversehrt bleiben. Notfallpläne müssten<br />
erstellt, die eingesetzten Chemikalien nach Art und<br />
Menge offengelegt werden.<br />
Nicht grundsätzlich wollte sich Peterwitz gegen die<br />
Nutzung alternativer Energiequellen aussprechen, aber<br />
sie sollten umweltverträglich und mit Blick auf den<br />
Trinkwasserschutz gebraucht werden.<br />
Thesen zu Ansatzpunkten der kartellrechtlichen<br />
Missbrauchsaufsicht<br />
Dr. Felix Engelsing, Bundeskartellamt, Bonn, gab eine<br />
Definition der <strong>Wasser</strong>märkte: Die Netze seien meist<br />
kleinteilig, das Monopol läge beim jeweiligen <strong>Wasser</strong>versorger.<br />
Die Durchleitung von <strong>Wasser</strong> sei nicht, beziehungsweise<br />
kaum möglich, daher gebe es keine Netzregulierung.<br />
Da die Kunden keine Wechselmöglichkeit<br />
hätten, sei eine Preismissbrauchsaufsicht notwendig.<br />
Staatliche Abgaben seien die <strong>Wasser</strong>entnahmeentgelte<br />
und die Konzessionsabgaben.<br />
Die Erhebung der Entgelte hänge von der Organisationsform<br />
ab, privatrechtliche Versorger müssten Preise<br />
erheben, öffentlich-rechtliche hätten ein Wahlrecht.<br />
<strong>Wasser</strong>preise unterlägen einer kartellrechtlichen Prüfung,<br />
<strong>Wasser</strong>gebühren dem Kommunalabgabengesetz,<br />
die Anwendbarkeit des Kartellrechtes sei hier strittig.<br />
Als Eingriffsgrundlage bei Preishöhenmissbrauch bei<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung hätte weiterhin § 103, Abs. 5 S.2<br />
Nr. 2 GWB 1990 (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)<br />
Bestand. Hier sei allerdings nur die Missbräuchlichkeit<br />
für die Zukunft feststellbar. Anders bei § 19 Abs.<br />
1, Abs. 4 Nr. 2 GWB, Art. 102 AEUV, wonach eine Feststellung<br />
für die Vergangenheit möglich sei und eine Rückerstattung<br />
an die Kunden verfügt werden könne.<br />
Das im März 2010 eingeleitete Verfahren gegen die<br />
Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe (BWB) sei von der Landeskartellbehörde<br />
Berlin an das Bundeskartellamt abgegeben<br />
worden. Dazu seien Auskunftsbeschlüsse an BWB und<br />
an die 38 größten deutschen <strong>Wasser</strong>versorger gegangen<br />
wie beispielweise an Hamburg<strong>Wasser</strong>, SW München<br />
und RheinEnergie Köln. Der Ansatzpunkt des Bundeskartellamtes<br />
beim Verfahren sei ganz klar das Vergleichsmarktkonzept<br />
gewesen. Der Erlösvergleich biete<br />
Dr. Felix<br />
Engelsing,<br />
Bundeskartellamt.<br />
Diskussionsrunde mit Prof. Thorsten Beckers, TU Berlin; Dr. Felix<br />
Engelsing, Bundeskartellamt; Ute Holzhey; Horst Meierhofer MdB;<br />
Dr. Peter Rebohle, Südsachsen <strong>Wasser</strong>.<br />
Wolfgang Müller, Stadtwerke Saarlouis; Reinhold Hüls, Veolia<br />
<strong>Wasser</strong> GmbH; Dr. Franz-Josef Schulte, RWW Rheinisch-Westfälische<br />
<strong>Wasser</strong>werksgesellschaft mbH; Sebastian Freier, THÜGA<br />
Aktiengesellschaft.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 295
FachberichtE Tagungsbericht<br />
gegenüber dem Tarifvergleich den Vorteil, dass ein<br />
Gesamtbild erfasst werden könne. Beim Verfahren sei<br />
ein erheblicher Erlösunterschied zwischen BWB und<br />
Vergleichsunternehmen festgestellt worden, berichtete<br />
Engelsing. Im Rahmen der Rechtfertigung müsse nun<br />
festgestellt werden, ob es gebietsbezogene, strukturelle<br />
Unterschiede gebe, die zu höheren Kosten führten.<br />
Dabei würden auch kalkulatorische Kosten, Abschreibungen<br />
und Fremdkapitalzinsen in Ansatz gebracht.<br />
Derzeit würden Zuständigkeiten und Anwendbarkeit<br />
des Kartellrechts noch gerichtlich geprüft.<br />
Aus Sicht der Kartellbehörde sei prinzipiell die Wettbewerbsaufsicht<br />
gegenüber einer Regulierung vorzuziehen.<br />
Hilfreich sei dabei das Benchmarking, um <strong>Wasser</strong>preise<br />
transparenter zu machen.<br />
Kartellverfahren, Leistungsfähigkeit,<br />
Datenpool – Wie lässt sich Leistungsfähigkeit<br />
dokumentieren?<br />
Sebastian Freier, THÜGA Aktiengesellschaft, München,<br />
gab einen kurzen Überblick über die aktuell laufenden<br />
Kartellverfahren und stellte die Möglichkeiten der Kartellbehörden<br />
vor. Entweder könne nach altem Recht der<br />
§ 103 GWB angewandt werden oder nach neuem Recht<br />
nach § 19 GWB vorgegangen werden. Nach altem Recht<br />
läge die Beweislast beim <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
und es gebe keine rückwirkende Missbrauchsfeststellung,<br />
nach neuer Rechtslage habe die Kartellbehörde<br />
die Beweislast zu tragen und eine rückwirkende<br />
„Mehrerlösabschöpfung“ sei möglich.<br />
Konzeptionell seien derzeit zwei Verfahren möglich:<br />
das Vergleichsmarktkonzept und die Kostenprüfung.<br />
Beim Vergleichsmarktkonzept vergleicht die Kartellbehörde<br />
lediglich die Preise und nicht die Kalkulationen,<br />
bei der Kostenprüfung würden die tatsächlichen effizienten<br />
Kosten in Ansatz gebracht.<br />
Damit ein Kartellverfahren initiiert würde, erklärte<br />
Freier, müsse ein <strong>Wasser</strong>versorger zuerst auffällig werden,<br />
beispielweise durch hohe Preisanpassungen. Dann<br />
sei bislang rückwirkend mit anderen Versorgern verglichen<br />
wurden, ohne auf Strukturunterschiede einzugehen.<br />
Bei der anschließenden Rechtfertigung hätten<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen die strukturellen Un -<br />
terschiede, die Effizienz in der Betriebsführung sowie<br />
die Kosten anhand einer detaillierten, nachvollziehbaren<br />
Kalkulation nachweisen müssen. Zur Bestimmung<br />
der Effizienz würde der Aufwand verglichen, den verschiedene<br />
Unternehmen betrieben, um die jeweilige<br />
Versorgungsaufgabe zu erfüllen. Deshalb sei es besonders<br />
wichtig, die Versorgungsaufgabe detailliert zu<br />
beschreiben. Eine weitere Voraussetzung, nachvollziehbar<br />
Kosten vergleichen zu können, sei, einheitliche Kostenstellen<br />
zu verwenden. Ziel und Aufgabe für das Jahr<br />
2012 sei, ein einheitliches Kalkulationsschema für die<br />
<strong>Wasser</strong>branche zu schaffen sowie die Etablierung und<br />
Verbreitung einer einheitlichen Datenbasis.<br />
BDEW-VKU-Kalkulationsleitfaden –<br />
So kalkulieren Sie richtig!<br />
Wolfgang Müller, Stadtwerke Saarlouis, beschrieb in seinem<br />
Vortrag die betriebswirtschaftlichen Grundlagen<br />
für die <strong>Wasser</strong>preiskalkulation. Es sei beispielsweise<br />
möglich, mit oder ohne Substanzerhalt zu kalkulieren,<br />
also mit oder ohne Verzinsung des Eigenkapitals sowie<br />
mit oder ohne Realkapitalerhaltung. Für <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen,<br />
die in der Regel über viel Eigenkapital<br />
verfügten, sei besonders ratsam, dessen Verzinsung<br />
in Ansatz zu bringen. Oftmals würden auch steuerliche<br />
Aspekte vernachlässigt, zum Beispiel betriebliche<br />
Steuern nicht mit einkalkuliert, aber auch Konzessionsabgaben<br />
in der Kalkulation vernachlässigt. Das bilanzielle<br />
Eigenkapital sei nicht identisch mit der nach<br />
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verzinsenden<br />
Bemessungsgrundlage.<br />
Preisstruktur und Preisbildung könnten je nach<br />
angesetztem Kostendeckungsgrad bei Abweichungen<br />
bei Effizienz und Abgabemengen gewaltige Unterschiede<br />
beim <strong>Wasser</strong>preis bewirken. Um <strong>Wasser</strong>preise<br />
wirklich vergleichen zu können, sei es deshalb notwendig,<br />
auf einer vergleichbaren Basis zu kalkulieren. Denn<br />
als mögliche Ursachen für die heterogene Preislandschaft<br />
in der <strong>Wasser</strong>branche sieht Müller neben der<br />
Konzeption der Versorgungssysteme und den Strukturmerkmalen<br />
der Versorgungsgebiete die unterschiedliche<br />
Preispolitik der Unternehmen.<br />
Um den <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen Unterstützung<br />
im Umgang mit den Kartellbehörden zu geben,<br />
hätten die Verbände ein Gutachten (NERA) zur Preiskalkulation<br />
in Auftrag gegeben, würden zudem einen Kalkulationsleitfaden<br />
entwickeln und einen Pool mit Vergleichsdaten<br />
anlegen. Diese angestrebte einheitliche<br />
Kalkulation sei eine freiwillige Normierung der Branche,<br />
resümierte Müller, sie sei notwendig, um die Preisbildung<br />
transparenter zu machen und um Vertrauen zu<br />
gewinnen.<br />
Vom Grund- zum Systempreis – ein neues<br />
Preismodell auf dem Weg in die Praxis<br />
Dr. Franz-Josef Schulte, RWW Rheinisch-Westfälische<br />
<strong>Wasser</strong>werksgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr,<br />
berichtete über den Systemwechsel, den die RWW bei<br />
ihren Tarifen vorgenommen hat. Triebfeder des Projektes<br />
war die gravierende Veränderung des Nachfrageverhaltens<br />
gegenüber den gestellten <strong>Wasser</strong>verbrauchsprognosen.<br />
Denn die Auslastung der Versorgungsanlagen<br />
von RWW ging in den letzten zehn Jahren aufgrund<br />
sinkender Nachfrage pro Jahr um jeweils ein Prozent<br />
zurück. Gründe dafür, so Schulte, seien der demografische<br />
Wandel sowie der technologiebedingte, strukturelle<br />
und verhaltensbedingte Rückgang des Verbrauchs.<br />
In der Folge des Nachfragerückgangs sei entweder<br />
eine Preisspirale oder eine Kostendeckungslücke zu<br />
erwarten gewesen, denn die bislang gebräuchlichen<br />
März 2012<br />
296 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
Tarifstrukturen bildeten Fixkosten in der Regel nur unzureichend<br />
ab. Um die Schieflage zwischen 20 Prozent<br />
Grundpreis und 80 Prozent Arbeitspreis auszugleichen,<br />
habe man bei RWW ein neues Tarifsystem entwickelt.<br />
Dabei sei nicht die tatsächliche Kostenstruktur abgebildet<br />
worden, sondern die Tarife setzten sich jetzt zu je<br />
50 Prozent aus einem fixen Systempreis und einem variablen<br />
Mengenpreis zusammen. Zudem könne jeder<br />
Kunde auch noch Zusatzleistungen von RWW wie beispielsweise<br />
Zähler, Standrohre, usw. beziehen. Mit dem<br />
neuen Tarifsystem sei ein Kompromiss zwischen Ressourcenschutz<br />
und Preisstabilisierung erreicht worden.<br />
Ganz wichtig war laut Schulte, dass zum Umstellungszeitpunkt<br />
keine versteckte Preissteigerung vorgenommen<br />
wurde. Ein Wirtschaftsprüfer habe dies bestätigt.<br />
Künftig werde der Systempreis nicht mehr von der Größe<br />
des Zählers abhängen, sondern von Wohneinheiten je<br />
Gebäude und Referenzverbrauch für Industriekunden.<br />
Auswirkungen der Oberflächengewässerverordnung<br />
auf die Branche<br />
Dr. Winfried Haneklaus, Ruhrverband, Essen, bemerkte,<br />
dass Zweck und Anlass der Oberflächengewässerverordnung<br />
(OGewV) die Umsetzung europäischer Vorgaben<br />
zum besseren Schutz von Oberflächengewässern<br />
durch Festlegung von Umweltqualitätsnormen für<br />
die verbindliche Einstufung des ökologischen und chemischen<br />
Gewässerzustands waren. Die hierzu intensiv<br />
geführten Diskussionen hätten sich vor allem an der<br />
Frage entzündet, welche Stoffe in welchen Konzentrationen<br />
zusätzlich in Umweltqualitätsnormen in Deutschland,<br />
jenseits der ohnehin durchzuführenden Vorgaben<br />
aus Brüssel, festgesetzt werden sollten.<br />
Die Regelungen im Einzelnen: In der OGewV, Anlage<br />
3, werden biologische, hydromorphologische, chemische<br />
und allgemein physikalisch-chemische Qualitätskomponenten<br />
zur Einstufung des ökologischen<br />
Zustands (Potenzials) benannt. In Anlage 5 sind 162<br />
flussgebietsspezifische Schadstoffe als chemische Qualitätskomponenten<br />
für den ökologischen Zustand aufgeführt.<br />
Nur noch 13 von den Ländern als signifikant<br />
gemeldete Stoffe fanden Eingang in die Verordnung.<br />
Anlage 7 enthalte 38 Umweltqualitätsnormen für prioritäre<br />
oder prioritär gefährliche oder bestimmte andere<br />
Schadstoffe aus der UQN-RL sowie für Nitrat zur Einstufung<br />
des chemischen Zustandes. Paragraph 7 der<br />
OGewV behandelt die Anforderungen an Oberflächengewässer,<br />
die der Trinkwassergewinnung dienen. Die<br />
Oberflächen gewässerverordnung konkretisiert die<br />
Bewirtschaftungsanforderungen des WHG im Hinblick<br />
auf den guten ökologischen und chemischen Zustand.<br />
Sie ist Grundlage für Bewirtschaftungs entscheidungen<br />
im Einzelfall, ersetzt jedoch nicht die Bewirtschaftungsentscheidungen<br />
im Vollzug; sie gibt keine das wasserwirtschaftliche<br />
(Auswahl-)Ermessen lenkende Abwägungsdirektiven<br />
vor (etwa: Vorrang der Trinkwasserversorgung,<br />
Verursacherprinzip, Gebot der Kosteneffizienz,<br />
etc.)<br />
Die OGewV enthält keine über die Vorgaben von Art.<br />
7 III WRRL hinausgehenden Anforderungen an Oberflächengewässer,<br />
die der Trinkwassergewinnung dienen<br />
(Übernahme des RL-Wortlauts 1:1). Bezug auf die Werte<br />
der Trinkwasserverordnung für Rohwasser wird nicht<br />
genommen. Pauschale Konzentrationswerte für die<br />
sogenannten unbekannten Stoffe (ursprünglich geplant<br />
10 µ/L für synthetische nicht halogenierte und 1 µ/L für<br />
synthetische halogenierte Stoffe) sind ebenso wenig<br />
enthalten wie ein Bewertungsverfahren für die sogenannten<br />
unbekannten Stoffe (wie das in NRW diskutierte<br />
GOW-Konzept).<br />
Endgültig „vom Tisch“ dürften nach Einschätzung<br />
Haneklaus’ der Bezug auf die Werte der Trinkwasserverordnung<br />
für Rohwasser sein sowie die pauschalen Konzentrationswerte<br />
für die sogenannten unbekannten<br />
Stoffe. Auf EU-Ebene dürfte die Fortschreibung der Liste<br />
der prioritären Stoffe in der Diskussion bleiben. Nach<br />
Vorschlag des SCHER-Ausschusses der Generaldirektion<br />
Gesundheit und Verbraucherschutz werde bereits über<br />
weitere 22 Stoffe und Stoffgruppen diskutiert, darunter<br />
die Medikamente Diclofenac und Ibuprofen, Wirkstoffe<br />
von Antirezeptiva und Menopausepräparaten, Blei,<br />
Nickel, verschiedene Flammschutzmittel, Dioxine, Pflanzenschutzmittel<br />
und polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe.<br />
Auf Bundesebene stehe die Umsetzung des UMK-<br />
Beschlusses vom 11.06.2010 zur Entwicklung einer<br />
Methodik zur Risikoabschätzung von Stoffen in Oberflächengewässern<br />
zur Trinkwassergewinnung noch aus.<br />
Kürzlich habe sich der Präsident des Umweltbundesamtes<br />
für eine vierte Reinigungsstufe stark gemacht,<br />
berichtete Haneklaus, zumindest bei den Gewässern,<br />
aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Allerdings gebe<br />
es derzeit keine gesicherten Bemessungsgrundlagen<br />
für weitergehende Verfahren in der <strong>Abwasser</strong>reinigung,<br />
so Haneklaus. Es bestünden erhebliche Wissenslücken<br />
über öko- und humantoxikologische Wirkungen bei<br />
vielen Stoffen und die Risiken durch Transformationsprodukte<br />
seien weitgehend unbekannt. Auch die energetische<br />
Bilanz beispielsweise beim Einsatz von Aktivkohle<br />
sei noch nicht gezogen.<br />
Auf Landesebene würden noch ergänzende, über<br />
die OGewV hinaus gehende oder von ihr abweichende<br />
Regelungen in Landesverordnungen diskutiert (z. B.<br />
eigene Stofflisten, Bewertungsmethoden für unbekannte<br />
Stoffe).<br />
Nach seiner subjektiven Einschätzung, meinte Haneklaus,<br />
müsse der Bund in absehbarer Zeit die OGewV<br />
novellieren, um neue Anforderungen der EU (prioritäre<br />
Stoffe) umzusetzen. Der Bund werde die Liste der flussgebietsspezifischen<br />
Stoffe regelmäßig aktualisieren<br />
(Anlage 5) und zu gegebener Zeit Bewertungsmethoden<br />
für sogenannte unbekannte Stoffe vor allem in<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 297
FachberichtE Tagungsbericht<br />
Trinkwasserflüssen einführen. Der Vollzug der OGewV<br />
werde in den kommenden Jahren wasserwirtschaftlichen<br />
Handlungsbedarf im Hinblick auf Spurenstoffe<br />
erzeugen und einseitig den Druck auf Betreiber von<br />
<strong>Abwasser</strong> behandlungsanlagen weiter erhöhen. Wissenschaft<br />
und Technik würden weitergehende <strong>Abwasser</strong>behandlungsverfahren<br />
zur gezielten Elimination von<br />
Spurenstoffen entwickeln und den Stand der Technik<br />
vorantreiben. Dies werde mittelfristig zu einer Anpassung<br />
der <strong>Abwasser</strong>verordnung führen.<br />
Trinkwasserverordnung – wichtige<br />
Änderungen im Überblick, Rechte und<br />
Umsetzungspflichten für die Branche<br />
Dr. Dietmar Petersohn, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, erläuterte,<br />
welche Neuerungen in der Ersten Verordnung zur<br />
Änderung der Trinkwasserverordnung vom 3. Mai 2011<br />
zu finden sind:<br />
Die Bezeichnung „<strong>Wasser</strong> für den menschlichen<br />
Gebrauch“ wurde in „Trinkwasser“ geändert. Mit der<br />
Unterscheidung von sechs Arten von <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
anstelle von dreien und mit der Definition<br />
von verschiedenen wichtigen Begriffen sind die<br />
Regelungen der Trinkwasserverordnung nun eindeutiger<br />
geworden. Neu ist auch der Verweis darauf, dass<br />
die Desinfektion nach den allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik unter Beachtung des chemischen<br />
Minimierungsgebots durchzuführen ist.<br />
Eine klare Vorschrift gibt es nun zur Absicherung der<br />
Trinkwasseranlagen gegen Kontaminationen durch<br />
Nicht-Trinkwasseranlagen und den Verweis auf die<br />
Sicherungseinrichtungen nach den allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik.<br />
Die Rolle des Umweltbundesamtes bei der Führung<br />
der Liste gemäß § 11 TrinkwV und die im Anhörungsverfahren<br />
beteiligten Kreise sowie das Antragsverfahren<br />
zur Neuaufnahme von Stoffen oder Desinfektionsverfahren<br />
wurden näher bestimmt. Aber die Strafbewehrung<br />
jeglicher Verstöße gegen § 11 Absatz 1 bleibt<br />
erhalten.<br />
Coliforme Bakterien werden analog zur Trinkwasserrichtlinie<br />
98/83/EG aus Anlage 1 (mikrobiologische Parameter)<br />
in Anlage 3 (Indikatorparameter) transferiert, um<br />
ihre Stellung als Indikatororganismen hervorzuheben<br />
und sie von den Parametern zu unterscheiden, denen<br />
eine unmittelbare Gesundheitsrelevanz zugeschrieben<br />
wird. Für Uran wurde aufgrund seines ubiquitären Vorkommens<br />
und seiner chemisch-toxikologischen Wirkung<br />
ein Grenzwert eingeführt.<br />
Neu in der TrinkwV findet eine klare Verantwortungsabgrenzung<br />
durch Begriffsbestimmungen statt. Beispielsweise<br />
wird in § 3 definiert, dass <strong>Wasser</strong>versorgungsanlagen<br />
nach Buchstabe f) Anlagen sind, aus<br />
denen Trinkwasser entnommen oder an Verbraucher<br />
abgegeben wird und die zeitweilig betrieben werden<br />
oder zeitweilig an eine Anlage nach Buchstabe a, b oder<br />
Buchstabe e angeschlossen sind (zeitweise <strong>Wasser</strong>verteilung<br />
auf beispielsweise Volksfesten oder Großveranstaltungen).<br />
Geändert wurden die Allgemeinen Anforderungen<br />
in § 4 (1). In der alten Version hieß es „<strong>Wasser</strong> für den<br />
menschlichen Gebrauch muss frei von Krankheitserregern<br />
sein“. Die neue Formulierung lautet: „Trinkwasser<br />
muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder<br />
Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit<br />
insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu<br />
besorgen ist.“<br />
Neufassung des § 5 Mikrobiologische Anforderungen:<br />
(4) „Konzentrationen von Mikroorganismen, die das<br />
Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit<br />
nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehalten<br />
werden, wie dies nach den allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand unter<br />
Berücksichtigung des Einzelfalls möglich ist.“ Dies könne<br />
als unscharfe Formulierung aufgefasst werden, so<br />
Petersohn, mit Risiken im Vollzug. Andererseits gebe es<br />
kein steriles Trinkwasser und man käme weg von der<br />
„Nulldiskussion“.<br />
Neuformulierungen gab es bei § 9 und § 10: Bei § 9 –<br />
Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten,<br />
der Nichterfüllung von Anforderungen sowie<br />
des Erreichens oder der Überschreitung von technischen<br />
Maßnahmewerten – hier wurde neu der direkte<br />
Bezug auf <strong>Wasser</strong>versorgungsgebiete aufgenommen<br />
sowie die Unterbrechung und Wiederinbetriebnahme<br />
unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der<br />
Technik. In § 10 ist nun die Zulassung der Abweichung<br />
von Grenzwerten für chemische Parameter angesiedelt.<br />
Zu § 19, Umfang der Überwachung, habe es bereits<br />
in manchen Bundesländern heftige Diskussionen gegeben,<br />
berichtete Petersohn. Darin steht: (3) „Soweit das<br />
März 2012<br />
298 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
Gesundheitsamt die Entnahme oder Untersuchung von<br />
<strong>Wasser</strong>proben nach Absatz 1 und 2 nicht selbst durchführt,<br />
beauftragt es hierfür eine vom <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
unabhängige Untersuchungsstelle,<br />
die nicht bereits die Betreiberuntersuchung durchgeführt<br />
hat und welche die Anforderungen des § 15 Absatz<br />
4 Satz 1 erfüllt.“ Dies bedeute, so Petersohn, dass das<br />
Gesundheitsamt die Untersuchungsstelle bestimmen<br />
könne.<br />
Bei § 21, Information der Verbraucher und Berichtspflichten,<br />
ist neu, dass es eine Informationspflicht für<br />
Unternehmer und sonstige Inhaber ab Dezember 2013<br />
gibt, wenn der Werkstoff Blei in der <strong>Wasser</strong>versorgungsanlage<br />
vorhanden ist. Ab 1. Dezember 2013 wird der<br />
Grenzwert für den Parameter Blei auf 0,01 mg/L abgesenkt;<br />
dieser Wert könne jedoch nur eingehalten werden,<br />
wenn in der <strong>Wasser</strong>versorgung keine Bleirohre<br />
mehr vorhanden sind.<br />
Anlage 3 (zu § 7) Indikatorparameter, Teil I: Allgemeine<br />
Indikatorparameter Clostridium perfringens (einschließlich<br />
Sporen) Anzahl/100 mL: 0 – dieser Parameter<br />
braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Rohwasser<br />
von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser<br />
beeinflusst wird. Wird dieser Grenzwert nicht<br />
eingehalten, veranlasst die zuständige Behörde Nachforschungen<br />
im Versorgungssystem, um sicherzustellen,<br />
dass keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit<br />
aufgrund eines Auftretens krankheitserregender<br />
Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidium, besteht. Über<br />
das Ergebnis dieser Nachforschungen unterrichtet die<br />
zuständige Behörde über die zuständige oberste Landesbehörde<br />
das Bundesministerium für Gesundheit.<br />
Anlage 3 (zu § 7) Indikatorparameter, Teil I: Allgemeine<br />
Indikatorparameter, Trübung Nephelometrische<br />
Trübungseinheiten (NTU) 1,0 – der Grenzwert gilt als<br />
eingehalten, wenn am Ausgang des <strong>Wasser</strong>werks der<br />
Grenzwert nicht überschritten wird. Der Unternehmer<br />
und der sonstige Inhaber einer <strong>Wasser</strong>versorgungsanlage<br />
nach § 3 Nr. 2 Buchstabe a oder b haben einen<br />
plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich<br />
der zuständigen Behörde zu melden. Letzteres gilt auch<br />
für das Verteilungsnetz.<br />
Anlage 3 (zu § 7) Indikatorparameter, Teil I: Allgemeine<br />
Indikatorparameter – geogen bedingte Überschreitungen<br />
(alt) bei Ammonium, Chlorid, Sulfat (neuer<br />
Grenzwert bei 250 mg/L), Eisen, Mangan werden jetzt<br />
allgemein in § 9 (5) geregelt. Bei Nichteinhaltung der<br />
festgelegten Grenzwerte beziehungsweise Anforderungen<br />
(§ 7) ordnet das Gesundheitsamt Maßnahmen zur<br />
Wiederherstellung der Trinkwasser-Qualität an. Das<br />
Gesundheitsamt legt fest, bis zu welchem Wert oder bis<br />
zu welchem Zeitraum die Nichteinhaltung, Nichterfüllung<br />
geduldet wird.<br />
Termin<br />
Die 11. <strong>Wasser</strong>wirtschaftliche Jahrestagung wird voraussichtlich<br />
am 19. und 20. November 2012 in Berlin<br />
stattfinden.<br />
Bilder © BDEW<br />
Autorin<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
E-Mail: ziegler@oiv.de |<br />
Rosenheimer Straße 145 |<br />
D-81671 München<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Biogas<br />
In der Ausgabe 3/2012 lesen Sie u. a. fol gende Bei träge:<br />
Dübbel<br />
Köppel/Ortloff/Erler/Graf<br />
Trost/Jentsch/<br />
Holzhammer/Horn<br />
Lubenau<br />
Dörr<br />
Biogas – Herkunftsnachweise für die Vergütung nach EEG und bei Verwendung<br />
als nachhaltiger Kraftstoff nach Biokraft-NachV<br />
Vermeidung und Entfernung von Sauerstoff bei der Einspeisung<br />
von Biogas in das Erdgasnetz<br />
die Biogasanlagen als zukünftige CO 2 -Produzenten für die Herstellung<br />
von erneuerbarem Methan<br />
aufbereitung von Erdgas und Biogas mit Membranen<br />
µ-KWK aus Anwendersicht: Fokus auf Funktion statt Technik<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 299
praxis Pumpentechnik<br />
Lebenszykluskosten in der<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
Teil 1: Betriebs- und Instandhaltungskosten minimieren<br />
durch optimale Pumpenkonfiguration<br />
Holger Stark, Leiter Produktmanagement Schmutz- und <strong>Abwasser</strong> bei der WILO SE in Dortmund<br />
In Kommune und Industrie stellt der Betrieb von Pumpen für die <strong>Abwasser</strong>entsorgung einen der größeren<br />
Kostenblöcke dar. Auf Basis einer gezielten Analyse der Rahmenbedingungen für den Pumpenbetrieb und der<br />
daraus resultierenden Lebenszykluskosten können oftmals geeignete Maßnahmen ergriffen werden, durch die<br />
sich erhebliche Einsparerfolge erzielen lassen. In diesem Zusammenhang bietet die moderne Pumpentechnik<br />
vielfältige Möglichkeiten, Effizienz und Betriebssicherheit in der <strong>Abwasser</strong>entsorgung zu steigern. Der zweiteilige<br />
Praxisbeitrag erläutert, wie sich die Betriebskosten durch eine optimale Pumpenkonfiguration senken<br />
lassen und welchen Einfluss dabei die im Pumpenbau eingesetzten Materialien haben.<br />
Eine LCC-Analyse (Life Cycle Cost, deutsch: Lebenszykluskosten)<br />
ist sowohl bei der Planung von Neuanlagen<br />
als auch zur Optimierung von Bestandsanlagen<br />
sinnvoll. Bezogen auf den Lebenszyklus einer Pumpe<br />
werden verschiedene Kostenblöcke unterschieden<br />
(Tabelle 1).<br />
Investoren, Planer und Anlagenbauer können die<br />
voraussichtlichen Lebenszykluskosten ermitteln, indem<br />
sie die oben genannten Kostenelemente berechnen<br />
und addieren. Grundlage ist die zu erwartende<br />
Lebensdauer der Anlage.<br />
Im Vorfeld werden die einzelnen Kostenelemente<br />
der LCC-Analyse auf ihre Relevanz für den konkreten<br />
Anwendungsfall überprüft. Anschließend wird ermittelt,<br />
welche Werte statisch und welche beeinflussbar<br />
sind. Letzteren gilt die besondere Aufmerksamkeit, da<br />
sie die Stellschrauben für einen kostengünstigen An -<br />
lagenbetrieb sind. Denn das Hauptziel des Betreibers,<br />
Tabelle 1. Elemente der LCC-Analyse.<br />
Formelzeichen<br />
C ic<br />
C in<br />
C e<br />
C o<br />
C m<br />
C s<br />
C env<br />
C d<br />
Bezeichnung der Kostenelemente<br />
Anschaffungskosten<br />
Installationskosten<br />
Energiekosten<br />
Bedienungskosten<br />
Instandhaltungskosten<br />
Produktionsausfallkosten<br />
Umweltschutzkosten<br />
Außerbetriebnahmekosten<br />
eine optimale Wirtschaftlichkeit, kann durch eine energiesparende,<br />
zuverlässige und wartungsfreundliche<br />
Anlage erreicht werden.<br />
Einsparpotenziale bei Energie- und<br />
Instandhaltungskosten<br />
Doch bei der Neu- oder Ersatzbeschaffung einer Pumpe<br />
für die <strong>Abwasser</strong>entsorgung in Kommune oder Industrie<br />
wird als zentrales Entscheidungskriterium oftmals nur<br />
der Einkaufspreis bzw. die Höhe der Investition herangezogen.<br />
Je nach Anschaffungswert werden die laufenden<br />
Kosten dann oftmals auf eine Laufzeit von fünf Jahren<br />
für kleinere Pumpen bzw. zehn Jahren für größere<br />
Anschaffungen gerechnet. Dabei wird übersehen, dass<br />
die Investitionskosten nur zwischen 5 und 10 % der<br />
gesamten gemittelten Lebenszykluskosten einer Pumpe<br />
ausmachen. Geringer sind nur die Entsorgungskosten<br />
mit 3 %. Auf den Spitzenplätzen liegen die Energiekosten<br />
mit 52 % und die Instandhaltungskosten mit 35 %.<br />
Alle Werte beziehen sich auf kritische Ab wässer wie z. B.<br />
Rohabwässer und sind gemittelte Werte über sämtliche<br />
Laufradformen.<br />
Da Pumpen meist über viele Jahre tagtäglich ihren<br />
Dienst verrichten, bieten die Energie- und Instandhaltungskosten<br />
die größten Einsparpotenziale und sollen<br />
im Folgenden näher betrachtet werden. Bei der Auswahl<br />
des Aggregates auf Basis der Energiekosten sollte<br />
in erster Linie der Gesamtwirkungsgrad betrachtet werden,<br />
da nur dieser eine zuverlässige Aussage über den<br />
tatsächlichen Stromverbrauch gibt. Denn vielfach werden<br />
die Effekte hoher Motorwirkungsgrade durch niedrige<br />
Pumpenwirkungsgrade aufgezehrt, sodass daraus<br />
ggf. eine höhere Stromaufnahme resultiert.<br />
März 2012<br />
300 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Pumpentechnik<br />
praxis<br />
Mit moderner Pumpentechnik Lebenszykluskosten<br />
senken<br />
Die Position „Energiekosten“ lässt sich oftmals besonders<br />
deutlich reduzieren durch<br />
""<br />
moderne energiesparende Pumpentechnik,<br />
""<br />
die optimale Auslegung der Pumpe auf den<br />
Anlagenbetriebspunkt,<br />
""<br />
den Einsatz von Frequenzumformern (bei Vorliegen<br />
entsprechender Einsatzbedingungen),<br />
""<br />
die Bauform des Laufrads sowie<br />
""<br />
unter bestimmten Voraussetzungen durch die<br />
verwendeten Materialien und Beschichtungen.<br />
Erhebliche Einsparpotenziale bietet vor allem der Einsatz<br />
moderner Pumpentechnik. Hier verfügt der Dortmunder<br />
Pumpenspezialist WILO SE über ein breites Produktspektrum<br />
von Pumpen und Aggregaten für die<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung, die sich durch Langlebigkeit,<br />
Wartungsfreundlichkeit, hohe Wirkungsgrade und<br />
geringe Stromverbrauchswerte auszeichnen. Damit<br />
wird ein entscheidender Beitrag zur Senkung der<br />
Lebenszykluskosten geleistet.<br />
Einflussfaktor Fördermedium<br />
Während Einsparpotenziale bei den Energiekosten mit<br />
moderner Pumpentechnik vergleichsweise einfach<br />
erschlossen werden können, erfordert die Senkung der<br />
Instandhaltungskosten eine solide Planung. Damit diese<br />
dauerhaft niedrig gehalten werden können, ist eine<br />
möglichst exakte Abstimmung auf den jeweiligen<br />
Anwendungsfall unerlässlich. Da es keine Universal-Fördereinrichtung<br />
gibt, sollten bei der Auswahl der Pumpe<br />
und des zugehörigen Laufrads die aus dem Fördermedium<br />
resultierenden Einflussfaktoren einbezogen<br />
werden. So ist der Fasergehalt bei industriellen Schmutzwässern<br />
in der Regel eher klein und die Feststoffgröße<br />
gering. Demgegenüber ist im kommunalen <strong>Abwasser</strong><br />
von einem höheren Fasergehalt und großen Feststoffen<br />
auszugehen. In diesem Fall kann noch zwischen unterschiedlichen<br />
Einleitern, wie z. B. einem Einkaufszentrum<br />
oder Einfamilienhäusern, differenziert werden.<br />
Darüber hinaus hat das ressourcenschonendere Nutzerverhalten<br />
der Verbraucher und der Einsatz immer<br />
wassersparender Techniken in den vergangenen Jahren<br />
zu einer kontinuierlichen Reduzierung des durchschnittlichen<br />
<strong>Wasser</strong>verbrauchs pro Kopf geführt. Das<br />
hat allerdings eine höhere Feststoffkonzentration in den<br />
häuslichen Abwässern zur Folge. Diese lagern sich in der<br />
Druckrohrleitung ab und gelangen erst dann zur<br />
Pumpe, wenn beispielsweise bei Regen genügend Trägerflüssigkeit<br />
zur Verfügung steht. Dann werden sie<br />
durch einen konzentrierten Schwall komprimiert dem<br />
Pumpwerk zugeführt. Diese Spülung der Rohrleitung<br />
stellt für das Förderaggregat eine extreme Belastung<br />
dar, da der Pumpenhydraulik eine große Menge an Feststoffen<br />
zugeführt wird.<br />
Bei der Betrachtung der Lebenszykluskosten einer Pumpe fällt auf,<br />
dass die Energiekosten mit 52 % und die Instandhaltungskosten mit<br />
35 % die größten Posten darstellen. Der Anteil der Anschaffungskosten<br />
fällt demgegenüber mit maximal 10 % vergleichsweise<br />
gering aus.<br />
© Alle Abbildungen: WILO SE<br />
Hinsichtlich der Betriebs- und Wartungskosten stellen Pumpen<br />
in der <strong>Abwasser</strong>entsorgung von Industrie und Kommune einen<br />
der größten Kostenblöcke dar. Mit moderner Pumpentechnik<br />
und der richtigen Materialauswahl kann deren Effizienz und<br />
Betriebssicherheit erheblich gesteigert werden. Darüber hinaus<br />
sorgen Tauchmotorpumpen für zusätzliche Prozesssicherheit,<br />
da sie selbst bei einem <strong>Wasser</strong>eintritt in den Aufstellungsraum<br />
ihren Betrieb zuverlässig fortsetzen. Dies sollte bei der Pumpenauswahl<br />
angesichts der sich verändernden Wetterbe dingungen<br />
beachtet werden.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 301
praxis Pumpentechnik<br />
Aus dieser wechselnden Zusammensetzung und Konsistenz<br />
der Entsorgungsmedien ergeben sich darüber<br />
hinaus hohe Anforderungen an die im Pumpenbau verwendeten<br />
Materialien, da sie gegen Korrosion und Abrasion<br />
resistent sein müssen. Schließlich werden in kommunalen<br />
Anwendungen nicht nur fäkalienbelastete<br />
Medien mit leicht abrasiven Anteilen gepumpt, sondern<br />
auch Sand, Split und Steine aus Oberflächenabwasser.<br />
Diese stellen im Bereich der Hydraulik eine extreme<br />
Belastung der Pumpenkonstruktion und der verwendeten<br />
Materialien dar. In diesem Zusammenhang sind<br />
metallische Werkstoffe nicht immer die beste Wahl, da<br />
sich ihre Standzeit mit zunehmendem Feststoffgehalt<br />
verkürzt, dementsprechend erhöht sich dadurch der<br />
Instandsetzungsaufwand. Hier bieten sich entweder Bauteile<br />
aus Kunststoff oder entsprechende Beschichtungen<br />
an, mit denen metallische Werkstoffe wirkungsvoll vor<br />
Korrosion und Abrasion geschützt werden können.<br />
Verstopfungen der Pumpenhydraulik<br />
Auch zu geringe Drehzahlen der Pumpe können zu<br />
erhöhten Ausfallzeiten führen. Zwar bietet es sich bei<br />
wechselnden Lastfällen an, die Pumpen in Kombination<br />
mit einer Drehzahlregelung zu betreiben und sie per<br />
Sanftanlauf langsam bis auf die gewünschte Leistung<br />
„hochzufahren“. Dabei stehen die Energieeinsparung<br />
und ein möglichst gleichmäßiger Prozess im Vordergrund,<br />
da sich so die Energiekosten senken lassen. Allerdings<br />
ist der sichere Betrieb der Pumpe nicht immer<br />
gegeben, denn bei einer zu geringen Drehzahl bzw.<br />
Fließgeschwindigkeit steigt das Risiko einer Verstopfung.<br />
Die Folge ist der Stillstand der Pumpe mit entsprechenden<br />
Kosten für die Reinigung bzw. Instandsetzung.<br />
Deshalb ist der Drehzahlbereich der Pumpe entsprechend<br />
den Herstelleranweisungen auszuwählen, damit<br />
sie nie in einem kritischen Bereich gefahren wird.<br />
Als Maß für die Verstopfungsanfälligkeit gilt der freie<br />
Kugeldurchgang. Er ist jedoch nur ein Indiz, da die Strömungseigenschaften<br />
innerhalb der Hydraulik maßgeblichen<br />
Einfluss auf die Betriebssicherheit des Aggregats<br />
haben. Eine homogene Strömung sowie eine Pumpenhydraulik<br />
ohne Anlagerungsmöglichkeiten ist sicherer<br />
als eine Hydraulik, die große Feststoffpartikel in die<br />
Pumpe eindringen lässt, um diese dann druckseitig weiterzufördern.<br />
Demzufolge ist ein größerer Kugeldurchgang<br />
nicht unbedingt von Vorteil. Wichtig ist die richtige<br />
Auswahl der für das jeweilige Medium optimal<br />
geeigneten Hydraulikbauform. So ist ein Einkanallaufrad<br />
mit 80 mm Kugeldurchgang bei einem Medium mit<br />
langfaserigen Bestandteilen aufgrund der konstruktionsbedingten<br />
Strömungsführung die schlechtere Wahl<br />
im Vergleich zu einem Freistromlaufrad mit einem kleineren<br />
Kugeldurchgang.<br />
Bauformen der Laufräder<br />
Schmutz- und <strong>Abwasser</strong>pumpen von Wilo können vor<br />
diesem Hintergrund mit den unterschiedlichsten Laufradarten<br />
ausgestattet werden. Zur Verfügung stehen<br />
beispielsweise:<br />
""<br />
Freistromlaufräder (Vortex-Laufräder)<br />
""<br />
Einkanallaufräder<br />
""<br />
Mehrkanallaufräder<br />
""<br />
Axiallaufräder<br />
""<br />
SOLID-Laufräder (Safe Operation Logic Impeller<br />
Design)<br />
""<br />
sowie Zusatzeinrichtungen wie beispielsweise:<br />
""<br />
Schneidwerke<br />
""<br />
Rührköpfe<br />
Ein Allrounder in der <strong>Abwasser</strong>behandlung sind die<br />
modular aufgebauten <strong>Abwasser</strong>tauchmotorpumpen<br />
der Serie „Wilo EMU FA“, die für die Nass- und<br />
Trockenaufstellung geeignet sind. Die leistungsfähigen<br />
Pumpen bieten eine maximale Förderhöhe von<br />
rund 100 Metern oder einen Förderstrom von bis zu<br />
2400 Litern in der Sekunde. Durch ein breites Motoren-<br />
und Laufradspektrum lassen sie sich auf verschiedenste<br />
Anlagen und Fördermedien abstimmen.<br />
Jedes dieser Laufräder hat spezifische Vorteile, kann aber<br />
auch unter bestimmten Bedingungen Nachteile aufweisen.<br />
Deshalb sollten die Laufräder exakt auf das jeweilige<br />
Einsatzgebiet und das zu fördernde Medium abgestimmt<br />
werden, da nur so niedrige Energiekosten bei gleichzeitig<br />
großer Prozesssicherheit erzielt werden können.<br />
Bei problematischen Fördermedien bieten sich Freistromräder<br />
(Vortex-Laufräder) oder SOLID Laufräder an.<br />
Im Vergleich zu Einkanallaufrädern bieten Freistromräder<br />
eine hohe Ausfallsicherheit, da sie nicht zu Ver-<br />
März 2012<br />
302 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Pumpentechnik<br />
praxis<br />
stopfung neigen, d. h. Motorblockaden verhindert werden.<br />
Allerdings haben Freistromräder einen relativ<br />
geringen hydraulischen Wirkungsgrad, der je nach<br />
Nennweite bis zu 60 % im Bestpunkt beträgt und verursachen<br />
dadurch höhere Energiekosten. Demgegenüber<br />
bieten geschlossene Kanalräder einen deutlich höheren<br />
Wirkungsgrad von bis zu rund 85 %, abhängig von<br />
Nennweite und Kugeldurchgang. Eine auf eine Betriebszeit<br />
von fünf Jahren ausgelegte Vergleichsrechnung<br />
(Tabelle 2) belegt allerdings, dass dieser Faktor hier<br />
nicht ausschlaggebend ist. Stattdessen verursacht der<br />
Ein- und Ausbau der Pumpe aufgrund einer Verstopfung<br />
der Hydraulik des Einkanalrades Stillstand- und<br />
Servicekosten, die im Vergleich zu den Energiekosten<br />
der Vortex-Laufräder deutlich höher liegen.<br />
Neue Laufradgeneration<br />
Aufgrund dieser Kostendifferenz waren Freistromlaufräder<br />
bisher die gängige Lösung für Abwässer mit einer<br />
hohen Konzentration von langfaserigen oder größeren<br />
Feststoffen. Die Vorteile des hohen Wirkungsgrades von<br />
Ein- und Mehrkanalrädern und der Zuverlässigkeit von<br />
Vortex-Laufrädern vereint das von der Firma neu entwickelte<br />
Laufrad vom Typ SOLID in sich. Es bietet einen<br />
hydraulischen Wirkungsgrad von bis zu 81 % und kann<br />
auch stark feststoffhaltige Abwässer problemlos befördern.<br />
Der Wirkungsgrad beeinflusst auch die Anschaffungskosten,<br />
denn weniger effiziente Laufräder benötigen<br />
für die gleiche hydraulische Leistung einen größeren<br />
Antrieb. Der Anteil der Motoren am Anschaffungspreis<br />
der Pumpe kann je nach Größe bis zu 75 %<br />
betragen. Somit können diese Kosten durch die Laufradauswahl<br />
maßgeblich beeinflusst werden.<br />
Ein Vergleich (Tabelle 2) zwischen Einkanal-, Vortexund<br />
SOLID-Laufrädern zeigt, dass letztgenannte das<br />
beste Ergebnis hinsichtlich Instandhaltungs- und Energiekosten<br />
und somit bei den Gesamtkosten erzielen.<br />
Einkanallaufräder bieten einen<br />
relativ hohen Wirkungsgrad und<br />
einen großen freien Kugeldurch -<br />
gang, neigen aber bei langfaserigen<br />
Bestandteilen im <strong>Abwasser</strong><br />
zu Verstopfungen.<br />
Tabelle 2.<br />
Bei Freistrom- bzw. Vortex-Laufrädern<br />
ist der Wirkungsgrad<br />
geringer. Dafür zeichnen sie sich<br />
durch eine vergleichsweise hohe<br />
Betriebssicherheit aus.<br />
Ausfallursachen von <strong>Abwasser</strong>pumpen<br />
Der Ausfall einer <strong>Abwasser</strong>pumpe verursacht Stillstands-<br />
und Instandsetzungskosten. Deshalb ist es sinnvoll,<br />
bereits in der Planungsphase mögliche Ausfallursachen<br />
zu identifizieren und das daraus resultierende<br />
Risiko durch eine geeignete Pumpen- und Materialauswahl<br />
zu minimieren.<br />
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Pumpenausfälle<br />
in einem frühen Stadium nach der Inbetriebnahme<br />
stattfinden. Die Gründe sind:<br />
""<br />
Falsche Auslegung der Pumpe,<br />
""<br />
unzureichende Angaben zur Spezifikation des<br />
Mediums oder<br />
""<br />
Fehler bei der Inbetriebnahme.<br />
Diese können durch eine exakte Planung vermieden<br />
werden, bei der alle relevanten Daten zusammengetra-<br />
Das Laufrad vom Typ „SOLID“ wurde von Wilo speziell<br />
für <strong>Abwasser</strong>pumpen entwickelt. Es verbindet<br />
aufgrund seiner optimierten Laufradgeometrie hohe<br />
Unempfindlichkeit gegen Verstopfungen mit einem<br />
hohen Wirkungsgrad von bis zu 81 %. Damit lassen<br />
sich Volumenströme bis zu 600 l/s und Förderhöhen<br />
bis zu 60 m H max realisieren.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 303
praxis Pumpentechnik<br />
Die Motoren der Baureihe „FKT 27“ bieten bei den<br />
Tauchmotorpumpen der Baureihe „Wilo EMU FA“<br />
besonders hohe Effizienz, Prozesssicherheit und Servicefreundlichkeit<br />
sowie eine lange Lebensdauer.<br />
Das Zwei-Kammer-Dichtsystem mit räumlich<br />
getrennter Dicht- und Leckagekammer sowie<br />
integrierten Überwachungseinrichtungen bietet<br />
einen größtmöglichen Schutz für den Motor<br />
und den gesamten Prozess.<br />
gen werden, damit die Pumpe genau an den<br />
Anwendungsfall angepasst werden kann. Ist<br />
diese erste Phase überstanden, verrichten die<br />
Pumpen zuverlässig ihren Dienst, bis – oft erst<br />
nach vielen Betriebsjahren – die Alterung<br />
der Komponenten, Verschleiß, Korrosion<br />
oder Abrasion zu ihrem Ausfall führen<br />
können.<br />
Weitere häufige Gründe für Stillstandzeiten<br />
von <strong>Abwasser</strong>pumpen, die<br />
über den gesamten Lebenszyklus auftreten<br />
können, sind:<br />
""<br />
Verstopfungen und Blockaden der Pumpe,<br />
""<br />
durch Korrosion oder Abrasion verursachter<br />
Verschleiß und<br />
""<br />
defekte Wellenabdichtungen.<br />
Vermeidung von Pumpenstillstand<br />
Verstopfungen und Blockaden entstehen vor allem<br />
durch langfaserige oder großflächige steife Bestandteile<br />
im Medium. Diese können sich entweder zu langen<br />
Verzopfungen entwickeln oder an Laufradaustrittskanten<br />
sowie Spalten zwischen Laufrad und Pumpengehäuse<br />
zu Blockaden führen. Mit einer geeigneten<br />
Laufradform kann dieses Risiko minimiert werden.<br />
Schäden durch Abrasion und Korrosion können<br />
schon im Vorfeld durch eine gezielte und fundierte Produktauswahl<br />
begrenzt werden. Dazu müssen allerdings<br />
detaillierte Angaben zur Zusammensetzung des Fördermediums<br />
vorliegen. Damit kann aus dem breiten Spektrum<br />
der technischen Möglichkeiten das richtige Material<br />
oder die richtige Beschichtung ausgewählt werden,<br />
mit denen sich die Standzeit des Bauteils erheblich verlängern<br />
lässt.<br />
Defekte an der Wellenabdichtung können durch die<br />
richtige Wahl der Abdichtungskonstruktion bzw. der<br />
Materialpaarung vermieden werden. Meist sind zwei<br />
unabhängig wirkende Gleitringdichtungen in einer<br />
Ölsperrkammer ausreichend, wobei zumindest die<br />
medienseitige als Hart/Hart-Paarung (z. B. SiC/SiC) ausgeführt<br />
sein sollte. Dennoch können erhöhte Schwingungen<br />
der Pumpe oder das Auskristallisieren des<br />
Mediums auf den Gleitflächen zu Defekten dieser<br />
Abdichtung führen. Für diesen Fall gibt es Sonderbauformen,<br />
die eine Ablagerung der Kristalle auf den Gleitflächen<br />
vermeiden bzw. diese beim Betrieb schnellstmöglich<br />
von den Flächen entfernen.<br />
In diesem Zusammenhang kann auch mit modernen<br />
Pumpenmotoren die Prozess- und Betriebssicherheit<br />
deutlich gesteigert werden. So verfügt beispielsweise<br />
der Motor „FKT 27“, mit dem die „Wilo EMU FA“-<strong>Abwasser</strong>tauchmotorpumpen<br />
ausgestattet werden, über ein<br />
geschlossenes Kühlsystem, ein Zwei-Kammer-Dichtsystem<br />
mit räumlich getrennter Dicht- und Leckagekammer<br />
sowie integrierten Überwachungseinrichtungen.<br />
Daraus ergibt sich ein größtmöglicher Schutz für den<br />
Motor und den gesamten Prozess. Wenn das Fördermedium<br />
über die erste Gleitringdichtung in die Dichtkammer<br />
eindringt, verdrängt es das medizinische Weißöl.<br />
Erreicht die eindringende <strong>Wasser</strong>menge ein definiertes<br />
Maß, wird durch eine optionale externe Stabelektrode<br />
eine Warnmeldung ausgegeben oder – je nach Einstellung<br />
der Pumpensteuerung – der Motor abgeschaltet.<br />
Eine eventuelle Leckage über die zweite Gleitringdichtung<br />
wird von der Leckagekammer aufgenommen. Sie<br />
wird von einem Schwimmerschalter überwacht, der den<br />
Motor vor dem Erreichen eines kritischen Flüssigkeitspegels<br />
abschaltet. Dies sorgt für höchste Prozesssicherheit.<br />
Fazit<br />
Es gibt viele Stellschrauben, mit denen die Betriebskosten<br />
des Förderaggregats und vor allem die Stillstandsund<br />
Instandhaltungskosten von Pumpen in der <strong>Abwasser</strong>entsorgung<br />
nachhaltig gesenkt werden können.<br />
Dazu zählt zunächst natürlich eine solide Planung im<br />
Vorfeld, die auch alle Rahmenbedingungen wie beispielsweise<br />
die Zusammensetzung des Fördermediums<br />
sowie die Gestaltung des Bauwerks berücksichtigt.<br />
Durch ein entsprechend ausgewähltes Laufrad kann das<br />
Risiko einer Verstopfung und der daraus resultierenden<br />
Blockade der Pumpe minimiert, aber auch der Wirkungsgrad<br />
der Pumpe optimiert werden.<br />
Wie sich unterschiedliche Materialien im Pumpenbau<br />
auf die Betriebskosten auswirken, behandelt der zweite<br />
Teil dieses Beitrags in Heft 4/2012.<br />
Weitere Informationen<br />
WILO SE |<br />
Nortkirchenstraße 100 |<br />
D-44263 Dortmund |<br />
Tel. (0231) 41 02-0 |<br />
Fax (0231) 41 02-7575 |<br />
E-Mail: wilo@wilo.com |<br />
www.wilo.de<br />
März 2012<br />
304 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Buchbesprechungen<br />
Buchbesprechungen<br />
Praxis des technischen Rechts für<br />
Fach- und Führungskräfte<br />
Herausgegeben wird das Fachbuch vom DVGW<br />
Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V. –<br />
Technisch wissenschaftlicher Verein. Der Verein hat<br />
das Ziel, die Grundlage für eine zuverlässige,<br />
technisch einwandfreie und sichere Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
zu liefern. Er ist unabhängig und<br />
neutral. Der DVGW sieht seine Aufgaben in der<br />
Förderung des aktiven Gedanken- und Informationsaustauschs<br />
und in praxisrelevanten Hilfestellungen,<br />
die die Weiterentwicklung im Fach<br />
motivieren und fördern.<br />
Technik und Recht unterliegen heute einem<br />
schnellen Wandel. Kenntnisse des DVGW-Regelwerks<br />
und des relevanten europäischen und nationalen<br />
Rechts im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach sind unentbehrlich.<br />
Ziel des Buches ist es, die für das Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>fach relevanten europäischen und nationalen<br />
Rechtsthemen praxisgerecht und verständlich<br />
darzustellen. Der Aufbau ist so gewählt, dass jeder<br />
Nutzer die für ihn wesentlichen Teile schnell identifizieren<br />
kann. Kurzübersichten zu den einzelnen<br />
Rechtsakten erleichtern den Einstieg.<br />
Die Neuerscheinung ist für jede Führungs- und<br />
Fachkraft im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach gedacht, die sich<br />
über grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen<br />
informieren will. Die Hälfte dieses Buches ist dem<br />
Rechtsrahmen der Europäischen Union gewidmet.<br />
Das in Deutschland bestehende Recht für das Gasund<br />
<strong>Wasser</strong>fach ist zu einem ganz wesentlichen Teil<br />
durch Vorgaben der Europäischen Union geprägt.<br />
Das Buch befasst sich insbesondere mit den<br />
aktuellen Grundlagendokumenten zur Europäischen<br />
Energie- und <strong>Wasser</strong>politik, den relevanten<br />
europäischen Richtlinien und Verordnungen, der<br />
haftungsbefreienden Wirkung des DVGW-Regelwerks<br />
und den relevanten nationalen Gesetzen und<br />
Verordnungen.<br />
Bestell-Hotline<br />
wvgw Wirtschafts- und<br />
Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3,<br />
D-53123 Bonn, Tel. (0228) 9191-40,<br />
E-Mail: info@wvgw.de,<br />
www.wvgw.de<br />
Trinkwasserbehälter Band IV<br />
<strong>gwf</strong>-Reihe Praxiswissen<br />
Herausgeber: Christine Ziegler. München: Oldenbourg<br />
Industrieverlag 2012. 1. Auflage. 224 S.,<br />
Broschur, mit DVD (Bonusmaterial), Preis: € 54,90,<br />
ISBN 978-3-835-63266-0, Bestellnummer: 66008425.<br />
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel des<br />
Menschen. Zentrale Aufgabe der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
ist es, eine sichere Versorgung der Bevölkerung mit<br />
Trinkwasser durch tadellose Handhabung und Aufbewahrung<br />
zu gewährleisten. Behälter zur Speicherung<br />
von Trinkwasser müssen deshalb in technisch<br />
und hygienisch einwandfreiem Zustand sein.<br />
Band IV der <strong>gwf</strong>-Reihe Praxiswissen behandelt<br />
grundlegende Fakten zu Planung, Ausführung,<br />
Instandhaltung, Reinigung und Sanierung von<br />
Trinkwasserbehältern – lebendig veranschaulicht<br />
durch zahlreiche spannende Beispiele aus der<br />
Praxis. Ausführlich wird zudem die Geschichte<br />
der Trinkwasserspeicherung dargestellt, mit zahlreichen<br />
Bildern der schönsten Anlagen von der<br />
Antike bis zur Gegenwart.<br />
Auf der beiliegenden DVD befindet sich umfangreiches<br />
Bonusmaterial. Der Titel ist außerdem mit<br />
einer DVD erhältlich, auf der der Titel als komplett<br />
recherchierbares eBook (pdf) enthalten ist.<br />
Bestell-Hotline<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
München<br />
Tel. +49 (0) 201/82002-11<br />
Fax +49 (0) 201/82002-34<br />
E-Mail: S.Spies@vulkan-verlag.de<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 305
Praxis<br />
Preis für innovativ durchgeführte Baumaßnahme<br />
in grabenloser Bauweise<br />
Die Rohwasserleitung DN 700 der Galerie Schildhorn/Rupenhorn, <strong>Wasser</strong>werk Berlin-Tiefwerder, wurde im<br />
Horizontal-Spülbohrverfahren auf einer Länge von 500 m erneuert. Die Arbeiten im Trinkwasserschutzgebiet<br />
und unter den extremen Hochwasserbedingungen an der Havel stellten eine besondere Herausforderung für<br />
die Bauausführung dar.<br />
Die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
(BWB) erneuern auf insgesamt<br />
4 km Länge die Anbindung der Rohwasserleitungen<br />
an das <strong>Wasser</strong>werk<br />
Berlin-Tiefwerder. Den Auftrag zur<br />
Ausführung des 2. Bauabschnittes –<br />
die Neuverlegung von 500 m Rohwasserleitung<br />
aus duktilen Gussrohren<br />
DN 700 mit ZM-Umhüllung und<br />
Hochwassersituation am Havelufer im Bereich der<br />
Ziel-/Rohrmontagegrube.<br />
Preisverleihung 3. Platz GSTT-Award 2011.<br />
HDD Rig American Augers mit Pilotbohrkopf.<br />
längskraftschlüssiger Verbindung<br />
im Horizontal-Spülbohrverfahren<br />
(HDD Horizontal Directional Drilling)<br />
– erhielt die Arbeitsge meinschaft<br />
(ARGE)„WW Tiefwerder/Rupenhorn“,<br />
bestehend aus dem renommierten<br />
Berliner Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen<br />
Stehmeyer & Bischoff<br />
und die auf grabenlose Bauweise<br />
spezialisierte BLK – Bohrteam GmbH<br />
aus Görschen (Sachsen-Anhalt).<br />
Für die innovative Realisierung<br />
der Baumaßnahme in grabenloser<br />
Bauweise durch das HDD-Verfahren<br />
wurden die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
und die ausführende ARGE mit dem<br />
3. Platz des GSTT (German Society<br />
for Trenchless Technology e. V.)<br />
Awards prämiert, dem ersten Award<br />
der GSTT für eine Horizontalspülbohrmaßnahme<br />
überhaupt.<br />
Die Leitungstrasse verläuft in Berlin-Spandau,<br />
parallel zur Havelchaussee<br />
auf 530 m Länge direkt zur Galerie<br />
Rupenhorn am Ufer der Havel, in<br />
einer Raumkurve als Geländedüker<br />
mit einer maxi malen Überdeckungshöhe<br />
von 17 m unter Geländeoberkante.<br />
Der gesamte Trassenbereich<br />
befindet sich in den Trinkwasserschutzzonen<br />
I-III. Dies stellte für alle<br />
an der Realisierung der Maßnahme<br />
Beteiligten besondere Anforderungen<br />
an den Schutz der Umwelt und<br />
die Trinkwassergewinnung dar. Die<br />
notwendigen Eingriffe in das besonders<br />
schützenswerte Naturgebiet<br />
mussten demzufolge auf ein Minimum<br />
reduziert werden.<br />
Der zu bearbeitende Baugrund<br />
setzt sich, wie für dieses Gebiet<br />
typisch, unterhalb des Oberbodens<br />
vorwiegend aus Schmelzwassersanden<br />
zusammen. Diese bestehen aus<br />
Fein- und Mittelsanden mit unterschiedlichen<br />
Grobsand-, Kies- und<br />
Schluffanteilen und gehen bereichsweise<br />
in Grobsande über.<br />
Der ARGE gelang es, für diese<br />
Verhältnisse eine optimale Spülungsrezeptur<br />
zu erstellen. Der<br />
Maßgabe der Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
zur Durchführung einer ressourcenschonenden<br />
Bauweise folgend,<br />
konnte ein Großteil der Bohrspülung<br />
recycelt werden. Hierzu<br />
wurde eigens eine 600 m lange<br />
Rückflussleitung vom Zielbereich<br />
zum Startgrubenbereich installiert.<br />
Nach dem Herstellen der Startund<br />
Zielgruben mit Trägerbohlverbau<br />
konnte am 11.11.2010 mit der<br />
Pilotbohrung begonnen werden.<br />
Zur Herstellung der Bohrung<br />
kam der HDD Rig American Augers<br />
DD210 mit einer maximalen Schub-/<br />
Zugkraft von 100 to zum Einsatz. Die<br />
Einzelgestängelänge betrug 9,00 m.<br />
Der Bohrfortschritt belief sich<br />
auf etwa 160 m pro Arbeitstag. Der<br />
Spülungsverbrauch lag bei 3150<br />
Liter pro Bohrmeter. Zur Ortung des<br />
Bohrkopfes kam eine Kombination<br />
aus Steering Tool und Walk-Over-<br />
Verfahren zur Anwendung.<br />
Nach vier Arbeitstagen konnte<br />
die Pilotbohrung erfolgreich, zielgenau<br />
in die Zielbaugrube eingebohrt<br />
werden. Im Anschluss erfolgte die 1.<br />
von insgesamt 3 Aufweitstufen in<br />
der Staffelung 500 mm, 800 mm<br />
und 1200 mm. Nach gelungenem<br />
Abschluss der 1. Aufweitung kam es<br />
durch den frühen und heftigen Wintereinbruch<br />
im Dezember 2010 zur<br />
Unterbrechung der Bohrarbeiten.<br />
Die Projektbeteiligten, die Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe und die ARGE WW<br />
Tiefwerder/Rupenhorn, entschieden<br />
nach konstruktiven, gemeinsamen<br />
Beratungen die Einhausung und<br />
Beheizung des kompletten Startbe-<br />
März 2012<br />
306 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
reiches mit der gesamten Bohranlage,<br />
bestehend aus HDD-Rig, Mischanlage,<br />
Recyclinganlage und Steuerungseinheit.<br />
An der Havel, dem<br />
Zielbereich, wurde ebenfalls ein<br />
beheizbares Winterbauzelt errichtet.<br />
Die Bohrspülungsrückflussleitung<br />
wurde gedämmt und mit einer<br />
Begleitheizung ausgerüstet.<br />
Durch diese Maßnahmen gelang<br />
es der ARGE trotz extremer Witterungsbedingungen<br />
im Januar 2011,<br />
die 2. und 3. Aufweitbohrung mit<br />
Durchmessern von 800 mm bzw.<br />
1200 mm erfolgreich zu realisieren.<br />
Durch die anschließende Ausführung<br />
eines „Cleaning Ganges“ (um<br />
das sedimentierte Bohrklein aus dem<br />
Bohrkanal zu drücken) und der Realisierung<br />
eines „Check Trips“ (mittels<br />
einem Kurzrohr mit dem Durchmesser<br />
des später zum Einzug kommenden<br />
Medienrohrs) wurde der Bohrkanal<br />
seitens der Bohrmannschaft<br />
gesäubert und optimal für den<br />
Rohreinzug vorbereitet, um ein Festsetzen<br />
des DN 700 Gussrohres beim<br />
späteren Rohreinzug zu vermeiden.<br />
Für die Einzelrohrmontage, die<br />
aufgrund der speziellen topografischen<br />
Gegebenheiten infolge des<br />
Hochwassers der Havel und den<br />
minimal zu haltenden Eingriffen in<br />
die Trinkwasserschutzzone nur als<br />
Montage just in time mit dem<br />
Rohreinzug erfolgen konnte, wurde<br />
durch die BLK – Bohrteam GmbH<br />
eine Rohrmontage-Ablaufbahn konstruiert<br />
und in der betriebseigenen<br />
Werkstatt angefertigt. Die effi ziente<br />
Nutzung der Montagebahn durch<br />
die erfahrenen Rohrleitungsmonteure<br />
des Arge-Partners Stehmeyer<br />
& Bischoff in Zusammenarbeit mit<br />
dem technischen Support des Rohrlieferanten,<br />
Duktus Rohrsystem<br />
Wetzlar, äußerst kurze Montagezeiten<br />
für die einzelnen BLS-Verbindungen,<br />
bestehend aus formkraftschlüssiger<br />
Rohrverbindung mit Verriegelung<br />
und dem Muffenschutz aus<br />
Schrumpfmanschette und Blechkonus,<br />
der ZMU-Gussrohre DN 700.<br />
Am 09.02.2011 konnte mit dem<br />
Rohreinzug begonnen werden. Die<br />
maximal auftretenden Zugkräfte<br />
beim Einzugsvorgang lagen weit<br />
unter der technisch vorgehaltenen<br />
Zugkraft von 100 to.<br />
Die verhältnismäßig gering auftretenden<br />
Zugkräfte konnten nur<br />
aus der Kombination verschiedener<br />
Maßnahmen erreicht werden. Zum<br />
einen wurde durch eine ausgeklügelte<br />
Ballastierung der Medienrohre<br />
mittels <strong>Wasser</strong>befüllung ein Schwebezustand<br />
im Bohrkanal erreicht,<br />
der es ermöglichte, die Gussrohre<br />
ohne Kontaktreibung mit der Bohrlochwandung<br />
einzuziehen. Zum<br />
anderen konnten durch die im Einzelnen<br />
speziell an die vorhandene<br />
Bohrlochtopografie, an das Rohrmaterial<br />
und an den Baugrund<br />
angepasste Bohrspülungsrezeptur<br />
die Einzugskräfte reduziert werden.<br />
Letztendlich erzielte man durch die<br />
bereits erwähnten und durchgeführten<br />
„Cleaning Gänge“ und<br />
„Check Trips“ eine saubere und<br />
glatte Bohrlochinnenwandung.<br />
Aufgrund der guten Zusammenarbeit<br />
zwischen den Berliner <strong>Wasser</strong>betrieben<br />
(Projektleiter Herr von<br />
Trotha) als Bauherrn und der Arge<br />
„WW Tiefwerder/Rupenhorn“ (Stehmeyer<br />
& Bischoff und BLK – Bohrteam<br />
GmbH) als ausführendem<br />
Unternehmen sowie der Firma Duktus<br />
als Rohrlieferanten konnte nach<br />
knapp 34 Stunden durchgängiger<br />
Rohrmontage und Einzug dieses<br />
anspruchsvolle Spülbohrprojekt<br />
erfolgreich vollzogen werden.<br />
Der eingezogene Rohrstrang<br />
und die in offener Bauweise verlegten<br />
Anschlussleitungen wurden<br />
gemäß den Forderungen der BWB<br />
einer Druckprobe mit 15 bar unterzogen.<br />
Das gesamte System wurde<br />
dann zur abschließenden Kontrolle<br />
mit einer Kamera befahren.<br />
Zu Dokumentationszwecken<br />
und zum Nachweis des Einzugs in<br />
der geplanten Trassenlage wurde<br />
der Rohrstrang mittels Durchfahren<br />
eines Messgerätes horizontal und<br />
vertikal genau aufgemessen.<br />
An die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
wurde nach Abschluss der gesamten<br />
Arbeiten ein qualitativ einwandfreies<br />
Leitungssystem übergeben.<br />
Bohrgestänge im stabilen Bohrkanal.<br />
Einzelrohrmontage auf Ablaufbahn.<br />
Rohreinzug GGG DN 700 ZMU.<br />
Autoren:<br />
Dipl.-Ing. (FH) Florian Allmich<br />
Dipl.-Ing. Dirk Richter<br />
Kontakt:<br />
Stehmeyer + Bischoff GmbH & Co. KG,<br />
Scharnweberstraße 24,<br />
D- 13405 Berlin,<br />
Tel. (030) 417885-0,<br />
Fax (030) 417885-12,<br />
E-Mail: berlin@stehmeyer.de,<br />
www.stehmeyer.de<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 307
Praxis<br />
Sanierung eines Betonkanals mit GFK-Sonderprofilen<br />
Insituform GmbH verbaut in Basel HOBAS NC Line Profile<br />
für eiförmigen Entlastungskanal<br />
Nach 70 Betriebsjahren war der rund 1 km lange Entlastungskanal aus Beton in Basel-Stadt am Ende seiner<br />
Lebenszeit angelangt. Der Kanal mit dem Verlauf Leimgrubenweg-Walkeweg konnte durch punktuelle Reparaturen<br />
nicht mehr erhalten werden. Das Tiefbauamt des Kantons Basel-Stadt/Stadtentwässerung gab daher umfangreiche<br />
Analysen möglicher Sanierungsvarianten in Auftrag. Als beste Lösung mit zuverlässigem Betrieb und<br />
einer Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ging daraus das GFK-Einzelrohr-Lining hervor. Im Zuge des<br />
Ver gabeverfahrens stimmte das Tiefbauamt Basel-Stadt dem Vorschlag, Profile von HOBAS zu nutzen, zu.<br />
Herablassen der NC Line Profile in den vorbereiteten<br />
Einbauschacht.<br />
Der eiförmige Betonkanal<br />
(1420/1970 und 1500/2050<br />
mm) mit Trockenwetterrinne und<br />
seitlicher Berme wurde zwischen<br />
1936 und 1938 gebaut. Die Inspektionen<br />
der Amberg Engineering AG<br />
im Dezember 2009 zeigten, dass in<br />
den frühen 80er Jahren bereits<br />
Reparaturen durchgeführt worden<br />
waren. Dennoch wurden zahlreiche<br />
undichte Stellen entlang des Kanalverlaufs<br />
entdeckt und das zirkulierende<br />
<strong>Wasser</strong> würde die Betonstruktur<br />
in Zukunft weiter schwächen. Da<br />
der poröse <strong>Abwasser</strong>kanal vollständig<br />
unter Grundwasserniveau verläuft,<br />
würden sich die Schäden auch<br />
auf die bisher intakten Stellen ausweiten.<br />
In einigen Abschnitten war<br />
die Leitung nur noch dank Mörtelüberzug<br />
bzw. Spachtelung dicht,<br />
der Betonkörper wies teilweise<br />
große Poren auf. Ein Ende der<br />
Lebensdauer des Kanals war somit<br />
erreicht.<br />
Verschiedenste Verfahren wurden<br />
im Variantenvergleich untersucht.<br />
Der Vortrieb einer neuen<br />
Leitung schied insbesondere aus<br />
Kostengründen aus. Auch ein<br />
Schlauchlining musste in diesem<br />
speziellen Fall aus technischen<br />
Gründen sowie aufgrund der Profilform<br />
verworfen werden. Die drei<br />
besten verbleibenden Varianten<br />
waren: Reprofilierung im Spritzverfahren,<br />
Relining mit GFK-Profilen<br />
und die Instandsetzung mit einer<br />
Innenschale aus selbstverdichtendem<br />
Beton (SCC). Folgende Kriterien<br />
wurden in die Kosten-Nutzen-<br />
Analyse der Optionen miteinbezogen:<br />
Kosten, Gebrauchstauglichkeit/<br />
Tragsicherheit, Hydraulik/Kapazität,<br />
provisorische <strong>Wasser</strong>haltung, Maßnahmen<br />
bezüglich Verlegung und<br />
Verkehr, Wartungsaufwand und<br />
Bauzeiten. Diese Kriterien wurden<br />
gewichtet und dann die Jahreskosten<br />
ermittelt, da jede Alternative<br />
eine individuelle Lebensdauer hat.<br />
Obwohl der Kostenunterschied der<br />
drei Varianten gering war, sprach<br />
die Gesamtbeurteilung aus technischer<br />
und wirtschaftlicher Sicht klar<br />
für GFK-Lining mit dem HOBAS NC<br />
Line System.<br />
Gebrauchstauglichkeit und<br />
Tragsicherheit<br />
Ein großer Vorteil der HOBAS GFK<br />
NC Line Produkte ist ihre hohe Stabilität<br />
und Festigkeit bei relativ<br />
geringen Wanddicken. Obwohl die<br />
bestehenden Strukturen noch<br />
genug Tragfähigkeit aufwiesen,<br />
wurden die NC Line Profile selbsttragend<br />
mit einer Wanddicke von<br />
24 mm konstruiert, um eine langfristige<br />
Sicherheit zu gewährleisten.<br />
GFK-Lining war gesucht und gefunden:<br />
die optimale der drei Sanierungsvarianten,<br />
die die alten Strukturen<br />
in Zukunft stützen kann,<br />
wenn sich ihr Zustand weiter verschlechtert.<br />
Die Gebrauchstauglichkeit<br />
und die Tragsicherheit sind<br />
gesichert und es kann eine Betriebszeit<br />
von mindestens 50 Jahren<br />
erwartet werden.<br />
Hydraulik und Kapazität<br />
Eine Reduktion des Innendurchmessers<br />
musste bei allen drei Sanierungsmethoden<br />
in Kauf genommen<br />
werden. Der sehr kleine Rauheitskoeffizient<br />
der Innenschicht und<br />
die relativ geringen Wanddicken der<br />
HOBAS Profile sorgten jedoch für<br />
die größte <strong>Abwasser</strong>kapazität – verglichen<br />
mit den anderen Optionen.<br />
Die vorgefertigten 1300 x 1870 mm<br />
großen NC Profile wurden an die<br />
Form des bestehenden Kanals mittels<br />
Laser-Scan angepasst und verfügen<br />
über eine Trockenwetterrinne<br />
und seitlicher Berme mit Sicherheitsprofil<br />
für Inspektionen.<br />
Provisorische <strong>Wasser</strong>haltung,<br />
Verlegung und<br />
Umwelt<br />
Drei Zugangsschächte wurden vorbereitet,<br />
um die NC Profile in den<br />
Altkanal einzubringen. Die Elemente<br />
wurden in den Längen 0,5, 1<br />
und 2 m geliefert und konnten so<br />
optimal den bestehenden Verlauf<br />
nachbilden und die Verlegung er -<br />
leichtern. Vor allem das einfache<br />
Handling der Profile war angesichts<br />
März 2012<br />
308 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
Blick in den<br />
sanierten Kanal: für<br />
mindestens die nächsten<br />
50 Jahre wird er voll<br />
funktionsfähig sein. <br />
Arbeiten in 18 m<br />
Tiefe: Die Profile werden<br />
zu ihrem Einbauort<br />
transportiert.<br />
Das führende Fachorgan<br />
für <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Informieren Sie sich regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und <strong>Wasser</strong>fach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
der beschränkten Zugänglichkeit des Altkanals in 15 bis<br />
18 m Tiefe wichtig. Just-in-Time-Lieferungen und eine<br />
professionelle Installation hielten eventuelle Störungen<br />
von Umwelt, Verkehr und Anrainern so gering wie möglich.<br />
Obwohl die Altleitung zur Verlegung der NC Profile<br />
trockengelegt und Zugangsschächte vorbereitet werden<br />
mussten, konnte Insituform hohe Ver legeleistungen<br />
realisieren.<br />
Wartungskosten<br />
Dank der langen Lebensdauer der Produkte von mindestens<br />
50 Jahren und dem minimalen Reinigungsaufwand<br />
aufgrund der glatten Innenfläche der HOBAS NC Profile<br />
werden die Wartungskosten gegenüber dem Zustand<br />
vor der Sanierung um ein Vielfaches geringer sein.<br />
Kontakt:<br />
HOBAS Rohre GmbH, Wilfried Sieweke,<br />
Gewerbepark 1/Hellfeld, D-17034 Neubrandenburg,<br />
Tel. (0395) 4528-0, Fax (0395) 4528-100,<br />
E-Mail: wilfried.sieweke@hobas.com, www.hobas.de<br />
GSTT prämiert<br />
Vom 07. bis 08. Dezember 2011 fanden die 10.<br />
DWA Sanierungstage in Dortmund statt. Anlässlich<br />
dieser Veranstaltung wurde der „GSTT<br />
Award“ verliehen. Die GSTT (Deutsche Gesellschaft<br />
für grabenloses Bauen und Instandhalten<br />
von Leitungen e. V.) würdigte zum zweiten Mal<br />
besondere, herausragende Projekte der grabenlosen<br />
Bauweise. Für das Bauvorhaben „Sanierung<br />
Kanalisation Leimgruben-Walkeweg Basel“ wurde<br />
dem Tiefbauamt Basel-Stadt der Sonderpreis<br />
„Auslandsprojekt“ verliehen – ein krönender<br />
Abschluss für eine erfolgreiche Sanierung.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet-PC oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München
Produkte und Verfahren<br />
Innovative, dreifach exzentrische Klappe für<br />
Anwendungen mit großen Nennweiten: RMI Dubex<br />
DN 3000<br />
Klappe.<br />
DN 1800<br />
Klappe mit<br />
Epoxidharzbeschichtung.<br />
Für <strong>Wasser</strong>anwendungen im<br />
Energiesektor, in der Prozessindustrie<br />
und Versorgungswirtschaft,<br />
bei denen eine flexibel einsetzbare<br />
Armatur mit hoher Zuverlässigkeit<br />
im Betrieb gefordert ist,<br />
bietet Tyco Valves & Controls jetzt<br />
eine neue, dreifach exzentrische<br />
Klappe in großen Nennweiten an.<br />
Die RMI Dubex-Klappe ist mit<br />
einem auf der Klappenscheibe platzierten,<br />
weichdichtenden Dichtring<br />
ausgestattet. Auf der Grundlage<br />
umfangreicher Prüfdaten und<br />
Berechnungen ist sie nach KIWA,<br />
KTW, DGRL/CE und ATEX zertifiziert<br />
bzw. zugelassen.<br />
Die Klappe ist in Nennweiten ab<br />
150 mm mit einteiliger Scheibe<br />
erhältlich, für größere Anwendungen<br />
sind Nennweiten bis 4000 mm<br />
lieferbar. In der Standardausführung<br />
mit einteiliger Scheibe ist letztere<br />
mit einem Elastomer-Dichtring<br />
ausgestattet, der in Verbindung mit<br />
einem Metallsitz im Klappengehäuse<br />
den dichten Abschluss<br />
gewährleistet. Bei Nennweiten über<br />
2000 mm wird eine spezielle, durchströmbare<br />
Scheibenkonstruktion<br />
verwendet. Damit ist sichergestellt,<br />
dass die Klappenscheibe bei Druckstößen<br />
nicht beschädigt wird,<br />
gleichzeitig aber starr genug ist, um<br />
unter Mediendruck einen zuverlässigen<br />
Abschluss zu ermöglichen.<br />
Die Ausführung der RMI Dubex-<br />
Klappe kann je nach Nennweite<br />
und Anwendung unterschiedlich<br />
angepasst werden, sodass die<br />
Armatur vielseitig einsetzbar ist.<br />
Hochwertige Lager und eine<br />
leckagefreie Packung ermöglichen<br />
ein niedrigeres Betätigungsdrehmoment.<br />
Der Antrieb kann also<br />
entsprechend kleiner ausgelegt<br />
werden. Der Kunde profitiert<br />
dadurch von niedrigeren Betriebskosten<br />
und einer längeren Lebensdauer.<br />
Das Konstruktionsprinzip<br />
mit dreifacher Exzentrizität ge -<br />
währleistet einen reibungsfreien<br />
Kontakt zwischen Sitz und Dichtring.<br />
Dies erhöht die Standzeit<br />
der Armatur und senkt gleichzeitig<br />
die Instandhaltungskosten. Auf<br />
Wunsch ist die Klappe mit trockener<br />
Welle erhältlich, was den Verschleiß<br />
an kritischen beweglichen<br />
Bauteilen noch einmal weiter reduziert.<br />
Entwickelt wurde die Armatur<br />
insbesondere für den Einsatz in<br />
Pumpstationen, <strong>Abwasser</strong>anwendungen,<br />
<strong>Wasser</strong>kreisläufen, Entsalzungsanlagen<br />
und Kühlwassersystemen.<br />
Auch die innovative mechanische<br />
Verriegelung der Klappenscheibe<br />
trägt zur Senkung der Kosten<br />
für Instandhaltung und Service<br />
bei. Eine unbefugte Betätigung der<br />
Armatur während Instandhaltungsarbeiten<br />
wird dadurch zuverlässig<br />
verhindert, sodass sowohl die<br />
Anlage als auch die Instandhalter<br />
optimal geschützt sind. Dies ist<br />
besonders bei Anwendungen mit<br />
großen Nennweiten wichtig, wo<br />
derartige Arbeiten oft von Tauchteams<br />
im Inneren der Rohrleitung<br />
durchgeführt werden.<br />
Die Reduzierung von Stillstandszeiten<br />
für Service und Instandhaltung<br />
ist für viele Anlagenbetreiber<br />
ebenfalls ein wesentlicher Faktor.<br />
Durch die dreifach exzentrische<br />
Konstruktion werden eventuelle<br />
Ab lagerungen beim Betätigen der<br />
Klappe einfach abgestreift, sodass<br />
diesbezügliche Probleme deutlich<br />
reduziert werden. Der Dichtring<br />
kann bei installierter Armatur ausgetauscht<br />
werden. Die Klappe muss<br />
zur Instandhaltung also nicht aus<br />
der Rohrleitung ausgebaut werden,<br />
was den Zeitaufwand im Service<br />
verkürzt.<br />
Für Sonderanwendungen im<br />
Vakuumbereich oder bei unterirdischer<br />
Leitungsführung ist die RMI<br />
Dubex-Klappe auch mit Schweißenden<br />
lieferbar. Diese Ausführung<br />
ermöglicht neben den genannten<br />
Vorteilen einer dreifach exzentrischen,<br />
weichdichtenden Klappe zu -<br />
sätzlich eine vollständig leckagefreie<br />
Verbindung zwischen Armatur<br />
und Rohrleitung.<br />
Darüber hinaus lässt sich das<br />
Produkt als hydraulisch gesteuerte<br />
Rückschlagklappe konfigurieren,<br />
die einen dichten Abschluss mit<br />
schlagfreier Betätigung gewährleistet.<br />
Mithilfe eines hydraulischen<br />
Fallgewichtsantriebs wird dabei die<br />
Klappenfunktion gesteuert und<br />
gleichzeitig verhindert, dass beim<br />
Schließen Schäden am System entstehen.<br />
März 2012<br />
310 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Produkte und Verfahren<br />
Kees Hartkoorn, Global Marketing<br />
Manager Process Industries bei<br />
Tyco Valves & Controls, kommentiert<br />
das Angebot wie folgt: „Die<br />
Globalisierung hat in allen Industriezweigen<br />
zu erhöhten Ansprüchen<br />
und Erwartungen geführt. Der<br />
Kunde fordert hochwertigere Komponenten,<br />
eine längere Lebensdauer<br />
und eine verbesserte Leistungscharakteristik.<br />
Mit unserer<br />
dreifach exzentrischen RMI Dubex-<br />
Klappe bieten wir eine ausgereifte<br />
Lösung für Anwendungen mit großen<br />
Nennweiten. Dank innovativer<br />
Konstruktionsmerkmale bietet sie<br />
Vorteile in Sachen Arbeitsschutz<br />
und Sicherheit und vereinfacht<br />
zudem die Instandhaltungsabläufe<br />
bei unseren Kunden. “<br />
Weitere Informationen:<br />
www.tycoflowcontrol.com<br />
aimPort mobile: Ein GeoPortal für unterwegs<br />
g.on experience kündigt die mobile Version seiner Webportal-Software g.on aimPort an. Wie für jede<br />
erfolgreiche Software ist es auch für aimPort Zeit für den Einsatz auf mobilen Endgeräten.<br />
g<br />
.on aimPort ist ein webbasiertes<br />
Geoportal zur Dokumentation<br />
und Verwaltung komplexer Infrastrukturen,<br />
basierend auf Oracle-<br />
Technologie. Nicht zuletzt aufgrund<br />
dieses Standards fügt sich die Software<br />
problemlos in die IT-Umgebung<br />
jedes Unternehmens ein.<br />
Organisationen mit weitläufigen<br />
Immobilien behalten mit g.<br />
on aimPort den genauen Überblick<br />
über raumbezogene Informationen<br />
zu ihren Anlagen sowie wirtschaftliche<br />
Daten zu einzelnen<br />
Objekten. Zu den Anwendern<br />
gehören Stand ortbetreiber von<br />
Industrieanlagen, Büro- und<br />
Gewerbeparks sowie Flug- und<br />
Seehäfen. Alle verfügen über riesige<br />
Flächen mit zahl reichen unterschiedlichen<br />
Gebäuden, Grund -<br />
stücken und Betriebsmitteln. Die<br />
großen Datenmengen dahinter<br />
müssen detailliert dokumentiert<br />
und verwaltet werden.<br />
Die neueste Generation des<br />
Web-Portals heißt g.on aimPort<br />
mobile. Damit können Informationen<br />
direkt vor Ort erfasst werden.<br />
Das gilt dann zum Beispiel für die<br />
Aufnahme eines Schadens an einem<br />
Verkehrsweg, die Erfassung von<br />
Zählerdaten oder die fotografische<br />
Erfassung von Details für eine<br />
geplante Baumaßnahme. Dies vereinfacht<br />
die Prozesse, reduziert die<br />
Kosten und führt doch zu einem<br />
präzisen Ergebnis.<br />
Hierfür wurde aimPort mit neuen<br />
Eigenschaften ausgestattet, wie die<br />
optimierte grafische Repräsentation<br />
der Funktionen für den Einsatz auf<br />
mobilen Endgeräten. Daneben gibt<br />
es auch zusätzliche innere Werte der<br />
mobilen Version: u. a. eine Ortungsfunktion<br />
mittels GPS. Fotos können<br />
online mit ihren Koordinaten und<br />
einem Objektbezug in g.on aimPort<br />
abgelegt werden.<br />
Bestehende kundenspezifische<br />
Funktionen (Ortssuche, Kartenauswahl,<br />
Schadensmeldung, Routing,<br />
u. a.) sind identisch auch in mobiler<br />
Form abrufbar. Layout und Bedienung<br />
von aimPort (Zoom in/out,<br />
Messen, Datenabfragen und Analysen)<br />
sind auf die Eigenschaften von<br />
iPad & Co. angepasst.<br />
Die Webportal-Software g.on aimPort mobile auf<br />
einem mobilen Endgerät. ® g.on experience<br />
Kontakt:<br />
g.on experience gmbh,<br />
Dr. Uwe Meyer, Geschäftsführer,<br />
Willy-Brandt-Weg 29, D-48155 Münster,<br />
Tel. (0251) 136500,<br />
E-Mail: info@gon.de,<br />
www.gon.de<br />
Info<br />
Die g.on experience gmbh, Münster, ist ein branchenübergreifender<br />
IT-Dienstleister und Softwareentwickler mit Schwerpunkt Geoinformatik<br />
im Bereich Energieversorgung, Industrie und Verwaltung.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 311
Produkte und Verfahren<br />
AFRISO Druckmittler MD 52, MD 56 und MD 63<br />
mit EHEDG Zertifikat<br />
Die AFRISO Druckmittler MD 52, MD 56 und MD 63<br />
wurden von der TUM (Technische Universität München,<br />
Forschungszentrum Weihenstephan) geprüft<br />
und nach EHEDG Typ EL Klasse I zertifiziert und<br />
zugelassen. © AFRISO<br />
Um den stetig wachsenden An -<br />
sprüchen der Pharmazie, Le -<br />
bensmittel- und Biotechnologie<br />
gerecht zu werden, hat die Firma<br />
AFRISO im Rahmen einer Gesamtzertifizierung<br />
ihre Membrandruckmittler<br />
MD 52 (DIN 11864-1, -2, -3),<br />
MD 56 (NEUMO BioControl) und MD<br />
63 (VARINLINE / VARIVENT) einer<br />
Prüfung durch die EHEDG unterzogen.<br />
Die EHEDG (EUROPEAN<br />
HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN<br />
GROUP) untersucht die hygienegerechte<br />
Konstruktion und Gestaltung<br />
von Maschinen, Bauteilen und<br />
Baugruppen für offene und<br />
geschlossene Prozesse zur Verarbeitung<br />
und Verpackung von Nahrungsmitteln.<br />
Wichtige Merkmale<br />
hierbei sind leichte Reinigbarkeit,<br />
ein sauberes Abfließen (Selbstentleerung)<br />
und metallische Anschläge<br />
für Prozessanbindungen mit Elastomerdichtungen.<br />
Durch konstruktiv<br />
exakt berechnete Abstände der<br />
Anschläge werden die Dichtungen<br />
nur in ihrer Be stimmung verwendet.<br />
Reinigbare Spaltmaße werden<br />
eingehalten und eine Expansion in<br />
den Prozess sicher verhindert. Die<br />
prozessberührten Teile der Druckmittler<br />
werden hygie negerecht aus<br />
hochwertigem Chrom-Nickelstahl<br />
(1.4404/1.4435, AISI 316 L) mit einer<br />
spaltfreien Oberflächengüte Ra ><br />
0,8 µm an gefertigt. Selbst die<br />
Schweißnähte entsprechen diesem<br />
Mittenrauwert! Zertifiziert wurde<br />
beim Forschungszentrum für Brauund<br />
Lebensmittelqualität der TU<br />
München in Weihenstephan. Die<br />
Druckmittler MD 52, MD 56 und MD<br />
63 sind zertifizierte Bauteile nach<br />
EHEDG Typ EL Klasse I und können<br />
im eingebauten Zustand gereinigt<br />
werden (CIP). Sämtliche von AFRISO<br />
produzierten Druckmessgeräte wie<br />
Manometer, Druckmessumformer<br />
und Druckschalter können stoffschlüssig<br />
durch Schweißen mit den<br />
Druckmittlern verbunden werden.<br />
Für den Anbau von Fremdfabrikaten<br />
sind verschiedene Messgeräteadapter<br />
lieferbar.<br />
Autor/Kontakt:<br />
AFRISO-EURO-INDEX GmbH,<br />
Andreas Grunert/J.B.,v Geschäftsbereich GBII<br />
„Druck, Temperatur, Füllstand“,<br />
Lindenstraße 20, D-74363 Güglingen,<br />
Tel. (07135) 10 22 31,<br />
E-Mail: joerg.bomhardt@afriso.de,<br />
www.afriso.de<br />
Regelarmatur bleibt bei Fehler in aktueller Position<br />
Mit „Fail in Place“ lassen sich digitale Stellungsregler 8049 auf Versorgungssicherheit<br />
abstimmen<br />
Bei Standardreglern für Regelventile<br />
fährt die Armatur bei Ausfall<br />
des Stellsignals oder der Versorgungsspannung<br />
in ihre mechanische<br />
Sicherheitsstellung. Dies ist<br />
aber nicht bei allen Anwendungen<br />
gewünscht. Es gibt auch Anwendungen<br />
mit der Anforderung, dass<br />
das Regelventil in der aktuellen<br />
Position verbleibt (wie z. B. in der<br />
<strong>Wasser</strong>- oder Gasversorgung).<br />
Speziell hierfür hat Schubert &<br />
Salzer Control Systems eine Sonderversion<br />
des digitalen Stellungsreglers<br />
8049 in 4-Leiterausführung entwickelt.<br />
Bei Ausfall der Versorgungsspannung<br />
und/oder Ausfall des<br />
Sollwertsignals verharren Ventile,<br />
die mit diesen Reglern ausgerüstet<br />
sind, an ihrer aktuellen Position.<br />
Damit wird sichergestellt, dass in<br />
einer Anlage beim Auftreten dieser<br />
Fehler das Regelventil nicht automatisch<br />
auf bzw. zu fährt und damit<br />
der Prozess nicht unerwünscht<br />
gestört wird. In allen Fällen, in<br />
denen beim Ausfall der Versorgungsspannung<br />
und/oder des Sollwertes<br />
die Ventilstellung auf jeden<br />
Fall gehalten werden soll und man<br />
Schwankungen der Regelgröße aufgrund<br />
der fehlenden Reglung in<br />
Kauf nehmen kann, ist der digitale<br />
März 2012<br />
312 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Produkte und Verfahren<br />
Stellungsregler mit „Fail in Place“-<br />
Option die ideale Lösung.<br />
Zusätzlich wird auch der Ausfall<br />
der Druckluftversorgung abgesichert.<br />
Sollte die Druckluftversorgung<br />
nicht mehr gegeben sein,<br />
kann das Ventil trotzdem in Richtung<br />
seiner Sicherheitsstellung<br />
geregelt werden, z. B. um das Ventil<br />
langsam zu schließen und die<br />
Anlage herunterzufahren.<br />
Kontakt:<br />
Schubert & Salzer Control<br />
Systems GmbH,<br />
Melanie Stowasser,<br />
Postfach 10 09 07,<br />
D-85009 Ingolstadt,<br />
Tel. (0841) 96 54- 0,<br />
Fax (0841) 96 54-590,<br />
E-Mail: marketing@schubert-salzer.com,<br />
www.schubert-salzer.com<br />
Digitaler<br />
Stellungsregler<br />
8049.<br />
Moderne Fernwartungstechnik in Kläranlagen<br />
GO-Serie ermöglicht flexiblen Einsatz<br />
Die Aufgabenstellungen in Kläranlagen ähneln sich häufig und gefragt sind flexible und kostengünstige Fernwartungslösungen,<br />
denn die Kassen sind vielerorts leer. Die Stadtwerke von heute haben nicht mehr das Geld<br />
für teuren Vor-Ort-Support und große Investitionen.<br />
Meist sind die Kläranlagen mit<br />
mehreren schaltenden Sensoren<br />
ausgestattet. Die Daten sollen<br />
mit Hilfe von Fernwartungs- und<br />
Fernwirktechnik in einer Datenbank<br />
abgelegt werden, wobei im Fall kritischer<br />
Messwerte oder Störmeldungen<br />
(z.B. Ausfall wichtiger Pumpen)<br />
eine Alarmmeldung an die<br />
zuständigen Mitarbeiter des <strong>Abwasser</strong>zweckverbands<br />
gesandt werden<br />
soll. Zusätzlich möchte das Wartungspersonal<br />
den gesamten<br />
Datenbestand über ein Internetportal<br />
verfolgen.<br />
Das Unternehmen wireless-netcontrol<br />
hat sich auf den Bereich der<br />
Fernwartung spezialisiert und bietet<br />
mit der Go-Serie eine flexible<br />
Lösungsmöglichkeit, um alle Mess-<br />
Signale zu erfassen und Schaltaufgaben<br />
auszuführen. Die Module<br />
können digitale oder analoge Einbzw.<br />
Ausgänge besitzen und der<br />
Anwender kann bis zu 15 Module<br />
anschließen.<br />
Ziel aller Daten ist eine Datenbank,<br />
die mittels BGPRS über eine<br />
direkte IP- Verbindung erreicht wird.<br />
Die Datenbank ist der Datenlogger<br />
für das Gesamtsystem. Die zusätzliche<br />
Speicherung auf der SD-Karte<br />
der GO-Zentrale ist möglich. Die<br />
Daten werden in Tabellenform<br />
angezeigt, können aber auch grafisch<br />
dargestellt und im Anlagenschema<br />
eingeblendet werden. Der<br />
Anwender kann über einen gesicherten<br />
Zugang von beliebigen<br />
Standorten aus den Zustand der<br />
Anlage über eine Internetverbindung<br />
einsehen und Schaltvorgänge<br />
in der Anlage auslösen.<br />
Kontakt:<br />
wireless-netcontrol GmbH,<br />
Marco Riedel, Marketing & Vertrieb,<br />
Berliner Straße 4a,<br />
D-16540 Hohen Neuendorf,<br />
Tel. (03303) 409-692,<br />
Fax (03303) 409-691,<br />
E-Mail: mr@wireless-netcontrol.de,<br />
www.wireless-netcontrol.com<br />
Info<br />
Die wireless-netcontrol GmbH ist ein IT- und Datenkommunikationsunternehmen<br />
in den Bereichen Industrie, Energie- und Umweltwirtschaft.<br />
Kunden profitieren von innovativen Lösungen zur Fernüberwachung<br />
und Fernsteuerung von Sensoren, Zählern und Anlagen.<br />
Anwendungsbereiche sind z. B. Smart Metering, Energie Controlling,<br />
Gebäudetechnik, <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>systeme, EEG-Erzeuger,<br />
Straßenbeleuchtung und das Verkehrsmanagement.<br />
Go-Zentrale mit Module.<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 313
Fachmedien<br />
jetzt als Buch<br />
oder digital als<br />
eBook<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche<br />
und verfahrenstechnische Betrachtung<br />
Praxishilfen zur Anwendung wasserrechtlicher<br />
Vorschriften und zur verfahrenstechnischen<br />
Optimierung einer Kaskadendenitrifikation<br />
In diesem Buch für <strong>Abwasser</strong>profis werden wichtige wasser -<br />
recht liche Vorschriften durch deren konkrete Anwendung<br />
an einer exemplarischen Anlage verdeutlicht.<br />
Die Optimierung einer Belebungsstufe und die Ableitung von<br />
Optimierungsmaßnahmen für eine Kläranlage mit einer Ausbaugröße<br />
von rund 20.000 Einwohnerwerten sind anschaulich aufbereitet.<br />
Dieses Fachbuch gibt Experten wie auch Einsteigern<br />
wichtige Handlungsanweisungen für die Behandlung von <strong>Abwasser</strong><br />
an die Hand.<br />
A. Hamann<br />
1. Auflage 2011, ca. 150 Seiten, Broschur<br />
Erhältlich als Buch oder als Buch mit Bonusmaterial<br />
und vollständigem eBook auf Datenträger oder als<br />
digitales eBook.<br />
Alle Produktvarianten und Angebotsoptionen (inkl. eBook)<br />
finden Sie im Buchshop unter www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ANFORDERUNG PER FAX: +49 (0)201 / 82002-34 oder per Brief einsenden<br />
Ja, ich bestelle auf Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Ex. <strong>Abwasser</strong>reinigung: Umweltrechtliche und<br />
verfahrenstechnische Betrachtung<br />
als Buch (ISBN: 978-3-8356-3248-6)<br />
zum Preis von € 64,90 zzgl. Versand<br />
als Buch + eBook auf Datenträger (ISBN: 978-3-8356-3250-9)<br />
zum Preis von € 74,90 zzgl. Versand<br />
Die pünktliche, bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung<br />
wird mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Antwort<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAAUVB2011<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medienund Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Impressum<br />
Information<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Herausgeber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Dipl.-Wirtschafts-Ing. Gotthard Graß, figawa, Köln<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. Jost Körte, RMG Messtechnik GmbH, Butzbach<br />
Prof. Dr. Matthias Krause, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer, TU Clausthal,<br />
Clausthal-Zellerfeld<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hans Sailer, Wiener <strong>Wasser</strong>werke, Wien<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München,<br />
Tel. (0 89) 4 50 51-3 18, Fax (0 89) 4 50 51-3 23,<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. (0 89) 4 50 51-2 22,<br />
Fax (0 89) 4 50 51-3 23, e-mail: balzereit@oiv.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof Dr. med. Konrad Botzenhart, Hygiene Institut der Uni Tübingen,<br />
Tübingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfall technik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, figawa, Köln<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Institut für Siedlungswasserbau,<br />
<strong>Wasser</strong>güte- und Abfallwirtschaft, Universität Stuttgart, Stuttgart<br />
Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis, Bieske und Partner<br />
Beratende Ingenieure GmbH, Lohmar<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH,<br />
Hamburg<br />
Verlag:<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145,<br />
D-81671 München, Tel. (089) 450 51-0, Fax (089) 450 51-207,<br />
Internet: http://www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Essen<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. (089) 45051-228, Fax (089) 45051-207,<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. (089) 450 51-226, Fax (089) 450 51-300,<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 62.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppelausgabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Inland: € 370,– (€ 340,– + € 30,– Versandspesen)<br />
Ausland: € 375,– (€ 340,– + € 35,– Versandspesen)<br />
Einzelheft: € 37,– + Versandspesen<br />
ePaper als PDF € 340,–, Einzelausgabe: € 37,–<br />
Heft und ePaper € 472,–<br />
(Versand Deutschland: € 37,–, Versand Ausland: € 37,–)<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: 50 % Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61<br />
D-97091 Würzburg<br />
Tel. +49 (0) 931 / 4170-1615, Fax +49 (0) 931 / 4170-492<br />
e-mail: leserservice@oiv.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
© 1858 Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 315
INFormation Termine<br />
""<br />
10. Deutscher Schlauchlinertag<br />
20.03.2012, Berlin<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Dr.-Ing. Igor Borovsky, Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover, Tel. (0511) 3943330,<br />
Fax (0511) 3943340, E-Mail: info@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
""<br />
Streitpunkt <strong>Wasser</strong>zähler<br />
20.03.2012, Stuttgart<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin, Tel. (030) 284494-0, Fax (030) 284494-210,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
Betriebskosten von Kläranlagen reduzieren – Vogelsang „Kläranlagen-Effizienztage“<br />
22.03.2012, Essen<br />
www.biocrack.de, Tel. (05434) 83-0, E-Mail: marketing@vogelsang-gmbh.com<br />
""<br />
Nachhaltigkeit und Öffentliche <strong>Wasser</strong>wirtschaft – Eine symbiotische Verbindung!<br />
26.03.2012, Berlin<br />
Allianz der öffentlichen <strong>Wasser</strong>wirtschaft (AöW) e.V., Reinhardtstraße 18a, 10117 Berlin, Tel. (030) 397436-06,<br />
Fax (030) 397 436-83, E-Mail: kutzsch@aoew.de, www.aoew.de<br />
""<br />
Rekommunalisierung in der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
27.03.2012, Mainz<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin, Tel. (030) 284494-0, Fax (030) 284494-210,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
Schulung zur dynamischen Simulation von <strong>Abwasser</strong>systemen mit SIMBA<br />
03.–04.04.2012, Magdeburg<br />
ifak – Institut für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg, Nancy Bärwinkel, Werner-Heisenberg-Straße 1,<br />
39106 Magdeburg, Tel. (0391) 9901481, Fax (0391) 9901590, E-Mail: nancy.baerwinkel@ifak.eu, www.ifak.eu<br />
""<br />
16. Praktikerkonferenz – Pumpen in der Verfahrens- und Kraftwerkstechnik 2012<br />
16.–18.04, A-Graz (Österreich)<br />
Mag. Katrin Staudinger, Tagungsorganisation, T. + 43 (0) 316 873 8079, Fax + 43 (0) 316 873 7577,<br />
E-Mail: Info@praktiker-konferenz.com<br />
""<br />
analytica – 23. Internationale Leitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie<br />
und analytica Conference<br />
17.–20.04, München<br />
www.analytica.de<br />
""<br />
Kurs 1 – <strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
24.–26.04.2012, Nürtingen<br />
DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e.V., Katja Heythekker, Postfach 140362, 53058 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9188-602, Fax (0228) 9188-92-602, E-Mail: heythekker@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
""<br />
Planung, Durchführung und Auswertung von Pumpversuchen<br />
03.–04.05.2012, Dresden<br />
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V., Frau Dr. Helling, Meraner Straße 10, 01217 Dresden,<br />
Tel. (0351) 4050-676, Fax (0351) 4050-679, E-Mail: chelling@dgfz.de, www.gwz-dresden.de/aktuell<br />
""<br />
IFAT ENTSORGA – Weltmesse für <strong>Wasser</strong>-, <strong>Abwasser</strong>-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft<br />
07.–11.05.2012, München<br />
Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Tel. (089) 949-11358, Fax (089) 949-11359,<br />
E-Mail: info@ifat.de, www.ifat.de<br />
" " Energiewende und Akzeptanz<br />
08.05.2012, Dortmund<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin, Tel. (030) 284494-0, Fax (030) 284494-210,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
März 2012<br />
316 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/4 50 51-228<br />
Telefax: 0 89/4 50 51-207<br />
E-Mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
2012<br />
Einkaufsberater<br />
Anlagen und Geräte<br />
Armaturen<br />
Absperrarmaturen<br />
März 2012<br />
2 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>
2012<br />
Automatisierung<br />
Prozessleitsysteme<br />
Be- und Entlüftungsrohre<br />
Einkaufsberater<br />
Brunnenservice<br />
Informations- und Kommunikationstechnik<br />
Fernwirktechnik<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 3
2012<br />
Einkaufsberater<br />
Drehkolbengebläse<br />
Kompressoren<br />
Drehkolbenverdichter<br />
Schraubenverdichter<br />
Korrosionsschutz<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
März 2012<br />
4 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>
2012<br />
Leckortung<br />
Regenwasser-Behandlung,<br />
-Versickerung, -Rückhaltung<br />
Einkaufsberater<br />
Rohrhalterungen und Stützen<br />
Rohrhalterungen<br />
Rohrleitungen<br />
Kunststoffrohrsysteme<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 5
2012<br />
Einkaufsberater<br />
Schachtabdeckungen Smart Metering Umform- und<br />
Befestigungstechnik<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Biologische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
März 2012<br />
6 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>
2012<br />
Rohrdurchführungen<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung und <strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Sonderbauwerke<br />
Einkaufsberater<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Verbände<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Inge Matos Feliz<br />
Tel. 089 45051-228<br />
Fax 089 45051-207<br />
matos.feliz@oiv.de<br />
<strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
März 2012<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 7
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Darmstadt l Freiburg l Homberg l Mainz<br />
Offenburg l Waldesch b. Koblenz<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Wasser</strong> Abfall Energie Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure l Julius-Reiber-Str. 19 l 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
DIN EN ISO 9001<br />
DIN EN ISO 14001<br />
SCC**<br />
OHSAS 18001<br />
GW 11<br />
GW 301<br />
• G1: st, ge, pe<br />
• W1: st, ge, gfk, pe, az, ku<br />
GN2: B<br />
FW 601<br />
• FW 1: st, ku<br />
G 468-1<br />
G 493-1<br />
G 493-2<br />
W 120<br />
WHG<br />
AD 2000 HP 0<br />
DIN EN ISO 3834-2<br />
DIN 18800-7 Klasse E<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 · 94469 Deggendorf · T +49 (0) 991 330 - 231 · E rlb@streicher.de · www streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.<br />
Zertifizierungsanzeige_<strong>gwf</strong>_<strong>Wasser</strong>-<strong>Abwasser</strong>_20111109.indd 1 14.11.2011 11:27:54
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
Seite<br />
9. DVGW Betriebssicherheitstage, Bonn 4. Umschlagseite<br />
11th World Filtration Congress 2012, Filtech Exhibitions Germany, Meersbusch 241<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 289<br />
Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen<br />
Titelseite<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 269<br />
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar 227<br />
Endress + Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG, Weil am Rhein 233<br />
FESTO AG & Co.KG, Esslingen 237<br />
figawa e.V., Köln 249<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 269<br />
Huber SE, Berching 247<br />
Hydrometer GmbH, Ansbach 243<br />
IFH/Intherm 2012, GHM Gesellsch. F. Handwerksmessen mbH, 231<br />
Judo <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Winnenden 235<br />
Jung Pumpen GmbH, Steinhagen 239<br />
Krohne Messtechnik GmbH, Duisburg 225<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 266<br />
Netzsch Mohnopumpen GmbH, Waldkraiburg 229<br />
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg<br />
Beilage<br />
pigadi GmbH, Berlin<br />
Beilage<br />
Fritz Wiedemann & Sohn GmbH, Wiesbaden 235<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt 317–324<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
3-Monats-<strong>Vorschau</strong> 2012<br />
Ausgabe April 2012 Mai 2012 Juni 2012<br />
Erscheinungstermin:<br />
Anzeigenschluss:<br />
20.04.2012<br />
22.03.2012<br />
16.05.2012<br />
17.04.2012<br />
15.06.2012<br />
16.05.2012<br />
Themenschwerpunkt Hauptbericht zur IFAT Entsorga, München Trinkwasserbehälter<br />
Bau und Sanierung, Beschichtung und<br />
Reinigung<br />
• Planung und Bauausführung<br />
• Materialien für Trinkwasserbehälter<br />
• Technische Ausrüstung<br />
• Beschichtungssysteme<br />
• Instandhaltungs- und<br />
Sanierungsverfahren<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Produkte und Verfahren<br />
• Regenwassernutzung<br />
• Entwässerungssysteme<br />
• Misch- und Trennkanalisation<br />
• Dezentrale Regenwasserbehandlung<br />
• Regenwasserspeicherung und<br />
-versickerung<br />
• Reinigungssysteme für Straßenabläufe,<br />
Metalldachfilter, Filtersysteme<br />
Fachmessen/<br />
Fachtagungen/<br />
Veranstaltung<br />
(mit erhöhter Auflage<br />
und zusätzlicher<br />
Verbreitung)<br />
Hannover Messe –<br />
Hannover, 23.04.–27.04.2012<br />
rbv-Jahrestagung –<br />
Erfurt, 26.04.–28.04.2012<br />
Wiesbadener Kunststoffrohrtage –<br />
Wiesbaden, 26.04.–27.04.2012<br />
IFAT ENTSORGA –<br />
München, 07.05.–11.05.2012<br />
8. Internationale Geothermiekonferenz –<br />
Freiburg, 23.05.–25.05.2012<br />
Kongress und Fachmesse Gas <strong>Wasser</strong><br />
(122. ÖVGW-Jahrestagung) –<br />
Innsbruck (A), 23.05.–24.05.2012<br />
ECWATECH – Intern. Exhibition and<br />
Conference Water –<br />
Moskau (RUS), 05.06.–08.06.2012<br />
DWA-Landesverbandstagung Sachsen/<br />
Thüringen, Dresden – 06.06.2012<br />
11. Regenwassertage –<br />
Berlin/Potsdam, 12.06.–13.06.2012<br />
ACHEMA –<br />
Frankfurt/Main, 18.06.–22.06.2012<br />
Nürnberger <strong>Wasser</strong>wirtschaftstage mit<br />
Fachausstellung – Nürnberg, 19.07.2012<br />
Änderungen vorbehalten
l<br />
www.www.betriebssicherheitstage.de<br />
Jetzt anmelden unter:<br />
www.betriebssicherheitstage.de<br />
9. DVGW-Betriebssicherheitstage 2012<br />
Im Fokus: Umbau der Energiesysteme<br />
17. & 18. April 2012 in Bonn<br />
Themenschwerpunkte<br />
- Betriebssicherheit<br />
- Anlagensicherheit<br />
- Arbeitsschutz<br />
- Arbeitsmedizin<br />
Zielgruppen<br />
- Technische Führungskräfte<br />
- Betriebsingenieure<br />
- Sicherheitsfachkräfte<br />
- Betriebsärzte<br />
Kontakt<br />
DVGW-Hauptgeschäftsführung<br />
Caroline Ohlmeyer<br />
Josef-Wirmer-Straße 1-3<br />
53123 Bonn<br />
T +49 228 9188-734<br />
F +49 228 9188-92-734<br />
best@dvgw.de<br />
Medienpartner