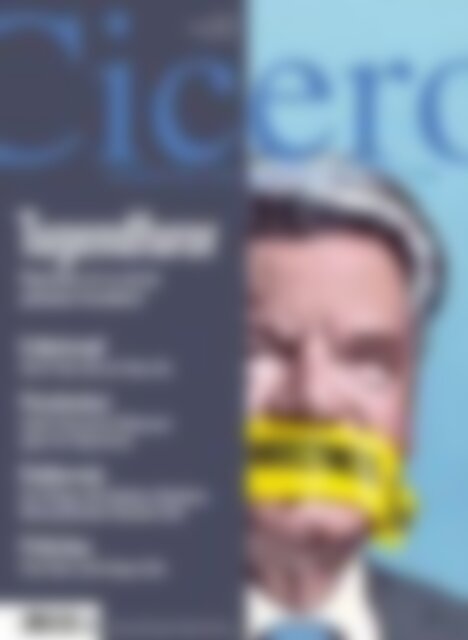Cicero Tugendfuror (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
April 2013<br />
8 EUR / 12,50 CHF<br />
www.cicero.de<br />
<strong>Tugendfuror</strong><br />
Übertreiben wir es mit der<br />
politischen Korrektheit?<br />
Kulturkampf<br />
Udo Di Fabio über die Homo-Ehe<br />
Fleischeslust<br />
Amelie Fried und ihr Widerstand<br />
gegen den Vegetarismus<br />
Ruhrbaronin<br />
Fritz Pleitgen trifft Nordrhein-Westfalens<br />
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft<br />
Politzirkus<br />
Petra Reski erklärt Beppe Grillo<br />
Österreich: 8 EUR, Benelux: 9 EUR, Italien: 9 EUR<br />
Spanien: 9 EUR, Portugal (Cont.): 9 EUR, Finnland: 12 EUR
EINE ANLEITUNG<br />
ZUM WIDERSTAND<br />
1. Alles könnte anders sein.<br />
2. Es hängt ausschließlich von Ihnen ab,<br />
ob sich etwas verändert.<br />
3. Nehmen Sie sich deshalb ernst.<br />
4. Hören Sie auf, einverstanden zu sein.<br />
5. Leisten Sie Widerstand, sobald Sie<br />
nicht einverstanden sind.<br />
6. Sie haben jede Menge<br />
Handlungsspielräume.<br />
7. Erweitern Sie Ihre Handlungsspielräume<br />
dort, wo Sie sind und Einfl uss haben.<br />
8. Schließen Sie Bündnisse.<br />
9. Rechnen Sie mit Rückschlägen,<br />
vor allem solchen, die von Ihnen<br />
selber ausgehen.<br />
10. Sie haben keine Verantwortung<br />
für die Welt.<br />
11. Wie Ihr Widerstand aussieht, hängt<br />
von Ihren Möglichkeiten ab.<br />
12. Und von dem, was Ihnen Spaß macht.<br />
336 Seiten,<br />
gebunden,<br />
€ (D) 19,99
E L E G A N Z I N B E W E G U N G<br />
Armbanduhr Dressage aus Edelstahl,<br />
mechanisches Manufakturuhrwerk H1837.<br />
Informationen unter: Tel. 089/55 21 53-0<br />
Hermes.com
C I C E R O | A T T I C U S<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 21. März 2013<br />
Thema: <strong>Tugendfuror</strong>, Di Fabio, neues Ressort<br />
Kollektives Korrektorat<br />
TITELBILD: WIESLAW SMETEK; ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS<br />
D<br />
AS THEMA STAND SCHON ALS TITEL FEST, als es auch noch den Bundespräsidenten<br />
erwischte. Einen unguten „<strong>Tugendfuror</strong>“ hatte Joachim Gauck im Zusammenhang<br />
mit Rainer Brüderles Dirndl-Affäre ausgemacht und diesen Eindruck ganz offen<br />
ausgesprochen. <strong>Tugendfuror</strong> – eine sehr schöne Wortschöpfung, weil sie ausdrückt, dass es<br />
auch ein Zuviel des Guten gibt. Reflexartig reagierte das politische Korrektorat im Netz und<br />
unterstellte dem Bundespräsidenten, mit dem Furor in Wahrheit Furien gemeint und damit<br />
frauenfeindlich geredet zu haben.<br />
Zuvor hatte ein selbst ernannter Sprachrat diverse bislang unbescholtene Wörter wie<br />
„Arbeitsloser“ auf den Index gesetzt – und ein Berliner Bezirksparlament hatte einheitliche<br />
Toiletten für Männer und Frauen beschlossen, damit Transsexuelle nicht ratlos vor den beiden<br />
Türen stehen. Schließlich erwischte es den Otto-Versand, der ein T-Shirt angeboten hatte mit<br />
der Aufschrift „In Mathe bin ich Deko“ – weil ein Mädchen im Online-Katalog damit posierte,<br />
vermutete das kollektive Korrektorat abermals diskriminierendes Gedankengut dahinter. Das<br />
T-Shirt kann man nicht mehr kaufen.<br />
Könnte es sein, dass wir es in letzter Zeit ein bisschen übertreiben mit der politischen<br />
Korrektheit? Dass wir uns lächerlich machen im berechtigten Bemühen, niemanden<br />
auszugrenzen und hinter jedem unschuldigen Wort das Böse zu vermuten? <strong>Cicero</strong>-Autor<br />
REINHARD MOHR beschleicht dieses Gefühl schon länger. Seinen Einspruch gegen den „Furor des<br />
Fortschritts“ lesen Sie AB SEITE 16.<br />
Den Konservativen in der Union geht dieser gesellschaftliche Fortschritt zu weit, wenn die<br />
eingetragene Lebenspartnerschaft Homosexueller der Hetero-Ehe gleichgestellt wird. Teile der<br />
CDU fordern das, aber Angela Merkel ist nun den Gegnern der völligen Gleichstellung gefolgt –<br />
und wird sich vom Bundesverfassungsgericht demnächst eines anderen belehren lassen müssen.<br />
So urteilt jedenfalls der frühere Verfassungsrichter UDO DI FABIO, der gemeinhin dem konservativen<br />
Lager zugerechnet wird (AB SEITE 26).<br />
Ein Hinweis in eigener Sache: Von nun an gibt es noch mehr <strong>Cicero</strong> fürs Geld. Zwischen<br />
Kapital und Salon hat jetzt der Stil als neues Ressort seinen Platz. Zum Geist kommt also<br />
der Genuss. LENA BERGMANN, die sich künftig um die Themen dieses Ressorts kümmert,<br />
hat den Erfolg der britischen Serie „Downton Abbey“ zum Anlass genommen, die<br />
Faszination des Country House in England und seinen Einfluss auf Design und Literatur zu<br />
analysieren (AB SEITE 98).<br />
Stil, bitte!, wird die neue Kollegin Ausgabe für Ausgabe einfordern. Die Forderung passt ganz<br />
gut zu der ein oder anderen Debatte, die über Bundespräsidenten oder T-Shirts hereinbricht.<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
das Herz ausgeschüttet<br />
Mit besten Grüßen<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 3
SEIT 1971 ÜBERZEUGT, DASS ES<br />
KEINE GESCHMACKVOLLERE<br />
FORTBEWEGUNG GIBT.<br />
NICHTS FÜR UNENTSCHLOSSENE. SEIT 1842.
I N H A L T | C I C E R O<br />
TITELTHEMA<br />
16<br />
VOM FUROR DES FORTSCHRITTS<br />
Sprachwächter, Sexistenjäger und Toilettenrevolutionäre: Im deutschen Frühling blüht die politische Korrektheit<br />
VON REINHARD MOHR<br />
ILLUSTRATION: LISA ROCK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS<br />
24<br />
„ICH BIN GEGEN VERBOTE“<br />
Die Feministin Anna-Katharina Meßmer über Furien,<br />
Sexismus und ihren Brief an Gauck<br />
VON PETRA SORGE<br />
26<br />
KULTURKAMPF UM DIE HOMO-EHE<br />
Gegen die Gleichstellungslogik kann man kaum<br />
argumentieren. Aber muss sie auch ausgereizt werden?<br />
VON UDO DI FABIO<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 5
C I C E R O | I N H A L T<br />
30 Kampf ums Essen<br />
64 Spielen mit Härte<br />
82<br />
Hotel der Zocker<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
30 | ALLES AUF DEN TISCH<br />
Anne Markwardt ist das neue Gesicht<br />
der Verbraucherlobby Foodwatch<br />
VON GEORG LÖWISCH<br />
50 | HE SPEAKS DEUTSCH<br />
Was ist vom neuen US-Außenminister<br />
John F. Kerry zu erwarten?<br />
VON CHRISTOPH VON MARSCHALL<br />
74 | YAHOOS TIGERMAMA<br />
Ihre Aktionen spalten die USA,<br />
Marissa Mayer rettet derweil Yahoo<br />
VON CHRISTINE MATTAUCH<br />
32 | MERKELSÖHNCHEN<br />
Muslim, Einwanderersohn und trotzdem<br />
CDU-Bundesvorstand: Younes Ouaqasse<br />
VON JULIA PROSINGER<br />
52 | KARATE KANN SIE AUCH<br />
Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite<br />
überzeugt durch Kompetenz<br />
VON PAUL FLÜCKIGER<br />
76 | WIR BRAUCHEN BASS<br />
Björn Stolls Instrumente aus dem<br />
„Musicon Valley“ sind weltweit gefragt<br />
VON STEFAN LOCKE<br />
34 | DIE GEGENSPIELERIN<br />
Hannelore Kraft ist die gefährlichste<br />
Kontrahentin der Kanzlerin aus der SPD<br />
VON FRITZ PLEITGEN<br />
54 | KAFFEEKLATSCH IN AACHEN<br />
Frans Timmermans will die holländische<br />
Außenpolitik neu ausrichten<br />
VON ROB SAVELBERG<br />
78 | GELD MACHT BLIND<br />
Daniel Vasella reformierte unfreiwillig<br />
das Schweizer Aktienrecht<br />
VON PETER HOSSLI<br />
38 | SOZI SUCHT FRAU<br />
Sind Spitzenfrauen in der SPD nur die<br />
Ausnahme? Ein Besuch in Bayern<br />
VON KATRIN WILKENS<br />
56 | WAS BLEIBT, IST DAS ÖL<br />
Hugo Chávez’ Tod und das Ende der<br />
Linkspopulisten in Lateinamerika<br />
VON CARLOS WIDMANN<br />
80 | ZURÜCK NACH MAASTRICHT<br />
Rettungsschirme und Staatsfinanzierung<br />
durch die EZB verlängern die Krise nur<br />
VON WOLFGANG KADEN<br />
40 | FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… wie sie sich gegen die<br />
Vegetarier wehren soll<br />
VON AMELIE FRIED<br />
42 | MEIN WUNSCHKABINETT<br />
In der <strong>Cicero</strong>-Wahlserie: Wenn eine<br />
Schriftstellerin die Regierung besetzt<br />
VON THEA DORN<br />
44 | DAS FDP-PARADOX<br />
Was hat der Kampf für Privilegien des<br />
Mittelstands mit dem freien Markt zu tun?<br />
VON GUNNAR HINCK<br />
48 | MEIN SCHÜLER<br />
Der ehemalige Lehrer Helmut Schnitter<br />
über Philipp Röslers schlechte Späße<br />
VON CONSTANTIN MAGNIS<br />
58 | ES WAR EINMAL EIN CLOWN<br />
Beppe Grillos Wahlerfolg hat viele<br />
verunsichert. Ein Blick hinter die Fassade<br />
VON PETRA RESKI<br />
64 | KEIN FOUL!<br />
Das Calcio Storico Fiorentino ist der<br />
härteste Mannschaftssport der Welt<br />
VON MICHAEL LÖWA<br />
72 | HERZLICH WILLKOMMEN!<br />
Ein Plädoyer für die Aufnahme der<br />
Türkei in die Europäische Union<br />
VON GERHARD SCHRÖDER<br />
82 | DAS ZOCKERHAUS IM SPESSART<br />
In einem Hotel am Main lernen<br />
Börsenspekulanten ihr Handwerk<br />
VON CONSTANTIN MAGNIS<br />
88 | BERGLER GEGEN FEUDALHERREN<br />
Das Schweizer Verdikt gegen die<br />
Abzocker entlarvt den Neofeudalismus<br />
VON FRANK A. MEYER<br />
FOTOS: GÖTZ SCHLESER, MICHAEL LÖWA, BERND HARTUNG; KARIKATUR: HAUCK & BAUER<br />
6 <strong>Cicero</strong> 4.2013
I N H A L T | C I C E R O<br />
98 Das Design der Landsitze 112<br />
Frankreichs neue Denker<br />
STIL<br />
SALON<br />
90 | DIE SUPERNASE<br />
Die Chemikerin Sissel Tolaas hat<br />
6703 verschiedene Düfte in ihrem Archiv<br />
VON ULRICH CLEWING<br />
106 | DER DRACHENTÖTER<br />
Sylvester Groth zwischen Hollywood,<br />
„Tatort“ und einem neuen RAF-Film<br />
VON INGO LANGNER<br />
130 | BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
Hans-Olaf Henkel mag Jazz<br />
und Thomas Mann<br />
VON ALEXANDER KISSLER<br />
92 | DER BRENNT FÜR DIE SACHE<br />
Der Kunstkenner Christoph Keller<br />
destilliert ausgezeichneten Schnaps<br />
VON ALEXANDER MARGUIER<br />
97 | WARUM ICH TRAGE, WAS ICH TRAGE<br />
Weiße Kleider erfordern einen ganz<br />
anderen Mut als Schwarz<br />
VON BIBIANA BEGLAU<br />
108 | JEDER WILL WAS<br />
Lisa Kränzler malt sehr bunt und<br />
schreibt sonderbar berührende Bücher<br />
VON OLIVER JUNGEN<br />
110 | EIN STÖRENFRIED<br />
Peter Strohschneider verwaltet als DFG-<br />
Präsident über zwei Milliarden Euro<br />
VON ALEXANDER GRAU<br />
134 | DAS SCHWARZE SIND<br />
DIE BUCHSTABEN<br />
Wie viel Berlin passt eigentlich<br />
zwischen zwei Buchdeckel?<br />
VON ROBIN DETJE<br />
136 | DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
Sterben, ein Scheißdreck<br />
VON SIBYLLE BERG<br />
FOTOS: HIGHCLERE ENTERPRISES LLP 2013, THOMAS GOISQUE, ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS<br />
98 | PRUNK UND PATINA<br />
Das Country House fasziniert über die<br />
Erfolgsserie „Downton Abbey“ hinaus<br />
VON LENA BERGMANN<br />
103 | DIE NEO-TRADITIONALISTEN<br />
Ein Londoner Paar schöpft Ideen aus<br />
dem Design englischer Landsitze<br />
104 | KÜCHENKABINETT<br />
Lauwarmes Essen ist in Restaurants<br />
heutzutage keine Schande mehr<br />
VON JULIUS GRÜTZKE UND THOMAS PLATT<br />
112 | SPALTE DAS HOLZ, LIEBE DAS LEBEN<br />
In Frankreich wächst eine neue<br />
Generation lustvoller Denker heran<br />
VON ALEXANDER PSCHERA<br />
119 | BENOTET<br />
Gibt es klassische Musik überhaupt?<br />
VON DANIEL HOPE<br />
120 | MAN SIEHT NUR, WAS MAN SUCHT<br />
Leonardos „Letztes Abendmahl“<br />
steht im Fokus vieler Künste<br />
VON BEAT WYSS<br />
122 | DILETTANTEN AUF THRONEN<br />
Im Sprechtheater herrscht der Zynismus<br />
VON IRENE BAZINGER<br />
124 | POSSE UM MARIA<br />
Ein Kölner Museum stellt beharrlich<br />
eine falsche Madonna aus<br />
VON ROLF SCHMIDT<br />
128 | WEHRLOS, ABER NICHT EHRLOS<br />
Die SPD stimmte 1933 gegen<br />
das Ermächtigungsgesetz<br />
VON PHILIPP BLOM<br />
Standards<br />
ATTICUS —<br />
Von Christoph Schwennicke — SEITE 3<br />
STADTGESPRÄCH — SEITE 8<br />
FORUM — SEITE 12<br />
IMPRESSUM — SEITE 94<br />
POSTSCRIPTUM —<br />
Von Alexander Marguier — SEITE 138<br />
Die nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 25. April 2013<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 7
C I C E R O | S T A D T G E S P R Ä C H<br />
ILLUSTRATIONEN: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
STIPENDIATEN DER VILLA MASSIMO zeigen ihre Arbeiten, Steffen Bilger ist<br />
CDU-Nachwuchsstar aus Südwest, das Parlament verliert einen großen Kicker, dafür<br />
gewinnt Schavan einen Job, und Gauck gibt seinen Reden selbst den letzten Schliff<br />
VILLA MASSIMO IN BERLIN:<br />
KUNST UND KÄSE<br />
E<br />
S WAR EINER der feineren Termine<br />
der Berliner Hochkultur, eine<br />
Sause der Bell’Arte: Die Deutsche<br />
Akademie Villa Massimo lud zur Abschlussfeier<br />
in den Martin-Gropius-Bau.<br />
Ein Massimo-Stipendium in Rom ist eine<br />
hochbegehrte Auszeichnung für junge<br />
deutsche Künstler. Sie sollten an diesem<br />
Abend dem Bundespräsidenten Joachim<br />
Gauck und einem ebenso kunstbeflissenen<br />
wie ehrfürchtigen Publikum vorführen,<br />
was sie in dem vom deutschen Steuerzahler<br />
finanzierten römischen Jahr zuwege<br />
gebracht hatten.<br />
Viele allerdings verloren die Ehrfurcht<br />
bereits in dem Menschenknäuel vor der<br />
Glastür, die den Vorraum vom Veranstaltungssaal<br />
trennte. Dort nämlich ließ ein<br />
grimmiger Sicherheitsmann niemanden –<br />
außer dem ebenfalls verspäteten Akademiedirektor<br />
– passieren. Wer mit Glück<br />
doch irgendwie durch den Türspalt tröpfelte,<br />
konnte beim Blick zurück<br />
ein sich gegen die<br />
Glaswand pressendes, ineinander verhaktes<br />
und mit sich ringendes Gewimmel bestaunen,<br />
das an die Laokoon-Gruppe erinnerte.<br />
Der Blick nach vorn zum Rednerpult<br />
war nicht minder ernüchternd. Ein fleischiger<br />
Villadirektor, ein salbungsvoller<br />
Sparkassenpräsident, eine Stipendiatin, die<br />
über Pilze referierte. Fast konnte man neidisch<br />
sein auf die zwei Buben, die in der<br />
letzten Reihe umherrutschten und kleine<br />
Spielzeugmopeds über den Marmorboden<br />
schoben.<br />
Als die Funghi-Frau fertig war, servierten<br />
Köche müffelnde Käse-Lollipops und<br />
zerbröselnden Parmesan an Spießchen.<br />
Fürs Ohr gab’s auch etwas: Ein Streichquartett<br />
stimmte fast eine Viertelstunde<br />
lang die Instrumente – die 14 Minuten<br />
waren das Konzert.<br />
Und das Bundespräsidentenpaar lächelte<br />
sich durch die Ausstellungsräume.<br />
Gucken, Nicken, Händeschütteln. In den<br />
majestätischen Hallen fand sich alles, was<br />
auch in eine der vorgestellten italienischen<br />
Sieben-Quadratmeter-Wohnungen gepasst<br />
hätte: ein paar Lumpen, etwas Geschirr,<br />
ein gestrickter Uhu. Dazu ein weißes<br />
kubistisches Oval, das in der<br />
Raummitte baumelte.<br />
„Als Lampe<br />
ginge das ja noch“, befand Hermann<br />
Kleinknecht, „aber als Kunst?“ Der Bildhauer,<br />
Maler und Filmemacher, der 1976<br />
selbst einmal Akademiestipendiat war und<br />
sich nur „Handwerker“ nennt, fasste den<br />
Abend denn auch kurz und zutreffend zusammen:<br />
„Völlig aufgeblasen.“ ps<br />
CDU-STAR IN SÜDWEST:<br />
SEKT ZUR KATASTROPHE<br />
D<br />
E R ABGEOR DNET E vom<br />
Katastrophenverband bietet erst<br />
mal ein Gläschen Sekt an. Kurz<br />
nach halb eins, wir sind im Berliner Bundestagsbüro<br />
von Steffen Bilger zu Besuch.<br />
Es gibt dort zwar auch eine Kaffeemaschine,<br />
aber hey: Bilger ist gerade 34 geworden,<br />
und zum Geburtstag hat ihm ein<br />
Parteifreund eine schöne Flasche<br />
geschenkt, Weingut<br />
Beck in<br />
Anzeige
Brackenheim. Bilger gehört der CDU Baden-Württemberg<br />
an, jener einst erfolgreichen<br />
Parteigliederung, die seit 2011 von<br />
einem Malheur ins nächste rasselt, von<br />
Mappus zu Turner und von Mappus zu<br />
Schavan. Leise ereignet sich dagegen der<br />
Machtzuwachs dieses jungen Mannes, der<br />
mit seinem Abiturientenlächeln und seinem<br />
manierlichen Scheitel so aussieht, wie<br />
ein linker Karikaturist einen Nachwuchsstar<br />
der Jungen Union zeichnen würde.<br />
Das ist Steffen Bilger.<br />
Während Thomas Strobl, der geplagte<br />
Vorsitzende der CDU Baden-Württemberg,<br />
über jede mappusfreie Woche heilfroh ist,<br />
kann Bilger lässig darauf verweisen, dass<br />
seine Beziehung zu Stefan Mappus bereits<br />
seit 2007 vorbei ist. Bilger, damals Nachwuchsstar<br />
der Jungen Union, führte seinerzeit<br />
mit Mappus einen Richtungsstreit<br />
um die Einführung des Führerscheins für<br />
17-Jährige. Als neulich eine SMS bekannt<br />
wurde, in der Mappus den Landesverband<br />
einen Scheißverein schimpfte, fragte Bilger<br />
in der Presse, ob Mappus eigentlich<br />
noch CDU-Mitglied bleiben müsse. So<br />
generiert er Aufmerksamkeit, aber weil er<br />
nie ein Mappus-Mann war, wirkt das nicht<br />
opportunistisch. „Es hat mich so geärgert,<br />
dass er wieder nur eine Angriffsstrategie<br />
gefahren hat“, erklärt er gut gelaunt beim<br />
Sekt in Berlin. Das alte Regime? Hatte er<br />
nichts mit zu tun.<br />
So gelang ihm in den Wirren nach der<br />
Landtagswahlpleite 2011 auch der Aufstieg<br />
zum Vorsitzenden des CDU-Bezirks Nordwürttemberg.<br />
Klingt kleinteilig, bedeutet<br />
aber Einfluss. Die CDU Nordwürttemberg<br />
zählt 22 000 Mitglieder.<br />
So viele hätten<br />
die Landesverbände<br />
von Sachsen und Sachsen-Anhalt<br />
nicht einmal dann, wenn sie ihre Mitglieder<br />
zusammenschmeißen würden. Ein<br />
Fürstentum vom liberalen Stuttgart bis ins<br />
knorrige Taubertal. Bilger, Wehrdienstverweigerer<br />
mit Deutschlandflagge im Büro,<br />
bedient sie alle. „Ich geh in jeden Ortsverband,<br />
der mich einlädt“, sagt er. 400 gibt<br />
es, fünf schafft er pro Monat, bald sind die<br />
100 voll. Und wie gesagt, er ist gerade erst<br />
34 geworden. löw<br />
KAPITÄN ÜBER BORD:<br />
KICKER FÜHRUNGSLOS<br />
D<br />
ER DEUTSCHE Bundestag wird<br />
nach der Bundestagswahl erheblich<br />
geschwächt – nicht politisch,<br />
sondern fußballerisch: Weil nämlich der<br />
CDU-Abgeordnete Klaus Josef Riegert<br />
nicht mehr dem Parlament angehören<br />
wird und somit auch nicht mehr für den<br />
FC Bundestag zum Kicken auflaufen kann.<br />
Riegert war Mannschaftskapitän seit<br />
1997, operierte in 311 Spielen<br />
als Mittelstürmer.<br />
Er schoss<br />
298 Tore und gilt als glänzender politischer<br />
Kontaktmann in Fragen der Verbands- und<br />
Sportpolitik, wo er auch weiterhin aktiv<br />
sein will. Außerdem war er dieser Tage Angela<br />
Merkel politisch sehr behilflich, weil er<br />
vorzeitig auf seinen Sitz im Entwicklungshilfeausschuss<br />
verzichtete, sodass die Kanzlerin<br />
dort Ex-Ministerin Annette Schavan,<br />
ihre Freundin, unterbringen konnte. Das<br />
wiederum wird unionsintern als Signal<br />
dafür gewertet, dass Schavan als Entwicklungshilfeministerin<br />
ins Kabinett zurückkehren<br />
könnte, falls es nach der Bundestagswahl<br />
nicht mehr zu Schwarz-Gelb<br />
reicht, sondern nur zu einer Großen Koalition<br />
mit der SPD.<br />
Großkoalitionär sind die Balltreter sowieso.<br />
Riegert rühmt den FC Bundestag<br />
als „Hort der Stabilität“, denn der Fußball<br />
führe über die Fraktionsgrenzen hinweg zu<br />
Kooperation. „Wenn man zuweilen auch<br />
nackt unter der Dusche steht, geht man tolerant<br />
miteinander um. Da sind alle gleich.“<br />
Zurzeit kicken Ballkünstler aller Parteien<br />
im FC Bundestag mit – nur die Grünen<br />
fehlen. Deren letzter Star war Joschka Fischer.<br />
Auch Wolfgang Schäuble war vor<br />
dem Attentat Stammspieler. Er spielte<br />
am liebsten wo? Na klar, auf<br />
Linksaußen. Und<br />
pflegte den
C I C E R O | S T A D T G E S P R Ä C H<br />
Verteidiger ihm gegenüber, ehe er zum<br />
Flankenlauf antrat, mit dem Ruf zu provozieren:<br />
„Na, kommscht’ mit mir mit?“<br />
So mache er auch heute noch Politik, behauptet<br />
Riegert. tz<br />
PRÄSIDENTEN-REDEN:<br />
DER CHEF FEILT SELBST<br />
S<br />
EIT SEINER WAHL am 18. März<br />
2012 hat Bundespräsident Joachim<br />
Gauck öffentlich 94 Reden<br />
gehalten. Einiges blieb haften, zum Beispiel<br />
seine Mahnung an die Banker,<br />
bei allem berechtigten<br />
Streben<br />
nach Gewinn ökologische und soziale Belange<br />
nicht aus dem Blick zu verlieren:<br />
„Schwarze Zahlen sind kein Grund, rote<br />
Linien zu überschreiten.“ Oder sein Appell,<br />
Hersteller zu boykottieren, die unter<br />
unmenschlichen Arbeitsbedingungen<br />
arbeiten lassen: „Wie lange greifen Europäer<br />
noch zu Jeans für zehn Euro, obwohl<br />
sie wissen, dass die Allerärmsten in Asien<br />
einen hohen Preis dafür zahlen, mit ihrer<br />
Gesundheit oder ihrer Menschenwürde?“<br />
Wie kommen solche erstaunlichen Sätze in<br />
eine offizielle Rede des Bundespräsidenten?<br />
Gut möglich, dass der einstige Pfarrer sie<br />
selbst erst in das Manuskript eingefügt hat,<br />
das ihm seine „Schreibstube“ – der von<br />
dem Theologen und Ökonomen<br />
Wolfgang Stierle<br />
geführte „Planungs-<br />
und Redenstab“ – regelmäßig liefern<br />
muss. Fünf Ghostwriter sitzen in<br />
diesem Stab und müssen das Material<br />
verarbeiten, das ihnen aus den Referaten<br />
des Präsidialamts zugeliefert wird – keine<br />
leichte Aufgabe, das oft sperrige Beamtendeutsch<br />
in griffige Sätze zu verwandeln.<br />
Manchmal holt sich der Präsident auch externen<br />
Rat von prominenten Philosophen,<br />
Schriftstellern oder Historikern, wenn er –<br />
wie jüngst – öffentlich über die Zukunft<br />
Europas nachdenkt. Den letzten<br />
Feinschliff aber, sagt<br />
ein Insider,<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
Anzeige
esorge der Präsident bei der Vorbereitung<br />
seiner öffentlichen Auftritte immer selbst. „Er<br />
hat eine feste Vorstellung von dem, was er sagen<br />
will. Aber er ist offen für Gegenargumente.<br />
Beratungsresistent ist er<br />
jedenfalls nicht.“ hp<br />
Der neue BMW Z4<br />
www.bmw.de/Z4<br />
Freude am Fahren<br />
FORDERND<br />
blickt der neue BMW Z4 nicht nur die Straße an. Auch seinen Betrachter.<br />
Und dabei ist seine Forderung eindeutig: Fahr mich!<br />
DER NEUE BMW Z4.<br />
JETZT BEI IHREM<br />
BMW PARTNER.<br />
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 9,4–6,8. CO 2 -Emission in<br />
g/km (kombiniert): 219–159. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt<br />
der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
C I C E R O | L E S E R B R I E F E<br />
FORUM<br />
Über Heimwerker und Journalisten, die Energiewende und die USA<br />
ZUM BEITRAG „ICH BI N SCHON AUCH<br />
MUTIG“, INTERV IEW MIT WIN FRIED<br />
K RETSCHMANN/MÄR Z 2013<br />
GRENZEN NÖTIG<br />
Es spricht für Herrn Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg,<br />
wenn er für sich den Anspruch auf eine eigene Vorstellung von Gesellschaft bewahrt<br />
und es für ihn Grenzen der Kompromissbereitschaft gibt. Auch sein Leitsatz<br />
„keine Freiheit ohne Verantwortung“ gefällt. Höchstes Ziel sei es, dass junge Menschen<br />
zum selbstständigen Denken und Handeln geführt werden. Wie aber will er<br />
diesen angestrebten Bildungserfolg ausschließlich mit der verstärkten Errichtung<br />
von Ganztagsschulen erreichen, ihn gänzlich abkoppeln von der Erziehung innerhalb<br />
der Familie?<br />
Eduard Biedermann, Hamburg<br />
wird den Sachverhalt je ändern können.<br />
Es gibt nur einen Ausweg aus der selbst<br />
verschuldeten Sackgasse: Strom importieren,<br />
und zwar im erheblichen Umfang<br />
und langfristig die Erneuerbaren ersetzend.<br />
Wir importieren Kohle, Öl und<br />
Gas. Es gibt keinen Grund, nicht auch<br />
Strom zu importieren, zumal die infrage<br />
kommenden Lieferanten politisch zuverlässiger<br />
sind als zum Beispiel bei Gas.<br />
Horst Steinmetz, Frankfurt/Main<br />
SCHRECKLICHE IGNORANZ<br />
Wenn man schon von „Lügen“ spricht,<br />
dann sollte man vermeiden, selbst einen<br />
Artikel in die Welt zu setzen, der von<br />
Halbwahrheiten, Unterstellungen und<br />
Verdrehungen der Tatsachen nur so<br />
strotzt. Die Ignoranz, die hier sichtbar<br />
wird, ist schon erschreckend … Was ist<br />
nur aus Ihrer Zeitschrift geworden?<br />
Gerhard Leuner, Halstenbek<br />
ZUM BEITRAG „DAS<br />
S CHW EIG EN DER LÄMMER“ VON<br />
F RAN K A. M E Y ER/MÄR Z 2013<br />
NUR NOCH LABERTASCHEN?<br />
Muss man davon ausgehen, dass der<br />
deutsche Journalismus so mittelmäßig<br />
ist, wie es zurzeit rüberkommt? Nur<br />
halbgebildete Labertaschen in den Talkshows!<br />
Unsäglicher Schwachsinn! Wann<br />
hört das auf? Für mich hat der Stern<br />
den Vogel abgeschossen: Die Brüderle-<br />
Geschichte war ja wohl das Allerletzte.<br />
Elisabeth Gutmann, Frankfurt/Main<br />
ZUM BEITRAG „DIE NEUE<br />
G OTTSCHALK“ VON DA N IEL HAAS/<br />
MÄR Z 2013<br />
SELTSAME WORTWAHL<br />
Schade, dass Herrn Haas bei der<br />
Beschäftigung mit der Kunstfigur<br />
„Cindy aus Marzahn“ nichts Intelligenteres<br />
eingefallen ist, als Ilka Bessin auf<br />
ihr Aussehen zu reduzieren und sie in<br />
seinem Beitrag in immer neuen Varianten<br />
zu beleidigen. Da hat sich der selbst<br />
ernannte „Kulturbürger“ als das perfekte<br />
Klischee des von ihm beschriebenen<br />
„Prekarisierten“ inszeniert. Schade auch,<br />
dass mir die <strong>Cicero</strong>-Redaktion solchen<br />
„Trash“ als „Kreativität“ verkaufen will.<br />
Dr. Stephan Voß, Senden (Westfalen)<br />
ZUM BEITRAG „LÜGEN, DASS ES<br />
KRACHT“ VON CLAUDIA KEMFERT/<br />
F EB RUAR 2013<br />
STROM IMPORTIEREN<br />
Die Fakten beweisen, eine versorgungssichere<br />
wettbewerbsfähige Stromversorgung<br />
ist mit Wind und Sonne nicht<br />
möglich … Kein politischer Beschluss<br />
LESENSWERTES BUCH<br />
Aufgrund Ihres Artikels „Die Wahrheit<br />
über die Energiewende“ habe ich mir<br />
das Buch von Frau Claudia Kemfert<br />
„Kampf um Strom“ gekauft. Dieses<br />
Buch sollten alle Politiker und sonstige<br />
Wirtschaftsfachleute lesen, die sich mit<br />
der Energiewende beschäftigen. Dr. Rösler<br />
wird es wahrscheinlich nicht lesen,<br />
da er „beratungsresistent“ ist und nur<br />
auf seine Lobbyisten hört. Der Umbau<br />
der Energielandschaft muss in einem<br />
Ministerium vereinigt sein, und das ist<br />
hier das Bundesumweltministerium mit<br />
der vollen Unterstützung der Kanzlerin.<br />
Felix Kötting, Havixbeck<br />
„UTOPIE ENERGIEWENDE“<br />
Ich habe zu jedem Ihrer Argumente ein<br />
Gegenargument gefunden. Die Schat-<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
12 <strong>Cicero</strong> 4.2013
C I C E R O | L E S E R B R I E F E<br />
N ACHLESE<br />
GRÜNE TÜFTLER<br />
Spaßvögel fordern kommunale<br />
Baumärkte<br />
Baden-Württembergs Ministerpräsident<br />
Wilfried Kretschmann<br />
(hier beim Studium des <strong>Cicero</strong>)<br />
liebt Baumärkte und entspannt<br />
sich am liebsten beim häuslichen<br />
Werkeln mit Schlagbohrer, Hammer,<br />
Schraubenzieher und Zollstock.<br />
Das Bekenntnis des grünen<br />
Hobby-Handwerkers im <strong>Cicero</strong>-<br />
Interview animierte ein paar seiner<br />
Parteifreunde im Landtag,<br />
spaßeshalber einen Antrag nach<br />
den Regeln des Parlaments zu formulieren.<br />
Die Landesregierung,<br />
heißt es darin, möge berichten,<br />
„ob eine flächendeckende Versorgung<br />
baden-württembergischer<br />
Handwerker mit qualitativ hochwertigen<br />
und ökologisch-nachhaltigen<br />
Werkzeugen – beispielsweise<br />
Schlagbohrmaschinen – gewährleistet<br />
ist“, und gleichzeitig prüfen,<br />
„wie Baumärkte innerhalb der<br />
baden-württembergischen Landesgrenzen<br />
unter Verwaltung der<br />
Kommunen gestellt werden können“.<br />
Die Antragsteller regen die<br />
Einsetzung einer Enquetekommission<br />
an, die unter „Leitung des<br />
MP Kretschmann“ entsprechende<br />
Gesetzesvorlagen erarbeiten soll.<br />
Insbesondere solle geprüft werden,<br />
„inwieweit private Initiativen<br />
zum Bau und zur Bereitstellung<br />
von Nistkästen“ von Baumärkten<br />
abhängig sind. Baumärkte, heißt<br />
es in der Begründung, seien bei<br />
der „Sicherung lokal bedrohter<br />
Vogelbestände“ von „elementarer<br />
Bedeutung“. Red.<br />
tenseiten der „Utopie Energiewende“,<br />
wie die Zerstörung des Landschaftsbildes<br />
durch Windräder, der Alpentäler<br />
durch die unbedingt notwendigen<br />
Pumpspeicherkraftwerke für die volatile<br />
Energieerzeugung via Fotovoltaik und<br />
Windkraft, die Vergiftung unseres<br />
Grundwassers durch die Pestizide im<br />
Maisanbau, die Ausbeutung der unteren<br />
Gesellschaftsschichten über das EEG,<br />
übergeht Frau Kemfert ganz oder karikiert<br />
sie.<br />
Johann Wagner, München<br />
ZUM BEITRAG „FRAU FRIED<br />
FRAGT SICH“ VON AMELIE FRIED/<br />
F EB RUAR 2013<br />
ZU VIEL MISSTRAUEN<br />
Frau Fried hat den Nagel auf den Kopf<br />
getroffen! Ich komme gerade aus Florida<br />
zurück, wo ich 27 Winter von 1978 bis<br />
2005 als Snowbird gelebt habe und froh<br />
bin, die schöne Vergangenheit erlebt<br />
zu haben. Heute möchte ich dort nicht<br />
mehr leben wegen der vielen Schikanen<br />
und des Misstrauens gegenüber Fremden,<br />
die seit dem 11. 09. 2001 (Nine-Eleven)<br />
immer schlimmer geworden sind.<br />
Edith Staunau, Sylt<br />
LIEBENSWERTE NACHBARN<br />
Wir sind vor anderthalb Jahren nach<br />
Des Moines/Iowa gezogen. Wir haben<br />
hier unglaublich freundliche, hilfsbereite<br />
Amerikaner kennengelernt. Die Amerikaner<br />
lieben ihr Land, hassen staatliche<br />
Steuern und zahlen klaglos horrende<br />
Grundsteuern. Es ist unglaublich, wie<br />
viel Geld Amerikaner spenden, wie viel<br />
Zeit und Energie sie in Ehrenämter<br />
investieren, sich freiwillig einsetzen für<br />
Kranke, Obdachlose, Behinderte, Kinder,<br />
Benachteiligte, Kunst, Bildung. Ja, es gibt<br />
hier viele Dinge, die irritieren, nerven<br />
und einen erschrecken – aber so ist das<br />
wohl immer, wenn man sich in einem<br />
anderen Land aufhält. Ach, und wie war<br />
das doch gleich vor 30 Jahren in den<br />
USA, mit den Schwulen und Lesben, den<br />
Rechten von Frauen und Farbigen, der<br />
Todesstrafe, dem Umweltbewusstsein, der<br />
Kriminalität in den Innenstädten, den<br />
Armen und den Reichen?<br />
Lutz Schüppenhauer, Des Moines, USA<br />
NUR DIE HALBE WAHRHEIT<br />
Ihre Argumentation, die USA als Land<br />
der Waffennarren, religiösen Fanatiker<br />
und perversen Kapitalisten darzustellen,<br />
kann ich nicht nachvollziehen. Denn<br />
das ist schließlich höchstens die halbe<br />
Wahrheit. Die andere Seite der Medaille<br />
zeigt ein Land, das seit nunmehr vier<br />
Jahren von einem jungen afroamerikanischen<br />
Präsidenten regiert wird, der<br />
sich für die Gleichstellung von Homosexuellen<br />
einsetzt, erstmals eine bundesweite<br />
staatliche Krankenversicherung<br />
eingeführt hat, für schärfere Waffengesetze<br />
plädiert und Klimaschutz sowie<br />
Einwanderungsreform auf die politische<br />
Agenda der nächsten vier Jahre gesetzt<br />
hat. Dieses bunte, fortschrittliche und<br />
progressive Amerika lassen Sie in Ihrer<br />
Kolumne völlig außer Acht.<br />
Christian Semmler, Berlin<br />
ZUM BEITRAG „VERDERB TER<br />
GEIST“ VON LUDW I G POULLAIN/<br />
F EB RUAR 2013<br />
SELTSAME WORTWAHL<br />
Geht schon in Ordnung, dass ein „Insider“<br />
, wie Ludwig Poullain, mit spitzer<br />
Feder „Ross und Reiter“ nennt. Ob er<br />
dabei auf Vokabeln wie „artverfremdet“<br />
und „Blut und Boden“ zurückgreifen<br />
muss, um einen Banker zu charakterisieren,<br />
„nur“ (davon gehe ich mal<br />
aus) weil dieser „Ackermann“ heißt?<br />
Eine solche Wortwahl scheint mir<br />
eine Frage keines guten Geschmacks<br />
zu sein. Der Verfasser ist alt genug,<br />
um über ausreichende Kenntnisse in<br />
deutscher Geschichte zu verfügen und<br />
zu wissen, dass diese Begriffe aus jener<br />
nicht näher zu erläuternden Zeit anders<br />
konnotiert sind.<br />
Werner Kaltefleiter, Wiesbaden<br />
(Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
14 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO. KUNST. EDITIONEN.<br />
Limitierte Edition von Werner Pawlok, 110 x 154 cm, signiert, €720 (Kaschierung auf Wunsch)<br />
Objekte von Molteni | Avenso AG, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Berlin, Deutschland<br />
Gegründet von Sammlern, getragen von 160 anerkannten<br />
Künstlern und Talenten der großen Hochschulen, hat sich<br />
LUMAS ganz der Idee gewidmet, inspirierende Kunst im<br />
Original als erschwingliche Editionen anzubieten.<br />
AACHEN | BIELEFELD | BREMEN | DORTMUND | DÜSSELDORF<br />
FRANKFURT | HAMBURG | HEIDELBERG | KÖLN | MÜNCHEN | MÜNSTER | STUTTGART<br />
BERLIN | LONDON | NEW YORK | PARIS | WIEN | ZÜRICH<br />
LUMAS.DE
T I T E L<br />
VOM FUROR DES<br />
FORTSCHRITTS<br />
Homo-Ehe, Sexismus-Streit, ein gesäubertes Vokabular – und<br />
Einheitstoiletten als Symbol gegen die Repression: Es triumphiert die<br />
Avantgarde der progressiven Gesinnung. Wer dabei nicht mitmachen will,<br />
stellt sich ins gesellschaftliche Abseits. Nachrichten aus dem politisch<br />
korrekten deutschen Frühling<br />
VON REINHAR D MOH R<br />
16 <strong>Cicero</strong> 4.2013
4.2013 <strong>Cicero</strong> 17
T I T E L<br />
S<br />
EIT EH UND JE steht der Berliner<br />
Bezirk Kreuzberg im berechtigten<br />
Verdacht, ein quicklebendiges<br />
Laboratorium sozialer Utopien<br />
zu sein. Nirgendwo sonst<br />
wurden in den achtziger Jahren so viele<br />
Häuser besetzt, nirgendwo sonst hatte<br />
die konkrete Anarchie des Alltags so viel<br />
Auslauf, und nirgendwo sonst wurde der<br />
1. Mai, internationaler „Kampftag“ der Arbeiterklasse,<br />
derart beim Wort genommen.<br />
So war es nur konsequent, dass diese revolutionäre<br />
Tradition auch nach der politisch<br />
zunächst verschmähten Wiedervereinigung<br />
mit dem Ostberliner Bezirk Friedrichshain<br />
fortgesetzt wurde.<br />
Unter der doppelten Regentschaft<br />
des Königs von Kreuzberg, Christian<br />
Ströbele I., und seines grünen Bezirksbürgermeisters<br />
Franz Schulz geht FriedrichshainKreuzberg<br />
seinen anti imperialistischökofeministisch-multikulturellen<br />
Weg<br />
unbeirrt weiter. Die letzte Errungenschaft<br />
ist erst ein paar Wochen alt: die Unisex-Toilette.<br />
In der Drucksache Nr. DS/0550/IV<br />
der Bezirksverordnetenversammlung heißt<br />
es, dass diese neuartigen Toilettenanlagen<br />
in öffentlichen Gebäuden von Menschen<br />
benutzt werden sollen, „die sich (1) entweder<br />
keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen<br />
können oder wollen oder aber (2)<br />
einem Geschlecht, das sichtbar nicht ihrem<br />
biologischen Geschlecht entspricht“. Spontan<br />
fallen einem hier etwa die Dschungelkämpferin<br />
Olivia Jones ein, womöglich<br />
auch Tony Marshall und Jens Riewa.<br />
Selbstverständlich belassen es die Kräfte<br />
des Fortschritts nicht bei vergleichsweise<br />
banalen Handreichungen im Zuge der unzweifelhaft<br />
komplexer gewordenen Verrichtung<br />
menschlicher Notdurft. Nein, sie liefern<br />
höhere Soziologie, Erkenntnistheorie<br />
und Metaphysik gleich mit. Die Unisex-<br />
Toilette verhindere eine tendenziell repressive<br />
„Selbstkategorisierung in das binäre<br />
Geschlechtersystem“. Originalton Drucksache<br />
DS/0550/IV: „Das kann selbst für<br />
Menschen, die sich prinzipiell zuordnen<br />
können, dazu aber nicht ständig angehalten<br />
werden möchten, angenehm sein. Sie<br />
regen außerdem dazu an, über Geschlechtertrennungen<br />
im Alltag nachzudenken.“<br />
Ein Quantensprung: die Toilette als<br />
Ort der Selbstreflexion, Ausgang aus der<br />
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Wenn<br />
Immanuel Kant davon gewusst hätte, wäre<br />
Königsberg zum Clochemerle Preußens<br />
geworden. Der kategorische Imperativ als<br />
dringende Bedürfnisklärung: Wo pinkle<br />
ich, wer bin ich, und wenn ja, wie viele?<br />
Endlich sind reaktionär verkürzte und polemisch-chauvinistische<br />
Selbstzuschreibungen<br />
jenseits des Gender-Mainstreaming<br />
wie „Ich muss mal!“ passé. Wie lange haben<br />
wir auf diese Befreiung gewartet!<br />
„Deutschland – Land der Ideen“ lautete<br />
das Motto zur Fußballweltmeisterschaft<br />
2006. Damals wurde es von nicht<br />
wenigen belächelt. Heute sehen wir, dass<br />
es keine leere Parole war. „Völker der Welt,<br />
schaut auf diese Stadt!“, möchte man mit<br />
Ernst Reuter ausrufen. In Friedrichshain-<br />
Kreuzberg beginnt die Zukunft schon<br />
jetzt. Einen Flughafen braucht es dafür<br />
am allerwenigsten.<br />
Im Frühling 2013 aber fegt der frische<br />
Sausewind des unaufhaltsamen Fortschritts<br />
in ganz Deutschland die letzten<br />
Reste konservativ-reaktionärer Verkrustungen<br />
hinweg. Obwohl in Berlin eine Eiserne<br />
Lady regiert, die Europa unter der<br />
Knute ihres unbarmherzigen Spardiktats<br />
in Angst und Schrecken hält, übt sich die<br />
deutsche Gesellschaft derzeit in einem<br />
täglichen Wettlauf um mehr Weltoffenheit,<br />
Liberalität und progressive Gesinnung.<br />
Schon die „Sexismus“-Debatte hat<br />
gezeigt, dass nun auch die letzten Winkel<br />
frauenfeindlicher Einstellungen gnadenlos<br />
ausgeleuchtet werden, selbst in den Redaktionen<br />
der führenden Nachrichtenmagazine<br />
und Illustrierten. Der Stern etwa erwägt,<br />
will man Gerüchten glauben, die<br />
ILLUSTRATIONEN: LISA ROCK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS (SEITEN 16 BIS 18)<br />
18 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Einstellung einer Frauenbeauftragten, die<br />
auch die Gestaltung allzu busenlastiger Titelbilder<br />
überwachen soll. Schließlich hat<br />
die Auseinandersetzung über Sexismus sogar<br />
den Bundespräsidenten erreicht, der gewagt<br />
hatte, das Wort vom „<strong>Tugendfuror</strong>“<br />
in den Mund zu nehmen.<br />
„Durch die Verwendung dieses Wortes“,<br />
so schrieben sieben empörte junge Frauen,<br />
darunter Protagonistinnen der #Aufschrei-<br />
Debatte, in einem offenen Brief an Joachim<br />
Gauck, „bringen Sie erniedrigende,<br />
verletzende oder traumatisierende Erlebnisse<br />
sowie das Anliegen, diese Erfahrungen<br />
sichtbar zu machen, in Verbindung mit<br />
dem Begriff Furie.“ Da das Wort verwendet<br />
werde, um die Wut der Frauen lächerlich<br />
zu machen, bediene er „jahrhundertealte<br />
Stereotype über Frauen“. Die Idee zum<br />
Brief hatte die 23-jährige Studentin Jasna<br />
Lisha Strick: „Wenn man so ein supereigenartiges<br />
Wort wie <strong>Tugendfuror</strong> liest, tut<br />
das weh und macht wütend.“<br />
Vielleicht wären Schmerz und Wut ein<br />
wenig kleiner gewesen, hätte frau zuvor mal<br />
kurz in den Duden geschaut. Womöglich<br />
wäre ihr dann der Gedanke gekommen,<br />
dass Gauck mit diesem supereigenartigen<br />
Wort vor allem die Raserei, also den Furor<br />
unserer medialen Erregungs- und Entrüstungsgesellschaft<br />
meinte, deren Talkshows<br />
sich binnen weniger Tage in eine Art virtuelles<br />
Dauertribunal hineingesteigert haben,<br />
das kaum weniger hysterisch und heuchlerisch<br />
war als die Revolutionstribunale von<br />
Fouquier-Tinville und Robespierre zwischen<br />
1793 und 1794.<br />
Doch auf derart feine Unterscheidungen<br />
kann der rasende Fortschritt keine<br />
Rücksicht nehmen. Das gilt nicht zuletzt<br />
für unsere Essgewohnheiten, die nicht<br />
bleiben können, wie sie sind. Täglicher<br />
Fleischkonsum, und sei es nur die bayerische<br />
Wurstsemmel in der Brotzeit – weg<br />
damit! Donnerstag ist „Veggie-Tag“, auch<br />
am Münchner Viktualienmarkt und in der<br />
weiß-blauen Landtagskantine. Die einzige<br />
Frage ist: Darf man „Mohrrübchen“ oder<br />
„Schwarzwurzeln“ anbieten?<br />
Völlig klar ist dagegen: Die „kleine Hexe“<br />
oder „zehn kleine Negerlein“ im Kinderbuch<br />
– das geht gar nicht. Auch der historische<br />
Begriff der „Hexenverbrennung“<br />
muss überdacht werden. Selbst die katholische<br />
Kirche hat ja ihre „Heilige Inquisition“<br />
schon in die unverfängliche „Glaubenskongregation“<br />
verwandelt. Besorgte<br />
Sozialpädagogen fordern längst die systematische<br />
Durchkämmung aller Kinderbücher<br />
nach 1918. Und was ist eigentlich mit<br />
Lukas, dem Lokomotivführer (!), der mit<br />
seiner „Emma“ (!) durch Lummerland (!)<br />
gondelt, um am Ende noch den kleinen Jim<br />
Knopf in die dampfend-stählerne (!) Männerdomäne<br />
(!) einzuführen (!)? Geht’s noch<br />
patriarchalischer? Wo bleibt das Nachdenken<br />
über den binären Geschlechter-Code?<br />
Derweil durchforsten die Säuberungskommandos<br />
der Netz-„Community“ sogar<br />
den Otto-Katalog aus Hamburg. Und<br />
siehe da, sie wurden fündig. Das Corpus<br />
delicti: Ein blaues, kurzärmeliges T-<br />
Shirt mit der Aufschrift „In Mathe bin ich<br />
Deko“. Hätte Dieter Bohlen oder Stefan<br />
Raab dringesteckt – kein Problem. Es wäre<br />
der Brüller gewesen, ein Must-have für alle<br />
starken Typen, die die Infinitesimalrechnung<br />
gehasst haben wie Kniestrümpfe und<br />
kurze Lederhosen. Leider hat der Otto-Versand<br />
ein kleines Mädchen posieren lassen,<br />
und schon brach auf Facebook und Twitter<br />
der Shitstorm los: „Reaktionär, chauvinistisch,<br />
sexistisch!“ Das üble Klischee von<br />
den mathematisch unbegabten Frauen! Ha!<br />
Dass Frauen den Slogan entworfen hatten,<br />
spielte hier keine Rolle. Provokation, Ironie?<br />
Moralisten kennen keine Ironie! Nach<br />
zwei Tagen knickte Otto ein und nahm das<br />
T-Shirt aus dem Markt. Man darf gespannt<br />
sein, wann die erste #Aufschrei-Brigade politisch<br />
unkorrekte Kabarettisten aufstöbert<br />
und an den Pranger stellt.<br />
Die Sprache ist ein Abbild der Realität,<br />
und wenn der soziale Fortschritt einmal<br />
eine Atempause einlegt, bleibt immer<br />
noch die Ächtung politisch unkorrekter<br />
Bezeichnungen, die sie falsch oder diskriminierend<br />
darstellen. So hat die Nationale<br />
Armutskonferenz jüngst 23 „soziale<br />
Unwörter“ aufgespürt, darunter sogar<br />
das moderne Attribut „alleinerziehend“.<br />
Grund: Der Begriff sage „nichts über mangelnde<br />
soziale Einbettung oder gar Erziehungsqualität“.<br />
Wir verstehen: Ein solches<br />
Wort kann man nicht einfach so allein stehen<br />
lassen. Man müsste gleich einen ganzen<br />
Aufsatz schreiben. Auch von „Arbeitslosen“<br />
soll fortan nicht mehr die Rede sein.<br />
Stattdessen muss es „Erwerbslose“ heißen,<br />
weil es „viele Arbeitsformen gibt, die kein<br />
Einkommen sichern“.<br />
Als gesellschaftliche Idealfigur erscheint<br />
hier Johannes Ponader, Noch-Geschäftsführer<br />
der Piratenpartei, der sich jeder<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 19<br />
Anzeige<br />
Thomas de Maizière<br />
steht Rede<br />
und Antwort<br />
384 Seiten, gebunden, € 22,99 [D]<br />
Auch als E-Book erhältlich<br />
Thomas de Maizière gewährt in<br />
diesem Buch tiefe Einblicke in<br />
das Innenleben der Politik. Er<br />
spricht außergewöhnlich offen<br />
über Themen wie innere Sicherheit,<br />
Guttenbergs Doppelspiel<br />
und gefallene Soldaten. Dabei<br />
spart er nicht mit Kritik – auch<br />
an der eigenen Partei.<br />
Ein eindrucksvolles Buch über<br />
Macht, Werte und Regieren.<br />
Siedler<br />
www. siedler-verlag.de
T I T E L<br />
autoritären Definition seiner hochsensiblen<br />
Identität entzieht – bis in den Privatbereich<br />
hinein, wo er sich „polyamor“, als<br />
nach allen Seiten offener Zeitgenosse auslebt.<br />
Er hat verstanden, was Judith Butler<br />
sagt: Geschlecht und Eros sind nichts als<br />
ein „soziales Konstrukt“. Wer daran arbeitet,<br />
ist also keinesfalls arbeitslos, auch wenn<br />
er von Hartz IV lebt.<br />
Zugegeben: Es ist auch wirklich nicht<br />
ganz leicht, die jeweils richtigen Worte zu<br />
finden. Nachdem etwa der gute alte „Ausländer“<br />
schon vor Jahren durch die „Person<br />
mit Migrationshintergrund“ ersetzt<br />
wurde (Kurzform: Migrant), erweist sich<br />
nun selbst diese Formulierung als diskriminierend,<br />
weil sie „häufig mit einkommensschwach,<br />
schlecht ausgebildet und<br />
kriminell in Zusammenhang gebracht“<br />
werde. Auch die Bezeichnung „Person mit<br />
Migrationshintergrund ohne eigene Migrationserfahrung“<br />
ist also nicht restlos korrekt.<br />
Sogar die Sprachsäuberer der Nationalen<br />
Armutskonferenz also wissen hier keine<br />
klinisch reine Endlösung.<br />
Immerhin ist beim Ausdruck „bildungsferne<br />
Schichten“, auch schon ein<br />
weich gespülter Neologismus aus dem<br />
Geist des Warmbadetags, guter Rat zur<br />
Hand. „Fern vom Bildungswesen“ sollen<br />
wir nun sagen. Besser noch: „vom Bildungswesen<br />
nicht Erreichte“.<br />
Rainer Brüderle hat all das noch nicht<br />
begriffen. Hätte er mit der jungen Stern-<br />
Kollegin an der Bar des Maritim-Hotels<br />
über soziale Geschlechterdifferenz,<br />
korrekte Genderpolitik und das poststrukturalistische<br />
Rhizom-Konzept von Deleuze/<br />
Guattari gesprochen, wäre ihm die Dirndl-<br />
Sache erst gar nicht in den Sinn gekommen.<br />
Aber so ist das mit alten, peinlich zurückgebliebenen<br />
Männern: Sie leben noch voll<br />
das anachronistische Programm 1.0. Und<br />
dabei ahnen sie noch nicht einmal, was<br />
ihnen in diesem Bücherfrühling prophezeit<br />
wird: Ganz schlicht „Das Ende der<br />
Männer“.<br />
Hinterwäldlerische Null-Checker<br />
sind auch jene Zeitgenossen, die das voll<br />
krasse Sprachgemisch namens „Kiezdeutsch“<br />
nicht umstandslos für eine segensreiche<br />
Erweiterung der deutschen<br />
Hochsprache halten. „Geh isch Aldi, Alter!“<br />
ist eben kein Ausdruck „reduzierter<br />
Grammatik“, wie rassistische Ignoranten<br />
behaupten, die nur Goethe und Thomas<br />
Mann gelten lassen, sondern vielmehr<br />
„eine faszinierende Entwicklung in<br />
unserer Sprache“. Das jedenfalls erklärt<br />
eine Potsdamer Professorin. Mögen Ausrufe<br />
wie „Mach isch disch Krankenhaus!“<br />
wahlweise „Schlag isch disch Urban!“ in<br />
ihrem semantischen Gehalt durchaus diskussionswürdig<br />
sein, was ihre tendenziell<br />
aggressive Botschaft betrifft, so spiegeln sie<br />
doch den signifikanten linguistischen Austausch<br />
zwischen unterschiedlichen Kulturen.<br />
German Mainstreaming ist hier das<br />
Zauberwort, die multikulturelle Angleichung<br />
der Sprechverhältnisse.<br />
Überhaupt, die faszinierende Vielfalt<br />
der Kulturen. Nachdem nun offiziell geworden<br />
ist, dass Zehntausende Roma und<br />
Sinti aus Bulgarien, Rumänien und anderen<br />
südosteuropäischen Staaten nach<br />
Deutschland einwandern, wird als Erstes<br />
der Rassismus bekämpft, der aus den Problemen<br />
resultieren könnte, die diese neue<br />
Form europäischer Armutswanderung unweigerlich<br />
mit sich bringt. Vor allem Claudia<br />
Roth, die Schmerzensfrau des grünen<br />
Gutmenschentums, tut sich dabei hervor,<br />
tatsächliche soziale Probleme zu leugnen,<br />
indem sie in einer Art moralischer Übersprungshandlung<br />
mögliche Reaktionen darauf<br />
zur einzig wahren Gefahr für Frieden<br />
und Freiheit darstellt. Auch der Migrationsforscher<br />
Klaus J. Bade ist ein Meister<br />
in der Disziplin „Flucht in die Ideologiekritik“,<br />
bei der die Konflikte einer Einwanderungsgesellschaft<br />
– und das ist die Bundesrepublik<br />
– fast ausschließlich auf das<br />
Schuldkonto der tendenziell „rassistischen“<br />
ILLUSTRATION: LISA ROCK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS<br />
20 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Anzeige<br />
Mehrheitsgesellschaft gebucht werden.<br />
Stets liegt ein deutliches, wenn auch unhörbares<br />
„Schämt euch!“ in der Luft.<br />
So kommt es, dass sogar die Berliner<br />
Staatsanwaltschaften, die sich in einem<br />
Brief an den Justizsenator über die mangelhafte<br />
personelle wie technische Ausstattung<br />
ihrer Ämter beklagten, Angst vor der eigenen<br />
Courage haben, wenn es um Tatsachen<br />
geht, die ihnen selbst vorliegen. Die Zahl<br />
der Verfahren sei stark gestiegen, schrieben<br />
sie laut Tagesspiegel. Allein der Zuzug<br />
von Menschen aus Rumänien und aus anderen<br />
Ländern Osteuropas habe zu einer<br />
„Explosion“ bei Einbrüchen und Diebstählen<br />
geführt. Aber das dürfe man ja nicht<br />
laut sagen. Wieso man das nicht darf, wenn<br />
es doch stimmt, wird leider nicht weiter<br />
ausgeführt.<br />
Eine extreme Blüte jener politischen<br />
Korrektheit, die die alte Ausländerfeindlichkeit<br />
durch eine neue Inländerfeindlichkeit<br />
kompensieren will, bot dieser Tage ein<br />
Leserblog in der taz. Nachdem Dutzende<br />
Asylbewerber seit Monaten auf dem Kreuzberger<br />
Oranienplatz campieren, um gegen<br />
das „unmenschliche“ deutsche Asylverfahren<br />
zu demonstrieren, schlug Blogger „Cometh“<br />
ein ganz neues Verfahren vor: „In<br />
den besseren Bezirken sollte jeder Berliner<br />
mit einer 3-Zi-Wohnung aufgefordert werden,<br />
einen Flüchtling aufzunehmen. Das<br />
wäre gelebte internationale Solidarität<br />
(natürlich gegen Kostenersatz vom Senat).<br />
Aber das nur, wenn unsere FreundInnen<br />
damit einverstanden sind, denn sie sind<br />
traumatisiert und Flüchtlinge und wollen<br />
vielleicht gar nicht mit ihren Unterdrückern<br />
und denjenigen, die an Waffengeschäften<br />
verdient haben, in einer Wohnung<br />
sein.“<br />
In Dahlem, Friedenau, Wilmersdorf<br />
und Charlottenburg konnte man das Aufatmen<br />
der ansässigen Sklavenhalter, Blutsauger<br />
und Waffenhändler förmlich hören.<br />
Aber letztlich geht es hier nicht um Einzelschicksale.<br />
Es geht, wie oft in Deutschland,<br />
ums Ganze, Grundsätzliche. Alles<br />
soll gut werden. Es soll überall solidarisch<br />
und gerecht zugehen, friedlich und demokratisch.<br />
Weil die Wirklichkeit aber seit<br />
Menschengedenken nicht solidarisch und<br />
gerecht ist, oft auch nicht friedlich und<br />
demokratisch, muss kräftig nachgeholfen<br />
werden.<br />
Das eine Mittel deutscher Fortschrittsfreunde<br />
ist die Verbesserung der Welt<br />
durch die Veränderung der Worte, mit<br />
denen sie beschrieben wird. Ein schlechter<br />
Schüler, gar ein „dummer Bub“, wie<br />
es früher im Frankfurter Bembel-Soziotop<br />
hieß, ist dann eben ein „vom Bildungswesen<br />
nicht Erreichter“. So muss sich das Bildungswesen<br />
ganz mächtig anstrengen, um<br />
an ihn ranzukommen. (Für die jüngeren<br />
Leser: Früher war das eher andersherum.)<br />
Sitzen bleiben soll der bildungsferne Bub<br />
aber keinesfalls mehr.<br />
Die andere, deutlich schwierigere Strategie<br />
ist die Verbesserung der Welt durch<br />
ihre systematische Veränderung. Ein äußerst<br />
anspruchsvolles Programm, an dem<br />
sich seit der Antike schon unzählige Generationen<br />
versucht haben. Wunsch und<br />
Wirklichkeit, Ideal und Realität, geraten<br />
dabei häufig durcheinander. Nicht selten<br />
wird die Wunschvorstellung mit einer bereits<br />
veränderten Wirklichkeit verwechselt.<br />
Dabei zielt der Kampf stets in eine<br />
Richtung: Jeder soll anders sein dürfen,<br />
aber auch ganz gleich – genau wie alle anderen.<br />
Auch wenn sich viele Menschen<br />
selbst diskriminieren, also von anderen<br />
ganz bewusst unterscheiden wollen – diskriminiert<br />
werden dürfen sie keinesfalls. So<br />
wird unermüdlich das Lob unserer buntindividualistischen,<br />
schrillen, multikulturellen<br />
Patchwork-Gesellschaft gesungen, in<br />
der vor allem das andere, Nonkonformistische,<br />
Subversive, Randständige und Kreative<br />
zählen. Im selben Atemzug aber verlangt<br />
man Gleichheit in allen Lebenslagen,<br />
viel mehr also als die grundgesetzlich garantierte<br />
Gleichheit jedes Bürgers vor dem<br />
Gesetz. Auch der Anarcho-Punk im besetzten<br />
Haus, der „Fuck off Deutschland!“ und<br />
„Scheißsystem!“ an die Wände sprüht, soll<br />
Anspruch auf das Ehegattensplitting haben,<br />
wenn er mit Matze und Hund Bakunin<br />
eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht.<br />
Alles was recht ist.<br />
Dass zum Beispiel eine strikt angewandte<br />
Frauenquote dazu führen kann,<br />
den Gleichheitsgrundsatz im konkreten<br />
Fall auszuhebeln, zeigt nur, wie im Namen<br />
des gesellschaftlichen Fortschritts manches<br />
noch gleicher sein darf als gleich. Das „Allgemeine<br />
Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG)<br />
hat hier schon Pionierarbeit geleistet. Ein<br />
Zahnarzt, der eine technisch-medizinische<br />
Assistentin einstellen will, darf nicht verlangen,<br />
dass sie im Dienst ihr islamisches<br />
Kopftuch ablegt. Wenn er sie deshalb abweist,<br />
muss er Strafe zahlen. Es sei denn, er<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 21
T I T E L<br />
Stets liegt ein deutliches,<br />
wenn auch unhörbares<br />
„Schämt euch!“ in der Luft<br />
ist so schlau, einen anderen, unverfänglichen<br />
Grund vorzuschieben.<br />
Nun also liefern Entscheidungen des<br />
Bundesverfassungsgerichts über die letzten<br />
rechtlichen Details einer absoluten Gleichstellung<br />
homosexueller Partnerschaften mit<br />
der bürgerlichen Ehe neuen Stoff für den<br />
großen Gleichheitsdiskurs. Unverkennbar<br />
zieht hier ein Hauch jenes „social engineering“<br />
durchs Land, jenes sozialrevolutionären<br />
Ingenieurwesens aus den zwanziger<br />
und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts,<br />
das nicht neue Maschinen bauen wollte,<br />
sondern den „neuen Menschen“. Am Reißbrett<br />
systematischer Gesellschaftsplanung<br />
wurde die allumfassende egalitäre Persönlichkeit<br />
entworfen, die sich von allen rückständigen<br />
Traditionen gelöst hat und in<br />
den großen Kollektiven der kommunistischen<br />
Lebenswirklichkeit ihre historische<br />
Erfüllung am roten Horizont der endlich<br />
befreiten Humanität findet.<br />
Zugegeben, heute geht es weniger pathetisch<br />
zu, ja geradezu putzig und bieder.<br />
Niemand will sich im Industriekombinat<br />
„Roter Oktober“ selbst verwirklichen. Doch<br />
die strenggläubige neue linke Betulichkeit,<br />
die vom Spießertum nicht immer zu unterscheiden<br />
ist (Achtung: Diskriminierung!),<br />
verlangt strikten Gehorsam, wenn<br />
es um den sozialen Fortschritt geht. Weh<br />
dem, der da nicht umstandslos und fröhlich<br />
in den Chor miteinstimmt und den<br />
Hinweis auf „neue Lebenswirklichkeiten“<br />
nicht als einziges schlagendes Argument<br />
gelten lässt! Weh dem, der über die fortschreitende<br />
Entkopplung biologischer und<br />
sozialer Realitäten samt ihren möglichen<br />
Folgen wenigstens ernsthaft reden will: Er<br />
ist ein hoffnungsloser Reaktionär, über den<br />
sich selbst Guido Westerwelle lustig macht,<br />
jener Mann, der noch vor einiger Zeit „altrömische<br />
Dekadenz“ in Deutschland beklagt<br />
hat und so selbst zu einem reaktionären<br />
Bösewicht wurde.<br />
Nein, nun müssen alle frohgemut und<br />
zukunftstrunken mitmachen beim großen<br />
Zug der Zeit; wer da fragend, gar mäkelnd<br />
zurückbleibt, den soll der Teufel, Pardon:<br />
die Teufelin holen.<br />
Das Schöne: Die Avantgarde der progressiven<br />
Gesinnung braucht keine Kritik,<br />
denn sie ist ja die Kritik in Person, auf die<br />
sie ein lebenslanges Abo hat. Wer sich also<br />
kritisch gegenüber den notorischen Gesellschaftskritikern<br />
äußert, stellt sich selbst ins<br />
Abseits. Und so triumphiert ein vermeintlich<br />
fortschrittlicher Mainstream ganz entspannt<br />
im Hier und Jetzt, gleichsam en passant.<br />
Auf echte Diskussion kann er locker<br />
verzichten.<br />
Auch der kritische Journalismus reiht<br />
sich da gern ein in die Einheitsfront. Vor allem<br />
das öffentlich-rechtliche Radio hat sich<br />
zum Vorreiter einer politischen Korrektheit<br />
gemacht, die andere Positionen nur noch<br />
als lästige Randerscheinungen wahrnimmt.<br />
„100 Prozent Quote!“, jubilierte eine Woche<br />
lang „Radio 1“ vom RBB – vom 4. bis<br />
8. März 2013 durften nur Frauen ans Mikro.<br />
Kein Wunder, dass auch eine lesbische<br />
Partnerschaft – „Mama und Mami“ –<br />
ausführlich zu Wort kam. Zwei Töchter<br />
sind der Beziehung entsprungen, für die<br />
ein passender Samenspender ausfindig gemacht<br />
wurde: die perfekte „Regenbogenfamilie“.<br />
Wer bei vier gleichgeschlechtlichen<br />
Wesen im Haus den bunten Regenbogen<br />
vermisst, dem ist wirklich nicht zu helfen.<br />
Hauptsache, der männliche Träger des<br />
„genetischen Materials“ (O-Ton Mama) hat<br />
der Adoption jeweils zugestimmt. Jetzt darf<br />
er alle paar Wochen mal vorbeischauen.<br />
„Erziehungsaufgaben hat er nicht“, stellt<br />
Mama zur Sicherheit klar. So weit kommt’s<br />
noch, dass das genetische Material über<br />
Schulprobleme seiner Kinder mitdiskutieren<br />
darf.<br />
Eine einzige kritische Frage oder skeptische<br />
Anmerkung der Moderatorin? Göttin<br />
bewahre!<br />
Nebbich.<br />
Wir freuen uns jedenfalls schon auf die<br />
Einweihung der ersten Kreuzberger Unisex-Toilette<br />
am 1. Juni, um endlich einmal<br />
wieder in Ruhe über „Geschlechtertrennungen<br />
im Alltag nachzudenken“.<br />
Wie sagte einst Karl Valentin zu Liesl<br />
Karlstadt: Es ist so einfach, und man kann<br />
sich’s doch nicht merken.<br />
R EINHAR D MOHR<br />
lebt in Berlin. Im April erscheint<br />
sein Buch „Bin ich jetzt<br />
reaktionär? Bekenntnisse eines<br />
Altlinken“<br />
ILLUSTRATION: LISA ROCK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS; FOTO: RAINER JENSEN/POOL/DDP IMAGES/DAPD<br />
22 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Mit <strong>Cicero</strong> durch das<br />
Wahljahr 2013<br />
Unser<br />
GESCHENK<br />
für Sie<br />
Ihre Abovorteile:<br />
Mehr Inhalt<br />
Sie erhalten zusätzlich<br />
4 x im Jahr das Magazin<br />
Literaturen.<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo sparen<br />
Sie über 10 % gegenüber<br />
dem Einzelkauf.<br />
Unser Geschenk<br />
Genießen Sie die Edel-<br />
Schokolade „Oster-Knusper“<br />
von Lindt.<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
Bundestagswahl 2013<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.<br />
Ich abonniere <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis.<br />
Bitte senden Sie mir <strong>Cicero</strong> monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit nur 7,– EUR / 5,–<br />
EUR (Studenten) pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im Einzelkauf).* Das Dankeschön erhalte<br />
ich nach Zahlungseingang. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein<br />
und können das Abonnement jederzeit kündigen.<br />
Meine Adresse<br />
*Preis im Inland inkl. MwSt. und Versand, Abrechnung als Jahresrechnung über zwölf Ausgaben,<br />
Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH,<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
Bei Bezahlung per Bankeinzug erhalten Sie eine weitere Ausgabe gratis.<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Kontonummer<br />
Name<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Ich bin Student.<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden einer<br />
E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen<br />
werden.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong> abonnieren!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/lesen<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 946126
T I T E L<br />
„ICH BIN GEGEN VERBOTE“<br />
Die Feministin ANNA-KAT HAR I N A M ESSMER über ihren Brief an<br />
Gauck, Furien und Furor, den Sexismus und die Medien<br />
F<br />
rau Meßmer, Sie und sechs<br />
andere Feministinnen haben<br />
Bundespräsident Joachim<br />
Gauck in einem offenen Brief angegriffen,<br />
weil er in einem Spiegel-Interview<br />
im Zusammenhang mit der Sexismus-<br />
Debatte von „<strong>Tugendfuror</strong>“ sprach. Was<br />
stört Sie so an diesem Begriff?<br />
Erstens greift das Wort „Tugend“ auf<br />
uralte Klischees zurück, wonach<br />
Frauen anständig, zurückhaltend und<br />
jungfräulich sein sollten. Zweitens<br />
hat „Furor“ den gleichen Wortstamm<br />
wie der Begriff der „Furie“, der ähnlich<br />
wie „Hysterie“ dazu verwendet<br />
wird, inhaltliche Kritik von Frauen<br />
abzuwerten.<br />
„Furor“ stammt aus dem Lateinischen –<br />
Wut, Zorn. Das Wort „Furie“ wurde im<br />
Deutschen erst im 18. Jahrhundert zum<br />
Synonym für rachsüchtige, wütende Weiber.<br />
Die semantische Verbindung zur Furie<br />
haben Sie doch erst hergestellt.<br />
Das haben Sie gut erklärt. Seit dem<br />
18. Jahrhundert gibt es diese semantische<br />
Verbindung. Und so hat der Bundespräsident<br />
eine inhaltliche Debatte zu einer<br />
wutgetriebenen umgedeutet und noch ergänzt,<br />
dass er kein flächendeckendes Problem<br />
erkennen könne.<br />
Gerade Ihre ursprüngliche Aktion lief unter<br />
dem Stichwort „Aufschrei“. Das klingt<br />
doch bereits recht wutgetrieben.<br />
Auch Sie versuchen jetzt vom eigentlichen<br />
Thema, nämlich Sexismus, abzulenken,<br />
indem Sie die Form kritisieren. Und<br />
dabei die immer gleichen Stereotype bemühen.<br />
Wer sich die vielen Blogbeiträge<br />
zu diesem Thema anschaut, wird schnell<br />
feststellen: Hier sind Frauen und Männer<br />
in einen konstruktiven Austausch<br />
miteinander getreten. Die vermeintliche<br />
Hysterie ist eine Zuschreibung. Genauso<br />
wie der Vorwurf, es ginge uns um<br />
Sprech- und Denkverbote. Das Gegenteil<br />
ist der Fall: Wir wollen eine offene Debatte<br />
darüber, wie wir ohne Sexismus zusammenleben<br />
können. Dazu muss eine<br />
Gesellschaft auch mal aushalten können,<br />
dass Menschen für ihr Verhalten und ihre<br />
Aussagen kritisiert werden.<br />
Mit Verlaub: Der Ton der Aufschrei-Bewegung<br />
war nicht immer sachlich. Yasmina<br />
Banaszczuk, eine der Unterzeichnerinnen<br />
des Briefes, beschimpft ihre Kritiker in<br />
einem Blogeintrag als „Arschlöcher“. Ist<br />
das eine angemessene Dialogform für<br />
Feministinnen?<br />
Nein, das stimmt so nicht. Frau<br />
Banaszczuk meint damit nicht diejenigen,<br />
die den offenen Brief oder uns inhaltlich<br />
kritisierten. Sie wehrt sich vielmehr gegen<br />
massive Anfeindungen.<br />
Anna-Katharina Meßmer, Soziologin, SPD-Mitglied, ist in Bayern<br />
aufgewachsen. Damals wollte sie Pfarrerin werden. Als sie begriff, dass das in<br />
der katholischen Kirche nicht möglich war, wurde sie zur Feministin<br />
Können Sie ein Beispiel nennen?<br />
Unmengen. Wir werden bei Twitter, per<br />
Mail und SMS, aber auch im persönlichen<br />
Gespräch als „Huren“, „Fotzen“<br />
und „Schlampen“ bezeichnet. Auch unter<br />
dem offenen Brief gingen Kommentare<br />
ein, die wir nicht freigeschaltet haben:<br />
Wir seien frigide, untervögelt, wir sollten<br />
die Fresse halten. Das geht bis zu Vergewaltigungsdrohungen<br />
und Stalking. Wir<br />
versuchen diese Debatte trotzdem ruhig,<br />
unaufgeregt und inhaltlich zu führen.<br />
FOTO: ANJA LEHMANN FÜR CICERO; KARIKATUR: HAUCK & BAUER<br />
24 <strong>Cicero</strong> 4.2013
In Ihrem Brief befreien Sie die Männer von<br />
einer „Kollektivschuld“, um im Satz danach<br />
festzustellen, dass Sexismus ein „kollektives<br />
Phänomen“ sei. Was denn nun?<br />
Nehmen wir ein Beispiel: Wenn sich ein<br />
Chef von 20 Mitarbeiterinnen schlecht<br />
verhält, dann sind diese im schlimmsten<br />
Fall alle vom Sexismus eines Mannes betroffen.<br />
In Bezug auf die Opfer sprechen<br />
wir von einem „kollektiven Phänomen“.<br />
Wenn ich aber nach diesem Vorfall alle<br />
Männer des Betriebs als Täter bezeichnen<br />
würde, wäre das die Unterstellung einer<br />
„Kollektivschuld“. Das ist ein maßgeblicher<br />
Unterschied.<br />
Ihre Botschaften scheinen nicht nachhaltig<br />
gewesen zu sein. Die Spiegel-Journalistin<br />
Annett Meiritz, die zuerst über<br />
sexistische Anfeindungen von Piraten<br />
berichtet hatte, nannte die Sexismus-<br />
Debatte „völlig überdreht“. Die Talkshow-<br />
Moderatorin Anne Will räumte ein: „Wir<br />
reiten Debatten manchmal tot.“<br />
Ja, die Medien waren anscheinend an einem<br />
konstruktiven Dialog nicht interessiert.<br />
Sie deckten eher das Bedürfnis<br />
nach Empörungsgenuss und den Aufgeregtheitsbedarf<br />
und haben damit den Geschlechterkampf<br />
erst geschürt, der den<br />
Aufschrei-Unterstützerinnen so oft vorgeworfen<br />
wurde.<br />
Der „Aufgeregtheitsbedarf“ ist doch auch<br />
Treibstoff Ihrer Kampagne.<br />
Das ist eine typische Art und Weise, jetzt<br />
wieder in die <strong>Tugendfuror</strong>-Richtung zu<br />
gehen – auch weil Sie gleich von Kampagne<br />
sprechen. Der Aufschrei hat Sexismus<br />
als flächendeckendes Problem sichtbar gemacht,<br />
es wurden bestehende Strukturen<br />
und Benachteiligungen kritisiert, und<br />
wir haben uns dafür das Netz zunutzegemacht.<br />
Das Spannende daran ist, dass<br />
die Debatte dort von Anfang an viel, viel<br />
weiter war. Daher auch unser Angebot an<br />
Herrn Gauck, sich mit uns über unsere ja<br />
doch verschiedenen Lebensrealitäten auszutauschen.<br />
Wir suchen den Dialog.<br />
Der Bundespräsident kritisierte die Mechanismen<br />
der Medien, die „tagelang über<br />
das Verhalten eines Politikers“ diskutierten.<br />
Sind Sie und Gauck damit nicht<br />
eigentlich einer Meinung?<br />
Absolut. Wir stimmen Herrn Gauck zu,<br />
dass in der öffentlichen Debatte häufig<br />
personalisiert statt analysiert wird. Auch<br />
die Sexismus-Debatte drehte sich immer<br />
wieder um Rainer Brüderle – und nicht<br />
etwa um die vielen Schicksale, die im<br />
Netz dokumentiert wurden.<br />
Was verlangen Sie von den Medien?<br />
Ich kritisiere, dass die Medien die Überemotionalität,<br />
die in dem Begriff „<strong>Tugendfuror</strong>“<br />
mitschwingt, fortschreiben.<br />
Die Beschimpfungen, von denen ich<br />
eben sprach, wurden zum Teil als kritische<br />
Stimmen zitiert. Das wertet die Probleme<br />
vollkommen ab und schafft ein<br />
Stammtischniveau. Man kann sogar sagen:<br />
Damit machen sich die Medien zu<br />
Komplizen der Sexisten.<br />
Was machen Feministinnen Ihrer Generation<br />
besser als die alten?<br />
Ich will mich von den Feministinnen<br />
der siebziger Jahre nicht abgrenzen – im<br />
Gegenteil.<br />
Ihre Mitunterzeichnerin Anne Wizorek,<br />
die den Hashtag #aufschrei bei Twitter<br />
anregte, sagte: „Das Problem des<br />
Feminismus in Deutschland ist, dass Alice<br />
Schwarzer über jeder Debatte schwebt.“<br />
Richtig. Und wir können doch nicht<br />
Alice Schwarzer als alleinige Vertreterin<br />
unserer Vorgängerinnen sehen.<br />
Sie belegt Platz vier des <strong>Cicero</strong>-Rankings<br />
der 500 wichtigsten deutschen Intellektuellen<br />
– und Platz eins bei den Frauen.<br />
Schön. Wir hören alle auf eine Feministin.<br />
Widersprechen Sie Alice Schwarzer?<br />
An mancher Stelle, ja. Aber – alle arbeiten<br />
sich an Frau Schwarzers Feminismus<br />
ab. Warum reden wir nicht lieber darüber,<br />
wofür wir stehen?<br />
Bitte sehr!<br />
Jüngst habe ich auf einer Veranstaltung<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Vertreterinnen<br />
aus Indien, England und<br />
Deutschland diskutiert, wie Feminismus<br />
international aussehen könnte. Wir fordern<br />
alle Gleichberechtigung, körperliche<br />
Unversehrtheit und Selbstbestimmung.<br />
Das ist doch nichts Neues. In der Emma<br />
schrieb Alice Schwarzer: „Die zu Recht<br />
empörten jungen Frauen fangen wieder<br />
einmal bei Null an.“<br />
Ja, sie hat uns gesagt, dass das keine<br />
Kritik an uns ist, sondern ein Bedauern:<br />
„Dafür habe ich mich in den siebziger<br />
Jahren eingesetzt – und diese Frauen<br />
müssen das immer noch durchkämpfen.“<br />
Trotzdem streiten sich sogar Feministinnen<br />
darüber, was politically correct ist.<br />
Frau Schwarzer fordert das Kopftuch-<br />
Verbot – Sie nicht.<br />
Das ist ein Punkt, bei dem ich nicht ihrer<br />
Meinung bin. Ich lehne Verbote grundsätzlich<br />
ab. Sie als weiße christliche Frau<br />
weiß nichts über die Lebensrealität von<br />
Muslimas. Ich erwarte von Feministinnen<br />
schon das Gleiche, was ich vom Bundespräsidenten<br />
erwarte: die Reflexion der eigenen<br />
Position.<br />
„Slutwalk“, eine Protestgruppe, die sich<br />
gegen das Verharmlosen sexueller Belästigung<br />
wehrt, stritt über die Frage: Darf sich<br />
eine weiße Frau bei einer Demonstration<br />
schwarz anmalen, um auf die Probleme<br />
dieser Bevölkerungsgruppe hinzuweisen?<br />
Ich glaube nicht, dass wir weißen Feministinnen<br />
paternalistisch people of colour<br />
vertreten sollten.<br />
Das heißt, Sie kämpfen nur für die arrivierte,<br />
bürgerliche, weiße Frau?<br />
Nein! Aber ich muss anerkennen, dass ich<br />
eine dieser arrivierten, bürgerlichen, weißen<br />
Frauen bin. Doch wir können lernen<br />
zuzuhören und uns mit den Frauen und<br />
Feministinnen aus aller Welt solidarisch<br />
zeigen. Auch hier gilt: Nur wenn wir einander<br />
mit Respekt und auf Augenhöhe<br />
begegnen, kommen wir weiter.<br />
Das Gespräch führte Petra Sorge<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 25
T i t e l<br />
KulTURKamPF<br />
um die Homo-Ehe<br />
Wer die Gleichstellungslogik bis<br />
ins letzte Detail ausreizen will,<br />
hat Rückenwind und wird sich<br />
durchsetzen. Fragt sich nur, ob<br />
das unsere Gesellschaft nicht<br />
eher spaltet als befriedet<br />
von Udo di Fabio<br />
26 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: GAO JING/XINHUA/GAMMA/LAIF<br />
Traumhochzeit: Bei<br />
einer Modenschau<br />
in Paris schickte<br />
Karl Lagerfeld diese<br />
beiden Bräute auf<br />
den Laufsteg, um<br />
damit ein Zeichen<br />
für die Homo-Ehe<br />
zu setzten. Ein Kind<br />
ist auch schon da<br />
W<br />
ENN EIN REPUBLIKANISCHER<br />
HAUDEGEN wie Clint Eastwood<br />
sich für die sogenannte<br />
Homo-Ehe ausspricht,<br />
ertönt auch für<br />
deutsche Konservative das Signal zum<br />
Rückzug. Nüchtern und nur ein wenig resignativ<br />
hat der ehemalige, von der Union<br />
ins Amt gewählte Präsident des Bundesverfassungsgerichts<br />
Hans-Jürgen Papier<br />
festgestellt, der Gesetzgeber habe bei der<br />
Gleichstellung keine Wahl mehr. Durch<br />
die Einführung der eingetragenen Partnerschaft<br />
im Jahre 2001 und die Billigung<br />
durch das Bundesverfassungsgericht seien<br />
die Würfel gefallen. Die Verfassung stelle<br />
zwar Ehe und Familie unter besonderen<br />
Schutz der staatlichen Ordnung, aber die<br />
Richter haben damals schon erklärt, das<br />
„Besondere“ an diesem Schutz müsse nicht<br />
darin liegen, dass andere Formen des Zusammenlebens<br />
nicht dieselbe Ausgestaltung<br />
für sich beanspruchen können. Und<br />
diesem Anspruch auf gleiche Ausgestaltung<br />
müsse auch stattgegeben werden, weil ansonsten<br />
diskriminiert würde. Das klingt etwas<br />
seltsam, aber Hans-Jürgen Papier hat<br />
recht: So denken nun mal die meisten Gerichte<br />
der westlichen Welt, und der Mainstream<br />
der Intellektuellen geht sowieso in<br />
diese Richtung.<br />
Verfassungsrechtlich scheint dieser Ansatz<br />
konsequent. Das Grundgesetz geht<br />
von der Würde des einzelnen Menschen<br />
aus, gewährleistet für jeden das Recht auf<br />
freie Entfaltung der Persönlichkeit, ganz<br />
nach seinen Vorstellungen, Plänen und<br />
Wünschen. Die sexuelle Orientierung darf<br />
weder von Staat noch Gesellschaft vorgeschrieben<br />
werden. Grenzen bestehen nur<br />
dort, wo die Rechte anderer auf dem Spiel<br />
stehen. So gesehen ist die Ehe ein historisch<br />
gewachsenes, religiös und kulturell<br />
geprägtes Institut, das besonderen Schutz<br />
verdient – aber sie ist nicht exklusiv gegen<br />
den Sinn nach gleichartigen Gemeinschaften<br />
gerichtet.<br />
Greift man hinter solche Rechtserwägungen<br />
auf den ideellen Kern der Ehe,<br />
fällt der Befund kaum anders aus. Die Ehe<br />
unterscheidet sich von bloßen Zweckgemeinschaften<br />
durch jene intime Nähe, die<br />
wir Liebe nennen, und die mit einer gemeinsamen<br />
Lebenspraxis verbunden wird,<br />
mit dem Versprechen, füreinander in guten<br />
wie in schlechten Zeiten einzustehen.<br />
Es ist kein sachlicher Grund zu erkennen,<br />
warum zwei sich liebende Frauen eine solche<br />
Bindung nicht mit entsprechenden<br />
rechtlichen Konsequenzen eingehen sollten.<br />
Es ist nicht einzusehen, warum eine<br />
solche Bindung zweier sich einander versprechender<br />
Männer nicht von der Rechtsordnung<br />
in gleicher Weise geachtet werden<br />
sollte.<br />
Diese Sichtweise entspricht der Bindungsfreundlichkeit<br />
des Grundgesetzes.<br />
Die Verfassung gewährleistet gewiss auch<br />
die ungebundene Freiheit der Menschen,<br />
schützt den, der allein sein will, aber sie<br />
fördert doch besonders jenen Freiheitsgebrauch,<br />
der auf soziale Bindung zielt.<br />
Diejenigen, die sich mit anderen zusammenschließen,<br />
um gemeinsam etwas zu gestalten,<br />
und mit wechselseitigen Pflichten<br />
Verantwortung füreinander übernehmen,<br />
geben dem Einzelnen Stärke und entlasten<br />
andere Solidarverbände. Solche übernommene<br />
Verantwortung verdient den Respekt<br />
der öffentlichen Ordnung. Denn nur<br />
aus einer freiwillig eingegangenen Bindung<br />
wächst eine staatsfreie Gesellschaft, die zwischen<br />
dem isolierten Einzelnen und einer<br />
ansonsten übermächtigen politischen Ordnung<br />
steht: Wir nennen so etwas intermediäre<br />
Kräfte.<br />
GIBT ES ÜBERHAUPT sachliche Gründe, die<br />
einer völligen Gleichbehandlung der Ehe<br />
mit gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften<br />
entgegenstehen? Will man eine<br />
Besonderheit der Ehe über den bestehenden<br />
Text des Grundgesetzes hinaus begründen,<br />
kommt man auf Kinder. Denn<br />
aus der Ehe wachsen Kinder, die dadurch<br />
entstehenden Familien sind ein originärer<br />
Schutz- und Freiheitsraum. Ehe und Familie<br />
sind kleinste, aber zugleich vielleicht<br />
auch wichtigste Einheiten einer Zivilgesellschaft,<br />
die Voraussetzung jeder gelingenden<br />
Demokratie ist. Nun weiß jeder,<br />
dass Kinder auch außerhalb von Ehen zur<br />
Welt kommen, obwohl das nicht die Regel<br />
ist, und nicht wenige Ehen gewollt<br />
oder ungewollt kinderlos bleiben, obwohl<br />
auch das nicht die Regel ist. Wenn man<br />
nach einem sachlichen Grund sucht, um<br />
einer auf Dauer angelegten, in der eheähnlichen<br />
Bindung vergleichbar gewollten<br />
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft<br />
die Gleichstellung mit der Ehe zu verweigern,<br />
müsste man also von der Regel, vom<br />
typischen Erscheinungsbild einer Verbindung<br />
her argumentieren. Aber auch dieses<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 27
T I T E L<br />
Eis, das der konservative Rückzug betritt,<br />
ist dünn. Wer der Ehe mit ihrer Eignung<br />
und Bestimmung als Keimzelle der mit<br />
Kindern bereicherten Familie Exklusivität<br />
verleihen will, gerät dann aber in die<br />
argumentative Falle, wie er den Adoptionswunsch<br />
gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften<br />
„abwehren“ will.<br />
Steht das Kindeswohl einer solchen Adoption<br />
entgegen? Maßstab der Adoption<br />
ist nicht die Selbstverwirklichung der präsumtiven<br />
Eltern, sondern allein das Kindeswohl,<br />
sorgfältig zu prüfen in jedem<br />
Einzelfall. Doch das empirisch vermutlich<br />
belastbare Argument, Kinder von gleichgeschlechtlichen<br />
Verbindungen würden<br />
leichter Opfer von Mobbing und Diskriminierung,<br />
wirkt in etwa so überzeugend<br />
wie die abschlägige Bescheidung des Wunsches<br />
eines dunkelhäutigen Ehepaars, das<br />
ein weißhäutiges Kind adoptieren will.<br />
Hier entfaltet sich nun mal eine Logik,<br />
die ein individuelles, sozial und kommunitär<br />
weitgehend dekomponiertes Menschenbild<br />
mit universell angelegten Entfaltungsund<br />
Gleichheitsrechten durchsetzt und<br />
gegen das innerhalb des Rechts kein Traditionsargument<br />
ankommt. Traditionen müssen<br />
durch bewahrende und entwicklungsoffene<br />
Lebenspraxis lebendig gehalten werden,<br />
ihre Erosion kann von der Verfassung nicht<br />
aufgehalten werden. Causa finita est?<br />
WER SCHON KEINE eigenen überzeugenden<br />
Argumente gegen die Öffnung der Ehe für<br />
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften<br />
findet, könnte allenfalls noch auf andere<br />
verweisen, die in anderen Kulturräumen<br />
unterwegs sind. Was etwa ist mit den<br />
in traditionellen Familienstrukturen verhafteten<br />
Einwanderern, was ist mit gläubigen<br />
Moslems, Juden oder Christen, die<br />
Anstoß nehmen an der Auflösung von Familienordnungen,<br />
die für sie durch Herkunft<br />
und Glauben garantiert sind? Wird<br />
eine Gesellschaft, die praktisch jede traditionelle<br />
Institution wie die Ehe dekonstruiert<br />
und sie womöglich auch durch Öffnung<br />
und Verallgemeinerung um ihre Kontur<br />
bringt, wirklich offener für die Integration?<br />
Oder fördert sie über kurz oder lang kulturoppositionelle<br />
Abschottungen hinter der<br />
Bühne des auf der ganzen Linie erfolgreichen<br />
politisch korrekten Schauspiels?<br />
Solche Rücksichtsargumente sind nicht<br />
wirklich durchschlagskräftig, weil diejenigen<br />
an der Spitze des Fortschritts sich von<br />
den Nachzüglern nicht gerne Wegweisungen<br />
geben lassen. Aber kulturplurale Hinweise<br />
können doch nachdenklich machen.<br />
Wenn das konservative Beharren auf einem<br />
bürgerlichen Lebensentwurf, der keineswegs<br />
andere ausgrenzt, aber seine grundlegend<br />
konstruktive Bedeutung für eine<br />
freie Gesellschaft lediglich weiter bestätigt<br />
haben will, nicht mehr artikuliert werden<br />
dürfte, wäre das gefährlich für eine freie<br />
Gesellschaft. Aus der Defensive einer in<br />
Rollenklischees verhafteten Welt heraus<br />
war es durchaus legitim, die Methode des<br />
Die Erosion<br />
von Traditionen<br />
kann durch die<br />
Verfassung nicht<br />
aufgehalten<br />
werden<br />
Mainstreamings von „Minderheitenthemen“<br />
anzuwenden. Aber das sollte nicht<br />
zu einem permanenten Kulturkampf der<br />
Eliten – unter Einschluss der Richter, die<br />
scheinbar immer nur Gleichheitsfragen<br />
entscheiden – gegen die einstmalige, aber<br />
eben noch massenhaft gelebte „Normalität“<br />
werden. Sonst droht eine gerade in<br />
ihren liberalen Grundlagen deformierte<br />
Gesellschaft.<br />
Auch in westlichen Gesellschaften gibt<br />
es viele Menschen, denen das Institut der<br />
Ehe und ihre Bestimmung, Form intimer<br />
Lebensgemeinschaft und Quelle einer<br />
neuen Familie zu sein, etwas ganz Besonderes,<br />
für religiöse Menschen sogar etwas<br />
Sakramentales ist. Diese Auffassung müssen<br />
nicht alle teilen, aber man sollte nicht<br />
so tun, als gäbe es jene Alltagsorientierung<br />
nicht mehr.<br />
WAS BEDEUTEN solche Einsichten für die<br />
praktische Politik? Wer die Gleichstellungslogik<br />
bis zum letzten Detail ausreizen will,<br />
hat Rückenwind und wird sich durchsetzen:<br />
Ehegattenzuschlag im öffentlichen<br />
Dienst auch für Lebenspartnerschaften,<br />
Ehegattensplittung, Adoptionsrecht. Eine<br />
liberal-konservative, eine bürgerliche Politik<br />
wäre nicht gut beraten, wenn sie hier<br />
symbolisch Widerstand leistete, auf Verteidigungsstellungen,<br />
die nicht zu halten sind.<br />
Auch der Versuch, die Ehe in ihrer Bedeutung<br />
allein auf die Pflege und Erziehung<br />
von Kindern zu verengen, ist nicht überzeugend.<br />
In diese Richtung geht der Vorschlag,<br />
das Ehegattensplitting abzuschaffen<br />
und durch ein Familiensplitting zu ersetzen.<br />
Die Behandlung des von den Eheleuten erzielten<br />
Einkommens als Gemeinschaftseinkommen,<br />
das durch zwei geteilt (gesplittet)<br />
wird, bekämpfen manche ideologisch im<br />
Herdprämienvokabular, weil sie angeblich<br />
nur „Alleinverdienerehen“ privilegiere. In<br />
Wirklichkeit verdienen aber kaum je beide<br />
Eheleute exakt das Gleiche, sodass die Abschaffung<br />
des Ehegattensplittings auf eine<br />
fühlbare Steuererhöhung der Verheirateten<br />
hinausliefe. Artikel 6 des Grundgesetzes<br />
will aber die Ehe gerade als Gemeinschaft,<br />
die freiwillig als Solidargemeinschaft<br />
begründet wurde, unter den besonderen<br />
Schutz stellen.<br />
Das gesamte Einkommen einer Familie<br />
mit Kindern durch die Zahl der Köpfe<br />
zu teilen, wäre ohne Zweifel genauso folgerichtig<br />
wie das Ehegattensplitting und<br />
demografisch sowieso angezeigt. Aber wo<br />
kommt das Geld her? Es besteht der Verdacht,<br />
dass die Einnahmeausfälle des Familiensplittings<br />
von kinderlosen Eheleuten<br />
bezahlt werden sollen und von denjenigen,<br />
die ihre Kinder bereits großgezogen haben,<br />
aber jetzt nicht mehr vom Familiensplitting<br />
profitieren würden. Mit einer Verfassungsvorschrift,<br />
die auch die kinderlose<br />
Ehe unter den besonderen Schutz der staatlichen<br />
Ordnung stellt, lässt sich ein solches<br />
Vorgehen nur schwer in Einklang bringen.<br />
Es wäre vielleicht doch naheliegender,<br />
der Ehe eine prinzipiell familien- und<br />
steuerrechtlich gleichgeregelte Institution<br />
an die Seite zu stellen, als sich noch weiter<br />
von einem recht eindeutigen Verfassungstext<br />
zu entfernen. Gelassenheit des bürgerlichen<br />
Lagers ist angezeigt, aber auch mehr<br />
Kritik an denjenigen, die so tun, als sei die<br />
Politik eine Bühne für den permanenten<br />
Kulturkampf gegen ein wohlfeiles Feindbild<br />
dunkler konservativer Mächte, die<br />
längst nicht mehr existieren.<br />
UDO DI FABIO<br />
ist Professor für öffentliches Recht<br />
an der Universität Bonn. Er war<br />
von 1999 bis 2011 Richter am<br />
Bundesverfassungsgericht<br />
FOTO: PRIVAT (AUTOR)<br />
28 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Ärmelschoner, Verwaltungsvorurteile:<br />
Stechuhr<br />
und 7-Stunden-Tag.<br />
Verwaltungsrealität:<br />
New E-Government Public Management,<br />
und<br />
Global Governance.<br />
Gemeinsame Bildungsförderung für Politiker.<br />
Das Master-Stipendium der ZU.<br />
Nächster<br />
Studienstart:<br />
06. September<br />
2013<br />
Bewerbungsschluss:<br />
15. April<br />
Für die Masterstudiengänge an der Zeppelin Universität. Zwei Jahre. Vollzeit. Praxistauglich<br />
durch Forschungsorientierung. Verwaltungs- und Politikwissenschaft und alles,<br />
was man wirklich braucht – für ein Management von Transformation in Verwaltung, Staat und<br />
Politik. Für Politik-, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaftler und Andersdenkende.<br />
Die Zeppelin Universität ist eine private Stiftungsuniversität am Bodensee, die als Uni<br />
zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik konsequent interdisziplinär, individualisiert und international<br />
lehrt und forscht. Weitere Informationen zu diesem Master-Studiengang wie auch<br />
zu den Master-Studiengängen in Kommunikations- und Kulturwissenschaften und in Wirtschaftswissenschaften<br />
sowie der Bewerbung unter www.zu.de/cicero
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
ALLES AUF DEN TISCH<br />
Die Verbraucherlobbyistin Anne Markwardt steht für die wachsende Deutungsmacht der Organisation Foodwatch<br />
V ON G EOR G L ÖWISCH<br />
U<br />
M 13:47 UHR IM CAP-SUPERMARKT<br />
in Berlin-Karlshorst klettert Anne<br />
Markwardt in einen Einkaufswagen.<br />
Der Kameramann ruft: „Läuft“, und<br />
Tim, der Reporter von „logo!“, den Nachrichten<br />
des Kinderkanals, schiebt Markwardt<br />
durch die Regalflure, vorbei am Tee,<br />
an der Marmelade. Sie lässt die Beine aus<br />
dem Wagen baumeln. „Eine schöne Position“,<br />
ruft der Kameramann, und Tim<br />
macht Tempo, stoppt, macht Tempo, vor,<br />
zurück. Sie lächelt, sie weiß, dass hier gerade<br />
ein gutes Bild entsteht.<br />
Ein perfektes Bild, denn in dem Kika-<br />
Film über Lebensmittelkennzeichnung<br />
wird sie auf diese Weise zur Freundin des<br />
Reporters, zur Vertrauensperson, die entscheidet,<br />
worauf man beim Einkauf achten<br />
muss. Davon träumen andere Interessenvertreter<br />
in Berlin: Dass die Rollen des<br />
Reporters und der Lobbyistin ineinanderfließen.<br />
Aber für Anne Markwardt und ihre<br />
Organisation Foodwatch ist so etwas inzwischen<br />
Gewohnheit. Man kann diesen<br />
Erfolg nicht nur auf die Skandale zurückführen,<br />
auf das Pferdefleisch in der Lasagne,<br />
die falsch gekennzeichneten Eier und das<br />
verschimmelte Viehfutter. Dass Foodwatch<br />
Deutungsmacht gewinnt, hat Methode.<br />
Anne Markwardt, 31, bewarb sich vor<br />
fünf Jahren bei Foodwatch. Sie hatte in<br />
Berlin Theater- und Kulturwissenschaften<br />
studiert. Thilo Bode, einst Chef zuerst<br />
von Greenpeace Deutschland, dann Greenpeace<br />
International, hatte sich nach dem<br />
Skandal um die Rinderseuche BSE 2002<br />
eine Art NGO-Start-up zusammengebaut:<br />
„Foodwatch, die Essensretter“. Als Markwardt<br />
bei Bode im Bewerbungsgespräch<br />
saß, erzählte sie von einem Fernsehspot,<br />
dem sie misstraute. Darin pries Jörg Kachelmann<br />
bei Wind und Wetter den Joghurt<br />
Actimel an und versprach eine Stärkung<br />
der Abwehrkräfte.<br />
Anderthalb Jahre später stand Markwardt<br />
auf dem Münchner Marienplatz neben<br />
einem riesigen Actimel-Becher, den sie<br />
vor laufenden Kameras zur dreistesten Werbelüge<br />
des Jahres kürte. Markwardt sagte in<br />
die Mikrofone: „Es gibt sehr viele Verbraucher,<br />
die sich darüber ärgern, dass nicht<br />
draufsteht, was drin ist oder nicht drin ist,<br />
was draufsteht.“<br />
In dem Satz steckt die Rezeptur von<br />
Foodwatch, sie ist einfach und reduziert:<br />
Die Organisation fordert erst einmal nur<br />
Transparenz. „Alle müssen essen und deshalb<br />
Essen einkaufen“, sagt Markwardt.<br />
„Wenn sie Geld ausgeben und belogen werden,<br />
sind sie sauer.“ Bevormundung wird<br />
vermieden, denn die Verbraucher lassen<br />
sich nicht gern den Speisezettel vorschreiben.<br />
Foodwatch mobilisiert nicht gegen die<br />
Fleischproduktion wie Peta oder schwelgt<br />
im Genuss der Weißen Gehörnten Heidschnucke<br />
wie Slowfood. Die Biobewegung?<br />
„Wir lassen uns nicht vereinnahmen.“<br />
Bode hat Markwardt gelehrt, wie man<br />
Kampagnen führt. Große Marken attackieren.<br />
Akribisch vorbereiten. Aggressiv zuschlagen.<br />
Mitmachkomponenten einbauen.<br />
Nicht einlullen lassen. Prägnant formulieren,<br />
auch mal ironisch. Inzwischen hat sie<br />
„abgespeist.de“ an einen Kollegen abgegeben<br />
und eine Kinderkampagne entwickelt.<br />
„Wir wollen, dass die Unternehmen aufhören,<br />
Kinder auf die falsche Ernährung zu<br />
polen, weil ihr das die größten Profite einbringt“,<br />
sagt sie. Es geht vor allem gegen<br />
zu viel Zucker. Richtige und falsche Ernährung?<br />
Das weicht von der puren Transparenzstrategie<br />
ab. Bei Kindern ist das aber<br />
nicht so heikel. An ihnen erzieht die Gesellschaft<br />
ganz gern herum.<br />
„Das Thema Essen wächst“, sagt Anne<br />
Markwardt. Foodwatch ist auf 25 000<br />
Fördermitglieder angewachsen. Wer über<br />
5000 Euro zahlt, wird auf der Website genannt,<br />
um Transparenz herzustellen. Ab<br />
500 Euro wird geprüft, ob ein Zusammenhang<br />
zur Lebensmittelindustrie besteht.<br />
Spenden wie die des Schokoladenfabrikanten<br />
Alfred Ritter in den Anfangsjahren<br />
würden heute abgelehnt, erklärt die<br />
Verbraucherschützerin. Inzwischen hat<br />
ihre Organisation 13 Mitarbeiter. In der<br />
Woche, als der Kika-Reporter sie durch<br />
den Supermarkt schaukelt, ist sie außerdem<br />
in der „Abendschau“ des RBB und im<br />
„ARD-Morgenmagazin“ zu Gast. Es geht<br />
um den Eierskandal. Sie wirkt ruhig vor der<br />
Kamera mit ihrem geraden, klaren Blick.<br />
Sie breitet keine Vision über eine bessere<br />
Essenswelt aus, sie beschränkt sich auf<br />
eine Forderung: Alle Informationen müssen<br />
„auf den Tisch“. Im Morgenmagazin<br />
gebraucht sie die Formulierung vier Mal.<br />
So schnell ändert sich die Welt der Lebensmittel<br />
allerdings nicht. Der Danone-<br />
Konzern hat die Werbung für Actimel modifiziert<br />
und eine Champignonsuppe ihr<br />
Rezept. Doch die Behörden zögern sogar,<br />
Hersteller zu outen, die gegen Vorschriften<br />
verstoßen. Sie prüfen, beschreiten Dienstwege,<br />
erheben Gebühren. Foodwatch? Essensretter?<br />
Der Sachbearbeiter ist zu Tisch!<br />
Aber schon an Markwardts Biografie<br />
kann man sehen, wie stark sich Politisieren<br />
ums Essen in der Gesellschaft verankert.<br />
Sie kommt aus Klütz, einer Kleinstadt<br />
an der Ostsee, der Vater war Landarzt. Vor<br />
den Sommerferien gab es in ihrer Schule<br />
in Grevesmühlen einen Projekttag. Einmal<br />
protestierten sie und ihre Mitschüler<br />
gegen Gentechnik, ihre Mutter nähte ein<br />
Tomaten kostüm. Eine Aktion mitten im<br />
Mainstream der Provinz.<br />
Jetzt steht sie mit Tim vom Kika vor<br />
der Fleischtruhe. Sie zeigt – Kamera läuft –<br />
eine Packung Hackfleisch, das womöglich<br />
mit Sauerstoff behandelt ist, damit es außen<br />
rot aussieht, obwohl es innen schon<br />
grau und zäh ist. Tim nickt. Im Film wird<br />
er den Kindern erklären, dass die Politik<br />
bessere Gesetze machen muss.<br />
G EOR G L ÖWISCH<br />
ist Textchef von <strong>Cicero</strong><br />
FOTOS: GÖTZ SCHLESER FÜR CICERO, ANDREJ DALLMANN (AUTOR)<br />
30 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Es gibt sehr viele<br />
Verbraucher, die sich<br />
ärgern, dass nicht drin<br />
ist, was draufsteht“<br />
Anne Markwardt, Foodwatch<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 31
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
MERKELSÖHNCHEN<br />
Younes Ouaqasse ist 24, Muslim und überzeugter Christdemokrat. Ein Glücksfall für die neue Union<br />
V ON J U LIA P R OSINGER<br />
I<br />
N EINEM GRAUEN GEBÄUDE spricht an<br />
diesem Tag ein Student über die<br />
Automarke Lamborghini. Fachhochschule<br />
Jena, Präsentationsübung.<br />
Lamborghini steht für Geschwindigkeit,<br />
für Coolness. Als Nächster ist Younes<br />
Ouaqasse dran. Er präsentiert die CDU.<br />
Die CDU stand nie für Geschwindigkeit,<br />
für Coolness schon gar nicht.<br />
In jüngster Zeit aber ist die Partei<br />
schneller geworden, sie hat die Wehrpflicht<br />
abgeschafft, ist aus der Atomkraft ausgestiegen,<br />
akzeptiert schwule und lesbische Lebenspartnerschaften.<br />
Beim Parteitag im<br />
Dezember 2012 hat sie Aygül Özkan und<br />
Serap Güler in den Bundesvorstand gewählt.<br />
Und Younes Ouaqasse, Sohn marokkanischer<br />
Eltern, gläubiger Muslim. Ein Referat<br />
über die CDU muss Ouaqasse nicht vorbereiten.<br />
Mitglied wurde er mit 16. Ihm gefielen<br />
die Werte der CDU, Familie, Religion.<br />
Ouaqasse fand, dass seine Lebensgeschichte<br />
da reinpasste, er sah keinen Widerspruch.<br />
Mit 18 wurde er Bundesvorsitzender der<br />
Schülerunion und damit der erste Migrant,<br />
der eine CDU-Organisation anführte.<br />
„Ich kann nicht einfach die Playtaste<br />
für meine Familienstory drücken“, sagt er,<br />
wenn man ihn nach seiner Geschichte fragt.<br />
Aus Sorge, dass ihn jemand zum Quotenmigranten<br />
macht. Dann erzählt er doch.<br />
Ouaqasse wurde 1988 in Mannheim geboren,<br />
lebte die ersten Jahre bei seiner Großmutter<br />
in Marrakesch. „Gemeinsames Essen,<br />
große Familie, es war eine schöne<br />
Zeit“, sagt er. Zurück in Deutschland, mit<br />
acht, war die Familie kleiner, dafür gab<br />
es Vergnügungsparks und Plastikroboter<br />
zum Spielen. Er musste die dritte Klasse<br />
wiederholen, übte abends mit dem Stiefvater<br />
Deutsch, kam auf die Hauptschule,<br />
schließlich auf ein Internat. Er war der Einzige<br />
mit Hip-Hop-Hosen. Die anderen trugen<br />
Polohemden. Die anderen gingen auf<br />
das Gymnasium, das zum Internat gehörte,<br />
er auf die Hauptschule auf der anderen<br />
Straßenseite. Mit einer Menge Trotz wurde<br />
aus seinem Notenschnitt von 3,7 eine 2,1<br />
und schließlich ein Fachabitur.<br />
„Unser dreigliedriges Schulsystem hat<br />
sich bewährt“, sagt Ouaqasse seither gern.<br />
Wer es nicht schaffe, der brauche mehr<br />
Zwang. In seiner Bewerbungsrede für den<br />
CDU-Bundesvorstand formulierte er das<br />
so: „Ich bin gegen ein Schulsystem, in dem<br />
Kinder erst ihren Namen tanzen können,<br />
bevor sie ihn überhaupt schreiben können.“<br />
Das gab Applaus.<br />
Mit 20 zog Ouaqasse zum Studium<br />
nach Jena an diese kleine graue Fachhochschule<br />
im Freistaat Thüringen, den er die<br />
Mitte Europas nennt. Für ihn, den deutschen<br />
Europäer mit marokkanischen Wurzeln,<br />
wie er sich sieht, gibt es kein Ost-West.<br />
Ihm fehlen überhaupt Kategorien. Ouaqasse,<br />
der Muslim, ist gegen Islamunterricht<br />
an deutschen Schulen. Er griff seine<br />
Parteikollegin Özkan an, als sie das Kruzifix<br />
in Klassenzimmern abschaffen wollte.<br />
Die doppelte Staatsbürgerschaft lehnt er<br />
ab. Er wollte sich immer voll zu Deutschland<br />
bekennen. „Ich liebe dieses wunderschöne<br />
Land.“<br />
Europas Asylpolitik? Allein die Frage<br />
findet er ideologisch. Er rollt die Augen.<br />
Ist die heutige CDU noch glaubwürdig?<br />
„Die Gesellschaft verändert sich, wir verändern<br />
uns mit – aber unser Wertegerüst<br />
bleibt dasselbe.“ Die neuen Positionen der<br />
CDU? Bei einem Auto will man doch auch<br />
die Servolenkung, sobald es die serienmäßig<br />
gibt.<br />
Wenn er politisiert, streift er gern seine<br />
Uhr ab und peitscht mit dem Armband<br />
auf den Tisch. Manchmal erwischt er damit<br />
sogar seine Gesprächspartner. Er will<br />
lieber über soziale Gerechtigkeit sprechen<br />
und über das, was er erlebt, wenn er auf Besuch<br />
in Berlin ist, durch die Stadt spaziert,<br />
sich Hochhäuser in Lichtenberg, Villen in<br />
Dahlem und Suppenküchen ansieht. Ein<br />
Interview mit Jean Ziegler, dem Globalisierungskritiker,<br />
hat ihn bewegt. „Ich bin<br />
schließlich Politiker, um die Welt ein wenig<br />
besser zu machen“, sagt er. „Aber gleichzeitig<br />
bin ich nur ein 24-jähriger Student.“<br />
Es kommt vor, dass er das vergisst.<br />
Zum Beispiel, wenn er, BWL im fünften<br />
Semester, an dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter,<br />
78, herumkrittelt: „Ein<br />
paar seiner Zahlen waren natürlich übertrieben.“<br />
Oder als er, damals noch Vorstand<br />
der Schülerunion, Nebengast in Maybrit<br />
Illners Talkshow sein sollte. Er lehnte ab,<br />
weil er sich nicht mit drei Fragen abspeisen<br />
lassen wollte.<br />
Fragt man Kommilitonen nach ihm,<br />
sagen einige, dass sie Ouaqasse für einen<br />
Schnösel halten. Weil er gegen den Studentenrat<br />
wettert: „Was soll der Bildungsstreik<br />
bringen? Dafür muss doch niemand Kosten<br />
für Polizeieinsätze verursachen.“ „Er<br />
macht Klientelpolitik für Reiche“, sagt Johannes<br />
Struzek, Mitglied des Studentenrats.<br />
Abends sieht man Ouaqasse selten in<br />
Jenas Studentenkneipen. Er finanziert sich<br />
sein Studium, indem er bei einer Unternehmensberatung<br />
arbeitet, fährt nach Mannheim,<br />
zu seiner Familie, nach Berlin, zum<br />
Bundesvorstand an den Tisch der Kanzlerin.<br />
Manchmal, so wie heute nach seiner<br />
Präsentation in Jena, besucht Ouaqasse die<br />
Konkurrenz. Bei Jenas Grünen geht es um<br />
Biomasse. Zu Beginn soll sich jeder vorstellen.<br />
Ein Imker, ein Schäfer, ein Waldorfschullehrer<br />
melden sich. Ouaqasse stellt<br />
sich nur als BWL-Student vor, so bleibt er<br />
in der Beobachterrolle.<br />
Ouaqasse ist mit Angela Merkel groß<br />
geworden. An Thüringens Hochschulen<br />
wirbt er neuerdings für Nachhaltigkeit,<br />
die Studenten sollen seltener aus Pappbechern<br />
trinken. Schwarz-Grün kann er<br />
sich auch vorstellen. Seine Ideologie heißt<br />
Pragmatismus.<br />
JULIA PROSINGER<br />
ist freie Reporterin in Berlin<br />
FOTOS: ANTJE BERGHÄUSER FÜR CICERO, MIKE WOLFF (AUTORIN)<br />
32 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Die<br />
Gesellschaft<br />
verändert<br />
sich – die CDU<br />
verändert<br />
sich mit“<br />
Younes Ouaqasse sitzt im<br />
CDU-Bundesvorstand – und<br />
hier im CDU-Logo in der<br />
Berliner Parteizentrale<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 33
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
DIE GEGENSPIELERIN<br />
Hannelore Kraft ist für Angela Merkel das stärkste Gegenüber aus der SPD – auch ohne Kanzlerkandidatur<br />
V ON FRI TZ P LEIT GEN<br />
V<br />
ORBILDER? HANNELORE KRAFT schüttelt<br />
den Kopf. Mit großen Leitfiguren<br />
könne und wolle sie nicht<br />
dienen. Beobachte sie bei Politikern beispielhaftes<br />
Verhalten, dann übernehme sie<br />
das gerne. An erster Stelle nennt sie Johannes<br />
Rau. Seinen respekt- und verständnisvollen<br />
Umgang mit den Bürgern habe sie<br />
sehr geschätzt. Das Gleiche gelte für Kurt<br />
Beck. Von Peer Steinbrück habe sie gelernt,<br />
wie unterschiedliche Meinungen zu<br />
gewinnbringenden Diskussionen genutzt<br />
werden können.<br />
Steinbrück? Das demonstrative Lob<br />
überrascht. War er es nicht gewesen, der<br />
2005 Hannelore Kraft als Landesvorsitzende<br />
verhindert hat? Irrtum, kontert die<br />
Ministerpräsidentin. Ganz in ihrem Sinne<br />
habe die SPD Nordrhein-Westfalen damals<br />
eine Arbeitsteilung vorgenommen: Landesvorsitz<br />
Jochen Dieckmann, Fraktionsvorsitz<br />
Hannelore Kraft. Die Botschaft ist klar:<br />
Versuche, einen Keil zwischen sie und den<br />
SPD-Kanzlerkandidaten zu treiben, sind<br />
zwecklos.<br />
Wir sitzen im Amtszimmer der Ministerpräsidentin.<br />
Düsseldorfer Stadttor,<br />
10. Stock. Unter uns der Rhein und die eigenwillige<br />
Architektur des Hafenviertels.<br />
Bei unserem letzten längeren Zusammentreffen<br />
hatten wir noch höher gesessen. Das<br />
war im Sommer der Kulturhauptstadt Ruhr<br />
2010. Wir flogen im Hubschrauber über<br />
die A 40. Die Autobahn war für das Projekt<br />
„Still-Leben“ von Dortmund bis Duisburg<br />
gesperrt, der Luftraum ebenfalls. Plötzlich<br />
schoss ein Leichtmetallflugzeug unter uns<br />
her. Sehr knapp. Sie hatte es nicht mitbekommen.<br />
Voller Freude betrachtete sie den<br />
Andrang der Millionen unter sich auf der<br />
Autobahn.<br />
Auf den Beinahe-Zusammenstoß<br />
komme ich nicht zurück. Auch nicht auf<br />
Steinbrück. Das brächte nichts. Ihre Haltung<br />
ist klar. Sie wird den SPD-Kanzlerkandidaten<br />
mit vollem Einsatz unterstützen,<br />
aus Loyalität und auch aus Selbstschutz.<br />
Sie weiß: Falls Steinbrück aussteigen sollte,<br />
würden sich die Augen auf sie richten. Ihre<br />
Umfragewerte versetzen ihre Parteifreunde<br />
ins Träumen. Auch lang gediente Experten<br />
von Infratest Dimap geraten ins Staunen.<br />
Empathie, Emotionalität, Durchsetzungsvermögen,<br />
Führungsstärke, Kompetenz<br />
– für Wahlforscher bringt Hannelore<br />
Kraft die wichtigsten Kriterien mit, um<br />
auch für eine breite Bevölkerung über die<br />
Parteigrenzen hinweg wählbar zu sein. Und<br />
sie kann in den Augen der Wähler Koalition,<br />
meint man bei Infratest Dimap. Die<br />
Partnerschaft mit der ebenfalls selbstbewussten<br />
Sylvia Löhrmann von den Grünen<br />
scheint krisenfest zu sein. Unter der<br />
Führung der beiden Frauen wirkt die rotgrüne<br />
Zusammenarbeit in Düsseldorf harmonischer<br />
und effizienter als unter den Ministerpräsidenten<br />
Johannes Rau, Wolfgang<br />
Clement und Peer Steinbrück.<br />
Für viele SPD-Mitglieder sind das<br />
Gründe genug, jetzt schon mit Hannelore<br />
Kraft in die Wahlschlacht gegen Angela<br />
Merkel zu ziehen, zumal die Hauptthemen<br />
der Partei – Bildung und soziale<br />
Gerechtigkeit – besser auf sie als auf Peer<br />
Steinbrück passen. Aber sie sagt kategorisch<br />
Nein. Sie habe sich nicht zur Ministerpräsidentin<br />
wählen lassen, um gleich<br />
danach das nächste Amt anzustreben.<br />
Was sie angekündigt habe, wolle sie auch<br />
erledigen.<br />
„Hannelore Kraft wird nicht wie Gerhard<br />
Schröder an den Gittern des Bundeskanzleramts<br />
rütteln“, meint Sabine Scholt,<br />
stellvertretende WDR-Chefredakteurin<br />
und langjährige Beobachterin der Landespolitik.<br />
Sie glaubt nicht, dass die Mülheimerin<br />
nach Berlin gehen will; auch nicht<br />
2017, wenn die übernächste Bundestagswahl<br />
ansteht. Sie brauche die Insignien<br />
einer Kanzlerkandidatur nicht. Bundespolitischen<br />
Einfluss habe sie jetzt schon<br />
reichlich – als Chefin des größten Bundeslands<br />
und neuerdings auch noch als Koordinatorin<br />
der SPD-Länder im Bundesrat.<br />
In dieser Doppeleigenschaft sei Kraft, sagt<br />
Sabine Scholt, gegenwärtig die stärkste Gegenspielerin<br />
der Kanzlerin.<br />
Oliver Welke wollte es näher wissen. In<br />
seiner „Heute-Show“ im ZDF hat er Hannelore<br />
Kraft gefragt, ob 2017 ein Wahlkampf<br />
Mutti gegen Mutti zu erwarten sei.<br />
Peng! Die Replik kommt wie aus der Pistole<br />
geschossen. „Nein, dann ist die andere<br />
längst weg.“<br />
In einem kurzen Satz hat sie einfach<br />
so die mächtigste Frau der Welt versenkt.<br />
Als wir uns in ihrem Amtszimmer gegenübersitzen,<br />
kommt mir die Antwort bei<br />
Welke in den Sinn. Wie ist nun das Verhältnis<br />
zu der anderen? Die Ministerpräsidentin<br />
sieht sich außerstande, der Bundeskanzlerin<br />
herausragende Noten zu geben.<br />
Sie sei zögerlich, gehe zu wenig voran und<br />
lasse einen klaren Kurs vermissen; vor allem<br />
in der Innenpolitik, aber auch in Europa.<br />
Dass Hannelore Kraft so entschieden gegen<br />
Angela Merkel antritt, sieht nach Arbeitsteilung<br />
in der SPD-Führung aus. Nachdem<br />
Gabriel, Steinbrück und Steinmeier sich<br />
vergeblich an der Bundeskanzlerin abgearbeitet<br />
haben, knöpft sich nun Kraft die<br />
Spitzenfrau der Union vor.<br />
Ihr Gesicht drückt wenig Freude aus,<br />
wenn sie mit Merkel verglichen wird. Die<br />
Kanzlerin verkörpere eine andere Art von<br />
Politik, sagt sie brüsk. Mit Merkels Politikstil<br />
könne sie nichts anfangen.<br />
Dabei gibt es in den Karrieren unbestreitbare<br />
Parallelen. Beide mussten sich in<br />
Männerwelten durchsetzen. Beide stürmten<br />
im Rekordtempo nach oben.<br />
HANNELORE KRAFT GING ERST 1994 in die Politik.<br />
Sie trat in ihrer Heimatstadt Mülheim<br />
in die SPD ein. Kaum Mitglied, sah sie<br />
sich mit einem parteiinternen Papier konfrontiert,<br />
in dem gefragt wurde, was sich<br />
in der SPD ändern müsste, um nach verlorener<br />
Kommunalwahl wieder in die Erfolgsspur<br />
zu kommen. Von zehn Themenfeldern<br />
kreuzte sie acht an. Daraufhin saß<br />
FOTO: WOLFGANG WILDE/ROBA PRESS<br />
34 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Hopp! Hannelore Kraft<br />
mit ihrem Hund<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 35
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
sie, wie sie erzählt, in acht Arbeitsgruppen.<br />
Es sei hart gewesen, aber ein besseres Training<br />
hätte ihr nicht passieren können. So<br />
habe sie die Partei im Schnelldurchgang<br />
von Grund auf kennenlernen können. Sie<br />
wusste so gut Bescheid, dass sie bereits ein<br />
Jahr später in den Vorstand des Unterbezirks<br />
gewählt wurde.<br />
Mit gleicher Geschwindigkeit stieg<br />
sie im Landtag auf. Als Parlamentsneuling<br />
wurde sie Ministerin, erst für Bundesund<br />
Europaangelegenheiten, dann für Wissenschaft<br />
und Forschung. Das kennzeichne<br />
Kraft, meint Theo Schumacher, langjähriger<br />
Korrespondent der NRZ in Düsseldorf.<br />
„Sie ist da, wo sie gebraucht wird. Immer<br />
zur richtigen Zeit für den richtigen Platz.“<br />
In die Politik ist sie gegangen, weil sie<br />
sich nicht mit inakzeptablen Verhältnissen<br />
abfinden wollte. Das hat sie mit Karl Marx<br />
gemeinsam. Der wollte die Welt verändern,<br />
ihr ging es erst einmal um Kitaplätze, auch<br />
um einen für ihren Sohn. Als Partei sei für<br />
sie nur die SPD infrage gekommen. Das<br />
habe mit ihrer Herkunft als Tochter eines<br />
Straßenbahnfahrers und einer Schaffnerin,<br />
aber auch mit eigenen Beobachtungen zu<br />
tun. Die SPD kümmere sich um die Nöte<br />
der Menschen, sie biete ihnen die Möglichkeit,<br />
sich über Bildung weiterzuentwickeln.<br />
Dieser Aufgabe fühle sie sich verpflichtet.<br />
„Kein Kind zurücklassen!“, habe sie deshalb<br />
zu ihrem Credo gemacht.<br />
Stolz sei sie auf ihre Partei und auf das,<br />
was sie in den 150 Jahren ihrer Existenz<br />
für die Entwicklung der Demokratie und<br />
die Lebensbedingungen der Menschen in<br />
Deutschland geleistet habe. Auf Otto Wels<br />
weist Hannelore Kraft mit Hochachtung<br />
hin. Sein Verhalten, seine Charakterfestigkeit<br />
seien Vorbild auf ewig. Der Sozialdemokrat<br />
hatte 1933 in der letzten freien<br />
Reichstagssitzung den tobenden Nazis den<br />
Satz entgegengeschleudert: „Freiheit und Leben<br />
kann man uns nehmen, die Ehre nicht!“<br />
HANNELORE KRAFT HAT KEINE PROBLEME mit<br />
der weiten Welt, spricht Englisch und Französisch,<br />
pflegt aber ihre Bodenständigkeit.<br />
Sommerurlaub macht sie mit ihrer Familie<br />
im Sauerland, der alte Freundeskreis ist ihr<br />
wichtig. Ihre direkte Art kommt an, auch<br />
außerhalb Nordrhein-Westfalens. Von Niedersachsen<br />
bis Bayern laden Parteifreunde<br />
sie als Rednerin ein. Sie verbreitet keine<br />
rhetorische Brillanz, aber Glaubwürdigkeit.<br />
Die Leute hören ihr zu. Sie wirkt, wie immer<br />
wieder zu hören ist, authentisch. Woher<br />
hat sie diese Gabe? „Ruhrgebiet!“, sagt<br />
sie nur. „Da sind die Menschen so.“ Und<br />
wie sind sie? Herbert Grönemeyer besingt<br />
sie so: schnörkellos und wetterfest, von klarer<br />
offener Natur, urverlässlich, sonnig, stur.<br />
Was macht man, um sich nicht von guten<br />
Meinungen über Kraft einlullen zu lassen?<br />
Man wendet sich an Kollegen, die sie<br />
aus der Nähe kennen und auf kritische Distanz<br />
achten. Aber auch bei ihnen kommt sie<br />
überwiegend gut weg. Sie habe an Souveränität<br />
gewonnen, wird ihr attestiert. Nachdem<br />
die Amtszeit der Minderheitsregierung<br />
noch von grünen Initiativen geprägt<br />
Das Schuldenmonster zu besiegen<br />
wird eine harte Prüfung<br />
worden sei, setze jetzt Hannelore Kraft als<br />
Chefin die Themen. Seit dem Erfolg bei der<br />
Landtagswahl 2012 ist ihre Position stark.<br />
Für Reiner Burger von der FAZ sind die<br />
39,1 Prozent, die Hannelore Kraft mit der<br />
SPD erzielte, unter den heutigen Bedingungen<br />
durchaus mit den großen Wahlerfolgen<br />
unter Johannes Rau zu vergleichen.<br />
Es sei ihr gelungen, die nach 40 Regierungsjahren<br />
und der Wahlniederlage 2005<br />
ausgelaugte SPD inhaltlich und personell<br />
wieder in Schwung zu bringen.<br />
Was macht sie über die SPD hinaus populär?<br />
Kraft habe ein Gespür für Beschwernisse<br />
entwickelt, die die Bürgerinnen und<br />
Bürger unmittelbar belasten, stellt Tobias<br />
Blasius fest. Der WAZ-Korrespondent<br />
spricht von „Straßenthemen“, wie Ärger<br />
über fehlende Kitaplätze, Streit um Kosten<br />
von Klassenfahrten und privaten Abwässerkanälen.<br />
Hier auf schnelle Lösungen<br />
zu drängen, entspreche ihrer Maxime,<br />
nahe bei den Menschen zu sein. Das bedeute<br />
nicht, dass sie den Problemen aus<br />
dem Wege gehe.<br />
Aus der Opposition ist verständlicherweise<br />
kaum Lob zu hören. Kraft kündige<br />
viel an, setze aber wenig oder nichts um.<br />
Statt gegen die Verschuldung anzugehen,<br />
kneife sie vor schmerzhaften, aber notwendigen<br />
Maßnahmen. Das Etikett „Schuldenkönigin“<br />
hat man der Ministerpräsidentin<br />
angehängt. Das Wahlvolk hat sich davon<br />
nicht beeindrucken lassen. Seit dem Erfolg<br />
von 2012 regiert Rot-Grün mit ordentlicher<br />
Mehrheit, aber nicht ganz unbedrängt.<br />
Das höchste Gericht von NRW hat gerade<br />
zum dritten Mal einen Haushalt der Regierung<br />
Kraft für verfassungswidrig erklärt.<br />
DIE ZEITEN DER HARTEN Prüfungen stehen der<br />
Regierung noch bevor, meinen die Journalisten<br />
Scholt, Blasius, Burger und Schumacher.<br />
Wie will sie das Schuldenmonster<br />
unter Kontrolle bringen und die Schuldenbremse<br />
einhalten? Durch Sparen, Mehreinnahmen,<br />
Investitionen in Bildung und<br />
generell eine vorbeugende Politik, sagt die<br />
Ministerpräsidentin. Sie hat ermitteln lassen,<br />
dass in NRW jährlich 23,6 Milliarden Euro<br />
für soziale Folgekosten ausgegeben werden,<br />
weil Kinder und Familien nicht gezielt und<br />
frühzeitig genug unterstützt werden. So blieben<br />
rund 20 Prozent der jungen Menschen<br />
ohne Schulabschluss und Ausbildung. Ihre<br />
Präventivstrategie solle Jugendlichen aus<br />
schwierigen Milieus den Aufstieg in bessere<br />
Verhältnisse ermöglichen. Dies entlaste auch<br />
die öffentlichen Haushalte von hohen „Reparaturkosten“<br />
und sei sinvoller als der stereotyp<br />
geforderte Stellenabbau.<br />
Investieren, um zu sparen, Krafts vorbeugende<br />
Politik klingt wie die Nato-Strategie<br />
„Aufrüsten, um abzurüsten“. Dieser<br />
Doktrin wird nachgesagt, das Ende des<br />
Sowjetimperiums und des Ost-West-Konflikts<br />
herbeigeführt zu haben. Aber hilft<br />
eine solche Politik gegen Verschuldung?<br />
Gesichert ist dieser Wechsel auf die Zukunft<br />
nicht. Kraft hat viel Arbeit vor sich.<br />
Da ist ein früher Wechsel nach Berlin nicht<br />
drin. 2017 wird neu entschieden. Wichtige<br />
Wahlen stehen an: im Land, im Bund und<br />
für das Amt des Bundespräsidenten / der<br />
Bundespräsidentin. Nirgends hat sie die<br />
Tür zugeschlagen. Hannelore Kraft wäre<br />
in ihrer heutigen Verfassung eine Spitzenkandidatin<br />
mit guten Siegchancen in allen<br />
drei Disziplinen.<br />
FRI TZ P LEIT GEN<br />
ist Journalist, er wurde im<br />
Rheinland geboren und ist in<br />
Westfalen aufgewachsen, er war<br />
bis 2007 WDR-Intendant<br />
FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/SÜDDEUTSCHE<br />
36 <strong>Cicero</strong> 4.2013
JETZT IM HANDEL<br />
HOHE LUFT Können wir den Tod überleben? D 8,00 Euro ∙ CH 13,90 sfr ∙ A 9,30 Euro ∙ L 9,50 Euro<br />
Ausgabe 3 / 2013<br />
HOHE LUFT<br />
FÜR ALLE, DIE LUST AM DENKEN HABEN<br />
Philosophie-Zeitschrift<br />
Ausgabe 3 / 2013; 8,- Euro; Schweiz 13,90 sfr; Österreich 9,30 Euro<br />
KÖNNEN<br />
WIR DEN TOD<br />
RÄCHT<br />
EUCH!<br />
ÜBERLEBEN?<br />
AUGUSTINUS<br />
UND DIE FRAUEN<br />
LOB DES EGOISMUS<br />
NIEDER MIT<br />
DERRIDA!<br />
MARTHA NUSSBAUM ÜBER TOLERANZ<br />
KANN MAN DAS LEBEN ÜBEN?<br />
JETZT<br />
ein HOHE LUFT-<br />
Jahresabonnement<br />
gewinnen!<br />
WWW.HOHELUFT-MAGAZIN.DE<br />
4 1 9 2 4 3 4 4 0 8 0 0 5 0 3<br />
HL03_01cover_neu.indd 1 27.02.13 14:50<br />
Bestellen Sie Ihr Exemplar versandkostenfrei<br />
unter www.hoheluft-magazin.de/aktion.<br />
Unter allen Einzelheftbestellern bis<br />
Ende April verlosen wir 10 Jahresabonnements<br />
von HOHE LUFT.
| B E R L I N E R R E P U B L I K | S O Z I A L D E M O K R A T I E<br />
SOZI SUCHT FRAU<br />
Die SPD hat Hannelore Kraft, Malu Dreyer und Manuela Schwesig. Aber wie stark ist die<br />
Position der Frauen in der Partei wirklich? Reise zu den Genossinnen der Bayern-SPD<br />
V ON KATRIN W ILK ENS<br />
H<br />
E RZOGENAURACH, kurz nach<br />
17 Uhr, die Halbgardinen hinter<br />
den Küchenfenstern sind<br />
mit Kranichen bestickt, das<br />
Reformhaus am Markt bietet<br />
Wollunterwäsche zum Aktionspreis, und<br />
unten im alten Rathaus kocht ein Thailänder.<br />
Oben im ersten Stock treffen sich an<br />
diesem Abend die örtlichen SPD-Frauen,<br />
sie erwarten die Landes-Generalsekretärin<br />
aus München. In einem Kamin lodern<br />
die Flammen, die Veranstaltung heißt auch<br />
Kamingespräch, der Begriff soll Exklusivität<br />
vermitteln. Und eigentlich auch Behaglichkeit,<br />
aber die Generalsekretärin verspätet<br />
sich, das Feuer entzieht<br />
dem Raum Sauerstoff. Die<br />
Stimmung wird gereizt.<br />
„Ich weiß nicht, ob’s hier<br />
nicht zu warm wird. Wir sind<br />
doch alle Frauen im besten<br />
Alter“, überlegt die stellvertretende<br />
Ortsvorsitzende<br />
Dankers laut. Die stellvertretende<br />
Kreisvorsitzende<br />
Stamm-Fibich mustert sie<br />
so, als hätte die Parteifreundin<br />
sie gerade ins Klimakterium<br />
verfrachtet. „Vielen Dank, liebe Rita,<br />
ich habe noch keine Hitzewallungen.“<br />
Reise zu den Frauen der SPD, jener<br />
Partei, die nach der erfolgreichen Hannelore<br />
Kraft in Nordrhein-Westfalen nun<br />
mit Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz eine<br />
zweite Ministerpräsidentin vorzeigen kann.<br />
Zu den Erfolgsfrauen der Partei zählt Manuela<br />
Schwesig, Sozialministerin von<br />
Mecklenburg-Vorpommern, und Andrea<br />
„Liebe Rita,<br />
ich habe<br />
noch keine<br />
Wallungen“<br />
Die SPD-<br />
Vize-Kreisvorsitzende<br />
Stamm-Fibich<br />
Nahles gibt es auch noch. Aber wie stark<br />
ist die Machtposition der Frauen in dieser<br />
Partei wirklich? Wie weiblich ist die SPD?<br />
Greifen wir uns den bayerischen Landesverband<br />
heraus, weil er als erster eine<br />
Frau an seiner Spitze hatte. Renate Schmidt<br />
übernahm den Vorsitz 1991, nachdem die<br />
SPD auf 26 Prozent gesunken war. Die<br />
Partei kennzeichnet in Bayern eine Mischung<br />
aus Pech, Selbstmitleid und Larmoyanz,<br />
seit Urzeiten regiert die CSU<br />
das Land. Daran vermochte auch Renate<br />
Schmidt nichts zu ändern, aber sie schaffte<br />
es, der Partei Hoffnung zu machen und<br />
ihre Ergebnisse zu verbessern. Es ging vorwärts.<br />
Schließlich wurde sie<br />
Bundesfamilienministerin.<br />
Inzwischen ist Schmidt<br />
raus aus der Politik. Nach ihr<br />
kamen wieder die Männer –<br />
und schlechtere Ergebnisse.<br />
Von 65 000 Mitgliedern sind<br />
20 700 Frauen: nur knapp<br />
ein Drittel. Ganz vorn ist die<br />
Partei so männlich wie vor<br />
Schmidt. Als Spitzenkandidat<br />
für die Landtagswahl im<br />
Herbst tritt der Münchner<br />
Oberbürgermeister Christian Ude an, den<br />
Parteivorsitz führt der Bundestagsabgeordnete<br />
Florian Pronold.<br />
„Frauen tun sich insgesamt immer noch<br />
schwer im politischen Alltag“, formuliert<br />
Pronold so vorsichtig wie möglich, und<br />
er klingt dabei wie ein Grundschullehrer:<br />
Die Marie tut sich immer noch ein<br />
bisschen schwer mit den Grundrechenarten.<br />
Damit seine Aussage wenigstens etwas<br />
Wahlkampfpfeffer enthält, setzt er hinzu:<br />
„Aber in der CSU sind die Schwierigkeiten<br />
noch größer.“<br />
Ganz stimmt das nicht, schon weil in<br />
diesem Wahljahr die Verbraucherministerin<br />
Ilse Aigner von Berlin in die Landespolitik<br />
zurückkehrt. Den mächtigsten Bezirksverband,<br />
die CSU Oberbayern, leitet<br />
sie schon, viele sehen sie als Nachfolgerin<br />
von Horst Seehofer, und das Ganze geht<br />
auch noch ohne Geschlechter-Gedöns-<br />
Debatte ab. Das muss die SPD wurmen.<br />
Sie hat doch schon seit 1988 die Automatik-Quote<br />
im Statut, nach der mindestens<br />
40 Prozent der Parteiämter und Abgeordnetenmandate<br />
an Frauen gehen müssen.<br />
Trotzdem muss man eine herausragende<br />
Frau in diesem Verband erst mal ausfindig<br />
machen: Cherchez la femme. Oder auf die<br />
Perspektive der Genossen übertragen: Sozi<br />
sucht Frau. Zumindest eine Frau hat die<br />
Bayern-SPD, die modern wirkt und überall<br />
einsetzbar ist: Natascha Kohnen, Generalsekretärin<br />
des Landesverbands. Pronold<br />
lobt sie am meisten dafür, dass sie „eben<br />
nicht diesen Stallgeruch der Politik hat“.<br />
Natascha Kohnen erscheint eine gute<br />
Stunde zu spät zum Kamingespräch im<br />
alten Rathaus von Herzogenaurach.<br />
Vollsperrung auf der Autobahn, sie<br />
lächelt, als wäre es das Schönste,<br />
zwei geschlagene Stunden im<br />
Wagen festzusitzen. Vielleicht<br />
ist das wirklich schöner als in<br />
der Bullenhitze des Kaminzimmers.<br />
Aber die Genossinnen sind jetzt erleichtert.<br />
Sie empfangen die Besucherin wie<br />
eine Heldin. Kohnen, 45, tritt tiefstimmig<br />
FOTOS: LUKAS BARTH/DAPD [M], HORST GALUSCHKA [M], JENS BÜTTNER [M]; COLLAGE: CICERO<br />
38 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Drei Generationen von Frauen der Bayern-SPD. Am Anfang war Renate Schmidt, die<br />
erste Vorsitzende eines SPD-Landesverbands, die Augenpartie unten links. Heute amtiert<br />
Natascha Kohnen – allerdings nur als Generalsekretärin, Augenpartie oben links. Und die<br />
nächste Frauengeneration? Vielleicht Johanna Uekermann, Augenpartie in der Mitte<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 39
F R A U F R I E D F R A G T S I C H …<br />
… wie sie sich gegen die<br />
Vegetarier wehren soll<br />
I<br />
CH ESSE GERN FLEISCH.<br />
Als Schwäbin ekle ich<br />
mich auch nicht vor Innereien,<br />
und mir ist klar, dass<br />
grobe Leberwurst sich nicht wesentlich<br />
von dem unterscheidet,<br />
was sich in den Futterdosen unseres<br />
Katers befindet. Warum alle so<br />
überrascht waren, dass in Lasagne<br />
für 1,99 Euro kein Bio-Rinderfilet<br />
drin ist, verstehe ich nicht. Dass<br />
hochwertige Lebensmittel nicht<br />
billig zu haben sind, sollte sich inzwischen<br />
herumgesprochen haben.<br />
Mein Problem ist: Ich fühle<br />
mich verfolgt. Mein vegetarisches<br />
Über-Ich heißt Hanna und<br />
ist eine Freundin von mir. Wenn<br />
wir zusammen im Restaurant sind,<br />
bestelle ich kein Fleisch, weil ich weiß, dass sie es nicht gerne sieht. Wenn jemand<br />
bei Facebook das Foto einer Schlachtplatte postet, schreibe ich nicht „Oh, lecker!“<br />
darunter, weil ich Sorge habe, sie könnte es lesen. Hanna gehört nicht zu den Vegetariern,<br />
die neben dem Würstchengrill stehend Vorträge über Massentierhaltung<br />
halten. Sie erwähnt ihre vegetarische Lebensweise nur, wenn man ihr Fleisch aufdrängen<br />
will, nicht um zu missionieren. Trotzdem macht Hanna mir ein schlechtes<br />
Gewissen, und das nehme ich ihr übel.<br />
Früher wäre es einfach gewesen. Da hätte ich Hanna als wunderliche Körnerfresserin<br />
belächelt und ungerührt weiter meine blutigen Steaks verspeist. Früher<br />
war Vegetarier-Bashing Mainstream. Heute, wo wir alle genau wissen, unter welchen<br />
Umständen unsere Steaks produziert werden, fällt es immer schwerer, die<br />
notwendige Verdrängungsleistung zu erbringen, um Fleisch noch genießen zu können.<br />
Dokumentationen über Tiertransporte und Schlachthöfe im Fernsehen sehe<br />
ich mir absichtlich nicht an – wozu gibt es Foodwatch? Ich rede mir ein, dass die<br />
teure Bio-Lende, die ich meistens kaufe, von einem Tier stammt, das glücklich auf<br />
der Wiese gegrast hat und fröhlich muhend in den Tod getrabt ist. Und ich beruhige<br />
mich damit, dass den Tieren ja auch nicht geholfen ist, wenn ich sie nicht<br />
esse – schließlich sind sie ja schon tot. Kurz: Ich möchte auf gar keinen Fall aufhören,<br />
Fleisch zu essen. Ich bestelle jetzt mal die Tageszeitung ab, sperre meine vegetarisch<br />
lebenden Freunde bei Facebook aus und boykottiere die Fernsehnachrichten.<br />
Die Ernährungsdebatte kann ruhig ohne mich stattfinden. Wer beim Essen<br />
das Wort Tierquälerei in den Mund nimmt, wird von meiner Einladungsliste gestrichen.<br />
Artikel über die Umweltbelastung durch Fleischherstellung melde ich als<br />
Spam. Und zu diesem blöden Arzt, der mir erzählen will, übermäßiger Fleischkonsum<br />
sei gesundheitsschädlich, gehe ich einfach nicht mehr hin. Wäre doch gelacht,<br />
wenn ich es nicht schaffen würde, keine Vegetarierin zu werden!<br />
A MELIE FRIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über<br />
Männer, Frauen und was das Leben sonst noch an Fragen aufwirft<br />
und kompetent auf, ihr Äußeres fällt hier<br />
auf, obwohl es unauffällig und geschmeidig<br />
ist. Alle der zwei Dutzend Herzogenauracherinnen<br />
integrieren wenigstens ein<br />
rotes Teil in ihre Garderobe – Mode made<br />
by Münte –, die Generalsekretärin nicht.<br />
Sie trägt Perlenohrringe, grauen Rollkragen,<br />
blonde, lange, offene Haare.<br />
Und so spricht sie auch. Emma und<br />
Alice Schwarzer, das war ihr schon früh<br />
„too much“, ihre erste Gemeinderatssitzung<br />
sei ein Graus gewesen. „Da hat man<br />
diskutiert, welche Farbe das Bushäuschen<br />
bekommen solle. Wow!, dachte ich, das ist<br />
Politik?“<br />
Vorm Kamin geht es um die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf. Die Frauen<br />
klagen. Kohnen, Mutter von zwei Kindern,<br />
bekommt Familie und Politik zusammen.<br />
Montags und dienstags arbeitet sie in München,<br />
Mittwoch bis Sonntag ist sie unterwegs,<br />
an jedem zweiten Wochenende darf<br />
sie wieder in München arbeiten. 60 Stunden<br />
kommen so locker zusammen. Wahrscheinlich<br />
viel mehr, genau festlegen will<br />
sie sich da nicht. Aber bei diesem Termin<br />
redet sie nicht von sich, sondern betont,<br />
wie aufschlussreich und interessant sie all<br />
die Berichte findet.<br />
Die Herzogenauracherinnen sind<br />
Lichtjahre von der aufstrebenden<br />
SPD-Frau entfernt, aber sie nicken, lachen<br />
und knabbern Kekse. Vielleicht bewundern<br />
die Frauen sie, gerade weil sie sich<br />
stark von ihnen unterscheidet. Aber die<br />
Unterschiedlichkeit zwischen Führungsfigur<br />
und Basis kann auch bedeuten: Von<br />
unten werden in der SPD nicht automatisch<br />
neue, erfolgreiche Frauen nach oben<br />
kommen. Erfolgsfrauen sind immer noch<br />
Ausnahmeerscheinungen.<br />
RENATE SCHMIDT hatte sogar beides: Sie<br />
stach heraus mit ihrem Führungsanspruch,<br />
und dennoch wirkt ihre Vita genossig. Mit<br />
17 schwanger, Rauswurf aus der Schule,<br />
wegen „Schande“, wie es damals hieß; leitende<br />
Systemanalytikerin bei Quelle, aber<br />
eben auch Betriebsrätin; Trägerin des Sozialistenhuts,<br />
aber auch des Ordens wider<br />
den tierischen Ernst.<br />
Kohnens Lebenslauf wirkt dagegen behütet.<br />
Abitur, naturwissenschaftliches Studium,<br />
Lektorin, zwei Jahre in Paris. Erst<br />
mit Mitte 30 in die SPD, dafür acht Jahre<br />
später schon Generalsekretärin. Auch<br />
wenn sie bestaunt wird, weil sie anders ist,<br />
40 <strong>Cicero</strong> 4.2013
www.tropen.de<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF; FOTO: SIMONE SCARDOVELLI<br />
bedeutet das gleichzeitig eine unausgesprochene<br />
Distanz zu den Mitgliedern, die sie<br />
zu überwinden hat. Zusätzlich zum Männerklub,<br />
der sich nur langsam öffnet.<br />
„Zu sehr testosterongesteuerte Männer<br />
hat man in der Politik satt, aber Rüschenblusen<br />
eben auch“, sagt Renate Schmidt.<br />
Wenn sie über die Anfänge ihrer Politik<br />
erzählt, meint man, sie lägen Jahrhunderte<br />
zurück, dabei sind es nur Jahrzehnte.<br />
54 Mal ist sie 1983 in einer 15-minütigen<br />
Parlamentsrede über Verteidigungspolitik<br />
unterbrochen worden – im Schnitt alle<br />
16 Sekunden. „Sie sehen besser aus, als Sie<br />
reden“, hat der damalige CSU-Kreisvorsitzende<br />
und spätere Bundesminister Michael<br />
Glos zu ihr gesagt, und weil es so ein Lacher<br />
war, gleich zweimal.<br />
Schmidt möchte keinen Extratermin<br />
machen, um über die SPD-Frauen zu reden,<br />
sondern allenfalls ein Telefonat<br />
führen. Sie will sich nur<br />
noch begrenzte Zeit mit Politik<br />
beschäftigen. Thesen hat<br />
sie allerdings schon. „Frauen<br />
und Männer sind in der Politik<br />
dann erfolgreich, wenn<br />
sie, ohne ihr Geschlecht zu<br />
verleugnen, auch Fähigkeiten<br />
praktizieren, die dem<br />
jeweils anderen zugeschrieben<br />
werden.“ Das sei zum<br />
Beispiel der „richtige Kerl“,<br />
der aber zuhören kann und<br />
teamfähig sei. Oder die mütterliche Frau,<br />
die sich durchsetzen kann. Schmidt sagt<br />
auch: „Frauen haben es in der Politik leichter<br />
als früher.“<br />
Ob das zutrifft? Vielleicht werden sie<br />
nicht mehr so häufig unterbrochen, aber<br />
schwer haben sie’s immer noch, zumindest<br />
machen sie es sich schwer, zumindest<br />
in Bayern, zumindest in der SPD. Man<br />
kann das an Johanna Uekermann sehen,<br />
Vize-Juso-Bundesvorsitzende und „junge<br />
Wilde“, so wird sie intern genannt. Sie ist<br />
ein Gesicht der ganz jungen SPD, der jungen<br />
Frau, der jungen Politik. Aber das ist<br />
ziemlich brav.<br />
25 Jahre, Studentin der Politikwissenschaften<br />
und seit zehn Jahren Mitglied<br />
der SPD. „Meine Eltern sind beide in der<br />
SPD aktive Mitglieder. Als Kind habe ich<br />
mehr Parteitage als Kindergeburtstage<br />
mitgemacht.“<br />
Wild klingt das nicht, wenn die Tochter<br />
in dieselbe Partei eintritt, in der schon Vati<br />
„Testosteron<br />
hat man<br />
satt. Aber<br />
Rüschenblusen<br />
auch“<br />
Renate Schmidt<br />
und Mutti sind. Und jung klingt es auch<br />
nicht, wenn sie sagt: „Ich finde Sach inhalte<br />
wichtiger als Provokation.“ Jeder Satz hört<br />
sich an wie in einem sorgfältig vorbereiteten<br />
Bewerbungsgespräch, da kommt nichts<br />
Unüberlegtes, Spontanes vor, man könnte<br />
auch sagen: nichts Lebendiges:<br />
„Um einen Listenplatz zu bekommen,<br />
muss man zeigen, dass einem sozialdemokratische<br />
Politik wichtiger ist als die eigene<br />
Karriere.“<br />
„Auf meinem Grabstein soll mal stehen:<br />
Ich bin wahrgenommen worden, als Person,<br />
die Ziele hatte, dafür gekämpft hat und dabei<br />
nicht eingeknickt ist.“<br />
„Um nach oben zu kommen, braucht<br />
es Ausdauer und Durchsetzungsfähigkeit.“<br />
ES GIBT BEGEGNUNGEN mit Politikern, da<br />
wünscht man sich eine heulende Petra<br />
Kelly zurück, einen „Ichwill-hier-rein“-Schröder<br />
oder einen Pflasterstein-Fischer.<br />
Weil all diese Politiker<br />
eine eigene Farbe haben,<br />
einen Stil, der ihre Politik<br />
beschreibt.<br />
Selbst Bücher, die<br />
Ueker mann nennt, um ihre<br />
Politik zu charakterisieren,<br />
sind auf ihre Art sozialdemokratischer<br />
McKinsey-Jargon:<br />
Marx, Schwarzer und …<br />
gähn … Simone de Beauvoir.<br />
Nur auf die Frage, welche Politikerin ein<br />
Vorbild ist, welcher Politiker ein modernes<br />
Männerbild in der Politik repräsentiere, da<br />
fällt der seit zehn Jahren mit 40 Wochenstunden<br />
in der SPD arbeitenden Sozialdemokratin<br />
keiner ein, gar keiner, nein, auch<br />
nicht mit Nachdenken. „Ich glaub …“ –<br />
lange Schweigepause –, „da kenn ich nicht<br />
so viele.“<br />
Sie klingt parteitaktisch, angepasst, fleißig.<br />
Uekermann erinnert eher an ein Frauenbild<br />
der fünfziger Jahre, als Frauen ihre<br />
Aufgaben zu erledigen hatten: Sachbearbeiterinnen<br />
für Sachthemen, die nicht einmal<br />
Perlenohrringe tragen dürfen. Die Emanzipation<br />
in der SPD schreitet nicht nur voran.<br />
Manchmal geht es sogar rückwärts.<br />
KATRIN W ILK ENS<br />
ist freie Journalistin in Hamburg<br />
Anzeige<br />
© Lars Borges<br />
»Je mehr Menschen von<br />
dem grassierenden<br />
Zynismus infiziert sind,<br />
desto wertvoller wird<br />
das Gegenmittel. Unter<br />
dem Namen ›Weisband‹<br />
bekommt man eines,<br />
das sofort wirkt.«<br />
Frank Schirrmacher<br />
176 Seiten, gebunden, € 16,95 (D)<br />
Auch als Ebook erhältlich<br />
Marina<br />
Weisband<br />
unterwegs:<br />
Termine unter<br />
tropen.de/<br />
weisband<br />
Die Demokratie ist in der Krise<br />
und die Menschen haben den<br />
Glauben an die politischen<br />
Instanzen verloren. Marina<br />
Weisband zeigt, dass es auch<br />
anders gehen kann: verständlich,<br />
ehrlich, menschlich und<br />
direkt.<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 41
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5 6 7<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
8 9<br />
10 11 12<br />
13 14 15 16<br />
Wen hätten Sie gern an der Macht? Bis zur Bundestagswahl lädt <strong>Cicero</strong><br />
Persönlichkeiten ein, sich die perfekte Regierung zu wünschen. Die Schriftstellerin<br />
Thea Dorn hat eine Allzeit-Wunschregierung zusammengestellt: Joseph von<br />
Eichendorff kümmert sich um das Umweltressort, Carl von Clausewitz um die Kriege.<br />
Das Kabinett für die Maiausgabe des <strong>Cicero</strong> wird Monika Maron auswählen<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF; FOTOS: PICTURE ALLIANCE/DPA (13), INTERFOTO, AKG IMAGES, ULLSTEIN BILD/AKG IMAGES, ZVG<br />
42 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: KERSTIN EHMER<br />
(1) BUNDESKANZLER<br />
Friedrich II. von Preußen (1712 bis<br />
1786). Hat schon einmal ein marodes<br />
Staatswesen auf Zack gebracht.<br />
(2) CHEF DES BUNDESKANZLERAMTS<br />
Thomas Mann (1875 bis 1955).<br />
Vielleicht wäre es ihm gelungen,<br />
Friedrich die wüstesten Hasardeurspiele<br />
auszureden. Hätte in jedem Fall zu<br />
verhindern versucht, dass aus Friedrich<br />
dem Großen „Der Alte Fritz“ wird.<br />
(3) AUSWÄRTIGES<br />
Marlene Dietrich (1901 bis 1992).<br />
Preußische Kosmopolitin mit klarer<br />
Westbindung. Hat bereits in Billy Wilders’<br />
„Eine auswärtige Affäre“ brilliert.<br />
(4) INNEN<br />
Novalis (1772 bis 1801). „Nach innen geht<br />
der geheimnisvolle Weg.“ Erzromantiker,<br />
hatte trotzdem Aussicht auf eine sächsischthüringische<br />
Beamtenkarriere. Könnte<br />
dem Ressort wieder Sinn verleihen.<br />
(5) JUSTIZ<br />
Heinrich von Kleist (1777 bis<br />
1811). Zeigte in seinem „Michael<br />
Kohlhaas“, wie Gerechtigkeit geht.<br />
(6) FINANZEN<br />
Johann Georg Faust (vermutlich 1480<br />
bis 1541). Alchemist. Hat als solcher die<br />
Grundlage des Geldwesens durchschaut.<br />
(7) ARBEIT UND SOZIALES<br />
Jakob Fugger (1459 bis 1525).<br />
Unermüdlicher „Kapitalist“. Hat die<br />
älteste Armensiedlung Deutschlands<br />
gegründet – für arbeitswillige<br />
Handwerker und Tagelöhner.<br />
(8) LANDWIRTSCHAFT UND<br />
VERBRAUCHERSCHUTZ<br />
Hildegard von Bingen (1098 bis 1179).<br />
Mystikerin mit Hang zum Klostergarten.<br />
„Die Gräslein können den Acker<br />
nicht begreifen, aus dem sie sprießen.“<br />
Meinte es wenigstens wirklich so.<br />
(9) VERTEIDIGUNG<br />
Carl von Clausewitz (1780 bis<br />
1831). Wenn schon, denn schon. „In so<br />
gefährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist,<br />
sind die Irrtümer, welche aus Gutmütigkeit<br />
entstehen, gerade die schlimmsten.“<br />
(10) FAMILIE, SENIOREN,<br />
FRAUEN UND JUGEND<br />
Hedwig Dohm (1831 bis 1919). Eine der<br />
klügsten Frauen, die es in Deutschland<br />
je gegeben hat. Fünffache Mutter.<br />
Wusste, dass die Mutter nicht immer<br />
die beste Erzieherin ihrer Kinder ist.<br />
(11) GESUNDHEIT<br />
Luis Trenker (1892 bis 1990). Nauf auf ’n<br />
Berg! (Staatsbürgerschaft ist kein Problem:<br />
Konnte sich nie recht entscheiden, ob er<br />
Österreicher, Italiener oder Deutscher ist.)<br />
(12) VERKEHR, BAU, STADTENTWICKLUNG<br />
Ludwig II. von Bayern (1845 bis 1886).<br />
Würde sich beim Bau von Flughäfen<br />
und Bahnhöfen an Walhall und<br />
Versailles orientieren. Ergäbe auch<br />
kein größeres Schlamassel.<br />
(13) UMWELT<br />
Joseph von Eichendorff (1788 bis 1857).<br />
Keiner liebte den deutschen Wald inniger.<br />
(14) BILDUNG UND FORSCHUNG<br />
Wilhelm und Alexander von Humboldt<br />
(1767 bis 1835 beziehungsweise 1769<br />
bis 1859). Damit die beiden endlich<br />
aufhören können, sich im Grab zu drehen.<br />
(15) WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE<br />
Beate Uhse (1919 bis 2001). Besaß<br />
ein glückliches Händchen für beides.<br />
(16) ENTWICKLUNG<br />
Christoph Schlingensief (1960 bis 2010).<br />
Würde jedem afrikanischen Dorf<br />
ein Opernhaus gönnen.<br />
Thea Dorn, 42, schreibt<br />
Essays, Romane<br />
und Theaterstücke.<br />
Im SWR-Fernsehen<br />
moderiert sie die<br />
Büchersendung<br />
„Literatur im Foyer“.<br />
Zuletzt erschien von ihr<br />
gemeinsam mit Richard<br />
Wagner der Bestseller<br />
„Die deutsche Seele“<br />
RedWorks Düsseldorf / ERDGAS_2013 / INNOVATION_Sozialverträgliche Sanierung / <strong>Cicero</strong> / ET: 21.03.2013 / Format: 210 x 94 mm / 4c<br />
Anzeige<br />
ERDGAS – Lösungen für die Zukunft<br />
Der wirtschaftliche Weg<br />
zur Sanierung beginnt<br />
im Heizungskeller.<br />
Günstig die Heizung modernisieren: mit ERDGAS.<br />
Die Energiewende hat begonnen. Die Klimaschutzziele sind ehrgeizig. ERDGAS kann dazu beitragen, diese Ziele zu<br />
erreichen – auch ohne die Kosten aus den Augen zu verlieren. Denn moderne Erdgas-Technologien ermöglichen dank<br />
ihrer Effizienz hohe CO 2<br />
-Einsparungen ohne großen Investitionsaufwand. Das hilft bezahlbare Mieten bei der energetischen<br />
Sanierung zu sichern. Dazu bietet ERDGAS als Partner der erneuerbaren Energien eine hohe Zukunftssicherheit.<br />
Mit anderen Worten: Klimaschutz und Sozialverträglichkeit müssen sich nicht ausschließen – mit ERDGAS.<br />
Mehr Informationen finden Sie unter:<br />
www.erdgas.info
| B E R L I N E R R E P U B L I K | L I B E R A L E<br />
DAS FDP-PARADOX<br />
Die Chefs der FDP feiern ihre Partei gern als Wächterin der Freiheit. Aber die eigene<br />
Klientel? Darf keinesfalls den Kräften des freien Marktes überlassen werden<br />
V ON GUNNAR H INCK<br />
44 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: MICHAEL GOTTSCHALK/DAPD<br />
Rösler, Brüderle,<br />
Lindner. Drei für<br />
die Freiheit. Und<br />
drei für die staatlich<br />
garantierten<br />
Privilegien des<br />
Mittelstands<br />
W<br />
ENN ES DARUM GEHT, die<br />
FDP als Stoßtrupp mutiger<br />
Freiheitskämpfer und konsequenter<br />
Gegner staatlicher<br />
Bevormundung darzustellen,<br />
ist auf die Parteielite Verlass. Christian<br />
Lindner, der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen,<br />
Parteichef Philipp Rösler<br />
und Fraktionschef Rainer Brüderle können<br />
auf Knopfdruck und bei jeder sich bietenden<br />
Gelegenheit über die segensreichen<br />
Kräfte der Eigenverantwortung und des<br />
freien Marktes sprechen. Lindner steht für<br />
die intellektuelle Variante, indem er gern<br />
John Stuart Mill und Karl Popper zitiert<br />
und über die liberale Ordnungslehre doziert;<br />
Rösler bemüht häufig Pathos, wenn<br />
er von der „Flamme der Freiheit“ spricht,<br />
die nicht erlöschen dürfe; und Brüderle<br />
deckt das sinnenfreudig-süddeutsche Segment<br />
ab. „Freiheit ist ein Lebensgefühl“,<br />
pflegt er zu sagen.<br />
Merkwürdig ist, dass die offizielle Rhetorik<br />
wenig mit der Binnenwelt der Partei<br />
zu tun hat. Diese wird von den Medien<br />
kaum wahrgenommen, ist aber für die<br />
Mentalität und das politische Handeln der<br />
Partei viel bestimmender. Hier, in der Tiefe<br />
der Partei, dominiert alter deutscher Mittelstand:<br />
In den Parlamenten und regionalen<br />
Vorständen sitzen mittelständische<br />
Verbandsfunktionäre, Handwerksmeister,<br />
höhere Beamte, Landwirte, lokal verankerte<br />
Unternehmer und Freiberufler, darunter<br />
viele Rechtsanwälte. Die 93 Abgeordnete<br />
starke Bundestagsfraktion spiegelt<br />
die soziale Struktur der Partei gut wider:<br />
34 Abgeordnete sind Mitarbeiter in Familienbetrieben<br />
oder Freiberufler, darunter<br />
16 Rechtsanwälte und Notare. 25 Abgeordnete<br />
haben vor ihrem Einzug in den Bundestag<br />
im öffentlichen Dienst oder in mittelständischen<br />
Berufsverbänden gearbeitet.<br />
Nur zehn Abgeordnete sind oder waren als<br />
Unternehmer oder Führungskräfte in der<br />
freien Wirtschaft tätig.<br />
Die FDP-Honoratioren aus Mittelstand<br />
und öffentlichem Dienst klatschen<br />
bei öffentlichen Reden der Parteielite stets<br />
kraftvoll mit, wenn diese wieder einmal das<br />
Allheilmittel des freien Marktes anpreisen.<br />
Was ihre eigenen Berufe angeht, sind sie dagegen<br />
froh, dass sie vor genau diesem freien<br />
Markt gut geschützt sind. Rechtsanwälte<br />
klammern sich an das Rechtsanwaltsgebührengesetz,<br />
das genau regelt, welchen Preis<br />
sie für welche Leistung verlangen können.<br />
Anzeige<br />
EIN<br />
INSIDER<br />
KLÄRT AUF<br />
Originalausgabe<br />
180 Seiten ¤ 13,90 [D]<br />
Auch als erhältlich<br />
Das kollektive Versagen der Ermittler<br />
bei der Aufklärung der Neonazi-Morde<br />
ist kein Geheimnis mehr. Dieses<br />
Versagen hat menschliche, aber<br />
auch strukturelle Ursachen.<br />
Winfried Ridder war lange »Chefaus werter«<br />
für den Verfassungsschutz mit der<br />
Verantwortung für die Infor mationen<br />
von V-Leuten. Auf der Basis seiner<br />
Erfahrungen analysiert er die Lage<br />
und legt die Grundzüge einer neuen<br />
Sicherheitsarchitektur vor.<br />
_<br />
premium<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 45<br />
www.dtv.de
| B E R L I N E R R E P U B L I K | L I B E R A L E<br />
Alle paar Jahre erbitten die Standesvertreter<br />
vom Gesetzgeber eine Anhebung<br />
der Gebührensätze. Auf die konsequent<br />
marktliberale Idee, das Gesetz einfach abzuschaffen<br />
und die Anwaltstarife frei auszuhandeln,<br />
ist noch kein FDP-naher Anwaltsvertreter<br />
gekommen.<br />
ODER DIE NOTARE: Sie werden nach<br />
der Bundesnotarordnung bezahlt.<br />
Die Gebührensätze sind stark formalisiert<br />
und werden nach dem Wert<br />
der zu beglaubigenden Sache berechnet.<br />
Die individuelle Leistung<br />
und der tatsächliche Aufwand spielen<br />
keine Rolle, worüber vermutlich<br />
viele Notare froh sind. Die Einnahmen<br />
von Architekten und Steuerberatern<br />
berechnen sich ebenfalls nach<br />
festen Gebühren- und Honorarsätzen.<br />
Wenn Standesvertreter der Landwirte<br />
mit kritischen Fragen zum Sinn der<br />
milliardenschweren EU-Subventionen<br />
konfrontiert werden, führen sie<br />
routiniert die angeblich zwingenden<br />
Gründe für die Subventionen an. Es<br />
gehe, so heißt es dann, um die Versorgungssicherheit<br />
der Bevölkerung –<br />
darunter machen es Bauernvertreter<br />
nicht. Höhere Beamte, die sich Fragen<br />
zum rundum abgesicherten Status<br />
ihrer Berufsgruppe anhören müssen,<br />
antworten in der Regel mit einem<br />
Kurzvortrag über Friedrich den Großen<br />
und die „hergebrachten Grundsätze<br />
des Berufsbeamtentums“. Sie<br />
verteidigen den Beamtenstatus mit<br />
einer Verve, als ob es sich bei diesem<br />
um ein Naturrecht handelte und nicht<br />
um ein Privileg, das es mit viel Glück<br />
ins Grundgesetz schaffte.<br />
Jeder, der schon einmal zu Gast auf<br />
einem Neujahrsempfang einer örtlichen<br />
IHK war, wird den Moment kennen,<br />
in dem der Verbandsfunktionär<br />
den Blick mahnend auf den Bürgermeister<br />
richtet und zu mehr Aufträgen<br />
der Kommune auffordert, denn sonst, so<br />
heißt es unterschwellig drohend, könnten ja<br />
viele Arbeitsplätze gefährdet sein. Der Staat<br />
gilt hier als der Garant für Umsätze und<br />
Wohlstand und nicht als der gierige Schröpfer<br />
der Steuerzahler. Die alternative marktliberale<br />
Idee, sich EU-weit um Aufträge zu<br />
bemühen, spielt in diesem lokalen Milieu<br />
der Mittelständler und Gewerbetreibenden<br />
nur eine untergeordnete Rolle.<br />
Der Mittelstand<br />
erhält seine<br />
ständischen<br />
Privilegien auch<br />
mithilfe der FDP<br />
Im Jahr 2003 wollte die damalige rotgrüne<br />
Bundesregierung den Meisterzwang<br />
für die meisten Handwerksberufe abschaffen.<br />
Die FDP war die Partei, die die Liberalisierung<br />
am schärfsten bekämpfte. Rainer<br />
Brüderle trompetete damals: „Das deutsche<br />
Handwerk darf nicht zum Prügelknaben<br />
der Nation gemacht werden.“ Anders<br />
als Lindner und Rösler beherrscht er<br />
sowohl die offizielle marktliberale Rhetorik<br />
als auch die kumpelige Rolle des Interessenvertreters<br />
des Mittelstands, was ein<br />
wichtiger Grund dafür sein dürfte, dass er<br />
in der Partei gut beleumundet ist.<br />
Zeitgleich plante die rot-grüne Regierung<br />
damals, den Arzneimittelhandel zu<br />
liberalisieren. Apotheker sollten mehrere<br />
Filialen betreiben können und der Internethandel<br />
ermöglicht werden. Selbstverständlich<br />
protestierte die FDP, schließlich<br />
fürchtete sie die Konkurrenz durch Apothekenketten<br />
und europäische Internetapotheken,<br />
die den geregelten Markt und<br />
damit die Renditen ihrer Klientel kaputt<br />
machen könnten. Der Autor fragte<br />
seinerzeit den damaligen FDP-Unterhändler<br />
im Bundestag, warum seine<br />
Partei eigentlich gegen die Liberalisierung<br />
im Gesundheitssektor ist, wo<br />
sie doch sonst immer von positiven<br />
Kräften des freien Marktes spricht.<br />
Der Politiker schwieg, lächelte verlegen<br />
und murmelte dann, dass das<br />
bisherige System doch ganz gut funktioniere.<br />
Es war ein ehrlicher Moment,<br />
der den Widerspruch der Partei<br />
aufzeigte.<br />
Die schwarz-gelbe Koalition hat<br />
die Privilegien des Mittelstands bewusst<br />
erhalten. Im Koalitionsvertrag<br />
ist dieses Ziel explizit aufgeführt.<br />
Der berüchtigte Steuernachlass für<br />
Hotelbetriebe, den die FDP einforderte<br />
und schließlich auch bekam,<br />
war letztlich nicht überraschend. Er<br />
passt ins Bild.<br />
Es gehört zu den größten Paradoxien<br />
der vergangenen 25 Jahre, dass in<br />
nahezu jedem Sektor der Berufswelt<br />
das Wettbewerbsprinzip Einzug hielt,<br />
während sich ausgerechnet die sogenannten<br />
freien Berufe davor weitgehend<br />
schützen konnten. Während inzwischen<br />
jede Krankenschwester beim<br />
Verbandswechsel auf die Uhr sehen<br />
muss, um die Renditeziele ihres Krankenhauses<br />
nicht zu gefährden, konnte<br />
der alte Mittelstand seine ständischen<br />
Privilegien des 19. Jahrhunderts auch<br />
mithilfe der FDP verteidigen.<br />
DER WIDERSPRUCH DER FDP zwischen<br />
Anspruch und Wirklichkeit ist noch<br />
größer geworden, seit Guido Westerwelle<br />
als Vorsitzender das Profil der Partei<br />
auf den Wirtschaftsliberalismus reduziert<br />
hat. Eine Interessenpartei war sie schon<br />
vorher.<br />
1972 sorgte die damalige SPD/FDP-<br />
Bundesregierung für einen teuren Systembruch<br />
in der Rentenversicherung. Selbstständige,<br />
die vordem von der gesetzlichen<br />
Rente ausgeschlossen waren, konnten<br />
sich zu Discount-Preisen in das staatliche<br />
KARIKATUR: BURKHARD MOHR<br />
46 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Anzeige<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Rentensystem einkaufen. Ein älterer Selbstständiger<br />
musste nur vergleichsweise läppische<br />
35 000 oder 40 000 D-Mark investieren,<br />
und schon profitierte er von einem<br />
Solidarsystem, in das normale Arbeitnehmer<br />
jahrzehntelang einzahlen müssen, um<br />
eine einigermaßen auskömmliche Rente zu<br />
bekommen.<br />
Das Urteil des damaligen „Verbands<br />
Deutscher Rentenversicherungsträger“<br />
war Jahre später eindeutig: Die Reform<br />
habe „lukrative Nachrichtungsmöglichkeiten<br />
mit hoher Rendite“ ermöglicht,<br />
die Neuregelungen seien „ausgabenträchtig“.<br />
Die Reform war ein typischer Koalitionskompromiss.<br />
Die SPD wollte, dass<br />
Hausfrauen in die Rentenversicherung<br />
einsteigen konnten, die FDP bediente<br />
im Gegenzug ihre Klientel. Weil aber die<br />
durchschnittliche Hausfrau des Jahres<br />
1972 viel weniger Bargeld in die Hand<br />
nehmen konnte als der Zahnarzt von nebenan,<br />
lagen die Renditen der Selbstständigen<br />
und die damit verbundenen Kosten<br />
für die Allgemeinheit viel höher. Aus der<br />
vergessenen Rentenreform von 1972 lassen<br />
sich zwei Erkenntnisse ziehen: Dass in<br />
einer Zeit, in der alle Parteien den Staat als<br />
unerschöpfliche Geldquelle betrachteten,<br />
auch die FDP mitmachte. Und dass sich<br />
ein politisches Milieu ohne Hemmungen<br />
eines Solidarsystems bedient, wenn sich<br />
die Gelegenheit bietet und leistungslose<br />
Gewinne winken.<br />
Die Idee blamierte sich immer, wenn<br />
sie von dem Interesse unterschieden war,<br />
schrieb Karl Marx. Mit anderen Worten:<br />
Purer Idealismus bleibt hohl, solange er<br />
nicht an handfeste Interessen gekoppelt<br />
ist. Der Satz gilt aber auch andersherum:<br />
Das reine, egoistische Verfechten eigener<br />
Interessen entlarvt sich irgendwann selbst,<br />
wenn mit den Interessen keine politische<br />
Idee verbunden ist. Bei SPD und Grünen<br />
finden sich gut verdienende Hochschulprofessoren<br />
oder Architekten, die bewusst die<br />
hohen Spitzensteuersätze, die ihre Parteien<br />
vertreten, in Kauf nehmen. Persönlich ist es<br />
ein Minusgeschäft für sie, aber weil sie von<br />
der sozialen Idee der Umverteilung überzeugt<br />
sind, stehen sie dahinter. Bei CDU<br />
und CSU finden sich Mitglieder, die aufgrund<br />
ihrer christlichen Überzeugung ähnlich<br />
denken.<br />
Der FDP fehlt dagegen ein übergeordnetes<br />
Ideal, von dem die Anhänger<br />
auch dann noch überzeugt sind, wenn es<br />
sich mal negativ auf das eigene Einkommen<br />
niederschlägt. Die Partei ist Opfer<br />
eines selbst geschaffenen Paradoxes: Der<br />
individualistische, auf das rein Materielle<br />
beschränkte Freiheitsbegriff untergräbt<br />
das Freiheitsideal, das die Partei<br />
ausruft. Am Ende geht es nur noch um<br />
Egoismus und persönliche Nutzenmaximierung.<br />
Man nimmt, was man kriegen<br />
kann, und wenn dies am einfachsten<br />
durch Klientelismus und staatlichen<br />
Protektionismus zu erreichen ist, suspendiert<br />
man leichthin die hehren Ideale von<br />
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.<br />
Am Ende findet sich der Liberalismus<br />
auf Mediamarkt-Niveau wieder: Ich<br />
bin doch nicht blöd.<br />
Die Partei steckt in einem strategischen<br />
Dilemma. Bekennt sie sich offen als Interessenpartei<br />
des Mittelstands, würde sie<br />
sich noch stärker an die Ketten dieser Klientel<br />
legen. Schlägt sie einen konsequent<br />
marktliberalen Kurs ein, liefe sie Gefahr,<br />
diese Wählerklientel zu verlieren. Die wirklichen<br />
Profiteure des freien Marktes – die<br />
Manager und Anteilseigner von börsennotierten<br />
Konzernen, international verflochtenen<br />
Unternehmen und Investmentfonds<br />
– brauchen die FDP nicht, um ihre<br />
Interessen durchzusetzen.<br />
„Der Liberalismus lässt sich heute weder<br />
als Großunternehmer-Philosophie<br />
missbrauchen noch auf eine Kleinhändler-Ideologie<br />
reduzieren.“ Das schrieb<br />
Karl-Hermann Flach, der liberale Vordenker,<br />
im Jahr 1971. Der erste Teil des Satzes<br />
stimmt heute nur teilweise, der zweite<br />
stimmt nicht mehr. Der politische Liberalismus<br />
ist derzeit auf eine Kleinhändler-<br />
Ideologie reduziert. Der legendäre FDP-<br />
Generalsekretär Flach wollte seine Partei<br />
einst „aus seiner besitzbürgerlichen Erstarrung“<br />
befreien. „Die individuellen Interessen<br />
eines sich konsolidierenden Bürgertums<br />
erhielten Vorrang vor dem liberalen<br />
Grundanliegen, nämlich Freiheit und<br />
Würde für möglichst viele Menschen zu<br />
sichern“, bilanzierte er die Geschichte des<br />
politischen Liberalismus in Deutschland.<br />
Die Beschreibung gilt exakt für die FDP<br />
im Jahr 2013.<br />
GUNNAR H INCK<br />
ist Politikwissenschaftler und<br />
freier Autor in Berlin<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 47<br />
Foto: Franziska Hüther<br />
Gerald Hüther zeigt, wie die<br />
Hirnforschung das Zusammenleben<br />
revolutionieren kann.<br />
ISBN 978-3-89684-098-1<br />
Auch als E-Book erhältlich.<br />
www.edition-koerber-stiftung.de<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Jetzt testen<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 943170
| B E R L I N E R R E P U B L I K | M E I N S C H Ü L E R<br />
„Rösler meinte, er sei witzig“<br />
Sprüche über Mitschüler, Witze über den Fernseher des Lehrers: H ELMUT SCHN I TTE R hat<br />
die Auftritte seine Schülers PHILIPP RÖSLER nie komisch gefunden. So ist es auch heute<br />
Die Lutherschule in Hannover war in den Neunzigern<br />
eine Hochburg des Philologenverbands, also<br />
eher konservativ, es gab sehr wenige Achtundsechziger-Lehrer.<br />
Ich hatte Philipp Rösler in der Oberstufe<br />
in Englisch. Äußerlich wirkte er unauffällig<br />
und angepasst, aufmüpfig war er nicht, und als politisch<br />
aktiv habe ich ihn auch nicht erlebt. Bei mir<br />
im Unterricht war er durchschnittlich. Er fiel aber<br />
dadurch auf, dass er gerne Sprüche über andere machte. Er meinte,<br />
er sei dadurch witzig. Aber ich hatte den Eindruck, das haben seine<br />
Mitschüler nicht unbedingt so empfunden. Ich erinnere mich an<br />
eine Situation: Wir haben in Englisch einen Roman gelesen und<br />
anschließend den Film geschaut, den es dazu gab. Es könnte „Kes“<br />
nach dem Buch „A Kestrel for a Knave“ von Barry Hines gewesen<br />
sein oder „Animal Farm“ von George Orwell, das weiß ich<br />
nicht mehr genau. Für den Film habe ich die Klasse zu mir nach<br />
Hause eingeladen. Rösler kam auch, ich habe einen kleinen Imbiss<br />
und etwas zu trinken hingestellt, und es war eigentlich alles<br />
ganz schön. Aber Rösler hat eine dumme Bemerkung über meinen<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
Fernseher gemacht. Das war so ein Grundig-Gerät,<br />
weder alt noch neu. Ein ganz normaler Fernseher.<br />
Darum lachte auch keiner.<br />
In der Presse erzählte Rösler später immer wieder<br />
die Geschichte, er hätte an der Schule deshalb<br />
keine Probleme wegen seines asiatischen Aussehens<br />
bekommen, weil die Leute dachten, er könne Karate.<br />
Darum hätten sie ihn in Ruhe gelassen. Das<br />
nehme ich ihm eigentlich übel, denn es ist ein großer Blödsinn.<br />
Die Lutherschule hatte immer schon Schüler aus ganz unterschiedlichen<br />
Familien: Aus der Unigegend kamen die Professoren- und<br />
Bürgerkinder, aber im Einzugsbereich der Schule war die Kernfabrik<br />
von Continental, also kamen beispielsweise auch Kinder aus<br />
türkischen Familien. Und es gab in den Neunzigern längst Schüler<br />
asiatischer Herkunft. Ich habe nie gehört, dass irgendjemand<br />
damit irgendein Problem gehabt hätte.<br />
In der <strong>Cicero</strong>-Serie „Mein Schüler“ zur Bundestagswahl spürt<br />
Constantin Magnis Lehrer unserer Spitzenpolitiker auf<br />
Die Lutherschule<br />
in Hannover.<br />
Hier unterrichtete<br />
Helmut Schnitter,<br />
71, von 1990 bis<br />
1992 den jungen<br />
Philipp Rösler<br />
FOTO: LUTHERSCHULE HANNOVER; GRAFIK: CICERO<br />
48 <strong>Cicero</strong> 4.2013
HAPE KERKELING<br />
Fotografiert von Martin Schoeller<br />
exklusiv für HÖRZU<br />
Einer, der<br />
zu Hause hat
| W E L T B Ü H N E<br />
HE SPEAKS DEUTSCH<br />
Man hat das Gefühl, John Kerry sei ein alter Bekannter. Doch wofür steht der US-Außenminister?<br />
V ON C H R IST OPH V ON M A R SCHALL<br />
D<br />
IE USA WENDEN SICH vom Atlantik<br />
ab und blicken nach Asien. Tatsächlich?<br />
Der neue US-Außenminister<br />
jedenfalls wirkt wie ein Dementi<br />
dieser These. John F. Kerry ist von Europas<br />
Kultur und Geschichte geprägt. Als<br />
Teenager hat er Berlin mit dem Fahrrad<br />
erkundet und die fortschreitende Teilung<br />
beobachtet. Sein Vater, ein Ex-Militär, war<br />
seit 1954 Rechtsberater der US-Mission<br />
dort. Mit elf Jahren schickten die Eltern<br />
den Sohn in ein Schweizer Internat. Sein<br />
Deutsch klingt auch heute noch passabel.<br />
Die Sommerferien verbrachten die Kerrys<br />
in der Bretagne, auf einem Anwesen der Familie<br />
seiner Mutter Rosemary Forbes. Dort<br />
ist ihm Frankreich ans Herz gewachsen.<br />
Im Rückblick mag es scheinen, als habe<br />
Kerry sich ein Leben lang auf das Amt vorbereitet,<br />
das er nun mit 69 Jahren übernommen<br />
hat – in einem Alter, in dem andere<br />
ihre Hobbys pflegen.<br />
Doch was sind die Schwerpunkte seiner<br />
späten Passion? Der Biografie nach ist<br />
es Europa. Die aktuellen Brennpunkte<br />
zwingen ihm eher den Mittleren Osten,<br />
Afrika und Asien auf. Er sagt, er wolle<br />
Lehren aus Europa auf aktuelle Konflikte<br />
anwenden und nennt die Marshall-Plan-<br />
Hilfe. Angesichts der aggressiven Töne im<br />
Inselstreit zwischen China, Japan und Korea<br />
wäre es ihm gewiss eine Beruhigung,<br />
wenn es in Asien ein Sicherheitssystem<br />
wie die Nato gäbe.<br />
Sein Leben ist reich an Überraschungen.<br />
Die Kerrys hatten wegen des Namens<br />
und der Treue zur katholischen Kirche<br />
lange als irische Amerikaner gegolten.<br />
Doch als John Forbes Kerry 2003 als neuer<br />
„JFK“ den Wahlkampf um das Weiße Haus<br />
aufnahm und Medien Parallelen zu John<br />
F. Kennedy untersuchten, der ebenfalls Senator<br />
von Massachusetts war und es zum<br />
Präsidenten geschafft hatte, förderte der<br />
Boston Globe Sensationelles zutage: Kerrys<br />
Großeltern väterlicherseits waren Juden<br />
aus Schlesien. Fritz Kohn und Ida Löwe<br />
hatten 1900 den Namen Kerry angenommen<br />
– der irische Ort war angeblich das<br />
Zufallsergebnis, als Fritz einen Stift mit verschlossenen<br />
Augen über einer Karte fallen<br />
„Es ist viel billiger, heute Diplomaten<br />
zu senden als morgen Truppen“<br />
John Kerry bei seiner Amtseinführung<br />
ließ. 1901 traten sie zum Katholizismus<br />
über, 1905 wanderten sie in die USA aus.<br />
Zwischen den Kindertagen in Berlin<br />
und dieser Enthüllung lagen Jahrzehnte einer<br />
typisch amerikanischen Karriere. Manche<br />
Etappen wie der Vietnamkrieg haben<br />
Kerrys internationale Erfahrung gestärkt,<br />
aber nicht absichtsvoll, eher als Nebenprodukt<br />
der Laufbahn im Militär einer Weltmacht.<br />
Als er 13 Jahre alt war, hatten die<br />
Eltern ihn nach Amerika zurückgeschickt,<br />
in Internate der weißen Oberschicht in<br />
Neuengland. An der Yale University erwarb<br />
er den Bachelor in Politologie und<br />
war wie George W. Bush, sein Gegner in<br />
der Wahl 2004, Mitglied der legendären<br />
studentischen Geheimgesellschaft „Skull<br />
and Bones“. 1966 trat Kerry in die Navy<br />
ein, befehligte 1968/69 in Vietnam ein<br />
Schnellboot und erhielt mehrere Orden.<br />
Zurück daheim schloss er sich dem Protest<br />
gegen den Krieg an und gewann Prominenz<br />
durch Auftritte in Kongressausschüssen.<br />
Im Kampf um das Weiße Haus<br />
wurde dies 2004 zur Last.<br />
Den Einstieg in die Politik fand Kerry<br />
nach dem Jurastudium und einigen Jahren<br />
als Staatsanwalt. 1982 wurde er Vizegouverneur<br />
von Massachusetts, seit 1984 ist er<br />
Senator dieses verlässlich progressiven Staates.<br />
Im Senat beackerte er viele Themen:<br />
Kleinbetriebe, Kommunikation, Frauenrechte,<br />
Veteranenversorgung, Luftsicherheit,<br />
dazu Außenpolitik, etwa bei der Untersuchung<br />
der Iran-Contra-Affäre. Zum<br />
Schwerpunkt wurde sie aber erst in jüngerer<br />
Zeit. 2009 rückte er an die Spitze<br />
des außenpolitischen Ausschusses im Senat,<br />
als Nachfolger Joe Bidens, der Vizepräsident<br />
wurde. Obama hat Kerry mit heiklen<br />
Missionen betraut. Er überredete Afghanistans<br />
Präsidenten Hamid Karsai 2009 zur<br />
Wiederholung der Präsidentenwahl, nachdem<br />
es im ersten Anlauf Manipulationen<br />
gegeben hatte. Kerry flog als Vermittler<br />
nach Pakistan, um die Gemüter nach tödlichen<br />
Schusswechseln mit US-Truppen<br />
im Grenzgebiet und nach dem Zugriff auf<br />
Osama bin Laden zu besänftigen.<br />
Auch als Außenminister bleibt Kerry<br />
Diener des Präsidenten und kann eigene<br />
Ambitionen nur begrenzt ausleben. Militäreinsätze<br />
betrachtet er mit Skepsis. „Es ist<br />
viel billiger, heute Diplomaten zu senden<br />
als morgen Truppen“, sagte er in seiner Antrittsrede.<br />
Er soll den Frieden in Asien retten,<br />
ein Nahostabkommen vorbereiten, mit<br />
dem sich Barack Obama schmücken will,<br />
und Irans Atomprogramm sowie Syriens<br />
Bürgerkrieg ohne Militäreinsatz stoppen.<br />
Und Europa? Kerry erliegt nicht dem<br />
Irrtum vieler Amerikaner, die Asien wegen<br />
der Wachstumsdynamik überschätzen und<br />
die EU unterschätzen. Er weiß, dass die<br />
atlantische Partnerschaft mehr amerikanische<br />
Jobs sichert als die pazifische.<br />
CHRISTOPH VON MARSCHALL<br />
ist seit 2005 USA-Korrespondent.<br />
Von ihm erschien zuletzt „Der<br />
neue Obama. Was von der zweiten<br />
Amtszeit zu erwarten ist“<br />
FOTOS: BROOKS KRAFT/CORBIS, PRIVAT (AUTOR)<br />
50 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Heute greift JFK nur noch<br />
selten zur Gitarre – vor mehr<br />
als 40 Jahren spielte er in der<br />
Rockband „The Electras“ den Bass<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 51
| W E L T B Ü H N E<br />
KARATE KANN SIE AUCH<br />
Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite überzeugt durch Standfestigkeit und Unabhängigkeit<br />
V ON PAU L F LÜCK IGER<br />
A<br />
LS ERSTE AMTSHANDLUNG halbierte<br />
Dalia Grybauskaite ihr eigenes<br />
Gehalt. Das war vor knapp vier<br />
Jahren, als die streitbare Finanzspezialistin<br />
aus Brüssel in ihre Heimat Litauen zurückkehrte,<br />
um Staatspräsidentin zu werden.<br />
Litauen steckte in der größten Wirtschaftskrise<br />
seit Erlangung der Unabhängigkeit<br />
von der Sowjetunion Anfang der neunziger<br />
Jahre. Die Wirtschaft schrumpfte um<br />
über 20 Prozent im Jahresschnitt. Statt wie<br />
ihre Herausforderer im Wahlkampf mit<br />
Populismus aufzutrumpfen, sprach Grybauskaite<br />
Klartext, kündigte eine schmerzhafte<br />
Sparrunde an – und gewann. Über<br />
zwei Drittel der Litauer wählten die unabhängige<br />
Kandidatin bereits in der ersten<br />
Wahlrunde. Schmutzkampagnen in dem<br />
katholischen Land, die der Singlefrau vorwarfen,<br />
eine Lesbe zu sein, nützten ihren<br />
Gegnern nichts. Was für die Wähler zählte,<br />
waren Unabhängigkeit und Sachverstand.<br />
Heute weist Litauen wieder eine der<br />
höchsten Wachstumsraten in der Europäischen<br />
Union auf, die Euro-Einführung im<br />
Jahr 2015 gilt als sicher, und Grybauskaite<br />
ist immer noch die weitaus beliebteste Politikerin<br />
in dem größten Baltenstaat.<br />
Dabei blieb sich die 56-Jährige treu wie<br />
kaum eine zweite Politikerin. Sie vermisse<br />
die Brüsseler Freiheit, auch mal in Jeans aus<br />
dem Haus zu gehen, klagte sie kurz nach<br />
Amtsantritt in einem Interview. Ihr Leben<br />
bestehe nun noch mehr nur aus „Arbeit,<br />
Arbeit und noch mal Arbeit“. Keine Klage,<br />
eher eine nüchterne Feststellung – typisch<br />
Grybauskaite.<br />
Als EU-Finanz- und Haushaltskommissarin<br />
hatte sie in Brüssel ab Herbst<br />
2004 Karriere gemacht. Die Brüsseler<br />
Korrespondenten stürzten sich gerne auf<br />
ihre undiplomatischen Auftritte. Die<br />
EU-Novizin aus dem kleinen 3,3-Millionen-Einwohner-Land<br />
wurde besonders<br />
als Haushaltskommissarin in Punkten<br />
deutlich, wo sich andere jahrelang hinter<br />
schönen Formeln versteckt hatten. Sie<br />
konnte schroff und arrogant sein, machte<br />
ätzende Witze und provozierte auch<br />
Schwergewichte.<br />
Die 1956 in Vilnius geborene Tochter<br />
einer Verkäuferin und eines Elektrikers<br />
wuchs im sowjetisch besetzten Litauen in<br />
einfachen Verhältnissen auf. Ihr Abendstudium<br />
in politischer Ökonomie in Leningrad<br />
musste sie sich selbst finanzieren –<br />
als Arbeiterin in der Pelzfabrik „Rot-Front“.<br />
Grybauskaite kennt die<br />
russische Mentalität aus<br />
Studium und Parteihochschule<br />
1983 kehrte sie nach Vilnius zurück und<br />
unterrichtete an der Parteihochschule der<br />
KPdSU. Daneben studierte sie in Moskau<br />
weiter. Grybauskaite schien unterwegs zu<br />
einer mustergültigen sowjetischen Beamtenkarriere,<br />
als Litauen 1991 die Unabhängigkeit<br />
erlangte. Noch im selben Jahr<br />
ergatterte sie einen Aufbaustudienplatz<br />
in Washington. In Litauens schwieriger<br />
Transformationsphase wusste sie die neuen<br />
Chancen zu packen und konnte sich rasch<br />
anpassen. In dem jungen Staat arbeitete sie<br />
bald im Finanz- und Außenministerium,<br />
verhandelte mit Brüssel den EU-Beitritt,<br />
war Botschafterin in den USA und wurde<br />
schließlich 2001 Finanzministerin einer sozialdemokratischen<br />
Regierung.<br />
Zwar nennt sie Winston Churchill und<br />
Margaret Thatcher als ihre politischen Vorbilder,<br />
doch sieht sich Grybauskaite bis<br />
heute eher als Beamtin denn als Politikerin.<br />
Der „Goldene Schnitt“ zwischen Haushaltsdisziplin<br />
und Wirtschaftswachstum<br />
interessiert sie mehr als Machtspiele und<br />
Parteiengezänk. Als große Pragmatikerin<br />
zeigte sich Grybauskaite auch in der Außenpolitik.<br />
Nicht unumstritten ist dabei<br />
ihr freundlicher Umgang mit dem weißrussischen<br />
Autokraten Alexander Lukaschenko.<br />
Litauen könne sich keinen „hungrigen<br />
und wütenden“ Nachbarn leisten,<br />
begründet sie ihre Kritik an Wirtschaftssanktionen.<br />
Brücken sind ihr wichtiger als<br />
Gräben – auch weil Litauen eine 600 Kilometer<br />
lange Grenze mit Weißrussland teilt.<br />
Zudem mache es keinen Sinn, das Nachbarland<br />
vollends in die Hände Russlands zu<br />
treiben, warnt Litauens Präsidentin.<br />
Grybauskaite kennt die russische Mentalität<br />
aus Studium und sowjetischer Parteihochschule.<br />
Neben Englisch und Polnisch<br />
spricht sie fließend Russisch. Das alles hilft<br />
ihr im Kontakt mit autokratischen Politikern<br />
aus dem postsowjetischen Raum.<br />
Doch sobald es um Litauens Verhältnis zu<br />
Russland geht, wird auch die Pragmatikerin<br />
zur litauischen Patriotin. Das Verhältnis<br />
zwischen Vilnius und Minsk mag sich<br />
entspannt haben, das zu Moskau ist immer<br />
noch eisig.<br />
Das gemeinsame private Interesse für<br />
asiatische Kampfsportarten hat sie bisher<br />
nicht mit dem russischen Präsidenten<br />
Wladimir Putin zusammengebracht. Vielleicht<br />
liegt es daran, dass die Litauerin ihren<br />
Schwarzen Karategürtel erst Ende der<br />
neunziger Jahre in den USA erlangte, der<br />
Russe seinen Judogürtel hingegen schon als<br />
junger Bursche im Sowjetheer. Karate sei<br />
eher eine Philosophie und Lebenseinstellung,<br />
die ihre Arbeit diszipliniere und Konflikte<br />
verhindere, erklärte Grybauskaite vor<br />
einigen Jahren. Darüber hinaus hält sich<br />
die Powerfrau ohne Familie mit Angaben<br />
über ihr Privatleben zurück.<br />
PAU L F LÜCK IGER<br />
arbeitet seit Sommer 2000<br />
als Osteuropakorrespondent in<br />
Warschau. Er ist Mitglied von<br />
weltreporter.net<br />
FOTOS: PLATON/TRUNK ARCHIVE, PRIVAT (AUTOR)<br />
52 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Dalia Grybauskaites<br />
politische Vorbilder sind<br />
Winston Churchill und<br />
Margaret Thatcher<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 53
| W E L T B Ü H N E<br />
KAFFEEKLATSCH IN AACHEN<br />
Der niederländische Chefdiplomat Frans Timmermans will die Außenpolitik seines Landes neu ausrichten<br />
V ON ROB S AV ELBER G<br />
F<br />
RANS TIMMERMANS kennt die Bundesrepublik<br />
und bewundert das<br />
Land wegen seiner politischen<br />
Kultur und Wirtschaftskraft. Jüngst hat<br />
der Sozialdemokrat und überzeugte Europäer<br />
seine Landsleute sogar dazu aufgerufen,<br />
mehr und vor allem besser Deutsch zu<br />
sprechen. Timmermans selbst spricht sieben<br />
Sprachen fließend, Deutsch ist eine davon.<br />
Dass ausgerechnet ein bekennender Europäer<br />
und Deutschland-Fan zum Außenminister<br />
der Niederlande ernannt wurde, mag<br />
manch einen überrascht haben, ist doch das<br />
Königreich unter dem Einfluss des Populisten<br />
Geert Wilders in den vergangenen Jahren<br />
immer euroskeptischer geworden.<br />
Timmermans verkörpert das genaue<br />
Gegenteil. Der 51-Jährige wuchs in Limburg<br />
an der Grenze zu Deutschland und<br />
Belgien auf. Dort, wo die Den Haager<br />
Elite ganz fern zu sein scheint. Noch immer<br />
geht der vierfache Vater, soweit es sein<br />
neuer Terminkalender zulässt, jedes Wochenende<br />
mit seiner Familie in Aachen<br />
Kaffee trinken und Kuchen essen.<br />
Als junger Beamter im Haager Außenministerium<br />
musste Timmermans am<br />
9. November 1989 nicht lange überlegen,<br />
was er tun sollte. Gemeinsam mit einigen<br />
Freunden fuhr er in seinem alten Toyota<br />
Starlet nach Ostberlin, wo sein Vater<br />
im Konsulat arbeitete. „Es war und ist<br />
das wichtigste Ereignis in meinem Leben<br />
als Politiker“, sagt er heute noch. Das Bild<br />
der geteilten Stadt mit ihren Checkpoints<br />
und den stinkenden Trabis hat sich seinem<br />
Gedächtnis eingeprägt. „Die Frauen aus<br />
Ostberlin waren alle blondiert, die Männer<br />
trugen komische Lederjacken, und alle<br />
fragten mich nach Geld für Bier.“<br />
Ein Jahr später, 1990, war der Westler<br />
wieder im Osten, bekam eine Stelle an der<br />
Botschaft in Moskau. Dort erlebte der Diplomatensohn<br />
die Krämpfe und Kämpfe um<br />
die untergehende Sowjetunion. Bei Heimweh<br />
setzte er sich einfach in seinen Wagen<br />
und fuhr quer durch Europa – durch<br />
„Holland soll sich mehr auf<br />
Europa und vor allem auf<br />
Deutschland konzentrieren“<br />
Frans Timmermans, Außenminister<br />
Weißrussland, Polen, die DDR und Westdeutschland<br />
– ohne Pause nach Hause.<br />
Heute ist es wieder so, dass er mehrere<br />
Länder am Tag besucht. Timmermans<br />
freut sich sichtbar über seinen „Traumjob“.<br />
Pflichtbewusst betont er die Kontinuität,<br />
stellt aber gleichzeitig die Weichen<br />
der niederländischen Außenpolitik neu. Es<br />
ist kein Geheimnis, dass er die traditionell<br />
angelsächsische Ausrichtung seines Landes<br />
ändern möchte. Während Regierungschef<br />
Mark Rutte Sir Winston Churchill und<br />
Ronald Reagan bewundert, schlägt Timmermans<br />
Herz schneller bei Willy Brandt<br />
und Helmut Schmidt. Daher lautet sein<br />
Rat: „Die Niederlande sollten sich mehr<br />
auf Europa und vor allem auf Deutschland<br />
konzentrieren.“<br />
Diese Aussage war gewagt angesichts<br />
der schweren Last der deutsch-holländischen<br />
Vergangenheit, die zu einem distanzierten<br />
Verhältnis zu den Deutschen<br />
geführt hatte. Timmermans weiß jedoch,<br />
dass dies für die heutige Generation<br />
keine so große Bedeutung mehr hat.<br />
Sichtbarstes Zeichen dafür: Niederländer<br />
sind die größte Touristengruppe zwischen<br />
Aachen und Zittau, sie machen inzwischen<br />
lieber Urlaub im Sauerland und<br />
tanzen in Berliner Klubs als an der Côte<br />
d’Azur.<br />
Der Blick auf die Bundesrepublik soll<br />
nicht nur richtungweisend für die Krisenpolitik<br />
in der Eurozone sein, sondern auch<br />
für die schwächelnde Wirtschaft der Niederlande.<br />
Das Land führt ein Viertel seiner<br />
Produkte nach Deutschland aus und ist eines<br />
der wohlhabendsten Staaten des Kontinents.<br />
Timmermans, der Holland wirtschaftlich<br />
als 17. Bundesland betrachtet,<br />
bleibt optimistisch. Der Enkel zweier Tagebauarbeiter<br />
ist überzeugt, dass die Haager<br />
Regierung ihre Probleme mit der Rezession,<br />
mit der Integration der Minderheiten<br />
und der stärker werdenden gesellschaftlichen<br />
Zweiteilung in Zeiten der Globalisierung<br />
lösen kann.<br />
Insbesondere zwei Bereiche der niederländischen<br />
Außenpolitik will Timmermans<br />
neu ausrichten. Im Nahostkonflikt steht<br />
der Außenminister nicht so bedingungslos<br />
an der Seite Israels wie sein Amtsvorgänger.<br />
Er versucht verstärkt, einen Ausgleich<br />
mit den Palästinensern zu erreichen.<br />
Auch will er, dass die Niederlande aufhören,<br />
sich in ihrer Außenpolitik hauptsächlich<br />
von wirtschaftlichen Erwägungen leiten zu<br />
lassen. Menschenrechte und Demokratiebestrebungen<br />
müssten wieder einen höheren<br />
Stellenwert bekommen.<br />
So zeigt sich auch heute, dass sich die<br />
internationale Politik der Niederlande, wie<br />
seit ihrer Blütezeit im 17. Jahrhundert üblich,<br />
zwischen dem Kaufmann und dem<br />
Pfarrer abspielt.<br />
ROB S AV ELBER G<br />
ist Deutschlandkorrespondent für<br />
De Telegraaf, die auflagenstärkste<br />
Zeitung der Niederlande. Er lebt<br />
seit 1998 in Berlin<br />
FOTOS: ROBIN UTRECHT/PICTURE ALLIANCE/ANP, PRIVAT (AUTOR)<br />
54 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Frans Timmermans fordert von<br />
seinen Landsleuten, mehr und<br />
besser Deutsch zu sprechen<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 55
| W E L T B Ü H N E | V E N E Z U E L A & C O<br />
WAS BLEIBT,<br />
IST DAS ÖL<br />
Nach dem Tod von Hugo Chávez steht Venezuelas<br />
„Bolivarische Revolution“ führungslos da.<br />
Und der Linkspopulismus in Lateinamerika<br />
verliert seinen dynamischen Krösus<br />
V ON C A R LOS W IDMANN<br />
D<br />
ER COMANDANTE der „Bolivarischen<br />
Revolution“ hat in Venezuelas<br />
Hauptstadt Caracas<br />
etwas Großes geschaffen: ein<br />
Pantheon für zwei. Dereinst<br />
soll Hugo Chávez hier gemeinsam mit seinem<br />
Idol Simón Bólivar verehrt werden,<br />
dem Befreier halb Südamerikas zu Beginn<br />
des 19. Jahrhundert. Dessen Gebeine hatte<br />
Chávez vorsorglich ausgraben und in den<br />
Pantheon umbetten lassen, seine eigenen<br />
Überreste werden folgen.<br />
Noch ist es aber nicht so weit. Noch<br />
sollen die Venezolaner möglichst lange am<br />
provisorisch konservierten Verblichenen<br />
Chávez vorüberdefilieren und der Welt ihre<br />
Verstörung darbieten. Mario Vargas Llosa,<br />
Literaturnobelpreisträger aus Peru, zeigt<br />
dafür wenig Verständnis. Man solle sich<br />
von den „flennenden Massen“ nicht beeindrucken<br />
lassen, schrieb er: „Das sind doch<br />
die gleichen Leute, die sich vor Schmerz<br />
und Verlassenheit krümmten beim Tod<br />
von Perón, von Franco, von Stalin, von<br />
Trujillo, und die morgen Fidel Castro das<br />
Geleit geben werden.“<br />
Nett klingt das nicht, etwas Wahres ist<br />
jedoch dran. Die politischen Erben des gescheiterten<br />
Putschisten und späteren Revolutionärs<br />
haben noch einiges vor mit dem<br />
Verstorbenen. Nicolás Maduro, der von<br />
Chávez ernannte Vizepräsident und derzeit<br />
per Verfassungsbruch amtierender Staatschef<br />
und auch Nachfolgekandidat bei der<br />
Wahl am 14. April, hat es verkündet: Hugo<br />
Chávez werde ebenso nachhaltig einbalsamiert<br />
„wie Lenin, Ho Tschi Minh und Mao<br />
Zedong“. Er hätte hinzufügen können: wie<br />
Eva Perón, Josef Stalin und der Nordkoreaner<br />
Kim Il Sung.<br />
Nur macht der ultraliberale Vargas<br />
Llosa es sich ein wenig zu leicht, wenn er<br />
die Erschütterung von Millionen Venezolanern<br />
allein ihrem naiven Erlösungshunger,<br />
ihrem Führerbedürfnis und dem schamlosen<br />
Personenkult von Chávez’<br />
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“<br />
zuschreibt. Die Ausstrahlung<br />
dieser „Mischung<br />
aus Hanswurst und Superman“<br />
(Vargas Llosa) reicht<br />
auch in Venezuelas Mittelstand<br />
hinein – und in breite<br />
Schichten einiger Länder Lateinamerikas.<br />
Brasiliens Präsidentin<br />
Dilma Rousseff etwa<br />
nahm mit ihrer Aussage, dieser<br />
Tod habe auf dem Kontinent eine<br />
„Leere in den Herzen“ hinterlassen, Rücksicht<br />
auf Millionen Menschen.<br />
Tatsächlich erfüllte der Comandante<br />
ein Bedürfnis: Er war die lauteste Stimme<br />
Trotz der<br />
größten<br />
Erdölreserven<br />
sind die<br />
meisten<br />
Venezolaner<br />
arm<br />
unter jenen Politikern, deren Rhetorik den<br />
Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit<br />
wirkungsvoll mit dem Ressentiment gegen<br />
die USA verknüpft. Dazu kam der schwärmerische<br />
Ernst, mit dem der<br />
wortmächtige Mestize seinen<br />
Traum von der Einheit<br />
Lateinamerikas vorzutragen<br />
wusste. Gepaart mit dem<br />
Witz und dem Redezwang<br />
eines geborenen Alleinunterhalters,<br />
machte ihn das<br />
zu einem unverwechselbaren<br />
Protagonisten der Zeitgeschichte.<br />
Selbst die Medien,<br />
die er zum Schweigen<br />
bringen wollte, werden ihn vermissen.<br />
Uruguays Präsident José Mujica nannte<br />
etwas treuherzig den anderen Grund für<br />
Chávez’ fast schon übernatürliche Ausstrahlung:<br />
„Er war der großzügigste<br />
FOTOS: PHOTOSHOT, PRIVAT (AUTOR)<br />
56 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Tränenreich nehmen die Menschen<br />
Abschied vom toten venezolanischen<br />
Staatschef Hugo Chávez<br />
Staatschef, dem ich je begegnet bin.“ Das<br />
viel gerühmte Charisma des Venezolaners<br />
hätte in der Tat nicht viel genutzt ohne<br />
die Petrodollar-Milliarden, die der karibische<br />
Krösus gezielt an Gleichgesinnte im<br />
In- und Ausland verteilte. Die Agitatoren<br />
in Bolivien, die mit Gebäudebesetzungen<br />
und Straßenblockaden gewählte Regierungen<br />
stürzten; Kolumbiens terroristische<br />
Guerrilleros, die die fast endemische<br />
Gewalt in ihrem Land auf Bürgerkriegsniveau<br />
zu verschärfen wussten; der bankrotte<br />
und korrupte Sandinist Daniel Ortega in<br />
Nicaragua, der nochmals Präsident werden<br />
konnte; radikale Gewerkschafter und Publizisten<br />
auf der ganzen Südhalbkugel. Die<br />
Scheckbuch- und Bargeld-Diplomatie von<br />
„Hurrikan Hugo“ hauchte ihnen allen Lebenskraft<br />
ein. Nur selten kam es zu peinlichen<br />
Pannen wie in Argentinien: Der große<br />
Koffer eines Chávez-Abgesandten, der auf<br />
dem Flughafen von Buenos Aires vom Zoll<br />
versehentlich geöffnet wurde, war prall gefüllt<br />
mit Dollarscheinen – für die Wahlkampfkasse<br />
der heutigen argentinischen<br />
Präsidentin Cristina Kirchner.<br />
Venezuela könnte das höchste Pro-<br />
Kopf-Einkommen der Welt haben. Zumindest<br />
hat das Land die größten Erdölreserven<br />
des Planeten: Die Reserven belaufen<br />
sich auf mehr als 297 Milliarden Barrel, in<br />
Saudi-Arabien, dem weltgrößten Ölförderer,<br />
sind es hingegen 265 Milliarden Barrel.<br />
Trotzdem sind die meisten Venezolaner<br />
weiterhin arm. Auch nach einem Jahrzehnt<br />
schwungvoller Sozialhilfe und Geldverteilung<br />
unter Chávez lebt ein Viertel der Bevölkerung<br />
– nach Drittweltstandards – unter<br />
der Armutsgrenze.<br />
Dabei hatte der sendungsbewusste Comandante<br />
auch noch unglaubliches Fortune:<br />
In den ersten zehn Jahren seiner<br />
Amtszeit ist der Weltmarktpreis für Erdöl<br />
um ein Fünffaches gestiegen – von 20 auf<br />
über 100 US-Dollar pro Barrel. Durch die<br />
Verstaatlichung der Erdölförderung ist die<br />
Produktion in Venezuela jedoch nicht gestiegen,<br />
sondern gesunken.<br />
Obwohl der wahrscheinliche Nachfolger<br />
Nicolás Maduro ein auf Kuba indoktrinierter<br />
Apparatschik ist, wird aus Havanna<br />
bedrückte Stimmung gemeldet. Es<br />
gilt dort keineswegs als gesichert, dass Venezuela<br />
es sich weiterhin leisten kann, die<br />
kubanische Wirtschaft vor dem Untergang<br />
zu bewahren. Wenn die 100 000 Barrel<br />
Erdöl ausfallen, die täglich aus der Bucht<br />
von Maracaibo nach Kuba fließen, gehen<br />
in Havanna die Lichter aus.<br />
Die Führungsrolle, die Hugo Chávez<br />
in Lateinamerika beanspruchte, war schon<br />
vor seinem Tod zweifelhaft. Unter der Präsidentin<br />
Dilma Rousseff ist Brasilien noch<br />
deutlicher als unter ihrem populären Vorgänger<br />
Lula auf Distanz zu Chávez gegangen,<br />
dem Kumpanen von Gaddafi, Assad<br />
und Ahmadinedschad. Aber nicht nur die<br />
Wirtschaftsriesen Mexiko und Brasilien<br />
standen ihm skeptisch gegenüber: Auch<br />
das Wirtschaftswunderland Chile, auch<br />
Peru und Kolumbien gehen andere Wege.<br />
Der kinderreiche katholische Bischof und<br />
Chávez-Fan Fernando Lugo ist als Präsident<br />
Paraguays vom Parlament abgesetzt<br />
worden. In Mittelamerika hat Venezuela<br />
nur das nicaraguanische Regime des Altsandinisten<br />
Ortega auf seiner Seite – mehr<br />
Belastung als Gewinn.<br />
Ein linker Populismus kann sich immerhin<br />
in Bolivien und Ecuador reformfähig<br />
halten, weil dort mit Erfolg Erdgas<br />
und Erdöl gefördert werden. Der linksrhetorischen<br />
Kleptokratie des Kirchner-Klans<br />
in Argentinien aber, wo die amtlich verschwiegene<br />
Inflation die Gelddrucker zu<br />
Höchstleistungen anspornt, stehen bittere<br />
Zeiten bevor.<br />
C A R LOS W IDMANN, geboren<br />
in Buenos Aires, war lange Zeit<br />
Korrespondent in Lateinamerika.<br />
Jüngst erschien von ihm: „Das<br />
letzte Buch über Fidel Castro“<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 57
| W E L T B Ü H N E | B E P P E G R I L L O<br />
ES WAR EINMAL<br />
EIN CLOWN<br />
Populist, Europafeind, Faschist. Das alles und noch viel mehr<br />
soll Beppe Grillo sein. Der wahre Sieger der italienischen<br />
Parlamentswahlen verstört viele. Wer ist er wirklich?<br />
V ON P E TRA RESK I<br />
58 <strong>Cicero</strong> 4.2013
4.2013 <strong>Cicero</strong> 59
| W E L T B Ü H N E | B E P P E G R I L L O<br />
V<br />
IELLEICHT HAT BEPPE GRILLO sich<br />
das auch nicht so vorgestellt.<br />
Damals, als er an einem nebligen<br />
Novembertag 2005 im Turiner<br />
Theater Valdocco stand.<br />
Zusammen mit Jungs in flusigen Pullovern,<br />
die ihren Kampf gegen den Feinstaub<br />
erklärten, und Mädchen, die mit<br />
rauchiger Stimme zu Mahnwachen vor<br />
dem Parlament und zum Kampf gegen<br />
den Bau des Tunnels für den TAV aufriefen,<br />
den Hochgeschwindigkeitszug durch<br />
das Val di Susa – eines der vielen Milliardenprojekte,<br />
die in Italien ohne Bürgerbeteiligung<br />
und in schönster Eintracht<br />
von Regierung und Opposition vorangetrieben<br />
werden. Einen Monat zuvor hatte<br />
Grillo von seinem Weblog die Idee der<br />
„Meet-ups“ lanciert: kleine, renitente Zellen,<br />
die nach nur drei Monaten bereits<br />
7000 Mitglieder zählten, in Turin fand ihr<br />
erstes nationales Treffen statt. „Sie können<br />
nicht länger so tun, als seien wir unsichtbar“,<br />
rief Grillo. In den italienischen Zeitungen<br />
las man darüber: nichts.<br />
DIE FAMILIE<br />
Heute arbeiten sich die Leitartikler sämtlicher<br />
Zeitungen an Grillo ab, wie sie es sonst<br />
nur mit Berlusconi tun, und beklagen den<br />
„Grillozentrismus“. In den Klatschblättern<br />
werden Kinderbilder von Grillo und Fotos<br />
seiner Frau beim Urlaub in Kenia veröffentlicht.<br />
Seitdem weiß man in Italien,<br />
dass seine zweite Frau Halbiranerin ist und<br />
sich überfordert fühlt, immer nur bio einkaufen<br />
zu müssen. Dank den Zeitschriften<br />
Oggi und Gente haben die Italiener erfahren,<br />
dass Beppe Grillo vier Söhne hat,<br />
65 Jahre alt ist, in Genua aufwuchs, seine<br />
Mutter eine Klavierlehrerin und sein Vater<br />
ein kleiner Metallunternehmer war; dass er<br />
in einer Villa in Genua lebt und ein Ferienhaus<br />
in der Toskana besitzt.<br />
Jetzt kampieren Journalisten Tag und<br />
Nacht vor Grillos Haus und fotografieren<br />
jeden, der sich nähert, denn die Welt<br />
fragt sich: Beppe Who? Wer ist dieser bärtige<br />
Komiker, der – scheinbar – aus dem<br />
Nichts kommend, ein Viertel der italienischen<br />
Wähler überzeugen konnte, für seine<br />
Fünf-Sterne-Bewegung zu stimmen. Eine<br />
Bewegung, die, glaubt man Berlusconis<br />
Kampfblatt Il Giornale, aus „einer Handvoll<br />
Spinner“ besteht, und die, je näher die<br />
Wahlen heranrückten, von dem Blatt zu<br />
„Globalisierungsgegnern und Gewalttätern“<br />
stilisiert wurden, die angeblich den Staatsstreich<br />
vorbereiteten.<br />
Seine<br />
Glaubwürdigkeit<br />
erlangte Beppe<br />
Grillo, weil er<br />
sich mit den<br />
Mächtigen anlegte,<br />
als es noch allen<br />
gut ging. Er war<br />
immer schon mehr<br />
als ein Komiker<br />
DIE LABEL<br />
In der italienischen Presse wurde Grillo<br />
wahlweise als Populist, Faschist, Antisemit,<br />
Putschist, Rotbrigadist, Rassist,<br />
Duce, Demagoge, Kommunist und Jakobiner<br />
geschmäht. Die Fünf Sterne sei<br />
eine „anarcho-antipolitisch-anachronistische<br />
Bewegung“, wusste Eugenio Scalfari,<br />
Herausgeber der linksdemokratischen Repubblica,<br />
und schauderte: „Hinter dem<br />
Grillismo sehe ich den Schatten des widerwärtigsten<br />
Law & Order, ich sehe dahinter<br />
die Diktatur.“ Die Unità, einstige Parteizeitung<br />
der Kommunistischen Partei Italiens,<br />
sah in der Bewegung ein Phänomen reiner<br />
Folklore, das potenziell umstürzlerische<br />
Tendenzen in sich trage: Grillo erinnere an<br />
Mussolini, Letzterer habe Schlagstöcke und<br />
Rhizinusöl eingesetzt, Grillo die Vulgarität.<br />
Der Corriere della Sera stellte fest, dass<br />
Grillo eine Person von brutaler Gier sei,<br />
die Turiner Stampa beschied, dass die Protestinitiativen<br />
der Fünf-Sterne-Bewegung<br />
so unbedeutend seien, dass sie „in einem<br />
normalen Land auf den Unterhaltungsseiten<br />
besprochen worden wären“. Kurz vor<br />
den Wahlen wusste sich Berlusconis Propagandablatt<br />
Libero nicht mehr anders zu<br />
helfen, als Beppe Grillo in „Grill Laden“<br />
umzutaufen, der Marschflugkörper nach<br />
Israel schicken wolle. Schließlich stimmte<br />
ein Viertel der Wähler für die Fünf-Sterne-<br />
Bewegung. Alle verrückt geworden? Geistesgestört?<br />
Unfähig, klar zu denken?<br />
OHNE GRILLO<br />
Fast 20 Jahre lang war der Ausgang der<br />
Wahlen in Italien so überraschend wie das<br />
Wahlergebnis der DDR-Volkskammer: Abgesehen<br />
von kurzen Unterbrechungen gewann<br />
Silvio Berlusconi. Falls er mal nicht<br />
gewann, sorgte er dafür, dass die Regierung<br />
der Linksdemokraten nicht von Dauer sein<br />
würde, indem er sich Abgeordnete kaufte.<br />
Die Linksdemokraten muckten kurz auf –<br />
um sich dann wieder in der Opposition bequem<br />
einzurichten, mit Blick auf den bösen<br />
Mann, dem bis auf einen alle privaten<br />
Fernsehsender gehören, das größte Verlagshaus,<br />
der berühmteste Fußballverein, drei<br />
Tageszeitungen, Banken und die Mafia<br />
auch, zu der er seit Jahrzehnten freundschaftliche<br />
Beziehungen pflegt. Was kann<br />
man gegen ihn schon ausrichten? Nichts!<br />
Selbst wenn sie an der Macht waren,<br />
waren die Linksdemokraten zu ermattet,<br />
um überfällige Gesetzesänderungen durchzusetzen,<br />
beispielsweise ein Gesetz zur Regelung<br />
von Interessenkonflikten – etwa<br />
zwischen Ministerpräsidentenamt und<br />
dem des größten Medienunternehmers des<br />
Landes. Oder das Wahlrecht zu reformieren,<br />
auch Porcellum, Schweinerei, genannt,<br />
weil es einer Partei, die nur auf 30 Prozent<br />
der Stimmen kommt, ermöglicht, 55 Prozent<br />
der Sitze zu erhalten. Ein Wahlrecht,<br />
bei dem keine Kandidaten zur Wahl stehen,<br />
sondern nur Parteien oder Parteibündnisse,<br />
weshalb der Wähler die Katze<br />
im Sack kaufen muss. Anstatt Gesetzesänderungen<br />
durchzusetzen, trösteten sich die<br />
Linksdemokraten damit, dass es ja auch ein<br />
paar Städte, Regionen und Banken gab, die<br />
ihnen gehörten, ein paar Großprojekte, an<br />
denen sie beteiligt waren, und dass sich das<br />
Problem Berlusconi irgendwann auf natürliche<br />
Weise erledigen würde.<br />
Und dann schaffte es eine Bewegung,<br />
die kein Geld hat, keine Fernsehsender,<br />
keine Tageszeitung, kein Verlagshaus,<br />
keine Banken, keine Fußballvereine<br />
und die überdies einen sperrigen Namen<br />
trägt – sie ist nach den fünf Leit-„Sternen“<br />
des Gründungsprogramms benannt: Wasser,<br />
Umwelt, Transport, Internet, Entwicklung<br />
–, stärkste Partei zu werden. Das kam<br />
einem Erdbeben gleich – jedenfalls für die<br />
FOTO: ALESSIO MAMO/REDUX/LAIF (SEITEN 58 BIS 59)<br />
60 <strong>Cicero</strong> 4.2013
etablierten Parteien. Nicht aber für normalsterbliche<br />
Italiener, die in einem Land<br />
leben, wo die Staatsverschuldung 120 Prozent<br />
des Bruttosozialprodukts beträgt, fast<br />
39 Prozent der jungen Italiener arbeitslos<br />
sind, die Mafia doppelt so viel Umsatz<br />
macht wie Fiat, täglich 35 Betriebe Konkurs<br />
anmelden, weshalb sich die Zahl der<br />
Selbstmorde unter kleinen und mittleren<br />
Unternehmern häuft, weil sie von den Banken<br />
keine Kredite mehr bekommen.<br />
Für Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung<br />
stimmten enttäuschte Linke und<br />
enttäuschte Berlusconi- und Lega-Wähler:<br />
Alle, die hoffen, dass sich endlich etwas<br />
ändert in einem Land, das gespalten ist.<br />
Wo auf der einen Seite wohlhabende Rentner<br />
leben, staatliche Angestellte mit üppigen<br />
Monatsgehältern, dank Parteiklüngel<br />
reich gewordene Politiker und Unternehmer,<br />
und auf der anderen Seite junge Italiener,<br />
deren einzige Gewissheit ist, nie einen<br />
festen Job zu bekommen, weil die Gewerkschaften<br />
ein rigides Arbeitsrecht verteidigen,<br />
das aus dem Jahr 1970 stammt, einer<br />
Zeit, als man unter „Globalisierung“ noch<br />
ein Synonym für Weltreise verstand.<br />
DER CLOWN<br />
Seine Glaubwürdigkeit erlangte Beppe<br />
Grillo, weil er sich mit den Mächtigen anlegte,<br />
als es noch allen gut ging. Er war<br />
immer schon mehr als ein Komiker. Er ist<br />
Politikwüterich, Umweltschützer, Moralist<br />
und Nationalheiliger in Personalunion. Silvio<br />
Berlusconi war noch nicht am politischen<br />
Horizont aufgetaucht, da war Grillo<br />
schon einer der beliebtesten italienischen<br />
Fernsehstars. Er wurde mit sämtlichen italienischen<br />
Fernsehpreisen überschüttet<br />
und hatte Einschaltquoten von 22 Millionen<br />
Zuschauern. Als er sich aber nicht<br />
mehr damit begnügte, Sitten und Gebräuche<br />
zu verspotten, sondern über die soziale<br />
und politische Wirklichkeit Italiens herzog,<br />
wurde er auf Druck des inzwischen verstorbenen<br />
Sozialistenchefs Bettino Craxi 1993<br />
vom Bildschirm verbannt. Daraufhin zog<br />
Grillo durch die großen Theater Italiens. Er<br />
wütete landauf, landab, stritt für die Meinungsfreiheit<br />
und gegen die Umweltzerstörung<br />
und Korruption, trennte auf der<br />
Bühne den Müll, jonglierte mit Zahlen<br />
und Statistiken, zerrte den Mailänder Bürgermeister<br />
auf die Bühne, zwang ihn, die<br />
Abgase eines wasserstoffbetriebenen Lieferwagens<br />
einzuatmen – und gründete 2005<br />
einen Blog, der schnell zu einem der erfolgreichsten<br />
der Welt wurde.<br />
Hier ist Grillo in seinem Element, auch<br />
weil er sich niemandem unterwerfen und<br />
sich nicht beschränken muss. Wenn es etwas<br />
gibt, das Grillo nicht kann, dann ist es,<br />
sich selbst in den Hintergrund zu stellen.<br />
Als man ihn mit dem amerikanischen Regisseur<br />
und Autor Michael Moore verglich,<br />
sagte Grillo, dass Moore ihm etwas voraushabe:<br />
sich selbst in die zweite Reihe zu stellen.<br />
„Es ist schrecklich, mich zu interviewen,<br />
ich kann nicht an mich halten und<br />
neige zu Monologen. Ich habe auch versucht,<br />
Filme zu machen, aber es geht nicht,<br />
man muss maßvoll sein und die Kontrolle<br />
behalten, und ich bin wie ein reißender<br />
Fluss.“ Jeder, der je den Versuch gemacht<br />
hat, Grillo zu interviewen, wird das bestätigen<br />
können.<br />
GRILLOS VERBÜNDETE<br />
Grillos Blog brachte ihm die Freundschaft<br />
mit Gianroberto Casaleggio ein, einem<br />
Mailänder Kommunikationsexperten, der<br />
inzwischen als Grillos Alter Ego gilt. Casaleggio<br />
sieht aus wie eine Mischung aus<br />
John Lennon und einem IT-Nerd, allerdings<br />
mit Jackett und Krawatte. Anders<br />
als Grillo, der keinen Schritt machen kann,<br />
ohne die Menschen zum Lachen zu bringen<br />
– er sieht in einem Theater ein Blumengesteck<br />
und ruft: „Und wo steht der<br />
Sarg?“ –, läuft Casaleggio stets mit Leichenbittermine<br />
durch die Welt. Er glaubt<br />
bedingungslos an das Netz, an die direkte<br />
Bürgerbeteiligung und daran, dass es möglich<br />
ist, die italienische Politik zu verändern.<br />
Ohne Casaleggio hätte es die Fünf-Sterne-<br />
Bewegung nicht gegeben, sagt Grillo. Mit<br />
ihm zusammen erarbeitet er nicht nur die<br />
Posts für seinen Blog, die Kommunikationsstrategie,<br />
die Initiativen – weshalb Casaleggio<br />
von dem einen Teil von Grillos<br />
Anhängern als Guru verehrt und von dem<br />
anderen als Diktator verdammt wird, hinter<br />
dem die CIA, die Freimaurer und die<br />
Weltfinanz vermutet werden. Niemand<br />
weiß, ob Casaleggio tatsächlich die Linie<br />
vorgibt, oder ob es so ist, wie Grillo sagt,<br />
dass sich die beiden Männer ergänzten wie<br />
Analyse und Synthese und beide stets auf<br />
die gleichen Ideen kämen: „Wir sind wie<br />
ein Ehepaar, wir telefonieren sechs Mal<br />
Anzeige<br />
WWW.SKD.MUSEUM<br />
ALBERTINUM<br />
16.3.–14.7.2013 /GALERIE NEUE MEISTER /DRESDEN<br />
Hauptförderer<br />
Gefördert durch die<br />
Abb.: Eugène Delacroix / Verwundeter Räuber [Brigand blessé] / um 1825 (Ausschnitt) // © Kunstmuseum Basel // Foto: Martin P. Bühler
| W E L T B Ü H N E | B E P P E G R I L L O<br />
am Tag, wir unterhalten uns, und so entsteht<br />
ein Stück für den Blog.“ Zu Grillos<br />
Mitstreitern gehören auch der italienische<br />
Nobelpreisträger Dario Fo sowie der Architekt<br />
Renzo Piano oder der Sänger Adriano<br />
Celentano, allesamt italienische Nationalheiligtümer.<br />
Was Grillos Feinde betrifft,<br />
so muss man nur die italienischen Zeitungen<br />
aufschlagen, da versammelt sich täglich<br />
die gesamte linke Nomenklatura zum<br />
Grillo-Bashing.<br />
SEINE SCHLACHTEN<br />
In seinem Blog führt Grillo seine im Theater<br />
und Fernsehen begonnenen Kämpfe<br />
weiter. Er startete die „Fazio-hau-ab“-Initiative<br />
gegen den in einen Bankenskandal<br />
verwickelten Chef der italienischen Nationalbank<br />
Antonio Fazio, der dafür verantwortlich<br />
war, dass viele Kleinsparer ihre<br />
Ersparnisse verloren. Grillo-Anhänger finanzierten<br />
einen Appell in der Tageszeitung<br />
Repubblica und schafften es tatsächlich,<br />
Fazio zum Rücktritt zu zwingen. Der<br />
„Raus-aus-dem-Irak“-Aufruf brachte dem<br />
Staatspräsidenten 800 000 E-Mails ein, der<br />
die Aktion allerdings mit Schweigen quittierte.<br />
Immer mehr Italiener unterstützten<br />
Grillos Initiativen, die Aktion „Sauberes<br />
Parlament“ forderte den Rücktritt<br />
vorbestrafter Parlamentarier und fand ihren<br />
Höhepunkt auf dem V-Day 2007, wobei<br />
V für Vaffanculo steht, also: Leck mich<br />
am Arsch. 50 000 Menschen versammelten<br />
sich damals in Bologna zum Protest:<br />
300 000 Italiener unterschrieben die Petition.<br />
Beim zweiten V-Day forderten Grillo<br />
und seine Anhänger die Streichung der üppigen<br />
staatlichen Subventionen, die Tageszeitungen<br />
in Italien zustehen – wenn sie<br />
sich als „parteinah“ erklären.<br />
DIE MEDIEN<br />
Dass er sich damit keine Freunde unter den<br />
Journalisten gemacht hat, war Beppe Grillo<br />
klar. Die Verbindung zu politischen Parteien<br />
und Interessengruppen der Wirtschaft<br />
ist in Italien so eng, dass dortige Zeitungen<br />
eigentlich einen Beipackzettel enthalten<br />
müssten, der über die Risiken und Nebenwirkungen<br />
der Lektüre aufklärt: Etwa, dass<br />
die Repubblica und der Espresso dem linksdemokratischen<br />
Industriellen Carlo De Benedetti<br />
gehören, Gegenspieler von Berlusconi.<br />
Dass die Wirtschaftszeitung Il sole 24<br />
Ore von dem italienischen Unternehmerverband<br />
herausgebracht wird, die Turiner<br />
Der Kommunikationsexperte Gianroberto<br />
Casaleggio ist Grillos engster Vertrauter<br />
Der italienische Nobelpreisträger Dario Fo<br />
gilt ebenso als Unterstützer Beppe Grillos …<br />
… wie der vielfach ausgezeichnete<br />
Architekt Renzo Piano und …<br />
… der Sänger, Schauspieler und<br />
Fernsehmoderator Adriano Celentano<br />
Stampa dem Fiatkonzern gehört, und Il<br />
Giornale, Il Foglio und Libero Berlusconis<br />
Hauspostillen sind. Einzig Il Fatto Quotidiano,<br />
eine Tageszeitung, die 2008 von einer<br />
Handvoll Investigativjournalisten gegründet<br />
wurde, die es leid waren, stets auf die<br />
politischen Empfindlichkeiten ihrer Herausgeber<br />
Rücksicht nehmen zu müssen,<br />
verzichtet auf die öffentlichen Gelder und<br />
leistet sich eine Berichterstattung, die nicht<br />
von Parteiinteressen gesteuert ist.<br />
Der Fatto Quotidiano ist denn auch die<br />
einzige Tageszeitung, die es schafft, ohne<br />
Schaum vor dem Mund über Beppe Grillo<br />
und seine Fünf-Sterne-Bewegung zu schreiben.<br />
Sie leistet sich auch Kritik an der Bewegung,<br />
um nicht zuletzt die Wagenburgmentalität<br />
aufzubrechen, in die sich viele<br />
Aktivisten geflüchtet haben. Hier war auch<br />
zu lesen, dass das von Grillo und seinem<br />
Alter Ego Casaleggio gepriesene Netz die<br />
Achillesferse einer Bewegung sein kann, die<br />
keine Sprecher hat, sondern Parlamentarier,<br />
die ihre Worte nicht auf die Goldwaage legen<br />
und lieber schnell mal twittern oder auf<br />
Facebook posten – was von den italienischen<br />
Zeitungen begierig aufgegriffen wird.<br />
In Copy & Paste-Manier verbreiteten<br />
sich die Grillo-Schmähungen in ganz Europa:<br />
In Deutschland erschien kaum ein Bericht<br />
über das neue politische Phänomen,<br />
ohne es umgehend als „populistisch“ und<br />
„anti-politisch“ zu ächten. Überall wurde<br />
vor dem „windigen Stimmenfänger“, dem<br />
„Politclown“ und „Radikalpopulisten“ gewarnt.<br />
Der britische Economist spielte den<br />
Ball unter dem Titel „Send in the clowns“<br />
weiter, und selbst die Franzosen rügten die<br />
Italiener: Der Korrespondent von Le Monde<br />
beschwor seine Liebe zu Italien, aber: „Dieses<br />
Mal bin ich wirklich wütend: Wollt ihr<br />
tatsächlich die Schlüssel für dieses Land in<br />
die Hand von Grillo legen?“<br />
Im Ausland kommt erschwerend hinzu,<br />
dass Grillo als Europafeind gilt. Tatsache<br />
aber ist, dass er vermutlich öfter im Europäischen<br />
Parlament gesehen wurde als<br />
Berlusconi. Drei Mal war Grillo dort auf<br />
Einladung italienischer EU-Parlamentarier<br />
zu Besuch und sprach auch die unangenehme<br />
Wahrheit aus, dass es womöglich<br />
unsinnig sei, aus Italien Milliarden nach<br />
Brüssel zu schicken, wenn diese Milliarden<br />
dann von Brüssel aus in die Taschen der italienischen<br />
Mafia umgeleitet würden. Vielleicht<br />
ist es auch nicht falsch, wenn Grillo<br />
sagt, dass sich heute niemand mehr etwas<br />
FOTOS: ANTONIO SCATTOLON/A3/CONTRASTO/LAIF, MILO SCIAKY/PICTURE ALLIANCE/DPA, ABACA DARGENT VINCENT/PICTURE ALLIANCE/DPA, VENTURELLI/GETTY IMAGES<br />
62 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> Probe lesen<br />
FOTO: PAUL SCHIRNHOFER<br />
unter Europa vorstellen könne – weil Europa<br />
in Italien nur in Form von Verboten<br />
und Verordnungen auftritt. Und dass nicht<br />
der Euro das Problem in Italien sei, sondern<br />
die Zinsen aus der Staatsverschuldung,<br />
die man neu aushandeln müsse.<br />
REGIERUNGSFÄHIGKEIT<br />
Der spektakuläre Wahlsieg war für Beppe<br />
Grillo Segen und Fluch zugleich. Seine<br />
Fünf-Sterne-Bewegung war plötzlich<br />
nicht mehr eine bloße außerparlamentarische<br />
Oppositionsbewegung; viele sehen<br />
in ihr jetzt eine Art Heilsbringerin, die die<br />
Probleme von 20 Jahren schlechter Regierung<br />
lösen soll, ohne sich zuvor erproben<br />
zu können. Was wäre gewesen, wenn<br />
die Grünen vor 30 Jahren sogleich mit<br />
163 Abgeordneten in den Bundestag eingezogen<br />
wären, mitsamt ihrem Ex-General,<br />
romantischen Pazifistinnen und grenzwertigen<br />
Naturschwärmern? Hätte damals<br />
jemand daran geglaubt, dass die Grünen<br />
später für einen langsamen Wandel in der<br />
politischen Kultur und in der Gesellschaft<br />
sorgen würden?<br />
Der in Bologna lehrende Politologe<br />
Piero Ignazi sagt über Grillos Fünf-Sterne-<br />
Bewegung, dass sie weder utopisch noch<br />
populistisch sei. Vielmehr handele es sich<br />
um einen pragmatischen Protest, der von<br />
Grillo vertreten und in ein Medienspektakel<br />
umgewandelt werde. Hinter dem Protest<br />
und Grillos Show fänden sich jedoch<br />
viele gute Ideen: Was ist schlecht daran, für<br />
die Umwelt zu kämpfen, für mehr Meinungsfreiheit,<br />
für das Internet, gegen die<br />
Verschwendung öffentlicher Gelder?<br />
Wer in Italien lebt und die Skandale der<br />
vergangenen 20 Jahre nicht ganz verdrängt<br />
hat, die Herrschaft eines notorischen Lügners,<br />
der während des Wahlkampfs noch<br />
einmal zu großer Form auflief, wer noch<br />
den Überblick über die Korruptionsskandale<br />
hat und sich noch an die parteiübergreifenden<br />
Einigungsgespräche zwischen Staat<br />
und Mafia erinnert, deren Früchte bis heute<br />
geerntet werden – der empfindet es als Erleichterung,<br />
wenn mal einer wie Grillo es auf<br />
den Punkt bringt und ausruft: „Ihr lebenden<br />
Leichen, wir reißen euch den Arsch auf.“<br />
PETRA RESKI, Journalistin und<br />
Schriftstellerin, lebt seit 1991<br />
in Venedig. Zuletzt erschien ihr<br />
Buch „Von Kamen nach Corleone<br />
– Die Mafia in Deutschland“<br />
Ihre Abo-Vorteile:<br />
Frei Haus: <strong>Cicero</strong> wird ohne<br />
Aufpreis zu Ihnen nach Hause<br />
geliefert .<br />
Vorteilspreis: Drei Ausgaben für<br />
nur 16,50 EUR* statt 24,– EUR.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 16,50 EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 16,50 EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts weiter<br />
zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,– EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im<br />
Einzelverkauf) und spare so über 10 %. Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen nach<br />
Erhalt der dritten Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit<br />
kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
*Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 943167<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Unterschrift<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
16,50 EUR*<br />
Bundestagswahl 2013<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.
| W E L T B Ü H N E | T O S K A N A<br />
KEIN FOUL!<br />
Erlaubt: Ein<br />
Spieler des weißen<br />
Teams schlägt<br />
dem Gegenspieler<br />
aus dem blauen<br />
Team ins Gesicht<br />
64 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Es ist das härteste<br />
Mannschaftsspiel<br />
der Welt: das Calcio<br />
Storico Fiorentino.<br />
Der Florentinische<br />
Fußball wird heute<br />
noch so gespielt<br />
wie vor 500 Jahren<br />
und hat nichts an<br />
Brutalität verloren.<br />
Michael Löwa hat<br />
das Spektakel für<br />
<strong>Cicero</strong> fotografiert<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 65
| W E L T B Ü H N E | T O S K A N A<br />
Erschöpft: Ein Spieler der<br />
„Weißen“ löscht kurz nach<br />
dem Spiel seinen Durst<br />
Ambitioniert: Ein Spieler der<br />
Seniorenmannschaft passt den<br />
Ball einem Mitspieler zu<br />
66 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Euphorisiert: Das<br />
blaue Team der<br />
Seniorenmannschaft<br />
nach dem gewonnenen<br />
Spiel mit demWappen<br />
ihres Stadtteils<br />
Enthusiasmiert: Junge Anhänger der<br />
„Blauen“ feuern ihre Mannschaft an<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 67
| W E L T B Ü H N E | T O S K A N A<br />
Einmarsch: Auf dem Platz vor<br />
der Franziskaner Kirche Santa<br />
Croce werfen Fans Blumen auf<br />
die Spieler der „Blauen“<br />
68 <strong>Cicero</strong> 4.2013
4.2013 <strong>Cicero</strong> 69
| W E L T B Ü H N E | T O S K A N A<br />
Vorbereitung: Der<br />
Mittelfeldspieler Pietro<br />
Cappelli trainiert mit dem<br />
Stürmer und Kampfsportlehrer<br />
Mario Santi Kickboxen<br />
„Dem Läufer, der mit<br />
dem Ball in der Hand<br />
das Feld durchläuft,<br />
sollen irgendwelche<br />
Kräftigen Platz<br />
schaffen, damit ihr<br />
Mann ungehindert<br />
freien Durchgang habe“<br />
Antonio Scaino, italienischer Humanist 1555<br />
70 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Alltag: Am<br />
Tag nach dem<br />
Spiel geht das<br />
normale Leben<br />
als Maler weiter<br />
E<br />
IN SPIEL AUS URALTEN ZEITEN, scheinbar ohne Regeln.<br />
Mannschaftskameraden sind Blutsbrüder, das gegnerische<br />
Team der Feind. Vier Mannschaften, vier<br />
Farben: Die Männer spielen für ihre Frauen, für Florenz und<br />
für ihr Stadtviertel. Das ist kurzgefasst der Calcio Storico<br />
Fiorentino.<br />
Bereits im Jahr 1555 beschrieb der italienische Humanist<br />
Antonio Scaino das Ballspiel so: „Dem Läufer, der mit dem Ball<br />
in der Hand das Feld durchläuft, sollen irgendwelche Kräftigen<br />
Platz schaffen, damit ihr Mann ungehindert freien Durchgang<br />
habe. Sieht er sich aber von einer großen Schar angegriffen,<br />
so soll er im Lauf nachlassen und … den Ball stoßen, und zwar<br />
wird er das schneller mit dem Stoße des Fußes als in anderer<br />
Weise können, da ein Stoß in dieser Weise sicherer ist.“<br />
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ineinander verkeilt<br />
ringen die Männer am Boden, schlagen sich mit Fäusten ins<br />
Gesicht, kämpfen um den Ball, angefeuert von den begeisterten<br />
Rufen der Zuschauer. Viele florentinische Jungen träumen davon,<br />
auch einmal auf der mit Sand aufgeschütteten Piazza Santa<br />
Croce im Herzen von Florenz für ihren Stadtteil um Ruhm und<br />
Ehre kämpfen zu dürfen.<br />
Am Namenstag des florentinischen Stadtpatrons San Giovanni<br />
(24. Juni) wird der Platz alljährlich zu einer Arena. Bis auf<br />
das gemeinsame Ziel eines Tores hat dieser Wettkampf nichts<br />
mit unserem Verständnis von Fußball zu tun. Wem die Bundesliga<br />
zu langweilig geworden ist, für den ist die Calcio Storico genau<br />
das Richtige. 27 Spieler pro Mannschaft kämpfen in einer<br />
Mischung aus Rugby, Boxen und American Football 50 Minuten<br />
lang ohne Pause und ohne Spielerwechsel um den Sieg. Vor<br />
500 Jahren waren es die Adeligen aus den einflussreichsten florentinischen<br />
Familien, die um die Ehre kämpften, heute sind es<br />
überwiegend einfache Arbeiter und Arbeitslose.<br />
Die Roten kommen aus Santa Maria Novella, die Blauen<br />
aus Santa Croce, die Weißen aus Santo Spirito und die Grünen<br />
aus San Giovanni. Das Spielfeld ist ein etwa 60 mal 30 Meter<br />
großer umzäunter Sandplatz, an dessen zwei Grundlinien sich<br />
die Tore befinden, in denen der Ball landen muss. Egal wie. Im<br />
Kampf Mann gegen Mann ist alles erlaubt bis auf Tritte gegen<br />
den Kopf und Attacken von hinten. Die Devise lautet: Kämpfen<br />
bis zum Kollaps. So verlassen die Spieler die Arena auch erst,<br />
wenn das Spiel beendet ist oder sie vorzeitig im Krankenwagen<br />
abtransportiert werden müssen. ml / jh<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 71
| W E L T B Ü H N E | K O M M E N T A R<br />
Herzlich willkommen!<br />
Die Türkei muss schleunigst in die Europäische Union<br />
aufgenommen werden – ein Plädoyer<br />
VON G E R HAR D S CHR ÖDER<br />
V<br />
O R WENIGEN W OCHEN hat der türkische Ministerpräsident<br />
Recep Tayyip Erdogan, mehr zwinkernd als drohend,<br />
angekündigt, dass sich die Türkei den „Shanghai<br />
Five“ anschließen könne. Jener Organisation, der China, Russland,<br />
Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan angehören.<br />
„Dann sagen wir der EU auf Wiedersehen“, fügte er an.<br />
Solche Reaktionen erlebe ich bei meinen Gesprächen mit Politikern,<br />
Unternehmern und Künstlern in Istanbul und Ankara immer<br />
häufiger. Sie drücken nicht nur ein neues Selbstbewusstsein,<br />
sondern vor allem eine tiefe Enttäuschung aus, die in der Türkei<br />
über die Europäische Union vorherrscht.<br />
Gerade in einer Zeit, in der die EU in einer tiefen Krise auf<br />
Partner angewiesen ist, besteht die Gefahr, dass sich mit der Türkei<br />
einer unserer engsten Verbündeten abwendet. Wirtschaftlich<br />
sehen wir bereits erste Zeichen: Der europäische Anteil am boomenden<br />
türkischen Handel ist in den vergangenen zehn Jahren<br />
von rund 60 Prozent auf 40 Prozent geschrumpft. Die EU aber<br />
braucht die Türkei, ebenso wie die Türkei eine europäische Perspektive<br />
benötigt, um den Modernisierungs- und Demokratisierungsprozess,<br />
der von Erdogan begonnen wurde, fortsetzen<br />
zu können. Ich bin sicher, dass die EU-Mitgliedschaft politisch,<br />
wirtschaftlich und kulturell für beide Seiten einen Zugewinn<br />
bringt.<br />
D IE TÜRKEI IST POLIT ISCH für uns Europäer wichtig, weil<br />
das Land an der Schnittstelle zum Nahen und Mittleren Osten<br />
liegt. Der arabische Frühling hat dazu geführt, dass Diktaturen<br />
endlich abgeschüttelt wurden, zugleich ist aber auch die Stabilität<br />
in dieser Region erschüttert. In Syrien tobt ein grausamer<br />
Bürgerkrieg. Die Weltgemeinschaft, aber vor allem wir Europäer<br />
müssen der Türkei für ihre vorbildliche Aufnahmebereitschaft<br />
von rund 200 000 Flüchtlingen, darunter vielen Christen,<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF<br />
72 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: DEFODI/PICTURE ALLIANCE/DPA<br />
dankbar sein. Die Bundesregierung unterstützt die Flüchtlinge<br />
zwar mit humanitärer Hilfe. Aber das ist noch unzureichend<br />
und muss finanziell ausgebaut werden.<br />
Unser europäisches Interesse muss es sein, dass die Region<br />
sich langfristig nicht nur zu einem Raum der Freiheit, sondern<br />
auch der Stabilität entwickelt. Für diesen Prozess ist die Türkei<br />
als Regionalmacht, die zugleich Nato-Mitglied ist, der Schlüssel.<br />
Eine jüngste Umfrage hat gezeigt, dass sich die Mehrheit der<br />
Menschen in den Staaten des arabischen Frühlings eine stärkere<br />
Rolle der Türkei wünscht, weil sie das Land als Vorbild betrachtet,<br />
das Freiheit, Wohlstand und Sicherheit in einer islamisch geprägten<br />
Gesellschaft garantieren kann. Die Sicherheit Europas<br />
hängt von der Stabilität seiner Nachbarregionen ab – es geht dabei<br />
auch um den südlichen Kaukasus und die Schwarzmeerregion.<br />
Die aber können wir Europäer mit einem EU-Mitgliedstaat<br />
Türkei, der in diese Regionen ausstrahlt, leichter erreichen.<br />
Auch zu einer Entspannung des israelisch-palästinensischen<br />
Konflikts kann die Türkei beitragen, weshalb es wünschenswert<br />
ist, dass sich das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel wieder<br />
verbessert.<br />
Es gibt für mich noch einen weiteren politischen Grund, der<br />
für einen EU-Beitritt spricht. Im globalen Wettbewerb hat nur<br />
ein vereintes Europa eine Chance zu bestehen, ein Nationalstaat<br />
alleine ist zu schwach. Selbst die großen europäischen Staaten –<br />
Großbritannien, Frankreich und Deutschland – sind global betrachtet<br />
Zwerge. Wenn Europa in der globalisierten Wirtschaft<br />
und in der multipolaren Welt auf Augenhöhe mit den USA und<br />
China bestehen will, dann müssen wir heute die richtigen Entscheidungen<br />
treffen. Wir müssen die politische Einheit Europas<br />
weiter vorantreiben; und wir brauchen starke Mitgliedsländer,<br />
wie es die aufstrebende Türkei sein wird.<br />
D AS L AND SPIELT GLOBAL eine immer größere Rolle. Es gehört<br />
schon jetzt zu den 20 größten Volkswirtschaften der<br />
Welt, und innerhalb der nächsten zwei Dekaden wird es die<br />
viertgrößte in Europa sein. Die Chance, eine solche boomende<br />
Wirtschaft vollintegriert in der EU zu haben, müssen<br />
wir nutzen. Gerade Deutschland kann und wird davon profitieren,<br />
denn wir sind der wichtigste europäische Handelspartner<br />
und der größte Investor. Auf der anderen Seite haben<br />
türkischstämmige Deutsche schon mehr als 75 000 Unternehmen<br />
mit rund 400 000 Arbeitsplätzen geschaffen. Diese<br />
Zahlen zeigen, dass wir eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit<br />
haben. Aber sie zeigen auch, dass wir das Bild<br />
von türkischstämmigen Deutschen nicht nur über wirkliche<br />
oder vermeintliche Integrationsdefizite, sondern auch über<br />
die Erfolge definieren sollten.<br />
Diejenigen, die vor einem „Kampf der Kulturen“ warnen,<br />
sind leider immer noch nicht verstummt. Es ist ein gefährliches<br />
Zerrbild. Bedauerlicherweise ist das öffentlich existierende,<br />
auch von den Medien beeinflusste Bild vom Islam immer<br />
noch von negativen Pauschalisierungen geprägt. Eine ist die Behauptung,<br />
dass islamische Gesellschaften und Demokratie ein<br />
Widerspruch seien. Die Türkei widerlegt das. Schon jetzt ist sie<br />
mit ihrer Weltoffenheit ein Vorbild für andere islamische Staaten<br />
und Gesellschaften. Das hat auch mit dem EU-Beitrittsprozess<br />
zu tun, denn die Erfüllung der Kriterien bedeutet, Wertvorstellungen<br />
und Rechtsvorschriften zu übernehmen. In den vergangenen<br />
Jahren wurden die Freiheits- und die Minderheitenrechte<br />
gestärkt, und vor allem wurde das Verhältnis zwischen zivilen sowie<br />
militärischen Institutionen neu definiert – und zwar zugunsten<br />
der Demokratie. Noch gibt es Defizite, das Land ist noch<br />
nicht am Ziel und hat noch eine Entwicklung vor sich. Das gilt<br />
insbesondere für die Rechte der christlichen Glaubensgemeinschaften,<br />
deren Freiheit ein Maßstab für Fortschritt und Toleranz<br />
in der Türkei bleibt. Aber ein positives Zwischenfazit der<br />
bisherigen Entwicklung kann gezogen werden.<br />
Ebenso muss aber auch die Europäische Union noch Aufgaben<br />
erfüllen. Das betrifft insbesondere die leidige Zypern-Frage,<br />
bei der sich nicht nur die Türkei bewegen muss. Die Überwindung<br />
der Teilung der Insel ist nicht an der Türkei und den türkischen<br />
Zyprioten gescheitert, sondern am griechischen Teil. Dies<br />
zu berücksichtigen, hat die EU stets versprochen, aber nicht immer<br />
eingehalten.<br />
W AS WIR BR A U CHEN, ist ein eindeutiges Signal aus Brüssel<br />
und den EU-Mitgliedstaaten, dass weitere Kapitel der Beitrittsverhandlungen<br />
geöffnet werden. Die Signale aus Frankreich<br />
sind hoffnungsvoll. Es ist vollkommen klar, dass der Beitrittsprozess<br />
noch Jahre dauern und die Türkei erst beitreten wird,<br />
wenn sie alle Kriterien erfüllt. Aber ebenso klar ist, dass die sogenannte<br />
„privilegierte Partnerschaft“, die von Teilen der jetzigen<br />
Bundesregierung angeboten wird, keine Alternative ist. Im<br />
Gegenteil: Sie wird in der Türkei nicht als Angebot, sondern als<br />
Diskriminierung verstanden. In der Folge richten sich die Blicke<br />
vieler in der Türkei gen Osten. Daher muss sich die Bundesregierung<br />
von diesem irreführenden Begriff verabschieden.<br />
Es ist auch nicht sonderlich überzeugend, wenn die Bundeskanzlerin<br />
bei ihrem jüngsten Besuch in der Türkei erklärt,<br />
man solle ein weiteres Kapitel der Beitrittsverhandlungen eröffnen,<br />
zugleich aber betont, dass sie gegen den Beitritt sei. Das ist<br />
widersprüchlich.<br />
Ich bin fest davon überzeugt, dass ein EU-Beitritt ein Gewinn<br />
für beide Seiten ist: Für Europa, dessen globaler Einfluss<br />
und Wohlstand gesichert werden, und für die Türkei,<br />
deren mutiger Reformweg zu wirtschaftlicher Stärke, mehr<br />
Demokratie und Stabilität belohnt wird. Es ist daher nicht an<br />
der Zeit, dass die Türken „Auf Wiedersehen“ sagen, sondern<br />
es ist an der Zeit, dass die Europäer jetzt endlich „Herzlich<br />
willkommen“ sagen.<br />
G E R HAR D S CHR ÖDER<br />
war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Bereits während seiner Kanzlerschaft hat<br />
er sich für die Aufnahme der Türkei in die EU eingesetzt<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 73
| K A P I T A L<br />
YAHOOS TIGERMAMA<br />
Ihre Methoden lösen nationale Debatten aus, Marissa Mayer versucht derweil ihren Internetkonzern zu retten<br />
V ON C H R IST INE M ATTAU CH<br />
N<br />
ACH SIEBEN MONATEN an der Spitze<br />
von Yahoo hat Marissa Mayer einen<br />
neuen Spitznamen weg: „Stalin<br />
des Silicon Valley“, schreibt die New<br />
York Times. Und warum? Per Dekret hatte<br />
sie ihren Mitarbeitern verboten, zu Hause<br />
zu arbeiten, und sie ins Büro zurückbeordert.<br />
Passender wäre vielleicht „WLAN-<br />
Lenin“ gewesen. Denn die Entscheidung<br />
fiel, nachdem Mayer die Login-Daten ihrer<br />
Heimarbeiter überprüft und festgestellt<br />
hatte, dass sich viele von ihnen eher selten<br />
im firmeneigenen Netz anmeldeten. Vertrauen<br />
ist gut, aber Kontrolle eben doch<br />
besser, wird sich die als Datenfetischistin<br />
bekannte Mayer gedacht haben.<br />
In ihrer kurzen Zeit als Yahoo-Chefin<br />
hat Mayer schon jede Menge Schlagzeilen<br />
produziert. Frauen sind rar in der<br />
Tech-Branche, und mit 37 Jahren ist sie<br />
die jüngste, die je ein IT-Unternehmen dieser<br />
Größe leitete. Einen Tag nach ihrer Ernennung<br />
gab sie bekannt, dass sie schwanger<br />
war. Ihre Babypause dauerte ganze zwei<br />
Wochen, dann ließ sie auf eigene Kosten<br />
ein Kinderzimmer in die Chefetage einbauen<br />
und bezeichnete kurze Zeit später<br />
das Kinderkriegen als „easy“.<br />
In den USA hat sie sowohl mit dieser<br />
Äußerung als auch mit dem Homeoffice-<br />
Verbot eine landesweite Debatte ausgelöst.<br />
Harte Kritik erntet Mayer vor allem<br />
von Frauen. New-York-Times-Kolumnistin<br />
Maureen Dowd und Frauenrechtlerin Joanne<br />
Bamberger werfen ihr vor, arbeitenden<br />
Müttern zu schaden, für die flexible<br />
Arbeitszeiten und Heimarbeitsplätze unverzichtbar<br />
seien. Selbst die deutsche Familienministerin<br />
Kristina Schröder fühlte<br />
sich berufen, Mayer für ihre kurze Babypause<br />
zu kritisieren.<br />
Mayer selbst kommt der Trubel um<br />
ihre Person sogar gelegen, weil die Publicity<br />
dem Konzern nützt – erstmals seit langem<br />
steigt die Zahl der Yahoo-Nutzer. Sie selbst<br />
ist es ohnehin gewohnt, im Rampenlicht<br />
zu stehen: Mayer war eine der wenigen, die<br />
ihren früheren Arbeitgeber Google nach<br />
außen vertreten durfte. Die Partys in ihrem<br />
Fünf-Millionen-Dollar-Penthouse<br />
oberhalb des Luxushotels Four Seasons in<br />
San Francisco waren legendär; ebenso die<br />
60 000 Dollar, die sie für ein Mittagessen<br />
mit Modezar Oscar de la Renta spendete.<br />
Nach außen glamourös, greift sie nach<br />
innen energisch durch, wie das unpopuläre<br />
Heimarbeitsverbot beweist. Aus der Yahoo-<br />
Zentrale heißt es dazu nur, Mayer wolle<br />
ihrer demoralisierten Mannschaft, die mit<br />
ihr den sechsten CEO in fünf Jahren erlebt,<br />
neuen Teamgeist vermitteln. „Sie mag ein<br />
darwinistisches Arbeitsumfeld, in dem sich<br />
die besten Ideen durchsetzen“, beschreibt<br />
das New York Magazine ihren Führungsstil.<br />
Um die Stimmung zu verbessern, lobt<br />
die Chefin bei jeder Gelegenheit alles, was<br />
sie bei Yahoo vorfindet, aber die Lage ist kritisch.<br />
In den Anfangsjahren des Internets<br />
war das Such- und Nachrichtenportal der<br />
Inbegriff der Onlinewelt. Doch Yahoo verliert<br />
seit Jahren Marktanteile. Der Aktienkurs,<br />
schon mal bei 110 Dollar, steht heute<br />
bei gut 20 Dollar – immerhin 30 Prozent<br />
mehr als bei Mayers Amtsantritt.<br />
„Marissa besitzt eine Qualität, die bei<br />
Yahoo Mangelware ist: Klarheit“, sagt der<br />
Sachbuchautor Ken Auletta, der zwei Jahre<br />
im Hauptquartier von Google recherchierte.<br />
Dort war sie bekannt dafür, Kollegen mit<br />
hochfliegenden Plänen zu erden – freundlich,<br />
aber unnachgiebig. Sie formulierte<br />
Leitlinien für Design und Sprache und definierte<br />
Prozesse, nach denen neue Projekte<br />
durchzuführen waren. Über 100 Produkte<br />
soll Mayer entwickelt haben. Als Informatikerin<br />
mit Stanford-Abschluss genießt sie<br />
auch den Respekt der eigenen Programmierer.<br />
Doch kann sie auch Strategie?<br />
Tech-Blogs wie „All Things Digital“<br />
halten ihr vor, keine Vision für Yahoo zu<br />
haben. Dabei hat Mayer gleich zu Anfang<br />
ein klares Statement abgegeben: Sie stattete<br />
die gesamte Belegschaft mit Smartphones<br />
aus. „Das mobile Geschäft birgt enorme<br />
Chancen für Yahoo“, sagt sie, „wir haben<br />
all die Informationen, die die Leute<br />
auf ihren Handys abrufen wollen.“ Yahoo<br />
solle die erste Anwendung werden, die sich<br />
Leute nach dem Kauf eines Smartphones<br />
herunterladen – eine Art Super-App. Wenn<br />
das keine Richtungsbestimmung ist.<br />
Gleichzeitig ist es aber auch ein Eingeständnis,<br />
dass Yahoo beim Aufstieg des<br />
mobilen Internets und der Entwicklung eigener<br />
Apps bisher tief geschlafen hat. Ob<br />
die Aufholjagd in einem hart umkämpften<br />
Markt gegen Konkurrenten wie Facebook,<br />
Google oder Apple funktioniert, ist fraglich.<br />
In der Branche gilt eine Kehrtwende<br />
bei Yahoo als schwierig bis unmöglich.<br />
Gerade deswegen hat Mayer der Wechsel<br />
zu Yahoo aber gereizt. Bei Google sah<br />
die Ex-Freundin des Firmengründers Larry<br />
Page dagegen keine weiteren Aufstiegschancen.<br />
Mayer war 1999 als 23-Jährige zu<br />
dem damals unbekannten Start-up gestoßen,<br />
als Mitarbeiter Nummer 20. Der Aufstieg<br />
der Suchmaschine machte sie reich:<br />
Ihr Vermögen wird auf 300 Millionen Dollar<br />
geschätzt.<br />
Bei Yahoo hat sie gleich zu Beginn ein<br />
loyales Team um sich versammelt. Schlüsselpositionen<br />
wurden neu besetzt, darunter<br />
die Vorstände für Finanzen, Organisation<br />
und Marketing. Viel zu verlieren hat Mayer<br />
nicht. Selbst wenn die Wende misslingt, gewinnt<br />
sie Erfahrung – der nächste Chefposten<br />
ist damit schon garantiert. Wenn<br />
sie noch mal einen haben will. Doch dass<br />
sie sich in Kürze auf die Erziehung ihres<br />
Sohnes Macallister beschränkt, kann man<br />
wohl ausschließen.<br />
C H R IST INE M ATTAU CH<br />
arbeitet als freie<br />
Wirtschaftskorrespondentin in<br />
New York<br />
FOTOS: ROBYN TWOMEY/CORBIS OUTLINE, THOMAS BAUER (AUTORIN)<br />
74 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Für ihren darwinistischen<br />
Führungsstil erntet<br />
Yahoo-Chefin Marissa<br />
Mayer häufig Kritik<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 75
| K A P I T A L<br />
WIR BRAUCHEN BASS<br />
Björn Stolls Instrumente aus dem „Musicon Valley“ sind weltweit gefragt<br />
V ON STEFAN L OCK E<br />
W<br />
ER GEIGENBAUER SAGT, denkt Stradivari,<br />
aber wer ist der Meister<br />
für Kontrabässe? „Gerade deshalb<br />
liebe ich es, sie zu bauen“, sagt Björn<br />
Stoll. „Ich habe viel mehr Freiheit, bin mit<br />
meinen Modellen nicht an eine Form gekettet<br />
und muss nicht versuchen, einen bestimmten<br />
Klang zu kopieren.“<br />
Wobei Letzteres ohnehin nicht gehe,<br />
meint Stoll. Jedes Stück Holz sei nun mal<br />
anders, Standort, Wuchs und Dichte verliehen<br />
selbst gleichen Holzarten verschiedene<br />
Eigenschaften. Deshalb könne auch<br />
der Klang zweier von ihm geschaffener<br />
Bässe zwar ähnlich, aber nie identisch sein.<br />
An vier Instrumenten bauen Stoll und<br />
seine zwei Mitarbeiter gerade, sie schleifen,<br />
feilen, sägen und schnitzen. Dicht unter<br />
der Decke der kleinen Hinterhofwerkstatt<br />
liegen Böden, Deckel und halbfertige Bassrümpfe,<br />
an den Wänden hängen Stechbeitel,<br />
Ziehklingen und Hobel in jeder Größe<br />
oder vielmehr Winzigkeit. Selbst daumenkleine<br />
Hobel führen sie mit einer Virtuosität<br />
über das Holz wie Bassisten im Konzertsaal<br />
den Bogen über ihr Instrument. Grobe,<br />
duftende Späne türmen sich am Boden,<br />
Maschinen gibt es keine, mal abgesehen<br />
von einem Bohrer und der Wärmplatte, auf<br />
der zwei Töpfe mit Knochenleim stehen.<br />
Der durch Auskochen tierischer Abfälle gewonnene<br />
Kleber lässt das Schwingungsverhalten<br />
des Holzes unverändert.<br />
Kein Schild weist auf Stolls Werkstatt<br />
hin, draußen an der Straße in Erlbach im<br />
tiefsten Südwestsachsen. „Meine Kunden<br />
finden mich auch so, häufig über Empfehlungen<br />
anderer Musiker“, sagt der 41-Jährige.<br />
Viele reisen extra aus dem Ausland an.<br />
So war es schon einmal hier im Vogtland.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten<br />
die Produkte aus dem „Musikwinkel“<br />
80 Prozent Marktanteil weltweit, die Gegend<br />
zählte zu einer der reichsten Deutschlands,<br />
und die USA unterhielten hier ein<br />
eigenes Generalkonsulat.<br />
Unter dem etwas bemühten Titel „Musicon<br />
Valley“ versucht die Region heute<br />
daran anzuknüpfen. Die Kombinate aus<br />
DDR-Zeiten sind verschwunden, stattdessen<br />
produzieren nun wieder Hunderte<br />
Familienbetriebe die Instrumente; gleich<br />
um die Ecke von Stoll gibt es zwei Geigen-,<br />
einen Gitarren- und<br />
einen Schallstückmacher für<br />
Blechbläser. Viele verkaufen<br />
den Großteil ihrer Produktion<br />
ins Ausland, Stoll<br />
selbst vor allem in die USA<br />
und nach Asien, wo Kunden<br />
auf europäische Handarbeit<br />
schwören. Sieben seiner<br />
Bässe gingen allein im<br />
vergangenen Jahr nach Japan.<br />
Nur Verbesserungsvorschläge<br />
erhält er auf seinen<br />
Reisen nach Tokio oder Yokohama<br />
selten. „Die Ehrfurcht<br />
vor unserer Arbeit ist<br />
dort riesengroß, manchmal<br />
fast zu groß“, sagt Stoll.<br />
STOLL HAT ERST vor knapp<br />
20 Jahren begonnen, Instrumente<br />
zu fertigen, sich<br />
aber schnell einen hervorragenden<br />
Ruf erworben.<br />
Seine Vorfahren stellten bereits Anfang des<br />
19. Jahrhunderts Saiten her, und sein Vater<br />
baute nicht nur im volkseigenen Betrieb,<br />
sondern auch nach Feierabend daheim<br />
Celli und Bässe, die er dann ungarischen<br />
Musikern mitgab, die sie nach Konzertreisen<br />
im Westen verkauften.<br />
„Ich kenne meinen Vater praktisch nur<br />
in der Werkstatt“, sagt Stoll. Er erwarb<br />
nach seiner Lehre auch noch den Meisterbrief<br />
und eröffnete kurze Zeit später seine<br />
eigene Werkstatt für Bässe und Celli.<br />
Seit vielen Jahren konzentriert sich<br />
Stoll jetzt aber schon auf das Geschäft mit<br />
Kontrabässen, entwickelt eigene Modelle,<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagt jetzt<br />
auch der Deutsche-<br />
Bank-Chef Anshu<br />
Jain. <strong>Cicero</strong> weiß das<br />
schon länger und stellt<br />
den Mittelstand in<br />
einer Serie vor. Die<br />
bisherigen Porträts aus<br />
der Serie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
experimentiert viel mit Material, Lack<br />
und Design. Seine Geigenbauer-Kollegen<br />
bezeichnen ihn gern als „Möbeltischler“,<br />
weil man viel Kraft braucht, um aus massivem<br />
Holz einen Bassboden herauszuschälen.<br />
Der ist wie der Hals aus Ahorn, der<br />
Deckel besteht aus Fichte und das Griffbrett<br />
aus Ebenholz, rabenschwarz<br />
und extrem hart,<br />
damit sich die Saiten nicht<br />
ins Holz graben.<br />
Zwischen zehn und<br />
30 Instrumente baut Stoll<br />
im Jahr. Gut 140 Arbeitsstunden<br />
stecken in einem<br />
Standardbass. Die Wartezeit<br />
beträgt drei Monate,<br />
der Preis 5000 Euro. Rund<br />
18 000 Euro kostet die Exklusiv-Version.<br />
„Vor allem<br />
wohlhabende Chinesen verlangen<br />
High-End, immer<br />
das Teuerste“, sagt Stoll.<br />
Neulich habe ihn ein Kunde<br />
aus China begeistert angerufen<br />
und berichtet, er schlafe<br />
nachts neben seinem Bass.<br />
Reich wird Stoll als Bassbauer<br />
nicht. Wenn er Geld<br />
übrig hat, investiert er in<br />
Holz. Gute Ware ist knapp<br />
und teuer, Bassbauer brauchen große, alte<br />
Baumstämme, derzeit bekommt er die in<br />
Bosnien und Rumänien. Aber um Reichtum<br />
geht es Stoll in seinem Beruf auch<br />
nicht. Am schönsten findet er immer wieder,<br />
zum ersten Mal den Klang eines fertigen<br />
Basses zu hören. „Wenn ich dann<br />
merke, er ist mir richtig gut gelungen, das<br />
ist für mich Selbstverwirklichung.“<br />
STEFAN L OCK E<br />
lebt als freier Journalist<br />
in Dresden<br />
FOTOS: CHRISTOPH BUSSE FÜR CICERO, PRIVAT (AUTOR)<br />
76 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Björn Stoll zwischen<br />
280 Stunden<br />
Arbeit: So lange<br />
dauert es, zwei<br />
Bässe zu fertigen<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 77
| K A P I T A L<br />
GELD MACHT BLIND<br />
Daniel Vasella wollte 58 Millionen fürs Nichtstun und reformierte so unfreiwillig das Schweizer Aktienrecht<br />
V ON P E T E R H OSSLI<br />
W<br />
ER SICH ALLES LEISTEN KANN, hat<br />
Freude an kleinen Dingen. Eine<br />
heiße Schokolade mit Sahnehäubchen<br />
stellt der Kellner auf den Tisch<br />
des Multimillionärs. „Herrlich“, schwärmt<br />
Daniel Vasella, schiebt einen Löffel Schlag<br />
in den Mund, lehnt sich zufrieden zurück.<br />
„Die erste Frage, bitte.“<br />
Dünn sind die Finger, die den Löffel<br />
halten, kantig das Gesicht, die Haut bleich.<br />
Gesund sieht er nicht aus, der 59-jährige<br />
Herrscher über das Imperium der Gesundheit.<br />
Es ist Ende Januar, im Salon eines<br />
schicken Hotels in der Alpenstadt Davos.<br />
Im Kamin lodert ein Feuer. Eben war bekannt<br />
geworden: Vasella tritt nach 17 Jahren<br />
an der Spitze des Schweizer Pharmakonzerns<br />
Novartis ab.<br />
Einer der schillerndsten Manager Europas<br />
hört auf, und einer der umstrittensten.<br />
„Große Konzerne überleben ihre Leute“,<br />
sagt er am Anfang des Gesprächs. „Sonst<br />
sind sie falsch aufgestellt.“<br />
Er hat Novartis aufgestellt, als Höhepunkt<br />
einer rasanten Karriere. Er studiert<br />
Medizin, ist mit 31 jüngster Oberarzt am<br />
Berner Inselspital. Nebenbei unterrichtet er,<br />
publiziert über das zentrale Nervensystem.<br />
Mit 35 legt er den weißen Kittel ab, will<br />
nun Manager sein. Dazu hat er die richtigen<br />
familiären Bande. Der Onkel seiner<br />
Frau ist Marc Moret, Chef beim Baseler<br />
Pharmakonzern Sandoz. Der schickt Vasella<br />
1988 für Sandoz in die USA.<br />
Wenige Jahre später ermöglicht Moret<br />
seinem Zögling den großen Coup. Vasella,<br />
gerade 42, vereint Sandoz mit dem Stadtrivalen<br />
Ciba-Geigy zu Novartis. Der kleinen<br />
Schweiz beschert er die bis dahin größte<br />
Fusion der Geschichte.<br />
Es ist eine Erfolgsgeschichte. Mit einem<br />
Mann im Mittelpunkt: Vasella.<br />
Zuerst als Konzernchef, ab 1999 zusätzlich<br />
als Präsident des Verwaltungsrats,<br />
vereint er am Rheinknie zwei Kulturen –<br />
zur Vasella-Kultur. Sogar die Fische im<br />
Teich am Hauptsitz wählt er aus. Er heimst<br />
Ehrentitel ein, behauptet, Lepra beinahe<br />
ausgerottet zu haben. Fotografen inszenieren<br />
ihn auf schweren Motorrädern, mit Lederjacke<br />
und Stoppelbart. 2012, in seinem<br />
letzten Jahr, setzt Novartis fast 57 Milliarden<br />
Dollar um. Nur der amerikanische<br />
Pfizer-Konzern verkauft mehr Pillen und<br />
Pulver.<br />
Und doch tritt Vasella nun in Schimpf<br />
und Schande ab, geht nach Amerika ins<br />
Exil. Wie niemand verkörpert der sanfte<br />
und kluge Manager den hässlichen Abzocker,<br />
angeblich getrieben von Geld und<br />
Gier. Schamlos habe er sich aus der Kasse<br />
von Novartis bedient, so lautet der Vorwurf,<br />
und umgerechnet 325 Millionen Euro kassiert.<br />
Wie viel war es wirklich? „Das weiß<br />
ich nicht, ich habe diese Rechnung nie gemacht“,<br />
sagt Vasella.<br />
Geht es ums Geld, ist er schmallippig.<br />
Was letztlich seinen Ruf zerstört. Schmach<br />
statt Ehre erntet er am 22. Februar auf der<br />
Generalversammlung, bei der er sich von<br />
Novartis verabschiedet. Tage zuvor hat<br />
ein Journalist Vasellas letzten Zahltag enthüllt:<br />
58 Millionen Euro für die Zusage,<br />
sechs Jahre nicht für die Konkurrenz zu<br />
arbeiten. 58 Millionen, um nichts zu tun.<br />
An Schweizer Stammtischen, auf Twitter,<br />
in Leitartikeln gärt es. Rechte wie Linke,<br />
Arme wie Reiche überschütten ihn mit<br />
Häme.<br />
VIELE SIND ERSTAUNT, wie stümperhaft Vasella<br />
agiert. Er hat sich die Abfindung 2010<br />
zugesichert, hält sie geheim. Als der Deal<br />
auffliegt, will er das Geld erst spenden, sagt<br />
aber nicht an wen. Zuletzt verzichtet er, gesteht<br />
Fehler ein, versäumt es jedoch, sich<br />
zu entschuldigen.<br />
Plötzlich gilt er als einer, der erst eigennützig<br />
handelt und unter Druck einknickt.<br />
Prompt folgt das Verdikt. Anfang März heißen<br />
zwei Drittel der Schweizer Stimmbürger<br />
strengere Regeln bei Managergehältern<br />
gut. Der Ärger über Vasella gab der Anti-<br />
Bonus-Initiative den entscheidenden Kick.<br />
Was tut er gegen das Abzockerimage?<br />
„Nichts“, sagt er. „Dieses Wort hat an Bedeutung<br />
verloren.“ Er spricht, als sei Geld<br />
eine schnöde Nebensache. „Mein Geld? Es<br />
ist doch interessant, wie viel andere Leute<br />
darüber reden. Bei mir nimmt es nicht so<br />
viel Platz ein.“<br />
War er sein Geld wert? „Rational gesehen,<br />
ja. Die Reaktionen auf meine Gehälter<br />
sind aber emotional.“<br />
So redet einer, der den Bezug zur Realität<br />
verloren hat. Die Gier vernebelt den<br />
Blick. Ist Geld für ihn die heimliche Sucht,<br />
für die er sich schämt? Ist aus dem maßvollen<br />
Schweizer einfach ein maßloser Amerikaner<br />
geworden?<br />
Zumindest faszinieren ihn die USA.<br />
Oft schwärmt er von der betriebswirtschaftlichen<br />
Schnellbleiche an der Harvard<br />
University. Bei Novartis macht er Englisch<br />
zur Konzernsprache, lässt die Buchhalter in<br />
Dollar rechnen, schickt die besten Forscher<br />
nach Kalifornien, New Jersey und Massachusetts.<br />
Bei Pepsico und American Express<br />
setzt er sich in die Aufsichtsräte.<br />
Im persönlichen Gespräch wirkt er neugierig,<br />
ruhig – und unbeirrt. Vielleicht wegen<br />
Schicksalsschlägen, die ihn früh treffen.<br />
Mit acht erkrankt er an tuberkulöser<br />
Hirnhautentzündung, verbringt ein Jahr im<br />
Sanatorium. Der Vater stirbt, als er 13 ist,<br />
kurz darauf die Schwester. Für Vasella waren<br />
es „Situationen, in denen man glaubt,<br />
es gehe nicht weiter – und es ging doch weiter.<br />
Das verlieh mir Zuversicht.“<br />
Zuversicht verdrängt manche Kritik.<br />
„Für mich zählt nur, was meine Kinder und<br />
meine Frau von mir denken, das ist mir<br />
wichtig.“ Er nimmt einen letzten Schluck.<br />
Jetzt ist der Kakao wohl kalt.<br />
P E T E R H OSSLI<br />
ist Autor der Schweizer Blick-<br />
Gruppe und schreibt über<br />
Wirtschaft und Politik<br />
FOTOS: LUKAS ILGNER/PICTURE ALLIANCE/DPA, STEFAN FALKE<br />
78 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Mein Geld? Bei mir nimmt<br />
es nicht so viel Platz ein“,<br />
behauptet Ex-Novartis-<br />
Chef Daniel Vasella<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 79
| K A P I T A L | W E N I G E R E U R O P A I S T M E H R<br />
ZURÜCK NACH MAASTRICHT<br />
Rettungsschirme, Staatsfinanzierung durch die EZB und Rufe nach mehr Europa verlängern<br />
nur die Krise. Deren Lösung liegt in der Rückbesinnung auf die Kriterien von Maastricht<br />
V ON WOLFGANG KADEN<br />
E<br />
R HAT DIE ITALIENER mit Versprechungen<br />
gelockt, die für Außenstehende<br />
wie Satire anmuteten.<br />
Silvio Berlusconi war auf einmal<br />
wieder da, und von Woche<br />
zu Woche stiegen seine Umfragewerte. Am<br />
Ende sicherte er sich im Senat eine Blockade-Mehrheit.<br />
Für Italien hätte es kaum<br />
schlimmer kommen können.<br />
Nur für Italien?<br />
Erst die Wahl des französischen Sozialisten<br />
François Hollande mit seinem realitätsblinden<br />
Programm in Frankreich, nun<br />
die Abstimmung in Italien mit der Rückkehr<br />
des Polit-Scharlatans Berlusconi und<br />
dem 25-Prozent-Erfolg des Komikers<br />
Beppe Grillo – wir mussten lernen: Wahlen<br />
in einem Land der Euro-Zone haben<br />
inzwischen den Stellenwert von Wahlen im<br />
eigenen Land.<br />
Seit die Europäer vertragswidrig das<br />
Verbot der wechselseitigen Haftung für<br />
Staatsschulden außer Kraft gesetzt haben,<br />
seit sie mit ihren Rettungspaketen und den<br />
Aktionen der Notenbank unverdrossen<br />
Beistand leisten – seither schlagen Wahlausgänge<br />
in einem Euro-Staat mit voller<br />
Wucht auf die Bürger aller anderen Länder<br />
des Währungsverbunds durch.<br />
Haben wir von diesem Europa geträumt?<br />
Einem Europa, in dem Bürger für<br />
politische Entscheidungen einstehen und<br />
zahlen müssen, auf die sie nicht den geringsten<br />
Einfluss haben? In dem einigermaßen<br />
solide wirtschaftende Länder für den<br />
Unfug haften sollen, den uninformierte,<br />
törichte oder frustrierte Wähler in Italien,<br />
Frankreich oder Griechenland anrichten?<br />
In dem das eherne Prinzip „no taxation<br />
without representation“ ausgesetzt ist?<br />
Ich war seit meiner Schulzeit ein<br />
entschiedener Anhänger der Idee eines<br />
geeinten Europas. Als Chefredakteur des<br />
Spiegels habe ich für den Euro gekämpft,<br />
nicht zuletzt gegen meinen Herausgeber<br />
Rudolf Augstein, der, argumentativ gespickt<br />
von seinem Nachbarn Karl Schiller,<br />
dem ehemaligen Wirtschafts- und Finanzminister<br />
unter Kiesinger und Brandt, gegen<br />
den Vertrag von Maastricht anschrieb.<br />
Natürlich war mir immer bewusst, dass<br />
diese Währungsunion ein Großexperiment<br />
ist. Aber ohne den Mut zu Neuem hätte es<br />
das europäische Einigungswerk nie bis zum<br />
Vertrag von Maastricht geschafft. Was sollte<br />
schon schiefgehen? Der Vertrag verpflichtete<br />
die Mitglieder der Geldgemeinschaft<br />
mit exakten Vorgaben zur Haushaltsdisziplin;<br />
die Notenbank war kraft Statut mindestens<br />
so unabhängig wie die Bundesbank;<br />
und die Unterschiede in der wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit zwischen den Teilnehmerstaaten<br />
waren auch nicht größer als<br />
die zwischen Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Baden-Württemberg.<br />
Ich bin nach wie vor davon überzeugt,<br />
dass dieses Konzept richtig und überfällig<br />
war. In die Krise ist die Währungsunion<br />
erst geraten, als die Politiker begannen,<br />
aus den Schulden- und Wettbewerbsproblemen<br />
einzelner Teilnehmerstaaten eine<br />
Währungskrise zu machen; als sie glaubten,<br />
Rettungsfonds für überschuldete Staaten<br />
gründen zu müssen; und als die Notenbank<br />
in die Staatsfinanzierung einstieg.<br />
Eine nie da gewesene Abfolge von Vertragsbrüchen,<br />
die Deutschland inzwischen für<br />
den abenteuerlichen Betrag von 958 Milliarden<br />
Euro haften lassen, mehr als das<br />
Dreifache des Bundeshaushalts. Zugleich<br />
wurde Deutschland auch noch zum Hassobjekt<br />
in ganz Europa.<br />
Den derzeitigen Oppositionsparteien<br />
SPD und Grüne reicht das noch nicht.<br />
KARIKATUR: BURKHARD MOHR; FOTO: PRIVAT (AUTOR)<br />
80 <strong>Cicero</strong> 4.2013
SPD-Chef Sigmar Gabriel propagiert in einem<br />
Thesenpapier, verfasst mit dem Philosophen<br />
Jürgen Habermas und etlichen anderen<br />
Denkern, als einzige Lösung für den<br />
Erhalt der Währungsunion „einen großen<br />
Integrationsschritt“ – einschließlich einer<br />
„gemeinschaftlichen Haftung für Staatsanleihen<br />
des Euroraums“, sprich: Eurobonds.<br />
Und Grünen-Spitzenkandidat Jürgen<br />
Trittin, der gern Finanzminister werden<br />
möchte, verlangt: „Mehr Europa, stärkere<br />
Institutionen und auch höhere Transfers.“<br />
Für Gabriel, Habermas & Co gibt<br />
es nur „zwei in sich stimmige Strategien<br />
zur Überwindung der aktuellen Krise: die<br />
Rückkehr zu nationalen Währungen (…)<br />
oder aber die institutionelle Absicherung<br />
einer gemeinsamen Fiskal-, Wirtschaftsund<br />
Sozialpolitik im Euroraum“.<br />
Die dritte, die naheliegendste Variante,<br />
beziehen die Rot-Grünen, wie inzwischen<br />
auch viele der Regierenden, gar<br />
nicht mehr in ihre Planspiele ein – die<br />
Rückkehr zu den Prinzipien von Maastricht.<br />
Jenen Grundsätzen, mit denen die<br />
Währungsunion Anfang der Neunziger gegründet<br />
wurde: Eigenverantwortung der<br />
Euro-Staaten für ihre nationalen Haushalte;<br />
strikte Beachtung des noch immer<br />
geltenden Rechts, dass kein Staat auf Kosten<br />
anderer Unionsmitglieder aus einer finanziellen<br />
Notlage befreit werden darf, das<br />
sogenannte Bail-out-Verbot.<br />
Die Erfahrungen der vergangenen drei<br />
Jahre haben uns nachdrücklich gelehrt,<br />
dass eine „radikale (!) Vergemeinschaftung“<br />
(Trittin) die Realität in Europa völlig verkennt.<br />
„Das Projekt der politischen Union<br />
taugt nicht als Instrument zur Bewältigung<br />
der Krise“, sagt Otmar Issing, gewiss kein<br />
Euro-Gegner: Der Wirtschaftsprofessor gehörte<br />
als Chefvolkswirt dem Direktorium<br />
der Europäischen Zentralbank an.<br />
Wir mussten zur Kenntnis nehmen,<br />
dass die Einstellungen zum Werterhalt des<br />
Geldes und zum staatlichen Schuldenmachen<br />
in Europa in hohem Maße divergieren,<br />
dass die Mentalitäten der Völker selbst<br />
nach Jahrzehnten Brüsseler Gemeinsamkeit<br />
immer noch sehr unterschiedlich sind.<br />
Bei aller Begeisterung für einen geeinten<br />
Kontinent ist unübersehbar, dass es bis<br />
heute an einer europäischen Öffentlichkeit<br />
fehlt. Und dass es „die eine europäische<br />
Identität genauso wenig gibt wie den europäischen<br />
Demos, ein europäisches Staatsvolk<br />
oder eine europäische Nation“, wie<br />
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner<br />
Europa-Rede Ende Februar sagte.<br />
In einem Interview warnte der britische<br />
Historiker Timothy Garton Ash Europas<br />
Politiker vor utopischen Entwürfen: „Wir<br />
müssen dieses Europa mit dem Stoff bauen,<br />
den wir haben. Und dieser Stoff ist die nationale<br />
Demokratie.“ Gesamteuropäische<br />
Wahlen, in denen eine Wirtschaftsregierung<br />
oder gar der EU-Kommissionspräsident<br />
zu wählen wären, bleiben auf absehbare<br />
Zukunft unrealistisch.<br />
Das traurige Beispiel der Europäischen<br />
Zentralbank sollte uns lehren, wie wenig<br />
Verlass im Ernstfall auf gesamteuropäische<br />
Einrichtungen ist.<br />
Die EZB wurde nach dem Modell der<br />
Bundesbank konstruiert. Sie ist formal von<br />
den Regierungen unabhängig, wurde in ihrem<br />
Statut deutlicher noch als die alte Bundesbank<br />
einzig dem Erhalt des Geldwerts<br />
verpflichtet. Es ist ihr verboten, Staatshaushalte<br />
zu finanzieren. Die Mitglieder des<br />
Zentralbankrats, des obersten Entscheidungsgremiums,<br />
sollten nicht als Vertreter<br />
ihrer Herkunftsländer agieren, sondern<br />
als geldpolitische Experten.<br />
Ein, wie ich fest überzeugt war, wasserdichtes<br />
Vertragswerk. Doch inzwischen<br />
kauft die Notenbank munter Staatsanleihen<br />
auf und versorgt die Banken notleidender<br />
Länder mit Geld zum Nulltarif, das<br />
diese an die öffentlichen Kassen weiterleiten.<br />
Sie betreibt ungeniert Staatsfinanzierung,<br />
und anders als bei den Rettungsfonds<br />
hat diese Methode noch den Vorteil, dass<br />
die Zahlungen nicht von den Parlamenten<br />
der Geberländer genehmigt werden müssen.<br />
Eine Mehrheit der Nehmerländer im<br />
Zentralbankrat setzt diese Politik notorisch<br />
durch.<br />
Nichts anderes hätten wir von einem<br />
fiskalpolitisch geeinten Europa zu erwarten.<br />
Wenn dessen Institutionen handlungsfähig<br />
sein sollen, würde dort mit Mehrheit<br />
entschieden – von Politikern, die nach wie<br />
vor auf ihr heimisches Wähler klientel schielen<br />
müssten. Diese Gremien würden – was<br />
immer auch vorher an hehren Absichten<br />
unterschrieben wurde – uns dann mit demokratischen<br />
Mehrheiten den vom ehemaligen<br />
Verfassungsrichter Udo Di Fabio<br />
bereits prophezeiten „Super-Länderfinanzausgleich“<br />
oktroyieren, mit den solide<br />
haushaltenden Ländern als Geber und<br />
den reformunfähigen oder -unwilligen als<br />
Nehmern.<br />
Neue, gesamteuropäische Institutionen<br />
würden nur den Veränderungsdruck von<br />
den Ländern nehmen, die dabei sind, ihre<br />
Zahlungsfähigkeit zu verlieren. Die Südländer<br />
– Frankreich eingeschlossen, das gerade<br />
dabei ist, den letzten Rest seiner Wettbewerbsfähigkeit<br />
zu verspielen – könnten<br />
alle die Ursachen der Krise selbst überwinden,<br />
indem sie die unvermeidlichen<br />
Reformen ihrer Sozialgesetzgebung, ihres<br />
Arbeitsrechts und ihrer Bürokratien umsetzen<br />
würden, so wie es das kleine Lettland<br />
vorgemacht hat. Doch zu dieser Umkehr<br />
scheinen eine ignorante Wählerschaft und<br />
eine opportunistisch agierende politische<br />
Elite nicht fähig oder nicht willens.<br />
Gewiss, der vertragliche Rahmen der<br />
Währungsunion ist verbessert worden. Die<br />
Banken sollen zukünftig einheitlich europaweit<br />
kontrolliert werden. Fiskalunion<br />
nebst Schuldenbremse können einen zusätzlichen<br />
Druck ausüben, staatliche Einnahmen<br />
und Ausgaben im Lot zu halten.<br />
Aber ob die Paragrafen im Getöse des<br />
politischen Alltags respektiert werden, ist<br />
nach der Serie bisheriger Vertragsbrüche<br />
keineswegs gesichert.<br />
Glaubwürdig wären all die Schwüre<br />
nur, wenn die Bestrafung für Fehlverhalten<br />
automatisch folgen würde und nicht<br />
von Beschlüssen Brüsseler Räte abhängig<br />
wäre. Doch solche Automatismen konnten<br />
die Deutschen nicht durchsetzen.<br />
Die Währungsunion wird Bestand haben.<br />
Es gibt kein Zurück mehr zu nationalen<br />
Währungen. Ein Ende des Euro wäre<br />
verhängnisvoll, politisch wie ökonomisch,<br />
nicht zuletzt für Deutschland mit seinen<br />
riesigen Haftungsverpflichtungen, die inzwischen<br />
eingegangen wurden und nicht<br />
rückgängig zu machen sind.<br />
Die einzige für Deutschland stimmige<br />
Strategie in diesem Euro-Europa aber muss<br />
darin bestehen, die Politik der ständigen<br />
Hilfsaktionen, via Rettungsfonds oder über<br />
die Notenbank, also die Sozialisierung von<br />
Schulden zu beenden und zurückzukehren<br />
zu einem ehernen Grundsatz vernünftigen<br />
Wirtschaftens: der Einheit von Risiko und<br />
Haftung, wie sie in Maastricht festgeschrieben<br />
wurde.<br />
WOLFGANG KADEN<br />
war Chefredakteur beim Spiegel<br />
und beim Manager Magazin<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 81
| K A P I T A L | D E R T R A U M V O M S C H N E L L E N G E L D<br />
DAS ZOCKERHAUS<br />
50 Seminare für<br />
Spekulanten veranstaltet<br />
das Traderhotel jedes Jahr<br />
82 <strong>Cicero</strong> 4.2013
IM SPESSART<br />
Daytrader verdienen ihr Geld<br />
mit Börsenspekulationen am<br />
heimischen Computer. Wenn<br />
das nicht so richtig klappt,<br />
pilgern sie zum Seminar auf<br />
einen Berg am Main –<br />
ein Besuch im Traderhotel<br />
V ON C ONSTANT IN M AGNIS<br />
FOTO: BERND HARTUNG FÜR CICERO<br />
D<br />
ER MANN MIT DER BRILLE schwitzt.<br />
Er will nichts mehr sagen, aber<br />
jetzt schaut ihn die Gruppe so<br />
mitfühlend an, und der Mann<br />
am Podium stellt die Frage<br />
schon zum zweiten Mal:<br />
„Wie viel Verlust machen Sie am Tag?“<br />
„Fünfhundert?“, sagt der Mann<br />
schuldbewusst.<br />
„Und? Mit wie viel würden Sie sich<br />
wohlfühlen?!“<br />
Er senkt den Blick. „Hundert?“<br />
„Und so wie Sie agieren, was sind die Folgen?<br />
Na los!“<br />
„Angst?“, sagt der Mann kleinlaut, sein<br />
Tischnachbar nickt ihm Mut zu.<br />
„Angst! Genau! Was noch?“<br />
„Unsicherheit, Frust?“<br />
„Merken Sie was?!“, sagt der Mann am<br />
Podium streng. „Mit Ihrer Methode machen<br />
Sie sich unglücklich!“<br />
Der Mann schlägt die Hände aufs Pult.<br />
„Ich weiß. Darum bin ich ja hier.“<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 83
| K A P I T A L | D E R T R A U M V O M S C H N E L L E N G E L D<br />
Nein, dies ist keine Selbsthilfegruppe<br />
für Spielsüchtige. Wir befinden uns im<br />
Spessart, im Gebäude einer Lungenheilanstalt<br />
aus dem vorletzten Jahrhundert,<br />
heute ein Hotel. „Zauberberg“ nennt die<br />
Hausbroschüre diesen Ort, natürlich. Aus<br />
den großen Fenstern blickt man kilometerweit<br />
über waldige Hügel, unten im Tal<br />
liegt das Städtchen Lohr am Main. „Zockerburg“<br />
nennen dort die Leute das trutzige<br />
Haus. Denn es führt ein Doppelleben.<br />
Für die meisten Besucher bedient es den regulären<br />
Tourismusbetrieb.<br />
Doch daneben gibt es für spezielle<br />
Gäste einen eigenen Trakt, eine eigene Telefonnummer,<br />
einen eigenen Internetauftritt,<br />
mit anderem Namen. Dort heißt es:<br />
das „Traderhotel“. Bis zu 50 Seminare für<br />
Trader – also Börsenspekulanten – finden<br />
hier jährlich statt. So wie der gerade ablaufende<br />
Intensivkurs des Frankfurter Börsenveteranen<br />
Erdal Cene, der den Brillenträger<br />
soeben von seiner riskanten Handelsstrategie<br />
abgebracht hat. Die 20 Seminarteilnehmer<br />
zahlen 4760 Euro plus Übernachtung<br />
und Verpflegung, um – so verspricht Cenes<br />
Website – „dauerhaft in das Lager der<br />
Gewinner zu wechseln“.<br />
Ungestört von Euro- und Finanzmarktkrisen,<br />
in Zeiten, in denen selbst konservative<br />
Publizisten wie Frank Schirrmacher<br />
den Homo oeconomicus niederschreiben,<br />
bildet der Hügel über Lohr einen Pilgerort<br />
für die Verlockungen des Kapitalismus<br />
in seiner reinsten Form.<br />
Die allermeisten Kursteilnehmer sind<br />
sogenannte Daytrader, Händler, die Wertpapiere<br />
innerhalb eines Handelstags kaufen<br />
und wieder verkaufen, um von winzigen<br />
Kursschwankungen schnell zu profitieren.<br />
Deswegen lieben sie, anders als die konservativ<br />
langfristig denkenden Anleger, volatile<br />
Marktphasen, in denen die Kurse an<br />
der Börse im ständigen Wechsel auf- und<br />
abgehen. Ob sie mit Aktien, Rohstoffen,<br />
Devisen, Indices oder Zinsen handeln: Sie<br />
alle sind Glücksritter, die hoffen, im Abermilliarden<br />
Zahlen starken Strom der globalen<br />
Märkte Gold zu heben oder zumindest<br />
ein Paar Nuggets herauszuschürfen.<br />
Die Teilnehmer<br />
des Seminars<br />
zahlen<br />
4760 Euro, um –<br />
so verspricht<br />
es die Website –<br />
„dauerhaft in<br />
das Lager der<br />
Gewinner zu<br />
wechseln“<br />
84 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTOS: BERND HARTUNG FÜR CICERO<br />
Man hatte sie sich anders vorgestellt,<br />
die Trader, die von Erfurt bis Wien, von<br />
Luzern bis Berlin in den Spessart eingeflogen<br />
sind. Ein bisschen so wie auf dem<br />
Bild, das im Seminarraum auf einer Staffelei<br />
steht. Darauf sitzt ein schneidiger junger<br />
Mann mit Scheitel, siegesgewiss lächelnd,<br />
im blauen Licht der Bildschirme,<br />
die vor ihm aufgebaut sind wie ein Altar.<br />
Hinter ihm schwebt ein brünettes Fräulein<br />
vorbei, sie wirft dem Aktienpriester einen<br />
scheuen Blick zu, ihre Brüste stehen prall<br />
nach vorne. Im „Traderhotel“ dagegen begegnen<br />
einem Rentner im Wanderschuh,<br />
Handwerker im Fleece-Pulli und Sparkassenangestellte<br />
in bunten Anoraks.<br />
In Deutschland sind nach Marktschätzungen<br />
etwa 30 000 Menschen als Daytrader<br />
aktiv, doch mehr als 75 Prozent<br />
von ihnen machen überwiegend Verluste.<br />
Wohl auch, weil die wenigsten Profis sind.<br />
Noch in den Neunzigern war diese Art des<br />
Wertpapierhandels Spezialisten vorbehalten.<br />
Transaktionskosten und schnelle, zuverlässige<br />
Internetverbindungen waren für<br />
Wie verdient man<br />
in 15 Minuten so<br />
viel wie sonst nur<br />
in einer Woche?<br />
Stefan Fröhlich<br />
steht vor den<br />
Teilnehmern des<br />
Trader-Seminars<br />
und unterrichtet<br />
Einzelkämpfer damals kaum bezahlbar,<br />
Händlerzulassungen rar. Doch inzwischen<br />
kosten selbst Aktienkäufe im sechsstelligen<br />
Bereich nur noch ein paar Euro Gebühr,<br />
Dutzende Brokerfirmen bieten Privatanlegern<br />
Handel mit kleinen Einsätzen an,<br />
und die Monopolstellung der großen Börsen<br />
ist gefallen. Jeder, der kreditwürdig ist,<br />
darf heute traden. Ob er es auch kann, ist<br />
eine andere Frage.<br />
WER ZUM SEMINAR nach Lohr anreist, hat offenbar<br />
nicht vor, diese Frage dem Zufall zu<br />
überlassen. Jede Kursminute ist hier bares<br />
Geld wert. Am Ende des Seminartages fragt<br />
Coach Erdal Cene, 42, stahlgraue Haare,<br />
hessischer Dialekt: „Wollen wir morgen zur<br />
Abwechslung mal eine halbe Stunde später<br />
anfangen, also um 8 Uhr?“ Er lächelt großzügig.<br />
Keiner lächelt zurück. „Was sollen<br />
wir mit der halben Stunde machen? Wegschmeißen?“,<br />
protestiert ein Mann. Der<br />
Rest murrt zustimmend. Cene blickt kurz<br />
resigniert, aber fragt dann noch mal erwartungsvoll:<br />
„Okay, wer kommt nachher<br />
noch für ein Glas Wein mit in die Stadt?“<br />
Die Trader blicken auf ihre Tische. Sie sind<br />
ja nicht zum Spaß hier.<br />
Immerhin sitzen einige von ihnen später<br />
noch bei einem Bier an der Hotelbar.<br />
Als sich der Autor zu ihnen setzt, wird<br />
die Runde nervös. „Keine Namen“, sagt<br />
einer, den wir deshalb nur Thomas nennen.<br />
Bei der dritten Frage zu ihrem Beruf<br />
treten sie die Flucht an. „Ich geh eine<br />
rauchen“, sagt der Erste. „Ich auch“, sagt<br />
der Zweite. Dann steht auch der Dritte auf.<br />
Thomas und sein Kollege sitzen nun alleine<br />
da. „Geld ist ein scheues Pferd“, sagt Thomas.<br />
„Bitte, setzen Sie sich woanders hin.“<br />
Kurt am Nachbartisch wischt sich den<br />
Bierschaum aus dem Schnurrbart. Er sagt:<br />
„In Deutschland über Geld zu reden, ist<br />
so wie in Amerika über Sex. Es ist unanständig.“<br />
Der pensionierte Bauingenieur<br />
hat Hände, die eigentlich zu groß für eine<br />
Computertastatur sind. Er hat sein Haus<br />
selbst gebaut, und weil die Banken ihn<br />
enttäuschten, verwaltet er jetzt auch sein<br />
Geld selber. Als Daytrader. Es flutscht noch<br />
nicht so. Sonst wäre er nicht hier, sagt er,<br />
und lacht.<br />
Wie die meisten Trader handelt Kurt<br />
von zu Hause. Um 7 Uhr steht er auf, liest<br />
Nachrichten, checkt die asiatischen Märkte.<br />
Bevor er den Rechner hochfährt, macht<br />
er Yoga. Nichts ist in diesem Geschäft so<br />
wichtig wie ein freier Kopf. Wer zu schnell<br />
oder zu spät aussteigt, weil er Angst oder<br />
Gier nicht kontrollieren kann, der scheitert.<br />
Jeder gute Trader entwickelt deshalb<br />
seine persönlichen Handelsregeln, an die<br />
er sich sklavisch hält, egal was passiert. Gegen<br />
8 Uhr, wenn die Großinvestoren schon<br />
im vorbörslichen Handel einkaufen, eine<br />
Stunde bevor die Märkte in Europa öffnen,<br />
loggt Kurt sich ein. Er wählt seinen Markt,<br />
meistens den deutschen Aktienindex Dax,<br />
entscheidet sich für eine Kontraktzahl, und<br />
ob er heute „long“ oder „short“ gehen, auf<br />
steigende oder fallende Kurse setzen will.<br />
Dann blendet er alles andere aus.<br />
Über den Bildschirm ruckelt der Dax-<br />
Kurs wie ein Gebirge, daneben fließen in<br />
rasendem Tempo Zahlenstrahlen – grün,<br />
wenn der Preis steigt, rot, wenn er fällt. Kurt<br />
sitzt dann bangend davor, als zeige sein Monitor<br />
das EKG eines Kranken, klickt mal<br />
„buy“, dann wieder „sell“. Entscheidend<br />
ist: „Beim Beuteschema bleiben. Sich nicht<br />
ablenken lassen. Frust, Verluste, und Langeweile<br />
aushalten.“ Wer mit Daytradern<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 85
| K A P I T A L | D E R T R A U M V O M S C H N E L L E N G E L D<br />
Die Daytrader<br />
lauschen den<br />
Weisheiten des<br />
Börsenveterans<br />
Erdal Cene, als sei<br />
jeder seiner Sätze<br />
bares Geld wert<br />
Das Traderhotel<br />
befindet sich in<br />
einer ehemaligen<br />
Lungenheilanstalt.<br />
Da ist der Verweis<br />
auf den Zauberberg<br />
in der Broschüre<br />
natürlich zwingend<br />
spricht, hört oft den Vergleich mit dem<br />
Feuerwehrmann: Man sitzt manchmal den<br />
halben Tag vor dem Rechner und nichts<br />
passiert. Aber wenn es brennt, muss man<br />
präsent sein und alle Aktionen schnell ausführen,<br />
ohne in Panik zu verfallen.<br />
Systematisch arbeitet Kurt seine Handelsstrategie<br />
ab, Kopf aus, Routine an.<br />
Er hält das etwa eine Stunde lang durch,<br />
dann braucht er eine Pause. Mittags isst<br />
er leicht, Fisch oder Gemüse. Spätestens<br />
um 15.30 Uhr, wenn die Börsen von Kanada<br />
bis Brasilien öffnen, knackt der Rücken.<br />
Und wenn sie um 17.30 Uhr in<br />
Deutschland schließen, kann Kurt meist<br />
kaum noch klar denken. An schlechten Tagen<br />
rackert er trotzdem weiter bis zum New<br />
Yorker Börsenschluss um 22.00 Uhr, hat<br />
ausschließlich Geld verloren und kann vor<br />
Stress nicht schlafen. An guten Tagen verdient<br />
er dafür in 15 Minuten so viel wie<br />
sonst in einer Woche.<br />
WIE VIEL STARTKAPITAL ein Daytrader mitbringen<br />
muss, ist umstritten. Thomas Vittner,<br />
selbst professioneller Spekulant und<br />
Autor des Buches „Das Trader Coaching:<br />
So werden Sie zum Gewinner“, empfiehlt<br />
seinen Lesern die sportliche Summe von<br />
500 000 Euro. Darunter sei es schwierig,<br />
da man auch hin und wieder längere Verlustserien<br />
aushalten müsse. Wer dabei mit<br />
einem kleineren Startkapital ständig Geld<br />
vom Konto nehmen müsse, dezimiere sein<br />
Kapital gleich doppelt, da der Zinseszinseffekt<br />
nicht ausreichend greifen könne.<br />
So viel Geld hat wohl kaum einer von<br />
den Kursteilnehmern in der Zockerburg<br />
zur Verfügung. Die meisten waren froh,<br />
wenn sie zu Anfang ihrer Traderkarriere<br />
ein Zehntel davon besaßen. Auch deswegen<br />
sind bei kleineren Daytradern Hebelprodukte<br />
wie die Contracts for Difference<br />
so beliebt. Mit diesen Papieren kann man<br />
von den Kursschwankungen eines Tages<br />
profitieren. Wer einen solchen Differenzkontrakt<br />
auf den Dax wählt, mit dem von<br />
den meisten Onlinebrokern angebotenen<br />
Standardhebel von hundert, setzt beim<br />
derzeitigen Daxstand von 8000 Punkten<br />
zum Beispiel 80 Euro auf steigende Kurse.<br />
Gehebelt handelt er mit 8000 Euro. Steigt<br />
der Dax an dem Tag um nur 1 Prozent,<br />
verdoppelt der Trader seinen Einsatz und<br />
gewinnt 80 Euro. Verliert der Index dagegen<br />
1 Prozent, ist der komplette Einsatz<br />
verloren.<br />
FOTOS: BERND HARTUNG FÜR CICERO, PRIVAT (AUTOR)<br />
86 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Traden ist nie gerecht“, sagt Stefan<br />
Fröhlich, 46, Schlabberjeans, Fahrradschuhe<br />
mit Klettverschluss. Er und seine<br />
Frau haben 2009 das „Traderhotel“ konzipiert,<br />
organisieren Ablauf der Tagungen<br />
und engagieren die Referenten. Auch weil<br />
sie wissen, wie einsam und hart das Leben<br />
eines Daytraders sein kann. Fröhlich ist seit<br />
25 Jahren an der Börse aktiv und hat zigfach<br />
erlebt, wie Händler ihre „Konten plätten“,<br />
wie es im Traderjargon heißt. Laut einer<br />
Studie der University of California dauert<br />
es bei 85 Prozent der Anfänger nur drei bis<br />
sechs Monate, bis das Konto leer ist. Mit<br />
den Schulungen im Traderhotel versucht<br />
Fröhlich, die Kursteilnehmer zumindest<br />
vor der schnellen Pleite zu bewahren.<br />
An diesem Morgen coacht er selbst<br />
neue Kursteilnehmer. Fröhlich trägt große<br />
Kopfhörer mit abstehendem Mikro, saust<br />
mit dem Mauszeiger durch das Zahlengewirr<br />
an der Wand und kichert über seine<br />
eigenen Witze. Während seiner Einführung<br />
in die Tradersoftware „Nano Trader“<br />
spricht er von „Bobl-Futures“ und „Volatilitätskomponenten“,<br />
schwärmt vom<br />
„Tradeguard Order“ und den „Aggregationen<br />
der Meta-Sentimentoren“ und warnt<br />
davor, den „Parabolic als Indikator“ zu unterschätzen.<br />
Spräche er nicht deutsch, sondern<br />
klingonisch, ein Laie wäre nicht weniger<br />
verwirrt. Doch seine Zuhörer nicken<br />
verständig, während sich die blauen Graphen<br />
an der Wand auf ihren glänzenden<br />
Stirnen und Brillengläsern spiegeln.<br />
NA KLAR, DAS HANDWERK, die Vokabeln, das<br />
alles muss gepaukt werden, sagt Michael,<br />
26, schwere Stahluhr, schwarze Haare,<br />
schwarze Kleidung. Mit der Gabel bearbeitet<br />
er das sogenannte „Trader-Menü“<br />
der Mittagskarte: Pellkartoffeln mit Hering,<br />
halbe Portion. Natürlich sei das Lernen<br />
mühsam, genau wie die Selbstdisziplin,<br />
die das Traden erfordert.<br />
Michael ist Berliner, vergangenes Jahr<br />
hat er begonnen, Seminare im Internet<br />
zu belegen und den Stoff aus der Ratgeberliteratur<br />
zu büffeln, nachts, neben seinem<br />
Beruf als Elektrotechniker. Dann hat<br />
er den Job geschmissen, um Vollzeittrader<br />
zu werden. Bis Ende des Jahres reicht sein<br />
Erspartes. Sein Traum wäre es, ganz vom<br />
täglichen Spekulieren leben zu können. Er<br />
liebt das Trading. Die Energie, die es bei<br />
ihm freisetzt, die Selbstständigkeit, die Arbeit<br />
an sich selbst und ja, auch die Chance<br />
auf das fette Geld.<br />
Nur einen Haken hat der Job für ihn.<br />
„Die Leute hassen uns“, sagt Michael. Seit<br />
der Finanzkrise ist die Stimmung gegen<br />
Spekulanten gekippt, auch andere Trader<br />
wie Erdal Cene erleben das. Zocker wie er<br />
seien schuld daran, dass Benzin und Weizenpreise<br />
steigen, Milch in die Ozeane gekippt<br />
und ganze Stämme in Afrika verhungern<br />
würden, bekommt Michael dann zu<br />
hören. Sein Vater war so enttäuscht, dass er<br />
ihn am liebsten enterbt hätte. Inzwischen<br />
sagt er nicht mehr, dass er Trader ist. Wenn<br />
heute jemand fragt, was er macht, antwortet<br />
er: „Gemüsehändler.“<br />
C ONSTANT IN M AGNIS<br />
ist Reporter bei <strong>Cicero</strong><br />
Anzeige<br />
Elegante Vielfalt für unsere Leser<br />
Die <strong>Cicero</strong>-Kollektion<br />
Entdecken Sie unsere <strong>Cicero</strong>-Klassiker:<br />
Der stabile <strong>Cicero</strong>-Sammelschuber, gebunden in stilvolles Brillianta-Leinen<br />
❶, unser erlesenes Weinangebot ❷, das handliche<br />
<strong>Cicero</strong>-Notizbuch in Rot oder Schwarz ❸<br />
❶<br />
❷<br />
❸<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 46 46 56 56<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/kollektion<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 943166
| K A P I T A L | K O M M E N T A R<br />
Bergler gegen<br />
Feudalherren<br />
Das Schweizer Verdikt gegen die Abzocker sch0ckiert den<br />
Geldadel und seinen Klerus. Der Neofeudalismus wird entlarvt<br />
VON FRANK A . ME Y E R<br />
Z<br />
UR VOLKSABSTIMMUNG gegen exzessive Managerlöhne<br />
und Boni in der Schweiz, der sogenannten Abzockerinitiative,<br />
druckte die Süddeutsche Zeitung folgende<br />
Formulierung: „Das merkwürdige Bergvolk ist zu Wutausbrüchen<br />
fähig.“<br />
Ein Sätzchen, das in dreierlei Hinsicht zu denken gibt.<br />
Erstens erscheinen die Schweizer deutschen Journalisten<br />
gerne als drollig oder putzig, als knorrige Bergler, jedenfalls<br />
nicht als ebenbürtige Nachbarn wie Franzosen, Niederländer<br />
oder Polen – irgendwie anders, vor allem als nicht sonderlich<br />
ernst zu nehmend, exotisch.<br />
Zweitens sind die merkwürdigen Bergler zwar zu temporären<br />
Ausbrüchen fähig, nicht aber zum Weitblick über ihre schneebedeckten<br />
Gipfel hinweg, wie die Abstimmung vom 3. März ja<br />
wohl zweifelsfrei belegt.<br />
Drittens lässt sich das Schweizer Volk in seinen Willensbekundungen<br />
von unberechenbaren Gefühlen wie Wut leiten,<br />
nicht aber von kühler, sachlicher Analyse.<br />
All das schwingt in dem Sätzchen der Süddeutschen Zeitung<br />
mit. Doch was hat die Wahrnehmung deutscher Journalisten<br />
mit der Schweiz zu tun?<br />
Unter den 14 weltweit führenden Industrieländern steht die<br />
Schweiz im Rating der Hochtechnologie auf Rang eins mit ihrem<br />
Maschinenbau, darunter Textil- und Werkzeugmaschinen,<br />
Automaten und Roboter; auf Rang eins mit ihren wissenschaftlichen<br />
Präzisionsinstrumenten; auf Rang eins mit ihrer Pharmaindustrie;<br />
auf Rang zwei mit ihrer Chemieproduktion.<br />
Allein der Wert aller Exporte der Schweiz pro Jahr und Kopf<br />
der Bevölkerung beträgt nach neuesten Zahlen 40 000 Dollar.<br />
Deutschland exportiert für 18 000 Dollar pro Kopf, die USA für<br />
4200.<br />
Die Schweizer: ein Bergvolk?<br />
Elektro-, Maschinen-, Metall- und Uhrenindustrie in diesem<br />
Land geben 340 000 Menschen Arbeit, Groß- und Einzelhandel<br />
445 000 Beschäftigten, das Gesundheitswesen fast ebenso vielen,<br />
540 000.<br />
Die Schweizer: ein Bergvolk?<br />
Die Schweiz beiderseits der Autobahn zwischen Romanshorn<br />
im Osten und Genf im Westen bietet das Bild dazu: eine<br />
Landschaft, vollgestopft mit Industrie und Gewerbe, planlos zersiedelt,<br />
von Verkehrsinfrastruktur zerteilt.<br />
Die Schweiz ist eine Industrienation wie kaum eine zweite,<br />
wahrscheinlich die wettbewerbsfähigste der Welt.<br />
Und nun haben die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes –<br />
seine Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger! – den Abzockern mit<br />
Zweidrittelmehrheit eine krachende Abfuhr erteilt.<br />
Das Düsseldorfer Handelsblatt zeigte sich erstaunt: „Mit<br />
der Annahme der sogenannten Abzockerinitiative gibt sich ausgerechnet<br />
die sonst wirtschaftsfreundliche Schweiz das wohl<br />
strengste Aktienrecht.“<br />
Auch dieses deutsche Sätzchen gibt zu denken, vor allem die<br />
Formulierung: „sonst wirtschaftsfreundliche Schweiz“.<br />
Denn das ist ja gerade die Pointe: Der wirtschaftsfreundliche<br />
Schweizer Souverän hat auch diesmal wirtschaftsfreundlich entschieden<br />
– gegen die Feinde der Wirtschaft!<br />
In den Ohren von Wirtschaftsjournalisten mag dies zunächst<br />
absurd klingen, doch es ist stringent und konsequent: Die<br />
Schweizer Stimmbürger stellen sich nicht feindlich gegen, sondern<br />
im Gegenteil schützend vor ihren heimischen Kapitalismus.<br />
Und sie exerzieren damit vor, was auch für andere Nationen die<br />
dringend nötige Gefechtsordnung beschreibt.<br />
In aller Welt hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges eine<br />
neue Kaste etabliert, in den Befehlszentralen der größten Unternehmen<br />
installiert, sich mit weiten Teilen der Politik alliiert –<br />
und die soziale Marktwirtschaft unterminiert.<br />
Erst Boni-Exzesse und Bankenkrise machten deutlich, was<br />
da die Demokratie bedroht: der Neofeudalismus eines von allen<br />
guten Geistern verlassenen, von allen gesellschaftlichen Regeln<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF<br />
88 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: PRIVAT (AUTOR)<br />
befreiten Geldadels. Wobei dem erblichen Adel von anno dazumal<br />
nicht böswillig Falsches nachgesagt werden soll, bewegte er<br />
sich doch kulturell und intellektuell auf einer erheblich höheren<br />
Ebene als die Hütchenspieler des Spätkapitalismus.<br />
Ja, es geht um die Usurpation des demokratisch-kapitalistischen<br />
Systems. Die neuen Feudalherren sichern dabei nicht<br />
nur ihren Machtanspruch über Kapital- und Firmenkonglomerate.<br />
Die Beherrscher des globalen Wirtschaftsgeschehens haben,<br />
wie es sich für Feudalherren gehört, auch eine Kirche in ihren<br />
Dienst gestellt. Deren höhere Würdenträger, gewissermaßen die<br />
Bischöfe und Kardinäle, werden von universitär bestallten Groß-<br />
Ökonomen verkörpert. Die Aufgaben des niederen Klerus, also<br />
der Pfäffchen, erfüllen beflissen die Wirtschaftsjournalisten.<br />
Es herrscht emsiges Treiben in diesem neuen Machtgefüge,<br />
unter anderem ablesbar an den Kommentaren nach dem<br />
Schweizer Entscheid. Da beschwor Michael Hüther, Direktor<br />
des Instituts der deutschen Wirtschaft, gar das „Fin du Capitalisme“<br />
und forderte seine Mitprälaten auf, sich dem Untergang<br />
beherzt entgegenzustellen.<br />
Die Schweizer Abzockerinitiative ist nicht von ungefähr<br />
durch den mittelständischen Mundwasser-Hersteller Thomas<br />
Minder lanciert worden. Ein neuer Klassenkampf zeichnet sich<br />
ab: Unternehmertum gegen Nehmertum – Patrons gegen Manager.<br />
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Klassen:<br />
Unternehmer arbeiten mit eigenem Geld, tragen persönliche<br />
Verantwortung, sind als ökonomische Elite in der Gesellschaft<br />
engagiert, traditionell in ihr verwurzelt – oft seit Generationen.<br />
Manager dagegen sind weder Unternehmer noch Arbeitnehmer,<br />
sie operieren mit fremdem Geld, bewegen sich in der Gesellschaft<br />
profitgetrieben wie Söldnerführer. Zur Rechtfertigung<br />
ihrer Gier nach Geld und Macht bedienen sie sich einer passenden<br />
Ideologie: des Marktradikalismus, einer ökonomistischen<br />
Heilsbotschaft religiösen Zuschnitts, letztlich eines ins Gegenteil<br />
gewendeten Marxismus – des Marktismus.<br />
In der Vorstellung seiner Gläubigen und deren Apostel gipfelt<br />
diese Lehre vom Nächsten, der sich jeder am besten selber<br />
sei, im Bild eines üppig gedeckten Tisches der Reichen und Superreichen,<br />
von dem doch genügend Krümel fürs gemeine Volk<br />
nach unten rieselten: ein neofeudales Abendmahl.<br />
Dem stehen in unserer neuzeitlich-aufgeklärten Gesellschaft<br />
jedoch die bürgerlichen Verhältnisse entgegen. Also gilt es für<br />
die neuen Masters of the Universe, Werte und Institutionen des<br />
Bürgertums zurückzudrängen, ja zu beseitigen – allen voran den<br />
bürgerlichen Staat mit seinen demokratischen Regeln.<br />
Denn der demokratische Staat ist das Feindbild der Marktbesessenen.<br />
Der Meisterdenker dieser Religion, Friedrich August<br />
von Hayek (1899 bis 1992), verachtet die Demokratie als „ein<br />
durch das Erpressungs- und Korruptionssystem der Politik hervorgebrachtes<br />
System“, als einen „Wortfetisch“, mehr nicht.<br />
Zu von Hayeks Dogmen gehört ferner, dass demokratische<br />
Entscheide ausschließlich von jenen zu fällen seien, die davon<br />
selbst betroffen sind. Will heißen: Nur Reiche sollen darüber<br />
befinden dürfen, wie viel Steuern Reiche an den Staat,<br />
also die Allgemeinheit, zu zahlen haben. Auch so lässt sich<br />
die Abschaffung der Demokratie bewerkstelligen. Vom Prinzip<br />
des „One Man – One Vote“ zum Wahlrecht nach Klassenzugehörigkeit.<br />
Feudalismus 2013. Von Hayek predigte dies bereits<br />
in den fünfziger Jahren, als im freien Europa noch der<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 89<br />
Rheinische Kapitalismus als sozial gerechtes Demokratiemodell<br />
triumphierte.<br />
Heute liest man derlei Putschisten-Fantasien beispielsweise in<br />
der Neuen Zürcher Zeitung. Das Stammblatt der Schweizer Wirtschaft,<br />
ein Osservatore Romano für Neoliberale, belehrte eben gerade<br />
seine Leser, dass Mehrheiten nicht einfach Mehrheiten seien,<br />
sondern sich nach den Folgekosten eines Volksentscheids richten<br />
müssten: „Je höher diese Kosten sind, desto höher sollte die<br />
Hürde für die Annahme solcher Vorlagen sein. Die sinnvolle erforderliche<br />
Ja-Quote kann also auch bei 60 oder 70 Prozent liegen.“<br />
Weiter dozierte die NZZ: „Eine Ausweitung der Staatsaufgaben<br />
und Staatsausgaben ist bei den heutigen riesigen Staatsquoten<br />
im Grunde eine zu ernste Sache, als dass man sie einfach so locker<br />
mit einer einfachen Mehrheit genehmigen kann.“<br />
Man darf das auch so lesen: Schluss jetzt mit dem demokratischen<br />
Firlefanz!<br />
Einst hat das Bürgertum mit Demokratie und Kapitalismus<br />
die Feudalherren samt Klerus zum Teufel gejagt. Eine historische<br />
Leistung. Sie führte zur erfolgreichsten Gesellschaftsordnung<br />
der Geschichte.<br />
Wie gesichert ist sie? So lange, wie es Bergvölker gibt.<br />
FRANK A . ME Y E R<br />
ist Journalist und Gastgeber der politischen<br />
Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
»Ein herausragendes Buch«<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
»Vogelsangs fabelhaftes<br />
Werk ist jedem ans Herz zu<br />
legen. Ein großer Wurf«<br />
Die Zeit<br />
»Ein neues deutschsprachiges<br />
Standardwerk«<br />
Neue Zürcher Zeitung<br />
»Vogelsangs Werk trägt dazu<br />
bei, die heutige Politik der<br />
ostasiatischen Weltmacht<br />
besser einschätzen zu<br />
können« Falter<br />
www.reclam.de<br />
Anzeige<br />
Kai Vogelsang: Geschichte Chinas<br />
3., aktual. Auflage 2013 · Paperback<br />
646 S. · 54 Abb. · 14 Karten · € 24,95<br />
ISBN 978-3-15-010933-5<br />
Reclam
| S T I L<br />
DIE SUPERNASE<br />
Sissel Tolaas archiviert und kreiert Gerüche. Sie changiert damit zwischen Chemie und Kunst<br />
V ON UL R ICH CLEWING<br />
D<br />
ER APPARAT, dem Sissel Tolaas<br />
so viel verdankt, sieht aus wie<br />
eine Mischung aus Staubsauger<br />
und Geigerzähler. Damit hat sie etwas gesammelt,<br />
von dem man nicht dachte, das<br />
man es überhaupt sammeln kann: Gerüche.<br />
Eine Enzyklopädie der Düfte, von<br />
den wohlriechenden bis zu jenen, für die<br />
sich sonst keiner interessiert, außer vielleicht<br />
Mitarbeiter des Gesundheitsamts.<br />
Das Aroma von Brandmauern und Bürgersteigen,<br />
von Parkanlagen, U-Bahnhöfen<br />
und Pissecken. Nichts, was man landläufig<br />
als angenehm beschreiben würde – aber<br />
da hätte man aus Sissel Tolaas’ Sicht bereits<br />
den ersten Fehler gemacht.<br />
Ein Mietshaus in Berlin-Wilmersdorf,<br />
gediegene Innenstadtlage, die Wohnung<br />
liegt im dritten Stock. Eine schlanke, groß<br />
gewachsene Frau Mitte vierzig öffnet die<br />
Tür, die hellblonden Haare zu einem jugendlich<br />
franseligen Pagenkopf geschnitten.<br />
Sissel Tolaas, in Norwegen geboren,<br />
hat nicht nur Chemie studiert, sondern<br />
auch Bildende Kunst, in Oslo, Moskau,<br />
Warschau und in Oxford. So ungewöhnlich<br />
wie die Liste ihrer Studienorte liest sich<br />
auch ihr beruflicher Werdegang. Mal ist sie<br />
Künstlerin, mal Wissenschaftlerin. Sie hat<br />
für Sportschuhfabrikanten gearbeitet und<br />
für die Nasa, sie hält Vorträge an den renommiertesten<br />
Universitäten der USA und<br />
veranstaltet Aktionen in Museen wie dem<br />
Moma in New York, dem SF Moma in San<br />
Francisco und dem Hamburger Bahnhof in<br />
Berlin. In ihrem Lebenslauf nennt sie sich<br />
einen professional In-Betweener.<br />
Auf den ersten Blick ist an der Altbauwohnung,<br />
in der sie lebt, nichts Besonderes<br />
zu entdecken. Wäre dort nicht dieses<br />
Eckzimmer, in dem ungefähr 2500 kleine<br />
Fläschchen mit Duftproben stehen. „Was<br />
Sie hier sehen, ist nur ein kleiner Teil meines<br />
Archivs. Der Rest befindet sich im<br />
Lager. Es hat mich sieben Jahre gekostet,<br />
es zusammenzutragen“, sagt Tolaas.<br />
6703 Düfte diverser Herkünfte: Damit<br />
hätte sie das Zeug, die Welt zu verändern.<br />
Oder zumindest die Menschen, mit ihren<br />
Angewohnheiten, Klischees und Vorurteilen.<br />
Denn was wir riechen, hält Tolaas<br />
zum großen Teil für willkürliche Konditionierung.<br />
Der Geruch von Schweiß, so<br />
wird einem von Klein auf eingetrichtert,<br />
ist schlecht, der von Rosen gut. Dass beide<br />
ihrer Meinung nach sehr nahe beieinander<br />
liegen – für diese Erkenntnis ist in unserer<br />
deodorierten, sterilisierten Gegenwart<br />
kein Platz.<br />
Früher hat sie Gerüche „analog“ aufgelesen:<br />
mit einem Schwamm. Doch seit sie<br />
den Vakuumsauger zur Verfügung hat, geht<br />
alles viel einfacher. Der Apparat saugt Luft<br />
an. In der Luft befinden sich Moleküle. Die<br />
Proben werden vakuumverpackt und nach<br />
New York geflogen, wo einer der Marktführer,<br />
die International Flavors and Fragrance<br />
Inc., ihre chemische Zusammensetzung<br />
analysiert. Diejenigen Moleküle, die<br />
in der Luftprobe am häufigsten vorkommen,<br />
sind auch jene, welche den Geruch<br />
an dem Ort, an dem die Probe genommen<br />
wurde, am stärksten prägen. Anhand dieser<br />
Auswertungen kann Tolaas dann damit<br />
beginnen, den spezifischen Duft künstlich<br />
zu replizieren.<br />
Wahrscheinlich gehen Parfümhersteller<br />
ähnlich vor, doch an dem Punkt wird die<br />
Norwegerin grundsätzlich. „Mit Parfüms<br />
hat meine Arbeit wenig zu tun“, sagt sie<br />
und wechselt, obwohl schon seit Anfang<br />
der neunziger Jahre in Berlin, vor Aufregung<br />
ins Englische. „Der Geruchssinn ist<br />
eine fundamentale Empfindung des Menschen.<br />
Er löst sofort Emotionen aus. Dabei<br />
dürfte es interessant sein zu erfahren,<br />
dass man neutral geboren wird. Die Fähigkeiten,<br />
Düfte zu unterscheiden, bilden<br />
sich erst nach und nach heraus.“ Ob sie<br />
als gefällig oder störend wahrgenommen<br />
werden, hängt vom Kulturkreis ab. Vor<br />
allem aber von der Situation, in der man<br />
das erste Mal mit ihnen konfrontiert wird.<br />
„Diesen Moment“, sagt Tolaas, „vergessen<br />
Sie Ihr Leben lang nicht.“ Eine Erkenntnis,<br />
die auch Marketing-Experten nutzen:<br />
Den penetranten Duft einiger Filialen des<br />
Kleidungsherstellers Abercrombie & Fitch<br />
riecht man bereits aus zehn Metern Entfernung,<br />
bevor man die Produkte sieht.<br />
Die Nase kann dem Menschen Gefahr<br />
signalisieren, Freude oder Trauer wecken,<br />
dem Gedächtnis helfen oder die<br />
Seele heilen. Sissel Tolaas weiß von Untersuchungen,<br />
bei denen man Schülern<br />
abstrakte, das heißt synthetische, bis dahin<br />
noch nicht gerochene Düfte unter die<br />
Nase hielt, während sie lernten. Bei erneuter<br />
Verabreichung konnten die Probanden<br />
das Gelernte deutlich besser referieren als<br />
jene ohne Duft-Stimulation. Umgekehrt<br />
kann man mit geduldigem Training aber<br />
auch erreichen, dass ein Mensch die einmal<br />
mit einem Geruch verbundene Situation<br />
wieder aus seinem Gedächtnis löscht.<br />
Diese Erkenntnis könnte sich für die Behandlung<br />
von Trauma-Patienten, die mit<br />
einem bestimmten Geruch ein schreckliches<br />
Erlebnis verbinden, noch als wertvoll<br />
herausstellen.<br />
Als vergangenen Dezember in Dresden<br />
Daniel Libeskinds Neubau für das Militärhistorische<br />
Museum eröffnet wurde, erhielt<br />
sie den Auftrag, das Odeur eines Schlachtfelds<br />
des Ersten Weltkriegs nachzustellen.<br />
Das Resultat überzeugte. Bald stellte die<br />
Museumsleitung geeignete Gefäße auf –<br />
zu viele Besucher mussten sich übergeben.<br />
Sissel Tolaas’ hat eine 15 Jahre alte<br />
Tochter – was sagt die zur Tätigkeit ihrer<br />
Mutter? „Sie findet es okay. Und sie hat<br />
eine außerordentlich liberale Nase.“<br />
U L R ICH CLEWING<br />
ist freier Autor und lebt in Berlin<br />
FOTOS: JULIA ZIMMERMANN FÜR CICERO, OHLENBOSTEL/VERVOORDT (AUTOR)<br />
90 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Brandmauern,<br />
Trottoire, Pissecken.<br />
Alle jene Gerüche hat<br />
Sissel Tolaas in ihrer<br />
Duft-Bibliothek<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 91
| S T I L<br />
DER BRENNT FÜR DIE SACHE<br />
Keine Schnapsidee: Wie aus dem Kunstbuch-Verleger Christoph Keller ein Meister an der Kupferdestille wurde<br />
V ON A LEXANDER M A R G U IER<br />
B<br />
IS NACH EIGELT INGEN findet sich<br />
das Navigationssystem prima zurecht.<br />
Sogar der wenige Kilometer<br />
entfernt liegende Ortsteil Münchhöf bereitet<br />
keine Probleme, obwohl die Straße<br />
dorthin manchmal an einen Feldweg erinnert.<br />
Dann aber hilft auch der Satellit<br />
nicht weiter, und wer nicht zufällig an dem<br />
weißen Hinweisschild zur Stählemühle vorbeifährt,<br />
kann sich einfach noch ein bisschen<br />
an der sanften Hügellandschaft des<br />
Hegaus erfreuen, die einen halben Tagesmarsch<br />
gen Osten an den Bodensee grenzt.<br />
Es ist einer dieser Orte, an denen die süddeutsche<br />
Provinz noch ganz bei sich ist,<br />
fast unberührt von den ästhetischen Zumutungen<br />
des schnellen Konsums: Landgasthöfe<br />
statt Burger King, Dorfläden statt<br />
Einkaufszentren. Und Streuobstwiesen, die<br />
ganz gemächlich dem Diktat flächenintensiver<br />
Landwirtschaft trotzen.<br />
In dieser Gegend, die man idyllisch<br />
nennen könnte, wenn der Begriff nicht<br />
so überstrapaziert wäre, fanden Christoph<br />
Keller und Christiane Schoeller vor<br />
neun Jahren ihre neue Heimat. Für sich<br />
selbst und ihre beiden kleinen Kinder, denen<br />
sie eine Jugend im Frankfurter Großstadtdschungel<br />
ersparen wollten. In der<br />
hessischen Bankenmetropole hatte Keller<br />
bis dahin einen Kunstverlag geführt, der<br />
von einem ambitionierten Wohnzimmerprojekt<br />
bald zur veritablen Branchengröße<br />
gewachsen war; noch heute trauern Liebhaber<br />
jenen Zeiten hinterher, als Keller mit<br />
„Revolver Books“ einige der anspruchsvollsten<br />
Bände für zeitgenössische Kunst publizierte.<br />
Alles lange her.<br />
Äpfel sind nicht gleich Äpfel: In<br />
der Stählemühle kommt es auf<br />
Herkunft, Sorte und Reifegrad an<br />
Dem Wegweiser zur Stählemühle folgend,<br />
geht es neben einem kleinen Bachlauf<br />
den Abhang hinunter auf ein Gehöft<br />
zu, dessen Mittelpunkt ein sorgsam renoviertes<br />
Bauwerk bildet. In ihm drehte sich<br />
einst der Mühlstein, mittlerweile dient es<br />
nur noch als Wohnhaus. Von der einen<br />
Steinwurf entfernten Schafsweide kommt<br />
ein Mann dahergelaufen, der ganz und<br />
gar dem Idealbild des Hinterwäldlers entspricht:<br />
grüne Cord-Latzhose, Fellweste<br />
und Filzmütze, das Gesicht rot gefärbt –<br />
zumindest jene Stellen, die nicht vom verwegenen<br />
Vollbart überwuchert sind. Diese<br />
rustikale Gesamterscheinung ist keineswegs<br />
ein angeheuerter Landarbeiter, es<br />
handelt sich um den Hausherrn persönlich.<br />
Christoph Keller hat sich auch äußerlich<br />
ganz und gar auf seine pastorale Umgebung<br />
eingelassen; wer ihm begegnet, käme wohl<br />
als Letztes auf die Idee, dass es sich um einen<br />
zugezogenen ehemaligen Kunstverleger<br />
handelt. Diese erstaunliche Mimikry<br />
hat allerdings auch mit dem Perfektionismus<br />
des 44-Jährigen zu tun: Wenn Keller<br />
etwas macht, dann macht er es richtig. So,<br />
wie die Sache mit dem Schnaps.<br />
Deswegen ist es auch kein Zufall, dass<br />
der Bibliomane heute zur Weltelite der<br />
Schnapsbrenner zählt. Er hatte es nur nicht<br />
geplant. Als ein paar Tage nach dem Einzug<br />
der Familie eine Abordnung der örtlichen<br />
Zollbehörde in der Stählemühle auftauchte<br />
und wissen wollte, wie die neuen<br />
Hausherren mit dem Brennrecht verfahren<br />
würden, dachte Keller, die Rede sei von einer<br />
Art Lizenz zum Verbrennen von Holz<br />
unter freiem Himmel. Tatsächlich aber<br />
handelte es sich um die in Süddeutschland<br />
gepflegte Tradition, nach der Obstbauern<br />
immer noch einen Teil ihrer Ernte in Alkohol<br />
verwandeln dürfen, wenn ihnen einst<br />
die Erlaubnis dafür erteilt wurde – und sei<br />
es noch so lange her. Dieses „Brennrecht“<br />
bezieht sich allerdings nicht auf bestimmte<br />
Personen, sondern auf den jeweiligen Betrieb.<br />
Und erlischt, falls es dort nicht mehr<br />
ausgeübt wird. Also stand Christoph Keller<br />
vor der Wahl, Schnaps zu produzieren,<br />
obwohl er nicht die geringste Ahnung davon<br />
hatte. Oder für immer auf diese Möglichkeit<br />
zu verzichten. Er entschied sich für<br />
Ersteres.<br />
DIE VORBESITZER, sagt Keller, hätten wohl<br />
vor allem Korn gebrannt. Was durchaus<br />
naheliegt, weil in der Stählemühle jahrhundertelang<br />
Getreide gemahlen wurde<br />
und der Grundstoff somit im Wortsinn<br />
vor der Haustür lag. Dass es sich dabei<br />
um edle Spirituosen gehandelt hat, kann<br />
man ausschließen; wahrscheinlich entstand<br />
hier früher einfach nur scharfes Feuerwasser,<br />
mit dem sich die Bauern in der<br />
Umgebung den Rachen putzen konnten.<br />
Zwar hatte Christoph Keller bis zu seiner<br />
Zwangsverpflichtung an die Destille nicht<br />
einmal als Konsument größere Erfahrung<br />
in Sachen Schnaps gesammelt. Aber eines<br />
wusste der gebürtige Schwabe von Anfang<br />
an: Er würde sich nur mit dem Besten<br />
zufriedengeben.<br />
„In meinem früheren Verlegerberuf<br />
habe ich gelernt, strukturiert zu denken“,<br />
erzählt Keller, „und das kam mir sehr zugute.“<br />
Mit stapelweise Fachliteratur arbeitete<br />
er sich in das Thema ein, experimentierte<br />
herum – und hatte im Jahr 2006<br />
endlich seinen ersten Schnaps aus Kirschen<br />
und Mirabellen in Flaschen gefüllt. Jeweils<br />
eine davon reichte der Autodidakt bei der<br />
„Destillata“ ein, einer Art Olympiade von<br />
Brennern aus aller Welt, die jedes Jahr in<br />
Österreich ausgetragen wird. Und siehe da:<br />
FOTO: BERND KAMMERER<br />
92 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Nach eigenen Plänen<br />
gebaut: Christoph Keller<br />
an seiner Brennanlage<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 93
I M P R E S S U M<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexander Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
RESSORTLEITER Lena Bergmann (Stil), Judith Hart<br />
(Weltbühne), Dr. Alexander Kissler (Salon), Til Knipper (Kapital)<br />
Constantin Magnis (Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT Hartmut Palmer<br />
ASSISTENZ DER CHEFREDAKTION Ulrike Gutewort<br />
REDAKTIONSASSISTENZ Monika de Roche<br />
PUBLIZISTISCHER BEIRAT Heiko Gebhardt,<br />
Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer, Jacques Pilet,<br />
Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
ART DIRECTOR Kerstin Schröer<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Rudolf Spindler<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
ABOMARKETING Mark Siegmann<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Lutz Fricke<br />
GRAFIK Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
DRUCK/LITHO NEEF+STUMME, premium printing GmbH<br />
& Co.KG, Schillerstraße 2, 29378 Wittingen Holger<br />
Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. *Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Versand im<br />
Inland, Auslandspreise auf Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland<br />
sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des<br />
Verlags statthaft.<br />
ANZEIGENLEITUNG (verantw. für den Inhalt der Anzeigen)<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
VERKAUFSBÜRO HAMBURG Jörn Schmieding-Dieck<br />
ANZEIGENVERKAUF ONLINE Kerstin Börner<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski, PremiumContentMedia<br />
Dieffenbachstraße 15 (Remise), 10967 Berlin<br />
Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 83 128 (IVW Q4/2012)<br />
LAE 2012 93 000 Entscheider<br />
REICHWEITE 390 000 Leser<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
VERLAG Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
ANZEIGEN Tel.: +49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung auf<br />
Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur nach<br />
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2013, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION DER RINGIER GRUPPE<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,– €, CH: 12,50 CHF, A: 8,– €<br />
JAHRESABONNEMENT (ZWÖLF AUSGABEN)<br />
D: 84,– €, CH: 132,– CHF, A: 90,– €*<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €*<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.<br />
Beide Schnäpse gewannen auf Anhieb die<br />
Silbermedaille. Damit war Christoph Kellers<br />
Ehrgeiz erst recht angefacht.<br />
Als Quereinsteiger, sagt er, hinterfrage<br />
man jeden einzelnen Schritt im Produktionsprozess.<br />
Wo andere nach alter Väter<br />
Sitte ihre Wässerchen brennen, existierten<br />
für Keller keine Selbstverständlichkeiten.<br />
Und mit unverstelltem Blick machte<br />
er sich ans Werk – ungefähr wie ein Naturwissenschaftler,<br />
der ohne Vorkenntnis<br />
und ohne Rezept einen Kuchen backen<br />
soll. Kein Wunder also, dass ihm die<br />
alte Destille schon bald nicht mehr genügte.<br />
Vor drei Jahren wurde in der Stählemühle<br />
eine neue Brennanlage angeliefert;<br />
konstruiert von der renommierten Kupferschmiede<br />
Arnold Holstein am Bodensee<br />
nach Plänen von – wie sollte es anders<br />
sein – Christoph Keller. Dabei sei das<br />
Werkzeug eigentlich gar nicht so wichtig:<br />
„95 Prozent der Qualität liegen im Obst.“<br />
Womit wir bei einem Thema wären, über<br />
das Keller wahrscheinlich stundenlang mit<br />
der Leidenschaft eines Konvertiten erzählen<br />
könnte.<br />
Man soll Äpfel bekanntlich nicht mit<br />
Birnen vergleichen (warum eigentlich<br />
nicht?), aber man sollte auch nicht alle Äpfel<br />
in die gleiche Tonne schmeißen. In der<br />
Stählemühle zählt nämlich der feine Unterschied<br />
– etwa zwischen „Rheinischem<br />
Bohnapfel vom Schuhmacherhof“, „Bavendorfer<br />
Hauxapfel“ oder „Hegauer Gewürzluiken“,<br />
der jeder für sich über sein<br />
eigenes typisches Aroma verfügt. Und die<br />
deswegen auch eigenständige Brände ergeben.<br />
So kommt es, dass Kellers Sortiment<br />
rund 180 verschiedene Positionen umfasst;<br />
allein in der Kategorie „Mostbirnen/Streuobstbirnen“<br />
gibt es in der aktuellen Edition<br />
elf verschiedene Schnäpse, angefangen<br />
bei der „Großen Linzgauer Rommelter aus<br />
Unteruhldingen“ für 65 Euro je halber Liter<br />
bis hin zur „Wahl’schen Schnapsbirne<br />
im Kastanienfass“ zum nicht ganz alltäglichen<br />
Preis von 145 Euro für die Halbliterflasche.<br />
Diese (ähnlich wie bei Spitzenweinen)<br />
konsequente Differenzierung<br />
nach Sorte, Lage und Jahrgang wird natürlich<br />
nur dann dem Charakter der Frucht<br />
gerecht, wenn diese im optimalen Reifegrad<br />
verarbeitet wird: „Baumfallend“ lautet<br />
der Fachbegriff, will sagen: schön reif,<br />
aber noch am Ast hängend. „Kein Zucker,<br />
keine fragwürdigen Aromastoffe – nur die<br />
reine Frucht darf ins Glas!“, lautet eine<br />
94 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
der vielen Qualitätsmaximen von Christoph<br />
Keller. Quitten werden bei ihm vor<br />
der Weiterverarbeitung sogar einzeln von<br />
Hand gereinigt, Birnen manuell entstielt,<br />
„um den Früchten ihre Essenz, das innerste<br />
geschmackliche Wesen zu entlocken“.<br />
Eigenen Obstanbau betreibt Keller<br />
nicht; er und seine Frau Christiane Schoeller<br />
sind auch so schon mindestens zwölf<br />
Stunden am Tag mit Arbeit ausgelastet.<br />
Umso wichtiger war es, Streuobstwiesenbesitzer<br />
zu finden, die den Qualitätsansprüchen<br />
der Stählemühle genügen; anfangs<br />
wurden sie per Zeitungsanzeige<br />
gesucht. Inzwischen kann Keller sich auf<br />
ein solides Netzwerk an Lieferanten verlassen<br />
– die meisten in der Region, einige<br />
(etwa für lothringische Mirabellen)<br />
sogar im Ausland. Am liebsten sind ihm<br />
aber wild wachsende Früchte, Hegauer<br />
Waldhimbeeren zum Beispiel, oder wilde<br />
Brombeeren aus dem Böhmerwald. Und<br />
natürlich Wildpflaumen, „mein Steckenpferd“.<br />
Im Sommer kann man Christoph<br />
Keller auf einem Motorroller durch die<br />
Landschaft fahren sehen, auf der Suche<br />
nach aussichtsreichen Sträuchern, Büschen<br />
und Bäumen. Die notiert er dann<br />
auf einer Landkarte und schickt Atilla,<br />
den rumänischen Erntehelfer, wieder hin,<br />
wenn die Zeit reif ist.<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
Hotel Schloss Neuhardenberg<br />
Schinkelplatz · 15320 Neuhardenberg · Tel: +49 (0)33476 600-0<br />
www.schlossneuhardenberg.de · hotel@schlossneuhardenberg.de<br />
»Unsere Wellness heißt Kultur. Auf Schloss Neuhardenberg<br />
trifft zurückhaltend-elegante Hotelkultur auf außergewöhnliche<br />
Denkzwischenfälle und herausragende Künstlerpersönlichkeiten.<br />
Gäste erleben in Schloss und Park genau<br />
das, was <strong>Cicero</strong> auszeichnet: Zuhören, Nachdenken und<br />
die Gelassenheit des Verstehenkönnens.«<br />
BERND KAUFFMANN, GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER<br />
EIN MÜHSAMES GESCHÄFT, bei dem je nach<br />
Sorte mitunter nur ein paar wenige Flaschen<br />
gebrannt werden können. „Hundert<br />
Kilo Holunder ergeben am Ende<br />
zwei Liter Alkohol, und dafür muss man<br />
eine Woche lang arbeiten.“ Wollte er<br />
seine Schnäpse in größerem Stil herstellen,<br />
ginge das womöglich auf Kosten der<br />
Qualität – für Keller indiskutabel. Als Perfektionist<br />
tut er sich ohnehin schwer damit,<br />
Arbeit zu delegieren (das ging ihm<br />
schon als Verleger so). Aber noch hat er<br />
Spaß daran. Und wenn eines Tages Routine<br />
einkehren sollte und die tägliche Herausforderung<br />
fehlt? Dann, sagt Christoph<br />
Keller, würde er wahrscheinlich noch einmal<br />
etwas ganz Neues beginnen. Was auch<br />
immer das sein könnte – eine halbe Sache<br />
ganz bestimmt nicht.<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan-Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger Hotel · Baden-Baden:<br />
Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss<br />
Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hôtel Concorde Berlin, Brandenburger Hof, Grand Hotel Esplanade,<br />
InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy Berlin, The Regent<br />
Berlin, The Ritz-Carlton Hotel · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle:<br />
Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg<br />
Essen: Schlosshotel Hugenpoet · Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter<br />
Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch · Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,<br />
Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental Hamburg, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance<br />
Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel<br />
Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst<br />
Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug<br />
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München: King’s Hotel<br />
First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg · Nürnberg:<br />
Le Méridien · Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel Bachmair am See,<br />
Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol<br />
bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Lienz: Grandhotel Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL Albufeira:<br />
Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale · Luzern:<br />
Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel Weggis<br />
A LEXANDER M A R G U IER<br />
ist stellvertretender<br />
Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de
Wer das neue NEON-Heft kauft,<br />
bekommt das 46-seitige Mode & Reise-Extra dazu.<br />
bekommt das neue NEON-Heft dazu.<br />
Wer das 46-seitige Mode & Reise-Extra kauft,<br />
Jetzt im Handel! Oder für 3,70 € zzgl. Versandkosten bequem per Telefon<br />
unter 01805/861 8000* bzw. online unter neon.de/heft bestellen.<br />
*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem dt. Mobilfunknetz.
K L E I D E R O R D N U N G | S T I L |<br />
Warum ich trage, was ich trage<br />
BIBIANA BEGLAU<br />
FOTO: STEPHANIE FÜSSENICH FÜR CICERO<br />
E<br />
IN ERNST ZU NEHMENDES Kleidungsstück.<br />
Das nicht aus der Zeit fällt.<br />
Tragbar zu jedem formellen Anlass,<br />
auch wenn ich die Stadt wechsle – das<br />
wollte ich immer. Der nachtblaue Hosenanzug<br />
von Kostas Murkudis hat viel erlebt.<br />
Zur Eröffnungsfeier der Berlinale<br />
habe ich ihn auch schon getragen. Mir gefällt,<br />
dass man sich damit nicht einreiht,<br />
in die vermeintlichen Vorgaben von roten<br />
Teppichen. Das hat damit zu tun, dass er<br />
zunächst wie ein Kleid aussieht. Bis man<br />
einen Schritt macht. Er hat etwas Organisches.<br />
Anders sexy als Dekolleté, nacktes<br />
Bein oder der tiefe Rückenausschnitt. Bewegen<br />
kann man sich darin gut. Man kann<br />
aber auch einfach darin stehen, dann hat<br />
der Anzug etwas Statuenhaftes.<br />
Drei Jahre, nachdem ich den Anzug gekauft<br />
habe, habe ich Kostas Murkudis zufällig<br />
getroffen, mich vorgestellt und für<br />
dieses tolle Kleidungsstück bedankt.<br />
Mode interessiert mich als Ausdruck<br />
von Kultur. Aber ich gehe nicht ständig<br />
einkaufen. Wenn eine Arbeit beendet ist,<br />
leiste ich mir mal ein Teil. In einer Vogue-<br />
Strecke hat man sich irgendwann mal ganz<br />
auf Weiß spezialisiert. Weiß erfordert einen<br />
ganz anderen Mut als Schwarz. Wenn mich<br />
etwas dazu anregt, so über Mode nachzudenken,<br />
dann erfreue ich mich daran.<br />
Auf der Bühne interessieren mich<br />
meine Kostüme extrem. Die Kostüme für<br />
meine Rolle der Petra von Kant habe ich<br />
mit entworfen. Borderline mit einer Hässlichkeit<br />
gedacht – das schießt in eine avantgardistische<br />
Richtung. Bauchweg-Gürtel,<br />
die eigentlich nicht sexy sind, übereinander<br />
gezogen. Ich vertrete in den Kostümen<br />
ja das gesprochene Wort, und wenn ich<br />
spüre, dass der Körper zusammengeschnürt<br />
ist, verändert das auch die Sprachkraft.<br />
Sexuelle Reize durch Mode? Enge Röcke,<br />
hoch geschnitten, mit offenen Blusen<br />
und Brillen? Da drehe ich durch. Dazu<br />
Mega-High-Heel-Waffen-Stilettos – und<br />
bitte meine Herren! Ich kann nicht sagen,<br />
dass mich diese Wirkung von Mode<br />
nicht fasziniert. Billige Reize, selbst wenn<br />
die schlecht gemacht sind, finde ich irre.<br />
Aufgezeichnet von Lena Bergmann<br />
BIBIANA BEGLAU<br />
Die Schauspielerin probt derzeit unter<br />
anderem am Münchner Residenztheater<br />
„Zement“ von Heiner Müller (Premiere<br />
am 5. Mai). Sie spielte die Hauptrolle<br />
in „Zappelphilipp“. Der Spielfilm<br />
ist für den Grimme-Preis nominiert<br />
(Verleihung am 12. April)<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 97
| S T I L | I N T E R I E U R<br />
Prunk und Patina<br />
98 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Die Welt vom Sofa aus<br />
betrachtet: Die Existenz<br />
der Familie Crawley,<br />
hier in einem der<br />
Drawing Rooms, ist nur<br />
scheinbar komfortabel<br />
Das Country House ist den Briten ein Nationalheiligtum.<br />
Seine Faszination wirkt in Mode, Literatur und Fernsehen<br />
V ON L ENA B E R GMANN<br />
FOTO: © 2010 UNIVERSAL STUDIOS (SZENENBILD AUS DER 1. STAFFEL DER SERIE DOWNTON ABBEY)<br />
IMMER WENN Her Ladyship, die Countess<br />
of Grantham, wieder einmal seufzend<br />
in eines ihrer Sofas sinkt, ist das<br />
Familienimage in Gefahr. Und alles,<br />
was das Ansehen des Crawley-<br />
Clans beschädigen könnte, setzt zwangsläufig<br />
auch das Hauptquartier der Familie<br />
aufs Spiel, den schlossartigen Landsitz, die<br />
Downton Abbey. Das Gebäude ist eine kulturelle<br />
Oase im Norden Yorkshires, inklusive<br />
Bibliothek, Musikzimmer und Ahnengalerie.<br />
In diesen Mauern manifestiert sich<br />
alles, was die Countess Cora Crawley und<br />
ihre Familie ausmacht: Bildung, Wohlstand,<br />
Einfluss und ein halbwegs ehrwürdiger<br />
Stammbaum. Der Wohnsitz verkörpert<br />
die verfeinerte Lebensart während der<br />
tumultuösen frühen Jahre des 20. Jahrhunderts.<br />
Dieses Universum für folgende Generationen<br />
zu sichern und dabei auch noch<br />
die Etikette zu wahren, sieht Her Ladyship,<br />
die Heldin der britischen Fernsehserie<br />
„Dowton Abbey“, als ihre Lebensaufgabe.<br />
Die Serie des Drehbuchautors Julian<br />
Fellowes ist mehrfach ausgezeichnet worden<br />
und wurde in über 100 Länder verkauft.<br />
In Deutschland lief die erste Staffel<br />
um Weihnachten im ZDF, die zweite<br />
gibt es auf Deutsch schon auf DVD. Der<br />
Erfolg rührt von den pikanten, britischtrockenen<br />
Dialogen her und von den sich<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 99
| S T I L | I N T E R I E U R<br />
Englands Landsitze wurden<br />
auch Power Houses genannt.<br />
Hier pflegte der Hausherr sein<br />
gesellschaftliches Standing<br />
Highclere Castle, südwestlich von London, wurde zwischen 1839 und 1842 vom<br />
Westminster-Abbey-Architekten Charles Barry im neugotischen Stil umgebaut. Gerade<br />
wurde hier die von Fans sehnsüchtig erwartete vierte Staffel von „Downton Abbey“ gedreht<br />
Die Möblierung des Salons stammt von 1862. Das Haus befindet sich noch in Privatbesitz.<br />
Ab Ostern können die Räume wieder besichtigt werden (www.highclerecastle.com)<br />
episodenübergreifend komplex entwickelnden<br />
Charakteren. Doch der wichtigste<br />
Faktor ist die Faszination, die vom<br />
Schauplatz der Serie ausgeht. Das britische<br />
Country House wird auch außerhalb Englands<br />
als romantisches Ideal wahrgenommen.<br />
Zu seiner Gattung zählen größenunabhängig<br />
alle Manors, Halls und Castles.<br />
Es sind Sehnsuchtsorte, weil dort die Rituale<br />
über Jahrhunderte bestehen und der<br />
Möblierung immer wieder Elemente hinzugefügt<br />
werden, ohne die ehrwürdige<br />
Grundstruktur zu zerstören.<br />
Der dramaturgische Reiz von „Downton<br />
Abbey“ besteht darin, dass diese<br />
große Kontinuität immer wieder verteidigt<br />
werden muss. Stets im tadellosen Outfit,<br />
bemühen sich Cora Crawley und ihre<br />
Familie, die Traditionen ihrer Klasse aufrechtzuerhalten.<br />
So gilt es, da kein Sohn<br />
vorhanden ist, einen männlichen Erben<br />
zu rekrutieren. Doch der erste Kandidat<br />
verschwindet bereits zum Auftakt<br />
mit der Titanic, während der nächste von<br />
der stolzen Erstgeborenen vergrault wird.<br />
Später muss verhindert werden, dass die<br />
jüngste Tochter mit dem Chauffeur durchbrennt<br />
– nach Feierabend ist der ein irischer<br />
Unabhängigkeitskämpfer.<br />
IMMER WIEDER STEHT sich die Familie selbst<br />
im Weg: Die Großmutter beispielsweise<br />
boykottiert jegliche Modernisierungsmaßnahmen.<br />
Elektrisches Licht? Telefon?<br />
Nur für Neureiche. Die Cousine erzwingt,<br />
dass die prachtvollen Gesellschaftsräume<br />
während des Ersten Weltkriegs zum Sanatorium<br />
für Verwundete umfunktioniert<br />
werden. Leider stören die Ping-Pong spielenden<br />
Soldaten in der Bibliothek erheblich<br />
bei der Lektüre. Noch dazu verteilt die<br />
mittlere Tochter den Bücherfundus an die<br />
Bettlägerigen. Der Hausherr selbst muss<br />
erkennen, dass er, wenn er mal ehrlich ist,<br />
von Agrarpolitik keine Ahnung und sein<br />
Land über Jahre hinweg schlecht bewirtschaftet<br />
hat. Das Vermögen der amerikanischen<br />
Ehefrau hat er auf eine einzige Aktie<br />
gesetzt – es war die falsche. Und die Dienerschaft!<br />
Zwischen Breakfast, Fuchsjagd<br />
und High Tea wirkt sie auf die Herrschaften<br />
ebenso intrigant wie moralisierend. Es<br />
ist demnach nicht nur optisch ein Genuss,<br />
die Crawleys vom bescheideneren heimischen<br />
Sofa aus (am besten im Jogginganzug!)<br />
bei ihrem Kampf um das Wahren der<br />
Form zu beobachten.<br />
FOTOS: HIGHCLERE ENTERPRISES LLP 2013 (2)<br />
100 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Genug Platz für Kunst und Antiquitäten: Die Long Gallery von Knole am Stadtrand von Sevenoaks in Kent (www.nationaltrust.com)<br />
FOTO: ANDREAS VON EINSIEDEL/NATIONAL TRUST IMAGES<br />
Das Ideal des Country House wird<br />
immer wieder in Literatur, Mode und Inneneinrichtung<br />
aufgenommen. Das Imperium<br />
von Ralph Lauren beispielsweise<br />
(Polo!) wäre ohne das Country House gar<br />
nicht denkbar. Was wäre die britische Literatur<br />
ohne diesen Kultort? Dazu passt,<br />
was der Schriftsteller Evelyn Waugh über<br />
den edwardianischen Glamour von Highclere<br />
Castle gesagt hat, den Drehort der Serie,<br />
in dem alle Räume bis auf den Dienstbotentrakt<br />
so erhalten sind, wie auf dem<br />
Bildschirm zu sehen: Ein besonders stilsicher<br />
inszeniertes Fest nannte Waugh „very<br />
Highclere“.<br />
Doch die zivilisierte Zerstreuung war<br />
nur eine Facette des aristokratischen Landlebens<br />
– nicht umsonst nannte man die<br />
Landsitze auch Power Houses, Symbole der<br />
Macht. An den Besitz von Land waren Einfluss<br />
und politische Ämter gebunden, viele<br />
Hausherren waren Mitglieder des Parlaments.<br />
Auch auf lokaler Ebene funktionierten<br />
die Landsitze oft wie kompakte Königreiche.<br />
Dabei waren die Eigentümer nicht<br />
etwa Farmer, Gott bewahre. Ihr Besitz verlieh<br />
ihnen vielmehr das Recht, die männlichen<br />
Bewohner und Pächter ihrer Ländereien<br />
in ihrem Namen zum Krieg oder<br />
später zur Wahl zu verpflichten, während<br />
die Pacht den Unterhalt des Landsitzes sicherte<br />
– und diverse Feste, Jagden und Einladungen<br />
finanzierte, mit denen der Hausherr<br />
sein politisches und gesellschaftliches<br />
Standing pflegte.<br />
Wie viele Anwesen seiner Kategorie befindet<br />
sich auch das in Hampshire – nicht<br />
wie in der Serie in Yorkshire – gelegene<br />
Highclere Castle in Familienbesitz, und<br />
zwar in der achten Generation. Das Landhaus<br />
als Drehort zu vermieten, ist keine<br />
besonders traditionelle, aber doch eine effektive<br />
Art, das Haus wohlbehalten in die<br />
neunte Generation weiterzureichen. Highclere<br />
ist auch Museum, die Besucherzahlen<br />
steigen. Darüber hinaus hat die Hausherrin<br />
Lady Fiona Carnarvon gerade ein Buch<br />
über das rauschende Gesellschaftsleben ihrer<br />
Vorfahrin Lady Alminia veröffentlicht,<br />
inklusive Grundrissen und Familienrezepten.<br />
Für die Rettung der architektonischen<br />
Schätze setzen sich allerdings auch Institutionen<br />
ein, allen voran der National Trust,<br />
der zahlreiche Country Houses verwaltet<br />
und der Öffentlichkeit zugänglich macht.<br />
Finanziert wird deren Erhaltung durch<br />
Spenden und Eintrittsgelder.<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 101
| S T I L | I N T E R I E U R<br />
Nur herein! Der National<br />
Trust hat die Türen von über<br />
300 Landsitzen geöffnet<br />
Kedleston Hall gehört heute zu den beeindruckendsten Gebäuden des National<br />
Trust. Architekt Robert Adams gilt als Vater des britischen Neo-Klassizismus<br />
Die imposanteren Landsitze sind meist<br />
vom Einfluss der „Grand Tour“ geprägt, einer<br />
Studienreise des heranreifenden Gentleman<br />
auf den Kontinent. Dort verlustierte<br />
sich dieser und eignete sich einen kulturellen<br />
Schliff an, beispielsweise indem er römische<br />
und griechische Baudenkmäler besichtigte.<br />
Viele der jungen Herren kamen<br />
mit Kunst und Antiquitäten beladen zurück<br />
in die Heimat, sodass einige Landsitze<br />
mit faszinierenden Sammlungen aufwarten<br />
können. Im 18. Jahrhundert begeisterten<br />
sich nicht wenige von ihnen als Amateur-Architekten<br />
so sehr für die Baukunst,<br />
dass sie ihre Landhäuser selbst entwarfen<br />
oder sich zumindest stark in die Planung<br />
involvierten.<br />
IN DEN INTERIEURS fasziniert der englische<br />
Eklektizismus: vom elegant-verspielten Dekor<br />
des 18. Jahrhunderts mit femininen<br />
Rokoko-Details und fernöstlichen Tapeten<br />
bis zum exotisch geprägten Look der<br />
viktorianischen Zeit, als Japonismus und<br />
Indien-Importe, stark gemusterte Teppiche<br />
und elaborierte Vorhänge die Zimmer<br />
schmückten, bevor die Arts-and-Crafts-Bewegung<br />
wieder heimische Handwerkstechniken<br />
und eine schlichtere Formensprache<br />
zelebrierte. Aufgrund der vielen Umbauarbeiten,<br />
die neuen Moden oder technischen<br />
Errungenschaften geschuldet waren, ist es<br />
heute kaum möglich, die Häuser einer stilistischen<br />
Phase zuzuordnen.<br />
Genau dieser Stilmix aus über Generationen<br />
angesammelten Möbeln, Kunstwerken<br />
und Büchern ergibt den in der Innenausstattung<br />
vielkopierten British Country<br />
Style. Auch das scheinbare Paradox zwischen<br />
aristokratischer Opulenz und selbstbewusstem<br />
Understatement hat viel mit Patina<br />
zu tun, mit der Gemütlichkeit in die<br />
Jahre gekommener Polstermöbel und exzentrischen<br />
Kombinationen von Mustern<br />
und Farben in altehrwürdigen Räumen.<br />
Die Formel klingt einfach, aber eine gekonnte<br />
Umsetzung ist schwierig. Wenn wir<br />
ehrlich sind: Ein solches Interieur sollte<br />
man besser erben.<br />
FOTOS: DENNIS GILBERT/NATIONAL TRUST IMAGES, ANDREAS VON EINSIEDEL/NATIONAL TRUST IMAGES, PRIVAT (AUTORIN)<br />
In der Bibliothek von The Vyne in Hampshire ist das Holz von Bücherregalen,<br />
Deckenverkleidung und Bilderrahmen aufeinander abgestimmt (www.nationaltrust.com)<br />
LENA BER GMANN<br />
ist bei <strong>Cicero</strong> zuständig für das<br />
Ressort Stil<br />
102 <strong>Cicero</strong> 4.2013
I N T E R I E U R | S T I L |<br />
Die Neo-Traditionalisten<br />
Ein Londoner Paar schöpft aus Englands Stilgeschichte<br />
Flights of FancyTable Lamp<br />
Hackney Empire Buttoned Back Sofa<br />
FOTOS: HOUSE OF HACKNEY<br />
J<br />
AVVY M. ROYLE UND SEINER PARTNERIN Frieda Gormley ist es ernst mit<br />
der Opulenz, wie ihr Showroom zeigt – ihr eigenes kleines Wohnhaus<br />
im inzwischen sehr angesagten Londoner Stadtteil Hackney.<br />
Nach diesem ist ihre Firma „House of Hackney“ auch benannt. Sie gehören zu<br />
einer Gruppe junger Designer, die für die Zukunft Englands stehen und dabei<br />
aus der Mottenkiste schöpfen. Als Inspiration dienen alte englische Landsitze,<br />
sie arbeiten mit kleinen handwerklichen Unternehmen, die über das ganze<br />
Land verteilt sind. Jedem Raum in ihrem Häuschen ist ein Muster gewidmet,<br />
das sich über Wände, Fenster und Möbel ausbreitet. „Flights of Fancy“ etwa<br />
sieht aus der Entfernung aus wie ein florales Motiv, bei näherer Betrachtung<br />
entlarvt es sich als ein Fest für exotische Tiere, die auf Schlingpflanzen sitzen<br />
und trinken, rauchen, musizieren – was man eben so machte im alten England.<br />
Die Formen sind eindeutig traditionell, die Farben und Muster heutig.<br />
Die neue Opulenz in der Inneneinrichtung hat auch mit der Krise von 2008<br />
zu tun: Wenn es auf den Märkten ungemütlich wird, tut zu Hause Rückbesinnung<br />
auf Bewährtes gut. Der Effekt, den auch Firmen nutzen: Uns hat es ewig<br />
gegeben, uns wird es auch noch ewig geben.<br />
Queen Bee Dressing Screen<br />
Dalston Rose High Tea Pot<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 103
| S T I L | K Ü C H E N K A B I N E T T<br />
„Lau“ ist das<br />
neue „heiß“<br />
Weniger Feuer, mehr Geschmack?<br />
Lauwarmes Essen gilt nicht mehr<br />
als Fauxpas<br />
VON JULIU S GRÜ TZKE U ND THOMAS P LATT<br />
N<br />
ICHT NUR POLITIKER verbrennen sich die Zunge – zumindest<br />
jedem Kind ist es schon einmal passiert, als es<br />
sich aus Ungeduld und Gier über eine verlockende Speise<br />
hergemacht hat, die gerade aus der Küche kam. Spätestens auf<br />
diese Weise haben wir alle gelernt, dass die Küche ein Gefahrenherd<br />
ist, von dem eine Faszination ausgeht. Die Verbindung von<br />
Feuer und Leidenschaft ist nicht nur ein poetischer Topos, sondern<br />
eine selbstverständliche Voraussetzung guten Speisens. Seit<br />
jeher assoziiert man die dampfenden Töpfe über dem domestizierten<br />
Feuer und die Gerüche, die von ihnen ausgehen, mit Geborgenheit<br />
und Genuss. Nicht zuletzt deshalb bildet die Küche in<br />
vielen Familien das Zentrum der Wohnung. Ein wenig von diesem<br />
heimatlichen Gefühl wollen auch manche Gourmetrestaurants<br />
wecken, wenn sie Küchenpartys veranstalten, bei denen die<br />
Gäste die Speisen am Ort ihrer Entstehung zu sich nehmen. Wer<br />
allerdings erwartet, dass es dort immer noch heiß hergeht, hat die<br />
Zeichen der jüngeren Zeit nicht erkannt. Kochend heiß wird in<br />
der Hochgastronomie kaum mehr etwas serviert. Was auch immer<br />
als Hauptgericht auf der Karte steht – eine Variation vom Lamm,<br />
eine Entenbrust oder eine Seezunge –, am Tisch erscheint es lauwarm.<br />
Dafür gibt es zunächst technische Gründe: Kleine Portionen<br />
kühlen naturgemäß rasch aus. Früher behalf man sich mit gewärmten<br />
Tellern und Cloches, metallenen Hauben, unter denen<br />
die Speisen an den Tisch gebracht und von einem Trupp Kellnern<br />
gleichzeitig fortgenommen wurden. Dieser Theatereffekt ist nach<br />
Personalkürzungen nicht mehr möglich. Weil bei den aus vielen<br />
Teilen bestehenden kulinarischen Kreationen einzelne Komponenten<br />
wie Estragoneis, Espuma von Parmesan oder Kalbskopfsülze<br />
keine Hitze vertragen, verbietet sich auch ein Vorwärmen<br />
des Porzellans. So ist die vormals oft gehörte Warnung des Kellners<br />
vor dem heißen Teller inzwischen eine Seltenheit.<br />
Auch bei Gerichten, die eigentlich nach Temperatur verlangen,<br />
ist die Hitze verloren gegangen. Die Brühe, die ja bereits im<br />
Namen quasi Blasen schlägt, kommt immer öfter lediglich zimmerwarm<br />
an den Platz, weil so der wertvolle Geschmack der Essenz<br />
besser gewürdigt werden kann.<br />
Selbst ein Instrument, das die Temperatur bewahren sollte, ist<br />
zum Werkzeug des Lauen geworden. Am sogenannten Pass – dem<br />
Ort der Übergabe der Teller von der Küche an das Servierpersonal<br />
– sind Wärmelampen installiert, um längere Aufenthaltszeiten<br />
zu überbrücken. Das nutzen die Köche, um ihre immer aufwendigeren<br />
Dekorationen anzubringen, und kalkulieren die Leistung<br />
der Infrarotstrahlung in die Garzeit ein. Damit schwindet die Bedeutung<br />
des Herdes als zentraler Ort der Zubereitung. Auch innerhalb<br />
der Küche verliert er immer mehr Aufgaben an Spezialgeräte<br />
wie Mixer mit Thermostat oder Wellenbäder, die vakuumiertes<br />
Fleisch im Sous-vide-Verfahren aufnehmen – all das natürlich bei<br />
Temperaturen weit unter dem Siedepunkt. Das Feuer spielt nurmehr<br />
auf Grillfesten eine Rolle.<br />
Man kann es als Abschied vom industriellen Zeitalter mit seinen<br />
Hochöfen und Stahlschmelzen deuten: Die Küche hört auf,<br />
eine Schmiede zu sein, und ähnelt heute eher den staubfreien Reinräumen<br />
der Chipfertigung. Viele mögen das Verschwinden des<br />
Handwerklichen und Bodenständigen bedauern und dem schweren<br />
Kochgeschirr hinterhertrauern, doch der sanftere Umgang mit<br />
den Lebensmitteln öffnet ein vollkommen neues Ausdrucksspektrum,<br />
ganz abgesehen davon, dass die Möglichkeiten des Misslingens<br />
im Niedertemperaturverfahren verringert werden. Natürlich<br />
gehen dabei Schlüsselreize verloren. Röstaromen zum Beispiel sind<br />
eigentlich ohne Feuer nicht zu haben. Aber dafür gibt es Techniken<br />
– der Geschmack von Rauch und Asche, der momentan en<br />
vogue ist, wird häufig nachträglich beigefügt. Und auch die heimelige<br />
Hitze, die so viele Kindheitserinnerungen weckt, lässt sich<br />
chemisch substituieren – mit der Schärfe von Chili kann man sich<br />
auch weiterhin den Mund verbrennen.<br />
JULIU S GRÜ TZKE und THOMAS P LATT<br />
sind Autoren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in Berlin<br />
ILLUSTRATION: THOMAS KUHLENBECK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS; FOTO: ANTJE BERGHÄUSER<br />
104 <strong>Cicero</strong> 4.2013
SCHÄFCHEN ZÄHLEN<br />
FÜR MÄNNER:<br />
LINKE KEULE,<br />
RECHTE KEULE,<br />
HAXEN, KRONE,<br />
RIPPEN, SCHULTER ...<br />
KÖSTLICHE LAMMREZEPTE. AB SEITE 36.<br />
MÄNNER KOCHEN ANDERS
| S A L O N<br />
DER DRACHENTÖTER<br />
Sylvester Groth ist unter den Schauspielern der bekannteste Unbekannte. Nun spielt er in einem RAF-Film<br />
V ON INGO LANGNER<br />
S<br />
EIN GRÖSSTER WUNSCH blieb unerfüllt:<br />
Sylvester Groth würde gerne<br />
in einem Stummfilm mitspielen.<br />
Er liebt das Genre wie kein zweites. Hat<br />
er am Ende vergebens vorgesprochen für<br />
„The Artist“, das sensationell erfolgreiche<br />
Leinwandereignis des französischen Regisseurs<br />
Michel Hazanavicius vom Aufstieg<br />
und Fall zweier Hollywoodstars um 1930?<br />
Groth kennt die zwischen Zweifel und<br />
Übermut changierende Atmosphäre eines<br />
Castings genau. Er war Theodor Storms<br />
„Schimmelreiter“, ist Dauergast im „Tatort“,<br />
lag für Joseph Vilsmaier vor „Stalingrad“<br />
und gab als Aufklärer Oswalt Kolle sein<br />
„Leben für Liebe und Sex“. Er spielte neben<br />
Henry Hübchen den überforderten Regisseur<br />
Telleck in Andreas Dresens wunderbarer<br />
Komödie „Whisky mit Wodka“ und<br />
stellte gleich zweimal Hitlers Propagandaminister<br />
Joseph Goebbels dar. Erst 2007<br />
an der Seite Helge Schneiders, ehe er zwei<br />
Jahre später in Quentin Tarantinos „Inglourious<br />
Basterds“ zu einer international<br />
beachteten Schauspielergröße wurde. Doch<br />
weil er am Talkshowgetingel nicht interessiert<br />
ist, blieb Sylvester Groth hierzulande<br />
einer der bekanntesten Unbekannten.<br />
Die Geschichte aber vom gescheiterten<br />
Casting für „The Artist“ gibt es nicht.<br />
„Das ist doch kein Stummfilm!“, faucht er<br />
geradezu. „Da ist bloß die Tonspur rausgefallen.<br />
Der zum ewigen Grinsen verurteilte<br />
Hauptdarsteller ist eine einzige Katastrophe!“<br />
Groth meint Jean Dujardin, der<br />
für seine Rolle in „The Artist“ den Oscar<br />
für die beste männliche Hauptrolle bekam.<br />
Groth begeistert sich hingegen für<br />
F. W. Mur naus Stummfilm „Der letzte<br />
Mann“ von 1924 mit Emil Jannings als altgedientem<br />
Hotelportier, „ein Geniestreich“.<br />
Die Geschichte werde „fast ohne Zwischentitel<br />
ganz allein aus den Schauspielern erzählt.<br />
Ihre Gesichter und Gesten ersetzen<br />
das gesprochene Wort. Zu dieser Konzentration<br />
auf den Darsteller müssten wir in<br />
Deutschland wieder kommen. Wir Schauspieler<br />
wollen nicht bloß zu Handlangern<br />
einer im Übrigen leider oft sehr klapprigen<br />
Dramaturgie degradiert werden.“<br />
Die harsche Kritik an „The Artist“ deutet<br />
an, dass Sylvester Groth vielleicht nicht<br />
von ungefähr daheim eine Ikone des drachentötenden<br />
Sankt Georg in Ehren hält.<br />
Das Fabeltier schmückt auch das Stadtwappen<br />
des sachsen-anhaltinischen Dörfchens<br />
Jerichow, wo Groth am 31. März 1958 das<br />
Licht einer Welt erblickt, die damals noch<br />
in zwei weltanschaulich konkurrierende<br />
Blöcke geteilt war.<br />
Als Bürger im realsozialistischen Teil<br />
Deutschlands darf Groth erst über den<br />
Umweg einer Elektrikerlehre die Staatliche<br />
Schauspielschule Berlin absolvieren.<br />
Reüssiert dann aber rasant, spielt viel und<br />
groß in Dresden und am Berliner Deutschen<br />
Theater. Er wird 1982 von Frank<br />
Beyer entdeckt, der ihm die Hauptrolle<br />
in seinem Film „Der Aufenthalt“ anvertraut.<br />
Dadurch wird er auch für bundesdeutsche<br />
Regisseure so interessant, dass Johannes<br />
Schaaf ihn 1984 für seinen „Nathan<br />
der Weise“ bei den Salzburger Festspielen<br />
als „jungen Tempelherrn“ möchte.<br />
Brav kehrt Sylvester Groth danach in<br />
die Heimat zurück. Als er bei der Wiederaufnahme<br />
des „Nathan“ 1985 merkt, dass<br />
ihm die Stasi niemals erlauben wird, eine<br />
von Schaaf neu angebotene Rolle im Kinderfilm<br />
„Momo“ anzunehmen, entschließt<br />
sich Groth, im Westen zu bleiben. Er wird<br />
bei diesem gewagten Schritt vom „Momo“-<br />
Produzenten Horst Wendlandt mit einer,<br />
so Groth, „Mordsgage“ bezahlt, die ihm<br />
den ersten Schritt ins Offene erleichtert.<br />
Seine Theaterregisseure heißen nun Peter<br />
Stein, Luc Bondy, Klaus Michael Grüber,<br />
Peter Zadek, Claus Peymann, Robert<br />
Wilson und Frank Castorf. Im Januar<br />
2010 wird er für seine „Outstanding Performance“<br />
in „Inglourious Basterds“ von<br />
der Screen Actors Guild ausgezeichnet.<br />
Von Tarantino schwärmt er: „Der arbeitet<br />
schon beim Casting richtig mit dir. Beim<br />
Dreh animiert er dich wahnsinnig. Da geht<br />
es allein ums Künstlerische und um nichts<br />
anderes. Das ist die Differenz zu Deutschland.<br />
Tarantino ist gleichzeitig ganz naiv<br />
und hochgebildet. Er will immer das Beste.<br />
Und treibt alles auf die Spitze.“<br />
Keineswegs nebenbei hat sich Groth<br />
eine Karriere als Sprecher für Hörspiele<br />
und Hörbücher aufgebaut. Die Arbeit am<br />
Mikrofon liegt ihm am Herzen. Bei großen<br />
Einsätzen zieht er ein Kostüm an. Für seine<br />
Rolle als Kara Ben Nemsi in Karl Mays gesamtem<br />
Orientzyklus hat er sich wüstengerecht<br />
eingekleidet. „Ich wusste, da muss<br />
ich vier Wochen Studioarbeit durchhalten.<br />
Das Kostüm hat mir dabei sehr geholfen.“<br />
Für die 1486 Minuten lange Neuübersetzung<br />
von Fjodor M. Dostojewskis „Verbrechen<br />
und Strafe“ hat Groth sich ein Raskolnikow-Outfit<br />
schneidern lassen. Mit<br />
Hose, Stiefel, Mantel, Mütze verwandelte<br />
er sich vor dem Mikrofon in einen Russen –<br />
Metamorphose ist ihm alles.<br />
Darum ist es nur auf den ersten Blick<br />
verwunderlich, mit welcher Freude am heiteren<br />
Zynismus er den geläuterten RAF-<br />
Sympathisanten Henner in „Das Wochenende“<br />
gibt. In der Verfilmung des Romans<br />
von Bernhard Schlink ist Groth der dem<br />
Leben zugewandte Konterpart zum verbitterten<br />
Überzeugungstäter Jens (Sebastian<br />
Koch). „Du bist Pop“, sagt er einmal zu diesem,<br />
und in seiner angerauten Stimme, seinem<br />
forcierten Bubenblick und der schlaksigen<br />
Körperrede schwingt mit, was ihn über<br />
die vielen Rollenwechsel hinaus kennzeichnet:<br />
die Freude am Spiel, das nicht Routine,<br />
nicht Kalkül werden darf.<br />
INGO L ANGNER<br />
ist Filmemacher, Autor<br />
und Publizist<br />
FOTOS: MATHIAS BOTHOR/PHOTOSELECTION, CHRISTOPH LERCH (AUTOR)<br />
106 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Wir Schauspieler<br />
wollen nicht bloß<br />
Handlanger sein“<br />
Sylvester Groth<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 107
| S A L O N<br />
JEDER WILL WAS<br />
Lisa Kränzler schreibt und malt nach dem Lustprinzip. Ein Atelierbesuch zwischen Bahngleisen<br />
V ON O LIV E R JUNGEN<br />
A<br />
UF DEM BODEN liegt ein bunt geflecktes<br />
Papier, sechs Quadratmeter<br />
groß, ein gutes Drittel des Ateliers<br />
beanspruchend. Der Banause könnte<br />
eine Unterlage aus einer Autolackiererei<br />
vermuten. Und die Urheberin würde das<br />
vielleicht nicht einmal übel nehmen, denn<br />
nichts läge Lisa Kränzler ferner als die auratische<br />
Überhöhung des einzelnen Bildes. Es<br />
komme auf den Prozess an, sagt sie, auf das<br />
Fühlen und Arbeiten, die Komponenten<br />
seien austauschbar. Eine Fabrik nennt sie<br />
ihr Atelier. Sechs Tage die Woche von 9 bis<br />
18 Uhr verschwindet sie in dem von Künstlern<br />
und Autonomen besiedelten Gebäude<br />
zwischen den Freiburger Bahngleisen und<br />
möchte nicht gestört werden, nicht einmal<br />
vom Postboten, der auf sensible Künstlerseelen<br />
freilich keine Rücksicht nimmt.<br />
Überhaupt: diese vermaledeite Außenwelt.<br />
Dringe in alles ein. „Ich kann Menschen<br />
einfach nicht leiden. Jeder will was.<br />
Stets hofft man, es könnte etwas passieren,<br />
eine Lebendigkeit entstehen. Aber es läuft<br />
immer auf Enttäuschung hinaus. Oder?“<br />
Die lächelnd angehängte Frage wirft den<br />
misanthropischen Gestus über den Haufen.<br />
Das ist nicht nur kokett, sondern charmant<br />
frech, schließlich ist man gerade samt Fotograf<br />
und einem Haufen idiotischer Journalistenfragen<br />
in ihr Atelier eingedrungen.<br />
Sofort wird klar: Lisa Kränzler, geboren<br />
1983 in Ravensburg, gehört zu den Komplizierten.<br />
Zu schlau, zu schnell, zu uneitel<br />
für das abgeklärte Frage-Antwort-Spiel.<br />
Sie ist diejenige, auf die man zwischen all<br />
den Künstler-Darstellern zu treffen hofft.<br />
Fragen nach dem autobiografischen<br />
Gehalt ihrer Werke liegen so nahe, wie sie<br />
überflüssig sind: „Woran sind nicht die Eltern<br />
schuld? Die vergiften alles.“ Privates<br />
gibt Lisa Kränzler nicht preis. Bis vor einem<br />
Jahr kannte man sie nur im Umfeld<br />
der Staatlichen Akademie der Bildenden<br />
Künste Karlsruhe, wo sie von 2005 an Malerei<br />
studierte und 2010 ihren Abschluss<br />
machte. Im anschließenden Meisterschülerjahr<br />
schrieb sie den Debütroman „Export<br />
A“, in dem eine Sechzehnjährige<br />
während des Austauschjahrs in Kanada verzweifelt<br />
nach dem Leben greift, das ihr immer<br />
mehr entgleitet. Selten wohl wurde ein<br />
Coming-of-Age-Roman mit Erbsünden-<br />
Verdammnis kurzgeschlossen. Der Mord<br />
am Ende mochte grell anmuten, aber der<br />
Stil ließ aufhorchen: sprachmächtig, authentisch,<br />
souverän. Hier spielte jemand<br />
mit Klischees pubertärer Radikalität, ohne<br />
auf sie hereinzufallen.<br />
Es folgte soeben der Roman „Nachhinein“<br />
über das Scheitern der Freundschaft<br />
zweier ungleicher „Blutsschwestern“, missbraucht<br />
und arm die eine, reich und überheblich<br />
die andere. Wieder geht es um<br />
Isolation und um die Einsicht, dass nicht<br />
einmal die Sexualität ihr Vereinigungsversprechen<br />
hält. Grausamkeit aus Selbstsucht<br />
ist das Leitmotiv. Das sei nicht pessimistisch,<br />
sondern realistisch: „Das, was man<br />
am meisten hasst oder liebt oder fürchtet,<br />
damit bleibt man immer allein. Eigentlich<br />
kann man nicht kommunizieren.“ Für einen<br />
Auszug aus „Nachhinein“ erhielt Lisa<br />
Kränzler den 3sat-Preis beim Klagenfurter<br />
Bachmann-Wettbewerb. Der Roman selbst<br />
wurde für den bedeutenden Preis der Leipziger<br />
Buchmesse nominiert.<br />
Damit ist Lisa Kränzler in Rekordzeit<br />
im Literaturbetrieb angekommen, zu<br />
Recht, denn eine ganz eigene Stimme verschafft<br />
sich hier Gehör. Ihre präzisen Visualisierungen<br />
faszinieren, obwohl darin<br />
oft eisige Kälte herrscht: „Fahles Licht sickert<br />
ins Zimmer, mischt sich wie Deckweiß<br />
in Möbel-, Boden- und Wandfarbe,<br />
hellt auf und kühlt ab. Bläuliche Schatten<br />
erinnern an bibbernde Lippen.“ Dass<br />
sich diese „Kopfbilder“ mitunter zu Gebirgen<br />
auftürmen, ist der Autorin natürlich<br />
nicht entgangen. Sie kehrt die Kritik<br />
um: „Und wenn es noch viel mehr wären?<br />
Der Plot ginge verloren. Ich stelle mir das<br />
ähnlich vor wie den Übergang zur abstrakten<br />
Malerei.“<br />
Im Atelier sieht man, wie eng Schreiben<br />
und Malen für Lisa Kränzler zusammenhängen.<br />
Unvermischt treffen etwa auf<br />
dem bunt gefleckten Bild Industrielacke<br />
aufeinander, bilden scharfe Kanten aus.<br />
Unheimliche Lust bereite es ihr, das Gelb<br />
hart auf das Rot treffen zu sehen: „Jede<br />
der Farben behauptet sich, beides ist ganz<br />
da, kein Wischiwaschi. Man kann auch ein<br />
braunes Ölbild malen, aber dazu habe ich<br />
gar keine Lust.“ Das ist die beste Kurzfassung<br />
ihrer Kontrast-Poetologie.<br />
Dann gibt es die wild mit Textmarker<br />
und Strichen bearbeiteten Din-A4-Seiten,<br />
den Anfang von Wittgensteins „Tractatus“<br />
etwa. Getippt sind diese „Kunsttexte“ – wie<br />
die Romane – auf der mitten im Gerümpel<br />
thronenden „Brother AX 110“. Lisa Kränzler<br />
schwört auf das Reale des Schreibmaschinenanschlags<br />
gegenüber dem digital<br />
Imaginären. Überhaupt ist sie eine Apologetin<br />
der Körperlichkeit. Sie unterläuft<br />
das Berechenbare der „erschreckend wenig<br />
subversiven Gegenwartskunst“ mit<br />
dem Lustprinzip.<br />
Sie habe, erzählt sie, einmal eine Riesenschreibmaschine<br />
konstruieren wollen,<br />
bei der man von Taste zu Taste springt. Mit<br />
genau diesem körperlichen Elan schreibt<br />
sie Romane. Das nächste Manuskript –<br />
wieder in Mädchenperspektive – ist abgeschlossen.<br />
Für den folgenden Satz würde<br />
der Banause natürlich hochkant aus dem<br />
Atelier fliegen: Alles Bildkünstlerische von<br />
Wittgenstein bis Industrielack war bei ihr<br />
vielleicht nur Vorbereitung und findet eine<br />
Vollendung in der Literatur. Es ist der eine<br />
Schritt von der Fabrik ins Offene.<br />
OLIV E R JUNGEN<br />
ist freier Autor und<br />
Literaturkritiker<br />
FOTOS: BASILE BORNAND FÜR CICERO, PRIVAT (AUTOR)<br />
108 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Ich kann<br />
Menschen<br />
einfach nicht<br />
leiden. Es<br />
läuft doch<br />
immer<br />
auf eine<br />
Enttäuschung<br />
hinaus“<br />
Lisa Kränzler<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 109
| S A L O N<br />
EIN STÖRENFRIED<br />
Als Chef der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist Peter Strohschneider Herr über Milliarden Euro<br />
V ON A LEXANDER GRAU<br />
E<br />
RKENNTNIS SEI NICHTS ANDERES<br />
als „die Störung der gegebenen<br />
Ordnungen des Wissens“. Der hier<br />
so barrikadenstürmerisch spricht, ist kein<br />
Anarchist, sondern seit Beginn des Jahres<br />
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
und damit Herr über knapp<br />
2,7 Milliarden Euro, die Bund und Länder<br />
jährlich in den Haushalt der größten<br />
deutschen Organisation zur Forschungsförderung<br />
einzahlen. Peter Strohschneider,<br />
Professor für Germanistik des Mittelalters,<br />
hat als Forscher selbst dazu beigetragen,<br />
Ordnungen des Wissens zu stören. Nun<br />
ist er Präsident einer Organisation, deren<br />
Aufgabe es ist, diese Störungen möglichst<br />
effektiv zu organisieren.<br />
Die Mittel dazu sind beachtlich:<br />
Anno 2011 förderte die DFG insgesamt<br />
32 584 Forschungsvorhaben, davon<br />
15 301 Einzelprojekte, die sich allein auf<br />
eine Summe von 954,9 Millionen Euro<br />
summierten. Im selben Jahr finanzierte die<br />
DFG 259 sogenannte Sonderforschungsbereiche,<br />
in denen etwa 6000 Wissenschaftler<br />
und Wissenschaftlerinnen arbeiten.<br />
Hinzu kommen die verschiedenen<br />
Forschungsprogramme, die Forschungszentren<br />
und 43 Exzellenzcluster im Rahmen<br />
der Exzellenzinitiative. Das Verstörungspotenzial,<br />
das in diesen Zahlen<br />
schlummert, ist erheblich.<br />
Strohschneider sitzt entspannt, die<br />
Beine übereinandergeschlagen, in seinem<br />
ehemaligen Büro in der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.<br />
Mit seiner<br />
Krawatte, die unter einem V-Ausschnitt<br />
hervorlugt, dem Tweed-Jackett und der<br />
Hornbrille würde er wesentlich besser in<br />
die neugotische Kulisse eines Colleges in<br />
Cambridge oder Oxford passen als in die<br />
Trostlosigkeit eines bundesrepublikanischen<br />
Nutzbaus. Seinen Kopf in die linke Hand<br />
gestützt, fasst er seine Überlegungen zusammen:<br />
„Wissenschaft ist systematisch darauf<br />
angelegt, sich selbst zu überholen.“<br />
Als der heutige DFG-Präsident 1975<br />
sein Studium in München aufnahm,<br />
konnte er sich auch eine Tätigkeit im<br />
Kulturmanagement vorstellen. Zu diesem<br />
Zweck begann er ein Doppelstudium,<br />
Germanistik und Rechtswissenschaften.<br />
Mit den Juristen habe er jedoch soziokulturell<br />
gefremdelt. „Da drüben“, seine<br />
rechte Hand deutet in Richtung der juristischen<br />
Fakultät, „waren die Leute mit<br />
den hirschbraunen Aufschlägen am Revers<br />
und den farbigen Bändchen, und hier waren<br />
die Leute, die hatten lange Haare wie<br />
ich und Jeans an.“<br />
So blieb die Germanistik übrig. Dass<br />
er Mediävist wurde, verdankt sich eher<br />
dem Zufall – ebenso wie das Engagement<br />
in der Wissenschaftspolitik: „Meinen ersten<br />
Lehrstuhl hatte ich 1992 in Dresden,<br />
da musste alles von Beginn an aufgebaut<br />
werden. Da gab es keine für die Literaturwissenschaft<br />
geeignete Bibliothek, keine<br />
Studienordnung, kein Hochschulgesetz.<br />
Es gab auch kein Telefon – dafür aber die<br />
Reste einer Abhöranlage.“ Aus dieser Situation<br />
heraus begann Strohschneider Hochschulpolitik<br />
zu machen, zunächst in seiner<br />
Hochschule, dann auf Landesebene. Strohschneider<br />
war als Kuratoriumsvorsitzender<br />
maßgeblich am Neubau der allein architektonisch<br />
sensationellen Sächsischen Landesbibliothek<br />
beteiligt.<br />
Der neue DFG-Präsident hält es für<br />
einen Irrtum zu meinen, ein erfolgreicher<br />
Wissenschaftsmanager könne als Manager<br />
in der Wirtschaft arbeiten. „Im Wissenschaftssystem“,<br />
sagt Strohschneider, „müssen<br />
die Strukturen so gebaut sein, dass der<br />
produktive Irrtum kein Fehler ist, dass es<br />
nicht nur die Beschleunigung von Erkenntnissuche<br />
gibt, sondern auch analytische Abstandnahme,<br />
Momente der Muße und Versenkung.“<br />
In solchen Momenten begreift<br />
man, dass es gerade die Überkomplexität<br />
des Wissenschaftssystems ist, die Strohschneider<br />
reizt und die ihn zugleich mit<br />
Vorsicht in die Zukunft schauen lässt: „Ich<br />
bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht<br />
in einer Phase sind, in der sich das, was wir<br />
seit 200 Jahren als moderne Wissenschaft<br />
definieren – also eine disziplinär verfasste,<br />
methodisch organisierte Form der Welterkenntnis<br />
– in einen offenen Horizont hinein<br />
transformiert, den ich nicht kenne.“ Je<br />
mehr die Wissenschaft zu einer Sache des<br />
Alltags werde und je mehr sich moderne<br />
Gesellschaften in Wissenschaftsgesellschaften<br />
verwandelten, desto schwieriger werde<br />
es, Wissenschaft überhaupt von Nichtwissenschaft<br />
und Wissenschaft von Pseudowissenschaft<br />
zu unterscheiden.<br />
„Als Mediävist“, ergänzt Strohschneider,<br />
„beobachte ich ja Formen der Rationalität<br />
in ihrer historischen Kontingenz.“ Allerdings<br />
sei dieses historische Bewusstsein<br />
selbst ein historisches Phänomen. „Nicht<br />
auszuschließen, dass es in 50 Jahren dieses<br />
historische Bewusstsein gar nicht mehr<br />
gibt, oder nur noch in irgendwelchen alteuropäischen<br />
Restbeständen.“<br />
Strohschneider strahlt kühle Vernünftigkeit<br />
aus. Darum klingen solche Sätze<br />
beinahe bedrohlich. Stehen wir am Ende<br />
vor einer Epoche der Gegenaufklärung, in<br />
der eine geschichtslos gewordene Vernunft<br />
nur noch zur Beschäftigung mit den Erfordernissen<br />
der jeweiligen Gegenwart taugen<br />
wird? Droht etwa ein neuer Irrationalismus?<br />
Wie mag die Universität in 50 Jahren<br />
aussehen? Strohschneider meidet die<br />
Prophetie: „Ich kann nur sagen, was ich<br />
mir als Universität wünsche: einen freien<br />
Raum der leidenschaftlichen Welterkenntnis.“<br />
Seine Stimme klingt dabei sehr viel<br />
nüchterner und leiser, als es seine Worte<br />
vermuten lassen.<br />
ALEXANDER GRAU<br />
ist Kultur- und<br />
Wissenschaftsjournalist<br />
FOTOS: MARCUS GLOGER FÜR CICERO, PRIVAT (AUTOR)<br />
110 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„Wissenschaft<br />
braucht auch<br />
Muße und<br />
Versenkung“<br />
Peter Strohschneider<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 111
| S A L O N | F R A N K R E I C H S N E U E D E N K E R<br />
SPALTE DAS HOLZ,<br />
LIEBE DAS LEBEN<br />
Im deutsch-französischen Jahr 2013 bildet sich bei unseren Nachbarn ein neuer Typus<br />
des Intellektuellen heraus: reisefreudig, wendig, radikal. Die Denkerstube hat ausgedient<br />
V ON A LEXANDER P SCHER A<br />
112 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Der Philosoph<br />
Sylvain Tesson<br />
umrundete<br />
die Welt auf<br />
einem Fahrrad.<br />
Nun lebte er<br />
ein halbes Jahr<br />
am Baikalsee<br />
FOTO: THOMAS GOISQUE<br />
W<br />
ENN FRANKREICH sich heute<br />
auf das Jahr 410 besinnt,<br />
dann verheißt das nichts<br />
Gutes. Denn 410 ist eine<br />
symbolische Zahl, eine Zahl<br />
der Dekadenz. Damals ging die abendländische<br />
Kultur zum ersten Mal unter. Im<br />
Jahr 410 wurde Rom von Alarichs Westgoten<br />
überrannt. 1602 Jahre später, im<br />
Herbst 2012, erhält ein schmaler Roman,<br />
der exakt diesen Untergang in die europäische<br />
Gegenwart überträgt, den begehrten<br />
Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis<br />
Frankreichs. Ist das ein Symbol? Sieht<br />
man linksrheinisch eine neue Apokalypse<br />
am Horizont?<br />
„Le sermon sur la chute de Rome“, die<br />
„Predigt auf den Untergang Roms“, soeben<br />
auf Deutsch im Züricher Verlag Secession<br />
erschienen, ist das sechste Werk des 1968<br />
geborenen Philosophielehrers Jérôme Ferrari.<br />
Er war bis dato nur Eingeweihten bekannt.<br />
Sein schmaler Roman ist kein süffiges<br />
Historienfresko, eher ein metaphernreicher<br />
Textwurm voller Anspielungen auf die neuere<br />
Geschichte des Landes. Ferraris Rom<br />
liegt auf dem heutigen Korsika. Die schlimmen<br />
Vandalen tragen dort Goldkettchen<br />
ums Handgelenk, haben tätowierte Oberarme,<br />
fahren fette Pick-ups und trinken<br />
viel zu viel Pastis. Dem korsischen Prekariat<br />
stellt der Autor zwei Philosophiestudenten<br />
gegenüber, die für sich beschließen, nun<br />
genug gedacht zu haben. Sie haben genug<br />
von den Pariser Intellektuellen, von abgehobenen<br />
Theorien über die Liebe und von endlosen<br />
Diskussionen über die beste aller möglichen<br />
Welten. Sie wollen die Dinge nicht<br />
nur denken, sondern tun. Sie wollen dem<br />
Leben die Hand schütteln und der Liebe in<br />
die Augen schauen.<br />
Also übernehmen die beiden eine heruntergewirtschaftete<br />
Kneipe in einem korsischen<br />
Bergdorf. Das, merken sie bald, ist<br />
keine gute Idee. Im Nirgendwo bröckelt<br />
die Zivilisation. Hier beginnt die décadence.<br />
Das Erste, was die beiden lernen,<br />
ist, wie man Jungschweine bei lebendigem<br />
Leib kastriert, wie man Hoden am Lagerfeuer<br />
grillt und sie genüsslich verspeist.<br />
Die zweite Lektion ist auch nicht viel angenehmer:<br />
Trage immer eine großkalibrige<br />
Schusswaffe im Gürtel.<br />
Die Bar wird zum Mittelpunkt des<br />
Dorfes und der Region. Neues Leben beginnt.<br />
Es brodelt und kocht in der korsischen<br />
Hitze. Schon bald brechen alte<br />
Konflikte auf: Es geht um weibliche Körper,<br />
um männliche Hormone, um die französische<br />
Kolonialgeschichte, den Algerienkrieg,<br />
die Résistance, sogar um den Ersten<br />
Weltkrieg. Die Weltgeschichte ergießt sich<br />
über den Tresen wie eine umgekippte Flasche<br />
Anis-Schnaps.<br />
Ferrari hat nicht umsonst Philosophie<br />
studiert. Seine Schilderung einer heutigen<br />
Zeitenwende greift auf große philosophische<br />
Ideen zurück. Er schreibt sich in den<br />
Untergang des französischen Abendlands<br />
auf einem prominenten Umweg ein: über<br />
Augustinus. Dieser war im bösen Jahr 410<br />
Bischof von Hippo im heutigen Algerien.<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 113
| S A L O N | F R A N K R E I C H S N E U E D E N K E R<br />
Aus dieser Zeit sind Tausende von Predigten<br />
erhalten. Und eben auch eine vom<br />
Dezember 410, in der er seine Gemeinde<br />
angesichts der gotischen Katastrophe im<br />
fernen Rom an die Zeitlichkeit des Irdischen<br />
gemahnt.<br />
Ferrari benutzt den augustinischen<br />
Subtext geschickt, um vom Untergang der<br />
großen und der kleinen Welt heute zu erzählen.<br />
Den sechs ersten Kapiteln stellt er<br />
Zitate aus der Untergangspredigt des Kirchenvaters<br />
voran. Im siebten und letzten<br />
Kapitel gipfelt das Buch in einer epischen<br />
Vergegenwärtigung der augustinischen Predigt<br />
über den Untergang Roms und verdichtet<br />
sich schließlich in dem Moment,<br />
als Augustinus von der Welt Abschied<br />
nimmt, ohne das Rätsel des Lebens, jenes<br />
undurchdringliche Mysterium, gelöst<br />
zu haben.<br />
„Die Welten“, schreibt Ferrari, „vergehen<br />
in Wahrheit eine nach der anderen,<br />
von Finsternis zu Finsternis, und gut<br />
möglich, dass ihre Abfolge nichts bedeutet.<br />
Diese unerträgliche Hypothese brennt<br />
Augustinus in der Seele, und er stößt, Ruhender<br />
im Kreis seiner Brüder, einen Seufzer<br />
aus, und er strengt sich an, zum Herrn<br />
zu blicken, sieht aber nur das merkwürdig<br />
tränenfeuchte Lächeln, das ihm einst<br />
die Arglosigkeit einer unbekannten jungen<br />
Frau geschenkt hatte, um vor ihm das Ende<br />
„Die Welten vergehen in<br />
Wahrheit eine nach der<br />
anderen, und gut möglich, dass<br />
ihre Abfolge nichts bedeutet“<br />
Der Philosophielehrer Jérôme Ferrari gewann den wichtigsten<br />
Literaturpreis Frankreichs – mit einer lakonischen Parabel<br />
auf die Zivilisationsmüdigkeit des 21. Jahrhunderts<br />
zu bezeugen, und zugleich die Ursprünge,<br />
denn dies ist eine einzige und sich gleichbleibende<br />
Bezeugung.“<br />
Ferraris Tonfall ist elegisch-distanziert.<br />
Wie Augustinus damals über das ferne<br />
Rom, so predigt Ferrari, der auf Korsika,<br />
in Algerien und zurzeit in den Arabischen<br />
Emiraten unterrichtet, aus räumlicher Distanz<br />
über den kulturellen Untergang seiner<br />
eigenen Grande Nation: über ihre<br />
Zivilisationsmüdigkeit, ihren Verlust an<br />
Orientierung, ihre Verrohung, über die<br />
Vergänglichkeit der großen französischen<br />
Leitmotive – das Glück, die Liebe und das<br />
Leben. Ferarris Text bezieht politisch keine<br />
Position. Fingerzeige auf reale gesellschaftliche<br />
Konflikte wie Immigration und Islamismus<br />
sucht man vergebens. Wer die modernen<br />
Goten wirklich sind, die Frankreich<br />
belagern, das verschweigt der Autor.<br />
Beim Globetrotter-Philosophen Sylvain<br />
Tesson, der den zweitwichtigsten Literaturpreis<br />
Frankreichs gewann, den Prix<br />
Medicis, schaut das ganz anders aus. Hier<br />
herrscht Klartext. Tesson, enfant terrible<br />
der französischen Reiseschriftsteller, ist<br />
der Sohn eines der bekanntesten Pariser<br />
Journalisten. Sein Vater Philippe gründete<br />
1974 den Quotidien de Paris und war bald<br />
der Nestor der französischen Theaterkritik.<br />
Dem Sohn wurde das Pariser Intellektuellenmilieu<br />
zu eng. Nach dem Besuch einer<br />
Privatschule umrundete er mit dem Fahrrad<br />
die Welt, marschierte 5000 Kilometer<br />
durch das Himalaya-Massiv und wenig<br />
später noch mal so viel durch die zentralasiatische<br />
Steppe. Seitdem zieht er schreibend,<br />
trinkend, lesend durch die Welt.<br />
Irgendwann schwor er sich, vor seinem<br />
40. Geburtstag als Einsiedler in Sibirien zu<br />
leben. So bezog er für sechs Monate die<br />
winzige Hütte eines Wetterbeobachters am<br />
Baikalsee, reichlich ausgerüstet mit Wodka,<br />
Zigarillos und einer Angel. Aus dem anachoretischen<br />
Selbstversuch ist ein zu Recht<br />
preisgekröntes Buch geworden: „Dans les<br />
Forêts de Sibérie“, „In den Wäldern Sibiriens“.<br />
Es soll auf Deutsch Anfang 2014 im<br />
Knaus-Verlag erscheinen.<br />
Sylvain Tesson ist der frierende Bruder<br />
Jérôme Ferraris. Sein Korsika liegt mitten<br />
in Sibirien. Dort, wo sich jeder leise Anflug<br />
von Kultur gegen die unerbittliche Macht<br />
des Wirklichen durchsetzen muss: „Nach<br />
der bitteren Kälte ruft das ‚Plopp‘ eines aus<br />
der Wodkaflasche springenden Korkens neben<br />
einem Ofen unendlich mehr Genuss<br />
FOTOS: JACQUES DEMARTHON/AFP/GETTY IMAGES, THOMAS GOISQUE<br />
114 <strong>Cicero</strong> 4.2013
„… das ‚Plopp‘<br />
eines aus der<br />
Wodkaflasche<br />
springenden<br />
Korkens neben<br />
dem Ofen ruft<br />
mehr Genuss<br />
hervor …“<br />
Zwischen Holz und Poesie, Lektüre und Eisloch:<br />
Sylvain Tesson erprobt die Alltagstauglichkeit<br />
von Literatur in der Wildnis<br />
XXXX<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 115
| S A L O N | F R A N K R E I C H S N E U E D E N K E R<br />
Hadjadj ist der Typus des<br />
nervösen Intellektuellen,<br />
der nah dran sein will am<br />
pulsierenden Leben<br />
Hochdekoriert: Der Publizist Fabrice Hadjadj, den der<br />
Philosoph Alain Finkielkraut fördert, verbindet in amüsanten<br />
Gedankenspielen Fußball, Gott und Monica Bellucci<br />
hervor als ein herrschaftlicher Tag in einem<br />
Palazzo am Canal Grande.“<br />
In einem solchen Moment verpuffen<br />
2000 Jahre abendländischer Kulturgeschichte<br />
im eisigen Nebel der Taiga. Solche<br />
Momente gibt es bei Tesson reichlich.<br />
Das ist keine intellektuelle Attitüde, kein<br />
Pariser Renegatentum. Tesson weiß, wovon<br />
er spricht. Er hat sich das alles nicht<br />
in einer Mansarde in Montmartre ausgedacht,<br />
sondern erlebt. Er beneidet sie wirklich,<br />
jene einfachen Russen, deren Blick auf<br />
die konkreten Dinge durch keine Lektüre,<br />
durch keine große Idee verstellt ist. Sechs<br />
Monate am Baikalsee werden so zu einer<br />
Zeitreise, an deren Ende die Erkenntnis<br />
steht, „dass das Leben nur das sein sollte:<br />
die Hommage des Erwachsenen an seine<br />
Kindheitsträume“. Wer wollte ihm da<br />
widersprechen?<br />
Tesson nimmt das wilde Denken, das in<br />
Frankreich seit Claude Lévi-Strauss Tradition<br />
hat, wörtlich. Er möchte wissen, was<br />
passiert, wenn ein Intellektueller, der zugleich<br />
die Statur und die Haartracht eines<br />
russischen Trappers hat, ein halbes Jahr im<br />
Niemandsland lebt und sich geistige Nahrung<br />
von jenen Autoren holt, die immer<br />
wieder den Rückzug in die Natur besungen<br />
haben. Er erprobt eine ganze Bibliothek, die<br />
er in einer Kiste in die Einöde geschleppt<br />
hat, an der harten sibirischen Wirklichkeit.<br />
Seine Frage lautet: Hält das Denken und<br />
Schreiben eines Rousseau, eines Diderot,<br />
eines Conrad, eines Jünger, eines Thoreau<br />
der Einsamkeit, arktischen Temperaturen<br />
von minus 40 Grad und teuflischen Mückenschwärmen<br />
stand? Oder zerbröselt es<br />
wie morsches Holz unter dem Fußabdruck<br />
der Wirklichkeit?<br />
Das ist die Versuchsanordnung. Ihr Ergebnis:<br />
Über die Einsamkeit des Waldgangs<br />
zu schreiben, ist eine Sache. Den Rückzug in<br />
den Wald zu leben, eine ganz andere. Welches<br />
Buch Tesson auch zur Hand nimmt<br />
(am Ende werden es 70 sein), seine Lektüreeindrücke<br />
werden von der Kraft der Natur<br />
sofort eingeholt und überlagert. Das Singen<br />
und Krachen der Eisplatten spaltet die<br />
subtilsten Gedanken. Ätherische Wolkenbilder<br />
dämpfen die schärfsten Antithesen ein.<br />
Die Poesie des Unterholzes überschreibt allen<br />
Sprachzauber. Zuletzt lacht eine leibhaftige<br />
Robbe, die ihr melancholisches Antlitz<br />
aus einem Eisloch steckt, über die ganze<br />
Eitelkeit der idealistischen Welt.<br />
In der Dreyfus-Affäre hat Frankreich –<br />
genauer: Georges Clemenceau – die Figur<br />
des „Intellektuellen“ erfunden, der gesellschaftliche<br />
Vorgänge analysiert und diskursiv<br />
beeinflusst. 100 Jahre haben Intellektuelle<br />
von Zola über Sartre bis Bernard-Henri<br />
Lévy die Wirklichkeit ihren Ideen untergeordnet<br />
und damit die französische Politik<br />
beeinflusst. Jetzt scheint es, als kehrten<br />
die ersten französischen Intellektuellen<br />
ins Leben zurück. Ferraris preisgekrönter<br />
korsischer Canto ist hierfür ebenso Signal<br />
wie Tessons sibirische Aphoristik. Wenn<br />
es bei Tessson am Ende heißt: „L’homme<br />
ne se refait pas“, „Der Mensch ändert sich<br />
nicht“, dann ist das französische Raisonnement<br />
tatsächlich wieder vor der Aufklärung<br />
angekommen.<br />
Der Publizist Fabrice Hadjadj, 41 Jahre<br />
alt, würde dieser Aussage widersprechen.<br />
Hadjadj bezeichnet sich als „Juden mit<br />
arabischem Namen und katholischer<br />
Konfession“. Früher kollaborierte er mit<br />
Houellebecq, schrieb nihilistische Traktate,<br />
verehrte Nietzsche. Dann erkrankte<br />
sein Vater, und Hadjadj hatte in der Pariser<br />
Kirche Saint-Séverin ein Bekehrungserlebnis.<br />
Er konvertierte zum Katholizismus.<br />
Heute arbeitet er als viel beachteter Publizist<br />
und Philosoph. Bekannt wurde er 2005<br />
mit einem preisgekrönten Langessay über<br />
FOTOS: ALAIN ELORZA/CIRIC, PRIVAT (AUTOR)<br />
116 <strong>Cicero</strong> 4.2013
die Kunst des Sterbens, „Réussir sa mort“.<br />
Hadjadj, zu dessen Förderern Alain Finkielkraut<br />
gehört, leitet seit 2012 das renommierte<br />
philosophische Institut Philanthropos<br />
im schweizerischen Fribourg.<br />
Hadjadj kehrt die Frage nach dem<br />
Verhältnis von Wirklichkeit und Idealismus<br />
um. Er betrachtet das Denken durch<br />
die Brille der Realität. Dabei kommt es zu<br />
überraschenden Gedankensprüngen. Die<br />
Wirklichkeit ist paradox. Hadjadj fragt:<br />
Wie muss eine Idee ausschauen, damit sie<br />
bis zur Realität durchdringen kann? Wie<br />
muss man argumentieren, damit man verstanden<br />
wird in einer oberflächlichen Welt?<br />
Diese Frage ist links- wie rechtsrheinisch<br />
aktuell. Daher ist Hadjadjs letztem<br />
Buch, dem amüsanten Essay „Comment<br />
parler de Dieu aujourd’hui?“, „Wie kann<br />
man heute über Gott reden?“, eine deutsche<br />
Übersetzung zu wünschen. Hadjadj<br />
findet eine Sprache, die dem Leben abgeschaut<br />
ist und die dennoch über dieses<br />
Leben hinausweist. Seine Rhetorik ist irgendwo<br />
zwischen den Absurditäten eines<br />
Groucho Marx und den präzisen Thesen<br />
eines Robert Spaemann verortet.<br />
Der schelmische Ansatz zeigt sich schon<br />
daran, dass Hadjadj seinem Buch den Untertitel<br />
„Anti-manuel d’évangélisation“,<br />
„Anti-Handbuch des Apostolats“ gibt.<br />
Hadjadj geht es nicht um Dogmen. Er<br />
wechselt permanent den Standpunkt, um<br />
das, was er über Gott, Glaube, Welt sagen<br />
will, straßentauglich zu machen. Er<br />
ist der Typus des nervösen Intellektuellen,<br />
der nah dran sein will am pulsierenden<br />
Leben. Man muss nicht Christ sein, um<br />
seine humorvollen Ausführungen mit Gewinn<br />
zu lesen.<br />
Realitätsgesättigt, wendig, konkret:<br />
Sieht so der intellektuelle Diskurs von morgen<br />
aus? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.<br />
Jedenfalls zeigt Hadjadj, wie man in einem<br />
Atemzug über den letzten Sieg von Real<br />
Madrid, die betörende Schönheit von Monica<br />
Bellucci und die Erhabenheit Gottes<br />
reden kann, ohne sich dabei lächerlich zu<br />
machen. Und das ist immerhin ein Etappensieg<br />
auf dem Weg der Intellektuellen<br />
zurück ins Leben.<br />
Anzeige<br />
Unser Wein des Monats<br />
Sauvignon Blanc Vin de Pays d‘ Oc, 2011<br />
Weißwein je Flasche für 6,50 EUR<br />
(zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 EUR)<br />
Dieser Weißwein präsentiert sich in heller Farbe mit grünlichen Reflexen. Er<br />
ist reich an Aromen von frisch geschnittenem Gras und reifer Stachelbeere,<br />
mit einer der Rebsorte eigenen intensiven Würznote. Der Wein wirkt sehr<br />
frisch und besitzt eine angenehm animierende Säure.<br />
Bestellnummer: 967226 (Einzelflasche); 967227 (Paket)<br />
Tipp: Bei einer Bestellung von elf Flaschen erhalten Sie zwölf.<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Online-Shop:<br />
www.cicero.de/wein<br />
ALEXANDER P SCHER A ist<br />
Übersetzer und Medientheoretiker.<br />
Zuletzt erschien „800 Millionen:<br />
Apologie der sozialen Medien“<br />
(Matthes & Seitz)
148 Seiten Inspiration. Jeden Monat neu!<br />
www.emotion.de<br />
Möchten Sie EMOTION kennenlernen?<br />
Dann bestellen Sie Ihr persönliches Probeabonnement unter www.emotion.de/probeabo
B E N O T E T | S A L O N |<br />
ILLUSTRATION: ANJA STIEHLER/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS<br />
Was heißt denn<br />
hier Klassik?<br />
Musik sprengt alle Schubladen und kommt<br />
doch nicht ohne diese aus<br />
VON D ANIEL H OPE<br />
E<br />
S WAR EINE DIESER VERANSTALTUNGEN, auf denen Plattenfirmen<br />
ihre Neuerscheinungen zu präsentieren pflegen.<br />
Kostproben aus der Musik, Künstlerinterview und Gespräch<br />
mit dem Publikum. Ins Liverpooler Planetarium waren<br />
überwiegend ältere Herrschaften gekommen. Deshalb fielen mir<br />
zwei Mädchen auf, die sich nach der Veranstaltung etwas abseits<br />
hielten und mich dabei anlächelten. Vielleicht hatten sie sich nur<br />
verlaufen, den Eindruck von eingefleischten Klassikliebhabern<br />
machten sie jedenfalls nicht. Damit, dass ich auf sie zuging, hatten<br />
sie anscheinend nicht gerechnet. Verlegenes Lächeln, sie wussten<br />
nicht recht, was sie sagen sollten. Dann machte eine doch<br />
den Anfang. Na ja, meinte sie, ich hätte ja ganz schön Dampf gemacht<br />
mit meiner Geige, und diese Klassik habe einen ordentlichen<br />
Drive, das müsse sie schon zugeben. Aber irgendwie nicht<br />
unsere Musik, sagte die andere. Im Grunde tote Hose, Musik von<br />
gestern, nicht der Sound von heute. Ich sei doch selber noch kein<br />
alter Mann, wieso ich mich trotzdem so viel mit alter Musik abgebe.<br />
Ob ich nicht viel lieber Aktuelles anstatt „Klassik“ spielen<br />
würde. Ob ich eigene Songs schreibe. Und ob ich vielleicht Lust<br />
auf einen Kaffee hätte. So kamen wir auf diesen seltsamen Ausdruck<br />
„klassische Musik“ zu sprechen.<br />
Während dieser durchaus charmanten Begegnung musste ich<br />
an ein anderes, ungewöhnliches Zusammentreffen denken. In<br />
Norddeutschland hatte ich das Violinkonzert von Mendelssohn<br />
gespielt. Hinterher stand ich ziemlich verschwitzt an einem Tisch<br />
im Foyer, um Autogramme zu schreiben. Da wollte ein junger<br />
Mann von mir wissen, ob das, was ich gerade gespielt hatte, überhaupt<br />
klassische Musik sei. Ich sah ihn fassungslos an. Etwas umständlich<br />
holte er aus. Zum bestandenen Abitur hätten ihm seine<br />
Eltern ein Klassikabonnement geschenkt, aber über die Programmauswahl<br />
sei er verwirrt. „Neben Sinfonien von Haydn, Mozart und<br />
Beethoven, bei denen es sich ja wohl eindeutig um Klassik handle,<br />
sind Stücke von Bach und Strawinski gespielt worden. Und heute<br />
Abend Mendelssohn, der doch schon zur Romantik gehört, soweit<br />
ich weiß“, sagte er. Jetzt verstand ich.<br />
Zum Zweck der besseren Übersichtlichkeit wird in Musikbüchern<br />
die viele Jahrhunderte lange Geschichte der Musik in<br />
verschiedene Epochen eingeteilt, vom Mittelalter bis in die Gegenwart.<br />
Je nachdem, wann die einzelnen Komponisten gelebt<br />
haben, werden sie einem dieser Zeitabschnitte zugeordnet. Bach<br />
also wandert in die Schublade mit der Aufschrift „Barock“, Mozart<br />
in die „Klassik“ und Mendelssohn in die „Romantik“. So<br />
kompetent diese Gliederung zweifellos auch sein mag, hat sie<br />
auch ihre Schwächen. Schließlich waren die Komponisten Individuen,<br />
jeder hatte neben den Gemeinsamkeiten auch seine<br />
persönlichen Eigenarten. War zum Beispiel Franz Schubert, der<br />
ein Jahr nach Beethoven gestorben ist, tatsächlich schon ein<br />
Romantiker oder doch noch ein Klassiker? Sieht man andererseits<br />
bei Beethoven nicht in vieler Hinsicht schon romantische<br />
Züge? Hört man dagegen bei Mendelssohn nicht oft eine sehr<br />
klassische Struktur?<br />
Zurück zu den jungen Damen in Liverpool, denen ich mühsam<br />
versuchte zu erklären, dass man erst die gesamte Musikvielfalt<br />
hören und erleben sollte, bevor man sie unter einem Begriff<br />
wie „Klassik“ ablehnt. Ich musste jedoch zugeben, dass ich es mir<br />
ebenfalls längst angewöhnt habe, einheitlich nur noch von „klassischer<br />
Musik“ zu sprechen. Korrekt ist es, streng genommen, nicht.<br />
Der Sammelbegriff, „Classical Music“, der anscheinend erstmals<br />
1863 im „Oxford Dictionary“ aufgetaucht ist und der sich längst<br />
überall auf der Welt eingebürgert hat, hängt vermutlich eher mit<br />
den großen Veränderungen in der Musikwelt Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
zusammen. Damals begann die Zeit der Unterhaltungsmusik<br />
und des Jazz, gegen die sich die Musik, die im Konzertsaal<br />
und in der Oper gespielt wurde, behaupten und abgrenzen<br />
musste. Der Strom der Musik hatte sich geteilt. Welche Namen<br />
sollte man den beiden Flussarmen geben? Wichtig wurde diese<br />
Frage vor allem für die gerade geborene Schallplattenindustrie, die<br />
ihrer Kundschaft die Orientierung und damit die Kaufentscheidung<br />
erleichtern wollte. Dass sie die Kreationen der leichten Muse<br />
unter der Rubrik „populäre Musik“ oder kurz „Popmusik“ laufen<br />
ließ, verstand sich angesichts des Millionenpublikums, das dafür<br />
empfänglich war, von selbst.<br />
Das interessierte die beiden Mädels in Liverpool allerdings<br />
herzlich wenig. Also gab ich mich geschlagen und ging mit ihnen<br />
doch lieber Kaffee trinken. Klassisch versteht sich …<br />
D ANIEL H OPE ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch<br />
„Toi, toi, toi! – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt)<br />
und die CD „Spheres“ (Deutsche Grammophon). Er lebt in Wien<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 119
| S A L O N | M A N S I E H T N U R , W A S M A N S U C H T<br />
Ein Judas, viele<br />
Opportunisten<br />
Das „Letzte Abendmahl“ aus dem<br />
Mailänder Dominikanerkloster<br />
verbindet nicht nur Leonardo da Vinci<br />
und Andy Warhol<br />
VON B EAT WYSS<br />
O<br />
S T E R N, ZEIT DER B ESINNU NG,<br />
wollen wir mit Andy Warhol<br />
beginnen. Dessen Idee, sich<br />
mit Leonardos „Letztem Abendmahl“<br />
auseinanderzusetzen, geht auf den Balletttänzer<br />
und Galeristen Alexandre Iolas<br />
zurück. Der Zeitpunkt war gut gewählt.<br />
Die Restaurierung des Wandbilds im Refektorium<br />
des Mailänder Dominikanerklosters<br />
Santa Maria delle Grazie währte<br />
damals – 1986 – schon acht Jahre und<br />
sollte noch fast doppelt so lange dauern:<br />
Zeit für etwas Publicity um ein bedrohtes<br />
Kunstdenkmal. 1969 hatte Ted<br />
Spiegel diesen matt kolorierten, prekären<br />
Schatten von Geniestreich im Auftrag<br />
von National Geographic fotografiert.<br />
Warhol schien die Aufnahme ungeeignet,<br />
da sie den ruinösen Zustand des Originals<br />
schonungslos dokumentierte. Er<br />
wählte für den Siebdruck einen anonymen<br />
Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert.<br />
Als Fest zur Überbrückung zwischen<br />
High und Low im Geist von Pop<br />
und Postmoderne wurde die Schau im<br />
Palazzo Stelline am 22. Januar 1987 eröffnet.<br />
Frucht der virtuellen Begegnung<br />
zwischen einer toten und einer lebenden<br />
Künstlerlegende bilden 100 Siebdrucke<br />
aus Warhols Factory nach Motiven von<br />
Leonardos Wandbild, die meisten heute<br />
in Privatbesitz.<br />
Es sollte Warhols letzter Auftritt sein.<br />
Einen Monat später starb der Künstler<br />
überraschend in New York. Das „Letzte<br />
Abendmahl“ sei das letzte Wort des Königs<br />
von Pop-Art, betont die Warhol-<br />
Hagiografie und versäumt nicht hervorzuheben,<br />
dass der Sohn polnischer<br />
Einwanderer als gläubiger Katholik gelebt<br />
habe. Auch Leonardo ist versöhnt mit<br />
Gott gestorben, nachdem er in der Osternacht<br />
1519 sein Testament geschrieben<br />
hatte. Glauben wir Giorgio Vasari, seinem<br />
ersten Biografen, starb das gefeierte<br />
Genie, nachdem es seine Sünden gebeichtet<br />
hatte, in den Armen von Franz I.<br />
Nun waren aber die französischen Könige<br />
Kriegsgegner von Ludovico Sforza,<br />
dem Auftraggeber des „Letzten Abendmahls“.<br />
Was war passiert? Wollte Leonardo<br />
seinen Mailänder Dienstherrn<br />
nicht sogar mit einer Reiterstatue ehren?<br />
Das Projekt kam nicht zustande, weil Il<br />
Moro, wie Sforza auch genannt wurde, alles<br />
Erz der Lombardei requirierte zum<br />
Kanonengießen: gegen die Franzosen.<br />
Der französische König Ludwig XII. marschierte<br />
1499 in Mailand ein und vertrieb<br />
den Herzog. Es kam zum Stellungskrieg<br />
FOTOS: TED SPIEGEL/CORBIS, ARTIAMO (AUTOR)<br />
120 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Am 1. September 1969 fotografierte Ted Spiegel Leonardos „Letztes Abendmahl“, um den schlechten<br />
Zustand des Freskos zu dokumentieren. Erst 1999 wurde die Restaurierung abgeschlossen<br />
in Novara mit einem fatalen Handicap:<br />
Beide Kriegsgegner waren durch Schweizer<br />
Söldnertruppen verstärkt. Damit die<br />
Eidgenossen nicht gezwungen wären, sich<br />
gegenseitig abzuschlachten, stimmte Ludwig<br />
XII. dem freien Abzug der Schweizer<br />
zu unter der Bedingung, dass Il Moro<br />
ausgeliefert werde. Die Schweizer in Mailänder<br />
Diensten griffen zur Kriegslist<br />
und verkleideten ihren Herrn als Söldner.<br />
Beim Auszug aus der belagerten Stadt am<br />
10. April 1500 durch eine Gasse von Eidgenossen<br />
auf der Seite der französischen<br />
Belagerer wurde Sforza aber von einem<br />
Urner Kriegsknecht verraten.<br />
200 Kronen waren sein Lohn, der<br />
fünffache Sold eines Jahres. Damit sei<br />
vom Zeitgeschehen zum „Letzten Abendmahl“<br />
ein ikonografischer Bogen geschlagen.<br />
Judas hatte für den Verrat an Jesus<br />
30 Silberlinge bekommen; Leonardo malt<br />
ihn als dritten Jünger links von Jesus, zurückgelehnt,<br />
den Geldbeutel in der Faust.<br />
Hinter ihm sitzt der impulsive Petrus und<br />
macht mit seiner ausgestreckten Linken<br />
am Hals von Johannes vor, wie er dem<br />
Verräter des Heilands an die Gurgel ginge.<br />
Verbirgt sich hinter jenem anmutig weiblichen<br />
Lieblingsjünger die angebliche Geliebte<br />
von Jesus, Maria Magdalena? Dan<br />
Brown machte diesen Verdacht im „Da<br />
Vinci Code“ populär.<br />
Ludwig XII., ein großer Leonardo-<br />
Sammler, wollte das „Letzte Abendmahl“<br />
dann als Beutekunst nach Frankreich<br />
schaffen, ließ aber vom Vorhaben ab, da<br />
der Transport samt Refektoriumsmauer<br />
zu kostspielig geworden wäre. Ludovico<br />
Sforza, der Auftraggeber des Wandbilds,<br />
starb acht Jahre später im Gefängnis von<br />
Loches an der Loire. Leonardo verschied<br />
erst 1519 im Schloss Clos Lucé bei Amboise,<br />
das ihm der junge König Franz I.<br />
zusammen mit einer ansehnlichen Ehrenpension<br />
überlassen hatte.<br />
Leonardo war kein Judas, er war ein<br />
normaler Opportunist, der auf der Seite<br />
der Sieger steht. Für die Künstler gilt:<br />
Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Die<br />
Gesellschaft nimmt es ihnen nicht übel<br />
und gedenkt ihrer in unschuldig lustigen<br />
Anekdoten, wie sie seit Plinius überliefert<br />
sind.<br />
B EAT WYS S<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt in Karlsruhe<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 121
| S A L O N | K R I S E D E S R E G I E T H E A T E R S<br />
DILETTANTEN AUF THRONEN<br />
Schamlos und ungebildet, banal, überheblich und ordinär: Das Sprechtheater liegt darnieder.<br />
Es ist höchste Zeit, dass es wieder zu einer Kathedrale des Besonderen wird<br />
V ON IRENE BAZ INGER<br />
W<br />
ILLIAM SHAKESPEARES „Coriolanus“<br />
ist ein Stück, das<br />
nicht oft aufgeführt wird –<br />
vielleicht, weil der Titelheld<br />
ein ziemlich arroganter<br />
Schnösel ist, der zwar alle Schlachten<br />
und Kriege gewinnt, aber das Volk, zu<br />
dessen Wohle er dies zu machen behauptet,<br />
grenzenlos verachtet. Er hält es für<br />
dumm, faul und bequem. Wenn man dieses<br />
Werk inszeniert, sollte man wissen, warum.<br />
Im Deutschen Theater Berlin kam<br />
es vor Weihnachten 2012 heraus, und der<br />
Regisseur, dessen Namen zu nennen hier<br />
zu viel der Ehre wäre, hatte offenbar weder<br />
Lust auf dieses Drama noch Interesse<br />
an der Thematik. Er hat es einfach – verspielt<br />
(und die bedauernswerten Darsteller<br />
in den Untiefen seiner Nicht-Einfälle<br />
scheitern lassen). Nun wollen wir allerdings<br />
nicht vergessen, dass von den damaligen<br />
Schauspielern ebendieses Deutschen<br />
Theaters im Jahr 1989 die große Demonstration<br />
organisiert wurde, die am 4. November<br />
auf dem Alexanderplatz stattfand<br />
und im Zuge derer die Angst der Bürger<br />
vor ihrer Regierung endgültig verschwand.<br />
Wenige Tage danach fiel die Berliner Mauer.<br />
Sagen wir es so: Im Theater ist – vom<br />
gewaltigen Blödsinn bis zur intellektuellen<br />
Emphase – alles möglich. Seine gesellschaftliche<br />
Relevanz erweist sich, wie in anderen<br />
Bereichen des öffentlichen Lebens<br />
auch, in der Qualität seiner Hervorbringungen.<br />
Wenn gelangweilte, ungebildete,<br />
überhebliche Regisseure mit schlecht gewaschenen<br />
Fingern an Texten herumfummeln,<br />
Nicht nur bei Frank Castorf ist das subventionierte Sprechtheater zur Bedürfnisanstalt<br />
verkommen: Szene aus „Kasimir und Karoline“ am Münchner Residenztheater<br />
die sie gar nicht interessieren und die sie<br />
deshalb auf ihr banales geistiges wie emotionales<br />
Niveau herunterbrechen, ist das<br />
Theater daran nicht schuld. Es kann nichts<br />
für einen künstlerischen Horizont, der sich<br />
zwischen „Sesamstraße“ und Facebook bewegt<br />
– und das nicht als Mangel empfindet,<br />
sondern sich damit „voll im Trend“ fühlt.<br />
Es kann auch nichts für Stückfassungen,<br />
die mit den Originalen kaum noch etwas<br />
zu tun haben, dafür mit Fremdtexten,<br />
Filmeinblendungen und Musiktiteln aus<br />
der gerade bevorzugten Playlist des jeweiligen<br />
Regisseurs zugeknallt sind. Oder wenn<br />
diese unsäglichen Spielvögte ihrem Ensemble<br />
nichts anderes abverlangen, als baldigst<br />
Hemd und Hose auszuziehen, mit blankem<br />
Hintern durch den Kartoffelsalat zu robben<br />
oder erst mal in irgendeine Ecke zu kotzen,<br />
per Videokamera riesig auf die Bühnenrückwand<br />
übertragen. Die Ekeldebatte<br />
über das Unwesen des „Regietheaters“ ist<br />
FOTOS: PETER KNEFFEL/PICTURE ALLIANCE/DPA/LBY, MAX LAUTENSCHLÄGER (AUTORIN)<br />
122 <strong>Cicero</strong> 4.2013
inzwischen wieder abgeflaut, aber nicht das,<br />
was sie ausgelöst hatte: dreiste Eingriffe<br />
in Stücke, Verletzungen von Sinnzusammenhängen,<br />
kalkulierte Schweinigeleien,<br />
um möglichst auffällig in die Feuilletons<br />
zu gelangen.<br />
Neben diesem rein äußerlichen Versuch<br />
von „Épater le bourgeois“ (ohne mal<br />
darüber nachzudenken, wer heute solch<br />
ein Bourgeois sein könnte, den man brüskieren<br />
will, und ob man nicht froh sein<br />
sollte, wenn er seine Eintrittskarte, sein<br />
Abonnement bezahlt) gibt es freilich die<br />
innere Auszehrung, die man höflicherweise<br />
als Blässe des Gedankens, ebenso als<br />
Dämlichkeit und Präpotenz bezeichnen<br />
könnte – wenn da nämlich Texte zerschlagen<br />
werden und das blindwütige Massaker<br />
als „Dekonstruktion“ verhübscht wird, um<br />
zu verschleiern, dass die Texte in Wahrheit<br />
einfach nicht kapiert wurden.<br />
Was in den Kunstmetropolen<br />
wie Berlin, Hamburg,<br />
München oder Wien<br />
mit viel Aufwand unter speziellen<br />
Umständen eventuell<br />
irgendwie und dank hervorragender<br />
Schauspieler durchrutschen<br />
kann, wird auf den<br />
kleineren Bühnen normalerweise<br />
zum Desaster. Eine Inszenierung<br />
„à la Frank Castorf“,<br />
„à la Armin Petras“, „à<br />
la Jürgen Gosch“ in der Provinz<br />
kann verheerend sein,<br />
denn sie senkt maßgeblich nicht nur das<br />
Niveau des regionalen Theaters, sondern<br />
verdirbt überdies die Perspektive des Publikums:<br />
Die einen bleiben weg, weil sie<br />
sich nicht für doof verkaufen lassen wollen<br />
und unterfordert fühlen, die anderen glauben,<br />
es müsste immer und alles so sein –<br />
und steigen aus, wenn sie an einem nächsten<br />
Theaterabend ein bisschen inhaltlich<br />
wie formal gefordert und vielleicht auch<br />
im vollen Ernst angesprochen werden. So<br />
treffen sich Produzenten und Rezipienten<br />
oft auf dem kleinsten gemeinsamen Niveau:<br />
Die einen führen vor, was sie sich –<br />
„Geht doch!“ – in Fernsehformaten abgeschaut<br />
haben, die anderen, die nicht mehr<br />
zu begreifen, zu beobachten, zu dechiffrieren<br />
gelernt haben, nehmen das gerne an –<br />
„Danke, Anke!“<br />
Und nachdem die Regisseure das anspruchsvolle<br />
Publikum aus dem Theater<br />
gejagt und mit ihren Eskapaden sämtliche<br />
Unbegabte<br />
Regisseure<br />
wie Christoph<br />
Schlingensief<br />
sind oder<br />
waren oft<br />
blendend im<br />
Geschäft<br />
Stücke, Figuren, Konflikte und den Respekt<br />
vor einem Text zerstört haben, rennen<br />
sie ins Kino, heulen bei einem Hollywood-<br />
Schinken, in dem es all das noch gibt – eine<br />
Geschichte, Dialoge, Figuren, dazu große<br />
Gefühle, kluge Gedanken, berührende Probleme.<br />
Ich kriege akute Hassschübe, wenn<br />
mir Theaterleute erzählen, um wie viel lieber<br />
sie Filme sehen als Theater. Kein Wunder,<br />
haben sie es doch selbst in Bausch und<br />
Bogen ruiniert!<br />
BEI INKOMPETENZ werden Politiker durchaus<br />
abgewählt, Fußballer kommen auf die<br />
Ersatzbank, aber im Theater sind unbegabte<br />
Regisseure – ich sage bloß Christoph<br />
Schlingensief! – oft blendend im Geschäft.<br />
Zu erklären ist das höchstens dadurch, dass<br />
sie mit ihren wohlkalkulierten Sujets –<br />
„Kühnen ’94 – Bring mir den Kopf von<br />
Adolf Hitler“ heißt es einmal<br />
bei Schlingensief – und mit<br />
ihrem schamlosen Bühnenbohei<br />
eine riesige Medienresonanz<br />
auslösen und so<br />
einerseits soziale Relevanz<br />
simulieren, andererseits für<br />
nicht minder mediengeile<br />
Intendanten zu Quotenbringern<br />
werden: Besser ein Verriss<br />
als nicht beachtet.<br />
Obwohl sie es gar nicht<br />
müssten, da sie ökonomisch<br />
im Prinzip unabhängig sind,<br />
tun Intendanten oft so, als<br />
hätten sie sich der viel beschworenen<br />
Quote, die uns das Fernsehen eingebrockt<br />
hat, zu unterwerfen. Warum setzen sie auf<br />
Quantität statt auf Qualität? Vielleicht,<br />
weil sie oft besser rechnen als schauen können<br />
und nackte Zahlen sich leichter rechtfertigen<br />
lassen als künstlerische Risiken<br />
und kreative Herausforderungen – für die<br />
sie indes eigentlich ihre Subventionen erhalten.<br />
Wo ist ein Intendant mit Mut zum<br />
Abenteuer, zur eigenen Meinung, zur intellektuellen<br />
Widerspenstigkeit? Wo ist einer<br />
mit einem eigenen Kopf und mit eigenen<br />
Gedanken? Ich kenne nicht alle, aber ich<br />
sehe keinen.<br />
Ja, ja, ja, ich weiß, Intendanten haben<br />
es im Allgemeinen schwer und müssen sich<br />
mit vernagelten Politikern und diversen finanziellen,<br />
innerbetrieblichen und sonstigen<br />
lästigen Hindernissen herumschlagen.<br />
Allerdings sind sie auch diejenigen, die entscheiden<br />
können – und müssen. Und die<br />
nicht a priori dazu gezwungen sind, immer<br />
das Gleiche zu veranstalten.<br />
Macht uns nicht dümmer, als ihr seid<br />
und wir sind! Lasst uns die Theater wieder<br />
als Kathedralen des Besonderen erleben!<br />
Rettet sie aus den handelsüblichen<br />
Komfortzonen! Man müsste die Quoten-<br />
Häscher von den Bühnen treiben, die Heimeligkeit<br />
aus den Foyers und die Selbstzufriedenheit<br />
aus den Sälen: Denn erst<br />
wenn wir in einer Aufführung vergessen,<br />
dass wir Hunger und Durst haben, unbequem<br />
sitzen und den letzten Bus versäumen<br />
werden, ist sie gelungen und hat uns<br />
mehr geschenkt als all die konsumorientierte<br />
Gemütlichkeit.<br />
Das Problem an der Debatte, die<br />
schlechtes Theater, dusselige Regisseure<br />
und unfähige Intendanten auslösen, ist<br />
freilich: Wenn es in einer Saison ein paar<br />
schlechte Filme gibt, zweifelt niemand an<br />
der Existenzberechtigung des Kinos. Nach<br />
einem schlechten Bücherherbst ruft niemand<br />
das Ende der Literatur aus. Ja, selbst<br />
wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft<br />
gegen Schweden 4:4 „verliert“, wird<br />
höchstens ein neuer Trainer eingefordert,<br />
aber nicht die Abschaffung des Fußballs<br />
verlangt.<br />
Als Theaterkritikerin gefragt, ob das<br />
Theater eine soziale Relevanz hat, möchte<br />
ich am liebsten freiheraus „Warum nicht?“<br />
erwidern. Sage ich jedoch Ja, müsste ich erklären,<br />
warum ich mich oft ärgere, wenn<br />
eine Aufführung zu Ende ist und wieder<br />
rundherum belanglos war. Sage ich Nein,<br />
müssten mir ein paar gute Gründe einfallen,<br />
warum das Theater trotzdem häufig<br />
so tut, als ob: Als ob es der Gesellschaft<br />
einen Spiegel vorhielte, als ob es die richtigen<br />
Fragen zu stellen wüsste, wie man<br />
gerechter, freier, schöner leben könnte, als<br />
ob es unter Umständen – die Form ist die<br />
Botschaft – sogar ein paar Antworten bereit<br />
hätte. Das Theater ist natürlich nicht<br />
trefflicher als die Gesellschaft, die es hervorbringt.<br />
Warum erwarten wir aber genau<br />
das von ihm? Ganz einfach: Weil wir<br />
es brauchen.<br />
IRENE BAZINGER<br />
ist Theaterkritikerin<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 123
Prächtig ist ihr<br />
Gewand, huldvoll<br />
ihr Blick: Auch eine<br />
Abguss-Madonna<br />
kann Charme<br />
haben, selbst wenn<br />
sie aus Gips ist<br />
124 <strong>Cicero</strong> 4.2013
K Ö L N E R M A D O N N E N S T R E I T | S A L O N |<br />
POSSE UM MARIA<br />
Das Kölner Museum Schnütgen präsentiert seit 2009 eine falsche Madonna.<br />
Nun tritt der zuständige Kulturdezernent ab, ohne für Aufklärung gesorgt zu haben<br />
V ON ROLF S CHMIDT<br />
FOTOS: REINER DIECKHOFF, HERMANN J. KNIPPERTZ/DDP IMAGES/DAPD<br />
D<br />
I E A N T WER PENER Onze-Lieve-<br />
Vrouwe-Kathedraal ist eine<br />
Schatzkammer: Neben monumentalen<br />
Gemälden des Lokalhelden<br />
Peter Paul Rubens sind<br />
eine Überfülle von Bildern, Skulpturen<br />
in Holz und Stein, Farbfenstern, Wandund<br />
Deckenmalereien, eine kostbar geschnitzte<br />
Kanzel, Beichtstühle und aufwendige<br />
Grabmäler zu bestaunen.<br />
Es ist eine Kunst, in der das Wuchtige<br />
dominiert. Doch es gibt eine stille Ausnahme.<br />
Sie steht am Rand des linken Seitenschiffs<br />
und misst vom Scheitel bis zur<br />
Sohle gerade mal 132 Zentimeter. Eine<br />
marmorne Mutter Gottes mit dem Jesuskind.<br />
Damit man sie nicht übersieht, macht<br />
draußen, im Fenster des Kirchen-Shops, ein<br />
riesiges Plakat auf die Statue aufmerksam.<br />
Die Antwerpener wissen, was sie an ihrer<br />
zarten Madonna haben. Als die japanische<br />
Stadt Kobe 1995 von einem Erdbeben<br />
heimgesucht wurde, schenkten die Bürger<br />
der Schelde-Metropole den Japanern eine<br />
Kopie „zur Erinnerung an die Opfer“.<br />
Laut Robert Didier handelt es sich<br />
um „eine der schönsten Madonnen des<br />
14. Jahrhunderts“. Die ungezwungen-elegante<br />
Gottesmutter, der ihr Söhnchen spielerisch<br />
ins Gesicht langt, hat es dem Belgier<br />
angetan. Didier ist führende Autorität für<br />
die Werke der spätmittelalterlichen „maasländischen<br />
Schule“, zu deren Höhepunkten<br />
die Liebe Frau von Antwerpen zählt.<br />
Bis heute dient sie als Vorbild für zahlreiche<br />
Kopien. Im „Atelier de Moulage“, der königlichen<br />
Abgusswerkstatt zu Brüssel, kann<br />
jedermann für 1380 Euro eine Nachfertigung<br />
erwerben. Noch in jüngster Zeit haben<br />
sich zwei Liebhaber aus Deutschland<br />
in Brüssel Repliken gießen lassen.<br />
Abgesehen von den modernen Abgüssen<br />
kennt der Kunsthistoriker Didier eine<br />
Reihe Duplikate, die entstanden sind, nachdem<br />
die Antwerpener Schönheit 1864 auf<br />
einer Ausstellung in Mechelen Furore gemacht<br />
hatte. Nachbildungen stehen unter<br />
anderem im neugotischen Schloss Loppem<br />
bei Brügge, im südbelgischen Trappistenkloster<br />
Orval, in der Brüsseler Vorort-Kirche<br />
St. Paul, im Hôtel Adornes in Brügge,<br />
in Sankt Petersburg und Paris. Und im Kölner<br />
Schnütgen-Museum – das freilich die<br />
Abstammung seiner Marienkopie nicht<br />
wahrhaben will. Denn das Haus, das sich<br />
einer der kostbarsten Sammlungen mittelalterlicher<br />
Kunst rühmt, hat ein Vielfaches<br />
dessen gezahlt, was die Brüsseler Moulage-<br />
Werkstatt verlangt. Im Dezember 2008 ersteigerte<br />
Schnütgen beim Münchner Auktionshaus<br />
Hampel eine Nachbildung der<br />
Antwerpener Maria für 100 000 Euro plus<br />
26 000 Euro Aufgeld inklusive Mehrwertsteuer.<br />
Für eine „bedeutende französische<br />
Steinmadonna des 14./15. Jahrhunderts“<br />
(Auktionskatalog) war das ein Schnäppchen.<br />
Für ein neuzeitliches Doppel war es<br />
abenteuerlich.<br />
Dass die Kölner eine Kopie eingekauft<br />
haben, steht nicht nur für Didier außer<br />
Zweifel. Der Doyen der deutschen Madonnen-Forschung,<br />
der Berliner Robert<br />
Suckale, hat die Hampel-Figur in Augenschein<br />
genommen. Er ist sich sicher: „Es<br />
Ende Mai endet die achtjährige Amtszeit des<br />
Kölner Kulturdezernenten Georg Quander.<br />
Der ehemalige Opernintendant hält den<br />
teuren Ankauf für echt. Ein Kolloquium<br />
zur Klärung der strittigen Frage wurde<br />
angekündigt, fand aber nicht statt<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 125
| S A L O N | K Ö L N E R M A D O N N E N S T R E I T<br />
handelt sich um einen der Abgüsse, die<br />
man nach 1864 nach der Antwerpener<br />
Marmormadonna gegossen hat. Sie war<br />
nicht als Fälschung geplant, dazu ist sie<br />
erst durch den Handel geworden.“ Zwar<br />
hatten die mittelalterlichen Produzenten<br />
von Sakralkunst keine Bedenken, beliebte<br />
Heiligenfiguren oder -bilder zu serialisieren.<br />
Doch das Resultat war jeweils eine Ähnlichkeit;<br />
keine „dreidimensionale Fotokopie“.<br />
Verwechslung oder gar Fälschung waren<br />
nicht beabsichtigt.<br />
„Bei den monumentalen Skulpturen<br />
dieser Epoche sind keine zwei identischen<br />
Exemplare bekannt“, sagt Suckale.<br />
Auch der Kölner Kunsthistoriker und<br />
frühere Schnütgen-Mitarbeiter Reiner<br />
Dieckhoff, Verfasser eines Buches über<br />
„Kölner Madonnen“, schreibt: „Übereinstimmung<br />
(…) heißt nicht Kopie. Es gibt<br />
in dieser Zeit keine Statue, die bis ins Detail<br />
eine andere kopiert – immer springen<br />
Unterschiede ins Auge.“ Anschaffung und<br />
Aufstellung der Statue im Schnütgen-Museum<br />
seien daher „ein fortwährender Skandal.<br />
Da sind 130 000 Euro Steuergelder<br />
verbraten worden.“<br />
Trotzdem haben das Schnütgen-Museum<br />
und das Kulturdezernat der Stadt<br />
keinen Versuch unternommen, den Deal<br />
rückgängig zu machen. Gestützt auf Materialgutachten,<br />
beharrt man auf der Echtheit<br />
der kölschen Marie – bis hin zu Spekulationen,<br />
sie sei älter als die Antwerpener<br />
Madonna, ja womöglich deren Vorlage.<br />
Wer beide Exemplare gesehen hat – die<br />
fein konturierte Antwerpener Marmor-<br />
Dame und ihr grobes Kölner Gegenstück<br />
–, wird das ausschließen.<br />
DIE ZWEIFEL an der Hampel-Madonna<br />
waren schon vor der Versteigerung aufgetaucht.<br />
Didier machte das Auktionshaus<br />
auf die Antwerpener Skulptur aufmerksam.<br />
Ohne Resonanz. Dieckhoff übermittelte<br />
die Vorbehalte – nach dem Ankauf,<br />
aber vor Ablauf der Rücktrittsfrist – vertraulich<br />
dem Kölner Kulturdezernenten<br />
Georg Quander. Auch das führte zu nichts.<br />
Stolz lud die Stadt im Mai 2009 zum Pressetermin<br />
ein und kündigte die Madonna<br />
mit der unverändert falschen Zuschreibung<br />
à la Hampel an, als „bedeutende französische<br />
Madonna aus feinem Kalksandstein“.<br />
Didier intervenierte nun bei der Schnütgen-Direktorin<br />
Hiltrud Westermann-<br />
Angerhausen, monierte die fehlerhafte<br />
Der Kenner sieht es: Die Antwerpener<br />
Madonna hat eine bis zum Boden<br />
reichende, intakte Faltenpartie<br />
Ein aktueller Abguss hingegen erfasst<br />
wesentliche Details des gefälteten Saumrands<br />
nicht und wirkt dadurch gröber<br />
Die Madonna im Museum Schnütgen<br />
wiederum weist dieselbe Vergröberung auf wie<br />
der Abguss und hat einen zusätzlichen Sockel<br />
Zuschreibung, verwies auf die zahlreichen<br />
Kopien der Antwerpener Madonna. Die<br />
Hampel-Maria sei vor der Münchener Auktion<br />
bereits in London und Paris angeboten,<br />
mangels nachweisbarer Echtheit aber nicht<br />
an den Mann gebracht worden. Schließlich<br />
erinnert Didier daran, dass Schnütgen selbst<br />
1972 eine große Ausstellung „Rhein – Maas“<br />
ausgerichtet habe, auf der die Antwerpener<br />
Skulptur zu sehen war. „Ich finde es ganz<br />
merkwürdig, dass die Schnütgen-Leute ihre<br />
eigenen Kataloge nicht angeschaut haben“,<br />
sagt der alte Herr heute. „Ich habe zu Frau<br />
Westermann-Angerhausen gesagt: Ihr habt<br />
doch das Original selbst ausgestellt!“<br />
Die Lokalpresse berichtet über den<br />
Verdacht. Das Museum bleibt ungerührt:<br />
Natürlich kenne man die Antwerpener<br />
Madonna. Materialanalysen hätten aber<br />
ergeben, dass die Figur aus natürlichem<br />
Stein geschlagen sei und nicht abgegossen.<br />
Die Kritik sei entkräftet. In einem<br />
Schreiben an die Grünen-Stadträtin Barbara<br />
Moritz mokiert sich Kulturdezernent<br />
Georg Quander im September 2009 über<br />
„unhaltbare Fälschungsbehauptungen“ und<br />
verfügt ein Ende der Debatte: „Wir können<br />
und wollen auch angesichts der bevorstehenden<br />
wichtigen Aufgaben unsere<br />
Zeit nicht weiter mit einer solchen Auseinandersetzung<br />
vergeuden.“<br />
Als der FAZ-Journalist Andreas Rossmann<br />
im Juni 2011 ausführlich über die<br />
„falsche Marie von Köln“ berichtet, schrecken<br />
die Verantwortlichen noch einmal<br />
hoch. Binnen Jahresfrist werde man ein<br />
wissenschaftliches Kolloquium abhalten,<br />
das letzte Klarheit schaffen werde. Auf<br />
dieses Großreinemachen wartete die Öffentlichkeit<br />
vergebens. Im vergangenen<br />
September teilte Georg Quander auf eine<br />
FDP-Anfrage mit, „das Verhältnis der Kölner<br />
Figur zu einer Reihe ähnlicher Madonnen“<br />
bleibe „interessant“, doch könne das<br />
Museum „2012 leider kein Kolloquium zu<br />
dieser Spezialfrage ausrichten“.<br />
Die Vorgeschichte der Kölner Madonna<br />
liegt im Dunkeln. Zwar hat Georg<br />
Quander versichert, in den städtischen<br />
Museen werde „zur Kontrolle der Echtheit<br />
von Kunstobjekten (...) die Provenienz des<br />
jeweiligen Werkes als wichtiger Faktor einbezogen“.<br />
Bis heute hat Schnütgen aber lediglich<br />
mitgeteilt, die Skulptur habe sich<br />
„mehr als 40 Jahre in europäischem Privatbesitz“<br />
befunden – für die Frage nach der<br />
Echtheit eine Null-Information. Das Haus<br />
Hampel mag sich unter Hinweis auf den<br />
Datenschutz nicht dazu äußern, in wessen<br />
Auftrag es die Statue seinerzeit versteigerte.<br />
DIE AUSSAGEKRAFT der Analysen, auf die<br />
sich das Museum stützt, ist begrenzt. Zwar<br />
kommen die Expertisen – teils an der Kölner<br />
Fachhochschule, teils in New York erstellt<br />
– anhand von Materialproben aus<br />
dem Sockel in der Tat zum Schluss, dass die<br />
Kölner Maria aus Naturstein bestehe. Indes<br />
könne man weder die Entstehungszeit<br />
FOTOS: RHEINISCHES BILDARCHIV, REINER DIECKHOFF, KATALOG HAMPEL<br />
126 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: PRIVAT (AUTOR)<br />
Eine Replik der<br />
„Lieben Frau<br />
von Antwerpen“<br />
kostet 1380 Euro.<br />
Die Kölner<br />
zahlten fast das<br />
Hundertfache<br />
und beharren<br />
auf der<br />
Echtheit – trotz<br />
aller Zweifel<br />
noch den Herkunftsort angeben. Die Altersbestimmung<br />
sei „technisch leider nicht<br />
möglich“, erklärt das Museum. „Eine Herstellung<br />
der Kölner Madonna muss prinzipiell<br />
ebenso gut zeitgleich wie später oder<br />
eben auch früher anzunehmen sein als die<br />
Antwerpener Figur.“<br />
Didier ist wenig beeindruckt: „Die<br />
Stein analysen sind verwirrend – Qualm in<br />
wissenschaftlicher Form.“ Außerdem heiße<br />
„Naturstein“ noch lange nicht „echt“. Kopien<br />
lassen sich nicht nur per Abguss aus<br />
Gips oder – mitunter schwer nachweisbarem<br />
– Kunststein herstellen, sondern auch<br />
mit dem sogenannten Punktierverfahren<br />
aus Naturstein. So entstehen etwa von Michelangelos<br />
David immer wieder Repliken<br />
aus demselben Material wie das Original:<br />
Carrara-Marmor. Nach Ansicht von Robert<br />
Didier wäre die Kölner Figur dann<br />
noch nicht einmal eine direkte Kopie der<br />
Antwerpener Madonna, sondern abhängig<br />
von einem der Brüsseler Abgüsse.<br />
Die kunsthistorische Evidenz ist eindeutig.<br />
Da ist beispielsweise der „Knubbel“<br />
unter dem rechten Fuß der Kölner<br />
Muttergottes. Sie steht auf einem unförmigen<br />
Materialklumpen, in den Kerben<br />
geritzt wurden, offenbar ein Versuch, eine<br />
Problemstelle der Gussform zu kaschieren.<br />
In Antwerpen steht die Gottesmutter<br />
auf einer fein gefältelten Gewandschlaufe,<br />
die zu ihrer vornehmen Erscheinung passt.<br />
Die Form in der Brüsseler Abgusswerkstatt<br />
weist hingegen an dieser Stelle ebenfalls<br />
eine Vereinfachung auf.<br />
Die echte Antwerpener Madonna hält<br />
in der rechten Hand einen Stiel mit einer<br />
Öffnung, die mit einer Masse verfüllt<br />
ist. Dort wurde ursprünglich eine Blume<br />
aus Metall oder Holz hineingesteckt. An<br />
der Hampel-Madonna ist der Stengel-Abschluss<br />
völlig verschliffen. Wie die vormalige<br />
Schnütgen-Direktorin Westermann-<br />
Angerhausen zutreffend feststellte: „Ein<br />
Abguss verrät sich immer.“ Das zielte auf<br />
Gussnähte ab – die sich freilich vollständig<br />
entfernen lassen. Aber so genau wollten<br />
die Kölner es gar nicht wissen. Wie sich<br />
ihre Maria zu den Gussformen der Brüsseler<br />
Moulage-Werkstatt verhält, scheint den<br />
Schnütgen-Kunsthistorikern keine Recherche<br />
vor Ort wert gewesen zu sein. Die Mitarbeiter<br />
des Atélier de Moulage können<br />
sich nicht an Besuch aus Köln erinnern.<br />
So treibt die peinliche Geschichte<br />
nicht auf die versprochene große Aufklärung<br />
zu, sondern auf ein Verdämmern<br />
durch abnehmende öffentliche Aufmerksamkeit.<br />
Westermann-Angerhausen hat das<br />
Schnütgen-Museum unterdessen verlassen,<br />
ebenso wie ihre seinerzeit federführenden<br />
wissenschaftlichen Mitarbeiter Dagmar<br />
Täube und Niklas Gliesmann. Der neue<br />
Schnütgen-Direktor Moritz Woelk kennt<br />
sich mit Fälschungen aus: Am Hessischen<br />
Landesmuseum in Darmstadt gelang ihm<br />
der Nachweis, dass eine vermeintlich aus<br />
dem 14. Jahrhundert stammende Skulptur<br />
in Wahrheit ein halbes Jahrtausend später<br />
aus Zement hergestellt worden war. Hinsichtlich<br />
der falschen Marie will er indes<br />
nichts weiter unternehmen.<br />
Georg Quanders Amtszeit endet im<br />
Mai. Dann droht aus dem Fehlgriff endgültig<br />
ein Dauerzustand zu werden. „So<br />
weit darf es nicht kommen“, sagt der Kölner<br />
Kunsthistoriker und Fälschungsexperte<br />
Hans Ost. Um Schaden von der Stadt abzuwenden,<br />
dürfe Quander nichts unversucht<br />
lassen, die fatale Anschaffung rückgängig<br />
zu machen.<br />
ROLF S CHMIDT<br />
ist Autor aus Köln. Er beschäftigt<br />
sich seit mehr als zwei Jahrzehnten<br />
unter anderem mit belgischen<br />
Themen<br />
Anzeige<br />
© Foto Cohn-Bendit: European Union 2011 PE-EP<br />
Scheitert Europa<br />
an Deutschland?<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, stellvertretender<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur, im Gespräch<br />
mit Daniel Cohn-Bendit.<br />
Sonntag, 28. April 2013, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble,<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
28. APRIL<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
Daniel<br />
Cohn-Bendit<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 127
| S A L O N | 1 9 3 3 – U N T E R W E G S I N D I E D I K T A T U R<br />
WEHRLOS,<br />
ABER NICHT EHRLOS<br />
Vor 80 Jahren besiegelte das Ermächtigungsgesetz das Ende der Weimarer Republik.<br />
Allein die SPD hatte versucht, sich dagegenzustemmen. Dritte Folge einer Serie<br />
V ON P HILIPP B LOM<br />
A<br />
LS OTTO WELS sich am 23. März<br />
1933 in der Berliner Kroll-<br />
Oper erhob, um eine Rede zu<br />
halten, wurde er zum letzten<br />
Helden der sterbenden Weimarer<br />
Republik. Nach dem Reichstagsbrand<br />
war die Kroll-Oper zum provisorischen<br />
Parlament umfunktioniert worden, und<br />
hier fand die Debatte über das Ermächtigungsgesetz<br />
statt. Vielleicht ist „Debatte“<br />
das falsche Wort. Denn viele Kommunisten<br />
waren der Verhaftungswelle nach dem<br />
Reichstagsbrand zum Opfer gefallen, und<br />
so blieben die Bänke der KPD leer. Außer<br />
der SPD hatte keine der anwesenden Parteien<br />
die Absicht, gegen das Gesetz zu stimmen.<br />
Der ehemalige Tapezierergeselle und<br />
spätere Fraktionsvorsitzende Wels war der<br />
Einzige, der es angesichts der im Saal postierten<br />
bewaffneten SA-Männer wagte, gegen<br />
das Gesetz zu sprechen.<br />
Das Protokoll der Sitzung verzeichnet<br />
jeden Zwischenruf und jeden Lacher<br />
(aus den Reihen der NSDAP) während<br />
der Rede, der wichtigsten in Wels’ Leben.<br />
Da er das Gesetz nicht verhindern konnte,<br />
blieb ihm nichts anderes übrig, als den ehemaligen<br />
SPD-Reichskanzler Gustav Bauer<br />
zu zitieren, der 1919 bei der Debatte um<br />
die Unterzeichnung des Vertrags von Versailles<br />
im Reichstag gerufen hatte: „Wir<br />
sind wehrlos, wehrlos ist aber nicht ehrlos.<br />
Gewiss, die Gegner wollen uns an die<br />
Ehre, daran ist kein Zweifel, aber dass dieser<br />
Versuch der Ehrabschneidung einmal<br />
auf die Urheber selbst zurückfallen wird,<br />
1933<br />
Als Deutschland die<br />
Demokratie verlor<br />
dass es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser<br />
Welttragödie zugrunde geht, das ist mein<br />
Glaube, bis zum letzten Atemzug.“<br />
Damals hatte das besiegte und gedemütigte<br />
Deutsche Reich seine Alleinschuld<br />
am Krieg unterschreiben müssen.<br />
Bauer aber spielte auch auf die Dolchstoßlegende<br />
an, die Behauptung der rechten<br />
Parteien, die damalige SPD-Regierung<br />
wäre der siegreichen deutschen Armee<br />
durch ein Friedensangebot<br />
Anno<br />
an die Alliierten in den Rücken<br />
gefallen und habe das<br />
Vaterland verraten. Eine Legende,<br />
die wie keine andere<br />
das demokratische Klima<br />
der Weimarer Republik vergiftet<br />
hatte.<br />
Jetzt musste die SPD zusehen,<br />
wie dem Parlament die letzten demokratischen<br />
Befugnisse aus der Hand genommen<br />
wurden. Der Protest war rein symbolisch,<br />
aber nicht weniger wichtig. Wehrlos,<br />
aber nicht ehrlos.<br />
Das „Gesetz zur Behebung der Not<br />
von Volk und Reich“ vom 24. März 1933<br />
war nicht das erste Ermächtigungsgesetz<br />
der Weimarer Republik, aber es sollte ihr<br />
letztes sein. Elf frühere Ermächtigungsgesetze<br />
hatten der Regierung zwischen 1914<br />
und 1927 mehr oder weniger verfassungskonform<br />
zusätzliche Vollmachten und<br />
Handlungsfreiheit gegeben. 1933 hatte<br />
die NSDAP mit 288 Sitzen und in Abwesenheit<br />
der KPD, deren Abgeordnete verhaftet<br />
oder untergetaucht waren, ohnehin<br />
eine absolute Mehrheit im Reichstag und<br />
brauchte keine Notverordnungen, um regieren<br />
zu können. Das Gesetz war aber der<br />
entscheidende Schritt, um die Demokratie<br />
endgültig auszuhebeln. Es erlaubte der<br />
Regierung Hitler, direkt und ohne Konsultation<br />
des Parlaments Gesetze zu verabschieden<br />
und internationale Abkommen<br />
zu treffen. Der Reichstag wurde zur<br />
Propaganda kulisse für Brandreden<br />
gegen die postulierten Feinde<br />
von Volk und Vaterland.<br />
Otto Wels, ein eher<br />
schmächtiger Mann mit hoher<br />
Stirn und intensiven Augen,<br />
sprach nicht besonders<br />
mitreißend an diesem Tag. Er<br />
war kein großer Redner, und seine<br />
Rhetorik und seine Stimme, die in<br />
historischen Aufnahmen noch immer zu<br />
hören ist, wirken bemüht und manchmal<br />
bühnenhaft überzogen – die Worte eines<br />
redlichen Mannes, nicht eines großen Demagogen.<br />
Wels verteidigt seine Partei etwas<br />
bemüht und folgt ganz der offiziellen Linie.<br />
Er hat hörbar Angst. Nur einmal hebt<br />
sich seine Stimme, aus gegebenem Anlass,<br />
zu echter emotionaler Intensität: „Freiheit<br />
und Leben kann man uns nehmen,<br />
die Ehre nicht!“, sagt er. Die Bedrohung ist<br />
für ihn sehr konkret. Anfangs herrscht fast<br />
völlige Stille im Saal, dann kommt zögerlich<br />
sozialdemokratischer Applaus, dann,<br />
langsam, überwiegt das Lachen der Nationalsozialisten.<br />
Am Ende der Rede bricht<br />
ein Tumult aus.<br />
128 <strong>Cicero</strong> 4.2013
Nur einer erhob seine Stimme gegen Hitler: Otto Wels’ Rede gegen das Ermächtigungsgesetz wurde zum Schwanengesang der<br />
deutschen Demokratie. Nur wenige Monate später flüchtete der SPD-Abgeordnete ins französisch besetzte Saarland<br />
FOTOS: KEYSTONE, PETER RIGAUD (AUTOR); GRAFIK: CICERO<br />
Dann kommt Adolf Hitler. Hitler, der<br />
große Redner, siegesgewiss und erregt. Er<br />
beginnt leise und langsam, greift die SPD<br />
an und steigert sich dann in eine hysterische<br />
Wut hinein, die von seinen Abgeordneten<br />
und den SA-Männern enthusiastisch<br />
beklatscht wird. Er klagt an, brüllt, skandiert<br />
und wird von aufbrausendem Applaus<br />
und gellenden Bravorufen begleitet.<br />
Es ist eine große Darbietung. Am Ende stehen<br />
nur noch Ausrufe und kaum verschleierte<br />
Drohungen.<br />
„Sie, meine Herren, sind nicht mehr benötigt!“,<br />
ruft der Reichskanzler den sozialdemokratischen<br />
Abgeordneten zu. Und:<br />
„Sie meinen, dass Ihr Stern wieder aufgehen<br />
könnte! Meine Herren, der Stern Deutschland<br />
wird aufgehen und Ihrer wird sinken.“<br />
Zum Abschluss seiner wütenden Tirade erteilt<br />
Hitler Wels und dessen Parteifreunden,<br />
die gegen das Ermächtigungsgesetz stimmen<br />
wollen, eine letzte Abfuhr: „Ich will auch gar<br />
nicht, dass Sie dafür stimmen! Deutschland<br />
soll frei werden, aber nicht durch Sie!“<br />
Hitlers Triumph war vollkommen. Mit<br />
dem mit großer Mehrheit angenommenen<br />
Gesetz hatte er sich nicht nur die ganze<br />
Macht im Staat gesichert, sondern auch<br />
den Anschein der Legalität gewahrt. Das<br />
war wichtig, denn er brauchte die deutsche<br />
Beamtenschaft, um regieren zu können.<br />
Und viele konservative Beamte hätten einem<br />
Regime ohne gesetzliche Grundlange<br />
wohl nur widerwillig gedient.<br />
Für Otto Wels bedeutete seine mutige<br />
Stellungnahme das Ende seiner parlamentarischen<br />
Karriere. Im Mai 1933 flüchtete<br />
er ins französisch besetzte Saarland, um der<br />
Verhaftung zu entgehen, im August wurde<br />
ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.<br />
Vom Podium aus hatte er sich dagegen<br />
gewandt, politische Gegner als vogelfrei<br />
zu behandeln. Jetzt war er es selbst. Er<br />
arbeitete weiterhin aus dem Exil für seine<br />
Partei, zuerst in Prag, dann, nach 1938, in<br />
Paris. Dort starb er im Jahr darauf, im Alter<br />
von 66 Jahren. Deutschland hat er nicht<br />
wiedergesehen.<br />
Die zögerliche Rede, die Wels am<br />
23. März 1933 in der Kroll-Oper gehalten<br />
hatte, wurde zum Schwanengesang der<br />
deutschen Demokratie. Der Schauplatz<br />
der letzten parlamentarischen Konfrontation<br />
wurde während des Krieges durch<br />
Bomben und Straßenkämpfe schwer beschädigt.<br />
In der Nachkriegszeit wurden<br />
im Garten neben der Ruine Tanztees und<br />
populäre Konzerte veranstaltet. 1957 riss<br />
man das Gebäude ganz ab. Heute ist an<br />
seiner Stelle eine Rasenfläche vor dem<br />
Bundeskanzleramt.<br />
Wir werden den Weg in die Diktatur von<br />
1933 weiterhin nachzeichnen. In der nächsten<br />
Ausgabe wenden wir uns der Bücherverbrennung<br />
zu.<br />
P HILIPP B LOM ist Historiker<br />
und Autor. Seine Bücher „Der<br />
taumelnde Kontinent“ und<br />
„Böse Philosophen“ wurden<br />
mehrfach ausgezeichnet<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 129
| S A L O N | B I B L I O T H E K S P O R T R Ä T<br />
ZWISCHEN WEST<br />
UND OST UND JAZZ<br />
130 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: CHRISTOPH MICHAELIS FÜR CICERO<br />
Bücher, die Hans-Olaf Henkel wichtig<br />
sind, atmen den Geist ferner Länder und<br />
der Freiheit: Besuch in einem Zuhause,<br />
aus dem alles Enge verbannt ist<br />
VON ALEXANDER KISSLER<br />
Chinesische Kunst<br />
hat es Hans-Olaf<br />
Henkel angetan.<br />
Mehrfach besuchte<br />
er schon den<br />
Künstler Ai Weiwei<br />
E<br />
R MAG KEINE ROMANE. Ein Bücherwurm war er nie. Nichts<br />
findet er alberner als Menschen, die sich in ihrer Bibliothek<br />
fotografieren lassen: Das sind die Voraussetzungen<br />
für ein Bibliotheksporträt mit Hans-Olaf Henkel.<br />
Der Gastgeber teilt sie dem Gast gleich zu Beginn mit.<br />
Müssen wir es demnach ein Wunder nennen oder zumindest<br />
einen offensiv eingestandenen Selbstwiderspruch, dass der langjährige<br />
Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie<br />
in ein Gespräch über Bücher einwilligt? Dass er die Tür zu seiner<br />
zweigeschossigen Wohnung über den Dächern von Berlin öffnet,<br />
um sich vor einer Bücherwand ablichten zu lassen, ausgerechnet<br />
einer Bücherwand? Dem oberflächlichen Betrachter könnte noch<br />
manch andere Zutat zur öffentlichen Person Henkel als Widerspruch<br />
erscheinen. Wie passt die Mitgliedschaft bei Amnesty International<br />
zusammen mit dem Image des Marktradikalen? Woher<br />
kommt die Leidenschaft für Jazz in einem Leben, das sich ganz<br />
der Rendite verschrieben zu haben scheint?<br />
Über den Dächern von Berlin hält eine Mao-Jacke Wacht.<br />
Sie ist aus Stein, kein Körper steckt in ihr, wohl aber teilt sie gebieterisch<br />
die Terrasse in einen vorderen, zu den Wohnräumen<br />
weisenden, und einen hinteren, zum Gästetrakt führenden Bereich.<br />
Asiatisch mutet auch die kühle Eleganz in den Zimmern<br />
an, die vollendete Aufgeräumtheit. Kein Barock ist hier, kaum<br />
Abendland. Helle Farben dominieren, unterbrochen von dunkel<br />
lackierten Hölzern. Chinesische Kunst interessiert Henkel.<br />
Ganze Regale füllen die entsprechenden Bildbände. Vor ihnen<br />
gibt er der Kamera gerne, was sie begehrt, das Bild eines Menschen<br />
mit Büchern.<br />
Spät brach diese Liebe aus. Vor rund acht Jahren saß Henkel<br />
zu Tisch bei einem befreundeten Schweizer Unternehmer, einem<br />
Sammler chinesischer Kunst. „Für mich“, sagt er, „war das eine<br />
gewisse Erleuchtung.“ Sein Nebenmann damals hieß Ai Weiwei.<br />
Es wurde der Beginn eines ganz neuen Blicks auf Hans-Olaf Henkels<br />
Lebensthema, die Freiheit.<br />
Im April 2011 zählte er zu den Initiatoren des „Berliner Appells“<br />
unter dem Motto: „Lasst Ai Weiwei frei!“ Gemeinsam mit<br />
Leuten von Amnesty International demonstrierte er vor dem Brandenburger<br />
Tor. Das Ziel wurde erreicht. Die chinesische Regierung<br />
entließ den regimekritischen Künstler aus dem Gefängnis. Angela<br />
Merkel hatte sich das Anliegen zu eigen gemacht. Die Kanzlerin,<br />
sagt Henkel, „trägt die Menschenrechte im Herzen und nicht nur,<br />
wie die Grünen, auf der Zunge.“ Sollte Ai Weiwei weiterhin untersagt<br />
bleiben, seine Gastdozentur an der Berliner Akademie der<br />
Künste wahrzunehmen, würde sich Henkel an einer weiteren Initiative<br />
zugunsten des Verfolgten beteiligen.<br />
Was in Bildbände mündete, begann als Bildergeschichte: Henkels<br />
Suche nach Freiheit. Dem Hamburger Knaben, dessen Vater<br />
im Krieg gefallen war, erschlossen einst Micky Maus und Donald<br />
Duck fremde Welten, dann waren es die Cowboy erzählungen<br />
um Tom Prox oder Billy Jenkins – Groschenhefte, „Schmutz und<br />
Schund“, sagte die kunstbeflissene Mutter, in deren Wohnung<br />
Händel erklang, immer Händel, Freudenklänge des Barock. Vor ihnen<br />
büxte er aus in die wilden Weiten des Jazz. Die ältere Schwester<br />
führte den 14-Jährigen heran. Weil im Kreise der Jazzfreunde<br />
fast nur Abiturienten sich befanden, während er, der insgesamt elf<br />
Schulwechsel über sich ergehen lassen musste, mit Mittlerer Reife<br />
abschloss, las er einmal doch einen klassischen Roman. Robert<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 131
| S A L O N | B I B L I O T H E K S P O R T R Ä T<br />
Eine Kostbarkeit, nicht nur des Alters wegen: In der Rede, die Thomas Mann 1939 in Stockholm halten sollte, fand Hans-Olaf Henkel eine<br />
klare Darlegung, warum Freiheit und Gleichheit einander widersprechen. In China ereignet sich derzeit die traurige Probe aufs Exempel<br />
Musils „Mann ohne Eigenschaften“ bezwang er ganz. „Ja, wir waren<br />
damals eine anspruchsvolle Gesellschaft, und ich wollte natürlich<br />
mithalten.“<br />
Heute steuert Hans-Olaf Henkel eine Jazz-Kolumne zum libertären<br />
Monatsmagazin Eigentümlich frei bei, während seine Radiosendung<br />
mit einschlägiger Musik noch immer im Internet wiederholt<br />
wird. Ein Buch über Jazz ist die aktuelle Lieblingslektüre.<br />
Wie einst auf den Rücken imaginärer Pferde gibt auch im Ozean<br />
der improvisierten Töne die Freiheit den Horizont ab. Jenseits von<br />
Deutschland, lernen wir, muss es besser um diese bestellt sein. Das<br />
Jazz-Buch stammt von Tad Hershorn und erzählt die Geschichte<br />
des Impresarios Norman Granz, der nicht nur Ella Fitzgeralds persönlicher<br />
Manager war. Granz stellte auch jene Gruppe zusammen,<br />
die der 16-jährige Hans-Olaf Henkel 1956 bei seinem ersten<br />
Jazz-Konzert erlebte, in der Hamburger Ernst-Merck-Halle,<br />
mit Ray Brown, Herb Ellis, Illinois Jacquet, Ella Fitzgerald. Und<br />
Granz war auch, erfuhr Henkel durch „The Man Who Used Jazz<br />
For Justice“, „einer der großen Vorbereiter der Rassenintegration<br />
in der amerikanischen Musik“.<br />
HIN ZU UNBEKANNTEN GESTADEN WEIST ein weiteres Lieblingsbuch,<br />
„1000 Places to See Before You Die“ von Patricia Schultz. „Etwa<br />
200 davon, schätze ich, habe ich schon gesehen.“ Reisen zählen<br />
zur Hauptbeschäftigung eines jeden BDI-Präsidenten, erst recht<br />
eines vielgefragten Buchautors. Als Henkel das Buch durchblättert,<br />
deuten große Markierungen mit Bleistift auf die jeweilige<br />
Visite: Costa Smeralda und die Insel La Digue, Seychellen, dann<br />
Singapur mit den legendären Garküchen und dem ebenso legendären<br />
Singapore Sling im „Raffles Hotel“, wo der Cocktail erfunden<br />
wurde. „Na ja“, bricht er die erinnernde Lektüre ab, „alle<br />
1000 Orte schaffe ich bestimmt nicht.“<br />
„Die Macht der Freiheit“ sind die Lebenserinnerungen überschrieben.<br />
Eine antiquarische Kostbarkeit lieferte das theoretische<br />
Grundgerüst. Hans-Olaf Henkel greift in sachlicher Andacht nach<br />
diesen Seiten. „Ich habe nirgends so klar und schön und knapp<br />
den Widerspruch zwischen Freiheit und Gleichheit erklärt bekommen<br />
wie in diesem Buch. Hierzulande darf man ja kaum noch sagen,<br />
dass Freiheit und Gleichheit Gegensätze sind.“ Er richtet den<br />
Blick auf ein Bändchen mit dem Titel „Das Problem der Freiheit“<br />
von Thomas Mann, erschienen 1939 in Stockholm.<br />
Die Rede, die Thomas Mann aufgrund des Ausbruchs des<br />
Weltkriegs nicht halten konnte, enthält einen für Henkel zentralen<br />
Satz: „Der Gegensatz von Demokratie und Sozialismus ist der<br />
von Freiheit und Gleichheit.“ Zufrieden blickt er auf vom leicht<br />
vergilbten Papier. Was Thomas Mann wusste, erklärt er, gerate in<br />
Vergessenheit. „Sie finden heute kaum einen Diskurs über Freiheit<br />
oder Gleichheit. Wir reden nur von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit.<br />
Dabei hat schon Friedrich August von Hayek darauf hingewiesen,<br />
dass soziale Gerechtigkeit eine Tautologie ist. Gerechtigkeit<br />
kann nur in Gemeinschaft zur Frage werden, sie ist immer<br />
ein soziales Phänomen.“ Ergo sieht Henkel hier wieder jene „Gutmenschen“<br />
am Werk, die „soziale Gerechtigkeit“ sagen und eine<br />
unmenschliche Gleichheit meinen. Auf Kuba, sagt er, sah er mit<br />
eigenen Augen die „Gleichheit der Misere“. Seine Unterstützung<br />
für die Euro-kritische Partei „Alternative für Deutschland“ verdankt<br />
sich wohl auch dem Impuls, die Freiheitsrechte des Individuums<br />
ins Politische zu übersetzen.<br />
Thomas Mann schrieb ferner: „Es ist die Forderung und das<br />
Statut der Menschenrechte (…), worin beide Prinzipien, das individualistische<br />
und das soziale, Freiheit und Gleichheit sich vereinigen<br />
und einander wechselseitig rechtfertigen.“<br />
Hans-Olaf Henkel greift zum kleinsten der Bücher, die er<br />
für den Gast ausgebreitet hat. „Mit diesem Buch“, sagt er mit allem<br />
Pathos, dessen ein Hanseate fähig ist, „mit diesem Buch in<br />
der Hand muss man durch Russland genauso laufen wie durch<br />
den Iran, durch China und durch Saudi-Arabien.“ Das fragliche<br />
Buch, ein Büchlein, steht dem Gast sehr nah vor Augen. Es enthält<br />
die Welt, wie sie sein müsste, damit sie ein guter Ort wäre.<br />
Es ist ein utopisches Büchlein. Es ist die „Allgemeine Erklärung<br />
der Menschenrechte“.<br />
A LEXANDER KISSLER<br />
leitet den Salon. Von ihm erschien soeben: „Papst<br />
im Widerspruch. Benedikt XVI. und seine<br />
Kirche 2005-2013“ (Pattloch-Verlag)<br />
FOTOS: CHRISTOPH MICHAELIS FÜR CICERO, ANDREJ DALLMANN (AUTOR)<br />
132 <strong>Cicero</strong> 4.2013
WELT.DE/DIGITAL<br />
Die Welt gehört denen,<br />
die mutig genug sind,<br />
sie zu verändern.
| S A L O N | D A S S C H W A R Z E S I N D D I E B U C H S T A B E N<br />
Diese geilen Außenklos!<br />
Drei Autoren versuchen sich an Berlin. Einer erzählt die wahre<br />
Geschichte. Einer kriecht ganz hinein. Und einer lässt es in Ruhe<br />
D IE B ÜCHERKOLU MNE V ON ROBIN D E TJE<br />
B<br />
ERLIN WEINT, und David Bowie<br />
ist schuld. Er hat eine neue<br />
CD veröffentlicht (David Bowie:<br />
„The Next Day“; CD, Sony Music 2013, 17-<br />
22 Euro), ein schönes ruhiges Alterswerk.<br />
In einer sogenannten Vorauskopplung war<br />
der Song „Where are we now“ zu hören, in<br />
dem Bowie sich mit viel Gefühl an seine<br />
Zeit im Westberlin der achtziger Jahre erinnert.<br />
Da kamen ganz Berlin vor Rührung<br />
die Tränen. Er liebt uns noch! Wir<br />
sind wieder wer! Oder waren mal wer – wenigstens<br />
das.<br />
Berlin ist eine offene Wunde. Die ewige<br />
Frontstadt leidet. Mit der Gegenwart ist<br />
nicht viel los, die alternative Vergangenheit<br />
entschwindet ihr. Das Tacheles, ein<br />
Zentrum für Pseudokunst, gegen das man<br />
in Berlin nichts sagen durfte, wurde geräumt.<br />
Die East-Side-Gallery soll abgerissen<br />
werden, um Platz für Luxusapartments<br />
zu schaffen (stimmt nicht, trotzdem überall<br />
Protest). Sasha Waltz, die wichtige Choreografin,<br />
hat mit dem Weggang gedroht, will<br />
ein eigenes Haus. Mit der Alternativszene<br />
hat sie ästhetisch nichts zu tun, aber mehr<br />
Vergangenheitsentzug kann hier niemand<br />
ertragen. Alle müssen bleiben!<br />
Berlin versteckt sich vor der Zukunft<br />
und klammert sich ans coole Gestern.<br />
Wolfgang Müllers Abhandlung „Subkultur<br />
Westberlin 1979-1989“ soll schon vor der<br />
offiziellen Buchpremiere in die dritte Auflage<br />
gegangen sein. (Wolfgang Müller: „Subkultur<br />
Westberlin 1979-1989 – Freizeit“;<br />
Philo Fine Arts, Hamburg 2013; 579 Seiten,<br />
24 Euro.) Ein irrer Wälzer! Das Personenregister<br />
lässt niemanden aus. Bei Müller<br />
steht Bowie 1977 als guter Nachbar Wache<br />
vor dem „Anderen Ufer“, einem Schwulenlokal<br />
in der Hauptstraße, dem die Fenster<br />
eingeworfen wurden, und wartet mit den<br />
Kellnern auf den heterosexuellen Glasermeister.<br />
Heroes! Das Buch steckt voller genialer<br />
Miniaturen dieser Art. 1983 meldet<br />
der deutsch-ägyptische Künstler Armin<br />
Ibrahim Golz eine Performance als politische<br />
Demonstration an. Mit einem Lastwagen<br />
fährt Golz über den Ku’damm. Auf<br />
der Ladefläche sieht man auf einer Leinwand<br />
seine Super-8-Filme, zu lauter Musik.<br />
Im Demonstrationszug dahinter: Matthias<br />
Roeingh, später bekannt als Dr. Motte.<br />
„Sechs Jahre später wird Dr. Motte auf dem<br />
gleichen Streckenabschnitt die erste Loveparade<br />
veranstalten – ebenfalls angemeldet<br />
als politische Demonstration.“<br />
Als Geschichtsschreiber will Müller vor<br />
allem den Künstlern gerecht werden, die<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
134 <strong>Cicero</strong> 4.2013
FOTO: LOREDANA FRITSCH<br />
Anzeige<br />
den umschwärmten Stars der Szene das<br />
Material geliefert haben und zu Unrecht<br />
weiterhungern mussten und vergessen worden<br />
sind. Eine überraschend große Rolle<br />
spielt dabei eine Avantgardeband namens<br />
„Die Tödliche Doris“, deren Gründung<br />
durch einen gewissen Wolfgang Müller auf<br />
Seite 21 beschrieben wird. Die „Tödliche<br />
Doris“ war eine fabelhafte, hochgenialische<br />
Künstlergruppe, die viel Lorbeer verdient –<br />
hier erscheint sie als Kristallisationspunkt<br />
der gesamten Berliner Subkultur.<br />
Viele alte Rechnungen werden beglichen.<br />
Manchmal ist Wolfgang Müller ein<br />
Meister der klugen Kleinlichkeiten. Trotzdem<br />
bleibt es eine Großtat zu dokumentieren,<br />
was er zusammentrug. 1983 singt<br />
das Musikkollektiv „Mekanik Destrüktiw<br />
Komandöh“ ihr Lied „Kreuzberg ist<br />
so wundervoll“: KREUZBERG IST SO<br />
WUNDERVOLL / DIESE GEILEN<br />
AUSSENKLOOHS / DIESE GRAUEN<br />
BETONSILOOS / WENN ICH DURCH<br />
DIE STRASSEN GEH / UND DIE BE-<br />
SÄTZTEN HÄUSER SEEH … / UND<br />
DIE LEUTE AUS DEM BESETZTEN<br />
HAUS / WINKEN MIR ZUM FENSTER<br />
RAUS. Ein Text, den man nicht mehr missen<br />
möchte. Und was die Kleinlichkeiten<br />
angeht: Glauben wir wirklich, Lou Reed<br />
würde in New York netter über Bowie reden,<br />
als Müller über seine Konkurrenten<br />
und Mittäter von damals schreibt?<br />
***<br />
Wolfgang Müller ist ein Kreuzberger aus<br />
Wolfsburg. Immer sind es die Jungs aus<br />
Westdeutschland, die nach Berlin kommen<br />
und sich aus ihrer Kleinstadtsozialisation<br />
dort ihre Großstadt bauen. David Wagner,<br />
Mitte-Berliner aus Andernach, hat schon<br />
im Jahr 2011 seine gesammelten Berlin-<br />
Geschichten veröffentlicht. (David Wagner:<br />
„Welche Farbe hat Berlin“; Verbrecher-<br />
Verlag, Berlin 2011; 215 Seiten, 14 Euro.)<br />
Das ist das merkwürdigste Berlin-Buch, das<br />
man sich denken kann. Die Welt, die hier<br />
entsteht, ist unleugbar schön und entwickelt<br />
einen ganz eigenen Sog. Alles Berlinerische<br />
marschiert verlässlich auf, von<br />
der Currywurst bis zum Opa am Rollator,<br />
und wird dann in eine Sprach- und Gedankenwelt<br />
von höchst aparter Verfeinerung<br />
überführt. Das Ganze schwingt sich<br />
zu einem emphatischen, geradezu symphonischen<br />
Finale auf: „Wir schwimmen, wir<br />
tasten uns durch die Falten der Stadt …<br />
wir treiben durch Berlin.“ Bei Wagner regiert<br />
der staunende Blick eines Flaneurs,<br />
der noch auf dem letzten Telefonverteilerkasten<br />
Spiegelflächen für die eigene Sensibilität<br />
sucht. Hier ist Berlin keine Metropole<br />
mehr, die einen zwingt, sich zu ihr zu<br />
verhalten, hier macht ein Autor die Stadt<br />
seinem Blick untertan und will restlos in<br />
ihr aufgehen: „Ich bin ein rotes Blutkörperchen,<br />
die Stadt ist mein Körper.“ Eben ist<br />
übrigens „Leben“ erschienen, David Wagners<br />
fiktionalisierter Bericht von einer Lebertransplantation<br />
mit Nahtoderfahrung.<br />
(David Wagner: „Leben“; Rowohlt, Reinbek<br />
2013; 288 Seiten, 19,95 Euro.) Jetzt geht<br />
es ganz um den Körper des Erzählers – eines<br />
Erzählers, der auch hier manchmal gebieterisch<br />
Aufmerksamkeit für seine Wahrnehmung<br />
verlangt.<br />
***<br />
Klaus Bittermann, ein Kreuzberger aus<br />
Kulmbach und großer Kleinverleger („Edition<br />
Tiamat“) hat auch Sensibilität, glaubt<br />
aber nicht wirklich, dass sie in Berlin viel<br />
bringt. Seine Kreuzberger Szenen strahlen<br />
Sensibilitäts-Defätismus aus. Die Texte<br />
sind frei von Raffinesse, sie führen Gesten<br />
eines achselzuckenden posthysterischen<br />
Aufgebens vor: Kann man nichts machen!<br />
(Klaus Bittermann: „Möbel zu Hause, aber<br />
kein Geld für Alkohol: Kreuzberger Szenen“;<br />
Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2013;<br />
164 Seiten, 8,99 Euro.) Junger Türke verprügelt<br />
Freundin im Schwimmbad – Security<br />
rettet sie – das Mädchen ruft: „Hey, ihr<br />
Schweine, lasst meinen Freund los!“ Kann<br />
man nichts machen. „Hamse was gegen<br />
Schwuletten?“, will der Mann im Straßencafé<br />
unvermittelt wissen. Das nervt. Kann<br />
man aber nichts machen.<br />
Hier will die Hauptstadt in Ruhe gelassen<br />
werden. Wenn du nicht zu viel von<br />
Berlin verlangst, nicht zu viel Ruhm und<br />
Sensibilitäts-Spiegelung erwartest, lässt<br />
die Stadt dich auch in Ruhe. Das ist das<br />
Schöne an Bittermanns Berlin: Es sitzt einfach<br />
neben dir im Schrebergarten auf der<br />
Bank, zischt ein Bier mit dir und macht<br />
keine großen Worte. In Bittermanns Personenregister<br />
kommt Bowie nicht vor.<br />
ROBIN D E TJE<br />
lebt als Autor, Übersetzer und<br />
Performancekünstler in Berlin<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 135<br />
253 S., 10 Ktn. Geb. € 19,95<br />
ISBN 978-3-406-64664-5<br />
„Kermani ist, bei aller literarischen<br />
Bildung, ein poetischer<br />
Kopf. Das zeichnet ihn aus<br />
– und verschafft uns faszinierende<br />
Einblicke.“<br />
Literaturen<br />
544 S., 12 Abb., 1 Kte. Geb. € 24,95<br />
ISBN 978-3-406-64522-8<br />
„Meisterhaft erzählt – mit<br />
Überraschungseffekten, die<br />
vom Autor eines Kriminalromans<br />
stammen könnten.“<br />
Rudolf Neumaier, SZ<br />
C.H.BECK<br />
WWW.CHBECK.DE
136 <strong>Cicero</strong> 4.2013
D I E L E T Z T E N 2 4 S T U N D E N | S A L O N |<br />
Sterben, ein Scheißdreck<br />
Die Autorin Sibylle Berg verbringt ihre letzten 24 Stunden im<br />
Tessin, in einem Waldstück über Tegna, von der Sonne beschienen,<br />
und ärgert sich noch einmal tüchtig über sich selbst<br />
FOTO: PETER PEITSCH/PEITSCHPHOTO.COM [M]<br />
I<br />
CH WEISS NICHT, was das ist, Tod.<br />
Ich war noch nicht tot. Wie alle,<br />
die noch nicht gestorben sind,<br />
habe ich nur eine Idee. Meine ist, dass der<br />
Tod sich vielleicht so anfühlt wie die Zeit<br />
vor der Geburt. Also nichts ist da. Ein absolutes,<br />
allgleiches Nichts.<br />
Wenn wir nicht selbstbestimmt sterben<br />
können – was ja immer noch keine<br />
Option ist, es aber unbedingt sein<br />
müsste –, ist die Idee des letzten Tages<br />
ein Quatsch. Ich bin absolut und uneingeschränkt<br />
für das Recht, selbstbestimmt<br />
zu sterben und die dazu nötigen Mittel in<br />
der Apotheke erwerben zu können.<br />
Dann möchte ich gerne im Tessin<br />
sterben, in einem Waldstück über Tegna,<br />
ein wenig von der Sonne beschienen und<br />
zusammen mit meinem geliebten Menschen.<br />
Musik ist mir nicht wichtig, es<br />
sollte nur bitte nicht regnen. Aber wenn<br />
ich es mir aussuchen kann – und ich bin<br />
mir sicher, Sie können mir den Wunsch<br />
erfüllen –, möchte ich vielleicht eher gar<br />
nicht sterben und miterleben, was mit<br />
der Welt weiter passiert. Vielleicht wird<br />
es einmal eine völlige Gleichberechtigung<br />
aller Geschlechter geben? Vielleicht werden<br />
großartige Dinge erfunden, die Menschen<br />
500 Jahre alt werden lassen (dann<br />
würde das Anhäufen von Milliarden<br />
Vor S ibylle B erg braucht man<br />
keine Angst zu haben. Zumindest<br />
behauptet sie das von sich<br />
selbst. Die in Weimar geborene<br />
Erfolgsautorin lebt heute in Zürich<br />
und schreibt Romane, Theaterstücke,<br />
Essays und Kolumnen. Gerade<br />
ist sie mit Regiearbeiten in<br />
den USA beschäftigt.<br />
www.cicero.de/24stunden<br />
endlich sinnvoll und nicht obszön sein).<br />
Ach, Sterben ist ein Scheißdreck.<br />
Es gibt nichts, was noch ein letztes<br />
Mal gemacht, gedacht oder ausgesprochen<br />
werden müsste. Was man bis<br />
zum Ende nicht gemacht, gedacht oder<br />
ausgesprochen hat, ist dann auch nicht<br />
mehr wichtig. Wem sollte ich auch etwas<br />
beichten? Und das Entschuldigen für<br />
Unachtsamkeiten erledige ich ebenfalls<br />
lieber jetzt.<br />
Die absolut unangenehme Idee der<br />
Vergänglichkeit versuche ich immer mit<br />
einzubeziehen. In jeder Sekunde, bei allem,<br />
was ich tue. Es gelingt nicht immer.<br />
Vorbereiten kann man sich auf so<br />
was schlecht, vielleicht bei einer langen<br />
Krankheit, aber da fehlt mir die Erfahrung.<br />
Einmal hatte ich einen Unfall mit<br />
klinischem Tod. Sagt man das so? Das<br />
kam völlig unerwartet und war nicht besonders<br />
schrecklich.<br />
Ab und zu habe ich Eitelkeitsattacken,<br />
ärgere mich über angebliche Missachtung<br />
und sehe mir doch dabei zu und<br />
finde mich lächerlich. Im Allgemeinen<br />
versuche ich aber, mich immer mit Güte<br />
zu behandeln. Einer muss das ja erledigen.<br />
Ich bin sehr nachsichtig mit mir. Ich<br />
habe ein sehr schönes, sehr angenehmes<br />
Leben. Ich habe viel Glück gehabt, mit<br />
dem Ort meiner Geburt und mit meiner<br />
Gesundheit. Den Rest habe ich selber zu<br />
verantworten.<br />
Die Menschen verbessern zu wollen,<br />
war eine irrsinnige Arroganz, die meiner<br />
Jugend geschuldet war. Wer bin ich, jemanden<br />
erziehen zu können? Ich ärgere<br />
mich immer noch über nicht zu Ende<br />
Gedachtes, über Arroganz, Dummheit,<br />
über Religionen und deren Sexismus.<br />
Ich ärgere mich über das Elend, das wir<br />
uns selbst bereiten, und über mich, dass<br />
mich das alles ärgert. Darüber ärgere ich<br />
mich auch.<br />
Aufgezeichnet von Sarah-Maria Deckert<br />
4.2013 <strong>Cicero</strong> 137
C I C E R O | P O S T S C R I P T U M<br />
Widerstand<br />
VON A LEXANDER M A R G U IER<br />
H<br />
EUTE SCHON DAGEGEN GEWESEN? Wenn nicht, wird<br />
es jetzt aber höchste Zeit! Es gibt schließlich immer<br />
und überall etwas, wogegen es sich lohnt zu protestieren:<br />
Atomkraft oder die Energiewende, Fleischkonsum oder<br />
Vegetarismus, Autoverkehr oder Geschwindigkeitsbegrenzungen,<br />
Sexismus oder Prüderie. Gemessen an den Empörungswellen,<br />
die inzwischen im Wochenrhythmus durch unser Land rollen,<br />
muss früher wirklich alles besser gewesen sein. Beziehungsweise<br />
umgekehrt, denn die Tatsache, dass immer mehr Menschen<br />
ihr Wort erheben und ihre Unzufriedenheit mit den bestehenden<br />
Verhältnissen artikulieren, ist ja eigentlich ein Fortschritt:<br />
Anstatt in stiller Anerkennung der eigenen Machtlosigkeit<br />
irgendwelche sinnlosen Hobbys zu pflegen, steigt der moderne<br />
Bürger schnell mal auf die Barrikaden. Ich finde es prinzipiell<br />
begrüßenswert, wenn erwachsene Männer, die sich vor 20 Jahren<br />
vielleicht noch ihre Zeit mit Modelleisenbahnen im Keller<br />
vertrieben hätten, heute rausgehen auf die Straße, um beispielsweise<br />
gegen veritable Bahnhofsprojekte zu demonstrieren.<br />
Für Frauen gilt das natürlich ganz genauso, weshalb sie aufpassen<br />
müssen, nicht schon wieder von Anfang an ins Hintertreffen<br />
zu geraten: Einer Studie des Göttinger Politologen Franz<br />
Walter zufolge ist der typische Wutbürger nämlich männlich,<br />
Mitte vierzig bis Mitte sechzig, wohlsituiert und akademisch<br />
gebildet. Was wiederum, so Walter, demokratiegefährdend sei,<br />
weil die gesellschaftlichen Debatten neueren Datums von eben<br />
dieser spezifischen Schicht dominiert würden. Wahrscheinlich<br />
brauchen wir bald eine Wutbürger-Quote, um diesen Tendenzen<br />
Einhalt zu gebieten. Der ubiquitäre Aufschrei darf keine<br />
Veranstaltung für besserverdienende Männer im fortgeschrittenen<br />
Alter bleiben; er ist vielmehr eine gesamtgesellschaftliche<br />
Angelegenheit. Sonst gerät die Sache aus dem Lot.<br />
Ich möchte daher an alle Bewohner dieses Landes, insbesondere<br />
auch an jüngere Nichtakademikerinnen, appellieren,<br />
Widerstand zu leisten. Dass es nicht immer ganz einfach<br />
ist, die innere Trägheit zu überwinden, weiß ich aus eigener Erfahrung:<br />
Meine letzte Teilnahme an einer Demonstration liegt<br />
mittlerweile mehr als zwei Dekaden zurück – damals ging es um<br />
den Golfkrieg. Und es ist wahrlich nicht so, dass ich mich seither<br />
über nichts anderes mehr geärgert hätte!<br />
Die gute Nachricht: Für notorische Widerstandsmuffel wie<br />
mich gibt es inzwischen allerlei Ratgeberliteratur. Allein schon<br />
der Verkaufserfolg von Stéphane Hessels „Empört Euch!“-Brevier<br />
hat deutlich gezeigt, wie groß hierzulande der Nachholbedarf<br />
an innerer Aufwallung ist. Wer es etwas ausführlicher haben<br />
möchte, dem sei das soeben erschienene Buch „Selbst denken“<br />
des Sozialpsychologen Harald Welzer empfohlen, es trägt den<br />
verheißungsvollen Untertitel „Eine Anleitung zum Widerstand“.<br />
Sollten Ihnen die 290 Seiten dann aber doch als zu voluminös<br />
erscheinen (George Bernard Shaw kam für sein „Handbuch des<br />
Revolutionärs“ mit weniger als der Hälfte an Umfang aus), weil<br />
Sie die Zeit lieber zum Selbstdenken nutzen wollen, dann werfen<br />
Sie zumindest einen kurzen Blick auf „12 Regeln für erfolgreichen<br />
Widerstand“, die Harald Welzer am Ende seines Werkes<br />
aufgelistet hat. Regel Nummer vier zum Beispiel lautet: „Hören<br />
Sie auf, einverstanden zu sein“, woraus sich ganz umstandslos<br />
Regel Nummer fünf ergibt: „Leisten Sie Widerstand, sobald Sie<br />
nicht einverstanden sind.“<br />
Wenn ich als rechtschaffener Wutbürger dieses Landes nun<br />
aber auch noch Widerstand leisten soll gegen Dinge, mit denen<br />
ich eigentlich einverstanden bin (und da kommt von Rechtsstaat<br />
bis Rechtsverkehr immer noch erstaunlich viel zusammen),<br />
wird das dann mit dem Protest aller gegen alles am Ende nicht<br />
ein bisschen arg unübersichtlich?<br />
Vielleicht könnte es sich ja manchmal sogar lohnen, dem permanenten<br />
Widerstandsdruck ganz souverän zu widerstehen.<br />
A LEXANDER M A R G U IER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS; FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
138 <strong>Cicero</strong> 4.2013
MANCHMAL<br />
MUSS ES EBEN<br />
MUMM SEIN.<br />
Das Sushi-Taxi auf den Aussichtsturm<br />
bestellen. Statt eines Blind Dates<br />
gleich einen Blind Ball veranstalten.<br />
Den roten Teppich auf dem Spielfeld<br />
ausrollen. Warum einen Tisch reservie -<br />
ren, wenn es da draußen noch so viel<br />
zu entdecken gibt? Manchmal muss<br />
es eben Mumm sein.