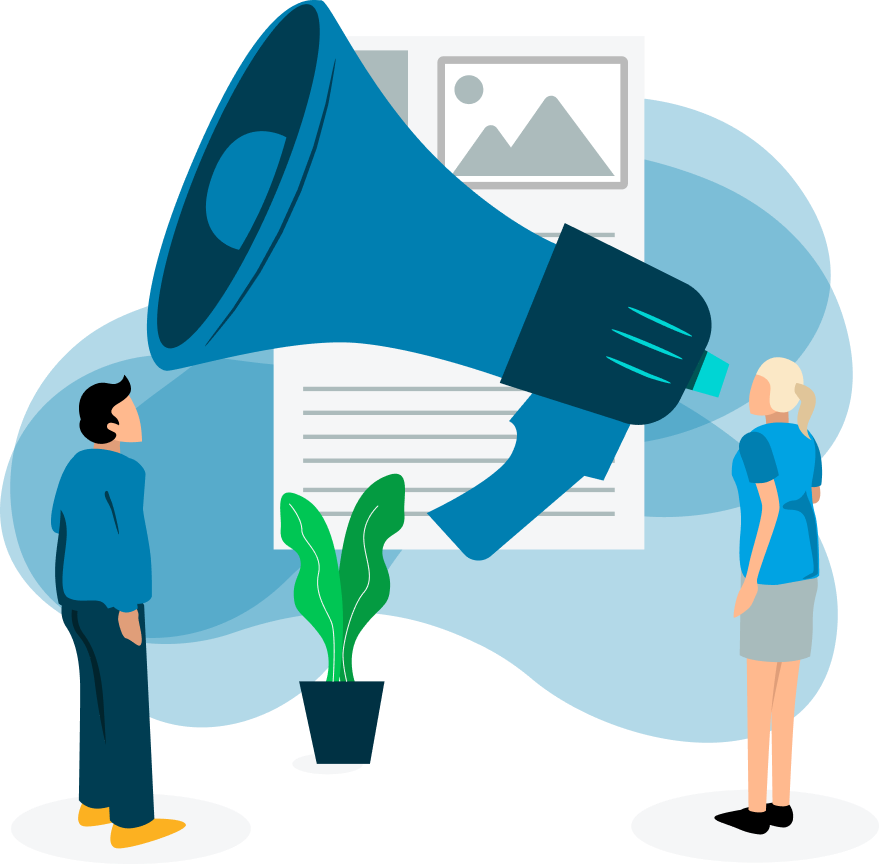Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.cicero.de<br />
September 2012<br />
8 EUR / 12,50 CHF<br />
www.cicero.de<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
über<br />
deutsche Schulen<br />
„Wir brauchen eine Revolution!“<br />
Boris Aljinovic und<br />
Dominic Raacke<br />
als Felix Stark und<br />
Till Ritter<br />
SONNTAGS, 20:15 IN BERLIN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Österreich: 8 EUR, Benelux: 9 EUR, Italien: 9 EUR<br />
Spanien: 9 EUR, Portugal (Cont.): 9 EUR, Finnland: 12 EUR
Wenigstens bin ich mir sicher,<br />
Die erste Seite<br />
was ihren Namen angeht. Sie hieß<br />
Maria Kowalenko, Mascha für ihre Freunde,<br />
und stand, als ich sie zum ersten Mal sah,<br />
auf dem Bahnsteig am Ploschad Revoluzii, dem<br />
Revolutionsplatz. Ich konnte ihr Gesicht kaum<br />
fünf Sekunden lang bewundern, da sie dann<br />
einen kleinen Make-up-Spiegel hervorkramte<br />
und hochhielt. Mit der anderen Hand setzte<br />
sie sich eine Sonnenbrille auf. (…) Ich schaute<br />
sie länger an, als es sich gehörte. (…) Ich bestieg<br />
den Zug, um eine Station weiter zur Haltestelle<br />
Puschkinskaja zu fahren, und stand unter den<br />
gelblichen Paneelen im Licht der uralten Leuchtstoffröhren,<br />
die mich jedes Mal, wenn ich mit<br />
der Metro fuhr, glauben ließen, ich sei ein<br />
Komparse in irgendeinem paranoiden Siebziger-<br />
Jahre-Film mit Donald Sutherland in der Hauptrolle.<br />
(…) Dann hörte ich sie schreien. Sie war<br />
etwa fünf Meter hinter mir und schrie nicht<br />
bloß; sie kämpfte mit einem hageren, Pferdeschwanz<br />
tragenden Mann, der ihr die Handtasche<br />
stehlen wollte (eindeutig eine gefälschte<br />
Burberry), und rief um Hilfe. (…) Anfangs habe<br />
ich nur zugesehen, aber der Mann holte mit der<br />
Faust aus, als wollte er zuschlagen, und hinter<br />
mir hörte ich jemanden brüllen, man solle doch<br />
endlich was unternehmen. Also lief ich zum<br />
Hageren und riss ihn am Kragen zurück. Er gab<br />
die Tasche auf und hieb mit den Ellbogen nach<br />
mir. Ich ließ ihn los. Sekundenschnell war alles<br />
vorbei, und ich hatte ihn nicht einmal genau<br />
zu Gesicht bekommen.<br />
»Spasibo«, sagte Mascha.<br />
›Danke.‹ Sie nahm die<br />
Sonnenbrille ab.<br />
Lesen Sie weiter…<br />
Aus dem Englischen von Bernhard Robben,<br />
288 Seiten, gebunden, € (D) 18,99<br />
Ein Buch von S. FISCHER
SONNTAGS, 20:15 IN BERLIN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens
C i c e r o | A t t i c u s<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 30. August 2012<br />
Thema: <strong>Tatort</strong>, Bundestag, Poullain, griechisches Katasteramt<br />
Lauter ungehaltene Reden<br />
Titelbild: Jan Rieckhoff; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
W<br />
er in deutschen GroSSstädten ungestört unterwegs sein möchte, der mache<br />
seine Spritztour sonntagabends nach der Tagesschau. Die Republik steht<br />
still, das Land hält inne, wenn der <strong>Tatort</strong> an die Bildschirme ruft. Die <strong>Tatort</strong>-<br />
Sommerpause ist überstanden – Anlass für <strong>Cicero</strong>, dem gesellschaftlichen Phänomen<br />
des letzten deutschen Straßenfegers auf den Grund zu gehen. Klaus Raab hat sich<br />
zu Süchtigen und Machern begeben (Seite 16). Und Anlass für eine ungewöhnliche<br />
Aktion: Das Heft erscheint mit 20 verschiedenen Titelbildern – in jeder Region mit<br />
den örtlichen Ermittlern im Porträt.<br />
Auch an einem anderen <strong>Tatort</strong> ist die Sommerpause vorüber. Der Bundestag<br />
nimmt seine Arbeit wieder auf und läutet das letzte Jahr der Legislaturperiode vor<br />
der Bundestagswahl im Herbst 2013 ein. Was für eine eigene Welt das hohe Haus<br />
der Volksrepräsentanten ist, hat Michael Frowin vor der Sommerpause erleben dürfen.<br />
Im sonstigen Leben macht sich der Kabarettist über das Schauspiel im Bundestag<br />
lustig. Für zehn Tage verwandelte er sich nun in einen <strong>Cicero</strong>-Reporter, begab sich auf<br />
Expedition ins Plenum und staunte nicht schlecht (Seite 52).<br />
Manchmal hilft es im Leben weiter, sich einfach mal wieder zu melden. Es war<br />
schon lange an der Zeit und bot sich an, im Zuge des Skandals um den Bankenzins<br />
Libor eine kleine Mail an Ludwig Poullain zu schreiben und ihn nach seinem<br />
Befinden und seiner Meinung zur Lage zu fragen. Poullain antwortete prompt und<br />
hängte unverbindlich einen Text an, den er „nur l’art pour l’art, nur für mich, ohne<br />
Fremdzweckbestimmung“ geschrieben habe.<br />
Das machte neugierig. Der Grandseigneur der deutschen Bankenwelt hatte<br />
vor acht Jahren mit einer „Ungehaltenen Rede eines ungehaltenen Mannes“<br />
schon einmal Furore gemacht. Sein Manifest gegen den Sittenverfall der Banken,<br />
seinerzeit abgedruckt in der FAZ, klingt bis heute nach. Auch Poullains neuerliche<br />
Wortmeldung, diesmal in <strong>Cicero</strong> (Seite 90), hat es in sich.<br />
Ins Gericht geht die Fast-Bundespräsidentin Gesine Schwan mit dem Schließlichdoch-Bundespräsidenten<br />
Joachim Gauck, und der frühere Verfassungsrichter Hans<br />
Hugo Klein wagt eine Prognose, wie seine Kollegen in Karlsruhe wohl über den<br />
Rettungsschirm ESM abstimmen werden (Seite 94).<br />
Der Ursache für diesen Riesenrettungsschirm ist Richard Fraunberger<br />
nachgegangen. Seine Odyssee auf der Suche nach dem griechischen Katasteramt<br />
(Seite 76) treibt die Tränen in die Augen – Lachtränen und Tränen der Wut.<br />
Mit besten Grüßen<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
sein Herz ausgeschüttet<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 3
C i c e r o | I n h a l t<br />
Titelthema<br />
16<br />
In mörderischer Gesellschaft<br />
Eine Ermittlung über den <strong>Tatort</strong> als Massenphänomen<br />
von Klaus Raab<br />
30<br />
20 Städte – 20 Cover<br />
Von Kiel bis zum Bodensee: <strong>Cicero</strong> in allen Varianten<br />
von Jan Rieckhoff und Karoline Kuhla<br />
36<br />
War nicht alles schlecht<br />
Was den Polizeiruf 110 vom <strong>Tatort</strong> unterscheidet<br />
von Matthias Dell<br />
28<br />
„Es ist alles zu korrekt“<br />
Der <strong>Tatort</strong>-Ermittler aus Kiel und sein Bonanza-Gefühl<br />
Interview mit Axel Milberg<br />
32<br />
„Ihr quatscht alles kaputt“<br />
Ein Dramolett über die Nöte eines <strong>Tatort</strong>-Autors<br />
von Peter Probst<br />
38<br />
Ach ja, die Quote …<br />
Ein Ex-<strong>Tatort</strong>-Kommissar beklagt mutlose TV‐Macher<br />
von Gregor Weber<br />
Illustration: Wieslaw Smetek<br />
4 <strong>Cicero</strong> 9.2012
I n h a l t | C i c e r o<br />
Soll Joachim Gauck die Krisenpolitik<br />
der Kanzlerin erklären?<br />
56 76<br />
90<br />
Wem gehört hier was? Auf der Suche<br />
nach dem griechischen Katasteramt<br />
Auf tönernen<br />
Füßen: Soll<br />
Deutschland<br />
den Euro<br />
verlassen?<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE kapital<br />
40 | Der Mutant<br />
Peter Müller muss sich an die rote Robe<br />
des Verfassungsrichters noch gewöhnen<br />
Von Benno Stieber<br />
62 | Chiles Vorzeigefrau<br />
Michelle Bachelet streitet<br />
für Frauen in aller Welt<br />
Von Carlos Widmann<br />
82 | Kläger mit Leseschwäche<br />
Charles Schwab kämpft im Libor-<br />
Skandal gegen das Finanzestablishment<br />
Von Moritz Küpper<br />
42 | Wolfgang und ich<br />
Wie Ingeborg Schäuble ihr Leben<br />
in den Dienst von anderen stellt<br />
Von Georg Löwisch<br />
64 | Merkels letzter Verbündeter<br />
Der niederländische Premier Mark<br />
Rutte bangt um seine Wiederwahl<br />
Von Rob Savelberg<br />
84 | Der Weichmacher<br />
Sein Vater erfand den Brita-Filter,<br />
Markus Hankammer modernisiert ihn<br />
Von Lenz Jacobsen<br />
Fotos: Steffi Loos/DAPD, Bruno Perousse/Hoaqui/Laif; Illustrationen: Robert Zimmermann, Christoph Abbrederis<br />
44 | PreuSSen im Shitstorm<br />
Hermann Parzinger, Chef der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz, in der Kritik<br />
Von Alexander Marguier<br />
48 | „Ja, ich habe beschnitten“<br />
Plädoyer für das Ritual der Circumcision<br />
Von Adriana Altaras<br />
49 | Gleiche Regeln für alle<br />
Beschneidung ist Körperverletzung<br />
Von Philipp Blom<br />
52 | Bonbons mit Bundesadler<br />
Wie ein Kabarettist im Reichstag<br />
den politischen Alltag erlebte<br />
Von Michael Frowin<br />
56 | Was der Bundespräsident<br />
jetzt tun sollte<br />
Ein paar kritische Anmerkungen zur<br />
<strong>Am</strong>tsführung von Joachim Gauck<br />
Von Gesine Schwan<br />
59 | Frau Fried fragt sich …<br />
… ob es ihrer Gesundheit zuträglich<br />
ist, sich an Bibelworte zu halten<br />
Von <strong>Am</strong>elie Fried<br />
60 | Zwei Deutsche Sittenbilder<br />
Im Gegensatz zur Politik ist bei Banken<br />
das Prinzip Verantwortung unbekannt<br />
Von Frank A. Meyer<br />
66 | Krieg der Pinocchios<br />
Henrique Capriles Radonski strebt<br />
nach der Macht in Venezuela<br />
Von Karen Naundorf<br />
68 | Korrupte KAder<br />
Was steckt wirklich hinter den<br />
politischen Verwerfungen in Rumänien?<br />
Von Keno Verseck<br />
71 | Rumänisch-ungarische<br />
lektionen<br />
Den beiden EU-Staaten gehört<br />
der Geldhahn zugedreht<br />
Von Alexander Graf Lambsdorff<br />
72 | „Europa muss<br />
mäSSigend einwirken“<br />
Rumänien macht Rückschritte – aber<br />
wir dürfen das Land nicht aufgeben<br />
Von Peter Maffay<br />
76 | Der Kern des Chaos<br />
Auf der Suche nach dem<br />
griechischen Katasteramt<br />
Von Richard Fraunbeger<br />
86 | Superhelden mit<br />
Migrationshintergrund<br />
Naif Al-Mutawa hat für seine Söhne<br />
eine muslimische Comicserie entwickelt<br />
Von Til Knipper<br />
90 | Weiterhin ungehalten<br />
Ein alter Bankier rügt die Kanzlerin<br />
und fordert Deutschlands Euroaustritt<br />
Von Ludwig Poullain<br />
96 | Der Systembruch<br />
Prognose eines ehemaligen Richters zum<br />
anstehenden Karlsruher ESM-Urteil<br />
Von Hans Hugo Klein<br />
98 | Streit beim Panzerbauer<br />
Die KMW-Eignerfamilien liegen im<br />
Zwist – ein Blick hinter die Kulissen<br />
Von Hauke friederichs<br />
102 | Verdi geht in die Kirche<br />
Die Gewerkschaft kämpft gegen das<br />
Sonderarbeitsrecht der Kirchenmitarbeiter<br />
Von Ludwig Greven<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 5
C i c e r o | I n h a l t<br />
cicero online<br />
Salon<br />
104 | die ganze Wahrheit<br />
Alan Hollinghurst soll das schönste<br />
Englisch der Welt schreiben<br />
Von Daniel Schreiber<br />
106 | Lettische Erdbeeren<br />
Die Mezzosopranistin Elīna Garanča<br />
hat gelernt, sich selbst zu retten<br />
Von Eva gesine Baur<br />
128 | Das Opernhaus im Urwald<br />
Provinz mit Weltklasse: Niederbayerns<br />
Kulturwald-Festival sorgt für Furore<br />
Von Eva gesine baur<br />
128<br />
Im Bayerischen<br />
Wald spielt nun<br />
auch die Musik<br />
132 | Bibliotheksporträt<br />
Zu Besuch bei Rainer Moritz, dem Leiter<br />
des Hamburger Literaturhauses<br />
Von Claudia Rammin<br />
Aktuell:<br />
Frage des Tages<br />
Wie steht es um den Abzug<br />
der Truppen aus Afghanistan?<br />
Ist die Beschneidung Teil<br />
der Religionsfreiheit? Jeden<br />
Morgen beantworten wir<br />
Ihnen Fragen zu einem<br />
aktuellen Thema.<br />
www.cicero.de<br />
Debatte:<br />
Religion und Gesellschaft<br />
Die katholische Kirche<br />
steckt in einer Glaubenskrise,<br />
in Deutschland tobt eine<br />
Beschneidungs-Debatte.<br />
Welche Bedeutung hat<br />
die Religion heute noch<br />
für das gesellschaftliche<br />
Zusammenleben?<br />
www.cicero.de/dossier/<br />
religion-und-gesellschaft<br />
108 | Über Vampirbücher<br />
und virtuellen Sex<br />
Der Literaturagent Andrew Wylie kämpft<br />
gegen den Untergang der Hochkultur<br />
Von Huberta von Voss<br />
112 | Prechts Prolog<br />
Warum Deutschland eine noch nie da<br />
gewesene Bildungsrevolution braucht<br />
Von Richard David Precht<br />
114 | Europa, enges Land<br />
Napoleons Russlandfeldzug wirft bis<br />
heute weltgeschichtliche Schatten<br />
Von Konstantin Sakkas<br />
122 | Benotet<br />
In der Hollywood Bowl werden<br />
Träume wahr, auch wenn es regnet<br />
Von Daniel Hope<br />
124 | Man sieht nur, was man sucht<br />
Schon Pieter Bruegel wusste, dass es<br />
schlecht bestellt ist um das Abendland<br />
Von Beat Wyss<br />
126 | Küchenkabinett<br />
Die großen Religionen sorgen auch<br />
in der Küche für kleine Einschnitte<br />
Von Thomas Platt und Julius grützke<br />
136 | Das Schwarze sind die Buchstaben<br />
Der Iran liegt näher an Deutschland,<br />
als man gemeinhin denkt<br />
Von Robin Detje<br />
138 | Die letzten 24 Stunden<br />
Warum sich ein Komiker vor seinem Tod<br />
noch mit Heinz Buschkowsky versöhnt<br />
Von Kurt Krömer<br />
Standards<br />
Atticus —<br />
Von Christoph Schwennicke — seite 3<br />
Forum — seite 10<br />
Impressum — seite 11<br />
Stadtgespräch — seite 12<br />
Postscriptum —<br />
Von Alexander Marguier — seite 140<br />
Die nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 27. September 2012<br />
Die Deutschen und ihr Glaube:<br />
Wie halten wir es mit der Religion?<br />
Unterhaltsam: Die<br />
cicero-Online-Mediathek<br />
Neben unserer Karikatur des<br />
Tages finden Sie dort aktuelle<br />
Bildergalerien und Videos.<br />
www.cicero.de/mediathek<br />
Interaktiv:<br />
Die <strong>Cicero</strong>-Online-Umfrage<br />
Wer soll Kanzlerkandidat<br />
der SPD werden? Brauchen<br />
wir eine Reichensteuer? Wir<br />
fragen, Sie antworten.<br />
www.cicero.de<br />
Fotos: Kulturwald festspiele Bayrischer Wald, Gerard Klijn/Joker; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
6 <strong>Cicero</strong> 9.2012
IHRE EXKLUSIVE<br />
AUSZEIT AUF SEE<br />
Neu ab<br />
Mai 2013<br />
Seit mehr als 120 Jahren setzen wir mit unseren Schiffen immer wieder die<br />
Maßstäbe für luxuriöse Seereisen. So vereint die neue EUROPA 2 Exklusivität<br />
und höchstes Niveau mit einer modernen und legeren Atmosphäre. Exzellent<br />
ausgestattete Suiten für jeden Anspruch, ein großes Fitness und Wellness -<br />
angebot, abwechslungsreiche kulinarische Genussmomente in acht Restaurants<br />
und vielfältiges Entertainment – das alles erwartet Sie an Bord der EUROPA 2.<br />
Genießen Sie Ihre exklusive Auszeit auf See. Für weitere Informationen<br />
schicken Sie eine E-Mail an prospekte@hlkf.de, rufen Sie gebührenfrei an<br />
unter 0800 2255556 mit dem Kennwort HL1205105, oder bestellen Sie<br />
unsere Kataloge direkt unter www.hlkf.de/HL1205105.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro und auf www.hlkf.de
SOUVERÄNITÄT KÖNNEN WIR NICHT<br />
ABER SIE KÖNNEN SIE ERFAHREN.<br />
Ein Automobil, dessen souveräne Leistung und elegante Exklusivität weit über das Gewohnte hinausgehen. Und<br />
das auch abseits der Straße Erwartungen übertrifft – mit einem exklusiven Kundenbetreuungsprogramm, das<br />
seinesgleichen sucht. Mehr über den neuen BMW 7er und den BMW Excellence Club unter www.bmw.de/7er<br />
DER NEUE BMW 7er.<br />
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 12,9–5,6. CO 2 -Emission in g/km (kombiniert): 303–148.<br />
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Der neue BMW 7er<br />
www.bmw.de/7er<br />
Freude am Fahren<br />
ERKLÄREN,
C i c e r o | L e s e r b r i e f e<br />
Forum<br />
Diesmal geht es um Zeit, Bücher, Europa und Märchenerzähler<br />
„Es lohnt sich.“ Fragt sich bestenfalls<br />
für wen, oder war es gar versteckter<br />
Zynismus?<br />
Hartmut Leubachert, per E-Mail<br />
zum Titelthema „Keine Zeit“<br />
August 2012<br />
Totschläger?<br />
Es ist schon kurios: Da widmen Sie – vermutlich – zusammengenommen viele<br />
Monate Recherchearbeit dem „göttlichen“ Thema Zeit, stellen Beiträge dazu unter<br />
den unterschiedlichsten Gesichtspunkten zusammen – und dann hat man den<br />
Eindruck, dass Sie mit einem einzigen Wort alles wieder zunichtemachen. Was um<br />
Himmels willen hat Sie bewogen, einerseits über die „knappste Ressource der Welt“<br />
zu sinnieren und andererseits Tipps zu geben zum „Zeittotschlagen“? … Schon<br />
Rilke war verstört über den Begriff „Zeit vertreiben“, und Sie wollen die Zeit sogar<br />
totschlagen?<br />
Dieter Bähre, Ibbenbüren<br />
Gute Alte Zeit<br />
gute alte zeit<br />
was war schon gut an dieser zeit<br />
weißt du noch<br />
früher war alles besser<br />
es war die zeit, als spinat noch eisen<br />
enthielt<br />
kleinkinder wurden als paket verschnürt<br />
große kinder hatten ehrfurcht vor den<br />
erwachsenen<br />
alte leute starben rechtzeitig<br />
gute alte zeit<br />
gut, dass sie vorbei ist<br />
Auch wenn ich nicht mit allen Ihren<br />
Aussagen einverstanden bin: ein wichtiges<br />
Thema, ein wichtiges Magazin,<br />
weiter so!<br />
Nachdenkliche Zeitgrüße<br />
Ernst Link, Biebergemünd<br />
zum Interview „Zeit gibt es<br />
nicht“ mit franz Müntefering/<br />
August 2012<br />
Versteckter Zynismus<br />
Als Abonnent erwarte ich von <strong>Cicero</strong>,<br />
gemäß Ihrem Namensgeber, Scharfsinn<br />
und Kompetenz, auch und vor<br />
allem in politischen Fragestellungen. In<br />
vieler Hinsicht bin ich diesbezüglich<br />
positiv überrascht; in puncto „Euro<br />
und Europa“ bin ich jedoch geradezu<br />
enttäuscht von der, entschuldigen Sie,<br />
billigen Mainstreammeinung, die Sie zu<br />
Papier bringen. Der Gipfel, und das ist<br />
symptomatisch für den ganzen Europawahn,<br />
ist das Interview mit Müntefering,<br />
der als einziges Pro für die unsäglichen<br />
Schulden, Verwerfungen, unnötigen<br />
Gefahren und Lasten für die nächsten<br />
fünf Generationen nur sagen kann:<br />
zu den beitrÄgen über europa<br />
und Eurokrise/August 2012<br />
Ungenutzte Zeit<br />
So wie es heute aussieht, ist Europa<br />
weiter denn je davon entfernt, eine<br />
demokratisch verfasste, politisch global<br />
einflussreiche Kraft zu sein. Trotz der<br />
vorgeblichen Beschleunigung der politischen<br />
und wirtschaftlichen Prozesse<br />
hat Europa dafür sehr viel Zeit gehabt<br />
und vertan … Dabei wäre und ist gerade<br />
Deutschland seit Jahrzehnten – bei<br />
aller sinnvollen Zurückhaltung – in der<br />
Lage, ein Grundmodell einer politischen<br />
Gestaltung für ein politisch vereintes<br />
Europa „zur Verfügung“ zu stellen: ein<br />
von allen Bürgern gewähltes europäisches<br />
Parlament, das wiederum eine<br />
europäische Regierung wählt (bezogen<br />
auf die Bevölkerungsstärke nach einem<br />
Mehrheitswahlrecht) und dazu einen<br />
europäischen Rat, in dem die Regierungschefs<br />
der Mitgliedsländer Sitz und<br />
Stimme hätten) … Sicher wäre es ein<br />
durchaus komplizierter und problemhaltiger<br />
Prozess. Wenn man davon absieht,<br />
dass alle Zeichen dafür sprechen, dass<br />
genau das die aktuelle Bundesregierung,<br />
also Angela Merkel, um keinen Preis<br />
will … Der „neue“, aber „verschwiegene“<br />
Nationalismus dominiert und<br />
verhilft der Kanzlerin zu ungeahnter<br />
Popularität. So hat der rechtsradikale<br />
Nationalismus aktuell in Deutschland<br />
keine Notwendigkeit und bleibt noch<br />
politisch wirkungslos. Niemand kann<br />
heute allerdings ausschließen – siehe<br />
Frankreich und anderswo –, dass er im<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
10 <strong>Cicero</strong> 9.2012
künftigen Europa eines Tages die Richtung<br />
bestimmt.<br />
Wieland Becker, Berlin<br />
zum beitrag „Was wir verlieren“<br />
von Thomas Hettche/august 2012<br />
Zu viele Fremdworte<br />
Mal davon abgesehen, dass ich mich der<br />
Meinung des Autors Thomas Hettche<br />
in keinster Weise anschließen kann (wo<br />
bitte schön ist der Unterschied, ob ich<br />
ein Buch lese oder genau dasselbe Buch<br />
auf meinem iPad oder Kindle?), habe<br />
ich den Artikel nicht verstanden. Ist ja<br />
wunderbar, dass der Autor ein berühmter<br />
Schriftsteller ist, aber ist es dann<br />
seine Pflicht, möglichst viele Fremdwörter<br />
aneinanderzureihen? Danke dennoch<br />
für eine wirklich gute Ausgabe, die ich<br />
sehr gerne gelesen habe.<br />
Anna Fischer, St. Georgen (Schwarzwald)<br />
zum beitrag „Natos neue Kleider“<br />
von Florence Gaub/August 2012<br />
Hans christian Grimm<br />
„Des Kaisers neue Kleider“ ist kein<br />
Grimmsches Märchen, sondern ein<br />
Märchen von H. C. Andersen. Das sollte<br />
man eigentlich auch als <strong>Am</strong>erikanerin<br />
wissen, denn sowohl die Märchen der<br />
Brüder Grimm wie die von H. C. Andersen<br />
gehören zur Weltliteratur. So, wie<br />
man als Deutscher wissen sollte, dass<br />
„Tom Sawyer und Huckleberry Finn“<br />
nicht von Hemingway ist. Im Übrigen:<br />
Ich bin erst seit einem knappen Jahr<br />
Ihre Leserin, freue mich aber auf jedes<br />
neue Heft.<br />
Elfriede Müller-Wiener, Darmstadt<br />
(Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
Coverwahl<br />
Zwölf Variationen unseres Illustrators Wieslaw<br />
Smetek zum Titelthema „Zeit“ standen zur<br />
Auswahl. Die Mehrheit unserer Leserinnen und<br />
Leser entschied sich per Online-Umfrage für<br />
die gehetzte Kreatur im Uhren-Hamsterrad –<br />
wie die Redaktion. Der Frauenkopf vor<br />
Renaissance-Landschaft belegte Platz zwei.<br />
verleger Michael Ringier<br />
chefredakteur Christoph Schwennicke (V.i.S.d.P.)<br />
Stellvertreter des chefredakteurs<br />
Alexander Marguier<br />
Redaktion<br />
Textchef Georg Löwisch<br />
Ressortleiter Judith Hart (Weltbühne), Til Knipper<br />
(Kapital), Daniel Schreiber (Salon), Constantin Magnis<br />
(Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
politischer Chefkorrespondent Hartmut Palmer<br />
Assistenz der Chefredaktion Ulrike Gutewort<br />
Publizistischer Beirat Dr. Michael Naumann (Vorsitz),<br />
Heiko Gebhardt, Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer,<br />
Jacques Pilet, Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
Art director Kerstin Schröer<br />
Bildredaktion Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
Produktion Utz Zimmermann<br />
Verlag<br />
verlagsgeschäftsführung<br />
Rudolf Spindler<br />
Leitung Vertrieb u. unternehmensentwicklung<br />
Thorsten Thierhoff<br />
Objektleitung Tina Krantz, Anne Sasse<br />
Redaktionsmarketing Janne Schumacher<br />
Abomarketing Mark Siegmann<br />
kommunikation André Fertich<br />
Tel.: +49 (0)30 820 82-517, Fax: -511<br />
E-Mail: presse@cicero.de<br />
grafik Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
zentrale dienste Erwin Böck, Stefanie Orlamünder,<br />
Ingmar Sacher<br />
herstellung Lutz Fricke<br />
druck/litho Neef+Stumme, Wittingen<br />
nationalvertrieb DPV Network GmbH, Hamburg<br />
leserservice DPV direct GmbH, Hamburg<br />
Hotline: +49 (0)1805 77 25 77*<br />
Anzeigenleitung (verantwortlich)<br />
Jens Kauerauf, Gruner+Jahr AG & Co KG<br />
<strong>Am</strong> Baumwall 11, 20459 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 3703-3317, Fax: -173317<br />
E-Mail: kauerauf.jens@guj.de<br />
Service<br />
Liebe Leserin, lieber leser,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
abonnement und nachbestellungen:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: +49 (0)1805 77 25 77*<br />
Telefax: +49 (0)1805 861 80 02*<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
Anregungen und Leserbriefe:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen Bearbeitung<br />
einverstanden. *0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min.<br />
aus dem Mobilfunk. **Preise inkl. gesetzlicher MwSt und Versand im Inland, Auslandspreise<br />
auf Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das<br />
Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
verkaufsbüro gruner+jahr ag & co KG<br />
Verkaufsbüro Nord – Berlin: Kurfürstendamm 182<br />
10707 Berlin, Tel.: +49 (0)30 25 48 06-50, Fax: -51<br />
Verkaufsbüro Nord – Hamburg: Stubbenhuk 10<br />
20459 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 3703-2201, Fax: -5690<br />
Verkaufsbüro Nord – Hannover: <strong>Am</strong> Pferdemarkt 9<br />
30853 Langenhagen, Tel.: +49 (0)511 76334-0, Fax: -71<br />
Verkaufsbüro West: Heinrichstraße 24<br />
40239 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)211 61875-0<br />
Fax: +49 (0)211 61 33 95<br />
Verkaufsbüro Mitte: Insterburger Straße 16<br />
60487 Frankfurt, Tel.: +49 (0)69 79 30 07-0<br />
Fax: +49 (0)69 77 24 60<br />
Verkaufsbüro Süd-West: Leuschnerstraße 1<br />
70174 Stuttgart, Tel.: +49 (0)711 228 46-0, Fax: -33<br />
Verkaufsbüro Süd: Weihenstephaner Straße 7<br />
81673 München, Tel.: +49 (0)89 4152-252, Fax: -251<br />
anzeigenverkauf buchverlage<br />
Thomas Laschinski, Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
E-Mail: advertisebooks@laschinski.com<br />
anzeigenverkauf online<br />
Kerstin Börner, Tel.: +49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
E-Mail: anzeigen@cicero.de<br />
verkaufte auflage 82 954 (2. Quartal 2012)<br />
LAE 2012 93 000 Entscheider<br />
reichweite 390 000 Leser<br />
gründungsherausgeber Dr. Wolfram Weimer<br />
<strong>Cicero</strong> erscheint in der<br />
ringier Publishing gmbh<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de, www.cicero.de<br />
redaktion Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
verlag Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
eine publikation der ringier gruppe<br />
einzelpreis<br />
D: 8,- €, CH: 12,50 CHF, A: 8,- €<br />
jahresabonnement (zwölf ausgaben)<br />
D: 84,- €, CH: 132,- CHF, A: 90,- €**<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,- €, CH: 108,- CHF, A: 72,- €**<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 11
C i c e r o | S t a d t g e s p r ä c h<br />
Das Berliner Flughafendrama wird zur Komödie, eine hessische Linke rettet<br />
einem CDU-Pensionär den Wahlkreis, ein Luxemburger zensiert deutsche<br />
Politiker, und Bücher über mögliche Kanzlerkandidaten verkaufen sich nicht<br />
FLUGHAFENAUSSCHUSS:<br />
LAUTER DORFRICHTER<br />
D<br />
ER UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS<br />
des Berliner Abgeordnetenhauses,<br />
der das Desaster des Großflughafens<br />
BER untersuchen soll, wird nun bald<br />
nach der Sommerpause seine Arbeit aufnehmen.<br />
Und schon jetzt ähnelt das Projekt<br />
Heinrich von Kleists Lustspiel „Der<br />
zerbrochene Krug“. Lauter kleine Berliner<br />
Dorfrichter sollen einen Skandal aufklären,<br />
in den sie selbst oder ihre Parteifreunde<br />
verwickelt sind. Die Linkspartei saß bis<br />
September im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft<br />
und ist als brandenburgische<br />
Regierungspartei dort immer noch mit<br />
zwei Ministern vertreten. Von den Linken<br />
kritische Ausschuss arbeit zu erwarten, ist so,<br />
als würde man den Verfassungsschutz bitten,<br />
seine Verstrickungen mit dem Rechtsterror<br />
öffentlich und in Eigenregie aufzuarbeiten.<br />
Auch die SPD, Regierungspartei<br />
in Berlin und Brandenburg, wird nicht<br />
allzu viel unternehmen, um die Genossen<br />
im Aufsichtsrat, Klaus Wowereit und Matthias<br />
Platzeck, ins Schwitzen zu bringen.<br />
Die CDU wird sich koalitionstreu geben.<br />
Und selbst aus Bayern wird kein Störfeuer<br />
kommen, solange der CSU‐Verkehrsminister<br />
Peter Ramsauer seinen Staatssekretär<br />
Rainer Bomba nicht aus dem Gremium<br />
abberuft und zum Abschuss freigibt. Bleiben<br />
noch die Grünen, die überall in der<br />
Opposition sitzen. Aber nicht ihnen fiel<br />
der Ausschussvorsitz zu, sondern der Piratenpartei<br />
– die bislang mit allem auffiel,<br />
nur nicht mit politischer Expertise. Deren<br />
neuer Flughafenbeauftragter, Martin<br />
Delius, sitzt in der Klemme. Seine Partei<br />
verlangt Transparenz, sein neues <strong>Am</strong>t Verschwiegenheit.<br />
Also fragte Delius die Piraten<br />
im Internet, wie er mit geheimen Dokumenten<br />
umgehen solle. Ein weiser Tipp<br />
lautete dort: „Julian Assange (Wikileaks)<br />
als Mitarbeiter der Piraten-Fraktion einstellen<br />
und ihm politisches Asyl gewähren.“<br />
Einen Probelauf haben die Piraten<br />
schon gestartet. Sie stellten einen für die<br />
Bauherren wenig schmeichelhaften Sachstandsbericht<br />
zum BER ins Internet. Wowereit<br />
tobte – nicht etwa über die in dem<br />
Bericht kalkulierten Mehrkosten in Milliardenhöhe,<br />
sondern über den Geheimnisverrat.<br />
Inzwischen scheint festzustehen,<br />
dass der angepeilte Eröffnungstermin am<br />
17. März 2013 erneut verschoben werden<br />
muss. Der neue Airport, lästerte der Tagesspiegel,<br />
„ist auf dem besten Weg, der einzige<br />
Flughafen der Welt zu sein, den die Reisenden<br />
für lange Zeit nur auf dem Landweg<br />
erreichen können“. Die Blamage ist perfekt.<br />
Und das Lustspiel der parlamentarischen<br />
Aufarbeitung hat schon begonnen,<br />
bevor sich der Untersuchungsausschuss an<br />
die Arbeit machen konnte. ps<br />
SprachUnterricht<br />
aus Luxemburg<br />
D<br />
er luxemburgische Premierminister<br />
Jean-Claude Juncker hat<br />
zwar auch schon Lobeshymnen<br />
auf die deutsche Bundesregierung und<br />
vor allem auf Angela Merkel gesungen. In<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
12 <strong>Cicero</strong> 9.2012
gürtlerbachmann<br />
„Eine Gesellschaft<br />
braucht Regeln –<br />
die Frage ist nur<br />
wie viele?“<br />
PETER FUNK<br />
Außendienst Vertrieb bei Reemtsma<br />
Wir bei Reemtsma sind der Ansicht, dass jede Gesellschaft Regeln für den<br />
Umgang miteinander braucht. Zu viele Regeln führen jedoch schnell in<br />
eine Verbotskultur. Wir sollten nicht vergessen: Die Selbstbestimmung<br />
des Einzelnen ist ein hohes gesellschaftliches Gut. Reemtsma leistet hier<br />
seinen ganz eigenen Beitrag. So unterstützen wir zum Beispiel mit dem<br />
Reemtsma Begabtenförderungswerk die Ausbildung junger Menschen aus<br />
sozial schwachen Umfeldern. Denn Bildung ist der Schlüssel zu einem<br />
selbstbestimmten Leben. Nur so hat unsere Gesellschaft eine Zukunft.<br />
www.reemtsma.de<br />
WERTE LEBEN. WERTE SCHAFFEN.
C i c e r o | S t a d t g e s p r ä c h<br />
jüngster Zeit fällt er aber eher durch beißende<br />
Kritik auf. Erst hat die Kanzlerin in<br />
der Eurokrise via Interview ihr Fett weggekriegt.<br />
Nun nimmt sich Juncker den Vizekanzler<br />
zur Brust. In dem Buch „Kauderwelsch“<br />
(Lingen-Verlag), das dieser Tage<br />
erscheint und sich mit der Blubb-Sprache<br />
der Politik befasst, rügt Juncker die<br />
Logorrhöe von Wirtschaftsminister Philipp<br />
Rösler (FDP). Manchmal wäre „in der<br />
Politik Schweigen wirklich Gold“, seufzt<br />
Juncker da. Wie angenehm wäre doch die<br />
politisch-mediale Landschaft, wenn jeder<br />
nur dann etwas sagte, wenn er auch<br />
wirklich etwas zu sagen hat, merkt er an.<br />
„Doch zu oft wirken Mikrofone auf Politiker<br />
wie Magneten auf Metall.“ Und<br />
gelegentlich fehlten verständliche Worte.<br />
„Weil nicht verstanden werden soll. Weil<br />
nicht verstanden werden darf. Weil Verständnis<br />
nicht interessiert. Oft auch, weil<br />
nicht verstanden wird.“ Eine Aussage des<br />
deutschen Wirtschaftsministers Philipp<br />
Rösler in der Schlecker-Debatte sei hierfür<br />
ein frappierendes Beispiel: „Jetzt gilt<br />
es für die Beschäftigten – mehr als 10 000<br />
vornehmlich Frauen, einzelne Mütter und<br />
ältere Frauen – schnellstmöglich eine Anschlussverwendung<br />
selber zu finden.“ Der<br />
Begriff „Anschlussverwendung“ sei „nicht<br />
nur ein sprachliches Unding!“, wettert Polit-Sprachpapst<br />
Juncker. Er sage auch viel<br />
über das Welt-, Menschen- und Wirtschaftsbild<br />
desjenigen aus, der es verwendet.<br />
Hört sich so an, als würde sich Juncker<br />
die FDP nicht gerade als Koalitionspartner<br />
wünschen. Gut möglich, dass der wortgewaltige<br />
Euroguppenchef damit inzwischen<br />
schon wieder etwas gemeinsam mit Angela<br />
Merkel hat. swn<br />
k-FRage der SPD:<br />
Der <strong>Am</strong>azon-Check<br />
M<br />
ontag, 9 Uhr 23: Platz 190 838,<br />
Dienstag 19 Uhr 12: Platz<br />
248 294, Donnerstag 15 Uhr 23,<br />
Platz 288 523. Es sind Zahlen, die Peer<br />
Steinbrück Sorgen machen müssten. Eben<br />
erst hat sich der kantige Kandidatenkandidat<br />
via Interview in der Süddeutschen Zeitung<br />
und Schmuseporträt im Stern flächig<br />
zurückgemeldet und Aufmerksamkeit erheischt,<br />
aber an den Bücherbörsen wird er<br />
nicht besser notiert, sondern sackt weiter ab.<br />
Es ist ein wirklich gutes Buch, das der<br />
Journalist Daniel Friedrich Sturm jüngst<br />
erst über den SPD-Spitzenmann vorgelegt<br />
hat. Aber bei diesen Platzierungen<br />
von „Bestsellerrang“ zu sprechen, wie<br />
das <strong>Am</strong>azon auf seiner Homepage tut,<br />
ist schon fast ein bisschen zynisch. Der<br />
einstige Internetbücher- und heutige Allesverkäufer<br />
ist ein ganz guter Seismograf<br />
für Stimmungen. Wenn die beiden<br />
Verlage, die in diesem Herbst auch<br />
noch mit Steinbrück-Biografien auf den<br />
Markt kommen, auf diesen Seismografen<br />
blicken, dürfte ihnen blümerant werden.<br />
Ist es möglich, dass der Mann schon<br />
durch ist, der Hype vorüber?<br />
Da hilft nur ein Kandidatencheck via<br />
<strong>Am</strong>azon weiter. Also: Sigmar Gabriel: „Die<br />
Kraft einer großen Idee“, Rang 948 235.<br />
Sein Jugendwerk (jedenfalls gemessen<br />
am Cover): „Mehr Politik wagen“, Rang<br />
1 088 772. Kein wirklich überzeugender<br />
Hinweis auf großes Interesse an den Thesen<br />
des SPD-Parteichefs.<br />
Jetzt aber: Frank-Walter Steinmeier:<br />
„Mein Deutschland – Wofür ich stehe“,<br />
Rang: 57 028. Da schau her! Das war das<br />
Thesenpapier, mit dem Steinmeier seinerzeit<br />
als Kanzlerkandidat für die SPD<br />
angetreten ist. Hatte der Spiegel eben<br />
doch recht? Steinmeier ante portas? Wollen<br />
jetzt alle wissen, wie der weise Weißhaarige<br />
denkt. Weitersuchen: Frank-Walter<br />
Steinmeier: „Die Biografie“, geschrieben<br />
von Torben Lüthjen. Rang 439 291.<br />
Ein Durchmarsch ist etwas anderes.<br />
swn<br />
Rentner Riesenhuber:<br />
Urgestein mit Sitzfleisch<br />
V<br />
on wegen Rente mit 67! Der<br />
CDU-Abgeordnete Heinz Riesenhuber<br />
wird im Dezember 77.<br />
Und selbstverständlich will das parlamentarische<br />
Urgestein – er ist seit 1976 MdB<br />
und war in Helmut Kohls Kabinett Forschungsminister<br />
– bei der Wahl 2013<br />
abermals kandidieren. In seinem Wahlkreis<br />
Main-Taunus vor den Toren Frankfurts<br />
gibt es zwar ein Grummeln, weil<br />
der alte Herr partout nicht aufhören will.<br />
Aber der umtriebige Multi-Aufsichtsrat<br />
hat dafür gesorgt, dass es keinen jüngeren<br />
Erben für dieses sichere Direktmandat<br />
gibt. Zudem hat er eine unfreiwillige<br />
Wahlhelferin: die Abgeordnete Luc<br />
Jochimsen von der Linkspartei. Die nämlich<br />
dürfte, träte Riesenhuber nicht mehr<br />
an, als erste Alterspräsidentin das neu gewählte<br />
Parlament eröffnen – sie ist gerade<br />
mal drei Monate jünger als Riesenhuber,<br />
der schon 2009 Alterspräsident war und<br />
es sehr gerne auch 2013 wieder werden<br />
möchte. Der Christdemokrat, dessen Markenzeichen<br />
die stets akkurat gebundene<br />
Fliege ist, setzt darauf, dass das Grummeln<br />
seiner Parteifreunde angesichts dieser<br />
Konstellation verstummen wird: Für<br />
stramme hessische CDU-Mitglieder verkörpert<br />
Jochimsen als ehemalige Fernseh-<br />
Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks<br />
nämlich das Feindbild schlechthin.<br />
In ihrer Ära war der HR bei den Konservativen<br />
als „Rotfunk“ verschrien. Jochimsen<br />
Alterspräsidentin? Da werden aus Riesenhuber-Kritikern<br />
in der CDU ganz schnell<br />
Riesenhuber-Fans. gom<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
14 <strong>Cicero</strong> 9.2012
EIN REBELL, DER DIE WELT<br />
NICHT ÄNDERN WILL.<br />
PRODUKTION AUSSCHLIESSLICH MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN. FÜR UNS DER NÄCHSTE SCHRITT.<br />
Cleve Beaufort ist bereit, ungewöhnliche Wege einzuschlagen,<br />
wenn sie ihn seinem Ziel näher bringen: Die<br />
Herstellung von Autos nachhaltiger zu gestalten. So denkt<br />
Beaufort bei erneuerbaren Energien nicht automatisch an<br />
Sonne, Wind oder Wasser, sondern an eine nahe gelegene<br />
Mülldeponie. Eine Maßnahme, die der Atmosphäre jedes<br />
Jahr 92.000 Tonnen CO 2<br />
erspart. Mithilfe von Turbinen<br />
wird im amerikanischen BMW Werk Spartanburg Methangas,<br />
das in Verrottungsprozessen auf der Mülldeponie<br />
entsteht, in Strom und Warmwasser umgewandelt –<br />
momentan über 50 Prozent des Gesamtbedarfs. Besonders<br />
stolz sind Beaufort und sein Team, dass ihr Modell<br />
mittlerweile auch in anderen Werken umgesetzt wird.<br />
Die BMW Group ist zum siebten Mal in Folge<br />
nachhaltigster Automobilhersteller der Welt.<br />
Erfahren Sie mehr über den Branchenführer<br />
im Dow Jones Sustainability Index auf<br />
www.bmwgroup.com/whatsnext<br />
Jetzt Film ansehen.
T i t e l<br />
In mörderischer<br />
gesellschaft<br />
Miroslav Nemec<br />
packt als „Kriminalhauptkommissar<br />
Ivo Batic“ auch heiße Eisen an, um<br />
die Aufklärungsquote in München<br />
dem Law-and-Order-Image<br />
des Freistaats anzugleichen<br />
16 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Jeden<br />
Sonntagabend<br />
um 20:15 Uhr<br />
sitzt die halbe<br />
Republik vor<br />
dem Fernseher<br />
und starrt auf<br />
sich selbst.<br />
Denn was in<br />
der populärsten<br />
deutschen<br />
TV‐Reihe<br />
verhandelt<br />
wird, ist nicht<br />
weniger als die<br />
Befindlichkeit<br />
der Nation.<br />
Klaus Raab<br />
hat sich auf<br />
Spurensuche<br />
begeben, um den<br />
erstaunlichen<br />
Erfolg des „<strong>Tatort</strong>“<br />
zu ermitteln.<br />
Und stieß dabei<br />
auf seltsame<br />
Zeugen<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 17
T i t e l<br />
Von Klaus Raab<br />
W<br />
enn sich das Fadenkreuz<br />
aufbaut, das Schlagzeug<br />
einsetzt, wenn der Mann<br />
über den nassen Asphalt<br />
spurtet, kurz: sonntags<br />
zur heiligen Zeit, da muss der SPD‐Politiker<br />
Ralf Stegner manchmal doch zu<br />
einem Termin. Einige Dinge lassen sich<br />
auch vom Sonntag nicht wegorganisieren,<br />
Wahlabende zum Beispiel. Aber zum<br />
Glück, sagt Stegner, gebe es ja noch den<br />
Rekorder. Er zeichnet auf, lückenlos, Blum,<br />
Ballauf, Borowski. Und die alten, Trimmel,<br />
Haferkamp, Schimanski, stehen eh in seinem<br />
Regal. Stegner hat sie alle, 852 Filme,<br />
1970 bis 2012.<br />
Ralf Stegner, Chef der schleswig-holsteinischen<br />
SPD, ist kein Genusspolitiker,<br />
er selbst wirkt im Fernsehen, als hätte er<br />
Büroklammern gefrühstückt. Aber er hat<br />
sich keinen Moment gewundert, dass man<br />
ihn zum <strong>Tatort</strong> befragen will, zu der Beziehung<br />
von Politik, Gesellschaft und dieser<br />
Sendung mit dem ungeheuren Erfolg. Er<br />
hat zu sich nach Hause eingeladen, nach<br />
Bordesholm südlich von Kiel. Stegner hat<br />
eigentlich Urlaub, aber das ist ein Termin,<br />
bei dem er bei sich und seiner Leidenschaft<br />
sein darf, er trägt Poloshirt und<br />
Hausschuhe.<br />
Ralf Stegner, Fraktionsvorsitzender der<br />
SPD im Kieler Landtag, hat sämtliche<br />
<strong>Tatort</strong>-Folgen bei sich im Regal stehen<br />
In der Person Ralf Stegner trifft sich<br />
beides: Als Politiker hat er leidvoll erfahren,<br />
wie schwierig es ist, das Publikum<br />
für sich zu begeistern. Und zugleich gehört<br />
er im Falle des <strong>Tatort</strong>s selber zu den<br />
Begeisterten dieses Krimis, dieser über<br />
die Langstrecke gesehen mit der Tagesschau<br />
erfolgreichsten Sendung des deutschen<br />
Fernsehens. Sechs bis elf Millionen<br />
Zuschauer sehen sie sich an, Sonntag für<br />
Sonntag, Jahr für Jahr, nur unterbrochen<br />
von einer Sommerpause, die aber von<br />
Wiederholungen überbrückt wird und die<br />
jetzt auch schon wieder vorbei ist. Der<br />
<strong>Tatort</strong> ist ein Phänomen. Wie verhält es<br />
sich zwischen ihm und der gesellschaftlichen<br />
Debatte, wie beeinflussen sie sich?<br />
Und warum werden die Zuschauer dieses<br />
Krimis partout nicht überdrüssig?<br />
Aufnahmegerät läuft. Also, Herr Stegner?<br />
„Was an wichtigen Themen in der<br />
Gesellschaft verhandelt wird, kommt im<br />
<strong>Tatort</strong> vor“, sagt er. „Er ist ein Stück Bundesrepublik<br />
Deutschland.“ Ein Satz ist das,<br />
den sich kein Drehbuchautor besser ausdenken<br />
könnte, um einen Politiker als jemanden<br />
einzuführen, der volksnah sein<br />
will und zugleich tief genug im Berufsjargon<br />
verwurzelt ist, um das Land bei der<br />
Staatsform zu nennen. „Die Republik“,<br />
sagt Stegner, „wird darin nicht nur aus<br />
München, Hamburg oder Berlin beschrieben“,<br />
wie sonst üblich, „sondern auch aus<br />
Saarbrücken, Stuttgart, Frankfurt, Münster,<br />
Hannover und, was weiß ich, Ludwigshafen.<br />
Das ist schon Darstellung bundesrepublikanischer<br />
Realität.“<br />
Da ist ein häufig benutztes <strong>Tatort</strong>-<br />
Stichwort: Realität.<br />
Und tatsächlich scheint vieles von<br />
dem, was man sieht, real. Nehmen wir<br />
Kiel. Wenn jemand, der noch nie in der<br />
Stadt war, erklären müsste, wie Kiel ist,<br />
was würde ihm einfallen? Der <strong>Tatort</strong>. Gut,<br />
und dann noch Ralf Stegner. Er hat für<br />
die SPD die Landtagswahl 2009 gegen den<br />
Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen,<br />
CDU, verloren und beim nächsten<br />
Mal in einer SPD-Mitgliederbefragung<br />
gegen den heutigen Ministerpräsidenten<br />
Torsten Albig. Aber man kennt dieses Gesicht.<br />
Wenn Stegner im Fernsehen auftaucht,<br />
weiß man sofort: aha, Kiel. Obwohl<br />
er in Süddeutschland aufwuchs, wo<br />
seine Eltern eine Gastwirtschaft hatten, in<br />
der sie sonntags schon in den siebziger Jahren<br />
den <strong>Tatort</strong> zeigten. Kiel, das ist sein Gesicht,<br />
das sind die Gesichter von Kubicki,<br />
Carstensen, Albig, früher Simonis, noch<br />
früher Engholm und Barschel.<br />
Ansonsten ist da der <strong>Tatort</strong>: Da ist<br />
das Moor im Wald, zu sehen in „Borowski<br />
und das Mädchen im Moor“. Dann<br />
hätten wir da das Meer und irgendwo<br />
Fotos: Wolfgang Wilde (SeiteN 16 bis 17), Anna Mutter<br />
18 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Eva Mattes<br />
geht als „Kriminalhauptkommissarin<br />
Klara Blum“ auch Bodensee-<br />
Bewohnern mit vermeintlich<br />
weißer Weste an die Gurgel<br />
Foto: Wolfgang Wilde<br />
dahinter Schweden; beides weiß man<br />
aus „Borowski und der coole Hund“.<br />
Und dann ist da diese grüne flurbereinigte<br />
Unendlichkeit, wie sie sich im <strong>Tatort</strong>-Fall<br />
„Borowski und der stille Gast“<br />
am 9. September andeutet.<br />
Der <strong>Tatort</strong> macht das Bild von Kiel.<br />
Und nichts von dem, was der <strong>Tatort</strong> zeigt,<br />
ist falsch. Betrachtet man Kiel aus der Totalen,<br />
auf einem Satellitenbild zum Beispiel,<br />
sieht man das, was man in den Filmen<br />
sieht: das Meer vor der Haustür, drum herum<br />
grüne Flächen, und irgendwo Baumansammlungen,<br />
zwischen denen sich ja<br />
wohl irgendwo ein Moor befinden wird.<br />
Schweden ist rechts oben.<br />
Und der <strong>Tatort</strong> macht nicht nur Kiel,<br />
er macht auch Ludwigshafen, Saarbrücken,<br />
Hannover und Leipzig, ab diesem<br />
Herbst Dortmund und von 2013 an Erfurt.<br />
Was weiß man von Konstanz? Dass es dort<br />
grünt und blüht. Der <strong>Tatort</strong> erzeugt Bilder,<br />
die von Soldaten, alleinerziehenden Müttern<br />
und Hartz‐IV‐Empfängern. Es geht<br />
um Menschen und wie sie in ihrer Zeit<br />
und bei sich selbst feststecken. Wie sie reden,<br />
wie sie sich die Hand geben, welche<br />
sozialen Rollen sie spielen, welche Autos<br />
sie fahren, wie sie lieben, wie viel sie saufen<br />
und wie oft sie „Scheiße“ sagen. Was<br />
sie treibt.<br />
Den meisten <strong>Tatort</strong>-Kommissaren, die<br />
überzeichneten Münsteraner Charaktere<br />
vielleicht ausgenommen, würde man daher<br />
zuschreiben, dass sie heute wirklich<br />
da draußen herumlaufen könnten; anders<br />
als zum Beispiel Spiderman oder die<br />
Christine-Neubauer-Figuren, die sich in<br />
Schmonzetten in ihresgleichen verlieben.<br />
<strong>Tatort</strong>-Charaktere, die nicht in die Zeit<br />
gehören, werden abgesetzt, wie Kommissar<br />
Haferkamp, der von 1974 bis 1980<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 19
T i t e l<br />
in Essen ermittelte. Er rauchte filterlose<br />
Roth-Händle und trug schwarze Existenzialisten-Rollkragenpullover<br />
unterm<br />
Trenchcoat. Er war modern – in den Siebzigern.<br />
Deshalb gibt es ihn heute nur noch<br />
als Wiederholung. Und in Ralf Stegners<br />
DVD‐Regal.<br />
Die Frage ist, was passiert, wenn man<br />
näher an die wirkliche Welt heranzoomt.<br />
Zoom auf Stegners Haus, nahe der Kieler<br />
Straße zwischen Bordesholmer See und<br />
Schmalsteder Mühlenteich gelegen. Man<br />
könnte einen Fußball in die Blumen schießen,<br />
könnte die Gartentür öffnen und sich<br />
in den angebauten Wintergarten auf Korbsessel<br />
setzen. Es ist real. Aber jeder Regisseur,<br />
der hier drehen müsste, würde aufheulen:<br />
Dieses Haus ist uneindeutig. Nicht<br />
klein- oder großbürgerlich, Nippes schon,<br />
aber doch wieder nicht so viel, dass es wehtut.<br />
An der Decke hängt ein Kronleuchter,<br />
aber oben wächst das Kabel heraus. Dagegen<br />
haben Häuser im <strong>Tatort</strong> eine eindeutige<br />
Schichtzugehörigkeit, es sieht<br />
dort nach Bahnhofstoilette aus oder nach<br />
Designerkatalog.<br />
Vom <strong>Tatort</strong>, Stegners Leidenschaft, die<br />
zu zeigen sich anbieten würde, um im Film<br />
die Person näherzubringen, die hier lebt, ist<br />
nirgends etwas zu sehen. In seinem Arbeitszimmer<br />
stehen zwar alle <strong>Tatort</strong>e auf DVD<br />
im Regal, aber kaum eine hat ein Originalcover.<br />
Das würde kein Requisiteur durchgehen<br />
lassen.<br />
Ermittlungsergebnis: Die Welt ist keine<br />
Kulisse. Die Welt im <strong>Tatort</strong> schon.<br />
Foto: Wolfgang Wilde<br />
Dominik Raacke<br />
treibt sich als<br />
„Hauptkommissar Till<br />
Ritter“ auch über den<br />
Dächern von Berlin<br />
herum, wenn der<br />
Einsatz es erfordert<br />
20 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Roland Magunia/DDP Images<br />
Und so mag es also sein, dass all das,<br />
was man im <strong>Tatort</strong> sieht, in der Gesellschaft<br />
vorkommen könnte, umgekehrt aber<br />
stimmt das nicht; es könnte nicht alles, was<br />
man in der Gesellschaft findet, im <strong>Tatort</strong><br />
auftauchen. Das gilt auch für die <strong>Tatort</strong>-<br />
Kommissare; sie würden in einer Fußgängerzone<br />
nicht auffallen, aber 95 Prozent<br />
der Fußgängerzone würden im <strong>Tatort</strong> wie<br />
Fremdkörper wirken.<br />
Nehmen wir Stegner: Dass er Marotten<br />
hat, die <strong>Tatort</strong>-Leidenschaft, dazu seine<br />
Fliegen, das qualifiziert ihn dringend als<br />
Kommissar. Ballauf und Schenk stehen<br />
an einer Kölner Currywurstbude, Stoever<br />
und Brockmöller sangen in Hamburg Lieder,<br />
und Borowksi kämpft in Kiel mit seinem<br />
Passat, den er „Brauner“ nennt wie die<br />
Walküre Helmwige das Pferd im „Ring des<br />
Nibelungen“. Einen Spleen braucht jede<br />
Figur, das macht sie wiedererkennbar.<br />
Stegner hat Eigenheiten, aber sein Beruf<br />
als Politiker wäre ein Grund zur Disqualifikation<br />
als populärer Krimicharakter.<br />
Komplexität, Aktentaschen und Büroklammern<br />
sind zwar real, aber langweilig. Und<br />
Langeweile ist der Tod des Films. Realistisch<br />
gezeichnete Politiker gibt es deshalb<br />
kaum im Krimi. „Wenn Politiker im <strong>Tatort</strong><br />
auftauchen, sind das in der Regel reiche<br />
Staatssekretäre, die große Villen haben,<br />
ihre Frauen betrügen und im Übrigen korrupt<br />
sind“, sagt Stegner. „Die Darstellung<br />
von Politik ist schon eine eigenartige.“<br />
Die Darstellung bundesrepublikanischer<br />
Realität endet im <strong>Tatort</strong> also, wo<br />
sie langweilen würde oder nicht glaubhaft<br />
wäre. Und ein Politiker, der keine korrupte<br />
Drecksau ist, das glaubt im Krimi<br />
kein Mensch.<br />
Der <strong>Tatort</strong> ist demnach kein Spiegel<br />
oder Abbild, er ist eine kulturelle Landkarte.<br />
Besser: eine Sammlung von Landkarten,<br />
ein Atlas. Landkarten bilden die<br />
Landschaft nicht ab, sie verweisen auf sie,<br />
sie sind ihr Modell. Sie vereinfachen, ordnen<br />
als zentral erachtete Aspekte, blenden<br />
aus. Aus der Totalen wirkt das Bild, das<br />
der <strong>Tatort</strong> zeichnet, daher noch wie ein<br />
sachgemäßer Überblick – Kiel liegt am<br />
Meer, Schweden rechts oben. Zoomt man<br />
aber heran, sieht man nicht mehr die Welt,<br />
sondern nur, wie die <strong>Tatort</strong>-Macher auf sie<br />
verweisen.<br />
Berlin. Der Schauspieler Fahri Yardim<br />
kommt mit dem Fahrrad zum Café. Er soll<br />
demnächst ein populärer <strong>Tatort</strong>-Charakter<br />
werden. Der NDR hat ihn engagiert,<br />
um mit Til Schweiger ein Ermittlerduo zu<br />
bilden. Yardim hat einen leicht norddeutschen<br />
Zungenschlag, er redet sofort los.<br />
Wer ist Fahri Yardim? „Ich bin Hamburger“,<br />
sagt er, „schon deshalb ist diese Rolle<br />
für mich eine große Ehre.“ Türkisch? Er sei<br />
Hamburger. Also deutsch? Och, eigentlich<br />
verbinde ihn mit einem Arbeiterkind aus<br />
Frankreich wahrscheinlich mehr als mit einem<br />
deutschen Spitzenbanker. So viel zum<br />
Selbstbild des Schauspielers Yardim.<br />
Gebhard Henke koordiniert bei der<br />
ARD den <strong>Tatort</strong>, damit nicht jedes<br />
Mal der Gärtner der Mörder ist<br />
Yardim wird allerdings nicht Yardim<br />
sein im <strong>Tatort</strong>. Gesucht für seine Rolle<br />
wurde kein Darsteller aus Hamburg, sondern<br />
explizit einer mit türkischem Hintergrund.<br />
Worauf also verweist Fahri Yardim?<br />
In der Zeitung jedenfalls stand, als bekannt<br />
wurde, dass er die Rolle übernimmt: „Tils<br />
Neuer wird ein Türke.“ Yardim ist, genau<br />
wie Schweiger, ein wandelnder Verweis.<br />
Der berühmte Schweiger verweist im <strong>Tatort</strong><br />
auf den Mainstream, Yardim auf eine<br />
gesellschaftliche Gruppe, selbst wenn er<br />
sich gar nicht über sie definiert.<br />
Auch so legt der <strong>Tatort</strong> Ist-Zustände<br />
in der Gesellschaft fest: Eine Gruppe, auf<br />
die ein Sonntagskommissar verweist, gehört<br />
dazu.<br />
Köln. Im Büro von Gebhard Henke<br />
stehen ein Grimme-Preis, ein Deutscher<br />
Fernsehpreis und ein Deutscher Comedypreis<br />
und verweisen darauf, dass hier Fernsehen<br />
nicht geglotzt, sondern gedacht wird.<br />
Henke arbeitet als Fernsehspielchef beim<br />
WDR, im ARD‐Verbund hat er das <strong>Am</strong>t<br />
des <strong>Tatort</strong>-Koordinators. Wenn der vielgliedrig-föderale<br />
Sonntagskrimi einen Kopf<br />
hat, dann ist er das.<br />
Henke nutzt, wenn er vom <strong>Tatort</strong><br />
spricht, als übergeordneten Begriff nicht<br />
„Realität“, sondern das Wort „Kunst“. Während<br />
die fiktionalen Figuren für, zum Beispiel,<br />
Ralf Stegner Transporteure gesellschaftspolitisch<br />
relevanter Geschichten<br />
sind, verhält es sich für Henke andersherum.<br />
Die Oberthemen sind für ihn Oberflächen,<br />
auf denen sich die Charaktere<br />
entwickeln können: „Selbst wenn der Aufhänger<br />
für einen Film ein aktuelles Thema<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 21
T i t e l<br />
Ulrike Folkerts<br />
macht als<br />
„Kriminalhauptkommissarin<br />
Lena Odenthal“ vor<br />
Ludwigshafener Industriekulisse<br />
selten eine schlechte Figur<br />
ist“, sagt er, „sind die Zwänge des Kriminalfilmgenres<br />
viel stärker als das Einklinken<br />
in die Realität. Oft sind die Oberthemen<br />
ja nur ein Rahmen, und die viel größere<br />
Frage ist: Wie schaffen wir darin Raum für<br />
die Figuren?“<br />
Es war im Juni 1981, als die Figur im<br />
<strong>Tatort</strong> die Oberhand über das Problem gewonnen<br />
hat. Damals tauchte Horst Schimanski<br />
auf. Seine Fälle wurden erstmals<br />
komplett aus der Ermittlerperspektive<br />
erzählt. Die erste Einstellung des ersten<br />
Schimanski-<strong>Tatort</strong>s zeigt: ihn. Wie um zu<br />
markieren, dass es sich um einen Bruch<br />
handelte, warf in Minute vier jemand einen<br />
Fernseher aus dem Fenster. Mit Schimanski<br />
zog das literarische Ich in den Sonntagskrimi<br />
ein. „Das Verhalten zum Fall<br />
war bei ihm immer wichtiger als der Fall<br />
selbst“, sagt Hajo Gies, einer der Schimanski-Erfinder,<br />
der als Regisseur 21 <strong>Tatort</strong>e<br />
gedreht hat. Und siehe da: Schimanski zog<br />
die ganze regionale Vielfalt des <strong>Tatort</strong>s mit.<br />
Mit ihm kam der konstante Erfolg, und<br />
Sonntag 20:15 Uhr wurde zum Ritual der<br />
Abendgestaltung.<br />
Die Frage ist, was das dann soll mit<br />
Afghanistan, Müllskandal, Ehrenmord<br />
und Pflegenotstand, mit dem bundesrepublikanischen<br />
Politikkram also, der zwar<br />
nicht in jedem Film aufpoppt, aber doch<br />
in vielen.<br />
Gebhard Henke hat darauf mehrere<br />
Antworten. Erstens: Die Gründerväter,<br />
wie er sie nennt, hätten es so gewollt.<br />
Der <strong>Tatort</strong> wurde erfunden, als man überlegte,<br />
wie man dem ZDF-Erfolg „Der<br />
Kommissar“ etwas entgegensetzen könne.<br />
Die Ursprungserzählung handelt von drei<br />
WDR-Mitarbeitern, dem Redakteur Peter<br />
Märthesheimer, dem Fernsehspielchef<br />
Günter Rohrbach und dem Dramaturgen<br />
Foto: Wolfgang Wilde<br />
22 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Gunther Witte, die laut Henke am entscheidenden<br />
Tag am Decksteiner Weier in<br />
Köln spazieren gingen, alle drei sollen einen<br />
Trenchcoat getragen haben. Wie Kommissar<br />
Haferkamp, der später im WDR-<br />
<strong>Tatort</strong> ermittelte.<br />
Witte hatte die Idee zu einer Regionalkrimireihe<br />
für das Genre des Fernsehspiels,<br />
das sich in den Siebzigern politisch<br />
verstand, und zu der alle ARD-Anstalten<br />
Beiträge leisten sollten. Die Sender brachten<br />
ihre regionale Identität ein, sie setzten<br />
ihre weltanschaulichen Akzente. Das Prinzip<br />
war: Jeder produziert für sich.<br />
Henke glaubt, dass hier, im Anstaltspluralismus<br />
und damit der Unterschiedlichkeit<br />
der Filme, die dieser hervorbringe,<br />
das Erfolgsgeheimnis der Reihe liegt, weil<br />
er „die Vielfalt sichert und auch ein Motor<br />
von Kreativität ist, den man definitiv nicht<br />
hätte, wenn alles aus einem Guss wäre“.<br />
Zweitens hat Henke eine dramaturgische<br />
Antwort: „Ich fände es langweilig,<br />
wenn man die Uhr danach stellen könnte,<br />
dass immer ein Reicher in seiner Villa erschlagen<br />
wird.“ Tatsächlich sind die Möglichkeiten,<br />
warum ein Mörder jemanden<br />
umbringt, begrenzt. Als Motive denkbar<br />
sind etwa Eifersucht, Neid, Eitelkeit oder<br />
Zorn. Oder ein Täter ist psychisch gestört,<br />
dann muss man nicht viel begründen, ein<br />
Irrer darf ja im Krimi immer alles. Oder<br />
aber die Umstände sind schuld, Armut,<br />
Arbeitslosigkeit, mafiöse Strukturen. Und<br />
da sind wir bei der Politik: Sie steigert die<br />
Vielfalt dramaturgischer Möglichkeiten,<br />
der <strong>Tatort</strong> benutzt sie, die Politik eröffnet<br />
ihm Varianten.<br />
Politik im <strong>Tatort</strong> – Henke hat noch<br />
eine dritte Antwort, warum sie stark vertreten<br />
ist. Verkürzt lautet sie: Klar könnten<br />
wir diese Themen weglassen, aber dann<br />
wäre der <strong>Tatort</strong> nicht mehr der <strong>Tatort</strong>, und<br />
da wären wir ja schön blöd.<br />
Das ist natürlich nicht so innovativ,<br />
und deshalb analysiert vermutlich Stegners<br />
Sohn beim Besuch in Bordesholm den<br />
<strong>Tatort</strong> so: „<strong>Am</strong> Anfang gibt es eine Leiche,<br />
am Ende immer eine Auflösung, und dazwischen<br />
lernt man die Kommissare kennen.<br />
Find’ ich langweilig.“ Stegner junior<br />
hat gerade Abitur gemacht, er gehört zu<br />
der Altersgruppe, unter der das Sonntagabendritual<br />
nach einer Allensbach-Befragung<br />
nicht halb so verbreitet ist wie unter<br />
den Zuschauern über dreißig.<br />
Aber der <strong>Tatort</strong> funktioniert wie keine<br />
andere Sendung, und die Fans haben<br />
eine konkrete Vorstellung von der Reihe.<br />
Man sehe das an jüngeren Regisseuren,<br />
sagt Henke; sie würden die Grundverabredung<br />
– der <strong>Tatort</strong> als politisches Fernsehspiel,<br />
in dem gesellschaftliche Realität<br />
verarbeitet werden kann – von Haus aus<br />
kennen, sie hätten ihn schon mit ihren Eltern<br />
geguckt, und man müsse ihnen nicht<br />
mehr erklären, was machbar sei. Der <strong>Tatort</strong><br />
ist eine gesellschaftspolitische Marke auch<br />
einfach deshalb, weil er es ist.<br />
Die Verarbeitung politischer Ereignisse<br />
gelingt dann mal besser und mal<br />
schlechter. In Köln, wo vielleicht der sozialdemokratischste<br />
aller <strong>Tatort</strong>e gedreht<br />
wird, trauern die Ermittler, wenn sie mal<br />
nach Leipzig fahren, ihrem Soli nach, fühlen<br />
sich aber ansonsten wohl, wenn sie in<br />
einen Arbeitskampf geraten. In Bremen,<br />
wo die ehemalige Friedensaktivistin Inga<br />
Lürsen ermittelt, kämpft man bisweilen<br />
mit der großen Weltbedrohung, mal mit<br />
„Das Verhalten<br />
zum Fall war<br />
bei ihm immer<br />
wichtiger als<br />
der Fall selbst“<br />
Regisseur Hajo Gies über Schimanski<br />
Satan-, mal mit Islam-, mal mit Terroristen,<br />
der Bremer ist der -ismus-<strong>Tatort</strong>. In<br />
Konstanz lotet die innerlich gespaltene<br />
Klara Blum aus, was ein Staatsdiener tut,<br />
wenn er an die Grenzen seiner Befugnisse<br />
stößt.<br />
In diesem Spätsommer bekommen es<br />
Ballauf und Schenk mit Afghanistan-Rückkehrern<br />
zu tun, Flückiger in Luzern mit<br />
Immobilienhaien, Borowski mit einem Serientäter<br />
und Lürsen in Bremen mit einem<br />
Geiselnehmer.<br />
Es gibt aber Jahre, 2008 war so eines,<br />
in denen fast jeder Film auf einer politischen<br />
Folie spielt. Manche nervt das. Als<br />
bei „Walulis sieht fern“, einer 2012 mit<br />
dem Grimme-Preis ausgezeichneten Comedyreihe,<br />
einmal „der typische <strong>Tatort</strong> in<br />
123 Sekunden“ nachgespielt wurde, fragte<br />
der Kommissar-Parodist seine Kollegin in<br />
ihrem Metagespräch über die Reihe: „Sag<br />
mal, haben wir eigentlich schon ein Ereignis<br />
von gesellschaftlicher Relevanz?“<br />
Und sie: „Du meinst den verkrampften<br />
sozialkritischen Einschlag? Kommt jetzt:<br />
Atomlobby.“<br />
Der Regisseur Hajo Gies sagt: „Der<br />
<strong>Tatort</strong> wird immer Themen aufgreifen,<br />
von denen er annimmt, dass sie ankommen.<br />
Man kann sicher sein, dass man<br />
das, was man im Spiegel oder Stern der<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 23
T i t e l<br />
letzten Woche gelesen hat, ein Jahr später<br />
als <strong>Tatort</strong> in der ARD wiederfindet.“<br />
Wenn man kurz mal eine Suchmaschine<br />
bemüht, sieht man: keine allzu unverschämte<br />
Zuspitzung.<br />
2003 sind Blutdiamanten Thema in<br />
den Medien; 2006 läuft ein WDR-<strong>Tatort</strong><br />
namens „Blutdiamanten“. 2007 wird an<br />
der Charité ein Forschungsprojekt zu Pädophilie<br />
abgeschlossen; zwei <strong>Tatort</strong>e 2008<br />
handeln von pädophilen Männern. Soldaten<br />
mit posttraumatischem Belastungssyndrom<br />
sind 2009 immer wieder in der<br />
Presse. 2011 sieht man traumatisierte Afghanistan-Rückkehrer<br />
im Saarbrücker,<br />
2012 einen traumatisierten Kriegsfotografen<br />
im Leipziger <strong>Tatort</strong>. 2010 kauft Nordrhein-Westfalen<br />
seine erste CD mit Kundendaten<br />
der Bank Credit Suisse; 2012<br />
handelt „Schmuggler“ aus Konstanz vom<br />
Geldtransfer über die Schweizer Grenze.<br />
Knapp eineinhalb Jahre dauere es von<br />
der Idee bis zur Ausstrahlung, sagt Gebhard<br />
Henke, der <strong>Tatort</strong>-Koordinator.<br />
Zwischen Dezember 2007 und Januar<br />
2009, ein bis zwei Jahre nach dem<br />
Streit um die Mohammed-Karikaturen<br />
also, senden verschiedene ARD-Anstalten<br />
gleich fünf <strong>Tatort</strong>e, in denen islamische<br />
Protagonisten auftauchen. In allen<br />
geht es, es wirkt im Nachhinein fast wie<br />
eine Kampagne, um Ehrenmord, Zwangsheirat<br />
oder Patriarchat. „Das war wie eine<br />
unterirdische Verabredung“, sagt Henke,<br />
„man merkte, das ist ein Stoff, auf den<br />
viele Autoren fast gleichzeitig angesprungen<br />
sind. In dem Moment, in dem man<br />
die Häufung realisierte, waren sie schon<br />
produziert. Das ist der Preis des föderativen<br />
Systems, in dem man nicht jeden<br />
Schritt abstimmt. Aber daraus lernen wir<br />
natürlich.“<br />
Bekannt ist schon jetzt, dass es die<br />
neuen Saarbrücker Ermittler um Kommissar<br />
Jens Stellbrink, gespielt von Devid<br />
Striesow, 2013 mit der Rockergang Dark<br />
Dogs zu tun bekommen und einem Mord,<br />
der an reale Fälle von 2010 und 2011 erinnert,<br />
in die Mitglieder der Hells Angels<br />
verwickelt waren.<br />
Die These liegt daher nahe, dass das,<br />
was der <strong>Tatort</strong> tatsächlich spiegelt, die Medienagenda<br />
des jeweiligen Vorjahrs ist. Die<br />
Frage, ob ein <strong>Tatort</strong> einen direkten politischen<br />
Zweck verfolge, wäre damit geklärt:<br />
in der Regel nicht. Dafür kommen die<br />
Filme zu spät.<br />
Was nicht heißen soll, dass im <strong>Tatort</strong><br />
nie klare politische Positionen vertreten<br />
würden.<br />
Der 2008 ausgestrahlte Film „Salzleiche“,<br />
der im Wendland spielt, kommentierte<br />
die Atompolitik, indem eine Leiche,<br />
Harald Krassnitzer<br />
ermittelt als<br />
„Chefinspektor Moritz<br />
Eisner“ auch gerne mal<br />
im Wiener Untergrund<br />
24 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Anzeige<br />
Foto: Wolfgang Wilde<br />
die in einem Salzhügel vergraben war, an<br />
der Oberfläche auftauchte – was, worauf<br />
Regisseurin Christiane Balthasar hinweist,<br />
unmöglich wäre, wenn stimmen würde,<br />
was Atomenergiebefürworter sagen: dass<br />
das Salz nie wieder hergibt, was es einmal<br />
einschließt.<br />
Ob Endlager, Rockerbanden oder<br />
Zwangsheirat: Bei allen Themen, die wiederkehren,<br />
wirkt der <strong>Tatort</strong> wie ein Verstärker:<br />
Der erste Anlass mag vorüber sein,<br />
aber beim nächsten Mal, wenn es wieder<br />
um das Verbot von Hells Angels oder Gorleben<br />
geht, hat man schon Bilder vor Augen.<br />
Der <strong>Tatort</strong>, der auf einer Folie spielt,<br />
kann dann selbst die Folie der nächsten<br />
Debatte zum Thema werden und die ersten<br />
Assoziationen liefern.<br />
Aber auch wenn der <strong>Tatort</strong> ein größeres<br />
Publikum für ein Thema emotionalisieren<br />
kann, vermag er es nicht, ein Thema<br />
zu setzen und sogar direkt etwas zu bewirken.<br />
Der einzige Spielfilm, von dem er<br />
wisse, dass er kausal etwas verändert habe,<br />
sei „Contergan“ vom WDR gewesen, sagt<br />
Gebhard Henke – danach seien die Renten<br />
der Geschädigten erhöht worden. Dass<br />
aber der <strong>Tatort</strong> die Welt eins zu eins verändere,<br />
glaube er nicht.<br />
Ermittlungsergebnis: Der <strong>Tatort</strong> nimmt<br />
am Gesellschaftsgespräch teil. Aber er kann<br />
kein Thema auf die Agenda setzen.<br />
Wir sind da wieder bei Ralf Stegner. Er<br />
ist als Politiker in der Lage, etwas zu bewirken,<br />
das der <strong>Tatort</strong> nicht kann. Er kann<br />
„Unterhaltung<br />
ist eine extrem<br />
gute Sache, um<br />
Themen zu<br />
transportieren“<br />
Politiker Ralf Stegner über die <strong>Tatort</strong>-Mission<br />
sich zum Beispiel mit anderen SPD-Linken<br />
zusammentun und ein Steuerkonzept formulieren.<br />
Das wäre eine Tat mit Ziel, vielleicht<br />
sogar mit Ergebnis. Der <strong>Tatort</strong> hat<br />
selten ein konkretes Ziel, außer ein möglichst<br />
guter Film zu sein. Was schreibt Stegner<br />
dem <strong>Tatort</strong> dann eigentlich zu? Was<br />
will er von ihm?<br />
Stegner sagt: „Unterhaltung ist eine extrem<br />
gute Sache, um Themen zu transportieren,<br />
insbesondere solche, die einem auch<br />
an die Nieren gehen. Also ich wette, dieser<br />
Afghanistan-Film hat Leute dazu gebracht,<br />
über den Kriegseinsatz nachzudenken,<br />
die das sonst nicht getan hätten.“ Der<br />
<strong>Tatort</strong> und seine fiktionalen Charaktere als<br />
erfolgreicher Vermittler institutionalisierter<br />
Politik.<br />
Die Frage ist, von wem sich die Zuschauer<br />
am liebsten etwas vermitteln lassen.<br />
Während der echte Polizist eine Wächterfunktion<br />
ausübt, hat der Fernsehkommissar<br />
eine andere Funktion: Er führt<br />
die Zuschauer über unbekanntes Terrain.<br />
Fernsehkommissare sind keine Polizisten.<br />
Sie sind Mischungen aus Entertainern und<br />
Ethnologen, die Mikrokosmen erkunden,<br />
mit einer mal sechs, mal elf Millionen Studenten<br />
umfassenden Seminargruppe.<br />
Manche Zuschauer vertrauen sich gern<br />
einer mütterlichen Klara Blum an. Die anderen<br />
folgen lieber einem alleinerziehenden<br />
Vater, wie ihn Til Schweiger bald geben<br />
soll. Oder darf’s eine alleinerziehende Mutter<br />
sein, wie sie Maria Furtwängler erfolgreich<br />
spielt? Oder eine Kommissarin und<br />
ein Kommissar – denen man ansieht, dass<br />
aus ihrer Familie mal jemand eingewandert<br />
ist – , wie sie Aylin Tezel im Herbst<br />
in Dortmund und Fahri Yardim 2013 in<br />
Hamburg verkörpern?<br />
Mit dem Hamburger Undercoveragenten<br />
Cenk Batu, gespielt von Mehmet Kurtulus,<br />
wollten sich zu wenige Zuschauer<br />
identifizieren. Schlechte Quote. Weil er<br />
ein Türke ist? Fahri Yardim, der nun einen<br />
der Hamburger Parts übernimmt, sagt:<br />
„Der Gedanke kommt mir auch, blöderweise,<br />
aber aus einer gewissen Impulsgewohnheit:<br />
Oh, irgendwas läuft nicht gut,<br />
und da kommt ein Türke drin vor, könnte<br />
man da stillen Rassismus vermuten, der<br />
sich in Desinteresse äußert?“ Die Antwort<br />
aber laute: nein. „Cenk Batu hat, glaube<br />
ich, eher deswegen nicht funktioniert, weil<br />
er vielen Leuten nicht traditionell genug<br />
<strong>Tatort</strong> war. Das Konzept des Undercovermanns,<br />
der da alleine in den Untergrund<br />
eintaucht, da fehlte womöglich etwas, was<br />
man sehr gerne sieht – dieses Geplänkel<br />
zwischen zwei Kollegen.“<br />
Was aber ist mit ihm, Fahri Yardim, der<br />
keinen Undercoveragenten spielt? Der im<br />
Casting ausgewählt wurde, weil er einen<br />
türkischen Hintergrund hat? Ist er damit<br />
glcons.de / Foto: David Ausserhofer<br />
ISBN 978-3-89684-092-9<br />
Auch als E-Book erhältlich<br />
Wolfgang Gründinger zeichnet<br />
das Porträt einer Generation, die<br />
für ihr Recht auf Zukunft streitet.<br />
www.edition-koerber-stiftung.de<br />
Eine elegante<br />
Sammlung<br />
Der <strong>Cicero</strong>-Sammelschuber<br />
für nur 15 Euro – Bestellen Sie per<br />
Telefon unter 0800 282 20 04 oder<br />
online: www. cicero.de/shop<br />
Bestellnr.: 858306<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 25
T i t e l<br />
Top 30<br />
Das TAtort-Ranking<br />
Mehr als 800 Folgen sind in den vergangenen 42 Jahren<br />
gelaufen. Manche waren schon am Montag darauf<br />
vergessen, andere sind Klassiker geworden. Eine Hitliste<br />
Rang Titel Ermittler Regie/Drehbuch Sender Erstsendung<br />
1 Nie wieder frei sein Batic, Leitmayr Christian Zübert/ BR 19. 12. 2010<br />
Dinah Marte Golch<br />
2 Kurzschluss Finke, Jessner Wolfgang Petersen/ NDR 07. 12. 1975<br />
Herbert Lichtenfeld<br />
3 Der oide Depp Batic, Leitmayr Michael Gutmann/ BR 27. 04. 2008<br />
Alexander Adolph<br />
4 Reifezeugnis Finke, Franke Wolfgang Petersen/ NDR 27. 03. 1977<br />
Herbert Lichtenfeld<br />
5 Borowski und die Frau am Fenster Borowski, Brandt Stephan Wagner/ NDR 02. 10. 2011<br />
Sascha Arango<br />
6 Schwarzer Advent Batic, Leitmayr Jobst Oetzmann/ BR 08. 11. 1998<br />
Christian Limmer<br />
7 Weil sie böse sind Dellwo, Sänger Florian Schwarz/ HR 03. 01. 2010<br />
Michael Proehl<br />
8 Ein mörderisches Märchen Batic, Leitmayr Manuel Siebenmann/ BR 04. 03. 2001<br />
Daniel Martin Eckhart<br />
9 Herzversagen Dellwo, Sänger Thomas Freundner/ HR 17. 10. 2004<br />
Thomas Freundner,<br />
Stephan Falk<br />
10 Herz aus Eis Blum, Perlmann Ed Herzog/<br />
SWR 22. 02. 2009<br />
Dorothee Schön<br />
11 Blechschaden Finke, Jessner Wolfgang Petersen/ NDR 13. 06. 1971<br />
Herbert Lichtenfeld<br />
12 Morde ohne Leichen Kant, Varanasi, Wolfgang Murnberger ORF 19. 05. 1997<br />
Fichtl, Maier<br />
13 Abschaum Lürsen, Stedefreund Thorsten Näter Radio 04. 04. 2004<br />
Bremen<br />
14 Der glückliche Tod Odenthal, Kopper Aelrun Goette/ SWR 05. 10. 2008<br />
André Georgi<br />
15 Der dunkle Fleck Thiel, Prof. Boerne Peter F. Bringmann/ WDR 20. 10. 2002<br />
Stefan Cantz,<br />
Jan Hinter<br />
16 Außer Gefecht Batic, Leitmayr Friedemann Fromm/ BR 07. 05. 2006<br />
Christian Jeltsch<br />
17 Hitchcock und Frau Wernicke Stark, Ritter Klaus Krämer RBB 24. 05. 2010<br />
18 Schatten Lürsen, Stedefreund Thorsten Näter Radio 28. 07. 2002<br />
Bremen<br />
19 Kindstod Ballauf, Schenk Claudia Garde/ Edgar WDR 17. 06. 2001<br />
von Cossart<br />
20 Kein Entkommen Eisner, Fellner Fabian Eder/Fabian ORF 05. 02. 2012<br />
Eder, Lukas Sturm<br />
21 Wolfsstunde Thiel, Prof. Boerne Kilian Riedhof/ WDR 09. 11. 2008<br />
Kilian Riedhof,<br />
Marc Blöbaum<br />
22 Bitteres Brot Blum, Perlmann Jürgen Bretzinger/ SWR 18. 01. 2004<br />
Dorothee Schön<br />
23 Wo ist Max Gravert? Dellwo, Sänger Lars Kraume HR 17. 04. 2005<br />
24 Kinder der Gewalt Ballauf, Schenk Ben Verbong/<br />
WDR 02. 05. 1999<br />
Ben Verbong, Edgar<br />
von Cossart<br />
25 Vermisst Odenthal, Kopper Andreas Senn/ SWR 11. 10. 2009<br />
Christoph Darnstädt<br />
26 Norbert Batic, Leitmayr Nikolaus Stein von BR 28. 11. 1999<br />
Kamienski/Harald<br />
Göckeritz<br />
27 Der traurige König Batic, Leitmayr Thomas Stiller/ BR 26. 02. 2012<br />
Magnus Vattrodt,<br />
Jobst Oetzmann<br />
28 Bienzle und sein schwerster Fall Bienzle, Gächter Hartmut Griesmayr/ SWR 25. 02. 2007<br />
Felix Huby<br />
29 Transit ins Jenseits Schmidt, Hassert Günter Gräwert/ SFB 05. 12. 1976<br />
Günter Gräwert,<br />
Jens‐Peter Behrend<br />
30 Wir sind die Guten Batic, Leitmayr Jobst Oetzmann/<br />
Jobst Oetzmann<br />
Magnus Vattrodt<br />
BR 13. 12. 2009<br />
Quelle: www.tatort-fundus.de<br />
eine Art Alibitürke, der, egal was er tut,<br />
vor allem einen Migrationshintergrund<br />
haben muss? „Das ist eine Thematik, mit<br />
der ich öfter konfrontiert werde“, sagt er,<br />
„aber die geht mir schon echt auf den Sack.<br />
Ich glaube, es ist einfach ein schönes Symbol<br />
für urbanes Leben. Das, was vielleicht<br />
noch irgendwo als exotisch gilt, als Selbstverständlichkeit<br />
zu erzählen, das bildet<br />
Großstadt schön ab.“<br />
Trotzdem projiziert am Ende jeder Zuschauer<br />
in seine Figuren, was er mag, empfindet<br />
Zu- oder Abneigung. Bildet sich<br />
Werturteile. Im besten Fall öffnen fiktionale<br />
Fernsehcharaktere damit Welten, im<br />
schlechtesten reproduzieren sie Vorurteile.<br />
An den Figuren kann man jedenfalls ablesen,<br />
in welcher Gesellschaft wir leben.<br />
Auch an der Ermittlerin Conny Mey<br />
etwa, die Nina Kunzendorf in Frankfurt<br />
spielt: In ihr manifestiert sich eine Genderdebatte<br />
der Gegenwart. Sie ist eine<br />
Frau, erkennbar im Arbeitermilieu aufgewachsen,<br />
die in erstaunlich engen Jeans<br />
ausführlich Flure entlanggeht und von einem<br />
Kollegen zu hören bekommt, sie solle<br />
lieber im Nagelstudio anfangen. Ist es sexistisch,<br />
sie ständig von hinten zu zeigen?<br />
Oder verweist ihr Hintern, da er zu dieser<br />
behänden, impulsiven und hartnäckigen<br />
Frauenfigur gehört, darauf, dass enge<br />
Jeans und Nagellack nicht gleich dumme<br />
Nuss bedeuten? Tatsache ist: Darüber<br />
wird debattiert.<br />
Bordesholm. Ralf Stegner sagt, wenn er<br />
es sich aussuchen dürfte, wäre er am liebsten<br />
Borowski. Grummelig, aber mit Tiefgang.<br />
Auf eine schüchterne Weise hat er<br />
damit erklärt, wie er selbst gesehen werden<br />
möchte.<br />
Ein bisschen wie ein Sonntagabendkommissar,<br />
das wäre womöglich gern<br />
manch ein Politiker. Es sind Identifikationsfiguren,<br />
denen Millionen vertrauen –<br />
was damit zu tun hat, dass sich Politiker<br />
90 Minuten nach Beginn ihrer Arbeit gerade<br />
den zweiten Sitzungskeks nehmen. Die<br />
Kommissare dagegen haben nach 90 Minuten<br />
eine Lösung gefunden. Abspann, Musik,<br />
die neue Woche kann beginnen. Die Probleme<br />
der alten sind gelöst.<br />
Klaus Raab ist Reporter<br />
und lebt in Berlin. Er schreibt<br />
unter anderem für das<br />
Magazin Wired. Sein erster<br />
Lieblingskrimi war Columbo<br />
Foto: privat (Autor)<br />
26 <strong>Cicero</strong> 9.2012
v<br />
iPhone App<br />
www.berlinartweek.de
T i t e l<br />
„Es ist alles zu korrekt“<br />
Axel Milberg, bekannt als Charakterschädel Borowski, über mangelnden Mut im deutschen<br />
Staatsfernsehen, den <strong>Tatort</strong> als Sucht und sein persönliches „Bonanza“-Gefühl<br />
H<br />
err Milberg, ich erhoffe mir<br />
von diesem Gespräch Heilung,<br />
mindestens Aufschluss. Ich tue<br />
es jeden Sonntagabend mit meiner Frau,<br />
danach sind wir meistens enttäuscht und<br />
tun es trotzdem am nächsten Sonntag<br />
wieder, freuen uns schon ab Samstag<br />
darauf. Was ist da los bei uns?<br />
Dann sind Sie also einer von denen.<br />
Ja, ich gestehe lieber gleich zu Anfang, es<br />
hilft ja nichts. Was passiert da?<br />
Das müssen Sie mir beantworten. Sie<br />
müssen Ihre Krankheit nicht nur benennen,<br />
sondern auch sagen, wie es dazu<br />
kam. Wo haben Sie sich angesteckt? Nehmen<br />
Sie etwas ein?<br />
Keine Medikamente, nein. Angesteckt?<br />
Keine Ahnung. Ich habe inzwischen andere<br />
mit angesteckt. Meine Frau beispielsweise,<br />
die sich jahrelang gesträubt hat, ist<br />
auch infiziert.<br />
Suchen Sie vielleicht Halt? Halt im Taumel<br />
der verrinnenden Zeit. Ich schlage<br />
doch der vergehenden Zeit ein Schnippchen,<br />
indem ich mir Konstanten in meinem<br />
Leben erhalte, und dazu gehören das<br />
Ritual X und die Übung Y. Oder eben der<br />
<strong>Tatort</strong> am Sonntagabend. Man will nicht<br />
wahrhaben, dass das Wochenende zu<br />
Ende geht. <strong>Am</strong> Sonntagmittag haben wir<br />
das Gefühl, es sei schon Montag.<br />
Aber das würde ja bedeuten, es ist mehr<br />
der Sendeplatz als das Format <strong>Tatort</strong>, das<br />
Millionen vor den Fernseher holt.<br />
Es ist vor allem die Regelmäßigkeit. Als<br />
ich ein kleiner Junge war, gab es einen<br />
Pflichttermin die Woche: Mittwoch,<br />
18:15 Uhr, Bonanza auf dem Sofa meiner<br />
Großmutter. Meine Eltern hatten keinen<br />
Fernseher. Ich schaute in eine fremde<br />
Welt hinein, wie durch ein umgedrehtes<br />
„Wo haben Sie sich angesteckt?“: Axel Milberg als <strong>Tatort</strong>-Therapeut<br />
Fernglas auf etwas, das ganz weit weg ist –<br />
<strong>Am</strong>erika! Immer scheint die Sonne, die<br />
Guten hier, die Bösen da, Pferde, ein Vater<br />
mit drei Söhnen. Meine Großmutter<br />
mochte den Hoss besonders gern, aber<br />
auch Little Joe, in den war sie verknallt,<br />
und dazu der vernünftige Adam – alle<br />
längst tot. Bonanza, das war ein Ritual.<br />
So wie heute der <strong>Tatort</strong>.<br />
Wir hatten eine norwegische Gasttochter<br />
für ein Jahr, 18 Jahre alt, die hat erst gefremdelt<br />
mit dem sehr deutschen Spargel<br />
und ihn dann geliebt. Und sie hat von<br />
Anfang an gefremdelt mit dem <strong>Tatort</strong> und<br />
bis zum Ende nicht verstanden, warum<br />
wir da jeden Sonntag sitzen. Ist der <strong>Tatort</strong><br />
vielleicht zu deutsch für eine Norwegerin?<br />
Oder zu diffus, zu verschieden.<br />
Ich finde die qualitativ auch sehr<br />
unterschiedlich – denken Sie mal an<br />
Hamburg, da hat man versucht, das moderner<br />
zu erzählen mit Mehmet Kurtulus.<br />
Oder der Kieler <strong>Tatort</strong>, den wir nach<br />
Finnland verkauft haben, der war extravagant,<br />
den wollten die Finnen haben.<br />
Wir müssten mehr wagen. Ich habe<br />
Wolfgang Petersen, der in den siebziger<br />
Jahren in Kiel gedreht hat, neulich gefragt,<br />
ob er sich vorstellen kann, dort erneut<br />
zu drehen. Mir war natürlich vollkommen<br />
klar, er ist in Hollywood, hat<br />
Etats von 120 Millionen Dollar. War mir<br />
aber wurscht.<br />
Und was hat er gesagt?<br />
Er hat nachgedacht, er hat mich lange<br />
angeschaut, gelächelt, er hat gesagt, sein<br />
Sohn, der in Hamburg lebt, habe schon<br />
mal versucht, ein Buch für den Kiel-<strong>Tatort</strong><br />
Foto: Gerald von Foris<br />
28 <strong>Cicero</strong> 9.2012
unterzubringen. Wurde abgelehnt. Aber,<br />
wenn er so darüber nachdenke, nein, er<br />
glaubt doch eher nicht, nein.<br />
Petersen hat schon <strong>Tatort</strong>e gemacht.<br />
Ja, drei oder vier mit Kommissar<br />
Finke, gespielt vom herrlichen Klaus<br />
Schwarzkopf. Ich habe ihm vorgeschlagen:<br />
Stell dir vor, aus einer deiner Folgen<br />
kommt ein Mörder nach 30 Jahren erfolgreich<br />
therapiert frei, und der taucht<br />
bei mir jetzt wieder auf. Da wäre so viel<br />
an Brückenschlag denkbar gewesen, von<br />
damals zu heute! Aber Wolfi wollte leider<br />
nicht.<br />
Schauen Sie die alten <strong>Tatort</strong>e an?<br />
Ja, klar. Das macht mir richtig Spaß.<br />
Durch diesen zeitlichen Abstand lernt<br />
man viel über die Bundesrepublik und Sozialgeschichte<br />
– Koteletten, Hosen mit<br />
Schlag, wie die Menschen gesprochen<br />
haben, ihre soziale Struktur. Auch, wie<br />
man sich damals beschimpft hat: „Gib<br />
die Knarre her!“ – „Du bist ein Ganove!“<br />
Niedlich. Heute sagen wir doch: „Fick<br />
dich doch, du Wichser“ oder irgend so<br />
was. Und damals gab es noch Moneten<br />
oder die Spritze, ja, statt Pistole haben<br />
sie Spritze gesagt und sind sich unglaublich<br />
frivol dabei vorgekommen. Und das<br />
macht dann Spaß, das wieder anzugucken.<br />
Wobei der <strong>Tatort</strong> der Realität doch hinterherhinkt.<br />
In Deutschland war das Wort<br />
Scheiße schon zehn Jahre länger salonfähig,<br />
bis es Schimanski das erste Mal im<br />
<strong>Tatort</strong> in den Mund nahm.<br />
Ja, es ist alles immer noch viel zu korrekt.<br />
Wir dürfen heute im öffentlich-rechtlichen<br />
Fernsehen, oder wie Thomas Platt sagen<br />
würde: im Staatsfernsehen, nicht mehr<br />
rauchen, und wir müssen auch immer angeschnallt<br />
sein. Vier Typen qualmend in<br />
einer DS, und dann die Verfolgungsjagd<br />
ohne Gurt wie in einem Film Noir – undenkbar<br />
im deutschen Staatsfernsehen!<br />
Ist der <strong>Tatort</strong> politisch?<br />
Wenn er will, schon. Er kann dann Anregungen<br />
und auch Verstörung in die Gesellschaft<br />
tragen. Primär ist aber, dass<br />
man spannende Unterhaltung macht.<br />
Das heißt, politische Themen, wenn sie<br />
denn vorkommen, sind Vehikel, ein dramaturgisches<br />
Mittel und kein Impetus?<br />
Wir klammern aktuelle politische Themen<br />
nicht aus, wenn wir uns davon eine<br />
gute Geschichte versprechen. Aber wenn<br />
ein korrupter Minister in einem <strong>Tatort</strong><br />
verhaftet wird oder ein Mörder ist, ist es<br />
ein korrupter Minister, der einen Mord<br />
begangen hat, aber deswegen sind nicht<br />
alle Minister Schweine. Wenn ein Angler<br />
ein Mörder ist, dann sind nicht die<br />
Angler gemeine Mörder. Was auch so<br />
öde ist in Deutschland: Wenn es politisch<br />
wird, ist es meistens gleich auch<br />
pädagogisch und erzieherisch. Dass wir<br />
„Bonanza, das war<br />
ein Ritual, ein<br />
Pflichttermin, so<br />
wie der <strong>Tatort</strong><br />
auch. Er gibt Halt<br />
im Taumel der<br />
verrinnenden Zeit“<br />
es mal hinkriegen und das voneinander<br />
lösen, diese siamesischen Zwillinge –<br />
politisch ist gleich auch erzieherisch –,<br />
das wäre geil. Aber das geht offenbar nur<br />
anderswo.<br />
Welches im weiteren Sinne politische<br />
Thema hätten Sie gerne mal im <strong>Tatort</strong>?<br />
Zum Beispiel Massentierhaltung. Ich<br />
finde es ganz schwierig, mir vorzustellen,<br />
dass um Mitternacht, wenn wir<br />
alle nicht auf den Straßen sind, Kolonnen<br />
von LKWs Schweine, Rinder und<br />
Kälber durch die Gegend zur Massenschlachtung<br />
fahren, die ein erbärmliches<br />
Leben gelebt haben. Da liegt doch ein<br />
Fehler im System, und dahinter steckt<br />
eine ganz fiese Fleischlobby – und Verbraucher,<br />
die im Ernst glauben, man<br />
könne ein Hähnchen artgerecht halten<br />
und dann für 7,99 Euro an der<br />
Pommesbude verkaufen. Als ich in irgendeiner<br />
Zeitschrift las, dass an der<br />
deutsch-holländischen Grenze ein Toter<br />
gefunden worden war, der Folterspuren<br />
trug, und man die Fleischlobby dahinter<br />
vermutete, da dachte ich: Hey,<br />
das ist doch ein <strong>Tatort</strong>-Stoff! Aber die<br />
Resonanz auf meine Idee war, na ja, verhalten.<br />
Genauso wie bei Kinderpornografie,<br />
ein furchtbares Milliardengeschäft<br />
mit <strong>Tatort</strong>-Potenzial. Also, es gibt<br />
schon ein paar Sachen, die man ruhig<br />
machen könnte.<br />
Warum ist eigentlich der primär politische<br />
Raum so <strong>Tatort</strong>-frei? Keine Morde im<br />
Kanzleramt.<br />
Da sind die Morde so perfekt, dass man<br />
sie nicht nachweisen kann. Nein, manche<br />
Themen kommen einfach nicht an.<br />
Dazu gehören Geschichten aus der Politik,<br />
aber auch zum Beispiel Geschichten,<br />
die in Schauspielerkreisen spielen.<br />
Ich wollte mal einen Stoff entwickeln lassen,<br />
wo ich einen Schauspieler spiele, der<br />
nicht besonders gut im Geschäft ist und<br />
sich so durchschlägt. Keine Chance.<br />
Man munkelt, dass Sie demnächst einen<br />
sehr politischen <strong>Tatort</strong> zeigen werden.<br />
Pst, unter uns: Man hat Haare gefunden<br />
auf Barschels Strickjacke, auf den Socken<br />
und auf der Hose. Was will ich damit sagen:<br />
Im übernächsten Borowski, der im<br />
Oktober ausgestrahlt wird, wenn sich<br />
Barschels Tod zum 25. Mal jährt, da gibt<br />
es eine Geschichte, in der dieser Todesfall<br />
vorkommt. Mehr kann, will, darf, soll ich<br />
darüber nicht sagen. Aber so viel schon.<br />
Dann eine unverfänglichere Frage: Wo ist<br />
diese unglaublich hässliche hellbraune<br />
Karre her? Und wie lange wollen Sie<br />
diesen alten Passat eigentlich noch fahren<br />
als Kommissar?<br />
Den erschieße ich in der nächsten Folge.<br />
Im Ernst?<br />
Ja, als mein Dienstwagen mal wieder<br />
stehen bleibt, auf freiem Acker. Wie im<br />
Western. Aber der Braune hat sich gewehrt.<br />
Mir ist in der Szene ein Rußpartikel<br />
aus der präparierten Patrone ins<br />
Auge gekommen, weil der Regisseur ein<br />
echtes Mündungsfeuer haben wollte. Ich<br />
hatte sofort einen stechenden Schmerz,<br />
habe aber, wie man das so macht als<br />
Schauspieler, zu Ende gespielt – bis:<br />
„Cut! Danke!“ Und dann sah ich mich<br />
im Spiegel, und das ganze Weiße des<br />
Auges war knallrot. Dann ging’s sofort<br />
ins Krankenhaus.<br />
Das Gespräch führte Christoph Schwennicke<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 29
20 Städte, 20 Titel<br />
Sie bringen die Republik am Sonntagabend zum Stillstand: Alle <strong>Tatort</strong>-Kommissare auf einen Blick<br />
Berlin<br />
Dominic Raacke und Boris<br />
Aljinovic als Till Ritter und<br />
Felix Stark:<br />
Von den U-Bahnschächten bis zu<br />
den Hochhäusern der Hauptstadt<br />
reicht ihr Revier. Actionreich<br />
ermitteln der treuherzige Stark<br />
und der Womanizer Ritter bis in<br />
die Kreise der Mächtigen.<br />
Bremen<br />
Oliver Mommsen und Sabine<br />
Postel als Nils Stedefreund<br />
und Inga Lürsen:<br />
Auf der Suche nach dem Mörder<br />
ist die nordisch-kühle Blondine<br />
Lürsen gern unkonventionell unterwegs.<br />
Obwohl er das missbilligt,<br />
ist Stedefreund zum Schluss ihr<br />
Netz und doppelter Boden.<br />
Dortmund<br />
Jörg Hartmann, Aylin Tezel,<br />
Anna Schudt und Stefan<br />
Konarske als Peter Farber,<br />
Nora Dalay, Martina Bönisch<br />
und Daniel Kossik:<br />
Ein vierköpfiges Team braucht<br />
es, um den alten Haudegen<br />
Schimanski zu ersetzen. Na, dann<br />
mal viel Erfolg im Ruhrpott!<br />
Erfurt<br />
Benjamin Kramme, Friedrich<br />
Mücke und Alina Levshin als<br />
Maik Schaffert, Henry Funck<br />
und Aline Grewel:<br />
Endlich hat auch Thüringen einen<br />
eigenen <strong>Tatort</strong>. Wie ihre Rollen<br />
sind auch die Darsteller des Trios<br />
in den neuen Bundesländern<br />
beheimatet.<br />
Frankfurt<br />
Joachim Król und Nina<br />
Kunzendorf als Frank Steier<br />
und Conny Mey:<br />
Mit Cowboygang und lautem<br />
Dekolleté kennt Mey keine Berührungsängste.<br />
Dem Zyniker Steier<br />
passt das gar nicht. Doch wenn<br />
es drauf ankommt, halten sie<br />
zusammen.<br />
Hamburg<br />
Til Schweiger als neuer<br />
Kommissar in Hamburg:<br />
Nach Schweigers Kritik am<br />
Kult-Vorspann der Serie und Cenk<br />
Batus Tod fragt sich die Republik:<br />
Wie viel Schweiger steckt im<br />
neuen Kommissar?<br />
Hamburg-Umland<br />
Petra Schmidt-Schaller<br />
und Wotan Wilke Möhring<br />
als Katharina Lorenz und<br />
Thorsten Falke:<br />
Ein neues Team im Norden: Erst<br />
ermitteln Lorenz und Falke wegen<br />
brennender Autos in Hamburg-<br />
Blankenese, der zweite Fall führt<br />
sie dann auf eine Nordseeinsel.<br />
Hannover<br />
Maria Furtwängler als<br />
Charlotte Lindholm:<br />
Alleinerziehende Mutter,<br />
deren schluffiger Mitbewohner<br />
weggelaufen ist. Beruflich voll<br />
involviert: Wer mit ihr das Bett<br />
teilt, ist am Ende der Folge meist<br />
tot oder der Mörder.<br />
Kiel<br />
Sibel Kekilli und Axel Milberg<br />
als Sarah Brandt und<br />
Klaus Borowski:<br />
Einmal aneinander gewöhnt,<br />
ergänzen sich der sensible<br />
Borowski und die tatkräftige<br />
junge Kollegin gut. Doch sie ist<br />
krank, und das bleibt nicht ohne<br />
Konsequenzen.<br />
Köln<br />
Klaus J. Behrendt und<br />
Dietmar Bär als Max Ballauf<br />
und Freddy Schenk:<br />
In beschlagnahmten<br />
Kult‐Karosserien fahnden Freddy<br />
und Max wie ein altes Ehepaar<br />
nach dem Mörder. Ende gut, alles<br />
gut: immer an der Wurstbude mit<br />
Blick auf den Dom.<br />
Konstanz<br />
Eva Mattes und Sebastian<br />
Bezzel als Klara Blum und<br />
Kai Perlmann:<br />
Das Muttertier vom Bodensee:<br />
Blum ermittelt mit Menschenkenntnis<br />
und Herzenswärme.<br />
Wird’s brenzlig, steht ihr Perlmann<br />
als Typ Klassensprecher zur Seite.<br />
Leipzig<br />
Martin Wuttke und Simone<br />
Thomalla als Andreas<br />
Keppler und Eva Saalfeld:<br />
Die Schmolllippige und der<br />
knochentrockene Ex-Alkoholiker<br />
waren mal verheiratet, was<br />
zu Zankereien, aber auch<br />
authentischer Tiefe während der<br />
Ermittlungen führt.<br />
30 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Ludwigshafen<br />
Andreas Hoppe und Ulrike<br />
Folkerts als Mario Kopper<br />
und Lena Odenthal:<br />
Als 100-prozentige Polizistin<br />
lässt Odenthal niemals locker.<br />
Mitbewohner und Kollege Kopper<br />
hat italienische Wurzeln und<br />
unterstützt sie nach getaner<br />
Arbeit mit Kochkünsten.<br />
Luzern<br />
Stefan Gubser und Delia<br />
Mayer als Reto Flückiger<br />
und Liz Ritschard:<br />
Vom Bodensee nach Luzern:<br />
Der Schweizer Flückiger wirkt<br />
ordentlich und korrekt, wagt aber<br />
auch „alternative“ Ermittlungsmethoden.<br />
Aus den USA kommt dazu<br />
die neue Kollegin Ritschard.<br />
Saarbrücken<br />
Devid Striesow und<br />
Elisabeth Brück als Jens<br />
Stellbrink und Lisa Marx:<br />
Ungern trennten sich <strong>Tatort</strong>-Fans<br />
von Kappl und Deininger. Werden<br />
Stellbrink und Marx ihnen das<br />
Wasser reichen können?<br />
Stuttgart<br />
Felix Klare und Richy Müller<br />
als Sebastian Bootz und<br />
Thorsten Lannert:<br />
Familienmensch Bootz und der<br />
durch einen Schicksalsschlag<br />
ernst gewordene Lannert ermitteln<br />
meist unter der Fuchtel ihrer<br />
spanisch ins Handy säuselnden<br />
Staatsanwältin Álvarez.<br />
Der <strong>Tatort</strong> ist auch ein Kaleidoskop Deutschlands und<br />
angrenzender Regionen: 20 Ermittlerteams führen durch<br />
den deutschen Fernsehföderalismus. In nur sieben Tagen<br />
vom Hamburger Illustrator Jan Rieckhoff per Pinselstrich<br />
erschaffen, präsentiert <strong>Cicero</strong> in einer einmaligen<br />
Aktion auf 20 Einzeltiteln alle Lokalhelden. Ob Kiel<br />
oder Konstanz, Wiesbaden oder Wien – so findet jeder<br />
<strong>Cicero</strong>‐Leser seinen Lieblingskommissar.<br />
München<br />
Udo Wachtveitl und<br />
Miroslav Nemec als Franz<br />
Leitmayr und Ivo Batic:<br />
Die beiden ergrauten Herren<br />
sind mit Hirn (Leitmayr) und<br />
Herz (Batic) bei der Sache. Das<br />
eingespielte Team trumpft mit<br />
allen emotionalen Facetten auf.<br />
Münster<br />
Jan Josef Liefers und<br />
Axel Prahl als Professor<br />
Karl-Friedrich Boerne und<br />
Frank Thiel:<br />
Karikaturen ihrer selbst: Boerne,<br />
der Kunstfreund mit Hang zur<br />
maßlosen Selbstüberschätzung.<br />
Thiel, der St.Pauli-Fan und<br />
Hippie-Taxifahrer-Sohn. Das sorgt<br />
für Zündstoff.<br />
Wien<br />
Harald Krassnitzer und<br />
Adele Neuhauser als Moritz<br />
Eisner und Bibi Fellner:<br />
Der spießige Eisner arbeitet mit<br />
Ex-Alkoholikerin Fellner von der<br />
Sitte. Er behält die Übersicht, sie<br />
kennt die Straße vom Türsteher<br />
bis zum Inkasso-Heinzi.<br />
Wiesbaden<br />
Ulrich Tukur als Felix Murot:<br />
Murot ermittelt schweigsam und<br />
ohne Rücksicht auf Verluste. Bis<br />
Lilly – sein Hirntumor, auch liebevoll<br />
„die Nuss“ genannt – sich<br />
mit Wahrnehmungsstörungen<br />
einmischt.<br />
Kiel<br />
Hamburg<br />
Bremen<br />
Münster<br />
Hannover<br />
Berlin<br />
Dortmund<br />
Leipzig<br />
Köln<br />
Erfurt<br />
DEUTSCHLAND<br />
Wiesbaden<br />
Frankfurt/Main<br />
Ludwigshafen<br />
Saarbrücken<br />
Stuttgart<br />
München Wien<br />
Konstanz<br />
ÖSTERREICH<br />
SCHWEIZ<br />
Luzern<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 31
T i t e l<br />
„Ihr quatscht alles kaputt“<br />
Drehbuchautoren müssen leiden können, besonders beim <strong>Tatort</strong>. Hier beschreibt einer<br />
von ihnen seinen kreativen Arbeitsalltag – als Dramolett mit den üblichen Verdächtigen<br />
Von Peter Probst<br />
1. Kneipe (innen/Tag)<br />
Versiffte Holztische, abblätternde Wandfarbe,<br />
über dem Filmplakat von „Messer im Kopf“<br />
eine Lichterkette mit farbigen Glühbirnen. Im<br />
Hintergrund ein einsamer Trinker. Um den<br />
zentralen Tisch sitzen die Produzentin (50),<br />
eine Walküre mit hennarotem Haar, der<br />
Redakteur (45), ein Marathonläufer im<br />
azurblauen Polo-Shirt, der Autor (55),<br />
grauhaarig mit tiefen Magenfalten,<br />
die propere Dramaturgin (35), der<br />
Regisseur (60) in einer speckigen, ärmellosen<br />
Lederweste und ein Schauspieler (50), der<br />
weiß, wie bekannt er ist. Der ausgemergelte<br />
Wirt (60) hat die Getränke serviert (bis auf<br />
das Pils des Regisseurs nur Analkoholika) und<br />
zieht sich hinter den Tresen zurück. Vor dem<br />
Autor liegt ein Drehbuch. Unter dem Titel<br />
„Der <strong>Tatort</strong>-Mörder“ steht gesperrt gedruckt<br />
„Drehfassung“.<br />
Produzentin (flüsternd): Ihr wisst,<br />
weshalb wir uns hier treffen?<br />
Alle nicken, der Autor spitzt konzentriert<br />
seinen Bleistift.<br />
Autor (mit deutlicher Verzögerung): Ne,<br />
ich nicht.<br />
Produzentin (flüsternd): Wegen dem Wirt.<br />
Autor: Hä?<br />
Redakteur (flüsternd): Mein Cousin<br />
braucht dringend Unterstützung. Hat<br />
sich mit der Kneipe total verhoben und<br />
wollte sich schon zwei Mal umbringen.<br />
Autor: Ah.<br />
Produzentin: Wisst ihr, dass ich mich<br />
richtig auf diese Besprechung gefreut<br />
habe? Also, wegen mir können wir diese<br />
Fassung so drehen – bis auf ein paar<br />
Dialogänderungen vielleicht.<br />
Der Autor strahlt.<br />
Dramaturgin: Mir ist da noch ein Fehler<br />
aufgefallen. Im siebten Bild sagt Berger:<br />
Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?<br />
Regisseur (stöhnt): Berger. Das ist jetzt<br />
mein dritter Berger im dritten Film.<br />
Können wir den nicht anders nennen?<br />
Kowalczyk zum Beispiel?<br />
Autor: Kowalczyk, gern.<br />
Notiert es.<br />
Dramaturgin: Es heißt aber<br />
Durchsuchungsbeschluss.<br />
Der Regisseur starrt auf ihre Brüste.<br />
Autor: Habe ich doch geschrieben.<br />
(blättert) Mich nervt es furchtbar, dass das<br />
immer wieder falsch gemacht wird. Da …<br />
(stutzt) Aber, wie kommt das denn da rein?<br />
Schweigen.<br />
32 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Redakteur: Ich habe mir erlaubt, das zu<br />
korrigieren.<br />
Autor: Was? In meinem Drehbu …<br />
Redakteur: Der Zuschauer ist es so<br />
gewohnt, da sollten wir ihn nicht ohne<br />
Not verwirren.<br />
Autor: Aber, das geht doch nicht, dass<br />
Sie, ohne mich zu fragen …<br />
Redakteur (unterbricht): Ich möchte jetzt<br />
mal von unserem Kommissar wissen, wie<br />
die Geschichte auf ihn wirkt. Ich meine,<br />
ist sie wirklich spannend?<br />
Der Autor zuckt zusammen.<br />
Schauspieler: Na ja, ich habe nach fünf<br />
Seiten gewusst, wer der Mörder ist.<br />
Produzentin: Die Mörderin.<br />
Schauspieler: Wieso?<br />
Produzentin: Weil es nicht Berger war,<br />
sondern seine Frau.<br />
Regisseur: Frau Kowalczyk.<br />
Schauspieler: Echt? Das versteht man<br />
aber nicht. Egal. Außerdem habe ich im<br />
Vergleich zu diesem Berger …<br />
Regisseur: Kowalczyk. Bitte, nur noch<br />
Kowalczyk.<br />
Schauspieler: … viel zu wenig Dialog.<br />
Autor: Weil du so angelegt bist, dass<br />
du lange nur beobachtest, dir deine<br />
Gedanken machst und am Ende völlig<br />
überraschend zuschlägst.<br />
Schauspieler: Und dann werden meine<br />
Blicke wieder weggeschnitten, weil wir zu<br />
lang sind.<br />
Regisseur: Wir sind deutlich zu kurz.<br />
Autor: Das kann nicht sein. Das Buch ist<br />
20 Seiten länger als mein letzter <strong>Tatort</strong>.<br />
Regisseur: Den hat auch Großkopf<br />
inszeniert, die Schnecke.<br />
Redakteur: Noch mal: Ist dieses Buch<br />
wirklich spannend?<br />
Der Autor beginnt, seinen Bleistift zu<br />
zerkauen.<br />
Schauspieler: Also, wenn Sie mich so<br />
fragen: Nein.<br />
Autor: Nach über 40 <strong>Tatort</strong>en findest du<br />
doch alles langweilig.<br />
Schauspieler: Stimmt nicht. Ich lese<br />
gerade ein Drehbuch, das ist wirklich<br />
spitzenmäßig.<br />
Redakteur: Zum Beispiel glaubt<br />
kein Zuschauer, dass die Frau eines<br />
Kommissars wirklich umgebracht wird.<br />
Dramaturgin: Aber, dass sie gefoltert<br />
wird, fand ich schon interessant. Mich<br />
hat das an „<strong>Am</strong>erican Psycho“ erinnert.<br />
Regisseur (animiert): Vielleicht sollten<br />
wir das mehr ausreizen. Haben Sie da<br />
Ideen?<br />
Dramaturgin (nickt eifrig): Mir fehlt<br />
da zum Beispiel ein Messer. Ein langes,<br />
blitzendes Messer. Phallus-Symbol.<br />
Autor: Schreibe ich euch gern rein. Aber<br />
habt ihr keine Angst, dass darunter<br />
die Szenen mit dem Hungerstreik der<br />
Flüchtlinge leiden?<br />
Produzentin: Die fand ich ja sehr<br />
klischeehaft. Und wahnsinnig aufwendig!<br />
Autor: Klischeehaft? Ich habe<br />
zwei Wochen in Flüchtlingsheimen<br />
recherchiert.<br />
Regisseur: Davon merkt man leider<br />
nichts. Aber, ich mache euch das. Müssen<br />
ja keine Flüchtlinge sein.<br />
Autor: Aber, natürlich. Das ist doch das<br />
Thema.<br />
Redakteur: Ach, ich soll noch vom<br />
Chef grüßen: Er hätte das Ganze gern<br />
komischer.<br />
Alle: Komischer?<br />
Redakteur: Ein bisschen mehr Richtung<br />
Münster-<strong>Tatort</strong>.<br />
Schauspieler: Müns-ter!? Scusi, aber<br />
dafür müsst ihr euch einen anderen<br />
suchen. Ich bin doch kein Zirkusclown.<br />
Produzentin: Leute, bitte, lasst uns beim<br />
Buch bleiben. Wir drehen in zehn Tagen.<br />
Ich muss die Locations klarmachen.<br />
Wenn wir das Flüchtlingsheim nicht<br />
mehr brauchen …<br />
Illustrationen: Leif Heanzo<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 33
T i t e l<br />
Autor: Doch, unbedingt.<br />
Regisseur: Wie fändet ihr ein Bordell?<br />
Autor: Für meine Flüchtlinge?<br />
Regisseur: Die, die schaffen da an.<br />
Dramaturgin: Cool.<br />
Autor: Das sind Jungs.<br />
Regisseur: Mein Gott, dann putzen die<br />
da halt.<br />
Autor: Aber …<br />
Der Redakteur hat die ganze Zeit im Drehbuch<br />
hin- und hergeblättert.<br />
Redakteur: Ich sage jetzt mal was<br />
Ketzerisches: Wie wär’s, wenn wir diesen<br />
Berger ganz rausnehmen?<br />
Regisseur: Wenn wir das Buch<br />
entsprechend überarbeiten.<br />
Autor: Die Ferres als magersüchtige<br />
25-Jährige?<br />
Regisseur: Ich mache euch das. Mit der<br />
Vroni kriege ich das hin.<br />
Autor: Aber wenn die Berger …<br />
Er blättert verzweifelt in seinem Buch.<br />
Dramaturgin: Kowalczyk.<br />
Autor: … die Szenen von ihrem Mann<br />
übernimmt, müsste sie ja an drei Orten<br />
gleichzeitig sein.<br />
Redakteur: Wie lange schreiben Sie<br />
eigentlich schon <strong>Tatort</strong>?<br />
Autor: 19 Jahre, wieso?<br />
Er winkt dem Wirt.<br />
Redakteur: Jetzt darfst du mir ein Glas<br />
von deinem Chardonnay bringen.<br />
Regisseur: Mir noch ein Pils.<br />
Produzentin: Wodka.<br />
Schauspieler: Un’ espresso doppio<br />
macchiato.<br />
Wirt: Was?<br />
Schauspieler: Scusi, ich habe grade zwei<br />
Wochen in Spanien gedreht. Milchkaffee.<br />
Autor: Kamillentee.<br />
Alle machen höhnisch Geräusche des Bedauerns.<br />
Produzentin: Peter, das kriegst du doch<br />
hin.<br />
Illustrationen: Leif Heanzo<br />
Regisseur: Kowalczyk.<br />
Autor: Aber er ist der Gegenspieler.<br />
Ohne ihn …<br />
Redakteur: Dann wären wir auch das<br />
Problem mit der Vorhersehbarkeit los.<br />
Autor: Aber die Frau vom Berger ist so<br />
ein Mäuschen, die käme von selbst nie<br />
auf die Idee mit dem Mord.<br />
Regisseur: Ich hätte da übrigens eine<br />
sensationelle Besetzung. Der Vroni ist<br />
gerade was geplatzt.<br />
Redakteur (erregt): Sie glauben, die Vroni<br />
spielt das?<br />
Redakteur: Weil Sie doch sehr klassisch<br />
denken.<br />
Autor: Klassisch? Ich? Überhaupt nicht.<br />
Ich kann einfach nicht völlig unlogische<br />
Dinge schreiben.<br />
Redakteur: Der Zuschauer ist inzwischen<br />
so geübt im Krimigucken, der setzt<br />
bestimmte Dinge einfach voraus.<br />
Produzentin: Die Logik passiert in der<br />
Lücke, sozusagen.<br />
Autor (entgeistert): Die Logik passiert in<br />
der Lücke.<br />
Redakteur: Genau. Ich würde sagen, so<br />
machen wir das.<br />
Der Autor schaut auf seine Aufzeichnungen.<br />
Autor: Berger raus, statt Flüchtlingsheim<br />
Bordell. Folterszene ausbauen, langes,<br />
blitzendes Messer. Komischer werden.<br />
Logik im Off. Vroni Ferres als 25-jährige<br />
Magersüchtige. Wie soll das alles<br />
zusammengehen?<br />
Redakteur: Ich bin nicht der Autor, aber<br />
das geht.<br />
Schauspieler: Ja, ich habe da ein gutes<br />
Gefühl.<br />
Produzentin: Wie lange wirst du<br />
brauchen, Peter, zwei Tage, drei Tage?<br />
Der Autor ist totenbleich. Er pumpt.<br />
34 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Autor: Habt ihr je drüber nachgedacht,<br />
was es für einen Autor bedeutet, wenn<br />
bei jeder Besprechung alles wieder auf<br />
den Kopf gestellt wird? Das ist die<br />
neunte Fassung. Bei der dritten hieß es:<br />
So machen wir das, es geht nur noch<br />
um ein paar klitzekleine Änderungen.<br />
Ich habe immer alle Bestellungen<br />
Punkt für Punkt abgearbeitet und<br />
jetzt …<br />
Redakteur: Vielleicht war das der Fehler:<br />
Wir bestellen nichts, wir versuchen nur,<br />
mit unseren Anregungen zu helfen.<br />
Autor (außer sich): Helfen? Ihr quatscht<br />
alles kaputt.<br />
Entsetztes Schweigen. Der Autor merkt, dass<br />
er eine rote Linie überschritten hat.<br />
Autor: Sorry, tut mir leid. Vergesst das,<br />
bitte.<br />
Redakteur: Also, ich muss mich schon<br />
sehr wundern. Ich habe Sie immer für<br />
einen Profi gehalten …<br />
Autor: Das bin ich auch. Ich mache das.<br />
Morgen habt ihr die neue Fassung.<br />
Redakteur: Ich möchte aber nicht, dass<br />
Sie als Autor das Gefühl haben, nur<br />
unseren Quatsch umgesetzt zu haben.<br />
Autor: Das habe ich nicht. Ehrlich nicht.<br />
Produzentin: Ich glaube, das hat er echt<br />
nicht so gemeint.<br />
Schauspieler: Ja, er weiß doch, was für<br />
ein Privileg es ist, einen <strong>Tatort</strong> für mich<br />
schreiben zu dürfen.<br />
Der Redakteur mustert den Autor weiter<br />
misstrauisch.<br />
Schauspieler: Jetzt komm, Peter. Ist<br />
schon klar, dass das noch mal ein<br />
ziemlicher Brocken ist. Aber du packst<br />
das. Und was du nicht mehr hinkriegst,<br />
improvisiere ich dir.<br />
Autor (schreit auf): Improvisierst du mir?<br />
Er zieht die Schlinge zu. Da sprühen Funken,<br />
ein Feuerball rast die Lichterkette entlang,<br />
verschwindet in der Steckdose.<br />
2. Küche (innen/Tag)<br />
Der Feuerball verlässt die Steckdose auf der<br />
anderen Seite der Wand, rast ein Stromkabel<br />
entlang, das in einem maroden Wasserkocher<br />
endet. Der Wirt gießt gerade heißes Wasser<br />
über den Kamillenteebeutel. Der Kocher<br />
beginnt in seiner Hand zu glühen. Er kann<br />
ihn nicht loslassen und bricht mit einem<br />
erstickten Schrei zusammen. Dann ein Knall,<br />
die Lichter gehen aus.<br />
Autor (off): Was ist denn jetzt los?<br />
Sich nähernde Schritte. Stimmen im Dunkeln.<br />
Redakteur (off): Sie haben ihn<br />
umgebracht! Sie Mörder!<br />
Dramaturgin (off): Mord? Ist das nicht<br />
eher Totschlag?<br />
Autor (off): Höchstens fahrlässige<br />
Körperverletzung mit Todesfolge.<br />
Produzentin (off): Wir müssen die Polizei<br />
rufen.<br />
Schauspieler (off): Was denn? Das mache<br />
ich. (im Kommissarston) Herr Redakteur,<br />
Sie haben gesagt, Ihr Cousin wollte sich<br />
sowieso umbringen?<br />
Anzeige<br />
Eine Insel für<br />
ausgestoßene<br />
Frauen.<br />
Eine Frau, die<br />
Rache nimmt an<br />
ihren Peinigern.<br />
Der 4. Fall für<br />
Carl Mørck.<br />
Ü: Hannes Thiess Deutsche Erstausgabe 544 Seiten € 19,90<br />
Foto: Wolfgang BAlk<br />
Autor: Muss ich mich jetzt entleiben,<br />
damit Sie mir glauben?<br />
Produzentin: Glückwunsch, das ist<br />
die Idee des Tages. Dann zahlt die<br />
Ausfallversicherung.<br />
Der Autor greift melodramatisch zu der<br />
Lichterkette hinter sich, macht eine Schlinge<br />
und legt sie sich um den Hals.<br />
Alle: Aber dann ist doch alles in<br />
Ordnung.<br />
Peter Probst<br />
54, ist Schriftsteller und<br />
Drehbuchautor. Er schrieb<br />
<strong>Tatort</strong>e wie „Jagdzeit“ (2011)<br />
oder „Gefallene Engel“ (1998)<br />
_<br />
© Peter Peitsch/peitschphoto.com<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 35<br />
www.adler-olsen.de
t i t e l<br />
War nicht alles schlecht<br />
Letzter Rest DDR: Das Ost-Pendant Polizeiruf 110 wird im West-<strong>Tatort</strong> aufgehen und verschwinden<br />
von Matthias Dell<br />
D<br />
er Erfolg des <strong>Tatort</strong>s verdankt<br />
sich neben der Sendezeit dem<br />
einschlägigen Vorspann. Der Versuchung,<br />
diesen zu aktualisieren, hat die<br />
ARD in 40 Jahren widerstanden, was für<br />
große, bis zu einem gewissen Zeitpunkt<br />
vermutlich unfreiwillige Weitsicht spricht.<br />
Dass Til Schweiger als Neukommissar im<br />
Frühjahr vorschlug, den Vorspann abzuschaffen,<br />
weil er „outdated“ sei, zeigt, wie<br />
wenig Schweiger verstanden hat. Allein<br />
durch den altmodischen Vorspann nämlich<br />
nobilitiert der <strong>Tatort</strong> auch durchwachsene<br />
Filme zur Institution und kann heute<br />
eine Geschichte behaupten, die der Reihe<br />
als Tradition gutgeschrieben wird.<br />
Das Gegenbeispiel wäre der Polizeiruf<br />
110, bei dem schon in den DDR-Jahren<br />
der Vorspann mehrfach überarbeitet<br />
worden war und der nach der letzten Aktualisierung<br />
mit einem pseudomodischlieblosen<br />
Auftakt aufwartet. Das kann man<br />
als Mahnung begreifen – und als eine Erklärung<br />
dafür nehmen, warum der Polizeiruf<br />
110 gemeinhin als „schlechter“ gilt,<br />
obwohl er spätestens seit dem Anfang der<br />
nuller Jahre nichts anderes macht als der<br />
<strong>Tatort</strong>. Die vermeintlich höhere Qualität<br />
des <strong>Tatort</strong>s besteht tatsächlich nur im besseren<br />
Label, im immer gleichen Vorspann:<br />
Klassisch ist er nicht, weil er besonders gut<br />
oder zeitlos ist. Klassisch konnte er werden,<br />
weil er nie verändert worden ist.<br />
Das sagt mehr über die Geschichte als<br />
jede Sonntagsrede. Wenn die Vereinigung<br />
von 1990 etwas anderes gewesen wäre als<br />
die Integration der DDR in die Bundesrepublik<br />
zu westdeutschen Bedingungen,<br />
hätte sich das auch auf den <strong>Tatort</strong>-Vorspann<br />
auswirken müssen. Was „outdated“<br />
über den Geschmack von Til Schweiger<br />
hinaus meint, nämlich geschichtspolitisch,<br />
lehrt der Blick auf den Polizeiruf-<br />
110-Vorspann am Beginn der neunziger<br />
Jahre. Musik und Machart sind die gleiche,<br />
der Wahl der Ausschnitte aus den Polizeiruf-110-Folgen<br />
aber, die der Vorspann<br />
Ermittlerteam in der Ost-Provinz:<br />
Hauptmeister Horst Krause und sein<br />
haariger Assistent bekämpfen das<br />
Verbrechen im Polizeiruf 110 des RBB<br />
kompilierte, fielen der Hubschrauber und<br />
die Uniformen der Genossen Volkspolizisten<br />
zwangsläufig zum Opfer.<br />
Bei der Ausdehnung der ARD auf das<br />
Sendegebiet des Deutschen Fernsehfunks<br />
Anfang 1992 soll darüber nachgedacht<br />
worden sein, den Polizeiruf 110 im <strong>Tatort</strong><br />
aufgehen zu lassen. Dass es dazu nicht<br />
kam, hatte verschiedene Gründe. Der Polizeiruf<br />
110, fast genauso alt wie der <strong>Tatort</strong>,<br />
war dem westdeutschen Zuschauer nicht<br />
unbekannt. Die dritten Programme hatten<br />
in den achtziger Jahren gelegentlich<br />
Folgen gezeigt. Vor allem aber ließ sich<br />
mit dem Überleben der Reihe Respekt<br />
gegenüber den ostdeutschen Zuschauern<br />
bekunden; es war nicht alles schlecht im<br />
DDR-Fernsehprogramm.<br />
Die konzeptuellen Unterschiede zwischen<br />
Polizeiruf 110 und <strong>Tatort</strong> wurden<br />
in der Folge eingeebnet. Zu DDR-Zeiten<br />
brauchte es für einen Polizeiruf 110 kein<br />
Kapitalverbrechen, und er war wie das<br />
Land, in dem er spielte: zentralistisch. Was<br />
sich in der Absurdität äußerte, dass es den<br />
Ermittlern, egal, wo sie in der DDR gerade<br />
tätig waren, an Büros und Ortskenntnissen<br />
nie mangelte. Von diesen Qualitäten blieb<br />
eine offenere Erzählweise und als Alternative<br />
zum großstädtischen <strong>Tatort</strong> die Flucht<br />
in den ländlichen Raum.<br />
Das Ende einer „anderen“ Krimireihe,<br />
an der sich bis 2004 auch westdeutsche<br />
ARD-Anstalten beteiligten, hat mit<br />
der Durchformatierung des Fernsehprogramms<br />
zu tun. Den <strong>Tatort</strong>, wie wir ihn<br />
heute kennen, gibt es seit 1994, als die<br />
ARD unter dem Druck des Privatfernsehens<br />
die Zahl der Produktionen deutlich<br />
erhöhte, um den Sonntagabend in ihrem<br />
Sinne zu labeln. Übrig geblieben als einzige<br />
Alternative ist der Polizeiruf 110, der<br />
mittlerweile ebenso föderalistisch organisiert<br />
ist und jene standardisierte Idee von<br />
Aufklärung propagiert, die bei einer Leiche<br />
in den ersten Minuten ansetzt. Die Hallenser<br />
Ermittlungen von Schmücke, Schneider<br />
und mittlerweile Lindner sind deshalb<br />
nicht schlechter, weil es sich um einen Polizeiruf<br />
110 handelt, sondern weil sich der<br />
MDR mit seinen Filmen so wenig Mühe<br />
gibt wie sonst nur der SWR.<br />
Mit Blick auf die Aufmerksamkeitskonzentration<br />
im Fernsehen liegt es nahe<br />
zu vermuten, dass der Polizeiruf 110 eines<br />
nicht zu fernen Tages im <strong>Tatort</strong> aufgehen<br />
wird. Mit Jaecki Schwarz (Schmücke)<br />
wird nächstes Jahr der Kommissar-Darsteller<br />
pensioniert, der kraft seiner Biografie<br />
noch glaubhaft die Identität eines durch<br />
die DDR geprägten Lebens vermitteln<br />
konnte, auch wenn die Filme davon zuletzt<br />
nicht mehr handelten. Horst Krause<br />
als gleichnamiger Polizist in Brandenburg<br />
ist lange als RBB-Darling regionalisiert. An<br />
einem Polizeiruf neben dem <strong>Tatort</strong> könnte<br />
nach Schmückes Abgang dann nur noch<br />
der BR Interesse haben, dem die Alternative<br />
Polizeiruf 110 aktuell ermöglicht, seinen<br />
Reichtum zentralistisch zu pflegen:<br />
Zwei <strong>Tatort</strong>-Kommissariate in München<br />
nämlich wären eines zu viel.<br />
Matthias Dell<br />
arbeitet beim Freitag, wo er auch<br />
einen <strong>Tatort</strong>-Blog veröffentlicht.<br />
In Kürze erscheint sein <strong>Tatort</strong>-<br />
Buch „Herrlich inkorrekt“<br />
Fotos: Oliver Feist/RBB, Oliver Schmidt (Autor)<br />
36 <strong>Cicero</strong> 9.2012
©J.Meese<br />
Ihre Meinung zuBILD, Jonathan Meese?
T i t e l<br />
ach ja, die Quote …<br />
Es hat sich verkauft, also ist es gut? Der Sendeplatz<br />
macht den <strong>Tatort</strong> zum Blockbuster, nicht seine Qualität.<br />
Ein später Stoßseufzer eines Ex-<strong>Tatort</strong>-Kommissars<br />
von Gregor Weber<br />
M<br />
an könnte denken, dass ich<br />
Schauspieler bin. Oder Autor.<br />
Beides falsch. Ich bin <strong>Tatort</strong>-Kommissar.<br />
Beziehungsweise<br />
Ex-<strong>Tatort</strong>-Kommissar,<br />
aber das soll hier egal sein.<br />
<strong>Tatort</strong>-Kommissar ist eine gültige Berufsbezeichnung<br />
an der Grenze zur persönlichen<br />
Eigenschaft. Jemand, der, bevor die<br />
Zeitungen melden, dass er <strong>Tatort</strong>-Kommissar<br />
wird, Schauspieler war, hat wahlweise:<br />
einen Ritterschlag erhalten, ist in<br />
große Fußstapfen getreten, wird der neue<br />
Schimanski, auch gerne der neue weibliche<br />
Schimanski oder – mittlerweile ein großer<br />
Renner – ist der jüngste <strong>Tatort</strong>-Kommissar<br />
aller Zeiten.<br />
Fest steht: Das Label wird man nicht<br />
mehr los. Nie. Und es darf als Konsens gelten,<br />
dass es ein Schauspieler geschafft hat,<br />
wenn er <strong>Tatort</strong>-Kommissar wird. Aber was<br />
genau hat man denn da geschafft?<br />
Nun, man ist Hauptdarsteller in der renommiertesten<br />
Krimireihe des deutschen<br />
Fernsehens, zu sehen auf dem besten Sendeplatz,<br />
vor dem aufgeschlossensten und<br />
klügsten Publikum. Die Redakteure, die<br />
die inhaltliche Verantwortung für die Filme<br />
der Reihe tragen, sind durch die Bank ausgewiesene<br />
Film- und vor allem Krimiexperten<br />
mit genauem Gespür sowohl für die<br />
drängenden Themen des bundesrepublikanischen<br />
Augenblicks als auch die ganz allgemeinen<br />
sozialen, zwischenmenschlichen<br />
und psychologischen Dramen der Gegenwart.<br />
Nur die besten Autoren und Regisseure<br />
arbeiten für dieses Format, Letztere<br />
wiederum suchen sich die innovativsten<br />
Kameraleute, was sich in den Qualitätsansprüchen<br />
an jeden Einzelnen in den Teams<br />
fortsetzt. Dann engagiert die Produktionsfirma<br />
die bestmöglichen Schauspieler für<br />
die Episodenrollen, jeder von ihnen weiß,<br />
dass der sonntägliche Auftritt von Millionen<br />
Zuschauern gesehen wird und wie ein<br />
Nachbrenner im Jet-Triebwerk seiner Karriere<br />
unaufhaltsam Schub verleiht. All das<br />
zu finanzieren, ist unproblematisch. Die<br />
Budgets sind hoch, und die Produktionsfirmen<br />
stecken nahezu jeden Cent in die<br />
Steigerung der Qualität. Beim <strong>Tatort</strong> wird<br />
zu Spitzengagen gearbeitet. Und deswegen<br />
sitzen die Zuschauer an gut 35 Sonntagen<br />
des Jahres um 20:15 Uhr auch immer<br />
wieder atemlos vor diesen fesselnden<br />
Filmen; Getränke und Salzstangen bleiben<br />
unberührt, der Anrufbeantworter ist eingeschaltet,<br />
und die kleinen Kinder, sonst<br />
von permissiver Pädagogik sanft geschaukelt,<br />
fliegen an jenen Abenden kommentarlos<br />
und unter strikten Schweigegeboten<br />
spätestens um 20:10 Uhr in die Federn.<br />
Okay.<br />
Die meisten in den letzten Absätzen<br />
aufgestellten Behauptungen waren leider<br />
unwahr oder zumindest eine, na ja, „optimierte<br />
Version“ der Wirklichkeit. Eine<br />
Sprachregelung, würde man es in Kommunikationsabteilungen<br />
nennen. Sprachregelungen<br />
erstellen solche Abteilungen zu<br />
für die Firma heiklen Themen, die von so<br />
eindeutig öffentlichem Interesse sind, dass<br />
man sie nicht elegant beschweigen kann.<br />
Der <strong>Tatort</strong> gehört wahrscheinlich zu<br />
den Lieblingsspielwiesen der Sendersprecher<br />
des ARD‐Verbunds, weil es hier, ihrer<br />
Meinung nach, nie Katastrophen zu beschönigen<br />
gilt, sondern stets Rekorde und<br />
Verdienste zu verlobhudeln.<br />
Man soll von Kommunikationsabteilungen<br />
nicht erwarten, dass sie Produkte<br />
ihrer Firma objektiv bewerten, das ist nicht<br />
ihr Job. Und kein Abteilungs- oder Projektleiter<br />
– sprich <strong>Tatort</strong>-Redakteur – wird<br />
dem Firmensprecher in zur Veröffentlichung<br />
gedachten Stellungnahmen ernsthaft<br />
von Qualitätsproblemen erzählen.<br />
Würde ja den eigenen Stuhl in Flammen<br />
setzen! Was beim Fernsehen allerdings niemandem<br />
bewusst zu sein scheint: Das Produkt<br />
selbst stellt eine Kommunikation des<br />
Senders mit der Öffentlichkeit dar. Und<br />
die acht bis zwölf Millionen Zuschauer, die<br />
der <strong>Tatort</strong> vor die Glotze lockt, haben eine<br />
gegen null tendierende Schnittmenge mit<br />
der Nachmittagsmeute vor RTL und Co.<br />
Will sagen, der <strong>Tatort</strong>-Zuschauer kann in<br />
der Regel Filme lesen und beurteilen.<br />
„Ha!“, sagt jetzt der <strong>Tatort</strong>-Redakteur,<br />
„das ist der Beweis! Wir können doch gar<br />
nicht falsch liegen, bei der Quote.“<br />
Ach ja, die Quote …<br />
Die Quote, lieber Redakteur, und ich<br />
bin dankbar, dass ich diese steile These endlich<br />
einmal öffentlich loswerden darf, die<br />
Quote sagt doch gar nichts über die Qualität.<br />
Die Quote sagt auch nicht, dass die<br />
Zuschauer den Film gut finden, den sie gerade<br />
gucken. Die Quote spiegelt nur die<br />
Erwartung, die die Zuschauer an den Film<br />
haben. Weil sie die Schauspieler irgendwie<br />
gut finden oder weil man so nett lachen<br />
kann über die Schrullen der Ermittler. Weil<br />
der letzte <strong>Tatort</strong> mit den zweien aus MünsterKölnMünchenBremenWasweißich<br />
ganz<br />
gut oder sogar toll war. Vor allem aber sagt<br />
die <strong>Tatort</strong>-Quote eines: Gebildete, kulturell<br />
interessierte Bürger haben Sonntagabend,<br />
20:15 Uhr Zeit, der Krimireihe<br />
zuzugucken, mit der sie aufgewachsen sind.<br />
Der Sendeplatz ist für das Fernsehen, was<br />
die Lage für Immobilienmakler ist. Die Lizenz<br />
zum Gelddrucken beziehungsweise<br />
Quote zu generieren. Und wozu braucht<br />
die ARD Quote? Nicht für die Werbung,<br />
der Zahn sei hier gezogen. Nein, Redaktion<br />
und Produktionsfirma brauchen die<br />
Quote als Nachweis, dass sie erfolgreich<br />
gearbeitet und die richtigen Entscheidungen<br />
getroffen haben. Kritiker sind unberechenbar,<br />
Preise gibt es zu selten und wenn,<br />
dann zu lange nach der Ausstrahlung, aber<br />
die Quote, die liegt am Morgen danach auf<br />
dem Tisch. Und wenn man sie zum Maßstab<br />
macht, enthebt einen das von jeder Reflexion<br />
über die Qualität des Produkts. Es<br />
hat sich gut verkauft, also ist es gut.<br />
Diese Haltung durchzieht den Apparat<br />
ARD, von Ausnahmen abgesehen. Doch<br />
die kommen offenbar wenig zu Wort, ganz<br />
38 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Derek Henthorn<br />
Webers Zehn-Punkte-Plan für bessere <strong>Tatort</strong>e<br />
Mutige Redakteure Mut gegen den<br />
eigenen Sender. Filme, vor denen der<br />
Programmdirektor Angst hat – das<br />
sollten <strong>Tatort</strong>e sein.<br />
Fähige Redakteure Redakteure<br />
waren früher noch aus eigener Erfahrung<br />
fähig, Filme zu drehen. Sie haben<br />
Filme gemacht, die sie selber gerne<br />
drehen würden.<br />
Flamboyante Redakteure Völlig<br />
aus der Mode gekommen. Redakteure<br />
sollen brennen. Kreative erst recht.<br />
„Dieser <strong>Tatort</strong> wird meine Karriere<br />
beenden, aber scheiß drauf, ich muss<br />
ihn drehen.“ Nur so geht es.<br />
ZeitgemäSSe Erzählformen Natürlich<br />
wird an <strong>Tatort</strong>-Sets über die „Sopranos“<br />
geredet, über „Breaking Bad“<br />
und „The Wire“. Und dann sofort faul<br />
abgewunken: „Die haben soooo viel<br />
Kohle.“ Stimmt. Aber das darf niemanden<br />
abhalten, gründlich zu analysieren,<br />
warum diese Serien so spannend sind,<br />
und die eigene Messlatte genauso<br />
hoch zu hängen.<br />
Weniger Teams Hallo ARD, schon<br />
mal das Wort „Marktüberschwemmung“<br />
gehört? Oder „Verramschung“?<br />
Durch ständig neue Teams soll vor allem<br />
Aufmerksamkeit generiert werden.<br />
Aber neue Schauspieler ändern mal gar<br />
nichts an den Geschichten – und auf<br />
die kommt es an.<br />
so, wie man es als Kreativer kennenlernt,<br />
dem Quote egal ist, aber der Anspruch<br />
alles. Denn das System ist leider maßgeschneidert<br />
für Anspruchslosigkeit. Stoffe<br />
für den <strong>Tatort</strong> werden nicht entwickelt,<br />
weil jemand unbedingt diese Geschichte<br />
erzählen will und ein anderer an diese Unbedingtheit<br />
glaubt. Nein, sie werden entwickelt,<br />
weil ein Sender mit diesem oder<br />
jenem Team einen bis drei Filme pro Jahr<br />
in die Reihe einspeist und das Geld dafür<br />
da ist und nur abgerufen werden muss.<br />
Und der Auftrag geht an eine Produktionsfirma<br />
nicht, weil sie sich überzeugend<br />
präsentiert hat, sondern weil sie – bis auf<br />
sehr seltene Ausnahmen – der Sendeanstalt<br />
oder der Gesamt-ARD gehört und deswegen<br />
Aufträge braucht, die ihre Existenz<br />
rechtfertigen.<br />
Mehr Geld Es muss beim <strong>Tatort</strong> ein<br />
Mindestbudget geben, das deutlich<br />
über den derzeit üblichen liegt.<br />
Die Marke ist auch deswegen kein<br />
Premium produkt mehr, weil sie nicht<br />
wie ein Premiumprodukt finanziert und<br />
produziert wird. Ein <strong>Tatort</strong> muss teurer<br />
sein als der Krempel, der während der<br />
Woche so weggesendet wird.<br />
Konkurrenz Und zwar auf allen<br />
Ebenen. Keine Gewissheiten, keine<br />
Abonnements. Weder für Redakteure<br />
noch für Produktionsfirmen,<br />
nicht für Autoren, Regisseure oder<br />
Schauspieler.<br />
It’s the reality, stupid Kriminalfilme<br />
müssen sich an der Wirklichkeit<br />
messen. Sie ist voll von unglaublichen<br />
Geschichten. Interessiert euch für das<br />
wahre Leben, geht raus und strengt<br />
euch an!<br />
Figuren, Figuren, Figuren Ob Kommissare<br />
oder Killer, ob Zeugen oder<br />
Zaungäste. Erspart ihnen Papiersound,<br />
Thesensprech und Klischees: Die Taffe<br />
und der Depri, der Intuitive und der<br />
Methodische, der Emotionale und die<br />
Kühle, schnarch …<br />
Herzblut Das Wichtigste überhaupt.<br />
Bei den Kreativen sowieso, aber<br />
auch beim Sender. Leider die größte<br />
Mangelware.<br />
Alleine die Bavaria Film (im Wesentlichen<br />
der ARD gehörend) und sechs ihrer<br />
Tochterfirmen produzieren <strong>Tatort</strong>e in<br />
Reihe für sieben von neun ARD-Anstalten.<br />
Der NDR wird von Studio Hamburg bedient,<br />
auch eine ARD-Tochter. Der Hessische<br />
Rundfunk produziert seine <strong>Tatort</strong>e<br />
immerhin komplett selbst, und der MDR<br />
hat die Neuentwicklung für einen <strong>Tatort</strong><br />
Erfurt frei ausgeschrieben.<br />
Solch interne Auftragsvergabe muss<br />
nicht zwangsläufig zu minderer Qualität<br />
führen. Die Firmen sind professionell und<br />
erfahren. Und es gibt ja auch immer wieder<br />
mal gute bis herausragende <strong>Tatort</strong>e. Aber<br />
das Hauptbedürfnis eines systemisch organisierten<br />
Apparats liegt in der Bestandserhaltung.<br />
Also soll es laufen wie gehabt<br />
und lieber nicht wie erträumt. Wagemut<br />
ist keine verlässliche Basis. Lieber ein Konsensprodukt<br />
als einen Ausreißer nach oben,<br />
der immer auch das Risiko des Ausreißens<br />
nach unten in sich trägt. Man darf sich<br />
vorstellen, dass letzten Endes immer eine<br />
graue Runde von Funktionären auf Firmenund<br />
Senderebene über die Stoffe entscheidet.<br />
Die Skills, die für Karrieren in solchen<br />
Apparaten nötig sind, haben nichts<br />
mit Kreativität und künstlerischer oder intellektueller<br />
Urteilskraft zu tun. Immer weniger<br />
Redakteure sind selbst Profis des Erzählens,<br />
Produzenten in diesem Bereich<br />
sowieso nicht.<br />
Kreative, die den Willen und das Talent<br />
haben, Kriminalgeschichten des 21. Jahrhunderts<br />
in das leider nur noch nominell<br />
edelste Format des deutschen Fernsehens<br />
einzubringen, verzweifeln über der achten<br />
Fassung ihres Drehbuchs, weil die einzige<br />
Kritik des Redakteurs in dem Satz bestand:<br />
„Ich weiß nicht, irgendwie macht<br />
mich der Stoff nicht mehr an.“ Verträge,<br />
die ein TV‐Autor heutzutage abschließt,<br />
bestehen aus plumpen Enteignungsparagrafen.<br />
Zu jeder Zeit kann der Autor durch<br />
einen anderen ersetzt werden, stets ist der<br />
Redakteur Alleinentscheider über Abnahme<br />
oder Zurückweisung der aktuellen<br />
Fassung. Und die letzte Fassung schreibt<br />
immer öfter der Regisseur – das gibt noch<br />
mal Extrakohle. Unter solchen Umständen<br />
wird die Annahme von „Kritik“ zur<br />
reinen Überlebensfrage für den Künstler.<br />
Das machen die wirklich guten Autoren<br />
nicht lange mit, so eine Politik zieht lediglich<br />
Jasager an, die die Chance wittern,<br />
ihre künstlerische Minderbegabung durch<br />
Hörigkeit wettzumachen. Und das funktioniert.<br />
Der Apparat stülpt also die Karrierekriterien<br />
einer starren Verwaltung über<br />
den Kreativbereich, in dem eigentlich der<br />
Streit um die überwältigende Vision im absoluten<br />
Zentrum zu stehen hätte.<br />
Soll sich also keiner wundern, wenn<br />
er Sonntagabend, 20:15 Uhr in der ARD<br />
mal wieder das Gefühl hat, dem unbeholfen<br />
in Krimiform gebrachten Monatsbericht<br />
eines Gleichstellungsbeauftragten zuzugucken.<br />
Gregor Weber<br />
Jahrgang 1968, ist Autor und<br />
Schauspieler. Im <strong>Tatort</strong> war er bis<br />
Januar 2012 als saarländischer<br />
Kommissar Deininger zu sehen<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 39
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Der Mutant<br />
Peter Müller, einst CDU-Politiker, heute Verfassungsrichter, entscheidet mit beim ESM-Urteil<br />
von Benno Stieber<br />
D<br />
ie scharlachroten Roben sind<br />
vielen Richtern ein Graus. Mal<br />
verheddert sich das weite Gewand<br />
in den Rollen des Richterstuhls, mal<br />
vergessen sie das Barett abzusetzen. Nur<br />
wenigen Richtern gelingt es, in der Robe<br />
eine gute Figur zu machen. Bei Peter Müller,<br />
wenn er meist ganz links auf der Richterbank<br />
sitzt, wirkt die Robe, als wäre sie<br />
ein Stück zu groß.<br />
Man hat ihn noch als selbstbewussten<br />
saarländischen Landesvater in Erinnerung.<br />
Jetzt ist er Teil des wohl mächtigsten<br />
Kollektivs des Landes. Müller ist in<br />
bewegten Zeiten gekommen. Das Gericht<br />
muss über die Zukunft des Euro mitentscheiden<br />
oder gleich der ganzen Europäischen<br />
Union – wer weiß das in diesen Tagen<br />
schon so genau. Bei der mündlichen<br />
Verhandlung zum ESM im Sommer saß er<br />
auf der Richterbank und stellte seinen ehemaligen<br />
Parteifreunden kritische Fragen zu<br />
den Abläufen im Bundestag bei dieser historischen<br />
Entscheidung. Aber seine neue<br />
Rolle ist für beide Seiten noch ungewohnt.<br />
In der Verhandlung wurde er von fast jedem<br />
Parlamentarier als „Herr Verfassungsrichter“<br />
Müller angesprochen – als einziger<br />
der acht Richter. Gleichgültig, ob das als<br />
kleine Spitze gegen den ehemaligen Kollegen<br />
Ministerpräsidenten gemeint ist, der<br />
von ihren Gnaden auf seinen Posten kam,<br />
oder ganz unbewusst. Peter Müller werden<br />
diese Feinheiten nicht entgangen sein.<br />
Müller hat im Sauseschritt die Seiten<br />
gewechselt. Kaum vier Monate lagen damals<br />
zwischen seinem Rücktritt in Saarbrücken<br />
und seinem <strong>Am</strong>tsantritt in Karlsruhe,<br />
der von bösen Kommentaren begleitet<br />
wurde. Es wurde seine mangelnde Qualifikation<br />
für das höchste Richteramt im<br />
Land kritisiert. Seine einschlägigen Erfahrungen<br />
beschränken sich tatsächlich auf<br />
zwei Jahre als <strong>Am</strong>tsrichter in Ottweiler und<br />
zwei Jahre beim Landgericht Saarbrücken.<br />
Wissenschaftliche Veröffentlichungen von<br />
bleibender Bedeutung sind von ihm nicht<br />
bekannt. Kritiker fürchteten, hier würde<br />
ein amtsmüder Ministerpräsident auf einem<br />
Richtersessel entsorgt. Es war von politischem<br />
Kuhhandel die Rede.<br />
Aber der wohl schwerwiegendste Vorbehalt,<br />
warum es vielleicht keine gute Idee<br />
ist, einen amtierenden Ministerpräsidenten<br />
zum krönenden Abschluss seiner Karriere<br />
zum Verfassungsrichter zu machen, wurde<br />
schon bald offenkundig.<br />
Beim jährlichen Presseempfang des Gerichts<br />
im Februar, bei dem traditionell die<br />
Fälle präsentiert werden, die die Senate<br />
im laufenden Jahr zum Abschluss bringen<br />
wollen, trug Müller eine Verfassungsbeschwerde<br />
gegen die Wahl der letzten Bundespräsidenten<br />
vor, die in seinem Dezernat<br />
liegt. Es geht dabei um die Frage, ob<br />
die Wahlmänner bei der Wahl der Bundespräsidenten<br />
Horst Köhler und Christian<br />
Wulff ordnungsgemäß bestimmt worden<br />
sind. Müller wäre zum ersten Mal Berichterstatter<br />
in einem Verfahren gewesen. Er<br />
hätte die Beratung im Senat vorbereitet,<br />
sein Votum wäre von großem Gewicht bei<br />
der Entscheidung.<br />
Allerdings war Müller 2009 und 2010<br />
auch einer der Wahlmänner, gegen deren<br />
Kür nun geklagt wird. Auf die Frage, ob<br />
Wulff und Köhler nun womöglich gar nicht<br />
ordnungsgemäß gewählt worden seien, antwortete<br />
Müller gut gelaunt, er könne sich<br />
nicht näher dazu äußern, weil ein Befangenheitsantrag<br />
vorliege. Verschmitzt fügte<br />
er hinzu: Spätestens wenn er jetzt antworten<br />
würde, wäre er wohl befangen. Eine<br />
Pointe, wie man sie vom Politiker Müller<br />
kennt. Aber aus dem Witz wurde Ernst.<br />
Der Zweite Senat hat ihn von dem Verfahren<br />
wegen Befangenheit ausgeschlossen.<br />
Die erste große Entscheidung aus Müllers<br />
Dezernat findet nun ohne ihn statt.<br />
Und es stehen weitere Verfahren an, bei<br />
denen Ähnliches droht. Ein weiteres NPD-<br />
Verbotsverfahren etwa. Als Politiker hatte<br />
sich Müller stets dagegen ausgesprochen.<br />
Macht ihn das bei einer Entscheidung<br />
des Verfassungsgerichts nun befangen?<br />
Oder Seehofers Klage gegen den Länderfinanzausgleich.<br />
Als Ministerpräsident eines<br />
strukturschwachen Landes war Müller<br />
immer ein entschiedener Befürworter des<br />
Transfers. Dürfte er nun als Richter darüber<br />
urteilen?<br />
Man würde Peter Müller gerne selber<br />
danach fragen. Doch die Pressestelle des<br />
Gerichts erklärt, dass er in diesem Jahr<br />
nicht für Interviews zur Verfügung steht.<br />
Ein Schweigegelübde passt gut in die<br />
klösterliche Atmosphäre des höchsten Gerichts,<br />
es ist offenbar Teil seines Eingliederungsprogramms<br />
in den „Achter ohne<br />
Steuermann“.<br />
Denn Ansehen unter den Kollegen erwirbt<br />
man sich in Karlsruhe weniger durch<br />
öffentlichkeitswirksame Auftritte als durch<br />
fleißiges Aktenstudium und brillante juristische<br />
Argumente. Und nicht selten klafft<br />
zwischen dem Einfluss einzelner Richter im<br />
Haus und der Aufmerksamkeit, die sie in<br />
der Öffentlichkeit genießen, eine größere<br />
Lücke. Die Lauten sind auch beim Verfassungsgericht<br />
nicht immer die Tüchtigen.<br />
Karlsruhe war für Müller seit einem<br />
Auftritt als Sachverständiger bei einer<br />
mündlichen Verhandlung vor einigen Jahren<br />
ein Sehnsuchtsort. Er hat das immer<br />
wieder durchblicken lassen. Ob das <strong>Am</strong>t<br />
seinem Temperament entspricht, ist aber<br />
noch offen. Ein politischer Weggefährte<br />
hatte vor Müllers <strong>Am</strong>tsantritt Zweifel angemeldet:<br />
„Der weiß gar nicht, was er sich<br />
da antut.“ Inzwischen dürfte er eine Ahnung<br />
haben.<br />
Benno Stieber<br />
berichtet als freier Korrespondent<br />
unter anderem für die Financial<br />
Times Deutschland von den<br />
Bundesgerichten in Karlsruhe<br />
Fotos: Imago, privat (Autor)<br />
40 <strong>Cicero</strong> 9.2012
„Herr Verfassungsrichter“,<br />
frotzeln seine<br />
einstigen Kollegen im<br />
Verhandlungssaal<br />
Peter Müller, früher CDU-Ministerpräsident im Saarland<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 41
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Wolfgang und ich<br />
Bisher hat Ingeborg Schäuble ihr Leben stets anderen gewidmet – das soll sich nun endlich ändern<br />
von Georg Löwisch<br />
E<br />
s ist auf den ersten Blick unvorstellbar,<br />
dass die schmale Frau mit<br />
der leisen Stimme das alles gemacht<br />
haben soll. Dass sie als Mädchen in<br />
Südbaden mit dem Traktor die Wege hochgebolzt<br />
ist. Dass sie fast allein vier Kinder<br />
großgezogen hat. Sich in den Angolakrieg<br />
einfliegen ließ. Und dass sie jede Etappe der<br />
vielleicht härtesten deutschen Politikerbiografie<br />
der vergangenen Jahrzehnte mitgegangen<br />
ist: den Weg ihres Mannes, Wolfgang<br />
Schäuble.<br />
Sitzt man Ingeborg Schäuble eine<br />
Weile gegenüber in einem Gartencafé in<br />
Berlin-Grunewald, dann meint man freilich,<br />
Anhaltspunkte für die Stärke dieser<br />
Frau auszumachen. Die kräftigen Hände<br />
zum Beispiel oder diese Spur von Bestimmtheit<br />
in ihren leisen Sätzen. Auf die<br />
Frage, wie sie reagiert, wenn ihr Mann unduldsam<br />
wird, sagt sie bloß: „Ich nehme<br />
das dann gar nicht erst zur Kenntnis.“<br />
<strong>Am</strong> 18. September wird der Finanzminister<br />
70 Jahre alt. Die CDU wird ihn feiern,<br />
eine Biografie wird erscheinen, eine<br />
Fernsehdokumentation ausgestrahlt werden.<br />
Es wird wieder um die Frage gehen,<br />
wie Wolfgang Schäuble das alles aushalten<br />
kann.<br />
Und Ingeborg?<br />
Die glücklichen Momente in der Kindheit<br />
von Ingeborg Hensle spielen vor dem<br />
weichen, hügeligen Grün des Kaiserstuhls.<br />
Aus dem Weinbaugebiet stammt ihre Mutter,<br />
und die fährt von Freiburg, wo die Familie<br />
wohnt, häufig zu den Verwandten.<br />
Ingeborg und ihre zwei Geschwister kommen<br />
mit, sie helfen im Weinberg oder bei<br />
der Obsternte. Nach der Knochenarbeit<br />
vespern alle zusammen unter einem Baum.<br />
In der Szene liegen einige Dinge, die Ingeborg<br />
Schäuble prägen: Das Vergnügen<br />
kommt nach der Arbeit. Und die Familie<br />
ist das Wichtigste.<br />
Nach dem Abitur studiert sie Volkswirtschaft.<br />
In der Freiburger Mensa trifft<br />
sie einen Jurastudenten. Sie heiraten. Wolfgang<br />
und Ingeborg, das ist zunächst auch<br />
beruflich eine gleich starke Beziehung.<br />
Sie fängt beim Freiburger Pharmaunternehmen<br />
Gödecke an, er beim Finanzamt.<br />
Manchmal kocht er ihr Linsen mit Spätzle.<br />
Eines Abends ruft die Junge Union an und<br />
trägt Wolfgang Schäuble die erste Bundestagskandidatur<br />
an. Er sagt zu, er gewinnt,<br />
da hat ihn die Politik. Meist bringt sie ihn<br />
Montagnacht um halb zwölf zum IC nach<br />
Bonn. „Und dann war er für die ganze Woche<br />
weg.“<br />
Obwohl sie schon zwei Kinder haben,<br />
lässt sie sich zur Lehrerin ausbilden. Aber<br />
als sie es geschafft hat, kommt das dritte<br />
Kind. Sie entscheidet, nur für die Familie<br />
da zu sein, wenn schon der Vater in Bonn<br />
ist. Fragt man sie, ob sie mit der Politik<br />
konkurriert habe um diesen Mann, sagt sie:<br />
„Ich hätte nie meinen Mann vor die Entscheidung<br />
gestellt – die Politik oder ich.“<br />
1990 schießt ein geistig Verwirrter auf<br />
Wolfgang Schäuble. Er überlebt. Aber das<br />
Leben nach dem Überleben ist ein Kampf,<br />
auch für seine Frau. Die Verben klingen<br />
hart, wenn sie über diese Zeit redet.<br />
Durchstehen, verzichten. 1991 bucht sie<br />
eine Reise nach Ägypten, sie muss raus, sie<br />
macht das nur für sich.<br />
Fünf Jahre später wird sie zur Vorstandsvorsitzenden<br />
der Welthungerhilfe<br />
gewählt. Sie reist zu den Projekten. Einmal,<br />
1999 in Angola, muss ihr Flugzeug<br />
lange über der eingekesselten Stadt Balombo<br />
kreisen, um nicht abgeschossen zu<br />
werden. Aber sie will den Menschen dort<br />
unbedingt Mut machen. Sie prangert die<br />
Ölkonzerne an, die die Kassen von Angolas<br />
Kriegsherren füllen. Ihr <strong>Am</strong>t besteht<br />
auch aus viel Kleinarbeit. Alleine tingelt<br />
sie im Regionalexpress zu den Initiativen<br />
und Weihnachtsbasaren. „Für keinen Termin<br />
war sie sich zu schade“, sagt Simone<br />
Pott, die Sprecherin der Welthungerhilfe.<br />
„Sie war nie eine Charity-Lady.“<br />
Neben ihrem <strong>Am</strong>t bei der Welthungerhilfe<br />
betreut sie ihre pflegebedürftige Mutter,<br />
sie hat sie zu sich nach Berlin geholt.<br />
Sie muss das machen, so ist sie, das ganze<br />
Leben kümmert sie sich um andere, um<br />
die Kinder, die Mutter, die Hungernden<br />
der Welt und um den Mann im Rollstuhl.<br />
„Es ist ja nicht so, dass man nichts für sich<br />
tut, wenn man für andere etwas tut“, sagt<br />
sie. „Aber ich habe immer gedacht, meine<br />
Zeit kommt noch.“<br />
2008 gibt sie das <strong>Am</strong>t bei der Welthungerhilfe<br />
ab. 2010 ist ihr Mann so krank,<br />
dass er während einer Brüssel-Reise in die<br />
Klinik muss. Schon tags darauf verlässt er<br />
das Krankenhaus wieder, der Professor ist<br />
fassungslos. Keine ärztliche Begleitung,<br />
kein Krankenwagen, nur Wolfgang und<br />
Ingeborg.<br />
Der Minister erholt sich. 2011 stirbt<br />
Ingeborg Schäubles Mutter.<br />
Auf einmal hat sie Zeit. Sie ist 68. Sie<br />
beschließt, einfach mal nicht so viel zu machen.<br />
Der Haushalt, aber sonst: lesen, Rad<br />
fahren, Leute treffen, Fitnessstudio. Es ist<br />
fast ein Wunder, dass der Pflichtmensch Ingeborg<br />
Schäuble so unbefangen über Freizeit<br />
sprechen kann.<br />
Und paradox: Während man bei Wolfgang<br />
Schäuble bisweilen den Eindruck hat,<br />
er tue alles, um nicht von unverplanter<br />
Zeit überrumpelt zu werden, hat sich Ingeborg<br />
Schäuble diese Zeit erkämpft. „Ich<br />
nutze die gewonnenen Freiräume“, sagt<br />
sie. Vielleicht zum ersten Mal lebt sie einfach<br />
so in den Tag hinein. Sie kann es sich<br />
leisten, die Frau, an der man sehen kann,<br />
welche Größe darin liegt, für andere da<br />
zu sein.<br />
Georg Löwisch<br />
ist Textchef bei <strong>Cicero</strong><br />
Fotos: Karin Rocholl, Wolfgang Borrs (Autor)<br />
42 <strong>Cicero</strong> 9.2012
„Es ist ja nicht<br />
so, dass man<br />
für sich nichts<br />
tut, wenn man<br />
für andere etwas<br />
tut“ – demnach<br />
hat Ingeborg<br />
Schäuble auch viel<br />
für sich getan<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 43
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
PreuSSen im Shitstorm<br />
Hermann Parzinger bringt als Chef der „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ derzeit die Feuilletons gegen sich auf<br />
von alexander marguier<br />
D<br />
afür, dass Hermann Parzinger die<br />
derzeit meistverachtete Person<br />
im deutschen Kulturbetrieb ist,<br />
wirkt er einigermaßen gefasst. Leute, die<br />
ihn gut kennen, behaupten allerdings, die<br />
Contenance des 53‐Jährigen sei reine Fassade;<br />
tief im Inneren sei der Präsident der<br />
Berliner „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“<br />
empfindlich getroffen – geradezu fassungslos<br />
über die Vorwürfe, die seit einigen Wochen<br />
auf ihn niederprasseln. Einen Kulturbanausen<br />
und Bilderstürmer hat man ihn<br />
geschimpft, wobei das noch die harmloseren<br />
Verbalattacken in Richtung dieses<br />
feingliedrigen, zurückhaltend wirkenden<br />
Mannes mit dem grau melierten Vollbart<br />
waren. Im medialen Shitstorm, den etliche<br />
bisweilen gar nicht sonderlich feinsinnige<br />
Feuilletonisten heraufbeschworen haben,<br />
herrscht offenbar die totale Enthemmung.<br />
Gerade so, als hätte ein Kartell von Kunstkritikern<br />
nur auf die passende Gelegenheit<br />
gewartet, um endlich auch mal so richtig<br />
die Sau rauslassen zu können: Boulevard<br />
meets Museum.<br />
Wie konnte es so weit kommen? Das<br />
Unglück nahm seinen Lauf am 12. Juni<br />
dieses Jahres mit einer, fast könnte man<br />
sagen: Petitesse von zehn Millionen Euro.<br />
Das ist natürlich nicht ganz wenig, aber im<br />
Vergleich zum 260 Millionen Euro schweren<br />
Gesamtetat der Preußen-Stiftung dann<br />
eben doch eher ein Trinkgeld. Ein gut gemeintes<br />
allemal, denn diese Summe, die<br />
an jenem frühsommerlich-heiteren Dienstag<br />
bei Beratungen zum Nachtragshaushalt<br />
im Bundestag der von Parzinger geleiteten<br />
Kulturinstitution zugeschlagen wurde,<br />
sollte so etwas sein wie die Initialzündung<br />
für eine Neuordnung der Berliner Museumslandschaft.<br />
Dieses Projekt firmiert inzwischen<br />
fast nur noch unter dem bündigen<br />
Titel „Rochade“, und es ist – anders als<br />
die Feuilletonpanik vermuten lässt – ein<br />
ziemlich alter Hut. Was Hermann Parzinger<br />
in seiner unaufgeregten Art jedenfalls<br />
als „die Lösung aller Probleme“ beschreibt,<br />
kommt je nach Standpunkt entweder einem<br />
Befreiungsschlag gleich oder aber einem<br />
Hütchenspiel mit viel Trickserei und<br />
ganz, ganz bösem Ende für die schönen<br />
Künste.<br />
So viel zur Ausgangslage: Berlin verfügt<br />
mit seiner Gemäldegalerie über eine der<br />
bedeutsamsten Sammlungen Alter Meister<br />
weltweit. Beherbergt wird sie von einem<br />
erst 1998 eröffneten Museum, das<br />
dafür zwar maßgeschneidert wurde, sich<br />
jedoch in einer etwas ungünstigen innerstädtischen<br />
Brachenlandschaft neben der<br />
Philharmonie und in Sichtweite des Potsdamer<br />
Platzes befindet. Ebenfalls ganz in<br />
der Nähe liegt die Neue Nationalgalerie<br />
mit ihrem berühmten Mies-van-der-Rohe-<br />
Bau aus dem Jahr 1968 – der als Ausstellungsfläche<br />
für insbesondere die Kunst der<br />
Klassischen Moderne schon seit Anbeginn<br />
aus allen Nähten platzt; nur ein kleiner<br />
Bruchteil der Bestände kann überhaupt<br />
dort gezeigt werden. Einen halben Kilometer<br />
Luftlinie in nordöstlicher Richtung<br />
von diesem Quartier entfernt: die Museumsinsel<br />
mit unter anderen dem Bode-<br />
Museum für Skulpturen vom Mittelalter<br />
bis zum späten 18. Jahrhundert. Wäre es<br />
nicht schlau, so schlugen es die Befürworter<br />
der Rochade schon vor mehr als zehn<br />
Jahren vor, die Alten Meister aus der Gemäldegalerie<br />
auf die Museumsinsel zu bringen<br />
und die Gemäldegalerie stattdessen in<br />
ein großes „Museum des 21. Jahrhunderts“<br />
umzuwidmen? Zumal sämtliche Flächen<br />
und Kunstwerke, die davon betroffen sind,<br />
ohnehin der „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“<br />
unterstehen?<br />
Wie aus diesem alles andere als abwegigen<br />
Plan quasi über Nacht ein erbitterter<br />
Kulturkampf werden konnte, ist ein<br />
Rätsel, das nicht nur Hermann Parzinger<br />
zu schaffen macht. Sondern auch Bundestagsabgeordneten<br />
wie Monika Grütters von<br />
der CDU, die mit viel Engagement für die<br />
Rochade geworben haben und es als Signal<br />
feiern wollten, dass die zehn Millionen<br />
Euro im Nachtragshaushalt für die<br />
Umbaumaßnahmen der Gemäldegalerie<br />
zu einem „Museum des 21. Jahrhunderts“<br />
bewilligt worden waren. Warum es anders<br />
kam, versucht Parzinger sich nun mit einem<br />
„etwas unglücklichen Ablauf der Ereignisse“<br />
zu erklären. Auch seine Stiftung<br />
sei von dem Zehn-Millionen-Segen überrascht<br />
worden, „wir hätten das gerne anders<br />
kommuniziert“. Vielleicht ahnte er ja bereits,<br />
dass sogar Feuilletonschreiber inzwischen<br />
vom Wutbürgervirus infiziert sind<br />
und plötzlich wild um sich schlagen können,<br />
wenn sie sich vor vermeintlich vollendete<br />
Tatsachen gesetzt fühlen. Der notorische<br />
Herdentrieb in der Kunstkritik sorgt<br />
dann für den Rest.<br />
Also hat Hermann Parzinger die vergangenen<br />
Wochen vor allem damit zugebracht,<br />
dem anschwellenden Bocksgesang<br />
seiner Kritiker Argumente entgegenzusetzen.<br />
Da geht es beispielsweise um den Vorwurf,<br />
die altmeisterlichen Gemälde würden<br />
wegen der Rochade für Jahrzehnte,<br />
wenn nicht für immer in irgendwelchen<br />
Lagern verschwinden. Falsch, beteuert der<br />
Stiftungschef, maximal sieben Jahre lang<br />
müsse wegen des Umzugs mit Einschränkungen<br />
gerechnet werden: Die Hälfte der<br />
aktuell gezeigten Werke könne im Bode-<br />
Museum präsentiert werden, und weil für<br />
die Übergangszeit bis zur Eröffnung eines<br />
Neubaus auf der Museumsinsel provisorische<br />
Ausstellungsflächen gefunden<br />
würden, seien 70 bis 80 Prozent des Bestands<br />
auch weiterhin öffentlich zugänglich.<br />
„Wenn man uns da vorwirft, Kulturschänder<br />
zu sein, dann verstehe ich die<br />
Welt nicht mehr.“<br />
Mit noch größerem Unverständnis<br />
dürfte Parzinger auf einen Zeitungsartikel<br />
des FAZ-Altkritikers Eduard Beaucamp<br />
reagiert haben, der Mitte Juli in geradezu<br />
unflätiger Weise die Umzugspläne<br />
Foto: Andreas Pein<br />
44 <strong>Cicero</strong> 9.2012
So schnell gibt er<br />
sich nicht geschlagen:<br />
Hermann Parzinger<br />
in der Berliner<br />
„Villa von der<br />
Heydt“, dem Sitz der<br />
Preußen-Stiftung<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 45
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
verdammte: Von einem „Handstreich“ war<br />
da die Rede, von einem „Abbruchunternehmen“<br />
und einem „brachialen Planungsdesaster“.<br />
Einmal davon abgesehen, dass<br />
derselbe Beaucamp die Rochadenpläne einige<br />
Jahre zuvor noch regelrecht bejubelt<br />
hatte, nutzte der inzwischen 75-jährige Kritiker<br />
seine Suada gleich noch für persönliche<br />
Beleidigungen: Parzinger sei „ohne<br />
Sensibilität für die klassischen Künste“,<br />
seine Argumente von „Einfalt und Grobheit“<br />
gezeichnet. Will sagen: Ein Archäologe<br />
an der Spitze der „Stiftung Preußischer<br />
Kulturbesitz“ mit ihren 16 Staatlichen Museen,<br />
der Staatsbibliothek und etlichen Instituten,<br />
das könne ja sowieso nicht gut gehen<br />
– solche Typen graben doch sonst nur<br />
den Sand in der Wüste um.<br />
„Sprachlich war das zum Teil unter der<br />
Gürtellinie“, sagt Parzinger, aber was ihn<br />
wirklich entsetzt habe: „Dass die FAZ einer<br />
Gegenmeinung überhaupt keinen Platz einräumt.“<br />
Er selbst sei von der Sekretärin abgewimmelt<br />
worden beim Versuch, den zuständigen<br />
Feuilleton-Herausgeber ans Telefon zu<br />
bekommen. Kein Wunder also, wenn bei<br />
der Preußen-Stiftung inzwischen von einer<br />
Kampagne die Rede ist. Gut möglich, heißt<br />
es, dass alte Differenzen wegen dem Wiederaufbau<br />
des Berliner Stadtschlosses der<br />
Grund dafür sind; auch an diesem Vorhaben<br />
ist die „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“<br />
maßgeblich beteiligt.<br />
Dass dem Archäologen Parzinger vor<br />
gut vier Jahren eine der größten Kulturinstitutionen<br />
des Landes anvertraut wurde,<br />
war kein Zufall – am Ende machte er sogar<br />
gegen den flamboyanten Kulturwissenschaftler<br />
Martin Roth das Rennen,<br />
der inzwischen das „Victoria and Albert<br />
Museum“ in London leitet. Aber Parzinger<br />
hatte sich bis dahin eben nicht nur als<br />
Altertumsforscher von Weltrang etabliert,<br />
sondern als Leiter des „Deutschen Archäologischen<br />
Instituts“ noch dazu großes organisatorisches<br />
Geschick bewiesen. Außerdem<br />
spricht der Mann zehn Sprachen<br />
und hat exzellente Kontakte nach Russland,<br />
die er bei Verhandlungen über die<br />
Rückgabe von Beutekunst aus dem Zweiten<br />
Weltkrieg bestens zu nutzen weiß. Für<br />
seine Verdienste um die Erforschung der<br />
Skythen, eines Reiternomadenvolks, das<br />
im 8. Jahrhundert in die Wolgagegend<br />
vordrang, bekam Parzinger vor drei Jahren<br />
sogar den „Orden der Freundschaft“<br />
von Dmitri Medwedew überreicht – die<br />
höchste Auszeichnung, die Russland an<br />
Ausländer zu vergeben hat. Während seiner<br />
Urlaube nimmt der passionierte Forscher<br />
immer noch an Grabungen teil, doch<br />
dass ihm dieser wissenschaftliche Eifer jetzt<br />
als Ausweis für Kulturbanausentum vorgehalten<br />
wird, hätte er sich wahrlich nicht<br />
träumen lassen. „Etwas billig“ sei diese Masche<br />
seiner Kritiker, stellt Hermann Parzinger<br />
dazu nur kühl fest.<br />
Im Arbeitszimmer des Stiftungspräsidenten,<br />
gleich neben der Eingangstür,<br />
befindet sich eine Ansicht des Brandenburger<br />
Tors – ein Werk Oskar Kokoschkas,<br />
das bereits von Parzingers Vorgänger<br />
Einfalt und Grobheit werden<br />
ihm wegen der Umzugspläne für<br />
Berlins Alte Meister vorgeworfen<br />
ausgesucht worden war. Er selbst hat sich<br />
aus dem Archiv zwei Bilder von Erich Heckel<br />
ausgeliehen, die nun neben seinem<br />
Schreibtisch hängen; der Übergang von<br />
Impressionismus zum Expressionismus<br />
bei diesem Künstler fasziniere ihn – „auch<br />
wenn manche Kollegen ein bisschen die<br />
Nase rümpfen“.<br />
Vom Sitz der Preußen-Stiftung am<br />
Landwehrkanal gelangt man zu Fuß in weniger<br />
als 15 Minuten zur Gemäldegalerie.<br />
Parzinger gibt gerne zu, dass er selbst viel<br />
zu selten den Weg dorthin finde – er hat<br />
sich eben noch um tausend andere Sachen<br />
zu kümmern. Aber auch auf Kunstinteressierte<br />
mit deutlich weniger Zeitdruck wirkt<br />
das Museum mit seinen altmeisterlichen<br />
Schätzen nicht gerade wie ein Magnet:<br />
250 000 Besucher im Jahr; die „Gemäldegalerie<br />
Alte Meister“ in Dresden kommt<br />
auf das Doppelte. Nun vertreten zwar beflissene<br />
Advokaten der reinen Lehre den<br />
Standpunkt, wer sich an solcherlei Zahlen<br />
orientiere, stelle die schönen Künste „auf<br />
eine Stufe mit Massenspektakeln“ (FAZ).<br />
Doch diese reichlich dünkelhafte Haltung<br />
lässt wiederum Parzinger nicht gelten: „Wir<br />
haben ja auch einen Beitrag zur kulturellen<br />
Bildung zu leisten.“ Und da darf man sich<br />
durchaus schon mal die Frage stellen, warum<br />
in der Berliner Gemäldegalerie trotz<br />
ihrer grandiosen Sammlung nicht selten<br />
mehr Museumswärter als Museumsgäste<br />
anzutreffen sind.<br />
„Es würde dem Ort wirklich helfen,<br />
wenn er ein klareres Profil bekäme“, lautet<br />
Parzingers feste Überzeugung. Gerade<br />
wegen der Nähe zum Potsdamer Platz, zur<br />
Philharmonie von Hans Scharoun und natürlich<br />
zum Mies-Bau der Neuen Nationalgalerie<br />
sei die heutige Gemäldegalerie prädestiniert<br />
für ein Museum mit der Kunst<br />
des 20. Jahrhunderts. „Davon haben wir<br />
hier in Berlin einen riesigen Bestand, den<br />
kein Mensch kennt, weil er wegen Platzmangels<br />
nicht gezeigt werden kann.“ Das<br />
alles künftig unter einem Dach sehen zu<br />
können – Befürworter der Rochade verwenden<br />
dafür den Slogan „Von Brücke bis<br />
Beuys“ –, sei eine „riesige Chance“. Von dieser<br />
Meinung lässt sich Hermann Parzinger<br />
auch nicht durch eine Internet-Petition beirren,<br />
die mittlerweile an die 15 000 Umzugsskeptiker<br />
aus aller Welt unterzeichnet<br />
haben. Ob diese Leute wirklich alle wissen,<br />
dass Parzinger sich auf die Rochade nur einlassen<br />
will, wenn der Bundestag einen Neubau<br />
für die Alten Meister auf der Museumsinsel<br />
garantiert? Fraglich.<br />
„Ich wage vorauszusagen: Wenn dieser<br />
große Plan jetzt scheitert, dann ist er für<br />
immer gescheitert.“ Was sich wie eine Drohung<br />
liest, klingt aus dem Munde Parzingers<br />
eher wie ein Appell an die Vernunft.<br />
Das laute Getöse hat ihn jedenfalls am Kern<br />
der Sache nicht zweifeln lassen; die „Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz“ wird unter<br />
Führung des gebürtigen Münchners weiter<br />
für die Rochade kämpfen. Und daran,<br />
dass Hermann Parzinger ein ziemlich versierter<br />
Kämpfer ist, besteht wenig Zweifel:<br />
Der Archäologe ist ganz nebenbei nämlich<br />
auch noch erfolgreicher Judoka: schwarzer<br />
Gürtel, 2. Dan, mehrfacher Berliner Meister<br />
in der Altersklasse über 30. Da ist schon<br />
ein bisschen Geschick nötig, um so jemanden<br />
auf die Matte zu legen.<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretender<br />
Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Foto: Andrej Dallmann (Autor)<br />
46 <strong>Cicero</strong> 9.2012
<strong>Cicero</strong> abonnieren<br />
Abonnieren Sie <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis und erhalten Sie unseren<br />
eleganten Sammelschuber als Dankeschön.<br />
Entdecken Sie<br />
Ihre Abovorteile!<br />
Vorzugspreis<br />
Sie sparen über 10 % gegenüber<br />
dem Einzelkauf.<br />
CICERO<br />
IM ABO<br />
Jetzt Vorteile<br />
sichern!<br />
Ohne Risiko<br />
Sie gehen kein Risiko ein und<br />
können Ihr Abonnement jederzeit<br />
kündigen.<br />
Mehr Inhalt<br />
Zusätzlich erhalten Sie 4 x<br />
im Jahr unser Literaturen-<br />
Sonderheft gratis.<br />
Ihr Geschenk<br />
Als passendes Dankeschön<br />
schenken wir Ihnen unseren<br />
eleganten Sammelschuber.<br />
Ich abonniere <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 84,– Euro.*<br />
Bitte senden Sie mir <strong>Cicero</strong> monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit nur 7,– EUR / 5,– EUR<br />
(Studenten) pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im Einzelkauf).* Als Dankeschön erhalte ich<br />
nach Zahlungseingang den <strong>Cicero</strong>-Sammelschuber gratis. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige<br />
Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit kündigen.<br />
*Preis im Inland inkl. MwSt. und Versand, Abrechnung als Jahresrechnung über zwölf Ausgaben,<br />
Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße<br />
140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Kontonummer<br />
Name<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Ich bin Student.<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden einer<br />
E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen<br />
werden.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong> abonnieren! Bestellnr.: 858334<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Weitere Aboangebote unter: www.cicero.de/abo
| B e r l i n e r R e p u b l i k | B e s c h n e i d u n g : P r o<br />
Ja, ich habe beschnitten!<br />
Seit Wochen streitet Deutschland über die Beschneidung muslimischer und jüdischer<br />
Jungen. Doch was denken jene, die es eigentlich angeht? Einblick in die Seele einer Mutter<br />
von Adriana Altaras<br />
Neulich bei Lanz wurde ich gefragt,<br />
wie ich denn als Mutter<br />
meine Söhne habe beschneiden<br />
lassen können. Das sei ja wohl<br />
das Allerletzte! Ich begann zu<br />
Entscheidung schwergetan hätte, schließlich<br />
sei ich eine moderne Frau und lebe ein<br />
assimiliertes Judentum … Ich kam nicht<br />
weit mit meiner Berichterstattung, denn<br />
sofort beherrschten Ekel und Abscheu,<br />
aber vor allem ein großes<br />
schwarzes Loch an Unwissen<br />
die Diskussion.<br />
Juden sind eben nur<br />
dann nett, wenn sie Opfer<br />
sind. Als Menschen mit<br />
eigener Kultur, womöglich<br />
noch fremdartigen Ritualen<br />
sind sie plötzlich nicht mehr so<br />
süß. Ich halte das für Doppelmoral,<br />
und da mir jetzt keiner reinbeten kann,<br />
werde ich rasch ein paar Gedanken zu Papier<br />
bringen.<br />
Ja, auch jüdischen Müttern fällt die Beschneidung<br />
schwer – denn auch sie hören<br />
ihr Neugeborenes weinen. Tradition und<br />
aufgeklärtes, modernes Berufsleben beginnen<br />
einen Wettstreit, der meist in schlaflosen<br />
Nächten, heftigen Diskussionen mit<br />
der Familie, dem Partner und den Freundinnen<br />
kulminiert. Ich kenne keine Jüdin,<br />
jedenfalls nicht in Berlin, die sich trotz aller<br />
Unsicherheit gegen die Beschneidung<br />
entschieden hätte. Vielleicht gibt es welche,<br />
ich habe sie nicht getroffen.<br />
Für den Jungen beginnt mit der Beschneidung<br />
ein Leben nicht nur in einer<br />
Familie, sondern in einer Gemeinschaft.<br />
Für manchen eine Glaubensgemeinschaft,<br />
für mich – die ich, bevor ich Kinder hatte,<br />
den Kommunismus, den Sozialismus, den<br />
erzählen, dass ich mich mit der<br />
+<br />
Kapitalismus und vier unterschiedliche<br />
Sprachen kennenlernen durfte – Identität.<br />
Ein großes Wort, aber ein besseres habe<br />
ich nicht dafür.<br />
Natürlich hingen mir meine Freunde<br />
in den Ohren: Bist du verrückt? Du beschneidest,<br />
wie die Frauen in Afrika beschnitten<br />
werden! (Absoluter Quatsch!)<br />
Er wird später kaum etwas fühlen, gaben<br />
meine schwulen Freunde zum Besten.<br />
(Auch Blödsinn!) Wenn Gott die<br />
Vorhaut nicht gewollt hätte,<br />
hätte er sie doch gleich weggelassen!<br />
Die Christen …<br />
Da wären wir bei einem<br />
wichtigen Punkt: Wir sind<br />
keine Christen. Wir haben<br />
andere Rituale, Rituale, die<br />
mich stärken – auch wenn ich<br />
immer noch nicht und wahrscheinlich<br />
nie verstehen werde, warum<br />
meine Familie dafür verfolgt wurde.<br />
Bei der Brit Mila, der Beschneidung<br />
meiner Söhne, waren mehr als 100 Gäste<br />
geladen. Sie standen uns bei, sie ersetzten<br />
Familienangehörige, die es nicht mehr<br />
gibt, sie gaben mir Halt, sie gingen mir<br />
auf die Nerven. Sie taten das, was man als<br />
Gemeinschaft tut. Bestenfalls. Füreinander<br />
da zu sein.<br />
Nein, es gibt keine Betäubung. Aber<br />
dem Jungen werden mit dem Finger einige<br />
Tropfen koscherer Wein gegeben, und auf<br />
einer sterilen Unterlage wird die Beschneidung<br />
vorgenommen. Das Kind weint, die<br />
Mutter japst, das Baby wird gestillt und<br />
schläft ein. Wenn es aufwacht, wird die<br />
Wunde angeschaut und neu verbunden,<br />
dann geht der Mohel (Beschneider), seine<br />
Arbeit ist getan.<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 50<br />
Foto: MENAHEM KAHANA/AFP/Getty Images<br />
Ein Schnitt für die Gemeinschaft:<br />
Beschneidungszeremonie in der<br />
israelischen Stadt Haifa<br />
48 <strong>Cicero</strong> 9.2012
B e s c h n e i d u n g : c o n t r a | B e r l i n e r R e p u b l i k |<br />
Gleiche Regeln für alle<br />
Rechtlich kann es keinen Zweifel geben: Beschneidung bei einem Kind ist<br />
Körperverletzung. Ein Plädoyer für eine konsequente Säkularisierung der Werte<br />
von Philipp Blom<br />
Selten hat ein Gerichtsurteil<br />
ohne unmittelbare strafrechtliche<br />
Auswirkungen so viel<br />
Entrüs tung und so viele Kontroversen<br />
verursacht wie das<br />
zur Beschneidung von Jungen. Beide Seiten<br />
der daraus resultierenden Debatte haben<br />
sich rhetorisch überboten, kein Klischee<br />
wurde ausgelassen, von A wie Antisemitismus<br />
und Auschwitz bis Z wie<br />
Zukunft von Islam und Judentum<br />
in Deutschland.<br />
Juristisch gesehen kann<br />
kein Zweifel bestehen:<br />
Ein medizinisch nicht<br />
notwendiger chirurgischer<br />
Eingriff an einem Kind ist<br />
Urteil des Kölner Landgerichts<br />
-<br />
Körperverletzung, noch<br />
dazu, wenn er ohne Narkose<br />
vorgenommen wird. Keine Tradition<br />
und keine gute Absicht kann das<br />
ändern. Es gibt wohl keinen deutschen<br />
Arzt, der einem westafrikanischen Kind<br />
traditionelle Ziernarben in den Körper<br />
ritzen würde, auch wenn die Konsequenzen<br />
dieses Eingriffs weniger gravierend sind<br />
als die Entfernung der Vorhaut bei einem<br />
Jungen – und auch wenn die Eltern meinten,<br />
sie würden ihm ein identitätsstiftendes<br />
Geschenk machen.<br />
Es lohnt sich daher kaum, die daran<br />
anschließenden Argumente noch einmal<br />
durchzuexerzieren, denn es geht nicht darum,<br />
ob ein beschnittener Mann sexuell<br />
eingeschränkt oder im Vorteil ist, was die<br />
hygienischen Aspekte sind und ob die Zeremonie<br />
von Kindern als traumatisch erfahren<br />
wird oder nicht und möglicherweise<br />
bleibende psychische Schäden hinterlässt.<br />
Tatsächlich geht es um Machtverhältnisse:<br />
die Macht einer Gemeinschaft über<br />
ihre Kinder, die Macht einer Gesellschaft<br />
über ihre Minderheiten und den Stellenwert<br />
von religiösen Überzeugungen und<br />
Traditionen in einer zunehmend säkularen<br />
Gesellschaft. Diese Frage ist in den vergangenen<br />
Jahren in verschiedener Form immer<br />
wieder aufgetaucht, sei es bei der Debatte<br />
um Verschleierung und Burka und<br />
das Verbot in Frankreich, im niederländischen<br />
Streit um das Schächten von<br />
Vieh nach jüdischem oder islamischem<br />
Religionsgesetz<br />
(das heißt ein Kehlschnitt<br />
ohne Narkose, der in anderen<br />
Kontexten längst<br />
verboten ist) oder in der<br />
kürzlich in Deutschland<br />
neckisch aufgeworfenen<br />
Forderung nach einem<br />
Blasphemieverbot.<br />
Diese Scharmützel zwischen<br />
religiösen Traditionen und weltlichen<br />
Werten stellen einen Kontext her, der hinter<br />
den oft hysterisch geführten Teildebatten<br />
ein größeres und wichtigeres Thema erkennen<br />
lässt: Wie können wir uns Regeln<br />
für eine Gesellschaft geben, deren Mitglieder<br />
nicht alle dieselbe Tradition haben,<br />
dieselben Werte und dieselben Ziele? Was<br />
kann und was muss in einer multikulturellen,<br />
von Migration geprägten Gesellschaft<br />
verbindlich sein und was verhandelbar?<br />
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg hat<br />
sich diese Frage kaum gestellt, weil europäische<br />
Gesellschaften historisch und ideologisch<br />
homogener waren. Es gab einen Riss<br />
zwischen christlichen und aufklärerischen<br />
Werten, der sich durch die Debatten zog<br />
und noch immer zieht, aber da wichtige<br />
Aufklärungsdenker wie Kant und Voltaire<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 51<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 49
| B e r l i n e r R e p u b l i k | B e s c h n e i d u n g : P r o<br />
Fortsetzung von Seite 48<br />
Frau von der Leyen, unsere Arbeitsministerin,<br />
saß mit mir in der Talkrunde bei<br />
Lanz. Bisher, erzählte sie, habe sie keine Ahnung<br />
gehabt, was Beschneidung wirklich<br />
sei. Aber hygienisch könne es auf keinen<br />
Fall sein. Schmallippig, applausheischend<br />
blickte sie in die Runde. Seit 5772 Jahren<br />
beschneiden Juden auf diese Art. Sie wären<br />
ja bekloppt, wenn sie dabei ihre Kinder<br />
nachhaltig verletzen würden. Man kann einiges<br />
darüber nachlesen, liebe Frau von der<br />
Leyen. Man kann Juden und Muslime befragen.<br />
Vielleicht sogar bevor man ein Gesetz<br />
kommentarlos durchgehen lässt.<br />
Wir jedenfalls haben gefeiert, gegessen<br />
und getanzt. Und als vor drei Jahren<br />
mein älterer Sohn Barmizwa hatte – in<br />
etwa das jüdische Äquivalent zur Konfirmation<br />
oder Firmung – waren dieselben<br />
Gäste wieder da, und wir feierten weiter,<br />
dass es uns noch gibt. Beide Male waren<br />
die Gäste Zeugen eines existenziellen Ereignisses:<br />
zunächst der Eintritt in die jüdische<br />
Gemeinschaft, dann die Feier, im religiösen<br />
Sinn erwachsen zu sein, mit dem Versprechen,<br />
sein Leben möglichst ehrenwert und<br />
gut zu leben. Was auch immer das heißen<br />
mag. Sie alle nehmen teil an dem Werdegang<br />
meiner Kinder. Geben mir Rat und<br />
Kraft: zum Beispiel jetzt, da die Pubertät<br />
in unsere Familie Einzug gehalten hat – die<br />
einen übrigens länger und härter beschäftigen<br />
kann als jede Beschneidung.<br />
Ja, bei der Beschneidung entscheiden<br />
die Eltern für ihre Kinder. Tun das Eltern<br />
nicht immer? Eigentlich schon ab der<br />
Schwangerschaft. Das ist wahrlich nicht<br />
leicht. Man übernimmt Verantwortung,<br />
in vielen Bereichen. Und genau das wollte<br />
ich. Ich wollte meinen Kindern eine Basis<br />
geben, einen festen Boden, von dem aus<br />
sie in die Welt gehen können. Ich glaube<br />
nicht daran, dass alles „später“, „aus freien<br />
Stücken“ sozusagen „buchbar“ ist. Meine<br />
Kinder haben ein Fundament, aus dem heraus<br />
sie handeln können, gegebenenfalls<br />
„umbuchen“. Es gibt beschnittene Hindus,<br />
Buddhisten – war Christus nicht auch beschnitten<br />
und hat sich dann für eine andere<br />
Religion entschieden?<br />
Natürlich ist auch das Judentum eine<br />
alte, an vielen Punkten überalterte Religion.<br />
Ich wäre sehr für eine Renovierung. Ein<br />
Thema, das langsam wieder Einzug findet in<br />
rabbinischen Kreisen. Aber die vergangenen<br />
60 Jahre war das jüdische Volk damit beschäftigt,<br />
die Schoah zu verkraften.<br />
Es ist müßig, Vergleiche zu ziehen: Aber<br />
der Ausschluss der Frauen aus den religiösen<br />
Handlungen in der katholischen Kirche,<br />
der Zölibat – da hätte ich auch noch<br />
einige Fragen … So lange schon toleriere<br />
ich diese merkwürdig verklemmte, christliche<br />
Religion und erhoffe mir eine ähnliche<br />
Toleranz für meine eigene.<br />
Ja, es gibt jüdische Mütter, die nicht<br />
beschnitten haben. Meist handeln sie aus<br />
dem Druck der Verhältnisse, aus Angst,<br />
man würde am Penis ihres Sohnes erkennen,<br />
dass er „staatsfeindlich“ ist, und ihn<br />
Ja, ich würde<br />
wieder<br />
beschneiden.<br />
Ich würde mich<br />
neun Monate<br />
den Zweifeln<br />
aussetzen,<br />
mich mit der<br />
Entscheidung<br />
quälen – und am<br />
Ende den Mohel<br />
anrufen<br />
der Universität oder des Landes verweisen.<br />
Angst vor Verfolgung war meistens der<br />
Grund: in Polen, in Ungarn noch in den<br />
fünfziger Jahren. Auch während des Holocausts<br />
war man vorsichtig, handelte aus Not<br />
gegen die jüdischen Gesetze. Man wollte<br />
unerkannt bleiben, kein identifizierendes<br />
Zeichen tragen – verständlicherweise.<br />
In meiner Umgebung hatten wir alle<br />
das Glück, uns nicht verstecken zu müssen.<br />
Und so haben orthodoxe, reformierte oder<br />
liberale Frauen ihre Söhne beschneiden lassen,<br />
meist zu Hause von einem Mohel am<br />
achten Tag nach der Geburt.<br />
Nein, wir konnten nicht klagen, bisher.<br />
Danke der Nachfrage: Meinen Söhnen<br />
geht es bestens, ihr Schmock sieht vorbildlich<br />
aus, sie sind gesund, übertragen weniger<br />
Krankheiten. Das hat sich bei den <strong>Am</strong>erikanern<br />
schon herumgesprochen, aber<br />
leider noch nicht in Deutschland.<br />
Ja, ich würde wieder beschneiden. Ich<br />
würde mich neun Monate den Zweifeln<br />
aussetzen, mich mit der Entscheidung quälen<br />
– und am Ende den Mohel anrufen. Die<br />
Angst vor dem jetzt kriminellen Akt würde<br />
mich weniger sorgen als das Gefühl, nach<br />
Holland zu müssen, um gegebenenfalls die<br />
Wunde zu versorgen. Denn eine deutsche<br />
Klinik würde mich beziehungsweise meinen<br />
Sohn nicht mehr behandeln. Müsste<br />
ich nach Holland wie unzählige Frauen,<br />
als das Abtreibungsgesetz, Paragraf 218, in<br />
Kraft trat? Ja, Frau von der Leyen, ich habe<br />
abgetrieben, ich habe beschnitten!<br />
Parallel zu Herrn Lanz saßen bei Frau<br />
Will der Berliner orthodoxe Rabbiner, eine<br />
Muslima und eine Psychologin. Der Rabbiner<br />
hatte seine Kippa auf, seine Schläfchenlocken<br />
kräuselten sich perfekt. Die<br />
Muslima war maßvoll, aber doch verhüllt.<br />
Die Psychologin hingegen hatte eine fesche<br />
Fönfrisur und elegante, schwarze Kleidung.<br />
Schon ohne Ton konnte man der Dämonisierung<br />
beiwohnen: Hier hält das Mittelalter<br />
Einzug in die modernen Wohnzimmer<br />
der Republik. Was auch immer die<br />
beiden Religionsvertreter zu sagen hätten:<br />
Ihr Äußeres sollte für sich sprechen – für<br />
eine Welt, die wir Aufgeklärten doch alle<br />
längst hinter uns gelassen haben sollten.<br />
Die Begegnung des Abendlands mit dem<br />
Morgenland findet auf dem abendländischen<br />
Spielfeld und nach abendländischen<br />
Spielregeln statt.<br />
Schade, dass Herr Müller, frisch gebackener<br />
Chef der Vatikanischen Kurie, nicht<br />
auch eingeladen war (ebenfalls in pittoreskem<br />
Outfit)! Er verteidigt die Beschneidung<br />
als religiöses Ritual – und religiöse<br />
Rituale seien unantastbar. Die Front verläuft<br />
nicht mehr zwischen Kirche contra Islam<br />
oder Judentum. In der Frage der Beschneidung<br />
verläuft sie anders als bisher.<br />
Interessant.<br />
Ob religiöse Rituale unantastbar sind,<br />
das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber<br />
ich weiß, dass es nicht verkehrt sein kann,<br />
wenn unsere Kinder ein wenig Spiritualität<br />
in ihren Umhängetaschen haben, wenn sie<br />
ganze Nachmittage lang in den Einkaufszonen<br />
umherstreunen.<br />
Adriana Altaras<br />
ist Schauspielerin und<br />
Regisseurin. Von ihr erschien<br />
der autobiografische Roman<br />
„Titos Brille“<br />
Foto: Privat<br />
50 <strong>Cicero</strong> 9.2012
B e s c h n e i d u n g : c o n t r a | B e r l i n e r R e p u b l i k |<br />
Foto: Peter Rigaut<br />
Fortsetzung von Seite 49<br />
es sich nicht mit dem lieben Gott verderben<br />
wollten, gab es doch einen gemeinsamen<br />
Boden, von dem aus argumentiert<br />
und gestritten werden konnte. In der Praxis<br />
bedeutete Aufklärung oft Christentum<br />
„light“.<br />
Das hat sich grundlegend geändert.<br />
Heute haben nicht nur Moslems, sondern<br />
auch andere Europäer, die unterschiedlichen<br />
Traditionen entstammen oder Atheisten<br />
sind, persönliche und kulturelle Prioritäten,<br />
die sich nicht in christlichen Werten<br />
fassen lassen – und dieser Anteil der Bevölkerung<br />
wird weiter steigen. Die Frage ist<br />
also, wie wir Werte definieren können, die<br />
eine minimale Gemeinsamkeit beschreiben<br />
und für alle verbindlich sind.<br />
Das Problem mit religiös inspirierten<br />
Werten – etwa dem „jüdisch-christlichen<br />
Wertekanon“ der CDU – ist, dass der Wahrheitsanspruch<br />
jeder Tradition den aller anderen<br />
ausschließt, trotz allem Gerede von<br />
Ökumene, die darin in der Praxis besteht,<br />
dass eine religiöse Krähe der anderen kein<br />
Auge aushackt, wie man auch jetzt beim demonstrativen<br />
und dubiosen Schulterschluss<br />
der Kirchen mit dem jüdisch-islamischen<br />
Beschneidungsgebot sehen kann.<br />
Unterschiedliche Traditionen und<br />
Weltbilder können nur dann miteinander<br />
leben, wenn die Ordnung des öffentlichen<br />
Raumes nicht einer von ihnen eine<br />
Vormachtstellung gibt, in einem neutralen<br />
Raum, der auf säkularen Minimalwerten<br />
aufbaut. Gerade in Deutschland tut<br />
man sich schwer damit – nicht nur, weil<br />
der Bundespräsident ein Pfarrer ist und die<br />
Bundeskanzlerin eine Pfarrerstochter, die<br />
christliche Werte im Grundgesetz verankert<br />
wissen möchte, sondern auch, weil die<br />
Bundesrepublik keine konsequente Trennung<br />
von Kirche und Staat vollzieht: Sie<br />
treibt Kirchensteuern ein (nicht aber Moscheen-,<br />
Synagogen- oder Tempelsteuern<br />
oder Beiträge für Fußballclubs), und der<br />
Standardtext eines <strong>Am</strong>tseids endet noch<br />
immer mit „so wahr mir Gott helfe“.<br />
Die Berufung auf „jüdisch-christliche“<br />
Werte täuscht darüber hinweg, dass<br />
viele davon mit unserem Moralverständnis<br />
völlig unvereinbar sind. Gemeint sind<br />
oft Nächstenliebe und universelle Bruderschaft,<br />
aber Erstere ist als „goldene Regel“<br />
(Was du nicht willst …) in fast allen<br />
moralischen Systemen verankert, und<br />
die zweite hinderte Christen und Moslems<br />
jahrhundertelang nicht daran, Menschen<br />
anderer Hautfarben und Bekenntnisse<br />
zu versklaven oder zu ermorden. Erst<br />
unter dem Druck der Aufklärung haben<br />
die abrahamitischen Religionen begonnen,<br />
sich von den Werten der Bronzezeit<br />
teilweise loszusagen, nach denen Frauen<br />
rechtlos waren, Homosexuelle gesteinigt<br />
wurden, Exorzisten Epileptikern Dämonen<br />
austrieben und kleine Jungen als Ersatz<br />
für Menschenopfer beschnitten wurden.<br />
Damals glaubte man übrigens auch<br />
noch, die Erde sei eine Scheibe.<br />
Eine multikulturelle Moral könnte<br />
ungefähr so funktionieren wie der Straßenverkehr.<br />
Es gäbe viele Möglichkeiten,<br />
eine Vorfahrtsregel praktikabel zu begründen<br />
– etwa indem Autos einheimischer<br />
Herstellung immer Vorfahrt haben oder<br />
besonders umweltfreundliche, kleine, oder<br />
rote Fahrzeuge oder Frauen vor Männern.<br />
Tatsächlich aber gilt: Ein Auto ist ein Auto<br />
ist ein Auto, solange es und sein Fahrer den<br />
technischen Anforderungen genügen. Es ist<br />
gleichgültig, was der Fahrer gerade denkt,<br />
wie er die Welt sieht, warum er fährt, woher<br />
er kommt oder wohin er will, solange<br />
er die StVO befolgt. Wenn er aber darauf<br />
besteht, auf der linken Straßenseite zu fahren,<br />
weil das bei ihm Tradition ist, baut er<br />
erst einen Unfall und verliert dann seinen<br />
Führerschein.<br />
Dieses täglich erfolgreich praktizierte<br />
System des Miteinander-Verkehrens basiert<br />
auf Gleichheit, auf Sicherheit und<br />
auf Freiheit (niemand fragt nach dem Warum,<br />
Woher oder Wohin). Es ist nicht sehr<br />
erhebend, weil es keine metaphysischen<br />
Ziele definiert, aber gerade deswegen ist<br />
es menschlich und anwendbar.<br />
Vielleicht sollten wir den lyrischen<br />
Paragrafen 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung<br />
ins Grundgesetz aufnehmen:<br />
„Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich<br />
so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt,<br />
gefährdet oder mehr, als nach den<br />
Umständen unvermeidbar, behindert oder<br />
belästigt wird.“ Darauf kann man keine<br />
Religion begründen – wohl aber eine<br />
Gesellschaft.<br />
Philipp Blom ist Historiker<br />
und Autor. Seine Bücher „Der<br />
taumelnde Kontinent“ und<br />
„Böse Philosophen“ wurden<br />
mehrfach ausgezeichnet<br />
Anzeige<br />
Jörg Schindler<br />
Dieses Buch ist aus Wut<br />
entstanden<br />
www.fischerverlage.de<br />
Dies ist ein Buch über Rüpel, Ignoranten, Sozial-Allergiker und andere Ichlinge. Menschen,<br />
die uns täglich auf offener Straße beleidigen. Kollegen, die rücksichtslos ihre Ellbogen<br />
ausfahren. Schmarotzer, die sich nicht um andere scheren.<br />
Traurig, aber wahr: Wir leben in einer Rüpel-Republik. Es wird Zeit für Veränderungen.<br />
Die Rüpel<br />
Republik<br />
scherz<br />
Warum<br />
sind wir so<br />
unsozial?<br />
ISBN 978-3-651-00047-6, 256 S. Broschur, € (D) 14,99
| B e r l i n e r R e p u b l i k | E x p e d i t i o n i n s P a r l a m e n t<br />
Bonbons mit<br />
Bundesadler<br />
Kein Witz: Wie ein politischer Kabarettist als <strong>Cicero</strong>-Reporter zwei<br />
Sitzungswochen im Deutschen Bundestag erlebte – Skandale inklusive<br />
von Michael Frowin<br />
„Der Bundestag ist mal voller und mal leerer“,<br />
pöbelte einst Otto Graf Lambsdorff, „aber<br />
immer voller Lehrer.“ Ist das immer noch so?<br />
52 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Fotos: Hans-Christian Plambeck/Laif, Julian Röder/Ostkreuz<br />
I<br />
ch gebe es zu: Ich lebe davon,<br />
den politischen Zirkus zu beobachten<br />
und satirisch aufbereitet<br />
einem gierigen Kabarettpublikum<br />
zum Fraß vorzuwerfen. Und<br />
ich gebe zu: Dem eingeschworenen<br />
Publikum läuft nicht das Wasser im<br />
Mund zusammen bei Themen wie „Zustimmung<br />
zum Freisetzungsversuch mit<br />
einem gentechnisch veränderten Lebendimpfstoff<br />
trotz erheblicher Risiken“. Vielleicht<br />
könnte aus dem Thema „Maßnahmen<br />
und Voraussetzungen zur Teilnahme<br />
an dem Programm ‚Initiative zur Flankierung<br />
des Strukturwandels‘ für Schlecker-<br />
Beschäftigte“ eine flotte Kabarettnummer<br />
werden, wenn man entweder gegen<br />
die Ausbeuterstrukturen von Discountern<br />
vom Leder zieht oder die<br />
Geiz-ist-Geil-Mentalität der Bevölkerung<br />
beschimpft.<br />
Ganz sicher aber ist die „Umstrittene<br />
Nutzung des Auslandsnachrichtendiensts<br />
für den Transport<br />
eines von BM Niebel privat gekauften<br />
Teppichs“ gefundene Munition<br />
für eine todsichere Pointenschlacht.<br />
Denn bei Niebel raucht die Tastatur<br />
des Gagschreibers: Der führt ein<br />
Ministerium, das er zuvor abschaffen<br />
wollte, rennt als „Guidos Großmaul“<br />
(Spiegel) mit olivgrüner Gebirgsjägermütze<br />
durch Afrika, verteilt Posten<br />
an Parteifreunde und schleust einen<br />
privat in Afghanistan gekauften Teppich<br />
am Zoll vorbei. Kabarett-Herz,<br />
was willst du mehr?<br />
Und genauso sollte es kommen.<br />
Allerdings nicht auf der Kabarettbühne,<br />
sondern im Bundestag.<br />
<strong>Cicero</strong> schickt mich, den Artfremden,<br />
ins Herz der Republik: zwei<br />
Sitzungswochen. Anschauen und<br />
berichten.<br />
Erste Station: Pressestelle. Die<br />
Bonbons mit dem Bundesadler auf<br />
dem Papier sind schon mal gut. Also gestärkt<br />
rein in die <strong>Am</strong>tsstube zur professionellen<br />
Abfertigung. Ausweis zeigen,<br />
sich vor die runde Kamera hocken – und<br />
zwei Minuten später halte ich ihn in der<br />
Hand: den roten Presseausweis des Deutschen<br />
Bundestags. Eine S-Bahn-Fahrkarte<br />
zu kaufen dauert länger. Ich decke mich<br />
ein mit kostenlosem Infomaterial (Geschäftsordnung,<br />
Kürschners Volkshandbuch,<br />
Lexikon der parlamentarischen<br />
Begriffe) – die Metamorphose vom Satiriker<br />
zum Schreiberling ist perfekt. Ich<br />
bin Reporter.<br />
Um warm zu werden, schickt man<br />
mich an Tag eins auf die Fraktionsebene.<br />
Zum Reinschnuppern. Und tatsächlich:<br />
Schon hier wird deutlich, was mich bis ans<br />
Ende der zwei Wochen begleiten wird: der<br />
Widerspruch zwischen Hektik und Handeln<br />
einerseits und Leerlauf und Langeweile<br />
andererseits.<br />
Tag zwei. Der Presseausweis öffnet alle<br />
Türen in den Bundestag. Das Spanngummi<br />
fürs Fahrrad muss ich abgeben, das Kellnermesser<br />
darf mit rein. Ob Abgeordnete<br />
eher erwürgt als erstochen werden?<br />
„So bleibt es dabei, dass offenbar alle dasselbe beklagen,<br />
obwohl alle dasselbe wollen“: <strong>Cicero</strong>-Autor Michael<br />
Frowin mit Hausausweis vor dem Reichstag<br />
Dann sitze ich im Saal. Es ist ein durchaus<br />
erhabenes Gefühl, so hautnah dran zu<br />
sein, sich so frei und selbstverständlich im<br />
politischen Zentrum zu bewegen, den Bundestag<br />
als so offenes Haus erleben zu können.<br />
Ich bin also gespannt.<br />
Aber um es vorwegzunehmen: Ernüchternder<br />
Höhepunkt der 183. Sitzung ist tatsächlich<br />
die aktuelle Stunde über den Teppich<br />
von Herrn Niebel. Denn ausgerechnet<br />
da kommt der Anschein von Wichtigkeit<br />
ins hohe Haus. Es treten auf: Brüderle und<br />
Döring, und sogar die Minister Bahr und<br />
Westerwelle geben sich die Ehre. Die komplette<br />
FDP-Fraktion tritt an. Sie alle sind<br />
da, um ihrem Teppichhändler die Stange zu<br />
halten. Ein Hauch von Hysterie liegt in der<br />
Luft, die Presse wittert den Skandal und bevölkert<br />
die Tribüne. Und dann fliegen auch<br />
schon die einstudierten Fetzen. „Liberales<br />
Teppichluder“ krakeelt der Angreifer – und<br />
wird von den Verteidigern niedergebrüllt.<br />
Der Minister selbst entschuldigt sich lustlos<br />
in der Hälfte seiner Redezeit. Danach dennoch<br />
lang anhaltender, rhythmischer Beifall.<br />
Als hätte er was gesagt.<br />
Und kaum ist der fade Auftritt des Ministers<br />
vorbei, trollt sich auch wieder<br />
der Außenminister und mit ihm die<br />
Hälfte der Fraktion. Und man fragt<br />
sich unwillkürlich: Langweilen diese<br />
einstudierten Mechanismen nicht<br />
furchtbar? Brigitte Zypries (SPD),<br />
ehemalige Bundesjustizministerin,<br />
wird im Gespräch mutmaßen, dass<br />
sich der Plenarsaal bei möglichen<br />
Skandalen deshalb füllt, weil die<br />
meisten Abgeordneten eben doch<br />
auch Bunte-Leser sind. Eine erstaunliche<br />
These.<br />
Die Rednerin Sibylle Pfeiffer<br />
(CDU/CSU) konstatiert: „Für mich<br />
stellt sich die Frage nach der Debattenkultur:<br />
Setzen wir nur noch auf<br />
Effekthascherei und Bedienung des<br />
Boulevards?“<br />
Über Debattenkultur und Boulevardisierung<br />
werde ich in den nächsten<br />
Tagen noch viel hören. Und obwohl<br />
die Frage von Frau Pfeiffer<br />
natürlich durchaus berechtigt ist,<br />
frage ich mich angesichts der gebotenen<br />
Parlamentsshow: Würden es die<br />
anderen nicht umgekehrt genauso<br />
machen? „Klar macht man auch aus<br />
der Mücke einen Elefanten“, sagt der<br />
SPD-Abgeordnete Sören Bartol. „Ich<br />
habe keine Lust am Skandalisieren. Trotzdem:<br />
Unterschiedliche Ansichten oder<br />
Fehlverhalten müssen in die Medien, wenn<br />
man Aufmerksamkeit erregen will.“ Und<br />
Brigitte Zypries ergänzt: „Bei Niebel ist es<br />
die Kette der Verfehlungen.“ Dennoch: Es<br />
bleibt der Eindruck der einstudierten, austauschbaren<br />
Empörungsmechanismen.<br />
CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach<br />
beschreibt das als den Sport in der Politik.<br />
„Nehmen Sie das EM-Spiel Deutschland<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 53
| B e r l i n e r R e p u b l i k | E x p e d i t i o n i n s P a r l a m e n t<br />
gegen Holland. Die letzten zehn Minuten<br />
zog es die Deutschen sehr zur holländischen<br />
Eckfahne. Das war nicht schön, das<br />
macht keinen Spaß, aber das war effizient<br />
und notwendig.“<br />
Das macht keinen Spaß, ist aber notwendig.<br />
So lässt sich der Eindruck nach<br />
zwei Wochen Parlamentssitzungen durchaus<br />
zusammenfassen. Wobei es sie natürlich<br />
gibt – die „großen“ Debatten. ESM,<br />
Betreuungsgeld, Fiskalpakt, sogar einen<br />
Hammelsprung – es war ja eine Menge<br />
drin in den letzten zwei Sitzungswochen<br />
vor der Sommerpause. Aber auch da<br />
möchte man dem Kabarett-Kollegen Dieter<br />
Hildebrandt zustimmen, der den Zustand<br />
des Parlaments einmal so beschrieb:<br />
„Nehmen wir mal an, wir befinden uns<br />
im rhetorischen Zentrum unserer Republik<br />
– im Parlament. Da, wo die <strong>Cicero</strong>nes<br />
und Demostenesse ihre feurigen Reden<br />
ins Volk feuern. (…) Ohne Rücksicht auf<br />
Kameras, einfach rückhaltlos ehrlich und<br />
leidenschaftlich. (…) Geistesblitze zucken<br />
durch das Haus, die Sprache feiert Feste,<br />
Bonmonts, Aperçus, Zitate überschlagen<br />
sich (…) – so wär das schön gewesen. Und<br />
so war es auch gemeint.“<br />
Wenn es so gemeint war, dann ist davon<br />
nicht mehr allzu viel übrig. Die Fragestunden<br />
bilden sicher den Tiefpunkt der<br />
Parlamentssitzungen. Der Bundestagspräsident<br />
liest eine schier endlose Liste von Fragen<br />
vor, ein Staatssekretär die Antwort der<br />
Bundesregierung mehr oder weniger lustlos<br />
vom Blatt, bei manchem ist auf den Rängen<br />
der vorgelesene Text nicht mal akustisch<br />
zu verstehen. Eine Katastrophe. Das<br />
Parlament ist leer, die Besuchertribünen<br />
sind voll, der Eindruck ist verheerend. Die<br />
15 Abgeordneten, die da sind, sind nicht<br />
anwesend, hören nicht zu, lesen Zeitung<br />
oder Akten, starren auf Smartphone oder<br />
„Der Presseausweis öffnet<br />
alle Türen in den Bundestag.<br />
Das Spanngummi muss ich<br />
abgeben, das Kellnermesser<br />
darf ich behalten“<br />
iPad. „Klar sind Fragestunden langweilig“,<br />
gibt Brigitte Zypries unumwunden zu.<br />
„Vor allem, weil da alles so reglementiert<br />
ist. Andererseits ist der Rücktritt von Franz<br />
Josef Jung durch eine Fragestunde bewirkt<br />
worden.“ Carsten Schneider, der haushaltspolitische<br />
Sprecher der SPD-Fraktion, hält<br />
hingegen die Fragestunden für überflüssig.<br />
Er ist dafür, die Minister direkt zu befragen.<br />
Dann könnte man sie wie im englischen<br />
Parlament richtig ins Kreuzverhör<br />
nehmen. Überhaupt plädiert er wie Brigitte<br />
Zypries für eine Parlamentsreform.<br />
Und auch Marlies Volkmer, SPD, bezweifelt,<br />
ob es in 20 Jahren die Parlamentsarbeit<br />
in dieser Form noch geben wird.<br />
Denn selbst die Debatten leiden unter<br />
den festgelegten Ritualen. Diejenigen,<br />
die eine Rede halten, versuchen den Anschein<br />
von Engagement und Leidenschaft<br />
zu erwecken, doch werden diese Versuche<br />
durch die antrainierten Mechanismen der<br />
Teilnahmslosigkeit drum herum in einer<br />
solchen Weise konterkariert, dass ich mich<br />
frage, ob da überhaupt ein Bewusstsein dafür<br />
existiert, wo man sich befindet und woran<br />
man gerade teilnimmt.<br />
Besonders deutlich wird das am späten<br />
Abend, wenn nach 21 Uhr noch immer<br />
debattiert wird. Während vorne in markigen<br />
Worten von der schlimmsten Form<br />
der Kinderarbeit gesprochen wird, haben<br />
sich im Saal Gesprächskreise gebildet, wo<br />
Köpfe zusammengesteckt werden und eifrig<br />
gelacht wird. Gebetsmühlenartig werden<br />
am Rednerpult die immer gleichen Argumente<br />
wiederholt, keiner bezieht sich auf<br />
den anderen.<br />
Bei der folgenden Aussprache (zum<br />
G-20‐Gipfel in Rio) ist die Teilnahmslosigkeit<br />
noch größer, und ich notiere: Es<br />
ist diese Demonstration von Belanglosigkeit,<br />
die einen beim Zuschauen nahezu<br />
ankotzt. Zum Beispiel der FDP-Abgeordnete<br />
Michael Kauch. Er sitzt in der ersten<br />
Reihe, albert vor seiner Rede für alle<br />
sichtbar mit Kollegen herum, geht dann<br />
ans Pult und spricht mit heiligem Ernst<br />
von der Macht der Parlamente. Zitat: „Es<br />
geht auch darum (…), die schrecklichste<br />
‚Laberbude‘ der Vereinten Nationen namens<br />
Konferenz für nachhaltige Entwicklung<br />
in New York durch ein sinnvolles<br />
Gremium zu ersetzen.“ Nach seiner Rede<br />
geht er zurück an seinen Platz und albert<br />
nahtlos weiter.<br />
„Wer mit einer vorher ausgedruckten<br />
Rede kommt, hat schon verloren“, sagt der<br />
junge CDU-Abgeordnete Peter Tauber und<br />
greift zur Geschäftsordnung des Bundestags.<br />
Er liest vor: „Paragraf 33 – Die Redner<br />
sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag.<br />
Sie können hierbei Aufzeichnungen<br />
benutzen.“ Da muss er selbst lachen. Denn<br />
die meisten Abgeordneten folgen eher Kurt<br />
Tucholskys „Ratschlägen für einen schlechten<br />
Redner“: „Sprich nicht frei – das macht<br />
einen so unruhigen Eindruck. <strong>Am</strong> besten<br />
ist es: du liest deine Rede ab.“<br />
Natürlich gibt es auch die guten Redner,<br />
die mitreißen können. Nur eben zu<br />
wenige davon. Das Parlament sei halt der<br />
Querschnitt der Gesellschaft, sagt Sören<br />
Bartol entschuldigend. Insofern gebe es<br />
eben gute und schlechte Rednerinnen und<br />
Redner. Das mag so sein, aber eine Rede<br />
zu halten, ist auch kein unergründliches<br />
Geheimnis. So sagt der Rhetorik-Coach<br />
Florian Mück: „Ein großer Redner informiert<br />
nicht, er bewegt.“ Und: „Alle großen<br />
Redner waren zu Beginn schlechte Redner.“<br />
Doch in den Gesprächen mit den Abgeordneten<br />
scheint mir gar nicht der Drang<br />
nach der Notwendigkeit des rhetorischen<br />
Ausdrucks vorhanden zu sein. Denn bei<br />
meinen Fragen zu eben diesen Beobachtungen<br />
über das Parlament wirken meine<br />
Gesprächspartner ratlos. „Die Leidenschaft<br />
verebbt bis ins Parlament“, räumt Marlies<br />
Volkmer ein. „In der Arbeitsgruppe brauchen<br />
Sie viel Leidenschaft, um die eigenen<br />
Leute zu überzeugen. In den Ausschüssen<br />
wissen Sie ja schon, wer da sitzt und was<br />
die denken. Und im Parlament will ich ja<br />
keinen mehr überzeugen.“<br />
Aber so ist es auch gar nicht vorgesehen.<br />
„In Parlamentsdebatten“, so die<br />
Theorie, „werden Argumente zu einem<br />
politischen Thema im Parlament ausgetauscht.“<br />
Und gerade die Öffentlichkeit,<br />
54 <strong>Cicero</strong> 9.2012
die an Arbeitsgruppen und Ausschüssen<br />
nicht teilnimmt, wünscht sich engagierte<br />
Debatten und leidenschaftliche Vorträge.<br />
„Ich liebe Debatten“, sagt Carsten<br />
Schneider, „aber wir brauchen eine Parlamentsreform,<br />
weil es zu viele Unsinnsdebatten<br />
gibt.“ Und auch Bundestagspräsident<br />
Lammert sagt bei Markus Lanz: „Ich<br />
habe mehrfach darauf hingewiesen, dass<br />
wir uns mit dem Missverhältnis zwischen<br />
der von uns selbst produzierten Menge<br />
der Initiativen aller Art und der dafür zur<br />
Verfügung stehenden Zeit auseinandersetzen<br />
müssen.“<br />
Das ist auch das, was alle Abgeordneten,<br />
mit denen ich gesprochen habe, einmütig<br />
beschreiben: die kaum zu bewältigende<br />
Menge der Arbeit, die immer drohende,<br />
manchmal eintretende Überforderung. Gefragt<br />
nach dem, was er sich wünsche, antwortet<br />
Wolfgang Bosbach: „Die Ressourcen,<br />
die auch die Ministerien haben, damit<br />
ich auf Augenhöhe mitdiskutieren kann.“<br />
Und Brigitte Zypries wünscht sich mehr<br />
Versuche, in den Ausschüssen über Parteigrenzen<br />
hinweg offener zu diskutieren.<br />
Überhaupt ist das die Erkenntnis, die<br />
ich nach zwei Sitzungswochen und Gesprächen<br />
mit Abgeordneten gemacht habe: der<br />
verblüffend große Unterschied zwischen<br />
dem, was im Parlament stattfindet – und<br />
dem Selbstverständnis der Abgeordneten<br />
und ihrer sehr engagierten Arbeit auf der<br />
anderen Seite. Also auch zwischen dem,<br />
was die Öffentlichkeit wahrnimmt (beziehungsweise<br />
wahrnehmen kann) und der<br />
tatsächlichen Arbeit vieler Abgeordneter.<br />
Als gelernter Schauspieler finde ich Theaterproben<br />
im Theater oder beim Film meist<br />
peinlich, weil sie mit einer tatsächlichen<br />
Probe so viel zu tun haben wie eine Wahlkampfrede<br />
mit Realpolitik. Auch lässt die<br />
immer wieder gestellte Frage „Ah, Sie sind<br />
Künstler! Und was machen Sie tagsüber?“ darauf<br />
schließen, dass gewisse Klischees eben<br />
partout nicht auszuräumen sind.<br />
Auf diesen Widerspruch im Beruf des<br />
Politikers angesprochen, reagieren die<br />
meisten Abgeordneten erstaunlich offen<br />
und ehrlich: „Dass die Leute mehr Vertrauen<br />
haben, weil wir es verdient haben“,<br />
wünscht sich Peter Tauber, und Sören Bartol,<br />
„dass sich der Blick von außen nicht<br />
nur auf einige wenige richtet, sondern aufs<br />
große Ganze“. Und auch Carsten Schneider<br />
findet, dass „diese ‚Bäh‘-Haltung einfach<br />
nicht angebracht ist“. Wolfgang<br />
Bosbach wiederum gibt freimütig zu, ihn<br />
nerve es, dass „der Großteil meiner Arbeit<br />
niemanden interessiert“.<br />
Und Marlies Volkmer wünscht sich<br />
mehr Mut von den Medien, auch mal andere<br />
Leute als die immer gleichen Gesichter<br />
zu Wort kommen zu lassen, weil sie glaubt,<br />
„dass die Mehrheit der Menschen durchaus<br />
interessiert ist an sachlichen Auseinandersetzungen“.<br />
Zu viel Boulevard – das sei<br />
das Problem. Über seine neue Brille sei im<br />
Internet mehr diskutiert worden als über<br />
sachliche Themen, berichtet Peter Tauber,<br />
aber „die Leute wollen halt das Menschliche“.<br />
„Viele verstehen eben nicht, wie<br />
das Parlament funktioniert, deshalb muss<br />
man es immer wieder erklären“, konstatiert<br />
Sören Bartol. Und so ergeben sich<br />
die Abgeordneten tapfer dem mühsamen<br />
Klein-Klein: Empfangen immer wieder Besuchergruppen,<br />
denen sie immer wieder<br />
dasselbe erzählen, beantworten unzählige<br />
E-Mails, die sie tagtäglich erreichen (Zypries:<br />
„Die Diskussionskultur im Interet ist<br />
unterirdisch und an Schärfe und Borniertheit<br />
oft nicht zu über- bzw. unterbieten.“) –<br />
und sagen doch wie Wolfgang Bosbach mit<br />
vollem Ernst: „Ich mache das aus Überzeugung.<br />
Solang die dicke Frau noch singt, ist<br />
die Oper nicht vorbei.“ Und das glaube ich<br />
Wolfgang Bosbach – und den anderen auch.<br />
Auch wenn Peter Tauber zugibt, ab und an<br />
sehr müde zu sein. „Man muss aufpassen,<br />
dass man nicht zynisch wird!“, sagt Carsten<br />
Schneider und ergänzt: „Gleich werde ich<br />
50 Besuchern wieder erklären, wie unsere<br />
Arbeit funktioniert, und warum das Parlament<br />
oft so leer ist. Aber heute Abend sehen<br />
eine Million eine Talkshow – 50 zu einer<br />
Million. Verstehen Sie, was ich meine?“<br />
Und das verstehe ich auch. Sehr gut.<br />
So bleibt es dabei, dass offenbar alle<br />
dasselbe beklagen, obwohl alle dasselbe<br />
„Im Gespräch mit den<br />
Abgeordneten scheint mir<br />
gar nicht der Drang nach der<br />
Notwendigkeit von Rhetorik<br />
vorhanden zu sein“<br />
wollen. Alle beklagen mangelnde Courage,<br />
fehlenden Mut, zu wenig Sachlichkeit.<br />
Alle wünschen sich besonnene, gebildete<br />
Führungspersönlichkeiten mit<br />
Kompetenz und Sachverstand. Aber offenbar<br />
ist es schwer, den Mut aufzubringen,<br />
eingefahrene Denkstrukturen aufzubrechen<br />
und sich zu neuen Denkmustern<br />
aufzumachen.<br />
Einzig Michael Glos ruht nach etlichen<br />
Jahren im Parlament und in zahlreichen<br />
Führungspositionen in sich und lässt die<br />
Frage nach seinen Wünschen von sich abtropfen.<br />
Er beobachte wenig Veränderungen,<br />
die Mechanismen seien noch immer<br />
dieselben. Man brauche ein dickes Fell, natürlich.<br />
Aber noch wichtiger sei viel Gelassenheit.<br />
Ihm jedenfalls gefalle es, dass er in<br />
der Öffentlichkeit anders wahrgenommen<br />
werde, als er tatsächlich sei, denn das sei<br />
schließlich eine wunderbare Tarnung. „<strong>Am</strong><br />
meisten hatte ich Angst davor, dass man<br />
mich durchschaut“, sagt er mit einem ironischen<br />
Lächeln. Und so weht in der Art,<br />
wie Michael Glos von seinen Erfahrungen<br />
erzählt, eine Ahnung davon herüber, wie<br />
es war, als Abgeordnete und Minister noch<br />
nicht jede Sekunde der Beobachtung ausgesetzt<br />
waren, als es noch etwas mehr Zeit<br />
gab, als noch nicht jedes Ereignis mediale<br />
Aufmerksamkeit hervorrief. Und als man<br />
sich noch etwas trauen durfte ohne Angst,<br />
dass ein Missgeschick sofort in zig Varianten<br />
veröffentlicht wird. „Ich gehe nicht<br />
ins Kabarett“, sagt Michael Glos. „Das hab’<br />
ich doch täglich hier.“ Ich weiß, was für<br />
ein Kabarett er meint. Das ist sympathisch.<br />
Und das meine ich auch.<br />
Michael Frowin<br />
Jahrgang 1969, ist Schauspieler, Autor und<br />
Kabarettist. Bekannt wurde er mit der Polit-<br />
Satire „Kanzleramt Pforte D“ (MDR)<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 55
| B e r l i n e r R e p u b l i k | J o a c h i m G a u c k<br />
Was der Bundespräsident<br />
jetzt tun sollte<br />
Zwei Mal hat sie selbst, von der SPD nominiert, für das höchste <strong>Am</strong>t im Staate kandidiert –<br />
kritische Anmerkungen einer engagierten Bürgerin zur <strong>Am</strong>tsführung Joachim Gaucks<br />
von Gesine Schwan<br />
56 <strong>Cicero</strong> 9.2012
W<br />
ir leben in politisch<br />
unübersichtlichen Zeiten.<br />
Vielleicht war es nie anders.<br />
Jedenfalls spüren viele Menschen<br />
seit der Banken- und<br />
Schuldenkrise eine besondere Unsicherheit,<br />
die unsere europäischen Nachbarn persönlich<br />
noch viel heftiger erreicht hat als uns<br />
Deutsche. Woran sollen wir uns in dieser<br />
Krise halten?<br />
Orientierung erwarten viele von „der“<br />
Politik. Wer kann sie geben? Seit dem Sommerinterview<br />
von Bundespräsident Gauck<br />
wird die Frage nach der Rollenverteilung<br />
zwischen Bundeskanzlerin und Bundespräsident<br />
– allgemeiner: zwischen den entscheidenden<br />
Politikerinnen und Politikern<br />
und dem Bundespräsidenten – diskutiert.<br />
Soll er die Krisenpolitik der Kanzlerin in<br />
Sachen Europa „erklären“? Aus mehreren<br />
Gründen sollte er das nicht.<br />
Schon weil er jenseits der Parteien steht,<br />
also auch nicht im Dienst der Regierung.<br />
Umgekehrt sollte er auch nicht in deren<br />
Geschäfte eingreifen. Ebenso ist eine direkte<br />
Kritik an Regierungsentscheidungen<br />
für sein <strong>Am</strong>t nicht vorgesehen. Darüber<br />
hinaus würde „erklären“ eine Lehrerrolle<br />
des Bundespräsidenten voraussetzen, die<br />
mündigen Bürgern gegenüber nicht angemessen<br />
ist.<br />
Aber er soll doch qua <strong>Am</strong>t „Orientierung<br />
geben“. Wie geht das angesichts<br />
der Tatsache, dass er nicht der Oberlehrer<br />
mündiger Bürger ist, sondern im Gegenteil<br />
von ihnen (wenn auch durch indirekte<br />
Wahl) sein Mandat erhalten hat?<br />
Sein <strong>Am</strong>t verweist ihn nicht nur auf die<br />
genannten Grenzen, sondern bietet vor allem<br />
auch ungewöhnliche Chancen. Denn<br />
was er sagt, wird öffentlich in hohem Maße<br />
beachtet, und er verfügt über schier unendliche<br />
Ressourcen, um sich ein differenziertes<br />
eigenes Urteil zu bilden. Vor allem<br />
kann er seine Einsichten, in den Grenzen<br />
der Verfassung, ohne Rücksicht auf bevorstehende<br />
Wahlen, öffentlich vertreten.<br />
Die täglich handelnde Politik steht hier vor<br />
viel schwierigeren Herausforderungen, weil<br />
sie in Deutschland angesichts des Föderalismus<br />
praktisch unaufhörlich im (Vor-)<br />
Wahlkampf steht.<br />
„Soll der Bundespräsident die Krisenpolitik<br />
der Kanzlerin in Sachen Europa ‚erklären‘?<br />
Aus mehreren Gründen sollte er das nicht“<br />
Ehrlichkeit fällt also im <strong>Am</strong>t des Bundespräsidenten<br />
erheblich leichter. Damit<br />
verbessert sich seine Möglichkeit, das für<br />
die Demokratie so notwendige Vertrauen,<br />
das durch wahltaktisches Sprechen unterminiert<br />
wird, zu stärken. Er könnte zum<br />
Beispiel die Logiken ebenso wie die Voraussetzungen<br />
und die langfristigen Implikationen<br />
unterschiedlicher politischer Positionen<br />
verdeutlichen. Damit würde er,<br />
ohne Partei zu ergreifen, das Terrain der<br />
öffentlichen Debatte klären helfen, sodass<br />
die taktischen und strategischen Absichten<br />
öffentlicher Positionen transparenter würden.<br />
Das wäre ein hilfreicher Beitrag zur argumentativen<br />
Erhellung der anstehenden<br />
Entscheidungen. Denn so würden deren<br />
Tragweite (die nicht auf Anhieb erkennbar<br />
ist), ihre Vielschichtigkeit, ihre oft unvermeidbare<br />
Unsicherheit oder Schwierigkeit,<br />
bei denen die Politik zuweilen zwischen<br />
Pest und Cholera wählen muss, erkennbar.<br />
Dadurch würde den mündigen Bürgern,<br />
die nicht den ganzen Tag mit detaillierter<br />
politischer Analyse verbringen<br />
können, ermöglicht, sich ihrerseits eigenständiger<br />
zu orientieren. Gleichzeitig trüge<br />
der Bundespräsident zu einem Vertrauenszuwachs<br />
zwischen Wählern und Gewählten<br />
bei, weil Verzerrungen der Kommunikation<br />
eingedämmt würden.<br />
Das erfordert ein ständiges Einarbeiten<br />
in komplizierte politische Streitfragen<br />
– und nicht zuletzt eine Urteilskraft,<br />
die zwischen Sachzusammenhängen und<br />
politischen Präferenzen zu unterscheiden<br />
weiß. Dazu gehört auch, behauptete<br />
Sachzwänge auf ihre impliziten politischen<br />
Wertungen zu durchleuchten und politische<br />
Präferenzen mit sachlichen Herausforderungen<br />
zu konfrontieren. Allerdings<br />
braucht es dazu einen gehörigen Mut, denn<br />
die Verantwortung und das Gewicht präsidialer<br />
Aussagen sind erheblich. Zum Teil<br />
ist das alles auch die Aufgabe der Medien,<br />
die aber häufig aus verschiedenen Gründen<br />
hinter ihren demokratiepolitischen Obliegenheiten<br />
zurückbleiben und meist auch<br />
nicht über die Ressourcen des Bundespräsidenten<br />
verfügen.<br />
Zum „Kerngeschäft“ des Bundespräsidenten<br />
gehört schließlich, auf eigene geistige<br />
Rechnung neuralgische Probleme der<br />
Gesellschaft oder längerfristige Zukunftsperspektiven<br />
zur Debatte zu stellen, vielleicht<br />
sogar Lösungen vorzuschlagen.<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 57
| B e r l i n e r R e p u b l i k | J o a c h i m G a u c k<br />
Darauf konzentriert sich in der Regel weniger<br />
die handelnde Politik, obwohl Parteien,<br />
die in der Verfassung zwischen Staat und<br />
Gesellschaft angesiedelt sind, dazu auch einen<br />
Beitrag leisten sollten. Die „großen Linien“<br />
eines Zukunftsentwurfs oder auch<br />
einer Geschichtsbetrachtung könnten im<br />
Übrigen indirekt Alternativen zur aktuellen<br />
Politik und damit implizit Kritik an ihr<br />
formulieren, aber eben indirekt und ausgewiesen<br />
durch die Leistung eines eigenen<br />
begründeten Entwurfs. Richard von Weizsäcker<br />
war ein Meister darin, solche Alternativen<br />
zur Sprache zu bringen.<br />
Nehmen wir zur Illustration dieser<br />
Überlegungen die gegenwärtige Schulden-<br />
und Bankenkrise in Europa. Hinter<br />
vorgehaltener Hand geben alle politisch<br />
Eingeweihten zu, dass Europa längst<br />
eine Haftungs- und Transferunion darstellt.<br />
Schon weil wir alle ökonomisch viel zu sehr<br />
voneinander abhängen. Politiker, die sich<br />
nicht mehr zur Wahl stellen wollen (wie<br />
Gerhard Schröder), sagen das auch öffentlich.<br />
Andere bemänteln es oder behaupten<br />
das Gegenteil, weil sie um ihre Wiederwahl<br />
fürchten. Sie vermuten, dass die Deutschen<br />
nicht bereit sind zu haften, weil eine gegebenenfalls<br />
zu zahlende Haftungssumme<br />
ihre Vorstellungskraft übersteigt.<br />
Vor allem aber wurde den Deutschen seit<br />
Beginn der Schuldenkrise eine Geschichte<br />
erzählt, der zufolge diese nicht aus der vorangegangenen<br />
Bankenkrise, sondern allein<br />
oder vornehmlich aus unverantwortlicher<br />
Politik hervorgegangen sei, an der<br />
sie selbst keinen Anteil trügen; die europäischen<br />
Nachbarn, vor allem im Süden,<br />
seien an ihrem Unglück selbst schuld und<br />
würden im Falle eines solidarischen Entgegenkommens<br />
nur mit dem alten unverantwortlichen<br />
Schlendrian fortfahren. Im Übrigen<br />
könnten die Deutschen ohnehin auf<br />
keinen Fall für alle anderen haften.<br />
So fest hat sich diese (deutsche!) Geschichte<br />
über Europa etabliert, dass es<br />
schier unmöglich scheint, gegenüber<br />
den deutschen Wählern öffentlich eine<br />
konsistente Position zugunsten des Euro zu<br />
vertreten, die die gemeinsame Haftung und<br />
auch gegebenenfalls Transferleistungen (sei<br />
es bei einem europäischen Bankenverbund,<br />
sei es beim Bürgen für Eurobonds, um die<br />
Zinsen südlicher Staatsanleihen bezahlbar<br />
zu halten) selbstverständlich einschließt –<br />
wie immer sie konkret geregelt werden.<br />
Aber dass die logische Alternative zu<br />
Haftung und Transfer das Zerbrechen der<br />
Währungsunion oder den Ausstieg Griechenlands,<br />
Spaniens, Italiens (beziehungsweise<br />
umgekehrt auch Deutschlands) aus<br />
der gemeinsamen Währung bedeutete,<br />
wird den Bürgern langsam bewusst. Die<br />
das auch wollen, proklamieren das Ende<br />
des Euro nicht ausdrücklich, polemisieren<br />
aber seit langem gegen ihn ebenso wie<br />
gegen Haftung und Transfer und behaupten,<br />
dass Europa den Euro nicht brauche.<br />
Wenn der Bundespräsident von der Kanzlerin fordert, ihr<br />
Verhalten genau zu erklären, hat er als „Bürger“ recht.<br />
Aber er bleibt hinter den Aufgaben seines <strong>Am</strong>tes zurück<br />
Eigentlich meinen sie, dass Deutschland<br />
Europa nicht (mehr) braucht. Exportieren<br />
kann man auch nach Asien.<br />
Die Kanzlerin dagegen hat erkannt,<br />
dass Deutschland für seine Wirtschaft den<br />
Euro und Europa braucht, und dass der<br />
Verlust des Euro, nachdem er einmal eingeführt<br />
ist, die Europäische Union schwer<br />
beschädigen würde. So versucht sie, gemeinsame<br />
Haftung und möglichen Transfer<br />
„unter der Hand“ (und das Gegenteil<br />
behauptend) einzuführen, um die öffentliche<br />
Debatte darüber und die klare politische<br />
Entscheidung zu vermeiden.<br />
Eine dritte Position, die logisch konsistent<br />
und klar zugunsten des Euro und<br />
der Europäischen Union einschließlich<br />
Haftung und möglichem Transfer argumentierte,<br />
bleibt zurzeit aus Angst vor<br />
den deutschen Wählern öffentlich auf der<br />
Strecke. Sie müsste, um schnell zu wirken,<br />
mit einem Vertrauensvorschuss gegenüber<br />
den europäischen Nachbarn beginnen und<br />
mit einem konzeptionellen Entwurf europäischer<br />
Willensbildung und Kontrolle<br />
einhergehen.<br />
Dieses Spiel mit verdeckten Karten ist<br />
kein Beispiel für politischen Mut oder eine<br />
gelungene demokratische Kommunikation,<br />
denn sie zerstört das Vertrauen der Bürger<br />
immer mehr. Sie spüren, dass etwas falsch<br />
läuft im öffentlichen Raum, trauen sich<br />
selbst aber kein eigenes Urteil zu und hoffen<br />
einfach, dass der Kelch der Haftung<br />
an ihnen vorübergeht. Und die Regierenden<br />
hoffen, dass sie irgendwie durch die<br />
Krise kommen.<br />
Wenn der Bundespräsident in dieser Situation<br />
von der Bundeskanzlerin fordert,<br />
ihr Verhalten ganz genau zu erklären, hat<br />
er als „Bürger“ recht, weil die Bürgerinnen<br />
und Bürger auf diese Weise Genauigkeit<br />
und Glaubwürdigkeit von handelnden<br />
Politikern verlangen können. Aber er bleibt<br />
damit hinter den Aufgaben und Chancen<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück. Wenn er seinerseits<br />
„mehr Europa“ für Deutschland und nicht<br />
„mehr Deutschland“ in Europa will, hat er<br />
großartige Möglichkeiten, das Argumentationsknäuel<br />
in Sachen Banken- und Schuldenkrise,<br />
in Sachen Haftung, Solidarität<br />
und wirklicher Zahlung zu entwirren. Er<br />
könnte mit seiner <strong>Am</strong>tsautorität klarstellen,<br />
dass die Deutschen bisher an ihre verschuldeten<br />
Nachbarn nichts gezahlt, dagegen einiges<br />
an Zinsen und durch unrealistisch<br />
billige Staatsanleihen gewonnen haben. Er<br />
könnte Zusammenhänge der gemeinsamen<br />
europäischen Verantwortung für die Krise,<br />
überhaupt die transnationale Verflechtung<br />
und damit auch die Notwendigkeit eines<br />
transnationalen Einstehens der ökonomischen<br />
Akteure erläutern. Deutsche Banker<br />
haben nicht nur in den USA am aufgeblähten<br />
Immobiliensektor gut verdient. Leichtsinnige<br />
Schuldner haben zuvor leichtsinnige<br />
Gläubiger gefunden; vorteilsgierige<br />
Gläubiger haben zuweilen gezielt auf den<br />
Leichtsinn ihrer Schuldner hingearbeitet.<br />
Und solange mit den Schulden der Nachbarn<br />
deutsche Exporte bezahlt wurden, haben<br />
diese Schulden uns auch nicht besonders<br />
gestört.<br />
Der Bundespräsident könnte überdies<br />
auch Positionen unserer europäischen<br />
Nachbarn fair erläutern. Damit würde er<br />
zu einer Kultur des ehrlichen Argumentierens<br />
und des „Gemeinsinns“ beitragen, die<br />
Kant in den drei Maximen: „Selbst denken!<br />
Jederzeit mit sich einstimmig denken! Jederzeit<br />
an der Stelle des anderen denken!“<br />
charakterisiert hat. Wenn wir in widersprüchlichen<br />
Positionen verharren und uns<br />
darüber hinaus nicht an die Stelle der anderen<br />
setzen, werden wir weder für Europa<br />
Foto: Steffi Loos/DAPD (Seiten 56 bis 57)<br />
58 <strong>Cicero</strong> 9.2012
F r a u F r i e d f r a g t s i c h . . .<br />
Illustration: Jan Rieckhoff; Foto: Picture alliance<br />
noch für unser globales Zusammenleben<br />
eine Zukunft in Demokratie und Wohlstand<br />
entwickeln. „Mehr Europa“ verlangt<br />
eine andere Geschichte über Europa.<br />
So hätte der Bundespräsident die<br />
Chance, mit reicher Expertise versehen<br />
eine „eigene“ andere Geschichte über Vergangenheit,<br />
aktuelle Krise und die Zukunft<br />
Europas sowie die Rolle Deutschlands darin<br />
zu erzählen als die öffentlich gängige,<br />
die stark durch Wahltaktik bestimmt ist.<br />
Es könnte eine ausgewogenere sein, die es<br />
den Deutschen plausibler machen würde,<br />
nicht nur ihre kurzfristigen nationalen Interessen<br />
zu sehen, was jeden gesellschaftlichen<br />
Zusammenhalt und damit zugleich<br />
Demokratie und wirtschaftlichen Wohlstand<br />
zerstört, auch in Deutschland selbst.<br />
Er könnte daran erinnern, dass der Wille<br />
zur vertrauensvollen und solidarischen Zusammenarbeit<br />
am Anfang der europäischen<br />
Einigung stand und allen Europäern unerwarteten<br />
Wohlstand und Frieden in Freiheit<br />
gebracht hat.<br />
Er könnte Gründe dafür anführen, dass<br />
der entschiedene Wille zum solidarischen<br />
Zusammenstehen in Europa, gerade von<br />
deutscher Seite dokumentiert, die Märkte<br />
für Europa zurückgewinnen würde, dass er<br />
die Einrichtung transparenter Kontrollen<br />
erleichtert und die besten Aussichten bietet,<br />
den Ernstfall eines Schuldenausgleichs<br />
oder des Eurozusammenbruchs zu vermeiden.<br />
Eine Geschichte über die Eurokrise,<br />
die Verantwortung, Leichtfertigkeit und<br />
Vorteile in der Vergangenheit realistischer<br />
zuordnete, würde auch eine europäische<br />
Haftungs- und Transferunion für die Zukunft<br />
plausibler machen.<br />
Damit würde er die Kanzlerin nicht<br />
nur kritisieren, sondern einen eigenen<br />
und hoffentlich überzeugenden Vorschlag<br />
zur Debatte stellen. Das wäre ein wunderbarer<br />
Beitrag zu einer öffentlichen Kommunikation,<br />
in der ein fairer Austausch<br />
von Argumenten hilft, gemeinsam Orientierung<br />
für den bestmöglichen Weg<br />
Deutschlands nach „mehr Europa“ zu finden<br />
und damit Demokratie wie Vertrauen<br />
zu stärken. Welche Chancen für den Bundespräsidenten!<br />
Gesine Schwan<br />
ist Präsidentin der Humboldt-<br />
Viadrina School of Governance<br />
in Berlin<br />
… ob es ihrer Gesundheit<br />
zuträglich ist, sich an<br />
Bibelworte zu halten<br />
M<br />
an möchte ja gern alles richtig<br />
machen, und dabei soll angeblich<br />
die Bibel helfen. Leider kommt<br />
oft Unsicherheit ob der korrekten Exegese<br />
auf. Nehmen wir die Forderung, man solle<br />
nach dem Erhalt einer Ohrfeige die andere<br />
Wange hinhalten: Gerade hat mich jemand,<br />
den ich für einen Freund gehalten habe,<br />
um Geld betrogen. Muss ich ihm jetzt<br />
meine restlichen Ersparnisse auch noch<br />
schenken? Schließlich heißt es: „Wenn<br />
einer dir dein Hemd nehmen will, so<br />
gib ihm auch noch den Mantel.“ Das<br />
käme sicher sehr cool rüber, würde<br />
aber kaum dazu führen, dass ich mich<br />
besser fühle.<br />
„Liebet eure Feinde und betet für alle, die<br />
euch hassen und verfolgen“, fordert Jesus in der<br />
Bergpredigt. Na, vielen Dank! Wenn’s nach mir ginge, könnten alle, die mich hassen<br />
und verfolgen, gern zur Hölle fahren – Freunde werden wir sowieso nicht<br />
mehr. Andererseits: Vielleicht ist die Hölle der viel interessantere Ort, und die größere<br />
Strafe wäre, sie in den Himmel zu beten. Bleibt die Frage, ob Gebete auch<br />
helfen, wenn man gar nicht gläubig ist?<br />
Wir leben in einer Zeit des Positivterrors. Sogar vernünftige Leute glauben,<br />
man müsse nur positiv denken, dann würde alles gut. Man schickt sich keine herzlichen<br />
Grüße mehr, sondern „positive Energien“. Und alle sollen sich ständig versöhnen.<br />
Missbrauchsopfer mit ihren Peinigern. Israelis mit Palästinensern. In Syrien<br />
wurde sogar ein Minister für Versöhnung ernannt, der die Verfolgten des<br />
Assad-Regimes mit ihren Verfolgern versöhnen soll. Wer sich nicht versöhnen<br />
will, gilt als Querulant. Aber der Versöhnung muss Aufarbeitung vorausgehen sowie<br />
Einsicht und Reue des Täters. Einem uneinsichtigen Täter zu verzeihen, mag<br />
christlich sein und von menschlicher Größe zeugen, vernünftig im Sinne der Verbrechensprophylaxe<br />
ist es nicht.<br />
Ich liebe gern und viel – warum soll ich nicht gelegentlich auch hassen? Und<br />
soll mir bloß keiner einreden, das sei schlecht für mein Seelenheil. Viel schlechter<br />
für mein Seelenheil ist, mich wie ein betrogener Idiot zu fühlen. Deshalb möchte<br />
ich mit manchen Menschen lieber ehrlich verfeindet als verlogen versöhnt sein.<br />
Gut gepflegte Feindschaften können einem übrigens fast so ans Herz wachsen wie<br />
Freundschaften – und gesundheitsfördernd sind sie auch: Der Zorn hält den Kreislauf<br />
in Schwung.<br />
„Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel.“ Dschieses!<br />
Geht’s vielleicht eine Nummer kleiner? Ein Bild sollen wir uns nicht von ihm machen<br />
– aber so heilig sein wie er?<br />
Da halte ich mich doch lieber an den alten Haudegen Georg von Frundsberg:<br />
Viel Feind, viel Ehr. Schließlich habe ich genügend Facebook-Freunde.<br />
<strong>Am</strong>elie Fried ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über<br />
Männer, Frauen und was das Leben sonst noch an Fragen aufwirft<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 59
| B e r l i n e r R e p u b l i k | K o m m e n t a r<br />
Zwei deutsche Sittenbilder<br />
Das Land bestraft seine Politiker hart für Abweichungen vom<br />
Pfad der Tugend – während sich die „Verantwortlichen“ in der<br />
Finanzbranche lächelnd davonstehlen<br />
Von Frank A. Meyer<br />
Sittenbild Nummer eins:<br />
Welch ein Abgang! Die Staatsanwaltschaft befragt ihn, Verfahren<br />
bedrohen ihn, das politische Berlin ächtet ihn.<br />
Sein neues Büro, das ihm der Deutsche Bundestag zugewiesen<br />
hat, ist „klein wie eine Abstellkammer“. Die Telefonzentrale<br />
des Parlaments kennt ihn nicht: „Wulff? Mit zwee f? Hamm wa<br />
hier nich.“ Beides will der Spiegel in Erfahrung gebracht haben.<br />
Nachrichten von einem Ausgegrenzten.<br />
Und wer ihn leibhaftig vor sich sah, hat Tristes zu vermelden:<br />
Als „Auftritt eines Gezeichneten“, beschreibt die Süddeutsche<br />
Zeitung seine Anwesenheit bei einer Feierstunde.<br />
Der gescheiterte Bundespräsident, bleich und abgemagert.<br />
Der gefallene Politiker, einsam und verlassen.<br />
Was hat er bloß verbrochen?<br />
Ein unordentlicher Kredit für ein ordentliches Häuschen<br />
im höchst ordentlichen Großburgwedel. Dazu kostengünstige<br />
bis kostenlose Ferien bei und mit Freunden. Auch eine Hotelübernachtung,<br />
für die ein Unternehmerfreund geradestand. Das<br />
Upgrade für einen Flug, Economy auf Business. Ein paar Partynächte<br />
in unschicklicher Nähe zu Wirtschaftsgrößen.<br />
Welch piefiges Sündenregister! Zu peinlich, um wahr zu sein.<br />
Doch alles leider nun mal nicht vereinbar mit Wulffs vorangegangenem<br />
<strong>Am</strong>t des niedersächsischen Ministerpräsidenten.<br />
Deshalb leider auch nicht vereinbar mit der Würde des<br />
Bundespräsidenten.<br />
Ja, die deutsche Demokratie bestraft ihre Politiker streng<br />
für Abweichungen vom Pfad der Tugend. Selbst wenn ihre<br />
Missetaten nichts weiter sind als Spießersünden, Geschmacksverirrungen,<br />
Stillosigkeiten – Verteidigungsminister Rudolf<br />
Scharping etwa musste gehen, weil er sich zur Unzeit eines<br />
Kampfeinsatzes der Bundeswehr mit seiner Freundin im Pool<br />
ablichten ließ.<br />
Sittenbild Nummer zwei:<br />
Welch ein Abgang! Die Schweiz heiligt ihn, die Finanzwirtschaft<br />
huldigt ihm, die Medien bewundern ihn.<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
60 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: privat<br />
Lachend lässt er sich im Formel-1-Cockpit ablichten – jeder<br />
Zoll ein Champion, ein Weltmeister, ein „Master of the Universe“,<br />
wie sich Banker seines Kalibers nun mal gern sehen.<br />
Deutschland behält Josef Ackermann strahlend in Erinnerung.<br />
Seine Heimkehr in die Eidgenossenschaft nach zehn Jahren<br />
als Chef der Deutschen Bank war triumphal.<br />
Lukrative Mandate fallen ihm reihenweise in den Schoß:<br />
in Deutschland, in der Schweiz, in der Türkei, in Kuwait, in<br />
Schweden. Natürlich und selbstredend, und wie könnte es anders<br />
sein, ist er doch auch noch Vizepräsident des „World Economic<br />
Forum“. Reputation verpflichtet.<br />
Was hat er geleistet?<br />
Die Deutsche Bank entwickelte sich unter seiner Ägide zu einer<br />
der größten, wenn nicht zur größten Spekulantenbank überhaupt.<br />
Sie steckte tief im Sumpf der US‐Subprime‐Krise, die<br />
2007/2008 zur Weltfinanzkrise wurde. „Joes“ Bank war damals<br />
Täter. Und sie ist es erneut im Libor-Betrug.<br />
Wo immer gezockt wurde, wo immer gezockt wird, das Institut<br />
mit dem Schweizer Siegelbewahrer war dabei und ist dabei.<br />
Anything goes, solang es nur der Rendite dient. Ziel unter<br />
Ackermann: 25 Prozent – und auch schon mal 14 Millionen<br />
Jahresgehalt für den Chef selber. Soll man ihn, darf man ihn den<br />
„obersten Verantwortlichen“ nennen?<br />
Verantwortung ist das Sonntagswort aller „Joes“ dieser bizarren<br />
Halbwelt. Damit begründen sie ihre exorbitanten Boni.<br />
Doch sobald tatsächlich einmal Verantwortung getragen werden<br />
muss, verflüchtigt sich das Sonntagswort. Im Ernstfall<br />
nämlich sind für Schuld und Sühne höchstens die Chargen<br />
auf der nächstunteren oder der nächstnächstunteren Ebene<br />
zuständig.<br />
Und der Chef selber? Natürlich über jeden Zweifel erhaben.<br />
Dasselbe gilt ebenso selbstredend für den neuen Deutsche-<br />
Bank-Chef Anshu Jain, ehedem „verantwortlich“ für das Investmentbanking<br />
der Deutschen Bank in London, oberster Koch<br />
also in der Giftküche der globalen Finanzwirtschaft, „verantwortlich“<br />
für fragwürdigste Finanztaten gegen Nationen, Gesellschaften<br />
und Menschen.<br />
Zieht ihn jemand zur Verantwortung? Nein. Man hängt an<br />
seinen Lippen!<br />
Anshu Jain verspricht „eine neue Kultur“. Der Bock verspricht<br />
zu gärtnern. Das Versprechen wird respektvoll begrüßt.<br />
Auch Christian Wulff versprach einst eine neue Kultur. Ganz<br />
Deutschland höhnte.<br />
Der Täter Anshu Jain ist gesellschaftsfähig. Das Täterchen<br />
Christian Wulff dagegen nicht.<br />
Das ist es, was uns die zwei Sittenbilder vor Augen führen:<br />
die Moral der Politik. Und die <strong>Am</strong>oral der Finanzwirtschaft.<br />
Und wie stehen wir Journalisten dazu? Chefredakteur Georg<br />
Mascolo lieferte im Spiegel jüngst ein Beispiel – es sei ausführlich<br />
zitiert:<br />
„Die Banken erpressen uns, hat SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />
in einem Thesenpapier geschrieben, und es ist zu hoffen, dass<br />
in dem Getöse über seine teilweise berechtigten, teilweise überzogenen<br />
Forderungen die wirklich wichtige Wortmeldung dieser<br />
Woche nicht vergessen wird. Sie kommt von Sandy Weill. Er<br />
war acht Jahre lang die bestimmende Figur der US-Großbank<br />
Citigroup.“<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 61<br />
Die Politik – „Getöse“, übertrieben, nicht ernst zu nehmen.<br />
Der Finanzspekulant – „die wirklich wichtige Wortmeldung der<br />
Woche“.<br />
So gegensätzlich sind die Sitten:<br />
Der Politiker hat Wahlen zu fürchten, außerdem Staatsanwälte,<br />
Untersuchungsausschüsse und die gesellschaftliche Ächtung,<br />
selbst wenn er sich nur bei unappetitlichen Petitessen ertappen<br />
lässt. Wie Wulff.<br />
Der Vormann der deutschen Finanzwirtschaft hingegen<br />
bleibt unbehelligt, bei welcher Tat auch immer er ertappt<br />
wird, sei es beim Sturmlauf auf Währungen, beim Zerstören<br />
von Volkswirtschaften, beim Aushebeln von Demokratie. Sei es<br />
Ackermann. Sei es Jain.<br />
Was für eine Gesellschaft zeigt sich da?<br />
Eine Gesellschaft, die ihre Politiker argwöhnisch beäugt und<br />
akribisch verfolgt – ihre Geldmächtigen dagegen bewundernd<br />
bestaunt und rechtsfrei schalten und walten lässt.<br />
Primat der Politik? Primat des Rechtsstaats?<br />
Im Sommer 2012 vor aller Augen verdampft.<br />
Anzeige<br />
Frank A. Meyer<br />
ist Journalist und Gastgeber der politischen<br />
Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
Geld ist nicht da,<br />
um Geld zu vermehren,<br />
sondern<br />
um Ideen zu<br />
verwirklichen.<br />
Geld ist Mittel der Zukunftsgestaltung —<br />
wenn wir es gemeinsam dazu machen.<br />
Machen<br />
Sie’s gut!<br />
Werden Sie<br />
Mitglied.<br />
glsbank.de<br />
das macht Sinn
| W e l t b ü h n e<br />
Chiles Vorzeigefrau<br />
Michelle Bachelet kämpft als Chefin von „UN Women“ für die Quote und gegen Zwangsehen<br />
von Carlos Widmann<br />
I<br />
n den Stinkenden Kellern der<br />
Villa Grimaldi herrschte Gleichberechtigung.<br />
Die Frauen wurden<br />
genauso gefoltert wie die Männer. Aber<br />
die damalige Medizinstudentin Michelle<br />
Bachelet weigert sich bis heute – beinahe<br />
vier Jahrzehnte später –, als Folteropfer<br />
kategorisiert zu werden: „Ja, mein Kopf<br />
steckte in einer Kapuze. Ja, ich wurde bedroht,<br />
geschmäht, geschlagen. Aber die<br />
‚parrilla‘ (der Grill) ist mir erspart geblieben.“<br />
Das war jenes eiserne Gestell, an<br />
das die nackten Leiber der Gefangenen<br />
geschnallt wurden, um ihnen die Namen<br />
ihrer Freunde oder Komplizen zu entreißen.<br />
Das wirksamste Mittel dafür waren<br />
die Elektroden, mit denen immer stärkere<br />
Stromstöße verabreicht wurden, gerne<br />
auch im Genitalbereich.<br />
Vermutlich war es der Respekt vor dem<br />
Vater, der Michelle Bachelet davon abhielt,<br />
sich selbst als Folteropfer registrieren zu<br />
lassen. Denn als die 24-Jährige im Februar<br />
1975 mit ihrer Mutter im Verhörzentrum<br />
Villa Grimaldi landete, war ihr Vater,<br />
der Luftwaffengeneral Alberto Bachelet,<br />
bereits ein Jahr tot – buchstäblich zu Tode<br />
gefoltert. Er war nach dem Militärputsch<br />
Augusto Pinochets intensiv gequält worden<br />
und erlag schließlich einem Herzinfarkt.<br />
Erst heute müssen sich die ehemaligen<br />
hohen Offiziere dafür vor Gericht<br />
verantworten.<br />
Vom Folterkeller ins Präsidentenpalais:<br />
Diesen unfassbar weiten Weg haben<br />
in Lateinamerika zwei Frauen zurückgelegt<br />
– nach Michelle Bachelet auch die<br />
einstige kommunistische Stadtguerillera<br />
Dilma Rousseff, die heute in Brasilia die<br />
Geschäfte führt. Beide sind Pragmatikerinnen,<br />
die sich von ihren Ideologien verabschiedet<br />
haben – sofern Michelle Bachelet<br />
je eine hatte. Die Generalstochter, die vier<br />
Exiljahre in der DDR verbrachte (Deutschunterricht<br />
am Herder-Institut, Leipzig; Medizinstudium<br />
an der Humboldt-Universität,<br />
Berlin), ist dort vom Sozialismus wohl eher<br />
kuriert worden. Schon 1979 – als der Diktator<br />
Pinochet im Zenit seiner Macht stand –<br />
„Ich bin eine Frau, Sozialistin,<br />
geschieden und Agnostikerin“<br />
Michelle Bachelet<br />
kehrte Michelle nach Chile zurück. Dem<br />
gewaltsamen Widerstand blieb sie fern, in<br />
der Sozialistischen Partei war sie eine Unbekannte.<br />
Mit dem Arzt Aníbal Henríquez,<br />
der Pinochet und die Reformen der neoliberalen<br />
„Chicago Boys“ unterstützte, hat sie<br />
fünf Jahre zusammengelebt. Eines ihrer drei<br />
Kinder stammt von ihm. Dennoch erklärte<br />
Bachelet bei ihrem <strong>Am</strong>tsantritt als Staatspräsidentin:<br />
„Ich bin eine Frau, Sozialistin,<br />
geschieden und Agnostikerin.“<br />
„Crusading feminist“ heißt es in einem<br />
Porträt aus New York – als „feministische<br />
Kreuzzüglerin“ wird die Chilenin darin<br />
vorgestellt. Dieses Bild passt so gar nicht<br />
zu Bachelet, ist aber gut gemeint und ihrer<br />
neuen Rolle geschuldet: Sechs Monate<br />
nach ihrer Präsidentschaft (2006 bis 2010)<br />
wurde Michelle Bachelet zum „Executive<br />
Director“ einer Instanz der Vereinten Nationen,<br />
die sich lapidar „UN Women“ nennt.<br />
Eine Selbstdefinition gibt es nur auf Englisch:<br />
„United Nations Entity for Gender<br />
Equality and the Empowerment of Women“.<br />
Den diplomatischen Rang der Chefin<br />
gibt es auch auf Deutsch: Michelle Bachelet,<br />
Untergeneralsekretär der Vereinten<br />
Nationen. Davon gibt es derzeit 40. Frauenbeauftragte<br />
der UN wäre eine solide<br />
deutsche Bezeichnung oder oberste Hüterin<br />
der Frauenrechte – zuständig also für<br />
die Hälfte der Menschheit.<br />
Wenn es über Geld und Macht verfügte,<br />
wäre es wohl das wichtigste <strong>Am</strong>t der Welt.<br />
Vom Zugang der Frauen zu Ärzten, zu Wissen,<br />
Ausbildung und bezahlter Arbeit hängt<br />
das Schicksal der Völker ab – nicht nur<br />
in der Dritten Welt, auch in Teilen Europas.<br />
„Equality is good business“, verkündet<br />
Michelle Bachelet mit entwaffnendem Lächeln:<br />
Gleiches Recht, Schutz vor Gewalt<br />
und Unterwerfung, vor religiösem Obskurantismus<br />
und Zwangsehen – das zahlt<br />
sich aus, hebt den Lebensstandard, bringt<br />
nachweislich die Wirtschaft voran! Doch<br />
ein <strong>Am</strong>t, das – nahezu ohne Mittel – sowohl<br />
für die Frauenquote in der Führung<br />
der Weltkonzerne wie gegen die Genitalverstümmelung<br />
somalischer Musliminnen<br />
kämpft, kann sich leicht im Banalen verirren.<br />
Jeder 25. Tag im Monat, verfügte<br />
UN Women jüngst, ist fortan „Orange<br />
Day“: der Tag, an dem ein Zeichen gesetzt<br />
wird, um Gewalt gegen Frauen zu<br />
bekämpfen – durch das Tragen orangefarbener<br />
Kleidungsstücke.<br />
Ganz und gar nicht banal sind hingegen<br />
erste Hinweise auf eine Rückkehr<br />
Bachelets in die chilenische Politik. Vor<br />
wenigen Wochen schickte die 60-Jährige<br />
eine Grußbotschaft an die Parteiführung<br />
der chilenischen Christdemokraten. Das<br />
schlug ein wie eine Bombe: Die Democristianos<br />
sind der unentbehrliche Koalitionspartner,<br />
mit dem die äußerst populäre<br />
Sozialistin im November 2013 nochmals<br />
Chiles Präsidentin werden könnte.<br />
Carlos Widmann war<br />
Korrespondent der Süddeutschen<br />
Zeitung. Im September erscheint<br />
von ihm „Das letzte Buch über<br />
Fidel Castro“ (Hanser-Verlag)<br />
Fotos: Platon/trunkarchive.com, Peter-Andreas HAssiepen (Autor)<br />
62 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Chiles ehemalige<br />
Präsidentin<br />
Michelle Bachelet<br />
gilt bis heute<br />
als populärste<br />
Politikerin<br />
ihres Landes<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 63
| W e l t b ü h n e<br />
Merkels letzter<br />
VerbÜndeter<br />
Mark Rutte hält der Kanzlerin die Stange. Wie lange noch, hängt auch von den Wahlen in den Niederlanden ab<br />
von Rob Savelberg<br />
W<br />
enig deutete Anfangs darauf hin,<br />
dass ausgerechnet Mark Rutte der<br />
letzte Verbündete Angela Merkels<br />
in der Eurokrise sein würde. Als der juvenile<br />
Regierungschef der Niederlande vor<br />
fast zwei Jahren sein <strong>Am</strong>t antrat, ließ die<br />
Chefin der liberalkonservativen Koalition<br />
an der Spree harsch verlautbaren, wie enttäuscht<br />
sie über die Bildung seiner Minderheitsregierung<br />
war. Sie bedauerte offiziell,<br />
dass Rutte sich vom unberechenbaren<br />
Populisten Geert Wilders unterstützen ließ.<br />
So undiplomatisch war die Kommunikation<br />
zwischen Berlin und Den Haag<br />
lange nicht mehr gewesen. Aber Rutte<br />
ließ sich nichts anmerken, übte stattdessen<br />
einige Wörter Deutsch, und als er Merkel<br />
dann wenig später zum ersten Mal im<br />
Kanzleramt traf, lachte er alle Kritik weg.<br />
Diese Reaktion ist exemplarisch für<br />
den niederländischen Regierungschef. Der<br />
45-Jährige ist ein unverbesserlicher Optimist,<br />
immer in der Lage, die schwierigsten<br />
Situationen umzudeuten. Stets behält<br />
er dabei sein entwaffnendes Lächeln.<br />
Ein richtiger Holländer eben, locker,<br />
fröhlich, gut gelaunt – und immer mit festem<br />
Blick auf das Portemonnaie: Richtig ist,<br />
was Geld bringt, falsch, was kein oder kaum<br />
Geld einbringt. Als sogar die Niederlande in<br />
die Rezession rutschten, sollte Schluss sein<br />
mit „linken Hobbys“ und Umverteilung.<br />
So wurden Kultursubventionen, Gelder für<br />
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die<br />
Entwicklungshilfe und sogar Mittel für Bildung<br />
für Behinderte massiv gekürzt.<br />
Rutte ist eben ein Neoliberaler, gilt<br />
als Fan von Ronald Reagan und Maggie<br />
Thatcher. Für ihn sind Menschen selbst<br />
für ihr Schicksal verantwortlich. Er befürwortet<br />
maximale persönliche Freiheit, sogar<br />
um den Holocaust zu leugnen. Seine<br />
wirtschaftspolitischen Ziele konzentrieren<br />
sich auf ein unternehmerfreundliches<br />
Klima. Dabei sollen der Staat und auch<br />
die Bürokraten aus Brüssel ihren Einfluss<br />
möglichst gering halten. Außer wenn es<br />
darum geht, Wohnungseigentümern mit<br />
Milliarden Euro zu helfen – die steuerliche<br />
Abziehbarkeit von Darlehenszinsen ist für<br />
Rutte eine heilige Kuh.<br />
Sein Vater war Handelsdirektor in der<br />
Kronkolonie Indonesien. Der Sohn wuchs<br />
in der Regierungsstadt Den Haag auf, wo er<br />
auch heute noch in einer kleinen Wohnung<br />
wohnt. Seine Mutter wusch bis vor kurzem<br />
noch seine Wäsche und bügelte die Hemden<br />
des bekanntesten Singles der Niederlande.<br />
Wie alle in seiner Familie ist Rutte<br />
Protestant und gilt als bescheiden. Seit Jahren<br />
unterrichtet er jeden Donnerstagmorgen<br />
Schüler in seiner Heimatstadt im Fach<br />
politische Weltkunde, egal wie voll der Terminkalender<br />
des Ministerpräsidenten ist.<br />
Nach dem Gymnasium wollte der passable<br />
Pianist zunächst das Konservatorium<br />
besuchen, entschloss sich dann jedoch für<br />
ein Geschichtsstudium in Leiden. Später<br />
wurde Rutte Personalchef beim Megakonzern<br />
Unilever, trug Verantwortung für den<br />
Erdnussbutterfabrikanten Calvé und die<br />
Tiefkühlprodukte von „Käpt’n Iglo“.<br />
Doch neben der Wirtschaft lockte die<br />
Politik. Rutte war Vorsitzender der Jungen<br />
Liberalen. Nach einem zähen Kampf<br />
mit der ehemaligen Gefängnisdirektorin<br />
Rita Verdonk wurde er Frontmann der<br />
Volkspartei für Freiheit und Demokratie<br />
(VVD). Und ausgerechnet in der größten<br />
Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit<br />
gewannen seine Rechtsliberalen die Wahlen<br />
2010, mit hauchdünnem Vorsprung<br />
vor den Sozialdemokraten.<br />
Regieren konnte Rutte allerdings nur,<br />
indem er vom Islamhasser Wilders toleriert<br />
wurde, einem Enfant terrible, das alles andere<br />
als tolerant ist. Rutte denkt in solchen<br />
Fragen eher praktisch als prinzipiell. Als<br />
Wilders ihn in der Tweede Kamer, dem<br />
Parlament, anschnauzte: „Sei doch mal<br />
normal, Mann!“, antwortete Rutte ruhig:<br />
„Sei doch lecker selber mal normal, Mann!“<br />
Ein anderes Beispiel für Ruttes Pragmatismus<br />
ist sein Pakt mit der bibeltreuen, theokratischen<br />
und antiliberalen SGP.<br />
Aller Pragmatismus hat nichts genutzt:<br />
Im Frühjahr ließ Wilders die Koalition<br />
platzen, weil er keine 15 Milliarden<br />
Euro einsparen wollte, um die Maastricht-<br />
Grenze von maximal 3 Prozent Defizit einzuhalten.<br />
Der Premier hatte sich sehr um<br />
die Hilfe des blondierten Euroskeptikers<br />
bemüht, umarmte ihn sogar kumpelhaft<br />
im Garten des „Catshuis“, seiner Haager<br />
Residenz. Umsonst.<br />
Rutte menschelt gerne. Zu den<br />
Sparklausuren erschien er auf dem Fahrrad,<br />
bevorzugt auch in Jeans. Als die Eurokrise<br />
wieder einmal eine Hochphase erlebte<br />
und Rutte sich beim EU-Gipfel in<br />
Brüssel um 50 Milliarden Euro verrechnet<br />
hatte, sah man ihn kurz darauf mit offenem<br />
weißen Hemd auf dem Technofestival<br />
„Dance Valley“ tanzen. Welch ein Kontrast<br />
zur Freizeitgestaltung der deutschen<br />
Kanzlerin, die alljährlich in Abendrobe in<br />
Bayreuth Wagners Musik lauscht.<br />
Dies zeigt die Nonchalance des Niederländers,<br />
der Deutschland mit seinem harten<br />
Sparkurs für angeschlagene Staaten<br />
unterstützt hat. Für Merkel ist das Nachbarland<br />
eine der letzten Stabilitätsstützen.<br />
Ob ihr die am Ende auch noch abhandenkommt,<br />
wird wesentlich vom Ausgang der<br />
Wahlen (am 12. September) im kleinen Königreich<br />
abhängen.<br />
Rob Savelberg ist Deutschlandkorrespondent<br />
für „De<br />
Telegraaf“, die auflagenstärkste<br />
Zeitung der Niederlande. Er<br />
lebt seit 1998 in Berlin<br />
Fotos: Michel de Groot, privat (Autor)<br />
64 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Jung und jovial:<br />
Der niederländische<br />
Regierungschef<br />
Mark Rutte<br />
mag es locker<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 65
| W e l t b ü h n e<br />
Krieg der Pinocchios<br />
Henrique Capriles Radonski will im Oktober Nachfolger von Hugo Chávez als Staatspräsident Venezuelas werden<br />
von karen naundorf<br />
E<br />
s geht um die Zukunft Venezuelas,<br />
doch das Land streitet sich über<br />
eine Baseballkappe. „La prohibida“,<br />
„die Verbotene“, heißt die umstrittene<br />
Schirmmütze in den Nationalfarben<br />
Gelb, Blau, Rot – und verkauft sich prächtig.<br />
Eigentlich darf in Venezuela während<br />
einer Wahlkampagne niemand mit den<br />
Landesfarben werben. Doch Henrique<br />
Capriles Radonski, der Herausforderer des<br />
amtierenden Staatspräsidenten Hugo Chávez,<br />
trägt „die Verbotene“ bei jeder Rede<br />
und macht sie so zu einem Symbol der Opposition:<br />
Er, bis vor kurzem Gouverneur<br />
des Bundesstaats Miranda, wolle das polarisierte<br />
Land einen, „der Präsident aller<br />
Venezolaner sein“. Da kommen die Nationalfarben<br />
gelegen. Die Androhung des Nationalen<br />
Wahlrats (CNE), eine Geldstrafe<br />
festzusetzen, scheint ihm egal zu sein. Er<br />
twitterte: „Jeden Tag werden 50 Venezolaner<br />
ermordet. Und die Regierung sorgt sich<br />
darum, welche Kappe ich trage.“<br />
Nach fast 13 Jahren Chávez-Regierung<br />
hat es das Oppositionsbündnis „Mesa de<br />
Unidad Democrática“ („Tisch der demokratischen<br />
Einheit“) geschafft, sich auf einen<br />
Kandidaten zu einigen. Ausgerechnet<br />
Capriles, der gemäßigtste von allen, gewann<br />
die Vorwahlen im Februar. Seine<br />
Wählerschaft ist konservativ, doch er selbst<br />
gibt an, die Mitte-Links-Regierung des<br />
ehemaligen brasilianischen Präsidenten<br />
von „Lula“ da Silva sei sein Vorbild.<br />
Capriles ist der Anti-Chávez schlechthin:<br />
Der 40-jährige Anwalt stammt aus einer<br />
der reichsten Familien Venezuelas, wurde<br />
schon mit 28 Jahren Bürgermeister von Baruta,<br />
einem wohlhabenden Bezirk in Caracas.<br />
Und bietet damit eine Angriffsfläche<br />
für den <strong>Am</strong>tsinhaber: „Es ist der Kampf des<br />
„Es ist der Kampf des Kandidaten<br />
der Bourgeoisie gegen das Volk“<br />
Hugo Chávez<br />
Kandidaten der Bourgeoisie gegen das Volk,<br />
des Imperiums gegen das venezolanische Vaterland“,<br />
sagt Chávez. Capriles’ volksnaher<br />
Diskurs sei aufgesetzt. Tatsächlich darf man<br />
sich fragen, wie demokratisch der Kandidat<br />
der Opposition wirklich ist: Seine Rolle bei<br />
einem Putschversuch gegen Chávez im Jahr<br />
2002 ist umstritten. „Capriles war an der<br />
Gefangennahme des Innenministers beteiligt“,<br />
sagt der Chávez zugewandte Journalist<br />
Roberto Malaver. „Und er war unfähig,<br />
der ihm unterstellten Polizei zu befehlen, die<br />
Aktionen der Putschisten vor der kubanischen<br />
Botschaft zu beenden.“<br />
Was passierte damals wirklich? Vielleicht<br />
ist das in diesem Wahlkampf, den ein Meinungsforscher<br />
unlängst als „Krieg der Pinocchios“<br />
bezeichnete, gar nicht mehr wichtig –<br />
denn ohnehin glaubt keiner dem anderen<br />
auch nur ein Wort. Kein Wunder, setzen<br />
doch beide Seiten regelmäßig Gerüchte in<br />
die Welt, um den Gegenkandidaten zu diffamieren.<br />
Chávez-Anhänger behaupten, der<br />
unverheiratete Capriles sei schwul, und die<br />
Opposition habe kolumbianischen Paramilitärs<br />
Geld geboten, um Hugo Chávez mit<br />
Waffengewalt zu stürzen. Capriles-Anhänger<br />
werfen Chávez vor, staatliche Gelder für den<br />
Wahlkampf einzusetzen, und streuen immer<br />
wieder Informationen über Chávez’ Krebserkrankung,<br />
in denen sie mehrfach sein baldiges<br />
Ableben prophezeien.<br />
Capriles geht abends joggen, trinkt<br />
Cola light, schläft selten mehr als vier<br />
Stunden – und das Wichtigste: Er hat sich<br />
nicht ein einziges Mal dazu herabgelassen,<br />
Chávez zu beschimpfen. Nicht einmal als<br />
der Präsident ihn aufforderte: „Setz die<br />
Maske ab! Du hast den Schwanz eines<br />
Schweins, die Ohren eines Schweins, du<br />
schnarchst wie ein Schwein, also bist du<br />
eines.“ Chávez spielte damit auf Capriles’<br />
jüdisch-polnische Wurzeln an: Die Großmutter<br />
entkam den Nazis knapp, ein Teil<br />
der Familie starb in Treblinka. Das Simon-<br />
Wiesenthal-Zentrum reagierte prompt und<br />
verbat sich weitere antisemitische Attacken.<br />
Capriles blieb ruhig.<br />
„Er möchte so venezolanisch wie möglich<br />
wirken“, vermutet Alex Vásquez, der<br />
die Wahlkampagne von Capriles für die Zeitung<br />
El Nacional begleitet. „Deshalb betont<br />
er seine jüdische Herkunft nicht. Er will<br />
keine Distanz zu seinen Wählern schaffen.“<br />
Der Kandidat geht von Haus zu Haus, sein<br />
Team notiert akribisch, wem Medikamente<br />
fehlen, wo es reinregnet, wer die Stromrechnung<br />
nicht zahlen kann. Er spielt Basketund<br />
Fußball mit den Jungs in den Armenvierteln.<br />
Und springt auch mal spontan aus<br />
dem Fenster des Wahlkampfbusses, wenn<br />
Anhänger am Straßenrand winken (und hält<br />
so seine Bodyguards auf Trab).<br />
Capriles’ Programm verspricht Kontinuität<br />
und Wandel zugleich: „Wir haben<br />
nicht vor, gewählt zu werden und dann<br />
alles umzuwerfen.“ Wirtschaftspolitisch<br />
dürfte sich aber unter ihm einiges ändern:<br />
Mehr Möglichkeiten für private Unternehmer,<br />
Enteignungen könnten rückgängig<br />
gemacht werden. „Besonders interessant<br />
scheint mir, was Capriles mit den Erdölerlösen<br />
vorhat: Arbeit schaffen, Wohnungsbau,<br />
in die Bildung investieren“, sagt Vásquez.<br />
„Sein Programm ist allerdings nicht<br />
sehr detailliert. Es zeigt zwar, was geschehen<br />
soll, aber erklärt nicht, wie.“<br />
Wer gewinnt am 7. Oktober? Klar ist<br />
nur: Es wird eng. Und damit ziemlich ungemütlich<br />
auf den Straßen, wenn die Wahllokale<br />
schließen. „Beiden Seiten wird es<br />
schwerfallen, ein knappes Ergebnis anzuerkennen“,<br />
befürchtet Vásquez.<br />
Karen Naundorf<br />
ist Korrespondentin des<br />
Weltreporter-Netzwerks<br />
Fotos: Meridith Kohut, privat (Autorin)<br />
66 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Der Kandidat mit der<br />
Kappe: Obwohl es untersagt<br />
ist, trägt Henrique Capriles<br />
Radonski im Wahlkampf<br />
eine Baseballmütze in den<br />
Nationalfarben Venezuelas<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 67
| W e l t b ü h n e | R u m ä n i e n<br />
Korrupte<br />
Kader<br />
Der Premier setzt den Präsidenten ab. Der<br />
weigert sich, sein <strong>Am</strong>t zu räumen, und wirft<br />
seinerseits dem Regierungschef vor, zu lügen<br />
und zu betrügen. Wer ist in Rumänien der Gute<br />
und wer der Böse? Und wer sind die Hintermänner<br />
in diesem undurchsichtigen Machtkampf?<br />
von Keno Verseck<br />
Stundenlang hatten die Kamerateams<br />
vor dem luxuriösen Apartmenthaus<br />
in der Museum-Zambaccian-Straße<br />
ausgeharrt. Die<br />
Bilder von der Verhaftung des<br />
ehemaligen Regierungschefs, von seiner<br />
Überführung ins Gefängnis wollte sich<br />
kein Fernsehsender entgehen lassen. Zwei<br />
Polizeibeamte waren gekommen, um ihn<br />
abzuführen. Da fiel im Haus ein Schuss.<br />
Ein Rettungswagen kam, verschwand<br />
in der Garage des Anwesens, raste kurz darauf<br />
in das nahe gelegene Floreasca-Krankenhaus.<br />
Dort erhaschten Kameraleute einige<br />
Bilder: Adrian Năstase auf einer Liege,<br />
zugedeckt, die Augen geschlossen, keine<br />
Blutspuren, um den Hals einen Schal.<br />
Năstase war von 2000 bis 2004 rumänischer<br />
Regierungschef und langjähriger<br />
Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei.<br />
In der Öffentlichkeit gilt er bis heute<br />
als eines der Symbole für Korruption im<br />
Land, mehrere Verfahren und Prozesse gegen<br />
ihn laufen noch. An diesem 21. Juni<br />
war er wegen illegaler Wahlkampf- und<br />
Parteienfinanzierung zu zwei Jahren Gefängnis<br />
verurteilt worden – rechtskräftig.<br />
Juristisch gab es für den 62-Jährigen kein<br />
Entkommen mehr.<br />
Doch offenbar hatte Năstase sich geschworen,<br />
dass Gefängnis für ihn keine<br />
Option sei. Ärzte bestätigten am selben<br />
Abend den Selbstmordversuch des Ex-<br />
Premiers. Er habe sich in den Hals geschossen,<br />
sei zwar nicht lebensgefährlich<br />
verletzt, müsse aber längere Zeit im Krankenhaus<br />
bleiben. Regierungschef Victor<br />
Ponta machte seinem einstigen Ziehvater<br />
im Spital die Aufwartung, gab sich hinterher<br />
vor der Presse erschüttert.<br />
Nur einige Tage später fiel die Selbstmordstory<br />
in sich zusammen. Der Ex-Regierungschef<br />
soll lediglich einen Kratzer am Hals<br />
gehabt haben. Er hatte wohl Theater gespielt,<br />
ein allerletzter Versuch, der Haft zu entgehen.<br />
Umsonst. <strong>Am</strong> 26. Juni wurde Năstase ins Gefängnis<br />
Rahova bei Bukarest gebracht. Gegen<br />
einige Mediziner, darunter einen Freund<br />
des Ex-Premiers, wird seither wegen Begünstigung<br />
von Straftaten ermittelt.<br />
Noch sind nicht alle Merkwürdigkeiten<br />
des Falles aufgeklärt, aber eines steht<br />
schon jetzt fest: Năstases Selbstmordtheater<br />
hat Geschichte gemacht – als Auftakt<br />
zu einer der schwersten politischen Krisen<br />
in Rumänien seit dem Sturz des Diktators<br />
Nicolae Ceauşescu im Dezember 1989.<br />
„Der Fall war ein Alarmsignal für die<br />
korrupten Politiker“, sagt der Bukarester<br />
Philosoph und Essayist Andrei Cornea. „Es<br />
war das Signal, dass sie nicht mehr sicher<br />
sind vor der Justiz. Deshalb haben sie begonnen,<br />
den Staat umzukrempeln.“<br />
Wenige Tage nach Năstases Verurteilung<br />
initiierte die Regierung unter Ministerpräsident<br />
Victor Ponta ein blitzartiges<br />
<strong>Am</strong>tsenthebungsverfahren gegen den<br />
Staatspräsidenten Traian Băsescu. Er habe<br />
seine Kompetenzen überschritten, lautete<br />
die Begründung. Das Verfassungsgericht<br />
wies das später zurück. Um das Verfahren<br />
durchzubringen, ließ die Regierung<br />
Foto: Mihai Barbu/Picture Alliance/DPA<br />
68 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Mit Plakaten polemisieren Anhänger des<br />
abgesetzten Staatspräsidenten Traian Băsescu<br />
gegen die Regierungspartei von Victor Ponta.<br />
Die sei wie ein Hyänenrudel über die Justiz<br />
hergefallen, um den wegen Korruption<br />
verurteilten früheren Regierungschef<br />
Adrian Năstase aus dem Knast zu befreien<br />
mit Notverordnungen Gesetze ändern, im<br />
Eilverfahren die Vorsitzenden der beiden<br />
Parlamentskammern austauschen und die<br />
Kompetenzen staatlicher Institutionen<br />
beschneiden. Maßnahmen, die sich nach<br />
Ansicht von Juristen am Rande oder jenseits<br />
der Legalität bewegten. Băsescu und<br />
seine Anhänger nannten das Vorgehen einen<br />
„Staatsstreich“, EU-Vertreter sprachen<br />
von „staatsstreichähnlichen Maßnahmen“.<br />
Mit der Suspendierung Băsescus am<br />
6. Juli entbrannte ein gnadenloser Machtkampf<br />
zwischen Regierung und Präsident.<br />
Bis zur Wiedereinsetzung Băsescus in sein<br />
<strong>Am</strong>t Ende August herrschte über Wochen<br />
Regierungsstillstand, die Tageszeitung<br />
Adevărul konstatierte einen „politischen<br />
Kollaps“, der auch ökonomische Folgen<br />
hatte: Zeitweilig verfiel der Wechselkurs<br />
der Landeswährung Leu zum Euro, der<br />
Nationalbankchef Mugur Isărescu warnte<br />
vor einem Absturz der Wirtschaft.<br />
Ein Zusammenhang zwischen Năstases<br />
Verurteilung und dem <strong>Am</strong>tsenthebungsverfahren<br />
gegen Băsescu ist naheliegend.<br />
„Sie haben den Staatspräsidenten suspendiert,<br />
weil er die Justizreform mitgetragen<br />
hat, er ist ein Hindernis für die korrupte<br />
Elite“, sagt Laura Ştefan, Juristin und Mitglied<br />
einer Expertengruppe, die im Auftrag<br />
der Europäischen Union (EU) periodisch<br />
den Stand der Rechtsstaatlichkeit in<br />
Rumänien begutachtet. In einen größeren<br />
Zusammenhang ordnet Andrei Cornea die<br />
Ereignisse ein: „Rumänien ist eine Oligarchie<br />
und keine Demokratie. Das Land wird<br />
von ,lokalen Baronen‘ geführt, sie haben<br />
die wirkliche Macht“, sagt er. „Einige von<br />
Băsescus Projekten, wie die Verwaltungsoder<br />
die Verfassungsreform, würden diese<br />
Verhältnisse grundlegend ändern, und das<br />
kann die Oligarchie nicht hinnehmen.“<br />
Dahinter steht eine historische Tradition,<br />
von der sich Rumänien nur schwer löst und<br />
an der auch die EU-Integration des Landes<br />
nichts geändert hat. So wie seit jeher wussten<br />
auch im postkommunistischen Rumänien<br />
Parteicliquen und die Seilschaften der<br />
Lokalfürsten ihre Interessen gut zu schützen.<br />
Selten verfuhren sie dabei legal. Das<br />
Verfahren zur <strong>Am</strong>tsenthebung von Staatspräsident<br />
Traian Băsescu ist dafür ein besonders<br />
anschauliches Beispiel.<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 69
| W e l t b ü h n e | R u m ä n i e n<br />
Wie dreist die Regierungsmehrheit um<br />
die Macht stritt, zeigte das Tauziehen um<br />
das Referendum, mit dem Rumäniens Bürger<br />
am 29. Juli verfassungsgemäß über die<br />
<strong>Am</strong>tsenthebung des Präsidenten entschieden<br />
hatten. Zwar votierten rund 87 Prozent<br />
der Wähler für die Absetzung Băsescus.<br />
Allerdings kamen nur 46 Prozent zur Abstimmung.<br />
Da für ein gültiges Referendum<br />
mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten<br />
an den Urnen erscheinen müssen, ist<br />
die Abstimmung ungültig – theoretisch.<br />
Die Regierung behauptete, es gäbe weit<br />
weniger als die 18,3 Millionen Wahlberechtigten,<br />
die sie vor dem Referendum<br />
offiziell angegeben hatte. Anfang August<br />
gelangten zudem Regierungspläne an die<br />
Öffentlichkeit, denen zufolge Wahllisten<br />
gefälscht werden sollten, um die Zahl der<br />
Wahlberechtigten zu verringern und die<br />
Wahlbeteiligung damit auf über 50 Prozent<br />
zu bringen.<br />
Das Verfassungsgericht, zuständig für<br />
die Validierung von Volksabstimmungen,<br />
zögerte ein Urteil wochenlang hinaus –<br />
kein Wunder, ist es doch mit Richtern besetzt,<br />
die nach politischem Proporz ernannt<br />
wurden und auf denen großer politischer<br />
Druck lastet. <strong>Am</strong> 21. August entschieden<br />
die Richter schließlich, dass Băsescu<br />
in sein <strong>Am</strong>t zurückkehren könne, da das<br />
Referendum wegen mangelnder Wahlbeteiligung<br />
gescheitert sei. Die Ponta-Regierung<br />
beschimpfte das Gericht daraufhin<br />
in einer Weise, die in der modernen europäischen<br />
Geschichte ihresgleichen sucht –<br />
die Richter seien „ehrlos“ und „ungerecht“,<br />
ihre Entscheidung „illegal“, sagte beispielsweise<br />
der Regierungschef Ponta.<br />
Rumänien erlebte seit 1989 schon mehrere<br />
Krisen, in denen sich offenbarte, wie<br />
schwach der Staat ist und wie leicht Interessengruppen<br />
seine Institutionen und die<br />
Gewaltenteilung aushebeln können. Die<br />
politische Kraft, die Rumänien diesmal in<br />
eine solche Krise gestürzt hat, ist die „Sozialliberale<br />
Union“ (USL). Doch mit sozialliberaler<br />
Politik hat das Drei-Parteien-Bündnis<br />
wenig zu tun. In der USL sind vielmehr<br />
Rumäniens mächtigste und korrupteste<br />
Seilschaften vereint: Da wäre zum einen<br />
die Sozialdemokratische Partei (PSD),<br />
nach 1989 das Sammelbecken für den<br />
größten Teil von Ceauşescus Securitate-,<br />
Partei- und Betriebselite; zum anderen die<br />
National-Liberale Partei (PNL), in der sich<br />
viele neureiche rumänische Unternehmer<br />
Regierungschef Victor<br />
Ponta (links) ließ den<br />
Staatspräsidenten<br />
Băsescu des <strong>Am</strong>tes<br />
entheben. Offenbar<br />
fürchtete er dessen<br />
gegen Korruption<br />
und Vetternwirtschaft<br />
gerichtete Reformen<br />
Zwei mächtige<br />
Hintermänner im<br />
Kampf um die Macht:<br />
Interimspräsident<br />
Crin Antonescu (links)<br />
und der Medienmogul<br />
Dan Voiculescu, die<br />
graue Eminenz der<br />
Konservativen<br />
und Magnaten zusammengeschlossen haben,<br />
und schließlich die Konservative Partei<br />
(PC), eine Zwerg- und Marionettenpartei,<br />
deren graue Eminenz Dan Voiculescu<br />
ist, ein ehemaliger Securitate-Mitarbeiter<br />
und Devisenbeschaffer Ceauşescus, heute<br />
Milliardär und Medienmogul.<br />
Zustande kam die Regierungsmehrheit<br />
Ende April, als viele Parlamentarier zur<br />
USL überliefen und die bis dahin regierenden<br />
Liberaldemokraten gestürzt wurden.<br />
Auch das hat in Rumänien historische<br />
Tradition: Zeichnet sich in Wahljahren wie<br />
in diesem – im Juni fanden Kommunalwahlen<br />
statt, im November wird ein neues<br />
Parlament gewählt – ein Stimmungsumschwung<br />
in der Bevölkerung ab, wechseln<br />
viele Lokal- oder Parlamentspolitiker in<br />
das Lager des künftigen Wahlsiegers und<br />
sichern sich so ihren Zugang zur Macht<br />
und zu Staatsgeldern.<br />
Seit Anfang Mai im <strong>Am</strong>t, regierten<br />
Ministerpräsident Victor Ponta und sein<br />
Kabinett bisher vor allem mit Dekreten,<br />
die sofortige Gesetzeskraft haben und erst<br />
nachträglich vom Parlament abgesichert<br />
werden müssen. Seit Jahren kritisiert die<br />
Europäische Union in ihren halbjährlichen<br />
Kontrollberichten zur Rechtsstaatlichkeit<br />
in Rumänien diese Praxis der Exekutive.<br />
Ungeachtet dessen brachte es die Ponta-<br />
Regierung inzwischen auf mehr als zwei<br />
Dutzend solcher Notverordnungen – so<br />
viele wie keine Vorgängerregierung in einem<br />
vergleichbaren Zeitraum.<br />
Ginge es allerdings allein nach Victor<br />
Ponta, hätte es die jetzige Krise wohl so<br />
nicht gegeben. Der Mann mit dem unschuldigen<br />
Bubengesicht ist ausgesprochen<br />
wendig und karrierebewusst. Einst Staatsanwalt<br />
für Korruptionsbekämpfung, stieg<br />
er als politischer Zögling des jetzt inhaftierten<br />
Ex-Regierungschefs Adrian Năstase<br />
schnell auf in der Sozialdemokratischen<br />
Partei und übernahm 2010 deren Vorsitz.<br />
Ponta hat noch nie feste ideologische Positionen<br />
vertreten, Konflikten geht er lieber<br />
aus dem Weg. Bereits nach dem gescheiterten<br />
Referendum plädierte er vorsichtig dafür,<br />
die Niederlage zu akzeptieren.<br />
Vergebens. Denn nicht der Regierungschef<br />
zieht im derzeitigen Machtkampf die<br />
Fäden. Er wirkt eher wie ein Gefangener<br />
der Lokalfürsten in seiner Partei, die ihn vor<br />
sich hertreiben, unter anderem mit seiner<br />
„Copy-and-Paste-Affäre“: Ponta hat mehr als<br />
ein Drittel seiner juristischen Doktorarbeit<br />
Fotos: Corbis, Geert Vanden Wijngaert/ddp images/AP Photo, Vadim Ghirda/ddp images/AP Photo, ZVG, Privat (Autor)<br />
70 <strong>Cicero</strong> 9.2012
nachweislich plagiiert, was er jedoch bestreitet.<br />
Die staatliche Kommission, die ihm den<br />
Doktortitel entziehen wollte, ließ die Regierung<br />
auflösen – per Dekret.<br />
Einer der Lokalfürsten, an denen Pontas<br />
Schicksal hängt, ist Liviu Dragnea, Generalsekretär<br />
der Sozialdemokraten und<br />
seit langem einer der mächtigsten „Barone“<br />
Rumäniens. Der 49-jährige Ingenieur verfügt<br />
über ausgedehnte Ländereien und ein<br />
Immobilienimperium im südrumänischen<br />
Kreis Teleorman, dem er jahrelang als Vorsitzender<br />
des Kreisrats vorstand. Im Laufe<br />
der vergangenen anderthalb Jahrzehnte war<br />
er in zahlreiche dubiose Geschäfte verwickelt,<br />
mehrmals ermittelte die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft<br />
DNA gegen<br />
ihn, unter anderem wegen betrügerischer<br />
Privatisierung, Mauscheleien bei der Vergabe<br />
von öffentlichen Aufträgen und Fälschung<br />
von Dokumenten bei einem Antrag<br />
auf EU-Fördergelder. Gerne würde man<br />
Dragnea zu seiner Rolle in der gegenwärtigen<br />
politischen Krise befragen, doch der<br />
mächtige „Baron“ antwortet weder auf Telefonanrufe<br />
noch auf schriftliche Anfragen.<br />
Neben Lokalfürsten wie Dragnea sind<br />
es vor allem zwei weitere Männer, die für<br />
die Strategie des Machtkampfs mit dem<br />
Staatspräsidenten verantwortlich zeichnen:<br />
der Milliardär und Medienmogul<br />
Dan Voiculescu und der zeitweilige Interimsstaatschef<br />
Crin Antonescu.<br />
Voiculescu betreibt seine Konservative<br />
Partei wie ein Puppentheater – er braucht<br />
die Parteifunktionäre, um sie auf Regierungsposten<br />
zu hieven, damit sie seinen<br />
Firmen von dort aus Staatsaufträge zuschanzen.<br />
Seine populären Fensehsender<br />
Antena 1 und Antena 3 senden unterdessen<br />
die jeweils ihm genehme Propaganda.<br />
Ende Juni trat Voiculescu als Senatsabgeordneter<br />
zurück. Der erwünschte Nebeneffekt<br />
dieses Schrittes: Ein gegen ihn<br />
anhängiges Gerichtsverfahren wegen eines<br />
mutmaßlich illegalen Grundstücksgeschäfts,<br />
bei dem ihm eine Gefängnisstrafe<br />
drohte, wird nun nicht mehr vom Obersten<br />
Kassationsgerichtshof (ICCJ) verhandelt,<br />
der für Politikerverfahren zuständig<br />
ist, sondern von einem anderen Gericht.<br />
Voiculescu gewinnt so Zeit. Wenn er das<br />
Verfahren lange genug hinauszögern kann,<br />
ist der Straftatbestand verjährt.<br />
Antonescu wiederum, Chef der National-Liberalen<br />
Partei, hegt gegen Băsescu<br />
einen tiefen persönlichen Hass. Mit dem<br />
Kommentar<br />
Rumänisch-Ungarische Lektionen<br />
Bei Grundrechtsverletzungen Geldhahn zudrehen<br />
Anhaltende Armut in weiten Teilen<br />
des Landes, die fortgesetzte Flucht<br />
der Besten ins Ausland, ein gerissener<br />
Premierminister, der kurz nach seinem<br />
Wahlsieg nicht nur die Institutionen<br />
der Republik, sondern sogar Justiz<br />
und Zivilgesellschaft unter Druck<br />
setzt: Die Nachrichten aus Rumänien<br />
bestätigen gerade so ziemlich jedes<br />
Vorurteil, das man über das Land<br />
haben kann. Ganz besonders gilt das<br />
für den Kampf, den Premier Victor<br />
Ponta gegen Präsident Traian Basescu<br />
führt, um seine Macht völlig uneingeschränkt<br />
ausüben zu können. Schlussfolgerung:<br />
Die EU hat das Land viel<br />
zu früh aufgenommen. Das stimmt,<br />
greift jedoch viel zu kurz. Denn bei<br />
näherem Hinsehen wird klar, dass<br />
die Vorgänge in Bukarest auf verblüffende<br />
Weise denen in Budapest ähneln.<br />
In Ungarn nimmt Premierminister<br />
Viktor Orbán nicht nur eine<br />
legitime politische Abrechnung mit<br />
seinem Vorgänger vor, er nutzt seine<br />
Zwei-Drittel-Mehrheit vielmehr dazu,<br />
diese Abrechnung verfassungsrechtlich<br />
so zu verankern, dass die Ungarn<br />
Orbáns Politik auch in künftigen demokratischen<br />
Wahlen nicht mehr ändern<br />
können.<br />
Die beiden im Kern so ähnlichen<br />
Konstellationen unterscheiden sich in<br />
einem wichtigen Punkt: In Ungarn<br />
wird die Revolution von oben von einem<br />
Konservativen, in Rumänien<br />
von einer sozialliberalen Koalition betrieben.<br />
Kommissionspräsident Barroso<br />
schlägt daher kräftig auf Ponta<br />
ein, während er zu Orban butterweich<br />
blieb. Im Europaparlament stehen<br />
CDU und CSU in Treue fest zum<br />
ungarischen Potentaten, können sich<br />
dagegen über Victor Ponta gar nicht<br />
genug echauffieren. Doch das bringt<br />
alles nichts. Das Problem ist nicht Rumänien,<br />
es ist auch nicht Ungarn. Das<br />
eigentliche Problem ist, wie die EU<br />
mit Mitgliedstaaten umgehen soll, die<br />
ihre Versprechen aus den Beitrittsverhandlungen<br />
brechen. Parteipolitik ist<br />
keine Lösung, denn es geht um grundsätzliche<br />
Fragen von Rechtsstaatlichkeit<br />
und Demokratie, die über dem<br />
Parteienstreit stehen.<br />
Drei andere Dinge sind entscheidend:<br />
die Wiederherstellung der<br />
Glaubwürdigkeit in der Erweiterungspolitik,<br />
eine objektive Bewertung von<br />
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie<br />
auch nach dem Beitritt und das Zudrehen<br />
des Geldhahns, wenn es nicht<br />
anders geht. In der Erweiterungspolitik<br />
gab Deutschland die Devise aus:<br />
„Keine Osterweiterung ohne Polen.“ In<br />
Warschau erlahmte daraufhin schnell<br />
der Reformeifer, 2004 war man ja sicher<br />
dabei (ein klassischer Fall von<br />
„moral hazard“), und Rumänien segelte<br />
2007 im Schlepptau Polens in die EU,<br />
obwohl sein Justizsystem Lichtjahre<br />
von rechtsstaatlich annehmbaren Standards<br />
entfernt war. Den aufgeweichten<br />
Beitrittskriterien wieder Geltung zu<br />
verschaffen, ist notwendig, aber schwierig.<br />
Eine objektive Bewertung der aktuellen<br />
Mitgliedstaaten zu organisieren,<br />
ginge dagegen leicht und schnell.<br />
Es würde völlig ausreichen, die Grundrechteagentur<br />
der EU in Wien damit<br />
zu beauftragen. Die Mitgliedstaaten,<br />
auch Deutschland, müssten sich dann<br />
allerdings bereit erklären, auch mit solchen<br />
Bewertungen konfrontiert zu werden,<br />
die politisch nicht genehm sind.<br />
Das aber ist ein annehmbarer Preis.<br />
Und wenn es gar nicht anders geht,<br />
muss es schmerzen – das heißt, dass<br />
EU‐Zahlungen gestoppt werden, wenn<br />
Wien den Daumen senkt.<br />
Alexander Graf<br />
Lambsdorff<br />
ist Vorsitzender der FDP im<br />
Europäischen Parlament<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 71
| W e l t b ü h n e | R u m ä n i e n<br />
Interview<br />
„Europa muss mässigend einwirken“<br />
Peter Maffay macht sich Sorgen um sein Heimatland und ruft<br />
das Ausland zu mehr Engagement auf<br />
H<br />
err Maffay, im Moment steht<br />
Rumänien für Chaos, für Krise.<br />
Sie engagieren sich schon<br />
lange in Ihrer alten Heimat. Was hat<br />
sich seit 1989 verändert?<br />
Eine Diktatur ist einer Gesellschaft gewichen,<br />
die demokratische Züge hat.<br />
Das war die Voraussetzung für eine Annäherung<br />
an Europa. Das Land hat<br />
neue Impulse bekommen, Industrie<br />
aus dem Ausland hat sich angesiedelt,<br />
die Menschen auf der Straße sind befreit<br />
von jahrzehntelanger Angst, wegen<br />
einer eigenen Meinung Repressalien<br />
ausgesetzt zu sein.<br />
Im Moment muss man an der Demokratiefähigkeit<br />
der Rumänen zweifeln.<br />
Dieser Zweifel ist berechtigt und angebracht.<br />
Das Ausland muss mäßigend<br />
auf Rumänien einwirken. Aber versuchen<br />
Sie sich zu vergegenwärtigen,<br />
wie undenkbar dieser Prozess unter<br />
Ceauşescu gewesen ist. Jetzt aber macht<br />
Rumänien einen Rückschritt. Da ist es<br />
Aufgabe der anderen Gesellschaften in<br />
Europa, die Rumänen daran zu erinnern,<br />
dass es so nicht geht.<br />
War Rumänien wirklich reif dafür, in die<br />
EU aufgenommen zu werden?<br />
Aus meiner Sicht ist es richtig gewesen,<br />
Rumänien abzuholen. Aber jetzt<br />
darf man es nicht allein lassen. Gleichzeitig<br />
ist es richtig, Rumänien zu mahnen,<br />
sich an die Kriterien zu halten,<br />
„Rumänien macht einen Rückschritt“,<br />
behauptet Peter Maffay<br />
unter denen es in die EU aufgenommen<br />
wurde.<br />
Haben Sie den Eindruck, dass die EU<br />
entschlossen agiert?<br />
Nein. Es werden Vorbehalte geäußert,<br />
und es gibt Versuche, auf Rumänien<br />
einzuwirken. Aber das müsste noch viel<br />
deutlicher geschehen. Wir können es<br />
uns nicht leisten, Staaten wie Rumänien<br />
und Bulgarien aus unserem Verbund<br />
zu verlieren. Das würde die EU<br />
wie ein Bumerang treffen.<br />
Was läuft falsch?<br />
Wir dürfen nicht von zu hoher Warte<br />
auf Rumänien blicken. Das ist nicht<br />
gut, schon gar nicht vor dem Hintergrund<br />
unserer Geschichte. Es gäbe sofort<br />
Gegenreaktionen, die zum Teil<br />
schon einsetzen. Wir müssen verstehen,<br />
welche Strecke Rumänien<br />
schon zurückgelegt hat. Rumäniens<br />
Schwierig keiten – ethnisch, politisch,<br />
wirtschaftlich – sind nicht so schnell zu<br />
überwinden, wie wir es gerne hätten.<br />
Wären dann nicht gerade die rumänischen<br />
Künstler gefordert?<br />
Es gibt eine ganze Reihe vorzüglicher<br />
Köpfe – Musiker, Schriftsteller. Das im<br />
Westen geläufige Handwerk aber, wie<br />
sich dieser Teil der Gesellschaft organisieren<br />
kann, muss erst wieder erlernt<br />
werden. Nach 50 Jahren Kommunismus<br />
und nur 20 Jahren Demokratie ist<br />
viel verlernt. Nehmen Sie das Stiftungswesen,<br />
das Kultur aus privater Initiative<br />
schafft und das im Westen so wesentlich<br />
ist. In Rumänien verfügt man<br />
nicht über das Wissen, wie man Stiftungen<br />
gründen und verwalten kann.<br />
Welche Kraft privates Engagement<br />
entfaltet.<br />
Sie haben Rumänien als 16-Jähriger<br />
verlassen. Was verbindet Sie heute noch<br />
mit dem Land?<br />
Was verbindet einen Sohn mit seiner<br />
Mutter? Das erfasst man nur gefühlsmäßig.<br />
Diese allerersten Impulse, die<br />
ein Mensch wahrnimmt, das sind alles<br />
bestimmende Einflüsse, die nie verloren<br />
gehen. Diejenigen, die vorgeben,<br />
dass ihnen das nichts mehr bedeutet,<br />
belügen sich selbst.<br />
Die Fragen stellte Judith Hart<br />
Staatschef verbindet die National-Liberalen<br />
eine Feindschaft, seit Băsescu es vor Jahren<br />
ablehnte, den Öl-Milliardär Dinu Patriciu,<br />
einen der Väter der postkommunistischen<br />
rumänischen Liberalen, vor einem Prozess<br />
wegen eines betrügerischen Privatisierungsgeschäfts<br />
zu schützen.<br />
Doch auch der Staatspräsident Băsescu<br />
ist in den Augen vieler Beobachter keine<br />
unbescholtene Lichtgestalt. Der Bukarester<br />
Politologe Cristian Pârvulescu sieht ihn<br />
als wesentlich Mitverantwortlichen an der<br />
gegenwärtigen politischen Krise in Rumänien.<br />
„Der Präsident pflegt einen autoritären<br />
Stil, fällt durch rassistische Äußerungen<br />
und ordinäre Ausdrucksformen auf“,<br />
sagt Pârvulescu. „Er hat sich oft in die Arbeit<br />
des Parlaments und der Regierung<br />
eingemischt und durch seine Sparpolitik<br />
eine tiefe soziale Spaltung des Landes<br />
verursacht.“<br />
Der Historiker und Publizist Ovidiu<br />
Pecican, der an der Universität im siebenbürgischen<br />
Klausenburg (Cluj) lehrt, sagt,<br />
Băsescu kündige oft viel an, von dem dann<br />
wenig verwirklicht werde. Im Machtkampf<br />
mit der Regierung repräsentiere er zwar die<br />
Foto: Marc Rehbeck/DDP Images Via Peta<br />
72 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Privat (Autor)<br />
Seite, die weniger antirechtsstaatlich agiere,<br />
aber, so Pecican, „letztlich geht es um einen<br />
Wettbewerb zweier Cliquen, die in<br />
der Bevölkerung beide keine Legitimität<br />
genießen“.<br />
Tatsächlich versteht sich Băsescu als<br />
„eingreifender“ und „mitspielender“ Präsident,<br />
der die Kompetenzen seines <strong>Am</strong>tes<br />
ausschöpft. Häufig vergreift sich der einstige<br />
Hochseekapitän in Wort und Ton.<br />
Eine Journalistin beschimpfte er als „dreckige<br />
Zigeunerin“, einen Kollegen nannte<br />
er „Schwuchtel“, Angestellten des öffentlichen<br />
Dienstes, die gegen seine Sparpolitik<br />
protestierten, empfahl er, aus Rumänien<br />
zu verschwinden und sich einen Arbeitsplatz<br />
im Ausland zu suchen. Zum Treiben<br />
vieler korruptionsverdächtiger Lokalfürsten<br />
in seiner eigenen Partei, den Liberaldemokraten,<br />
schweigt er meistens. Er selbst<br />
soll eine Staatsimmobilie unrechtmäßig erworben<br />
haben; im Frühjahr 2009 half er<br />
seiner Tochter Elena, die als Partygirl und<br />
für schlechte Grammatikkenntnisse bekannt<br />
ist, Abgeordnete des Europaparlaments<br />
zu werden.<br />
Andererseits unterstützte Băsescu als<br />
Staatschef die Justizreform und die Institutionalisierung<br />
des Kampfes gegen Korruption.<br />
Die ehemalige Justizministerin<br />
Monica Macovei, derzeit Abgeordnete der<br />
Liberaldemokraten im Europaparlament<br />
und eine Ikone des Kampfes gegen Korruption,<br />
sieht Băsescu deshalb als Garanten der<br />
Rechtsstaatlichkeit. „Mit seiner <strong>Am</strong>tsenthebung<br />
würde die Justiz wieder beeinflussbar<br />
und der Kampf gegen die Korruption<br />
gestoppt werden“, sagt sie. Auch viele Intellektuelle,<br />
die Băsescu durchaus kritisch gegenüberstehen,<br />
äußern sich nuanciert. Der<br />
Philosoph und Essayist Andrei Cornea charakterisiert<br />
den suspendierten Staatschef als<br />
„Vorstadtflegel, der jedoch politische Visionen<br />
und Projekte hat“.<br />
Băsescu kehrt unter äußerst schwierigen<br />
Umständen in sein <strong>Am</strong>t zurück. Er<br />
hat 7,5 Millionen Wähler gegen sich, die<br />
ihn ausdrücklich absetzen wollten. Mit<br />
der Unterstützung breiter Bevölkerungsschichten<br />
kann Băsescu nicht mehr rechnen,<br />
da er wegen seiner rigiden Sparpolitik<br />
und seines polarisierenden Stils bei den<br />
meisten Menschen im Land unbeliebt ist.<br />
Băsescu will sich künftig mehr zurücknehmen,<br />
doch den Beweis dafür muss er erst<br />
noch antreten. Dass eine Kohabitation<br />
zustande kommt, dafür sehen die meisten<br />
Beobachter kaum Chancen, zumindest<br />
nicht bis zu den Parlamentswahlen im November,<br />
zumal auch der PNL-Chef Antonescu<br />
nach Băsescus Wiedereinsetzung als<br />
Staatschef die Bürger im Land zu öffentlichen<br />
Protesten aufrief – bis „das Regime<br />
Băsescu eliminiert“ und „Rumänien befreit“<br />
sei.<br />
Auch die Europäische Union, die das<br />
„staatsstreichähnliche Vorgehen“ der Ponta-<br />
Regierung scharf geißelte, verfügt über wenige<br />
Möglichkeiten, ordnend einzugreifen.<br />
In Ungarn hat Viktor Orbán vorexerziert,<br />
wie die Regierung eines EU-Mitgliedstaats<br />
die Brüsseler Kommission mit Versprechungen<br />
hinhalten kann, von denen<br />
dann später höchstens ein Bruchteil umgesetzt<br />
wird.<br />
Diese Methode scheint der rumänische<br />
Victor nun zu übernehmen. Ohnehin ist<br />
Ponta von seinem ungarischen Namensvetter<br />
„fasziniert“, wie er schon vor längerer<br />
Zeit bekannte. Manche Sprüche Orbáns<br />
scheint der „Copy-and-Paste“-Regierungschef<br />
direkt kopiert zu haben, zum Beispiel<br />
den, dass Rumänien „keine Kolonie“ sei.<br />
EU-Politiker und Mitglieder der Brüsseler<br />
Kommission haben Rumäniens politische<br />
Klasse zu mehr Einheit, Dialogfähigkeit<br />
und Kompromissbereitschaft<br />
aufgerufen. Müsste die Elite im Land angesichts<br />
der gravierenden wirtschaftlichen<br />
Folgen der politischen Krise nicht ein Interesse<br />
daran haben? Nein, überhaupt<br />
nicht, sagt der Bukarester Ökonom Ilie<br />
Şerbănescu, der 1997/98 kurzzeitig als<br />
Minister für Reformen arbeitete. „Früher<br />
dachten wir, wenn ausländische Investoren<br />
ins Land kommen und wir der EU beitreten,<br />
würde uns das zivilisieren und uns eine<br />
funktionierende Marktwirtschaft bescheren“,<br />
sagt Şerbănescu. „Aber das war eine<br />
Illusion. Rumänien ist noch immer keine<br />
richtige Marktwirtschaft. Die meisten Angehörigen<br />
der Elite leben vom Raub und<br />
Diebstahl staatlicher Ressourcen, und sie<br />
lassen sich dabei von niemandem stören.<br />
Die jetzige politische Krise kommt ihnen<br />
sogar sehr gelegen, denn unter solchen chaotischen<br />
Verhältnissen können sie ihre Geschäfte<br />
am besten machen.“<br />
Keno Verseck<br />
berichtet seit 1991 über mittelund<br />
südosteuropäische Länder.<br />
Er ist Autor der „Landeskunde<br />
Rumänien“ (C. H. Beck)<br />
Anzeige<br />
© Foto Schmidt: Paul Ripke; Meyer, Marguier: Antje Berghäuser<br />
It’s never<br />
too late<br />
Der letzte große Entertainer über<br />
intelligente Satire und die Zukunft<br />
des Fernsehens<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, stellvertretender<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur, im Gespräch<br />
mit Harald Schmidt.<br />
Sonntag, 23. September 2012, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble,<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
<strong>Vorschau</strong><br />
Im September<br />
Im Dezember zu<br />
Gast: Peer Steinbrück<br />
www.cicero.de/<br />
foyergespraech<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
HARALD<br />
SCHMIDT<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 73
Wir sind das GE<br />
Wir sind das GE in
in GEräuscharm,<br />
weil unsere GEnx-Triebwerke nicht nur weniger<br />
CO ² , sondern auch weniger Lärm verursachen.<br />
Unsere neuen GEnx-Triebwerke verbrauchen deutlich weniger Kerosin und sind leiser im Vergleich zu den<br />
GE-Triebwerken, die sie ersetzen. Perfekt für die neuen Boeing 747-8-Maschinen der Lufthansa und ein<br />
weiterer Grund für unsere langjährige Partnerschaft.<br />
Wir bewegen Deutschland: www.ge.com/de<br />
GErmany.
| W e l t b ü h n e | g r i e c h e n l a n d<br />
Der Kern des Chaos<br />
Wer die griechische Misere verstehen will, mache sich auf die Suche nach dem<br />
Katasteramt. Diese Odyssee sagt mehr über das Land als alle Troika-Berichte<br />
von Richard Fraunberger<br />
V<br />
angelis Samaras, 75, stämmig,<br />
Hände wie Schaufeln, sitzt unter<br />
dem Feigenbaum und schaut<br />
zu, wie Mais und Bohnen auf seiner Parzelle<br />
wachsen. Die Bewässerungsanlage<br />
zischt, alles sprießt auf dem Acker unweit<br />
seines Hauses in Krieza, einem 500-Seelen-Dorf<br />
auf der Insel Euböa. Acker hat<br />
Samaras viel. Land, auf dem er Gemüse<br />
anbaut, auf dem Olivenbäume und Wein<br />
wachsen, Land, das wie Saatkorn verstreut<br />
auf Hügeln, in Tälern, am Meer und auf<br />
einem Berg liegt, wo er, Vangelis Samaras,<br />
Ex-Bauunternehmer und heute Rentner,<br />
Gott zu Ehren eine Kapelle erbauen ließ.<br />
Es ist Land, das er geerbt und im Laufe der<br />
Zeit hinzugekauft hat. Insgesamt fünf Hektar,<br />
vielleicht auch mehr, so genau weiß das<br />
Vangelis Samaras nicht.<br />
Auch in Athen hat er Grund und Boden.<br />
Es ist ein Grundstück im Stadtviertel<br />
Egaleo, 400 Quadratmeter groß. „Ich<br />
fuhr nach Egaleo, um darauf ein Haus zu<br />
bauen und kam aus dem Staunen nicht heraus“,<br />
erzählt er. Auf seinem Grundstück,<br />
das jahrelang brachlag, hatte ein Nachbar<br />
einen Zaun gezogen, zehn Meter lang, zwei<br />
Meter breit, weil er Platz für seine Hühner<br />
brauchte. Nun beanspruchte der Nachbar<br />
den Streifen für sich. Streit brach aus. Die<br />
Polizei wurde gerufen. „Zum Glück ersannen<br />
die Beamten eine findige Lösung“, sagt<br />
Vangelis Samaras. Sie schlugen ihm heimlich<br />
vor, ihn und den Nachbarn anderntags<br />
zu verhaften, sodass die Bauarbeiter in<br />
Ruhe den Hühnerzaun niederreißen und<br />
das Fundament für das Haus legen können.<br />
Das war 1966. Geändert hat sich seither<br />
wenig.<br />
Foto: Bruno Perousse/Hoaqui/Laif<br />
76 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Hinter den idyllischen<br />
Fassaden griechischer<br />
Dörfer lauert das<br />
Dickicht aus Bau- und<br />
Immobilienrecht – so<br />
verworren wie die<br />
griechische Mythologie<br />
Ein Heer von Rechtsanwälten, Notaren<br />
und Richtern beschäftigt sich mit<br />
Streitigkeiten um Grund und Boden. Das<br />
Dickicht aus Besitztitel, Erwerb von Immobilien,<br />
Bau- und Immobilienrecht ist so<br />
verworren wie die griechische Mythologie.<br />
Hinzu kommt die enge Verflechtung von<br />
Politik, Wirtschaft und Kirche. Vor einigen<br />
Jahren besuchten zwei Mönche aus dem<br />
Kloster Vatopedi die Chefetage des Finanzministeriums.<br />
Sie wollten einen angeblich<br />
vor tausend Jahren von byzantinischen Kaisern<br />
vermachten, heute wertlosen See gegen<br />
teure staatliche Grundstücke in Athen<br />
tauschen (<strong>Cicero</strong> 12/2011). Trotz erheblicher<br />
Zweifel an der Urkunde klappte der<br />
Deal. Die Mönche gründeten einen Immobilienfonds.<br />
Aus dem Nichts sackten sie zig<br />
Millionen Euro ein, während der Staat das<br />
Nachsehen hatte.<br />
Nahezu jeder Grieche besitzt ein<br />
Grundstück, ein Haus, eine Wohnung. Ein<br />
Eigenheim ist so selbstverständlich wie die<br />
Taufe. Doch Griechenland ist der einzige<br />
Staat innerhalb der EU, in dem es nach<br />
wie vor kein flächendeckendes Kataster<br />
gibt, also eine Liegenschaftskarte sämtlicher<br />
Immobilien und Flurstücke eines Landes.<br />
Größe, Lage, Nutzung, Art, Eigentümer,<br />
alles ist bis ins letzte Detail erfasst und<br />
kartografiert. Es ist die Bemessungsgrundlage<br />
der Grundsteuer. Es ist die Voraussetzung<br />
einer urbanen und ruralen Entwicklung<br />
eines Staates. Es dient der Nutzung<br />
und dem Schutz von Wald, Seen, Flüssen.<br />
Es bewahrt vor Willkür und Korruption.<br />
Ohne ein Kataster investieren keine Unternehmen.<br />
Ohne ein Kataster fließen keine<br />
Agrarsubventionen. Es ist die Bedingung<br />
für eine funktionierende Marktwirtschaft.<br />
Gut 20 Prozent des Bruttosozialprodukts<br />
hängen unmittelbar mit Grund und Boden<br />
zusammen.<br />
Seit 1830, seit der Anerkennung seiner<br />
Souveränität, hat Griechenland keinen<br />
Überblick darüber, was sein ist. Größe<br />
und Wert seines Staatseigentums verlieren<br />
sich im Ungefähren. Es kennt nicht seinen<br />
Grund und Boden, nicht seine Küste,<br />
Berge, Seen, nicht seine Gebäude und auch<br />
nicht seinen Wald, obgleich die Verfassung<br />
ein Waldkataster vorschreibt. Es weiß nicht,<br />
wo sein Eigentum beginnt und wo es endet.<br />
Immer wieder wurde versucht, das Land<br />
zu kartografieren. Man vermaß Ländereien,<br />
Weinfelder, ein paar Waldgebiete. Aber immer<br />
wieder stockte die Arbeit und blieb liegen.<br />
Einzig auf den Dodekanes gibt es ein<br />
Kataster. Die Inseln waren in italienischer<br />
Hand. Die Geschichte des griechischen Katasterwesens<br />
ist die Geschichte eines Staates,<br />
der geformt wurde von Abertausenden<br />
Einzelinteressen, die sich wie Bäche zu einem<br />
Mahlstrom vereinten und alles mit<br />
sich rissen, was auf dem Weg lag.<br />
Geschätzte 180 000 Hektar Land sind<br />
illegal in Besitz. 300 000 Gebäude sind<br />
ohne Eigentümer. Wälder verschwinden.<br />
Es wird gebaut, was das Zeug hält. Auf<br />
Bergen, in Wäldern und am Strand schießen<br />
Ferienhäuser aus dem Boden; die Kykladen<br />
ertrinken im Zement. Und das trotz<br />
oder gerade wegen der 4000 Gesetze und<br />
ministerialen Beschlüsse, die den Immobilienbesitz<br />
regeln. Auf eine Million wird die<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 77
| W e l t b ü h n e | g r i e c h e n l a n d<br />
Zahl der Schwarzbauten geschätzt. Bauten,<br />
die an das staatliche Strom- und Wassernetz<br />
angeschlossen sind. Bauten, die es<br />
nicht gäbe, existierte ein Kataster. Doch<br />
für alles finden sich Lösungen. Alle Jahre<br />
wieder erlässt der Staat eine <strong>Am</strong>nestie und<br />
füllt so seine Kassen auf. Der Bürger legalisiert<br />
seinen Schwarzbau. Und wer noch<br />
nicht gebaut hat, der kann es auch weiterhin<br />
schwarz tun, denn die nächste <strong>Am</strong>nestie<br />
kommt gewiss. Besonders gewieft ist<br />
die Antragstellung auf Legalisierung von<br />
Schwarzbauten, die noch gar nicht gebaut<br />
worden sind.<br />
Seit Jahren fordert die EU den Verkauf<br />
von Staatsimmobilien und die Privatisierung<br />
staatlicher Firmenbeteiligungen. Im<br />
Zuge der Finanzkrise willigte die Regierung<br />
unter Jorgos Papandreou ein und kündigte<br />
einen Erlös von 50 Milliarden Euro an.<br />
Doch wie sollen Häfen, Grundstücke, Gebäude<br />
und Betriebe verkauft werden, wenn<br />
Eigentumsrechte unklar sind? Wie kommt<br />
es, dass ein Staat, der seit 182 Jahren unabhängig<br />
und seit 31 Jahren Mitglied der EU<br />
ist, sein Vermögen verwaltet wie eine Studenten-WG?<br />
Alles, was bis heute existiert,<br />
sind 400 Grundbuchämter, die so aufgebaut<br />
sind wie vor 180 Jahren.<br />
Konstantinos Bibikas, 72, ein freundlicher<br />
Herr mit sanfter Stimme, ist Leiter<br />
eines solchen Grundbuchamts. Es liegt<br />
zwischen Autowerkstätten im zweiten<br />
Obergeschoss eines Neubaus in der Kleinstadt<br />
Aliveri auf Euböa. Es ist ein kleiner<br />
Raum mit Wandregalen, vollgestopft<br />
mit Ordnern und schweren Büchern, die<br />
so groß sind wie Atlanten. Ein Ventilator<br />
durchschneidet die heiße Luft. Zwei<br />
Rechtsanwälte sitzen über Büchern und<br />
machen Notizen. „Die ersten Grundbücher<br />
wurden 1836 unter Otto I eingeführt“,<br />
erklärt Konstantinos Bibikas. Sie dienten<br />
der Vergabe von Hypotheken an Privatpersonen<br />
und Körperschaften. Vom Grundbuch<br />
explizit ausgeklammert waren staatliche<br />
Immobilien. Die Wirtschaft musste<br />
angekurbelt, Geld in Umlauf gebracht werden.<br />
Kapital war knapp. Kaum gegründet,<br />
war der neue Staat bereits hoch verschuldet.<br />
König Otto I hatte als Antrittsgeschenk<br />
von den Großmächten zwar eine Garantie<br />
für eine Anleihe über 60 Millionen Francs<br />
mitgebracht. Doch das Geld zerrann dem<br />
Staat in Windeseile. Nicht einmal die Zinsen<br />
konnte Griechenland aufbringen. Wurden<br />
Truppen zum Eintreiben von Steuern<br />
losgeschickt, griffen die Untertanen zu den<br />
Waffen.<br />
Der neue, nach französischem Vorbild<br />
zentralisierte Staatsapparat und die<br />
importierten Ideen der Aufklärung waren<br />
nicht kompatibel mit dem jahrhundertealten<br />
Verständnis von Machtausübung<br />
und patriarchalem Klientelwesen der Bürger.<br />
Griechenland ist Heimat, Stolz, Identifikation.<br />
Der neue Staat dagegen ist ein<br />
aufoktroyiertes Konstrukt der Großmächte,<br />
des Westens, dem man schon seit Byzanz<br />
misstraut. So wurde aus dem neuen Griechenland<br />
fremdes Territorium, das man<br />
„Kaum ein Eintrag im Grundbuch<br />
entspricht der Wirklichkeit“<br />
Konstantinos Bibikas, Leiter des Grundbuchamts in Aliveri<br />
als Eroberer in der Gestalt eines Sekretärs,<br />
Bürgermeisters, Ministers betritt, es plündert<br />
und die Beute in den sicheren Hafen<br />
der Familie bringt. Ein Modus vivendi, der<br />
noch heute gilt.<br />
Die Zentralregierung in Athen schaffte<br />
es nicht, die Macht der lokalen Clans zu<br />
brechen. Graf Kapodistrias, der erste Ministerpräsident,<br />
wurde 1831 von Großgrundbesitzern<br />
erschossen. Ein neuer, von<br />
Fremdherrschaft befreiter Staat einigt kein<br />
Volk, und eine politische Neuordnung ändert<br />
nicht den Menschen. Mit dem Abzug<br />
der Türken entstanden unklare Besitzverhältnisse.<br />
Riesige Ländereien wurden umverteilt,<br />
die im Grunde jeder für sich beanspruchen<br />
konnte: arbeitslos gewordene<br />
Revolutionäre, die Kirche, Clans, Politiker.<br />
Und immer wieder verschoben sich<br />
die Staatsgrenzen. Griechenland wuchs<br />
bis 1947. Erst dann lag das Staatsgebiet<br />
endgültig fest. An einer genauen Klärung<br />
der Eigentumsrechte der riesigen Nationalgüter<br />
war unter den politischen und<br />
wirtschaftlichen Wirren kaum zu denken.<br />
Der Aufbau eines Katasters wurde auf den<br />
Sankt-Nimmerleins-Tag verlegt. Indem<br />
der Staat drängende Rechtsfragen unter<br />
den Teppich kehrte, hielt er seine Wähler<br />
bei Laune, und die besitzenden Schichten<br />
blieben gefügig.<br />
„Und heute zahlen wir die Zeche“, sagt<br />
Konstantinos Bibikas. „Nichts ist so, wie<br />
es sein sollte. Kaum ein Eintrag im Grundbuch<br />
entspricht der Wirklichkeit.“ Oder<br />
er ist schwammig formuliert und damit<br />
unbrauchbar. Das Grundbuchamt Aliveris<br />
ist ein Archiv aus Verträgen und Büchern,<br />
die Personennamen, Erfassungsdatum,<br />
Art und Ort der Immobilie, Art der<br />
Transaktion und Angaben zu Hypotheken<br />
und Pfändungen enthalten. Digitalisierte<br />
Grundbücher gibt es nicht. Die ältesten<br />
Bücher stammen von 1856. Sie enthalten<br />
handschriftliche Kopien der Kaufverträge,<br />
niedergeschrieben von Gymnasiasten für<br />
eine Mahlzeit. Manche Einträge sind zum<br />
Schmunzeln: „Das erworbene Grundstück<br />
liegt zwischen dem von Dimitris Raptis<br />
und Janis Makridis“, „Das Grundstück erstreckt<br />
sich vom Olivenbaum an der Kirche<br />
bis zum Hügel“. Alle Grundbücher sind<br />
personenbezogen. Eine Suche nach Grundstücken<br />
oder dem Eigentümer bestimmter<br />
Grundstücke ist somit unmöglich.<br />
Im Grunde genommen ist das griechische<br />
Grundbuchamt ein öffentliches<br />
schwarzes Brett, an das Rechte auf Eigentum<br />
gepinnt werden, deren Rechtmäßigkeit<br />
ungeprüft ist. Denn Eigentumsverhältnisse<br />
können aus dem Nichts geschaffen<br />
werden. Alles, wessen es bedarf, sind ein<br />
Notar und ein Eintrag ins Grundbuch.<br />
Land, das früher mittels „dia logou“, das<br />
heißt ausschließlich mündlich vererbt oder<br />
verkauft wurde, eine noch kürzlich praktizierte<br />
Gepflogenheit, verwandelt sich so<br />
rechtskräftig in Eigentum. Ebenso Land,<br />
das 20 Jahre lang bewirtschaftet wurde und<br />
auf dem, wie zum Beweis, Olivenbäume<br />
oder Bohnenstangen stehen. Ebenso ungeprüft<br />
sind topografische Karten. Sie beschreiben<br />
Immobilien und sind Bestandteil<br />
eines Kaufvertrags und Voraussetzung<br />
einer Baugenehmigung. „In manchen Fällen<br />
wurden Ställe im Nachbargrundstück<br />
einfach mit vermessen“, sagt Konstantinos<br />
Bibikas. Plötzlich hat der Stall zwei Eigentümer.<br />
Warum? Weil der Verkäufer vermessen<br />
lässt, was er verkaufen will. Doch<br />
auch klare Eigentumsrechte schützen nicht<br />
vor Überraschungen. Wer ein Grundstück<br />
kauft, erwirbt damit noch lange nicht die<br />
darauf befindlichen Olivenbäume.<br />
78 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Aber nicht nur Bürger werden kreativ,<br />
wenn es um ihre Interessen geht. Die<br />
Stadtgemeinde Aliveri wollte das Rathaus<br />
um ein Stockwerk erweitern, aber die dazu<br />
nötige Grundstücksfläche reichte nicht aus.<br />
Also wies man den Landvermesser an, die<br />
Verkehrsstraße als Baufläche in die topografische<br />
Karte einzuzeichnen. Prompt<br />
erfolgte die Baugenehmigung. So trickst<br />
sich der Staat selber aus. Wenn sich aber<br />
der Staat nicht an seine Gesetze hält, warum<br />
sollten es dann die Bürger tun? Es gibt<br />
ein Geflecht von sehr strengen Gesetzen<br />
in Griechenland. Und es gibt die jahrhundertealte<br />
Gewohnheit, Gesetze zu dehnen,<br />
mit ihnen zu spielen, sie nicht anzuwenden,<br />
sie zu ignorieren oder, besser noch, Gesetze<br />
eigens auf die Interessen einer bestimmten<br />
Gruppe oder Person zuzuschneiden. Und<br />
das Interesse ist groß. Denn jede Familie<br />
ist ein Interessenverband, und jeder Wähler<br />
ist seine eigene Lobby.<br />
Konstantinos Bibikas hält nichts von<br />
Schummeleien. Er mag Kontrolle, er<br />
braucht sie. Damit er über Akti Nireos,<br />
das 200 Hektar große Neubaugebiet Aliveris,<br />
nicht den Überblick verliert, hat er<br />
von Hand ein Büchlein angelegt. Es ist<br />
sein Kataster. Es erlaubt ihm, Immobilien<br />
und Eigentümer genau zu lokalisieren. Das<br />
Neubaugebiet mit Meeresblick umfasst bis<br />
jetzt gut 500 Häuser. Fast alle davon wurden<br />
nach der Einführung des Euro erbaut.<br />
Der riesige Hang, ursprünglich bewaldet,<br />
wurde 1967 von zwei Baukooperativen gekauft.<br />
Fast jede Berufsgruppe in Griechenland<br />
verfügt über eine solche Kooperative.<br />
Lehrer, Bankangestellte, Mitarbeiter der<br />
halbstaatlichen Stromgesellschaft. Sie erwerben<br />
riesige Flächen Bauland, parzellieren<br />
und verkaufen es günstig an ihre Mitglieder,<br />
und zwar unabhängig vom Beruf.<br />
Die Kooperativen reichen zurück bis in die<br />
zwanziger Jahre, als 1,5 Millionen Griechen<br />
im Zuge eines Bevölkerungsaustauschs aus<br />
Kleinasien in ihr Heimatland strömten und<br />
die Landflucht zugleich immer mehr verarmte<br />
Menschen in die Städte trieb. Wohnraum<br />
war nicht vorhanden, und der Staat<br />
war zu arm, um welchen zu bauen. Ein Finanzierungsmodell<br />
musste her. Die Baukooperativen<br />
entstanden. Ganze Stadtviertel<br />
in Athen erwuchsen auf diese Weise.<br />
In den Sechzigern explodierte die Anzahl<br />
der Kooperativen. Sie verkamen zum<br />
Rammbock privater Interessen. Einflussreiche<br />
Berufsgruppen, Rechtsanwälte, Notare,<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
Althoff Schlosshotel Lerbach<br />
Lerbacher Weg, D-51465 Bergisch Gladbach<br />
Telefon + 49 (0) 22 02 / 204 - 921<br />
www.schlosshotel-lerbach.com<br />
»Vor mehr als 100 Jahren als Familiensitz und Herrenhaus<br />
erbaut, verbindet das heutige Althoff Schlosshotel Lerbach<br />
seit nunmehr 20 Jahren Spitzenhotellerie mit Qualitätsgastronomie,<br />
an erster Stelle Küchenchef Nils Henkel<br />
mit seiner Stilrichtung ›Pure Nature‹ und unser aufmerksamster<br />
Service, dies alles eingebettet in einer einzigartigen<br />
Parklandschaft. Mit <strong>Cicero</strong> bieten wir unseren Gästen ein<br />
Magazin, das sowohl unseren eigenen Ansprüchen als auch<br />
den Ansprüchen unserer Gäste entspricht.«<br />
CHRISTIAN SIEGLING, HOTELDIREKTOR,<br />
ALTHOFF SCHLOSSHOTEL LERBACH<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Aachen: Pullman Aachen Quellenhof · Bad Doberan – Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont:<br />
Steigenberger Hotel · Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Bad Schandau: Elbresidenz Bad Schandau Viva<br />
Vital & Medical SPA · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg,<br />
Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hotel Concorde, Brandenburger Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin,<br />
Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy Berlin, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton<br />
Hotel Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf:<br />
InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Essen: Schlosshotel Hugenpoet<br />
Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch<br />
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental<br />
Hamburg, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese<br />
Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt:<br />
Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa<br />
Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel<br />
Magdeburg: Herrenkrug Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz<br />
München: King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg<br />
· Nürnberg: Le Méridien · Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel<br />
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof<br />
ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Lienz: Grandhotel Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL<br />
Albufeira: Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale<br />
Luzern: Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Park Hotel Weggis, Post Hotel Weggis<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de
| W e l t b ü h n e | g r i e c h e n l a n d<br />
Richter, das Militär schufen anstatt fehlenden<br />
Wohnraums Ferienhäuser und Villen<br />
mit Meeresblick. Manche Baukooperativen<br />
verkauften mehr Land, als sie erwarben.<br />
Andere erstanden Ländereien mit<br />
fragwürdigem Besitztitel. Die Bauwirtschaft<br />
boomte. Im Gegenzug verschwanden<br />
Wälder, circa eine Million Hektar. So<br />
auch in Aliveri. Aber das will heute keiner<br />
mehr so genau wissen. Und so genau lässt<br />
sich das auch nicht ermitteln ohne Kataster.<br />
Es gibt zwar Luftaufnahmen aus dem<br />
Jahr 1945. Aber was damals Wald war, ist<br />
heute Bauland – und umgekehrt.<br />
Was einen Wald definiert, ist gesetzlich<br />
festgeschrieben. Forstämter können Wald<br />
zu Ackerland machen und Ackerland zu<br />
Wald. Auch wo er beginnt und aufhört,<br />
was also noch Bauland ist und was nicht,<br />
liegt im Ermessen der Forstämter. Da liegt<br />
es auf der Hand, dass mithilfe eines Briefumschlags<br />
oder eines politischen Machtworts<br />
sich intakte oder verbrannte Wälder<br />
in Bauland verwandeln. Das Fehlen<br />
eines Katasters öffnet alle Schleusen. Zuerst<br />
rinnen Bäche, kleine Geldsummen an<br />
Mitarbeiter von Forstämtern und des Archäologischen<br />
Instituts, an Beamte, Makler,<br />
Notare, Rechtsanwälte, Landvermesser.<br />
Später sind es Ströme, große Geldsummen<br />
an Bauunternehmen, Politiker, Architektenbüros,<br />
Spekulanten. Für nahezu alles<br />
finden sich in Griechenland Lobbys. Nur<br />
das Gemeinwohl hat keine.<br />
„Niemand hatte ein Interesse an einem<br />
Kataster. Es fehlte der politische Wille“,<br />
sagt Apostolos Arvanitis. Er sitzt in seinem<br />
Büro im Athener Stadtviertel Agia<br />
Paraskevi und blickt zum Fenster hinaus.<br />
Was er sieht, ist ein betongewordener Moloch<br />
mit vier Millionen Einwohnern, eine<br />
Stadt, die so schnell wuchs, dass jede Planung,<br />
kaum fertig, bereits überholt war.<br />
„Es gibt große Unternehmen, deren Rechte<br />
an Grund und Boden nie ganz geklärt wurden“,<br />
sagt Arvanitis. Er sagt es vorsichtig,<br />
er wägt jedes Wort ab. Apostolos Arvanitis<br />
ist seit 2009 Direktor der Ktimatologia<br />
AG. Der 54-Jährige steht unter enormem<br />
Druck. Er und seine 365 Mitarbeiter erstellen<br />
das nationale Kataster. „Wir organisieren<br />
ein Land, das unorganisiert ist“, sagt<br />
er. Eine Herkulesaufgabe, ein Jahrhundertprojekt,<br />
gemessen an dem Dschungel aus<br />
illegalen, legalen und halblegalen Eigentumsverhältnissen<br />
und dem Desinteresse,<br />
Ordnung und Transparenz in den Dschungel<br />
zu bringen.<br />
Gegründet wurde die Ktimatologia<br />
AG 1995, als die Regierung den Aufbau<br />
eines Katasters beschloss. Sie gehört dem<br />
Ministerium für Umwelt, Raumplanung<br />
und öffentliche Arbeiten. 152 Millionen<br />
Euro wurden damals in Brüssel für das Pilotprojekt<br />
genehmigt. Einige Jahre später<br />
war fast alles Geld verbraucht und kaum etwas<br />
erledigt. In den Büros saß eine Mannschaft<br />
von Akademikern ohne jede Erfahrung.<br />
Man glaubte, das Kataster mit Excel,<br />
einem Tabellenkalkulationsprogramm, erstellen<br />
zu können. Ein Desaster. Der Staat<br />
„Niemand hatte ein Interesse<br />
an einem Kataster“<br />
Apostolos Arvanitis, Direktor der Ktimatologia AG<br />
musste Teile der Hilfsgelder zurückerstatten.<br />
„So ist halt Griechenland“, erklärte der<br />
damals zuständige Minister Kostas Laliotis<br />
bei einer Pressekonferenz.<br />
Nun ist das Projekt erneut erwacht.<br />
1,5 Milliarden Euro soll es kosten.<br />
15 000 Kilometer Küste, 3000 Inseln und<br />
132 000 Quadratkilometer Land wurden<br />
fotografiert. Ein Drittel der Landesfläche<br />
ist in Bearbeitung. Die Umsetzung hinkt<br />
dem Zeitplan hinterher. Schuld ist unter<br />
anderem die kafkaeske Lage. Im Zuge der<br />
Katastererstellung wurden auf Attika Immobilien<br />
deklariert, deren Gesamtfläche<br />
die Attikas um das Doppelte übersteigt.<br />
Wie ist das möglich? Viele Grundstücke<br />
im Ausland lebender Griechen wurden<br />
gleich von mehreren Nachbarn beansprucht,<br />
in der Hoffnung, eigenen Grund<br />
und Boden zu mehren. Ein weiterer Grund<br />
sind die offiziellen Grundstücksflächen,<br />
die meistens größer sind als die tatsächlichen.<br />
So konnten Häuser gebaut werden,<br />
für die sonst nie eine Baugenehmigung erteilt<br />
worden wäre. Ebenso spielen Agrarsubventionen<br />
eine Rolle. Je größer die gemeldeten<br />
Olivenhaine, desto mehr Gelder<br />
fließen. Abenteuerlich auch die Erstellung<br />
der Waldkarten. Manche Forstämter weigern<br />
sich, dem Katasteramt bereits bestehende<br />
Karten auszuhändigen, weil sie um<br />
den Verlust ihrer Befugnisse fürchten –<br />
und damit um ihren lukrativen Nebenverdienst.<br />
Andere können die Karten erst<br />
gar nicht anfertigen, weil sie dazu den örtlichen<br />
Bebauungsplan benötigen, den die<br />
Baubehörde versäumt hat zu erstellen.<br />
Die Hälfte der vor Bebauung geretteten<br />
Waldbestände ist erfasst. Sobald eine<br />
Waldkarte erstellt ist, muss sie zuerst im<br />
Ministerium abgestempelt werden. „Und<br />
das dauert“, klagt Dimitris Rokos, 44, Planungsleiter<br />
der Ktimatologia AG. „Leider<br />
ist unser Unternehmen so flexibel wie<br />
eine staatliche Behörde.“ Entscheidungen<br />
und Verantwortlichkeiten sind über<br />
mehrere Ministerien verteilt. Im Grunde<br />
kein Problem. Doch Ministerien konkurrieren<br />
und sind untereinander weder<br />
koordiniert noch vernetzt. Oft ist nicht<br />
klar, wer was in welchem Ministerium<br />
tut. Oft fehlt den Mitarbeitern die Kompetenz.<br />
Kürzlich noch wussten die Behörden<br />
nicht einmal, an wie viele Beamte und<br />
Rentner sie Gelder überweisen und ob sie<br />
überhaupt noch leben. Nur ein Big Bang<br />
könne helfen, den griechischen Staatsapparat<br />
zu reformieren, erklärte die OECD.<br />
„Die Troika würde unsere Probleme besser<br />
verstehen als unsere Behörden“, sagt Dimitris<br />
Rokos seufzend.<br />
2020 soll das Kataster fertiggestellt<br />
sein. Bis dahin wird um Grund und Boden<br />
geschachert, Grenzlinien werden hinund<br />
hergeschoben, und die Gerichte werden<br />
eine Fülle von Ungereimtheiten klären<br />
müssen. Der Aufbau des Katasters ist die<br />
letzte Möglichkeit, staatliches Territorium<br />
zu besetzen. „Das Kataster wird die Mentalität<br />
der Menschen verändern“, hofft Dimitris<br />
Rokos. „Transparente Eigentumsverhältnisse.<br />
Vereinfachte Baugenehmigungen.<br />
Gerechtigkeit. Alle werden profitieren.“<br />
Das Wohl der Gemeinschaft stünde über<br />
dem Wohl einzelner Gruppen. Bleibt zu<br />
hoffen, dass es die Menschen in Griechenland<br />
auch so sehen.<br />
Richard Fraunberger<br />
lebt seit 2001 in Griechenland<br />
und hat selbst einschlägige<br />
Erfahrungen mit Forstamt und<br />
Baubehörde gemacht<br />
Foto: privat<br />
80 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Ihr Sparpaket: iPad 3<br />
mit Tagesspiegel E-Paper<br />
für nur 24 ¤ im Monat. *<br />
Sichern Sie sich Ihr Sparpaket<br />
zum einmaligen Vorzugspreis:<br />
• iPad3 mit 16 GB<br />
• Tagesspiegel E-Paper<br />
• Tagesspiegel-App<br />
für iPad und iPhone<br />
für nur 24 ¤ im Monat! *<br />
Über<br />
1 Million Downloads:<br />
Die Tagesspiegel-App<br />
gehört zu den beliebtesten<br />
Nachrichten-Apps<br />
in Deutschland.<br />
Gleich bestellen:<br />
Telefon (030) 290 21 - 500<br />
www.tagesspiegel.de/ipad3<br />
*Einmalige Zuzahlung für iPad 3, 16 GB, schwarz, für W-LAN: 99,– ¤ / für W-LAN und SIM-Karte: 195,– ¤. Preise inkl. MwSt. Die Mindestvertragslaufzeit<br />
beträgt 24 Monate. Der Kauf des iPad 3 steht unter Eigentumsvorbehalt innerhalb der ersten 2 Jahre. Die Garantie für das iPad beläuft sich auf ein Jahr. Mit<br />
vollständiger Zahlung des Bezugspreises für die Mindestvertragslaufzeit geht das Eigentum am iPad an den Käufer über. Die einmalige Zuzahlung wird bei<br />
Lieferung des Gerätes fällig. Zusätzlich zur Zuzahlung werden 2,– ¤ Nachentgelt erhoben. Nur so lange der Vorrat reicht.
| K a p i t a l<br />
kläger mit Leseschwäche<br />
Der US-Milliardär und Finanzdienstleister Charles Schwab treibt im Libor-Skandal die Großbanken vor sich her<br />
von Moritz Küpper<br />
C<br />
harles Schwab Redet gern. Der<br />
weißhaarige Mann, Spitzname<br />
Chuck, sitzt auf seinem Sofa, trägt<br />
eine Brille mit schwarzem Rand, Hemd<br />
und Krawatte und redet: über Inflation, den<br />
Dollar oder die enorme US-Staatsverschuldung.<br />
„Conversations with Chuck“ heißt<br />
das Videoformat auf der Website des Finanzdienstleisters<br />
„Charles Schwab“.<br />
Die Unterhaltungen mit Chuck haben<br />
nur einen Haken. Es sind eher Monologe.<br />
Dabei würde man ihn so gern zu<br />
dem Thema befragen, das seit einiger Zeit<br />
die Bankenwelt in Atem hält und Rechtsanwälte<br />
und Aufsichtsbehörden weltweit<br />
elektrisiert: der sogenannte Libor-Skandal.<br />
Und wer, wenn nicht der heute 75‐jährige<br />
Namensgeber und Aufsichtsratsvorsitzende<br />
der Firma könnte dazu besser<br />
Stellung nehmen? War es doch sein Unternehmen,<br />
das als eines der ersten im Juni<br />
Klage auf Schadenersatz eingereicht und<br />
damit dem Establishment der Finanzwelt<br />
den Kampf angesagt hat.<br />
Das Kürzel Libor steht für „London<br />
Inter Bank Offered Rate“. Es ist der täglich<br />
ermittelte Durchschnittszins, zu dem<br />
sich die Banken untereinander Geld leihen<br />
würden. Die 18 nach Marktaktivität<br />
wichtigsten Banken geben an jedem Börsentag<br />
um 11 Uhr eine Schätzung ab, zu<br />
welchem Zinssatz sie sich ohne Sicherheiten<br />
Geld bei einer anderen Bank leihen<br />
könnten. Für die eigentliche Berechnung<br />
werden nur die mittleren 50 Prozent der<br />
Angaben berücksichtigt. Obwohl es sich<br />
lediglich um eine hypothetische Selbstauskunft<br />
der Banken handelt, wird der<br />
Libor nicht umsonst als „die wichtigste<br />
Zahl der Welt“ bezeichnet, weil auf diesem<br />
Zinssatz Finanzprodukte im Wert von<br />
800 Billionen Dollar basieren. Das ist das<br />
Zehnfache des weltweit erwirtschafteten<br />
Bruttosozialprodukts.<br />
Bereits Ende 2007 gab es bei der New<br />
Yorker Notenbank erste Erkenntnisse über<br />
zu niedrige, manipulierte Libor‐Zinsen.<br />
Über die britischen und amerikanischen<br />
Finanzaufsichtsbehörden kam der Skandal<br />
ins Rollen, in dem bislang allerdings<br />
nur die britische Barclays-Bank Manipulationen<br />
eingeräumt hat. Die Folgen: eine<br />
Strafzahlung in Höhe von 450 Millionen<br />
Dollar sowie die Rücktritte des Vorstandsvorsitzenden<br />
Bob Diamond und des Verwaltungsratschefs<br />
Marcus Agius.<br />
Ein Ende des Skandals ist aber noch<br />
gar nicht abzusehen. Die am Libor-Fixing<br />
beteiligten Großbanken fürchten sich vor<br />
allem vor langwierigen Zivilprozessen, wie<br />
sie Charles Schwab und einige andere bereits<br />
angestrengt haben. Schwabs Klagebegründung:<br />
Die Manipulationen des Libor-<br />
Zinssatzes hätten seine Rendite und die<br />
seiner Kunden geschmälert. Im Gegenzug<br />
hätten die beteiligten Banken „Milliarden<br />
unberechtigter Gewinne“ eingefahren. Zu<br />
den von Charles Schwab verklagten Geldhäusern<br />
gehören auch die Deutsche Bank<br />
und die sich in Auflösung befindende<br />
WestLB, wodurch eventuell Schadenersatz<br />
und Bußgelder vom deutschen Steuerzahler<br />
übernommen werden müssten.<br />
Der fünffache Familienvater Schwab<br />
schmückt sich gerne mit dem Image des<br />
Saubermanns und Demokratisierers der<br />
Branche. Schwab, der 2003 kurz als möglicher<br />
Finanzminister der Bush-Regierung<br />
im Gespräch war, ist in den USA durchaus<br />
angesehen, weil er exemplarisch den<br />
amerikanischen Traum verkörpert: Der<br />
aus einfachen Verhältnissen stammende<br />
Kalifornier steht in der aktuellen Forbes-<br />
Liste der reichsten <strong>Am</strong>erikaner auf Platz<br />
101 mit einem geschätzten Vermögen von<br />
rund 3,5 Milliarden Dollar. Gepaart mit<br />
dem Label: „Self-made.“ Ein Ritterschlag.<br />
Das Unternehmen „Charles Schwab“ betreut<br />
heute rund acht Millionen Konten<br />
und eine Summe von circa 1,65 Billionen<br />
Dollar. Besonderen Respekt erhält<br />
Schwab dafür, dass er es in seiner Karriere<br />
inklusive MBA‐Abschluss an der amerikanischen<br />
Elite‐Universität Stanford<br />
trotz ausgeprägter Lern- und Leseschwäche<br />
so weit gebracht hat. Das Lesen bereitet<br />
ihm bis heute Probleme. Eine von<br />
ihm und seiner Frau Helen gegründete<br />
Stiftung kümmert sich daher um Kinder<br />
mit Lernschwächen.<br />
Ist der mehrfache Milliardär also eine<br />
Art Robin Hood? „Um Himmels willen,<br />
nein“, sagt Karen Petrou, geschäftsführende<br />
Partnerin bei Federal Financial<br />
Analytics, „Charles Schwab ist nun wirklich<br />
kein kleines Unternehmen. Sie haben<br />
nur das gemacht, was sie tun mussten:<br />
die Rechte ihrer Anleger schützen.“ Dafür<br />
bekomme das Unternehmen schließlich<br />
seine Maklergebühren. Ohnehin hat<br />
das Saubermann-Image der Bank und ihres<br />
Gründers im vergangenen Jahr empfindliche<br />
Kratzer erhalten, als das Unternehmen<br />
von der US‐Finanzaufsicht SEC<br />
zu einer Geldstrafe von 119 Millionen<br />
Dollar verurteilt wurde, weil es einen seiner<br />
Fonds als sichere Anlage angepriesen<br />
hatte, der voller hochriskanter Wertpapiere<br />
steckte.<br />
Auch der restliche Lebensstil Schwabs<br />
bietet nur bedingt Robin-Hood-Potenzial:<br />
Seit Jahrzehnten zählt der leidenschaftliche<br />
Golfer zu den großzügigen Wahlkampfspendern<br />
der Republikaner und fordert die Privatisierung<br />
der Sozialversicherungskonten<br />
und weitere Steuersenkungen, weswegen er<br />
im laufenden Präsidentschaftswahlkampf<br />
voll auf Herausforderer Mitt Romney setzt.<br />
Das Wahlergebnis erfährt Schwab Anfang<br />
November. Wie lange der Feldzug gegen die<br />
Banken dauern wird, ist dagegen nicht abzusehen:<br />
„Das wird kompliziert und kann<br />
Jahre dauern“, schätzt Petrou. Beides auf<br />
jeden Fall spannende Themen für weitere<br />
„Conversations with Chuck“.<br />
Moritz Küpper<br />
ist Redakteur beim Deutschlandfunk<br />
und als Arthur-F.-Burns-<br />
Stipendiat zurzeit in den USA<br />
Fotos: Eric Millette, Deutschland radio (Autor)<br />
82 <strong>Cicero</strong> 9.2012
„Die Libor-<br />
Manipulationen<br />
haben die<br />
Renditen der<br />
Bank und<br />
unserer Kunden<br />
geschmälert“<br />
Auszug aus der Klage von<br />
Charles Schwab, dem Gründer<br />
der gleichnamigen Bank<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 83
| K a p i t a l<br />
Der Weichmacher<br />
Heinz Hankammer hat den Brita-Wasserfilter erfunden, Sohn Markus macht die Firma fit für die Zukunft<br />
von Lenz Jacobsen<br />
A<br />
m Senior kommt keiner vorbei.<br />
Direkt im Haupteingang der Firmenzentrale<br />
im hessischen Taunusstein<br />
hängt er an der Wand, in Öl<br />
gemalt, zufrieden lächelnd: Heinz Hankammer,<br />
Unternehmensgründer und Erfinder<br />
des Wasserfilters Brita. Damit erst<br />
gar kein Zweifel aufkommen kann, wessen<br />
Werk all das hier ist: seins, natürlich.<br />
Zwei Stockwerke weiter oben sitzt sein<br />
Sohn, Markus Hankammer, in der warmen<br />
Spätnachmittagssonne, und doch ein wenig<br />
im Schatten seines Vaters. Seit 1999 schon<br />
ist er der Chef bei Brita und damit verantwortlich<br />
für 320 Millionen Euro Umsatz<br />
und mehr als 1000 Mitarbeiter. In 60 Ländern<br />
verkauft er das Produkt, das sein Vater<br />
einst entwickelt und sich so seinen eigenen<br />
Markt geschaffen hat. Der Brita-Wasserfilter<br />
ist eine Mischung aus Aktivkohle und<br />
Entionisierer, die das Wasser weicher machen<br />
soll. 250 Millionen Menschen trinken<br />
weltweit das Brita-Wasser, so die Firma.<br />
Die Haushaltsfilter, bei denen die Filterkartusche<br />
in eine Kanne eingesetzt ist, haben<br />
die Firma berühmt gemacht. So wie Taschentücher<br />
Tempo heißen und Klebeband<br />
Tesa, so heißen Wasserfilter eben Brita – ein<br />
Traum für jede Marketingabteilung.<br />
Markus Hankammer hat also, könnte<br />
man denken, einen ziemlich bequemen Job.<br />
Doch es ist nicht einfach, der Nachfolger<br />
des großen Pioniers und Gründers zu sein –<br />
besonders als Sohn. Er muss absichern, was<br />
der Vater aufgebaut hat, ohne sich auf den<br />
alten Erfolgsrezepten auszuruhen.<br />
Deshalb war er sich lange Zeit überhaupt<br />
nicht sicher, ob er das Lebenswerk<br />
seines Vaters weiterführen wollte. „Noch<br />
während des Studiums hatte ich eigentlich<br />
andere Pläne.“ Trotzdem hat er sich<br />
immer sehr beeilt mit allem. Mit 18 Jahren<br />
Abitur, mit 22 Diplom. „Früher wollte<br />
ich nicht unbedingt der Beste sein, sondern<br />
der Schnellste. Vielleicht war mir unbewusst<br />
doch klar: Wenn ich das Geschäft<br />
übernehmen will, muss ich mich beeilen.“<br />
Als Markus von der Uni kam, war sein Vater<br />
bereits 59 Jahre alt. Auch wenn er das<br />
so nicht sagt, der Druck auf ihn, den designierten<br />
Nachfolger, war groß.<br />
Denn Brita ist so sehr Familienunternehmen,<br />
dass es schon beinahe Karikatur<br />
ist. Da ist zum Beispiel jenes Schwarz-<br />
Weiß-Foto aus dem Sommer<br />
1967, das bei Brita bis heute<br />
in Ehren gehalten wird:<br />
Die ganze Familie ist zu sehen,<br />
wie sie an einem langen<br />
Holztisch im eigenen<br />
Garten die ersten Wasserfilter<br />
zusammenbaut. Ganz<br />
vorne turnt Tochter Brita herum,<br />
nach der die Firma benannt<br />
ist. Wie sehr er Unternehmer<br />
werden wollte, ließ<br />
der junge Heinz Hankammer<br />
bereits seine verdutzte<br />
Lehrerin in der Berufsschule<br />
beim Steno-Unterricht wissen:<br />
„Ich lerne das nicht, ich<br />
werde mal selbstständig sein,<br />
dann habe ich eine Sekretärin,<br />
die für mich tippt.“ Bereits<br />
Anfang der sechziger<br />
Jahre probierte Hankammer<br />
es zweimal erfolglos, einmal<br />
mit Süßigkeiten, einmal mit Reifen aus der<br />
Dose. Dann entdeckte er in einem Labor jenen<br />
Filter, der das Wasser entmineralisierte,<br />
und begann im Garten zu basteln.<br />
Sohn Markus musste 30 Jahre später<br />
erst nach Chile gehen, um zu merken, dass<br />
der heimische Betrieb das Richtige für ihn<br />
ist: Von einem winzigen Zwölf-Quadratmeter-Büro<br />
aus baute er den Vertrieb auf.<br />
Zweieinhalb Jahre später hatte Hankammer<br />
Junior 15 Angestellte und ganz Chile<br />
mit Brita-Filtern versorgt.<br />
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland<br />
war er vor allem damit beschäftigt,<br />
die Firma dem immer noch rasanten<br />
Wachstum anzupassen: Ein durchdachtes<br />
Vertriebsnetz, klarere Strukturen und der<br />
Umzug der Verwaltung in den schicken<br />
Bürobau gegenüber der eigenen Produktions-<br />
und Lagerhalle folgten. „Mein Vater<br />
war ein großartiger Verkäufer, ich bin eher<br />
Stratege“, sagt Hankammer. Man könnte<br />
auch sagen: Der Senior ist vorgeprescht, hat<br />
die Märkte erobert, der Junior<br />
pflegt diese Eroberungen,<br />
sorgt für Ordnung und<br />
organisches Wachstum.<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagte<br />
kürzlich der neue<br />
Deutsche-Bank-Chef<br />
Anshu Jain. <strong>Cicero</strong><br />
weiß das schon länger<br />
und stellt besondere<br />
Mittelständler in einer<br />
Serie vor.<br />
Markus Hankammer<br />
probiert seit einiger Zeit<br />
neue Anwendungsbereiche<br />
für den Wasserfilter aus:<br />
Eingebaut in Kaffeemaschinen<br />
oder in Wasserspendern<br />
für Unternehmen und Gastronomie,<br />
soll die Abhängigkeit<br />
von der klassischen Filterkanne<br />
reduziert werden.<br />
2009 hat Markus auch<br />
das Ruder beim zweiten großen<br />
Interessenschwerpunkt<br />
der Hankammers übernommen:<br />
dem Fußball-Drittligisten<br />
SV Wehen-Wiesbaden.<br />
Dort hatte ihn der<br />
Vater als Kind hingeschickt,<br />
da Markus damals ein Querulant<br />
gewesen sei, sagt zumindest der Senior:<br />
„Beim Fußball hat er gelernt, sich<br />
zu fügen.“ Aus Dankbarkeit übernahm<br />
Heinz Hankammer den Verein und führte<br />
ihn bis in die Zweite Bundesliga, was ihm<br />
den Spitznamen „Abramowitsch vom Dorf“<br />
einbrachte. Nach dem kometenhaften Aufstieg<br />
brauchen sie jetzt aber auch im Verein<br />
einen besonnenen Strategen.<br />
Lenz Jacobsen<br />
ist Mitgründer des Journalistenbüros<br />
„Weitwinkel Reporter“<br />
in Köln, wo das Leitungswasser<br />
besonders hart ist<br />
Fotos: Andreas Reeg, Privat (Autor)<br />
84 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Gefiltertes Wasser:<br />
Lebenselixier für Markus<br />
Hankammer und<br />
seine 1000 Mitarbeiter<br />
bei Brita<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 85
| K a p i t a l<br />
Superhelden mit<br />
Migrationshintergrund<br />
Naif Al-Mutawa hat muslimische Comicfiguren geschaffen als Vorbilder für seine fünf Söhne<br />
von Til Knipper<br />
S<br />
Eine Mutter hat ihn immer gewarnt:<br />
„Wähle deine Freunde<br />
sorgfältig aus, da du wahrscheinlich<br />
auch ihre Feinde dazubekommst.“<br />
Aber in dem Fall hatte er doch niemanden<br />
ausgewählt, und das überschwängliche Lob<br />
in einer Rede von Barack Obama für die<br />
von ihm entworfene Comicserie The 99 traf<br />
Naif Al-Mutawa völlig unvorbereitet. Obamas<br />
Feinde bekam er trotzdem gratis dazu,<br />
und sie machen ihm und seinen 99 muslimischen<br />
Superhelden seitdem das Leben<br />
in den USA schwer.<br />
Für <strong>Am</strong>erikas rechte, christliche Fundamentalisten<br />
war Obamas Äußerung ein<br />
weiterer Beleg dafür, dass der Präsident ein<br />
Muslim sei. Und einmal in Fahrt, gaben<br />
sie auch der noch jungen Comicserie eine<br />
volle Breitseite mit: The 99 sei ein Trojanisches<br />
Pferd, das die Scharia direkt in die<br />
Kinderzimmer bringe, hieß es in den einschlägigen<br />
Radiotalkshows und Blogs. Wer<br />
seine Kinder mit der Serie in Berührung<br />
kommen lasse, könne sie auch gleich im<br />
Dschihadisten-Ausbildungscamp in Afghanistan<br />
anmelden. Al-Mutawa bekam das<br />
Label eines „teuflischen arabisch-amerikanischen<br />
Terroristen“ verpasst. „Wie können<br />
Sie es wagen, mich amerikanisch zu<br />
nennen?“, antwortete der gebürtige Kuwaiti<br />
trocken.<br />
Angriffe aus dieser Ecke haben ihn ohnehin<br />
nicht überrascht. „Das macht mich<br />
Präsident Obamas Lob hat Naif<br />
Al-Mutawa in den USA geschadet<br />
eher stolz, weil es mir zeigt, dass ich etwas<br />
richtig mache“, sagt Al-Mutawa. Erschrocken<br />
hat ihn eher, dass sich der<br />
amerikanische Kabelfernsehsender Hub<br />
dadurch so unter Druck setzen ließ, dass<br />
er die 26‐teilige erste Staffel der animierten<br />
The 99‐Fernsehserie auf unbestimmte<br />
Zeit im Archiv verschwinden ließ. „Sie hatten<br />
offenbar Angst, dass ihnen nach den<br />
Protesten Werbekunden abspringen“, sagt<br />
Al-Mutawa. Er empfindet es schon fast als<br />
Klischee, dass die von ihm entwickelten Figuren,<br />
die für Toleranz und Verständigung<br />
stünden, nun „von Extremisten abgeschossen“<br />
würden. Da hilft es Al-Mutawa auch<br />
nicht, dass der Sender ihn voll bezahlt hat.<br />
„Für unser Geschäftsmodell, das auf dem<br />
Verkauf von Lizenzen beruht, wäre es extrem<br />
wichtig gewesen, die Serie zuerst erfolgreich<br />
im wichtigsten Fernsehmarkt der<br />
Welt zeigen zu können.“<br />
Das Absurde an den Vorwürfen ist, dass<br />
es sich bei The 99 um säkulare Comicgeschichten<br />
handelt. Andernfalls müsste man<br />
auch Supermans alttestamentarische Bezüge<br />
beklagen, weil dessen Auftauchen bei<br />
seinen Pflegeeltern, den Kents, eine moderne<br />
Version von Mose im Korb am Nil<br />
ist. Al-Mutawas 99 Helden kommen aus<br />
ebenso vielen verschiedenen Ländern und<br />
verfügen dank besonderer Edelsteine über<br />
jeweils eine herausragende Fähigkeit: die<br />
einzige religiöse Anspielung, dass es sich<br />
um genau jene 99 Eigenschaften handelt,<br />
die Allah im Koran zugeschrieben werden,<br />
darunter Stärke, Mut, Weisheit und Gnade.<br />
„Das sind universell anwendbare Begriffe,<br />
egal an welchen Gott man glaubt“, sagt<br />
Al-Mutawa.<br />
Die Idee für die Comicserie war 2003<br />
bei einer gemeinsamen Taxifahrt in London<br />
mit seiner Schwester Samar entstanden.<br />
Naif Al-Mutawa hatte gerade seinen<br />
MBA von der Columbia University in New<br />
York in der Tasche sowie den Doktortitel in<br />
klinischer Psychologie, und seine Schwester<br />
nervte ihn damit, dass er Kinderbücher<br />
schreiben solle. So fern lag das nicht, weil<br />
Al-Mutawa während des Studiums über das<br />
Thema Toleranz schon mal eine illustrierte<br />
Buchserie für Kinder verfasst hatte, für die<br />
er prompt mit einem Preis der Unesco ausgezeichnet<br />
worden war. „Ich habe dann zu<br />
ihr gesagt, das müsse schon so etwas Großes<br />
wie Pokémon sein. Sie sagte: Ja, mach<br />
doch.“ Der Gedanke ließ ihn nicht mehr<br />
los, und das Potenzial von The 99 scheint<br />
tatsächlich ähnlich groß zu sein wie bei<br />
den Pokémonfiguren aus dem japanischen<br />
Videospiel.<br />
Mehr als 50 Comicbücher sind inzwischen<br />
bei Al-Mutawas Teshkeel Group in<br />
Kuwait auf Englisch und Arabisch erschienen.<br />
20 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen<br />
fest. Insgesamt, schätzt Al-Mutawa,<br />
haben an der bisherigen Realisierung<br />
des Projekts The 99 etwa 800 Leute mitgearbeitet.<br />
Die Bücher haben sich insgesamt<br />
etwa eine Million Mal verkauft. Besonders<br />
stolz ist der Chef dabei auf die fünf Spezialausgaben,<br />
in denen sein noch junges Unternehmen<br />
mit dem legendären amerikanischen<br />
Verlag DC Comics die Helden aus<br />
The 99 zusammen mit Batman, Superman<br />
Foto: Cara Hromada Photography/ Teshkeel Media Group/ddp images/AP Photo<br />
86 <strong>Cicero</strong> 9.2012
„Extremismus<br />
lässt sich nur mit<br />
Kunst und Kultur<br />
besiegen“, sagt<br />
der Comicverleger<br />
Naif Al-Mutawa<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 87
| K a p i t a l<br />
Dr. Ramzi Razem, der Mentor der 99 Helden, ist das schlankere, größere<br />
Alter Ego von Naif Al-Mutawa in den Comics: „Aber so entspannt und<br />
ruhig wie er werde ich wohl erst 20 Jahre nach meinem Tod sein“<br />
und Wonderman auf die Jagd nach den<br />
Bösewichten dieser Welt schicken durfte.<br />
„So was hat DC Comics zuletzt vor 20 Jahren<br />
gemacht“, kann sich Al-Mutawa noch<br />
heute freuen. Auf diese Ausgaben bezog<br />
sich auch das präsidiale Lob, weil Obama<br />
diese Kooperation für die „innovativste Reaktion“<br />
auf seine Rede in Kairo hielt, wo<br />
er für ein Zusammenrücken von westlicher<br />
und muslimischer Welt plädiert hatte.<br />
Zusammen mit der niederländischen<br />
Produktionsfirma Endemol wird gerade die<br />
zweite Staffel der Fernsehserie produziert,<br />
in der dann auch ein deutscher Charakter<br />
als Teil der 99 Helden eingeführt werden<br />
soll.<br />
Neben den Büchern und der Fernsehserie<br />
gibt es in Kuwait-City auch einen Themenpark,<br />
den ein Lizenznehmer betreibt<br />
und der im Jahr etwa 300 000 Besucher<br />
zählt. Weitere Parks sind in Planung.<br />
Was Al-Mutawa bei dem ganzen Projekt<br />
antreibt, sind vor allem seine fünf Söhne,<br />
die zwischen vier und 15 Jahren alt sind.<br />
„Ich möchte, dass sie mit positiven Rollenbildern<br />
aufwachsen aus ihrem eigenen Kulturkreis“,<br />
sagt Al-Mutawa. Das ist in der islamischen<br />
Welt gar nicht so einfach, weil<br />
dort bisher eher palästinensische Selbstmordattentäter<br />
oder Osama bin Laden in die<br />
Kategorie Helden einsortiert werden, und<br />
in iranischen Kinderbüchern amputierte<br />
Märtyrer auf dem Weg zu den versprochenen<br />
72 Jungfrauen gezeigt werden.<br />
Das wollte Al-Mutawa nicht mehr<br />
länger akzeptieren, weil er während seiner<br />
Arbeit als Psychologe in New York und<br />
Kuwait genug traumatisierte Kriegs-, Folter-<br />
und Terroropfer behandelt hatte. „Ich<br />
war schon immer davon überzeugt, dass<br />
sich Extremismus nur mit Kunst und Kultur<br />
besiegen lässt“, sagt al Mutawa. „So war<br />
es in Europa während der Renaissance und<br />
der Reformation, und etwas Vergleichbares<br />
muss auch in der islamischen Welt<br />
passieren.“<br />
Nicht so einfach fiel es Al-Mutawa am<br />
Anfang, ein Team für sein Vorhaben zusammenzustellen.<br />
Der Businessplan war<br />
schnell geschrieben, und auch die erste Finanzierungsrunde<br />
mit sieben Millionen<br />
US‐Dollar 2003 verlief erstaunlich erfolgreich,<br />
aber die Skepsis von Autoren und<br />
Zeichnern ließ sich nicht so leicht überwinden.<br />
Kurz nach den Anschlägen vom<br />
11. September 2001 wollte kaum jemand<br />
mit einem muslimischen Jungverleger islamische<br />
Helden entwickeln.<br />
Al-Mutawas Verlag Teshkeel kaufte daraufhin<br />
2005 das Cracked-Magazin, ein wenig<br />
erfolgreiches Satireblatt, das nie an das<br />
Vorbild Mad heranreichte. Damit räumte<br />
er zumindest bei potenziellen Mitstreitern<br />
und Geldgebern die letzten Zweifel aus,<br />
dass es sich bei dem Macher von The 99 um<br />
einen religiösen Fanatiker handele. Denn<br />
der Kauf von Cracked durch einen radikalen<br />
Muslim war ungefähr so wahrscheinlich<br />
wie die Übernahme der Titanic durch den<br />
Vatikan. Prompt wollte sich bei der zweiten<br />
Finanzierungsrunde eine saudi-arabische<br />
Investmentbank nur unter der Bedingung<br />
beteiligen, dass Cracked verkauft<br />
wurde. Danach hoben die Saudis auch das<br />
Verbot der Comics in ihrem Land auf. „Ironie<br />
des Schicksals: Jetzt ist die Fernsehserie<br />
schon gelaufen, während der US‐Sender<br />
sie noch unter Verschluss hält.“ Das<br />
faktische Sendeverbot in den USA wurmt<br />
ihn weiterhin. Das merkt man daran, dass<br />
er plötzlich noch schneller redet, wenn er<br />
davon spricht.<br />
Gut, dass Al-Mutawa bei The 99 auch<br />
ein Vorbild für sich selbst eingebaut hat: Dr.<br />
Ramzi Razem, den Mentor der jungen Helden.<br />
Der sieht aus wie sein schlanker, größerer<br />
Bruder, ist aber deutlich ruhiger als Al-<br />
Mutawa. „So entspannt werde ich wohl erst<br />
20 Jahre nach meinem Tod sein“, sagt Al-<br />
Mutawa, der nebenbei auch noch eine psychologische<br />
Klinik mit 27 Therapeuten in<br />
Kuwait betreibt und an der medizinischen<br />
Fakultät lehrt. Auch hier ist er nicht dem elterlichen<br />
Rat gefolgt: „Wenn du Psychologie<br />
studierst, wirst du irgendwann zwangsläufig<br />
verrückt“, hat ihn sein Vater schon vor dem<br />
Studium gewarnt.<br />
Til KNipper<br />
leitet das Ressort<br />
Kapital bei <strong>Cicero</strong><br />
Fotos: Teshkeel Group, privat (Autor)<br />
88 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Mehr politische<br />
Kultur wagen<br />
Jetzt auch als<br />
ePAPER<br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Richard David Precht<br />
über<br />
deutsche Schulen<br />
„Wir brauchen eine Revolution!“<br />
SONNTAGS, 20:15 IN HANNOVER<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Die <strong>Cicero</strong>-Edition für das iPad oder als ePaper<br />
Profitieren Sie von den Vorteilen der digitalen <strong>Cicero</strong>-Version und lesen<br />
Sie als erster die aktuelle Ausgabe auf Ihrem iPad, Tablet oder Desktoprechner.<br />
Mit tagesaktuellen Beiträgen, Videos aus der Redaktion, der<br />
Literaturen-Bestenliste sowie mehr Karikaturen und Beiträgen.<br />
Mehr Informationen unter www.cicero.de/digital
| K a p i t a l | d e r E u r o i s t g e s c h e i t e r t<br />
Weiterhin ungehalteN<br />
Einst Kritiker der eigenen Zunft, knöpft sich der ehemalige WestLB-Chef<br />
jetzt die Kanzlerin vor – und plädiert für Deutschlands Austritt aus der Euro-Zone<br />
Von Ludwig Poullain<br />
Z<br />
u meinem langen Leben gehört<br />
auch die zwölf Jahre währende<br />
Phase, in der mir von den Nazis<br />
eigenständiges Denken untersagt<br />
war. Nach deren Vertreibung<br />
habe ich die Befreiung von dieser<br />
Zensur als die beste aller damaligen Errungenschaften<br />
empfunden. Danach habe<br />
ich eine längere Zeit gebraucht, bis es mir<br />
dämmerte, dass auch gewählte Regierende<br />
einer demokratischen Republik dazu neigen,<br />
ihren Untertanen vorzugeben, was<br />
und in welche Richtung sie zu denken haben<br />
und was zu denken sie vermeiden sollen,<br />
um es dafür lieber ihnen, den Oberen,<br />
zu überlassen.<br />
Nicht zuletzt hierauf führe ich es zurück,<br />
dass in unserem Land die Debattenkultur<br />
erstorben ist. Diskussionen, die per<br />
Definition ein Austausch von Intelligenz<br />
sein sollen, sind verpönt. Falls sich einer<br />
der Wortführer der Politik einmal eine eigene<br />
Meinung gebildet haben sollte, so<br />
wird sie kein noch so überzeugendes Argument<br />
jemals ändern können.<br />
Erst etwa ein Jahr nach ihrem <strong>Am</strong>tsantritt<br />
ist mir die Art der Bundeskanzlerin<br />
Merkel, durch Verschweigen ihrer Absichten<br />
und durch verstecktes Tun zu herrschen,<br />
aufgestoßen. Wenn sie es für unumgänglich<br />
hält, die Meinungsbildung der Bürger<br />
in eine ihr genehme Richtung zu lenken,<br />
so geschieht dies nicht etwa durch<br />
eine klare Vorgabe und die Darlegung der<br />
Gründe. Vielmehr pflegt sie uns nur etwa<br />
kurz zu verkünden, die Energieerzeugung<br />
sei auf den Kopf zu stellen, oder auch,<br />
dem notleidenden Griechenland sei Hilfe<br />
Ludwig Poullain<br />
Vom Saulus zum Paulus: Der 92‐jährige<br />
Poullain hat als ehemaliger Chef der<br />
WestLB und Präsident des Deutschen<br />
Sparkassen- und Giroverbands das deutsche<br />
Bankwesen geprägt. Selbst während seiner<br />
Zeit bei der WestLB in einen Skandal<br />
um einen Beratervertrag verstrickt, hat er<br />
sich nach seinem Abschied aus der Welt<br />
der Banker zu deren schärfsten Kritiker<br />
entwickelt. Berühmt geworden ist seine<br />
„Ungehaltene Rede“ über den Sittenverfall<br />
im deutschen Bankwesen, geschrieben 2004<br />
für die Verabschiedung des NordLB‐Chefs<br />
Manfred Bodin. Der Vortrag wurde<br />
aufgrund seines kritischen Inhalts<br />
kurzfristig abgesagt, erschien dann aber<br />
wenig später in voller Länge in der FAZ<br />
zu gewähren, um dann, anstelle einer fälligen<br />
Begründung, den Nachsatz anzuhängen,<br />
dies sei alternativlos.<br />
Mit diesem Hinweis errichtet sie offenkundig<br />
Verbotsschilder für Andersdenkende.<br />
Nachdem mir dieses Taktieren<br />
bewusst geworden ist, lehne ich mich dagegen<br />
auf und zwinge mich dazu, das mir<br />
von ihr Vorgesetzte nicht mehr als gegeben<br />
hinzunehmen und das von ihr zum Tabu<br />
Erklärte besonders sorgfältig durch meine<br />
Hirnwindungen zu drehen.<br />
Das gilt aktuell natürlich besonders in<br />
Bezug auf die von ihr gewählte Methode,<br />
unsere Gemeinschaftswährung zu retten.<br />
Ich glaube beobachten zu können, dass sie<br />
sich bei der Pflege dieses Homunkulus namens<br />
Euro mittlerweile keine Mühe mehr<br />
gibt, uns Bürgern vorzugaukeln, sie bedächte<br />
hierbei irgendetwas. Mit ihrem Finanzminister<br />
macht sie das, was sie glaubt,<br />
aus dem Diktat der Märkte folgern zu<br />
müssen. Denn diese allein lenken ihr Tun.<br />
Wenn sie mit dem, was sie anrichten, wenigstens<br />
das Ende bedenken würden! Doch<br />
die schiere Automatik ihrer Handlungen<br />
lässt mich argwöhnen, dass sie davon ausgehen,<br />
diese vermeintlichen Rettungstaten<br />
bis zum jüngsten Tag fortsetzen zu können.<br />
Just die Folgen eines solchen Gebarens<br />
bis zu seinem Ende zu bedenken, dies habe<br />
ich versucht. Das Ergebnis dieses abenteuerlichen<br />
Unterfangens ist hier zu lesen.<br />
Der Niederschrift schicke ich die Aufklärung<br />
voraus, dass ich hierbei von meinen<br />
Erfahrungen als Vorstand der zu seiner<br />
Zeit noch wohlfunktionierenden WestLB<br />
sowie als (nebenamtlicher) Präsident des<br />
Foto: Dominik Asbach/Laif; Illustration: Robert Zimmermann<br />
90 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands<br />
gezehrt habe.<br />
Anders als die in dieser Zeit im <strong>Am</strong>t<br />
des Sparkassenpräsidenten Agierenden, die<br />
sich als Cheflobbyisten der deutschen Sparkassen<br />
verstehen, habe ich in den siebziger<br />
Jahren die Sparer zum Dreh- und Angelpunkt<br />
meines Handelns gemacht, als es<br />
galt, das von ihnen mühsam Erarbeitete vor<br />
der Gefahr einer importierten Inflation zu<br />
bewahren. Den meisten der damals arbeitenden<br />
Bürger war das mit ihnen im Jahre<br />
1948 Geschehene noch allzu gegenwärtig,<br />
als durch die Währungsreform über Nacht<br />
100 Mark auf 7,50 Mark reduziert wurden.<br />
Ich bin mir sicher, dass Frau Merkel jener<br />
Generation ihre groß angelegte Schuldenvermehrung<br />
mit dem ihm innewohnenden<br />
riesigen Inflationspotenzial nicht hätte<br />
oktroyieren können. Sie hätten ihr bei der<br />
nächsten Wahl ihre Stimmen entzogen.<br />
Was die Kanzlerin in dieser Euroschuldenkrise<br />
hätte anders machen sollen? Ganz<br />
einfach: bereits beim ersten Hilfeschrei der<br />
Griechen bei dem „Nein“, das sie in der allerersten<br />
Reaktion von sich gegeben hatte,<br />
zu verharren und standhaft zu bleiben bis<br />
zum heutigen Tag. Um wie vieles besser erginge<br />
es heute den Hellenen, wenn sie den<br />
von den Geberländern zugeteilten Schuldenberg<br />
nicht mit sich herumschleppen<br />
müssten, stattdessen zur Drachme zurückgekehrt<br />
wären und sich dann ihrer Lieblingsbeschäftigung<br />
hätten hingeben können,<br />
ihre eigene Währung nach eigenem<br />
Belieben abzuwerten. Auf der Geberseite<br />
verfügten alle Staaten, die den Griechen<br />
glaubten, zur Hilfe eilen zu müssen, auch<br />
heute noch über ihre Moneten. Und mangels<br />
Präzendenzfalls hätten sich folgende,<br />
durch eigenes Verschulden in Not geratene<br />
Länder nicht auf Griechenland berufen<br />
können.<br />
Wenn die Überweisungen wenigstens<br />
etwas Positives bewirkt hätten! Dies vermochten<br />
sie allein schon deswegen nicht,<br />
weil sie für die Behebung der Schäden, die<br />
die Griechen durch den Missbrauch des<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 91
| K a p i t a l | d e r E u r o i s t g e s c h e i t e r t<br />
billigen Euro sich selbst zugefügt hatten,<br />
ungeeignet waren. Nicht einmal die Symptome<br />
konnten sie lindern, wie hätten sie<br />
gar den Grund des Übels wirksam bekämpfen<br />
können? Dieser lag nämlich nicht in<br />
der bloßen Anhäufung von Schulden, sondern<br />
in der mangelnden Leistungsfähigkeit<br />
ihrer Volkswirtschaft.<br />
Die aus all diesen Hilfsmaßnahmen<br />
rührenden furchteinflößenden Verpflichtungen<br />
unseres Staates in Höhe von zurzeit<br />
etwa 310 Milliarden Euro können darum<br />
also auch nur als ein Zwischenstand betrachtet<br />
werden. Ich bin mir sicher, dass die<br />
auf zustimmendes Kopfnicken getrimmten<br />
Mitglieder des Deutschen Bundestags<br />
diesem Schuldenbetrag ein stetes Wachstum<br />
garantieren.<br />
Dass die Regierungen der sich in Zahlungsschwierigkeiten<br />
manövrierten Länder<br />
die einfachsten Gebote der Sittsamkeit<br />
missachten, also dreist den Beistand<br />
der ordentlich Wirtschaftenden fordern,<br />
anstatt höflich um Beistand zu bitten, wundert<br />
mich nicht. Ich habe schon als junger<br />
Kreditsachbearbeiter einer Sparkasse<br />
genau dieses Verhalten bei Kreditsuchenden<br />
beobachtet. Kunden mit einwandfreier<br />
Bonität pflegten ihre Anliegen artig vorzutragen,<br />
während die andere Sorte frech<br />
auf ihren vermeintlichen Rechtsanspruch<br />
pochte, auch ohne Offenlegung ihrer miesen<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse jeden Kredit<br />
zu erhalten. Heute weiß ich, dass eine<br />
solche Haltung für Hochverschuldete, die<br />
ihren Zustand selbst herbeigeführt haben,<br />
systemimmanent ist.<br />
Zusammengefasst lautet das erste Ergebnis<br />
meines ungebührlichen Denkens:<br />
Alle bisherigen Hilfsmaßnahmen waren<br />
nutzlos, und sie werden es fürderhin sein.<br />
Das geflossene Geld ist weg, die Eurorettung<br />
ein einziges Fiasko.<br />
Nicht nur Griechenland und Portugal<br />
kranken an der mangelhaften Wettbewerbsfähigkeit<br />
ihrer Wirtschaft, Spanien<br />
und Italien plagen dieselben Symptome,<br />
und ganz offensichtlich leidet auch Europas<br />
sogenannter Industriestaat Nummer<br />
zwei, Frankreich, hieran.<br />
Und darum ist Griechenland für mich<br />
nicht das Problem. Diese Sache wird sich<br />
nahezu automatisch regeln. Es liegt vielmehr<br />
bei den drei großen, sich immer noch<br />
als bedeutende Industrienationen gebärdenden<br />
Ländern Frankreich, Italien und<br />
Spanien, von denen unser Nachbarland der<br />
schwierigste und auch schwerwiegendste<br />
Fall ist. Gewiss, noch sind die Märkte ruhig<br />
– sie haben aktuellere Fälle vor ihren<br />
Flinten. Jedoch werden sie sich, wenn die<br />
noch unter der Oberfläche schlummernden<br />
gravierenden Strukturschwächen<br />
Das geflossene Geld ist weg,<br />
die bisherige Eurorettung ein<br />
einziges Fiasko<br />
Frankreichs offenkundig werden, dieses<br />
Landes mit besonderer Inbrunst annehmen.<br />
Mit der Einführung der Gemeinschaftswährung<br />
haben diese drei Länder<br />
die Pflege ihrer Industrielandschaft bewusst<br />
vernachlässigt. Anstelle einer anstrengenden<br />
Industriegesellschaft haben<br />
sie sich für die bequemere der Dienstleistungen<br />
entschieden. Diese Strukturänderung<br />
hat zu einer endgültigen Vernichtung<br />
von Millionen von Industriearbeitsplätzen<br />
geführt. Sie sind durch kein Wachstumsprogramm<br />
neu zu schaffen. Diese Lücken<br />
gehören nunmehr endgültig auch zur<br />
Struktur dieser Länder. Sie bedingen Arbeitslosenquoten,<br />
die über Jahrzehnte auf<br />
einem Sockel im zweistelligen Prozentbereich<br />
verharren werden. Als weitere Folge<br />
dieser Deindustrialisierung wird das Bruttosozialprodukt<br />
dieser Staaten in Zukunft<br />
kein erwähnenswertes Wachstum erfahren<br />
können, und deswegen wird sich auch die<br />
Staatsverschuldung weiterhin zwangsweise<br />
erhöhen. An dieser Konsequenz werden<br />
alle Fiskalpakte dieser Welt nichts ändern<br />
können.<br />
Der nach meinen Beobachtungen bereits<br />
vor einigen Jahrzehnten begonnene<br />
Prozess der Deindustrialisierung ist während<br />
der Vor-Euro-Epoche durch laufende<br />
Abwertungen der Francs, Lira und Peseten<br />
absorbiert worden und hat sich deshalb auf<br />
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie dieser<br />
Länder nicht ausgewirkt. Ich war erschreckt,<br />
als ich mir deutlich gemacht habe,<br />
wie weit sich der Wert des französischen<br />
Franc in der Zeit von 1950 bis zur Einführung<br />
des Euro von dem der Deutschen<br />
Mark entfernt hat: Durch Abwertungen ist<br />
er in jedem Jahrzehnt um durchschnittlich<br />
30 Prozent gesunken.<br />
Der Kern aller Gründe für die mangelnde<br />
Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder<br />
liegt in der mangelnden Flexibilität. Frankreich,<br />
ebenso Italien wie auch Spanien, hätten,<br />
wenn es ihnen denn möglich gewesen<br />
wäre, auch in jüngerer Zeit mehrfach abgewertet.<br />
Doch das System lässt solches nun<br />
einmal nicht zu. Der Euro liegt wie ein Leichentuch<br />
über diesen Ländern.<br />
Zwar gibt es, rein theoretisch, noch<br />
ein weiteres Regulativ, auf das aber schon<br />
mangels politischer Umsetzbarkeit nicht<br />
zurückgegriffen werden kann: eine der<br />
unterbliebenen Abwertungsquote entsprechende<br />
Kürzung der sozialen Leistungen.<br />
Die Griechen und nunmehr auch die Spanier<br />
demonstrieren, dass ein solch grundsätzlich<br />
probates Mittel in der Praxis immer<br />
am militanten Widerstand der Betroffenen<br />
scheitern muss.<br />
Die aus den herrschenden Verzerrungen<br />
herrührenden Spannungen belasten<br />
nicht nur die Finanzmärkte, sie haben<br />
auch schon längst die Gemüter der Bürger<br />
erfasst. Neben der Wut über die verhängten<br />
Einschränkungen haben sich Neid<br />
und Missgunst der Völker des Südens bemächtigt,<br />
derweil die Nordländer, die vermeintlichen<br />
Tresorverwalter, sich schwarz<br />
darüber ärgern, dass jede ihrer Überweisungen<br />
nur mit einem lauten Schrei nach<br />
mehr quittiert wird.<br />
Komme mir nur jetzt keiner mit der<br />
These, der Euro habe die Völker vor einem<br />
neuen Krieg bewahrt, oder ärger noch:<br />
Nur sein Bestand vermöge in Zukunft einen<br />
Krieg zu verhindern. Auch ohne Euro<br />
wird in Europa niemals mehr aufeinander<br />
geschossen werden.<br />
Abgesehen von der Generalklausel der<br />
Verfechter des Euro, dass ein jeder, der<br />
sich gegen ihn als Währungsmittel wendet,<br />
ein Verräter am vereinigten Europa<br />
ist, gibt es eine weitere Unterstellung, die<br />
nicht beweisbar, aber weitverbreitet ist:<br />
Kein Land habe vom Euro so profitiert<br />
wie Deutschland, bei einem Verlassen der<br />
92 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Gemeinschaftswährung werde sich das ins<br />
Gegenteil verkehren.<br />
Meine Wahrnehmungen und Erfahrungen<br />
der vergangenen sieben Jahrzehnte<br />
als Bankier und Beobachter der Weltwirtschaft<br />
lassen mich zu dem Schluss kommen,<br />
dass das Gegenteil richtig ist: Die<br />
Grundlage der Leistungsfähigkeit unserer<br />
Industrie ist während der Zeit der Deutschen<br />
Mark gelegt worden. Wie sich heutige<br />
Lobbyisten gegen jedwede Änderungen<br />
wehren, so stemmten sich während<br />
der Herrschaft der festen Wechselkurse des<br />
Bretton-Woods-Systems die vorgeschobenen<br />
Interessenwahrer der deutschen Industrie<br />
gegen jedwede Aufwertung der Deutschen<br />
Mark gegenüber dem Dollar. Auch<br />
damals schon waren es die bösen Spekulanten,<br />
die, wenn die Ungleichgewichte der<br />
beiden Währungen auf den Märkten Wirkung<br />
zeigten, durch Anhäufungen der Dollars<br />
auf den Konten der Deutschen Bundesbank<br />
die Politik auf Trab brachten. Wenn<br />
man denn den beschwörenden Worten der<br />
Bewahrer hätte Glauben schenken können,<br />
drohte mit jeder Aufwertung der Mark der<br />
Weltuntergang, hätte sie doch Deutschlands<br />
Wettbewerbsfähigkeit zerstört und<br />
damit die Exporte zum Erliegen gebracht.<br />
Doch, oh Wunder, stets trat das genaue<br />
Gegenteil ein, verzeichnete doch das<br />
Statistische Bundesamt nach jeder Aufwertung<br />
weitere kräftige Zunahmen der<br />
Exportaufträge.<br />
Die Gründe für diese Erscheinung liegen<br />
auf der Hand: Eine jede Aufwertung<br />
zwang die deutsche Industrie, ihre Produkte<br />
zu verbessern und die Produktivität<br />
zu erhöhen. In dicken Lettern schreibe ich<br />
es nieder: Mit jeder Aufwertung der Deutschen<br />
Mark ist die deutsche Industrie leistungsfähiger<br />
geworden. Die Grundlage ihres<br />
heutigen hohen Standards ist in jener<br />
Zeit gelegt worden. Als Ergebnis dieser Prozesse<br />
halte ich fest, dass nicht der Preis eines<br />
Produkts allein das entscheidende Kriterium<br />
für eine Auftragserteilung ist; vielmehr<br />
sind seine Qualität und die Zuverlässigkeit<br />
von Lieferung und Leistung von<br />
ausschlaggebender Bedeutung.<br />
Schwankenden Wechselkursen und damit<br />
der Gefahr fallender Erlöse aufgrund<br />
sich verteuernder Euros unterliegt unsere<br />
Exportindustrie auch heute auf den Märkten<br />
außerhalb des Euroraums. Allerdings<br />
erleichtert der infolge der Eurokrise niedrige<br />
Kurs des Euro gegenüber dem Dollar<br />
zurzeit die Geschäfte. Ich gehe davon<br />
aus, dass dieser Umstand ein wesentlicher<br />
Grund dafür ist, dass die Herren der großen<br />
deutschen Industriekonzerne so leidenschaftlich<br />
für den Erhalt des Euro votieren.<br />
Dass sich auch der Verband der deutschen<br />
Banken zu diesen Befürwortern gesellt,<br />
gehört zur Wahrung der Interessen<br />
seiner Mitglieder, verspricht doch der weitere<br />
Bestand der Gemeinschaftswährung<br />
eine fortwährende wundersame Geldvermehrung<br />
durch die Europäische Zentralbank<br />
(EZB). Deren Präsident Mario<br />
Draghi muss ich zumindest ob der Unbekümmertheit,<br />
mit der er seinem Herkunftsland<br />
durch die von ihm geleitete<br />
Institution Beihilfe zur Zinssenkung für<br />
Staatsanleihen gewährt, fast schon so etwas<br />
wie stille Bewunderung zollen.<br />
Die deutsche Industrie, die, dies sei an<br />
dieser Stelle angemerkt, die Trägerin des<br />
Anzeige<br />
Was denkbar ist, ist machbar.<br />
In der IT. In Berlin.<br />
Grenzen überwinden – wie das geht, hat Berlin schon<br />
einmal gezeigt. Heute öffnen sich hier für die IT neue<br />
Horizonte. Denn in der Stadt treffen Weltmarktführer<br />
der IT-Branche auf Start-ups, arbeiten Wirtschaftsgrößen<br />
mit jungen Kreativen, tauschen sich innovative<br />
Forscher mit engagierten Investoren aus. Für die<br />
digi tale Wirtschaft ist Berlin Marktplatz, Labor,<br />
Wissensbörse, Sprungbrett und mehr.<br />
Wie viel mehr? Finden Sie es heraus. In Berlin. Log in.<br />
www.loginberlin.de
| K a p i t a l | d e r E u r o i s t g e s c h e i t e r t<br />
Fortschritts und des Wohlstands und auch<br />
der Finanzier unseres Sozialstaats ist, hat<br />
in Zukunft weltweit wachsende Märkte<br />
zu erwarten. Entwicklungsländer werden<br />
zu Schwellenländern, und Schwellenländer<br />
wachsen zu Industrienationen heran –<br />
alle aufnahmefähig für deutsche Produkte.<br />
Die Initiatoren des Euro waren der<br />
Wahnvorstellung unterlegen, die Gemeinschaftswährung<br />
würde die ihr<br />
angehörenden Länder zu einer<br />
mächtigen Wirtschaftsmacht zusammenfügen,<br />
die den beiden anderen<br />
Monolithen, den USA und<br />
China, Paroli bieten würde. Doch<br />
der Homunkulus Euro hat das genaue<br />
Gegenteil bewirkt. Er hat die<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Schwächeren<br />
weiterhin eingeschränkt<br />
und damit eine Machtblockbildung<br />
unmöglich gemacht. Von<br />
den vermeintlichen Industrienationen<br />
Frankreich, Italien und<br />
Spanien im globalen Wettbewerb<br />
im Stich gelassen, tummelt sich<br />
Deutschland allein auf den globalen<br />
Märkten.<br />
Trifft ihn die Ironie der Geschichte,<br />
oder wird er von der<br />
Strafe der Götter heimgesucht, der<br />
ehemalige Präsident der Republik<br />
Frankreich, François Mitterrand,<br />
weil das Mittel, der Euro, den er<br />
erkor, die Wirtschaftskraft der<br />
Deutschen zu schwächen, nicht<br />
diese, sondern sein eigenes Land<br />
getroffen hat? Erzählt uns die griechische<br />
Mythologie nicht auch schon von Krösus,<br />
der sein eigenes Imperium zerstörte, nachdem<br />
er die Einflüsterungen der Pythia, er<br />
würde, wenn er denn seinen Feind angreife,<br />
ein großes Reich zerstören, falsch deutete?<br />
Was also folgere ich aus dem bislang in<br />
diesem Beitrag Aufgereihten? Die Strukturprobleme<br />
werden Spanien, Italien und<br />
Frankreich, eines nach dem anderen, an die<br />
Wand drücken. Sie werden, wahrscheinlich<br />
in dieser Reihenfolge, Hilfe erbitten müssen.<br />
Frau Merkel mit ihren blinden Terrakottasoldaten<br />
im Gefolge nicht nur aus<br />
ihrer Partei wird sie so lange gewähren lassen,<br />
bis Deutschland selbst am Ende sein<br />
wird. Und welche andere Rettungsstation<br />
bliebe uns dann wohl noch außer China?<br />
Doch gemach! So weit wird es nicht<br />
kommen. Noch bevor es eine Rettungsaktion<br />
für Italien gibt, werden wir einen<br />
gewaltigen Knall, so etwas wie einen währungspolitischen<br />
Urknall erleben, mit<br />
dem das Eurokartenhaus in sich zusammenfällt.<br />
Doch zur großen Verwunderung<br />
aller wird sich bei der Sichtung der<br />
Reste ergeben, dass die im Tresor gelagerten<br />
Werte und Substanzen erhalten sind<br />
und dass sich aus ihnen gesundes Neues<br />
gestalten lässt.<br />
Aus dieser Erkenntnis schöpfend entwickle<br />
ich den verwegen klingenden Vorschlag,<br />
dass das nach Größe und Struktur<br />
am besten ausgestattete Land, und<br />
das ist in Europa nun einmal Deutschland,<br />
nicht länger auf Godot, also darauf<br />
warten sollte, bis sich Griechenland und<br />
dann, peu à peu, auch weitere Staaten aus<br />
dem Euro verabschieden müssen. Stattdessen<br />
sollten wir uns selbst aus dem Gewürge<br />
lösen, eine neue Währung kreieren<br />
und hierzu die Staaten und Völker gleicher<br />
Struktur und Gesinnung einladen. Zu diesen<br />
zähle ich die skandinavischen Länder,<br />
die Niederlande, Österreich selbstredend,<br />
aber auch die Schweiz würde unter diesen<br />
Umständen daran Gefallen finden,<br />
sich solch einem Gebilde anzuschließen,<br />
denken und handeln doch die alten Eidgenossen<br />
ebenso stabilitätsorientiert und<br />
industriepolitisch wie wir und bewegen<br />
sich dabei auf höchstem Niveau. Ja, und<br />
die Franzosen, bitte schön, auch, aber nur<br />
dann, wenn sie sich den stringenten Regeln<br />
der neuen Gemeinschaft unterwerfen.<br />
Um Deutschland ist mir dabei nicht<br />
bange. Eine neue Währung, wie immer<br />
sie auch aussehen oder heißen mag, wird<br />
zwar die während der Euroherrschaft unterbliebene<br />
Aufwertung gegenüber den anderen,<br />
im Euroverbund verbleibenden<br />
Ländern nachholen müssen.<br />
In dieser Phase wird die deutsche<br />
Industrie hart zu kämpfen haben,<br />
doch sie wird sich durchbeißen<br />
und diese Belastung, wie weiland<br />
zu Bretton-Woods-Zeiten, auch<br />
als Chance nutzen, ihre Produkte<br />
zu modernisieren, ihre Qualität<br />
zu verbessern und dabei gleichzeitig<br />
ihre Produktivität zu erhöhen.<br />
Ein solcher Gang würde<br />
auch nicht nationaler Überheblichkeit<br />
entsprießen, sondern<br />
wäre zunächst ohnehin nur ein<br />
Notausstieg.<br />
Das sogenannte „vereinte“ Europa<br />
oder gar die Vereinigten Staaten<br />
von Europa blieben dabei auf<br />
der Strecke. Aber was für ein Europa<br />
wäre ein solches Gebilde überhaupt?<br />
Das Europa der Brüsseler<br />
Technokraten, die aus einem Gewirr<br />
endloser Knäuel ein Europa<br />
hunderttausendfacher Reglements<br />
stricken? Oder das Europa, dessen<br />
Interessen von den in erster Linie<br />
auf die Wahrung nationaler Belange bedachten<br />
Regierungschefs immer erst dann<br />
in Betracht gezogen werden, nachdem sie<br />
sich gegenseitig über den Tisch gezogen haben?<br />
Oder das Europa der Wunsch- und<br />
Wahnvorstellungen, die sich in den Köpfen<br />
der Bürger nach den Feiertagsreden der Berufseuropäer<br />
gebildet haben?<br />
Wie ich begonnen habe, so beende ich<br />
diese Gedanken mit einer persönlichen Anmerkung.<br />
Im Jahre 1930, also drei Jahre<br />
vor dem Machtantritt Hitlers, wurde ich<br />
damals als zehnjähriger Sextaner in ein<br />
Gymnasium eingeschult, das das Französische<br />
als erste Fremdsprache lehrte. Mein<br />
Lehrer, Frontsoldat des Ersten Weltkriegs,<br />
bläute uns Knaben ein, diese Sprache mit<br />
Eifer zu lernen, weil wir sie später als Soldaten<br />
im Revanchekrieg gegen Frankreich<br />
bei der Besetzung dieses Landes gut verwenden<br />
könnten. Wir Jungen fanden an<br />
Illustration: Robert Zimmermann<br />
94 <strong>Cicero</strong> 9.2012
dieser Rede nichts Anstößiges, galt doch<br />
Frankreich damals im ganzen Land als<br />
unser Erbfeind. Als Ergebnis dieser Lehre<br />
habe ich mich 1939 als 19-Jähriger freiwillig<br />
zur Truppe gemeldet und dann im Verlauf<br />
des Krieges vier Jahre lang in Russland<br />
als Sturmgeschützler meinen Teil dazu beigetragen,<br />
Europa zu zerstören.<br />
1945, kurz nach Ende des Krieges, habe<br />
ich im Kreis der wenigen mir verbliebenen<br />
Klassenkameraden den Schwur getan,<br />
nie wieder in unserem Leben auf andere zu<br />
schießen. Damals wähnten wir uns als die<br />
ersten Europäer.<br />
Die Euphorie, mit der wir Gleichgesinnten<br />
nach dem Krieg Europa anstrebten,<br />
entsprang dem Bedürfnis, nach der Welt<br />
des Mordens zukünftig auf einem Kontinent<br />
des Friedens zu leben.<br />
Um dies sicherzustellen, erschien auch<br />
mir in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende<br />
der Weg, die Grenzen zwischen den<br />
Völkern verschwinden zu lassen, als der logische.<br />
Damals habe ich nicht bedacht, wie<br />
viel andersartig sie doch alle sind, die Griechen<br />
und Norweger, die Italiener und Finnen,<br />
die Spanier, Serben, Holländer, Balten<br />
und die Deutschen. Europa ist nun einmal<br />
von seiner Geschichte, seinen Völkern und<br />
ihren Kulturen als Ansammlung von Nationalstaaten<br />
geprägt. Das sollten auch die<br />
Einigungsfetischisten respektieren und es<br />
dabei belassen.<br />
Kehren wir also zur EWG, der Europäischen<br />
Wirtschaftsgemeinschaft, zurück.<br />
Das war die richtige Einrichtung, weil sie<br />
es den einzelnen Ländern ermöglichte,<br />
freien und friedlichen Handel miteinander<br />
zu treiben und ein jedes Volk nach seiner<br />
Fasson glücklich werden zu lassen. Und<br />
dies jeweils auf eigene Kosten.<br />
Ist das, was ich mir zusammengedacht<br />
habe, nur ein Hirngespinst? Sicherlich ist<br />
der Gedanke insoweit eine Utopie, unsere<br />
Regierung vermöchte die Initiative entwickeln<br />
und die Tatkraft aufbringen, eine<br />
solche Lösung aktiv anzustreben. Darum<br />
also wird das Spektakel – so wie bislang geübt,<br />
aber noch zusätzlich durch wachsende<br />
feindselige Emotionen angeheizt – weitergehen,<br />
bis es zu dem von mir genannten<br />
Knall kommt. Das sich hiernach entwickelnde<br />
Gebilde wird zwar eher von Zufälligkeiten<br />
gestaltet sein, aber es wird um ein<br />
Vielfaches besser werden, als das vom unglückseligen<br />
Homunkulus Euro geprägte<br />
jemals werden kann.<br />
Anzeige<br />
Drei Monate zum Vorzugspreis testen:<br />
<strong>Cicero</strong> im Probeabo<br />
Entdecken Sie Ihre Abo-Vorteile:<br />
Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein.<br />
Frei Haus: <strong>Cicero</strong> wird ohne Aufpreis zu Ihnen nach Hause geliefert .<br />
Vorteilspreis: Drei Ausgaben für nur 16,50 EUR* statt 24,– EUR.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 16,50 EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 16,50 EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts<br />
weiter zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,– EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt<br />
8,– EUR im Einzelverkauf) und spare so über 10 %. Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von<br />
zwei Wochen nach Erhalt der dritten Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das<br />
Abonnement jederzeit kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin,<br />
Geschäftsführer Rudolf Spindler. *Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 858364<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Unterschrift<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
16,50 EUR*
| K a p i t a l | B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t<br />
Der Systembruch<br />
<strong>Am</strong> 12. September fällt Karlsruhe sein Urteil über den ESM. Ein ehemaliger<br />
Verfassungsrichter wagt eine Prognose<br />
von Hans Hugo Klein<br />
M<br />
it groSSer Spannung erwartet<br />
nicht nur die deutsche Politik<br />
das Urteil, mit dem das<br />
Bundesverfassungsgericht am<br />
12. September – der Form<br />
nach vorläufig, der Sache nach aber definitiv<br />
– über die Vereinbarkeit sowohl des<br />
Fiskalpakts als auch des Vertrags zur Einrichtung<br />
des Europäischen Stabilitätsmechanismus<br />
(ESM) mit dem Grundgesetz<br />
entscheiden wird. Der Fiskalpakt verfolgt<br />
das Ziel, die wirtschaftliche Säule der Währungs-<br />
und Wirtschaftsunion zu stärken. Er<br />
will die seit Jahren schmerzlich vermisste<br />
Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten der<br />
Eurozone gewährleisten, indem er sie zur<br />
Einführung von Schuldenbremsen nach<br />
deutschem Vorbild und zu einem ausgeglichenen<br />
Haushalt verpflichtet. Die Vertragsparteien<br />
verpflichten sich zur Korrektur<br />
vertragswidriger Defizite und unterwerfen<br />
sich der Überwachung durch Rat und<br />
Kommission. Die Gewährung von Leistungen<br />
aus dem ESM wird an die Ratifizierung<br />
des Fiskalpakts und an die Einführung nationaler<br />
Schuldenbremsen geknüpft.<br />
Der Fiskalpakt schließt damit eine Lücke,<br />
die seit der Einführung der Währungsunion<br />
durch den Vertrag von Maastricht<br />
bestand. Der sogenannte Stabilitäts- und<br />
Wachstumspakt konnte diese Lücke nicht<br />
schließen, zumal er aufgeweicht wurde,<br />
als er seine Bewährungsprobe hätte ablegen<br />
sollen. Der Fiskalpakt ist nicht verfassungswidrig,<br />
obgleich er das nationale Budgetrecht<br />
spürbar einschränkt. Schon das<br />
Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts<br />
(1993) hat auf das finanzpolitische<br />
Defizit der Währungsunion hingewiesen<br />
und erklärt, dass für die Ergänzung der<br />
Währungs- durch eine Wirtschaftsunion<br />
„rechtlich Raum“ sei. Das Lissabon-Urteil<br />
(2009) hebt hervor, dass die vom Grundgesetz<br />
erlaubte Mitwirkung Deutschlands an<br />
der Entwicklung der EU auch eine politische<br />
Union umfasst, also „die gemeinsame<br />
Ausübung öffentlicher Gewalt … bis hinein<br />
in die Kernbereiche des staatlichen Kompetenzraums“,<br />
zu denen auch das Budgetrecht<br />
gehört. Das Urteil vom 7. September<br />
2011 schließlich betont, dass Deutschland<br />
Ohne das Ziel der<br />
Preisstabilität dürfte<br />
Deutschland laut<br />
Verfassung am Euro<br />
nicht teilhaben<br />
sich mit der Öffnung für die europäische<br />
Integration auch finanzpolitisch bindet.<br />
Das Budgetrecht werde auch dann nicht<br />
verletzt, wenn solche Bindungen einen erheblichen<br />
Umfang annähmen.<br />
Mit dem Fiskalpakt wird also nur nachgeholt,<br />
was im Integrationsprogramm des<br />
Maastricht-Vertrags tendenziell bereits angelegt<br />
war und über zwei Jahrzehnte hinweg<br />
versäumt worden ist. Die Haushaltsautonomie<br />
eines Staates wird nicht dadurch<br />
aufgehoben, dass der Haushaltsgesetzgeber<br />
sich sehenden Auges in die Verschuldensfalle<br />
begibt, also wissentlich gegen ihn bindendes<br />
supranationales Recht verstößt und<br />
die dort vorgesehenen Sanktionen auslöst.<br />
Die verfassungsrechtliche Problematik<br />
des ESM-Vertrags ist anders gelagert.<br />
Durch den Vertrag wird eine „internationale<br />
Finanzinstitution“ (Artikel 1)<br />
eingerichtet, die die Aufgabe hat, „Finanzmittel<br />
zu mobilisieren und ESM-<br />
Mitgliedern, die schwerwiegende Finanzierungsprobleme<br />
haben, … unter strikten …<br />
Auflagen eine Stabilitätshilfe bereitzustellen,<br />
wenn dies zur Wahrung der Finanzstabilität<br />
des Euro-Währungsgebiets insgesamt<br />
und seiner Mitgliedstaaten unabdingbar<br />
ist“ (Artikel 3). Zu diesem Zweck wird<br />
der ESM mit einem Stammkapital von<br />
700 Milliarden Euro ausgestattet, bestehend<br />
aus 80 Milliarden eingezahltem und<br />
620 Milliarden abrufbarem Kapital. Davon<br />
entfallen auf Deutschland 21,7 beziehungsweise<br />
168,3 Milliarden, zusammen<br />
also 190 Milliarden Euro.<br />
Über die Vergabe der dem ESM zur<br />
Verfügung stehenden Mittel entscheidet<br />
der Gouverneursrat, in dem jede Vertragspartei<br />
mit einem für die Finanzen zuständigen<br />
Regierungsmitglied vertreten ist.<br />
Einstimmig, in Dringlichkeitsfällen mit<br />
der qualifizierten Mehrheit von 85 Prozent<br />
der Stimmen, beschließt der Gouverneursrat<br />
unter anderem über die Gewährung<br />
von Stabilitätshilfen einschließlich der<br />
damit verbundenen wirtschaftspolitischen<br />
Auflagen. Das bedeutet, dass Deutschland,<br />
das mehr als 27 Prozent des Stammkapitals<br />
hält, in keinem Fall überstimmt werden<br />
kann. Generell gilt, dass wichtige Entscheidungen<br />
(wie zum Beispiel über unmittelbare<br />
Zahlungen an Banken) nur einstimmig<br />
getroffen werden können.<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat in<br />
seinem Urteil vom 7. September 2011<br />
bereits entschieden, dass der Bundestag<br />
„auch in einem System intergouvernementalen<br />
Regierens die Kontrolle über grundlegende<br />
haushaltspolitische Entscheidungen<br />
behalten“ muss. Daraus folgt, dass<br />
96 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Anzeige<br />
Erfolg ist zeitlos<br />
Foto: picture alliance<br />
der Bundestag „seine Budgetverantwortung<br />
nicht durch unbestimmte haushaltspolitische<br />
Ermächtigungen auf andere Akteure<br />
übertragen“ darf. „Insbesondere darf<br />
er sich keinen finanzwirksamen Mechanismen<br />
ausliefern, die … zu nicht überschaubaren<br />
haushaltsbedeutsamen Belastungen<br />
ohne vorherige konstitutive Zustimmung<br />
führen können …“ Von Verfassungs wegen<br />
ist der Bundestag gehindert, „einem …<br />
nicht an strikte Vorgaben gebundenen und<br />
in seinen Auswirkungen nicht begrenzten<br />
Bürgschafts- oder Leistungsautomatismus“<br />
zuzustimmen, „der – einmal in Gang gesetzt<br />
– seiner Kontrolle und Einwirkung<br />
entzogen ist“.<br />
Eine Regelung, die es ermöglicht, dass<br />
„fiskalische Dispositionen anderer Mitgliedstaaten<br />
zu irreversiblen, unter Umständen<br />
massiven Einschränkungen der nationalen<br />
Gestaltungsspielräume führen“, darf der<br />
Bundestag nicht beschließen. Eine „Haftungsübernahme<br />
für Willensentscheidungen<br />
anderer Staaten“ ist verfassungsrechtlich<br />
ausgeschlossen. Deutlicher konnte das<br />
Bundesverfassungsgericht nicht zum Ausdruck<br />
bringen, dass „Eurobonds“ jeder Art<br />
mit dem geltenden Verfassungsrecht nicht<br />
vereinbar sind.<br />
Für die verfassungsrechtliche Beurteilung<br />
des ESM‐Vertrags kommt es nun darauf<br />
an, ob er sich in diesem Rahmen hält<br />
(ob sich also zum Beispiel die Haftung<br />
Deutschlands tatsächlich auf jene 190 Milliarden<br />
Euro beschränkt), oder ob sie, ohne<br />
dass der Bundestag noch darauf Einfluss<br />
hätte, eine weit größere Dimension erreichen<br />
könnte. So wird behauptet (aber<br />
auch bestritten), dass der ESM nach Artikel<br />
21 des Vertrags unbeschränkt Kredite<br />
aufnehmen könnte, für die alle Mitgliedstaaten<br />
gemeinsam haften, und weiter, dass<br />
Deutschland, wenn andere Mitgliedstaaten<br />
ihren Pflichten zur Einzahlung des auf<br />
sie entfallenden Kapitalanteils nicht nachkämen,<br />
eine Nachschusspflicht träfe, die<br />
sich auf bis zu 700 Milliarden Euro steigern<br />
könnte.<br />
Träfen diese Behauptungen zu, stünde<br />
der ESM-Vertrag verfassungsrechtlich auf<br />
schwankendem Grund. Im Übrigen ist<br />
durch das ESM-Finanzierungsgesetz dafür<br />
Sorge getragen, dass die Haushalts- und<br />
Stabilitätsverantwortung des Bundestags<br />
wirksam wahrgenommen werden kann.<br />
Das Gesetz gewährleistet einerseits eine<br />
umfassende Unterrichtung des Parlaments,<br />
andererseits wird das Abstimmungsverhalten<br />
des deutschen Vertreters im Gouverneursrat<br />
bei gewichtigen Entscheidungen<br />
an die vorherige Zustimmung des Bundestags<br />
gebunden.<br />
Das Problem der Währungsunion liegt<br />
freilich tiefer. So ist die vertragliche Konzeption<br />
der Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft<br />
nach ständiger Rechtsprechung<br />
des Bundesverfassungsgerichts<br />
Grundlage und Gegenstand des deutschen<br />
Zustimmungsgesetzes zum Vertrag von<br />
Maastricht. Die Unabhängigkeit der EZB<br />
und das vorrangige Ziel der Preisstabilität<br />
sind dauerhaft geltende Verfassungsanforderungen<br />
einer Beteiligung Deutschlands<br />
an der Währungsunion.<br />
Gleiches gilt für das unionsrechtliche<br />
Verbot des unmittelbaren Erwerbs von<br />
Schuldtiteln öffentlicher Einrichtungen<br />
durch die EZB und das Verbot der Haftungsübernahme<br />
(bail out) für die Schulden<br />
anderer Staaten. Alle diese Vorschriften<br />
des Unionsrechts – wie gesagt: nach<br />
deutschem Verfassungsrecht unabdingbare<br />
Voraussetzungen der Zugehörigkeit<br />
Deutschlands zur Währungsunion – werden<br />
seit Jahren teils offen, teils listenreich<br />
gebrochen oder umgangen, was natürlich<br />
auch Zweifel daran nährt, ob die Verantwortlichen<br />
sich künftig rechts treu verhalten<br />
werden.<br />
Der ESM-Vertrag markiert, wie man<br />
gesagt hat, einen währungsrechtlichen<br />
Richtungswechsel, indem er die bisherigen,<br />
als vorübergehend bezeichneten Stützungsmaßnahmen<br />
ersetzt durch eine dauerhaft<br />
vertraglich gesicherte Erwartung der<br />
Schuldnerländer auf finanzielle Hilfen derjenigen,<br />
die solide gewirtschaftet haben:<br />
Die Vergemeinschaftung der Schulden ist<br />
auf den Weg gebracht. Zwar ist der ESM-<br />
Vertrag mit verfassungsändernder Mehrheit<br />
beschlossen worden. Das Bundesverfassungsgericht<br />
wird aber gleichwohl die<br />
Frage beantworten müssen, ob der mit dem<br />
beschriebenen Systembruch bewirkte Austausch<br />
der Geschäftsgrundlage der Währungsunion<br />
nicht an den unabänderlichen<br />
Kern des Grundgesetzes rührt.<br />
Hans Hugo Klein<br />
war von 1983 bis 1996 Richter<br />
am Bundesverfassungsgericht<br />
und von 1972 bis 1983 Bundestagsabgeordneter<br />
der CDU<br />
»Wer nicht mehr will, als er kann,<br />
bleibt unter seinem Können.«<br />
Herbert Marcuse, Philosoph, 1898 – 1979<br />
IOM | Steinbeis-Hochschule Berlin<br />
Institut für Organisations-Management<br />
Organizational Management<br />
Human Capital Management<br />
Information Systems Management<br />
Eine lohnende Investition:<br />
Das berufsbegleitende, praxisbezogene<br />
Masterstudium für Organisations-<br />
Management für engagierte junge<br />
Nachwuchs- und Führungskräfte.<br />
Einstieg<br />
jederzeit<br />
möglich!<br />
www.steinbeis-iom.de<br />
IOM<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 97
| K a p i t a l | W a f f e n g e s c h ä f t e<br />
Streit beim Panzerbauer<br />
Bei Krauss-Maffei Wegmann liegen die beiden Eignerfamilien im Zwist über<br />
Panzerlieferungen in den Nahen Osten – ein Blick hinter die Kulissen<br />
von Hauke Friederichs<br />
D<br />
eutschlands wichtigster Panzerbauer<br />
lässt sich öffentlich<br />
feiern – ein Ereignis mit Seltenheitswert.<br />
An einem Sommertag<br />
im August 2007 erhält<br />
Manfred Bode, Aufsichtsratschef von<br />
Krauss-Maffei Wegmann (KMW), im<br />
Stadtschloss Palais Bellevue in Kassel das<br />
„Verdienstkreuz am Bande“ der Bundesrepublik<br />
– die höchste Anerkennung, die<br />
Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl<br />
vergibt.<br />
Fotos zeigen Manfred Bode während<br />
der Feier entspannt lächelnd. Zu sehen<br />
ist ein schlanker, mittelgroßer Mann mit<br />
ergrautem Haar und Seitenscheitel. Er<br />
trägt eine Brille mit dünnem Gestell. Es<br />
sind fast die einzigen Aufnahmen, die von<br />
Manfred Bode zu finden sind. „Ich habe<br />
mich gewundert, dass er den Orden überhaupt<br />
angenommen hat, das ist schließlich<br />
mit Öffentlichkeit verbunden“, sagt<br />
ein Bekannter der Familie. Bode scheue<br />
das Rampenlicht sehr, er wirke lieber im<br />
Verborgenen.<br />
In der Öffentlichkeit ist Bode weitgehend<br />
unbekannt, obwohl er seit 1979 bei<br />
KMW die Zügel in der Hand hält. Die<br />
Firma wird weltweit für ihre Waffensysteme<br />
geschätzt: Die Kampfpanzer Leopard<br />
1 und 2 sowie die geschützten Transportfahrzeuge<br />
Fennek und Dingo sind im<br />
Ausland äußerst begehrt.<br />
Der Geehrte wirkt im Stillen. „Ein<br />
Schattenmann“ sei Bode, stellt das Wirtschaftsmagazin<br />
Capital fest, „ein Strippenzieher,<br />
vernetzt bis in höchste politische<br />
Kreise“. Das Phantom wird er genannt.<br />
Bode veröffentlicht kaum Zahlen<br />
über sein Unternehmen. Er scheue die<br />
Aufnahme von Krediten, um Banken keinen<br />
Einfluss auf seine Firma zu geben und<br />
weist bisher alle fremden Investoren ab.<br />
Auch das Loben überlässt er anderen.<br />
Im Stadtpalais hält Kassels Oberbürgermeister<br />
Bertram Hilgen vor fünf Jahren<br />
die Laudatio: „Sie haben mit Ihrem weitreichenden<br />
unternehmerischen Sachverstand<br />
das Unternehmen KMW nicht nur<br />
ausgesprochen erfolgreich geführt, sondern<br />
zugleich durch konsequente Entwicklung<br />
und Forschung mit einzigartigen Kernfähigkeiten<br />
und dem derzeit umfangreichsten<br />
Portfolio der europäischen Heerestechnik<br />
ausgestattet“, sagt das Stadtoberhaupt.<br />
Im Dezember 1969 ist Bode in die Firma<br />
Wegmann eingetreten. Zehn Jahre später<br />
wird er Vorsitzender der Geschäftsführung.<br />
Heute leitet Manfred Bode den Aufsichtsrat<br />
der Wegmann-Gruppe. Ein Leben<br />
für den Panzerbau.<br />
Auch privat interessiert<br />
sich Bode, heute 71,<br />
für Motoren und Waffen.<br />
Bode mag alte Rennwagen.<br />
Er soll eine Oldtimer-Sammlung<br />
haben,<br />
dazu zähle ein gelber Lotus<br />
Elite, den er selber auf<br />
Rennen fährt. Bode gehe zudem<br />
gerne jagen, erzählt der<br />
Bekannte. Selbst mit Freunden<br />
habe er kaum über Geschäfte<br />
gesprochen und sei ein eher<br />
zurückhaltender Typ.<br />
In der generell verschwiegenen<br />
deutschen Rüstungsindustrie<br />
gelten Bode und seine Firma Krauss-<br />
Maffei Wegmann als besonders still<br />
und öffentlichkeitsscheu. Das Werk in Kassel<br />
ist für Ortsfremde kaum zu finden. Namenszüge<br />
oder Fahnen mit dem Firmenlogo,<br />
den Buchstaben KMW, sind dort<br />
nirgends zu entdecken.<br />
Journalisten erhalten bei KMW kaum<br />
Informationen. Auch Anfragen von <strong>Cicero</strong><br />
zu aktuellen Rüstungsdeals beantwortet<br />
der selbst ernannte<br />
„Marktführer in Europa<br />
für hochgeschützte Radund<br />
Kettenfahrzeuge“<br />
nicht. Transparenz<br />
schade dem Geschäft,<br />
so heißt es<br />
bei Krauss-Maffei<br />
Wegmann, berichtet<br />
ein<br />
98 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Der Leopard 2 ist überall gefragt. Wegen<br />
europäischer Sparzwänge bemüht sich<br />
KMW intensiv um arabische Kunden<br />
Insider. „Die Tradition dieser Firma ist,<br />
dass Öffentlichkeit des Teufels ist“, sagt<br />
auch Burkhart von Braunbehrens, einer<br />
der Anteilseigner und bis vor kurzem<br />
Aufsichtsratsmitglied beim Panzerbauer.<br />
Er hat mit dieser 170-jährigen Tradition<br />
gebrochen. Erstmals sucht ein KMW-<br />
Gesellschafter die Öffentlichkeit – sehr<br />
zum Ärger von Manfred Bode, heißt es in<br />
Unternehmenskreisen.<br />
„Die strikte Geheimhaltungspraxis von<br />
KMW finde ich lächerlich, die wird aus<br />
Angst vor Konkurrenten wie Rheinmetall<br />
ins Absurde getrieben“, sagt Braunbehrens.<br />
Das Schweigen schade der Firma und der<br />
ganzen Rüstungsindustrie. „Denn so begibt<br />
die Branche sich unter den Generalverdacht,<br />
dass sie schmutzige Geschäfte<br />
mache.“ Bislang konnte er sich mit seiner<br />
Forderung nach mehr Transparenz bei<br />
KMW nicht durchsetzen. „Im Aufsichtsrat<br />
der Firma war es mir nicht<br />
möglich, über Rüstungsexporte<br />
nach Saudi-<br />
Arabien, Katar oder<br />
an andere Länder<br />
vernünftig zu<br />
sprechen“, sagt<br />
Braunbehrens.<br />
Generell wird über<br />
Waffenausfuhren<br />
bei KMW nicht offen gesprochen, bestätigt<br />
ein Mitarbeiter.<br />
Dabei hätte KMW in den vergangenen<br />
Monaten durchaus wirtschaftliche Erfolge<br />
vermelden können: In Saudi-Arabien steht<br />
das Unternehmen vor einem Vertragsabschluss<br />
über den Export von mindestens<br />
270 Kampfpanzern. Ein Leopard 2 wurde<br />
im Juli in Saudi-Arabien erprobt. In Katar<br />
sollen Firmenvertreter über eine Bestellung<br />
von 200 Leopard 2 und weiterer Waffensysteme<br />
von KMW gesprochen haben.<br />
Der Umfang des Katar-Geschäfts stelle<br />
den Panzerdeal mit Saudi-Arabien in den<br />
Schatten, heißt es im Umfeld von KMW.<br />
Katar solle nicht nur an Panzern interessiert<br />
sein. In den Vereinigten Arabischen<br />
Emiraten fand 2011 ein erfolgreicher Wüstentest<br />
des Leopard 2 statt. Es geht um<br />
Milliardenaufträge. Und es gibt, so ist es<br />
aus dem Umfeld von KMW zu hören, in<br />
Saudi-Arabien außerdem noch Interesse an<br />
dem geschützten Transportfahrzeug Dingo.<br />
Den gepanzerten Jeep nennt KMW einen<br />
Lebensretter, weil noch kein deutscher Soldat<br />
darin in Afghanistan gestorben sei.<br />
Jahrzehntelang hat KMW vor allem<br />
die Bundeswehr und Nato-Staaten beliefert.<br />
Nun sucht KMW neue Abnehmer.<br />
„Grundsätzlich stehen wir vor der Herausforderung,<br />
dass in den kommenden Jahren<br />
bei allen unseren europäischen Kunden gespart<br />
werden muss“, stellt der Geschäftsführer<br />
Frank Haun in der KMW-Mitarbeiterzeitung<br />
Leo Inside fest. „Für<br />
uns bedeutet das zweierlei: Erstens,<br />
dass wir unsere Internationalisierung<br />
weiter vorantreiben,<br />
und zweitens,<br />
dass wir neue Marktsegmente<br />
erschließen.“<br />
Nicht allen Gesellschaftern<br />
und Mitarbeitern<br />
passen dieser neue<br />
Kurs des Unternehmens<br />
und die Ausrichtung auf<br />
neue Märkte im Nahen und<br />
Mittleren Osten. Braunbehrens<br />
hat sich zum Wortführer<br />
der Gegner des Strategiewechsels<br />
aufgeschwungen.<br />
Er glaube zwar nicht, dass<br />
Saudi-Arabien den Leopard<br />
gegen Demonstranten einsetzen<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 99
| K a p i t a l | W a f f e n g e s c h ä f t e<br />
werde – dennoch lehnt Braunbehrens den<br />
Deal mit Riad ab: „Panzer zu liefern, ist<br />
ein falsches politisches Signal, gegenüber<br />
dem arabischen Frühling und nach dem<br />
Einmarsch der Saudis in Bahrain. Es muss<br />
als feindlicher Akt gegen die arabische Demokratiebewegung<br />
verstanden werden.“<br />
Nachdem Burkhart von Braunbehrens öffentlich<br />
das Geschäft mit den Saudis kritisiert<br />
hatte, wurde er am 5. Juni 2012 aus<br />
dem Aufsichtsrat der Krauss-Maffei Wegmann<br />
Verwaltungs GmbH abberufen. Damit<br />
scheint der Konflikt unter den Gesellschaftern<br />
aber nicht beigelegt zu sein.<br />
38 Kommanditisten sind an der Holding<br />
beteiligt. Laut einer Berechnung von<br />
Rüstungsgegnern sollen die Braunbehrens<br />
zusammen etwas mehr als die Hälfte der<br />
Wegmann-Holding halten. Dennoch sei<br />
es Manfred Bode immer wieder gelungen,<br />
Mehrheiten zu organisieren – zuletzt aber<br />
mit größerer Mühe als früher, berichtet ein<br />
Insider. Er spricht von „Verhärtungen im<br />
Gesellschaftsrat“. Es habe Konflikte zwischen<br />
den Braunbehrens und den Bodes<br />
über den Unternehmenskurs gegeben –<br />
aber auch innerhalb der einzelnen Familien.<br />
Untereinander herrsche großes Misstrauen,<br />
das mit den öffentlichen Äußerungen von<br />
Burkhart von Braunbehrens noch größer<br />
geworden sei.<br />
Die Braunbehrens sind die Nachfahren<br />
der Gründer von Wegmann. Viele ihrer<br />
Familienmitglieder bewegen sich in einem<br />
Umfeld, das der Waffenproduktion<br />
kritisch gegenübersteht. Zum Braunbehrens-Klan<br />
gehören Künstler, ein Mozart-<br />
Biograf, Therapeuten, Humanisten. Ihre<br />
Lebensläufe passen einfach nicht zu Waffenproduzenten,<br />
allen voran die Vita von<br />
Burkhart von Braunbehrens. Er war Kommunist,<br />
Vietnamkriegsgegner und aktives<br />
Mitglied der Studentenbewegung. „Meine<br />
Familie war mit der unmittelbaren Geschäftsführung<br />
nie befasst“, sagt Burkhart<br />
von Braunbehrens. „Die Bodes haben stets<br />
die Firma geleitet. Die Braunbehrens erwägen<br />
seit langem, sich von den Anteilen zu<br />
trennen. Das ist innerhalb der Gesellschaft<br />
aber kaum möglich.“ Mit einer komplizierten<br />
Firmenstruktur und den umständlich<br />
geregelten Verkaufsmöglichkeiten von<br />
Anteilen haben die Bodes und die Braunbehrens<br />
sich aneinandergekettet. Als besonders<br />
innig kann diese Partnerschaft nicht<br />
bezeichnet werden. Insider berichten über<br />
Ein Leben für den Panzerbau: Manfred<br />
Bode hält seit drei Jahrzehnten die<br />
Zügel bei KMW fest in der Hand<br />
KMW-Gesellschafter Burkhart von<br />
Braunbehrens ist gegen Panzerlieferungen<br />
nach Saudi-Arabien und Katar<br />
einen Machtkampf, der nun erstmals teilweise<br />
öffentlich ausgetragen wird.<br />
In E-Mails und Briefen an Bekannte<br />
versicherten einige Braunbehrens, wenig<br />
Einfluss auf den Kurs des Unternehmens<br />
ausüben zu können, und lediglich<br />
stille Teilhaber zu sein. Darin stand auch,<br />
dass Familienmitglieder mit dem Kunden<br />
Saudi-Arabien nicht glücklich seien. Und<br />
dass die Braunbehrens erst aus den Medien<br />
von dem Deal erfahren hätten – nicht von<br />
der KMW-Führung. Von den Bodes gibt<br />
es dazu keine Stellungnahme.<br />
Sie bestimmen seit 1912 das Geschäft<br />
bei Wegmann & Co. Damals wurde der<br />
Ingenieur August Bode Geschäftsführer<br />
und drei Jahre später persönlich haftender<br />
Gesellschafter des damaligen<br />
Eisenbahnwaggonbauers. Unter seiner<br />
Geschäftsleitung gewann die Rüstungsproduktion<br />
eine immer stärkere Bedeutung<br />
– früh stieg das Unternehmen in die<br />
Panzerfertigung ein. 1917, zum Ende des<br />
Ersten Weltkriegs, stellte Wegmann den<br />
ersten deutschen Panzer, den „Großkampfwagen<br />
Kolossal“, her. Als die Nazis mit der<br />
Wiederaufrüstung des Deutschen Reiches<br />
begannen und Panzerbauer suchten, war<br />
August Bode sofort zur Stelle. Für die<br />
Wehrmacht liefen bei Wegmann in Kassel<br />
Hunderte Panzer vom Band. Während<br />
des Zweiten Weltkriegs wurde dort der<br />
schwere Kampfpanzer Tiger gebaut. Die<br />
Tradition mit den Tiernamen hat man bis<br />
heute beibehalten.<br />
August Bode trat 1937 in die NSDAP<br />
ein und erhielt später Auszeichnungen<br />
wie das „goldene Treuedienstehrenzeichen“<br />
und „Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse ohne<br />
Schwerter“. Nach dem Krieg wurden er<br />
und seine beiden Söhne Engelhard und<br />
Fritz, Mitglieder der SS ehrenhalber, nur<br />
zur Zahlung einer geringen Geldstrafe verurteilt<br />
und führten die Geschäfte weiter.<br />
Mit der Wiederbewaffnung Westdeutschlands<br />
1955 stieg Wegmann wieder ins Panzergeschäft<br />
ein.<br />
Manfred Bode, der Enkel von August,<br />
fusionierte Wegmann im Jahr 1999 mit<br />
Krauss-Maffei Wehrtechnik, einer Tochter<br />
von Mannesmann. Die Wegmann-Holding<br />
erhielt 51 Prozent an KMW, Mannesmann<br />
49. Später übernahm Siemens die<br />
Anteile von Mannesmann. Manfred Bode<br />
blieb Chef. Er fädelte zehn Jahre später<br />
auch die komplette Übernahme von KMW<br />
durch die Familienholding ein, als Siemens<br />
beschloss, sich vom Rüstungsgeschäft zu<br />
trennen: Für einen geschätzten Kaufpreis<br />
von rund 200 Millionen Euro übernahm<br />
Wegmann im Dezember 2010 die Anteile<br />
von Siemens. Seitdem veröffentlicht KMW<br />
kaum noch Geschäftszahlen. Die letzten<br />
Umsatzzahlen, die per Pressemitteilung<br />
genannt wurden, sind von 2008. In dem<br />
Jahr machte der Panzerbauer 1,4 Milliarden<br />
Euro Umsatz. Ein Jahr später – so steht<br />
es in dem im Bundesanzeiger veröffentlichten<br />
Geschäftsbericht von 2010, waren es<br />
898 Millionen Euro. Neuere Zahlen gibt es<br />
nicht. Bekannt ist aber, dass das Auslandsgeschäft<br />
eine große Rolle spielt: In manchem<br />
Jahr gehen mehr als 70 Prozent der<br />
Produktion in den Export – wohin KMW<br />
liefert, wird selten öffentlich.<br />
Fotos: Thomas Imo/Photothek.net (Seiten 98 bis 99), Tobias Hase/Picture Alliance/DPA, ZDF<br />
100 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Hannah Schuh/Arne Mayntz (Autor)<br />
Selbst die Panzergeschäfte mit dem<br />
klammen Griechenland, das trotz leerer<br />
Kassen für Milliarden Euro Leoparden<br />
bestellte, machten kaum Schlagzeilen.<br />
Bode soll dabei persönlich in Athen<br />
für die Produkte seiner Firma geworben<br />
haben. „Dass wir mit deutschen Steuergeldern<br />
den Griechen die KMW-Panzer<br />
bezahlen, zeigt doch, dass den Deutschen<br />
alles egal ist“, sagt ein Mitarbeiter des Panzerbauers.<br />
Auch die anstehenden Geschäfte<br />
mit arabischen Staaten findet mancher Angestellte<br />
problematisch. „Die Deals verlagern<br />
sich einfach in die Länder, die noch<br />
flüssig sind und die glauben, mit Panzern<br />
was regeln zu können“, sagt ein Mitarbeiter.<br />
Intern sei bekannt, dass sich die Chefs<br />
intensiv um arabische Kunden bemühten.<br />
Wer dagegen die sporadisch herausgegebenen<br />
Pressemitteilungen des Unternehmens<br />
liest, muss davon ausgehen, dass<br />
der wichtigste KMW-Kunde die Bundeswehr<br />
ist: „Der Leopard 2A7+ wurde für die<br />
neuen Aufgaben der Bundeswehr entwickelt<br />
und qualifiziert. Die auf den Schutz<br />
der Fahrzeugbesatzung optimierten Systemkomponenten<br />
bewähren sich derzeit<br />
im Afghanistaneinsatz mit dem Nato-Partner<br />
Kanada.“ Dabei hat die Bundeswehr<br />
kein einziges Modell des neuen Leopard<br />
2A7+ gekauft, weil es an Geld und dem<br />
Bedarf fehlt. Deutschland will künftig mit<br />
225 Exemplaren auskommen – 1990 waren<br />
es noch fast zehnmal so viele.<br />
KMW sucht deswegen weltweit potente<br />
Kunden. Das Münchner Unternehmen<br />
baute in den vergangenen beiden Jahren<br />
in Singapur ein Büro für Asien auf und<br />
gründete in Indien ein Joint Venture. Diese<br />
Aktivitäten und die insgesamt intransparenten<br />
Geschäfte der Firma sorgen in<br />
Deutschland immer häufiger für Proteste.<br />
Für Aufsehen sorgte im Sommer 2012<br />
die Kampagne „25 000 Euro“, die ein<br />
symbolisches Kopfgeld auf die Eigner von<br />
Krauss-Maffei Wegmann ausgelobt hatte.<br />
Die Aktion ging aufs Konto des „Zentrums<br />
für Politische Schönheit“ aus Berlin, einem<br />
Zusammenschluss von Künstlern und Menschenrechtsaktivisten.<br />
Mittlerweile haben<br />
sich mehrere Mitglieder der Familie Braunbehrens<br />
juristisch gegen das Projekt gewehrt.<br />
Aber längst haben andere Gruppen den<br />
Protest mit zweifelhaften Methoden fortgeführt<br />
und veröffentlichen im Internet die<br />
Namen der Mitarbeiter des Panzerbauers.<br />
Die Bundeswehr hat kein<br />
einziges Modell des neuen<br />
Leopard gekauft, weil es an Geld<br />
und dem Bedarf fehlt<br />
Das sorge im Unternehmen für Unruhe,<br />
sagt jemand aus dem Umkreis der Firma.<br />
Organisationen wie die „Aktion Aufschrei“,<br />
ein Bündnis von Menschenrechtlern, Rüstungsgegnern<br />
und Friedensbewegung, haben<br />
im August zu „Hausbesuchen“ bei<br />
KMW in Kassel und München aufgerufen.<br />
Und nun scheint mit Katar der nächste<br />
umstrittene Kunde festzustehen. KMW<br />
äußert sich zu diesem Thema nicht – ganz<br />
anders die Bundesregierung, die jeden Export<br />
von Kriegswaffen genehmigen muss:<br />
„Bei mir ist angekommen, dass es eine Interessensbekundung<br />
gab, ja“, sagte der stellvertretende<br />
Regierungssprecher Ende Juli<br />
in Berlin in der Bundespressekonferenz zu<br />
der Meldung, Katar wolle 200 Leoparden<br />
kaufen.<br />
Burkhart von Braunbehrens will weiter<br />
die Öffentlichkeit suchen. Er fordert eine<br />
strikte internationale Rüstungskontrolle.<br />
Ein genereller Gegner von Waffenausfuhren<br />
ist er nicht. Der Leopard sei schließlich<br />
auch für die militärische Begleitung von<br />
Friedensmissionen geeignet. Er fordert eine<br />
Konsolidierung für den deutschen und für<br />
den europäischen Rüstungsmarkt: „Ein<br />
Zusammengehen mit Rheinmetall halte<br />
ich auf lange Sicht für KMW für eine sinnvolle<br />
Option. Die meisten Systeme produzieren<br />
KMW und Rheinmetall sowieso<br />
zusammen“, sagt der Eigner von KMW.<br />
„Bisher sträubt sich die Familie Bode bei<br />
jeder Gelegenheit gegen eine Fusion mit<br />
Rheinmetall.“ Er befürchte, dass es nicht<br />
zu der notwendigen Konsolidierung kommen<br />
wird, „weil der wirtschaftliche Druck<br />
auf KMW fehlt – vor allem, wenn nun<br />
Verträge mit Saudi-Arabien und Katar geschlossen<br />
werden sollten“.<br />
Für Manfred Bode sind solche Forderungen<br />
die reine Provokation. Er hat<br />
eine starke Abneigung gegen Rheinmetall<br />
und sieht im Branchenriesen aus Düsseldorf<br />
die schärfste Konkurrenz. Rheinmetall<br />
soll mehrfach versucht haben, sich an<br />
KMW zu beteiligen. Schließlich bauen<br />
beide Unternehmen gemeinsam den Leopard,<br />
den Schützenpanzer Puma, die Panzerhaubitze<br />
2000 und die neuen gepanzerten<br />
Transportfahrzeuge AMPV und<br />
Boxer. Eine noch engere Kooperation<br />
berge viele Synergieeffekte, heißt es in der<br />
Rüstungsbranche.<br />
Bode jedoch habe kein Interesse an einem<br />
Einstieg von großen Konzernen, die<br />
mitreden wollen, schließlich habe er bereits<br />
den Machtübergang auf die nächste<br />
Generation vorbereitet, heißt es bei KMW-<br />
Kennern. Sein Sohn Felix leitet Wegmann<br />
Automotive, eine Tochter der Wegmann<br />
Unternehmensholding. Der andere Sohn<br />
Stephan führt die Geschäfte von Schleifring<br />
und Apparatebau, ebenfalls eine Firma<br />
der Holding. Beide Söhne leiten mit Haun<br />
zusammen zudem die Holding. Wenn es<br />
nach dem Willen von Manfred Bode gehe,<br />
dann seien Stephan und Felix seine Nachfolger,<br />
sagt ein Insider. Ob die Gesellschafterversammlung<br />
die Geschäfte weiter in<br />
den Händen der Bodes lassen will, sei aber<br />
noch nicht ausgemacht. Noch halte Manfred<br />
Bode die Zügel fest in der Hand, heißt<br />
es. Seine Söhne seien kompetente Unternehmer,<br />
aber keine Machtmenschen wie<br />
der Vater. Spätestens wenn der Patriarch<br />
die Firma aus Altersgründen verlassen wird,<br />
dürfte der Machtkampf mit neuer Leidenschaft<br />
geführt, das Fusionsthema wiederbelebt<br />
werden, nicht zuletzt deswegen, weil die<br />
verkaufswilligen Braunbehrens dann endlich<br />
ihre Anteile loswerden könnten.<br />
Hauke Friederichs<br />
ist freier Journalist. Anfang<br />
September erscheint sein Buch<br />
„Bombengeschäfte – Tod made in<br />
Germany“<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 101
| K a p i t a l | F r i e d e n s p f l i c h t s e i m i t D i r<br />
Verdi geht in die Kirche<br />
Die Gewerkschaft möchte das Sonderarbeitsrecht der 1,2 Millionen Mitarbeiter der Kirchen<br />
kippen. Der Konflikt eskaliert in Niedersachsen – gegen das Interesse vieler Beschäftigter<br />
von Ludwig Greven<br />
V<br />
erdi-Chef Frank Bsirske greift<br />
tief in die Klassenkampfkiste.<br />
„Ihr schreibt Geschichte!“, ruft<br />
er einigen Hundert Angestellten<br />
aus mehreren Kliniken und<br />
anderen Sozialeinrichtungen der evangelischen<br />
Kirche in Hannover zu, die in einen<br />
Warnstreik getreten sind. Schließlich<br />
gehe es hier, proklamiert der Vorsitzende<br />
der Dienstleistungsgewerkschaft, um etwas<br />
sehr Grundsätzliches: das „Menschenrecht<br />
auf Streik“ und das im Grundgesetz geschützte<br />
Grundrecht, Tarifverträge auszuhandeln<br />
– auch für Kirchenmitarbeiter.<br />
Dafür ist Bsirske an diesem Sommertag<br />
extra aus Berlin angereist. Denn es ist<br />
ein besonderer Tarifkonflikt, der seit mehr<br />
als einem Jahr in Niedersachsen als Pilotbezirk<br />
tobt. Es geht nicht nur um viele<br />
potenzielle neue Verdi-Mitglieder. Und<br />
es geht auch nicht nur um ein paar Prozent<br />
mehr Gehalt, sondern um das historische<br />
Sonderrecht der Kirchen, das aus<br />
der Weimarer Verfassung unverändert ins<br />
Grundgesetz übernommen wurde: das<br />
Recht der Kirchen, ihre inneren Angelegenheiten<br />
ohne Einmischung von außen<br />
regeln zu dürfen.<br />
Dieses Selbstbestimmungsrecht beinhaltet<br />
nach Ansicht der evangelischen wie<br />
der katholischen Kirche die Möglichkeit,<br />
als größter Arbeitgeber in Deutschland<br />
Bezahlung und Arbeitsbedingungen ihrer<br />
1,2 Millionen Erzieherinnen, Sozialarbeiter,<br />
Krankenschwestern oder Ärzte in paritätischen<br />
Kommissionen mit Mitarbeitervertretern<br />
direkt auszuhandeln – ohne<br />
Gewerkschaftsbeteiligung. Und vor allem<br />
ohne Streiks. „Mit unserem diakonischen<br />
Auftrag und dem partnerschaftlichen Verhältnis<br />
zu den Mitarbeitern ist ein Arbeitskampf<br />
unvereinbar“, sagt der Hannoveraner<br />
Landesbischof Ralf Meister.<br />
Dieser sogenannte dritte Weg, auf dem<br />
sich die kirchlichen Mitarbeiter und ihre<br />
Dienstherren gleichberechtigt bewegen<br />
sollen, ist Verdi schon lange ein Dorn im<br />
Auge. „Die kirchlichen Unternehmen verhalten<br />
sich genauso wie andere Arbeitgeber“,<br />
sagt Bsirske, „zum Teil behandeln sie<br />
ihre Mitarbeiter noch schlimmer!“ Deshalb<br />
versucht Verdi jetzt in Niedersachsen Tarifverträge<br />
zu erzwingen. Sobald die ersten<br />
Bastionen fallen, kalkuliert Bsirske, ist die<br />
Sonderstellung der kirchlichen Arbeitgeber<br />
bundesweit kaum mehr zu halten. Die Kirchenoberen<br />
beider Konfessionen verfolgen<br />
diesen Stellvertreterkrieg argwöhnisch. In<br />
einem gemeinsamen Positionspapier von<br />
Caritas und Diakonie heißt es dazu: „Der<br />
dritte Weg ermöglicht den Kirchen und<br />
ihren Wohlfahrtsverbänden, die religiöse<br />
Dimension ihres Wirkens nach innen wie<br />
nach außen auch in der Form des Arbeitsrechts<br />
zu leben.“<br />
Tatsächlich bezahlten die Kirchen ihre<br />
Mitarbeiter lange Zeit besser als die nichtkirchlichen<br />
Träger. Seit Mitte der neunziger<br />
Jahre hat aber der Kostendruck auf<br />
alle sozialen Einrichtungen in Deutschland<br />
drastisch zugenommen. Das betrifft auch<br />
die Kirchen, weil sie die Gelder für ihre<br />
Kliniken, Pflegeheime, Jugend- und Sozialhelfer<br />
wie andere Wohlfahrtsverbände<br />
und private Heimbetreiber fast vollständig<br />
von den Sozialkassen und der öffentlichen<br />
Hand erhalten.<br />
Die Konsequenz daraus ist ein teilweise<br />
ruinöser Wettbewerb. Besonders drastisch<br />
ist die Lage in der Altenpflege und hier wiederum<br />
am eklatantesten in Niedersachsen.<br />
Denn die Pflegeversicherungen und die übrigen<br />
öffentlichen und staatlichen Kostenträger<br />
diktieren die Pflegesätze jeweils in<br />
Landeskommissionen. Und in Niedersachsen,<br />
angeführt von der schwarz-gelben Landesregierung,<br />
rühmen sie sich damit, die<br />
niedrigsten Sätze von allen Bundesländern<br />
zu zahlen.<br />
Das hat dazu geführt, dass diakonische<br />
Werke Gehälter gesenkt, Arbeitszeiten<br />
verlängert und Personal abgebaut haben.<br />
Sie beschäftigen jetzt Billigkräfte als<br />
Leiharbeiter oder gliedern Tochterfirmen<br />
aus, für die der Kirchentarif nicht gilt. Bei<br />
Karikatur: Burkhard Mohr<br />
102 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: privat<br />
den Sozialverbänden ist es allerdings teilweise<br />
noch schlimmer. So hat die Arbeiterwohlfahrt<br />
ihren bundesweiten Tarifvertrag<br />
schon vor Jahren gekündigt. Auch hier zahlen<br />
die einzelnen Einrichtungen ihre Mitarbeiter<br />
jetzt je nach Finanzlage und jeweils<br />
geltendem Haustarif. Oder ganz ohne Tarif.<br />
Von den Privaten, die inzwischen in Niedersachsen<br />
60 Prozent der Altenheime betreiben,<br />
ganz zu schweigen.<br />
Die Kirchen sind jedoch Verdis bevorzugtes<br />
Feindbild. Und Bsirske hat sich<br />
bewusst die evangelische vorgenommen.<br />
Anders als die katholische Kirche sind die<br />
Protestanten dezentral organisiert und in<br />
Niedersachsen auch noch in fünf Landeskirchen<br />
aufgeteilt. So kann der Geschäftsführer<br />
jeder diakonischen Einrichtung,<br />
auch wenn er formal an die kirchlichen<br />
Vereinbarungen gebunden ist, faktisch<br />
selber entscheiden, ob er sich daran hält.<br />
Verdi spricht deshalb gezielt Diakonieeinrichtungen<br />
an, in denen die Finanznot und<br />
die Unzufriedenheit der Mitarbeiter besonders<br />
groß sind. Gemeinsam mit der Ärztegewerkschaft<br />
Marburger Bund konnte<br />
man in Oldenburg bereits ein evangelisches<br />
Krankenhaus aus dem kirchlichen Tarifverbund<br />
herausbrechen. Die Klinik fand<br />
keine Ärzte mehr, weil die woanders mehr<br />
verdienen konnten. Nach wochenlangem<br />
Streik des medizinischen Personals gab die<br />
Klinik leitung schließlich nach und schloss<br />
den ersten Tarifvertrag eines diakonischen<br />
Trägers mit einer Gewerkschaft.<br />
Nach diesem Vorbild versucht Verdi<br />
nun, Haustarifverträge auch in den drei<br />
evangelischen Krankenhäusern in der Landeshauptstadt<br />
zu erzwingen. Ihr Problem<br />
allerdings: Die Streikbereitschaft des Klinikpersonals<br />
ist gering. Bei den Mitarbeitern<br />
von Alten- und Pflegeheimen ist der<br />
Organisationsgrad noch viel niedriger. Nur<br />
wenige der meist weiblichen Teilzeitpflegekräfte<br />
sind in der Gewerkschaft. Und selbst<br />
wenn, können sie die Arbeit nicht niederlegen,<br />
ohne die Versorgung der alten Menschen<br />
zu gefährden.<br />
Die Möglichkeiten der Gewerkschaft,<br />
Druck auf die kirchlichen Arbeitgeber<br />
auszuüben, ist deshalb im Moment gering.<br />
Das bestreitet Verdi-Chef Bsirske auch gar<br />
nicht. Er geht aber davon aus, dass der Unmut<br />
unter den rund 50 000 Diakonie-Beschäftigten<br />
in Niedersachsen wächst, weil<br />
es für die große Mehrheit von ihnen seit<br />
2010 keine Gehaltserhöhung gegeben hat.<br />
Im Frühjahr 2011 scheiterten die Lohnverhandlungen<br />
im Rahmen des dritten Weges.<br />
Bsirske hofft, dass sich die evangelischen<br />
Arbeitgeber spätestens am Ende des Jahres<br />
mit den Mitarbeitervertretern und Verdi an<br />
den Verhandlungstisch setzen. Aufgrund<br />
des erhöhten Wettbewerbsdrucks ist inzwischen<br />
auch bei Kirchenleitung und Diakonie<br />
die Bereitschaft gestiegen, sich auf<br />
einen alten Vorschlag von Verdi einzulassen:<br />
einen Flächentarifvertrag für alle sozialen<br />
Träger in Deutschland, einschließlich<br />
Awo, Deutschem Roten Kreuz und Paritätischem<br />
Wohlfahrtsverband, abzuschließen.<br />
„Das würde den ruinösen Wettbewerb<br />
„Kirchliche<br />
Unternehmen<br />
sind teilweise<br />
schlimmer<br />
als andere“<br />
Frank Bsirske, Verdi-Chef<br />
mit Dumpinglöhnen beenden“, hofft Bischof<br />
Meister.<br />
Zusammen beschäftigen Kirchen und<br />
Wohlfahrtsverbände noch 60 Prozent des<br />
Personals in den Pflegeberufen. Ein bundesweiter<br />
„Tarifvertrag Soziales“ könnte<br />
deshalb von der Bundesregierung für allgemeinverbindlich<br />
erklärt werden und<br />
gälte dann auch für die privatwirtschaftliche<br />
Konkurrenz.<br />
Es gibt aber noch einen Haken aus<br />
Sicht der Gewerkschaft: Die Kirche möchte<br />
den Flächentarifvertrag bisher nur für die<br />
anderen Träger – und ihn dann für sich<br />
übernehmen. Dafür müsste der Bundestag<br />
das Tarifvertragsgesetz ändern. Und die<br />
Kirchenbeschäftigten hätten dann weiterhin<br />
kein Streikrecht. Aus Sicht der Kirche<br />
kein Nachteil: „Streik ist ein Relikt alter Industriekultur<br />
und passt nicht ins 21. Jahrhundert.<br />
Da gibt es heute andere Wege“,<br />
sagt Christoph Künkel, Leiter der Diakonie<br />
Niedersachsen.<br />
So haben sich beide Seiten vorerst ideologisch<br />
eingegraben. Und werfen sich gegenseitig<br />
vor, einen „Machtkampf auf<br />
dem Rücken der Beschäftigten“ auszutragen.<br />
Verdi wolle in Wahrheit nur ihren<br />
Einflussbereich ausdehnen und Mitglieder<br />
gewinnen, argumentieren die Kirchenvertreter.<br />
Tatsächlich hat die Dienstleistungsgewerkschaft<br />
seit ihrer Gründung<br />
eine Million Mitglieder verloren. „Die Kirchen<br />
wollen einen Dammbruch verhindern<br />
und mauern sich ein“, hält Bsirske dagegen<br />
und wirft ihnen bigottes Verhalten vor.<br />
Die Beschäftigten selber werden kaum<br />
gefragt. Lothar Germer, Vorsitzender der<br />
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen<br />
in der niedersächsischen Diakonie<br />
und Verdi-Mitglied, argumentiert<br />
wie die Gewerkschaft: „Lohnfragen sind<br />
Machtfragen. Ohne Streikrecht haben wir<br />
keine Macht.“ Sabine Meyer, die als Förderlehrerin<br />
in einer großen kirchlichen Jugend-<br />
und Behindertenstiftung in Burgwedel<br />
bei Hannover mit fast 400 Mitarbeitern<br />
arbeitet und die dortigen Kollegen vertritt,<br />
ist dagegen, die Gewerkschaft reinzuholen<br />
und einen Tarifvertrag zu schließen. „Wir<br />
sind mit dem dritten Weg immer gut gefahren.<br />
Die Gehälter sind in Ordnung, die<br />
Mitarbeiter sind zufrieden.“ Sie weiß dabei<br />
die Mehrheit ihrer Kollegen hinter sich.<br />
Ein Ende des Kirchen-Tarifkampfs ist<br />
vorerst nicht zu erwarten. Beide Seiten<br />
warten jetzt erst einmal auf das Bundesarbeitsgericht.<br />
Das will am 20. November<br />
entscheiden, ob die Diakonie-Mitarbeiter<br />
streiken dürfen oder ob die Kirchen sich zu<br />
Recht auf ihre Sonderstellung berufen. Die<br />
unterlegene Seite wird danach vors Bundesverfassungsgericht<br />
ziehen, Verdi will den<br />
Streit notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof<br />
für Menschenrechte tragen.<br />
Hans-Peter Hoppe, Vorsitzender des<br />
Diakonischen Dienstgeberverbands in Niedersachsen,<br />
verzweifelt langsam. Als junger<br />
Pfarrer war er in den achtziger Jahren selber<br />
in der ÖTV, bevor die in Verdi aufging.<br />
„Dass ich als Spät-68er heute als Arbeitgebervertreter<br />
unser Dienstrecht gegen eine<br />
völlige Zersplitterung der Tariflandschaft<br />
verteidigen muss, gegen meine eigene frühere<br />
Gewerkschaft“, stöhnt er, „das hätte<br />
ich mir nie träumen lassen.“<br />
Ludwig Greven<br />
arbeitet als Politikredakteur in<br />
der Online-Redaktion der Zeit<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 103
| S a l o n<br />
Die ganze wahrheit<br />
Wie es Alan Hollinghurst gelingt, das schönste Englisch der Welt zu schreiben<br />
von Daniel Schreiber<br />
E<br />
s sind immer die heterosexuellen<br />
Kritiker, die sich um ihre Dosis<br />
schwulen Sex betrogen fühlen“,<br />
amüsiert sich Alan Hollinghurst. Den festen<br />
Bariton seiner Stimme würde man eher<br />
bei einem Wagner-Sänger vermuten als bei<br />
einem Autor von mittlerweile fünf gespenstisch<br />
fein geschliffenen Romanen, die ihm<br />
den Ruf eingebracht haben, von allen lebenden<br />
Schriftstellern das schönste Englisch<br />
zu schreiben – und eben aufsehenerregende<br />
schwule Sexszenen, für die sich selbst<br />
Frauenhelden wie John Updike begeistern<br />
konnten. An Letzterem schien es James<br />
Wood, dem Literaturkritiker des New Yorker,<br />
beim neuen Roman „Des Fremden<br />
Kind“ etwas zu mangeln. Im Vergleich zu<br />
Hollinghursts vorherigen „atemberaubend<br />
fleischlichen“ Büchern, schrieb er in seiner<br />
mehrseitigen Kritik, falle ihm das neue „etwas<br />
zu zahm“ aus.<br />
Wir befinden uns in Hollinghursts<br />
eher schlicht eingerichtetem Townhouse<br />
im Londoner Stadtteil Hampstead Heath,<br />
einem viktorianischen Jahrhundertwendetraum<br />
aus Backstein, weißen Giebeln und<br />
ausladenden Fuchsien. Kate Moss wohnt<br />
ein paar Straßen weiter. Im Treppenhaus<br />
liegen Hunderte von Ausgaben der Übersetzungen<br />
seiner Bücher. Er weiß nicht, wohin<br />
mit ihnen. Die meisten davon sind Exemplare<br />
der „Schönheitslinie“, seinem vor<br />
sieben Jahren erschienenen Booker-Prizegekrönten<br />
Weltbestseller, in dem er ein von<br />
Geld, Kokain und Sex getränktes Sittengemälde<br />
der Thatcher-Ära zeichnete.<br />
58 ist Hollinghurst jetzt; nach den recht<br />
wild durchfeierten achtziger und neunziger<br />
Jahren und einigen längeren Beziehungen<br />
lebt er allein. „Als ich mit dem Schreiben<br />
begonnen habe, war es noch relativ neu, etwas<br />
explizit Schwules zu machen“, sagt er.<br />
„Es hat sich dringend angefühlt.“ In Oxford<br />
besuchte er das gleiche College wie<br />
Oscar Wilde, seine Magisterarbeit schrieb<br />
er über Ronald Firbank und E. M. Forster.<br />
Auch in seiner Arbeit als stellvertretender<br />
Chefredakteur des Times Literary Supplement<br />
setzte er sich für schwule Autoren ein.<br />
„In ‚Des Fremden Kind‘ aber ging es mir<br />
eher um etwas Verstecktes“, sagt er, „darum,<br />
wie manche schwule Beziehungsgeflechte<br />
erst im Laufe der Zeit, manchmal<br />
erst nach Jahrzehnten, zutage treten.“<br />
Gravitationszentrum des knapp 690<br />
Seiten langen Romans ist Cecil Valance,<br />
ein charismatischer Lyriker, der eine Affäre<br />
mit seinem Cambridge-Kommilitonen<br />
George Sawle hat, bevor er im Ersten Weltkrieg<br />
ums Leben kommt. Ein Teil der Figur<br />
ist dem bisexuellen britischen Dichter<br />
Rupert Brooke nachempfunden, den William<br />
Butler Yeats einmal als „den schönsten<br />
Mann Englands“ bezeichnete. Wie Brooke<br />
hat auch Valance egomanische Tendenzen<br />
und ein gepeinigtes Privatleben – Frauen<br />
wie Männer verlieben sich viel zu einfach<br />
in ihn. Auch er schreibt charmante, aber<br />
nicht wirklich gute Lyrik. Und wie bei<br />
Brooke wird auch eines von Valances Gedichten<br />
durch einen adelnden Kommentar<br />
von Winston Churchill zum emblematischen<br />
Text für das seine Söhne verlierende<br />
Weltkriegsengland.<br />
Hollinghurst holt ein Buch mit Briefen<br />
und Fotos von Brooke aus seinem Arbeitszimmer,<br />
das seiner Mutter gehört hatte.<br />
Wie viele war auch er mit dessen Lyrik aufgewachsen.<br />
„Es ist faszinierend, wie lange<br />
es gedauert hat, dass die ganze komplizierte<br />
Wahrheit über ihn ans Tageslicht kam.“<br />
In fünf Kapiteln, deren Handlung sich<br />
über ein Jahrhundert erstreckt, rekonstruiert<br />
Hollinghurst die posthume Heiligsprechung<br />
und das literarische Nachleben seines<br />
Brooke’schen Helden Cecil Valance.<br />
Quasi en passant entstehen dabei ein Panorama<br />
des postimperialen Verfalls des britischen<br />
Weltreichs zu einem prosaischen<br />
Kleinbürgerstaat – und eine Geschichte<br />
der wandelnden sozialen Einstellungen<br />
zur Homosexualität, ihrer Verleugnung<br />
und psychologischen Verdrängung. Das<br />
Ende des Romans taucht in eine schwule<br />
Welt ein, die zumindest auf der Oberfläche<br />
so selbstverständlich daherkommt, als<br />
hätte es die lange Geschichte des Sich-Verstecken-Wollens<br />
und -Müssens nie gegeben.<br />
Nicht nur die Atmosphäre des Romans<br />
und sein eleganter, evokationsfreudiger Ton<br />
erinnern dabei an die großen englischen<br />
Autoren, an Henry James, E. M. Forster<br />
oder Evelyn Waugh, die neben zeitgenössischen<br />
Schriftstellern wie Alice Munro,<br />
Colm Tóibín und Tessa Hadley in den vielen<br />
Bücherregalen in Hollinghursts Townhouse<br />
stehen. Was einem beim Lesen von<br />
„Des Fremden Kind“ vor allem das seltsame<br />
Gefühl gibt, einen Klassiker in der Hand<br />
zu halten, ist Hollinghursts mildes und humoreskes<br />
Auge für die Sittenkomödie, die<br />
das Leben ist: sein Gespür für die moralischen<br />
Komplexitäten des Alltags, die unter<br />
den Gesprächen anwesenden Spannungen,<br />
sein Wissen darum, auf welch fadenscheiniger<br />
Grundlage die meisten von uns Entscheidungen<br />
treffen, die unser ganzes Leben<br />
bestimmen werden.<br />
„Wissen Sie, ich schätze das Alleinsein<br />
sehr“, sagt Hollinghurst zum Ende unseres<br />
Gesprächs. „Es ist nicht einfach, eine<br />
Beziehung mit mir zu führen, besonders<br />
wenn ich schreibe.“ Wenn er arbeitet,<br />
zieht er sich für vier bis fünf Wochen an<br />
den Schreibtisch zurück und bricht jeden<br />
Kontakt zur Außenwelt ab. Dann trinkt er<br />
nicht, spricht mit kaum jemandem, geht<br />
allerhöchstens kurz zum Einkaufen aus<br />
dem Haus. Vielleicht kann man die Welt,<br />
wie sie ist, nur so klar erkennen, wenn man<br />
sich zumindest für eine Zeit ganz von ihr<br />
verabschiedet. Das Opfer lohnt sich in jedem<br />
Fall. „Wenn das Schreiben gut geht“,<br />
sagt er, „bringt es mir ungeheuer viel. Dann<br />
ist es die beste Sache der Welt.“<br />
Daniel Schreiber<br />
leitet den Salon bei <strong>Cicero</strong> und<br />
ist Autor der Biografie „Susan<br />
Sontag. Geist und Glamour“<br />
(Aufbau-Verlag)<br />
Fotos: Andrea Artz, Privat (Autor)<br />
104 <strong>Cicero</strong> 9.2012
„Es sind<br />
immer die<br />
heterosexuellen<br />
Kritiker, die sich<br />
um ihre Dosis<br />
schwulen Sex<br />
betrogen fühlen“<br />
Alan Hollinghurst in London. Sein<br />
neuer Roman „Des Fremden Kind“<br />
erscheint im Blessing-Verlag<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 105
| S a l o n<br />
Lettische Erdbeeren<br />
Elina Garanča, begnadeter Mezzosopran und Opernschönheitskönigin du jour, hat gelernt, sich selbst zu retten<br />
von Eva gesine Baur<br />
E<br />
rst, wer ihr gegenübersitzt, bemerkt,<br />
was ihre Erscheinung ungewöhnlich<br />
macht: zupackende<br />
Hände mit kräftigen Fingern und kurz geschnittenen<br />
Nägeln. Eine große, klare, breite<br />
Stirn. Ein überwacher, forschender Blick.<br />
Sieht so eine romantische Frau aus?<br />
Elīna Garanča, von den Kritikern zur<br />
Schönheitskönigin der Oper hochgejubelt,<br />
hat eine neue CD eingespielt, die „Romantique“<br />
heißt. Sie liebt die Lieder der deutschen<br />
Romantik und hat am Vorabend<br />
unserer Begegnung das bis auf den letzten<br />
Platz gefüllte Münchner Opernhaus mit<br />
leisen Liedern von Robert Schumann in<br />
Aufruhr versetzt.<br />
Das Wesen der Romantik, hat Oscar<br />
Wilde gesagt, sei die Ungewissheit. Es wirkt<br />
jedoch so, als gebe es nichts Ungewisses<br />
bei dieser Mezzosopranistin. Ihr beruflicher<br />
Weg, der in nur zehn Jahren vom Debüt in<br />
Meiningen bis zur Met in New York führte,<br />
scheint eine Autobahn gewesen zu sein, mit<br />
Gewissheit asphaltiert.<br />
Über Garanča wird oft geschrieben,<br />
dass sie alles habe: Timbre, Technik, Charisma,<br />
Musikalität, Darstellungskraft und<br />
besagte Schönheit. Dass die Lettin nordisch<br />
kühl wirkt, passt. Was nicht passt, ist ihr<br />
Eingeständnis, eine professionelle Maske zu<br />
tragen. Auf der Höhe des Weltruhms bebt<br />
sie noch immer vor dem ersten Ton, auf<br />
mancher Gala fühlt sie sich sterbenseinsam.<br />
Hören will das niemand.<br />
Das, was alle hören wollen, gibt sie nur<br />
sehr zögerlich preis: Ihren Ehemann, den<br />
Dirigenten Karel Mark Chichon, erzählt<br />
sie stockend, habe sie bei einer gemeinsamen<br />
Probe in ihrer Heimatstadt Riga kennengelernt.<br />
Er kam zehn Minuten zu spät.<br />
„Und ich war bitterböse.“ Aber als er ihr die<br />
Hand reichte, durchfuhr sie ein Blitz. „Ich<br />
wusste: Das ist ein Mann, den du heiraten<br />
kannst.“ Vor sechs Jahren tat sie das auch,<br />
im vergangenen Jahr wurde die Tochter Catherine<br />
geboren.<br />
In ihrer Heimat habe Romantik viel<br />
mit Wehmut und Sehnsucht zu tun, sagt<br />
Garanča. Im Unabhängigkeitskampf haben<br />
Hunderttausende von Letten bei Demonstrationen<br />
etwas gesungen, was von<br />
den Deutschen ihres Alters kaum mehr<br />
einer kennt: Volkslieder. In Lettland heißt<br />
es, für jeden Letten gebe es ein Volkslied.<br />
Zwei Millionen für zwei Millionen. „Unsere<br />
Volkslieder sind voller Weisheit“, sagt<br />
sie und dreht an ihrem Brillantring. Ihre<br />
Stimme klingt so innig wie am Abend zuvor<br />
bei einem Schumann-Lied. „Aber es<br />
gibt darin auch viel Schmutziges“, strahlt<br />
sie.<br />
Die Hände von Elīna Garanča bewegen<br />
sich wenig, aber energisch. Sie sehen aus,<br />
als könnten sie hart arbeiten. „Ich habe gelernt,<br />
wie viel Erdung mein Beruf verlangt.“<br />
Ihre Großeltern sind Bauern. „Die väterlicherseits<br />
haben sich mehr mit Pferden, die<br />
mütterlicherseits mehr mit Milchwirtschaft<br />
und Fleischproduktion befasst.“ Ferienmachen<br />
hieß für Elina, dort, 200 bis 300 Kilometer<br />
von Riga entfernt, mitten im Wald,<br />
Kühe zu melken, Schweine zu füttern, Unkraut<br />
zu jäten. Und sie melkte, fütterte und<br />
jätete gern. „Ich habe als Kind kapiert, dass<br />
es eine Welt gibt, die sich mit Lebenserhalt<br />
befasst, und eine, die sich mit Kunst<br />
beschäftigt.“ Ihr Vater war Chorleiter, die<br />
Mutter Liedsängerin. „Ich habe Schumanns<br />
‚Frauenliebe und -leben‘ in ihrem<br />
Bauch gehört. Und singe das aus ihren Noten,<br />
in denen ihre handschriftlichen Eintragungen<br />
stehen.“ Oper, die hybrideste aller<br />
Kunstformen, hat für sie nichts mit Abheben<br />
zu tun. Opernsängerin zu werden, lag<br />
so nahe wie das Theater in ihrer Jugend:<br />
direkt gegenüber der Schule. Im Winter,<br />
also die meiste Zeit des Jahres, wechselte sie<br />
nach der letzten Stunde tagtäglich die Straßenseite.<br />
Drüben unterrichtete die Mutter<br />
Schauspieler in Gesang.<br />
In jenen sieben, acht Monaten des Jahres,<br />
in denen es in Lettland finster ist, lebt<br />
Garanča inzwischen unweit von Málaga.<br />
Dort pflanzt sie Tomaten und Zucchini,<br />
düngt Erdbeeren und Rosen. Manchmal<br />
stinken ihre Hände zwei Tage lang nach<br />
Schafscheiße, erzählt sie, und spricht<br />
„Schafscheiße“ so vollendet aus wie „Todesschlaf“<br />
oder „Segensspruch“, wenn sie<br />
Schumann-Lieder singt. Als kleines Mädchen<br />
versuchte sie, auf einer Kuh zu reiten<br />
und Fallschirm zu springen, hielt eine<br />
Decke an vier Zipfeln fest und sprang im<br />
Kuhstall vom höchsten Balken ab. Dass sie<br />
bis zu den Knien im Mist landete, raubte<br />
ihr nicht die Lust an Exkursionen ins Dickicht<br />
der Unvernunft.<br />
Aber gibt es auch etwas Zerbrechliches<br />
hinter dieser starken Garanča? Steigen<br />
Ängste auf hinter der glatten Stirn? „Im<br />
Dunkeln verfüge ich über einen Wahrnehmungsradius<br />
von 360 Grad. Weil ich Angst<br />
habe vor der Dunkelheit“, sagt sie. Als sie<br />
mir erklärt, woher diese Angst kommt,<br />
schaut sie auf den Boden. Und als sie mich<br />
zum Schluss bittet, das nicht zu schreiben,<br />
ist ihre Stimme 30 Jahre jünger als sie selbst.<br />
Psychologin zu werden, könnte sie sich<br />
vorstellen. Sie interessiert brennend, was<br />
Menschen zu unvernünftigen Handlungen<br />
verleitet. Vor allem aber interessiert<br />
sie, welche Überlebensinstinkte wach werden,<br />
wenn Menschen in eine unerwartete<br />
Situation geraten. In Opern wollen Frauen<br />
meist gerettet werden, und üblicherweise<br />
kommt die Rettung zu spät. Elīna Garanča<br />
rettet sich in ihrem Dasein lieber selbst und<br />
rechtzeitig.<br />
Kürzlich wurde ihr angeboten, erstmals<br />
ein neu komponiertes, hochgelobtes Werk<br />
zu singen. Es handelte von einer Mutter,<br />
die im Tsunami ihr Kind verlor. Da war<br />
gerade ihre Tochter zur Welt gekommen.<br />
„Ich habe abgelehnt“, sagt sie. Stattdessen<br />
hat sie ganz privat eine Ersteinspielung produziert:<br />
lettische Volkslieder. Wiegenlieder<br />
für Catherine, wenn ihre Mama auf Tournee<br />
ist. Perfekt maskiert.<br />
Eva Gesine Baur<br />
schreibt Biografien und Romane,<br />
die von Musik handeln. Zuletzt<br />
erschien ihr Buch über „Emanuel<br />
Schikaneder“ (C. H. Beck)<br />
Fotos: Felix Broede, Privat (Autorin)<br />
106 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Bebt, auch wenn es<br />
niemand hören will,<br />
auf der Höhe ihres<br />
Weltruhms immer<br />
noch vor dem ersten<br />
Ton: Elīna Garanča<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 107
| S a l o n<br />
Über Vampirbücher und<br />
virtuellen Sex<br />
Wie Andrew Wylie, der berühmteste Literaturagent der Welt, gegen den Untergang der Hochkultur kämpft<br />
von Huberta von Voss<br />
V<br />
ielleicht räkelte sich Hampton,<br />
die Ladenkatze, gerade auf der<br />
Holztheke neben der antiken Registrierkasse,<br />
als Andrew Wylie die bimmelnde<br />
Tür des Corner Bookstore nach<br />
einem Lauf im Central Park öffnete. Vielleicht<br />
brauste gerade der Bus M3 auf der<br />
Madison Avenue auf dem Weg nach Harlem<br />
vorbei. Vielleicht war wieder mal<br />
kein Vogel im Central Park zu hören gewesen,<br />
nur das Rauschen des Verkehrs, das<br />
Klicken der Touristenkameras und das<br />
dumpfe Wummern der iPods der anderen<br />
Jogger. Man findet alles in Manhattan, nur<br />
keine Stille. Es sei denn, man sucht Zuflucht<br />
an der Ecke der 93. Straße in dieser<br />
kleinen Kathedrale der guten Literatur,<br />
in der Frank McCourt erstmals „Die<br />
Asche meiner Mutter“ vorstellte und das<br />
Geräusch der Sohlen auf dem alten rotgrauen<br />
Terrazzoboden zu leisen Schritten<br />
gemahnt.<br />
Wylies Blick fiel auf „Vertigo“, die erste<br />
Übersetzung von W. G. Sebalds Erzählungsband<br />
„Schwindel. Gefühle“. „Ist literarische<br />
Größe noch möglich?“, fragt da Susan<br />
Sontag rhetorisch auf dem Einband. „Ich<br />
hatte kein Geld dabei, aber nahm das Buch<br />
mit und rief Susan an“, erinnert sich Wylie.<br />
Sontag geriet ins Schwärmen. „Okay“,<br />
sagte ich. „Ich werde duschen, gehe das<br />
Buch bezahlen und lese es dann. Nachdem<br />
ich durch war, habe ich sie direkt danach<br />
wieder angerufen und gesagt ‚Mein Gott,<br />
Susan, das ist großartige Literatur!‘“ Wylie<br />
besorgte sich Sebalds Nummer und beschloss,<br />
ihn weltweit berühmt zu machen.<br />
Wenig später fuhr er mit dem Zug ins ostenglische<br />
Norwich und besiegelte die Zusammenarbeit<br />
wie üblich per Handschlag.<br />
Bald verband Andrew und Max, wie Sebald<br />
von Freunden genannt wurde, eine innige<br />
Freundschaft.<br />
Wenn Wylie einen Autor gewinnen<br />
will, reist er an und spielt notfalls über die<br />
Bande. „Er ist ein meisterhafter Stratege“,<br />
sagt der Autor George Prochnik. So hat<br />
Wylie einst die Kooperation mit der früheren<br />
pakistanischen Politikone Benazir<br />
Bhutto als Köder ausgeworfen, um Salman<br />
Rushdie für seine Agentur zu gewinnen.<br />
Kaum ein Agent verfügt über derart<br />
solide internationale Verlagskontakte von<br />
Nordamerika und Europa bis nach Japan,<br />
China und in die arabische Welt. Seit der<br />
Harvard-Absolvent und Sohn einer wohlhabenden<br />
Bostoner Familie nach wilden<br />
Jahren als bärtiger Taxifahrer und Partygast<br />
von Andy Warhol 1980 die Wylie Agency<br />
gründete, hat er sein Netzwerk aus Autoren<br />
und Verlegern, Chefredakteuren und<br />
Rezensenten unermüdlich ausgebaut. Wer<br />
von Wylie vertreten wird, hat gute Chancen,<br />
in New York und London besprochen<br />
und bis nach Karachi gelesen zu werden.<br />
Sebalds Roman „Austerlitz“ wurde von der<br />
New York Times zu einem der zehn wichtigsten<br />
Bücher des Jahres gewählt und<br />
ein weltweiter Erfolg. „Mein letztes Buch<br />
wurde von Wylies Agentur nach Südkorea<br />
und Katar verkauft“, sagt Prochnik. „Kein<br />
anderer meiner Agenten hat diese Märkte<br />
vorher auch nur für relevant gehalten, geschweige<br />
denn Verbindungen dorthin aufgebaut.“<br />
Für die Autoren summieren sich<br />
diese internationalen Verkäufe.<br />
Wie im Corner Bookstore herrscht auch<br />
in Wylies New Yorker Büro in der Nähe<br />
von Broadway und Carnegie Hall eine fast<br />
schon gespenstische, weltabgewandte Ruhe.<br />
Es würde einen nicht wundern, wenn Wylie<br />
statt elegantem Maßanzug einen weißen<br />
Kittel trüge, um in seinem Chemielabor<br />
ungestört von dem Getöse der Bestsellerlisten<br />
die Essenz der Weltliteratur zu destillieren.<br />
Es ist Mittwochnachmittag, die<br />
drückende Hitze Manhattans wird sich in<br />
wenigen Minuten in einem heftigen Sommersturm<br />
entladen. 18 Mitarbeiter in kleinen<br />
Büros und Arbeitsnischen beschäftigen<br />
sich hier nahezu geräuschlos mit ihren Manuskripten,<br />
umgeben von Tausenden von<br />
Erstausgaben ihrer Autoren. Niemand<br />
spricht, niemand blickt auf, als der Chef<br />
mit festem Schritt vorbeieilt. Ein Mitarbeiter<br />
isst ein Reisgericht aus einer Aluschale<br />
und brütet über einem Balkendiagramm.<br />
Zu den Geschäftspraktiken der Agentur<br />
gehören Zahlen und Präzision: Wie hoch<br />
schätzt man das Potenzial eines Buches ein,<br />
welche zusätzlichen Märkte könnte man<br />
dafür noch erobern? Wie viel Vorschuss<br />
kann man einem Verlag abhandeln?<br />
Wylie nimmt auf einem Sessel Platz,<br />
schlägt die Beine übereinander und beobachtet<br />
mich auf dem dunkelblauen Sofa.<br />
Die eigenartige Schräge seiner hellen Augen<br />
geben seinem schmalen Kopf etwas Raubkatzenhaftes.<br />
Seit er 1995 Martin <strong>Am</strong>is von<br />
dessen langjähriger Agentin Pat Kavanagh,<br />
der Frau des britischen Schriftstellers Julian<br />
Barnes, abwarb, haftet ihm der Spitzname<br />
„Schakal“ an. Dabei handelt Wylie weniger<br />
wie ein aasfressender Wildhund, sondern<br />
eher wie ein Gepard, von dem man sagt, er<br />
beobachte seine Beute lange im Verborgenen,<br />
bevor er zugreife. „Oft stellen wir fest,<br />
dass ein Autor von sieben internationalen<br />
Verlagen gedruckt wird, die allesamt für ihren<br />
schlechten Geschmack und ihr mangelndes<br />
Urteil bekannt sind. Das spart mir<br />
unglaublich viel Zeit, weil ich mir dann die<br />
Werke noch nicht mal anschauen muss“,<br />
meint er trocken. Man tue Autoren keinen<br />
Gefallen damit, ihre Bücher an Joe<br />
Mudpuddle in Sussex zu verkaufen. Mancher<br />
wirft ihm vor, nur etablierten Autoren<br />
zu Ruhm zu verhelfen, dabei findet<br />
man bei der Durchsicht seines 240 Seiten<br />
Foto: Kai Nedden<br />
108 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Andrew Wylie in<br />
seinem New Yorker<br />
Büro. Zu seinen<br />
850 Klienten zählen<br />
Orhan Pamuk,<br />
David Bowie und<br />
Henry Kissinger<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 109
| S a l o n<br />
starken Katalogs eine Reihe von Debütwerken.<br />
Und niemand kann ihm vorwerfen,<br />
sein Geld mit Buchmarkt-Trash oder<br />
billiger Mädelliteratur zu verdienen. „Dieser<br />
Mann hat einen unglaublich guten Geschmack“,<br />
sagt Steve Wasserman, bis vor<br />
kurzem New Yorker Direktor der Konkurrenzagentur<br />
Kneerim & Williams.<br />
Würde er einschlagen, wenn E. L. James,<br />
die alleine in den USA gerade 35 Millionen<br />
Exemplare ihrer Sadomaso-Trilogie<br />
verkauft hat, ihn bäte, ihr Agent zu werden?<br />
Wylie lächelt genüsslich. „Ich würde<br />
ihr sagen, dass ich ihre Arbeit nicht gelesen<br />
habe“, sagt er lang gedehnt und unterdrückt<br />
ein Lachen, „was der Fall ist. Und<br />
dass ich das Gefühl habe, dass wir nach<br />
dem, was ich höre, nicht die richtigen<br />
Agenten für sie wären.“ Vor James bekam<br />
Danielle Steel lange den Spott Wylies ab,<br />
der „kein Interesse an Literatur für frustrierte<br />
Frauen hat“ – es sei denn auf dem literarischen<br />
Niveau von Charlotte Brontës<br />
„Jane Eyre“.<br />
Einen Steinwurf entfernt von Wylies<br />
Agentur sitzt einer seiner wichtigsten Geschäftspartner<br />
in einem raumgreifenden<br />
Büroturm, der die Macht des größten internationalen<br />
Publikumsverlags spiegelt:<br />
Markus Dohle, CEO von Random House,<br />
Verleger von E. L. James, Danielle Steel und<br />
einer beachtlichen Zahl von Wylies Klienten<br />
wie dem vor elf Jahren verstorbenen<br />
W. G. Sebald. Der energische Westfale ist<br />
dieser Tage bestens gelaunt, denn dank<br />
der „Mommy-Porn“-Trilogie und anderer<br />
erfolgreicher Titel läuft das Geschäftsjahr<br />
2012 trotz allgemeiner Krisenstimmung<br />
hervorragend. Im Herbst geht Random<br />
House mit Salman Rushdies Memoiren<br />
„Joseph Anton“ sowie neuen Werken von<br />
John Grisham und Ian McEwan an den<br />
Start. Hinzu kommt der rapide Anstieg der<br />
E‐Book-Verkäufe, mit denen laut Dohle<br />
neue Käuferschichten gewonnen wurden.<br />
So rapide, dass selbst der Zusammenbruch<br />
der amerikanischen Buchhandelskette Borders<br />
mit 700 nun fehlenden Verkaufsstellen<br />
verkraftbar scheint. „Ich werde häufig<br />
gefragt, wie es uns denn mit unserem ‚traditionellen‘<br />
Verlagsmodell geht. Uns geht<br />
es sehr gut, weil wir das Modell modernisiert<br />
haben und weiterentwickeln!“, sagt<br />
der 44-Jährige.<br />
Derweil steht der internationale Buchmarkt<br />
unter Druck: Einerseits soll laut des<br />
Marktforschungsunternehmens Forrester<br />
„Jeder Verleger sollte sich für<br />
W. G. Sebald ruinieren. Stattdessen<br />
machen sie das für E. L. James“<br />
Andrew Wylie<br />
Der Corner Bookstore ist eine New Yorker Institution. Natürlich wird hier auch „Shades of<br />
Grey“ verkauft, berühmt aber ist der Buchladen für sein ausgesuchtes literarisches Sortiment<br />
Research 2015 der Umsatz mit E-Books<br />
in den USA auf ganze drei Milliarden Dollar<br />
klettern. Andererseits hat Jeff Bezos,<br />
Chef des amerikanischen Buchversandriesen<br />
<strong>Am</strong>azon, den Verlagen mit der Einführung<br />
des hauseigenen digitalen Lesegeräts<br />
Kindle und der Gründung eines<br />
eigenen Verlags de facto den Krieg erklärt.<br />
Dass <strong>Am</strong>azon Publishing vom Verlagsurgestein<br />
Larry Kirshbaum, dem früheren<br />
CEO der Time Warner Book Group, geleitet<br />
wird, ist für das Feld der Konkurrenten<br />
keine Beruhigung. „16 von 100 Bestsellern<br />
auf dem Kindle werden heute mit<br />
unserer Hilfe selbst verlegt“, erklärte Bezos<br />
kürzlich stolz dem New-York-Times-Starkolumnisten<br />
Thomas L. Friedman. „Das<br />
bedeutet: kein Agent, kein Verleger, kein<br />
Papier – nur ein Autor, der den Großteil<br />
der Lizenzgebühren bekommt, plus <strong>Am</strong>azon<br />
und Leser.“ Wann immer er die Gelegenheit<br />
hat, trompetet Jeff Bezos: „Weg<br />
mit den Türhütern!“ Die Zukunft des Verlegens<br />
sei digital und demokratisch.<br />
Wylie und Dohle sind da natürlich<br />
gänzlich anderer Meinung. Schon seit langem<br />
halten sie dagegen, dass Buchproduktion<br />
ohne Qualitätskontrolle das Netz verstopfe<br />
wie Schmutz ein Abflussrohr. „Der<br />
einzige Ehrgeiz von <strong>Am</strong>azon ist Größe. Für<br />
die macht es gar keinen Unterschied, ob sie<br />
Hot Dogs verkaufen oder ‚Ulysses‘, solange<br />
es nur 99 Cents kostet“, schnarrt Wylie.<br />
Dass der Internetversand und E-Book-Verleger<br />
seinen Autoren 70 Prozent der Einnahmen<br />
verspricht, sei aufgrund der in den<br />
USA relativ niedrigen Verkaufspreise von<br />
E-Books ohnehin Rosstäuscherei. Wenn er<br />
einen Vorschuss von drei bis vier Dollar<br />
pro Buch auf prospektive 100 000 Printexemplare<br />
aushandle, könne sich der Autor<br />
zwei Jahre zum Schreiben zurückziehen.<br />
Aber wenn man 30 Cents von 100 000<br />
digitalen Exemplaren bekäme, die zu<br />
Foto: ZVG<br />
110 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Dagmar Morath<br />
Schleuderpreisen auf den Markt geworfen<br />
würden, sei man rasch pleite. „Oder man<br />
arbeitet sieben Jahre bei McDonalds und<br />
schreibt nach Feierabend ‚Ulysses‘ und versucht,<br />
sich nicht aufzuhängen.“<br />
In den Gängen der Verlage geht dennoch<br />
das Gespenst der Autorenautonomie<br />
um. Dohle räumt ein, dass er vor den neuen<br />
Spielern und Marktmodellen großen Respekt<br />
hat. „Wir beobachten und analysieren<br />
die Marktentwicklungen ganz genau.“ Allerdings<br />
bemüht er sich auch darum, den<br />
Hype zu dämpfen. Nur ganz wenigen der<br />
sich selbst online verlegenden Autoren sei<br />
es gelungen, nach oben auszubrechen. Von<br />
denen seien dann zudem durchaus viele zu<br />
klassischen Verlagen gegangen, um satte<br />
Vorschüsse zu kassieren.<br />
So unterzeichnete etwa <strong>Am</strong>anda Hocking,<br />
die mit online selbst veröffentlichten<br />
Vampirromanen berühmt wurde, bei<br />
der amerikanischen Verlagsgruppe Macmillan.<br />
„<strong>Am</strong>anda wer?“, knarzt Wylie mit<br />
hochgezogenen Brauen. „Was fasziniert<br />
Leute überhaupt so an diesen Vampirbüchern?<br />
Ich kann das echt nicht nachvollziehen.“<br />
Überhaupt tummelten sich im Netz<br />
Tausende von „matschbesprengten Schreiberlingen,<br />
die an gnadenloser Selbstüberschätzung<br />
leiden“. „So viele Autoren können<br />
einfach nicht schreiben und glauben<br />
trotzdem, dass jemand einen Haufen Geld<br />
für den von ihnen fabrizierten Müll zahlen<br />
sollte.“ Für Stefan Zweig war die Literatur<br />
der Eingang in eine andere Welt. Wylie<br />
scheint bereit zu sein, diesen Eingang<br />
wie ein Zerberus zu verteidigen.<br />
Random House verfolgt eine andere<br />
Strategie. Auf die Herausforderung der<br />
E-Book-Ära stellt man sich hier nolens, volens<br />
ein. In einem Imagefilm auf seinem<br />
US-Autorenportal präsentiert der Verlagsriese<br />
eine ausgeklügelte Marketingstrategie:<br />
Experten für Social Media, Blogger und<br />
Mundpropagandisten, Analysten digitaler<br />
Entwicklungen, Beobachter der explodierenden<br />
Self-Publishingszene, die gezielt erfolgreiche<br />
Autoren anwerben, Mitarbeiter,<br />
die selbst kreierte Online-Literaturseiten<br />
wie „Suvudu“ oder „Everyday eBook“ bespielen<br />
– sie alle sollen den Autoren des<br />
Hauses und seiner zahlreichen Imprints<br />
die Gewissheit geben, dass die Verlagsmaschine<br />
brummt und man werbe- und vertriebstechnisch<br />
längst im 21. Jahrhundert<br />
angekommen ist. Während das Geschäft<br />
mit den E-Books in Deutschland wegen<br />
der Buchpreisbindung und der damit verbundenen<br />
verhältnismäßig hohen Preise<br />
nur schleppend in Gang kommt, liegt ihr<br />
Umsatzanteil in den USA bei gut 25 Prozent.<br />
„In drei Jahren könnten wir 35 bis<br />
40 Prozent erreichen“, sagt Dohle.<br />
Für Steve Wasserman, mittlerweile<br />
Cheflektor bei der Yale University Press,<br />
bleibt die Zukunft des Verlegens ein Geheimnis.<br />
„Ob Autoren weiter auf traditionellem<br />
Wege veröffentlichen oder ihre<br />
Werke lieber direkt online stellen werden,<br />
ist eine offene Frage. Wie sie beantwortet<br />
wird, ist der Kern der aktuellen Auseinandersetzung<br />
zwischen <strong>Am</strong>azon und traditionellen<br />
Verlegern“, schrieb er unlängst in der<br />
amerikanischen Wochenzeitschrift The Nation.<br />
Den Unterschied zwischen E-Books<br />
und Printausgaben beschreibt er in unserem<br />
Gespräch so: „Das ist wie virtueller<br />
und echter Sex. Jeder weiß, dass echter Sex<br />
besser ist, aber für den virtuellen gibt es<br />
trotzdem einen großen Markt.“<br />
Andrew Wylie will, dass seine Agentur<br />
100 Jahre besteht und den Wandel überdauert.<br />
„Ich glaube, dass die Autoren, für<br />
die ich mich interessiere, einen bleibenden<br />
Wert haben. Deswegen sollten sie nicht nur<br />
dafür bezahlt werden, was ihr Buch in einem<br />
Jahr einbringt, sondern im Verlauf<br />
von 50 Jahren. Wie kann man jemals genug<br />
für Sebald zahlen? Jeder Verleger sollte<br />
sich für Sebald ruinieren. Stattdessen ruinieren<br />
sie sich für E. L. James. Das ist einfach<br />
verrückt“, meint Wylie zum Abschluss<br />
meines Besuchs, und man kann die Leidenschaft<br />
durchhören, mit der er Verhandlungen<br />
führt.<br />
Im Corner Bookstore liegt auf den gediegenen<br />
Lesetischen zurzeit Dave Eggers’<br />
viel gelobter neuer Roman „A Hologram<br />
for the King“, neben vielen anderen anspruchsvollen<br />
Neuerscheinungen aus der<br />
Schmiede des Staragenten. Irgendwann<br />
wird hier Prochniks neues Buch über Stefan<br />
Zweig liegen, für den Bücher eine Handvoll<br />
Stille inmitten von Unruhe und Qual<br />
waren. „Sie verkaufen also nicht ‚Shades of<br />
Grey‘?“, frage ich Robert, den Buchhändler.<br />
„Doch, doch, das hält den Laden am Leben“,<br />
seufzt er. „Wollen Sie’s haben?“<br />
Huberta von Voss<br />
lebt als freie Journalistin in<br />
New York. Zuletzt erschien ihr<br />
Reportageband „Arme Kinder,<br />
reiches Land“ (Rowohlt)<br />
Anzeige<br />
Elegant durch<br />
das Jahr 2013<br />
Bestellen Sie den <strong>Cicero</strong> Kalender<br />
NEU: herausnehmbares Adressbuch<br />
Der Original <strong>Cicero</strong> Kalender:<br />
Auch in<br />
schwarzem<br />
LEDER<br />
erhältlich<br />
Mit praktischer Wochenansicht<br />
auf einer Doppelseite und herausnehmbarem<br />
Adressbuch.<br />
Begleitet von Karikaturen, bietet<br />
unser Kalender viel Platz für Ihre<br />
Termine und Notizen.<br />
Im Handlichen Din-A5-Format,<br />
mit stabiler Fadenheftung und<br />
wahlweise in rotem Surbalin- oder<br />
schwarzem Ledereinband erhältlich.<br />
Jetzt bestellen! Lieferbar ab 8.10.2012<br />
Surbalin: 25,- EUR Bestellnr.: 890649<br />
für Abonnenten: 19,95 EUR<br />
Leder: 69,- EUR Bestellnr.: 890650<br />
Zzgl. 2,95 EUR Versandkosten, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/kalender<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 111
| S a l o n | P r e c h t s p r o l o g<br />
Auf die barrikaden!<br />
Kinder werden in Deutschland immer noch nach den gleichen Methoden unterrichtet wie vor<br />
50 Jahren. Unsere Schulen zerstören die angeborene Neugier. Eine Revolution muss her<br />
von Richard David Precht<br />
K<br />
inder, die heute eingeschult werden,<br />
gehen im Jahr 2070 in Rente.<br />
Welche Bildung werden sie für ihr<br />
Leben brauchen? Was müssen sie wissen,<br />
und was müssen sie können? Welche Herausforderungen<br />
werden sie in ihrem Zusammenleben<br />
meistern müssen und welche<br />
in ihrem Berufsleben?<br />
So naheliegend es ist, sich diese Fragen<br />
zu stellen, und so wichtig es ist, sie zu<br />
beantworten, so wenig beschäftigen sich<br />
unsere Schulen, unsere Lehrer und unsere<br />
Bildungspolitiker damit. Kinder lernen<br />
heute nahezu das Gleiche in der Schule<br />
wie die Generation ihrer Eltern und Großeltern.<br />
Die alten Sprachen sind etwas unwichtiger<br />
geworden, die Fremdsprachen<br />
wichtiger, der Biologie-Unterricht enthält<br />
heute mehr und anderen Stoff – aber<br />
das sind auch schon die wichtigsten Unterschiede.<br />
Selbst die Schullektüre gleicht<br />
fast durchgehend der von vor 40 Jahren:<br />
Goethes „Werther“, Max Frischs „Homo<br />
faber“, Friedrich Dürrenmatts „Physiker“.<br />
Aber behandeln diese Bücher wirklich die<br />
Probleme, die Sorgen, die Ängste, Träume<br />
und Sehnsüchte unserer Kinder?<br />
Die „Bildungshochstapler“, wie der<br />
Psychologe Thomas Städtler sie nennt, packen<br />
im Zweifelsfall immer mehr Stoff in<br />
die Lehrpläne, ohne dabei den alten Stoff<br />
auszumisten. Die Folge ist das, was der<br />
Bildungsexperte Reinhard Kahl als „Bulimie-Lernen“<br />
bezeichnet: schnell füttern,<br />
schnell wieder in Klausuren von sich geben<br />
und danach schnell vergessen. Mehr als<br />
100 000 Stunden geht ein deutsches Kind<br />
bis zum Abitur zur Schule – aber bis dahin<br />
hat es bereits den überwiegenden Teil<br />
des Gelernten vergessen. Noch verheerender<br />
sieht die Bilanz einige Jahre später aus.<br />
Welcher Erwachsene kann heute noch den<br />
Stoff, den er mit 13 gelernt hat? Wovon<br />
handelt das ohmsche Gesetz? Was ist der<br />
Der Gastgeber<br />
Der Philosoph und Schriftsteller<br />
Richard David Precht wird von<br />
September an regelmäßig in <strong>Cicero</strong><br />
über das Thema schreiben, das er in<br />
der neuen ZDF‐Sendung „Precht“<br />
jeweils am ersten Sonntag eines<br />
Monats um 23:30 Uhr zur Diskussion<br />
stellt. Seine Premiere – und damit auch<br />
seinen ersten <strong>Cicero</strong>-Prolog – widmet<br />
er der Bildungsmisere in Deutschland.<br />
Der Gast<br />
„Ein guter Unterricht“, sagt der<br />
Hirnforscher und Bildungskritiker<br />
Gerald Hüther, „ist einer, der<br />
die allen Kindern angeborene<br />
Begeisterungsfähigkeit erhält, statt<br />
sie zu zerstören.“ Der Göttinger<br />
Neurobiologe, der mit zahlreichen<br />
populärwissenschaftlichen Büchern<br />
und Interviews bekannt wurde, ist<br />
Prechts erster Gast.<br />
Inhalt der „Goldenen Bulle“? Wer kann als<br />
Erwachsener noch den „Höhensatz“ in der<br />
Geometrie anwenden?<br />
Gewiss, all dies ist wichtiger Bildungsstoff.<br />
Doch so wie er an unseren Schulen<br />
gelehrt und gelernt wird, bleibt im Regelfall<br />
kaum etwas davon hängen. Denn, wie<br />
bereits Konfuzius wusste: „Das, was man<br />
erklärt bekommt, vergisst man. Das, was<br />
einem vorgemacht wurde, daran erinnert<br />
man sich. Nur das aber, was man selber<br />
gemacht hat, kann man.“ Selber machen,<br />
das heißt bezogen auf den Schulstoff, mit<br />
Neugier und Begeisterung ausführen, nicht<br />
aber aus Pflicht repetieren.<br />
Welchen Sinn macht es, 100 000 Stunden<br />
zu lernen, wenn so wenig davon in<br />
Erinnerung bleibt? Welche ungeheure Verschwendung<br />
von Zeit und Energie liegt<br />
hier vor? Wie viel angeborene Neugier<br />
wird dabei von der Schule zerstört? Wären<br />
unsere Schulen Unternehmen, sie wären<br />
längst pleite. Sie sind viel zu ineffizient.<br />
Wären unsere Schulen Staaten, wären<br />
sie längst implodiert. Gescheitert am Widerstand<br />
ihrer Bürger.<br />
Die Anforderungen der zukünftigen<br />
Lebens- und Arbeitswelt verlangen nach<br />
kreativen Problemlösern und nicht nach<br />
Köpfen, die wie Aktenordner mit totem<br />
Wissen angefüllt sind. Doch statt Kinder<br />
als individuelle Rennpferde zu behandeln,<br />
schulen wir sie zu geduldigen Postpferden,<br />
wie der Mathematiker und Managementberater<br />
Gunter Dueck anmahnt. Unsere<br />
Schulen bereiten nicht nur schlecht auf<br />
das Leben vor, sie zerstören sogar gezielt<br />
jene Potenziale an Neugier, Begeisterungsfähigkeit<br />
und Kreativität, die später für ein<br />
erfülltes Leben gebraucht werden.<br />
Nach alldem, was die moderne Entwicklungspsychologie,<br />
die Lerntheorie und<br />
die Hirnforschung über das Lernen wissen,<br />
lässt sich schlussfolgern: Genau so wie<br />
Fotos: Axel Heimken/DDP Images/DAPD, Frank Schinski/Ostkreuz<br />
112 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Verbessert: Was Personalentscheider<br />
gegen die Benachteiligung<br />
von Frauen<br />
bei Berufungen tun können.<br />
Seite 3<br />
Verkürzt: In Europa wollen<br />
Hochschulen den<br />
Fachkräftemangel mit<br />
Express-Studiengängen<br />
lindern. Seite 4<br />
Verändert: Der europäische<br />
Forschungsrat renoviert<br />
sein Programm und<br />
fördert nun Forscher mit<br />
Geschäftssinn. Seite 6<br />
Vernetzt: Wie eine Informatikerin<br />
Web 2.0-Elemente<br />
in bundesdeutsche<br />
Hörsäle bringen<br />
möchte. Seite 9<br />
kontakte Seite 10<br />
Internet: www.iwwb.de/weiterbildung.<br />
html?seite=38<br />
Vertrackt: Tschechiens<br />
Regierung steckt in der<br />
Dauerkrise und macht<br />
den Hochschulen so das<br />
Leben schwer. Seite 30<br />
unsere Schulen glauben, Wissen zu vermitteln<br />
– genau so geht Lernen nicht. Doch<br />
warum werden diese Erkenntnisse an unseren<br />
Schulen bis heute kaum berücksichtigt?<br />
Warum dressieren wir immer noch Postpferde,<br />
anstatt den Charakter und die Fähigkeiten<br />
der Rennpferde zu stärken?<br />
Die Antwort ist vermutlich recht einfach:<br />
Weil unser Bildungssystem selbst in<br />
hohem Maße unkreativ ist! Die Anzahl<br />
der Begeisterten, Neugierigen und Kreativen<br />
unter deutschen Lehrern ist sehr überschaubar.<br />
Gar nicht zu reden von Kultusbürokraten<br />
und Kulturpolitikern. Statt<br />
über ein völlig neues Lernen nachzudenken,<br />
finden sich in den öffentlichen Debatten<br />
noch immer uralte Freund-Feind-<br />
Linien von vermeintlich „linker“ oder<br />
„rechter“ Bildungspolitik. Dabei geht es um<br />
„linke“ Gesamtschulen gegen die „rechten“<br />
Bildungsprivilegien der Besserverdienenden<br />
– aber es geht kaum um die Frage, was<br />
inhaltlich an unseren Schulen passiert. Wer<br />
ändert unsere Lehrpläne? Wer macht unsere<br />
Klassenzimmer zu architektonisch gelungenen<br />
Lernräumen? Wer schafft unsere<br />
völlig absurde Lehrerausbildung ab, die den<br />
Referendaren den gleichen fleißigen Konformismus<br />
abnötigt, den sie später von ihren<br />
Schülern einfordern werden?<br />
Was dagegen ist ein guter Lehrer? Einer,<br />
der selbst weiterlernen möchte, hätte Wilhelm<br />
von Humboldt geantwortet. Was sind<br />
seine wichtigsten Voraussetzungen? Fachwissensfülle?<br />
Didaktik? Nein, die wichtigsten<br />
Voraussetzungen eines Lehrers sind<br />
1) dass er Kinder mag und 2) dass er ein<br />
Mensch ist, dem man gerne zuhört und der<br />
mit seiner eigenen Begeisterung andere begeistert.<br />
Alles andere ist demgegenüber sekundär.<br />
Aber: An wie viele solcher Lehrer<br />
erinnern wir uns aus unserer eigenen Schulzeit?<br />
An einen, zwei oder bestenfalls drei.<br />
Ein guter Lehrer begleitet seine Schüler<br />
auf ihrer Entdeckungsreise durch die faszinierende<br />
Welt des Wissens, Glaubens und<br />
Meinens, die man Kultur nennt. Und nur<br />
was dabei mit Neugier gelernt wird, wird<br />
unseren Kindern wichtig und bedeutsam.<br />
Und nur was ihnen bedeutsam ist, weckt<br />
ihre Kreativität und spornt die Leistungsbereitschaft<br />
an. Ein guter Unterricht, so<br />
sagt der Hirnforscher und Bildungskritiker<br />
Gerald Hüther, ist einer, der die allen Kindern<br />
angeborene Begeisterungsfähigkeit erhält<br />
statt sie zu zerstören. „Leben ist mehr<br />
als die Jagd nach guten Zensuren. Leben ist<br />
mehr als die Vorbereitung auf ein Examen.<br />
Kinder können mehr, als auf Zeugnisse zu<br />
schielen. Wir demütigen sie, wenn wir ihre<br />
Leistungen nur auf die in der Schule erzielten<br />
Noten reduzieren“, schreibt Hüther in<br />
seinem soeben erschienenen Buch „Jedes<br />
Kind ist hochbegabt“.<br />
Ungezählte Bildungsreformen hat die<br />
Bundesrepublik Deutschland bisher erlebt<br />
bis hin zu den jüngsten Verfehlungen des<br />
Bologna-Prozesses und zur flächenweisen<br />
Abschaffung des 13. Schuljahrs. Das, was<br />
heute ansteht, ist keine neue Reform. Unsere<br />
Schulen müssen nicht reformiert werden.<br />
Sie müssen völlig anders werden als<br />
bisher. Wir brauchen andere Lehrer, andere<br />
Methoden und ein ganz anderes Zusammenleben<br />
in der Schule. Mit einem<br />
Wort: Wir brauchen keine weitere Bildungsreform,<br />
wir brauchen eine Bildungsrevolution!<br />
Anzeige<br />
Unabhängige<br />
Deutsche Universitätszeitung<br />
UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG<br />
europa<br />
04<br />
Für Forscher und Wissenschaftsmanager<br />
Teils heiter, teils wolkig<br />
Doktorandenausbildung<br />
11.05.2012 | EUR 6,80<br />
UNABHÄNGIGE DEUTSCHE UNIVERSITÄTSZEITUNG<br />
Elite-Institut baut<br />
erfolgreich auf die<br />
Auftragsforschung<br />
Was man fürs<br />
Betriebsklima<br />
tun kann<br />
Personal frisst Budget<br />
Florenz Vor ziemlich genau 40 Jahren gegründet,<br />
setzt das europäische Universitätsinstitut<br />
(EUI) nicht nur Maßstäbe als Deutsche Hochschulen<br />
Eliteschmiede für Doktoranden aus ganz<br />
Europa. Auch als Thinktank hat sich das werden immer ärmer<br />
bei Florenz gelegene Institut offenbar einen<br />
Markt erobert. Fast die Hälfte seines<br />
Etats, rund 20 Millionen Euro, verdient das<br />
international geförderte EUI nach eigenen<br />
Fünf Jahre Programmpauschale<br />
Angaben mittlerweile mit der Auftragsforschung.<br />
Ihm ist damit gelungen, woran andere<br />
Hochschulen und Institute in Europa Warum Unis Forscher mit<br />
verbissen arbeiten. Ein Blick auf ein Institut<br />
mit Modellcharakter. kontakte Seite 10 vielen Drittmitteln lieben<br />
20.07.2012 | EUR 7,90<br />
MAGAZIN<br />
FÜR FORSCHER UND WISSENSCHAFTSMANAGER<br />
Wissenschaft<br />
weiterdenken<br />
duz.de<br />
duz-wissenschaftskarriere.de<br />
tipp der redaktion<br />
duzAKADEMIE<br />
Nutzen Sie Datenbanken!<br />
Frankfurt/Main Wer sich weiterbilden möchte,<br />
sucht vor allem in Datenbanken nach Angeboten.<br />
Das ergab eine Online-Umfrage des fit In-<br />
für die Welt macht<br />
foWeb Weiterbildung. Jeder zweite, der in den<br />
vergangenen zwölf Monaten im Internet fündig<br />
wurde, buchte anschließend einen Kurs. Datenbanken<br />
sind also ein wichtiges Marketinginstrument,<br />
gerade für Wie man Studenten daheim<br />
Hochschulen.<br />
➜ www.iwwb.de/weiterbildung.<br />
themen<br />
agenda<br />
hochschule<br />
forschung<br />
kontakte<br />
brennpunkt<br />
Hintergrundinfos, Analysen, Empfehlungen und die besten Jobs<br />
für Nachwuchswissenschaftler, Fach- und Führungskräfte aus Hochschule und Wissenschaft
Historische<br />
Darstellung<br />
von Napoleons<br />
Einmarsch in<br />
Moskau, das<br />
vom Zaren und<br />
seiner Regierung<br />
aufgegeben und<br />
in Brand gesetzt<br />
worden war<br />
Europa, enges Land<br />
Napoleons Russlandfeldzug jährt sich diesen Herbst zum 200. Mal.<br />
Seine weltgeschichtlichen Schatten wirken bis heute nach. Nicht<br />
zuletzt in der tragischen Figur seines Feldherrn<br />
von Konstantin Sakkas<br />
Foto: Action Press/Ullstein Bild<br />
114 <strong>Cicero</strong> 9.2012
D a s a l t e e u r o p ä i s c h e L e i d e n | S a l o n |<br />
Hat der Moderne<br />
den Weg<br />
bereitet, war im<br />
Herzen jedoch<br />
ein Anhänger<br />
der politischen<br />
Romantik des<br />
Ancien Régime:<br />
Napoleon<br />
Bonaparte<br />
(1769-1821)<br />
Foto: Bridgemanart.com<br />
A<br />
m 16. Dezember 1812 veröffentlichte der Moniteur, das<br />
offizielle Mitteilungsblatt der kaiserlich-französischen<br />
Regierung, ein Kommuniqué, worin dem französischen<br />
Volk der Rückzug der Grande Armée aus Russland und<br />
die bevorstehende Rückkehr Napoleons nach Paris verkündet<br />
wurde. Der Text schloss mit dem eindrucksvollen Satz: „La santé<br />
de sa majesté n’a jamais été meilleure“, zu Deutsch: „Die Gesundheit<br />
Seiner Majestät ist nie besser gewesen.“ Mit diesem Satz endete<br />
der Russlandfeldzug, zu dem Napoleon sechs Monate zuvor,<br />
am 22. Juni 1812, mit dem bis dahin größten Heer der Geschichte<br />
aufgebrochen war und der in einem beispiellosen Desaster geendet<br />
hatte. Und mit diesem Satz begann zugleich der Befreiungskrieg<br />
der europäischen Länder gegen die französische Besatzung und<br />
gegen das junge französische Kaisertum. Er war der Anfang vom<br />
Ende Napoleons.<br />
Der napoleonische Russlandfeldzug war der erste Versuch eines<br />
westeuropäischen Herrschers, das Riesenreich im Osten zu erobern.<br />
Die Erobererkarriere des Kaisers hatte 1796 mit dem Italienkrieg<br />
begonnen, damals noch im Dienst des revolutionären<br />
Pariser Direktoriums. Seither hatte er das gesamte europäische<br />
Festland entweder unterworfen oder dessen Souveräne zu Friedensverträgen<br />
gezwungen. Damit trat er in die Fußstapfen des<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 115
| S a l o n | D a s a l t e e u r o p ä i s c h e L e i d e n<br />
Noch im September 1812, nach seinem Sieg bei der blutigen Schlacht von Borodino, feuerte Napoleon<br />
seine Truppen mit dem sprichwörtlich gewordenen Satz „Seht, die Sonne von Austerlitz!“ an<br />
Auch seine fatale<br />
Fehlorganisation tat der<br />
epochalen Emblematik<br />
des Russlandfeldzugs<br />
keinen Abbruch<br />
von ihm bewunderten Alexanders des Großen. Was er 1812 anstrebte,<br />
war nicht mehr die europäische Hegemonie, sondern das<br />
eurasische Großreich.<br />
Neben dem epochalen Anspruch Napoleons, eine Universalmonarchie<br />
zu errichten, stand der politisch-taktische, England zu<br />
bezwingen. Trotz seiner parlamentarischen Tradition hatte sich<br />
Frankreichs alter Erbfeind der Revolutionsregierung<br />
widersetzt und lag seit 1792 beinahe<br />
ununterbrochen im Krieg mit Paris. Die<br />
Kontinentalsperre, 1806 im besetzten Berlin<br />
von Napoleon dekretiert, verbot den französisch<br />
besetzten Ländern den Handel mit der<br />
Weltmacht England. Auch mit Russland, das<br />
Napoleon zuvor nicht hatte besiegen können<br />
und mit dem es im Tilsiter Frieden 1807 zum<br />
Ausgleich gekommen war, bestand ein Abkommen,<br />
das den Handel mit England verbot.<br />
Noch auf dem Erfurter Fürstentag von<br />
1808 standen sich Kaiser Napoleon und Kaiser<br />
Alexander I von Russland als gleichberechtigte Staatsmänner<br />
gegenüber, die das Schicksal Europas untereinander entschieden<br />
zu haben schienen.<br />
Doch der Schein trog. Der Gegensatz zwischen Frankreich und<br />
England war ein unlösbares Dilemma, und Russland war der Faktor,<br />
an dem es sich entscheiden sollte. Die Ehe, die Napoleon 1810<br />
mit der österreichischen Erzherzogin Marie Louise schloss, um<br />
sich, dem sozialen Aufsteiger und „Leutnant auf dem Kaiserthron“,<br />
die ersehnten Weihen dynastischer Legitimität zuzulegen, war das<br />
erste offizielle Signal seiner Abwendung von Russland. Der Zar seinerseits<br />
unterlief die Kontinentalsperre und blockierte den Handel<br />
mit französischen Waren. Eine europäische Wirtschaftskrise,<br />
hervorgerufen durch Frankreichs isolationistische Handelspolitik,<br />
war die äußere Gestalt der politischen Konfrontation, die sich seit<br />
1807 unaufhaltsam anbahnte. Angestachelt<br />
durch klarsichtige Berater wie den aus Preußen<br />
verbannten Freiherrn vom Stein, der in<br />
Russland Exil gefunden hatte, betrieb Alexander<br />
leise, aber zügig die diplomatische Lösung<br />
von Frankreich.<br />
Napoleon reagierte. Nachdem seine österreichische<br />
Gattin 1811 mit einem Sohn<br />
niedergekommen war, dem der Kaiser gleich<br />
bei der Geburt, in Anlehnung an die alte<br />
deutsche Reichstradition, den Titel „König<br />
von Rom“ verlieh, schienen ihm seine dynastischen<br />
<strong>Am</strong>bitionen gesichert. Er hatte nun<br />
einen Nachfolger und war bereit für einen neuen Feldzug. Diesmal<br />
ging es gegen Russland, in den unheimlichen, gewaltigen Osten.<br />
Seine Unterwerfung würde ihm den Zugang nach Südasien<br />
erschließen, damit aber zugleich die kolonialen Reserven Englands<br />
bedrohen und die handelspolitische Geschlossenheit des<br />
Kontinents vollenden.<br />
Was nun kam, ist im kulturellen Gedächtnis Europas bis<br />
heute so tief verankert wie sonst nur der Zweite Weltkrieg und<br />
Foto: Fine Art Images<br />
116 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Napoleon auf der Anhöhe von Borodino: Trotz der siegreichen Schlacht war der Feldzug eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt<br />
verloren. Die russische Armee war noch intakt, und Moskau hatte als strategisches Ziel seine Bedeutung verloren<br />
Foto: AKG Images<br />
die Hitlerherrschaft: der Einmarsch ins weite russische Land; die<br />
großen, blutigen Schlachten mit bis dahin ungekannten Gefallenenziffern;<br />
die tragikomische Einnahme Moskaus, das vom Zaren<br />
und seiner Regierung aufgegeben und in Brand gesetzt worden<br />
war; schließlich der beschwerliche Rückmarsch durch die<br />
eisige Winterkälte, bei dem russische Kosaken über die erschöpften<br />
französischen Regimenter herfielen und ihnen unglaubliche<br />
Verluste beibrachten. So überlieferte Leo Tolstoi Napoleons Russlandabenteuer<br />
in „Krieg und Frieden“ der Nachwelt, so machten<br />
es Hollywood-Verfilmungen unsterblich.<br />
Von Anfang an litt der Feldzug unter seiner fatalen Fehlorganisation.<br />
Er begann im Juni, zu einem angesichts des frühen<br />
russischen Wintereinbruchs viel zu späten Zeitpunkt. Die<br />
zwangsverpflichteten nichtfranzösischen Truppen aus Italien,<br />
Deutschland und den slawischen Ländern waren nicht mit dem<br />
Herzen bei der Sache. Selbst das französische Volk, obschon berauscht<br />
von der glänzenden Imperatorengestalt ihres Führers,<br />
stöhnte über die Lasten der neuen Truppenerhebungen, die erdrückende<br />
Besteuerung und das straffe, diktatoriale Regime im<br />
Inneren. Doch all das konnte der epochalen Emblematik dieses<br />
Unternehmens, das irgendwie nicht von diesem Planeten schien,<br />
keinen Abbruch tun.<br />
Noch nach Jahrzehnten schwelgten ausgediente französische<br />
Grenadiere, unbeirrt durch den Frieden und bescheidenen Wohlstand<br />
der Restaurationsphase nach Napoleons Sturz 1814/15,<br />
in der Erinnerung an den russischen Feldzug, der ihnen doch<br />
so unsägliches Leid, Entbehrungen und furchtbare moralische<br />
Grenzerfahrungen gebracht hatte. Schwärmerisch hielt der Intellektuelle<br />
André Maurois fest: „Nie hat die französische Armee den<br />
kleinen Hut, den grauen Mantel vergessen, hinter dem sie alle Könige<br />
Europas besiegt und die Trikolore bis nach Moskau getragen<br />
hatte.“ Ins kollektive Gedächtnis gingen vor allem der alexandrinische<br />
Gestus der Welteroberung dieses Feldzugs ein, sein Ausbruch<br />
aus der stickigen Enge europäischer Machtpolitik in die<br />
unwirkliche Sphäre einer grenzenlosen Expansion.<br />
In Wirklichkeit war die Grenze Moskau. Napoleon erlag, wie<br />
so viele Feldherren vor und nach ihm, der Illusion, dass der Besitz<br />
der fremden Hauptstadt zugleich schon den Sieg bedeuten<br />
würde. Tatsächlich hielt sich das Gros der russischen Truppen im<br />
Hinterland auf, umsichtig geführt von ihrem Marschall Kutusow,<br />
einem ungebildeten Haudegen, dessen feiner kriegerischer Instinkt,<br />
bereichert von einer inbrünstigen orthodoxen Religiosität,<br />
richtig lag mit der Einschätzung, man müsse Napoleon in Moskau<br />
einfach an den Rand seiner Ressourcen bringen.<br />
Ein warnendes Vorzeichen war das Gespräch mit dem russischen<br />
General Balachoff, den Zar Alexander zu Beginn der Kampfhandlungen<br />
als Emissär zu Napoleon gesandt hatte. Als ihn der<br />
ungestüme Franzose fragt, welche Straße denn am schnellsten<br />
nach Moskau führe, antwortet der Russe geradeheraus: „Sire, alle<br />
Wege führen nach Rom. Man kann auf mehreren Routen nach<br />
Moskau gelangen. Karl XII etwa marschierte über Poltawa.“ Das<br />
war ein Schlag ins Gesicht. Karl XII, der jugendliche Schwedenkönig,<br />
der sich im Nordischen Krieg zu Beginn des 18. Jahrhunderts<br />
mit Zar Peter dem Großen anlegte, wurde in Poltawa nach<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 117
| S a l o n | D a s a l t e e u r o p ä i s c h e L e i d e n<br />
Beim Rückmarsch aus<br />
Moskau kam es Ende<br />
November 1812 zur Schlacht<br />
von Beresina, nach der<br />
sich der Befehlshaber des<br />
preußischen Hilfskorps auf<br />
die Seite Russlands stellte<br />
118 <strong>Cicero</strong> 9.2012
9.2012 <strong>Cicero</strong> 119
| S a l o n | D a s a l t e e u r o p ä i s c h e l e i d e n<br />
einem lange ungebrochenen Vormarsch vernichtend geschlagen.<br />
Napoleon war gewarnt.<br />
Noch im September 1812, nach seinem Sieg bei der Schlacht<br />
von Borodino, feuerte er seine Truppen mit dem sprichwörtlich<br />
gewordenen Satz: „Voilà le soleil d’Austerlitz – Seht, die Sonne<br />
von Austerlitz!“ an, in Anspielung auf die Dreikaiserschlacht von<br />
1805, aus der das junge französische<br />
Kaiserreich so glorreich hervorgegangen<br />
war. Doch die Geschichte wiederholte<br />
sich nicht. Borodino war taktisch<br />
ein Sieg, strategisch war es ein Patt: Der<br />
Weg nach Moskau war zwar frei, aber<br />
die russische Armee blieb intakt, und<br />
das Ziel selber hatte seine Bedeutung<br />
für die Entscheidung des Feldzugs verloren.<br />
Wenig später befahl er seinen<br />
Truppen den Rückmarsch aus Moskau,<br />
und zur Jahreswende stellte sich General<br />
von Yorck, widerwilliger Befehlshaber<br />
des preußischen Hilfskorps, das<br />
unter Napoleon gegen Russland hatte<br />
kämpfen müssen, offen auf die russische<br />
Seite. Im Frühjahr 1813 erklärt Friedrich<br />
Wilhelm III von Preußen Frankreich<br />
den Krieg. Im August endlich<br />
verbündet sich Österreich mit Preußen<br />
und Russland, und Neujahr 1814, genau<br />
ein Jahr nach dem preußischen Abfall,<br />
überschreitet die große Koalition<br />
den Rhein. Im April ziehen die verbündeten<br />
Monarchen in Paris ein. Napoleon<br />
muss abdanken und geht ins erste<br />
Exil auf die Insel Elba. Sein Stern war<br />
gesunken. Auch sein hunderttägiges Intermezzo<br />
1815, bei dem er sich die Macht in Paris wiederaneignete<br />
und neue Truppen aufstellte, kann das Rad der Geschichte nicht<br />
zurückdrehen. Bei Waterloo in Belgien, am 18. Juni 1815, fast auf<br />
den Tag genau drei Jahre nach Beginn der russischen Expedition,<br />
schlägt er seine letzte Schlacht. Es ist seine endgültige Niederlage.<br />
Die historische Gestalt Napoleons ist bis heute, trotz einer<br />
Flut von Veröffentlichungen und fiktionaler Verarbeitungen, auratisch<br />
und menschlich weitgehend ungeklärt. Nichts als seine<br />
schiere Kraft ist in Erinnerung geblieben, die pure Gewalt seiner<br />
Wirkung und das ewig Drängende, das ihn von Feldzug zu Feldzug<br />
führte. Sein Gestalten und Entwerfen aber blieben merkwürdig<br />
geisterhaft und ungreifbar.<br />
Doch eben in diesem Aktionismus, dem Drang, immer Neues<br />
zu schaffen, spiegelt sich exakt das Wesen Europas und das Wesen<br />
der europäischen Neuzeit ab – vom kopernikanischen Traum der<br />
Vermessung der Welt über die cartesianische Fantasie der restlos<br />
rationalen Gliederung bis hin zur rasenden, suchtartigen Verliebtheit<br />
des Kontinents in die Bewegung. Dass Napoleon kein eigentliches<br />
Ziel kannte, sondern dass das „Immer weiter“, das „Immer<br />
werden“ und „Niemals sein“ sein Charakter waren, wurde nirgends<br />
so deutlich wie bei seinem Russlandfeldzug. Der französische Kaiser<br />
verkörperte die reine, haltlose Kraft, die fleischgewordene „Furie<br />
des Verschwindens“, von der Georg Wilhelm Friedrich Hegel,<br />
„Ich bin ein Stück Fels, das in den Weltraum<br />
geschleudert wurde“: Wie kein anderer verkörperte<br />
Napoleon das uralte europäische Leiden an<br />
der Begrenztheit des insularen Daseins<br />
sein großer philosophischer Zeitgenosse und glühender Bewunderer,<br />
1806 in der „Phänomenologie des Geistes“ sprach.<br />
Als Napoleon Bonaparte 1799 in einem Staatsstreich die<br />
Macht an sich riss, lag die Französische Revolution gerade ein<br />
Jahrzehnt zurück. Zweifelsohne stand er unter ihrem Enfluss.<br />
Doch ideologisch war er, aus korsischem Adel stammend, ein<br />
Kind des aufgeklärten Absolutismus<br />
und des Ancien Régime mit seiner<br />
uralten Fantasie der Welteroberung.<br />
Schon 1804 erhebt er sich selbst zum<br />
Kaiser. Auch sein Lebenswandel erinnert<br />
an den eines spät geborenen europäischen<br />
Heerkönigs mit all den<br />
kriegerischen, amourösen und schöngeistigen<br />
Allüren der Herren von einst.<br />
Im Grunde war er eine südländisch<br />
eingefärbte Mischung aus Ludwig XIV<br />
und Friedrich dem Großen. Doch er<br />
war eben auch mehr. Waren jene anderen<br />
beiden großen Monarchen der<br />
westeuropäischen Vormoderne irgendwann<br />
in ihrem Leben zur Ruhe gekommen,<br />
blieb Napoleon zeitlebens,<br />
bis zum bitteren Ende, der große Ruhelose.<br />
Er wollte Alexander sein, und<br />
es war Alexanders Weg, den er ideell<br />
und geografisch einschlug.<br />
Doch auf diesem Weg musste er<br />
scheitern. Von ihm selber, einem Kind<br />
der Aufklärung, der Entzauberung der<br />
Welt, stammt der Satz: „Als Alexander<br />
verkündete, der Sohn des Gottes <strong>Am</strong>mon<br />
zu sein, glaubten ihm alle bis auf<br />
den Philosophen Aristoteles; würde<br />
ich das sagen, würde mich das letzte Pariser Marktweib auslachen.“<br />
Die Zeit der großen Ideen, denen man sich rauschhaftunreflektiert,<br />
im Glauben und im Machen, hingeben konnte, war<br />
vorbei, spätestens mit der Revolution, als deren Testamentsvollstrecker<br />
er einst selbst die politische Bühne betreten hatte. Napoleon,<br />
bis heute als Wegbereiter der Moderne, als Vater der rationalen<br />
Staatsorganisation, der freiheitlichen Grundrechte, des<br />
Fortschritts angesehen, war tatsächlich ein Kind der Vergangenheit,<br />
Zuspätgekommener.<br />
„Je suis une parcelle de rocher, lancée dans l’espace“, hatte der<br />
Kaiser gesagt: „Ich bin ein Stück Fels, das in den Weltraum geschleudert<br />
wurde.“ Das ist die Selbst- und Weltsicht des Menschen<br />
der frühen Neuzeit, des cartesianischen Suchers und Zweiflers,<br />
ins Faustisch-Mannhafte, Abenteuerliche gewandt. Das uralte<br />
europäische Leiden an der Begrenztheit des insularen Daseins, die<br />
brennende, verzehrende Sehnsucht nach Entgrenzung, nach Überschreitung,<br />
nach Transzendenz: Napoleon lebte sie aus ins politische<br />
Extrem. Der wehmutsvolle, ängstlich gepflegte Traum der<br />
alten Griechen und Römer, hinauszusegeln über die Säulen des<br />
Herakles ins weite, grenzenlose Meer: Napoleon schickte sich an,<br />
ihn mit modernsten Mitteln wahr zu machen. Diesem Traum gab<br />
er sich hin, erbarmungslos sich selbst und die anderen ausnutzend;<br />
und an diesem Traum zerbrach er nach Anstrengungen, die man<br />
Fotos: Russian Look/AKG (Seiten 118 bis 119), Ullstein Bild<br />
120 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Privat (Autor)<br />
Anzeige<br />
auf den europäischen Kriegsschauplätzen seit dem Dreißigjährigen<br />
Krieg nicht mehr gesehen hatte und die sich erst in der Apokalypse<br />
des Weltkriegszeitalters wiederholen sollten.<br />
Napoleons Scheitern setzte einen Endpunkt unter die politische<br />
Romantik des Ancien Régime, unter seinen Wunsch,<br />
es den Helden Homers gleichzutun und sich durch die Inbesitznahme<br />
der Welt selbst eine Welt zu schaffen – jene Welt,<br />
die man innerlich, durch den Fortfall der alten Glaubenssätze,<br />
durch den Verlust Gottes verloren hatte. Des Gottes, von dem<br />
Hegel just zu jener Zeit schrieb, er sei „gestorben“. Napoleons<br />
Seele war die Seele eines Heimatlosen, eines von der Insel Vertriebenen,<br />
der sich zeitlebens in der Welt, in Europa wie auf einem<br />
verlassenen, auf dem Ozean schwimmenden Eiland fühlen<br />
sollte – in einer unsäglichen Leere, die auszufüllen sein Lebensinhalt<br />
war und um deren Verdrängung willen er seinen politischen<br />
Weg einschlug.<br />
Folgerichtig endete dieser Weg auf einer Insel. Weit ab von<br />
Europa, auf Sankt Helena, vor der westafrikanischen Küste. Helena<br />
– so hieß die spartanische Prinzessin, die bei Homer von Paris<br />
geraubt wird und um deren Rückholung willen die Griechen<br />
den Trojanischen Krieg beginnen. Bei Homer endet dieser Feldzug<br />
zwar mit dem Sieg und mit der Niederbrennung Trojas; aber<br />
auch die heimkehrenden Griechen kommen nicht mehr zur Ruhe.<br />
Ihre häuslichen Altäre sind ihnen fremd geworden, das zehnjährige<br />
Kriegserlebnis, die Rastlosigkeit der Feldlagerexistenz haben sie<br />
ihrer Heimat für immer entfremdet, ohne dass sie in der Fremde<br />
eine neue Heimat gefunden hätten. Die Ruhe und Ganzheitlichkeit<br />
ihrer bürgerlichen Existenz war verloren, für immer. Eben<br />
diese Ganzheitlichkeit und Ruhe hatte Napoleon wiederherstellen<br />
wollen. Es ist ihm nicht gelungen.<br />
Als der Kaiser während der französisch-russischen Friedensverhandlungen<br />
1807 vom Thronwechsel in Spanien erfuhr, der seine<br />
europäische Position gefährdete, und General Rapp fragte, wie weit<br />
es von Danzig nach Cádiz sei, antwortete dieser lakonisch: „Zu<br />
weit, Sire.“ Napoleon, dessen Leben ein einziger Traum von der<br />
Überschreitung der Grenzen der Zeit war, scheiterte daran, dieses<br />
unmögliche Projekt im Modus der Überschreitung der bloß räumlichen<br />
Grenzen wahr zu machen. Er hätte ewig weitermarschieren<br />
können: Ans Ziel wäre er niemals gekommen. Es gibt kein „Ende<br />
der Welt“. Sein Ziel hätte in ihm selbst gelegen. Die Welt, die er<br />
außen nicht fand, hätte er in sich selbst finden müssen, anstatt<br />
sich immer neuen Kraftanstrengungen und Gewaltleistungen hinzugeben<br />
wie ein Drogensüchtiger dem Rausch.<br />
In Wahrheit war Napoleon schwächer als der letzte seiner Grenadiere<br />
gewesen. Frankreich mag er neu geformt, Europa mit seinen<br />
Gedanken inspiriert haben: Sich selber hat er nicht gefunden.<br />
Ein ruheloser Marsch war sein Leben gewesen. Die Ruhe kam erst<br />
auf dem verlassenen Felsenriff vor Afrika, weit weg von Europa,<br />
jenem Kontinent, der ihm in seiner tiefen, traurigen Weltlosigkeit,<br />
wie so vielen großen Europäern auf dem Thron und am Schreibtisch<br />
vor ihm, doch immer zu eng gewesen war.<br />
One of a kind<br />
Entspannen Sie im belebenden Spa,<br />
schlendern Sie durch den angrenzenden Park<br />
oder genießen Sie einfach erlesene Gaumenfreuden<br />
in unserem mit zwei Michelin-Sternen<br />
ausgezeichneten Park-Restaurant. Wer stilvolle<br />
Entspannung in einer eleganten Umgebung sucht,<br />
ist hier genau am richtigen Ort.<br />
Konstantin Sakkas<br />
ist freier Autor. Er schreibt Essays und Reportagen für das<br />
Deutschlandradio, den SWR, <strong>Cicero</strong> und die Zeit<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 121<br />
Brenners Park-Hotel & Spa · Schillerstraße 4/6<br />
D-76530 Baden-Baden<br />
Telefon 07221-900-0 · Fax 07221-3 87 72<br />
information@brenners.com · www.brenners.com
| S a l o n | B e n o t e t<br />
Gladiatorenmusik<br />
Von einem Auftritt in der Hollywood Bowl,<br />
einer der größten Freiluftarenen der Welt, hatte<br />
unser Kolumnist schon als Kind geträumt. Vom<br />
monsunartigen Regen, der einsetzte, als dieser<br />
Traum endlich wahr wurde, nicht<br />
Von Daniel Hope<br />
E<br />
s gibt Auftritte, von denen ein Musiker schon als Kind<br />
träumt: das erste Mal in der Carnegie Hall zu spielen<br />
etwa, der Royal Albert Hall oder im Sydney Opera House.<br />
Wenn man irgendwann tatsächlich das Glück hat, an diesen Orten<br />
aufzutreten, erfüllt es einen mit Stolz und Ehrfurcht.<br />
Bis vor kurzem gab es für mich einen Ort, bei dem es nur bei<br />
einem Traum geblieben war: die Hollywood Bowl. Mitten in Los<br />
Angeles gelegen, ist sie eine der größten Freiluft arenen der Welt,<br />
mit Platz für über 18 000 Zuschauer. Eingeweiht wurde sie am<br />
11. Juli 1922 und entwickelte sich schnell zum beliebten Spielort<br />
für die größten klassischen Musiker aller Zeiten. Jascha Heifetz,<br />
der legendäre Geiger, der 1931 dort sein Debüt gab, verglich einen<br />
Auftritt in der Hollywood Bowl mit einem Wettkampf bei<br />
den Olympischen Spielen. Man sei dort nicht Musiker, man sei<br />
Gladiator, sagte er. Neben meinen Klassikhelden sind inzwischen<br />
auch die Popgrößen der Welt in der Bowl aufgetreten: von den<br />
Beatles und Pink Floyd bis zu The Doors und Elton John. Klassik<br />
spielt jedoch immer noch eine große Rolle. Während des Sommers<br />
ist der Spielort Sitz des Hollywood Bowl Orchestra und des<br />
Los Angeles Philharmonic Orchestra.<br />
Vom Letzteren kam vor ein paar Monaten die Einladung, auf<br />
die ich mein Leben lang gewartet hatte: <strong>Am</strong> 12. Juli dieses Jahres<br />
sollte ich mein Debüt geben, zusammen mit dem amerikanischen<br />
Dirigenten Leonard Slatkin.<br />
Alleine die ersten Schritte auf dem gigantischen Gelände, die<br />
ich am Abend zuvor unternahm, um ein wenig Stimmung zu<br />
schnuppern, erfüllten mich mit unbändiger Vorfreude. Als ich<br />
die Werbung für mein Konzert auf der großen Leinwand vor dem<br />
Eingang fotografierte, hastete ein schwer bewaffneter Polizist herbei<br />
und sagte: „Weitergehen, Sir, hier dürfen Sie nicht stehen bleiben!“<br />
Dann erklärte ich ihm, warum ich das Plakat fotografierte,<br />
und er grinste. „Echt? Sie spielen in der Bowl? Cool! Dann mache<br />
ich doch ein Bild von Ihnen vor dem Plakat!“<br />
<strong>Am</strong> Vormittag darauf fand die Probe in der Bowl statt. Das<br />
Thermometer zeigte 33 Grad, und die kalifornische Luft war ungewöhnlich<br />
feucht. Vor der Bühne hatte man eine Sonnengardine<br />
aufgehängt, um das Orchester zu schützen. Es hatte sich ein<br />
besonderer Gast angemeldet, der mittlerweile 93 Jahre alte Komponist<br />
Walter Arlen, der nach seiner Flucht aus Wien 1939 über<br />
30 Jahre lang als Musikkritiker für die Los Angeles Times tätig gewesen<br />
war. Nach meiner Probe setzten wir uns in den Zuschauerraum,<br />
und er erzählte mir Anekdoten über Musiker wie Arturo<br />
Toscanini oder Bruno Walter, die er in der Bowl erlebt hatte.<br />
<strong>Am</strong> Abend meines Konzerts passierte dann etwas, was es in<br />
der Bowl seit mehr als 30 Jahren so gut wie nie gegeben hatte: Es<br />
regnete! Erst waren es nur ein paar Tropfen, dann öffnete sich der<br />
Himmel, und es goss in Strömen. Die Orchestermitglieder der Los<br />
Angeles Philharmonic machten tapfer weiter. Zu Beginn des Konzerts<br />
spielten sie die amerikanische Nationalhymne, und das Publikum<br />
sprang begeistert auf, um patriotisch mitzusingen. Diejenigen<br />
unter ihnen, die heimlich Regenschirme mit ins Stadion geschmuggelt<br />
hatten, versuchten, sie aufzuspannen, wurden jedoch gleich<br />
von den anwesenden Polizisten verwarnt. Irgendwann prasselte der<br />
Regen fast monsunartig nieder, und es fing an, auf die Kontrabässe<br />
zu tropfen. Verärgerte Gewerkschaftsmitarbeiter gestikulierten wild<br />
herum und bestanden darauf, das Orchester um einige Meter nach<br />
hinten zu verlegen. Es platschte sogar auf die riesigen Bildschirme<br />
herunter, die das Konzert ins Stadion übertrugen.<br />
In der Bowl gibt es allerdings eine goldene Regel: „The show<br />
must go on!“ Das hatte mir mein Künstlerbetreuer schon am<br />
Abend zuvor erklärt. Nichts konnte die bombastische Stimmung<br />
trüben, weder für mich noch erstaunlicherweise für das Publikum.<br />
Nach der Ouvertüre und mehreren Unterbrechungen war<br />
es endlich Zeit für meinen Auftritt. Der Regen hatte beinahe aufgehört.<br />
Dafür wehte jetzt ein starker Wind, und die Musiker hielten<br />
ihre Noten und Pulte fest. Ich schritt auf die Bühne. Das Publikum<br />
begrüßte mich mit Ovationen, bevor ich auch nur einen<br />
einzigen Ton spielte.<br />
Es wurde ein großartiger Abend, die Kulmination eines Kindheitstraums<br />
und eine Hommage an viele meiner musikalischen<br />
Helden. Ich habe jede Sekunde genossen und wollte nicht, dass<br />
der Auftritt zu Ende geht. Als Frederick, ein guter Freund aus Los<br />
Angeles, mich hinterher ziemlich durchnässt in der Garderobe besuchte,<br />
umarmte er mich mit den Worten: „Hey, du hast in der<br />
Hollywood Bowl gespielt! Es hat geregnet und du hast gewonnen!“<br />
Jascha Heifetz hatte wohl recht mit seinem Gladiatorenvergleich.<br />
Daniel Hope ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch „Toi,<br />
Toi, Toi – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt) und die<br />
CD „Vivaldi Recomposed“ (Deutsche Grammophon). Er lebt in Wien<br />
illustration: anja stiehler/jutta fricke illustrators<br />
122 <strong>Cicero</strong> 9.2012
GESUCHT!<br />
QUERDENKER AWARD 2012<br />
© Martin Schumann - Fotolia.com<br />
werden die kreativsten Unternehmen und Köpfe für die Kategorien:<br />
START-UP. HIDDEN CHAMPION. VORDENKER. MARKTFÜHRER. INNOVATIONEN. ERFINDER.<br />
Jetzt bis zum 30. September 2012 bewerben unter www.querdenker.de!<br />
QUERDENKER AWARD 2012<br />
VERLEIHUNG AM 16. NOV. 2012 IM DOPPELKEGEL DER BMW WELT IN MÜNCHEN<br />
PREMIUM-Partner
| S a l o n | M a n s i e h t n u r , w a s m a n s u c h t<br />
Goldene Zeitkritik<br />
Das Abendland war schon immer im Begriff unterzugehen. Ein<br />
Blick auf den malenden Intellektuellen Pieter Bruegel legt nahe,<br />
dass es unklug wäre, die Europa- auf eine Eurokrise zu reduzieren<br />
Von Beat Wyss<br />
124 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Pieter Bruegel der Ältere:<br />
„Landschaft mit Ikarussturz“,<br />
Öl auf Leinwand, 74 x 112 cm,<br />
Brüssel, Musées Royaux des<br />
Beaux-Arts de Belgique<br />
Fotos: DeAgostini/Getty Images, artiamo (Autor)<br />
V<br />
ielleicht hilft es ja, unseren<br />
mit Melancholie geschlagenen<br />
Europapatriotismus aufzuhellen,<br />
indem wir uns klar werden, dass<br />
das Abendland immer schon im Begriff<br />
war unterzugehen. Es muss am Namen<br />
liegen, wenn über dieser Weltgegend<br />
die Sonne unentwegt sinken will.<br />
Auch Pieter Bruegel der Ältere hat es so<br />
empfunden. Das Dämmerlicht, in das<br />
seine „Landschaft mit Ikarussturz“ getaucht<br />
ist, belegte er daher auch mit einem<br />
humanistischen Argument. Als gelernter<br />
Kupferstecher gehörte er zu den<br />
Intellektuellen seiner Zeit. Sein Gemälde<br />
ist als gelehrsamer Kommentar<br />
auf Ovids Metamorphosen zu lesen.<br />
Ein Fischer, ein Hirte und ein pflügender<br />
Bauer hätten den schwebenden<br />
Jüngling am Himmel gesehen, schreibt<br />
der augusteische Dichter; Bruegel malt<br />
die genannten Zeugen, um von der Sage<br />
ja kein Jota abzuweichen. Wir sehen den<br />
Verwegenen, wie er gerade ins Meer fällt,<br />
nachdem er der Sonne zu nahe kam, was<br />
das Wachs in den kunstvoll gefertigten<br />
Flügeln zum Schmelzen brachte. Er hatte<br />
den Rat seines Vaters Dädalus, nicht zu<br />
hoch zu fliegen, missachtet.<br />
Spielt der pflügende Bauer zur Himmelsstürmerei<br />
etwa den währschaften<br />
Widerpart mit Bodenhaftung? Weit gefehlt:<br />
Bruegels Bauer bietet nur ein anderes<br />
Beispiel für Niedergang. Er steht<br />
für den Abschied vom Goldenen Zeitalter,<br />
jener Epoche ewigen Frühlings, als<br />
der Sammler von Feldfrüchten mit dem<br />
sich begnügte, was die freigiebige Natur<br />
ihm zum Essen gab. Der Ovid’sche Bauer<br />
ist hier biblisch überblendet und hört<br />
auf den Namen Kain, den Erfinder des<br />
Pflugs. Dessen Mord an Bruder Abel besiegelt<br />
im Bruegel’schen Weltbild den<br />
Kulturkampf zwischen dem Ackerbau der<br />
Sesshaften und nomadischem, dem goldenen<br />
Hirtendasein. Hinter dem Acker<br />
im Gebüsch liegt eine Leiche, Beleg für<br />
die eiserne Zeit der Gewalt. Jean-Jacques<br />
Rousseau sollte diese Denktradition später<br />
fortsetzen, als er Gold und Eisen als<br />
Ursache für die Ungleichheit der Menschen<br />
beschrieb.<br />
Bruegels „Landschaft mit Ikarussturz“<br />
ist Zeitkritik. Das Gemälde muss<br />
zwischen 1555 und 1569 entstanden<br />
sein. Der Krieg zwischen Spanien und<br />
Frankreich führte zur ersten kontinentalen<br />
Finanzkrise. Der Freiheitskrieg<br />
der Niederländer gegen die Spanier, der<br />
ebenfalls zu dieser Zeit begann, sollte<br />
ein paar Jahrzehnte später in den Dreißigjährigen<br />
Krieg münden – einen Kolonialkrieg<br />
im Gewand konfessioneller<br />
Konflikte. Es ging um nichts weniger<br />
als die Neuverteilung der Welt, bei der<br />
die alten katholischen Großmächte Spanien<br />
und Portugal gegen das anglikanische<br />
Großbritannien und das protestantische<br />
Holland als Verlierer hervorgehen<br />
sollten.<br />
Bruegel glaubte wie Erasmus von<br />
Rotterdam an die Unteilbarkeit des<br />
Chris tentums. Der niederländische<br />
Humanist sah sich im Zeitalter der<br />
Polarisierung zwischen katholischer<br />
Inquisition und calvinistischem Gesinnungsterror<br />
auf verlorenem Posten: zwischen<br />
Scylla und Charybis, sagt uns das<br />
Gemälde. Denn der Maler führt uns vor<br />
das Panorama der Meerenge von Messina,<br />
wo, nach Homer, Odysseus bei der<br />
Passage sechs seiner Gefährten verlor.<br />
Das kleine Werk hängt in Brüssel,<br />
wo Bruegel wirkte und begraben liegt.<br />
In jener Stadt, wo Karl V als Kaiser des<br />
Heiligen Römischen Reiches 1555 abdankte,<br />
wird heute wieder um den Fortbestand<br />
der europäischen Einheit gestritten.<br />
Konfliktparteien sind eben jene<br />
Nationalstaaten, die aus den Trümmern<br />
des Dreißigjährigen Krieges hervorgegangen<br />
waren. Überblickt man die blutige<br />
Geschichte Europas, scheinen die<br />
vergangenen 67 Jahre relativen Friedens<br />
wie ein Wunder. Das eiserne Zeitalter<br />
der Kriege ist vorbei. Nur im Zank um<br />
das Gold, scheint es, sind wir die Alten<br />
geblieben.<br />
B e at W y s s<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes. Er<br />
lehrt in Karlsruhe<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 125
| S a l o n | K ü c h e n k a b i n e t t<br />
Matzebrot mit<br />
Blutwurst?<br />
Die großen Religionen sorgen auch in der<br />
Küche für kleine Einschnitte. Doch wer die<br />
Bräuche der Glaubensgemeinschaften als<br />
abstrus und nostalgisch verspottet, sollte sich<br />
überlegen, was nach ihnen kommen könnte<br />
Von Thomas Platt und Julius Grützke<br />
O<br />
b es um Moscheen, den Zölibat oder Beschneidungen<br />
geht: Religiöse Traditionen schmecken vielen nicht mehr.<br />
Den Kritikern geht es dabei selten um das Heilsversprechen<br />
der Glaubensrichtungen als vielmehr um ihre Riten, die überwiegend<br />
aus dem alten Orient stammen. In unserer säkularisierten<br />
Gesellschaft scheint es kaum noch verständlich, dass Sitten und<br />
Bräuche gepflegt werden, die auf eine Reglementierung oder gar<br />
eine Verletzung hinauslaufen. Das gilt auch und besonders für die<br />
zahlreichen Gebote, die Nahrungsmittel betreffen.<br />
Es sind zumeist genießbare und oft auch wohlschmeckende<br />
Speisen, von denen die Gläubigen Abstand nehmen sollen. Die<br />
Ursprünge dieser Verbote liegen oft im Dunkeln und sind schwer<br />
vermittelbar. Nicht zuletzt deshalb werden sie streng überwacht.<br />
Die Unreinheit des Schweinefleischs etwa wird meistens auf hygienische<br />
Vorbehalte aus fernen Zeiten und exotischen Klimazonen<br />
zurückgeführt. Anderen Erklärungen zufolge entspringt sie dem<br />
Wunsch, die Haltung von Vieh zu verhindern, das im Leben als<br />
Nahrungskonkurrent auftritt und lediglich nach seinem Tod zum<br />
Nutztier wird. Vorschriften wie die Tötungstechnik des Schächtens<br />
leiten sich aus einem moralischen Vorbehalt ab: Das Blut als<br />
Träger der Seele soll vom Verzehr ausgeschlossen sein.<br />
Die herrschende Meinung verurteilt solche Überlegungen als<br />
abseitig. Als lächerlich gewordene Zeugnisse überkommener Epochen<br />
werden sie umstandslos einer abstrusen Nostalgie zugerechnet,<br />
ähnlich der Fastenzeit und dem Fischgericht am Freitag. Doch<br />
man sollte über diese religiösen Gebote den Stab nicht zu schnell<br />
brechen – Einschränkungen können auch etwas Befreiendes haben:<br />
Wer hat nicht schon vor einer langen Speisekarte gesessen<br />
und unter der Unschlüssigkeit gelitten, die eine große Auswahl<br />
mit sich bringt? In solchen Situationen wünscht man sich ein<br />
Regelwerk. Außerdem stiften Tabus immer auch ein Zugehörigkeitsgefühl.<br />
Wer mit Gleichgesinnten das Matzebrot bricht, bildet<br />
eine Gemeinde – eine Insel der Seligen im Meer aus anderen.<br />
Der Ansehens- und Mitgliederverlust der großen Glaubensgemeinschaften<br />
hat eine Lücke hinterlassen. Der Wunsch, die Welt<br />
an der Tafel in Gut und Böse zu scheiden, besteht jedoch weiter.<br />
Agnostiker essen ihren Fisch vielleicht am Sonntag, aber niemals<br />
mehr Viktoriabarsch, weil sie dessen Zucht und Transport<br />
für unethisch halten. Die Zahl der Vegetarier in unserem Land<br />
nimmt stetig zu. Auch die vielfältigen Allergien und Unverträglichkeiten<br />
stiften im Chaos der Vielfalt eine neue Liturgie. Gerade<br />
Köche der Hochgastronomie klagen über Gäste, die mit ihren<br />
Forderungen nach gluten- und laktosefreien Zubereitungen<br />
und ellenlangen Ausschlusslisten mit verbotenen Früchten die<br />
Küche vor ernste Probleme stellen. Man kann sich gut vorstellen,<br />
dass sich manch einer die Segnungen einer religiösen Ordnung<br />
zurückwünscht. Immerhin absorbiert ihre Autorität die Marotten,<br />
die in einer kirchenfreien Welt regelrecht aufblühen.<br />
Sosehr man spotten mag über die mystischen Bräuche der<br />
Glaubensgemeinschaften – wer sie auf dem Altar der Vernunft<br />
opfern will, sollte bedenken, was danach kommen könnte. Schon<br />
jetzt ermöglicht das Studium des Kochbuchangebots der verschiedenen<br />
ethischen und esoterischen Richtungen einen Ausblick auf<br />
eine Welt ohne Gottesfurcht, die von zahllosen anderen Ängsten<br />
beherrscht wird. Bei all dem, was dort verteufelt wird, bleibt für<br />
den Speiseplan nur eine kleine Auswahl – immer begleitet von dem<br />
Mantra, es schmecke auch sehr gut ohne die verfemten Zutaten.<br />
Parmesan zum Beispiel ersetzt die vegane Küche mit einem Gemisch<br />
aus Hefeflocken und Semmelbröseln aus Dinkelbrot. Nicht<br />
wenige wird es bei solchen Aussichten gruseln, und sie werden sich<br />
fragen, ob man mit den kleinen Einschnitten der hergebrachten<br />
Religionen nicht besser dran gewesen wäre.<br />
Julius Grützke und Thomas Platt<br />
sind Autoren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in Berlin<br />
illustration: Thomas Kuhlenbeck/Jutta Fricke Illustrators; Foto: Antje Berghäuser<br />
126 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Anderes Cover gewünscht?<br />
Die aktuelle <strong>Cicero</strong>-Ausgabe erscheint in diesem Monat mit 20 unterschiedlichen Titelbildern.<br />
Bestellen Sie Ihr Exemplar mit Ihrem persönlichen Lieblings-<strong>Tatort</strong>.<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay<br />
sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN BERLIN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN BREMEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN HANNOVER<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras<br />
und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay<br />
sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN KIEL<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN KÖLN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN KONSTANZ<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN LEIPZIG<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Tatort</strong>: Berlin<br />
<strong>Tatort</strong>: Bremen<br />
<strong>Tatort</strong>: Hannover<br />
<strong>Tatort</strong>: Kiel<br />
<strong>Tatort</strong>: Köln<br />
<strong>Tatort</strong>: Konstanz<br />
<strong>Tatort</strong>: Leipzig<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN LUDWIGSHAFEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für<br />
Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffaysorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN MÜNCHEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN MÜNSTER<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN STUTTGART<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN ERFURT<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für<br />
Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Richard David Precht ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN DORTMUND<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines<strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN SAARBRÜCKEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Tatort</strong>: Ludwigshafen<br />
<strong>Tatort</strong>: München<br />
<strong>Tatort</strong>: Münster<br />
<strong>Tatort</strong>: Stuttgart<br />
<strong>Tatort</strong>: Erfurt<br />
<strong>Tatort</strong>: Dortmund<br />
<strong>Tatort</strong>: Saarbrücken<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über<br />
Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder für<br />
Andersdenkende“<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter<br />
den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
<strong>Cicero</strong> September 2012 <strong>Am</strong> <strong>Tatort</strong><br />
WWW.CICERO.DE<br />
Gesine Schwan<br />
über Joachim Gauck<br />
„Er bleibt hinter den Aufgaben<br />
seines <strong>Am</strong>tes zurück“<br />
Ludwig Poullain<br />
über<br />
Angela Merkel<br />
„Verbotsschilder<br />
für Andersdenkende“<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN FRANKFURT<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay<br />
sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN WIESBADEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay<br />
sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN HAMBURG<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay<br />
sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IM HAMBURGER UMLAND<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN WIEN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
Richard David Precht<br />
ruft zur Revolution auf<br />
Adriana Altaras und Philipp Blom<br />
streiten über Beschneidung<br />
Peter Maffay sorgt sich um Rumänien<br />
SONNTAGS, 20:15 IN LUZERN<br />
AM TATORT<br />
Innenansichten eines TV-Phänomens<br />
<strong>Tatort</strong>: Frankfurt<br />
<strong>Tatort</strong>: Wiesbaden<br />
<strong>Tatort</strong>: Hamburg 1<br />
<strong>Tatort</strong>: Hamburg 2<br />
<strong>Tatort</strong>: Österreich<br />
<strong>Tatort</strong>: Schweiz<br />
Ich bestelle folgende <strong>Cicero</strong>-September Ausgabe zum Preis von 8,– Euro. Zzgl. 2,95 EUR Versandkosten, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Berlin Stück Bremen Stück Hannover Stück Kiel Stück Köln Stück Konstanz Stück Leipzig Stück<br />
Ludwigshafen Stück München Stück Münster Stück Stuttgart Stück Erfurt Stück Dotmund Stück Saarbrücken Stück<br />
Frankfurt Stück Wiesbaden Stück Hamburg 1 Stück Hamburg 2 Stück Österreich Stück Schweiz Stück<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Kontonummer<br />
Name<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden einer<br />
E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen<br />
werden.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong>-<strong>Tatort</strong>-Cover bestellen! Bestellnr.: 890646<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/einzelhefte<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg
| S a l o n | P r o v i n z m i t K l a s s e<br />
Das Opernhaus<br />
im Urwald<br />
Seit fünf Jahren macht das niederbayerische<br />
Kulturwald-Festival in der ganzen Welt von sich reden.<br />
Wer steckt hinter den September-Festspielen?<br />
von Eva gesine Baur<br />
D<br />
er Wald sei die Urheimat der<br />
Barbarei, hat August Strindberg<br />
behauptet. Und er sei<br />
der Feind der Kultur. Das mit<br />
der Barbarei würde Thomas<br />
E. Bauer, weltweit gefeierter Bariton, nicht<br />
völlig in Abrede stellen. „In meiner Kindheit<br />
hat es im Bayerischen Wald nach fast<br />
jedem Bierfest heftige Schlägereien und<br />
Messerstechereien gegeben“, sagt er. Ganz<br />
vorbei sei es damit noch immer nicht.<br />
„Das neue Lieder-Traumpaar“, als das die<br />
Musikkritikerin Eleonore Büning Thomas<br />
E. Bauer und seine angeheiratete Begleiterin<br />
Uta Hielscher bejubelte, lebt dennoch<br />
seit fünf Jahren in dieser Gegend,<br />
die bei Partymünchnern als Entwicklungsland<br />
gilt.<br />
Fotos: Kulturwald Festspiele Bayrischer Wald<br />
128 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Wer von hier kommt,<br />
den wirft so leicht nichts<br />
um, sagt man sich in<br />
Niederbayern. Die<br />
Festspiele Bayerischer<br />
Wald versuchen das<br />
trotzdem – mit Bach<br />
im Ratskeller, Punk<br />
in der barocken<br />
Kirche und Beethoven<br />
im Klosterfestsaal<br />
hat, bedeutet nicht etwa, dass ihm die akademische<br />
Fortbildung seiner Landsleute ein<br />
dringendes Anliegen wäre. Die brauchen<br />
nicht zu wissen, dass Horaz der Kultur zutraute,<br />
sie könne belehren, erregen und bewegen.<br />
Sie sollen es nur spüren.<br />
Damit das geschieht, gibt Thomas<br />
E. Bauer einiges ab von seinem Geld, seiner<br />
Zeit und seiner Energie. Denn, erklärt<br />
er sich dankbar mit dem Satz: „Ich habe immer<br />
Glück gehabt.“ Er sei „ein arg schüchternes<br />
Kind“ gewesen und war als Sohn eines<br />
Arbeiters eigentlich nicht mit großen<br />
Chancen gesegnet. In der Grundschule in<br />
Edenstetten hatte er das erste Mal Glück in<br />
Gestalt eines Lehrers, der nebenbei Organist<br />
war und sich ein Klavier ins Klassenzimmer<br />
hatte stellen lassen. Während die<br />
Kinder ihre Buchstaben malten, spielte er.<br />
Alle malten stumm, bis auf einen: Thomas<br />
sang lauthals mit. Vom Lehrer aufgestachelt,<br />
reiste Mutter Bauer mit ihrem singenden<br />
Sohn nach Regensburg, und wie vom Lehrer<br />
erhofft, wurde er Domspatz.<br />
Dann hatte er das Glück, nach der ersten<br />
Halbzeit seines Jurastudiums zum Ersatzdienst<br />
als Altenpfleger ins Abseits berufen<br />
zu werden und festzustellen, was ihm<br />
fehlte: nicht die Stadt, nicht die Paragrafen,<br />
sondern die Musik. Mit fünf anderen<br />
flügge gewordenen Domspatzen gründete<br />
er 1991 ein Vokalensemble, „Singer<br />
Pur“, das sich zuerst vor allem dem Jazz<br />
verschrieb und das Glück hatte, in einer<br />
Regensburger Kneipe den großen Bandleader<br />
Peter Herbolzheimer zu treffen,<br />
der sie zum Bundesjugendjazzorchester<br />
brachte. Als sich dann einer der Sänger in<br />
eine singende Schwedin verliebte, wurde<br />
die Gruppe um einen Kopf und viele Möglichkeiten<br />
reicher und gewann den Deutschen<br />
Musikwettbewerb.<br />
Das Ensemble reiste als Gast deutscher<br />
Botschaften durch alle Kontinente, sog Welt<br />
in sich auf und kultivierte Heimat, indem<br />
es unterwegs Schafkopf spielte. Den Erfolg<br />
der Gruppe fanden Fachleute spektakulär,<br />
Thomas E. Bauer naheliegend: Es sei eben<br />
kostengünstig gewesen, ein paar Sänger einzuladen,<br />
die ohne Instrumente auskamen.<br />
Die Lust auf Jura war Bauer vergangen, die<br />
auf eine Sängerlaufbahn in ihm erwacht. Er<br />
rief bei der Münchner Musikhochschule an<br />
und fragte: „Was muss ich tun, wenn ich<br />
als Sänger weiterkommen will?“ Fassungslos<br />
über so viel Naivität beschied man ihm,<br />
er solle sich mal mit den Bedingungen der<br />
Aufnahmeprüfung beschäftigen. Der Wäldler<br />
sah sich die Namen der Gesangsprofessoren<br />
an, suchte Hanno Blaschke, den ersten<br />
im Alphabet, zu Hause auf, nahm als<br />
Domspatz a. D., der in Regensburg Tonsatz<br />
und Musikgeschichte gelernt hatte, die<br />
Prüfung mit links und ließ seine Gefährten<br />
von „Singer Pur“ ihre Preise künftig alleine<br />
absahnen.<br />
Zu seinen Glückstreffern, sagt Thomas<br />
E. Bauer, gehöre es, zum richtigen<br />
Zeitpunkt den richtigen Menschen begegnet<br />
zu sein. Einen Goldrichtigen zog<br />
er mit seinem niederbayerischen Landsmann<br />
Prof. Siegfried Mauser, Rektor der<br />
Münchner Musikhochschule und Leiter<br />
der Liedklasse; er wurde Bauers Mentor,<br />
„Der Wald ist ambivalent“, sagt Thomas<br />
E. Bauer. „Der hat etwas Ekstatisches,<br />
Dunkles. Eine seltsame Melancholie.“ Die<br />
Wanderwege sind nicht vernünftig ausgezeichnet.<br />
Der Fremde muss sich verlaufen.<br />
Oberbayern ist postkartentauglich und touristentrainiert.<br />
Der Wald ist das Gegenteil<br />
davon. Und Thomas E. Bauer, der zwischen<br />
Washington und Warschau, Rom und Rotterdam,<br />
Peking und Straubing, Barcelona<br />
und Brüssel, Petersburg und Hamburg unterwegs<br />
ist, fühlt sich nach wie vor als ein<br />
typischer Bayernwäldler. „Ich habe hier in<br />
der Gegend 200 Verwandte, und keiner<br />
hat ein Abitur oder jemals etwas von Hölderlin<br />
gelesen.“<br />
Dass der vielseitige Sänger vor fünf Jahren<br />
dort das Festival „Kulturwald“ gegründet<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 129
| S a l o n | P r o v i n z m i t K l a s s e<br />
Begleiter, Freund und riet ihm, sich für die<br />
Titelpartie der Kammeroper „Jakob Lenz“<br />
von Wolfgang Rihm zu bewerben, die im<br />
Rahmenprogramm der Salzburger Festspiele<br />
aufgeführt wurde. „Ich hatte etwas<br />
Einfaches erwartet. Dann hatte ich die Noten<br />
in der Hand und wusste: Oh weh, da<br />
kommt was auf mich zu.“ Thomas E. Bauer<br />
wurde für seine Darstellung des Jakob Lenz<br />
prämiert, weitergereicht unter den lebenden<br />
Komponisten, von Penderecki bis Ruzicka,<br />
und macht sich seither mit Gegenwartsmusik<br />
genauso einen Namen wie mit<br />
Schubert und Haydn, Gluck und Brahms,<br />
Schumann und Bach.<br />
Die Warnung, er verzettle sich, schlug<br />
er in den Wind. „Lied und Oper, Barock<br />
und Gegenwart, Klassik und Volksmusik<br />
profitieren voneinander.“ Das ist auch der<br />
Grundgedanke seines Festivals, das alles andere<br />
als reinsortig ist. Doch bis Bauer dadurch<br />
zu dem wurde, was der Bayerische<br />
Rundfunk den „Fitzcarraldo vom Bayerwald“<br />
nannte, gelang dem Bariton ganz unauffällig<br />
der Aufstieg in die erste Liga seines<br />
Faches. Als er am Deutschen Musikwettbewerb<br />
teilnahm, hatte er eine gute Ausbildung,<br />
aber keine Strategie und keinen Begleiter,<br />
nahm also zuerst den, der ihm dort<br />
gestellt wurde. Als er bis in die Endrunde<br />
durchdrang, wurde ihm eine in Tokio geborene<br />
Pianistin zur Seite gestellt, die einen<br />
Sänger begleitet hatte, der in der ersten<br />
Runde bereits ausgeschieden war. Beide<br />
gewannen, sie als Begleiterin, er als Sänger.<br />
Gewinnen hieß, eine Konzerttournee mit<br />
drei Programmen spendiert zu bekommen.<br />
Die Jury wollte nun die beiden Sieger zusammenspannen,<br />
die Sieger aber wollten<br />
das beide nicht, schon weil es unfair gegenüber<br />
dem Kollegen gewesen wäre. Erst<br />
als verlautbart wurde: „Wenn Sie nicht miteinander<br />
auf Tour gehen, dann streichen<br />
wir das Stipendium“, machten sie gemeinsame<br />
Sache. Und machen es als Ehepaar<br />
Bauer & Hielscher noch immer – auf CD,<br />
auf Musikfestspielen und natürlich beim<br />
eigenen Festival.<br />
Auf die Idee dazu brachte sie der Kauf<br />
eines Landhauses mit großem Grund unweit<br />
von Deggendorf, eine ehemalige Pension<br />
für Berliner Sommergäste mit einem<br />
100 000-Liter-Pool und vielen Zimmern,<br />
in dem die eingeladenen Künstler gratis<br />
übernachten konnten. „Dorthin kommt<br />
kein Mensch“, wurde Fitzcarraldo gewarnt.<br />
Es kamen 3000 Menschen, vor allem aus<br />
„Kultur<br />
kann der<br />
Gesellschaft<br />
einen Ruck<br />
versetzen“:<br />
Thomas<br />
E. Bauer,<br />
Gründer<br />
des niederbayerischen<br />
Kulturwald-<br />
Festivals<br />
der Region, großenteils Menschen, die<br />
noch nie klassische Musik gehört hatten.<br />
Geboten wurde Samba, Schafkopfturnier,<br />
Volksmusik, Punk, Bach und Beethoven.<br />
„Und die, die nur zum Schafkopf<br />
gekommen waren, habe ich genötigt, bis<br />
zum Beethoven zu bleiben. Hinterher haben<br />
sie gesagt: Der Beethoven war gar nicht<br />
so schlecht.“<br />
Bereits im zweiten Jahr fand Fitzcarraldo<br />
Sponsoren, von BMW über Eon bis<br />
zum Rotarier-Club. „Sie haben mir Vertrauen<br />
geschenkt, weil ich gesagt habe:<br />
Ihr müsst mitmachen, aber ich kann euch<br />
überhaupt nichts versprechen.“ Die Presse<br />
fand das Ergebnis jedoch vielversprechend,<br />
denn was Thomas E. Bauer da an international<br />
renommierten Musikerfreunden zusammengezogen<br />
hatte, brachte Weltklasse<br />
in die Provinz. Das war Ziel des Gründers,<br />
der selbst als Kind von der Welt nichts gesehen<br />
hatte und den nicht der Karrierehunger,<br />
sondern der Welthunger in entlegene<br />
Regionen treibt.<br />
Mit seinem Verbündeten Siegfried Mauser<br />
reiste er etwa in der Transsibirischen Eisenbahn<br />
durchs Land, von Omsk bis Tomsk,<br />
von Irkutsk bis Nowosibirsk, um den Menschen<br />
dort in winterlicher Region Schuberts<br />
Winterreise nahezubringen. „Winter, Winterreise,<br />
Sibirien, Transsibirische Eisenbahn:<br />
Die Idee hat sofort gezündet.“ Die Förderer<br />
drängten sich, und Regisseur Klaus Voswinckel<br />
drehte einen Dokumentarfilm über<br />
das Projekt. Die Menschen im hohen Norden<br />
hörten mit feuchten Augen den beiden<br />
Musikern aus Deutschlands Süden zu und<br />
verstanden Schuberts Lieder, ohne ein Wort<br />
Deutsch zu können. Im Truck fuhr Thomas<br />
E. Bauer gemeinsam mit Bernhard Wulff,<br />
Professor für Schlagzeug an der Freiburger<br />
Musikhochschule, auch durch die mongolischen<br />
Wüsten und Steppen, wo sich vor<br />
Konzertbeginn die Besucher hoch zu Ross<br />
am Horizont zeigten und nach den üblichen<br />
Programmpunkten wie Bogenschießen im<br />
Sattel zuhörten, wie der Mann aus Bayern<br />
zum Schlagzeug sang. Thomas E. Bauer ist<br />
stolz darauf, Mitglied des Mongolian Art<br />
Council und Botschafter Niederbayerns zu<br />
sein, gibt im mongolischen Fernsehen gerne<br />
ein mongolisches Volkslied zum Besten und<br />
nimmt an den Treffen in der Niederbayerischen<br />
Botschaft teil, einem Bauernhaus im<br />
Münchner Westpark.<br />
Dass so einer kein Festspielprogramm<br />
bietet, bei dem man die Gehirnwindungen<br />
Foto: Kulturwald Festspiele Bayrischer Wald<br />
130 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Foto: Privat (Autorin)<br />
knacken hört, liegt nahe. Und genau das<br />
lockt die Besucher zu den Veranstaltungen<br />
in eine barocke Kirche oder einen<br />
Klosterfestsaal, in einen Stadl oder einen<br />
Ratskeller, ein Kino, eine Glasmanufaktur<br />
oder einen Rittersaal. Von Hugo von<br />
Hofmannsthals „Jedermann“ lassen sie<br />
sich zu Johann Sebastian Bachs Kammermusik<br />
treiben, von Johannes Brahms’ Liederzyklus<br />
„Die schöne Magelone“ zu einer<br />
Voodoo-Nacht mit Vortrag, Film und<br />
Musik aus Benin, von einer Fado-Sängerin<br />
zu Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie.<br />
„Ich will nicht verkrampft irgendwelche<br />
Zusammenhänge herstellen. Diese<br />
Suche nach einem Motto hat so etwas Bemühtes.<br />
Unser Kulturwald-Festival ist wie<br />
ein Kindergeburtstag.“<br />
Mit einem höchst erwachsenen Anliegen<br />
des Festivalgründers: Er will hier im<br />
Bayerischen Wald zeigen, dass Kultur nicht<br />
nur Sinn stiften, sondern auch Infrastrukturen<br />
schaffen kann. „Kultur kann der Gesellschaft<br />
einen Ruck versetzen und so Entwicklungen<br />
in Gang bringen.“<br />
Nach Blaibach bei Kötzting, nah an<br />
der Grenze zu Tschechien gelegen, kam<br />
man bisher nur aus Versehen. In Zukunft<br />
kommt man dorthin mit gutem Grund:<br />
Ausgerechnet in Blaibach baut Thomas<br />
E. Bauer ein Konzerthaus. Nichts bajuwarisch<br />
Rustikales, sondern eine visionäre<br />
Architektur. Bisher war Blaibach<br />
ein völlig heruntergekommenes, ruinöses<br />
Dorf. Jetzt wird dort restauriert und investiert,<br />
ein neues Hotel aufgemacht und<br />
das Schwimmbad wieder in Betrieb genommen.<br />
Fitzcarraldo scheiterte mit seinem<br />
Vorhaben, im Urwald ein Opernhaus<br />
zu errichten. Bauer hat im Bayernwald Erfolg.<br />
Warum?<br />
Im vergangenen Jahr hat er Mozarts<br />
„Zauberflöte“ aufgeführt. Die Partie des ersten<br />
Knaben studierte seine Tochter Naomi<br />
ein, während sie im beschallten Hof Rollerblades<br />
lief. Dass der „Zauberflöten“-Librettist<br />
Emanuel Schikaneder, ein Mann, der<br />
zahlreiche Krisen durchstand, aus seiner<br />
Heimat stammt, ist für Thomas E. Bauer<br />
kein Zufall: „Wer von dort kommt“, sagt<br />
er, „den wirft so leicht nichts um.“<br />
Anzeige<br />
Unser Wein des Monats<br />
<strong>Cicero</strong> empfiehlt: Chardonnay Millaman Condor, 2011<br />
JETZT ZUM<br />
VORZUGSPREIS<br />
GENIESSEN!<br />
Weißwein je Flasche für 4,95 Euro<br />
(zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 Euro)<br />
Von der Sonne Chiles verwöhnt, ist dieser trockene Chardonnay ein frischer,<br />
saftiger Gaumenschmeichler. Seine Farbe erstrahlt in frischem Gelbgrün mit<br />
goldenen Reflexen. Die kräftigen Aromen erinnern an tropische Früchte.<br />
Aber auch leichte Gewürz- und Kräuternoten sind wahrnehmbar.<br />
Bestellnummer: 888345 (Einzelflasche); 888346 (Paket)<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Online-Shop:<br />
www.cicero.de/wein<br />
Eva gesine Baur<br />
schreibt Biografien und Romane,<br />
die von Musik handeln. Zuletzt<br />
erschien ihr Buch über „Emanuel<br />
Schikaneder“ (C. H. Beck)<br />
Tipp: Beim Kauf<br />
von 11 Flaschen<br />
erhalten Sie eine<br />
weitere gratis.
Das leben als Pfeife<br />
Rainer Moritz ist bekennender Schlager- und Fußballfan und gilt als eine Art Tausendsassa<br />
des Buchbetriebs. Ein Bibliotheksbesuch beim Leiter des Hamburger Literaturhauses<br />
Von Claudia Rammin<br />
132 <strong>Cicero</strong> 9.2012
B i b l i o t h e k s p o r t r ä t | S a l o n |<br />
Foto: Florian Sonntag<br />
Sein wichtigstes Buch schenkte ihm seine Tante Maria, als er acht war:<br />
Rainer Moritz in seiner Altbauwohnung in Hamburg-Eppendorf<br />
M<br />
it dem Abseits kennt er sich aus. Als Rainer Moritz<br />
sieben war und sonnabends die Frühstücksbrezeln<br />
beim nahe gelegenen Bäcker holte, sang er eines Tages<br />
lauthals und unbedarft Bill Ramseys „Pigalle, Pigalle,<br />
das ist die größte Mausefalle mitten in Paris“. Dafür<br />
bekam er eine extra Laugenbrezel in die Tüte. Es war der Beginn seiner<br />
Begeisterung für das deutsche Liedgut. Und die wirkte für viele<br />
mindestens genauso abseitig wie seine spätere Tätigkeit als jugendlicher<br />
Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Schon mit 17 machte<br />
der in Heilbronn geborene Schwabe seine Schiriprüfung. Acht Jahre<br />
lang hatte er bei Kreis- und Bezirksligaspielen die Gelbe Karte so<br />
locker sitzen wie weiland John Wayne den Colt.<br />
Doch er hat davon profitiert. „Das Leben als Pfeife stählt“,<br />
lacht Moritz, studierter Germanist, Lektor, Verlagschef, Herausgeber,<br />
Kritiker, Autor und seit 2005 Chef des Hamburger Literaturhauses.<br />
Gäste, die der 54-Jährige in seiner Altbauwohnung in<br />
Hamburg-Eppendorf empfängt, erfahren gleich im Flur viel über<br />
die Faszination des Hausherrn für den Ball, den er zur Freude seines<br />
sechsjährigen Sohnes „heute noch treten kann“. Mehrere Hundert<br />
Bücher über Fußball sammeln sich in langen Regalreihen. Sie<br />
sind „nach dem Umzug vor kurzem leider immer noch nicht alphabetisch<br />
geordnet“, bedauert Moritz. Er schiebt unwirsch einen<br />
Bonsai-Kickertisch im Regal beiseite, der ihm die Sicht auf<br />
seine Schätze versperrt. Antiquarische Ausgaben von „Soccer Revolution“,<br />
daneben „Pfeifend durch die Welt“ aus dem Jahr 1943,<br />
sein eigenes Werk über die ungeliebte elfte Fußballregel: „Abseits.<br />
Das letzte Geheimnis des Fußballs“. Früher, erzählt er, war es im<br />
Kulturbetrieb relativ schwierig, sich als Fußballfan zu outen. Im<br />
Gegensatz zur Beschäftigung mit dem Schlager, der „immer auch<br />
ein Stück deutsche Sozialgeschichte widerspiegelt“, galt die Auseinandersetzung<br />
mit dem Sport lange als unintellektuell. Das war<br />
natürlich, bevor Ballexegeten wie Dirk Schümer oder der Günter-Netzer-Biograf<br />
Helmut Böttiger in den neunziger Jahren die<br />
Feuilletonisierung des Fußballs einleiteten.<br />
Sein „wichtigstes Fußballbuch“ schenkte ihm seine Tante Maria,<br />
als er acht war. Moritz holt ein kleines, schmales, 1966 erschienenes<br />
Bändchen aus dem Regal, von seinem Torwartidol, dem<br />
famosen Petar Radenković. „Das Spielfeld ist mein Königreich“<br />
heißt es. Mit sakralem Tremolo in der Stimme zitiert er: „Es gibt<br />
keine unhaltbaren Bälle.“ Ein „hochphilosophischer Satz, der für<br />
das ganze Leben gilt. Nur wenn der Torwart richtig steht, hält er<br />
jeden Ball.“<br />
Doch nun von der Alltags- zur Hochkultur, vom Flur ins<br />
Wohn- und Esszimmer. Jeweils sechs Meter Designerregale ragen<br />
an den Wänden der beiden Räume in die Höhe. Sie bergen<br />
die Belletristik, streng geordnet nach Alphabet, von A wie Herbert<br />
Achternbuschs „Die Stunde des Todes“ bis Z wie Gerhard<br />
Zwerenz’ „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“. Dazwischen<br />
Julien Greens „Adrienne Mesurat“, einer seiner frühesten<br />
Romane und einer von Moritz’ liebsten. „Ein psychologisch bis<br />
ins Kleinste austariertes Meisterwerk“, sagt er und steigt auf die<br />
Leiter, die an der Bücherwand lehnt. Die erste Übersetzung habe<br />
ihm ein Freund geschenkt. „Auch hier wurde nach dem Umzug<br />
noch nicht perfekt sortiert“, murmelt der Hausherr, der sich als<br />
„sehr ordnungsliebend“ bezeichnet. Eine Hilfe hatte wohl Schwierigkeiten<br />
mit dem ABC.<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 133
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Der Mann fürs Abseits: Im „Bookinist“-Sessel des Designers Nils Holger Moormann lässt sich wegen der harten Sitzoberfläche nur in asketischer<br />
Haltung lesen; eines von Rainer Moritz’ Lieblingsbüchern ist Julien Greens heute kaum noch bekannter Roman „Adrienne Mesurat“<br />
Zu seinen Hausgöttern zählen auch Gustave Flaubert und Hermann<br />
Lenz. Er sei zwar kein Sammler, aber von Lenz habe er sich<br />
fast alle Erstausgaben zugelegt, ebenso von „Auf der Suche nach<br />
der verlorenen Zeit“. Das sei der moderne Roman schlechthin,<br />
sagt Moritz, der neben seinen anderen Tätigkeiten noch als Vizepräsident<br />
der Marcel-Proust-Gesellschaft tätig ist. Auch wenn er<br />
immer wieder gern Kriminalromane lese, sei er sehr dafür, Literatur<br />
ernst zu nehmen, auch als Sprachkunstwerk. „Ich habe durchaus<br />
eine Schwäche für Romane, in denen wenig passiert. Stifters<br />
‚Nachsommer‘ ist ein Musterbeispiel dafür, wie durch stilistische<br />
Feinheiten Atmosphäre geschaffen wird, Landschaftsbilder heraufbeschworen<br />
werden.“ Die „ganz harte Variante an Langatmigkeit,<br />
reduzierter, fast karger Sprache“ sei Stifters Mittelalterroman<br />
„Witiko“. 1000 Seiten Dünndruck, die sich Moritz einst auf einem<br />
Campingplatz in der Bretagne erarbeitet hat. „Das werde<br />
ich nie vergessen.“<br />
Die vereinzelten Lücken in Rainer Moritz’ Regalen entpuppen<br />
sich als schimärenhafter Stauraum für Neuzugänge. „Der hält<br />
höchstens für ein Jahr.“ Aber es gibt zum Glück ein Zwischenlager<br />
im Literaturhaus. Nicht jedes Buch schafft die Hürde zu ihm<br />
nach Hause. „Aber was hier ist, darf hierbleiben. Es wandert nicht<br />
mehr zurück“, sagt er und fügt kategorisch hinzu: „Ich sortiere<br />
keine Bücher aus, auch wenn meine Frau das gern hätte.“ Moment,<br />
„wir haben ja auch trojanische Pferde“, sagt er schmunzelnd.<br />
Er sucht unter L und greift nach Hera Linds „Das Superweib“.<br />
Kleinlaut entschuldigt er sich für das literarische Schmuddelkind,<br />
offenbar nicht das einzige. Er habe mal etwas über Unterhaltungsromane<br />
schreiben müssen und auch eine Dora Heldt und eine<br />
Gaby Hauptmann gelesen.<br />
Moritz ist Frühaufsteher, „notorisch fleißig und fröhlich“. Er<br />
liest sehr viel, wann immer sich eine Nische findet. <strong>Am</strong> liebsten zu<br />
Hause in seinem schwarzen Leder-Lady’s-Chair. Er besitzt auch den<br />
rollbaren „Bookinist“ des Designers Nils Holger Moormann, aber<br />
der erfordert wegen seiner harten Sitzfläche eher eine asketische Lesehaltung.<br />
Manchmal schafft er es auch während der Arbeitszeit im<br />
Literaturhaus, in dem er für die Programmgestaltung und die Finanzen<br />
verantwortlich ist. Bei knapp 100 000 Erstauflagen im Jahr ist<br />
es wahrlich nicht leicht, wie eine Art Pythia des Buchwesens Autoren<br />
herauszupicken, die er zu Lesungen einladen kann.<br />
Plötzlich wird Moritz von einem ohrenbetäubenden Lärm aus<br />
dem Flur unterbrochen: „Tor, Toor, Tooor.“ Das Geschrei kommt<br />
von einer Soundinstallation, die bei starker Lichteinwirkung Herbert<br />
Zimmermanns tönendes Wunder von Bern erklingen lässt.<br />
Der Blitz des Fotografen hatte sie offenbar ausgelöst. Moritz verfällt<br />
in unbändiges Gelächter, ehe er sich wieder in Worte fassen<br />
kann.<br />
Er habe schon als Jugendlicher viel gelesen, sagt er dann, immer<br />
noch grinsend. „Ich komme nicht aus einem klassischen Bildungsbürgerhaus.<br />
Mein Vater war kein Leser, die Mutter zwar<br />
im Bücherbund, aber es war alles sehr überschaubar.“ Moritz,<br />
Mittelkind – ein Ausdruck wie Mittelklassewagen –, hatte einen<br />
fünfeinhalb Jahre älteren Bruder und eine fünfeinhalb Jahre jüngere<br />
Schwester und fühlte sich häufig allein. Er vergrub sich früh<br />
in Büchern, zur Sorge seiner Mutter. In der Stadtbücherei entdeckte<br />
er einen Autor, den „niemand außer mir kennt“. Anthony<br />
Buckeridge, in England sehr populär, schrieb „harmlose Geschichten,<br />
klassische Schulromane“. Aber auch Daniel Defoe „Moll Flanders“<br />
hat er begierig mit nach Hause genommen. Das war „ein<br />
wichtiger Faktor in meiner Sozialisation, die ohnehin untypisch<br />
war. Ich sage nur Stichwort Schlager. Als ich 13 oder 14 war, habe<br />
ich Bernd Clüvers ‚Der Junge mit der Mundharmonika‘ gesungen,<br />
während die anderen auf die Rolling Stones standen.“ Bei<br />
den Mädchen war er nicht besonders populär.<br />
Die schräge Passion hat Moritz in „Ich Wirtschaftswunderkind“<br />
schreibend verarbeitet. Überhaupt hat er viele Bücher geschrieben,<br />
Anthologien, Literaturkritiken, Essays. Vor drei Jahren probte er<br />
erstmals das „leichte Fach – Romane, die leicht sind, aber nicht<br />
peinlich“. Ein dritter Versuch folgt in diesem Herbst bei Piper:<br />
„Sophie fährt in die Berge“. Weiß seine Frau, worüber er schreibt?<br />
Ja, Überraschungen à la Charlotte Roche gibt es im Hause Moritz<br />
nicht. Auch von Experimenten gemäß Karen Duve, deren Buch<br />
„Anständig essen – ein Selbstversuch“ es immerhin in seine Bibliothek<br />
geschafft hat, hält er wenig, verrät er zum Schluss unseres<br />
Gesprächs. Er werde sich von keiner Abhängigkeit befreien und<br />
auch künftig nicht auf schweren Rotwein, gefüllte Kalbsbrust, die<br />
Lindenstraße oder die Bundesliga verzichten.<br />
Claudia Rammin<br />
arbeitete für CNN, dpa, den Stern und das Zeit-Magazin.<br />
Heute lebt sie als freie Journalistin in Hamburg<br />
Fotos: Florian Sonntag, privat (Autorin)<br />
134 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Jetzt im Handel<br />
Mehr entdecken. Mehr erfahren.<br />
Mehr GEO.<br />
www.geo.de<br />
GEO. Die Welt mit anderen Augen sehen
| S a l o n | D a s S c h w a r z e s i n d d i e B u c h s t a b e n<br />
Die Frau, die ein<br />
Baum sein wollte<br />
In mancher Hinsicht liegt der Iran viel näher an<br />
Deutschland, als man gemeinhin denkt. Über Bücher<br />
von Shahrnush Parsipur und Gabriele Goettle<br />
Die Bücherkolumne von Robin Detje<br />
Z<br />
wei Frauen ziehen in die Welt und<br />
schreiben. Die Welt ist gegen die<br />
Frauen, wenn auch auf jeweils<br />
sehr verschiedene Weise. Die eine bringt<br />
sich mit ihrem Schreiben in Lebensgefahr<br />
und verbringt Zeit im Gefängnis. Die andere<br />
lebt in einer Welt, in der eigentlich alles,<br />
dann aber doch nicht alles erlaubt ist,<br />
und protokolliert die zermürbenden kleinen<br />
Kämpfe des weiblichen Berufslebens.<br />
Die eine schreibt poetisch, die andere fast<br />
bürokratisch. In der Welt der einen wird<br />
man so grausam attackiert, dass man sich<br />
in lyrische Traumfantasien retten muss;<br />
in der Welt der anderen fühlt man sich<br />
eher langsam im Rahmen der Vorschriften<br />
zermahlen.<br />
Nummer eins: Iran. Shahrnush Parsipurs<br />
Buch „Frauen ohne Männer“ macht<br />
einen geradezu aberwitzigen Vorschlag,<br />
wie man größtem Leid und politischer<br />
Bedrängnis begegnen kann: mit Schönheit<br />
und Poesie. (Shahrnush Parsipur: „Frauen<br />
ohne Männer“; aus dem Farsi von Jutta Himmelreich;<br />
Bibliothek Suhrkamp, Berlin 2012;<br />
137 Seiten, 19,95 Euro) Die Autorin kann<br />
sich dabei auf Traditionen der persischen<br />
Literatur berufen, die zweieinhalbtausend<br />
Jahre zurückreichen. Davon verstehen wir<br />
nichts. Beim Lesen können wir nur staunen<br />
vor den dreisten Brüchen und Wendungen<br />
der Erzählung. Oft sind sie von geradezu<br />
clownesker Komik.<br />
Der Titel ist eine bewusste Umkehrung<br />
von Hemingways „Männer ohne Frauen“.<br />
Das Buch spielt im Iran der fünfziger Jahre.<br />
Es gibt darin eine Frau, die aus Weltekel<br />
und Enttäuschung beschließt, ein Baum<br />
zu werden. Sie rammt sich in die Erde<br />
und schlägt Wurzeln. Im Garten rund um<br />
diesen Menschenbaum finden sich andere<br />
Frauen ein, Männerflüchtige und Vertriebene,<br />
ein kleines Häuflein, das dort einen<br />
Sommer verbringt. Eine von ihnen ist<br />
schon zweimal gestorben, was ihren Blick<br />
auf die Welt natürlich prägt. Eine andere<br />
wird in der Schwangerschaft durchsichtig:<br />
„ganz kristallen …, transparent, eins mit<br />
dem Licht“. Alle haben Tragisches erlebt –<br />
Ehrenmord, Vergewaltigungen –, aber sie<br />
sind keine Herzchen, und nach der Zeit im<br />
verzauberten Garten leben sie wieder ganz<br />
normale kleine Leben und arrangieren sich.<br />
Das ist eine struppige, wie von einem<br />
Vogel dahingezwitscherte Geschichte. Sie<br />
enthält Sätze wie: „Bei Gott, glaub mir,<br />
Jungfräulichkeit ist völlig unwichtig.“ Sie<br />
empfiehlt Frauen, ihre Körper kennenzulernen<br />
und ihre Sexualität auszuleben.<br />
Das Buch wurde Ende der siebziger Jahre<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
136 <strong>Cicero</strong> 9.2012
foto: Loredana Fritsch<br />
geschrieben, 1990 im Iran veröffentlicht<br />
und verboten. Da hatte die Autorin schon<br />
viel Zeit hinter Gittern verbracht. Heute<br />
lebt sie in den USA. Shahrnush Parsipurs<br />
Erinnerungen an ihre Haft im Iran sollen<br />
im kommenden Jahr auf Englisch im<br />
Verlag Feminist Press erscheinen. Auszüge<br />
kann man schon im Netz lesen.<br />
Aus dem Stoff des Romans hat die bildende<br />
Künstlerin Shirin Neshat einen geradezu<br />
prunkvoll süffigen und trotzdem<br />
seltsam vergurkten Film gemacht, für den<br />
sie im Jahr 2009 auf den Filmfestspielen<br />
von Venedig preisgekrönt wurde. („Women<br />
without Men“; Regie: Shirin Neshat; DVD,<br />
Euro Video, 2011; Farsi mit deutschen Untertiteln;<br />
im Online-Handel zwischen 6 und<br />
19 Euro) Die Frau als Baum ist gestrichen,<br />
dafür wird plötzlich ganz viel politisches<br />
Geschehen nacherzählt, was den mystischen<br />
Bildern, in die Kamera und Regie<br />
viel verliebter zu sein scheinen, seltsam das<br />
Wasser abgräbt. Ein Film, der sich selbst<br />
nicht kennt.<br />
***<br />
Nummer zwei: Deutschland. Ein prosaisches<br />
Land. Berlin, Bayreuth, Lüchow-<br />
Dannenberg. Seit circa 20 Jahren ist Gabriele<br />
Goettle mit Elisabeth Kmölninger<br />
bei uns unterwegs und porträtiert Menschen.<br />
Das heißt: Sie räumt ihnen Platz für<br />
lange, kunstlos anmoderierte O-Ton-Passagen<br />
ein. Auf über 2000 Buchseiten ist ihre<br />
Deutschland-Erzählung inzwischen angewachsen.<br />
(Im Juli war in dieser Kolumne<br />
vom Endlostext des Thomas Kapielski die<br />
Rede, im Oktober wird es um den Endlosheimatroman<br />
des Rainald Goetz gehen.)<br />
Und je gnadenloser die von zahllosen<br />
Kommunikationsagenturen gepimpte<br />
Deutschland-Inszenierung auf allen Kanälen<br />
auf uns hereinprasselt, desto kostbarer<br />
kommt uns Gabriele Goettles unstillbare<br />
Neugier auf das Grau des wirklichen Lebens<br />
vor.<br />
Im neuen Band „Der Augenblick“ gesellt<br />
sich zur unparteiischen Neugier gelegentlich<br />
der Zorn auf den Untergang des<br />
Wohlfahrtsstaats BRD, auf das Ende einer<br />
besseren und gütigeren Zeit. ( Gabriele<br />
Goettle: „Der Augenblick – Reisen durch den<br />
unbekannten Alltag“; Kunstmann-Verlag,<br />
München 2012; 396 Seiten, 22,95 Euro)<br />
Je weniger sich dieser Zorn zwischen die<br />
Reporterin und ihre Geprächspartnerin<br />
schiebt, desto kühler dürfen wir sie<br />
betrachten, und seltsamerweise macht erst<br />
diese Kühle beim Lesen echte Einfühlung<br />
möglich. Dann verliert man sich in seltsamen<br />
Beschreibungen eines Lebens als<br />
Präparatorin medizinischer Exponate, als<br />
Sozialanwältin, als Kämpferin gegen die<br />
Psychiatrie oder als Bodybuilderin. Dann<br />
sind diese Frauen einem so schön fremd.<br />
Und eine geglückte Fremdheitserfahrung<br />
ist immer das größte Geschenk, das Bücher<br />
uns machen können.<br />
Natürlich teilt man den Zorn der Autorin.<br />
Immer wieder streut sie den Namen<br />
Peter Hartz ein, weil sie uns daran erinnern<br />
will, dass die einschneidendste Sozialreform<br />
Nachkriegsdeutschlands bis heute<br />
den Namen eines wegen Untreue rechtskräftig<br />
verurteilten Automanagers trägt.<br />
Und daran, wie viel das über den Anstandsbegriff<br />
unserer Eliten aussagt. Was aber von<br />
der Lektüre dieses Buches vor allem übrig<br />
bleibt, ist ein fast überscharfes Bild vom<br />
Klein-Klein eines deutschen Alltagslebens<br />
aus bürokratischen Vorschriften, starren<br />
Hierarchien und kleinlichem, dörflichem<br />
Misstrauen. Von den Bindungen der eigenen<br />
Biografie und den ganz altmodischen<br />
deutschen Tugenden, die diese Frauen benötigen,<br />
um sich trotzdem durchzusetzen:<br />
Fleiß und Beharrlichkeit.<br />
Zwei unterschiedlichere Bücher kann<br />
man sich kaum vorstellen. Obwohl die beiden<br />
Autorinnen gut gemeinsam auf einem<br />
Podium sitzen könnten: Politisch hätten sie<br />
einander viel zu sagen. Die eine schreibt,<br />
um Frauen überhaupt erst einmal einen<br />
Raum zu öffnen, die andere lehrt uns, dass<br />
dieser Raum, einmal erkämpft, zäh verteidigt<br />
werden muss. Die eine gewinnt ihrer<br />
Bedrängnis ein merkwürdig helles Leuchten<br />
ab, ein Feuerwerk aus großer Not. Und<br />
die andere beharrt auf einem Grau, so undurchdringlich,<br />
dass man sich nach der<br />
Lektüre kaum noch eine andere Farbe vorstellen<br />
kann. So klaustrophobische Züge<br />
nimmt die deutsche Normalität bei Gabriele<br />
Goettle an, dass man im Grunde auswandern<br />
möchte, sobald man mit dem<br />
Buch durch ist. Notfalls in den leuchtenden<br />
Iran, und wenn man dabei in Lebensgefahr<br />
geriete.<br />
Robin Detje<br />
lebt als Autor und Übersetzer<br />
in Berlin<br />
Anzeige<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Jetzt gratis<br />
testen<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst<br />
und Leben, den internationalen<br />
Kunstbetrieb wider. Herausragende<br />
Porträts und Ausstellungsrezensionen,<br />
spannende Debatten und Neuigkeiten<br />
aus der Kunstwelt, alles in einer unverwechselbaren<br />
Optik.<br />
Telefon +49 1805 47 40 47*<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 864571<br />
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 137
138 <strong>Cicero</strong> 9.2012
D i e l e t z t e n 2 4 S t u n d e n | S a l o n |<br />
„Mensch, hätt ick mal …“<br />
Warum sich Kurt Krömer vor einem deliriösen Abgang<br />
noch schnell mit Heinz Buschkowsky versöhnen würde<br />
wFoto: Maurice Weiss/Ostkreuz<br />
N<br />
a jut. 24 Stunden also. Ganz<br />
klar. Ich würde überall dort rauchen,<br />
wo es verboten ist. Und<br />
ich würde spazieren gehen. Im Grunewald.<br />
Den Tag, den ich dann noch zu<br />
leben hätte, möchte ich für mich haben.<br />
Teilweise würde ich den Leuten<br />
gar nichts sagen. Die Mitleidsschiene<br />
brauch ich nicht. Was mir auf den Sack<br />
gehen würde, wären Leute, die sagen,<br />
„Oh, dit is ja traurig. Kieck ma, 17 Stunden<br />
noch, ach dit is ja schade, wa? Wir<br />
leben alle weiter und du musst jehn.“<br />
Nein. Ich würde all das machen, was<br />
man nicht machen darf: So richtig viel<br />
essen, viel saufen, mit dem Auto übern<br />
Ku’damm fahren. Ich hab ja keinen Führerschein.<br />
Also alles auf die Spitze treiben.<br />
Obwohl. Vielleicht sollte ich nicht<br />
ganz so viel trinken, sonst vergisst man ja<br />
wieder alles. Und dann vergesse ich vielleicht,<br />
dass ich nur noch 15 Stunden zu<br />
leben hätte, und am Ende verpasse ich<br />
dann den eigenen Tod.<br />
In meine letzte Sendung würde ich all<br />
die Leute einladen, die bis jetzt nicht gekommen<br />
sind. Denen würde ich sagen:<br />
„Ick hab nur noch einen Tag zu leben und<br />
denn muss ick qualvoll sterben. Können<br />
Se nich kommen, Herr Adorf.“ Oder<br />
Udo Lindenberg. Ich würde sagen: „Udo,<br />
komm ma morgen, ick hab nich mehr so<br />
Seit Mitte August ist Kurt Krömer,<br />
Deutschlands Lieblingskomiker,<br />
wieder im Fernsehen zu<br />
sehen. Nach seiner inzwischen<br />
legendären „Internationalen<br />
Show“, einem Grimme-Preis<br />
und einem erfolgreichen Ausflug<br />
ins Filmbusiness moderiert er<br />
jeden Samstag die „Late-Night-<br />
Show“ im Ersten. Direkt nach<br />
dem Wort zum Sonntag<br />
lang.“ Nach der Show würden wir dann<br />
einen trinken gehen. Zwei große Bier<br />
und dann vom Tresen fallen. „Lasst mich<br />
liegen, trinkt weiter uff mein Wohl!“,<br />
würde ich rufen. Und die Rechnung bliebe<br />
auch aus.<br />
Vielleicht könnte ich mich auch mit<br />
Heinz Buschkowsky versöhnen. Meine<br />
Harmoniebedürftigkeit würde vermutlich<br />
durchschlagen. Obwohl. Er hat<br />
ja angefangen, mich zu beleidigen. Für<br />
sein gutes Gewissen würde ich es tun.<br />
Nicht, dass er am Ende von meinem Tod<br />
aus der Zeitung erfährt und sich sagt:<br />
„Mensch, der Krömer, mit dem hatte ich<br />
mich doch gestritten und jetzt isser tot.<br />
Mensch, hätt ick mal …“ Ich würde in<br />
sein Büro gehen, ihm die Hand reichen<br />
und sagen: „Buschkowsky, ick nehm dit<br />
uff meene Kappe, es war meine Schuld,<br />
ick entschuldige mich in aller Form bei<br />
Ihnen.“ Beim Rausgehen würde ich dann<br />
denken, was ich für den Blödmann alles<br />
gemacht habe, das geht auf keine Kuhhaut,<br />
und dann treff ich mich mit Udo.<br />
Davon darf Buschkowsky aber nichts<br />
erfahren.<br />
Wie viele Stunden hab ick noch? Oh.<br />
Ich würde noch mal gern jemanden zusammenschlagen,<br />
mal so richtig ohrfeigen.<br />
Ich prügele mich ja nie. Einmal<br />
rausfinden, wie das ist. <strong>Am</strong> besten in<br />
meiner Sendung. Und die Intendantin<br />
sagt dann: „Ab morgen können Sie sich<br />
einen neuen Arbeitsplatz suchen, Herr<br />
Krömer.“ Es müsste auf jeden Fall einer<br />
sein, der es verdient hat. Einer, bei dem<br />
alle sagen: Jawohl. Es dürfte auch niemand<br />
sein, der einen Kopf kleiner ist.<br />
Und es müsste jemand sein, bei dem man<br />
weiß, wenn man den schlägt, dann ist dit<br />
übel …<br />
Aber den Namen nehme ich mit ins<br />
Grab. Echt. Man muss, auch wenn man<br />
tot ist, noch Geheimnisse haben. Ich<br />
schreibe den Namen dann auf ein Zettelchen,<br />
der kommt in einen Umschlag,<br />
den ich in der ausgestreckten Hand halte.<br />
Und dann geht die Kiste zu. Klappe<br />
zu, Affe tot.<br />
9.2012 <strong>Cicero</strong> 139
C i c e r o | P o s t S c r i p t u m<br />
Klarer denken<br />
Von Alexander Marguier<br />
D<br />
ie Energiewende in ihrem Lauf halten weder Ochs noch<br />
Esel auf. Frei nach Erich Honecker, dem großen Staatsratsvorsitzenden<br />
der DDR, lautet so inzwischen der<br />
Marschbefehl des neuen Bundesumweltministers Peter Altmaier.<br />
Da unterscheidet er sich übrigens kaum von seinem Vorgänger<br />
Norbert Röttgen, für den „die größte wirtschaftspolitische Herausforderung<br />
seit dem Wiederaufbau“ (Altmaier) ungefähr der<br />
Dimension des eigenen Egos entsprach. Auf den ersten Blick<br />
könnten die beiden Herren unterschiedlicher kaum sein; tatsächlich<br />
steht der stets jovial-gemütlich wirkende Peter Altmaier<br />
in wohltuendem Kontrast zum schneidig-selbstverliebten Superstaatsmann<br />
aus Meckenheim, der sich trotz seiner Pleite in<br />
NRW immer noch für den besseren Bundeskanzler halten mag.<br />
Aber man sollte sich da nicht täuschen lassen – auch nicht von<br />
Altmaiers saarländischem Zungenschlag, der (mit Ausnahme<br />
des gebürtigen Neunkircheners Honecker) irgendwie volkstümlich<br />
und auf sympathische Weise unpreußisch klingt.<br />
Denn von dialektischer Färbung abgesehen, sind die jüngsten<br />
Einlassungen des Bundesumweltministers geradezu mustergültiger<br />
Apparatschik-Sprech: Als „irreversibel“ bezeichnete Peter<br />
Altmaier die Energiewende jüngst bei der Präsentation eines<br />
„Zehn-Punkte-Programms“ zur Umweltpolitik – gerade so, als<br />
handle es sich um eine physikalische Notwendigkeit, und nicht<br />
um ein von Menschen gemachtes Gesetz. „Irreversibel“, also<br />
unumkehrbar, bedeutet ja in diesem Fall nichts anderes als ein<br />
Festhalten am Atomausstieg auch für den Fall, dass neu hinzugewonnene<br />
Erkenntnisse Zweifel am gesamten Projekt aufkommen<br />
lassen würden. Solches Handeln wider besseres Wissen<br />
wäre aber eine ausgemachte Dummheit, um nicht zu sagen: gegen<br />
die Interessen der eigenen Bevölkerung. Wie kommt Peter<br />
Altmaier, der dem Vernehmen nach ja ein kluger Kopf sein soll,<br />
zu derlei Behauptungen?<br />
Ein Blick in Rolf Dobellis Dauerbestseller „Die Kunst des<br />
klaren Denkens“ hilft da möglicherweise weiter, genauer gesagt,<br />
in das Kapitel „The Sunk Cost Fallacy“. Die sogenannten versunkenen<br />
Kosten sind ein Bild aus der Spieltheorie, mit dem<br />
irrationale Momente menschlichen Verhaltens erklärt werden<br />
können. Aktienbesitzer kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung:<br />
Je tiefer ein Wertpapier unter den Einstandspreis sinkt,<br />
desto geringer ist die Bereitschaft, sich von ihm zu trennen –<br />
und zwar unabhängig von der prognostizierten Kursentwicklung.<br />
Das ist ähnlich wie bei einer unglücklichen Ehe: Die Trennung<br />
fällt umso schwerer, je länger die Beziehung währt. Denn die<br />
Partner haben ja bereits so viele Emotionen in sie investiert. Das<br />
Motiv für objektiv widersinniges Weitermarschieren auf dem<br />
einmal eingeschlagenen Weg besteht in Dobellis Worten darin:<br />
„Menschen streben danach, konsistent zu erscheinen. Mit Konsistenz<br />
signalisieren wir Glaubwürdigkeit. Widersprüche sind<br />
uns ein Gräuel. Entscheiden wir, ein Projekt in der Mitte abzubrechen,<br />
generieren wir einen Widerspruch: Wir geben zu, früher<br />
anders gedacht zu haben als heute.“<br />
Zuzugeben, früher anders gedacht zu haben als heute – mit<br />
diesem Satz ist das Modernisierungsprogramm der CDU ziemlich<br />
präzise auf den Punkt gebracht: Die Partei Peter Altmaiers<br />
hat unter Angela Merkels Führung während der vergangenen<br />
zehn Jahre unter Ächzen und Stöhnen viele „versunkene Kosten“<br />
abgeschrieben und alte Positionen geräumt – von der Ausländerpolitik<br />
über Kindererziehung bis hin zur Homo-Ehe; bei<br />
der Atompolitik ist ihr sogar das denkwürdige Kunststück einer<br />
doppelten Kehrtwende gelungen. Wer kann es dem Bundesumweltminister<br />
da schon verdenken, wenn er jetzt endlich ganz<br />
besonders konsistent erscheinen will – und „irreversibel“ nennt,<br />
was in einer Demokratie selbstverständlich auch wieder rückgängig<br />
gemacht werden kann?<br />
Rolf Dobellis Buch trägt übrigens den Untertitel „52 Denkfehler,<br />
die Sie besser anderen überlassen“. Minister Altmaier<br />
sollte sich das zu Herzen nehmen.<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretender Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Illustration: Christoph Abbrederis; Foto: Andrej Dallmann<br />
140 <strong>Cicero</strong> 9.2012
Jetzt<br />
im<br />
Handel.<br />
REFORMATION Zum Umdenken gezwungen<br />
PETERSDOM Der lange Streit der Architekten<br />
KLEIDERORDNUNG Was trägt der Papst?<br />
www.spiegel-geschichte.de
BEWEIST<br />
STROM-<br />
STÄRKE<br />
DER NEUE RX 450h VOLLHYBRID<br />
Erleben Sie einen faszinierenden Premium-SUV, der seine Stärken auf jedem Terrain<br />
eindrucksvoll unter Beweis stellt: den neuen Lexus RX 450h. Die innovative Vollhybrid-<br />
Technologie verbindet souveräne Fahrdynamik mit klassenbesten Verbrauchs- und<br />
Emissionswerten. Bei beeindruckenden 220 kW (299 PS) und einer Beschleunigung von<br />
0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden verbraucht der RX 450h lediglich 6,3 l/100 km* – und ist<br />
auch damit Klassenbester. Freuen Sie sich auf unverwechselbares Design und wegweisende<br />
Technologie im neuen RX 450h – bei einer einmaligen Probefahrt in Ihrem Lexus Forum!<br />
SIND SIE BEREIT?<br />
*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert 6,3 (innerorts 6,5/außerorts 6,0), CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 145 nach dem vorgeschriebenen<br />
EU-Messverfahren. Rein elektrisch fahren bis zu 4 km und mit bis zu 65 km/h. Maximale Gesamtreichweite einer Tankfüllung:<br />
bis zu 1.083 km, Systemleistung: 220 kW (299 PS). Abb. zeigt RX 450h F Sport.