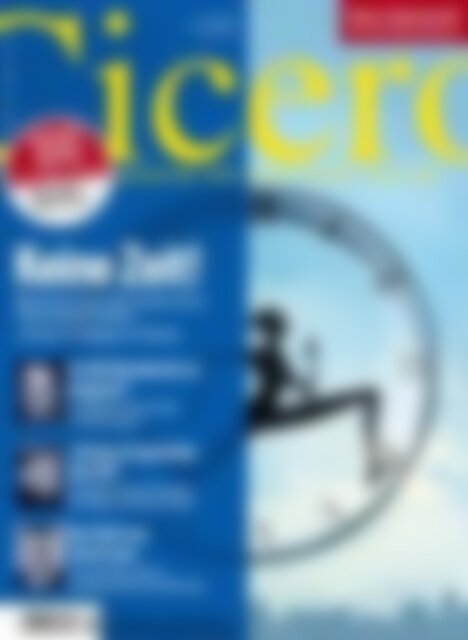Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WWW.CICERO.DE<br />
August 2012<br />
8 EUR / 12,50 CHF<br />
www.cicero.de<br />
Eberts Staatsstreich<br />
90 Jahre Nationalhymne<br />
<strong>Keine</strong> <strong>Zeit</strong>!<br />
Warum wir immer mehr machen und zu<br />
immer weniger kommen…<br />
…und was wir dagegen tun können<br />
Ist die Demokratie zu<br />
langsam?<br />
Franz Müntefering über Politik<br />
im Schweinsgalopp<br />
„Tristan ist gesünder<br />
als LSD“<br />
Der Dirigent Christian Thielemann<br />
über Rauschzustände in der Musik<br />
Der Chef von<br />
Tom Cruise<br />
Das mysteriöse Leben des<br />
Scientology-Führers David Miscavige<br />
Österreich: 88 EUR, Benelux: 9 EUR, Italien: 9 EUR<br />
Spanien: 9 EUR, 9 EUR, Portugal (Cont.): 9 EUR, 9 EUR Finnland: 12 EUR
Was ist Ihr Titelbild?<br />
Unser Illustrator Wieslaw Smetek ist ein<br />
kreatives Kraftwerk. Für den Titel dieses<br />
Heftes hat er so viele gute Entwürfe<br />
geliefert, dass wir Ihnen auch jene zeigen<br />
wollen, die es nicht geworden sind. Unter<br />
www.cicero.de/zeit finden Sie noch mehr.<br />
Dort haben Sie die Wahl. Stimmen Sie ab.<br />
Das Ergebnis dann im nächsten Heft.<br />
TiTelbild und enTwürfe: wieslaw smeTeK<br />
Verschiedene Titelbild-Entwürfe unseres<br />
Illustrators Wieslaw Smetek
Eberts Staatsstreich<br />
90 Jahre Nationalhymne
SOUVERÄNITÄT KÖNNEN WIR NICHT<br />
ABER SIE KÖNNEN SIE ERFAHREN.<br />
Ein Automobil, dessen souveräne Leistung und elegante Exklusivität weit über das Gewohnte hinausgehen. Und<br />
das auch abseits der Straße Erwartungen übertrifft – mit einem exklusiven Kundenbetreuungsprogramm, das<br />
seinesgleichen sucht. Mehr über den neuen BMW 7er und den BMW Excellence Club unter www.bmw.de/7er<br />
DER NEUE BMW 7er.<br />
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 12,9–5,6. CO 2 -Emission in g/km (kombiniert): 303–148.<br />
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Der neue BMW 7er<br />
www.bmw.de/7er<br />
Freude am Fahren<br />
ERKLÄREN,
BOROS<br />
www.deutschlandradio.de<br />
Ich will wissen.<br />
› woraus unser Universum besteht<br />
› was die Welt im Innersten zusammenhält<br />
› wie sich unser Universum weiter entwickelt<br />
Felicitas Pauss, Professorin für experimentelle Teilchenphysik<br />
Jetzt auch<br />
auf DAB+<br />
Hirn will Arbeit. ®<br />
Über Digitalradio, Kabel, Satellit und Internet
A t t i c u s | C i c e r o<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 26. Juli 2012<br />
Thema: Jubiläumsausgabe, <strong>Zeit</strong><br />
Immer mehr machen,<br />
immer weniger schaffen<br />
Titelbild: WieslaW Smetek; Fotos: DPA (2), action press/PSG (Titelseite); Illustration: Christoph Abbrederis<br />
C<br />
icero wird 100. Nicht 100 Jahre alt, das dauert noch ein bisschen. Aber vor Ihnen liegt<br />
die 100. Ausgabe unseres Magazins. Der richtige Anlass, eine große Frage in Angriff zu<br />
nehmen. Warum haben wir nie <strong>Zeit</strong>?<br />
Manchmal bekommt man welche geschenkt. Auf einem Transkontinentalflug zum Beispiel.<br />
Eine rare Gelegenheit, in einem Buch wie diesem zu versinken: Nicholas Wapshotts „The Clash<br />
That Defined Modern Economics“ über John Maynard Keynes und Friedrich August von Hayek.<br />
Bis der Flieger in Berlin aufsetzt ist klar, dass sich Neoliberale und Keynesianer nicht zuletzt wegen<br />
der Eitelkeit zweier Männer bis heute unversöhnlich gegenüberstehen.<br />
Oder auf einer langen Bahnfahrt quer durch Deutschland, ein ruhiges Abteil und den Briefwechsel<br />
von Voltaire und Friedrich dem Großen in der Tasche. Bis Hamburg bleibt genug <strong>Zeit</strong><br />
zu staunen, wie zwei große Männer sich über so viele Seiten unerträglich servil umschmeicheln,<br />
um sich schließlich nicht so sehr wegen Friedrichs Kriegslust zu überwerfen, sondern aufgrund<br />
der Tatsache, dass sich der Preußenkönig alsbald noch einen anderen Hofintellektuellen hielt.<br />
Das gleiche Muster: Zwei Männer zerstreiten sich nicht zuerst in der Sache, sondern aus Eifersucht<br />
und Missgunst. Für solche Trouvaillen braucht man <strong>Zeit</strong>. <strong>Zeit</strong>, die uns dauernd fehlt.<br />
Wir machen immer mehr und kommen dabei zu immer weniger. Wieso ist das so? Der Wissenschaftsjournalist<br />
Stefan Klein ist diesem Phänomen auf den Grund gegangen (ab Seite 16), der<br />
<strong>Zeit</strong>philosoph Hartmut Rosa macht durchdachte Vorschläge, der <strong>Zeit</strong>falle zu entgehen (Seite 25).<br />
Für den neuen Berliner Großflughafen reicht die <strong>Zeit</strong> bekanntlich auch hinten und vorne<br />
nicht, weshalb der Architekt Albert Speer zu dem Schluss kommt, dass Großprojekte wie<br />
Schönefeld oder die Elbphilharmonie in einer bürokratisierten Welt der Planfeststellungsverfahren<br />
zwangsläufig aus dem Ruder laufen (ab Seite 84).<br />
In der aktuellen EU-Krise fehlt nicht nur Geld. Schlaflos hetzt die Kanzlerin zwischen<br />
Brüssel und Berlin hin und her, vom EU-Gipfel direkt in den Bundestag. Und das Bundesverfassungsgericht<br />
leistet sich den Luxus, sorgfältig zu prüfen, ob Merkels Europapolitik noch im<br />
Einklang mit dem Grundgesetz ist. Dafür fallen alle über das Gericht her, weil in der Zwischenzeit<br />
die Rettung Europas warten muss. Franz Müntefering, der frühere SPD-Chef und Vizekanzler,<br />
macht sich bei diesem Tempo Sorgen um Europa und die Demokratie (ab Seite 28), ebenso<br />
der frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio (ab Seite 48). Spitzenpolitiker reden über ihr gespaltenes<br />
Verhältnis zum Taktgeber an ihrem Handgelenk (ab Seite 34), und Prominente führen uns an<br />
Orte, an denen sie sich eine Auszeit gönnen (ab Seite 19).<br />
Suchen Sie sich doch auch so einen Ort und nehmen sich <strong>Zeit</strong>.<br />
<strong>Zeit</strong> für diese 100. Ausgabe von <strong>Cicero</strong>.<br />
Mit besten Grüßen<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
das Herz ausgeschüttet<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 3
C i c e r o | I n h a l t<br />
Titelthema<br />
16<br />
In der <strong>Zeit</strong>falle<br />
Warum wir mehr machen und zu weniger kommen<br />
von Stefan Klein<br />
25<br />
Mythos Multitasking<br />
Zehn Hinweise zum Umgang mit <strong>Zeit</strong>not<br />
von Hartmut rosa<br />
28<br />
„<strong>Zeit</strong> gibt es nicht“<br />
Ein ausgeruhtes Gespräch mit Franz Müntefering<br />
Von Christoph Schwennicke<br />
19<br />
Auszeit vom Alltag<br />
Prominente zeigen die Orte, an denen<br />
sie Kraft schöpfen und Ruhe suchen<br />
26<br />
Die knappste Ressource der Welt<br />
<strong>Cicero</strong>-Redakteure verraten, womit sie<br />
am liebsten ihre <strong>Zeit</strong> verschwenden<br />
34<br />
Metronome der Macht<br />
Spitzenpolitiker und ihre Uhren<br />
von Laurence Chaperon<br />
TitelIllustration: Wieslaw Smetek<br />
4 <strong>Cicero</strong> 8.2012
I n h a l t | C i c e r o<br />
Fremdelt David McAllister mit Berlin?<br />
Der Ministerpräsident widerspricht<br />
44 68<br />
88<br />
In Syrien geht das staatliche Töten<br />
weiter. Und was macht die Nato?<br />
Wie ticken Cern-Forscher? Ein Blick<br />
in die Seele der Wissenschaftler<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE kapital<br />
40 | Immer wieder aufstehen<br />
Andrea Verpoorten ist das neue Gesicht<br />
in der NRW-CDU<br />
Von Jürgen Zurheide<br />
52 | dER sTRIPPENZIEHER<br />
Kardinal Tarcisio Bertone hat viele<br />
Gegner, allein der Papst hält zu ihm<br />
Von MaRTIN zÖLLER<br />
70 | Euroretter Wider Willen<br />
ESM-Chef Klaus Regling ist der<br />
Herr über 700 Milliarden Euro<br />
Von Eric Bonse<br />
42 | Der EWIGE INDER<br />
Sebastian Edathy, der die NSU-Morde<br />
aufarbeiten soll, gilt vielen als Fremder<br />
Von Hartmut Palmer<br />
54 | Pragmatiker der Macht<br />
Wie ernst ist es Burmas Präsidenten<br />
Thein Sein mit dem Wandel?<br />
Von Sascha Zastiral<br />
72 | Strafe für die Zunge<br />
Ralf Nowak stellt in Pforzheim die<br />
schärfsten Saucen Deutschlands her<br />
Von Benno Stieber<br />
44 | „Ich habe noch viel <strong>Zeit</strong>“<br />
Niedersachsens CDU-Ministerpräsident<br />
kopiert im Wahlkampf Hannelore Kraft<br />
Ein Gespräch mit David McAllister<br />
56 | Genie oder Wahnsinn?<br />
David Miscavige herrscht über<br />
Scientology wie ein unduldsamer Despot<br />
Von Frank Nordhausen<br />
74 | Die Geduld des Fischers<br />
Hausbesuch bei Paul Volcker, der<br />
lebenden Legende der Weltfinanzen<br />
Von Nikolaus Piper<br />
Fotos: Stefan Thomas Kroeger/Laif, Peter Ginter; Illustrationen: Jan Rieckhoff, Christoph Abbrederis<br />
47 | Frau Fried fragt sich …<br />
… ob das Leben Spaß macht, wenn man<br />
kein Risiko mehr eingeht<br />
Von Amelie Fried<br />
48 | Die Ruhe der Getriebenen<br />
Der <strong>Zeit</strong>druck auf das Verfassungsgericht<br />
ist ein Herrschaftsmittel<br />
Von Udo di Fabio<br />
50 | Deutschland wird deutscher<br />
Die späte Seligsprechung des Kanzlers<br />
Gerhard Schröder folgt perfiden Motiven<br />
Von Frank A. Meyer<br />
60 | Im Klammergriff des Militärs<br />
Seit Jahren haben Soldaten das Sagen in<br />
der Politik Ägyptens. Wie lange noch?<br />
Von Gerhard Haase-Hindenberg<br />
66 | „Der Islam bietet keine Lösung“<br />
Amr Mussa glaubt an die<br />
Wandlungsfähigkeit Ägyptens<br />
Von Julia Gerlach<br />
68 | Natos neue Kleider<br />
Warum der Einsatz des<br />
Militärbündnisses in Syrien falsch wäre<br />
Von Florence Gaub<br />
78 | Deutschlands 17. Bundesland<br />
Im Pazifik tobt ein Kampf um die<br />
Rohstoffressourcen der Tiefsee<br />
Von Andreas Rinke und<br />
Christian Schwägerl<br />
84 | „Da stimmt etwas nicht<br />
in unserem System“<br />
Warum deutsche Infrastrukturprojekte<br />
immer häufiger im Debakel enden<br />
Ein Gespräch mit Albert Speer<br />
88 | Urknallköpfe<br />
Eine Fotoreportage über die Forscher des<br />
größten Experiments der Geschichte<br />
Von Peter Ginter<br />
96 | Europas schmutziges<br />
kleines Geheimnis<br />
Nach dem Dotcom-Crash rettete die<br />
EZB Deutschland, zulasten der anderen<br />
Von Mark Dittli<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 5
C i c e r o | I n h a l t<br />
cicero online<br />
Salon<br />
98 | Die Macht des Orakels<br />
Heiner Goebbels spektakulärer<br />
Start in die Ruhrtriennale<br />
Von Barbara Burckhardt<br />
100 | Töchter und Väter<br />
Nora Bossong hat den Wirtschaftsroman<br />
der Stunde geschrieben<br />
Von Maike Albath<br />
102 | „Ich will manipulieren“<br />
Deutschlands bekanntester Dirigent über<br />
einen Haufen Vorurteile<br />
Ein gespräch mit christian thielemann<br />
108 | Man sieht nur, was man sucht<br />
Kunst ist nicht gleich Werbung: über<br />
Leni Riefenstahls „Olympia“-Film<br />
Von Beat Wyss<br />
110 | Was wir verlieren<br />
Mit dem Ende der Buchkultur steht so<br />
viel mehr auf dem Spiel, als wir denken<br />
Von Thomas Hettche<br />
116 | Benotet<br />
Für Musikliebhaber ist es im Sommer<br />
nirgends schöner als in Heiligendamm<br />
Von Daniel Hope<br />
118 | Eberts Staatsstreich<br />
Die deutsche Nationalhymne wird<br />
90 Jahre alt<br />
Von Uwe Soukup<br />
120 | Bibliotheksporträt<br />
Zu Besuch bei Nir Baram, dem<br />
israelischen Starintellektuellen<br />
Von Marko Martin<br />
124 | das schwarze sind<br />
die Buchstaben<br />
Intelligentes Leben ist möglich: Bücher<br />
über die HBO-Serie „The Wire“<br />
Von Robin detje<br />
126 | Küchenkabinett<br />
Das Doping am Herd ist so verpönt wie<br />
im Spitzensport – und genauso verbreitet<br />
Von Thomas Platt und Julius Grützke<br />
128 | Die letzten 24 stunden<br />
Warum ein Fotograf und Umweltaktivist<br />
mit einem Lächeln sterben wird<br />
Von Yann Arthus-Bertrand<br />
Standards<br />
Atticus —<br />
Von Christoph Schwennicke — seite 3<br />
Forum — seite 8<br />
Impressum — seite 9<br />
Stadtgespräch — seite 10<br />
Postscriptum —<br />
Von Alexander Marguier — seite 130<br />
Die nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 30. August 2012<br />
110<br />
Thomas Hettche<br />
nimmt Abschied<br />
vom Buch<br />
Aktuell:<br />
Frage des Tages<br />
Wie geht es Angela Merkel?<br />
Warum ist Griechenland<br />
pleite? Wer wird<br />
Kanzlerkandidat der SPD?<br />
Jeden Morgen beantworten<br />
wir Ihnen Fragen zu<br />
einem aktuellen Thema.<br />
www.cicero.de<br />
Debatte:<br />
Brauchen wir mehr<br />
Direkte Demokratie?<br />
Die Forderung nach<br />
Volksentscheiden auch im<br />
Bund wird immer populärer.<br />
Aber passen diese überhaupt<br />
zur parlamentarischen<br />
Demokratie?<br />
Diskutieren Sie mit.<br />
www.cicero.de<br />
HINTERGRÜNDIG:<br />
Parteiencheck<br />
Wie geht es der CDU, CSU,<br />
SPD, FDP, der Linken<br />
und den Piraten ein Jahr<br />
vor der Bundestagswahl?<br />
In unserem Parteiencheck<br />
blicken wir in die Zukunft<br />
der Parteien, benennen<br />
Stärken und Schwächen,<br />
Chancen und Risiken.<br />
www.cicero.de/Parteiencheck<br />
Kolumne:<br />
Ökonomie und Alltag<br />
Jeden Freitag beschäftigt<br />
sich unser Kolumnist Til<br />
Knipper mit der Frage,<br />
wie die Ökonomie unser<br />
Leben bestimmt.<br />
www.cicero.de/kolumnen/<br />
oekonomie-und-alltag<br />
Unterhaltsam:<br />
Karikaturen<br />
Mit spitzer Feder zeichnen<br />
Burkhard Mohr und<br />
Heiko Sakurai ihre<br />
täglichen Kommentare<br />
für <strong>Cicero</strong> Online.<br />
www.cicero.de/Karikaturen<br />
Foto: Michael Short/Prisma; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
6 <strong>Cicero</strong> 8.2012
C i c e r o | L e s e r b r i e f e<br />
Forum<br />
Es geht um Wähler, Griechen, Burschenschafter und Annoncen<br />
arabischen Ländern gearbeitet. Die vor<br />
kurzem geäußerten Worte von C. Roth<br />
zu Panzerlieferungen an Saudi-Arabien<br />
zeigten, dass diese „Dame“ für das<br />
Amt einer Außenministerin absolut<br />
ungeeignet ist. Also – Frau Merkel,<br />
werden Sie besser, dann könnten Sie<br />
auch wiedergewählt werden.<br />
Erwin Chudaska, Rödermark<br />
zum Titelthema „Comeback<br />
der Autokraten“ von William<br />
J. Dobson / <strong>Cicero</strong> Juli 2012<br />
Zu nebulös<br />
Sie haben das Titelthema breit gefächert, jedoch meines Erachtens nebulös abgehandelt.<br />
Was ist denn eigentlich das Charakteristikum einer Demokratie: das<br />
Wählendürfen – um dann ohnmächtig zuzusehen, wie die Krisenverursacher mit<br />
Milliardenspritzen gefüttert werden von der demokratischen Regierung? Darf<br />
eine Demokratie (nach Ihrem Verständnis) diplomatisch eine Diktatur politisch<br />
hofieren? Und möchte nicht zum Beispiel die CSU auch gern mit 90 Prozent<br />
Wahlergebnis herrschen? Gerade die politischen Magazine zählen ja gern mit, ob<br />
bei innerparteilichen Wahlen ein Ergebnis von 95 Prozent oder 98 Prozent herauskommt<br />
– wo ist da der Unterschied zu den verteufelten Staaten? Sie machen es<br />
sich sehr einfach auf der Welle des politischen Mainstreams … Bisher war ich vom<br />
<strong>Cicero</strong> anderes gewohnt, nicht eine derartige Undifferenziertheit.<br />
Bernd Ebert, Groß-Zimmern<br />
zum beitrag „Athens Che<br />
Guevara“ von Richard<br />
Fraunberger / <strong>Cicero</strong> Juli 2012<br />
In die eigene Tasche<br />
Das Wort graeculare beschreibt seit Caesars<br />
<strong>Zeit</strong>en den Umgang der Griechen<br />
mit Fremden. Insofern bezeichnet es<br />
eine alte Tradition. Aber dem jungen<br />
Che-Verschnitt sei gesagt, wenn Griechenland<br />
keine deutsche Kolonie ist, ist<br />
Deutschland auch keine griechische.<br />
Und wenn der Durchschnittsgrieche<br />
keine Opfer bringen will, kann vielleicht<br />
der Überdurchschnittsgrieche mal in<br />
seine eigene Tasche greifen? Damit<br />
wären die lumpigen paar Milliarden<br />
locker zu erledigen.<br />
Dr. Ing. Karl Reißmann, Mittweida<br />
zum beitrag „Die Glucke<br />
der Nation“ von Christoph<br />
Schwennicke / <strong>Cicero</strong> Juni 2012<br />
Polit-Gau Roth!<br />
Danke an Ihr Magazin für den<br />
aufschlussreichen Beitrag. Ich bin kein<br />
Fan von A. Merkel, habe aber nichts<br />
dagegen, wenn sie nach der nächsten<br />
Wahl wieder Kanzlerin würde. Denn<br />
was wäre die Alternative? Mit einigen<br />
SPD-Oberen könnte ich ja leben, aber<br />
niemals mit einer Außenministerin<br />
Claudia Roth. Dies wäre ein Polit-Gau!<br />
Da hat G. Westerwelle bisher einen<br />
guten Job gemacht. Der Schnuckel-Bär<br />
S. Gabriel würde etliche Zugeständnisse<br />
an die Grünen machen, damit er<br />
Kanzler wird. Ich habe drei Jahre in<br />
zur Kolumne „Frau Fried Fragt<br />
sich – Frauen und FuSSball“<br />
von Amelie Fried und zur<br />
anzeigenwerbung / <strong>Cicero</strong><br />
Juli 2012<br />
Nur auf Gewinn aus<br />
Ich lese Ihr Magazin seit der ersten<br />
Ausgabe, war von Anfang an begeistert<br />
und hab es auch bald abonniert. Es<br />
war ebenso schön zu sehen, wie die<br />
Relevanz Ihrer Themen und Artikel<br />
gestiegen ist und Ihr Magazin zu Recht<br />
an Bedeutung gewann. Schon an den<br />
Gästen des Foyergesprächs war das gut<br />
zu erkennen. Seit den letzten Ausgaben<br />
bin ich jedoch etwas enttäuscht … Zuerst<br />
wurde das Magazin teurer, was natürlich<br />
nicht ausbleibt, wenn die Autoren und<br />
Artikel „teurer“ werden. Doch gleichsam<br />
verstärkte sich meiner Auffassung nach<br />
ebenso die Werbung. Als dann eine<br />
Parfümwerbung (was an sich ja nicht<br />
verwerflich ist) samt Pröbchen in ihrem<br />
Magazin erschien, wunderte es mich<br />
doch. So etwas würde ich in einer typischen<br />
Frauenzeitschrift erwarten! Aber<br />
nun gut. In der letzten Ausgabe durfte<br />
ich dann zwei Kataloge durchblättern,<br />
die mir Schuhpuder argentinischer Tangotänzer<br />
und Eidottertrenner verkaufen<br />
wollten. Letzteres mag für den unerfahrenen<br />
Backanfänger ganz nützlich sein<br />
und besitzt definitiv eher eine Daseinsberechtigung,<br />
aber es hat meiner Ansicht<br />
nach nichts in einem Magazin für<br />
Politische Kultur zu suchen. In derselben<br />
Ausgabe wurde dann eine Kolumne zum<br />
Thema Männer und Frauen eingeführt,<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
8 <strong>Cicero</strong> 8.2012
I m p r e s s u m<br />
die gleich mit dem Thema Fußball<br />
begann. Die Kolumnen und Blogs auf<br />
<strong>Cicero</strong> Online sind da doch um einiges<br />
sinnvoller … Einzig gute Beilage zurzeit,<br />
über die ich mich jedes Mal freue, ist die<br />
Literaturen – die sollten Sie unbedingt<br />
beibehalten! In den Anfängen wurde auf<br />
den ersten Seiten noch dem Leser und<br />
den Abonnenten gedankt, was das Lesen<br />
noch erfreulicher machte, da man das<br />
Gefühl hatte, man hat an etwas Wachsendem<br />
teil und hilft, eine neue, wichtige<br />
Art von Magazin voranzubringen.<br />
Janine Stibaner, Jena<br />
zur Fotoreportage „Freiheit,<br />
Ehre, Vaterland“ / <strong>Cicero</strong><br />
Juli 2012<br />
kleinbürgerlich<br />
Glückwunsch zu Ihrem Burschenschafter-Artikel.<br />
Er enthüllt die ganze<br />
kleinbürgerliche, rückwärtsgewandte<br />
Denkweise von Burschenschaftern, die<br />
die Machtübernahme von rechtsextremen<br />
Burschenschaftern erst ermöglicht<br />
hat. Glücklicherweise gibt es auch ein<br />
paar andere Burschenschafter. Nicht<br />
viele, aber immerhin.<br />
Christian J. Becker, Hamburg<br />
verleger Michael Ringier<br />
chefredakteur Christoph Schwennicke (V.i.S.d.P.)<br />
Stellvertreter des chefredakteurs<br />
Alexander Marguier<br />
Redaktion<br />
Ressortleiter Judith Hart (Weltbühne), Til Knipper<br />
(Kapital), Daniel Schreiber (Salon), Constantin Magnis<br />
(Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
politischer Chefkorrespondent Hartmut Palmer<br />
Assistenz der Chefredaktion Ulrike Gutewort<br />
Publizistischer Beirat Dr. Michael Naumann (Vorsitz),<br />
Heiko Gebhardt, Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer,<br />
Jacques Pilet, Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
Art director Kerstin Schröer<br />
Bildredaktion Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
Produktion Utz Zimmermann<br />
Verlag<br />
verlagsgeschäftsführung<br />
Rudolf Spindler<br />
Leitung Vertrieb u. unternehmensentwicklung<br />
Thorsten Thierhoff<br />
Redaktionsmarketing Janne Schumacher<br />
Abomarketing Mark Siegmann<br />
kommunikation André Fertich<br />
Tel.: +49 (0)30 820 82-517, Fax: -511<br />
E-Mail: presse@cicero.de<br />
grafik Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
zentrale dienste Erwin Böck, Stefanie Orlamünder,<br />
Ingmar Sacher<br />
herstellung Lutz Fricke<br />
druck/litho Neef+Stumme, Wittingen<br />
nationalvertrieb DPV Network GmbH, Hamburg<br />
leserservice DPV direct GmbH, Hamburg<br />
Hotline: +49 (0)1805 77 25 77*<br />
Anzeigenleitung (verantwortlich)<br />
Jens Kauerauf, Gruner+Jahr AG & Co KG<br />
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 3703-3317, Fax: -173317<br />
E-Mail: kauerauf.jens@guj.de<br />
verkaufsbüro gruner+jahr ag & co KG<br />
Verkaufsbüro Nord – Berlin: Kurfürstendamm 182<br />
10707 Berlin, Tel.: +49 (0)30 25 48 06-50, Fax: -51<br />
Verkaufsbüro Nord – Hamburg: Stubbenhuk 10<br />
20459 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 3703-2201, Fax: -5690<br />
Verkaufsbüro Nord – Hannover: Am Pferdemarkt 9<br />
30853 Langenhagen, Tel.: +49 (0)511 76334-0, Fax: -71<br />
Verkaufsbüro West: Heinrichstraße 24<br />
40239 Düsseldorf, Tel.: +49 (0)211 61875-0<br />
Fax: +49 (0)211 61 33 95<br />
Verkaufsbüro Mitte: Insterburger Straße 16<br />
60487 Frankfurt, Tel.: +49 (0)69 79 30 07-0<br />
Fax: +49 (0)69 77 24 60<br />
Verkaufsbüro Süd-West: Leuschnerstraße 1<br />
70174 Stuttgart, Tel.: +49 (0)711 228 46-0, Fax: -33<br />
Verkaufsbüro Süd: Weihenstephaner Straße 7<br />
81673 München, Tel.: +49 (0)89 4152-252, Fax: -251<br />
anzeigenverkauf buchverlage<br />
Thomas Laschinski, Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
E-Mail: advertisebooks@laschinski.com<br />
anzeigenverkauf online<br />
Kerstin Börner, Tel.: +49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
E-Mail: anzeigen@cicero.de<br />
verkaufte auflage 82 954 (2. Quartal 2012)<br />
LAE 2011 88 000 Entscheider<br />
reichweite 450 000 Leser<br />
gründungsherausgeber Dr. Wolfram Weimer<br />
<strong>Cicero</strong> erscheint in der<br />
ringier Publishing gmbh<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de, www.cicero.de<br />
redaktion Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
verlag Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
eine publikation der ringier gruppe<br />
ZU den CICERO-Ausgaben<br />
Juni und Juli 2012<br />
FRECHER, MODERNER<br />
Was für ein erfrischender Neustart! Mit<br />
großem Interesse habe ich den Wechsel<br />
in der Chefredaktion von <strong>Cicero</strong> wahrgenommen<br />
– erstaunlich, wie schnell<br />
die neue Handschrift sichtbar wird.<br />
Frecher, moderner, kritischer – aber<br />
nicht weniger fundiert und hintergründig<br />
präsentiert sich das Magazin auch in<br />
seiner jüngsten Ausgabe. <strong>Cicero</strong> bietet,<br />
im Gegensatz zu anderen politischen<br />
Magazinen, einen etwas anderen Blick<br />
auf Politik und Kultur und besetzt<br />
damit eine Nische auf dem deutschen<br />
<strong>Zeit</strong>schriftenmarkt. Das ist mutig, weil<br />
nicht immer mainstreamtauglich. Schön,<br />
dass die meisten Journalisten hier<br />
noch wahre „Wortwerker“ sind; gute<br />
Geschichten – bitte mehr davon!<br />
Claudia Krüger, Stuttgart<br />
(Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
Service<br />
Liebe Leserin, lieber leser,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
abonnement und nachbestellungen:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: +49 (0)1805 77 25 77*<br />
Telefax: +49 (0)1805 861 80 02*<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
Anregungen und Leserbriefe:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen Bearbeitung<br />
einverstanden. *0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min.<br />
aus dem Mobilfunk. **Preise inkl. gesetzlicher MwSt und Versand im Inland, Auslandspreise<br />
auf Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das<br />
Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
einzelpreis<br />
D: 8,- €, CH: 12,50 CHF, A: 8,- €<br />
jahresabonnement (zwölf ausgaben)<br />
D: 84,- €, CH: 132,- CHF, A: 90,- €**<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,- €, CH: 108,- CHF, A: 72,- €**<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.
B e r l i n e r R e p u b l i k | S t a d t g e s p r ä c h<br />
Warum das Weltklima an der Hotelbar nicht gerettet werden konnte, Lammert<br />
keinen Sprecher mehr hat, ein CDU-Politiker auf eine eingebildete Jüdin hereinfiel<br />
und die Große Koalition als plausibles Gerücht in Berlin umgeht<br />
Mit dem Fahrstuhl:<br />
zum Klimagipfel<br />
D<br />
ie welt zu retten, ist keine einfache<br />
Aufgabe. Und beim Nachhaltigkeitsgipfel<br />
in Rio de Janeiro<br />
Mitte Juni hatte man zuweilen den Eindruck,<br />
dass wir dafür vielleicht nicht das<br />
richtige Personal haben. Obwohl das ansonsten<br />
unbekümmerte Stadtbild Rios<br />
für ein paar Tage von ernsten Delegiertentrossen<br />
in dunklen Anzügen bestimmt<br />
wurde, von Limousinenkarawanen, Straßensperrungen<br />
und Hubschraubereinsätzen.<br />
Angela Merkel war nicht dabei. Sie<br />
hatte Umweltminister Peter Altmaier und<br />
Entwicklungsminister Dirk Niebel nach<br />
Brasilien geschickt. Niebel und seine Berater<br />
wohnten, wie Hillary Clinton auch,<br />
im Luxushotel Windsor Atlantica, direkt<br />
am Strand der Copacabana. Es ist nicht bekannt,<br />
wie viel Anteil die deutsche Delegation<br />
am betrüblichen Ergebnis des Gipfels<br />
hatte. Schon vor Beginn des Staatstreffens<br />
war der Entwurf des Abschlussdokuments<br />
an Delegierte und Journalisten verschickt<br />
worden. Darin wurde ersichtlich, dass der<br />
legendäre erste Klimagipfel am selben Ort<br />
vor 20 Jahren nicht nur so gut wie keine<br />
konkreten Folgen gezeitigt hatte, sondern<br />
auch, dass der größte Erfolg der diesjährigen<br />
Zusammenkunft nur darin hätte bestehen<br />
können, sich trotz der ungleich dramatischeren<br />
Situation auf Richtlinien zu<br />
einigen, die nicht hinter denen von 1992<br />
zurückbleiben. Rio war ein Flop. Unter<br />
den Deutschen herrschte trotzdem joviale<br />
Männerurlaubsatmosphäre. Bei einer<br />
gemeinsamen abendlichen Fahrstuhlfahrt<br />
im 39-stöckigen Windsor tauschte sich<br />
das Team Niebel darüber aus, wo sich die<br />
besten Bars des Hotels befänden. Jemand<br />
wusste von einer auf der vierten Etage, und<br />
sein Kollege zeigte sich beeindruckt. Aber<br />
punkten konnte letztlich der Chef: „Auf<br />
dem Dach gibt es auch noch eine Bar“,<br />
sagte Niebel. „Aber die macht schon um<br />
23 Uhr zu. Sehen Sie, über die wichtigen<br />
Sachen habe ich mich informiert!“ ds<br />
Dumm gelaufen:<br />
Lammert ohne Sprecher<br />
P<br />
ressesprecher für Norbert<br />
Lammert zu sein, ist aus verschiedenen<br />
Gründen nicht einfach.<br />
Erstens beherrscht der christdemokratische<br />
Parlamentspräsident die Kunst<br />
der freien Rede so virtuos, dass es schwer<br />
ist, es ihm auch nur annähernd gleichzutun<br />
oder als sein Sprachrohr genau seinen<br />
Ton zu treffen. Lammert ist selbst sein bester<br />
Sprecher. Zweitens gibt es eine Bundestagsverwaltung,<br />
die jeden, der von außen<br />
kommt, mit Argwohn beäugt – und erst<br />
recht, wenn es sich dabei um eine so bekannte<br />
Journalistin wie Sabine Adler handelt.<br />
Die war Leiterin des Hauptstadtbüros<br />
beim Deutschlandradio, als sie vor noch<br />
nicht einmal einem Jahr bei Lammert anheuerte.<br />
Sie hatte sich ihren Job etwas anders<br />
vorgestellt: Nicht nur Interviews redigieren<br />
und Pressemitteilungen herausgeben,<br />
sondern sie wollte für Lammert das sein,<br />
was der Regierungssprecher Steffen Seibert<br />
für Angela Merkel ist: eine kundige Interpretin.<br />
Aber Lammert – siehe oben – interpretiert<br />
sich am besten selbst. Außerdem<br />
lernte Adler bald die Macht der Verwaltung<br />
kennen: Journalisten arbeiten immer<br />
unter <strong>Zeit</strong>druck, Verwaltungen nie. Wenn<br />
Adler um halb fünf mal schnell eine Auskunft<br />
brauchte, war der Betreffende entweder<br />
im Urlaub oder im Feierabend. Es<br />
stellte sich also schon bald heraus, dass es<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
10 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Da bekommt<br />
jedes Schiff<br />
feuchte Bullaugen!<br />
Willkommen im neuen<br />
JadeWeserPort.<br />
Niedersachsen hat Deutschlands<br />
einzigen Tiefwasserhafen.<br />
Im neu gebauten JadeWeserPort Wilhelmshaven<br />
begrüßen wir die größten Containerschiffe der Welt.<br />
Und das ist nur einer der Gründe, warum unser<br />
Land der Heimathafen der globalen Wirtschaft ist.<br />
www.innovatives.niedersachsen.de<br />
Sie kennen unsere Pferde. Erleben Sie unsere Stärken.
B e r l i n e r R e p u b l i k | S t a d t g e s p r ä c h<br />
besser wäre, sich wieder zu trennen. Und<br />
da Frau Adler eine Rückfahrkarte zum<br />
öffentlich-rechtlichen Sender hatte, war<br />
das auch kein Problem. Lammert willigte<br />
ein. Für das eine Jahr bis zur Bundestagswahl<br />
wollte er Adlers Stellvertreter Christian<br />
Hoose zum Leiter der Pressestelle machen.<br />
Leider aber hatte Hoose einen Anruf<br />
aus Dresden erhalten. Der sächsische Ministerpräsident<br />
Stanislaw Tillich (CDU)<br />
fragte ihn, ob er Regierungssprecher werden<br />
wolle. Und Hoose, der das Sprechergeschäft<br />
von der Pike auf in Hans-Dietrich<br />
Genschers Außenministerium gelernt<br />
hat, sagte zu. Nun ist Lammert zwar nicht<br />
sprach-, aber sprecherlos. Sabine Adler hat<br />
sich nach Warschau verabschiedet, Christian<br />
Hoose fängt am 1. August in Dresden<br />
an. Dumm gelaufen. hp<br />
eingebildete jüdin:<br />
Polenz wurde getäuscht<br />
W<br />
er sich ins Netz begibt, klagen<br />
Datenschützer, kommt darin<br />
um. Ganz so schlimm ist es Ruprecht<br />
Polenz nicht ergangen, aber eine blutige<br />
Nase hat er sich schon geholt. Und<br />
das ging so: Der Vorsitzende des Auswärtigen<br />
Ausschusses im Bundestag ist ein reger<br />
Nutzer sozialer Netzwerke. Besonders<br />
heiß her geht es auf seiner Facebookseite,<br />
wenn das Thema Nahost und das Zusammenleben<br />
von Israelis und Palästinensern<br />
behandelt wird. In den vergangenen Jahren<br />
tat sich dabei die Lyrikerin Irena Wachendorff<br />
aus Remagen mit Engagement<br />
für einen arabisch-jüdischen Kindergarten<br />
und heftiger Israelkritik hervor. Einsprüche<br />
hebelte sie bevorzugt mit Hinweisen<br />
auf ihre Biografie aus: Ihr Vater sei „orthodoxer<br />
Jude“, der per Kindertransport<br />
aus Deutschland geflohen sei. Ihre Mutter<br />
habe Auschwitz überlebt und sei zuvor<br />
vom Kreisauer Kreis versteckt worden. Je<br />
verbissener ihre Israelkritik, desto doller die<br />
biografischen Details: Schließlich wollte sie<br />
sogar ihren Militärdienst in Israel abgeleistet<br />
haben. Wem das nicht ganz koscher war,<br />
der wurde von Polenz, einem Unterstützer<br />
des von Wachendorff angeblich geförderten<br />
Kindergartens, auf der Facebookseite<br />
„entfreundet“. Nun stellt sich heraus: Polenz’<br />
Schützling ist eine eingebildete Jüdin,<br />
deren Vater bei der Wehrmacht war und<br />
deren Mutter ganz gewiss nicht Auschwitz –<br />
oder sonst ein Lager – überlebte. Und Polenz?<br />
Wütete zunächst gegen die Journalistin<br />
Nathalie Pyka, die die Geschichte<br />
aufgedeckt hatte („Man kann doch keinen<br />
umgekehrten Ariernachweis verlangen“)<br />
– und kommt nun doch langsam ins<br />
Grübeln. Parteifreunden gegenüber gab er<br />
sich zerknirscht. Da sei er doch glatt „einer<br />
Betrügerin“ aufgesessen. Einer Betrügerin,<br />
deren unverschämte Lügen man durchaus<br />
früher hätte erkennen können. jh<br />
ein gerücht geht um:<br />
koalition wieder groSS?<br />
I<br />
n Berlin geistert etwas herum namens<br />
Große Koalition. Es ist ein<br />
Gerücht, aber ein plausibles Gerücht,<br />
und es geisterte schon, bevor sich<br />
Horst Seehofer öffentlich darüber ausließ,<br />
dass es auch eine Abstimmung zur Eurorettung<br />
geben könnte, bei der die CSU ausschert.<br />
Nein, nein, nein, wiegelte er gleich<br />
wieder ab: Das wolle er natürlich nicht<br />
als drohenden Koalitionsbruch verstanden<br />
wissen. (Als was aber sonst?) Danach<br />
wurde das Gespenst noch größer, das Gerücht<br />
noch plausibler. Was ist, wenn Folgendes<br />
passiert: Zu den notorischen Abweichlern<br />
in der CDU und in der FDP<br />
läuft eines Tages die komplette CSU-Landesgruppe<br />
über? Muss dann die SPD nicht<br />
mindestens eine informelle Große Koalition<br />
eingehen und Kanzlerin Angela Merkel<br />
in ihrer Politik bis zum Ende dieser Legislaturperiode<br />
unterstützen?<br />
Der SPD-Altmeister Franz Müntefering<br />
hat unlängst schon in einem viel beachteten<br />
Auftritt in der Bundestagsfraktion<br />
seinen Genossen den Weg in diese Richtung<br />
gewiesen, jetzt legt er im <strong>Cicero</strong>-Interview<br />
nach: „Es gibt im Moment ein Ziel,<br />
dem sich alle demokratischen Parteien in<br />
Deutschland verpflichtet fühlen sollten:<br />
Europa muss jetzt gelingen. Und dafür<br />
muss man sich einsetzen, dafür müssen<br />
sich gerade die Sozialdemokraten einsetzen.“<br />
(Seite 28) Übersetzt heißt das: Kocht<br />
keine parteipolitischen Süppchen auf Europa,<br />
erliegt nicht der Versuchung, für den<br />
Bundestagswahlkampf Kapital aus diesem<br />
Thema zu schlagen – Kapital auf Kosten<br />
des EU-Bündnisses.<br />
Was aber hieße eine Große Koalition<br />
der europäischen Vernunft für die Bundestagswahlen<br />
2013 und vor allem: Was bedeutet<br />
das für die <strong>Zeit</strong> danach? Wieder eine<br />
Große Koalition? Die SPD hat die letzte<br />
noch in traumatischer Erinnerung – nicht,<br />
weil man nicht klargekommen wäre miteinander,<br />
sondern weil die Sozialdemokraten<br />
mit knapp 24 Prozent daraus hervorgingen.<br />
Kürzlich gab es nun eine Art großkoalitionäres<br />
Wetterleuchten. Da flogen die<br />
Fraktionschefs Volker Kauder (CDU) und<br />
Frank-Walter Steinmeier (SPD) gemeinsam<br />
zu einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident<br />
José Manuel Barroso nach Brüssel.<br />
Es war klar, dass die SPD bei aller Kritik im<br />
Detail im Bundestag wieder mehrheitlich<br />
die Hand für Merkel heben – und so deren<br />
Mehrheit sichern würde. Da sehe man<br />
doch mal, „unter der klugen Führung der<br />
Koalition kann man sogar mit euch Sozen<br />
was zusammenmachen“, flachste Kauder.<br />
Er ist ein Mann, der in der Großen Koalition<br />
Leute wie Steinmeier und den damaligen<br />
SPD-Fraktionschef Peter Struck schätzen<br />
gelernt hat. Und für einen Augenblick<br />
hatte es den Anschein, als denke er den eigenen<br />
Gedanken zu Ende – in Richtung<br />
Große Koalition. Aber Steinmeier, der damalige<br />
SPD-Kanzlerkandidat mit den<br />
24 Prozent, lachte und sagte gleich: „Machen<br />
wir aber nicht mehr.“ Darauf beendete<br />
Kauder das Geplänkel: „Wir ja auch<br />
nicht!“ Mal sehen. swn<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
12 <strong>Cicero</strong> 8.2012
BEWEIST<br />
STROM-<br />
STÄRKE<br />
DER NEUE RX 450h VOLLHYBRID<br />
Erleben Sie einen faszinierenden Premium-SUV, der seine Stärken auf jedem Terrain<br />
eindrucksvoll unter Beweis stellt: den neuen Lexus RX 450h. Die innovative Vollhybrid-<br />
Technologie verbindet souveräne Fahrdynamik mit klassenbesten Verbrauchs- und<br />
Emissionswerten. Bei beeindruckenden 220 kW (299 PS) und einer Beschleunigung von<br />
0 auf 100 km/h in 7,8 Sekunden verbraucht der RX 450h lediglich 6,3 l/100 km* – und ist<br />
auch damit Klassenbester. Freuen Sie sich auf unverwechselbares Design und wegweisende<br />
Technologie im neuen RX 450h – bei einer einmaligen Probefahrt in Ihrem Lexus Forum!<br />
SIND SIE BEREIT?<br />
*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert 6,3 (innerorts 6,5/außerorts 6,0), CO 2 -Emissionen in g/km kombiniert 145 nach dem vorgeschriebenen<br />
EU-Messverfahren. Rein elektrisch fahren bis zu 4 km und mit bis zu 65 km/h. Maximale Gesamtreichweite einer Tankfüllung:<br />
bis zu 1.083 km, Systemleistung: 220 kW (299 PS). Abb. zeigt RX 450h F Sport.
Verschenken Sie eine <strong>Cicero</strong>-Ausgabe!<br />
Feiern Sie mit <strong>Cicero</strong> die 100. Ausgabe und lassen Sie Ihre besten Freunde<br />
oder guten Bekannten kostenlos in den Genuss einer <strong>Cicero</strong>-Ausgabe kommen.<br />
Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir:<br />
Mark Siegmann<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
Tel.: 030 981 941-147<br />
siegmann@cicero.de
T i t e l<br />
In der<br />
<strong>Zeit</strong>falle<br />
E-Mails, SMS, Internet oder Smartphones: Wir leben<br />
unser Leben in einer Aufregung, die unsere Vorfahren<br />
nur aus der Schlacht kannten – und mit der unser<br />
Gehirn auf Dauer nicht zurechtkommt. Die üblichen<br />
Rezepte der <strong>Zeit</strong>planung helfen da nicht weiter, und<br />
Multitasking ist ohnehin eine Legende. Dennoch sind wir<br />
den ständigen Ablenkungen nicht hilflos ausgeliefert<br />
Von Stefan Klein<br />
„Alles ist jetzt ultra. (…) Niemand<br />
kennt sich mehr, niemand begreift das<br />
Element, worin er schwebt und wirkt. (…)<br />
Junge Leute werden (…) im <strong>Zeit</strong>strudel<br />
fortgerissen; Reichtum und Schnelligkeit ist<br />
es, was die Welt bewundert und wonach<br />
jeder strebt. Alle möglichen Erleichterungen<br />
der Kommunikation sind es, worauf<br />
die gebildete Welt ausgeht, sich zu<br />
überbieten …“<br />
Anscheinend leidet der Autor dieser Zeilen<br />
unter dem Dauerbombardement durch<br />
E-Mails; vielleicht wird er auch von einer<br />
jener entsetzlichen Telefonanlagen traktiert,<br />
die mitten im Gespräch mit Piepen bereits<br />
den nächsten Anruf ankündigen. Oder<br />
sein Twitter-Account quillt über, der Kopf<br />
schwirrt ihm, weil er mit seinen Kindern<br />
ein paar der aberwitzigen Clips auf Youtube<br />
ansehen musste? Nichts dergleichen:<br />
Der Schreiber ist Johann Wolfgang von<br />
Goethe. In einem Brief an seinen Freund,<br />
den Komponisten Zelter, beklagt er sich<br />
außerdem über „Eisenbahnen, Schnellposten<br />
und Dampfschiffe“. Das war 1825.<br />
Seitdem ist das Reisen hundert Mal<br />
und die Kommunikation zehn Millionen<br />
Foto: Zoonar<br />
16 <strong>Cicero</strong> 8.2012
8.2012 <strong>Cicero</strong> 17
T i t e l<br />
Mal schneller geworden. Der Brief, der zu<br />
Zelter nach Berlin mehr als eine Woche<br />
brauchte, wäre heute als E-Mail in Sekunden<br />
am Ziel. Nach Italien zu reisen, ist eine<br />
Angelegenheit von ein paar Stunden. Und<br />
selbst in Weimar hält der ICE.<br />
Wenn schon Goethe sich über zu viel<br />
Tempo beklagte – haben wir dann nicht<br />
erst recht allen Grund dazu? Jedenfalls<br />
spricht der Dichter den meisten Deutschen<br />
aus der Seele: 67 Prozent der Mitbürger<br />
empfinden die „ständige Hektik und Unruhe“<br />
als den größten Auslöser von Stress.<br />
Wie sehr sich das Lebenstempo gerade in<br />
den vergangenen Jahren beschleunigt hat,<br />
lässt sich am besten an den vermeintlich<br />
kleinen Dingen des Alltags ablesen: Fotokopierer<br />
mit einem Ausstoß von 30 Blatt<br />
pro Minute; Internetanbieter, die Sie mit<br />
neuen Anschlüssen locken, bei denen sich<br />
die Seiten um ein paar Zehntelsekunden<br />
schneller aufbauen; Kaffee „To Go“.<br />
Jeder etwas ältere Film im Fernsehen<br />
führt uns vor Augen, in welchem Maß<br />
nicht nur unser Lebenswandel, sondern<br />
selbst die Wahrnehmung einen Zahn<br />
zugelegt hat. Die kühnen Schnitte von<br />
Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker<br />
„2001 – Odyssee im Weltraum“ beanspruchten<br />
bei seinem Erscheinen im<br />
Jahr 1968 die Sehgewohnheiten der Kinogänger<br />
bis an ihre Grenzen. Heute verlieren<br />
wir bei denselben Einstellungen, in<br />
denen die Raumschiffe zu klassischer Musik<br />
durchs Weltall gleiten, fast die Geduld.<br />
Als vor einigen Jahren einige Folgen des<br />
1965 gedrehten Fernsehklassikers „Raumpatrouille<br />
Orion“ neu für das Kino zusammengeschnitten<br />
wurden, beschleunigten<br />
die Produzenten denn auch die Geschwindigkeit,<br />
mit der die Orion von ihrer Heimatbasis<br />
abhebt, um fast das Doppelte.<br />
Kaum einem alten Fan der Kultserie fiel<br />
es auf. Wir finden inzwischen ein höheres<br />
Tempo normal.<br />
Der Preis, den wir zahlen, ist das Gefühl,<br />
ständig außer Atem zu sein. Noch ein<br />
paar Zahlen über die <strong>Zeit</strong>, in der wir leben:<br />
Auf die Frage, ob sie sich oft oder immer<br />
gehetzt fühlten, antworteten mehr als ein<br />
Viertel der Deutschen mit Ja. Noch größer<br />
und ständig wachsend ist das Heer der<br />
Angestellten, die sich über ein hohes Arbeitstempo<br />
beschweren. Und die Befragten<br />
sind sich einig darüber, dass Hektik krank<br />
macht. Von den Gehetzten klagten fast<br />
doppelt so viele über Rückenschmerzen,<br />
67 Prozent<br />
der Mitbürger<br />
empfinden<br />
die „ständige<br />
Hektik und<br />
Unruhe“ als<br />
den größten<br />
Auslöser von<br />
Stress<br />
Verspannungen an Schultern und Nacken,<br />
Verletzungen und ganz allgemein Stress als<br />
Beschäftigte, die ihre Arbeit gemächlich genug<br />
fanden.<br />
Wir kennen das Gefühl der <strong>Zeit</strong>not so<br />
sattsam, dass wir darüber ganz vergessen<br />
haben, wie merkwürdig es ist. Schließlich<br />
sind wir reicher an <strong>Zeit</strong>, als es Menschen je<br />
waren – und verfügen über eine nie da gewesene<br />
Freiheit, sie zu gestalten. Die Kombination<br />
aus Zwölfstundentag und Sechstagewoche,<br />
einst die übliche Arbeitszeit,<br />
ist heute die Ausnahme. Vor allem aber<br />
hat sich während der vergangenen hundert<br />
Jahre die Lebenserwartung beinahe<br />
verdoppelt. Wir hätten also eigentlich allen<br />
Grund, uns zu entspannen. Stattdessen<br />
fühlen wir uns gejagt.<br />
Wo bleibt all die gewonnene <strong>Zeit</strong>? Acht<br />
Stunden und 18 Minuten verschläft der<br />
erwachsene Deutsche. Eine Stunde und<br />
33 Minuten lang isst er. 47 Minuten am<br />
Tag weilt er hinter den geschlossenen Türen<br />
von Bad und Toilette. Frauen schlafen im<br />
Durchschnitt vier, essen drei und pflegen<br />
sich acht Minuten länger als Männer. Männer<br />
opfern zwei Stunden und neun Minuten,<br />
Frauen drei Stunden 49 Minuten des<br />
Tages dem Haushalt. Davon entfallen bei<br />
den Frauen 20 Minuten täglich auf Wäschepflege.<br />
Die entsprechende Zahl bei den<br />
Männern ist statistisch nicht nachweisbar.<br />
Um diese Erkenntnisse zu gewinnen,<br />
hat das Statistische Bundesamt einigen<br />
Aufwand getrieben. Alle zehn Jahre bekommen<br />
mehr als 12 000 Menschen im ganzen<br />
Land ein Tagebuch in die Hand und<br />
müssen im Zehn-Minuten-Rhythmus notieren,<br />
was sie tun. Das Ergebnis präsentiert<br />
sich als ein gar nicht so unerfreulicher<br />
Alltag in Deutschland. Jede und jeder im<br />
Land verfügt im Schnitt über 42 Stunden<br />
Freizeit pro Woche, mehr Muße haben in<br />
Europa einzig die Finnen. Und wir wissen<br />
durchaus mit diesem Gut umzugehen.<br />
Fast 15 Stunden pro Woche widmen die<br />
Deutschen Freunden und Vergnügungen<br />
wie Kino, Theater und Stadion. Selbst für<br />
das Essen lassen wir uns heute 21 Minuten<br />
täglich mehr <strong>Zeit</strong> als noch vor zehn Jahren.<br />
Man könnte fast glauben, die Deutschen<br />
seien am Ende gar auf dem Weg, das Genießen<br />
zu lernen – wären da nur nicht die<br />
Stimmen von immer mehr Menschen zu<br />
hören, die über Stress klagen.<br />
Zweifellos sind Muße und Hetze ungleich<br />
verteilt. Berufstätige Mütter kleiner<br />
Kinder etwa, erst recht Alleinerziehende,<br />
haben in Deutschland tatsächlich mehr<br />
Aufgaben, als sie vernünftigerweise an einem<br />
Tag bewältigen können. Aber für die<br />
meisten, die sich gehetzt fühlen, trifft das<br />
nicht zu. Die Statistiken über den objektiven<br />
und den gefühlten Mangel an <strong>Zeit</strong> sind<br />
denn auch ein Sammelsurium an Merkwürdigkeiten.<br />
Deutsche Rentner beispielsweise<br />
fühlen sich schon dann unerträglich<br />
gestresst, wenn fünf ihrer 24 Stunden verplant<br />
sind; Landwirtinnen hingegen beschweren<br />
sich erst, wenn sie elf Stunden<br />
täglich eingespannt sind. Und wie ist zu<br />
erklären, dass Menschen bei gleicher Arbeitsbelastung<br />
umso größere <strong>Zeit</strong>not empfinden,<br />
je mehr sie verdienen?<br />
Vielleicht bringt uns eine kleine <strong>Zeit</strong>reise<br />
ins Weimar jener Epoche, die Goethe<br />
so hektisch vorkam, dem Phänomen näher.<br />
Die Menschen auf der Straße bewegen sich<br />
mit geradezu aufreizender Langsamkeit –<br />
in ungefähr dem halben Tempo, das Sie<br />
gewohnt sind. Wenn Sie das noch nicht<br />
ungeduldig macht, dann genügt ein Besuch<br />
beim Bäcker: Bis Sie Ihre Brötchen bekommen,<br />
sind eine Viertelstunde und zwei<br />
Schwätzchen mit anderen Kunden vergangen.<br />
Sie wären tagelang mit öden Aufgaben<br />
beschäftigt, etwa mit der Hand Texte abzuschreiben,<br />
Rechnungen auf dem Papier anzustellen,<br />
Wäsche zu waschen. Die Abende<br />
bei Kerzenlicht und ohne Zerstreuung erscheinen<br />
Ihnen unendlich. Und wenn Sie<br />
Fotos: Alan Ginsburg/ Jahreszeiten-Verlag (Foto und Zitat aus dem Buch von Stefanie von Wietersheim und Claudia von Boch: Frauen & ihre Refugien/Callwey-Verlag/EUR 29,95), Tine Acke<br />
18 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Auszeit vom Alltag<br />
Gegen die wachsende Hektik hilft oft nur der strategische Rückzug. <strong>Cicero</strong> hat Prominente<br />
gefragt, wohin sie abtauchen, wenn sie einmal ganz bei sich selbst sein wollen<br />
Schauspielerin<br />
Senta Berger:<br />
„Ich wandere in<br />
meinem Haus von<br />
einem Refugium<br />
zum nächsten. Da,<br />
wo ich meinen<br />
Reiseschreibtisch<br />
aufklappe, ist<br />
mein Zimmer“<br />
Hinterm Horizont<br />
geht’s weiter: Wenn<br />
es ihm an Land<br />
zu viel wird, geht<br />
Udo Lindenberg<br />
an Bord. Mehrmals<br />
im Jahr mietet<br />
sich der Sänger auf<br />
Kreuzfahrtschiffen ein<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 19
T i t e l<br />
eine kleine Unterbrechung von so viel Einförmigkeit<br />
suchen, hätten Sie schon bald<br />
nach den ersten Ausläufern des Thüringer<br />
Waldes Ihren Aktionsradius erreicht. Die<br />
Gelegenheit, darüber hinauszublicken, bekommen<br />
Sie selbst als gut situierter Bürger<br />
höchstens ein- oder zweimal im Jahr. So sehen<br />
Sie nichts als tagaus, tagein dieselben<br />
Mauern, dieselben Gesichter.<br />
Wollen Sie schon mit der <strong>Zeit</strong>maschine<br />
die Rückreise in Ihren hektischen Alltag antreten?<br />
Widerstehen Sie dieser Versuchung,<br />
dann werden Sie nach einer Weile subtile<br />
Veränderungen Ihrer Wahrnehmung bemerken.<br />
Die Gerüche verschiedener Phasen des<br />
Frühlings im Wald werden Ihnen vertraut.<br />
Sie nehmen wahr, wie sich die Gesichtszüge<br />
Ihrer Mitmenschen verändern, und lernen<br />
die hohe Kunst der geistreichen Konversation.<br />
Während sich Ihr Ausdruckswille in<br />
Ihrem früheren Leben in kaum mehr als ein<br />
paar E-Mail-Kürzeln erschöpfte ;-) , beginnen<br />
Sie nun, in sorgsam formulierten Briefen<br />
und in gestochener Handschrift über<br />
Ihre Gefühle Rechenschaft abzulegen – keiner<br />
ist mehr darüber erstaunt als Sie selbst.<br />
Einige Gedichte haben Sie so oft gelesen,<br />
dass Sie die Verse ganz von allein auswendig<br />
lernten. Sogar die Lebensgeschichte Ihres<br />
Bäckers wird Ihnen geläufig. Und seine<br />
von Hand gefertigten Brötchen verströmen<br />
einen intensiven Duft, von dem Ihre Lieben<br />
daheim im 21. Jahrhundert noch nicht<br />
einmal ahnen.<br />
In der Vergangenheit, in der Sie sich herumtreiben,<br />
ist Abwechslung kostbar. Weil<br />
Sie nicht viel erleben, beschäftigen Sie sich<br />
umso intensiver mit den Reizen, die Sie<br />
wahrnehmen. Ausgehungert nach Zerstreuung,<br />
empfinden Sie selbst einen Jahrmarkt<br />
als ein Ereignis, das eine mühsame<br />
Anreise lohnt.<br />
Uns heutige Menschen dagegen erreicht<br />
so viel Stimulation, wie wir wollen.<br />
Der Jahrmarkt findet jeden Abend im Fernsehen<br />
statt; in einer einzigen Stunde vor<br />
dem Bildschirm bekommen wir mehr als<br />
tausend Einstellungen zu sehen. Fernreisen,<br />
Musik auf Knopfdruck, ausgefallene<br />
Speisen – in einem einzigen Jahr sammeln<br />
wir mehr Eindrücke als Goethes <strong>Zeit</strong>genossen<br />
in einem ganzen Leben. Soziologen<br />
nennen dies die „Ereignisgesellschaft“:<br />
Sinnesreize gibt es in beliebiger Menge sofort.<br />
Nur fehlt uns die <strong>Zeit</strong>, sie zu genießen.<br />
Denn das Gehirn kann Information<br />
nicht beliebig schnell verarbeiten. Darum<br />
ist Aufmerksamkeit ein knappes Gut. Erreicht<br />
uns ein Reiz, während wir mit etwas<br />
anderem beschäftigt sind, können wir<br />
uns ihm zuwenden, dann aber bleibt der<br />
erste Vorgang im Kopf unvollendet. Oder<br />
aber wir blocken die Neuigkeit ab. In jedem<br />
Fall verzichten wir auf einen großen<br />
Teil der eigentlich verfügbaren Information.<br />
Das wäre nicht weiter schlimm, wenn es<br />
uns gelänge, sinnvoll auszuwählen. Fatalerweise<br />
aber funktionieren die nötigen Filter<br />
schlecht – zu schlecht für unsere moderne<br />
Umgebung.<br />
Versuchen Sie einmal, nicht auf einen<br />
der Monitore zu achten, über die in<br />
Bahnen und Bussen Werbung flimmert.<br />
In einem<br />
einzigen Jahr<br />
sammeln<br />
wir mehr<br />
Eindrücke<br />
als Goethes<br />
<strong>Zeit</strong>genossen in<br />
einem ganzen<br />
Leben<br />
Noch schwerer fällt es, sich vom laufenden<br />
Fernseher oder gar von einem spannenden<br />
Computerspiel loszureißen. Als ginge<br />
von den Bildschirmen eine bannende Kraft<br />
aus, gelingt es uns nicht, einfach den Ausknopf<br />
zu drücken, obwohl wir es eigentlich<br />
wollen.<br />
Ein Gegenstück im Büro sind die ständig<br />
hereintröpfelnden E-Mails. Natürlich<br />
ist jedem klar, dass erstens Outlook und Co<br />
<strong>Zeit</strong>räuber sind, die uns unablässig daran<br />
hindern, eine Sache ungestört zu Ende zu<br />
führen, und dass zweitens nur die wenigsten<br />
Mails einer umgehenden Antwort bedürfen.<br />
Und doch kostet es größte Überwindung,<br />
das E-Mail-Programm einfach zu<br />
beenden und dann auch abgeschaltet zu<br />
lassen. Denn als das Netz in die Haushalte<br />
einzog, wurden die Menschen nach dem<br />
neuen Medium süchtig. Eine Untersuchung<br />
der inzwischen untergegangenen Internetfirma<br />
AOL berichtet aus diesen Tagen:<br />
Schon in den späten neunziger Jahren<br />
verbrachten drei Viertel aller Amerikaner<br />
mehr als eine Stunde mit ihrer elektronischen<br />
Post. 41 Prozent der Befragten riefen<br />
morgens noch vor dem Zähneputzen<br />
zum ersten Mal ihre Mails ab, ebenso viele<br />
gaben zu, sogar nachts schon einmal extra<br />
aufgestanden zu sein, nur um am Computer<br />
das Postfach zu prüfen. 4 Prozent taten<br />
es selbst dann, wenn sie, mit Laptop ausgerüstet,<br />
auf der Toilette saßen. Seit in jeder<br />
Hosentasche ein Smartphone steckt, dürften<br />
sich sehr viel mehr Menschen das angewöhnt<br />
haben.<br />
Liegt es daran, dass es Menschen unmöglich<br />
ist, ständiger Ablenkung zu entsagen?<br />
Die genetische Programmierung unseres<br />
Gehirns entstand in einer <strong>Zeit</strong>, in der<br />
neue Reize rar waren und, wenn sie doch<br />
auftraten, eine möglicherweise lebenswichtige<br />
Bedeutung hatten. Was sich in unserer<br />
Umgebung verändert, weckt die Aufmerksamkeit,<br />
ob wir es wollen oder nicht. Automatisch<br />
wird der Blick dorthin gezogen.<br />
So mögen wir heute vor dem Computer<br />
durchaus wissen, wie belanglos die meisten<br />
per E-Mail eintreffenden Botschaften<br />
sind – wir stürzen uns dennoch mit derselben<br />
Intensität darauf, mit der einst ein Savannenbewohner<br />
die Ohren spitzte, wenn<br />
er ein Rascheln im Laubwerk vernahm.<br />
Diese Reaktionen sind einem eigenen<br />
Netzwerk von Nervenzellen zu verdanken.<br />
Es geht von einem bläulichen Kern namens<br />
Locus coeruleus im Hirnstamm aus (coeruleus<br />
ist lateinisch für „blau“). Von dort<br />
zieht sich das Geflecht der Neuronen nach<br />
unten und oben – einerseits ins Rückenmark,<br />
andererseits ins Stirnhirn und in tiefere<br />
Hirnzentren, welche Emotionen auslösen.<br />
Sobald ein bemerkenswerter Reiz<br />
eintrifft, setzt der blaue Kern automatisch<br />
den Botenstoff Noradrenalin frei. Diese<br />
Substanz ist eng verwandt mit dem besser<br />
bekannten Stresshormon Adrenalin. Noradrenalin<br />
sorgt dafür, dass der Blutdruck<br />
steigt und der Pulsschlag etwas schneller<br />
wird – plötzlich fühlen Sie sich lebendig.<br />
In den höher gelegenen Zentren des Gehirns<br />
beschleunigen sich Wahrnehmung<br />
und Denken. Der Körper macht sich bereit<br />
zu reagieren, Gefühle melden sich. Wenn<br />
der Reiz nicht bedrohlich ist, gelangt nur<br />
Fotos: Claudia von Boch/Callwey-Verlag (Foto und Zitat aus dem Buch von Stefanie von Wietersheim und Claudia von Boch: Frauen & ihre Refugien/Callwey-Verlag/EUR 29,95), Karin Rocholl<br />
20 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Schauspielerin<br />
Nadja Uhl kaufte<br />
sich im Oktober<br />
2005 gemeinsam mit<br />
drei Freunden die<br />
Villa Gutmann in<br />
der Nauener Vorstadt<br />
bei Potsdam. Die<br />
Villa ist „meine Burg<br />
der Zuflucht“, sagt<br />
Uhl. „Sie hat so<br />
etwas Liebevolles“<br />
„Da steht eine Bank am See,<br />
und wären da nichts als eine Bank<br />
und ein sanft bewegter See, es sähe aus<br />
wie Harmonie. Da sitzt aber einer drauf<br />
auf der Bank, der sieht die tolle Photographin stehn,<br />
der er liefern soll den Dichter auf der Bank am See.<br />
Und schon krampft sich die Rechte ins Revers und<br />
die Linke klemmt zwischen den vierten und den fünften Finger<br />
die Bank, die, stünde sie allein am See,<br />
ein Bild ergäbe der reinen Harmonie“<br />
Martin Walser beantwortete die <strong>Cicero</strong>-Anfrage<br />
mit einem Gedicht<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 21
T i t e l<br />
„Mit spektakulären<br />
Plätzen kann ich leider<br />
nicht dienen. Soll<br />
ich meinen häufig<br />
kranken Mann allein<br />
lassen, um mal eben<br />
auf den Brocken<br />
zu fliegen? Und die<br />
vier Enkelkinder, die<br />
regelmäßig hier spielen,<br />
um ihre Apfelschorle<br />
und das Hefeteilchen<br />
betrügen, um über den<br />
Bodensee zu rudern?<br />
Es sieht vielmehr<br />
so aus: Ich sitze in<br />
unserem Garten unter<br />
einem Kirschbaum<br />
auf einer Bank, die<br />
ich dringend mal<br />
putzen müsste. Dort<br />
gerate ich durchaus in<br />
einen kontemplativen<br />
Zustand, wenn ich<br />
zum Beispiel Tiere<br />
beobachte – Amseln,<br />
die ihre Jungen<br />
füttern, Eichhörnchen,<br />
Bienen, Hummeln,<br />
Schmetterlinge,<br />
Nachbars Katze. Am<br />
liebsten belausche ich<br />
aber zwei sechsjährige<br />
Enkel, die Feuerwehr<br />
oder Agent spielen<br />
und sich gegenseitig<br />
über absurde<br />
Wichtigkeiten belehren“<br />
Ingrid Noll<br />
Schriftstellerin<br />
22 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Anzeige<br />
Foto: Andreas Reeg<br />
relativ wenig Noradrenalin in die Nervenbahnen<br />
– wohlige Anregung breitet sich<br />
aus, auch ein leichtes Kribbeln der Spannung.<br />
Nur wenn die Neuigkeit gefährlich<br />
erscheint, wird eine große Dosis Noradrenalin<br />
freigesetzt, sodass die Reaktion in<br />
Stress und Furcht umschlägt.<br />
Doch die wenigsten Anlässe im geordneten<br />
Alltag von heute geben Anlass zu<br />
Angst. Wir werden mit Reizen bombardiert,<br />
die ein bisschen aufregend, doch alles andere<br />
als bedrohlich sind. Vielmehr liegt in<br />
den meisten Ablenkungen sogar ein kleines<br />
Versprechen: Das Klingeln des Handys<br />
könnte den Anruf eines Freundes bedeuten;<br />
die E-Mail eine Einladung auf eine<br />
Party; und selbst die Bilder auf dem Werbemonitor<br />
in der U‐Bahn verheißen ein<br />
etwas besseres Leben.<br />
Da die Aufmerksamkeit sich selbst<br />
steuert, ist es schwer, solche Signale willentlich<br />
zu missachten. Aber vielleicht würden<br />
wir es auch gar nicht wollen. Ob ein<br />
unbekanntes Gesicht oder auch nur eine<br />
gerade eintreffende SMS – jede neue Information,<br />
die das Bewusstsein erreicht, bewirkt<br />
einen kleinen, schönen Flash. Der<br />
Effekt ist tatsächlich mit dem einer Droge<br />
vergleichbar; Substanzen wie Nikotin und<br />
vor allem Kokain wirken auf dieselben Nervenbahnen<br />
ein.<br />
Und mit jedem Reiz, der Aufmerksamkeit<br />
fordert, steigt das allgemeine Erregungsniveau.<br />
„Sie leben Ihr Leben in einer<br />
Aufregung, die Ihre Vorfahren nur in der<br />
Schlacht kannten“, schreibt der amerikanische<br />
Autor Mark Helprin. In einem Zustand<br />
ständiger Stimulation fühlen wir uns<br />
lebendig: Wir haben guten Grund, das verfluchte<br />
Tempo, in dem wir leben, zu lieben.<br />
Doch je mehr die Erregung zunimmt,<br />
umso schlechter können wir uns konzentrieren.<br />
Das vom blauen Kern ausgehende<br />
Neuronennetzwerk, das uns rege macht,<br />
kann nämlich die höheren Funktionen<br />
der Aufmerksamkeit hemmen: Es verhindert,<br />
dass wir Störungen ausblenden. Dann<br />
ist es kaum mehr möglich, zwischen wichtig<br />
und unwichtig zu unterscheiden; wahllos<br />
fliegt das Bewusstsein auf jeden neuen<br />
Reiz. Einst war eine solche Blockade höchst<br />
sinnvoll. Für den Steppenbewohner, der<br />
ein bedrohliches, unbekanntes Geräusch<br />
hört, wäre ein Filter der Wahrnehmung ein<br />
lebensgefährlicher Luxus. Er ist darauf angewiesen,<br />
dass jede neue Entwicklung im<br />
Gebüsch sofort sein Bewusstsein erreicht.<br />
Heute freilich wirkt die Selbstabschaltung<br />
der Filter fatal. Gerade diese Funktion<br />
der Aufmerksamkeit, die wir angesichts<br />
der Reizfülle am dringendsten bräuchten,<br />
bricht als erste zusammen. Die Filter<br />
der Wahrnehmung beginnen durchlässig<br />
zu werden, immer mehr Stimulation<br />
erreicht das Bewusstsein, immer häufiger<br />
springt die Aufmerksamkeit zum nächsten<br />
Signal. Dies erhöht nun erst recht die<br />
Erregung und schwächt die Filter – eine<br />
Abwärtsspirale.<br />
Die ganz normalen Folgen der Überflutung<br />
hat die kalifornische Arbeitswissenschaftlerin<br />
Gloria Mark dokumentiert. Sie<br />
zeichnete auf, wie oft Angestellte in Softwarefirmen<br />
von einer Tätigkeit zur nächsten<br />
wechselten, sich also beispielsweise von<br />
der Lektüre eines Schriftstücks abwandten,<br />
um ein wenig im Internet zu surfen. Dies<br />
war in der Regel 20 Mal pro Stunde und<br />
öfter der Fall: Den Mitarbeitern gelang es<br />
nicht, sich länger als durchschnittlich drei<br />
Minuten mit einer Angelegenheit zu befassen!<br />
Da hilft auch nicht der oft gegebene<br />
Rat, „Multitasking“ zu üben, weil das Gehirn<br />
zu jeder <strong>Zeit</strong> nur eine bewusste Tätigkeit<br />
ausführen kann. Wer trotzdem versucht,<br />
beim Telefonieren eine E-Mail zu<br />
beantworten, springt in Wirklichkeit mit<br />
seiner Aufmerksamkeit unablässig hin und<br />
her. Dabei vergeht in der Summe mehr<br />
<strong>Zeit</strong>, als wenn man beide Tätigkeiten nacheinander<br />
ausgeführt hätte, und es häufen<br />
sich Fehler.<br />
Je löcheriger die Filter der Aufmerksamkeit<br />
werden, umso weniger können<br />
wir den selbst gewählten Vorhaben folgen.<br />
Deswegen fällt es in einer Welt voller Reize<br />
so schwer, nach dem eigenen Rhythmus zu<br />
leben. Was ringsum geschieht, nötigt uns<br />
seinen Takt auf. Wir folgen den Ereignissen<br />
der Außenwelt wie ein dressiertes Hündchen<br />
der Glocke: Man saust den ganzen<br />
Tag von Termin zu Termin, bekommt einen<br />
Kick nach dem anderen. Fragt man<br />
sich allerdings abends, was eigentlich die<br />
Stunden von früh bis spät so sehr ausgefüllt<br />
hat, stellt sich ein schales Gefühl ein: <strong>Keine</strong>n<br />
einzigen Eindruck von nennenswerter<br />
Bedeutung hat man erlebt, sondern vor allem<br />
die Geschwindigkeit selbst.<br />
So ähnelt nicht nur das Hochgefühl,<br />
sondern auch der Nachgeschmack dem<br />
einer Droge. Rauschmittel versetzen das<br />
Gehirn auf chemischem Weg in einen<br />
Ausnahmezustand. Was genau ringsum<br />
Wolfram Weimer<br />
LAND UNTER<br />
Ein Pamphlet zur Lage der Nation<br />
96 Seiten / geb. mit Schutzumschlag<br />
€ 10,00 (D) / € 10,30 (A) / CHF* 14,90<br />
ISBN 978-3-579-066655-4<br />
Christian Wulff und Theodor zu<br />
Guttenberg – nur zwei Beispiele von<br />
vielen, deren mangelndes Unrechtsbewusstsein<br />
unser Vertrauen in die<br />
Politik und ihre Gesichter nachhaltig<br />
erschüttert hat. Wolfram Weimer zeigt,<br />
was in unserer Demokratie fehlt:<br />
Rückgrat beweisen und Haltung zeigen.<br />
Ein überzeugender Appell.<br />
*empf. Verkaufspr.<br />
GÜTERSLOHER<br />
VERLAGSHAUS<br />
www.gtvh.de<br />
www.aufbau-verlag.de<br />
Das neue Buch<br />
des großen<br />
Rebellen<br />
Hrsg. Roland Merk. ISBN 978-3-351-02758-2. € 10,00. Auch als E-Book<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 23
T i t e l<br />
Der Fotograf<br />
Jim Rakete hatte<br />
kürzlich die<br />
Gelegenheit, sich für<br />
ein paar Wochen in<br />
die Villa Massimo in<br />
Rom zurückzuziehen.<br />
„Urlaub ist das<br />
nicht“, schrieb er. „Ich<br />
arbeite hier, wie alle<br />
anderen auch, nur<br />
eben: in inspirierender<br />
Umgebung“<br />
Für den 86-jährigen<br />
Historiker Fritz<br />
Stern ist es immer<br />
noch die akademische<br />
Arbeit, bei der er<br />
sich am wohlsten<br />
fühlt. Wenn er nicht<br />
an seinem Institut<br />
an der Columbia<br />
University in New<br />
York forscht, zieht er<br />
sich in sein Haus in<br />
Princeton zurück<br />
24 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Fotos: <strong>Cicero</strong>, Kai Nedden, Sven Paustian (Autor)<br />
geschieht, wird uninteressant; es zählt nur<br />
noch die starke Empfindung. Ein Hochgeschwindigkeitstag<br />
wirkt so ähnlich.<br />
Und wie Süchtige haben wir nicht nur<br />
unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch,<br />
weit schlimmer, die Freiheit der Selbstkontrolle<br />
verloren. Diese Erfahrung macht uns<br />
heute zu schaffen – nicht etwa ein Mangel<br />
an verfügbarer <strong>Zeit</strong>, auch nicht die oft und<br />
schwammig beklagte Beschleunigung der<br />
Welt. Das Drama findet vielmehr in unseren<br />
Köpfen statt. Eine mit verheißungsvollen<br />
Angeboten überladene Umgebung<br />
stellt uns eine Aufgabe, für die wir nicht<br />
gemacht sind: Es gilt auszuwählen – und<br />
zu verzichten.<br />
Die üblichen Rezepte der <strong>Zeit</strong>planung<br />
greifen denn auch viel zu kurz: Gute Vorsätze<br />
sind machtlos gegen die automatische<br />
Steuerung der Aufmerksamkeit. Wer<br />
es neben sich knallen hört, wird aufsehen<br />
– ob es auf der To-do-Liste steht oder<br />
nicht. Und doch sind wir den Ablenkungen<br />
keineswegs ausgeliefert. Denn zum einen<br />
lässt sich die Konzentrationsfähigkeit<br />
wie ein Muskel trainieren. Zum anderen<br />
folgt die Aufmerksamkeit zwar selten unseren<br />
schönen Absichten, sehr wohl aber tieferen,<br />
oft verborgenen Motivationen. Diese<br />
Antriebe, einmal bewusst gemacht, wirken<br />
nämlich wie ein Gegengewicht zu den Verlockungen<br />
des Augenblicks. So stellen uns<br />
Smartphone und Co und die Explosion der<br />
Möglichkeiten in unserem Leben vor die<br />
überraschende Herausforderung, uns selbst<br />
kennenzulernen. Im Takt der sich vollziehenden<br />
technischen Revolution bestehen<br />
wird nur, wer um seine tiefsten Wünsche<br />
und Sehnsüchte weiß.<br />
Goethe übrigens kam mit der von<br />
ihm selbst bemängelten Schnelligkeit seiner<br />
Epoche bestens zurecht. In „Dichtung<br />
und Wahrheit“ bekennt er:<br />
„Da man immer <strong>Zeit</strong> genug hat, wenn<br />
man sie gut anwenden will, so gelang mir<br />
mitunter das Doppelte und Dreifache.“<br />
Denn: „Die <strong>Zeit</strong> ist unendlich lang und<br />
ein jeder Tag ein Gefäß, in das sich sehr<br />
viel eingießen lässt, wenn man es wirklich<br />
ausfüllen will.“<br />
Stefan Klein<br />
ist Wissenschaftsjournalist und<br />
Buchautor. Zuletzt erschien von<br />
ihm „Der Sinn des Gebens“<br />
Zehn Tipps zum Umgang mit <strong>Zeit</strong>not<br />
von Hartmut Rosa<br />
Die Momo-Erkenntnis: <strong>Zeit</strong>sparen ist nicht die Lösung. Befreien Sie sich von der<br />
Illusion, durch neue <strong>Zeit</strong>spartechniken Ihr <strong>Zeit</strong>problem zu überwinden. Dem Hamsterrad<br />
kann man nicht entkommen, man kann sich nur häuslich darin einrichten.<br />
Die Momo-Konsequenz: <strong>Zeit</strong> verschenken macht zeitreich! Wenn Sie einmal das<br />
Gefühl haben wollen, richtig viel <strong>Zeit</strong> zu haben, dann müssen Sie sie verschwenden!<br />
<strong>Zeit</strong>kontrolle und <strong>Zeit</strong>management sind nicht mehr zeitgemäSS. Der Versuch,<br />
mittels exakter <strong>Zeit</strong>- und Stundenpläne oder klarer Prioritätsordnungen das<br />
<strong>Zeit</strong>problem zu lösen, muss in einer hochdynamischen Umgebung notwendigerweise<br />
scheitern.<br />
Entwickeln Sie ein Gefühl für Verschiebungen und Resonanzen! Erwerben<br />
Sie eine Technik der Ad-hoc-Balancierung, die Ihrer beschleunigten Umwelt angemessen<br />
ist. Aber bedenken Sie: Wirkliche Innovationen in Wirtschaft, Wissenschaft,<br />
Kunst und Politik entstehen nur durch zähes, zeitresistentes Festhalten an einer<br />
Vision wider alle Kontingenzen.<br />
Sie verpassen Vieles und Wichtiges! Reden Sie sich gar nicht erst ein, dass Sie<br />
schon nichts Wichtiges verpassen werden unter den E-Mails, Anrufen und Kontaktanfragen.<br />
Akzeptieren Sie, dass sich da draußen viel ereignet, während Sie offline<br />
sind. Das ist nicht nur egal, sondern notwendig.<br />
Legen Sie sich auf eine prioritäre Kommunikationsform fest! Wählen Sie unter<br />
E-Mail, Facebook, SMS oder Voicemail einen Kommunikationsweg, durch den Sie<br />
regelmäßig zu erreichen sind und über den Sie immer antworten. Nennen Sie diesen<br />
Weg denen, die für Sie wichtig sind (Ehepartner, Sekretariat etc.). Dieser Kanal ist<br />
nicht nur Ihre am häufigsten benutzte, sondern Ihre wichtigste Weltverbindung.<br />
Der Schreibtisch muss voll sein! Die Strategie, den Schreibtisch oder das E-<br />
Mail-Fach abzuarbeiten, bevor Sie nach Hause gehen und bevor Sie mit dem Wichtigen<br />
anfangen, muss scheitern. Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Aufgabenberge<br />
schneller wachsen, als Sie sie abarbeiten können. Problematisch wird es erst, wenn<br />
es andersherum ist. Akzeptieren Sie dieses Verhältnis!<br />
Entwickeln und pflegen Sie ihre Monotaskingfähigkeit! Die Idee, dass man<br />
mehr schafft, wenn man sich um mehrere Sachen gleichzeitig kümmert, ist wissenschaftlich<br />
widerlegt. Multitasking ist ein Mythos.<br />
Schaffen Sie sich Entschleunigungsoasen! Tragen Sie „nichts“ in den Kalender<br />
ein, und stellen Sie sicher, dass Sie das dann auch tun! Erklären Sie ein paar Routinen<br />
für sakrosankt: Zum Beispiel können Sie zwischen Weihnachten und Neujahr<br />
grundsätzlich für niemanden zu sprechen sein, am Freitag immer zum Volleyball<br />
gehen oder sonntags, egal was dazwischenkommt, den „Tatort“ schauen.<br />
Steigen Sie nicht als schuldiges Subjekt ins Bett! Ontologisieren Sie Ihr Leiden<br />
nicht. An die Stelle der Beichte kann die Soziologie treten: Nicht Sie sind schuld,<br />
sondern die Strukturen!<br />
Hartmut Rosa ist Professor für Soziologie an der Universität Jena und Autor des<br />
Buches „Beschleunigung. Die Veränderung der <strong>Zeit</strong>strukturen in der Moderne“ (Suhrkamp)<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 25
T i t e l<br />
Die knappste Ressource der Welt<br />
Eine Sache von zeitloser<br />
Schönheit<br />
Ein Buch,<br />
in dem man viel über<br />
<strong>Zeit</strong> lernen kann<br />
Ein Ort, an dem<br />
man mehr <strong>Zeit</strong> hat<br />
als anderswo<br />
Ein Augenblick,<br />
in dem die <strong>Zeit</strong> stehen<br />
zu bleiben scheint<br />
Til Knipper<br />
Abstract City – der Blog<br />
von Christoph Niemann auf<br />
NYTimes.com<br />
Marc Fischer: „Die Sache<br />
mit dem Ich“ – in jeder<br />
von Fischers Reportagen<br />
erfährt man, dass sich<br />
besondere Situationen,<br />
Begegnungen und<br />
Zufälle nur dann<br />
ergeben, wenn man sich<br />
<strong>Zeit</strong> nimmt<br />
Alexander Marguier Die Natur Thomas Mann:<br />
„Der Zauberberg“<br />
In Monatsmagazin-<br />
Redaktionen<br />
In der Kindheit<br />
Bei Hochzeitsreden<br />
von Trauzeuginnen –<br />
niemanden interessiert,<br />
was du und die Braut<br />
auf eurer Weltreise<br />
nach dem Abitur erlebt<br />
habt; nicht mal die<br />
Braut, denn die war<br />
dabei<br />
Verkehrsunfall kurz<br />
bevor es kracht<br />
Judith Hart<br />
Marilyn Monroe, weil sie<br />
niemals aufhören wird, unsere<br />
Fantasie anzuregen<br />
Stefan Zweig:<br />
„Schachnovelle“ – weil<br />
sie ein Paradebeispiel<br />
dafür ist, dass der<br />
menschliche Wille <strong>Zeit</strong><br />
und Raum überwinden<br />
kann<br />
In der Badewanne<br />
Der Tod eines nahe<br />
stehenden Menschen<br />
Hartmut Palmer<br />
Die Matthäus-Passion von<br />
Johann Sebastian Bach<br />
Thomas Mann:<br />
„Joseph und seine<br />
Brüder“<br />
Der Friedhof – getreu<br />
dem Motto, das auch der<br />
Titel eines wunderbaren<br />
Films ist: „Wer früher<br />
stirbt, ist länger tot“<br />
Beim Betrachten<br />
eines klaren<br />
Sternenhimmels – weil<br />
einen dabei die Frage<br />
beschäftigt, ob es den<br />
Stern, dessen Licht<br />
man sieht, überhaupt<br />
noch gibt<br />
Christoph<br />
Schwennicke<br />
Eine Wanderung durch<br />
die Hardangervidda in<br />
Norwegen – endlos weit,<br />
endlos erhaben<br />
Lemmy Kilmister: „White<br />
Line Fever“ – das Carpe<br />
diem eines lebensklugen<br />
Mannes<br />
Im Zug auf langen<br />
Bahnfahrten. Bedingung:<br />
allein und ohne<br />
Umsteigen<br />
Die Geburt des eigenen<br />
Kindes<br />
Daniel Schreiber<br />
Michael Naumann<br />
Der „Lepanto-Zyklus“ von<br />
Cy Twombly – Abstraktion,<br />
die zu Tränen rührt; zu sehen<br />
im Münchener Museum<br />
Brandhorst<br />
Die amerikanische<br />
Unabhängigkeitserklärung<br />
Die Erzählungen<br />
der kanadischen<br />
Schriftstellerin Alice<br />
Munro, weil sie zeigen,<br />
dass es im Leben immer<br />
auch ein Danach gibt<br />
Marcel Proust:<br />
„Auf der Suche nach der<br />
verlorenen <strong>Zeit</strong>“<br />
Yoga-Matte und<br />
Psychoanalyse-Sofa: An<br />
beiden Orten kommt man<br />
in Berührung mit seiner<br />
inneren <strong>Zeit</strong><br />
Auf jedem Friedhof<br />
Frank A. Meyer <strong>Zeit</strong> Bibel Kirche Abschied<br />
Der Moment, in dem<br />
man zum ersten Mal<br />
bemerkt, dass man<br />
schon einige graue<br />
Haare an den Schläfen<br />
hat<br />
Als ich zum ersten Mal<br />
vom Zwölf-Meter-Turm<br />
des Schwimmbads in<br />
Köln-Müngersdorf in<br />
den Abgrund schaute<br />
26 <strong>Cicero</strong> 8.2012
In dieser Tabelle offenbaren die Kollegen aus der Redaktion, wie sie ihre <strong>Zeit</strong> sinnvoll<br />
oder lustvoll sinnlos verbringen. Eine kleine Handreichung zum <strong>Zeit</strong>totschlagen<br />
Eine besonders<br />
schöne<br />
<strong>Zeit</strong>verschwendung<br />
Ein Popsong,<br />
der erstaunlich<br />
zeit resistent ist<br />
Eine <strong>Zeit</strong>investition,<br />
die sich lohnt<br />
Ein besonders<br />
großer <strong>Zeit</strong>killer<br />
Schwimmen – als<br />
Fortbewegungsart zu langsam<br />
und wahnsinnig anstrengend,<br />
wenn man es nicht kann. Fühle<br />
mich danach aber trotzdem<br />
immer gut<br />
Al Bano & Romina Power:<br />
„Felicità“ – bei Lichte<br />
betrachtet gar nicht so<br />
erstaunlich, weil schon die<br />
Namen der Interpreten so stark<br />
sind und das Lied sehr gute<br />
Laune macht<br />
Zahnseide benutzen – sagt<br />
mein Zahnarzt<br />
„Spiegel-Online“ – nicht „Bild“,<br />
nicht Fleisch<br />
Schönheit ist keine<br />
Verschwendung<br />
Serge Gainsbourg & Jane Birkin:<br />
„Je t’aime“ – volle Stöhnung für<br />
Seniorennachmittage<br />
Bedienungsanleitungen lesen<br />
Schlechte Gewohnheiten<br />
Im Strandkorb aufs Meer<br />
blicken<br />
Hildegard Knef:<br />
„Für mich soll’s rote Rosen<br />
regnen“ – die Knef konnte ja<br />
nicht wirklich singen, aber<br />
wahrscheinlich traut sich<br />
gerade deshalb jeder, lauthals in<br />
den Refrain einzustimmen<br />
Lesen<br />
Kfz-Anmeldestelle<br />
Alte Filme anschauen<br />
Medizinische<br />
Vorsorgeuntersuchung<br />
Mehr als einmal täglich<br />
Facebook checken – weshalb<br />
man sich so schnell wie möglich<br />
von Facebook abmelden sollte<br />
(was gar nicht so einfach ist)<br />
Fische beobachten in<br />
kristallklarem Wasser – völlig<br />
sinnlos ohne Angel, aber schön<br />
Herbert Grönemeyer:<br />
„Männer“ – ein Mann, der<br />
nicht singen kann, bellt<br />
Banalitäten über seine<br />
Geschlechtsgenossen<br />
Die Steuererklärung machen –<br />
und nicht mit schlechtem<br />
Gewissen vor sich herschieben<br />
Das „Postamt“ – warum ist<br />
da eigentlich IMMER eine<br />
Schlange?<br />
Komplizierte französische<br />
Rezepte mit gefühlten<br />
200 Zutaten aus dem<br />
„Larousse Gastronomique“<br />
nachkochen<br />
Kate Bush:<br />
„Wuthering Heights“ – selbst<br />
Sex-Pistols-Sänger John<br />
Lyndon und Rapper Big Boi<br />
sind Fans<br />
Schwimmen, Laufen und ins<br />
Fitnessstudio gehen, weil man<br />
sich sonst mit 40 schon so<br />
fühlen könnte, als wäre man 50<br />
Diäten (macht man eigentlich<br />
nur, wenn man es sowieso nicht<br />
ernst meint)<br />
Die ersten Liebesbriefe<br />
The Beatles:<br />
„Strawberry Fields Forever“<br />
Die Lektüre von Robert Musils<br />
„Mann ohne Eigenschaften“<br />
Der Tod<br />
Schlafen „Barbara“ Nachdenken Fragebögen<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 27
T i t e l<br />
„<strong>Zeit</strong> gibt es nicht“<br />
Franz Müntefering über eine Erfindung des Menschen, die Rasanz der Moderne,<br />
die Langsamkeit der Demokratie – und ein Europa, dessen Uhr tickt<br />
H<br />
err Müntefering, was ist <strong>Zeit</strong>?<br />
<strong>Zeit</strong> ist eine Erfindung der<br />
Menschen, so wie der Raum<br />
auch. Alle Dimensionen sind Erfindungen<br />
des Menschen, um sich orientieren<br />
zu können.<br />
Moment mal! <strong>Zeit</strong> ist eine physikalische<br />
Größe, eine Gesetzmäßigkeit, mit der<br />
wir rechnen. Wie können Sie sagen, dass<br />
wir sie einfach nur erfunden haben, um<br />
klarzukommen?<br />
Es gibt sie nicht, die <strong>Zeit</strong> an sich. <strong>Zeit</strong><br />
ist nicht absolut, sie ist relativ. Ist sie ein<br />
Punkt oder eine Linie? Wir wissen es<br />
nicht, wir versuchen, ihr mit Uhren einen<br />
Rahmen zu geben. Uhren sind ohnehin<br />
eine komische Sache. Sie ticken<br />
Punkte und erwecken doch die Illusion,<br />
die <strong>Zeit</strong> sei eine gerade Linie. Es gibt<br />
aber keine lineare <strong>Zeit</strong>.<br />
Warum kommt es uns so vor, als ob unsere<br />
<strong>Zeit</strong> immer knapper wird, obwohl wir immer<br />
älter werden?<br />
Was wir gerade erleben, ist eine Neuordnung<br />
der <strong>Zeit</strong> und des Raumes. Und das<br />
ereignet sich durch die Geschwindigkeit,<br />
durch die Globalität, durch die Mobilität,<br />
die wir in den vergangenen hundert Jahren<br />
entwickelt haben. Also, Raum und<br />
<strong>Zeit</strong> verändern sich. Das hat es schon immer<br />
gegeben, aber das geschieht exponentiell<br />
im Augenblick. Früher haben die<br />
Menschen in ihrer Sippe gewohnt, und<br />
dann entstanden Städte, und dann zog<br />
„Demokratie braucht eine menschenmögliche Geschwindigkeit“, sagt Franz Müntefering<br />
und macht sich Sorgen um den Parlamentarismus in Europa. Der 72-jährige frühere<br />
SPD-Vorsitzende und Vizekanzler der Großen Koalition mahnt seine Sozialdemokraten<br />
zur Unterstützung der Europapolitik der Kanzlerin. Es gebe „im Moment ein Ziel, dem<br />
sich alle demokratischen Parteien in Deutschland verpflichtet fühlen sollten: Europa muss<br />
gelingen.“ Seine Stimme hat immer noch großes Gewicht, über alle Parteigrenzen hinweg<br />
Foto: Frank Zauritz<br />
28 <strong>Cicero</strong> 8.2012
man ins Nachbarland, auch in die Welt<br />
hinein. Und heute ist die Globalität da,<br />
und die Mobilität, Menschen und Güter<br />
und Informationen rund um die Welt<br />
transportieren zu können.<br />
Aber der Mensch erfindet doch permanent<br />
Maschinen, die helfen sollen, <strong>Zeit</strong> zu<br />
sparen: das Rad, der Motor, die Eisenbahn,<br />
das Flugzeug, das Fax, das Handy. Und am<br />
Ende hat er erst recht keine. Was läuft da<br />
schief?<br />
Die Frage, die wir uns stellen müssen:<br />
Was hat das Ganze für eine Wirkung,<br />
diese höhere Geschwindigkeit, dieses<br />
hohe Tempo in der <strong>Zeit</strong>? Und es hat eine<br />
gewaltige Wirkung auf die Politik, weil<br />
es das Zusammenleben der Menschen<br />
berührt. Das ist Politik. Die Politik<br />
macht sich Gedanken darüber, wie arbeiten,<br />
wie leben wir zusammen, wer hat<br />
die Macht, wer hat die Aufgabe, diese<br />
Dinge zu regeln. Das hohe Tempo hat<br />
hier Folgen.<br />
Sie haben keine Armbanduhr am Handgelenk.<br />
Warum nicht?<br />
Habe ich in meinem Leben nie gehabt,<br />
doch, einmal kurz, als ich 20 war. Ich<br />
mag Uhren nicht besonders. Als Junge<br />
habe ich aus einer Uhr mal den Stundenzeiger<br />
ausgebaut. Ein Experiment. Ich<br />
wollte deutlich machen, dass die <strong>Zeit</strong> etwas<br />
ist, was sich im Kreise dreht an der<br />
großen Uhr, ohne dass man genau weiß,<br />
wie spät es eigentlich ist. Und dass dieser<br />
Spruch „Es ist fünf vor zwölf“ voraussetzt,<br />
dass wir zwei Zeiger in Bewegung haben.<br />
Wenn es nur einer ist, weiß man das gar<br />
nicht mehr. Man sieht nur, wie das weitergeht,<br />
man sieht nur, wie das tickt, aber<br />
man weiß eigentlich gar nicht so genau,<br />
wie spät es ist. Das hat mir immer Spaß<br />
gemacht, war ein bisschen auch ein Schabernack<br />
und ein bisschen skurril, aber es<br />
war mein Spiel mit der <strong>Zeit</strong>, ja.<br />
Sie haben sehr intensive Jahre in der<br />
Politik verbracht, als Vizekanzler, als<br />
SPD-Chef. Aus dieser <strong>Zeit</strong> ist mir ein Satz<br />
von Ihnen in Erinnerung geblieben. Er fiel<br />
auf einer rasanten Autofahrt, hinten in<br />
Ihrem Dienstwagen. Aus dem Fax quollen<br />
die Papiere, das Handy klingelte dauernd.<br />
Da haben Sie gesagt: „Was fehlt, sind<br />
die Tankstellen.“ Was haben Sie damit<br />
gemeint?<br />
Dass man mal Ruhe braucht, dass man<br />
konzentriert bleiben muss und dass man<br />
sich nicht berauschen darf an der Geschwindigkeit.<br />
Und dass man dann auf<br />
diese Art und Weise, ja, bei sich selbst<br />
bleibt und nicht verloren geht in der Geschwindigkeit,<br />
in der wir uns bewegen.<br />
Das ist nämlich schnell passiert.<br />
„Eigentlich bräuchte die Politik mehr<br />
Momente der Entschleunigung, Reflexionsschleifen,<br />
um über grundlegende<br />
Entscheidungen nachzudenken“, sagt<br />
Andreas Voßkuhle, der Präsident des<br />
Bundesverfassungsgerichts.<br />
Er trifft es genau. Ja, das ist eines der<br />
großen Probleme. Ich glaube, an dem,<br />
was der Präsident da anspricht, hängt<br />
die ganze Frage der Demokratie. Als<br />
ich 1975 das erste Mal in den Bundestag<br />
kam, da gab es kein Handy, da<br />
„Bei einem<br />
G‐8‐Gipfel hat mal<br />
ein russischer<br />
Kollege zu mir<br />
gesagt: ‚Wir<br />
gewinnen. Weil<br />
wir schneller sind‘“<br />
gab es kein Faxgerät, da gab es drei<br />
große Kopierautomaten, und das war<br />
es auch. Da herrschte eine ganz andere<br />
Geschwindigkeit.<br />
Ist die Demokratie zu langsam für diese<br />
schnelle neue Welt?<br />
Demokratie setzt voraus, dass per Wahl<br />
beauftragte Menschen Dinge diskutieren,<br />
dass sie auch streiten und dann Entscheidungen<br />
treffen. Demokratie braucht <strong>Zeit</strong>,<br />
sie braucht eine menschenmögliche Geschwindigkeit,<br />
und die gibt es nicht mehr<br />
immer.<br />
Politik nur noch als hilflose Nacheile?<br />
Was jetzt stattfindet an den Finanzmärkten,<br />
ist von der Politik nicht mehr<br />
beherrscht. Das ist eine der verhängnisvollen<br />
Realitäten, die sich mit dem Finanzkapitalismus<br />
verbinden. Der Primat<br />
der Politik ist nicht garantiert an der<br />
Stelle. Deshalb müssen wir Tempo rausnehmen<br />
aus der Sache. Demokratie wird<br />
nur bestehen können, wenn wir nicht<br />
durch die Geschwindigkeit der Ereignisse<br />
ihre Handlungsmuster völlig zerstören.<br />
Wenn ein Parlament keine <strong>Zeit</strong><br />
mehr hat zu diskutieren, kontrovers zu<br />
diskutieren, zu befragen, auch mal nachzudenken<br />
und dann zur Entscheidung<br />
zu kommen, wenn das alles nicht mehr<br />
geht, dann werden die autokratischen<br />
Systeme gewinnen, die auf niemanden<br />
Rücksicht nehmen. Die Demokratie wäre<br />
dann nicht mehr das Ideal. Bei einem<br />
G‐8‐Gipfel hat zu meiner <strong>Zeit</strong> als Arbeitsminister<br />
einmal ein russischer Kollege<br />
zu mir gesagt: „Wir gewinnen. Weil<br />
wir schneller sind.“ <strong>Keine</strong> andere Staatsform<br />
braucht so viel kalkulierbare <strong>Zeit</strong><br />
wie die Demokratie. Das ist das Dilemma.<br />
Das ist aber auch ihre Stärke.<br />
Gibt es eine Lösung, wie demokratische<br />
Politik wieder in Vorlage kommt?<br />
Entscheidend ist, dass man eine Dimension<br />
hat, die wirkungsmächtig ist. Und<br />
Deutschland alleine ist nicht wirkungsmächtig<br />
genug. Das haben wir auch damals<br />
diskutiert, als es darum ging, auch<br />
unsere Märkte zu öffnen für Derivate<br />
und derlei, als die Engländer uns gesagt<br />
haben: Wenn ihr nicht mitmacht, dann<br />
geht das Geld um euch herum, dann<br />
ist man halt draußen. Aber Europa mit<br />
400 Millionen Menschen hat das Potenzial,<br />
wirkmächtig zu sein. Das sehe ich als<br />
die große Chance an, die wir haben, die<br />
wir jetzt nutzen müssen: Wenn Europa<br />
es schafft zu beweisen, dass einigermaßen<br />
legitimierte Demokratien gemeinsam Regeln<br />
finden, ohne ein Staat zu sein, mit<br />
denen auf diese Geschwindigkeiten der<br />
Welt reagiert wird, dann könnte das ein<br />
Zeichen sein in die Welt hinein.<br />
Und wenn nicht?<br />
Wenn Europa das nicht schafft, wenn es<br />
zurückfällt in die blanke Nationalstaatlichkeit,<br />
dann weiß ich nicht, an welcher<br />
Stelle auf unserem Planeten eigentlich die<br />
Demokratie noch einen Anschub bekommen<br />
könnte. Die Zeichen der <strong>Zeit</strong>, die<br />
Globalität und die Geschwindigkeit, in<br />
der alles stattfindet, sprechen gegen die<br />
Demokratie, die sich aufs Nationalstaatliche<br />
reduziert.<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 29
T i t e l<br />
Was erwidern Sie denjenigen, die sagen,<br />
das wollen wir aber nicht, wir wollen keine<br />
Souveränitätsrechte an Europa abgeben?<br />
Es gibt natürlich Angst bei den Menschen<br />
vor den Veränderungen. Und die,<br />
die das Thema nicht tief genug durchdringen,<br />
die sagen: Lasst uns lieber auf<br />
uns zurückziehen. Aber das geht nicht.<br />
Wir müssen institutionell etwas tun und<br />
von der nationalen Ebene Rechte abgeben.<br />
Darüber müssen die Völker dann<br />
abstimmen. Wir brauchen ganz konkret<br />
eine Verfassungsänderung, und über eine<br />
solche Verfassungsänderung muss es einen<br />
Volksentscheid geben.<br />
Das schwächt am Ende die nationalen<br />
Parlamente.<br />
Es gibt einen Automatismus: In einer so<br />
globalisierten und schnellen Welt gewinnen<br />
die großen Einheiten und die kleinen<br />
an Gewicht. Nicht die Landtage,<br />
nicht die nationalen Parlamente, sondern<br />
das, was darüber ist, das gewinnt an Gewicht,<br />
und die Metropolen, die Städte<br />
und Gemeinden, da wo die Menschen zu<br />
Hause sind.<br />
Ein ungeheurer Einschnitt ins deutsche<br />
Staatsgefüge.<br />
Ich weiß. Wir stehen an einem historischen<br />
Wendepunkt. Ich habe in meinem<br />
Leben einmal eine vergleichbare Situation<br />
erlebt. Das war 1969 bis 1972, als<br />
die Ostpolitik von Willy Brandt zu scheitern<br />
drohte, als die Mehrheiten zerbröckelten<br />
und eigentlich alles dafür sprach,<br />
dass diese Politik nicht fortgesetzt würde.<br />
Konkret: Dass der Moskauer und der<br />
Warschauer Vertrag nicht unterschrieben<br />
würden und es auch keine Vereinbarung<br />
mit der DDR geben würde. Da haben<br />
Willy Brandt und die Sozialdemokraten<br />
gesagt, wir machen weiter, den Weg gehen<br />
wir weiter. Das kam dann auch so,<br />
und die Menschen haben in einer grandiosen<br />
Wahl Willy Brandt ihre Unterstützung<br />
gegeben, 1972, und darauf fußt viel<br />
von dem, was hinterher passiert ist.<br />
War das der Hintergrund für Ihren Appell<br />
in der SPD-Bundestagsfraktion, die Europapolitik<br />
der Kanzlerin im Prinzip weiter zu<br />
unterstützen?<br />
Ja. Es gibt im Moment ein Ziel, dem sich<br />
alle demokratischen Parteien in Deutschland<br />
verpflichtet fühlen sollten: Europa<br />
muss jetzt gelingen. Und dafür muss man<br />
sich einsetzen, dafür müssen sich gerade<br />
die Sozialdemokraten einsetzen. Da sind<br />
im Moment noch zu viele in der Welt<br />
unterwegs, die sagen: Den Euro kriegen<br />
wir schon noch platt. Denen muss Europa<br />
die Stirn bieten und jetzt die Bereitschaft<br />
zeigen, dass man zusammensteht<br />
und dass man sich nichts kaputt schießen<br />
lässt.<br />
Die 27 Chefs, die da<br />
zusammensitzen,<br />
sind für alles<br />
Mögliche gewählt,<br />
nur nicht um<br />
Europa zu regieren“<br />
Bekommen wir so die Vereinigten Staaten<br />
von Europa?<br />
Nicht unbedingt. Aber wir müssen oberhalb<br />
unserer Nationalstaaten einen europäischen<br />
Rahmen finden, der sich möglicherweise<br />
mehr am amerikanischen als<br />
am deutschen Föderalismus orientiert.<br />
Ich glaube, dass die Nationalstaaten eine<br />
Rolle behalten, aber dass wir aus den<br />
Staaten heraus, und zwar mit demokratischen<br />
Methoden, Wege finden müssen,<br />
um neue Muster demokratischer Strukturen<br />
in Europa und auch weltweit entwickeln<br />
zu können.<br />
Welche institutionellen Veränderungen<br />
schweben Ihnen konkret vor?<br />
Es kann nicht sein, dass auf Dauer die<br />
Regierungschefs, die Präsidenten oder<br />
Kanzler wie ein exekutivföderaler Rat<br />
agieren. Das ist einfach Unsinn. Jürgen<br />
Habermas spricht mit Recht vom Exekutivföderalismus.<br />
Die da zusammensitzen,<br />
die 27 Chefs, die sind ja für alles<br />
Mögliche gewählt, nur nicht um Europa<br />
zu regieren. Das Parlament in Europa<br />
hat nur bedingt Möglichkeiten, irgendetwas<br />
zu tun. Aber die Staats- und Regierungschefs<br />
entscheiden, was die Kommission<br />
tun soll. Und diese Kommission, das<br />
sind Ministerien ohne den Rang eines<br />
Ministers, und da schickt jedes Land jemanden<br />
hin, ungewählt. Wenn wir das<br />
Ganze mal übertragen auf den Föderalismus<br />
unseres Landes, dann wäre das<br />
so: Die Bundesregierung ist abgeschafft,<br />
die Ministerpräsidenten der Länder treffen<br />
sich und sagen den Ministerien, ihr<br />
macht jetzt mal schön dieses oder jenes.<br />
Minister gibt es nicht mehr, und das Parlament<br />
ist weitgehend draußen, es wird<br />
informiert. Absurd, oder? Aber genauso<br />
funktioniert derzeit Europa oder eben gerade<br />
nicht.<br />
Also, was tun?<br />
Wir müssen auf europäischer Ebene größere<br />
Verantwortung organisieren. Wie<br />
das dann aussieht, ob man das ohne eine<br />
Verfassungsänderung machen kann, das<br />
weiß ich nicht. Was jetzt beschlossen<br />
ist, mag verfassungskonform sein. Aber,<br />
wenn man da weitergeht, wenn man<br />
wirklich eine europäische Wirtschaftsund<br />
Sozialregierung haben will, dann<br />
müssen vorher die demokratischen Strukturen<br />
eingezogen werden. Am besten vorbereitet<br />
in einem europäischen Konvent.<br />
Das wird ein langer Prozess sein, für den<br />
man sich <strong>Zeit</strong> nehmen muss. Vielleicht<br />
acht bis zehn Jahre. Vielleicht länger. Das<br />
geht nicht im Schweinsgalopp. Wir reden<br />
von einer unglaublichen Anstrengung,<br />
der wir uns aber unterwerfen müssen. Es<br />
lohnt sich.<br />
Wieder die Sache mit der <strong>Zeit</strong>, die uns davonläuft.<br />
Werden Sie das Europa erleben,<br />
das Sie sich wünschen?<br />
Das weiß man nie. Je älter ich werde, ich<br />
bin jetzt 72, umso gelassener und ruhiger<br />
bin ich eigentlich dabei in diesem Älterwerden.<br />
Also, ich kann von mir aus<br />
sagen: Da ist keine Angst vor irgendwas.<br />
Tot zu sein, ist nicht schwer. Aber<br />
jeder von uns hat nur ein einziges Mal<br />
die Chance, hundert Jahre alt zu werden.<br />
Also rate ich: möglichst nichts leichtfertig<br />
davon aufgeben und es genießen. Es gibt<br />
von Ingeborg Bachmann ein Gedicht<br />
„An die Sonne“, und die zentrale Zeile<br />
heißt: „Nichts Schönres unter der Sonne<br />
als unter der Sonne zu sein.“ Das gefällt<br />
mir. Aber Europa soll sich beeilen.<br />
Das Gespräch führte<br />
Christoph Schwennicke<br />
30 <strong>Cicero</strong> 8.2012
www.suedtirol.info<br />
südtirol: zeitlos<br />
IN VIERZEHN TAGEN ÜBER DIE ALPEN VON MERAN ZUM BRENNER GEHEN, EINE WOCHE IM WEINBERG WOHNEN,<br />
EINEN ABEND LANG DEN LIEDERN EINER ALTEN SPRACHE LAUSCHEN – SÜDTIROL BIETET UNGEZÄHLTE MÖG-<br />
LICHKEITEN, DEN TAKT DER ZEIT SELBST ZU BESTIMMEN. ACHT BEISPIELE.<br />
inteGrAtion im WeinBerG<br />
Architektur ist raumgewordene <strong>Zeit</strong>. Wenn dieser satz stimmt, dann für die Werke des in Bozen geborenen matteo Thun. er ist dafür bekannt, dass er<br />
sich bei seiner Arbeit viel <strong>Zeit</strong> nimmt. sei es bei der innengestaltung der Therme meran oder dem Bau von hotels in den Alpen. Bei letzteren ist ihm<br />
wichtig, dass die vorgefundene umgebung und der neu geschaffene raum nicht nur zusammenpassen, sondern sich ergänzen. so wie beim hotel Pergola<br />
residence in Algund, das mitten in einem Weinberg steht. Thun machte aus den Auflagen der naturschutzbehörden eine tugend und die bäuerliche<br />
Bautradition zur Grundlage seiner Planung. einheimisches lärchenholz und natursteinplatten bestimmen das äußere, lehmverputz und Weidengeflecht<br />
das innere. das hotel könnte, so es die Besitzer eines – hoffentlich fernen – tages nicht mehr als luxusresidenz betreiben wollten, als Wohnhaus dienen.<br />
das Gebäude sollte auch ohne nutzung als hotel eine Berechtigung haben, inmitten eines Weinberges zu stehen. die integration ist geglückt: die reben<br />
wachsen über die namensgebenden Pergolen der terrassen von zwölf suiten und zwei Villen. www.pergola-residence.de 1<br />
hAlten oder Gehen!<br />
Wer sich die <strong>Zeit</strong> nimmt, an den Wirtshaustischen das<br />
Watten zu erlernen, wird ein spiel fürs leben mit nach hause<br />
nehmen. Vom erstklässler bis zum 90-Jährigen fordern die<br />
südtiroler „halten!“, wenn sie sich sicher sind, das spiel<br />
gewonnen zu haben, und donnernd die nächste karte auf die<br />
tischplatte knallen. Gerne erklären sie jedem Gast die nur<br />
auf den ersten Blick undurchschaubaren regeln des spiels.<br />
Genau wie die Zeichen mit Augen, mund und Fingern, mit<br />
denen man seinen mitspieler heimlich sein Blatt wissen lässt.<br />
online trainieren: www.watten.org 1
www.suedtirol.info<br />
der schAukelnde BischoF<br />
das Gotteshaus st. Prokulus in naturns überrascht seine Besucher mit<br />
einem schaukelnden mann. das weltweit einmalige Fresko aus dem 7. oder<br />
8. Jahrhundert zeigt wahrscheinlich den namenspatron Prokulus. schaukelt<br />
der frühchristliche Veroneser Bischof zwischen erde und himmelreich, zwischen<br />
diesseits und Jenseits? An anderer stelle ist, ganz prosaisch, eine bunte<br />
kuhherde verewigt – auch das ein seltenes motiv der kirchenmalerei. Viele<br />
meister haben in der kirche, an der Via claudia Augusta gelegen, gearbeitet.<br />
Von Volkskundlern wird das untere Vinschgau gerne auch eine transitzone<br />
der <strong>Zeit</strong>en und kulturen genannt. das gegenüber der kirche unterirdisch angelegte<br />
museum begeistert heute auch kinder für die 1500-jährige Geschichte<br />
der Gegend rund um naturns. www.naturns.it/prokulus 1<br />
Andere <strong>Zeit</strong>rechnunG<br />
die Pension Briol wurde 1928 im Bauhausstil gebaut und eingerichtet. seither haben die Besitzer fast nichts daran verändert. Vom Gebäude<br />
mit seiner sonnenterrasse, der holzvertäfelten stube und den gusseisernen Öfen ist alles so klar und einfach gestaltet, wie es der maler und<br />
Architekt hubert lanzinger entworfen hat. die Gäste, sie fühlen sich sofort in die entstehungszeit des hauses zurückversetzt. und genießen<br />
dabei die ruhe und die dolomitenkulisse am horizont gegenüber. Fernseher und internetanschluss gibt es nicht, dafür ein schwimmbecken<br />
mit Quellwasser und ausgezeichnete südtiroler Gerichte. Autos müssen unten im eisacktal warten. nur zu Fuß über Waldwege oder mit dem<br />
Bergtaxi ist die 1310 meter hoch gelegene <strong>Zeit</strong>maschine erreichbar. www.briol.it 1<br />
Ausdruck der menschlichen nAtur<br />
seine holzskulpturen werden weltweit ausgestellt, experten nennen seinen<br />
namen in einem Atemzug mit den Großen der kunstszene. Bei allem ruhm<br />
verbirgt der Bildhauer Aron demetz seine herkunft aus dem Grödnertal,<br />
die tradition der südtiroler holzschnitzkunst nicht. er schafft übergroße<br />
Figuren, majestätisch stehend, auf allen Vieren kriechend, umständlich<br />
hockend. demetz übergießt sie mit Baumharz, bearbeitet sie mit silber oder<br />
Aluminium oder übergibt sie dem Feuer – und schafft so eine künstlerische<br />
sprache, die die kraft, aber auch die Verletzungen und die Vergänglichkeit<br />
der menschlichen natur zum Ausdruck bringt. www.arondemetz.it1
www.suedtirol.info<br />
ÜBer 13 hÜtten musst du Gehen<br />
südtirols höchstgelegene Berghütte ist das Becherhaus auf 3195 metern. sieben<br />
stunden brauchen gletschergeübte Bergsteiger für den Aufstieg vom ridnauntal<br />
oder timmelsjoch aus. kein spaziergang für den sonntagnachmittag.<br />
hüttenwirt erich Pichler lebt mit seiner Familie an diesem zeitenthobenen ort<br />
und sorgt zwischen Juni und september unermüdlich für die Gäste. Frühstück<br />
bereiten, mittag- und Abendessen kochen, sich um die Wassertanks und das<br />
stromaggregat kümmern, ohne die hier oben nichts geht. die Vorräte werden<br />
mit dem hubschrauber eingeflogen. Viele Bergsteiger erfüllen sich mit der<br />
13-hütten-tour einen lebenstraum: in 14 tagen zu Fuß von meran zum Brenner.<br />
das Becherhaus steht genau in der mitte und ist in doppelter hinsicht der<br />
höhepunkt der unternehmung. www.becherhaus.com 1<br />
urlAuB länGer hAltBAr<br />
kalt geräuchert, mindestens 22 Wochen gereift, wenig<br />
Pökelsalz: so entsteht aus schweineschinken südtiroler<br />
Bauernspeck. der ist lange haltbar und verlängert die<br />
urlaubszeit scheibchenweise über das ganze Jahr hinweg<br />
– ausreichender Vorrat vorausgesetzt. die hersteller,<br />
oft familiär geführte kleinbetriebe, füttern die schweine<br />
mit speziellem Futter, um das Fleisch besonders mürbe<br />
zu machen. ebenso wie die zum räuchern verwendeten<br />
holzsorten werden diese Geheimnisse von Generation<br />
zu Generation weitergegeben. www.speck.it 1<br />
lAdinische FeenklänGe<br />
die schwestern marlene und elisabeth schuen und ihre cousine maria moling<br />
bilden das Folktrio Ganes aus Wengen im Gadertal. die drei erobern gerade die<br />
konzertsäle deutschlands. mit ihren elektroakustisch verstärkten liedern bringen<br />
sie eine sprache zum klingen, die außerhalb ihrer heimat niemand versteht.<br />
lediglich 30 000 menschen in den dolomiten sprechen ladinisch – und dies<br />
auch noch in fünf unterschiedlichen idiomen. so heißen die „Ganes“ im nachbartal<br />
„Aguanes“ und werden mit „Wassernixen“ oder „Feen“ übersetzt. dass<br />
sie feenhaft singen und die <strong>Zeit</strong> vergessen lassen, wissen die konzertbesucher in<br />
südtirol schon lange. www.ganes-music.com 1<br />
© Blanko Musik, Foto: Anne De Wolff
T i t e l<br />
Metronome der macht<br />
34 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Spitzenpolitiker klagen fast immer über Terminstress und <strong>Zeit</strong>mangel. Für <strong>Cicero</strong> hat die Fotografin<br />
Laurence Chaperon deshalb einige nach ihrem Verhältnis zum Taktgeber am Handgelenk<br />
befragt. Auf den nächsten Seiten werden diese acht Armbanduhren von ihren Trägern gewürdigt<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 35
T i t e l<br />
„Die Uhr hat mir<br />
mein Mann 2003 zu<br />
Weihnachten geschenkt.<br />
Auf meine Uhr ist Verlass,<br />
das mag ich an ihr. Aber<br />
die <strong>Zeit</strong>, die sie anzeigt,<br />
ist an hektischen Tagen<br />
oft genug mehr Gegner<br />
als Freund“<br />
Kristina Schröder,<br />
Bundesfamilienministerin<br />
„Meine Uhr ist ein<br />
Geschenk. Ich finde<br />
sie schön, und sie<br />
ist nützlich. Sie ist<br />
mit Erinnerungen<br />
verbunden – so wie der<br />
Gedanke an die <strong>Zeit</strong><br />
immer auch Gedanken<br />
an die verschiedenen<br />
<strong>Zeit</strong>en des eigenen<br />
Lebens wachruft“<br />
Annette Schavan,<br />
Bundesministerin für<br />
Bildung und Forschung<br />
36 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Die Uhr ist ein<br />
Geschenk von<br />
meiner Frau – Hilfe<br />
und Feind zugleich.<br />
Hilfe, weil nur<br />
mit ihr die Arbeit<br />
effizient bewältigt<br />
werden kann. Und<br />
Feind, weil die Uhr<br />
oft die Herrschaft<br />
über die Inhalte<br />
gewinnt. Im Urlaub<br />
lege ich als Erstes<br />
meine Uhr ab“<br />
Thomas de Maizière,<br />
Bundesverteidigungsminister<br />
„Die Uhr ist<br />
ein Geschenk<br />
gewesen. Sie<br />
ist aber nur ein<br />
Mittel. <strong>Zeit</strong> selbst<br />
bedeutet mir<br />
viel mehr“<br />
Hans-Peter Friedrich,<br />
Bundesinnenminister<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 37
T i t e l<br />
„Meine Uhr habe<br />
ich mir selbst<br />
gekauft. Sie ist<br />
mir wegen ihrer<br />
sachlichen und<br />
funktionsgerechten<br />
Art gleich<br />
aufgefallen. Sie ist<br />
minimalistisch, auf<br />
das Wesentliche<br />
beschränkt, hat<br />
klare Linien. Ich<br />
mag das mehr als<br />
barocke Schnörkel“<br />
Rainer Brüderle,<br />
FDP-Fraktionsvorsitzender im<br />
Bundestag<br />
„Die Uhr haben<br />
mir vor zwei<br />
Jahren meine<br />
Kinder geschenkt,<br />
weil sie die<br />
alte so hässlich<br />
fanden. Sie ist ein<br />
unverzichtbarer<br />
Helfer, um mein<br />
Arbeitspensum<br />
zu schaffen“<br />
Ursula von der Leyen,<br />
Bundesministerin für Arbeit<br />
und Soziales<br />
38 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Meine Uhr habe<br />
ich geschenkt<br />
bekommen. Sie<br />
ist für mich<br />
ein Anker, ein<br />
Kompass und<br />
ein ständiger<br />
Begleiter“<br />
Claudia Roth,<br />
Bundesvorsitzende von<br />
Bündnis 90/Die Grünen<br />
„Die Uhr hat mir<br />
meine Frau zum<br />
50. Geburtstag<br />
geschenkt.<br />
Quälen kann<br />
einen jede Uhr<br />
im täglichen<br />
Terminstress.<br />
Aber wenn das<br />
schon so ist,<br />
dann sollte sie<br />
wenigstens gut<br />
aussehen“<br />
Frank-Walter Steinmeier,<br />
Vorsitzender der SPD-<br />
Bundestagsfraktion<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 39
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Immer wieder aufstehen<br />
Trotz vieler Niederlagen ist Andrea Verpoorten das neue Gesicht in der NRW-CDU – mit Zukunftschancen<br />
von Jürgen Zurheide<br />
D<br />
ie jüngsten Tiefschläge haben<br />
noch keine Spuren hinterlassen.<br />
Andrea Verpoorten spricht darüber<br />
ohne Groll und mit erstaunlicher Gelassenheit.<br />
Wo andere vielleicht ein paar Tränen<br />
verdrücken würden, bleibt sie cool. Es<br />
gab ja auch schöne politische Erfolge. Aber<br />
die Zahl der Niederlagen ist eindeutig höher:<br />
erst die verlorene Landtagswahl, die sie<br />
das Mandat in Düsseldorf kostete, dann der<br />
kölsche Klüngel in der Domstadt, der ihr zu<br />
schaffen machte. Und jetzt dieses neue Parteiamt<br />
im nordrhein-westfälischen Landesvorstand<br />
ihrer Partei, um das man sie nicht<br />
beneiden muss: Schatzmeister der klammen<br />
Landes-CDU zu sein, ist kein Vergnügen.<br />
Trotzdem bleibt sie heiter. „Man muss immer<br />
wieder aufstehen“, sagt sie tapfer.<br />
Nach dem Verlust des Landtagsmandats<br />
hat sie sich neue Ziele gesetzt. Daran<br />
ist Christa Thoben nicht ganz unschuldig.<br />
Die frühere nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin<br />
hatte sich in den Jahren<br />
nach dem Machtverlust der CDU an Rhein<br />
und Ruhr 2010 darauf beschränkt, die Finanzen<br />
des größten christdemokratischen<br />
Landesverbands zu verwalten; besonderes<br />
Vergnügen bereitete das angesichts eines<br />
Schuldenbergs von mehr als sechs Millionen<br />
Euro nicht. Als Norbert Röttgen nach<br />
der Wahlniederlage im Mai zurücktreten<br />
musste, bat sie dessen designierten Nachfolger<br />
Armin Laschet, die Verantwortung<br />
in jüngere Hände zu legen, und präsentierte<br />
dem Aachener die Kölnerin Andrea<br />
Verpoorten.<br />
Die Landtagswahl war für Verpoorten<br />
deshalb eine Katastrophe, weil sie auf der<br />
Landesliste nicht abgesichert war und im<br />
traditionell sozialdemokratisch dominierten<br />
Bezirk Köln I diesmal keine Chance auf<br />
Wiederwahl hatte. Tief getroffen musste<br />
sie ihr Büro in der Landeshauptstadt räumen.<br />
Immerhin lag ihr Erststimmenergebnis<br />
knapp zehn Punkte über den mageren<br />
18 Prozent für die CDU in ihrem<br />
Wahlkreis. Nicht nur deshalb gibt es einige<br />
Parteifreunde, die fest davon überzeugt<br />
sind, dass Verpoorten in der Landespartei<br />
eine Zukunft hat. Man müsse dieses frische<br />
Gesicht der Kölner CDU in der Politik<br />
halten, fanden sie. Hermann-Josef<br />
Arentz, der frühere Vorsitzende der CDU-<br />
Sozialausschüsse, zum Beispiel, setzte sich<br />
bei Laschet für sie ein: „Ich finde die gut.“<br />
Danach hatte der künftige Landeschef eine<br />
Sorge weniger. Seine Kandidatin für den<br />
Posten des Kassenwarts wurde auf dem<br />
Landesparteitag in Krefeld mit einem besseren<br />
Ergebnis gewählt als er selbst.<br />
Seither muss sich die 39-jährige Anwältin<br />
um die Finanzen des größten Landesverbands<br />
kümmern. „Ich weiß nicht, ob<br />
ich Ihnen gratulieren oder Ihnen Beileid<br />
wünschen soll“, begrüßte sie Hannelore<br />
Kraft, als sich die beiden kürzlich zufällig<br />
begegneten. Die nordrhein-westfälische<br />
Ministerpräsidentin hatte die SPD 2005<br />
in einer ähnlichen Lage übernommen, in<br />
der sich die CDU jetzt befindet. Die Sozis<br />
hatten damals nach 39 Jahren die Macht<br />
verloren und litten unter einem so hohen<br />
Schuldenberg, dass Kraft sich innerparteilich<br />
erst einmal unbeliebt machen und Personal<br />
entlassen musste. Andrea Verpoorten<br />
wird das auch nicht erspart bleiben. Aber<br />
Probleme sind für sie Herausforderungen:<br />
„Meine Schwester sagt immer: Wenn es etwas<br />
zu verteilen gibt, bekommst du garantiert<br />
die schwerere Aufgabe.“<br />
Es gibt 54 gut bezahlte und fest angestellte<br />
Kreisgeschäftsführer in der demoralisierten<br />
CDU an Rhein und Ruhr. Mit<br />
ihnen muss sie sich jetzt herumschlagen.<br />
Denn ihr Job ist es, die Bilanz von rot auf<br />
schwarz zu drehen. Immerhin kennt sie sich<br />
mit Zahlen aus. Nach dem Abitur am erzbischöflichen<br />
Gymnasium in Köln, wo sie<br />
auch studierte, arbeitete sie in Reichweite<br />
des Doms in einer auf Steuer- und Nachfolgefragen<br />
spezialisierten Anwaltskanzlei.<br />
Auch ihr Name hilft. „Man traut mir zu,<br />
die Dinge zu verstehen“, hat sie beobachtet,<br />
denn sie entstammt der Unternehmerdynastie,<br />
die seit fünf Generationen den<br />
gleichnamigen Eierlikör herstellt. Obwohl<br />
sie selbst damit nicht kokettiert, hatte sie<br />
nichts dagegen, dass eine Boulevardzeitung<br />
im Frühjahr ihre Kandidatur für den Vorsitz<br />
der Kölner CDU mit dem legendären<br />
Werbespruch kommentierte: „Ei, Ei, Ei!<br />
Verpoorten soll Kölns CDU retten“.<br />
Die eigene Familie, aber auch die Adenauers<br />
– deren Wort in der Stadt zählt – hatten<br />
sie ermuntert zu kandidieren. Und sie<br />
war selbstbewusst in die Schlacht gezogen.<br />
Aber sie hatte die Kraft des kölschen Klüngels<br />
unterschätzt: Nicht sie wurde Parteivorsitzende,<br />
sondern der außerhalb der Stadt<br />
unbekannte Bankmanager Bernd Petelkau.<br />
Denn der hatte die Unterstützung von Richard<br />
Blömer, dem Strippenzieher hinter<br />
den Kulissen, den auch äußerst unappetitliche<br />
Parteispendenaffären nicht aus dem<br />
Ring geworfen haben. Aus Blömers Sicht<br />
hatte Verpoorten einen entscheidenden<br />
Nachteil: Sie gehört zu keiner der berüchtigten<br />
Klüngelrunden rings um das historische<br />
Rathaus. Sie vertritt und repräsentiert<br />
die gutbürgerlichen konservativen Familien,<br />
denen der kleinkarierte innerparteiliche<br />
Grabenkampf zuwider ist.<br />
Ihre Gegner feierten Verpoortens Niederlage<br />
mit Eierlikör, dabei hält ihr Familienzweig<br />
keine Anteile am Unternehmen. Selbst<br />
das erzählt Andrea Verpoorten eher ruhig,<br />
aus der Bahn geworfen hat sie das nicht. Sie<br />
kandidierte anschließend – gegen das ausdrückliche<br />
Votum des neuen CDU-Vorsitzenden<br />
– für einen Stellvertreterposten in der<br />
Kölner CDU und wurde gewählt. Man muss<br />
eben immer wieder aufstehen.<br />
Jürgen Zurheide<br />
arbeitet als Düsseldorfer<br />
Korrespondent u.a. für den<br />
Tagesspiegel und als Moderator<br />
für den Deutschlandfunk<br />
Fotos: Frank Ossenbrink, privat (Autor)<br />
40 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Meine<br />
Schwester<br />
sagt immer:<br />
Wenn es<br />
etwas zu<br />
verteilen gibt,<br />
bekommst du<br />
garantiert die<br />
schwerere<br />
Aufgabe“<br />
Andrea Verpoorten hat die<br />
undankbare Aufgabe, die Kasse<br />
der NRW-CDU zu sanieren<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 41
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Der Ewige Inder<br />
Sebastian Edathy, der die NSU-Morde an Ausländern aufarbeiten soll, gilt im eigenen Land oft als Fremder<br />
von Hartmut Palmer<br />
D<br />
er Vorsitzende ist müde. Er hat<br />
kaum geschlafen, nächtelang<br />
Akten gelesen. Aber Sebastian<br />
Edathy muss wach bleiben. Denn er leitet<br />
den parlamentarischen Untersuchungsausschuss,<br />
der klären soll, warum eine rechtsextreme<br />
Mörderbande, die sich hochtrabend<br />
Nationalsozialistischer Untergrund<br />
(NSU) nannte, zehn Jahre lang unbehelligt<br />
durch die Republik fahren und Ausländer<br />
erschießen konnte. Draußen schwimmen<br />
Touristenschiffe auf der Spree am Reichstag<br />
vorbei. Die Sonne scheint, die Gäste<br />
an Bord sind fröhlich. Drinnen ist es heiß.<br />
Edathy hat das Jackett ausgezogen, als Einziger.<br />
Er hält sich dadurch wach, dass er<br />
ständig die Position ändert: mal vorgebeugt,<br />
mal zurückgelehnt, den Kopf mal<br />
links, mal rechts aufgestützt und zwischendurch<br />
in beiden Händen vergraben, als<br />
könne er nicht glauben, was er hört.<br />
Es ist ja auch unglaublich, was Heinz<br />
Fromm, der scheidende Präsident des Kölner<br />
Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV),<br />
erzählt. Nichts haben sie gewusst in seiner<br />
Behörde: nichts von den Kontakten<br />
ihrer Länderkollegen in die rechtsradikale<br />
Szene, nichts von den Berichten der V‐Leute,<br />
nichts vom NSU. Die wenigen Akten, die<br />
sie hatten, wurden auch noch geschreddert,<br />
einen Tag nachdem das Trio aufflog. Unfassbar!<br />
Es riecht nach Verschwörung, Vertuschung<br />
und Staatsaffäre, nach Vorsatz und<br />
Komplott. Edathy will das nicht ausschließen.<br />
Aber er hat einen anderen Verdacht:<br />
Die Unfähigkeit der Sicherheitsbehörden,<br />
die Morde als rassistisch motiviert einzuschätzen,<br />
könnte damit zu tun haben, dass<br />
die meisten Menschen hierzulande zwar wissen,<br />
wo Rassismus endet, nicht aber, wo er<br />
beginnt. Zum Beispiel bei einer so harmlos<br />
klingenden Zeile über den „schwarzen Präsidenten<br />
Obama“ oder den „indischstämmigen<br />
Vorsitzenden“ Edathy. Ja, sein Vater<br />
war Inder und seine Mutter Deutsche.<br />
Aber: „Was macht mich, der ich hier geboren<br />
wurde, ‚indischstämmig‘? Was macht<br />
einen Präsidenten der USA, der Eltern unterschiedlicher<br />
Hautfarbe hatte, zu einem<br />
„Da ist die Strafverfolgung<br />
eindeutig behindert worden“<br />
Sebastian Edathy über die Behandlung eines NSU-Mordes in Hessen<br />
‚Schwarzen‘“? Seine Antwort: „Der Mangel<br />
an Reflexion. Und die Tatsache, dass es<br />
heute immer noch nicht ungewöhnlich ist,<br />
Menschen aufgrund ihrer phänotypischen<br />
Erscheinung zu sortieren.“ Die „Banalität<br />
des Rassismus“ hat dies der Migrationsforscher<br />
Mark Terkessidis genannt.<br />
Er kennt das, seit er denken kann. Seine<br />
Mitschüler wurden nie gefragt, wo sie herkämen<br />
– er jedoch ständig. Nie vergisst er,<br />
wie seine Mutter – er war damals sechs Jahre<br />
alt – auf einem Spielplatz von der Mutter<br />
eines anderen Kindes gefragt wurde, wo sie<br />
denn ihr süßes Kind adoptiert habe. Schon<br />
damals habe er es „irgendwie ungerecht gefunden“,<br />
wie ein Fremder behandelt zu werden.<br />
Selbst im Bundestag passiert das: Der<br />
Saaldiener, der ihn nicht in den Sitzungssaal<br />
lassen, sondern auf die Diplomatentribüne<br />
geleiten will. Die Kollegen, die ihn auf einer<br />
EU‐Konferenz in Wien mit der Bemerkung<br />
empfangen: „Oh, der Türkisch-Dolmetscher<br />
ist ja auch schon da.“ Oder der<br />
Genosse Ortwin Runde, damals Hamburger<br />
Bürgermeister, der ihn auf einer Reise<br />
in die Hamburger Partnerstadt St. Petersburg<br />
auf Englisch begrüßte: „Nice to meet<br />
you.“ Edathy entgegnete: „Wir können<br />
auch Deutsch reden, Ortwin.“ Kann so einer,<br />
der selbst so oft mit der Banalität des<br />
ganz alltäglichen Rassismus konfrontiert<br />
wurde, die schlimmsten rassistischen Verbrechen<br />
in der Geschichte der Bundesrepublik<br />
aufklären? Ist er unbefangen und neutral<br />
genug, einen solchen Ausschuss zu leiten?<br />
Edathy kennt die Fragen. Sie werden<br />
sich häufen, je konkreter der Ausschuss<br />
nicht nur das Versagen der Sicherheitsbehörden,<br />
sondern auch Fehlentscheidungen<br />
von Politikern untersucht. Spätestens am<br />
28. September wird es zum Eklat kommen,<br />
wenn der hessische Ministerpräsident<br />
Volker Bouffier als Zeuge auftritt. Denn er<br />
wird dem Ausschuss erklären müssen, warum<br />
er sich im Jahr 2006 nach der Ermordung<br />
des Türken Halit Yozgat in Kassel<br />
damals noch als hessischer Innenminister<br />
weigerte, verdächtige V‐Leute des hessischen<br />
Verfassungsschutzes durch seine und<br />
die bayerische Polizei vernehmen zu lassen.<br />
Nach dem Motto: Quellenschutz geht immer<br />
vor – auch vor Mordaufklärung. Edathy<br />
findet das skandalös: „Da ist die Strafverfolgung<br />
eindeutig behindert worden“,<br />
erklärte er im Fernsehen. Seitdem fordern<br />
hessische CDU- und FDP-Politiker seinen<br />
Rücktritt. Ein Vorsitzender müsse sich wie<br />
ein Richter zurückhalten und dürfe nicht<br />
vorschnell urteilen.<br />
Edathy ist aber kein Richter. Er ist noch<br />
nicht einmal Jurist, sondern Soziologe.<br />
Auch als Vorsitzender bleibt er Politiker.<br />
Und wenn es um rassistische Gewalt geht,<br />
ist er Partei. „Ich arbeite mit Leidenschaft<br />
an der Aufklärung“, sagt Edathy. „Aber ich<br />
werde mich von den Leiden der Opfer nicht<br />
überwältigen lassen.“<br />
Hartmut Palmer<br />
ist politischer Chefkorrespondent<br />
von <strong>Cicero</strong>. Er lebt und arbeitet<br />
in Bonn und in Berlin<br />
Fotos: Michael Gottschalk/DDP Images/dapd, Andrej Dallmann (Autor)<br />
42 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Mein Vater war<br />
Inder, meine Mutter<br />
Deutsche. Aber was<br />
macht mich zum<br />
indischstämmigen<br />
Menschen?“<br />
Sebastian<br />
Edathy, SPD<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 43
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
„Ich habe noch viel <strong>Zeit</strong>“<br />
In Berlin gefragt, in der Provinz verwurzelt: David McAllister kopiert das Erfolgsmodell von Hannelore Kraft<br />
H<br />
err McAllister, was haben Sie<br />
eigentlich gegen Berlin?<br />
Gar nichts. Berlin ist meine<br />
Geburtsstadt. Ich bin für Berlin. In<br />
Charlottenburg bin ich aufgewachsen<br />
und habe dort bis 1982, also bis zu<br />
meinem elften Lebensjahr gelebt. In<br />
Berlin komme ich ohne Navi und Karte<br />
klar. Unsere Hauptstadt ist historisch<br />
spannend, kulturell vielseitig und zu<br />
Recht ein Magnet für Besucher aus aller<br />
Welt.<br />
Aber mit dem politischen Berlin haben Sie<br />
nicht viel am Hut?<br />
Im Gegenteil. Im Schnitt bin ich zweimal<br />
pro Woche in Berlin – ob im Präsidium<br />
und Bundesvorstand der CDU,<br />
im Bundesrat oder bei anderen wichtigen<br />
Treffen. Dort bin ich hundertprozentig<br />
präsent, wenn es um die gezielte<br />
Durchsetzung niedersächsischer Belange<br />
geht. Landespolitik wird auch in Berlin<br />
gestaltet. Zu bestimmten Umgangsformen<br />
im Berliner Politikbetrieb halte<br />
ich Distanz. Manche Gepflogenheiten<br />
sind einfach nicht mein Stil – etwa<br />
das Durchstechen vertraulicher Unterlagen<br />
oder Gesprächsinhalte an die Medien<br />
oder das Schlechtreden politischer<br />
Freunde in sogenannten Hintergrundkreisen.<br />
Um sich mit seinen politischen<br />
Inhalten Gehör zu verschaffen, muss<br />
man auch nicht zwingend jedes Mikrofon<br />
ungefragt und ununterbrochen<br />
ansteuern.<br />
So hat Kurt Beck aus Mainz auch mal von<br />
Berlin geredet. Es ging nicht lange gut.<br />
Kurt Beck ist als SPD-Parteivorsitzender<br />
an innerparteilichen Intrigen und der<br />
mangelnden Solidarität seiner Genossen<br />
gescheitert. Was mich angeht, so habe<br />
ich zu den Spitzen der Bundes-CDU ein<br />
sehr gutes Verhältnis. Daher bin ich ganz<br />
entspannt.<br />
Warum?<br />
In Berlin will ich nichts werden. <strong>Keine</strong>r<br />
muss fürchten, ich wolle ihm oder ihr einen<br />
Posten wegnehmen. Mein Platz ist<br />
in Niedersachsen. Dieses Land ist meine<br />
Heimat. Hier bin ich froh und glücklich<br />
mit dem, was ich bin. Hier mache ich<br />
meine Arbeit und bin für die Menschen<br />
da. So einfach ist das.<br />
Auch das hat schon mal einer gesagt und<br />
galt dann erst recht als derjenige, der<br />
Merkel ans Leder wollte: Ihr Vorgänger<br />
Christian Wulff.<br />
Dass in der Berliner Republik alles aus<br />
der Sicht der Bundeshauptstadt wahrgenommen<br />
wird, verstehe ich. Aber es gibt<br />
in Deutschland auch ein reiches politisches,<br />
wirtschaftliches und kulturelles Leben<br />
außerhalb des Berliner Regierungsviertels.<br />
Landespolitik ist spannend und<br />
nah an den Menschen. Gerade Letzteres<br />
ist mir besonders wichtig. Als Ministerpräsident<br />
kann ich viel für das schönste<br />
Land der Bundesrepublik tun. Für mich<br />
ist es eine große Ehre, in vergleichsweise<br />
jungen Jahren dieses Amt bekleiden zu<br />
dürfen.<br />
„Du musst auch mal den Arm heben“, hat<br />
Ihnen Ihr väterlicher Freund Peter Harry<br />
Carstensen empfohlen. Was ist falsch an<br />
der Empfehlung?<br />
Die Empfehlung ist richtig. Alles zu seiner<br />
<strong>Zeit</strong>. Und ich habe noch ganz viel<br />
<strong>Zeit</strong>.<br />
Wie jetzt? Erst sagen Sie: Ich will nichts<br />
werden, dann sagen Sie: Ich habe noch<br />
ganz viel <strong>Zeit</strong>! <strong>Zeit</strong>, um nichts zu werden?<br />
Am 20. Januar 2013 findet die Landtagswahl<br />
in Niedersachsen statt. In diesem<br />
Land habe ich meinen Platz. Wenn<br />
die Niedersachsen mir als CDU-Spitzenkandidaten<br />
das Vertrauen aussprechen –<br />
und dafür kämpfe ich –, dann bleibe ich<br />
Ministerpräsident. Seit zwei Jahren habe<br />
ich mich auf die Landespolitik konzentriert<br />
und die <strong>Zeit</strong> genutzt, um mich in allen<br />
Teilen des Landes vorzustellen. Niedersachsen<br />
hat für mich Priorität. Hätte<br />
ich von Anfang an gesagt „Hoppla, Berlin,<br />
hier komme ich, welche Posten gibt es für<br />
mich“, dann hätte es doch geheißen: „Herr<br />
McAllister kümmert sich doch nur um<br />
Berlin, der ist nur an seinem eigenen Fortkommen<br />
interessiert.“ Politik ist eben nicht<br />
das permanente Schielen auf einen neuen<br />
Job. Mir geht es um die Sache. Punkt.<br />
Warum haben Sie bisher jedes Parteiamt<br />
auf Bundesebene abgelehnt? Der Vizeposten<br />
der CDU ist mit Ursula von der Leyen<br />
und nicht mit Ihnen besetzt, was normal<br />
wäre.<br />
Auf diese Weise haben wir als Niedersachsen<br />
eine weitere Persönlichkeit im<br />
engsten Führungskreis der CDU, nämlich<br />
Ursula von der Leyen. Ich habe sie<br />
vorgeschlagen.<br />
Im nächsten Jahr sind zwei Landtagswahlen.<br />
Die erste in Niedersachsen und die<br />
zweite in Bayern. Sie haben noch nie eine<br />
Wahl gewonnen und tun so, als könnten<br />
Sie die bevorstehende Wahl im Schlaf<br />
gewinnen. CSU-Chef Horst Seehofer<br />
dagegen macht für seine Wiederwahl eine<br />
Menge Wind. Wer macht hier also was<br />
falsch?<br />
Wahlkämpfe führt man hellwach<br />
und nicht im Schlaf. Ihre Wahrnehmung<br />
ist unzutreffend. <strong>Keine</strong>r von uns<br />
macht etwas „falsch“. Für Horst Seehofer<br />
und mich gelten unterschiedliche<br />
Bedingungen.<br />
Ach so. Wir machen es falsch.<br />
Horst Seehofer ist als CSU-Vorsitzender<br />
ein „Pfeiler“ der Berliner Koalition. Damit<br />
ist er in bundespolitischen Fragen anders<br />
gefordert.<br />
Foto: Stefan Thomas Kroeger/Laif<br />
44 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Politik ist<br />
eben nicht das<br />
permanente<br />
Schielen auf<br />
einen neuen Job“<br />
Niedersachsens Ministerpräsident McAllister<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 45
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Wieso eigentlich? Faktisch ist die CSU<br />
doch auch nichts weiter als ein Landesverband<br />
der CDU.<br />
Eben nicht. Die CSU ist eine eigenständige<br />
Partei. Meine Aufgabe als niedersächsischer<br />
CDU-Landesvorsitzender<br />
ist, die Bundeskanzlerin nach Kräften zu<br />
unterstützen. Das, was die Regierungskoalition<br />
richtig macht, wird von uns<br />
in Niedersachsen unterstützt. Wenn es<br />
mal unterschiedliche Auffassungen gibt,<br />
dann tragen wir das intern in den dafür<br />
zuständigen Gremien vor.<br />
Sie melden sich ja nicht einmal zu den<br />
Dingen zu Wort, die Sie stark angehen, die<br />
Energiewende zum Beispiel.<br />
Niedersachsen ist von der Energiewende<br />
so stark betroffen wie kein anderes Bundesland.<br />
Damit meine ich sowohl die<br />
damit verbundenen besonderen Herausforderungen<br />
als auch die sich daraus<br />
ergebenden Chancen. Die Energiepolitik<br />
hat für uns eine zentrale Bedeutung<br />
– allein schon wegen unserer geografischen<br />
Lage. Wir wollen, dass die<br />
Energiewende gelingt. Als eine der ersten<br />
Landesregierungen haben wir ein<br />
energiepolitisches Konzept verabschiedet.<br />
Niedersachsen ist das Land Nummer<br />
eins bei den erneuerbaren Energien.<br />
Dazu äußere ich mich quasi täglich bei<br />
jeder nur passenden Gelegenheit, nun<br />
auch im <strong>Cicero</strong>.<br />
Und Niedersachsen wird das Atomklo von<br />
Deutschland bleiben, wenn Sie weiterhin<br />
so gefügig sind.<br />
Gerade bei dem Thema Gorleben hat<br />
die Landesregierung im Zuge der Energiewende<br />
die Chance genutzt, die Endlagersuche<br />
auf eine neue Grundlage zu<br />
stellen. Die einseitige Fokussierung auf<br />
Gorleben ist vorbei. Das ist gut so! Niedersachsen<br />
hat sich sehr engagiert in der<br />
Bund-Länder-Arbeitsgruppe beteiligt.<br />
Hier sind wir bereits einen weiten Weg<br />
gegangen. Als Ministerpräsident eines<br />
Landes, das die Hauptlasten der atomaren<br />
Entsorgung zu tragen hat, fände ich<br />
es gut, wenn wir nun sehr bald zu einem<br />
Konsens kommen würden. Der Endlagersuchprozess<br />
ist ja ein Verfahren, das<br />
Jahrzehnte dauert. Dieser Prozess kann<br />
nur erfolgreich sein, wenn er auf einer<br />
breiten parlamentarischen Mehrheit beruht.<br />
Dafür werbe ich.<br />
Das heißt konkret?<br />
Beim Erkundungsstopp für Gorleben gibt<br />
es bereits einen Konsens. In einem ergebnisoffenen<br />
bundesweiten Suchprozess wird<br />
am Ende die Geologie entscheiden und<br />
nicht die Politik, welcher Standort geeignet<br />
ist oder nicht. Das gilt dann auch für<br />
Gorleben. Das Ganze muss ein transparenter<br />
Prozess sein. Im Interesse der heute<br />
und künftig betroffenen Menschen darf<br />
die abschließende Lösung der nuklearen<br />
Entsorgung nicht weiter hinausgezögert<br />
werden. Wir brauchen absehbar eine Lösung<br />
aus einem Guss. Den Versuch des<br />
Bundes, das Standortauswahlgesetz auf<br />
die Grundlage einer inhaltlichen und parteiübergreifenden<br />
Verständigung zu stellen,<br />
begrüße ich sehr. Die deutsche Politik<br />
wird auch die Frage entscheiden müssen:<br />
Ist das bisher verfolgte Konzept der Nichtrückholbarkeit<br />
des atomaren Mülls tatsächlich<br />
noch das nach wissenschaftlichen<br />
Kriterien richtige Verfahren? Oder müssen<br />
wir nicht aufgrund von Erfahrungen,<br />
die wir andernorts – beispielsweise in der<br />
Asse – gemacht haben, umdenken?<br />
Die Bundeskanzlerin hat den Umweltminis<br />
ter ja auch deshalb abberufen, weil<br />
ihr die Energiewende operativ zu zäh voranzugehen<br />
schien. Ist der <strong>Zeit</strong>plan noch zu<br />
halten, oder haben Sie Zweifel?<br />
Die Bundeskanzlerin hat die Energiewende<br />
als größte politische, wirtschaftliche<br />
und gesellschaftliche Herausforderung<br />
seit der Wiedervereinigung<br />
bezeichnet. Das hat sie nicht ohne Grund<br />
gesagt. Ohne Frage gibt es noch sehr viel<br />
zu tun. Auf der anderen Seite sollten wir<br />
bitte auch nicht alles kleinreden, was<br />
in den zurückliegenden zwölf Monaten<br />
schon alles auf den Weg gebracht wurde.<br />
Kommt es dann jetzt auf ein verlorenes<br />
Jahr nicht so an?<br />
Die Energiewende ist ein Projekt, das auf<br />
mehrere Jahrzehnte angelegt ist. Manche<br />
Kritik an einem mangelnden Tempo<br />
kann ich nachvollziehen. Aber es ist doch<br />
nicht so, dass sich die deutsche Politik<br />
seit den Beschlüssen nach Fukushima zurückgelehnt<br />
hat. Was mich in der energiepolitischen<br />
Auseinandersetzung stört,<br />
ist, dass in kaum einem Politikfeld in<br />
Deutschland von meinen politischen<br />
Mitbewerbern so geheuchelt wird wie in<br />
der Energiepolitik.<br />
Sie meinen die Grünen.<br />
Ja, ich meine die Grünen, aber zum Teil<br />
auch Sozialdemokraten. Manche sind vor<br />
Ort unredlich unterwegs. Sie sind gegen<br />
den Bau neuer fossiler Kraftwerke, gegen<br />
weitere Biogasanlagen oder gegen<br />
neue Energiespeicher-Technologien. Die<br />
Offshore-Windenergie wird zwar dem<br />
Grunde nach positiv bewertet, aber spätestens,<br />
wenn es um den erforderlichen<br />
Netzausbau geht, stellt man sich an die<br />
„Spitze der Bewegung“ und fordert Unbezahlbares<br />
– wie komplette Erdverkabelungen.<br />
In der deutschen Energiepolitik<br />
sind zu viele unterwegs, die gegen alles<br />
zugleich sind. Die Energiewende ist kein<br />
Thema einer Partei, sondern ein Projekt,<br />
das über alle Parteigrenzen hinweg<br />
gemeinsam beschlossen wurde. Das hat<br />
mir gut gefallen. An dieser Gemeinsamkeit<br />
sollten wir festhalten. Deshalb sind<br />
alle politischen Kräfte gefordert, dass die<br />
Energiewende tatsächlich ein Erfolg wird.<br />
Noch einmal zu Ihrem Politikprinzip. Sie<br />
sagen: „Ich schiele nicht nach Berlin,<br />
sondern diene meinem Land als<br />
Karikatur: Heiko Sakurai<br />
46 <strong>Cicero</strong> 8.2012
F r a u F r i e d f r a g t s i c h . . .<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
Ministerpräsident.“ Frau Kraft hat nach<br />
dem gleichen Prinzip eine gute Landtagswahl<br />
hingelegt in Nordrhein-Westfalen.<br />
Sehen Sie, so mache ich das auch.<br />
Wir haben Sie verstanden. Sie machen es<br />
wie Frau Kraft. Jetzt zwinkern Sie mit den<br />
Augen!<br />
Nochmals: Mein Platz ist in Niedersachsen.<br />
Das ist so, und das bleibt so. Ungeachtet<br />
dessen können Sie davon ausgehen,<br />
dass wir Niedersachsen sehr genau wissen,<br />
wann es darauf ankommt, in Berlin präsent<br />
zu sein.<br />
Und wenn Sie dann die Wahl auf diese<br />
Art und Weise gewinnen, haben Sie, ob<br />
Sie wollen oder nicht, den gefährlichsten<br />
Titel am Bein, den die CDU zu vergeben<br />
hat, nämlich den des Kronprinzen. Wer soll<br />
da sonst noch sein? Es ist ja keiner mehr<br />
da. Das sind dann Sie, ob Sie wollen oder<br />
nicht …<br />
Es gibt in der Union ganz viele hervorragende<br />
Köpfe und Nachwuchskräfte.<br />
Ach ja? Wen denn?<br />
Erstens mal leben wir nicht in einer Monarchie.<br />
Es gibt keine Kronprinzessin<br />
und keinen Kronprinzen.<br />
Die Antwort haben wir erwartet.<br />
Zweitens haben wir eine starke Parteivorsitzende<br />
und Kanzlerin. Und drittens<br />
sind wir ein Team.<br />
Jetzt sind wir aber gespannt.<br />
Die Mitglieder des Präsidiums, die Spitzen<br />
der Bundestagsfraktion, die Bundesminister,<br />
die Ministerpräsidenten und<br />
viele mehr.<br />
Sie führen einen Dolch in Ihrem schottischen<br />
Familienwappen. Vielleicht wollen<br />
Sie nur alle einlullen, um im richtigen<br />
Moment zuzuschlagen.<br />
Das Clan-Motto der McAllisters lautet:<br />
Fortiter in re, suaviter in modo. Hart in<br />
der Sache, aber eben gemäßigt im Umgang<br />
und im Ton. Als Generalsekretär<br />
der CDU in Niedersachsen hatte ich<br />
mal eine <strong>Zeit</strong>, in der ich frech und forsch<br />
war und auch sein musste. Das ist vorbei.<br />
Mein Stil ist jetzt ein anderer.<br />
Das Gespräch führten Hartmut Palmer und<br />
Christoph Schwennicke<br />
… ob das Leben noch<br />
Spaß macht, wenn man<br />
nichts riskiert<br />
D<br />
as Leben hat eine unangenehme<br />
Eigenschaft: Es ist lebensgefährlich.<br />
Und das empört uns. Was bildest<br />
du dir ein, Leben? Schließlich fliegen wir<br />
auf den Mond, klonen Schafe, spalten und<br />
verschmelzen Atome – da wird es doch wohl<br />
möglich sein, dir deine Risiken auszutreiben!<br />
Also checken und scannen wir dieses Leben,<br />
bevor es noch mit bloßem Auge sichtbar<br />
ist, wir prüfen und optimieren seine<br />
Qualität, damit auf jeden Fall ein<br />
gesundes Kind zur Welt kommt,<br />
das im Kindergarten Chinesisch<br />
lernen und später eine Elite-<br />
Uni besuchen kann. Damit es<br />
die <strong>Zeit</strong> bis dahin unbeschadet<br />
übersteht, setzen wir ihm<br />
einen Helm auf, sobald es das<br />
Babybett verlässt, packen es in<br />
monströse Schutzmonturen und<br />
transportieren es in TÜV‐geprüften, bruchfesten Kindersitzen. Wir schließen<br />
sämtliche Versicherungen für Schadensfälle von Arbeitslosigkeit bis Zahnausfall<br />
ab und wiegen uns in der Illusion, damit seien wir vor den Unwägbarkeiten des<br />
Schicksals geschützt.<br />
Alles in unserem Leben muss optimal laufen. Bloß keine <strong>Zeit</strong> verlieren, und<br />
vor allem kein Risiko eingehen. Wir programmieren unser Navi, um so schnell wie<br />
möglich den nächstgelegenen Briefkasten zu finden, checken Hunderte von Gästebewertungen,<br />
bevor wir ein Hotel buchen, und vergewissern uns, dass vor uns<br />
680 Kunden diese Kaffeemaschine gekauft und nicht nach einer Woche aus dem<br />
Fenster geworfen haben. Wir rennen zu Vorsorgeuntersuchungen von Organen,<br />
deren Existenz uns unbekannt war, und entdecken dabei Auffälligkeiten, die besser<br />
unentdeckt geblieben wären, weil sie uns nie beeinträchtigt hätten. Wir sind so<br />
besessen von dem Wahn, jede potenzielle Gefahr auszuschalten, dass wir wohl bald<br />
nicht mehr das Haus verlassen, ohne den aktuellen Meteoritenflugbericht zu lesen.<br />
Früher haben wir uns ins Auto gesetzt und sind einfach losgefahren. Haben<br />
irgendwo gegessen, irgendwo übernachtet, sind irgendwo angekommen. Mal war’s<br />
toll, mal nicht so, aber jeden Moment konnte etwas passieren. Das Leben war<br />
so, wie es sein sollte: unberechenbar und deshalb lebendig. Heute setzen wir alles<br />
daran, dem Leben seine Lebendigkeit auszutreiben. Bevor wir riskieren, schlecht<br />
zu essen oder eine Nacht in einem miesen Hotel zu verbringen, bleiben wir lieber<br />
zu Hause und googeln ein paar Krankheiten, die uns womöglich befallen könnten.<br />
Am Ende besitzen wir alle die optimale Kaffeemaschine und werden dank<br />
exzessiver Vorsorge sehr alt. Aber wir werden uns dabei furchtbar langweilen.<br />
Amelie Fried ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über<br />
Männer, Frauen und was das Leben sonst noch an Fragen aufwirft<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 47
| B e r l i n e r R e p u b l i k | G e w a l t e n t e i l u n g<br />
Die Ruhe der Getriebenen<br />
Das Bundesverfassungsgericht wird von Politik und Märkten unter <strong>Zeit</strong>druck<br />
gesetzt. Es widersetzt sich zu Recht und gibt der Vernunft wieder Raum<br />
von Udo Di Fabio<br />
E<br />
s rauscht im Blätterwald, weil<br />
ein Gericht den ESM/Fiskalpakt<br />
nicht innerhalb von Stunden<br />
prüft, sondern für eine Entscheidung<br />
Tage und Wochen braucht.<br />
Regierungsvertreter warnen vor den Folgen<br />
einer solchen Verzögerung – schließlich<br />
wurde die Ausfertigung der Zustimmungsgesetze<br />
durch den Bundespräsidenten angehalten.<br />
Was werden die nervösen Märkte<br />
tun? Journalisten dagegen feiern das Gericht<br />
für seine Courage, auch im Eilverfahren<br />
sich <strong>Zeit</strong> für eine Rechtsprüfung zu<br />
nehmen: endlich kein Durchwinken also.<br />
Wie kommt es, dass nicht so sehr der sachliche<br />
Ausgang des Verfahrens eigentlicher<br />
Gegenstand der Erörterung ist, sondern der<br />
triviale Hinweis des Gerichts eine große<br />
Nachricht wird, sich die für den Fall erforderliche<br />
<strong>Zeit</strong> zu nehmen?<br />
Der Hinweis auf <strong>Zeit</strong>druck ist nicht<br />
nur Vorwand. Behaupteter <strong>Zeit</strong>druck<br />
kann aber auch ein Herrschaftsmittel sein,<br />
genauso wie das früher gepflegte „Aussitzen“<br />
einer Sache. Die <strong>Zeit</strong> wird zu einem<br />
Instrument der Macht, wenn derjenige,<br />
der zu rascher Entschließung fähig ist, andere<br />
unter <strong>Zeit</strong>not setzt, die langsamer getaktet<br />
sind. Europäische Krisengipfel oder<br />
internationale Krisenreaktionen gelten als<br />
Stunde der Exekutive. Hier trifft man sich,<br />
bleibt so lange zusammen, bis etwas vereinbart<br />
ist, und zwar unter dem sachlichen<br />
Druck eines Problems, das nach rascher<br />
Lösung ruft. Die Öffentlichkeit, die<br />
Parlamente, ja sogar die Ministerialverwaltungen<br />
und erst recht die Gerichte brauchen<br />
viel mehr <strong>Zeit</strong>, sie alle sind schon deshalb<br />
meist zum Nachvollzug verurteilt. Je<br />
mehr die übernational verhandelnden Regierungsvertreter<br />
unter <strong>Zeit</strong>druck geraten<br />
und ihn zugleich erzeugen, desto weniger<br />
Bürger können ihnen folgen – ein Problem<br />
für die Demokratie.<br />
Die zeitliche Überlegenheit der Exekutive<br />
im System der Gewaltenteilung<br />
ist natürlich altbekannt. Im Abstand von<br />
100 Jahren kann im Ausbruch des Ersten<br />
Weltkriegs eine Dynamik beobachtet<br />
werden, die öffentliche Meinung und<br />
Parlamente, Beamte und Diplomaten außen<br />
vor ließ, während die Stäbe des Militärs<br />
mit ihren Plänen der Mobilmachung<br />
und des Truppenaufmarschs das Geschehen<br />
beherrschten und die Diplomatie an<br />
den Rand drängten. Deutschland wollte<br />
1914 nicht um jeden Preis den Krieg, es<br />
hatte gute Gründe, ihn zu fürchten. Aber<br />
seine schlechte geostrategische Lage zwang<br />
zu besonderer Eile, erst im Westen erfolgreich<br />
schlagen und dann sich dem russischen<br />
Heer entgegenstellen, bevor die<br />
maritime Überlegenheit Englands den Mittelmächten<br />
die Luft zum Atmen nimmt.<br />
Aus einem sachlichen militärstrategischen<br />
Problem entsteht <strong>Zeit</strong>druck, der in anderen<br />
Hauptstädten damals mit anderen Erwägungen<br />
ähnlich herrschte, und die Ökonomie<br />
der <strong>Zeit</strong> drückt dann auf eine womöglich<br />
noch offene Sachentscheidung.<br />
Der <strong>Zeit</strong>druck der Mobilmachung und<br />
die sofort unter Beweis zu stellende Bündnistreue<br />
haben damals den Weg in den<br />
Krieg kräftig verbreitert. Es gibt einen engen<br />
Zusammenhang zwischen der Mechanik<br />
des <strong>Zeit</strong>drucks und der sachlichen Entscheidung:<br />
ein „Sach-<strong>Zeit</strong>-Kontinuum“,<br />
das mit dem Raum-<strong>Zeit</strong>-Kontinuum Einsteins<br />
die Relativität der Bestimmungsfaktoren,<br />
ihre Abhängigkeit voneinander gemein<br />
hat.<br />
Die europäische Staatsschuldenkrise<br />
ist ein Musterbeispiel für ein solches Sach-<br />
<strong>Zeit</strong>-Kontinuum. Staatsschulden besitzen<br />
schon von ihrer Natur her eine ausgeprägte<br />
<strong>Zeit</strong>dimension, die allerdings gerne unterschätzt<br />
wird, weil sie in einer längerwelligen<br />
Amplitude verläuft. Der Staat<br />
verschafft sich Finanzmittel zu Marktbedingungen,<br />
er borgt sich damit für die Gegenwart<br />
Handlungsfreiheit von anderen,<br />
die er später durch eine Einschränkung seiner<br />
Handlungsmöglichkeiten zurückführen<br />
muss. Eine Situation wechselseitigen<br />
Karikatur: Heiko Sakurai<br />
48 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: privat (Autor)<br />
Vorteils entsteht gleichwohl, wenn mit<br />
ausreichend hohem Zins und geringem<br />
Ausfallrisiko die Sache für den Kreditgeber<br />
interessant wird und auf der Seite des<br />
Kreditnehmers das geliehene Geld insofern<br />
sinnvoll investiert wird, als dass bei ihm<br />
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in<br />
der Zukunft mehr Reichtum entsteht, aus<br />
dem dann die Kredite ohne spürbare Freiheitseinbuße<br />
aus den Überschüssen beglichen<br />
werden können.<br />
Kredite erzeugen aber wegen derartiger<br />
Zusammenhänge sofort <strong>Zeit</strong>druck, weil<br />
beide Seite daran interessiert sein müssen,<br />
dass zum Fälligkeitstermin der Schuldner<br />
leistungsfähig ist, und dafür muss vor allem<br />
der Kreditnehmer mehr tun, als es ohne<br />
Verschuldung nötig wäre. Die Währungsunion<br />
war insofern für leistungsschwächere<br />
Mitgliedstaaten, die vorher Probleme<br />
hatten, sich an den Anleihemärkten<br />
zu finanzieren, vor allem eine große Gefahr.<br />
Das nunmehr viel leichter fließende<br />
Geld konnte konsumtiv verbraucht oder<br />
mit konjunkturellen Strohfeuern verbrannt<br />
werden und dadurch die Illusion von rasch<br />
wachsendem Wohlstand erzeugen, während<br />
in Wirklichkeit die steigende Kreditaufnahme<br />
einen ungeheuren <strong>Zeit</strong>druck<br />
für Reformen setzte, die auf eine tragfähige<br />
Haushaltswirtschaft und auf eine steigende<br />
Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften<br />
drängte.<br />
Diese lange <strong>Zeit</strong>amplitude, die aus jedem<br />
großen Kredit folgt, ist seit der drohenden<br />
Insolvenz Griechenlands durch<br />
eine wesentlich kürzer schwingende Amplitude<br />
der Liquiditätsengpässe fast in den<br />
Hintergrund gerückt. Wer am Rand der<br />
Insolvenz steht, braucht Geld und immer<br />
nur frisches Geld, sonst droht eine Zäsur.<br />
Die Länder der Eurozone haben Griechenland<br />
und anderen bislang das Geld gegeben,<br />
das misstrauisch gewordene Märkte<br />
verweigerten.<br />
Der Einstieg in eine solche gemeinsame<br />
Staatsfinanzierung, die nach Buchstaben<br />
und Geist der europäischen Verträge<br />
an sich untersagt ist, weil sonst die Währungsunion<br />
„auf Dauer“ (also wiederum<br />
eine leicht zu übersehende lang schwingende<br />
Amplitude) nicht funktionieren<br />
kann, gelang über ein <strong>Zeit</strong>argument, das<br />
schnell wie eine alternativlose Sachkonstellation<br />
wirkte. Zuerst wurde gesagt, man<br />
kaufe nur <strong>Zeit</strong>, damit kein Super-Lehman-<br />
Desaster entstehe, weil ja doch so große<br />
unbekannte Risiken in Kreditausfallversicherungen<br />
für griechische Staatsanleihen<br />
schlummerten. Wer hat eigentlich je nachgeprüft,<br />
ob solche Argumente stimmen?<br />
Die ansonsten pfeilschnellen Banken und<br />
Märkte brauchten plötzlich <strong>Zeit</strong>, um ihre<br />
Investments umzuschichten, um die drohende<br />
hellenische Insolvenz einzupreisen<br />
und abzufedern. Ja und was ist jetzt, wo seit<br />
zwei ganzen Jahren Umschichtungen und<br />
„Haircuts“ stattgefunden haben? Wie viel<br />
<strong>Zeit</strong> braucht denn eigentlich „der Markt“,<br />
und wie viel <strong>Zeit</strong> braucht eigentlich Griechenland,<br />
um endlich zu reformieren und<br />
seine Steuern einzutreiben? Oder hat vielleicht<br />
die griechische Steuerverwaltung einfach<br />
nur größere rechtliche Skrupel, illegale<br />
Steuer-CDs zu erwerben?<br />
Es besteht der dringende Verdacht,<br />
dass das <strong>Zeit</strong>argument „überfällige“ Sachentscheidungen<br />
verhindert. Es besteht der<br />
Verdacht, dass aktionistische Szenarien grell<br />
ausgeleuchtet auf die Bühne gebracht werden,<br />
damit langfristige Sach- und <strong>Zeit</strong>zusammenhänge<br />
in den Schatten geraten.<br />
Dahinter steht das große Thema der modernen<br />
westlichen Welt: Kann auf Dauer<br />
eine Gesellschaft zusammenhalten, die wesentliche<br />
Leistungen wie die Wirtschaft,<br />
die Wissenschaft, das Recht und auch die<br />
Politik spezialisiert und diese Bereiche nach<br />
eigenen Sachgesetzen und jeweils eigenem<br />
<strong>Zeit</strong>rhythmus sich entfalten lässt?<br />
Die moderne Gesellschaft sucht nach der<br />
einen Vernunft und findet viele Rationalitäten.<br />
Die Welt des Kaufmanns unterscheidet<br />
sich von der des Wissenschaftlers, die<br />
Politikerin denkt anders als die Erzieherin,<br />
bei Journalisten sind Takt und Tempo anders<br />
als bei Juristen. Seit einigen Jahren<br />
kommt es zu bemerkenswerten Reibungen<br />
zwischen sozialen Welten, die sich voneinander<br />
entfernt haben und dann doch wieder<br />
– allerdings nunmehr als Fremde – sich<br />
sehr nahegerückt sind: Finanz- und Realwirtschaft,<br />
Politik und Anleihemärkte, Gerichte<br />
und Parlamente, internationale Organisationen<br />
und Nationen.<br />
Die Neuzeit – deshalb der Name – hat<br />
sich vor 500 Jahren auf der <strong>Zeit</strong>achse erfunden:<br />
Dynamik, Mobilität und Fortschritt<br />
sind ihre Fanfarenstöße. Aber der<br />
Westen kann nur offen und fortschrittlich<br />
bleiben, wenn er aus dem Gefängnis<br />
des kurzfristigen <strong>Zeit</strong>drucks ausbricht: Im<br />
Blick auf die langfristigen Bedingungen<br />
einer ausgewogenen Sozialordnung muss<br />
er viel wachsamer und aktiver werden, zugleich<br />
aber im Blick auf die vordergründigen<br />
Bestimmungsfaktoren viel kühler<br />
und besonnener reagieren. Wachstumsschwächen<br />
kann aushalten, wer sofort mit<br />
der Arbeit an der Gesundung der Wirtschaft<br />
beginnt, anstatt mit Deficit Spending<br />
sich erneut an Strohfeuern zu wärmen<br />
oder andere zur Begleichung eigener<br />
Rechnungen ultimativ, weil unter <strong>Zeit</strong>druck<br />
aufzufordern.<br />
Weltfinanzkrise und Schuldenkrise erzeugen<br />
nicht nur Reibungen, sondern offenbaren<br />
regelrechte Friktionen: Wie zusammenstoßende<br />
Kontinente schlagen<br />
Sachzwänge und Logik des einen Bereichs<br />
in den anderen hinein, wirken zurück und<br />
fügen Unvereinbares zu einem gemeinsamen<br />
Schicksal zusammen. Die arbeitsteilig<br />
auseinanderstrebende Gesellschaft kommt<br />
sich so wieder gefährlich nahe, einfache Zusammenhänge<br />
wirken mächtig in undurchsichtigen<br />
künstlichen Gebilden: so wie der<br />
sehr einfache Mechanismus der amerikanischen<br />
oder spanischen Immobilienkrise<br />
im Weltfinanzsystem. Ein amerikanisches<br />
Rentnerehepaar wird über ein paar Organisationsschritte<br />
hinweg zu einem winzig<br />
kleinen Baustein eines riesigen Hedgefonds,<br />
der wiederum von kühnen Strategen mit<br />
ihrem ausgeprägten Renditekalkül gesteuert<br />
wird, die aber doch abhängig bleiben<br />
von Konjunkturen oder der Unberechenbarkeit<br />
politischer Entscheidungen.<br />
In einer Weltgesellschaft, die wirtschaftliche<br />
Rationalität zu ihrem eigentlichen<br />
geistigen Zentrum gemacht hat, ist<br />
jeder auf seinen Vorteil aus. Auf Dauer<br />
funktioniert aber auch die Wirtschaftsgesellschaft<br />
nur, wenn sie den Boden einer<br />
Vernunft der bürgerlichen Solidität und Eigenverantwortung<br />
nicht zerstört. Es geht<br />
um die Erhaltung einer Freiheit, die nicht<br />
auf eine isolierte Existenz, sondern auf aktive<br />
Bindungsfähigkeit zielt, einer Kultur<br />
also, aus der alles an Solidarität und Rücksichtnahme<br />
wächst, was eine humane Gesellschaft<br />
ausmacht. Wir sollten gerade in<br />
der Krise uns die <strong>Zeit</strong> nehmen, über diese<br />
sachlichen Zusammenhänge zu reden.“<br />
Udo Di Fabio<br />
ist Professor für öffentliches Recht<br />
an der Universität Bonn. Er war<br />
von 1999 bis 2011 Richter am<br />
Bundesverfassungsgericht<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 49
| B e r l i n e r R e p u b l i k | K o m m e n t a r<br />
Deutschland<br />
wird deutscher<br />
Die späte Seligsprechung des<br />
Reformkanzlers Schröder folgt<br />
perfiden Motiven<br />
Von Frank A. Meyer<br />
W<br />
as für ein Satz! „Wir waren auch schon mal der<br />
‚kranke Mann Europas‘, und zwar vor den Arbeitsmarktreformen<br />
des damaligen Kanzlers Gerhard<br />
Schröder.“ Zitiert hat ihn der Spiegel; gesagt hat ihn Günther<br />
Oettinger, einst CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg,<br />
heute EU‐Kommissar für Energie in Brüssel.<br />
Man könnte diesen Satz durchaus polemisch interpretieren.<br />
Zum Beispiel so: „Liebe Kanzlerin, spiel dich nicht so auf in Europa,<br />
denn du profitierst doch bloß von den Reformen deines<br />
Vorgängers.“<br />
So hat es der liebenswert-seriöse Parteifreund natürlich nicht<br />
gemeint. Doch dokumentiert er als unverdächtiger Zeuge, was<br />
derzeit gerade im Schwange ist: Schröder war’s. Er hat Deutschland<br />
krisenfest gemacht.<br />
War er’s? Nach Meinung von konservativen und rechten<br />
Blättern, von der Frankfurter Allgemeinen über die <strong>Zeit</strong> bis zu<br />
Springers Welt: Ja, er war’s.<br />
So ist beispielsweise aus der Feder von Ulf Poschardt (Die<br />
Welt), dem Etagenkellner aller Neoliberalen, zu lesen: „Die positiven<br />
Impulse aus dieser Reformzeit wirken fort.“ Und der<br />
transatlantische Titan Josef Joffe (Die <strong>Zeit</strong>) empfiehlt die Schröder-Medizin<br />
auch den Franzosen: „Ohne eine blau-weiß-rote<br />
Agenda 2015 wird Frankreich nicht gesunden.“<br />
So tönt es allenthalben durch die Republik: „Lob für Gerhard<br />
Schröder“ oder „Das deutsche Jobwunder macht die Hartz-<br />
Reformen zum Vorbild für ganz Europa“ (beides: FAZ). Auch<br />
außerhalb von Deutschland wird der Lobgesang angestimmt:<br />
Die Ironie der Wahl von François Hollande bestehe darin, „dem<br />
Beispiel der letzten Mitte-Links-Regierung des deutschen Kanzlers<br />
Gerhard Schröder zu folgen“ (Wall Street Journal).<br />
Patrons und Banker und Publizisten entdecken ihr Herz für –<br />
ja für wen eigentlich? Für den „Brioni“- und den „Basta“-Schröder,<br />
für den „Sozi“, den sie vor acht Jahren mit allen Mitteln der<br />
Polemik und Demagogie schmähten!<br />
Die Springer-Medien betrieben das Schröder-Bashing so<br />
blindwütig, dass sich der damalige Chefredakteur der Welt am<br />
Sonntag, Christoph Keese, in einem Interview – statt als journalistischer<br />
Handwerker – als politischer Propagandist outete:<br />
„Wir, die Minderheit der Neoliberalen, schreiben seit Jahren<br />
gegen eine Mehrheit von Menschen an, die vehement gegen Kapitalismus<br />
und freie Marktwirtschaft eintreten.“<br />
Nicht nur der Springer-Verlag verkam zur politischen Propaganda-Bude.<br />
Auch der Spiegel, da noch unter Stefan Aust, reihte<br />
sich in die Kampagne derer ein, die Gerhard Schröder samt Rot-<br />
Grün vom Hof jagen wollten. Federführer war Gabor Steingart,<br />
seinerzeit Spiegel-Bürochef in Berlin, heute Chefredakteur des<br />
Handelsblatts.<br />
Mit dem inquisitorischen Eifer eines Savonarola errichtete<br />
Steingart nahezu wöchentlich neue Scheiterhaufen: „Rot-<br />
Grün stolpert mit schludrigen Reformkonzepten in den Herbst.“<br />
„Schröder-Truppe sprunghaft, verworren, konzeptlos.“ „Durch<br />
gezielte Unwahrheiten versuchen der Kanzler und seine Getreuen<br />
ihre prekäre Ausgangslage zu verbessern.“ „Der SPD-<br />
Kanzler bekommt das zentrale Problem des Landes nicht in den<br />
Griff.“ Und mit ätzender Häme: „Historisch – das ist des Kanzlers<br />
Lieblingseigenlob.“<br />
Inzwischen gelten die Schröder-Reformen in der Tat als „historisch“<br />
– sie wurden zur Grundlage des aktuellen deutschen<br />
Erfolgs. Auch erzkonservative Blätter empfehlen das „schludrige<br />
Reformkonzept“ zur Nachahmung in ganz Europa, um „das<br />
zentrale Problem des Kontinents“ in den Griff zu kriegen.<br />
Es war eine journalistisch dürftige Epoche, die Spätzeit<br />
von Kanzler Schröder. Es war die <strong>Zeit</strong> von ARD-Christiansen,<br />
die, unbedarft, aber wirkmächtig, allsonntäglich zum<br />
Talk-Gericht über Rot-Grün lud. Ihr Spiel lief nach der perfiden<br />
Anleitung: Deutschland schlechtreden, um die Regierung<br />
schlechtzumachen.<br />
Zu diesem Power-Game lieferte Spiegels Steingart das Programm<br />
in Buchform. Es hieß: „Deutschland – der Abstieg eines<br />
Superstars“.<br />
Jetzt ist Deutschland Superstar. Dank der Regierung von damals.<br />
Die Seligsprechung von Gerhard Schröder ist in vollem<br />
Gange.<br />
Und nun? Übt man journalistische Selbstkritik? In der Welt?<br />
In der FAZ? Im Spiegel? So etwas ist in unserem Metier nicht<br />
vorgesehen. Jedenfalls nicht in Deutschland. Ganz im Gegenteil:<br />
Schon wird zur nächsten Jagd geblasen, als Auftakt für das<br />
Wahljahr 2013. Allen voran – wie ehedem – Die Welt, die FAZ.<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
50 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Gegen wen geht’s diesmal? Gegen die „Sozis“ – gegen wen<br />
denn sonst?<br />
Den schrillen Ton hat Dorothea Siems in der Welt vorgegeben:<br />
„Sollten sich die Sozialdemokraten vor den Karren<br />
der Reformgegner spannen lassen, grenzte dies an<br />
Vaterlandsverrat.“<br />
Seitdem wird den Genossen systematisch der Marsch geblasen:<br />
„Angela Merkel hat auf dem EU‐Gipfel weitere rote Linien<br />
geräumt. Und die deutschen Sozialdemokraten halfen kräftig<br />
mit, Deutschlands Position zu schwächen“, so ebenfalls die Welt.<br />
Deren Herausgeber Thomas Schmid singt voller Inbrunst<br />
mit: „Zu Merkels Schwäche haben nicht nur Mario Monti und<br />
François Hollande, sondern auch SPD und Grüne beigetragen.“<br />
Den „Sozis“ ist einfach nicht zu trauen, was Deutschland<br />
betrifft – was die Heimat betrifft. Sie sind eben „vaterlandslose<br />
Gesellen“. So wurden sie einst in der wilhelminischen Monarchie<br />
diffamiert. So wurden sie auch in der Bundesrepublik schon<br />
diffamiert – zum Beispiel Willy Brandt wegen seiner Vergangenheit<br />
als norwegischer Offizier im Kampf gegen die Nazis.<br />
Nun also ein neuer Fall von sozialdemokratischem Vaterlandsverrat:<br />
mitten in der Europäischen Union! Da muss natürlich<br />
auch die Marktradikale Heike Göbel von der FAZ mit einstimmen.<br />
Unter dem sinnigen Titel „Was die SPD tut“ wirft sie<br />
den Sozialdemokraten vor, durch ihre Forderung nach einem<br />
Wachstumspaket für Europa unserer Kanzlerin den „starken innenpolitischen<br />
Rückhalt“ verweigert zu haben.<br />
1914 schnarrte Kaiser Wilhelm II: „Ich kenne keine Parteien<br />
mehr, ich kenne nur noch Deutsche!“ Die Sozialdemokraten<br />
hatten soeben den Kriegskrediten zugestimmt – dem<br />
Monarchen also den starken innenpolitischen Rückhalt nicht<br />
verweigert.<br />
Das sollen sich die Genossen doch bitte endlich mal hinter<br />
die Ohren schreiben: Im Ringen um Euro und Europa kennen<br />
wir keine Partei mehr, nur noch Deutsche!<br />
So ist denn angerichtet für den Wahlkampf 2013:<br />
deutsch-national.<br />
Denn: „Europa greift nach unserem Geld“, wie die Welt am<br />
Sonntag alle wahren Patrioten mit riesengroßer Schlagzeile anfixte.<br />
Wer wollte es da wagen, eine abweichende Meinung auch<br />
nur zu äußern: etwa darauf hinweisen, dass auch Frankreich<br />
und – man glaubt es kaum – sogar Italien happig für hilfsbedürftige<br />
EU-Nationen haften und zahlen?<br />
Wer wollte da zum Opfer der publizistisch subtil eingefädelten<br />
neuen Dolchstoßlegende werden?<br />
Ja, das Klima wird gerade vergiftet. Durch Populismus<br />
ohne Populistenführer – mit Publizistenführern stattdessen.<br />
Wofür Angela Merkel selbstverständlich nichts kann. Was sie<br />
aber durchaus in Kauf nimmt, wenn es ihr hilfreich erscheint.<br />
Widerworte aus dem Kanzleramt waren bis dato keine zu<br />
vernehmen.<br />
Deutschland wird deutscher.<br />
Anzeige<br />
Neue Serie:<br />
»Gesund essen«<br />
Die meisten Menschen wissen recht genau,<br />
was gesunde Ernährung ist. Im stressigen<br />
Berufs- und Familienalltag klappt es aber<br />
oft trotzdem nicht. ZEIT WISSEN erklärt, wie<br />
es gelingen kann, sich auf unkomplizierte<br />
Weise im Alltag gut zu ernähren. Mit zahlreichen<br />
Tipps.<br />
Neue Serie: »Gesund essen«<br />
Jetzt am Kiosk!<br />
Weitere Folgen ab dem 9. Oktober.<br />
Neue<br />
Serie<br />
Foto: privat<br />
Frank A. Meyer<br />
ist Journalist und Gastgeber der politischen<br />
Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 51
| W e l t b ü h n e<br />
Der Strippenzieher<br />
Wer geglaubt hatte, Tarcisio Bertone sei am Ende, irrt: Der Papst hält an seinem Kardinalstaatssekretär fest<br />
von Martin Zöller<br />
E<br />
S war ein typischer Bertone-Termin.<br />
Einer, von dem er wohl<br />
selbst weiß, dass einige im Vatikan<br />
wieder die Augen rollen werden. Kurz<br />
vor der Sommerpause bekam Kardinal Tarcisio<br />
Bertone, der zweitwichtigste Mann im<br />
Vatikan, Besuch vom deutschen Botschafter<br />
am Heiligen Stuhl und von einem Vertreter<br />
von Mercedes-Benz. Die beiden Herren<br />
hatten ein Geschenk dabei: das Modell<br />
eines Formel-1-Mercedes. Ein netter Gag,<br />
ein Insiderwitz unter Vatikan-Besuchern,<br />
steht doch in Bertones Empfangszimmer<br />
im Apostolischen Palast bereits ein rotes<br />
Ferrari-Modell, dessen Bedeutung für die<br />
vatikanische Diplomatie nicht hoch genug<br />
einzuschätzen ist. Der Ferrari dient als Eisbrecher<br />
zwischen Gastgeber und Gast. Ein,<br />
zwei lockere Sprüche über das Automodell,<br />
bevor es etwa um das Verhältnis von Kirche<br />
und Staat in Guatemala geht.<br />
Für eine lockere Gesprächsatmosphäre<br />
sorgen, einen Witz machen. Es gibt viele<br />
im Vatikan, die dies als eine herausragende<br />
Fähigkeit Bertones anerkennen –<br />
und ebenso viele, die dies für seine einzige<br />
Fähigkeit halten. War es schon bislang<br />
eine regelrechte Manie einiger Kurialer,<br />
bei jeder Gelegenheit über Tarcisio Bertone<br />
herzuziehen, ist seit der Veröffentlichung<br />
geheimer Vatikan-Dokumente<br />
daraus offenbar ein regelrechter Kampf<br />
gegen den 77-Jährigen geworden: Der<br />
Kardinal soll vor den Augen der Welt als<br />
unfähig dargestellt werden. Immer häufiger<br />
sieht sich der Papst genötigt, Bertone<br />
demonstrativ das Vertrauen auszusprechen:<br />
Zum 75. Geburtstag vor zwei<br />
Jahren, dann 2012 bereits Ende Januar,<br />
Ende Mai und zuletzt am 2. Juli in einem<br />
öffentlichen Brief. Dass Benedikt XVI vor<br />
dem Sommer noch Ruhe geschaffen hat,<br />
begrüßen viele im Vatikan. Dass damit<br />
Bertones Abschied in weite Ferne gerückt<br />
ist, weniger. Denn: Unter Druck macht<br />
Benedikt XVI gar nichts. Erst recht nicht<br />
gegen einen Mitarbeiter, an dem er vor allem<br />
eins schätzt: seine Loyalität.<br />
Als Tarcisio Bertone im Juni 2006 von<br />
seinem Amt als Erzbischof von Genua nach<br />
Rom ins Amt des Kardinalstaatssekretärs<br />
berufen wurde, schien dies eine gute Idee<br />
zu sein: ein erdverbundener, humorvoller,<br />
jovialer zweiter Mann als Gegenpol zum<br />
zurückhaltenden Deutschen, der wenig<br />
Lust auf große Reisen hatte und es sich<br />
zum Inhalt des Pontifikats machen wollte,<br />
den Glauben zu vertiefen. Schließlich hatte<br />
doch die Zusammenarbeit der beiden in<br />
der Glaubenskongregation schon gut funktioniert.<br />
Doch im Maschinenraum des Vatikans,<br />
dem Staatssekretariat, war man von<br />
dem Wechsel vom hochpolitischen Kardinal<br />
Angelo Sodano zum leutseligen Bertone<br />
wenig erfreut. Der Vorwurf lautete:<br />
Bertone reise zwar als eine Art zweiter Papst<br />
über die Kontinente und spiele dort auch<br />
Papst – allerdings mit dem einzigen Ziel,<br />
„bella figura“ zu machen.<br />
Während diese wachsende Selbstgefälligkeit<br />
die bedeutendsten Kardinäle<br />
mit vielen weltlichen Ministern und Regierungschefs<br />
verbindet, hat Tarcisio Bertone<br />
im Laufe seiner Amtszeit auch in der<br />
Sache nicht immer eine glückliche Hand<br />
bewiesen. Nachhaltig geschadet hat er dem<br />
Pontifikat durch die Lässigkeit der Behandlung<br />
des Falles Richard Williamson: Weder<br />
fielen ihm die Holocaust-Leugnungen<br />
auf noch hielt er es für erforderlich, den<br />
ohnehin schon kritischen Schritt der Annäherung<br />
an die Piusbrüder ausführlich<br />
zu erläutern. Als Benedikt XVI bereits in<br />
größten Schwierigkeiten steckte, war von<br />
Bertone wenig zu sehen.<br />
Und auch sonst gibt es genug Baustellen:<br />
Der mühsam gesponnene Faden zur<br />
Volksrepublik China ist mittlerweile abgerissen;<br />
ein Streit zwischen Irland und dem<br />
Vatikan wurde in aller Öffentlichkeit ausgetragen;<br />
mit der italienischen Bischofskonferenz<br />
liegt Bertone im Clinch, weil er alles,<br />
was Italien betrifft, am liebsten selbst regeln<br />
will. Und positive Initiativen? Vatikan-Beobachter<br />
bemängeln, dass der Vatikan<br />
zu ganz wesentlichen Fragen wie etwa<br />
der Krise der europäischen Idee im Zuge<br />
der Schuldenkrise wenig beizutragen hat.<br />
Bei aller Sympathie für Benedikt sagen<br />
auch papsttreue Journalisten in Rom: „In<br />
zehn Jahren wird man bei einem Rückblick<br />
auf diesen Papst sagen: Bertone war ein<br />
Schwachpunkt des Pontifikats.“<br />
Schließlich gibt es auch strukturelle<br />
Gründe für die massive Kritik, die Bertone<br />
entgegenschlägt: Unter Benedikt XVI und<br />
der Regierung Bertones wurden viele Vatikan-Karrieren<br />
auf ein Nebengleis gelenkt:<br />
Während vor Benedikt die Nuntien in aller<br />
Welt damit rechnen konnten, nach ihrem<br />
Dienst im Ausland in verantwortungsvolle<br />
Posten im Vatikan zu kommen, idealerweise<br />
in der Verantwortung eines Dikasteriums<br />
(vergleichbar einem Ministeramt),<br />
setzt Benedikt XVI in der Personalauswahl<br />
andere Schwerpunkte: Leiter von Dikasterien<br />
werden Kandidaten aus der Praxis.<br />
Bertone ist so möglicherweise zum Blitzableiter<br />
ehrgeiziger Diplomaten geworden,<br />
die sich insgeheim über den Papst empören.<br />
Tarcisio Bertone lässt sich jedenfalls<br />
nicht aus der Ruhe bringen. Verglichen mit<br />
dem, was Kardinälen in der Renaissance<br />
von ihren Kollegen widerfahren ist, ist „Vatileaks“<br />
harmlos. Benedikt XVI wünschte<br />
ihm vor dem Sommer die Fürsprache der<br />
Jungfrau Maria und der Apostel Petrus und<br />
Paulus. Ob das seine Gegner abschrecken<br />
wird? Auch wenn Bertone erneut das Vertrauen<br />
des Papstes erlangt hat: Die Kritik<br />
an ihm macht wohl nur erzwungenermaßen<br />
Sommerpause.<br />
Martin Zöller<br />
hat jahrelang für die ARD und<br />
deutsche Tageszeitungen über den<br />
Vatikan und italienische Politik<br />
berichtet<br />
Fotos: Polaris/laif, Pivat (Autor)<br />
52 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Der Vorwurf<br />
lautete:<br />
Bertone reise<br />
zwar als eine<br />
Art zweiter<br />
Papst über die<br />
Kontinente –<br />
allerdings mit<br />
dem einzigen<br />
Ziel, „bella<br />
figura“ zu<br />
machen<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 53
| W e l t b ü h n e<br />
Pragmatiker der Macht<br />
Burmas Präsident Thein Sein wird als Wegbereiter einer Demokratisierung seines Landes gefeiert – zu Recht?<br />
von Sascha Zastiral<br />
E<br />
S ist noch gar nicht lange her, da<br />
galt Myanmar als hoffnungsloser<br />
Fall: ein von zahlreichen Bürgerkriegen<br />
zerrissener, wirtschaftlich desolater<br />
Staat, fest im Würgegriff seiner brutalen wie<br />
korrupten Generäle. Ein Land, in dem die<br />
meisten Menschen keinen Stromanschluss<br />
hatten, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung,<br />
von politischen Freiheiten ganz zu<br />
schweigen. Myanmar, so schien es, war aus<br />
der <strong>Zeit</strong> gefallen.<br />
Dann tauchte ein Mann auf, der auf<br />
der Weltbühne fast unbekannt war: Thein<br />
Sein. Der unscheinbare Karriereoffizier, ein<br />
schmächtiger Mann, Mitte 60, mit Glatze<br />
und runder Brille, legte seine Generalsuniform<br />
ab und wurde im vergangenen März<br />
der erste zivile Präsident des Landes seit<br />
50 Jahren. Kurz danach setzten Reformen<br />
ein, die selbst die zuversichtlichsten Optimisten<br />
verblüfft haben.<br />
Als Architekt dieser Veränderungen gilt<br />
Thein Sein. Er soll, so heißt es, eine Gruppe<br />
von Reformern anführen, die den politischen<br />
Wandel vorantreiben und dabei hinter<br />
den Kulissen mit den Hardlinern des alten<br />
Regimes um die Vorherrschaft kämpfen.<br />
Aber stimmt dieses Bild?<br />
Akzente in der Politik seines Landes setzt<br />
Thein Sein seit 2007, als ihn der damalige<br />
Gewaltherrscher Than Shwe zum Premierminister<br />
der Militärjunta ernennt. 2009 reist<br />
er nach New York und verteidigt vor der<br />
UN-Vollversammlung das Militärregime<br />
und dessen „Fahrplan zu einer disziplinierten<br />
Demokratie“. Den Diplomaten fällt er<br />
als ruhiger, aber überzeugender Gesprächspartner<br />
auf.<br />
In Myanmar gilt Thein Sein als loyaler<br />
Untergebener, der mehr von einem Bürokraten<br />
hat als von einem Krieger und der sich<br />
nie in den Vordergrund drängt. Damit war<br />
er für Diktator Than Shwe – der das Land<br />
seit 1992 mit großer Brutalität regiert hat –<br />
ganz offensichtlich der ideale Nachfolger.<br />
Denn Than Shwe wollte sich unbehelligt<br />
in den Ruhestand verabschieden und sich<br />
dabei keine Sorgen darüber machen müssen,<br />
ob er eines Tages in einer Gefängniszelle in<br />
Den Haag aufwachen wird.<br />
Dabei war Thein Sein schon immer eine<br />
Ausnahmeerscheinung. Zwar haben alle führenden<br />
Generäle des Landes stets beteuert,<br />
sie seien gläubige Buddhisten. Thein Sein ist<br />
jedoch der einzige unter ihnen, der auch die<br />
Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlt, die<br />
mit der wichtigsten Religion des Landes in<br />
Verbindung gebracht wird. Menschen, die<br />
ihm nahe sind, sagen, er versuche stets, seiner<br />
Familie als gutes Beispiel voranzugehen.<br />
Und tatsächlich sind aus seinem unmittelbaren<br />
familiären Umfeld keine Fälle von Korruption<br />
bekannt.<br />
Zugleich ist Thein Sein jedoch auch einer<br />
der Väter der umstrittenen Verfassung<br />
aus dem Jahr 2008, die das Militärregime<br />
in einem farcehaften Referendum durchgedrückt<br />
hat. Das Dokument wäscht alle früheren<br />
Regierungen von ihren Verbrechen<br />
rein und zementiert die politische Macht<br />
des Militärs.<br />
Kein Wunder also, dass es sich die Nationalliga<br />
für Demokratie (NLD) von Aung<br />
San Suu Kyi zum vorrangigen Ziel gemacht<br />
hat, diese Verfassung zu ändern. Das dürfte<br />
schon bald zu Konflikten führen. Armeechef<br />
Min Aung Hlaing hat erst vor wenigen Monaten<br />
unmissverständlich klargestellt, dass<br />
es die Aufgabe der Armee sei, „die Verfassung<br />
zu verteidigen“. Der Präsident fügte<br />
kurz darauf hinzu: „Unser Land befindet<br />
sich im Übergang zu einem System der<br />
Demokratie mit der Verfassung als Kernstück.“<br />
Einige Beobachter reagierten überrascht,<br />
solche Worte vom Reformer Thein<br />
Sein zu hören.<br />
Dabei ist klar, dass sich Thein Sein<br />
nicht gegen die Interessen des Militärs stellen<br />
wird. Er selbst hat der Armee vier Jahrzehnte<br />
lang bedingungslos gedient und es<br />
dabei bis an die Spitze des Armeeapparats<br />
gebracht. Obwohl er aus sehr einfachen<br />
Verhältnissen stammt, hat er 1968 einen<br />
Abschluss an der Elitemilitärakademie des<br />
Landes gemacht. Danach diente er lange in<br />
Einheiten im Norden und Osten des Landes.<br />
1997 wurde er in den „Staatsrat für Frieden<br />
und Entwicklung“, die Militärjunta, berufen.<br />
Sieben Jahre später stieg er dort zum<br />
ersten Sekretär auf. 2007 wurde er Premierminister,<br />
kurz danach folgte die Beförderung<br />
zum General.<br />
Daher war es für den Vater zweier Töchter<br />
vermutlich das größte persönliche Opfer,<br />
als er vor zwei Jahren seine Uniform ablegte,<br />
um als Zivilist die „Unionspartei für<br />
Solidarität und Entwicklung“ (USDP) – die<br />
Partei der Generäle – in die massiv manipulierten<br />
Parlamentswahlen vom November<br />
2010 zu führen. Er hat es dennoch getan<br />
und sich wahrscheinlich nicht einmal darüber<br />
beschwert. Es war schließlich ein Befehl.<br />
Man täte Thein Sein jedoch Unrecht,<br />
würde man ihn als reinen Erfüllungsgehilfen<br />
einer Militärjunta betrachten, die sich<br />
ungestört in den Ruhestand verabschieden<br />
möchte. Jene, die ihn länger kennen, sagen,<br />
Thein Seins Reformwille erscheine glaubwürdig.<br />
Zudem hängt vieles an dem Einvernehmen<br />
zwischen Regierung und der NLD,<br />
von dem persönlichen Verhältnis zwischen<br />
Thein Sein und Aung San Suu Kyi ab, die<br />
über den Präsidenten sagt, er sei „ein guter<br />
Zuhörer“.<br />
Dieses Verhältnis dürfte allerdings spätestens<br />
in drei Jahren enden. Soeben hat<br />
Thein Sein erklärt, er werde nach dem Ende<br />
seiner Amtszeit 2015 nicht noch einmal für<br />
das Präsidentenamt kandidieren – angeblich<br />
wegen seiner Herzprobleme. Vielleicht<br />
glaubt er auch nur, er habe bis dahin seine<br />
Pflicht als Soldat erfüllt.<br />
Sascha Zastiral berichtet<br />
seit 2010 für das Korrespondentennetzwerk<br />
Weltreporter<br />
aus Bangkok. Davor war er<br />
Südasienkorrespondent der taz<br />
Fotos: Edgar Su/REUTERS, Privat (Autor)<br />
54 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Thein Sein ist einer<br />
der Väter jener<br />
neuen Verfassung,<br />
die alle früheren<br />
Regierungen von<br />
deren Verbrechen<br />
reinwäscht und<br />
die Macht des<br />
Militärs zementiert<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 55
| W e l t b ü h n e<br />
genie Oder Wahnsinn?<br />
Als Scientology-Chef ist David Miscavige reich und mächtig – doch kaum jemand weiß etwas über ihn<br />
von Frank Nordhausen<br />
A<br />
usgerechnet Tom Cruise. Es ist<br />
nicht bekannt, wie David Miscavige<br />
auf die Nachricht reagiert hat,<br />
dass Katie Holmes sich von Hollywoods Superstar<br />
scheiden lässt. Doch amüsiert wird<br />
der Scientology-Chef über die Meldungen<br />
nicht gewesen sein. Es ist gewiss nicht schön<br />
zu lesen, dass Katie Holmes die gemeinsame<br />
Tochter Suri vor der bösen Sekte ihres Mannes<br />
schützen wollte und sich deshalb von<br />
ihm trennt. Schließlich ist Tom Cruise Scientologys<br />
wichtigster Werbeträger – und der<br />
beste Freund von David Miscavige.<br />
Der Sektenführer scheut die Öffentlichkeit,<br />
ganz anders als der charismatische<br />
Scientology-Gründer L. Ron Hubbard.<br />
Der knapp 1,70 Meter kleine, 52 Jahre alte<br />
„Vorstandsvorsitzende“ verbirgt sich meist<br />
hinter den Mauern der Scientology-Bürohäuser<br />
in Hollywood oder der schwerbewachten<br />
„Gold Base“ in der kalifornischen<br />
Wüste. Glaubt man abtrünnigen Top-Scientologen,<br />
so führt er das ausschweifende<br />
Leben eines karibischen Diktators und<br />
agiert zugleich kühl wie der Chef eines<br />
multinationalen Konzerns – der er auch ist.<br />
Zu wirklich großer Form läuft der<br />
Mann mit den scharfen Gesichtszügen stets<br />
auf, wenn er auf den glamourösen Meetings<br />
seiner Organisation in Hollywood davon<br />
spricht, wie die „weltweite Expansion von<br />
Scientology“ noch energischer vorangetrieben<br />
werden könne. Bei diesen Versammlungen<br />
sitzen die Hollywood-Berühmtheiten<br />
in der ersten Reihe, neben Tom Cruise beispielsweise<br />
John Travolta, Kirstie Alley, Juliette<br />
Lewis. Der Fischzug in der Filmbranche<br />
war eine Idee des 1986 verstorbenen<br />
Hubbard, und Miscavige hat sie umgesetzt.<br />
Er hat verstanden, dass Macht in Hollywood<br />
Macht in der Öffentlichkeit und sogar<br />
Macht in der Politik bedeutet.<br />
Vielleicht war es auch Miscavige, der<br />
deshalb jetzt dafür sorgte, dass die Scheidung<br />
von „TomKat“ schnell geregelt wurde.<br />
Mit Tom Cruise geht Miscavige seit 20 Jahren<br />
Gleitschirm springen, Motorrad fahren<br />
und Tontauben schießen. Ehemalige Top-<br />
„Er ist extrem eitel, aber auch<br />
sehr intelligent“<br />
Mike Rinder, ehemaliger Scientology-Geheimdienstchef über David Miscavige<br />
Scientologen haben keinen Zweifel daran,<br />
dass Miscavige die Regeln ihrer Beziehung<br />
definiert und er den Superstar – als eine Art<br />
bürgerliches Alter Ego – losschickt, um beispielsweise<br />
Politiker in den USA zum Protest<br />
gegen die angebliche Diskriminierung<br />
von Scientology in Europa zu gewinnen.<br />
Es war Miscavige gewiss nicht in die<br />
Wiege gelegt, Hollywoodstars wie Schachfiguren<br />
zu benutzen. Ebenso wenig wie<br />
voraussehbar war, dass er als Vorsitzender<br />
des scientologischen „Religious Technology<br />
Center“ in Los Angeles, mitten in einem<br />
der freiesten Länder der Erde, eine<br />
totalitäre Gehirnwäsche-Organisation leiten<br />
würde. Der Erbe Hubbards stammt aus<br />
kleinsten Verhältnissen und machte bei Scientology<br />
eine uramerikanische Karriere –<br />
vom Laufburschen zum Milliardär. „Er ist<br />
extrem eitel, aber auch sehr intelligent“,<br />
sagt sein ehemaliger Geheimdienstchef<br />
Mike Rinder, der 2007 ausstieg. „Doch er<br />
nutzt seine Intelligenz für böse Dinge. Er<br />
ist wirklich der Diktator von Scientology.<br />
Ein verrücktes Genie. Wenn er sich von dir<br />
gekränkt fühlt, wird er das nie vergessen –<br />
und dir das Messer in den Rücken stechen,<br />
wenn du es überhaupt nicht erwartest.“<br />
David Miscavige wurde 1961 in eine<br />
polnisch-italienische Einwandererfamilie<br />
in Philadelphia geboren. Als er zehn Jahre<br />
alt war, begann sein Vater, der die Familie<br />
als Trompeter durchbrachte, in der lokalen<br />
Scientology-Filiale („Org“) sogenannte Auditings<br />
zu buchen, Rückführungen in vergangene<br />
Leben am Lügendetektor („E-Meter“).<br />
Weil David unter Asthma litt, nahm<br />
ihn der Vater mit in die Org – und die Beschwerden<br />
verschwanden, zumindest eine<br />
<strong>Zeit</strong> lang. Miscavige sagte später, er habe<br />
damals gefühlt: „Das ist es. Ich habe die<br />
Antwort.“ Kurz danach ging die Familie<br />
für drei Jahre nach England, um dort „clear“<br />
zu werden. Nach der Rückkehr in die USA<br />
entschied sich der 15-Jährige, fortan nur<br />
noch für Scientology zu arbeiten. Der ehrgeizige<br />
Jugendliche fand zunächst Verwendung<br />
als Laufbursche. Bald aber wurde er<br />
für die „Messenger Org“ rekrutiert, eine<br />
Elitetruppe aus halbwüchsigen Kindern<br />
von Scientologen, die unmittelbar dem<br />
Sektenchef Hubbard unterstanden.<br />
1979 fand in Washington ein aufsehenerregender<br />
Prozess gegen die Führung des<br />
Scientology-Geheimdiensts statt wegen<br />
Verschwörung gegen die USA, bei dem<br />
elf Top-Scientologen zu Haftstrafen verurteilt<br />
wurden. Hubbard tauchte damals<br />
unter, und Miscavige wurde sein wichtigster<br />
Verbindungsmann zur Zentrale in Hollywood.<br />
Der Aufsteiger nutzte Hubbards<br />
Protektion und die internen Wirren, um<br />
1982 gegen das Scientology-Management<br />
zu putschen. Handstreichartig kaperten er<br />
und seine „Messenger“-Kumpel – ungebildete,<br />
wilde Jungen, die nichts als Scientology<br />
gelernt hatten – ein globales Unternehmen,<br />
das einen jährlichen Umsatz von<br />
rund 300 Millionen Dollar machte und<br />
Tausende von abhängigen Kunden besaß.<br />
Anschließend begannen der 21-Jährige<br />
und sein Führungsstab, den Psychokonzern<br />
militärisch straff durchzuorganisieren. Doch<br />
gingen sowohl die Strapazen des Machtkampfs<br />
wie die unkontrollierten Wutanfälle<br />
Hubbards an Miscavige nicht spurlos<br />
vorbei. Der Aussteiger Jesse Prince, damals<br />
Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images<br />
56 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Scientology ist<br />
sein Leben: David<br />
Miscavige leitet<br />
die Organisation<br />
mit harter Hand<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 57
| W e l t b ü h n e<br />
die Nummer zwei in der Scientology-Spitze,<br />
beobachtete schreckliche Asthma-Attacken<br />
des jungen Führers. „Mit Hubbard unmittelbar<br />
zu tun zu haben, war eine traumatische<br />
Erfahrung.“ Vielleicht empfand Miscavige<br />
es als Befreiung, als der Sektengründer<br />
1986 im kalifornischen Creston starb. Die<br />
Stärke des Nachfolgers war es, dass er die<br />
Sekte nach dem Verlust des charismatischen<br />
Führers darauf einschwor, dessen Werk fortzusetzen.<br />
Zugleich begann er, um Hollywoodstars<br />
zu werben, denen die Sekte Seelenmassage<br />
und Hilfe beim beruflichen<br />
Aufstieg versprach.<br />
Die größte Aufgabe aber, die vor Miscavige<br />
lag, war, den jahrzehntelangen Streit<br />
mit der Steuerbehörde IRS zu lösen, deren<br />
Millionen-Dollar-Forderungen den Bankrott<br />
für Scientology bedeutet hätten. Miscavige<br />
ging zweigleisig vor. Zunächst begann<br />
er, große Summen aus den USA auf Konten<br />
in Europa zu leiten. Sein Ex-Finanzchef<br />
Marty Rathbun, der 2004 ausstieg, beziffert<br />
den Wert des Scientology-Vermögens<br />
auf derzeit rund drei Milliarden Dollar. Er<br />
bestätigt zudem, dass es Scientology gelang,<br />
die Steuerbehörde mit 2300 Klagen gegen<br />
einzelne Sachbearbeiter fast lahmzulegen:<br />
„Das hat ausgereicht.“ Die Behörde kapitulierte<br />
und gewährte Scientology 1993 völlige<br />
Steuerfreiheit. Der Coup machte aus<br />
einer Sekte, die damals auch in Amerika<br />
als verrückt und gefährlich galt, eine respektable<br />
„Kirche“ mit Steuerprivilegien<br />
und Protektion durch die US-Regierung.<br />
„Der Krieg ist vorbei!“, jubelte Miscavige<br />
vor Tausenden Anhängern in Hollywood.<br />
Der „Vorstandsvorsitzende“ bezieht<br />
nach offiziellen Angaben nur ein sehr bescheidenes<br />
Geschäftsführergehalt. Doch<br />
Jesse Prince konnte „Daves“ Verwandlung<br />
vom bettelarmen Boten in einen der vermutlich<br />
tausend reichsten Männer Amerikas<br />
direkt miterleben. Während seine Untergebenen<br />
oft gerade mal 25 Dollar in<br />
der Woche verdienten, habe sich der junge<br />
Scientology-Herrscher maßgeschneiderte<br />
250-Dollar-Hemden gegönnt, sagt Prince.<br />
Ein Stab von bis zu 20 scientologischen<br />
Butlern, Dienstmädchen, Boten und Bodyguards<br />
sei nur für den Chef tätig. Sein<br />
Reisebudget sei unbegrenzt, wenn er mit<br />
Entourage zum Shoppen nach Paris oder<br />
zum Hochseefischen auf die Bahamas<br />
fliege. Seine Frau Shelly habe am liebsten<br />
bei Chanel und Dior eingekauft (sie<br />
ist allerdings in Ungnade gefallen und<br />
wurde seit zwei Jahren nicht mehr öffentlich<br />
gesehen).<br />
„DM“, wie er intern genannt wird,<br />
gilt als absoluter Perfektionist, der jedes<br />
Detail seines Imperiums unter Kontrolle<br />
haben will, bis hin zur Auswahl der<br />
Uniformstoffe für die paramilitärische Elitetruppe<br />
Sea Org. „Seine Macht und Kontrolle<br />
sind in jeder Hinsicht absolut“, sagt<br />
Jesse Prince. Seine Untergebenen lässt er<br />
„Bringt doch endlich was vor<br />
oder haltet den Mund“<br />
David Miscavige<br />
angeblich sogar vor seinem Hund salutieren,<br />
der eine Uniform mit goldenen Streifen<br />
trägt.<br />
Ende der neunziger Jahre verlagerte<br />
Miscavige das Machtzentrum in die „Gold<br />
Base“ genannte Wüstenbasis rund 100 Kilometer<br />
südöstlich von Los Angeles, die<br />
er in ein Luxusresort mit privaten Kinos,<br />
Swimmingpools und Golfplatz umbauen<br />
ließ. Neben seinem Anwesen wurden dort<br />
Villen für Tom Cruise und John Travolta<br />
errichtet. Die Sicherheitsarchitektur des<br />
mit 700 Elitescientologen besetzten Geländes<br />
entspricht der einer Militäreinrichtung:<br />
Kameras, Bewegungsmelder und massive<br />
Stahlzäune mit rasiermesserscharfen Metallspitzen.<br />
Jesse Prince ist überzeugt, dass<br />
man auch Waffen einsetzen würde, falls die<br />
Regierung jemals auf die Idee käme, David<br />
Miscavige zu verhaften. „Der einzige Weg,<br />
den er kennt, um zu handeln, ist mit extremer<br />
Kraft alles zu überwältigen, was sich<br />
ihm in den Weg stellt.“<br />
Frühere hochrangige Scientologen<br />
schildern den Waffennarren als skrupellosen<br />
Tyrannen mit extremen Launen, der<br />
Untergebene erniedrigt und geschlagen<br />
habe. Miscavige wies die Anschuldigungen<br />
zurück und höhnte in einem <strong>Zeit</strong>ungsinterview:<br />
„Bringt doch endlich was vor oder<br />
haltet den Mund. Lasst mal die Beweise<br />
sehen.“ Zumindest Hinweise gibt es inzwischen<br />
zuhauf. Zahlreiche Schlüsselfiguren<br />
aus dem innersten Führungszirkel haben<br />
Scientology in den vergangenen Jahren verlassen<br />
und von körperlichen Misshandlungen,<br />
Psychoterror, Sklavenarbeit berichtet.<br />
Mike Rinder, der selbst nicht als zimperlich<br />
galt, bezeugt, er sei von Miscavige bis<br />
zu 50 Mal mit Faustschlägen und Fußtritten<br />
malträtiert worden. Auch Marty Rathbun<br />
erzählt von regelrechten Prügelorgien.<br />
Miscavige habe eine interne Gewaltkultur<br />
etabliert, die den gesamten Apparat durchziehe,<br />
und er halte etwa 80 Manager seit<br />
Jahren in einer Baracke in der Gold Base<br />
gefangen. „Sie müssen auf dem Fußboden<br />
schlafen und immer wieder vor allen anderen<br />
ihre Verbrechen gestehen. Weil Miscavige<br />
sie zu Feinden erklärt hat.“ Scientology<br />
bestreitet all dies. Es handele sich um<br />
„absolute und totale Lügen“.<br />
Miscavige aber fürchtet die Abtrünnigen.<br />
Seit mehr als einem Jahr werden Rathbun<br />
und seine Frau in ihrem Haus in Texas<br />
von Scientology-Agenten rund um die<br />
Uhr observiert, gefilmt, geschmäht. Ähnlich<br />
geht es den anderen Top-Aussteigern.<br />
„Immer angreifen, nie verteidigen“, den<br />
Leitspruch Hubbards hat Miscavige offenbar<br />
verinnerlicht. 1998 sagte er der <strong>Zeit</strong>ung<br />
St. Petersburg Times in Florida: „Wenn wir<br />
in einen Krieg verwickelt werden, in dem<br />
wir unser Überleben bedroht sehen, werden<br />
wir entschlossen kämpfen!“<br />
Es könnte bald so weit sein, befürchten<br />
ehemalige Weggefährten. Mehr und mehr<br />
Mitglieder verlassen die Organisation in<br />
immer kürzeren Abständen. Darunter sogar<br />
Miscaviges Eltern, sein Bruder Ronnie<br />
und seine Nichte Jenna. Für den ehemaligen<br />
Finanzchef Marty Rathbun befindet sich<br />
Scientology derzeit „in der Endphase einer<br />
Diktatur“. Er glaubt, dass ihr harter Kern<br />
aus gerade noch 20 000 Menschen bestehe.<br />
„Ich habe Angst, dass Scientology in einem<br />
Blutbad endet“, sagt er. „Mein Albtraum:<br />
Miscavige befiehlt die letzten tausend Scientologen<br />
in die Gold Base und lässt seine<br />
Garde dann mit Maschinengewehren alle<br />
niedermähen. Er ist ein Soziopath, er will<br />
die Herrschaft oder den Untergang.“<br />
Frank Nordhausen<br />
schreibt seit 20 Jahren über Sekten.<br />
Zuletzt erschien von ihm:<br />
„Scientology. Wie der Sektenkonzern<br />
die Welt erobern will“<br />
Foto: privat<br />
58 <strong>Cicero</strong> 8.2012
www.berlinartweek.de<br />
v
| W e l t b ü h n e | Ä g y p t e n s M i l i t ä r<br />
Im Klammergriff<br />
des Militärs<br />
Foto: Corbis<br />
60 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Allein unter Soldaten: Der neue ägyptische Präsident<br />
Mohammed Mursi (Mitte) bei einer Parade mit Mitgliedern des Militärrats<br />
Wer bestimmt die politische Zukunft Ägyptens? Der Präsident, das Parlament<br />
oder am Ende doch die Offiziere? Mit dem ägyptischen Militärrat und den<br />
Muslimbrüdern stehen sich zwei starke Gegner gegenüber – in einem Streit,<br />
der bereits vor 60 Jahren begann<br />
Von Gerhard Haase-Hindenberg<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 61
| W e l t b ü h n e | Ä g y p t e n s M i l i t ä r<br />
E<br />
s ist der Kampf zweier Giganten.<br />
Auf der einen Seite der ägyptische<br />
Militärrat (Scaf), dem alle Befehlshaber<br />
der Teilstreitkräfte angehören,<br />
und auf der anderen die<br />
Muslimbruderschaft, hinter der eine Million<br />
Mitglieder und ein Vielfaches davon<br />
an Sympathisanten steht. Gerade erst war<br />
Mohammed Mursi Isa Ayyat, der Kandidat<br />
der Muslimbrüder, als erster ziviler Präsident<br />
der ägyptischen Republik vereidigt<br />
worden, da setzte er als eine seiner ersten<br />
Amtshandlungen das zum Jahreswechsel<br />
gewählte Parlament wieder ein, dem durch<br />
das Verfassungsgericht kurz zuvor die Legitimation<br />
entzogen worden war. Hinter<br />
der Entscheidung der Richter stand so offensichtlich<br />
die „Empfehlung“ des Scaf,<br />
dass Mursis Verfügung zu Recht als offene<br />
Kampfansage an die Offiziersriege zu verstehen<br />
ist.<br />
Der Machtkampf am Nil aber ist fast so<br />
alt wie die ägyptische Republik und durchlief<br />
in den vergangenen sechs Jahrzehnten<br />
eine höchst wechselvolle Geschichte. Am<br />
23. Juli 1952 putschten die „Freien Offiziere“<br />
um den charismatischen Oberst Gamal<br />
Abdel Nasser das Militär an die Macht.<br />
Da waren die Muslimbrüder noch mit ihnen<br />
verbündet. Kaum aber hatte sich König<br />
Faruk im italienischen Exil eingerichtet,<br />
da lagen die ungleichen Partner schon<br />
im Streit über ein postmonarchistisches<br />
Ägypten. Die enttäuschten Muslimbrüder<br />
versuchten im Oktober 1954 erfolglos<br />
den einstigen Verbündeten Nasser durch<br />
ein Attentat aus dem Weg zu räumen. Der<br />
ließ daraufhin zahlreiche Muslimbrüder<br />
verhaften und hinrichten.<br />
Mit einer solchen Zuspitzung ist diesmal<br />
nicht zu rechnen, denn die Muslimbruderschaft<br />
hat sich erklärtermaßen von<br />
der Gewaltanwendung verabschiedet und<br />
kann sich zudem auf präsidiale Dekrete<br />
stützen. Mohammed Mursis jüngster Erlass<br />
sieht „vorgezogene Neuwahlen des Parlaments<br />
60 Tage nach einem Referendum<br />
über die neue Verfassung“ vor, was der Scaf<br />
unter dem Vorsitz von Feldmarschall Hussein<br />
Tantawi mit der Bemerkung kommentiert,<br />
zunächst „die Auswirkungen dieser<br />
Entscheidung“ erörtern zu wollen.<br />
In einem geräumigen Apartment im<br />
vornehmen Teil von Heliopolis sitzt der<br />
90‐jährige Mursi Saad el Din und versucht,<br />
die chaotisch gewordene Welt um<br />
sich herum zu verstehen. Der einstige<br />
Karrierediplomat und Sprecher des 1981<br />
ermordeten Präsidenten Anwar al Sadat,<br />
hat keinen Zweifel, dass die Militärführung<br />
auch künftig eine starke Rolle im politischen<br />
Leben seines Landes spielen wird,<br />
und verweist auf die Tradition. Das Militär<br />
spielte in der Politik eine Rolle, seit sich<br />
die Mamluken, ehemals kaukasische Militärsklaven,<br />
im 13. Jahrhundert zu Ägyptens<br />
Herrschern aufschwangen. Sie regierten<br />
600 Jahre, bis sie in einem nächtlichen<br />
Massaker von Muhammad Ali Pascha ausgeschaltet<br />
wurden. Der albanische Offizier<br />
in osmanischen Diensten begründete am<br />
An einer<br />
Islamisierung<br />
Ägyptens zeigte<br />
sich bislang kein<br />
Militärführer offen<br />
interessiert<br />
Nil eine neue Dynastie, die erst durch Nassers<br />
Putsch gegen dessen Ururenkel Faruk<br />
beendet wurde. Seither saßen in Folge vier<br />
säkular gesinnte Offiziere auf dem Präsidentenstuhl<br />
– bis Ende Juni der Zivilist<br />
Mohammed Mursi vereidigt wurde.<br />
Doch an ein Ende des militärischen<br />
Engagements in der ägyptischen Innenwie<br />
Außenpolitik vermag auch Yousry Ezbawy<br />
vom renommierten Forschungsinstitut<br />
des „Al Ahram Center for Political and<br />
Strategic Studies“ nur unter bestimmten<br />
Bedingungen zu glauben. „Wenn es zu einer<br />
echten Zusammenarbeit zwischen säkularen<br />
und islamischen Kräften kommen<br />
sollte, wäre dies eine von der Scaf favorisierte<br />
Variante. Sollte dies aber nicht gelingen,<br />
wird der Militärrat an die Macht<br />
zurückkehren.“<br />
Natürlich weiß auch Ezbawy, dass ein<br />
solcher Wunsch frommer ist, als es die<br />
Imame von ihren Gläubigen erwarten.<br />
Auch wenn die jüngere Generation der<br />
Muslimbruderschaft Konsensbereitschaft<br />
signalisiert, steht die Organisation letztlich<br />
in der Tradition starrer ideologischer<br />
Prinzipien. Ziel der 1928 gegründeten Bruderschaft<br />
ist eine Gesellschaftsordnung, deren<br />
Moralvorstellungen sich am Koran und<br />
an der islamischen Rechtsprechung Scharia<br />
orientieren.<br />
An einer Islamisierung Ägyptens aber<br />
zeigte sich bislang kein Militärführer offen<br />
interessiert, auch wenn Anwar al Sadat<br />
1971 die Muslimbrüder aus der Haft<br />
entließ, deren Betätigung auf sozialem Gebiet<br />
duldete und Ägypten gar durch Verfassungsergänzung<br />
zur „islamischen Republik“<br />
erklärte. Durch deren zeitweilige Aufwertung<br />
wollte er seinerzeit den zunehmenden<br />
Einfluss linksgerichteter Kräfte einschränken.<br />
Als Sadat in Camp David aber den<br />
Frieden mit Israel aushandelte, fand sich<br />
die ägyptische Linke mit den Muslimbrüdern<br />
erst in der gemeinsamen Opposition<br />
und schließlich in den Gefängnissen wieder.<br />
Auch unter Mubarak blieb die Bruderschaft<br />
verboten, selbst ihre Kandidaten<br />
durften nur als Unabhängige Wahlkämpfe<br />
führen und ins Parlament einziehen. Erst<br />
die Tahrir-Revolution bescherte ihr (wieder)<br />
die volle Legalität. Ende April 2011<br />
gründete sie die islamische „Freiheits- und<br />
Gerechtigkeitspartei“ (FJP). Deren Präsidentschaftskandidat<br />
Mohammed Mursi ist<br />
heute das Staatsoberhaupt.<br />
Der hat es mit einem Militär zu tun,<br />
dessen Einfluss weit in die ägyptische Gesellschaft<br />
reicht. Kaum ein westlicher Tourist,<br />
der seinen Golfcaddy über den gepflegten<br />
Rasen des Kairoer „Al Masah“ zieht,<br />
ahnt, dass sich diese Luxusherberge im Besitz<br />
der ägyptischen Armee befindet. Erst<br />
recht weiß er nicht, dass Khaled Faruk,<br />
der freundliche Hotelmanager, ein pensionierter<br />
Oberst ist. Es würde den Besucher<br />
auch erstaunen, wüsste er, dass die<br />
Frühstückseier aus armeeeigenen Hühnerfarmen<br />
stammen und das Brot aus einer<br />
Bäckerei, der ebenfalls ein Ex-Offizier<br />
vorsteht. Die Armee baut auch Straßen, betreibt<br />
Zementwerke, Erdölraffinerien und<br />
besitzt Ländereien. Nach Schätzungen von<br />
Experten ist das ägyptische Militär mit seinem<br />
uniformierten wie zivilen Personal inzwischen<br />
größter Arbeitgeber des Landes.<br />
Das Geschäft der Generäle macht 10 bis<br />
40 Prozent des ägyptischen Wirtschaftsvolumens<br />
aus. Genau weiß das niemand, da<br />
sich deren Betriebe einer zivilen Kontrolle<br />
entziehen.<br />
Begonnen hatte das wirtschaftliche Engagement<br />
der Armee bereits unter Nasser,<br />
der mit der Nationalisierung von Unternehmen<br />
den Grundstein dafür legte. Die<br />
62 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Fotos: ullstein bild-TopFoto, AFP PHOTO/AFP/Getty Images<br />
Expansion aber begann erst nach dem Friedensvertrag<br />
von Camp David. Präsident<br />
Sadat setzte die Hälfte der fast eine Million<br />
Militärangehörigen frei und halbierte<br />
das Budget. Um seine Leute nicht in die<br />
Arbeitslosigkeit entlassen zu müssen, schuf<br />
das Militär jenes Geflecht an Unternehmen.<br />
Und die vom Staat bewilligten Steuerbefreiungen<br />
und Subventionen verleihen<br />
der militäreigenen Schattenwirtschaft gegenüber<br />
der privatwirtschaftlichen Konkurrenz<br />
einen enormen Vorsprung. In einer<br />
von Wikileaks 2008 veröffentlichten,<br />
geheimen Depesche der US‐Botschafterin<br />
Margaret Scobey in Kairo an ihre Regierung<br />
beklagte die Diplomatin: „In unseren<br />
Augen hintertreibt das Militär marktwirtschaftliche<br />
Reformen, indem es die direkte<br />
Beteiligung des Staates an den Märkten fördert.“<br />
Noch aber werden die amerikanischen<br />
Interessen in der Region vorwiegend<br />
vom Pentagon bestimmt, und das ließ<br />
sich die Überflugrechte für seine Kampfflugzeuge,<br />
die Öffnung des Sueskanals für<br />
die US-Kriegsflotte und die Sicherung der<br />
Grenze nach Gaza einiges kosten. Jährlich<br />
wurden dem Konto des Militärs 1,3 Milliarden<br />
Dollar gutgeschrieben.<br />
Wer in Kairo regieren will, kann all<br />
diese Fakten nicht ignorieren – nicht das<br />
wirtschaftliche Imperium des heimischen<br />
Militärs und nicht die strategischen Interessen<br />
des Westens. Das Scaf wird darauf<br />
bestehen, auch künftig das Verteidigungsministerium<br />
zu besetzen und in<br />
der Wirtschaftspolitik ein wichtiges Wort<br />
mitzureden.<br />
Mehr als einmal hatte Mubaraks neoliberaler<br />
Wirtschaftskurs beim Militärrat<br />
zu Verärgerung und hinter den Kulissen<br />
zu kaum verdeckter Rebellion geführt.<br />
Nahezu alle von ihm in den beiden letzten<br />
Jahren seiner Regentschaft verfügten<br />
Versetzungen innerhalb des Militärs wurden<br />
von diesen ignoriert. Als dann im Januar<br />
2011 die jungen Leute lautstark ihre<br />
Forderungen vortrugen und von Mubaraks<br />
Polizeigarden beschossen wurden, schickte<br />
der Militärrat am vierten Abend des Aufstands<br />
Panzer zum Schutz der Demonstranten.<br />
Zwar stand die Armeeführung zu<br />
keinem <strong>Zeit</strong>punkt entschlossen hinter der<br />
Protestbewegung, doch gab es mit ihr eine<br />
zeitweilige Kongruenz von Interessen.<br />
Mubaraks Rücktritt veränderte das<br />
schlagartig. Um das entstandene Machtvakuum<br />
zu füllen, brauchte es eine<br />
Kaum jemand wird<br />
in der arabischen<br />
Welt so verehrt<br />
wie Gamal Abdel<br />
Nasser. Der Offizier,<br />
Politiker und<br />
Putschist stürzte<br />
1952 König Faruk<br />
und begründete<br />
damit eine neue<br />
Tradition – die<br />
nachfolgenden<br />
Präsidenten des<br />
Landes waren<br />
hohe Offiziere<br />
Während<br />
Präsident Anwar<br />
al Sadat (rechts)<br />
anfänglich<br />
mit den<br />
Muslimbrüdern<br />
paktierte und sie<br />
erst nach dem<br />
Friedensvertrag<br />
von Camp David<br />
bekämpfte,<br />
waren sie<br />
unter der<br />
Präsidentschaft<br />
von Husni<br />
Mubarak<br />
von Anfang<br />
an verboten<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 63
| W e l t b ü h n e | Ä g y p t e n s M i l i t ä r<br />
Der Konflikt zwischen dem Militär und den Muslimbrüdern ist weitaus älter als die jüngsten Auseinandersetzungen<br />
entschlossene Hand, und die war vom Parlamentspräsidenten<br />
Fathi Sorur nicht zu<br />
erwarten, der laut Verfassung bis zu Neuwahlen<br />
provisorisches Staatsoberhaupt gewesen<br />
wäre. Als Mann des alten Regimes<br />
stand er auch zu sehr im Fadenkreuz der öffentlichen<br />
Kritik. Es musste also schnell gehandelt<br />
werden. „Für den Scaf lag es nahe,<br />
selbst die Schalthebel des Staates zu besetzen“,<br />
begründet Aman Ahmad Ragab, wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am „Al Ahram<br />
Center for Political and Strategic Studies“,<br />
die nicht verfassungsgemäße Machtübernahme.<br />
„Der 25. Januar brachte ja keine<br />
einzige politische Führergestalt hervor.<br />
Vielmehr übten ganz unterschiedliche<br />
Gruppen auf die staatlichen Institutionen<br />
Druck aus, indem sie Leute mobilisierten<br />
und verschiedene politische, soziale und<br />
ökonomische Forderungen aufstellten.“<br />
Schon in den Tagen der Tahrir-Revolte<br />
konnten Beobachter aus den Aussagen<br />
führender Offiziere graduelle Unterschiede<br />
herauslesen. Beim Truppenbesuch<br />
von Feldmarschall Mohammed Hussein<br />
Tantawi am 4. Februar auf dem Tahrir-<br />
Platz wandte er sich auch an die Demonstranten.<br />
Um sie zum Aufgeben zu bewegen,<br />
sagte er zu, Mubarak werde definitiv<br />
nach Ablauf seiner Amtszeit im September<br />
das Präsidentenamt niederlegen. Und eine<br />
neue Verfassung würde die künftige Amtszeit<br />
seiner Nachfolger limitieren. Noch einmal<br />
machte Tantawi seinem Ruf als „Mubaraks<br />
Pudel“, wie ihn mittlere Offiziersränge<br />
schon seit längerem hinter vorgehaltener<br />
Hand verspotteten, alle Ehre. Sein Generalstabschef<br />
Sami Hafez Enan, der kurz zuvor<br />
aus Washington zurückgekehrt war, erntete<br />
eine Woche später zehntausendfachen Applaus,<br />
als er den Menschen auf dem Tahrir-Platz<br />
kaum versteckte Zustimmung zur<br />
Forderung nach Mubaraks Rücktritt signalisierte.<br />
Tags darauf ist er maßgeblich daran<br />
beteiligt gewesen, dass Vizepräsident<br />
Omar Suleiman Mubaraks Demission verkünden<br />
konnte.<br />
Nach fast 30 Jahren auf dem Präsidentenstuhl<br />
war Husni Mubarak nicht vom<br />
Amt zurückgetreten, er wurde von seinen<br />
Militärs abgesetzt. Es ist ein Zufall der Geschichte,<br />
dass in diesem historischen Moment<br />
„Mubaraks Pudel“ als amtierender<br />
Verteidigungsminister den Vorsitz des Scaf<br />
übernahm und zum nominell mächtigsten<br />
Mann Ägyptens wurde. Ausgerechnet<br />
Tantawi, dem drei Jahre zuvor in jener geheimen<br />
US-Depesche bescheinigt wurde,<br />
„altersstarr und resistent“ gegen Neuerungen<br />
zu sein.<br />
Innerhalb des Militärrats sei der Feldmarschall<br />
nie mehr als ein Primus inter<br />
pares gewesen, sagt der Politanalyst Walid<br />
Shehab (Name von der Redaktion geändert).<br />
Ein Gleicher unter Gleichen also.<br />
Doch wie gleich sind innerhalb des Scaf<br />
die Vorstellungen von Ägyptens Zukunft?<br />
„Es gibt zwar keine Fraktionierungen“, sagt<br />
Shehab, „wohl aber divergierende Vorstellungen<br />
über die künftige Rolle des Militärs.“<br />
Vizeadmiral Mohab Mamish etwa,<br />
der humanistisch gebildete und bei der<br />
Truppe sehr populäre Befehlshaber der<br />
Marine, habe bereits die Erarbeitung eines<br />
Foto: B.Amsellem/Signatures/laif<br />
64 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: Siegfried Büker (Autor)<br />
Konzepts angeregt, welches den schrittweisen<br />
Ausstieg aus dem aktiven politischen<br />
wie auch wirtschaftlichen Engagement vorsieht.<br />
Es werde angenommen, dass Mamish<br />
in Absprache oder gar mit Order aus Washington<br />
handle.<br />
Auch wenn im Kairoer Offizierscorps<br />
angesichts der aktuellen Auseinandersetzungen<br />
mit den islamischen Kräften ein<br />
solches Szenario kaum mehrheitsfähig<br />
sein dürfte, hat es wohl dennoch den einen<br />
oder anderen Unterstützer. So wird<br />
General Hassan al Rawini als ein solcher<br />
genannt. Dem Befehlshaber der Zentralen<br />
Militärzone Kairo werden glänzende<br />
organisatorische Fähigkeiten zugeschrieben,<br />
und die wären unbedingt<br />
gefragt – vor allem bei einer Dezentralisierung<br />
des Wirtschafts imperiums und<br />
dessen Eingliederung in marktwirtschaftliche<br />
Strukturen. Die Mehrheit im Militärrat<br />
aber dürfte derzeit nicht gewillt sein,<br />
mehr Machtpositionen als unbedingt nötig<br />
abzugeben.<br />
Sechs Wochen nach Mubaraks Sturz<br />
rief der Militärrat das Volk zur Abstimmung<br />
über einen neuen Verfassungsentwurf<br />
auf. Während die revolutionären<br />
Kräfte in dem überhastet formulierten<br />
Entwurf die Forderungen des Tahrir-Platzes<br />
zu wenig berücksichtigt sahen, fanden<br />
sich die gerade erst entstehenden demokratischen<br />
Parteien gegenüber den Muslimbrüdern<br />
benachteiligt, die auf eine seit<br />
Jahrzehnten bestehende Organisation zurückgreifen<br />
konnten. Die säkularen Kräfte<br />
empfahlen daher ihren Wählern, mit<br />
Nein zu stimmen. Abstimmungen aber<br />
werden in Ägypten auf dem Land entschieden,<br />
und dort gelten vor allem die<br />
Empfehlungen der Imame. In den Metropolen<br />
Kairo und Alexandria konnte die<br />
Ablehnungsfront gegen das Referendum<br />
zwar mobilisiert werden, landesweit aber<br />
stimmten 77,2 Prozent für den umstrittenen<br />
Verfassungsentwurf.<br />
Das erfolgreiche Zweckbündnis des<br />
Militärs mit Muslimbrüdern und den islamistischen<br />
Salafisten gegen die Gruppen<br />
der Tahrir-Revolutionäre verführte<br />
den Militärrat Monate später zu einer für<br />
ihn fatalen Fehleinschätzung. Bei den Parlamentswahlen<br />
hatte er durch Manipulationen<br />
eben jenes Ergebnis herbeigeführt,<br />
welches der Scaf nun per Gerichtsbeschluss<br />
wieder kippen ließ. Einer der Ersten, der in<br />
Kairo offen benannte, was in der Militärabteilung<br />
der amerikanischen Botschaft bereits<br />
hinter vorgehaltener Hand kolportiert<br />
wurde, war Ägyptens führender Romancier<br />
Alla al Aswani („Der Jakubijân-Bau“).<br />
Während einer Diskussionsrunde auf dem<br />
Mokattamberg über den Dächern der Stadt<br />
sprach er davon, dass mindestens ein Drittel<br />
der gewählten Abgeordneten durch eine<br />
vom Militärrat organisierte Wahlfälschung<br />
zu ihrem Mandat gekommen sei. Exakt jenes<br />
Drittel, dem derselbe Militärrat nun<br />
die parlamentarische Legitimation abspricht.<br />
Tatsächlich sollte laut Wahlgesetz<br />
Im ägyptischen<br />
Militärrat hat<br />
inzwischen die<br />
Suche nach einem<br />
zivilen politischen<br />
Kopf begonnen, der<br />
von breiten Teilen<br />
der Bevölkerung<br />
akzeptiert würde<br />
ein Drittel der Mandate auf unabhängige<br />
Kandidaten entfallen. Da die Offiziere des<br />
Scaf aber eine Mehrheit für revolutionäre<br />
Gruppen fürchteten, hatte man mancherorts<br />
Manipulationen zugunsten von Bewerbern<br />
vorgenommen, die den Muslimbrüdern<br />
nahestehen oder der „Freiheits- und<br />
Gerechtigkeitspartei“ angehören. Doch<br />
die mehrheitlich säkularen Offiziere hatten<br />
nicht mit den Erfolgen jener Parteien<br />
gerechnet, die schließlich islamischen Kräften<br />
eine überragende Parlamentsmehrheit<br />
sicherten. So fanden sich die Militärs in der<br />
Rolle von Goethes Zauberlehrling wieder,<br />
welche die gerufenen Kräfte nun wieder<br />
loswerden müssen. Da aber will Präsident<br />
Mursi verständlicherweise nicht mitspielen.<br />
Der Militärrat hat zumindest zugesagt,<br />
„die Auswirkungen“ des präsidialen<br />
Dekrets über vorgezogene Neuwahlen erörtern<br />
zu wollen. Immerhin läge darin<br />
die Chance, gemäßigte säkulare Kräfte zu<br />
bündeln und sich deren Unterstützung<br />
zu sichern. Die Muslimbrüder wiederum<br />
dürften an raschen Neuwahlen nur wenig<br />
Interesse haben. Die Präsidentschaftswahl<br />
habe gezeigt, dass die Bruderschaft den<br />
Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten<br />
habe, sagt Walid Sheha: „Kaum noch jeder<br />
zweite wahlberechtigte Ägypter ging<br />
zur Stichwahl, und Mursi bekam von diesen<br />
knapp 52 Prozent der Stimmen. Also<br />
26 Prozent der Wahlberechtigten stimmten<br />
für ihn. Wir müssen aber davon ausgehen,<br />
dass die Hälfte seiner Wähler ihn<br />
nur gewählt hat, um dessen Gegenkandidaten,<br />
den Mubarak-Mann Ahmed Schafik,<br />
zu verhindern. Damit sind die Muslimbrüder<br />
auf ihre alte Größe von 13 Prozent<br />
Stammwählern zurückgefallen.“<br />
Tatsächlich ist ein schwindender Einfluss<br />
der Muslimbrüder bei großen Teilen<br />
der ägyptischen Bevölkerung festzustellen.<br />
Dem Aufruf zu einer Solidaritätskundgebung<br />
für Präsident Mursi, nach dessen vor<br />
Gericht abermals gescheiterten Versuch<br />
der Wiedereinsetzung des Parlaments, kamen<br />
am 13. Juli statt der erwarteten Million<br />
gerade mal einige Tausend Demonstranten<br />
nach.<br />
Im ägyptischen Militärrat hat inzwischen<br />
die Suche nach einem zivilen politischen<br />
Kopf begonnen, der von breiten Teilen<br />
der Bevölkerung akzeptiert würde. Es<br />
sollte jemand sein, der den eigenen wirtschaftlichen<br />
Zielen nicht zuwiderläuft,<br />
die zivilgesellschaftlichen Visionen teilt<br />
und sich einer Islamisierung der Gesellschaft<br />
entgegenstellt. Favorisiert wird jener<br />
Mann, der trotz geringer Wahlkampfmittel<br />
als drittstärkster Kandidat aus der<br />
Präsidentschaftswahl hervorgegangen ist:<br />
Hamdin Sabahi.<br />
Der 57-jährige Journalist gilt als gemäßigter<br />
Nasserist. Wie dieser verfügt Sabahi<br />
über die Attribute eines Volkstribuns,<br />
genießt zunehmendes Ansehen unter Arbeitern<br />
und als langjähriger politischer<br />
Aktivist auch bei einem großen Teil der<br />
Facebook-Jugend. Trotz seiner kritischen<br />
Haltung gegenüber dem Scaf dürfte Hamdin<br />
Sabahi aber auch für die militärische<br />
Führung Ägyptens berechenbarer sein als<br />
der islamistische Mohammed Mursi. Noch<br />
aber ist der Kampf der Giganten in vollem<br />
Gange.<br />
Gerhard Haase-Hindenberg<br />
ist freier Publizist. Zuletzt<br />
erschien: „Ich werde nicht zerbrechen“<br />
(Biografie der ägyptischen<br />
Revolutionärin Shahinda Maklad)<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 65
| W e l t b ü h n e | D e r Ä g y p t i s c h e W e g<br />
„Der Islam bietet<br />
keine Lösungen“<br />
Ägyptens ehemaliger Außenminister Amr Mussa über die Zukunft seines Landes, die<br />
Rolle der Muslimbrüder – und über die Macht des neuen Präsidenten Mohammed Mursi<br />
Amr Mussa ist der weise alte<br />
Herr der ägyptischen Politik: Er<br />
war Außenminister unter Husni<br />
Mubarak, fiel in Ungnade<br />
und wechselte zur Arabischen<br />
Liga. Seit 2000 wurde er als<br />
möglicher Nachfolger Mubaraks<br />
gehandelt. Nach dessen Sturz<br />
meldete der 75-Jährige Interesse<br />
auf den Posten an und landete<br />
schließlich bei der Präsidentenwahl<br />
abgeschlagen auf Platz sechs<br />
H<br />
err Mussa, Ägypten erlebt wieder<br />
einmal unruhige <strong>Zeit</strong>en. Wohin<br />
steuert Ihr Land?<br />
Sie haben recht, es sind verwirrende <strong>Zeit</strong>en.<br />
Viele von uns haben gedacht, dass<br />
wir nach den Wahlen und der Übergabe<br />
der Macht an den neuen Präsidenten<br />
nach vorne schauen und den Neubeginn<br />
vorantreiben könnten, aber nun<br />
verstricken wir uns schon wieder in diesen<br />
endlosen Streit. Es ist ein Streit zwischen<br />
den politischen Lagern und um<br />
die Frage: „Wer hat das letzte Wort – das<br />
Militär, das Verfassungsgericht oder der<br />
Präsident?“<br />
Wer hat denn nun das letzte Wort? Die<br />
Rechte des Präsidenten wurden ja vom<br />
Militärrat stark beschnitten.<br />
Nein, das stimmt nicht. Wenn man die<br />
Verfassungsergänzung genau liest, bemerkt<br />
man, dass seine Macht gar nicht<br />
so sehr eingeschränkt wurde. Der Präsident<br />
beruft die Minister und den Premier,<br />
und wie man sieht, hat er das Recht und<br />
die Macht, ein Dekret zu erlassen und<br />
das Parlament wiedereinzusetzen. Deswegen<br />
kann man nicht sagen, dass er keine<br />
Macht hat. Es zeigt sich klar und deutlich,<br />
dass die Macht vom Militär an den<br />
Präsidenten abgegeben wurde.<br />
Und welches sind jetzt die Rolle und die<br />
Macht der Militärs?<br />
Der Militärrat spielt in der Exekutive<br />
keine Rolle mehr. Der Feldmarschall ist<br />
nicht mehr derjenige, der Dekrete erlässt<br />
oder auch nur seine Unterschrift daruntersetzen<br />
muss. Herr Mursi regiert. Auf<br />
seine Entscheidung, das Parlament wiedereinzusetzen,<br />
gab es einige scharfe Reaktionen<br />
von den Generälen, aber ich<br />
sehe keine Anzeichen, dass sie nervös<br />
werden.<br />
Sie meinen also, die Befürchtung, dass es<br />
zu einem offenen Machtkampf zwischen<br />
Foto: Shawn Baldwin/Corbis<br />
66 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Militär und Muslimbrüdern kommen<br />
könnte, ist übertrieben?<br />
Es besteht die Gefahr einer Eskalation,<br />
aber ich habe die Hoffnung, dass sie ausbleibt.<br />
Es liegt in der Hand des Präsidenten:<br />
Will er in Richtung Konfrontation<br />
steuern, oder sucht er Stabilität? Ich<br />
denke, sein Interesse liegt in der Stabilität.<br />
Er muss die Wirtschaft wieder ankurbeln,<br />
schon deswegen wird er weitere<br />
Konfrontation vermeiden.<br />
Was ist die größte Herausforderung der<br />
neuen Regierung?<br />
Sie muss die Lebensbedingungen der<br />
Menschen spürbar verbessern, und zwar<br />
schnell. Die Not ist groß, und die Menschen<br />
haben keine Geduld. Zuerst müssen<br />
die langen Schlangen verschwinden:<br />
der Mangel an Gasflaschen, Benzin, das<br />
schlechte Transportsystem, die Krankenhäuser<br />
und so weiter. Es reicht nicht, dass<br />
man die Straßen in der Innenstadt reinigt.<br />
Die Viertel der Armen, die Slums,<br />
da muss zuallererst etwas passieren. Was<br />
wir brauchen, ist eine neue Geisteshaltung,<br />
dann klappt es auch mit der Verbesserung<br />
der Lebensbedingungen.<br />
Die vergangenen 18 Monate haben Ägypten<br />
auch wirtschaftlich zugesetzt, die<br />
Reserven sind fast aufgebraucht. Da hat<br />
der Präsident wenig Handlungsspielraum.<br />
Solange es keine Stabilität gibt, erholt<br />
sich die Wirtschaft nicht, Investoren bleiben<br />
fern, und die Touristen kommen<br />
nicht zurück. Es ist klar, dass die Regierung<br />
nicht dauerhaft die Situation verbessern<br />
kann, es sei denn, es gelingt, die<br />
Wirtschaft wieder anzukurbeln.<br />
Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der<br />
Tourismus, und gerade in dieser Branche<br />
gibt es große Sorgen, dass die Muslimbrüder<br />
Alkohol und Bikinis verbieten und so<br />
dem Tourismus schaden könnten. Teilen<br />
Sie diese Befürchtungen?<br />
Es gibt diese Sorge. Wenn man sich jedoch<br />
anhört, was der neue Präsident zu<br />
dem Thema sagt, so klingt das beruhigend.<br />
Ihm bleibt auch nichts anderes übrig,<br />
als den Tourismus zu schützen, denn<br />
er ist eine so wichtige Einkommensquelle<br />
des Landes.<br />
Ägypten ist ja bereits ein sehr religiöses<br />
Land. Nun haben wir eine Regierung, die<br />
mehr Islam verspricht. Welche Rolle wird<br />
der Islam in Zukunft spielen?<br />
Es wird sich sicher bemerkbar machen,<br />
dass wir einen Präsidenten aus der Muslimbruderschaft<br />
haben. Allerdings gibt<br />
es in Ägypten auch eine starke Fraktion,<br />
die sich eine moderne und keine islamische<br />
Regierungsform wünscht. In manchen<br />
Bereichen wird es daher Widerstand<br />
gegen den Einfluss der Islamisten geben,<br />
zum Beispiel in der Bildung. Es geht<br />
um Wissenschaft, um die Zukunft und<br />
Weltoffenheit unseres Landes. Wir können<br />
nicht zulassen, dass eine ganze Generation<br />
zu halbgebildeten, engstirnigen<br />
Menschen erzogen wird.<br />
„Wir können<br />
nicht zulassen,<br />
dass eine ganze<br />
Generation zu<br />
halbgebildeten,<br />
engstirnigen<br />
Menschen<br />
erzogen wird“<br />
Wie steht es um die Liberalen? Welches<br />
Gehör finden sie?<br />
Es geht ihnen besser denn je! Es ist etwas<br />
sehr Bemerkenswertes passiert: Die Islamisten<br />
mit ihrer Parlamentsmehrheit haben<br />
sich selbst vorgeführt. Die Menschen<br />
haben gesehen, dass sie keine Lösungen<br />
haben, und sind von ihnen enttäuscht.<br />
Sie sind hungrig, sie wollen Brot, eine<br />
gute Schule für den Sohn und ein Bett<br />
für die Oma im Krankenhaus. Auf diese<br />
Fragen gibt es keine religiöse Antwort.<br />
Das haben die Menschen im vergangenen<br />
Jahr erkannt.<br />
Dennoch haben die Liberalen die Wahl<br />
verloren. Das lag vor allem daran, dass sie<br />
sich nicht einigen konnten. Führt dieser<br />
Schock zu mehr Einheit im nichtreligiösen<br />
Lager?<br />
Hoffentlich. Doch es ist sehr schwierig,<br />
das liberale Lager zu vereinen, hier sind<br />
alle politischen Richtungen vertreten:<br />
von links bis konservativ. Es fehlt ein<br />
Führer, ein gemeinsames Programm, und<br />
es gibt bisher keine Anzeichen, dass eine<br />
Einigung möglich ist.<br />
Sie sitzen in der Verfassungsversammlung.<br />
Bis September soll der Entwurf einer<br />
neuen Verfassung fertig sein und das Volk<br />
in einem Referendum darüber abstimmen.<br />
Wie gehen die Verhandlungen voran?<br />
Es gibt viele gute Diskussionen. Gerade<br />
jetzt diskutieren wir den Islamartikel.<br />
Meiner Meinung nach sollte er so<br />
sein, wie von Scheich al Azhar mit Papst<br />
Schenuda III vereinbart, bevor dieser<br />
kürzlich gestorben ist. Der Artikel sollte<br />
so, wie er bisher in der Verfassung steht,<br />
bleiben, ergänzt durch das Bekenntnis zu<br />
Minderheitenrechten. Die Islamisten sehen<br />
das natürlich anders.<br />
Wie sehen Sie Ägyptens Rolle in der<br />
Region?<br />
Ägypten muss wieder aktiv werden. Die<br />
Tatenlosigkeit unter der alten Regierung<br />
war sehr schlecht. Ich gehöre zu den Befürwortern<br />
von besseren Beziehungen<br />
zum Iran. Nur so lassen sich die Konflikte<br />
in Palästina, Libanon und Syrien<br />
lösen.<br />
Sie kennen die Regime aus langer Erfahrung<br />
und haben mehrere stürzen sehen.<br />
Was muss passieren, damit der Regierungswechsel<br />
in Syrien gelingt?<br />
Ich bin kein Experte im Stürzen von Regierungen,<br />
doch ich weiß, welche Macht<br />
das Volk hat. Es ist nur eine Frage der<br />
<strong>Zeit</strong>. Assad fährt eine Art von Selbstmordpolitik.<br />
Ihm einen sicheren Platz<br />
im Exil anzubieten, wäre eine Lösung,<br />
jedoch auch nicht perfekt, denn sein<br />
System ist dadurch noch lange nicht<br />
besiegt.<br />
Haben denn langfristig der Aufbruch und<br />
die Demokratie in der arabischen Welt<br />
eine Chance?<br />
Ich sehe in den nächsten Jahren auf jeden<br />
Fall mehr Veränderung. Wir werden<br />
Schritte in Richtung Demokratisierung<br />
erleben. Allerdings sehe ich auch mehr<br />
Unsicherheit, Spannungen und Unruhe.<br />
Dies geht mit dem Übergang zur Demokratie<br />
einher.<br />
Das Gespräch führte Julia Gerlach<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 67
| W e l t b ü h n e | K o m m e n t a r<br />
Natos neue Kleider<br />
Syrien und das Märchen von der gerechten Welt<br />
Von Florence Gaub<br />
E<br />
s war einmal eine erfolgreiche Militärallianz. Sie<br />
schützte Zivilisten im Kosovo und in Libyen, half Irak<br />
und Afghanistan beim Staatsaufbau und hatte – militärisch<br />
betrachtet – keinerlei Konkurrenz. Alles war also gut in<br />
Nato-Land. Doch dann entschied ein junger Herrscher namens<br />
Baschar al Assad, sein Volk zu massakrieren, und so manch einer<br />
war sich sicher: Die Allianz muss handeln. Schließlich hatte<br />
sie dies im Namen der Menschenrechte schon anderswo erfolgreich<br />
getan. Und die Ritter der Nato-Runde entschieden, dem<br />
syrischen Volk zur Hilfe zu eilen …<br />
Doch was wie ein Märchen klingt, ist meistens auch eines.<br />
Die Rufe nach einer Militärintervention in Syrien werden lauter,<br />
die Nato wird kritisiert für ihre Passivität und doppelte Standards,<br />
so, als wäre eine Lösung ganz einfach, wenn man nur<br />
wollte. Dabei zwingt uns die syrische Krise in erster Linie, endlich<br />
manche Dinge beim Namen zu nennen, so wie das Kind in<br />
Grimms Märchen „Des Kaisers neue Kleider“.<br />
Denn Fakt ist: Die Nato kann nicht überall auf der Welt eingreifen<br />
– und soll es auch nicht. Noch wichtiger ist: Selbst wenn<br />
Russland zustimmte, eine militärische Lösung ist in diesem Fall<br />
keine; und wer immer noch glaubt, dass Libyen ein gelungenes<br />
Beispiel ist, kennt die Fakten nicht. Die grausame Wahrheit ist,<br />
dass die Welt nicht nur sehr komplex, sondern auch nicht gerecht<br />
ist; dass auch allmächtig erscheinende Militärallianzen mit<br />
den teuersten Waffen der Welt nicht kurzerhand eine Lösung<br />
schaffen können, und dass westliches Eingreifen auch deshalb<br />
nicht gerne gesehen wird, weil es regionalen Akteuren die Gelegenheit<br />
nimmt, endlich mal eigenverantwortlich zu handeln.<br />
Doch das wollen viele nicht hören. Vor lauter Wunschvorstellungen<br />
von einer idealen und einfachen Welt werden die Augen<br />
verschlossen vor einer Realität, die weder schön noch simpel ist.<br />
Denn die neuen Kleider der Nato sind in Wahrheit keine.<br />
Militärische Lösungen sind grundsätzlich kein Allheilmittel; zugegeben<br />
wäre es nett, wenn dem so wäre, aber Tatsache ist, dass<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
68 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: privat<br />
Waffen alleine keine sozial-politischen Prozesse beschleunigen,<br />
keinen Konsens herstellen und keinen Staat aufbauen können.<br />
Die meisten Probleme, die Syrien hat, sind nicht militärischer,<br />
sondern politischer Natur, und daran wird auch ein Sieg<br />
über die Armee nichts ändern. Selbst wenn Assad abträte, wären<br />
diese nicht gelöst, denn er ist nicht allein verantwortlich für die<br />
derzeitige Lage, sondern wird von einem umfassenden System<br />
getragen.<br />
Hinzu kommt, dass interne Konflikte immer eine innere<br />
Uhr haben; das bedeutet, dass sie je nach Konflikttyp (etwa Unabhängigkeitskrieg,<br />
Sezessionskrieg, Bürgerkrieg etc.) eine gewisse<br />
angeborene Dauer haben und daher nicht vorzeitig beendet<br />
werden können. Ein Bürgerkrieg kommt im Regelfall nur<br />
dann zum Ende, wenn eine Seite gewinnt oder wenn beide Seiten<br />
erkannt haben, dass sie nicht gewinnen können. Daran können<br />
Außenstehende nur wenig ändern. Ein trauriges Beispiel dafür<br />
ist der Eingriff der US Marines im Libanon 1982: Sieben<br />
Jahre dauerte der Bürgerkrieg zu diesem <strong>Zeit</strong>punkt schon, als die<br />
Militärs unverrichteter Dinge abziehen mussten, nachdem bei<br />
einem Attentat fast 300 Soldaten getötet worden waren. Amerikas<br />
militärische Potenz änderte gar nichts an der libanesischen<br />
Dynamik. Frieden (wenngleich ein fragiler) entstand im Libanon<br />
erst acht Jahre später, als die <strong>Zeit</strong> reif war und eine Konferenz<br />
in Saudi-Arabien dies besiegelte. Die traurige Wahrheit ist,<br />
dass Konfliktlösung ganz oft eben nicht am mangelnden Engagement<br />
der internationalen Gemeinschaft scheitert, sondern an<br />
den Konfliktparteien selbst. Es ist an der <strong>Zeit</strong>, unsere bisweilen<br />
frustrierende Machtlosigkeit anzuerkennen, wenn es um komplexe<br />
interne Konflikte geht: Häufig gibt es keine Lösung.<br />
Doch im Westen hat sich seit Ende des Kalten Krieges das<br />
Wunschdenken einer gerechten Welt ausgebreitet. Menschenrechte<br />
müssen zweifelsohne geschützt werden. Aber haben wir<br />
auch die Mittel und die Bereitschaft, dies überall auf der Welt<br />
zu tun und unsere eigenen Soldaten dafür in den Krieg zu schicken?<br />
Zwar kam beim Libyen-Einsatz kein einziger Nato-Soldat<br />
ums Leben, aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel.<br />
Und Libyen ist noch längst nicht gesichert; sein politischer<br />
Gleitflug kann sich jederzeit noch in einen Sturzflug verwandeln.<br />
Milizen schalten und walten im Land, wie sie wollen; Bombenattentate<br />
auf das Rote Kreuz, die Konsulate der USA und Tunesien<br />
schreibt sich eine Al-Qaida-Splittergruppe zu, und jede<br />
Nacht wird in Tripolis geschossen. Ein Regime zu stürzen, bedeutet<br />
viel mehr Arbeit, als die meisten anerkennen wollen –<br />
eine Weltbankstudie ergab, dass es im Schnitt 20 Jahre dauert,<br />
funktionierende Institutionen aufzubauen.<br />
Doch <strong>Zeit</strong> ist ein seltenes Gut in der internationalen Politik.<br />
Niemand hat die <strong>Zeit</strong>, politischen Prozessen den Raum zu<br />
geben, den sie benötigen. Als Gaddafi nach fünf Monaten Bombardements<br />
noch im Amt war, wurde die Nato als ineffizient bezeichnet;<br />
libysche Wahlen wurden für nur acht Monate später<br />
angesetzt. Zum Vergleich: In Deutschland fanden erste nationale<br />
Wahlen vier Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches statt.<br />
Bestimmte Aspekte des menschlichen Seins können nicht beschleunigt<br />
werden, dies wollen jedoch im digitalen <strong>Zeit</strong>alter nur<br />
wenige wahrhaben. Alles muss sofort passieren – der Krieg, der<br />
Sieg, der Wiederaufbau. Wie viel <strong>Zeit</strong>, Mühe und Geld es kostet,<br />
eine solche Situation aufzulösen, davor verschließen allzu viele<br />
die Augen.<br />
Schließlich ist Syrien nicht Libyen. Das Land ist wesentlich<br />
kleiner, hat aber etwa die vierfache Bevölkerung; es hat funktionsfähige<br />
Luftabwehrraketen (wie die Türkei bestätigen kann),<br />
eine heterogene Bevölkerung und eine weitgehend funktionierende<br />
Armee. Wer nach Intervention aus der Luft ruft, wird tote<br />
Nato-Piloten rechtfertigen müssen. Dies wäre vertretbar, wenn<br />
das Endergebnis ein stabiles, demokratisches Syrien wäre; doch<br />
wenn dafür nur eine geringe Chance besteht, ist es schlicht verantwortungslos,<br />
nach den Waffen zu rufen.<br />
Und dann sind da noch die Nachbarstaaten. Im Gegensatz<br />
zu Libyen besteht kein arabischer Konsens, wie die syrische<br />
Quadratur des Kreises gelöst werden soll. Es gab keinen Hilferuf<br />
der Regionalorganisation Arabische Liga, dass die Nato doch<br />
bitte agieren solle – dabei ist dies die wichtigste Voraussetzung.<br />
Seit Jahrzehnten beschweren sich arabische Politiker über westliche<br />
Einmischerei in ihre Angelegenheiten; wie sollen sie Eigenverantwortlichkeit<br />
für ihre Region entwickeln, wenn wir ihnen<br />
nie die Gelegenheit dazu geben? Die Arabische Liga mag langsamer<br />
sein, als es manchen lieb ist; letztendlich ist es ihre Aufgabe,<br />
die syrische Krise beizulegen.<br />
Am Ende des Tages ist daher kein militärischer Akteur, egal<br />
welcher Herkunft, geeignet, die syrische Krise zu meistern. Die<br />
Nato auch deshalb nicht, weil niemand sie gerufen hat; weil sie<br />
nicht die Vereinten Nationen als Schützer der Menschenrechte<br />
weltweit ersetzen soll; und weil es <strong>Zeit</strong> wird, dass die arabische<br />
Welt ihre eigene Nato gründet.<br />
Florence Gaub<br />
ist Wissenschaftlerin in der Nahostabteilung<br />
des Nato Defense College in Rom. Der Artikel<br />
gibt ihre private Meinung wieder<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 69
| K a p i t a l<br />
Euroretter wider Willen<br />
ESM-Chef Klaus Regling ist Herr über 700 Milliarden Euro, dabei lehnte er einen solchen Fonds lange ab<br />
von Eric Bonse<br />
W<br />
ie fühlt es sich an, Herr über<br />
700 Milliarden Euro zu sein?<br />
Die Antwort kennt nur Klaus<br />
Regling. Der Chef des neuen Eurorettungsfonds<br />
ESM verwaltet die gewaltige<br />
Kriegskasse, mit der Kanzlerin Angela Merkel<br />
und die anderen 16 Eurochefs die Existenzkrise<br />
der Währungsunion überwinden<br />
wollen. Auf ihm ruht die Hoffnung von<br />
Bürgern und Bankern, Managern und<br />
Märkten.<br />
Doch Regling ist an diesem regnerischen<br />
Tag im Juli nicht zum Reden zumute.<br />
Gerade hat er erfahren, dass er den neuen,<br />
umstrittenen Topjob bekommen wird. Die<br />
Bundesregierung hat sich über die Bedenken<br />
der ESM-Gegner in Deutschland und<br />
den Widerstand Spaniens hinweggesetzt.<br />
Der Kampf ist vorbei, aber der Sieger<br />
lässt sich nichts anmerken. Kein Jubel,<br />
keine Dankesrede, kein Champagner. Der<br />
61‐jährige Regling macht einfach weiter,<br />
als sei nichts gewesen. Als sei es ganz normal,<br />
wieder eine Stufe auf der Karriereleiter<br />
nach oben zu klettern und zum Gralshüter<br />
des Euro aufzusteigen.<br />
Dabei hat Regling diese Karriere nie<br />
so gewollt. Er hat auch diesen ESM nie so<br />
gewollt. Im Grunde müsste ihm die ganze<br />
Eurorettung zuwider sein, denn sie war weder<br />
in seiner Karriereplanung noch in seinem<br />
politischen Denken vorgesehen. Sein<br />
VWL-Studium in Hamburg schloss er mit<br />
einer Diplomarbeit zur „Theorie des optimalen<br />
Währungsgebietes“ ab. Doch von<br />
dieser Theorie ist der Sohn eines SPD-Politikers<br />
weiter entfernt denn je.<br />
Mitte der neunziger Jahre dachte er,<br />
der Euro werde mit ein paar Regeln gut<br />
über die Runden kommen. Regling hatte<br />
gerade seine Karriere im Finanzministerium<br />
begonnen. Gemeinsam mit Finanzminister<br />
Theo Waigel (CSU) arbeitete er<br />
den Stabilitätspakt aus. Von Krise war<br />
keine Rede.<br />
Damals konnte er noch nicht ahnen,<br />
dass er eines Tages rund um den Globus<br />
Anleihen eines Luxemburger Fonds anpreisen<br />
würde, der überschuldete EU-<br />
Länder stützen soll. Rund die Hälfte seiner<br />
Arbeitszeit verbringt Regling heute mit<br />
„Das erste Jahrzehnt ist einfach,<br />
das zweite wegen der Pubertät<br />
schwierig. Dann wird’s besser“<br />
Klaus Regling, ESM-Chef, vergleicht den Euro gerne mit einem Kind<br />
„Roadshows“ vor Investoren, bei denen er<br />
Millionen einwirbt. Die übrige <strong>Zeit</strong> geht<br />
bei Arbeits- und Krisensitzungen drauf –<br />
oft mit Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker,<br />
der nicht weit von Reglings Büro auf<br />
dem Luxemburger Kirchberg residiert.<br />
Entschädigt wird er mit einem Gehalt,<br />
das das der Kanzlerin übersteigt:<br />
324 000 Euro sind in den vertraulichen<br />
„Beschäftigungsbedingungen“ des ESM<br />
vorgesehen. Doch das Jahressalär ist ihm<br />
nicht zu Kopf gestiegen. Als er einmal in einer<br />
Nobelherberge in Paris absteigen sollte,<br />
lehnte er dies empört ab und suchte sich<br />
ein kleineres Hotel.<br />
Dass er verzichten kann, hat Regling<br />
schon 1998 bewiesen. Damals ließ er sich<br />
in den einstweiligen Ruhestand versetzen,<br />
weil er die Politik von Finanzminister Oskar<br />
Lafontaine nicht mittragen wollte. Der<br />
„Waigel-Mann“ flüchtete aus Berlin nach<br />
London, um bei einem US-Hedgefonds die<br />
Finanzmärkte von innen kennenzulernen.<br />
Doch letztlich war dies nur eine Episode<br />
in Reglings Karriere. Die prägende<br />
Phase kam später, 2001 bis 2008. Nach<br />
dem Abstecher an die Themse arbeitete er<br />
als Generaldirektor für Wirtschaft und Finanzen<br />
bei der EU-Kommission in Brüssel.<br />
Fassungslos musste er mitansehen, wie<br />
Deutschland seinen Stabilitätspakt verletzte.<br />
Regling kritisierte den Regelverstoß lautstark,<br />
verhindern konnte er ihn nicht.<br />
Aber er suchte den Konflikt. Regling<br />
leitete ein Defizitverfahren gegen Berlin<br />
ein, überwarf sich mit Kanzler Gerhard<br />
Schröder (SPD). Als der Streit eskalierte,<br />
war es wiederum Regling, der eine Reform<br />
des Stabilitätspakts auf den Weg brachte –<br />
und Deutschland in Geheimgesprächen<br />
mit Noch-nicht-Kanzlerin Merkel zurück<br />
auf Konsolidierungskurs.<br />
Seither gilt er als das personifizierte Gewissen<br />
des Euro. Der Kampf mit Deutschland<br />
hat ihn geläutert, das Bündnis mit<br />
Merkel hat ihn gestärkt. Im Juli 2010 wird<br />
er beauftragt, den damals noch provisorischen<br />
Rettungsschirm EFSF aufzubauen.<br />
Die Märkte würden sich schnell beruhigen,<br />
lautete sein „zentrales Szenario“. Doch<br />
Regling sollte sich irren, wie so oft in seinem<br />
Leben. Die Krise wurde schlimmer,<br />
der Rettungsschirm von einem Provisorium<br />
zur Dauereinrichtung. Der Stabilitätspakt,<br />
sein Mantra, wurde zu Makulatur.<br />
Andere, wie sein Weggefährte Jürgen<br />
Stark, der ehemalige EZB-Chefvolkswirt,<br />
sind an diesem Widerspruch verzweifelt<br />
und haben aufgegeben. Doch Regling<br />
glaubt immer noch an den Euro. „Ich<br />
sage oft: Das erste Jahrzehnt ist einfach,<br />
das zweite ist wegen der Pubertät schwierig,<br />
aber dann wird alles besser.“ Dazu lächelt<br />
er vieldeutig. Endlich.<br />
Eric Bonse lebt und arbeitet<br />
seit 2004 als EU-Korrespondent<br />
in Brüssel. Zuvor berichtete<br />
er für den Tagesspiegel und<br />
das Handelsblatt aus Paris<br />
Fotos: Tim Wegner/laif, Privat (Autor)<br />
70 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Theorie des<br />
optimalen<br />
Währungsgebietes“<br />
hieß der Titel seiner<br />
Diplomarbeit. Als<br />
ESM-Chef ist<br />
Klaus Regling<br />
davon weiter<br />
entfernt denn je<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 71
| K a p i t a l<br />
Strafe für die Zunge<br />
In Pforzheim kocht Ralf Nowak die schärfsten Saucen Deutschlands – und angeblich auch die gefährlichsten<br />
von Benno Stieber<br />
W<br />
enn Ralf Nowak mit seinen Mitarbeitern<br />
die Filiale eines Supermarkts<br />
betritt, drücken ihm die<br />
Kassenkräfte schon mal ganz arglos die<br />
Tageseinnahmen in die Hand. Eine Verwechslung.<br />
Mit schwarzer Uniform und<br />
Polizeimütze sieht Ralf Nowak wie ein<br />
Sicherheitsmann aus. Dabei ist der Gründer<br />
von Hot Mamas doch nur gekommen,<br />
um Deutschlands schärfste Sauce im<br />
Markt sortiment unterzubringen.<br />
Das mit der Marshall-Uniform, inklusive<br />
Abzeichen und Sprechfunk, war Nowaks<br />
Idee. Denn die Kluft, die jeder Mitarbeiter<br />
im Außendienst tragen muss, bleibt<br />
im Gedächtnis. Kein Filialleiter verwechselt<br />
„die Chilipolizisten“ mit den Anzugträgern<br />
der Konkurrenz.<br />
Hot Mamas ist angetreten, es mit den<br />
großen Lebensmittelkonzernen aufzunehmen.<br />
Auch die haben Würzsaucen zuhauf<br />
im Sortiment. Aber aus Nowaks Sicht ist<br />
das alles schlappes Zeug. Seine Saucen heißen<br />
Painmaker, und auf den Etiketten steht<br />
großmäulig „Medium Hot für Anfänger“<br />
oder „fühl den Schmerz“. Sie liegen auf<br />
der nach oben offenen Schärfeskala unangefochten<br />
an der Spitze. Die Maßeinheit<br />
heißt Scoville. Und Nowaks schärfste Saucen<br />
bringen es auf bis zu 120 000 Scoville.<br />
Tabasco hat nur 5000.<br />
Gerichte, die wegen ihrer Schärfe eher<br />
Mutprobe als Genuss sind, haben zunächst<br />
etwas Pubertäres. Aber klar ist auch, dass<br />
mit dem Siegeszug fernöstlicher Küche in<br />
unseren Breiten das gepflegte Brennen auf<br />
der Zunge immer mehr Freunde findet.<br />
Eine wachsende Grillbegeisterung steigert<br />
zudem die Nachfrage nach Fertigsaucen.<br />
Es scheint, als hätte Nowak diesen<br />
Trend schon bei der Hot-Mamas-Gründung<br />
vor sechs Jahren erahnt. Lange hat er<br />
als Koch in den Töpfen von Kantinen und<br />
anderen Großküchen gerührt, wo er gern<br />
auch mal Scharfes servierte. Nowak stellte<br />
aber bald fest, dass das handelsübliche<br />
Chilipulver genormt ist und einen Schärfegrad<br />
hat, über den jeder Mexikaner oder<br />
Thai lachen würde.<br />
Er besorgte sich frische Habanero-Chilis<br />
und begann, mit eigenen Saucenrezepten<br />
zu experimentieren. Nach ersten Erfolgen<br />
gründete er mit dem Stuttgarter<br />
Gastronom Klaus Lorenz, der sich schon<br />
vor längerer <strong>Zeit</strong> den Namen „Hot Mamas“<br />
gesichert hatte, seine Saucen-Manufaktur.<br />
Aus seiner <strong>Zeit</strong> in der<br />
Großküche wusste Nowak,<br />
wie man mit dem Großhandel<br />
reden muss. Er setzte<br />
seine Marshall-Mütze auf<br />
und stellte seine Saucen bei<br />
Edeka und Rewe vor. Hartnäckigkeit,<br />
sein Rampensau-<br />
Gen und erfolgreiche Messeauftritte<br />
führten zum Erfolg.<br />
Gekocht werden die<br />
Höllensaucen in den Räumen<br />
einer befreundeten<br />
Großmetzgerei im Pforzheimer<br />
Norden. Morgens werden<br />
hier Würste gestopft,<br />
nachmittags braut Nowaks<br />
Team auf einem Großküchenherd<br />
die Tunken aus frischen<br />
Chilis, Tomatenmark<br />
und allerlei Gewürzen. „Hot<br />
Mamas“ setzt auf natürliche<br />
Zutaten und verzichtet komplett<br />
auf künstliche Aromen und Konservierungsstoffe.<br />
Nowak sagt: „Ich habe zum<br />
Glück nie gelernt, wie man Lebensmittel<br />
industriell fertigt.“ Er produziert Feinkost,<br />
die ihren Preis hat. Eine Flasche kostet bis<br />
zu zwölf Euro.<br />
Qualität ist für das Unternehmen eine<br />
Art Lebensversicherung. Neulich habe eine<br />
große deutsche Restaurantkette um Kostproben<br />
gebeten und einen Auftrag in Aussicht<br />
gestellt. Dann habe er nichts mehr<br />
gehört, berichtet Nowak. Über Umwege<br />
hat er später den wirklichen Grund für die<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagte<br />
kürzlich der neue<br />
Deutsche-Bank-Chef<br />
Anshu Jain. <strong>Cicero</strong><br />
weiß das schon länger<br />
und stellt besondere<br />
Mittelständler in einer<br />
Serie vor.<br />
Anfrage erfahren. Der Systemgastronom<br />
wollte Nowaks Produkt kopieren und im<br />
großen Stil selbst anbieten. Vergeblich. Die<br />
aufwendige Produktionsweise hätte sich für<br />
das große Unternehmen nicht gerechnet.<br />
Nowak stellt jetzt für die Restaurantkette<br />
eine Haussauce in Lizenz her.<br />
Längst platzt die kleine Firma aus<br />
allen Nähten. Das Büro ist vollgestopft<br />
mit Akten und Unterlagen. In Fluren stapeln<br />
sich die Paletten, die<br />
ausgeliefert werden müssen.<br />
4000 Flaschen kann<br />
er in seiner Manufaktur<br />
täglich produzieren. Zu<br />
wenig, in der Grillsaison<br />
gehen manchmal bundesweit<br />
10 000 Saucen täglich<br />
über den Ladentisch. Deshalb<br />
wird derzeit ein eigenes<br />
Firmengebäude mit<br />
20 000 Quadratmetern<br />
gebaut.<br />
Derweil drohen rechtliche<br />
Schwierigkeiten. Das<br />
Bundesamt für Risikobewertung<br />
will festgestellt<br />
haben, dass hohe Dosen<br />
schärfster Chilis schädlich<br />
seien. Nowak hält das<br />
zwar für Unsinn, fühlt sich<br />
aber gleichzeitig geschmeichelt:<br />
Er ist der Hersteller<br />
von Deutschlands schärfster und angeblich<br />
auch gefährlichster Sauce. Den amtlichen<br />
Befund nutzt er zum Marketing:<br />
Der Deckel von Nowaks schärfstem Gebräu<br />
hat jetzt eine Kindersicherung. Und<br />
oben drauf thront ein weißer Totenkopf<br />
aus Plastik.<br />
Benno Stieber<br />
ist freier Korrespondent mit dem<br />
Themenschwerpunkt Mittelstand.<br />
Bei sehr scharfem Essen bekommt<br />
er Schluckauf<br />
Fotos: Andy Ridder, Privat (Autor)<br />
72 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Ich habe<br />
zum Glück<br />
nie gelernt,<br />
wie man<br />
Lebensmittel<br />
industriell<br />
herstellt“, sagt<br />
Ralf Nowak.<br />
Die Hot-<br />
Mamas-Saucen<br />
kochen er und<br />
sein Team selbst<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 73
| K a p i t a l<br />
Die Geduld des Fischers<br />
Eine Begegnung mit Paul Volcker, dem großen alten Mann der amerikanischen Finanzpolitik<br />
von Nikolaus Piper<br />
P<br />
aul Volcker ist ein großer Mann.<br />
Er misst genau zwei Meter und<br />
zwei Zentimeter, was durchaus<br />
einschüchternd wirken kann. Aber er hat<br />
gelernt, mit dem Problem umzugehen. Ermutigend<br />
lächelt er seinem Gegenüber zu,<br />
während er sich zu ihm herabbeugt. Auch<br />
sein trockener Humor hilft: „Wollen Sie<br />
wirklich so viel über mich schreiben?“ In<br />
Amerika ist Volckers Körpergröße fast so<br />
etwas wie ein Markenzeichen geworden.<br />
Am 21. Januar 2010 stellte Präsident Barack<br />
Obama im Weißen Haus eine neue<br />
Vorschrift vor, die die großen Banken an<br />
systemsprengender Spekulation hindern<br />
soll. Dabei betonte er, so als sei dies sein<br />
stärkstes Argument, die Regel stamme „von<br />
diesem langen Kerl hinter mir“ – von Paul<br />
Volcker eben. Die Regel heißt seither „Volcker<br />
Rule“. Im Juni trat sie nach langen,<br />
schwierigen Beratungen in Kraft.<br />
Der 84-Jährige steht seit über 50 Jahren<br />
im öffentlichen Leben und ist immer<br />
noch einer der einflussreichsten Männer<br />
der amerikanischen Politik. Dass er dabei<br />
oft unbequem ist, hat ihm nie geschadet,<br />
im Gegenteil. Mit dem ehemaligen<br />
Staatssekretär im US‐Finanzministerium,<br />
dem ehemaligen Notenbankchef und dem<br />
ehemaligen Chef des Beratergremiums<br />
von Präsident Obama für die Finanzkrise<br />
muss man weiterhin rechnen. Sein Terminkalender<br />
ist bis an den Rand gefüllt, sein<br />
Granit-Schreibtisch steht in einem Büro<br />
oberhalb des Rockefeller Centers in Manhattan.<br />
Aus seinem Fenster guckt er auf<br />
den goldenen Prometheus-Brunnen. Davor<br />
liegt jener aus unzähligen Filmen bekannte<br />
Platz, wo im Winter alte und junge New<br />
Yorker Schlittschuh laufen.<br />
Volcker ist so präsent, dass Ende 2008<br />
viele Politexperten und Journalisten in Washington<br />
glaubten, er könne Obamas Finanzminister<br />
werden, wenigstens für eine<br />
halbe Amtszeit. Tatsächlich bekam dann<br />
Timothy Geithner den Job. Volcker wurde<br />
Chef eines Gremiums, das den Präsidenten<br />
dabei beriet, die Anfang 2009 kollabierende<br />
Wirtschaft zu retten. Spricht man<br />
ihn heute auf die damaligen Gerüchte an,<br />
„Deutschland ist das stärkste Land.<br />
Und mit Stärke kommt Verantwortung“<br />
Paul Volcker<br />
dann lacht er: „Hören Sie, ich bin ein alter<br />
Mann. Andere haben über dieses Thema<br />
geredet, ich nie.“ Ein echtes Dementi<br />
klingt anders.<br />
Wer Volcker besucht, kommt an einer<br />
kleinen Steinskulptur in Form eines<br />
Lachses vorbei. Die Wände im Flur, im<br />
Sekretariat und im Büro sind bedeckt mit<br />
Fischbildern. Das Fischen ist die große Leidenschaft<br />
des Ökonomen. „Es ist eine Ausrede,<br />
um sich an den schönsten Plätzen der<br />
Welt aufzuhalten“, sagt Volcker. Und es bedürfe<br />
einer „gewissen intellektuellen Anstrengung,<br />
um einen Fisch anzulocken“.<br />
Volcker steht auf und holt ein Memo, in<br />
dem sorgfältig mit Bleistift eine Reihe von<br />
Zahlen notiert ist – die Daten seines zuletzt<br />
gefangenen Lachses: 30 Pfund, einer der<br />
größten, die er je gefangen hat.<br />
Fischen hat auch etwas mit Beharrungsvermögen<br />
zu tun, und passend dazu erscheint<br />
zu Volckers 85. Geburtstag im<br />
September eine große Biografie unter dem<br />
Titel „The Triumph of Persistence“ – „Der<br />
Triumph der Beharrlichkeit“. Der Autor<br />
ist William Silber, Professor für Finanzwissenschaften<br />
an der New York University.<br />
Volckers Karriere kann man auch als<br />
große Übung in Beharrlichkeit sehen. Als<br />
Ökonom wurde er deswegen so erfolgreich,<br />
weil er am einmal als richtig Erkannten<br />
stur festhielt, auch wenn er sich damit<br />
Feinde machte. Das jüngste Beispiel<br />
dafür ist die besagte Volcker-Regel. Es ist<br />
eine ziemlich komplizierte Vorschrift innerhalb<br />
eines noch komplizierteren Gesetzes<br />
zur Neuregulierung der Finanzmärkte,<br />
dem „Dodd-Frank Act“. Das Prinzip ist<br />
jedoch denkbar einfach: Große Banken<br />
dürfen nicht mehr auf eigene Rechnung<br />
spekulieren. Diese Banken, argumentiert<br />
Volcker, werden vom Staat vor dem Bankrott<br />
geschützt, und sie müssen auch geschützt<br />
werden, weil sie als Kreditgeber für<br />
das Funktionieren der gesamten Wirtschaft<br />
unverzichtbar sind. Im Gegenzug dürfen<br />
sie diesen Schutz nicht missbrauchen, indem<br />
sie ihr Kapital im sogenannten Eigenhandel<br />
bei hochriskanten Zockereien aufs<br />
Spiel setzen. Das Verbot gilt für die Giganten<br />
der Branche: Goldman Sachs, Bank<br />
of America, Citigroup, JP Morgan Chase.<br />
Nicht jedoch für Hedgefonds und andere<br />
Finanzfirmen. „Die können tun, was sie<br />
wollen. Wenn sie scheitern, verlieren die<br />
Investoren und vielleicht die Gläubiger ihr<br />
Geld. Das war’s dann.“<br />
Wie weitreichend der Eingriff der Volcker-Regel<br />
für die Banken ist, ließ sich am<br />
erbitterten Widerstand der Wall-Street-<br />
Lobbyisten in Washington ablesen. Kein<br />
Wunder, war doch der Eigenhandel vor<br />
der Krise eine der wichtigsten Gewinnquellen<br />
der Branche. Den Lobbyisten gelang<br />
es, die Regel in einigen Punkten zu<br />
verwässern. Ihre Substanz habe aber keinen<br />
Schaden genommen, glaubt der Erfinder.<br />
„Die Volcker-Regel ist immer noch<br />
eine gute Regel“, sagt er energisch. Im Übrigen<br />
komme es gar nicht so sehr auf die<br />
Details an, sondern auf die Kultur. Kultur?<br />
Foto: Holger Keifel/Agentur Focus<br />
74 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Triumphator der<br />
Beharrlichkeit:<br />
Paul Volcker, der<br />
große alte Mann<br />
der Weltfinanz<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 75
| K a p i t a l<br />
Ja, die Gebräuche der wilden Typen in den<br />
Handelsräumen hätten „das unterminiert,<br />
was notwendig ist für eine starke Bankenkultur<br />
– Sorgfalt, Verantwortung gegenüber<br />
dem Kunden, treuhänderische Pflichten.<br />
Wenn Sie Händler sind, machen Sie<br />
sich keine Gedanken um die Kunden, sie<br />
versuchen Geld für sich selbst zu machen.“<br />
Es war Volckers Sturheit zu verdanken,<br />
dass seine Regel trotz des Widerstands Gesetz<br />
wurde. Ein wenig kam ihm dabei aber<br />
auch der Zufall zu Hilfe. Im Mai musste<br />
Jamie Dimon, der erfolgsverwöhnte Chef<br />
der Großbank JP Morgan, einen Spekulationsverlust<br />
von über zwei Milliarden Dollar<br />
melden, und zwar aus dem Eigenhandel.<br />
Wie sich später herausstellte, könnten es sogar<br />
5,8 Milliarden Dollar werden. Die Meldung<br />
kam in der heißen Endphase der Verhandlungen<br />
um die Volcker-Regel, deren<br />
entschlossenster Gegner Dimon war. Hat<br />
ihm dessen Fehltritt geholfen, die Lobby zu<br />
bremsen? Volcker lacht ausweichend. Diese<br />
Frage könne er nun wirklich nicht beantworten.<br />
Auch die Verwicklung von JP Morgan<br />
in den aktuellen Skandal um illegale<br />
Absprachen beim Interbanken-Zinssatz Libor<br />
will er nicht kommentieren.<br />
Volckers Werte kommen aus einer anderen<br />
Welt. Nach dem Studium in Princeton,<br />
Harvard und an der London School of<br />
Economics trat er 1952 seinen ersten Job<br />
als Ökonom bei der Federal Reserve Bank<br />
of New York an. Die New York Fed ist so<br />
etwas wie der operative Arm der US‐Notenbank.<br />
Wer dort arbeitet, sitzt an der<br />
Schnittstelle zwischen Regierung und Wall<br />
Street und kann auf beiden Seiten Karriere<br />
machen. Nach drei Jahren ging Volcker<br />
zunächst zur Chase Manhattan Bank, der<br />
Vorläuferin von Jamie Dimons JP Morgan<br />
Chase, und dann nach Washington ins Finanzministerium.<br />
Er war erst 42 Jahre alt,<br />
als man ihn zum Staatssekretär für internationale<br />
Fragen machte.<br />
Das war im Sommer 1969, als die einst<br />
in Bretton Woods beschlossene Währungsordnung<br />
der Nachkriegszeit mit ihren festen<br />
Wechselkursen kurz vor dem Zusammenbruch<br />
stand. In Bretton Woods hatten<br />
die USA versprochen, jederzeit Gold aus<br />
ihren Reserven zum Preis von 35 Dollar für<br />
die Feinunze zu verkaufen. Das begründete<br />
den Rang des Dollars als Leitwährung. In<br />
den sechziger Jahren jedoch häuften die<br />
Europäer immer höhere Dollaransprüche<br />
an. Es war absehbar, dass die Reserven<br />
der USA bald nicht mehr reichen würden,<br />
diese Ansprüche zu befriedigen.<br />
In den Geschichtsbüchern, jedenfalls<br />
in deutschen, steht meist, das System von<br />
Bretton Woods sei zusammengebrochen,<br />
weil das Handels- und das Staatsdefizit<br />
Amerikas wegen des Vietnam-Krieges außer<br />
Kontrolle gerieten. Das stimmt zwar,<br />
es gibt aber auch noch eine andere Seite,<br />
und auf die kommt es Volcker an. Um das<br />
System zu retten, hätten die Europäer auch<br />
bereit sein müssen, etwas gegen ihre Überschüsse<br />
zu tun, indem sie ihre Währungen<br />
aufwerten. Das waren sie aber nicht,<br />
aus Angst um die Arbeitsplätze. „Eine Ausnahme<br />
waren übrigens die Deutschen. Sie<br />
reagierten als Einzige.“<br />
In Washington war jedenfalls klar, dass<br />
es so nicht weitergehen konnte. Volcker<br />
riet dem damaligen Finanzminister John<br />
Connally, das Dollar-Gold-Versprechen<br />
zu kündigen. Tatsächlich teilte Präsident<br />
Richard Nixon am 15. August 1971 der<br />
Welt in einer Fernsehansprache mit, dass<br />
die USA „vorübergehend“ die Konvertibilität<br />
von Dollar in Gold aussetzten. Der<br />
„Nixon-Schock“ war gleichzeitig das Ende<br />
von Bretton Woods.<br />
Man dürfe das alles nicht zu sehr personalisieren,<br />
sagt Volcker heute: „Es haben<br />
auch noch andere diesen Rat gegeben.“<br />
Seine Stimme damals aber war entscheidend,<br />
und das dementiert er auch nicht.<br />
Zum ersten Mal zeigte er 1971 seine Fähigkeit,<br />
unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen.<br />
In Amerika nennt man das<br />
„Leadership“.<br />
Die nächste Gelegenheit kam 1979.<br />
Damals lagen die USA politisch und<br />
wirtschaftlich danieder. Das Land litt unter<br />
dem verlorenen Vietnamkrieg, die Wirtschaft<br />
stagnierte, die Inflation erreichte<br />
14 Prozent. In der Situation berief Präsident<br />
Jimmy Carter Volcker an die Spitze der<br />
US-Notenbank. „Ich sagte ihm, dass das<br />
Problem nur durch eine Rosskur zu lösen<br />
sein würde, und er stimmte mir zu.“ Volcker<br />
setzte den Leitzins der Fed schrittweise<br />
auf beispiellose 20 Prozent herauf. Das Ergebnis<br />
war, wie gewünscht, Preisstabilität.<br />
Davor jedoch kamen eine schwere Rezession<br />
auf der ganzen Welt und eine politische<br />
Wende in den USA. Carter verlor 1980 die<br />
Wahl, und Ronald Reagan zog ins Weiße<br />
Haus ein. Hat der Fed-Präsident Carter<br />
die zweite Amtszeit gekostet? Er habe ihn<br />
dies auch gefragt, sagt Volcker, und Carter<br />
habe „mit einer Art Lächeln“ geantwortet:<br />
„Es gab auch noch andere Gründe.“<br />
Was setzt einen in die Lage, sehr Unpopuläres<br />
zu tun, von dem man erst in ein<br />
paar Jahren weiß, ob es richtig war? „Es<br />
gab ein verbreitetes Gefühl im Land, dass<br />
etwas schieflief, dass etwas geändert werden<br />
musste. So einfach war das.“ Daraus habe<br />
„eine Art grundsätzliche Unterstützung“ in<br />
der Bevölkerung resultiert. „Die war nicht<br />
sehr sichtbar, weil es auf der anderen Seite<br />
viel Lärm gab. Aber sie war da.“ Als Volcker<br />
1987 sein Amt verließ, war die Inflation<br />
auf 4,5 Prozent gesunken.<br />
Viele Menschen haben heute wieder<br />
Angst vor einer großen Inflation, die den<br />
Wert ihrer Ersparnisse vernichtet. Das ist<br />
verständlich angesichts der riesigen Mengen<br />
an Geld, mit denen die Notenbanken<br />
die Wirtschaft geflutet haben. Werden die<br />
Karikatur: Klaus Stuttmann<br />
76 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: Privat<br />
Notenbanken in den USA und Europa in<br />
der Lage sein, das Geld wieder einzusammeln,<br />
bevor es zu spät ist? „Inflation ist<br />
kein technisches Problem“, antwortet Volcker.<br />
„Es ist ein menschliches Problem. Die<br />
technischen Möglichkeiten gibt es, das ist<br />
keine Frage. Aber werden sie auch bereit<br />
sein, die richtigen Schritte zu tun? Werden<br />
sie gegen heftige Opposition die Zinsen<br />
erhöhen?“ Die selbst gestellte Frage beantwortet<br />
er mit einem typischen Volcker:<br />
„Wir bezahlen die Leute in der Fed dafür,<br />
dass sie solche unbequemen Entscheidungen<br />
treffen.“<br />
Wenn es um unpopuläre Entscheidungen<br />
geht, kommt das Gespräch heute unweigerlich<br />
auf den Euro. Volcker gehörte zu<br />
den wenigen amerikanischen Ökonomen,<br />
die 1999 die Einführung der Gemeinschaftswährung<br />
unterstützten. Allerdings<br />
war er zu optimistisch, wie so viele andere<br />
auch. „Ich dachte damals implizit, dass die<br />
Unmöglichkeit von Auf- und Abwertungen<br />
von selbst für Disziplin in den Mitgliedsländern<br />
sorgen würde. Diese Hoffnung hat<br />
sich als falsch erwiesen. Alle Länder pumpten<br />
einfach billig Geld.“<br />
Volcker versucht, kontroverse Aussagen<br />
zu vermeiden, weil er „niemandem<br />
etwas diktieren will“. Aber er sagt dann<br />
doch so viel: „Ich stimme denen zu, die<br />
sagen: Wenn man mit dem Euro weitermacht,<br />
erfordert dies mehr Integration,<br />
nicht nur in der Finanz-, sondern auch<br />
in der Wirtschaftspolitik.“ Er sagt nicht,<br />
dass die Deutschen mehr zahlen müssen,<br />
aber er legt es nahe: „Deutschland ist das<br />
stärkste Land. Und mit Stärke kommt Verantwortung.<br />
Es ist wie in den USA nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg. Viele hielten den<br />
Marshall-Plan für ein Opfer. Aber es war<br />
kein Opfer, sondern ein Beitrag zu einer<br />
Welt, in der wir leben wollten: friedlich,<br />
ökonomisch erfolgreich.“<br />
Sollten sich die Deutschen bei der Eurorettung<br />
also am Marshall-Plan orientieren?<br />
„Ja, absolut. Deutschland hat unheimlich<br />
profitiert vom Euro. Aber egal, wie Sie<br />
darüber denken, Sie kommen nicht raus<br />
aus dem Problem, ohne starke Führung in<br />
Europa zu zeigen.“<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
Grand Hotel Heiligendamm, Prof.-Dr.-Vogel-Straße 6, 18209 Bad Doberan-Heiligendamm,<br />
Telefon +49 (0)38203 740-0, www.grandhotel-heiligendamm.de<br />
»Das Grand Hotel Heiligendamm steht für eine Kultur der Gastlichkeit,<br />
die sich wunderbar in die Tradition des ersten deutschen Seebades<br />
einfügt. Zur Kultur am Meer mit einem Programm aus Konzerten,<br />
Lesungen und Diskussionen, das nationale wie internationale Künstler<br />
einlädt, ist es für uns ganz selbstverständlich, dass wir ein herausragendes<br />
Magazin wie <strong>Cicero</strong> unseren Gästen als Lektüre bieten.«<br />
HENNING MATTHIESEN, GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR<br />
Gewinnen Sie zwei Übernachtungen im Grand Hotel Heiligendamm<br />
Wir laden Sie ein, <strong>Zeit</strong> im Grand Hotel Heiligendamm zu verbringen.<br />
Freuen Sie sich auf zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Personen.<br />
Gleich mitmachen und gewinnen:<br />
Mark Siegmann<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
E-Mail: 100@cicero.de<br />
www.cicero.de/100<br />
Aachen: Pullman Aachen Quellenhof · Bad Doberan-Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger<br />
Hotel · Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Bad Schandau: Elbresidenz Bad Schandau Viva Vital & Medical SPA · Baiersbronn:<br />
Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hotel Concorde, Brandenburger<br />
Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy<br />
Berlin, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle:<br />
Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Essen: Schlosshotel<br />
Hugenpoet · Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch<br />
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental Hamburg, Madison<br />
Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover<br />
Hinterzarten: Parkhotel Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst<br />
Königstein im Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg<br />
Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency<br />
Mainz · München: King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg<br />
Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel<br />
am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Lienz: Grandhotel<br />
Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL Albufeira: Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano:<br />
Splendide Royale · Luzern: Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Park Hotel Weggis, Post Hotel Weggis<br />
Nikolaus Piper<br />
arbeitet als Wirtschaftskorrespondent<br />
der Süddeutschen<br />
<strong>Zeit</strong>ung in New York<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de
Deutschlands<br />
17. Bundesland<br />
Im Pazifik tobt ein Kampf um die Rohstoffressourcen in der Tiefsee.<br />
Spät eingestiegen, droht Berlin bereits jetzt den Anschluss zu verlieren<br />
Von Andreas Rinke und Christian Schwägerl<br />
78 <strong>Cicero</strong> 8.2012
R o h s t o f f e | K a p i t a l |<br />
E<br />
S klingt alles so friedlich und<br />
passend zur Jahreszeit auch<br />
nach Urlaub: Hawaii, Mexiko,<br />
„Sonne“, 17. Bundesland. Aber<br />
wenn im Bundeskanzleramt<br />
diese Worte fallen, geht es nicht etwa um<br />
einen vorgezogenen Wahlkampfauftritt<br />
Angela Merkels am Ballermann auf Mallorca,<br />
sondern um knallharte geopolitische<br />
und wirtschaftliche Interessen der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Das entscheidende<br />
Stichwort lautet „Versorgungssicherheit“,<br />
weil der Zugang zu den weltweiten Rohstoffen<br />
für die Exportnation lebensnotwendig<br />
ist. Nicht nur auf der Prioritätenliste<br />
der Politiker, sondern auch in den Vorständen<br />
der Dax-Unternehmen ist das Thema<br />
ganz nach oben gerückt.<br />
Mit Argusaugen beobachtet man in<br />
Berlin, wie Chinas Führung gerade zur<br />
Rohstoffakquise um die Welt jettet, etwa<br />
nach Dänemark, um ein Bergbauprojekt<br />
auf Grönland voranzutreiben oder nach Island,<br />
um einen Vertrag über Technologien<br />
für den Tiefsee-Bergbau abzuschließen.<br />
Trotz Dauerbelastung durch die Eurokrise<br />
treibt Bundeskanzlerin Angela Merkel<br />
das Rohstoffthema voran. Denn je systematischer<br />
China sich weltweit den Zugang<br />
zu strategischen Ressourcen sichert,<br />
desto mehr geraten deutsche Industrieunternehmen<br />
durch hohe Rohstoffpreise unter<br />
Druck. Ohne kritische Rohstoffe wie<br />
Kupfer, Nickel, Kobalt oder die sogenannten<br />
Seltenen Erden ist keine Produktion<br />
von Hightechgütern mehr möglich. Auch<br />
Windräder, Solarzellen und andere Kernelemente<br />
der deutschen Energiewende<br />
kommen ohne diese Materialien nicht<br />
aus. Daher untersucht inzwischen auch<br />
Berlin auf einem zwischen Mexiko und<br />
Hawaii gelegenen Explorationsgebiet die<br />
Möglichkeit, die Rohstoffressourcen in der<br />
Tiefsee auszubeuten. Aber andere Länder<br />
sind schon deutlich weiter, und Deutschland<br />
muss aufpassen, will es den Anschluss<br />
nicht verlieren.<br />
Wie alarmiert die Politik ist, war Ende<br />
April auf dem Rohstoffkongress der Unions-Bundestagsfraktion<br />
zu spüren. Kanzlerin<br />
Merkel mahnte ungewohnt martialisch<br />
an: Man werde „darum kämpfen<br />
müssen, Zugang zu Rohstoffen zu haben“.<br />
Deutschland stehe „im Wettbewerb<br />
mit Staaten, die eine sehr strategische rohstoffpolitische<br />
Planung betreiben“, sagte sie<br />
mit Blick vor allem auf China. Ab sofort<br />
müssten Industrie und Politik sich gegenseitig,<br />
„sozusagen im nationalen Interesse,<br />
stützen“. Der gesamte deutsche Wohlstand<br />
hänge von der Exportfähigkeit ab.<br />
SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier<br />
sieht die Entwicklung kritisch und<br />
zieht bereits Parallelen zur blutigen Kolonialzeit.<br />
„Vieles am Beginn des 21. Jahrhunderts<br />
erinnert an den alten ‚scramble<br />
for Africa‘, an den weltweiten Run nach<br />
Flottenstützpunkten und Aufkohlstationen“,<br />
warnte er vor kurzem.<br />
Drastisch ausgedrückt hat damit auch<br />
in Deutschland, wo Staat und Wirtschaft<br />
seit 1945 in geostrategischen Fragen eher<br />
Distanz wahrten, eine neue Phase begonnen:<br />
Ein „politisch-industrieller Rohstoffkomplex“<br />
bekommt Konturen. Künftig<br />
soll auch die deutsche Entwicklungspolitik<br />
ganz offen die Sicherung von Rohstoffpartnerschaften<br />
mit ressourcenreichen Ländern<br />
wie Kasachstan oder der Mongolei<br />
„flankieren“.<br />
Auf der Seite der Wirtschaft kümmert<br />
sich Ulrich Grillo, der designierte Chef des<br />
Bundesverbands der Deutschen Industrie<br />
(BDI), um das Thema. Als bisheriger Chef<br />
des Arbeitskreises Rohstoffe im BDI gehört<br />
er zu den Architekten der neuen deutschen<br />
Rohstoffpolitik. Im Hintergrund trieb er<br />
die Gründung einer Rohstoffallianz voran,<br />
in der sich führende deutsche Industriekonzerne<br />
wie BASF, Daimler oder Thyssen-Krupp<br />
zusammengeschlossen haben.<br />
Anders als noch vor einigen Jahren befürwortet<br />
auch Grillo, dass Staat und Firmen<br />
hierbei näher zusammenrücken: „Die<br />
Rohstoffversorgung selbst bleibt natürlich<br />
Aufgabe der Unternehmen, aber die Politik<br />
hilft überall bei der Sicherung des Zugangs.“<br />
Das sei nicht nur bei uns und den<br />
Chinesen so, sondern auch in Japan, Korea<br />
und Frankreich, sagt Grillo.<br />
Dabei ist die Erde entgegen den ursprünglichen<br />
Prognosen des Club of Rome<br />
reich an Bodenschätzen. Nur ist absehbar,<br />
dass viele Vorkommen aus geologischen<br />
und politischen Gründen immer schwerer<br />
zugänglich sein werden. So hat China<br />
die Ausfuhr der sogenannten Seltenen Erden<br />
stark reguliert, weil es die Rohstoffe<br />
für seine stark wachsende Industrieproduktion<br />
braucht.<br />
Da viele der Ressourcen an Land<br />
schon ausgebeutet und verteilt sind, liegt<br />
der Fokus nun auf der Jagd nach den gigantischen<br />
Rohstoffressourcen in der<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 79
| K a p i t a l | R o h s t o f f e<br />
bislang herrenlosen Tiefsee außerhalb der<br />
200-Meilen-Zone. Vor allem im Pazifik findet<br />
derzeit eine neue Phase der Kolonialisierung<br />
statt. In mehreren Tausend Meter<br />
Tiefe unter der Wasseroberfläche schlummern<br />
Milliarden Tonnen der begehrten<br />
Metalle: Kupfer, Zink, Eisen, aber auch<br />
große Vorkommen der Seltenen Erden.<br />
Als „Schatztruhe“ hat Bundesforschungsministerin<br />
Annette Schavan die<br />
Tiefsee bezeichnet, als sie den Vertrag<br />
zum Bau eines neuen deutschen Rohstoff-<br />
Forschungsschiffs namens „Sonne“ unterschrieb.<br />
Doch die Bundesregierung muss<br />
viel nachholen, denn in den vergangenen<br />
Jahrzehnten hat Deutschland die Erkundung<br />
der Tiefsee vernachlässigt.<br />
Es wäre nur folgerichtig, wenn Merkel<br />
demnächst einmal zu einer Dienstreise in<br />
den Pazifik aufbrechen würde. Denn dort<br />
liegt zwischen Mexiko und Hawaii so etwas<br />
wie das 17. Bundesland. In einem riesigen<br />
Gebiet auf Hoher See, also außerhalb<br />
nationaler Ansprüche, hat die Internationale<br />
Meeresbodenbehörde ISA seit 1994<br />
Lizenzrechte für die Rohstofferkundung<br />
vergeben. Gleich zu Beginn sicherten sich<br />
sieben Staaten einen „Pionierinvestorenstatus“.<br />
Deutschland verzichtete damals<br />
unter Kanzler Kohl, weil das Bundeswirtschaftsministerium<br />
die Antragskosten von<br />
250 000 Dollar scheute. Man überließ<br />
China, Russland, Japan, Südkorea, Indien,<br />
Frankreich und einem Konsortium aus ehemaligen<br />
Ostblockstaaten das Terrain.<br />
Erst als die Rohstoffpreise wieder stiegen,<br />
erinnerte man sich in Berlin der<br />
Schätze auf dem Meeresgrund und beantragte<br />
ein Lizenzgebiet, das der Bundesrepublik<br />
2006 zugesprochen wurde. Das potenzielle<br />
deutsche Abbaugebiet im Pazifik<br />
hat eine Größe von rund 75 000 Quadratkilometern<br />
und ist damit etwas größer als<br />
Bayern. Bis 2021 muss sich die Bundesregierung<br />
entscheiden, ob sie im Pazifik Rohstoffe<br />
abbauen will oder nicht.<br />
Für die öffentliche Debatte zumindest<br />
in Deutschland wird die Frage nach möglichen<br />
Umweltschäden von großer Bedeutung<br />
sein. „Der Abbau von Rohstoffen in<br />
der Tiefsee ist vermutlich nicht ohne massive<br />
negative Beeinträchtigung der Ökosysteme<br />
möglich“, warnt etwa die Biologin<br />
und Meeresexpertin Iris Menn von Greenpeace.<br />
„Eine umweltverträgliche Ausbeutung<br />
der Ressourcen ist nach dem derzeitigen<br />
Wissensstand nicht möglich.“<br />
Doch am Ende könnte die Gier nach Bodenschätzen<br />
die ökologischen Bedenken<br />
übertrumpfen – gerade im Kalkül asiatischer<br />
Staaten. Immerhin schätzt die Bundesanstalt<br />
für Geowissenschaften und<br />
Rohstoffe (BGR), dass in dem von ihr erkundeten<br />
Gebiet etwa eine Milliarde Tonnen<br />
wertvoller Manganknollen liegen, im<br />
Die kartoffelgroßen Manganknollen enthalten Kupfer, Kobalt, Nickel und die sogenannten<br />
Seltenen Erden. Bis zu 500 Milliarden Tonnen werden auf dem Meeresboden vermutet<br />
Schnitt mit einer Dichte von zwölf Kilogramm<br />
pro Quadratmeter. Diese kartoffelgroßen<br />
Erzklumpen enthalten die begehrten<br />
Metalle. Der Abbau würde sich wohl<br />
vor allem auf jene Gebiete konzentrieren,<br />
bei denen man eine Dichte von 30 Kilogramm<br />
pro Quadratmeter gemessen hat.<br />
Außerdem liegen im deutschen Lizenzgebiet<br />
mindestens zwei interessante Vulkane,<br />
deren Hänge reich bestückt sind mit Mangankrusten.<br />
Nach einer internen Berechnung<br />
der BGR hätten die vermuteten zehn<br />
Millionen Tonnen Nickel, die acht Millionen<br />
Tonnen Kupfer und die 1,2 Millionen<br />
Tonnen Kobalt einen Marktwert von rund<br />
561 Milliarden Dollar.<br />
Der aufkommende Tiefseebergbau hat<br />
auch schon deutsche Großkonzerne wie<br />
Siemens auf den Plan gerufen. Das Münchner<br />
Unternehmen kaufte 2011 zwei kleine<br />
norwegische Firmen namens Bennex und<br />
Poseidon, die Spezialisten für die Stromversorgung<br />
in der Tiefsee sind. Im März<br />
schlug Siemens erneut zu und übernahm<br />
für 470 Millionen Dollar von der britischen<br />
Expro Holding deren Geschäftszweig<br />
mit tiefseetauglichen Komponenten<br />
für Öl- und Gasleitungen. Der deutsche<br />
Erdöl- und Bergbauspezialist Aker Wirth<br />
ist mit der Entwicklung eines Knollenkollektors<br />
beschäftigt. Stück für Stück werden<br />
die Bausteine für eine Infrastruktur am<br />
Meeresboden zusammengefügt.<br />
Doch der Vorsprung vor allem der asiatischen<br />
Länder Korea, Indien und China,<br />
die ebenfalls Lizenzfelder für Manganknollen<br />
im Pazifik besitzen, ist schwer<br />
wettzumachen. Während die BGR im<br />
Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums<br />
im Frühjahr mit dem alten Forschungsschiff<br />
„Sonne“ erst die vierte Erkundungsmission<br />
in das Gebiet startete,<br />
um mögliche Umweltauswirkungen eines<br />
Rohstoffabbaus zu untersuchen, hat<br />
Korea bereits 30 Missionen im eigenen<br />
Lizenzgebiet hinter sich. Die koreanische<br />
Regierung hat bereits ein eigenes Testgelände<br />
für die Erprobung tiefseetauglicher,<br />
automatisierter Abbausysteme für die<br />
Manganknollen eingerichtet. Ende Juni<br />
tauchte zudem das chinesische Unterseeboot<br />
„Jiaolong“, benannt nach einem<br />
mystischen Seedrachen, im Pazifik zum<br />
ersten Mal tiefer als 7000 Meter.<br />
Im Pazifik droht ein Machtkampf, und<br />
das Wettrennen um die Schätze in der Tiefe<br />
ist dort längst eröffnet. Hier könnte das<br />
Grafik: Eric Tscherne/Rebrush, Quelle: BGR (Seiten 78 bis 79); Foto: BGR<br />
80 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Illustration: BGR/Aker Wirth GmbH; Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz (Autoren)<br />
Gedrängel um die besten Abbaugebiete besonders<br />
riskant werden, weil sich die USA<br />
als wichtigster Spieler der Region bisher<br />
noch nicht eingeschaltet haben. Da die Supermacht<br />
die internationale Seerechtskonvention<br />
nie unterzeichnet hat, konnte sie<br />
bisher von der ISA auch kein Explorationsgebiet<br />
erhalten. Doch nun pocht Amerika<br />
verstärkt auf seine Hegemonie im Pazifik.<br />
US-Präsident Barack Obama hat das „pazifische<br />
Jahrhundert“ ausgerufen, und das<br />
Pentagon kündigte Anfang Juni an, künftig<br />
den Großteil der US-Flotte im Pazifik<br />
zu stationieren.<br />
Noch geht es dabei um die strategische<br />
Kontrolle von Transport und militärischen<br />
Versorgungsrouten. Aber wenige Experten<br />
zweifeln daran, dass auch die USA aus<br />
Sorge um die Rohstoffversorgung des Landes<br />
mit Macht versuchen könnten, sich in<br />
die lukrativsten Gebiete im Pazifik zu drängen,<br />
zumal die vielversprechendsten Manganknollengebiete<br />
direkt vor der amerikanisch-mexikanischen<br />
Westküste liegen.<br />
Gleichzeitig macht China mobil. Der<br />
renommierte chinesische Politologe Pang<br />
Zhongying von der People’s University<br />
of China bezeichnet sein Land bereits als<br />
zweite „Hegemonialmacht“ neben den<br />
USA. Andere chinesische Strategen entwickeln<br />
bereits Planspiele für den Aufbau von<br />
bewaffneten Rohstoff- und Fischereiflotten.<br />
Der Bau mehrerer Flugzeugträger markiert<br />
die Rückkehr Chinas auf die Weltmeere –<br />
das erste Mal seit dem Ende der Kaiserflotte<br />
im 16. Jahrhundert beansprucht das<br />
Land wieder eine globale Präsenz. Dazu<br />
kommt, dass sich das Riesenreich im Pazifik<br />
durch geschickte Entwicklungskooperationen<br />
längst auch bei kleinen Inselstaaten<br />
den Zugriff auf Rohstoffgebiete sichert.<br />
Manche Vorkommen liegen in den exklusiven<br />
Sonderwirtschaftszonen dieser Staaten,<br />
andere fallen ihnen durch eine Uno-<br />
Sonderregelung aus den Lizenzgebieten in<br />
internationalen Gewässern zu.<br />
Die drohende Ressourcenknappheit<br />
birgt großes Konfliktpotenzial und bedroht<br />
die friedliche Erforschung der Rohstoffvorkommen<br />
im Pazifik zwischen Asien<br />
und Amerika. Im Streit um die vermuteten<br />
Gas- und Ölvorkommen im südchinesischen<br />
Meer sind bereits Schüsse zwischen<br />
China und anderen ostasiatischen<br />
Staaten gefallen.<br />
Wo Deutschland und die Europäer in<br />
diesem geopolitisch hochbrisanten Umfeld<br />
Entwürfe des deutschen Mittelständlers Aker Wirth für einen Manganknollenkollektor.<br />
Südkorea und Indien verfügen bereits über Prototypen tiefseetauglicher Abbausysteme<br />
bleiben, sorgt Industrie und Politik auf<br />
dem alten Kontinent gleichermaßen. Sie<br />
kommen bei der Erkundung des Pazifiks<br />
nicht nur spät. Sie sind auch militärisch<br />
und politisch zu schwach, um erfolgreich<br />
Einfluss auf die anderen Erdteile auszuüben.<br />
Bereits im Rennen um Rohstoffe<br />
in Afrika und anderen Kontinenten droht<br />
Europa zurückzufallen – zumal auch hier<br />
die Dominanz der nationalen Blickwinkel<br />
weiter ein gemeinsames Vorgehen der Europäer<br />
verhindert.<br />
SPD-Fraktionschef Steinmeier, der<br />
in seiner Amtszeit als Außenminister die<br />
„Energieaußenpolitik“ entdeckt und strategische<br />
Interessen Deutschlands pointiert<br />
formuliert hat, hält sogar die Gefahr<br />
von Rohstoffkriegen für real. Das moderne<br />
China wolle zwar die Fehler des wilhelminischen<br />
Reiches vermeiden und nicht zu<br />
aggressiv auftreten. Aber es genüge nicht,<br />
„ein etwas klügerer Wilhelm II zu sein“.<br />
Der Druck auf die chinesische Regierung,<br />
die eigene Wachstumsmaschine mit der<br />
Zufuhr von immer mehr Rohstoffen zu<br />
schmieren, ist enorm. „Wer blutige Konflikte<br />
wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg<br />
vermeiden will, muss den Weg internationaler<br />
Kooperation gehen“, sagt<br />
Steinmeier. Das sieht Kanzlerin Merkel<br />
ähnlich, aber ihr Satz, dass Deutschland<br />
künftig um Rohstoffe „kämpfen“ müsse,<br />
zeigt, dass im Kanzleramt auch weniger<br />
kooperative Entwicklungen für möglich<br />
erachtet werden.<br />
Ein künftiger Rohstoffkonflikt gehört<br />
deshalb zu den Szenarien, auf die sich die<br />
deutsche Politik einstellen muss. Umso<br />
mehr erhalten Investitionen in neue Recycling-Technologien<br />
für kritische Rohstoffe,<br />
wie sie etwa am Helmholtz-Zentrum im<br />
sächsischen Freiberg erfolgen, eine geound<br />
verteidigungspolitische Bedeutung. Je<br />
geringer die Abhängigkeit von Rohstofflieferungen<br />
aus sensiblen, umstrittenen Regionen<br />
der Welt ist, desto stabiler kann die<br />
deutsche Wirtschaft funktionieren.<br />
Denn sollte in nicht allzu ferner Zukunft<br />
der Kapitän eines deutschen Rohstoff-Frachters<br />
nach Berlin melden müssen,<br />
dass U‐Boote einer unbekannten Macht<br />
die Fördermaschinen im deutschen Lizenzgebiet<br />
zerstört haben, stünde die deutsche<br />
Politik vor ganz neuen sicherheitspolitischen<br />
Fragen.<br />
Andreas Rinke<br />
(rechts), Chefkorrespondent<br />
der Nachrichtenagentur<br />
Reuters, und der Politikund<br />
Wissenschaftsjournalist<br />
Christian<br />
Schwägerl haben<br />
im April bei C. Bertelsmann das Buch<br />
„11 drohende Kriege“ veröffentlicht. Darin<br />
entwickeln sie Szenarien künftiger Konflikte<br />
um Technologien, Rohstoffe und Nahrung<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 81
Redaktionsgespräch<br />
Besuchen Sie uns in Berlin und<br />
kommen Sie mit den Redakteuren<br />
von <strong>Cicero</strong> ins Gespräch. Wir<br />
laden Sie ein zu einem Blick hinter<br />
die Kulissen und sind gespannt auf<br />
Ihre Meinung, Anregungen oder<br />
Kritik zu <strong>Cicero</strong>. Bitte vormerken:<br />
19. oder 26.10. 2012, 16 Uhr. Jeweils<br />
mit anschließendem Abendessen.<br />
Frühschoppen<br />
Treffen Sie Hartmut Palmer, den<br />
politischen Chefkorrespondenten<br />
von <strong>Cicero</strong>, in der berühmtesten<br />
Frühstückskantine der Republik.<br />
Im „Einstein Unter den Linden“<br />
erklärt er Ihnen, wer an welchem<br />
Tisch sitzt und warum politische<br />
Hintergrundgespräche hier gerne<br />
in aller Offenheit geführt werden.<br />
Danke, liebe<br />
Als Leser kennen Sie uns schon – höchste <strong>Zeit</strong>, dass wir uns<br />
jetzt persönlich kennenlernen. Hier zehn Vorschläge für Sie.<br />
Anglerglück<br />
Seine Freizeit verbringt Christoph<br />
Schwennicke, Chefredakteur von<br />
<strong>Cicero</strong>, am liebsten beim Fischen<br />
am Halensee oder an der Spree.<br />
Fachsimpeln Sie bei einem gemeinsamen<br />
Angelausflug mit ihm<br />
über die besten Köder und die<br />
dicksten Fische – am Wasser und<br />
in der Politik.<br />
Redaktionskonferenz<br />
Dienstags um 10 Uhr – einmal in<br />
der Woche trifft sich die <strong>Cicero</strong>-<br />
Redaktion zur großen Themenkonferenz.<br />
Nehmen Sie daran<br />
teil und schlagen Sie uns Ihre<br />
Themen und Geschichten für die<br />
kommenden Ausgaben vor. Bitte<br />
vormerken: 18. oder 25. 9. 2012.<br />
Berliner Republik<br />
Treffen Sie Michael Naumann,<br />
den ehemaligen Kulturstaatsminister<br />
und jetzigen Vorsitzenden<br />
des Publizistischen Beirats von<br />
<strong>Cicero</strong>. Auf verschlungenen<br />
Wegen führt er Sie durch das<br />
Reichstagsgebäude und erzählt<br />
Ihnen seine schönsten Anekdoten<br />
aus Politik und Journalismus.<br />
100 Ausgaben <strong>Cicero</strong> – ein Grund zum Feiern!<br />
Zu unserem Jubiläum möchten wir uns persönlich bei Ihnen bedanken. Wählen Sie aus,<br />
wen Sie treffen möchten, und schreiben Sie uns eine E-Mail oder Postkarte:<br />
Mark Siegmann<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: 100@cicero.de<br />
www.cicero.de/100
Titelkunst<br />
Die Titelbilder von <strong>Cicero</strong> sind<br />
preisgekrönt. Erleben Sie den<br />
Mann hinter den Werken bei<br />
der Arbeit. Schauen Sie Wieslaw<br />
Smetek über die Schulter, wenn<br />
in seinem Atelier in Hamburg ein<br />
neues Cover unseres Magazins<br />
entsteht.<br />
Leser!<br />
Foto: Harald Hoffmann/Deutsche Grammophon<br />
Musikgenuss<br />
Erleben Sie Daniel Hope am<br />
12. 8. 2012 während der Festspiele<br />
Mecklenburg-Vorpommern bei<br />
der Probe, auf der Bühne und<br />
lernen Sie den Star-Geiger und<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnisten („Benotet“)<br />
auf der Terrasse des Gutshauses<br />
Stolpe bei einer Tasse Kaffee<br />
persönlich kennen.<br />
Foto: Tobias Bohm<br />
Foto: Paul Ripke<br />
Privatlesung<br />
Gewinnen Sie eine private Lesung<br />
der Schriftstellerin und Literaturen-<br />
Autorin Felicitas Hoppe. Die<br />
Büchner-Preisträgerin 2012 liest<br />
für Sie und Ihre besten Freunde<br />
in einer Buchhandlung Ihres<br />
Vertrauens. Ob aus „Picknick der<br />
Friseure“, „Pigafetta“ oder „Hoppe“,<br />
das entscheiden Sie.<br />
Foyergespräch<br />
Diskutieren Sie am 23. 9. 2012<br />
mit Harald Schmidt über „Die<br />
Zukunft des Fernsehens“ – oder<br />
am 2. 12. 2012 mit Peer Steinbrück<br />
über das Thema „Europa neu<br />
erzählen“. Anlässlich des <strong>Cicero</strong>-<br />
Foyergesprächs im Berliner Ensemble,<br />
moderiert von Alexander<br />
Marguier und Frank A. Meyer.<br />
Küchenkabinett<br />
Lernen Sie die <strong>Cicero</strong>-Kolumnisten<br />
Julius Grützke und Thomas Platt<br />
in ihrem Lieblingsrestaurant<br />
„Horvath“ in Berlin kennen. Nach<br />
dem Menü erwartet Sie hier der<br />
Koch des Jahres 2011, Sebastian<br />
Frank, in seiner Küche zu einem<br />
Gespräch über Genuss und<br />
Politik.<br />
Foto: Daniel Biskup
| K a p i t a l | G r o S S p r o j e k t e<br />
„Da stimmt etwas nicht<br />
in unserem System“<br />
Der Städteplaner Albert Speer über das Berliner Flughafen-Debakel, die Pannen von<br />
„Stuttgart 21“ – und über seine Vision für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar<br />
H<br />
err Professor Speer, Sie sind ein<br />
international gefragter Städteplaner<br />
und kommen für Ihre<br />
Projekte viel in der Welt herum. Einmal<br />
ganz allgemein gefragt: Sind sich die<br />
Deutschen des Ausmaßes an Globalisierung<br />
überhaupt richtig bewusst?<br />
Ganz ehrlich: nein. Ich habe nicht den<br />
Eindruck, dass wir die Rolle in der Welt,<br />
die wir mit unserem Know-how, mit<br />
unserem Wissen, mit unserer Kompetenz<br />
spielen könnten, auch tatsächlich<br />
wahrnehmen.<br />
Woran liegt das?<br />
Das liegt zum einen daran, dass wir es in<br />
der Vergangenheit überhaupt nicht nötig<br />
hatten, im Ausland zu arbeiten, und darin<br />
auch keine Tradition haben – anders<br />
als zum Beispiel die Niederländer<br />
oder die Briten. Das hat auch damit zu<br />
tun, dass Deutschland nie Kolonien besaß.<br />
Dann kommen noch die sprachlichen<br />
Verständigungsschwierigkeiten dazu.<br />
Und zum Dritten hatten wir immer genügend<br />
in Deutschland zu tun. Aus diesem<br />
Grund ist unsere Rolle in der Welt<br />
immer noch unterentwickelt.<br />
Immerhin ist Deutschland<br />
Exportweltmeister …<br />
Das ist richtig, aber viele unserer Ideen,<br />
Entwicklungen und Vorstellungen kommen<br />
eben immer noch in anderen<br />
Albert Speer, Jahrgang 1934, ist der Gründer des Frankfurter Architektur- und<br />
Stadtplanungsbüros „Albert Speer & Partner“. Das Abitur machte er auf dem<br />
zweiten Bildungsweg nach einer Schreinerlehre, um dann Architektur in<br />
München zu studieren. Er ist der Sohn von Hitlers Generalbauinspektor und<br />
späterem Reichsminister für Bewaffnung und Munition gleichen Namens<br />
Ländern zur Serienreife. Wir sind da<br />
nicht gut genug aufgestellt. Wir sind zu<br />
provinziell und zu langsam.<br />
Für Katar hat Ihr Büro die Planungen<br />
für die Fußball-WM 2022 gemacht und<br />
damit sogar den Zuschlag bekommen; in<br />
China entstehen unter Ihrer Regie ganze<br />
neue Städte. In Deutschland dagegen<br />
kommt es wegen des geplanten Umbaus<br />
des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu bürgerkriegsähnlichen<br />
Zuständen. Ist unsere<br />
Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu<br />
wohlstandsverwöhnt geworden?<br />
Die Frage kann man sich durchaus stellen.<br />
Stuttgart 21 ist für mich allerdings<br />
ein Sonderfall, den man in die allgemeine<br />
Entwicklung großer städtebaulicher<br />
Projekte eigentlich nicht einordnen<br />
kann, weil der lange Planungszeitraum<br />
von mehr als 15 Jahren nicht in Fehlplanungen<br />
begründet ist. Sondern darin,<br />
dass die Auftraggeber und die Politik<br />
über Jahre hinweg das Projekt gar nicht<br />
mehr wollten. In dieser <strong>Zeit</strong> ist dann<br />
überhaupt nichts passiert. Das ist natürlich<br />
für die Umsetzung eine Katastrophe.<br />
Ich bin der Überzeugung, dass große Infrastruktur-<br />
und Architekturvorhaben einen<br />
fest umrissenen <strong>Zeit</strong>rahmen brauchen.<br />
Wenn es innerhalb von sagen wir<br />
mal fünf Jahren nicht gelingen sollte, mit<br />
dem Bau überhaupt zu beginnen, sollte<br />
man ein Großprojekt einstellen und eine<br />
Generation warten.<br />
Das heißt, Stuttgart 21 wäre nicht wegen<br />
des Widerstands der Bürger, sondern<br />
wegen des falschen politischen Managements<br />
beinahe gescheitert?<br />
Foto: Bernd Roselieb/Visum<br />
84 <strong>Cicero</strong> 8.2012
2022 in Katar: So könnte das Al-Gharafa-Stadion in Doha nach Plänen von Speers Büro aussehen<br />
Visualisierung: HHVISION, Köln; © AS&P - Albert Speer und Partner GmbH<br />
Am Anfang der Planungen gab es für Stuttgart<br />
21 überhaupt kein Akzeptanzproblem.<br />
Was dann aber folgte, waren Managementprobleme<br />
der Politik und der öffentlichen<br />
Verwaltung mit den Genehmigungsverfahren<br />
und allem, was daran hängt. Ich bin<br />
der Überzeugung, dass wir auch da unsere<br />
Kompetenzen nicht ausspielen.<br />
Was müsste also verbessert werden?<br />
Das ist von Projekt zu Projekt verschieden,<br />
weil jedes individuelle Organisationsstrukturen<br />
erfordert. Unser Büro ist<br />
immer bemüht, für eine ganz bestimmte<br />
<strong>Zeit</strong>spanne die Zuständigkeiten und die<br />
Interessen zu bündeln und somit schnell<br />
und schlagkräftig agieren zu können. Wir<br />
brauchen eine Organisationsstruktur auf<br />
<strong>Zeit</strong>. Der Bau der Allianz-Arena in München<br />
ist ein Beispiel dafür.<br />
Aber es kommt doch vor allem auch darauf<br />
an, der Bevölkerung das Erfordernis eines<br />
solchen Großprojekts zu vermitteln …<br />
Das ist selbstverständlich ein ganz großes<br />
Thema, das von vielen Fachleuten<br />
immer noch weit unterschätzt wird.<br />
Im Fall der Allianz-Arena haben wir<br />
der Stadt München dazu geraten, selbst<br />
einen Bürger entscheid zu organisieren<br />
und nicht zu warten, bis Bürgerinitiativen<br />
auftreten. Bei diesem Entscheid haben<br />
dann sogar mehr Bürger abgestimmt<br />
als vor kurzem, als es um die dritte Landebahn<br />
des Münchener Flughafens ging –<br />
und über 60 Prozent waren dafür.<br />
Das jüngste Debakel eines deutschen<br />
Großprojekts ist der Flughafen Berlin-<br />
Brandenburg, dessen Eröffnung mindestens<br />
auf März verschoben wurde. Jetzt<br />
schieben sich das Land Brandenburg, die<br />
Stadt Berlin und der Bund als Anteilseigner<br />
gegenseitig den Schwarzen Peter<br />
zu, von den beteiligten Architektur- und<br />
Ingenieurbüros einmal ganz abgesehen.<br />
Sind in der föderalen Bundesrepublik die<br />
Kompetenzen womöglich zu zersplittert,<br />
um ein Planungsvorhaben dieser Dimension<br />
vernünftig zu stemmen?<br />
Einen großen Flughafen zu bauen, ist<br />
eine sehr komplexe und anspruchsvolle<br />
Aufgabe. Wenn versucht wird, so etwas in<br />
den gewöhnlichen Genehmigungs- und<br />
Verwaltungsmühlen durchzusetzen, wundere<br />
ich mich überhaupt nicht, dass es<br />
da zu Kompetenzgerangel kommt. Es<br />
kann doch nicht sein, dass ein Beamter<br />
des Landkreises Dahme-Spreewald verantwortlich<br />
ist für das gesamte Brandsicherungssystem.<br />
Genau in solchen Fällen<br />
braucht es eine Kompetenzbündelung,<br />
mit der sich klare Entscheidungen treffen<br />
lassen. Wir haben vor Jahren in Berlin<br />
die Wissenschaftsstadt Adlershof mitgeplant,<br />
aus dieser <strong>Zeit</strong> kenne ich die Berliner<br />
Besprechungsgewohnheiten ganz gut.<br />
Wenn in Frankfurt eine Besprechung<br />
stattfindet, sind daran vielleicht zehn<br />
oder 15 Leute beteiligt; in Berlin sind es<br />
ungefähr 40. Und ich glaube, daran hat<br />
sich bis heute nicht viel geändert.<br />
Das heißt, die rechtlichen Grundlagen in<br />
Deutschland sind kein Hindernis, sondern<br />
eher die Verwaltung?<br />
Ich würde schon sagen, dass auch das<br />
Planungs- und Baurecht nicht mehr den<br />
gesellschaftlichen Anforderungen von<br />
heute entspricht. Da besteht ein enormer<br />
Handlungsbedarf.<br />
Inwiefern?<br />
Das ist sehr komplex. Aber um nur ein<br />
Beispiel zu nennen: Wenn die Bundesregierung<br />
jetzt stolz darauf ist, dass sie eine<br />
Novelle des Baugesetzes organisiert hat,<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 85
| K a p i t a l | g r o s s p r o j e k t e<br />
wonach in reinen Wohngebieten Kindergärten<br />
„bis zu einer gewissen Größenordnung“<br />
gestattet werden, dann stimmt<br />
doch das ganze System nicht.<br />
Heute wird ja viel darüber sinniert, ob<br />
westliche Demokratien überhaupt noch in<br />
der Lage sind, mit den schnellen Entscheidungswegen<br />
in Ländern wie China mitzuhalten.<br />
Haben Sie manchmal den Eindruck,<br />
dass wir mit unserem politischen System<br />
Gefahr laufen, wirtschaftlich ins Hintertreffen<br />
zu geraten?<br />
Nein. Wenn es darauf ankommt, sind wir<br />
ja in der Lage, auch große Dinge zu vollbringen.<br />
Aber in der Demokratie sind<br />
Großprojekte eben nur dann fristgerecht<br />
durchsetzbar, wenn ein konkreter Endtermin<br />
feststeht. Wir haben fünf Jahre<br />
lang die Weltausstellung in Hannover<br />
geplant; da war klar, dass an einem bestimmten<br />
Tag alles fertig sein muss, weil<br />
die Ausstellung eben beginnt. Wir können<br />
es also, aber wir leisten uns oft Verzögerungen.<br />
Dann kommt zum Beispiel<br />
ein Genehmigungsverfahren vier Wochen<br />
lang zum Erliegen, nur weil der zuständige<br />
Beamte in Urlaub ist. Das geht übrigens<br />
fast immer auf Kosten der Steuerzahler.<br />
Die Elbphilharmonie in Hamburg<br />
ist ein schönes Beispiel dafür. Es fehlt an<br />
der Disziplin. Und oft auch am Willen,<br />
nach Alternativen zu suchen.<br />
Ist die Elbphilharmonie eine Fehlplanung?<br />
Auf einen früheren Speicher eine Philharmonie<br />
draufzusetzen, ist komplex genug.<br />
Aber darüber noch einmal ein großes Hotel<br />
zu bauen, das halte ich für ausgemachten<br />
Schwachsinn. Die Philharmonie wäre<br />
längst fertig, wenn man das Hotel nebendran<br />
gebaut hätte. Das technisch Machbare<br />
verführt Politiker und Planer dazu,<br />
einfachere Lösungen zu ignorieren.<br />
Ist es für Sie einfacher, in China oder in<br />
Ländern des Mittleren Ostens zu arbeiten<br />
als in Deutschland?<br />
Überhaupt nicht. Es ist anders. Und auch<br />
in solchen Ländern geht es nicht unbedingt<br />
einfacher als in Deutschland. In<br />
China haben wir uns erst einmal sehr<br />
daran gewöhnen müssen, dass es dort<br />
5000 Jahre alte Traditionen gibt, die bis<br />
heute durchschlagen. Das Denken und<br />
die Kultur des Miteinander-Redens sind<br />
völlig anders als bei uns.<br />
Eröffnung verschoben: Der Flughafen Berlin-Brandenburg kann<br />
frühestens im März 2013 seinen Betrieb aufnehmen<br />
Als gelegentlicher China-Besucher könnte<br />
man den Eindruck gewinnen, dass zum<br />
Beispiel der Denkmalschutz dort keine<br />
besonders große Rolle spielt.<br />
Das tut er mittlerweile sogar sehr. Da hat<br />
längst ein großes Umdenken stattgefunden.<br />
Trotzdem geht immer noch sehr viel<br />
kaputt. Aber die Chinesen sind ja auch<br />
clevere Geschäftsleute, die wissen, dass<br />
man mit Denkmalschutz und alter Bausubstanz<br />
viel Geld verdienen kann.<br />
Es ist also nicht so, dass in China irgendwelche<br />
Politiker etwas beschließen, und<br />
am nächsten Tag rollen die Bagger?<br />
Überhaupt nicht. Auch in China gibt es<br />
bei großen Bau- und Infrastrukturprojekten<br />
einen erheblichen Diskussionsprozess,<br />
der auch gegenläufig ist – von der<br />
Stadtebene zur Staatsebene und umgekehrt.<br />
Aber daran sind wir als Planungsbüro<br />
nicht beteiligt.<br />
Wie denken Ihre chinesischen Geschäftspartner<br />
heute über Deutschland?<br />
Mein Eindruck ist, dass nicht nur in<br />
China, sondern auch in vielen anderen<br />
Staaten Deutschland immer noch mit das<br />
höchste Ansehen in der Welt hat. Leider<br />
nutzen wir dieses Ansehen in Deutschland<br />
nicht genug.<br />
Umgekehrt verbinden viele Deutsche<br />
mit China immer noch billige<br />
Massenproduktion.<br />
Was ein Fehler ist. Man muss sich doch<br />
nur einmal anschauen, welche riesigen<br />
Anstrengungen die Chinesen etwa auf<br />
dem Gebiet der Energieeffizienz geleistet<br />
haben. Auch bei den alternativen Energien<br />
sind sie inzwischen dabei, uns zu<br />
überrunden. Das ist dort ein sehr wichtiges<br />
Thema. Die Chinesen wollen sich auf<br />
diesem Gebiet auch deshalb keinen internationalen<br />
Regeln unterwerfen, weil<br />
sie der Überzeugung sind, es besser machen<br />
zu können. Solche Themen werden<br />
in Deutschland kaum gewürdigt. Überhaupt<br />
wird China in den deutschen Medien<br />
immer schlechter dargestellt, als es<br />
der Realität entspricht.<br />
Sie arbeiten ja auch viel für Regierungen,<br />
die demokratisch nicht legitimiert sind.<br />
Foto: Picture Alliance/ZB/euroluftbild.de<br />
86 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Das<br />
technisch<br />
Machbare<br />
verführt<br />
Politiker<br />
und Planer<br />
dazu,<br />
einfachere<br />
Lösungen zu<br />
ignorieren“<br />
Haben Sie da manchmal ein ungutes<br />
Gefühl?<br />
Die Frage stellt sich auf der Ebene nicht,<br />
auf der unser Büro in solchen Ländern<br />
arbeitet. Denn wir haben mit der Politik<br />
wenig zu tun. Aber grundsätzlich finde<br />
ich schon, dass die Frage berechtigt ist.<br />
Wer wie ich seit 40 Jahren auch in Saudi-<br />
Arabien arbeitet, muss sich einfach klarmachen,<br />
dass das eine andere Welt ist,<br />
die aus dem Beduinentum entstammt.<br />
Dort kann übrigens jeder Bürger zu einer<br />
Audienz beim König kommen und findet<br />
Gehör. Man kann nicht alles an unserer<br />
doch sehr jungen Demokratie messen.<br />
Ich bin aber überzeugt davon, dass wir in<br />
jedem Land arbeiten können sollten, mit<br />
dem die Bundesrepublik diplomatische<br />
Beziehungen unterhält.<br />
Im Handelsblatt war unlängst zu lesen,<br />
dass die ständigen Verweise aus Deutschland<br />
bezüglich Menschenrechten in den<br />
betroffenen Ländern zu einer Benachteiligung<br />
deutscher Firmen führten. Haben Sie<br />
diese Erfahrung auch gemacht?<br />
Nein.<br />
Die Entscheidung, eine Fußball-Weltmeisterschaft<br />
im Wüstenstaat Katar abzuhalten,<br />
wurde hierzulande heftig kritisiert. Sie<br />
selbst waren ja maßgeblich daran beteiligt,<br />
dass das Emirat den Zuschlag dafür erhielt.<br />
Hat es Sie nicht selbst ein bisschen<br />
erstaunt, dass es geklappt hat?<br />
Ich war schon überrascht. Ich saß zu<br />
Hause vor dem Fernseher und habe die<br />
Übertragung der Endausscheidung gesehen.<br />
Scheich Mohammed, einer der<br />
Söhne des Emirs von Katar und Vorsitzender<br />
des Bewerbungskomitees, rief hinterher<br />
bei mir an und sagte: „I love my<br />
Germans!“<br />
Was erwidern Sie denn Kritikern wie Franz<br />
Beckenbauer, der eine WM in Katar schon<br />
aufgrund der dortigen Klimaverhältnisse<br />
ablehnt?<br />
Wir haben nachgewiesen, dass es trotz der<br />
Hitze mit hohem technischem Aufwand<br />
und unter Verwendung von Solarenergie<br />
möglich ist, dort eine Fußball-WM zu<br />
veranstalten. Dass es ökologisch sinnvoller<br />
wäre, den Termin in den Herbst oder<br />
Winter zu verschieben, ist eindeutig. Aber<br />
es geht auch so. Ich bin zudem der Überzeugung,<br />
dass diese Region ein Recht<br />
darauf hat, trotz der klimatisch schwierigen<br />
Bedingungen ein solches Großereignis<br />
durchzuführen.<br />
Franz Beckenbauer hat den Katarern mehr<br />
oder weniger offen unterstellt, die WM<br />
gekauft zu haben …<br />
Da liegt er völlig verkehrt. Wir haben<br />
nachgewiesen, dass Katar in der Lage ist,<br />
die WM zu stemmen. Und natürlich gehört<br />
Lobbying immer dazu, um den Zuschlag<br />
zu erhalten; das machen alle anderen<br />
Bewerber genauso. Aber dass die<br />
Katarer die Fußball‐WM „gekauft“ haben,<br />
halte ich für völlig ausgeschlossen.<br />
Werden Sie im Ausland eigentlich oft<br />
auf Ihren berühmt-berüchtigten Vater<br />
angesprochen?<br />
Überhaupt nicht. Das ist nur in Deutschland<br />
Thema. Ich gebe aber offen zu, dass<br />
das Interesse an meiner Person mit meinem<br />
Vater zusammenhängt. So ist es halt.<br />
Gibt es in anderen Ländern eine Faszination<br />
für Großprojekte, die wir in Deutschland<br />
auch aufgrund der Erfahrungen aus<br />
der Nazizeit verloren haben?<br />
Den Eindruck habe ich nicht. Wir haben<br />
in Deutschland wegen der schrumpfenden<br />
Bevölkerung schlicht keinen Bedarf mehr,<br />
zum Beispiel ganze Stadtviertel neu zu planen.<br />
Das ist in einem Land wie Ägypten<br />
ganz anders, wo wir für Alexandria einen<br />
Masterplan bis zum Jahr 2033 erstellen –<br />
die Stadt wird bis dahin von 3,5 Millionen<br />
auf 5,5 Millionen Einwohner gewachsen<br />
sein. Da braucht es einfach neue<br />
Städte und eine neue Infrastruktur.<br />
Sie haben einmal gesagt, Ihr persönliches<br />
Motto laute: „Das Leben ist Risiko.“ Ist<br />
uns Deutschen die Bereitschaft zum<br />
Risiko abhandengekommen?<br />
Generell kann man das nicht sagen. Aber<br />
um Risiken einzugehen, braucht es ein<br />
erhebliches Maß an Eigeninitiative.<br />
Kommen Sie von Ihren vielen Reisen gern<br />
nach Deutschland zurück?<br />
Ja. Wir leben hier auf einer Wohlstandsinsel<br />
von ungeheuren Ausmaßen – von<br />
der Infrastruktur bis hin zur Kultur. Um<br />
das alles zu erhalten, müssen wir uns zukünftig<br />
mehr anstrengen.<br />
Das Gespräch führte Alexander Marguier<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 87
| K a p i t a l | G o t t e s t e i l c h e n<br />
Urknallköpfe<br />
Fast ein halbes Jahrhundert hat die Suche nach dem Higgs-Boson gedauert.<br />
Die Fotoreportage von Peter Ginter zeigt die Menschen hinter dem aufwendigsten<br />
wissenschaftlichen Experiment der Menschheitsgeschichte am Cern in Genf<br />
88 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Der Zen-Buddhist<br />
Vincent Vuillemin ist seit<br />
2010 der Ombudsmann<br />
am Cern, vorher<br />
leitete der Physiker<br />
die Technikabteilung<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 89
90 <strong>Cicero</strong> 8.2012
G o t t e s t e i l c h e n | K a p i t a l |<br />
Urgestein am<br />
Cern: John Ellis<br />
ist seit 1973 in<br />
Genf und leitete<br />
jahrelang die<br />
Theorie-Abteilung<br />
Zusammenbau des<br />
inneren Detektors<br />
der Atlas‐Messstation<br />
im Reinraum<br />
Der CMS-Detektor, eine von vier Messstationen entlang des<br />
27 Kilometer langen LHC-Rings, wiegt mehrere Tausend Tonnen<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 91
| K a p i t a l | G o t t e s t e i l c h e n<br />
Helm ab zum<br />
Gebet: Mehr als<br />
10 000 Wissenschaftler<br />
verschiedenster<br />
Religionen<br />
aus aller Welt<br />
arbeiten am Cern<br />
friedlich zusammen<br />
Stringtheorie in der<br />
Praxis: Pippa Wells<br />
(links), Projektleiterin<br />
beim LHC, und<br />
ihre Kolleginnen<br />
treten regelmäßig<br />
als Streicherensemble<br />
auf<br />
Bewegliches Teilchen: Der Physikerin Helenka Przysiężniak kommen<br />
die besten Einfälle beim Klettern, unter ihr Hunderte Meter Leere<br />
92 <strong>Cicero</strong> 8.2012
8.2012 <strong>Cicero</strong> 93
94 <strong>Cicero</strong> 8.2012
G o t t e s t e i l c h e n | K a p i t a l |<br />
Wartung des Beschleunigers:<br />
Die Teilchen fliegen im<br />
Vakuum bei -271,3 Grad<br />
Celsius durch die schmale<br />
Röhre in der Mitte des Rohrs<br />
W<br />
issenschaft ist wie Sex: Manchmal<br />
kommt etwas Sinnvolles dabei<br />
raus, das ist aber nicht der<br />
Grund, warum wir es tun.“ Diese vorbildliche<br />
Definition für Grundlagenforschung<br />
stammt aus der Feder des amerikanischen<br />
Physikers Richard P. Feynman, der 1965<br />
für seine Arbeiten zur Quantenfeldtheorie<br />
den Physiknobelpreis erhielt. Je nachdem,<br />
wie man den Satz liest, dient er entweder<br />
als Beleg des Vorurteils des vergeistigten,<br />
eindimensionalen, beziehungsunfähigen<br />
Wissenschaftlers oder als das genaue Gegenteil.<br />
Denn um Wissenschaft und Sex<br />
zu vergleichen, muss man schließlich beides<br />
mal gemacht haben.<br />
Das obige Zitat ist dem Fotobildband<br />
„LHC“ von Peter Ginter vorangestellt. Der<br />
Fotograf hat 15 Jahre lang den Aufbau des<br />
Large Hadron Collider (LHC) dokumentiert,<br />
vor allem aber auch die Menschen<br />
hinter dem leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger<br />
am Cern in Genf porträtiert.<br />
Anfang Juli fand dort die vorläufige Krönung<br />
der Arbeit von mehr als 10 000 Physikern<br />
und Ingenieuren aus aller Welt statt,<br />
als erstmals im Experiment die Existenz des<br />
Higgs-Boson nachgewiesen werden konnte,<br />
dem letzten Baustein in der Theorie der<br />
Elementarteilchen.<br />
Weniger bekannt ist, dass es beim Cern<br />
bis Ende Juli noch eine weitere Einheit mit<br />
der Abkürzung LHC gab, die Band Les<br />
Horribles Cernettes, die kürzlich in Genf<br />
ihr Abschiedskonzert gab. Gegründet<br />
wurde die Band vor 22 Jahren von einer<br />
Sekretärin, die über ihre unbefriedigende<br />
Beziehung zu einem Cern-Physiker sang:<br />
„Nie rufst du an, nie triffst du dich mit mir.<br />
Du gehst nicht mal mit anderen Mädchen<br />
aus, du liebst nur deinen Beschleuniger.“<br />
Allgemeine Schlüsse lassen sich aus<br />
dem Song allerdings nicht ziehen, weil<br />
es am Cern viele Forscher gibt, die neben<br />
ihrer Expertise in der Teilchenphysik<br />
über weitere erstaunliche Talente verfügen.<br />
Die Britin Pippa Wells, Projektleiterin<br />
beim LHC, ist ambitionierte Geigerin.<br />
„Als gewissenhafter Amateur kann man in<br />
der Musik ein ordentliches Niveau erreichen,<br />
in der Teilchenphysik nicht“, begründet<br />
Wells ihren Entschluss, sich beruflich<br />
gegen die Musik und für die Welt<br />
der Kleinstelemente entschieden zu haben.<br />
Wie gewissenhaft die Britin aber auch ihr<br />
Geigenspiel weiter vorangetrieben hat,<br />
zeigt die Tatsache, dass sie nebenher beim<br />
Genfer Symphonieorchester die erste Geige<br />
spielt. Ihre kanadische Kollegin Helenka<br />
Przysiężniak, die sich in Genf mit Extradimensionen<br />
beschäftigt, läuft zur Ablenkung<br />
Marathons in etwas mehr als drei<br />
Stunden. Da die zweifache Mutter aus<br />
<strong>Zeit</strong>gründen nicht mehr so viel klettern<br />
und wandern gehen kann, hat sie die zeiteffizienteren<br />
intensiven Bergläufe für sich<br />
entdeckt.<br />
Vincent Vuillemin nutzt seine private<br />
intensive Beschäftigung mit dem Zen-<br />
Buddhis mus auch am Cern, wo der ehemalige<br />
Leiter der Technikabteilung inzwischen<br />
als Ombudsmann tätig ist, der Konflikte<br />
und Eifersüchteleien unter den Eliteforschern<br />
intern zu schlichten hilft.<br />
Es gibt aber am Cern auch die anderen<br />
Geschichten von Forschern, die nach<br />
mehreren Jahren den Genfer See nie gesehen<br />
haben und außerhalb ihrer Büros, in<br />
denen sie zwischen monströsen Papierbergen<br />
hausen, Entzugserscheinungen bekommen.<br />
Vor Jahren soll ein Physiker sogar mal<br />
an Skorbut erkrankt sein, weil er monatelang<br />
nichts Frisches gegessen hatte.<br />
Ob er Pate für das Lied von Les Horribles<br />
Cernettes stand, ist nicht bekannt.<br />
Letztlich haben auch die Bandmitglieder<br />
von ihren hyperintelligenten Forscherfreunden<br />
profitiert. Nach eigener Darstellung<br />
waren sie nämlich die erste Band mit<br />
eigener Homepage und einem Foto von ihnen<br />
im World Wide Web. Selbiges wurde<br />
nämlich auch Ende der achtziger Jahre<br />
von dem Cern-Mitarbeiter Tim Berners-<br />
Lee mehr oder weniger nebenher erfunden.<br />
Wenn ab und zu etwas so Sinnvolles dabei<br />
herauskommt, erübrigt sich jede Diskussion<br />
über den Sinn der Suche nach dem<br />
Higgs-Teilchen. Carlo Rubbia, italienischer<br />
Physiknobelpreisträger, sagte dazu kürzlich<br />
in der FAZ: „Der praktische Nutzen<br />
ist gleich null. Aber es gibt Dinge, die wichtig<br />
sind, weil sie unserem Wunsch entsprechen<br />
zu wissen, woher wir kommen, wohin<br />
wir gehen und woraus wir sind.“ til<br />
Der Bildband „ L H C “<br />
von Peter Ginter<br />
ist in der Edition<br />
Lammerhuber erschienen.<br />
Die Texte haben der<br />
Schriftsteller Franzobel<br />
und Cern-Generaldirektor<br />
Rolf-Dieter Heuer verfasst<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 95
| K a p i t a l | E u r o k r i s e<br />
Europas schmutziges<br />
kleines Geheimnis<br />
Das Unheil begann in Deutschland: Die Niedrigzinspolitik der EZB nach dem Dotcom-<br />
Crash half vor allem den Deutschen. Europas Peripherie hat sie ins Verderben gestürzt<br />
von Mark Dittli<br />
D<br />
ie Spanier sind faul. Die Portugiesen<br />
und Italiener sowieso.<br />
Und die Iren trinken hauptsächlich.<br />
Ihrem eigenen Schlendrian<br />
haben es diese Länder zu verdanken,<br />
dass ihre Staatsschulden heute untragbar<br />
hoch sind, sie ihre Wettbewerbsfähigkeit<br />
verloren haben und sie in der Krise<br />
stecken.<br />
Die Deutschen dagegen sind die erfolgreichen<br />
Exporteure. Global wettbewerbsfähig<br />
wie kaum eine andere Nation. Diesen<br />
Status haben sie sich selbst erschaffen,<br />
mit harten Strukturreformen im eigenen<br />
Arbeitsmarkt.<br />
Wenn die Welt doch bloß so einfach<br />
wäre.<br />
Leider ist alles etwas komplizierter.<br />
Die heutige Stärke Deutschlands und die<br />
Schwäche Spaniens, Irlands, Portugals und<br />
zum Teil auch Italiens ist eine direkte Folge<br />
der Einführung der Gemeinschaftswährung<br />
im Jahr 1999 sowie der Politik der<br />
Europäischen Zentralbank nach der Jahrtausendwende.<br />
Griechenland wird in der<br />
Aufzählung bewusst nicht aufgeführt, denn<br />
dort ist die Lage tatsächlich verbockt.<br />
Blenden wir also zurück, ins Jahr 2000:<br />
Deutschland war damals der kranke Mann<br />
Europas, der es kaum mehr zu schaffen<br />
schien, Wachstumsraten von mehr als<br />
2 Prozent zu erreichen. Das Platzen der<br />
Technologieblase im Frühjahr 2000 traf<br />
die Deutschen besonders hart: Der zuvor<br />
hochgejubelte Neue Markt in Frankfurt<br />
brach um 96 Prozent ein.<br />
Als Folge dieses Schocks fiel die deutsche<br />
Wirtschaft 2002 und 2003 in eine sich<br />
selbst verstärkende Abschwungphase. Es<br />
handelte sich dabei nämlich nicht um eine<br />
normale, harmlose Abkühlung, sondern<br />
Finanzierungssaldi Deutschland [in % des BIP]<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
-20<br />
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 [Jahr]<br />
Quelle: Nomura Research Institute<br />
Lohnkosten in den wichtigsten Ländern der Eurozone [2000=100]<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
Haushalte<br />
Außenhandel<br />
Unternehmen<br />
Staat<br />
Bilanzrezession<br />
Deutschland<br />
Irland<br />
Griechenland<br />
Spanien<br />
Frankreich<br />
Italien<br />
Portugal<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
2011 [Jahr]<br />
Quelle: Eurostat<br />
96 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Grafiken: <strong>Cicero</strong> (Quelle: Eurostat); Foto: privat<br />
um eine Bilanzrezession. Ein Land kann in<br />
eine Bilanzrezession fallen, wenn es zuvor<br />
einen exzessiven privaten Schuldenaufbau<br />
durchlebt hat. Kippt dann die Stimmung<br />
und kühlt sich die Wirtschaft des Landes<br />
ab, setzt das „Sparparadox“ ein: Die privaten<br />
Haushalte oder die Unternehmen sind<br />
plötzlich mit zu hohen Schulden belastet<br />
und versuchen, sie abzubauen. Jeder agiert<br />
für sich rational; er erhöht seine Sparquote<br />
und zahlt Schulden zurück. Wenn das aber<br />
alle gleichzeitig tun, sackt die Nachfrage<br />
in der Volkswirtschaft in sich zusammen.<br />
Was damals in Deutschland geschah, hat<br />
Richard Koo, der Leiter des Nomura Research<br />
Institute in Tokio, in einer aktuellen<br />
Studie beschrieben (siehe Grafik „Finanzierungssaldi<br />
Deutschlands“).<br />
Die Kurven zeigen die Finanzierungssaldi<br />
der vier Nachfragesektoren in einer<br />
Volkswirtschaft (Haushalte, Unternehmen,<br />
Staat, Ausland). Speziell zu beachten sind<br />
die rote und die blaue Kurve. Sie zeigen,<br />
wie die privaten Haushalte und besonders<br />
die Unternehmen in Deutschland nach<br />
dem Schock von 2000 ihre Sparquote deutlich<br />
erhöhten – im Fall der Unternehmen<br />
von minus 5 Prozent auf plus 4 Prozent des<br />
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Diese Bewegung<br />
entzog der deutschen Volkswirtschaft<br />
nach Berechnungen Koos zwischen 2000<br />
und 2005 eine aggregierte Nachfrage von<br />
12,6 Prozent des BIP.<br />
Deutschlands Inflationsrate fiel damals<br />
auf deutlich unter 1 Prozent, das Land<br />
drohte in die Deflation abzugleiten. Was<br />
Deutsche Handelsbilanz [in Mrd. € pro Monat]<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12<br />
Eurozone US Asien<br />
Deutschlands<br />
Stärke ist die<br />
Schwäche der<br />
anderen<br />
tat die Europäische Zentralbank (EZB) dagegen?<br />
Sie riss die geldpolitischen Schleusen<br />
auf. Zwischen 2001 und 2003 senkte<br />
die Zentralbank den Leitzins von 4,75 Prozent<br />
auf ein Nachkriegstief von 2 Prozent<br />
und beließ den Satz dort.<br />
Diese Maßnahme rettete Deutschland.<br />
Und sie stürzte Irland, Spanien und Portugal<br />
ins Verderben. Deren Volkswirtschaften<br />
nämlich steckten nicht in einer Bilanzrezession,<br />
und die Niedrigzinspolitik der<br />
EZB ließ sie überhitzen. Spanien und Irland<br />
verzeichneten zwischen 2001 und<br />
2007 im Schnitt jährliche Konsumpreis-<br />
Inflationsraten von deutlich über 3 Prozent<br />
pro Jahr, während es in Deutschland weniger<br />
als 1,7 Prozent waren. Wie Richard<br />
Koo in seiner Studie nachweist, stiegen<br />
die Immobilienpreise in Spanien zwischen<br />
2000 und 2005 sogar um 107 Prozent, in<br />
Irland schossen sie um 76 Prozent in die<br />
Höhe. In Deutschland fielen sie dagegen<br />
um 8 Prozent.<br />
[Jahr]<br />
Quelle: Deutsche Bundesbank<br />
Und als direkte Konsequenz der divergierenden<br />
Inflationsraten begannen auch<br />
die Arbeitskosten auseinanderzuklaffen<br />
(siehe Grafik „Lohnkosten in den wichtigsten<br />
Ländern der Eurozone“). Es war in diesen<br />
verhängnisvollen Jahren zwischen 2000<br />
und 2005, als die internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
der europäischen Peripheriestaaten,<br />
ganz besonders Spaniens und Irlands,<br />
ruiniert wurde.<br />
Sie wurde geopfert, um Deutschland zu<br />
retten. Bezeichnenderweise argumentierten<br />
deutsche Ökonomen wie Hans-Werner<br />
Sinn und Axel Weber damals, einige Länder<br />
in Europa müssten höhere Inflationsraten<br />
erdulden, damit die EZB sicherstellen<br />
könne, dass kein Land – gemeint war in<br />
diesem Fall Deutschland – in eine Deflation<br />
abgleite. Weber kam in seinem Papier sogar<br />
zu dem Schluss, dass Inflationsdivergenz innerhalb<br />
der Eurozone kein Problem darstelle.<br />
Deutsche Politiker argumentieren<br />
heute oft und gerne, ihre Wirtschaft sei<br />
so wettbewerbsfähig, weil zwischen 2003<br />
und 2005 harte Reformen am Arbeits- und<br />
Dienstleistungsmarkt durchgesetzt wurden.<br />
Diese waren gewiss nötig, und Deutschland<br />
hat allen Grund, stolz darauf zu sein.<br />
Bloß, ist das wirklich die einzige Erklärung?<br />
Ein Blick auf den Saldo der deutschen<br />
Handelsbilanz (siehe Grafik) mit den Ländern<br />
der Eurozone, den USA und Asien:<br />
Nach der Einführung des Euro und der<br />
extrem lockeren Geldpolitik der EZB zwischen<br />
2001 und 2004 schwollen vor allem<br />
Deutschlands Handelsüberschüsse mit den<br />
anderen Euroländern an. Wäre Deutschland<br />
nach den eigenen Marktreformen tatsächlich<br />
weltweit wettbewerbsfähiger geworden,<br />
hätten auch die Überschüsse im<br />
Handel mit den USA und Asien steigen<br />
müssen. Das taten sie aber erst ab 2010.<br />
Nein, die Sache ist profaner: Deutschland<br />
fand zu neuer Stärke, weil es die Handelsüberschüsse<br />
mit den anderen Euroländern<br />
massiv erhöhen konnte. Deutschland<br />
wurde in Europa wettbewerbsfähiger, weil<br />
die Peripheriestaaten als Folge der EZB-Politik<br />
wettbewerbsunfähiger wurden.<br />
Das ist das kleine schmutzige Geheimnis<br />
der heutigen Eurokrise.<br />
Mark Dittli<br />
ist Chefredakteur der Schweizer<br />
<strong>Zeit</strong>ung Finanz und Wirtschaft<br />
und einer der Autoren des Blogs<br />
„Never mind the markets …“<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 97
| S a l o n<br />
Die Macht des Orakels<br />
Heiner Goebbels, der legendäre Experimentaltheater-Macher, leitet die Ruhrtriennale – und inszeniert John Cage<br />
von Barbara Burckhardt<br />
I<br />
m August wird er 60. Die weiße<br />
Haarpracht passt dazu, die Biografie<br />
nicht. Für sie hätten die meisten<br />
doppelt so viele Jahre gebraucht und<br />
wären jetzt einigermaßen erschöpft. Der<br />
Mann, der da gelassen in einem sachlich<br />
hellen Zimmer im Gelsenkirchener Wissenschaftspark<br />
sitzt, übt stattdessen mal wieder<br />
einen neuen Beruf aus. Heiner Goebbels,<br />
der Komponist, Theatermacher und Professor,<br />
ist für die nächsten drei Jahre Chef<br />
der Ruhrtriennale, jenes legendären Festivals,<br />
das die Industriedenkmäler des Ruhrgebiets<br />
in Plätze der Kunst verwandelt. Am<br />
17. August geht es los: mit dem Festival und<br />
dem neuen Lebensjahrzehnt.<br />
Das alte endete erfreulich: Im<br />
März erhielt Heiner Goebbels den mit<br />
300 000 Euro dotierten norwegischen Ibsen-Preis,<br />
der vor ihm an die Theatermacher<br />
Peter Brook, Ariane Mnouchkine<br />
und Jon Fosse ging. Goebbels, mit weichem<br />
pfälzischen Tonfall und so freundlich,<br />
als wolle er die scharfe Intellektualität<br />
des Avantgarde-Künstlers kaschieren,<br />
fragt: „Hatten Sie von dem Preis vorher<br />
schon mal gehört?“ Ehrlich gesagt: nein.<br />
Der Maestro nickt.<br />
In den siebziger Jahren studierte Goebbels<br />
in Frankfurt Musik, aber auch Soziologie,<br />
das Lieblingsfach der politisch bewegten<br />
Nachachtundsechziger. Er lebte im<br />
selben besetzten Häuserblock wie Joschka<br />
Fischer, und sein 1976 gegründetes „Sogenanntes<br />
Linksradikales Blasorchester“ gab<br />
der dortigen Spontiszene fünf Jahre lang<br />
den musikalischen Takt vor. Goebbels blies<br />
das Saxofon. Frankfurt ist bis heute einer<br />
der wenigen Fixpunkte im Leben des Mannes,<br />
der von sich sagt, dass er am liebsten<br />
alle sieben Jahre das Berufsfeld wechsele.<br />
Er langweile sich so schnell.<br />
In den vergangenen 30 Jahren prägte<br />
er als Professor und Direktor die deutsche<br />
Performance-Schmiede, das Institut für<br />
Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen.<br />
Er ging als Musiker mit dem Art-Rock-Trio<br />
„Cassiber“ auf Tour, komponierte Theaterund<br />
Filmmusik für Hans Neuenfels, Claus<br />
Peymann und Helke Sander, vertonte als<br />
Hörspielmacher vor allem Heiner-Müller-<br />
Material, komponierte Kammermusik für<br />
das weltberühmte Ensemble Modern und<br />
reiste mit seinen legendären eigenen Theaterarbeiten<br />
um die Welt.<br />
Die Texte, mit denen Goebbels auf der<br />
Bühne arbeitet, stammen von Samuel Beckett,<br />
Ludwig Wittgenstein, Elias Canetti,<br />
Heiner Müller oder Franz Kafka. Vieldeutig<br />
sind sie, und ihr Rätsel sollen sie auch<br />
behalten, findet er. Er sampelt Klänge dazu,<br />
und am Ende ist es der Zuschauer, der sich<br />
aus dem Angebot an Tönen, Worten, Gesten,<br />
Bildern und Licht im eigenen Kopf<br />
sein Kunstwerk schafft. „Er muss nicht alles<br />
verstehen, ich arbeite nie symbolisch“,<br />
sagt Goebbels. Es gehe um das Material<br />
selbst, um die sinnliche Erfahrung, die<br />
Wahrnehmung des Moments.<br />
Auch die nächsten drei Jahre Ruhrtriennale<br />
sollen Musik, Performance und Bildende<br />
Kunst gleichberechtigt zusammenbringen.<br />
Und die teilnehmenden Künstler<br />
können so arbeiten, wie Goebbels selbst es<br />
tut: ausgehend von Orten, von Menschen,<br />
vom Vorgefundenen, multiperspektiv, im<br />
offenen Probenprozess. Die Preise wird<br />
die unvoreingenommenste Publikumsjury<br />
vergeben, die man sich nur denken kann:<br />
100 Kinder aus der Region. Sie werden bestimmen,<br />
wer die coolste Tänzerin ist, die<br />
gruseligste Frisur hat und welcher Moment<br />
nicht vergehen soll.<br />
Zur Eröffnung des Festivals inszeniert<br />
Goebbels selbst in der Jahrhunderthalle in<br />
Bochum John Cages fast vergessene „Europeras<br />
1&2“ von 1987, eine experimentelle<br />
Versuchsanordnung ganz in seinem<br />
Sinne: Mit Versatzstücken und Figuren<br />
aus 64 Opern der europäischen Musikgeschichte<br />
montierte Cage nach dem Zufallsprinzip<br />
des auch als „Weisheitsbuch“ bekannten<br />
chinesischen Orakels I Ging ein<br />
neues Ganzes, eine „Oper der Wandlungen“,<br />
die Goebbels’ Prinzip der Gleichberechtigung<br />
aller Mittel auf die Spitze treibt.<br />
Goebbels und sein Bühnenbildner<br />
Klaus Grünberg zitieren dafür nicht weniger<br />
als 32 Bühnenräume aus über 100 Jahren<br />
Theatergeschichte herbei. Goebbels klappt<br />
den Laptop auf und zeigt ein paar Bilder<br />
von überwältigender Schönheit. Nicht länger<br />
als drei Minuten werden die Sets in den<br />
ersten 90 Minuten des Abends aufleuchten,<br />
und alle sind sie echt – gemalt, gebaut, geschichtet.<br />
Nicht zuletzt eine gewaltige logistische<br />
Leistung. Wird der Orakel-Zufall da<br />
vielleicht doch ab und zu pragmatisch korrigiert?<br />
Goebbels grinst: „Auch Cage hat hier<br />
und da geschummelt.“<br />
Mit 60 könnte man eine erste Bilanz<br />
ziehen, nach einem Leben, das aus der<br />
Ferne selbst ein bisschen so wirkt, als sei es<br />
mithilfe des I Ging gesampelt worden: Auf<br />
wie vielen Hochzeiten hat man getanzt, wie<br />
viele Begabungen unter einen Hut gebracht,<br />
wie viel Welt gesehen? So etwas macht der<br />
Künstler aber höchstens für Journalisten,<br />
in aller Freundlichkeit auch bei den<br />
dümmsten Fragen: Wie schafft man das alles<br />
bloß? „Ich bin zwar kein Buddhist“, sagt<br />
er, „aber eine gewisse buddhistische Gelassenheit<br />
hilft.“ Lehnt sich zurück, trinkt einen<br />
Schluck Tee und knabbert am Keks.<br />
Man kann gar nicht anders: Heiner Goebbels<br />
muss man sich als einen glücklichen<br />
Menschen vorstellen.<br />
Barbara Burckhardt<br />
ist Redakteurin der <strong>Zeit</strong>schrift<br />
Theater heute<br />
Fotos: Edgar Schoepal, Privat (Autorin)<br />
98 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Heiner Goebbels<br />
vor einem der<br />
32 Bühnenbilder<br />
seines John-Cage-<br />
Spektakels<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 99
| S a l o n<br />
Töchter und Väter<br />
Nora Bossong hat den Roman der Stunde geschrieben. Und der handelt von einem Frotteewarenhersteller<br />
von Maike ALBATH<br />
E<br />
s ist einer dieser Berliner Sommervormittage,<br />
an denen man<br />
sich wundert, dass die Stadt nicht<br />
am Meer liegt, so badestrandversessen sehen<br />
die Cafébesucher mit ihren Flipflops<br />
und kurzen Hosen aus. Auch der leichte<br />
norddeutsche Tonfall von Nora Bossong<br />
hat mehr mit der Küste als mit Berlin zu<br />
tun. Bossong, Jahrgang 1982, wuchs zwischen<br />
Bremen und Hamburg auf. Einen<br />
Moment lang denkt man bei ihrem klaren,<br />
durchscheinenden Gesicht an die Gemälde<br />
der Präraffaeliten. Der Eindruck des<br />
Ätherischen verfliegt sofort, denn die junge<br />
Autorin, die nicht nur Prosa, sondern auch<br />
Gedichte schreibt, hat etwas erfrischend<br />
Diesseitiges. Nach ihrem Abschluss am<br />
Leipziger Literaturinstitut und dem Studium<br />
der Kulturwissenschaften ging sie für<br />
eine Recherche länger nach Rom. „Wenn<br />
ich Heimweh bekam, las ich immer die<br />
Buddenbrooks“, sagt sie. Dies sei der Auslöser<br />
für ihren dritten Roman gewesen, in<br />
dem ein Familienunternehmen im Mittelpunkt<br />
steht.<br />
Tietjen & Söhne ist eine kleine Firma<br />
für Frotteeware mit 250 Angestellten. Kurt<br />
Tietjen, Enkel des Gründers und mittlerweile<br />
fast im Pensionsalter, hat mit seinem<br />
Schwager das Unternehmen an den Rand<br />
der Insolvenz gebracht. In einer Kurzschlussreaktion<br />
taucht er in New York ab.<br />
Seiner Tochter Luise, die gerade an einer<br />
Abschlussarbeit über Horkheimer sitzt,<br />
bleibt nichts anderes übrig, als die Geschäfte<br />
zu übernehmen. „Wie wird Macht<br />
vererbt und weitergegeben? Das hat mich<br />
interessiert“, meint Bossong. So egalitär<br />
wie die Bundesrepublik immer tue, sei sie<br />
gar nicht. „Schon achtjährige Kinder wissen<br />
genau, wo sie sozial stehen.“ Ohne dass<br />
ihr Vater sonderlich arm gewesen wäre – er<br />
hat als Sozialwissenschaftler für den Hamburger<br />
Senat gearbeitet –, gehörte die Familie<br />
in Blankenese eher zur Unterschicht.<br />
„Das wurde mir in der Schule signalisiert;<br />
da funktionieren bestimmte Codes“, sagt<br />
Bossong. „Bei denjenigen aus den großen<br />
Hamburger Familien war klar, was ihnen<br />
zusteht.“ Aber Reichtum und Einfluss sind<br />
nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein<br />
Fluch. Kurt Tietjen, der plötzlich die Freiheit<br />
der Besitzlosen ahnt und versucht, in<br />
einer schäbigen Mietwohnung in Brooklyn<br />
ein neues Leben anzufangen, entkommt<br />
seinem Schicksal natürlich nicht. Selbst<br />
seine billig blondierte neue Freundin weiß<br />
genau, wen sie vor sich hat.<br />
Als Inhaber eines Unternehmens habe<br />
man schließlich auch eine Verantwortung,<br />
sagt Bossong, die für ihre Recherche den<br />
Aufstieg der Krupps studierte und Joseph<br />
Schumpeter, Friedrich August von Hayek<br />
und Alexis de Tocqueville las. „Eine herausragende<br />
soziale Stellung muss man<br />
erst einmal schultern. Man kann sich<br />
nicht indifferent verhalten. Selbst wenn<br />
ich 50 Millionen Euro verschenke, löst<br />
das eine Kette von Handlungen aus.“ Luise<br />
Tietjen, die sich mithilfe des aufstiegsbewussten<br />
Managers Krays bemüht, den<br />
Karren aus dem Dreck zu ziehen, geht mit<br />
diesem Krays auch noch ein Liebesverhältnis<br />
ein, was die vollkommene Verschmelzung<br />
von Beruf und Privatsphäre unterstreicht.<br />
„Schon Luises Großvater nimmt<br />
seinen Sohn Kurt nicht als liebenswertes<br />
Wesen, sondern als seinen besten Angestellten<br />
wahr. Die Zusammenhänge des<br />
Wirtschaftslebens verdrängen die Zusammenhänge<br />
des Familienlebens“, meint<br />
Bossong. Im vergangenen Jahr schrieb<br />
sie für die <strong>Zeit</strong> ein FDP-Gedicht und traf<br />
mehrere Politiker in ihrem Alter, bei denen<br />
ebenfalls kaum eine Trennung zwischen<br />
Privatem und Öffentlichem herrsche.<br />
Die Geschwindigkeit, mit der diese<br />
Leute Familienfotos zückten und auf dem<br />
iPhone Lieblingslieder und Youtube-Videos<br />
abspielten, hat Bossong geradezu erschüttert.<br />
Nach 15 Minuten wusste sie,<br />
wie Frau und Kinder aussahen. „Da wird<br />
eine Nähe inszeniert, die sich nicht einmal<br />
künstlich anfühlt. Das finde ich unheimlich.“<br />
Präzise diagnostiziert sie in ihrem<br />
spannungsgeladenen Roman den Zustand<br />
solcher Beziehungen. Ihre Figuren sind<br />
allesamt Gefangene. Wirtschaftliche, private<br />
und politische Interessen verschwimmen<br />
in einer wabernden Grauzone.<br />
Auch Luise Tietjen entkommt dieser<br />
Gefangenschaft nicht. Eine Weile lang<br />
beißt sie sich erfolgreich durch, am Ende<br />
stolpert sie aber in eine Falle ihres Vaters.<br />
Väter und Töchter stehen schon in Bossongs<br />
Romanen „Gegend“ (2006) und<br />
„Webers Protokoll“ (2009) im Mittelpunkt,<br />
ein Thema, an dem sie sich offensichtlich<br />
abarbeitet. „Auch für Frauen meiner Generation“,<br />
meint sie, „sind bei der beruflichen<br />
Orientierung die Väter entscheidend.<br />
Meine Mutter war auch immer berufstätig,<br />
aber sie musste sich rechtfertigen.“ Wenn<br />
ihr Vater eine Packung Miracoli kochte, erzählt<br />
sie, verschaffte ihm das Respekt bei<br />
ihren Großeltern. Dass ihre Mutter ebenfalls<br />
keine besonders gute Köchin war, galt<br />
als Skandal.<br />
Solche Muster zeitigen natürlich Folgen.<br />
Ihre Freundinnen, beobachtete Bossong<br />
später, hätten trotz bester Leistungen<br />
enorm unter Druck gestanden und seien<br />
mit Ende zwanzig dann erschöpft gewesen.<br />
Ihre männlichen Altersgenossen schonten<br />
ihre Ressourcen und starteten dann zum<br />
Berufseinstieg durch. „Selbst von meiner<br />
Mutter höre ich vollkommen inakzeptable<br />
Bemerkungen wie: „Nora, du musst dich<br />
entscheiden. Entweder Beruf oder Glück<br />
in der Liebe.“ Da sage ich dann: „Moment<br />
mal, nee.“ Wir unterhalten uns noch eine<br />
Weile über Rollenmuster und ihre Beständigkeit.<br />
Dann bezahlen wir unseren Kaffee<br />
und genießen die Freiheit.<br />
Maike Albath<br />
ist Literaturkritikerin und<br />
Autorin des Sachbuchs<br />
„Der Geist von Turin“<br />
(Berenberg-Verlag)<br />
Fotos: Maurice Weiss/Ostkreuz, privat (Autorin)<br />
100 <strong>Cicero</strong> 8.2012
„Selbst von meiner Mutter höre<br />
ich manchmal, dass ich mich<br />
zwischen Beruf und Glück in<br />
der Liebe entscheiden müsse!“<br />
Die Schriftstellerin Nora Bossong über Rollenmuster und ihre<br />
Beständigkeit. Ihr neuer Roman „Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung“ erscheint am 27. August im Hanser-Verlag<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 101
| S a l o n<br />
„Ich will manipulieren“<br />
Der Dirigent Christian Thielemann über Rausch, den Maestro als Menschen und einen Haufen Vorurteile<br />
P<br />
robentag in Bayreuth: Fliegender<br />
Holländer. Wir treffen uns in<br />
der getäfelten Festspielkantine.<br />
Christian Thielemann kommt gerade<br />
von einer Massage – der Rücken macht<br />
Probleme. Das viele Proben. „Draußen<br />
oder drinnen?“, fragt er und sagt dann,<br />
ohne eine Antwort abzuwarten, „draußen,<br />
oder?“ Schon vor dem Gespräch wird<br />
klar, wie er bekommt, was er will: offen,<br />
charmant, bestimmt. Dieser Christian<br />
Thie lemann hat nichts mit dem Mann<br />
zu tun, der in der deutschen Presse gern<br />
als ewig Gestriger, als Hans Dampf, als<br />
Urdeutscher beschrieben wird. Dieser<br />
Christian Thielemann ist ganz bei sich.<br />
„Hier in Bayreuth fühle ich mich zu Hause“,<br />
sagt er. „Hier sind wir eine Familie.“ Im<br />
September wird er noch eine Familie<br />
dazubekommen. Eine Wunschfamilie.<br />
Thielemann wird offiziell die Sächsische<br />
Staatskapelle Dresden übernehmen. Das<br />
Orchester Webers und Wagners – seiner<br />
Idole. Und, so sagen viele, eine der besten<br />
Musiktruppen Deutschlands.<br />
Herr Thielemann, warum machen Sie<br />
eigentlich Musik?<br />
Um ehrlich zu sein, darüber habe ich nie<br />
nachgedacht. Das war immer so.<br />
Sie meinen, man muss für die Musik<br />
geboren sein?<br />
Wahrscheinlich schon. Im Idealfall wird<br />
man in ein Umfeld der Musik hineingeboren.<br />
Bei uns zu Hause war das Musizieren<br />
immer selbstverständlich. Der Beruf<br />
Musiker war klar wie Kloßbrühe. Ich<br />
habe als Kind Beethovens Egmont-Ouvertüre<br />
gehört. Das hat einen gewaltsamen<br />
und mächtigen Eindruck auf mich<br />
gemacht. Zwei komische Worte, oder?<br />
Gewaltsam und mächtig! Aber es war irgendwie<br />
schön gewaltsam. Und es war<br />
schön mächtig.<br />
Haben Sie so große Gefühle jemals außerhalb<br />
der Musik empfunden?<br />
Och ja, irgendwann schon – natürlich<br />
im Privatleben. Wenn man mit anderen<br />
Menschen zusammen ist und dankbar ist,<br />
eine bestimmte Situation gemeinsam zu<br />
erleben. Oder wenn ich eine Landschaft<br />
anschaue – wie die Sonne untergeht oder<br />
die Vögel zwitschern. Das ist auch schön.<br />
Aber ich habe auch festgestellt, dass das,<br />
was mir in der Musik so gewaltsam und<br />
mächtig und dabei gleichzeitig so schön<br />
vorkam, im Privaten manchmal nur gewaltsam<br />
und mächtig ist – und manchmal<br />
enttäuschend und unschön.<br />
Sie meinen, dass die Musik selbst dem<br />
menschlichen Abgrund eine gewisse<br />
Ästhetik gibt?<br />
Darin liegt ihr großer Reiz. Und genau<br />
darin liegt auch ihre Gefahr. Musik<br />
schafft es, selbst das Böse schön erscheinen<br />
zu lassen. Ich habe lange gebraucht,<br />
um zu lernen, diese Gefühle zu kontrollieren.<br />
Es ist ein langer Weg, bis man<br />
feststellt, dass die Musik so groß ist, dass<br />
sie einen auch kaputtmachen kann. Dass<br />
man sich in ihr verlieren kann. Dass sie<br />
zerstörerisch wirkt.<br />
Wie meinen Sie das?<br />
Das ist eine psychische Sache. Manchmal<br />
scheint die Musik mehr über mich<br />
zu wissen als ich selbst. Was sie mit mir<br />
anstellt, ist so privat, so intim, so nackt,<br />
dass ich Angst habe, es zuzulassen. In diesen<br />
Augenblicken ist sie wie ein Dämon,<br />
der das Archaische in mir berührt und<br />
mich dazu zwingt, mich ihr vollkommen<br />
auszuliefern. Sie saugt alles aus mir heraus.<br />
Ich hatte etwa oft Angst, unter dem<br />
Einfluss von Musik in Situationen zu geraten,<br />
in denen ich alle Grenzen verliere.<br />
Zum Beispiel Drogen zu nehmen oder<br />
zu schnell mit dem Auto zu fahren und<br />
am Baum zu landen. Inzwischen habe<br />
ich das etwas besser im Griff. Ich weiß,<br />
dass ich an dieser Stelle sehr angreifbar<br />
und verführbar bin. Dass die Musik mich<br />
aufputscht, mich antreibt und aufbaut.<br />
Und dass all das, was sie schafft, auch in<br />
sich zusammenfallen kann. Die Intensität,<br />
mit der man in der Musik lebt, ist so<br />
hoch, dass man selbst irgendwann leer ist.<br />
Musik kann also lebensgefährlich werden?<br />
Jede Kunst ist selbstverständlich eine<br />
Gefahr für das Leben. Alle Formen der<br />
Kunstvermittlung haben ja etwas Existenzielles.<br />
Denken Sie an Maria Callas,<br />
an Wilhelm Furtwängler, an Dietrich Fischer-Dieskau.<br />
Um mit der Musik ein<br />
großes Publikum zu erreichen, müssen<br />
Sie all ihre Konzentration sammeln und<br />
befinden sich automatisch an der Grenze<br />
der Selbstaufgabe. Kunst entsteht auf jeden<br />
Fall immer nur an dieser Grenze.<br />
Um auf ihr zu balancieren, braucht der<br />
Künstler Bauch und Kopf. Und ein Bewusstsein<br />
von der Gefahr des Rausches<br />
und für die wahre Welt.<br />
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie, während<br />
Sie dirigieren, auch private Bilder zu der<br />
Musik im Kopf haben?<br />
Selbstverständlich.<br />
Umso verwunderlicher ist, dass Sie Ihr<br />
Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit<br />
heraushalten.<br />
Ja, weil es sich ja um meinen persönlichen<br />
Film handelt! Welche Bilder, Situationen<br />
und Gefühle man zur Musik<br />
erlebt, ist individuell. Diese Nacktheit<br />
entsteht nur im eigenen Kopf – aus dem<br />
eigenen Leben. Meine Aufgabe als Dirigent<br />
ist, das Persönliche zum Allgemeinen<br />
zu erheben. Erst so kann die Musik<br />
in Kommunikation mit einem Publikum<br />
treten. Deshalb rede ich bei den<br />
Foto: Mat Hennek/Deutsche Grammophon<br />
102 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Christian Thielemann,<br />
Jahrgang 1959,<br />
ist Deutschlands<br />
bekanntester und<br />
umstrittenster Dirigent<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 103
| S a l o n<br />
Proben ja auch nicht viel. Bei den Musikern<br />
ist es ja genauso: Sie müssen ihren<br />
eigenen Zugang, ihre eigene Existenz in<br />
den gleichen Noten finden. Und letztlich<br />
ist das doch auch bei den Komponisten<br />
so: Sie werden vom eigenen Leben inspiriert,<br />
aber ihre Sinfonien und Opern sind<br />
Werke der allgemeinen Menschlichkeit.<br />
Ganz abgesehen davon, dass die Sichtbarkeit<br />
des allzu Privaten meiner Erziehung<br />
widerstrebt. Es ist nicht meine Sache,<br />
mein privates Empfinden in der <strong>Zeit</strong>ung<br />
auszubreiten.<br />
„Wenn Sie mir ein Quäntchen<br />
Selbstherrlichkeit erlauben: Ich<br />
bin die Avantgarde. Ich bin ein<br />
geläuterter Konservativer“<br />
Vielleicht machen sich die Leute deshalb<br />
so viele Gedanken um Ihr Leben? Weil Sie<br />
in der Öffentlichkeit so exzessiv wirken?<br />
Mag sein. Sollen sie ruhig.<br />
Ist die Musik für Sie auch ein Experimentierfeld<br />
für das Leben?<br />
Das muss sie sein, weil sie uns einen risikofreien<br />
Raum schenkt, in dem es kein<br />
Gesetzbuch gibt. Auf der Opernbühne<br />
muss ich dafür sein, dass Tosca von der<br />
Engelsburg springt. Gleichzeitig muss<br />
ich aber auch einer Meinung mit Scarpia<br />
sein, der sie vergewaltigen will. Daran<br />
sehen Sie die Schizophrenie der Musik.<br />
Man bewegt sich – ob man will oder<br />
nicht – Takt für Takt in einem vielfältig<br />
zwiespältigen Kosmos. Zum Wahnsinnigwerden<br />
eigentlich, das alles.<br />
Und wie genau kühlen Sie sich wieder ab?<br />
Ich habe mir Dinge gesucht, mit denen<br />
ich von der Musik loskomme. Ich beschäftige<br />
mich mit Geschichte und bildender<br />
Kunst. Gestern zum Beispiel war<br />
ich im Neuen Schloss in Bayreuth und<br />
habe nach Gemälden gesucht, die ich<br />
unbedingt finden wollte. Das sind Unternehmungen,<br />
um der Macht der Musik<br />
wenigstens zeitweise zu entkommen.<br />
Ganz nach dem Motto von Tannhäuser:<br />
„Aus deinem Reiche muss ich fliehn!“<br />
Merken Sie eigentlich, dass Sie durch<br />
die Musik auch selbst mächtig werden?<br />
Orchestermusiker schwärmen von Ihrer<br />
Inspiration, von Ihrer Art zu bekommen,<br />
was Sie wollen …<br />
Das ist ja keine Macht im eigentlichen<br />
Sinne. In den Proben geht es darum, das<br />
Feuer, das in den Partituren steht, zu entzünden.<br />
Tatsächlich gibt es nur wenige<br />
Menschen, die das können. Die diese<br />
2012 ist ein gutes Jahr für Thielemann: Im September wird er als Chefdirigent die<br />
Leitung der Sächsischen Staatskapelle Dresden übernehmen, zur gleichen <strong>Zeit</strong> erscheint<br />
im Verlag C. H. Beck seine musikalische Autobiografie „Mein Leben mit Wagner“<br />
Prometheus-Qualität haben, weil sie selber<br />
brennen. Aber das ist eine naturgegebene<br />
Begabung.<br />
Und wie steht es mit dem Publikum –<br />
merken Sie, dass Sie eine Macht über Ihre<br />
Zuhörer haben?<br />
Natürlich will ich das Publikum manipulieren.<br />
Mir ist es wichtig, dass mein Publikum<br />
das Theater in einem guten Sinne<br />
manipuliert verlässt. Nicht, dass ich sie<br />
zu Dingen treiben will, die sie nicht wollen.<br />
Aber ich möchte sie günstig beeinflussen<br />
– und vielleicht auf sich selbst,<br />
auf ihre Nacktheit, zurückwerfen. Ich<br />
möchte ihnen jenen Raum öffnen, der<br />
sich auch mir durch die Musik öffnet:<br />
eine Welt, in der man hemmungslos und<br />
ohne Rücksicht auf die Regeln der Welt<br />
denken und fühlen darf. Ich möchte den<br />
Menschen mit der Musik zeigen, dass<br />
wir in einer Sinfonie oder einer Oper<br />
Grenzen überschreiten können, die im<br />
Leben unmöglich wären. Würden wir<br />
zehn Flaschen Wein trinken, hätten wir<br />
eine Alkoholvergiftung. Hören wir zehn<br />
Mal den „Tristan“, erweitert der Rausch<br />
unser Bewusstsein.<br />
Jetzt hören Sie sich an wie ein Alt-68er!<br />
Sie meinen, „Tristan“ ist besser und gesünder<br />
als LSD?<br />
Aber natürlich! Grundsätzlich hat der<br />
Mensch Rauschzustände ja sehr gern.<br />
Weil es im Rausch um das Gleiche geht<br />
wie in der Musik, um die Erweiterung<br />
des Bewusstseins. Ich finde es immer ein<br />
bisschen lustig, dass die 68er gegen den<br />
Rausch von Hitlers Reichstagsgedöns waren<br />
– völlig zu Recht natürlich – und sich<br />
zu Hause ihren eigenen Rausch geschaffen<br />
haben, indem sie sich mit LSD vollballerten,<br />
bis sie ihren privaten Lichtdom<br />
gesehen haben. Beide Arten von Rausch<br />
Foto: Matthias Creutziger/Deutsche Grammophon (Life aus der Semperoper, The Lehár Gala from Dresden)<br />
104 <strong>Cicero</strong> 8.2012
sind mir suspekt, weil sie entweder manipulativ<br />
sind oder man in ihnen jede<br />
Kontrolle verliert. Mir ist die Bewusstseinserweiterung<br />
durch eine „Tristan“-<br />
Aufführung lieber.<br />
Und welche Wirkungen hat diese Erfahrung<br />
auf Ihr Leben?<br />
Jeder Rausch beeinflusst uns – weil wir in<br />
ihm Dimensionen erfahren, die wir im<br />
echten Leben nicht erreichen.<br />
Macht „Tristan“ uns etwa zu besseren<br />
Liebhabern?<br />
Das kann durchaus sein. Ich glaube<br />
schon, dass Menschen, die „Tristan“ kennen,<br />
potenziell bessere Liebhaber sein<br />
könnten. Diese Musik kann einen fantasiemäßig<br />
beflügeln. Sie zeigt einem die<br />
Sinnlichkeit und das Existenzielle. Auf jeden<br />
Fall macht dieses Erlebnis freizügiger<br />
und regt an. Das ist schon irre. Ich finde,<br />
wir müssen überhaupt bessere Musikliebhaber<br />
und bessere Liebhaber werden. Sicher<br />
ist: Die Kunst ist eine sinnenfrohe<br />
Angelegenheit. Und davon können wir<br />
im Leben nur lernen.<br />
Erkennen Menschen, die Ihnen nahestehen,<br />
eigentlich den Christian Thielemann<br />
auf der Bühne wieder, den sie auch von<br />
zu Hause kennen? Oder sind Sie vor dem<br />
Orchester ein anderer Mensch?<br />
Leute, die mich gut kennen, sagen oft,<br />
dass mein eigentliches Wesen beim Dirigieren<br />
am besten zu sehen ist. Letztlich<br />
ist das Künstlerische ja nur eine Ausblühung<br />
des Menschen, der diese Kunst betreibt.<br />
Und es ist egal, was jemand tut, ob<br />
er sich für Topfbegonien interessiert oder<br />
Streichholzschachteln sammelt – in dem<br />
Moment, in dem Sie sich in einer Sache<br />
auflösen, sind Sie ganz bei sich. Dann<br />
entsteht ein positiver Fanatismus, der andere<br />
nicht behindert. Ich liebe diese Spinner.<br />
Und, ja, ich bin einer von ihnen. Ich<br />
habe immer etwas für Leute übrig, die<br />
eine gepflegte Macke haben. Aber sie soll,<br />
bitte schön, gepflegt bleiben.<br />
Wegen Ihrer Macken wurden Sie<br />
lange angefeindet. Inzwischen sind<br />
Sie Everybody’s Darling. Was hat sich<br />
geändert?<br />
Für mich persönlich nur, dass ich vor<br />
15 Jahren dachte, mich und mein Leben<br />
vorhersehen zu können. Inzwischen<br />
genieße ich es, wie unvorhersehbar ich<br />
für mich selber geworden bin.<br />
Sie müssen sich also immer neu erfinden?<br />
Der Kern bleibt wahrscheinlich. Aber<br />
ich befrage mich gern neu und definiere<br />
meine Position in der Welt. Ich arbeite ja<br />
nur mit Partituren ohne Einzeichnungen.<br />
Ich sehe also nicht, wie ich einen „Holländer“<br />
vor einigen Jahren gemacht habe.<br />
Ich muss diese Opern immer wieder<br />
neu entdecken. Und manchmal denke<br />
ich an einer Stelle: „Da steht zwar kein<br />
Ritardando – aber ich fände es schön.“<br />
Das sage ich dann den Musikern. Und<br />
manchmal fragen die mich: „Aber warum<br />
denn, das steht doch gar nicht drin.“<br />
Und ich antworte: „Weil ich das schön<br />
finde.“ Dann schmunzeln sie – und machen<br />
es.<br />
Früher wurden Sie noch angefeindet, weil<br />
Sie Werke von Hans Pfitzner aufgeführt<br />
haben, der in das Nazi-System verstrickt<br />
war. Davon ist heute nicht mehr die Rede.<br />
Weil es mir nie um Politik ging, sondern<br />
um die Musik. Ich habe Pfitzners Kompositionen<br />
studiert und geschaut, ob sie<br />
etwas taugen. Das tun sie! Also habe ich<br />
sie aufgeführt. Heute kann ich zurückblicken<br />
und feststellen, dass ich mir in diesen<br />
Fragen treu geblieben bin. Und dass<br />
die <strong>Zeit</strong> und der <strong>Zeit</strong>geist mir entgegengekommen<br />
sind.<br />
Sind denn am Ende alle Werke legitim?<br />
Egal, wie ein Künstler gelebt hat?<br />
Schauen Sie, wir hatten das doch schon<br />
einmal, dass Komponisten aufgrund ihrer<br />
Überzeugungen oder Religionen<br />
nicht aufgeführt wurden. Und nun wollen<br />
einige Leute sich noch immer als<br />
moralischer Wächter aufspielen? Wir<br />
können doch nicht auf der einen Seite<br />
Ressentiments und Rassismus anklagen<br />
und auf der anderen Seite Rassismus<br />
in einen guten und in einen schlechten<br />
unterteilen. Ich war immer der Meinung,<br />
dass wir ohne Ressentiments an<br />
die Musik herangehen müssen. Und, ja,<br />
auch dass wir es uns gerade als Deutsche<br />
nicht so leicht machen dürfen und<br />
einige Musiker von vornherein aus dem<br />
Kanon streichen, weil uns die Auseinandersetzung<br />
mit ihrer Musik auf ein gefährliches<br />
Feld führt. Das gehört zu unserer<br />
Kulturtradition.<br />
Es ist also nichts verboten?<br />
Ich weiß nicht, wie Sie sich so einen Kanon<br />
vorstellen. Sollen wir jetzt zum Wagner-Jahr<br />
eine Liste der politisch unbedenklichen<br />
Wagner‐Werke herausgeben<br />
und eine der politisch belasteten Stücke?<br />
Also, mit Verlaub: ohne mich!<br />
Im Falle Wagner geht es ja auch um die<br />
Vereinnahmung durch Adolf Hitler. Eine<br />
Frage, die sich gerade wieder in Israel<br />
gestellt hat.<br />
Aber was kann Wagner denn dafür? Sicher,<br />
wir müssen uns mit seinem Antisemitismus<br />
auseinandersetzen. Aber in den<br />
meisten seiner Werke ist davon nichts zu<br />
lesen. Wir können doch nichts für die<br />
Verbrecher, die im Festspielhaus gesessen<br />
haben. Unten im Graben wird C‐Dur<br />
gespielt. Und dieses C‐Dur klang 1944<br />
genauso wie heute. Musik ist stärker als<br />
ihre Vereinnahmung.<br />
Es gab eine <strong>Zeit</strong>, da haben Sie Ihre Meinung<br />
provokanter vorgetragen.<br />
Auf jeden Fall habe ich unterschätzt, wie<br />
provokant meine Thesen aufgenommen<br />
wurden. Und wie ideologisch die Situation<br />
damals war. Das ging ja so weit, dass<br />
sogar über meinen Scheitel geschrieben<br />
wurde. Auf dem Höhepunkt dieser Stimmung<br />
hätte ich meine Haare zerwühlen<br />
müssen, damit mein Wagner politisch<br />
korrekt gewesen wäre.<br />
Und heute?<br />
Schauen Sie – ich ruhe in mir. Und vielleicht<br />
ist das die größte Veränderung. Ich<br />
merke, wie die Ruhe in meinen Körper<br />
kommt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen:<br />
Ich habe auch immer gewusst, dass<br />
das vorbeigehen würde. Weil ich wusste,<br />
dass ich die zeitlose Wahrheit der Noten<br />
auf meiner Seite hatte und nicht die<br />
schwankende Wahrheit der modischen<br />
Politik. Mich hat es wirklich irritiert, dass<br />
die Leute gesagt haben, ich wollte provozieren.<br />
Aber irgendwann haben sie dann<br />
festgestellt: „Ach Gott, der ist ja wirklich<br />
so.“ Ich war glaubhaft in dem, was ich<br />
getan habe. Und deshalb haben die Menschen<br />
aufgehört, sich aufzuregen.<br />
Vielleicht auch, weil Sie offener geworden<br />
sind?<br />
Es hat bei mir vielleicht etwas gedauert,<br />
dass ich Meinungen, die nicht meine<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 105
| S a l o n<br />
sind, akzeptiert habe. Heute weiß ich,<br />
dass ich sie nicht teilen muss, dass ich<br />
sie rhetorisch erwidern kann – und dass<br />
es wichtig ist, jede Meinung als gegeben<br />
zur Kenntnis zu nehmen. Aber dieses<br />
Recht fordere ich auch für mich ein. Darum<br />
ging es letztlich auch in Israel: Ich<br />
finde, dass man niemanden dazu zwingen<br />
darf, etwas zu hören, was er nicht hören<br />
will. Aber ich finde auch, dass man niemandem<br />
verbieten sollte, das zu hören,<br />
was er gern hören möchte. All das ist eine<br />
Frage der Toleranz. Ich beobachte, dass<br />
unsere Musik gerade in diesen <strong>Zeit</strong>en immer<br />
besser verstanden wird. Weil sie den<br />
Menschen auf das eigentliche Ziel der<br />
Politik zurückführt: den einzelnen, freien<br />
und selbstbestimmten Menschen.<br />
Wie politisch ist die Musik denn wirklich?<br />
Musik sind zunächst einmal Noten. Ob<br />
Wagner Revolutionär war oder Beethoven<br />
seine Sinfonie Napoleon widmen<br />
wollte – das sind Fragen für Musikhistoriker.<br />
Für einen Musiker sind sie weniger<br />
entscheidend. Die Sprache der Musik ist<br />
Politik einer anderen Art: Es ist die Politik<br />
des Unterbewussten, des Menschlichen,<br />
des Individuums. Und es macht<br />
mich wütend, wenn ich Traktate der Musikwissenschaftler<br />
lese, die versuchen,<br />
eine Partitur einer Ideologie unterzuordnen.<br />
<strong>Keine</strong>s dieser Bücher zeigt mir, wie<br />
ich die „Meistersinger“ besser dirigieren<br />
kann. Mir ist es auch unmöglich, aus<br />
einem späten Beethoven-Quartett abzulesen,<br />
ob er gerade Probleme hatte,<br />
schlechte Laune oder Hunger. Inzwischen<br />
beobachte ich, dass die Ideologisierung<br />
der Musik schwindet.<br />
Können Politiker denn trotzdem etwas<br />
von Musik lernen? Angela Merkel ist<br />
Stammgast in Bayreuth, kommt nach den<br />
Konzerten zu Ihnen hinter die Bühne …<br />
Ich glaube, es geht in der Musik um Authentizität.<br />
Und darum, dass Politik immer<br />
beim humanistischen Individuum<br />
anfängt. Das ist bei Wagner genauso wie<br />
bei Mozart. Das Private macht nicht nur<br />
die Musik, sondern auch die Politik. Und<br />
es geht um Wahrhaftigkeit. Als Dirigent<br />
kann ich nicht heute weniger Steuern<br />
versprechen und dieses Versprechen<br />
morgen nicht einlösen. Ich muss mir, bevor<br />
sich der Vorhang hebt, eine Position<br />
erarbeiten. Die muss nicht allen gefallen,<br />
aber sie muss kongruent mit mir sein –<br />
und das wünsche ich mir zuweilen auch<br />
von der Politik.<br />
Sie gelten als konservativ. Gleichzeitig<br />
geben Sie sich aber auch revolutionär. Wie<br />
ordnen Sie sich selbst politisch ein?<br />
Wenn Sie mir ein Quäntchen Selbstherrlichkeit<br />
erlauben, antworte ich Ihnen,<br />
dass ich die neue Avantgarde bin.<br />
Ich bin ein geläuterter Konservativer. Ich<br />
bin nicht engstirnig und trotzdem traditionsbewusst.<br />
Ich fühle mich sehr in meiner<br />
Tradition verwurzelt und bin gerade<br />
deshalb in der Lage, neugierig auf anderes<br />
zu sein.<br />
„Das ist der<br />
Unterschied<br />
zwischen Musik<br />
und Museum: Die<br />
Mona Lisa sieht<br />
seit Jahrhunderten<br />
gleich aus. Wagner<br />
klingt jeden Abend<br />
anders“<br />
Ist die konservative Politik schon genauso<br />
weit wie Sie?<br />
Nein, wahrscheinlich nicht. Deshalb rede<br />
ich ja von Avantgarde.<br />
Und was ist der Unterschied zwischen<br />
einem geläuterten 68er und einem geläuterten<br />
Konservativen?<br />
Die können sich inzwischen gut begegnen.<br />
Es ist doch so, dass die wahren Konservativen<br />
die Grünen geworden sind.<br />
Wir befinden uns ja in einer Umwertung<br />
sämtlicher Begriffe. Konservativ bedeutet<br />
nicht mehr: engstirnig, ausländerfeindlich<br />
und rechtsradikal. Konservativ<br />
bedeutet: das Alte ehren und daher<br />
neugierig auf das Neue sein. Ich habe<br />
durch meinen Beruf gelernt, dass die alten<br />
Stereotype nicht mehr greifen. Für<br />
mich ist es politisch wie künstlerisch<br />
dort am spannendsten, wo große Persönlichkeiten<br />
mit eigener Meinung zusammenarbeiten.<br />
Schlechtes Benehmen<br />
und mangelnde Qualität sind für mich<br />
<strong>Zeit</strong>verschwendung. Und überall gilt die<br />
Regel: Je höher das Niveau ist, desto gelassener<br />
kann man miteinander umgehen.<br />
In der Musik sind wir an diesem Punkt<br />
angekommen, in der Politik vielleicht<br />
noch nicht ganz.<br />
Spielt die <strong>Zeit</strong>, in der ein klassisches Werk<br />
interpretiert wird, eigentlich eine Rolle für<br />
den Klang?<br />
Der große Vorteil der klassischen Musik<br />
ist, dass die gleichen Noten in vielen unterschiedlichen<br />
<strong>Zeit</strong>en und in vielen unterschiedlichen<br />
politischen Kontexten<br />
interpretiert wurden. Klar, wenn Furtwängler<br />
1942 Beethoven zwischen zwei<br />
Bombenangriffen dirigiert hat, klang das<br />
anders als ein Beethoven, bei dem uns<br />
höchstens der EU-Rettungsschirm beschäftigt.<br />
So gesehen verschmelzen in der<br />
<strong>Zeit</strong>maschine Musik Vergangenheit und<br />
Gegenwart immer wieder aufs Neue. Die<br />
Noten bilden den historischen Fixpunkt.<br />
Das ist der Unterschied zwischen Musik<br />
und einem Museum. Die Mona Lisa<br />
sieht seit Jahrhunderten gleich aus. Wagner<br />
klingt jeden Abend anders.<br />
Sie werden mit der Staatskapelle in Dresden<br />
nun ein Orchester mit langer Tradition<br />
übernehmen – Weber und Wagner haben<br />
hier dirigiert. Und die Staatskapelle wird<br />
bis heute für ihren deutschen Klang<br />
gefeiert …<br />
Ich treffe in Dresden auf eine historisch<br />
einmalige Situation: Neben vielen negativen<br />
Dingen ist im Osten ein historischer<br />
Vorteil auszumachen. Während im Westen,<br />
ausgelöst durch die 68er-Bewegung,<br />
versucht wurde, möglichst viele Traditionen<br />
über Bord zu werfen, ist diese Mode<br />
am Osten vorbeigezogen. So hat sich vieles<br />
erhalten, was wir heute sehr schätzen.<br />
Und das hört man auch heute noch im<br />
Klang der Orchester.<br />
Daniel Barenboim hat einmal gesagt, dass<br />
man in der Staatskapelle in Berlin noch<br />
den Klang von 1932 hört …<br />
Das trifft für Dresden ebenfalls zu. Das<br />
liegt auch daran, dass es lange <strong>Zeit</strong> kaum<br />
einen Zuzug von frischem Fleisch gab,<br />
dass das Orchester auf eine merkwürdig<br />
wohltuende Art im eigenen Saft gekocht<br />
hat. Heute sehen wir, dass in Dresden<br />
eine alte Tradition lebt. Und das ist in einer<br />
<strong>Zeit</strong>, in der große Orchester Gefahr<br />
106 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Anzeige<br />
It’s never too late<br />
laufen, gleich zu klingen und ihren Klang<br />
zu globalisieren, ein großes Pfund.<br />
Es fällt auf, dass Sie wenig mit fremden<br />
Orchestern zusammenarbeiten …<br />
Ich mag es lieber, mit Menschen zu arbeiten,<br />
die ich kenne – und da hat sich<br />
in den vergangenen Jahren einfach die<br />
Achse Dresden-Wien-Bayreuth ergeben.<br />
Das ist ein überschaubares Areal, in<br />
dem ich machen kann, was ich will. Und<br />
wenn ich die Welt sehen will, fahre ich<br />
eben mit meinen Dresdenern oder den<br />
Wienern los.<br />
Die Wiener Philharmoniker scheinen es<br />
Ihnen besonders angetan zu haben.<br />
Von denen heißt es ja immer, dass sie so<br />
verstockt seien. Aber ich erlebte immer<br />
wieder ein unglaublich offenes Orchester.<br />
Ich glaube, das liegt daran, dass es sich<br />
seiner Tradition bewusst ist. Die Wiener<br />
wissen, woher sie kommen, und können<br />
deshalb offen für anderes sein. Sie verkörpern<br />
den offenen Konservativismus –<br />
und, ja, das gefällt mir sehr.<br />
Andererseits gibt es keine andere Stadt,<br />
in der die Erwartungen so hoch sind.<br />
Das geht so weit, dass ich Wien manchmal<br />
meiden muss, weil der Druck mir<br />
zu groß wird. Nicht nur vom Publikum,<br />
sondern auch vom Orchester. Ich kann<br />
so langsam nachvollziehen, dass der legendäre<br />
Carlos Kleiber manchmal vor einer<br />
Aufführung die Flucht ergriffen hat.<br />
Gibt es diese Momente bei Ihnen auch,<br />
dass Sie vor einem Konzert am liebsten<br />
fliehen würden?<br />
Ja, das gibt es. Ich denke dann: Jetzt ins<br />
Auto und einfach nur weg. Aber meine<br />
preußische Erziehung verbietet mir das.<br />
Dann gehe ich da hin und dirigiere.<br />
Manchmal macht mir meine Nervosität<br />
auch Angst. Ich verstehe mich da selbst<br />
nicht.<br />
© Foto Schmidt: Paul Ripke; Steinbrück: Daniel Biskup; Meyer, Marguier: Antje Berghäuser<br />
Der große Entertainer über intelligente Satire<br />
und die Zukunft des Fernsehens<br />
<strong>Vorschau</strong><br />
Sonntag,<br />
2. Dezember 2012:<br />
Peer Steinbrück<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
im Berliner Ensemble<br />
Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, Stellvertreter<br />
des Chefredakteurs, im Gespräch<br />
mit Harald Schmidt.<br />
Sonntag, 23. 9. 2012, 11 Uhr<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
Gewinnen Sie 10 x 2 Eintrittskarten zum <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
Erleben Sie Harald Schmidt live beim <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch und lernen<br />
Sie den großen Entertainer persönlich kennen.<br />
Gibt es denn einen Moment, in dem Sie<br />
keine Musik mehr machen würden?<br />
Nein – weniger, das kann ich mir gut<br />
vorstellen. Aber gar keine Musik? Nein!<br />
Auf keinen Fall. Was hat Loriot gesagt?<br />
Ein Leben ohne Möpse wäre möglich,<br />
aber sinnlos. So verhält sich das auch mit<br />
der Musik.<br />
Gleich mitmachen und gewinnen:<br />
Mark Siegmann<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: 100@cicero.de<br />
www.cicero.de/100<br />
Das Gespräch führte Axel Brüggemann<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner<br />
Ensemble
| S a l o n | M a n s i e h t n u r , w a s m a n s u c h t<br />
Kunst ist nicht<br />
gleich Werbung<br />
Der olympische Fackellauf, der 1936<br />
seine Weltpremiere hatte, wurde<br />
überaus erfolgreich entnazifiziert. <strong>Keine</strong><br />
Olympiade kommt seither ohne ihn aus.<br />
Hoffentlich wird Leni Riefenstahl nicht<br />
das Gleiche passieren<br />
Von Beat Wyss<br />
N<br />
azi-nostalgie ist gern bereit,<br />
der Bewegung Sinn für politische<br />
Symbolik zuzuschreiben.<br />
Aber ausgerechnet die Erfindung<br />
des Fackellaufs verdankt sich einem jüdischen<br />
Archäologen: Alfred Schiff. Der<br />
Sportbegeisterte war der olympischen<br />
Idee Baron de Coubertins von Anfang<br />
an verbunden. Schiff sprach Neugriechisch<br />
und wirkte sogar als Schiedsrichter<br />
bei der ersten Olympiade der Neuzeit<br />
in Athen 1896 mit. Dem Juden<br />
Schiff war 1933 die Stelle an der Berliner<br />
Hochschule für Leibesübungen gekündigt<br />
worden. Seine Idee wurde arisiert,<br />
indem man sie dem Sportfunktionär Carl<br />
Diem zuschrieb, der schützend die Hand<br />
über seinen Freund und Kollegen hielt.<br />
Die Berliner Olympiade von 1936<br />
unterstand Propagandaminister Joseph<br />
Goebbels, der den Empfang des Feuers<br />
aus dem fernen Olympia mit SA-Verbänden<br />
inszenierte. 3197 Kilometer hatte die<br />
Glut hinter sich, entzündet an der Sonne<br />
Hellas’ mit einem Brennspiegel von Zeiss,<br />
von 3331 Stafettenläufern in zwölf Tagen<br />
und elf Nächten nach Berlin getragen.<br />
Die Fackelschäfte, ausgetauscht bei jeder<br />
Etappe, waren geschaffen in Form eines<br />
Ölbaumzweigs aus Kruppstahl: Das Friedenssymbol<br />
war aus dem Stoff, aus dem<br />
auch die Instrumente der Massenvernichtung<br />
geschmiedet wurden.<br />
Nicht überall waren die Läufer willkommen<br />
gewesen. Noch in Griechenland<br />
versuchten Mitglieder der kommunistischen<br />
Jugendorganisation OKNE erfolglos,<br />
ein Durchkommen des brennenden<br />
Symbols nach Deutschland zu behindern.<br />
Proteste gab es auch in Jugoslawien.<br />
In Prag gelang es einigen Aktivisten,<br />
die Fackel dem Läufer zu entreißen und<br />
auszulöschen.<br />
Solche Szenen sind in jenem Film<br />
nicht zu finden, der Mediengeschichte<br />
schreiben sollte: „Olympia: Fest der<br />
Völker, Fest der Schönheit“ von Leni Riefenstahl.<br />
Ihr Olympiafilm bildet einen<br />
frühen Höhepunkt von Berichterstattung<br />
als Dokusoap. Während der 16-tägigen<br />
Dreharbeiten waren 45 Kameramänner<br />
mit 30 Kameras dabei, rund<br />
800 000 Meter Licht auf Zelluloid zu<br />
bannen. Einige Wettkämpfe wurden für<br />
den Film noch einmal nachgestellt. Während<br />
der anderthalbjährigen Arbeit am<br />
Schneidetisch verdichtete die Produzentin<br />
das Material auf 5151 Filmmeter:<br />
rechtzeitig, um an Adolf Hitlers 49. Geburtstag<br />
Premiere zu feiern und an den<br />
Filmfestspielen in Venedig 1938 den<br />
Preis des Goldenen Löwen abzuräumen.<br />
108 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Ein Szenenbild aus Leni Riefenstahls zweiteiliger Dokusoap „Olympia: Fest der Völker, Fest der Schönheit“ von 1938<br />
Fotos: DDP Images, artiamo (Autor)<br />
Das Reproduktionsmedium greift<br />
nicht nur in das technische Material<br />
ein, sondern auch direkt in das Geschehen,<br />
das im Sinne der Botschaft<br />
reproduziert werden soll. So war die<br />
Ehre des Schlusslaufs zur Opferschale<br />
im Berliner Stadion dem Langstreckenläufer<br />
Fritz Schilgen zugefallen.<br />
Riefenstahl hatte den Sportler vorgeschlagen<br />
wegen seines „schwebenden<br />
Schrittes“. Der überschlanke Ephebe<br />
mit wallendem, blondem Deckhaar entsprach<br />
nicht den massigen Kraftmenschen<br />
im Stil von Arno Breker, sondern<br />
dem Wandervogel deutscher Jugendbewegung.<br />
Mit dieser Wahl zeigte sich der<br />
Wolf dem Weltpublikum ein letztes Mal<br />
im Schafspelz.<br />
Das Olympiastadion in Berlin gehört<br />
zu den wenigen Großbauten der Nazizeit,<br />
die den Krieg unbeschadet überstanden<br />
haben. Seit 1966 steht es unter Denkmalschutz.<br />
Doch nicht nur die Entnazifizierung<br />
des steinernen <strong>Zeit</strong>zeugen verlief problemlos,<br />
auch der olympische Fackellauf,<br />
der 1936 seine Weltpremiere hatte, ist aus<br />
keiner Olympiade mehr wegzudenken.<br />
Riefenstahl gewann in Künstlerkreisen<br />
viele Bewunderer, unter ihnen Jean<br />
Cocteau, Mick Jagger und David Bowie.<br />
Schon Susan Sontag wandte sich<br />
deswegen in ihrem Essay „Faszinierender<br />
Faschismus“ gegen die um sich greifende<br />
„Rehabilitation Riefenstahls als unbezwingbare<br />
Priesterin des Schönen“. Einen<br />
klaren Blick auf die Berliner Olympiade<br />
hatte auch Walter Benjamin, als er vor<br />
der „Ästhetisierung der Politik“ warnte.<br />
Wer Riefenstahl als Popikone verharmlost,<br />
verwechselt Kunst mit Werbung. Herrscherlob<br />
ist eine Aufgabe, der die Kunst<br />
seit der Moderne entwachsen ist.<br />
B e at W y s s<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt in Karlsruhe<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 109
| S a l o n | P a p y r i i<br />
Was wir<br />
verlieren<br />
Bibliotheken wirken heute wie<br />
potemkinsche Dörfer. Und auch die<br />
Ideen von Autor- und Urheberschaft<br />
stehen zur Disposition. Einer der<br />
bekanntesten deutschen Schriftsteller<br />
nimmt Abschied vom Buch und hat<br />
sich dafür mit dem Schicksal der<br />
Papyrusrolle auseinandergesetzt<br />
Von thomas Hettche<br />
D<br />
er Altphilologe zuckt entschuldigend mit den Achseln.<br />
Ich halte noch immer seine Geschichte der antiken Texte<br />
in der Hand, die er mir in seinem Büro gegeben hat,<br />
700 Seiten mit Listen von Editorennamen und Fundorten, Verlagen,<br />
Autoren und Titeln, bibliografischen Kürzeln und Jahreszahlen.<br />
Über zehn Jahre hat Manfred Landfester an dem Band<br />
gearbeitet, Teil einer Neuausgabe der 84-bändigen „Realencyclopädie<br />
der classischen Altertumswissenschaft“, die der Stuttgarter<br />
Gymnasiallehrer August Friedrich Pauly 1837 begann. Der Neue<br />
Pauly enthält auf 12 000 Seiten unter 30 000 Stichworten, verfasst<br />
von über 2000 wissenschaftlichen Beiträgern aus 50 Ländern, unser<br />
Wissen über die Antike. 19 Bände, von dem Typografen Hans<br />
Peter Willberg aus der Bembo auf holz- und säurefreiem, geglättetem<br />
und alterungsbeständigem Werkdruckpapier gesetzt, in stabiles<br />
Bibliotheksleinen geschlagen und fadengeheftet, mit einem<br />
schönen Vorsatzpapier versehen und einer zweifarbigen Prägung<br />
auf dem Rücken.<br />
„Das ist rein äußerlich ja ein etwas trockenes Werk“, sagt Professor<br />
Landfester und setzt mit einem etwas schüchternen Lächeln<br />
hinzu: „Aber im Grunde genommen ist es die Auflistung unseres<br />
ganzen kulturellen Gedächtnisses.“<br />
Sieht schon jetzt<br />
aus wie ein<br />
Relikt aus der<br />
Vergangenheit:<br />
die Bibliothek des<br />
Trinity College<br />
in Dublin<br />
Foto: Michael Short/Prisma<br />
110 <strong>Cicero</strong> 8.2012
8.2012 <strong>Cicero</strong> 111
| S a l o n | P a p y r i i<br />
Eine solche Edition wird es nie mehr geben, schon bei Erscheinen<br />
war sie anachronistisch. Brill, der Verlag der englischsprachigen<br />
Ausgabe, bietet längst den Zugang zur elektronischen<br />
Version im Abonnement. Und, höre ich die Verfechter der Netzkultur<br />
fragen, was ändert sich dadurch? Alles. Der Verweis auf<br />
die unendlichen Speicher der digitalen Welt, in denen nichts verloren<br />
geht, verkennt die spezifische Verschränkung von Medium<br />
und Gehalt, die unsere literarische Kultur ausgezeichnet hat, seit<br />
1816 von Friedrich Christoph Perthes „Der deutsche Buchhandel<br />
als Bedingung des Daseyns einer deutschen Literatur“ erschien.<br />
Perthes, der 1796 in Hamburg die erste Sortimentsbuchhandlung<br />
in Deutschland eröffnete, gehörte zu den Gründern des Börsenvereins<br />
des deutschen Buchhandels, und die Entwicklung, die<br />
mit ihm einsetzte, gibt seiner Überzeugung recht, Literatur entstehe<br />
immer in Wechselwirkung mit der Kultur ihrer Verbreitung.<br />
So, wie etwa der Roman als Form seinen Siegeszug nur deshalb<br />
und erst dann antreten konnte, als er sich für eine literarisierte Öffentlichkeit<br />
als das ideale Packmaß von Fiktionen erwies. Mit der<br />
Gründung der modernen Universitäten, mit den <strong>Zeit</strong>ungen und<br />
ihren Feuilletons, den Verlagen, Buchhandlungen und Lesezirkeln<br />
fand diese Kultur die Gestalt, die wir kennen, eine gesellschaftliche<br />
Formation der Lesenden, zu deren grundlegenden Gesetzen<br />
die Unterscheidung von Text und Kommentar gehört, diejenige<br />
zwischen Autor und Werk, die Anerkennung und Honorierung<br />
von Urheberschaft, die Unverletzlichkeit des Textes. Das Ausmaß<br />
des medialen Bruchs, den wir erleben, zeigt sich daran, dass all<br />
diese Regeln heute zur Disposition stehen.<br />
Ein schleichender Prozess der Auszehrung ist im Gang, man<br />
spürt sein Fortschreiten überall, in den Buchhandlungen, den<br />
Universitäten, den Rundfunkanstalten, den Literaturhäusern und<br />
Schulen: überall die potemkinsche Empfindung, durch bloße Fassaden<br />
zu gehen. Zwar gibt es all diese Institutionen noch, aber es<br />
kommt mir so vor, als wären sie dabei, von innen heraus zu vergehen.<br />
Die literaturwissenschaftlichen Seminare, in die ich eingeladen<br />
werde, muten ihren Studenten keine Bücher mehr zu, sondern<br />
kopieren zehnseitige Ausschnitte, anhand derer nicht etwa<br />
Romane verstanden, sondern lediglich Frage- und Diskussionstechniken<br />
eingeübt werden sollen. Kunststücke. Immer mehr Traditionsbuchhandlungen,<br />
die seit Jahrzehnten Lesungen veranstalten,<br />
mutieren zu Papeterien. In den Rundfunksendern trifft man<br />
auf Redakteure, die das Buch, über das sie mit einem sprechen<br />
wollen, nicht mehr gelesen haben dürfen, damit sie die Hörer besser<br />
abholen können, wie man das nennt.<br />
Es ist, als fahre man von einer Geisterstadt zur nächsten, und<br />
überall trifft man auf Menschen, die in ihrer Begeisterung für die<br />
Literatur alt geworden sind und wissen, dass das, was sie tun, mit<br />
ihnen enden wird. Der literarische Raum zerfällt, er verliert seine<br />
Gravitation, alle Kräfte streben hinaus.<br />
Wie sehr das literarische Kunstwerk selbst im Kern von diesem<br />
Prozess der Auszehrung betroffen wird, ja dass man sich dieses<br />
Kunstwerk überhaupt nicht unabhängig von dem Gedächtnisraum<br />
der literarischen Öffentlichkeit vorstellen darf, in den<br />
hinein es entsteht, zeigt sich an den eklatanten Veränderungen<br />
der Weise, wie Bücher gelesen werden. Auffällig an den Leserrezensionen<br />
des Onlinebuchhandels, die zunehmend die literarische<br />
Kritik ablösen, ist, dass jedes Buch rezipiert wird, als wäre<br />
es das erste, das man liest. Intertextuelle Bezüge, Anspielungen,<br />
Traditionen werden nicht mehr erkannt, eine gelungene Lektüre<br />
ist vor allem eine, bei der keine Verunsicherung der eigenen Kompetenz<br />
die Leseerfahrung stört. Der Boom von Festivals und Literaturevents<br />
bestätigt paradoxerweise nur dieses Absterben der<br />
Literarizität, denn der Untergang der literarischen Öffentlichkeit<br />
und Bildung erzwingt geradezu das eintauchende, unbedingte Leseerlebnis<br />
der Jugend, bei dem das Buch die reale Welt zu ersetzen<br />
imstande ist. Danach bleibt nur, es ebenso wie den musikalischen<br />
Hit, dem man eine Weile verfällt und dessen man doch zwangsläufig<br />
überdrüssig wird, in einer Liste abzuspeichern.<br />
Wird unter diesen Voraussetzungen etwas bleiben von dem,<br />
was mir kostbar an Literatur ist? Von jenem Zwielicht der Erwartung<br />
und des Wissens, das um die Bücher glimmt und sie mit all<br />
den anderen Lektüren irrlichternd auflädt? Ich glaube: Nichts<br />
bleibt. Die Hoffnung, wir könnten uns in der <strong>Zeit</strong>kapsel unserer<br />
Romane und Filme, unserer Bilder und Lieder in die Zukunft retten,<br />
ist naiv. <strong>Zeit</strong>en grundlegender medialer Brüche, wie wir gerade<br />
einen erleben, zeichnen sich dadurch aus, dass den Menschen<br />
plötzlich all das, was ihnen eben noch kostbar war, zum Ballast<br />
wird, mit dem sie im besten Fall lediglich Pietät noch verbindet.<br />
Ein solcher medialer Bruch geschieht nicht zum ersten Mal in<br />
unserer Geschichte. In den Breviarien des vierten, fünften Jahrhunderts<br />
unserer <strong>Zeit</strong>rechnung, die hilflos versuchten, das schwindende<br />
Wissen Roms in Kompilationen zusammenzufassen, als die<br />
Fähigkeiten der Autoren zu erlahmen begannen, kann man nachlesen,<br />
was das bedeutet. Als sei etwas dabei zu verwelken, spürt<br />
man in diesen Texten das Nachlassen des Stils, die fehlende Kraft<br />
zur Durchführung, die Unfähigkeit, ein Thema zu gestalten. Wie<br />
von einer Krankheit befallen, werden die Sätze immer einfacher,<br />
die rhetorischen Figuren nicht mehr beherrscht, die Metaphern<br />
stupide. An die Stelle des zerfallenden Wissens zuvor sorgfältig<br />
tradierter Quellen tritt nach und nach hilfloses Hörensagen. Diese<br />
Hilf- und Sprachlosigkeit, die sich schließlich im mühsamen Aufrechterhalten<br />
der Form erschöpft, ist unendlich traurig. Wir leben<br />
in einer solchen Epoche. Mit dem Verschwinden des Nährbodens,<br />
auf dem die Werke siedeln, verdorren auch sie.<br />
Ich schaue mich um in Raum 79 des Philosophikums I der<br />
Universität Gießen, sehe diesen Fußboden, die Lampen, die leeren<br />
Regale und Resopaltische und diesen Schrank darin, der aus<br />
einer anderen <strong>Zeit</strong> stammt. Auch seine handwerkliche Schönheit<br />
ist die Schönheit einer einmal gelebten Realität des Wissens.<br />
Endlich öffnet Professor Landfester ihn. An den Innenseiten der<br />
Türen, mit Reißzwecken befestigt, eine vergilbte schreibmaschinengeschriebene<br />
Inventarliste und der Stahlstich des Fabrikanten<br />
Kalbfleisch, des privaten Sammlers, der seine berühmte Sammlung<br />
ägyptischer Papyrii zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts der<br />
Universität vermachte. Die kostbaren Stücke stehen in schmalen<br />
Fächern wie in einem alten Schallplattenschrank, jeweils zwischen<br />
zwei Glasscheiben gepresst.<br />
„Warum kennen wir eigentlich das, was wir aus der Antike kennen?“,<br />
frage ich. „Es ist das, was übrig geblieben ist“, sagt Landfester.<br />
„Zunächst ging all das verloren, was keine Aufnahme in die<br />
alexandrinische Bibliothek fand. Dann gab es den verheerenden<br />
Brand. Und schließlich einen entscheidenden Bruch der Überlieferung<br />
zwischen 600 und 800. Die sogenannten dunklen Jahrhunderte.<br />
In dieser <strong>Zeit</strong> ist die antike Literatur weitgehend verloren<br />
gegangen.“ „Wie kann man sich das vorstellen? Was geschah<br />
112 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: Stefan Noebel-Heise/imago<br />
da?“ „Ganz banal: Die Menschen haben die Texte nicht mehr abgeschrieben.<br />
Und die Bücher sind dann einfach verrottet, nicht<br />
wahr? Das waren heidnische Bücher, also bestand kein Interesse.<br />
Das ist ja das Besondere an Karl dem Großen, dass er meinte, das<br />
Lateinische sei für seinen modernen Staat und die Bildung notwendig.<br />
Er hat alles suchen lassen an Literatur, was in Klöstern<br />
noch da war. Und die Literatur, die man da um 800 nach Christus<br />
fand, die ist uns heute weitgehend erhalten. Von da an gab es<br />
einen kontinuierlichen Prozess der Tradierung. Im Westen über<br />
Karl, in Byzanz etwa über Photios, den großen Patriarchen. Alles<br />
aber, was damals im Westen nicht in die neue Schrift, in die<br />
karolingische Minuskel, übernommen wurde, gibt es nicht mehr.<br />
Und das Gleiche geschah fast zur selben <strong>Zeit</strong> im griechischen Bereich:<br />
Was in Byzanz nicht gesucht und gesammelt wurde, war<br />
dauerhaft verloren.“<br />
Wie sich das angefühlt haben muss, dieses Verschwinden?<br />
Ist uns diese Empfindung nicht längst vertraut? Zivilisatorischer<br />
Irgendwann hat man<br />
die Texte nicht mehr<br />
abgeschrieben. Der<br />
Rest ist dann einfach<br />
verrottet<br />
Headcrash. Schweigen auf allen Kanälen. Pausenbild. Die kulturelle<br />
Nulllinie. Nur hier und da flackert noch etwas in der Dunkelheit<br />
auf, wohl immer, bis zum Ende, hoffnungsspendendes Zeichen,<br />
es lasse sich doch zurückgewinnen, was längst verloren ist.<br />
„Wir kennen Schulen aus Bordeaux etwa, wo im sechsten Jahrhundert<br />
noch Griechisch unterrichtet wurde. Das ist ganz außergewöhnlich.<br />
Es ist schon erstaunlich, wie lange das antike Bildungssystem<br />
sich auch im politischen Zusammenbruch noch gehalten<br />
hat.“ „Hat man eine Vorstellung davon, was alles verloren gegangen<br />
ist?“ „Man kann rechnen. Wir wissen für Athen, dass zwischen<br />
500 und 100 vor Christus ungefähr 1500 Komödien aufgeführt<br />
worden sind. Und davon sind elf vollständig erhalten, von Aristophanes,<br />
und fünf weitgehend, von Menander, nicht?“ „Kann man<br />
sagen, dass die erhaltenen die besten sind? Oder ist die Überlieferung<br />
zufällig?“ „Nicht ganz. Menander etwa ist, obwohl er der<br />
große Klassiker war, nicht ins Mittelalter gekommen, der ist am<br />
Ende der Antike verloren gegangen. Aber durch Papyrusfunde in<br />
Ägypten, also durch Reste nichtverrotteter Bücher aus Müllhaufen<br />
und Ruinen, die teilweise vollständig waren, ist er überliefert<br />
worden. Aristophanes, einer der größten Komödiendichter, ist<br />
nicht wegen seiner Komik erhalten, sondern weil er gutes Attisch<br />
schrieb. Und das war vom zweiten Jahrhundert nach Christus an<br />
Kult. Man musste so schreiben, es entstanden Lexika, und darüber<br />
wurde Aristophanes in Byzanz weitergegeben.“<br />
„Gibt es eigentlich antike Originalausgaben?“ „Nein, das haben<br />
wir nicht. Wir versuchen, aus den verschiedenen Handschriften,<br />
die ja meist erst aus dem achten und neunten Jahrhundert<br />
stammen, zusammenzusetzen, was der Autor geschrieben haben<br />
könnte.“ „Es gibt keinen einzigen Autografen?“ „Nein, nein, ich<br />
glaube nicht.“<br />
Die Problematik des Umkopierens sei eben nicht neu, sagt<br />
Professor Landfester weiter. Bedenklich sei aber das zunehmende<br />
Tempo in den digitalen Medien. Schnelle Generationswechsel, das<br />
wisse man ja aus der Biologie, produzieren genetische Fehler. „Das<br />
führt zum Verlust. Und zwar zum endgültigen Verlust. Und leichter<br />
als früher bei den Papyrii. Heute ist dann einfach nichts mehr<br />
da. Aber vielleicht haben wir auch zu viel, nicht? Eine gewisse Selektion<br />
ergibt sich immer daraus, dass tatsächlich nicht alles in<br />
das neue Medium überführt wird. Das ist wie bei der Umschrift<br />
damals in die Minuskel. Das ist nur viel schlimmer heute, da es<br />
keine zweite Chance des Wiederentdeckens mehr geben wird. Damals<br />
verrotteten die Schriftrollen dann eben, und das dauerte. Jetzt<br />
aber geht es ganz schnell.“<br />
Aber was ist es eigentlich, das uns heute verloren geht? Gewiss<br />
jene beschriebene literarische Kultur, in der das Buch auf<br />
eine komplexe Weise zirkulierte. Doch was ist es, was da zirkulierte?<br />
Was ist das Buch?<br />
Jacques Derrida betont in einem Vortrag in der Bibliothèque<br />
nationale de France bereits 1997, die Frage des Buches habe nichts<br />
mit der Frage der Schrift, der Schreibweise oder der Einschreibungstechniken<br />
zu tun, denn Bücher würden nach völlig heterogenen<br />
Schriftsystemen verfasst. Das Buch ist nicht an eine Schrift<br />
gebunden. Die Frage des Buches fällt auch nicht mit der Frage der<br />
Druck- und Reproduktionstechniken deckungsgleich in eins: Es<br />
gab zum Beispiel Bücher vor und nach der Erfindung des Druckes.<br />
Die Frage des Buches ist genauso wenig die Frage des Werkes.<br />
Nicht jedes Buch ist ein Werk. Viele Werke hingegen, selbst<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 113
| S a l o n | P a p y r i i<br />
literarische oder philosophische Werke, Werke eines geschriebenen<br />
Diskurses, sind nicht notwendigerweise Bücher. Schließlich<br />
fällt die Frage des Buches auch nicht mit der Frage des Trägers in<br />
eins. Auf strikt buchstäbliche Weise kann man von Büchern sprechen,<br />
die von den verschiedensten Trägern getragen werden: nicht<br />
nur von den klassischen Trägern, sondern auch von der Quasi-<br />
Immaterialität oder Virtualität elektronischer oder telematischer<br />
Operationen.<br />
Was aber bleibt dann? Was ist es, von dem unsere Empfindung<br />
uns so deutlich sagt, dass es im Medienwechsel, den wir erleben,<br />
unwiederbringlich verloren gehen wird? Nachdem Derrida alles<br />
ausgeschieden hat, was jenes Ding, das wir Buch nennen, mit sich<br />
führt, ohne dass es seinen Kern berührte, und was in diesem Wechsel<br />
mühelos übersetzt werden wird, bleibt für ihn als wesentliche<br />
Kennzeichnung des Buches eine dialektische Spannung zwischen<br />
Sammlung und Zerstreuung. Nichts anderes.<br />
Das Buch ist flüchtige Zerstreuung, zitiert er Maurice Blanchots<br />
Aufsatz „Das kommende Buch“, denn es enthält, was es nicht<br />
umfassen kann, es ist zugleich größer und kleiner als das, was es<br />
ist. Es ist eine Weise, die Endlichkeit der eigenen Form mit der<br />
Unendlichkeit seines Inhalts zu verknüpfen.<br />
Dabei handelt es sich indes nur um eines von zwei Modellen<br />
des Buches, es gibt noch ein zweites, das eine nennt Derrida das<br />
neohegelianische Modell des großen totalen Buches, das andere<br />
das ontologisch-enzyklopädische. Der Medienwechsel, den wir erleben,<br />
ist nichts als die Weise, wie jenes gegen dieses ausgespielt<br />
wird. Nicht das Buch selbst verschwindet, sondern die Idee, dass<br />
der Text von einem Anfang und einem Ende begrenzt wird, einer<br />
Totalität also, von der man annimmt, dass sie von einem Autor, einem<br />
einzigen identifizierbaren Autor konzipiert und produziert, ja<br />
signiert und der respektvollen Lektüre eines Lesers vorgelegt wird,<br />
der das Werk nicht antastet. Ihren Grund hat diese respektvolle<br />
Lektüre in der Erfahrung, dass das begrenzte Werk, begrenzt wie<br />
das Leben des Lesers, das Wunder erlebbar macht, einen unendlichen<br />
Inhalt zu evozieren.<br />
Der damit konkurrierende Entwurf des Buches ist die Enzyklopädie,<br />
in der alles seinen Raum hat und die für Derrida in der<br />
Tradition der christlichen Metapher vom Buch der Welt steht.<br />
Das Netz hat die Sehnsucht einer totalen Repräsentanz wiederbelebt<br />
und aktualisiert sie permanent in der Aufforderung, einzutreten<br />
in einen Raum des Schreibens und Lesens der elektronischen<br />
Schrift, die mit vollem Tempo von einem Punkt der Welt<br />
zu einem anderen reist und über die Grenzen und Rechte hinweg<br />
nicht nur die Weltbürger, sondern jeden Leser als möglichen oder<br />
virtuellen Schriftsteller mit dem universellen Netz einer potenziellen<br />
„Universitas“ einer mobilen und transparenten Enzyklopädie<br />
verbindet. Es beruht dieser Raum der elektronischen Schrift auf<br />
dem zutiefst religiösen Versprechen, alle Alterität werde verschwinden,<br />
wie auch die gesamte Geschichte der Einschreibungs- und<br />
Archivierungstechniken, die ganze Geschichte der Träger und der<br />
Weisen des Druckes davon bestimmt ist, dass jede neue Etappe<br />
unweigerlich von einer sakralen oder religiösen Reinvestition begleitet<br />
wird. Eine solche religiöse Reinvestition erleben wir. Oder,<br />
anders gesagt: einen Kreuzzug.<br />
Schon 1999, als ich mit „Null“ eine der ersten literarischen<br />
Anthologien im Netz publizierte, deren Texte sich die Redakteure<br />
der Feuilletons damals zumeist noch von ihren Sekretärinnen<br />
ausdrucken lassen mussten, weil sie noch nicht online waren, erhoffte<br />
man sich unendlich viel von einer solchen digital-enzyklopädischen<br />
Literatur. Aber ich wüsste keinen Hypertext im Netz,<br />
keinen Blog, keinen Tweet, dessen literarische Halbwertszeit seitdem<br />
länger gewesen wäre als das Staunen über die jeweilig neuen<br />
medialen Möglichkeiten, die er nutzt. Denn Literatur ist in ihrem<br />
Kern nicht enzyklopädisch, eben weil sie das Unendliche im Blick<br />
hat, das in der Endlichkeit ihrer Werke erscheint. Ihre Chiffre für<br />
eine Weltabbildung, die im Anspruch auf Totalität natürlich mit<br />
der Enzyklopädie konkurriert, ja sich sogar immer sicher war, nicht<br />
der falschen Unendlichkeit der Addition zu verfallen, ist die Geschichte.<br />
Die Geschichte, verstanden als Erzählung, bildet in der<br />
Literatur auf eine Weise, die mit jener Dialektik von Sammlung<br />
und Zerstreuung zu tun hat, von der Derrida spricht, sich scheinbar<br />
deckungsgleich ab auf jener anderen Geschichte, die alle <strong>Zeit</strong><br />
des Menschlichen meint, alle <strong>Zeit</strong> überhaupt.<br />
Verloren geht, wie es mir scheint, die Fähigkeit zu dieser Erfahrung.<br />
Denn sie ist im höchsten Maße auf eine ganz bestimmte<br />
Die Konsequenzen<br />
des Verlusts unserer<br />
Lesekultur könnten<br />
viel verheerender sein,<br />
als wir denken<br />
Lektürepraxis angewiesen, in der die Autonomie und Totalität des<br />
Werkes ihre notwendige Entsprechung in der Einsamkeit und Abgeschlossenheit<br />
des Lesers finden. Solche Lektüre stiftet einen Ort<br />
und ist auf einen spezifischen Ort angewiesen, dazu gehören Leser<br />
und Buch auf eine unbedingte, von der Welt losgelöste Weise.<br />
Es gibt mich und den Text. Das Zuklappen des Buches ist Scheitern<br />
und lässt Stille zurück. Das Gespräch kann nur geführt oder<br />
verweigert werden. Wird es geführt, ist die <strong>Zeit</strong> angehalten und<br />
suspendiert jede Ökonomie von Down- und Uploads. Die Begegnung,<br />
die das Buch ermöglicht, ist ernst. Diese Unbedingtheit ist<br />
die erste Wahrheit der Literatur. Ihre Sätze sind nichts, sind nur<br />
Papier, oder eben Orte einer solchen Anerkennung, an denen ein<br />
Pakt geschlossen wird.<br />
Ich weiß beim Weiterwischen eines Textes auf dem iPad: Das<br />
ist fraglos ein Text. Aber ich weiß auch, dass dieser Text zu einem<br />
anderen Reich gehört als dem beschriebenen. Es ist naiv zu meinen,<br />
neue Ausgabegeräte träten nun einfach an die Stelle dessen,<br />
was ein Buch ist. So unklar es noch sein mag, auf welchem Gerät<br />
bald die Buchstaben erscheinen werden, so klar ist, dass dieses<br />
Medium Inhalte und Formen verändern wird nach der Weise, in<br />
der sich bereits unsere Apperzeptionsfähigkeit verändert. Es steht<br />
kaum zu erwarten, dass, wie es ein optimistisches Vorurteil will,<br />
weiterhin eine nennenswerte Anzahl von Menschen Bücher auf<br />
die beschriebene Weise lesen wird, die für mich stets ein Akt der<br />
Wandlung, ja der Gnade ist.<br />
114 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Foto: Privat<br />
Die Fähigkeit dazu schwindet in dem Maß, in dem die Wirklichkeit<br />
der mobilen und transparenten Enzyklopädie uns einhüllt.<br />
Die Dialektik, die den Prothesengott Mensch so mit seinen technischen<br />
Ausstülpungen verbindet, dass sie immer auf ihn zurückwirken,<br />
macht es schon heute für viele Menschen immer schwerer,<br />
sich auf einen längeren, abgeschlossenen – und das heißt hier:<br />
nicht mit dem Netz verbundenen – Text zu konzentrieren, ja selbst,<br />
sich in einem Buch zu verlieren. Man schweift in Gedanken ab.<br />
Man vermisst den Hyperlink zu Bildern, Tönen, anderen Texten.<br />
Den Kommentar zu dem, was man gerade liest. Was wiederum der<br />
Revolution der Formate entgegenkommt. Das Buch wird sich im<br />
digitalen Raum auflösen. Habent sua fata libelli – das Buch teilt<br />
das Schicksal seiner Besitzer. Wenn die Literatur der freie Traum<br />
der Literarizität war, war die Schrift im Wachen die bindende<br />
Form unseres Ichverständnisses, unseres Gesellschaftsvertrags, unserer<br />
Vorstellungen von Öffentlichkeit, Menschenrecht, Politik.<br />
Die Konsequenz des Verlusts dieser Form von Literarizität könnte<br />
noch verheerender sein, als wir momentan schon befürchten.<br />
„Wie kamen Sie zur Altphilologie?“, frage ich Professor Landfester.<br />
„Das hatte nur bildungsgeschichtliche Gründe“, sagt er.<br />
„Ich komme aus dem Münsterland und habe sehr stark miterlebt,<br />
wie man in den fünfziger Jahren noch mal mit aller Energie versucht<br />
hat, eine Wertewelt aufrechtzuerhalten der antiken Bildung,<br />
des Humanismus, sozusagen als Rettungsanker gegen die kommunistische<br />
Barbarei. In diesem Milieu bin ich groß geworden.“<br />
„Sie sind 1937 geboren.“ „Ja. Wobei das Personal dieser Restauration<br />
des Humanismus nach dem Krieg natürlich dasselbe Personal<br />
war, das schon in den dreißiger und vierziger Jahren tätig war.<br />
Das machte das damals auch schnell unglaubwürdig.“ „Es verschwindet,<br />
womit Sie Ihr ganzes Leben verbracht haben.“ „Nicht<br />
zwingend. Ich empfinde keine Trauer darüber, dass andere nicht<br />
mitmachen, was ich tue. Dass wir nicht auf der Erfolgsspur sind.“<br />
Schon sei das Altgriechische beinahe verschwunden. „In Hessen<br />
sind es etwa 600 Schüler, die es noch lernen. Die Quote liegt bei<br />
anderthalb Prozent eines Abiturjahrgangs.“<br />
„Und? Was sagen Sie Ihren Studenten? Warum sollen sie heute<br />
Griechisch lernen?“ Landfester überlegt lange und spricht dann<br />
so leise, als wäre ihm nur allzu bewusst und daher auch ein wenig<br />
peinlich, wie unzeitgemäß klingt, was er dann doch sagt: „Im<br />
griechischen Denken ist von Anfang an immer wieder alles infrage<br />
gestellt worden. Radikalität des Denkens zeigt sich aber in<br />
der Sprache. Es gibt in keiner mir bekannten Literatur eine solche<br />
Radikalität wie im Griechischen. Und je mehr die griechischen<br />
Texte im Mittelpunkt standen, umso stärker ist auch das Denken<br />
der Neuzeit radikal gewesen.“<br />
Vielleicht, weil ihm das Schweigen nach diesem Satz unangenehm<br />
ist, nimmt Professor Landfester jetzt endlich eine der<br />
Glasplatten aus dem deckenhohen dunklen Sammlungsschrank,<br />
der noch immer offen steht, und zeigt mir ein handtellergroßes,<br />
ausgefranstes Stück Papyrus. Es sei das Fragment des Briefes einer<br />
Sklavin, erklärt er und fährt mit dem Finger die Buchstaben<br />
entlang, mit denen die Frau ihre Sorge ausdrückte, ob es ihrem<br />
Herrn gutgehe. Auch die Anschrift des Adressaten findet sich auf<br />
dem Fetzen, der irgendwann begraben wurde vom Sand und wiedergefunden<br />
in den Ruinen einer Lehmziegelsiedlung am Nil wie<br />
Abertausende andere Überreste dieses Schreibstoffs auch, von winzigen<br />
Bruchstücken, auf deren dünnem Gewebe die letzten Reste<br />
der uralten Tinte fast verschwinden, bis zu foliogroßen Abschriften<br />
kaiserlicher Edikte. Kaum Literatur, leider, vor allem Rechnungen,<br />
buchhalterische Aufzeichnungen, Dekrete, Brieffragmente, und<br />
vor allem die immer selben Texte, endlose Abschriften von Schülern,<br />
alle geborgen aus jener schmalen Zone, die zufällig weder<br />
die Winde aus der Wüste noch die jährlichen Überschwemmungen<br />
des Nils erreichten.<br />
Es bleibt das Wort immer analog, denke ich, während ich den<br />
Papyrusfetzen betrachte und darauf die verblassende Schrift. Galltinte,<br />
nicht wahr? Gerbsäure, Wasser, Kupfer- und Eisensulfat. Was<br />
ich meine: Die Unterscheidung von analog und digital trifft nicht<br />
den Kern von Sprache. Verändert bei der Digitalisierung von Tönen<br />
oder Bildern sich stets etwas substanziell, so berührt sie das<br />
Entscheidende an der Sprache nicht, weil der Übersetzungsprozess<br />
immer schon zu ihr gehört. Jedes Wort wird von uns übersetzt in<br />
eine innere Präsenz. Und diese Übersetzung gleicht einem operativen<br />
Eingriff, sie trepaniert den Schädel des Lesers, indem sie sich<br />
seiner Vermögen und vor allem seiner Mängel bedient, denn mit<br />
ihren Metaphern und Metonymien und mit ihren Paradoxa zielt<br />
sie auf Überforderung ab und damit paradoxerweise auf Schöpfung.<br />
Gerade in der Erfahrung der Unerschöpflichkeit eines literarischen<br />
Werkes, das doch immer ein endliches bleibt, erlebt der<br />
Leser seine eigene Endlichkeit, die ja nur dadurch unerträglich<br />
ist, dass uns die Empfindung der Unendlichkeit eingegeben ist.<br />
Die Unendlichkeit des digitalen Raumes ist lügenhaft darin,<br />
dass er diese Sterblichkeit zu überwinden behauptet, sie aber tatsächlich<br />
nur leugnen kann. All die Texte, die von vornherein ihren<br />
Platz in einem Netz des Gesprächs und im Gespräch des Netzes<br />
haben und finden, sind der mediale Sand, in dem die Papyrii<br />
der Literatur vergraben werden. Doch auch aus diesem Sand wird<br />
man einmal ihre verrotteten Reste wieder hervorziehen. Und auch<br />
dann wird es wieder jemanden geben, der an diesen Resten von<br />
Lebendigkeit sich wärmen wird als der Glut des Humanums, das<br />
letztlich nichts anderes ist als die Sehnsucht, das Ewige zu denken<br />
in einem sterblichen Körper, wahrhaftig zu sein und autonom<br />
in einer Welt, die diese Autonomie zu jeder Stunde bedroht.<br />
Professor Landfester stellt die Glasplatte zurück und zieht eine<br />
andere heraus. Das sei, erklärt er, der Überrest der Schreibübung<br />
eines ägyptischen Kindes. Er übersetzt: „Homer ist kein Mensch.<br />
Homer ist ein Gott.“ Vorstellbar, dass wir nicht mehr wüssten,<br />
wer Homer war. Und unvorstellbar zugleich. Wir wären andere.<br />
Noch aber leben wir in derselben Welt mit jenem Kind am Nil,<br />
das vor mehr als 2000 Jahren mit einem Schreibrohr und Galltinte<br />
erste griechische Buchstaben auf ein Stück Papyrus malte.<br />
Nicht nur schreiben lernte es so mit Homer, sondern: mit uns zu<br />
sprechen. Und wir hören ihm zu. Die Fragilität dieses Gesprächs<br />
ist das Wunder der Schrift.<br />
Der Text ist ein Vorabdruck aus Thomas Hettches neuem Essayband „Totenberg“, der<br />
am 10. September im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint und 18,99 Euro kostet<br />
Thomas Hettche<br />
ist mit Romanen wie „Die Liebe der Väter“ und „Woraus<br />
wir gemacht sind“ (KiWi) bekannt geworden<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 115
| S a l o n | B e n o t e t<br />
Freude<br />
empfängt Dich!<br />
Im August ist es nirgends schöner als in<br />
Heiligendamm. Das wusste schon der<br />
15-jährige Felix Mendelssohn. Die Festspiele<br />
Mecklenburg-Vorpommern lassen die Tradition<br />
der musikalischen Sommerfrische fortleben<br />
Von Daniel Hope<br />
V<br />
or zwei Jahren habe ich die künstlerische Leitung der<br />
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern übernommmen,<br />
die jeden Sommer im Nordosten Deutschlands stattfinden:<br />
127 Konzerte zwischen Mitte Juni und Mitte September.<br />
Diese Festspiele liebe ich besonders, weil sie eine Art musikalische<br />
Entdeckungsreise durch einen wunderschönen Landstrich bieten.<br />
Konzerte finden in idyllischen Gutshäusern, kleinen Dorfkirchen,<br />
Schlössern und Scheunen statt. Manche Spielorte wie das malerische<br />
Renaissanceschloss an einem kleinen See im Dorf Ulrichshusen<br />
haben – dank der Vision der Schlossherren Alla und Helmuth<br />
von Maltzahn sowie durch unvergessliche Auftritte von Künstlern<br />
wie Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter und Mstislaw Rostropowitsch<br />
– längst ihren festen Platz in der deutschen, ja sogar<br />
europäischen Musiklandschaft erobert.<br />
Auch Heiligendamm hat sich erneut als bemerkenswerte Spielstätte<br />
etabliert. „Hier ist der Blick bewunderungswürdig schön,<br />
der heilige Damm bezaubert uns gänzlich“, schrieb 1766 der englische<br />
Reiseschriftsteller Thomas Nugent. Wer schon einmal auf<br />
der magischen Strandpromenade vor dem Grand Hotel gestanden<br />
hat, die prunkvollen weißen Villen aus dem 19. Jahrhundert<br />
im Rücken mit Blick auf die Ostsee mit ihren aufwühlenden Farben,<br />
vergisst das nie mehr. Sogar dem 15-jährigen Felix Mendelssohn<br />
erging das ähnlich. Aufgeregt schrieb er 1824 seiner Mutter,<br />
dass er um halb sechs Uhr morgens aus den Federn in eine<br />
kleine Zinkwanne sprang, Kaffee trank und rasch die Treppe abwärtseilte,<br />
„damit ich Punkt 7 Uhr den ersten Badewagen, der an<br />
den Strand zum Heiligen Damm fährt, bekomme“. Vom ersten<br />
deutschen Seebad hatte Familie Mendelssohn von Wilhelm von<br />
Humboldt erfahren, dem preußischen Staatsmann, der in höchsten<br />
Tönen davon schwärmte. Damals hatte man die luxuriöse Möglichkeit,<br />
bei starkem Seegang das neue Badehaus zu besuchen, wo<br />
erwärmtes Wasser in Badewannen als Heilmittel angeboten wurde.<br />
Entstanden ist Heiligendamm im Jahre 1793 durch den mecklenburgischen<br />
Herzog Friedrich Franz I. Im 19. und 20. Jahrhundert<br />
war das Bad vom europäischen Hochadel geprägt. Auch einzelne<br />
Mitglieder der russischen Zarenfamilie sollen zu den Gästen<br />
gezählt haben sowie der Seeheld Lord Nelson, Rainer Maria Rilke<br />
und Franz Kafka. Ungewöhnlich sind auch die Ausführungen zu<br />
den Aufwendungen, die der Großherzog betrieb, um die Badegesellschaft<br />
zu unterhalten. Er war ein moderner Regent, der mit der<br />
<strong>Zeit</strong> ging und dem Musischen viel Raum ließ. Genau das scheint<br />
den jungen Mendelssohn so beeindruckt zu haben. Im malerischen<br />
Nachbarort Bad Doberan wurden die teuersten Blasinstrumente<br />
aus London importiert und die besten Musiker engagiert, um sie<br />
für die Gäste spielen zu lassen. Der Großherzog verstand schon<br />
damals die Idee von „Wellness“ und war überzeugt, dass das intensive<br />
Hören von „neuartigen Klangnuancen“ den Geist fördern<br />
würde. Mendelssohn geriet in Verzückung, als er merkte, dass ihm<br />
die Umgebung „so viel Komponierlaune“ entlockte.<br />
Als ich zu Beginn meiner Arbeit für die Festspiele von der<br />
Verbindung zu Mendelssohn erfuhr, entschied ich mich sofort,<br />
Musik auf eine besondere Art wieder mit Heiligendamm zu verbinden,<br />
und zwar in Form eines Brückenschlags zwischen Mecklenburg<br />
und den Vereinigten Staaten. Zum dritten Mal in Folge<br />
werden auch während der diesjährigen Festspiele die besten Nachwuchsmusiker<br />
aus der Carnegie Hall und dem Lincoln Center<br />
nach Heiligendamm kommen. Sie wohnen, proben öffentlich,<br />
konzertieren im Grand Hotel und lassen sich von dieser historischen<br />
Umgebung immer wieder aufs Neue inspirieren, genau<br />
wie der junge Mendelssohn. Und Nachwuchsmusiker aus Mecklenburg-Vorpommern<br />
bekommen die Chance, mit den Amerikanern<br />
zu musizieren oder sogar in New York aufzutreten. Das einzige<br />
Problem: Für einige der Amerikaner ist Heiligendamm der<br />
erste Eindruck, den sie von Europa bekommen, und damit sind<br />
sie für immer reichlich verwöhnt! „Heic te laetitia invitat post balnea<br />
sanum – Freude empfängt Dich hier, entsteigst Du gesundet<br />
dem Bade“ verheißt die goldene Inschrift am Kurhaus, in dem<br />
die Konzerte der Festspiele stattfinden. Ein gutes Omen und der<br />
Beweis dafür, dass Musik und das Wohlbefinden eigentlich öfter<br />
beieinanderliegen könnten.<br />
Daniel Hope ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch „Toi,<br />
Toi, Toi – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt) und die<br />
CD „The Romantic Violinist“. Er lebt in Wien<br />
illustration: anja stiehler/jutta fricke illustrators<br />
116 <strong>Cicero</strong> 8.2012
GESUCHT!<br />
QUERDENKER AWARD 2012<br />
© Martin Schumann - Fotolia.com<br />
werden die kreativsten Unternehmen und Köpfe für die Kategorien:<br />
START-UP. HIDDEN CHAMPION. VORDENKER. MARKTFÜHRER. INNOVATIONEN. ERFINDER.<br />
Jetzt bis zum 30. September 2012 bewerben unter www.querdenker.de!<br />
QUERDENKER AWARD 2012<br />
VERLEIHUNG AM 16. NOV. 2012 IM DOPPELKEGEL DER BMW WELT IN MÜNCHEN<br />
PREMIUM-Partner
| S a l o n | 9 0 J a h r e H y m n e<br />
Eberts Staatsstreich<br />
Die Olympischen Spiele haben begonnen, die Fußball-EM liegt gerade hinter uns. Wäre<br />
es nicht an der <strong>Zeit</strong>, uns eine Nationalhymne zu geben, die niemanden beschämt?<br />
von Uwe Soukup<br />
D<br />
ie<br />
Reichspräsidenten Friedrich<br />
Ebert zur Nationalhymne bestimmt<br />
wurde, gingen schon immer weit<br />
auseinander. Während Golo Mann in dem<br />
Lied noch 1986 „zarte Lyrik“ erkannte,<br />
war es Heinrich Böll einfach nur „peinlich“.<br />
Egal, wie man dazu steht, Fakt ist,<br />
dass Hoffmann von Fallerslebens „Lied der<br />
Deutschen“ als Nationalhymne nie demokratisch<br />
legitimiert wurde. Weder hat je ein<br />
deutsches Parlament über diese Frage entschieden<br />
noch findet sich – im Unterschied<br />
zur Flagge – irgendwo ein entsprechender<br />
Gesetzestext, der die Nationalhymne bestimmt.<br />
Es ist nicht einmal geregelt, wie<br />
diese Frage geregelt werden soll.<br />
Dieses erstaunliche juristische Vakuum<br />
geht auf die Anfangsjahre der Weimarer<br />
Republik zurück. Politische Morde<br />
der Rechten waren an der Tagesordnung:<br />
Matthias Erzberger und Walther Rathenau<br />
zählten zu den prominentesten Opfern.<br />
Just in dieser Situation entschied der<br />
sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich<br />
Ebert, das „Lied der Deutschen“ mit<br />
allen drei Strophen per Verordnung zur<br />
deutschen Nationalhymne zu dekretieren.<br />
Der Hintergedanke dabei soll gewesen sein,<br />
die undemokratische Rechte wenn schon<br />
nicht für die Republik zu begeistern, so<br />
doch wenigstens ruhig zu stellen und ihrem<br />
„irregeleiteten Patriotismus“ den richtigen<br />
Weg zu weisen. Dieser Plan ist gründlich<br />
misslungen, so wie eigentlich alle Pläne<br />
Eberts: Die Weimarer Republik entstand<br />
links, in einer Friedensrevolution, und endete<br />
rechts, bei Hitler.<br />
Meinungen über das „Lied<br />
der Deutschen“, das vor 90 Jahren,<br />
am 11. August 1922, vom<br />
Schon am späten Abend der Revolution,<br />
am 9. November 1918, hatte sich Ebert als<br />
neuer Reichskanzler in der Staatskanzlei<br />
wiedergefunden und war buchstäblich von<br />
dieser Minute an bemüht, die Revolution<br />
ungeschehen zu machen. Dazu brauchte<br />
er Partner, und die konnte er nicht im eigenen,<br />
eher revolutionären Lager finden.<br />
Und genauso kam es später auch zu der unglücklichen<br />
Hymnenentscheidung.<br />
Geschrieben hatte Heinrich August<br />
Hoffmann von Fallersleben das Lied im<br />
August 1841 auf Helgoland. Dort wurde<br />
es auch 1890 erstmals offiziell gesungen,<br />
in Anwesenheit des Kaisers. Es entwickelte<br />
sich bald zu einem deutschnationalen<br />
und antisemitischen Kampflied. Im Ersten<br />
Weltkrieg wurde die Legende verbreitet,<br />
junge Soldaten wären „Deutschland,<br />
Deutschland über alles“ singend in das<br />
feindliche Sperrfeuer gelaufen. Natürlich<br />
wusste Ebert um die Belastung des Liedes,<br />
aber er gehörte zu jenen Sozialdemokraten,<br />
die zu Kriegsbeginn nur noch „Deutsche“<br />
kannten. Er verlor zwei Söhne an der<br />
Front, die SPD Millionen von Mitgliedern.<br />
Die rechtsradikalen Freicorps-Verbände,<br />
die Ebert bald auf jene früheren Anhänger<br />
der SPD schießen ließ, die unzufrieden<br />
waren mit seiner „Revolution“, sangen<br />
gerne das Deutschlandlied. Ebenso wie die<br />
Putschisten vom März 1920, die ihn zur<br />
Flucht aus der Hauptstadt nötigten. Nein,<br />
eine demokratische Weise war das Lied nie.<br />
„Man darf doch nicht vergessen“, kritisierte<br />
die Vossische <strong>Zeit</strong>ung 1922 Eberts Entscheidung,<br />
„dass in letzter <strong>Zeit</strong> gerade die rechtsradikalen<br />
Kräfte sich des Liedes bemächtigt<br />
haben, als ob es sich um eine Art von<br />
Parteigesang handelte.“<br />
Ebert versuchte das schwierige Lied<br />
zu kaschieren, indem er möglichst oft die<br />
dritte Strophe „Einigkeit und Recht und<br />
Freiheit“ zitierte und Deutschland lediglich<br />
„über alles liebte“, aber es half nichts.<br />
„Seit Monaten bemühen sich Sozialisten<br />
und Demokraten, das ‚Deutschland-<br />
Lied‘ aus dem Lager der ‚Hakenkreuzler‘<br />
zu annektieren. Aber dieses Lied ist vollkommen<br />
kompromittiert“, schrieb Weihnachten<br />
1922 ein junger Sozialdemokrat<br />
im Vorwärts.<br />
Es mag ja sein, dass Hoffmann von<br />
Fallersleben nicht die Weltherrschaft im<br />
Sinn hatte, als er „Deutschland, Deutschland<br />
über alles“ textete und der Hamburger<br />
Verleger Campe es begeistert druckte. In<br />
der NS‐<strong>Zeit</strong> wurde natürlich mit Verve die<br />
erste Strophe gesungen, anschließend das<br />
Horst‐Wessel‐Lied. Das Welteroberungsprogramm<br />
Hitlers hatte einen Soundtrack,<br />
der schon immer da war und so klang, als<br />
sei die Weltherrschaft a priori die politische<br />
Bestimmung der Deutschen gewesen:<br />
„Über alles in der Welt.“<br />
Man sollte meinen, das „Lied der Deutschen“<br />
wäre spätestens nach den Hitlerjahren<br />
unrettbar verloren gewesen. Viele sahen<br />
das so. Auch „Papa Heuss“, der erste Bundespräsident.<br />
Lange wehrte er sich gegen<br />
Adenauers Wunsch, die alte Hymne wieder<br />
einzusetzen, gab einen Text in Auftrag, bat<br />
Carl Orff um eine Melodie – vergeblich.<br />
Die neue Hymne, die Heuss nach seiner<br />
Silvesteransprache 1951 präsentierte, fiel<br />
beim Publikum durch. Adenauer nutzte<br />
die Gunst der Stunde. Während eines tatsächlich<br />
„Staatsbesuch“ genannten Aufenthalts<br />
in Westberlin forderte er im Titania-Palast<br />
in Berlin-Steglitz das Publikum<br />
118 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Illustration: jan Rieckhoff; Foto: Harald Miko (Autor)<br />
vollkommen überraschend auf, sich zu erheben<br />
und mit ihm die dritte Strophe des<br />
Deutschlandlieds zu singen: „Wenn ich<br />
Sie nunmehr bitte, die dritte Strophe des<br />
Deutschlandlieds zu singen, dann sei uns<br />
das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges<br />
Volk, ein freies Volk und ein friedliches<br />
Volk sein wollen.“ Niemandem fiel<br />
auf, dass es das Wort Frieden in der deutschen<br />
Hymne gar nicht gibt.<br />
Franz Neumann, Berliner SPD‐Chef,<br />
verließ aus Protest den Saal, andere folgten.<br />
Die SPD nannte den Vorgang eine „eigenmächtige<br />
Handlung mit schwierigsten<br />
nationalen Folgen“. Das Lied sei von den<br />
Nationalsozialisten entwertet worden. Jakob<br />
Kaiser, Adenauers „Bundesminister für<br />
gesamtdeutsche Fragen“, schwärmte: „Ein<br />
schöner Staatsstreich!“ Im Tagesspiegel hieß<br />
es am nächsten Tag, dass der Kanzler nicht<br />
habe klären können, „ob es sich um eine<br />
Improvisation oder um ein Missverständnis<br />
bei der Aufstellung des Programms“ gehandelt<br />
habe. Dabei hatte er vor der Veranstaltung<br />
den Text der dritten Strophe auf die<br />
Sitze legen lassen. Sicher ist sicher.<br />
Bundespräsident Heuss ließ sich vernehmen,<br />
„das Singen der dritten Strophe des<br />
Deutschlandlieds bedeute keine Entscheidung<br />
über eine Nationalhymne“. Die <strong>Zeit</strong><br />
dafür sei noch nicht reif. Er hoffte auf den<br />
Erfolg seiner in Auftrag gegebenen neuen<br />
Hymne und blockierte Adenauer noch<br />
einige Monate. Doch als seine Hymne<br />
keinen Anklang fand, einigte er sich mit<br />
Adenauer zähneknirschend in einem Briefwechsel,<br />
der anschließend von der Bundesregierung<br />
veröffentlicht wurde, als handle<br />
es sich um ein Gesetz. Um mit sich selbst<br />
„im Reinen zu bleiben“, wie Heuss schrieb,<br />
wolle er aber auf eine feierliche Proklamation<br />
verzichten. Ausdrücklich wird in diesem<br />
Briefwechsel erneut das gesamte Lied –<br />
alle drei Strophen – zur Nationalhymne<br />
erklärt. Der letzte Satz Adenauers lautet:<br />
„Bei staatlichen Veranstaltungen soll die<br />
dritte Strophe gesungen werden.“ Schwer<br />
nachvollziehbar, wie aus diesem lapidaren<br />
Satz die weitverbreitete, aber falsche<br />
Annahme entstehen konnte, die erste, die<br />
„Deutschland-Deutschland-über-alles“-<br />
Strophe sei verboten.<br />
Dass alle drei Strophen Teil der Nationalhymne<br />
blieben, hatte über Jahrzehnte<br />
eine ganze Reihe von Skandalen und Skandälchen<br />
zur Folge. Immer wieder ließen<br />
vor allem christdemokratische Politiker den<br />
Text der gesamten Hymne drucken und in<br />
Schulen verteilen oder sangen in der Öffentlichkeit<br />
demonstrativ die erste Strophe.<br />
Auch die deutsche Fußballnationalmannschaft<br />
stimmte vor dem Endspiel 1954 in<br />
Bern die erste Strophe an, ebenso wie die<br />
20 000 deutschen Schlachtenbummler<br />
nach dem überraschenden Sieg. Damit sich<br />
das bei der Siegerfeier im Berliner Olympiastadion<br />
nicht wiederholte, las Theodor<br />
Heuss den versammelten 80 000 Zuschauern<br />
den Text der dritten Strophe vor.<br />
Während der Wiedervereinigungsverhandlungen<br />
der beiden deutschen Staaten<br />
1990 tauchte der Gedanke auf, eine neue<br />
Hymne aus Versatzstücken beider Staatslieder<br />
zusammenzubasteln, da die Versmaße<br />
fast identisch waren. Daraus wurde nichts.<br />
Manche brachten auch Brechts sogenannte<br />
„Kinderhymne“ ins Spiel, die er aus Ärger<br />
über Adenauers Coup im Titania-Palast<br />
geschrieben hatte. Aber Helmut Kohl<br />
hatte schon 1987 gewarnt: „Wer gegen das<br />
Deutschlandlied ist, der will eine andere<br />
Republik.“ Das war mit Kohl nicht zu machen.<br />
Immerhin hatte er 1949 als 19-Jähriger<br />
an einer Wahlkampfveranstaltung in<br />
Landau teilgenommen, bei der Adenauer<br />
den Trick mit der dritten Strophe schon<br />
einmal ausprobiert hatte.<br />
Nach der Wiedervereinigung erinnerten<br />
sich Bundeskanzler Kohl und Bundespräsident<br />
von Weizsäcker der Methode<br />
Adenauer/Heuss und griffen zur Feder. In<br />
knappen Briefen teilten sie sich gegenseitig<br />
mit, dass nunmehr allein „die dritte Strophe<br />
des Liedes der Deutschen von Hoffmann<br />
von Fallersleben mit der Melodie<br />
von Joseph Haydn die Nationalhymne für<br />
das deutsche Volk“ sei.<br />
Deutschland im Jahre 2012: Wäre es<br />
nicht an der <strong>Zeit</strong>, sich einmal grundsätzlich<br />
um die Frage der Hymne zu kümmern,<br />
statt unsere Fußballnationalspieler, vor allem<br />
jene mit Migrationshintergrund, tadelnd<br />
aufzufordern, dieses schwierige Lied<br />
mitzusingen? Uns eine Hymne zu geben,<br />
die nicht peinlich ist, die niemanden beschämt<br />
und niemanden verletzt? Die auch<br />
Menschen singen können, deren Heimat<br />
vor Jahrzehnten zu den Klängen unserer<br />
Hymne in Schutt und Asche gelegt<br />
wurde? Sicherlich ist eine Nationalhymne<br />
kein Hemd, das man so einfach wechselt.<br />
Aber dieses Hemd ist unmodern, verschlissen<br />
und blutbefleckt.<br />
Uwe Soukup<br />
ist Journalist und Buchautor.<br />
Unter anderem schrieb er die<br />
Sebastian-Haffner-Biografie<br />
„Ich bin nun mal Deutscher“<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 119
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Schmales für<br />
Selbstdenker<br />
Nir Baram ist angetreten, um die israelischen<br />
Starintellektuellen Amos Oz und David Grossman zu<br />
beerben. Sein jüngster Roman „Gute Leute“ tut genau<br />
das – mit einem Paukenschlag. Zu Besuch in Tel Aviv<br />
Von Marko martin<br />
U<br />
nd das soll eine Bibliothek sein – ein paar metallicgraue<br />
Baumarktregale wie in einer Studenten-WG?<br />
Dazu ein Hausherr, der sich in Jeans und ausgeleiertem<br />
T-Shirt irgendwann aus der Sofaecke eines weiträumigen,<br />
leer wirkenden Tel Aviver Wohnzimmers schält<br />
und barfuß über den Fliesenboden schlurft. „Dann darf ich also<br />
die vielen Bücher zeigen …“, sagt Nir Baram mit jener merkwürdig<br />
kristallinen Adoleszentenstimme, die in Israel jeder literarisch<br />
und politisch interessierte Radiohörer oder Fernsehzuschauer seit<br />
langem kennt. Macht er womöglich Witze? Mehr oder minder<br />
schma le, windschief dastehende oder übereinandergestapelte Exemplare<br />
mit hebräischen Lettern. Vielleicht handelt es sich dabei<br />
ja um Anleitungsbüchlein für den Bau von Regalen.<br />
„Ich würde eher von Dekonstruktion sprechen. Etwa da drüben,<br />
bei Nikolai Gogols ‚Mantel‘. Ich war 14, es war der Jom-<br />
Kippur-Gedenktag 1991, und als wäre es gestern gewesen, erinnere<br />
ich mich an meinen damaligen Schock: Verdammt, der<br />
Erzähler sagt ja gar nicht immer die Wahrheit, sondern spielt mit<br />
dem Leser.“ Weil es ohnehin keine Wahrheit gibt und nur Nuancen<br />
des mehr oder minder Fiktionalen? „Von wegen“, entgegnet<br />
der preisgekrönte Romancier, dessen Zweiter-Weltkriegs-Roman<br />
„Gute Leute“ in diesem Monat in deutscher Übersetzung<br />
im Hanser-Verlag erscheint. „Einfache Wahrheiten gibt es nicht,<br />
doch umso dringender stellt sich eine Frage. Wie in seiner <strong>Zeit</strong><br />
leben ohne Lügen, trotz aller Masken und Projektionen? F. Scott<br />
Fitzgerald jagt seine Helden auf diese Erkundungstour, und der<br />
120 <strong>Cicero</strong> 8.2012
In Israel kennt jeder politisch interessierte Radiohörer und Fernsehzuschauer seine<br />
kristalline Adoleszentenstimme: Nir Baram, zu Hause in Tel Aviv<br />
Foto: Ziv Koren<br />
‚Große Gatsby‘ ist tatsächlich der Größte von ihnen – eine Art<br />
Geistesbruder von Ulrich.“ Welcher Ulrich denn?<br />
Nir Baram kneift die dunkelbraunen, in tiefen Höhlen liegenden<br />
Augen spöttisch zusammen, legt den Kopf schief und wuselt<br />
sich in gespielter Verzweiflung das Haar. „Könnte sein, dass gerade<br />
von Robert Musils ‚Mann ohne Eigenschaften‘ die Rede ist …“ Der<br />
lakonische Fitzgerald und der kunstvoll mäandernde Musil als prägende<br />
Einflüsse für einen 35‐jährigen Tel Aviver Schriftsteller, dem<br />
sein älterer Kollege Amos Oz erst kürzlich bescheinigt hat, er öffne<br />
der israelischen Literatur neue Wege? „Aber klar doch, der Intellektuelle<br />
Ulrich! Wobei es übrigens weniger um den Stil geht als<br />
um die Aneignung von Sujets, den Blick auf Mentalitäten.“ Aber<br />
weshalb ist dann Musils Wälzer vor uns im Regal so dünn, als sei<br />
er geschrumpft? Statt einer Antwort zieht Baram ein weiteres, eher<br />
handliches Buch heraus und öffnet es von hinten – quadratische<br />
schwarze Buchstaben, am unteren Rand die arabische Ziffer 1 und<br />
wenige Hundert Seiten weiter, von rechts nach links geblättert: „Natürlich<br />
‚Schuld und Sühne‘!“ Das Hebräische ist einfach kompakter<br />
als andere Sprachen, also benötigt es gedruckt auch weniger Raum.<br />
Den Fjodor-Dostojewski-Roman hat übrigens irgendjemand aus<br />
dem Polen vor dem Krieg hierher gerettet, es gehörte Nir Barams<br />
vor ein paar Jahren verstorbenen Mutter, die es geradezu verschlungen<br />
hat, wie auch die Bücher von Iwan Turgenjew und Lew Tolstoi<br />
und selbst die der sozialistischen Realisten Michail Scholochow<br />
und Maxim Gorki, die in den fünfziger und sechziger Jahren im<br />
israelischen Gewerkschaftsverlag erschienen sind.<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 121
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Einen Teil seiner Bibliothek hat Baram von seiner Mutter geerbt, die ägyptisch-spanische Vorfahren hatte, vor allem<br />
die russische Literatur liebte und selbst vor sozialistischen Realisten wie Michail Scholochow nicht zurückschreckte<br />
Die Mutter las aus Liebe zur Literatur, aber auch zur Festigung<br />
der eigenen Identität, erzählt Baram. Sie hatte ägyptisch-spanische<br />
Vorfahren, die Eltern seines Vaters kamen aus Polen und Syrien,<br />
und um beim damals den Ton angebenden, vor allem aus Osteuropa<br />
stammenden aschkenasischen Establishment akzeptiert zu<br />
werden, las sie all die Russen.<br />
Wobei – und auch das weiß im überschaubaren Israel ein jeder<br />
– Nir Baram alles andere als ein Außenseiterspross ist. Sowohl<br />
sein Großvater als auch sein Vater hatten in den Regierungen<br />
von Ben Gurion und Jitzchak Rabin Ministerämter inne, unkorrumpierbare<br />
linksliberale Zionisten, deren dennoch zwiespältiges<br />
Erbe Baram in seinem 2009 erschienenen Roman „Der Wiederträumer“<br />
geradezu apokalyptisch fiktionalisiert hat: Am Schluss<br />
geht das sich stets als emanzipatorisches Eiland verstehende Tel<br />
Aviv in einem Hurrikan unter. Folgt man den öffentlichen Einsprüchen<br />
und Reden, die Baram als eine Art eloquenter Nachfolger<br />
von Amos Oz und David Grossman auf Buchmessen und bei<br />
den Demonstrationen der israelischen Friedensbewegung hält, ist<br />
seine Sorge nicht gering, der demokratische Judenstaat könnte irgendwann<br />
auch in der Realität untergehen. Bedroht von außen,<br />
vor allem aber unterminiert von den ultrarechten und fundamental-religiösen<br />
Kräften im Inneren.<br />
„Aber stopp mal, palavern wir etwa wieder über den ewigen<br />
Nahostkonflikt, oder geht’s um die Bibliothek?“ Nir Barams Lächeln<br />
wird unverschämt breit; gleich wird die helle Stimme Provozierendes<br />
verkünden. „Fehlen also hier in den Regalen die<br />
entsprechenden Bücher über den Unabhängigkeits- und den<br />
Sechstagekrieg, und könnte außer dem Standardwerk von Raul<br />
Hilberg nicht auch die Holocaust-Literatur umfangreicher vertreten<br />
sein? Das ist es doch, was man im Ausland von einem schreibenden<br />
Israeli erwartet: In seinen Romanen hat er über die Besatzung<br />
oder über Terroranschläge zu schreiben, nicht zu vergessen<br />
diese Familiengeschichten über die Schoah.“<br />
Stattdessen: Der von Nir Baram geradezu kultisch verehrte<br />
Roberto Bolaño, dazu Jorge Luis Borges, Louis-Ferdinand Céline,<br />
Marcel Proust und Salman Rushdie, auch sie alle in einer vermeintlich<br />
„schmalen“ hebräischen Ausgabe, die Amerikaner von<br />
Dos Passos und Norman Mailer bis Saul Bellow, William Gaddis<br />
und Thomas Pynchon. Man ahnt die postmoderne Präferenz<br />
und wundert sich dann zum ersten Mal nicht, als nebenan – obwohl<br />
ebenso anarchisch gestapelt – die üblichen Universitätsverdächtigen<br />
auftauchen: Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel<br />
Foucault, Jean Baudrillard oder Maurice Blanchot. „Meine Studentenlektüren,<br />
denen ich viel verdanke“, sagt Baram. „Was kein<br />
Widerspruch ist: Theorielektüre muss das Fabulieren ja nicht notwendigerweise<br />
zerstören, im Gegenteil: Flexibel und gegen den<br />
Strich gelesen, wappnet sie gegen unnütze Psychologisierungen<br />
und Bedeutungshuberei.“<br />
Nun hat der längst erwachsene Sohn einer russische Literatur<br />
verschlingenden Mutter jedoch diesen neuen, in Israel lebhaft diskutierten<br />
Roman „Gute Leute“ geschrieben, der im Vorkriegs-Berlin<br />
und in Stalins Sowjetunion spielt, dessen Protagonistin Alexandra<br />
sich mit dem Geheimdienst NKWD einlässt, während der<br />
Deutsche Thomas als apolitischer Individualist in der mittleren<br />
Ebene der Nazi-Administration den geplanten Massenverbrechen<br />
zuarbeitet – und dies bereits vor dem berüchtigten „Plan Barbarossa“.<br />
Ein diktaturvergleichendes Aufarbeitungsepos also?<br />
„Gehen wir mal ins Arbeitszimmer!“ Vorbei an den DVD- und<br />
CD-Stapeln im Flur – ein kurzes Hallo ins Schlafzimmer, wo Barams<br />
Freundin für ein Universitätsexamen büffelt – und dann in<br />
einem kleinen Raum mit Schreibtisch und PC linker Hand erneut<br />
ein Baumarktregal, bis obenhin gefüllt. Nicht ohne die Überraschung<br />
des Besuchers auszukosten, liest Nir Baram die Namen:<br />
Joachim Fest, Karl Dietrich Bracher, Christopher Browning, Ian<br />
Kershaw, Nadeshda Mandelstam, Warlam Schalamow. „And here<br />
we go: All die Bücher, die ich lesen musste, ehe ich ‚Gute Leute‘<br />
schreiben konnte. Vor allem, um die Täter nicht als Monster ästhetisieren<br />
zu müssen, wie es Jonathan Littell so effektvoll in den<br />
‚Wohlgesinnten‘ getan hat.“ Und wieder ist da dieses Nesteln am<br />
T-Shirt und das teenagerhafte Lächeln. Vermutlich ist es Nir Barams<br />
Art, auch im Alltagsgestus Zuschreibungen und Erwartungen<br />
zu unterlaufen. Ganz zu schweigen von seinen Büchern.<br />
Marko Martin<br />
ist Journalist und Schriftsteller. Zuletzt erschien sein<br />
Erzählband „Schlafende Hunde“ (Die Andere Bibliothek,<br />
2009). Zurzeit arbeitet er an einem Buch über israelische<br />
Literatur, das „Kosmos Tel Aviv“ heißen soll<br />
Fotos: Ziv Koren, Privat (Autor)<br />
122 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Ab 40 ist man<br />
von Männern,<br />
die nur<br />
schön sind,<br />
gelangweilt.<br />
Jetzt<br />
im<br />
Handel
| S a l o n | D a s S c h w a r z e s i n d d i e B u c h s t a b e n<br />
Die strukturelle Gewalt<br />
der Dummheit<br />
Intelligenz muss nicht absatzschädigend sein! Den Beweis<br />
erbringen amerikanische Fernsehserien wie „The Wire“<br />
Die Bücherkolumne von Robin Detje<br />
H<br />
eute geht es um die Frage: Gibt<br />
es intelligentes Leben im Fernsehen?<br />
Man muss sie differenziert<br />
beantworten: In Deutschland eher nicht,<br />
in den USA eher doch. Komisch, wir<br />
Deutschen machen uns so gerne über die<br />
Dummheit der Amerikaner lustig. Dabei<br />
ist dort, anders als bei uns, in der Unterhaltungsindustrie<br />
Intellektualität erlaubt.<br />
Intelligenz gilt nicht als absatzschädigend.<br />
Nur beim deutschen Fernsehen lautet das<br />
Gesetz: Was noch nicht doof ist, wird doof<br />
gemacht.<br />
Die US-amerikanische Kabelfernsehserie<br />
„The Wire“ aus den Jahren 2002 bis<br />
2008 gehört zu den ersten großen Kunstwerken<br />
des 21. Jahrhunderts. (Staffel 1-3<br />
auf DVD bei Warner Home Video; zwischen<br />
10 und 35 Euro; Box mit allen fünf Staffeln<br />
von HBO Video, nur auf Englisch, circa<br />
100 Euro.) Getaggt unter: Später Höhepunkt<br />
des Naturalismus, Gesellschaftspanorama,<br />
Honoré de Balzac. Ein Racheakt<br />
gestandener Reporter und Polizisten an einem<br />
System, das sie ausgestoßen hat: Sie<br />
wollten mit der Wirklichkeit umgehen.<br />
Aber die Gesellschaft wollte nichts mehr<br />
von der Wirklichkeit wissen. Also schlugen<br />
sie dieser Gesellschaft eine Fernsehserie<br />
um die Ohren und führten uns vor, was<br />
mit uns passiert, wenn wir uns der Wirklichkeit<br />
verweigern und uns stattdessen in<br />
potemkinschen Dörfern einbunkern: Wir<br />
verrotten.<br />
Die Heroinsüchtigen in den Abbruchhäusern<br />
der Stadt Baltimore, an deren Leid<br />
sich diese Serie entzündet, verrotten buchstäblich.<br />
Rundherum sind es dann eher die<br />
Strukturen, die zu verrottet sind, ihnen zu<br />
helfen: Die Polizei soll lieber Statistiken frisieren,<br />
damit die Politiker besser dastehen,<br />
anstatt die Verbrechen an der Wurzel zu<br />
bekämpfen. Die Lehrer sollen den Schülern<br />
Testfragen einbläuen, damit die Schule<br />
besser dasteht, anstatt die Schutzbefohlenen<br />
fürs Leben stark zu machen. Die Journalisten<br />
sollen lieber kitschige Geschichten<br />
für die Pulitzer-Preis-Jury erfinden, mit<br />
denen die <strong>Zeit</strong>ungen sich selbst inszenieren,<br />
anstatt ihren Kontrollauftrag zu erfüllen.<br />
Staffel für Staffel zeigt „The Wire“, dass<br />
bei uns – denn Baltimore ist überall – das<br />
Funktionieren der Institutionen nur noch<br />
eine hohle Behauptung ist. Und wenn es<br />
Probleme gibt, engagieren wir einen neuen<br />
PR-Berater, der sie wegredet, anstatt sie zu<br />
lösen. Es geht um die Dummheit selbst,<br />
eine zerstörerische Dummheit, erzeugt von<br />
den von uns selbst geschaffenen Strukturen.<br />
Es geht sozusagen um die strukturelle<br />
Gewalt der Dummheit. Und um die<br />
Menschen, die sich an unserer Dummheit<br />
bereichern.<br />
***<br />
Auch mit der Hilflosigkeit von bürokratisch<br />
erstarrten Fürsorgeeinrichtungen beschäftigt<br />
sich die Fernsehserie „The Wire“.<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
124 <strong>Cicero</strong> 8.2012
foto: Loredana Fritsch<br />
Zu den Vorarbeiten der Autoren der Serie,<br />
David Simon und Ed Burns, gehörte<br />
die Großreportage „The Corner“ aus dem<br />
Jahr 1997. (David Simon, Ed Burns: „The<br />
Corner. Bericht aus dem dunklen Herzen<br />
der amerikanischen Stadt“; Kunstmann-Verlag,<br />
München 2012; 800 Seiten,<br />
24,95 Euro.) Das jetzt von einer unüberschaubaren<br />
Anzahl von Übersetzern sehr<br />
souverän ins Deutsche gebrachte Buch ist<br />
das Werk einer anderen Art von Fürsorge.<br />
Ein Jahr haben Simon und Burns, wie sie<br />
schreiben, an einer Straßenecke in einem<br />
Drogenviertel von Baltimore zugebracht,<br />
bis sie dort jede Menschenseele kannten.<br />
Man fürchtet sich beim Lesen ein wenig<br />
vor dem Kitsch, den die journalistische<br />
Pseudofiktionalisierung des Lebens wirklicher<br />
Menschen so leicht erzeugt. Aber<br />
die Autoren begegnen dieser Angst mit<br />
einer Gründlichkeit und Beharrlichkeit,<br />
der man nicht leicht entkommt. Sie lassen<br />
nicht nach, bis ihre Botschaft eisklar<br />
ist: Es ist das kleine Leben kleiner Menschen,<br />
dem die Fürsorge der Institutionen<br />
gelten sollte und an dem sie schändlich<br />
scheitern. Und der „Krieg gegen die<br />
Drogen“, den die USA führen, löst keine<br />
Probleme; er dient als Deckmantel für<br />
schmutzige Geschäfte. Das Buch ist eine<br />
Ehrenrettung des Journalismus, so wie<br />
„The Wire“ zur Ehrenrettung des Fernsehens<br />
werden sollte.<br />
***<br />
Der Diaphanes-Verlag hat eine neue Buchreihe<br />
aufgelegt, sogenannte „Booklets“,<br />
um die hundert Seiten dünn, die Qualitätsfernsehserien<br />
behandeln. In den ersten<br />
drei Bänden geht es um „The Wire“, die<br />
„Sopranos“ und „The West Wing“. Fernsehabende<br />
mit Fußnoten sozusagen. Ein<br />
Brückenschlag zwischen Entertainment<br />
und Intelligenz. Ein schöner, in Deutschland<br />
ganz unüblicher Gedanke. Ist friedliche<br />
Koexistenz zwischen Fernsehen und<br />
Klugheit möglich? Der Verlag sagt Ja und<br />
schlägt zur Bekräftigung drei Mal zart mit<br />
dem Schuh aufs Rednerpult.<br />
Simon Rothöhler gelingt der schönste<br />
Band. (Simon Rothöhler: „The West<br />
Wing“; Diaphanes, Berlin 2012; 96 Seiten,<br />
10 Euro.) Er schreibt allerdings auch über<br />
die schwächste, angreifbarste Serie, was<br />
ihm eine kritische Distanz erlaubt, aus<br />
der sich Funken schlagen lassen. Diedrich<br />
Diederichsens Zugang ist von fast<br />
schon altmeisterlicher Eleganz. (Diedrich<br />
Diederichsen: „The Sopranos“; Diaphanes,<br />
Berlin 2012; 112 Seiten, 10 Euro.) Und<br />
Daniel Eschkötter sieht man bei der Interpretationsarbeit<br />
am meisten schwitzen.<br />
( Daniel Eschkötter: „The Wire“; Diaphanes,<br />
Berlin 2012; 96 Seiten, 10 Euro.) Aber „The<br />
Wire“ ist auch eine Serie, über die man eher<br />
960 Seiten schreiben möchte als 96.<br />
Manchmal kommen die Herren ins gemütliche<br />
Intellektualisieren, machen in Jargon<br />
und erinnern uns daran, dass man Intelligenz<br />
leider auch in Form eines höheren<br />
Fußballfanclubs für ältere Jungs organisieren<br />
kann. Und manchmal sitzen sie auch<br />
einfach nur auf dem Sofa und kratzen sich<br />
den Barthes. Aber wirklich nur manchmal<br />
und vergleichsweise selten. (Apropos Roland<br />
Barthes: Die „Mythen des Alltags“<br />
aus den fünfziger Jahren, bahnbrechend für<br />
den geisteswissenschaftlichen Allinterpretationsanspruch<br />
und auf Deutsch lange nicht<br />
vollständig zu haben, gibt es jetzt auch als<br />
Taschenbuch im Suhrkamp-Verlag. Mit<br />
34 Bonusmythen! Muss man lesen.)<br />
Meistens funkeln diese drei Bände<br />
und bringen einen auf verbotene Gedanken:<br />
Wie wäre es, wenn diese Art von Intellektualität<br />
in Deutschland ganz selbstverständlich<br />
wäre? Wenn sich niemand<br />
mehr dafür schämen müsste, dass er oder<br />
sie Michel Foucault zitiert? Wenn man in<br />
Deutschland klug sein dürfte, ohne sich<br />
ständig dafür entschuldigen zu müssen?<br />
Und wenn irgendwann auch Frauen Diaphanes-Booklets<br />
schreiben dürften?<br />
Ach, eher wird Angela Merkel das Spardiktat<br />
für Europa aufheben, und das<br />
wird niemals geschehen. Seltsam, dass in<br />
Deutschland so viele Menschen Geisteswissenschaften<br />
studieren und dann brav<br />
die eigene Marginalisierung hinnehmen.<br />
Der Intellektualität fehlt bei uns<br />
das Selbstbewusstsein. Gibt es intelligentes<br />
Leben in Deutschland? Lassen die<br />
Strukturen es zu? Mit dieser Frage schalten<br />
wir wieder um zu Florian Silber eisen<br />
und Slavoj Žižek.<br />
Robin Detje<br />
lebt als Autor und Übersetzer<br />
in Berlin<br />
Anzeige<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Jetzt gratis<br />
testen<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst<br />
und Leben, den internationalen<br />
Kunstbetrieb wider. Herausragende<br />
Porträts und Ausstellungsrezensionen,<br />
spannende Debatten und Neuigkeiten<br />
aus der Kunstwelt, alles in einer unverwechselbaren<br />
Optik.<br />
Telefon +49 1805 47 40 47*<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 864568<br />
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 125
| S a l o n | K ü c h e n k a b i n e t t<br />
Minestrone mit<br />
Mariahilf<br />
Geschmacksverstärker haben einen schlechten<br />
Ruf, aber das hindert niemanden daran, sie<br />
großzügig einzusetzen. Wie das Doping im<br />
Spitzensport ist ihr Einsatz das Ergebnis<br />
unseres eigenen, willentlichen Selbstbetrugs<br />
Von Thomas Platt und Julius Grützke<br />
D<br />
er Sommer ist die <strong>Zeit</strong> der Enttäuschungen. Nicht nur<br />
das Wetter fällt uns regelmäßig in den Rücken, sondern<br />
auch bei großen Sportereignissen müssen die Fans erkennen,<br />
dass ihre Lieblinge das in sie gesetzte Vertrauen nicht erfüllen.<br />
Schlimmstenfalls werden diese sogar wegen Dopings disqualifiziert.<br />
Nicht wenige Sportarten sind wegen solcher Vergehen in<br />
Verruf geraten und stehen inzwischen in noch schlechterem Ansehen<br />
als die Parteien. Doch wie in der Politik liegen die Ursachen<br />
für die Lügen und die falschen Versprechungen in den hochgesteckten<br />
Erwartungen des Publikums.<br />
Unmögliches zu verlangen und sich später darüber zu erregen,<br />
dass es nur mit Schwindelei erreicht werden konnte, ist eine<br />
Form von Selbstbetrug, die nicht nur die Renten- und die Dopingdiskussion<br />
bestimmt. Auch bei den Lebensmitteln lügt man<br />
sich in die Einkaufstasche. Der massenhafte Wunsch nach einem<br />
billigen Wein, der schmeckt wie eine Trockenbeerenauslese, lässt<br />
sich nun einmal nur mit Frostschutzmittel befriedigen. Es wäre<br />
auch naiv anzunehmen, der erbitterte Preiskampf der Dönerbuden<br />
könnte ohne Gammelfleisch geführt werden. Und wenn man mal<br />
genauer auf die wundersame Vermehrung der Discounter-Bioprodukte<br />
schaut, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass<br />
am Horizont schon der nächste Skandal wartet.<br />
Es geht aber nicht bloß darum, die Massen zu versorgen, sondern<br />
auch um den Rekord. Wie Olympioniken, die die Grenzen<br />
des physischen Leistungsvermögens überreizen, versuchen<br />
auch Spitzenköche die aromatischen Möglichkeiten ihrer Zutaten<br />
zu vertiefen. Dabei verfügen sie über zahlreiche Hilfsmittel<br />
und Kniffe – erlaubte wie verpönte. Allein das Erhitzen auf dem<br />
Herd ist ein Akt der Denaturierung. Von einigen neuartigen Techniken,<br />
zum Beispiel jenen der Molekularküche, ganz zu schweigen.<br />
Aber auch sie werden akzeptiert.<br />
Anders verhält es sich mit den Mitteln, die man als das Doping<br />
der Küche bezeichnen könnte. Geschmacksverstärker haben<br />
einen schlechten Ruf, aber das hindert niemanden daran, sie<br />
großzügig einzusetzen. Fast in jedem Fertiggericht tut Mononatriumglutamat<br />
seine Wirkung. Wenn allerdings ein Spitzenkoch<br />
sich zu seiner Verwendung bekennt und es nicht heimlich seinen<br />
Speisen beifügt wie seine Kollegen, die es beschönigend als<br />
„Mariahilf“ bezeichnen, wird er verfemt und geht seiner Sterne<br />
verlustig. Niemand scheint genau wissen zu wollen, wie der intensive<br />
Geschmack zustande kommt. Deshalb wird das Glutamat<br />
auf Lebensmittelpackungen kaum mehr deklariert, sondern<br />
erscheint allenfalls als „Hefeextrakt“. Man will die argwöhnischen<br />
Konsumenten nicht durch einen belasteten Begriff vom<br />
Kauf abhalten.<br />
Dabei ist die auf dem Index gelandete Chemikalie geradezu<br />
ein Baustein unserer Ernährung und seiner Geschmackserlebnisse.<br />
Tomaten und Pilze sind vielleicht deshalb als Zutat und<br />
Würzmittel so beliebt, weil sie viel Glutamat enthalten. Noch<br />
konzentrierter findet sich der Stoff im Parmesan – da wundert<br />
es nicht, dass die Italiener ihre fade Minestrone und so manchen<br />
Pastateller mit dem Hartkäse beraspeln. Aber auch jeder<br />
Saucenfonds findet seinen Sinn darin, natürliches Glutamat zu<br />
konzentrieren, nicht viel anders als die Sojasauce. Gegen diese<br />
alten Kulturtechniken aromatischer Vertiefung wendet niemand<br />
etwas ein. Wenn der hilfreiche Stoff aber nicht aus dem Kochvorgang<br />
selbst stammt, sondern in der Fabrik synthetisiert wurde,<br />
wirkt es, als sei eine unzulässige Abkürzung genommen worden –<br />
ganz wie ein Radrennfahrer, der mit Epo die Ergebnisse eines<br />
Höhentrainings potenziert, um Pyrenäengipfel in übermenschlicher<br />
Geschwindigkeit zu erklimmen.<br />
Genau wie im Sport entfaltet letztlich auch das Doping in der<br />
Küche eine fatale Wirkung. Der herzhafte Geschmack, den das<br />
Glutamatsalz auf die Spitze treibt, überstrahlt alle anderen Nuancen<br />
der Zubereitung und gewöhnt den Gaumen an eine Übertreibung.<br />
Von dieser Illusion einer Intensität zu lassen, fällt schwer – die<br />
Sinne stumpfen ab und lassen sich über eine fade Realität hinwegtäuschen,<br />
in der authentische Aromen nicht für alle zu haben sind.<br />
So wird Glutamat zum neuen Opium fürs Volk, ein Stoff, der den<br />
Menschen eine trostlose Situation schmackhaft macht.<br />
Julius Grützke und Thomas Platt<br />
sind Autoren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in Berlin<br />
illustration: Thomas Kuhlenbeck/Jutta Fricke Illustrators; Foto: Antje Berghäuser<br />
126 <strong>Cicero</strong> 8.2012
Unser Wein des Monats<br />
<strong>Cicero</strong> empfiehlt: Champagne Gosset Brut Excellence<br />
Champagner je Flasche für 32,90 Euro<br />
(zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 Euro)<br />
Gosset ist das älteste im Familienbesitz befindliche<br />
Champagnerhaus. Der Champagner Brut Excellence<br />
hat eine hellgoldene Farbe und ein lebhaftes<br />
Perlenspiel. In der Nase ist er intensiv, frisch und<br />
fruchtig. Am Gaumen sind Aromen von Birne, reifem<br />
Steinobst und Rebstockblüten mit leichtem Pinot<br />
Noir-Einschlag erkennbar.<br />
Jetzt direkt bestellen (Bestellnr.: 886295)<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg<br />
Telefon: 0800 282 20 04, E-Mail: shop@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/wein<br />
Gewinnen Sie 10 x 1 Flasche Gosset Brut Excellence<br />
Stoßen Sie auf die 100. <strong>Cicero</strong>-Ausgabe mit einer Magnum-Flasche<br />
Gosset Brut Excellence an.<br />
Gleich mitmachen und gewinnen:<br />
Mark Siegmann<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: 100@cicero.de<br />
www.cicero.de/100
128 <strong>Cicero</strong> 8.2012
D i e l e t z t e n 2 4 S t u n d e n | S a l o n |<br />
Mit einem Lächeln<br />
Warum der Fotograf und Filmemacher Yann Arthus‐Bertrand<br />
alles, was er besitzt, verschenken wird<br />
Foto: Michael von Aulock<br />
M<br />
ein nächster Film wird davon<br />
handeln, was es heute heißt, ein<br />
Mensch zu sein. Ein Mensch<br />
zu sein heutzutage, bedeutet, dass man<br />
von Umweltzerstörung und Klimawandel<br />
weiß, von der Wirtschaftskrise und<br />
von der Armut in der Dritten Welt. Und<br />
man weiß auch, dass man Teil des Ganzen<br />
ist, dass man diese Dinge unterstützt,<br />
auch wenn man es nicht will. Ein<br />
Mensch zu sein, bedeutet aber auch, dass<br />
man seiner Familie gegenübertritt und<br />
seinem eigenen Tod ins Angesicht schaut.<br />
Kürzlich starb eine meiner engsten<br />
Freundinnen. Und sie tat das mit einem<br />
Lächeln auf den Lippen. Sie musste sich<br />
keine Sorgen über Dinge machen, die<br />
sie versäumt hatte. Sie hatte ein erfülltes,<br />
glückliches Leben. Sie war viel gereist,<br />
hatte immer versucht, ein guter Mensch<br />
zu sein, sie wurde geliebt. Das zu beobachten,<br />
war wunderschön.<br />
Wenn ich nur noch 24 Stunden zu leben<br />
hätte, würde ich also versuchen, der<br />
bestmögliche Mensch zu sein. Grundsätzlich<br />
sind wir nicht besonders gut, meistens<br />
denken wir nur an uns selbst. Ich<br />
werde mich nicht beschweren, sondern<br />
versuchen, mich meinem Schicksal zu ergeben.<br />
Wenn du selbst stirbst, ist das viel<br />
weniger dramatisch, als wenn deine Frau<br />
stirbt oder eines deiner Kinder.<br />
Vor nicht allzu langer <strong>Zeit</strong>, bei Dreharbeiten<br />
in New Orleans, hatte ich einen<br />
Hubschrauberunfall. Plötzlich befanden<br />
Mit atemberaubenden<br />
Luftbildaufnahmen und Filmen,<br />
die die Zerstörung der Erde<br />
dokumentieren, ist der Pariser<br />
Fotograf und Umweltaktivist Yann<br />
Arthus-Bertrand, Jahrgang<br />
1946, weltbekannt geworden. Im<br />
Herbst erscheint sein neuester,<br />
so schöner wie erschreckender<br />
Film „Planet Ocean“, der sich mit<br />
dem beginnenden Kollaps der<br />
Weltmeere auseinandersetzt<br />
wir uns im Sinkflug. Der Pilot und ich<br />
versuchten erst, den Absturz aufzuhalten,<br />
und dann, dem Helikopter zu entkommen.<br />
Beides war nicht möglich. Hubschrauber<br />
sind sehr gefährlich, man hat<br />
viele Unfälle mit ihnen. Deswegen ist es<br />
auch so unglaublich teuer, sie versichern<br />
zu lassen. Ich war mir sicher, dass ich<br />
sterben würde.<br />
Wir hatten unglaubliches Glück, als<br />
der Helikopter zu Boden stürzte. Wir kamen<br />
beide mit dem Leben davon, was an<br />
ein Wunder grenzte. Das Glück, das man<br />
in einem solchen Moment empfindet, ist<br />
schwer zu beschreiben. Die Rettungssanitäter<br />
kamen, und man steckte uns in ein<br />
Krankenhaus. Ich war so glücklich, dass<br />
ich mich fühlte, als sei ich betrunken. Ich<br />
wollte nur zwei Dinge tun: meine Frau<br />
anrufen und ein Glas Wein trinken. Ich<br />
fragte die Krankenschwestern so lange<br />
nach dem Wein, dass sie mir irgendwann<br />
entnervt ein paar Schlafmittel gaben,<br />
um mich ruhig zu stellen. Der Wein<br />
bedeutete Freundschaft für mich – mein<br />
Land, das Terroir, der Boden, von dem<br />
ich stamme. Ich wollte trinken wie ein<br />
Betrunkener. Ich habe diesen Moment<br />
nie vergessen. Das Wissen, dass man im<br />
Begriff ist zu sterben, löst ein unglaublich<br />
starkes Gefühl aus.<br />
An meinem letzten, dem perfekten<br />
Tag werde ich alles, was ich besitze, verschenken.<br />
Ich werde mit meinen Freunden<br />
und mit meiner Familie sprechen,<br />
mit meinen Eltern, meiner Frau und<br />
meinen Kindern, und versuchen, Wiedergutmachung<br />
zu leisten für die Sachen,<br />
die ich falsch gemacht habe. Ich werde<br />
ihnen sagen, dass ich sie liebe. Wir sind<br />
alle so ehrgeizig und versuchen, so viel zu<br />
erreichen, aber ich glaube, dass am Ende<br />
geliebt zu werden alles ist, was wir wollen.<br />
Um einen solchen letzten Tag zu leben,<br />
muss man den Tod akzeptieren. Er<br />
ist eines der Dinge, die man am schwersten<br />
akzeptieren kann. Aber es ist normal<br />
zu sterben. Jeder von uns muss es. Der<br />
Tod ist der wahrscheinlich wichtigste Teil<br />
unseres Lebens. Auch ich möchte mit einem<br />
Lächeln auf den Lippen sterben. Ich<br />
möchte sagen können: Au revoir, c’est<br />
fini, j’ai bien vécu. Ich habe alles getan,<br />
was ich konnte.<br />
8.2012 <strong>Cicero</strong> 129
C i c e r o | P o s t S c r i p t u m<br />
Vorbild Athen<br />
Von Alexander Marguier<br />
D<br />
ie deutschen hatten schon immer ein ambivalentes<br />
Verhältnis zur Freiheit, zur freien Marktwirtschaft erst<br />
recht. Amerikaner dagegen lassen sich in ihrem Vertrauen<br />
auf die segensreiche Wirkung des Kapitalismus für ihr<br />
individuelles Streben nach Glück so schnell durch nichts erschüttern.<br />
So lautet jedenfalls die fromme Legende über die angeblichen<br />
Mentalitätsunterschiede zwischen Alter und Neuer<br />
Welt. Und sie wird immer noch gern erzählt – insbesondere von<br />
jenen, die den deutschen Sozialstaat mit seinen vermeintlich<br />
überbordenden Umverteilungsmechanismen und seiner schier<br />
unersättlichen Gier nach Steuereinnahmen als geradezu gesellschaftszersetzend,<br />
weil leistungsfeindlich brandmarken wollen.<br />
Die jüngst veröffentlichte Studie des „Pew Research Center“<br />
(wohlgemerkt handelt es sich bei diesem nach einem amerikanischen<br />
Ölbaron benannten Forschungsinstitut um keine sozialistische<br />
Vorfeldorganisation) zeichnet allerdings ein ganz anderes<br />
Bild. Demzufolge glauben immerhin 69 Prozent der Deutschen,<br />
dass freie Märkte am besten für das Wohlergehen der<br />
Menschen sorgen. In den Vereinigten Staaten sind es indes nur<br />
noch 67 Prozent, Tendenz seit Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
vor vier Jahren stetig sinkend. Und während die<br />
Musterschüler des Kapitalismus offenbar von einer Sinnkrise erfasst<br />
sind, profiliert sich ausgerechnet die Bevölkerung des kommunistisch<br />
regierten China mit einer Zustimmungsquote von<br />
74 Prozent als neue Avantgarde der freien Marktwirtschaft.<br />
Verkehrte Welt? Ganz im Gegenteil. Die Abnutzungserscheinungen<br />
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in ihrem angloamerikanischen<br />
Stammesgebiet – in Großbritannien sprachen<br />
sich sogar nur 61 Prozent der Befragten für sie aus – folgen einem<br />
Muster, das bis in die Antike zurückreicht. Plutarch etwa<br />
hatte über das Athen des Jahres 594 v. Chr. Folgendes zu berichten:<br />
„Da nun damals die Ungleichheit zwischen Arm und Reich<br />
gleichsam den Gipfel erreichte, so befand sich die Stadt in einer<br />
höchst kritischen Lage, und es sah so aus, als ob sie allein<br />
durch Errichten einer Tyrannis würde aus den Wirren heraus<br />
zur Ruhe kommen können.“ Tatsächlich, so schreibt das amerikanische<br />
Historikerpaar Will und Ariel Durant in seinem 1968<br />
erschienenen Buch „The Lessons of History“, sei schon bei den<br />
alten Griechen die Schere zwischen Vermögenden und Habenichtsen<br />
immer weiter auseinandergegangen: „Die Armen (…)<br />
begannen von gewaltsamer Auflehnung zu sprechen. Die Reichen,<br />
die um ihren Besitz zitterten, beschlossen, sich mit Waffengewalt<br />
zu verteidigen.“ Schließlich habe aber die Vernunft<br />
gesiegt, als gemäßigte Gruppen die Wahl Solons, eines Geschäftsmanns<br />
von aristokratischer Herkunft, zum obersten Regierungsbeamten<br />
durchsetzten.<br />
Und was tat Solon als rechtschaffener antiker Technokrat?<br />
Er senkte den Münzfuß (was man heute mit „Inflation“ übersetzen<br />
würde) und gab damit armen Schuldnern die Möglichkeit,<br />
einen Teil ihrer Schulden abzuschütteln; er schaffte die Verzugszinsen<br />
für Steuern und Grundpfandschulden ab und führte<br />
ein neues, gestaffeltes Besteuerungsverfahren ein, aufgrund dessen<br />
die Reichen das Zwölffache der von den Armen geforderten<br />
Steuern zu zahlen hatten. Nicht zuletzt startete er eine Bildungsoffensive,<br />
indem er dafür sorgte, dass die Söhne von Bürgern,<br />
die im Krieg für Athen gefallen waren, auf Staatskosten erzogen<br />
und geschult wurden. Dass das alles nicht reibungslos verlief,<br />
kann man sich denken: „Die Reichen jammerten über die hohen<br />
Steuern, die Radikalen schalten ihn, weil er den Grundbesitz<br />
nicht neu verteilt hatte“, so Will und Ariel Durant in „The<br />
Lessons of History“. Aber „innerhalb einer Generation waren<br />
sich fast alle einig, dass Solons Reformen Athen vor einem gewaltsamen<br />
Umsturz bewahrt hatten“.<br />
Als Rom gut 300 Jahre später in eine ähnliche systemische<br />
Schieflage geriet, konnte sich der Senat übrigens zu keinen Zugeständnissen<br />
nach athenischem Vorbild durchringen. Es folgten<br />
100 Jahre Bürgerkrieg und Klassenkampf.<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretender Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Illustration: Christoph Abbrederis; Foto: Andrej Dallmann<br />
130 <strong>Cicero</strong> 8.2012
MEHR SPRINT,<br />
WENIGER SPRIT.<br />
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Spaß und Sparsamkeit.<br />
Im neuen Yaris Hybrid. Jetzt bei Ihrem Toyota Partner.<br />
Kraftstoffverbrauch Yaris Hybrid kombiniert/außerorts/innerorts 3,7–3,5/3,7–3,5/<br />
3,4–3,1 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 85–79 g/km (nach EU-Messverfahren).<br />
Abb. zeigt Yaris Hybrid mit Sonderausstattung. hybrid-sommer.de