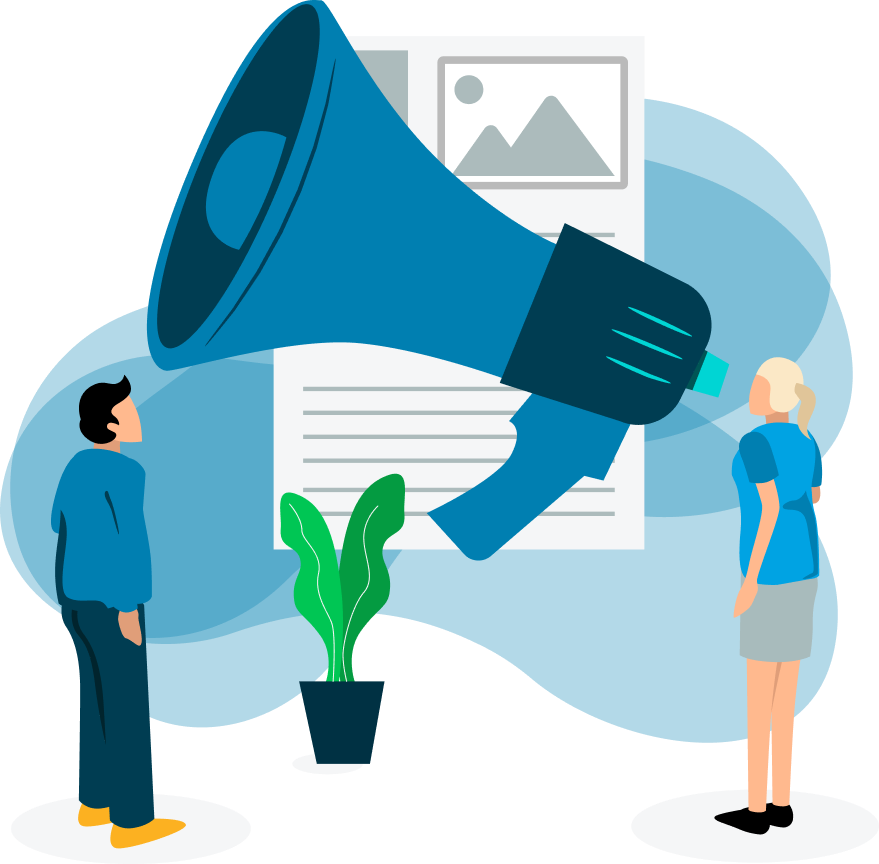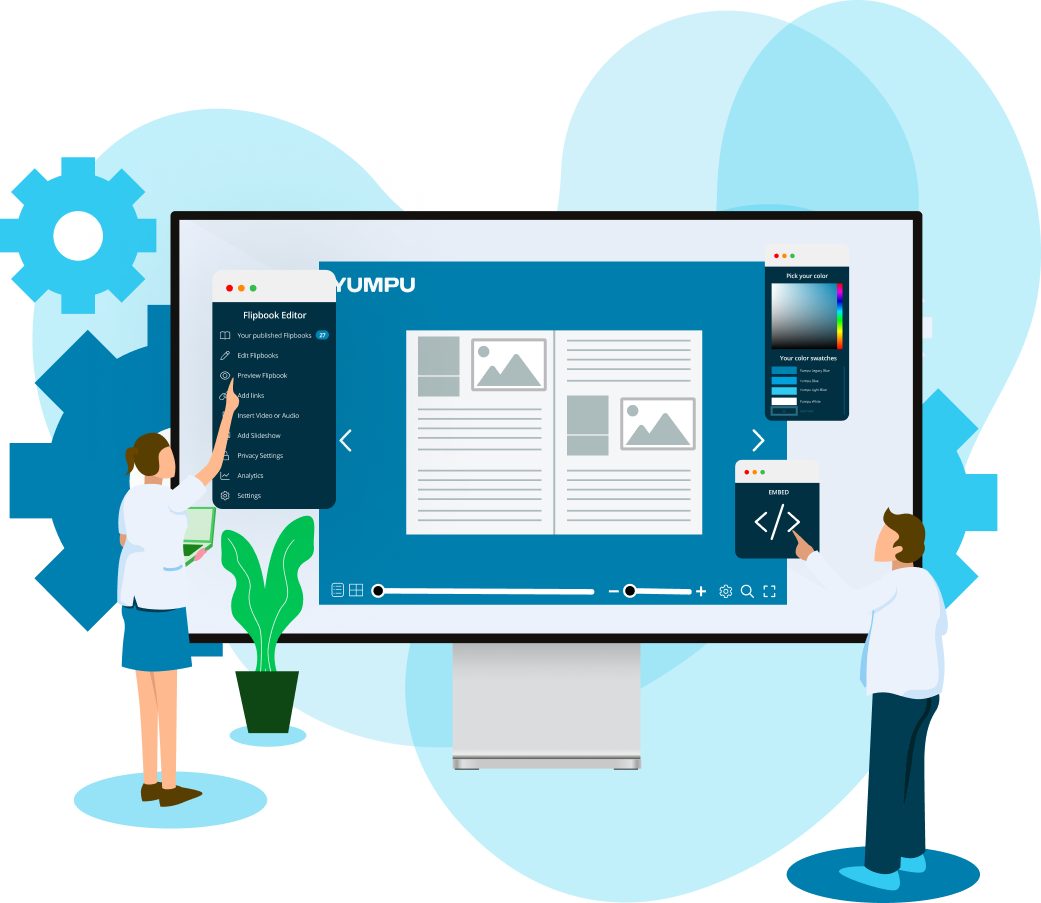Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.cicero.de<br />
<strong>Babel</strong> <strong>Berlin</strong><br />
Nichts klappt, alle lieben sie:<br />
Das Geheimnis unserer<br />
verschlunzten Hauptstadt<br />
„Sexy ist ein<br />
Lebensgefühl“<br />
Ein Gespräch mit<br />
Klaus Wowereit<br />
Bayreuth bröselt<br />
Im Wagner‐Jahr blamieren<br />
sich die Festspiele<br />
Prinzip Protestpartei<br />
Welche Chancen hat die<br />
„Alternative für Deutschland“?
Warum sind<br />
nationen<br />
reich oder arm?<br />
Über den Erfolg oder das Scheitern von Nationen wird viel<br />
geschrieben. Manche behaupten, dass die Geographie der<br />
entscheidende Faktor sei, andere betonen kulturelle Faktoren:<br />
Bestimmte Werte und Verhaltensweisen, beispielsweise (…)<br />
das nordische oder deutsche Arbeitsethos, seien hilfreich für<br />
die Wirtschaftsentwicklung, während südeuropäische oder<br />
afrikanische Einstellungen eher ein Hindernis bildeten. Noch<br />
andere sehen die Ursache bei einer aufgeklärten oder unaufgeklärten<br />
politischen Führung. (…) Im vorliegenden Buch wird<br />
ein anderer Ansatz zur Untersuchung der Ursachen des Erfolgs<br />
und des Scheiterns von Nationen vertreten. Unserer Meinung<br />
nach sind es die von den Staaten gewählten Regeln – oder<br />
Institutionen – , die darüber bestimmen, ob sie wirtschaftlich<br />
erfolgreich sind oder nicht. Das Wirtschaftswachstum wird<br />
von Innovationen sowie vom technologischen und organisatorischen<br />
Wandel angetrieben, die sich den Ideen, den Begabungen,<br />
der Kreativität und der Energie von Individuen verdanken.<br />
Aber dazu bedarf es entsprechender Anreize. Zudem sind<br />
Fähigkeiten und Ideen breit über die Gesellschaft verstreut,<br />
weshalb ein Staat, der große Teile der Bevölkerung benachteiligt,<br />
kaum das vorhandene Innovationspotential nutzen und<br />
vom wirtschaftlichen Wandel profitieren dürfte. All das legt<br />
eine einfache Schlussfolgerung nahe: Den Schlüssel zu nachhaltigem<br />
wirtschaftlichen Erfolg findet man im Aufbau einer<br />
Reihe von Wirtschaftsinstitutionen, welche die Talente und<br />
Ideen der Bürger eines Staates nutzbar machen können, indem<br />
sie geeignete Anreize und Gelegenheiten bieten, dazu gesicherte<br />
Eigentums- und Vertragsrechte, eine<br />
funktionierende Justiz sowie einen<br />
freien Wettbewerb, so dass sich die<br />
Bevölkerungsmehrheit produktiv<br />
am Wirtschaftsleben beteiligen kann.<br />
Lesen Sie weiter…<br />
Daron Acemoglu / James A. Robinson<br />
Warum Nationen scheitern<br />
608 Seiten, gebunden<br />
€ (D) 24,99
In Bestform.<br />
Die neue E-Klasse. Jetzt Probe fahren.<br />
Hohe Erwartungen – für Sie übertroffen. Lassen Sie sich von der sportlichsten E-Klasse<br />
aller Zeiten überraschen. Mit einem auffallend dynamischen Design, das perfekt auf die<br />
kompromisslose Fahrleistung abgestimmt ist. www.mercedes-benz.com/e-klasse<br />
Eine Marke der Daimler AG<br />
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 13,1–4,1/7,4–4,0/9,5–4,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 222–107<br />
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen<br />
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
g/km; Effizienzklasse: E–A+.<br />
Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
LeagasDelaney.de<br />
GROSSE UHREN<br />
FINDEN SIE IN IHREM<br />
LONDON-REISEFÜHRER.<br />
GROSSARTIGE BEI UNS.<br />
Eine unvergessliche Zeit in London, 43–44 New Bond Street<br />
In Paris, Madrid, Wien, New York, PEKING, London<br />
und an den besten Adressen Deutschlands. www.wempe.de<br />
WEMPE CHRONOMETERWERKE GLASHÜTTE I /SA in 18k Gold mit Handaufzugswerk.<br />
4 <strong>Cicero</strong> 5.2013<br />
Deutscher Chronometer. € 8.450. Gerhard D. Wempe KG, Steinstraße 23, 20095 Hamburg
C i c e r o | A t t i c u s<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 25. April 2013<br />
Thema: <strong>Berlin</strong><br />
Magische Hauptstadt<br />
abc-Job#: 528822 · Kunde: Wempe · Motiv: NY1 London 2 Tonneau (April 2013) · Adresszeile: keine · Format: 210 x 287 + 3 mm · Farbe: CMYB<br />
abc-opix#: 1303-075 · Titel: <strong>Cicero</strong> - Ausgabe 5/2013 · DU: 09.04.2013 · ET: 25.04.2013 · Das Dokument ist ohne Überfüllung/Trapping angelegt, Titelbild: vor weiterer Rolf Verarbeitung Ohst; Illustration: diese anlegen!<br />
Christoph Abbrederis<br />
D<br />
er Song macht gute Laune. „<strong>Berlin</strong> – du bist so wunderbar – <strong>Berlin</strong>!“ singen<br />
tiefenentspannte Menschen zu einem Ska-Rhythmus, und alle sind eins in dieser<br />
Ansicht: der Polizist, das Partygirl, der Straßenfeger. Der Werbespot einer Brauerei<br />
läuft seit bald zehn Jahren in den Kinos der Hauptstadt. Trink dieses Hauptstadtbier, und<br />
du bist wie diese Menschen hier, das ist die Botschaft: Sei lässig, sei <strong>Berlin</strong>.<br />
Die Frage ist: Wann geht lässig in fahrlässig über? Im Augenblick macht sich die deutsche<br />
Hauptstadt weltweit lächerlich. Ein Bauherr kann sich darauf berufen, in das letzte große<br />
Stück zusammenhängender Mauer, die East Side Gallery, behördlich genehmigt Löcher zu<br />
reißen. Für dieses Stück betonierte Geschichte mit ihren Graffiti reisen die Touristen aus<br />
der ganzen Welt an. Viele landen auf dem liebenswerten Flughafen Tegel, denn der neue<br />
Großflughafen – eine weitere Chiffre für das <strong>Berlin</strong>er Chaos – wird nicht fertig. Über allem<br />
Gewurstel und Geschlunze schwebt ein Bürgermeister, als hätte er damit nichts zu schaffen.<br />
Läuft ja auch so weit alles, nicht zuletzt, weil Länder wie Bayern, Baden-Württemberg und<br />
Hessen die Sause ohne Pause über den Länderfinanzausgleich bezahlen. Bist du wirklich so<br />
wunderbar, <strong>Berlin</strong>? Oder die Folge davon, dass hier Rosinenbombermentalität West und<br />
Alimentationsgewohnheit Ost aufeinandergetroffen sind?<br />
<strong>Berlin</strong> ist lustvoll und liederlich zugleich. Die Deutschen schimpfen auf ihre Hauptstadt<br />
und fahren doch begeistert hin. <strong>Berlin</strong> bricht laufend seine eigenen Besucherrekorde. Vielen<br />
reicht die Stippvisite nicht. 40 000 Menschen ziehen jedes Jahr an die Spree, hippe Start-ups<br />
siedeln sich an, weil ihre jungen Spitzenkräfte hier leben wollen, wie Marcus Pfeil beschreibt<br />
(ab Seite 32).<br />
Vorhang also auf für das magische <strong>Berlin</strong>, dessen Frivolität der Künstler Rolf Ohst für<br />
das <strong>Cicero</strong>-Cover in Öl gemalt hat. Alexander Marguier hat sich an Orte und zu Menschen<br />
in dieser Stadt begeben, um ihren zwiespältigen Zauber zu ergründen (ab Seite 16).<br />
Herausgekommen ist ein Kaleidoskop der Kontraste, ein Mosaik der Momente. Ich würde<br />
Ihnen empfehlen, zur Lektüre seines Textes die eigens für <strong>Cicero</strong> komponierte CD „Sinfonie<br />
einer Hauptstadt“ einzulegen und so eine sinnliche Dimension mehr zu haben, diese<br />
widersprüchliche Stadt zu erfassen. Der <strong>Berlin</strong>er Jazzer und Komponist Volker Schlott hat<br />
für <strong>Cicero</strong> ein Hörbild der deutschen Hauptstadt und ihrer Klänge geschaffen. Es ist der<br />
Soundtrack einer Stadt der Widersprüche. Die CD liegt einem Teil der Auflage bei, kann<br />
von Abonnenten kostenlos, ansonsten für 8,90 Euro bestellt werden.<br />
Klaus Wowereit, der „Regierende“, wie man in <strong>Berlin</strong> sagt, stellt sich dem Vorwurf, die<br />
schlunzigste Stadt der Welt zu repräsentieren. Irgendwelche Gewissensbisse, Herr Wowereit?<br />
(ab Seite 26). Iwo. „<strong>Berlin</strong> wird gezielt schlechtgeredet“, sagt der Regierende.<br />
Na dann: Weiterfeiern!<br />
Mit besten Grüßen<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
das Herz ausgeschüttet<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 5
C i c e r o | I n h a l t<br />
Titelthema<br />
16<br />
Boom, Boom, <strong>Berlin</strong><br />
Die Durcheinanderstadt begreifen. Eine Reportage<br />
von Buschkowsky bis in den Pärchenclub<br />
von Alexander Marguier<br />
26<br />
„<strong>Berlin</strong> wird gezielt schlechtgeredet“<br />
Klaus Wowereit erklärt sich. Ein Interview über<br />
Pannen, Partys, Schulden und die Sexyness der Stadt<br />
von Georg Löwisch und Alexander Marguier<br />
20<br />
<strong>Berlin</strong> in Zahlen<br />
Günstige Kitas, Milliarden aus Bayern, nur<br />
16 Michelin‐Sterne: Die wichtigsten Kennziffern der Stadt<br />
von Til Knipper<br />
32<br />
<strong>Berlin</strong>s neuer Mittelstand<br />
Finanzstarke Investoren sind in der Hauptstadt selten.<br />
Was lockt die Internetbranche trotzdem an?<br />
von Marcus Pfeil<br />
Fotos. Antje Berghäuser, tanja Raeck<br />
6 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Die schönsten<br />
Momente teilen<br />
Zusammen fliegen lohnt sich – mit den Begleitertarifen für<br />
First Class und Business Class. Begrüßen Sie ausgezeichneten<br />
Service, preisgekrönte Unterhaltung und feinste Gourmet-<br />
Menüs: jetzt schon ab 2.195 Euro pro Person.<br />
Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Weitere Informationen auf emirates.de, in Ihrem Reisebüro* oder telefonisch unter 069 945192000.<br />
*Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.
C i c e r o | I n h a l t<br />
36 Politik für Teenager<br />
64 Das Königreich und die EU 80<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE kapital<br />
36 | Meinung, Zack, Zack<br />
Florian Mundt alias LeFloid ist der<br />
Leitartikler der Generation Youtube<br />
Von Klaus Raab<br />
38 | Guerilla im Tweed<br />
Beatrix von Storch, einflussreiche Alliierte<br />
der „Alternative für Deutschland“<br />
Von Constantin Magnis<br />
40 | Feind wird Freund<br />
Die CDU-Kontrahenten Matthias Zimmer<br />
und Christean Wagner verbünden sich<br />
Von Volker Resing<br />
44 | Die Politpilze<br />
Der Lebenszyklus von Protestparteien<br />
Von Christoph Seils<br />
46 | Mein SChüler<br />
Sigmar Gabriels Lehrer erzählt<br />
Von Constantin Magnis<br />
48 | Fleischfan im Veganerclub<br />
Steinbrücks Scheitern zeigt den Siegeszug<br />
des Protestantischen in der Politik<br />
Von Christine Eichel<br />
50 | Frau Fried fragt sich<br />
...ob Frauen zu faul für Führungsjobs sind<br />
Von Amelie Fried<br />
52 | Mein Wunschkabinett<br />
<strong>Cicero</strong>-Wahlserie: Warum Iris Berben<br />
und Paul Kirchhof ministrabel sind<br />
Von Monika Maron<br />
54 | Man ist Mensch, wenn<br />
man mit Menschen ist<br />
Das Netz boomt. Aber auch der Drang<br />
nach Begegnung und Besprechung<br />
Von Frank A. Meyer<br />
56 | Seelöwe im PolitZirkus<br />
David Axelrod wechselt vom<br />
Weißen Haus zum Fernsehen<br />
Von Christoph von Marschall<br />
58 | Kampferprobte Reporterin<br />
Le Monde hat in Natalie Nougayrède<br />
erstmals eine Chefredakteurin<br />
Von Sascha Lehnartz<br />
60 | „Manchmal muss man<br />
den Bauch aufschneiden“<br />
Amadou Haya Sanogo, Malis<br />
oberster Militär, im Interview<br />
Von Martin Specht<br />
64 | Ein bisschen Europa<br />
darf’s schon sein<br />
Während Griechenland und Zypern<br />
straucheln, streitet London über die EU<br />
Von sebastian Borger<br />
70 | Opiate sind keine Lösung<br />
Das Oberhaupt der katholischen Kirche<br />
über Kapitalismus und Kommunismus<br />
Von Papst Franziskus<br />
72 | Wie man dem Satan ein<br />
schnippchen schlägt<br />
Franziskus und Benedikt XVI.<br />
eint mehr, als sie trennt<br />
Von Alexander Kissler<br />
74 | Renaissance der Atombombe<br />
Warum so viele Staaten die<br />
Massenvernichtungswaffe haben wollen<br />
Von Karl-Heinz Kamp<br />
Herr der Dosenrepublik<br />
76 | Weniger ist Meer<br />
EU-Kommissarin Maria Damanaki<br />
kämpft gegen Überfischung<br />
Von Christian Schwägerl<br />
78 | Läckerläckerläcker<br />
Erfolg mit selbst gebastelter Werbung:<br />
Willi Pfannenschwarz und sein Müsli<br />
Von Benno Stieber<br />
80 | Scheuer roter Bulle<br />
Der Milliardär Dietrich Mateschitz<br />
kombiniert Analyse mit Bauchgefühl<br />
Von Stefan Tillmann<br />
86 | „Neue Rasterfahndung“<br />
Der Autor Rudi Klausnitzer erklärt, was<br />
unsere Datenspur über uns verrät<br />
Von Til Knipper<br />
88 | Not macht erfinderisch<br />
Unterwegs mit deutschen Rettungsärzten,<br />
die dem Mangel trotzen<br />
Von Petra Sorge<br />
Fotos: Julia Zimmermann für <strong>Cicero</strong>, Martin Parr/Magnum Photos/Agentur Focus, Sutton Images/Corbis; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
8 <strong>Cicero</strong> 5.2013
I n h a l t | C i c e r o<br />
Fotos: Danielle Levitt, Jürgen Holzenleuchter für <strong>Cicero</strong>; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
96 En vogue? Ihre Entscheidung 124<br />
Stil<br />
96 | Die Bildermacherin<br />
Vogue-Kreativchefin Grace Coddington ist<br />
die einflussreichste Stylistin der Welt<br />
Von Anne Waak<br />
Bayreuther Baufestspiele<br />
Salon<br />
118 | harmlos ist niemand<br />
Philip Seymour Hoffman spielt<br />
gerne die zweite Geige<br />
Von björn eenboom<br />
138 | Erdogans Stachel<br />
Zülfü Livaneli singt und schreibt gegen<br />
die Einschränkung der Demokratie<br />
Von Necla Kelek<br />
98 | „Eine dramatische Geste“<br />
Interview mit dem Architekten Norman<br />
Foster zum Münchner Lenbachhaus<br />
Von Ulrich Clewing<br />
100 | Warum ich trage, was ich trage<br />
Emotional aufgeladene Kleidungsstücke<br />
können Erfolg im Beruf bringen<br />
Von Andreas Rumbler<br />
102 | Die Stilhalde<br />
Fotografien eines Möbellagers, das<br />
ein gigantischer Designfundus ist<br />
Von Achim Hatzius<br />
112 | Mehr als ein Tick<br />
Wenn die Liebe zu Uhren zur Profession<br />
wird und man sich davon ein Haus kauft<br />
Von Gisbert L. Brunner<br />
116 | Küchenkabinett<br />
Spargel ist das heimliche<br />
Nationalgericht der Deutschen<br />
Von Julius Grützke und Thomas Platt<br />
120 | da stehst Du doch drauf<br />
Das Duo Joko und Klaas knüpft an<br />
eine lange Klamauk-Tradition an<br />
Von daniel haas<br />
122 | liebe, ein Pendelschlag<br />
Peter Carey verbindet in seinen<br />
Büchern Schönheit und Komik<br />
Von hannes stein<br />
124 | walhall bröselt<br />
Ausgerechnet im Wagner-Jahr 2013 ist<br />
Bayreuth eine einzige große Baustelle<br />
Von michael Stallknecht<br />
129 | Benotet<br />
Musik und Musikkritik sind<br />
allzu oft geschiedene Leute<br />
Von daniel Hope<br />
130 | Im Flammenmeer<br />
der Niedertracht<br />
Die Folgen der Bücherverbrennung<br />
von 1933 sind bis heute spürbar<br />
Von Philipp Blom<br />
132 | man sieht nur, was man sucht<br />
Xu Bing zeigt, dass Kunst die Summe<br />
aus Abfall und Abgeltung sein kann<br />
Von beat Wyss<br />
134 | Kapitale Ignoranz<br />
Antikapitalismus hat viele blinde Flecken<br />
Von ernst-wilhelm Händler<br />
140 | Bibliotheksporträt<br />
Der Essayist Karl-Markus Gauß schläft<br />
und arbeitet zwischen Büchern<br />
Von vladimir Vertlib<br />
144 | die letzten 24 Stunden<br />
Ab nach Kassel<br />
Von hubertus Meyer-Burckhardt<br />
Standards<br />
Atticus —<br />
Von Christoph Schwennicke — seite 5<br />
Stadtgespräch — seite 10<br />
Forum — seite 14<br />
Impressum — seite 28<br />
Postscriptum —<br />
Von Alexander Marguier — seite 146<br />
Die nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 23. Mai 2013<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 9
C i c e r o | S t a d t g e s p r ä c h<br />
Vom <strong>Berlin</strong>er SChwabylon hat der CSU-General keine Ahnung, Merkel<br />
wappnet sich gegen Putins Hunde, die Protestparteijugend blamiert sich, der<br />
<strong>Berlin</strong>er Gaslaternen-Streit tobt, und Uwe Vorkötter wechselt zur dunklen Seite<br />
Prenzlberg à la CSU:<br />
schwul und schwäbisch<br />
S<br />
eit Bundestagsvizepräsident<br />
Wolfgang Thierse (SPD) sich öffentlich<br />
darüber beklagte, dass<br />
die in seiner Nachbarschaft wohnenden<br />
Schwaben ein Brötchen nicht „Schrippe“,<br />
sondern „Weckle“ nennen, tobt in <strong>Berlin</strong><br />
ein kleiner Kulturkampf. Die Schwaben<br />
fühlen sich verleumdet, die Einheimischen<br />
überfremdet und Thierse missverstanden.<br />
Nun hat sich auch noch ein Bayer in den<br />
schwelenden Streit eingemischt. CSU-Generalsekretär<br />
Alexander Dobrindt vermutet<br />
in Thierses Wohnbezirk Prenzlauer Berg,<br />
wegen der dort gemessenen hohen Schwabendichte<br />
„Schwabylon“ genannt, offenbar<br />
auch noch eine Hochburg der Lesben<br />
und Schwulen: „Die Modernität einer Gesellschaft<br />
ergibt sich aus den Lebensphilosophien<br />
der Mehrheit der Menschen und<br />
nicht einer Minderheit, wie sie beispielsweise<br />
im <strong>Berlin</strong>er Szenebezirk Prenzlauer<br />
Berg zu finden ist“, sagte er, um zu begründen,<br />
warum die CSU gegen die steuerliche<br />
Gleichstellung von Hetero- und<br />
Homo-Ehen ist. Damit offenbarte er eine<br />
fast schon rührende Unkenntnis der tatsächlichen<br />
Verhältnisse. In „Prenzlberg“<br />
(Szenebegriff) schieben mit Abstand mehr<br />
junge Heteropaare Kinderwagen über den<br />
Gehsteig als in jedem anderen Stadtteil.<br />
Homosexuelle sind dort allem Anschein<br />
nach eher eine Rarität. Dobrindts homophobes<br />
Geschwafel wird deshalb in Regierungskreisen<br />
eher belächelt. Der Mann<br />
habe offenbar keine Ahnung, sagt Angela<br />
Merkels zweiter Regierungssprecher Georg<br />
Streiter, der selbst in Prenzlauer Berg<br />
wohnt. „Wenn man sich in diesem Stadtteil<br />
ohne Kinderwagen und ohne Babybauch<br />
bewegt, fühlt man sich ganz fremd.“ tz<br />
Die Merkel-dogtrin<br />
keine Köter im Kreml<br />
W<br />
enn Ulrich Brandenburg, der<br />
deutsche Botschafter in Moskau,<br />
ein Treffen von Bundeskanzlerin<br />
Angela Merkel mit dem russischen<br />
Präsidenten Wladimir Putin vorbereitet,<br />
muss er stets auf einem – sonst im diplomatischen<br />
Verkehr eher unüblichen – Protokollvermerk<br />
bestehen: Hunde sind absolut<br />
unerwünscht und deshalb unter allen<br />
Umständen fernzuhalten.<br />
Denn Merkel mag Hunde nicht, sie<br />
hat sogar große Angst vor ihnen. Dies<br />
hat, wie man in dem Buch „Angela Merkel.<br />
Die Kanzlerin und ihre Welt“ des SZ-<br />
Journalisten Stefan Kornelius nachlesen<br />
kann, biografische Gründe. Merkel wurde<br />
1995 in der Uckermark beim Fahrradfahren<br />
vom Jagdhund des Nachbarn angefallen<br />
und ins Knie gebissen. Seitdem meidet<br />
sie Hunde.<br />
Putin, seinerseits ein Hundenarr,<br />
kannte die Phobie der Kanzlerin offenbar<br />
und nutzte sie zweimal zu merkwürdigen<br />
Scherzen. Als Merkel im Januar 2006<br />
ihren Antrittsbesuch bei ihm machte, beglückte<br />
er sie im Präsidentenpalast mit einem<br />
Stoffhund. Grinsend beobachtete<br />
er, wie Merkels außenpolitischer Berater<br />
Christoph Heusgen die Kanzlerin unauffällig<br />
von dem ihr unsympathischen Kuscheltier<br />
befreite.<br />
Ein Jahr später erlaubte er sich in seiner<br />
Residenz am Schwarzen Meer einen<br />
noch derberen Scherz. Plötzlich stürmte<br />
sein großer, schwarzer Labrador Koni in<br />
den Raum, beschnupperte die verängstigte<br />
Kanzlerin sorgfältig, legte sich dann aber<br />
artig vor ihre Füße. Wieder beobachtete<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
10 <strong>Cicero</strong> 5.2013
FOTO. KUNST. EDITIONEN.<br />
Limitierte Edition von Pep Ventosa, 105 x 140 cm, signiert, €720 (Kaschierung auf Wunsch)<br />
Objekte von Molteni | Avenso AG, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 <strong>Berlin</strong>, Deutschland<br />
Gegründet von Sammlern, getragen von 160 anerkannten<br />
Künstlern und Talenten der großen Hochschulen, hat sich<br />
LUMAS ganz der Idee gewidmet, inspirierende Kunst im<br />
Original als erschwingliche Editionen anzubieten.<br />
AACHEN | BIELEFELD | BREMEN | DORTMUND | DÜSSELDORF<br />
FRANKFURT | HAMBURG | HEIDELBERG | KÖLN | MÜNCHEN | MÜNSTER | STUTTGART<br />
BERLIN | LONDON | NEW YORK | PARIS | WIEN | ZÜRICH<br />
LUMAS.DE
C i c e r o | S t a d t g e s p r ä c h<br />
Putin grinsend, wie Merkel ängstlich ihre<br />
Beine an sich zog und völlig verkrampfte.<br />
Er genoss den Auftritt in „sadistischer<br />
Pose“, wie Kornelius schreibt. Und bei<br />
Merkel verstärkte sich der Eindruck, dass<br />
sie – vor laufenden Fernsehkameras – bewusst<br />
als Angsthäsin vorgeführt werden<br />
sollte. Seitdem gilt für deutsch-russische<br />
Gipfeltreffen das Hundeverbot – nach der<br />
„Hallstein-Doktrin“ ist die „Merkel-Dogtrin“<br />
ein neues, weltweit einzigartiges Petitum<br />
deutscher Außenpolitik. tz<br />
Im rechten unterholz:<br />
schwarze unerwünscht<br />
A<br />
ls konservative Sammlungsbewegung<br />
der Unzufriedenen gegen<br />
Angela Merkels Euro- und<br />
Europapolitik hat die „Alternative für<br />
Deutschland“ in den vergangenen Wochen<br />
ziemlich viel Wirbel in den Medien<br />
gemacht. Während der Widerstand<br />
in Resteuropa von überwiegend nichtakademischen<br />
Populisten angeführt wird,<br />
hat hierzulande eine Gruppe von Professoren<br />
die Führung der Euro-Skeptiker<br />
übernommen. Weil aber die „Alternative<br />
für Deutschland“ nicht nur die älteren<br />
Semester ansprechen soll, sondern auch<br />
mit Stimmen von Erst- und Jungwählern<br />
in den Bundestag einziehen will, hat sie<br />
sich bereits eine eigene Jugendorganisation,<br />
die AfD-Jugend, zugelegt. Und die<br />
mischt jetzt mit einer eigenen Facebook-<br />
Seite im Wahlkampf mit.<br />
Wahrscheinlich um zu beweisen, dass<br />
er auf der Höhe der Zeit ist, schmückte<br />
der Protestparteinachwuchs kürzlich seine<br />
Facebook-Seite mit einem Titelbild, auf<br />
dem fünf junge Menschen zu sehen waren<br />
– darunter ein Schwarzer. Aber die<br />
Rechnung schien ohne die Partei-Klientel<br />
gemacht. Aus dem rechten Umfeld meldeten<br />
sich empörte AfD-Sympathisanten,<br />
die das Gruppenbild mit Neger voll daneben<br />
fanden und dahinter eine plumpe Anbiederei<br />
an den multikulturellen Zeitgeist<br />
vermuteten. Doch statt die ausländerfeindlichen<br />
Kritiker in die Schranken zu weisen,<br />
verhedderte sich die AfD-Jugend selbst im<br />
rechten Unterholz: „Hier biedert sich keiner<br />
bei Multikulti an … Nur die Ausländer,<br />
die sich anpassen wollen, sind willkommen.<br />
Also auch ein Schwarzer, der sich integriert<br />
…“, kommentierte der Administrator.<br />
Bernd Lucke, der Kopf der „Alternative“,<br />
beteuerte im <strong>Cicero</strong>-Online-Interview zwar:<br />
„Wir lehnen Ausländerfeindlichkeit ab.“<br />
Trotzdem löschte die AfD-Jugend, offenbar<br />
selbst erschrocken von dem rechtspopulistischen<br />
Shitstorm, den sie ausgelöst hatte, das<br />
Titelbild mitsamt den Kommentaren. Eine<br />
klare Positionierung gegen Rassismus geht<br />
anders. ts<br />
Gaslaternen-Abriss:<br />
senat schafft fakteN<br />
D<br />
er Kampf um die <strong>Berlin</strong>er Gaslaternen<br />
geht in eine neue Runde.<br />
Seit der Senat im vorigen Jahr allen<br />
Protesten und Einwänden zum Trotz<br />
damit begonnen hat, die historischen Straßenleuchten<br />
mit dem schönen gelben Licht<br />
durch moderne energiesparende LED-<br />
Lampen zu ersetzen (<strong>Cicero</strong>, Juni/2012),<br />
machen engagierte Bürger – unterstützt<br />
von Schauspielern, Malern, Kunstprofessoren<br />
und Denkmalschützern – auf zwei<br />
Internetportalen www.denk-mal-an-berlin.<br />
de und www.gaslicht-kultur.de – gegen den<br />
Abriss mobil. Ein Gutachter hat ihnen bereits<br />
bescheinigt, dass die alten Laternen<br />
– einzeln und als Ensemble – ein einzigartiges<br />
Kulturdenkmal darstellen. Jetzt<br />
wollen sie, mithilfe eines zweiten Gutachters,<br />
die Unesco davon überzeugen, dass<br />
die <strong>Berlin</strong>er Gaslaternen zum Weltkulturerbe<br />
gehören und deshalb geschützt werden<br />
müssen. Aber während sie Protestbriefe<br />
verfassen, schafft der Senat Fakten.<br />
Gut möglich also, dass die Laternen verschwunden<br />
sind, bevor sie Weltkulturerbe<br />
werden konnten. hp<br />
abrupter Seitenwechsel:<br />
journalist als hausierer<br />
E<br />
s ist ja nicht so, dass der Journalist<br />
grundsätzlich gut und der<br />
Lobbyist grundsätzlich böse wäre.<br />
Obwohl es natürlich Figuren gibt, die<br />
diese Klischees festigen. So erlangte Uwe<br />
Vorkötter als Chefredakteur von <strong>Berlin</strong>er<br />
Zeitung und Frankfurter Rundschau einst<br />
eine Art Heldenstatus, weil er die Integrität<br />
seiner Redaktionen gegen den Heuschrecken-Verleger<br />
David Montgomery<br />
verteidigte. Ex-Bild-Redakteur Hans-<br />
Erich Bilges, Eigentümer der PR- und Beratungsagentur<br />
Consultum Communications,<br />
wird hingegen eher auf der dunklen<br />
Seite der Macht verortet, weil er – jedenfalls<br />
laut der jüngsten Spiegel-Berichterstattung<br />
– in Lobby- und Beraterdienste<br />
für Regime wie Kasachstan, Weißrussland<br />
oder zuletzt Aserbaidschan involviert gewesen<br />
sein soll.<br />
Daher war es eine ziemliche Überraschung,<br />
dass der Ex-Chef der Rundschau<br />
unlängst als „Managing Partner“ und<br />
zweiter Mann zu Bilges’ Agentur wechselte.<br />
In <strong>Berlin</strong>-Mitte sitzt er nun in einem Büro,<br />
das mit seinen kahlen Wänden, den grauen<br />
Teppichböden und dem Blick in den Innenhof<br />
kaum sinistren Glamour, sondern<br />
eher den Charme einer Hautarztpraxis versprüht,<br />
und muss sich seinen Kaffee selber<br />
machen. Noch ernüchternder war es zu erfahren,<br />
dass es gar nicht zu seinen neuen<br />
Aufgaben gehören wird, als Spin-Doctor<br />
PR-Kampagnen für die Achse des Bösen<br />
zwischen Nordkorea und Iran zu entwickeln.<br />
Vielmehr soll Vorkötter für Consultum<br />
Unternehmen, Verbände und Medienhäuser<br />
redaktionell und wirtschaftlich<br />
beraten. Neu ist für den langjährigen und<br />
leidgeprüften Medienmanager dabei vor allem<br />
eines: „Als Chefredakteur will einem<br />
dauernd jemand Themen andrehen, heute<br />
ist eine meiner Hauptaufgaben die Kundenakquise,<br />
und ich muss selber meine Themen<br />
an den Mann bringen, ein bisschen<br />
wie ein Handelsvertreter.“ cm<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
12 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Das geht besser!<br />
Nicht vergessen: Am 12. Mai ist Muttertag!<br />
Jetzt stöbern im Onlineshop für Geschenkideen.<br />
www.geschenkidee.de
C i c e r o | L e s e r b r i e f e<br />
Forum<br />
Über Tugendwächter, Werte, die Schweizer und Warhols Wurzeln<br />
Zum Beitrag „vom furor<br />
des fortschritts“ von<br />
Reinhard Mohr / April 2013<br />
sehr deutsch<br />
Danke für Reinhard Mohrs ebenso geistreiche wie präzise Bestandsaufnahme deutscher<br />
Befindlichkeiten. Am deutschen Wesen soll nach wie vor die Welt genesen:<br />
So zynisch es klingen mag, ist das von Ihnen geschilderte Phänomen eine typische<br />
Ausprägung deutscher Mentalität. Besonders deutlich wurde dies angesichts der<br />
von bestimmten politischen Kreisen und dem medialen Mainstream angefachten<br />
Demontage des letzten Bundespräsidenten (dessen Ungeschicktheit wir hier einmal<br />
außer Acht lassen wollen): Die Inquisition der Empörung, die dort anrollte, war<br />
im Grunde genommen nichts anderes als eine demokratisch verbrämte Spielart<br />
ureigensten deutschen Spießertums.<br />
Jan Eschbach, Düsseldorf<br />
Mehr doof als lustig<br />
Auch wer sich wie ich über sprachliche<br />
Überkorrektheiten oder Peinlichkeiten<br />
wie „Mitglieder/innen“ amüsiert, behält<br />
am Ende aller <strong>Cicero</strong>-Beiträge das schale<br />
Gefühl zurück, dass die lustigen Formulierungen<br />
Reinhard Mohrs am Ende<br />
doch nur der Verunsicherung angesichts<br />
der ach so komplexen Wirklichkeit entspringen.<br />
Angesichts der gleich dahinter<br />
abgedruckten klugen Antworten der<br />
Feministin Anna-Katharina Messmer<br />
wirkt auch Mohrs Herumreiten auf der<br />
„supereigenartigen“ sprachlichen Entgleisung<br />
ihrer Mitstreiterin am Ende mehr<br />
doof als lustig.<br />
Jürgen Terhag, Leichlingen<br />
recht wachsweich<br />
Ihre Titelgeschichte „Vom Furor des<br />
Fortschritts“ von Reinhard Mohr ist<br />
inhaltlich nicht übel. Mohr trägt so<br />
einige zentrale Possen des „sozialen<br />
Fortschritts“ zusammen und versäumt<br />
nicht, diese entsprechend bissig zu<br />
kommentieren. Dennoch klingt mir das<br />
Ganze recht wachsweich in den Ohren:<br />
Ich bezweifle, ob der durchgängig ironische<br />
Tonfall – mit polemischen Spitzen –<br />
das adäquate Ausdrucksmittel ist, um<br />
Gesellschaftsveränderndes von solcher<br />
Wichtigkeit und Diskussionsbedürftigkeit<br />
darzustellen. Ich persönlich nenne<br />
das „Kabarettisierung des Journalismus“,<br />
die Mohr hier geradezu beispielhaft<br />
betreibt … Das (aber) halte ich dem<br />
verhandelten Gegenstand für nicht<br />
angemessen, denn da geht es um etwas:<br />
um das Umsichgreifen von Absurditäten,<br />
Widersinn, ja Idiotie, das konkrete Folgen<br />
hat. Und zwar Folgen, die keineswegs<br />
als harmlos für eine Gesellschaft<br />
angesehen werden können.<br />
Stefan Till Schneider, Eppelheim<br />
kündigung storniert<br />
Meine Kündigung (des <strong>Cicero</strong>-Abos, die<br />
Redaktion) nehme ich zurück. Verantwortlich<br />
hierfür ist – im Wesentlichen –<br />
der Beitrag von Reinhard Mohr in der<br />
aktuellen Ausgabe!<br />
Holger Bessler, Bad Bevensen<br />
inquisitorische attitüde<br />
Ist ja eh ein netter Versuch, so eine journalistisch<br />
zugespitzte, um nicht zu sagen<br />
„überdrehte“ Aufmacher-Geschichte.<br />
Wenn dann nicht der Autor in die selbstgestellte<br />
Falle tappen würde. Das leidige<br />
an der „political correctness“ ist ja meiner<br />
bescheidenen Meinung nach nicht<br />
die correctness an sich, sondern die<br />
besserwisserische, inquisitorische Attitüde,<br />
mit der sie oft vorgetragen wird.<br />
Humorfreiheit scheint dabei oberste<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
14 <strong>Cicero</strong> 5.2013
illustrationen: cornelia von seidlein<br />
BürgerInnenpflicht zu sein. Welchen<br />
Gegenentwurf entwickelt nun der Autor,<br />
was unterscheidet ihn in seiner Haltung?<br />
Das hat sich mir mit diesem Artikel leider<br />
nicht erschlossen (außer, dass er halt<br />
recht zwänglerisch die Gegenposition<br />
zum correctness-mainstream einnimmt).<br />
Die schärfsten Kritiker der Elche waren<br />
früher selber welche, hat Herr Bernstein<br />
einmal so schön gedichtet. Anregend<br />
lesenwert war die Themenstrecke aber<br />
allemal. Mit freundlichen Grüßen aus<br />
dem Burgenland.<br />
Franz Renner, Mattersburg, Österreich<br />
Zum beitrag „Bergler gegen<br />
Feudalherren“ von<br />
Frank A. Meyer / April 2013<br />
demokratische schweiz<br />
Frank A. Meyer trifft mit seinen Kommentaren<br />
öfter den Kern der Dinge,<br />
aber selten stimme ich ihm so sehr aus<br />
vollem Herzen zu wie in diesem Fall.<br />
Dass die soziale Marktwirtschaft bei<br />
uns durch die viel gerühmte (auch von<br />
der SZ) Agenda 2010 praktisch ruiniert<br />
wurde, scheint ja hierzulande kaum wen<br />
zu stören (Herrn Steinbrück sicherlich<br />
nicht). Dass wir uns aber an der Schweiz,<br />
in meinen Augen das einzige wirklich<br />
demokratische Land in Europa, ein Beispiel<br />
nehmen sollten, anstatt uns über<br />
sie lustig zu machen, musste mal gesagt<br />
werden! Und zwar nicht nur hinsichtlich<br />
der sehr erfolgreichen Schweizer Wirtschaft,<br />
sondern auch und gerade unter<br />
dem Blickwinkel der fortschreitenden<br />
Erosion demokratischer Institutionen<br />
bei uns und in der Eurozone insgesamt.<br />
Prof. Dr. Claus Prießner, München<br />
FAST immer ins Schwarze<br />
Weiblich, ledig und dazu noch jung<br />
(35) … Eigentlich entspreche ich so gar<br />
nicht Ihrer Leserschicht! (Kleiner Hinweis<br />
vom Redaktionsmarketing.) Aber<br />
<strong>Cicero</strong> hat es geschafft, meinen kreativen<br />
Designerkopf für andere Themen<br />
zu begeistern als etwa „Schriftgröße,<br />
Bildqualität, Layout“ und „welcher Lipgloss<br />
steht mir am besten“. Ein großes<br />
Kompliment vor allem an Herrn Meyer<br />
und Frau Fried. Ihre Kolumnen treffen<br />
immer wieder ins Schwarze.<br />
Nicole Franke, Kelkheim<br />
zum beitrag „Widerstand“ von<br />
Alexander Marguier / April 2013<br />
tumbes Bashing<br />
Von einem Magazin für politische<br />
Kultur wie dem <strong>Cicero</strong> erwarte ich<br />
kontroverse Meinungen und hintergründiges,<br />
wie auch pointiertes Darstellen<br />
von politischen Zusammenhängen und<br />
Diskursen. Auch wenn ich nicht immer<br />
bei all Ihren Standpunkten mitgehen<br />
kann, interessant argumentiert und<br />
scharf beobachtet sind sie zumeist schon.<br />
In diesem Sinne muss ich doch recht<br />
enttäuscht das tumbe „Gutmenschen“-<br />
Bashing Ihres stellvertretenden Chefredakteurs<br />
zur Kenntnis nehmen. Das<br />
Befassen mit der Politik sollte doch<br />
zumindest diese insofern ernst nehmen,<br />
als dass Politik möglicherweise von<br />
Menschen gemacht wird, die eine politische,<br />
das heißt eben auch normative<br />
und nicht nur eine ästhetische Agenda<br />
haben, wie es die vielleicht überspitzten,<br />
aber gleichwohl simplen Reflexinterpretationen<br />
eines Gesellschaftsreporters<br />
nahelegen.<br />
Saskia Ellenbeck, <strong>Berlin</strong><br />
zum beitrag „Mein Schüler“ von<br />
Constantin Magnis / April 2013<br />
„schööler“ Rösler<br />
In der April-Ausgabe bot die Serie<br />
„Mein Schüler“ einem pensionierten<br />
Oberstudienrat das Forum, sich über<br />
seinen „unbotmäßigen Schööler“ Rösler<br />
zu äußern.<br />
Ich selbst wurde von eben diesem<br />
Pädagogen in Englisch und Geschichte<br />
unterrichtet, jetzt leite ich ein Gymnasium<br />
in Hannover. Schüler, die von uns<br />
unterrichtet werden, haben dem Lehrer<br />
zweifelsohne mit Anstand und Respekt<br />
zu begegnen, aber Lehrer haben auch<br />
zu gewärtigen, dass die uns Anvertrauten<br />
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung<br />
noch Suchende, Ausprobierende,<br />
Unsichere sind. Ich wäre jedenfalls froh,<br />
wenn ich wüsste, dass meine Lehrer so<br />
manche meiner Verhaltensweisen als<br />
Pennäler vergessen hätten … Es ist überaus<br />
problematisch, wenn sich Lehrer<br />
aus der Erinnerung heraus zu ehemaligen<br />
Schülern äußern. Das gilt für Lob<br />
ebenso wie für Tadel.<br />
Martin Thunich, Hannover<br />
zum beitrag „MaN sieht<br />
nur, was man sucht“ von<br />
Beat Wyss / April 2013<br />
Warhols wurzeln<br />
Im April-Heft bringen Sie den Artikel<br />
„Ein Judas, viele Opportunisten“ des<br />
„bekanntesten Kunsthistorikers des Landes“,<br />
Beat Wyss.<br />
Unglücklicherweise ist ihm ein<br />
Abstammungsfehler unterlaufen, indem<br />
er Andy Warhol als „Sohn polnischer<br />
Einwanderer“ bezeichnet hat. Warhols<br />
Eltern stammen aus dem Dorf Mikova<br />
in der Nähe der Stadt Medzilaborce.<br />
Beide Orte befinden sich auf dem<br />
Gebiet der Slowakei. Auf diesem Gebiet<br />
leben bis heute die Ruthenen, deren<br />
Sprache ein Dialekt aus Russisch und<br />
Slowakisch ist.<br />
Hauptmerkmal der Ruthenen ist die<br />
Religion – russisch-orthodoxe, später<br />
griechisch-katholische Religion. Seine<br />
Eltern, Andrej Varchola und Julia Varcholova,<br />
waren also keine Polen, sondern<br />
Ruthenen aus der Slowakei.<br />
Alice Boldis, Ulm<br />
(Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 15
T i t e l<br />
<strong>Berlin</strong>-Fototagebuch. Diese Eindrücke haben<br />
die <strong>Cicero</strong>-Bildredakteurinnen Antje Berghäuser<br />
und Tanja Raeck seit 2011 zusammengetragen<br />
16 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Boom, Boom,<br />
<strong>Berlin</strong><br />
Die Besucher strömen, die Stadt wächst, die Mieten<br />
steigen. <strong>Berlin</strong> zieht viele an, obwohl es das reine<br />
Durcheinander ist. Oder gerade deshalb? Nachforschungen<br />
bei Sarrazin und einer Luxusmaklerin, bei Buschkowsky<br />
und einem Piraten, im Bizarrclub und auf der „Third<br />
Reich“-Tour, zwischen <strong>Berlin</strong>-Flaggen-Verbrennung<br />
und den Fronten im täglichen Hundestreit<br />
Von Alexander Marguier<br />
B<br />
erlin ist eine Stadt zwischen<br />
Glanz und Kläglichkeit, zwischen<br />
Lust und Liderlichkeit,<br />
zwischen Boom und Depression.<br />
Außerhalb <strong>Berlin</strong>s schütteln<br />
die Menschen den Kopf über manches<br />
Versagertum, den Ort aber finden<br />
sie trotzdem attraktiv. Im Januar regt man<br />
sich in Deutschland über den Flughafen<br />
auf, und im Mai genießt man ein verlängertes<br />
Wochenende in der Hauptstadt. Die<br />
Deutschen stellen fest, dass <strong>Berlin</strong> verlottert<br />
ist, und trotzdem entscheiden sie sich, ihre<br />
Freizeit dort zu verbringen – oder ihr Leben.<br />
Kaum eine andere Metropole in Europa<br />
zieht so viele Menschen an wie die deutsche<br />
Hauptstadt. <strong>Berlin</strong> ist der Versager, der<br />
aufsteigt; ein abschreckendes Beispiel, das<br />
Tausende anzieht. Wie passt das zusammen?<br />
Wie lebt <strong>Berlin</strong> mit Erfolg und Chaos, mit<br />
all seinen Gegensätzen? Eine Reise zum besseren<br />
Verständnis der Durcheinanderstadt.<br />
Eine Wohnung in der Hauptstadt<br />
<strong>Berlin</strong> und seine Schmuddel-Ecken, ein<br />
ewiges Thema. Wer sich darüber aufregt,<br />
sollte wissen: Die latente Verlottertheit ist<br />
in Wahrheit ein wichtiger Standortfaktor.<br />
Sagt zumindest Anne Riney. Und sie muss<br />
es wissen, denn die resolute Irin lebt seit<br />
30 Jahren in der Stadt und leitet das Büro<br />
„Mitte“ des Luxusimmobilienmaklers<br />
„Engel & Völkers“.<br />
Riney hat viel internationale Kundschaft,<br />
in letzter Zeit vor allem Italiener:<br />
„Als Berlusconi abtreten musste, stieg die<br />
Zahl der Interessenten aus Italien von einem<br />
Tag auf den nächsten.“ Es seien insbesondere<br />
Privatleute, die ihr Geld sicher<br />
anlegen wollen und Deutschland als eine<br />
Insel der Stabilität im krisengeschüttelten<br />
Europa sähen. Eine Immobilie in der<br />
Hauptstadt gilt deshalb als gute Investition,<br />
auch in Schweden, Dänemark, Spanien, Island<br />
oder Israel. „Besonders jüngere Italiener<br />
kaufen sich eine Wohnung aber nicht<br />
einfach nur als Renditeobjekt, sondern<br />
verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach<br />
<strong>Berlin</strong> und ziehen selbst ein.“ Da würde<br />
sich <strong>Berlin</strong>s Schmuddel-Image bewähren,<br />
sagt Riney: „Viele, die zum ersten Mal aus<br />
dem Ausland hierherkommen, sind positiv<br />
überrascht, dass die Hauptstadt so gar<br />
nicht dem deutschen Klischee von sauberer<br />
Aufgeräumtheit entspricht.“<br />
Anne Riney selbst findet <strong>Berlin</strong> denn<br />
auch eher vergleichbar mit New York als<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 17
T i t e l<br />
mit anderen deutschen Großstädten – nur<br />
nicht bei den Immobilienpreisen. Die seien<br />
zwar in letzter Zeit deutlich gestiegen, aber<br />
im Gegensatz zu anderen Metropolen immer<br />
noch ziemlich niedrig. „<strong>Berlin</strong> ist eben<br />
noch nicht so durchkommerzialisiert, eher<br />
so wie London vor 40 Jahren.“<br />
Für Schnäppchenjäger wird der Markt<br />
so langsam trotzdem eng. Vor sechs oder<br />
sieben Jahren war in <strong>Berlin</strong> ein Mietshaus<br />
noch für das Zehnfache der Jahreskaltmiete<br />
zu haben, inzwischen zahlt man deutlich<br />
mehr als doppelt so viel. Dennoch bleibt<br />
die Nachfrage hoch, was nicht zuletzt an<br />
Angela Merkel liegt. Auch das ist ein Erfahrungswert<br />
der irischen Maklerin: „Außerhalb<br />
Deutschlands wird zwar viel über<br />
die Bundeskanzlerin geschimpft. Aber viele<br />
Ausländer, die in <strong>Berlin</strong> eine Immobilie<br />
kaufen, tun das, weil sie in Angela Merkel<br />
eine Garantin für Stabilität sehen.“ Solange<br />
die Kanzlerin regiert und <strong>Berlin</strong> sich<br />
nicht zu sehr herausputzt, hat die Immobilienbranche<br />
offenbar nichts zu befürchten.<br />
<strong>Berlin</strong> für <strong>Berlin</strong>-Hasser<br />
<strong>Berlin</strong> ist die einzige deutsche Metropole,<br />
in der sich Schmähschriften über die<br />
eigene Stadt als eigenständiges literarisches<br />
Genre herausgebildet haben. Mindestens<br />
einmal im Jahr erscheint ein neues Buch,<br />
das die Hässlichkeiten der Architektur,<br />
die Unfreundlichkeit der Bewohner, die<br />
aufgesetzte Mitte-Coolness, das Hornbrillen-Hipstertum,<br />
verlotterte Lebensgewohnheiten<br />
oder auch die nervigen Touristen<br />
in den Mittelpunkt stellt. Die Titel<br />
heißen dann „Das Buch für <strong>Berlin</strong>-Hasser“,<br />
„I hate <strong>Berlin</strong>“ oder „Vergiss <strong>Berlin</strong>!“ und<br />
werden stets von <strong>Berlin</strong>ern verfasst. Außerhalb<br />
<strong>Berlin</strong>s interessiert sich zwar kein<br />
Mensch für diese Werke, aber für die Lokalpresse<br />
sind solche vernichtenden Selbstreflexionen<br />
immer ein Thema. Allein schon<br />
deshalb, weil sie regelmäßig empörte Leserkommentare<br />
nach sich ziehen, in denen es<br />
dann heißt, der Autor des jeweils aktuellen<br />
<strong>Berlin</strong>-Bashings solle doch abhauen, wenn<br />
es ihm hier nicht gefällt. Ein verlässliches<br />
Reiz-Reaktions-Schema.<br />
Die jüngste Hervorbringung aus dieser<br />
nicht enden wollenden Reihe ist „<strong>Berlin</strong><br />
zum Abkacken“ und geht auf 160 Seiten<br />
die einzelnen Bezirke durch – von<br />
Tempelhof bis Köpenick. Über Prenzlauer<br />
Berg erfährt der Leser beispielsweise: „Architektonisch<br />
hätte die Stadt den Bezirk<br />
sehr attraktiv gestalten können. Stattdessen<br />
wurde er zum Totsanieren freigegeben.<br />
Die Straßen sehen aus, wie mit Photoshop<br />
bearbeitet. Jeder, der nach <strong>Berlin</strong> kommen<br />
und keine Überraschung erleben will, ist<br />
hier richtig. Hoffentlich ist es genau das,<br />
was Prenzlauer Berg das Genick brechen<br />
wird.“ Nichts Neues also.<br />
Zur Buchvorstellung in einer Charlottenburger<br />
Buchhandlung sind trotzdem an<br />
die 30 Leute gekommen, was für Hauptstadt-Verhältnisse<br />
nicht schlecht ist. Der<br />
Autor nennt sich Kristjan Knall, trägt Fellmütze<br />
und Sonnenbrille und macht sich zu<br />
Beginn der Lesung erst mal eine Flasche<br />
Bier mit dem Feuerzeug auf. Die Tarnung<br />
und das Pseudonym seien wichtig, er wolle<br />
nicht erkannt werden. Kristjan Knall liest<br />
zu schnell und verhaspelt sich an vielen<br />
Stellen. Zwischen den einzelnen Passagen<br />
erzählt er, warum er den gefühlt 100 existierenden<br />
<strong>Berlin</strong>-Hasser-Büchern noch eines<br />
hinzufügen musste: Weil ihm die anderen<br />
nicht hasserfüllt genug gewesen seien.<br />
„Ich habe keinen künstlerischen Anspruch,<br />
mir ging es einfach nur ums Abkotzen.“<br />
Ein paar Tage zuvor hat der <strong>Berlin</strong>er<br />
Kurier eine Geschichte über Kristjan<br />
Knall und sein Buch gebracht; die Reporter<br />
18 <strong>Cicero</strong> 5.2013
hätten eine <strong>Berlin</strong>-Flagge dabeigehabt<br />
und ihn gebeten, diese<br />
zu verbrennen. Im Blatt hieß es<br />
dann unter dem entsprechenden<br />
Foto: „Kristjan Knall fackelt<br />
symbolisch für seinen Hass auf<br />
die Stadt in Neukölln eine <strong>Berlin</strong>-Flagge<br />
ab.“ Im Online-Auftritt<br />
des <strong>Berlin</strong>er Kuriers hinterlässt<br />
ein Leser am 18. Februar in<br />
der Kommentarspalte hinter dem<br />
Bericht über die Flaggenverbrennung<br />
folgende Nachricht: „Für den<br />
Vogel sollten wir <strong>Berlin</strong>er sammeln,<br />
um ihm ein Ticket nach Russland<br />
zu spendieren, am besten dorthin,<br />
wo der Meteorit runtergekommen<br />
ist. Oder an die Elfenbeinküste, da<br />
kann er ja dann die Menschen weiter<br />
beleidigen. Mal sehen, was die dann<br />
mit ihm machen.“<br />
Alles wie gehabt.<br />
Auf den Spuren Adolf Hitlers<br />
Im vergangenen Jahr kamen laut Statistik<br />
10,8 Millionen Touristen aus aller Welt<br />
nach <strong>Berlin</strong>; 2013 werden es wahrscheinlich<br />
noch mehr Besucher gewesen sein.<br />
15 von ihnen stehen an einem kalten Aprilmorgen<br />
vor dem Bahnhof Zoo und warten<br />
auf ihren Führer – den Führer zum Führer<br />
gewissermaßen, denn sie haben die Erkundungstour<br />
„Third Reich <strong>Berlin</strong>“ gebucht:<br />
einen vierstündigen Stadtspaziergang, bei<br />
dem es laut Veranstalter darum geht, „die<br />
Überreste des Tausendjährigen Reiches“ zu<br />
entdecken. Klingt ein bisschen finster, ist<br />
es aber nicht.<br />
Der Tourguide heißt Cesar, wurde in<br />
Kolumbien geboren, hat in England Geschichte<br />
studiert und lebt seit zehn Jahren<br />
in <strong>Berlin</strong>. Die historischen „<strong>Berlin</strong> Walks“<br />
sind nur sein zweites berufliches Standbein,<br />
hauptsächlich spielt Cesar die Laute<br />
in einem Barockorchester. Eine Glorifizierung<br />
des Naziregimes ist von ihm ganz bestimmt<br />
nicht zu erwarten. Manchmal seien<br />
auf seinen Drittes-Reich-Rundgängen zwar<br />
Teilnehmer dabei, die „ein bisschen seltsam“<br />
wirkten, sagt er. Aber bei den allermeisten<br />
Gästen handele es sich einfach nur um geschichtlich<br />
interessierte Touristen aus dem<br />
Ausland. Ganz harmlos. So auch heute:<br />
Spanier, Israelis, Schotten, Japaner und ein<br />
amerikanisches Ehepaar mit zwei Töchtern.<br />
Keine politisch verdächtigen Subjekte.<br />
Mit dem Linienbus geht es zur Siegessäule,<br />
der ersten Station. Die Gruppe erfährt,<br />
dass sich nach der deutschen Kapitulation<br />
Hunderte Sowjetsoldaten an<br />
diesem Ort versammelt hätten, um mit viel<br />
Schnaps „a great party“ zu feiern. Und dass<br />
Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen<br />
von einer großen Inflation heimgesucht<br />
worden sei, „so ähnlich wie in Simbabwe<br />
von ein paar Jahren“. Weiter zum<br />
Reichstag, „Hitler didn’t like this building“.<br />
Cesar erzählt vom Reichstagsbrand, dessen<br />
Ursache „still a mystery“ sei, und wie die<br />
Nazis sich dieses Ereignis zunutze gemacht<br />
hätten. Dann deutet er auf das gegenüberliegende<br />
Bundeskanzleramt und macht auf<br />
die vielen Fenster in der Fassade aufmerksam:<br />
Die Deutschen wollten damit zeigen,<br />
wie transparent Politik heutzutage in ihrem<br />
Land sei. Zustimmendes Nicken der<br />
Teilnehmer. Es folgt eine Kaffeepause in einem<br />
Imbiss-Pavillon auf der anderen Straßenseite,<br />
die beiden Japaner teilen sich eine<br />
Bratwurst. Sie wirken mäßig begeistert von<br />
dieser kulinarischen Spezialität.<br />
Danach führt Cesar seine Gruppe<br />
zum Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten<br />
und dann zur Philharmonie. Vor dem<br />
Gebäude befindet sich eine Gedenkplatte,<br />
die an eine ehemalige Villa an der Tiergartenstraße<br />
4 erinnert. In ihr haben die Nationalsozialisten<br />
damals die Euthanasie geplant<br />
und organisiert. Cesar erklärt, was es<br />
damit auf sich hatte und fragt hinterher:<br />
„<strong>Berlin</strong> hat ein<br />
Design für<br />
sechs bis sieben<br />
Millionen<br />
Einwohner:<br />
ein großartiges,<br />
wenn auch<br />
verkommenes<br />
Gehäuse“<br />
Thilo Sarrazin<br />
„Any questions about the euthanasia programme?“<br />
Nein, keine weiteren Fragen.<br />
Der Bendlerblock, Zentrum der Widerstandsgruppe<br />
um Graf von Stauffenberg,<br />
ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten während<br />
des Rundgangs. „You know the movie<br />
with Tom Cruise?“, will der Amerikaner<br />
von seinen beiden halbwüchsigen Töchtern<br />
wissen. „This was the building!“ Die Mädchen<br />
freuen sich. Der Walküre-Film mit<br />
Tom Cruise in der Rolle Stauffenbergs hat<br />
bleibenden Eindruck hinterlassen.<br />
Die „Third Reich“-Tour endet etwas<br />
unspektakulär auf einem Parkplatz zwischen<br />
Plattenbauten nahe dem Holocaust-<br />
Denkmal. Ein paar Meter tiefer unter der<br />
Erde befand sich einst der Führerbunker.<br />
Das spanische Ehepaar wirkt leicht enttäuscht,<br />
als Cesar mitteilt, „Hitler’s bunker“<br />
sei längst abgetragen und könne deshalb<br />
nicht mehr besichtigt werden. Schade,<br />
aber das lässt sich dann wohl nicht ändern.<br />
Sarrazin macht sich keine Sorgen<br />
Es fällt schwer, sich einen gut gelaunten<br />
Thilo Sarrazin vorzustellen. Der Mann<br />
strahlt eine permanente Mürrischkeit aus;<br />
er neigt zum Dozieren und zur Besserwisserei.<br />
Dabei kann ein Gespräch mit dem<br />
ehemaligen <strong>Berlin</strong>er Finanzsenator ganz<br />
unterhaltsam sein. Zwischen den älteren<br />
Herrschaften, die an diesem Vormittag<br />
das „Wiener Caffeehaus“ im langweiligen<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 19
T i t e l<br />
Statistik<br />
<strong>Berlin</strong> in Zahlen<br />
Einwohner 2013 3 543 676<br />
Einwohner pro Quadratkilometer 3974<br />
Einwohner 1942 4 478 102<br />
Einwohner pro Quadratkilometer 5014<br />
Anzahl der Hunde in <strong>Berlin</strong> 109 746<br />
Anzahl der Hunde pro 1000 Einwohner 31<br />
Anfallender Hundekot in <strong>Berlin</strong> pro Jahr in Tonnen 20 020<br />
Roggenmenge, die Deutschland als<br />
staatliche Notfallreserve lagert, in Tonnen 50 000<br />
Anzahl der Schafe in <strong>Berlin</strong> 368<br />
Anzahl der Schafe pro 1000 Einwohner 0,1<br />
Anzahl der Schafe in Baden-Württemberg 248 650<br />
Anzahl der Schafe pro 1000 Einwohner 23<br />
Geld, das <strong>Berlin</strong> 2012 aus dem Länderfinanzausgleich bekam,<br />
in Milliarden Euro 3,323<br />
Geld, das Bayern 2012 in den Länderfinanzausgleich einzahlte,<br />
in Milliarden Euro 3,904<br />
Kosten für einen Kindergartenplatz eines Vierjährigen in <strong>Berlin</strong><br />
sieben Stunden wochentags in Euro 0<br />
Kosten für einen Kindergartenplatz eines Vierjährigen in München<br />
sieben Stunden wochentags in Euro 105<br />
Kita-Mittagessen in <strong>Berlin</strong> pro Monat in Euro 23<br />
Kita-Mittagessen in München pro Monat in Euro 61<br />
Bauzeit des Flughafens Willy Brandt in <strong>Berlin</strong> in Jahren bisher 7<br />
Baukosten in Milliarden Euro bisher 4,3<br />
Passagierkapazität in Millionen 27<br />
Bauzeit des Flughafens Chek Lap Kok in Hongkong in Jahren 8<br />
Baukosten in Milliarden Euro 15,2<br />
Passagierkapazität in Millionen 53,3<br />
Ladenmiete an der Tauentzienstraße in <strong>Berlin</strong><br />
für einen Quadratmeter pro Jahr in Euro 2760<br />
Ladenmiete an der Friedrichstraße in <strong>Berlin</strong><br />
für einen Quadratmeter pro Jahr in Euro 1920<br />
Ladenmiete auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris<br />
für einen Quadratmeter pro Jahr in Euro 9573<br />
Zahl der Michelin-Sterne in <strong>Berlin</strong>, die 2012 vergeben wurden 16<br />
Zahl der Michelin-Sterne in Paris, die 2012 vergeben wurden 114<br />
Anzahl der McDonald’s-Filialen in <strong>Berlin</strong> 56<br />
Anzahl der McDonald’s-Filialen in Paris 81<br />
Til Knipper<br />
Westend bevölkern, fällt der 68-Jährige<br />
nicht weiter auf. Sarrazin, der in der Nähe<br />
wohnt, scheint hier öfter zu Gast zu sein.<br />
Jedenfalls dreht niemand den Kopf nach<br />
ihm um.<br />
Obwohl Optimismus nicht gerade<br />
zu den prägenden Charaktereigenschaften<br />
des Autors von „Deutschland schafft<br />
sich ab“ zählt, fallen Sarrazins Zukunftsprognosen<br />
für <strong>Berlin</strong> überraschend positiv<br />
aus: „Die Stadt wird in den nächsten Jahrzehnten<br />
blühen, wachsen und gedeihen.“<br />
Nicht einmal die Turbulenzen wegen des<br />
missglückten Flughafenneubaus könnten<br />
daran etwas ändern. Ein „Riesenskandal“<br />
sei das Projekt zwar, aber letztlich werde<br />
auch der nur eine Fußnote in der Hauptstadtgeschichte<br />
bleiben. „Der Grundriss<br />
<strong>Berlin</strong>s ist der Grund für seine Lebensqualität<br />
und die kolossal leistungsfähige<br />
Infrastruktur“, sagt Sarrazin, „diese Stadt<br />
hat ein Design für sechs bis sieben Millionen<br />
Einwohner.“ <strong>Berlin</strong> nennt er „ein<br />
großartiges, wenn auch leicht verkommenes<br />
Gehäuse“, dessen Qualität nicht einmal<br />
von der Unfähigkeit in Politik und Verwaltung<br />
zunichtegemacht werden könne. Womit<br />
wir dann doch wieder bei einem von<br />
Sarrazins Lieblingsthemen wären: dem Versagen<br />
der öffentlichen Hand beim Beseitigen<br />
von Problemen.<br />
Ineffizienz ist Sarrazin ein Gräuel, und<br />
die <strong>Berlin</strong>er Verwaltung sei jahrzehntelang<br />
der Inbegriff an Ineffizienz gewesen – mit<br />
entsprechenden Nachwehen bis heute.<br />
„Der öffentliche Dienst wurde in Ermangelung<br />
anderer Arbeitsplätze vollgesogen<br />
mit viel mehr Mitarbeitern, als man<br />
brauchte“, erzählt der ehemalige Finanzsenator<br />
und erinnert sich an seine Zeit im<br />
Aufsichtsrat der <strong>Berlin</strong>er Verkehrsbetriebe:<br />
14 000 Mitarbeiter seien dort im Jahr 2002<br />
beschäftigt gewesen, nach der Wende sogar<br />
27 000. „Ich habe dann ausgerechnet,<br />
dass ein Unternehmen dieser Größenordnung<br />
mit 7000 Leuten auskommen müsste.<br />
Und der gesamte Verwaltungsapparat war<br />
genauso aufgebläht. Das führte zu übermäßiger<br />
Arbeitsteilung und extrem verlangsamten<br />
Abläufen. Wer schnell und effizient<br />
war, nahm den anderen die Arbeit<br />
weg. Die <strong>Berlin</strong>er Landespolitiker wiederum<br />
waren vor allem daran gewöhnt, woanders<br />
Geld einzuwerben. Gestaltungswille<br />
und Gestaltungskompetenz lagen durchweg<br />
unter dem in Westdeutschland gewohnten<br />
Niveau. Diese Mängel von Politik<br />
20 <strong>Cicero</strong> 5.2013
und Verwaltung potenzierten sich gegenseitig<br />
und führten zum berühmten <strong>Berlin</strong>er<br />
Sumpf. Das galt quer durch alle Parteien.“<br />
Thilo Sarrazin schaut sich eine Grafik<br />
an, bei der es um die Finanzentwicklung<br />
der Stadt <strong>Berlin</strong> geht. „Als ich Finanzsenator<br />
wurde, haben wir erst mal damit begonnen,<br />
die Dinge analytisch auseinanderzunehmen.“<br />
Dann bleibt sein Blick an<br />
irgendeiner Ziffer kleben, offenbar verspürt<br />
er Erklärungsbedarf seinem Gesprächspartner<br />
gegenüber. „Um die Relation zu ermitteln,<br />
wurde diese absolute Zahl umgerechnet.<br />
Verstehen Sie?“ Ja.<br />
Mit Zahlen hantiert Sarrazin auch dann<br />
besonders gern, wenn er auf die Bevölkerungsstruktur<br />
<strong>Berlin</strong>s zu sprechen kommt.<br />
Auf diesem Gebiet gibt es aus seiner Sicht<br />
natürlich nichts Gutes zu vermelden: „In<br />
<strong>Berlin</strong> entfallen mit stark steigender Tendenz<br />
etwa 40 Prozent der Geburten auf die<br />
sogenannten bildungsfernen Schichten, ein<br />
großer Teil davon Empfänger von Transferleistungen.<br />
Das prägt die Ausgaben für<br />
die Bildungspolitik, die Kosten der Unterkunft,<br />
die Hilfen zur Erziehung, die Hilfen<br />
in besonderen Lebenslagen, die Kosten der<br />
Gerichte, des Strafvollzugs und so weiter.“<br />
Daraus entstehe „ein Ausgabendruck, auf<br />
den eigentlich niemand eine Antwort hat“.<br />
Nicht einmal Thilo Sarrazin.<br />
Schlaflos durch die Nacht<br />
Svenja und Frank kennen <strong>Berlin</strong> kaum –<br />
obwohl sie mindestens zwei Mal im Monat<br />
dort sind. Aber wenn sie am Wochenende<br />
mit dem Auto aus der Lüneburger Heide<br />
in die Stadt gefahren kommen, ist es immer<br />
schon dunkel. Und wenn die beiden<br />
Endzwanziger nach vier oder fünf Stunden<br />
wieder aufbrechen, dämmert allenfalls im<br />
Sommer das Morgenlicht.<br />
Svenja und Frank haben immer das<br />
gleiche Ziel, das „Insomnia“ im Stadtteil<br />
Tempelhof – den „Pärchenclub für Liebhaber<br />
des Fetisch, des Bizarren und des Besonderen“.<br />
So steht es auf der Homepage.<br />
Und weiter: „Insomnia ist lustvolle, erotische<br />
Kommunikation auf allen Ebenen unter<br />
hedonistischen Freidenkern“. Freidenker,<br />
dieser Begriff ist Svenja und Frank wichtig;<br />
sie bezeichnen sich selbst ausdrücklich nicht<br />
als „Swinger“, sondern als „Libertinäre“. Für<br />
Laien ist diese Unterscheidung nicht ganz<br />
leicht nachzuvollziehen, jedenfalls geht es<br />
Svenja und Frank nicht ums „Gruppenrammeln“,<br />
wie sie es nennen, sondern um erotische<br />
Selbstentfaltung. Die sieht an diesem<br />
Samstagabend so aus: Frank wechselt in der<br />
Umkleidekabine seine Alltagsklamotten gegen<br />
einen schwarzen Ganzkörperanzug aus<br />
Latex, während aus der zierlich-unscheinbaren<br />
Svenja binnen weniger Minuten eine<br />
Art Lolita-Vamp wird, mit kniehohen weißen<br />
Stiefeln und einer Krankenschwesternhaube<br />
auf dem Kopf. Frank legt seiner<br />
Freundin noch das Hundehalsband an und<br />
führt sie dann an der Leine nach oben, in<br />
den großen Ballsaal.<br />
„Circus Bizarre“ lautet das Motto des<br />
Abends, um 23 Uhr ist die Tanzfläche<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 21
T i t e l<br />
schon schwitzend voll. Frauen in schwarzen<br />
Negligés oder knappen Höschen, manche<br />
mit, andere ohne BH, in engen Ledercorsagen,<br />
Stringtangas oder aufwendigen<br />
Kostümen aus dem ästhetischen Repertoire<br />
des Fantasy-Romans. Die Männer geben<br />
sich nicht ganz so viel Mühe, dem Insomnia-Dresscode<br />
„Sexy, Fetish, elegantes<br />
Schwarz, Black Glamour“ zu entsprechen –<br />
die meisten tragen schwarze Unterhosen,<br />
Lendenschurz oder sehr dunkle Anzüge; einige<br />
aber auch, so wie Sven, schwarze Latex-Suits,<br />
die sogar das Gesicht bedecken.<br />
Sie sehen darin aus wie Kampfschwimmer.<br />
Der DJ spielt Progressive House, Trance<br />
und Techno, auf die hohe Wand über seinem<br />
Pult werden von der Empore aus Pornos<br />
projiziert. In <strong>Berlin</strong> gibt es einige solcher<br />
Orte, die harte Beats mit sexuellem<br />
Anything Goes zusammenbringen, Svenja<br />
und Frank waren auch schon im „Kit Kat<br />
Club“ oder dem ewigen „Berghain“. Seit<br />
ein, zwei Jahren gehen sie aber nur noch<br />
ins Insomnia: „Es ist hier nicht so groß und<br />
irgendwie familiärer als in den anderen Läden“,<br />
sagt Svenja.<br />
An der Bar treffen sie ein Pärchen im<br />
SM-Look, man kennt einander von den<br />
vielen Besuchen. Die Unterhaltung ist weniger<br />
exotisch als das Aussehen der vier, es<br />
geht um Urlaub und Unterhaltungselektronik.<br />
Svenja arbeitet an vier Tagen in der<br />
Woche als Kundenberaterin, Frank macht<br />
irgendetwas mit Computern. Ihre Kleinstadt<br />
in der Lüneburger Heide sei zwar „ein<br />
bisschen langweilig und sehr, sehr übersichtlich,<br />
aber zum Leben super“. <strong>Berlin</strong>?<br />
„Nichts für uns, auf Dauer sowieso nicht“,<br />
sagt Svenja. Frank fügt hinzu: „viel zu anonym“.<br />
Drei Stunden später haben die beiden<br />
noch einmal Sex im Whirlpool, ein<br />
paar Männer schauen ihnen dabei zu.<br />
Dann geht es zurück in die Umkleide<br />
und mit dem Auto nach Hause. Nächste<br />
Woche kommen sie wieder.<br />
Ein Pirat und der Flughafen<br />
Martin Delius „ist ein deutscher Politiker<br />
der Piratenpartei“. So steht es im Wikipedia-Eintrag<br />
über den 29-Jährigen. Delius<br />
gehört zu den 15 Piraten, die nach der zurückliegenden<br />
Landtagswahl ins <strong>Berlin</strong>er<br />
Abgeordnetenhaus einzogen. 8,9 Prozent<br />
der Wählerstimmen hat die Partei im September<br />
2011 geholt – fast fünf Mal mehr<br />
als die FDP. Für die Piraten war das der<br />
Auftakt zu einer Erfolgsserie in anderen<br />
Bundesländern, inzwischen ist der Trend<br />
gebrochen. Delius lässt sich davon nicht<br />
verunsichern.<br />
Wahlanalysen zeigen, dass 80 Prozent<br />
der <strong>Berlin</strong>er Piraten-Wähler ihre Stimme<br />
22 <strong>Cicero</strong> 5.2013
aus Unzufriedenheit über die anderen Parteien<br />
gegeben haben. Das sagt mehr aus<br />
über die Stadt als über die Partei. Dabei<br />
war damals der verkorkste Hauptstadtflughafen<br />
noch überhaupt kein Thema. Inzwischen<br />
gibt es dazu sogar einen Untersuchungsausschuss,<br />
und dessen Vorsitzender<br />
heißt Martin Delius. Der studierte Physiker<br />
hat sich tief in die Materie eingearbeitet<br />
– und je tiefer er kam, desto erstaunter<br />
war er über die Ignoranz der maßgeblich<br />
am Flughafenbau Beteiligten.<br />
Über das Projekt spricht er mit einer<br />
Ruhe und Abgeklärtheit, die fast schon an<br />
Zynismus grenzt. Seine Analysen lassen den<br />
Naturwissenschaftler erkennen. „Systemversagen“<br />
nennt Delius, was dazu geführt<br />
hat, dass der Rest der Republik über die<br />
Hauptstadt und ihren unfertigen Flughafen<br />
spottet. „Ganz allgemein gesagt, hatte<br />
der gesamte Planungsprozess derart viele<br />
Sollbruchstellen, dass gar nichts anderes<br />
passieren konnte als das jetzige Desaster.“<br />
Die <strong>Berlin</strong>-Brandenburger Flughafengesellschaft,<br />
Betreiberin der bestehenden Flughäfen<br />
Tegel und Schönefeld, sei von Anfang<br />
an mit dem Neubauprojekt überfordert<br />
gewesen, weil es ihr dafür an Erfahrung<br />
gefehlt habe. Die Kompetenzen, sagt Delius,<br />
seien derartig verwischt worden, dass<br />
die externen Kontrolleure „spätestens seit<br />
dem Jahr 2005 die Controlling-Berichte<br />
gemeinsam mit der Geschäftsführung der<br />
Flughafengesellschaft geschrieben“ hätten.<br />
Eine unabhängige Überprüfung des Baufortschritts<br />
habe es also nicht gegeben.<br />
Stattdessen sei etwas eingetreten, das<br />
Delius als „Premiereneffekt“ bezeichnet,<br />
wie man ihn aus dem Theater kennt: Je<br />
näher die Premiere rückt, desto mehr Abstriche<br />
macht der Regisseur von einer Inszenierung,<br />
um den Aufführungstermin<br />
einhalten zu können. Am Schluss hätten<br />
die <strong>Berlin</strong>er Flughafenbauherren nur noch<br />
die Airport-Eröffnung im Kopf gehabt und<br />
den Sinn für die technischen Realitäten verloren.<br />
Eine Art kollektive Autosuggestion.<br />
„Im Mai vergangenen Jahres, kurz vor Bekanntgabe<br />
der ersten Verschiebung, war das<br />
Hauptthema in der Aufsichtsratssitzung die<br />
Frage, wer bei der feierlichen Eröffnung neben<br />
der Bundeskanzlerin sitzen darf.“<br />
Inzwischen hält Delius alles für möglich.<br />
Sogar, dass der Hauptstadtflughafen<br />
nie fertig wird. „Die Tatsache, dass der<br />
technische Geschäftsführer der Flughafengesellschaft<br />
immer und immer wieder<br />
betont, es sei möglich, dieses Bauprojekt<br />
zu einem guten Ende zu bringen, sagt doch<br />
schon alles“, unkt Delius und setzt dazu ein<br />
leicht sardonisches Lächeln auf.<br />
Natürlich geht es ihm nicht nur um<br />
die Sache, sondern auch um Politik. Die<br />
Piraten fordern Klaus Wowereits Rücktritt,<br />
und zwar als Stadtoberhaupt. „Wowereit ist<br />
völlig überfordert mit der Situation, mit<br />
ihm sind in <strong>Berlin</strong> keine sinnvollen Projekte<br />
mehr zu machen. Allein schon, weil<br />
er im Senat keine Stärke mehr hat. So ein<br />
Regierender Bürgermeister ist schädlich für<br />
die Stadt.“ Systemversagen hin oder her.<br />
Ist das Flughafendebakel womöglich<br />
sogar ein Beleg dafür, dass das System der<br />
gesamten Hauptstadt nicht funktioniert?<br />
Ist <strong>Berlin</strong> überfordert von den Ansprüchen<br />
an sich selbst? Darauf antwortet Delius<br />
kühl: „Ich gehe davon aus, dass an anderer<br />
Stelle in Deutschland genau dasselbe<br />
passiert.“<br />
Baustelle <strong>Berlin</strong><br />
„<strong>Berlin</strong> hat viele Baustellen. Schön, dass<br />
wenigstens der Strom problemlos fließt.“<br />
Mit diesem Slogan wirbt der schwedische<br />
Energiekonzern Vattenfall derzeit in einer<br />
großen Kampagne für Sympathie bei der<br />
Hauptstadtbevölkerung. Unter dem Baustellen-Spruch<br />
ist auf den riesigen Vattenfall-Plakaten<br />
ein kleiner Junge abgebildet,<br />
der aus Holzklötzen einen wackeligen<br />
Turm baut.<br />
In <strong>Berlin</strong> ist Vattenfall der sogenannte<br />
Grundversorger; wer sich nicht um einen<br />
anderen Anbieter kümmert, bekommt<br />
seinen Strom automatisch von dort. Aus<br />
Geldnot verkaufte der <strong>Berlin</strong>er Senat im<br />
Jahr 1997 seinen Stromversorger Bewag für<br />
umgerechnet 1,17 Milliarden Euro. Inzwischen<br />
hat sich der Wind wieder gedreht, etliche<br />
lokale Initiativen wollen die Privatisierung<br />
rückgängig machen. Geht es nach<br />
dem „<strong>Berlin</strong>er Energietisch“, soll <strong>Berlin</strong><br />
wieder ein eigenes Stadtwerk bekommen.<br />
Auch das Stromnetz soll rekommunalisiert<br />
werden, wenn Ende nächsten Jahres<br />
der entsprechende Konzessionsvertrag zwischen<br />
dem Land <strong>Berlin</strong> und Vattenfall ausläuft.<br />
Im Februar hat der „Energietisch“<br />
deshalb eine Unterschriftensammlung gestartet,<br />
mit der er ein Volksbegehren erreichen<br />
will, um seine Pläne zu verwirklichen.<br />
Der Politik ist das Vorhaben nicht<br />
ganz geheuer. Allein schon deshalb, weil<br />
das von der Senatsverwaltung für Finanzen<br />
in Gang gesetzte Verfahren für die Neukonzessionierung<br />
des <strong>Berlin</strong>er Stromnetzes<br />
in Konflikt mit einem erfolgreichen Volksbegehren<br />
geraten würde – und <strong>Berlin</strong> eine<br />
juristische Baustelle mehr hätte.<br />
Bei Vattenfall traut man der Stadt ohnehin<br />
nicht zu, dass sie allein in der Lage<br />
wäre, die Stromversorgung sicherzustellen.<br />
Deswegen die Plakatkampagne, mit der<br />
unverhohlen auf die derzeit größte <strong>Berlin</strong>er<br />
Baustelle angespielt wird. Nach dem<br />
Motto: Wer schon keinen Flughafen hinbekommt,<br />
sollte sich nicht auch noch als<br />
Energieversorger und Stromnetzbetreiber<br />
versuchen. Aus Sicht von Vattenfall stellt<br />
sich die <strong>Berlin</strong>er Landespolitik nämlich<br />
so dar: ein kleiner Junge, der aus Bauklötzen<br />
einen wackeligen Turm zu errichten<br />
versucht.<br />
Hunde im Dialog<br />
Als „Hundehasser“ will Martin Goldbach<br />
auf keinen Fall gesehen werden. Er bevorzugt<br />
die Bezeichnung „Hunde-Skeptiker“.<br />
Goldbach, 40 Jahre alt, ist freischaffender<br />
Werbeberater und Vater von zwei kleinen<br />
Kindern – einem zehnjährigen Jungen und<br />
einem sechs Jahre alten Mädchen.<br />
Die Familie wohnt an der Krummen<br />
Lanke, einem See am Rande des Grunewalds.<br />
In dieser Gegend spürt man die<br />
Stadt kaum; die vielen Bäume, Rasenflächen<br />
und das nahe Gewässer wirken beinahe<br />
wie ein ländliches Idyll. Für Kinder<br />
eigentlich ideal. Wenn da nicht die Hunde<br />
wären. Goldbachs Tochter wurde vor einiger<br />
Zeit beim Spielen neben dem elterlichen<br />
Grundstück von einem frei laufenden<br />
Tier umgerannt und fürchtet sich seither<br />
vor Hunden. Und im vergangenen Sommer,<br />
die Goldbachs saßen gerade beim<br />
Ein Hund<br />
überrumpelte<br />
Martin Goldbach<br />
beim Picknick, das<br />
Herrchen rief: „Oh<br />
Gott, er verträgt<br />
keine Wurst!“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 23
T i t e l<br />
Picknick an der Krummen Lanke, kam<br />
wieder ein Hund angestürmt und tat Anstalten,<br />
sich über ihre mitgebrachten Speisen<br />
herzumachen. Wenig später folgte der<br />
Hundebesitzer und rief der Familie schon<br />
von weitem zu: „Um Gottes willen, lassen<br />
Sie ihn bloß keine Wurst fressen! Die verträgt<br />
er nicht!“<br />
Es sind Erlebnisse wie diese, die Martin<br />
Goldbach zu <strong>Berlin</strong>s inzwischen bekanntestem<br />
Hunderebellen haben werden<br />
lassen. Im September vergangenen Jahres<br />
hat die Senatsverwaltung nämlich den sogenannten<br />
„Bello-Dialog“ ins Leben gerufen,<br />
bei dem Hundehalter und von Hunden<br />
genervte Bürger ins Gespräch kommen<br />
und zu irgendeinem Kompromiss finden<br />
sollten. Denn die <strong>Berlin</strong>er Hunde genießen<br />
traditionell größere Freiheiten als ihre<br />
Artgenossen in anderen deutschen Städten;<br />
der Leinenzwang wird hier eher als<br />
unverbindliche Empfehlung wahrgenommen.<br />
Und wie weit die Pflicht zur Mitnahme<br />
von Hundekot reicht, das merken<br />
Fußgänger ziemlich schnell am Zustand ihrer<br />
Schuhsohlen.<br />
Goldbach machte sich also auf ins<br />
Schöneberger Rathaus, um zunächst als<br />
Zuschauer an der konstituierenden Sitzung<br />
des „Bello-Dialogs“ teilzunehmen.<br />
Er traf dort auf eine übermächtige Fraktion<br />
von Hundebesitzern, die um ihre<br />
ungeschriebenen Privilegien fürchteten.<br />
Immerhin wurde Martin Goldbach wenig<br />
später zum offiziellen Teilnehmer am<br />
„Bello-Dialog“ ernannt. Es war eine ernüchternde<br />
Erfahrung.<br />
Denn eigentlich, sagt Goldbach,<br />
bräuchte es solche Bürgerforen überhaupt<br />
nicht. Wenn nur die geltenden Vorschriften<br />
zur Leinenpflicht und der Mitnahme<br />
von Hundekot eingehalten würden, gäbe<br />
es auch keine Probleme. Diesen Einwand<br />
trug er dann auch dem im Bello-Dialog<br />
federführenden Justizsenator vor, Thomas<br />
Heilmann von der CDU. Dessen Antwort<br />
fiel, zumal für einen Juristen, bemerkenswert<br />
aus: Laut Protokoll „erläuterte Herr<br />
Heilmann, dass die Aufbringung von Finanzmitteln<br />
zur Durchsetzung von Regelungen<br />
des Hundegesetzes in Konkurrenz<br />
zur Bewältigung anderer öffentlicher<br />
Aufgaben steht“. Mit anderen Worten: In<br />
<strong>Berlin</strong> fehlt das Geld, um die Hunde an<br />
die Leine zu bringen. Und das ist auch gut<br />
so, zumindest aus Sicht der Hundebesitzer.<br />
Zwar sind Hunde nur in 5 Prozent der<br />
<strong>Berlin</strong>er Haushalte zu Hause, doch deren<br />
Gewohnheitsrecht nach Laisser-faire-Manier<br />
steht über dem Gesetz.<br />
Goldbach wird nicht müde, diese Zustände<br />
öffentlich anzuprangern. Er glaubt,<br />
für die Mehrheit der Menschen in seiner<br />
Stadt zu sprechen, wenn er sagt, als<br />
„Unsere<br />
Infrastruktur<br />
ist auf dem<br />
Weg in die<br />
DDR“<br />
Heinz Buschkowsky<br />
Fußgänger in <strong>Berlin</strong> gewöhne man sich einen<br />
Blick nach unten an, um nicht ständig<br />
in Hundehaufen zu treten. Goldbach<br />
fragt sich auch, warum der Justizsenator<br />
mit dem in <strong>Berlin</strong> üblichen Hinweis auf<br />
knappe Haushaltsmittel argumentiere,<br />
wo doch gleichzeitig rund 60 Prozent der<br />
Hunde steuerlich nicht gemeldet seien.<br />
Dadurch würden der Stadt jährliche Einnahmen<br />
in Höhe von 19 Millionen Euro<br />
entgehen. „Ich bin gegenüber den reflexartigen<br />
Verweisen auf <strong>Berlin</strong>s Finanzlage inzwischen<br />
etwas empfindlich. Insbesondere<br />
wenn damit eigenes Nichtstun gerechtfertigt<br />
und zugleich die allgemeine <strong>Berlin</strong>er<br />
Schluffigkeit auch noch als Standortfaktor<br />
überhöht wird“, sagt Goldbach.<br />
Der „Bello-Dialog“ hat nach fünf Sitzungen<br />
übrigens die Einführung einer<br />
Sachkundeprüfung für Hundehalter beschlossen;<br />
erfolgreich geprüfte Hunde<br />
sollen in ausgewiesenen Grünflächen die<br />
Möglichkeit zum Freilauf erhalten. Dass<br />
diese Regelung jemals kontrolliert wird, ist<br />
nicht zu erwarten.<br />
Buschkowskys Neukölln<br />
Das Rathaus Neukölln ist ein imposantes<br />
Bauwerk im Stil der deutschen Neorenaissance.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet,<br />
wird es dominiert von einem 68 Meter<br />
hohen Turm, auf dessen Spitze sich eine<br />
Statue der Glücksgöttin Fortuna befindet.<br />
Wer Neukölln nur aus der aufgeregten Berichterstattung<br />
über Jugendgewalt, migrantische<br />
Parallelgesellschaften und Integrationsverweigerer<br />
kennt, dürfte überrascht<br />
sein, wie ruhig und gesittet es hier zugeht.<br />
Zumindest an einem Donnerstagvormittag.<br />
Da unterscheidet sich die Karl-Marx-<br />
Straße vor dem Rathaus nicht sehr von anderen<br />
<strong>Berlin</strong>er Einkaufsmeilen mit ihren<br />
Coffee-to-go-Bäckereien an jeder Ecke.<br />
Heinz Buschkowskys Arbeitszimmer<br />
liegt im ersten Stock, auf dem Besprechungstisch<br />
steht eine große Sanduhr. Ein<br />
unmissverständlicher Hinweis darauf, dass<br />
der Hausherr nicht viel Zeit hat. Tatsächlich<br />
ist Buschkowsky ein viel beschäftigter<br />
Mann. Als Neuköllner Bezirksbürgermeister<br />
ist er in den Medien omnipräsent, wenn<br />
es mal wieder um Themen wie Zuwanderung<br />
oder Armut geht. Außerdem schreibt<br />
er Kolumnen für die Bild-Zeitung; sein<br />
Buch „Neukölln ist überall“ stand monatelang<br />
auf den Bestsellerlisten. Der Mann<br />
24 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Andrej DAllmann (Autor)<br />
ist eine Berühmtheit. Und dafür bekannt,<br />
kein Blatt vor den Mund zu nehmen.<br />
Im Zuwanderer-Kiez Neukölln hat<br />
ihm seine direkte, mitunter ins Schroffe<br />
neigende Art nicht geschadet, im Gegenteil.<br />
Bei der letzten Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung<br />
holte Buschkowsky<br />
knapp 43 Prozent – die Hauptstadt-SPD<br />
hingegen kam bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus<br />
nur auf 27,4 Prozent der<br />
Wählerstimmen. Trotzdem beäugen viele<br />
<strong>Berlin</strong>er Sozialdemokraten ihren erfolgreichen<br />
Genossen mit Argwohn. „Spalter“,<br />
„Panikmacher“, „Populist“: Diese Begriffe<br />
fallen häufig, wenn in den besseren Kreisen<br />
der <strong>Berlin</strong>er SPD über Buschkowsky<br />
geredet wird. Sogar das Wort „Rassist“ ist<br />
manchmal zu hören.<br />
Wenn der vermeintliche Rassist Buschkowsky<br />
über die Probleme der Stadt im<br />
Allgemeinen und die seines Bezirks im Besonderen<br />
spricht, dann klingt das so: „Ich<br />
möchte gern, dass alle Kinder, die in Neukölln<br />
geboren werden, die gleichen Chancen<br />
auf ein eigenständiges Leben haben,<br />
wie ich sie hatte.“ Dazu muss man wissen:<br />
Heinz Buschkowsky ist als Sohn eines<br />
Schlossers und einer Sekretärin in einer<br />
Einzimmerwohnung groß geworden, die<br />
noch dazu im Keller lag. „Hocharbeiten“<br />
ist bei ihm also im Wortsinn zu verstehen.<br />
Mit Laisser-faire, Ausländerromantik oder<br />
Schnorrermentalität sollte ihm deshalb besser<br />
keiner kommen.<br />
Buschkowsky macht Politik nach dem<br />
Motto „Anpacken statt Rumlabern“ – und<br />
kommt damit gut an, zumindest bei der<br />
Neuköllner Bevölkerung. Die ehemals<br />
skandalumwitterte Rütli-Schule etwa<br />
wurde auf Vordermann gebracht und in<br />
ein Leuchtturmprojekt namens „Campus<br />
Rütli“ verwandelt. Auf solche Erfolge ist<br />
Buschkowsky stolz. Zur Verzweiflung dagegen<br />
treiben ihn realitätsblinde Schönredner:<br />
„Mich stört an der <strong>Berlin</strong>er Politik,<br />
dass sie seit mindestens 15 Jahren die<br />
zunehmende soziale Spaltung der Stadt<br />
schlichtweg ignoriert oder kleinredet. Der<br />
verstorbene Soziologe Hartmut Häußermann<br />
und ich in seinem Fahrwasser konnten<br />
uns den Mund darüber fusselig reden,<br />
dass in <strong>Berlin</strong> an die 700 000 Menschen<br />
in von Ausgrenzung bedrohten Gebieten<br />
leben. Es war, als ob wir den Mond anbellten.“<br />
Anstatt „Hunderte von Millionen<br />
Euro für eine Landesbibliothek oder<br />
Schlampereien beim Flughafenbau aufzuwenden,<br />
sollte man das Geld nehmen, um<br />
Ganztagsschulen für alle Kinder einzurichten<br />
und eine Kindergartenpflicht mit ausreichenden<br />
Plätzen einzuführen“.<br />
Wenn Buschkowsky erst einmal die<br />
richtige Betriebstemperatur erreicht hat, ist<br />
nichts und niemand vor seinem Zorn sicher,<br />
der sich in der typischen <strong>Berlin</strong>er Schnodderigkeit<br />
Luft macht. Die <strong>Berlin</strong>er Verwaltung?<br />
„Nicht sehr leistungsfähig und kreativ.“<br />
Und die <strong>Berlin</strong>er Parteienlandschaft<br />
erst! Über die Grünen, deren Koalitionspläne<br />
mit Wowereits SPD nach der zurückliegenden<br />
Wahl am Streit über ein Straßenbauprojekt<br />
scheiterten, sagt Buschkowsky:<br />
„Wer wegen 300 Meter Autobahn den Anspruch<br />
aufgibt, die Stadt zu gestalten, bedarf<br />
zweifellos einer politischen Therapie.“<br />
Die CDU trifft es nicht ganz so hart; sie<br />
sei „ohne Zweifel taktisch klüger und regierungsorientierter.<br />
Allerdings hat sie auf der<br />
Suche nach den richtigen Köpfen starken<br />
Verschleiß“. Die Liberalen dagegen sind aus<br />
Neuköllner Sicht kaum noch einer Erwähnung<br />
wert: „Die FDP ist in <strong>Berlin</strong> bis zur<br />
Unkenntlichkeit deformiert.“ Und Buschkowskys<br />
eigene Partei? „Die SPD weiß, dass<br />
es irgendwann eine Zeit nach Wowereit geben<br />
wird. Das Personaltableau dafür quillt<br />
nicht unbedingt über.“<br />
Heinz Buschkowskys Zustandsbeschreibung<br />
seiner Heimatstadt kann ganz<br />
schön deprimierend sein. Wer ihm zuhört,<br />
könnte fast glauben, <strong>Berlin</strong> läge irgendwo<br />
in der Dritten Welt. Allein die<br />
Straßen! „Sie sind in einem miserableren<br />
Zustand als in Ostberlin anno 1989. Unsere<br />
Infrastruktur ist auf dem Weg in die<br />
DDRisierung.“<br />
Gegen Ende seiner Suada wird er dann<br />
doch noch optimistisch: „Der Tourismus<br />
boomt. Die Welt interessiert sich für uns.<br />
Ich glaube, dass <strong>Berlin</strong> eine gute Zukunft<br />
hat, wenn es seine Preziosen putzt und nicht<br />
verramscht. Ich denke da an den Flughafen<br />
Tempelhof und die East-Side-Gallery.“<br />
Deutschlands Hauptstadt ein Schmelztiegel<br />
für Zuwanderer aus aller Herren Länder?<br />
Buschkowsky fände es gut. Allerdings:<br />
„Bunt, klug und modern ist kein Widerspruch<br />
zu arm und sexy.“<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretender<br />
Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 25
T i t e l<br />
„<strong>Berlin</strong> wird gezielt<br />
schlechtgeredet“<br />
Was reizt ihn an <strong>Berlin</strong>? Und was will er überhaupt noch in seinem Amt nach dem<br />
Flughafendesaster? Klaus Wowereit über Pannen und Partys, Geld und Sexyness,<br />
über den Dorfteich von Lichtenrade, das Berghain und den Boom seiner Stadt<br />
Klaus Wowereit kommt zur Tür seines<br />
Amtszimmers im Roten Rathaus. Der<br />
Raum ist ein kleines Museum. In Schränken<br />
werden hinter Glas Vasen verwahrt, Figürchen<br />
und ein signiertes Bild der Queen.<br />
In der Mitte des Zimmers steht rechter<br />
Hand die geschwungene Skulptur „Mitternacht“<br />
aus Messing und Zinn und links ein<br />
Karussellpferd in Originalgröße, das hat er<br />
vom Schaustellerverband. Hinterm Schreibtisch<br />
auf einem Regal sind elf kleine <strong>Berlin</strong>-<br />
Bären aufgereiht, daneben zwei Teddybären.<br />
An der Wand leuchtet ein Gemälde, Leim<br />
auf Leinwand, Rainer Fetting: „Drummer<br />
und Gitarrist“. Viele Dinge, über die ein<br />
Regierender Bürgermeister mit Besuchern<br />
plaudern kann, und welche, mit denen<br />
er vielleicht etwas über sich erzählen will.<br />
Aber draußen wummert und hämmert es,<br />
vor dem Fenster schwingt ein Kran hin und<br />
her, und da ist Wowereit schon wieder beim<br />
Thema Baustelle gelandet, auch wenn hier<br />
bloß ein neuer U-Bahnhof gebaut werden<br />
soll und kein Flughafen.<br />
Bei Ihnen vor dem Fenster ist es ja ganz<br />
schön laut.<br />
Das wird nächste Woche noch lauter,<br />
wenn hier eine 22 Meter hohe<br />
Wand errichtet wird. Es wird im Zuge<br />
des U‐Bahn-Baus Betonarbeiten geben,<br />
und damit die Rathausfassade<br />
nicht beschädigt wird, bauen sie eine<br />
Spritz-Schutzwand.<br />
Vor dem Fenster?<br />
Vor allen Fenstern, für die gesamte<br />
Fassade.<br />
Dann ist es zwei Jahre dunkel?<br />
Die Plane soll licht- und luftdurchlässig<br />
sein, so jedenfalls die Ankündigung. Und<br />
sie soll für zwei Monate vor dem Haus<br />
stehen.<br />
Wowereit nimmt auf dem Sofa vor dem<br />
Fenster Platz und lehnt sich zurück.<br />
Herr Wowereit, 2011 haben Sie die Wahl<br />
mit dem Slogan „<strong>Berlin</strong> verstehen“ gewonnen.<br />
Verstehen Sie <strong>Berlin</strong> noch?<br />
Ich lebe seit meiner Geburt hier. Natürlich<br />
ist die Stadt im Wandel. Täglich verändert<br />
sich etwas, da muss man sich auf<br />
dem Laufenden halten. Aber <strong>Berlin</strong> und<br />
ich, wir verstehen uns noch.<br />
In den vergangenen Monaten hat Ihr Ansehen<br />
gelitten. Nach einer Meinungsumfrage<br />
halten Sie nur noch 47 Prozent der Bürger<br />
dieser Stadt für kompetent.<br />
Im Moment wird meine Arbeit natürlich<br />
stark mit der Entwicklung beim Flughafen<br />
identifiziert. Der ist fast schon ein<br />
Jahr lang das zentrale Thema – die berühmte<br />
F-Frage. Sie hat Themen wie<br />
Wirtschaft, Arbeit, Integration und Bildung<br />
in der Wahrnehmung zurückgedrängt.<br />
Da wundert es mich nicht, dass<br />
viele Menschen unzufrieden sind. Mit<br />
dem, was auf dem Flughafen passiert, bin<br />
ich ja selber nicht zufrieden.<br />
Sie halten sich selbst auch nur zu 47 Prozent<br />
für kompetent?<br />
Ach, das sind Wortspiele. Es ist ja gar<br />
nicht die Frage, wie ich es empfinde.<br />
Sondern, dass ich für alles verantwortlich<br />
gemacht werde, was am Flughafen<br />
passiert.<br />
Sie fühlen sich ungerecht behandelt?<br />
Sagen wir es mal so: Als es gut lief, ist<br />
das nicht mir zugeschrieben worden. Die<br />
großen Erfolge zum Beispiel in der Akquise<br />
von Airlines, die vom BER starten,<br />
waren selbstverständlich. Das hat<br />
sich total geändert. Aber wenn man an<br />
der Spitze des Aufsichtsrats gestanden<br />
hat, muss man die Kritik aushalten. Dass<br />
sich andere vom Acker gemacht haben<br />
und nicht zu ihrer Verantwortung standen,<br />
als es schieflief, fand ich allerdings<br />
schon seltsam.<br />
Dass die F-Frage immer nur Ihnen gestellt<br />
wird und beispielsweise nicht Peter<br />
Ramsauer, dem Bundesverkehrsminister?<br />
Der Bund hat zwar etwas weniger Anteile<br />
an der Flughafengesellschaft als <strong>Berlin</strong><br />
und Brandenburg, aber gegen ihn können<br />
keine Entscheidungen fallen. Deshalb<br />
hat auch er die volle Verantwortung.<br />
Vor der geplanten Eröffnung vor einem<br />
Jahr gab es doch schon das Gerangel, wie<br />
die Bundeskanzlerin platziert wird und<br />
wo Herr Ramsauer sitzt, das Vorausprotokoll<br />
des Bundeskanzleramts war auch<br />
schon da. Ganz wichtig auch, dass alle<br />
gut in die „Tagesschau“ kommen. Als die<br />
Eröffnung dann abgesagt werden musste,<br />
waren plötzlich alle weit weg.<br />
Dann drehen wir die F-Frage mal um: Wofür<br />
sind Sie denn nicht verantwortlich?<br />
Foto: Lene Münch für <strong>Cicero</strong><br />
26 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Für das konkrete Bauen. Das müssen<br />
die Ingenieure machen. Und schrauben<br />
müssen die Handwerker. Wir haben die<br />
Bauaufträge ja auch nicht an No-Names<br />
vergeben, sondern an renommierte<br />
Firmen. Dazu waren Heerscharen von<br />
Planungsbüros, Controllern und Beratern<br />
unterwegs. Dass trotzdem derartige<br />
technische Probleme auftauchen, kann<br />
man doch nicht einfach bei der Politik<br />
abladen.<br />
Aber die muss jemand führen. Und der<br />
Aufsichtsrat ist dafür da, die Geschäftsführung<br />
zu berufen. Warum haben Sie<br />
den Chef der Flughafengesellschaft nicht<br />
schon entlassen, nachdem Sie vor einem<br />
Jahr, im Mai 2012, den Eröffnungstermin<br />
erstmals verschieben mussten?<br />
Der Geschäftsführer, den Sie meinen –<br />
Herr Schwarz –, war nur Sprecher der<br />
Geschäftsführung. Seine Zuständigkeit<br />
lag insbesondere auf dem kaufmännischen<br />
Gebiet und beim Betrieb der bisherigen<br />
Flughäfen. Die Verantwortung fürs<br />
Bauen trug nach dem damaligen Konstrukt<br />
ein anderer Geschäftsführer, Herr<br />
Körtgen. Den haben wir sofort entlassen.<br />
Alle Pferde gleichzeitig auszutauschen,<br />
wäre falsch gewesen.<br />
Das heißt: Sie sind als Aufsichtsratsvorsitzender<br />
gar nicht wegen dieses atemberaubenden<br />
Desasters, sondern nur aus<br />
taktischen Gründen zurückgetreten?<br />
Nein. Nach der erneuten Verschiebung<br />
Anfang Januar dieses Jahres, als der vom<br />
neu geholten Geschäftsführer Amann<br />
festgelegte Eröffnungstermin vom selben<br />
Herrn Amann schon wieder gestrichen<br />
wurde, war es notwendig zu zeigen: Es<br />
gibt drei Gesellschafter, die gemeinsam in<br />
der Verantwortung stehen. Deshalb hat<br />
Matthias Platzeck den Vorsitz des Aufsichtsrats<br />
übernommen.<br />
Klaus Wowereit, 59, seit<br />
fast zwölf Jahren <strong>Berlin</strong>s<br />
Regierender Bürgermeister, hier<br />
in seinem Amtszimmer durch<br />
die Skulptur „Mitternacht“<br />
hindurch fotografiert<br />
Haben Sie überhaupt ernsthaft überlegt,<br />
nicht bloß den Aufsichtsratsvorsitz abzugeben,<br />
sondern als Regierender Bürgermeister<br />
zurückzutreten?<br />
Ich habe überlegt, welche Konsequenzen<br />
ich ziehe – auch persönlich.<br />
Was hat Sie bewogen, am Amt<br />
festzuhalten?<br />
Verantwortung. Ich bin gewählt für diese<br />
Legislaturperiode.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 27
I m p r e s s u m<br />
verleger Michael Ringier<br />
chefredakteur Christoph Schwennicke<br />
Stellvertreter des chefredakteurs<br />
Alexander Marguier<br />
Redaktion<br />
Textchef Georg Löwisch<br />
Ressortleiter Lena Bergmann (Stil), Judith Hart<br />
(Weltbühne), Dr. Alexander Kissler (Salon), Til Knipper (Kapital)<br />
Constantin Magnis (Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
politischer Chefkorrespondent Hartmut Palmer<br />
Assistentin des Chefredakteurs Monika de Roche<br />
Redaktionsassistentin Sonja Vinco<br />
Publizistischer Beirat Heiko Gebhardt,<br />
Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer, Jacques Pilet,<br />
Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
Art director Kerstin Schröer<br />
Bildredaktion Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
Produktion Utz Zimmermann<br />
Verlag<br />
geschäftsführung<br />
Rudolf Spindler<br />
Vertrieb und unternehmensentwicklung<br />
Thorsten Thierhoff<br />
Redaktionsmarketing Janne Schumacher<br />
Abomarketing Mark Siegmann<br />
nationalvertrieb/leserservice<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
Anzeigen-Disposition Erwin Böck<br />
herstellung Lutz Fricke<br />
grafik Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
druck/litho Neef+Stumme, premium printing<br />
GmbH & Co.KG, Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
anzeigenleitung (verantw. für den Inhalt der Anzeigen)<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
Verkaufsbüro Hamburg Jörn Schmieding-Dieck<br />
anzeigenverkauf online Kerstin Börner<br />
anzeigenmarketing Inga Müller<br />
anzeigenverkauf buchmarkt<br />
Thomas Laschinski, PremiumContentMedia<br />
Dieffenbachstraße 15 (Remise), 10967 <strong>Berlin</strong><br />
Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
verkaufte auflage 83 335 (IVW Q1/2013)<br />
LAE 2012 93 000 Entscheider<br />
reichweite 390 000 Leser<br />
<strong>Cicero</strong> erscheint in der<br />
ringier Publishing gmbh<br />
Friedrichstraße 140, 10117 <strong>Berlin</strong><br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
redaktion Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
verlag Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
Anzeigen Tel.: +49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
gründungsherausgeber Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung auf<br />
Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur nach<br />
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2013, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
eine publikation der ringier gruppe<br />
Sie haben sich angeblich 48 Stunden<br />
zurückgezogen, bevor Sie gesagt haben,<br />
dass Sie weitermachen. Was lief<br />
da? Mussten Ihre Parteifreunde Sie in<br />
Krisenberatungen zum Weitermachen<br />
überreden?<br />
Das habe ich mit mir selber beraten. Und<br />
bin dann zu der Entscheidung gekommen,<br />
im Amt zu bleiben.<br />
Wie läuft so eine Selbstberatung ab?<br />
Es gibt keine Live-Übertragung meines<br />
Privatlebens, und dabei bleibt es.<br />
Werden Sie denn zur Eröffnung des<br />
Flughafens gehen, falls dieser Termin je<br />
stattfindet?<br />
Der Flughafen wird eröffnet werden, und<br />
ich werde dabei sein – als Regierender<br />
Bürgermeister.<br />
Ein blöder Termin für Sie. Matthias Platzeck,<br />
der Aufsichtsratschef, und Hartmut<br />
Mehdorn, der Chef der Flughafengesellschaft,<br />
werden sich als diejenigen präsentieren<br />
können, die rausgerissen haben,<br />
was Klaus Wowereit fast verbockt hätte.<br />
Das ist genau diese falsche Art der Betrachtung,<br />
die weder angemessen noch<br />
fair ist. Erstens geht es nicht um Eitelkeiten.<br />
Zweitens tragen alle drei Gesellschafter<br />
gemeinsam die Verantwortung –<br />
egal, wer den Aufsichtsratsvorsitzenden<br />
stellt.<br />
Service<br />
Liebe Leserin, lieber leser,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
abonnement und nachbestellungen<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
Anregungen und Leserbriefe<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 <strong>Berlin</strong><br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. *Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Versand im<br />
Inland, Auslandspreise auf Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland<br />
sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des<br />
Verlags statthaft.<br />
einzelpreis<br />
D: 8,– €, CH: 12,50 CHF, A: 8,– €<br />
jahresabonnement (zwölf ausgaben)<br />
D: 84,– €, CH: 132,– CHF, A: 90,– €*<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €*<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.<br />
Teilen Sie den Eindruck, dass die F-Frage<br />
vielen <strong>Berlin</strong>ern peinlich ist?<br />
Mein Eindruck ist, dass <strong>Berlin</strong>s Ruf auch<br />
sehr gezielt schlechtgeredet wird. Aber<br />
das sind nicht die Bürgerinnen und Bürger,<br />
sondern andere.<br />
Nennen Sie mal diese anderen!<br />
Da geht es nicht zuletzt um die Interessen<br />
anderer Regionen. Mein Eindruck<br />
bei Auslandsreisen, oder wenn ich Besucher<br />
hier habe, ist: Da steht mitnichten<br />
das Wort mit dem F im Zentrum. Das<br />
ist wahrlich kein Glanzstück gewesen,<br />
aber die Attraktivität der Stadt hat unter<br />
den Problemen mit dem BER nicht gelitten.<br />
<strong>Berlin</strong> ist so attraktiv wie nie – das<br />
sehen Sie sowohl an den Tourismuszahlen<br />
als auch an der Bevölkerungsentwicklung.<br />
Und inzwischen auch an den Wirtschaftsdaten,<br />
beim Wachstum und bei<br />
der Zahl der Jobs.<br />
28 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Nicht-<strong>Berlin</strong>er finden die Stadt interessant<br />
und spotten trotzdem gern, dass hier<br />
nichts klappt: Faszinierend, aber chaotisch,<br />
das ist doch die <strong>Berlin</strong>-Ambivalenz.<br />
Da passt die F-Katastrophe gut rein.<br />
In Hamburg wird bei der Elbphilharmonie<br />
eine gigantische Kostensteigerung<br />
verursacht. Hören Sie dort solche Debatten<br />
wie in <strong>Berlin</strong>? Ich glaube nicht.<br />
Die Hamburger haben da ein stabileres<br />
Selbstbewusstsein.<br />
Dabei ist <strong>Berlin</strong> doch Hauptstadt.<br />
Aber <strong>Berlin</strong> muss mit Ressentiments leben,<br />
die über Jahrzehnte gepflegt worden<br />
sind. In der DDR ging es gegen die<br />
Hauptstadt, die immer Vorrang hatte,<br />
und im Westen gegen die Subventionsmentalität.<br />
Dagegen muss man auch<br />
heute noch kräftig arbeiten. Die <strong>Berlin</strong>erinnen<br />
und <strong>Berlin</strong>er sollten da selbstbewusster<br />
sein, aber ohne chauvinistisch zu<br />
werden.<br />
Sie haben ein heute berühmtes Zitat in die<br />
Welt gesetzt: „<strong>Berlin</strong> ist arm, aber sexy.“<br />
Würden Sie das heute noch sagen?<br />
Warum nicht? Als ich den Satz vor einem<br />
Jahrzehnt in London gesagt habe,<br />
hat ihn in <strong>Berlin</strong> erst mal keiner zur<br />
Kenntnis genommen. Ich habe damals<br />
versucht, eine Stadt zu beschreiben, die<br />
nicht vom Reichtum geprägt ist, aber<br />
trotzdem eine starke Anziehungskraft<br />
ausübt. Erst später hat in <strong>Berlin</strong> dann<br />
die Opposition versucht, ihn gegen<br />
mich zu verwenden.<br />
In Süddeutschland steht der Satz häufig<br />
dafür: <strong>Berlin</strong> hat selbst kein Geld, sondern<br />
gibt unseres aus und prahlt dann auch<br />
noch, wie sexy es ist.<br />
Wer bösartig ist, kann jeden Satz verdrehen.<br />
Sexy hat nichts mit Geldausgeben<br />
zu tun. Es ist eine Haltung, ein<br />
Lebensgefühl.<br />
„In <strong>Berlin</strong> muss man nicht geboren<br />
sein. Man muss nicht in einem<br />
bestimmten Tennisclub sein, um<br />
dazuzugehören. Die Stadt nimmt<br />
Leute nach drei Monaten auf“<br />
Führt <strong>Berlin</strong> ein lustiges Lotterleben auf<br />
Kosten reicher Länder wie Bayern und<br />
Hessen, die vor dem Bundesverfassungsgericht<br />
gegen den Länderfinanzausgleich<br />
klagen?<br />
Dann fallen Sie aber bitte mal nicht auf<br />
die Wahlkampfaktionen der Union in<br />
Bayern und Hessen rein. Es ist ein falsches<br />
Klischee, dass <strong>Berlin</strong> nicht hart<br />
daran arbeitet, seine wirtschaftliche Situation<br />
zu verbessern. Eine eiserne Haushaltsdisziplin<br />
hat dazu geführt, dass wir<br />
im Ländervergleich seit einem Jahrzehnt<br />
den geringsten Ausgabenzuwachs haben.<br />
Hessen und Bayern liegen beim Geldausgeben<br />
an der Spitze. Unsere öffentlich<br />
Beschäftigten haben die niedrigste Einkommensentwicklung,<br />
da wurden nun<br />
wirklich harte Nachteile in Kauf genommen.<br />
<strong>Berlin</strong> will 2015 ohne neue Schulden<br />
auskommen.<br />
Und der F?<br />
Den Landesanteil an den Mehrkosten<br />
tragen wir aus eigener Kraft.<br />
Worin besteht <strong>Berlin</strong>s Sexyness?<br />
In der Offenheit. In der Möglichkeit,<br />
sich hier zu entfalten. Die ständigen Veränderungen<br />
in der Stadt gehören dazu.<br />
In vielen Gegenden <strong>Berlin</strong>s stößt die<br />
Veränderung auf Protest. Bürger rufen:<br />
Gentrifizierung! Stört Sie das?<br />
Wenn es zum Mantra wird, stört mich<br />
das. <strong>Berlin</strong> darf keine Stadt unter einer<br />
Käseglocke sein, unter der sich nichts verändert.<br />
Das hatten wir schon mal mit der<br />
Mauer, und daran ist <strong>Berlin</strong> fast erstickt.<br />
Die Stadt muss sich umgestalten. Wir haben<br />
hart an Quartieren gearbeitet, die<br />
eine einseitige Sozialstruktur hatten und<br />
gekippt waren. Wer das jetzt als Gentrifizierung<br />
diffamiert, hat nicht verstanden,<br />
wie eine Stadt sich entwickeln muss.<br />
Trotzdem bringt natürlich Wachstum<br />
auch neue Probleme. Beispielsweise,<br />
wenn Wohnungen unbezahlbar und dadurch<br />
Mieter vertrieben werden. Da<br />
müssen wir gegensteuern, zum Beispiel<br />
mit öffentlichem Wohneigentum.<br />
In den vergangenen zwei Jahren sind<br />
80 000 Menschen nach <strong>Berlin</strong> gezogen.<br />
Und das freut uns. Die Perspektive ist,<br />
dass das Wachstum anhält. Aber <strong>Berlin</strong><br />
hatte schon mal über 4,5 Millionen<br />
Einwohner vor dem Zweiten Weltkrieg.<br />
Diese Stadt ist für mehr angelegt.<br />
Die Herausforderung muss bewältigt<br />
werden. Vor nicht allzu langer Zeit hatten<br />
wir 150 000 leer stehende Wohnungen.<br />
Heute brauchen wir Wohnungsbau,<br />
mehr Kitas, mehr Schulen.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie könnten einem<br />
Besucher drei Orte zeigen, die ihm helfen,<br />
<strong>Berlin</strong> zu verstehen. Welche wären das?<br />
Ich würde erst mal das Schuhwerk kontrollieren<br />
und dann mit den Leuten in die<br />
Quartiere hineingehen. Kreuzberg, Nord-<br />
Neukölln. Dort kann man viel lernen.<br />
Dann würde ich den Besucher mit rausnehmen<br />
nach Buch, wo die alten Kliniken<br />
stehen.<br />
Buch? Das war doch das frühere Regierungskrankenhaus,<br />
wo die hohen SED-<br />
Funktionäre ihren Haferschleim löffelten?<br />
Aber dort sind auch die Hufeland-Kliniken,<br />
architektonisch wunderbar. Man<br />
denkt, man wäre auf einem Universitätscampus<br />
in Großbritannien.<br />
Dritter Ort?<br />
Das wäre die Gedenkstätte am Grenzstreifen<br />
an der Bernauer Straße oder Hohenschönhausen,<br />
das Gelände des ehemaligen<br />
Stasi-Gefängnisses.<br />
Sie sind in Lichtenrade aufgewachsen. In<br />
einem eben erschienenen <strong>Berlin</strong>-Buch<br />
heißt es über diesen Stadtteil: „Der<br />
Lichtenrader sieht einen. Hinter Vorhängen<br />
und unter gestickten Tischdecken<br />
beobachtet er argwöhnisch jeden<br />
Eindringling, gegen den sich sein Frust<br />
richten kann.“ Aus was für einer Gegend<br />
stammen Sie?<br />
Diese Beschreibung kann ich nicht nachvollziehen.<br />
Und wie Lichtenrade ist? Der<br />
Stadtteil hat sich radikal verändert. Von<br />
einem ländlich geprägten Ort mit Bauern<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 29
T i t e l<br />
Wie hat es Ihnen gefallen? Können Sie den<br />
Club empfehlen?<br />
In Ihrem Alter nicht mehr.<br />
Wie alt waren Sie denn, als Sie da waren?<br />
Das braucht hier keine Rolle zu spielen.<br />
Foto: Lene Münch für <strong>Cicero</strong><br />
und Dorfteich, Dorfkrug und Dorfkirche<br />
mit Einfamilienhäusern hin zu den<br />
Wohnungsbauprojekten der sechziger<br />
und siebziger Jahre. Das hat die Atmosphäre<br />
verändert. Es gab den Reiterverein,<br />
den Karnevalsverein, den Männerchor,<br />
den gemischten Chor, die Freiwillige<br />
Feuerwehr.<br />
Was kam hinter Lichtenrade?<br />
Die Mauer. Lichtenrade war sogar umgeben<br />
von ihr. Für mich war da Schluss.<br />
Deswegen ist man immer gerne gereist.<br />
Man wollte raus.<br />
Trotzdem haben Sie bisher Ihr ganzes<br />
Leben nur in <strong>Berlin</strong> verbracht.<br />
Was heißt nur?<br />
Das sollte doch gar nicht abwertend klingen.<br />
Aber wollten Sie nie richtig weg?<br />
Nein. Wenn man den idealen Ort hat,<br />
muss man nicht weg.<br />
Warum ist er ideal?<br />
<strong>Berlin</strong> ist die einzige echte Metropole in<br />
Deutschland. Eine pulsierende Stadt.<br />
Was genau mögen Sie an <strong>Berlin</strong>?<br />
Die Atmosphäre ist offen. Wir sind nicht<br />
verkrustet. Wir haben – das ist ein Vorteil<br />
und ein Nachteil – keine starren bürgerlichen<br />
Strukturen. Wir haben keine<br />
Kaufmannschaft wie in Hamburg, die<br />
seit Jahrzehnten die Stadt geprägt hat,<br />
und das ist manchmal auch ein Problem.<br />
Aber in <strong>Berlin</strong> muss man nicht geboren<br />
sein. Man muss nicht in einem bestimmten<br />
Golfclub oder Tennisclub sein, um<br />
Wowereit beim<br />
<strong>Cicero</strong>-Interview<br />
mit Alexander<br />
Marguier (links)<br />
und Georg Löwisch<br />
dazuzugehören. Diese Stadt nimmt Leute<br />
nach drei Monaten auf. Die innere Liberalität<br />
<strong>Berlin</strong>s lässt mir Luft zum Atmen.<br />
Viele verbinden ja mit <strong>Berlin</strong> eine Dauerparty.<br />
Sie haben das Image des Partybürgermeisters.<br />
Wieso hängt Ihnen das so an?<br />
Das fragen mich die Leute, die es<br />
schreiben.<br />
Wir haben das noch nie geschrieben.<br />
Nie geschrieben, nur gefragt. Aber diese<br />
Zeit ist ja nun schon längst vorbei. Dabei<br />
gehe ich heute eigentlich zu genauso<br />
vielen Veranstaltungen, die andere Party<br />
nennen. Obwohl das ein völlig dusseliger<br />
Begriff ist. Ich verstehe unter Party etwas<br />
anderes. Wenn ich zur Echo-Verleihung<br />
gehe, gibt es den anschließenden<br />
Empfang. Für manche Leute ist das Party,<br />
für mich ist das Arbeit. Das hat mit Spaß<br />
wenig zu tun.<br />
Warum ist das Arbeit?<br />
Weil einen jeder anquatscht und man<br />
permanent unter Beobachtung steht.<br />
Wenn ich tanze, dann lauern 20 Kameras.<br />
Das ist keine Party, wenn du nirgendwo<br />
privat bist.<br />
Wollen Sie hier allen Ernstes behaupten,<br />
dass Ihre Prominenz Sie stört?<br />
Ständig öffentlich zu sein, kann nerven.<br />
Es ist aber der Preis, den man zahlt.<br />
Waren Sie schon im Berghain, dem Club,<br />
der für die coole Zügellosigkeit <strong>Berlin</strong>s<br />
steht?<br />
Ich war auch schon im Berghain.<br />
Weil Sie nicht privat da waren?<br />
Ich war auch schon privat da.<br />
Wenn Sie immer beobachtet und gefilmt<br />
werden, wäre es nicht angenehmer, einmal<br />
aus <strong>Berlin</strong> wegzuziehen?<br />
Wollen Sie mich loswerden?<br />
Wir haben allein in Ihrem Interesse gedacht.<br />
Vielleicht in 20 Jahren, wenn Sie<br />
nicht mehr Bürgermeister sind?<br />
Dann kann ich auch schon wieder privat<br />
sein.<br />
Wie viele Einwohner wird <strong>Berlin</strong> dann<br />
haben?<br />
In den nächsten Jahren rechnen wir mit<br />
etwa 30 000 Plus pro Jahr. Dann wird<br />
<strong>Berlin</strong> in 20 Jahren schon an die vier Millionen<br />
haben.<br />
2005 waren Sie auf dem Titel des<br />
Magazins „Time“ abgebildet. Der <strong>Berlin</strong>-<br />
Botschafter, weltbekannt. Sie wurden als<br />
Kanzlerkandidat der SPD gehandelt. Ist es<br />
für Sie nicht bitter, jetzt als Pannen-Wowi<br />
verspottet zu werden?<br />
So viel hat sich nicht geändert. Der Regierende<br />
Bürgermeister wird mit allem<br />
identifiziert, was in <strong>Berlin</strong> passiert.<br />
Sie eröffnen morgen die neue Non-Stop-<br />
Verbindung <strong>Berlin</strong>-Chicago von Air <strong>Berlin</strong>.<br />
Da kommt dann wieder die F-Frage.<br />
Mit einer Panne muss man leben. Jeder<br />
erfahrene Bürgermeister weiß, dass das<br />
nicht ursächlich mit <strong>Berlin</strong> zu tun hat.<br />
Reagieren die Menschen anders auf<br />
Sie als früher, wenn Sie die Straße<br />
entlanggehen?<br />
Nein, die Menschen reagieren nicht<br />
anders.<br />
Das heißt, Sie sind glücklich in Ihrem<br />
Amt?<br />
Sonst würde ich das nicht machen.<br />
Das Gespräch führten Georg Löwisch und<br />
Alexander Marguier<br />
30 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Nächster<br />
Studienstart:<br />
06. September 2013<br />
Bewerben bis<br />
zum 01. Juli<br />
Gemeinsame Bildungsförderung für Politiker.<br />
Das Master-Stipendium der ZU.<br />
Für die Masterstudiengänge an der Zeppelin Universität. Zwei Jahre. Vollzeit. Praxistauglich durch<br />
Forschungsorientierung. Verwaltungs- und Politikwissenschaft und alles, was man wirklich braucht – für<br />
ein Management von Transformation in Verwaltung, Staat und Politik. Für Politik-, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaftler<br />
und Andersdenkende.<br />
Die Zeppelin Universität ist eine private Stiftungsuniversität am Bodensee, die als Uni zwischen Wirtschaft,<br />
Kultur und Politik konsequent interdisziplinär, individualisiert und international lehrt und forscht. Weitere<br />
Informationen zu diesem Master-Studiengang wie auch zu den Master-Studiengängen in Kommunikationsund<br />
Kulturwissenschaften und in Wirtschaftswissenschaften sowie der Bewerbung unter zu.de/cicero
T i t e l<br />
<strong>Berlin</strong>s Neuer Mittelstand<br />
Die Hauptstadt<br />
entwickelt sich<br />
zu Europas<br />
Internetmetropole.<br />
Niedrige Mieten,<br />
der attraktive<br />
Standort und<br />
gut ausgebildete<br />
Mitarbeiter locken<br />
Gründer und<br />
Investoren an<br />
von Marcus Pfeil<br />
Anna Alex und Juli Bösch<br />
kleiden mit ihrem Start-up<br />
Outfittery Männer ein,<br />
die Angst vorm Shoppen<br />
oder keine Zeit haben<br />
32 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Philipp Gross<br />
E<br />
inen Hinterhof weiter verkaufte<br />
früher der Modedesigner Andreas<br />
Murkudis seine Kleidung,<br />
bis es ihn aus <strong>Berlin</strong>-Mitte weg<br />
nach Schöneberg zog. Jetzt frisst<br />
sich das Start-up „Outfittery“ von Anna<br />
Alex durch das Jugendstilgebäude an der<br />
Münzstraße. Outfittery ist ein virtueller<br />
Einkaufsberater, Anna Alex stellt Kleidung<br />
für Herren zusammen, die entweder allergisch<br />
aufs Einkaufen reagieren oder wenig<br />
Zeit haben. Ein Jahr nach der Gründung<br />
hat das Unternehmen bereits 50 000 Kunden<br />
und beschäftigt 30 Mitarbeiter.<br />
Outfittery ist eines von 2500 Internet-<br />
Start-ups, die seit 2008 in <strong>Berlin</strong> gegründet<br />
wurden. Das jedenfalls ist die Zahl, die der<br />
neu gegründete Bundesverband deutscher<br />
Startups e. V. ermittelt hat. <strong>Berlin</strong> kämpft<br />
dabei mit Städten wie Istanbul, Warschau<br />
oder Tel Aviv um die digitale Vormachtstellung<br />
diesseits des Atlantiks.<br />
In Europa dürfte derzeit keine Stadt<br />
mehr Gründer und Investoren anziehen<br />
als die deutsche Hauptstadt. Wie viele es<br />
tatsächlich sind, weiß zwar niemand genau,<br />
weil täglich neue Firmen entstehen,<br />
es keine vernünftige Branchenstudie gibt,<br />
nicht klar ist, ob sich schon Start-up nennen<br />
darf, wer nur eine Idee ausbrütet, oder<br />
ob der Eintrag im Handelsregister entscheidet.<br />
Die New York Times jedenfalls adelte<br />
<strong>Berlin</strong> – in Anlehnung an das Silicon Valley<br />
– schon zur „Silicon Alley“.<br />
„Internet-Start-ups haben in den vergangenen<br />
Jahren rund 20 000 Arbeitsplätze in<br />
<strong>Berlin</strong> geschaffen“, sagt Florian Nöll, Vorstandsmitglied<br />
im Start-up-Verband. Wenn<br />
man jede IT-Firma mitzählt, sind es laut einer<br />
Studie der Industrie- und Handelskammer<br />
sogar 45 000 neue Jobs. Jede 25. Stelle<br />
in <strong>Berlin</strong> hängt inzwischen von der Branche<br />
ab. So entsteht in der industriefreien<br />
Hauptstadt etwas, das sich zum Mittelstand<br />
von morgen auswachsen könnte.<br />
Weil der Mittelstand von heute sich<br />
in der Finanzkrise als Rückgrat der deutschen<br />
Wirtschaft erwiesen hat, lassen sich<br />
neuerdings auch Politiker mit den Jungunternehmern<br />
ablichten. Schließlich ist<br />
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bilder<br />
bis zur Wahl im September halten und<br />
sich weder Kanzlerin noch Herausforderer<br />
mit Nachwuchs-Pleitiers verewigt haben.<br />
<strong>Berlin</strong> scheint für den Boom wie geschaffen,<br />
geht es hier doch unangepasster<br />
und wilder zu als anderswo. Jeder kann<br />
hier sein Ding machen. Getragen von einer<br />
Melange aus Euphorie, Unsicherheit<br />
und Zweifeln fühlt sich <strong>Berlin</strong> ja selbst ein<br />
wenig an wie ein Start-up. Noch fehlt das<br />
große Geld, der ganz große Deal, noch ist<br />
<strong>Berlin</strong>s Start-up-Boom vor allem eins: ein<br />
Zukunftsversprechen.<br />
Gründer wie Investoren vereint dabei<br />
die Hoffnung, ein neues Instagram zu<br />
entwickeln. Instagram ist eine Foto-App,<br />
die es den Nutzern erlaubt, die mit dem<br />
Smartphone geschossenen Bilder direkt mit<br />
ihren Freunden online zu teilen. Das soziale<br />
Netzwerk Facebook kaufte den Instagram-Entwicklern<br />
deren Unternehmen<br />
kurz vor dem eigenen Börsengang für eine<br />
Milliarde Dollar ab. Von derartigen Deals<br />
ist die deutsche Szene noch weit entfernt:<br />
So heißt es in einer Analyse des renommierten<br />
Tech-Blogs Startup Genome zwar,<br />
<strong>Berlin</strong> sei zurzeit der beste Standort, um<br />
Die Internetbranche hat<br />
in <strong>Berlin</strong> 45 000 neue<br />
Jobs geschaffen – ein<br />
neuer Mittelstand für die<br />
industriefreie Hauptstadt<br />
eine Firma zu eröffnen. Allerdings sei „das<br />
Ökosystem noch nicht reif genug, um sie<br />
hier auch wachsen zu lassen“. Im Global<br />
Startup Ecosystem Index liegt <strong>Berlin</strong> deshalb<br />
abgeschlagen hinter Städten wie Toronto,<br />
Paris, São Paulo oder Hongkong auf<br />
Platz 15.<br />
Zwar sitzen in <strong>Berlin</strong> eine Menge Business<br />
Angels und Inkubatoren, also Brutkästen,<br />
die sich in eine Idee verlieben, die<br />
neue Ideen mit Cash päppeln und auf Rendite<br />
hoffen. Um es aber mit dem richtigen<br />
Valley aufzunehmen, fehlen in der Alley<br />
die großen Investoren, die auch bereit<br />
sind, in späteren Finanzierungsrunden ins<br />
Risiko zu gehen. Nach einer Analyse der<br />
Nachrichtenagentur Dow Jones haben<br />
Deutschlands Gründer im vergangenen<br />
Jahr 822 Millionen Euro eingesammelt, das<br />
sind zwar 48 Prozent mehr als 2011, und<br />
ein Großteil davon floss auch nach <strong>Berlin</strong>.<br />
Insgesamt ist das aber nicht viel mehr als<br />
die Summe, die Investoren vor dem Börsengang<br />
allein in Facebook pumpten.<br />
Anzeige<br />
UM DIE №1<br />
ZU WERDEN,<br />
MUSS MAN<br />
ALLES GEBEN.<br />
WIRKLICH<br />
A L L E S.<br />
Originalausgabe<br />
200 Seiten ¤ 12,90<br />
Auch als erhältlich<br />
»Dramen, Euphorie, Panik, gescheiterte<br />
Strategien, Beinahe-Katastrophen<br />
und Lucky Punches im ewigen<br />
Krimi zwischen Macht und Untergang<br />
[...]. Erleben Sie die Anwendung<br />
moderner Kommunikationsstrategien<br />
in einer Umgebung, die keine Gnade<br />
bei Fehlern kennt und in der Mitgefühl<br />
Zeit bis nach dem Wahltag hat.«<br />
Frank Stauss<br />
_<br />
premium<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 33<br />
www.dtv.de
T i t e l<br />
Vor allem die deutsche Erbengeneration<br />
scheut das Wagnis, sich mit Start-ups<br />
einzulassen. Das meiste Geld, das nach<br />
<strong>Berlin</strong> fließt, kommt aus dem Ausland:<br />
„Ab einem Volumen von über 15 Millionen<br />
Euro finanzieren fast nur die großen<br />
angelsächsischen Venture-Capital-Fonds“,<br />
sagt Florian Nöll vom Start-up-Verband.<br />
Auch bei der jüngsten Finanzierungsrunde<br />
des Online-Händlers Zalando kamen die<br />
knapp 300 Millionen Euro von der schwedischen<br />
Beteiligungsgesellschaft Kinnevik.<br />
Innerhalb der EU investieren schwedische<br />
Wagniskapitalgeber im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung<br />
am stärksten, deutsche Investoren<br />
liegen nur auf Rang zwölf.<br />
Um die Risiko- und Unternehmerkultur<br />
am Standort Deutschland zu verbessern,<br />
hat Nöll im Oktober mit drei anderen<br />
Gründern den Bundesverband deutscher<br />
Startups e. V. gegründet. „Um gegenüber<br />
der Politik mit einer Stimme sprechen zu<br />
können“, sagt er. Die Themen sind: Steuererleichterungen,<br />
eine Reform der Insolvenzordnung<br />
oder eine Verbesserung der<br />
Einwanderungspolitik. Die Politik hat inzwischen<br />
erkannt, dass der Hype um <strong>Berlin</strong>s<br />
Start-up-Szene auf lange Sicht gerechtfertigt<br />
sein könnte. Im Wahlkampf hat<br />
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück bereits<br />
kurz nach Ostern die Factory, einen<br />
Gründer-Campus an der Bernauer Straße<br />
besucht, in den Google eine Million Euro<br />
investiert hat. Die Kanzlerin schaute Anfang<br />
März beim Spieleentwickler Wooga<br />
und bei Researchgate, einer Vernetzungsplattform<br />
für Wissenschaftler, vorbei und<br />
rief eine „neue Gründerzeit“ aus.<br />
Wirtschaftsminister Philipp Rösler protegiert<br />
die Gründerelite mit speziellen Investitions-<br />
und Förderprogrammen. Ende<br />
Februar war der Vizekanzler sogar auf<br />
Dienstreise im Silicon Valley. Dort gefiel<br />
es ihm so gut, dass er im Mai für eine ganze<br />
„German Valley Week“ hinfliegen will. <strong>Berlin</strong>s<br />
Gründer wollen ihn in einem eigenen<br />
Charterflieger begleiten.<br />
Auch Outfittery-Gründerin Anna Alex<br />
will mitfliegen. Auf der Reise will sie Rösler<br />
als Kunden gewinnen. „Genau unsere Zielgruppe:<br />
einer, der keine Zeit zum Shoppen<br />
hat“, sagt die 28-Jährige, die Volkswirtschaft<br />
in Paris und Freiburg studiert hat.<br />
Rösler und Alex eint der Traum von<br />
einem deutschen Apple, Google oder Facebook.<br />
„Noch fehlt <strong>Berlin</strong> die ganz große<br />
Die Samwer-<br />
Brüder<br />
Alexander,<br />
Oliver<br />
und Marc<br />
dominieren<br />
mit ihrer<br />
Holding<br />
Rocket Internet<br />
die deutsche<br />
Start-up-<br />
Branche<br />
Idee von internationaler Bedeutung“, sagt<br />
Kolja Hebenstreit vom Inkubator Team<br />
Europe. Zwar gab es auch schon Exits,<br />
so nennen Gründer und Investoren den<br />
Verkauf eines Start-ups oder dessen Börsengang,<br />
die zu Träumen verleiten. Ende<br />
2012 etwa hat der Online-Reisevermarkter<br />
Expedia 477 Millionen Euro für das Vergleichsportal<br />
Trivago bezahlt, und im Sommer<br />
davor kaufte die US-Firma Care, eine<br />
Plattform für Betreuungsdienstleistungen,<br />
für einen zweistelligen Millionenbetrag<br />
ihre deutsche Kopie Betreut.de. Aber<br />
im Vergleich zu den USA nehmen sich die<br />
Summen noch bescheiden aus.<br />
Der Online-Versandhändler Zalando<br />
könnte der erste <strong>Berlin</strong>er Milliardendeal<br />
sein, wenn er es bis an die Börse schafft.<br />
Oder die Musiktauschbörse Soundcloud,<br />
die inzwischen mehr als zehn Millionen<br />
Menschen nutzen. Die Firma des Schweden<br />
Alexander Ljung, die auch in der <strong>Berlin</strong>er<br />
Factory residiert, hat es zumindest<br />
in die dritte Finanzierungsrunde geschafft<br />
und vor gut einem Jahr 50 Millionen Euro<br />
vom US-Investor Kleiner Perkins Caufield<br />
& Byers eingesammelt.<br />
„Vielleicht braucht die Stadt aber<br />
auch noch ein paar Jahre, bis sie eine<br />
große Company ausspuckt. Im Silicon<br />
Valley machen die das schließlich etwas<br />
länger“, sagt Jens Munk, Deutschland-<br />
Chef der britischen Investmentbank<br />
Torch Partners. „<strong>Berlin</strong> war immer eine<br />
kreative Stadt, das verbindet sich jetzt mit<br />
den relativ günstigen Immobilienpreisen<br />
und hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern.“<br />
Munk glaubt fest daran, dass der aktuelle<br />
Start-up-Boom beständiger ist als<br />
das Phänomen der New Economy um die<br />
Jahrtausendwende.<br />
Heute dominieren die <strong>Berlin</strong>er Szene<br />
die nach dem Dotcom-Crash zur Jahrtausendwende<br />
übrig gebliebenen Gründer, die<br />
mit ihrem Geld jetzt andere Firmen finanzieren.<br />
Lukasz Gadowski mit Team Europe<br />
gehört dazu, Verlage wie Dumont, Madsack<br />
oder Holtzbrinck hoffen, im Netz<br />
ihr wegbrechendes Kerngeschäft kompensieren<br />
zu können. Handelskonzerne wie<br />
Otto oder Tengelmann sind angefixt vom<br />
E-Commerce. AWD-Gründer Carsten<br />
Maschmeyer und SAP-Mitgründer Hasso<br />
Plattner wetteifern um die heißesten Geschäftsideen.<br />
Angeführt wird diese Generation<br />
von den Samwer-Brüdern Marc, Oliver<br />
und Alexander, die einst Alando, Jamba<br />
und Citydeal teuer an Ebay, Verisign und<br />
Groupon verkauften. Ihre Holding Rocket<br />
Internet, über die sie an diversen Internetunternehmen<br />
beteiligt sind, beschäftigt<br />
8000 bis 10 000 Mitarbeiter auf der ganzen<br />
Welt, die meisten bei Zalando.<br />
Auch Anna Alex hat dort vorher gearbeitet,<br />
ihre Mitgründerin Julia Bösch<br />
kennengelernt und den Kontakt zu ihrem<br />
ersten Investor Holtzbrinck Ventures geknüpft.<br />
Und so ist ihr junges Unternehmen<br />
längst Teil eines immer engmaschigeren,<br />
immer größer werdenden Netzwerks<br />
in <strong>Berlin</strong>, das sich schon bald aus sich selbst<br />
heraus nähren könnte.<br />
Marcus Pfeil<br />
beobachtet als Kolumnist des<br />
Wall Street Journal die deutsche<br />
Internetszene<br />
Fotos: Dieter Mayr/Agentur Focus, Privat (Autor)<br />
34 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Hört diese Stadt!<br />
Von Prenzlauer Berg bis Tiergarten, von Neukölln bis zum S-Bahnhof Alexanderplatz: Eine musikalische<br />
Reise durch <strong>Berlin</strong> – klangvoll-fließend, pulsierend-bunt, rhythmisch-hämmernd, wie das<br />
Leben in der Hauptstadt so spielt. Elektrobeats, Schlager und Big-Band-Sounds verbinden sich mit<br />
lärmenden Alltagsgeräuschen und historischen O-Tönen zu einer etwas anderen Sinfonie.<br />
Exklusiv<br />
für die Leser von <strong>Cicero</strong>,<br />
komponiert von dem<br />
<strong>Berlin</strong>er Musiker<br />
Volker Schlott.<br />
Jetzt die CD zum Preis von 8,90 € bestellen.<br />
<strong>Cicero</strong>-Abonnenten erhalten diese kostenlos.<br />
Limitierte Auflage<br />
S I N F O N I E<br />
E I N E R<br />
H A U P T S TA D T<br />
Jetzt CD »Sinfonie einer Hauptstadt« für 8,90 EUR bestellen.<br />
<strong>Cicero</strong>-Abonnenten erhalten die CD gratis.<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/kollektion<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 983445 (für Abonnenten)<br />
Bestellnr.: 979205
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Meinung, Zack, Zack<br />
Wer erreicht heute Teenager mit politischen Themen? Florian Mundt schafft das in seinen rasanten Videos<br />
von Klaus Raab<br />
W<br />
as an Florian Mundts Videos sofort<br />
auffällt, ist das hohe Tempo.<br />
„Aloha“, sagt er zur Begrüßung,<br />
dann zack, erste Pointe, zack, erstes Thema,<br />
zack, zack, zack. Tippt man den Text ab,<br />
den er während einer Minute spricht, so<br />
kommt man auf 1245 Anschläge. Zum<br />
Vergleich: Eine zufällig ausgewählte Minute<br />
Text aus dem „heute journal“ ergibt<br />
841 Anschläge. Mundt liefert 50 Prozent<br />
mehr Inhalt als herkömmliches Fernsehen.<br />
Mundt, 25 Jahre alt, hat sich den Künstlernamen<br />
LeFloid gegeben und ist damit<br />
im Netz auf der Video-Plattform Youtube<br />
bereits sehr bekannt geworden. Der <strong>Berlin</strong>er<br />
ist ein Fachmann für Comics, japanische<br />
Popkultur und Computerspiele, der<br />
in seiner Show „LeNews“ überraschende<br />
Ausflüge in die Gesellschaftspolitik unternimmt,<br />
der zu Zivilcourage anhält und<br />
seine jungen Fans ohne jede Lehrerhaftigkeit<br />
anregt, sich für Politik zu interessieren,<br />
indem er über Nordkoreas Atomtests<br />
so unverkrampft spricht wie über Batman.<br />
Seit etwa zweieinhalb Jahren lädt er<br />
mindestens einmal pro Woche ein selbst<br />
produziertes Video auf seinen Kanal. Mehr<br />
als 150 Videos sind es inzwischen, er erreicht<br />
mit einem 400 000 bis 1,8 Millionen<br />
Zuschauer. Davon können viele Zeitungskommentatoren<br />
nur träumen. So<br />
viele Zuschauer in LeFloids Zielgruppe<br />
unter 25 Jahren hätte auch manche Fernsehsendung<br />
gern.<br />
Pro 1000 Klicks verdient ein deutscher<br />
Youtube-Partner 60 Cent bis 1,30 Euro,<br />
Mundt kommt so schätzungsweise auf<br />
350 bis 1000 Euro pro Sechsminutenvideo.<br />
LeFloid verkauft zudem T‐Shirts. Ein<br />
Starmoderatorengehalt hat er trotzdem<br />
nicht, zumal ein Youtube-Kanal viel unsichtbaren<br />
Aufwand erfordert: Diskussionen<br />
mit Nutzern oder die Pflege eines weit<br />
verzweigten Netzwerks, das Links zu den<br />
Filmen verbreitet.<br />
Fernsehen ist für Mundt hierarchisch,<br />
Onlinevideos sind es nicht: „Das Videomachen<br />
hört für mich an dem Punkt auf,<br />
an dem sich jemand ansatzweise als Vorgesetzter<br />
gerieren könnte“, sagt er. Beim<br />
Fernsehen wolle er nicht enden. Auch ein<br />
Youtuber muss sich Zwängen fügen, den<br />
Geschäftsbedingungen der Google-Tochter<br />
Youtube etwa. Der einzige Vorgesetzte, den<br />
Mundt anerkennt, ist aber der Zuschauer:<br />
„Sobald man eine Sekunde lockerlässt, wird<br />
ein Video weggeklickt“, sagt er. Auch das<br />
ist ein Korsett, aber eines, in dem er sich<br />
beweglich fühlt.<br />
In einem Moment steht er in der Bildmitte,<br />
im nächsten weiter links. In einer<br />
Sekunde trägt er Schildmütze, in der folgenden<br />
Batman-Kostüm. Zack, zack, harte<br />
Schnitte, man muss sich daran gewöhnen.<br />
Journalisten wird beigebracht, dass man<br />
zwei Szenen weich ineinanderfließen lassen<br />
sollte, um niemanden mit Bildsprüngen<br />
zu verstören. Mundt aber ist Autodidakt<br />
und tut, wie Pippi Langstrumpf, was<br />
ihm gefällt. Er ist in einer komfortablen<br />
Position: Er muss es nicht allen recht machen,<br />
er sieht ja an den Nutzerzahlen, dass<br />
genug Leute seine Filme mögen.<br />
Er zitiert Agentenfilme, die man gesehen<br />
haben muss, um die Zitate zu erkennen,<br />
er spricht über Nischenbands und befreundete<br />
Youtuber; für seine Themen, sagt<br />
er, gebe es nur ein Auswahlkriterium: Sie<br />
müssen ihn interessieren. Konsequent geht<br />
er den Weg des eigenen Geschmacks, anders<br />
als etablierte Medien, die am liebsten<br />
jeder neuen Idee eine Kundenbefragung<br />
vorausschicken würden.<br />
Es gibt bei Youtube Comedy-, Beauty-,<br />
Gaming-, BMX- und Actionkanäle. Auch<br />
LeFloid veranstaltet kein philosophisches<br />
Nachtstudio, aber er ist der mit dem originellsten<br />
Zugriff auf politische Themen.<br />
„Unverzüglich“ heißt bei ihm „instant“, statt<br />
„ziemlich“ sagt er „sauig“. Mal wird er ärgerlich,<br />
etwa wenn es um einen Hitlergruß<br />
zeigenden Fußballer geht, mal albert er vor<br />
sich hin, aber er trifft in der Regel den richtigen<br />
Ton. Wäre Youtube eine Zeitung, Le-<br />
Floid wäre mit seiner Show „LeNews“ der<br />
Leitartikler. Das Unternehmen Mediakraft,<br />
ein Internet-TV-Sender, der die bekanntesten<br />
deutschen Youtuber präsentiert und<br />
auch LeFloids Show zeigt, hat für das laufende<br />
Wahljahr angekündigt, nach US-Vorbild<br />
auf das „wachsende Publikum für Infound<br />
Bildungsinhalte“ zu reagieren: Es soll<br />
mehr Informationsprogramm geben. Mediakraft<br />
nennt LeFloid den „Anchorman des<br />
deutschsprachigen Youtube“.<br />
Mundt lässt sich nicht so leicht politisch<br />
einordnen. Mal nervt ihn die Pharmaindustrie,<br />
mal der Papst, und dann stören<br />
ihn Polizisten beim Skateboarden. „Mir<br />
ist wichtig, dass man der Community was<br />
mitgibt“, sagt er. Über japanische Popkultur<br />
und Ufo-Geschichten kommt er zu einer<br />
Sonntagsbotschaft für gestresste Teenager:<br />
„Man sollte viel dankbarer sein im<br />
Leben.“ Im Herbst legte er sich mit der homophoben<br />
und rassistischen Internetseite<br />
kreuz.net an. Von Januar bis März, da hatte<br />
er in einem Video gerade gelobt, dass US-<br />
Politiker Onlinepetitionen ernst nähmen,<br />
sammelte er exemplarisch 32 000 Unterschriften<br />
für die „Operation Todesstern“ –<br />
für den Bau einer deutschen Raumstation<br />
nach „Star Wars“-Vorbild –, um zu zeigen,<br />
dass Mitbestimmung möglich ist.<br />
Florian Mundt ist ein ernsthafter und<br />
freundlicher Gesprächspartner. Im Rahmen<br />
seines Studiums der Psychologie und<br />
Rehabilitationspädagogik in <strong>Berlin</strong> klärt er<br />
Schulklassen über Cybermobbing und Datenschutz<br />
auf. Im Netz ist er zu einem Meinungsmacher<br />
für junge Leute geworden. Er<br />
spricht sie als „Dudes und Dudines“ an. Drei-,<br />
viermal pro Video fragt er: „Was meint ihr?<br />
Lasst uns mal in den Kommentaren drüber<br />
quatschen“; er wirkt dabei nicht anbiedernd,<br />
weil er selbst aus der Generation kommt, die<br />
mit „Was meint ihr?“ aufgewachsen ist. Man<br />
wird von ihm hören.<br />
Klaus Raab<br />
schreibt als freier Autor vor allem<br />
über Themen an der Schnittstelle<br />
zwischen Medien, Politik und<br />
Alltag<br />
Fotos: Julia Zimmermann für <strong>Cicero</strong>, privat (Autor)<br />
36 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Leitartikler der Youtube-<br />
Generation. Mit seinen LeFloid-<br />
Videos erreicht Florian Mundt<br />
Millionen Zuschauer<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 37
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Guerilla im Tweed<br />
Beatrix von Storch ist eine einflussreiche Unterstützerin der neuen Partei „Alternative für Deutschland“<br />
von Constantin Magnis<br />
Z<br />
wei gegen eine, es sieht schlecht<br />
aus für Beatrix von Storch. Mittagspause<br />
auf einem Wirtschaftssymposium,<br />
20 Minuten, um beide zu<br />
bezwingen: Sie muss das kleckernde Eier-<br />
Shrimps-Brötchen in ihrer Hand aufessen<br />
und den widerspenstigen Mann von der<br />
belgischen Botschaft vor ihr niederdiskutieren.<br />
Der Belgier widerspricht ihrer These,<br />
der Euro habe Deutschland wirtschaftlich<br />
geschadet. Er ahnt nicht, mit wem er sich<br />
angelegt hat.<br />
Auch wenn die zierliche Frau mit dem<br />
Tweed-Jackett nicht so aussieht: Beatrix von<br />
Storch ist eine der wirkmächtigen Gegnerinnen<br />
der Euro-Rettungspolitik und als<br />
Vorsitzende des Vereins „Zivile Koalition“<br />
eine der einflussreichen konservativen Netzwerkerinnen<br />
des Landes. In der kommenden<br />
Viertelstunde haut sie dem Belgier Argumente<br />
um die Ohren, rattert Zahlen<br />
herunter, und irgendwann starrt er nur<br />
noch betroffen schweigend auf den Tisch.<br />
Von ihrer Buffet-Schnitte bleibt lediglich<br />
ein einsamer Shrimp am Tellerrand übrig.<br />
Zwei zu null für Beatrix von Storch.<br />
<strong>Berlin</strong>, ein Saal der Technischen Universität.<br />
Auf dem Programm steht ein „intimer<br />
Gedankenaustausch“ über eine europäische<br />
Bankenunion. Während auf dem Podium<br />
der Direktor der Europäischen Zentralbank,<br />
Yves Mersch, die Idee als „Vollendung der<br />
Währungsunion“ bewirbt, macht sich von<br />
Storch im Publikum Notizen, bald ist ihr<br />
Papier gesprenkelt mit strengen Ausrufeund<br />
Fragezeichen. Immer wieder schnaubt<br />
sie verächtlich, tippt sich an die Stirne oder<br />
zischt: „Wenn ich so einen Unfug höre, geht<br />
mein Puls auf 180.“ Die Skepsis beruht auf<br />
Gegenseitigkeit. Als von Storch sich nach<br />
dem Vortrag das Mikrofon greift, werden<br />
die Lippen des EZB-Direktors schmal. Das<br />
liegt nicht nur an ihren kritischen Fragen.<br />
Vergangenes Jahr hat von Storch 5127 Unterschriften<br />
für eine Massenklage gegen<br />
die EZB und deren Ankündigung gesammelt,<br />
notfalls unbegrenzt Staatsanleihen<br />
aufzukaufen. Im Januar hat das Gericht der<br />
Europäischen Union die Klage angenommen.<br />
Nicht, dass sie große Chancen hätte.<br />
Aber von Storch geht es bei dem, was sie tut,<br />
weniger um Punktsiege und mehr um Prinzipienverteidigung.<br />
Mehrheiten hatte sie bisher<br />
nicht auf ihrer Seite, den Zeitgeist auch<br />
nicht, vielleicht liegt das in der Natur bürgerlich-konservativer<br />
Grabenkämpfe.<br />
Als Herzogin von Oldenburg wird sie<br />
1971 geboren. Ihr Vater hat als Nachgeborener<br />
der Fürstenfamilie kein Vermögen<br />
und verdient sein Geld als Bauingenieur.<br />
Als sie Mitte der Neunziger Jura studiert,<br />
begeistert sie ihr späterer Mann Sven von<br />
Storch für die Politik. Sie gründen den Verein<br />
„Allianz für den Rechtsstaat“ und machen<br />
dagegen mobil, dass Kohl die Enteignungen<br />
der DDR-Bodenreform anerkennt.<br />
Der Kanzler hatte dafür die Verfassung ändern<br />
lassen – unter fadenscheinigen Vorwänden,<br />
ist sie überzeugt.<br />
Ihre Familie hatte nie Grundbesitz im<br />
Osten, aber der Rechtsstaat, sagt sie, ist wie<br />
ein Schirm: „Hat der ein Loch, werden erst<br />
die nass, die direkt darunterstehen, aber irgendwann<br />
kriegen wir alle nasse Füße.“ Zu<br />
verhindern, dass der Rechtsstaat auf Kosten<br />
individueller Freiheitsrechte aufgeweicht<br />
wird, sagt die Juristin, sei bis heute ihr Antrieb,<br />
auch beim Kampf gegen die Euro-Rettungspolitik.<br />
Darum demonstriert sie damals<br />
tagelang im Bonner Regierungsviertel,<br />
verteilt Flugblätter auf dem CDU-Parteitag,<br />
sammelt per Post Petitionen, lernt, wie man<br />
Menschen mobilisiert.<br />
Inzwischen führt sie mit ihrem Mann<br />
in <strong>Berlin</strong> ein 14-köpfiges Protestunternehmen<br />
rund um ihren 2004 gegründeten<br />
Kampagnenverein „Zivile Koalition“, der<br />
heute Vorreiter im Widerstand gegen den<br />
Euro-Rettungskurs ist. Knapp hunderttausend<br />
Unterstützer hat sie, ihre Adresskartei<br />
schätzt sie auf das Zehnfache. Daneben<br />
trommelt die angeschlossene „Initiative Familienschutz“<br />
für das Betreuungsgeld und<br />
gegen die Homo-Ehe, der hausinterne<br />
Thinktank „Institut für strategische Studien“<br />
entwickelt Argumente, die eigene<br />
Online-Zeitung Freie Welt spielt sie nach<br />
draußen, und die Website „Abgeordnetencheck“<br />
übt Druck auf Parlamentarier<br />
aus, allein seit 2011 gingen 1,7 Millionen<br />
E-Mails über die Plattform an den Bundestag.<br />
Eigentlich ist von Storch Anwältin,<br />
inzwischen ist Protest ihr Hauptberuf.<br />
An ihrenTruppen kommt heute keiner<br />
mehr vorbei, der außerhalb der Union im<br />
konservativen Lager etwas bewegen will.<br />
Der „<strong>Berlin</strong>er Kreis“ der CDU konsultierte<br />
ihr Netzwerk, die Freien Wähler holten sie<br />
sich für Demos ins Boot. Die Gründung der<br />
neuen Partei „Alternative für Deutschland“<br />
begleitet sie, bei der Auftaktveranstaltung in<br />
Oberursel saß Beatrix von Storch wie selbstverständlich<br />
auf dem Podium, auch wenn<br />
ein Parteiamt für sie nicht infrage kommt.<br />
Die Zivilgesellschaft brauche neutrale Repräsentanten,<br />
die keine Rücksicht auf parteipolitische<br />
Strategien nehmen müssten und<br />
sich ausschließlich an Sachthemen orientierten,<br />
sagt sie: „Das ist unsere Aufgabe.“<br />
Sie ist sich nicht sicher, ob die AfD eine<br />
Zukunft als eine Art deutsche Tea Party hat.<br />
Sie hoffe es, aber es widerspräche, sagt sie,<br />
allen bisherigen Erfahrungen konservativer<br />
Parteigründungen. Eigentlich will sie<br />
die neue Partei gar nicht konservativ nennen,<br />
mit dem Begriff kann sie nichts mehr<br />
anfangen, seit Angela Merkel sich selbst<br />
so nennt. Im Flur ihres bunt gestrichenen<br />
Hauptquartiers hängt ein Gruppenfoto der<br />
Belegschaft. Alle grinsen breit in die Kamera.<br />
Alle formen mit den Händen dasselbe<br />
Zeichen: die Merkel-Raute. Es sieht<br />
aus, als wollten sie zusammen einen Geist<br />
bannen.<br />
Constantin Magnis<br />
ist Reporter von <strong>Cicero</strong><br />
Fotos: Christoph Michaelis für <strong>Cicero</strong>, Privat (Autor)<br />
38 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Verein, Thinktank,<br />
Initiative, Online-<br />
Zeitung: Von Storch<br />
führt ein 14-köpfiges<br />
Protestunternehmen<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 39
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Feind wird Freund<br />
Christean Wagner und Matthias Zimmer, zwei Protagonisten im CDU-Richtungsstreit, tun sich zusammen<br />
von Volker Resing<br />
N<br />
ormale spiele gibt es bei<br />
Christean Wagner nicht. Normal<br />
fällt aus. Erst Bock, dann Ramsch,<br />
das ist die Skat-Regel des hessischen CDU-<br />
Fraktionsvorsitzenden. Egal, wo er spielt.<br />
Bock heißt: Der Gewinn zählt doppelt.<br />
Ramsch verkehrt die normalen Spielregeln:<br />
Man muss möglichst wenig Stiche<br />
machen. Am ersten Abend des Bundesparteitags<br />
der CDU in Hannover im Dezember<br />
sitzt Wagner in der lila getünchten Bar<br />
des Hotels Domero und teilt Karten aus.<br />
Es ist grell, es ist ungemütlich. Egal, Wagner<br />
macht es sich an einem Tisch gemütlich<br />
mit seinen Vertrauten. Mit seinen Regeln.<br />
„Spielen Sie mit“, ruft er rüber, als er<br />
den Kollegen Matthias Zimmer sieht. Der<br />
kommt an den Tisch. „Hab 20 Jahre nicht<br />
gespielt“, sagt er. Er schaut nur zu, aber er<br />
zecht mit. Bis spät in die Nacht.<br />
Als es im Dezember beim Bundesparteitag<br />
in Hannover krachte, als die Delegierten<br />
an der Homo-Ehe aneinandergerieten,<br />
als ein Dutzend aufgewühlte Redner<br />
ihre Weltbilder, ihre Lebensentwürfe und<br />
ihren Glauben verteidigten, als es darum<br />
ging, wem die CDU gehört – da hatte sich<br />
im Stillen längst eine erstaunliche Annährung<br />
vollzogen, in der Nacht an jenem<br />
Skattisch. Christean Wagner und Matthias<br />
Zimmer haben gemerkt, dass sie sich<br />
prächtig verstehen. Dabei ist Wagner Initiator<br />
des „<strong>Berlin</strong>er Kreises“, des Traditionsbataillons<br />
der CDU, und Matthias Zimmer<br />
will eine moderne Großstadtpartei.<br />
Er kämpft als einer der „Wilden 13“ für<br />
die Gleichstellung der Homo-Ehe. Der<br />
Bewahrer und der Reformer, zwei Protagonisten<br />
des Streits in der CDU, aber sie<br />
können miteinander. Man hört diese Sympathie<br />
heraus, wenn Zimmer den Abend in<br />
der Hotelbar schildert. Und man hört sie,<br />
wenn Wagner über Zimmer sagt: „Der ist<br />
intellektuell brillant.“<br />
Ausgerechnet ein Wortführer der<br />
Traditionalisten und ein Vertreter<br />
der Reformer haben ein Manifest<br />
der Versöhnung geschrieben<br />
Seit Hannover duzen sie sich. Sie haben<br />
sich damals, am Abend nach dem Schlagabtausch<br />
um die Homo-Ehe, gleich ein<br />
zweites Mal in die Bar gesetzt. Sie verabredeten<br />
dort, ein gemeinsames Papier zu<br />
schreiben. Nun ist es fertig und trägt gleich<br />
den wuchtigen Titel: „Die CDU als Volkspartei“.<br />
Die zwei wollen damit ein Signal<br />
im Wahljahr aussenden: Wenn sie sich verstehen,<br />
Wagner und Zimmer, dann müssen<br />
doch auch die Flügel der CDU wieder zueinanderkommen,<br />
die Modernisierer und<br />
die Traditionalisten, die „Wilde 13“ und<br />
der „<strong>Berlin</strong>er Kreis“. „Wagner und ich wollen<br />
die Grabenkämpfe in der CDU beenden<br />
und auf das Verbindende in der christlichen<br />
Volkspartei verweisen“, sagt Zimmer.<br />
„Wir sind verschieden, aber unterschiedliche<br />
Denkrichtungen stärken die CDU.“<br />
Es ist ein Papier der Versöhnung. Der<br />
Trick: Die Gegensätze in der Partei werden<br />
positiv gewendet. Gerade die Unterschiedlichkeit<br />
mache die CDU aus, wird<br />
argumentiert. Verschiedene Werte, soziale<br />
Herkünfte und Interessen zu bündeln,<br />
sei doch das Erfolgsrezept der CDU. „Die<br />
Pluralität und Vielschichtigkeit hat nichts<br />
mit Beliebigkeit oder Warenhauskatalog<br />
zu tun“, heißt es in dem Text, der unter<br />
cicero.de/cduvolkspartei nachzulesen ist.<br />
Die CDU als große Integrationspartei der<br />
Gesellschaft müsse auch den Anspruch haben,<br />
„40 Prozent plus X“ an Stimmen zu<br />
holen. „Die CDU ist unser großes Integrationsprojekt<br />
der politischen Mitte“, sagt<br />
Zimmer.<br />
Der Schritt der beiden ist erstaunlich,<br />
denn in der CDU hat ein Jahrzehnt unter<br />
Angela Merkel Gegensätze wachsen lassen.<br />
Die einen sehen keine Alternative zu den<br />
Veränderungen, die die Kanzlerin vollzogen<br />
hat. Die anderen fühlen sich nach Atomausstieg,<br />
Abschaffung der Wehrpflicht und<br />
Hinwendung zum Mindestlohn fremd im<br />
eigenen Haus. Zwei Sonnensysteme in einer<br />
Partei. Wie haben da Wagner und Zimmer<br />
zusammengefunden?<br />
Die Annäherung beginnt mit einem<br />
Streit. 2011 ruft der Fraktionschef im hessischen<br />
Landtag wegen irgendeiner Sache bei<br />
Zimmer an. Der ist Bundestagsabgeordneter,<br />
2009 hat er der SPD den Wahlkreis Frankfurt<br />
I abgenommen. Ein Neuling, in der Hierarchie<br />
der Union steht Wagner klar über<br />
ihm. Am Telefon ist er wütend. Doch das<br />
Gespräch zieht sich. Zimmer lässt sich nicht<br />
einfach umpusten. Vielleicht gefällt das Wagner,<br />
er schätzt Kampfgeist. Aber bis zum Du<br />
ist es da noch weit, denn sie sind zwei Männer<br />
aus unterschiedlichen Welten.<br />
Christean Wagner wurde 1943 in Ostpreußen,<br />
in Königsberg, geboren, dem<br />
heutigen Kaliningrad. Dort ist seine Heimat,<br />
sagt er. Seinen jüngsten Sohn, den<br />
jetzt 13 Jahre alten Nachzügler, hat er 2000<br />
im alten Königsberger Dom taufen lassen.<br />
„Es war die erste Taufe dort seit 1945“,<br />
sagt Wagner. Es gibt nicht mehr viele in<br />
der CDU, die eine solche Geschichte stolz<br />
macht. Gerade ist er 70 Jahre alt geworden,<br />
und im Herbst nach der Landtagswahl<br />
Foto: Oliver Rüther für <strong>Cicero</strong><br />
40 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Die Grabenkämpfe<br />
beenden“ – Christean<br />
Wagner (rechts) und<br />
Matthias Zimmer<br />
in Frankfurt<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 41
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
hört er auf. Die Homo-Ehe ist eine letzte<br />
Schlacht eines langen Kampfes gegen den<br />
linken Mainstream. Als Student in Marburg<br />
hatte das begonnen. Er trat einer Studentenverbindung<br />
bei. Eroberte mit einer<br />
rechten Listenverbindung die Mehrheit<br />
im Studentenparlament. Es war die Zeit,<br />
als die Welt in Freund und Feind geteilt<br />
war. Studentenverbindung oder Sozialismus.<br />
„Stahlhelmfraktion“ wurden er und<br />
Gleichgesinnte später genannt. Zunächst<br />
war ihnen nicht mal der damals aufstrebende<br />
Roland Koch geradlinig genug. Seit<br />
dieser Zeit hat sich Wagner mit Leuten zusammengetan,<br />
die so konservativ sind wie<br />
er. Er und seine Freunde arbeiten zusammen.<br />
Nach seinen Regeln.<br />
Christean Wagner ist eine der letzten<br />
konservativen Größen der CDU. Als Kultusminister<br />
hat er die Gesamtschule verdammt,<br />
als Justizminister den „härtesten<br />
Strafvollzug“ Deutschlands angekündigt.<br />
Klar, schneidig, Jurist. Aber er haut nicht<br />
nur drauf, er kann mit Raffinesse fechten.<br />
Die hessische Parteispendenaffäre, in der<br />
die Partei Schwarzgeld als jüdische Vermächtnisse<br />
ausgab, überstand er fast galant.<br />
Vor ein paar Jahren hat er den „<strong>Berlin</strong>er<br />
Kreis“ mitbegründet, um den „Markenkern“<br />
der CDU wieder zu stärken.<br />
Matthias Zimmer ist fast zwei Jahrzehnte<br />
jünger, im Mai wird er 52. Er ist Politikwissenschaftler,<br />
Studium in Trier, in den USA,<br />
in München. Er wurde in Hamburg promoviert<br />
und hat sich in Köln habilitiert. Er<br />
arbeitete am Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung,<br />
er hat in Kanada<br />
gelehrt – ein akademisches Leben, in dem<br />
er einen Blick für Veränderungen entwickelt<br />
hat. In Frankfurt arbeitete er für die<br />
Oberbürgermeisterin Petra Roth, die später<br />
ein schwarz-grünes Bündnis einging.<br />
Aber Wagner und Zimmer lassen sich<br />
nicht so einfach einsortieren. Der Konservative<br />
Wagner hat vier Kinder und ist das<br />
dritte Mal verheiratet. „Ich habe es immer<br />
als einen Tiefpunkt empfunden“, sagt er,<br />
„dass ich in meinem Leben meinen eigenen<br />
Ansprüchen an Ehe und Familie nicht gerecht<br />
werden konnte.“ Zimmer wiederum<br />
taugt eigentlich nicht zum Bürgerschreck.<br />
Verheiratet, zwei Kinder, manchmal lässt<br />
er sich einen Drei-Tage-Bart stehen, aber<br />
dazu trägt er ordentlich Krawatte. Wie<br />
Wagner gehörte er einer Studentenverbindung<br />
an. Auf die Frage, warum er für<br />
die Gleichstellung der Homo-Ehe eintritt,<br />
sagt er, er habe da nicht immer so gedacht,<br />
sondern seine Meinung gründlich geändert,<br />
weil er kein Argument für die Ungleichbehandlung<br />
mehr gefunden habe. Zimmer<br />
sieht sich als Analytiker.<br />
Im vergangenen Jahr hat er ein Papier<br />
vorgelegt: „Die CDU in der Großstadt“.<br />
13 Seiten gegen den Frust nach der Serie<br />
verlorener Oberbürgermeisterwahlen und<br />
ein Plädoyer, dass die CDU sich öffnen<br />
müsse – auch für die Grünen. Es hat ihm<br />
Als Zimmer in der Hessen-CDU<br />
Prügel bekommt, nimmt ihn<br />
Wagner plötzlich in Schutz<br />
ein paar Auftritte und vor allem Aufmerksamkeit<br />
eingebracht. Vielleicht merkte sich<br />
Merkel damals seinen Namen.<br />
Als er für seine Großstadt-Streitschrift<br />
im vergangenen Herbst im hessischen Landesvorstand<br />
Prügel bekommt, nimmt ausgerechnet<br />
Wagner ihn plötzlich in Schutz.<br />
„Gutes Papier, wichtige Denkanregung.“<br />
Wagner lädt Zimmer sogar in einen Kreis<br />
von Vertrauten ein, der sich im Kloster<br />
Eberbach trifft. Seine Mitstreiter reiben<br />
sich die Augen. „Mit dem Zimmer kann<br />
man eben gut diskutieren“, sagt Wagner.<br />
Eigentlich umgibt sich Wagner doch<br />
seit der Studentenzeit mit Gleichgesinnten.<br />
Da könnte es auch eine List sein: den<br />
Großstadt-Reformer vereinnahmen, um<br />
die Traditionalisten aus der Schmollecke<br />
herauszuführen. Immerhin ist Zimmer<br />
auch Bundesvize der Christlich-Demokratischen<br />
Arbeitnehmerschaft. Aber vielleicht<br />
hat ein Mann von 70 Jahren so ein<br />
Taktieren auch nicht mehr nötig.<br />
Zimmer jedenfalls profitiert von der<br />
Nähe zum Kontrahenten. Sie interessiert<br />
ihn. Sie macht ihn auch interessant. Und<br />
die Zeit spielt eh für ihn. „Er ist einer der<br />
letzten echten Herren in der CDU“, lobt<br />
er Wagner.<br />
Das jetzt vorliegende Volkspartei-Manifest<br />
sollte Zimmer schreiben. Wagner<br />
würde es redigieren. Reibungslos verlief die<br />
Entstehung dann doch nicht. Der größte<br />
Streit ging um einen Lieblingsbegriff der<br />
Konservativen, geradezu um ein Heiligtum:<br />
den Stammwähler.<br />
Das Wagner’sche Mantra lautet, die<br />
CDU müsse sich mehr um die Stammwähler<br />
kümmern, anstatt den Wechselwählern<br />
nachzujagen. Die verdrossenen Treuen<br />
von einst seien leichter zurückzuerobern als<br />
die flatterhaften mal Richtung Grün mal<br />
sonst wohin irrlichternden neuen Wähler.<br />
Zimmer hingegen nennt dies einen fatalen<br />
Irrtum. Es schlummerten ja auch in den<br />
jungen bürgerlichen Schichten der Städte<br />
CDU-affine Geister, die auf Ansprache<br />
warteten. Diese dürften nicht als Wechselwähler<br />
abgewertet werden. Schwarz-Grün<br />
sei kein Teufelszeug. Wer setzt sich durch?<br />
Sie finden eine Formel. „Die größte<br />
Herausforderung besteht darin, Stammwähler<br />
zu motivieren und neue Stammwähler<br />
zu gewinnen“, heißt es in dem<br />
Papier. Wagner und Zimmer predigen<br />
„Vielstimmigkeit“ in „Grundharmonie“.<br />
Diese Sicht passt zu einer Analyse des Parteienforschers<br />
Franz Walter, der der CDU<br />
ein „Vielfaltsmanagement“ empfohlen hat.<br />
In dem Papier ist viel vom Christentum die<br />
Rede, aber zu den neuen Stammwählern<br />
sollen sogar Islamgläubige gehören: „Die<br />
CDU könnte so auch für eine zunehmende<br />
Zahl von Muslimen attraktiv sein.“<br />
Nur das Problem mit der Homo-Ehe<br />
haben sie in ihrem Papier gemieden. Es<br />
scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.<br />
Wagner sagt: „Die CDU ist ausdrücklich<br />
eine Partei der Toleranz.“ Im Manifest der<br />
zwei steht aber auch, es dürfe keine Abkehr<br />
von „Grundwerten und Traditionen<br />
geben“. Beim Skat nennt man es „drücken“,<br />
wenn man unliebsame Karten im<br />
Spiel beiseitelegt. Das hilft beim Gewinnen.<br />
Auf dem Parteitag in Hannover haben<br />
Wagner und die Konservativen die Abstimmung<br />
gegen die Homo-Ehe gewonnen.<br />
Am Abend danach lief in der Hotelbar<br />
eine zweite Skatrunde. Diesmal stieg<br />
Zimmer ein. Er siegte.<br />
Volker Resing<br />
ist Hauptstadtkorrespondent.<br />
Soeben erschien sein Buch „Die<br />
Kanzlermaschine: Wie die CDU<br />
funktioniert“ (Herder-Verlag)<br />
Foto: Laurence Chaperon<br />
42 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Mit <strong>Cicero</strong> durch das<br />
Wahljahr 2013<br />
Ihre Abovorteile:<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo sparen<br />
Sie über 10 % gegenüber<br />
dem Einzelkauf.<br />
Mehr Inhalt<br />
Sie erhalten zusätzlich<br />
4 x im Jahr das Magazin<br />
Literaturen.<br />
Fit für die Wahl<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.<br />
Unser Geschenk für Sie: „Sinfonie einer Hauptstadt“<br />
Eine musikalische Reise durch <strong>Berlin</strong> – klangvoll-fließend,<br />
pulsierend-bunt, rhythmischhämmernd,<br />
wie das Leben in der Hauptstadt<br />
so spielt. Elektrobeats, Schlager und Big-<br />
Band-Sounds verbinden sich mit lärmenden<br />
Alltagsgeräuschen und historischen O-Tönen<br />
zu einer etwas anderen Sinfonie.<br />
Exklusiv für die Leser von <strong>Cicero</strong> komponiert<br />
von dem <strong>Berlin</strong>er Musiker Volker Schlott.<br />
Ich abonniere <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis.<br />
Bitte senden Sie mir <strong>Cicero</strong> monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit nur 7,– EUR / 5,– EUR<br />
(Studenten) pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im Einzelkauf).* Das Dankeschön erhalte<br />
ich nach Zahlungseingang. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und<br />
können das Abonnement jederzeit kündigen.<br />
Meine Adresse<br />
*Preis im Inland inkl. MwSt. und Versand, Abrechnung als Jahresrechnung über zwölf Ausgaben,<br />
Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH,<br />
Friedrichstraße 140, 10117 <strong>Berlin</strong>, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
Bei Bezahlung per Bankeinzug erhalten Sie eine weitere Ausgabe gratis.<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Kontonummer<br />
Name<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Ich bin Student.<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden einer<br />
E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen<br />
werden.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong> abonnieren! Bestellnr.: 946127<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Shop: www.cicero.de/lesen
| B e r l i n e r R e p u b l i k | N e u l i n g e<br />
Die Politpilze<br />
Nach den Piraten macht die „Alternative für Deutschland“ Schlagzeilen. Protestparteien<br />
schießen aus dem Boden, aber die meisten verkümmern bald wieder. Warum ist das so?<br />
von Christoph Seils<br />
W<br />
as macht eigentlich Gabriele<br />
Pauli? Jenes politische<br />
Talent aus Franken,<br />
das einst die Ehe befristen<br />
und die CSU entmannen<br />
wollte. Gehüllt in eine bayerische Fahne<br />
eroberte Pauli sogar die Titelseite der Bunten.<br />
Dann hob die selbst ernannte CSU-<br />
Rebellin ab. Sie wechselte zu den Freien<br />
Wählern, fühlte sich auch dort gemobbt,<br />
gründete schließlich ihre eigene Protestpartei.<br />
Für einen Moment machten Pauli und<br />
ihre „Freie Union“ im Jahr 2009 bundesweit<br />
Schlagzeilen: Den etablierten Parteien<br />
dräue gefährliche Konkurrenz, schrieben<br />
manche Kommentatoren. Heute sind Freie<br />
Union und Pauli verschwunden.<br />
Politische Hasardeure, die <strong>Berlin</strong> erobern<br />
wollten, gab es in den vergangenen<br />
Jahrzehnten viele. Am Anfang ist es<br />
ja auch einfach. Eine Handvoll Mitstreiter,<br />
eine Vereinssatzung aus dem Internet und<br />
ein paar Forderungen, schon kann man das<br />
System herausfordern.<br />
Schwierig wird es später. Der Weg<br />
vom Küchentisch ins Parlament ist steinig.<br />
Viele Politpilze sind in den vergangenen<br />
sechs Jahrzehnten aus dem Boden<br />
geschossen und wieder eingegangen. Die<br />
Stattpartei ist längst versunken, die Schillpartei<br />
hat sich im Drogenrausch aufgelöst,<br />
die Republikaner sind zur Sekte mutiert.<br />
Nachdem der Piratenhype vorbei<br />
ist, fordert nun die Partei „Alternative für<br />
Deutschland“ das Parteiensystem heraus.<br />
Auch diesmal sind die Töne der Parteigründer<br />
schrill, die Warnungen vor dem<br />
„Euro-Zwangsverband“, dem „Niedergang<br />
der Demokratie“ und den „verbrauchten<br />
Altparteien“ sind eindringlich. Ihr Protest<br />
füllt Säle. Das Selbstbewusstsein der<br />
Parteigründer Bernd Lucke und Konrad<br />
Adam ist beeindruckend. In fünf Monaten<br />
wollen sie in den Bundestag einziehen.<br />
Schon wird prophezeit, die AfD könne<br />
dem schwarz-gelben Lager wichtige Prozente<br />
wegnehmen.<br />
Gemach, gemach. Im Lebenszyklus einer<br />
Protestpartei durchlebt die AfD gerade<br />
die klassische Aufbruchphase. Die Partei ist<br />
gegründet, ein paar spektakuläre Übertritte<br />
von der CDU haben Schlagzeilen gebracht,<br />
die Journalisten sind noch neugierig und<br />
wohlwollend. Mit der Forderung nach<br />
„Wiedereinführung der D-Mark“ hat die<br />
AfD sich klar gegen die etablierten Parteien<br />
positioniert. Das macht sie interessant.<br />
Die Aufbruchphase<br />
Jetzt kann sie den Ansturm von Interessenten<br />
kaum bewältigen. Alle Frustrierten<br />
der Republik jubeln. Nerds und Ideologen<br />
spült es nun in die neue Partei. Und weil<br />
diese noch keine Strukturen hat, wird es<br />
auch dem einen oder anderen politischen<br />
Halbirren oder Ex-Neonazi gelingen, sich<br />
in Amt und Würden wählen zu lassen. Die<br />
politische Konkurrenz reibt sich schon die<br />
Hände.<br />
Gut ist es für eine Protestpartei, wenn<br />
in dieser Aufbruchphase eine Landtagswahl<br />
ansteht, möglichst in einem der drei Stadtstaaten.<br />
Nirgendwo ist es für neue Parteien<br />
einfacher, in ein Landesparlament einzuziehen,<br />
als in Bremen, Hamburg oder <strong>Berlin</strong>.<br />
Die traditionellen Parteienbindungen<br />
sind dort brüchiger, das Erregungspotenzial<br />
höher. Kein Wunder, dass viele Protestparteien<br />
dort ihren Ursprung hatten:<br />
die Republikaner und die Piraten in <strong>Berlin</strong>,<br />
die Schill- und die Stattpartei in Hamburg.<br />
Pech für die Alternative für Deutschland.<br />
Bis zu den Wahlen in Hamburg und<br />
Bremen muss sie sich bis 2015 gedulden,<br />
<strong>Berlin</strong> wählt noch später.<br />
Die Grünen zogen bei ihrem Kampf gegen<br />
den Atomtod 1978 erstmals in Bremen<br />
in ein Landesparlament ein. 20 000 Wähler<br />
reichten, um die alte Bundesrepublik<br />
aufzumischen. Der Osten mit seinen vielen<br />
Wechselwählern ist auch ein geeignetes<br />
Terrain. Mit einer Materialschlacht etwa<br />
gelang es der DVU 1998 in Sachsen-Anhalt,<br />
12,9 Prozent der Wähler zu mobilisieren.<br />
Die genauso schlichte wie erfolgreiche<br />
Parole lautete: „Diesmal Protest wählen“.<br />
Angst ist für die politischen Neulinge<br />
eine ideale Helferin. Wo die etablierten<br />
Parteien in einem Kokon aus Verantwortung,<br />
Sachzwängen und Interessenausgleich<br />
gefangen sind, können die politischen<br />
Außenseiter ohne Rücksichtnahme<br />
hemmungslos ihre Angstkampagnen inszenieren:<br />
gegen Ausländer, gegen Gift im<br />
Essen, gegen den Euro, gegen Massenverarmung<br />
durch Hartz IV, gegen den Überwachungsstaat.<br />
Die Projektionsflächen der<br />
Unzufriedenen variieren.<br />
Karikaturen: Burkhard mohr; Foto: Andrej Dallmann<br />
44 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Die Aufbauphase<br />
Mit dem ersten Wahlerfolg beginnt die<br />
nächste Phase im Lebenszyklus einer neuen<br />
Partei, die Aufbauphase. Es gilt, professionelle<br />
Strukturen aufzubauen. Einfach<br />
ist das nicht. Denn auf die erste Euphorie<br />
folgen meist der Frust, der Streit ums<br />
Programm und der Kampf um die Macht.<br />
Kein Wunder, dass spätestens in dieser<br />
Phase die meisten neuen Parteien scheitern.<br />
Die Stattpartei erlebte ein paar wilde<br />
Monate. Bei den Piraten dauerte es etwas<br />
länger als ein Jahr, bis sie an ihre Grenzen<br />
stießen und in der Wählergunst wieder<br />
abstürzten. Die AfD steht vor allem unter<br />
Zeitdruck: Weil die Bundestagswahl bevorsteht,<br />
muss sie die Aufbauphase in kurzer<br />
Zeit durchziehen. Innerhalb weniger Wochen<br />
müssen 16 Landesverbände gegründet,<br />
Landeslisten gewählt und 299 Direktkandidaten<br />
aufgestellt werden.<br />
Der bundesdeutsche Föderalismus<br />
stellt eine zusätzliche Herausforderung<br />
dar. Noch vor ein paar Wochen galt der<br />
Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert<br />
Aiwanger, als konservativer Hoffnungsträger.<br />
Doch dann trat der designierte<br />
Spitzenkandidat und Adenauer-Enkel Stephan<br />
Werhahn aus der Partei aus und beschwerte<br />
sich über den autoritären Führungsstil<br />
des Parteichefs. Keine Partei in<br />
Deutschland lässt sich hierarchisch und<br />
zentralistisch von oben nach unten organisieren.<br />
Stattdessen müssen Provinzfürsten<br />
eingebunden werden, Kandidaten<br />
brauchen ihren Freiraum. Parteien sind<br />
im Föderalismus ein fragiles Gefüge von<br />
checks and balances.<br />
Zudem müssen die Wähler in Ost und<br />
West, in Nord und Süd, in Großstädten<br />
und der Provinz unterschiedlich angesprochen<br />
werden. Der Landwirt Aiwanger ist<br />
Großstädtern genauso wenig vermittelbar<br />
wie die Internet-Junkie Marina Weisband<br />
von den Piraten auf dem flachen Land,<br />
wo es noch nicht mal Breitbandkabel gibt.<br />
Ob der überalterte und männerdominierte<br />
Volkswirteclub AfD auch Frauen, Jugendliche<br />
und Arbeiter erreichen kann, das muss<br />
sich erst noch erweisen.<br />
Die Bürokratiephase<br />
In der nächsten Phase müssen die Regularien<br />
des Parteienstaats überwunden werden.<br />
So leicht es ist, Partei zu werden, so schwer<br />
ist es, erstmals an einer Wahl teilzunehmen.<br />
Wenn die Basis im Wahlkampf endlich loslegen<br />
will, müssen in der Bürokratiephase<br />
Unterschriften gesammelt werden: 200<br />
für jeden Direktkandidaten, bis zu 2000<br />
für jede Landesliste. Nur bis zum 15. Juli<br />
hat die AfD dafür Zeit. Spätestens bei dieser<br />
politischen Kleinarbeit zeigt sich, ob<br />
die Partei schon Stehvermögen<br />
hat. Jede falsche Unterschrift<br />
kann sich zu einem Skandal<br />
ausweiten.<br />
Und das Geld? Aus der staatlichen<br />
Parteienfinanzierung fließen Mittel,<br />
wenn der ziemlich komplexe<br />
Rechenschaftsbericht fehlerlos ist.<br />
Jede Partei, die bei einer Landtagswahl<br />
mindestens 1 Prozent der<br />
Stimmen erzielte oder bei einer Bundestagswahl<br />
0,5 Prozent, wird in Deutschland<br />
vom Staat alimentiert. Wieder hat die<br />
AfD Pech: Für sie öffnet sich die Staatskasse<br />
noch nicht. Die Piraten hingegen erhalten<br />
in diesem Jahr Abschlagszahlungen<br />
in Höhe von 792 000 Euro.<br />
Die Reaktionsphase<br />
In der nächsten Phase schlägt das System<br />
zurück, gnadenlos. Populismus! Extremismus!<br />
Je lauter die etablierten Parteien die<br />
Neuen beschimpfen, desto nervöser sind<br />
sie. Dennoch kann die Schärfe der Angriffe<br />
unangenehm sein. Nicht selten ertönt nun<br />
auch der Ruf nach dem Verfassungsschutz.<br />
Wie bei den Republikanern, die 1989 überraschend<br />
ins Westberliner Abgeordnetenhaus<br />
eingezogen waren.<br />
In der Reaktionsphase, wenn die etablierten<br />
Parteien aufgewacht sind, integrieren<br />
sie gerne auch Inhalte der jungen<br />
Konkurrenz. Wenn plötzlich das Asylrecht<br />
doch verschärft, der Aufbau Ost intensiviert<br />
oder die staatliche Datensammelwut<br />
gebremst wird, verliert der Marsch auf <strong>Berlin</strong><br />
an Schwung.<br />
So einfach lässt sich das bundesdeutsche<br />
Parteiensystem nicht ins Wanken<br />
bringen. Nur zwei Parteien ist es in sechs<br />
Jahrzehnten gelungen, in die Phalanx der<br />
etablierten Parteien einzudringen: den<br />
Grünen und der PDS beziehungsweise<br />
deren Nachfolgepartei Die Linke.<br />
Unter welchen Voraussetzungen gelingt<br />
es Parteien, sich doch zu etablieren?<br />
Parteien brauchen nicht nur ein Programm<br />
und charismatische Figuren. Sie<br />
sind nicht bloß Interessenvertretung und<br />
Machtmaschine, sondern auch Wertegemeinschaft.<br />
Sie werden nicht nur von gemeinsamen<br />
Zielen zusammengehalten,<br />
sondern von kollektiven Erinnerungen,<br />
etwa an den Friedenskanzler Willy Brandt,<br />
an die Schlacht am Bauzaun in Brokdorf<br />
oder an das Ampelmännchen, die<br />
Puhdys und die Polikliniken.<br />
Mythen und Legenden<br />
sind der Kitt, mit dem<br />
sich Anhänger langfristig<br />
mobilisieren und die Mitglieder<br />
auch über tiefe persönliche und<br />
politische Differenzen hinweg<br />
binden lassen.<br />
Und Parteien brauchen auf<br />
dem Weg vom Rand in die Mitte<br />
der Gesellschaft eine gesellschaftliche<br />
Konfliktlinie, an der die etablierte<br />
Konkurrenz versagt. Den Grünen gelang<br />
der Aufstieg, weil in den siebziger Jahren<br />
im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik<br />
eine junge Generation nach den ökologischen<br />
Kosten der Industriegesellschaft<br />
fragte und die SPD die „Randgruppe der<br />
Aussteiger“ nicht ernst nahm. Die PDS<br />
wiederum nahm sich nach der Wiedervereinigung<br />
der Interessen der ehemaligen<br />
DDR-Eliten an. Die Westparteien fanden<br />
zu diesen weder politisch noch kulturell<br />
einen Zugang. Als die ostdeutsche Regionalpartei<br />
ihren Zenit überschritten hatte,<br />
verschaffte ihr Schröders Agenda 2010 einen<br />
zweiten Frühling.<br />
Jetzt droht also auch der Union Konkurrenz<br />
im eigenen Lager. Europa ist ein<br />
Konfliktthema, mit dem sich eine neue<br />
Partei profilieren könnte. Zumal die Bundesregierung<br />
keine andere Wahl hat, als<br />
den Euro zu verteidigen, und konservative<br />
Christdemokraten auch darüber hinaus<br />
mit Kanzlerin Merkel hadern. Doch<br />
die Herausforderungen, an denen schon<br />
so viele Politpilze gescheitert sind, beginnen<br />
auch für die Alternative für Deutschland.<br />
Die Zeit ist knapp, den Machern<br />
fehlt Erfahrung, und den rechten Narrensaum,<br />
den die Euro-Gegner anlocken, werden<br />
sie so schnell nicht los.<br />
Christoph Seils<br />
leitet <strong>Cicero</strong> Online. Er ist Autor<br />
des Buches „Parteiendämmerung<br />
oder: Was kommt nach den<br />
Volksparteien?“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 45
| B e r l i n e r R e p u b l i k | M e i n S c h ü l e r<br />
„Wir nannten ihn Rächer“<br />
Notfalls erzwang Sigmar Gabriel Gespräche beim Direktor.<br />
Klaus Drüner, damals Lehrer, über den heutigen SPD-Chef<br />
Pausbäckig war Sigmar Gabriel als Schüler, er sah<br />
ein bisschen wie ein Barockengel aus. Er war ernst,<br />
aber immer sympathisch. Gabriel ist ein gutes Beispiel<br />
für die Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems.<br />
Er war ja erst auf der Realschule und kam<br />
in der zehnten Klasse zu uns aufs Ratsgymnasium in<br />
Goslar, wo er dann reüssierte und 1979 Abitur gemacht<br />
hat. Ich hatte ihn im Sozialkundeunterricht.<br />
Wir haben den Nationalsozialismus durchgenommen, den Kommunismus<br />
sowjetischer und chinesischer Prägung und vor allem<br />
die Vier-Mächte-Verantwortung für Deutschland. Gabriel war extrem<br />
wissbegierig, was manchmal den Unterricht in die Länge zog,<br />
und ihn in andere Richtungen lenkte, als ich wollte. Oft sprang er<br />
auch von Thema zu Thema. Da musste ich manchmal bremsen.<br />
Er war ein extrovertierter Typ, der sehr gut bei seinen Mitschülern<br />
ankam. Er machte in der Schule viel Propaganda für die<br />
SPD-nahen „Falken“, bei denen er Mitglied war. Ich glaube, jede<br />
Jugendorganisation braucht Typen wie ihn. Weil er es verstand,<br />
junge Menschen an sich zu binden. Bei uns wurde er dann Schülersprecher.<br />
Wir Lehrer haben uns gefreut, weil Gabriel kein Typ<br />
war, der gleich die Schule aufmischen wollte, wie viele seiner Mitschüler.<br />
Er hatte zwar viel zu kritisieren, aber das war immer konstruktiv.<br />
Ich gebe zu, manchmal war es lästig, wenn Konferenzen<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
kein Ende fanden, weil ihm immer wieder etwas<br />
Neues einfiel. Oder seine penetrante Einsatzfreude:<br />
gegen Unrecht, aber manchmal eben auch gegen<br />
vermeintliches Unrecht. Im Lehrerzimmer nannten<br />
wir ihn scherzhaft „Rächer der Enterbten“ oder<br />
auch „Erzengel Gabriel“.<br />
Einmal wollte er zum Direktor vordringen. Aber<br />
dem passte es gerade nicht, deshalb sagte er Gabriel,<br />
er solle einen Termin im Sekretariat ausmachen. Was machte Gabriel?<br />
Er klopfte einfach noch mal. Da kam der Direktor wieder<br />
raus und rief: „Ich habe Ihnen doch gesagt, es passt gerade nicht!“<br />
Aber noch bevor er die Türe wieder zuknallen konnte, hatte Gabriel<br />
schon seinen Fuß in den Türrahmen geklemmt. So war er.<br />
Als ich neulich in der Zeit las, dass sein Vater überzeugter Nazi<br />
gewesen sei, war ich erschüttert. Das wussten wir alle nicht. In der<br />
Schulzeit trat nur seine Mutter in Erscheinung, und die war besonders<br />
nett. Wenn ich ihn heute im Fernsehen sehe, erkenne ich<br />
meinen damaligen Schüler sofort wieder. Obwohl mir manchmal<br />
scheint, ihm fehlt intellektuelle Tiefe. Ich verstehe schon, dass die<br />
SPD ihn noch nicht aufs Schild gehoben hat.<br />
In der <strong>Cicero</strong>-Serie „Mein Schüler“ zur Bundestagswahl spürt<br />
Constantin Magnis Lehrer unserer Spitzenpolitiker auf<br />
Sigmar Gabriel vor<br />
dem Ratsgymnasium<br />
in Goslar, wo er<br />
1979 Abitur machte.<br />
Klaus Drüner, 84,<br />
unterrichtete den<br />
heutigen SPD-<br />
Vorsitzenden dort<br />
in Sozialkunde<br />
Fotos: Privat, M.C.Hurek.de; Grafik: <strong>Cicero</strong><br />
46 <strong>Cicero</strong> 5.2013
ZEIT FÜR NEUE GEDANKEN<br />
Ö ST E R R E I C H 5 , 9 0 €<br />
S C H W E I Z 9 , 5 0 S F R<br />
148 Seiten Inspiration. Jeden Monat neu!<br />
LEBEN . LIEBE . JOB . WOHLFÜHLEN<br />
05/13<br />
Schlecht<br />
geträumt?<br />
Entschlüsseln<br />
Sie den Code der<br />
Nacht<br />
M A I 2 0 1 3<br />
D E U TS C H L A N D 4 , 8 0 €<br />
LUST JA, LIEBE NEIN<br />
Geht Sex<br />
ohne Gefühl?<br />
Deshalb sind wir Freundinnen! BeNeLux 6,20 € Italien 7,20 € Spanien 7,20 €<br />
REISE<br />
Wie im Paradies<br />
Acht (fast) unbekannte Inseln<br />
– von Mittelmeer bis Karibik<br />
JOB<br />
Baby, du bringst<br />
mich auf Ideen<br />
Neustart nach der Elternzeit<br />
DOSSIER<br />
Deshalb<br />
sind wir<br />
Freundinnen!<br />
„<br />
EXKLUSIV<br />
Schauspielerin<br />
MARTINA GEDECK<br />
Ich würde<br />
nie gegen mein<br />
Empfinden<br />
handeln<br />
„<br />
WAS FREUNDSCHAFTEN ÜBER UNS VERRATEN. EIN NEUER BLICK<br />
ERKENNTNIS: So formen Freundinnen unser Ich<br />
MÄNNER, KARRIERE, LOYALITÄT: Die 12 kniffligsten Freundschaftsfragen<br />
ZUSAMMENHALT: Von Sandkastenliebe bis Zickenkrieg<br />
01_0513_Cover_D_RZ_fuer_Werbung.indd 1<br />
4 1 9 7 0 8 3 1 0 4 8 0 3 0 5<br />
01_0513_Cover_D_RZ_fuer_Werbung.indd 1 21.03.13 12:34<br />
21.03.13 12:34<br />
www.emotion.de<br />
Möchten Sie EMOTION kennenlernen?<br />
Dann bestellen Sie Ihr persönliches Probeabonnement unter www.emotion.de/probeabo
| B e r l i n e r R e p u b l i k | L e i t b i l d e r<br />
FleiSchFan im<br />
Veganerclub<br />
Dienendes Ethos übertrumpft grelles Ego: Peer Steinbrücks Scheitern zeigt<br />
den Siegeszug der protestantischen Kultur in der politischen Sphäre<br />
von Christine Eichel<br />
D<br />
er Empörungspegel ist hoch.<br />
Wohl selten hat ein Kanzlerkandidat<br />
für derart viel Unmut<br />
gesorgt, und das, noch bevor<br />
der Wahlkampf richtig begonnen<br />
hat. Fehler, Fettnäpfchen, falsche Töne.<br />
Wie konnte es zu der bemerkenswerten<br />
Aversion gegen einen Mann kommen, auf<br />
dessen Fehltritte geradezu gelauert wird?<br />
Woher rührt der notorisch negative Reflex?<br />
Peer Steinbrück versucht, sich als Klartexter<br />
zu stilisieren. Er spreche doch nur<br />
aus, was viele denken, verteidigt er sich.<br />
Damit bemüht er den alten Mythos, dass<br />
öffentliche und veröffentlichte Meinung<br />
weit auseinanderklaffen. Sein wahrer Fehler<br />
ist jedoch nicht der kantige Klartext, es<br />
ist ein Denkfehler: zu meinen, der Wähler<br />
favorisiere einen Haudegen, der sich mit<br />
markigen Sprüchen, einträglichen Nebengeschäften<br />
und einem Faible für erlesene<br />
Weine positioniert.<br />
In Zeiten, in denen Parteiprogramme<br />
verwechselbar sind – wenn sie denn überhaupt<br />
gelesen werden – und in denen man<br />
sich gegenseitig Themen wie Mindestlohn<br />
und Homo-Ehe abjagt, sind Menschen<br />
Programm. Die Personalisierung von Politik<br />
ist nicht neu. Doch mit den Kontrahenten<br />
Angela Merkel und Peer Steinbrück<br />
gewinnt sie Konturenschärfe. Ein Blick auf<br />
jene, die mehr Fortune auf dem politischen<br />
Parkett haben, verrät die kollektive Sympathie<br />
für einen ganz anderen Typus, als ihn<br />
Peer Steinbrück verkörpert. Dabei fällt eine<br />
eigentümliche Symptomatik auf: das Pfarrhaus<br />
als Ressource des politischen Personals.<br />
Schauen wir zur Spitze der Republik.<br />
Angela Merkel ist Pfarrerstochter, Joachim<br />
Gauck war lange Pfarrer. In der Nachfolgedebatte<br />
um Christian Wulff wurden neben<br />
Gauck weitere evangelische Theologen<br />
genannt: Margot Käßmann beispielsweise,<br />
Altbischof Wolfgang Huber. Katrin Göring-<br />
Eckardt, Präses der EKD und Ehefrau eines<br />
Pfarrers, obsiegte jüngst über ihre Gegenspielerin<br />
Claudia Roth. Offenbar sorgen<br />
Gestus und Habitus des Pfarrhauses für einen<br />
kräftigen Vertrauensvorschuss, für die<br />
freundliche Unterstellung ethischer Integrität<br />
aus dem Geist von Hausmusik<br />
und Tischgebet. Ja, es scheint, als seien<br />
Erfolg hat das<br />
Pfarrhaus mit<br />
seinem Geist<br />
von Fleiß und<br />
Bescheidenheit<br />
evangelische Pfarrhäuser geradezu Kaderschmieden<br />
für Ämter mit höchstem Symbolwert<br />
und moralischer Leuchtturmfunktion.<br />
Die Pfarrhausherkunft wirkt wie ein<br />
Gütesiegel in einem politischen Klima, in<br />
dem mancher auffallend geschmeidig seine<br />
Prinzipien auswechselt. Oder gar nicht erst<br />
welche hat.<br />
Vom Aroma der Pfarrhausherkunft ist<br />
Peer Steinbrück weit entfernt. Zwar ist er<br />
selbst evangelisch, hat sogar Pastoren unter<br />
seinen Vorfahren und soll ein Luther-<br />
Verehrer sein. Dennoch bricht er geräuschvoll<br />
die Regeln dieses Milieus. Woran er<br />
letztlich scheitert, ist der Siegeszug der<br />
protestantischen Kultur in der politischen<br />
Sphäre. Vor allem Pfarrerskinder verinnerlichten<br />
die moralischen und ästhetischen<br />
Codes des Elternhauses. Merkel ist das prominenteste<br />
Beispiel dafür. Sie repräsentiert<br />
den heilignüchternen Pfarrhausbewohner<br />
mit all jenen Tugenden, die Konjunktur<br />
haben: Bescheidenheit, Pflichtgefühl, unprätentiöses<br />
Auftreten. Dabei mischen sich<br />
Qualitäten des Pfarrhauses mit den Sekundärtugenden<br />
preußischer Couleur: Selbstdisziplin<br />
und Verantwortungsbewusstsein,<br />
Sparsamkeit, Unbestechlichkeit, Zuverlässigkeit.<br />
„Dienst ist alles“, sagt ein preußischer<br />
Offizier in Fontanes „Stechlin“. „Was<br />
uns obliegt, ist nicht die Lust des Lebens,<br />
auch nicht einmal die Liebe, die wirkliche,<br />
sondern lediglich die Pflicht.“<br />
Es ist das Ethos des Dienens, nicht die<br />
grelle Selbstinszenierung. Angela Merkel<br />
48 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein<br />
bedient dieses Ethos instinktsicher. Schon<br />
äußerlich nimmt sie sich zurück. Mit den<br />
immer gleichen Dreiknopfjacketts uniformiert<br />
sie sich – kein elegantes Kostüm,<br />
keine Koketterie lenken vom Amt<br />
ab. Während Politikerinnen in Frankreich<br />
oder Italien ohne Weiteres in Designeroutfits<br />
auftreten, ist solch noble Eleganz<br />
in Deutschland verpönt. Gleichzeitig<br />
wirkt die Kanzlerin entsexualisiert in ihrer<br />
Arbeitsuniform, ganz in der eher prüden<br />
Tradition des Pfarrhauses. Einmal nur wich<br />
die Kanzlerin von ihrer textilen Strategie<br />
der planvollen Untertreibung ab: als sie im<br />
April 2008 zur Eröffnung der Osloer Oper<br />
ein üppiges Dekolleté präsentierte. Allein<br />
in Deutschland beschäftigten sich 78 der<br />
302 Artikel und Hörfunkbeiträge über das<br />
Event mit dem Kleid der Kanzlerin, errechnete<br />
die Osloer Tourismusförderung.<br />
Hoppla, sie ist eine Frau!<br />
Angela Merkel hat nie wieder ihr dirndltaugliches<br />
Dekolleté gezeigt. So wollte sie<br />
nicht gesehen werden, als Objekt der Begierde,<br />
als Frau hinter der Uniform. Sie hatte<br />
längst verstanden: Die Leibfeindlichkeit des<br />
Pfarrhauses ist weit entfernt von fröhlichem<br />
Hedonismus, und genau das macht sie mit<br />
dem Anforderungsprofil des Politikers kompatibel.<br />
„Sorgt nicht um euer Leben, was ihr<br />
essen und trinken werdet; auch nicht um euren<br />
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht<br />
das Leben mehr als die Nahrung und der<br />
Leib mehr als die Kleidung?“, heißt es im<br />
Neuen Testament. Seit Luther stehen Pomp<br />
und Pracht vollends unter dem Verdacht der<br />
Prätention. Wer im evangelischen Pfarrhaus<br />
aufgewachsen ist, hält sich zurück, zuweilen<br />
in fast klösterlicher Askese.<br />
Diese Haltung hat heute Leitbildpotenzial.<br />
Denn nicht nur bei der Kleidung,<br />
auch beim Essen und Trinken schaut man<br />
genau hin, wenn es um die politische Bonität<br />
geht. Schon die eher harmlose Bemerkung<br />
Steinbrücks, er würde keinen Pinot<br />
Grigio unter fünf Euro trinken, löste eine<br />
heftige Debatte aus. Unvergessen ist auch<br />
die Aufregung über Gerhard Schröders Brioni-Anzüge.<br />
Ein Pastor im Porsche hätte<br />
ähnlich irritiert. Angela Merkel dagegen<br />
lässt sich beim Einkaufen im Supermarkt<br />
fotografieren und beteuert, sie bevorzuge<br />
Hausmannskost. Auch Sahra Wagenknecht<br />
hat verstanden, wie wichtig solche Details<br />
sind. Sie löschte einst eigenhändig Fotos,<br />
die sie beim Hummeressen in Straßburg<br />
zeigten.<br />
Petitessen? Wohl eher sind es Fußnoten<br />
zu einem gesellschaftlichen Klima, in<br />
dem krisengebeutelte Wähler fürchten,<br />
dass an höchster Stelle womöglich Wasser<br />
gepredigt und Wein getrunken werde. Natürlich<br />
geht es nicht nur um Äußerlichkeiten.<br />
Doch die Oberflächen werden zunehmend<br />
wichtiger. Das Sichtbare rückt<br />
in den Fokus, denn kaum ein Laie kann<br />
noch beurteilen, welche politischen Konzepte<br />
angemessen sind. Sachthemen wie<br />
die Lösungsansätze zur Rettung des Euro<br />
sind hochkomplex, kaum vermittelbar fürs<br />
große Publikum. Klar kann man darüber<br />
reden, aber wer hört schon zu, wenn wieder<br />
einmal eine Talkshow über die Finanzkrise<br />
ansteht? TMI nennt man so etwas in<br />
der Terminologie der Kommunikationsstrategen:<br />
too much information. Deshalb<br />
sind Menschen zum Programm geworden.<br />
Was Menschenkenntnis betrifft, hält sich<br />
jeder für einen Spezialisten: Sage mir, wie<br />
du dich verhältst, und ich sage dir, wer du<br />
bist – und ob ich dich wähle.<br />
Damit geraten Stil- und Haltungsfragen<br />
ins Zentrum des Interesses. Und es<br />
spricht immer mehr dafür, dass man heute<br />
vom Politiker verlangt, was einst den idealen<br />
Pfarrer auszeichnete. Zu dessen Image<br />
gehörte traditionell aufopferungsvoller<br />
Fleiß. In der Bibel heißt es über das Leben:<br />
„Und wenn’s köstlich gewesen ist, so<br />
ist’s Mühe und Arbeit gewesen.“ Das klingt<br />
nach einem reichlich spaßbefreiten Credo,<br />
aber Angela Merkel macht vor, wie es sich<br />
in eine erfolgversprechende Strategie verwandeln<br />
lässt. Ihr Bienenfleiß wird gerühmt,<br />
so wie die unerschütterliche Disziplin,<br />
mit der sie nächtelange Sitzungen<br />
übersteht und auch nach transatlantischen<br />
Flügen konzentriert vor die Kameras tritt.<br />
Hier kommt die protestantische Arbeitsethik<br />
ins Spiel. Sie zeichnet sich durch eine<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 49
F r a u F r i e d f r a g t s i c h …<br />
… ob Frauen zu faul für<br />
Führungspositionen sind<br />
I<br />
ch will nicht vorstandsvorsitzende<br />
sein. Oder<br />
Chefredakteurin. Macht interessiert<br />
mich nicht. Ich gestalte lieber<br />
freiberuflich vor mich hin, ohne<br />
einen Chef zu haben und ohne Chefin<br />
zu sein. Chef sein lohnt sich eigentlich<br />
nicht. Man arbeitet deutlich mehr<br />
als andere und kriegt Haue, wenn’s<br />
schlecht läuft. Gut, man verdient auch<br />
deutlich mehr und kann sich wichtig<br />
fühlen. Aber auch das interessiert mich<br />
nicht besonders. So, nun ist es raus.<br />
Wahrscheinlich werde ich jetzt sofort<br />
aus der Initiative Pro Quote (für<br />
mehr Frauen in journalistischen Spitzenpositionen)<br />
ausgeschlossen. Dabei<br />
gehöre ich ihr aus voller Überzeugung an. Ich finde es nämlich richtig und wichtig,<br />
dass die Medien dieses Landes, die zur Hälfte von Frauen konsumiert werden,<br />
zu mindestens 30 Prozent (lieber noch zur Hälfte) von Frauen geleitet werden. Nur<br />
möchte ich keine von ihnen sein. Und, wie ich immer häufiger feststelle, auch viele<br />
andere nicht. Diese vielen anderen Frauen wollen auch nicht Vorstände oder gar<br />
Vorstandsvorsitzende anderer Unternehmen sein. Diese Frauen wollen überhaupt<br />
nicht nach ganz oben. Sie wollen nicht an albernen Pinkelwettbewerben teilnehmen,<br />
sich mit ausgefahrenen Ellbogen in einer Machowelt durchsetzen müssen und<br />
einem absurden – von Männern etablierten – Anwesenheitskult unterwerfen. Oh<br />
nein, sie sind nicht faul. Sie wollen arbeiten und Karriere machen, aber nur bis zu<br />
einem Punkt, an dem sie auch noch ein Leben haben. Freunde. Eine Familie. Und<br />
ganz ehrlich: Ich verstehe sie.<br />
Leider dienen diese Frauen vielen Männern dazu, Frauen generell am Aufstieg<br />
zu hindern. Und zwar auch jene, die aufsteigen wollen (und davon gibt es ebenfalls<br />
eine Menge)! Sie stoßen immer noch an die unsichtbaren Grenzen eines uralten<br />
Mannschaftsgeists, der dafür sorgt, dass alles bleibt, wie es ist. Aber nur, wenn<br />
es mehr von diesen Frauen nach ganz oben schaffen, besteht die Chance, dass sich<br />
endlich etwas ändert. Dass aus halbherzigen Teilzeitmodellen „für unsere Muttis<br />
im Betrieb“ endlich flexible Arbeitszeitregelungen für Frauen und Männer werden.<br />
Dass Väter nicht nur zwei Monate Elternzeit nehmen, weil sie Angst haben,<br />
gemobbt zu werden. Dass beruflich engagierte Mütter nicht mehr schief angesehen<br />
und als karrieregeil beschimpft werden. Dass in Wirtschaft und Gesellschaft endlich<br />
gleiche und vernünftige Bedingungen für Männer und Frauen herrschen.<br />
Dann würden auch mehr Frauen in Spitzenpositionen wollen. Weil sie immer<br />
noch Zeit für ihren Partner, ihre Kinder und ihre Freunde hätten. Weil der Beruf<br />
nicht ihr Leben wäre, sondern ein wichtiger Teil davon. Gleichberechtigung kann<br />
schließlich nicht heißen, dass wir Frauen jeden Mist nachmachen, den uns die<br />
Männer vormachen.<br />
Amelie Fried ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über<br />
Männer, Frauen und was das Leben sonst noch an Fragen aufwirft<br />
hohe Innenleitung aus. Wer sie überzeugend<br />
vermittelt, steht nicht im Ruch, es<br />
auf Ruhm oder Geld abgesehen zu haben.<br />
Wenn Steinbrück erklärt, ein Kanzler verdiene<br />
zu wenig, muss er sich nicht wundern,<br />
dass ihm seine Glaubwürdigkeit verloren<br />
geht. Sofort kommt der Verdacht auf,<br />
hier wolle jemand Kapital aus seinem Amt<br />
schlagen.<br />
Von jeher war es ein Distinktionsmerkmal<br />
protestantischer Kreise, nie über Geld<br />
zu sprechen, um ja nicht den Eindruck der<br />
Gier zu erwecken. Welchem Pfarrer würde<br />
man schon attestieren, er verfolge mit seinem<br />
Amt finanzielle Interessen? Das leidenschaftslose<br />
Verhältnis zum Geld wird in der<br />
Außenwahrnehmung oft als Qualität des<br />
Protestantischen gesehen, und als Qualität<br />
des Pfarrhauses. Denn es gilt auch der Umkehrschluss:<br />
Wenn ein Pfarrer sich nichts aus<br />
Luxus macht, kann er nicht in Versuchung<br />
geraten, sich Luxus unredlich zu erwerben.<br />
Bestechlichkeit ist daher weitgehend ausgeschlossen.<br />
In einer ökonomisierten Gesellschaft<br />
hat das Pfarrhaus damit gewissermaßen<br />
ein Alleinstellungsmerkmal. Womit<br />
wir bei einem weiteren heiklen Punkt wären,<br />
dem Eindruck unzulässiger Komplizenschaft<br />
mit den Reichen dieser Welt.<br />
Als bekannt wurde, dass der inzwischen<br />
eingestellte „Peer-Blog“ von zahlungskräftigen<br />
Unternehmern finanziert wurde, hatte<br />
Steinbrück Mühe, den Imageschaden in<br />
Grenzen zu halten. Noch war in Erinnerung,<br />
dass Christian Wulff über allzu innige<br />
Beziehungen zu Unternehmern gestolpert<br />
war. Nicht zuletzt ein Urlaub auf Sylt,<br />
der Insel der Reichen und Schönen, sorgte<br />
für Stirnrunzeln: Dort hatte der Filmproduzent<br />
David Groenewold 2007 die Hotelrechnung<br />
für Wulff bezahlt. Wulffs<br />
Rechtsanwalt erklärte, sein Mandant habe<br />
Groenewold die Summe in bar erstattet –<br />
ein Geschmäckle blieb. Angela Merkel dagegen<br />
wandert in den Dolomiten, ohne<br />
glamouröse Freunde. Außerdem residiert<br />
sie nicht in einer Villa, die von Privatkrediten<br />
vermögender Freunde finanziert werden<br />
muss, sondern begnügt sich mit einer<br />
Etagenwohnung. Es war Martin Luther,<br />
der als Erster das lateinische Wort „modestia“<br />
im Sinne von Genügsamkeit und<br />
Verzicht übersetzte. Darin mitgedacht ist,<br />
dass die Bescheidenheit nicht durch Armut<br />
erzwungen, sondern eine selbst gewählte<br />
Lebensform ist. Merkel führt das so<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
50 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Privat<br />
beiläufig vor, dass man es fast schon wieder<br />
virtuos nennen kann. Selbst der neue Papst<br />
hat den Zeitgeist verstanden: Schlichtheit<br />
und Bescheidenheit stehen neuerdings<br />
auch auf der Agenda des Oberhaupts der<br />
Katholiken.<br />
Natürlich spielt auch die DDR-Herkunft<br />
für den Erfolg Merkels und Gaucks<br />
eine Rolle. Im ostdeutschen Pfarrhaus bildete<br />
sich eine eigene Identität im Schatten<br />
der Macht aus, jenseits des real existierenden<br />
Machtmissbrauchs. Die Verhältnisse<br />
waren karg, täglich fand ein moralischer<br />
Lackmustest statt. Das Pfarrhaus konnte<br />
seine Glaubwürdigkeit in der DDR nur<br />
aufrechterhalten, wenn es innerlich unabhängig<br />
und äußerlich unbestechlich blieb.<br />
So etwas prägt. Man mag beklagen, dass<br />
der politischen Kultur Deutschlands mit<br />
dem Protestantismus das nötige Quäntchen<br />
Übermut und auch das Spielerische<br />
abhandenkommt, das die Politik von jeher<br />
beatmete und attraktiv machte. Ein<br />
bisschen mehr Sinnlichkeit und Showbiz<br />
dürften schon sein. Doch die Umfragewerte<br />
sind eindeutig. Fleiß, Pflichtgefühl,<br />
Bescheidenheit statt Egopirouetten und finanzieller<br />
Interessen – damit punktet die<br />
Kanzlerin und Pfarrerstochter, das grenzt<br />
den Ex-Pfarrer Gauck von seinem gestrauchelten<br />
Vorgänger Wulff ab.<br />
Steinbrück, der egobetonten Machtwillen<br />
zur Schau stellt, hat sich demgegenüber<br />
selbst diskreditiert. In der protestantischen<br />
Kultur wirkt er so deplatziert wie<br />
ein Fleischesser im Veganerclub. Ein neuer<br />
Beraterstab, so ist zu hören, arbeitet fieberhaft<br />
an einer Imagekorrektur. Was die Berater<br />
Steinbrück empfehlen sollten, um zu<br />
reüssieren, ist Demut. Genau jene Demut,<br />
die zum Tafelsilber, pardon, zum Alltagsbesteck<br />
der protestantischen Kultur gehört.<br />
Doch auch wenn der Wolf Kreide frisst,<br />
bleibt er ein Wolf. Die Spin-Doctors und<br />
Coaches werden Steinbrück den einen oder<br />
anderen Schafspelz verpassen, ändern werden<br />
sie ihn nicht. Dafür sind seine Wolfsinstinkte<br />
zu vital, seine Lust an der Provokation,<br />
auch seine Eitelkeit. Posen kann man<br />
einstudieren, Haltung nicht.<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
Althoff Hotel Fürstenhof Celle<br />
Hannoversche Straße 55/56 · 29221 Celle<br />
Tel: +49 (0)5141 2010 · www.fuerstenhof-celle.com<br />
»Das Althoff Hotel Fürstenhof Celle präsentiert sich in<br />
einzigartigem Ambiente als stilvolles Refugium am Südrand<br />
der Lüneburger Heide. Unsere Gäste genießen das Erlebnis<br />
außergewöhnlicher Kulinarik im Restaurant Endtenfang<br />
und im Palio Taverna & Trattoria. Private Gastfreundschaft<br />
sorgt für Behaglichkeit und unbeschwertes Vergnügen, der<br />
persönliche Service für <strong>Cicero</strong>, das Magazin für politische<br />
Kultur aus der Hauptstadt <strong>Berlin</strong>.«<br />
INGO SCHREIBER, HOTELDIREKTOR<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan-Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger Hotel · Baden-Baden:<br />
Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss<br />
Bensberg, Schlosshotel Lerbach · <strong>Berlin</strong>: Hôtel Concorde <strong>Berlin</strong>, Brandenburger Hof, Grand Hotel Esplanade,<br />
InterContinental <strong>Berlin</strong>, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy <strong>Berlin</strong>, The Regent<br />
<strong>Berlin</strong>, The Ritz-Carlton Hotel · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle:<br />
Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg<br />
Essen: Schlosshotel Hugenpoet · Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter<br />
Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch · Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,<br />
Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental Hamburg, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance<br />
Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel<br />
Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst<br />
Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug<br />
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München: King’s Hotel<br />
First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg · Nürnberg:<br />
Le Méridien · Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel Bachmair am See,<br />
Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol<br />
bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Lienz: Grandhotel Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL Albufeira:<br />
Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale · Luzern:<br />
Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel Weggis<br />
Christine Eichel lebt als<br />
freie Autorin in <strong>Berlin</strong>. Zuletzt<br />
erschien von ihr „Das deutsche<br />
Pfarrhaus. Hort des Geistes und<br />
der Macht“ (Quadriga-Verlag)<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5 6<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
7<br />
12<br />
8 9<br />
10 11<br />
13 14 15<br />
Wen hätten Sie gern an der Macht? Bis zur Bundestagswahl lädt <strong>Cicero</strong><br />
Persönlichkeiten ein, sich die perfekte Regierung zu wünschen. Diesmal stammt die<br />
Besetzungsliste von der Schriftstellerin Monika Maron: Merkel darf Kanzlerin<br />
bleiben, aber mit diesem Kabinett dürfte sie viel zu tun bekommen. Die Regierung für<br />
die Juniausgabe des <strong>Cicero</strong> wird der Moderator Jörg Thadeusz auswählen<br />
Illustration: Jan Rieckhoff; Fotos: Picture Alliance/DPA (12), Ralf Krieger/Visum [M], Dirk Dorsemagen, F.A.Z. Foto, Action Press<br />
52 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Anzeige<br />
Foto: Picture Alliance/DPA<br />
(1) Bundeskanzlerin<br />
Da mir keine geeignete Person<br />
eingefallen ist, bleibe ich bei Angela<br />
Merkel, zumal mein Kabinett sie<br />
vermutlich vor neue Herausforderungen<br />
stellen wird. Notfalls würde ich auch<br />
dem Wunsch meiner Freunde folgen<br />
und das Amt selbst übernehmen.<br />
(2) Auswärtiges<br />
Iris Berben – weil ein nationaler<br />
Außenminister in der EU vermutlich<br />
keine großen Befugnisse hat, darstellerische<br />
Qualitäten und ein einnehmendes<br />
Wesen aber sicher von Vorteil sind.<br />
(3) Innen<br />
Heinz Buschkowsky. Er ist klarsichtig,<br />
mutig und durchsetzungsfähig.<br />
(4) Justiz<br />
Horst Dreier, Juraprofessor und<br />
Rechtsphilosoph. Seine Wahl zum<br />
Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts<br />
wurde 2008 leider durch eine Intrige der<br />
katholischen Kirche und der CDU verhindert.<br />
(5) Finanzen<br />
Prof. Paul Kirchhof, dessen verlockendes<br />
Steuermodell, das von Angela Merkel<br />
Gerhard Schröders schnödem Hohn<br />
geopfert wurde, eine Chance haben soll.<br />
(6) Arbeit und Soziales<br />
Gabriele Goettle. Ihre journalistischen<br />
Grab- und Schürfarbeiten in allen<br />
denkbaren Arbeits- und Sozialbereichen<br />
sollten die besten Voraussetzungen<br />
für eine unsentimentale, dafür<br />
wirkungsvolle Amtsführung bieten.<br />
familiären Glücks und Unglücks bürgt,<br />
und eine furchtlose Streiterin gegen<br />
Unterdrückung der Frauen durch den Islam.<br />
(10) Integration<br />
Henryk M. Broder. Polnische Abstammung,<br />
gut integriert, kennt sich als Jude mit<br />
Diskriminierung aus. Neigt zu Polemik,<br />
aber nachdem Beschwichtigungstaktik<br />
gegenüber muslimischen Verbänden bisher<br />
nur unbefriedigende Ergebnisse erzielt hat,<br />
könnte man es ja einmal mit ihm versuchen.<br />
(11) Umwelt<br />
Dirk Maxeiner und Michael Miersch:<br />
Da sie auch in ihren Publikationen fast<br />
nur paarweise auftreten, sollten sie auch<br />
das Amt gemeinsam führen, vor allem die<br />
Klima- und Energiepolitik von dogmatisch<br />
und halbreligiösen Dogmen befreien und<br />
einen offenen Meinungsstreit garantieren.<br />
(12) Bildung und Forschung<br />
Jürgen Kaube, „FAZ“-<br />
Wissenschaftsredakteur, von fast<br />
einschüchternder Intelligenz, originell,<br />
kennt die Bildungs- und Wissenschaftswelt<br />
genau, verzweifelt zuweilen an ihr<br />
und weiß sicher, welche Reformen<br />
unsinnig sind und welche nötig wären.<br />
(13) Wirtschaft und Technologie<br />
Friedrich Merz, von Angela Merkel aus<br />
der Politik vertrieben, ohne dass er ersetzt<br />
werden konnte. Er sollte wieder dabei sein.<br />
(14) Entwicklung<br />
Daniel Cohn-Bendit: polyglott, enthusiastisch,<br />
hat ein realistisches Verständnis von globaler<br />
Gerechtigkeit und sozialen Gegebenheiten.<br />
Foto: ullstein bild – Teutopress<br />
ISBN 978-3-89684-096-7<br />
Auch als E-Book erhältlich.<br />
Der Philosoph Julian Nida-Rümelin<br />
fordert eine kulturelle Leitidee für<br />
die Bildung.<br />
www.edition-koerber-stiftung.de<br />
(7) Landwirtschaft und Tierschutz<br />
Hermann Schlüsing, mein Tierarzt,<br />
aufgewachsen auf einem Bauernhof, mit<br />
innigem Verhältnis zu kleinen und großen<br />
Tieren und Einblick in die Massentierhaltung,<br />
was ihm das Fleischessen vergällt.<br />
(8) Verteidigung<br />
Michael Wolffsohn, Historiker und, wie<br />
er sich selbst nennt, ein deutschjüdischer<br />
Patriot. Seit kurzem emeritiert, aber<br />
nicht müde, also ein idealer Kandidat.<br />
(9) Familie<br />
Necla Kelek. Soziologin, türkische<br />
Abstammung, was für spezielle Kenntnis<br />
(15) Kultur und Medien<br />
Thea Dorn, Philosophin, Schriftstellerin,<br />
ungemein gebildet, hoher Kunstverstand<br />
und ausreichende Medienerfahrung.<br />
Monika Maron, 71,<br />
ist Schriftstellerin in<br />
<strong>Berlin</strong>. Ihre Romane<br />
und Essays wurden<br />
mehrfach ausgezeichnet.<br />
Ihr Debütroman<br />
„Flugasche“<br />
war die erste<br />
Auseinandersetzung mit<br />
der Umweltzerstörung<br />
in der DDR<br />
Reinhard Mohr<br />
BIN ICH JETZT REAKTIONÄR?<br />
Bekenntnisse eines Altlinken<br />
189 Seiten / geb. mit Schutzumschlag<br />
€ 17,99 (D) / € 18,50 (A) / CHF* 25,90<br />
ISBN 978-3-579-06638-7<br />
Reinhard Mohr geht der Frage nach,<br />
wie es kommt, dass man seinem<br />
Vater immer ähnlicher wird, Globuli<br />
für Hokuspokus hält und die Griechen<br />
nicht nur für Opfer einer bösen<br />
ungerechten Welt. Selbstironisch,<br />
polemisch und anekdotenreich: ein<br />
Plädoyer, sich immer wieder vom<br />
wahren Leben irritieren zu lassen.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 53<br />
*empf. Verkaufspr.<br />
GÜTERSLOHER<br />
VERLAGSHAUS<br />
www.gtvh.de
| B e r l i n e r R e p u b l i k | K o m m e n t a r<br />
Man ist Mensch, wenn<br />
man mit Menschen ist<br />
Im Netz wird Wissen geliefert,<br />
sekündlich, im Lidschlagtempo.<br />
Aber das Leben spielt woanders<br />
Von Frank A. Meyer<br />
D<br />
er Salon floriert. Zum Beispiel in <strong>Berlin</strong>. Sei es privat,<br />
in herrschaftlichen Wohnungen aus wilhelminischer<br />
Zeit, sei es in Buchhandlungen, sei es im Foyer<br />
von Theatern. Die Bürger eilen in Scharen herbei, um zu diskutieren:<br />
mit Philosophen, Literaten, Künstlern, Zeitzeugen,<br />
Akademikern, Politikern. Wer etwas zu sagen hat, findet in der<br />
deutschen Hauptstadt Podium und Publikum.<br />
Schon einmal war es so, im späten Kaiserreich. Ende des<br />
19. Jahrhunderts wurde der Salon zum Ort bürgerlicher Emanzipation<br />
– Ort von Esprit und Causerie.<br />
Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den Blütejahren<br />
der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik,<br />
bot der Salon – bis die Nazis kamen – den Freiraum<br />
zur Debatte über die Zeitläufte. Und tagsüber, wenn der Salon<br />
ruhte, lief der Diskurs in Wein- und Kaffeehäusern und in den<br />
Zeitungsredaktionen.<br />
Alles Geschichte?<br />
Das 21. Jahrhundert brach an mit dem Internet. Was wir erfahren,<br />
was wir sagen, was wir denken: In Facebook und Google<br />
und Twitter und Wikipedia findet es seinen Niederschlag.<br />
Ja, das Internet ist das Niederschlagsgebiet allen neuen Wissens.<br />
Die sekündlich anschwellende Menge des elektronisch<br />
vermittelten Menschheitsgedächtnisses ist nur noch in Terabytes<br />
zu bemessen – die Größenordnung, die den jetzt gerade<br />
aktuellen Wissensstand benennen kann. Und der ist ohnehin<br />
jetzt schon überholt. Und jetzt gerade erneut. Das Einspeisen,<br />
Einordnen und Einmotten im Netz vollzieht sich im Tempo<br />
des Lidschlags.<br />
Dennoch sind <strong>Berlin</strong>s Salons gesucht und begehrt, wie wohl<br />
auch in anderen Kulturmetropolen. Es herrscht ganz offensichtlich<br />
der Drang des Bürgers nach Begegnung und Besprechung<br />
mit anderen Bürgern – in intellektueller, in geistvoller Absicht.<br />
Man will reden miteinander; denken miteinander; und man will<br />
dabei zusammensitzen; auch zu einem Glas Wein will man greifen<br />
können beim Diskutieren und Zuhören; man will sich in die<br />
Augen schauen; man will die Körpersprache des Gegenübers erleben<br />
und genießen.<br />
Man ist Mensch, wenn man mit Menschen ist.<br />
Aber auch die Virtualität ist Realität. Unablässig schwatzen<br />
wir doch schwärmend davon, dass die Netzwirklichkeit eine<br />
neue Wirklichkeit schaffe, die sich schließlich als unser aller<br />
wirkliche Wirklichkeit erweisen werde!<br />
In Deutschland haben Netz-Nerds diese Wandlung bereits<br />
gewagt: Aus dem virtuellen Raum heraus gründeten sie die Piratenpartei,<br />
eine Partei, die den Anspruch, die herkömmliche Politik<br />
zu entern, bereits im Namen führt. Und im Logo: Die „Piraten“<br />
setzten flott ihre Segel unter der Totenkopf-Flagge, die ja<br />
dem Feind seit je nichts weniger androht als den Untergang.<br />
Daraus ist nichts geworden. Zwar feierte die Laptop-Partei<br />
ein paar provinzielle Wahltriumphe, doch sie verflüssigte sich inzwischen<br />
wieder fast völlig im Netz.<br />
Ihr Versprechen allerdings war gewaltig: Sie wollte Transparenz<br />
schaffen, hundertprozentiges Sichtbarmachen aller Regungen<br />
in der Demokratie. Ein Totalitarismus von gleißender, von<br />
blendender Helligkeit – bis in den hintersten politischen Winkel<br />
hinein.<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
54 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Privat<br />
Die Partei schaffte nicht einmal den Überblick über sich<br />
selbst. Sie zerstritt sich in Shitstorms, Twitter-Intrigen und Facebook-Verunglimpfungen.<br />
Der entgeisterten Öffentlichkeit bot<br />
sich ein Bild zumeist junger Menschen, die nicht zusammenfanden,<br />
weil sie kaum je physisch teilgenommen hatten an der realen<br />
Politik, so wie sie immer schon war.<br />
Auch die Abschaffung von Herrschaftswissen durch Transparenz<br />
misslang. Denn was ist Transparenz? Ist es der Klick<br />
auf ein Dialogfeld des Bildschirms? Der Blick in die Google-<br />
Welt? Transparent machen heißt sichtbar machen. Sichtbar aber<br />
bedeutet begreifbar, zum Greifen, also intellektuell-sinnlich<br />
erfahrbar.<br />
Das aber zwingt zum Zusammenfügen und Ergänzen von<br />
Wissenspartikeln, wie sie das Netz liefert; es zwingt zum Einbetten<br />
von partiellem Wissen in den großen menschlichen Erfahrungsschatz;<br />
und es zwingt zur Konfrontation von allem Wissen<br />
mit ethischen und moralischen Grundwerten.<br />
Das wäre dann Bildung zu nennen.<br />
Doch wo und wie bildet sich Bildung? Das Netz liefert dazu<br />
nur den kruden Werkstoff. Die Denkhandwerker aber schreiben<br />
Bücher, halten Vorträge, diskutieren in Salons. Vor allem gestalten<br />
redaktionelle Gemeinschaften Zeitungen, Zeitschriften und<br />
Magazine. Auf Papier wird vorgedacht, nachgedacht und weitergedacht,<br />
wird debattiert und ausprobiert, wird erwogen und abgewogen,<br />
oft umständlich, bisweilen auch vollendet elegant.<br />
Die Zeitung und die Zeitschrift sind der gedruckte Salon<br />
unserer demokratischen Gesellschaft. Journalisten sind in diesem<br />
Salon Gastgeber und Gedankengeber, manchmal brillante Causeure,<br />
gerne auch geistvolle Gaukler. Sie erzählen die sinnfälligen<br />
und hintersinnigen und immer wieder lehrreichen Märchen<br />
des Alltags. Mit ihrem altmodischen Medium garantieren sie das<br />
Denkgeflecht, das unsere freie Gesellschaft zusammenhält.<br />
Und sie tun ihr Werk von Tag zu Tag, von Woche zu Woche,<br />
geradezu bedächtig, auf wohltuende Weise entschleunigt,<br />
mithin also viel zu langsam für die permanent hysterisch erregte<br />
Netzwelt. Zeitungsjournalisten entlarven das Funkengestiebe im<br />
Netz, von bildschirmsüchtigen Kids und Nerds fürs Sternenzelt<br />
gehalten, als unendlich viel Meteoritenschrott.<br />
Das Schicksal der Menschen spielt unter Menschen und hinieden,<br />
wo wir uns begegnen in Salons, in Cafés, in Lounges, in<br />
Redaktionen, in Zeitungen und Zeitschriften, in Büchern – im<br />
persönlichen Gespräch.<br />
Das ist Lebenselixier und Luxus der Demokratie: Zeit zu haben<br />
und Räume dazu.<br />
Frank A. Meyer<br />
ist Journalist und Gastgeber der politischen<br />
Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
Anzeige<br />
Art|Basel<br />
Basel|June|13–16|2013<br />
Vernissage | Wednesday, June 12, 2013 | By invitation only<br />
artbasel.com | facebook.com/artbasel | twitter.com/artbasel
| W e l t b ü h n e<br />
Seelöwe im Politzirkus<br />
David Axelrod hat Barack Obama zum Präsidenten gemacht. Nun kommentiert er dessen Politik im Fernsehen<br />
von Christoph von Marschall<br />
N<br />
un ist er wieder ein Mann der<br />
Medien. So wie vor seinem langen<br />
Ausflug in die Politik. Die<br />
29 Jahre in der Politikberatung haben David<br />
Axelrod an Erfahrungen reicher gemacht<br />
und sein Bankkonto gefüllt. Er hat<br />
Berühmtheit erlangt als der Stratege, der<br />
Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten<br />
machte.<br />
Die journalistische Unabhängigkeit<br />
aber, die Axelrod bis 1984 bei der Chicago<br />
Tribune genossen hatte, wird er nie<br />
wieder zurückerlangen. Wenn er jetzt mit<br />
58 Jahren als politischer Kommentator vor<br />
die Kameras der NBC-Senderfamilie tritt,<br />
wird er als Schönfärber wahrgenommen,<br />
der nun von einem TV-Konzern entlohnt<br />
wird und nicht mehr vom Weißen Haus,<br />
der aber quasi eine „I love Obama“-Tätowierung<br />
auf der Stirn trägt.<br />
Die Anstellung solcher „Pundits“ bei<br />
Fernsehsendern ist in Amerika nichts Ungewöhnliches.<br />
Jeder weiß, dass die Aufgabe<br />
dieser „Experten“ nicht die unabhängige Berichterstattung<br />
ist, sondern dass sie vielmehr<br />
Politik mit anderen Mitteln betreiben. Für<br />
die Republikaner besorgen das etwa Karl<br />
Rove auf Fox News und Alex Castellanos,<br />
der Bush und Romney diente, auf CNN.<br />
Für die Demokraten Bill Clintons Chefstratege<br />
James Carville auf CNN, Obamas Ex-<br />
Sprecher Robert Gibbs auf MSNBC und<br />
nun eben auch David Axelrod.<br />
Ein weiter Weg für jemanden, dessen<br />
beruflicher Werdegang als Student beim<br />
Hyde Park Herald in Chicago begann und<br />
seinen vorläufigen Höhepunkt in der Wahl<br />
Obamas zum Präsidenten fand. Auf den<br />
ersten Blick traute man Axelrod die Aggressivität<br />
eines Präsidenten-Machers kaum zu.<br />
Er reagiert bedächtig, redet langsam. Mit<br />
dem kräftigen Schnauzer und den dunklen,<br />
leicht melancholischen Augen erinnert<br />
er an einen Seelöwen. Als er seinen<br />
Arbeitsplatz 2009 ins Weiße Haus verlegte<br />
und sich für das erste Staatsbankett einen<br />
Frack zulegte, sah er aus, als habe er sich<br />
als Pinguin verkleidet. Das Umfeld eines<br />
Staatsoberhaupts war eine neue Welt für<br />
ihn. Nicht hingegen die Macht. Von der<br />
fühlte er sich früh angezogen.<br />
Amerika hat immer wieder gerätselt,<br />
was ihn antreibt. Eine Antwort hat Axelrod<br />
selbst gegeben: aufrichtiger Idealismus.<br />
Eine weitere Erklärung dürfte der Wunsch<br />
nach Kontrolle sein. Wie wehrlos man sein<br />
kann, hat Axelrod als Kind wie auch als<br />
junger Vater selbst erfahren. Seine Eltern<br />
lassen sich scheiden, als er acht ist. Sein<br />
Vater begeht Selbstmord, als er in Chicago<br />
studiert – er eilt nach New York, um die<br />
Leiche zu identifizieren. Auch dem Schicksal<br />
der eigenen Tochter steht der damals<br />
26-Jährige machtlos gegenüber. Sie ist erst<br />
wenige Monate alt, als bei ihr Epilepsie diagnostiziert<br />
wird. Jahre später wird Axelrod<br />
2012 seinen Schnauzer verwetten, um einer<br />
Spendenaktion für Epilepsieforschung<br />
zu helfen. Da ist er wieder in seinem Element<br />
– als Macher.<br />
Der Durchbruch als Politikberater kam<br />
1987, als Harold Washington, der erste<br />
schwarze Bürgermeister Chicagos, mit<br />
Axelrods Hilfe wiedergewählt wurde. Die<br />
Herausforderung dabei war weniger, die<br />
Republikaner auf Distanz zu halten. Chicago<br />
ist fest in der Hand der Demokraten.<br />
Es kam darauf an, eine Koalition aus afroamerikanischer<br />
Unterschicht, gebildeten<br />
schwarzen Aufsteigern und liberaler weißer<br />
Oberschicht zu schmieden, die sich<br />
gegen die gut organisierten Vertreter der<br />
weißen Arbeiterklasse und unteren Mittelschicht<br />
durchsetzt.<br />
Darin lag später auch seine Leistung<br />
für Obama, der 1991 mit dem Juraexamen<br />
aus Harvard nach Chicago zurückkam, den<br />
Einstieg in die Politik suchte, aber zunächst<br />
als arrogant und zu intellektuell galt. Nach<br />
einigen Jahren in der Landespolitik in Illinois<br />
bereitete Axelrod Obamas Sprung<br />
auf die nationale Bühne vor, 2004 als Senator,<br />
2008 als Präsidentschaftskandidat.<br />
Er verschaffte ihm das Doppelimage, ein<br />
moderner Kandidat des Wandels und zugleich<br />
traditionell genug zu sein, um bodenständige<br />
Schwarze nicht zu verlieren. Er<br />
öffnete ihm auch den Zugang zu weißen<br />
„Lakeshore Liberals“ – Millionärsfamilien<br />
mit großzügigen Häusern am Ufer des Michigan-Sees,<br />
die mit Spenden Wahlkämpfe<br />
finanzieren.<br />
In den Bush-Jahren, in denen Amerika<br />
unter Lagerspaltung litt, umgab Axelrod<br />
Obama mit einer Aura des Idealismus,<br />
der Versöhnung sowie der Heilung historischer<br />
Sünden wie Sklaverei und Rassentrennung.<br />
Zum Marketing gehörte neben<br />
„Hope“, „Change“ und „Yes, we can“ das<br />
Versprechen der Teilhabe. Nicht Obama<br />
sollte den Wandel bringen, sondern die<br />
Wähler, indem sie ihn unterstützen.<br />
Mit Obamas Sieg 2008 war Axelrod<br />
auf dem Höhepunkt seines Einflusses. Danach<br />
sank seine Macht, zunächst kaum<br />
sichtbar. 2009 war er noch im engsten<br />
Kreis um den Präsidenten zu sehen. Die<br />
Wahl 2008 hatte jedoch eine neue Dynamik<br />
eröffnet: Die technische Organisation<br />
über das Internet und die sozialen Medien<br />
lief der klassischen Strategie, die auf die<br />
Identifizierung der entscheidenden Themen<br />
und die besseren Slogans setzt, den<br />
Rang ab. Axelrod aber war der Guru der alten<br />
Ära, Internet-Zauberer David Plouffe<br />
wurde zum Wunderkind der neuen Zeit.<br />
Bei der Präsidentenwahl 2012 war Axelrod<br />
zwar noch mit an Bord, spielte aber nicht<br />
mehr eine so dominierende Rolle wie noch<br />
vier Jahre zuvor.<br />
Obama wird nie mehr zu einer Präsidentenwahl<br />
antreten, und Axelrod wird<br />
ihm nicht mehr den Steigbügel halten. Im<br />
Fernsehen aber und als Buchautor ist Axelrods<br />
Wort weiter viel Geld wert.<br />
Christoph von Marschall<br />
ist seit 2005 USA-Korrespondent.<br />
Von ihm erschien zuletzt „Der<br />
neue Obama. Was von der<br />
zweiten Amtszeit zu erwarten ist“<br />
Fotos: Jeff Sciortino, Privat (Autor)<br />
56 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Auf den ersten<br />
Blick traute man<br />
David Axelrod<br />
die Aggressivität<br />
eines Präsidenten-<br />
Machers kaum zu<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 57
| W e l t b ü h n e<br />
Kampferprobte<br />
Reporterin<br />
Erstmals steht eine Frau an der Spitze der französischen Tageszeitung Le Monde: Natalie Nougayrède<br />
von Sascha Lehnartz<br />
E<br />
s geschieht nicht allzu oft,<br />
dass eine Frau einen Führungsposten<br />
in einem Prestigeunternehmen<br />
ergattert – und sich dabei gegen<br />
drei renommierte männliche Konkurrenten<br />
durchsetzt. Besonders, wenn der selbstgewisse,<br />
breitbeinige Auftritt nicht zu den<br />
größten Talenten der Kandidatin zählt.<br />
Genau dies ist bei Frankreichs wichtigster<br />
Zeitung geschehen. Die drei Hauptanteilseigner<br />
von Le Monde – Pierre Bergé,<br />
der frühere Lebens- und Geschäftspartner<br />
des Modeschöpfers Yves Saint-Laurent,<br />
der Internetunternehmer Xavier Niel und<br />
der Investmentbanker Matthieu Pigasse –<br />
wählten Natalie Nougayrède als neue<br />
Direktorin des Referenzblatts aus. Anschließend<br />
wurde die 46-Jährige von den<br />
Vertretern der Gesellschaft der Redakteure<br />
mit 79,98 Prozent der Stimmen gewählt.<br />
Das Wahlergebnis lässt ahnen, wie viel<br />
Überzeugungsarbeit die Reporterin in zahllosen<br />
Gesprächen mit der Redaktion geleistet<br />
hat. Als ihr Name Ende Januar erstmals<br />
fiel, fragten selbst lang gediente Mitarbeiter<br />
der Monde, „Natalie Qui?“, Natalie, wer? –<br />
und googelten ihren Namen. Obwohl die<br />
preisgekrönte Journalistin bereits seit 1996<br />
bei der linksliberalen Zeitung arbeitet, war<br />
sie eine vergleichsweise unbekannte Größe.<br />
Das lag zum einen daran, dass Natalie Nougayrède<br />
die meiste Zeit als Korrespondentin<br />
in eher entlegenen Gegenden Osteuropas<br />
zugebracht hatte. Zum anderen pflegt<br />
sie noch einen zuweilen zu diskreten Auftritt.<br />
Nachdem ihre erste Präsentation vor<br />
den Hauptaktionären der Zeitung etwas<br />
dünn geriet, räumte sie selbstkritisch ein:<br />
„Meinen mündlichen Auftritt muss ich<br />
wohl noch verbessern.“<br />
Bevor sie sich für den Posten bewarb,<br />
hatten sich drei männliche Redaktionshaudegen<br />
– der Wirtschaftsjournalist<br />
Alain Faujas, der zeitweilige Chefredakteur<br />
Franck Nouchi, und der langjährige<br />
Deutschlandkorrespondent des Blattes,<br />
Arnaud Leparmentier, um den Chefposten<br />
beworben, der seit dem plötzlichen<br />
Tod des bisherigen Redaktionsleiters Érik<br />
Izraelewicz im vergangenen November vakant<br />
war.<br />
Die drei Hauptaktionäre vermochten<br />
sich jedoch nicht auf einen der ambitionierten<br />
Herren zu einigen. Pierre Bergé<br />
bevorzugte Franck Nouchi. Niel und Pigasse<br />
neigten eher zu Arnaud Leparmentier.<br />
„In ihren eigenen Firmen entscheidet<br />
jeder von den dreien alles allein. Dass andere<br />
eine andere Meinung haben, sind sie<br />
nicht gewohnt“, beschreibt ein Le Monde-<br />
Kenner das Dilemma der Besitzverhältnisse<br />
des Blattes.<br />
In dieser Situation kam den uneinigen<br />
Eigentümern die späte und überraschende<br />
Bewerbung von Natalie Nougayrède gerade<br />
recht.<br />
Die 1966 in Dijon geborene Spezialistin<br />
für Internationale Beziehungen studierte<br />
in Straßburg Politik und lernte ihr<br />
Handwerk am Pariser Centre de Formation<br />
des Journalistes. Als Tochter eines Ingenieurs<br />
wuchs sie teilweise in Großbritannien<br />
und Kanada auf. Sie spricht neben<br />
Französisch auch Englisch und Russisch.<br />
Während des Studiums entwickelte sie ein<br />
leidenschaftliches Interesse an Osteuropa.<br />
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ging<br />
sie 1991 in die Tschechoslowakei und berichtete<br />
von dort aus für die französische<br />
Tageszeitung Libération und für die BBC.<br />
Seit 1996 arbeitete sie zunächst als freie<br />
Mitarbeiterin für Le Monde, schrieb über<br />
den Kosovokrieg und die Ukraine, bevor<br />
sie schließlich Korrespondentin des Blattes<br />
in Moskau wurde. Vor allem durch<br />
ihre furchtlose Berichterstattung über den<br />
Tschetschenienkrieg machte sie sich einen<br />
Namen. 2005 erhielt sie den Prix Albert<br />
Londres, den renommiertesten französischen<br />
Reporterpreis, für eine Geschichte<br />
über das Geiseldrama von Beslan. Nach<br />
ihrer Rückkehr nach Paris wurde sie zur<br />
„diplomatischen Korrespondentin“ ihres<br />
Blattes. Durch ihre eher undiplomatischkritische<br />
Haltung zu Nicolas Sarkozys Außenminister<br />
Bernard Kouchner verscherzte<br />
sie es sich in dieser Funktion rasch mit dem<br />
Quai d’Orsay. Von der Jahreskonferenz der<br />
französischen Botschafter wurde sie 2008<br />
sogar hinauskomplimentiert.<br />
Natalie Nougayrède aber ist nicht leicht<br />
einzuschüchtern. „Man merkt, dass sie in<br />
Tschetschenien war“, sagen Kollegen, die<br />
sie mit ihrer Durchsetzungsfähigkeit beeindruckt<br />
hat. Diese könnte ihr noch von<br />
Nutzen sein, wenn es auf ihrem neuen Posten<br />
darum geht, die journalistischen Prinzipien<br />
der Redaktion gegen die Profitziele<br />
der Eigentümer zu verteidigen. Was sie<br />
auszeichnet, sind der Elan der Reporterin<br />
und ein beinah altmodischer journalistischer<br />
Stolz: „Wenn ich als normale Journalistin<br />
dieses Abenteuer wage, dann ist das<br />
auch eine starke Botschaft, die zeigt, dass<br />
das Unerwartete möglich ist“, sagt sie. Dass<br />
sie bislang keine Führungspositionen hatte,<br />
hält sie nicht für einen Nachteil. Sie sei<br />
schließlich Journalistin und gewohnt, sich<br />
in neue Felder einzuarbeiten.<br />
Das wird sie nun rasch müssen. Wie<br />
alle überregionalen französischen Tageszeitungen<br />
steckt auch Le Monde in einer Krise.<br />
Die Investoren erwarten von Nougayrède<br />
nichts Geringeres als ein Wunder: Sie soll<br />
mit einer ernst zu nehmenden Zeitung im<br />
digitalen Zeitalter Geld verdienen.<br />
Sascha Lehnartz<br />
ist Frankreichkorrespondent der<br />
Tageszeitung Die Welt<br />
Fotos: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images, Privat (Autor)<br />
58 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Wenn ich<br />
als normale<br />
Journalistin<br />
dieses<br />
Abenteuer<br />
wage, dann<br />
zeigt das,<br />
dass das<br />
Unerwartete<br />
möglich ist“<br />
Natalie Nougayrède<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 59
| W e l t b ü h n e<br />
„Manchmal muss man den<br />
Bauch aufschneiden“<br />
Amadou Haya Sanogo putschte Malis Präsidenten weg und ist oberster Militär des Landes. Was hat er vor?<br />
C<br />
apitaine Sanogo, wie stürzt man<br />
eine Regierung in Afrika?<br />
Auf diese Frage gibt es keine eindeutige<br />
Antwort. Es ist zwar Hunderte<br />
Male geschehen, aber jedes Mal anders.<br />
Es hängt von der Situation, den Umständen<br />
und den Möglichkeiten ab.<br />
Wie haben Sie es gemacht?<br />
Das werde ich Ihnen vielleicht später einmal<br />
erzählen, aber noch ist es nicht zu<br />
Ende gebracht. Das Regime war krank,<br />
und ich habe ihm geholfen zu sterben.<br />
Im Grund war das sehr einfach. Ich<br />
habe Mali eine Chance gegeben, sich zu<br />
erneuern.<br />
Betrachten Sie es als das Recht der Armee,<br />
gegen die Regierung zu putschen?<br />
Ein Militärputsch ist niemals zu rechtfertigen.<br />
Aber im Fall Malis ist es wie mit<br />
der Arbeit eines Chirurgen. Manchmal<br />
muss man den Bauch aufschneiden, um<br />
den Patienten zu heilen. Das habe ich getan.<br />
Wenn man so will, war nicht ich es,<br />
der geputscht hat. Vielmehr war eine Situation<br />
entstanden, die es verlangte.<br />
Wie würden Sie diese Situation<br />
beschreiben?<br />
Ich begann, über einen Coup nachzudenken,<br />
als die Regierung bewaffnete<br />
Gruppen, die aus Libyen kamen, in unser<br />
Land gelassen hat. Es gab Minister,<br />
die haben diese Kämpfer auf unserem<br />
Territorium begrüßt. Das hätte niemals<br />
geschehen dürfen. Zur gleichen Zeit haben<br />
sie die Anführer unserer Armee bestohlen<br />
und geschwächt. Die Armee bekam<br />
so gut wie keine Ausrüstung, keine<br />
Fahrzeuge und keine Verpflegung. Der<br />
Sold wanderte in die Taschen korrupter<br />
Vorgesetzter. Als die Islamisten in den<br />
Norden einfielen, wurden Hunderte unserer<br />
Soldaten ohne Waffen und Munition<br />
im Stich gelassen. Das Geld, das<br />
für die Ausrüstung vorgesehen war, hatten<br />
korrupte Offiziere veruntreut. Jeder<br />
wusste davon.<br />
Wurde ein Soldat verwundet, der nicht<br />
aus einer wohlhabenden Familie stammt,<br />
dann wurde er nicht im Militärkrankenhaus<br />
versorgt. Gleichzeitig sind Kinder<br />
„Was wir nicht brauchen,<br />
sind Soldaten, die im Land<br />
herumsitzen und nichts tun“<br />
und Ehefrauen der Generäle auf Staatskosten<br />
zur medizinischen Behandlung in<br />
die USA oder nach Europa gereist. Manche<br />
Offiziere erhielten nach nur einer Woche<br />
Ausbildung das Kommando über eine Armee-Einheit<br />
– allein aufgrund von Vetternwirtschaft.<br />
Auf die Militärakademie kam<br />
man nur durch Beziehungen, nicht durch<br />
Qualifikation. Unter der gestürzten Regierung<br />
hatten wir nicht mehr die Armee, die<br />
dieses Land verdient.<br />
Was in Mali bisher geschah<br />
Unter der Führung von Capitaine Amadou Haya<br />
Sanogo marschieren am 21. März 2012 Soldaten<br />
in Malis Hauptstadt Bamako ein. Die Soldaten<br />
protestieren, weil sie ohne vernünftige Ausrüstung<br />
gegen viel stärkere Rebellen im Norden<br />
des Landes an die Front geschickt wurden.<br />
Schnell ist der Präsidentenpalast erobert und<br />
Präsident Amadou Toumani Touré geflohen.<br />
Islamisten und Tuareg-Rebellen nutzen das<br />
Chaos in der Hauptstadt, um den Norden des<br />
Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Die<br />
Tuareg-Rebellen, weil sie einen unabhängigen<br />
Staat anstreben, den sie am 6. April 2012<br />
auch ausrufen. Islamistische Gruppen, weil<br />
sie die Scharia, das strenge islamische Recht,<br />
durchsetzen wollen. Schnell werden aus<br />
Freunden Feinde: Die Islamisten vertreiben die<br />
Tuareg; ihr unabhängiger Staat ist Geschichte.<br />
Im Oktober 2012 einigen sich UN-Sicherheitsrat,<br />
die Westafrikanische Staatengemeinschaft<br />
Ecowas und die Afrikanische<br />
Union auf einen militärischen Einsatz „zum<br />
Erhalt der Einheit Malis“. Die französische<br />
Armee, Soldaten aus dem Tschad und<br />
Ecowas-Truppen drängen die Islamisten<br />
aus allen größeren Städten des Nordens und<br />
stoppen deren Vormarsch auf die Hauptstadt.<br />
Die Bundesrepublik stellt drei Transportflugzeuge<br />
zur Beförderung von Ecowas-Truppen<br />
aus den Nachbarstaaten nach Mali; mithilfe<br />
eines weiteren Flugzeugs werden französische<br />
Jets in der Luft betankt. Zudem beteiligt sich<br />
Deutschland seit April 2013 an der europäischen<br />
Ausbildungsmission: Der Bundestag<br />
hat die Entsendung von bis zu 330 Soldaten<br />
beschlossen. Sie sollen malische Soldaten<br />
schulen und Feldlazarette aufbauen.<br />
Der seit April 2012 amtierende Übergangspräsident<br />
Dioncounda Traoré bereitet derweil Wahlen<br />
vor. Am 7. Juli soll ein neuer Staatspräsident, am<br />
21. Juli ein neues Parlament gewählt werden. jh<br />
Foto: Martin Specht [M]<br />
60 <strong>Cicero</strong> 5.2013
In Amerika bestens<br />
geschult: Capitaine<br />
Amadou Haya Sanogo<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 61
| W e l t b ü h n e<br />
War es deshalb für die Rebellen so einfach,<br />
den Norden Malis zu erobern?<br />
Ja. In den Streitkräften gab es keine Ausrüstung,<br />
so gut wie keine Führung und<br />
keinerlei Motivation.<br />
Wie schätzen Sie die derzeitige Lage ein?<br />
Vieles ist jetzt in Bewegung geraten.<br />
Dank ausländischer Hilfe wurde der Norden<br />
zurückerobert. Aber wir müssen vorsichtig<br />
sein. Von meinen 24 Jahren in der<br />
Armee habe ich 13 im Norden verbracht,<br />
acht davon in Kidal. Es gibt heute kaum<br />
einen Soldaten in der Armee Malis, der<br />
länger im Norden war als ich. Ich kenne<br />
daher die Region aus eigener Anschauung<br />
sehr gut. Die Islamisten kämpfen einen<br />
anderen Krieg als moderne Armeen.<br />
Es geht ihnen nicht darum, eine Stadt<br />
wie Timbuktu einzunehmen. Das ist den<br />
Islamisten vollkommen egal. Wenn sie einen<br />
französischen oder westlichen Soldaten<br />
pro Woche töten, ist das für sie ein<br />
Erfolg. Tötet hingegen die französische<br />
Armee einen Terroristen pro Woche, ist<br />
das kein Erfolg.<br />
Es gibt Gerüchte, Sie seien gegen eine Intervention<br />
der französischen Streitkräfte<br />
gewesen?<br />
Das sind politisch motivierte Lügen mit<br />
dem Ziel, die Dinge zu komplizieren.<br />
Um die Situation im Norden zu klären,<br />
brauchen wir militärische Hilfe, brauchen<br />
wir Luftunterstützung, brauchen<br />
wir Ausbilder. Das Einzige, was wir nicht<br />
brauchen, sind Soldaten, die im Land herumsitzen<br />
und nichts tun. Das ergibt keinen<br />
Sinn.<br />
Bedeutet die französische Intervention<br />
nicht auch so etwas wie die Rückkehr der<br />
ehemaligen Kolonialmacht?<br />
Es ist nicht nur Frankreich. Es sind auch<br />
die USA, es sind Deutschland und viele<br />
andere, die uns militärisch helfen. Ich<br />
bin dafür, dass sie hierbleiben, solange sie<br />
gebraucht werden. Keine afrikanische Armee<br />
hätte den Norden ohne fremde Hilfe<br />
befreien können. Es ist für die malische<br />
Armee also keine Schande, zusammen<br />
mit ausländischen Truppen zu kämpfen.<br />
Wie beurteilen Sie die Präsenz der Truppen<br />
der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft<br />
Ecowas?<br />
Die Soldaten aus dem Tschad kämpfen,<br />
während die Anwesenheit der Ecowas-Truppen<br />
eine Frage der Politik ist.<br />
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass wir<br />
es ohne die französischen Truppen nicht<br />
schaffen können.<br />
Deutschland hat nun Militärberater und<br />
Ausbilder nach Mali entsandt. Was halten<br />
Sie davon?<br />
Viel. Ich selbst bin in den USA ausgebildet<br />
worden. Daher weiß ich, wie wichtig<br />
„Für mich ist jeder, der sich<br />
mit den Islamisten verbündet,<br />
ein Terrorist“<br />
diese Kooperation ist. Mein größtes Interesse<br />
ist, dass Mali eine starke und professionelle<br />
Armee bekommt. Wenn also<br />
Ausbilder aus Deutschland, aus Frankreich,<br />
aus den USA zu uns kommen, begrüßen<br />
wir diese Hilfe. Wir können sie<br />
brauchen, um die Armee aufzubauen.<br />
Kann der Konflikt über die Grenzen Malis<br />
hinaus die Region destabilisieren? Könnte<br />
das, was in Mali geschehen ist, sich etwa<br />
auch im Niger ereignen?<br />
Vor der französischen Intervention war<br />
die Gefahr, dass sich der Konflikt auf die<br />
Nachbarländer ausbreitet, groß. Danach<br />
haben sich die Dinge geändert. Jedenfalls<br />
wird es stabil bleiben, solange die Militäroperation<br />
andauert. Ich gehe davon aus,<br />
dass es im Niger Schläfer beziehungsweise<br />
Zellen gibt, die darauf warten, auch<br />
dort die Lage zu destabilisieren.<br />
Besteht für Sie ein Unterschied zwischen<br />
den Tuareg, die Autonomie fordern, und<br />
den Islamisten, die einen religiösen Staat<br />
errichten wollen?<br />
Die Tuareg, die sich mit den Islamisten<br />
zusammentun, selbst wenn sie unterschiedliche<br />
Ziele verfolgen, sind für<br />
mich Terroristen. Für mich ist jeder, der<br />
sich mit den Islamisten verbündet, ein<br />
Terrorist.<br />
Ist Mali nicht eigentlich ein geteiltes Land,<br />
mit den Tuareg im Norden und den Bambara<br />
im Süden?<br />
Nein, überhaupt nicht. Es gab zwar immer<br />
wieder Unruhen – 1968, 1989 und<br />
1991 –, aber anschließend haben die Bevölkerungsgruppen<br />
wieder zueinandergefunden.<br />
Es gibt viele Tuareg, die im Süden<br />
leben, und wie gesagt, ich selbst habe<br />
lange im Norden gelebt.<br />
Wenn alles so harmonisch ist, warum<br />
kommt es dann immer wieder zu<br />
Aufständen?<br />
Darauf bekommen Sie von mir keine<br />
Antwort. Fragen Sie jemand anderen<br />
außerhalb Malis. Die Aufständischen<br />
kämpfen mit Waffen und Geld aus dem<br />
Ausland. Dort müssen Sie diese Fragen<br />
stellen.<br />
Was erwarten Sie von den Wahlen im<br />
Juli? Können die angesichts der angespannten<br />
Situation im Norden überhaupt<br />
stattfinden?<br />
Sicher können sie das. Nicht der Norden<br />
Malis, sondern Bamako ist wichtig<br />
für die Wahlen. Ich hoffe, das Land bekommt<br />
den Präsidenten, den es verdient.<br />
Er sollte im nationalen Interesse Malis<br />
denken und handeln.<br />
Werden Sie jeden gewählten Präsidenten<br />
akzeptieren?<br />
Ja. Ich erwarte eine freie und faire Wahl<br />
ohne Einmischung von außen. Ich hoffe,<br />
das wird möglich sein. Ich selbst bin kein<br />
Politiker. Hätte ich ein politisches Amt<br />
haben wollen, so hätte ich es nach dem<br />
Coup haben können. Als Offizier habe<br />
ich einen Eid geschworen, dieses Land<br />
zu beschützen. Ohne die Armee gibt es<br />
keine Demokratie in Mali.<br />
Das Gespräch führte Martin Specht<br />
62 <strong>Cicero</strong> 5.2013
welt.de/digital<br />
Die Welt gehört denen,<br />
die mutig genug sind,<br />
sie zu verändern.
| W e l t b ü h n e | G r o S S b r i t a n n i e n u n d E u r o p a<br />
Ein bisschen europa<br />
darf’s schon sein<br />
64 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Martin Parr/Magnum Photos/Agentur Focus<br />
Griechenland kämpft ums Überleben, Zypern droht die<br />
Staatspleite, Italien hat keine handlungsfähige Regierung.<br />
Wie hält es Großbritannien in diesen Zeiten mit der EU?<br />
von Sebastian Borger<br />
A<br />
ndrea Leadsom fröstelt. Eingemummt<br />
in Wintermantel<br />
und Schal sitzt die konservative<br />
Unterhausabgeordnete im Atrium<br />
von Portcullis House und<br />
nippt an ihrem Kaffee. Dem Verwaltungsgebäude<br />
des britischen Parlaments soll eine<br />
Gruppe wohlgepflegter Feigenbäume ein<br />
wenig mediterranes Flair verleihen. Doch<br />
draußen wehen die kalten Nordostwinde<br />
aus Skandinavien. Vom Kontinent kommt<br />
in diesem Frühjahr keine Wärme.<br />
Immerhin befeuert das Projekt Europa<br />
Leadsoms politische Fantasie. Sie ist Sprecherin<br />
einer informellen Fraktionsgruppe<br />
mit dem programmatischen Namen Fresh<br />
Start. Die EU, sagt die Konservative und<br />
lächelt freundlich, sei „eine großartige Gelegenheit<br />
zur Kooperation zwischen demokratischen<br />
Nationen, um als Block im<br />
globalen Wettbewerb zu bestehen“. Nur<br />
mache Brüssel viel zu viel falsch, es gebe<br />
erheblichen Reformbedarf, es sei nichts weniger<br />
nötig als ein Neustart. Dann zählt sie<br />
auf: zu wenig Hilfe für die Dienstleistungsbranche,<br />
zu viele Vorschriften für den Finanzsektor,<br />
überflüssige Arbeitsschutzgesetze,<br />
die Verrücktheiten der gemeinsamen<br />
Agrarpolitik. Und, und, und.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 65
| W e l t b ü h n e | G r o S S b r i t a n n i e n u n d E u r o p a<br />
„Wir haben<br />
keine<br />
geheime<br />
Agenda,<br />
streben nicht<br />
den Austritt<br />
an. Der<br />
wäre eine<br />
Katastrophe<br />
für unsere<br />
Wirtschaft“<br />
Andrea Leadsom, Sprecherin von Fresh Start<br />
Redet die Sprecherin von etwa einem<br />
Drittel ihrer 304-köpfigen Fraktion wirklich<br />
von nötigen Reformen? Oder wird hier<br />
der Boden für Großbritanniens Austritt aus<br />
dem ungeliebten Brüsseler Club bereitet?<br />
Da kommt Bewegung in die Abgeordnete,<br />
ihr Lächeln verschwindet, jetzt fröstelt<br />
nur noch die Stimme. „Das ist schlicht<br />
und einfach falsch. Wir haben keine geheime<br />
Agenda, streben nicht den Austritt<br />
an. Der wäre eine Katastrophe für unsere<br />
Wirtschaft. Wir wollen erreichen, dass die<br />
EU sich global engagiert, den Freihandel<br />
befördert und gleichzeitig viele der wirklich<br />
dummen, ungewollten Auswirkungen früherer<br />
Beschlüsse revidiert.“<br />
Dazu hat Fresh Start im Juli nach einjähriger<br />
Vorbereitung ein detailliertes Papier<br />
von 260 Seiten vorgelegt. Ein Manifest<br />
von immer noch 40 Seiten fasste im<br />
Januar die wichtigsten Vorschläge zusammen,<br />
das Vorwort schrieb Außenminister<br />
William Hague. Dient Fresh Start also<br />
als Sprachrohr des konservativen Teils von<br />
David Camerons Koalitionsregierung?<br />
Auch diesmal hat Leadsom eine robuste<br />
Antwort parat. „Noch so ein Vorwurf, der<br />
uns gern gemacht wird. Wir sind eine unabhängige<br />
Gruppe und wollen keineswegs<br />
im Namen der Regierung die Diskussion<br />
abwürgen.“<br />
Das wäre allerdings überraschend.<br />
Seit ihre Partei bei der Unterhauswahl im<br />
Mai 2010 die absolute Mehrheit der Mandate<br />
verfehlte und mit den ungeliebten Liberaldemokraten<br />
koalieren musste, treiben<br />
die Europaskeptiker in unterschiedlichen<br />
Formationen ihren Parteichef in die Enge.<br />
Die parteiinterne Diskussion nimmt kein<br />
Ende. Bei Fresh Start gibt man sich Cameron<br />
gegenüber loyal. Doch Leadsoms<br />
Gruppe lässt auch keinen Zweifel an der<br />
Dringlichkeit, mit der die Insel dem 27er-<br />
Club Reformen abverlangen soll: „Der Status<br />
quo ist keine Option.“<br />
Weil der genervte Regierungschef das<br />
im Grunde genauso sieht, hat er im Januar<br />
die alte Forderung nach Reformen in Europa<br />
mit einem Versprechen verknüpft.<br />
Wenn die Briten sich bei der nächsten<br />
Wahl 2015 für eine konservative Alleinregierung<br />
entscheiden, dürfen sie 2017 über<br />
ihren Verbleib in der Europäischen Union<br />
abstimmen. Bis dahin wird nicht nur die<br />
amtierende Regierung ihre Analyse veröffentlichen,<br />
welche Kompetenzen die Briten<br />
aus Brüssel zurückhaben wollen. Cameron<br />
will die kommenden vier Jahre auch dazu<br />
nutzen, bei den Verbündeten um Sympathien<br />
zu werben.<br />
Es ist die vorläufig letzte Runde im endlos<br />
scheinenden Ringkampf um Großbritanniens<br />
Position im europäischen Einigungsprozess.<br />
Der Tod Margaret Thatchers<br />
hat in Erinnerung gerufen, welchen Wandel<br />
die eiserne Lady selbst ebenso wie ihr<br />
Land und ihre Partei in Bezug auf Brüssel<br />
vollzogen haben. Da ist zunächst jener Auftritt,<br />
bei dem die damalige Oppositionsführerin<br />
einen Pullover mit den Nationalflaggen<br />
der damals neun EU-Mitgliedstaaten<br />
trug und, wie alle wichtigen gesellschaftlichen<br />
Gruppen sowie die meisten Medien,<br />
für Großbritanniens Ja im Referendum<br />
1975 warb. Ihr unerbittliches Eintreten<br />
für die Reduzierung des überhöhten britischen<br />
Beitrags („I want my money back“).<br />
Die erbitterte Gegenwehr gegen die deutsche<br />
Wiedervereinigung und die Europäische<br />
Währungsunion. Zuletzt – da war die<br />
eiserne Lady schon im Ruhestand – der<br />
Wandel von der harten, pragmatischen Verantwortungsethikerin<br />
in eine Propagandistin<br />
des englischen Nationalismus.<br />
Maurice Fraser hat Thatchers letzte<br />
Amtsjahre aus der Nähe erlebt, schließlich<br />
diente er von 1989 bis 1995 drei Tory-Außenministern<br />
als Sonderberater. Im Jahr<br />
des Mauerfalls war dies zunächst Geoffrey<br />
Howe. Der langjährige Weggefährte Margaret<br />
Thatchers sollte im November 1990<br />
wegen deren immer schrilleren Anti-Europarhetorik<br />
den Sturz der eisernen Lady<br />
einläuten. Dann war drei Monate lang<br />
der spätere Premierminister John Major<br />
Frasers Boss. Schließlich erlebte er knapp<br />
sechs Jahre lang an der Seite von Douglas<br />
Hurd die Neuorientierung des europäischen<br />
Kontinents. Wie Fraser jetzt die<br />
Position seines Landes sieht, da er an der<br />
weltberühmten London School of Economics<br />
(LSE) lehrt?<br />
Fraser nimmt sich Zeit, bevor er antwortet.<br />
Draußen dämmert es, wieder einer dieser<br />
kühlen Frühlingstage. Drinnen, im Wohnzimmer,<br />
verbreitet ein zotteliger Hund frischen<br />
Park- und Schweißgeruch. Der Europakenner<br />
lebt in Notting Hill, jenem<br />
Viertel, das der gleichnamige Film mit Julia<br />
Roberts und Hugh Grant weltberühmt<br />
gemacht hat. Eine transatlantische Romanze<br />
wollen die Briten immer aufs Neue<br />
Foto: Horst Friedrichs für <strong>Cicero</strong><br />
66 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Foto: Horst Friedrichs für <strong>Cicero</strong><br />
erleben, fast rührend pochen sie auf ihre<br />
„special relationship“ mit Washington. Europa<br />
hingegen ist eine mühsam ertragene<br />
Pflichtehe. „Wir sehen Brüssel als Mittel<br />
zum Zweck“, sagt Fraser. „Wir schauen uns<br />
die Themen im kalten Tageslicht an, große<br />
Visionen sind nicht unsere Sache.“ Über<br />
Jahrzehnte hinweg hätten die Befürworter<br />
des gemeinsamen Europa ihre Pflicht sträflich<br />
vernachlässigt, den Briten die Vorteile<br />
ihrer Mitgliedschaft zu erläutern. Dass Europa<br />
auch mit gemeinsamer Herkunft und<br />
Kultur, Vergangenheit und Zukunft zu tun<br />
hat, wird auf der Insel überhaupt nicht thematisiert.<br />
„Der Letzte, der darüber in emotional<br />
anrührender Weise sprechen konnte,<br />
war Winston Churchill.“<br />
Das Staatsbegräbnis des legendären<br />
Kriegspremiers ist 48 Jahre her. Wer sich<br />
daran erinnern kann, gehört zur Minderheit<br />
des Landes, die 1975 über die EU-<br />
Mitgliedschaft abstimmen durfte. Die Umfragen<br />
prophezeiten damals ein Nein, am<br />
Ende stimmten zwei Drittel der Briten für<br />
ihren Verbleib. Heutzutage verhalte es sich<br />
mit den Briten und Europa etwa so, doziert<br />
Frasers LSE-Kollege Patrick Dunleavy:<br />
„Ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel will<br />
lieber heute als morgen raus aus der EU.<br />
Ungefähr ein Fünftel findet Brüssel gut.<br />
Der große Rest denkt nicht viel darüber<br />
nach, ist aber instinktiv dagegen.“<br />
Was der Politikprofessor halb scherzhaft<br />
auf einen knappen Nenner bringt, bewertet<br />
Charles Grant ganz ähnlich: Seine<br />
Landsleute würden sich nicht viel aus<br />
der EU machen, die Diskussion über das<br />
schwierige Thema bleibt der Elite vorbehalten<br />
– und den rabiaten Boulevardblättern.<br />
Dass der Brüsseler Apparat sich erneuern<br />
muss, ist in Großbritannien ein<br />
solcher Allgemeinplatz, dass Grant schon<br />
1996 an der Gründung des Thinktanks<br />
Zentrum für Europareformen (CER) beteiligt<br />
war. 15 Jahre amtiert er nun als Direktor,<br />
hat von seinen Büroräumen mit Blick<br />
auf den Garten der feinen Privatschule<br />
Westminster aus die Reformbemühungen<br />
diverser Premierminister verfolgt. Cameron<br />
und dessen Hinterbänkler betrachtet<br />
Grant voller Argwohn. „Fresh Start, na ja,<br />
die geben sich sehr vernünftig und moderat.<br />
Aber sie reden immer von der Neuverhandlung<br />
europäischer Verträge. Das ist<br />
völlig unrealistisch. Das wollen weder die<br />
Franzosen noch die Deutschen.“<br />
Grant ist gerade aus <strong>Berlin</strong> zurückgekommen.<br />
In den Nuancen deutscher Europapolitik<br />
kennt er sich aus. Überhaupt<br />
kommt ganz schnell auf Deutschland zu<br />
sprechen, wer in London nach der Zukunft<br />
Europas fragt. Mit dem untrüglichen Gespür<br />
der Briten für Machtverhältnisse hat<br />
sich die Aufmerksamkeit von Paris und<br />
Brüssel auf die deutsche Hauptstadt verlagert.<br />
Genauer gesagt: auf die beiden Standorte,<br />
in denen derzeit europäische Politik<br />
entschieden wird, sagt Mats Persson vom<br />
Thinktank Open Europe. „Im Moment<br />
gibt es zwei Hauptstädte in Europa: <strong>Berlin</strong><br />
und Frankfurt. Was Deutschland beschließt,<br />
wird gemacht.“<br />
Schon schreiben nationalistische Kolumnisten<br />
wie Simon Heffer von der Daily<br />
Mail wieder vom „Vierten Reich“ – ein zu<br />
Zeiten der Wiedervereinigung gern an die<br />
Wand gemaltes Menetekel, das zwischendurch<br />
deutlich verblasst war. Diesen März<br />
erschreckte das linke Magazin New Statesman,<br />
das in diesem Jahr 100. Geburtstag<br />
feiert, seine Leser mit einer ähnlich anmutenden<br />
Titelseite. Da prangten Bismarck,<br />
Hitler, Kohl und Angela Merkel unter der<br />
düsteren Zeile „The German problem“.<br />
Nach dem Motto: Hitler verkauft sich<br />
immer?<br />
Dabei hat der derart reißerisch angekündigte<br />
Artikel des angesehenen Geschichtsprofessors<br />
Brendan Simms mit<br />
Hitler wenig zu tun, mit der suggerierten<br />
Verbindung zwischen ihm und der Kanzlerin<br />
überhaupt nichts. Ganz sachlich referiert<br />
Simms die „mehr als 600 Jahre alte<br />
Frage“ nach Deutschlands Platz in Europa –<br />
vom strategischen Vakuum des Spätmittelalters<br />
über Reformation und Dreißigjährigen<br />
Krieg bis hin zur Wiedervereinigung.<br />
400 Jahrhunderte lang sei das Land in der<br />
Mitte Europas zu schwach gewesen, resümiert<br />
der Historiker. „Heute ist Deutschland<br />
sowohl zu stark wie zu schwach,<br />
jedenfalls zu ungebunden.“ In der Tageszeitung<br />
The Guardian wurde das Problem<br />
kurz darauf in Frageform aufgeworfen: „Ist<br />
Deutschland zu mächtig für Europa?“ Antwort:<br />
Na ja, irgendwie schon, aber nicht<br />
so richtig.<br />
Die Macht deutscher Korrespondenten in<br />
London jedenfalls bleibt bis auf Weiteres<br />
eng begrenzt. Ob an der Regierung (1997<br />
bis 2010) oder wie zurzeit in der Opposition<br />
– die Europapolitischen Sprecher der<br />
„Wir sehen<br />
Brüssel als<br />
Mittel zum<br />
Zweck. Wir<br />
schauen uns<br />
die Themen<br />
im kalten<br />
Tageslicht<br />
an, große<br />
Visionen sind<br />
nicht unsere<br />
Sache“<br />
Maurice Fraser, London School of Economics<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 67
| W e l t b ü h n e | G r o S S b r i t a n n i e n u n d E u r o p a<br />
„Ich will<br />
nur nicht<br />
von Brüssel<br />
regiert<br />
werden. Wir<br />
halten den<br />
Nationalstaat<br />
für die<br />
richtige<br />
Einheit. Das<br />
schließt eine<br />
Kooperation<br />
mit anderen<br />
Europäern<br />
nicht aus“<br />
Harry Aldridge, UK Independence Party<br />
Labour-Party zu einem Gespräch zu bewegen,<br />
ist stets ein Ding der Unmöglichkeit.<br />
Vereinbarte Termine kommen doch nicht<br />
zustande, zugesagte Anrufe bleiben aus. Es<br />
scheint so zu sein, wie Thinktanker Persson<br />
vermutet: „Labour will möglichst wenig<br />
über Europa reden.“<br />
Da ist sie wieder, die Taktik aus den<br />
Regierungsjahren nach Tony Blairs überragenden<br />
Siegen von 1997 und 2001.<br />
Damals entzückte der Premier die Verbündeten<br />
vom Kontinent gelegentlich<br />
mit EU-freundlichen Reden, zu Hause<br />
herrschte Schweigen. In das Vakuum stießen<br />
die europafeindlichen Tageszeitungen,<br />
die Amerikanern wie Rupert Murdoch<br />
(Sun, Times) oder Steuerflüchtlingen wie<br />
den Barclay-Brüdern (Telegraph) gehören.<br />
Murdochs Lieblingskolumnist Trevor Kavanagh<br />
träufelt den Sun-Lesern seit Jahren<br />
das Gift der Euro-Paranoia ins Ohr: Die<br />
Europäische Union werde von „Mafia-Tyrannen“<br />
geleitet.<br />
So sei das eben, sagt Ulrich Storck:<br />
„Da wird den Stimmungsmachern gegen<br />
die EU der Raum überlassen.“ Storck leitet<br />
seit vergangenem Jahr das Büro der<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung in Sichtweite des<br />
Britischen Museums. Er hat also schon<br />
von Amts wegen viel Kontakt mit Labour-<br />
Leuten. In der Schlange beim Italiener um<br />
die Ecke – wenigstens die europäische Küche<br />
findet bei den kulinarisch darbenden<br />
Engländern Anklang – kommt der deutsche<br />
Beobachter schnell auf Camerons<br />
Volksabstimmung und deren Folgen für<br />
seine Partnerpartei zu sprechen. „Er hat<br />
sich als europäischer Erneuerer dargestellt<br />
und damit Labour in die Ecke des Stillstands<br />
gedrängt“, analysiert Storck. Dass<br />
Labour-Chef Edward Miliband erklärtermaßen<br />
das Referendum verweigern will,<br />
werde dieser im Vorfeld der nächsten<br />
Wahl kaum durchhalten können. Mats<br />
Persson von Open Europe sagt es drastischer:<br />
„Das Thema wird Labour wie eine<br />
Dampfwalze überrollen.“<br />
Nicht, dass der Schwede darüber glücklich<br />
ist. Ganz unbescheiden billigt er sich<br />
„einigen Einfluss“ auf Camerons Europarede<br />
zu, drei Vierteln von deren Inhalt<br />
könne er voll zustimmen. Nur das Versprechen<br />
eines Referendums über Großbritanniens<br />
EU-Mitgliedschaft hält er für<br />
falsch. „Wenn die Leute mit Ja stimmen,<br />
haben wir weiterhin den Status quo“, argumentiert<br />
Persson. „Wenn die Antwort<br />
Nein lautet – was passiert dann am Tag danach?“<br />
Darauf gebe niemand eine zufriedenstellende<br />
Antwort.<br />
Persson hat sein Büro im Dunstkreis<br />
der Westminster Abbey. Auf engstem<br />
Raum sitzen seine Mitarbeiter in einem<br />
schäbigen Büro unterm Dach, im Besprechungszimmer<br />
des Direktors wackelt jeder<br />
zweite Stuhl beängstigend. Dass seine<br />
Mitarbeiter aus mehreren europäischen<br />
Ländern kommen und Briten im Team<br />
in der Minderheit sind, sieht der Chef als<br />
Symbol. „Wir sind gute Europäer.“ Aber<br />
er identifiziert sich auch mit der Skepsis<br />
seiner schwedischen Heimat gegenüber<br />
grandiosen Luftschlössern. „Wir wollen<br />
kreativ über Europa nachdenken, konstruktive<br />
Kritik üben, auch die Vorteile<br />
benennen.“<br />
So viel Einfluss Open Europe auch ausübt<br />
auf Torys wie Cameron oder Andrea Leadsom<br />
– genau hier endet die Gemeinsamkeit.<br />
Positives über den Brüsseler Club bleibt auf<br />
Tory-Seite Mangelware. Beim Regierungschef<br />
und seiner Partei wächst die Angst vor<br />
einer neuen politischen Kraft auf der politischen<br />
Rechten. Die Nationalpopulisten<br />
von UK Independence Party (Ukip) unter<br />
dem früheren Tory Nigel Farage propagieren<br />
den Austritt aus der EU sowie harte<br />
Einwanderungsbeschränkungen. Bei Umfragen<br />
erzielen sie damit inzwischen kontinuierlich<br />
zweistellige Ergebnisse – 2010<br />
waren es nur 3 Prozent. Das ist kurz vor<br />
der Kommunalwahl in England und gut<br />
ein Jahr vor der nächsten Europawahl alarmierend,<br />
weshalb es in Camerons Parlamentsfraktion<br />
heftig brodelt. Dabei wirkt<br />
das Ukip-Programm „wie die Notizen von<br />
einem Thekengespräch im Vorstadt-Golfclub“,<br />
höhnt der Times-Kolumnist David<br />
Aaronovitch: weniger Steuern, Einwanderungsstopp,<br />
höhere Rüstungsausgaben,<br />
Nein zur Homo‐Ehe. Deutlich konservativer<br />
als die Konservativen also, dazu fiskalisch<br />
inkonsistent, wie es sich für Parteien<br />
gehört, die von der Macht nicht einmal<br />
träumen. Oder etwa doch?<br />
„Politik hat mit Einfluss zu tun“, sagt<br />
Harry Aldridge und lacht. „Euroskeptiker<br />
wie Leadsom haben die Europadiskussion<br />
in unserem Sinne angeschoben. Sie<br />
sind unsere Einflussagenten in der Konservativen<br />
Partei.“ Der 26-Jährige verdient<br />
sein Geld mit einem kleinen Import-Export-Geschäft<br />
und engagiert sich seit neun<br />
Fotos: Horst Friedrichs für <strong>Cicero</strong>, Privat (Autor)<br />
68 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> Probe lesen<br />
Jahren bei Ukip, war sogar Vorsitzender der<br />
Jugendorganisation. Wir treffen uns am<br />
Bahnhof Waterloo, benannt nach der erfolgreichen<br />
Zusammenarbeit britischer mit<br />
preußischen Truppen gegen Frankreichs<br />
Vorherrschaft auf dem Kontinent, und gehen<br />
Pizza essen. Schließlich hat Aldridge<br />
nichts gegen Europa, wie er versichert. „Ich<br />
will nur nicht von Brüssel regiert werden.<br />
Wir halten den Nationalstaat für die richtige<br />
Einheit. Das schließt eine Kooperation<br />
mit anderen Europäern nicht aus.“<br />
Kein Zweifel: Mit solch maßvoll klingenden<br />
Parolen hat Ukip die britische Europapolitik<br />
verändert. Neuerdings darf<br />
Parteichef Farage sogar am Tisch des Medienzaren<br />
Murdoch speisen. Wie der von<br />
beiden angestrebte „Brixit“ (Austritt Großbritanniens<br />
aus der EU, Anmerkung der<br />
Redaktion) ablaufen soll, weiß niemand.<br />
Aber es träumt sich so schön davon.<br />
„Enorme Kosten“ werde es verursachen,<br />
sagt einer, dessen Job nüchterne<br />
Zahlen sind statt hochfliegender Träume.<br />
Der unabhängige Unternehmensberater<br />
Howard Wheeldon hat vier Jahrzehnte<br />
in der City of London gearbeitet, dem<br />
wichtigsten internationalen Finanzplatz<br />
der Welt. Dort sei tiefe Skepsis bis hin<br />
zu offener Feindschaft gegenüber der EU<br />
„weitverbreitet“, sagt Wheeldon. Er selbst<br />
klingt wie Andrea Leadsom, die streitbare<br />
Konservative. Die gemeinsame Agrarpolitik<br />
sei „nicht hilfreich“, die Sozialcharta<br />
mit ihren Beschränkungen für Arbeitszeiten<br />
„völliger Unsinn“, der dauernde Umzug<br />
des EU-Parlaments zwischen Brüssel<br />
und Straßburg „ein einziger Zirkus“. Vor<br />
allem aber, findet der Ökonom, „muss es<br />
uns möglich sein, die Zuwanderung aus<br />
neuen EU-Ländern zu begrenzen. Hier ist<br />
kein Platz mehr.“<br />
Da bleiben keine Fragen offen. Bei der<br />
bevorstehenden Volksabstimmung votiert<br />
Wheeldon doch gewiss gegen die EU?<br />
Weit gefehlt. Die Ungewissheit, die Kosten<br />
schrecken diesen Engländer ab. „Ich<br />
würde für unseren Verbleib stimmen. Aber<br />
die Entscheidung fällt knapp aus.“<br />
Ihre Abo-Vorteile:<br />
Frei Haus: <strong>Cicero</strong> wird ohne<br />
Aufpreis zu Ihnen nach Hause<br />
geliefert .<br />
Vorteilspreis: Drei Ausgaben für<br />
nur 16,50 EUR* statt 24,– EUR.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 16,50 EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 16,50 EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts weiter<br />
zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,– EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im<br />
Einzelverkauf) und spare so über 10 %. Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen nach<br />
Erhalt der dritten Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit<br />
kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 <strong>Berlin</strong>, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
*Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
16,50 EUR*<br />
Bundestagswahl 2013<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Sebastian Borger<br />
lebt in deutsch-britischer<br />
Harmonie in London – solange<br />
nicht Bayern München auf den<br />
FC Arsenal trifft<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 943167
| W e l t b ü h n e | D e r P a p s t u n d d a s K a p i t a l<br />
Opiate sind keine Lösung<br />
Die weltlichen Ideologien haben versagt. Weder Kommunismus noch Kapitalismus<br />
können den Weg aus der Krise weisen. Gelebtes Christentum aber schon<br />
von Papst Franziskus<br />
in der immanenten Vorstellung des<br />
kommunistischen Systems lähmt alles,<br />
was über das Diesseits hinausgeht<br />
und eine Hoffnung im Jenseits markiert,<br />
die Tätigkeit im Hier. Da es den<br />
Menschen lähmt, ist es folglich ein Opium,<br />
das ihn konformistisch macht, ihn aushalten<br />
lässt und vom Fortschritt abhält. Aber<br />
diese Vorstellung ist nicht nur dem kommunistischen<br />
System zu eigen. Das kapitalistische<br />
System hat ebenfalls seine geistige<br />
Perversion: die Religion zähmen zu wollen.<br />
Es zähmt sie, damit sie nicht zu sehr stört,<br />
es verweltlicht sie. Eine gewisse Transzendenz<br />
darf sein, aber nur ein bisschen.<br />
Für den religiösen Menschen bedeutet<br />
ein Akt der Anbetung Gottes, sich seinem<br />
Willen, seiner Gerechtigkeit, seinem<br />
Gesetz und seiner prophetischen Inspiration<br />
zu unterwerfen. Für den Weltmenschen<br />
hingegen, der die Religion manipuliert,<br />
ist dieser Akt völlig belanglos. In etwa<br />
wie: „Benimm dich gut, begeh’ ein paar<br />
Untaten, aber nicht zu viele.“ Das wären<br />
gute Umgangsformen und schlechte Angewohnheiten:<br />
eine Zivilisation des Konsumdenkens,<br />
des Hedonismus, der politischen<br />
Vetternwirtschaft, die Herrschaft des Geldes.<br />
Das sind alles Ausdrucksformen der<br />
Weltlichkeit.<br />
Das Christentum verurteilt mit derselben<br />
Stärke den Kommunismus wie den ungezähmten<br />
Kapitalismus. Es gibt Privateigentum,<br />
aber mit der Verpflichtung, es in<br />
gerechten Parametern gesellschaftlich zugänglich<br />
zu machen. Ein klares Beispiel für<br />
das, was vor sich geht, ist die Geldflucht ins<br />
Ausland. Auch das Geld hat ein Vaterland,<br />
und wer eine Industrie im Land betreibt<br />
und das Geld mitnimmt, um es außerhalb<br />
des Landes zu horten, der sündigt. Denn er<br />
ehrt mit diesem Geld nicht das Land, das<br />
ihm den Reichtum gibt, und auch nicht<br />
das Volk, das arbeitet, um diesen Reichtum<br />
hervorzubringen.<br />
In beiden antagonistischen Systemen<br />
gibt es die Vorstellung vom Opium, beim<br />
kommunistischen, weil es möchte, dass<br />
alle Arbeit dem Fortschritt des Menschen<br />
dient, eine Auffassung, die sich schon bei<br />
Eine Religion<br />
braucht Geld,<br />
um ihre<br />
Tätigkeiten<br />
auszuführen<br />
Nietzsche findet. Und beim kapitalistischen,<br />
weil es eine Art gezähmter Transzendenz<br />
toleriert, die sich im weltlichen<br />
Geist ausdrückt.<br />
Ein Prediger aus den ersten Jahrhunderten<br />
des Christentums sagte, hinter jedem<br />
großen Vermögen verberge sich ein<br />
Verbrechen. Ich glaube nicht, dass das immer<br />
wahr ist. Wir haben das siebte Gebot:<br />
Du sollst nicht stehlen. Mancher hat unredlich<br />
erworbenes Geld und möchte es<br />
mit einem wohltätigen Werk gewissermaßen<br />
zurückerstatten. Ich akzeptiere nie eine<br />
Rückerstattung, sofern es keine Verhaltensänderung<br />
gibt, eine erkennbare Reue. Sonst<br />
wäscht derjenige sein Gewissen rein, aber<br />
danach geht das Spielchen weiter.<br />
Ein religiöses Oberhaupt wurde einmal<br />
beschuldigt, Geld aus dem Drogenhandel<br />
zu empfangen; er sagte dazu, er setze das<br />
Geld für gute Zwecke ein und frage nicht,<br />
woher es komme. Das ist schlecht. Blutbeflecktes<br />
Geld kann man nicht annehmen.<br />
Die Beziehung zwischen Religion<br />
und Geld ist nie einfach gewesen. Es ist<br />
immer die Rede vom Gold des Vatikans,<br />
aber das ist ein Museum. Man muss auch<br />
zwischen dem Museum und der Religion<br />
unterscheiden. Eine Religion braucht Geld,<br />
um ihre Tätigkeiten auszuführen, und das<br />
macht man mittels Bankinstituten, daran<br />
ist nichts unzulässig. Die Frage ist, wie man<br />
das Geld nutzt, das man in Form von Zuwendungen<br />
oder als Unterstützung erhält.<br />
Die Bilanz des Vatikans ist öffentlich, sie<br />
ist immer im Defizit: Was durch Spenden<br />
oder Museumsbesuche hereinkommt, geht<br />
an Leprakranke, an Schulen, an afrikanische,<br />
asiatische, amerikanische Gemeinden.<br />
Das Schlimmste, was einem Kirchenmenschen<br />
passieren kann, ist ein Doppelleben,<br />
ob er nun Rabbiner, Priester oder<br />
Pastor ist. Bei einem gewöhnlichen Menschen<br />
kann es vorkommen, dass er hier sein<br />
Zuhause und dort sein Liebesnest hat und<br />
dies nicht weiter verwerflich erscheint, aber<br />
bei einem Mann der Religion ist es absolut<br />
verwerflich.<br />
Einen Vers aus dem Buch Jesaja machen<br />
auch wir im Christentum uns – als<br />
jüdisches Erbe – zu eigen: „Entzieh’ dich<br />
nicht deinen Verwandten, deinem Fleisch<br />
und Blut.“ Der Schlüssel liegt in der Parabel<br />
vom Jüngsten Gericht, wenn der Menschensohn<br />
die einen (die Guten) zu seiner<br />
Rechten und die anderen (die Schlechten)<br />
zur Linken versammelt. Der König wird<br />
dann zu denen auf der rechten Seite sagen:<br />
Foto: Mario Tama/Getty Images<br />
70 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet<br />
seid, nehmt das Reich in Besitz …<br />
Denn ich war hungrig, und ihr habt mir<br />
zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr<br />
habt mir zu trinken gegeben … ich war<br />
nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben;<br />
ich war krank, und ihr habt mich besucht;<br />
ich war im Gefängnis, und ihr seid<br />
zu mir gekommen.“ Sie fragen, wann sie<br />
das getan haben sollen, und der König antwortet<br />
ihnen, dass sie es jedes Mal, wenn<br />
sie es für einen der Geringsten seines Reiches<br />
taten, für ihn taten. Die anderen, die<br />
es nicht taten, verurteilt er.<br />
Im Christentum ist die Haltung der Armut<br />
und den Armen gegenüber – in ihrem<br />
Kern – eine wirkliche Verpflichtung. Diese<br />
Verpflichtung muss ganz aus nächster Nähe<br />
persönlich erfüllt werden. Es ist nicht damit<br />
getan, dass sie durch die Institutionen<br />
erledigt wird, was hilfreich ist, weil es einen<br />
Multiplikationseffekt hat; aber es genügt<br />
nicht, es befreit nicht von der Verpflichtung,<br />
in Kontakt mit den Bedürftigen zu<br />
treten. Man muss den Kranken pflegen –<br />
selbst wenn das Widerwillen, Ekel hervorruft<br />
–, man muss den Häftling besuchen.<br />
Ich finde es schrecklich schwer, in ein<br />
Gefängnis zu gehen, denn was man dort<br />
sieht, ist sehr hart. Aber ich gehe trotzdem,<br />
denn der Herr möchte, dass ich ganz nah<br />
am Bedürftigen bin, am Armen, am Leidenden.<br />
Die erste Aufmerksamkeit der<br />
Armut gegenüber ist unterstützender Art:<br />
„Hast du Hunger? Nimm, hier hast du etwas<br />
zu essen.“ Doch dort sollte die Hilfe<br />
nicht stehen bleiben, man muss Wege der<br />
Förderung und der Integration in die Gemeinschaft<br />
aufzeigen. Der Arme soll nicht<br />
für immer am Rande stehen bleiben.<br />
Wir können nicht akzeptieren, dass der<br />
zugrunde liegende Diskurs lautet: „Wir,<br />
denen es gut geht, geben dem etwas, dem<br />
es schlecht geht, doch er soll bloß dort bleiben,<br />
weit weg von uns.“ Das ist nicht christlich.<br />
Unbedingt muss man ihn so bald wie<br />
möglich in unsere Gemeinschaft eingliedern,<br />
mit Erziehung, mit Handwerksschulen.<br />
So, dass er da rauskommen kann.<br />
Diese Auffassung herrschte im 19. Jahrhundert<br />
mit den Schulen vor, die Don Bosco<br />
für alle bedürftigen Jugendlichen schuf, die<br />
er in seinem Oratorium versammelt hatte.<br />
Don Bosco dachte, dass es wenig Sinn habe,<br />
sie aufs Lyzeum zu schicken, weil ihnen das<br />
für ihr Leben nichts nutzen würde, daher<br />
schuf er Handwerksschulen.<br />
Etwas Ähnliches wiederholen gerade<br />
die Geistlichen in den Elendsvierteln von<br />
Buenos Aires; sie bemühen sich, dass die<br />
jungen Leute mit einem oder zwei Jahren<br />
Lehrzeit eine Ausbildung erhalten, die ihrem<br />
Leben einen anderen Lauf gibt: Sie<br />
Lange bevor er Papst wurde, gewann Jorge Mario Bergoglio als Bischof von Buenos Aires die Herzen der Menschen im Slum „Villa 21-24“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 71
| W e l t b ü h n e | D e r P a p s t u n d d a s K a p i t a l<br />
papstprogramm<br />
wie man dem Satan ein Schnippchen schlägt<br />
Franziskus setzt die Lehre Benedikts XVI. trotz neuer Akzente weitgehend fort<br />
Von Alexander Kissler<br />
Benedikt XVI. argumentierte, Papst<br />
Franziskus appelliert. Das ist der<br />
größte Unterschied zwischen Vorgänger<br />
und Nachfolger. Mag manch erfrischender<br />
Umgangston das Amt in<br />
neuem Licht und den Pontifex wie einen<br />
Revoluzzer erscheinen lassen: Die<br />
Substanz der Verkündigung blieb unberührt.<br />
Die erste Botschaft nach der<br />
Wahl war ein Echo auf den letzten Satz<br />
Benedikts. Dieser hatte sich verabschiedet<br />
mit den Worten, „gehen wir<br />
miteinander weiter mit dem Herrn“;<br />
Franziskus betrat die Loggia des Petersdoms<br />
mit der Ankündigung, „jetzt<br />
beginnen wir diesen Weg, Bischof und<br />
Volk“: Christentum als Weggemeinschaft<br />
über Personalwechsel hinweg.<br />
Mehrfach stellte Franziskus sich in<br />
die Traditionsspur Benedikts, bekannte<br />
sich zu zwei dessen Pontifikat prägenden<br />
Begriffen. Vermutlich wäre Jorge<br />
Mario Bergoglio sogar zu Ostern wieder<br />
in Buenos Aires gewesen, hätte er<br />
nicht vor dem Konklave eine aufrüttelnde<br />
Rede wider die Verweltlichung<br />
der Kirche gehalten. Der für den gesamten<br />
Lebens gang Ratzingers typische<br />
Ausdruck kehrte in Bergoglios Mahnung<br />
wieder. Schluss müsse sein mit der<br />
„mundanidad espiritual“, einer spirituellen<br />
Weltlichkeit, die zu einer selbstbezüglichen,<br />
weltlichen Kirche führe.<br />
In seinen Büchern „Offener Geist<br />
und gläubiges Herz“ und „Über Himmel<br />
und Erde“ bekräftigt Bergoglio<br />
diesen Gedanken, wie beim Konklave<br />
unter Verweis auf Henri de Lubac.<br />
Wenn die Kirche weltlich wird, entwickele<br />
sie „Haltungen der Hoffnungslosigkeit,<br />
die im Reichtum, in der Eitelkeit<br />
und der Überheblichkeit wurzeln“.<br />
Das Schlimmste, was einem Priester<br />
widerfahren kann, sei, „nach den Kriterien<br />
der Welt zu leben statt nach<br />
den Kriterien, die der Herr durch die<br />
Gesetzestafeln und das Evangelium<br />
Gegen die „Irrlichter der Vernunft“<br />
aufgetragen hat“. In seiner ersten<br />
Messe als Papst wandte Franziskus sich<br />
gegen die „Weltlichkeit des Teufels“.<br />
Das zweite Schlüsselwort Ratzingers,<br />
die „Diktatur des Relativismus“,<br />
griff Franziskus vor dem diplomatischen<br />
Korps auf. Besagte „Diktatur“ sei<br />
Zeichen der „geistlichen Armut unserer<br />
Tage, die ganz ernstlich auch die Länder<br />
betrifft, die als die reichsten gelten“.<br />
Franziskus erinnerte an Benedikts Einsicht,<br />
dass – radikal antirelativistisch –<br />
kein Friede, kein innerer Reichtum<br />
ohne Wahrheit möglich sei.<br />
In der Ökumene will Franziskus,<br />
wie es EKD-Chef Nikolaus Schneider<br />
zu hören bekam, an die Impulse Benedikts<br />
und dessen Reden im Augustinerkloster<br />
Erfurt anknüpfen. Dort hatte<br />
Joseph Ratzinger Eschatologie, Gericht<br />
und Rechtfertigung als Themenfelder<br />
identifiziert. Wie Benedikt will Franziskus<br />
das Erbe der Märtyrer fruchtbar<br />
machen. Der Aufruf Franziskus’<br />
am Palmsonntag, „seid niemals traurige<br />
Menschen“, war die in den Imperativ<br />
übersetzte Einsicht Benedikts, die<br />
Freude sei jene Gabe, „in der alle anderen<br />
Gaben zusammengefasst sind“.<br />
Traurigkeit ist für Bergoglio „Satans<br />
Zauberkunst, die unser Herz verhärtet<br />
und verbittert“. Als er die Kathedra<br />
Petri in Besitz nahm und dort die<br />
menschliche Ungeduld von der Geduld<br />
Gottes abgrenzte, klangen die Sätze aus<br />
Benedikts Amtseinführung von 2005<br />
nach: „Die Welt wird durch die Geduld<br />
Gottes erlöst und durch die Ungeduld<br />
der Menschen verwüstet.“<br />
Die praktischen Folgen von Bergoglios<br />
katholischem Way of thinking<br />
überraschen nicht. Abtreibung lehnt<br />
er ebenso deutlich ab wie die Gleichstellung<br />
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften<br />
mit der Ehe; das wäre ein „anthropologischer<br />
Rückschritt …, denn<br />
es hieße, eine jahrtausendealte Institution<br />
zu schwächen, die in Übereinstimmung<br />
mit der Natur und der Anthropologie<br />
herausgebildet wurde“.<br />
Akzentverschiebungen gibt es dennoch.<br />
Bergoglio ist, obwohl Jesuit, vernunftskeptischer.<br />
Er spricht von der<br />
„Versuchung, die Werte des Verstands<br />
über die des Herzens zu stellen. Das<br />
ist falsch. Nur das Herz eint und integriert.“<br />
Wer sich von den „Irrlichtern<br />
der Vernunft“ leiten lässt, werde zum<br />
„Intellektuellen, der nichts weiß“.<br />
Nicht die Vernunft, sondern die<br />
Zärtlichkeit ist das Leitmotiv des neuen<br />
Kapitels. Sechsmal kam das Wort in<br />
der Predigt zur Amtseinführung vor.<br />
Verbunden mit der von Benedikt übernommenen<br />
Theologie der Demut lauten<br />
die Koordinaten des franziskanischen<br />
Pontifikats: Arm soll die Kirche<br />
sein, unabhängig und entweltlicht, das<br />
menschliche Leben soll sie schützen,<br />
das Naturrecht verteidigen und auf diesem<br />
gemeinsamen Weg aller Getauften<br />
den Mut zur Zärtlichkeit sich bewahren<br />
und gerade so dem Teufel ein<br />
Schnippchen schlagen, wo auch immer,<br />
wie auch immer, von nun an.<br />
Alexander Kissler<br />
leitet das Ressort Salon. Von<br />
ihm erschien soeben „Papst im<br />
Widerspruch. Benedikt XVI.<br />
und seine Kirche 2005-2013“<br />
Fotos: Imago, Andrej Dallmann (Autor)<br />
72 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Anzeige<br />
werden Elektriker, Köche, Schneider. Man<br />
muss fördern, dass sie sich ihre Brötchen<br />
verdienen können. Es setzt den Armen herab,<br />
nicht über dieses Öl zu verfügen, das<br />
einen mit Würde salbt: die Arbeit.<br />
Man darf sich vor dem Armen nicht<br />
ekeln, man muss ihm in die Augen sehen.<br />
Manchmal ist das unangenehm, aber wir<br />
müssen dafür einstehen, was unsere Lebensrealität<br />
ist. Die große Gefahr – oder<br />
die große Versuchung – bei der Unterstützung<br />
der Armen liegt darin, in protektionistischen<br />
Paternalismus zu verfallen, der<br />
sie letztlich nicht wachsen lässt. Die Verpflichtung<br />
des Christen ist es, selbst den<br />
Besitzlosesten in die Gemeinschaft zu integrieren,<br />
so gut es geht, ihn auf jeden Fall<br />
irgendwie zu integrieren.<br />
Die christliche Liebe ist die Liebe zu<br />
Gott und zum Nächsten. Sie kann mit der<br />
Unterstützung beginnen, doch darf sie sich<br />
nicht auf die Organisation von Teepartys<br />
beschränken. Es gibt Veranstaltungen, die<br />
sich wohltätig nennen und in Wirklichkeit<br />
gesellschaftliche Events sind. Diese Art<br />
von Aktionen werden durchgeführt, damit<br />
man sich selbst gut fühlt, doch die Liebe<br />
setzt immer voraus, aus sich herauszugehen,<br />
sich selbst zurückzustellen. Die geliebte<br />
Person verlangt, dass ich mich in ihren<br />
Dienst stelle. Aber es gibt Karikaturen<br />
der Nächstenliebe.<br />
Einmal, ich war schon Bischof, erhielt<br />
ich eine Einladung für ein Benefiz-Dinner<br />
der Caritas. An den Tischen saß, wie<br />
man so sagt, die Crème de la Crème. Ich<br />
entschied, nicht hinzugehen. An jenem<br />
Tag gehörte zu den Geladenen der damalige<br />
Präsident. Bei diesem Treffen wurden<br />
Sachen versteigert, und nach dem ersten<br />
Gang kam eine goldene Rolex unter den<br />
Hammer. Eine wirkliche Schande, eine<br />
Kränkung, ein schlechter Gebrauch der<br />
Nächstenliebe. Man suchte nach jemandem,<br />
der mit dieser Uhr eitel herumprotzen<br />
wollte, um die Armen zu speisen.<br />
Zum Glück werden bei der Caritas solche<br />
Sachen nicht mehr gemacht. Heute begleitet<br />
sie kontinuierlich die Förderung von<br />
Schulen, unterhält Häuser für alleinerziehende<br />
Mütter und Obdachlose, hat eine<br />
Bäckerei, wo auch das Kunsthandwerk verkauft<br />
wird, das die jungen Leute in den<br />
Handwerksschulen herstellen. Das ist Armenförderung<br />
durch den Armen selbst.<br />
Manchmal werden im Namen der Nächstenliebe<br />
Aktionen veranstaltet, die nicht<br />
karitativ sind, sie sind wie Karikaturen einer<br />
guten Absicht. Es gibt keine Wohltätigkeit<br />
ohne Liebe, und wenn bei der Unterstützung<br />
des Bedürftigen die eigene<br />
Eitelkeit genährt wird, ist da keine Liebe,<br />
dann täuscht man etwas vor.<br />
Wenn man das Handbuch der Soziallehre<br />
der Kirche aufschlägt, wundert man<br />
sich über die Anklagen darin. Zum Beispiel<br />
die Verurteilung des Wirtschaftsliberalismus.<br />
Alle denken, die Kirche sei gegen den<br />
Kommunismus; doch sie ist ebenso gegen<br />
dieses System wie gegen den ungezähmten<br />
Wirtschaftsliberalismus von heute. Das ist<br />
auch kein Christentum, wir können das<br />
nicht akzeptieren. Wir müssen die Gleichheit<br />
von Chancen und Rechten suchen, für<br />
soziale Vorrechte eintreten, würdige Renten,<br />
Urlaub, Ruhetage, die Freiheit zum<br />
Zusammenschluss. All diese Fragen machen<br />
die soziale Gerechtigkeit aus. Es darf<br />
keine Besitzlosen geben, und es gibt keine<br />
schlimmere Besitzlosigkeit, als sich seinen<br />
Lebensunterhalt nicht verdienen zu können,<br />
nicht die Würde der Arbeit zu haben.<br />
Eine Anekdote klärt vielleicht das Bewusstsein<br />
der Kirche zu diesem Thema:<br />
Als bei einer der vielen Verfolgungen der<br />
Kaiser von Laurentius, einem römischen<br />
Diakon, verlangte, er solle ihm kurzfristig<br />
die Schätze der Kirche herausgeben, kam<br />
Laurentius ein paar Tage später mit einer<br />
Gruppe Armer zu dem Treffen und sagte:<br />
„Diese Menschen sind der wahre Schatz<br />
der Kirche.“ Dieses Paradigma müssen wir<br />
pflegen, denn jedes Mal, wenn wir uns davon<br />
entfernen – sei es als Institution im<br />
Ganzen oder als kleine Gemeinschaft – verleugnen<br />
wir unser Wesen. Wir rühmen uns<br />
in der Schwäche unseres Volkes, dem wir<br />
helfen voranzukommen.<br />
Die Armen sind der Schatz der Kirche,<br />
man muss für sie sorgen; und wenn wir<br />
diese Vision nicht haben, werden wir eine<br />
mediokre, laue, kraftlose Kirche errichten.<br />
Unsere wahre Macht muss das Dienen<br />
sein. Man kann Gott nicht verehren,<br />
wenn in unserem Geist der Bedürftige keinen<br />
Platz hat.<br />
Papst Franziskus<br />
ist seit dem 13. März das Oberhaupt<br />
der katholischen Kirche.<br />
Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck<br />
aus seinem Buch „Über Himmel<br />
und Erde“, das er noch als Erzbischof<br />
von Buenos Aires verfasste<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 73<br />
634 S., 33 Abb. Geb. € 29,95<br />
ISBN 978-3-406-64096-4<br />
„Jonathan Sperbers exzellenter<br />
Biographie gelingt es glänzend,<br />
unser Bild von Karl Marx neu<br />
zu gewichten.“ Ian Kershaw<br />
192 S.,Klappenbr. € 14,95 ISBN 978-3-406-64386-6<br />
„Dank Wehlers Buch habe ich<br />
endlich verstanden, dass der<br />
alte Stéphane Hessel seinen<br />
Aufruf ‚Empört euch‘ auch<br />
für die Deutschen geschrieben<br />
hat.“<br />
Klaus Harpprecht,<br />
DIE ZEIT<br />
C.H.BECK<br />
WWW.CHBECK.DE
| W e l t b ü h n e | K o m m e n t a r<br />
Renaissance der Atombombe<br />
Die erneute Eskalation in Nordkorea zeigt: Das Drohpotenzial der<br />
A-Waffe ist ungebrochen. Kein Wunder, dass immer mehr Staaten<br />
die Massenvernichtungswaffe haben wollen<br />
Von Karl-Heinz Kamp<br />
E<br />
in Relikt des Kalten Krieges? Von wegen! Die Angst<br />
vor dem Atomkrieg ist wieder allgegenwärtig. Auslöser<br />
sind nicht etwa die immer noch beachtlichen Kernwaffenbestände<br />
Russlands oder der USA, sondern die Äußerungen<br />
der bizarren Führung eines Steinzeitregimes, das nicht einmal<br />
die eigene Bevölkerung ernähren kann. Kim Jong Un, pausbäckiger<br />
Twen mit Vorliebe für Disney-Figuren und „Oberster<br />
Führer“ Nordkoreas, droht der Welt mit dem Einsatz seiner<br />
Atomwaffen und beherrscht damit die Schlagzeilen weltweit.<br />
Die Streitkräfte Südkoreas erhöhen ihre Bereitschaft, die USA<br />
verschiffen riesige Radaranlagen nach Asien, und Japan stationiert<br />
Abwehrraketen mitten in Tokio. Dabei weiß niemand, ob<br />
Nordkorea überhaupt Kernwaffen besitzt. Das Land hat zwar<br />
mehrere Atomtests durchgeführt – mit wechselndem Erfolg übrigens.<br />
Doch der Weg von einer turmhohen nuklearen Versuchsanlage<br />
zu einem kleinen Atomsprengkopf, der auf eine Rakete<br />
passt, ist weit.<br />
Was ist nur aus Barack Obamas Vision einer atomwaffenfreien<br />
Welt geworden, die der US-Präsident 2009 verkündet<br />
hatte und für die er nicht nur das Lob fast aller Nationen erntete,<br />
sondern auch mit dem Friedensnobelpreis belohnt wurde?<br />
Gesunken ist die Zahl der atomaren „Player“ in der Weltpolitik<br />
seither jedenfalls nicht. Neben Nordkorea arbeitet auch<br />
Iran mit Hochdruck an der Entwicklung von Atomwaffen und<br />
kommt dabei offenbar zügig voran. Sobald aber Teheran seine<br />
erste Kernwaffe erfolgreich testet und damit die Eintrittskarte in<br />
den Club der Atommächte präsentiert, werden andere diesem<br />
Beispiel folgen. Schon länger träumen Regime im Nahen und<br />
Mittleren Osten von der „islamischen Bombe“. Gleiches gilt für<br />
Ostasien. Die Kapriolen des „Obersten Führers“ werden nicht<br />
ohne langfristige Folgen bleiben, selbst wenn die nordkoreanischen<br />
Atomdrohungen eher hochgestapelt sind. Länder wie Japan<br />
oder Südkorea sind technisch hoch entwickelt und werden<br />
die Notwendigkeit eigener Atomarsenale künftig sehr intensiv<br />
diskutieren.<br />
Worin liegt aber der Reiz einer Waffe, die seit Hiroshima<br />
und Nagasaki im Jahr 1945 nicht mehr eingesetzt wurde und<br />
deren Wert offenbar nur darin besteht, andere Staaten vom Einsatz<br />
ihrer Kernwaffen abzuhalten? Warum nehmen Länder wie<br />
Iran heftige Kritik, schmerzhafte internationale Sanktionen und<br />
politische Isolation in Kauf, nur um in den Besitz dieser Waffe<br />
zu gelangen? Und wird Obamas Vision einer Welt ohne Atomwaffen<br />
ein Wunsch bleiben?<br />
Jedenfalls gibt es nicht nur einen Daseinszweck von Atomwaffen.<br />
Zu Beginn des Atomzeitalters glaubte man in Ost und<br />
West, Kernwaffen militärisch nutzen zu können. Während Kim<br />
Junior das vermutlich immer noch denkt, sind die Sowjetunion<br />
und die USA weiter. Sie lernten in so scharfen Konflikten wie<br />
der Kuba-Krise, dass die Atombombe nicht „just another weapon“<br />
ist, die sich in Kriegen einsetzen lässt. Kriegsverhinderung<br />
durch wechselseitige Abschreckung wurde das Ziel. Für andere<br />
Länder zählt eher der Status, den Atomwaffen verleihen. Frankreich<br />
gründet einen Teil seines nationalen Selbstbewusstseins auf<br />
die Tatsache, unabhängige Atommacht zu sein. Indien agiert auf<br />
Augenhöhe im Kreis der Weltmächte, seitdem es über Atomwaffen<br />
verfügt.<br />
Entscheidend aber ist der Umstand, dass Atomwaffen ihrem<br />
Besitzer in einer Krise politischen Handlungsspielraum verschaffen<br />
und ihn vor militärischen Interventionen schützen. Wäre<br />
Serbien 1999 Atommacht gewesen, hätte die Nato keinen Krieg<br />
um den Kosovo geführt. Hätte Saddam Hussein Atomwaffen<br />
besessen, als er Kuwait überfiel, hätten die USA tatenlos zusehen<br />
müssen. Libyens Muammar al-Gaddafi soll während seiner<br />
Flucht gegenüber Vertrauten bedauert haben, dass er nicht die<br />
Entwicklung eigener Kernwaffen vorangetrieben hatte – er säße<br />
vermutlich noch heute in seinem Regierungszelt. So gesehen,<br />
sind die iranischen Nuklearambitionen durchaus folgerichtig:<br />
Illustration: Jan Rieckhoff; Foto: Privat<br />
74 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Man ist entweder selbst Atommacht oder zumindest mit einer<br />
Atommacht eng verbündet, wie die Nato-Staaten mit den USA.<br />
Wie steht es vor diesem Hintergrund mit der Idee einer<br />
atomwaffenfreien Welt? Obama war klug genug zuzugeben, dass<br />
sich seine Vision wohl kaum zu seinen Lebzeiten verwirklichen<br />
wird. Aus heutiger Sicht werden aber auch zwei oder drei Präsidentenleben<br />
nicht ausreichen, um die totale nukleare Abrüstung<br />
zu erreichen. Das liegt zunächst daran, dass viele Länder<br />
allen Bekenntnissen zum Trotz ihre Atomwaffen schlicht nicht<br />
aufgeben wollen. Israel versteht sie als Garant für das eigene<br />
Überleben – kein Wunder bei den vielen Wünschen aus der Region,<br />
Israel von der Landkarte tilgen zu wollen. Frankreich sieht<br />
sie vor allem als Insignien der Macht, während Indien sie auch<br />
als Mittel gegen chinesische Aggressionen versteht. Pakistan hat<br />
sie wiederum wegen Indien, und für Russland sind sie sowohl<br />
ein Gegengewicht zu der aus ihrer Sicht militärisch überlegenen<br />
Nato als auch ein Denkmal des vergangenen Ruhms einer<br />
Supermacht. China geht nicht einmal gegen die nuklearen Tiraden<br />
seines nordkoreanischen Schützlings entschieden vor. Nicht,<br />
dass man sein Spiel mit dem Feuer billigt, aber man will auch<br />
nicht, dass das Regime kollabiert. Der Status quo mit einem absonderlichen<br />
Führer ist aus Pekings Sicht immer noch besser als<br />
ein Ende der Kim-Dynastie und eine Wiedervereinigung unter<br />
südkoreanischen Vorzeichen.<br />
Selbst wenn sich alle Nuklearstaaten zu einem beispiellosen<br />
Akt der Selbstbeschränkung entschließen sollten und ihre Kernwaffen<br />
zur Verschrottung freigäben, so wäre der Globus nicht<br />
notwendigerweise sicherer. Das Wissen um den Bau von Kernwaffen<br />
ist in der Welt – der nukleare Geist ist aus der Flasche<br />
und lässt sich auch nicht wieder einsperren. In einem ernsten<br />
Konflikt würde ein entschlossener Aggressor nur wenige Monate<br />
brauchen, um die alten Blaupausen aus dem Safe zu holen und<br />
eine funktionsfähige Kernwaffe zu konstruieren. Andere würden<br />
versuchen gleichzuziehen. Ein solcher Rüstungswettlauf in einer<br />
Krise wäre kaum beruhigender als das derzeitige System gegenseitiger<br />
Abschreckung. Auch gibt es vermutlich schon heute geheime<br />
Nuklearprogramme in Staaten, die derzeit noch niemand<br />
auf dem Schirm hat. In Zeiten, in denen ein Smartphone eine<br />
höhere Computerleistung hat als die Großrechner amerikanischer<br />
Atomlabors der sechziger Jahre, ist man vor Überraschungen<br />
nicht sicher.<br />
Heißt das, den nuklearen Realitäten tatenlos zuschauen zu<br />
müssen und zu warten, bis in der kommenden multinuklearen<br />
Welt eine der vielen Tausend Kernwaffen detoniert – sei es geplant<br />
oder als tragische Fehlkalkulation? Keinesfalls, es muss dringend<br />
gehandelt werden. Allerdings hilft das Machbare mehr als<br />
die Vision. Machbar ist die Reduzierung der vorhandenen Bestände.<br />
Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum derzeit etwa<br />
4400 Atomwaffen weltweit einsatzbereit gehalten werden. Noch<br />
weniger ist zu verstehen, dass knapp 15 000 Atomsprengköpfe in<br />
Reserve lagern, teils montiert, teils in Einzelteilen. Die USA und<br />
Russland haben sich schon auf kleinere Arsenale geeinigt, andere<br />
Länder stehen noch außen vor. Allerdings ist die Umsetzung der<br />
beschlossenen Maßnahmen sehr zeitaufwendig.<br />
Hilfe bei der Rüstungskontrolle kommt von unerwarteter<br />
Seite: Die weltweite Finanzkrise macht es den Nuklearstaaten<br />
immer schwerer, ihre kostspieligen Atomarsenale zu erhalten.<br />
Hier wird es eine „kalte Abrüstung“ geben, auch ohne dass man<br />
sich auf komplizierte Abkommen einigt.<br />
Ein zweites Schlüsselwort ist Transparenz. Waffenbestände,<br />
die man kennt, sind weniger problematisch als verborgene Arsenale.<br />
Lässt man den vermeintlichen Gegner in den eigenen militärischen<br />
Hinterhof schauen, erweckt man Vertrauen und baut<br />
Fehleinschätzungen ab. Politisch ist die Forderung nach Transparenz<br />
nicht leicht durchzusetzen, da man immer gegen historische<br />
Ängste und gewachsene Bedrohungsvorstellungen ankämpfen<br />
muss. Vor allem geht auch dies nicht von heute auf morgen.<br />
Helfen uns diese Ideen bei der Bewältigung der unmittelbaren<br />
Krise in Ostasien? Vermutlich nicht – aber das tut der<br />
Traum von der atomwaffenfreien Welt ebenso wenig.<br />
Karl-Heinz Kamp<br />
ist Forschungsdirektor des Nato Defence College in Rom.<br />
Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder<br />
Lesetipps: Israel und Palästina<br />
Anzeige<br />
Die scharfsinnige Analyse<br />
einer Beziehung in der Krise<br />
Peter Beinart zeigt, warum<br />
sich immer weniger junge<br />
amerikanische Juden mit Israel<br />
identifizieren. Er schildert den<br />
Streit zwischen Obama und<br />
Netanjahu über die Nahostpolitik<br />
und beschreibt das<br />
Versagen der amerikanischen<br />
jüdischen Organisationen.<br />
320 Seiten, 1 Karte, gebunden;<br />
€ 24,95 (D);<br />
ISBN 978-3-406-64547-1<br />
Zu Fuß durch Israel<br />
und Palästina<br />
Martin Schäuble bringt<br />
uns nicht nur den Alltag<br />
der Israelis und Palästinenser<br />
näher, er hilft<br />
auch zu verstehen, wie<br />
auf engstem Raum unterschiedliche<br />
Interessen und<br />
Ansprüche aufeinandertreffen.<br />
224 Seiten mit Karte,<br />
gebunden; € 17,90 (D);<br />
ISBN 978-3-446-24142-8<br />
Israel von Innen<br />
verstehen<br />
Der Graben des Unverständnisses<br />
zwischen<br />
Israel und seinen Verbündeten<br />
vertieft sich zusehends.<br />
Ruth Kinet taucht<br />
in die israelische Gesellschaft<br />
ein und erschließt<br />
sie dem Leser mit einem<br />
empathischen Blick.<br />
200 Seiten mit Karte, Klappenbroschur;<br />
€ 16,90 (D);<br />
ISBN 978-3-86153-714-4<br />
Alle Bücher sind in Ihrer Buchhandlung erhältlich.
| K a p i t a l<br />
Weniger ist meer<br />
Die griechische EU-Kommissarin Maria Damanaki kämpft erfolgreich gegen die Überfischung<br />
von Christian Schwägerl<br />
I<br />
hre Kampfbereitschaft hat Maria<br />
Damanaki früh bewiesen. 1973<br />
war sie die Stimme des Aufstands<br />
gegen die griechische Militärdiktatur. Damals<br />
21 Jahre alt, Studentin, angehende<br />
Chemieingenieurin, rief sie in einer Radiosendung<br />
vom Gelände der besetzten Polytechnischen<br />
Hochschule die Bevölkerung<br />
zum Widerstand gegen die Generäle auf.<br />
Diese schlugen den „Polytechnio-Aufstand“<br />
blutig nieder. Damanaki landete im Gefängnis<br />
und wurde gefoltert. Weniger als<br />
ein Jahr später brach die Militärdiktatur<br />
in sich zusammen, es war auch ein Sieg<br />
Damanakis.<br />
40 Jahre später ist Damanaki Athens<br />
Vertreterin in der EU-Kommission und dabei<br />
auf dem Weg, als die Fischereikommissarin<br />
in die Annalen Europas einzugehen,<br />
die die jahrzehntelange Überfischung der<br />
Meere durch bis zu 100 000 europäische<br />
Fangschiffe beendet hat. Dabei war ihr jetziges<br />
Amt alles andere als ihr Traumjob:<br />
„Wenn man als Grieche schon EU-Kommissar<br />
wird, kann man sich das Ressort<br />
nicht aussuchen“, hat sie einmal lakonisch<br />
gesagt. Die ehemalige Vorsitzende der sozialistischen<br />
Partei Synaspismos muss schon<br />
bis in ihre Kindheit auf Kreta zurückgehen,<br />
um etwas über ihre Beziehung zur Welt der<br />
Fische erzählen zu können. Und ihr EU-<br />
Amt sah zunächst auch tatsächlich nicht<br />
nach einem Gewinnerposten aus: Fischereipolitik<br />
galt bis zu Damanakis Amtsantritt<br />
2010 als sehr technisch, der zuständige<br />
Kommissar stand stets in der hinteren<br />
Reihe.<br />
Ihre Vorgänger waren darauf bedacht,<br />
die kurzfristigen Interessen der Fischereiwirtschaft<br />
zu schützen, vor allem die der<br />
Eigner großer, industrieller Fangschiffe.<br />
Milliardensubventionen flossen in den Aufbau<br />
einer übergroßen Flotte, die heute bis<br />
in den Südpazifik tuckert, um die Weltmeere<br />
zu leeren. In den Gewässern rund<br />
um Europa rächt sich die falsche Politik<br />
von früher bereits brutal: Der Fischfang<br />
ging von acht Millionen Tonnen 1995<br />
auf fünf Millionen Tonnen im Jahr 2012<br />
zurück – nicht wegen strikterer Auflagen,<br />
sondern weil nichts mehr zu holen ist.<br />
Damanaki hat sich vom ersten Tag an<br />
vorgenommen, die alten Strukturen aufzubrechen,<br />
und steht kurz vor dem Ziel.<br />
Bis spätestens Juni will sie sich mit dem<br />
Europaparlament und den 27 Mitgliedstaaten<br />
auf eine umfassende Reform der<br />
EU‐Fischereipolitik einigen.<br />
Damanaki sorgt sich dabei um mehr<br />
als die Fische. Es geht ihr eben nicht nur<br />
um Kabeljau, Hering und Makrelen, es<br />
geht auch um 400 000 Arbeitsplätze in<br />
der Fischereibranche, um viele Milliarden<br />
Euro Umsatz und rund drei Milliarden<br />
Euro Subventionen. Die Kritik der<br />
Fischereilobby, Damanakis Reformen schadeten<br />
der Wirtschaft, weist sie barsch zurück<br />
und sieht Parallelen zur Schuldenkrise<br />
in ihrer Heimat: „Unser Umgang<br />
mit den Meeren ist genauso verantwortungslos<br />
wie der griechische Umgang mit<br />
Geld. Wenn wir weiter zu viel Fisch-Kapital<br />
abheben, ist das Meereskonto bald leer.“<br />
Mit ihren Reformen strebt sie eine nachhaltige<br />
Regeneration der Fischbestände an.<br />
Der Branchenumsatz könne dadurch sogar<br />
um 1,8 Milliarden Euro wachsen, rechnet<br />
sie ihren Kritikern vor.<br />
Die kennen den kämpferischen Kurs<br />
der Kommissarin schon. Kaum im Amt,<br />
entließ sie einen EU-Spitzenbeamten, der<br />
als verkappter Lobbyist der großen Fischereifirmen<br />
galt, und sorgte gleichzeitig dafür,<br />
dass neue Stimmen in Brüssel Gehör<br />
finden. „Bei den ersten Sitzungen war niemand<br />
da, der die Besitzer kleiner Boote in<br />
den Küstengemeinden vertreten hat“, erzählt<br />
Damanaki, „das musste ich natürlich<br />
sofort ändern.“<br />
2011 legte sie den ersten Reformentwurf<br />
vor, mit dem sie seither durch Europa<br />
zieht, durch Hauptstädte und Küstendörfer,<br />
zu Wissenschaftskonferenzen und den Treffen<br />
der Fischereiwirtschaft. Mit einer einfachen,<br />
zugespitzten und zugleich warmen<br />
Sprache wirbt sie für ihren Plan. Die Rettung<br />
der Meere scheint ihr zur Herzensangelegenheit<br />
geworden zu sein, und ihre<br />
Kampagne hat Erfolg.<br />
„Am Anfang haben die Lobbyisten<br />
über den Reformplan gelacht, aber inzwischen<br />
ist ihnen das Lachen vergangen“,<br />
sagt Thilo Maack, Meeresexperte<br />
bei Greenpeace. Damanaki ging auf Konfrontationskurs<br />
mit den EU-Fischereiministern,<br />
als sie forderte, die Kungelei bei<br />
den Fangquoten zu beenden. Deren berüchtigte<br />
Dezembertreffen verliefen meist<br />
nach einem einfachen Prinzip: „Gibst du<br />
mir mehr Kabeljau, dann gebe ich dir<br />
mehr Thunfisch.“<br />
Künftig sollen wissenschaftliche Empfehlungen<br />
den Ausschlag geben. Zweitens<br />
geht sie das Thema „Beifang“ an. Europas<br />
Fischer werfen knapp ein Viertel ihres<br />
Fangs tot zurück ins Meer, weil die Tiere<br />
nicht zu den Fangplänen passen. Ab 2014<br />
soll schrittweise die Pflicht gelten, alle gefischten<br />
Tiere an Land zu bringen und zu<br />
verwerten. Drittens will sie Subventionen<br />
an strenge Kriterien knüpfen. Es sei unverantwortlich<br />
bei der anhaltenden Überfischung,<br />
den Bau immer größerer Schiffe<br />
zu fördern, die durch leere Meere schippern,<br />
schimpft Damanaki.<br />
Das EU-Parlament hat ihren Kurs Anfang<br />
Februar mit großer Mehrheit bestätigt.<br />
Nun muss sie einen Kompromiss mit den<br />
Regierungen finden, vor allem mit den Fischereinationen<br />
Spanien und Frankreich.<br />
Damanaki droht: „Wenn wir so weitermachen,<br />
sind die Meere bald leer.“<br />
Christian Schwägerl<br />
gehört zu den profilierten<br />
Fachjournalisten für<br />
Umweltthemen in Deutschland<br />
Fotos: Francois Lenoir/REUTERS, Maurice Weiss/Ostkreuz (Autor)<br />
76 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Fish’s Friend –<br />
Maria Damanaki<br />
ist zu stark für<br />
die schwächelnde<br />
Fischereilobby<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 77
| K a p i t a l<br />
Läckerläckerläcker<br />
Willi Pfannenschwarz hat mit seiner eigenwilligen Werbung das bekannteste Müsli Deutschlands kreiert<br />
von Benno Stieber<br />
M<br />
it Frühstücksflocken zu provozieren,<br />
das muss man erst mal<br />
schaffen. Für Willi Pfannenschwarz,<br />
Chef der Firma Seitenbacher,<br />
ist das kein Problem. Daheim im Keller<br />
produziert er grob zusammengezimmerte<br />
Spots, unterlegt sie mit harten Gitarrenriffs<br />
und preist „Bergsteigermüsli“, „Kakao-Düsis“<br />
und den „Feel-Good-Mix“ an.<br />
Selbst vor dem wenig werbewirksamen<br />
Wort „Verdauung“ schreckt er nicht zurück.<br />
Am Ende setzt er in seiner schwäbischen<br />
Mundart ein genüssliches „Läckerläckerläcker“<br />
obendrauf, und wieder ist einer<br />
dieser Spots fertig, die Werber und Radiohörer<br />
zur Verzweiflung bringen.<br />
Mit dieser, nun ja, Marketingstrategie<br />
hat Pfannenschwarz sein Müsli bundesweit<br />
bekannt gemacht. Hinter der hohen Stirn<br />
wallen lange schwarze Haare, er ist der Rocker<br />
unter Deutschlands Mittelständlern.<br />
Hausgemachte Produkte, bodenständige<br />
Unternehmensführung, selbst die Maschinen<br />
programmiert der Chef selbst. Vor allem<br />
an den selbst produzierten Werbespots,<br />
die er in der Analog-Ära gerne mal mit dem<br />
eigenen Hubschrauber an die Radiosender<br />
lieferte, hängt sein Herz: „Am Mischpult<br />
kann ich alles vergessen.“<br />
Es war Anfang der Achtziger, als sich<br />
Pfannenschwarz, Sohn einer Müllerdynastie<br />
im schwäbischen Waldenbuch, trotz<br />
hoffnungsvoller Ansätze gegen eine Karriere<br />
als Rockmusiker entschied und beschloss,<br />
die Menschheit zum Vollkorn<br />
zu bekehren. Abseits aller Ökoideologie<br />
mischte Pfannenschwarz nach Schweizer<br />
Vorbild seine ersten Frühstücksflocken<br />
und nannte sie nach dem heimischen Seitenbach,<br />
an dem die Mühle seines Vaters<br />
stand. „Die Idee war, ein Müsli zu machen,<br />
in dem alles drin ist, auch wenn man sich<br />
sonst von nichts anderem ernährt“, erinnert<br />
er sich. Doch der Verkauf lief anfangs<br />
schleppend. Die Leute auf dem Land kannten<br />
Vollkorn nur als Tierfutter, und die<br />
Ökoszene mixte sich ihren Frühstücksbrei<br />
damals lieber selbst. Da Pfannenschwarz<br />
sich eine professionelle Kampagne nicht<br />
leisten konnte, nahm er einen Kredit auf<br />
und buchte selbst Sendezeiten. Für den ersten<br />
Werbespot flötete damals eine seiner<br />
Töchter „läckerläckerläcker“ ins Mikrofon.<br />
Heute ist Seitenbacher<br />
das bekannteste Müsli<br />
in Deutschland. Pfannenschwarzs<br />
Unternehmen gehört<br />
zu den fünf großen<br />
Herstellern von Frühstücksflocken.<br />
Den Marktanteil<br />
seiner teuren Mischungen<br />
schätzen Experten aber auf<br />
unter 10 Prozent. „Für einen<br />
nationalen Anbieter<br />
im Lebensmittelgeschäft<br />
sind wir eigentlich ein ganz<br />
kleines Licht“, sagt Willi<br />
Pfannenschwarz.<br />
Mit den großen Handelsketten<br />
verhandelt er<br />
trotzdem hart. Als 2008 die<br />
Preise für Getreide stark anzogen,<br />
sah sich Seitenbacher<br />
gezwungen, ebenfalls mehr<br />
zu verlangen. Doch eine der<br />
großen Supermarktketten<br />
wollte dies nicht akzeptieren.<br />
„Wir standen vor der Alternative, die<br />
Preise nicht zu erhöhen und damit in den<br />
nächsten Monaten pleitezugehen, oder die<br />
Lieferung einzustellen“, erinnert sich Pfannenschwarz.<br />
Seitenbacher ging das volle Risiko<br />
ein, obwohl er auf Dauer nicht auf<br />
diesen Kunden hätte verzichten können.<br />
Wieder einmal zahlte sich die Beliebtheit<br />
der Marke aus. Nach einigen Wochen akzeptierte<br />
die Supermarktkette die Preiserhöhung<br />
per Fax. Zu viele Kunden hatten<br />
Pfannenschwarzs Produkte in den Regalen<br />
vermisst.<br />
Längst macht Seitenbacher an seinem<br />
heutigen Sitz in Buchen im Odenwald<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagt jetzt<br />
auch der Deutsche-<br />
Bank-Chef Anshu<br />
Jain. <strong>Cicero</strong> weiß das<br />
schon länger und stellt<br />
den Mittelstand in<br />
einer Serie vor. Die<br />
bisherigen Porträts aus<br />
der Serie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
mehr als nur Müsli aller Art. Vor zwei Jahren<br />
hat Pfannenschwarz eine Ölmühle gekauft<br />
und Sonnenblumen- und Kürbiskernöl<br />
ins Sortiment aufgenommen. In<br />
den USA kümmert sich sein Sohn Harry<br />
um den Vertrieb von Eiweiß-Riegeln<br />
und Protein-Nudeln für Fitnessanhänger.<br />
„Harry P.“ ist dabei gleichzeitig<br />
Werbefigur und Namensgeber.<br />
Die Produkte<br />
werden aus Buchen per<br />
Container in die USA verschifft.<br />
Die USA sind für<br />
Pfannenschwarz der ideale<br />
Testmarkt für seine Gesundheitsprodukte:<br />
„Anders, als<br />
in Europa viele glauben, ist<br />
der amerikanische Verbraucher<br />
der aufgeklärteste und<br />
kritischste der Welt.“<br />
Auch seine Zwillingstöchter<br />
Sarah und Liza mischen<br />
inzwischen im Unternehmen<br />
mit. Eine im<br />
Einkauf, die andere gestaltet<br />
als Grafikdesignerin<br />
das Erscheinungsbild der<br />
Marke neu. Die Etiketten<br />
auf den Ölflaschen sind bereits<br />
edler und moderner als<br />
der hausbackene Schriftzug,<br />
den man bisher kannte.<br />
Willi Pfannenschwarz wird dieses Jahr<br />
60 und führt seine drei erwachsenen Kinder<br />
Schritt für Schritt an die Geschäftsleitung<br />
heran. Bedeutet das auch das baldige<br />
Ende der nervigen Werbung? Die<br />
wichtigsten Entscheidungen treffe er noch<br />
immer selbst, sagt Pfannenschwarz. Seine<br />
Spots gehören definitiv dazu.<br />
Benno Stieber<br />
arbeitet seit zehn Jahren als freier<br />
Korrespondent in Karlsruhe<br />
Fotos: Oliver Rüther für <strong>Cicero</strong>, privat (Autor)<br />
78 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Als Willi<br />
Pfannenschwarz<br />
anfing, Müsli<br />
zu verkaufen,<br />
galt Vollkorn<br />
als Viehfutter<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 79
| K a p i t a l | M a r k e t i n g - m i l l i a r d ä r<br />
80 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Scheuer<br />
Roter<br />
Bulle<br />
Der Energydrink Red Bull lebt vom Spektakel. Dahinter liegt<br />
die abgeriegelte Welt des Milliardärs Dietrich Mateschitz.<br />
Eine DDR, sagen manche: „Didis Dosenrepublik“.<br />
Wie tickt der Mann hinter der Inszenierung?<br />
von Stefan Tillmann<br />
Foto: Sutton Images/Corbis<br />
D<br />
er Milliardär hat einen Mann<br />
ins Weltall geschossen und von<br />
dort auf die Erde fallen lassen.<br />
Er hat Fußballvereine übernommen,<br />
einen Formel-1-Rennstall<br />
aufgebaut, er lässt Propellermaschinen im<br />
Slalom um aufblasbare Riesenkegel fliegen<br />
und baut nebenbei ein Medienimperium<br />
auf. Dietrich Mateschitz, 68 Jahre alt,<br />
Gründer von Red Bull, reichster Mann Österreichs,<br />
will Aufmerksamkeit erzeugen.<br />
Er ist ein Meister des Spektakels, und über<br />
so einen müsste viel zu erfahren sein: Geschichten<br />
aus der Jugend, Kabinettsstückchen,<br />
Rekorde. Aber in Sankt Marein im<br />
Mürztal, wo Mateschitz geboren und aufgewachsen<br />
ist, schweigen die Leute.<br />
Sankt Marein ist ein 2500-Einwohner-Ort<br />
in der Steiermark. Die Sonne<br />
scheint auf die Berge, die hier kaum höher<br />
als 1000 Meter sind und nur wenige Touristen<br />
anlocken. Dietrich Mateschitz’ Geburtsort<br />
ist klein, aber geschäftig: Direkt<br />
neben der Autobahn, eine große Einfallstraße<br />
mit Tankstellen, Billig-Supermarkt<br />
und Baumärkten führt durch den Ort. Ein<br />
Stahlwerk, ein Flugplatz, eine Volksschule,<br />
eine Hauptschule. Letztere leitete jahrelang<br />
Franz Pichler, ein Schulfreund von Mateschitz.<br />
Am Telefon sagt er: „Ich habe ihm<br />
mein Wort gegeben, dass ich nicht über ihn<br />
rede.“ Die Leiterin der Volksschule, Elfriede<br />
Luttenberger, erst ein paar Monate im Amt,<br />
ist etwas offener, sie zeigt die Schul- und<br />
Ortschroniken aus Zeiten, als der Ort noch<br />
ein Dorf war – und die Schule noch sehr<br />
jung. Als im Schulhaus ein Mann vorbeikommt,<br />
fragt sie ihn, ob er nicht etwas über<br />
Mateschitz erzählen könne. Er schreckt zusammen:<br />
„Wir dürfen nichts sagen. Und du<br />
eigentlich auch nicht.“<br />
Im Gemeindeamt erklären sie, dass sie<br />
gerne etwas sagen würden, aber nicht dürfen,<br />
dass sie ihm eine Ehrenbürgerschaft<br />
verleihen wollten, die er nicht haben wollte,<br />
und dass sie ihn zur 900-Jahr-Feier einluden,<br />
er aber nicht kam.<br />
Die Feier ist nun zehn Jahre her, aber<br />
das Sprechverbot ist seither strikt befolgt<br />
worden. Der Milliardär, der Millionen in<br />
Aufmerksamkeit für sein Produkt investiert,<br />
minimiert den Informationsfluss über sich<br />
selbst.<br />
Bekannt ist die Firmengeschichte. Auf<br />
einer Asienreise 1982 entdeckt der damals<br />
38 Jahre alte Marketing-Direktor der Zahncreme-Firma<br />
Blendax zufällig den Markt für<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 81
| K a p i t a l | M a r k e t i n g - M i l l i a r d ä r<br />
Energydrinks, der in Europa noch unterentwickelt<br />
ist. „Krating Daeng“ aus Thailand<br />
heißt übersetzt „Roter Stier“. Mit seinen<br />
Ersparnissen von fünf Millionen Schilling<br />
– damals 350 000 D-Mark – bringt er<br />
das Produkt auf den europäischen Markt,<br />
zusammen mit der thailändischen Industriellenfamilie<br />
Yoovidhya, die bis heute<br />
zu 51 Prozent beteiligt ist. Mateschitz’<br />
Das Stadion von Red Bull Salzburg heißt,<br />
wenig überraschend, Red Bull Arena, zwei<br />
weitere gibt es in Leipzig und New Jersey<br />
Nur Bandenwerbung reicht nicht, Red Bull<br />
kauft lieber ganze Vereine. Zur Sammlung<br />
gehören auch die Salzburger Eishockeyspieler<br />
Motto lautet von Beginn an: „Marketing<br />
ist alles.“ Er erzeugt um ein Getränk, das<br />
nicht viel mehr ist als angereichertes Zuckerwasser,<br />
eine Aura aus künstlichen Geschichten.<br />
Abenteurertum, Leistung, Lässigkeit.<br />
2012 war wieder ein Erfolgsjahr:<br />
Über fünf Milliarden verkaufte Dosen, ein<br />
Plus von fast 13 Prozent, 8966 Mitarbeiter<br />
in 165 Ländern, nebenbei wurde Red Bull<br />
Salzburg österreichischer Fußballmeister<br />
und Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel zum<br />
dritten Mal Formel-1-Weltmeister. Mateschitz<br />
belegt in der jüngsten Forbes-Liste der<br />
reichsten Menschen Platz 162, Vermögen:<br />
7,1 Milliarden Dollar.<br />
Seinen Aufstieg kann man ohne Übertreibung<br />
als einmalig bezeichnen. Er ist<br />
Ein kleiner Sprung für die Menschheit, ein<br />
großer für Red Bull: 200 Sender zeigten<br />
Felix Baumgartners Sprung aus dem All live<br />
Seit 2010 dominiert ein Energydrink die<br />
Formel 1: Red Bull Racing gewann in der<br />
Zeit alle Fahrer- und Konstrukteurstitel<br />
kein Computer-Nerd wie Bill Gates oder<br />
Steve Jobs, die als junge Erwachsene neue<br />
Technologien entdeckten. Er hat keine Fabriken<br />
aufgebaut wie andere. Das Getränk<br />
produziert vom ersten Tag an die österreichische<br />
Firma Rauch. Mateschitz konzentriert<br />
sich auf Marketing und Vertrieb eines<br />
Produkts, das andere erfunden haben.<br />
Wer sich heute auf die Suche nach dem<br />
Menschen Mateschitz macht, wer ihn verstehen<br />
will, der stößt nicht nicht nur in<br />
Sankt Marein auf Schweigen. Sein Unternehmen<br />
solle im Mittelpunkt stehen, nicht<br />
er als Person, begründet die Firmenzentrale<br />
die Entscheidung, dass der Chef keinen<br />
Gesprächstermin gewährt. Wenn er Interviews<br />
gibt, spricht er über Fußball und<br />
Formel 1, jedoch kaum über sich. Auf Fotos<br />
präsentiert er sich mit dem immergleichen<br />
Abenteurerlächeln: ein Mann mit silbergrauem<br />
kurzen Haar und Dreitagebart,<br />
der offene Hemden und Lederjacken trägt,<br />
dessen Haut aussieht, als sei er den ganzen<br />
Tag an der frischen Luft.<br />
Um sich hat er Mitarbeiter installiert,<br />
die oft mehr als zehn Jahre in der Firma<br />
sind. Es herrscht eine extreme, fast zwanghafte<br />
Loyalität. Selbst wenn man aktuellen<br />
und ehemaligen Mitarbeitern oder<br />
Geschäftspartnern verspricht, sie nicht zu<br />
zitieren, sagt niemand etwas Negatives. Die<br />
Welt von Red Bull scheint perfekt, schnell<br />
und doch voller Ruhe. Der Chef: charismatisch,<br />
heißt es, klar in der Ansage, immer<br />
informiert. Mitarbeiter witzeln selbst,<br />
dass die Verschworenheit sie an eine Sekte<br />
erinnere.<br />
Für seine Jünger im Unternehmen ist<br />
er eine Ikone des modernen Managements:<br />
Im Alter von 38, wenn andere Familien<br />
gründen, sich niederlassen und ein Häuschen<br />
bauen, hat er eine neue Welt begründet,<br />
eine, in der seine Regeln gelten, die er<br />
kontrollieren kann, eine schnelle Welt, in<br />
der er aber seine Ruhe hat. Von der Außenwelt<br />
hat er sich verabschiedet.<br />
Johannes Kastner ist einer der wenigen,<br />
die sich keine Genehmigung holen müssen,<br />
wenn sie über Dietrich Mateschitz<br />
reden. Der 66-Jährige studierte mit dem<br />
Firmengründer Welthandel in Wien. Mit<br />
seiner Werbeagentur Kastner & Partner war<br />
er von Anfang an dabei: Er hat den Red-<br />
Bull-Erfolg mit geschaffen – und doch hat<br />
er sich seine Unabhängigkeit einigermaßen<br />
bewahrt. Seine Agentur sitzt auch nicht wie<br />
die Red Bull GmbH in Fuschl am See bei<br />
Salzburg, sondern in einem siebenstöckigen<br />
Hochhauskasten in einem Vorort von Zürich.<br />
Als Besprechungsraum dient die Teeküche,<br />
auf dem Boden stehen Getränkekästen<br />
und ein Red-Bull-Pappaufsteller.<br />
Kastner kommt aus Osttirol. Dietrich<br />
Mateschitz und er nennen sich „Didi“ und<br />
Fotos: Helmut Fohringer/Picture Alliance/DPA, Picture Alliance/DPA/AP Photo, Picture Alliance/DPA (2)<br />
82 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Hansl“. Als Didi aus Asien mit der Idee für<br />
einen Energydrink kam, rief er Hansl an,<br />
der nach dem Studium eine Werbeagentur<br />
in Frankfurt führte. Didi bat Hansl, sich<br />
um die Kommunikation dieses Getränks<br />
zu kümmern, das noch gar nicht existierte.<br />
Anderthalb Jahre lang werkelte Hansl<br />
Kastner an einem Werbeslogan. 50 Vorschläge<br />
brachte er, 50 lehnte Mateschitz<br />
ab. „Ich war alle, kaputt, leer“, sagt Kastner.<br />
Dann kam ihm in der Nacht die Idee: „Red<br />
Bull verleiht Flüüügel.“ Als er Didi anrief,<br />
sagte der nur: „Passt.“ Kastner sagt heute:<br />
„Die Gedanken sind irgendwann deckungsgleich.<br />
Und wenn der Satz kommt, dann<br />
weißt du als Texter, das ist es.“<br />
Mateschitz saß zu dieser Zeit noch<br />
in Wiesbaden und ließ das Getränk entwickeln<br />
– in leicht veränderter Rezeptur<br />
zur „Krating Daeng“-Vorlage aus Thailand.<br />
Wasser, Zitronensäure, über 11 Prozent Zucker,<br />
0,03 Prozent Koffein und 0,4 Prozent<br />
Taurin, eine Aminosulfonsäure, die<br />
ursprünglich aus der Galle von Ochsen<br />
stammt und stimulierend wirken soll. Red<br />
Bull hätte ein deutsches Unternehmen werden<br />
können, aber die deutschen Behörden<br />
waren Mateschitz zu bürokratisch bei der<br />
Zulassung des Getränks. Ende 1986 zog er<br />
nach Salzburg. Kastner erzählt, dass Mateschitz<br />
ihm damals einen Zettel mit einer<br />
Hochrechnung zeigte: „Österreich hat sieben<br />
Millionen Einwohner, wenn jeder nur<br />
eine Dose im Jahr trinkt, à 14 Schilling,<br />
also zwei Mark, haben wir schon 14 Millionen<br />
Mark Jahresumsatz.“ So kam es.<br />
Am 1. April 1987 kam das Getränk in<br />
Österreich auf den Markt. Bereits 1988<br />
verkaufte Mateschitz 1,2 Millionen Dosen.<br />
Der Journalist Wolfgang Fürweger schreibt<br />
in dem Buch „Die Red-Bull-Story“, dass<br />
Mateschitz mal gesagt habe: „Der Hansl<br />
ist der kreative Vater von Red Bull.“ Kastner<br />
schrieb die humoristischen Comics, die<br />
eine möglichst breite Zielgruppe erschließen<br />
sollten. Mit Red Bull wuchs auch Kastners<br />
Agentur, die weltweit alle Werbekampagnen<br />
begleitet. Dennoch stieg er nie in<br />
Mateschitz’ Firma ein. Zwei Alphatiere in<br />
einer Firma – das wäre vielleicht auch nicht<br />
gut gegangen. Als Red Bull noch in der Planungsphase<br />
war, versuchten sie nebenher,<br />
ein paar Werbekunden zu akquirieren. Sie<br />
bekamen keinen Auftrag.<br />
Zu Studienzeiten kannten sie sich nur<br />
flüchtig, „wie sich Jungs so kennen, die zusammen<br />
fortgehen und Mädels aufreißen“,<br />
wie Kastner sagt. Inzwischen seien sie sehr<br />
gute Freunde. Beide sähen sich als kreative<br />
Nonkonformisten, liebten die Unabhängigkeit.<br />
Und doch unterscheiden sie sich.<br />
Johannes Kastner ist ein rundlicher, gemütlicher<br />
Typ, drei Töchter, inzwischen Großvater.<br />
Er sagt, er sei großzügig, loyal und<br />
faul. Überstunden findet er schrecklich.<br />
„Diejenigen, die sich damit brüsten, viel<br />
gearbeitet zu haben, sind entweder fremdgegangen<br />
oder sie schaffen ihren Job nicht“,<br />
sagt er. Wenn Red Bull Geist und Körper<br />
bewegen soll, dann sei es bei ihm eher der<br />
Geist. „Einen besonderen Bewegungsdrang<br />
habe ich nie gehabt.“<br />
Kastner liebt Oldtimer, Mateschitz<br />
Sportwagen. Auch Mateschitz wohne diese<br />
Sehnsucht nach Ruhe inne, die viele haben,<br />
die zwischen den Bergen groß geworden<br />
sind. Aber er liebte immer schon auch<br />
den Sport und die Geschwindigkeit. Vor<br />
allem, sagt Kastner, verbinde Mateschitz<br />
zwei Eigenschaften, die man selten in einer<br />
Person vereint findet: ein Analytiker<br />
mit Bauchgefühl.<br />
Zu dieser Mischung musste er sich<br />
erst selbst ein passendes Unternehmen<br />
aufbauen. Über seine Arbeit bei Blendax<br />
sagte er der Neuen Zürcher Zeitung vor<br />
Jahren, dass er wegwollte von einem Job<br />
in einem multinationalen Konzern, da sei<br />
er „stets ein Exot“ gewesen. Zudem habe<br />
er „ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis nach<br />
Freiheit und Unabhängigkeit“. Mateschitz<br />
war nie verheiratet, führte diverse längere<br />
Beziehungen, aus einer stammt sein Sohn<br />
Mark, der heute 20 Jahre alt ist.<br />
Das ganze Red-Bull-Reich, das sich<br />
Dietrich Mateschitz aufgebaut hat, ist betont<br />
anders als die Wirtschaftswelt, in die er<br />
hineinwuchs. Es gibt Menschen, die nennen<br />
es „Österreichs DDR“: Didis Dosenrepublik.<br />
Er hat viele kleine Orte geschaffen,<br />
zwischen denen er pendelt: der<br />
Hangar 7 am Salzburger Flughafen, wo<br />
Red Bull alte und neue Flugzeuge und<br />
Rennautos auffährt, aber auch feines Essen,<br />
Kunst und eine Bar bietet. Die Zentrale<br />
in Fuschl am See, die mit den gläsernen<br />
Pyramidendächern an einen Vulkan erinnern<br />
soll und dennoch hinter Bäumen fast<br />
am Seeufer verschwindet. Die Mitarbeiter<br />
nennen das Gebäude „das Auge“, weil der<br />
Ort so geheimnisvoll sei. Die Produkte präsentiert<br />
Red Bull gerne in Las Vegas, wo es<br />
laut ist, in Fuschl am See prangt nicht mal<br />
das Bullen-Logo am Firmengebäude.<br />
Anzeige<br />
© Foto Cohn-Bendit: European Union 2011 PE-EP; Meyer, Marguier: Antje Berghäuser<br />
Scheitert Europa<br />
an Deutschland?<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, stellvertretender<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur, im Gespräch<br />
mit Daniel Cohn-Bendit.<br />
Sonntag, 28. April 2013, 11 Uhr<br />
<strong>Berlin</strong>er Ensemble,<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 <strong>Berlin</strong><br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
28. APRIL<br />
In Kooperation<br />
mit dem <strong>Berlin</strong>er Ensemble<br />
Daniel<br />
Cohn-Bendit
| K a p i t a l | M a r k e t i n g - M i l l i a r d ä r<br />
Die Mitarbeiter sehen Mateschitz eher<br />
selten. Aber eine Begegnung ist jedem sicher.<br />
In unregelmäßigen Abständen lädt<br />
Red Bull neue Mitarbeiter ein. Eine Art<br />
Willkommenstag für Neulinge. Die Orte<br />
wechseln. Sicher ist nur, dass beim Abendessen<br />
der Chef erscheint und ein bisschen<br />
über die Firma plaudert. Dann geht ein<br />
Mikrofon rum und jeder der manchmal<br />
100 neuen Mitarbeiter muss sich kurz vorstellen,<br />
sagen, was er macht, was er will.<br />
Auch eine Frage an den Chef ist möglich.<br />
Diese Prozedur dauert oft ein, zwei Stunden.<br />
Mateschitz begutachtet die neuen Einwohner<br />
seiner Welt.<br />
Aber eins ist „DM“, wie ihn einige<br />
Mitarbeiter nennen, bisher nicht gelungen:<br />
neue starke Männer um sich herum<br />
aufzubauen. 2003 installierte er Kellogg-<br />
Manager Flemming Sundo, der ist aber<br />
inzwischen genauso weg wie Dany Bahar,<br />
zeitweise Nummer zwei hinter Mateschitz.<br />
Er wechselte zum Autobauer Lotus.<br />
Mateschitz pendelt zwischen einer<br />
Villa in Salzburg, der Haflingerzucht auf<br />
dem Bauernhof in Zell am See und dem<br />
entlegenen Annaberg, wo er eine Hütte auf<br />
einem Bergplateau zu einem Spitzenrestaurant<br />
ausgebaut hat. Manchmal feiert er Geburtstag<br />
auf seiner Südseeinsel Laucala, wo<br />
er ansonsten Ferienvillen vermietet.<br />
„Solange in Moskau eine perforierte<br />
Kniescheibe 500 Dollar kostet, sind<br />
Sie nicht mehr sicher“, drohte<br />
Mateschitz einem Journalisten.<br />
Später entschuldigte er sich per Brief<br />
Die Zukunft liegt hinter drei Torbögen: Red Bull hat kürzlich eine 17,8 Hektar große Kaserne<br />
bei Salzburg erworben und eine „schrittweise Verlegung eines Teiles der Konzernverwaltung“<br />
bestätigt. In Fuschl am See geht man davon aus, den Firmensitz 2014 zu verlieren<br />
In Sankt Marein, seinem Heimatdorf, ist<br />
er lange nicht gesehen worden. Dabei liegt<br />
dort vermutlich der Ursprung für seine<br />
Sehnsucht nach Unabhängigkeit, aber<br />
auch Ruhe. In seiner alten Volksschule<br />
unterrichtete ihn seine Mutter. Die Alten<br />
im Dorf sagen, sie sei eine strenge Lehrerin<br />
gewesen. Viel mehr erfährt man nicht.<br />
Als der österreichische Wirtschaftsjournalist<br />
Michael Nikbakhsh vor Jahren in Sankt<br />
Marein recherchierte, ließ Mateschitz ihm<br />
ausrichten, „solange in Moskau eine perforierte<br />
Kniescheibe 500 Dollar kostet“,<br />
werde er nicht mehr sicher sein. Später entschuldigte<br />
er sich in einem Brief.<br />
Die Volksschule Sankt Marein ist ein<br />
schlichter zweigeschossiger Bau, seit dem<br />
Umbau 1961 ist nicht mehr viel gemacht<br />
worden. In den Bänden der Schulchronik<br />
lässt sich nachvollziehen, in welcher Zeit<br />
Mateschitz, Jahrgang 1944, groß wurde.<br />
Zwei Fotos zeigen die erste und fünfte<br />
Klasse von damals. Die 32 Erstklässler auf<br />
dem Bild lachen, die Zehn- und Elfjährigen<br />
gucken entschlossen. Mit Tinte haben<br />
Lehrer auf liniertem Papier für jedes<br />
Jahr die Ereignisse im Ort notiert, aufgelistet<br />
nach Verkehrsunfällen, Todesfällen,<br />
Bautätigkeiten, Geschäftseröffnungen,<br />
aber auch die Erlebnisse der Schüler wie<br />
die Suche nach Kartoffelkäfern, die Kriegerdenkmalweihe<br />
oder die Altstoffsammlung<br />
am 26. Mai 1951, bei der die Schüler<br />
293,20 Schilling einnahmen. Die Schule<br />
war ein kleiner, heiler Ort in einer Welt,<br />
die sich im Aufbruch befand.<br />
Dietrich Mateschitz wuchs bei seiner<br />
Mutter auf, über den Vater ist nur bekannt,<br />
dass er Lehrer war und aus Maribor kam.<br />
Vielleicht braucht der Sohn deswegen sein<br />
Unternehmen als Ersatzfamilie. Es gibt jedenfalls<br />
Menschen, die ihn als „Familienoberhaupt“<br />
anerkennen. Hannes Arch zum<br />
Beispiel. Der 45-Jährige ist Extremsportler<br />
und einer von mehr als 600 Sportlern, die<br />
der Konzern unter Vertrag hat. Er ist der<br />
einzige, der in fünf verschiedenen Sportarten<br />
aktiv war: Klettern, Basejump, Kunstflug,<br />
Air-Race und Paragliding.<br />
Die Red-Bull-Zentrale vermittelt ihn<br />
gerne bei Presseanfragen, weil er so loyal ist.<br />
Arch sitzt auf Hawaii und sagt übers Internettelefon<br />
artig, dass Red Bull mehr sei als<br />
ein Getränk: „wie eine Familie“, „ein Lebensgefühl“.<br />
Es klinge vielleicht komisch,<br />
aber: „Durch meine Venen fließt Red Bull.“<br />
Früher habe er jeden Tag fünf bis zehn Dosen<br />
getrunken. Heute seien es weniger, vor<br />
allem zum Frühstück und verdünnt zum<br />
Sport. Als Familienmitglied genießt er das<br />
Privileg, dass ihm seine Lieblingslimo an<br />
jeden Ort der Welt geliefert wird.<br />
Hannes Arch sagt, er spüre, dass Mateschitz<br />
die Leistung der Sportler respektiere.<br />
Das mag sein, aber der Marketingstratege<br />
kalkuliert auch kühl den Werbewert jedes<br />
einzelnen Athleten. Seinen größten Coup<br />
landete Red Bull im vergangenen Oktober,<br />
als mehr als 200 Fernsehsender weltweit<br />
live von Felix Baumgartners Sprung<br />
aus dem Weltall berichteten. Die für die<br />
Menschheit verzichtbare Aktion hatte nach<br />
Schätzungen von Experten einen Werbewert<br />
jenseits der Milliarden-Euro-Grenze.<br />
Auch der Einstieg in den Fußball war<br />
für Mateschitz in erster Linie eine Marketingentscheidung,<br />
nachdem das Geschäft<br />
Fotos: Luckyprof, Privat (Autor)<br />
84 <strong>Cicero</strong> 5.2013
mit den selbst kreierten Events und Extremsportarten<br />
weitgehend ausgereizt<br />
scheint. Fans, die gegen die Übernahme<br />
ihrer Vereine protestieren, spielen deswegen<br />
kaum eine Rolle. Mateschitz kauft, was<br />
in seine Welt hineinpasst. Seinen Heimatverein<br />
SV St. Marein-St. Lorenzen in die<br />
erste Liga bringen? Niemals, Mateschitz ist<br />
kein Mäzen, wie SAP-Gründer und Milliardärskollege<br />
Dietmar Hopp, der den Provinzklub<br />
TSG Hoffenheim mit seinem<br />
Geld in die Bundesliga brachte. Nur Bandenwerbung<br />
bei Spitzenvereinen buchen<br />
oder Hauptsponsor werden? Zu konventionell.<br />
Zuletzt kaufte er sich stattdessen<br />
beim Eishockeyclub EHC München ein.<br />
Aus dem Fußballoberligisten SSV Markranstädt<br />
hat er RB Leipzig gemacht. Die<br />
Abkürzung steht für Rasen-Ballsport, weil<br />
eine Umbenennung in Red Bull Leipzig im<br />
deutschen Fußball nicht erlaubt ist.<br />
Mateschitz will die Kontrolle. Deswegen<br />
gehört zum Unternehmen auch der<br />
Fernsehsender Servus TV, aus dem sich<br />
ein weltweiter Red-Bull-Sender entwickeln<br />
könnte. Eigenes Fernsehen, eigene Magazine<br />
wie das Red Bulletin, Websites, Social<br />
Media – das Unternehmen nutzt alle Kanäle,<br />
um mit selbst produzierten Inhalten<br />
die Marke populärer zu machen.<br />
Alles immer größer – dafür wird sogar<br />
die Zentrale verlegt. Die Zukunft<br />
von Red Bull liegt südlich von Salzburg<br />
hinter einer Einfahrt mit weißen Torbögen.<br />
Der Konzern hat den Zuschlag für<br />
die 17,8 Hektar große Rainer-Kaserne in<br />
Elsbethen-Glasenbach erhalten. Eine Red-<br />
Bull-Sprecherin will nur eine „schrittweise<br />
Verlegung eines Teils der Konzernverwaltung“<br />
bestätigen.<br />
Ungewiss bleibt, wie lange Dietrich<br />
Mateschitz seine Dosenrepublik noch<br />
selbst lenkt. Einen Verkauf an Coca-Cola<br />
oder Pepsi, die mit eigenen Energydrinks<br />
bisher erfolglos blieben, gilt als ausgeschlossen.<br />
Sein Sohn Mark ist seit kurzem Geschäftsleiter<br />
einer Verwaltungsgesellschaft<br />
im Imperium. Ob er die Nachfolge antreten<br />
wird? Auf persönliche Anfragen meldet<br />
sich die Red-Bull-Zentrale und sagt, dass<br />
er nichts sagt. Ganz der Vater.<br />
Anzeige<br />
Unser Wein des Monats<br />
<strong>Cicero</strong> empfiehlt: Grüner Veltliner, 2012<br />
Weißwein je Flasche für 5,90 EUR<br />
(zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 EUR)<br />
Helles Gelbgrün. In der Nase reifer, gelber Apfel. Feine Fruchtsüße,<br />
etwas Blütenaromen. Am Gaumen saftig, würzig. Bestens als Begleiter<br />
zu Spargel geeignet. Restzucker: trocken, Säurewert 5,9 g/l.<br />
Bestellnummer: 982066 (Einzelflasche); 982065 (Paket)<br />
Tipp: Bei einer Bestellung von elf Flaschen erhalten Sie zwölf.<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Online-Shop:<br />
www.cicero.de/wein<br />
Stefan Tillmann<br />
schreibt für <strong>Cicero</strong> Reportagen<br />
über Köpfe der Wirtschaft
| K a p i t a l | D a t e n s a m m l e r<br />
„neue Rasterfahndung“<br />
Der Autor Rudi Klausnitzer erklärt das Phänomen der Datensammelwut, warum<br />
Supermärkte wissen, wer schwanger ist, und Steakmesser nicht verboten werden müssen<br />
H<br />
err Klausnitzer, möchten Sie<br />
von Ihrem Supermarkt erfahren,<br />
dass Ihre Frau oder Ihre<br />
Tochter schwanger ist?<br />
Nein, natürlich nicht, aber ich muss<br />
zur Kenntnis nehmen, dass Supermärkte<br />
in der Lage sind, allein aus<br />
dem Einkaufsverhalten ihrer Kundinnen<br />
mit hoher Treffsicherheit auf eine<br />
Schwangerschaft zu schließen.<br />
Wie funktioniert das konkret?<br />
In den USA hat eine Supermarktkette<br />
mithilfe der Daten, die sie durch Kundenkarten-<br />
oder Kreditkartenabrechnungen,<br />
Befragungen und Tests gesammelt<br />
und mit eigens entwickelten<br />
Algorithmen ermittelt haben, herausgefunden,<br />
dass eine hohe Korrelation<br />
zwischen einer Schwangerschaft und<br />
dem Kauf von rund 25 Produkten besteht.<br />
Zum Beispiel fangen Frauen im<br />
zweiten Drittel der Schwangerschaft<br />
an, unparfümierte Körperlotions zu<br />
kaufen, und greifen plötzlich zu Spurenelementen<br />
wie Kalzium, Zink und<br />
Magnesium.<br />
Was macht der Supermarkt mit dieser<br />
gewonnenen Erkenntnis?<br />
Er lässt dann den Algorithmus über<br />
seine Datenbank laufen und hat anschließend<br />
eine Liste mit Tausenden<br />
von schwangeren Frauen, die regelmäßig<br />
bei ihm einkaufen. Die Auswertung<br />
ist inzwischen so genau, dass<br />
das Unternehmen nicht nur mit einer<br />
Wahrscheinlichkeit von mehr als<br />
80 Prozent sagen kann, dass eine Kundin<br />
schwanger ist, sondern auch mit<br />
relativ hoher Genauigkeit den Geburtstermin<br />
vorhersagen kann. Mit<br />
Rudi Klausnitzer, 65, hat seine Karriere beim Radio in Österreich begonnen, war Sat1-<br />
Programmdirektor und Intendant der Vereinigten Bühnen Wien. Jetzt hat er das Buch<br />
„Das Ende des Zufalls“ zu den Folgen des digitalen Datensammelns herausgebracht<br />
Gutscheinen für unparfümierte Seife<br />
oder Coupons für Windeln kann es dann<br />
maßgeschneiderte Marketingmaßnahmen<br />
ergreifen.<br />
In Ihrem neuen Buch „Das Ende des Zufalls“<br />
beschreiben Sie das Phänomen „Big<br />
Data“: Wir produzieren und veröffentlichen<br />
bewusst und unbewusst immer mehr<br />
Daten, gleichzeitig werden Unternehmen,<br />
Staaten, Geheimdienste und andere<br />
Institutionen immer besser darin, diese<br />
gewaltigen Mengen auszuwerten und<br />
für sich nutzbar zu machen. Ist das eher<br />
Segen oder Fluch?<br />
Beides, wenn man ehrlich ist. Es gibt beispielsweise<br />
die QS-Bewegung. Das steht<br />
für Quantified Self: Selbsterkenntnis<br />
durch Selbstbeobachtung lautet das<br />
Motto. Deren Anhänger messen die Zahl<br />
ihrer Schritte pro Tag, mehrfach ihren<br />
Blutdruck und -zucker, wie viele Liegestütze<br />
sie machen, wann sie Sex haben<br />
und stellen sich morgens und abends auf<br />
die Waage. Letztere ist direkt mit dem<br />
Internet verbunden, die anderen Daten<br />
werden mithilfe von Smartphone-Anwendungen<br />
festgehalten und über Facebook<br />
oder andere Netzwerke mit anderen<br />
geteilt.<br />
Ist dieser Kontrollzwang nicht krankhaft?<br />
Ab einem gewissen Punkt sicherlich,<br />
aber diese spielerische Form der Datensammlung<br />
hat, die Experten sprechen<br />
von Gamifizierung, auch einen hoch<br />
Foto: Picture Alliance/Picturedesk<br />
86 <strong>Cicero</strong> 5.2013
motivierenden Effekt, der bei vielen Fitnessprogrammen<br />
genutzt wird. Und alle<br />
diese Daten stehen dank digitaler Speicherung<br />
auch für wissenschaftliche Zwecke<br />
zur Verfügung. Das gehört für mich<br />
in die Abteilung Segen, weil es mir heute<br />
eher Angst und Bange macht, dass die<br />
medizinische Forschung mit kleinen<br />
Stichproben auskommen muss.<br />
Gut, aber wenn meine Waage meldet, dass<br />
ich zu dick bin, meine Toilette online ist<br />
und mitteilt, dass in meinem Urin Drogen<br />
sind oder ich eine chronische Krankheit<br />
habe, sind wir dann nicht auf dem Weg in<br />
die Gesundheitsdiktatur?<br />
Wenn Sie infolgedessen aus der Krankenversicherung<br />
fliegen, gehört das in<br />
die Abteilung Fluch, weil Datenanalyse<br />
dann gesellschaftliche Benachteiligung<br />
und Ausgrenzung zur Folge hat. Besonders<br />
problematisch ist es da, wo Daten<br />
aus verschiedenen Bereichen akkumuliert<br />
werden und daraus Rückschlüsse mit einer<br />
gewissen Wahrscheinlichkeit gezogen<br />
werden können. Da landen sie dann<br />
plötzlich in der Schublade „psychisch instabil“<br />
aufgrund der Musik, die sie bei<br />
iTunes heruntergeladen, und der Bücher,<br />
die Sie bei Amazon gekauft haben. Aber<br />
gerade deswegen brauchen wir einen gesellschaftlichen<br />
Diskurs über den Umgang<br />
mit diesen Datenmengen.<br />
Wie könnte ein vernünftiger Umgang mit<br />
Big Data aussehen?<br />
Ich plädiere für die freie Verfügbarkeit<br />
anonymisierter Daten. Wer die zu Forschungszwecken<br />
oder auch mit Gewinnerzielungsabsicht<br />
analysieren will, muss<br />
sich strengen Richtlinien unterwerfen. Jeder<br />
Versuch, sensible anonymisierte Daten<br />
zu reidentifizieren, also wieder einer<br />
Person zuzuordnen, muss empfindlich<br />
bestraft werden.<br />
Aber es bleibt doch eine Wiederauferstehung<br />
der Rasterfahndung, die wir vor<br />
allem aus der Terrorbekämpfung kennen?<br />
Das stimmt, mit dem feinen Unterschied,<br />
dass die Rasterfahndung heute nicht<br />
mehr nur vom Staat, sondern auch von<br />
börsennotierten Unternehmen eingeleitet<br />
werden kann. Ich finde es aber grundsätzlich<br />
in Ordnung, wenn zum Beispiel<br />
der Staat modernste algorithmusgestützte<br />
Datenanalyse bei der Steuerfahndung<br />
einsetzt. Das kann er zunächst mit anonymisierten<br />
Datensätzen machen. Wer<br />
im Raster hängen bleibt, muss dann natürlich<br />
auch reidentifiziert werden können.<br />
Dessen Steuererklärung prüft man<br />
genauer und setzt so die Steuerfahnder<br />
gezielter und effizienter ein, was die Steuergerechtigkeit<br />
erhöht.<br />
Und bei privaten Unternehmen?<br />
Die dürfen mit den Daten all das machen,<br />
wozu die Kunden ihre Einwilligung<br />
gegeben haben. Aber wenn ein E‐Commerce-Händler<br />
versucht, auf diese Weise<br />
die Kundengruppen herauszufiltern, die<br />
nicht bezahlen oder extrem hohe Retourquoten<br />
haben, finde ich das auch legitim.<br />
„Man kann<br />
sich den<br />
Datensammlern<br />
nicht entziehen,<br />
wenn man sich in<br />
der digitalen Welt<br />
bewegt“<br />
Wer sind denn dann die großen Gewinner<br />
dieser Entwicklung?<br />
Menschen mit mathematisch-statistischem<br />
Hintergrund, die die digitale<br />
Welt verstehen und ein Gefühl für<br />
die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten<br />
moderner Datenanalyse haben, sind<br />
extrem gefragt. Aber auch in den Medien<br />
ist ein neuer Typ von Journalist gefragt,<br />
der komplexe Daten analysieren<br />
und verständlich aufbereiten kann. Und<br />
der Bereich der Markt- und Meinungsforschung<br />
muss sich einem drastischen<br />
Wandel unterziehen. Es wird viel wichtiger<br />
zu analysieren, was die Leute tatsächlich<br />
tun, statt auszuwerten, was sie zum<br />
Beispiel in einer Befragung sagen. Denn<br />
dazwischen gab es schon immer eine Diskrepanz.<br />
Die Prognosen werden daher<br />
präziser, wenn es gelingt, aus der Datenflut<br />
direkt herauszufiltern, was die Leute<br />
tatsächlich machen oder haben wollen,<br />
wie das Beispiel mit den Schwangeren<br />
zeigt.<br />
Aber woher rührt dieses manische Bedürfnis,<br />
den Zufall abzuschaffen und alles<br />
präzise vorherzusagen?<br />
Zum einen ist es bares Geld wert, zum<br />
anderen entspricht es der Arbeitsweise<br />
unseres Gehirns. Das macht ständig Vorhersagen<br />
und prüft dann, ob die von den<br />
Sinnesorganen gelieferten Daten mit der<br />
Vorhersage übereinstimmen. Das ist der<br />
effizienteste Umgang mit unseren Energieressourcen.<br />
Zufälle stören da nur.<br />
Wenn das, was wir erwarten, auch eintritt,<br />
wird das Glückshormon Dopamin<br />
ausgeschüttet.<br />
Wird das Leben nicht entsetzlich langweilig,<br />
wenn nichts Unvorhergesehenes mehr<br />
passiert?<br />
Keine Angst, Überraschungen wird es<br />
noch genug geben. Dafür ist die Welt<br />
komplex genug. Aber eine Studie der Unternehmensberatung<br />
McKinsey sagt voraus,<br />
dass man mit besseren Prognosen<br />
allein in den OECD-Ländern im Bereich<br />
der öffentlichen Verwaltung rund<br />
150 Milliarden Euro im Jahr einsparen<br />
könnte. Für den US-Gesundheitsbereich<br />
wurde das Potenzial sogar mit 300 Milliarden<br />
Dollar im Jahr veranschlagt. Wenn<br />
diese Beträge in die Bildung investiert<br />
würden, wäre das doch ein guter Deal.<br />
Und entziehen kann man sich der Datensammelwut<br />
ohnehin nicht, oder?<br />
Kaum, wir produzieren jeden Tag das<br />
Zwölfeinhalbfache der Datenmenge aller<br />
jemals gedruckten Bücher. Man kann<br />
nicht zum Digitalaussteiger werden, wenn<br />
man gleichzeitig die Vorteile der Digitalisierung<br />
nutzen will. Wichtig ist, dass wir<br />
uns die Mechanismen bewusst machen,<br />
die dahinterstehen. Sonst sind wir leichte<br />
Beute für die Datensammler, weil wir uns<br />
zu schnell verführen lassen durch Gegenleistung<br />
oder einfach aus Bequemlichkeit<br />
Informationen preisgeben, die wir eigentlich<br />
gar nicht mitteilen wollten. Mir geht<br />
es aber auch darum, die Chancen zu zeigen,<br />
die sich aus dieser Entwicklung ergeben.<br />
Wir neigen in Europa häufig dazu,<br />
nur die Gefahren zu sehen und darauf mit<br />
Verboten zu reagieren. Man kann auch<br />
mit einem Steakmesser jemanden töten,<br />
aber deswegen käme keiner auf die Idee,<br />
es zu verbieten.<br />
Das Gespräch führte Til Knipper<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 87
Rettungswache in Gräfenhainichen,<br />
Sachsen-Anhalt. Was passiert,<br />
nachdem man 110 gewählt hat?<br />
Not macht<br />
erfinderisch<br />
In der Notfallmedizin geht es um Minuten. Aber es<br />
fehlen Ärzte, und die Wege werden weiter. Für die<br />
Patienten ein Bett zu ergattern, wird auch schwieriger –<br />
besonders auf dem Land. Wie löst man solche<br />
Probleme? Unterwegs mit einem Rettungsteam<br />
von Petra Sorge<br />
S<br />
amstagmorgen, 6:32 Uhr. Über<br />
der Wache des Deutschen Roten<br />
Kreuzes in Gräfenhainichen<br />
hängt eine schläfrige Stille, als<br />
der Alarm losgeht. Es ist ein<br />
schrilles Piepen, in Intervallen.<br />
Bettina von Gebhardt eilt aus ihrem<br />
Zimmer, drahtige Figur, blonde Kurzhaarfrisur,<br />
unter ihren Augen zeichnen<br />
sich Schatten ab. Es war eine lange Nachtschicht,<br />
bis halb eins. Sie drückt auf den<br />
Funkmeldeempfänger, dann ist Ruhe. Auf<br />
dem Display steht: männlich, 70 Jahre,<br />
Verdacht auf Herzinfarkt. Bad Schmiedeberg.<br />
„Das ist am Rand des Einsatzgebiets“,<br />
murmelt von Gebhardt.<br />
Sie springt in die Garderobe: Thermohose,<br />
Fleece-Pulli, Stiefel, eine Montur wie<br />
für die Skipiste. Sie hastet durchs Treppenhaus.<br />
Auf ihrer Jacke steht in schwarzen<br />
Buchstaben „Notarzt“. In der Garage im<br />
Erdgeschoss wartet der Einsatzwagen. Am<br />
Steuer sitzt Andy Richter, Rettungsassistent,<br />
rote Hose, sehniger Hals.<br />
Richter ist im Landkreis Wittenberg<br />
zu Hause. Hier hat er seine Ausbildung<br />
88 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Ä r z t e m a n g e l | K a p i t a l |<br />
Sie sticht eine<br />
Spritze in die<br />
Infusionstüte.<br />
„Morphium.<br />
Mein Lieblingsmedikament“<br />
Die Notärztin Bettina von<br />
Gebhardt im Einsatz<br />
Fotos: Christoph Busse für <strong>Cicero</strong><br />
gemacht, hier duzt er den Metzgermeister.<br />
Dr. von Gebhardt kommt aus <strong>Berlin</strong>,<br />
in Sachsen-Anhalt arbeitet sie nur zeitweise.<br />
Man kann sie im Internet buchen – tageoder<br />
wochenweise, auf notarzt-boerse.de<br />
oder auf hireadoctor.de. Einer ihrer Auftraggeber<br />
ist das DRK Gräfenhainichen.<br />
Andy Richter, 39, muskulös, früher Zeitsoldat,<br />
und Bettina von Gebhardt, grazil,<br />
58, Kinderchirurgin, sind ein ungleiches<br />
Duo. Zusammen müssen sie an diesem<br />
Samstagmorgen um kurz nach halb sieben<br />
ein Leben retten.<br />
Der Notarzt mit seinem Rettungsteam:<br />
Wo auch immer jemand die 112 wählt, ist er<br />
da, seit Jahrzehnten wird das erwartet. Sterbende<br />
sehen ihn als letztes Gesicht, Überlebende<br />
verdanken ihm alles, Angehörige<br />
richten ihre Hoffnungen auf seine Künste.<br />
Doch die Notfallmedizin, jener Bereich,<br />
in dem Minuten zählen, hat Probleme, besonders<br />
auf dem Land. Junge Ärzte ziehen<br />
hier gar nicht erst hin, die alternde Patientenstruktur<br />
verteuert alles, Kassen und Kliniken<br />
rechnen brutal. Die einst gut ausgestattete<br />
Hilfsstruktur ist zerschnitten. Die<br />
Rettungsdienste müssen damit klarkommen,<br />
sie müssen erfinderisch sein.<br />
6:35 Uhr. Das Auto kurvt lautlos aus der<br />
Garage. Blaulicht. Vorne knackt das Funkgerät,<br />
hinten rechts surrt ein Kühlschrank.<br />
Es nieselt. Andy Richter tritt aufs Gaspedal.<br />
In Sachsen-Anhalt muss der Rettungswagen<br />
nach zwölf, der Notarzt nach 20 Minuten<br />
eintreffen. Die gesetzliche Vorgabe<br />
variiert von Bundesland zu Bundesland. Im<br />
dünn besiedelten Kreis Wittenberg sind die<br />
20 Minuten an vielen Orten nicht zu schaffen.<br />
In Bad Schmiedeberg wird die Frist<br />
häufig überschritten.<br />
6:43 Uhr. Dübener Heide, über der Landstraße<br />
dämmert es. Die Tachonadel wandert<br />
nach rechts. 100 km/h, ein Überholmanöver<br />
mit Sirene, 130 km/h. Bettina<br />
von Gebhardt starrt aus dem Fenster. Ihr<br />
Blick streift über den Fahrbahnrand, heftet<br />
sich ans Dickicht.<br />
Notärztin sein, das ist für sie kein Beruf,<br />
sondern eine Leidenschaft. Die hat<br />
sie ihr Leben lang verfolgt, zielstrebig.<br />
Sie studierte erst Biologie, dann Medizin.<br />
Während der chirurgischen Facharztausbildung<br />
fuhr sie in Bremerhaven in ihrer Freizeit<br />
Notarztdienste. Sie wollte „die ganze<br />
Bandbreite“ erleben. Sie blieb dabei, als sie<br />
nach <strong>Berlin</strong> zog: von Freitag, 19 Uhr, bis<br />
Sonntag, 19 Uhr, neben der regulären Arbeitszeit,<br />
acht Jahre lang. Zeit für Familie<br />
blieb da nicht.<br />
Zuletzt war sie in der Kinderurologie.<br />
Doch es wurde ihr zu viel – 15 Bereitschaftsdienste<br />
monatlich. Sie kündigte,<br />
machte sich selbstständig. Sie wurde lieber<br />
Honorarärztin, eine Unternehmerin,<br />
die für wechselnde Auftraggeber arbeitet.<br />
6:48 Uhr. Der VW erreicht Bad Schmiedeberg.<br />
Jetzt noch die genaue Adresse. Die<br />
Straße hat mehrere Seitenarme, das Auto<br />
tuckert umher. „Laut Navi müssten wir da<br />
sein“, sagt die Ärztin. Minuten verstreichen.<br />
Endlich, ein Mann wedelt mit den<br />
Armen und brüllt: „Hinten rum.“<br />
Wer in Sachsen-Anhalt krank wird,<br />
dem kann es passieren, dass er warten<br />
muss, und das nicht nur auf den Notarzt.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 89
| K a p i t a l | Ä r z t e m a n g e l<br />
Wanderärztin. Bettina von Gebhardt bekommt 700 Euro für 24 Stunden. Sie lebt eigentlich in <strong>Berlin</strong>, aber<br />
Rettungswachen in Ostdeutschland buchen sie per Internetbörse, weil es dort an Ärzten mangelt<br />
In keinem anderen Bundesland gibt es so<br />
wenige Mediziner pro Einwohner wie hier.<br />
Zugleich war es nach Angaben der Bundesärztekammer<br />
2010 das einzige Land mit<br />
einer Unterdeckung von Hausärzten. Im<br />
Kreis Wittenberg liegt der Versorgungsgrad<br />
bei 86 Prozent. 13 Hausarztstellen sind unbesetzt.<br />
Bundesweit liegt die Abdeckung<br />
dagegen bei 108 Prozent. Es mangelt nicht<br />
an Ärzten in Deutschland, sagen auch Experten,<br />
sie sind nur ungleich verteilt. In<br />
den Großstädten drängeln sie sich, auf dem<br />
Land fehlen sie.<br />
Die Kassenärztliche Vereinigung nennt<br />
die Lage „angespannt“. Die Krankenhausgesellschaft<br />
warnte im September, die notärztliche<br />
Versorgung in Sachsen-Anhalt sei<br />
„in Gefahr“, denn mehr als 200 Rettungsärzte<br />
fehlten an den Kliniken.<br />
So ist ein neuer Markt entstanden.<br />
Die Betreiber der Rettungsdienste werben<br />
ihr Personal über Internet-Agenturen<br />
wie die „Notarzt-Börse“ oder „Hire a doctor“<br />
an. Dort gibt es mittlerweile fast ein<br />
Dutzend Anbieter für mobile Mietmedizin.<br />
Ihre Kunden: Kliniken, Landkreise,<br />
Krankenkassen, private Rettungsdienste.<br />
An Feiertagen kletterten die Stundensätze<br />
schon mal um bis zu 70 Prozent, sagt Erik<br />
Björk, kaufmännischer Leiter der „Notarzt-<br />
Börse“. Im armen Sachsen-Anhalt werden<br />
Spitzenhonorare von bis zu 85 Euro die<br />
Stunde gezahlt.<br />
„Die Kosten liegen über denen für einen<br />
angestellten Arzt“, sagt auch der Geschäftsführer<br />
der Agentur Hire a doctor,<br />
Michael Weber. Teuer für die Kliniken, die<br />
aber auch nicht bereit sind, Ärzte durch<br />
höhere Gehälter dauerhaft in die Provinz<br />
zu locken. Das hat den absurden Effekt,<br />
dass viele Westdeutsche in Sachsen-Anhalt<br />
als Mietärzte arbeiten, während Ärzte aus<br />
Sachsen-Anhalt nach Hessen oder Baden-<br />
Württemberg pendeln, wo sie besser bezahlte<br />
Festanstellungen gefunden haben.<br />
Bettina von Gebhardt bekommt<br />
700 Euro für 24 Stunden. Das Internet<br />
hat ihr die neue Karriere überhaupt erst<br />
ermöglicht. Sie musste einmal ihr Profil<br />
bei den Vermittlungsagenturen einstellen –<br />
seitdem laufen die Aufträge ein, deutschlandweit.<br />
Die Wanderärztin beschränkt<br />
sich auf den Osten, weil es dann von <strong>Berlin</strong><br />
nicht so weit ist. In diesem Monat hat<br />
sie noch Dienste in Brandenburg, Neustrelitz/Mecklenburg<br />
und auf der Insel Rügen.<br />
6:53 Uhr. Das Notarztauto hat die richtige<br />
Hausnummer gefunden. Der Rettungswagen<br />
steht schon da. Von Gebhardt blickt<br />
auf die Uhr. 21 Minuten vom Eingang des<br />
Notrufs bis zur Ankunft. Eine Minute zu<br />
spät – gesetzliche Hilfsfrist überschritten.<br />
In der Wohnung liegt der Patient, grauschütteres<br />
Haar, Freizeithose, eingesunken<br />
auf der Couch. Sein Gesicht schimmert<br />
bläulich, die Stirn glitzert, der Körper<br />
zuckt. Seine Finger bohren sich in die Polster.<br />
Daneben zwei Johanniter-Rettungsassistenten<br />
in orange-blauer Uniform. Auf<br />
dem Parkettboden haben sie ihr Medizintäschchen<br />
aufgerollt: mit Spritzen, Röhrchen,<br />
Fläschchen. Ein EKG liegt bereit, ein<br />
Blutdruckmessgerät.<br />
Da, wo Notärzte fehlen, müssen die<br />
Rettungsassistenten einspringen. Während<br />
sie in der Großstadt bessere Taxifahrer<br />
sind, übernehmen sie auf dem Land die<br />
Fotos: Christoph Busse für <strong>Cicero</strong><br />
90 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Man will helfen,<br />
und es geht<br />
nicht, weil es<br />
Engpässe gibt“<br />
Andy Richter, Rettungsassistent<br />
Tempo. Andy Richter lebt im Kreis Wittenberg. Der ist groß. Nicht immer schafft es Richter, in den vorgeschriebenen 20 Minuten den<br />
Einsatzort zu erreichen. Und finden muss man den auch erst einmal<br />
komplette Erstversorgung. Im Kreis Wittenberg<br />
sind von den sechs Rettungswachen<br />
nur zwei mit Notärzten besetzt. Meistens<br />
fahren nur die Assistenten raus. Wird<br />
dennoch ein Mediziner benötigt, wie an<br />
diesem Morgen in Bad Schmiedeberg, wird<br />
der aus Wittenberg oder Gräfenhainichen<br />
dazubestellt – das „Rendezvous-System“.<br />
In Zukunft erhalten die Assistenten noch<br />
mehr medizinische Kompetenzen und eine<br />
längere Ausbildung. Aus Rettungsassistenten<br />
werden dann Notfallsanitäter. Das hat<br />
der Bundestag gerade erst beschlossen.<br />
6:54 Uhr. Im Wohnzimmer stehen zwei riesige<br />
Esstische. Ringsum sind Stühle aufgereiht.<br />
„Heute ist sein 70. Geburtstag“,<br />
flüstert die Ehefrau. Sie guckt unschlüssig.<br />
„Die Feier kann jetzt wohl abbestellt<br />
werden.“<br />
Von Gebhardt lächelt: „Dann wird<br />
nachgefeiert.“ Sie erkundigt sich nach<br />
einer Patientenverfügung. Kopfschütteln.<br />
Sie setzt sich auf die Couch, nimmt<br />
die Hand des Mannes, fragt nach seiner<br />
Vorgeschichte.<br />
Er hustet, kaum vernehmungsfähig.<br />
Seine Verwandten helfen aus: Zwei Lungenembolien<br />
und einen Herzinfarkt hat<br />
der Patient bereits hinter sich. Jetzt sind<br />
Symptome hinzugekommen – asthmatische<br />
Bronchitis, ein Lungenödem, Herzinsuffizienz,<br />
Schweißausbrüche, Atemnot.<br />
Dazu ein Stechen in der Brust. Ein<br />
„internistisches Polytrauma“ nennen die<br />
Fachleute so eine Vielzahl an Leiden. „Betroffene<br />
können irgendwann bewusstlos<br />
werden“, erklärt Bettina von Gebhardt später.<br />
„Absolut lebensgefährlich.“<br />
Die Ärztin greift seinen rechten Arm,<br />
schnürt ihn oben ab, fährt mit ihrem Finger<br />
die Beuge entlang. Bei einer blauen<br />
Vene hält sie an, desinfiziert, sticht eine Nadel<br />
hinein. Sie schiebt einen dünnen Plastikschlauch<br />
hinterher. Der springt wieder<br />
heraus. Blut entweicht. Zweiter Versuch,<br />
der Zugang in die Vene ist gelegt. Sie zieht<br />
die Nadel wieder heraus.<br />
Durch den Schlauch pulsiert eine<br />
klare Flüssigkeit – der Blutdrucksenker.<br />
Ein paar Minuten, dann folgen weitere<br />
Medikamente: eine Elektrolytlösung, ein<br />
Entwässerungsmittel, etwas gegen Übelkeit.<br />
Die Notärztin sticht eine Spritze in die Infusionstüte.<br />
Morphium. „Mein Lieblingsmedikament“,<br />
sagt sie.<br />
Der Mann entspannt sich. Doch viel<br />
Zeit lassen sie ihm nicht. Andy Richter und<br />
die zwei Johanniter stehen schon mit der<br />
Trage da. Zu dritt hieven sie ihn hinein. Das<br />
Beutelchen mit der Infusion muss der Patient<br />
selbst halten. Vor der Wohnungstür legen<br />
sie ihn auf eine fahrbare Trage, über eine<br />
Laderampe geht es in den Rettungswagen.<br />
7:04 Uhr. Das Team zurrt ihn fest. Ein Assistent<br />
schiebt das T-Shirt des Patienten<br />
hoch, klebt Elektroden auf die Brust. Das<br />
EKG. Ein anderer setzt ihm eine Maske auf<br />
Mund und Nase, dreht das Rädchen an einer<br />
Sauerstoffflasche. Es zischt leise. Über<br />
die Luftzufuhr erhält der Herzkranke weitere<br />
Medikamente: Er wird vernebelt, heißt<br />
das im Sanitäterjargon. Die Ärztin füllt das<br />
Protokoll aus. Der Patient ist intensivfertig.<br />
Notarzt sein, das heißt nicht nur, medizinisch<br />
alles richtig zu machen, schnell<br />
zu sein, zu improvisieren. Das heißt auch,<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 91
| K a p i t a l | Ä r z t e m a n g e l<br />
Sicherheit zu geben. Die Angehörigen zu<br />
beruhigen. Psychologe sein und Seelsorger.<br />
Aber viel zu oft auch nur: Servicekraft, rollender<br />
Spritzendienst. Denn häufig rufen<br />
Menschen die 112, obwohl sie gar nicht in<br />
Lebensgefahr sind. Sie rufen an, weil der<br />
Hausarzt im Urlaub ist oder weil sie nicht<br />
wissen, dass es für einfachere Fälle einen<br />
kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer<br />
116 117 gibt.<br />
Der Notarzteinsatz kostet zehnmal<br />
mehr als der klassische Hausbesuch. Geld<br />
erwirtschaftet das Rettungsteam nur, wenn<br />
auch tatsächlich ein Patient transportiert<br />
wird. Andernfalls erstatten die Krankenkassen<br />
dem Betreiber des Rettungswagens – in<br />
Gräfenhainichen dem DRK – die Kosten<br />
nicht. Reicht es, den Kranken vor Ort zu<br />
behandeln, wird die Fahrt auch nicht bezahlt.<br />
Im vergangenen Jahr passierte das<br />
nach offiziellen Angaben bei etwa einem<br />
von 16 Notarzteinsätzen im Landkreis.<br />
Bei den Rettungswagen gab es sogar für<br />
jede sechste Fahrt kein Geld von der Kasse.<br />
Bundesweit sind rund 40 Prozent der Einsätze<br />
notfallmedizinisch nicht erforderlich,<br />
schätzt Michael Burgkhardt von der Bundesvereinigung<br />
der Arbeitsgemeinschaften<br />
der Notärzte: „Der allseits verwöhnte deutsche<br />
Patient nutzt das System grundlos aus.“<br />
Die Träger der Rettungsdienste kalkulieren<br />
diese Fahrten aber in ihre Jahresplanung<br />
ein – was das Notarztwesen am Ende für<br />
alle teurer macht.<br />
Bettina von Gebhardt muss vieles sein,<br />
auch Detektivin: Wenn jemand stirbt,<br />
muss sie zweifelsfrei ermitteln, ob es ein<br />
natürlicher Tod war. „Kann ich das nicht,<br />
kreuze ich an: nicht geklärt“, sagt sie. Dann<br />
steht die Kriminalpolizei vor der Tür.<br />
Als Wander-Notärztin braucht sie außerdem<br />
ein Gespür für Menschen, wenn<br />
sie von Wache zu Wache zieht und ständig<br />
neue Teams trifft.<br />
In <strong>Berlin</strong> geht die Chirurgin oft ins<br />
Theater, in die Schaubühne, oder plaudert<br />
Italienisch, die Sprache Puccinis und Verdis,<br />
verarztet das <strong>Berlin</strong>er Ensemble. Als<br />
Regisseur Christoph Schlingensief noch<br />
Richter hat Angst, dass einer<br />
im Wagen stirbt. Keine Klinik<br />
nimmt eine Leiche an<br />
lebte und mit seinen behinderten Schauspielern<br />
auftrat, war sie die Medizinerin im<br />
Hintergrund.<br />
In Gräfenhainichen schaut die Wache<br />
nachmittags TV-Soaps, der Humor ist<br />
derb, bisweilen zotig. Als sie vor zehn Jahren<br />
hier anfing, hätten die Kollegen noch<br />
gelästert: „Jetzt räumt die Wessi-Frau unseren<br />
alten Leuten hier den Hintern aus.“ In<br />
dem Moment, in dem sie das erzählt, sitzt<br />
sie mit den Männern vom DRK gerade um<br />
den Mittagstisch bei Fleischklößchen mit<br />
Mischgemüse. Bettina von Gebhardt legt<br />
nach, deutet auf einen Wittenberg-Kalender,<br />
der an der weißen Wand hängt: „Hattet<br />
ihr nicht mal einen mit nackten Damen,<br />
so im Stil der Lkw-Fahrer?“ Andy Richter<br />
und die anderen Assistenten lachen.<br />
Hier die Intellektuelle mit dem Adelszusatz<br />
im Namen, die gern lateinische Sprichwörter<br />
zitiert, dort die Raubeine vom Land:<br />
Sie haben sich gefunden. Die Ärztin putzt,<br />
die Männer kochen. „Manchmal ist es wie<br />
Klassenfahrt“, sagt Bettina von Gebhardt.<br />
7:14 Uhr. Der Rettungswagen ist startklar,<br />
der Motor läuft, die Scheibenwischer quietschen.<br />
Aber Andy Richter, der Rettungsassistent,<br />
telefoniert noch. Sohn und Schwiegertochter<br />
des Patienten stehen angespannt<br />
daneben, ohne Schirm oder Mütze. Der<br />
Regen prasselt.<br />
Richter ruft: „Wittenberg ist voll!“ Im<br />
dortigen Paul-Gerhardt-Stift sind alle Intensivbetten<br />
belegt. Der Assistent tippt<br />
die nächste Nummer in sein Mobiltelefon.<br />
Er registriert die Blicke der Angehörigen,<br />
verschwindet im Notarzteinsatzwagen.<br />
Er spricht, legt auf, wählt erneut. Sieben<br />
Mal. Bitterfeld, Dessau – alles voll.<br />
7:19 Uhr. Richter sagt, in so einer Situation<br />
brauche man „Vitamin B“. Direkten Kontakt<br />
zum Klinikpersonal. Deshalb führt<br />
er die Gespräche, und nicht die auswärtige<br />
Notärztin. Die tröstet so lange ihren<br />
Patienten. Richter dagegen fleht, erklärt,<br />
feilscht. Verhandelt. „Es ist manchmal wie<br />
ein Verkaufsgespräch.“<br />
Es gibt Momente, da fühlt er sich in seinem<br />
Job als Lebensretter behindert. „Man<br />
will helfen und es geht nicht. Weil es Versorgungsengpässe<br />
gibt.“ Einmal habe ihn<br />
ein Krankenhaus abgewiesen mit der Begründung,<br />
nur noch ein Bett sei frei. „Aber<br />
gibt es einen Patienten, der mehr Anrecht<br />
auf dieses Bett hat als der Patient, der jetzt<br />
gerade ankommt?“<br />
Es geht auch um Geld. Dr. von<br />
Gebhardt, die selbst einmal für die Dokumentation<br />
der Fallpauschalen, also der einzelnen<br />
Klinikbehandlungen, zuständig war,<br />
drückt es so aus: „Aus Sicht der Klinik ist<br />
es nicht so toll, wenn man einen Schwerkranken,<br />
der wochenlang liegt, letztlich nur<br />
als Embolie abrechnen kann. Aus Sicht des<br />
Arztes ist dieses Fallpauschalen-System allerdings<br />
schrecklich.“<br />
Als Notärztin habe sie schon Situationen<br />
erlebt, wo sie ihren Kranken einfach<br />
nicht losbekam. „Dann sage ich: So, Kollege,<br />
es reicht! Und lade den Patienten einfach<br />
in der Notaufnahme ab.“ Bei ihr habe<br />
das stets geklappt.<br />
Andy Richters Angst ist, dass ein Patient<br />
in seinem Rettungswagen stirbt. Keine<br />
Klinik nimmt eine Leiche an. Dafür gibt<br />
es keine Vorschrift. Das Team muss dann<br />
warten, bis der Bestatter kommt, was Stunden<br />
dauern kann. Stunden, in denen das<br />
Einsatzfahrzeug blockiert ist.<br />
7:25 Uhr. Das Bangen in Bad Schmiedeberg<br />
dauert nun schon fast eine halbe Stunde.<br />
Der Patient liegt noch immer im Wagen<br />
auf der Pritsche. Dann ruft Richter endlich:<br />
„Es geht nach Bitterfeld.“<br />
7:50 Uhr. Eine Stunde und 18 Minuten<br />
nach dem Notruf, das Gesundheitszentrum<br />
Bitterfeld-Wolfen. Andy Richter und<br />
die Johanniter schieben den Herzkranken<br />
in die Notaufnahme. Bettina von Gebhardt<br />
geht mit dem leitenden Stationsarzt die<br />
Zahlen durch. Einen Platz in der Intensivstation<br />
gibt es trotzdem nicht. Dafür ein<br />
Bett in der Stufe darunter: „Intermediate<br />
Care“. Das Klinikpersonal wird genau hinschauen<br />
müssen.<br />
Wieder eine Notlösung.<br />
Petra Sorge<br />
ist Redakteurin bei <strong>Cicero</strong><br />
Online<br />
Foto: Andrej Dallmann<br />
92 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Lisa Simpson, Tochter<br />
Dahinter steckt<br />
immer ein kluger Kopf.<br />
www.faz.net
Solange<br />
Deutschland<br />
liest, werden<br />
wir schreiben.
| S t i l<br />
DIE BILDERMACHERIN<br />
Grace Coddington, seit drei Dekaden Kreativchefin der Vogue, beeinflusst die Modewelt wie keine andere<br />
von ANNE WAAK<br />
S<br />
IE SAGT VON SICH: „Ohne meine<br />
Haare wäre ich nicht wiederzuerkennen.“<br />
Tatsächlich kommt<br />
keine Beschreibung ihrer Person ohne die<br />
ellenbogenlangen, karottenfarbenen Kraushaare<br />
aus. Seit drei Jahrzehnten ist Grace<br />
Coddington die Kreativchefin der amerikanischen<br />
Vogue und mitverantwortlich dafür,<br />
welche Designer es in das wichtigste<br />
Modemagazin der Welt schaffen und damit<br />
in den Olymp der milliardenschweren<br />
Luxusmodenindustrie. Wer hingegen von<br />
der Vogue ignoriert wird, kann buchstäblich:<br />
einpacken. Aber da sie nur darin kreativ<br />
sei, die Kleider ihrer Modestrecken auszuwählen<br />
und zu arrangieren, nennt sich<br />
Coddington selbst schlicht „Stylistin“. Andere<br />
hingegen nennen sie die größte lebende<br />
Vertreterin ihrer Zunft.<br />
Grace Coddington, 72, wäre kaum jemandem<br />
außerhalb ihrer Branche bekannt,<br />
gäbe es nicht die aus dem Jahr 2009 stammende<br />
Dokumentation „The September Issue“.<br />
Da sieht man sie auf ihren immerflachen<br />
Sohlen wie ein hoch aufgeschossener<br />
Teenager mit schlenkernden Armen durch<br />
die Redaktion schlappen, fluchen und mit<br />
ihrer als ultrastreng und unnahbar geltenden<br />
Chefredakteurin Anna Wintour, „der<br />
mächtigsten Frau der Branche“, um jedes<br />
einzelne Bild ihrer aufwendig inszenierten<br />
Modegeschichten kämpfen. Wenn der<br />
Teufel Prada trägt, wie es ein Enthüllungsroman<br />
über Wintour nahelegt, dann ist<br />
Coddington so etwas wie die sympathische<br />
linke Hand des Teufels. Ihre ungehorsame<br />
Emotionalität macht sie zum heimlichen<br />
Star der Redaktion. Schaut man<br />
ihr bei der Arbeit zu, versteht man, dass<br />
es hier nicht nur um Fotos von ein paar<br />
Kleidern geht. Sondern immer auch um<br />
die entschiedene Feier von Schönheit. Und<br />
die hat bei Coddington immer auch etwas<br />
mit Eskapismus zu tun. Bis sie 18 Jahre alt<br />
war, hatte sie die pittoreske Einöde ihrer<br />
regnerischen nordwalisischen Heimatinsel<br />
Anglesey noch kein einziges Mal verlassen.<br />
Ihre Eltern führten ein plüschiges kleines<br />
Hotel, was die Familie in der Nachkriegszeit<br />
jedoch nicht vor der Armut bewahren<br />
konnte. Aus der transportierte sich Grace<br />
mithilfe der Vogue gedanklich in schönere,<br />
aufregendere Welten.<br />
Heute erschafft sie diese Welten selbst.<br />
Für eine ihrer liebsten Arbeiten verkleidete<br />
sie Designergrößen wie Karl Lagerfeld,<br />
Tom Ford und Marc Jacobs als weißen<br />
Hasen, rote Königin und Raupe aus<br />
dem Kinderbuch „Alice im Wunderland“.<br />
Anders als viele Modemenschen zieht<br />
es Coddington nicht in die Öffentlichkeit.<br />
Menschenansammlungen ängstigten<br />
sie schon als Kind dermaßen, dass sie<br />
ihr Mittagessen, statt in der Kantine ihrer<br />
Klosterschule, allein in einem nahe gelegenen<br />
Café zu sich nehmen durfte. Model<br />
wurde sie deswegen, weil sie nun einmal<br />
groß und schlank war und der Job ihr die<br />
Möglichkeit bot, ins London der Petticoats,<br />
Bienenkorbfrisuren und bleich angemalten<br />
Lippen zu ziehen.<br />
Als sie dann zunächst als Moderedakteurin<br />
bei der britischen Vogue anfing, verabschiedete<br />
sie sich fast vollständig von<br />
Make-up. Mit ihren blassen Lidern, ihrer<br />
hohen Stirn und eben diesen Haaren galt<br />
sie immer eher als präraffaelitisch-interessant<br />
denn als klassisch schön. So viel Wert<br />
Coddington darauf legt, ihre schwelgerischen<br />
modischen Visionen hochglänzende<br />
Wirklichkeit werden zu lassen, so uneitel<br />
ist sie selbst. Sie konstatiert, dass die Leute<br />
vor kosmetischen Operationen immer viel<br />
besser aussähen als hinterher. In den Sechzigern<br />
musste sie nach einem Autounfall<br />
mehrmals am Augenlid operiert werden.<br />
Geblieben ist eine Abneigung gegen jeden<br />
nicht lebensnotwendigen Eingriff.<br />
Modefotografie ist für Coddington –<br />
ebenso wie die Mode selbst – keine Kunstform.<br />
Ihre Aufgabe sei es vielmehr, wahlweise<br />
poetisch, provokant oder intelligent<br />
zu sein. Immer aber sollte sie die Kleidung<br />
selbst zur Geltung bringen. Die beiden<br />
Auszeichnungen für ihr Lebenswerk, die<br />
ihr sowohl die Briten als auch die Amerikaner<br />
verliehen haben, dienen ihren geliebten<br />
Katzen als Türstopper. Was keineswegs bedeutet,<br />
sie nähme ihre Branche nicht ernst.<br />
Schließlich gehören ihre Freunde sämtlich<br />
der Modewelt an, ebenso wie ihr langjähriger<br />
Lebensgefährte, der Friseur Didier Malige.<br />
Coddington verachtet es regelrecht,<br />
wenn der Betrieb der Lächerlichkeit preisgegeben<br />
wird.<br />
Den modisch härtesten Prüfungen sah<br />
sie sich während der Neunziger ausgesetzt,<br />
als Gianni Versace mit seinen kreischenden<br />
Farben und goldenen Ornamenten<br />
plakative Sexyness sozusagen salonfähig<br />
machte. Vulgarität widerstrebt ihrer Zurückhaltung<br />
– ein Erbe der viktorianisch<br />
geprägten Mutter und ihres geliebten introvertierten<br />
Vaters. Der starb an Lungenkrebs,<br />
als sie erst elf Jahre alt war.<br />
Ihr großes Trauma erlebte Coddington<br />
jedoch 1968 in London, als sie in ihrem<br />
Mini sitzend in eine Gruppe wild gewordener<br />
Fußballfans geriet. Diese rüttelten dermaßen<br />
an ihrem Auto, dass es mit ihr darin<br />
umkippte. Sie selbst blieb unverletzt, ihr<br />
ungeborenes Kind aber verlor sie. „Es war<br />
das einzige Mal, dass ich schwanger war“,<br />
konstatiert sie in ihren Memoiren und lässt<br />
den erlittenen Schmerz nur erahnen. Gerade<br />
eine halbe Seite räumt sie dem Vorfall<br />
ein. Kaum mehr Platz gesteht sie der langwierigen<br />
Adoption des Sohnes ihrer früh<br />
verstorbenen Schwester Rosie zu.<br />
Diese Wortkargheit passt zu einer, die<br />
freimütig zugibt, in ihrem Leben keine<br />
zwei Bücher gelesen zu haben, in denen<br />
nicht die Bilder dominierten. Es ist Grace<br />
Coddingtons Begehr, allein die schönen<br />
Geschichten zu erzählen.<br />
Anne Waak<br />
ist freie Journalistin in <strong>Berlin</strong>.<br />
Sie schreibt am liebsten über<br />
Mode und Pop<br />
Fotos: Danielle Levitt, Joachim Bessing (Autorin)<br />
96 <strong>Cicero</strong> 5.2013
In der Vogue erschafft<br />
sich Grace Coddington<br />
ihre Welten selbst – und<br />
beeinflusst damit die<br />
Luxusmodenindustrie<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 97
| S t i l<br />
„Eine dramatische GestE“<br />
Das neue Münchner Lenbachhaus eröffnet im Mai. Architekt Norman Foster über Bilder, Licht und Ökologie<br />
L<br />
ord Foster, Sie sind bekannt dafür,<br />
sich auf Aufträge intensiv vorzubereiten.<br />
Nun haben Sie einen<br />
Anbau an die berühmte Städtische Galerie<br />
im Lenbachhaus konzipiert. Was war das<br />
Besondere an der Situation in München?<br />
Ursprünglich war das Museum 1891 als<br />
Wohn- und Atelierhaus für den Maler<br />
Franz von Lenbach gebaut worden. Aber<br />
die verschiedenen Umbauten im vergangenen<br />
Jahrhundert haben daraus eine<br />
komplexe Abfolge von Räumen aus unterschiedlichen<br />
Zeiten gemacht. Wir haben<br />
viel mit den Kuratoren geredet, über<br />
die Sammlung, das historische Ensemble<br />
und seine Lage im städtebaulichen<br />
Zusammenhang.<br />
Ihr Anbau steht in scharfem Kontrast zu<br />
den übrigen Gebäuden am Königsplatz,<br />
den viele für einen der schönsten Plätze<br />
Deutschlands halten – und das in München,<br />
wo jeder mittelhohe Neubau Bürgerproteste<br />
hervorruft. Sind Sie Masochist?<br />
Der Umbau des Lenbachhauses ging völlig<br />
ohne Kontroversen über die Bühne.<br />
Wir haben von Anfang an nicht nur sehr<br />
eng mit den Behörden zusammengearbeitet,<br />
sondern auch mit den Konservatoren<br />
und der Öffentlichkeit. Ich finde, dass<br />
unsere zeitgenössische Ergänzung mit<br />
dem Altbau in Farbe, Textur und Maßstab<br />
gut harmoniert.<br />
Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt,<br />
den Neubau historisch oder wenigstens<br />
neutral aussehen zu lassen?<br />
Nein, nie. Architektur sollte die Zeit reflektieren,<br />
in der sie errichtet wurde, anstatt<br />
sich in Nachahmungen zu flüchten.<br />
Jedes Gebäude war zu seiner Entstehungszeit<br />
ein moderner Bau in einer historischen<br />
Umgebung. Außerdem bestand<br />
ein Großteil unserer Arbeit am Lenbachhaus<br />
in der Erhaltung und Bewahrung.<br />
Wir haben viel Mühe darauf verwendet,<br />
die alten Strukturen der Villa wiederherzustellen,<br />
die Anbauten aus den siebziger<br />
Jahren zu entfernen und die unterschiedlichen<br />
Gebäudeteile an der Richard-Wagner-Straße<br />
durch einen neuen Flügel zu<br />
vereinen. Selbst die goldfarbenen Metallstäbe<br />
an der Fassade des Neubaus sind als<br />
zeitgenössische Variation von Farbe und<br />
Bauschmuck des Altbaus gedacht.<br />
Das Museum beherbergt eine heterogene<br />
Sammlung, vom Symbolismus des<br />
19. Jahrhunderts bis Beuys, von Kandinsky<br />
bis zu Dan Flavins Neonarbeiten. Wie<br />
muss eine Architektur aussehen, die keinen<br />
dieser Bereiche vernachlässigt?<br />
Als Architekten ist es nicht unsere Aufgabe,<br />
die kuratorische Strategie zu diktieren.<br />
Wir müssen einem solchen Haus<br />
Freiheit und räumliche Flexibilität geben.<br />
Das bedeutete, die Räume in einer gewissen<br />
Vielfalt zu gestalten, in der sowohl<br />
die Zeitgenossen als auch die älteren<br />
Meister zur Geltung kommen. Wir haben<br />
bewegliche Wände eingezogen, um<br />
Galerien bei Bedarf vergrößern zu können.<br />
Auch die Beleuchtung erlaubt eine<br />
Reihe von unterschiedlichen Szenarios,<br />
von reinem Tageslicht bis zu dunklen Kabinetten<br />
für Videos.<br />
Im Lenbachhaus haben Sie erstmals mit<br />
LED-Licht gearbeitet. Warum?<br />
LED ist kompakt und präzise zu steuern,<br />
wirkt natürlich und verbraucht wenig<br />
Energie. Dadurch wird die Beleuchtung<br />
sehr gleichmäßig, auch in Räumen,<br />
die dem Tageslicht ausgesetzt sind. Und<br />
LED-Licht ist für ältere und neuere<br />
Kunst gleichermaßen geeignet. Dieses<br />
System wurde von der Stadt München<br />
in Auftrag gegeben. Das Lenbachhaus ist<br />
das erste Museum weltweit, in dem es zur<br />
Anwendung kommt.<br />
Das Lenbachhaus war immer das<br />
schönste Museum Münchens, zumindest<br />
von außen. Drinnen war die Raumsituation<br />
allerdings verwirrend. Jetzt gibt<br />
es dort nur 500 Quadratmeter mehr an<br />
Ausstellungsfläche – war das den Aufwand<br />
wert?<br />
Wir wollten nicht nur den Raum für Ausstellungen<br />
vergrößern. Die Wege, die Sie<br />
durch das Museum gehen, sind jetzt ganz<br />
andere. Da haben wir versucht, mehr<br />
Klarheit zu erreichen. Der neue gläserne<br />
Eingangsbereich schließt die Lücke zwischen<br />
Atrium und Villa, wo das Alte und<br />
das Neue in einer ziemlich dramatischen<br />
Geste aufeinandertreffen. Und dass wir<br />
den Altbau als „Gebäude im Gebäude“<br />
akzentuiert haben, erleichtert die Orientierung<br />
und macht ihn im Ganzen viel<br />
besser lesbar als früher.<br />
Sie haben schon öfter in Deutschland<br />
gebaut. Wie unterscheidet sich die Arbeit<br />
hier von anderen Ländern?<br />
Die Deutschen sind besonders aufgeschlossen,<br />
was Ökologie und Energiefragen<br />
angeht. Es ist kein Zufall, dass wir einige<br />
unserer avanciertesten Lösungen auf<br />
dem Gebiet zusammen mit deutschen<br />
Bauherren entwickelt haben, etwa beim<br />
Reichstag oder bei der Umgestaltung des<br />
Binnenhafens in Duisburg.<br />
Haben Architekten eigentlich eine besondere<br />
soziale Verantwortung, weil ihre<br />
Werke im Alltag so präsent sind?<br />
Unsere Entwürfe sind von der Überzeugung<br />
geleitet, dass die Qualität der Umgebung<br />
direkte Auswirkungen auf die<br />
Lebensqualität hat. Deshalb haben Architekten<br />
eine doppelte Verantwortung –<br />
einmal dem Bauherrn und zum anderen<br />
der Öffentlichkeit gegenüber. Und wenn<br />
Sie sich vor Augen halten, dass Wohnen,<br />
Arbeiten und Verkehr heute 70 Prozent<br />
des weltweiten Energieverbrauchs beanspruchen,<br />
dann stehen Architekten auch<br />
in der Pflicht, energieeffizient zu bauen<br />
und Transportwege durch stadtplanerische<br />
Eingriffe zu verkürzen.<br />
Das Gespräch führte Ulrich Clewing<br />
Foto: Alfredo Caliz/Panos Pictures/VISUM<br />
98 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Norman Foster gehört<br />
zu den renommiertesten<br />
Architekten weltweit. Jüngst<br />
hat er mit seinem Büro,<br />
das mehr als tausend<br />
Mitarbeiter beschäftigt, den<br />
internationalen Flughafen<br />
der jordanischen Hauptstadt<br />
Amman fertiggestellt<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 99
| S t i l | K l e i d e r o r d n u n g<br />
Warum ich trage, was ich trage<br />
ANDREAS RUMBLER, TOP-VERSTEIGERER bei Christie’s<br />
I<br />
CH BIN NOSTALGISCH. Kleidung<br />
lade ich emotional auf. Diesen<br />
taubenblauen Anzug hatte ich zu<br />
meiner Hochzeit im April 2011 an. Ich<br />
trage ihn zu besonderen Anlässen, zum Beispiel<br />
bei Auktionen. Beim Versteigern hat<br />
er mir schon Glück gebracht. Letzten November<br />
habe ich darin das Spitzenlos, eines<br />
der Seerosenbilder von Monet, für knapp<br />
44 Millionen Dollar versteigert.<br />
Während einer Auktion schauen alle<br />
auf mich, es geht aber nicht wirklich um<br />
mich, in erster Linie geht es um das Kunstwerk.<br />
Daran muss ich mich immer wieder<br />
erinnern, auch bei der Kleiderwahl.<br />
Während einer Auktion trage ich Dezentes.<br />
Trotzdem muss ich den Raum kontrollieren.<br />
Es können sich Momente ergeben,<br />
in denen die Stimmung kippt. Ich erreiche<br />
mehr Aufmerksamkeit, wenn ich beim<br />
Sprechen eine Pause mache oder die Lautstärke<br />
variiere, als wenn ich zum Beispiel<br />
eine grelle Krawatte anziehe.<br />
Der Anzug ist von meinem Zürcher<br />
Schneider, da kaufe ich einmal im Jahr ein.<br />
Die Krawatte der britischen Firma „Hackett“<br />
ist eine Hommage an meine zehn<br />
Jahre in London.<br />
Wenn ich aufstehe und weiß, das muss<br />
heute klappen, müssen mir die Sachen,<br />
die ich anziehe, Sicherheit geben. Ich sage<br />
dann: „Mit der Uhr wird’s klappen, mit<br />
den Manschettenknöpfen, mit deinem<br />
Lieblingshemd wird’s klappen und mit<br />
dem Anzug und der Krawatte, also da kann<br />
eigentlich nichts mehr schiefgehen. Vorbereitet<br />
bist du auch, also los geht’s!“<br />
Ich würde mich als gesund eitel beschreiben,<br />
professionell eitel. Das hat für<br />
mich mit Anstrengung zu tun. Wer eitel<br />
ist, strengt sich an. Wenn ich morgens<br />
aufwache, könnte ich mir auch oft sagen:<br />
„Ach, ist doch eh alles egal. Heute begegne<br />
ich keinem wichtigen Menschen und was<br />
soll’s.“ Es geht um die Einstellung: „Auch<br />
heute am Freitag, ohne Kundentermine,<br />
betreibst du die Anstrengung, einfach weil<br />
du an deinen Arbeitsplatz gehst.“ Ich lebe<br />
ja in Zürich, und bei den Schweizern gibt<br />
es dieses interessante Wort „adrett“. Etwas<br />
Urschweizerisches. Sie müssen hier nicht<br />
unbedingt einen Anzug und eine Krawatte<br />
tragen, aber adrett muss es sein. Alle<br />
Schweizer wissen, was damit gemeint ist.<br />
Aufgezeichnet von Lena Bergmann<br />
Der gebürtige Frankfurter, 46, ist<br />
heute Christie’s Chefauktionator<br />
und Vizevorstand der Abteilung<br />
Kunst des 20. Jahrhunderts. Bei<br />
der New Yorker Abendauktion<br />
im vergangenen November hat<br />
ihm dieser Anzug bereits Glück<br />
gebracht. „Adrett“, wie er gerne<br />
ist, erzielt er darin vielleicht auch<br />
diesen Monat wieder Weltrekorde<br />
Foto: Noë Flum/13 Photo für <strong>Cicero</strong><br />
100 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Diese Marken treffen Sie vor Ort:<br />
inside<br />
BASEL GENF 2013<br />
Hinter den Kulissen von<br />
SIHH und Baselworld<br />
Panerai in Hamburg, Stuttgart und München<br />
DAS FEINSTE<br />
UHREN-DINNER<br />
DEUTSCHLANDS<br />
Juni 2013 in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt,<br />
Stuttgart und München<br />
24. Juni: Hamburg, Hotel Atlantic<br />
25. Juni: Düsseldorf, Steigenberger Parkhotel<br />
26. Juni: Frankfurt, Villa Kennedy<br />
27. Juni: Stuttgart, Cube im Kunstmuseum<br />
28.Juni: München, Charles Hotel<br />
Die Nr. 1 der deutschen Uhrenjournalisten,<br />
Gisbert L. Brunner, präsentiert die<br />
Top-Neuheiten 2013 des Uhrensalons<br />
SIHH/Genf und der Baselworld. Da sich in<br />
Genf die Türen des Uhrensalons nur für<br />
Fachbesucher öffnen und in Basel Uhrenfans<br />
die schönsten Preziosen meist nur<br />
in der Vitrine betrachten können, hat<br />
Gisbert L. Brunner erneut eine einmalige<br />
Uhren-Präsentation – für echte Uhrenkenner<br />
und -liebhaber – ausgearbeitet.<br />
Sie können im Juni mit dabei sein.<br />
Jedes Event beginnt mit einem 90-minütigen<br />
Cocktail-Empfang, bei dem sich Uhrenaficionados,<br />
Sammler und Vertreter der<br />
ausstellenden Marken begegnen und erste<br />
Erfahrungen und Meinungen austauschen.<br />
Dann startet das festliche Dinner.<br />
Zwischen den drei Gängen – begleitet von<br />
edlen Weinen – verrät Deutschlands führender<br />
Uhrenjournalist Gisbert L. Brunner,<br />
was sich auf dem Genfer Uhrensalon und<br />
der Baselworld abgespielt hat. Vor und<br />
nach dem Dinner haben die Gäste die<br />
Möglichkeit, an den Tischen der teilnehmenden<br />
Uhrenmarken die neuen Modelle<br />
und Kollektionen persönlich in Augenschein<br />
zu nehmen. Die Markenbeauftragten<br />
werden so dem Gast ganz persönlich<br />
die Philosophie und das Besondere der<br />
Kollektion darlegen und Fragen beantworten.<br />
Jeder Teilnehmer begleicht für dieses<br />
exklusive Dinnerereignis einen Beitrag von<br />
150 Euro (inkl. aller Speisen und Getränke).<br />
Die Zahl der Gäste ist, dem besonderen<br />
Anlass entsprechend, limitiert.<br />
Willkommen zu „Inside Basel.Genf 2013“.<br />
Vorregistrierung<br />
www.watchtime.net/ibg<br />
Medienpartner:<br />
Video des 2012-Events<br />
www.watchtime.net/ibg/ibg-2012<br />
In Kooperation mit
| S t i l | F U N D U S<br />
Die Stilhalde<br />
Den Stuhl zum Wirtschaftswunder, die erste Sofalandschaft der Welt, eine Antilope von<br />
Honecker: In einer <strong>Berlin</strong>er Halle lagert das Design des Jahrhunderts. Die Geschichten<br />
dahinter erzählt der Sammler Stephan Schilgen – zu Fotos von Achim Hatzius<br />
102 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Ich habe kein Sammelgebiet und<br />
auch nicht den Anspruch, meine<br />
Sammlung bis zum Prototypen<br />
zu vervollständigen. Es geht mir<br />
in der Sekunde der Entscheidung<br />
nur um diesen einen Gegenstand<br />
und ob ich ihn besitzen<br />
möchte. Dieses Lager sollte jeden<br />
einzelnen sichtbar machen“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 103
| S t i l | F U N D U S<br />
104 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Mir geht es darum, Dinge, deren Schönheit und Funktionalität einmal geachtet<br />
wurden, die aber irgendwann in einer Ecke außerhalb der Wahrnehmung gelandet<br />
sind, zurückzuholen aus dem Schattenreich, wenn auch nur für mich. Diese Koffer und<br />
Reisetruhen mit Aufklebern sind zum Beispiel frühe Dokumente touristischen Ehrgeizes“<br />
Stephan Schilgen hat in den<br />
Neunzigern einen Gastronomie-<br />
Club betrieben. Heute<br />
vermietet er seine Möbel<br />
an Produktionsfirmen und<br />
Veranstalter oder stellt sie als<br />
Leihgabe in Einrichtungsprojekte.<br />
Gerade hat er in <strong>Berlin</strong>-Kreuzberg<br />
das Restaurant „Ö“ ausgestattet.<br />
Verkaufen will er nichts aus dem<br />
Fundus. Doch Besichtigungen<br />
kann man per Mail vereinbaren:<br />
info@kstar-setdesign.de<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 105
| S t i l | F U N D U S<br />
„Bei Oldtimern schätzt man den Urzustand. Dies sollte auch für Möbel<br />
gelten. Designklassiker wie diese Originale von Harry Bertoia aus den<br />
Fünfzigern würde jeder Möbelhändler heute neu beziehen. Für mich steht<br />
das Dokumentarische im Vordergrund, auch bei großen Stückzahlen“<br />
106 <strong>Cicero</strong> 5.2013
„Das ist Sowjet Art aus den Kasernen um <strong>Berlin</strong>, die habe ich nach der Wende in den frühen Neunzigern<br />
in Nacht- und Nebelaktionen zusammengestöbert. Am Wachschutz vorbei vor dem Verfall gerettet. Durch<br />
die Ignoranz der neuen Mächte sind hier unglaubliche Schätze unter dem Schutt der Abrissbirnen<br />
verloren gegangen. Areale, die heute komplett verschwunden sind oder zu Investorenruinen verkommen“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 107
| S t i l | F U N D U S<br />
„Die Sofa-Units von de Sede waren in den Siebzigern Kult. Berühmtheit hatten sie erlangt,<br />
weil John Lennon und Yoko Ono sich nackt darauf fotografieren ließen. Diese weißen Leder-<br />
Einheiten sollen bei Bubi Scholz durch die Wohnung gegangen sein, als er seine wilde Drogenzeit<br />
hatte. Sie lassen sich beliebig zu Berg- und Talinseln, aber auch zu Linien verbinden“<br />
„Die Wand- und Stehlampen sind<br />
nach Sujet geordnet. Einige stammen<br />
aus markanten <strong>Berlin</strong>er Gebäuden,<br />
wie aus dem Bauministerium der<br />
DDR oder der Teppichabteilung<br />
des Kaufhauses des Westens. Für<br />
mich ist es wichtig, die Modelle<br />
sämtlicher Größen, Materialitäten,<br />
Epochen und Provenienzen auf<br />
einen Blick erfahrbar zu machen.<br />
Ohne Ordnung kein Sammler“<br />
108 <strong>Cicero</strong> 5.2013
5.2013 <strong>Cicero</strong> 109
| S t i l | F U N D U S<br />
„Zwischen Hardcore-Sammlern und Messies ist es<br />
nur ein schmaler Grat. Bei mir stehen Hunderte<br />
Objekte von Designikonen neben Dingen,<br />
die andere als Ramsch bezeichnen würden.<br />
Natürlich macht Sammeln süchtig, aber was gibt<br />
es Schöneres, als nach etwas süchtig zu sein?“<br />
110 <strong>Cicero</strong> 5.2013
S<br />
TEPHAN SCHILGEN, 46, kann sich heute<br />
noch jedes Detail der elterlichen Wohnung<br />
vor Augen führen. „Stundenlang<br />
habe ich als Kleinkind Möbel und andere<br />
Gegenstände betrachtet. Deren<br />
Stille und beruhigende Ausstrahlung haben lange<br />
meine kindliche Langeweile begleitet. Spielkonsolen<br />
oder Gameboys gab es ja damals noch nicht.“<br />
Seit er laufen kann, hat er Muscheln, Schneckenhäuser<br />
und Steine gesammelt. Als Zehnjähriger<br />
dann der erste spektakuläre Fund: menschliche<br />
Schädelfragmente und Beinknochen, die er nach<br />
Baggerarbeiten auf einem mittelalterlichen Friedhof<br />
entdeckte. Heimlich arrangierte er mit einem<br />
Freund Ausstellungen, die Erwachsenen durften<br />
nichts wissen.<br />
Was macht einen Menschen zum besessenen<br />
Sammler? „Es geht sicher auch um den Reiz, etwas<br />
Seltenes zu besitzen, das kein anderer hat. Aber<br />
mir geht es vor allem darum, Dinge zurückzuholen,<br />
die Jahre oder jahrzehntelang ein Dasein außerhalb<br />
jeder Wahrnehmung gefristet haben, da<br />
sie irgendwann in die Ecke gelegt wurden.“ Der<br />
stets wachsende Fundus verteilte sich auf Dachböden,<br />
Keller oder sonstige Zwischenlager. Seit<br />
Anfang dieses Jahres hat er zum ersten Mal einen<br />
vorzeigbaren Fundus unter einem Dach, in<br />
einer Halle auf dem ehemaligen Gelände der Modemesse<br />
„Bread & Butter“. Doch ist die Gesamtfläche<br />
von 3000 Quadratmetern bereits wieder<br />
vollgestellt. Dem <strong>Berlin</strong>er, der neben wertvollen<br />
Objekten von namhaften Designern auch Bundesrepublikana<br />
und Ostalgie-Klassiker lagert, ging es<br />
dabei nie um Geld. In den Neunzigern betrieb er<br />
den Club „Kurvenstar“, den er selbst ausgestattet<br />
hatte, was ein solcher Erfolg war, dass die öffentliche<br />
Wahrnehmung zu Aufträgen im Bereich Interior<br />
Design führte. Kunden wie MTV, Telekom<br />
International oder das Label Schumacher schätzen<br />
ihn als Idealisten, dem es auch beim Einrichten<br />
um Authentizität und leidenschaftlichen Einsatz<br />
geht.<br />
Ein absurder Moment seines Sammlerlebens<br />
ereignete sich kurz nach der Wende, als einer seiner<br />
Zulieferer anrief und ihm nervös von einem<br />
Fund im Keller der Honecker-Villa berichtete.<br />
Man vereinbarte als Treffpunkt die Grillstelle im<br />
Garten. Nachdem Schilgen den auf eine Wandplatte<br />
montierten Antilopenkopf entgegengenommen<br />
und das Geschäft abgewickelt hatte, las er<br />
die Widmung, mit der Unterschrift: „Idi Amin<br />
Abu Dada, President of Uganda“. In solchen Momenten<br />
ist er überwältigt: „Dieser Völkerschlächter,<br />
der bei aller Grausamkeit etwas Clowneskes<br />
hatte, schenkte dem Chef der staubigen DDR ein<br />
Bambi mit langen Wimpern. Was für eine bizarre<br />
Konstellation.“<br />
Lena Bergmann<br />
Anzeige<br />
6. + 7. Mai 2013<br />
STATION <strong>Berlin</strong><br />
Wie können Sozialunternehmen,<br />
Stiftungen und NGOs die Möglichkeiten<br />
von Social Media für sich<br />
nutzen?<br />
Die Konferenz re:campaign zeigt<br />
die besten Kampagnen im Netz.<br />
Im Fokus steht dabei, wie Online-<br />
Kommunikation zu mehr politischer<br />
Mitbestimmung führen kann.<br />
Buchen Sie jetzt Ihr Ticket für den<br />
6. und 7. Mai 2013 in <strong>Berlin</strong>. Das<br />
sind unsere Themen:<br />
Online-Campaigning<br />
Volunteering<br />
Mobile Fundraising<br />
Content Strategy<br />
Open Data<br />
Community Organizing<br />
www.recampaign.de<br />
Aest<br />
GmbH<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 111
| S t i l | U H R E N<br />
mehr als ein Tick<br />
Gisbert L. Brunner<br />
besitzt heute noch<br />
circa 150 mechanische<br />
Uhren. Von den<br />
anderen hat er sich<br />
in München sein<br />
Haus gekauft<br />
112 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Vom ersten Geld als Zeitungsjunge kaufte sich unser<br />
Autor eine Uhr mit wunderschönem Handaufzug. Dann<br />
war es um ihn geschehen. Geschichte einer Leidenschaft<br />
von GISBERT L. BRUNNER<br />
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
U<br />
HREN SPIELEN IN meinem Leben<br />
seit 1964 eine Rolle. Damals,<br />
als Schüler, träumte ich von einem<br />
echten, aber leider viel zu<br />
teuren Armbandchronografen.<br />
Zur Aufbesserung des Taschengelds verteilte<br />
ich freitags im Münchner Stadtteil<br />
Harlaching 800 Exemplare eines Anzeigenblatts.<br />
An Weihnachten gab es Trinkgeld.<br />
Mehr als 500 Deutsche Mark zählte ich<br />
am Ende des besagten Jahres – genug, um<br />
den neuen Heuer „Carrera“ mit dem wunderschön<br />
fein bearbeiteten Handaufzugskaliber<br />
Valjoux 72 zu erwerben. 311 Mark<br />
machten mich quasi über Nacht zu einer<br />
Art Star. Jeder in der Schule wollte die Drücker<br />
der Uhr bedienen und sehen, wie die<br />
Zeiger starteten, anhielten und wieder in<br />
die Senkrechte sprangen.<br />
Solcherart bestätigt, kaufte ich 1965<br />
einen „Memovox“-Wecker von Jaeger-Le-<br />
Coultre, im Jahr darauf eine Omega „Constellation“.<br />
1970 hatte ich auf der Münchner<br />
„Auer Dult“, einem Traditions-Trödelmarkt,<br />
gleich dreifaches Glück. Ich entdeckte ein<br />
Trio aus Rolex „Prince“, Omega „Speedmaster“<br />
und Angelus „Chronodato“, Gesamtpreis:<br />
600 Mark. Bei drei guten Uhren,<br />
heißt es, beginnt eine ernsthafte Sammlung.<br />
Mir gehörten sechs, und ich wollte<br />
mehr. Mich faszinierte die technische<br />
Komplexität, die in dem kleinen Gehäuse<br />
Platz findet. Darüber hinaus waren Uhren<br />
für mich sympathische, weil dezente Statussymbole,<br />
anders als zum Beispiel Autos.<br />
Allmählich verbreiteten sich die schwingenden<br />
Quarze an den Handgelenken. Bei<br />
Quarzuhren erfolgt die Zeitmessung durch<br />
einen elektronisch angeregten Schwingquarz,<br />
ohne die Räder im Laufwerk. Als<br />
James Bond 1973 in „Leben und sterben<br />
lassen“ das feuerrote Display einer Hamilton<br />
„Pulsar“ aufleuchten ließ, war auch ich<br />
zunächst angefixt. Doch mir wurde schnell<br />
klar, dass mich auf Dauer nur die mechanischen<br />
Modelle faszinieren können, ohne<br />
Batteriebetrieb und ohne jeglichen CO 2<br />
-<br />
Ausstoß. Mechanische Uhren können<br />
Modelle mit Handaufzug sein oder Automatikfunktion,<br />
bei denen die Unruh, ein<br />
Bauteil des Uhrwerks, bestehend aus Unruhreif<br />
und Unruhspirale, als Energiequelle<br />
dient. Seit über 700 Jahren wird so die Zeit<br />
erfasst. Die elektronische Zeitmessung dagegen<br />
entwickelte sich erst in den Zwanzigern.<br />
Ich konzentrierte mich als Sammler<br />
auf die altehrwürdige Mechanik.<br />
Heute, als Uhrenjournalist, bestätigen<br />
mir immer wieder Experten, dass ich damit<br />
richtig lag, wie gerade wieder Stephen<br />
Urquhart, Direktor der Uhrenmanufaktur<br />
Omega: „Wir bekommen inzwischen<br />
viele Quarz-Armbanduhren aus den siebziger<br />
und achtziger Jahren zur Reparatur. Oft<br />
müssen wir passen, da es keine Teile mehr<br />
gibt. Mechanische Uhrwerke hingegen<br />
können wir immer instand setzen. Notfalls<br />
fertigen wir das defekte Teil eben an.“<br />
Ähnlich verhält es sich bei anderen Traditionsmarken.<br />
Und genau das sollten sich<br />
potenzielle Sammler hinter die Ohren schreiben.<br />
Da die Quarzwelle in den Siebzigern<br />
das traditionelle Handwerk förmlich<br />
überrollte, blieben feine mechanische<br />
Armbanduhren in den Läden liegen. Offiziell<br />
zertifizierte Chronometer von Junghans<br />
oder Laco, Modelle mit Selbstaufzug,<br />
auch wunderbare Chronografen wanderten<br />
zu kräftig reduzierten Preisen über den<br />
Tresen. Breitling offerierte ausdrucksstarke<br />
Klassiker vom Schlag eines „Navitimer“ im<br />
Discounter für ein Drittel ihres offiziellen<br />
Ladenpreises.<br />
Als inzwischen Uhren-Süchtiger entdeckte<br />
ich auch die Flohmärkte. Hier ließ<br />
jedoch der Zustand teilweise sehr zu wünschen<br />
übrig. Heftige Gebrauchsspuren<br />
mahnen zur Vorsicht. Permanent führte<br />
Dieses Schnäppchen vom Antiquitätenmarkt<br />
in Buenos Aires ist einer der frühesten<br />
Chronografen überhaupt und<br />
heute Brunners Lieblingsuhr<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 113
| S t i l | U H R E N<br />
TIPPS vom Profi<br />
WAS SAMMLER WISSEN SOLLTEN<br />
Wissen ist Macht<br />
Bücher über alte Uhren, die wichtigen Marken und Technisches gibt es<br />
zuhauf. Wer mit dem Sammeln beginnt, braucht keinesfalls Detailwissen.<br />
Aber das Aneignen eines groben Überblicks würde ich sehr empfehlen.<br />
Wertvolle Hinweise können auch Sammler- oder Markenforen im Internet<br />
liefern. Empfehlen kann ich die Seiten von „Dr. Crott“, „Antiquorum“,<br />
„Christie’s“, „Sotheby’s“ oder auch www.chrono24.com.<br />
Wo kaufen, wo verkaufen?<br />
Für alte Uhren gibt es zahlreiche Einkaufsquellen: Auktionen, Flohmärkte,<br />
Internetportale, Pfandleihen, „Rent a Jeweller“, Uhrenbörsen und natürlich<br />
einschlägig spezialisierte Fachhändler mit Ladengeschäft. Letztere sind<br />
naturgemäß teurer, bieten dafür aber auch Service. Beispielsweise offerieren<br />
sie überholte Uhren mit Garantie. Manche nehmen auch Gekauftes zum<br />
Einstandspreis zurück, wenn man etwas Höherwertiges erwirbt. Vorsicht<br />
empfehle ich bei Ebay-Auktionen, wenn sich die Uhren nicht vor Ort<br />
besichtigen und Geld gegen Ware tauschen lässt. Bei den genannten Stellen<br />
kann man seine Uhren im Fall des Falles auch wieder loswerden.<br />
Preisfindung<br />
Als absolut sinnvoll und notwendig erachte ich eine gewisse Preisvorstellung.<br />
Wegen der Komplexität des Marktes gibt es jedoch keine genauen Regeln.<br />
Das einschlägige Auktionsgeschehen samt den erzielten Zuschlagspreisen<br />
verfolge ich regelmäßig im Internet. Außerdem suche ich immer wieder<br />
Portale auf, die alte Uhren verkaufen. Auch sie verschaffen mir eine<br />
gewisse Orientierung. Bei Auktionen setze ich mir stets ein persönliches<br />
Limit, das die klein gedruckten Aufgelder beinhaltet. Das vermeidet böse<br />
Überraschungen.<br />
Zertifizierung<br />
Beim Kauf einer gebrauchten Armbanduhr für beispielsweise 500 Euro<br />
erwarte ich keine Dokumente. Bei teuren Stücken jedoch schon. Vor<br />
allem, wenn sie aus nicht näher bekannter Quelle stammen. Schließlich<br />
kann man in Deutschland an Gestohlenem kein Eigentum erwerben. Hier<br />
erscheint für mich die Frage nach Kaufbelegen oder sonstigen Zertifikaten<br />
nicht nur erlaubt, sondern zwingend geboten. Das gilt insbesondere für<br />
sogenannte Kult-Uhren wie beispielsweise die Rolex „Daytona“ mit dem<br />
preistreibenden Paul-Newman-Zifferblatt. Manipulation, um aus normalen<br />
Zifferblättern die sehr begehrten zu machen, ist an der Tagesordnung.<br />
Was kaufen, was sammeln?<br />
Genau das ist eine echte Gewissensfrage, die selbst ich als langjähriger<br />
Sammler nicht beantworten kann. Neben der Analyse des finanziellen<br />
Spielraums gilt es zu überlegen, ob man lieber in wenige, aber sehr<br />
gute Exemplare oder eher in Mannigfaches auf bescheidenerem Niveau<br />
investieren möchte. Der Markt bietet sehr viele Möglichkeiten. Persönlich<br />
plädiere ich für Klasse statt Masse, wobei sich Klasse nicht zwangsläufig in<br />
Tausenden von Euro definiert.<br />
ich Uhrmacherlupe und Gehäuseöffner<br />
mit. Armbanduhren bis in die Achtziger<br />
hinein besitzen nämlich in aller Regel keinen<br />
Sichtboden, durch den man ihr mechanisches<br />
Werk betrachten kann. Verständlicherweise<br />
war nicht jeder Händler<br />
begeistert, wenn ich ins Innere seiner<br />
Ware vordringen wollte. Gegenstände heißer<br />
Sammlerdiskussionen sind in diesem<br />
Kontext auch die Zifferblätter. Lässt man<br />
verblichene, oxidierte oder angekratzte Exemplare,<br />
wie sie sind, oder gibt man sie einem<br />
Spezialisten zum Erneuern? Mit dem<br />
Auffrischen, wie Fachleute sagen, geht die<br />
Patina verloren. Genau daran können sich<br />
Interessenten beim späteren Wiederverkauf<br />
stören. In diesem Sinne waren die Zifferblätter<br />
meiner Uhren absolut tabu.<br />
Der wohlmeinende Rat meiner Lebensgefährtin<br />
und Freunde, die Finger von derart<br />
unnützem, kostspieligem Zeug zu lassen,<br />
störte einen Süchtigen wie mich nicht.<br />
In Proportion zu meiner Sammlung wuchsen<br />
meine Schulden. Freunde fuhren mit<br />
schicken neuen Autos ins Bade- oder Skiwochenende,<br />
ich mit einem ehemaligen<br />
Taxi, einem Diesel mit 55 Pferdestärken<br />
und 480 000 Kilometern auf dem Buckel<br />
dorthin, wo es eventuell Armbanduhren,<br />
aber auch Fachzeitschriften und Bücher<br />
zum Thema zu kaufen geben könnte. Einschlägige<br />
Literatur war damals nämlich rar.<br />
Eines Freitags im Jahr 1981 war ich in<br />
Augsburg. Wie es der Zufall wollte, öffnete<br />
exakt an diesem Nachmittag das zuvor<br />
jahrelang geschlossene Geschäft eines<br />
angesehenen Juweliers. Nach dem Eintreten<br />
traute ich meinen Augen kaum. In flachen<br />
schwarzen Schachteln lag, was mein<br />
Herz sehnlichst begehrte: mechanische<br />
Armbanduhren von Breitling, Ebel, IWC,<br />
Jaeger-LeCoultre, Omega, Longines oder<br />
auch Vacheron & Constantin. Meist aus<br />
den vierziger, fünfziger und frühen sechziger<br />
Jahren. Alle mit Original-Preisschildern<br />
aus ihrer Zeit versehen. Zur Eröffnung gab<br />
es darauf nochmals 30 Prozent Rabatt. Eine<br />
IWC mit dem legendären Kaliber 89 war<br />
für 40 Mark wohlfeil, eine IWC „Ingenieur“<br />
mit Goldhaube für 250 Mark und ein<br />
Breitling „Duograph“ mit Schleppzeiger-<br />
Chronograf für 400 Mark. Zu allem Überfluss<br />
stand vieles doppelt und dreifach zur<br />
Verfügung. Dass ich anschließend überhaupt<br />
noch heil nach Hause kam, grenzt<br />
an ein Wunder. Im Auto verteilten sich<br />
114 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
über 50 mit Scheck bezahlte Armbanduhren.<br />
Stolz musste ich laufend darauf blicken.<br />
Meine Freundin und spätere Ehefrau<br />
hingegen war entsetzt, als sie abends vor<br />
das uhrenübersäte Bett trat. „Musste das<br />
wirklich sein? Du weißt doch um deine<br />
Finanzen.“<br />
Flohmarkt-Sternstunden und andere<br />
Glücksgriffe ließen die Sammlung bis<br />
1982, damals war ich 34 Jahre alt, auf über<br />
800 Armbanduhren anwachsen. Mehr als<br />
90 Prozent davon waren ungetragen. Besonders<br />
freute mich eine Kollektion rechteckiger<br />
Modelle aus den dreißiger Jahren,<br />
alle mit unterschiedlichen Gehäusen<br />
und feinen Formwerken von IWC, Jaeger-<br />
Mich fasziniert, was<br />
für eine Komplexität<br />
in diesen kleinen<br />
Gehäusen Platz findet<br />
LeCoultre, Movado, Longines und Urofa.<br />
Oder ein breites Spektrum an Uhren, welches<br />
gleichzeitig die Geschichte des automatischen<br />
Aufzugs, der Chronografen und<br />
der Armbandchronometer deutscher Provenienz<br />
abbildete.<br />
Inzwischen war ich schleichend vom<br />
Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Instituts<br />
zum Uhren-Journalisten geworden.<br />
1982/83 verfasste ich mit zwei Koautoren<br />
eines der weltweit ersten Bücher über Armbanduhren,<br />
meine Bibel. Die Tantiemen<br />
für das Buch gestatteten weitere Uhrenkäufe,<br />
die das Budget schließlich wieder<br />
kräftig überstiegen. Dann kam der Dämpfer:<br />
Weihnachten 1986, zwei Kleinkinder<br />
auf dem Schoß, bemängelte meine Frau<br />
mit trauriger Miene unsere wenig großzügige<br />
Wohnsituation. Als sich kurz darauf<br />
ein Reihenhaus in einem alten Münchner<br />
Stadtteil anbot, empfand ich dies als<br />
Chance, die kein Zögern erlaubte.<br />
Viele Armbanduhren gehabt und in einem<br />
Buch verewigt zu haben, war wunderbar.<br />
Nun gab es andere Prioritäten. An<br />
Kaufinteressenten für meine Uhrensammlung<br />
mangelte es nicht. Bücher machen<br />
bekannt und schaffen Vertrauen. Der Ruf<br />
eilte bis nach Japan. Ein Sammler aus Tokio<br />
interessierte sich für die Modelle mit<br />
Selbstaufzug. Ein anderer Freak nahm die<br />
rechteckigen Armbanduhren mit. Auch<br />
viele Chronografen waren schnell weg,<br />
und schließlich hatte ich den Hauptteil verkauft<br />
– bis auf 150 Exemplare, von denen<br />
ich mich bis heute nicht trennen konnte.<br />
Ins neue Haus kam ein Tresor für den<br />
chronometrischen Wochenbedarf, der Rest<br />
wanderte konsequent in die Bank. Das war<br />
zwar umständlich, ließ mich aber ruhig<br />
schlafen. Versicherungen spielen bei häuslicher<br />
Verwahrung nämlich nur in begrenztem<br />
Umfang mit. Oder die Prämien sind<br />
schier unbezahlbar.<br />
Meine Frau gestand mir nun wieder<br />
feierlich zu, Geld für Uhren auszugeben.<br />
Doch das Weitersammeln gestaltete sich<br />
schwierig. Reize und Werte interessanter<br />
Sammlerarmbanduhren aus vergangenen<br />
Epochen hatten sich herumgesprochen.<br />
Die Preise kletterten und kletterten. 1983<br />
bekam man eine IWC Fliegeruhr „Mark<br />
11“ je nach Erhaltungszustand für 200 bis<br />
300 Mark. Heute geht unter 2500 Euro<br />
kaum noch etwas. Ähnlich verhält es sich<br />
beispielsweise mit dem Omega Chronometer<br />
Kaliber 30T2 oder einem Kaliber 135<br />
von Zenith. Die Nachfrage übersteigt das<br />
Angebot und diktiert damit den Preis.<br />
Ansichtssache ist und bleibt, welche Art<br />
von Armbanduhren man sammeln sollte.<br />
Marken, Material, Designs, Werke, Zusatzfunktionen,<br />
Epochen – die Möglichkeiten<br />
sind endlos. Spezialisierung bringt<br />
unbestreitbare Vorteile. Chronometrisches<br />
Kraut-und-Rüben-Sammeln besitzt aber<br />
auch seine Reize. Wer vieles sucht, wird<br />
womöglich leichter etwas finden. So ging<br />
es mir 2011 in San Telmo, Buenos Aires.<br />
Aus einem der vielen „Antiquitäten-Käfige“<br />
strahlte das weiße Emaillezifferblatt eines<br />
45 Millimeter großen Armband-Chronografen,<br />
signiert „Geneva Timing and Repeating<br />
Company“. 300 Dollar war die<br />
nach Aussagen des Verkäufers umgebaute<br />
Taschenuhr allein schon wegen des traumhaften<br />
Innenlebens wert. In meinen Augen<br />
hatte die heute völlig unbekannte Firma<br />
das stattliche Gerät allerdings schon Ende<br />
des 19. Jahrhunderts fürs Handgelenk gefertigt<br />
– eine Pioniertat. Ich behielt recht:<br />
Es handelte sich, wie sich herausstellte, um<br />
einen der frühesten Armband-Chronografen<br />
überhaupt. Dieser zeitschreibende<br />
Jumbo begleitet mich derzeit fast täglich.<br />
Nach fast 50 Sammlerjahren bereitet er mir<br />
heute ähnliche Freude wie der Heuer „Carrera“<br />
von 1964.<br />
Inzwischen hat Brunner zahlreiche Bücher<br />
über Uhren verfasst. Das Trio entdeckte er<br />
1970 auf einem Münchner Flohmarkt. Seine<br />
allererste Uhr hat er inzwischen verkauft,<br />
den Beleg hebt er sich zur Erinnerung auf.<br />
Die 311 DM hatte er sich als Schüler mit<br />
dem Austragen von Zeitungen verdient<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 115
| S t i l | K ü c h e n k a b i n e t t<br />
Spargel statt<br />
Sauerkraut<br />
Wenn der Spargel reift, zeigt sich<br />
Deutschland von einer Seite, die gar nicht<br />
dem Klischee entspricht<br />
Von Julius Grützke und Thomas Platt<br />
I<br />
MMER WIEDER SAUERKRAUT. Wenn Deutschland in die<br />
Kritik gerät, erscheinen stets die gleichen Bilder auf den<br />
Kundgebungen der enttäuschten Freunde – Stereotypen<br />
mit Stahlhelm, Swastika und dem unausweichlichen Sauerkraut,<br />
das immer noch zur Charakterisierung unseres Landes verwendet<br />
wird, obwohl es mit dem heutigen Deutschland wenig zu tun hat.<br />
Die Suche nach anderen und zeitgemäßen Symbolen bringt allerdings<br />
kaum etwas zutage. Den Deutschen war nach dem Krieg<br />
eher daran gelegen, nicht auf bestimmte Eigenschaften festgelegt<br />
zu werden, um die Spuren der eigenen Vergangenheit zu verwischen.<br />
Das hat auch und gerade in der Küche seinen Niederschlag<br />
gefunden, wo das Mediterrane und Asiatische den nationalen Speiseplan<br />
bestimmt.<br />
Es gibt allerdings eine Zeit, in der etwas Einzigartiges in deutschen<br />
Küchen geschieht. Das ganze Land lässt sich davon mitreißen.<br />
Kurz nach Ostern beginnt die Spargelsaison, und dieses<br />
eigentlich recht schmucklose Gemüse dominiert plötzlich die Teller<br />
in der ganzen Republik. Menüfolgen werden um die weißen<br />
Stangen herum geplant, und nicht nur Feinschmecker streiten<br />
über die richtigen Methoden der Zubereitung und des Verzehrs.<br />
Denn der Spargel eint Bürger quer durch alle Schichten, ohne<br />
dass es viele Abstufungen bei der Darreichung gäbe. Die frisch<br />
geschnittenen Triebe aus dem Sandboden werden in Wasser gekocht<br />
und mit viel Butter serviert, ob sie nun als Hollandaise daherkommt,<br />
flüssig mit Semmelbröseln oder aber auf badische Art<br />
im Pfannkuchen – in jedem Fall sind sie die Hauptattraktion auf<br />
dem Teller und verweisen Schnitzel oder Schinken als Beilage in<br />
die ungewohnte Rolle des Gemüses. Das ist für eine Nation, die<br />
einen Teil ihrer traditionellen Identität aus dem Fleisch und seiner<br />
Verwurstung bezieht, eine verblüffende Wendung. Erstaunlich<br />
mutet es an, dass die wachsende Fraktion der Vegetarier diesen<br />
Umstand nicht für ihre Ziele nutzt. Vielleicht spricht sie dem<br />
Spargel den Rang als Gemüse ab, sondern erblickt in ihm eher<br />
einen Fleischersatz, der korrumpiert ist, weil gerade Fleischesser<br />
ihn so sehr verehren, dass sie seinetwegen ausnahmsweise auf das<br />
tote Tier verzichten. Außerdem stört es den Fortschrittsgedanken<br />
des Vegetarismus, sich an eine ausgeformte Tradition anzulehnen<br />
– Tofu wirkt moderner.<br />
Auch unter konventionellen Essern hat der Spargel viele Gegner,<br />
die zu erbitterten Feinden werden, weil er ihnen ständig unter<br />
die Nase gehalten wird. Die Spargelkarte im Restaurant, der dauernde<br />
Diskurs über die Preisschwankungen, die Qualitätsvergleiche<br />
der Anbaugebiete – die Gleichschaltung am Esstisch belästigt<br />
die Außenstehenden. Der durchdringende Geruch in den Gaststuben,<br />
der sich im Abtritt wiederholt, erzeugt für sie eine Atmosphäre<br />
fortdauernder Nötigung, und sie sehnen den Johannistag<br />
herbei, der traditionell der Spargelsaison von heute auf morgen<br />
ein Ende setzt. Dann verschwinden auch die Marktstände an den<br />
Straßenrändern, und Wallfahrtsorte wie Beelitz, Schrobenhausen<br />
und Schwetzingen sinken wieder in den Dornröschenschlaf. Darin<br />
ähnelt die Spargelzeit einem Wahlkampf: Einem formlosen<br />
Beginn folgen Wochen propagandistischer Völlerei weit über die<br />
Sättigung hinaus bis zu einem Stichtag, an dem vieles vergeben<br />
und manches vergessen ist. Sie könnte uns lehren, die Aufregungen<br />
der politischen Kampagnen genauso wenig ernst zu nehmen<br />
wie den Streit, ob der Spargel mit dem Messer zerstückelt oder im<br />
Ganzen in den Mund geschoben werden sollte.<br />
Doch auch dem Bild von Deutschland könnte das weiße Stangengemüse<br />
eine neue Färbung geben. Eine Nation, die überall dafür<br />
verschrien ist, Belehrungen zu erteilen und Exempel zu statuieren,<br />
zeigt sich von einer anderen Seite, wenn sie sich selbstvergessen<br />
dem Genuss der ersten Frühlingssprossen hingibt – womöglich,<br />
weil sie vom Spargel nichts abgeben will.<br />
Julius Grützke und Thomas Platt<br />
sind Autoren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in <strong>Berlin</strong><br />
illustration: Thomas Kuhlenbeck/Jutta Fricke Illustrators; Foto: Antje Berghäuser<br />
116 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Mehr politische<br />
Kultur wagen<br />
Jetzt auch als<br />
ePAPER<br />
Die <strong>Cicero</strong>-Edition für das iPad oder als ePaper<br />
Profitieren Sie von den Vorteilen der digitalen <strong>Cicero</strong>-Version und lesen<br />
Sie die aktuelle Ausgabe auf Ihrem iPad, Tablet oder Desktoprechner.<br />
Mit tagesaktuellen Beiträgen, Videos aus der Redaktion, der Literaturen-<br />
Bestenliste sowie mehr Karikaturen und Beiträgen.<br />
Mehr Informationen unter www.cicero.de/digital
| S a l o n<br />
harmlos ist Niemand<br />
Philip Seymour Hoffman, König der Nebendarsteller, spielt in einem neuen Film lustvoll die zweite Geige<br />
von Björn Eenboom<br />
E<br />
s gibt Schauspieler, die funkeln<br />
mit ihren immer gleichen<br />
Hochglanz-Gesichtern durch jeden<br />
Hollywoodfilm. Bei Philip Seymour<br />
Hoffman glänzt allenfalls der Schweiß, den<br />
ihm seine Rollen abverlangen. Er ist ein<br />
Meister aus der zweiten Reihe, ist König<br />
der Nebendarsteller – und dieser Kategorie<br />
zugleich entwachsen.<br />
Gerade eben spielte er in Paul Thomas<br />
Andersons „The Master“ einen an L. Ron<br />
Hubbard angelehnten Sektengründer, wofür<br />
er prompt für den Oscar nominiert<br />
wurde: seine dritte Nominierung in Folge<br />
in der Rubrik „Nebendarsteller“. Nun erscheint<br />
die Rolle als zweiter Geiger im Kinofilm<br />
„Die Saiten des Lebens“ wie eine<br />
Blaupause der eigenen Karriere, des eigenen<br />
Schicksals. Frustriert als ewiger Sekundant<br />
Robert in einem weltberühmten<br />
Streichquartett an der Seite der Violaspielerin<br />
Jules (Catherine Keener) und des Cellisten<br />
Peter (Christopher Walken), versucht er<br />
kurz vor dem 25-jährigen Bühnenjubiläum<br />
aus dem Korsett des Ensembles auszubrechen<br />
und die erste Geige Daniel (Mark Ivanir)<br />
mit allen Mitteln streitig zu machen.<br />
In einer Schlüsselszene des nuancenreichen<br />
Künstlerdramas von Yaron Zilberman<br />
probt das Quartett, als Robert erfährt, dass<br />
Daniel mit seiner jungen Tochter eine Liaison<br />
eingegangen ist. Er ist konsterniert,<br />
den Tränen nahe, nur um dann wie aus<br />
dem Nichts die Wut eines Berserkers hervorzustemmen.<br />
Er schlägt Daniel zu Boden.<br />
Der ganze Frust einer zweiten Geige entlädt<br />
sich – ansatzlos, hinterrücks, wie es Hoffmans<br />
Art ist. Sein Schauspiel ist immer Körpersprache<br />
und lässt so die Verzweiflung der<br />
Figur physisch werden. Er weiß zu überwältigen.<br />
Dabei ist die zweite Geige der ersten<br />
nicht untergeordnet, sondern nimmt lediglich<br />
eine andere Position ein; die wichtigere<br />
sogar, weil sie die Soli vorbereitet und<br />
das Quartettspiel zusammenhält. Doch wer<br />
möchte nicht die erste Geige sein, der Star,<br />
dem die anderen zuarbeiten?<br />
Aus einer anderen Perspektive hat Hoffman<br />
den Durchbruch zum Hauptdarsteller<br />
schon vollzogen. 2006 wurde er für<br />
sein feinsinniges Porträt Truman Capotes<br />
als bester Hauptdarsteller mit dem Oscar<br />
bedacht. Ihm gelang dabei das Kunststück,<br />
seine massige Statur in den 17 Zentimeter<br />
kleineren und zierlich wirkenden Schriftsteller<br />
zu verwandeln. So weit können metamorphische<br />
Kräfte tragen.<br />
Hoffman gilt als Spezialist für das Absonderliche.<br />
So spielte er in Todd Solondz’<br />
bitterböser Tragikomödie „Happiness“ einen<br />
übergewichtigen, beständig transpirierenden<br />
Telefon-Stalker, der seine Nachbarin<br />
mit Obszönitäten überhäuft, um dabei<br />
im Dunkeln zu masturbieren. In „Cold<br />
Mountain“ gab er einen triebhaften Pastor,<br />
in „Punch Drunk Love“ einen schmierigen<br />
Matratzenhändler. Hoffman, dreifacher<br />
Vater, verwahrt sich jedoch gegen das<br />
Vorurteil, er bediene sich lediglich im Kuriositätenkabinett.<br />
Sein Anspruch sei es,<br />
Normalität zu dekonstruieren und gerade<br />
so Menschlichkeit herzustellen. Schließlich<br />
habe jeder Mensch ein Quantum Leid zu<br />
tragen: „Ich denke, tief im Inneren wissen<br />
die Menschen, mit wie vielen Makeln<br />
sie behaftet sind. Je harmloser man einen<br />
Charakter spielt, desto unglaubwürdiger<br />
wirkt er.“<br />
Anfänglich sah alles danach aus, als<br />
sollte Philip Seymour Hoffman nie auf<br />
einer Leinwand erscheinen. Der heute<br />
45-Jährige wuchs mit drei Geschwistern<br />
im 5000-Seelen-Nest Fairport am Ontariosee<br />
im Staat New York auf. Das Scheidungskind<br />
begeisterte sich für Baseball<br />
und Wrestling, bis ihn im 15. Lebensjahr<br />
eine Halsverletzung außer Gefecht setzte.<br />
Nach der Scheidung wuchs Hoffman bei<br />
seiner Mutter auf. Sie, Menschenrechtsaktivistin<br />
und Familienrichterin, begeisterte<br />
ihren Sohn für das Theater. Nach seinem<br />
Abschluss an der Tisch School of Arts der<br />
New York University jobbte er als Kellner<br />
und Rettungsschwimmer.<br />
Damals lebte er exzessiv, nahm Drogen,<br />
litt an einer Alkoholsucht. „Mit 22 Jahren<br />
geriet ich in Panik um mein Leben. Hätte<br />
ich so weitergemacht, wäre ich daran gestorben“,<br />
gestand er einem TV-Sender. Seit<br />
einer Therapie ist er trocken. In Interviews<br />
ist Hoffman einsilbig, wenn Fragen persönlich<br />
werden. „Eine der Aufgaben eines<br />
Schauspielers ist es, privat zu bleiben.<br />
Wenn man den Leuten alles aus seinem Privatleben<br />
erzählt, fangen sie an, es auf die<br />
Arbeit zu projizieren.“<br />
Dem Theater bleibt Hoffman treu. Im<br />
West Village in Lower Manhattan besitzt er<br />
ein Off-Broadway-Theater. Dort führt er<br />
Regie oder ist auf der Bühne zu sehen. Am<br />
Broadway spielte er vergangenes Jahr Willi<br />
Loman in Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“.<br />
In Deutschland führte ihn<br />
der Weg an das Bochumer Schauspielhaus.<br />
Dort gab er 2009 in einer internationalen<br />
Produktion des Star-Regisseurs Peter Sellars<br />
in Shakespeares „Othello“ die Rolle des<br />
diabolischen Fähnrichs Jago – eine, wen<br />
wundert’s, Nebenrolle. Auch der Bochumer<br />
Teilzeit-Schauspieler Harald Schmidt<br />
ist von Hoffman beeindruckt. „Ich gehe ins<br />
Kino und sehe Philip Seymour Hoffman.<br />
Und sage: Donnerwetter, es ist ja irre, was<br />
der kann, ich kann es nicht. Warum sollte<br />
ich es dann überhaupt versuchen, wenn er<br />
es schon kann.“<br />
Doch Hollywood will Hoffman nicht<br />
den Rücken kehren. Er wird 2013 in der<br />
Fortsetzung der „Tribute von Panem“-Trilogie<br />
und in John le Carrés „Marionetten“<br />
zu sehen sein. Eigentlich, sagte er einmal,<br />
will er nur noch für seine Familie da sein.<br />
Die Erfüllung dieses Traumes muss auf sich<br />
warten lassen. Hoffman weiß: Die zweite<br />
Geige hält alles zusammen.<br />
björn Eenboom<br />
ist freier Journalist und<br />
Filmkritiker<br />
Fotos: Nicolas Guerin/Contour by Getty Images, Magdalena Gajewski (Autor)<br />
118 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Gilt als Spezialist für das<br />
Absonderliche und beharrt<br />
auf dessen Normalität:<br />
Philip Seymour Hoffman<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 119
| S a l o n<br />
Da Stehst Du doch drauf<br />
Sie nerven, sind kindisch, quälen sich und bergen einen Traum: Neues vom Klamaukduo Joko und Klaas<br />
von Daniel Haas<br />
W<br />
enn ich mit ihm fertig bin, wird<br />
er sich wünschen, er wäre Friseur<br />
geblieben“, sagt der junge<br />
Mann und lacht. Dann kommt sein Mitspieler,<br />
der ebenfalls gluckst, obwohl ihm<br />
das Lachen doch gleich vergehen soll, und<br />
beide betreten einen mit Plastikplanen ausgeschlagenen<br />
Raum. Hier soll der Mann,<br />
der früher tatsächlich einmal Friseur gewesen<br />
und nun im Fernsehen ein Star geworden<br />
ist, hier soll Klaas Heufer-Umlauf<br />
Brechmittel trinken, möglichst viel. Das<br />
Spiel heißt „Aushalten“. Und so trinken<br />
der ehemals als Coiffeur tätige Umlauf und<br />
sein Kollege Joko Winterscheidt, der sich<br />
in einem früheren, weniger amüsanten Leben<br />
als Werbekaufmann versuchte, aus einer<br />
Flasche Brechmittel.<br />
So sieht die vermeintliche Avantgarde<br />
der deutschen Fernsehunterhaltung aus.<br />
Joko, 34, und Klaas, 29, gelten als die<br />
großen Gewinner der Ironisierungswelle,<br />
wie sie seit Jahren unaufhaltsam durch<br />
die deutschen Medien rollt. Was Stefan<br />
Raab mit den mittlerweile schwächelnden<br />
Formaten „Schlag den Raab“ und „Wok-<br />
WM“ begann, setzen die beiden Moderatoren<br />
brachial fort. Es gibt so ziemlich keine<br />
Geschmacklosigkeit, die sich hier nicht mit<br />
einem Augenzwinkern als Entertainment<br />
verwerten ließe, und wenn das Zwinkern<br />
zur epileptischen Zuckung wird, umso besser.<br />
Umlauf und Winterscheidt haben den<br />
Körper zur Kampf- und Spaßzone erklärt.<br />
Bei MTV waren sie nur bessere Pausenclowns,<br />
aber dann kam, nach einem Boxenstopp<br />
bei ZDFneo, Pro Sieben und erkannte<br />
in ihnen Quotenbringer.<br />
Nun wird in wechselnden Formaten<br />
Flatulenzspray eingeatmet, man zerschlägt<br />
sich Eier am Kopf („Russisch Omelette“),<br />
lässt sich von einem Eishockeyspieler in<br />
voller Montur umrennen. Gehirnerschütterung<br />
auf beiden Seiten des Bildschirms:<br />
Eine Klaas- und Joko-Sendung bedeutet<br />
Ad-hoc-Regression in den Bereich pubertärer<br />
Gehässigkeit. Was dir wehtut, macht<br />
mir Spaß und umgekehrt; der Witz ist unmittelbar<br />
an die Physis gekoppelt. Zerebral<br />
verrenken sollen sich die Leute bei Harald<br />
Schmidt, der bei Sky jedoch fast unter Ausschluss<br />
der Öffentlichkeit witzelt.<br />
Für Kulturbürger ist diese Art der Komödie<br />
bestenfalls irrelevant, schlimmstenfalls<br />
sozial flurschädigend. Konventionelle<br />
Witzdramaturgie sieht eine Geschichte vor<br />
und am Ende Erkenntnisgewinn, Pointe<br />
genannt. Diese Showmaster aber sind<br />
keine Erzähler, ihr Humor zerstreut sich<br />
in klamaukigen Momentaufnahmen: Klaas<br />
bei der Karussellfahrt in einer Zentrifuge<br />
für Raumfahrttraining; Joko, der einen Alligator<br />
am Schwanz zieht.<br />
Das Prinzip ist nicht neu, es hat im angelsächsischen<br />
Raum sogar eine eminente<br />
Tradition. Slapstick war eine der Grundlagen<br />
des Vaudeville-Theaters. Joe Keaton,<br />
der Vater von Buster, bekämpfte bereits<br />
1895 einen Tisch, mit Hechtsprüngen,<br />
Fausthieben und Rempeleien. Der Kampf<br />
mit der Dingwelt zeigte den Zivilisationsbewohner<br />
als paradoxen Akteur, der sich<br />
mit den von ihm geschaffenen Sachen<br />
überwerfen muss. Eine späte Blütezeit erreichte<br />
die Pein- und Peinlichkeitsartistik<br />
dann bei der Künstlertruppe „Jackass“.<br />
Ehemalige Skateboarder pervertierten<br />
Ende der neunziger Jahre die Happening-<br />
Idee zur Sadismussause. Man schnupfte<br />
Wasabi, inhalierte Pfefferspray oder legte<br />
sich mit Steaks behängt auf einen Grill.<br />
Und nun Klaas und Joko. Auch in der<br />
aktuellen Sendung „Circus Halligalli“, der<br />
„Manege des Wahnsinns“ von Pro Sieben,<br />
greift die bewährte Methode: Schmerzsketche,<br />
Demütigungsgags, dazwischen ein<br />
paar Showgäste. Sido war schon da, Lena,<br />
Detlev Buck. Die Gespräche sind wirre<br />
Simulationen von Unterhaltung. Geistreicher<br />
sind die Untertitel zum jeweiligen<br />
Gast. Jürgen von der Lippe wird als „Entertainer,<br />
Moderator, Hawaiianer“ vorgestellt,<br />
weil er vorzugsweise Hawaiihemden trägt.<br />
Das bezeichnet exakt die Grundidee dieses<br />
Humors: Alles wird mit ironischer Fußnote<br />
versehen, eigentliches Sprechen ist etwas<br />
für Spießer, Beamte oder Programmchefs,<br />
die bei Pro Sieben nicht müde werden,<br />
ihre beiden Stars als Wunderwaffe für die<br />
Rekrutierung junger Zuschauer zu loben.<br />
Nun kann man sich fragen, ob die Generation<br />
der unter 40-Jährigen wirklich<br />
noch so ironieverliebt ist oder ob sich in<br />
diesem Gesellschaftssegment nicht längst<br />
ein neuer Lebensernst breitgemacht hat,<br />
mit Yogakursen, Bioläden und dem Flirten<br />
mit einer schwarz-grünen Koalition. Man<br />
kann auch fragen, wie lange Deutsche unter<br />
30 noch fernsehen werden oder ob sie<br />
nicht lieber durchs Internet surfen. Eine<br />
60-Minuten-Sendung am Abend muss<br />
Smartphone-Junkies wie ein Wachkoma<br />
vorkommen.<br />
Die ordentlichen, wenngleich nicht<br />
herausragenden Quoten für „Circus Halligalli“<br />
und Artverwandtes haben womöglich<br />
einen ganz anderen Grund: Es gibt einen<br />
wertkonservativen Zug im ironischen<br />
Overdrive von Klaas und Joko. Die beiden<br />
sind eine Solidargemeinschaft en miniature.<br />
Sie haben sich gegenseitig permanent im<br />
Blick, auch wenn er gespielt, hämisch und<br />
gehässig ist. Wie bei Dick und Doof, Ernie<br />
und Bert, Pat und Patachon setzt sich<br />
hier eine Verbindlichkeit in Szene, die in<br />
hochflexiblen, konkurrenzverschärften Zeiten<br />
nicht selbstverständlich ist.<br />
Klaas und Joko gehören zusammen. Sie<br />
sind aneinandergekettet, aufeinander verwiesen.<br />
Ihr Spiel ist, so narzisstisch es daherkommt,<br />
nicht Ego-Entertainment, sondern<br />
der Traum von Kumpelei. Wer seinen<br />
Nächsten triezen will, muss erst mal einen<br />
haben. Das wissen die Sammler virtueller<br />
Friends und Follower nur zu gut.<br />
Daniel Haas<br />
ist Autor und Spezialist für<br />
populäre Medien<br />
Fotos: Urban Zintel/Laif, Privat (Autor)<br />
120 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Klaas Heufer-Umlauf (links)<br />
und Joko Winterscheidt bei der<br />
Arbeit: Sie verlachen die Welt<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 121
| S a l o n<br />
Liebe, ein pendelschlag<br />
Der australische Schriftsteller Peter Carey verbindet Schönheit mit Komik und mit der Kuckucksuhr<br />
von hannes Stein<br />
W<br />
ussten Sie schon immer, dass<br />
Sie Schriftsteller werden wollten?<br />
Ich weiß nicht mehr genau,<br />
wann ich Peter Carey mit dieser Frage behelligte<br />
– war es beim Puntarelle, dem römischen<br />
Salat, der aussieht wie grüne Würmer,<br />
oder hatte uns der Kellner schon Teller<br />
voll dampfender Pasta serviert? Jedenfalls<br />
waren wir beim ersten Glas Hauswein (rot).<br />
Die Frühlingssonne brach schräg durch die<br />
Fensterscheiben. Das kleine italienische Restaurant<br />
in Greenwich Village war gefüllt<br />
mit lauten, fröhlichen Menschen.<br />
Nein, sagt Carey, der zweimal den<br />
Man-Booker-Prize gewann, den begehrtesten<br />
Literaturpreis der angelsächsischen<br />
Welt. Aber nicht doch. Seine Familie sei<br />
von Literatur unbeleckt. „Meine Eltern<br />
waren Autoverkäufer in einer Kleinstadt<br />
westlich von Melbourne.“ Literarische Bildung:<br />
null, wenn man von Shakespeare<br />
und der Bibel absieht. Er war das erste<br />
Kind in der Familie, das auf eine bessere<br />
Schule durfte: Peter Carey besuchte also<br />
die „Geelong Grammar School“, weil seine<br />
Eltern das Geld zusammenkratzen konnten.<br />
Auf dieselbe Schule gingen auch der<br />
Zeitungstycoon Rupert Murdoch sowie<br />
mehrere australische Premierminister. Allerdings<br />
hat er diese hohen Herrschaften<br />
nicht getroffen.<br />
Später verdiente Carey sein Geld als<br />
Werbetexter, gleichzeitig begann er, ernsthaft<br />
zu schreiben. Seine erste Veröffentlichung:<br />
ein Band mit Kurzgeschichten anno<br />
1974, auf die er heute nur noch halb stolz<br />
ist. Peter Carey grinst spitzbübisch und erzählt:<br />
„Wenn Leute mich damals auf Partys<br />
nach dem Beruf fragten, sagte ich, ich<br />
arbeite für die Werbung. Dann fingen sie<br />
meistens an, mich zu beschimpfen. Zur<br />
Rechtfertigung schob ich nach, eigentlich<br />
sei ich Schriftsteller. Das hatte zur Folge,<br />
dass sie noch stärker schimpften. Ich revanchierte<br />
mich mit ein paar Kraftausdrücken,<br />
und so wurden wir auf sehr australische<br />
Weise schnell Kumpels.“<br />
Was hat ihn, den Ur-Australier, vor<br />
20 Jahren nach New York verschlagen?<br />
„Meine erste Frau wollte hier leben. Ich<br />
nicht, aber ich habe nachgegeben. Wir<br />
sind längst geschieden, sie lebt in Brooklyn,<br />
zum Glück laufen wir einander nie<br />
über den Weg. Meine zweite Frau ist Engländerin.<br />
Komische Sache, das Leben.“<br />
Peter Carey hat mehrere weltweite Bestseller<br />
geschrieben, etwa „Mein Leben als<br />
Fälschung“ oder „Liebe. Eine Diebesgeschichte“.<br />
Trotzdem ist er kein Schriftsteller<br />
für jedermann. Seine Romane drohen –<br />
wie es im Guardian einmal sehr hübsch<br />
hieß – jeden Augenblick zu explodieren<br />
und bunte Flecken auf dem Teppich zu<br />
hinterlassen. Jene, die ihre Literatur gern<br />
sauer und schal haben, nehmen ihn darum<br />
nicht ganz ernst; aber auch jene, die gern<br />
Leseschnellfutter wollen, kommen bei Carey<br />
kaum auf ihre Kosten.<br />
Sein neuer Roman „Die Chemie der<br />
Tränen“ ist soeben auf Deutsch erschienen.<br />
Die Geschichte spielt halb im modernen<br />
London und halb im Schwarzwald des<br />
19. Jahrhunderts, wo die Kuckucksuhr erfunden<br />
wurde. Von ihr ist Carey fasziniert.<br />
Auf der einen Ebene geht es um Catherine,<br />
Angestellte eines Museums für Kunsthandwerk,<br />
die einen fatalen Verlust erleidet:<br />
Ihr Boss, zugleich ihr Liebhaber, stirbt<br />
an einem Herzinfarkt. Wie bekämpft man<br />
Kummer? Mit Arbeit. Catherine, Spezialistin<br />
für komplizierte Uhrwerke, setzt etwas<br />
Altmodisches zusammen, ein Artefakt,<br />
von dem sie glaubt, es sei eine mechanische<br />
Ente. Sie folgt Jacques de Vaucanson und<br />
dessen weltberühmter „Canard Digérateur“<br />
von 1739.<br />
Auf der zweiten Ebene handelt „Die<br />
Chemie der Tränen“ von Henry, einem verrückten<br />
Engländer mit einem Sohn, der<br />
an einer seltsamen, potenziell tödlichen<br />
Krankheit leidet. Mitten im 19. Jahrhundert<br />
reist Henry in den Schwarzwald, wo<br />
es besonders deutsch und dunkel ist, um<br />
ein mechanisches Spielzeug in Auftrag zu<br />
geben. Nur mithilfe jenes Spielzeugs, davon<br />
ist er überzeugt, kann sein krankes<br />
Kind genesen. Am Ende des Romans entpuppt<br />
sich die Ente, die Henry bestellt hat,<br />
als majestätischer Schwan mit silbernem<br />
Hals – wie im Märchen von Hans Christian<br />
Andersen. Und die Liebe ist mächtig<br />
wie der Tod: Catherine findet Trost. Ein<br />
komisches, ein ergreifendes Kabinettstück<br />
ist Peter Carey gelungen. Man denkt über<br />
den Roman noch sehr lange nach, wenn<br />
man ihn aus der Hand gelegt hat.<br />
Warum also schreiben Sie? Diese Frage<br />
habe ich dem Schriftsteller wohl nicht vor<br />
dem zweiten Glas Hauswein gestellt. Ganz<br />
bestimmt stellte ich sie erst, nachdem Carey<br />
mir gestanden hatte, auch er sitze noch<br />
jedes Mal mit dem blanken Gefühl der Verzweiflung<br />
vor dem Bildschirm – mit der<br />
Furcht, er sei ein Versager und Hochstapler,<br />
und jetzt werde der Schwindel auffliegen.<br />
„Bevor ich einen Roman schreibe, ist<br />
das Gefühl immer noch: Wie kannst du es<br />
wagen! Wie kannst du allen Ernstes glauben,<br />
du dürftest dich auf das Terrain begeben,<br />
auf dem sich ein James Joyce herumgetrieben<br />
hat. Was für eine Anmaßung!“<br />
Am Anfang der Schriftstellerkarriere<br />
habe ihn Unwissenheit vor solchen Selbstzweifeln<br />
geschützt. Aber jetzt – im Mai<br />
wird er 70 Jahre alt – schütze ihn leider gar<br />
nichts mehr. Also bitte: Warum schreiben<br />
Sie? „Stellen Sie diese Frage jedem Autor,<br />
den Sie treffen?“ Nein. Nur von ihm, von<br />
Peter Carey, will ich es dann doch gern wissen.<br />
Der Australier mit dem Lausbubengesicht<br />
denkt lange nach. Dann bestellen wir<br />
einen doppelten Espresso und einen Cappuccino.<br />
Und endlich sagt er: „Um etwas<br />
Schönes zu erschaffen, das es vorher noch<br />
nicht auf der Welt gegeben hat.“<br />
Hannes Stein<br />
ist Schriftsteller und lebt in New<br />
York. Sein Roman „Der Komet“<br />
erschien im Galiani-Verlag<br />
Fotos: Andrew Kelly/Insider Images, Chanah Brenenson (Autor)<br />
122 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Bestsellerautor Peter Carey<br />
wird am 7. Mai 70 Jahre<br />
alt. Er kennt noch immer<br />
die Furcht, er sei ein<br />
Versager und Hochstapler<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 123
| S a l o n | b a y r e u t h i m W a g n e r - J a h r<br />
Walhall bröselt<br />
Im Richard-Wagner-Jahr 2013 schaut die Welt nach Bayreuth. Und was sieht sie?<br />
Baugerüste, bröckelnden Putz, marode Inszenierungen und mittelmäßige<br />
Sänger. Ein Ortstermin auf der Suche nach dem Mythos<br />
von Michael Stallknecht<br />
124 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Wo einst des „Meisters“<br />
Bücher standen, im Saal<br />
der Villa Wahnfried,<br />
soll bald wieder ein<br />
Museum sein, heißt es<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 125
| S a l o n | b a y r e u t h i m W a g n e r - J a h r<br />
W<br />
as ist er nicht alles gewesen,<br />
dieser eigentlich so<br />
schlichte Bau! Walhall und<br />
Gralsburg, Gründungstempel<br />
einer Kunstreligion der<br />
Zukunft und letzter Hort im großen deutschen<br />
Untergang. Doch nun steht er da, als<br />
hätten die Riesen Walhall nicht fertig gebaut,<br />
als seien die Gralsritter ausgezogen.<br />
Eingerüstet mit grünen Bauplanen, da oben<br />
am Grünen Hügel. Walhall bröselt.<br />
„Man kann die Steine teilweise zwischen<br />
den Fingern zerreiben, die Fenster könnten<br />
dann rausfallen“, sagt Peter Emmerich. Der<br />
Sprecher der Bayreuther Festspiele wirkt,<br />
als habe er in seinen bald 25 Dienstjahren<br />
Schlimmeres erlebt. In seinem Büro seien<br />
die Fenster schon lange zugig, die jüngste<br />
Heizung im Haus stamme aus den zwanziger<br />
Jahren. Das Fachwerk an den Längsseiten<br />
sei seit langem durch Sichtbeton ersetzt.<br />
Doch nun geht es an die Substanz, an<br />
die verbliebenen Teile aus der Bauzeit des<br />
Hauses vor 140 Jahren. Auf 48 Millionen<br />
Euro und eine mögliche Laufzeit von zehn<br />
Jahren veranschlagen erste Schätzungen die<br />
vollständige Sanierung.<br />
Angela Merkel wird zu den Festspielen<br />
Ende Juli also unter Gerüsten nach Walhall,<br />
ins Festspielhaus einziehen müssen. Dabei<br />
ist 2013 ein besonderes Jahr. Die ganze Welt<br />
feiert den 200. Geburtstag Richard Wagners,<br />
die Opernhäuser spielen Wagner am laufenden<br />
Band. Drinnen probt Frank Castorf,<br />
Chef der <strong>Berlin</strong>er Volksbühne, seine Neuinszenierung<br />
des „Ring des Nibelungen“, mit<br />
dem Richard Wagner 1876 die ersten Festspiele<br />
eröffnet hatte. Bis zu den diesjährigen<br />
Festspielen müssen selbst die notwendigsten<br />
Restaurierungen warten. Das Haus,<br />
von Wagnerianern „Scheune“ genannt, ist<br />
so hellhörig, dass es jeder Hammerschlag<br />
von draußen locker mit den Schlägen des<br />
Germanengottes Donner drinnen auf der<br />
Bühne aufnehmen kann. Nur bedruckte<br />
Planen sollen noch kommen, um die Architektur<br />
abzubilden.<br />
Als seine eigene Attrappe wird sich<br />
das Festspielhaus dann immerhin im Einheitslook<br />
mit Haus Wahnfried präsentieren,<br />
dem am häufigsten besuchten Gedenkort<br />
zu Wagner. Rund um Richard Wagners<br />
ehemalige Villa am Hofgarten – „Hier wo<br />
mein Wähnen Frieden fand, Wahnfried sei<br />
dieses Haus von mir benannt“ – hängen<br />
die Planen schon, die Bagger rollen fleißig.<br />
Die Büste von König Ludwig II., der es mit<br />
kostenintensiven Neubauten bekanntlich<br />
nicht so genau nahm, blickt stoisch über<br />
den Bauzaun. Vielleicht amüsiert er sich ja,<br />
dass es selbst die Preußen trifft. Denn, man<br />
glaubt es kaum, als Drittes im Bunde wird<br />
auch das Markgräfliche Opernhaus, erbaut<br />
in Bayreuth unter Markgräfin Wilhelmine,<br />
der Schwester Friedrichs des Großen, seit<br />
vergangenem Herbst renoviert. Ironie der<br />
Geschichte: Erst wenige Monate zuvor<br />
hatte die Unesco das Haus, eines der wenigen<br />
original erhaltenen Barocktheater,<br />
zum Weltkulturerbe erklärt.<br />
„Wer den Schaden hat, spottet jeder<br />
Beschreibung“, übt sich Sven Friedrich<br />
in Galgenhumor und schimpft über das<br />
„Von Richard Wagners<br />
Villa stehen derzeit nur<br />
noch die Außenmauern<br />
und die Zwischendecke“<br />
Sven Friedrich, Direktor des<br />
Richard-Wagner-Museums<br />
„dämliche Jubiläumsjahr“. Der Direktor<br />
des Richard-Wagner-Museums, das im<br />
Haus Wahnfried beheimatet ist, berichtet,<br />
er habe die nötige Neukonzeption bereits<br />
seit 2001 vorbereitet. Doch im Jahr 2009<br />
beschlossen Stadt und Freistaat einen ehrgeizigen<br />
Neubau im Garten des Hauses.<br />
Inzwischen laufe es gut, nur sehen könne<br />
man von außen eben nichts. „Von Richard<br />
Wagners Villa stehen derzeit nur noch die<br />
Außenmauern und die Zwischendecke.“<br />
Um Wagnerianern und Touristen zur<br />
Festspielzeit irgendetwas zu bieten, will<br />
man kurzfristig ein paar Räume zugänglich<br />
machen und eine Ausstellung über Ludwig<br />
II. zeigen. Doch „Götterdämmerung“,<br />
wie die Ausstellung passenderweise heißt,<br />
tourt schon seit zwei Jahren durch alle bayerischen<br />
Regierungsbezirke. Bereits in ihrer<br />
ursprünglichen Variante als Bayerische<br />
Landesausstellung des Jahres 2011 war sie<br />
vor allem durch multimedialen Kitsch und<br />
forcierte Plakativität aufgefallen.<br />
„Es hat seinen eigenen Charme, das<br />
Haus trotz Baustelle zugänglich zu machen“,<br />
versucht es Brigitte Merk-Erbe, die<br />
Oberbürgermeisterin von Bayreuth und<br />
Geschäftsführerin der für das Museum<br />
verantwortlichen Richard-Wagner-Stiftung,<br />
mit trotzigem Optimismus. „Spätestens<br />
Ende 2011 war absehbar, dass Wahnfried<br />
2013 nicht fertig werden würde.“<br />
Sven Friedrich klagt indes über hohe<br />
Reibungsverluste in öffentlichen Strukturen,<br />
zieht Parallelen zu anderen öffentlichen<br />
Unternehmen wie der Hamburger Elbphilharmonie<br />
oder dem <strong>Berlin</strong>er Flughafen. Ein<br />
Nachbar erwirkte hier eine einstweilige Verfügung,<br />
die Bayreuther erregten sich über<br />
den Entwurf des prominenten <strong>Berlin</strong>er<br />
Architekturbüros Volker Staab, Umweltschützer<br />
darüber, in Richard Wagners Garten<br />
würden die Baumschutzordnung und<br />
die Vogelschutzbestimmungen missachtet.<br />
Dass auch die Familie des „Meisters“, wie<br />
man hier sagt, sich immer wieder einschaltete,<br />
verrät Toni Schmid vom Kultusministerium<br />
des Freistaats Bayern. „Wir wollten<br />
niemanden übergehen“, so der Leiter der<br />
Kunstabteilung, „der noch als Kind in dem<br />
Haus aufgewachsen ist.“<br />
Das Gespräch mit Sven Friedrich findet<br />
in jenem Teil des Hauses statt, in dem<br />
bis 1980 Richard Wagners Schwiegertochter<br />
Winifred lebte. Im Nebenzimmer steht<br />
der Steinway-Flügel des Meisters. Als glühende<br />
Nationalsozialistin hatte Winifred<br />
die Festspiele mit dem „Dritten Reich“ nah<br />
an den Untergang geführt. Auf diese ideologischen<br />
Verstrickungen ging das alte Richard-Wagner-Museum<br />
aus dem Jahr 1976<br />
kaum ein, was sich nun ändern soll.<br />
Indem Winifred den Familienbesitz in<br />
die Richard-Wagner-Stiftung überführte,<br />
gab sie ihm zum ersten Mal eine öffentliche<br />
Rechtsform. Dennoch bleiben die Wagners<br />
Fotos: Jürgen Holzenleuchter für <strong>Cicero</strong> (Seiten 124 bis 127)<br />
126 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Grüne Planen auf dem<br />
Grünen Hügel: Das<br />
Bayreuther Festspielhaus<br />
ist innen wie außen<br />
eine große Baustelle<br />
bis heute so etwas wie die letzte Monarchie<br />
auf deutschem Boden: völlig degeneriert<br />
und doch mit stolzem Erbe, eine der<br />
wenigen echten Institutionen hierzulande<br />
und in den Einzelpersonen immer wieder<br />
untragbar. Hätte sie sich woanders als Produzentin<br />
beworben, ihr wäre innerhalb einer<br />
Viertelstunde die Tür gewiesen worden,<br />
schrieb der Journalist Moritz Wirth<br />
schon über Richards Witwe und „Nachfolgerin“<br />
Cosima.<br />
Was die nicht davon abhielt, in Wahnfried<br />
ein quasimonarchisches Zeremoniell<br />
mit grotesken Formen einzuführen. Dummerweise<br />
war die Thronfolge immer ungesichert<br />
– die innerfamiliären Streitigkeiten<br />
füllen bis heute ganze Zeitungsarchive.<br />
Zuletzt regierte Winifreds Sohn Wolfgang<br />
Wagner, anfangs mit seinem Bruder, dann<br />
alleine, ganze 57 Jahre lang, die gesamte<br />
deutsche Nachkriegszeit. Rechtlich funktionierte<br />
das über eine GmbH, deren einziger<br />
Gesellschafter wiederum er selber war.<br />
Als solcher mietete Wolfgang Wagner dann<br />
das Festspielhaus von der Richard-Wagner-<br />
Stiftung und setzte – Überraschung – sich<br />
selbst als Geschäftsführer auf Lebenszeit ein.<br />
Brüchige Steine an den Fassaden klopfte er<br />
als sein eigener Hausmeister notfalls einfach<br />
runter. „Der hat alles gemacht, wie er<br />
meinte“, sagt Toni Schmid vom Ministerium.<br />
„Wir als Freistaat waren zufrieden,<br />
wenn am Ende keine Schulden entstanden,<br />
und in alles andere waren wir nicht involviert.<br />
Das war viel angenehmer.“<br />
Dass das alles spätestens seit Wolfgang<br />
Wagners Tod im Jahr 2010 nicht mehr einfach<br />
so geht – das ist die eigentliche, die<br />
grundlegende Baustelle in Bayreuth. Denn<br />
weil dieser unbedingt seine eigentlich viel<br />
zu junge Lieblingstochter Katharina zur<br />
Nachfolgerin wollte, bestanden die bisherigen<br />
Geldgeber – Bund, Freistaat, Stadt und<br />
die Mäzenatengesellschaft der „Freunde von<br />
Bayreuth“ – auf Anteilen in der GmbH.<br />
Bayreuth ist damit in der konstitutionellen<br />
Monarchie angekommen.<br />
Katharina und ihre Partnerin in der<br />
Festspielleitung, die ältere Halbschwester<br />
Eva Wagner-Pasquier, regieren seitdem als<br />
Geschäftsführerinnen in einem öffentlichrechtlichen<br />
Konstrukt, das indes ziemlich<br />
auf Sand gebaut scheint. Ein „undurchsichtiges<br />
Geflecht von Bestimmungen<br />
und Regelungen“, diagnostizierte kürzlich<br />
ein rechtswissenschaftliches Symposion<br />
der EBS Law School in Wiesbaden.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 127
| S a l o n | b a y r e u t h i m W a g n e r - J a h r<br />
Die Struktur sei der Öffentlichkeit kaum<br />
vermittelbar, Einzelteile der aus Wolfgang<br />
Wagners Zeiten einfach fortgeführten Regelungen<br />
seien ungültig oder mindestens<br />
zweifelhaft. Ihre beiden Cousinen Katharina<br />
und Eva arbeiteten „im Zustand der<br />
Illegalität“, die Nachfolge sei „sittenwidrig“<br />
verlaufen, fauchte danach öffentlich<br />
Nike Wagner und verdeutlichte damit, woran<br />
das dynastische Prinzip scheitert. Die<br />
Leiterin des Kunstfests Weimar hatte 2008<br />
selbst Festspielleiterin werden wollen.<br />
Als reiner Staatsbetrieb funktionieren<br />
die Festspiele freilich auch nicht unbedingt.<br />
Vor allem Bayern und der Bund,<br />
hört man, kriegten sich in der GmbH gern<br />
in die Haare. Für die Bayern seien die Preußen<br />
kontrollwütig, aber finanziell unzuverlässig.<br />
Man werde sich vom Bund im Festspielhaus<br />
nicht die Buntstifte nachzählen<br />
lassen, schimpfte der bayerische Kunstminister<br />
Wolfgang Heubisch. Die rechtlichen<br />
Abhängigkeiten und personellen Identitäten<br />
zwischen Stiftung und GmbH – Toni<br />
Schmid ist Verwaltungsratsvorsitzender in<br />
beiden – wirken wie die Fortschreibung<br />
bayerischer Stammtischtraditionen.<br />
Andererseits hat sich der Freistaat bei der<br />
fälligen Sanierung des Festspielhauses zum<br />
Erbe Ludwigs II. bekannt, der beim Bau<br />
mit einem rettenden Kredit eingesprungen<br />
war. 16 Millionen sind in den Haushalt<br />
eingestellt. Für die übrigen 32 Millionen<br />
stehen die anderen Gesellschafter unter<br />
Zugzwang. „Alle Beteiligten werden sich finanziell<br />
engagieren“, hört man nur von der<br />
Oberbürgermeisterin, deren Kommune so<br />
pleite ist wie alle anderen.<br />
„Die Moderne greift nach Bayreuth“,<br />
sagt Peter Emmerich mit süffisantem Lächeln.<br />
Plötzlich, so der Sprecher der Festspiele,<br />
sei „Erfolgskontrolle“ zentral, die<br />
Zahl von Klicks auf Homepages und Ähnliches.<br />
Als vor zwei Jahren der Bund seinen<br />
Rechnungshof schickte, rügte der die<br />
Kartenvergabepraxis. 60 Prozent der Festspielkarten<br />
waren nie in den freien Verkauf<br />
gelangt. Wie es eben im Feudalismus so üblich<br />
ist, waren viele Karten über Privilegien<br />
und langjährige Gewohnheitsrechte immer<br />
schon vergeben. Die berühmte zehnfache<br />
Überbuchung erwies sich als Mythos.<br />
In den vergangenen Wochen suchten<br />
die beiden Festspielleiterinnen händeringend<br />
nach einem kaufmännischen Geschäftsführer,<br />
der einen simplen Jahresabschluss<br />
zustande bringt. Dass die beiden<br />
Damen zuweilen überfordert sind, spürt<br />
man als Journalist, wenn man – wie für diesen<br />
Beitrag – mehrfach um ein Gespräch<br />
bittet: tagelang keinerlei Reaktion.<br />
Vielleicht passen Mythen nicht in die<br />
verwaltete Welt. Richard Wagner gestaltete<br />
das Festspielhaus bewusst als provisorischen,<br />
rein funktionalen Bau. Er hatte genau gespürt,<br />
dass die Schere zwischen Provinzialismus<br />
und Anspruch, Talmi und Heiligkeit<br />
in Bayreuth von Anfang an weit offen<br />
stand. Die Festspiele blieben in den ersten<br />
Jahrzehnten finanzielle Kompletthavarien.<br />
Von Anfang an stand hier<br />
die Schere zwischen<br />
Provinzialismus und<br />
Anspruch, Talmi und<br />
Heiligkeit weit offen<br />
Und dass der Festspielbesuch oft als Pilgerfahrt<br />
beschrieben wurde, hat mit den begleitenden<br />
Strapazen ebenso zu tun wie<br />
mit der Kunstreligion. Bis heute nächtigen<br />
traditionsbewusste Festspielgäste mangels<br />
Hotellerie bei Bayreuther Bürgern, die<br />
zur Festspielzeit ein Bett anbieten. Nach<br />
der Vorstellung essen sie am Fuß des Hügels<br />
in den „Holländer-Stuben“, obwohl es<br />
dort neben Sängerfotos an den Wänden nur<br />
verranzte Möbel und fettige Ćevapčići gibt.<br />
Besser gesagt: gab. Vor zwei Jahren haben<br />
die „Holländer-Stuben“ dichtgemacht.<br />
Tempel können in die Jahre kommen,<br />
bei der Liturgie aber muss die Sache stimmen.<br />
Auch hier bröselt es schon lange. Kein<br />
Komponist ist in den vergangenen Jahren<br />
stärker demokratisiert worden als Wagner,<br />
auch die kleinen Bühnen spielen seine Stücke<br />
inzwischen. Die Exklusivität ist dahin.<br />
Bei den Sängerbesetzungen können die<br />
Festspiele seit Jahren kaum noch mit den<br />
großen Häusern mithalten, auch die Besetzung<br />
des kommenden „Rings“ wirkt bis auf<br />
ein paar Namen glanzlos. Dass die Inszenierung<br />
für das Mittelmaß entschädigt, glaubt<br />
in Branchenkreisen kaum jemand.<br />
Einst prägend für eine ganze Generation,<br />
zeigen die Schauspielproduktionen<br />
von „Ring“-Regisseur Frank Castorf seit<br />
Jahren schwere Ermüdungserscheinungen.<br />
Castorf ist das lebendige Symbol der Legitimationskrise,<br />
in der das Regietheater<br />
deutscher Prägung unübersehbar steckt.<br />
Wolfgang Wagner hatte zu dessen Blütezeiten<br />
die brillantesten Köpfe nach Bayreuth<br />
einladen können. Zugleich aber betrieb<br />
er eine Mischkalkulation, indem seine<br />
eigenen, reichlich bodenständigen Inszenierungen<br />
das Ritual bedienten. Denn die<br />
Spaltung zwischen dem Progressiven und<br />
dem Sakralen steckt tief in Richard Wagners<br />
Werk.<br />
Urenkelin Katharina dagegen nutzte<br />
2007 ihre erste eigene Bayreuther Inszenierung,<br />
um mit den „Meistersingern von<br />
Nürnberg“ eine Avantgarde von vorgestern<br />
als alternativlos zu feiern. Im vergangenen<br />
Jahr durfte der 31-jährige Regisseur<br />
Jan Philipp Gloger den „Fliegenden Holländer“<br />
grandios im Meer versenken. 2015 ist<br />
wieder Katharina dran, 2016 soll der fachfremde<br />
Bildende Künstler Jonathan Meese<br />
den „Parsifal“ inszenieren. Wie viele Kleinstadtintendanten<br />
versprechen sich die Festspielleiterinnen<br />
von „frischem Blut“ die<br />
große Zukunft. Dazu passt die jährliche<br />
Kinderoperproduktion, die Katharina<br />
Wagner einführte, als müsse sie wie in Ingolstadt<br />
oder Rostock den Nachwuchs ins<br />
Theater locken. Das Problem ist nur, dass<br />
im gegenwärtigen Theaterbetrieb nichts gewöhnlicher<br />
geworden ist als das Experiment.<br />
Die Eintrittskarten und Programmhefte der<br />
Festspiele sind ein Menetekel: Nach einer<br />
Modernisierung sehen sie aus wie in jedem<br />
anderen Theater auch.<br />
In diesem Herbst stehen die Verhandlungen<br />
über die erste Vertragsverlängerung<br />
der beiden Halbschwestern in der Festspielleitung<br />
an. Sollte man sich irgendwann gegen<br />
das dynastische Prinzip entscheiden,<br />
wäre Bayreuth endgültig ein Staatstheaterbetrieb<br />
unter vielen. Toni Schmid wird<br />
die Verhandlungen wahrscheinlich führen.<br />
„Es ist auch ein Zeichen des Optimismus,<br />
wenn ein Gerüst steht“, sagt er mit<br />
Blick auf das Festspielhaus. „Es ist ein Signal,<br />
dass wir uns um die Zukunft des Hauses<br />
kümmern.“<br />
michael Stallknecht<br />
ist Kulturwissenschaftler,<br />
Musikkritiker und freier<br />
Publizist<br />
Foto: privat<br />
128 <strong>Cicero</strong> 5.2013
B e n o t e t | S a l o n |<br />
illustration: anja stiehler/jutta fricke illustrators<br />
Der Hund ist nur<br />
ein Rezensent<br />
Musik und Musikkritik sind heute oft<br />
geschiedene Leute. Doch es gibt Ausnahmen<br />
Von Daniel Hope<br />
E<br />
s war anno 2001: In der Lobby des Hotels, wo ich einchecken<br />
wollte, stand zufällig eine Kollegin vor mir, eine<br />
brillante amerikanische Musikerin, damals am Anfang ihrer<br />
Weltkarriere. Kopfschüttelnd gestikulierte sie, während sie in<br />
eine Tageszeitung schaute. „Ich fasse es nicht!“, sagte sie zu ihren<br />
Eltern, die neben ihr standen: „Ein ganzes Jahr arbeite ich an diesem<br />
Programm, und das Einzige, was diesem MANN einfällt, ist,<br />
mich ein ‚loliteskes Persönchen‘ zu nennen! Ich möchte ihn einmal<br />
auf der Bühne erleben!“<br />
Darf man reagieren, wenn eine Kritik unter die Gürtellinie<br />
trifft? Legendär ist Max Regers Antwort: „Ich sitze im kleinsten<br />
Raum des Hauses. Ihre Kritik habe ich vor mir. Bald werde ich sie<br />
hinter mir haben.“ Als ich mit 15 begann, öffentlich aufzutreten,<br />
habe ich mit pochendem Herzen geblättert, um zu erfahren, wie<br />
der Rezensent meine Leistung bewertet hatte. Inzwischen kann<br />
ich behaupten, dass ich jede Art von Kritik erlebt habe. Neben<br />
köstlichen Verwechslungen wie „Donald Hope, der australische<br />
Pianist“ sind die Urteile mal so übertrieben positiv, mal so unglaublich<br />
schlecht, dass ich sicher bin: Dies kann einfach nicht<br />
sein. Trotzdem frage ich mich jeweils nach einer negativen Kritik,<br />
ob etwas davon stimmt. Der Dirigent Leopold Stokowski sagte:<br />
„Am gefährlichsten sind jene Kritiker, die von der Sache nichts verstehen,<br />
aber gut schreiben.“ Ich würde es anders formulieren: Eine<br />
schlechte Kritik, wenn sie kenntnisreich und fundiert ist, kann einem<br />
Künstler helfen und ihn weiterbringen.<br />
Einer der gefürchtetsten Musikkritiker seiner Zeit war Eduard<br />
Hanslick (1825-1904), berühmt für seine von Ironie und Wortwitz<br />
sprühenden Rezensionen. Manche Künstler haben sich für<br />
die bösen Auslassungen revanchiert. Richard Wagner hat es seinem<br />
Widersacher heimgezahlt, indem er ihn in den „Meistersingern<br />
von Nürnberg“ in Gestalt des „Merkers“ Sixtus Beckmesser verewigte.<br />
Am berühmtesten ist Goethes Gedichtzeile: „Schlagt ihn<br />
tot, den Hund! Er ist ein Rezensent.“ Ein Schauspieler im Frankfurter<br />
Theater tat 2006 fast genau das: Er sprang von der Bühne<br />
runter, entriss dem Kritiker den Notizblock und beschimpfte ihn.<br />
Es gab Zeiten, da die Leute Kritiken fasziniert gelesen haben,<br />
weil sie unbedingt etwas über die jeweils aufgeführten Werke und<br />
die mitwirkenden Musiker erfahren wollten. Damals waren die<br />
Zeilen informativ, kompetent, manchmal mit einer gesunden Dosis<br />
Ironie – aber niemals persönlich. Leider beherrschen nur noch<br />
wenige diese Kunst. Symptomatisch war eine Begegnung mit einem<br />
Studienfreund, der mir nach dem Besuch eines Konzerts erzählte,<br />
dass er nun Musik- statt Filmkritiken schreibe. Ich fragte<br />
ihn, wie er über das Konzert berichten wolle. Er bat mich, ihm<br />
zu raten, er selbst wisse nämlich nicht weiter. Heute kommt noch<br />
hinzu, dass viele Zeitungen, bedingt durch die rapide Abnahme<br />
von Werbeeinnahmen, bei der Musikredaktion radikal sparen müssen.<br />
Und mit dem Internet-Blogging scheint der Sofa-Kritiker endgültig<br />
etabliert zu sein. Jetzt muss sich der Rezensent sogar vor der<br />
ganzen Welt verteidigen: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er selber<br />
im Netz beurteilt wird. Die Spielregeln ändern sich.<br />
Im November 2012 las ich einen bizarren Artikel mit der Überschrift<br />
„Unter dem Röckchen der Hure Klassik“. Zielscheibe dieser<br />
Tirade waren viele geschätzte Kollegen, die neben ihren Musikkarrieren<br />
andere Tätigkeiten wie das Schreiben oder Moderieren mit<br />
Erfolg ausüben. Der Artikel richtete sich auch gegen mich, wobei<br />
die trashigen Bemerkungen in meinem Fall ausschließlich mein<br />
Aussehen betrafen, und erinnerte mich eher an „Dschungelcamp“-<br />
Journalismus. Im Übrigen war der Autor derselbe, dem es gelungen<br />
war, sein Klassik-Vokabular in den elf Jahren von „lolitesk“<br />
auf „Hure“ zu steigern.<br />
Eine würzige Rezension, die hingegen wirklich saß, war von einem<br />
Kritiker, den ich sehr schätze. Sie erschien nach meinem ersten<br />
Auftritt mit dem Beaux Arts Trio in Boston. In der Kritik las<br />
ich, dass ein Newcomer eingesprungen sei, ein (immerhin!) feinfühliger<br />
Musiker, bei dem man es aber leider mit dem lautesten<br />
Fußstampfer seit Rudolf Serkin zu tun habe. Er habe bei Schumann<br />
so laut gestampft, dass man sich gewünscht habe, im Publikum<br />
säße ein Chirurg, der den fraglichen Fuß umgehend amputierte.<br />
Ein Jahr später spielte ich wieder in Boston und achtete<br />
peinlichst darauf, meine Füße keinesfalls zu bewegen. Anschließend<br />
schrieb derselbe Kritiker: „Vor einem Jahr hat Mr. Hope mit<br />
seinem lauten Gestampfe beinahe das ganze Schumann-Trio ruiniert.<br />
Diesmal hielt er seine Füße exemplarisch ruhig. Halleluja!“<br />
Manchmal bewirken Kritiken doch etwas.<br />
Daniel Hope ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch<br />
„Toi, toi, toi! – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt)<br />
und die CD „Spheres“ (Deutsche Grammophon). Er lebt in Wien<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 129
| S a l o n | 1 9 3 3 – u n t e r w e g s i n d i e D i k t a t u r<br />
Im Flammenmeer<br />
der Niedertracht<br />
Mit der Bücherverbrennung verabschiedete sich Deutschland im Mai 1933 aus der Welt<br />
der Wissenschaft und Kultur. Die Folgen sind bis heute spürbar. Vierte Folge einer Serie<br />
von Philipp Blom<br />
W<br />
enn es ein Datum gibt, an<br />
dem Deutschland aufhörte,<br />
die größte Wissenschaftsnation<br />
und die wichtigste<br />
Kulturnation der Welt zu<br />
sein, dann war es der Abend des 10. Mai<br />
1933, an dem Studenten, Professoren, Burschenschaftler<br />
in voller Montur und Mitglieder<br />
von SA und Hitlerjugend einen<br />
Schritt in Richtung eines der Scheiterhaufen<br />
machten, die in mehr als 70 deutschen<br />
Städten brannten, und mit einem „Feuerspruch“<br />
auf den Lippen Bücher von „undeutschen“<br />
Autoren in die Flammen warfen.<br />
Das ehemalige Land der Dichter und<br />
Denker bekannte sich damit endgültig zu<br />
einem neuen Barbarismus.<br />
Die ersten Scheiterhaufen im Rahmen<br />
der Aktion hatten im Februar gelodert.<br />
Kurz darauf hatte die deutsche Studentenschaft<br />
unter dem Motto „Wider den<br />
undeutschen Geist“ zu einer Großaktion<br />
aufgerufen, die nicht nur „zersetzende Literatur“<br />
zerstören, sondern auch den universitären<br />
Machtanspruch der studentischen<br />
Funktionäre festigen sollte.<br />
Schon der „Judenboykott“ am 1. April,<br />
der alle Geschäfte und Betriebe in jüdischem<br />
Besitz betraf, hatte die Absichten<br />
der Nationalsozialisten deutlich gemacht.<br />
Mit dem im April erlassenen „Gesetz zur<br />
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“<br />
wurde die Machtergreifung auch an den<br />
Universitäten vollzogen. Beamte mussten<br />
von jetzt ab einen „Ariernachweis“ erbringen<br />
und konnten ohne Angabe von<br />
Gründen entlassen werden. Hunderte<br />
von jüdischen und politisch unliebsamen<br />
Hochschullehrern, mehr als 20 Prozent der<br />
Lehrkräfte, waren so entfernt worden. Die<br />
Proteste von Professorenseite hielten sich in<br />
Grenzen, denn die frei gewordenen Stellen<br />
boten Karrieremöglichkeiten.<br />
Mit der Bücherverbrennung sollte nun<br />
auch das Gedankengut im akademischen<br />
„Ich übergebe<br />
dem Feuer …“:<br />
So klang der<br />
böse Refrain in<br />
vielen Städten.<br />
Deutschland<br />
verbrannte<br />
sich da selbst<br />
130 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Fotos: Picture Alliance/DPA, Peter Rigaud (Autor); Grafik: <strong>Cicero</strong><br />
Bereich symbolisch „gereinigt“ werden. In<br />
Anlehnung an Luthers 95 Thesen publizierte<br />
die deutsche Studentenschaft zwölf<br />
Thesen, in denen sie forderte, „die Lügen“<br />
der „jüdischen Literatur“ auszumerzen.<br />
Was am 10. Mai 1933 geschah, beschrieb<br />
ein rhetorisch beseelter Redakteur<br />
der Greifswalder Zeitung: „Die Fackeln entzündeten<br />
den Holzstoß, auf dem die roten<br />
Fahnen und Transparente, die 14 Jahre<br />
lang durch die Straßen getragen wurden<br />
und zum Klassenkampf die Volksgenossen<br />
aufhetzten, in Flammen aufgingen. In<br />
dieses aufzüngelnde Flammenmeer flogen<br />
in hohem Bogen die Bücher, die<br />
auf der schwarzen Liste der nationalen<br />
Bewegung standen. Von<br />
Remarques ‚Im Westen nichts<br />
Neues‘ bis hin zu Heinrich<br />
Heine flogen die zersetzenden<br />
Zeitschriften und Flugblätter<br />
russischer und kommunistischer<br />
Funktionäre. Der<br />
aufsteigende Rauch entführte die<br />
brennenden Blätter weit zum Nachthimmel<br />
hinauf, dass sie wie entschwebende<br />
Geister erscheinen mochten. Und das ist<br />
wohl auch der Sinn dieser symbolischen<br />
Handlung, den Geist der Zersetzung, den<br />
Geist des Zwiespalts, kurz den Geist des<br />
Marxismus und Kommunismus auszutreiben,<br />
nicht bloß aus den Bücherschränken,<br />
sondern aus Gedanken und Herzen aller<br />
Volksgenossen.“<br />
Das Privileg, verbrannt zu werden, teilten<br />
die Bücher jüdischer Autoren wie Karl<br />
Marx, Heinrich Heine, Sigmund Freud,<br />
Alfred Kerr und Franz Kafka mit denen<br />
nichtjüdischer Autoren von den Brüdern<br />
Mann über Erich Kästner, Kurt Tucholsky<br />
und Hermann Hesse. Aber nicht nur die<br />
Bücherschränke und die Herzen der Volksgenossen<br />
leerten sich. Bis zum Kriegsbeginn<br />
verließen eine halbe Million von Intellektuellen,<br />
Wissenschaftlern, Künstlern,<br />
Journalisten und Schriftstellern Deutschland<br />
und Österreich und emigrierten ins<br />
Exil. Die Hälfte von ihnen ließ sich in den<br />
Vereinigten Staaten nieder.<br />
Kulturell und wissenschaftlich hat sich<br />
Deutschland von diesem Exodus nie erholt.<br />
Zwischen 1901 und 1933 ging ein Drittel<br />
aller Nobelpreise für Wissenschaften nach<br />
Deutschland. Zwischen 1933 und 1960<br />
waren es noch acht. Vor dem Krieg nahmen<br />
Chemiker und Physiker in der ganzen<br />
Welt Kurse in Deutsch, um wichtige<br />
1933<br />
Anno<br />
Als Deutschland die<br />
Demokratie verlor<br />
wissenschaftliche Publikationen zu verstehen.<br />
Heute schreiben deutsche Naturwissenschaftler<br />
lieber gleich auf Englisch. Die<br />
Liste der Exilierten gibt eine Ahnung von<br />
dem intellektuellen Potenzial, das verloren<br />
ging, von Hollywood bis zum militärpolitischen<br />
Manhattan-Programm der USA, von<br />
Bertolt Brecht bis zu Leo Strauss, dem Vater<br />
der ursprünglichen Neoliberalen Ökonomie<br />
in Chicago, Max Horkheimer, Hannah<br />
Arendt und Arnold Schönberg.<br />
Viel schlimmer als der Verlust seiner<br />
intellektuellen und kulturellen Weltstellung<br />
aber war die endgültige Perversion<br />
einer moralischen und kulturellen<br />
Tradition, die zumindest dem<br />
akademischen Selbstverständnis<br />
nach an den Universitäten<br />
besonders verankert sein<br />
sollte. Am 10. Mai 1933 kam<br />
es trotzdem kaum zu Reaktionen<br />
von Professorenseite.<br />
In <strong>Berlin</strong> hielt ein Philosophieprofessor,<br />
der zu Recht vergessene<br />
Alfred Baeumler, seine Antrittsvorlesung<br />
zu dieser Gelegenheit und marschierte<br />
dann mit den Studenten zum Scheiterhaufen.<br />
Der Rektor der Universität, Eduard<br />
Kohlrausch, trat zwar aus Protest zurück,<br />
wurde aber danach zu einem hochrangigen<br />
Juristen in der NS-Hierarchie. Hitler persönlich<br />
zeichnete ihn 1944 aus.<br />
Nur an der Universität Marburg fand<br />
sich kein Professor, der am Scheiterhaufen<br />
sprechen oder mit den Studenten<br />
marschieren wollte. Dort hatte sich<br />
nur wenige Tage zuvor der angesehene<br />
Sprachwissenschaftler Hermann Jacobsohn,<br />
als Nichtarier aus dem Dienst entlassen,<br />
das Leben genommen. Wenn es<br />
auch vielleicht nicht aus humanistischen<br />
Prinzipien geschehen war, bewegte diese<br />
Verzweiflungstat ihres Kollegen die Marburger<br />
Professoren augenscheinlich zum<br />
passiven Widerstand.<br />
Wir werden Deutschlands Weg in die Diktatur<br />
weiterhin nachzeichnen. In der nächsten<br />
Ausgabe wenden wir uns der Volkszählung<br />
von Juni 1933 zu.<br />
Philipp Blom ist Historiker<br />
und Autor. Seine Bücher „Der<br />
taumelnde Kontinent“ und<br />
„Böse Philosophen“ wurden<br />
mehrfach ausgezeichnet<br />
Anzeige<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Jetzt gratis<br />
testen<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst<br />
und Leben, den internationalen<br />
Kunstbetrieb wider. Herausragende<br />
Porträts und Ausstellungsrezensionen,<br />
spannende Debatten und Neuigkeiten<br />
aus der Kunstwelt, alles in einer unverwechselbaren<br />
Optik.<br />
Hier bestellen:<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 943170<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 131
| S a l o n | M a n s i e h t n u r , w a s m a n s u c h t<br />
Kunst als Abfall<br />
und Abgeltung<br />
Xu Bing schuf zwei gigantische Eisenvögel aus Schrott, die das<br />
neue Peking an den Preis seines Reichtums erinnern sollten. Zu<br />
sehen aber ist der doppelte Phönix nur in den USA<br />
Von Beat Wyss<br />
132 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Alte Feuerlöscher, gebrauchte Schutzhelme und aufgeschnittene Ölfässer sind hier<br />
der Stoff, aus dem die Vögel sind: Xu Bing bringt das Abgelegte zum Schweben<br />
D<br />
Fotos: Massachusetts Museum of Contemporary Art, artiamo (Autor)<br />
ie zwei Schrottskulpturen sind<br />
rund 30 Meter lang und wiegen<br />
zusammen zwölf Tonnen. Gegenwärtig<br />
hängen sie in Halle 5 des „Massachusetts<br />
Museum of Contemporary Art“,<br />
dem MASS MoCA von North Adams,<br />
Massachusetts. Der Künstler Xu Bing war<br />
von einem chinesischen Immobilieninvestor<br />
beauftragt worden, ein monumentales<br />
Kunstwerk zu schaffen: zum Schmuck<br />
der prächtigen Plaza zwischen den beiden<br />
Türmen des China World Trade Center,<br />
Tower III. Der Bau steht in Pekings<br />
Geschäftsviertel, deren Skyline die großen<br />
Namen zeitgenössischer Architektur zitiert.<br />
Den Künstler beeindruckten 2008<br />
beim Ortstermin auf der Baustelle die Arbeits-<br />
und Lebensbedingungen der Wanderarbeiter,<br />
die hier unter schäbigsten<br />
Bedingungen die glitzernden Kolosse<br />
ökonomischer und politischer Prachtentfaltung<br />
in die Höhe treiben. Xu Bing kam<br />
die Idee, diesen Ort mit einem Phönix-<br />
Paar zu überhöhen, dem mythischen Vogel<br />
der Erneuerung. In der Han-Dynastie,<br />
der Zeit unserer hellenistischen Antike,<br />
wurde das Fabeltier paarweise dargestellt,<br />
weiblich und männlich, als Metapher für<br />
den Kreislauf von Yin und Yang.<br />
So wie sich der Phönix selber erneuert,<br />
entstand das Kunstwerk aus den Abfällen,<br />
aus denen sich die Architektur des<br />
Geschäftsviertels geschält hat: den schadhaften<br />
Bambusstangen der Baugerüste,<br />
gebrauchten Feuerlöschern, Kreissägen,<br />
Polierkreisel, Abdeckmaterial aller Art.<br />
Kraus gerollte, aufgeschnittene Ölfässer<br />
bilden die Hälse, Schutzhelme und Ventilatoren<br />
die Federhauben der Königsvögel.<br />
Die Schwanzfedern sind aus gelochten<br />
Stahlträgern, farbigen Abdeckplanen und<br />
Blech zusammenmontiert. Grüne Akkordeonrohre<br />
aus Plastik schlängeln sich<br />
unter den Monstern und bringen diese<br />
gleichsam im Fahrtwind zum Schweben.<br />
Im Halbdunkel glimmen im Schrottgefieder<br />
Myriaden kleiner Niedervoltlämpchen<br />
wie die Milchstraße am Firmament<br />
einer Sommernacht. Die Köpfe<br />
und Schnäbel der Riesenvögel werden geformt<br />
von Baggerschaufeln mit Bohrkopf,<br />
womit das alte Peking abgerissen worden<br />
war, um das neue entstehen zu lassen:<br />
Phönix aus der Asche. Das Kunstwerk<br />
hätte das Handelszentrum Chinas an die<br />
Verschleißspuren der Arbeit erinnert, die<br />
seinen Glanz ermöglichen.<br />
Diese Aussage zu verkraften, war die<br />
Kommission der chinesischen Handelskammer<br />
jedoch nicht reif; ihr war die<br />
Schrottplastik nicht repräsentativ genug.<br />
Der Künstler wurde gebeten, die Vögel<br />
in Kristallglas zu gestalten, prunkvoll<br />
glitzernd wie die Halle, wofür sie vorgesehen<br />
waren. In Gestalt einer monströs<br />
gleißenden Chinoiserie wäre die Aussage<br />
des Werkes aber korrumpiert worden:<br />
dass Kunst ein Kompensationsgeschäft ist,<br />
eine symbolische Abfindung an die Opfer<br />
der Gesellschaft. Der Phönix heißt im<br />
Chinesischen Fenghuang; er gleicht dem<br />
Fasan oder Pfau und verkörpert die kaiserlichen<br />
Tugenden von Güte, Gerechtigkeit,<br />
Anstand und Weisheit. Sich mit solchen<br />
Tugenden zu schmücken, hat der<br />
zynische Raubtierkapitalismus kommunistischer<br />
Prägung nicht verdient.<br />
Xu war 34-jährig, als im Juni 1989<br />
der Volksaufstand auf dem Platz des<br />
Himmlischen Friedens niedergeschlagen<br />
wurde. Er emigrierte nach New York,<br />
von wo aus er seit 2007 wieder ein Atelier<br />
auch in Peking unterhält. Nur im transkulturellen<br />
Grenzgang ist Kunst in den<br />
Schwellenländern möglich. Es ist Ethnozentrismus<br />
wider Willen: So global sich<br />
das Kunstsystem auch versteht, es ruht<br />
auf politischen Wertvorstellungen des<br />
Westens. In jedem Kunstwerk ist die Erklärung<br />
der Menschenrechte als Kleingedrucktes<br />
eingeschrieben. Kunst der Gegenwart<br />
kann nur da entstehen, wo das<br />
Kapital zur Selbstkritik fähig ist.<br />
Momentan gehört das Skulpturenpaar<br />
Barry Lam, einem Computermagnaten<br />
aus Taiwan, der das Werk dem MASS<br />
MoCA auslieh, damit, so nebenher, seiner<br />
Neuerwerbung Markt- und Diskurswert<br />
nachgetankt werde. Gegenwartskunst<br />
bleibt unterwegs. Die riesigen Holzcontainer,<br />
in denen die zwei Phönixe von China<br />
nach Massachusetts verschifft wurden, stehen<br />
bereit in der Halle 5, selber ein Phönix:<br />
Die zur Kunsthalle umgebaute Elektrofabrik<br />
hatte in den besten Zeiten mehr<br />
als 4000 Arbeiter beschäftigt – bis die Produktion<br />
von Elektronik in Billiglohnländer<br />
wie China abwanderte. Hier, in einer<br />
neuenglischen Industriebrache, hängen<br />
jetzt zwei Abfallassemblagen, gefertigt aus<br />
Werkzeugen chinesischer Wanderarbeiter,<br />
und klagen den Ort ein, für den sie bestimmt<br />
waren.<br />
B e at W y s s<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt in Karlsruhe<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 133
| S a l o n | M a c h t k r i t i k u n d V e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e<br />
kapitale Ignoranz<br />
Linker Antikapitalismus ist gerade sehr en vogue. Er hat jedoch – zwischen<br />
David Graeber, Sahra Wagenknecht, Dietmar Dath und Frank Schirrmacher – viele<br />
blinde Flecken. Die Linke versteht nichts von der Macht, die sie kritisiert<br />
von ernst-Wilhelm Händler<br />
134 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Illustration: Jens Bonnke<br />
N<br />
ach Ansicht der Linken ist der Kapitalismus am Ende,<br />
moralisch bankrott und funktioniert nicht mehr. Dabei<br />
sind die Linken traditionell zersplittert in ihrem<br />
Bestreben, ihn abzuschaffen und durch etwas anderes<br />
zu ersetzen. Aber in jüngster Zeit gibt es doch<br />
etwas, worauf sich die unterschiedlichsten linken Strömungen<br />
einigen können: die Analyse des kapitalistischen Ist-Zustands<br />
durch David Graebers „Schulden – Die ersten 5000 Jahre“. Dieses<br />
durchaus mittelmäßige Buch dient als neue Bibel des linken<br />
Antikapitalismus.<br />
Die Funktion des Geldes besteht bei Graeber darin, Unterordnungsverhältnisse<br />
zu schaffen. Der Gläubiger hat die Macht, und<br />
er gebraucht sie, um den Schuldner zu einem<br />
bestimmten Verhalten zu zwingen. Graebers<br />
Leitgedanke ist die Verschränkung von finanziellen<br />
Schuldverhältnissen mit individueller<br />
und kollektiver Gewalt. Er formuliert: „Kapitalismus<br />
… ist grundsätzlich ein System von<br />
Macht und Ausschluss.“ Diese Beschreibung<br />
trifft zu, gilt aber keineswegs ausschließlich<br />
für den Kapitalismus, wie Graeber behauptet.<br />
In jeder dauerhaften Gesellschaftsform, die<br />
der Planet bisher gesehen hat, gibt es Mitglieder<br />
mit mehr und solche mit weniger Macht.<br />
Die illiteraten Gesellschaften am Anfang der<br />
Menschheitsgeschichte waren in hohem Maß<br />
durch situativen physischen Zwang reguliert.<br />
Der Stärkste hatte das Sagen und machte von<br />
seiner Stärke Gebrauch. Die Geldbeziehungen<br />
emanzipierten den Menschen auch von<br />
der Anwendung kurzsichtiger, unmittelbarer<br />
körperlicher Gewalt. Geld erschloss von Beginn<br />
an individuelle Freiheitsräume. Pasion etwa, von 400 v. Chr.<br />
bis zu seinem Tod 370 v. Chr. der bekannteste Bankier Athens,<br />
war ein freigelassener Sklave. Diese Freiheitskarriere kommt in<br />
„Schulden“ nicht vor.<br />
Das Buch „Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und<br />
Idee “ von Dietmar Dath und Barbara Kirchner trifft sich mit<br />
„Schulden“ in der Betonung der Unfreiheit. Die Gesellschaft besteht<br />
nach Auffassung der Autoren aus zwei Klassen. Eine kleine<br />
Minderheit von Besitzenden verfügt über die Güter, mit denen<br />
andere Güter erzeugt werden können, Grund und Boden sowie<br />
Hardware-Technologie. Die große Mehrheit der Nichtbesitzenden<br />
hat nur ihre Arbeitskraft. Allein Besitz verleiht Macht und<br />
Unabhängigkeit. Nichtbesitz ist gleichbedeutend mit Ohnmacht.<br />
Diese klassische marxistische Analyse ist jedoch unbedingt<br />
zu ergänzen um den im linken Antikapitalismus oft ausgesparten<br />
Faktor Information. Software, Patente und andere Rechtstitel,<br />
überhaupt Know-how, stellen ebenfalls Produktionsmittel<br />
dar, mit denen Gewinne erzielt werden können. Mit dieser<br />
Die linke<br />
Gleichung<br />
„Mehr Besitz<br />
gleich mehr<br />
Macht“<br />
stimmt<br />
eben nicht<br />
automatisch<br />
unerlässlichen Anpassung stimmt die Behauptung: Die Mitglieder<br />
der Klasse der Besitzenden verfügen über mehr Möglichkeiten<br />
als die Mitglieder der Klasse der Nichtbesitzenden.<br />
Aber welchen Nutzen bringt denn diese Begrifflichkeit? Gar<br />
nicht selten lassen sich die besitzende und die nichtbesitzende<br />
Klasse nur mit erheblicher Willkür abgrenzen. Im Manchester-<br />
Kapitalismus war klar, wem die Fabrik gehörte. In unserem Jahrhundert<br />
investiert eine Venture-Capital-Gesellschaft in 20 Startups.<br />
Es gehört zum Geschäftsmodell, dass 18 Firmen nach zwei<br />
Jahren liquidiert werden, zwei Firmen dafür jedoch explosionsartig<br />
wachsen. Welche Gründer gehören zum Zeitpunkt der Investition<br />
zu den Besitzenden? Der technische Fortschritt sorgt<br />
dafür, dass ständig neue, profitable Firmen<br />
entstehen und alte Firmen unprofitabel werden.<br />
Aus Nichtbesitzenden werden Besitzende,<br />
aber es werden auch Besitzende zu<br />
Nichtbesitzenden.<br />
Die Gleichung „Mehr Besitz gleich mehr<br />
Macht“ stimmt nicht automatisch. Der Halter<br />
eines Aktienpakets an einer Publikumsgesellschaft<br />
hat keinen Einfluss auf den Geschäftsgang,<br />
wenn sein Anteil unterhalb einer<br />
Sperrminorität liegt. Der angestellte Manager<br />
der Publikumsgesellschaft besitzt ungleich<br />
mehr Macht als der Aktionär, auch wenn er<br />
kein Vermögen aufbaut, sondern nur teure<br />
Autos kauft.<br />
Die Linke hat einen unfruchtbaren Begriff<br />
von Gesellschaft. Sie konstruiert das Verhältnis<br />
von Gesellschaft und Einzelnen als<br />
Beziehung zwischen einem Ganzen und dessen<br />
Teilen. Die Gesellschaft wird lediglich als<br />
die Summe der Einzelmenschen gedacht. Diese reduktionistische<br />
Vorstellung wird mit einer ungeeigneten Konzeption von<br />
Kausalität kombiniert. Die Gesellschaft soll kausal geschlossen<br />
sein in dem Sinn, dass sich alle gesellschaftlichen Phänomene<br />
als Wirkungen zurechenbarer Handlungen von Einzelnen ergeben.<br />
Dabei ist die Annahme der kausalen Geschlossenheit keine<br />
Hypothese, die durch Erfahrung widerlegt werden könnte, sondern<br />
eine Verfahrensregel.<br />
Nach dem vermeintlichen Vorbild der Naturwissenschaften ist<br />
im linken Antikapitalismus eine Erklärung dann besonders sachhaltig,<br />
wenn kleine Ursachen große Wirkungen haben. Tatsächlich<br />
aber führt Reichtum allein weder zu Bedeutung noch zu<br />
Einfluss. Der Missbrauch des Gläubiger-Schuldner-Verhältnisses<br />
aus moralischer Sicht ist keine anthropologische Konstante.<br />
Die Aufklärung, die Ideale des Rechtstaats und der Menschenrechte<br />
haben viel dazu beigetragen, dieses ökonomische Verhältnis<br />
ethisch zu regulieren.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 135
| S a l o n | M a c h t k r i t i k u n d v e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e<br />
In der Gesellschaft handeln<br />
keineswegs nur Einzelne, sondern<br />
auch Zusammenschlüsse von Einzelnen<br />
wie etwa Firmen und Institutionen.<br />
Man kann von Netzwerken<br />
sprechen, zu denen nicht<br />
nur die Menschen, sondern auch<br />
Dinge – etwa Maschinen – und<br />
Ideen – etwa Programme – gehören.<br />
Die Linke vollzieht einen logischen<br />
Fehlschluss vom Sollen zum<br />
Sein. Gemäß westlichen Moralvorstellungen<br />
ist der Einzelmensch das<br />
mit Abstand wichtigste Element<br />
von oder für Gesellschaft. Aber deswegen<br />
muss die Gesellschaft nicht<br />
ausschließlich aus Einzelnen bestehen.<br />
So, wie die Linke es sich vorstellt,<br />
funktioniert Gesellschaftsanalyse<br />
nicht. Die Linke übersieht:<br />
Zusammenschlüsse von Einzelnen<br />
entwickeln grundsätzlich ein<br />
Eigenleben. Eine Institution und<br />
eine Firma sind immer mehr als<br />
die Summen ihrer Mitglieder. Das<br />
gilt auch für das Ganze der Gesellschaft.<br />
Sie ist immer mehr als der<br />
Wille der ökonomischen Elite.<br />
Wo will die Linke hin? Graeber<br />
legt eine Maxime nahe: Schulden,<br />
die durch irgendeine Art von<br />
Zwang zustande gekommen sind,<br />
müssen nicht beglichen werden. Niemand hat jedoch bekanntlich<br />
die griechischen Regierungen gezwungen, Geld aufzunehmen,<br />
das der Staat nicht zurückzahlen kann. Wenn jemand eine<br />
Schuldenlast trägt, die ihm unter Zwang aufgebürdet wurde,<br />
dann ist es nach jeder ethischen Intuition gerecht, ihm die Schulden<br />
zu erlassen. Die Schulden, die die momentane Krise ausmachen,<br />
sind aber nicht unter Zwangsbedingungen zustande<br />
gekommen. Aus der historischen Analyse Grae bers folgt nichts<br />
Wegweisendes für die Gegenwart, geschweige denn für die Zukunft<br />
des Kapitalismus.<br />
Das Vakuum zwischen Ist- und Sollzustand der Gesellschaft<br />
wird gern auf krude Weise gefüllt. Modellhaft sind die Vorstellungen<br />
Sahra Wagenknechts. Egal, ob es eine besitzende Klasse<br />
gibt, die die ganze Macht hat oder nicht, man muss sie abschaffen.<br />
Das Mittel ist eine Erbschaftsteuer von 100 Prozent auf alles, was<br />
im Erbschaftsfall den Betrag von einer Million Euro übersteigt.<br />
Eine solche Regelung würde dazu führen, dass es keine ökonomischen<br />
Werte von über einer Million mehr gibt. Warum sollte<br />
ein Unternehmer eine Firma für zehn Millionen kaufen, wenn<br />
er weiß, dass die Firma sowieso, mit oder ohne Besitzwechsel, in<br />
ein paar Jahren an die Belegschaft oder an den Staat fällt – sofern<br />
sie weiterexistiert?<br />
Mit seinem Buch „Ego“ hat auch Frank Schirrmacher um<br />
Aufnahme in den ziemlich großen Club der fundamentalen<br />
Die Linke übersieht:<br />
Gesellschaft ist<br />
immer mehr als<br />
der Wille der<br />
ökonomischen Elite<br />
Kapitalismuskritiker angesucht,<br />
dafür jedoch als Mitherausgeber<br />
der FAZ einen exklusiven Mitgliedstatus<br />
erhalten. Die „informationskapitalistische“<br />
Gesellschaft besteht<br />
bei ihm aus zwei Sorten von<br />
Akteuren: „Nummer 2“ soll der<br />
Nachfolger des bisher bekannten<br />
Einzelmenschen sein, die fleischgewordene<br />
Version von mathematischen<br />
Modellen wie demjenigen<br />
des Homo oeco nomicus. Seine<br />
Analyse ist nicht mehr der Idee<br />
der kausalen Geschlossenheit der<br />
Gesellschaft verhaftet, lässt Raum<br />
für unvorhersehbare Ereignisse und<br />
führt so tatsächlich in die Zukunft.<br />
Die Bestandteile der Gesellschaft<br />
aber sollen bei Schirrmacher<br />
immer Agenten sein, die nach Eigennutz<br />
streben. Der Eigennutz<br />
soll den Élan vital aller sozialen<br />
Konfigurationen bilden. Das ist<br />
empirisch nicht einzulösen. Der<br />
Mensch ist nicht nur ein egoistisches,<br />
sondern auch ein altruistisches<br />
Wesen. Es kann keine Rede<br />
davon sein, dass man menschliches<br />
Verhalten nur dann in die Sprache<br />
der Mathematik übersetzen kann,<br />
wenn man von der Prämisse des Eigennutzes<br />
ausgeht.<br />
Der Kapitalismus hat fundierte Kritik dringend nötig. Der<br />
demokratisch verfasste Kapitalismus westlicher Ausprägung<br />
weist der Entfaltung aller Einzelmenschen einen sehr hohen<br />
Stellenwert zu. Was die Verwirklichung dieses Zieles angeht,<br />
genügt er allerdings seinen eigenen Maßstäben nicht. Ein Kapitalismus,<br />
der sich nicht selbst destabilisieren will, muss massiv<br />
in Regeln und Anreize investieren, die rücksichtsloses Verhalten<br />
begrenzen.<br />
Die Voraussetzung für wirksame Regulierungen ist eine adäquate<br />
Erfassung der tatsächlichen gesellschaftlichen Wirkungszusammenhänge.<br />
Theoretische Machtanalysen gibt es, von Foucault<br />
bis Luhmann, im Überangebot. Was jetzt nottut, sind empirische<br />
Machtanalysen: Welche Elemente der Gesellschaft haben in<br />
der Gegenwart aufgrund welcher Voraussetzungen welche Macht,<br />
nach welchen Maßgaben handhaben sie diese? Wie können diese<br />
Maßgaben nach den erlebten Auswüchsen verändert werden? Intellektuell<br />
unscharfe Pauschalkritik am Geld und Verschwörungstheorien,<br />
die alle Macht bei einer kleinen, geschlossenen Gruppe<br />
von Vermögenden sehen, sind nicht hilfreich.<br />
ernst-Wilhelm Händler<br />
ist Schriftsteller. Soeben erschien sein Roman<br />
„Der Überlebende“ (S. Fischer)<br />
Illustration: Jens Bonnke; Foto: Thomas Dashuber/Agentur Focus<br />
136 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Jetzt<br />
im<br />
Handel.<br />
RELIGION Heilige Haine und bizarres Göttergewimmel<br />
MOORLEICHEN Glücksfälle für die Archäologen<br />
GOTEN Lange Wanderschaft ins Mittelalter<br />
www.spiegel-geschichte.de
| S a l o n | Z ü l f ü L i v a n e l i<br />
Erdogans Stachel<br />
Der Künstler Zülfü Livaneli kämpft gegen die Einschränkung von Demokratie<br />
und Meinungsfreiheit in der Türkei. Nach Deutschland kommt er nicht gerne<br />
von Necla Kelek<br />
E<br />
s war im Sommer 2006 auf dem<br />
von Salman Rushdie organisierten<br />
Literaturfestival in New York.<br />
Ich las im Goethe-Institut aus<br />
meinem Buch „Die fremde Braut“<br />
und sprach über muslimische Frauen in<br />
Deutschland und der Türkei und über<br />
den Islam. Zülfü Livaneli sollte mit mir<br />
diskutieren. Er kam zu spät, wusste nicht,<br />
was ich gelesen hatte, und sagte, die türkische<br />
Frau sei modern und selbstbewusst.<br />
Livaneli argumentierte wie die meisten türkischen<br />
Intellektuellen, wenn sie im Ausland<br />
sind. Er erklärte die Ehrenmorde zu<br />
einem „internationalen Problem“. Das erregte<br />
meinen Widerspruch. Livaneli wollte<br />
den Fortschritt sehen, ich auf die Probleme<br />
und Missstände hinweisen.<br />
Was ich damals nicht wusste, war, dass<br />
Livaneli einen Roman über Ehrenmorde<br />
in der Türkei geschrieben hatte. „Glückseligkeit“<br />
handelt davon, wie in Anatolien<br />
die junge Meryem von ihrer Familie in einem<br />
Stall gefangen gehalten wird. Ihr Onkel,<br />
der Clanchef, hat sie vergewaltigt. Jetzt<br />
soll sie sterben, damit die „Ehre“ der Familie<br />
wiederhergestellt wird. Umbringen soll<br />
sie ihr vom Militär zurückgekehrter Cousin.<br />
Livaneli schafft es bereits in dieser inzwischen<br />
verfilmten Geschichte, aktuelle<br />
gesellschaftliche Themen in eine stimmige<br />
Dramaturgie zu bringen. Auch sein gerade<br />
erschienener Roman „Serenade für Nadja“<br />
ist solch ein Thesenroman, der menschlich<br />
anrührende Schicksale in Figuren kleidet<br />
und sie politisch existenzielle Dinge verhandeln<br />
lässt.<br />
In „Serenade für Nadja“ nimmt sich<br />
Livaneli, obwohl es sich im Kern um ein<br />
Zwei-Personen-Stück handelt, mehrerer<br />
großer Themen der Weltgeschichte an. Der<br />
alte deutschstämmige Professor Wagner<br />
„Die AKP-Leute erwarten, dass die Menschen dankbar sind. Wer sie kritisiert,<br />
bekommt Probleme“: Zülfü Livaneli, Sänger, Schriftsteller und Regisseur<br />
kommt aus den USA zu einem Kongress<br />
nach Istanbul und wird von Maja, die an<br />
der Universität für die Betreuung ausländischer<br />
Gäste zuständig ist, begleitet. Wagner<br />
will sich mit einer auf der Geige gespielten<br />
Serenade von seiner Frau Nadja verabschieden,<br />
die 1942 zusammen mit über 700 anderen<br />
jüdischen Flüchtlingen im Schwarzen<br />
Meer vor Sile ertrunken ist.<br />
Es geht in dem Buch um heimatlose<br />
deutsche Professoren in der Türkei in den<br />
Dreißigern, um die von den Deutschen<br />
verfolgten Juden, die türkische Regierung,<br />
die die Flüchtlinge nicht an Land ließ, um<br />
die Engländer, die eine Weiterfahrt des<br />
Schiffes nach Palästina verhinderten, und<br />
um die Russen, die die „Struma“ schließlich<br />
versenkten.<br />
Foto: Jens Gyarmaty/VISUM, picture alliance (Autorin)<br />
138 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Maja wird durch diese Reminiszenz<br />
auch mit der Vergangenheit ihrer Familie<br />
konfrontiert. Sie erfährt, dass eine Großmutter<br />
Armenierin, die andere eine Krimtatarin<br />
war. Diese und andere Geheimnisse<br />
werden auf über 300 Seiten langsam<br />
wie die Schalen einer Zwiebel enthäutet.<br />
Das ist spannend bis zum letzten Satz, der<br />
gleichzeitig das Credo des Romans ist:<br />
„Denn überleben kann nur ein Mensch,<br />
dessen Geschichte erzählt wird.“<br />
Warum treffen diese Fragen erst jetzt<br />
auf so großes Interesse? Es sei der „Zeitgeist“,<br />
sagt Zülfü Livaneli, der sich in der<br />
Türkei geändert habe. Die Leute würden<br />
wieder mehr lesen, seien neugieriger und<br />
ließen sich nicht mehr mit den Atatürk-<br />
Parolen über die Geschichte abspeisen.<br />
Offenbar hat er mit seinen Büchern einen<br />
Weg gefunden, die Menschen zu berühren<br />
und dieses Bedürfnis zu stillen.<br />
Für die Leser sei die deutsch-türkische<br />
Verstrickung im Zweiten Weltkrieg auch<br />
so etwas wie ein zarter Hinweis, dass die<br />
gemeinsame Geschichte nicht erst mit den<br />
Gastarbeitern begonnen habe, sagt Livaneli.<br />
Muss er darauf besonders hinweisen?<br />
„Wenn ich ehrlich bin, komme ich nicht<br />
gerne nach Deutschland“, sagt er. Es gebe<br />
hier fertige Bilder von den Türken. „Demnach<br />
ist der Mann aus Anatolien und Gastarbeiter.<br />
Seine Frau trägt Kopftuch, und<br />
er betet.“ Die Türken wiederum glaubten,<br />
die Deutschen würden ihre Töchter<br />
die schlimmsten Dinge machen lassen und<br />
bezeichneten das als „Freiheit“. Halb amüsiert,<br />
halb erschrocken reagiert Livaneli<br />
darauf, wie er selbst in Deutschland gesehen<br />
wird. Eine große Tageszeitung wollte<br />
ein Interview und Fotos mit ihm machen.<br />
Der Fotograf hatte die Idee, Livaneli in einem<br />
Dönerladen zu fotografieren. „Warum<br />
soll ich einen Döner in der Hand halten“,<br />
fragte sich Livaneli, „wo ich doch Vegetarier<br />
bin? Wenn Bob Dylan nach <strong>Berlin</strong><br />
kommt, fotografieren Sie ihn doch auch<br />
nicht bei McDonalds.“<br />
In der Türkei ist der 66-Jährige seit<br />
Jahrzehnten eine Legende und der Vergleich<br />
mit Bob Dylan nicht kokett, sondern<br />
legitim. 1974 veröffentlichte Livaneli<br />
sein erstes von bisher fast 30 Alben als Liedermacher<br />
mit revolutionären Liedern. Es<br />
waren die Zeiten, als rechte und linke Organisationen<br />
darum stritten, wer in der<br />
Türkei für die Revolution zuständig sei,<br />
und schließlich das Militär mit mehreren<br />
Putschen allen zeigte, wer Herr im Land<br />
ist. Livaneli verlegte kritische Bücher, kam<br />
ins Gefängnis und musste fliehen. Mehrere<br />
Jahre lebte er in Schweden, Frankreich und<br />
Griechenland. Als er 1984 in die Türkei zurückkehren<br />
konnte, erlebte das Land das<br />
bisher größte Konzert seiner Geschichte.<br />
Mehr als eine Million Menschen hießen<br />
den Sänger willkommen.<br />
Was er mit der griechischen Sängerin<br />
Maria Farantouri begonnen hatte, setzte er<br />
mit dem Komponisten Mikis Theodorakis<br />
fort. Jeder sang die Lieder des anderen, sie<br />
komponierten füreinander, traten in Griechenland<br />
und der Türkei zusammen auf,<br />
nahmen gemeinsam Platten auf, die bald in<br />
jedem türkischen wie griechischen Haushalt<br />
gespielt wurden, der über einen Plattenspieler<br />
verfügte. Ihnen gelang, was die<br />
Politiker nicht schafften: eine neue Freundschaft<br />
zwischen Griechen und Türken zu<br />
begründen.<br />
Trotz Büchern, Filmen und Konzerten<br />
wollte Livaneli immer auch das Schwierigste<br />
wagen und die Welt verändern. Er<br />
ließ sich daher 1994 überreden, zur Bürgermeisterwahl<br />
in Istanbul anzutreten. Er kandidierte<br />
für die kleine sozialdemokratische<br />
SHP, lag in den Umfragen vorn und verlor<br />
dennoch. Man sprach von Wahlmanipulationen.<br />
Gewonnen hatte der Kandidat der<br />
Wohlfahrtspartei: Recep Tayyip Erdoğan,<br />
heute als AKP-Vorsitzender und Ministerpräsident<br />
mächtigster Mann der Türkei.<br />
Wie beurteilt Livaneli die Lage im Land<br />
und Erdoğans Politik? „Die türkische Gesellschaft<br />
driftet in drei große Blöcke auseinander.“<br />
Zum einen seien da die bisher<br />
bestimmenden Säkularen, die weltlich und<br />
westlich orientierten Eliten in den Großstädten<br />
und an der Ägäis. Zum anderen die<br />
islamisch orientierte Landbevölkerung, die<br />
es auch in die Städte ziehe, und schließlich<br />
die Kurden, die sich von beiden Gruppen<br />
absetzten.<br />
Der Türkei geht es aber doch wirtschaftlich<br />
besser, seit die AKP regiert,<br />
oder? „Ja, Erdoğans Leute in Verwaltung<br />
und Wirtschaft machen eine kluge Politik.<br />
Sie erfüllen die Erwartungen des Volkes,<br />
gewähren großzügig Kredite, bauen Straßen,<br />
haben das Gesundheitswesen und die<br />
Rente reformiert.“ Gleichzeitig finde eine<br />
Art ziviler Putsch statt. Still und leise würden<br />
an den entscheidenden Stellen die Verantwortlichen<br />
ausgetauscht und mit Parteigängern<br />
der AKP besetzt. „Demokratie<br />
und Meinungsfreiheit werden immer stärker<br />
eingeschränkt. Die AKP-Leute erwarten,<br />
dass die Menschen dankbar sind. Wer<br />
sie kritisiert, bekommt Probleme.“ Hunderte<br />
Journalisten und über 9000 Kurden<br />
seien in Haft. Wer in der Türkei angeklagt<br />
wird, für den gelte nicht wie in Deutschland<br />
die Unschuldsvermutung, sondern der<br />
gelte vom ersten Tag an als schuldig.<br />
Ist Erdoğan ein kluger Staatsmann oder<br />
ein Islamist? „Er ist klüger, als wir alle gedacht<br />
haben“, sagt Livaneli lächelnd. „Er<br />
hat eine Vision, er weiß, was er will, und<br />
ist tief in seinem Herzen ein traditioneller<br />
Muslim.“ Er wolle als der Führer der muslimisch-arabischen<br />
Welt anerkannt werden<br />
und deren Interessen durchsetzen. „Von<br />
den Europäern will er technischen Fortschritt<br />
und Geld. Die Europäer wiederum<br />
akzeptieren ihn, weil er ihnen den Türken<br />
gibt, den einfachen Anatolier, wie man ihn<br />
hier erwartet und kennt. Die andere Türkei,<br />
die Goethe oder Kleist liebt, und die<br />
Türkei von Yaşar Kemal treten hinter diesem<br />
Bild zurück.“<br />
Und die politische Opposition? Hängt<br />
ihr Unvermögen mit Erdoğans autoritärer<br />
Politik zusammen, oder ist die AKP so<br />
stark, weil die republikanische CHP so<br />
schwach ist? „Die CHP, die jahrzehntelang<br />
die türkische Politik in Atatürks Sinne<br />
dominiert hat“, sagt Livaneli, „ist eigentlich<br />
Geschichte.“ Mit ihr sei ein Eintreten<br />
für Menschen- oder Frauenrechte oder der<br />
EU-Beitritt nicht zu machen. Sie gebe sich<br />
zwar immer noch sozialdemokratisch, sei<br />
aber nationalistisch. „Die SPD in Deutschland<br />
hatte die Arbeiterbewegung im Hintergrund,<br />
die Basis der CHP sind das Militär<br />
und der Kemalismus.“<br />
Was ist mit den Türken in Deutschland?<br />
„Wenn unsere Landsleute, anstatt an<br />
ihren Traditionen und archaischen Sitten<br />
und Bräuchen festzuhalten, die Chance genutzt<br />
hätten, etwas von der Kultur in diesem<br />
Land aufzunehmen, dann hätte auch<br />
die Türkei etwas davon.“ Aber auch den<br />
Deutschen scheine das egal zu sein. „Können<br />
Sie mir sagen“, fragt Livaneli, „warum<br />
die Deutschen von den Türken nicht mehr<br />
erwarten?“<br />
Necla kelek ist Sozialwissenschaftlerin<br />
und Frauenrechtlerin.<br />
Zuletzt erschien von ihr:<br />
„Hurriya heißt Freiheit. Die arabische<br />
Revolte und die Frauen“<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 139
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Eine Fackel,<br />
die nie<br />
verlöscht<br />
Der österreichische Essayist und Schriftsteller<br />
Karl-Markus Gauß lebt, schläft und arbeitet<br />
in einer Welt der Bücher. Sie erinnern ihn an<br />
sich selbst und halten das Denken im Fluss<br />
Von Vladimir Vertlib<br />
V<br />
on ihrem ersten Gehalt als Lehrerin kaufte Maresi, damals<br />
23 Jahre alt, ihrem Freund, dem Studenten Karl-<br />
Markus, eine 13-bändige Reprint-Ausgabe der legendären<br />
Zeitschrift Die Fackel. Karl-Markus erinnert sich<br />
noch gut, wie ihm Maresi das 35 Kilo schwere Paket<br />
überreichte. Sie hatte es mit dem Fahrrad von der Buchhandlung<br />
zu seiner Wohnung transportiert. Inzwischen sind die beiden seit<br />
35 Jahren ein Paar. Der einstige Student der Geschichte und Germanistik<br />
ist der bekannte österreichische Kritiker, Schriftsteller<br />
und preisgekrönte Essayist Karl-Markus Gauß. In der gemeinsamen<br />
Fünf-Zimmer-Wohnung im gutbürgerlichen Salzburger<br />
Bezirk Riedenburg stehen etwa 11 000 Bücher, eine stattliche<br />
Bibliothek, die „ganz eng mit der Beziehung“ zusammenhänge,<br />
haben doch Maresi und er in ihrer Jugend das meiste Geld für<br />
Bücher ausgegeben – und für Wein. Heute bekomme er die meisten<br />
neuen Bücher als Rezensionsexemplare zugeschickt, was den<br />
„kompakten, biografisch bedingten, persönlich gefärbten Charakter<br />
der Bibliothek“ etwas zerstöre. Denn auch jene Bücher,<br />
die ihm nicht gefallen oder die er nicht liest, könne er niemals<br />
wegwerfen …<br />
Die 13 weinrot gebundenen Fackel-Bände bilden den Kern der<br />
Gauß’schen Bibliothek. Durch die Lektüre der von Karl Kraus in<br />
den Jahren 1899 bis 1936 herausgegebenen satirischen Zeitschrift<br />
entwickelte Gauß sein besonderes Verhältnis zur Sprache: „Es war<br />
die Erkenntnis, dass man in der Kritik, auch wenn es um die Kritik<br />
von Haltungen geht, Ross und Reiter nennen muss, weil sich<br />
140 <strong>Cicero</strong> 5.2013
Vorteile des Altbaus: Bis zu zehn Buchreihen kann Karl-Markus Gauß in seiner Wohnung übereinander anbringen, der hohen Decke sei Dank<br />
Foto: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
Missstände in bestimmten Personen manifestieren. Man darf nicht<br />
drum herumreden.“<br />
In seinem Fackel-Jahr 1981 las Gauß alle 922 Nummern der<br />
Zeitschrift. In einem „Fackel-Fahrplan“ – Notizbüchern in A5-<br />
Format mit hartem Einband – kommentierte er mit jugendlichem<br />
Eifer jede einzelne Nummer, exzerpierte besonders glänzende Gedanken<br />
und Formulierungen, schärfte seinen eigenen Stil an jenem<br />
von Kraus. „Zu Kraus“, erklärt Gauß, „kann man jedoch nur<br />
dann eine sinnvolle Beziehung bewahren, wenn man ihn und seinen<br />
unglaublich autoritären Habitus zu kritisieren weiß.“<br />
Das deutliche, pointierte Formulieren ist ein Markenzeichen des<br />
1954 in Salzburg geborenen Autors Gauß. Seine Auseinandersetzung<br />
mit der modernen Gesellschaft und den politischen Verhältnissen<br />
in Österreich und anderswo (etwa im Essay-Tagebuch von 2012,<br />
„Ruhm am Nachmittag“), mit sozialen Missständen, mit nationalen<br />
Minderheiten an den Rändern Europas oder den Roma in der<br />
Slowakei („Die Hundeesser von Svinia“, 2004) öffnet trotz der oftmals<br />
bitterbösen Kommentare Denkräume, in denen der Leser zum<br />
Mitgestalten der Welt angeregt wird. Im kommenden Herbst wird<br />
„Das Erste, was ich sah“ erscheinen – ein autobiografischer Bericht<br />
mit 45 Bildern und Szenen einer Kindheit.<br />
Dass solche Texte entstehen können, ist nicht zuletzt dem<br />
Wohn-, Arbeits- und Bibliotheksraum zu verdanken, in dem der<br />
Bonvivant und luzide Denker zu Hause ist. Die einzelnen Bereiche<br />
sind nicht voneinander zu trennen. Der Schreibtisch des Autors<br />
steht im Schlafzimmer, welches gleichzeitig – wie auch drei<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 141
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Dumme Menschen und böse Absichten, sagt Gauß, kann man an der Sprache erkennen. Theodor Kramer hat da<br />
nichts zu befürchten. Die Erstausgabe von 1936 trägt eine Widmung des klugen und leidenschaftlichen Lyrikers<br />
der vier anderen Räume der Wohnung – als Bibliothek genutzt<br />
wird. Die hohen Decken im Altbau aus dem Jahre 1894 schaffen<br />
Raum für Regale mit bis zu zehn Buchreihen übereinander. „Ich<br />
baue meine Bibliothek nach etwas auf, das ich sonst ablehne, nach<br />
nationalen Kriterien“, erklärt der Autor. Die Zuordnung ist jedoch<br />
eigenwillig. So gibt es einen Bereich, der „Jugoslawien“ gewidmet<br />
ist, weil Gauß, dessen Eltern Donauschwaben waren, den Zerfall<br />
des Vielvölkerstaats bibliothekarisch nicht zur Kenntnis nehmen<br />
möchte. Der seichte Unterhalter Ephraim Kishon wurde „mit einer<br />
gewissen Gehässigkeit“ nicht ins israelische, sondern ins deutsche<br />
Regal gestellt, weil „er dort besser hineinpasst“.<br />
Im Wohnzimmer ist eine ganze Wand ausschließlich der österreichischen<br />
Literatur gewidmet. Ordentlich gereiht und alphabetisch<br />
geordnet, findet man alte und moderne Klassiker neben<br />
weniger Bekannten (zum Beispiel dem Expressionisten Robert<br />
Müller), vor allem aber die Werke vieler Exilautoren oder jener,<br />
die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewesen waren,<br />
wie Franz Kain oder Ernst Lothar. Die Deutschen wurden weit<br />
nach oben, auf die wenigen Regalbretter über der Tür oder oberhalb<br />
der zahlreichen Bilder verbannt. „Da kommt man schwer hinauf“,<br />
meint Gauß augenzwinkernd, bekennt aber, dass er Autoren<br />
wie Wilhelm Genazino oder Peter Weiss zu den ganz Großen<br />
ihres Faches zählt. Wie Weiss in seinen avantgardistischen Texten<br />
„Abschied von den Eltern“ oder „Fluchtpunkt“ seine persönliche<br />
Geschichte mit den großen gesellschaftlichen Problemen in<br />
Verbindung bringt und in einen historischen Kontext stellt, habe<br />
auch seine eigene Haltung geprägt.<br />
In vielen seiner Essays versucht Gauß, subjektive Erfahrungen<br />
und Erlebnisse festzuhalten, hat dabei aber stets den Ehrgeiz, dass<br />
alles, was sich in der Welt ereignet, auf seine Persönlichkeit zurückwirkt:<br />
„Ich versuche stets, meine Stellung zur und in der Welt zu<br />
begreifen.“ Dass das Stöbern in der Bibliothek dazugehört, versteht<br />
sich von selbst. Für Bücher, die ihm zugeschickt werden, nimmt<br />
sich Gauß Zeit. Bis zu acht Stunden lang studiert er regelmäßig –<br />
Rotwein trinkend – ohne Unterbrechung die Neuerscheinungen.<br />
Manchmal kommen ihm Ideen, die durch „irgendetwas angeregt<br />
werden“. Eines ist für ihn jedenfalls gewiss: „Dummheit und böse<br />
Absichten von Menschen kann man an ihrer Sprache erkennen.“<br />
Die Gauß’sche Wohnung nimmt zwei Stockwerke ein. Die<br />
Wand neben der Treppe, die vom Esszimmer in den oberen Bereich<br />
führt, ist zwar zu einem großen Teil den „kleineren“ Literaturen,<br />
jenen Islands, Norwegens oder der Schweiz, vorbehalten. In einer<br />
„österreichischen Ecke“ befindet sich jedoch eine echte Rarität, eine<br />
wunderbare Erstausgabe von Theodor Kramers Lyrikband „Mit<br />
der Ziehharmonika“ aus dem Jahre 1936 mit einer Widmung des<br />
Autors an den Schriftstellerkollegen Michael Guttenbrunner vom<br />
12. Oktober 1957 und dessen Weiterwidmung mit den knappen<br />
Worten „Meinen Dankesruf, lieber Gauß!“ aus dem Jahre 1998.<br />
Der Dank galt einem Porträt, das Gauß für die Neue Zürcher<br />
Zeitung über den damals noch stark unterschätzten Guttenbrunner<br />
geschrieben hatte. So nahm das Buch schließlich auf Umwegen<br />
den ihm gebührenden Platz ein, zu dem man allerdings über die<br />
Treppe emporsteigen muss – eine stimmige Symbolik, war doch<br />
der Lebensweg des aus Niederösterreich stammenden jüdischen<br />
„Heimatdichters“ Theodor Kramer, dessen sozialkritische Außenseitergedichte<br />
lange Zeit in Vergessenheit geraten waren, voller<br />
Umwege. Sie führten ihn unter anderem 1939 ins englische Exil<br />
und schließlich 1957 nach Österreich zurück, wo er 1958 verstarb.<br />
Erst in den achtziger Jahren wurde Kramer wiederentdeckt<br />
und auf den ihm angemessenen Platz in der österreichischen Literatur<br />
emporgehoben.<br />
Gauß hat zu seiner Lektüre eine „stark assoziative Verbindung“,<br />
die sich jedoch von den Büchern selbst oder deren Inhalten emanzipiert<br />
hat. Jedes wichtige Buch ordnet er einer bestimmten Phase<br />
seines Lebens zu. Mit dem erwähnten Theodor-Kramer-Band assoziiert<br />
er jene Zeit Ende der neunziger Jahre, als die beiden Kinder<br />
alt genug waren, dass die Eltern sie allein zu Hause lassen<br />
konnten, um ins Wirtshaus oder ins Kino zu gehen. „Wenn ich<br />
dieses Buch in die Hand nehme, fällt mir das ein“, sagt er. „Maresi<br />
und ich hatten auf einmal wieder viel mehr Zeit füreinander.“<br />
So ist für den Autor das Abschreiten der eigenen Bibliothek immer<br />
auch eine Reise in die eigene Vergangenheit, ein emotionales<br />
literarisch-biografisches Wiederfinden, das den Blick in die Zukunft<br />
ermöglicht.<br />
Vladimir Vertlib<br />
ist Schriftsteller. Er veröffentlichte unter anderem die<br />
Romane „Letzter Wunsch“ und „Schimons Schweigen“<br />
und den Essayband „Ich und die Eingeborenen“<br />
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong>, Privat (Autor)<br />
142 <strong>Cicero</strong> 5.2013
ZEIG FLAGGE FÜR<br />
FRAUEN!<br />
Ägyptens Frauen kämpfen für<br />
gleiche Rechte.<br />
Du kannst sie unterstützen.<br />
amnesty.de/aegypten<br />
FÜR ÄGYPTENS ZUKUNFT.
144 <strong>Cicero</strong> 5.2013
D i e l e t z t e n 2 4 S t u n d e n | S a l o n |<br />
Ab nach Kassel<br />
Am Ende braucht Hubertus Meyer-Burckhardt Ahle Worschd und<br />
gute Freunde, Neil Diamond und Rod Stewart. Und er wird auf<br />
seine Mutter anstoßen. Weil Glück eine Frage der Entscheidung ist<br />
Foto: David Maupilé für <strong>Cicero</strong><br />
T<br />
homas Hermanns, las ich im <strong>Cicero</strong>,<br />
geht nach New York, wenn<br />
der finale Countdown beginnt.<br />
Bei mir muss es Kassel sein. Ich war zu<br />
lange unterwegs; ich will, wenn’s zu Ende<br />
geht, nach Hause. Ich schiebe also Neil<br />
Diamonds Spätwerk „Home before dark“<br />
in den CD-Player und fahre mit dem<br />
Wagen die 340 Kilometer von Hamburg<br />
nach Kassel, in meine Geburtsstadt. Unterwegs<br />
rufe ich meinen Freund Sandro<br />
Convertino an und bitte ihn, sein „La<br />
Bruschetta“ für 24 Stunden von Hamburg-Winterhude<br />
nach Kassel-Wilhelmshöhe<br />
umzusiedeln. Ich werde ihn bitten,<br />
mitten im Habichtswald, nahe der Löwenburg<br />
einen langen Tisch aufzustellen,<br />
an dem 25 Personen Platz finden können.<br />
Da kommen dann Menschen zusammen,<br />
die mir gutgetan haben. Manche<br />
kommen inkognito, andere dürfen genannt<br />
werden, Marianne Sägebrecht etwa,<br />
Harald Wieser, in jedem Fall Wolfgang<br />
Rademann, vielleicht Hermine Zehl, Stefan<br />
Hunstein. Und die drei Ritter der Tafelrunde,<br />
die engsten der Engen, deren<br />
Namen nichts zur Sache tun. Ich werde<br />
sie bitten, Dorothee in ihre Mitte zu nehmen,<br />
meine Kinder zu umarmen und gemeinsam<br />
meine drei All-Time-Favourites<br />
von Rod Stewart zu üben: „I was only joking“,<br />
„Hard lesson to learn“ und „Gasoline<br />
alley“. Sandro muss sich an die Vorstellung<br />
gewöhnen, dass es neben Pasta<br />
auch Ahle Worschd gibt, eine nordhessische<br />
Spezialität. Wir werden das Leben<br />
feiern und über Bücher reden, die<br />
man lesen sollte. Wahrscheinlich werde<br />
ich den Text nennen, der wohl irrtümlich<br />
Als Fernsehproduzent hat<br />
Hubertus Meyer-Burckhardt<br />
viele Preise gewonnen, zuletzt<br />
für den Film „Blaubeerblau“. Als<br />
Autor veröffentlichte er den Roman<br />
„Die Kündigung“. Gemeinsam<br />
mit Barbara Schöneberger ist er<br />
Gastgeber der „NDR Talk Show“.<br />
www.cicero.de/24stunden<br />
Jorge Luis Borges zugeschrieben wird:<br />
„Wenn ich mein Leben noch einmal leben<br />
könnte ..., im nächsten Leben würde<br />
ich versuchen, mehr Fehler zu machen.“<br />
Wahrscheinlich gehe ich den Freunden<br />
auf die Nerven, wenn sie mindestens zwei<br />
jener drei Produktionen anschauen müssen,<br />
auf die ich als Produzent am meisten<br />
stolz bin: „Das Urteil“ (Klaus Löwitsch<br />
sehe ich ja in wenigen Stunden wieder),<br />
„Mein letzter Film“ (vielleicht kommt<br />
Hannelore Elsner auch im Wald vorbei,<br />
um „Lebewohl“ zu sagen – auf diesen Abschiedsgruß<br />
bestehe ich) und „Blaubeerblau“<br />
von Rainer Kaufmann, dem Bruder<br />
in der Seele. Ein besonderer Mensch, ein<br />
besonderer Regisseur.<br />
Ich glaube, in den letzten Stunden<br />
nimmt bei mir die Aufregung zu. Irgendetwas<br />
wird ja danach passieren. Langeweile<br />
wäre verdrießlich. Zur Sicherheit<br />
würde ich mit den Freunden ein paar<br />
Formalitäten besprechen, sofern der Rotweinkonsum<br />
das noch zulässt: ein Grab<br />
im Wald, bitte an einen Luftschacht<br />
denken, durch den man zur Not einmal<br />
im Monat den neuen Rolling Stone durchwerfen<br />
kann, und, falls mal Damenbesuch<br />
kommt, gerne auch das Magazin<br />
Emotion. Und Reiseliteratur.<br />
Wenn ich schon selbst nicht mehr on<br />
the road bin, dann will ich zumindest wissen,<br />
was Merian publiziert. Verleger Thomas<br />
Ganske stammt auch aus Nordhessen.<br />
Dieser wunderbare Mann müsste ab<br />
und zu an meinem Grab vorbeischauen.<br />
Ich bin sicher, dass ich mich da auf ihn<br />
verlassen kann.<br />
Da wir beim Reisen sind: Ich würde<br />
die Runde auffordern zu erzählen, wo<br />
„ihre“ Plätze auf der Welt sind. Wo waren<br />
sie glücklich? Wo ging alles zusammen,<br />
Seele, Schönheit der Landschaft,<br />
Reisebegleitung, Architektur, Kunst? Und<br />
ich würde ihnen empfehlen, diese Plätze<br />
noch häufig aufzusuchen. Ach, könnte<br />
ich noch einmal nach Monforte d’Alba,<br />
Panama City, Kalkutta. Aber ich will<br />
nicht klagen, im Gegenteil. Ich würde jubelnd<br />
danken für das Leben, das ich hatte.<br />
Ich täte gut daran, das Glas auf meine<br />
Mutter zu erheben, die nach der Devise<br />
lebte: „Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung,<br />
nicht Schicksal.“ Das habe ich<br />
verinnerlicht. Ich danke für Begegnungen,<br />
für Freunde in der Not, für die wunderbarsten<br />
Kinder, die man haben kann. Es<br />
war ein besterntes Leben.<br />
So, Freunde, ihr hattet nun genug<br />
Zeit, die drei Rod-Stewart-Songs zu üben.<br />
Legt los. Ich trinke meine letzte Flasche.<br />
Kann es mir leisten. Muss morgen<br />
nicht früh raus. Kann etwas länger liegen<br />
bleiben.<br />
5.2013 <strong>Cicero</strong> 145
C i c e r o | P o s t S c r i p t u m<br />
Mitleid<br />
Von Alexander Marguier<br />
N<br />
ach der Vertreibung aus dem Paradies seiner Präsidentschaft<br />
wird Christian Wulff schon wieder gedemütigt.<br />
Jetzt aber auf eine ganz andere, vielleicht sogar<br />
perfidere Weise als während der öffentlichen Treibjagd vor<br />
gut einem Jahr. Denn die neue Form der Demütigung zeigt sich<br />
im blütenweißen Kleid des menschlichen Mitgefühls. Ob Wulff<br />
sich am Ende tatsächlich vor Gericht wird verantworten müssen,<br />
spielt da kaum noch eine Rolle. Rehabilitiert ist er nämlich<br />
bereits – und zwar ausgerechnet von denen, die sich über das<br />
angebliche Fehlverhalten des damaligen Hausherrn von Bellevue<br />
gar nicht genug empören konnten. Die Dämonisierung<br />
Christian Wulffs hat sich binnen weniger Monate verwandelt in<br />
mediale Mitleidsbekundungen, deren Adressat sich allerdings<br />
kaum mit der ihm neuerdings zugeschriebenen Rolle eines bedauerlichen<br />
Opfers widriger Umstände anfreunden dürfte. Der<br />
Fall Wulff war eben keine harmlose Verwechslungskomödie,<br />
sondern ein Trauerspiel in Sachen politischer Kultur, an dem<br />
alle Beteiligten fleißig mitgeschrieben haben – der Hauptdarsteller<br />
genauso wie der Chor seiner Kritiker in der veröffentlichten<br />
Meinung. Wulff aber hat alles verloren, wohingegen die mediale<br />
Jagdgesellschaft von Anfang an ohne eigenes Risiko spielte.<br />
Nun jammert sie dem toten Hasen hinterher – und macht ihn<br />
dadurch erst recht lächerlich. Sich selbst natürlich auch, aber<br />
damit kann sie leben.<br />
Mitleid ist in der Politik ohnehin keine angemessene Ausdrucksform,<br />
schon aus diesem Grund hat Christian Wulff es<br />
nicht verdient. Was er jedoch sehr wohl verdient und deshalb<br />
auch selbst anstrebt, ist eine faire juristische Aufklärung der gegen<br />
ihn erhobenen Vorwürfe. Ein von der Staatsanwaltschaft<br />
vorgeschlagener „Deal“ – 20 000 Euro für die Einstellung des<br />
Verfahrens – wäre allerdings das exakte Gegenteil einer rechtsstaatlich<br />
sauberen Aufarbeitung dieses Skandals gewesen, der<br />
immerhin den Rücktritt des Bundespräsidenten zur Folge hatte.<br />
Dass ein sogenanntes Organ der Rechtspflege überhaupt auf die<br />
Idee kommt, von ihr als strafrechtlich relevant angesehene Mauscheleien<br />
Wulffs mit einer zusätzlichen Mauschelei aus der Welt<br />
zu schaffen, macht deutlich, wie wenig die Staatsanwälte aus<br />
Hannover die Tragweite ihres eigenen Handelns überblicken.<br />
Ihre Anklageerhebung wirkt nach dem geplatzten Ablasshandel<br />
beinahe trotzig; so sorgt man (ohne Not?) schon im Voraus für<br />
einen schlechten Nachgeschmack.<br />
Dabei hätte die Affäre Wulff bereits am Anfang ein halbwegs<br />
gutes Ende nehmen können, und zwar ganz ohne Zutun<br />
der Justiz. Oder war Christian Wulff tatsächlich der Meinung,<br />
vergünstigte Hauskredite, undurchsichtige Geschäfte mit dubiosen<br />
Partymanagern und von halbseidenen Filmproduzenten<br />
gesponserte Oktoberfestbesuche vertrügen sich mit höchsten<br />
politischen Ämtern? Ein früher Rücktritt des Bundespräsidenten<br />
wäre ein Signal der Einsichtsfähigkeit gewesen; er aber entschied<br />
sich lieber für die Hängepartie. Als käme es beim Staatsoberhaupt<br />
darauf an, ob ein Straftatbestand erfüllt ist oder<br />
nicht. Dabei war es Christian Wulff selbst, der schließlich in seiner<br />
Rücktrittsrede „unserem Land von ganzem Herzen eine politische<br />
Kultur“ wünschte, „in der die Menschen die Demokratie<br />
als unendlich wertvoll erkennen“.<br />
Der Wert einer Demokratie bemisst sich für „die Menschen“<br />
aber eben vor allem an der Unabhängigkeit ihrer gewählten Repräsentanten.<br />
Deswegen ist es aus dem Verständnis der Politik<br />
auch gar nicht so wichtig, ob die Staatsanwaltschaft mit ihrer<br />
Anklage vor Gericht Erfolg hat. Dass Wulff ihr durch sein<br />
Verhalten überhaupt erst die Möglichkeit dazu gegeben hat, darin<br />
besteht das eigentliche Problem. Denn die von ihm eingeforderte<br />
politische Kultur ist bereits dann in Gefahr, wenn auch nur<br />
der Anschein von Kungelei besteht. Es gibt übrigens tatsächlich<br />
Männer und Frauen in der Politik, die das nicht nur wissen, sondern<br />
auch beherzigen. Eine davon heißt Angela Merkel.<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretender Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Illustration: Christoph Abbrederis; Foto: Andrej Dallmann<br />
146 <strong>Cicero</strong> 5.2013
MANCHMAL MUSS<br />
ES EBEN MUMM SEIN.<br />
Statt Blumen mitzubringen, gleich im Grünen dinieren.<br />
Den Chefkoch in die eigene Küche einladen. Und das<br />
Kochen zum eigentlichen Event machen. Beim Starfriseur<br />
alle Plätze reservieren. Und gemeinsam den besten<br />
Schnitt machen. Manchmal muss es eben Mumm sein.
cartier.de – 089 55984-221<br />
calibre de cartier<br />
CHRONOGRAPH 1904-CH MC<br />
DAS NEUE CHRONOGRAPHEN-UHRWERK MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 1904-CH MC WURDE IN GRÖSSTER<br />
UHRMACHER TRADITION VON DEN UHRMACHERN DER CARTIER MANUFAKTUR KREIERT, ENTWICKELT UND<br />
GEBAUT. UM PERFEKTE PRÄZISION ZU ERREICHEN, WURDE DAS UHRWERK MIT VIRTUOSER TECHNIK<br />
AUSGESTATTET: EIN SCHALTRAD, UM ALLE FUNKTIONEN DES CHRONOGRAPHEN ZU KOORDINIEREN,<br />
EIN VERTIKALER KUPPLUNGSTRIEB, UM DIE AKKURATESSE DES STARTENS UND STOPPENS DER TIMER<br />
FUNKTION ZU VERBESSERN, EINE LINEARE RESET FUNKTION UND EIN DOPPELTES FEDERHAUS, UM EIN<br />
UNVERGLEICHLICHES ABLESEN DER ZEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.<br />
42MM GEHÄUSE AUS STAHL , MECHANISCHE S MANUFAK TUR – CHRONOGR APHENUHRWERK, AUTOMATIK AUFZUG,<br />
KALIBER 1904-CH MC (35 STEINE, 28.800 HALBSCHWINGUNGEN PRO STUNDE, CA. 48 STUNDEN<br />
GANG RESERVE), KALENDERÖFFNUNG BEI 6 UHR, ACHTECKIGE KRONE AUS STAHL, SILBER OPALIERTES<br />
ZIFFERBLATT, PROFILRILLEN MIT SILBER FINISH, ARMBAND AUS STAHL.