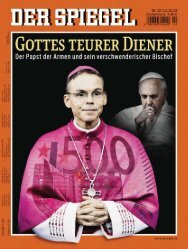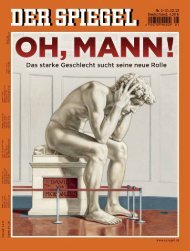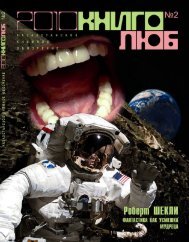Deutschland - elibraries.eu
Deutschland - elibraries.eu
Deutschland - elibraries.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hausmitteilung<br />
12. August 2013 Betr.: Titel, Nanny-Staat, Billigmedizin, Serie<br />
Für ihre Kinder wollen Eltern nur das Beste. Aber wie viel<br />
vom Besten ist gut für das Kind? Für den SPIEGEL-Titel<br />
sprach Redakt<strong>eu</strong>rin Kerstin Kullmann, selbst Mutter zweier Söhne,<br />
mit Josef Kraus, Präsident des D<strong>eu</strong>tschen Lehrerverbands,<br />
der schilderte, wie sich Eltern zu den Bodyguards ihres Nachwuchses<br />
entwickeln und sich in jeden kleinen Streit unter Schülern<br />
einmischen. „Sie verhindern damit das eigenverantwortliche<br />
Handeln ihrer Kinder. Sie ziehen eine unmündige Generation<br />
heran“, sagt Kraus. Froh war Kullmann über einen einfachen<br />
Rat des Päd agogen: „Gute Erziehung bed<strong>eu</strong>tet: leichte Hilfestellung<br />
bei größtmöglicher Zurückhaltung“ (Seite 118).<br />
Kullmann<br />
Normalerweise hält sich SPIEGEL-Redakt<strong>eu</strong>r Alexander N<strong>eu</strong>bacher an die Gesetze<br />
– doch was tun, wenn keine Regeln existieren? Auf der Hauptstraße im<br />
niedersächsischen Bohmte gibt es weder Ampeln noch Schilder. Auch Bürgersteige<br />
und Zebrastreifen sind abgeschafft. Die Bewohner glauben, dass sich die Autofahrer<br />
dann rücksichtsvoller verhalten. Bohmtes Vizebürgermeisterin empfahl N<strong>eu</strong>bacher<br />
sogar, mit geschlossenen Augen im dichten Verkehr über die Straße zu gehen, ihm<br />
werde nichts passieren. Das Experiment gelang; N<strong>eu</strong>bachers Recherchen über den<br />
„Nanny-Staat“, über das Für und Wider von Verboten in einer Gesellschaft, die<br />
sich mit immer n<strong>eu</strong>en Regeln das Leben schwermacht, blieben unfallfrei (Seite 20).<br />
Das Erste, was SPIEGEL-Reporter<br />
Guido Mingels auf dem Gelände<br />
der indischen Herzklinik Narayana in<br />
Bangalore begegnete, war eine schmutzige<br />
Kuh. Das Tier war offensichtlich<br />
darum bemüht, indische Klischees zu<br />
erfüllen. Im Krankenhaus selbst allerdings<br />
herrschten makellose hygienische<br />
Verhältnisse. Der Chirurg Devi Shetty,<br />
Gründer der Klinik und oft als „Henry<br />
Ford der Herzchirurgie“ bezeichnet,<br />
wendet die Prinzipien der Massenproduktion<br />
im Gesundheitswesen an und<br />
Mingels in der Herzklinik Narayana<br />
verschafft so Zehntausenden armen Indern Zugang zu Spitzenmedizin. Während<br />
Mingels Shetty im Operationssaal bei einem Eingriff am offenen Herzen beobachtete,<br />
ging ihm eine Frage durch den Kopf: „Würde ich mich hier operieren lassen?“<br />
Seine Antwort nach einer Woche in Bangalore: „Unbedingt“ (Seite 54).<br />
Was ist h<strong>eu</strong>te sozialdemokratisch? Als Redakt<strong>eu</strong>r Stefan Willeke für die SPIE-<br />
GEL-Wahlserie im Ruhrgebiet nach Antworten auf diese Frage suchte, war<br />
es auch eine Reise in seine Kindheit. Er wuchs in Bochum auf, einer traditionell<br />
roten Stadt. Im Rathaus regierten Sozialdemokraten, so war es bei Willekes Geburt<br />
im Jahr 1964, so war es, als er 1984 Abitur machte. Die Partei des damaligen Ministerpräsidenten<br />
Johannes Rau empfand er als Heilsbringerin und verfilzte Clique<br />
zugleich. In zuvor ungekanntem Maße bot die Partei Arbeiterkindern Chancen zu<br />
sozialem Aufstieg, benahm sich aber gleichzeitig wie eine herrschende Klasse, die<br />
ihre Genossen überall mit lukrativen Posten versorgte. Für Willeke war das ein<br />
prägendes Erlebnis. „Bis h<strong>eu</strong>te“, sagt er, „beobachte ich die SPD mit großem Inter -<br />
esse, habe sie aber noch nie gewählt“ (Seite 60).<br />
FRIEDEL AMMANN / DER SPIEGEL<br />
NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL<br />
Im Internet: www.spiegel.de<br />
DER SPIEGEL 33/2013 5
In diesem Heft<br />
Titel<br />
Verbissen kämpfen ehrgeizige Eltern<br />
für den Erfolg ihrer Kinder ........................... 118<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Panorama: Bundesbank rechnet mit n<strong>eu</strong>em<br />
Rettungsprogramm für Griechenland /<br />
Altersschwache Stellwerke sorgen für Ausfälle<br />
bei der Bahn / Saudi-Arabien darf<br />
bei Rüstungsprojekt der Nato mitreden .......... 15<br />
Geheimdienste: Im Bundestagswahlkampf<br />
wird die NSA-Affäre instrumentalisiert ......... 20<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> als Aufklärungsziel der USA ..... 23<br />
Sozialdemokraten: Parteichef Gabriel<br />
will die Basis über den Kurs nach der Wahl<br />
entscheiden lassen .......................................... 26<br />
Regulierung: Wie der Staat die Bürger mit<br />
absurden Vorschriften drangsaliert ................. 28<br />
Grünen-Politiker Boris Palmer lehnt einen<br />
staatlich verordneten Veggie-Day ab .............. 33<br />
Karrieren: Machtkampf um die<br />
Seehofer-Nachfolge ......................................... 34<br />
FDP: Parteichef Philipp Rösler besteht auf<br />
der Abschaffung des Soli ............................... 36<br />
Parteienfinanzierung: Die FDP-Fraktion<br />
macht Wahlkampf für die Partei .................... 38<br />
Justiz: Was Gustl Mollaths Ex-Ehefrau<br />
zu dessen Freilassung sagt .............................. 42<br />
Affären: Wie Olaf Glaeseker, ehemaliger<br />
Sprecher von Christian Wulff,<br />
seine kostenlosen Urlaube erklärt .................. 46<br />
Verbrechen: Der Gladbecker Geiselgangster<br />
Dieter Degowski hofft auf ein Leben<br />
in Freiheit ....................................................... 47<br />
Naturkatastrophen: Viele Anwohner fürchten<br />
die nächste Elbeflut und wollen umziehen ..... 48<br />
Zeitgeschichte: Ein ehemaliger US-Soldat<br />
berichtet über seine Spitzeleien für die Stasi ... 50<br />
Gesellschaft<br />
Szene: Fallschirmspringen mit Hund /<br />
Was macht eine Scheidungsfotografin? .......... 52<br />
Eine Meldung und ihre Geschichte –<br />
zwei Weißrussen gingen Scheinehen mit<br />
D<strong>eu</strong>tschen ein ................................................ 53<br />
Lebensretter: Der Herzchirurg Devi Shetty<br />
betreibt in Indien Krankenhäuser nach dem Aldi-<br />
Prinzip – preiswert, schmucklos, zuverlässig .... 54<br />
Homestory: Warum Fr<strong>eu</strong>ndschaften durch<br />
Facebook beschädigt werden ......................... 59<br />
Serie<br />
Wahl-Spezial: Die Gerechtigkeitsversprechen<br />
der Parteien ................................................... 60<br />
Kümmerer und Traditionspartei – das<br />
Selbstverständnis der Sozialdemokraten in<br />
ihrem Herzland Nordrhein-Westfalen ............ 64<br />
Wirtschaft<br />
Trends: Der Subventionsabbau stockt /<br />
Cromme will Chefaufseher bei Siemens bleiben /<br />
Poker um BayernLB-Prozess .......................... 70<br />
Internet: Die Unternehmer des Silicon Valley<br />
wollen politisch Einfluss nehmen ................... 72<br />
Vermögen: Die Journalistin Chrystia<br />
Freeland gibt Einblicke in die abgeschottete<br />
Welt der Superreichen ................................... 75<br />
Geldanlage: Unternehmensanleihen sind trotz<br />
hoher Risiken bei Privatanlegern beliebt ....... 76<br />
St<strong>eu</strong>ern: In den Euro-Ländern greift der Staat<br />
höchst unterschiedlich zu ............................... 78<br />
Hauptstadt: Der Machtkampf<br />
zwischen Flughafenchef Hartmut Mehdorn<br />
und seinem Bau-Geschäftsführer ................... 79<br />
Tourismus: Die kurzzeitige Vermietung privater<br />
Unterkünfte soll erschwert werden ................ 80<br />
6<br />
PDH<br />
DPA<br />
Anti-NSA-Demonstrant bei Darmstadt<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> im Visier der NSA Seiten 20, 23<br />
Dokumente aus dem Snowden-Archiv zeigen, was US-Geheimdienste wie etwa<br />
die NSA in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ausspionieren: Gefragt sind vor allem Informationen<br />
über die Außenpolitik, den Finanzsektor und über Waffenexporte.<br />
WAHL<br />
2013<br />
Rückfall in den Ständestaat Seiten 60, 64<br />
In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> bestimmt die Herkunft den beruflichen Erfolg. Wer<br />
unten ist, hat kaum Aussicht auf Aufstieg. Wer soziale Gerechtigkeit<br />
will, muss für eine gerechte Verteilung der Chancen sorgen.<br />
Internetelite mit politischen Ambitionen Seite 72<br />
Der Kauf der „Washington Post“ durch Amazon-Gründer Jeff Bezos ist keine<br />
Heldentat zur Rettung des Journalismus. Die Internetelite nutzt vielmehr die<br />
Medien, um sich in die politische Debatte einzumischen.<br />
Degowski mit Geisel Silke Bischoff 1988<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Freiheit<br />
in Sicht Seite 47<br />
Seit 1988 sitzen die Geiselgangster<br />
von Gladbeck im<br />
Gefängnis. Dieter Degowski<br />
und Hans-Jürgen Rösner<br />
sind für den Tod zweier<br />
Menschen verantwortlich.<br />
Nun soll Degowski auf eine<br />
Entlassung in drei Jahren<br />
vorbereitet werden. Das<br />
empfiehlt zumindest der<br />
Essener Psychologe Norbert<br />
Leygraf, der den Häftling<br />
begutachtet hat.
Verurteilt aus Mangel an Beweisen Seite 94<br />
Der Ergenekon-Prozess ist zu einer Abrechnung mit der türkischen Opposition<br />
geworden. Der Journalist Adnan Türkkan soll für mehr als zehn Jahre in<br />
Haft, die Begründung ist fadenscheinig. Er sucht nun Schutz in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />
Unerwünschte Dopingstudie Seiten 138, 140<br />
Nach Veröffentlichung einer brisanten Studie zur Dopingforschung in Westd<strong>eu</strong>tschland<br />
beschönigen Politiker und Sportfunktionäre die Lage. Einer der<br />
Autoren klagt nun, das Projekt sei von den Funktionären „blockiert“ worden.<br />
„F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
im Kino Seite 100<br />
Als das Buch 2008 auf den<br />
Markt kam, war es so umstritten<br />
wie erfolgreich. Charlotte<br />
Roche schrieb in „F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
über Sex, Analfissuren<br />
und Körperbehaarung. Viele<br />
fanden das eklig, andere<br />
hielten es für eine n<strong>eu</strong>e Stufe<br />
des Feminismus. Nun hat<br />
der Regiss<strong>eu</strong>r David Wnendt<br />
den Roman mit der brillanten<br />
Carla Juri in der Hauptrolle<br />
verfilmt.<br />
Unterstützer der islamistischen Regierung in Tunis<br />
Tunesien: Das ägyptische Virus Seite 84<br />
Zwei Jahre nach der ersten freien Wahl bekämpfen sich die regierenden<br />
Islamisten und ihre Kritiker. Politische Morde, zunehmender Extremismus und<br />
eine desolate Wirtschaft lassen viele Tunesier an der Demokratie zweifeln.<br />
Darstellerin Juri (r.)<br />
MAJESTIC FILM<br />
MOHAMED MESSARA / DPA<br />
Ausland<br />
Panorama: Sonderwirtschaftszone Kaesong in<br />
Nordkorea könnte wieder öffnen / Gefährliches<br />
Krisenmanagement in Fukushima .................. 82<br />
Tunesien: Droht ein ägyptisches Szenario im<br />
Geburtsland des Arabischen Frühlings? ......... 84<br />
Al-Qaida: Die n<strong>eu</strong>en Filialen der<br />
Terrorgruppe .................................................. 88<br />
Gregory D. Johnsen über den Drohnenkrieg<br />
der USA im Jemen ......................................... 89<br />
Italien: Das Berlusconi-Urteil und die<br />
Folgen für die Regierung in Rom ................... 90<br />
Griechenland: Die Krise hat auch gute Seiten –<br />
die Bürger entdecken ihren Gemeinsinn ........ 92<br />
Türkei: Im Ergenekon-Prozess wurden auch<br />
Journalisten als Terroristen verurteilt ............ 94<br />
Global Village: Wie ein Wissenschaftler in<br />
New York aussterbende Sprachen rettet ........ 96<br />
Kultur<br />
Szene: „Bußestunde“, ein bizarrer<br />
Krimi von Arne Dahl / Eine CD-Box feiert<br />
die Beach Boys ............................................... 98<br />
Kino: Die sehenswerte Verfilmung von<br />
Charlotte Roches Roman „F<strong>eu</strong>chtgebiete“ ... 100<br />
Suhrkamp: Insolvenzplan macht<br />
den Anteilseigner Barlach zum Statisten ...... 103<br />
Autoren: Uwe Timm erzählt in<br />
„Vogelweide“ von einem Mann, der<br />
alles verliert .................................................. 104<br />
Kapital: Ein Oligarch aus Kiew will seine<br />
Frau zur n<strong>eu</strong>en Lady Gaga aufbauen ........... 106<br />
Sachbücher: Die US-Journalistin<br />
Susannah Cahalan beschreibt ihre Reise<br />
in den Wahn ................................................. 112<br />
Bestseller ..................................................... 113<br />
Filmkritik: Im Blockbuster „Elysium“<br />
ist die Erde im Jahr 2154 ein Schreckensort ... 114<br />
Wissenschaft · Technik<br />
Prisma: Impfung gegen Malaria /<br />
Anfällige Bienen / Koffein-Test spürt<br />
Dreckwasser auf ............................................ 116<br />
Umwelt: Moderne Biotechnik soll<br />
in den USA die beinahe ausgerottete<br />
Kastanie retten ............................................. 126<br />
Verkehr: Flüssiggas statt Schweröl – gesucht<br />
wird der Schiffstreibstoff der Zukunft .......... 128<br />
Erfinder: Elektronikbastler feiern<br />
ihre verrückten Kreationen auf der<br />
„Maker Faire“ .............................................. 130<br />
Krankenhäuser: Der tödliche Fehler<br />
eines Medizinstudenten ................................ 132<br />
Medien<br />
Trends: Foodwatch will Kanzler-Talk<br />
stoppen / Bundestag sendet schwarz ............ 133<br />
TV-Kanäle: Mit dem Auslandssender Russia<br />
Today hat Putin ein Anti-CNN geschaffen ... 134<br />
Sport<br />
Szene: Ein d<strong>eu</strong>tscher Profisurfer überrascht<br />
die Weltelite / Warum sich Radrennfahrer<br />
die Beine rasieren ......................................... 137<br />
Sportpolitik: Die verspätete Debatte über<br />
Doping in Westd<strong>eu</strong>tschland .......................... 138<br />
Der Historiker Erik Eggers klagt über die<br />
Vertuschung des Betrugssystems ................... 140<br />
Briefe .............................................................. 10<br />
Impressum, Leserservice .............................. 142<br />
Register ........................................................ 143<br />
Personalien ................................................... 144<br />
Hohlspiegel / Rückspiegel ............................. 146<br />
Titelbild: Foto Gerd George für den SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
7
SPIEGEL-Titel 32/2013<br />
Briefe<br />
„Ich habe mehrere Bücher über<br />
Napoleon gelesen, aber ich kann<br />
mich nicht erinnern, einen so<br />
brillanten und knappen Aufsatz<br />
über ihn gesehen zu haben.“<br />
PROF. MARKO ZLOKARNIK, GRAZ<br />
Sie versuchen sich am Tiefloten einer<br />
Epoche, bleiben aber mit dem Senkblei<br />
bereits am Schiffsdeck hängen. So wahr<br />
es auch ist, dass Napoleon Volkes Meinung<br />
mittels Zeitungsmedien manipulierte,<br />
mutet Ihre Einlassung über „richtige<br />
Techniken von Politikern und das Geheimnis<br />
der Demokratie“ als an den Haaren<br />
herbeigezogen an. Ohne seine überragende<br />
Intelligenz, Energie, Entschlossenheit,<br />
ja auch sein Charisma hätte<br />
Bonaparte keinen Hund zwischen Paris<br />
und Moskau hinterm Ofen vorlocken<br />
oder gar beeinflussen können.<br />
HENDRIK SCHLEGEL, ERFURT<br />
Nr. 32/2013, Der Fall Napoleon –<br />
die Geburt der modernen Diktatur<br />
Weltseele zu Pferde<br />
Ich glaube nicht, dass sich die <strong>eu</strong>ropäischen<br />
Völker mit der – fast reflexhaften –<br />
Bekämpfung Napoleons einen Gefallen<br />
getan haben. Übersehen wird oft, dass es<br />
in den „Napoleonischen Kriegen“ auch<br />
um den (frühen) Versuch einer Einigung<br />
Europas ging. Zwar unter französischen<br />
Vorzeichen, aber wäre das wirklich so<br />
schlecht gewesen? Besonders angesichts<br />
dessen, was im folgenden Jahrhundert<br />
dann an wirklich Diktatorischem über<br />
Europa hereinbrechen sollte, hauptsächlich<br />
in d<strong>eu</strong>tschem und (russisch-)so -<br />
wjetischem Namen? Goethe jedenfalls<br />
hat der „Weltseele zu Pferde“ (Hegel über<br />
Napoleon) durchaus Glück gewünscht!<br />
MICHAEL JARRATH, BRECKERFELD (NRW)<br />
Mein Geschichtslehrer antwortete errötend<br />
auf die Frage, warum diese Militärs<br />
wie Caesar, Alexander der Große, Friedrich<br />
der Große, Napoleon et cetera, die<br />
Millionen Menschen auf dem Gewissen<br />
haben, von den Historikern häufig so<br />
positiv b<strong>eu</strong>rteilt werden: „Die haben<br />
doch auch so viel Gutes getan.“<br />
JÜRGEN NEUNABER, OLDENBURG<br />
Sie hätten das Foto von dem Invalidendom-Besucher<br />
Hitler noch näher kommentieren<br />
sollen. Da blickt der größte<br />
Verbrecher des 20. Jahrhunderts auf den<br />
Sarkophag des größten Verbrechers des<br />
19. Jahrhunderts. Es gibt so viele Parallelen,<br />
nicht nur die Lügen, Vertragsbrüche,<br />
den unkontrollierten Größenwahn, die<br />
Plünderungen, Brandschatzungen, Vertreibungen,<br />
die systematische Massenvernichtung,<br />
die Millionen Toten, Verstümmelten,<br />
Hungernden und Verzweifelten.<br />
Die Moderne beginnt in Europa politisch<br />
betrachtet mit der Französischen Revolution,<br />
nicht mit den Napoleonischen Kriegen.<br />
Militärische Erfolgsberichte als versuchte<br />
Rechtfertigung von unbe schreib -<br />
lichen Tragödien gibt es schon zu viele.<br />
WOLFGANG LEDERER, SCHWAZ (ÖSTERREICH)<br />
10<br />
Im Juni 1813 drängte Fürst von Metternich,<br />
der österreichische Außenminister,<br />
Napoleon zu einem Verhandlungsfrieden,<br />
um weiteres, unnötiges Blutvergießen zu<br />
verhindern. Doch Napoleon war zu keinem<br />
Zugeständnis bereit. Der Franzosenkaiser<br />
lehnte die Friedensinitiative Metternichs<br />
mit den Worten: „Ein Mann wie<br />
Völkerschlachtdenkmal in Leipzig<br />
ich scheißt auf das Leben einer Million<br />
Menschen“, schroff ab. Übrigens, das<br />
Zeitalter der modernen Politik und<br />
Kriegsführung hat nicht in Paris, sondern<br />
schon in Sanssouci begonnen. Europa<br />
hat es zu spüren bekommen, und wir<br />
spüren es h<strong>eu</strong>te noch. Deshalb kein Nachruhm<br />
und keine Verherrlichung dieser<br />
sogenannten großen Feldherren, gleichgültig<br />
ob sie Napoleon Bonaparte,<br />
Fritz, Wilhelm et cetera geheißen haben,<br />
auch wenn sie uns den Code Civil hinterlassen,<br />
komponiert und Querflöte<br />
gespielt haben.<br />
WALTER BERCHTHOLD, FÜRSTENZELL (BAYERN)<br />
Nicht nur die Sprachästhetik, die Stendhal<br />
lobt, sondern vor allem der Inhalt<br />
des Code Civil waren wegweisend. Die<br />
im Code proklamierte Rechtsgleichheit<br />
und Freiheit der Person sowie der Abschied<br />
von allen f<strong>eu</strong>dalen Reminiszenzen<br />
hat Napoleon über die französischen Landesgrenzen<br />
hinaus Akzeptanz eingebracht.<br />
Der Code Civil ist ein wirkliches<br />
Geschöpf der Aufklärung.<br />
DR. HELMUT ESCHWEILER, BERLIN<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
WALTRAUD GRUBITZSCH / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Nr. 31/2013, SPIEGEL-Gespräch mit<br />
Otto Schily<br />
Als Schily noch Schily war<br />
Jeden Satz von Schily kann man dick unterstreichen.<br />
Betroffen dreinschauende<br />
Politiker, Intellektuelle und nicht wenige<br />
Journalisten sch<strong>eu</strong>en das Wort „Terrorismusbekämpfung“<br />
mit Blick auf die NSA<br />
wie der T<strong>eu</strong>fel das Weihwasser. Eine Verhöhnung<br />
der Terroropfer von 2001.<br />
WERNER SCHNEPP, WERDOHL (NRW)<br />
Wer ist hier eigentlich paranoid? Es ist ein<br />
politischer Fehler zu versuchen, den Terrorismus<br />
allein mit polizeilichen, militärischen,<br />
kriegsähnlichen Methoden zu bekämpfen.<br />
Dauerhaften Erfolg werden wir<br />
nur haben, wenn wir uns unsere Art zu leben<br />
erhalten, aber auch wenigstens versuchen,<br />
uns um die Ursachen des Terrorismus<br />
zu kümmern. Und selbst wenn Herr Schily<br />
damit einverstanden ist, möchte ich nicht,<br />
dass die USA in unserer Verfassung her -<br />
umholzen wie eine Besatzungsmacht.<br />
„Man bekämpft“, hieß es 1978 in einem<br />
Aufruf der Humanistischen Union, „die<br />
Feinde des Rechtsstaats nicht mit dessen<br />
Abbau, und man verteidigt die Freiheit<br />
nicht mit deren Einschränkung.“ Erstunterzeichner<br />
war Otto Schily, als er noch<br />
Otto Schily war. Richtig ist es h<strong>eu</strong>te noch.<br />
DR. DR. BURKHARD HIRSCH, DÜSSELDORF<br />
BUNDESTAGSVIZEPRÄSIDENT A. D.<br />
Wie kann ein so erfahrener Mann so blauäugig<br />
sein? Die USA stellen ihre Interessen<br />
im Zweifelsfall doch über die Menschenrechte<br />
und das Recht anderer Staaten.<br />
HEINER SCHÜRMANN, SCHÖNEBECK<br />
Wenn Otto Schily den Schutz der Würde<br />
des Menschen gleichsetzt mit der Gewährleistung<br />
der Sicherheit des Menschen,<br />
dann ist das schon eine abent<strong>eu</strong>erliche<br />
verfassungsrechtliche Entgleisung.<br />
MANFRED STEINBACH, BAD KARLSHAFEN<br />
Wieso sollte ein Bürger einem Staat vertrauen,<br />
wenn der ihm nicht vertraut?<br />
DR. STEFAN GORSOLKE, BERLIN
Nr. 31/2013, Wie Car-Sharing das Leben<br />
in der Großstadt verändert<br />
Haha<br />
Car-Sharing an sich ist keine schlechte<br />
Idee, doch von Teilen und Gemeinschaftssinn<br />
kann keine Rede sein. Entfremdete<br />
Menschen, die wie besessen auf ihr Handy<br />
Car-Sharing-Kundin<br />
starren, sich virtuell organisieren und sich<br />
einbilden, mitten im Geschehen zu sein –<br />
da sehe ich keine positive Entwicklung.<br />
FRANCESCA GOLL, BERLIN<br />
So, so, die Jugend wendet sich also vom<br />
Auto ab, weil sie lieber teilen möchte, Statussymbole<br />
sind ihr nicht mehr wichtig,<br />
die Welt wird endlich besser. Haha. Diese<br />
Sharing-Modelle funktionieren wie Leasing.<br />
Genieße h<strong>eu</strong>te den Luxus, den du<br />
dir eigentlich gar nicht leisten kannst.<br />
Gleichzeitig geben sie dir das Gefühl, hip<br />
zu sein. Die Jüngeren stehen h<strong>eu</strong>te doch<br />
unter einem noch viel größeren Druck,<br />
sich mit Markenprodukten zu zeigen als<br />
wir vor 30 Jahren. Statt des alten Klein -<br />
wagens wählen sie lieber das n<strong>eu</strong>este<br />
Smartphone, in dem sie dann zyklopenäugig<br />
versinken, um sich per App eine<br />
Bohrmaschine in 4,3 Kilometer Entfernung<br />
zu leihen, statt wie wir beim Nachbarn zu<br />
fragen. Geben sie die defekt zurück, dann<br />
hat sich’s bald wieder mit Sharing.<br />
ANDREAS KURZ, GRÄFELFING (BAYERN)<br />
Car-Sharing ist Business. Punkt. Gepaart<br />
mit einer guten Portion Pragmatismus,<br />
denn man spart ein eigenes Auto mit allen<br />
Problemen und Kosten. Der Kerngedanke<br />
des Konsumverzichts lebt zwar noch weiter,<br />
steht aber nicht im Vordergrund.<br />
RAINER KUHN, BERLIN<br />
Nr. 31/2013, Botho Strauß’ Anmerkungen<br />
zum Außenseiter<br />
Fremdwörtelei<br />
Boah, war das schwierig zu lesen!! Ich<br />
bin drauf und dran, mir das Buch zu kaufen,<br />
sobald es erscheint. Um mir daran<br />
die Zähne auszubeißen. Möglicherweise<br />
aus Sportsgeist. Wenn ich Botho Strauß<br />
12<br />
MAURICE WEISS / DER SPIEGEL<br />
Briefe<br />
recht verstehe, will er den Pöbel von seinen<br />
feingeistigen Überlegungen fernhalten<br />
– dann kann ihm das gar nicht so lieb<br />
sein: Verkauf an jeden Dahergelaufenen.<br />
Was lässt sich da tun?<br />
BERND HEYDECKE, NEUKALEN (MECKL.-VORP.)<br />
Wie schön, dass der SPIEGEL in einem<br />
Vorspann zu erläutern versucht, was in<br />
dem sogenannten Essay eigentlich drinstehen<br />
soll. Denn der Strauß-Text enthält keinen<br />
einzigen verständlichen oder gar vernünftigen<br />
Gedanken. Zur Beruhigung mag<br />
die Erwartung beitragen, dass wir jetzt die<br />
nächsten 20 Jahre von einem ern<strong>eu</strong>ten Geschwurbel<br />
dieses blasierten Ps<strong>eu</strong>doliteraten<br />
verschont bleiben werden.<br />
PROF. GEORG KÜPPER, BERLIN<br />
Wenn Strauß seine scharfen Beobachtungen<br />
etwas allgemeinverständlicher dar -<br />
legen würde, könnten es auch die Außenseiter<br />
verstehen, die nicht zu den Intellektuellen<br />
gehören, und die sind sicher in<br />
der Mehrheit. Und er könnte dort etwas<br />
entfachen, wo noch ein Funke glimmt.<br />
RALF GROSSER, DÖBELN (SACHSEN)<br />
Eine Bestandsaufnahme des Status quo<br />
der geistigen Verwahrlosung und sprachlichen<br />
Umdefinierung simpelster Begriffe<br />
durch einen Vertreter der intellektuellen<br />
Elite unseres Landes war überfällig. Während<br />
Strauß riskiert, sich wieder einmal<br />
unbeliebt zu machen, herrscht nämlich<br />
Schweigen im Walde. Es ist nur konsequent,<br />
wenn allein der Duktus von<br />
Strauß’ Essay das „Breite“ ausschließt<br />
und sich an seinesgleichen wendet. Die<br />
„große Schar“ kann und muss ihn auch<br />
gar nicht verstehen.<br />
GERALD DRUMINSKI, LEIPZIG<br />
Wohl die beste Zeitdiagnose seit Jahren!<br />
Botho Strauß erlaubt sich den Luxus, sich<br />
aus dem allgemeinen Irrsinn, jede Mode<br />
mitzumachen, und sei sie noch so hohl,<br />
herauszunehmen.<br />
MATTHIAS PIERRE LUBINSKI, BERLIN<br />
Endlich ist eine Stimme zu vernehmen,<br />
mit deren Hilfe ein Entfliehen aus Verramschung<br />
und Verbreitung möglicher<br />
wird. Übersättigungsverstopfung heißt<br />
die Kurzdiagnose.<br />
BERND KREBS, ASCHAFFENBURG<br />
Botho-Strauß-Illustration<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
RICCARDO VECCHIO / DER SPIEGEL<br />
Nr. 31/2013, Wie die indische Spiritualität<br />
einst im Westen erfunden wurde<br />
Selbst erlöst Selbst<br />
Trivialerweise ist richtig, dass die h<strong>eu</strong>tige<br />
Form indisch geprägter Spiritualität im<br />
Westen ein Produkt der verfügbaren Informationen<br />
und der westlichen Bedürfnisse<br />
ist. Richtig ist auch, dass in Indien<br />
eine ritualisierte Form der Religiosität ohne<br />
tieferes Verständnis verbreitet ist. Gänzlich<br />
unlogisch ist aber, dass damit die „wahren<br />
Ursprünge asiatischer Geisteslehren“ enthüllt<br />
würden oder gar, dass Spiritualität<br />
eine Erfindung westlicher Esoteriker wäre.<br />
DR. RUDOLF WINKEL, BINGEN<br />
Der Hinduismus hat Texte von ähnlicher<br />
Qualität und Wirkung aufzuweisen wie die<br />
Einleitung des Johannesevangeliums und<br />
den Sonnengesang des Franziskus.<br />
ROLF MONNERJAHN, EMMELSHAUSEN (RHLD.-PF.)<br />
Massen-Yoga in New York<br />
Die indische Spiritualität wurde von Vivekananda<br />
nicht erfunden, sondern wiederbelebt.<br />
Es gab sie schon immer, die<br />
ungemein reiche, alte Sanskrit-Literatur<br />
mit mehr spirituellen Texten, als sie jede<br />
andere Literatur der Welt aufweist. Vivekananda<br />
hat in seinen Vorträgen im Westen<br />
alle Aspekte des Yoga tiefgründig dargelegt,<br />
sich aber nicht für Hatha-Yoga eingesetzt,<br />
das zwar bei uns häufig mit Yoga<br />
gleichgesetzt wird, aber tatsächlich nur<br />
eine von vielen Praktiken darstellt.<br />
WILFRIED HUCHZERMEYER, KARLSRUHE<br />
Wenn Sie Vivekananda gründlicher studiert<br />
hätten, wäre Ihnen sein Satz „Das<br />
Selbst ist der Erlöser des Selbst, und nichts<br />
sonst“ aufgefallen. Ramakrishna, der Lehrer<br />
Vivekanandas, erläuterte das 1885 so:<br />
Vernunft und Bewusstsein sind rein, sobald<br />
sie sich von den irdischen Dingen<br />
völlig losgelöst haben. Die alten Seher erlebten<br />
das göttliche Bewusstsein mittels<br />
ihres inneren Bewusstseins. In diesem Sinne<br />
ist Ihre Überschrift „Erlösung ohne Erlöser“<br />
zu kurz gedacht: Sie übersehen das<br />
Subtile beziehungsweise das Subtilste.<br />
WILFRIED MARQUARDT, DÜSSELDORF<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />
Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />
zu veröffentlichen. Die E-Mail-Anschrift lautet:<br />
leserbriefe@spiegel.de<br />
EMMANUEL DUNAND / AFP
Panorama<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Zentralbank in Athen<br />
YORGOS KARAHALIS / REUTERS<br />
BUNDESBANK<br />
Nach der Wahl mehr Geld für Griechenland<br />
Die Bundesbank rechnet damit, dass es bereits kurz nach<br />
der Bundestagswahl ein n<strong>eu</strong>es Rettungsprogramm für Griechenland<br />
geben wird. In einem internen Dokument der Zentralbank<br />
heißt es, die Europäer müssten spätestens Anfang<br />
2014 „wohl in jedem Fall ein n<strong>eu</strong>es Kreditprogramm mit<br />
Griechenland beschließen“. In der Stellungnahme für das<br />
Berliner Finanzministerium und den Internationalen Währungsfonds<br />
(IWF) kritisieren die Frankfurter Experten die<br />
jüngste Kredittranche und die dafür erfolgte Überprüfung<br />
durch die Troika. Sie dürfte „politischen Zwängen geschuldet<br />
sein“. Zwar bestreitet die Bundesbank, es handle sich dabei<br />
um eine Anspielung auf die Bundesregierung, die vor der<br />
Wahl eine Diskussion über einen Schuldenschnitt verhindern<br />
will – und deshalb die Fortschritte in Griechenland betont.<br />
Doch die Bundesbank kommentiert diesen Optimismus in ihrem<br />
Dossier äußerst unterkühlt: „Wir nehmen die zustimmende<br />
Haltung zur Kenntnis.“ Das hat auch damit zu tun,<br />
dass laut Bundesbank die Risiken des Rettungsprogramms<br />
„außergewöhnlich hoch“ bleiben. Auch die Performance der<br />
Athener Regierung sei „kaum zufriedenstellend“, es bestünden<br />
„erhebliche Zweifel“ an der Fähigkeit, unabdingbare Reformen<br />
umzusetzen. Im Juli hatten Euro-Rettungsfonds und<br />
IWF 5,7 Milliarden Euro an Griechenland überwiesen. Insgesamt<br />
flossen bislang Hilfen von über 200 Milliarden Euro.<br />
RÜSTUNG<br />
Saudi-Arabien erstmals<br />
in Nato-Agentur<br />
Saudi-Arabien mischt künftig bei einem<br />
wichtigen Rüstungsprojekt der<br />
Nato mit. Das geht aus einer Firmenpublikation<br />
über den „Eurofighter“<br />
hervor. Danach ist Riad im vergangenen<br />
Jahr der NETMA beigetreten, der<br />
Nato-Agentur für das Management<br />
des „Eurofighter“. Damit kann Saudi-<br />
Arabien Einfluss auf die weitere Entwicklung<br />
der Modelle<br />
nehmen. Die Mitgliedschaft<br />
eines<br />
Nicht-Nato-Landes in<br />
einer Nato-Agentur<br />
ist höchst ungewöhnlich.<br />
Saudi-Arabien<br />
ist allerdings für die<br />
<strong>eu</strong>ropäischen Partner ein wichtiger<br />
Kunde. 28 „Eurofighter“ hat das Land<br />
bereits, weitere 44 folgen. Wegen Menschenrechtsverletzungen<br />
sind Rüstungsexporte<br />
in das<br />
„Eurofighter“<br />
MARKO DJURICA / REUTERS<br />
Land umstritten. Zuletzt<br />
sorgte ein möglicher<br />
Verkauf von<br />
„Leopard 2“-Panzern<br />
für Debatten über<br />
die Lieferung von<br />
Kriegsmaterial.<br />
15
Panorama<br />
PARTEI EN<br />
Unsaubere Methoden<br />
Der CDU-Rebell Siegfried Kauder<br />
wird im Internet mit unsauberen Methoden<br />
bekämpft. Am 12. Juli hatte<br />
der Bundestagsabgeordnete aus dem<br />
Schwarzwald bestätigt, dass er bei der<br />
Wahl im September als unabhängiger<br />
Kandidat gegen die eigene Partei antreten<br />
wolle. Noch am selben Tag manipulierte<br />
ein unbekannter Nutzer den<br />
Eintrag des Politikers im Online-Lexikon<br />
Wikipedia. Pikantes Detail: Die<br />
IP-Adresse des Users gehört zum Computernetzwerk<br />
des Bundestags. Ob es<br />
sich um einen Abgeordneten, einen<br />
Fraktions- oder einen Verwaltungsmitarbeiter<br />
handelt, ist unklar. Der Unbekannte<br />
löschte den schmeichelhaftesten<br />
Part im Artikel zu Kauder, den Absatz<br />
über das gesellschaftliche Engagement<br />
des Politikers. Dieser amtiert als<br />
Präsident des FC 08 Villingen sowie<br />
der Bundesvereinigung D<strong>eu</strong>tscher<br />
Musikverbände, außerdem engagiert<br />
er sich im Weißen Ring. Die Änderung<br />
hatte allerdings nur<br />
wenige Minuten<br />
Bestand. Dann setzte<br />
ein selbsternannter<br />
Vandalismusbekämpfer<br />
der Wikipedia<br />
den Artikel<br />
zurück auf die vorherige<br />
Kauder<br />
Version.<br />
PATRICK SEEGER / DPA<br />
TIM SCHULZ / DDP IMAGES<br />
DEUTSCHE BAHN<br />
Betagte Technik<br />
Stellwerk in Oberhausen<br />
Personalausfälle in Stellwerken, die seit der vorigen Woche den Zugverkehr im<br />
Mainzer Hauptbahnhof weitgehend lahmlegen, könnten auch andernorts zu<br />
empfindlichen Störungen des Schienenverkehrs führen: Wie in der rheinlandpfälzischen<br />
Landeshauptstadt ist in den meisten Bahnhofsstellwerken die Technik<br />
veraltet und personalintensiv. Knapp 3000 Weichen-Schaltzentralen der D<strong>eu</strong>tschen<br />
Bahn werden immer noch weitgehend mechanisch betrieben. Die Anlagen,<br />
meist mehrere pro Bahnhof, sind oft 40 Jahre und älter. An wenig befahrenen<br />
Strecken stammen sie mitunter sogar noch aus der Kaiserzeit. Lediglich 415<br />
Stellwerke, die ein Drittel des Schienenverkehrs in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> regeln, werden<br />
computergest<strong>eu</strong>ert. Die betagte Technik ist zwar zuverlässig, benötigt aber mehr<br />
Personal als die elektronischen Stellwerke. Nach Angaben der Eisenbahn-Gewerkschaft<br />
EVG fehlen derzeit 1000 Stellen. Außerdem schieben die 12000 Fahrdienstleiter<br />
der Bahn rund eine Million Überstunden vor sich her. Die Personaldecke<br />
sei extrem dünn, sagt ein EVG-Sprecher. Da müssten nur wie in Mainz<br />
Fahrdienstleiter wegen Krankheit und Urlaub ausfallen, „dann bricht das Kartenhaus<br />
zusammen“. Ein Bahn-Sprecher wies die Vorwürfe zurück.<br />
FINANZAUSGLEICH<br />
Seehofer stellt<br />
Bedingung für Koalition<br />
Die CSU verschärft ihre Forderung<br />
nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs.<br />
„Wir erwägen, es zur Bedingung<br />
für einen künftigen Koali -<br />
tionsvertrag zu machen, dass die Bundesregierung<br />
bei unserer Klage gegen<br />
den Länderfinanzausgleich mitwirkt“,<br />
sagte Bayerns Ministerpräsident Horst<br />
Seehofer am vergangenen Dienstag<br />
bei einer CSU-Veranstaltung im oberpfälzischen<br />
Amberg. Die Reform des<br />
Länderfinanzausgleichs, mit dessen<br />
Hilfe Geld zwischen zahlungskräftigen<br />
und weniger reichen Ländern umverteilt<br />
wird, ist für die CSU ein zentrales<br />
Wahlkampfanliegen. Gemeinsam mit<br />
Hessen hatte Bayern im vergangenen<br />
März Klage beim Bundesverfassungsgericht<br />
eingereicht.<br />
16<br />
FREIZEIT<br />
Boom der Bäder<br />
In den vergangenen Jahren haben<br />
zwar etliche d<strong>eu</strong>tsche Kommunen aus<br />
Kostengründen ihre Schwimmbäder<br />
geschlossen, doch das von Politik und<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Medien oft unterstellte<br />
Massen -<br />
sterben der Einrichtungen<br />
hat es nicht<br />
gegeben – im Gegenteil.<br />
Nach einer<br />
vom Bundeswirtschaftsministerium<br />
in Auftrag gegebenen<br />
Studie ist die<br />
Zahl der Hallenund<br />
Freibäder zwischen<br />
2000 und 2012<br />
um etwa zehn Prozent<br />
auf 7499 gestiegen.<br />
Das liege unter<br />
anderem daran,<br />
dass besonders im Osten der Republik<br />
etliche n<strong>eu</strong>e Spaßbäder errichtet wurden,<br />
teilt die Beratungsfirma 2hm &<br />
Associates mit, die die Zahlen für das<br />
Ministerium erhob. In den n<strong>eu</strong>en Bundesländern<br />
kommt nun ein Bad auf<br />
15000 Einwohner, im Westen müssen<br />
sich durchschnittlich 11000 Einwohner<br />
eine Anlage teilen.<br />
HEINER MÜLLER-ELSNER / AGENTUR FOCUS
ZENSUS<br />
Wahlbenachrichtigung<br />
für Geisterwähler<br />
In Berlin werden seit voriger Woche<br />
Wahlbenachrichtigungen an mehrere<br />
zehntausend Einwohner verschickt,<br />
die es laut Zensus 2011 nicht gibt. Die<br />
Bundeshauptstadt richtet sich weiterhin<br />
nach ihrem Melderegister, das<br />
knapp 3,5 Millionen Einwohner verzeichnet.<br />
Die Zahl mutmaßlicher Geisterwähler<br />
ist freilich genauso rätselhaft<br />
wie das Gesamtergebnis des Zensus,<br />
demzufolge die Hauptstadtbevölkerung<br />
um 5,2 Prozent oder exakt<br />
179 391 Personen geschrumpft sein<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
soll. Ob der Bevölkerungsverlust real<br />
oder doch eher ein Rechenfehler ist,<br />
beschäftigt Berliner Politiker auch in<br />
anderen Bereichen: Weil es in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s größter Stadt laut Zählung<br />
angeblich knapp 40 000 Wohnungen<br />
weniger gibt als bislang gedacht,<br />
müsste beispielsweise die F<strong>eu</strong>erwehr<br />
entsprechend verkleinert werden. Dabei<br />
ist die Zahl der F<strong>eu</strong>erwehreinsätze<br />
real gestiegen, weshalb Berlin beim<br />
Brandschutz das Personal ausbaut.<br />
Eine Staatssekretärsrunde unter Leitung<br />
von Björn Böhning, dem Chef<br />
der Senatskanzlei, untersucht nun, ob<br />
und wie die Landespolitik auf die n<strong>eu</strong>en<br />
Zahlen eingestellt werden muss.<br />
Berlin hat wie mehr als 800 weitere<br />
Kommunen Widerspruch gegen das<br />
Zensus-Ergebnis eingelegt.<br />
Der digitale<br />
SPIEGEL<br />
NS-VERGANGENHEIT<br />
Sollte Hitler Ehrenbürger bleiben?<br />
KRANKENKASSEN<br />
Sonderabgabe für<br />
Luxusimmobilie<br />
Hitler in Goslar 1934<br />
SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />
hat sich skeptisch<br />
zu den Plänen geäußert,<br />
Adolf Hitler die Ehrenbürgerwürde<br />
seiner Heimatstadt<br />
Goslar abzuerkennen.<br />
„Man versucht<br />
sich da von etwas reinzuwaschen,<br />
von dem man<br />
sich nicht reinwaschen<br />
kann“, sagte Gabriel am<br />
Rande eines Schulbesuchs<br />
im niedersächsischen<br />
Empelde über die<br />
Bemühungen, den ehemaligen<br />
Reichskanzler<br />
aus der Ehrenreihe zu tilgen:<br />
„H<strong>eu</strong>te finde ich es<br />
fast falsch, das zu machen.“<br />
Als Jugendlicher<br />
habe er eine andere Meinung<br />
vertreten, sagte Gabriel:<br />
„Als Mitglied der<br />
Falken habe ich die Ab -<br />
erkennung immer gewollt.“<br />
Der Stadtrat Goslar<br />
soll sich im September<br />
mit einem entsprechenden<br />
Antrag der Partei<br />
Die Linke befassen.<br />
Der Spitzenverband der gesetzlichen<br />
Krankenkassen (GKV) will bei seinen<br />
Mitgliedern eine Sonderabgabe erheben,<br />
um ein Bürogebäude zu kaufen.<br />
Das hat der Verwaltungsrat des Verbandes<br />
auf seiner letzten Sitzung<br />
Ende Juni beschlossen. Den Kaufpreis<br />
für das „Palais am D<strong>eu</strong>tschen Theater“<br />
in Berlin schätzen die Kassen auf<br />
rund 70 Millionen Euro, der Eigentümer<br />
auf 78 Millionen. Rund acht Millionen<br />
Euro will der Verband aus<br />
Rücklagen finanzieren, für den Rest<br />
sollen die Mitgliedskassen aufkommen.<br />
Sie müssen eine einmalige Umlage<br />
zahlen, die in etwa einen Euro pro<br />
Versicherten betragen soll. Klamme<br />
Kassen dürfen die Zahlung aber stunden,<br />
um Zusatzbeiträge zu vermeiden.<br />
Bundesgesundheitsminister Daniel<br />
Bahr, FDP, hat den Kauf bereits genehmigt.<br />
Gegen eine Finanzierung<br />
über Kredite hatte der Bundesrechnungshof<br />
in vertraulichen Vorgesprächen<br />
Vorbehalte angemeldet. Schon<br />
Anfang Juli waren die 375 Mitarbeiter<br />
des Verbandes in die angemietete<br />
15 000-Quadratmeter-Fläche umgezogen,<br />
die der Eigentümer als „Spitzenimmobilie“<br />
bewirbt. Die Kassenlobbyisten<br />
berufen sich jetzt auf eine<br />
Kaufoption, die ihnen der Mietvertrag<br />
einräumt. Der Verband argumentiert,<br />
dass der Erwerb der Immobilie langfristig<br />
günstiger sei.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 17<br />
In dieser Ausgabe:<br />
Alt-Hippies oder Manager?<br />
Fünf verschiedene Elterntypen<br />
im Video<br />
Welche Krise?<br />
Video über den Kampf junger Griechen<br />
für ihr Land<br />
Job für die Welt<br />
Video über Billigkrankenhäuser<br />
in Indien<br />
Die n<strong>eu</strong>e Art zu lesen.<br />
Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.<br />
Mit exklusiv produzierten Videos.<br />
Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven<br />
Grafiken und 3-D-Modellen.<br />
Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!<br />
DER SPIEGEL<br />
Einfach scannen und<br />
Testangebot sichern –<br />
Nutzen Sie dafür unsere<br />
App DER SPIEGEL mit<br />
integriertem QR-Code-<br />
Scanner
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
BOTSCHAFTEN<br />
„Gefahren für Leib<br />
und Leben“<br />
Das Bundesinnenministerium ist mit<br />
seiner Forderung nach 60 n<strong>eu</strong>en Bundespolizei-Stellen<br />
für den Botschaftsschutz<br />
vorerst gescheitert. Das Ministerium<br />
hatte die Posten, darunter 30<br />
im Personen- und 30 im Objektschutz,<br />
im März für den Bundeshaushalt 2014<br />
angemeldet. Im Haushaltsentwurf, den<br />
das Kabinett im Juni verabschiedet<br />
hat, sind sie allerdings nicht enthalten.<br />
Dabei hat das Innenministerium den<br />
Bedarf sogar noch höher angesetzt,<br />
nämlich auf 240 n<strong>eu</strong>e Stellen bis 2017.<br />
Schließlich habe die Bundespolizei neben<br />
den schon länger von ihr gesicherten<br />
Botschaften in Kabul und Bagdad<br />
inzwischen auch die Standorte in Tripolis<br />
(Libyen), Sanaa (Jemen), Bogotá<br />
(Kolumbien) und Bamako (Mali) übernommen,<br />
außerdem das n<strong>eu</strong>e Generalkonsulat<br />
in Masar-i-Scharif (Afghani -<br />
stan). Nach einer Wiedereröffnung<br />
wäre sie zudem für die Vertretung im<br />
syrischen Damaskus zuständig. Welche<br />
Folgen es hätte, wenn ihr Wunsch<br />
D<strong>eu</strong>tsche Botschaft im Jemen nach Anschlag am 14. September 2012<br />
nach mehr Stellen abgelehnt würde,<br />
hatten die Innenministerialen vorsichtshalber<br />
schon in ihrem Antrag beschrieben:<br />
Dies führe entweder „zu erheblichen<br />
Gefahren für Leib und Leben<br />
der Entsandten des Auswärtigen<br />
Amtes“, oder aber die Bundespolizei<br />
Panorama<br />
werde im Inland geschwächt, wenn die<br />
benötigten Kräfte hier abgezogen und<br />
ins Ausland geschickt werden müssten.<br />
Diese „faktische Reduzierung“ sei mit<br />
„Blick auf die nationale Sicherheitslage<br />
(illegale Migration und Terrorismus)<br />
nicht mehr hinnehmbar“.<br />
MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / REUTERS<br />
WAHL<br />
2013<br />
KOLUMNE<br />
Sechs Wochen noch<br />
Zu den Gefahren des Wahlkampfs gehört, dass er<br />
dick macht. Peer Steinbrück informierte darüber<br />
kürzlich die Öffentlichkeit, als er äußerst kritisch<br />
über „Pappbrötchen“ sprach. Diese „Dickmacher“<br />
würden bei nahezu jedem Termin gereicht. Er habe<br />
sich nun sieben pappbrötchenfreie Tage in der Woche<br />
vorgenommen. Damit ist Ernährung das große Thema<br />
des Wahlkampfs 2013. Denn die Grünen überlegen, in Kantinen<br />
einen vegetarischen Tag pro Woche einzuführen, womit<br />
sie eine Debatte über Vorschriften ausgelöst haben. Es ist<br />
also Zeit für eine kleine Kulinarik der Politik,<br />
bei der es selbstverständlich nur um<br />
große Fragen geht: Egalität, Demokratie,<br />
Schuldenstaat, Freiheit, Koalitionen.<br />
Helmut Kohl isst gern Saumagen, Kurt<br />
Beck Schweinerüssel. Von Gerhard<br />
Schröder bleibt in Erinnerung, dass er die geliebten Schnitzel<br />
zeitweise heimlich „in Autobahnraststätten“ essen musste,<br />
weil ihn eine seiner Ex-Frauen gesund ernähren wollte. Angela<br />
Merkel kocht und löffelt gern Kartoffelsuppe, und Norbert<br />
Röttgen hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen 2012 auch<br />
verloren, weil er ungekonnt Bratwürste aß. Bratwürste gehören<br />
ebenfalls zu nahezu jeder Wahlveranstaltung.<br />
Auf Pappbrötchen traf Steinbrück in der vergangenen Woche<br />
bei einem Besuch im Landkreis Steinfurt. Die Pappe hatte<br />
die Form von Brot, nicht von Brötchen, aber der Geschmack<br />
Politiker kommen immer zu<br />
spät, der Käse muss warten<br />
und beginnt zu schwitzen.<br />
war gleich. Als Belag diente wie gewohnt Käse, der schwitzt.<br />
Politiker kommen immer zu spät, der Käse muss warten<br />
und beginnt zu schwitzen. Steinbrück widerstand und nahm<br />
lieber ein Stück Str<strong>eu</strong>selkuchen.<br />
Was sagt uns das alles? Aussage eins: Politiker denken egalitär<br />
und essen das, was der normale Bürger auch isst, ob<br />
nun Schweinerüssel oder Schnitzel. Aussage zwei: Der Einsatz<br />
für die Demokratie ist ein Knochenjob, weshalb auf<br />
dem Speisezettel der Politiker das steht, was auch den Kalorienbedarf<br />
von Pflasterern und Möbelpackern deckt. Aussage<br />
drei: Politiker leben bescheiden, können also kaum verantwortlich<br />
sein für den Schuldenstaat.<br />
Nun zu den Getränken: Als Steinbrück in der vorletzten<br />
Woche in Bayern den Lusen bestiegen hatte, kippte er am<br />
Gipfelkr<strong>eu</strong>z einen Schnaps. Dann ging er zu Weißbier über.<br />
Am Mittwoch der letzten Woche diskutierte<br />
er mit Bürgern auf Norderney und<br />
bestellte überraschend ein Wasser. „Ich<br />
habe meiner Frau zugesagt, dass ich<br />
während des Wahlkampfs keinen Alkohol<br />
mehr trinke“, sagte er.<br />
Halten wir fest: Schröder durfte zu Hause kein Schnitzel essen,<br />
Steinbrück darf im Wahlkampf keinen Alkohol trinken.<br />
Von Merkel ist hingegen nicht bekannt, dass ihr Mann Joachim<br />
Sauer jemals zu ihr gesagt hat: Angela, muss ein zweiter<br />
Teller Kartoffelsuppe wirklich sein? Das führt zu Aussage<br />
vier: Politikerinnen sind freier als Politiker.<br />
So wird eine Prognose zur nächsten Regierung möglich. Sozialdemokraten<br />
sind es gewöhnt, sich bei der Nahrungsaufnahme<br />
Vorschriften machen zu lassen. Rot-Grün liegt näher<br />
als Schwarz-Grün.<br />
Dirk Kurbjuweit<br />
18<br />
DER SPIEGEL 33/2013
SPD-Fraktionschef Steinmeier bei der Vogelbeobachtung in einem Brandenburger Naturpark<br />
THOMAS KOEHLER / PHOTOTHEK VIA GETTY IMAGES<br />
GEHEIMDIENSTE<br />
Attacke im Nebel<br />
In der NSA-Affäre versucht die Regierung, die SPD zum Mitschuldigen zu machen.<br />
Es ist eine riskante Strategie, denn schon kommen n<strong>eu</strong>e Vorwürfe:<br />
Half der BND den Amerikanern bei der Drohnen-Zielerfassung in Afghanistan?<br />
Es gibt einen Schlüsselbegriff, auf<br />
den erfahrene Krisenmanager in<br />
ihren Erzählungen immer wieder<br />
zurückkommen. Kontrollfähigkeit. Darum<br />
geht es, wenn eine Regierung plötzlich<br />
mit einer unangenehmen Entwicklung<br />
konfrontiert wird. Sie muss den Prozess<br />
irgendwie unter Kontrolle behalten.<br />
Die Regierung verfügt dabei über einen<br />
entscheidenden Vorteil: Sie weiß mehr<br />
als alle anderen. Sie kennt die Vorgänge<br />
vollständig. Sie kann abgleichen, was davon<br />
öffentlich geworden ist. Sie kann das<br />
Risiko einschätzen, wie viel noch bekannt<br />
20<br />
werden könnte und durch gezielte Veröffentlichungen<br />
vorb<strong>eu</strong>gen. Mit etwas Geschick<br />
wird es ihr gelingen, die wirklich<br />
wichtigen Dinge am Ende unter der Decke<br />
zu halten.<br />
Die NSA-Affäre passt nicht in dieses<br />
Schema. Seit der geflohene amerikanische<br />
Geheimdienstmann Edward Snow -<br />
den vor n<strong>eu</strong>n Wochen die ersten Einzelheiten<br />
über Washingtons beispiellose Datensammelwut<br />
in die Öffentlichkeit brachte,<br />
fehlt Angela Merkels Regierung das<br />
wichtigste Instrument in einer Krise: die<br />
Kontrollfähigkeit.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Das Kanzleramt weiß nicht, was die<br />
Amerikaner wissen. Es weiß nicht, was<br />
Snowden weiß, es kann nicht einschätzen,<br />
was noch kommen wird. Es weiß nicht<br />
genau, was die eigenen L<strong>eu</strong>te wissen und<br />
ob sie das Gleiche wissen wie die Amerikaner.<br />
Der Unterschied zwischen Wissen<br />
und Nichtwissen hat sich für die Regierung<br />
gefährlich verschoben. Wer will sich<br />
öffentlich festlegen, wenn man selbst so<br />
wenig Durchblick hat?<br />
Sieben Wochen lang sind Merkel und<br />
ihre Getr<strong>eu</strong>en deshalb halbblind durch<br />
die NSA-Affäre gestolpert, doch seit Frei-
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
tag vorvoriger Woche erwecken sie den<br />
Eindruck, als hätten sie plötzlich einen<br />
Pfad im Nebel gefunden. Da antwortete<br />
der Bundesnachrichtendienst (BND) auf<br />
entsprechende Fragen des SPIEGEL, womöglich<br />
stehe er selbst hinter einem großen<br />
Teil der NSA-Daten aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />
Und die kämen zudem vor allem aus Afghanistan.<br />
Ein paar Tage später dann ging die Regierung<br />
zur Attacke über. Der damalige<br />
Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier<br />
(SPD) sei es gewesen, der den Amerikanern<br />
im April 2002 in einem bislang unbekannten<br />
Abkommen den Zugang zu den<br />
d<strong>eu</strong>tschen Daten verschafft habe, verkündete<br />
Regierungssprecher Georg Streiter.<br />
Ist Steinmeier also schuld? Und der<br />
Merkel-Herausforderer Peer Steinbrück<br />
ein scheinheiliger H<strong>eu</strong>chler, weil er der<br />
Kanzlerin vorgeworfen hatte, sie habe ihren<br />
Amtseid verletzt? „Jämmerlich“ sei<br />
es, wie die Bundesregierung versuche,<br />
sich aus der Verantwortung zu stehlen,<br />
konterte Steinmeier. Damals, nach 9/11,<br />
sei es um die Aufklärung „eines grauenhaften<br />
Verbrechens“ gegangen, h<strong>eu</strong>te dagegen<br />
um die „lückenlose und flächendeckende<br />
Abschöpfung von Daten unserer<br />
Bürgerinnen und Bürger“.<br />
Merkels Helfer waren dennoch happy.<br />
Endlich Angriff. „Pure H<strong>eu</strong>chelei“ sei das<br />
Verhalten Steinmeiers gewesen, donnerte<br />
CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe.<br />
An diesem Montag will Kanzleramtschef<br />
* Mit Geheimdienstkoordinator Günter Heiß am 25. Juli<br />
in Berlin.<br />
Ronald Pofalla das Abkommen vom 28.<br />
April 2002, das Grundlage für die Geheimdienstzusammenarbeit<br />
mit den USA ist, im<br />
geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremium<br />
im Wortlaut präsentieren.<br />
Zudem erwägt die CDU, ihre Attacken<br />
auszubauen. Die SPD soll in ihrer Rolle<br />
als sauberer Ankläger demaskiert werden.<br />
Die Regierung des Sozialdemokraten Gerhard<br />
Schröder habe ihr Nein zum Irak-<br />
Krieg mit einer hohen Willfährigkeit bei<br />
der Kooperation der Geheimdienste kompensiert.<br />
„Die Aussage der bedingungslosen<br />
Solidarität könnte eine ganz n<strong>eu</strong>e<br />
Bed<strong>eu</strong>tung bekommen“, sagt Fraktionschef<br />
Volker Kauder.<br />
Doch der Verlauf der NSA-Affäre hat<br />
gezeigt, dass sich die Fronten gefährlich<br />
schnell verschieben können. Seit der SPIE-<br />
GEL in der vergangenen Woche berichtet<br />
hat, dass der massenhafte Transfer von<br />
Verbindungsdaten an die NSA wohl über<br />
den BND-Horchposten im bayerischen<br />
Bad Aibling und einen Stützpunkt in Afghanistan<br />
laufe, wähnt sich die Bundesregierung<br />
auf der sicheren Seite. Der BND<br />
selbst liefere die Daten, d<strong>eu</strong>tsche Staatsbürger<br />
seien nicht betroffen, alles entspreche<br />
Recht und Gesetz, so die offizielle<br />
Lesart. Tatsächlich aber wäre auch diese<br />
n<strong>eu</strong>e Erklärung nicht unproblematisch.<br />
Ein beträchtlicher Teil der millionenfach<br />
übertragenen Metadaten stammen nach<br />
SPIEGEL-Informationen aus der Funkzellenauswertung.<br />
Die Signale entstehen fortlaufend,<br />
wenn sich ein Handy über einen<br />
Sendemast in eine Funkzelle einloggt.<br />
Die blinde Weitergabe dieser Funkzellendaten<br />
an amerikanische Taliban-Jäger<br />
dürfte die politische Auseinandersetzung<br />
noch verschärfen. Blind deshalb, weil der<br />
BND gar nicht prüft, welche Signale er<br />
den Amerikanern im Einzelnen zur Verfügung<br />
stellt. Die in den Snowden-Unterlagen<br />
genannte gigantische Summe von<br />
500 Millionen d<strong>eu</strong>tschen Daten aus dem<br />
vergangenen Dezember („Germany –<br />
Last 30 Days“) hält der BND aber für<br />
„plausibel“.<br />
Der BND erfasst monatlich im Schnitt<br />
3,2 Millionen Inhaltsdaten mit XKeyscore.<br />
Sicher ist, dass XKeyscore, das Spähprogramm,<br />
mit dem BND und Amerikaner<br />
arbeiten, sehr weitreichende Möglichkeiten<br />
bietet. Es gehört wohl zu den größten<br />
Kostbarkeiten aus dem Arsenal der<br />
US-Lauscher (siehe SPIEGEL 30/2013).<br />
Im Parlamentarischen Kontrollgremium<br />
erklärte BND-Chef Gerhard Schindler<br />
am Donnerstag vorletzter Woche, sein<br />
Dienst habe 2012 monatlich im Schnitt<br />
3,2 Millionen Inhaltsdaten mittels XKey -<br />
score aus der Satellitenüberwachung erfasst.<br />
Die Auslandsaufklärer erfuhren<br />
demnach, was in Telefongesprächen besprochen<br />
oder in E-Mails und SMS geschrieben<br />
wurde. Das erklärt aber nur einen<br />
kleinen Teil des Datenstroms, den<br />
Kanzleramtsminister Pofalla*: Umschalten auf Attacke<br />
SOEREN STACHE / DPA<br />
DER SPIEGEL 33/2013 21
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
die NSA intern erfasst. Dort ist nämlich<br />
von 182 Millionen XKeyscore-Datensätzen<br />
aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> allein im Dezember<br />
die Rede.<br />
Der BND nimmt an, es könnte sich bei<br />
der Differenz um ebenjene Verbindungsdaten<br />
handeln, die in Bad Aibling direkt<br />
an die Amerikaner weitergeleitet werden<br />
und auch Daten aus der Funkzellenauswertung<br />
umfassen. Diese liefern der westlichen<br />
Koalition wertvolle Hinweise für<br />
den Krieg am Hindukusch. Spionageprogramme<br />
wie XKeyscore erstellen daraus<br />
Bewegungsprofile, die mit nur wenigen<br />
Minuten Verzögerung anzeigen, wo sich<br />
die Handynutzer gerade aufhalten – ob<br />
Taliban, Qaida-Kämpfer oder d<strong>eu</strong>tscher<br />
Islamist. Die brisanten Informationen erhöhen<br />
aber auch die Sicherheit der Soldaten.<br />
Nach eigenen Angaben leistete der<br />
BND seit Januar 2011 „maßgebliche Hilfe“,<br />
um vier Anschläge auf d<strong>eu</strong>tsche Soldaten<br />
in Afghanistan zu verhindern. Bei<br />
weiteren 15 verhinderten Anschlägen<br />
habe die Datenüberwachung des Dienstes<br />
„zu diesen Erfolgen beigetragen“.<br />
Im selben Zeitraum, so der BND, habe<br />
er „67 Warnhinweise verfasst, die auf bevorstehende<br />
Anschläge oder auf eine Verschärfung<br />
der Bedrohungslage in Afghanistan<br />
hinwiesen“. Auch die Amerikaner<br />
wissen die Beteiligung des d<strong>eu</strong>tschen Auslandsgeheimdienstes<br />
am Hindukusch zu<br />
schätzen. In geheimen Unterlagen äußerte<br />
sich die NSA mehrfach lobend<br />
über das größere „Risiko“,<br />
das die früher als zu zaghaft<br />
verschrieenen D<strong>eu</strong>tschen<br />
seit geraumer Zeit eingehen.<br />
Für die Regierung könnte<br />
diese Risikobereitschaft jedoch<br />
unangenehme Folgen haben.<br />
Die heikle Frage, die sich nun<br />
aufdrängt, betrifft die Legitimation<br />
dieser engen Kooperation<br />
durch Datentransfer. Darf der<br />
BND Funkzellendaten an die<br />
NSA weiterleiten, wenn sie<br />
womöglich auch eine Rolle bei<br />
tödlichen Operationen der US-<br />
Militärs spielen, wie etwa der<br />
gezielten Tötung von Qaida-<br />
Kämpfern durch amerikanische<br />
Drohnen? Einem Bericht der<br />
„Südd<strong>eu</strong>tschen Zeitung“ zufolge<br />
gibt der Dienst auf ausdrückliche<br />
Anweisung von BND-<br />
Chef Schindler zudem Handy -<br />
nummern an die Partnerdienste<br />
weiter. Liefert er damit den<br />
Hinweis, wonach sie bei der<br />
Funkzellenauswertung suchen<br />
müssen?<br />
Der BND selbst beschwichtigt: Die gelieferten<br />
Daten seien „für eine konkrete<br />
Zielerfassung durch Drohnen zu ungenau“.<br />
Allerdings räumte er auf Anfrage<br />
auch ein: „Die Hilfe bei der Orientierung<br />
für militärische Operationen kann nicht<br />
ausgeschlossen werden.“<br />
Gezielte Tötungen mit unbemannten<br />
Flugz<strong>eu</strong>gen, die martialische Namen wie<br />
„Reaper“ (Sensenmann) und „Predator“<br />
(Raubtier) tragen, stehen weltweit in der<br />
Kritik und sind rechtlich höchst umstritten.<br />
Zwei D<strong>eu</strong>tsche kamen in den vergangenen<br />
Jahren bei solchen Angriffen ums<br />
Leben. Der in Wuppertal aufgewachsene<br />
Bünjamin E. starb am 4. Oktober 2010 in<br />
Softwareprogramme wie XKeyscore erstellen<br />
aus Funkzellendaten Bewegungsprofile.<br />
22<br />
Mir Ali. Im Frühjahr 2012 traf eine Drohne<br />
einen Pick-up, in dem der Aachener<br />
Islamist Samir H. saß. Experten gehen<br />
davon aus, dass Funkzellendaten sehr<br />
wohl zielführende Hinweise für derartige<br />
Angriffe liefern können.<br />
Fraglich ist auch, ob die massenhafte<br />
Datenerhebung und -weitergabe an einen<br />
fremden Geheimdienst ohne weiteres mit<br />
d<strong>eu</strong>tschem Recht vereinbar ist. „Das Gesetz<br />
erlaubt dem BND zwar, von <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
aus den internationalen E-Mail- und<br />
Telefonverkehr zu überwachen“, sagt der<br />
Jurist Niko Härting, der an der Berliner<br />
Hochschule für Wirtschaft und Recht lehrt,<br />
„die millionenfache Abschöpfung von Verbindungsdaten<br />
sieht es aber nicht vor.“<br />
Der liberale Jurist und Bürgerrechtler<br />
Burkhard Hirsch hält es für sehr pro -<br />
Wahlkämpfer Steinbrück: Ein scheinheiliger H<strong>eu</strong>chler?<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
HANNIBAL HANSCHKE / DPA<br />
blematisch, dass die systematische Zusammenarbeit<br />
d<strong>eu</strong>tscher und amerika -<br />
nischer Dienste offenbar jenseits einer<br />
parlamentarischen Kontrolle stattfindet:<br />
„Wenn der BND in solchem Umfang für<br />
einen anderen Geheimdienst tätig wird,<br />
dann ist das ein politischer Vorgang, der<br />
unter allen Umständen im zuständigen<br />
Bundestagsgremium hätte behandelt<br />
werden müssen.“ Das Parlamentarische<br />
Kontrollgremium jedoch ist in mehreren<br />
Sondersitzungen seit Beginn der NSA-<br />
Affäre nicht über das Ausmaß der Datenweitergabe<br />
durch den BND informiert<br />
worden.<br />
An diesem Montag ergibt sich für das<br />
Kontrollgremium die nächste Gelegenheit,<br />
Licht ins Dunkel zu bringen. Die<br />
wichtigste Frage lautet seit nunmehr zwei<br />
Monaten, wie genau die Tätigkeit von befr<strong>eu</strong>ndeten<br />
ausländischen Diensten in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> aussieht.<br />
Denn selbst wenn die Einlassungen von<br />
BND und Bundesregierung aus der vergangenen<br />
Woche zutreffen sollten, ist damit<br />
noch immer nicht Edward Snowdens<br />
Hauptvorwurf widerlegt: dass amerikanische<br />
und britische Geheimdienste eigenständig,<br />
systematisch und millionenfach<br />
weltweit Kommunikationsdaten abfischen.<br />
Ein weiteres Indiz für Snowdens Darstellung<br />
liefert eine Stellungnahme der<br />
Bundesregierung aus dem Jahr 2011. Danach<br />
räumte sie von Januar 2005 bis<br />
Februar 2011 exakt 207 ausländischen<br />
Unternehmen Sonderrechte bei „ana-<br />
lytischen Dienstleistungen“ auf d<strong>eu</strong>tschem<br />
Boden ein. Bei deren Tätigkeiten<br />
handelt es sich unter anderem um „Si-<br />
gnals Intelligence“, „Human<br />
Intelligence“ und „Military Intelligence“<br />
– mit anderen Worten:<br />
um menschliche und technische<br />
Spionage.<br />
Ob die Arbeit dieser Unternehmen<br />
die Grundrechte von<br />
Bundesbürgern aushebelt und<br />
was die Bundesregierung im<br />
Einzelnen darüber weiß, ist<br />
ungeklärt. Darüber hinaus zei -<br />
gen n<strong>eu</strong>e Dokumente, die der<br />
SPIEGEL einsehen konnte,<br />
dass US-Geheimdienste ex -<br />
plizit mit etlichen Spionage -<br />
aufgaben in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> betraut<br />
sind (siehe Seite 23).<br />
Die d<strong>eu</strong>tsch-amerikanische<br />
Zusammenarbeit sei auch h<strong>eu</strong>te<br />
noch von großer Bed<strong>eu</strong>tung,<br />
sagt der Altliberale Hirsch. „Es<br />
geht aber nicht, dass die Amerikaner<br />
als Hegemon unserer<br />
Wertegemeinschaft in den<br />
Grundwerten unserer Verfassung<br />
herumholzen wie eine Besatzungsmacht.“<br />
HUBERT GUDE,<br />
KONSTANTIN VON HAMMERSTEIN,<br />
PETER MÜLLER, JÖRG SCHINDLER
Demonstranten am US-Komplex im hessischen Griesheim<br />
PDH<br />
Shrimps aus Griesheim<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ist für die NSA Partner und Angriffsziel zugleich, wie eine Aufgabenliste der<br />
amerikanischen Aufklärung zeigt. Von Hessen aus operiert der Nachrichtendienst mit<br />
dem Schnüffelwerkz<strong>eu</strong>g XKeyscore – die Ergebnisse werden dem US-Präsidenten vorgetragen.<br />
Das Gelände ist mit einem hohen<br />
Drahtzaun gesichert, darüber haben<br />
die dort ansässigen US-Truppen<br />
teils zusätzlich Nato-Stacheldraht gewickelt.<br />
Die Parkflächen sind riesig, die<br />
Gebäude eher überschaubar, deshalb ahnen<br />
Griesheimer Bürger schon lange, dass<br />
sich der Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter<br />
unter der Erde abspielt – und es um ein<br />
geheimes Geschäft geht: Spionage.<br />
Der sogenannte „Dagger-Komplex“ gehört<br />
zu den am besten geschützten Arealen<br />
in Hessen, und was passieren kann,<br />
wenn man sich zu intensiv dafür inter -<br />
essiert, erlebte kürzlich der Griesheimer<br />
Daniel Bangert. Inspiriert durch die Enthüllungen<br />
von Edward Snowden, hatte er<br />
Anfang Juli via Facebook zu einem „Spaziergang“<br />
zum Dagger-Komplex eingeladen,<br />
um „gemeinsam den bedrohten Lebensraum<br />
der NSA-Spione zu erforschen“.<br />
Prompt bekam es Bangert noch vor seiner<br />
Spionage-Safari mit der Polizei zu tun.<br />
Für den Gebäudekomplex im Umland<br />
von Darmstadt interessieren sich derzeit<br />
auch die Parlamentarier des D<strong>eu</strong>tschen<br />
Bundestags. Denn der Campus beherbergt<br />
eine der wichtigsten <strong>eu</strong>ropäischen<br />
Dependancen des amerikanischen Geheimdienstes<br />
National Security Agency<br />
(NSA), der durch die Informationen seines<br />
ehemaligen Mitarbeiters Edward<br />
Snowden weltweit in der Kritik steht.<br />
Laut internen Dokumenten der NSA,<br />
die der SPIEGEL einsehen konnte, residiert<br />
in Griesheim das „Europäische kryptologische<br />
Zentrum“ des Dienstes, kurz<br />
ECC. Aus einem NSA-Bericht von 2011<br />
geht hervor, dass es sich dabei um den<br />
„größten Analyse- und Produktionsstandort<br />
in Europa“ handle: Die Ergebnisse<br />
der Arbeit in der geheimen Einrichtung<br />
im Landkreis Darmstadt-Dieburg fänden<br />
durchschnittlich zweimal pro Woche<br />
Eingang in die Lageberichte an Präsident<br />
Barack Obama, die sogenannten „Presidential<br />
Daily Briefs“.<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ist für die NSA in vielerlei<br />
Hinsicht ein besonderer Standort. Aus wenigen<br />
anderen Ländern fließen so viele<br />
Daten nach Amerika, erhebliche Teile liefert<br />
der d<strong>eu</strong>tsche Bundesnachrichtendienst<br />
(SPIEGEL 32/2013). Zugleich ist die<br />
Bundesrepublik – allen fr<strong>eu</strong>ndschaftlichen<br />
Bet<strong>eu</strong>erungen zum Trotz – selbst Zielscheibe<br />
der Aufklärung. Laut einer als<br />
„geheim“ eingestuften Übersicht aus dem<br />
Snowden-Archiv, die der SPIEGEL einsehen<br />
konnte, gehört <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zu jenen<br />
Nationen, die von den Amerikanern nachrichtendienstlich<br />
aufgeklärt werden.<br />
In der Übersicht aus dem April 2013<br />
definiert die NSA ihre „intelligence priorities“,<br />
also die nachrichtendienstlichen<br />
Prioritäten. Die Skala reicht von „1“<br />
(höchstes Interesse) bis „5“ (niedrigstes<br />
Interesse). Zu den Top-Zielen zählen, wenig<br />
überraschend, China, Russland, Iran,<br />
Pakistan und Afghanistan.<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> rangiert in dieser Art<br />
Hausaufgabenliste im Mittelfeld, etwa auf<br />
einer Ebene mit Frankreich und Japan,<br />
aber vor Italien und Spanien. Im Themenraster<br />
des Geheimdienstes befinden sich<br />
laut der Übersicht vor allem die d<strong>eu</strong>tsche<br />
Außenpolitik sowie Fragen der ökonomischen<br />
Stabilität und Gefahren für die Finanzwirtschaft,<br />
beide sind mit einer „3“<br />
markiert. Weitere Aufklärungsaufträge<br />
umfassen Themen wie Waffenexporte,<br />
n<strong>eu</strong>e Technologien, hochentwickelte konventionelle<br />
Waffen und den internationalen<br />
Handel, alle mit der Priorität „4“. Für<br />
weniger bedrohlich halten die US-Lau-<br />
DER SPIEGEL 33/2013 23
Regierungschefs Merkel, Obama*: „Abhören von Fr<strong>eu</strong>nden ist inakzeptabel“<br />
scher offenbar die Gegenspionage aus<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> und die von hier ausgehende<br />
Gefahr für Cyberangriffe auf US-Infrastrukturen<br />
(Priorität „5“). Insgesamt sind<br />
es n<strong>eu</strong>n Themenbereiche, die in Bezug<br />
auf die Bundesrepublik aufgeklärt werden<br />
sollen.<br />
Das Spionage-Tableau bestätigt zudem,<br />
dass die Europäische Union zu den Zielen<br />
gehört, die die Amerikaner attackieren.<br />
Sechs Themenfelder werden demnach ausgeforscht.<br />
Hauptsächlich sind dies die<br />
Bereiche „Außenpolitische Ziele“, „Internationaler<br />
Handel“ und „Wirtschaftliche<br />
Stabilität“, sie sind jeweils mit einer „3“<br />
gelistet. Dazu kommen, mit der geringeren<br />
Priorität „5“, n<strong>eu</strong>e Technologien, Energiesicherheit<br />
sowie Ernährungsfragen.<br />
Staaten wie Kambodscha, Laos oder<br />
Nepal scheinen aus der US-Perspektive<br />
dagegen offenbar geheimdienstlich weitgehend<br />
irrelevant, ebenso die meisten<br />
eruopäischen Länder, etwa Finnland, Dänemark,<br />
Kroatien oder Tschechien.<br />
Die Übersicht drückt das ambivalente<br />
Verhältnis aus, das die USA zu vielen<br />
Ländern unterhalten. Auf der einen Seite<br />
kooperieren die Geheimdienste miteinander<br />
und tauschen Informationen aus. Auf<br />
der anderen Seite werden viele Länder<br />
ausgespäht, zumindest in Teilen. Nur<br />
Großbritannien, Australien, Kanada und<br />
N<strong>eu</strong>seeland – zusammen mit den USA<br />
auch die „fünf Augen“ genannt – gelten<br />
als echte Fr<strong>eu</strong>nde, die weitgehend tabu<br />
* Am 19. Juni in Berlin.<br />
24<br />
sind und mit denen ein offener Austausch<br />
stattfindet.<br />
Etwa 30 andere Staaten werden von<br />
der NSA als „3rd party“ bezeichnet, mit<br />
denen sie unter Vorbehalt zusammen -<br />
arbeitet; dazu zählt <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>. „Wir<br />
können die Signale der meisten ausländischen<br />
Partner dritter Klasse angreifen –<br />
und tun dies auch“, heißt es in einer geheimen<br />
Selbstdarstellung der NSA.<br />
Die Prioritätenliste, in der <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
als Angriffsziel aufgeführt ist, ist ein Rückschlag<br />
für die Bemühungen der Amerikaner,<br />
den bisher durch das Bekanntwerden<br />
diverser Spionageprogramme und Überwachungsaktionen<br />
eingetretenen Schaden<br />
einzudämmen; noch vergangene Woche<br />
bet<strong>eu</strong>erte der BND, er habe „keine Anhaltspunkte“,<br />
dass die NSA „personenbezogene<br />
Daten d<strong>eu</strong>tscher Staatsangehöriger<br />
in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> erfasst“.<br />
„Abhören von Fr<strong>eu</strong>nden, das ist inakzeptabel“,<br />
hatte die Kanzlerin ihren Sprecher<br />
Steffen Seibert ausrichten lassen,<br />
nachdem der SPIEGEL beschrieben hatte,<br />
wie die NSA Einrichtungen der Europäischen<br />
Union infiltriert. „Wir sind nicht<br />
mehr im Kalten Krieg.“<br />
Gut sechs Wochen nach Beginn der Affäre<br />
wartet die Bundesregierung noch immer<br />
auf Antworten darauf, was genau die<br />
NSA in und gegen <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> treibt.<br />
Insbesondere fehlt eine vollständige Auskunft,<br />
welche Daten die NSA erhebt oder<br />
erheben lässt, zusätzlich zu jenen Millionen<br />
Metadaten, von denen der BND einräumt,<br />
sie in seinen Abhörstationen, etwa<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
in Bad Aibling, zu sammeln<br />
und weiterzu leiten.<br />
Wie intensiv die Amerikaner<br />
von <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> aus im<br />
internationalen Datenverkehr<br />
stöbern, illustrieren verschiedene<br />
NSA-Unterlagen aus den<br />
vergangenen Jahren, die der<br />
SPIEGEL erstmals einsehen<br />
konnte. Neben der Station in<br />
Bad Aibling spielt darin die<br />
NSA-Dependance in Griesheim<br />
eine große Rolle, sie sei<br />
eine „Erfolgsgeschichte“ im<br />
Bereich der technischen Aufklärung,<br />
loben die NSA-L<strong>eu</strong>te.<br />
Allein von 2007 bis 2011 sei<br />
die Zahl der Aufträge, bestimmte<br />
Ziele auszuforschen,<br />
von 5 auf 26 gestiegen, heißt<br />
es in einem Papier. Demnach<br />
haben die dort tätigen 240<br />
ECC-Mitarbeiter (Stand 2011)<br />
diverse Schwerpunkte, darunter<br />
Afrika, Europa und den<br />
Nahen Osten sowie die Terrorabwehr.<br />
Der Standort in Hessen ist<br />
aber noch aus einem weiteren<br />
Grund interessant: Dort wird<br />
offenbar die umstrittene Software<br />
XKey score eingesetzt.<br />
Das geht aus einem NSA-internen Erfahrungsbericht<br />
von 2012 hervor. Er trägt den<br />
merkwürdigen Titel „Erzählungen aus<br />
dem Land der Gebrüder Grimm“ und beschreibt,<br />
wie erfolgreich die Analysten<br />
das Schnüffelprogramm einsetzen. Er ist<br />
auch deshalb erhellend, weil d<strong>eu</strong>tlich<br />
wird, dass viele NSA-Mitarbeiter selbst<br />
gehörigen Respekt vor XKeyscore haben.<br />
Er habe immer Angst gehabt, mit einem<br />
Bein im Gefängnis zu stehen, wenn er das<br />
Programm benutzt habe, wird ein Analyst<br />
zitiert – seit dem Training gehe er selbstbewusster<br />
damit um.<br />
Früher sei die Arbeit der NSA-Analysten<br />
vergleichbar gewesen mit „Forrest<br />
Gump auf seinem Shrimpkutter vor der<br />
Küste von Alabama“, heißt es in dem Bericht<br />
aus Griesheim. Man habe aus dem<br />
Datenozean hauptsächlich „Klobrillen<br />
und Seetang gefischt und irgendwann …<br />
drei Shrimps!“. Man habe eine Menge<br />
Ressourcen „verbrannt“, um an diese<br />
paar Shrimps zu kommen, also Dokumente<br />
oder Metadaten, die das Wissen über<br />
die Ziele erweitern, „wir haben es mit<br />
Tonnen von Klobrillen, Spam und anderem<br />
Müll zu tun“. Nach der Einführung<br />
von XKeyscore sei die Arbeit wesentlich<br />
effizienter geworden. Die Instrumente<br />
erlaubten präzise Fischzüge – mehr<br />
Shrimps, weniger Beifang.<br />
Seine L<strong>eu</strong>te hätten damit „n<strong>eu</strong>e Datenströme<br />
und n<strong>eu</strong>e Dokumente entdeckt“,<br />
schwärmt ein Bereichsleiter der Afrika-<br />
Abteilung. Darunter sei etwa Material<br />
des tunesischen Innenministeriums gewe-<br />
MARCUS BRANDT / DPA
sen, das in keinem anderen Überwachungssystem<br />
hängengeblieben sei.<br />
Die n<strong>eu</strong>en Möglichkeiten des Systems,<br />
das nach eigenen Angaben auch der BND<br />
in kleinem Maßstab seit 2007 einsetzt,<br />
will die NSA offenbar mit einem internen<br />
Modernisierungsprogramm möglichst<br />
weit verbreiten. Sie setzt dabei auf eine<br />
Schulung, die sich der britische Geheimdienst<br />
GCHQ ausgedacht hat, eine Art<br />
Zirkeltraining für verschiedene Stationen.<br />
Im März 2012 fand demnach in Griesheim<br />
ein solches Training für 68 Teilnehmer<br />
statt – die jeweils 20 Minuten an den verschiedenen<br />
Stationen seien wie „Speed<br />
Dating“ gewesen.<br />
Um zusätzliche Motivation zu schaffen,<br />
bedient sich die NSA im Umgang mit<br />
dem Programm verschiedener Anleihen<br />
aus dem Computerspielebereich: So sollen<br />
die Analysten durch besonders erfolgreiche<br />
XKeyscore-Ausspähungen „Skilz“-<br />
Punkte erwerben und verschiedene „Level“<br />
erreichen. Die Trainingseinheiten in<br />
Hessen zeigen offenbar Erfolg: ECC-Analysten<br />
hätten die „höchsten durchschnittlichen<br />
Skilz-Punkte“, verglichen mit allen<br />
anderen entsprechenden NSA-Abteilungen,<br />
heißt es.<br />
Was genau die Truppe in Griesheim<br />
treibt und ob sie von dort aus möglicherweise<br />
auch Ziele in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> überwacht,<br />
werden die Amerikaner der Bundesregierung<br />
wohl kaum eingestehen.<br />
Schon jetzt, klagt der Ex-NSA-Chef Michael<br />
Hayden gegenüber dem SPIEGEL,<br />
sei durch die Enthüllungen „schwerer<br />
Schaden für das d<strong>eu</strong>tsch-amerikanische<br />
Verhältnis entstanden“. Nach dem 11.<br />
September 2001 habe er sich intensiv um<br />
ein gutes Verhältnis zum BND bemüht.<br />
„Ich wollte nicht wie ein Besatzer auftreten,<br />
sondern die Zusammenarbeit ausbauen.“<br />
Dieser Erfolg sei nun gefährdet.<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Der mittlerweile pensionierte Vier-Sterne-General<br />
streitet allerdings nicht ab,<br />
dass die NSA spioniere: „Wir sind die<br />
Nummer eins darin, Informationen zu<br />
klauen.“ Hayden ist stolz darauf, dies sei<br />
keine böse Spionage, sondern eine, die<br />
noblen Zwecken diene: „Wir stehlen<br />
nicht, um die Menschen reicher zu machen,<br />
sondern um ihnen mehr Sicherheit<br />
zu geben.“<br />
Der 11. September 2001, sagt auch der<br />
ehemalige NSA-Mitarbeiter Thomas<br />
Drake, habe für das amerikanische Verhältnis<br />
zu <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> eine zentrale Rolle<br />
eingenommen. Drake flog jahrelang in Aufklärungsflugz<strong>eu</strong>gen<br />
über d<strong>eu</strong>tschem Boden,<br />
er horchte den Ostblock aus und<br />
spricht die d<strong>eu</strong>tsche Sprache. Er hat den<br />
Dienst 2008 verlassen und ist wie Snowden<br />
zum Whistleblower geworden. „Die Anschläge<br />
vom 11. September waren ein<br />
Schlüsselerlebnis“, sagt Drake. „Danach<br />
wurde <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> von der NSA zu einem<br />
wichtigen Operationsgebiet und Zielland<br />
erklärt.“ Die Amerikaner hätten selbst aufklären<br />
wollen, wer in der Bundesrepublik<br />
etwa mit Islamisten sympathisiere.<br />
Drakes Behauptung wird durch eine<br />
Präsentation des Griesheimer NSA-Zentrums<br />
gestützt. Darin werden „Analyseansätze<br />
für Ziele in Europa“ beschrieben.<br />
Anlass für die Überwachung: „Die meisten<br />
Terroristen reisen durch Europa.“<br />
Einen weiteren Ansatzpunkt, für wen<br />
sich die Amerikaner interessieren, liefert<br />
die NSA in einem anderen Dokument.<br />
Es gebe aktive Gruppen der Anonymous-<br />
Bewegung in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>, die für die<br />
NSA ein legitimes Ziel seien – solange es<br />
sich bei ihnen nicht um US-Bürger handle.<br />
Außerdem durchforsten die Ameri -<br />
kaner Daten aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> nach möglichen<br />
Rüstungsgeschäften.<br />
XKeyscore ist dafür ein hervorragendes<br />
Instrument, weil es unspezifische Suchvorgänge<br />
erlaubt: Ein Analyst kann mit Hilfe<br />
der Software auf bislang völlig unbekannte<br />
Internetnutzer aufmerksam gemacht werden,<br />
weil die sich plötzlich für bestimmte<br />
Themen interessieren oder ein bestimmtes<br />
Verhalten an den Tag legen.<br />
Interessant wird nun sein, ob die amerikanische<br />
Regierung das Glasnost-Versprechen<br />
wahrmacht, das Obama am Freitag<br />
aufgrund des gestiegenen öffentlichen<br />
„Wir sind die Nummer eins darin,<br />
Informationen zu klauen.“<br />
NSA-Aussteiger Drake: „Nach dem 11. September 2001 wurde <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zum Ziel“<br />
DAN CHUNG<br />
Drucks abgab. „Wir können und müssen<br />
transparenter sein“, so der Präsident. Er<br />
habe die Geheimdienste angewiesen, wesentlich<br />
mehr Informationen über die kritisierten<br />
Überwachungsprogramme zu<br />
veröffentlichen.<br />
Ob dazu allerdings die Arbeit der NSA<br />
in Griesheim zählt, ist ebenso fraglich wie<br />
eine Erklärung zu der Prioritätenliste für<br />
Spionageziele. Wie immer in diesen Fällen<br />
kommt es aufs Kleingedruckte an.<br />
Manche Vorwürfe, das Verwanzen von<br />
EU-Botschaften etwa, ließen sich nicht<br />
ohne Gesichtsverlust erklären – zumal<br />
Obama nach seinem Besuch in Berlin versichert<br />
hatte, wenn er wissen wolle, wie<br />
Merkel denke, dann rufe er sie an, dafür<br />
brauche er nicht die NSA.<br />
Bundesinnenminister Hans-Peter Fried -<br />
rich (CSU) und Kanzleramtschef Ronald<br />
Pofalla (CDU) werden vor allem einen<br />
Satz des amerikanischen Präsidenten mit<br />
Genugtuung zur Kenntnis genommen haben:<br />
Amerika spioniere nicht die Bevölkerungen<br />
anderer Länder aus. Wochenlang<br />
hatte die Bundesregierung auf ein<br />
solches Statement in Washington gedrängt.<br />
Dass die Bundesrepublik und die<br />
EU als Spionageziele der NSA geführt<br />
werden, trübt die Fr<strong>eu</strong>de freilich.<br />
Die d<strong>eu</strong>tschen Geheimdienste hoffen<br />
ohnehin auf ein baldiges Ende der Enthüllungen,<br />
sie wollen zum Alltag zurückkehren,<br />
der eine enge Kooperation mit<br />
den Amerikanern vorsieht. Das eint sie<br />
mit den meisten NSA-Mitarbeitern, denen<br />
Snowden ein Gräuel ist, weil sie die<br />
Macht von Instrumenten wie XKeyscore<br />
genießen. Jeder möge doch „ein n<strong>eu</strong>es<br />
Spielz<strong>eu</strong>g“, schwärmt ein NSA-Mann in<br />
einem der Berichte. XKeyscore sei vielleicht<br />
„wie ein siebenköpfiger Drache“:<br />
„Groß und angsteinflößend? Sicher. Stark<br />
und mächtig? Oh ja!“<br />
Es liege an den NSA-Mitarbeitern, ihn<br />
zu zähmen, um dann „damit zu tun, was<br />
immer wir wollen“. LAURA POITRAS,<br />
MARCEL ROSENBACH, HOLGER STARK<br />
DER SPIEGEL 33/2013 25
SOZIALDEMOKRATEN<br />
Pakt mit<br />
der Basis<br />
Nach der Wahl will Sigmar<br />
Gabriel einen Konvent einberufen<br />
und damit seine Macht sichern:<br />
Fraktionschef Steinmeier muss das<br />
als Kampfansage betrachten.<br />
Die Vorlage für den Parteichef<br />
kommt aus Nordrhein-Westfalen.<br />
Es ist Montagvormittag,<br />
die SPD-Vorstandssitzung in<br />
WAHL<br />
Berlin plätschert vor sich hin.<br />
2013 Michael Groschek, General -<br />
sekretär der nordrhein-westfälischen SPD,<br />
hat jetzt genug gehört von den Phrasen<br />
über den Haustürwahlkampf, genug von<br />
den seichten Erlebnisberichten seiner Vorstandskollegen.<br />
Er will endlich über den<br />
Tag danach reden, den Tag nach der drohenden<br />
Pleite am 22. September.<br />
„Wie sollen eigentlich die Entscheidungen<br />
nach der Bundestagswahl laufen?“,<br />
fragt er, „werden die wichtigen Beschlüsse<br />
wieder im engsten Kreis gefasst?“ Die<br />
Parteilinke Hilde Mattheis springt ihm<br />
bei: „Ich bin dafür, die Mitglieder so weit<br />
es geht einzubinden“, fordert sie.<br />
Sigmar Gabriel nutzt die Gelegenheit<br />
und greift das Thema auf. Eigentlich hatte<br />
er den Punkt unter „Verschiedenes“ am<br />
Ende der Sitzung abhandeln wollen. Doch<br />
jetzt muss er sich dem Begehren stellen.<br />
„Wir werden direkt nach der Wahl einen<br />
Parteikonvent einberufen“, kündigt der<br />
Parteichef an. Die Vorstandskollegen sind<br />
baff. Kurz darauf steht auch der Termin<br />
fest: am Dienstag, 24. September, 16 Uhr,<br />
26<br />
Parteichef Gabriel<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
KAY NIETFELD / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
in Berlin. Nicht einmal 48 Stunden nach<br />
Schließung der Wahllokale – und einen<br />
Tag bevor die Fraktion über die eigene<br />
Führung entscheiden kann.<br />
Gabriels Kollegen in der SPD-Spitze<br />
sind vor den Kopf gestoßen. Unmittelbar<br />
nach Ende der Sitzung greifen zahlreiche<br />
Genossen zu ihrem Handy, für viele hat<br />
der Parteichef mal wieder einen Alleingang<br />
hingelegt, ohne Rücksprache in den<br />
engeren Führungszirkeln, ohne Diskus -<br />
sion im Parteivorstand. Aber niemand<br />
hatte den Mut, ihn offen zu kritisieren:<br />
Der Konvent wird ohne Gegenstimme beschlossen.<br />
In der Regel trifft nach einer Bundestagswahl<br />
die Fraktion die erste Entscheidung<br />
– am Dienstag mit der Wahl ihres<br />
Vorsitzenden. Die Partei muss warten. So<br />
hat es Tradition, und so sicherten sich Angela<br />
Merkel 2005 in der Union und Frank-<br />
Walter Steinmeier 2009 in der SPD nach<br />
desolaten Wahlergebnissen die Macht.<br />
Doch genau das will Gabriel dieses Mal<br />
verhindern. Die Stunden und Tage nach<br />
der Wahl könnten auch über sein politisches<br />
Schicksal entscheiden. Sollte das<br />
Ergebnis für die Sozialdemokraten dramatisch<br />
schlecht ausfallen, muss Gabriel<br />
um den Parteivorsitz fürchten. Kein Szenario<br />
wäre dann gefährlicher als dieses:<br />
Ein Kanzlerkandidat, der sich aus dem<br />
Staub macht, ein Fraktionschef, der sich<br />
rasch im Amt bestätigen lässt, und ein<br />
Parteivorsitzender, auf den allein sich der<br />
Frust über eine ern<strong>eu</strong>te Niederlage konzentriert.<br />
Mit dem kleinen Parteitag verbündet<br />
sich Gabriel mit dem Mittelbau der Partei.<br />
Im Konvent kann er auf Unterstützung<br />
hoffen, selbst bei einem schlechten Wahlergebnis.<br />
So ist der Vorstoß auch eine<br />
Kampfansage, nicht zuletzt an Frank-<br />
Walter Steinmeier. Der hatte sich vor vier<br />
Jahren noch am Abend der Niederlage<br />
im Schulterschluss mit Franz Müntefering<br />
zum Fraktionschef ausgerufen – obwohl<br />
er das schlechteste Ergebnis seit 1949 geholt<br />
hatte. Ein zweites Mal soll ihm das<br />
nicht gelingen.<br />
Bisher hatte Steinmeier gehofft, mit<br />
den Abgeordneten im Rücken von den<br />
Folgen einer möglichen Wahlpleite verschont<br />
zu bleiben. Doch dieser Plan ist<br />
perdu. Bevor der Fraktionschef sich wiederwählen<br />
lassen könnte, muss er sich<br />
nun den Funktionären stellen – mit ungewissem<br />
Ausgang. Ein Konvent von<br />
rund 200 Delegierten ist unkalkulierbar.<br />
Die Abrechnung wird dieses Mal nicht in<br />
den Hinterzimmern, sondern auf offener<br />
Parteibühne stattfinden.<br />
Mit dem Konvent hofft Gabriel den<br />
Parteivorsitz für sich zu retten. Dafür hat<br />
er in letzter Zeit Verbündete gewonnen:<br />
Die Parteilinke hat ihre Zuneigung zum<br />
Vorsitzenden entdeckt. Mit ihm als starkem<br />
Mann, so das Kalkül, ließe sich nach<br />
der Bundestagswahl ein echter Linkskurs<br />
umsetzen.<br />
Und auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin<br />
Hannelore Kraft, sonst<br />
gern anderer Meinung als Gabriel, ist unverhofft<br />
zur Verbündeten geworden. Sie<br />
hat kein Interesse an einem Sturz Gabriels,<br />
weil sie dann, so ihre Sorge, möglicherweise<br />
selbst SPD-Chefin werden<br />
müsste. Kraft hat Respekt vor Berlin. Sie<br />
fürchtet, dasselbe Schicksal zu erleiden<br />
wie Kurt Beck oder Matthias Platzeck,<br />
die als Parteichefs in der Hauptstadt nie<br />
wirklich ankamen.<br />
Geht es nach Gabriel, ist der Konvent<br />
erst der Anfang. Sollten es die Mehrheiten<br />
bei der Wahl ergeben, will er die Partei<br />
in einem Mitgliederentscheid über die<br />
ungeliebte Große Koalition entscheiden<br />
lassen. Dass der Ausgang einer solchen<br />
Abstimmung offen wäre, stört ihn dabei<br />
keineswegs. So oder so könnte er sich an<br />
die Spitze der Bewegung setzen.<br />
Als der Vorstand am Montag den Konvent<br />
beschloss, fehlte in der Sitzung nicht<br />
nur Steinmeier, auch Spitzenkandidat<br />
Peer Steinbrück war gerade nicht im<br />
Raum. Für ihn kommt die Debatte zur<br />
Unzeit: Schon wieder befasst sich die<br />
SPD mit einer möglichen Niederlage.<br />
HORAND KNAUP, GORDON REPINSKI
MANFRED VOLLMER / IMAGETRUST<br />
REGULIERUNG<br />
Der Nanny-Staat<br />
Politiker aller Parteien versuchen, die Bürger mit strengen Vorschriften oder sanftem<br />
Druck zu richtigem Verhalten anzuleiten. In vielen Fällen helfen die Regeln<br />
aber nicht, sondern bedrohen die Freiheit des Einzelnen. Von Alexander N<strong>eu</strong>bacher<br />
Für Fußgänger, die in Düsseldorf eine<br />
Straße überqueren wollen, hat der<br />
Oberbürgermeister einen Leitfaden<br />
herausgegeben. Thema: So gehen Sie<br />
richtig über die Ampel. In Düsseldorf hält<br />
man das für eine erklärungsbedürftige<br />
Sache. Einige Fußgängerampeln verfügen<br />
nämlich nicht nur über eine Rot- und eine<br />
Grün-, sondern auch über eine Gelb -<br />
phase. Das gibt es in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> selten,<br />
weshalb die Verwaltung auf acht Seiten<br />
und einigen Schautafeln alle wichtigen<br />
Regeln zusammengefasst hat. „Die Ampel<br />
springt auf Grün“, heißt es dort: „Der<br />
ideale Zeitpunkt für alle Fußgänger, jetzt<br />
loszugehen.“ Oder: „Die Ampel springt<br />
auf Gelb. Jetzt gilt für alle: Auf dem<br />
Überweg weitergehen – vor dem Überweg<br />
anhalten!“<br />
Man könnte die Ampelbroschüre als<br />
Posse um eine überfürsorgliche Verkehrsbehörde<br />
abtun. Schließlich gibt es die<br />
Gelbphase für Fußgänger in Düsseldorf<br />
seit fast 50 Jahren. Doch das Regelwerk<br />
steht für ein Phänomen, das weit über die<br />
28<br />
Landeshauptstadt hinausreicht:<br />
Es geht um einen Staat, der<br />
zunehmend glaubt, er müsse<br />
den Bürger vor sich<br />
selbst beschützen.<br />
Bundesverkehrsminister<br />
Peter Ramsauer droht mit<br />
einer Helmpflicht für Fahrradfahrer<br />
und warnt Fußgänger<br />
vor dem Tragen von Kopfhörern.<br />
Der von der Bundesregierung<br />
eingesetzte Sachverständigenrat<br />
für Umweltfragen<br />
schlägt vor, eine St<strong>eu</strong>er<br />
auf gesättigte Fettsäuren zu<br />
erheben, damit die Bürger weniger<br />
Fleisch, Wurst und Butter essen. Auf dem<br />
Jahn-Sportplatz im Berliner Stadtteil<br />
Prenzlauer Berg dürfen Mütter und Väter<br />
jetzt nicht mehr hinter einem Kinderwagen<br />
herjoggen: Berlins Innensenator hat<br />
ein Buggy-Verbot für öffentliche Sportanlagen<br />
ausgesprochen.<br />
In Nordrhein-Westfalen trat kürzlich<br />
ein nochmals verschärftes Anti-Raucher-<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Joggen mit Kinderwagen<br />
untersagt<br />
Gesetz in Kraft. Es trifft auch<br />
Elektrozigaretten, aus denen<br />
überhaupt kein Rauch<br />
herauskommt. An Deck<br />
bayerischer Ausflugsdampfer<br />
ist das Rauchen<br />
sogar unter freiem Himmel<br />
verboten und demnächst<br />
womöglich sogar in<br />
Biergärten.<br />
Als die grünen Wahlkämpfer<br />
in der vergangenen Woche<br />
ihre Forderung nach<br />
einem wöchentlichen Vegetariertag<br />
in Kantinen ern<strong>eu</strong>erten,<br />
muckten selbst jene Bürger auf, die<br />
sonst durchaus bereit wären, sich über<br />
den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum,<br />
Massentierhaltung und Weltklima<br />
Gedanken zu machen. Auf Twitter<br />
und Facebook erregten sich Tausende<br />
über die grünen Tischsittenwächter. Unter<br />
dem Slogan „Burger-Rechte für alle“ nutzen<br />
Jugendvertreter von Union und FDP<br />
die Wahlkampfvorlage, um mit Grillwürs-
ten und Buletten vor der Grünen-Parteizentrale<br />
zu protestieren. SPD-Kanzlerkandidat<br />
Peer Steinbrück („Es geht um<br />
die Wurst“) distanzierte sich vom potentiellen<br />
Koalitionspartner.<br />
Die Wähler beschleicht der Verdacht,<br />
zum Opfer politischer Ablenkungsmanöver<br />
zu werden. Sie sind nicht gegen Regulierung,<br />
im Gegenteil. Die Bankenund<br />
die Finanzkrise oder die<br />
Energie- und Klimaschutz -<br />
politik sind Bereiche, in denen<br />
die ordnende Hand<br />
des Staates dringend gebraucht<br />
wird. Es wäre ein<br />
Segen gewesen, hätte die<br />
Politik die Regulierung des<br />
Bankgewerbes mit derselben<br />
Konsequenz und Härte<br />
verfolgt wie das Verbot der<br />
Glühbirne. Und auch um die<br />
Verletzungsgefahr:<br />
Sitzbälle verboten<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Privatsphäre der Bürger zu<br />
wahren, brauchte es nach<br />
Ansicht vieler Wähler den<br />
Schutz eines starken Staates,<br />
wie die jüngsten Erkenntnisse über Internetausspähungen<br />
und Abhörmethoden<br />
zeigen.<br />
Doch womöglich wollen einige Politiker<br />
durch Lifestyle-Regulierung ihre<br />
Handlungsfähigkeit beweisen, gerade<br />
weil sie bei den wichtigen Themen nicht<br />
vorankommen. Es ist eben leichter, den<br />
Gebrauch von Heizpilzen zu untersagen,<br />
als den <strong>eu</strong>ropäischen Emissionszertifikatehandel<br />
auf eine funktionierende Grundlage<br />
zu stellen.<br />
Vater Staat umsorgt und behütet, lenkt<br />
und motiviert. Er neigt zum Moralisieren<br />
und mischt sich gern in Wertefragen ein.<br />
Er greift tief in den Alltag der Menschen<br />
ein.<br />
Bundesarbeitsministerin Ursula von<br />
der Leyen möchte per Gesetz erzwingen,<br />
dass Arbeitgeber öfter Frauen befördern<br />
und Arbeitnehmer seltener Überstunden<br />
machen. Bundesumweltminister Peter<br />
Altmaier will die Kennzeichnungspflicht<br />
für Ein- und Mehrwegflaschen verschärfen;<br />
er behauptet, die Verbraucher bemerkten<br />
sonst den Unterschied nicht.<br />
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr<br />
möchte den Versandhandel mit Arzneimitteln<br />
teilweise wieder einschränken;<br />
die „Patientensicherheit“ sei gefährdet.<br />
Hinter der Verbotswelle steckt ein pessimistisches<br />
Menschenbild. Das Individuum<br />
ist in Verruf geraten. Der Staat traut<br />
dem Einzelnen nicht mehr viel zu, jedenfalls<br />
nichts Gutes. An die Stelle des<br />
Homo sapiens tritt der Homo demenz,<br />
der betr<strong>eu</strong>ungsbedürftige Trottelbürger.<br />
Über 200 Jahre nachdem Immanuel Kant<br />
den Aufbruch des Menschen aus dessen<br />
selbstverschuldeter Unmündigkeit verkündete,<br />
schlägt das Pendel jetzt in die<br />
Gegenrichtung.<br />
Der angebliche Trottelbürger neigt zu<br />
Verantwortungslosigkeit und selbstschädigendem<br />
Verhalten; er weiß nicht, was<br />
gut für ihn ist. Im Straßenverkehr ist er<br />
je nach Untersatz als Autoraser oder<br />
Kampfradler unterwegs. Er ernährt sich<br />
ungesund, trinkt Alkohol und arbeitet bis<br />
zum Burnout. Er nimmt für bare Münze,<br />
was ihm in der Fernsehreklame erzählt<br />
wird. Ihm fehlt die Einsicht in höhere<br />
Wirkzusammenhänge wie den glo -<br />
balen Klimawandel. Womöglich<br />
raucht er.<br />
Der Nanny-Staat hält es<br />
für seine Pflicht, dem Bürger<br />
zu sagen, was falsch<br />
und was richtig ist. Die Paternalisten<br />
und Gouvernanten<br />
sitzen in allen Parteien.<br />
Der CDU-Gesundheitspolitiker<br />
Jens Spahn<br />
regt sich darüber auf, dass bei<br />
Fernsehübertragungen von<br />
Fußgängerampel mit Gelbphase in Düsseldorf<br />
Eine Million Vorschriften<br />
OLIVER TJADEN / LAIF / DER SPIEGEL<br />
Fußballspielen für Bier geworben<br />
wird, ein ungesundes Produkt,<br />
das nicht zu einer Sportveranstaltung<br />
passe. Lothar<br />
Binding (SPD) möchte sämtliche Zigarettenautomaten<br />
verbieten. Und ginge es<br />
nach der Grünen-Spitzenkandidatin Katrin<br />
Göring-Eckardt, kämen demnächst<br />
auch Kaffeesahnedöschen auf den Index.<br />
„Ist das kleine Plastikmilchbehältnis nicht<br />
auch ein Symbol dafür, wie unbedarft wir<br />
oftmals mit Rohstoffen umgehen?“,<br />
schrieb sie in einem Positionspapier.<br />
„Muss das wirklich sein?“<br />
Der dressierte Bürger zahlt einen hohen<br />
Preis. Mit jeder n<strong>eu</strong>en Vorschrift verliert<br />
er einen Teil seiner Freiheit. Kann<br />
es sein, dass der paternalistische Staat<br />
jene Unmündigkeit, die er seinen Schutzbefohlenen<br />
unterstellt, in Wahrheit erst<br />
erz<strong>eu</strong>gt?<br />
Was, wenn die Annahmen, auf denen<br />
staatliche Regulierung basiert, falsch<br />
sind? Sind Politiker und Bürokraten wirklich<br />
klüger als die Bürger? Vertreter der<br />
älteren Generation können sich noch gut<br />
an Zeiten erinnern, als Butter, Fleisch und<br />
eine sonnengebräunte Haut aus Gesundheitsgründen<br />
ausdrücklich empfohlen<br />
wurden.<br />
Gehört es nicht auch zur Freiheit des<br />
Einzelnen, sich unvernünftig, egoistisch<br />
und lasterhaft zu verhalten? Ist der Bürger<br />
verpflichtet, sich in den Dienst des<br />
Kollektivs zu stellen, allzeit bereit, durch<br />
Tabakverzicht und salzarme Kost Schaden<br />
von der gesetzlichen Krankenversicherung<br />
abzuwenden?<br />
Und schließlich: Wo bleibt in einer tempogemäßigten,<br />
zuckerreduzierten und<br />
naturtrüben Tugendgesellschaft eigentlich<br />
der Spaß?<br />
Die schwarze Pädagogik<br />
des Staates<br />
Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der<br />
Lämmer. Es braucht also Regeln für ein<br />
gedeihliches Miteinander. Die Frage ist,<br />
ob es so viele sein müssen.<br />
Schätzungen gehen von mehr als einer<br />
Million Vorschriften aus. Sie reichen von<br />
den Gebührensatzungen für Kindergärten<br />
bis zu den Friedhofsordnungen. Die<br />
Frage, wie viel Wasser eine öffentliche<br />
Toilette maximal verbrauchen darf, ist<br />
ebenso geregelt wie das Design von Sonnenschirmen<br />
in der Außengastronomie.<br />
Allein in dieser Legislaturperiode traten<br />
bislang 485 n<strong>eu</strong>e Bundesgesetze in<br />
Kraft. Wer sich in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> nicht an<br />
die vorgeschriebene Farbe von Parkscheiben<br />
hält oder die Verfallsangaben auf<br />
dem Erste-Hilfe-Kasten missachtet, wird<br />
seit diesem Jahr noch strenger bestraft.<br />
Für Fahrradfahren in einer Fußgänger -<br />
zone sind jetzt 15 statt 10 Euro Bußgeld<br />
fällig, für „nicht platzsparendes Parken“<br />
weiter 10 Euro und für „unnützes Hinund<br />
Herfahren innerhalb geschlossener<br />
Ortschaften“ 20 Euro. Details stehen im<br />
n<strong>eu</strong>en bundeseinheitlichen Bußgeld-Katalog,<br />
der am 1. April in Kraft trat.<br />
Die Straßenverkehrsordnung enthält<br />
rund 640 amtliche Hinweiszeichen, laut<br />
Verkehrsclub ADAC mehr als in jedem<br />
anderen Land der Welt. In diesem Frühjahr<br />
kamen die Zeichen „Parkraumbewirtschaftung“,<br />
„Ende Streckenempfehlung“<br />
und „Inline-Skater zugelassen“ n<strong>eu</strong><br />
hinzu. Und wenn demnächst im Straßenbild<br />
ein Piktogramm auftaucht, das so<br />
aussieht, als würden ein Fußgänger und<br />
ein Fahrrad auf einem rot-weißen Hämmerchen<br />
balancieren, bitte nicht wun-<br />
DER SPIEGEL 33/2013 29
dern: Es handelt sich um das n<strong>eu</strong>e amtliche<br />
Zeichen für eine „Durchlässige Sackgasse“.<br />
Betr<strong>eu</strong>tes Leben<br />
Im bayerischen Penzberg fiel dieses Jahr<br />
zum ersten Mal seit Jahrzehnten der<br />
Faschingsumzug aus – angeblich zu gefährlich.<br />
Zunächst hatte das zuständige<br />
Landratsamt das Mitlaufen von Pferden<br />
verboten. Dann untersagte es den Gebrauch<br />
einer Kanone, mit der in Penz -<br />
berg traditionell Sägemehl in die Luft<br />
gef<strong>eu</strong>ert wurde. Und schließlich sollten<br />
auch keine Bonbons und Blumen mehr<br />
geworfen werden; es bestehe Verletzungsgefahr.<br />
Das war zu viel. Die Penzberger entschieden,<br />
den Umzug abzusagen. „Die<br />
Sicherheitsauflagen waren nicht zu erfüllen“,<br />
sagt Sprecher Holger Fey, Vorsitzender<br />
des Organisationskomitees. Schon der<br />
Papierkram sei für juristische Laien<br />
nicht zu bewältigen.<br />
Einige Fälle staatlicher Fürsorglichkeit<br />
sind so skurril,<br />
dass sie es in die Zeitung<br />
schaffen. Einem beliebten<br />
Hamburger Fischhändler<br />
wurde nach einem Schadensersatzprozess<br />
auferlegt,<br />
ein Hinweisschild an<br />
der Verkaufstheke anzubringen<br />
mit der Warnung, dass<br />
Fische Fischgräten enthalten<br />
können. Ende vergangenen<br />
Jahres sorgte das Bundesinnenministerium<br />
für Aufsehen<br />
mit einer n<strong>eu</strong>en Schützenfest-<br />
Richtlinie. Aus Sicherheitsgründen dürfe<br />
künftig nur noch auf Holzvögel aus dünnem<br />
Weichholz geschossen werden. Die<br />
betroffenen Ver eine kritisierten, eine<br />
jahrhundertealte Tradition stehe auf dem<br />
Spiel; die Bundesregierung kündigte eine<br />
wissenschaftliche Evaluierung an. Zuletzt<br />
wollte die EU-Kommission nachfüllbare<br />
Olivenölkännchen in Restaurants verbieten,<br />
weil ihr Inhalt möglicherweise ranzig<br />
sein könnte.<br />
Zu überregionaler Berühmtheit brachte<br />
es Dieburgs Bürgermeister Werner<br />
Thomas mit seinem Verbot, im örtlichen<br />
Freibad vom Zehn-Meter-Turm zu springen:<br />
Es bestehe Blendgefahr. Tatsächlich<br />
weist die 60 Jahre alte Anlage einen konstruktionsbedingten<br />
Mangel auf. Der<br />
Sprungturm zeigt nach Osten, Richtung<br />
Sonnenaufgang. Damit verstößt er gegen<br />
DIN EN 13451-10, eine d<strong>eu</strong>tlich jüngere<br />
Norm für den Bäderbau, die wiederum<br />
auf eine Richtlinie der D<strong>eu</strong>tschen Gesellschaft<br />
für das Badewesen e. V. zurückgeht.<br />
Sie besagt: „In Europa sollten<br />
Sprunganlagen im Freien nach Norden<br />
gerichtet sein.“<br />
Als Bürgermeister Thomas von einem<br />
Gutachter auf das Problem aufmerksam<br />
30<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Feinstaub: Osterf<strong>eu</strong>er<br />
verboten<br />
gemacht wurde, legte er gleich<br />
den ganzen Turm samt Becken<br />
still. Von Abriss und N<strong>eu</strong>bau war<br />
die Rede. Inzwischen hat sich die<br />
Aufregung etwas gelegt. Doch<br />
wegen der „Blendgefahr“ (Thomas)<br />
darf die Anlage erst betreten<br />
werden, wenn die Sonne<br />
hoch am Himmel steht. Weitere<br />
Expertisen wurden in Auftrag gegeben.<br />
In der Regel haben sich die Bürger<br />
an die staatliche Bevormundung<br />
gewöhnt, zumal da, wo sie<br />
im Namen der Sicherheit daherkommt.<br />
Seit viele Kommunen die<br />
Hygienevorschriften verschärft haben,<br />
gibt es auf Schul- und Vereinsfesten zur<br />
Salmonellenabwehr jetzt eben keinen<br />
selbstgemachten Kartoffelsalat mehr.<br />
Die Bürger verzichten aufs Osterf<strong>eu</strong>er<br />
(Brandgefahr, Feinstaubbelastung), be -<br />
gnügen sich beim Musikhören mit Zimmerlautstärke<br />
(die EU begrenzt<br />
den Kopfhörerausgang beim<br />
MP3-Player auf 85 Dezibel)<br />
und haben auch ihren orthopädischen<br />
Sitzball fürs<br />
Büro wieder abgeschafft,<br />
seit die gesetzliche Be -<br />
rufs genossenschaft unter<br />
Berufung auf Paragraf 4<br />
ArbSchG monierte, dass<br />
sich der Benutzer eines solchen<br />
Balls im „labilen Gleichgewicht“<br />
befinde.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Lebensmittelkennzeichnung: Verbraucher als Trottel<br />
Mitunter gehen Verbote<br />
auch auf den Druck von Lobbyisten<br />
zurück, wie sich bei<br />
der Rauchmelderpflicht zeigt.<br />
In fast allen Bundesländern sind Immobilienbesitzer<br />
inzwischen verpflichtet,<br />
Rauchmelder an die Decken von Schlafzimmern<br />
und Wohnungsfluren zu kleben.<br />
Bricht ein F<strong>eu</strong>er aus, reißen die Geräte<br />
die Bewohner mit einem Alarmsignal<br />
aus dem Schlaf – so lautet jedenfalls<br />
der Plan. „Die Zahl der Brandopfer kann<br />
um 40 Prozent gesenkt werden“, heißt es<br />
bei der Initiative „Rauchmelder retten<br />
Leben“.<br />
Mehr als zwei Milliarden Euro dürfte<br />
es kosten, alle Häuser und Wohnungen<br />
mit Rauchmeldern auszustatten. Hinzu<br />
kommen die Kosten für Installation und<br />
jährliche Wartung. Und so stellt sich<br />
heraus, dass hinter der Initiative „Rauchmelder<br />
retten Leben“ ein Lobbyverein<br />
namens „Forum Brandrauchprävention“<br />
steckt, in dem sich die großen Hersteller<br />
und Dienstleister der Rauchmelderbranche<br />
zusammengeschlossen haben: Bavaria<br />
Rauchmelder, Bosch Sicherheitssysteme,<br />
Siemens, Ista, Techem, Minol Messtechnik,<br />
Hekatron. Die Geschäftsstelle<br />
des Vereins ist in den Räumen einer Berliner<br />
PR-Agentur untergebracht.<br />
Weniger klar ist, ob die Rauchmelder<br />
wirklich die Sicherheit verbessern. Statistisch<br />
belegen lässt sich das nicht. Zwar<br />
ist die Zahl der Todesfälle bei Wohnungsbränden<br />
in den vergangenen zehn Jahren<br />
allgemein zurückgegangen. Doch verblüffenderweise<br />
fiel der Rückgang in Bundesländern,<br />
in denen keine Rauchmelderpflicht<br />
bestand, stärker aus als in Bundesländern<br />
mit Rauchmelderpflicht.<br />
Zumal die Geräte ihre Macken haben.<br />
Sie verursachen etwa 90000 Fehleinsätze<br />
der F<strong>eu</strong>erwehr pro Jahr. In Hamburg stellte<br />
sich zuletzt fast jeder zweite Notruf<br />
als Falschalarm heraus.<br />
Der überforderte Kunde<br />
Menschen verhalten sich, zugegeben,<br />
nicht immer rational. Jeder Zweite fasst<br />
an Silvester gute Vorsätze, doch nur jeder<br />
Zehnte hält sich auch daran. Vor dem<br />
Krankenhaus stehen Lungenpatienten in<br />
Bademantel und Filzpantoffeln und<br />
stecken sich hustend eine Zigarette an.<br />
Es gibt mehr Lebensversicherungen in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> als Leben, die man versichern<br />
könnte.<br />
Viele Politiker glauben deshalb, dass<br />
es sich beim Durchschnittskonsumenten<br />
um ein betr<strong>eu</strong>ungsbedürftiges Wesen<br />
handle, das im Tarifdschungel von Stromversorgern,<br />
Handy-Anbietern und Fitnessstudios<br />
den Überblick verliere. Den<br />
Werbeversprechungen stehe dieser arme<br />
Kunde ratlos gegenüber. Der Supermarkt<br />
sei für ihn zu einem Ort geworden, an<br />
dem er belogen und ausgeplündert werde.<br />
Nach dieser Logik haben es die Verbraucher<br />
in Pjöngjang oder Havanna vergleichsweise<br />
gut, denn wo die Regale leer<br />
sind, müssen sie nicht fürchten, in die<br />
Konsumfalle gelockt zu werden.<br />
War im Koalitionsvertrag von Union<br />
und FDP noch vom Leitbild des mündigen<br />
Verbrauchers die Rede, spricht Verbraucherschutzministerin<br />
Ilse Aigner h<strong>eu</strong>te<br />
gern vom „vulnerablen“, verletzlichen<br />
Konsumenten. In den aktuellen Leitlinien<br />
der SPD-Bundestagsfraktion heißt es:<br />
„Der stets informierte, immer rationale<br />
und selbstbestimmt handelnde Verbraucher<br />
existiert im Alltag nicht.“ Es folgt<br />
eine 14-Punkte-Liste angeblich typischer<br />
Torheiten, von „verwendet Daumenre-
MAURIZIO GAMBARINI / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Rauchmelder: Sieg der Lobby<br />
JO NEANDER / OBS<br />
Tabakwarnung: Der Bürger weiß nicht, was gut für ihn ist<br />
JOERG KOCH / DAPD<br />
geln“ über „verschiebt gerne Entscheidungen“<br />
und „überschätzt sich selbst“ bis<br />
hin zu „irrt häufig“, „ist überlastet“ und<br />
„lässt sich durch Emotionen leiten“.<br />
Die Politik will dem Konsumenten also<br />
helfen. Sie verabschiedet eine Vorschrift,<br />
wonach eine Kalbsleberwurst, die zwar<br />
Kalbfleisch, aber keine Kalbsleber enthält,<br />
demnächst „Kalbfleisch-Leberwurst“<br />
genannt werden muss. Sie zwingt Werbeagenturen<br />
dazu, zahlreiche Warnhinweise<br />
und Fürsorgebotschaften in ihre<br />
Anzeigen einzubauen. Sie geißelt spärlich<br />
gefüllte Pralinenschachteln als Luftnummern<br />
und üppig gefüllte Pralinenschachteln<br />
als Dickmacher.<br />
Manchmal stellt sich leider heraus, dass<br />
der Verbraucherschutz den Verbrauchern<br />
mitunter mehr schadet als nutzt. Etwa<br />
bei der Finanzberatung. Um zu verhindern,<br />
dass Banken ihre Kunden unzureichend<br />
über Risiken aufklären, führte die<br />
Bundesregierung vor gut drei Jahren ein<br />
Pflichtprotokoll ein. Die Berater müssen<br />
seither abfragen, welches Risiko der Kunde<br />
eingehen will, über welche Kenntnisse<br />
und Erfahrungen er verfügt, wie er<br />
finanziell dasteht. Der Kunde<br />
quittiert das Protokoll mit seiner<br />
Unterschrift.<br />
Doch was zum Schutz<br />
der Verbraucher gedacht<br />
war, schützt nun die Banken.<br />
In der Praxis sichern<br />
sich die Berater mit dem<br />
Formular erfolgreich gegen<br />
Schadensersatzklagen ab,<br />
die sie früher, ohne Unterschrift<br />
des Kunden, womöglich<br />
verloren hätten. Dabei ist<br />
das Kauderwelsch der Beratungsprotokolle<br />
für Nicht -<br />
experten kaum zu verstehen<br />
– was ebenfalls an den überkomplexen<br />
Vorgaben des Gesetzgebers<br />
liegt.<br />
Allzu simpel darf die Beratung des Verbrauchers<br />
aber auch nicht sein. Politiker<br />
von SPD und Grünen fordern eine Farbkennung<br />
von Lebensmitteln. Gesunde<br />
Nahrung soll auf der Verpackung eine<br />
grüne Ampel tragen, allzu Süßes, Salziges<br />
oder Fettes dagegen eine rote Ampel.<br />
Blendgefahr:<br />
Turmspringen nach<br />
Süden untersagt<br />
Der Vorschlag klingt überz<strong>eu</strong>gend einfach.<br />
Doch die Verwirrung des Verbrauchers<br />
wäre bei einer Lebensmittelampel<br />
wohl noch größer. Orangensaft würde<br />
plötzlich als ungesund klassifiziert: zu<br />
viel Zucker. Ebenso Vollkornbrot: zu viel<br />
Salz. Und das native, kaltgepresste Olivenöl<br />
aus dem Bioladen stünde ebenfalls<br />
am Pranger: zu viel Fett.<br />
Der süchtige Bürger<br />
Wenn der Staat alle Bereiche des Lebens<br />
in Watte gepackt hat, bleibt am Ende nur<br />
noch ein Gegner übrig: der Bürger selbst.<br />
Früher bed<strong>eu</strong>tete Freiheit, alles tun zu<br />
dürfen, was einem anderen nicht schadet.<br />
Doch diese Definition gilt bei einigen<br />
Politikern als allzu egozentrisch. Ihrer Ansicht<br />
nach bed<strong>eu</strong>tet Freiheit, alles tun zu<br />
dürfen, was der Gesellschaft nutzt.<br />
Besonders d<strong>eu</strong>tlich zeigt sich die Umd<strong>eu</strong>tung<br />
des Freiheitsbegriffs beim Rauchverbot.<br />
Erst ging es darum, die Nichtraucher<br />
in öffentlichen Gebäuden vor Qualm<br />
zu schützen. Dagegen konnte niemand<br />
etwas haben; die Freiheit des Rauchers<br />
endet da, wo die Freiheit<br />
des Nichtrauchers beginnt.<br />
Auch das Rauchverbot in<br />
Kneipen und Restaurants<br />
mit der Begründung, der<br />
Qualm stelle ein Gesundheitsrisiko<br />
für die dort<br />
Beschäftigten dar, konnte<br />
man nach dieser Logik gelten<br />
lassen.<br />
Nun aber lautet das Ziel, den<br />
Raucher vor sich selbst zu<br />
schützen. Die EU will verbieten,<br />
dass dem Tabak Aromen<br />
wie Menthol beigemischt werden.<br />
75 Prozent einer Kippenschachtel<br />
sollen künftig mit<br />
Schockfotos belegt werden. Den Herstellern<br />
wird es untersagt, Rauchen in einen<br />
„positiven Zusammenhang“ zu stellen,<br />
und was genau das bed<strong>eu</strong>tet, will die EU-<br />
Kommission offenbar von Fall zu Fall<br />
entscheiden. Sogar ein Verbot aller Markenlogos<br />
steht im Raum. Die Gesundheitspolitiker<br />
aller Bundestagsfraktionen<br />
unterstützen die EU-Pläne.<br />
Niemand bezweifelt, dass Rauchen<br />
sehr gesundheitsschädlich ist. Zigaretten<br />
sind so ungesund, dass sie das Leben<br />
nachweislich verkürzen. Damit freilich<br />
entfällt ein wichtiges Argument für ein<br />
Verbot. Raucher sind unterm Strich keine<br />
Belastung für den Staat und die sozialen<br />
Sicherungssysteme, wie zahlreiche Stu -<br />
dien herausgefunden haben.<br />
Es gibt, im Gegenteil, keinen schlimmeren<br />
Rentenkassenschädling als den<br />
nichtrauchenden, sportlichen, alkoholabstinenten,<br />
ernährungsbewussten Gesundheitsapostel.<br />
Eine Untersuchung im<br />
Auftrag des niederländischen Gesundheitsministeriums<br />
kam zu dem Ergebnis,<br />
dass der durchschnittliche Raucher bis zu<br />
seinem Ableben mit rund 77 Jahren etwa<br />
220 000 Euro Behandlungskosten verursacht.<br />
Nichtrauchende und schlanke Menschen<br />
hingegen sterben mit 84 Jahren und<br />
haben dann insgesamt 281000 Euro gekostet,<br />
also gut 60000 Euro mehr.<br />
Die Gesundheitspolitiker haben sich<br />
deshalb einen Kniff einfallen lassen: Sie<br />
betrachten den Bürger als Opfer seiner<br />
Sucht.<br />
Demnach würden die allermeisten<br />
Raucher am liebsten mit der Qualmerei<br />
aufhören, schaffen es aber nicht, weil<br />
das Nikotin sie im Griff hält. Der Staat<br />
kann nun so tun, als hätten ihn die Raucher<br />
um Hilfe gerufen. Indem er das Rauchen<br />
gesetzlich untersagt, wird er zum<br />
Befreier.<br />
Das Suchtargument ist bei fürsorglichen<br />
Politikern auch deshalb so beliebt,<br />
weil es sich leicht auf andere Bereiche<br />
übertragen lässt. Es wimmelt bereits von<br />
Abhängigkeiten, von der Internet- über<br />
die Kauf- bis zur Sex- und Zuckersucht.<br />
Der Spielraum für weitere Befreiungs -<br />
taten ist dementsprechend groß.<br />
Das Schilderparadoxon<br />
Die Hauptverkehrsstraße im niedersächsischen<br />
Bohmte ist ein Schock für jeden<br />
Autofahrer – es gibt keine Verkehrszeichen:<br />
kein Vorfahrtsschild, keine Ampel,<br />
keinen Zebrastreifen. Genau genommen<br />
gibt es nicht einmal eine richtige Straße.<br />
Fahrbahn, Radweg, Bürgersteig: Alles<br />
DER SPIEGEL 33/2013 31
Schilderfreie Zone, Bauhof in Bohmte: Weniger Regeln, mehr Sicherheit<br />
geht irgendwie ineinander über – und das<br />
bei mehr als 12000 Autos und Lastwagen,<br />
die hier Tag für Tag mitten durch den<br />
Ortskern rollen.<br />
Ja, sind die L<strong>eu</strong>te in Bohmte denn total<br />
verrückt geworden?<br />
„Im Gegenteil“, sagt Sabine de Buhr-<br />
Deichsel, 50. „Seit wir die Schilder abgeschafft<br />
haben, fließt der Verkehr nicht<br />
nur viel flüssiger, es ist auch sicherer so.“<br />
De Buhr-Deichsel ist Vizebürgermeisterin<br />
32<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
CHRISTOPH GÖDAN / LAIF / DER SPIEGEL<br />
FRISO GENTSCH / PICTURE-ALLIANCE/ DPA<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
im Ort; sie hat Fotos mitgebracht, um zu<br />
zeigen, wie es bis vor vier Jahren aussah.<br />
Man sieht eine stark befahrene Haupt -<br />
verkehrsstraße, mehrere Ampeln, zwei<br />
Dutzend Schilder und eine Kr<strong>eu</strong>zung,<br />
vor der sich Staus gebildet haben. „Ständig<br />
Lärm und Gestank“, sagt Sabine de<br />
Buhr-Deichsel, „das war nicht auszu -<br />
halten.“<br />
H<strong>eu</strong>te geht es in Bohmte zwar langsam,<br />
aber stetig voran. Wo früher Ampeln<br />
die Vorfahrt regelten, fädeln die Autos<br />
jetzt im Reißverschlussverfahren ein.<br />
Viele Fahrer verständigen sich mit Blicken<br />
und Handzeichen. Ein Radler biegt<br />
gemächlich nach links ab, ein Lieferwagen<br />
parkt vor einem Bekleidungsgeschäft,<br />
ein Autofahrer wendet. Das alles<br />
geschieht, ohne dass der Verkehr ins Stocken<br />
geriete. In vier Jahren ohne Beschilderung<br />
hat es nicht einen größeren Unfall<br />
gegeben.<br />
Aber was ist mit den Fußgängern? Wie<br />
kommen Kinder auf die andere Straßenseite,<br />
wenn es keine Ampel und keinen<br />
Zebrastreifen gibt? Wie sollen sich alte<br />
L<strong>eu</strong>te und Behinderte gegen 12000 Autos<br />
durchsetzen?<br />
Es gibt eine spektakuläre Methode, das<br />
herauszufinden. „Ich tue jetzt mal so, als<br />
wäre ich blind“, sagt de Buhr-Deichsel<br />
und kneift die Augenlider zusammen. Sie<br />
steht an einer besonders engen Stelle<br />
nahe der Bäckerei, von rechts kommen<br />
Autos, von links nähert sich ein Sattelschlepper.<br />
„Und jetzt gehe ich einfach<br />
mal los.“<br />
Und tatsächlich: Der Lkw bremst vor<br />
ihr ab, die Autos lenken um sie herum.<br />
Mit geschlossenen Augen geht de Buhr-<br />
Deichsel über die Straße und erreicht unversehrt<br />
die andere Seite.<br />
Aus der ganzen Welt sind Wissenschaftler<br />
in den vergangenen Jahren nach<br />
Bohmte gereist, um die schilderfreie Straße<br />
zu studieren. Die „Washington Post“<br />
und das japanische Staatsfernsehen berichteten.<br />
Bei der EU, die den Umbau<br />
mitfinanziert hat, gilt das Projekt als<br />
Erfolg. Mehr als hundert Gemeinden in<br />
Großbritannien, Belgien und den Nie -<br />
derlanden haben inzwischen ebenfalls<br />
einige ihrer Straßen von Verkehrsschildern<br />
befreit.<br />
Doch wie kommt es, dass Fußgänger<br />
in Düsseldorf eine acht Seiten lange Broschüre<br />
studieren sollen, bevor sie über<br />
die Ampel gehen, während sie in Bohmte<br />
zur Not sogar mit geschlossenen Augen<br />
einfach so über die Straße laufen dürfen?<br />
Wo sind sie in Bohmte bloß hin, die rücksichtslosen<br />
Autofahrer, die Rüpel-Radler<br />
und die gedankenlosen Fußgänger?<br />
Vizebürgermeisterin de Buhr-Deichsel<br />
glaubt, dass zu viele Regeln schlecht für<br />
die Sicherheit seien, weil sie die Verkehrsteilnehmer<br />
in Sicherheit wiegten, sie aber<br />
in Wahrheit oft überforderten. Wo es hingegen<br />
keine Schilder gebe, seien die L<strong>eu</strong>te<br />
wachsam. Die Unsicherheit erhöht die<br />
Sicherheit, ein scheinbares Paradoxon. In<br />
Bohmte haben sie sich deshalb gegen ein<br />
besonderes Tempolimit entschieden. Am<br />
Anfang der Gemeinschaftsstraße steht<br />
nur das Schild „Vorfahrt geändert“.<br />
Ab da gelten rechts vor links sowie Paragraf<br />
1 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung:<br />
„Die Teilnahme am Straßenverkehr<br />
erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige<br />
Rücksicht.“
Lob der Freiheit<br />
Politiker sind Volksvertreter, nicht Vormünder.<br />
„Wer einem anderen das Beste<br />
wünscht, ist ein guter Mensch“, sagt der<br />
frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhof.<br />
„Wer das Beste befiehlt, ist ein Tyrann.“<br />
Die meisten Bürger sind sehr wohl in<br />
der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Als<br />
die Autofahrer erkannten, dass Bremskraftverstärker<br />
und Anti-Blockier-Systeme<br />
die Sicherheit d<strong>eu</strong>tlich erhöhen, brauchte<br />
es kein Gesetz, das den Einbau dieser Geräte<br />
vorschrieb. Womöglich hätte sich der<br />
Anschnallgurt auch ohne gesetzlichen<br />
Zwang durchgesetzt. Wohingegen die Vermengung<br />
von Pflanzentreibstoff zu E10-<br />
Benzin sicher nicht gekommen wäre, hätte<br />
der Staat hier kein Gesetz erlassen.<br />
Viele Verbote zielen am Problem vorbei<br />
oder treffen Unschuldige. Das Alkoholverbot<br />
in der Hamburger U-Bahn<br />
richtet sich auch gegen die harmlose Frauenrunde,<br />
die mit Prosecco Junggesellinnenabschied<br />
feiert. Dem betrunkenen<br />
Pöbler hingegen ist das Gesetz egal. War -<br />
um hat er neben ihnen seine dreckigen<br />
Schuhe auf den Sitz gelegt? Weil ein<br />
Schild fehlt, das ihm dies verbietet?<br />
Wer dem Durchschnittsverbraucher<br />
Konsumvorschriften machen will, sollte<br />
sich daran erinnern, dass dieser kein<br />
Hanswurst ist, sondern der Souverän im<br />
marktwirtschaftlichen System. Die Verbraucher<br />
entscheiden durch ihre Nachfrage,<br />
was wie produziert wird. Wer<br />
ihren Konsum manipuliert, verändert<br />
den Markt. Es braucht<br />
also gute Gründe, die Verbraucher<br />
zu zwingen, Produkte<br />
zu bezahlen, die sie<br />
nicht bestellt haben, ob es<br />
sich nun um Strom aus<br />
Photovoltaikanlagen oder<br />
um Energiesparlampen<br />
handelt.<br />
Verbote tragen dazu bei, Eigenverantwortung<br />
und Selbstbestimmung<br />
zu ersticken. Die<br />
Verantwortung liegt dann immer<br />
woanders, nie bei den<br />
Akt<strong>eu</strong>ren. Der Wiener Philosoph<br />
Konrad Paul Liessmann sagt: „Verspielt<br />
jemand sein Vermögen an der Börse,<br />
wurde er schlecht beraten; scheitert<br />
jemand in der Schule, waren die Lehrer<br />
eine Katastrophe; studieren zu wenig<br />
Frauen technische Physik, hat die Gesellschaft<br />
versagt. Was gilt eigentlich der Wille<br />
des Einzelnen in solch einer Welt verschobener<br />
Verantwortlichkeit?“<br />
Zur Freiheit gehört schließlich auch die<br />
Möglichkeit, sich unvernünftig zu verhalten.<br />
Wo kein anderer Schaden nimmt,<br />
können gutgemeinte Ratschläge getrost<br />
ignoriert werden. Es gibt sogar ein Recht<br />
auf Rausch.<br />
Liebe Nannys: Die kurze Phase vor<br />
dem Tod nennt man – Leben.<br />
Alkoholgenuss im<br />
Zug verboten<br />
„Fr<strong>eu</strong>nde des Kiffens“<br />
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, 41, über die<br />
Verbotsforderungen seiner grünen Partei<br />
SPIEGEL: Unterstützen Sie die Forderung<br />
des Grünen-Wahlprogramms, in<br />
öffentlichen Kantinen einmal pro Woche<br />
nur Vegetarisches anzubieten?<br />
Palmer: Als freiwillige Aktion, wie es<br />
von uns gemeint ist: ja. Dass etwas<br />
weniger Fleischkonsum gesünder für<br />
uns und besser für die Tiere wäre,<br />
kann ja niemand bestreiten.<br />
SPIEGEL: Als Oberbürgermeister könnten<br />
Sie Ihren Einfluss auf die Schulspeisung<br />
geltend machen und in Tübingen<br />
einen Veggie-Day einführen.<br />
Palmer: Tierschutz- und Vegetarier -<br />
organisationen haben mich schon oft<br />
dazu aufgefordert. Ich sage: sehr gern,<br />
wenn die Schulen das wollen. Aber<br />
ich werde das nicht verordnen.<br />
SPIEGEL: Ihre Nachwuchsorganisation<br />
Grüne Jugend fordert zudem ein Verbot<br />
der ersten Klasse im Regionalverkehr.<br />
Ein guter Plan?<br />
Palmer: Als Jugendlicher fand ich die<br />
erste Klasse auch sinnlos. H<strong>eu</strong>te brauche<br />
ich sie, um arbeiten zu können.<br />
Diese Forderung wird nicht grünes<br />
Programm.<br />
SPIEGEL: Und hier noch ein Vorschlag<br />
aus der grünen Bundestagsfraktion:<br />
Affenverbot für<br />
Zoos.<br />
Palmer: Ich war gerade im<br />
n<strong>eu</strong>en, t<strong>eu</strong>ren Affenhaus<br />
der Stuttgarter Wilhelma.<br />
Toll! Ich finde, artgerechte<br />
Haltung ist die Lösung.<br />
SPIEGEL: Wie kommt es, dass<br />
grüne Politiker ständig Verbote<br />
fordern?<br />
Palmer: Das tun wir nicht. Es<br />
ist kein typisch grünes, sondern<br />
ein typisch d<strong>eu</strong>tsches<br />
Zeitgeistphänomen, alles regeln<br />
zu wollen. Als Oberbürgermeister<br />
werde ich überschüttet mit Verboten,<br />
an denen die Grünen vollkommen<br />
unschuldig sind.<br />
SPIEGEL: Zum Beispiel?<br />
Palmer: Wegen der Fluchtwegeverordnung<br />
dürfen wir in unserem schönen,<br />
altehrwürdigen Tübinger Schloss n<strong>eu</strong>erdings<br />
keine Konzerte mehr veranstalten.<br />
Und in unseren Schulgebäuden<br />
mussten wir die Geländer erhöhen.<br />
Da ist in hundert Jahren zwar<br />
noch kein Kind heruntergefallen.<br />
Aber angeblich stellen die alten Geländer<br />
ein untragbares Risiko dar.<br />
Kommunalpolitiker Palmer<br />
SPIEGEL: Trotzdem fällt auf, dass die<br />
Grünen den Bürgern gern vorschreiben<br />
wollen, wie sie zu leben haben.<br />
Palmer: Wer sich bei den Grünen engagiert,<br />
hat eine Mission. Letztlich<br />
geht es uns, im positiven Sinne, um<br />
nichts weniger als die Rettung der<br />
Welt. Deswegen bin ich der Partei<br />
überhaupt beigetreten. Wir sind der<br />
Ansicht, dass dazu jeder Einzelne etwas<br />
beitragen kann. Die Herausforderung<br />
für uns besteht nun darin, unsere<br />
Misson zu verfolgen, ohne missionarisch<br />
zu werden. Das ist ein Balanceakt,<br />
der uns insgesamt gelingt.<br />
SPIEGEL: Sie halten Verbote für ein ungeeignetes<br />
Mittel?<br />
Palmer: Verbote sind die Ultima Ratio.<br />
Ich setze lieber auf die Kraft von Argumenten.<br />
Wenn wir vorrechnen können,<br />
dass sich eine Energiesparmaßnahme<br />
finanziell lohnt, werden die<br />
Bürger freiwillig mitmachen. Man<br />
überz<strong>eu</strong>gt die L<strong>eu</strong>te leichter mit einem<br />
erhobenen Rechenschieber als<br />
mit einem erhobenen Zeigefinger.<br />
SPIEGEL: Bei ihrer Gründung galten die<br />
Grünen als Revoluzzer, als Bürgerschreck,<br />
als Anarcho-Truppe. Wo ist<br />
der alte Geist geblieben?<br />
Palmer: Wir sind immer noch eine rebellische<br />
Partei …<br />
SPIEGEL: … die das Kiffen legalisieren,<br />
Zigarettenautomaten hingegen ver -<br />
bieten will. Wie passt denn das zusammen?<br />
Palmer: Wir sind eine Partei, die unterschiedliche<br />
Strömungen vereinigt,<br />
in diesem Fall gesundheitsbewusste<br />
Eltern auf der einen Seite und Fr<strong>eu</strong>nde<br />
des Kiffens auf der anderen. Aber<br />
solange mir bei uns niemand vorschreiben<br />
will, beim Kiffen mitzumachen,<br />
halte ich diesen Widerspruch in<br />
unserer Politik gut aus.<br />
INTERVIEW: ALEXANDER NEUBACHER<br />
DER SPIEGEL 33/2013 33<br />
HC PLAMBECK / LAIF
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
CSU-Kontrahenten Söder, Aigner: Ein Schauspiel, wie es die Republik selten erlebt<br />
34<br />
KARRIEREN<br />
Empathie gegen Ego<br />
Ilse Aigner und Markus Söder wollen Horst Seehofer als<br />
bayerischen Ministerpräsidenten beerben.<br />
Ihr Duell bringt Spannung in den drögen Sommerwahlkampf.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
DOMINIK BECKMANN / BRAUERPHOTOS<br />
Wenn es darum geht, im bayerischen<br />
Erbfolgekrieg zu sticheln,<br />
ist Horst Seehofer keine<br />
Bühne zu abgelegen. Die<br />
WAHL<br />
Bänke der Rachlalm sind bis<br />
2013 zum letzten Platz besetzt.<br />
Wanderer fläzen sich im Gras und packen<br />
ihre Brotzeit aus, Bayerns Ministerpräsident<br />
hat sich extra von München zu dem<br />
Ausflugsziel auf 920 Meter Höhe im<br />
Chiemgau kutschieren lassen, um die<br />
Almbauern im Wahljahr zu umgarnen.<br />
Doch statt eine große Rede zu halten,<br />
reicht er das Mikrofon an die Frau weiter,<br />
die in Wanderhosen und Karobluse neben<br />
ihm sitzt. „Sie ist jung, sie ist kräftig,<br />
sie ist nervenstark“, sagt er und räumt<br />
die Bühne für Ilse Aigner. „Sie hat das<br />
Schlusswort“, sagt ihr Parteichef großzügig.<br />
Und schränkt grinsend ein: „Solange<br />
sie nichts gegen die bayerische Staatsregierung<br />
sagt.“ Es sind Bilder höchster<br />
Harmonie, Seehofer macht sich klein, damit<br />
seine Spitzenfrau glänzen kann.<br />
Im Saal des Nürnberger Sheraton-Hotels<br />
kann von Rücksicht dagegen keine<br />
Rede sein. „<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> geht es nur so<br />
gut, weil es Bayern gutgeht“, tönt Markus<br />
Söder. In markigen Worten hastet Bayerns<br />
Finanzminister durch seine Bewerbungsrede<br />
für den Bezirksvorsitz, als Seehofer<br />
eintrifft. Der CSU-Chef muss vor<br />
der Tür warten, keine Situation, die er<br />
besonders schätzt.<br />
Nach wenigen Minuten wird es ihm zu<br />
bunt, er marschiert in den Saal. Söders<br />
Zuhörer applaudieren. Er kann nur zusehen,<br />
wie Seehofer ihm die Show stiehlt.<br />
„Wir müssen uns gegenseitig ertragen“,<br />
stichelt der Parteichef, als er das Rednerpult<br />
übernimmt. Er spart nicht mit Seitenhieben<br />
auf seinen Gastgeber. „Jede<br />
Reise nach Franken ist eine Bildungsreise.<br />
Ich muss wissen, was er macht.“<br />
Seehofer liebt solche Auftritte. Nichts<br />
verschafft dem ewigen Hallodri an der<br />
Spitze des Freistaats mehr Spaß als Frotzelei<br />
über sein Personal. Wenn die bayerische<br />
Nachfolgedebatte am Köcheln bleibt<br />
und die CSU im Gespräch – umso besser.<br />
Aigner und Söder machen kein Geheimnis<br />
daraus, dass sie Seehofer als Ministerpräsidenten<br />
und CSU-Chef beerben wollen.<br />
Und Seehofer hat längst durchgespielt,<br />
wen er auf welchen Posten einsetzen will.<br />
Wenn die Landtagswahl am 15. September<br />
geschlagen ist, steht der Höhepunkt<br />
dieses Duells noch bevor. Aigner<br />
greift nach dem Posten der Fraktionsvorsitzenden<br />
im bayerischen Landtag als<br />
Sprungbrett für die Seehofer-Nachfolge.<br />
Söder will genau das verhindern und in<br />
ein paar Jahren selbst bayerischer Ministerpräsident<br />
werden.<br />
Es ist ein Schauspiel, wie es die Republik<br />
selten erlebt: ein Langstrecken-<br />
Machtkampf auf offener Bühne. Frau gegen<br />
Mann, Katholikin gegen Protestant,<br />
Oberbayerin gegen Franke, Empathie ge-
gen Ego. Das Duell Aigner gegen Söder<br />
spiegelt die Zerrissenheit des Freistaats<br />
und seiner Regierungspartei wider. Vor<br />
allem aber ist es ein Kräftemessen zweier<br />
völlig unterschiedlicher Politiker. Aigner<br />
ist fr<strong>eu</strong>ndlich, zurückhaltend, defensiv,<br />
Söder laut, ehrgeizig und populistisch.<br />
Mit stolzgeschwellter Brust beschreibt er<br />
sich als letzte Testosteroneinheit der d<strong>eu</strong>tschen<br />
Politik.<br />
In anderen Teilen <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s wäre<br />
klar, wie so ein Rennen ausgeht, zumal<br />
h<strong>eu</strong>tzutage, wo es keimfrei und korrekt<br />
zugehen muss in der Politik. Doch in Bayern<br />
und vor allem in der CSU wurde immer<br />
schon mit härteren Bandagen gekämpft.<br />
Und so geht es auch um die Seele<br />
der Christsozialen und die Frage, welche<br />
Partei die CSU künftig sein wird: Will sie<br />
ihr Raufboldimage pflegen oder ins seriöse<br />
Fach wechseln? Nicht wenige in der<br />
CSU finden, dass es Zeit dafür wird.<br />
Ein Knall geht durch den Raum und<br />
noch einer. Ilse Aigner erschrickt kurz,<br />
dann lächelt sie. Die Schuhplattler des<br />
Trachtenvereins schlagen sich auf die<br />
Schenkel. Anfang Juni gibt die Bundesagrarministerin<br />
im oberbayerischen Weiler<br />
Böbing den Startschuss für den Wettbewerb<br />
„Unser Dorf hat Zukunft“.<br />
Aigner sagt Sätze fürs Poesiealbum:<br />
„Wenn du schnell gehen willst, dann geh<br />
allein, wenn du weit gehen willst, dann<br />
geh gemeinsam.“ Oder, als es beim Dorfrundgang<br />
Bindfäden regnet: „Die Sonne<br />
war im Herzen.“ Es ist ein typischer Termin<br />
für Aigner, harmonisch und harmlos.<br />
Wo Aigner hinkommt, badet sie in Sympathie.<br />
In Böbing schleichen am Ende die<br />
Dorfältesten in der Krachledernen heran,<br />
um „die Ilse“ mal so richtig zu drücken.<br />
Im Kampf gegen Söder hat sie einen starken<br />
Verbündeten – das Volk.<br />
Söder kann nicht fassen, wie Aigner<br />
die Herzen zufliegen. Nach dem Scheitern<br />
von CSU-Star Karl-Theodor zu Guttenberg<br />
wähnte er sich schon halb auf<br />
Seehofers Thron. Als sich Aigner im September<br />
vor einem Jahr entschied, nach<br />
Bayern zu wechseln, verstand Söder das<br />
als Kampfansage. Aigner übermittelte<br />
ihm die Nachricht persönlich, es war ein<br />
denkwürdiges Telefonat.<br />
Söder schob sein eisernes Ich hervor,<br />
er zürnte und schimpfte. Aigner solle<br />
bloß nicht glauben, dass die Oberbayern<br />
jetzt alle Posten bekommen würden.<br />
„Wir brauchen erst die Mehrheit, dann<br />
können wir ans Verteilen denken“, antwortete<br />
Aigner. Sie ließ seinen Dampfhammer<br />
in Watte versinken.<br />
Die beiden tauschen SMS aus, telefonieren<br />
viel, bald wollen sie sogar gemeinsam<br />
in Söders Heimat Nürnberg übers<br />
Volksfest schlendern. Doch ihre Rivalität<br />
ist nicht gespielt. Es ist wie so oft in der<br />
CSU. L<strong>eu</strong>te, die sich seit Jahrzehnten kennen<br />
und um jede Schwäche des anderen<br />
wissen, werden plötzlich zu Gegnern.<br />
Das Kräftemessen zwischen<br />
Aigner und Söder begann<br />
schon vor zwei Jahrzehnten.<br />
1995 musste der<br />
Posten des bayerischen<br />
Chefs der Jungen Union<br />
besetzt werden. Aigner hatte<br />
sich bereits in die Welt<br />
der Politik vorgetastet und<br />
war stellvertretende JU-<br />
Chefin. Beim Kampf um<br />
den Chefposten verzichtete<br />
sie aber zu Söders Gunsten.<br />
Söder dankte es ihr<br />
nicht. Jahre später, Aigner<br />
war seit wenigen Monaten<br />
Bundesagrarministerin und<br />
Söder Umweltminister in<br />
München, wetterte er gegen<br />
die „Gen-H<strong>eu</strong>schrecken“ aus Amerika.<br />
Im Auftrag Seehofers drängte er die<br />
Parteifr<strong>eu</strong>ndin, den Anbau der Gen-Kartoffel<br />
Amflora zu untersagen. Aigner<br />
stand so da, als würde sie die Befehle direkt<br />
aus der Münchner Staatskanzlei empfangen.<br />
„Es war ein fürchterlicher Krach“,<br />
erinnert sich Aigner.<br />
Als CSU-Fraktionschef Georg Schmid<br />
im April in den Strudel der Verwandtenaffäre<br />
geriet und gehen musste, schien Söder<br />
fast am Ziel. Als Nachfolger Schmids<br />
hätte er den Machtkampf für sich entschieden.<br />
Aigner griff zum Hörer und<br />
warb für eine Übergangslösung bis zur<br />
Wahl. Seehofer unterstützte sie, er hatte<br />
kein Interesse daran, dass Aigner beschädigt<br />
wurde. Söder wurde gestoppt. Vorerst.<br />
Parteichef Seehofer<br />
Beide tauschen SMS aus,<br />
telefonieren viel, doch ihre<br />
Rivalität ist nicht gespielt.<br />
Ein Freitagnachmittag Ende Juni, Söders<br />
schwarzer Audi schiebt sich durch<br />
den Stau der Nürnberger Innenstadt. Söders<br />
Stimmkreis im Nürnberger Westen<br />
hat mit Ilse Aigners Bilderbuchbayern<br />
nichts gemein. Hier gibt es ein Bahnhofsviertel<br />
und eine Rotlichtmeile, Arbeitslose<br />
und Migranten.<br />
„Das ist hier nicht der Grunewald“,<br />
sagt Söder. In Wirklichkeit meint er: Das<br />
hier ist nicht Oberbayern. Dort, in der<br />
satten Champions-League-Erfolgsregion,<br />
kann jeder eine Mehrheit für die CSU<br />
holen. Hier, in Nürnberg, gelingt das nur<br />
einem harten Burschen wie ihm.<br />
Im Kampf gegen Aigner inszeniert er<br />
sich als Anti-Münchner. Für ihn ist Franken<br />
ein Landstrich, der im Vergleich zum<br />
reichen Oberbayern seit je benachteiligt<br />
wird. Und den er, Söder, auf Augenhöhe<br />
hievt. „Wieso braucht München einen<br />
Konzertsaal? Wir auch.“ Söder hat aus seinem<br />
Ehrgeiz nie einen Hehl gemacht, in<br />
ANDREAS GEBERT / DPA<br />
seinem Büro am Münchner Odeonsplatz<br />
steht eine Skulptur, ein Mann mit Fernglas,<br />
der Richtung Staatskanzlei späht.<br />
Auf Seehofers Vorwürfe, er sei ein Ichling,<br />
der sich mit „Schmutzeleien“ den<br />
Weg nach oben bahne, reagierte Söder<br />
im vergangenen Dezember besonnen.<br />
„Mein Motto ist: Ruhe bewahren, Haltung<br />
zeigen, Pflichten erfüllen“, sagte er<br />
im Landtag. Seine Beliebtheit in der Partei<br />
ist seitdem d<strong>eu</strong>tlich gestiegen.<br />
Als der Audi die Ringstraße mit Blick<br />
auf die Kaiserburg erreicht, tönt er, das<br />
Bauwerk sei gerade mit 16 Millionen Euro<br />
St<strong>eu</strong>ergeldern saniert worden. „Das habe<br />
ich gemacht.“ Bei solchen Sätzen glüht<br />
Söder vor Bed<strong>eu</strong>tung wie einst sein Ziehvater<br />
Edmund Stoiber.<br />
Ilse Aigner dagegen hat nur ein kleines<br />
Kr<strong>eu</strong>z verteidigt. Sie erzählt die Geschichte<br />
Anfang Februar im Bräuwirt in<br />
Miesbach und danach immer wieder. Unten<br />
in der Stube spielt die Hausmusik mit<br />
Akkordeon und Zither auf, oben im Saal<br />
lässt sich Aigner für die Landtagswahl<br />
aufstellen. Etwa hundert L<strong>eu</strong>te sind da,<br />
Schulfr<strong>eu</strong>nde und ihre engsten Verbündeten.<br />
Die Wahl ist geheim, doch die Vorsichtsmaßnahme<br />
hätte man sich sparen<br />
können. Aigner erhält hundert Prozent.<br />
Das Kr<strong>eu</strong>z, das zum Kern ihrer Antrittsreden<br />
in Bayern wird, hängt im Besucherraum<br />
des Berliner Agrarministeriums, beinahe<br />
unsichtbar, ein schlichtes Holzkr<strong>eu</strong>z<br />
auf heller Holzwand. Vertreter aus dem<br />
Personalrat drängten, das Kr<strong>eu</strong>z abzu -<br />
nehmen. Auch von einer Besuchergruppe<br />
der Grünen gab es Beschwerden. Dann<br />
kommt Aigners Pointe: „Das Kr<strong>eu</strong>z hängt<br />
noch immer.“ Großer Beifall.<br />
Die Anekdote ist typisch für Aigner.<br />
Sie will Entscheidungsstärke demonstrieren,<br />
doch in Wirklichkeit beschreibt sie<br />
einen defensiven Akt. Aigner wehrt Kürzungen<br />
von EU-Fördergeldern für die<br />
Bauern ab, sie reagiert, wenn Dioxin in<br />
Hühnereiern gefunden wird, und sie weigert<br />
sich, ein Kr<strong>eu</strong>z abzuhängen.<br />
„Konflikt um des Konflikts willen hat<br />
sich noch nie bewährt“, sagt sie. „Die<br />
DER SPIEGEL 33/2013 35
CSU ist nicht mehr wie in Strauß’ Zeiten.“<br />
Das war’s mit ihrer Bayern-Vision.<br />
Sogar ihr Privatleben poliert sie kurz<br />
vor der Wahl, damit böse Gerüchte erst<br />
gar nicht aufkommen. Als sie jüngst ihren<br />
Namen googelte und die Suchmaschine<br />
als Ergänzung „Fr<strong>eu</strong>nd“ und „Lebensgefährte“<br />
anbot, war sie erschrocken. Ihre<br />
Beziehung zu einem Unternehmer ist<br />
längst vorbei, in der „Bunten“ machte sie<br />
es jetzt offiziell. „Mein Fr<strong>eu</strong>nd und ich<br />
haben uns getrennt.“ Aigner ist Single.<br />
Seehofer sieht das Bemühen um einen<br />
reibungslosen Wahlkampf mit Wohlgefallen.<br />
Erst kürzlich nahm er Söder zur Seite<br />
und ermahnte ihn: „Wer jetzt Zwietracht<br />
sät, ist über Jahre beschädigt.“ Doch trotz<br />
aller Sympathie für Aigner hat er nichts<br />
entschieden. „Sympathien beim Wähler<br />
sind für Politiker natürlich sehr wichtig“,<br />
sagt er, „aber sie sind nicht alles.“<br />
Denn zur Jobbeschreibung des CSU-<br />
Chefs gehört es seit je, den Anliegen der<br />
ewig von Selbstzweifeln geplagten Regionalpartei<br />
auch in Berlin Gehör zu verschaffen.<br />
Um ein vergleichsweise schlichtes<br />
Projekt wie das Betr<strong>eu</strong>ungsgeld<br />
durchzusetzen, brauchte selbst ein Machtprofi<br />
wie Seehofer stählerne Nerven. Die<br />
Frage stellt sich: Kann Aigner das?<br />
Zusagen für den Fraktionsspitzenposten<br />
gibt es keine, und Seehofer will den<br />
Posten Aigner längst nicht in jedem Fall<br />
überlassen. Nur falls die CSU weiter mit<br />
der FDP regieren muss, ist Aigner gesetzt.<br />
Dann sind Verhandlungsgeschick und<br />
Ausgleichsfähigkeit gefragt, ihre Stärken.<br />
Sollte die CSU dagegen die absolute<br />
Mehrheit erreichen, muss der Fraktionschef<br />
eine selbstbewusste Abgeordnetentruppe<br />
in Schach halten, eine Aufgabe<br />
für einen Brachialpolitiker wie Söder.<br />
Langsam dämmert es vielen, dass sich<br />
Aigners Popularität und Söders Durchsetzungsstärke<br />
gut kombinieren ließen,<br />
nicht wenige plädieren für eine Arbeitsteilung<br />
für die Zeit nach Seehofer. Aigner<br />
würde dann Ministerpräsidentin, Söder<br />
Parteichef und Minister in Berlin. Vorbilder<br />
dafür gibt es. Unter Alfons Goppel<br />
als Ministerpräsident und Franz Josef<br />
Strauß als Parteichef und Bundespolitiker<br />
hatte die CSU ihre erfolgreichste Zeit.<br />
Doch Söder winkt ab, vorerst jedenfalls.<br />
Er kandidiert nicht für den Bundestag.<br />
Er wäre in den nächsten Jahren ein<br />
Bundesminister von Seehofers Gnaden.<br />
Aigner dagegen legt ihr Schicksal vertrauensvoll<br />
in die Hände ihres Chefs. „Die<br />
Kunst vom Horst ist rauszufinden: Wer<br />
ist wofür geeignet?“, sagt sie. Ein Montagnachmittag,<br />
Aigner ist auf dem Sprung<br />
ins nächste Bierzelt. In der Nähe der Salzburger<br />
Autobahn sitzt sie in einem Gasthof,<br />
die Gäste bestellen Weißbier. Aigner<br />
ist ein bisschen matt, sie ist schon den ganzen<br />
Tag auf den Beinen. „Am liebsten<br />
würde ich jetzt ein Glas Sekt trinken“,<br />
sagt sie, „stört Sie das?“ PETER MÜLLER<br />
FDP<br />
„Wir sind das Korrektiv“<br />
FDP-Chef Philipp Rösler, 40, fordert, den Soli<br />
auch gegen das Votum der Kanzlerin abzuschaffen und<br />
die Energiewende auf eine n<strong>eu</strong>e Basis zu stellen.<br />
SPIEGEL: Glauben Sie an ein<br />
Leben nach dem Tod?<br />
Rösler: Natürlich, ich bin<br />
schließlich Katholik.<br />
WAHL<br />
SPIEGEL: Dann muss Ihr eigenes<br />
Schicksal Sie im Glauben<br />
2013<br />
ja enorm gestärkt haben. Anfang des<br />
Jahres galt Ihr baldiges Ableben im Amt<br />
des FDP-Chefs als so gut wie sicher. Dann<br />
haben die Liberalen bei der Landtagswahl<br />
in Niedersachsen knapp zehn Prozent der<br />
Stimmen geholt, und Sie durften bleiben.<br />
Wie war Ihre politische Nahtoderfahrung?<br />
Rösler: Nicht nur in der katholischen<br />
Kirche, sondern auch für die schon manches<br />
Mal totgesagte FDP spielt die Auf -<br />
erstehung eine besondere Rolle. Hier<br />
kann ich nun einige persönliche Erfahrungen<br />
beist<strong>eu</strong>ern.<br />
MAURICE WEISS / DER SPIEGEL<br />
SPIEGEL: Heißt das, die Tage des „netten<br />
Herrn Rösler“ sind gezählt?<br />
Rösler: In der Politik ist Führung gefordert,<br />
gerade von einem Parteivorsitzenden. Natürlich<br />
sollte er sympathisch auftreten,<br />
aber er darf keinen Zweifel daran lassen,<br />
dass er bereit ist, für seine Überz<strong>eu</strong>gungen<br />
auch bei Gegenwind zu kämpfen.<br />
Eines ist doch klar: Wer eine solch schwierige<br />
Phase durchgestanden hat, schöpft<br />
daraus Kraft für die nächsten politischen<br />
Debatten.<br />
SPIEGEL: Sie haben Ihr Amt vor allem<br />
dadurch gerettet, dass Sie Fraktionschef<br />
Rainer Brüderle in der entscheidenden<br />
Sitzung überrumpelt haben. Sie haben<br />
ihm den Parteivorsitz angeboten, er hat<br />
abgelehnt. Jetzt, im Wahlkampf, soll er<br />
die Sturmspitze sein, Sie der Mann -<br />
36 DER SPIEGEL 33/2013
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
schafts kapitän. Wie viel Spielraum lassen<br />
Sie Ihrem wichtigsten Mann auf dem<br />
Feld?<br />
Rösler: Als Spitzenkandidat prägt Rainer<br />
Brüderle unseren Wahlkampf. Anders als<br />
bei der SPD funktioniert bei uns die Zusammenarbeit<br />
zwischen dem Spitzenkandidaten<br />
und dem Parteivorsitzenden hervorragend.<br />
Wir arbeiten eng im Team zusammen,<br />
legen gemeinsam die Themen<br />
fest, melden uns mit gemeinsamen Initiativen<br />
zu Wort, und wir werden bei den<br />
meisten Großkundgebungen gemeinsam<br />
auftreten.<br />
SPIEGEL: Gehört zu dieser Gemeinsamkeit<br />
auch, dass Sie Brüderle jüngst beim Thema<br />
Solidaritätszuschlag zurückgepfiffen<br />
haben?<br />
Rösler: Das Gegenteil ist der Fall. Auch<br />
beim Soli haben wir eine klare gemeinsame<br />
Linie.<br />
SPIEGEL: Die FDP-Fraktion hat dafür plädiert,<br />
den Solidaritätszuschlag bereits ab<br />
dem Jahr 2014 abzusenken. Sie dagegen<br />
wollen die Bürger erst später entlasten.<br />
Rösler: Da missinterpretieren Sie ein Gutachten,<br />
das zeigen sollte, ob und wie eine<br />
Entlastung möglich ist. Beim Soli sprechen<br />
Rainer Brüderle und ich dieselbe<br />
Sprache. Wir wollen den Soli schrittweise<br />
abschaffen, aber wir wollen das tun, ohne<br />
im Gegenzug die Schulden zu erhöhen.<br />
Das ist ein solides Konzept. Entscheidend<br />
ist, dass der Soli bald Geschichte ist.<br />
SPIEGEL: Daraus wird wohl nichts. Die<br />
Bundeskanzlerin lehnt es ab, den Soli anzutasten.<br />
Rösler: Der Soli wurde 1991 eingeführt,<br />
um die d<strong>eu</strong>tsche Einheit und den sogenannten<br />
Solidarpakt zwischen alten und<br />
n<strong>eu</strong>en Bundesländern zu finanzieren.<br />
Der Solidarpakt läuft 2019 aus. Bei der<br />
Einführung wurde versprochen, den Soli<br />
zeitlich zu begrenzen. An dieses Ver -<br />
sprechen fühlt sich die FDP gebunden.<br />
Ich bin zuversichtlich, dass<br />
sich auch die Union dieser Argumentation<br />
nicht verschließt.<br />
Für die FDP ist das Einhalten<br />
dieses Versprechens ein wichtiger<br />
Punkt.<br />
SPIEGEL: Mit anderen Worten,<br />
in der nächsten Legislaturperiode<br />
soll es genauso laufen<br />
wie in dieser. Die FDP verspricht<br />
fleißig St<strong>eu</strong>ersenkungen,<br />
die von der Union genauso<br />
fleißig abgewehrt werden.<br />
Glauben Sie im Ernst,<br />
dass Sie die Wähler auf diesem<br />
Weg von Schwarz-Gelb<br />
überz<strong>eu</strong>gen können?<br />
Rösler: Wir haben in dieser<br />
Legislaturperiode dazu beigetragen,<br />
dass die Menschen<br />
um 22 Milliarden Euro ent -<br />
lastet worden sind. Und auf<br />
Drängen der FDP wurde<br />
die Praxis gebühr abgeschafft.<br />
Das zeigt, dass wir als Korrektiv funktionieren.<br />
Wir werden d<strong>eu</strong>tlich machen,<br />
dass auch in der kommenden Legislaturperiode<br />
nur die FDP für eine Entlastung<br />
der Bürger steht. Alle anderen Parteien<br />
wollen St<strong>eu</strong>ern und Abgaben erhöhen,<br />
wir wollen die Menschen entlasten, sobald<br />
wir die Spielräume im Haushalt<br />
geschaffen haben.<br />
SPIEGEL: Das Problem ist nur, dass die Vorstellungen<br />
über das, was notwendig ist,<br />
im schwarz-gelben Lager auseinander -<br />
driften. Dürfen wir Sie mit einigen der<br />
jüngsten politischen Forderungen aus der<br />
Union konfrontieren?<br />
Rösler: Nur zu.<br />
SPIEGEL: Was halten Sie vom Vorschlag<br />
der Kanzlerin, mit Hilfe einer Mietpreisbremse<br />
in den Großstädten die Wohnungsnot<br />
zu lindern?<br />
Rösler: Durch einen Preisdeckel wird keine<br />
einzige n<strong>eu</strong>e Wohnung geschaffen. Nötig<br />
ist vielmehr, auf dem Immobilienmarkt<br />
die richtigen Anreize für mehr Investitionen<br />
zu setzen.<br />
SPIEGEL: Unionsfraktionschef Volker Kauder<br />
will lieber die Mütterrente erhöhen,<br />
als die Sozialbeiträge zu senken. Stimmen<br />
Sie zu?<br />
Rösler: Dass wir die Abgaben auf den Faktor<br />
Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode<br />
reduziert haben, war eine der<br />
wichtigsten Voraussetzungen für die positive<br />
Entwicklung am Arbeitsmarkt. Ich<br />
habe nicht den Eindruck, dass die Union<br />
das anders sieht. Im Gegenteil: Das haben<br />
wir gemeinsam erreicht.<br />
SPIEGEL: Die CDU drängt trotz des NSA-<br />
Abhörskandals darauf, die Kommunikationsdaten<br />
mindestens sechs Monate zu<br />
speichern. Sind Sie dabei?<br />
Rösler: Die jüngsten Enthüllungen zeigen,<br />
wie richtig der jahrelange Kampf von<br />
Justizministerin Sabine L<strong>eu</strong>th<strong>eu</strong>sser-<br />
Schnarrenberger und der gesamten FDP<br />
Liberale Brüderle, Rösler: „Wir arbeiten eng im Team“<br />
gegen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung<br />
war und ist. In der Union hat<br />
hier offenbar auch ein Nachdenken eingesetzt.<br />
SPIEGEL: Der Graben zwischen Ihrer Partei<br />
und der CDU vertieft sich auch beim<br />
wichtigsten Thema Ihres eigenen Ressorts,<br />
der Energiewende. Täuscht der<br />
Eindruck, dass Umweltminister Peter Alt -<br />
maier besser mit den Grünen regieren<br />
könnte als mit Ihnen?<br />
Rösler: Das kann ich nicht erkennen. Gemeinsam<br />
mit Peter Altmaier ist es gelungen,<br />
wichtige Weichen für die Energiewende<br />
zu stellen. Richtig ist allerdings,<br />
dass bislang nur die FDP ein Konzept<br />
vorgelegt hat, wie die Förderung ern<strong>eu</strong>erbarer<br />
Energien reformiert werden<br />
kann.<br />
SPIEGEL: Es bleibt dabei, dass Sie mit der<br />
Union in vielen wichtigen Fragen aus -<br />
einanderliegen. Werden wir in der nächsten<br />
Legislaturperiode also eine N<strong>eu</strong>inszenierung<br />
des Stücks „Gurkentruppe gegen<br />
Wildsäue“ erleben?<br />
Rösler: Die Auffassung, dass wir in allen<br />
wichtigen Fragen auseinanderliegen, teile<br />
ich überhaupt nicht. Bei den meisten Themen<br />
gibt es eine große Übereinstimmung.<br />
Die schwarz-gelbe Koalition hat in den<br />
vergangenen vier Jahren viel erreicht,<br />
von der Haushaltskonsolidierung bis hin<br />
zur erleichterten Zuwanderung. Den Ton<br />
im Regierungsbündnis habe ich übrigens<br />
zumindest in meiner Zeit als Parteivorsitzender<br />
immer als ausgesprochen angenehm<br />
empfunden. In schwierigen Phasen<br />
meiner Partei konnte ich mich auf Angela<br />
Merkel und Horst Seehofer stets verlassen.<br />
Das werde ich den beiden persönlich<br />
nicht vergessen.<br />
SPIEGEL: Selbst wenn es noch einmal für<br />
Schwarz-Gelb reicht, so hat im Bundesrat<br />
die Opposition noch jahrelang die Mehrheit.<br />
Die FDP kann fordern, was sie will,<br />
am Ende regiert eine informelle<br />
Große Koalition.<br />
Rösler: Ich war selbst lange<br />
Zeit Landespolitiker. Deshalb<br />
weiß ich, dass im Bundesrat<br />
die Maxime gilt: erst das<br />
Land, dann die Partei. Ich<br />
bin überz<strong>eu</strong>gt: Wenn die<br />
schwarz-gelbe Koalition gute<br />
Argumente hat, geschickt verhandelt,<br />
kann sie auch unter<br />
den jetzigen Mehrheitsverhältnissen<br />
im Bundesrat viel<br />
erreichen. Beim Netzausbau<br />
etwa ist das gerade erst ge -<br />
lungen.<br />
SPIEGEL: Die Kanzlerin lässt<br />
aber keine Gelegenheit aus,<br />
um klarzustellen, dass sie mindestens<br />
so gern wie mit Ihnen<br />
mit der SPD regieren würde.<br />
Müsste sich Angela Merkel<br />
nicht d<strong>eu</strong>tlicher zur FDP bekennen?<br />
MICHAEL KAPPELER / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
DER SPIEGEL 33/2013 37
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
Rösler: Alle führenden Unionspolitiker<br />
von Angela Merkel über Volker Kauder<br />
bis zu Horst Seehofer haben sich für die<br />
Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition<br />
ausgesprochen. Mir war das d<strong>eu</strong>tlich genug.<br />
Es waren vier gute Jahre für <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />
Und wir wollen gemeinsam, dass<br />
dies so bleibt.<br />
SPIEGEL: Die Union vermeidet es aber<br />
auffällig, sich auf eine Koalitionsoption<br />
festzulegen. In der FDP dagegen drängen<br />
viele darauf, eine Ampelkoalition aus<br />
SPD, FDP und Grünen noch vor der<br />
Wahl formal auszuschließen. Wird es<br />
dazu kommen?<br />
Rösler: Die FDP wird am 12. September<br />
einen Wahlkonvent abhalten. Dort werden<br />
wir beschließen, dass die Liberalen<br />
nach der Wahl für eine Ampelkoalition<br />
nicht zur Verfügung stehen. Die Inhalte<br />
sind entscheidend, hier sehe ich keine<br />
Übereinstimmung.<br />
SPIEGEL: Dass sich die FDP freiwillig zum<br />
Anhängsel der Union macht, hat sich bislang<br />
für Sie nicht sonderlich ausgezahlt.<br />
In den Umfragen liegt Ihre Partei aktuell<br />
bei gerade fünf Prozent, und der beliebteste<br />
Liberale im Kabinett sind nicht Sie,<br />
sondern Außenamtschef Guido Westerwelle.<br />
Wurmt es Sie eigentlich, dass Ihr<br />
Vorgänger im Amt des Parteichefs so viel<br />
populärer ist als Sie?<br />
Rösler: Guido Westerwelle genießt im Inund<br />
Ausland zu Recht eine hohe Anerkennung<br />
für seine hervorragende Arbeit.<br />
Darüber fr<strong>eu</strong>e ich mich, denn das hilft<br />
der FDP.<br />
SPIEGEL: Kürzlich hat sich Westerwelle im<br />
„Stern“ bitter darüber beklagt, wie er<br />
beim Amtswechsel von einigen seiner<br />
Parteifr<strong>eu</strong>nde behandelt worden ist. Fühlten<br />
Sie sich angesprochen?<br />
Rösler: Nein. Es war 2011 eine gemeinsame<br />
Entscheidung der gesamten Parteispitze,<br />
die FDP im Hinblick auf die Wahl<br />
2013 personell n<strong>eu</strong> aufzustellen. Jetzt<br />
zeigt sich, dass die Konstellation, die wir<br />
gefunden haben, bestens funktioniert.<br />
Das sieht auch die Parteibasis so.<br />
SPIEGEL: Woher wollen Sie das wissen?<br />
Rösler: Ein gutes Indiz ist, welche Plakate<br />
unsere Kreisverbände für den Wahlkampf<br />
ordern. Am meisten werden die Motive<br />
mit unserem Spitzenkandidaten Rainer<br />
Brüderle bestellt, denn er ist unser Gesicht<br />
im Wahlkampf. Danach folgen die des Parteivorsitzenden<br />
und der anderen Minister.<br />
SPIEGEL: Wenn es für Schwarz-Gelb nicht<br />
reicht, arbeiten Sie dann wieder als Arzt<br />
in Hannover?<br />
Rösler: Die Frage stellt sich nicht. Ich bin<br />
überz<strong>eu</strong>gt, dass es reicht.<br />
INTERVIEW: MICHAEL SAUGA,<br />
GERALD TRAUFETTER<br />
38<br />
Animation: Die Karriere des<br />
Philipp Rösler<br />
spiegel.de/app332013roesler<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
PARTEIENFINANZIERUNG<br />
Vier gute Jahre<br />
Die FDP-Bundestagsfraktion<br />
verschickt vor der Bundestagswahl<br />
fragwürdige Werbebriefe. Doch<br />
Rechnungshof und Bundestagsverwaltung<br />
halten sich zurück.<br />
FDP-Fraktions-Schreiben (Ausschnitt): Verdeckte Botschaft<br />
Das Schreiben, das mehrere zehntausend<br />
Anwälte Mitte Juli in<br />
ihrem Briefkasten fanden, beginnt<br />
mit einem Lob des Berufsstandes: Ohne<br />
Anwälte sei weder Recht noch Freiheit<br />
möglich. Dann gibt es noch ein besonders<br />
dickes Lob – für die FDP. Die habe im<br />
Bundestag nicht nur das anwaltliche Berufsrecht,<br />
sondern auch „die Rolle des Anwalts<br />
im gelebten Rechtsstaat“ gestärkt.<br />
Detailliert listet das Schreiben die Erfolge<br />
der Liberalen auf: höhere Gebühren,<br />
Ablehnung der Gewerbest<strong>eu</strong>er für die<br />
Freien Berufe, Förderung des elektronischen<br />
Rechtsverkehrs. N<strong>eu</strong>n Punkte umfasst<br />
die Lobeshymne. Der Brief schließt<br />
mit den Worten: „Es waren vier gute Jahre<br />
für <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>! Vier gute Jahre für<br />
die Anwaltschaft und die Rechtspolitik<br />
insgesamt.“<br />
Das Schreiben liest sich wie eine der<br />
Werbebroschüren, die Parteien gern vor<br />
Wahlen an die Haushalte verschicken. Es<br />
gibt nur ein Problem: Es stammt nicht von<br />
der Partei, sondern von der FDP-Bundestagsfraktion.<br />
Und die darf Öffentlichkeitsarbeit<br />
betreiben, aber laut Parteiengesetz<br />
keine Wahlwerbung verschicken.<br />
Es ist nicht die erste fragwürdige Ak -<br />
tion der FDP in dieser Legislaturperiode.<br />
Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob<br />
die Liberalen gegen die Regeln zur Parteienfinanzierung<br />
verstoßen haben. Vor<br />
den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen<br />
und Schleswig-Holstein im vergangenen<br />
Jahr hatte sich Fraktionschef Rainer<br />
Brüderle in Briefen an mehr als drei<br />
Millionen Bürger gewandt. Der Verfassungsgerichtshof<br />
in NRW bewertete das<br />
als eine verdeckte Werbebotschaft, die<br />
vermutlich gegen das Grundgesetz verstoße.<br />
Bei der Arbeitsteilung von Partei und<br />
Fraktion wurde schon häufiger heftig ge-<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
trickst. So setzte die FDP fast zwei Jahre<br />
lang Pressesprecher der Fraktion an Wochenenden<br />
und Feiertagen zu Bereitschaftsdiensten<br />
für die Partei ein. Auch<br />
dies ist verboten, weil die aus St<strong>eu</strong>ergeldern<br />
finanzierte Arbeit der Fraktion nicht<br />
den Parteien direkt zugutekommen soll.<br />
Auf Nachfrage der Bundestagsverwaltung<br />
erklärte die Partei, es habe sich nicht<br />
um unerlaubte Parteienfinanzierung gehandelt,<br />
weil Fraktion und Partei „in jeweils<br />
vergleichbarem Umfang“ voneinander<br />
profitiert hätten (SPIEGEL 32/2013).<br />
Doch das stimmt nicht. Im vergangenen<br />
Jahr übernahm die Partei nur rund<br />
zehn Bereitschaftsdienste für die Frak -<br />
tion. Fraktionssprecher hatten dagegen<br />
mehr als 20-mal Bereitschaftsdienst für<br />
die Partei. Von einem vergleichbaren Umfang<br />
kann keine Rede sein. Trotzdem erklärte<br />
die Fraktion in der vergangenen<br />
Woche auf Nachfrage ern<strong>eu</strong>t, die Rufbereitschaft<br />
sei „in der Regel“ abwechselnd<br />
von Fraktions- und Parteimitarbeitern<br />
wahrgenommen worden.<br />
Nun führt die Bundestagsverwaltung<br />
nach eigenen Angaben eine „Sachverhaltsklärung“<br />
durch. Die<br />
kann sich hinziehen. Bundestagspräsident<br />
Norbert<br />
Lammert agiert in der den<br />
Koalitionspartner betreffenden<br />
Angelegenheit bislang<br />
höchst defensiv. Die Frage,<br />
ob die FDP mit der Briefkampagne<br />
gegen das Parteiengesetz<br />
verstoßen habe,<br />
könne nicht abschließend<br />
beantwortet werden, heißt<br />
es in einem Brief Lammerts an die Grünen.<br />
Ob die FDP-Fraktion verdeckte<br />
Parteienfinanzierung betrieben habe,<br />
müsse zunächst der Bundesrechnungshof<br />
prüfen.<br />
Der sieht das anders. „Nach Auffassung<br />
des Bundesrechnungshofs hat der<br />
Bundestagspräsident eine Prüfzuständigkeit“,<br />
sagt eine Sprecherin. Eigentlich<br />
sind beide zuständig. „Es gibt bewusst<br />
eine doppelte Kontrolle durch Rechnungshof<br />
und Bundestag. Wenn eine Instanz<br />
auf die andere wartet, wird dieses System<br />
ausgehebelt“, kritisiert der Parteienforscher<br />
Martin Morlok.<br />
Auch der Rechnungshof verhält sich<br />
sehr zurückhaltend. Vor der Bundes -<br />
tagswahl wird es wohl nichts mehr werden.<br />
Immerhin dürfte die „Sachverhaltsklärung“<br />
den Prüfern der Behörde keine<br />
Schwierigkeiten bereiten. Mitverantwortlich<br />
für die Briefkampagne der FDP-<br />
Bundestagsfraktion vor der NRW-Wahl<br />
war der damalige Parlamentarische Geschäftsführer<br />
Christian Ahrendt. Im Januar<br />
legte Ahrendt sein Bundestags -<br />
mandat nieder, weil seine Partei ihn in<br />
ein n<strong>eu</strong>es Amt gehoben hatte. Er ist seither<br />
Vizepräsident des Bundesrechnungshofs.<br />
RALF NEUKIRCH
Freigelassener Mollath: „Du, der Gustl ist im Fernsehen“<br />
Am Dienstag voriger Woche klingelte<br />
das Telefon bei Petra M. Ein<br />
Mann vom Radio war dran, er<br />
fragte: „Wissen Sie’s schon?“ – „Was<br />
denn?“ – „Gustl Mollath ist frei. Was sagen<br />
Sie dazu?“ – „Das ist schön für ihn“,<br />
sagte Petra M. überrascht.<br />
Dann besann sie sich und schaute auf<br />
den Merkzettel, den sie neben das Telefon<br />
gelegt hat, für den Fall, dass mal wieder<br />
Reporter dran sind und etwas wissen<br />
wollen über ihre damalige Ehe mit Gustl<br />
Mollath: Hat er Sie wirklich geschlagen?<br />
Warum haben Sie erst nach mehr als<br />
einem Jahr Anzeige erstattet? Wann äußern<br />
Sie sich zu den Schwarzgeld-Vorwürfen?<br />
Warum haben Sie seine Habe<br />
vernichtet? Haben Sie Angst vor ihrem<br />
Ex-Mann?<br />
Auf dem Zettel steht: „Für den Moment<br />
ist alles gesagt. Bitte haben Sie dafür<br />
Verständnis.“ Das sagte sie zu dem<br />
Radiomann. Und legte auf.<br />
Das Telefon läutet oft bei Petra M., seit<br />
der Fall Gustl Mollath Schlagzeilen macht.<br />
Manchmal mitten in der Nacht, und am<br />
anderen Ende hört sie nur jemanden atmen.<br />
Manchmal kommen lange Hass -<br />
42<br />
JUSTIZ<br />
Die andere Hälfte<br />
Nach sieben Jahren in der Psychiatrie ist Gustl Mollath frei.<br />
Was sagt eigentlich seine Ex-Ehefrau dazu? Besuch bei<br />
einer Frau, die gefangen ist in einer längst beendeten Beziehung.<br />
tiraden, „natürlich anonym, die L<strong>eu</strong>te<br />
sind ja feige“. N<strong>eu</strong>lich sagte eine Frau einfach<br />
nur: Drecksau! Da entfuhr es ihr:<br />
Selber Drecksau. Sofort nahm sie sich<br />
vor, sich beim nächsten Mal zur Höflichkeit<br />
zu zwingen, sie will sich nicht auf<br />
dieses Niveau herabziehen lassen. Sie will<br />
ihre Ruhe.<br />
Wertsachen von Mollath<br />
Eine Kiste im Keller, eine im Wohnzimmer<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
GETTY IMAGES<br />
Als Nächstes war vorigen Dienstag<br />
aber eine Fr<strong>eu</strong>ndin dran: „Du, der Gustl<br />
ist im Fernsehen!“ Auf allen Sendern<br />
brachten sie es: Gustl Mollath, wie er auf<br />
dem Gelände des Bezirkskrankenhauses<br />
über eine grüne Wiese einem Pulk von<br />
Reportern und Unterstützern entgegengeht,<br />
im hellblauen Polohemd. Wie er erschöpft,<br />
verschwitzt und glücklich vor die<br />
Kameras tritt, nur mit Pflanzen im Arm,<br />
die er selbst gezogen hat in der forensischen<br />
Psychiatrie, aus einem Orangenund<br />
einem Dattelkern.<br />
Petra M. war mal Bankerin, h<strong>eu</strong>te behandelt<br />
sie Klienten mit Bioenergetik, sie<br />
reinigt Räume von schlechten Schwingungen.<br />
Schon lange hat sie die Business -<br />
kostüme gegen sportliche Jeans getauscht,<br />
sie ist eine zierliche Frau, die Haare kurz<br />
geschnitten, sie hat wieder geheiratet, ein<br />
n<strong>eu</strong>es Leben begonnen.<br />
Was hat sie in diesem Moment empfunden?<br />
Angst vielleicht vor dem, was<br />
nun auf sie zukommt? Oder doch eher<br />
Wut darüber, dass der Mann, der 2006 als<br />
ihr Peiniger verurteilt worden war, nun<br />
als Freiheitsheld und Unschuldslamm gefeiert<br />
wird? Petra M. zögert einen Augenblick,<br />
lächelt und sagt: „Ich will jetzt<br />
nichts Falsches sagen, aber irgendwie<br />
hat’s mich schon gerührt, wie er da stand<br />
und sich an dem Blumentopf festgehalten<br />
hat. Dabei hat ja nicht so viel gefehlt dar -<br />
an, dass er mich umgebracht hätte.“<br />
So sah es auch das Landgericht Nürnberg-Fürth<br />
im Jahr 2006. Gustl Mollath<br />
habe seine Frau geschlagen, gebissen und<br />
gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit, er habe<br />
Menschenleben in Gefahr gebracht, indem<br />
er etliche Autoreifen auf eine Weise<br />
zerstach, dass die Luft aus den Reifen erst<br />
beim Fahren entwich. Er sei eine Gefahr<br />
für die Allgemeinheit. So steht es im Urteil.<br />
Aber das zählt nun nicht mehr.<br />
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat<br />
die Wiederaufnahme des Verfahrens verfügt<br />
und Mollaths sofortige Entlassung.<br />
Auch für Mollath kam das plötzlich. Ein<br />
Fr<strong>eu</strong>nd half ihm, seine Sachen in einen<br />
Transporter zu packen, am späten<br />
Dienstagnachmittag waren<br />
siebeneinhalb Jahre Psychiatrieaufenthalt<br />
Geschichte. „Irgendwann“,<br />
sagt Petra M., „musste<br />
ja mal was passieren. Sie können<br />
den Mollath ja nicht ewig<br />
da drin behalten.“<br />
Immer nennt sie ihn h<strong>eu</strong>te<br />
„den Mollath“, nicht „Gustl“<br />
oder „meinen Ex-Mann“; das<br />
hält ihn auf Abstand zu ihrem<br />
jetzigen Leben, soweit das überhaupt<br />
möglich ist. Seit Wochen<br />
blickt er ihr in ganz Nürnberg<br />
von Plakaten entgegen, auf<br />
denen seine Unterstützer „Freiheit<br />
und Gerechtigkeit für Gustl<br />
Mollath“ fordern. Was Mollath<br />
selbst unter Gerechtigkeit ver-<br />
OTTO LAPP
steht, hat er in vielen Interviews gesagt:<br />
„die volle Rehabilitierung und Wiederherstellung<br />
meiner Unschuld“.<br />
Ihr, der Ex-Bankerin, haben diejenigen,<br />
die an Gustl Mollath glauben, in diesem<br />
Justizdrama die Rolle der bösen Frau zugedacht:<br />
die Hexe, die ihren unbequemen<br />
Mann ins Irrenhaus sperren lässt und ihn<br />
um Haus und Besitz bringt. „Vielleicht ist<br />
das so eine Urangst“, sagt Petra M., „anders<br />
kann ich mir den Hass, der mir entgegenschlägt,<br />
nicht erklären.“ Ihr glaube<br />
man nichts, ihm jedoch alles.<br />
Zum Beispiel, dass sie ihm alles genommen<br />
habe. Immer wieder hat er das in<br />
Interviews gesagt. Sein Unternehmen,<br />
sein Haus, seine Habe, auch seine Ausweispapiere<br />
– alles weg. Nicht mal das<br />
Bild seiner Mutter sei ihm geblieben.<br />
Das Bild der Mutter. Petra M. kennt es<br />
noch, aus Zeiten, in denen der Mollath<br />
für sie noch der Gustl war. „Es hing am<br />
Spiegel vor seinem Schlafzimmer“, sagt<br />
sie, „das war ihm heilig.“<br />
Nach Mollaths Fernsehauftritt stieg sie<br />
in den Keller. Eine Kiste hat sie dort stehen<br />
lassen, Geschirr, Kristallgläser und<br />
Besteck der Mutter sind darin, vielleicht<br />
kann er das ja jetzt brauchen. Auch die<br />
vielen Autoposter in schweren Rahmen<br />
sind noch da, die Mollath damals überall<br />
aufgehängt hatte. Die andere Kiste steht<br />
jetzt im Wohnzimmer. Petra M. weiß nicht<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
mehr genau, was sie alles hineingepackt<br />
hat, damals, als sie das Haus ihres Mannes<br />
vor der Zwangsversteigerung räumte.<br />
Es war ja mal die große Liebe, Gustl<br />
und Petra, sie 18 Jahre alt, als sie sich<br />
kennenlernten, er 22. Sie hatten ein schönes<br />
Leben, finanziert von ihrem Gehalt<br />
bei der Bank.<br />
Petra M. atmet noch einmal tief durch,<br />
dann schaut sie in die Kartons und<br />
Schachteln, öffnet eine blaue Kunststoffmappe:<br />
Z<strong>eu</strong>gnisse. Zum Beispiel das der<br />
Hiberniaschule, „da hat er sein Fach-Abi<br />
gemacht, als Zweitbester seines Jahrgangs“.<br />
Der Vertrag beim Maschinenbauer<br />
MAN, dann seine Kündigung: „…kündige<br />
ich fristlos“, steht da mit blauer Tinte<br />
geschrieben.<br />
Danach kam die Zeit, in der er einen<br />
Handel für Motorradreifen und Zubehör<br />
aufmachte, später restaurierte er alte<br />
Sportwagen, Ferraris, Alfas, Maseratis.<br />
Gemeinsam fuhren sie zu Autorennen<br />
nach Monza und Silverstone. Sie machte<br />
in der Bank Karriere. Doch seine Werkstatt<br />
lief nie. Jahrelang steckte sie ihr<br />
Geld in seine Firma, als sie damit aufhörte,<br />
im Jahr 2000, war er pleite.<br />
Petra M. öffnet jetzt einen großen braunen<br />
Umschlag. Stockfleckiges Papier, sie<br />
breitet es aus, schnuppert. Das mollathsche<br />
Familienstammbuch, in rotschwarz<br />
geprägtem Leinen. Eine Ahnentafel, das<br />
Reichspost-Sparbuch des Vaters. Und dann<br />
Fotoalben. „Hier, das ist er als Baby!“<br />
Nachdenklich betrachtet Petra M. das<br />
Schwarzweißporträt aus dem Jahr 1957:<br />
Mollath, noch kein Jahr alt, wie er ernst<br />
und ein wenig staunend in die Welt blickt.<br />
„Ich hasse ihn ja nicht“, sagt sie.<br />
Schrecklich müsse das sein, habe sie sich<br />
oft gedacht. So lange eingesperrt. Schließlich<br />
habe er sie ja nicht aus bösem Willen<br />
misshandelt: „Das war ja seine Krankheit,<br />
die ihn dazu gebracht hat.“<br />
Noch ein dicker Umschlag, Petra M.<br />
breitet seinen Inhalt aus: ein Führerschein<br />
aus dem Jahr 1972, da trägt Mollath das<br />
Haar noch verwegen, nicht so sorgfältig<br />
gescheitelt wie h<strong>eu</strong>te. Und einen Schnauzer<br />
wie Charles Bronson. „Der Führerschein<br />
ist ja h<strong>eu</strong>te noch gültig“, sagt Petra<br />
M. „Da braucht er sich gar keinen n<strong>eu</strong>en<br />
zu besorgen.“ Und die Reisepässe! Petra<br />
M. schaut in den letzten: abgelaufen im<br />
Jahr 2009.<br />
Nachdem Mollath in der Presse einmal<br />
mehr den Verlust seiner persönlichen<br />
Sachen beklagt hat, erzählt Petra M.<br />
einem Reporter vom „Nordbayerischen<br />
Kurier“, dass sie etliches davon für ihn<br />
aufbewahrt habe. Viele Wochen ist das<br />
nun her. „Ich dachte, wenn das in der<br />
Zeitung steht, klingelt hier sofort das<br />
Telefon“, sagt sie. „Aber komisch, keiner<br />
von all denen, die dem Mollath jetzt an-
geblich helfen wollen, hat sich daraufhin<br />
gemeldet.“<br />
Laut Gerichtsurteilen schuldet er ihr<br />
zum Zeitpunkt der Trennung mehr als<br />
210000 Euro plus Zins und Zinseszins,<br />
dazu kamen Schulden bei der Bank. Sie<br />
habe ihn in der Psychiatrie angerufen und<br />
ihm vorgeschlagen, das Haus auf dem freien<br />
Markt zu verkaufen, um einen besseren<br />
Preis zu erzielen als über die Zwangsversteigerung.<br />
Was nach Abzug seiner Schulden<br />
bei ihr übrig geblieben wäre, hätte ja<br />
ihm gehört. Aber der Mollath habe nicht<br />
gewollt. „Mit ihm war ja nicht zu reden.“<br />
Am Ende ordnet ein Gericht die<br />
Zwangsversteigerung an. Petra M. sagt,<br />
sie habe mitgeboten, um den Preis in die<br />
Höhe zu treiben. Ungewollt bekommt<br />
sie den Zuschlag, zahlt 226000 Euro. Die<br />
verteilt das Gericht an die Gläubiger, damit<br />
ist der größte Teil seiner Schulden<br />
bei ihr getilgt. Sie verkauft das Haus für<br />
264 000 Euro weiter.<br />
„Es wurde ihm nichts genommen“, sagt<br />
Petra M. „Er selbst hat alles verloren.<br />
Aber das will ja niemand hören“, eine andere<br />
Wahrheit, ihre Hälfte der Geschichte.<br />
Es wird jetzt einiges auf Petra M. zukommen,<br />
ein n<strong>eu</strong>es Gerichtsverfahren<br />
vor allem, schon jetzt war in der „Nürnberger<br />
Zeitung“ zu lesen, der größte Saal<br />
im Regensburger Gericht werde nicht reichen<br />
für die vielen Zuschauer. Und die<br />
Motorrad-Freak Mollath in den Achtzigern<br />
Zweitbester seines Jahrgangs<br />
meisten von ihnen, das lässt sich wohl<br />
h<strong>eu</strong>te schon sagen, werden kaum ein anderes<br />
Urteil akzeptieren als einen Freispruch<br />
für Gustl Mollath ohne Wenn und<br />
Aber. Petra M. sagt: „Ich staune nur. Für<br />
die L<strong>eu</strong>te ist er der Held, und ich bin die<br />
Böse.“<br />
Warum, so fragt sie, hat er nicht ein<br />
einziges Mal vor Gericht konkret bestritten,<br />
dass er sie geschlagen, gebissen, gewürgt<br />
hat?<br />
Das Attest, in dem sie sich ihre Verletzungen<br />
drei Tage nach dem Vorfall beim<br />
Arzt hatte dokumentieren lassen, brachte<br />
nun das Urteil zu Fall: Ausgestellt war es<br />
auf dem Briefpapier einer Ärztin, doch<br />
erstellt hatte es stellvertretend deren<br />
Sohn, ebenfalls Arzt, der Petra M. untersucht<br />
hatte. Das war für das Gericht nicht<br />
zu erkennen gewesen.<br />
Das Nürnberger Oberlandesgericht<br />
wollte nun nicht ausschließen, dass das<br />
Verfahren einen anderen Ausgang genommen<br />
hätte, wenn das Gericht davon<br />
gewusst hätte. Den Inhalt des Attests<br />
hatte das Gericht allerdings nicht angezweifelt.<br />
Irgendwas, so sieht Petra M. es, ist hier<br />
gewaltig schiefgelaufen, es sei eine verkehrte<br />
Welt: „Der Täter wird zum Opfer<br />
gemacht, das Opfer zum Täter“, sagt sie.<br />
„Er ist aber kein Opfer“, sagt sie. „Er hat<br />
sich das ja alles selbst zuzuschreiben.<br />
Aber die L<strong>eu</strong>te wollen sich das Bild von<br />
der bösen Frau einfach nicht mehr kaputtmachen<br />
lassen.“<br />
Und dann noch ein Griff in die Kiste:<br />
„Ach“, ruft Petra M., „da ist es ja!“<br />
Ein Abzug in Farbe, 9×13, das Bild der<br />
Mutter.<br />
BEATE LAKOTTA
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
AFFÄREN<br />
Männerfr<strong>eu</strong>nde<br />
Olaf Glaeseker weist<br />
Korruptionsvorwürfe zurück –<br />
und widerspricht<br />
der Darstellung seines ehemaligen<br />
Chefs Christian Wulff.<br />
Weggefährten Wulff, Glaeseker 2010: „Null Kontakt“<br />
46<br />
Was ist von einer Ferienwohnung<br />
zu halten, die nahezu ausschließlich<br />
mit Ikea-Möbeln bestückt<br />
ist? Was bed<strong>eu</strong>tet es für den Wert<br />
eines Urlaubsdomizils, wenn ein Gast auf<br />
lackierten Euro-Paletten nächtigt, auf einer<br />
gewöhnlichen Matratze, ohne Bettgestell,<br />
ohne Lattenrost?<br />
Das sind merkwürdige Fragen, auch<br />
lästige, wenn man Staatsanwalt oder<br />
Strafverteidiger ist und kein Reiseveranstalter.<br />
Doch mit genau solchen Fragen<br />
haben sich in den letzten Monaten beide<br />
Seiten beschäftigt: die Ermittler der Zentralstelle<br />
für Korruptionsstrafsachen in<br />
Hannover und, im Auftrag seines Mandanten<br />
Olaf Glaeseker, dessen Verteidiger<br />
Guido Frings.<br />
Mit einer 69-seitigen Stellungnahme an<br />
das Landgericht Hannover ist das Verfahren<br />
gegen Glaeseker, den langjährigen<br />
Sprecher und Berater von Christian<br />
Wulff, vorige Woche in die nächste Runde<br />
gegangen. Frings weist darin den Vorwurf<br />
der Anklage zurück, sein Mandant habe<br />
sich von dem Party-Manager Manfred<br />
Schmidt bestechen lassen, mit kostenlosen<br />
Urlauben, Flügen und Unterkünften.<br />
Die Art, wie Glaesekers Anwalt argumentiert,<br />
streift des Öfteren den Tatbestand<br />
der Haarspalterei. Aber Frings<br />
wählt diesen Weg, um seinen Mandanten<br />
als engagiertes, tr<strong>eu</strong>es Arbeitstier darzustellen,<br />
als jemanden, der alles möglich<br />
macht – ob fürs Land Niedersachsen, für<br />
seinen Boss Wulff, den damaligen niedersächsischen<br />
Ministerpräsidenten, oder<br />
eben für Schmidt, seinen engen Buddy.<br />
Die Fr<strong>eu</strong>ndschaft zu dem Event-Veranstalter,<br />
so heißt es in der Stellungnahme,<br />
zeichne sich „durch eine Qualität aus, die<br />
nur wenigen zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
vergönnt ist“.<br />
Als Beleg der „tiefen persönlichen Zuneigung“<br />
führt der Verteidiger an,<br />
Schmidt habe seinen Arzt<br />
von der Schweigepflicht gegenüber<br />
Glaeseker entbunden.<br />
Auch dass der weltgewandte,<br />
vielreisende Party-<br />
Macher das Ehepaar Glaeseker<br />
in dessen Eigenheim<br />
in der „knapp 5000 Einwohner<br />
zählenden Gemeinde<br />
Steinhude“ nicht nur mehrfach<br />
besucht, sondern dort<br />
auch übernachtet habe, sei<br />
„als besonderer Ausdruck<br />
eines von Vertrauen und<br />
tiefer Verbundenheit geprägten<br />
Fr<strong>eu</strong>ndschaftsverhältnisses“<br />
zu werten.<br />
Sogar die frühere ARD-<br />
Moderatorin Sabine Christiansen<br />
wird in die Argumentationskette<br />
eingefädelt.<br />
Auch sie eine Fr<strong>eu</strong>ndin<br />
von Schmidt, hatte den<br />
Ermittlern gegenüber ausgesagt:<br />
„Wenn er bei uns<br />
eingeladen war, hat er diese<br />
privaten Termine mit beruflichen<br />
Terminen kombiniert.<br />
Er war also mehrere<br />
Tage in Berlin und hat dann<br />
lieber im Hotel übernachtet.“<br />
Glaesekers Anwalt<br />
schließt daraus in seiner<br />
Stellungnahme: „Diese Bekundung<br />
verd<strong>eu</strong>tlicht in<br />
nicht zu überbietender Weise<br />
den besonderen Wert<br />
der (Gegen-)besuche Manfred<br />
Schmidts bei unserem<br />
Mandanten.“<br />
DANIEL PILAR / LAIF<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Warum die Männerfr<strong>eu</strong>ndschaft so vorgeführt<br />
werden muss, ist simpel. Für den<br />
von Schmidt erfundenen und von 2007<br />
bis 2009 dreimal veranstalteten „Nord-<br />
Süd-Dialog“, dem Niedersachsens Mi -<br />
nisterpräsident als Schirmherr diente,<br />
sammelte Olaf Glaeseker fleißig Sponsorengelder,<br />
und zwar von seinem Mail-<br />
Account in der Regierungszentrale aus –<br />
weshalb die Staatsanwaltschaft Glaeseker<br />
wegen Bestechlichkeit im Amt angeklagt<br />
hat. Den geldwerten Vorteil, den Wulffs<br />
Sprecher in den Jahren des Nord-Süd-<br />
Dialogs durch Flüge und Logis auf<br />
Schmidts Kosten erhielt, beziffern die<br />
Strafverfolger auf rund 12000 Euro.<br />
Um den Vorwurf zu entkräften, will<br />
Glaeseker drei Umstände belegen: Erstens,<br />
dass er die Sponsorenakquise nicht<br />
als „Diensthandlung“ vorgenommen<br />
habe, sondern rein privat. Zweitens, dass<br />
ihn mit Schmidt eine „enge Fr<strong>eu</strong>ndschaft<br />
seit den 1990er Jahren“ verbinde; somit<br />
könne die private Einladung eines guten<br />
Fr<strong>eu</strong>ndes keine Bestechung sein. Und drittens,<br />
dass die geldwerten Vorteile nicht<br />
so hoch gewesen seien wie von der Anklage<br />
kalkuliert. Frings rechnet die Ausstattung<br />
und Größe der Ferienunterkünfte,<br />
die Kosten für die Flugtickets oder andere<br />
Annehmlichkeiten herunter – so<br />
dass subjektiv gar keine „Verpflichtung<br />
zur Dankbarkeit“ mehr erz<strong>eu</strong>gt werde.<br />
In solchen Zeilen wird d<strong>eu</strong>tlich, dass<br />
beide Seiten ihre Schriftsätze in erheb -<br />
licher Not verfasst haben: eine Staatsanwaltschaft,<br />
die sich müht, Glaeseker als<br />
behördenintern zuständigen Geldeintreiber<br />
für den Nord-Süd-Dialog zu präsentieren,<br />
der sich vom Event-Unternehmer<br />
schmieren ließ. Die Verteidigung, die es<br />
mit einem Hansdampf zu tun hat, dem<br />
augenscheinlich jedes Sensorium dafür<br />
fehlt, wie weit Fr<strong>eu</strong>ndschaft mit einem<br />
Geschäftspartner gehen sollte.<br />
Als Indiz für Glaesekers Bestechlichkeit<br />
sieht die Anklage, dass er in der<br />
Staatskanzlei die Ferienreisen zu Schmidt<br />
verheimlicht habe. Das sei aber nicht<br />
wahr, entgegnet Anwalt Frings. Vielmehr<br />
habe es die Staatsanwaltschaft versäumt,<br />
Glaesekers ehemaligen Stellvertreter zu<br />
befragen: Roman Haase könne bez<strong>eu</strong>gen,<br />
dass sich Wulff nach einem Urlaubsaufenthalt<br />
erkundigt habe, „wie es bei Manfred<br />
gewesen sei“.<br />
Wulff hatte bei seiner Befragung behauptet,<br />
zu Glaeseker in dessen Urlaubsabwesenheit<br />
„null Kontakt“ gehabt und<br />
von den Trips in Schmidts Feriendomizile<br />
nichts gewusst zu haben. Die Verteidigung<br />
beantragt deshalb die Vernehmung<br />
des Z<strong>eu</strong>gen Haase.<br />
Bestätigt dieser Glaesekers Version, so<br />
passiert womöglich, was Wulff immer zu<br />
verhindern suchte: Der Fall Glaese -<br />
ker/Schmidt wird auch für Wulff Konsequenzen<br />
haben – wegen einer falschen<br />
Aussage. HUBERT GUDE, ALFRED WEINZIERL
Entführer Degowski, Rösner 1988*, Haftanstalt Werl: Immer in Fesseln<br />
VERBRECHEN<br />
Schreckweite<br />
Augen<br />
25 Jahre nach dem Gladbecker<br />
Geiseldrama hofft der<br />
Mörder Dieter Degowski auf seine<br />
Freilassung. Ein Gutachter<br />
plädiert für Haftlockerungen.<br />
Im Juni 2008, knapp 20 Jahre nach dem<br />
Geiseldrama von Gladbeck, schreibt<br />
Dieter Degowski in der Haftanstalt<br />
Werl einen Brief. Er tippt zweieinhalb<br />
Seiten in die Maschine, und dafür, dass<br />
er einen Intelligenzquotienten von 79 hat,<br />
den Satzbau eines Sechsjährigen, die<br />
Rechtschreibung eines Legasthenikers,<br />
schätzt er seine Lage ziemlich gut ein.<br />
„Mein bestreben ist, ein Leben in die<br />
Gesellschaft in sozialer Verantwortung<br />
aufrichtig zu führen“, verspricht er. Aber:<br />
„Ich als LLer (Abkürzung für „Lebens-<br />
* Mit Silke Bischoff (r.) und weiteren Geiseln.<br />
länglicher“ –Red.) dem anderen LLer<br />
gegenüber im Nachteil stehe in Bezug,<br />
eines der spektakulärsten Verbrechen der<br />
Nachkriegsgeschichte zu gelten.“ Und<br />
deshalb ahnte er schon damals: „Das Ziel<br />
bei der mindes Strafverbüssungsdauer<br />
von 24 Jahren bedingt Entlassen zu werden,<br />
erreiche ich nicht.“<br />
Degowski, 57, sollte recht behalten.<br />
Auch fünf Jahre später sitzt er im Gefängnis.<br />
An diesem Mittwoch aber stellt sich<br />
bei einem Anhörungstermin des Land -<br />
gerichts Arnsberg in der Haftanstalt Werl<br />
die Frage, ob er entlassen werden kann.<br />
Es ist ausgerechnet die Woche, in der<br />
sich die Tat zum 25. Mal jährt und all die<br />
verstörenden Bilder wieder hochkommen:<br />
die Geiselnehmer Degowski und<br />
Hans-Jürgen Rösner, die eine Crime-<br />
Show in den Innenstädten von Bremen<br />
und Köln inszenieren; Journalisten in<br />
ihrem Schlepptau, die nach Bildern und<br />
Interviews gieren; die schreckweiten<br />
Augen der Geisel Silke Bischoff, 18, die<br />
den Gangstertrip durch die halbe Re -<br />
publik nicht überlebt. So wie der Italie -<br />
ner Emanuele de Giorgi, 15, den Degowski<br />
erschießt; der Junge hatte in einem<br />
Bus, den die Täter gekapert hatten,<br />
seine kleine Schwester Tatiana beschützen<br />
wollen.<br />
KEYSTONE / AP (O.); ROLAND GEISHEIMER / ATTENZIONE (U.)<br />
Degowski kann keinesfalls damit rechnen,<br />
in Kürze aus dem Knast zu kommen.<br />
Der Essener Psychiater Norbert Leygraf,<br />
der ihn begutachtet hat, lehnt eine baldige<br />
Entlassung ab. Immerhin hat die Arnsberger<br />
Kammer dieses Gutachten aber<br />
überhaupt in Auftrag gegeben. Das gilt<br />
unter Juristen als Indiz dafür, dass ein<br />
Gericht die Entlassung ins Auge fasst und<br />
ein Prozess in Gang kommen soll, der in<br />
die Freiheit führt. Nach einer längeren<br />
Phase mit Haftlockerungen könnte Degowski<br />
das Gefängnis verlassen.<br />
Diese Perspektive zeigt auch das Leygraf-Gutachten<br />
auf. Noch drei Jahre,<br />
heißt es darin, dann sollte Degowski reif<br />
für die Entlassung sein. Vorausgesetzt,<br />
dass Degowski sich bis dahin bei jeder<br />
n<strong>eu</strong>en Lockerung bewährt. Er käme damit<br />
seinem Komplizen d<strong>eu</strong>tlich zuvor;<br />
wie es für Rösner weitergeht, wird frühestens<br />
2016 geprüft.<br />
Degowski sitzt in Werl hinter acht Meter<br />
hohen Mauern im Hafthaus 1. Jeden<br />
Morgen um 6.15 Uhr Wecken und „Vitalkontrolle“,<br />
ein Beamter schaut nach, ob<br />
er noch lebt. Dann Frühstück in der Zelle,<br />
um 6.45 Uhr Ausrücken zur Arbeit, um<br />
11.40 Uhr Einrücken in die Zelle, Mittagessen,<br />
noch mal Arbeiten bis 15.30 Uhr.<br />
Degowski kehrt den Gefängnishof. Später<br />
darf er am Hofgang teilnehmen, um 21<br />
Uhr wird er eingeschlossen. Immer das<br />
Gleiche. Seine Schwester Annemarie hat<br />
noch Kontakt zu ihm. Er sei gesund, guter<br />
Dinge, nicht depressiv, wie er vor Jahren<br />
selbst mal geklagt hat. Und er wolle endlich<br />
entlassen werden.<br />
Schon vor fünf Jahren hatte ihm ein<br />
Therapiebericht Hoffnung gemacht. Dar -<br />
in bescheinigte der behandelnde Psychologe<br />
Werner Rebber, dass Degowski eine<br />
Therapie „mit zufriedenstellendem Ergebnis<br />
abgeschlossen“ habe. Aus Rebbers<br />
Sicht bestanden „keine Einwände dagegen,<br />
Herrn Degowski nach weiterer Gruppentherapie<br />
mittelfristig die Behandlung<br />
in einer sozialtherap<strong>eu</strong>tischen Einrichtung<br />
zu ermöglichen, um damit eine Haftentlassung<br />
vorzubereiten“.<br />
Degowski sei in Gesprächen durchaus<br />
in der Lage gewesen, „glaubwürdig Opferempathie<br />
zu äußern“, urteilte Rebber.<br />
Auch in seinem Brief 2008 hatte Degowski<br />
Worte des Mitleids für die Hinterbliebenen<br />
gefunden: „Ich ber<strong>eu</strong>e, was<br />
ich getan habe, was ich angerichtet habe<br />
aufrichtig.“ Und: „Ich empfinde es so,<br />
dass ich die Angehörigen in ihren Familien<br />
unsagbares Leid und Schmerzen im<br />
ihren Seelenheil zu gefügt habe.“ Doch<br />
sein Antrag, in die Sozialtherap<strong>eu</strong>tische<br />
Anstalt Gelsenkirchen verlegt zu werden,<br />
wurde abgelehnt, und auch mit den Lockerungen<br />
ging es nicht recht voran.<br />
In 25 Jahren hat Degowski nur viermal<br />
begleiteten Ausgang bekommen: dreimal<br />
zwischen 2002 und 2004 und zuletzt 2012,<br />
immer in Hand- und Fußfesseln, bewacht<br />
DER SPIEGEL 33/2013 47
von zwei bewaffneten Beamten. Besucht<br />
hat er den einzigen Menschen, zu dem er<br />
neben seiner Schwester noch Kontakt hat,<br />
einen pensionierten Gefängnispfarrer.<br />
Zwar machte Degowski dabei nie Ärger,<br />
ebenso wenig in der Anstalt. Keine Schlägereien,<br />
keine Drogen. Doch bei einer seiner<br />
ersten Ausführungen hatte es einen Medienauflauf<br />
gegeben. Seitdem wurden immer<br />
wieder Ausgänge abgelehnt, etwa mit<br />
der Begründung, selbst in Fesseln könnte<br />
Degowski seine Begleiter noch entwaffnen.<br />
Das scheint weit hergeholt, auch das<br />
Leygraf-Gutachten kommt zu dem<br />
Schluss, dass Degowski h<strong>eu</strong>te nicht mehr<br />
gefährlich sei. Tatsächlich sprach gegen<br />
Degowski aber zumindest die Einschätzung,<br />
die auch im Gutachten stehen soll:<br />
dass Therapien nicht mehr viel bringen.<br />
„Menschlich eine Null“, „dissozial“, „hat<br />
die Therapien nur angekratzt“, so beschrieb<br />
Anstaltsleiter Michael Skirl vergangenes<br />
Jahr im „Focus“ seinen Eindruck<br />
von Degowski. Aus Düsseldorfer<br />
Justizkreisen heißt es, Degowski empfinde<br />
unverändert kein echtes Mitgefühl mit<br />
den Hinterbliebenen. Er könne daherplappern,<br />
dass ihm das alles leidtue, aber<br />
ohne das verinnerlicht und reflektiert zu<br />
haben. Für ernsthafte Therapieerfolge<br />
fehle ihm schon der Intellekt.<br />
Das alles kann aber kein Grund sein,<br />
ihn noch auf unabsehbare Zeit wegzusperren.<br />
Nach der Rechtsprechung des<br />
Bundesverfassungsgerichts muss jeder<br />
Häftling eine Perspektive auf ein Leben<br />
in Freiheit haben. Auch wenn Therapien<br />
bei Degowski kaum noch etwas ändern,<br />
soll er laut Leygraf-Gutachten zumindest<br />
dafür trainiert werden, mit dem Alltag<br />
draußen klarzukommen.<br />
Hinzu könnten nach und nach Haft -<br />
lockerungen kommen: Ausgang ohne<br />
Fesseln, Ausgang ohne Begleiter, längerer<br />
Hafturlaub, Übergang in eine sozial -<br />
therap<strong>eu</strong>tische Anstalt und am Ende, was<br />
Experten die Entlassung in einen „so-<br />
zialen Empfangsraum“ nennen. Seine<br />
Schwester wird ihm so etwas nicht bieten<br />
können: „Zu mir kann er nicht“, sagt sie.<br />
In Frage käme aber ohnehin nur eine<br />
betr<strong>eu</strong>te Wohngruppe. Denn ohne enge<br />
Führung, so die Befürchtung, könnte Degowski<br />
wieder trinken – wie vor der Tat<br />
und mit unabsehbaren Risiken.<br />
Für einen Menschen wäre ein Degowski<br />
in Freiheit auf jeden Fall unerträglich, egal<br />
wie er sich führen würde: für Tatiana de<br />
Giorgi, die als Kind ihren Bruder sterben<br />
sah. Am Telefon in Italien sagt sie: „Ich<br />
bin mit einer Entlassung von Degowski<br />
auf keinen Fall einverstanden. Er hat meinen<br />
Bruder vor meinen Augen umgebracht,<br />
das ist doch wohl keine Kleinigkeit.“<br />
Aus dem Hintergrund ruft ihr Ehemann,<br />
das alles belaste seine Frau noch<br />
viel zu sehr. Dann ist das Gespräch zu<br />
Ende.<br />
48<br />
FELIX BOHR, JÜRGEN DAHLKAMP,<br />
BEATE LAKOTTA, BARBARA SCHMID<br />
Betroffene Müller, Jelitte, Haupt: Mit dem Fernglas beobachtete er sein abgesoffenes Zuhause,<br />
Es war dieses hässliche Geräusch, das<br />
Christa Jelitte zu gut kannte. Ein<br />
Sprudeln, von drüben am Supermarkt.<br />
Die Uhr zeigte 13.30 Uhr, es war<br />
der 5. Juni 2013. Wasser schoss aus den<br />
Gullys. „Es hat gerauscht wie ein Gebirgsbach“,<br />
erinnert sich Jelitte.<br />
Alle in Nünchritz nahe Riesa hatten<br />
das schon einmal erlebt, im August 2002,<br />
als in Sachsen und anderswo das Land<br />
großflächig überschwemmt wurde. Jeder<br />
hier wusste, was nun kommen würde.<br />
Das Wasser würde unaufhaltsam über die<br />
Straße kriechen, die Elbgasse fluten und<br />
dann die N<strong>eu</strong>bausiedlung. Die stinkende<br />
Brühe würde tagelang in Jelittes Wohnzimmer<br />
stehen, noch einmal, wie ein Alptraum,<br />
der immer wiederkehrt.<br />
Christa Jelitte ist 74 Jahre alt, ihr Mann<br />
Thomas 82. Von ihrem kleinen Traumhaus<br />
im Grünen ist nicht viel geblieben.<br />
Jelitte steht auf einer Bodenplatte aus<br />
Beton, Heizungsrohre laufen darüber, die<br />
Innenwände aus Gipskarton sind herausgerissen.<br />
Die Reste ihres Hauses sehen<br />
aus wie ein Großraumbüro im Rohbau.<br />
Kein Schlafzimmer mehr, keine Küche,<br />
kein Bad. Entf<strong>eu</strong>chter vom Roten Kr<strong>eu</strong>z<br />
dröhnen. Und über allem liegt der penetrante<br />
Gestank nach abgestandenem Elbwasser.<br />
NATURKATASTROPHEN<br />
Nur noch weg<br />
Nach der zweiten großen Flut innerhalb von elf Jahren<br />
haben zahlreiche Opfer an der Elbe die<br />
Geduld verloren: Sie wollen umgesiedelt werden.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
„Wir haben uns wohl selbst belogen“,<br />
sagt die Rentnerin leise. Die Jelittes hatten<br />
geglaubt, 2002 ein Jahrhunderthochwasser<br />
überstanden zu haben, eines, wie<br />
es die nächsten hundert Jahre nicht wieder<br />
kommen würde.<br />
2001 hatten sie in Nünchritz gut 300 Meter<br />
neben der Elbe ihren Altersruhesitz<br />
gebaut. Als 2002 alles fertig war, kam die<br />
erste Flut. Christa Jelitte und ihr Mann<br />
fuhren nicht mehr in Urlaub, rackerten<br />
sich ab, sanierten das Haus. Nun sind sie<br />
elf Jahre älter, können nicht mehr selbst<br />
sanieren und wollen nur noch weg. Weg<br />
vom Fluss, damit nicht mehr jeder ausgiebige<br />
Regen sie in Panik versetzt.<br />
Nach der zweiten gewaltigen Flut innerhalb<br />
von elf Jahren hat unter Anwohnern<br />
der Elbe und vieler kleiner Flüsse<br />
ein Umdenken eingesetzt. 2002 wollten<br />
fast alle Hochwasseropfer – auch dank<br />
großzügiger Hilfen – ihre Häuser sanieren.<br />
Nun fordern zahlreiche Menschen ihre<br />
Umsiedlung in sichere Gebiete. Sie wollen,<br />
dass ganze Ortsteile geordnet abgerissen<br />
werden. Und sie wollen eine hundertprozentige<br />
Entschädigung, wie sie 2002 durch<br />
Spenden und staatliche Aufbauhilfen für<br />
den Wiederaufbau gewährt wurde.<br />
Nach der jüngsten Flut sollen 80 Prozent<br />
des Schadens vom Acht-Milliarden-
erst nach vier Tagen ging das Wasser zurück<br />
Fonds zur Aufbauhilfe erstattet werden,<br />
so sehen es die Pläne von Bund und<br />
Ländern vor. Doch Entschädigungen für<br />
h<strong>eu</strong>te unverkäufliche Grundstücke und<br />
Gebäude sind nicht vorgesehen. So fehlt<br />
den Betroffenen das Geld, an sicherer<br />
Stelle n<strong>eu</strong> anzufangen. Der Staat müsste<br />
ihnen die Flutgrundstücke und -häuser<br />
abkaufen, um ihre Umsiedlung zu ermög -<br />
lichen; die Gemeinden könnten den Flutopfern<br />
Ersatzflächen anbieten.<br />
In der Siedlung von Christa Jelitte stehen<br />
41 Häuser. 38 Besitzer wollen umziehen,<br />
manche sind schon dreimal abgesoffen.<br />
Im Ort hängen mit Parolen besprühte<br />
Bettlaken: „Wir wollen ein Leben ohne<br />
Angst“, „Absiedlung = Hochwasserschutz“,<br />
„Glaubt nicht, wir warten aufs<br />
nächste“. Ein Spaßvogel hat geschrieben:<br />
„Haus zu verkaufen“. Hier wird wohl lange<br />
kein Grundstück mehr verkauft.<br />
Die Nünchritzer geben der Kommune<br />
eine Mitschuld. Der Kreistag hatte 1977<br />
das Gelände ihrer Siedlung als „Überschwemmungsgebiet“<br />
ausgewiesen. Bebaut<br />
werden dürfe es nur, wenn „eine Gefährdung<br />
von Leben und Gesundheit der<br />
Bewohner und Sachwerte durch geeignete<br />
Maßnahmen ausgeschlossen“ werde.<br />
Zwar ließ die Gemeinde das Baugebiet<br />
aufschütten und damit höherlegen, doch<br />
offensichtlich nicht hoch genug.<br />
Ein paar Dörfer weiter, gut zehn Kilometer<br />
flussabwärts, will sich Mario Müller<br />
nicht mehr mit dem Blick zurück aufhalten.<br />
Der Angestellte einer Mülldeponie<br />
wird sein Haus in Altoppitzsch verlassen.<br />
Um jeden Preis. „Soll ich auf die nächste<br />
Schneeschmelze warten oder auf ein heftiges<br />
Sommergewitter?“<br />
Die Müllers haben einen Umsiedlungsantrag<br />
gestellt; zur Sicherheit haben sie<br />
sich ein n<strong>eu</strong>es Grundstück in sicherer Ent-<br />
fernung zum Kauf für den Fall vormerken<br />
lassen, dass die Gemeinde nichts tun sollte.<br />
1999 kamen sie in den Ort und bauten<br />
ein altes LPG-Gebäude aus. Es ging drei<br />
Jahre lang gut, dann stand das Wasser im<br />
Wohnzimmer zwei Meter hoch. Die Müllers<br />
waren nicht versichert. Sie bauten<br />
mit Spendengeldern alles n<strong>eu</strong> auf. Müllers<br />
Frau Birgit erlitt in dem Stress eine<br />
Totgeburt.<br />
Der 52-Jährige campiert im Wohn -<br />
wagen auf seinem Hof. Nur noch 40 Quadratmeter<br />
unter dem Dach sind im Haus<br />
bewohnbar. In der ehemaligen Küche<br />
sind beide Hochwassermarken zu erkennen:<br />
2002 waren es 2,02 Meter, dieses Mal<br />
1,81 Meter. Im verschlammten Swimmingpool<br />
tummeln sich kleine Elbfische.<br />
Am 5. Juni hat Müller bis kurz vor elf<br />
Uhr abends die wichtigsten Sachen zu<br />
Fr<strong>eu</strong>nden gefahren. Dann sah er die braune<br />
Welle auf sein Haus zurollen. 600 Meter<br />
ist die Elbe von seinem Grundstück entfernt,<br />
im Normalfall von einem Deich im<br />
Zaum gehalten. Nun sei das Wasser noch<br />
ein Meter höher gewesen als der Raps auf<br />
dem Feld. Mit dem Fernglas beobachtete<br />
2 km<br />
Strehla<br />
Elbe<br />
Ortsteil Altoppitzsch<br />
Wohnort von<br />
Mario Müller<br />
Riesa<br />
Zeithain<br />
Ortsteil Moritz<br />
Wohnort von Ines<br />
und Udo Haupt<br />
FOTOS: JOERG BRUEGGEMANN / OSTKREUZ / DER SPIEGEL<br />
Müller sein abgesoffenes Zuhause. Erst<br />
nach vier Tagen ging das Wasser zurück.<br />
Der Gutachter der Versicherung schätzte<br />
den Schaden auf 128000 Euro. Wenn Müller<br />
nicht wieder aufbaut, bekäme er wohl<br />
nur zwei Drittel davon. Das Grundstück<br />
wird kaum zu verkaufen sein.<br />
Die SPD in Sachsen will die Umsiedlungswilligen<br />
unterstützen und fordert<br />
einen Fonds. Der Dresdner Fraktionschef<br />
Martin Dulig bezeichnet es als „fatal“,<br />
die Menschen mit Ankündigungen n<strong>eu</strong>er<br />
Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu<br />
beruhigen. Niemand könne garantieren,<br />
dass die Deiche künftig halten. Zudem<br />
verlagern immer höhere Deiche das Problem<br />
flussabwärts, was ein Grund dafür<br />
ist, dass Sachsen-Anhalt in diesem Jahr<br />
so stark unter dem Hochwasser gelitten<br />
hat. Dulig hofft, dass Versicherungen,<br />
Freistaat und Kommunen die Umsiedler<br />
gemeinsam unterstützen. Doch die sächsische<br />
Regierung brachte bislang nur die<br />
Möglichkeit zinsloser Kredite ins Spiel.<br />
Um den Politikern der Landesregierung<br />
seine Not begreiflich zu machen,<br />
will Udo Haupt endlich mal einen auf seinem<br />
Hof sehen. Sein Zuhause liegt im<br />
Ortsteil Moritz in Zeithain, nicht weit von<br />
den Häusern von Christa Jelitte und Mario<br />
Müller. Hier hatte Haupt, Anlagenfahrer<br />
in einer Chemiefabrik, 1995 sein Haus<br />
gebaut, 150 Meter von der Elbe entfernt.<br />
Das Hochwasser ruinierte ihm jetzt die<br />
dritte Fußbodenheizung. Eine vierte will<br />
er nicht einbauen.<br />
Beim Hochwasser 2002 war Haupts Öltank<br />
aufgetrieben und geplatzt, der Gutachter<br />
hielt die übelriechende Ruine trotzdem<br />
für reparabel. Udo und Ines Haupt<br />
gingen ans Werk. 2006 stellte sich heraus,<br />
dass die Mühe vergebens war, das Heizöl<br />
im Mauerwerk stank noch immer erbärmlich.<br />
Die nächste Sanierung zahlte die<br />
Diakonie, aus Spendengeldern.<br />
Im Juni saß Udo Haupt dann trotz<br />
Evakuierungsanweisung mit seiner Katze<br />
im Haus und tat, was noch getan werden<br />
konnte. Sandsäcke stapeln, Möbel nach<br />
oben tragen, Steckdosen entfernen. Dann<br />
saß er oben auf der Treppe und sah zu,<br />
wie sein Haus volllief. Die Elbe stand<br />
43 Zentimeter hoch in seinem<br />
Wohnzimmer.<br />
Haupt sagt, er erwarte von<br />
den Politikern ein faires Angebot.<br />
Die Häuser sollten geschätzt,<br />
das private Vermögen<br />
solle offengelegt werden.<br />
Dann müsse von Fall zu Fall<br />
Wohnort von<br />
Christa Jelitte<br />
Nünchritz<br />
eine Lösung gefunden werden.<br />
Für zehn Millionen Euro sollen<br />
bei Moritz nun wohl die<br />
Deiche ern<strong>eu</strong>ert werden. „Da<br />
sollen sie den Menschen lieber<br />
fünf Millionen für die Um -<br />
siedlung geben“, sagt Udo<br />
Haupt, „und das Wasser laufen<br />
lassen.“ STEFFEN WINTER<br />
DER SPIEGEL 33/2013 49
Überläufer Carney (l.) mit Fr<strong>eu</strong>nden in Ost-Berlin 1988: Zur Belohnung blaue Dopingpillen<br />
ZEITGESCHICHTE<br />
Geheimnisse im Gummistiefel<br />
Ein amerikanischer Soldat, stationiert in Berlin, gehörte zu den<br />
Top-Agenten der Stasi. Jetzt hat er seine Memoiren geschrieben –<br />
argwöhnisch beobachtet von US-Militär und alten Genossen. Ex-Spion Carney 2011<br />
Berlin-Marienfelde im Herbst 1983:<br />
Der Tag, an dem Jeff Carney seinen<br />
Teil dazu beitrug, die Welt zu<br />
retten, war erst vier Stunden alt. Carney,<br />
20 Jahre alt, Abhörspezialist der US-Luftwaffe,<br />
saß vor seinen Geräten, die in den<br />
Osten lauschten. Nachtschicht, keine besonderen<br />
Vorkommnisse.<br />
Da erzählte ihm sein Vorgesetzter, dass<br />
es in wenigen Stunden eine Geheimoperation<br />
geben sollte. Eine Art Kriegsspiel:<br />
US-Kampfflugz<strong>eu</strong>ge, die sich bedrohlich<br />
dem sowjetischen Luftraum nähern würden;<br />
alarmierende Signale auf den Radarschirmen<br />
der Russen, Verwirrung. Diese<br />
Manöver, so das Kalkül, würden den Gegner<br />
so verunsichern, dass drüben die ganze<br />
Reaktionskette für den Ernstfall abliefe<br />
– und damit für die US-Aufklärung erkennbar<br />
wäre wie eine Lichterkette.<br />
Was aber, wenn die Russen dann tatsächlich<br />
an den Ernstfall glaubten und<br />
den Gegenschlag auslösten? Carney, der<br />
seit ein paar Monaten als Agent für die<br />
Stasi arbeitete, hatte nur noch Stunden.<br />
Er musste seine Schicht absitzen, dann<br />
hetzte er zu einem Kontaktmann der<br />
Stasi, einem Lehrer in West-Berlin. Und<br />
tatsächlich kam die Nachricht drüben<br />
50<br />
an: nur eine Finte, eine Falle, nicht der<br />
Ernstfall.<br />
Später, nach seiner Flucht in die DDR,<br />
bekam Carney von Stasi-Chef Erich Mielke<br />
die „Medaille der Waffenbrüderschaft“<br />
in Gold. Und noch später, nach dem Mauerfall,<br />
von einem US-Gericht eine Verurteilung<br />
zu letztlich 20 Jahren Haft in Fort<br />
Leavenworth, dem Militärgefängnis in<br />
Kansas. Denn Carney, Codename „Kid“,<br />
war einer von zwei Top-Agenten, mit denen<br />
die Stasi das US-Militär in West-Berlin<br />
unterwandert hatte. Den Schaden, den<br />
„Kid“ mit seinem Geheimnisverrat in gut<br />
zwei Jahren anrichtete, schätzten die<br />
Amerikaner auf 14,5 Milliarden Dollar<br />
(SPIEGEL 29/2003).<br />
Über das Leben auf beiden Seiten des<br />
Kalten Krieges hat Carney, der nach elf<br />
Jahren vorzeitig freikam, nun seine<br />
Memoiren geschrieben*. Auf knapp 700<br />
Seiten offenbart er Ansichten eines Ex-<br />
Spions und Einsichten in eine Welt, die<br />
seit einer Ewigkeit versunken scheint, obwohl<br />
sie vor noch nicht mal 25 Jahren<br />
untergegangen ist. Eine Welt von Lüge<br />
* Jeffrey M. Carney: „Against All Enemies“. Eigenverlag,<br />
bei Amazon; 700 Seiten; 20 Dollar.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
und Verrat, Tarnung, Täuschung, mit<br />
toten Briefkästen im Wald und jener<br />
Getränkedose, Lipton-Eistee, in deren<br />
Boden eine Minikamera verschraubt war.<br />
Damit fotografierte sich Carney für die<br />
Stasi reihenweise durch Aktenordner der<br />
US-Aufklärung.<br />
Dass das Buch selbst weitgehend frei<br />
von Lügen und Fälschungen sein dürfte,<br />
darauf d<strong>eu</strong>ten die zahlreichen Schwärzungen<br />
hin. Rund ein Jahr lang prüften<br />
Air Force und NSA das Werk, sie machten<br />
an zahlreichen Stellen unkenntlich,<br />
was aus ihrer Sicht bis h<strong>eu</strong>te geheim bleiben<br />
muss. Und doch: Was die Zensoren<br />
übrig ließen, erlaubt spannende Einblicke<br />
in den Alltag an der unsichtbaren Front<br />
der Ost-West-Spionage.<br />
Carney hatte im Sommer 1980 bei der<br />
Air Force angeh<strong>eu</strong>ert. Es war eine Flucht<br />
mit nur 17 Jahren aus einem zerrütteten<br />
Elternhaus, in dem es nicht mal jeden Tag<br />
genug zu essen gab. Drei Jahre D<strong>eu</strong>tsch<br />
in der Schule brachten ihm das Ticket zur<br />
6912th Electronic Security Group in Marienfelde,<br />
wo ihn aber Ärger mit Vorgesetzten,<br />
eine labile Psyche und Angst vor<br />
der Entdeckung seiner Homosexualität<br />
am 22. April 1983 überlaufen ließen. Und
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
das im wahrsten Sinne des Wortes: Er<br />
spazierte nach einem Kneipenbesuch<br />
über die Zonengrenze am Checkpoint<br />
Charlie und meldete sich bei den verdutzten<br />
Ost-Grenzern, ohne dass West-Geheimdienste<br />
davon etwas mitbekamen.<br />
Er wolle gern in der DDR leben, sagte er<br />
den sofort herbeigerufenen Stasi-L<strong>eu</strong>ten,<br />
doch die hatten eine bessere Verwendung:<br />
Sie schickten ihn zurück und platzierten<br />
ihn als Maulwurf in seiner Einheit.<br />
Ein Jahr später versetzte ihn die Air<br />
Force in die USA, beförderte ihn zum Ausbilder<br />
für Abhörspezialisten. In dieser<br />
Zeit spionierte er weiter, bis er die Nerven<br />
verlor und über die DDR-Botschaft in Mexiko<br />
nach Ost-Berlin flüchtete. Dort machte<br />
die Stasi aus Jeffrey Carney einen Jens<br />
Karney, Legende: Postangestellter. Und<br />
weil er nicht nur Englisch, sondern auch<br />
den Militärjargon der Amerikaner besser<br />
als jeder andere verstand, hörte er für die<br />
Stasi bis zum Mauerfall die US-Botschaft<br />
in Ost-Berlin und die US-Militärmission<br />
in Potsdam ab. Im April 1991 – Carney<br />
hielt sich inzwischen als U-Bahn-Fahrer<br />
der Berliner Verkehrsbetriebe über Wasser<br />
– entführte ihn ein Greiftrupp des US-<br />
Geheimdienstes OSI auf offener Straße<br />
und verschleppte ihn in die Staaten.<br />
Zu seinen frühen Lieferungen an die<br />
Stasi, damals noch in Berlin, hatten 1983<br />
dicke Ausbildungs- und Trainingshand -<br />
bücher für US-Abhörspezialisten gezählt.<br />
Carney hatte sie in die Gummistiefel seiner<br />
ABC-Ausrüstung gesteckt und aus<br />
dem amerikanischen Horchposten in Marienfelde<br />
geschmuggelt. Schon da hatte<br />
er die Erfahrung gemacht, dass beim US-<br />
Militär vertrauliche Papiere herumlagen<br />
und sich Geheimnisse gern mit der Ankündigung<br />
„Eigentlich darf ich es ja nicht<br />
sagen …“ in Geplapper verwandelten.<br />
Für eine Lieferung an die Stasi bekam<br />
er meistens nur 300 D-Mark. Das Geld<br />
sei ihm, wie er schreibt, auch<br />
nicht so wichtig gewesen, er<br />
habe vielmehr etwas gegen<br />
die aus seiner Sicht aggres -<br />
sive US-Politik tun wollen.<br />
Doch wie wichtig er für die<br />
DDR war, wurde ihm klar,<br />
als er seinem Führungsof -<br />
fizier sagte, er würde gern<br />
mal ein paar Muskelpräpa -<br />
rate ausprobieren, für sein<br />
Hobby – lange Fahrradtouren<br />
durch Berlin. Kurz danach<br />
versorgte ihn die Stasi<br />
mit dem Besten, was das<br />
DDR-Doping zu bieten hatte:<br />
Oral-Turinabol, jene blauen<br />
Pillen, mit denen die DDR<br />
ihre Schwimmer und Leichtathleten<br />
zu Olympiasiegern<br />
aufpumpte.<br />
Später in Texas fotografierte<br />
sich Carney in einer Air-<br />
Force-Bibliothek durch Meter<br />
von Aktenordnern mit Verschluss -<br />
sachen. Dabei will er unter anderem auf<br />
ein Papier gestoßen sein, das die Amerikaner<br />
als Trickser entlarvt habe, wenn<br />
sie die militärische Stärke von Ost und<br />
West verglichen. Um die Bedrohung aus<br />
dem Osten aufzubauschen, hätten sie auf<br />
der anderen Seite sogar die zahlreichen<br />
Panzerveteranen mitgerechnet, die nach<br />
dem Krieg in vielen Städten als Denkmal<br />
zum Ruhme der Roten Armee aufgebockt<br />
worden waren.<br />
Eine andere Liste, die er fand, habe<br />
sieben Namen enthalten, Mitglieder von<br />
Todesschwadronen, die in den USA für<br />
Mordaufträge in ihrer Heimat ausgebildet<br />
worden seien – weitere Details dazu hat<br />
die Air Force in Carneys Memoiren lieber<br />
geschwärzt.<br />
Nach seiner Flucht in die DDR merkte<br />
Carney schnell, dass er dort keine Fr<strong>eu</strong>nde<br />
hatte, nur Geheimdienstler, die ihn<br />
benutzen wollten. Oder auch nicht. Zunächst<br />
habe ihn die DDR nämlich loswerden<br />
wollen, nach Schweden; doch aus Sorge,<br />
er könne dort plaudern, habe ihn die<br />
Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) dann<br />
doch im eigenen Land untergebracht: bei<br />
den Funkaufklärern, die sich in die Kabel<br />
der US-Botschaft und der US-Militärmission<br />
in der DDR einklinkten.<br />
Die westd<strong>eu</strong>tschen Tonbandgeräte<br />
vom Typ Uher SG-561, die dabei zum<br />
Einsatz kamen, habe man sich erst leisten<br />
können, nachdem die DDR 1983 durch<br />
Vermittlung von Bayerns Ministerpräsident<br />
Franz Josef Strauß den lebensrettenden<br />
Milliardenkredit erhalten habe. Kassetten<br />
für andere Uher-Geräte stammten<br />
direkt von der Grenze, wo sie West -<br />
touristen abgenommen worden seien.<br />
In seinen Erinnerungen erzählt Carney,<br />
wie er in den mitgeschnittenen Gesprächen<br />
nach Vorlieben von Sekretärinnen<br />
der US-Botschaft suchte, damit Romeo-<br />
US-Horchposten in Berlin-Marienfelde 1986: Minikamera in der Dose<br />
Agenten der Stasi mit einem genauen<br />
Profil auf Damenjagd gehen konnten.<br />
Oder wie er mal beim Abhören mitbekam,<br />
dass eine Botschaftsmitarbeiterin<br />
eine Putzfrau suchte. Kurz danach hing<br />
an den Bushaltestellen auf dem Arbeitsweg<br />
der Frau das Stellengesuch einer<br />
Putzfrau, die der Stasi später bereitwillig<br />
die Tür zur Wohnung der Diplomatin<br />
öffnete.<br />
Allerdings ahnten die Amerikaner<br />
durchaus, dass sie überwacht und abgehört<br />
wurden, was mitunter zu skurrilen<br />
Gesprächen führte. Etwa nach dem Bombenanschlag<br />
auf die von US-Soldaten besuchte<br />
Discothek La Belle, für den ein<br />
libysches Kommando verantwortlich war.<br />
Kurz danach fuhr ein verdächtiges Auto<br />
an der US-Botschaft in Ost-Berlin vorbei,<br />
und ein besorgter Diplomat sagte ins Telefon:<br />
„Wenn ihr Ostd<strong>eu</strong>tschen zuhört,<br />
ich habe hier ein Nummernschild für<br />
<strong>eu</strong>ch“ – das Diplomatenkennzeichen eines<br />
Autos, das auf die libysche Vertretung<br />
zugelassen war. Die Stasi sollte die Libyer<br />
von weiteren Anschlägen abhalten.<br />
H<strong>eu</strong>te, zehn Jahre nach der Entlassung<br />
aus dem Militärgefängnis, lebt Carney<br />
mit seinem Adoptivsohn in Ohio. Als Vorbestrafter,<br />
noch dazu als Verräter, findet<br />
er keine feste Stelle, und auch der Versuch,<br />
in Berlin noch mal Fuß zu fassen,<br />
scheiterte. Von Herbst 2010 bis Herbst<br />
2011 wohnte er in der alten Frontstadt.<br />
Bekannte von früher – auch solche, die<br />
nicht bei der Stasi waren – wollten ihm<br />
helfen. Sie besorgten ihm eine Anstellung<br />
bei einem Verlag, der bevorzugt Titel für<br />
Regime-Nostalgiker führt, von Margot<br />
Honecker bis Egon Krenz. Hier sollte<br />
auch Carneys Buch erscheinen, aber offenbar<br />
passte es beim Verlag dann doch<br />
nicht ins Programm – und auch einigen<br />
Ex-Stasi-Granden nicht ins Weltbild.<br />
Schließlich lässt Carney darin nicht nur<br />
die Amerikaner schlecht aussehen,<br />
sondern auch die Stasi.<br />
„Du bist uns gegenüber<br />
unfair“, habe sich ein ehemaliger<br />
Stasi-Oberst mokiert.<br />
Prompt fiel Carneys Monatslohn<br />
immer kleiner aus,<br />
es reichte nicht für die Aufenthaltserlaubnis,<br />
und mit<br />
seiner Rückkehr in die Staaten<br />
hat nicht nur der Verlag<br />
die Buchrechte verloren, sondern<br />
Carney auch den letzten<br />
Glauben an alte Kame -<br />
raden. „Da waren einige<br />
spürbar froh, mich wieder<br />
loszuwerden. Mit diesen<br />
L<strong>eu</strong>ten bin ich fertig.“ Was<br />
die Sache für Carneys<br />
Zukunft allerdings noch<br />
schwieriger macht: Er hat<br />
nun kaum noch Fr<strong>eu</strong>nde,<br />
nicht mal mehr die alten, die<br />
falschen. JÜRGEN DAHLKAMP<br />
DER SPIEGEL 33/2013 51<br />
CHRIS HOFFMAN / PICTURE-ALLIANCE / DPA
Szene<br />
Was war da los,<br />
Herr Herrera?<br />
Jorge Herrera, 37, Fallschirmjäger<br />
aus Kolumbien,<br />
über Abstürze: „Als<br />
wir zum ersten Mal auf<br />
2000 Meter Höhe über<br />
dem kolumbianischen<br />
Dschungel auf der<br />
Absprungrampe saßen,<br />
strampelte meine Hündin<br />
so sehr, dass wir fast<br />
vornübergekippt wären.<br />
Jany ist eine Belgische<br />
Schäferhündin, sie<br />
hatte ziemlich viel<br />
Angst. Mittlerweile<br />
öffnet sie beim<br />
Sprung manchmal<br />
die Lefzen,<br />
so dass die<br />
Luft sie kitzelt. Es sieht<br />
dann aus, als würde sie<br />
lachen. Ich habe 500<br />
Sprünge hinter mir, Jany<br />
erst 5. Meine Kameraden<br />
und ich werden gerufen,<br />
wenn Flugz<strong>eu</strong>ge entführt<br />
werden oder Terroristen<br />
sich im Dschungel verstecken.<br />
Jany kann Sprengstoff<br />
riechen, wenn wir<br />
uns in vermintem Gelände<br />
bewegen. Sie beschützt<br />
uns. Der nächste Schritt<br />
ist, dass Jany lernt, aus<br />
einer Sauerstoffflasche zu<br />
atmen. Dann können wir<br />
aus noch größerer Höhe<br />
abspringen.“<br />
Herrera (l.)<br />
HGMPRESS<br />
Warum fotografieren Sie Scheidungen, Frau Palma?<br />
Jede dritte Ehe in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
zerbricht. Carmen Palma, 40, aus<br />
München verdient ihr Geld als<br />
Scheidungsfotografin.<br />
SPIEGEL: Frau Palma, was macht eine<br />
Scheidungsfotografin?<br />
Palma: Ich fotografiere Menschen nach<br />
einer Trennung in ihrem Brautkleid<br />
oder ihrem Hochzeitsanzug.<br />
SPIEGEL: Warum?<br />
Palma: Ich glaube, die Menschen haben<br />
ein Bedürfnis danach, alles foto -<br />
grafisch festhalten zu wollen: Geburtstagsfeiern,<br />
die Hochzeit, die Scheidung.<br />
Viele meiner Kundinnen heben<br />
die Bilder sorgsam auf und schauen<br />
sie sich bei Gelegenheit an, einfach<br />
um an einen Abschnitt ihres Lebens<br />
erinnert zu werden.<br />
SPIEGEL: Glauben Sie, dass diese Fotos<br />
den Menschen dabei helfen, ihre<br />
Trennung zu verarbeiten?<br />
Palma: Frauen knüpfen sehr viel Kraft<br />
aus solchen Shootings. Bislang hat<br />
52<br />
jede Frau gesagt, dass sie sich danach<br />
befreit fühlt. Frauen verarbeiten<br />
dadurch die Trennung.<br />
SPIEGEL: Was zeichnet eine gute Scheidungsfotografin<br />
aus?<br />
Palma: Wichtig ist, dass die Frauen, die<br />
zu mir kommen, das Gefühl haben,<br />
sich fallenlassen zu<br />
können. Denn es entstehen<br />
emotionale Momente,<br />
wenn zum Beispiel<br />
eine Frau ihr Hochzeitskleid<br />
in Stücke reißt und<br />
dann verbrennt oder<br />
ihren Hochzeitsschuh<br />
mit einer Axt zertrümmert.<br />
SPIEGEL: Wie sind Sie auf<br />
diesen Beruf gekommen?<br />
Palma: Früher war ich<br />
Angestellte bei einer<br />
Krankenkasse. Als ich<br />
mich vor zwei Jahren als<br />
Fotografin selbständig<br />
gemacht habe, habe ich Palma-Foto<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
nach einem Alleinstellungsmerkmal<br />
gesucht. Im Internet bin ich dann<br />
auf die Scheidungsfotografie gestoßen.<br />
Das war gleich mein Ding, weil ich<br />
auch selbst geschieden bin und<br />
weiß, was Frauen in so einer Situation<br />
durchmachen.<br />
SPIEGEL: Kommen auch<br />
Männer zu Ihnen, um sich<br />
fotografieren zu lassen?<br />
Palma: Ich hatte zwei Anfragen<br />
von Männern. Allerdings<br />
sind beide abgesprungen.<br />
Ich glaube, das<br />
liegt daran, dass Männer<br />
nicht so eine emotionale<br />
Bindung zu ihrem Hochzeitsanzug<br />
haben.<br />
SPIEGEL: Fotografieren Sie<br />
auch Hochzeiten?<br />
Palma: Vor drei Wochen<br />
habe ich zum ersten<br />
Mal eine Hochzeit fotografiert.<br />
Es war wunderschön.<br />
CARMEN PALMA
Gesellschaft<br />
Herr Schwotzer aus Baranowitschi<br />
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum zwei Weißrussen Scheinehen mit D<strong>eu</strong>tschen eingingen<br />
Es ist schon spät am Abend, ein Sommergewitter<br />
zieht über Chemnitz,<br />
und Oleg Schwotzer, 47 Jahre alt,<br />
groß, braun, mit grauen, kurzen Haaren,<br />
steht noch immer in seiner Werkstatt und<br />
repariert Autos. Er will die Zeit nutzen,<br />
Geld verdienen, weil er nicht weiß, wie<br />
lange es dauert, bis die Polizei zu ihm<br />
kommt und ihm sagt, dass alles vorbei<br />
sei und er zurückmüsse nach Weißrussland.<br />
Angefangen hatte es vor 17 Jahren,<br />
als Oleg und seine Frau Oksana<br />
noch glaubten, das Leben<br />
stehe ihnen offen. Die beiden waren<br />
das Ehepaar Karpovich aus<br />
der Stadt Baranowitschi in Weißrussland,<br />
140 Kilometer südwestlich<br />
von Minsk. Sie waren sich<br />
auf der Straße das erste Mal begegnet,<br />
hatten sich verliebt und<br />
studiert, er Kraftfahrz<strong>eu</strong>gtechnik,<br />
sie Ökonomie. Aber sie waren,<br />
weil die Möglichkeiten fehlten,<br />
in einer Fabrik gelandet.<br />
Sie bekamen einen Sohn, Artiom,<br />
sie waren glücklich, aber<br />
seit dem Putsch gegen Gorbatschow<br />
hörten sie oft Schüsse auf<br />
den Straßen ihrer Nachbarschaft.<br />
Sie besuchten Demonstrationen,<br />
und sie waren von Soldaten umgeben.<br />
Sie sorgten sich um ihre<br />
Zukunft.<br />
Oleg bewarb sich bei der Regierung<br />
von Weißrussland dar -<br />
um, an einem Programm teil -<br />
zunehmen, das ihn zu einem<br />
Praktikum in eine d<strong>eu</strong>tsche Autowerkstatt<br />
führte. Olegs Abschluss<br />
war gut, es verschlug ihn<br />
nach Chemnitz. Tagsüber ar -<br />
beitete er in einer Ford-Vertragswerkstatt,<br />
die n<strong>eu</strong>e Stadt war<br />
grau, aber fr<strong>eu</strong>ndlich. Am Abend ging<br />
er ein Bier trinken, er hatte d<strong>eu</strong>tsche<br />
Fr<strong>eu</strong>nde, sie erzählten ihm, wie leicht<br />
das sei – eine Scheinehe.<br />
Oleg fuhr nach Hause, weihte seine Frau<br />
in den Plan ein. Dann beschlossen sie, mutig<br />
zu sein. Oksana suchte die Papiere her -<br />
aus und bat im Standesamt von Baranowitschi<br />
um die Scheidung. Im Februar 1997<br />
kam sie mit einem Koffer und dem Jungen<br />
an der Hand auf einem Bahnhof in Berlin<br />
an. Oleg holte sie ab, sie fuhren gemeinsam<br />
nach Chemnitz und aßen dort im Imbiss<br />
neben dem Schuhladen einen Döner.<br />
Kurz zuvor hatte der geschiedene Oleg<br />
in Chemnitz ein zweites Mal geheiratet,<br />
im geliehenen Anzug, eine blonde Frau<br />
Schwotzer. Kurz danach heiratete Oksana<br />
dort auch, jetzt nicht mehr im weißen<br />
Kleid, einen großgewachsenen Mann namens<br />
Knöfel. Oleg und Oksana fühlten<br />
sich nicht gerade wohl dabei, aber sie<br />
dachten auch an ihren Sohn, und am<br />
Ende lief alles unkomplizierter, als sie befürchtet<br />
hatten.<br />
Sohn Artiom, Eltern Knöfel, Schwotzer<br />
Aus Bild.de<br />
Es gab keine langen Befragungen, keine<br />
Tests. Sie gingen einfach mit den n<strong>eu</strong>en<br />
Papieren in die Ausländerbehörde und<br />
beantragten ihre Aufenthaltserlaubnis.<br />
Sie ern<strong>eu</strong>erten die Genehmigung regelmäßig,<br />
nur dann trafen sie auch ihre n<strong>eu</strong>en<br />
Ehepartner.<br />
Ansonsten lebten Oleg und Oksana das<br />
Leben, das sie leben wollten. Sie hatten<br />
eine gemeinsame Wohnung, eine mit drei<br />
Klingelschildern, Oleg trat der Handwerkskammer<br />
bei und eröffnete eine Autowerkstatt.<br />
Er beschäftigte junge L<strong>eu</strong>te,<br />
spielte Volleyball, ging am Wochenende<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
in den Angelverein. Oleg und Oksana hatten<br />
Fr<strong>eu</strong>nde, sie zahlten St<strong>eu</strong>ern. Artiom,<br />
der Sohn, besuchte das Gymnasium, er<br />
vertrat das Land Sachsen viermal bei „Jugend<br />
trainiert für Olympia“ im Badminton.<br />
So vergingen die Jahre.<br />
Weite Teile ihres alten Lebens hatten<br />
sie schon vergessen. Sie fuhren nach Paris,<br />
ins Disneyland, und Oleg Schwotzer, ehemals<br />
Oleg Karpovich, sprach viel über<br />
die n<strong>eu</strong>gewonnene Freiheit. Nur manchmal,<br />
da bekamen sie Angst,<br />
wenn die Polizei im Haus war,<br />
weil jemand zu viel Krach machte.<br />
Oleg und Oksana flogen auf,<br />
warum, wissen sie nicht.<br />
Die Schreiben der Ausländerbehörde,<br />
die gleichzeitig im<br />
Briefkasten lagen, waren einzeln<br />
adressiert an Oleg Schwotzer,<br />
Oksana Knöfel und Artiom Karpovich.<br />
Sie enthielten alle die -<br />
selbe Aussage: Entzug der Aufenthaltserlaubnis.<br />
Beinahe drei Jahre sind seitdem<br />
vergangen. Oleg Schwotzer<br />
hat sich einen Anwalt gesucht,<br />
der sitzt jetzt an Olegs Seite in<br />
einem Büro neben der Werkstatt,<br />
als Oleg seine Geschichte erzählt.<br />
Der Mann aus Weißrussland<br />
trägt eine schwarze Arbeitshose<br />
und sieht müde durch das Fenster<br />
in den Regen. Draußen auf<br />
dem Hof stehen die Autos, die<br />
er an diesem Tag repariert hat.<br />
Man weiß nicht, wann diese<br />
Geschichte zu Ende geht. Verschiedene<br />
Gerichte beschäftigen<br />
sich mit dem Fall. Es gibt Unterschriftensammlungen,<br />
Politiker<br />
und Fr<strong>eu</strong>nde setzen sich für die<br />
Familie ein, Nachbarn schreiben<br />
Briefe an Behörden. Auch der<br />
Angelverein setzt sich für die Familie ein.<br />
Herr Schwotzer soll im kommenden Jahr<br />
ehrenamtlicher Fischereiaufseher werden.<br />
Artiom, das ist inzwischen sicher, darf<br />
vorerst in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> bleiben, seine<br />
Eltern nicht. Für sie kann es jeden Tag<br />
zurück gehen, weil sie sich ihre Aufenthaltstitel<br />
durch die Scheinehen erschlichen<br />
haben.<br />
Man kann es kurz machen und sagen:<br />
D<strong>eu</strong>tsche Behörden sind herzlos. Man<br />
kann es aber auch anders sehen und sagen:<br />
Was Oleg und Oksana taten, ist illegal.<br />
BARBARA HARDINGHAUS<br />
R. BONSS / MOMENTPHOTO.DE / DER SPIEGEL<br />
53
Gesellschaft<br />
LEBENSRETTER<br />
Discounter der Herzen<br />
Der Chirurg Devi Shetty betreibt in Indien Krankenhäuser nach dem Aldi-Prinzip –<br />
preiswert, schmucklos, zuverlässig. Bald soll seine<br />
Billigmedizin auch in die Erste Welt exportiert werden. Von Guido Mingels<br />
Im Loch zwischen den am Brustbein doziert er weiter seine Ideen in den<br />
auseinandergesägten, mit stählernen Raum.<br />
Klammern auseinandergezwungenen „Indien bringt eine riesige Menge Ärzte<br />
Rippen glänzt, klein und rosa, ein krankes und medizinische Fachl<strong>eu</strong>te hervor. Wir<br />
Herz, Muskel des Lebens.<br />
haben zudem die meisten Kranken und<br />
„Wussten Sie, dass in Indien pro Jahr finden deshalb Lösungen, die für die ganze<br />
28 Millionen Babys geboren werden? Das<br />
Welt gut sind. Indien kann in zehn Jah-<br />
ist eines pro Sekunde. Drei Millionen davon<br />
ren Weltmarktführer der globalen Ge-<br />
sterben vor ihrem fünften Geburtstag sundheitsindustrie sein.“<br />
an einem behandelbaren Herzleiden.“ Indien, das Land der ungeh<strong>eu</strong>erlichen<br />
Das ist er also, Doktor Shetty. Der große<br />
Zahlen. 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050<br />
Lebensretter, Chirurg der Armen, Phil - könnten es 1,6 Milliarden sein. Betrachtet<br />
anthrop, Gesundheitsfabrikant, Pionier man die Umrisse des Subkontinents auf<br />
der Billigmedizin für die Massen. Einst dem Globus, so sieht man einen gewaltigen<br />
war er Arzt des Vertrauens von Mutter<br />
Reißzahn, der sich in den Planeten<br />
Teresa.<br />
schlägt. Und mörderisch muss sich das<br />
Vor ihm liegt der geöffnete Brustkorb Leben anfühlen, für die rund 350 Millionen,<br />
eines Patienten, das Interview findet während<br />
die in Indien mit weniger als einem<br />
der Operation statt, Zeit ist Geld, Dollar pro Tag auskommen müssen. Der<br />
Geld ist Leben. Aus einem Radio klingt zweitbevölkerungsreichste Staat der Welt,<br />
indische Popmusik, wie sie der Meister weltgrößte Demokratie, Atommacht, vor -<br />
gern zur Arbeit hört. Es ist drei Uhr an aussichtlich drittgrößte Wirtschaftsmacht<br />
einem Montagnachmittag in Bangalore, bis zur Mitte des Jahrhunderts. Sieben<br />
Karnataka, Indien.<br />
Prozent durchschnittliches Wirtschaftswachstum<br />
„300000 Kinder in Indien sterben pro<br />
in den vergangenen 20 Jahren,<br />
Jahr am Tag ihrer Geburt. Jedes siebte Platz 67 von 81 auf dem Welthunger-<br />
Kind auf der Welt, das den fünften Geburtstag<br />
Index. Die Mittelschicht wächst, aber vie-<br />
nicht erlebt, stirbt in Indien. Alle le Millionen Menschen bleiben auf der<br />
zehn Minuten stirbt eine indische Mutter Strecke, zermalmt. Nach 65 Jahren ist ein<br />
im Kindbett.“<br />
indisches Leben im Durchschnitt vorbei.<br />
Von seinem Gesicht, mit einem Mundschutz<br />
Wohl nirgendwo auf der Welt, so hat der<br />
bedeckt, sind nur die l<strong>eu</strong>chtenden indische Ökonom und Nobelpreisträger<br />
Augen zu sehen. Sein Name ist Devi Prasad<br />
Amartya Sen erklärt, hat so viel Fort-<br />
Shetty, Dr. Shetty oder nur Devi, wie schritt den Armen so wenig gebracht.<br />
es auf seinem Arztkittel steht. Zum T<strong>eu</strong>fel,<br />
Debasis Santra ist vier Jahre alt und<br />
Devil, fehlt nur ein Buchstabe, dabei hat ein Loch im Herzen.<br />
ist er für viele tausend Menschen, die in Er sitzt mit seinen Eltern Pratima und<br />
seinen Kliniken behandelt wurden, nicht Swaphan Santra in der Eingangshalle von<br />
weniger als ein Engel.<br />
Dr. Shettys Narayana Health City neben<br />
Mehr als 30000 Patienten soll der einer vielarmigen, über dem Wasser<br />
Mann, 60 Jahre alt, operiert haben. Als schwebenden Statue des Gottes, der der<br />
„Henry Ford der Herzchirurgie“ hat ihn Klinik ihren Namen gab. Großer subarterieller<br />
das „Wall Street Journal“ bezeichnet,<br />
Ventrikelseptum-Defekt, steht in<br />
weil er die Grundsätze der Massenproduktion<br />
den Akten, eingeschränkt durch einen Pro-<br />
auf die Medizin<br />
laps des rechten Aortenklap-<br />
anwendet, um die Kosten radikal<br />
pensegels. Ein hübscher, kleiner,<br />
mangelernährter Junge<br />
zu senken.<br />
N<strong>eu</strong>-Delhi<br />
Sein Ziel ist eine Art in -<br />
aus einem Dorf bei Kalkutta,<br />
dustrielle Revolution des<br />
Kalkutta ein blaues Baby, wie man sie<br />
Gesundheitswesens in der INDIEN nennt, die Kinder, deren Blut nicht<br />
Dritten Welt. Während Dr.<br />
genügend Sauerstoff erhält: Finger-,<br />
Shetty mit einem Spatel Verkalkungen<br />
Zehenspitzen und Zunge verfärben sich<br />
aus einer Arterie schabt, oft blau. Debasis hustet. Seine Mutter<br />
hat<br />
54<br />
Bangalore<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
ihm einen schwarzen Punkt zwischen die<br />
Augenbrauen gemalt, der soll ihn beschützen.<br />
Ohne Operation wird der Junge nicht<br />
lange leben. Er ist einer von Millionen.<br />
„Ich gebe dem Leben ein Preisschild“,<br />
sagt Doktor Shetty.<br />
Auf dem Schreibtisch seines riesigen<br />
Sprechzimmers steht das Modell eines<br />
Herzens. Eine Gandhi-Statue blickt von<br />
einem Sideboard, ein grellbuntes Gemälde<br />
des Gottes Krishna als Kind hängt an<br />
der Wand. Der nächste Patient wartet bereits<br />
auf einem Sofa in der Ecke. Shetty<br />
sagt, er empfange jeden Tag 50 bis 70 Patienten<br />
zur Besprechung, dazwischen führe<br />
er zwei bis drei Operationen aus.<br />
Was heißt das, ein Leben mit Preisschild?<br />
Als junger Chirurg in Kalkutta<br />
habe er die Erfahrung gemacht, sagt Shetty,<br />
dass die erste Frage der vielen mittellosen<br />
Patienten, denen er die notwendige<br />
Operation geschildert hatte, immer dieselbe<br />
war: Wie viel kostet das? „Als ich<br />
ihnen die Zahl nannte, bedankten sie sich<br />
und kamen nie wieder.“ Irgendwann beschloss<br />
Shetty, dass er keine Patienten<br />
mehr ziehen lassen wollte, nicht in den<br />
Tod. Mit Geld seines Schwiegervaters<br />
gründete er 2001 am Rande von Banga -<br />
lore seine eigene Klinik und setzte alles<br />
daran, die Kosten zu senken, ohne die<br />
Qualität zu gefährden. Die Zahl auf dem<br />
Preisschild musste so niedrig sein, dass<br />
auch die Armen es sich leisten konnten,<br />
weiterzuleben. Um das zu erreichen,<br />
musste Shetty, der Idealist, zum Manager<br />
werden, zum Discounter der Herzen.<br />
Unter dem Namen Narayana Hrudayalaya,<br />
Tempel des Herzens, inzwischen<br />
verkürzt auf Narayana Health, ist in<br />
zwölf Jahren eine Kette mit bisher 19 Kliniken<br />
in ganz Indien entstanden, für die<br />
Shetty verschiedene Vorbilder zitiert:<br />
den amerikanischen Discounter Wal-<br />
Mart, Billigfluggesellschaften wie Ryan -<br />
air oder Air Asia, die japanische Auto -<br />
industrie. 13 000 Betten betreibt das Unternehmen<br />
mittlerweile, bis 2018 sollen<br />
es 30 000 sein. Aus d<strong>eu</strong>tscher Sicht könnte<br />
man von Aldi-Kliniken sprechen. Shetty<br />
strebt im Gesundheitswesen ähnliche<br />
Ziele an, wie sie in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> die Gebrüder<br />
Albrecht für den Einzelhandel
Patient Debasis mit Eltern<br />
Chirurg Shetty, Patienten<br />
FOTOS: NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL
verfolgten: billig, schmucklos,<br />
zuverlässig gut.<br />
Die Qualität genügt internationalen<br />
Standards: Die Klinik<br />
in Bangalore ist von der<br />
angesehenen Joint Commis -<br />
sion International, JCI, akkreditiert.<br />
Die JCI-Kriterien werden<br />
vor allem in der Ersten<br />
Welt, auch in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>, als<br />
Basis für die Zertifizierung<br />
von Gesundheitseinrichtungen<br />
verwendet. In Entwicklungsländern<br />
gelingt es nur<br />
wenigen Einrichtungen, das<br />
JCI-Gütesiegel zu bekommen.<br />
Shetty schafft dies dank<br />
einer Ökonomie der großen<br />
Zahlen. Die Narayana Health<br />
City in Bangalore, Hauptstadt<br />
seines Gesundheitsimperiums,<br />
versammelt auf 100 000 Quadratmetern<br />
Kliniken für Herz-,<br />
Krebs-, Augenkrankheiten<br />
und viele andere Leiden, bietet<br />
3200 Betten an, gleich viele<br />
wie die Berliner Charité.<br />
Ähnlich den Flugz<strong>eu</strong>gen der<br />
Billiganbieter, die so kurz wie<br />
möglich am Boden bleiben,<br />
sind Shettys Opera tionssäle<br />
an sechs Tagen pro Woche so<br />
oft wie möglich belegt. In der<br />
Herzklinik, mit 1000 Betten<br />
weltweit eine der größten ihrer<br />
Art, haben die Chirurgen<br />
im vergangenen Jahr 11400<br />
Herzoperationen absolviert,<br />
mehr als 30 pro Tag. Das<br />
D<strong>eu</strong>tsche Herzzentrum Berlin<br />
bei der Charité verfügt über<br />
168 Betten und führte im letzten<br />
Jahr 3000 vergleichbare<br />
Eingriffe durch. 1500 Euro berechnet die<br />
Shetty-Klinik im Durchschnitt für eine<br />
Koronararterien-Bypass-OP, eine der<br />
meistverbreiteten Prozeduren – etwa<br />
halb so viel wie in indischen Privatkliniken<br />
üblich. In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> kostet derselbe<br />
Eingriff je nach Komplexität etwa<br />
12000 bis 17000 Euro, in den USA rund<br />
15 000 bis 30 000 Euro.<br />
Auf dem Preisschild für das Leben von<br />
Debasis steht: 125 000 Rupien. 1500 Euro.<br />
Und über das Gelände der Megaklinik<br />
läuft unbehelligt eine Kuh. Innen, in der<br />
großen Eingangshalle des Herzzentrums,<br />
die an ein Flughafenterminal erinnert, sitzen<br />
mehrere hundert Patienten in langen<br />
Stuhlreihen. Eine Gruppe Sikhs kauert<br />
am Boden, Röntgenbilder werden herumgereicht,<br />
eine verhüllte Muslimin stillt unter<br />
dem Tschador ihr Baby.<br />
Die Armen stehen vor dem Büro von<br />
Lakshmi Mani und warten. Zu Lakshmi,<br />
Vorsteherin der Spendenabteilung, einer<br />
65-Jährigen mit resolutem Blick, kommen<br />
jene, denen auch die niedrigen Tarife der<br />
Narayana-Klinik noch zu hoch sind. Für<br />
56<br />
Schlafsaal der Klinik in Mysore<br />
Gesellschaft<br />
141 Dollar pro Bürger wendet Indien<br />
jährlich für die Gesundheit auf.<br />
die Ärmsten der Armen geht die Klinik<br />
auf Geldsuche. Die Tür öffnet sich, Familie<br />
Santra ist an der Reihe. Debasis sitzt<br />
auf dem Schoß seiner weinenden Mutter,<br />
der Vater steht schweigend daneben. Swaphan<br />
Santra ist Hilfsarbeiter auf dem Bau<br />
und verdient 4000 Rupien im Monat, etwa<br />
50 Euro. Lakshmi Mani, die auf einen<br />
Bildschirm blickt, rechnet den Eltern vor,<br />
was es kosten würde, das Leben ihres<br />
Sohnes zu retten.<br />
„Es ist eine komplizierte Operation.<br />
Der Vollpreis würde 213000 Rupien betragen,<br />
wir bieten <strong>eu</strong>ch aber einen Spezialpreis<br />
von 125000 Rupien an.“<br />
Die Mutter und der Vater blicken ein -<br />
ander an. Sie haben nicht so viel Geld.<br />
„Wie viel habt ihr?“<br />
„30000. So viel werden wir bei Fr<strong>eu</strong>nden<br />
sammeln“, sagt die Mutter. „Und sobald<br />
wir das Geld für unser verkauftes<br />
Land erhalten, noch mal 30000.“<br />
60000 Rupien sind gut 700 Euro. Es fehlen<br />
noch 65000 Rupien oder 800 Euro für<br />
die Operation. Dieses Geld wird Lakshmi<br />
bei einer wohltätigen Stiftung beantragen.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL<br />
Die Eltern sinken auf die<br />
Knie, wollen Lakshmis Füße<br />
küssen, sie wiegelt ab. In drei<br />
Tagen sollen sie wiederkommen,<br />
um ihren Fall Vertretern<br />
der Stiftung „Have a Heart“<br />
vorzutragen, einer Gruppe<br />
von Wohltätern, die Shettys<br />
Klinik nahesteht. Erst wenn<br />
die Spender überz<strong>eu</strong>gt sind,<br />
dass der Patient das Geld<br />
wirklich braucht, wird das Almosen<br />
bewilligt.<br />
Lakshmi Mani sagt, man<br />
dürfe die Armen nicht gratis<br />
behandeln. Das würde die Klinik<br />
finanziell überfordern.<br />
„Und wir würden von Patienten<br />
schlicht überschwemmt.“<br />
In Shettys Kliniken werden<br />
die Preise an die Kunden angepasst.<br />
Etwa 60 Prozent der<br />
Patienten bezahlen den vollen<br />
Tarif, 40 Prozent erhalten Rabatt,<br />
einige von ihnen werden<br />
gratis behandelt. So subventionieren<br />
die Vermögenden<br />
die Mittellosen. Etwa 40 Prozent<br />
der Narayana-Patienten<br />
in Bangalore erhalten zudem<br />
irgendeine Form von staatlicher<br />
Hilfe. Nicht aber die Familie<br />
Santra.<br />
Debasis, Pratima und Swaphan<br />
Santra kommen aus einem<br />
Ort namens Bishnupur,<br />
in der Nähe von Kalkutta,<br />
1800 Kilometer weit weg von<br />
Bangalore. Die Busreise dauerte<br />
vier Tage. In Kalkutta<br />
fanden sie keine Klinik, die<br />
bereit war, ihren Sohn aufzunehmen,<br />
doch sie hatten von<br />
Dr. Shettys Krankenhaus in Bangalore gehört,<br />
wo niemand abgewiesen wird. Das<br />
Stück Land, von dem sie bisher lebten,<br />
600 Quadratmeter, werden sie verkaufen,<br />
um die Operation bezahlen zu können.<br />
Pratima Santra hat ihren Brautschmuck<br />
veräußert, sie haben alles, was sie haben,<br />
aufs Spiel gesetzt, sie werden nicht zurückkehren.<br />
Die Frage, ob sie noch weitere<br />
Kinder haben wolle, verneint die<br />
Mutter und legt ihre Hand auf den Kopf<br />
des Sohnes. „Wir müssen zuerst dieses<br />
retten.“<br />
Ein Husten schüttelt Debasis.<br />
Die Großbaustelle im Süden Bangalores,<br />
auf der das Leben der Santras stattfindet,<br />
heißt „Mahaveer Orchids“. Es entstehen<br />
490 großzügige Wohnungen für<br />
die n<strong>eu</strong>e indische Mittelschicht, der sie<br />
nie angehören werden, „aber vielleicht“,<br />
sagt Pratima, „wird ja unser Sohn irgendwann<br />
so wohnen“. Sie blickt zu dem hoch<br />
aufragenden Betonskelett. Daneben stehen<br />
lange Reihen von Hütten aus Wellblech<br />
und Ästen, vorübergehende Heimat<br />
für die paar hundert Bauarbeiter. Viele
von ihnen leben wie der<br />
Handlanger Swaphan Santra<br />
zusammen mit ihrer Familie<br />
hier. Kinder spielen zwischen<br />
Betonmischern, eine große<br />
Schuttmulde nutzen sie als<br />
Schwimmbecken. Sind die<br />
Hochhäuser fertig, werden die<br />
Hütten abgerissen, und die<br />
Arbeiter ziehen weiter, auf<br />
der Suche nach n<strong>eu</strong>en Jobs.<br />
Hinter einer aus dem Wellblech<br />
gefrästen Tür, auf der<br />
die Nummer 26 steht, leben<br />
die Santras. Zehn Quadratmeter.<br />
Eine Pressspanplatte, mit<br />
einer Bastmatte belegt, dient<br />
als Bett. Es gibt ein elektrisches<br />
Kabel mit einer Lampenfassung<br />
an der Decke, das<br />
durch alle Hütten gezogen<br />
wurde, doch keinen Stromschalter,<br />
weshalb Pratima die<br />
Glühbirne, die sie wie einen<br />
Schatz aufbewahrt, immer<br />
wieder n<strong>eu</strong> in die Fassung<br />
schraubt, um Licht zu machen.<br />
Ein einziges Spielz<strong>eu</strong>g<br />
ist zu sehen, ein kleiner, gelber<br />
Plastikbagger. Debasis<br />
schiebt ihn durch den Staub.<br />
Dann sagt der Vater, der<br />
sehr selten spricht: „Aber das<br />
Leben in der Stadt ist besser<br />
als auf dem Dorf.“ Er will<br />
nicht zurück. Er verdient hier<br />
besser. An den meisten Tagen<br />
gibt es genug zu essen.<br />
Direkt vor den Toren von<br />
Dr. Shettys Health City erklingt<br />
das Grundrauschen der<br />
Dritten Welt. Hupende Autos,<br />
gemurmelte Gebete, vielsilbiges<br />
Gerede, der Ameisenmarkt der Straßenhändler.<br />
Manchmal taucht im Vor -<br />
übergehen aus dem fremden Schwall die<br />
vertraute Melodie von Apples Handy-<br />
Klingelton auf, Marimba. Die Hosur<br />
Road, je nach Fahrkünsten vier- bis zwölf -<br />
spurig befahrbar, ist Bangalores Schnellstraße<br />
in den Fortschritt. Sie verbindet<br />
das Zentrum mit dem Stadtviertel Elec -<br />
tronic City, in dem Dutzende Weltkon -<br />
zerne wie Siemens, Bosch, General Elec -<br />
tric oder Hewlett-Packard präsent sind,<br />
um vom gutausgebildeten, billigen Personal<br />
zu profitieren. Wenn das indische<br />
Billigauto Tata Nano westliche Konkurrenten<br />
aufschreckte, wenn der indische<br />
IT-Gigant Infosys aus diesem Nichts<br />
heraus die Welt eroberte, warum sollte<br />
das Dr. Shettys Kliniken nicht auch gelingen?<br />
Denn Shettys Traum reicht weit über<br />
Indien hinaus. Er möchte expandieren,<br />
nach Afrika, Südamerika, sogar nach<br />
Europa. Schon h<strong>eu</strong>te belegen Patienten<br />
aus 70 Ländern zehn Prozent der Betten<br />
in Bangalore, sie kommen vor allem aus<br />
Patientin Lois Ben aus Nigeria mit Großmutter Fagbola<br />
11400 Herz-OPs wurden<br />
in der Shetty-Klinik 2012 durchgeführt.<br />
Afrika und dem Mittleren Osten. Ihnen<br />
will Shetty künftig ent gegenkommen und<br />
seine Billigmedizin in viele Länder exportieren.<br />
Längst ist auch ein Hospital<br />
auf den Cayman Islands im Bau, das im<br />
Frühjahr 2014 eröffnet werden und sich<br />
an US-amerikanische Kunden richten<br />
wird. Shetty sagt: „Wir möchten den<br />
Amerikanern mit ihrem absurd ineffizienten<br />
Gesundheitswesen zeigen, was h<strong>eu</strong>te<br />
möglich ist.“ 2011 war eine Delegation<br />
um den damaligen slowenischen Ministerpräsidenten<br />
Borut Pahor zu Besuch in<br />
Bangalore, man diskutierte über einen<br />
möglichen Ableger in Slowenien, um <strong>eu</strong>ropäische<br />
Patienten zu erreichen. Auch<br />
mit Georgien und Malta sind Shettys Manager<br />
im Gespräch.<br />
Der 59-jährige Amerikaner Brian Navalinsky<br />
kam im Jahr 2011 nach Bangalore,<br />
weil ihm mehrere Ärzte in den USA gesagt<br />
hatten, eine Operation sei zu riskant.<br />
Einer der Mediziner gab ihm noch fünf<br />
Jahre. Eine Klinik unterbreitete ihm einen<br />
Kostenvoranschlag über 200000 Dollar.<br />
Er recherchierte im Internet nach Alternativen,<br />
„und Doktor Shettys<br />
Name tauchte immer wieder<br />
auf“, erzählt Navalinsky am<br />
Telefon. Ihm gefiel auch, dass<br />
der zuständige Spezialist in<br />
Bangalore die komplizierte<br />
Prozedur, die nötig war, „dreimal<br />
pro Woche macht und<br />
nicht dreimal pro Jahr“, wie<br />
viele amerikanische Herzchir -<br />
urgen. Auf dem Preisschild<br />
für sein Weiterleben, das ihn<br />
aus Indien erreichte, stand:<br />
19000 Dollar. Er stieg ins Flugz<strong>eu</strong>g.<br />
Rebecca Fagbola, 58, aus<br />
Nigeria, Zimmer 18 im 5.<br />
Stock der Herzklinik, erhielt<br />
in Lagos die Information, es<br />
gebe in ganz Afrika keinen<br />
Chirurgen, der imstande sei,<br />
ihre Enkelin Lois Ben, 3 Jahre,<br />
zu operieren. Aber man kenne<br />
jemanden in Bangalore.<br />
Sie stieg ins Flugz<strong>eu</strong>g.<br />
Die Assistenzärzte Anne-<br />
Laure Colin aus Frankreich<br />
und Brendan McKenna aus<br />
Irland, die neben Dr. Shetty<br />
im Operationssaal stehen, um<br />
von ihm zu lernen, hätten<br />
auch in <strong>eu</strong>ropäischen Kliniken<br />
arbeiten können. Aber Colin<br />
wollte erleben, „wie man die<br />
wichtigste Frage im Gesundheitswesen<br />
anpacken kann,<br />
die der Kosten“. Und McKenna<br />
wollte schlicht „die Zukunft<br />
der Herzchirurgie sehen“.<br />
Sie stiegen ins Flugz<strong>eu</strong>g.<br />
Shetty glaubt, dass Masse<br />
zu Qualität führt. Seine Ärzte<br />
entwickeln aufgrund der<br />
schieren Fallzahlen eine Routine, die für<br />
westliche Fachl<strong>eu</strong>te unerreichbar ist. Ähnlich<br />
einer Fließbandproduktion ist auch<br />
die Arbeitsteilung in den OPs organisiert:<br />
Nachwuchschirurgen machen den Hautschnitt,<br />
öffnen den Brustkorb, bereiten<br />
alles vor, während die leitenden Ärzte<br />
erst für den heiklen Teil des Eingriffs im<br />
OP erscheinen.<br />
An einem Donnerstag in Bangalore ist<br />
die Familie Santra auf dem Weg zu ihrem<br />
Auftritt vor dem Ausschuss der privaten<br />
Have-a-Heart-Stiftung. Die Spender müssen<br />
davon überz<strong>eu</strong>gt werden, dass die<br />
Santras die Unterstützung verdienen. Es<br />
fehlen 800 Euro für das Leben von Debasis.<br />
Gemeinsam mit 15 weiteren Patientenfamilien,<br />
die in anderen Kliniken aus<br />
Geldmangel abgelehnt wurden, sind sie<br />
in einem Bus von der Klinik ins Stadtzentrum<br />
gefahren worden, wo sie nun im<br />
vierten Stock eines halbfertigen Lagerhauses<br />
warten.<br />
Wie bei einem Hochschulexamen sitzen<br />
die Vertreter der Stiftung auf einem<br />
Podium, über Patientenakten geb<strong>eu</strong>gt,<br />
DER SPIEGEL 33/2013 57<br />
NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL
58<br />
Gesellschaft<br />
Narayana-Klinik-Gelände in Bangalore<br />
350 Millionen Inder leben<br />
von weniger als einem Dollar pro Tag.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL<br />
während vor ihnen eine Familie<br />
nach der anderen Platz<br />
nimmt. Mita Das, 46, hat einen<br />
schweren Herzklappenfehler.<br />
Es fehlen 320 Euro zur<br />
Finanzierung des Eingriffs, für<br />
ihren Mann vier Monatsgehälter.<br />
Bewilligt. Roopa Kumari,<br />
n<strong>eu</strong>n Jahre, Herzfehlbildung,<br />
380 Euro. Bewilligt. Der Vater,<br />
weinend, bittet außerdem um<br />
Geld für eine Vermissten -<br />
anzeige, sein einziger Sohn,<br />
acht jährig, sei vor zwei Mo -<br />
naten verschwunden. Die<br />
Schicksale werden im Zehnminutentakt<br />
abgehandelt.<br />
„Wir bewilligen fast jeden<br />
Antrag“, sagt Manohar Chatlani,<br />
Vorsitzender der Stiftung,<br />
„aber wir wollen die<br />
L<strong>eu</strong>te erst persönlich sehen.“<br />
Es komme vor, dass manche<br />
sich für ärmer ausgeben, als<br />
sie sind, „und das merken<br />
wir“, sagt Chatlani. Der Unternehmer,<br />
Betreiber einer<br />
Billigmodekette, unterstützt<br />
pro Jahr etwa tausend Herzoperationen.<br />
Jeden Tag rette<br />
er ein paar Leben, sagt er. „Es<br />
gibt dir ein High, Leben zu<br />
retten kann süchtig machen.“<br />
Auch der Antrag von Santra,<br />
Debasis, aus Bishnupur,<br />
Distrikt Bankura, Westbengalen,<br />
geht durch. 800 Euro.<br />
Man bittet die Eltern, mit dem<br />
Jungen nächste Woche in der<br />
Klinik zu erscheinen und ihren<br />
Anteil des Honorars bar<br />
mitzubringen. Pratima Santra<br />
küsst ihren Sohn. Eine Frau<br />
von der Stiftung drückt ihm einen Schokoriegel<br />
in die Hand.<br />
Mit 14 Jahren hörte Devi Shetty, das<br />
achte von n<strong>eu</strong>n Kindern eines Restaurantbetreibers<br />
im südindischen Mangalore,<br />
dass es einem Arzt in Südafrika namens<br />
Christiaan Barnard zum ersten Mal gelungen<br />
sei, ein Herz zu transplantieren.<br />
Der junge Shetty wollte das auch können.<br />
Nach dem Medizinstudium in Indien arbeitete<br />
er sechs Jahre lang in der Herzchirurgie<br />
des Guy’s Hospital in London.<br />
Das pragmatische englische Gesundheitssystem<br />
beeindruckte ihn, und er nahm<br />
1989 seine wichtigste Erkenntnis mit zurück<br />
nach Indien: „Eine Lösung, die man<br />
sich nicht leisten kann, ist keine.“<br />
Am radikalsten umgesetzt ist Shettys<br />
Billigstrategie im soeben eröffneten Krankenhaus<br />
in der Stadt Mysore, drei Autostunden<br />
von Bangalore. Die Preise sind<br />
hier noch einmal wesentlich niedriger als<br />
in Bangalore. Eine einfache Herzopera -<br />
tion kostet rund 1000 Euro, Shettys Ziel<br />
sind 600 Euro. Die 200-Betten-Anlage, in<br />
zehn Monaten aus vorgefertigten Bauteilen<br />
errichtet, ist nur einstöckig, das spart<br />
t<strong>eu</strong>re Fundamente und Aufzüge. Die Patienten<br />
werden in großen Sälen mit 50<br />
Betten untergebracht, die nur mit Vorhängen<br />
voneinander getrennt sind. Klimaanlagen<br />
gibt es nur in den Behandlungsräumen,<br />
nicht in den Schlafsälen. Das Spardiktat<br />
geht so weit, dass die Angehörigen<br />
der Patienten dazu angehalten werden, einen<br />
mehrstündigen Pflegekurs zu absolvieren,<br />
damit sie den Krankenschwestern<br />
einfache Aufgaben wie das Wechseln von<br />
Verbänden abnehmen können. So gelingt<br />
es der Klinik, mit zehn Prozent weniger<br />
Pflegepersonal auszukommen. Nach diesem<br />
Vorbild will Shetty in den kommenden<br />
fünf Jahren 100 identische Kliniken<br />
in indischen Provinzstädten bauen, um<br />
die medizinisch besonders schlecht ausgestattete<br />
Landbevölkerung zu versorgen.<br />
„Alle großen Errungenschaften der<br />
Welt galten als undenkbar, bevor sie Wirklichkeit<br />
wurden.“ Sinnsprüche wie diesen<br />
hat Shetty gerahmt in seinem Büro hängen,<br />
neben Fotos von Mutter Teresa, deren<br />
Herz er einmal flickte. Sein Sendungsbewusstsein,<br />
sein Vertrauen in<br />
die eigene Mission, ohnehin<br />
schon gut entwickelt, kann aggressive<br />
Züge annehmen,<br />
wenn er über die Erste Welt<br />
spricht. Die Gesundheitsversorgung<br />
vieler Industriestaaten<br />
– vornehmlich an den Bedürfnissen<br />
orientiert, kaum an<br />
den Kosten – ist in seinen Augen<br />
„krankhaft t<strong>eu</strong>er, übertechnisiert,<br />
überluxuriös“ und<br />
damit nicht zukunftsfähig. Einbettzimmer<br />
hält er für Sünde.<br />
„Die Gesundheitssysteme<br />
in der reichen Welt stammen<br />
aus einer Zeit, als die L<strong>eu</strong>te<br />
mit 60 pensioniert wurden<br />
und mit 70 starben. H<strong>eu</strong>te<br />
feiern die L<strong>eu</strong>te ihren 95. Geburtstag.<br />
Das Geld der St<strong>eu</strong>erzahler<br />
wird diese Strukturen<br />
auf Dauer nicht finanzieren<br />
können.“ Blickt Shetty<br />
von der Dritten auf die Erste<br />
Welt, zeichnet er das Bild einer<br />
Gesundheitswirtschaft im<br />
Stadium der Dekadenz. „Sie<br />
erfinden dauernd n<strong>eu</strong>e Pillen,<br />
n<strong>eu</strong>e Impfungen und komplizierte,<br />
kostspielige Maschinen.<br />
Was wir aber brauchen, sind<br />
Innovationen der Arbeitsprozesse.“<br />
Äußert man Kritik an<br />
Shettys Konzepten, etwa an<br />
den langen Arbeitszeiten der<br />
Chirurgen, reagiert er verständnislos:<br />
„Soldaten im<br />
Krieg können auch nicht um<br />
fünf nach Hause gehen.“<br />
Dann verabschiedet sich Dr.<br />
Devi Prasad Shetty, Chirurg<br />
der Mittellosen, Kostenkiller,<br />
Träger des „Economist“-Preises für innovative<br />
Business-Prozesse, und bittet den<br />
nächsten Patienten herein.<br />
Um acht Uhr morgens am 14. Juli 2013<br />
wird Debasis Santra im Kinderherzzentrum<br />
der Narayana Health City aufgenommen.<br />
In einer Plastiktüte, von der<br />
Mutter aus Angst vor Dieben unter ihrem<br />
Sari versteckt, haben die Eltern ihren Anteil<br />
an den Operationskosten mitgebracht,<br />
60000 Rupien. Von den bunten Wänden<br />
der Flure lächeln Mickey Mouse und Pluto<br />
und lauter andere Figuren, die Debasis<br />
noch nie gesehen hat. Am nächsten Tag<br />
schließt eine Chirurgin das Loch in der<br />
Scheidewand zwischen Debasis’ Herzkammern.<br />
Als der Junge aufwacht, in<br />
einem n<strong>eu</strong>en Leben, erkennt er die Mutter,<br />
den Vater. Sein Herz schlägt, hundertmal<br />
pro Minute. Er ist durstig. Er sagt:<br />
„Mama“.<br />
Video:<br />
Der Chirurg der Armen<br />
spiegel.de/app332013indien<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Facebooktussis<br />
HOMESTORY Warum wir durch Social Media<br />
zu unsozialen Wesen geworden sind<br />
Mein erster Facebookeintrag wird bald sechs Jahre alt,<br />
so lange verbrenne ich also meine Freizeit schon mit<br />
L<strong>eu</strong>ten, von denen ich die meisten gar nicht richtig<br />
kenne. Zu den Bikinifotos kommen wir noch. Im Großen und<br />
Ganzen hätte man diese Zeit wohl besser nutzen können, im<br />
Schwimmbad beispielsweise, mit Spaziergängen oder den Sopranos.<br />
Nur war damals, am Anfang, nicht absehbar, wie bed<strong>eu</strong>tend<br />
diese Website für unseren Alltag werden und wie tief<br />
Mark Zuckerberg in unsere Köpfe kriechen würde.<br />
N<strong>eu</strong>lich war zu lesen, dass Facebook jeden Monat Millionen<br />
Nutzer verliere, vor allem in westlichen Ländern. Zeit, sich<br />
Gedanken über ein untergehendes Phänomen zu machen. Wäre<br />
Facebook eine Party, dann wäre es jetzt drei Uhr morgens,<br />
und die interessanten Gäste hätten sich verabschiedet. Zurück<br />
bleiben diejenigen, die heimlich hoffen, dass sie doch noch jemanden<br />
zum Knutschen finden, was auch unterhaltsam sein<br />
kann, aus Beobachterperspektive.<br />
Am Anfang ging es auf der Seite anarchisch zu, weil man unter<br />
Fr<strong>eu</strong>nden war. Man hackte Frechheiten in den Statusschlitz,<br />
verschickte digitale Küsse und teilte in frühen Fällen von oversharing<br />
allen mit, dass man gerade Suppe kochte oder Tee<br />
trank. Als Verwandte, ältere Kollegen und L<strong>eu</strong>te aus dem weiteren<br />
Bekanntenkreis dazukamen, die nicht alles sehen mussten,<br />
nahm die Lockerheit ab. Das eine oder andere Foto wurde<br />
versteckt, Einträge wurden redigiert oder gelöscht. Ein Mensch<br />
ist immer nur so mutig wie sein gewagtestes Status-Update.<br />
Im Alltag hatte der steigende Facebookkonsum heikle Folgen.<br />
Es entwickelte sich ein Phänomen, das wir Facebooktussis nannten<br />
– junge Frauen, umhüllt von der blassen Aura eines l<strong>eu</strong>chtenden<br />
Mobiltelefons, die wie zerstr<strong>eu</strong>te Heilige auf Partys her -<br />
umstanden und ihre Aufmerksamkeit denjenigen schenkten, die<br />
gerade anderswo mit ihrem Handy beschäftigt waren.<br />
Facebook war immer eine Übung in simulierter Lässigkeit,<br />
Raum für ein schöneres, glänzenderes Ich. Plötzlich konnte<br />
man mangelnde Schlagfertigkeit dadurch kompensieren, dass<br />
man minutenlang über einen originellen Kommentar nachdachte.<br />
Im Alltag ist das schwierig.<br />
2009 lautet mein meistkommentierter Eintrag: „Tennis-Arm<br />
ist Achtziger, ich habe einen Kicker-Arm.“ Partys, Schnappschüsse,<br />
Zufallsbekanntschaften, angetrunkene Ideen um zwei<br />
Uhr früh klopfe ich darauf ab, ob sie es wert sind, anderen<br />
übermittelt zu werden. Das große Selbstüberwachungszeitalter<br />
beginnt, in dem ein Ereignis nicht mehr stattfindet, wenn es<br />
nicht geteilt wird.<br />
Es ist nicht nur lustig, auf der eigenen Facebooktimeline in<br />
die Vergangenheit zu reisen. Etliche Einträge blieben unbeantwortet,<br />
andere leider nicht. Im Frühjahr 2011 schickt mir meine<br />
Mutter eine Fr<strong>eu</strong>ndschaftsanfrage und kommentiert ein Foto<br />
von mir in Badehose, das von meiner damaligen Mitbewohnerin<br />
hochgeladen wurde, mit zehn Ausrufezeichen. Auf viele<br />
Cartoons aus dem „New Yorker“, die ich hochlade, reagiert<br />
dagegen niemand.<br />
Allmählich begann sich etwas zwischen mir und meinen<br />
Fr<strong>eu</strong>nden zu verschieben. Wir wurden ungeduldiger, unkonzentrierter<br />
miteinander, wenn wir uns sahen, vielleicht in der<br />
Befürchtung, etwas zu verpassen, was parallel im Internet passiert.<br />
Wir stellten einander weniger Fragen, denn unsere Leben<br />
synchronisierten sich ja online. Noch ein Effizienzgewinn. Ich<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
frage mich, was wir mit der gesparten Zeit gemacht haben.<br />
Unsere Sprache wurde kurzatmiger, wir rutschten in Super -<br />
lative ab – irre, krass, Wahnsinn, geil. Die Zwischentöne aber,<br />
die Selbstironie, die Zweifel, diese schöne, alberne Melancholie<br />
nach drei, vier Stunden Plaudern, all das, auf dem Vertrauen<br />
wächst und später vielleicht Fr<strong>eu</strong>ndschaft, wurde seltener.<br />
Es lag nicht nur an Zuckerberg und seiner Website, aber die<br />
Digitalisierung des Fr<strong>eu</strong>ndeskreises hat dazu beigetragen, dass<br />
der Alltag unromantischer geworden ist. Wenn ich mich mit<br />
Fr<strong>eu</strong>nden traf, wusste ich manchmal nicht, was ich erzählt und<br />
was ich nur gepostet hatte. Morgens griff ich als Erstes zum<br />
Handy neben dem Bett, um zu schauen, was das Leben der<br />
anderen machte. Mit dem Schlafzimmer war auch der letzte<br />
analoge Ort in der Wohnung entweiht, der bislang für Bücher,<br />
Träume und Liebe reserviert war.<br />
Die Bikinifotos spielten natürlich mit. Keine Ahnung, wie<br />
viel Lebenszeit der west<strong>eu</strong>ropäische Durchschnittsmann damit<br />
verbringt, sich durch Urlaubsbilder von Facebookfr<strong>eu</strong>ndinnen<br />
zu klicken, mit denen er nicht liiert ist. Vermutlich Jahre. Wenn<br />
ich die Signale richtig d<strong>eu</strong>te, geht aber auch das zurück beziehungsweise<br />
werden die Nutzerinnen sparsamer mit Bildern.<br />
Mein Kumpel Thomas erklärt die westliche Facebookkrise so:<br />
„Irgendwann kommt der Tag, an dem du alle Frauen abgecheckt<br />
hast, die du früher in der Schule scharf fandest.“<br />
Inzwischen stapelt sich auf meiner Facebookseite sehr viel<br />
Müll: 22 Gründe, weshalb dein Hund introvertiert ist (ich habe<br />
keinen Hund); ein Video von Dustin Hoffman, der h<strong>eu</strong>lt; ein<br />
Link zu Fotos, die beweisen sollen, dass Hipster doch nicht tot<br />
sind. Ab und zu drücke ich „Gefällt mir“, damit niemand denkt,<br />
ich sei komplett durchgeknallt und hätte mich abgemeldet.<br />
Facebook wollte die Bindung zwischen Menschen im digi -<br />
talen Universum weiterführen. Inzwischen geben die meisten<br />
dort nichts mehr von sich preis, ihre Einträge lesen sich wie<br />
Meldungen eines außer Kontrolle geratenen Livetickers:<br />
„Träumte, ich war in San Francisco letzte Nacht.“ – „Beachparty.“<br />
– „Sonne & Home Office.“ – „Rügen-Nord.“<br />
Das ist kein schlechtes Zeichen. Die Chance wächst, dass<br />
wir uns endlich wieder mit den wichtigen Dingen befassen.<br />
Wir müssen reden.<br />
CHRISTOPH SCHEUERMANN<br />
Meine Mutter kommentiert<br />
ein Foto von mir in Badehose<br />
mit zehn Ausrufezeichen.<br />
59<br />
THILO ROTHACKER FÜR DEN SPIEGEL
DEUTSCHLAND, WIE GEHT’S? (II) Demokratien lassen sich daran<br />
messen, ob sie ihren Bürgern Lebenschancen einräumen. Knapp<br />
zwei Drittel aller D<strong>eu</strong>tschen glauben, dass die sozialen Verhält -<br />
nisse dabei sind zu erstarren – wer oben ist, dessen Kinder haben<br />
beste Chancen, ihren Status zu bewahren; wer unten ist, dem<br />
bleibt der Aufstieg, anders als in den Anfängen der Republik, eher<br />
verwehrt. Was tun? Die SPD propagiert im Wahlkampf eine St<strong>eu</strong>er<br />
für Gutverdiener. In Nordrhein-Westfalen versteht sich Hannelore<br />
Kraft als Kümmerin, die sich der Nöte der Bedrängten annimmt.<br />
Aber lassen sich so die wachsenden Gegensätze verringern?<br />
Wahlplakate in Berlin<br />
STEFAN BONESS / IPON<br />
Der n<strong>eu</strong>e Ständestaat<br />
Die Parteien versprechen „soziale Gerechtigkeit“ und buhlen damit um die Wählergunst.<br />
Für viele ist es eine Verteilungsfrage, doch in Wahrheit geht es um Chancen.<br />
Wer von unten startet, hat in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> kaum Aussicht, je nach oben zu kommen.<br />
Wer weiß schon, ob er jemals<br />
zurückkehren wird in diesen<br />
Büropalast. Wer weiß schon,<br />
ob er noch einmal eine solche<br />
WAHL<br />
Halle betreten darf, in der die<br />
2013<br />
Mitarbeiter ihren Espresso<br />
auf Designerliegen schlürfen und durch<br />
ein Glasdach in den Himmel blicken.<br />
Can, 20 Jahre alt und Sohn türkischer<br />
Einwanderer, weiß es nicht. Und so zückt<br />
er sein Smartphone und schießt ein paar<br />
Erinnerungsfotos. Von der glänzenden<br />
Kaffeemaschine. Den Pflanzen in den Betonbassins.<br />
Und vom Paternoster, der in<br />
ewiger Kette Männer im dunklen Anzug<br />
und Damen im schmalen Rock unter das<br />
Sonnendach befördert.<br />
So weit oben ist Can nur Gast. Mit dem<br />
Karohemd und dem großen Kopfhörer,<br />
der um seinen Nacken baumelt, bleibt er<br />
in der Münchner Dependance der Boston<br />
60<br />
Consulting Group sichtbar fremd. Er ist<br />
hier, weil einer der Unternehmensberater<br />
sein persönlicher Coach ist. Die Arbeitsagentur<br />
hat sie zusammengebracht. Nun<br />
arbeiten sie gemeinsam an einem Projekt:<br />
Cans Zukunft.<br />
Bislang sah die ziemlich düster aus.<br />
Can hat das, was Betr<strong>eu</strong>er vom Amt<br />
„schwierige Startbedingungen“ nennen.<br />
Er wuchs in einer Gegend auf, in der es<br />
sehr viele Hochhäuser und sehr wenige<br />
Musikschulen gibt. Er hat die fünfte Klasse<br />
wiederholt, die siebte und die zehnte.<br />
Er verließ die Schule mit einer Fünf in<br />
Mathe und einer Fünf in D<strong>eu</strong>tsch. Bewerbungen<br />
hat er gar nicht erst abgeschickt.<br />
Nun soll ihm ein Berater helfen, ein<br />
Mann „aus einer anderen Welt“, wie Can<br />
sagt, aus einem Leben, in dem man den<br />
Doktortitel auf Visitenkarten druckt und<br />
seine Kinder zum Austauschjahr nach<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Übersee schickt. Von montags bis donnerstags<br />
kümmert sich der Boston-Consulting-Mann<br />
Fabian Barthel darum, Straßen<br />
und Staudämme in Afrika zu planen.<br />
Freitagnachmittags hilft er Can dabei,<br />
eine Lehrstelle zu finden – unentgeltlich,<br />
als eine Art persönlicher Entwicklungshelfer.<br />
„Cans Startbedingungen waren definitiv<br />
schlechter als meine. Aber es kann<br />
doch nicht sein, dass uns das ein Leben<br />
lang prägt“, sagt Barthel. Seine Vorstellung<br />
von Gerechtigkeit sei jedenfalls eine<br />
andere.<br />
Was die Parteien unter Gerechtigkeit<br />
verstehen, können Can und Barthel auf<br />
den Plakaten und Flyern lesen, die jetzt<br />
überall im Land verteilt werden. Unionspolitiker<br />
preisen Betr<strong>eu</strong>ungsgeld für Eltern<br />
an, die ihre Kinder zu Hause erziehen.<br />
Die SPD verspricht stabilere Renten.<br />
Es soll alles gut bleiben – für die, für die
Serie<br />
BERT HEINZLMEIER / DER SPIEGEL<br />
schon beinahe alles gut ist. Nur für Can<br />
wird das wenig ändern.<br />
Die Parteien haben die soziale Gerechtigkeit<br />
als Wahlkampfschlager entdeckt.<br />
Das G-Wort zieht sich wie ein roter Faden<br />
durch viele Programme. Rund 60-mal verheißen<br />
die Grünen Gerechtigkeit, auf fast<br />
40 Nennungen kommt die SPD – knapp<br />
gefolgt von der Linkspartei. Die SPD will<br />
die „Fliehkräfte in der Gesellschaft“ (Kanzlerkandidat<br />
Peer Steinbrück) eindämmen,<br />
indem sie die St<strong>eu</strong>ern für Gutverdiener erhöht.<br />
Die Grünen wollen die Reichen mit<br />
einer Vermögensabgabe zur Kasse bitten.<br />
Ihre Wähler seien für „eine gerechte Verteilung<br />
der St<strong>eu</strong>ern“, sagt Grünen-Spitzenkandidatin<br />
Katrin Göring-Eckardt. Auch<br />
wenn sie dafür zahlen müssten.<br />
Die Union knüpft das Versprechen sozialer<br />
Gerechtigkeit nicht an höhere St<strong>eu</strong>ern,<br />
aber an staatliche Wohltaten. Die<br />
Rente für ältere Mütter will sie erhöhen<br />
und kleine Senioreneinkommen zu einer<br />
Lebensleistungsrente aufstocken. Das Betr<strong>eu</strong>ungsgeld<br />
soll schon im nächsten Jahr<br />
steigen. „Jede Familie ist anders. Und uns<br />
besonders wichtig“, hat die Union auf<br />
ihre Wahlplakate gedruckt. Sie hätte auch<br />
schreiben können: Es wird Geld geben.<br />
„Soziale Gerechtigkeit ist ein schillernder<br />
Begriff, unter dem jeder etwas anderes<br />
versteht. Gerade das macht ihn im<br />
Wahlkampf so attraktiv für die Parteien“,<br />
sagt Michael Sommer, der die D<strong>eu</strong>tschen<br />
regelmäßig befragt, was sie vom Ausgleich<br />
in der Gesellschaft halten. Im<br />
Wahljahr hat der Projektleiter beim Institut<br />
für Demoskopie Allensbach eine<br />
große Studie vorgelegt. Die Parteistrategen<br />
hätten sie vielleicht mal lesen sollen.<br />
Knapp zwei Drittel der D<strong>eu</strong>tschen glauben,<br />
dass die sozialen Verhältnisse in der<br />
vergangenen Legislaturperiode ungerechter<br />
geworden sind. Doch zugleich hat der<br />
Anteil der Bundesbürger, die das St<strong>eu</strong>ersystem<br />
für unfair halten, stark abgenommen.<br />
Nur 21 Prozent der Befragten halten<br />
die Verteilung der Einkommen für das<br />
wichtigste Problem. Mit 57 Prozent glaubt<br />
die Mehrheit, dass Gerechtigkeit vor allem<br />
die Ausgewogenheit von Chancen bed<strong>eu</strong>te<br />
– und damit etwas völlig anderes.<br />
Die Umfragen decken sich mit den<br />
Befunden der Wissenschaft. Seit den<br />
achtziger Jahren geht die Schere zwischen<br />
Arm und Reich beständig auseinander.<br />
Doch seit etwa 2005 schließt sie<br />
sich bei den Einkommen wieder ein wenig,<br />
weil der Arbeitsmarkt brummt, konstatiert<br />
das D<strong>eu</strong>tsche Institut für Wirtschaftsforschung<br />
(DIW).<br />
Gewachsen sind dagegen die Barrieren<br />
zwischen den Schichten. In der Zeitspanne<br />
zwischen 1996 und 1999 schafften es in<br />
Westd<strong>eu</strong>tschland fast 70 Prozent der<br />
Menschen, sich aus der untersten Ein -<br />
kommensschicht nach oben zu arbeiten.<br />
Zwischen 2006 und 2009 konnten sich<br />
aber nur noch 52 Prozent verbessern. In<br />
Ostd<strong>eu</strong>tschland sind es sogar nur 45 Prozent.<br />
Von „Verharrungstendenzen“ spricht<br />
DIW-Forscher Markus Grabka. „Die Aufstiegsbewegung<br />
vom unteren Rand der<br />
Gesellschaft in die Mitte ist erlahmt.“<br />
Wenn es um soziale Dynamik geht, ist<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> nur Mittelmaß. In einem internationalen<br />
Vergleich von 28 Industrienationen<br />
sortierte das arbeitgebernahe<br />
Institut der d<strong>eu</strong>tschen Wirtschaft Köln die<br />
Bundesrepublik jüngst in Sachen Chancen -<br />
gerechtigkeit nur auf dem 14. Platz ein –<br />
hinter Rumänien und Slowenien.<br />
Dass es hierzulande so schwierig geworden<br />
ist, von unten nach oben zu kommen,<br />
untergräbt auch das Vertrauen in<br />
die Wirtschaftsordnung, wie vor knapp<br />
zwei Jahren der Sachverständigenrat<br />
mahnte. Nur dann, wenn es eine hohe<br />
Durchlässigkeit gebe, würden sich die<br />
Menschen aus der unteren Einkommensklasse<br />
„ausreichend motiviert fühlen, in<br />
ihre Qualifizierung und damit in ihren<br />
gesellschaftlichen Aufstieg zu investieren“,<br />
schrieben die fünf Wirtschaftsweisen.<br />
Und nur dann, wenn jeder glaubt,<br />
dass er es einmal selbst nach oben schaffen<br />
kann, wird er akzeptieren, dass es<br />
Menschen gibt, die mehr verdienen.<br />
Doch in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> droht der Glaube<br />
an ein besseres Leben verlorenzugehen.<br />
Der Darmstädter Soziologe Michael<br />
Hartmann erforscht, wer es hierzulande<br />
nach oben schafft. Die ernüchternde Erkenntnis<br />
lautet: Die da oben waren immer<br />
schon da. Und die da unten werden<br />
nach ganz oben nur sehr selten kommen.<br />
„Die Gesellschaft ist gespalten“, konstatiert<br />
Hartmann. „Hier glauben viele Menschen<br />
inzwischen, dass es ihren Kinder<br />
nicht bessergehen wird als ihnen selbst,<br />
sondern eher schlechter.“<br />
Dabei zählte die Überz<strong>eu</strong>gung, dass jeder<br />
es schaffen kann, wenn er sich nur<br />
anstrengt, zu den Gründungsmythen der<br />
alten Bundesrepublik. 1957, in den Jahren<br />
des Wirtschaftswunders, erfand der erste<br />
westd<strong>eu</strong>tsche Wirtschaftsminister Ludwig<br />
Erhard die Erfolgslosung vom „Wohlstand<br />
für alle“. Gut ein Jahrzehnt später ergänzte<br />
Bundeskanzler Willy Brandt Erhards<br />
materielle Verheißung um das Versprechen<br />
von sozialem Aufstieg: Mit Bildung<br />
für alle wollte die sozial-liberale<br />
Geförderter Jugendlicher Can DER SPIEGEL 33/2013 61
Serie<br />
Koalition eine weitgehend schrankenlose<br />
Gesellschaft schaffen, in der nicht das<br />
Schicksal der Geburt über die Zukunft<br />
eines Menschen entscheidet. Aus Arbeiterkindern<br />
sollten endlich auch Akademiker<br />
werden können.<br />
Eine Zeitlang funktionierte das sogar.<br />
Doch inzwischen wird der Aufstieg in die<br />
oberen Gesellschaftsetagen durch eine<br />
doppelte Barriere gebremst. Zum einen<br />
sorgt der gespaltene Arbeitsmarkt dafür,<br />
dass ganze Erwerbstätigen-Gruppen von<br />
der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt<br />
werden. Zum anderen versagt das Bildungssystem<br />
bei der Aufgabe, gleiche<br />
Startchancen für alle zu schaffen.<br />
Das Problem beginnt mit der Geburt.<br />
„In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> hängen die Bildungschancen<br />
der Kinder stark von der materiellen<br />
Lage ihrer Eltern ab“, sagt Soziologe<br />
Hartmann. Wenn der Nachwuchs<br />
dann auch noch aus einer Migranten -<br />
familie stammt, in der kaum D<strong>eu</strong>tsch gesprochen<br />
wird, ist der Kreislauf programmiert:<br />
kein D<strong>eu</strong>tsch, kein Schulabschluss.<br />
Kein Schulabschluss, kein Job.<br />
In der katholischen Kita St. Raphael<br />
im rheinland-pfälzischen Weißenthurm<br />
tummeln sich 115 Kinder. Kein einziges<br />
kommt aus einem Akademikerhaushalt,<br />
vier von fünf haben ausländische Wurzeln.<br />
Auf einer Weltkarte an der Wand<br />
können sie zeigen, wo ihre Eltern geboren<br />
wurden: in Syrien oder Russland, in<br />
Polen oder Marokko.<br />
Kita-Leiterin Martina Huckriede hat<br />
viel unternommen, um die Defizite ihrer<br />
Schützlinge auszugleichen. Sie hat das<br />
Personal aufgestockt und vier „interkulturelle<br />
Fachkräfte“ eingestellt. Sie hat sogar<br />
ein Qualitätshandbuch zur Sprachförderung<br />
verfasst. Seither hat sich vieles<br />
gebessert, und doch erlebt Huckenriede<br />
immer wieder, was sie „eine<br />
62<br />
THEODOR BARTH / DER SPIEGEL<br />
Kinder in der Kita St. Raphael in Weißenthurm<br />
typische Karriere“ nennt: Migrationshintergrund,<br />
Sprachprobleme,<br />
Schulabbruch. „Ich<br />
fr<strong>eu</strong>e mich über jedes Kind,<br />
das später einmal auf das<br />
Gymnasium geht oder eine<br />
tolle Handwerksausbildung<br />
macht.“<br />
Eigentlich sollten die Fähigkeiten und<br />
Talente eines Kindes über sein Schicksal<br />
entscheiden. Stattdessen sortiert das d<strong>eu</strong>tsche<br />
Bildungssystem nach sozialer Herkunft.<br />
Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien<br />
erreichen 79 die gymnasiale<br />
Oberstufe, aus Nicht-Akademiker-Haushalten<br />
schaffen es nur 43.<br />
Im Juni urteilte die Bertelmann-Stiftung<br />
über die Chancengleichheit im Bildungssystem,<br />
trotz leichter Fortschritte<br />
habe „auch weiterhin die soziale Herkunft<br />
großen Einfluss auf den Bildungserfolg“.<br />
Es ist der Ständestaat im modernen<br />
Gewand.<br />
Die Bildungspolitik ist ein nationales<br />
Notstandsgebiet. Statt Problemgruppen<br />
gezielt zu fördern, verzetteln sich die<br />
klammen Länder in einem sinnlosen<br />
Wettbewerb: vier Jahre Grundschule in<br />
Bayern, sechs Jahre in Berlin. Die einen<br />
schaffen die Hauptschule ab, die anderen<br />
halten an ihr fest. Mal Abitur in 13 Jahren,<br />
mal in 12 – oder man überlässt die Entscheidung<br />
einfach den Schulen selbst.<br />
„VIELE MENSCHEN GLAUBEN<br />
INZWISCHEN, DASS ES IHREN<br />
KINDERN NICHT BESSER -<br />
GEHEN WIRD ALS IHNEN SELBST.“<br />
Und noch immer verlassen jedes Jahr<br />
rund 50 000 junge Menschen ohne Hauptschulabschluss<br />
die Schulen.<br />
Wenn sie Glück haben, finden sie sogar<br />
einen Job. Der Weg in die oberen Ränge<br />
der Einkommenspyramide aber bleibt ihnen<br />
oft versperrt, weil die Arbeitswelt<br />
den sozialen Graben im Land weiter vertieft.<br />
Wer gut ausgebildet und flexibel ist,<br />
findet beste Job- und Karrierechancen.<br />
Viele Geringqualifizierte dagegen müssen<br />
sich mit einem Platz im wachsenden Niedriglohnsektor<br />
der Republik begnügen, in<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
dem beruflicher und materieller Aufstieg<br />
vielfach nicht mehr vorgesehen sind. Dabei<br />
haben die Arbeitsmarktreformen der<br />
rot-grünen Koalition geholfen, Armut in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zu verringern. Denn die entscheidende<br />
Bedingung, um am wachsenden<br />
Wohlstand teilzuhaben, ist Arbeit.<br />
Bis 2005 war die Arbeitslosigkeit in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> stets gestiegen, jeder Abschwung<br />
hinterließ einen höheren Sockel<br />
an Chancenlosen. Dann hat sich der Trend<br />
umgekehrt, selbst die Zahl der Langzeitarbeitslosen<br />
schrumpft. Doch<br />
der Erfolg hat seinen Preis.<br />
Das Normalarbeitsverhältnis<br />
mit unbefristetem und sicherem<br />
Vertrag wurde ergänzt mit<br />
dem unerbittlichen Prinzip<br />
der Hartz-Reform: Schlecht -<br />
bezahlte Arbeit ist besser als<br />
keine Arbeit.<br />
Seither wächst die Zahl niedrig entlohnter<br />
Jobs: Teilzeitstellen, Leiharbeit<br />
und Minijobs. Das senkte die Arbeits -<br />
losigkeit. Aber die n<strong>eu</strong>en flexiblen Jobs<br />
bildeten weniger Brücken in traditionelle<br />
Arbeitsverhältnisse als erhofft. Noch h<strong>eu</strong>te<br />
liegt die Arbeitslosenquote Gering -<br />
qualifizierter bei fast 20 Prozent. Dazu<br />
müssen die Betroffenen Unsicherheit und<br />
Härten ertragen.<br />
Oliver Schneider ist 32 Jahre alt. Er hat<br />
die Fachhochschulreife erlangt und eine<br />
Lehre als Kfz-Elektriker bei Daimler in
Wunsch und Wirklichkeit<br />
„Was ist soziale Gerechtigkeit?“<br />
IfD-Allensbach-Umfrage 2013<br />
Sindelfingen gemacht. Später wechselte<br />
er zu einer P<strong>eu</strong>geot-Werkstatt. Als nach<br />
zwei Jahren einer der Beschäftigten gehen<br />
musste, traf es Schneider. „Ich war der<br />
Jüngste und hatte keine Familie“, sagt er.<br />
Ende 2003 schickte ihn die Arbeitsagentur<br />
zu einer Zeitarbeitsfirma. In den<br />
vergangenen zehn Jahren ist Schneider<br />
davon nicht mehr losgekommen. Wenn<br />
ihn eine Zeitarbeitsfirma entließ, schickten<br />
ihn die Vermittler gleich wieder in<br />
die Leiharbeit; manchmal zum selben<br />
Unternehmen, das ihn gerade eben entlassen<br />
hatte.<br />
„Mittlerweile habe ich mindestens<br />
30 verschiedene Jobs in 45 Firmen gemacht“,<br />
sagt Schneider. Er arbeitete während<br />
einer Rückholaktion wieder beim<br />
Daimler auf Zeit. Er war Möbelpacker<br />
und Bauhelfer, er saß im Büro und stand<br />
an Maschinen in der Industrie. Mal war<br />
er für Tage, mal für Jahre an ein Unternehmen<br />
ausgeliehen. Vom „Klebeeffekt“<br />
der Zeitarbeit hat er nichts gespürt.<br />
„Wenn ich länger in einem Betrieb war,<br />
habe ich reingekloppt, um übernommen<br />
zu werden“, sagt Schneider. Geklappt<br />
hat es nie.<br />
Schneider bekommt um die 1050 Euro<br />
netto im Monat. Der Kfz-Elektriker hofft<br />
noch immer auf einen regulären Job, seine<br />
Chancen hält er für gering. Fragt man<br />
nach seiner Perspektive, fällt ihm nur ein<br />
Wort ein: „Beschissen.“<br />
Auswahl Ja-Antworten<br />
Dass man von dem Lohn für<br />
seine Arbeit auch leben kann<br />
91 %<br />
Alle Kinder haben die<br />
gleichen Chancen auf<br />
eine gute Schulausbildung<br />
Wer mehr leistet, soll auch<br />
mehr verdienen als derjenige,<br />
der weniger leistet<br />
Der Staat muss durch St<strong>eu</strong>ern<br />
dafür sorgen, dass die Einkommensunterschiede<br />
in der Gesellschaft<br />
nicht größer werden<br />
53 %<br />
70 %<br />
Familien mit Kindern werden<br />
vom Staat finanziell unterstützt 66 %<br />
90 %<br />
Anteil der Schulanfänger, die ein Studium beginnen<br />
Kinder von<br />
Nichtakademikern<br />
23 %<br />
Kinder von<br />
Akademikern<br />
77 %<br />
Einen Aufstieg aus der untersten Einkommensklasse<br />
in eine höhere schafften<br />
zwischen 1996 und 1999 2006 und 2009<br />
im Westen 69 % 52 %<br />
im Osten 64 %<br />
45 %<br />
Quellen: Statistisches Bundesamt, DSW/HIS 2012; Sachverständigenrat 2011<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> nähert sich einer Drei-<br />
Klassen-Gesellschaft: An der Spitze stehen<br />
Manager mit Millionengehältern,<br />
Freiberufler mit gutgehenden Kanzleien<br />
oder Büros, erfolgreiche Selbständige. Es<br />
folgt die Masse gutausgebildeter Angestellter<br />
und Facharbeiter mit hohen und<br />
durchschnittlichen Löhnen. Das untere<br />
Drittel der Geringqualifizierten und Ausgest<strong>eu</strong>erten<br />
aber hat kaum Aussicht auf<br />
Aufstieg.<br />
In den ersten Nachkriegsjahrzehnten<br />
profitierten auch die mit wenig Lohn<br />
vom wachsenden Wohlstand. H<strong>eu</strong>te<br />
sind selbst Menschen, die früher zum<br />
Kern bestand der Arbeitnehmerschaft<br />
zählten – Verkäufer, Erzieherinnen oder<br />
Köche –, von der Einkommensentwicklung<br />
abgekoppelt.<br />
„Insbesondere ab Mitte der n<strong>eu</strong>nziger<br />
Jahre öffnete sich die Einkommensschere<br />
zwischen Gering- und Hochqualifizierten“,<br />
sagt Ulrich Walwei, Vizedirektor<br />
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<br />
(IAB). Nach Berechnungen<br />
des Instituts fielen die Reallöhne der Geringqualifizierten<br />
in den vergangenen<br />
zwei Jahrzehnten auf den Stand von<br />
1984, während die der Hochqualifizierten<br />
kräftig stiegen – trotz Krisen und Lohnzurückhaltung.<br />
Wer viel hat, bekommt immer mehr.<br />
Wer nicht mal Bildung besitzt, bleibt Verlierer.<br />
Es ist ein T<strong>eu</strong>felskreis, der die soziale<br />
Schichtung im Land weit stärker<br />
prägt als jede St<strong>eu</strong>er- oder Gesundheitsreform.<br />
Für die Politiker ist das eine bittere<br />
Nachricht. Wollen sie <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> wirklich<br />
gerechter machen, so lautet die Botschaft,<br />
müssten sie für mehr Aufstiegsmöglichkeiten<br />
sorgen, vor allem im Bildungswesen<br />
und am Arbeitsmarkt.<br />
Doch die Pläne von Sozialdemokraten<br />
und Grünen, mehr Geld bei den Reichen<br />
einzusammeln und in die Bildung zu stecken,<br />
sind nur bedingt hilfreich. So zeigt<br />
eine n<strong>eu</strong>e DIW-Studie, dass die St<strong>eu</strong>erpläne<br />
viel weniger Geld einbringen werden<br />
als gedacht. Außerdem haben die Parteien<br />
noch weitere kostspielige Versprechen<br />
im Angebot.<br />
Vor allem aber lässt sich das Problem<br />
nicht allein mit Geld lösen. Mehr Krippenplätze<br />
und Erzieher bringen wenig,<br />
wenn Familien ihre Kinder gar nicht erst<br />
in die Kita schicken. Und den Arbeitsmarkt<br />
auf Aufstieg zu programmieren<br />
verlangt ein Umdenken bei allen Beteiligten.<br />
Nötig wären Unternehmer, die<br />
mehr in Weiterbildung investieren, Arbeitsvermittler,<br />
die stärker auch geringqualifizierte<br />
Beschäftigte betr<strong>eu</strong>en, und<br />
Politiker, die Schluss machen mit der Privilegierung<br />
prekärer Beschäftigungsverhältnisse<br />
wie zum Beispiel Minijobs. „Wir<br />
müssen die Forderung nach lebenslangem<br />
Lernen endlich ernst nehmen“, sagt IAB-<br />
Vizedirektor Walwei.<br />
Doch mit solch langwierigen Umbauprogrammen<br />
lassen sich kaum kurzfristige<br />
politische Erfolge erzielen. Und so<br />
greifen Bürger, die etwas gegen die größten<br />
Gerechtigkeitsdefizite im Land unternehmen<br />
wollen, zur Selbsthilfe.<br />
Berater Fabian Barthel hatte irgendwann<br />
genug davon, nur zuzusehen, wie<br />
das System Bildungsverlierer in Serie produziert.<br />
Deshalb trat er der Initiative<br />
„Joblinge“ bei, einem Sozialprojekt der<br />
Boston Consulting Group und der Eberhard<br />
von Kuenheim Stiftung. Barthel will<br />
nicht, dass „die Frage, ob man in einem<br />
akademischen Umfeld oder in einem sozialen<br />
Brennpunkt groß geworden ist,<br />
den Lebensweg bestimmt“. Deshalb hat<br />
er mit Can über Wochen trainiert, wie<br />
man Bewerbungen schreibt und im Vorstellungsgespräch<br />
antwortet.<br />
Inzwischen gibt es Erfolge. N<strong>eu</strong>lich hat<br />
Can ein Praktikum bei einer Versicherung<br />
gemacht. Im September tritt er eine Lehrstelle<br />
an. Und Can hat noch mehr Ziele.<br />
„Mein Traum ist, dass ich mir irgendwann<br />
eine eigene Wohnung in einer guten Gegend<br />
leisten kann“, sagt er. Schwabing<br />
zum Beispiel gefällt ihm gut.<br />
In München ist das ganz weit oben.<br />
MARKUS DETTMER, CORNELIA SCHMERGAL<br />
63
Wahlkämpfer Kraft, Steinbrück in Mettmann<br />
RALPH SONDERMANN<br />
„Wir sind die Guten“<br />
Was ist h<strong>eu</strong>te sozialdemokratisch? In Nordrhein-Westfalen, ihrem Herzland, verstehen sich<br />
die Sozialdemokraten als große Kümmerer, und Hannelore Kraft ist ihr Idealbild.<br />
Wenn es schiefgeht am 22. September, könnte Kraft Parteichefin werden. Von Stefan Willeke<br />
An einem dieser heißen Sommerabende,<br />
die jeden vernünftigen<br />
Gedanken verdunsten<br />
lassen, setzt sich Rudolf<br />
WAHL<br />
Malzahn in sein Auto und<br />
2013<br />
fährt zum Carolinenglück.<br />
Das Bergwerk Carolinenglück gibt es<br />
zwar schon seit fast 50 Jahren nicht mehr,<br />
aber die Kleingartensiedlung Carolinenglück<br />
und das Vereinsheim Carolinenglück<br />
sind noch immer da. Das Glück hat<br />
also überlebt, das ist das Wichtigste.<br />
Malzahn ist guter Dinge. Er hat das rote<br />
Parteibuch eines n<strong>eu</strong>angeworbenen Ge -<br />
nossen in die Tasche gesteckt, als Beleg für<br />
einen Trend. Er trägt eine rote Hose, auch<br />
das ist eine Mitteilung. „Ich hole ein paar<br />
L<strong>eu</strong>te zusammen“, hat er am Telefon gesagt,<br />
und das hörte sich ein bisschen so an,<br />
als hätte der Anführer der Hells Angels angekündigt:<br />
„Ich hole die Jungs zusammen.“<br />
64<br />
Da sitzen sie dann eng nebeneinander<br />
an einem Kneipentisch, fünf Männer aus<br />
dem Vorstand des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme,<br />
mit Gesichtern wie aus<br />
einem Bilderbuch der d<strong>eu</strong>tschen Arbeiterbewegung.<br />
Rudolf Malzahn, genannt<br />
Rudi, gelernter Maschinenschlosser, Chef<br />
des Ortsvereins. Martin Oldengott, Wirtschaftsförderer<br />
in Castrop-Rauxel. Gerhard<br />
Gleim, genannt Gerd, Klempner.<br />
Dieter Schröder, ehemals Fuhrparkchef<br />
bei Aldi in Datteln. Norbert Kriech, Elektriker.<br />
Norbert hat eine Narbe neben dem<br />
rechten Auge. Dieter trägt einen Brustb<strong>eu</strong>tel.<br />
Gleich werden sie bei der Kellnerin<br />
eine Platte Mettbrötchen bestellen.<br />
Die SPD in Bochum-Hamme ist der bekannteste<br />
Ortsverein der Partei, seit diese<br />
Männer auf eine Idee kamen, für die sie<br />
sich noch h<strong>eu</strong>te lieben: Wir schmeißen<br />
Wolfgang Clement raus, den früheren<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen,<br />
Kanzler Schröders Superminister.<br />
Clement hatte vor der hessischen Landtagswahl<br />
im Jahr 2008 in einem Zeitungsbeitrag<br />
dazu geraten, der SPD die Stimme<br />
zu verweigern, und der kleine SPD-Ortsverein<br />
aus Bochum strengte ein Ausschlussverfahren<br />
an. Am Ende wurde Clement<br />
nicht rausgeworfen, aber er war zermürbt<br />
und trat aus.<br />
Rudi sagt: „Der Wolfgang Clement war<br />
noch nie ein Sozialdemokrat.“ Genau genommen<br />
nennt er ihn gar nicht Clement,<br />
er sagt immer „Klemment“, mit kurzem<br />
e. Das klingt dann, als hätte sich bei Clement<br />
etwas Entscheidendes verklemmt.<br />
Norbert sagt: „Die SPD war immer für<br />
die Schwachen da.“<br />
Rudi sagt: „Wir sind ein Bollwerk.“<br />
Martin sagt: „Wir sind in einer Schwarzweiß-Welt<br />
groß geworden.“
Serie<br />
Dieter sagt: „Wir sind Links-Denker.“<br />
Weil Rudi Malzahn gern das letzte<br />
Wort behält, sagt er noch: „Wir sind die<br />
Kümmerer.“<br />
Das hat er auch Sigmar Gabriel auf<br />
einer Veranstaltung zugerufen, dem Parteichef,<br />
damit der weiß, wer die echten<br />
Kümmerer sind, diejenigen, die sich<br />
schon gekümmert haben, bevor die nordrhein-westfälische<br />
Ministerpräsidentin<br />
Hannelore Kraft und ihre L<strong>eu</strong>te sich<br />
ständig Kümmerer nannten. „Sigmar“,<br />
rief Malzahn mit seiner durchdringen -<br />
den Stimme, „hömma, wir sind die Küm -<br />
merer!“<br />
Das war der Versuch, Bochum-Hamme<br />
zum Modell zu machen – für die ganze<br />
Partei. Es war auch der Versuch, dem Vorsitzenden<br />
zu erklären, warum sich die Sozialdemokratie<br />
in Nordrhein-Westfalen<br />
nach ein paar elenden Jahren politisch<br />
erholt hat, warum sie konstanter ist als<br />
die Bundespartei, erfolgreicher.<br />
Nordrhein-Westfalen wird von der SPD<br />
regiert, zusammen mit den Grünen. Bei<br />
der Landtagswahl im Mai 2012 holte die<br />
Partei der Ministerpräsidentin 39 Prozent<br />
der Stimmen. In Meinungsfragen steht<br />
Kraft noch h<strong>eu</strong>te ungewöhnlich gut da.<br />
Martin sagt: „In vier Jahren ist sie Kanzlerkandidatin.“<br />
Norbert sagt: „Wenn Hannelore<br />
Kraft jetzt schon angetreten wäre,<br />
hätten wir bessere Chancen.“ Es ist völlig<br />
klar, dass sie einem Kandidaten, der niemals<br />
eine Flasche Pinot Grigio für fünf<br />
Euro kauft, von Grund auf misstrauen.<br />
In der Adventszeit verteilen die L<strong>eu</strong>te<br />
von der SPD Bochum-Hamme Weihnachtsmänner<br />
aus Schokolade, versehen<br />
mit einem kleinen Flugblatt. Am Muttertag<br />
verschenken sie Rosen, auch mit Flugblatt.<br />
Sie besorgen Wohnungen für Alte,<br />
beschaffen dem Fußballverein Geld. Sie<br />
setzten sich dafür ein, eine Baracke niederzureißen,<br />
in der Asylbewerber lebten,<br />
und die Menschen auf andere Wohnungen<br />
zu verteilen. Gerd sagt, er habe ein<br />
Foto vom Patriarchen eines Roma-Clans<br />
geschossen, der am Straßenrand auf einem<br />
Sessel thront und seine Füße in einer<br />
Wasserwanne badet.<br />
Die Männer von der SPD sind für geordnete<br />
Verhältnisse. Sie prozessieren<br />
gern. Im Augenblick klagen sie gegen den<br />
Betrieb einer Mülldeponie. Steckt man<br />
in einem Konflikt, dann ist es bestimmt<br />
ein beruhigendes Gefühl, einen dieser<br />
Männer hinter sich zu wissen. Aber sie<br />
sind auch die Pest. Es muss nur einer von<br />
Malzahns Gruppe in einer Behörde auftauchen.<br />
Man kann sich gut vorstellen,<br />
wie sich die Sachbearbeiter dann in ihren<br />
Zimmern einschließen, weil sie ahnen,<br />
dass gleich eines ihrer Vorhaben blockiert<br />
werden soll.<br />
Malzahns Männer waren auch dagegen,<br />
dass die Love Parade in Bochum stattfindet,<br />
wegen der Enge und des Drecks.<br />
„Die Geschichte hat uns recht gegeben“,<br />
sagt Martin. Norbert sagt: „Sozialdemokrat<br />
ist man, wenn man sich für die Mehrheit<br />
der Bevölkerung einsetzt.“<br />
Rudi sagt: „Wir sind hier weit und breit<br />
der einzige Ortsverein mit einem Mitgliederzuwachs.“<br />
160 Genossen, Jahr für Jahr<br />
ein paar mehr. Einer ist mal ausgetreten,<br />
der ehemalige Schriftführer, wegen des<br />
Rauchverbots in Kneipen. Gerd sagt: „Ich<br />
habe schon in der dritten Klasse geraucht.“<br />
In die Gesichter dieser Männer haben<br />
sich Lebensgeschichten gegraben. Rudi<br />
Malzahn und seine Genossen spielen sich<br />
Mitglieder des SPD-Ortsvereins Bochum-Hamme*<br />
auf, aber sie verstellen sich nicht. Sie verkörpern<br />
etwas, um das sich Politiker bemühen.<br />
Man braucht nicht viel Phantasie, um<br />
die politische Linie aus Bochum-Hamme<br />
zur Staatskanzlei in Düsseldorf zu verlängern,<br />
wo seit drei Jahren eine Sozialdemokratin<br />
regiert, die viel Geld in benachteiligte<br />
Städte und in benachteiligte<br />
Familien steckt, die Studiengebühren gestrichen<br />
und damit ärmere Familien entlastet<br />
hat, die den gemeinsamen Schulunterricht<br />
von behinderten und nicht -<br />
behinderten Kindern fördert. „Kein Kind<br />
zurücklassen“, das ist ihre wichtigste poli -<br />
tische Botschaft.<br />
Fasst man Krafts Bilanz wohlwollend<br />
zusammen, dann kann man sagen: Sie<br />
macht die Sozialdemokratie bei den Menschen<br />
glaubhaft, die sie wählen sollen.<br />
Sie macht sich verdient um Politik, weil<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
sie der Politikverdrossenheit, die im Kern<br />
aus Politikerverdrossenheit besteht, mit<br />
ihrer frappierenden Normalität entgegenwirkt.<br />
Von anderen Sozialdemokraten<br />
wird sie um ihre Popularität beneidet.<br />
Das Erstaunliche an Hannelore Kraft<br />
ist die Stille, die sie geschaffen hat. Ihre<br />
Politik verursacht fast keine störenden<br />
Geräusche. Sie koaliert mit den Grünen,<br />
aber anders als bei ihren sozialdemokratischen<br />
Vorgängern Peer Steinbrück und<br />
Wolfgang Clement, die lieber mit der<br />
FDP als mit den Grünen regiert hätten,<br />
dringt kein politischer Streit nach draußen.<br />
Es ist ihr gelungen, sich durchzusetzen,<br />
ohne sich in Kämpfen aufzureiben.<br />
„Sie hat zwar die Macht, aber sie fängt<br />
damit wenig an“, sagt ein Sozialdemo-<br />
krat, der viele SPD-Politiker ehemaliger<br />
Landesregierungen gut kennt. „Früher<br />
stellte sich ein Ministerpräsident gegen<br />
den Wind, weil er glaubte, er müsse die<br />
Richtung des Windes ändern. Hannelore<br />
Kraft lässt sich mit dem Wind treiben.<br />
Vielleicht ist das die weibliche Art, Politik<br />
zu machen, vielleicht ist es sogar die klügere<br />
Methode.“<br />
Der Christdemokrat Jürgen Rüttgers,<br />
der im Jahr 2010 als Ministerpräsident<br />
von Nordrhein-Westfalen abgelöst wurde,<br />
hoffte noch, sich das Image des früheren<br />
SPD-Regierungschefs Johannes Rau aneignen<br />
zu können. Aber das ging schief.<br />
Rüttgers bemühte sich um den Nachlass<br />
des politischen Gegners und machte sich<br />
* V. l.: Martin Oldengott, Dieter Schröder, Rudolf Malzahn,<br />
Gerhard Gleim, Norbert Kriech im Vereinsheim<br />
Caro linenglück.<br />
65<br />
KARSTEN SCHÖNE / DER SPIEGEL
Serie<br />
FOTOS: KARSTEN SCHÖNE / DER SPIEGEL<br />
Opel-Betriebsrat Einenkel<br />
Sozialdemokratin Hördum<br />
dadurch unglaubwürdig. Hannelore Kraft<br />
unternimmt gar nicht erst den Versuch,<br />
sich mit ihren Vorgängern in eine Reihe<br />
zu stellen. Ohnehin misstraut sie den alten<br />
Männerbünden der nordrhein-westfälischen<br />
SPD, den Skatrunden und Biertischbeschlüssen,<br />
und deswegen misstraut<br />
sie zugleich einem Teil ihrer eigenen Biografie.<br />
So ist sie ja groß geworden, in Mülheim<br />
an der Ruhr, umgeben von der Stahl -<br />
arbeiter-SPD der siebziger und achtziger<br />
Jahre. Sie kann fünfmal kurz hintereinander<br />
„dat“ und „wat“ sagen – was dann<br />
wie eine Verneigung vor ihrer eigenen<br />
Geschichte wirkt. Aber man würde Hannelore<br />
Kraft unterschätzen,<br />
wenn man annähme, sie führe<br />
nichts im Schilde.<br />
Besucht man sie in ihrem<br />
Büro in Düsseldorf, dann sitzt<br />
man einer auf merksamen<br />
Frau gegenüber, die eine knallrote<br />
Hose trägt und nicht bereit<br />
ist, sich politisch festzu -<br />
legen. Fragt man sie, ob sie für die untere<br />
Hälfte der Gesellschaft Politik mache,<br />
dann antwortet sie: „Nicht ausschließlich.“<br />
Sie handle auch im Sinne der<br />
mittelstän dischen Unternehmer.<br />
Hannelore Kraft spricht von Politik wie<br />
von einer Werkstatt. Politik müsse reparieren,<br />
was kaputtgegangen sei. Sie sagt:<br />
„Ich sehe all die Menschen vor mir, die<br />
es im Leben schwer haben.“ Dafür findet<br />
man in ihrer Politik eine Menge Belege.<br />
Dann, am Ende des Gesprächs, wird sie<br />
<strong>eu</strong>phorisch und sagt über die SPD einen<br />
bemerkenswerten Satz: „Wir sind die Guten.“<br />
Das ist ein Satz, der hängenbleibt.<br />
Man könnte denken, das sei ein flapsiger<br />
Wahlkampf-Slogan, aber sie meint<br />
diesen Satz ernst. Als sich Kraft nach der<br />
66<br />
Landtagswahl im Jahr 2010 mit den Verhandlungsführern<br />
der CDU im Konferenzraum<br />
eines Düsseldorfer Flughafenhotels<br />
traf, um die Chancen für eine gemeinsame<br />
Regierung zu sondieren, ging<br />
es anderthalb Stunden lang allein darum,<br />
den Christdemokraten moralisches Versagen<br />
vorzuhalten. Kraft regte sich damals<br />
über ein „Kraftilanti“-Wahlplakat<br />
der CDU auf, das sie als ätzenden Spott<br />
empfunden hatte. Beobachter erinnern<br />
sich daran, wie unablässig Hannelore<br />
Kraft die CDU-Politiker in jeder der gemeinsamen<br />
Sitzungen zu einer Katharsis<br />
nötigen wollte, bevor sie bereit war, über<br />
Inhalte zu reden. Die politische Stärke<br />
ALLES, WAS SICH NICHT AUS<br />
DER VERGANGENHEIT ERGIBT, GILT<br />
ALS VERDÄCHTIG. DAS IST DAS<br />
SOZIALDEMOKRATISCHE DILEMMA.<br />
war ihr nicht genug, auch moralisch musste<br />
sie gewinnen.<br />
„Wir sind die Guten.“ Das könnte die<br />
Losung des Jahres 2013 werden. Jeder<br />
möchte gut sein, moralisch überlegen. Sogar<br />
die Anti-Euro-Partei Alternative für<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> plakatierte den Satz auf eine<br />
Wand in einer Versammlungshalle. Selbst<br />
Politiker, die aus der Politik geflohen sind,<br />
wie der ehemalige Hamburger Bürgermeister<br />
Ole von B<strong>eu</strong>st, bemühen mora -<br />
lische Kategorien, um ihre Motive zu veredeln.<br />
Die Guten sind überall. Nur: Was<br />
ändert sich dadurch?<br />
Die Sozialdemokratie ist zu einem unscheinbaren<br />
Gast geworden an einem Ort,<br />
der ihr eigentlich gehören müsste, den<br />
Opel-Werken in Bochum. Die Stadt wird<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
von der SPD regiert, seit es die Bundesrepublik<br />
gibt. Auch als andere rote Städte<br />
an der Ruhr plötzlich schwarz wurden,<br />
blieb Bochum rot.<br />
Opel war der Beweis für politische Weitsicht.<br />
Noch bevor die meisten Bergwerke<br />
in den sechziger Jahren starben, trafen<br />
sich Politiker mit den Managern des Autokonzerns<br />
General Motors in Hotels außerhalb<br />
der Stadt. In geheimen Verhandlungen<br />
holten Politiker die Opel-Werke<br />
in die Stadt, gegen den Willen des Bergbaus,<br />
der sich vor einer Konkurrenz fürchtete,<br />
die höhere Löhne zahlen könnte.<br />
Dem Bergbau gehörten die Flächen, auf<br />
denen die Opel-Werke entstehen sollten,<br />
und die Politiker traten als Zwischenhändler<br />
auf, die ihre wahren<br />
Absichten verschleierten.<br />
Opel war ihr Scoop.<br />
Das Werk wurde später zu<br />
einem Aushängeschild der Sozialdemokratie,<br />
weil in ihm<br />
vieles zusammenkam, wofür<br />
die SPD stand. Opel war der<br />
Sieg des politischen Willens über die vorherrschende<br />
Industrie. Opel bed<strong>eu</strong>tete Ern<strong>eu</strong>erung,<br />
20000 Arbeitsplätze. Opel löste<br />
ein Versprechen ein, das die Sozialdemokraten<br />
der siebziger Jahre gaben: Morgen<br />
wird es <strong>eu</strong>ch besser gehen. Das war ein<br />
ma terialistischer Zugang zur Politik, aber<br />
einer, der ein ganzes Land beflügelte.<br />
Inzwischen steckt Opel tief in der Krise,<br />
das Bochumer Werk soll Ende kommenden<br />
Jahres geschlossen werden, dagegen<br />
haben die Arbeiter oft protestiert. Früher<br />
waren das Veranstaltungen, auf denen<br />
die roten Fahnen der IG Metall neben<br />
denen der SPD flatterten. Fragt man<br />
Rainer Einenkel, den Chef des Betriebsrats<br />
im Bochumer Autowerk, wie viele<br />
seiner L<strong>eu</strong>te h<strong>eu</strong>te noch Sozialdemokra-
ten seien, dann muss er eine Weile überlegen.<br />
Der Betriebsrat hat 31 Mitglieder.<br />
„Vier müssten es sein“, sagt Einenkel, „ich<br />
weiß es aber nicht genau. Die treten nicht<br />
groß in Erscheinung.“<br />
Im Dezember erklärte der Kanzlerkandidat<br />
Peer Steinbrück in einer Talkshow,<br />
es sei sinnlos, das Bochumer Werk zu<br />
retten, es sei wirtschaftlich am Ende. Und<br />
es folgte einer dieser Tage, an denen<br />
Einenkel zu den Sozialdemokraten im<br />
Opel-Betriebsrat ging und ihnen sagte:<br />
„Nehmt es nicht persönlich.“ Der parteilose<br />
Einenkel, der früher Kommunist war,<br />
ist inzwischen geübt darin, Sozialdemokraten<br />
zu trösten.<br />
Es sei seltsam, sagt Einenkel, mit dem<br />
Wirtschaftsministerium des Landes habe<br />
er kaum noch Kontakt. Schlage er morgens<br />
seine Pressemappe auf, entdecke er<br />
nie einen Artikel über Opel, in dem Hannelore<br />
Kraft vorkomme. Äußert sie sich<br />
dazu nicht, weil sie hier nichts mehr gewinnen<br />
kann? Einenkel gibt noch nicht<br />
auf. Vor Jahren sei ihm schon einmal mitgeteilt<br />
worden, das Werk werde geschlossen.<br />
Ein Datum für das Ende wurde genannt,<br />
und eine Uhrzeit. Aber das Werk<br />
hat überlebt.<br />
Fragt man Einenkel, ob es für die Opel-<br />
Arbeiter noch Gründe gebe, SPD zu wählen,<br />
antwortet er: „Einen Grund muss es<br />
noch geben, ja.“<br />
Welchen?<br />
„Vielleicht wegen der sozialen Gerechtigkeit.“<br />
Wo sehen Sie die?<br />
Er versucht, etwas zu entgegnen, aber<br />
ihm fällt nichts ein. Schließlich sagt er:<br />
„Es ist nicht so, dass wir meinen: Die SPD<br />
hilft uns.“<br />
Sozialdemokraten sind hier nicht die<br />
Guten und nicht die Bösen. Sie sind hilflose<br />
Beobachter. Das kann man bedauern,<br />
aber man kann es Hannelore Kraft nicht<br />
vorwerfen. Es wäre aber an der Zeit zu<br />
fragen: Was kommt, wenn Opel geht?<br />
Gibt es ein sozialdemokratisches Bild der<br />
Zukunft, einen Entwurf, irgendetwas, das<br />
die politische Phantasie anspricht? Ein<br />
Versprechen, das besser in die Zeit passt<br />
als Opel?<br />
Vor langer Zeit war die SPD in Nordrhein-Westfalen<br />
eine Macht der Ern<strong>eu</strong>erung,<br />
inzwischen ist sie ein Reparatur -<br />
betrieb, dessen Chefin sich überlegt, für<br />
welchen Schaden sie zuständig ist, für<br />
welchen nicht. Der fröhliche Materia -<br />
lismus, den die SPD einst in wirtschaftlich<br />
stabileren Zeiten verströmte, ist einem<br />
engagierten Flickschustern gewichen, das<br />
viel Geld kostet.<br />
130 Milliarden Euro Schulden hat<br />
Nordrhein-Westfalen angehäuft. Solange<br />
die St<strong>eu</strong>ereinnahmen so hoch sind wie<br />
im Augenblick, ist Krafts Politik nicht<br />
akut in Gefahr. Verringern sich die<br />
Einnahmen, droht sofort die Grundlage<br />
zu zerbrechen. Im März rügte das<br />
Landesverfassungs gericht in Münster<br />
zum dritten Mal Nordrhein-Westfalens<br />
Haushalt. Der Haushalt sei verfassungswidrig,<br />
wegen der hohen Kredite, so etwas<br />
ist bei früheren Landesregierungen<br />
nicht vorgekommen.<br />
Blickt man argwöhnisch auf Hannelore<br />
Kraft, dann kann man sagen: Sie baut<br />
ihre Regierung zu einem Landessozialamt<br />
um. Sie vergrößert die Basis der<br />
poli tisch Begünstigten, aber sie verkleinert<br />
den gestalterischen Ehrgeiz an der<br />
Spitze. Die SPD hat keine Idee gefunden,<br />
die nach vorn weist, das ist ihr Problem.<br />
Wen vertritt die Partei, wenn es immer<br />
sinnloser wird, sich für Fabrikarbeiter<br />
starkzumachen, von denen es immer<br />
weniger gibt? Was hat die SPD einem
Serie<br />
Menschen zu sagen, der keine schwere<br />
Last mehr trägt?<br />
Tine Hördum ist so ein Mensch. In ihrer<br />
Familie gibt es keine Bergarbeiter, sie<br />
fährt auch keinen Opel. Vor einem Café<br />
in Köln bindet sie ihr Fahrrad an einem<br />
Laternenpfahl fest. Sie setzt sich lachend<br />
auf einen Stuhl und steckt die Sonnenbrille<br />
ins Haar. Sie sagt, sie mag den Sommer.<br />
Tine Hördum ist 30 Jahre alt, seit<br />
2012 ist sie im Landesvorstand der SPD.<br />
Tine Hördum machte auf sich auf -<br />
merksam, weil sie die erste Frau war, die<br />
in Köln die Juso-Gruppe leitete, in der<br />
dann die Zahl der Mitglieder überraschend<br />
stark stieg. Sie wohnt in Köln-<br />
Rodenkirchen, einem sehr bürgerlichen<br />
Viertel, frei von sozialen Schäden. Zwischen<br />
Tine Hördum in Köln-Rodenkirchen<br />
und Rudi Malzahn in Bochum-<br />
Hamme gibt es keine Verbindung außer<br />
dem Parteibuch.<br />
Man müsste Tine Hördum mühevoll erklären,<br />
wie eine Kokerei funktioniert.<br />
Viele Menschen verstehen nicht sofort,<br />
was sie meint, wenn sie mit einer ihrer<br />
liebsten Abkürzungen um sich wirft:<br />
ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).<br />
Bei den Kölner Stadtwerken ist sie<br />
für Europapolitik zuständig. Europa beschäftigt<br />
sie sehr. Sie hat Fr<strong>eu</strong>nde in Italien,<br />
sie hat einen dänischen und einen<br />
68<br />
d<strong>eu</strong>tschen Pass. Oft hat sie in Brüssel zu<br />
tun. Das ist die berufliche Seite.<br />
Die sozialdemokratische Seite ist anders.<br />
Sobald sie sich für Familien in sozialen<br />
Brennpunkten einsetzt, muss sie<br />
das Viertel verlassen, in dem sie lebt. Sie<br />
muss sich für Menschen interessieren, die<br />
Schwierigkeiten haben, die Miete zu zahlen.<br />
Sie muss sich aus ihrem eigenen Leben<br />
entfernen. Sie vertieft sich in Probleme,<br />
die nicht ihre sind. Das ist ein poli -<br />
tischer Auftrag, und den nimmt sie ernst.<br />
Sie sagt, sie sei in die SPD eingetreten,<br />
weil das die Partei des sozialen Zusam-<br />
Stahlarbeiter in Duisburg<br />
menhalts sei. Sie ist bereit, bis Bochum-<br />
Hamme zu denken, auch wenn ihr Brüssel<br />
näherliegt.<br />
Eine junge Sozialdemokratin, die in<br />
<strong>eu</strong>ropäischen Kategorien denkt, fern von<br />
alten Seilschaften, das könnte ein interessanter<br />
Weg sein. Jemand wie Tine Hördum<br />
könnte Modell stehen für eine so -<br />
zialdemokratische Idee, die sich gegen<br />
ihre Beharrungskräfte durchsetzt. Aber<br />
so sind die Verhältnisse in Nordrhein-<br />
Westfalen noch lange nicht, das ist das<br />
sozialdemokratische Dilemma. Was sich<br />
nicht aus der Vergangenheit erschließt,<br />
gilt sofort als verdächtig oder als Verrat.<br />
Man sieht es an Norbert Römer, dem<br />
Fraktionschef der SPD im Landtag. Er ist<br />
Hannelore Krafts wichtigster Vertrauter,<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
VOLKER HARTMANN / DAPD<br />
66 Jahre alt. Römer war früher Chef der<br />
Bergarbeiterzeitung „Einheit“, ein knochenharter<br />
Lobbyist der Montanindustrie.<br />
Die „Einheit“ war für die SPD an der<br />
Ruhr immer das, was der „Bayernkurier“<br />
für die CSU ist, nicht bloß eine Zeitung,<br />
sondern eine Festung. Wer wie Römer<br />
der „Einheit“ vorstand, hat sich als Planierraupe<br />
bewährt. Manche seiner Genossen<br />
nennen ihn „Hannelores Kettenhund“.<br />
Das Überraschende daran ist, dass<br />
es Kraft gelungen ist, Römer an ihre Kette<br />
zu legen.<br />
Stärker denn je versucht sie, die Fraktion<br />
im Landtag geschlossen auf ihre Linie<br />
zu ziehen. Ein Abgeordneter sagt: „Kraft<br />
hat einen Plan, den kaum jemand kennt.<br />
Römer könnte ihn kennen.“ Der Plan<br />
könnte sein: Bundesvorsitzende der Partei<br />
zu werden, falls SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />
am 22. September über eine drastische<br />
Wahlniederlage stürzen sollte. Dann würde<br />
sich die Frage nach der Ern<strong>eu</strong>erung<br />
stellen, und auf Hannelore Kraft käme<br />
die SPD sehr schnell. Bundespolitik, Berlin?<br />
Das hat sie immer dementiert.<br />
Ministerpräsidentin, so bet<strong>eu</strong>ert sie,<br />
werde sie bleiben, und ihre Absage an<br />
Berlin ist auch ein Instrument in Düsseldorf.<br />
Rebellen gibt es in ihrer Fraktion<br />
ohnehin nicht mehr, aber wenn mal ein<br />
Abgeordneter wagt, sich querzustellen,<br />
kommt hinterher Norbert Römer oder<br />
einer seiner Verbündeten und bittet den<br />
Abweichler zum Gespräch. Über die Besoldung<br />
von Beamten wurde im Juli heftig<br />
gestritten. „In der ganzen Debatte“,<br />
sagt ein Abgeordneter, „bewegte sich<br />
Kraft keinen Millimeter. Das ging schon<br />
Richtung Basta-Politik. Sie fühlt sich persönlich<br />
angegriffen, wenn zu viele L<strong>eu</strong>te<br />
nicht ihrer Meinung sind. In dieser Unerbittlichkeit<br />
ähnelt sie inzwischen Wolfgang<br />
Clement.“<br />
Es gibt niemanden in der Fraktion, der<br />
ihr gefährlich werden könnte, niemanden,<br />
der es wagt, sie herauszufordern. Des -<br />
wegen nennen einige SPD-Abgeordnete<br />
sie „Mutti“ – Angela Merkels Spitzname.<br />
Aber das ist ein heimlicher Spott, eine<br />
kleine Gemeinheit, die bloß getuschelt<br />
wird. Dass es sich niemand mit ihr verderben<br />
will, sagt etwas über Hannelore<br />
Krafts Autorität, aber es sagt noch viel<br />
mehr über die Verzagtheit in ihrer Partei.<br />
Krafts Fraktionschef Norbert Römer<br />
drückt es so aus: „Die SPD ist da am<br />
erfolgreichsten, wo sie ganz alt ist und<br />
sich auf ihre Traditionen besinnt.“ Treffender<br />
kann man das Dilemma nicht<br />
beschreiben.<br />
Im nächsten Heft: Regieren im Haifisch -<br />
becken Berlin. Dazu ein Essay über das<br />
Ostd<strong>eu</strong>tsche in Angela Merkel.
Subventionsempfänger Landwirtschaft<br />
FINANZPOLITIK<br />
Stillstand beim Subventionsabbau<br />
ANDREAS DUNKER / NRW-IMAGE.DE<br />
Die Bundesregierung ist in den vergangenen drei Jahren mit<br />
dem Abbau von Subventionen kein Stück vorangekommen.<br />
Das geht aus dem n<strong>eu</strong>en Subventionsbericht hervor, den Finanzminister<br />
Wolfgang Schäuble (CDU) in dieser Woche dem<br />
Kabinett vorlegt. Demnach werden die direkten Finanzhilfen<br />
und St<strong>eu</strong>ervergünstigungen des Bundes für Unternehmen im<br />
kommenden Jahr mit 21,8 Milliarden Euro genauso hoch sein<br />
wie schon 2011. Zwar sind die Finanzhilfen dem Bericht zufolge<br />
zeitweise um 700 Millionen Euro auf 5,5 Milliarden<br />
Euro gesunken. Die Einsparungen werden aber im nächsten<br />
Jahr wieder eingebüßt – durch zusätzliche Fördermittel im<br />
Energiebereich, insbesondere durch die „Aufstockung des<br />
CO 2 -Gebäudesanierungsprogramms“ und die „Strompreiskompensation<br />
für stromintensive Unternehmen“. Die St<strong>eu</strong>er -<br />
vergünstigungen des Bundes fallen nächstes Jahr mit 15,5<br />
Milliarden Euro nur um rund hundert Millionen Euro geringer<br />
aus als 2011. In den Vorjahren kam der Subventionsabbau<br />
d<strong>eu</strong>tlich zügiger voran. 54 Prozent der Subventionen entfallen<br />
auf die gewerbliche Wirtschaft, der Rest verteilt sich vor allem<br />
auf Verkehr, Wohnungswesen und Landwirtschaft.<br />
70<br />
ZAHL DER WOCHE<br />
10,3 Prozent<br />
mehr Erdgas als im ersten Halbjahr<br />
2012 haben die D<strong>eu</strong>tschen bis Ende<br />
Juni verbraucht. Aufgrund des lan -<br />
gen Winters haben sie länger geheizt.<br />
Kein anderer Energieträger ver -<br />
zeichnete so einen starken Zuwachs.<br />
Arbeiter an Erdgas-Pipeline<br />
STEFAN SAUER / DPA<br />
SIEMENS<br />
Cromme will bleiben<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Cromme, Siemens-Technopark Mülheim<br />
Nach dem Rauswurf von Siemens-<br />
Chef Peter Löscher fordern Kritiker,<br />
dass auch der verantwortliche Chefaufseher<br />
Gerhard Cromme spätestens zur<br />
nächsten Hauptversammlung Ende Januar<br />
2014 abtritt. Doch der 70-Jährige<br />
stellt sich offenbar auf einen längeren<br />
Verbleib an der Spitze des Kontrollgremiums<br />
ein. Das zeigen bislang unbekannte<br />
Details zu seiner Aufsichtsratstätigkeit:<br />
Kurz nach seinem erzwungenen<br />
Ausscheiden als Chefkontroll<strong>eu</strong>r<br />
bei ThyssenKrupp Ende März bezog<br />
Cromme ein komfortables Büro in der<br />
Nähe seines Privatwohnsitzes – am<br />
Siemens-Standort in Mülheim an<br />
der Ruhr. Dort sind Teile der Energie -<br />
sparte des Konzerns untergebracht.<br />
Die n<strong>eu</strong>en Räumlichkeiten liegen im<br />
Siemens-Technopark an der Mellinghofer<br />
Straße. Betr<strong>eu</strong>t wird Cromme von<br />
seiner ehemaligen Assistentin bei<br />
ThyssenKrupp. Dabei nutzt er schon<br />
seit längerem zwei Büros samt Sekretariat<br />
und Fahrdienst an den Siemens-<br />
Verwaltungssitzen in München und<br />
Berlin. Die Gesamtkosten dafür in<br />
Höhe von mehr als 100000 Euro pro<br />
Jahr trägt Siemens. Ein Konzern -<br />
sprecher erklärt, die Rechtsabteilung<br />
und eine externe Anwaltskanzlei<br />
hätten das Vorgehen geprüft, und der<br />
Vorstand habe es gebilligt. Ähnliche<br />
Regelungen gebe es im Übrigen<br />
auch bei anderen Dax-Unternehmen.<br />
DIETER GOLLAND (R.)
Wirtschaft<br />
Bauarbeiten an der A100 in Berlin<br />
MATTHIAS BALK / DPA<br />
VERKEHR<br />
Ramsauers Schlafbaustellen<br />
Das Vorhaben klingt gut, Verbesserungen<br />
aber gibt es kaum: Bereits seit<br />
knapp zwei Jahren ruft Bundesverkehrsminister<br />
Peter Ramsauer (CSU)<br />
die Bürger auf, jene Baustellen zu<br />
melden, „auf denen kein Mensch arbeitet“.<br />
Mit Hilfe des „Baustellenmelders“<br />
auf der Internetseite seines<br />
Ministeriums will er die Zahl der Stillstandbaustellen<br />
verringern. Tatsächlich<br />
aber bringt die Einrichtung so gut<br />
wie nichts, wie aus einer Anfrage der<br />
Grünen im Bundestag hervorgeht.<br />
Danach sind zwar bis Ende Juli 3244<br />
Hinweise zu sogenannten Schlafbaustellen<br />
eingegangen. Aber nur bei 14<br />
von bundesweit rund tausend Baustellen<br />
kam es zu Bauzeitverkürzungen.<br />
Ramsauers Ministerium räumt in<br />
seiner Antwort sogar ein, bei bereits<br />
bestehenden Baustellen gar nicht eingreifen<br />
zu können. Eine nachträgliche<br />
Bauzeitverkürzung sei „rechtlich<br />
problematisch, da sie eine Änderung<br />
eines bereits abgeschlossenen Vertrags<br />
bed<strong>eu</strong>te“. Die Meldungen der Bürger<br />
würden den Ländern zugeleitet und<br />
die an den Bund zurückgemeldeten<br />
Ursachen „vertieft ausgewertet“, heißt<br />
es unklar. „Herr Ramsauer ist besonders<br />
gern dort aktiv, wo er entweder<br />
nicht zuständig ist oder wo Ankündigungen<br />
ohne Folgen bleiben“, kritisiert<br />
deshalb Valerie Wilms, Verkehrsexpertin<br />
der Grünen. „Der Baustellenmelder<br />
ist eine reine Show-Nummer.“<br />
BAYERNLB<br />
Ermittler contra Richter<br />
Die Münchner Staatsanwaltschaft gibt<br />
die Hoffnung nicht auf, dass der umstrittene<br />
Kauf der Kärntner Skandalbank<br />
HGAA durch die BayernLB doch<br />
noch vor Gericht verhandelt wird. Anlass<br />
ist ausgerechnet ein Beschluss, in<br />
dem das Landgericht München begründet,<br />
warum der Kern der Affäre im<br />
geplanten Prozess gegen acht Ex-Vorstände<br />
keine Rolle spielen soll. Die<br />
81 Seiten umfassende Abhandlung<br />
könnte aber nach Auffassung der Ermittler<br />
der Hauptverhandlung in un -<br />
zulässiger Weise vorgreifen. Die<br />
Staatsanwaltschaft wirft Ex-BayernLB-<br />
Chef Werner Schmidt und seinen früheren<br />
Kollegen vor, sie hätten beim<br />
Erwerb der HGAA gut eine halbe Milliarde<br />
Euro zu viel bezahlt und so das<br />
Vermögen der Bank geschädigt. Das<br />
Landgericht argumentiert hingegen,<br />
die Ex-Vorstände hätten ihren Er -<br />
messensspielraum nicht überschritten.<br />
In ihrem Beschluss bieten die Juristen<br />
allerdings selbst Ansatzpunkte für<br />
Kritik. So beschäftigen sie sich etwa<br />
mit Personen, die in der Anklageschrift<br />
gar nicht auftauchen. Ob die An klage<br />
doch noch im vollen Umfang zur<br />
Hauptverhandlung zugelassen wird,<br />
entscheidet nun das Oberlandesgericht.<br />
Schmidt<br />
GUIDO KRZIKOWSKI / REUTERS<br />
DER SPIEGEL 33/2013 71
Internetunternehmer Bezos<br />
INTERNET<br />
Bezos’ n<strong>eu</strong>e Bühne<br />
Die Mächtigen des Silicon Valley wollen nicht länger bloß für technische Revolutionen<br />
stehen. Sie suchen die intellektuelle Debatte und den politischen Einfluss.<br />
Das zeigt auch der Kauf der „Washington Post“ durch den Amazon-Gründer.<br />
MACKENZIE STROH / CONTOUR BY GETTY IMAGES
Es ist Tag eins nach dem Verkauf der<br />
„Washington Post“ an den Internetunternehmer<br />
Jeff Bezos, und die<br />
Zeitungen schlagen bereits den Ton von<br />
Geschichtsbüchern an. „Zäsur“, „Zeitenwende“,<br />
„Ära“. Bezos wird als „Retter<br />
aus dem Internet“ bejubelt, der nicht nur<br />
an die „Washington Post“ glaube, sondern<br />
an die Zukunft der Zeitung ganz allgemein.<br />
In Washington sichern sich die „Post“-<br />
Mitarbeiter rasch noch ein persönliches<br />
Exemplar ihres Blattes mit der Titelzeile<br />
„Grahams to sell the ,Post‘“, das jetzt<br />
schon als historisch gilt. Morgens um<br />
n<strong>eu</strong>n Uhr sind die Zeitungskörbe im Verlagsgebäude<br />
– sonst den ganzen Vormittag<br />
über gutgefüllt – bereits leergeräumt.<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s Journalisten sind ähnlich<br />
aufgeschreckt wie ihre US-Kollegen. Immerhin<br />
ist es erst zwei Wochen her, dass<br />
Springer sich von einem Schwung international<br />
eher unbed<strong>eu</strong>tender Blätter für<br />
eine knappe Milliarde Euro trennte. Und<br />
nun geht ein Weltsymbol für investigativen<br />
Journalismus für den lächerlichen<br />
Preis von 250 Millionen Dollar (etwa 190<br />
Millionen Euro) weg. An ein Weltsymbol<br />
für das Revolutionieren oder – je nach<br />
Perspektive – Zerstören einer anderen<br />
Printbranche, des Buchmarkts.<br />
An Tag vier nach dem Deal ist die Debatte<br />
noch keinen Millimeter weiter. Journalisten<br />
und Zeitungen machen das, was<br />
sie am besten können: Sie kreisen um<br />
sich selbst. Kaum einer stellt die naheliegende<br />
Frage: Was hat Bezos von dem<br />
Deal?<br />
Seit einiger Zeit ist eine d<strong>eu</strong>tliche<br />
Tendenz zu beobachten: Die führenden<br />
Köpfe des Silicon Valley, schwerreich, erfolgsverwöhnt<br />
und ökonomisch mit die<br />
mächtigsten US-Manager, sind zunehmend<br />
bemüht, ihren wirtschaftlichen und<br />
kulturellen Einfluss auf die politische<br />
Bühne zu übertragen.<br />
Bislang war das Motto der Weltveränderer<br />
im Silicon Valley: Wozu sich<br />
einmischen in Washington, wo es nur<br />
die Mittelmäßigen hinverschlägt, die<br />
nicht wirklich etwas bewegen?<br />
Aber zunehmend haben einige der<br />
führenden Köpfe durchblicken lassen,<br />
dass sie anders denken. Sie merken, dass<br />
die von ihnen gest<strong>eu</strong>erte digitale Revolution<br />
tatsächlich die Welt verändert. Dass<br />
sie ihren Glauben an die Berechenbarkeit<br />
von allem und jedem, ihre Philosophie<br />
der totalen Transparenz in Realität umsetzen<br />
können – dass sie dafür aber politischen<br />
Einfluss benötigen.<br />
Es sind die großen Namen der Branche,<br />
die mit einem Mal Gefallen am politischen<br />
Geschäft und politischer Debatte<br />
finden: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg<br />
und seine Vertraute Sheryl Sandberg,<br />
Yahoo-Chefin Marissa Mayer, Google-<br />
Mann Eric Schmidt – also die geballte<br />
ökonomische und technologische Kraft<br />
8,5 Mrd. $ 1,65<br />
2011<br />
30<br />
Mio. $<br />
2013<br />
250<br />
Mio. $<br />
2013<br />
Wirtschaft<br />
dessen, wofür das Silicon Valley symbolhaft<br />
steht.<br />
Auch Bezos ist so ein Typ. Auch wenn<br />
er 1300 Kilometer abseits des Valley residiert.<br />
Einer mit einer unternehmerischen<br />
Vision, die längst nicht mehr bloß unternehmerisch<br />
ist. Seine Idee von der absoluten<br />
Verfügbarkeit aller Waren zu jeder<br />
Zeit an jedem Ort, der er alles unterordnet,<br />
ist in Wahrheit ein politisches Projekt.<br />
Es ist das Projekt eines Kommerzes<br />
ohne Einschränkung.<br />
Bezos arbeitet unermüdlich an seinem<br />
Reich. Er ist ja längst nicht mehr nur der<br />
Herrscher des weltweiten Online-Handels,<br />
sondern ist beteiligt an Weltraumprojekten,<br />
an der Erforschung des Quantencomputers<br />
und Dutzenden anderen Innova -<br />
tions-Dingen. Zudem kommt Amazon das<br />
politische Tagesgeschäft immer häufiger<br />
in die Quere. Hier werden Mehrwert -<br />
st<strong>eu</strong>erprivilegien in Frage gestellt, dort<br />
wird das Preismodell für E-Books kritisiert.<br />
„Die Ironie ist, dass viele von uns in<br />
Studententagen politisch aktiv waren“,<br />
sagt Kevin Hartz. Er weiß genau, was das<br />
Silicon Valley bewegt. Wenige sind an so<br />
vielen Erfolgsgeschichten der vergangenen<br />
Jahre beteiligt wie er. Seitdem Hartz<br />
bereits Ende der n<strong>eu</strong>nziger Jahre sein erstes<br />
IT-Unternehmen verkaufte, hat er immer<br />
wieder früh in Start-ups investiert,<br />
die auch dank seiner Hilfe zu globalen<br />
Größen aufstiegen: PayPal, Airbnb (siehe<br />
Seite 80), Pinterest – unter anderem.<br />
Die Politik sei lange als „aufgeblasener,<br />
bürokratischer Prozess“ wahrgenommen<br />
Billiges Papier<br />
Kaufpreise von Internetunternehmen<br />
verglichen<br />
mit der „Washington Post“<br />
315<br />
Mio. $<br />
2010<br />
580<br />
Mio. $<br />
2005<br />
Mrd. $<br />
2006<br />
715<br />
Mio. $<br />
2012<br />
worden, sagt Hartz. Als Technologie -<br />
unternehmer lasse sich mehr bewegen,<br />
fänden die klugen Köpfe im Silicon Valley.<br />
„Jetzt aber wird realisiert, dass wir<br />
mehr Einfluss nehmen müssen in Washington.<br />
Wir verstehen nur die dortigen<br />
Mechanismen noch nicht genau, das lernen<br />
wir gerade.“<br />
Doch es sei klar: Ähnlich wie man hier<br />
ständig auf der Suche nach technischen<br />
N<strong>eu</strong>erungen sei, müsse nun ein innovativer<br />
Ansatz für den Umgang mit Politik<br />
und Regierung gefunden werden. Der<br />
Kauf einer einflussreichen Zeitung mitsamt<br />
ihrem Renommee ist so ein Ansatz,<br />
zwar kein wirklich innovativer, aber ein<br />
relativ billiger. Die Preise von Zeitungen<br />
sind rasant gefallen. 2007 war dem Milliardär<br />
Sam Zell die Tribune-Gruppe, zu<br />
der die „Chicago Tribune“ und die „Los<br />
Angeles Times“ gehören, noch sagenhafte<br />
8,2 Milliarden Dollar wert. Und in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> wurden im gleichen Jahr für<br />
die „Braunschweiger Zeitung“ noch 210<br />
Millionen Euro aufgerufen, d<strong>eu</strong>tlich mehr,<br />
als die „Post“ jetzt wert sein soll.<br />
Doch die Branche redet sich weiter<br />
Mut zu, hofft auf Retter Bezos und merkt<br />
kaum, dass der Verkauf einer ihrer Ikonen<br />
in der anderen Branche, von der sie<br />
aufgesogen wird, lediglich noch eine<br />
Randnotiz ist. Kann sein, dass Bezos die<br />
Zeitung rettet, aber das ist bloß ein Nebeneffekt.<br />
Bei der „Post“ beantwortete Chefredakt<strong>eu</strong>r<br />
Martin Baron in der vergangenen<br />
Woche Fragen aus seiner Belegschaft. Er<br />
erwarte „n<strong>eu</strong>e große Ideen“ von Bezos,<br />
sagte er. „Er investiert in uns, weil er eine<br />
große unternehmerische Gelegenheit<br />
sieht.“ Gesprochen mit dem n<strong>eu</strong>en Eigentümer<br />
hatte er da noch nicht, aber er gab<br />
sich notorisch optimistisch. Bezos habe<br />
„nicht nur den Buchmarkt, sondern<br />
auch den gesamten Einzelhandel umgekrempelt“,<br />
so Baron. „Das war revolutionär.“<br />
Ein solcher Unternehmer<br />
kaufe sich für 250 Millionen<br />
Dollar nicht einfach nur ein<br />
Spielz<strong>eu</strong>g.<br />
Vielleicht kein Spielz<strong>eu</strong>g.<br />
1,1<br />
Mrd. $<br />
2013<br />
1,0<br />
Mrd. $<br />
2013<br />
Aber ein Werkz<strong>eu</strong>g? Der<br />
Amazon-Gründer wäre ja<br />
nicht der erste Protagonist<br />
der Digitalbranche, der sich<br />
nicht mehr damit zufriedengeben<br />
will, die digitale Revolution<br />
bloß ökonomisch<br />
und gesellschaftlich voranzutreiben.<br />
Es ist nach der<br />
technologischen auch die intellektuelle<br />
Umwälzung, die im<br />
Silicon Valley jetzt alle anzustreben<br />
scheinen. Und das ironischerweise am<br />
liebsten immer noch mit den alten Mitteln<br />
der politischen Debatte – bedrucktem<br />
Papier.<br />
Im Frühjahr veröffentlichte Google-<br />
Chairman Eric Schmidt gemeinsam mit<br />
DER SPIEGEL 33/2013 73
Zuckerberg (r., mit Präsident Obama)<br />
Mayer<br />
Google-Mann Jared Cohen das Buch<br />
„The New Digital Age“, das ja vor allem<br />
eine politische Reflexion der Zukunftsagenda<br />
von Google ist. Und Facebook-<br />
Chefin Sheryl Sandberg mischte sich<br />
ebenfalls per Buch in Frauenpolitik und<br />
Arbeitswelt ein. Vor allem Schmidts<br />
Werk ist eine aufschlussreiche Lektüre.<br />
Da wird d<strong>eu</strong>tlich, warum die Einmischung<br />
in die Politik für die Digitalelite<br />
so essentiell ist: Die Veränderungen, die<br />
Schmidt für die nächsten Jahre annimmt,<br />
werden nicht bloß die Ökonomie verändern<br />
– sie werden die Frage von Grundrechten<br />
noch einmal ganz n<strong>eu</strong> stellen,<br />
weil es immer weniger um Maschinen<br />
und immer mehr um das Zusammenwachsen<br />
von Mensch und Maschine gehen<br />
wird.<br />
Dazu kommt ein n<strong>eu</strong>er Gestaltungsdrang.<br />
Eine ganze Phalanx der führenden<br />
Köpfe des Silicon Valley, allen voran Face -<br />
book-Gründer Zuckerberg und Yahoo-<br />
Chefin Mayer, hat sich vor wenigen Monaten<br />
zu einer Lobby-Organisation namens<br />
FWD.us zusammengefunden. Das<br />
offizielle Ziel: eine n<strong>eu</strong>e Einwanderungspolitik<br />
sowie bessere Schul- und Uni-Ausbildung.<br />
Doch das Ganze ist zugleich<br />
auch ein Versuchslabor, wie sich politischer<br />
Einfluss organisieren lässt.<br />
Zuckerberg nutzte dabei originellerweise<br />
die „Washington Post“, um für seine<br />
Position zu werben. „Wir haben eine seltsame<br />
Einwanderungspolitik für eine Nation<br />
von Einwanderern“, schrieb er. Es<br />
74<br />
Sandberg<br />
Silicon-Valley-Manager: N<strong>eu</strong>e Debattenlust der Online-Ikonen<br />
REUTERS<br />
MARIO TAMA / AFP<br />
Schmidt (3. v. r., in Nordkorea)<br />
könne nicht angehen, dass man viele der<br />
ausländischen Studenten wieder aus dem<br />
Land schmeiße, nachdem man sie erst<br />
zum Studieren in die USA geholt habe.<br />
Die n<strong>eu</strong>e Debattenlust der Online-Ikonen<br />
ist erfolgreich. Zuckerbergs Engagement<br />
hat in kurzer Zeit zu einem Entwurf<br />
für eine Einwanderungsreform geführt.<br />
Was die Tech-Protagonisten nun darin bestärkt,<br />
sich endlich eine umfassendere offizielle<br />
Agenda zu schaffen.<br />
Was da gerade geschieht, ist ein fundamentaler<br />
Wandel gegenüber früheren Generationen<br />
der Internetwirtschaft, die<br />
von Männern wie Steve Jobs und Bill<br />
Gates geprägt wurden. Lange haben sich<br />
die meisten Führungsfiguren des Silicon<br />
Valley konsequent von der politischen<br />
Bühne ferngehalten. Noch vor einem Jahr<br />
sagte ein Apple-Top-Manager, es sei die<br />
Pflicht seines Konzerns, die besten Produkte<br />
möglich zu machen, aber nicht,<br />
Amerikas Probleme zu lösen. Doch diese<br />
Zurückhaltung ist vorbei.<br />
Für die Machtzentralen der Welt, sei<br />
es Washington oder Brüssel, haben große<br />
Teile der Tech-Elite zwar weiter bloß eine<br />
Mischung aus Desinteresse und Verachtung<br />
übrig. Auf Partys und in kleinem<br />
Kreis wird gern gelästert, wie langsam<br />
und ineffizient die politische Welt sei, gest<strong>eu</strong>ert<br />
von ahnungslosen Bürokraten. Inkompetenz<br />
ist ein Wort, das in solchen<br />
Gesprächen häufig fällt.<br />
Doch jetzt zeigen sie n<strong>eu</strong>en Ehrgeiz:<br />
der lahmen Politik-Welt zu zeigen, dass<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
ULLSTEIN BILD<br />
DAVID GUTTENFELDER / AP<br />
auch sie sich auf das Silicon-Valley-Tempo<br />
der Veränderung einstellen muss.<br />
Unpolitisch war die digitale Elite nie,<br />
sie hat sich nur nicht politisch betätigt.<br />
Im Gegenteil, sie ist zutiefst ideologisch.<br />
Ihre Wurzeln liegen in der Gegenkultur<br />
der sechziger Jahre in San Francisco. Bis<br />
h<strong>eu</strong>te ist die gesamte Tech-Szene geprägt<br />
von utopistischen Phantasien und durchzogen<br />
von ultraindividualistischen, libertaristischen<br />
Denkern – allen voran Peter<br />
Thiel, Facebook-Investor der ersten Stunde<br />
und einer der einflussreichsten Gestalten<br />
im Silicon Valley. Er diskutiert auch<br />
gern öffentlich mit Google-Mann Schmidt,<br />
wie sie die Welt verändern, verbessern,<br />
ja aus ihrer Sicht beglücken wollen.<br />
Die Internet-Techis waren nie bloß die<br />
Adepten eines Geschäftsmodells, sondern<br />
stets auch der esoterische Zirkel von Zukunftsgläubigen,<br />
die Computertechnologie<br />
als Spitze des menschlichen Fortschritts<br />
sahen. Als Fortsetzung der Evolution<br />
mit anderen Mitteln.<br />
Doch allmählich merken sie, dass sich<br />
ihre Sicht auf die Welt dauerhaft nur<br />
durchsetzen kann, wenn sich ihre Ansichten<br />
auch in der intellektuellen und politischen<br />
Diskussion bewähren. Aus der technologischen<br />
Mission der Zuckerbergs und<br />
Bezos’ und Schmidts wird immer mehr<br />
eine weltanschauliche – mit einem Hang<br />
ins Technologisch-Totalitäre.<br />
Bei Facebook ist es Konzernglaube, das<br />
soziale Netzwerk bringe die Menschheit<br />
näher zusammen und löse dadurch schon<br />
allerhand Probleme. Bei Google schwören<br />
nicht wenige, dass Technologie an<br />
sich „gut“ sei und stets das Potential besitze,<br />
die Menschheit weiter voranzubringen.<br />
Diese Haltung herrscht fast überall<br />
im Valley, frei nach dem Motto: Für jedes<br />
Problem gibt es die passende App.<br />
Nach dieser Denkweise ist es nur konsequent,<br />
dass jemand wie Jeff Bezos die<br />
„Washington Post“ kauft: als VIP-Eintrittskarte<br />
in die konservative Polit-Szene von<br />
Washington.<br />
Lange haben sich die Macher im Valley<br />
weitgehend darum gedrückt, aktiver Teil<br />
der öffentlichen Diskussion zu sein, der<br />
schon längst über die Folgen ihrer Arbeit<br />
geführt wird: Was ist noch privat in der<br />
digitalen Welt? Welche Bildungspolitik<br />
brauchen wir? Was sind die Folgen für<br />
den Arbeitsmarkt in einer zunehmend<br />
technologisierten Umgebung? Wie sichert<br />
man die Rechte von Menschen, wenn Maschinen<br />
immer mehr Macht bekommen?<br />
Wenn sich jetzt Bezos und das Silicon<br />
Valley stärker politisch engagieren, wird<br />
erstens spürbar, dass es tatsächlich um<br />
politische Fragen geht. Zweitens, dass<br />
Politik und Staat bisher kaum Antworten<br />
haben. Und drittens wird es zumindest<br />
für Bezos kaum noch zu verhindern sein,<br />
dass er als Person in den Mittelpunkt der<br />
Debatte gerät.<br />
MARKUS BRAUCK,<br />
JAN FRIEDMANN, THOMAS SCHULZ
Wirtschaft<br />
VERMÖGEN<br />
„Der Gewinner kriegt alles“<br />
Die kanadische Journalistin Chrystia Freeland gibt<br />
Einblicke in die Welt der Superreichen: Sie bleiben am liebsten<br />
unter sich und fühlen sich vom Staat schikaniert.<br />
Freeland, 45, war für verschiedene Medien<br />
tätig, unter anderem als leitende<br />
Redakt<strong>eu</strong>rin der „Financial Times“. Ihr<br />
Buch über die n<strong>eu</strong>e globale Geld-Elite erscheint<br />
jetzt in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>*.<br />
SPIEGEL: Frau Freeland, Unternehmer<br />
wie der spanische Zara-Gründer Ar -<br />
mancio Ortega oder Ikea-Mogul Ingvar<br />
Kamprad häufen unvorstellbare Ver -<br />
mögen an, frühere Unternehmer brauchten<br />
dafür Generationen. Wie ist das<br />
möglich?<br />
Freeland: Wir leben in einer Superstar-<br />
Wirtschaft. Es gilt das Prinzip: „The winner<br />
takes it all“ – der Gewinner kriegt<br />
alles. Technologie und Globalisierung ermöglichen<br />
es ihm, seine Erträge zu vervielfachen.<br />
Zara ist dafür ein gutes Beispiel.<br />
Ortega verteilt n<strong>eu</strong>e Mode massenhaft<br />
in alle Welt, im Wochentakt. Er wäre<br />
wahrscheinlich auch früher ein erfolgreicher<br />
Unternehmer gewesen – mit vier<br />
oder fünf Läden in einer Stadt. So aber<br />
wurde er zum Multimilliardär.<br />
* Chrystia Freeland: „Die Superreichen. Aufstieg und<br />
Herrschaft einer n<strong>eu</strong>en globalen Geldelite“. Westend<br />
Verlag, Frankfurt am Main; 368 Seiten; 22,99 Euro.<br />
SPIEGEL: Ortega begann angeblich als Aushilfskraft<br />
in einer Hemdenschneiderei.<br />
Kann jeder superreich werden, wenn er<br />
eine gute Idee hat und 100 Stunden die<br />
Woche arbeitet?<br />
Freeland: Viele Superreiche stammen<br />
selbst nicht aus reichen Familien, das ist<br />
anders als früher. Aber sie kommen in<br />
der Regel auch nicht aus Slums. Viele<br />
stammen aus der Mittelschicht, sind sehr<br />
jung und haben eine sehr gute Ausbildung<br />
…<br />
SPIEGEL: … und fast alle sind Männer. War -<br />
um eigentlich?<br />
Freeland: Die Welt an der Spitze des Reichtums<br />
ist tatsächlich sehr patriarchalisch<br />
strukturiert. Die Ehefrauen arbeiten selten.<br />
Warum, ist ein Mysterium.<br />
SPIEGEL: Scheint eine sehr eigene Welt zu<br />
sein.<br />
Freeland: Absolut. Superreiche leben in<br />
einer globalen Gemeinschaft, gehen zu<br />
den gleichen Konferenzen, reisen in die<br />
gleichen Hotels und in die gleichen<br />
Städte. Ein Private-Equity-Unternehmer<br />
sagte mir, er habe mehr gemeinsam mit<br />
jemandem, der eine große afrikanische<br />
Bank leitet, als mit jemandem aus seiner<br />
Heimatstadt.<br />
SPIEGEL: Diese globale Elite nimmt Einfluss<br />
auf die Politik, auch in den USA.<br />
Superreiche bezahlen die Wahlkämpfe<br />
der Präsidentschaftskandidaten, sie gründen<br />
gigantische Denkfabriken und kaufen<br />
nun auch noch Zeitungen. Kann man so<br />
etwas noch Demokratie nennen?<br />
Freeland: Natürlich, was ist die Alternative?<br />
Eine Diktatur sind die USA sicherlich<br />
nicht.<br />
SPIEGEL: Eine Oligarchie?<br />
Freeland: Noch nicht. Aber das viele Geld<br />
in der Politik ist ein Problem. Und es gibt<br />
noch ein subtileres Thema: Die Superreichen<br />
leben weit entfernt von dem Rest<br />
der Bevölkerung, aber Journalisten und<br />
Politiker haben Zugang zu dieser Welt.<br />
Dadurch denken alle irgendwann ähnlich.<br />
Sie erkennen dann vielleicht, dass die<br />
Wirtschaft gestört ist, aber sie sehen das<br />
aus der Perspektive der L<strong>eu</strong>te, die an der<br />
Spitze stehen …<br />
SPIEGEL: … die oft ziemlich erstaunlich ist.<br />
Als US-Präsident Obama 2010 die Reichen<br />
über höhere St<strong>eu</strong>ern stärker an der<br />
Bekämpfung der Finanzkrise beteiligen<br />
wollte, verglich das der Gründer der Private-Equity-Firma<br />
Blackstone, Stephen<br />
Schwarzman, mit Hitlers Einmarsch in<br />
Polen.<br />
Freeland: Dieses Sichtweise, vom Staat<br />
schikaniert zu werden, fand ich am erstaunlichsten.<br />
Ein Hedgefonds-Manager<br />
hatte zur gleichen Zeit eine E-Mail geschrieben<br />
mit der Betreffzeile: Geprügelte<br />
Ehefrau. So fühlte er sich durch die Regierung<br />
behandelt. Ein anderer Investor<br />
verglich die Behandlung mit der Verfolgung<br />
von ethnischen Minderheiten.<br />
SPIEGEL: Viele russische Oligarchen pflegen<br />
engste Verbindungen zum Staat. Die<br />
Familie des früheren chinesischen Pre-<br />
Die Reichsten der Welt Vermögen, in Milliarden Dollar<br />
1. Carlos Slim Helú<br />
Unternehmer<br />
(Telekommunikation)<br />
MEXIKO ........................73<br />
Milliardäre 2013<br />
1426<br />
Veränderung<br />
gegenüber 2012<br />
+16%<br />
2. Bill Gates<br />
Microsoft -Gründer<br />
USA............................67<br />
3. Amancio Ortega<br />
Textilunternehmer (Zara)<br />
SPANIEN .......................57<br />
Gesamtvermögen<br />
5,4 Billionen Dollar<br />
+17%<br />
Länder mit den meisten Milliardären<br />
ACTION PRESS, WIREIMAGE, CORBIS, DPA<br />
4. Warren Buffett<br />
Investor<br />
USA............................54<br />
5. Larry Ellison<br />
Gründer des Software-<br />
Konzerns Oracle<br />
USA ...........................43<br />
USA 442<br />
China 122<br />
Russland 110<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> 58<br />
Indien 55<br />
Brasilien 46<br />
Türkei 43<br />
Hongkong 39<br />
Großbritannien 38<br />
Taiwan 26<br />
Quelle: Forbes, 2013<br />
Autorin Freeland<br />
JO-ANNE MCARTHUR / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 33/2013 75
miers Wen Jiabao soll Milliarden Dollar<br />
besitzen. Selbst US-Präsident Obama<br />
bringt es auf ein Vermögen von mehreren<br />
Millionen Dollar. Werden die größten<br />
Länder der Erde nicht längst von Reichen<br />
geführt?<br />
Freeland: Es ist ein großer Unterschied, ob<br />
man einige Millionen Dollar besitzt oder<br />
Milliardär ist. Aber tatsächlich beziehen<br />
die USA ihre politischen Führungskräfte<br />
und ihre Unternehmensführer aus dem<br />
gleichen Pool von L<strong>eu</strong>ten. Obama war<br />
Herausgeber des „Harvard Law Review“.<br />
Er hätte eine sehr erfolgreiche Karriere<br />
in der Wirtschaft machen können, bei der<br />
er leicht mehrere Millionen Dollar im<br />
Jahr verdient hätte.<br />
SPIEGEL: Viele Politiker verschieben das<br />
Geldscheffeln auf die Zeit nach ihrer<br />
Amtszeit.<br />
Freeland: Es sorgt immer für Ärger, wenn<br />
Politiker nach ihrem Amtsende im Bankensektor<br />
oder mit Vorträgen und Büchern<br />
viel Geld verdienen. Aber was erwarten<br />
wir von ihnen? Sie sehen andere<br />
Menschen aus ihren Kreisen, die so viel<br />
mehr Geld machen. Ich halte es für einen<br />
Fehler, dass die L<strong>eu</strong>te im öffentlichen Sektor<br />
so schlecht angesehen sind und so<br />
schlecht bezahlt werden.<br />
SPIEGEL: Ist die Demokratie in Gefahr?<br />
Freeland: Die Kluft zwischen den Allerreichsten<br />
und dem Rest wird immer tiefer.<br />
Ich frage mich schon, ob eine Massen -<br />
demokratie so wirklich bestehen kann.<br />
Außerdem: Wenn sich der Reichtum immer<br />
mehr an der Spitze konzentriert, inwieweit<br />
kann ein Staat ihn dann noch so<br />
regulieren, wie es für eine funktionierende<br />
Wirtschaft unabdingbar ist?<br />
SPIEGEL: Dennoch liest sich Ihr Buch an<br />
vielen Stellen wie ein flammendes Plädoyer<br />
für eben jenen Kapitalismus, den<br />
diese L<strong>eu</strong>te vertreten.<br />
Freeland: Ich finde den Kapitalismus trotz<br />
allem großartig. Er ist definitiv das beste<br />
Wirtschaftssystem, um Wohlstand zu<br />
schaffen. Wir brauchen Menschen, die<br />
Amazon erfinden, Banken führen, Risiken<br />
eingehen. Es geht nicht darum, den<br />
Kapitalismus zu verdammen oder zu sagen:<br />
Die Superreichen sind schlechte<br />
Menschen. Schließlich hätte jedes Land<br />
gern ein Silicon Valley. Aber wir müssen<br />
dafür sorgen, dass die Gewinne nicht nur<br />
den L<strong>eu</strong>ten an der Spitze zugutekommen.<br />
SPIEGEL: Sie plädieren für strengere Regeln<br />
– und gleichzeitig kandidieren Sie<br />
in Ihrem Heimatland Kanada jetzt für<br />
eine liberale Partei für einen Parlamentssitz.<br />
Wie passt das zusammen?<br />
Freeland: Ich bin nicht reflexhaft für mehr<br />
oder für weniger Regeln, sondern für einen<br />
klugen Staat. Wenn die kapitalistische<br />
Demokratie der breiten Mehrheit ökonomisch<br />
nichts bringt, wird diese Mehrheit<br />
entweder den Kapitalismus aufgeben –<br />
oder die Kapitalisten werden die Demokratie<br />
aufgeben. INTERVIEW: ANNE SEITH<br />
76<br />
MICHAEL URBAN / DAPD<br />
Katjes-Produktion in Potsdam<br />
GELDANLAGE<br />
Aus purer Verzweiflung<br />
Mittelständler borgen sich zunehmend Geld<br />
von Privatl<strong>eu</strong>ten. Die lassen sich von den hohen Zinsen<br />
blenden – und übersehen oft die Risiken.<br />
Seine Internetwelten sind voller<br />
Aliens, Wikinger und sportlicher<br />
Herausforderungen. Remco Westermann,<br />
Chef des Online-Spiele-Vermarkters<br />
Gamigo, will in diesen Welten künftig<br />
Gewinne machen, vor allem mit dem Verkauf<br />
von virtuellen Schwertern und Golfschlägern.<br />
Der Verkauf solcher „items“<br />
sei seine „Haupteinnahmequelle“, sagt er.<br />
In den vergangenen Jahren hatte die<br />
Firma damit allerdings wenig Erfolg, der<br />
erste Überschuss nach zwei verlustreichen<br />
Jahren kam zuletzt vor allem deshalb zustande,<br />
weil einstige Gesellschafter der<br />
Firma auf die Rückzahlung von Millionendarlehen<br />
verzichteten. „Das ist kein gutes<br />
Zeichen“, sagt Heinz Steffen vom unabhängigen<br />
Analysehaus Faire search.<br />
Trotzdem sammelte Gamigo bei Anlegern<br />
kürzlich zwölf Millionen Euro frisches<br />
Geld für die Zukunft ein – über die<br />
Ausgabe einer Mittelstandsanleihe. Eine<br />
ähnlich wundersame Geldbeschaffung gelang<br />
dem Küchenhersteller Alno, der vergangenes<br />
Jahr noch kurz vor dem Bankrott<br />
stand. Er kam mit Hilfe solcher Schuldscheine<br />
im Frühjahr zu 45 Millionen Euro.<br />
Es waren nur zwei von einem Dutzend<br />
Emissionen allein im Jahr 2013 – der<br />
Markt für Mittelstandsanleihen ist zum<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Milliardengeschäft geworden. Ausgelöst<br />
wurde der Boom durch die Börse Stuttgart,<br />
die vor drei Jahren das erste Handelssegment<br />
für die Papiere einrichtete.<br />
Vor allem Privatanleger greifen zu, als<br />
hätte es die Finanzkrise nie gegeben,<br />
wenn Unternehmen wie Gamigo, der<br />
Safthersteller Valensina oder das Kr<strong>eu</strong>zfahrtschiff<br />
MS „<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>“ – bekannt<br />
aus der Serie „Das Traumschiff“ – ihre<br />
Schuldscheine feilbieten.<br />
Die Wiener Feinbäckerei Heberer sammelte<br />
sogar unabhängig von den Börsen<br />
8,5 Millionen Euro bei Kunden ein, sie<br />
druckte die Anzeigen für ihre Firmenanleihe<br />
schlicht auf die eigenen Brötchentüten.<br />
Hohes Risiko wird mit hohen Zinsen<br />
bezahlt, scheint der Deal bei solchen Geschäften<br />
zu lauten. 7,5 Prozent bieten die<br />
Firmen an – im Schnitt. Gamigo will seinen<br />
Anlegern sogar 8,5 Prozent zahlen.<br />
„Eigentlich wäre das eine gute Sache“,<br />
sagt Wirtschaftsprofessor Olaf Schlotmann<br />
über die n<strong>eu</strong>e Form der Unternehmensfinanzierung.<br />
„Wenn die Spielregeln<br />
fair wären.“<br />
Doch das sind sie nicht. Trotz der hohen<br />
Zinsen machen Anleger mit Mittelstandsanleihen<br />
oft ein ziemlich schlechtes Geschäft.<br />
Den Emittenten der Papiere geht es
Wirtschaft<br />
häufig sehr viel schlechter, als ihre Firmendaten<br />
glauben machen, und wenn sie wirklich<br />
pleitegehen, gehören Anleiheinvestoren<br />
zu den letzten in der langen Schlange<br />
von Gläubigern, die entschädigt werden.<br />
Gerade deshalb, mutmaßen Experten,<br />
werben viele Firmen gezielt um Privatanleger<br />
oder halbprofessionelle Vermögensverwalter<br />
als Käufergruppen. „Die sind<br />
leichter auszutricksen als Profis“, sagt der<br />
Geschäftsführer der Unternehmensberatung<br />
Capmarcon, Hans-Werner Grunow.<br />
Er hat gemeinsam mit Ökonom Schlotmann<br />
eine Studie zum Thema erstellt, die<br />
Ergebnisse sind erschütternd. Viele Firmen<br />
geben Mittelstandsanleihen demnach<br />
offenbar aus purer Verzweiflung heraus –<br />
weil sie keine normalen Kredite mehr bekommen.<br />
Das frische Geld fließt oft nicht<br />
in n<strong>eu</strong>e Investitionen, sondern in die Ablösung<br />
alter Verbindlichkeiten.<br />
Hauptprofit<strong>eu</strong>re des jungen Marktes<br />
sind deshalb weniger die Emittenten der<br />
Papiere als die Banken: Die Geldhäuser<br />
können sich ihrer Problemkredite ent -<br />
ledigen und kassieren dazu noch Provisionen.<br />
Denn auch ein Mittelständler braucht<br />
beim Gang an den Kapitalmarkt Hilfe von<br />
Profis. 150 Millionen Euro haben d<strong>eu</strong>tsche<br />
Finanzdienstleister so in den letzten Jahren<br />
verdient, schätzt Schlotmann.<br />
Auch beim Verkauf der Papiere an Anleger<br />
mischen die Geldhäuser mit. „Viele<br />
Banken bieten ihren Kunden sogar Anleihen<br />
von Firmen an, denen sie selber<br />
keinen Kredit mehr geben“, empört sich<br />
Anlegeranwalt Klaus Nieding.<br />
Umfragen zufolge kaufen zwar vor allem<br />
Anleger, die sich selbst als erfahren einstufen,<br />
Mittelstandsanleihen. Oft fallen sie<br />
aber auf das solide Rating herein, das etliche<br />
Mittelständler vorweisen können. Viele<br />
Firmen haben Noten im sogenannten Investmentgrade-Bereich,<br />
eine Empfehlung<br />
für eher sicherheitsbewusste Anleger also.<br />
Der Grund für die guten Z<strong>eu</strong>gnisse:<br />
Die Kriterien, nach denen die Rating-<br />
Agenturen Mittelständler b<strong>eu</strong>rteilen, sind<br />
oft laxer als bei Großkonzernen. Das tatsächliche<br />
Ausfallrisiko werde so häufig<br />
„fast zur Unkenntlichkeit“ verschleiert,<br />
so die Experten Grunow und Schlotmann.<br />
Die Anleihe des Düsseldorfer Immo -<br />
bilienunternehmens WGF galt sogar als<br />
„mündelsicher“. Mit diesem Label jedenfalls<br />
bot der Online-Broker-Dienst der<br />
Sparkassengruppe dem Rentner Wolfgang<br />
Leicht die Papiere an. „Die Erfolgsstory<br />
geht weiter“, stand im Betreff.<br />
Leicht, der früher Biochemiker war, lässt<br />
sich eigentlich in Gelddingen nicht so leicht<br />
einlullen. „Finanzen haben mich immer interessiert“,<br />
sagt er. Sogar eine Schulung<br />
zum Finanzcoach hat der Pensionär einmal<br />
gemacht. Doch die Zusicherung eines<br />
kr<strong>eu</strong>zsoliden Sparkassenunternehmens,<br />
„Die meisten Unternehmen<br />
haben Probleme mit<br />
dem Geschäftsmodell oder<br />
kämpfen um die Existenz.“<br />
dass die WGF-Papiere quasi vor Wertverlust<br />
geschützt seien, gaben den Ausschlag:<br />
Leicht investierte 20000 Euro – nun ist ein<br />
großer Teil des Geldes wohl weg. Denn<br />
WGF operiert mittlerweile am Rande der<br />
Pleite. Die Immobilien im Bestand sind<br />
nur knapp über die Hälfte der Summe<br />
wert, die sich die Firma ausgeliehen hat.<br />
Leicht fühlt sich übers Ohr gehauen –<br />
wie viele andere Anleger auch, die jetzt<br />
klagen, denn längst hat der Markt seine<br />
ersten Skandale. Der Schwarzwälder Straßenlaternenhersteller<br />
Hess AG etwa setzte<br />
kurz nach dem Börsendebüt seine<br />
Chefs wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation<br />
vor die Tür. Die vermeintlichen<br />
Missetäter bestreiten die Vorwürfe,<br />
das Unternehmen musste aber trotzdem<br />
wenig später Konkurs anmelden.<br />
Der charismatische Gründer des schwäbischen<br />
Windparkentwicklers Windreich,<br />
Willi Balz, musste zuletzt sogar seine Privathäuser<br />
beleihen, um die Zinsen für einen<br />
Schuldschein nach zweitägiger Verspätung<br />
zu bedienen. Anfang März rückte<br />
die Staatsanwaltschaft in der Firmenzentrale<br />
zur Razzia an. Ein Verdacht unter<br />
vielen, den Balz vehement bestreitet:<br />
Insolvenzverschleppung.<br />
Fairesearch-Analyst Steffen hat schon<br />
vor Jahren auf das Chaos bei Windreich<br />
hingewiesen. Zu ihrem Anlagevermögen<br />
zählte die Firma früher sogar einige Oldtimer<br />
von Auto-Fan Balz.<br />
Ähnliche Zustände herrschen Steffen<br />
zufolge in vielen Unternehmen, die an<br />
den Anleihemarkt gehen: „Die meisten<br />
Unternehmen haben Probleme mit dem<br />
Geschäftsmodell oder kämpfen um die<br />
Existenz.“<br />
Vor allem bekannte Markennamen<br />
scheinen viele Anleger blind zu machen<br />
auch für andere Risiken. Der Süßigkeitenhersteller<br />
Katjes etwa stockte eine erste<br />
30-Mil lionen-Euro-Anleihe vergangenes<br />
Jahr nochmals um 15 Millionen Euro<br />
auf. Dabei verleihen die Anleger ihr Geld<br />
aber nicht an den d<strong>eu</strong>tschen Lakritzproduzenten<br />
selbst, sondern an eine Holding-<br />
Gesellschaft für die ausländischen Beteiligungen<br />
der Katjes-Gruppe. „Wenn die<br />
Holding in Konkurs geht, haben die Anleger<br />
ihr Geld verloren – egal wie gut das<br />
Geschäft in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> läuft“, erklärt<br />
Unternehmensberater Grunow. Die verschachtelte<br />
Struktur sei ein üblicher Trick,<br />
den viele Anleger nicht erkennen.<br />
„Laien sind mit Mittelstandsanleihen<br />
oft überfordert“, resümiert Anlegeranwalt<br />
Joachim Cäsar-Preller.<br />
Wie es um den Küchenhersteller Alno<br />
noch im April stand, ließ sich allerdings<br />
einfach auf den ersten Seiten des Anleiheprospektes<br />
nachlesen. Die „Fortführung<br />
der Unternehmenstätigkeit“, so heißt es<br />
da, hänge maßgeblich von der termingerechten<br />
Begebung einer Anleihe im Volumen<br />
„von mindestens EUR 40,0 Mio“ ab.<br />
Im Klartext: Alno hätte die Pleite gedroht,<br />
wäre die Mittelstandsanleihe gefloppt.<br />
Trotzdem waren die Papiere nach nur<br />
einer Stunde verkauft. ANNE SEITH<br />
Fertigung beim L<strong>eu</strong>chtenhersteller Hess, Anlage des Windparkentwicklers Windreich: Längst hat der Markt seine ersten Skandale<br />
PAWEL SOSNOWSKI / DAPD (L.); DANIEL MAURER / DDP IMAGES (R.)<br />
DER SPIEGEL 33/2013 77
Wirtschaft<br />
Mercedes-Arbeiter in Sindelfingen<br />
STEUERN<br />
Billiger Ouzo<br />
Innerhalb des Euro-Raums greift<br />
der Fiskus auf höchst unterschiedliche<br />
Weise zu: Ausgerechnet<br />
Bürger der Krisenstaaten müssen<br />
oft sehr wenig abgeben.<br />
In Griechenland haben St<strong>eu</strong>erfahnder<br />
einen schweren Job: Vergangene Woche<br />
wurden sie auf Kreta aus einem<br />
Dorf gejagt, weil sie Tavernenbesitzern<br />
Strafen wegen St<strong>eu</strong>ervergehen abverlangen<br />
wollten. Die Kneipiers hatten es unterlassen,<br />
Quittungen für Speisen und Getränke<br />
auszustellen.<br />
So wie in Griechenland hat der Fiskus<br />
auch in den meisten anderen Krisenstaaten<br />
wenig zu melden. Ein zyprischer Arbeitnehmer,<br />
beispielsweise, muss nur 20<br />
Prozent seines Gehalts für St<strong>eu</strong>ern und<br />
Sozialabgaben ausgeben. Da verwundert<br />
nicht, dass der Staat bei der Rettung seiner<br />
Banken passen musste. Im Frühjahr<br />
musste die drittgrößte Insel des Mittelmeers<br />
von den anderen Europäern vor<br />
dem Bankrott gerettet werden.<br />
Der Krisenstaat Irland hält sich ebenfalls<br />
vornehm zurück, wenn es um die<br />
Belastung der eigenen Bürger geht. Die<br />
Iren konnten schon am 24. April Tax Liberation<br />
Day feiern. Seitdem arbeitet der<br />
durchschnittliche Arbeitnehmer von der<br />
Grünen Insel nicht mehr für den Staat,<br />
sondern in die eigene Tasche. So kommt<br />
es, dass irische Arbeiter auch im dritten<br />
Jahr nach der nationalen Pleite im Durchschnitt<br />
netto mehr in der Tasche haben<br />
als die D<strong>eu</strong>tschen.<br />
Die 67,5 Milliarden Euro, die die Iren<br />
zur Rettung ihrer Banken brauchten, kamen<br />
vom Währungsfonds IWF und den<br />
anderen EU-Staaten. Hartnäckig und mit<br />
Erfolg weigerten die Iren sich, in den Verhandlungen<br />
mit den anderen Europäern<br />
selbst die Mini-Unternehmenst<strong>eu</strong>er von<br />
12,5 Prozent anzuheben.<br />
Dagegen müssen die Arbeitnehmer in<br />
den Geberländern Zentral<strong>eu</strong>ropas d<strong>eu</strong>tlich<br />
länger arbeiten, bis sie frei über ihr<br />
Geld verfügen können. Das zeigt eine<br />
Studie der konservativen Brüsseler Denkfabrik<br />
Institut Economique Molinari, die<br />
einen internationalen Vergleich der realen<br />
St<strong>eu</strong>erbelastung von Arbeitseinkommen<br />
mit Hilfe von OECD-Zahlen vorlegte.<br />
Zu den staatlichen Lasten zählten die<br />
Forscher neben der Einkommenst<strong>eu</strong>er<br />
auch noch die Sozialabgaben von Arbeitnehmern<br />
und -gebern sowie einen Teil<br />
der Mehrwertst<strong>eu</strong>er.<br />
Der d<strong>eu</strong>tsche Arbeitnehmer muss demnach<br />
im Durchschnitt 53 Prozent seines<br />
Gehalts an den Staat und die gesetzlichen<br />
Sozialkassen abliefern. Auch Franzosen,<br />
THOMAS NIEDERMUELLER / GETTY IMAGES<br />
Österreicher oder Belgier, die neben den<br />
D<strong>eu</strong>tschen zu wichtigen Finanziers der<br />
Solidarmaßnahmen in Europa gehören,<br />
brauchen viel länger als beispielsweise<br />
die Spanier und Portugiesen, bis sie nicht<br />
mehr ausschließlich für den Staat arbeiten<br />
(siehe Grafik).<br />
„Wir haben damit gerechnet, dass unsere<br />
Studie einiges Aufsehen in den Geberländern<br />
erregen wird“, sagt James Rogers<br />
vom Institut Molinari. Schließlich<br />
werden mit den dort erwirtschafteten<br />
d<strong>eu</strong>tlich höheren St<strong>eu</strong>ereinnahmen die<br />
Hilfen für die möglicherweise gar nicht<br />
so bedürftigen Nehmerländer finanziert.<br />
Allein <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> haftet bisher mit 95,3<br />
Milliarden Euro für die Krisenländer.<br />
Eine isolierte Betrachtung der Belastung<br />
durch St<strong>eu</strong>ern und Abgaben greift<br />
allerdings zu kurz. „Es kommt entscheidend<br />
darauf an, was der Staat mit dem<br />
ihm anvertrauten Geld macht“, sagt Stefan<br />
Bach, der St<strong>eu</strong>erexperte des D<strong>eu</strong>tschen<br />
Instituts für Wirtschaftsforschung<br />
in Berlin. Eine Belastung im wohlfahrtsökonomischen<br />
Sinne entstehe erst dann,<br />
wenn der Staat damit nicht effizient wirtschafte.<br />
Die D<strong>eu</strong>tschen können beispielsweise<br />
auf eine gut ausgebaute gesetzliche Kranken-<br />
und Rentenversicherung vertrauen,<br />
was die Notwendigkeit lindert, sich privat<br />
abzusichern. Die Leistungen des Sozialstaats<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s fallen in der Regel<br />
üppiger aus als die der meisten Krisenländer.<br />
So zahlt die Arbeitslosenversicherung<br />
auf Zypern nur sechs, in Irland nur<br />
n<strong>eu</strong>n Monate. Hunderttausende sind bereits<br />
ausgewandert, um der Not zu entgehen<br />
– mit allen negativen Konsequenzen<br />
für die Familien und die Gesellschaft.<br />
Dennoch belegen die niedrigen Abgabenquoten<br />
in den Krisenländern eindrucksvoll,<br />
dass dort noch finanzielle Reserven<br />
schlummern – vor allem bei den<br />
Reichen. Die Rückzahlung der großteils<br />
von den St<strong>eu</strong>erzahlern Zentral<strong>eu</strong>ropas<br />
garantierten Darlehen wird nur gelingen,<br />
wenn die Vermögenden aus den Krisenstaaten<br />
an den Lasten beteiligt werden.<br />
Und wenn der St<strong>eu</strong>erstaat sich auch in<br />
Griechenland durchsetzt, müssen auch<br />
die Ouzo-Trinker in der Taverne ihren<br />
Beitrag zur Rettung des Landes leisten.<br />
CHRISTOPH PAULY<br />
Durchschnittliche Abgabenbelastung<br />
in Prozent des Einkommens*<br />
* einschließlich<br />
geschätzter<br />
Mehrwertst<strong>eu</strong>er<br />
Quelle: Institut<br />
Economique Molinari<br />
20<br />
Zypern<br />
14. März<br />
31 42<br />
Irland<br />
24. April<br />
Spanien<br />
12. Juni<br />
Portugal<br />
4. Juni<br />
45 57<br />
53<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
13. Juli<br />
Frankreich<br />
26. Juli<br />
60<br />
Belgien<br />
8. August<br />
Tag der St<strong>eu</strong>erbefreiung<br />
Bis zu welchem Tag des Jahres<br />
arbeitet ein Angestellter<br />
ausschließlich für das Finanzamt?<br />
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
78<br />
DER SPIEGEL 33/2013
GÜNTER WICKER / LIGATUR<br />
HAUPTSTADTFLUGHAFEN<br />
Gummi auf<br />
der Piste<br />
Nach fünf Monaten im Amt soll<br />
Hartmut Mehdorn Ergebnisse<br />
präsentieren. Doch der BER-Chef<br />
steckt in einem Machtkampf<br />
mit seinem Bau-Geschäftsführer.<br />
Manchmal gibt es im Urlaub Wichtigeres<br />
als Erholung. Diese Erfahrung<br />
machte Hartmut Mehdorn,<br />
als er sich in Südfrankreich ein paar Tage<br />
lang entspannen wollte.<br />
Am 2. August waren Ausflüge mit seinem<br />
Motorboot im Mittelmeer kein Thema<br />
mehr – Mehdorn musste kurzfristig<br />
für einen Tag nach Berlin reisen, wo ihn<br />
Klaus Wowereit mit Mitgliedern des Projektausschusses<br />
seines Aufsichtsrats am<br />
Airport Tegel in einem Sitzungssaal zum<br />
Rapport erwartete.<br />
Seit fünf Monaten ist der 71-Jährige als<br />
Flughafenchef im Amt. Jetzt wollen seine<br />
Gesellschafter – Berlin, Brandenburg und<br />
der Bund – nach vollmundigen Ankündigungen<br />
auch Ergebnisse sehen. In Wowereits<br />
Rathaus gilt der Manager schon als<br />
„Luftikus“.<br />
Auf der Aufsichtsratssitzung an diesem<br />
Freitag soll Mehdorn ins Kr<strong>eu</strong>zverhör genommen<br />
werden. Das Bundesverkehrsministerium<br />
hat einen umfangreichen Fragenkatalog<br />
vorbereitet. Wann werden die<br />
Beschl<strong>eu</strong>nigungseffekte seines Sprint-Programms<br />
sichtbar? Was genau machen die<br />
Roland-Berger-Berater, die Mehdorn für<br />
mehrere Millionen Euro ins Haus holte?<br />
Und wie soll die vorgezogene Eröffnung<br />
des Terminal-Flügels „Pier Nord“, die<br />
Mehdorn schon vor Wochen angekündigt<br />
hat, funktionieren?<br />
Vor allem aber drängen die Eigentümer<br />
auf ein schnelles, friedliches Ende des<br />
Machtkampfs zwischen Mehdorn und<br />
seinem Technikchef Horst Amann. Der<br />
war bereits vor einem Jahr als Trouble -<br />
shooter nach Berlin geholt worden und<br />
setzt – anders als sein n<strong>eu</strong>er, ungeduldiger<br />
Chef – auf eine gründliche, mehrjährige<br />
Sanierung.<br />
Schon in seiner ersten Arbeitswoche<br />
Mitte März stürmte Mehdorn wütend in<br />
Amanns Büro und knallte ihm mit den<br />
Worten „Was soll das?“ die aktuelle<br />
Ausgabe des SPIEGEL (11/2013) auf den<br />
Tisch. Rot markiert hatte er einen Satz,<br />
den Amann Tage zuvor bei der Vorstellung<br />
Mehdorns als n<strong>eu</strong>er Flughafenchef<br />
am Rande gesagt hatte: „Ich brauche keinen,<br />
der mir bei der Baufertigstellung<br />
hilft, das mache ich schon selber.“<br />
Es begann ein nerviger Kleinkrieg, der<br />
bis h<strong>eu</strong>te andauert.<br />
Mehdorn holte dieselben Baufachl<strong>eu</strong>te<br />
des alten Flughafenmanagements zurück,<br />
die Amann für unfähig gehalten und kaltgestellt<br />
hatte. Dann h<strong>eu</strong>erte er manche<br />
der zuvor gef<strong>eu</strong>erten Planer des Airport-<br />
Architekten Meinhard von Gerkan wieder<br />
an. Im SPIEGEL-Gespräch machte er<br />
sich über die umfangreiche Bestandsaufnahme<br />
lustig, die Amann in monatelanger<br />
Arbeit erstellt hatte. „Das ist Quatsch.<br />
Auf so eine Mängelliste kann ich verzichten“,<br />
sagte Mehdorn, der eigens eingestellt<br />
worden war, um die lähmende Ruhe<br />
am Bau zu beenden.<br />
Im „War Room“, den Mehdorn als n<strong>eu</strong>es<br />
Lagezentrum mitten im Terminal errichten<br />
ließ, sitzen der Chef und sein<br />
Flughafenmanager Mehdorn<br />
wichtigster Mitarbeiter zwar Seite an Seite.<br />
Intern machte Mehdorn aber schnell<br />
klar, dass ihm das gesamte Bauregime<br />
Amanns und insbesondere dessen Zeitplan<br />
nicht passten. Am liebsten hätte er<br />
seinen Bau-Geschäftsführer sofort rausgeworfen,<br />
wie er auch im größeren Kreis<br />
am Flughafen verkündete.<br />
Anfang Juni wurde Mehdorn bei Matthias<br />
Platzeck, dem bisherigen Aufsichtsratschef<br />
und Brandenburger Ministerpräsidenten,<br />
vorstellig und forderte die<br />
Ablösung Amanns – vergebens. Man brauche<br />
jetzt keine Personalquerelen, befand<br />
der Präsidialausschuss des Gremiums diplomatisch;<br />
das gemeinsame Ziel der Geschäftsführung<br />
müsse sein, den Flughafen<br />
möglichst schnell in Betrieb zu nehmen.<br />
Statt gemeinsamer Ziele jedoch verfolgen<br />
beide Manager jeweils eine eigene<br />
Agenda.<br />
Mehdorn wollte, damit das Milliardenprojekt<br />
auch einmal positive Schlagzeilen<br />
schreibt, möglichst schnell „Gummi auf<br />
der Piste“ sehen und den Probebetrieb<br />
im Pier Nord noch in diesem Jahr beginnen.<br />
„Vielleicht nur mit zwei kleinen<br />
Airlines, 1500 Fluggäste, sechs oder acht<br />
Flugz<strong>eu</strong>ge am Tag“, sagte er im Juni, „so<br />
können wir testen, wie etwa die Gepäckabfertigung,<br />
die Sicherheitskontrolle und<br />
die F<strong>eu</strong>erwehr funktionieren.“ Berlin<br />
hätte dann vorübergehend drei Flughäfen:<br />
Tegel, Schönefeld und das teileröffnete<br />
Terminal BER.<br />
Inzwischen musste er vor leitenden Managern<br />
einräumen, dass als „Zieltermin<br />
die Aufnahme des Testbetriebs bis März<br />
2014 als realistisch angesehen“ wird.<br />
Wenn es denn überhaupt dazukommt.<br />
Finanzexperten des BER halten den Umbau<br />
des Pier Nord schlicht für zu t<strong>eu</strong>er.<br />
Mehdorn müsste mehr als fünf Millionen<br />
Euro investieren, um unter anderem<br />
DER SPIEGEL 33/2013 79
80<br />
Wirtschaft<br />
Gepäckbänder, Sicherheitskontrollen und<br />
Check-in-Schalter zu installieren und damit<br />
den Nordflügel des Flughafens vor -<br />
übergehend zu einem funktionsfähigen<br />
Mini-Terminal umzubauen.<br />
Zudem würde der Teilbetrieb mit täglich<br />
sechs Starts und Landungen der Fluggesellschaft<br />
Germania pro Monat über<br />
eine halbe Million Euro verschlingen,<br />
etwa weil für jeden Flug Personal vom<br />
benachbarten Flughafen Schönefeld her -<br />
angekarrt werden müsste.<br />
Spätestens bis Februar 2015 muss alles<br />
schließlich wieder in den Originalzustand<br />
zurückgebaut werden – dann erlischt die<br />
bestehende Baugenehmigung. Deren Verlängerung<br />
sei „nicht mehr möglich“, heißt<br />
es in einem Vermerk der Flughafengesellschaft<br />
vom 31. Juli nach einem Gespräch<br />
mit dem zuständigen Bauordnungsamt.<br />
Amann, der den Testbetrieb ohnehin<br />
von Beginn an für eine unausgegorene<br />
PR-Aktion hielt, fühlt sich bestätigt. Der<br />
Bau-Geschäftsführer hat inzwischen ein<br />
Alternativszenario erarbeitet und dieses<br />
auch gleich dem Bundesverkehrsministerium<br />
und Wowereits Berliner Senatskanzlei<br />
vorgestellt. Danach soll der n<strong>eu</strong>e Flughafen<br />
nur in Teilbetrieb gehen, wenn<br />
gleichzeitig Schönefeld geschlossen wird.<br />
Neben den Fliegern der Gesellschaft Germania<br />
würden auch Easyjet und alle weiteren<br />
bislang in Schönefeld operierenden<br />
Fluglinien umziehen.<br />
Anders als Mehdorn will Amann den<br />
fertiggestellten Pier Nord nicht umbauen,<br />
sondern für Check-in-Schalter und Gepäckbänder<br />
einen schon bestehenden<br />
Anbau nutzen. Als Reserve soll ein<br />
schlichter Fertigbau errichtet werden. Der<br />
Betrieb wäre zwar weitgehend kostenn<strong>eu</strong>tral,<br />
weil die Ausgaben für das dann<br />
stillgelegte Terminal Schönefeld entfielen.<br />
Allerdings wären auch Investitionen von<br />
rund 16 Millionen Euro fällig, weil das<br />
Verkehrsaufkommen d<strong>eu</strong>tlich höher wäre<br />
als in Mehdorns Szenario. Im Sommer<br />
oder Herbst 2014 könnten laut Amann<br />
am Mini-Terminal die ersten Flieger starten.<br />
Falls sein Konzept technisch umsetzbar<br />
ist und die Airlines es akzeptieren –<br />
was manche Airport-Manager bezweifeln.<br />
Am Freitag will sich der Aufsichtsrat,<br />
da ein Zeitplan für die komplette Fertigstellung<br />
immer noch nicht erkennbar ist,<br />
nun mit beiden Konzepten zur Teileröffnung<br />
beschäftigen. Berlin und der Bund<br />
lassen bereits Sympathien für die Amann-<br />
Variante erkennen.<br />
Mehdorn hält dennoch an seinem Vorschlag<br />
fest und arbeitet in diesen Tagen<br />
intensiv an seiner Präsentation für das<br />
Kontrollgremium. Vor Vertrauten beklagte<br />
er kürzlich, dass es an dem klaren<br />
Willen fehle, an einem Strang zu ziehen.<br />
Wenn das Projekt BER gelingen solle,<br />
müssten die Politiker Vertrauen in seine<br />
Arbeit haben, und zwar „ohne Wenn und<br />
Aber“.<br />
ANDREAS WASSERMANN<br />
Airbnb-Nutzerin Odenthal<br />
TOURISMUS<br />
Teilen verboten<br />
Die kurzzeitige Vermietung privater Unterkünfte soll erschwert<br />
werden, aus Rücksicht auf die Wohnungsnot<br />
in Großstädten – und die Unternehmen des Hotelgewerbes.<br />
Vielleicht hatte der Berliner Senator<br />
für Stadtentwicklung Menschen<br />
wie Katja Odenthal im Sinn, als er<br />
über ein Verbot von Ferienwohnungen<br />
nachdachte. Odenthal lebt seit zehn Jahren<br />
in Berlin, ganz in der Nähe der zurzeit<br />
sehr gefragten Gegend Alt-Stralau im Viktoriakiez<br />
an der Rummelsburger Bucht.<br />
Weil Odenthal sich „schon immer irgendwie<br />
als WG-Typ“ sah, vermietet sie<br />
Teile ihrer Wohnung auf Zeit an Touristen.<br />
Anfangs aus finanziellen Gründen,<br />
Odenthal ist freiberufliche Autorin, sie<br />
schreibt Gebrauchskunst, wie sie es<br />
nennt, und ihr Einkommen war nicht immer<br />
rosig. Jetzt beherbergt sie Menschen<br />
aus der ganzen Welt vor allem deshalb,<br />
weil sie es „exotisch und spannend“ findet,<br />
mit anderen L<strong>eu</strong>ten und ihren Denkund<br />
Lebensweisen in Kontakt zu kommen.<br />
Zwischen 300 und 400 Euro st<strong>eu</strong>ern<br />
die Durchreisenden zur monatlichen Miete<br />
bei, im Sommer, wenn viele Touristen<br />
in der Stadt sind, tragen sie sie auch mal<br />
komplett. 60 bis 70 Prozent des Jahres<br />
hat Katja Odenthal fremde Menschen im<br />
Haus.<br />
Wie viele andere auch bietet die Wahl-<br />
Berlinerin ihre Räumlichkeiten auf dem<br />
Internetportal Airbnb an, einer Vermittlungsplattform<br />
aus San Francisco, die sich<br />
weltweit wachsender Beliebtheit erfr<strong>eu</strong>t.<br />
Längst gibt es Nachahmer wie 9flats,<br />
housetrip oder Wimdu, die nach einem<br />
ganz ähnlichen Prinzip funktionieren. Sie<br />
kassieren Provision für jede gebuchte<br />
Nacht, manche vom Vermieter, manche<br />
vom Mieter, einige auch von beiden.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Airbnb hat es nach Berechnungen des<br />
Magazins „Forbes“ im vergangenen Jahr<br />
auf einen Umsatz von 150 Millionen Dollar<br />
gebracht.<br />
Das US-Unternehmen vermittelt inzwischen<br />
in 34000 Städten und 192 Ländern<br />
mehr als 300 000 Privatwohnungen zu<br />
Urlaubszwecken. Auch in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
scheint sich das Konzept „Urlaub bei privaten<br />
Gastgebern“ durchzusetzen. Gerade<br />
bei Jüngeren ist es hip, statt in gleichförmigen<br />
Ps<strong>eu</strong>do-Design-Hotels bei Einheimischen<br />
zu übernachten, oft zu einem<br />
Bruchteil des Hotelpreises.<br />
Hierzulande ist Airbnb erst seit gut<br />
zwei Jahren aktiv, doch inzwischen sind<br />
schon über 20000 Übernachtungsmöglichkeiten<br />
auf der Seite registriert.<br />
Menschen wie Odenthal finden es<br />
schön, sich mit fremden L<strong>eu</strong>ten zu um -<br />
geben, und eigentlich müsste es auch im<br />
In teresse der Berliner Politik sein, Touristen<br />
in die Stadt zu locken. Dennoch sind<br />
einige Kurzzeitvermieter zum n<strong>eu</strong>en<br />
Feindbild der Volksvertreter geworden.<br />
Die werfen jenen vor, Wohnraum dem normalen<br />
Mietmarkt zu entziehen, stattdessen<br />
kurzfristig zu vermieten und damit die<br />
normalen Mieten in die Höhe zu treiben.<br />
Touristen eine Unterkunft zu bieten<br />
kann sich durchaus lohnen. Je nach Stadt,<br />
Ausstattung und Größe der Räumlichkeit<br />
sind zwischen 50 und 100 Euro pro Nacht<br />
drin. Für ausländische Gäste ist es reizvoll,<br />
bei normalen L<strong>eu</strong>ten unterzukommen,<br />
weil die ihnen ihre Stadt oft auf<br />
ganz andere Weise näherbringen als ein<br />
gewöhnlicher Reiseführer.<br />
THOMAS GRABKA / DER SPIEGEL
Mitunter kommt es vor, dass Mieter<br />
aus ihrer alten Wohnung ausziehen und<br />
in eine n<strong>eu</strong>e wechseln, die alte nicht kündigen,<br />
sondern sie lieber als Ferienwohnung<br />
weiterbetreiben und sich damit ein<br />
Geschäftsmodell erschließen. Auf diese<br />
Weise summieren sich im Monat schnell<br />
1500 bis 3000 Euro, d<strong>eu</strong>tlich mehr als eine<br />
ortsübliche Miete – und meist auch ohne<br />
Kenntnis des Finanzamts.<br />
Doch das ist die Ausnahme, auch Odenthal<br />
vergibt lediglich ein Zimmer an<br />
Ferien gäste. Bereits das empfinden Politiker<br />
wie der Berliner Senator Michael<br />
Müller (SPD) als Wohnraumentzug, denn<br />
das Zimmer könnte ja auch dauerhaft als<br />
WG-Zimmer vermietet werden, beispielsweise<br />
an Studenten – zumindest theoretisch.<br />
„Mein vermietetes Zimmer stünde<br />
dem Wohnungsmarkt auf andere Weise<br />
gar nicht zur Verfügung“, sagt Odenthal.<br />
In Berlin soll voraussichtlich vom<br />
Herbst an jeder ein stattliches Bußgeld<br />
zahlen, dem nachgewiesen werden kann,<br />
dass er seine Wohnung zu kommerziellen<br />
Zwecken weitervermietet; so hat es der<br />
Senat im Juni beschlossen. Als „Schaufensterpolitik“<br />
bezeichnet der Verband<br />
Haus & Grund das n<strong>eu</strong>e Gesetz. Es müsse<br />
erst mal „mit harten statistischen Fakten<br />
nachgewiesen“ werden, dass eine ausreichende<br />
Versorgung der Bevölkerung mit<br />
Wohnraum zu angemessenen Preisen<br />
nicht mehr gegeben sei.<br />
Von den etwa 1,8 Millionen Wohnungen<br />
in Berlin werden bisher höchstens<br />
12000 als Ferienwohnungen genutzt. Die<br />
Not der Mieter wird das Gesetz deshalb<br />
kaum lindern.<br />
Ähnliche Gesetze gibt es in beliebten<br />
Touristenmetropolen wie San Francisco,<br />
London oder Paris. In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> gehen<br />
München und Hamburg ebenfalls gegen<br />
schwarze Privatvermietungen vor. In München<br />
sei das Angebot an lukrativen Ferien -<br />
wohnungen in den vergangenen Jahren<br />
um 40 Prozent gestiegen, rechnet die örtliche<br />
SPD vor, während normale Wohnungen<br />
zur Mangelware werden. Bis zu 50000<br />
Euro Bußgeld riskiert in der bayerischen<br />
Gastgeberin Kuhl<br />
Hauptstadt, wer seine Wohnung unter der<br />
Hand an Kurzzeitgäste wie Touristen oder<br />
Messebesucher vergibt. Doch der Nachweis<br />
ist schwer. Im Jahr 2011 hat die<br />
Münchner Stadtverwaltung gerade mal<br />
183 zweckentfremdete Wohnungen in normalen<br />
Wohnraum zurückverwandeln lassen.<br />
Und in Hamburg stehen offiziell rund<br />
2000 Wohnungen leer, d<strong>eu</strong>tlich höher sei<br />
allerdings die Zahl der Zweckentfremdungen<br />
für Ferienwohnungen. „Wir vermuten<br />
30000 Fälle“, sagt Eckard Pahlke, Vorsitzender<br />
des Hamburger Mietervereins.<br />
Bei Airbnb ist man dennoch aufgeschreckt:<br />
Die politischen Vorstöße treffen<br />
das Geschäftsmodell der Plattform im<br />
Kern, auch wenn in den Regularien steht,<br />
dass jeder Nutzer sich mit den lokalen<br />
Gesetzeslagen selbst befassen muss.<br />
Das Unternehmen hat jetzt überprüft,<br />
wie viele der angebotenen Wohnungen so -<br />
genannte Primary Homes sind, also dau -<br />
erhaft vom eigentlichen Wohnungsinhaber<br />
genutzt werden. Heraus kamen etwa<br />
90 Prozent. „Da kann man nicht von spekulativem<br />
Leerstand sprechen“, sagt Lena<br />
Sönnichsen von Airbnb <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>. Im<br />
Übrigen bewegten sich die Belegungsraten<br />
zwischen zwei und vier Prozent im Jahr.<br />
Deshalb wehren sich die Airbnb-L<strong>eu</strong>te<br />
auch gegen Verbote und Bußgelder.<br />
So unterstützten sie jüngst den New<br />
Yorker Nigel Warren bei einem Gerichtsprozess.<br />
Der hatte sein Zimmer in einer<br />
WG für die Zeit eines kurzfristigen Wochenendtrips<br />
bei Airbnb angeboten, um<br />
die Kosten für die t<strong>eu</strong>re Miete etwas zu<br />
reduzieren. Jemand schwärzte ihn an,<br />
nach seiner Rückkehr fand er einen Bußgeldbescheid<br />
in Höhe von 7000 Dollar in<br />
seinem Briefkasten. Er hätte sein Zimmer<br />
mindestens 30 Tage vermieten oder aber<br />
während der Vermietung selbst zu Hause<br />
sein müssen, dann wäre es legal gewesen.<br />
Nach einigem juristischen Hin und Her<br />
reduzierte sich die Strafe auf 2400 Dollar,<br />
weil sein fester Mitbewohner während<br />
Warrens Kurztrip anwesend war.<br />
Heike Kuhl findet ein solches „Zweckentfremdungsverbot“,<br />
wie es Berlin nun<br />
THOMAS GRABKA / DER SPIEGEL<br />
einführen will, regelrecht absurd. Auch<br />
sie lebt in Berlin, auch sie vermietet ab<br />
und an ein Zimmer in ihrer Zweizimmerwohnung<br />
in Alt-Treptow, die sie mit ihrer<br />
Tochter und einem Hund bewohnt. „Ich<br />
teile gern“, sagt Kuhl, die das Zimmer ab<br />
31 Euro pro Nacht anbietet.<br />
Die selbständige Familientherap<strong>eu</strong>tin<br />
hat durchaus Verständnis dafür, dass<br />
Berlinern ein vernünftiger Mietmarkt erhalten<br />
bleiben soll, doch nicht, indem<br />
man L<strong>eu</strong>te bestraft, die ihre Wohnungen<br />
teilen. „Es gibt ja auch keine Zwangs -<br />
abgabe für Investoren, wenn ihre Büroklötze<br />
jahrelang als Spekulationsobjekte<br />
leer stehen.“<br />
Die Sorge um ausreichenden Wohnraum<br />
dürfte jedoch nur ein Grund für den<br />
Aktionismus des Gesetzgebers sein. Denn<br />
die Politik steht auch unter erheblichem<br />
Druck der Tourismusindustrie. Durch die<br />
n<strong>eu</strong>en Internet-Buchungsmöglichkeiten<br />
entstünden viele virtuelle Hotels, die mit<br />
den klassischen Anbietern konkurrierten,<br />
sagt Stephan Gerhard von der Beratungsfirma<br />
Tr<strong>eu</strong>gast. Der Hotelverband klagt,<br />
dass ihm Privatl<strong>eu</strong>te mittlerweile 87 Millionen<br />
Übernachtungen im Jahr abspenstig<br />
machen. „Damit geht der Hotellerie<br />
rund ein Viertel der jährlich rund 370 Millionen<br />
Übernachtungen in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
verloren“, behauptet der Präsident des<br />
D<strong>eu</strong>tschen Hotel- und Gaststättenverbandes,<br />
Willy Weiland. Wie er auf diese phantastische<br />
Zahl kommt, erklärt er nicht.<br />
Airbnb als größter Anbieter bringt es in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> auf 1,8 Millionen Vermittlungen<br />
pro Jahr.<br />
Das Hotelgewerbe ärgert vor allem,<br />
dass es sich an zig Auflagen halten muss,<br />
während die Privatanbieter auch die ranzigsten<br />
Zimmer feilbieten dürfen, ohne<br />
kontrolliert oder gar zur Rechenschaft gezogen<br />
zu werden.<br />
Für Airbnb gleichen die Klagen der<br />
Tourismusindustrie denen der Telekommu -<br />
nikationskonzerne, als kostenlose Dienste<br />
wie Skype oder anfangs Whatsapp auf<br />
den Markt kamen. Die etablierten Konzerne<br />
riefen auch nach Regulierung, letztlich<br />
aber hätten sich die Ideen durchgesetzt.<br />
„Wir sind nun mal n<strong>eu</strong>, wir treten<br />
manchen auf die Füße, manchmal nur gefühlt,<br />
manchmal echt“, sagt Airbnb-Frau<br />
Sönnichsen.<br />
Katja Odenthal jedenfalls will weiterhin<br />
bei Airbnb aktiv bleiben. Demnächst<br />
beabsichtigt sie, ein Kochbuch mit den<br />
geheimen Familienrezepten ihrer Gäste<br />
zu veröffentlichen. Jedes einzelne hat sie<br />
mit ihnen gekocht. In der Speisefolge<br />
kommen singapurische Reisgerichte vor,<br />
aber auch n<strong>eu</strong>seeländische Gingernuts<br />
oder italienisches Tiramisu. JANKO TIETZ<br />
Video: Airbnb-Nutzerin Katja<br />
Odenthal zeigt ihre Wohnung<br />
spiegel.de/app332013airbnb<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 33/2013 81
Panorama<br />
82<br />
KOMMENTAR<br />
Abgesagt,<br />
na und?<br />
Von Christian Neef<br />
Der Moskauer Gipfel zwischen Barack<br />
Obama und Wladimir Putin ist<br />
abgesagt. Na und? Früher wären die<br />
Russen schwer beleidigt gewesen.<br />
Jetzt herrscht in Moskau fast Gleichgültigkeit.<br />
Obama hat längst seinen<br />
Glanz verloren, der Kreml rechnet<br />
nicht mehr mit ihm; Außenminister<br />
John Kerry halten die Russen für unerfahren.<br />
Ein n<strong>eu</strong>er Kalter Krieg stehe<br />
bevor? Völliger Unsinn. In dem<br />
ging es für beide Staaten ums Über -<br />
leben, jeder Druck auf den nuklearen<br />
Knopf hätte Dutzende Städte des<br />
Gegners ausgelöscht und Millionen<br />
Menschenleben gekostet. Deswegen<br />
waren Moskau und Washington in<br />
Fragen der strategischen Stabilität<br />
immer wieder zum Dialog gezwungen,<br />
während sie geopolitisch erbarmungslos<br />
miteinander konkurrierten.<br />
Aber jetzt? Politisch ist keine der beiden<br />
Seiten durch die andere in ihrer<br />
Existenz bedroht – aber genau das<br />
macht die Suche nach gemeinsamen<br />
Interessen so schwer. Nur wenig verbindet<br />
die USA und Russland noch,<br />
nicht mal beim Handel kommen beide<br />
voran. Und Moskaus Einfluss auf<br />
den Rest der Welt ist mit dem Amerikas<br />
nicht mehr annähernd vergleichbar.<br />
In beiden Ländern ist der Blick<br />
auf den anderen innenpolitisch motiviert,<br />
die Lage verfahrener als im<br />
Kalten Krieg. In Washington gibt<br />
eine starke antirussische Lobby den<br />
Ton vor, in Moskau sind es die mächtigen<br />
Antiamerikaner. Auf Putin in<br />
der Affäre Snowden Druck auszuüben,<br />
als der Whistleblower noch am<br />
Flughafen in Scheremetjewo saß, war<br />
albern und der Kreml geradezu<br />
gezwungen, seine Unabhängigkeit<br />
zu beweisen. Andererseits: Es war<br />
Putin, der es nach seinem Amts -<br />
antritt vor einem Jahr ablehnte, zum<br />
G-8-Gipfel nach Camp David zu fahren.<br />
Wir dürfen keine Wunder erwarten,<br />
Putin wird eine schnippische,<br />
vielleicht böse Antwort auf Obamas<br />
Absage finden. In Amerika könnte<br />
ein Hardliner zum Boykott der Spiele<br />
in Sotschi aufrufen. Irgendwann<br />
aber wird in beiden Lagern die<br />
patho logische Fixiertheit auf den<br />
früheren Klassenfeind vergehen.<br />
Wähler, Sicherheitskräfte in Harare<br />
Nuklearexperte Mycle Schneider, 54,<br />
Herausgeber des „Welt-Statusberichts<br />
Atomenergie“, über das Krisen -<br />
management in Fukushima<br />
SPIEGEL: Japans Regierung hat den<br />
Konzern Tepco kritisiert, weil das vers<strong>eu</strong>chte<br />
Wasser ins Meer läuft. Sollte<br />
der Staat die Kontrolle übernehmen?<br />
Schneider: Die Firma ist de facto bereits<br />
bankrott und wurde nationalisiert,<br />
der Staat wäre also zuständig.<br />
Doch sie darf weiterwurschteln, als<br />
ginge es darum, eine Garage zu<br />
reparieren. Dabei erfordert der Umgang<br />
mit der beispiellosen Zerstörung<br />
von vier Atomanlagen die Beratung<br />
durch die besten internationalen<br />
Experten.<br />
SPIEGEL: Was ist das größte Problem?<br />
Schneider: Täglich drücken 400 Tonnen<br />
Grundwasser in die Keller, wo sich<br />
hochradioaktiv vers<strong>eu</strong>chtes Wasser<br />
sammelt. Diese gewaltigen Massen<br />
fließen zum Teil ins Meer. Tepco will<br />
nun eine Wand mit Kühlmitteln in den<br />
Boden einziehen, die das Grundwasser<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
SIMBABWE<br />
Beistand für den Diktator<br />
Nach dem erdrutschartigen Wahlsieg<br />
von Dauer-Präsident Robert Mugabe<br />
steht nun eine israelische IT-Firma<br />
unter Verdacht, dem Diktator beim<br />
Siegen geholfen zu haben. Die Opposi -<br />
tionspartei MDC sagt, es gebe Hinweise,<br />
dass das Unternehmen Nikuv International<br />
Projects aus Herzlija bei Tel<br />
Aviv an dem „gigantischen Wahlschwindel“<br />
beteiligt gewesen sei. Die<br />
israelischen IT-Experten arbeiten seit<br />
2000 mit dem Regime in Harare zusammen.<br />
Diesmal assistierten sie offenbar<br />
bei der Erstellung des Wählerverzeichnisses:<br />
Nur wer darin erfasst<br />
ist, darf abstimmen. Doch in vielen<br />
Stimmbezirken waren mehr Wähler<br />
als Einwohner verzeichnet, andererseits<br />
wurden 1,9 Millionen Wahlberechtigte<br />
unter 30 Jahren erst gar nicht<br />
registriert. Dafür standen nach Angaben<br />
unabhängiger Gutachter mehr als<br />
eine Million Geisterwähler auf den Listen.<br />
All das begünstigte Mugabe. In<br />
manchem Wahlkreis konnte<br />
dessen Partei ihren Anteil verzwanzigfachen.<br />
Insider berichten<br />
nun, dass Emmanuel Antebi,<br />
der Chef von Nikuv, am<br />
Tag vor den Wahlen noch eine<br />
90-minütige Unterredung mit<br />
Mugabe gehabt haben soll.<br />
Das Unternehmen bestreitet<br />
den Vorwurf der Manipula -<br />
tion. In Wahlkampfzeiten werde<br />
mit Dreck geworfen, Nikuv<br />
sei zu keinem Zeitpunkt in<br />
die Politik verwickelt gewesen,<br />
erklärte die Firma.<br />
JAPAN<br />
„Ein störanfälliges Provisorium“<br />
PETE MULLER / NEW YORK TIMES / LAIF<br />
vereist. Aber das wäre, wie so vieles<br />
in Fukushima, ein störanfälliges Provisorium:<br />
Es versagt, falls der Strom ausfällt.<br />
Anfällig ist auch die Kühlung:<br />
Die vier Kilometer langen Leitungen<br />
sind vor allem aus Plastik, nicht aus<br />
Stahl; Frost führt im Winter zu zahlreichen<br />
Lecks. Dabei müsste das System<br />
Jahrzehnte halten, bis der zerstörte<br />
Kernbrennstoff entfernt werden kann.<br />
SPIEGEL: Wie schwer ist die radioaktive<br />
Belastung der Umwelt?<br />
Schneider: Das Wasser ist besonders<br />
problematisch. Tepco lagert knapp<br />
300000 Tonnen belastetes Wasser in<br />
provisorischen Tanks; bis Mitte 2015<br />
sollen es mehr als doppelt so viele sein.<br />
Die Untersuchungskommission des<br />
Parlaments hat errechnet, dass in dem<br />
ganzen Wasser rund dreimal so viel<br />
radioaktives Cäsium-137 freigesetzt<br />
wurde wie beim GAU von Tscher no -<br />
byl. Auch ist Reaktor 4, in dessen Abklingbecken<br />
mehr Brennstäbe unter<br />
freiem Himmel lagern als in den drei<br />
anderen Reaktoren zusammen, in katastrophalem<br />
Zustand.
Ausland<br />
JOHAN ORDONEZ / AFP<br />
Bauern gegen Beton Die Maisbauern von San Juan<br />
Sacatepéquez, einer Gemeinde westlich von Guatemala-Stadt,<br />
gelten als friedliche L<strong>eu</strong>te. Doch wenn sie ihr Land bedroht<br />
sehen, hat ihre Sanftmut ein Ende: Zu Hunderten besetzten sie<br />
Felder, die sie einem fragwürdigen Fortschritt opfern sollen.<br />
Eine der reichsten Familien Guatemalas will hier eine Fabrik<br />
errichten, die Zement und Beton für den Bau einer mehr spu ri -<br />
gen Schnellstraße liefern soll. Die Bauern bangen nun um<br />
ihren Maisanbau und fürchten Umweltschäden. „Unsere Kinder<br />
essen keinen Zement, sie wollen Mais“, heißt ihre Parole.<br />
KOREA<br />
Weiße Fahne<br />
Gut vier Monate nach seinen militärischen<br />
Drohgebärden und der Schließung<br />
der Sonderwirtschaftszone Kaesong<br />
ist Nordkoreas Führer Kim Jong<br />
Un offenbar bereit, den Industriepark<br />
wieder für südkoreanische Unternehmen<br />
zu öffnen. Mitte dieser Woche<br />
wollen Vertreter beider Länder in Kaesong<br />
zusammentreffen und Details verhandeln.<br />
Pjöngjang garantiere die Sicherheit<br />
aller Südkoreaner, um eine<br />
„n<strong>eu</strong>e Phase von Versöhnung, Zusammenarbeit,<br />
Frieden, Wiedervereinigung<br />
und Wohlstand“ einzuleiten, ließ<br />
Kim mitteilen. Der Kursschwenk gilt<br />
als großer diplomatischer Erfolg für<br />
Seouls n<strong>eu</strong>e Präsidentin Park G<strong>eu</strong>n<br />
200 km<br />
CHINA<br />
Pjöngjang<br />
NORDKOREA<br />
Kaesong<br />
Seoul<br />
CHINA<br />
SÜDKOREA<br />
RUSSLAND<br />
Hye. Sie hatte die kommunistische<br />
Führung ultimativ zu Verhandlungen<br />
gedrängt: Parallel stellte ihre Regierung<br />
allen südkoreanischen Firmen<br />
staatliche Ausfallentschädigungen von<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
JAPAN<br />
insgesamt gut 250 Millionen Dollar in<br />
Aussicht. Das wurde als politischer<br />
„Todesstoß“ für jegliche Form wirtschaftlicher<br />
Zusammenarbeit in der<br />
Zukunft gewertet. Nun habe Kim<br />
durch sein Einknicken „die weiße Fahne<br />
hissen“ müssen und „sein Gesicht<br />
verloren“, sagt der südkoreanische<br />
Politikprofessor Son Tae Gyu. Zum<br />
ersten Mal seit über 20 Jahren habe<br />
der Süden wieder die politische Initiative<br />
zurückgewonnen, kommentiert<br />
der Seouler Wissenschaftler Chung<br />
Young Tae.<br />
In Kaesong an der Grenze zum Süden<br />
beschäftigten zuletzt mehr als 120<br />
süd koreanische Unternehmen rund<br />
53000 nordkoreanische Arbeiter in<br />
der Produktion von Billigprodukten.<br />
Das bescherte dem bitterarmen Regime<br />
im Norden Devisen von rund<br />
90 Millionen Dollar jährlich.<br />
83
Ausland<br />
TUNESIEN<br />
Revolution<br />
am Nullpunkt<br />
Knapp zwei Jahre nach der ersten freien Wahl herrscht<br />
Chaos im Geburtsland des Arabischen Frühlings.<br />
Die Säkularen wollen die regierenden Islamisten zum<br />
Rückzug zwingen; vielen geht es schlechter als zuvor.<br />
Berg Chambi<br />
Der Berg Chambi brennt, seit vier<br />
Tagen schon. An seinem Fuß, in<br />
einem Haus zwischen Olivenbäumen,<br />
schaut Khaled Dalhoumi zu, wie<br />
schwarzer Rauch in den Himmel steigt,<br />
als sei der Chambi ein Vulkan.<br />
Dumpfe Einschläge weckten Dalhoumi<br />
am Freitag vor einer Woche. Als er vor<br />
die Tür trat, sah er Bomben auf das Gebirgsmassiv<br />
fallen. Seither hört er rund<br />
um die Uhr Schüsse und Einschläge,<br />
nachts l<strong>eu</strong>chtet der Berg im F<strong>eu</strong>erschein<br />
gewaltiger Waldbrände. Der Berg, in dem<br />
sein Vater einst Blei schürfte und der später<br />
unter Naturschutz gestellt wurde, ist<br />
zum Kriegsgebiet geworden. „Es bricht<br />
mir das Herz“, sagt Dalhoumi.<br />
Khaled Dalhoumi ist 53 Jahre alt,<br />
Grundschullehrer und Gewerkschafter.<br />
Ein sanfter Mann mit Schnurrbart, der<br />
Karl Marx gelesen und die Revolution unterstützt<br />
hat. Nun versucht er zu verstehen,<br />
was mit seinem Berg geschieht, mit<br />
seiner Stadt, mit seinem Land.<br />
Das Chambi-Gebirge, 1544 Meter hoch,<br />
erhebt sich am Rand der Stadt Kasserine<br />
im Westen Tunesiens; die Grenze zu Algerien<br />
ist nah, die Hauptstadt Tunis vier<br />
Stunden Autofahrt entfernt. Kasserine<br />
84<br />
ONS ABID / DER SPIEGEL<br />
war einer der Orte, in denen Ende 2010<br />
die Revolution begann, die den Diktator<br />
Zine el-Abidine Ben Ali stürzte und die<br />
arabischen Aufstände in Gang setzte.<br />
Jetzt kämpft die tunesische Armee hier<br />
gegen islamistische Terroristen, deren<br />
Herkunft und Identität ungeklärt ist, und<br />
die das Gebirgsmassiv als Rückzugsort<br />
genutzt haben sollen. Seit die Kämpfer<br />
acht Soldaten töteten, geht die Armee<br />
mit vollem Einsatz gegen sie vor. Die<br />
Rauchsäule über Kasserine ist für Khaled<br />
Dalhoumi ein Zeichen, dass beim tunesischen<br />
Frühling etwas grundsätzlich schiefgegangen<br />
ist. „Die Revolution ist auf die<br />
falsche Spur geraten“, sagt er.<br />
Schuld sind seiner Meinung nach die<br />
Islamisten der Partei al-Nahda, die seit<br />
der Wahl vor knapp zwei Jahren zusammen<br />
mit zwei säkularen Parteien das<br />
Land regiert. Die Nahda und ihr Anführer<br />
Rachid Ghannouchi hätten kein Interesse,<br />
gegen Extremisten vorzugehen, glaubt<br />
Dalhoumi. „Vorher war es so: Ben Ali<br />
macht, was er will, und alle müssen<br />
schweigen. Nun ist es so: Die Islamisten<br />
machen, was sie wollen, und die anderen<br />
können sagen, was sie wollen.“<br />
Alles hängt für Dalhoumi zusammen:<br />
die Wut und Hoffnungslosigkeit der Menschen<br />
in Kasserine und im ganzen Land.<br />
Die Terroristen auf dem Berg und die ungeklärten<br />
Morde an zwei Oppositions -<br />
politikern. Und natürlich der Militärputsch<br />
in Ägypten. All das hat innerhalb kurzer<br />
Zeit dafür gesorgt, dass der komplizierte,<br />
aber hoffnungsvolle Übergang zur Demokratie<br />
zum Stillstand kam – und das Land<br />
in eine tiefe Krise gestürzt ist. Vorige Woche<br />
wurde nun sogar die Arbeit an der<br />
n<strong>eu</strong>en Verfassung ausgesetzt, obwohl dies<br />
das wichtigste Ziel der Regierung war.<br />
Der rauchende Berg ist ein Symbol für<br />
die politische Krise, weil hier wie da die<br />
Verhältnisse undurchsichtig sind und jede<br />
Konfliktpartei sich eine eigene D<strong>eu</strong>tung<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Junge Männer im Café Total in Kasserine: Es gibt<br />
der Realität erschaffen hat, in der Verdächtigungen<br />
die Fakten ersetzen.<br />
Sicher ist: Am 25. Juli wurde der linksliberale<br />
Politiker Mohammed Brahmi vor<br />
seinem Haus in einem Vorort von Tunis<br />
erschossen, vor den Augen seiner Frau<br />
und Tochter. Z<strong>eu</strong>gen sagten später aus,<br />
sie hätten zwei Männer auf einem Motorrad<br />
gesehen. Die Tat erinnert an die Ermordung<br />
eines anderen führenden Oppositionspolitikers<br />
vor einem halben Jahr.<br />
Auch Chokri Belaid wurde vor seiner<br />
Wohnung ermordet, offenbar mit derselben<br />
Waffe, das gab das Innenministerium<br />
inzwischen bekannt. Beide Ermordeten<br />
waren lautstarke Kritiker des politischen<br />
Islam. Offiziellen Angaben zufolge gibt<br />
es 14 Verdächtige, die mit al-Qaida im<br />
Maghreb in Verbindung stehen sollen.
nichts zu tun, selbst die Jobs auf dem Bau, wo es drei Euro am Tag gibt, sind inzwischen rar<br />
ONS ABID / DER SPIEGEL<br />
Der Mord an Mohammed Brahmi löste<br />
eine Kettenreaktion aus: Noch am selben<br />
Tag protestierten Tausende auf der Avenue<br />
Habib Bourguiba in Tunis gegen die<br />
Regierung. Genau an jenem Ort, an dem<br />
auch Anfang 2011 die Proteste gegen das<br />
Regime von Ben Ali stattfanden. Die Polizei<br />
setzte Tränengas ein, dann zogen<br />
die Demonstranten vor das Parlamentsgebäude<br />
im Stadtteil Le Bardo.<br />
Dort demonstrierten in den darauffolgenden<br />
Tagen die Anhänger und Gegner<br />
von al-Nahda. Zwei Tunesien, dicht nebeneinander,<br />
getrennt nur durch Stacheldraht.<br />
Bei den Gegnern die J<strong>eu</strong>nesse dorée<br />
aus den Vorstädten, mit engen Jeans<br />
und t<strong>eu</strong>ren T-Shirts, bei den Islamisten<br />
die Frauen mit Kopftüchern. Aber manchmal<br />
eben auch andersherum: die zwei<br />
hübschen, unverhüllten Schwestern auf<br />
der Seite von al-Nahda, die schreien, die<br />
Oppositionellen seien Putschisten. Und<br />
die alte Verschleierte zwischen den Säkularen,<br />
die sagt, dies sei nicht der Islam,<br />
den sie wolle.<br />
Die Demonstrationen der Opposition<br />
sind größer, weil sie in der Hauptstadt in<br />
der Mehrheit ist. Deshalb karrte al-Nahda<br />
am Samstag vor einer Woche aus dem<br />
ganzen Land Zehntausende Unterstützer<br />
herbei. Am vergangenen Mittwoch konterte<br />
die Opposition mit einer eigenen<br />
Großdemonstration. Anschließend versuchten<br />
beide Seiten mit Hilfe von Luftaufnahmen<br />
zu beweisen, dass ihre Veranstaltung<br />
die größere gewesen sei.<br />
Die mehrheitlich säkularen Gegner der<br />
Islamisten fordern die sofortige Auflösung<br />
der gewählten Verfassunggebenden<br />
Versammlung; die meisten wollen zudem<br />
eine Regierung aus unabhängigen Technokraten.<br />
Die Nahda sei vielleicht nicht<br />
der Auftraggeber, zumindest aber politisch<br />
verantwortlich für die Morde, sagen<br />
ihre Gegner, weil sie zu zögerlich gegen<br />
die Extremisten vorgegangen sei. Der Verfassunggebenden<br />
Versammlung werfen<br />
sie überdies vor, ihr Mandat von einem<br />
Jahr weit überschritten zu haben.<br />
Die Oppositionsparteien haben sich<br />
den Forderungen der Demonstranten angeschlossen,<br />
etwa ein Drittel ihrer Abgeordneten<br />
boykottieren das Quasi-Parlament.<br />
Es ist ähnlich wie in Ägypten: Das<br />
Land ist gespalten, auf der einen Seite<br />
stehen die Islamisten, auf der anderen<br />
Seite formieren sich ihre Gegner – dazwi-<br />
DER SPIEGEL 33/2013 85
schen verläuft ein tiefer Graben.<br />
Und wie in Ägypten sieht<br />
sich auch hier eine demo -<br />
kratisch gewählte Regierung,<br />
angeführt von Islamisten, mit<br />
Rücktrittsforderungen konfrontiert,<br />
weil die Masse es so<br />
will. Die Armee hat in Tunesien<br />
allerdings keine politischen<br />
Ambitionen, dafür gibt<br />
es die mächtige Gewerkschaft<br />
UGTT, die schon während der<br />
Revolution eine entscheidende<br />
Rolle spielte und auch im<br />
aktuellen Konflikt Druck auf<br />
die Islamisten ausübt.<br />
Im Hauptsitz der Nahda, im<br />
großzügigen Büro seines Vaters,<br />
sitzt Moadh Ghannouchi,<br />
der im britischen Exil aufgewachsene<br />
Sohn und Stabschef<br />
des Parteiführers. Er spricht<br />
ein sehr britisches Englisch<br />
und weist die Verantwortung<br />
für die Morde weit von sich.<br />
Stattdessen beschuldigt er die<br />
Opposition, sie wolle einen<br />
Putsch herbeiführen, so wie in<br />
Ägypten. Doch anders als die<br />
Muslimbrüder sei al-Nahda<br />
stets kompromissbereit gewesen,<br />
sagt er: Man habe mit den<br />
Säkularen koaliert und auf die<br />
Erwähnung der Scharia in der<br />
Verfassung verzichtet.<br />
Für den Islamisten Ghannouchi<br />
repräsentiert die Opposition<br />
die alte, westlich geprägte Elite des<br />
Landes, die sich noch immer nicht damit<br />
abfinden wolle, dass sie nicht mehr allein<br />
das Sagen habe. Weil diese Säkularen<br />
aber mit demokratischen Mitteln offenbar<br />
nicht an die Macht kommen könnten, probierten<br />
sie es nun mit anderen Mitteln.<br />
Es zeige sich, sagt Ghannouchi, dass sie<br />
dem Islam keinen Platz in der Politik zubilligen<br />
wollten, egal wie demokratisch<br />
die Islamisten gewählt worden seien. Er<br />
scheint ernüchtert, dass es sich für die<br />
Nahda nicht aus gezahlt hat, sich an die<br />
Spielregeln zu halten. So argumentieren<br />
derzeit viele Islamisten in Tunesien.<br />
Die meist säkularen Gegner eint dagegen<br />
die Furcht vor einer geheimen Agenda<br />
der Islamisten. „Die Nahda-L<strong>eu</strong>te sind<br />
keine Demokraten, sie wollen sich nur<br />
an der Macht festklammern“, sagt Béji<br />
Caïd Essebsi, Gründer der wichtigsten<br />
Oppositionspartei Nida Tunis, dem „Ruf<br />
Tunesiens“. Es gibt sie erst seit kurzem,<br />
sie vereint Linke, Liberale und Mitglieder<br />
der früheren Regimepartei RCD – und<br />
sie könnte am meisten von den Protesten<br />
profitieren. Glaubt man den unzuverlässigen<br />
Umfragen, würde sie bei Wahlen<br />
al-Nahda als stärkste Partei ablösen.<br />
In der n<strong>eu</strong>en Parteizentrale im edlen<br />
Stadtteil Berges du Lac wird noch überall<br />
gehämmert, Essebsi sitzt müde im Sessel.<br />
86<br />
Studentin Rabhi mit Mutter: „Ich werde langsam zur Minderheit“<br />
Er diente schon unter Habib Bourguiba,<br />
dem ersten Präsidenten nach der Unabhängigkeit;<br />
nach der Revolution war er<br />
vorübergehend Premier. Nun ist er für<br />
viele Nahda-Gegner die letzte Hoffnung.<br />
Der Politiker hält nichts von dem Argument,<br />
die Islamisten seien demokratisch<br />
legitimiert. Er meint, ihr Mandat sei<br />
abgelaufen. Es stimmt, dass die Parteien<br />
vor der Wahl übereinkamen, die Arbeit<br />
an der Verfassung auf ein Jahr zu begrenzen.<br />
Der Zeitplan war allerdings von Anfang<br />
an unrealistisch.<br />
Bis zu der für Dezember angekündigten<br />
Wahl will Essebsi nun „unabhängigen<br />
Persönlichkeiten“ die Regierungsverantwortung<br />
übertragen. „Stimmt al-Nahda<br />
nicht zu“, sagt er, „riskieren wir ein ägyptisches<br />
Szenario.“ Die Nahda sei fast wie<br />
die Muslimbruderschaft, sie müsse sich<br />
auf Verhandlungen einlassen. Es klingt<br />
wie eine Drohung.<br />
Béji Caïd Essebsi und al-Nahda-Chef<br />
Rachid Ghannouchi sind derzeit die wichtigsten<br />
Gegenspieler, der eine ist 86, der<br />
andere 72 Jahre alt. In einem Land, in<br />
dem die Jugend die Revolution machte,<br />
verwalten nun alte Männer den Übergang<br />
zur Demokratie. Vor allem die Jungen in<br />
Tunis sind frustriert, dass alles so lange<br />
dauert, man spürt bei ihnen inzwischen<br />
so etwas wie Revolutionsnostalgie. Weil<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
ONS ABID / DER SPIEGEL<br />
kaum einer mehr weiß, was<br />
im Land passiert, aber alle<br />
mitreden wollen, mischen sich<br />
auf den Straßen Wahrheit und<br />
Verdächtigungen, Hysterie<br />
und Ängste, Gerüchte und<br />
Wut.<br />
In den Augen der Liberalen<br />
sind die Islamisten schuld am<br />
Anstieg der Gewalt im Land.<br />
Al-Nahda habe enge Verbindungen<br />
zu Salafisten und den<br />
Extremisten von Ansar al-<br />
Scharia, sagen ihre Gegner.<br />
Tatsächlich wurden unter der<br />
amtierenden Regierung auch<br />
einige Extremisten freigelassen;<br />
am Anfang schien die Regierung<br />
nicht gegen die Radikalen<br />
vorgehen zu wollen.<br />
In den Wochen seit dem<br />
zweiten Mord häufen sich nun<br />
aber Berichte über gefundene<br />
Waffen, verhaftete Terroristen<br />
und angebliche Anschlagsversuche.<br />
Es kursieren Videos<br />
von Polizeieinsätzen, doch<br />
weil sich die Behörden in<br />
Schweigen hüllen, sind viele<br />
Tunesier verunsichert. Auch<br />
dass die Armee zu den Vorgängen<br />
im Chambi-Gebirge<br />
keine Auskunft gibt und<br />
Journalisten fernhält, nährt<br />
die Verschwörungstheorien. Je<br />
nach dem, mit wem man<br />
spricht, stecken hinter all diesen<br />
Bedrohungen al-Qaida, al-Nahda, das<br />
alte Regime, die Linken, Frankreich,<br />
Katar, Israel, Algerien – oder eine beliebige<br />
Kombination davon.<br />
Viele Oppositionelle sprechen al-Nahda<br />
die Legitimität ab, ihr Wahlsieg sei<br />
ohnehin von Anfang an gekauft gewesen.<br />
Dabei gibt es dafür keinerlei Beweise.<br />
Die im Verfassungsentwurf vorgesehene<br />
Erwähnung des Islam als „Staatsreligion“<br />
führe direkt in die Scharia, glauben andere.<br />
Aber eine ähnliche Formulierung<br />
findet sich auch in der bisherigen Verfassung.<br />
Am meisten jedoch fürchten sie,<br />
dass die Islamisten bald die Verwaltung<br />
und das Innenministerium kontrollieren<br />
könnten, das Zentrum des einstigen Unterdrückungs-<br />
und Überwachungsapparats.<br />
Aber versucht nicht jede Regierung,<br />
Posten mit ihren eigenen L<strong>eu</strong>ten zu besetzen,<br />
vor allem nach Jahrzehnten der<br />
Diktatur?<br />
In Kasserine, der Stadt im Schatten des<br />
rauchenden Bergs, 200 Kilometer von Tunis<br />
entfernt, interessiert sich kaum jemand<br />
für den Machtkampf in der Hauptstadt.<br />
Hier, im vernachlässigten Landesinneren,<br />
begann der Arabische Frühling,<br />
und der Frust der Bewohner ist noch immer<br />
derselbe wie der jener Jugendlichen,<br />
die im Dezember 2010 im nahen Sidi Bouzid<br />
die Revolution ins Rollen brachten.
27 junge Männer starben damals<br />
auch in der Gegend um<br />
Kasserine, viele Bewohner waren<br />
stolz auf ihren Anteil am<br />
Sturz des autoritären Herrschers.<br />
Doch im Armenviertel<br />
Ennour, aus dem viele der Getöteten<br />
stammten, erzählen<br />
die Jugendlichen, es sei für sie<br />
h<strong>eu</strong>te noch immer einfacher<br />
zu stehlen, als einen Job zu<br />
finden. Die meisten von ihnen<br />
haben keine Ausbildung. Und<br />
wer doch eine hat, ist nicht<br />
viel besser dran.<br />
Rabeh, 20, hat gerade das<br />
Abitur bestanden und ist mit<br />
zwei Fr<strong>eu</strong>nden im Stadtzentrum<br />
von Kasserine unterwegs.<br />
Sie erzählen, dass sie bei der<br />
Wahl entweder für al-Nahda<br />
gestimmt oder zumindest mit<br />
den Islamisten sympathisiert<br />
haben – das aber sei vorbei.<br />
„Die haben zwei Jahre lang<br />
nichts gemacht“, sagt Rabeh,<br />
ein massiger Kerl. Er habe sich<br />
Jobs erhofft, aber es sei alles<br />
noch schlimmer geworden.<br />
Auf dem Bau erhalte man in<br />
Kasserine für einen Tag Arbeit<br />
sieben Dinar, das sind etwas<br />
über drei Euro. Und selbst diese<br />
Jobs würden immer rarer.<br />
Er sagt, er würde beim nächsten<br />
Mal Nida Tunis wählen.<br />
Aber eigentlich glaubt er nicht<br />
mehr an die Demokratie, er sagt einen<br />
harten Satz: „Dieses Volk ist für einen<br />
Diktator gemacht.“<br />
Rabeh erzählt, sein Bruder sei jetzt in<br />
Rom, er habe mit einem Boot übergesetzt,<br />
viele Fr<strong>eu</strong>nde und Verwandten hätten das<br />
Gleiche getan. Sein Fr<strong>eu</strong>nd Houssem, der<br />
im Touristenort Monastir studiert, ergänzt,<br />
dass er schon mehrere Angebote<br />
älterer Europäerinnen abgelehnt habe,<br />
sich Geld schicken zu lassen oder nach<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zu kommen. Zwei seiner<br />
Cousins aber hätten sich darauf eingelassen,<br />
sie seien nun mit älteren Frauen verheiratet<br />
und warteten in Rom auf ihre italienische<br />
Staatsbürgerschaft.<br />
Houssem hält nichts von den Demonstrationen<br />
in Tunis, von den Forderungen,<br />
die Verfassunggebende Versammlung aufzulösen,<br />
er fühlt sich den Demonstranten<br />
aus den besseren Vororten von Tunis<br />
nicht sonderlich verbunden. Gleichzeitig<br />
ist er aber auch dagegen, Politik und Islam<br />
zu vermischen.<br />
Einer seiner Jugendfr<strong>eu</strong>nde ist Salafist<br />
geworden, er will Houssem jetzt dauernd<br />
belehren, dass man Mädchen nicht berühren<br />
und auch nicht mit ihnen reden dürfe.<br />
Und auch an seiner Universität in Monastir<br />
werden die Salafisten immer einflussreicher<br />
– sie haben durchgesetzt, dass die<br />
Kantine nun nach Geschlechtern getrennt<br />
Islamist Ghannouchi: Alte Männer verwalten den Übergang<br />
ist. Im ganzen Land ist zu spüren, dass<br />
sich ein Teil der Bevölkerung stärker der<br />
Religion zuwendet als vor der Revolution.<br />
Mittlerweile gibt es außerhalb von Tunis<br />
kaum noch Frauen, die kein Kopftuch<br />
tragen.<br />
Mariam Rabhi, 20, gehört zu den wenigen<br />
Frauen in Kasserine, die sich weigern,<br />
sich zu verhüllen. Sie sitzt mit ihrer<br />
Mutter Mounira um Mitternacht in einem<br />
Restaurant im Stadtzentrum. Das ist sehr<br />
ungewöhnlich, nicht wegen der Uhrzeit,<br />
denn es ist Ramadan, sondern weil Frauen<br />
hier selten auf den Straßen zu sehen<br />
sind – und schon gar nicht in Cafés.<br />
„In meiner Altersgruppe werde ich<br />
langsam zur Minderheit“, sagt die Studentin<br />
der französischen Literatur. „Nach<br />
dem Abitur beginnen die meisten Frauen,<br />
das Kopftuch zu tragen, damit ihre Eltern<br />
ihnen erlauben zu studieren.“ Und es<br />
seien gerade die Frauen, die Bestleistungen<br />
in der Schule brächten und an die<br />
Universität können, sagt sie, während die<br />
jungen Männer fast alle arbeitslos seien.<br />
Gleich um die Ecke, im Café Total, gibt<br />
es keine Frauen. Unter einem Eukalyptusbaum<br />
sitzen vier Männer, die sich hier<br />
fast jeden Abend treffen und diskutieren.<br />
Alle vier haben die Islamisten gewählt,<br />
drei von ihnen sind schwer enttäuscht,<br />
aber nicht alle aus dem gleichen Grund.<br />
Badredine Fridhi, 41, hatte<br />
erst genug von den Säkularen,<br />
doch jetzt ist er sauer auf al-<br />
Nahda. Denn die Kaufkraft<br />
sinke, die L<strong>eu</strong>te hätten kein<br />
Geld mehr. Sein Handel für<br />
Baumaterial laufe schlecht.<br />
Ihm gegenüber sitzt Mongi<br />
Bouazi, er ist 58 und arbeitet<br />
in einem Berufsbildungszentrum.<br />
Er ist nicht einverstanden.<br />
„Aller Wandel braucht<br />
Zeit“, sagt er. „Die Französische<br />
Revolution hat Jahrzehnte<br />
gedauert. Man kann eine<br />
Regierung nicht nach weniger<br />
als zwei Jahren b<strong>eu</strong>rteilen.“ Er<br />
würde sie wiederwählen. Bloß<br />
durchgreifen müsste sie mehr,<br />
gegen die Streiks, die es ständig<br />
gebe, Meinungsfreiheit hin<br />
oder her. Über die Demon -<br />
stranten in Tunis sagt er: „Die<br />
wollen einen Staatsstreich!“<br />
Der Dritte heißt auch Mongi,<br />
mit Nachnamen Yahyaoui,<br />
er ist 39: Seit vier Jahren<br />
schmuggle er Benzin aus Algerien<br />
nach Tunesien, das sei<br />
der lukrativste Job weit und<br />
breit. Doch obwohl das illegal<br />
sei und kaum verborgen ablaufe,<br />
unternehme die Polizei<br />
nichts dagegen. Gut für ihn,<br />
einerseits. Andererseits würde<br />
Yahyaoui auch gern mal wieder<br />
einer legalen Erwerbstätigkeit<br />
nachgehen. Doch solche Jobs gibt es<br />
kaum in Kasserine, klagt er: „Und die<br />
L<strong>eu</strong>te von al-Nahda denken nur an ihre<br />
eigenen Interessen.“<br />
Der Vierte schließlich, Ridha Abdelli,<br />
45, ist Französischlehrer und sagt, er dürfe<br />
keine andere Partei wählen. „Wir stimmen<br />
für jene, die für den Islam sind. Dazu<br />
verpflichtet uns die Religion.“ Aber er<br />
sei sehr enttäuscht, dass al-Nahda nicht<br />
versucht habe, die Scharia in die Verfassung<br />
aufzunehmen.<br />
Nicht weit entfernt von dem Café steht<br />
Khaled Dalhoumi am rauchenden Berg<br />
und sagt, auch er habe den Glauben an<br />
die Demokratie verloren. Sie funktioniere<br />
nicht in Ländern mit großer Armut.<br />
„Stimmen werden gekauft. Und die Islamisten<br />
veranstalten nur einmal Wahlen.“<br />
Es sei ein Fehler gewesen, sagt Dalhoumi,<br />
sie überhaupt erst durch Wahlen an die<br />
Macht kommen zu lassen.<br />
So d<strong>eu</strong>tlich wie der Mann am Fuß des<br />
Chambi würden das die Oppositions -<br />
führer in Tunis nie sagen. Aber manche<br />
von ihnen denken insgeheim ganz ähnlich.<br />
MATHIEU VON ROHR<br />
DER SPIEGEL 33/2013 87<br />
FETHI BELAID / AFP<br />
Video: Mathi<strong>eu</strong> von Rohr über<br />
Tunesiens enttäuschte Kämpfer<br />
spiegel.de/app332013tunesien<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Sicherheitskontrolle in Sanaa: Die Maxime vom fernen Feind wurde abgelöst<br />
Osama Bin Laden telefonierte nicht.<br />
In den Jahren in Abbottabad vermied<br />
er alles, was die Geheimdienste<br />
auf seine Spur hätte führen können,<br />
er kommunizierte nur über Boten.<br />
Glaubt man, was zwei Journalisten vergangene<br />
Woche auf der amerikanischen<br />
Nachrichten-Website The Daily Beast veröffentlichten,<br />
so hat die Qaida-Führung<br />
nun aber derartige Vorsichtsmaßnahmen<br />
fallengelassen.<br />
Denn Auslöser für die Schließung von<br />
21 US-Vertretungen von Jemen bis Paki -<br />
stan soll eine Konferenzschaltung der Qaida-Führung<br />
gewesen sein. Die Top 20 des<br />
Terrors hätten da virtuell zusammengesessen:<br />
Qaida-Chef Aiman al-Sawahiri,<br />
der bei dieser Gelegenheit den Leiter der<br />
Filiale im Jemen, Nassir al-Wuhaischi, offiziell<br />
zur Nummer zwei ernannte; außerdem<br />
die Anführer im Irak, in Nordafrika,<br />
in Usbekistan, der pakistanischen Taliban<br />
sowie der nigerianischen Boko Haram,<br />
dazu ein Vertreter der aufstrebenden Qaida<br />
auf dem Sinai.<br />
88<br />
AL-QAIDA<br />
Geschwätzige Terroristen<br />
Eine Warnung vor n<strong>eu</strong>en Anschlägen versetzte nicht nur die USA<br />
in Angst. Dabei hat sich die von Bin Laden gegründete<br />
Bewegung längst auf lokale Kampffelder zurückgezogen – mit Erfolg.<br />
Qaida-Chef Sawahiri<br />
Seine Befehlsgewalt hat Grenzen<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
AFP<br />
„Es war wie ein Treffen der Bruderschaft<br />
des Bösen“, zitierten die Daily-<br />
Beast-Reporter einen von drei US-Geheimdienstlern,<br />
mit denen sie gesprochen<br />
hatten. Die Runde hätte Anschlagsziele<br />
erörtert und erwähnt, dass ein oder mehrere<br />
Teams bereits vor Ort seien.<br />
Dass sich ausgerechnet in Zeiten des<br />
NSA-Skandals die weltweit meistgesuchten<br />
Terroristen zu einer Einsatzbesprechung<br />
im Netz treffen,<br />
käme einem Bruch aller Regeln<br />
gleich, denen jemand wie Sa -<br />
wahiri auch nach zwei Jahrzehnten<br />
Fahndung nach ihm sein<br />
Über leben verdankt. „Hirnrissig“<br />
nannte deshalb ein ehemaliger<br />
US- Außenministeriumssprecher<br />
die Veröffentlichung, die Regierung<br />
schwieg. Die Darstellung<br />
birgt eine weitere Ungereimtheit:<br />
Sie geht davon aus, dass al-Qaida<br />
allem Verfolgungsdruck und internen<br />
Spannungen zum Trotz<br />
eine zentral gest<strong>eu</strong>erte Organisation<br />
sei, mit Sawahiri als Boss,<br />
auf den alle hören.<br />
Das aber widerspricht den Entwicklungen<br />
der letzten Jahre –<br />
und auch dem am vergangenen<br />
Mittwoch veröffentlichten 14.<br />
Uno-Bericht zu der Terrororganisation<br />
und ihren Ablegern:<br />
„Al-Qaidas dezimierte Kernführung<br />
im afghanisch-pakistanischen<br />
Grenzgebiet hat sich nicht<br />
erholt“, heißt es dort. „Sie zeigt<br />
sich eher unfähig, Anschläge zu<br />
organisieren und zu befehlen.“<br />
Sawahiri schaffe es nicht, die<br />
einzelnen Ableger zu vereinen.<br />
Eine Bedrohung gehe eher von Tätern<br />
aus, die sich über Propaganda im Internet<br />
selbst radikalisierten und Anschläge verübten<br />
– wie die beiden Tschetschenen,<br />
die im April beim Boston-Marathon Bomben<br />
legten. Zum anderen bestehe die Gefahr,<br />
dass al-Qaida n<strong>eu</strong>e Konflikte für sich<br />
nutze, wie derzeit den Krieg in Syrien.<br />
Dieser habe der Organisation einen „markanten<br />
Auftrieb gegeben“.<br />
Das sehen <strong>eu</strong>ropäische Geheimdienste<br />
genauso: Syrien ist zum bevorzugten Reiseziel<br />
für Dschihadisten geworden, in den<br />
vergangenen zwölf Monaten kamen sie<br />
zu Tausenden in das umkämpfte Land.<br />
Dass sie die Einzigen sind, die den Rebellen<br />
im Kampf gegen die Militärmaschinerie<br />
des Regimes zu Hilfe kommen, gibt<br />
ihnen eine fatale Macht.<br />
Und niemand scheint sie dabei aufhalten<br />
zu wollen: Auf Inlandsflügen nach<br />
Hatay in der Südtürkei sitzen Vollbärtige<br />
aus Saudi-Arabien, Tunesien und aus russischen<br />
Kaukasus-Republiken dicht an<br />
dicht. Sie reisen unbehelligt in die Türkei<br />
ein und werden von ihren Kameraden<br />
über die nahe syrische Grenze gebracht.<br />
Auch am Abfluggate stehen ähnliche Gestalten<br />
in der Schlange, mit leichtem Gepäck<br />
und oft noch dem roten Lehm Nordsyriens<br />
an den Schuhen.<br />
Die türkischen Behörden stören sich<br />
bislang nicht an den Dschihad-Touristen.<br />
An den Grenzübergängen preisen<br />
Schmuggler offen ihre Dienste an. Irgendwie<br />
komisch sei das schon, sagte im Juni<br />
ein einstiger syrischer Gefolgsmann des<br />
YAHYA ARHAB / DPA
Ausland<br />
„Emirs“ Asadullah al-Schischani aus der<br />
grenznahen Dschihadisten-Hochburg Atmeh:<br />
„Vor einem Monat ist ein Dutzend<br />
Tschetschenen unbehelligt von Hatay<br />
wieder nach Hause geflogen. Dabei hatten<br />
sie uns erzählt, sie würden alle von<br />
Interpol gesucht.“<br />
Al-Qaidas diffuse Ideologie vom fortwährenden<br />
Kampf verschafft der Organisation<br />
den taktischen Vorteil, bei diversen<br />
Konflikten gleichzeitig präsent sein zu<br />
können. Die einzelnen Qaida-Ableger<br />
nähren sich wie Parasiten von ihren<br />
unterschiedlichen Gegnern: Im Jemen<br />
kämpfen sie gegen die Regierungsarmee<br />
und gegen die USA; in Syrien gegen die<br />
alawitische Diktatur von Baschar al-Assad<br />
und gegen die Kurden; in Mali gegen<br />
die Regierung und die Tuareg; und im<br />
Irak vor allem gegen das schiitische Regime<br />
von Premier Nuri al-Maliki.<br />
Bin Ladens einstige Maxime vom „fernen<br />
Feind“, den es in Amerika und<br />
Europa zu treffen gelte, ist abgelöst worden<br />
vom Prinzip der Vereinnahmung lokaler<br />
Auseinandersetzungen unterschiedlichster<br />
Prägung.<br />
Den innerislamischen Bruderkrieg gegen<br />
die Schiiten erkannte schon Abu Mussab<br />
al-Sarkawi, der ehemalige, inzwischen<br />
getötete Qaida-Führer im Irak, als<br />
günstige Gelegenheit, einen ohnehin<br />
schwelenden Konflikt für die eigenen Ziele<br />
zu nutzen. Damals versuchte Osama<br />
Bin Laden noch, ihn zu stoppen; h<strong>eu</strong>te<br />
ist die Terrororganisation im Irak wieder<br />
im Aufschwung. Sie profitiert von der<br />
Politik des Premiers, der zugunsten seiner<br />
schiitischen Machtbasis systematisch alle<br />
Sunniten aus wichtigen Ämtern verdrängt.<br />
Der „Islamische Staat im Irak und Syrien“<br />
(Isis) ist zum schlagkräftigsten Ableger<br />
von al-Qaida aufgestiegen. Nach<br />
und nach übernimmt die Organisation in<br />
Syrien Kämpfer und Basen der Nusra-<br />
Front, einst ein Sammelbecken der Dschihadisten.<br />
Die Qaida-Führung hat hier allerdings<br />
wenig zu sagen: „Die erfolglosen<br />
Versuche Sawahiris, interne Konflikte beizulegen,<br />
zeigen die Grenzen seiner Befehlsgewalt“,<br />
so der Uno-Bericht.<br />
Sawahiris schwache Führungsposition<br />
brachte den „Washington Post“-Autor<br />
Max Fisher zu einer ganz n<strong>eu</strong>en Vermutung,<br />
warum der Qaida-Chef auf der angeblichen<br />
Schaltkonferenz so geschwätzig<br />
wurde: „Dass er eine große Operation anzuordnen<br />
vermochte, könnte ihm im internen<br />
Machtgerangel helfen.“<br />
Washingtons hektische Reaktion auf<br />
das Gespräch – ein gutes halbes Dutzend<br />
Drohnenattacken im Jemen und eine<br />
weltweite Reisewarnung für Amerikaner<br />
– dürfte ihn dann gefr<strong>eu</strong>t haben. Hätte<br />
Sawahiri doch genau jenen Effekt erzielt,<br />
den er beabsichtigte. Voraus gesetzt, die<br />
Geschichte stimmt.<br />
CHRISTOPH REUTER<br />
„Haarsträubende Fehler“<br />
Der US-Nahostexperte Gregory D. Johnsen über den Aufstieg<br />
von al-Qaida im Jemen und den Drohnenkrieg Amerikas<br />
Johnsen gilt als einer der<br />
besten Kenner von al-<br />
Qaida im Jemen. Ende<br />
2012 erschien zum gleichen<br />
Thema sein Buch<br />
„The Last Refuge“.<br />
Autor Johnsen<br />
„Schlechte Informanten“<br />
JEFF TAYLOR<br />
SPIEGEL: Die USA haben<br />
gerade den siebten<br />
Drohnenangriff in weniger<br />
als zwei Wochen auf<br />
mutmaßliche Mitglieder<br />
der Qaida im Jemen<br />
ausgeführt. Seit 2009<br />
gab es dort 75 Drohneneinsätze.<br />
Im gleichen<br />
Zeitraum stieg die Zahl<br />
der Qaida-Kämpfer von<br />
rund 300 auf über 1000 Kämpfer an –<br />
eine Folge der Drohnen?<br />
Johnsen: Es sind nicht nur die Drohnen,<br />
die zum Erstarken der Qaida im Jemen<br />
beigetragen haben. Aber sie sind<br />
das wichtigste Element. Denn sie treffen<br />
eben nicht nur Radikale, sondern<br />
auch deren Kinder, sie treffen unbeteiligte<br />
Zivilisten – und sie bringen die<br />
Jemeniten insgesamt gegen die USA<br />
auf. Denn sie sehen diese Attacken<br />
aus der Luft als Demütigung. Außerdem<br />
passieren immer wieder haarsträubende<br />
Dinge.<br />
SPIEGEL: Ein Beispiel?<br />
Johnsen: Der Geistliche Salim Ahmed<br />
Bin Ali Dschabir aus dem Ostjemen<br />
hielt im vergangenen Jahr Predigten<br />
gegen Qaida-Mitglieder und beschuldigte<br />
sie, keine wahren Muslime, sondern<br />
Mörder zu sein. Der Mann war<br />
so erfolgreich, dass al-Qaida aus seiner<br />
Gegend keine Rekruten mehr bekam.<br />
Also baten sie um ein Treffen mit<br />
ihm – und wurden alle zusammen von<br />
einer amerikanischen Drohne getötet:<br />
der Prediger, sein Begleiter und die<br />
Männer von al-Qaida. Schlechte In -<br />
formanten, das ist ein Kernproblem.<br />
Aber selbst wenn die Angriffe nur Mitglieder<br />
der Qaida träfen, würde das<br />
von den meisten Jemeniten nicht unbedingt<br />
als Maßnahme im Anti-Terror-Kampf<br />
verstanden.<br />
SPIEGEL: Sondern wie?<br />
Johnsen: Al-Qaida besteht im Jemen,<br />
anders als in Afghanistan, nicht im<br />
Wesentlichen aus Ausländern, sondern<br />
aus Einheimischen. Und jeder Jemenit<br />
hat eine Familie<br />
und einen Stamm. Wird<br />
er umgebracht, zählt für<br />
seine Angehörigen in<br />
erster Linie, dass einer<br />
der Ihren getötet wurde,<br />
was Vergeltung fordert.<br />
SPIEGEL: Haben die<br />
Drohnenangriffe am<br />
Ende also mehr n<strong>eu</strong>e<br />
Feinde geschaffen?<br />
Johnsen: Ich bin kein<br />
grundsätzlicher Kritiker<br />
der Einsätze. Aber die<br />
Obama-Regierung hat<br />
im Jemen den Fehler gemacht,<br />
den Verlockungen<br />
des taktischen Nutzens<br />
von Drohnen zu erliegen. Dar -<br />
über wurde versäumt, eine Strategie<br />
zu entwerfen, wie man mit al-Qaida<br />
langfristig umgehen will. Die Drohnen<br />
sollen alles richten. Und so etwas geht<br />
schief.<br />
SPIEGEL: Sie haben vor kurzem geschrieben,<br />
nur die Stammesführer und<br />
Geistlichen könnten al-Qaida dort<br />
schwächen. Aber wie?<br />
Johnsen: Indem man ihnen die Chance<br />
dazu lässt. Die Lage hat sich völlig<br />
verändert. Es geht inzwischen nicht<br />
mehr um Jemeniten gegen al-Qaida,<br />
sondern um Amerikaner gegen al-Qaida<br />
im Jemen. Die zahlreichen Angriffe<br />
lassen Qaida-Mitglieder in den Augen<br />
vieler Jemeniten als Patrioten erscheinen,<br />
während ihre Gegner als Handlanger<br />
der Amerikaner angesehen<br />
werden.<br />
SPIEGEL: Was würde eigentlich geschehen,<br />
wenn al-Qaida im Jemen einfach<br />
verschwände?<br />
Johnsen: Das Land würde dann wieder<br />
in Vergessenheit geraten, und mit den<br />
Millionenhilfen aus Amerika wäre es<br />
auch vorbei. Die USA sehen den Jemen<br />
nur noch im Zusammenhang mit<br />
al-Qaida. Das müsste sich als Erstes<br />
ändern. Das Land ist unfassbar arm,<br />
leidet unter Wassermangel, der Staat<br />
existiert in vielen Landesteilen kaum,<br />
Krankenversorgung, Strom und Gerichte<br />
funktionieren so gut wie nicht.<br />
Hier müsste Amerika helfen. Wenn<br />
sich nur die Radikalen kümmern, werden<br />
die populär, das gilt auch für al-<br />
Qaida.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 89
Ehemaliger Regierungschef Berlusconi mit Verlobter Pascale*: Hausarrest in einem seiner italienischen Domizile?<br />
ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS<br />
90<br />
ITALIEN<br />
Ein Urteil und<br />
viele Optionen<br />
Der wegen St<strong>eu</strong>erhinterziehung<br />
verurteilte Ex-Premier Silvio<br />
Berlusconi ringt ums politische<br />
Überleben. Und gefährdet<br />
den Fort bestand der Koalition.<br />
Sie sind entschlossen, an allen Fronten<br />
zu kämpfen. Zu Wasser, zu Lande<br />
und in der Luft. Unten, entlang<br />
den Sandstränden von Riccione oder<br />
Portofino, sollen die Sonnenhungrigen<br />
und Badenden Protestplakate zu sehen<br />
bekommen. Und oben, am Himmel über<br />
der Mittelmeerküste, Flugz<strong>eu</strong>ge mit<br />
Spruchbändern. Den Berlusconi-tr<strong>eu</strong>en<br />
Aktivisten schwebt dabei die Losung „Silvio<br />
libero“ vor – Freiheit für Silvio.<br />
Zu vier Jahren Haft wegen St<strong>eu</strong>erhinterziehung<br />
ist Ex-Premier Silvio Berlusconi<br />
rechtskräftig verurteilt worden. Er,<br />
der milliardenschwere Medienunternehmer,<br />
der zwei Jahrzehnte lang Italiens<br />
politische Bühne sich und seinen Geschäftsinteressen<br />
ungestraft dienstbar<br />
machte. Und der dabei dank trickreicher<br />
Anwälte Dutzende Anzeigen wegen Bilanzfälschung,<br />
Bestechung oder Mafia-<br />
Nähe, wegen Meineids und gebrochener<br />
Amtsgeheimnisse überstand.<br />
Umso tiefer sitzt nun, nach dem Verdikt<br />
des römischen Berufungsgerichts, der<br />
Schock. Umso lauter klagen sie in der autokratisch<br />
geführten Berlusconi-Partei<br />
Volk der Freiheit (PdL) über einen politisch<br />
motivierten Schuldspruch, bei dem<br />
ein 71 Jahre alter Richter das letzte Wort<br />
hatte, der sich gleich danach in einem Interview<br />
mit der Tageszeitung „Mattino“<br />
offenherzig und wider alle Regeln zur Urteilsfindung<br />
äußerte. Fiebrig arbeiten die<br />
PdL-Strategen nun an Maßnahmen, die ihrem<br />
Anführer den Kopf retten sollen. Landesweit<br />
läuft die Mobilisierung am 15. August<br />
an, an Ferragosto, Mariä Himmelfahrt,<br />
dem Tag, den Italiener als sommerliche<br />
Krönung süßen Nichtstuns verstehen.<br />
Berlusconi aber kümmert das nicht, er<br />
steht unter Zeitdruck. Denn über die Frage,<br />
ob ihm sein Abgeordnetenmandat im<br />
Oberhaus entzogen wird, berät der Senat<br />
am 9. September. Kurz darauf bricht eine<br />
30-Tage-Frist für den Ex-Premier an, in<br />
der er bekanntgeben muss, wie er seine<br />
Strafe verbüßen will.<br />
Dank Teilamnestie bleibt ihm nur noch<br />
ein Jahr abzusitzen. Zusätzlich kann ihm,<br />
wegen seines Alters von bald 77 Jahren,<br />
der Gang ins Gefängnis per Gerichts -<br />
beschluss erlassen werden. Eine vollständige<br />
Begnadigung durch Staatspräsident<br />
* Am 4. August in Rom.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Giorgio Napolitano gilt allerdings als wenig<br />
wahrscheinlich. Weswegen sich die<br />
Kommentatoren, nicht ohne wohliges<br />
Schaudern, seit Tagen der Erörterung der<br />
Alternativen widmen.<br />
Ob Berlusconi, der immerhin vier Regierungen<br />
in Rom vorstand, demnächst<br />
als Haftersatz Sozialarbeit leisten wird?<br />
Vielleicht gar mit Senioren, um endlich<br />
altersgemäß vom „Bunga Bunga zum Bingo<br />
Bingo“ überzuwechseln, wie der Regiss<strong>eu</strong>r<br />
und Oscar-Preisträger Roberto Benigni<br />
höhnisch forderte?<br />
Oder ob die Variante Hausarrest in Frage<br />
kommt, bei der Berlusconi, dessen Reisepass<br />
eingezogen wurde, sich zwar nicht<br />
für seinen Wohnsitz auf Antigua, wohl<br />
aber für eines seiner italienischen Domizile<br />
entscheiden könnte? Telefonate und Besuche<br />
müsste er sich in diesem Fall genehmigen<br />
und eine Meldepflicht bei der örtlichen<br />
Polizeistation möglicherweise gefallen lassen.<br />
Das letzte Wort hat in derlei Dingen<br />
das zuständige Gericht in Mailand. Der<br />
verurteilte Politiker jedoch scheint anderes<br />
im Sinn zu haben. Eine der rabiateren Frauen<br />
aus seinem Umfeld, die Abgeordnete<br />
Daniela Santanchè, hat er sicherheitshalber<br />
schon verkünden lassen, er werde am Ende<br />
den Weg in den Knast wählen – „aber vorher<br />
gehen wir noch an die Urnen“.<br />
Sollte Berlusconi mit seiner Drohung<br />
Ernst machen, so steht Italien ein unruhiger<br />
Herbst bevor. Die im April mühsam<br />
geschmiedete Koalition mit der Demokratischen<br />
Partei (PD), einem Mitte-links-
Ausland<br />
Bündnis, dem Regierungschef Enrico Letta<br />
angehört, wäre dann wohl Geschichte.<br />
Und Berlusconi, sofern noch nicht endgültig<br />
aus dem Senat verbannt, könnte<br />
bei N<strong>eu</strong>wahlen im Oktober oder November<br />
als Kandidat ein letztes Mal triumphieren<br />
– ehe er als Märtyrer den Weg<br />
hinter Gitter anträte.<br />
Im berüchtigtsten römischen Gefängnis,<br />
einem ockerfarbenen Klotz am Tiber-Ufer<br />
namens Regina Coeli, Himmels königin,<br />
hat der mit Berlusconi befr<strong>eu</strong>ndete Gefängnispfarrer<br />
bereits geistlichen Beistand<br />
gelobt für den Fall, dass der Cavaliere bei<br />
ihm einsitzen wolle. Eine Haftanstalt, in<br />
der Freiheitskämpfer wie der spätere Präsident<br />
Sandro Pertini unter den Faschisten<br />
gefangen gehalten wurden, würde zu Berlusconis<br />
Selbstbild blendend passen.<br />
Wer allerdings den Ex-Premier nach<br />
Verkündung des Urteils weinend und von<br />
seiner fast 50 Jahre jüngeren Verlobten<br />
Francesca Pascale getröstet sah, der mag<br />
an einen freiwilligen Opfergang in die<br />
Zelle am Tiber nicht glauben. Eher an einen<br />
Trick des für Possen und Peinlichkeiten<br />
berühmten Polit-Profis.<br />
Das von der Wirtschaftskrise schwer<br />
angeschlagene Italien und mit ihm der<br />
Rest der EU kommen durch den Richterspruch<br />
in Bedrängnis: Wird Berlusconi<br />
nicht begnadigt und somit wie im Urteilsspruch<br />
gefordert auf Jahre hinaus vom<br />
politischen Betrieb ausgeschlossen, so<br />
wäre dies wohl das Ende der regierenden<br />
Koalition. Einer Koalition, der Premier<br />
Letta in seiner 100-Tage-Bilanz, allen Differenzen<br />
mit dem Berlusconi-Lager zum<br />
Trotz, zaghafte Erfolge bei der Erholung<br />
der Wirtschaft attestierte.<br />
Und das, nachdem soeben im sechsten<br />
Quartal hintereinander eine Rezession gemeldet<br />
wurde; das durchschnittliche reale<br />
Einkommen von Beschäftigten ist mittlerweile<br />
auf den Stand von 1985 gesunken.<br />
Es könnte, so warnt der Gouvern<strong>eu</strong>r<br />
der Nationalbank, noch schlimmer kommen<br />
– im Falle politischer Instabilität folge<br />
die Strafe der Märkte sofort. Würde<br />
der Risikoaufschlag bei Staatsanleihen<br />
nur um einen halben Punkt steigen, so<br />
entspräche allein das einem Minus von<br />
2,5 Milliarden Euro in Italiens Kassen.<br />
Auch für Berlusconi könnte der Herbst<br />
trübe Tage bringen. Dann nämlich, wenn<br />
im „Ruby“-Prozess ein rechtskräftiges Urteil<br />
ergeht – wenn also der Richterspruch<br />
aus erster Instanz, sieben Jahre Haft wegen<br />
Prostitution und Amtsmissbrauchs,<br />
bestätigt wird. In diesem Fall würde die<br />
Haftverschonung für Berlusconi hinfällig,<br />
die allen über 70-Jährigen in Italien gewährt<br />
wird, sofern sie weder als Gewohnheits-<br />
noch Berufsverbrecher gelten.<br />
„Es wären dann insgesamt elf Jahre<br />
Haft“, urteilt der renommierte Turiner<br />
Rechtsexperte und Ex-Staatsanwalt Bruno<br />
Tinti, „und damit könnte er tatsächlich<br />
im Knast landen.“<br />
WALTER MAYR<br />
DER SPIEGEL 33/2013 91
Aktivistinnen Karantza, Xydia in Athen*: „Sie haben uns behandelt wie unmündige Kinder“<br />
Es gibt da eine Frage, die Mary Karantza<br />
schon seit längerem umtreibt,<br />
sie stellt sie auch an diesem August-<br />
Nachmittag wieder. Diesmal allerdings<br />
laut. Die Frage lautet: Was unterscheidet<br />
Griechenland von Rest <strong>eu</strong>ropa?<br />
Warum ticken die Griechen anders als<br />
die D<strong>eu</strong>tschen? Warum leben sie jahrelang<br />
unbekümmert über ihre Verhältnisse,<br />
verweigern ihrem Staat die St<strong>eu</strong>ern und<br />
werfen ihren Müll ungetrennt in große<br />
Container, obwohl sie wissen, dass er auf<br />
illegalen Deponien entsorgt wird?<br />
Karantza sitzt in ihrem hellen, loft -<br />
artigen Büro, der Weg dorthin führt<br />
durchs Zentrum Athens, ein Stahltor mit<br />
Gegensprechanlage sichert den Zugang<br />
zum Gebäude. Die Junkies hier in Psiri,<br />
so erklärt Karantza, spritzten sich seit kur-<br />
* Im einst verwahrlosten Teil der Hauptstadt in einer<br />
Gasse, die sie mit n<strong>eu</strong>en Lampen versahen.<br />
92<br />
GRIECHENLAND<br />
Lebenszeichen aus Athen<br />
Die Krise hat eine Generation von jungen, aufbegehrenden<br />
Bürgern hervorgebracht. Dem Stillstand begegnen<br />
sie mit Gemeinsinn, Kooperativen und kreativen Ideen.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
zem einen Cocktail, versetzt mit Batteriesäure.<br />
Seither seien sie unberechenbar.<br />
Mit ihren Fragen will die 33-jährige<br />
Designerin, schmal und im schwarzen Jerseykleid,<br />
nicht etwa unfr<strong>eu</strong>ndliche Klischees<br />
über die Griechen aufzählen, im<br />
Gegenteil. Sie will mit diesen Klischees<br />
aufräumen, der Moment dafür sei gekommen,<br />
sagt sie. Ihr Loft dient als Labor.<br />
Das Experiment: eine griechische Zivilgesellschaft<br />
aufzubauen. Karantza ist, zusammen<br />
mit Ähnlichdenkenden, Pionierin<br />
dieser n<strong>eu</strong>en Bewegung.<br />
An einer Glasscheibe in ihrem Büro<br />
klebt in dicken, roten Lettern ein Bukowski-Zitat:<br />
„A chance for change is<br />
some where.“ Irgendwo existiert eine<br />
Chance auf Veränderung.<br />
Man muss sie nur suchen. Für Karantza<br />
bed<strong>eu</strong>tet die Krise diese Chance. Sie hat,<br />
gemeinsam mit Stephania Xydia, 26,<br />
„Imagine the City“ gegründet. Die Nichtregierungsorganisation<br />
ist eine Koordinierungsstelle<br />
für Bürgerinitiativen, zugleich<br />
aber auch eine Art Umerziehungsmaßnahme<br />
mit dem Ziel eines besseren<br />
Managements in Städten und Dörfern.<br />
Die Griechen, sagt Stephania Xydia,<br />
hätten nie gelernt, sich am öffentlichen<br />
Leben zu beteiligen, es selbst zu gestalten.<br />
„Der Staat hat uns behandelt wie unmündige<br />
Kinder, und die meisten waren froh<br />
darüber.“ Sie selbst ist in Luxemburg aufgewachsen,<br />
hat in England studiert. Erst<br />
2011 ist sie nach Athen zurückgekehrt,<br />
ihren Job als Unternehmensberaterin in<br />
London hat sie aufgegeben. Ihren Eltern<br />
war das nicht recht. Was willst du in<br />
Athen?, fragten sie. Etwas tun, antwortete<br />
die Tochter.<br />
Jetzt hält sie gemeinsam mit Karantza<br />
die lokalen Behörden in ganz Griechenland<br />
auf Trab. Seit es „Imagine the City“<br />
gibt, können die Bürger untereinander<br />
leichter Informationen austauschen, Gutachten<br />
und Statistiken etwa. Bürgermeister<br />
können nun nicht mehr schnell ein<br />
n<strong>eu</strong>es Rathaus oder einen n<strong>eu</strong>en Dorfplatz<br />
bauen, Dinge, die niemand braucht<br />
– außer den Verantwortlichen, die die<br />
Aufträge ihren Fr<strong>eu</strong>nden zuschanzen.<br />
Es bewegt sich etwas in Griechenland<br />
in diesen Monaten. Es wird nicht mehr<br />
nur gestreikt, gezetert und aus Protest<br />
mit Joghurt geschmissen. Es bildet sich,<br />
ausgelöst durch die Krise, ein n<strong>eu</strong>es Be-<br />
NIKOS PILOS / DER SPIEGEL
wusstsein, ein Gemeinsinn, der vorher so<br />
nicht vorhanden war.<br />
Es gibt nun zivilen Widerstand, der<br />
andere Ziele hat, als lediglich eigene Interessen<br />
durchzuboxen.<br />
In Thessaloniki wehren sich Bürger<br />
nicht einfach nur gegen die geplante<br />
Privatisierung der städtischen Wasserwerke,<br />
sondern sie haben als Kollektiv selbst<br />
ein Angebot für den Kauf eingereicht.<br />
„136“ heißt die Bewegung, weil jeder, der<br />
mitmacht, 136 Euro zahlen müsste, sollten<br />
die Behörden auf das Angebot ein -<br />
gehen.<br />
Auf der Halbinsel Chalkidiki protestieren<br />
die Bewohner auf einmal dagegen,<br />
dass eine kanadische Firma dort, gemeinsam<br />
mit einem griechischen Baulöwen,<br />
Gold abbauen will. Dabei war Umweltschutz<br />
bisher keine besonders griechische<br />
Tugend.<br />
Was also geschieht da gerade im Land,<br />
was ist los mit den Griechen?<br />
Es gehe nicht unbedingt um Mentalitäten,<br />
sagt Mary Karantza: „Lebt ein Grieche<br />
in Dänemark, verhält er sich irgendwann<br />
wie ein Däne, zahlt St<strong>eu</strong>ern und<br />
trennt den Müll. Ein D<strong>eu</strong>tscher hingegen,<br />
der auf dem Peloponnes wohnt, hört auch<br />
auf, seine Wasserrechnung zu bezahlen –<br />
weil sie sowieso nur unregelmäßig bei<br />
ihm eintrifft und keiner danach fragt.“<br />
Die Spielregeln des Staates, sagt Karantza,<br />
bestimmten die Handlungsweise<br />
einer Gesellschaft. Und für die meisten<br />
Griechen war der Staat lange vor allem<br />
ein Feind. Das Gemeinwesen wurde sabotiert,<br />
wo immer es möglich war. Das<br />
fing bei sich hemmungslos bereichernden<br />
Politikern an und hörte beim Taxifahrer<br />
auf, auch jetzt ist das manchmal noch so.<br />
Es war ja allen egal.<br />
Ausland<br />
„Andere Völker haben Institutionen,<br />
wir haben Luftspiegelungen“, schrieb der<br />
Autor Nikos Dimou 1975 in seiner berühmten<br />
Aphorismensammlung „Über<br />
das Unglück, ein Grieche zu sein“.<br />
Im sechsten Jahr der Krise sind selbst<br />
die Scheininstitutionen im Untergang begriffen:<br />
Das Gesundheitssystem ist so gut<br />
wie kollabiert. Die nationale Gesundheitsbehörde<br />
schuldet ihren Trägern mehr als<br />
zwei Milliarden Euro. Und der Staat selbst<br />
steht bei der Privatwirtschaft mit etwa sieben<br />
Milliarden Euro in der Kreide.<br />
Der Staat ist am Ende,<br />
finanziell und moralisch.<br />
Das ist keine ausschließlich<br />
schlechte Nachricht.<br />
Es sind die alten Spielregeln, die Griechenland<br />
in die Krise geführt haben. Die<br />
politische Klasse mag sie vorgegeben haben,<br />
aber fast jeder hat sich daran gehalten.<br />
Jetzt ist das Spiel zu Ende, es ist kein<br />
Geld mehr da für Fakelaki und Rousfeti,<br />
Korruption und Vetternwirtschaft, bisher<br />
zwei Grundprinzipien des griechischen<br />
Gemeinwesens.<br />
Und so gibt es plötzlich Raum für diejenigen,<br />
die n<strong>eu</strong>e Regeln aufstellen wollen.<br />
Für Veränderung. Für mehr Mit -<br />
einander. 3000 Initiativen wurden in den<br />
vergangenen drei Jahren gegründet, überall<br />
in Griechenland. Sie alle haben dasselbe<br />
Ziel: etwas besser zu machen als<br />
zuvor. Es gibt jetzt Lebensmittelkoope -<br />
rativen, Gemeinschaftsgärten, soziale<br />
Apotheken, Nachbarschaftshilfe für die<br />
Ärmeren.<br />
„Jahrzehntelang zählte für uns nur der<br />
BMW vor der Tür und die Miele-Waschmaschine<br />
im Bad“, sagt Andreas Roumeliotis,<br />
ein ehemaliger Journalist, der die<br />
Bemühungen der jungen griechischen Zivilgesellschaft<br />
in einem Buch zusammengefasst<br />
hat. „Ich kann auch ohne Euro“<br />
heißt es, und der Titel spielt nicht etwa<br />
auf die Rückkehr zur Drachme an, sondern<br />
darauf, dass Griechenland auch<br />
ohne BMWs ein reiches, weil fruchtbares<br />
Land ist.<br />
N<strong>eu</strong>nmal hat Roumeliotis, 52, in den<br />
vergangenen drei Jahren seinen Job verloren.<br />
Bevor Premierminister Antonis<br />
Samaras den Staatssender ERT von einem<br />
Tag auf den anderen schloss, hatte<br />
er dort eine Radiosendung. Im Augenblick<br />
lebt der Journalist auf Kreta und<br />
bastelt an einem sozialen Netzwerk: Unter<br />
der Adresse enallaktikos.gr sollen von<br />
September an alle sozialen Bewegungen<br />
im Land erfasst sein; die n<strong>eu</strong>e Infrastruktur<br />
der Solidarität, ob Suppenküche oder<br />
Kleiderbasar, kann dann auf Google<br />
Maps abgerufen werden.<br />
„Was wir jetzt leisten müssen, ist eigentlich<br />
Aufgabe des Staates“, sagt Roumeliotis.<br />
Aber der Staat ist am Ende, finanziell<br />
und moralisch. Das ist keine ausschließlich<br />
schlechte Nachricht. Es ist kein<br />
sanfter Umbruch, der da stattfindet. Eher<br />
ein recht brutales Erwachen.<br />
Allein auf Kreta gibt es mittlerweile fünf<br />
alternative Währungen. Bezahlt wird mit<br />
Dienstleistungen statt Euro, die eigentliche<br />
Währung aber heißt Vertrauen. Wenn der<br />
Schreiner einen Anwalt braucht, zimmert<br />
er ihm für seine Beratung anschließend<br />
einen Stuhl.<br />
In Athen gibt es Cafés, in denen ein<br />
Gast jeweils den Cappuccino für einen<br />
Demonstrierende Umweltschützer auf Chalkidiki: Bewusstsein, das vorher so nicht vorhanden war<br />
NIKOS PILOS<br />
DER SPIEGEL 33/2013 93
Ausland<br />
Unbekannten mitbezahlt, so dass auch<br />
Menschen, die sich das nicht mehr leisten<br />
können, hin und wieder ein Café<br />
besuchen. In Thessaloniki darf man seine<br />
Theaterkarte mit Lebensmitteln be -<br />
gleichen.<br />
Hätte die n<strong>eu</strong>e Solidarität im Land eine<br />
Ikone, Giorgos Vichas wäre in der engeren<br />
Auswahl. Der 55-jährige Kardiologe<br />
betreibt eine Klinik in einem Container<br />
auf der alten Luftwaffenbasis Elleniko im<br />
Süden Athens. Er arbeitet ehrenamtlich,<br />
zusammen mit 90 anderen Ärzten, fast<br />
alle Fachrichtungen sind vertreten. Geräte,<br />
Betten, Stühle und Medikamente sind<br />
Sachspenden; Geld nehmen Vichas und<br />
seine Kollegen nicht an.<br />
Gemeinsam ersetzen sie seit fast zwei<br />
Jahren den Staat, der die medizinische<br />
Grundversorgung seiner Bürger nicht<br />
mehr garantieren will und kann, weil diese<br />
sich ihre Versicherungen nicht mehr<br />
leisten können.<br />
Kardiologe Vichas: Ikone der n<strong>eu</strong>en Solidarität<br />
94<br />
Mittlerweile sitzen jeden Monat bis zu<br />
3000 Patienten in dem Warteraum, der<br />
aussieht wie eine provisorische Bushaltestelle.<br />
Die Zahl steigt weiter an. Trotzdem<br />
ist die Klinik nur auf den ersten Blick ein<br />
Symbol für das griechische Elend. Sie ist<br />
auch ein Beleg für den n<strong>eu</strong>en Zusammenhalt.<br />
Griechen, die gemeinsam etwas auf die<br />
Beine stellen, ohne dafür bezahlt zu werden,<br />
habe er vorher einfach nicht gekannt,<br />
sagt Giorgos Vichas: „Ich hätte nie<br />
geglaubt, dass eine Gesellschaft, die so<br />
lange derart oberflächlich war, sich solidarisch<br />
verhalten kann.“<br />
Bis zur Krise, sagt Vichas, habe nur die<br />
eigene Familie, das eigene Wohl gezählt.<br />
Jetzt gebe es zwar weniger Wohlstand,<br />
dafür aber mehr Anteilnahme und Mitgefühl.<br />
Die Krise bringt das Gute in den<br />
Griechen wieder zum Vorschein.<br />
Mary Karantza und Stephania Xydia,<br />
die beiden Frauen von „Imagine the<br />
City“, haben mit Hilfe ihres Netzwerks<br />
im vergangenen Winter 200 Lampen in<br />
einer unbel<strong>eu</strong>chteten Straße im Athener<br />
Zentrum angebracht. Aus der ganzen<br />
Stadt kamen L<strong>eu</strong>te, um zu helfen, jeder<br />
mit einem Lampenschirm. Die Aktion erregte<br />
derart Aufsehen, dass Coca-Cola<br />
sich als Sponsor anbot. Der Bürgermeister<br />
hat den Frauen eine Dankeskarte geschickt.<br />
Seit langem versucht die Stadt, ihr Zentrum<br />
wieder bewohnbar zu machen – derzeit<br />
leben hier vor allem Flüchtlinge und<br />
Drogensüchtige. Mit den n<strong>eu</strong>en Lampen<br />
haben Karantza und Xydia mehr erreicht<br />
als die Sonderkommandos, die der Innenminister<br />
regelmäßig schickt. In der Straße<br />
haben seither n<strong>eu</strong>e Läden eröffnet, einmal<br />
in der Woche wird Tango getanzt,<br />
Studenten wollen jetzt<br />
wieder hier wohnen.<br />
Es sind vor allem die<br />
Jüngeren, die den Aufbruch<br />
wollen und dafür<br />
hart arbeiten. Die Älteren<br />
haben das nie gelernt, sie<br />
hatten sich eingerichtet in<br />
einem System, in dem<br />
nicht Leistungen zählen,<br />
sondern die Verbindungen<br />
zu denen, die mehr Einfluss<br />
haben. Der größte<br />
Wunsch der Eltern für ihre<br />
Kinder war in ganz Griechenland<br />
lange Zeit derselbe:<br />
ein Job im Öffentlichen<br />
Dienst.<br />
Die Eltern mögen sich<br />
durch die Krise nicht sehr<br />
verändert haben, ihre Kinder<br />
aber umso mehr. „Viele<br />
suchen immer noch<br />
NIKOS PILOS / DER SPIEGEL<br />
nach einem Heilsbringer<br />
in der Politik, nach jemandem,<br />
der sie füttert“, sagt<br />
Mary Karantza.<br />
Sie hat oft überlegt, ihr Land zu verlassen.<br />
Bis vor kurzem hat sie ihr Büro<br />
mit zwei Modedesignerinnen geteilt, die<br />
eine lebt jetzt in Los Angeles, die andere<br />
in Berlin. „Es gibt hier so viele Möglichkeiten,<br />
etwas zu verändern“, sagt sie, „wir<br />
dürfen nicht gehen.“<br />
Im Herbst starten die beiden Frauen<br />
ihr n<strong>eu</strong>es Projekt. Dabei geht es nicht<br />
mehr um Städte, sondern um den Staat.<br />
Die beiden planen eine Art Verfassungskonvent,<br />
sie haben ihrem Vorhaben<br />
einen großen Namen gegeben: Politeia<br />
2.0. Alle, die etwas N<strong>eu</strong>es wollen für<br />
Griechenland, sollen mitmachen. Giorgos<br />
Vichas, der Kardiologe, hat bereits zugesagt.<br />
Sie wollen sie wirklich ändern, die<br />
Spielregeln.<br />
JULIA AMALIA HEYER<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
TÜRKEI<br />
Jede Menge<br />
Staatsfeinde<br />
Im Ergenekon-Prozess gegen<br />
angebliche Verschwörer wurden<br />
auch Oppositionelle verurteilt.<br />
Darunter sind drei Journalisten, die<br />
in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> Schutz suchen.<br />
Seit zwei Tagen ist Adnan Türkkan<br />
ein verurteilter Terrorist. Nun sitzt<br />
der junge Türke, 30 Jahre alt, angezogen<br />
wie fürs Büro, mit blauem Hemd<br />
und grauer Anzughose, in einer Kellerwohnung<br />
in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs.<br />
Und überlegt, ob er wieder zurückkehren<br />
will in seine Heimat. Oder ob<br />
er in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> Asyl beantragen sollte.<br />
An diesem Mittwoch ist er noch unsicher.<br />
Am 5. August wurde der Studentenführer<br />
und Fernsehjournalist von einem<br />
Sondergericht in Abwesenheit für schuldig<br />
erklärt, Mitglied der „bewaffneten<br />
Terrororganisation Ergenekon“ zu sein.<br />
Von seiner Verurteilung erfuhr Türkkan<br />
durch Zeitungen und Fernsehen. Nun soll<br />
er plötzlich ein Staatsfeind sein.<br />
„Zehneinhalb Jahre“, sagt er bedächtig.<br />
„Weil ich eine sogenannte Terrorstraftat<br />
begangen haben soll, haben sie mich zu<br />
zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Ich<br />
würde gern wissen, was für eine Tat das<br />
eigentlich gewesen sein soll.“ Im Urteil<br />
heißt es, wegen seines „negativen Verhaltens“<br />
während des Verfahrens könne die<br />
Strafe nicht reduziert werden. Und weil<br />
er als Wiederholungstäter gelten müsse,<br />
werde danach „seine Bewegungsfreiheit<br />
unter Kontrolle“ gestellt.<br />
Bereits Ende Juli war Türkkan zusammen<br />
mit zwei befr<strong>eu</strong>ndeten, ebenfalls angeklagten<br />
Journalisten von Istanbul nach<br />
Frankfurt geflogen. Die drei Türken bet<strong>eu</strong>ern,<br />
dass sie kamen, um an einer Konferenz<br />
teilzunehmen, nicht um sich ins Ausland<br />
abzusetzen. Doch sie dürften geahnt haben,<br />
dass ihnen lange Haftstrafen drohten.<br />
Auch die Kollegen, Mehmet Sabuncu<br />
und Mehmet Bozkurt, wurden am Montag<br />
wegen ihrer angeblichen Mitgliedschaft<br />
im Ergenekon-Geheimbund verurteilt,<br />
der eine zu sechs, der andere zu<br />
n<strong>eu</strong>n Jahren Haft. Der Oberste Gerichtshof<br />
muss ihre Urteile allerdings noch bestätigen;<br />
sie wollen vorerst in die Türkei<br />
zurückkehren. Gegen Türkkan liegt bereits<br />
ein Haftbefehl vor; er will daher in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> bleiben.<br />
Sie sind 3 von insgesamt 275 Angeklagten<br />
im spektakulärsten und zugleich umstrittensten<br />
Prozess der jüngeren tür -<br />
kischen Justizgeschichte. 21 Angeklagte
Abtransport eines Ergenekon-Verurteilten*: Prozess voller Widersprüche und Unklarheiten<br />
wurden freigesprochen, gegen alle anderen<br />
Beschuldigten größtenteils drako -<br />
nische Strafen verhängt. Etwa gegen den<br />
ehemaligen Generalstabschef Ilker Başbug,<br />
lebenslang, und den prominenten<br />
Kolumnisten Mustafa Balbay, 34 Jahre<br />
und acht Monate Haft.<br />
Als das Verfahren im Sommer 2008<br />
begann, bezeichnete die türkische Presse<br />
es als „Jahrhundertprozess“. Die Staats -<br />
anwaltschaft erhob damals Anklage gegen<br />
Dutzende ranghohe Ex-Militärs, Geschäftsl<strong>eu</strong>te,<br />
Unterweltgrößen, Politiker, Anwälte<br />
und Akademiker, die ein nationalistisches<br />
Netzwerk namens Ergenekon gegründet<br />
haben sollen. Ergenekon, so heißt ein legendäres<br />
Tal in Zentralasien, dem Mythos<br />
nach ist es die Heimat der Urtürken.<br />
Der Vorwurf: Die Gruppe habe Attentate<br />
und Terroranschläge geplant, das dadurch<br />
entstehende Chaos habe die Armee<br />
nutzen wollen, um einzugreifen. Unter<br />
dem Vorwand, Ruhe und Ordnung<br />
wiederherzustellen, sollte die islamischkonservative<br />
Regierung von Ministerpräsident<br />
Recep Tayyip Erdogan<br />
gestürzt werden.<br />
Viele Türken glaubten<br />
diese Enthüllungen zunächst.<br />
In einem Land, das<br />
drei Putsche und zahlreiche<br />
Eingriffe der „Paschas“<br />
in die Politik erlebt hat,<br />
sitzt die Angst vor einem<br />
Umsturz noch immer tief.<br />
Und man weiß seit langem<br />
von geheimen Verbindungen<br />
zwischen Militär, Politik<br />
und Organisierter Kriminalität,<br />
jenem sogenannten<br />
tiefen Staat, der die<br />
* Vergangenen Montag bei Istanbul.<br />
Journalist Türkkan<br />
„Negatives Verhalten“<br />
türkische Politik aus dem Hintergrund<br />
manipuliert. Genauso weitverbreitet ist<br />
die türkische Passion für Verschwörungstheorien.<br />
Doch nährten n<strong>eu</strong>e Verhaftungswellen<br />
den Verdacht, dass der Regierung<br />
Erdogan nicht nur daran gelegen war, den<br />
„tiefen Staat“ trockenzulegen – sondern<br />
dass es auch darum ging, Kritiker außer<br />
Gefecht zu setzen.<br />
Von einer Hexenjagd auf politische<br />
Gegner sprach die oppositionelle Republikanische<br />
Volkspartei. Der britische Türkei-Experte<br />
Gareth Jenkins sagt, es gebe<br />
zwar zweifellos einige Beschuldigte, die<br />
in kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen<br />
seien. „Die meisten Angeklagten“,<br />
so Jenkins, „scheinen jedoch nur insofern<br />
schuldig, als dass sie säkularistische und<br />
ultranationalistische Ansichten teilen.“ Es<br />
handele sich also in erster Linie um einen<br />
politischen Prozess.<br />
Wohl deshalb geriet auch Adnan Türkkan<br />
2008 ins Visier der Ermittler. Am<br />
1. Juli standen mehrere bewaffnete Polizisten<br />
der Anti-Terror-Einheit TEM vor<br />
der Tür des damals 26-Jährigen<br />
und führten ihn ab.<br />
Die Begründung: Verdacht<br />
auf „Mitgliedschaft in einer<br />
Terrororganisation“.<br />
Der Student kam in Untersuchungshaft<br />
und wurde<br />
verhört. „Dabei ging es vor<br />
allem um regierungskritische<br />
Demonstrationen, die<br />
ich mitorganisiert habe“,<br />
erzählt Türkkan. Er gehört<br />
zu den Gründern der kemalistischen<br />
Jugendorganisa -<br />
HESSEN TOPLUM ZEITUNG<br />
tion TGB; er hat nie verheimlicht,<br />
dass er von der<br />
islamistischen Regierungspartei<br />
AKP wenig hält.<br />
MURAD SEZER / REUTERS<br />
Aus Mangel an Beweisen wurde er vier<br />
Tage später wieder freigelassen, doch die<br />
Ermittler behielten ihn im Auge, hörten<br />
seine Telefonate ab und konfrontierten<br />
ihn später mit deren Inhalt. „Sie drehten<br />
jedes Wort um und interpretierten es so,<br />
als wäre ich ein Putschist.“<br />
Während des unter Ausschluss der Öffentlichkeit<br />
stattfindenden Verfahrens<br />
wurde er einmal angehört. Doch der Richter<br />
fragte lediglich seine Personalien ab,<br />
dann verlas Türkkan eine Erklärung – das<br />
war alles. Die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft<br />
ist ein Wirrwarr ominöser<br />
Vorwürfe. Es heißt dort, dass bei der<br />
Durchsuchung verdächtige Visiten- und<br />
Kreditkarten gefunden worden seien,<br />
dass er mit radikalen Parteien kooperiere<br />
und zu Demonstrationen gegen die Regierung<br />
aufrufe. Sie schloss daraus, Türkkan<br />
habe eine Art Jugendorganisation<br />
von Ergenekon aufbauen wollen.<br />
Auch Sabuncu und Bozkurt warten<br />
noch auf Beweise für die Vorwürfe gegen<br />
sie. Die Journalisten gerieten offenbar<br />
vor allem in Verdacht, weil sie für die linksnationalistische<br />
Tageszeitung „Aydinlik“<br />
arbeiten. Diese hatte den Mitschnitt eines<br />
kompromittierenden Telefonats zwischen<br />
Erdogan und dem ehemaligen nordzyprischen<br />
Premier veröffentlicht, in dem sie<br />
die Entmachtung eines Rivalen diskutierten.<br />
„Dieses Gespräch wurde allen Zeitungen<br />
in der Türkei zugespielt, wir<br />
waren die Einzigen, die es wortwörtlich<br />
wiedergaben“, sagt Bozkurt.<br />
Für den Türkei-Kenner Jenkins steckt<br />
der Ergenekon-Prozess voller Widersprüche.<br />
Schon 2009 veröffentlichte der Brite<br />
einen kritischen Bericht: Es gebe keinen<br />
klaren Beleg für die Existenz des Geheimbundes,<br />
nur Aussagen „geheimer Z<strong>eu</strong>gen“<br />
und Dokumente ohne eind<strong>eu</strong>tige<br />
Urheberschaft. Selbst in den Abhörprotokollen<br />
von Angeklagten fehlten Hinweise<br />
auf Ergenekon.<br />
Besonders merkwürdig findet Jenkins,<br />
dass auf den über 4000 Seiten der Anklageschrift<br />
so gut wie jede in der Türkei bekannte<br />
illegale Organisation genannt<br />
wird. Folge man der Anklage, unterhalte<br />
Ergenekon Verbindungen zur kurdischen<br />
PKK, zur marxistischen DHKP-C sowie<br />
zur türkischen Hizbullah. Eine seltsame<br />
Allianz, meint Jenkins.<br />
Adnan Türkkan jedenfalls ist überz<strong>eu</strong>gt,<br />
dass die Ergenekon-Urteile am<br />
Ende immerhin eine positive Sache zur<br />
Folge hätten: Sie zeigten das wahre, autoritäre<br />
Gesicht der Regierung und würden<br />
damit n<strong>eu</strong>e Protestaktionen nach sich<br />
ziehen. Er erwartet einen heißen Herbst.<br />
Seinen Widerstand gegen Erdogan will<br />
er aber zur Sicherheit vorerst von<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> aus fortführen. „Es gibt hier<br />
ein großes oppositionelles Potential“,<br />
sagt er. „Viele junge D<strong>eu</strong>tschtürken haben<br />
ein Problem mit der Erdogan-Regierung.“<br />
DANIEL STEINVORTH<br />
DER SPIEGEL 33/2013 95
Ausland<br />
NEW YORK<br />
In den Straßen von Babylon<br />
GLOBAL VILLAGE: Ein Linguist will aussterbende Sprachen retten –<br />
und fährt dafür nicht um die Welt, sondern quer durch New York.<br />
Vor einigen Jahren reiste Daniel<br />
Kaufman nach Indonesien, auf der<br />
Suche nach einem Menschen, der<br />
Mamuju spricht. Er fand Dutzende verwandte<br />
Sprachen, nicht aber Mamuju.<br />
Unverrichteter Dinge flog der amerika -<br />
nische Linguist zurück nach New York.<br />
Zwei Jahre später besuchte er im Stadtteil<br />
Queens eine Hochzeit, neben ihm saß ein<br />
Mann namens Husni Husain, Ende sechzig,<br />
gebürtiger Indonesier – und<br />
er sprach Mamuju. Kaufman<br />
konnte sein Glück kaum fassen,<br />
er hatte den vermutlich einzigen<br />
Mamuju-Sprecher von New York<br />
gefunden. Und mit ihm eine fast<br />
verlorene Sprache.<br />
Kaufman ist 37 Jahre alt und<br />
Professor für Linguistik an der<br />
Columbia University in New<br />
York, sein Spezialgebiet sind die<br />
Sprachen Indonesiens und der<br />
Philippinen. Vor drei Jahren hat<br />
er die Endangered Language<br />
Alliance mitgegründet, die „Allianz<br />
für gefährdete Sprachen“. Ihr<br />
Ziel ist es, seltene Sprachen ausfindig<br />
zu machen, zu beschreiben<br />
und zu erforschen.<br />
„Für meine Arbeit ist New<br />
York der beste Platz auf der<br />
Welt“, sagt Daniel Kaufman in<br />
seinem Büro in Manhattan. Die<br />
Flipflops hat er abgestreift, das<br />
bunte Hemd sitzt locker. Nirgendwo<br />
werden so viele verschiedene<br />
Sprachen gesprochen wie in der<br />
größten Stadt der USA: 800 haben<br />
die Einwanderer in die fünf<br />
Bezirke am Hudson River mitgebracht,<br />
schätzt Kaufman; mehr als 6000 existieren<br />
laut Uno weltweit. Die Hälfte von ihnen<br />
könnte bis Ende dieses Jahrhunderts<br />
ausgestorben sein.<br />
Kaufman sammelt seltene Sprachen,<br />
weil ihn die große Frage der Linguistik<br />
umtreibt: Gibt es eine universelle Grammatik?<br />
Also Muster und Strukturen, die<br />
sich im Rätoromanischen oder Jiddischen<br />
genauso wie im Englischen oder Chinesischen<br />
finden? „Was wir wissen, ist stark<br />
beeinflusst von den wenigen großen Sprachen,<br />
die gut erforscht sind“, sagt Kaufman.<br />
„Aber viele der Sprachen, die wir<br />
hier untersuchen, brechen diese Regeln<br />
in irgendeiner Weise.“<br />
Dass Sprachen zu seinem Lebensinhalt<br />
wurden, ist vielleicht kein Zufall. Auch<br />
96<br />
die Eltern des Wissenschaftlers sind Einwanderer,<br />
sie zogen von Israel in die<br />
USA, sie redeten Hebräisch miteinander.<br />
Als Jugendlichem war ihm das peinlich,<br />
vor allem, wenn andere L<strong>eu</strong>te zuhörten,<br />
bis er begriff, dass er damit einen Teil seiner<br />
Identität verl<strong>eu</strong>gnete. Seitdem spricht<br />
er mit seinen Eltern Hebräisch. „Es hat<br />
einen anderen Menschen aus mir gemacht“,<br />
erzählt er. „Erst wenn man die<br />
Wissenschaftler Kaufman<br />
Gibt es eine universelle Grammatik?<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Muttersprache eines Menschen versteht,<br />
versteht man, wie er wirklich denkt.“<br />
Wenn der Professor auf der Suche nach<br />
einer seltenen Sprache ist, reist er nicht,<br />
er geht nicht ins Mus<strong>eu</strong>m oder in die Bibliothek.<br />
Er läuft durch die Straßen, setzt<br />
sich in ein Restaurant, unterhält sich mit<br />
einem Kellner oder Taxifahrer. „Ich kann<br />
einfach loslaufen und Sprachen finden,<br />
die vielleicht nur noch von ein paar hundert<br />
Menschen gesprochen werden“, sagt<br />
er. „Das ist der perfekte Grund, mit Fremden<br />
zu reden und alle Ecken dieser Stadt<br />
kennenzulernen.“<br />
Bei seinen Streifzügen durch die Bronx,<br />
Brooklyn und Queens hat Kaufman mehr<br />
seltene Sprachen gefunden, als er in sein<br />
Rettungsprogramm aufnehmen kann. Er<br />
muss daher entscheiden: Wie viele Menschen<br />
sprechen die Sprache? Wie gut ist<br />
sie bereits dokumentiert?<br />
Je gefährdeter die Sprache, desto eher<br />
nimmt Kaufman sich ihrer an. Dann treffen<br />
sich am Projekt beteiligte Wissenschaftler,<br />
Studenten und Ehrenamtliche<br />
mit den Muttersprachlern. Vor laufender<br />
Kamera erzählen diese Geschichten aus<br />
ihrer Heimat, rezitieren Gedichte und<br />
reden über ihr Leben in New York. Das<br />
gesammelte Filmmaterial stellen<br />
die Forscher mit Untertiteln versehen<br />
auf YouTube – ein erster<br />
Schritt, um die Sprache zurück<br />
ins Leben und in die Gemeinschaft<br />
zu bringen. Zusätzlich<br />
zeichnen sie Alphabet, Grammatik<br />
und Wortschatz auf. Kaufmans<br />
Ziel: eine Art Spracharchiv.<br />
Das nutzt er dann, um nach<br />
Besonderheiten bei den Zeitformen<br />
oder in der Grammatik zu<br />
suchen.<br />
Doch Kaufman ist nicht nur<br />
Forscher, er will auch den Menschen<br />
helfen, ihre Mundart und<br />
damit ihre Kultur zu bewahren.<br />
Denn Sprache ist Identität – doch<br />
Einwanderer geben sie nur selten<br />
an ihre Kinder weiter. Sie halten<br />
es für wichtiger, dass diese in<br />
Amerika Englisch lernen statt<br />
SARAH GIRNER / DER SPIEGEL<br />
Aramäisch oder Kaschubisch.<br />
Er ermuntert sie daher dazu,<br />
wieder ihre Muttersprache zu<br />
sprechen, er gibt ihr einen Wert<br />
zurück. Einige Gemeinschaften<br />
haben seither begonnen, gegen<br />
das Sprachsterben zu kämpfen.<br />
Es gibt in New York inzwischen Chöre,<br />
die auf Garifuna singen, während es in<br />
Mittelamerika inzwischen von Englisch<br />
und Spanisch weitgehend verdrängt worden<br />
ist.<br />
Solche Erfolge fr<strong>eu</strong>en Kaufman, doch<br />
in der Mehrzahl der Fälle kommen seine<br />
Wiederbelebungsversuche zu spät.<br />
Für die Sprache Yahgan etwa, die nur<br />
noch von einer alten Frau auf F<strong>eu</strong>erland<br />
gesprochen wird – und in der Kaufman<br />
sein Lieblingswort gefunden hat. Um dessen<br />
Bed<strong>eu</strong>tung zu beschreiben, braucht<br />
er einen ganzen Satz: „Der Blick zwischen<br />
zwei Menschen, die wollen, dass<br />
der andere etwas in Gang setzt, was beide<br />
begehren, aber keiner bereit ist zu tun.“<br />
Auf Yahgan sagt man einfach: mamihlapinatapai.<br />
FRITZ HABEKUSS
Szene<br />
AUSSTELLUNGEN<br />
Goldstaub über<br />
Niedersachsen<br />
Hannover, die eher unauffällige Landeshauptstadt,<br />
will mit Hilfe von viel<br />
Gold endlich strahlen. Am 23. August<br />
eröffnet im Landesmus<strong>eu</strong>m die Schau<br />
„Im Goldenen Schnitt“. In ihr l<strong>eu</strong>chten<br />
archäologische Funde, die beim Bau<br />
der Trasse für die transnationale Erdgasleitung<br />
NEL gehoben wurden, etwa<br />
der 3300 Jahre alte „Goldschatz von<br />
Gessel“. In der Kestnergesellschaft eröffnet<br />
zeitgleich die Ausstellung<br />
„Der Schein. Glanz, Glamour, Illusion“.<br />
Zeitgenössische Werke sollen ver -<br />
anschaulichen, was Künstler so anstellen,<br />
wenn sie Gold in die Hände bekommen.<br />
Die<br />
Schweizerin Sylvie<br />
Fl<strong>eu</strong>ry überzog<br />
damit einen<br />
Einkaufswagen,<br />
der D<strong>eu</strong>tsche<br />
Thomas Demand<br />
fotografierte<br />
Barren,<br />
die wie Gold<br />
aussehen, aber<br />
keines sind.<br />
Niedersachsen<br />
Fl<strong>eu</strong>ry-Werk, 2000<br />
wird den Goldstaub<br />
nicht<br />
mehr los: 2014<br />
erinnern meh -<br />
rere Museen daran, dass englische Könige<br />
einst aus Hannover kamen. Zu<br />
den präsentierten Kostbarkeiten gehört<br />
ein Brief von 1756, den der birmanische<br />
König an Georg II. schickte, verfasst<br />
auf einem Blatt aus purem – Gold.<br />
COURTESY DIE KÜNSTLERIN UND ALMINE RECH GALLERY<br />
Polanski 1955<br />
REGISSEURE<br />
Der Überlebenskünstler<br />
Die Schauspielschule in Krakau lehnte<br />
ihn einst mit der Begründung ab, er<br />
sei, mit 1,65 Metern, zu klein. Also studierte<br />
Roman Polanski in Lodz an der<br />
Filmhochschule und wurde Regiss<strong>eu</strong>r,<br />
eines der größten Genies in der Geschichte<br />
des Kinos. Er drehte Meisterwerke<br />
wie „Rosemary’s Baby“ und<br />
„Chinatown“, für das Holocaust-Drama<br />
„Der Pianist“ wurde er 2003 mit einem<br />
Oscar ausgezeichnet. Am 18. August<br />
wird Roman Polanski 80 Jahre alt.<br />
Jetzt erscheinen gleich drei n<strong>eu</strong>e Biografien:<br />
Der Filmwissenschaftler<br />
Thomas Koebner analysiert in „Roman<br />
Polanski – Der Blick der Verfolgten“<br />
(Reclam Verlag) vor allem das Werk<br />
des Regiss<strong>eu</strong>rs, der Autor Paul Werner<br />
erzählt in „Polanski“ (Verlag Langen<br />
Müller) dessen Lebensgeschichte nach.<br />
Das eindrucksvollste Buch ist jedoch<br />
der Bildband „Roman Polanski – Seine<br />
Filme, sein Leben“ (Knesebeck Verlag)<br />
mit Texten von James Greenberg;<br />
Polanski hat das Vorwort verfasst.<br />
„Wahrscheinlich kann man seinen<br />
Lebens unterhalt auf leichtere Weise<br />
verdienen“, schreibt er, aber „meine<br />
schönsten Momente“ sind „diejenigen,<br />
die ich am Set verbringe“. Das sieht<br />
man: Dutzende Fotos zeigen Polanski<br />
bei Dreharbeiten, von den fünfziger<br />
Jahren bis zur Gegenwart – ein kleiner<br />
großer Mann, der auch mit 80 nicht an<br />
den Ruhestand denkt. Sein n<strong>eu</strong>er<br />
Film „Venus im Pelz“ kommt im Herbst<br />
in die d<strong>eu</strong>tschen Kinos.<br />
FILMMUSEUM IN LODZ (PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA FILMOWA)/KNESEBECK VERLAG<br />
LITERATUR<br />
Die mageren Mädchen<br />
98<br />
Es beginnt, jedenfalls für einen Krimi,<br />
recht harmlos: In einem Videoverleih<br />
in der Stockholmer Altstadt raubt ein<br />
drogenabhängiger Mann die Kasse aus<br />
und verletzt eine Kundin. Dieser Vorfall<br />
setzt eine Ermittlung in Gang,<br />
die einem der schlimmsten Verbrechen<br />
auf die Spur kommt, mit dem es die<br />
A-Gruppe je zu tun hatte. Es ist der<br />
zehnte Fall für das Team und, wie es<br />
vom Verlag heißt, auch sein letzter.<br />
Der Schwede Arne Dahl, 50, der sich<br />
die A-Gruppe der Stockholmer Polizei<br />
ausgedacht hat, gibt sich in „Bußestunde“<br />
noch einmal seiner Vorliebe<br />
für bizarre Szenarien hin.<br />
Der Chef des schwedischen Geheimdienstes<br />
ist verschwunden,<br />
und niemand weiß, wo er<br />
steckt. Ein Zuhälterring lässt<br />
auf Bestellung Prostituierte auf<br />
dem OP-Tisch so verändern,<br />
dass sie wie die Traumfrauen<br />
der reichen Freier aussehen.<br />
Lauren Bacall? Angelina Jolie?<br />
Alles wird geliefert. Gleichzeitig<br />
werden in Schweden einige<br />
junge Frauen ermordet, die an<br />
Anorexie leiden. Andere<br />
scheinen entführt worden zu<br />
sein. Es stellt sich heraus, dass<br />
die Frauen eine Gemeinsamkeit<br />
haben: Die Magersüchtigen<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Arne Dahl<br />
Bußestunde<br />
Aus dem Schwe -<br />
dischen von Wolfgang<br />
Butt. Piper<br />
Verlag, München;<br />
464 Seiten;<br />
19,99 Euro.<br />
wollten über eine dubiose<br />
Website ein illegales Medikament<br />
erwerben, das an geblich<br />
rasch eine weitere Gewichts -<br />
abnahme ermöglicht. Best -<br />
sellerautor Arne Dahl ist ein<br />
geschickter Erzähler. Was er<br />
seinen Fans an Grausam keiten<br />
zumutet, ist wohlkalkuliert.<br />
Seine düsteren und abgefeimten<br />
Plots verfolgen seine Leser,<br />
auch wenn die das Buch<br />
längst aus der Hand gelegt haben.<br />
Sicher, es ist surreal und<br />
unwahrscheinlich, was Dahl<br />
da fabuliert, aber Alpträume –<br />
jeder, der sie einmal hatte,<br />
weiß das – sind ein Stück unauslöschliche<br />
Wirklichkeit.
Kultur<br />
POP<br />
Fun, Fun, Fun<br />
Das dürften die Brüder Brian, Carl und Dennis<br />
Wilson, ihr Cousin Mike Love und der Fr<strong>eu</strong>nd<br />
Alan Jardine kaum erwartet haben, als sie 1961<br />
die Beach Boys gründeten, um Lieder über<br />
das Surfen und das Autofahren zu singen: dass<br />
sie eines Tages Kulturgut werden sollten und<br />
eine dicke CD-Box mit unveröffentlichten<br />
Songs und beigefügter Materialsammlung erscheinen<br />
würde. Tatsächlich ist kaum eine andere<br />
Band so einflussreich gewesen wie die<br />
Beach Boys. Sie haben mit ihren Songs den<br />
Mythos Kalifornien erfunden, die Illusion ewigen<br />
Sommers und ewiger Jugend. Sie haben<br />
aber auch die dunkle Seite erlebt. Dennis ertrank elend,<br />
als er mit Alkohol, Kokain und Valium im Blut tauchen<br />
ging, und Brian, das Genie der Band, der das Surfen nie gemocht<br />
hatte, hörte irgendwann auf, Musik zu machen, und<br />
verbrach te Jahre in Therapie. „Made in California“ heißt<br />
die Box, mit der die Band nun die vergangenen 50 Jahre<br />
bei der Plattenfirma Capitol Records feiert, sechs<br />
CDs mit ihren größten Hits, einigen unbekannten<br />
Songs und Live-Aufnahmen. Im Booklet findet sich<br />
ein Schul essay von Brian aus dem Jahr 1959, da<br />
war er 17 Jahre alt. „My Philosophy“ heißt er, in<br />
ihm schreibt der Schüler: „Ich möchte mich<br />
nicht mit einem durchschnittlichen Leben<br />
zufrie dengeben.“ Das ist ihm gelungen.<br />
Beach Boys um 1962<br />
MICHAEL OCHS ARCHIVES / GETTY IMAGES<br />
KINO IN KÜRZE<br />
„Kick-Ass 2“ handelt von Teenagern,<br />
die sich für Superhelden halten und mit<br />
aller Gewalt gegen Verbrecher vorgehen.<br />
Jim Carrey, der in dem Film einen<br />
fanatischen Rächer spielt, hat sich inzwischen<br />
von dem Werk distanziert –<br />
ein in Hollywood seltener Vorgang. Nach<br />
dem Massaker an der Sandy Hook<br />
Elemen tary School, bei dem im vergangenen<br />
Dezember im US-Bundesstaat<br />
Connecticut 26 Menschen ums Leben<br />
kamen, könne er „das Maß an Gewalt“<br />
in dem Film nicht mehr gutheißen, so<br />
Carrey. Regiss<strong>eu</strong>r Jeff Wadlow zeigt ein<br />
15-jähriges Mädchen (gespielt von<br />
Chloë Grace Moretz), das einem Mann<br />
die Hand abhackt und einer<br />
Frau Glasscherben in den<br />
Leib stößt, bis sie daran<br />
stirbt. Das Ganze wird als<br />
ein großer Spaß inszeniert,<br />
als Kostümparty, bei der das Blut<br />
in Strömen fließt. Ein widerwärtiger,<br />
per fider Film, der ständig über die<br />
Schlechtigkeit der Welt jammert, um<br />
seine Schlächtereien zu rechtfertigen.<br />
„Gold“ erzählt von der Gier und dem<br />
Scheitern d<strong>eu</strong>tscher Abent<strong>eu</strong>rer. Angelockt<br />
von legendären<br />
Goldfunden in Kanada,<br />
quälen sich einige Auswanderer<br />
Ende des 19.<br />
Jahrhunderts durch die<br />
Wildnis, doch unzuläng -<br />
liches Kartenmaterial,<br />
eine überforderte Reiseleitung<br />
und konsequentes<br />
Ignorieren indianischer<br />
Ratschläge führen sie<br />
schnurstracks ins Verderben.<br />
Gern würde der Zuschauer<br />
mit den Figuren<br />
bangen, die sich der Ber -<br />
Nina Hoss in „Gold“<br />
liner Regiss<strong>eu</strong>r Thomas Arslan aus -<br />
gedacht hat. Doch leider wecken sie in<br />
ihrer miesepetrigen Einfältigkeit so<br />
gut wie keine Empathie. Nachdem der<br />
Film auf der Berlinale schlecht auf -<br />
genommen worden war, hat Arslan ihn<br />
noch einmal umgeschnitten. Es bleibt<br />
ein sehr harter Ritt.<br />
PIFFL MEDIEN<br />
DER SPIEGEL 33/2013 99
Schauspielerin Juri als Romanfigur Helen<br />
KINO<br />
Der Körper als Schlachtfeld<br />
Kann man Charlotte Roches Skandalroman „F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
verfilmen? Man kann. Man kann ihn sich sogar anschauen, ohne vor<br />
lauter Ekel aus dem Kino zu rennen. Von Georg Diez
Kultur<br />
Was war gleich noch mal „F<strong>eu</strong>chtgebiete“?<br />
Ach ja, die Befreiung<br />
des Körpers aus der Diktatur<br />
der Schönheit und der Sauberkeit, natürlich<br />
ein feministisches Fanal und, das sagt<br />
sich halt so leicht, eine Generalabrechnung<br />
mit einem Kapitalismus, der uns<br />
von uns selbst entfremdet und zu Sexualobjekten<br />
degradiert.<br />
Ein Erbeben. Ein Erschaudern. Mehr<br />
als zwei Millionen verkaufte Bücher.<br />
Die Geschichte der jungen Helen Memel,<br />
deren Hobby das Ficken ist und die<br />
sich sonst gern mit dem Duschkopf befriedigt,<br />
die von der „Muschiflora“ redet,<br />
den „Hahnenkämmen“ und ihrem „Perlen-<br />
rüssel“ – die aber irgendwann mit einer<br />
hässlichen Wucherung am Hintern im<br />
Krankenhaus landet und schließlich, nachdem<br />
reichlich Blut, Sperma und Scheiße<br />
vergossen wurden, mit ihrem Pfleger Robin<br />
glücklich wird.<br />
Wie konnte es sein, dass ausgerechnet<br />
eine Frau aus dem Fernsehen eine Art<br />
Fuck-you-Feminismus erfand?<br />
Die D<strong>eu</strong>tungsmaschine lief heiß damals,<br />
wie es immer ist, wenn etwas größer ist<br />
als der Schreibtisch der F<strong>eu</strong>ille tonisten.<br />
„Sexualität ist Wahrheit“, das war der Titel<br />
eines der klügeren Texte – und trotzdem:<br />
Butter ist doch auch Wahrheit und Schlafen<br />
und die Wolken über dem Wald.<br />
Die einen sahen in der Hygieneverweigerung<br />
von Charlotte Roches Romanfigur<br />
eine Forderung nach mehr Natur, Natürlichkeit,<br />
Haar unter den Achseln; die anderen<br />
erklärten, es sei gerade der Irrtum<br />
des alten Feminismus gewesen, dass er<br />
Hässlichkeit mit Selbständigkeit verwechselt<br />
habe.<br />
Es war, als wäre Simone de Beauvoir<br />
ins Dschungelcamp geraten, und die Kritikerinnen<br />
und Kritiker konnten sich nicht<br />
entscheiden, ob sie sie rausholen sollten.<br />
Fünf Jahre ist das alles her, und wenn<br />
nun die Verfilmung von „F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
in die Kinos kommt, dann kann man ermessen,<br />
wie sich das Land und das Reden<br />
über Feminismus in dieser Zeit verändert<br />
haben: von der Analfissur und Avocadokernen<br />
als Masturbationshilfe zu Kita-<br />
Plätzen und der Quote. Von der Freiheit<br />
des Sex zu den Folgen des Sex. Von der<br />
anarchischen Lust zur Logik der Angestelltenkultur.<br />
Anders gesagt: Die Wirkung von<br />
„F<strong>eu</strong>chtgebiete“ war gleich null. Der Spaß<br />
des Buches war dafür umso größer.<br />
Das wurde schon in den Erklärungsversuchen<br />
2008 übersehen, als alle Welt rätselte,<br />
was das bed<strong>eu</strong>ten könnte, Analsex,<br />
Spermabonbons, die Hämorrhoiden der<br />
Heldin Helen: „Die D<strong>eu</strong>tschen“, schrieb<br />
die „New York Times“ damals, „neigen<br />
zur Überanalyse. Manchmal ist ein lustiges,<br />
schmutziges Buch genau das, ein lustiges,<br />
schmutziges Buch.“<br />
Auch wenn es schwer zu akzeptieren<br />
ist in diesem Land, das gute Laune gern<br />
mit Kulturverfall verwechselt, in dem<br />
Erfolg erklärungsbedürftig ist und auch<br />
das mehr oder weniger Banale eine Bed<strong>eu</strong>tung<br />
haben muss. „F<strong>eu</strong>chtgebiete“ war<br />
keine Streitschrift für eine selbstbestimmte<br />
Körperlichkeit, sondern ein satirischer<br />
Roman, mit Stärken und Schwächen.<br />
Hatte denn auch im Ernst jemand geglaubt,<br />
dass man Millionen Bücher mit<br />
Feminismus verkauft?<br />
Es ging bei „F<strong>eu</strong>chtgebiete“ um etwas<br />
anderes, und der Abstand der fünf Jahre<br />
lässt das besser erkennen, fünf Jahre, in<br />
denen sich erst mit der Banken- und Finanzkrise<br />
und dann mit dem Euro-Debakel<br />
das Ökonomische wieder vor das Ästhetische<br />
geschoben hat: Die Figur der<br />
Helen war immer das Symbol einer Suche<br />
nach Identität. Und Sex, Lust, Schmutz,<br />
oder was man eben dafür hält, waren nur<br />
die Mittel, diese Suche voranzutreiben.<br />
Bestsellerautorin Roche: „Voll auf die Klobrille“<br />
Eine klassische, sehr h<strong>eu</strong>tige Comingof-age-Story,<br />
die Selbstbeschreibung einer<br />
selbstbewussten, suchenden Frau – darin<br />
lagen die Schönheit und die Stärke des<br />
Buches: Und hier setzt auch der Film an,<br />
der am 11. August bei den Filmfestspielen<br />
in Locarno seine Weltpremiere feiert und<br />
am 22. August in die Kinos kommt.<br />
Jugend, weiß Regiss<strong>eu</strong>r David Wnendt,<br />
ist ein Drama, Sex ist Selbsterforschung,<br />
und Lust ist ein Weg zur Freiheit.<br />
Es ist ein existentielles Delirium, in das<br />
er den Zuschauer in der ersten Hälfte seines<br />
Films stößt, mit Bildern, die sich ins<br />
Hirn bohren wollen, mit Musik, die einen<br />
durchschießt, mit einer Hauptdarstellerin,<br />
die jede Frage danach, ob diese Helen<br />
etwa mit Charlotte Roche zu verwechseln<br />
sei, souverän beantwortet: Helen ist Carla<br />
Juri, eine Frau wie ein Junge, ein Gesicht<br />
wie eine Heilige, ein zerschlissenes<br />
T-Shirt der Band Bad Religion um den<br />
dünnen Körper – diese so gut wie unbekannte<br />
28-jährige Schauspielerin aus der<br />
Schweiz trägt in der Rolle der 18-jährigen<br />
Helen den Film mit einer fast philoso -<br />
phischen Naivität, die es ihr erlaubt, auch<br />
die abstrusesten Sätze zu sagen.<br />
„Mir macht es Riesenspaß, mich nicht<br />
nur immer und überall bräsig voll auf die<br />
dreckige Klobrille zu setzen“, schreibt<br />
Charlotte Roche in dem surreal-heiteren<br />
Ton, der das ganze Buch durchzieht und<br />
den auch der Film trifft.<br />
„Wenn ich mit der Muschi auf der Klobrille<br />
ansetze, gibt es ein schönes schmatzendes<br />
Geräusch, und alle fremden<br />
Schamhaare, Tropfen, Flecken und Pfützen<br />
jeder Farbe und Konsistenz werden<br />
von meiner Muschi aufgesogen. Das mache<br />
ich jetzt schon seit vier Jahren auf<br />
jeder Toilette. Am liebsten an Raststätten,<br />
wo es für Männer und Frauen nur eine<br />
Toilette gibt. Und ich habe noch nie einen<br />
einzigen Pilz gehabt.“<br />
Das ist die Komik, die Charlotte Roche<br />
sucht und die auch David Wnendt sucht –<br />
eine Komik, die sich aus Ekel, Scham und<br />
Demütigungen zusammensetzt, so wie<br />
die Kindheit ja auch, mit einer Heldin,<br />
die vom Schwanzlutschen und der eigenen<br />
Sterilisation redet und zu sehr in ihrer<br />
eigenen Welt lebt, um ins Tragische<br />
abzugleiten.<br />
Carla Juri nun gleitet und lächelt und<br />
nuschelt sich durch diesen Film, sie kurvt<br />
wild auf dem Skateboard und wild durch<br />
ihr Leben, sie ist eine Figur an der Grenze<br />
von Aufklärung und Wohlstandsverwahrlosung,<br />
sie ist Freiheitsheldin und Verlorene<br />
zugleich – und damit einer anderen<br />
Figur sehr ähnlich, die Wnendt 2011 in<br />
seinem ersten, furiosen Spielfilm „Kriegerin“<br />
beschrieben hat: dem rechtsradikalen<br />
ostd<strong>eu</strong>tschen Mädchen Marisa, das<br />
prügelt und säuft und ihren wüst tätowierten,<br />
dünnen Leib durch eine Welt<br />
ohne Sinn und Schönheit schiebt.<br />
Wnendt, 35, ist, so scheint es, ein Experte<br />
für antibürgerliche Extremistinnen,<br />
und so wird Helen bei ihm eine Kriegerin<br />
der ganz anderen Art: Auch sie kämpft<br />
mit dem Körper und um den Körper, auch<br />
MAJESTIC FILM (L.); HERMANN BREDEHORST / POLARIS / LAIF (R.)<br />
DER SPIEGEL 33/2013 101
Filmszene aus „F<strong>eu</strong>chtgebiete“: Symbol einer Suche nach Identität<br />
MAJESTIC FILM<br />
sie sucht den Schmerz und findet sich im<br />
Schmerz, der Rausch ist auch für sie eine<br />
Gegenwelt zum Alltag der Eltern – aber<br />
Helen will nicht zerstören, sie will Genuss,<br />
sie ist auf einem existentiellen Trip,<br />
eine heilige Johanna des Sex, ein Wesen<br />
ohne nachvollziehbare Motive, aber mit<br />
einer höheren Mission. Ein Rätsel.<br />
Das ist eigentlich der Stoff für einen<br />
Film, der sich ganz auf diese fast spiri -<br />
tuelle Suche einlässt, der beschreibt, wie<br />
jede Generation n<strong>eu</strong> die Schichten von<br />
Schmutz und Sucht um sich legt, um sich<br />
von der Welt und den Erwachsenen abzugrenzen,<br />
die Popkultur der vergangenen<br />
60 Jahre ist so entstanden – man<br />
könnte nun sagen, dass zum Beispiel Larry<br />
Clark 1995 mit „Kids“ das schon mal<br />
gemacht hat oder Danny Boyle 1996 mit<br />
„Trainspotting“: Aber warum soll man<br />
das nicht für das <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> des Jahres<br />
2013 n<strong>eu</strong> erzählen?<br />
Tatsächlich scheinen Wnendt und seine<br />
faszinierende Hauptdarstellerin lange<br />
Zeit in dieser existentiellen Richtung unterwegs<br />
zu sein – bis der Film ins Stocken<br />
gerät, weil er die anderen Ebenen aufnimmt,<br />
die auch schon das Buch beschwert<br />
haben: die Scheidung der Eltern,<br />
den ichbesoffenen Vater, die krankhaft<br />
religiöse Mutter, das gebrochene Ur -<br />
vertrauen, den Selbstmordversuch der<br />
Mutter, eine Sehnsucht nach dem Heilen,<br />
die das Kaputte relativiert und die Radikalität<br />
nimmt.<br />
Amerikaner nennen das dann die<br />
„Rubber Duck“-Theorie: Weil dem Helden<br />
einer Geschichte als Kind die Quietscheente<br />
geklaut wurde, so die Erklärung,<br />
102<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
ist er ein Killer, Soziopath, Drogenabhängiger,<br />
Sexsüchtiger, Präsident geworden,<br />
you name it.<br />
Es ist, als ob die Familienpsychologie<br />
den Tabubruch erst erträglich machen<br />
würde – und je länger die Verfilmung von<br />
„F<strong>eu</strong>chtgebiete“ dauert, desto d<strong>eu</strong>tlicher<br />
wird, dass Wnendt da einen Kompromiss<br />
eingegangen ist, der seinem Werk die unmittelbare<br />
Wucht nimmt: Der Sog der Bilder<br />
erlahmt, die Schablonen der Dialoge<br />
werden sichtbar, die Stärke, die in der<br />
Autonomie von Helen gelegen hat, wird<br />
einem Klischee von Familie geopfert, das<br />
so banal ist, dass es fast obszön ist.<br />
Dabei war der Charme von Charlotte<br />
Roches Buch ja gerade, dass sie die Kategorien<br />
„banal“, „obszön“, „normal“ auflöste<br />
oder umdrehte – und dabei so spielerisch<br />
und geschickt vorging, dass die<br />
Klischees zerrieben wurden: Sie selbst<br />
zum Beispiel ist kein verzotteltes und stinkendes<br />
Wesen, keine Recycle-Feministin,<br />
sondern eine schöne Frau mit Tattoos an<br />
den richtigen Stellen. Und auch die begeisterten<br />
Leserinnen von „F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
werden nicht schreiend aus dem Zimmer<br />
gelaufen sein, wenn sich im Fern -<br />
sehen Heidi Klums Mädchen gerade mal<br />
wieder von der blonden Megäre züchtigen<br />
ließen.<br />
Das ist die Ambivalenz, mit der das<br />
Buch hantiert, das ist auch die Ambivalenz,<br />
die in den guten Momenten den<br />
Film sehenswert macht: Wie selbstverständlich<br />
und zart Intimität gefilmt wird,<br />
etwa in der Szene, in der sich Helen von<br />
einem nackten Mann, den sie kaum<br />
kennt, an sexuell relevanten Stellen rasieren<br />
lässt, ohne dass der Mann dann<br />
mit ihr schläft – da liegt ein Film versteckt,<br />
der über die 20-Uhr-15-Dramaturgie und<br />
die Krankenhaus-Erotik des tr<strong>eu</strong>äugigen,<br />
hübsch verstrubbelten Pflegers Robin<br />
hinausweist.<br />
Oder wie zärtlich und brutal Helen mit<br />
ihren Eltern über deren Alter redet, und<br />
wie ratlos die beiden sind, Meret Becker<br />
als Mutter und Axel Milberg als Vater,<br />
was sie nun anfangen sollen mit dieser<br />
Tochter, die beschreibt, wie sie ihnen den<br />
Popo waschen wird, später mal, „im Kreise<br />
der Familie“. Der Körper ist hier das<br />
Schlachtfeld eines viel härteren Kampfs,<br />
als ihn der Feminismus je schlagen wird –<br />
es ist das Leben selbst, das sich gegen<br />
sich wendet, und auch diesen Film lässt<br />
Regiss<strong>eu</strong>r Wnendt einfach liegen.<br />
Diese Helen ist eine Romantikerin, die<br />
an sich selbst zu verbrennen droht, eine<br />
Erotomanin, die ihre Familie verloren hat<br />
und auf ihrem Skateboard mit nacktem<br />
Arsch im Krankenhauskittel durch die<br />
Gänge gleitet, sie stellt sich vor, wie fünf<br />
Männer gleichzeitig auf eine Pizza wichsen<br />
– das alles sind Facetten einer Figur,<br />
die nur im Extrem zu sich findet.<br />
Fünf Jahre später wirken die Aufregung<br />
und der Skandal sehr weit weg. Der<br />
Kapitalismus hat sich andere Opfer gesucht<br />
als junge Frauen mit einer Vorliebe<br />
für Analrasur. „F<strong>eu</strong>chtgebiete“ ist einsortiert<br />
ins Archiv der d<strong>eu</strong>tschen Lüste.<br />
Video: Ausschnitte aus<br />
„F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />
spiegel.de/app332013f<strong>eu</strong>chtgebiete<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Kultur<br />
SUHRKAMP<br />
Pleite ohne Pleite<br />
Der berühmteste d<strong>eu</strong>tsche<br />
Literaturverlag ist zahlungsunfähig,<br />
aber nicht am Ende. Der Insolvenz -<br />
plan macht den Minderheitseigner<br />
Hans Barlach zum Statisten.<br />
Auf Seite fünf des Insolvenzplans<br />
ist die Erschöpfung und Ermüdung<br />
fast spürbar. Die Rede ist<br />
dort von den Streitereien der vergangenen<br />
Jahre. Von unterschiedlichen Auffassungen<br />
über die Ausrichtung des Verlags,<br />
über die Geschäftspolitik, über Führung<br />
des operativen Geschäfts und auch über<br />
den Umgang mit den Gewinnen. Und<br />
schließlich: „Diese Streitigkeiten haben<br />
die Kräfte der Geschäftsführung zunehmend<br />
gebunden, mehr und mehr die<br />
Führung der Geschäfte beeinträchtigt und<br />
deren Fortentwicklung gelähmt.“<br />
Uff. Aber jetzt ist es vorbei. Vergangenen<br />
Dienstag hat das Amtsgericht in<br />
Berlin-Charlottenburg das Insolvenzverfahren<br />
eröffnet. Im Oktober wird die sogenannte<br />
Gläubigerversammlung den<br />
Insolvenzplan verabschieden. Die Suhrkamp<br />
GmbH & Co. KG ist tot, es lebe<br />
die Suhrkamp Aktiengesellschaft.<br />
Es ist vermutlich auch eine Art Abschied<br />
von Hans Barlach, der 2006 bei<br />
Suhrkamp einstieg, gefürchtet und gehasst,<br />
der jetzt seine Macht verliert, mit der er<br />
den Verlag und dessen Geschäftsführung<br />
zu besserem Wirtschaften und vor allem<br />
zu vernünftigen Renditen zwingen wollte.<br />
Der Insolvenzplan sieht vor, umstrittene<br />
Forderungen der Gesellschafter nach<br />
Ausschüttungen von Gewinnen, die in<br />
den Jahren 2010 und 2011 durch den Verkauf<br />
des Archivs und des Frankfurter Verlagsgebäudes<br />
entstanden waren und zur<br />
Eröffnung des Verfahrens führten, zu erlassen.<br />
Gleichzeitig soll die Umwandlung<br />
in eine Aktiengesellschaft sicherstellen,<br />
„dass der insolvenzauslösende Gesellschafterstreit<br />
nicht länger das operative<br />
Geschäft beeinflussen kann“. Zwar werden<br />
die bisherigen Gesellschafter auch zu<br />
Aktionären des n<strong>eu</strong>en Unternehmens,<br />
aber im Vergleich zu früher hat Barlach<br />
kaum Einfluss. Er ist nur noch Statist.<br />
Er wird nicht einmal verhindern können,<br />
dass der Vorstand mit Zustimmung<br />
des Aufsichtsrats den Kreis der Aktionäre<br />
erweitert und das Kapital erhöht, was<br />
wohl dazu führen würde, dass sich Barlachs<br />
Anteil am Verlag verringert. In vielen<br />
Aktiengesellschaften sind für solche<br />
drastischen Einschnitte qualifizierte Mehrheiten<br />
nötig, also 75 Prozent. Bei der<br />
Suhrkamp Verlag AG reicht die einfache<br />
Mehrheit, was bei Aktionären, bei denen<br />
AXEL SEIDEMANN / DAPD<br />
Geschäftsführerin Unseld-Berkéwicz: „Mehr und mehr gelähmt“<br />
der eine – die Familienstiftung um Ulla<br />
Unseld-Berkéwicz – 61 Prozent der Aktien<br />
besitzt und der andere nur 39 Prozent,<br />
jede Abstimmung auf einer Hauptversammlung<br />
eigentlich überflüssig macht.<br />
Es ist sogar vorstellbar, dass Barlach nicht<br />
einmal im Aufsichtsrat vertreten sein<br />
wird.<br />
Für den Fall, dass einem der Aktionäre<br />
diese Lösung nicht behagt, sieht der Plan<br />
ein Abfindungsangebot von 50 Euro pro<br />
Aktie vor. Im Falle Barlachs wäre das<br />
knapp eine Million Euro. Investiert haben<br />
dürfte er mehr als 12 Millionen.<br />
Stattdessen, auch das wird im Insolvenzplan<br />
erwähnt, bestätigt das Ehepaar<br />
Sylvia und Ulrich Ströher in einem Schreiben,<br />
dass es sich an der AG beteiligen<br />
will. Die Ströhers, seit Wochen schon als<br />
mögliche Investoren gehandelt (SPIEGEL<br />
23/2013), gehörten zu den Besitzern des<br />
Wella-Konzerns, der 2003 für 6,5 Milliarden<br />
Euro an Procter & Gamble verkauft<br />
wurde. Das Ehepaar selbst soll dabei<br />
1,6 Milliarden Euro bekommen haben.<br />
„Wir wären bereit“, heißt es in dem<br />
Schreiben, „uns im Rahmen einer Kapital -<br />
Gesellschafter Barlach<br />
Katastrophale Niederlage<br />
VALESKA ACHENBACH<br />
erhöhung zu beteiligen oder Aktien bisheriger<br />
Gesellschafter zu erwerben.“<br />
Barlach selbst bestätigt ein Angebot<br />
der Ströhers schon aus dem Mai. Es belief<br />
sich damals auf 10 Millionen Euro. Barlach<br />
hat abgelehnt. Das war vor der Eröffnung<br />
des Schutzschirmverfahrens: Barlach<br />
sah da den Wert des Unternehmens<br />
bei 75 Millionen Euro und seinen Anteil<br />
somit bei rund 30 Millionen. Das war es<br />
wahrscheinlich nie wert, h<strong>eu</strong>te ist es das<br />
ganz sicher nicht.<br />
Die Eröffnung des Verfahrens bed<strong>eu</strong>tet<br />
für ihn eine katastrophale Niederlage.<br />
Trotzdem sagt er: „Ich werde meine Anteile<br />
vorerst nicht verkaufen.“ Bald wird<br />
er dies nur noch mit Zustimmung des Aufsichtsrats<br />
tun können, auch das sieht die<br />
Satzung der n<strong>eu</strong>en Suhrkamp AG vor.<br />
Im September werden vor dem Frankfurter<br />
Landgericht die Klagen der Familien -<br />
stiftung und der Medienholding auf gegenseitigen<br />
Ausschluss verhandelt. Ob<br />
allerdings ein Landgericht in ein laufendes<br />
Insolvenzverfahren eingreifen wird,<br />
erscheint fraglich. Alle weiteren juristischen<br />
Schritte wären langwierig und würden<br />
hohe Kosten verursachen, weil eine<br />
außerordentliche Beschwerde wegen<br />
Rechtsmissbrauchs oder eine Klage auf<br />
Schadens ersatz gegen die Geschäftsführung<br />
und deren Berater wegen der Entwertung<br />
der Suhrkamp-Anteile auf juristisch<br />
schwieriges Terrain führt.<br />
Ein Fall mit Seltenheitswert: eine Pleite<br />
ohne Pleite. Aus dem Insolvenzplan geht<br />
auch hervor, dass der Verlag nicht überschuldet<br />
gewesen wäre, wenn die Familien -<br />
stiftung die Ausschüttung ihrer Gewinne<br />
in Höhe von fast 5 Millionen Euro zurückgestellt<br />
hätte. Ohne die Insolvenz, so<br />
die Prognose des Verlags, stünde am<br />
Ende des Jahres ein operatives Minus von<br />
610000 Euro. Nicht das größte Minus in<br />
der Ära Unseld-Berkéwicz.<br />
LOTHAR GORRIS, CLAUDIA VOIGT<br />
DER SPIEGEL 33/2013 103
Kultur<br />
AUTOREN<br />
Sex im Konjunktiv<br />
Der Schriftsteller Uwe Timm hat eine tr<strong>eu</strong>e<br />
Lesergemeinde. Mit seinem Roman<br />
„Vogelweide“ stellt er sie jetzt auf eine harte Probe.<br />
104<br />
Uwe Timm<br />
Vogelweide<br />
Kiepenh<strong>eu</strong>er &<br />
Witsch, Köln; 336<br />
Seiten; 19,99 Euro.<br />
Das Schönste an diesem Roman ist<br />
sein Schauplatz. Scharhörn: eine<br />
Miniaturinsel vor der Elbmündung<br />
mit einer Fläche von rund 20 Hektar,<br />
entstanden auf einer Sandbank. Ein einsames<br />
Haus steht drauf. In den Sommermonaten<br />
logiert ein Vogelwart auf der<br />
Insel. Besuch nur nach vorheriger An -<br />
meldung und Genehmigung.<br />
Ideal also für einen Romanhelden, der<br />
über sich und sein Leben nachdenken<br />
möchte. Gleich nebenan liegen die unbewohnte<br />
Schwesterinsel mit dem klingenden<br />
Namen Nigehörn und, sechs Kilometer<br />
entfernt, die größere Insel N<strong>eu</strong>werk,<br />
alles inmitten des Nationalparks Hamburgisches<br />
Wattenmeer.<br />
Die Inselgruppe gehört nicht nur zu<br />
Hamburg, sie ist sogar, obgleich 100 Kilometer<br />
von der Hansestadt entfernt, ein<br />
eigener Stadtteil. Fast 30 Jahre lang gab<br />
es den Plan, dort einen Tiefwasserhafen<br />
zu errichten, doch daraus ist bis<br />
h<strong>eu</strong>te nichts geworden.<br />
Der in Hamburg geborene<br />
Schriftsteller Uwe Timm hat<br />
Scharhörn jetzt zum Schauplatz<br />
seines n<strong>eu</strong>en Romans „Vogelweide“<br />
gemacht. Auf der Insel<br />
spielt sich die Rahmenhandlung<br />
ab. Eschenbach heißt der als Unternehmer<br />
und Liebhaber gescheiterte<br />
Mann, der sich hierhin<br />
zurückgezogen hat. Statt für<br />
einige Zeit ins Kloster zu gehen<br />
oder sich auf den Pilgerpfad zu<br />
begeben, übernimmt er das Amt<br />
des Vogelwarts.<br />
Was ihn dafür qualifiziert?<br />
Zur Erklärung wird im Roman<br />
angeführt, dass er früher einmal einem<br />
befr<strong>eu</strong>ndeten Ornithologen bei dessen<br />
Arbeit half. Von dem ist er nun gefragt<br />
worden, ob er kurzfristig auf Scharhörn<br />
eine Schwangerschaftsvertretung übernehmen<br />
könne. Eschenbach zögert nicht<br />
lange und erfüllt mit Vergnügen die Aufgaben,<br />
die er als Herr der Insel zu er -<br />
ledigen hat: Aufzeichnungen über die<br />
nistenden Vögel zu machen, die vorbeiziehenden<br />
Schwärme zu beobachten<br />
und deren Größe abzuschätzen, den Müll<br />
aufzusammeln, den das Meer anschwemmt.<br />
Begeistert rühmt er den einsamen Ort,<br />
freilich so, als müsste er den Text für einen<br />
Reiseführer schreiben: „Die Sterne<br />
sind so überraschend nah. Du siehst die<br />
ferne Lichterkette der Küste. Das Licht<br />
des L<strong>eu</strong>chtturms von Helgoland und von<br />
der Insel N<strong>eu</strong>werk, so als schneide der<br />
Strahl Bahnen in die Dunkelheit, eine<br />
Verbindung zum Großen Wagen dort<br />
oben, zum Nordstern. Und du siehst in<br />
der Ferne die Lichter der Schiffe.“<br />
Uwe Timm, 73, hat in vier Jahrzehnten<br />
gut zwei Dutzend Bücher publiziert, dar -<br />
unter bekannte und anerkannte Werke<br />
wie „Morenga“, „Kopfjäger“, „Rot“. Der<br />
n<strong>eu</strong>e Roman hält leider nicht, was der<br />
Schauplatz verspricht. Der Autor hat sich<br />
offenbar zu sehr auf seine Fertigkeiten<br />
und sein Handwerk verlassen.<br />
Die Karrieren von Schriftstellern sind –<br />
wie schon ein kurzer Blick in die Gegenwartsliteratur<br />
zeigt – voll von Unwägbarkeiten.<br />
Es gibt die Autoren, die gleich mit<br />
ihrem ersten Roman einen Bestseller<br />
schreiben, danach aber mehr<br />
oder weniger in Schweigen verfallen<br />
(wie Patrick Süskind nach<br />
seinem Millionenerfolg „Das<br />
Parfum“). Es gibt solche, die mit<br />
mehreren Büchern zu guter Auflage<br />
und großem Ansehen gekommen<br />
sind, bevor ihre Erfolgskurve<br />
jäh abbricht (wie im<br />
Fall des h<strong>eu</strong>te fast vergessenen<br />
Schweizers Gerold Späth). Auch<br />
solche, die in größeren Abständen<br />
Romane publizieren, souverän<br />
und ohne um die Lesergunst<br />
zu bangen (Christoph Ransmayr).<br />
Es gibt die Autoren, deren<br />
Erfolg sich an der Kritik vorbei<br />
entwickelt (Daniel Glattauer mit „Gut gegen<br />
Nordwind“). Und dann sind da umgekehrt<br />
die jenigen, die bei emsiger Pro -<br />
duktion kaum ein Publikum finden, aber<br />
von Teilen der Kritik unerbittlich gelobt<br />
und hochgehalten werden (bestes Beispiel:<br />
Reinhard Jirgl). Andere schreiben<br />
ihr Leben lang Buch um Buch und landen<br />
erst spät einen Überraschungserfolg (wie<br />
Dieter Wellershoff mit seinem Roman<br />
„Der Liebeswunsch“). Und gelegentlich<br />
gibt es ein Glückskind wie Eugen Ruge,<br />
der im Alter von 57 seinen Debütroman<br />
publizierte und damit auf Anhieb den<br />
D<strong>eu</strong>tschen Buchpreis und ein großes Publikum<br />
gewann.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Literat Timm: Wo bleibt das Begehren?<br />
Romanschauplatz Scharhörn: „Die Sterne sind
so überraschend nah“<br />
ISOLDE OHLBAUM / LAIF<br />
RALF ROLETSCHEK<br />
Solche Extreme kennt Uwe Timms Autorenlaufbahn<br />
nicht. Sie hat sich stetig<br />
entwickelt. Und obgleich die große Leser -<br />
schaft etwas auf sich warten ließ, so darf<br />
man ihn h<strong>eu</strong>te doch einen erfolgsverwöhnten<br />
Autor nennen. Er begann als<br />
Lyriker, promovierte 1971 über Camus<br />
und veröffentlichte mit Mitte dreißig den<br />
immer noch lesenswerten Roman der<br />
68er-Revolte: „Heißer Sommer“.<br />
Vier weitere Höhepunkte gibt es. Dazu<br />
zählt sogar ein Kinderbuch, 1989 publiziert,<br />
das sich – auch als Film – anhal -<br />
tender Beliebtheit erfr<strong>eu</strong>t: „Rennschwein<br />
Rudi Rüssel“. Dann die 1993 veröffentlichte<br />
und ebenfalls verfilmte Novelle<br />
„Die Entdeckung der Currywurst“, die<br />
Geschichte eines untergetauchten Desert<strong>eu</strong>rs<br />
aus den letzten Kriegstagen in<br />
Hamburg. Schließlich zwei autobiografisch<br />
geprägte Bücher: 2003 das fragmentarische<br />
Porträt seines im Krieg gefallenen<br />
Bruders Karl-Heinz, eines SS-Soldaten<br />
(„Am Beispiel meines Bruders“), und<br />
2005 die private Spurensuche im Fall von<br />
Benno Ohnesorg, des 1967 in Berlin<br />
getöteten Studenten, mit dem Timm<br />
befr<strong>eu</strong>ndet war („Der Fr<strong>eu</strong>nd und der<br />
Fremde“).<br />
Der n<strong>eu</strong>e Roman nun ist ein Beleg<br />
dafür, dass Schreibroutine auch in die<br />
Sackgasse führen kann. Und er zeigt<br />
zugleich beispielhaft, was an der d<strong>eu</strong>tschen<br />
Gegenwartsliteratur mitunter so<br />
quälend ist.<br />
Dazu gehört zum Beispiel, dass Dialoge<br />
in wörtlicher Rede eher gemieden werden.<br />
Es mag die Furcht davor sein, dass<br />
es zu stark an Unterhaltungsliteratur erinnert,<br />
wenn die Gespräche der Figuren<br />
gar zu lebhaft und mitreißend ausfallen<br />
(und womöglich noch durch Anführungszeichen<br />
kenntlich sind), also werden ganze<br />
Abendunterhaltungen und selbst Bettgeflüster<br />
in indirekter Rede wiedergegeben:<br />
Referat und Zusammenfassung statt<br />
Vergegenwärtigung – bei Timm immerhin<br />
in korrektem Konjunktiv.<br />
Aber wenn es nur das wäre. Es soll in<br />
„Vogelweide“ ja auch um Liebe und Leidenschaft<br />
gehen, um Verletzungen, Verzweiflung,<br />
Lust und Qual. Nichts davon<br />
wird lebendig. Es bleibt in diesem Roman<br />
pure, sprachlich lustlose Behauptung.<br />
Da ist man „zusammen gewesen“, oder<br />
es gibt ein „tastend staunendes, von Zweifeln<br />
begleitetes Zusammensein“. Nichts<br />
gegen Diskretion, And<strong>eu</strong>tung, Auslassung<br />
in literarischen Werken, zumal das<br />
vulgär Direkte inzwischen ausreichend<br />
erprobt ist (und selten so gelungen wie<br />
bei John Updike) – aber das Begehren<br />
sollte doch zumindest spürbar werden.<br />
Hier ist nur viel davon die Rede.<br />
Und wenn dann mal eine D<strong>eu</strong>tlichkeit<br />
gewagt wird, endet das nicht gut. Anna,<br />
die Geliebte von Eschenbach, ruft im<br />
Liebesrausch „das zuvor Unvorstellbare“,<br />
nämlich: „Ja, fick mich, fick mich“ – was<br />
gleich mit dem Satz „sie hatten getrunken“<br />
entschuldigt wird. Ganz und gar<br />
bizarr dann der Kommentar Eschenbachs:<br />
„Es war, als wären sie mit Benzin<br />
übergossen worden.“ Es bleibt Timms<br />
Geheimnis, wie das zu verstehen sein<br />
soll.<br />
Es gibt vier Hauptpersonen, zwei Paare,<br />
die Timm in seinem Roman nach Art<br />
der „Wahlverwandtschaften“ zusammenführt<br />
und einem Wechselbad der Gefühle<br />
aussetzt. Anders als bei Goethe kommt<br />
es wirklich zum Partnerwechsel, wenn<br />
auch zeitversetzt. Das desolate Ergebnis<br />
wird dem Leser schon früh im Buch mitgeteilt.<br />
Eschenbach verliert alles. Er ist es, der<br />
die mit dem Architekten Ewald verheiratete<br />
Anna, Mutter von zwei Kindern, unbedingt<br />
erobern will. Und sie, der die Ehe<br />
eigentlich heilig ist, da nur durch sie die<br />
„Beliebigkeit des Begehrens“ unterbrochen<br />
werde, zahlt am Ende mit der Trennung<br />
von Ehemann und Geliebtem. Sie<br />
zieht mit ihren Kindern in die USA.<br />
Ewald dagegen findet bei Selma Trost,<br />
der Silberschmiedin, die vorher mit<br />
Eschenbach zusammen war.<br />
Dieser, so viel Strafe muss sein, verliert<br />
am selben Tag wie Anna auch noch seine<br />
Firma. Das Software-Unternehmen geht<br />
in Konkurs, 40 Mitarbeiter stehen auf der<br />
Straße. Doch nachdem er sich ein paar<br />
Tage lang verkrochen hat, weder ans Telefon<br />
noch an die Tür gegangen ist,<br />
kommt Eschenbach zumindest mit diesem<br />
Verlust, auch mit dem seines gepfändeten<br />
Eigentums inklusive Luxuswohnung,<br />
überraschend gut klar.<br />
Sechs Jahre ist das alles her, nun sitzt<br />
der Held auf seiner Vogelinsel – und erwartet<br />
eine Besucherin: jene Anna, mit<br />
der ihn damals die unglückselige Liebesaffäre<br />
verband.<br />
Angekündigt wird dieser Besuch gleich<br />
auf den ersten Seiten des Romans. Doch<br />
es dauert rund 280 weitere Seiten, bis die<br />
Ex-Geliebte endlich dort ankommt. Kein<br />
Wunder: Der Weg vom Festland ist nur<br />
zu bestimmten Tageszeiten möglich, abhängig<br />
von Flut und Ebbe, und auch nur<br />
mit einem Pferdefuhrwerk, falls man<br />
nicht kilometerweit durchs Watt laufen<br />
möchte. Bleibt also Zeit genug, dem Leser<br />
brav und betulich, wenn auch in überflüssig<br />
verschachtelten Rückblenden, die<br />
ganze Vorgeschichte zu erzählen.<br />
H<strong>eu</strong>te kann jeder per Google Earth aus<br />
der Vogelperspektive einen Blick auf<br />
Scharhörn werfen, sogar das kleine Haus<br />
auf Stelzen ist zu erkennen. Derzeit<br />
hü tet ein angehender Tiermediziner dort<br />
ein.<br />
Der Besucherandrang dürfte dank der<br />
ansehnlichen Lesergemeinde von Uwe<br />
Timm bald kräftig anwachsen. Denn wie<br />
immer der Roman „Vogelweide“ gefallen<br />
mag, eines weckt die Lektüre gewiss: N<strong>eu</strong>gier<br />
auf die Insel.<br />
VOLKER HAGE<br />
DER SPIEGEL 33/2013 105
Kultur<br />
KAPITAL<br />
Popstar aus Stahl<br />
Wenn man eine Milliarde verdient hat, was macht man mit dem Geld? Einen Fußballverein<br />
kaufen? Der Kiewer Oligarch Mohammad Zahoor hat ein<br />
anderes Projekt: Seine Frau Kamaliya soll Lady Gaga ablösen. Von Philipp Oehmke<br />
Er würde sich eigentlich nicht als<br />
Olig archen bezeichnen, sagt Mohammad<br />
Zahoor, allerdings ist die<br />
Art und Weise, in der er sich gerade über<br />
die Stadtautobahn von Kiew bewegt,<br />
ziemlicher Oligarchen-Style. Sein blauer<br />
Bentley schneidet durch den Verkehr mit<br />
140 Stundenkilometern, wo 80 erlaubt<br />
sind, gefolgt, Stoßstange an Stoßstange,<br />
von einem Mercedes-Geländewagen. Die<br />
beiden Wagen teilen den ukrainischen<br />
Verkehr wie das Meer, draußen fliegen<br />
Sozialismus-Wohnblöcke vorbei.<br />
Mohammad Zahoor sinkt in den Rücksitz,<br />
neben ihm seine Frau Kamaliya,<br />
wunderschön, wie er findet, in einem weißen,<br />
diamantbesetzten Kleid. Vorn neben<br />
dem Fahrer sitzt Igor, der Leibwächter.<br />
Früher gehörte Igor zum Bewacherteam<br />
von Boris Jelzin, er blickt finster auf jene<br />
Verkehrsteilnehmer, die nicht schnell genug<br />
aus dem Weg gehen.<br />
Kamaliya hat in zehn Minuten einen<br />
Auftritt im Nationalpalast von Kiew, eine<br />
Gala zu Ehren eines verstorbenen ukrainischen<br />
Modeschöpfers namens Voronin,<br />
der in der Ukraine eine so bewunderte<br />
Ikone war, dass 4000 Menschen zu der<br />
Gala kommen werden. Kamaliya wird<br />
dort einen ihrer Songs singen, sie hat sich<br />
für eine Ballade entschieden.<br />
Die Sängerin Kamaliya ist nicht nur<br />
Zahoors Frau, sie ist auch sein Projekt.<br />
In der Ukraine ist sie ein ziemlich bekannter<br />
Popstar, sie verbindet klassischen<br />
Operngesang mit Dancepop, was für west<strong>eu</strong>ropäische<br />
Ohren gewöhnungsbedürftig<br />
klingen kann, sie war Mrs. World im Jahr<br />
2008 und hat auch in einem Film mit Sharon<br />
Stone mitgespielt, der allerdings noch<br />
nicht in die Kinos gekommen ist. Zahoor<br />
sieht da viel Potential. Er hat endlich eine<br />
Bestimmung für sein Geld gefunden.<br />
Mohammad Zahoor, Ende fünfzig, hat<br />
einmal fünf Stahlwerke in der Ukraine besessen,<br />
und als er sie 2008 verkaufte, brachte<br />
ihm das ungefähr eine Milliarde Dollar,<br />
genau will er es nicht sagen. Was macht<br />
man mit einer Milliarde auf dem Konto<br />
mitten in der Finanzkrise? Zahoor investierte<br />
in zwei Hotels in Kiew und in ein<br />
paar Bürogebäude, er kaufte die liberale<br />
englischsprachige „Kyiv Post“ sowie ein<br />
Fernsehstudio, ein Flugz<strong>eu</strong>g, eine Yacht,<br />
106<br />
Unternehmer Zahoor: Blöd, dass das h<strong>eu</strong>te mit dem roten Teppich nicht geklappt hat …<br />
DER SPIEGEL 33/2013
zwei Bentleys, zwei Mercedes, einen Audi<br />
S8, einen Range Rover. Und jetzt?<br />
Seine Oligarchen-Kollegen haben Fußballvereine<br />
gekauft, das wäre eine Idee.<br />
Dem ukrainischen Oberoligarchen Rinat<br />
Achmetow zum Beispiel gehört Schachtjor<br />
Donezk. Achmetow holte einen Haufen<br />
Brasilianer und führte den Verein in die<br />
<strong>eu</strong>ropäische Fußballspitze. Nichts für Zahoor,<br />
aber was wäre, wenn er keine Brasilianer,<br />
sondern die besten Produzenten,<br />
Tänzer, PR-L<strong>eu</strong>te holte und seine Frau in<br />
die <strong>eu</strong>ropäische Popspitze brächte? Und<br />
so formuliert Zahoor an diesem Abend<br />
auf dem Weg zur Gala folgendes Ziel: „Wir<br />
wollen Lady Gaga in Rente schicken.“<br />
Das klingt ordentlich verrückt, andererseits<br />
kam ja auch Zahoor mit 19 ganz<br />
mittellos aus Karatschi in die Sowjet -<br />
union. Er wollte nur eine Ausbildung als<br />
Stahlingeni<strong>eu</strong>r machen. Dass er h<strong>eu</strong>te einer<br />
der reichsten Männer der Ukraine ist,<br />
war mindestens genauso unwahrscheinlich.<br />
Kamaliya hat Talent, sie singt professionell,<br />
seit sie elf ist, den Rest kann<br />
man kaufen.<br />
Möglicherweise ist das, was Zahoor<br />
macht, nur folgerichtig oder gar visionär<br />
… denn sie hat h<strong>eu</strong>te vier Stunden gebraucht, um sich zu schminken: Ehefrau Kamaliya<br />
FOTOS: MAXIM SERGIENKO / AGENTUR FOCUS / DER SPIEGEL<br />
in der Post-Finanzkrisenzeit, in der immer<br />
mehr klassische Kultur- und Unterhaltungsmodelle<br />
des Nachkriegskapitalismus<br />
auf Mäzene angewiesen sind. Von<br />
den in diesem Jahr für den Oscar nominierten<br />
Filmen wurden die meisten von<br />
Milliardären oder Erben maßgeblich mitfinanziert,<br />
darunter „Argo“ oder „Zero<br />
Dark Thirty“; große Kunstausstellungen<br />
würde es sowieso nicht mehr geben ohne<br />
private Geldgeber, etliche Fußballvereine,<br />
die in der Champions League spielen,<br />
hängen am Tropf von Milliardären. Der<br />
Moskauer Unternehmer Wladislaw Doronin<br />
hat eine russische und eine d<strong>eu</strong>tsche<br />
Version der Andy-Warhol-Zeitschrift<br />
„Interview“ auf den Markt gebracht, wohl<br />
vor allem als Spielz<strong>eu</strong>g für seine damalige<br />
Fr<strong>eu</strong>ndin Naomi Campbell. In Zeiten, in<br />
denen Yachten und Flugz<strong>eu</strong>ge selbst reichen<br />
Russen nur noch gestrig vorkommen,<br />
ist der Pakt, den die Scheichs und<br />
Oligarchen schließen, stets derselbe: Geld<br />
gegen Anerkennung. Geld gegen Lebenssinn.<br />
Zahoor sagt, als Stahlmanager habe seine<br />
Freizeit früher aus Abendessen mit<br />
anderen Stahlmanagern bestanden. H<strong>eu</strong>te<br />
genießt er es, zwei Stunden lang zu<br />
warten, bis seine Frau fertig angekleidet<br />
ist, um dann mit ihr und dem Bodyguard<br />
Igor über einen roten Teppich zu gehen.<br />
Igor muss dabei mit breiter russischer<br />
Geste so tun, als wollte er die Fotografen<br />
und Kameramänner versch<strong>eu</strong>chen, obwohl<br />
sie ja eigentlich zum Spiel gehören<br />
und unverzichtbar sind.<br />
Blöd, dass das h<strong>eu</strong>te mit dem roten<br />
Teppich nicht geklappt hat. Trotz der 140<br />
auf der Stadtautobahn kamen sie zu spät.<br />
Kamaliya hat diesmal vier Stunden gebraucht,<br />
um sich zu schminken.<br />
Kamaliya, 36 Jahre alt, hat mit elf ihren<br />
ersten Gesangswettbewerb gewonnen,<br />
das war noch zu Sowjetzeiten. Danach<br />
hat sie sich klassisch ausbilden lassen,<br />
Gesang und Violine, sie kann über drei<br />
Oktaven singen. 1997 veröffentlichte sie<br />
ihr erstes Album, das sie „Techno Style“<br />
nannte und sie in der Ukraine bekannt<br />
machte. Ihre Mutter übernahm das Management,<br />
sie sang Duette mit dem russischen<br />
Schnulzenstar Filipp Kirkorow,<br />
aber ihre Karriere stagnierte. 2008 wurde<br />
sie immerhin Mrs. World, doch eigentlich<br />
ist sie wie eine von Zahoors Stahlwerken:<br />
Irgendwo müssen sich da Schätze verbergen,<br />
doch zunächst muss man sanieren.<br />
Zurück auf Zahoors Anwesen etwas<br />
außerhalb von Kiew möchte Kamaliya<br />
von ihrem d<strong>eu</strong>tschen Manager sogleich<br />
die n<strong>eu</strong>esten Zahlen wissen. Obwohl sie<br />
auf Englisch singt, ist ihre englische Artikulation<br />
ausbaufähig.<br />
„In Spanien bist du diese Woche das<br />
meistgeklickte Video auf YouTube, in<br />
Polen auch. <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> immer noch<br />
15000 Klicks pro Woche, das ist viel“, sagt<br />
der Manager, doch später stellt sich her -<br />
DER SPIEGEL 33/2013 107
Falke Layla im Wohnzimmer, Popdiva Kamaliya mit Kolleginnen: Sie singt professionell, seit sie elf ist, den Rest kann man kaufen<br />
FOTOS: MAXIM SERGIENKO / AGENTUR FOCUS / DER SPIEGEL<br />
110<br />
aus, dass all diese Zahlen etwas schwierig<br />
zu überprüfen sind. Es ist diese n<strong>eu</strong>e<br />
Schattenwelt des Pop mit seinen Klick -<br />
zahlen und YouTube-Hits, die Zahoor erst<br />
mal verstehen musste. Diese n<strong>eu</strong>en Maßeinheiten<br />
werden immer wichtiger, nur<br />
leider verdient man mit Klicks kaum Geld.<br />
Aber das ist hier ja zum Glück zweitrangig.<br />
Außerdem, in England, immerhin das<br />
sogenannte Mutterland des Pop, hat<br />
Kamaliya es schon in die richtige Hit -<br />
parade geschafft, bis auf Platz sechs der<br />
DJ-Charts, das war vergangenes Jahr.<br />
Zahoor hatte dafür die Londoner Produzenten<br />
Digital Dog angeh<strong>eu</strong>ert, die<br />
schon für Cyndi Lauper, Britney Spears<br />
oder Miley Cyrus gearbeitet haben. Für<br />
ihr aktuelles Album „Club Opera“, das<br />
vor ein paar Wochen erschienen ist und<br />
mit dem vor allem in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> und<br />
West<strong>eu</strong>ropa angegriffen werden soll, hat<br />
Zahoor den alten Nena-Produzenten<br />
Uwe Fahrenkrog-Petersen engagiert; er<br />
hat Thomas Anders, den man in der<br />
Ukraine für riesig hält, für ein Duett eingekauft,<br />
genauso den Tenor José Carreras,<br />
mit dem Kamaliya jetzt zwei Stücke<br />
einsingen wird; Zahoor lässt zu ihren<br />
Liedern aufwendige Videos in Miami<br />
oder Mumbai drehen; Zahoor hat sich an<br />
der Finanzierung des Hollywood-Films<br />
„What About Love“ mit Sharon Stone beteiligt,<br />
seine Bedingung für die Beteiligung:<br />
Kamaliya bekommt eine Rolle.<br />
„Es geht doch“, sagt Zahoor. So schwierig<br />
ist das Popgeschäft nicht. Fünf Mil -<br />
lionen Dollar hat er bisher investiert, aber<br />
das ist erst der Anfang.<br />
Er traf die Sängerin im Jahr 2003, da<br />
war er noch Stahlhändler, auch schon<br />
schwerreich, aber uninteressant für eine<br />
ukrainische Popdiva. Er schickte ihr täglich<br />
so lange Blumen, bis sie ihn heiratete.<br />
Am Tag vor der Gala ist Zahoor mit<br />
Kamaliya aus England zurückgekommen.<br />
Dreharbeiten für eine Dokumentation<br />
über das Leben der Superreichen, Zahoor<br />
weiß, dass sein Reichtum seine Frau zusätzlich<br />
interessant macht.<br />
Auch an diesem Abend in Kiew ist ein<br />
Fernsehteam da. Rossija 1, das putintr<strong>eu</strong>e<br />
Fernsehen, ist für ein paar Tage aus Moskau<br />
gekommen. Das liegt vor allem dar -<br />
an, dass Zahoor eine Produzentin des<br />
Senders als Kamaliyas PR-Beraterin angeh<strong>eu</strong>ert<br />
hat. So etwas geht in Russland,<br />
und weil der Sender staatsnah ist, hat<br />
Kamaliya auch schon für den Ministerpräsidenten<br />
Dmitrij Medwedew gesungen.<br />
In der Wohnzimmerhalle der Zahoors<br />
hat sich Kamaliya einen roten Lederhandschuh<br />
über ihren Unterarm gezogen, dar -<br />
auf nimmt nun ein Falke Platz, der bei<br />
den Zahoors im Wohnzimmer lebt. Das<br />
Tier heißt Layla und sitzt normalerweise<br />
auf einem thronartigen Holzpflock mitten<br />
in der Wohnzimmerhalle. Kamaliya füttert<br />
den Vogel mit rohem Hühnerfleisch.<br />
Der Falke reißt blutige Brocken aus dem<br />
Huhn und schlingt sie hinunter, Kamaliya<br />
schaut ihn dabei verliebt an.<br />
Soll sie denn mit Carreras nun in ihrer<br />
Opernstimme singen oder in ihrer Popvoice?<br />
Carreras, heißt es, wolle die Opernstimme.<br />
Kamaliya würde lieber im Popstil<br />
Sie ließ das Haus für<br />
ihn arabisch schmücken,<br />
bis er ihr erklärte,<br />
er sei doch Pakistaner.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
singen. Sie macht sich Sorgen, dass die<br />
Songs sonst zu bieder werden.<br />
Als der Falke genug gefressen hat, reißt<br />
er weiterhin Stücke aus dem Huhn und<br />
wirft sie aus dem Schnabel abwechselnd<br />
den sechs Pekinesen vor die Füße. Die<br />
Hunde sollen auch etwas bekommen. Aus<br />
ihren Käfigen schauen ein Hase und ein<br />
Chinchilla zu, hinten am Fenster schreit<br />
ein Kakadu. Möglicherweise ist die Idee,<br />
eine ukrainische Mrs. World zum Weltstar<br />
zu machen, noch nicht einmal das<br />
Verrückteste hier im Hause Zahoor.<br />
Das Haus, das Zahoor vor ein paar Jahren<br />
bauen ließ, hat Kamaliya dekoriert.<br />
Sie mochte das Dubaier Hotel Burj al-<br />
Arab, also ließ sie das Haus arabisch<br />
schmücken, mit echten Goldtapeten, viel<br />
Ornament, Marmor und bunten Farben.<br />
Sie dachte, dass sich ihr Mann darin vielleicht<br />
ein bisschen heimisch fühlen könne,<br />
bis Zahoor ihr erklärte, dass er kein Araber<br />
sei, sondern Pakistaner.<br />
Jeden Morgen kommt ein Inder in<br />
einem gelben Gewand ins Haus und legt<br />
im Garten in der Nähe des Bootsanlegers<br />
zwei Yogamatten aus. Er macht dem<br />
Hausherrn dann 90 Minuten lang Yogaübungen<br />
vor, aber Zahoor telefoniert<br />
dabei die meiste Zeit oder schmust mit<br />
den Pekinesen, die beim Yoga stets dabei<br />
sind. Vom Bootsanleger in seinem Garten<br />
kann Zahoor mit seiner Yacht bis<br />
nach Venedig fahren. Leider liegt das<br />
Schiff gerade in Sewastopol, aber Zahoor<br />
will es bald durch den Bosporus ins Mittelmeer<br />
verlegen lassen. Er hat Carreras<br />
auf das Schiff eingeladen, er soll mit<br />
Kamaliya auf der Yacht an den Duetten<br />
arbeiten.<br />
Mohammad Zahoor heißt eigentlich<br />
Zahoor mit Vornamen, aber sein Nachname,<br />
sagt er, sei so unaussprechlich, dass<br />
er einfach Zahoor zum Nachnamen gemacht<br />
habe. Er hatte als junger Mann keine<br />
Vorstellung, was die Sowjetunion war,<br />
aber er wollte weg aus Pakistan. 1974 kam<br />
er in Moskau an, er war 19, es war Winter,<br />
Zahoor verstand kein Wort Russisch. Er<br />
lernte es in drei Monaten, und er lernte an<br />
einer technischen Hochschule in Donezk,<br />
wie man rohen Stahl glättet. Nach seiner<br />
Ausbildung in der Sowjetunion ging er<br />
noch einmal nach Pakistan zurück, stieg<br />
schnell auf bei einem staatlichen pakistanischen<br />
Stahlproduzenten. Doch er hatte<br />
inzwischen seine erste Frau geheiratet,<br />
eine Russin, und nachdem die So wjets<br />
Ende der Siebziger in Afghanistan einmarschiert<br />
waren, wurden die Russen<br />
auch zu den Feinden der Pakistaner. Ein<br />
Manager in einem staatlichen Betrieb, der<br />
mit einer Russin verheiratet war, das ging<br />
nicht mehr, und Zahoor musste weg.<br />
Er zog zurück in die Sowjetunion, begann<br />
selbst mit Stahl zu handeln, kaufte<br />
sein erstes Stahlwerk, man bekam die<br />
damals günstig. Bald hatte er fünf davon<br />
sowie Büros in New York und Hongkong.<br />
Er wurde britischer Staatsbürger und<br />
legte sich ein viktorianisches Haus in<br />
London zu.
Kultur<br />
Die anderen ukrainischen Oligarchen<br />
hätten ihn gewähren lassen, sagt Zahoor.<br />
„Stahl hat die nicht interessiert damals.<br />
Galt als eine sterbende Industrie, in die<br />
man erst mal viel Geld stecken musste,<br />
um zu was zu kommen. Das war kein<br />
schnelles Geld. Was meine Kollegen wollten,<br />
waren Casinos, Wodka oder Öl.“<br />
Zahoor sagt, er versuche, sich von der<br />
Oligarchengesellschaft in Kiew ein bisschen<br />
fernzuhalten, ohne auf zu offensichtliche<br />
Distanz zu gehen. Er hat seine Rolle<br />
darin gefunden, der gute Oligarch zu sein,<br />
dem ein angesehenes regierungskritisches<br />
Politikmagazin gehört und der dem Land<br />
die Ukrainian Music Awards geschenkt<br />
hat. Er sagt öffentlich, er werde sein Geld<br />
nicht außerhalb der Ukraine anlegen.<br />
Trotzdem heißt es in Kiew, es sei eigentlich<br />
nicht denkbar, dass jemand eine Milliarde<br />
macht und nicht zumindest über<br />
eine gewisse Durchsetzungskraft verfügt<br />
und sich juristisch ab und zu ambivalent<br />
verhalten hat. Auch Zahoor hat sich mit<br />
ehemaligen Geschäftspartnern überworfen,<br />
es gab Prozesse.<br />
Als es Nacht wird in Kiew, um Viertel<br />
vor zwei, legt Zahoor eine Konzert-DVD<br />
seiner Frau ein. Er hat sich eine Zigarre<br />
angezündet und setzt sich mit Kamaliya<br />
vor sein Heimkino. Er besteht darauf,<br />
dass der Gast aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> mitguckt.<br />
Man soll sich bitte jetzt noch nicht in das<br />
Gästehaus zurückziehen. Das Ehepaar<br />
geht nie vor dem Morgengrauen ins Bett,<br />
und das, obwohl Kamaliya jetzt im siebten<br />
Monat schwanger ist. Zahoor ist sich<br />
noch unschlüssig, wie die Schwangerschaft<br />
in den Karriereplan passt. Eigentlich<br />
wollten sie sie auf der Gala in einem<br />
Interview feierlich bekanntgeben, aber<br />
im letzten Moment hat Zahoor sich umentschieden.<br />
Es war dann die Aufgabe<br />
des Leibwächters Igor, die Kamerateams,<br />
die Fragen zu dem unübersehbaren Baby -<br />
bauch stellten, abzuwimmeln.<br />
Zahoor hat den Dolby-Surround-<br />
Sound voll aufgedreht. Er liegt tief im<br />
Sofa und sieht seiner Frau, die neben ihm<br />
wippt, auf dem Bildschirm verträumt<br />
beim Singen und Tanzen zu. Für die Konzert-DVD<br />
haben sie sich eine kleine<br />
Handlung ausgedacht. Kamaliya steht in<br />
den Trümmern der Kiewer Oper. Mit<br />
jedem Song, den sie singt, errichtet sich<br />
nach und nach ein n<strong>eu</strong>es Gebäude. Als<br />
Kamaliya den letzten Song beendet hat,<br />
sieht die n<strong>eu</strong>e Oper schöner und moderner<br />
aus als die alte. Für Zahoor ist das<br />
die perfekte Parabel. Er ist die Oper.<br />
Kamaliya hat auch ihn schöner und<br />
moderner gemacht. Vielleicht muss man<br />
an so etwas nur glauben. Den Rest kann<br />
man kaufen.<br />
Video:<br />
Kamaliya in Aktion<br />
spiegel.de/app332013kamaliya<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 33/2013 111
Autorin Cahalan<br />
SACHBÜCHER<br />
Irre<br />
Eine amerikanische Reporterin<br />
wird plötzlich psychotisch und<br />
nur mit Glück geheilt. In einem<br />
Buch erzählt sie von ihrer<br />
Exkursion in den Wahnsinn.<br />
Die Frau in dem Video sieht aus wie<br />
sie, wie Susannah Cahalan. Sie<br />
liegt in einem Krankenhausbett<br />
und trägt ein Krankenhausnachthemd.<br />
Ihre Stimme klingt verzweifelt und hyste -<br />
risch. „Ich bin in den Nachrichten!“, wimmert<br />
die Frau und zeigt panisch auf den<br />
Fernseher. Sie glaubt, dass draußen vor<br />
der Klinik Übertragungs wagen stehen,<br />
ein Heer von Paparazzi und Reportern,<br />
die über sie berichten. Die Frau klammert<br />
die Hände vors Gesicht, wirft sich zur<br />
Seite: Alle sind hinter ihr her.<br />
Doch es gibt keinen Übertragungs -<br />
wagen vor dem Krankenhaus, keine Paparazzi,<br />
es gibt keine Nachrichten über<br />
sie. All das existiert nur in ihrer Einbildung.<br />
Sie glaubt, die anderen machten ihr<br />
das Leben zur Hölle. Doch der T<strong>eu</strong>fel<br />
steckt in ihr. Es gibt nur dieses Video der<br />
Patientin im Bett. Die Ärzte im Krankenhaus<br />
haben die Wahnvorstellungen von<br />
Susannah Cahalan per Kamera dokumentiert.<br />
Erst nach ihrer Heilung hat sich<br />
Cahalan diese Aufnahmen immer wieder<br />
angesehen.<br />
Noch h<strong>eu</strong>te findet sie das Material gruselig.<br />
Diese Frau ist sie – und sie ist es<br />
auch nicht. Cahalan erinnert sich nicht,<br />
diese Frau dort im Video gewesen zu sein,<br />
sie erinnert sich aber an ihre Halluzina -<br />
tion. Sie nennt die Frau in dem Video ein<br />
Monster. Sie sagt „sie“, wenn sie über die<br />
Frau spricht, nicht „ich“. Sie sagt: „Das<br />
ist der elektronische Beweis für meinen<br />
Monat im Wahn.“<br />
Was sie damals erlebte, wie sie zum<br />
Monster wurde und wie sie geheilt wurde,<br />
das hat die 28-jährige Reporterin der<br />
„New York Post“, der das alles zustieß,<br />
zu einem Buch verarbeitet: „Brain on<br />
Fire – My Month of Madness“ war in den<br />
USA auf der Bestsellerliste der „New<br />
York Times“, nun erscheint es auf D<strong>eu</strong>tsch<br />
112<br />
unter dem Titel „F<strong>eu</strong>er im Kopf – Meine<br />
Zeit des Wahnsinns“*.<br />
Der T<strong>eu</strong>fel kam vor vier Jahren in ihren<br />
Körper. Er fühlte sich an wie eine<br />
Grippe. Sie spürte einen scharfen<br />
Schmerz im Kopf, ihre Beine wurden<br />
schwach. Sie konnte nicht schlafen, nichts<br />
essen. Sie schwankte zwischen Betrübtheit<br />
und Begeisterung. Ihre linke Hand<br />
fing an zu kribbeln, wurde taub, dann<br />
der linke Fuß.<br />
Ein Arzt tippte auf Pfeiffersches Drüsen -<br />
fieber. Sie wurde vergesslich, unruhig, aggressiv.<br />
Sie sah die Wände ihres Büros auf<br />
sich zukommen. Sie bekam Krampfanfälle.<br />
Ein Arzt sagte, sie feiere zu viel, typische<br />
Symptome eines Alkoholentzugs.<br />
Sie zweifelte an sich, vielleicht war alles<br />
zu viel: das Leben in Manhattan, die<br />
Arbeit beim Boulevardblatt, der n<strong>eu</strong>e<br />
Fr<strong>eu</strong>nd. Sie diagnostizierte sich selbst: bipolare<br />
Störung. Die Ärzte im Krankenhaus<br />
glaubten an eine Psychose. Sie analysierten<br />
Urin und Blut, schauten mit<br />
Magnet resonanztomografen ins Gehirn,<br />
untersuchten Nerven wasser aus dem<br />
Patientin Cahalan im Krankenhaus<br />
„Ich habe Macht“<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
MIKE MCGREGOR / CONTOUR BY GETTY IMAGES<br />
Rückenmarks kanal. Alle Tests: negativ.<br />
Sie sprach nur noch verworren, ihre<br />
Zunge verdrehte sich, sie faselte, sabberte,<br />
gab meist nur noch Silben von sich,<br />
manchmal auch nur ein Grunzen. Sie lag<br />
nur da, stumm und starr. Sie schien verloren,<br />
die Ärzte zweifelten, ob sie sie jemals<br />
retten könnten. Die Liste der Krankheiten,<br />
an denen sie nicht litt, wurde länger. Nach<br />
drei Wochen in der Klinik zeigte eine<br />
Unter suchung: Das Gehirn ist entzündet.<br />
An der New Yorker Uni-Klinik war<br />
Susannah Cahalan die erste Patientin, bei<br />
der eine spezielle Autoimmunerkrankung<br />
festgestellt wurde. Die 217. weltweit. Erst<br />
2007 ist die Krankheit entdeckt worden.<br />
Cahalan konnte geheilt werden.<br />
Cahalan hat während der Recherche<br />
über ihr Leben mit der Krankheit Hunderte<br />
Gespräche mit Ärzten, Pflegern,<br />
mit ihrer Familie und ihren Fr<strong>eu</strong>nden geführt,<br />
hat das Klinik-Notizbuch gelesen,<br />
das ihre geschiedenen Eltern führten, um<br />
sich auszutauschen. Sie hat über ihr aufgelöstes<br />
Selbst geforscht, um das aufzuarbeiten,<br />
was sie verpasst hat, zum Beispiel<br />
diesen Abend im März 2009:<br />
Mit ihrem Fr<strong>eu</strong>nd Stephen liegt sie auf<br />
der Couch, sie schauen eine Reality-Show.<br />
Cahalan versucht zu entspannen, sie hat<br />
beim Essen keinen Bissen Nudeln herunterbekommen,<br />
sie raucht eine Zigarette<br />
nach der anderen und sieht auf dem Bildschirm,<br />
wie Gwyneth Paltrow in einem<br />
dünnflüssigen Ziegenmilchjoghurt herumstochert.<br />
Plötzlich wird es dunkel.<br />
Als Stephen mir vorschlug, ich solle versuchen,<br />
mich zu entspannen, wandte ich<br />
ihm mein Gesicht zu, wobei ich wie besessen<br />
durch ihn hindurchstarrte. Plötzlich<br />
schlugen meine Arme gestreckt nach vorne<br />
aus, mein Körper versteifte sich, ich<br />
schnappte nach Luft. Mein Körper versteifte<br />
sich weiter, als ich wiederholt einatmete,<br />
ohne jedoch auszuatmen. Durch<br />
die zusammengebissenen Zähne quollen<br />
Blut und Schaum aus meinem Mund.<br />
Es ist der erste schwere Blackout, Beginn<br />
ihrer verlorenen Zeit. Cahalan hat<br />
sie recherchiert und rekonstruiert, als handelte<br />
es sich nicht um ihr Ich, sondern<br />
um eine dritte Person.<br />
Eine schwierige Recherche. Sie erinnert<br />
sich an ein orangefarbenes Bändchen<br />
mit der Aufschrift „Fluchtgefahr“,<br />
das sie um ihr Handgelenk trug. Die<br />
Schwestern und Ärzte erzählten ihr, dass<br />
es solche Bändchen nicht gibt. Während<br />
Cahalan versucht, Tatsachen von Fiktion<br />
zu unterscheiden, merkt sie, wie viel sie<br />
sich eingebildet hat. Sie entfernt sich immer<br />
mehr von dieser kranken Susannah,<br />
aber die Wahngedanken, die die kranke<br />
Susannah hatte, sind immer noch da, so<br />
als ob dieses zweite Ich ihr sagte: Ich bin<br />
gegangen, aber nicht vergessen.<br />
* Susannah Cahalan: „F<strong>eu</strong>er im Kopf – Meine Zeit des<br />
Wahnsinns“. MVG Verlag; 272 Seiten; 17,99 Euro.
Kultur<br />
Die Schilderungen ihrer Halluzina -<br />
tionen, ihrer Paranoia sind die stärksten<br />
Abschnitte im Buch:<br />
Ich muss pinkeln. Ich schnappe meinen<br />
rosa Rucksack, ziehe die Schnur heraus<br />
und gehe zur Gemeinschaftstoilette. Als<br />
ich meine schwarzen Leggins und meinen<br />
Slip bis zu den Knien hinunterschiebe,<br />
werde ich das Gefühl nicht los, beobachtet<br />
zu werden. Ich schaue nach rechts –<br />
ein großes braunes Auge starrt mich<br />
durch einen Schlitz in der Tür an. „Hau<br />
ab, verdammt noch mal!“ Ich bedecke<br />
meine Blöße, ziehe meine Hosen wieder<br />
hoch und renne zurück ins Bett, ziehe<br />
mir die Decke bis über die Augen. (…)<br />
Alle wollen mich kriegen. Ich bin hier<br />
nicht sicher.<br />
Sie glaubt, dass ihre Zimmernachbarin<br />
sie ausspioniert und Informationen an<br />
die Medien weitergibt. Sie glaubt, dass<br />
ihr Vater ein Betrüger und Entführer ist,<br />
dass er ihre Stiefmutter umgebracht hat.<br />
Sie glaubt, dass sie eine besondere<br />
Gabe hat.<br />
Ich starre auf die Wangenknochen der<br />
Ärztin und ihre hübsche olivfarbene<br />
Haut. Ich starre fester, fester und noch<br />
fester. Ihr Gesicht wirbelt vor mir herum.<br />
Strähne für Strähne ergraut ihr Haar. Falten,<br />
zuerst nur um die Augen, dann um<br />
ihren Mund und über ihre Wangen durchziehen<br />
jetzt ihr ganzes Gesicht (…) Ich<br />
habe eine Gabe. Ich kann L<strong>eu</strong>te mit meinem<br />
Geist altern lassen. Das bin ich. Das<br />
können sie mir nicht nehmen. Ich habe<br />
Macht.<br />
Vielleicht wäre Cahalan h<strong>eu</strong>te tot, zumindest<br />
aber wäre sie wohl in einer geschlossenen<br />
Anstalt, wäre nicht ein N<strong>eu</strong>rologe<br />
zu dem Fall n<strong>eu</strong> hinzugezogen<br />
worden. Als er zu ihr kommt, macht er<br />
einen simplen Test: Er bittet sie, eine Uhr<br />
auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Sie<br />
quetscht alle Zahlen auf die rechte Hälfte:<br />
Da, wo eine Sechs stehen müsste, steht<br />
die Zwölf. Das ist es. Testergebnis: positiv.<br />
Die rechte Gehirnhälfte, zuständig für<br />
das linke Gesichtsfeld, ist entzündet. „Ihr<br />
Gehirn steht in Flammen“, sagt der Doktor.<br />
„Ihr Gehirn wird von Ihrem eigenen<br />
Körper angegriffen.“<br />
Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis. Der<br />
T<strong>eu</strong>fel hat jetzt einen Namen. Wie er in<br />
ihren Körper gekommen ist, bleibt ein<br />
Rätsel: Das Immunsystem, das eigentlich<br />
schützen soll, hat die Nervenzellen im<br />
Gehirn attackiert. Wahrscheinlich war es<br />
eine genetische Veranlagung zusammen<br />
mit einem äußeren Auslöser.<br />
Sie bekommt Medikamente und fängt<br />
ein halbes Jahr später an zu arbeiten. Sie<br />
sieht sich ein erstes Mal die Videos aus<br />
dem Krankenhaus an. Sie schämt sich.<br />
H<strong>eu</strong>te hält Cahalan Vorträge in Universitäten<br />
und Krankenhäusern, immer wieder<br />
zeigt sie die Aufnahmen. Ihre Krankheit,<br />
sagt sie, sei auch ein Geschenk gewesen.<br />
SONJA HARTWIG<br />
Bestseller<br />
Belletristik<br />
1 (1) Dan Brown<br />
Inferno<br />
Lübbe; 26 Euro<br />
2 (2) Kerstin Gier<br />
Silber – Das erste Buch der Träume<br />
Fischer JB; 18,99 Euro<br />
3 (3) Timur Vermes<br />
Er ist wieder da<br />
Eichborn; 19,33 Euro<br />
4 (4) Nina George<br />
Das Lavendelzimmer<br />
Knaur; 14,99 Euro<br />
5 (5) Martin Suter<br />
Allmen und die Dahlien<br />
Diogenes; 18,90 Euro<br />
6 (15) Alex Capus<br />
Der Fälscher,<br />
die Spionin und<br />
der Bombenbauer<br />
Hanser; 19,90 Euro<br />
Ein Pazifist, eine<br />
Musikantentochter und<br />
ein Kunststudent:<br />
drei Schweizer Biografien<br />
in einem Roman<br />
7 (9) Dora Heldt<br />
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben<br />
gewonnen! dtv; 17,90 Euro<br />
8 (8) Stephen King<br />
Joyland<br />
Heyne; 19,99 Euro<br />
9 (10) John Green<br />
Das Schicksal ist ein mieser Verräter<br />
Hanser; 16,90 Euro<br />
10 (6) Donna Leon<br />
Tierische Profite<br />
Diogenes; 22,90 Euro<br />
11 (16) Suzanne Collins<br />
Die Tribute von Panem –<br />
Gefährliche Liebe Oetinger; 18,95 Euro<br />
12 (11) Eugen Ruge<br />
Cabo de Gata<br />
Rowohlt; 19,95 Euro<br />
13 (17) Hans Pleschinski<br />
Königsallee<br />
C. H. Beck; 19,95 Euro<br />
14 (14) Suzanne Collins<br />
Die Tribute von Panem –<br />
Flammender Zorn Oetinger; 18,95 Euro<br />
15 (7) Joachim Meyerhoff<br />
Wann wird es endlich wieder so,<br />
wie es nie war<br />
Kiepenh<strong>eu</strong>er & Witsch; 19,99 Euro<br />
16 (12) Anne Gesthuysen<br />
Wir sind doch Schwestern<br />
Kiepenh<strong>eu</strong>er & Witsch; 19,99 Euro<br />
17 (13) Volker Klüpfel/Michael Kobr<br />
Herzblut Droemer; 19,99 Euro<br />
18 (–) Kerstin Gier<br />
Saphirblau – Liebe geht durch<br />
alle Zeiten Arena; 16,99 Euro<br />
19 (–) Kerstin Gier<br />
Smaragdgrün – Liebe geht durch<br />
alle Zeiten Arena; 18,99 Euro<br />
20 (18) Martin Walker<br />
Femme fatale<br />
Diogenes; 22,90 Euro<br />
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom<br />
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -<br />
kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller<br />
Sachbücher<br />
1 (1) Florian Illies<br />
1913 – Der Sommer des<br />
Jahrhunderts S. Fischer; 19,99 Euro<br />
2 (4) Rolf Dobelli<br />
Die Kunst des klaren Denkens<br />
Hanser; 14,90 Euro<br />
3 (3) Meike Winnemuth<br />
Das große Los<br />
Knaus; 19,99 Euro<br />
4 (5) Hannes Jaenicke<br />
Die große Volksverarsche<br />
Gütersloher Verlagshaus; 17,99 Euro<br />
5 (2) Bronnie Ware<br />
5 Dinge, die Sterbende am meisten<br />
ber<strong>eu</strong>en Arkana; 19,99 Euro<br />
6 (6) Markus Gabriel<br />
Warum es die Welt nicht gibt<br />
Ullstein; 18 Euro<br />
7 (8) Eben Alexander<br />
Blick in die Ewigkeit<br />
Ansata; 19,99 Euro<br />
8 (7) Dieter Nuhr<br />
Das Geheimnis des perfekten Tages<br />
Bastei Lübbe; 14,99 Euro<br />
9 (10) Dirk Müller<br />
Showdown Droemer; 19,99 Euro<br />
10 (–) Ruth Maria Kubitschek<br />
Anmutig älter<br />
werden<br />
Nymphenburger;<br />
19,99 Euro<br />
Wenn Gelassenheit<br />
auf Weisheit trifft:<br />
Schönheitstipps der<br />
82-jährigen<br />
Schauspielerin<br />
11 (12) Rolf Dobelli<br />
Die Kunst des klugen Handelns<br />
Hanser; 14,90 Euro<br />
12 (9) Hans-Olaf Henkel<br />
Die Euro-Lügner<br />
Heyne; 19,99 Euro<br />
13 (–) Gerd Ruge<br />
Unterwegs – Politische Erinnerungen<br />
Hanser; 21,90 Euro<br />
14 (11) Richard David Precht<br />
Anna, die Schule und der liebe Gott<br />
Goldmann; 19,99 Euro<br />
15 (14) Guillem Balagué<br />
Pep Guardiola<br />
C. Bertelsmann; 19,99 Euro<br />
16 (17) Frank Schirrmacher<br />
Ego – Das Spiel des Lebens<br />
Blessing; 19,99 Euro<br />
17 (13) Wilhelm Schlötterer<br />
Wahn und Willkür<br />
Heyne; 19,99 Euro<br />
18 (–) Ronald Reng<br />
Spieltage<br />
Piper; 19,99 Euro<br />
19 (–) Hubert Wolf<br />
Die Nonnen von Sant’Ambrogio<br />
C. H. Beck; 24,95 Euro<br />
20 (19) Andreas Platthaus<br />
1813 – Die Völkerschlacht und<br />
das Ende der alten Welt<br />
Rowohlt Berlin; 24,95 Euro<br />
DER SPIEGEL 33/2013 113
Kultur<br />
Vom anderen Stern<br />
FILMKRITIK: „Elysium“ erzählt von der Welt im Jahr 2154 – in Wahrheit<br />
geht es um die politischen Konflikte von h<strong>eu</strong>te.<br />
Der klügste Blockbuster der Saison<br />
beginnt so stereotyp wie fast jeder<br />
Weltuntergangsfilm. Staubig geht<br />
die Sonne über den Straßen von Los Angeles<br />
im Jahr 2154 auf, Slums ziehen sich<br />
bis zum Horizont, vernachlässigte Kinder<br />
spielen zwischen Wellblechhütten. Der<br />
Ex-Kriminelle Max (gespielt von einem<br />
glatzköpfigen Matt Damon, den man vor<br />
lauter Muskeln, Narben und Tätowie -<br />
rungen kaum erkennt) steht auf, wäscht<br />
sich und macht sich auf den Weg zu seinem<br />
Job in einer Kampfroboterfabrik –<br />
schwerstens entfremdete<br />
Arbeit. An der Bushaltestelle<br />
wird er von zwei<br />
dieser Maschinen zusammengeschlagen.<br />
Über der ehemaligen<br />
Stadt der Engel klebt derweil<br />
das n<strong>eu</strong>e Paradies<br />
wie ein künstlicher Mond<br />
am Himmel. Es ist eine<br />
riesige Raumstation, so<br />
groß wie ein kleiner Erdtrabant.<br />
Hierhin haben<br />
sich die Superreichen geflüchtet,<br />
um das schöne<br />
Leben zu leben. Sie brauchen<br />
die Roboter, um ihren<br />
Wohlstand zu schützen<br />
und ihre Hecken zu<br />
trimmen.<br />
Man ahnt, wie es ausgehen<br />
wird.<br />
Tatsächlich ist es nicht<br />
der Plot, der „Elysium“,<br />
das n<strong>eu</strong>e Werk des südafrikanischen<br />
Hollywood-Regiss<strong>eu</strong>rs und<br />
Drehbuchautors Neill Blomkamp, 33, zu<br />
einem so großartigen und überraschenden<br />
Film über das Auseinanderdriften von<br />
Arm und Reich macht. Es sind seine Ideen.<br />
Natürlich beherrscht Blomkamp die<br />
Konventionen des Actionkinos. Auch bei<br />
ihm kommt die Energie aus der Bewegung,<br />
dem Ballett der fliegenden Körper, den<br />
Verfolgungsjagden und Schießereien, der<br />
kinetischen Kraft der rasenden Kamerafahrt.<br />
Seine Kunst geht aber darüber hin -<br />
aus. Kaum ein anderer webt derzeit mit<br />
ähnlicher Lässigkeit politische Ideen in das<br />
Genre-Gerüst wie Blomkamp.<br />
Das war schon in seinem gefeierten<br />
„District 9“ von 2009 so. Es war ein Film,<br />
in dem Außerirdische auf die Erde kom-<br />
Kinostart: 15. August.<br />
114<br />
men und in Lagern landen. Blomkamp<br />
nutzte das Alien-Genre, um von den<br />
Mechanismen der Apartheid zu erzählen.<br />
Und so geht er auch in „Elysium“ vor.<br />
Nur in Groß.<br />
Der Film hat viele Themen: die Tragödie<br />
von Wirtschaftsflüchtlingen, die ihrem<br />
Traum von einem besseren Leben<br />
folgen und an den Grenzanlagen sterben,<br />
die Privatisierung der Sicherheit und das<br />
weltweite Söldnerunwesen, das den<br />
Wohlstand der Reichen sichert. Der Film<br />
erzählt von Gated Communities, die sich<br />
„Elysium“-Star Damon: Von Robotern zusammengeschlagen<br />
als Wohlstandsinseln vom Rest der Städte<br />
abspalten. Vom Drohnenkrieg und der<br />
Angst, sich vor dem allmächtigen Auge<br />
der Macht nicht mehr verstecken zu<br />
können. „Elysium“ thematisiert die profi -<br />
table Verbindung von Privatfirmen und<br />
militärischen Geheimdiensten und die<br />
Ungerechtigkeit eines Gesundheitssystems,<br />
das viele Leben retten könnte, diesen<br />
Service aber nur denen erlaubt, die<br />
ihn sich leisten können.<br />
Die ganz großen politischen Probleme<br />
unserer Tage also. Und all das, ohne dass<br />
eine Person je mehr als einen zusammenhängenden<br />
Satz sagt.<br />
Das funktioniert, weil Blomkamps Bildsprache<br />
subversiven Witz hat. Elysium,<br />
diese rotierende Raumstation, die die<br />
Slumbewohner ständig daran erinnert,<br />
dass ein anderes Leben möglich ist und<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
sie davon ausgeschlossen sind, sieht aus,<br />
als hätte man aus Miami Beach eine<br />
ganze Welt gebaut, für N<strong>eu</strong>reiche und<br />
Oligarchen: weiße Fake-Toskana-Villen<br />
mit riesigen Terrassen für Cocktailpartys.<br />
Der Raumgleiter eines menschenverachtenden<br />
Managers, den Max und seine<br />
Kumpane in einer Szene zum Absturz<br />
bringen, ist von Bugatti (von der echten<br />
Bugatti-Designabteilung entworfen, da<br />
wird an Zukunftsmärkte gedacht).<br />
Als kurz darauf eine Söldnergruppe<br />
Max und seine L<strong>eu</strong>te aufspürt und aus<br />
einem Raumschiff auf sie<br />
f<strong>eu</strong>ert, erinnern die Bilder<br />
der Fliehenden im<br />
Display des Schützen<br />
stark an die Aufnahmen<br />
der U. S. Army aus dem<br />
Irak, die der Whistle -<br />
blower Bradley Manning<br />
der Enthüllungsplattform<br />
SONY PICTURES<br />
WikiLeaks zugespielt<br />
hat te. Sie zeigten irakische<br />
Zivilisten, die aus<br />
einem Kampfhubschrauber<br />
heraus beschossen<br />
wurden.<br />
Nur eines ist in die -<br />
sem ansonsten erstaunlich<br />
klarsichtigen Film<br />
grundlegend falsch – wie<br />
überhaupt im amerika -<br />
nischen Actionkino der<br />
vergangenen Jahre. Hollywood<br />
überschätzt die<br />
Macht des Computer -<br />
codes.<br />
Die alte Herrschaft in Elysium fällt, als<br />
die Rebellen die Software des Paradieses<br />
in die Finger bekommen.<br />
Aber so funktioniert das Soziale nicht,<br />
und auch keine Revolution. Niemand gibt<br />
seine Privilegien auf, bloß weil jemand einen<br />
Code umschreibt. Die Gesellschaft ist<br />
kein Programm, das sich hacken und dann<br />
von „Böse“ in „Gut“ umschalten lässt –<br />
auch wenn es ein gutes Filmende ergibt.<br />
Aber vielleicht ist das auch etwas viel<br />
verlangt von einem Actionfilm, der immer<br />
noch mehr politische Phantasie hat<br />
als ein paar Jahrgänge des <strong>eu</strong>ropäischen<br />
Autorenfilms zusammen. TOBIAS RAPP<br />
Video: Ausschnitte<br />
aus „Elysium“<br />
spiegel.de/app332013elysium<br />
oder in der App DER SPIEGEL
Prisma<br />
MEDIZIN<br />
Mückenspucke<br />
gegen Malaria<br />
Gibt es bald eine Impfung gegen Malaria?<br />
Diese Hoffnung scheint ein Artikel<br />
in der Zeitschrift „Science“ zu nähren:<br />
Zuerst machten die Forscher<br />
den Malaria-Erreger, einen Einzeller<br />
der Gattung Plasmodium, mit Gammastrahlen<br />
vermehrungsunfähig. Dann<br />
spritzten sie ihn ins Blut von sechs<br />
Testpersonen, die daraufhin tatsächlich<br />
gegen die Krankheit geschützt waren.<br />
Nach fünfmaliger Gabe waren<br />
die Probanden immun: Testweise verabreichten<br />
Malaria-Erregern gelang es<br />
nun nicht mehr, sich einzunisten und<br />
die roten Blutkörperchen anzugreifen,<br />
ellen: Roll Back Malaria<br />
rtnership, WHO<br />
219<br />
Millionen<br />
Malaria-Fälle<br />
660 000<br />
Malaria-Tote<br />
2010, geschätzt<br />
Verbreitung<br />
von Malaria<br />
um 1850<br />
bis 1946<br />
1967<br />
2010<br />
Plasmodium (Mikroskopaufnahme)<br />
CNRI / SPL / AGENTUR FOCUS<br />
was sonst zu Schüttelfrost und Fieber<br />
führt. Die Arbeit zeige erstmals, dass<br />
„durch die Injektion eines Impfstoffs<br />
Malaria im Prinzip verhindert werden<br />
kann“, sagt Rolf Horstmann, 63, Leiter<br />
des Bernhard-Nocht-Instituts für<br />
Tropenmedizin in Hamburg. Doch ein<br />
praxistauglicher Impfstoff gegen das<br />
Leiden, das jedes Jahr rund 660 000<br />
Menschen dahinrafft, sei dies nicht.<br />
Der Impfstoff sei bislang nur gegen<br />
eine Sorte Plasmodium getestet worden<br />
– in der Natur dagegen gibt es viele<br />
Varianten. Überdies benötigt man<br />
für eine einzige Impfspritze rund<br />
135000 bestrahlte Erreger. Und die<br />
müssen bisher mühselig per Hand gewonnen<br />
werden: aus den winzigen<br />
Speicheldrüsen der Anopheles-Stechmücken,<br />
in denen sie leben.<br />
CHEMIE<br />
Billiger Wassertest<br />
Ist da Koffein drin? Das soll sich nun<br />
einfach und schnell messen lassen: mit<br />
einer Koffein-Ampel. Schon lange gibt<br />
es verschiedene Verfahren zur Koffein-<br />
Messung, doch die sind meist t<strong>eu</strong>er,<br />
kompliziert oder beruhen auf der Verwendung<br />
toxischer Substanzen. Die<br />
n<strong>eu</strong>e Methode, für die eine Gruppe um<br />
den Chemiker Young-Tae Chang von<br />
der Universität Singapur Patente angemeldet<br />
hat, beruht auf einem ungiftigen<br />
Molekül namens Caffeine Orange.<br />
Wenn es einer koffeinhaltigen Flüssigkeit<br />
beigemischt und unter einen grünen<br />
Laser gehalten wird, l<strong>eu</strong>chtet es<br />
orange auf; ohne Koffein l<strong>eu</strong>chtet es<br />
grün. Diese schnelle, billige Methode<br />
soll weniger dazu dienen, die Koffein-<br />
Freiheit von Cappuccini oder die Dosis<br />
in n<strong>eu</strong>en Wachmacher-Drinks zu testen.<br />
Vielmehr ließe sich so die Wasserqualität<br />
überwachen. Denn wenn sich<br />
Koffein in einem Fluss findet, ist das<br />
oft ein Indiz dafür, dass ungeklärtes<br />
Schmutzwasser eingeleitet wurde: Urin<br />
von Kaffeetrinkern.<br />
116<br />
NASA<br />
ASTRONOMIE<br />
Stürmisches Weltraumwetter<br />
Alle elf Jahre tut sich Großes auf der<br />
Sonne: Das Magnetfeld des Sterns<br />
dreht sich zwischen Nord- und Südpol<br />
einmal um, auch „magnetic flip“ genannt.<br />
„Anscheinend sind wir nur<br />
noch drei bis vier Monate vom kompletten<br />
Umkippen des Magnetfelds<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Sonne mit Plasma-<br />
Eruptionen<br />
entfernt“, sagt der<br />
Sonnenphysiker<br />
Todd Hoeksema von<br />
der kalifornischen<br />
Stanford University.<br />
„Das wird Auswirkungen<br />
im ganzen<br />
Sonnensystem haben.“<br />
Die Umpolung<br />
in der Mitte eines<br />
Sonnenzyklus wird<br />
begleitet von intensiver<br />
Sonnenaktivität<br />
und stürmischem<br />
Weltraumwetter –<br />
und das kann sogar<br />
Auswirkungen auf<br />
Erdlinge haben. Heftige<br />
Partikelströme<br />
treffen während des<br />
sogenannten solaren<br />
Maximums auf die oberen Schichten<br />
der Erdatmosphäre, möglicherweise<br />
werden dadurch sogar einzelne Satelliten<br />
gestört. Vor allem aber: Die prächtig-bunten<br />
Polarlichter könnten in<br />
diesem Winter auf der Erde besonders<br />
intensiv l<strong>eu</strong>chten.
Wissenschaft · Technik<br />
CATERS NEWS AGENCY<br />
Der italienische Fotograf Roberto Guidici traute seinen<br />
Augen nicht, als er von der Yacht zur griechischen Insel<br />
Orthoni blickte. Wer eine einzige Wasserhose sieht, kann sich<br />
schon beglückwünschen – aber gleich vier davon? Wasser -<br />
hosen sind kleine Verwandte der Tornados. Wenn das Meer<br />
wärmer ist als die Luft und Gewitterwolken darüberziehen,<br />
können sich Tiefdruckrüssel gen Himmel schrauben. Das Bild<br />
entstand 1999; nun wurde es bei der Nasa wiederentdeckt.<br />
BIOLOGIE<br />
Wehrlose Bienen<br />
Seit Jahren geht in Europa und Nordamerika<br />
ein geheimnisvolles Bienensterben<br />
um, in einigen Regionen rafft<br />
es rund 90 Prozent der Völker dahin.<br />
Oft sind die Tiere unfähig, sich gegen<br />
Infektionen zur Wehr zu setzen, die<br />
durch Varroa-Milben verbreitet werden.<br />
Ein Risikofaktor liegt möglicherweise<br />
in ihrem eigenen Immunsystem.<br />
Bei der Untersuchung dieses Problems<br />
stieß eine Forschergruppe auf eine<br />
Überraschung: „Je nach Stadium haben<br />
die Bienen eines Volkes extrem<br />
unterschiedliche Immunsysteme“, sagt<br />
Jürgen Tautz, Bienenforscher an der<br />
Bienenpuppen mit Varroa-Milben<br />
HELGA R. HEILMANN<br />
Universität Würzburg. Die Ergebnisse,<br />
die im Wissenschaftsjournal „Plos<br />
One“ veröffentlicht worden sind, belegen<br />
unterschiedliche Abwehrreaktionen<br />
bei den Sommerbienen, die nicht<br />
mehr als sechs Wochen leben, und<br />
den Winterbienen, die bis zu n<strong>eu</strong>n<br />
Monate überdauern. Der erstaunlichste<br />
Fund: Die Puppen von Arbeiterinnen<br />
und Drohnen sind selbst harmlosen<br />
Erregern wie Kolibakterien<br />
schutzlos ausgeliefert. Normalerweise<br />
sind die Puppen in ihren verdeckelten<br />
Brutwaben gut geschützt vor Erregern.<br />
Möglicher weise wäre daher ein<br />
Immunsystem reine „Energieverschwendung“,<br />
spekulieren die Autoren.<br />
Dieser Energiesparmodus<br />
allerdings erweist sich angesichts des<br />
Varroa-Befalls nun als fatal.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
117
Titel<br />
Kampfauftrag Kind<br />
Aus Angst, der Nachwuchs könnte im Leben scheitern, überwachen<br />
Eltern ihre Kinder. Aus nächster Nähe kontrollieren sie,<br />
natürlich voller Liebe, Schullaufbahn, Studium und Karriere. Ob aus den<br />
behüteten Geschöpfen glückliche Erwachsene werden, ist fraglich.<br />
ILLUSTRATIONEN: ANDREAS KLAMMT<br />
Seit ein paar Jahren unterteilt<br />
der Gymnasial -<br />
direktor Josef Kraus, 64,<br />
seine Arbeitstage in zwei Hälften.<br />
Die erste, die Schülerhälfte,<br />
beginnt mit dem ersten Schulgong,<br />
in der Regel verläuft sie<br />
problemlos. Was Kraus neben<br />
seiner normalen Arbeit vormittags<br />
über den Weg läuft, ist<br />
meist nicht der Rede wert: Mal<br />
raufen zwei Jungs auf dem<br />
Gang, mal nimmt ein Lehrer<br />
einem Schüler im Unterricht<br />
das Handy ab. Aber das war’s<br />
dann auch schon.<br />
Die zweite, die Elternhälfte,<br />
beginnt gegen 14.15 Uhr, mit<br />
dem Telefonläuten im Sekretariat.<br />
Dann sind Mama oder<br />
Papa am Apparat. Sie b<strong>eu</strong>rteilen<br />
das, was am Vormittag geschehen<br />
ist, meist anders als<br />
Josef Kraus. Das Raufen? War<br />
eine Körperverletzung. Das<br />
Abnehmen des Handys im Unterricht?<br />
Diebstahl.<br />
Diebstahl? Klar, was sonst.<br />
Josef Kraus ist seit über 30<br />
Jahren im Schuldienst, als Lehrer,<br />
als Psychologe und seit 18<br />
Jahren als Direktor. Kraus ist außerdem<br />
Präsident des D<strong>eu</strong>tschen Lehrerverbands,<br />
er spricht für rund 160 000 Pädagogen in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>. Seine Lehrer kennen die<br />
Beschwerden der Eltern. Man kann klagen<br />
über die Sitzordnung in der Klasse,<br />
die Zahl der Englischvokabeln, das Gewicht<br />
des Schulranzens, das Fehlen eines<br />
Salatblatts auf dem in der Pause gekauften<br />
Wurstbrötchen und, natürlich, den<br />
Klassiker: unfaire Noten.<br />
Gibt es irgendetwas, worüber sich Eltern<br />
nicht beschweren?<br />
„Sicher“, sagt Kraus, „die eigenen Kinder.“<br />
Stimmt. Die sind ja heilig.<br />
Über dieses Schimpfen, Drohen, Meckern<br />
im Dienste der Kinder will Josef<br />
Kraus endlich sprechen. Kraus sieht, dass<br />
die Eltern in den vergangenen Jahren<br />
Wie können Eltern erkennen, wann sie<br />
mit ihrer Fürsorge übertreiben?<br />
massiv aufgerüstet haben im Kampf um<br />
Vorteile für ihren Nachwuchs. Aber er<br />
befürchtet, dass das für die Kinder nicht<br />
von Vorteil ist.<br />
Er hat ein Buch geschrieben, es heißt:<br />
„Helikopter-Eltern“*.<br />
Der Ausdruck kommt aus dem Amerikanischen<br />
und bezeichnet Eltern, die vor<br />
lauter Sorge wie Hubschrauber ständig<br />
um ihre Kinder kreisen. „Ich bin schon so<br />
weit“, sagt Kraus, „ich kann verschiedene<br />
Typen identifizieren.“ Mit der rechten<br />
Hand neben dem Kopf simuliert er Flugbewegungen:<br />
„Ich kenne die Transport-,<br />
Kampf- und Rettungshubschrauber.“<br />
* Josef Kraus: „Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn<br />
und Verwöhnung“. Rowohlt Verlag, Reinbek; 224<br />
Seiten; 18,95 Euro.<br />
Diese Helikopter-Eltern<br />
sind ein eigenartiges Phä -<br />
nomen. Einerseits kann man<br />
sich herrlich lustig machen<br />
über sie.<br />
Über die Mutter in Paris<br />
zum Beispiel, die vor kurzem<br />
in knapp über der Pofalte abschließender<br />
Hose und stark<br />
geschminkt versuchte, für ihre<br />
Tochter eine Englischprüfung<br />
im Baccalauréat zu schreiben.<br />
Erst bei der Ausweiskontrolle<br />
flog sie auf: Sie war nicht 19,<br />
sondern 52. Der Direktor rief<br />
die Polizei.<br />
Oder über die Eltern in Colorado<br />
Springs, die vor einer<br />
Weile bei der Ostereiersuche<br />
in einem Park in den Büschen<br />
herumsprangen, um sicherzustellen,<br />
dass der eigene Nachwuchs<br />
genügend Süßes ab -<br />
bekomme. Die Suche musste<br />
abgebrochen werden.<br />
Dann gibt es auch die d<strong>eu</strong>tsche<br />
Helikopter-Mama, die<br />
das Baby und dann Kleinkind<br />
über Jahre hinweg abends<br />
nicht einmal ihrem Mann anvertraut<br />
(„Dann weint die<br />
Kleine so, weil sie ihn nicht so<br />
gut kennt wie mich“), die schluchzend<br />
den Mann als Wächter hinterherschickt,<br />
wenn der achtjährige Sohn beim Verwandtenbesuch<br />
in der fremden Stadt mit<br />
seinem Vetter zum Bäcker losgezogen ist.<br />
Auch wenn der Laden in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft liegt – das Kind könnte ja<br />
überfahren oder von Pädophilen entführt<br />
werden.<br />
Andererseits: Sind wir nicht alle irgendwie<br />
auch Helikopter-Eltern?<br />
Wann hat man sich getraut, das eigene<br />
Kind allein in die Schule zu schicken?<br />
Wann ihm das erste Mal ein Obstmesser<br />
in die Hand gedrückt? Und telefoniert<br />
man nicht doch immer wieder hinterher,<br />
wenn der Teenager beim besten Fr<strong>eu</strong>nd<br />
übernachtet? Warum nicht gleich mit dem<br />
Direktor sprechen, wenn klar ist, dass der<br />
DER SPIEGEL 33/2013 119
Mathelehrer die Tochter auf<br />
dem Kieker hat?<br />
In der Elternbrust schlagen<br />
zwei Herzen. Das eine befiehlt:<br />
Locker bleiben! Das<br />
andere, sofort zum Telefon<br />
zu rennen.<br />
Aber was ist für die Kinder<br />
gut? Und vor allem: Wie viel<br />
davon?<br />
Bei den Kindern machen<br />
sich Mama und Papa jedenfalls<br />
nicht unbeliebt: Eltern<br />
und Kinder in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
kamen wohl noch nie so gut<br />
miteinander aus wie h<strong>eu</strong>te.<br />
In der Shell-Jugendstudie<br />
von 2010 gaben drei Viertel<br />
der Jugendlichen an, ihren<br />
Nachwuchs einmal so erziehen<br />
zu wollen, wie sie es von<br />
ihren eigenen Eltern kennen.<br />
Ein größeres Lob für Mutter<br />
und Vater geht nicht.<br />
Doch sind die Eltern für<br />
dieses Lob womöglich ein<br />
bisschen zu weit gegangen?<br />
Schaden sie den Kindern?<br />
Im Jahr 2010 lebte über die<br />
Hälfte der jungen Frauen von<br />
18 bis 24 Jahren noch bei<br />
Mama und Papa. Bei den<br />
jungen Männern waren es<br />
mehr als 70 Prozent. Der<br />
Nesthocker wird zum Massenphänomen.<br />
Das hat viele<br />
Gründe: Die Ausbildung dauert länger,<br />
die Mieten sind gestiegen, der Weg in den<br />
Beruf beginnt später. Aber auch: Daheim<br />
ist alles so angenehm.<br />
Und, ist das jetzt schlimm? Nein. Nicht<br />
an sich. Die Frage ist, wie es weitergeht<br />
im Leben so wohlbehüteter Geschöpfe.<br />
Die Frage ist: Werden die Kinder h<strong>eu</strong>te<br />
noch erwachsen?<br />
Die Psychologieprofessorin Inge Seiffge-Krenke<br />
von der Universität Mainz<br />
warnt davor, dass Eltern h<strong>eu</strong>te die Autonomie<br />
ihrer Kinder zu sehr blockieren.<br />
„Man hat in Studien an Eltern junger Erwachsener<br />
gefunden, dass Vater und Mutter<br />
regelrecht Trennungsangst erleben.“<br />
Durch Manipulationen, zu viel Unterstützung<br />
und psychischen Druck versuchten<br />
sie, das erwachsene Kind weiterhin stark<br />
ans Elternhaus zu binden.<br />
In der Wirtschaft wird regelmäßig bemängelt,<br />
dass viele Schulabgänger kaum<br />
den Anforderungen einer Berufsausbildung<br />
gewachsen sind. Das D<strong>eu</strong>tsche Studentenwerk<br />
bietet Hilfe für Studenten,<br />
die Schwierigkeiten haben, sich von ihren<br />
Eltern abzunabeln.<br />
Es ist ein soziales Experiment riesigen<br />
Ausmaßes: Was wird aus einer Gene -<br />
ration von Kindern, denen die eigenen<br />
Eltern so viel Förderung und Rückhalt<br />
geben wie möglich? Und die dabei<br />
womöglich versäumen, sie fit fürs Leben<br />
120<br />
„Die Mutter geht ans Telefon. Sie sagt: ,Das<br />
stimmt nicht. Mein Sohn raucht nicht.‘“<br />
zu machen? Wie können Eltern erkennen,<br />
wann sie mit ihrer Fürsorge übertreiben?<br />
Und wann ihre Sorgen berech -<br />
tigt sind?<br />
Ein Hamburger Gymnasium, es liegt<br />
in einem wohlhabenden Viertel, die Eltern<br />
der Schüler sind in der Mehrzahl<br />
Akademiker. Ein Lehrer schildert folgende<br />
Situation: „Ich erwische einen 14-Jährigen<br />
beim Rauchen auf dem Schulgelände.<br />
Ich weiß, der Junge raucht regelmäßig,<br />
ich rieche es jeden Morgen. Der Junge<br />
darf es nicht, schon gar nicht in der Schule.<br />
Ich rufe die Eltern an.<br />
Die Mutter geht ans Telefon. Sie sagt:<br />
,Das stimmt nicht. Mein Sohn raucht<br />
nicht.‘<br />
Ich sage: ,Doch. Das ist leider so.‘<br />
Die Mutter sagt: ,Das müssen Sie mir<br />
erst einmal beweisen.‘ Das Gespräch ist<br />
damit beendet.“<br />
Der Lehrer ist jetzt angehalten, seine<br />
Beobachtungen zu dokumentieren, er<br />
wird für die Eltern einen Bericht schreiben<br />
müssen. Am Ende wird bei ihnen das<br />
Gefühl bleiben: Der Lehrer übertreibt,<br />
der rauchende Sohn ist das Opfer seiner<br />
Nachstellungen. Eine Strafe, das ist dem<br />
Pädagogen schnell klar, hat das Kind<br />
nicht zu erwarten.<br />
Man fragt sich, warum sagt die Mutter<br />
nicht einfach: „Danke für den Hinweis“?<br />
Und: „Ich kümmere mich drum“?<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Mittagszeit in Niederbayern,<br />
die Sekretärin hat Pause,<br />
also muss Schulleiter Kraus<br />
übernehmen. Ein zartes<br />
Klopfen. Vor der Tür stehen<br />
zwei 12-Jährige, sie wollen<br />
eine DVD ausleihen. Sie sagen:<br />
„Bitte, Herr Kraus.“<br />
Und: „Mei, toll, danke.“<br />
Kraus zieht mit dem Schlüssel<br />
los: „Ja, ja, des mach ma<br />
gleich.“<br />
Mitte der n<strong>eu</strong>nziger Jahre<br />
saß Josef Kraus im Wahlkampfteam<br />
von CDU-Mann<br />
Manfred Kanther in Hessen.<br />
Er sollte Kultusminister werden,<br />
aber Kanther scheiterte<br />
bei der Wahl. Linke Zeitungen<br />
nannten Kraus damals<br />
die „Gefahr aus dem Süden“.<br />
Kraus lacht darüber. Die<br />
schlimmste Strafe, erzählt er,<br />
die er in drei Jahrzehnten<br />
Schuldienst verhängt habe,<br />
waren ein paar Tage Unterrichtsausschluss.<br />
Kraus hält<br />
sich nicht für sonderlich gefährlich.<br />
Er sagt, er wolle Eltern mit<br />
seinem Buch nicht an den<br />
Pranger stellen. Die meisten<br />
hätten sehr bodenständige<br />
Vorstellungen von Erziehung.<br />
„Siebzig, achtzig Prozent<br />
handeln mit Sinn und<br />
Verstand“, sagt er. Doch links und rechts<br />
dieser Normalität machten sich zwei Extreme<br />
breit: die, die ihre Kinder vernachlässigten<br />
– und die, die ihre Kinder mit<br />
zu viel Fürsorge überschütteten.<br />
„Auf diese beiden Extreme wenden die<br />
Kindergärten und die Schulen schon h<strong>eu</strong>te<br />
den Großteil ihrer Energie auf“, sagt<br />
Kraus. Und er sieht, dass die überbesorgten,<br />
die, wie er sie nennt, „hyperaktiven<br />
Eltern“ noch weiter auf dem Vormarsch<br />
sind.<br />
In seinem Direktorat säßen Eltern, die<br />
sagten: „Da haben wir mal wieder eine<br />
Fünf geschrieben, obwohl wir doch so<br />
viel gelernt haben.“ Mütter und Väter,<br />
die bis zur Unkenntlichkeit verschmelzen<br />
mit den Siegen und Niederlagen ihres<br />
Nachwuchses. Die unzählige Ratgeber lesen,<br />
in jeder Sprechstunde sind, die Lehrer<br />
zu Hause anrufen, sich mit dem Busfahrer,<br />
der das Kind mal kritisch beäugt<br />
hat, anlegen. Die im Grunde aber, so<br />
übersetzt es Kraus, ihren Kindern nichts<br />
zutrauen.<br />
Das ist das Hauptproblem.<br />
Zum Beispiel der Schulweg: 2012 machte<br />
sich laut Forsa-Umfrage nur jeder zweite<br />
d<strong>eu</strong>tsche Grundschüler allein auf den<br />
Schulweg. 1970 waren es noch 91 Prozent.<br />
Kraus sagt: „Kaum ein Kind kommt hier<br />
allein an. Bei Regen würden die Eltern<br />
am liebsten mit dem Auto bis in die Aula
fahren.“ Inzwischen gibt es Initiativen an<br />
Grundschulen wie „Zu Fuß ist cool“, mit<br />
denen Kinder, aber vor allem deren Erziehungsberechtigte<br />
angeregt werden sollen,<br />
mal darüber nachzudenken, warum<br />
500 Meter Schulweg, bitte schön, so gefährlich<br />
oder mühselig sein können, dass<br />
sie besser mit dem Range Rover zurückgelegt<br />
werden müssen.<br />
Zum Beispiel die Hausaufgaben: In einer<br />
Emnid-Umfrage von 2012 gaben 77<br />
Prozent der befragten Eltern an, sie würden<br />
gezielt vor Klassenarbeiten und Referaten<br />
helfen. Allensbach erhob 2011,<br />
dass 27 Prozent der Eltern der Meinung<br />
sind, in der Schule werde h<strong>eu</strong>te so viel<br />
verlangt, dass man die Kinder zusätzlich<br />
fördern müsse. Kraus sagt: „Die Mütter<br />
sitzen Tag für Tag neben ihren Kindern<br />
und kontrollieren die Hausaufgaben. Dabei<br />
sollten die selbständig erledigt werden.<br />
Das Kind muss auch mal mit einer<br />
falschen Hausaufgabe in die Schule kommen.“<br />
Sonst könne der Lehrer nicht einschätzen,<br />
wie gut der Stoff verstanden<br />
wurde.<br />
Titel<br />
Fragt man Eltern, was sie sich in ihrer<br />
Erziehung für ihre Kinder wünschen,<br />
dann sagen die meisten: dass sie selbständig<br />
werden, sich durchsetzen können. Lernen,<br />
sich eine eigene Meinung zu bilden.<br />
Für Kraus gehen diese Wünsche nicht mit<br />
dem Handeln der Helikopter-Eltern zusammen.<br />
Wie soll ein Kind, dessen Mutter bei<br />
jeder Rangelei die Schule anruft, lernen,<br />
sich durchzusetzen?<br />
Um Selbstvertrauen zu entwickeln,<br />
brauche es ein realistisch begründetes<br />
Selbstbewusstsein. „Es muss gelernt haben,<br />
mit Frustrationen umzugehen.“<br />
Die Entwicklungspsychologin Inge<br />
Seiffge-Krenke erforscht seit Jahren, wie<br />
sich die Beziehung von Kindern und ihren<br />
Eltern verändert. Will sie aber ein<br />
schnelles, eindrückliches Beispiel geben,<br />
wohin der Trend in den vergangenen Jahren<br />
geht, dann nennt sie zwei Namen:<br />
Angelina Jolie und Heidi Klum. Mütter,<br />
die ihr Muttersein ausstellen, als gäbe es<br />
einen Preis dafür, oder beweisen, dass es<br />
zumindest die Figur nicht ruiniert.<br />
„Kinder sind nicht mehr wichtig für<br />
die Altersvorsorge“, sagt Seiffge-Krenke.<br />
„Man bekommt sie freiwillig, und sie sind<br />
wichtig für den Selbstwert der Eltern geworden.“<br />
Das habe eine narzisstische<br />
Komponente angenommen. Die Eltern<br />
schmückten sich mit ihren Kindern, sie<br />
seien zum Faktor in der Repräsentation<br />
der Familie nach außen geworden. „Früher<br />
haben die Kinder in Haus und Hof<br />
geholfen, h<strong>eu</strong>te machen sie Ballett, Klavier,<br />
sollen viel lernen für gute Noten.“<br />
2006 befragten Seiffge-Krenke und ihre<br />
Kollegen in einer Studie 15 000 Kinder<br />
aus 25 Ländern. Die größte Not der Kinder:<br />
„Meine Eltern wollen gute Noten<br />
und machen deswegen Druck.“ Zum Teil<br />
seien das berechtigte Sorgen der Eltern<br />
in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit,<br />
gibt die Forscherin zu. Aber dahinter<br />
stecke auch pures Statusdenken: „Man<br />
möchte sich mit seinen klugen und tüchtigen<br />
Kindern schmücken.“<br />
Die 23-jährige Olivia Marschall studiert<br />
an der Universität Freiburg Geografie,<br />
Englisch und Italienisch auf Lehramt. Seit<br />
Man kann klagen über die Sitzordnung in der Klasse, die Zahl der Englischvokabeln,<br />
das Gewicht des Schulranzens und, natürlich, den Klassiker: unfaire Noten.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 121
122<br />
Titel<br />
drei Jahren jobbt sie in der Telefon-Hotline<br />
der Uni, erklärt den Anrufern Bewerbungsfristen,<br />
Fach- und Uni-Wechsel.<br />
Als sie begann, sagt Marschall, hätten<br />
sich hin und wieder auch mal Eltern gemeldet.<br />
Doch in diesem Jahr sei bei jedem<br />
zweiten Telefonat eine Mutter oder<br />
ein Vater am Apparat gewesen. Meist<br />
wüssten die Eltern über die Studiengänge<br />
bestens Bescheid. Ihre Fragen sind anderer<br />
Natur.<br />
Es sind Kontrollanrufe. „Sie wollen<br />
wissen, ob die Bewerbungsfrist, die ihr<br />
Kind ihnen genannt hat, auch stimmt“,<br />
sagt Marschall. Mitunter bekommt sie<br />
mit, dass die Familie wegen des Studienplatzes<br />
des Kindes beschlossen hat, mit<br />
in die Stadt zu ziehen. „Ich finde es gut,<br />
wenn die Eltern einen in der Ausbildung<br />
unterstützen“, sagt sie. „Aber man sollte<br />
sein Studium schon auch selbst organisieren.“<br />
Jeden Herbst begrüßt die Universität<br />
Freiburg ihre Erstsemester und deren Eltern<br />
mit einer kleinen Feier, dem „Erstsemestertag“.<br />
Universitätssprecher Rudolf-Werner<br />
Dreier hatte die Veranstaltung<br />
1997 initiiert. Seine Kollegen lachten<br />
damals über den Vorschlag. Welcher Student<br />
würde schon freiwillig seine Eltern<br />
an die Uni mitbringen? „Schultüten-Tag“<br />
nannten sie Dreiers Idee. Doch schon<br />
„Wir sehen den Erstsemestertag als eine Übergabeveranstaltung.<br />
Aber danach sollten die Eltern bitte auch loslassen.“<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
beim ersten Mal zählte man über 400<br />
Gäste.<br />
15 Jahre später musste der Brandschutzbeauftragte<br />
einschreiten. Nachdem<br />
2011 bereits 4300 Eltern und Studenten<br />
gekommen waren, verlegte die Uni den<br />
Erstsemestertag ins Stadion an der Dreisam,<br />
sonst Heimat des Fußball-Bundes -<br />
ligisten SC Freiburg. Die Gäste füllten<br />
die Osttribüne.<br />
„Die Eltern unserer Studierenden sind<br />
für uns eine feste Zielgruppe geworden“,<br />
sagt Dreier. Sie bestimmten maßgeblich<br />
mit, wo und was ihre Kinder studieren.<br />
Über Alumni-Netzwerke versucht Dreier<br />
außerdem, die Ehemaligen, die eines Tages<br />
als Eltern ihre Kinder zum<br />
Studium entlassen, mit ihrer<br />
Alma Mater in Verbindung zu<br />
halten. Die Verbindung hält. Die<br />
Eltern kommen.<br />
„Wir sehen diesen Tag als eine<br />
Übergabeveranstaltung, einen<br />
Initiationsritus. Aber danach<br />
sollten die Eltern bitte auch loslassen“,<br />
sagt Dreier.<br />
Die Uni biete ihren Studenten<br />
viel: Beratung, soziale Betr<strong>eu</strong>ung,<br />
man kann Studienfächer im<br />
Internet testen. „Wir machen<br />
fast alles“, sagt Dreier, „aber<br />
Windeln wechseln wir nicht.“<br />
Nehme die Uni die Kinder weiterhin<br />
an die Hand und ließen<br />
die Eltern auf der anderen Seite<br />
nicht los, bleibe den jungen Erwachsenen<br />
zu wenig Freiraum,<br />
um ihre eigene Persönlichkeit zu<br />
finden.<br />
Deswegen gibt Dreier den<br />
n<strong>eu</strong>en Studenten gern einen Rat:<br />
„Nehmt <strong>eu</strong>ch ein kleines WG-<br />
Zimmer. Dann kommen die Eltern<br />
nicht jedes Wochenende zu<br />
Besuch.“<br />
2004 traf die amerikanische<br />
Anthropologin Carolina Izquierdo<br />
in Peru auf das Mädchen Yanira.<br />
Die Wissenschaftlerin wollte<br />
herausfinden, wie viel Verantwortung<br />
verschiedene Kulturen<br />
ihren Kindern geben und welche<br />
Folgen das für deren Entwicklung<br />
hat. Die Forscherin verbrachte<br />
mehrere Monate bei den<br />
Matsigenka im peruanischen Regenwald,<br />
einem Fischervolk, das<br />
in großen Familienverbänden<br />
lebt.<br />
Eines Tages stand die kleine<br />
Yanira da, in der Hand einen<br />
Kochtopf, zwei Kleidchen und<br />
n<strong>eu</strong>e Unterwäsche. Ihr Plan:<br />
eine Familie des Stammes auf<br />
Angeltour begleiten.<br />
In den folgenden Tagen fing<br />
Yanira Krebse, die sie für die<br />
Gruppe kochte, sammelte Blätter<br />
für den Hüttenbau und fegte
„Haare kämmen, Zähne putzen,<br />
duschen, Sachen zusammenräumen –<br />
alles Dinge, die Schulkinder<br />
schon selbst erledigen können.“<br />
morgens und nachmittags<br />
Sand von den Schlafmatten.<br />
Yanira half, wo sie konnte,<br />
und bemühte sich, niemandem<br />
zur Last zu fallen. Das<br />
Mädchen war damals sechs<br />
Jahre alt.<br />
In Los Angeles beobachteten<br />
Izquierdo und eine Kollegin<br />
das Leben amerikanischer<br />
Mittelklassefamilien. Beispielsweise<br />
das morgendliche Aufstehritual:<br />
Um 6.30 Uhr weckt<br />
die Mutter den 11-jährigen<br />
Mikey, den 12-jährigen Mark<br />
und die 15-jährige Stephanie.<br />
Sie ruft so etwas wie: „Aufstehen<br />
Kinder, aufstehen! Raus<br />
aus den Federn!“<br />
Die Kinder weigern sich<br />
zunächst, die Mutter muss<br />
mehrere Weckrunden drehen.<br />
Unten in der Küche fragt sie<br />
jeden, was er frühstücken<br />
möchte. Sie bietet mehrere Alternativen<br />
an, fragt auch nach<br />
den Wünschen für die Lunchbox<br />
und bereitet die Pausenbrote<br />
zu. Dann erinnert sie<br />
alle daran, sich die Zähne zu<br />
putzen, Haare zu kämmen<br />
und Schuhe anzuziehen.<br />
Während des gesamten<br />
Frühstücks hat die Mutter die<br />
Uhr im Blick. Sie ruft: „Noch<br />
zehn Minuten! Noch fünf Minuten!“<br />
Schließlich bittet sie<br />
den zwölfjährigen Mark, auf<br />
dem Weg nach draußen den<br />
Müll mitzunehmen. Mark schreit: „Nein!“<br />
Nur widerwillig tut er es später doch.<br />
In 30 amerikanischen Familien, die für<br />
die Studie beobachtet wurden, übernahm<br />
kein einziges Kind routinemäßig und eigenständig<br />
Aufgaben im Haushalt. Alle<br />
wurden zum Bettmachen, Tischabräumen,<br />
sogar zum Anziehen ermahnt und<br />
folgten nur zögerlich.<br />
Anweisungen wurden von den Eltern<br />
dabei häufig als Vorschläge formuliert.<br />
Etwa so: „Weißt du, was du machen<br />
kannst? Du kannst dir bitte die Haare im<br />
Badezimmer waschen! Willst du das machen?“<br />
In einer typischen Szene bat ein<br />
Vater seinen achtjährigen Sohn fünfmal,<br />
zum Duschen ins Bad zu gehen. Schließlich<br />
trug er ihn dorthin. Kurz darauf kehrte<br />
der Junge ungewaschen zurück und<br />
spielte ein Videospiel.<br />
Hört sich das sehr fremd, sehr amerikanisch<br />
an? Eher nicht.<br />
In ihrer Studie berücksichtigten die<br />
Wissenschaftlerinnen, welchen Stellenwert<br />
die Schulbildung und die Entwicklung<br />
von Individualität in den verschiedenen<br />
Kulturen haben. Doch dass die<br />
Schule im Leben amerikanischer Mittelklassekinder<br />
eine größere Rolle spielt als<br />
bei den Matsigenka, erklärt für die Forscherinnen<br />
nicht, weshalb so wenige<br />
Schulkinder in L.A. bei einfachen, schnellen<br />
Hausarbeiten helfen.<br />
Selbst beim Haarekämmen, Zähne -<br />
putzen, Duschen, Sachenzusammenräumen<br />
– alles Dinge, die kleine Schulkinder<br />
von ihrer Entwicklung her schon selbst<br />
erledigen können müssten – erhielten sie<br />
Hilfe von ihren Eltern.<br />
Wohin die übertriebene Unterstützung<br />
führen kann, sieht die Mannheimer Diplompädagogin<br />
Gabriele Pohl, 60, täglich<br />
in ihrer Praxis. Pohl therapiert seit zwölf<br />
Jahren Kinder mit Angststörungen. Sie<br />
sagt, den Kindern fehle h<strong>eu</strong>te der Mut<br />
für alles Mögliche. „Die können oft schon<br />
nicht mehr hüpfen oder auf einem Bein<br />
stehen. Die trauen sich nirgends runterzuspringen.“<br />
So viel Entfremdung vom<br />
eigenen Körper wirke sich auch auf die<br />
Seele aus.<br />
Sie erzählt von dem zwölfjährigen<br />
Mädchen, das kein Streichholz anzünden<br />
kann, das durfte es noch nie. Von dem<br />
Zehnjährigen, der sich den Reißverschluss<br />
seiner Jacke noch immer von der<br />
Mutter schließen lässt.<br />
Bei ihren Beratungsgesprächen hat sie<br />
häufig den Eindruck, da komme kein<br />
Kind, sondern ein Kopf durch die Tür.<br />
Zum Beispiel der Fünfjährige,<br />
der all ihre Puppen<br />
durchzählt, aus Stoffschlangen<br />
Buchstaben legt. Und es<br />
dann nicht schafft, auf den<br />
Stuhl zu klettern.<br />
„Es wird nur auf den Intellekt<br />
geguckt, aber nicht<br />
darauf, was die Kinder sonst<br />
noch brauchen. An körperlichen<br />
Erfahrungen, an Sozialerfahrungen,<br />
an emotionaler<br />
Intelligenz“, sagt Pohl.<br />
„Kinder wollen Mutproben,<br />
sie wollen wissen, wer von<br />
ihnen stärker ist, sie wollen<br />
Abent<strong>eu</strong>er.“ Vor allem<br />
brauchten sie die Freiheit,<br />
Dinge zu tun, bei denen sie<br />
nicht unter Aufsicht stehen.<br />
„Losziehen, etwas machen<br />
können. Ohne dass immer<br />
jemand hinter einem her<br />
ist.“<br />
Gewähren Eltern ihnen<br />
diese Freiheiten nicht, dann,<br />
meint Pohl, werden die Kinder<br />
sie sich irgendwann nehmen.<br />
„Dann machen sie<br />
irgendeinen Kokolores.“ Sie<br />
weiß da von Sachen wie<br />
S-Bahn-Surfen, Drogennehmen,<br />
Komasaufen.<br />
Kinder, die sich selbst<br />
nicht ausprobieren können,<br />
sind ihrer Meinung nach<br />
stärker gefährdet. „Ein Jugendlicher<br />
mit einem gesunden<br />
Selbstvertrauen, der<br />
kennt seine Grenzen. Der kann sagen:<br />
,So, jetzt hör ich auf mit dem Trinken,<br />
mir reicht es jetzt.‘“<br />
Bei ihrem ersten Kind war Erika Kochel*<br />
36 Jahre alt, und dann bekam sie<br />
noch ein zweites. Sie sagt: „Ich war eine<br />
späte, ängstliche Mutter.“ Ihre Kinder<br />
sind h<strong>eu</strong>te 17 und 19, ihr großer Sohn hat<br />
gerade Abitur gemacht.<br />
Hat alles gut geklappt?<br />
Sie s<strong>eu</strong>fzt. „Ja, schon. Weil ich vor<br />
zehn Jahren die Notbremse gezogen<br />
habe.“<br />
Die ersten Jahre war Kochel mit den<br />
kleinen Kindern daheimgeblieben, sie<br />
und ihr Mann hatten sich für eine klassische<br />
Rollenaufteilung entschieden. Ihre<br />
Welt bestand aus Wohnung, Spielplatz,<br />
Wohnung. „Es war eine wahnsinnig enge<br />
Geschichte.“<br />
Damals hatte sie ständig Angst, dass<br />
die Kinder entführt oder auf der Straße<br />
überfahren werden. Sogar das Nachrichtengucken<br />
fiel ihr schwer, all das Schlechte<br />
erschütterte sie maßlos.<br />
Sie sagt: „Es passiert sehr leicht, dass<br />
man mit seinen Sorgen übertreibt. Wenn<br />
man allein ist mit den Kindern, ver-<br />
* Name von der Redaktion geändert.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 123
„Die Noten sind gut, Klavier kann er schon, Tennis spielt er auch. Was soll denn<br />
schwimmt die Grenze. Was ist zu viel,<br />
was gerade richtig?“<br />
Gleichzeitig hatte sie Bilder einer perfekten<br />
Familie im Kopf. Von Kindern, lustig<br />
und gesellig, so wie sie selbst auch<br />
mal war. Doch statt auf den Bolzplatz zu<br />
gehen, blieb der Große lieber für sich.<br />
Sie fragte sich: Was hab ich falsch gemacht?<br />
Wie kann man das ändern?<br />
Ständig bedrängte sie ihn, mehr aus sich<br />
herauszugehen.<br />
Als der Sohn in die Schule kam, begann<br />
er, sich zu fürchten. Morgens,<br />
abends, nachts. Irgendwann begriff sie,<br />
dass er sich mehr als andere Kinder fürchtete,<br />
und bat einen Psychologen um Rat.<br />
Sie ging auch selbst zu einer Therap<strong>eu</strong>tin.<br />
Erst als diese ihr viele Male glaubhaft<br />
versicherte: „Es ist alles gut. Sie haben<br />
tolle Kinder. Vertrauen Sie darauf, das<br />
wird schon“, war Erika Kochel allmählich<br />
bereit zu glauben, dass nicht alles im Leben<br />
ihrer Kontrolle bedurfte. H<strong>eu</strong>te sagt<br />
sie: „Ich habe mühsam gelernt, die Dinge<br />
auch mal laufen zu lassen.“<br />
Klaus Hurrelmann ist Professor für<br />
Public Health and Education an der<br />
Hertie School of Governance in Berlin.<br />
Er leitet seit über zehn Jahren die Shell-<br />
Jugendstudie, er untersucht, wie Kinder<br />
in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> leben.<br />
Er sagt, wer wissen wolle, wie Eltern<br />
und Kinder h<strong>eu</strong>te miteinander zurechtkommen,<br />
müsse auch betrachten, wie<br />
sich die Paarbeziehungen der Erwachsenen<br />
im Laufe der Zeit verändert haben.<br />
„Kaum jemand muss h<strong>eu</strong>te noch einen<br />
Hof oder ein Geschäft zusammen betreiben“,<br />
sagt Hurrelmann.<br />
Ein Paar zu sein, das sei h<strong>eu</strong>te kaum<br />
mehr eine pragmatische Entscheidung,<br />
sondern fast ausschließlich emotional<br />
gest<strong>eu</strong>ert, eine Liebesbeziehung. „Man<br />
schaut, ob man in seinem Charakter zueinanderpasst.<br />
In seinen Interessen, seinen<br />
Anschauungen.“<br />
Eine solche Beziehung ist geprägt von<br />
starkem Einfühlen, hoher Empathie, intensivem<br />
Mitdenken für den Partner.<br />
124<br />
Hurrelmann glaubt, dass nicht wenige Eltern<br />
diese Art von Beziehung auch auf<br />
ihr Kind übertragen. „Das sind alles sehr<br />
hohe Werte“, sagt Hurrelmann. Aber das<br />
Kind müsse erzogen werden. „Das muss<br />
der Partner nicht.“ In manchen Fällen<br />
werde die Erziehung sogar komplett<br />
durch die Beziehung ersetzt.<br />
Was Hurrelmann von den Eltern verlangt,<br />
ist eine stärkere erzieherische Haltung,<br />
eine gesunde Distanz zum Kind.<br />
Eine solcher Abstand schütze das Kind<br />
auch, denn es gehöre einer anderen Generation<br />
an, sei ein anderer Mensch. „Es<br />
ist sein eigener Mensch. Das zu akzeptieren<br />
fällt vielen Eltern schwer.“<br />
Vor ein paar Jahren wurde die amerikanische<br />
Journalistin Lenore Skenazy<br />
über Nacht berühmt: In ihrer Kolumne<br />
für die „New York Sun“ bekannte sie,<br />
dass sie ihren n<strong>eu</strong>njährigen Sohn allein<br />
mit der New Yorker U-Bahn fahren lasse.<br />
Binnen kurzem hatte Skenazy den Beinamen<br />
„America’s Worst Mom“ – die<br />
schlechteste Mutter Amerikas. Aufgebrachte<br />
Eltern ließen sich über sie aus.<br />
Tenor: „Was, wenn da etwas passiert?“<br />
Skenazy ging in die Offensive. Sie<br />
schrieb ein Blog und ein Buch mit dem<br />
Titel „Free-Range Kids“, freilaufende<br />
Kinder, in dem sie das Recht ihres Sohnes<br />
verteidigte, die Welt auch für sich allein<br />
zu entdecken. Das Buch war ein Erfolg,<br />
Skenazy bekam eine eigene TV-Sendung.<br />
In einer Folge von „World’s Worst<br />
Mom“ blickt ein Zehnjähriger traurig in<br />
die Kamera. Er sagt: „Ich kann nicht Rad<br />
fahren und nicht mit einem Messer schneiden.<br />
Meine Mutter hat Angst, ich falle hin<br />
oder schneide mir die Finger ab.“<br />
Skenazy kommt, setzt den Jungen aufs<br />
Rad, lässt ihn in der Küche Tomaten<br />
schneiden. Am Ende sind alle vor Glück<br />
den Tränen nahe. Skenazy sagt: „Ich denke,<br />
das Leben dieser Familie hat sich für<br />
immer verändert.“<br />
Wird die Hamburger Psychologin Katrin<br />
Hagemeyer, 35, bei Schwierigkeiten<br />
von Eltern um Rat gebeten, besucht auch<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
sie die Familie zu Hause. Sie beobachtet<br />
einige Stunden das Miteinander von Eltern<br />
und Kindern. Häufig sieht sie dabei,<br />
wie die Eltern die Kinder mit ihren gutgemeinten<br />
Sorgen erdrücken. Und selbst<br />
nichts davon merken.<br />
„Ich spreche mit Eltern, die sich über<br />
den grassierenden Förderwahnsinn mokieren,<br />
aber mir gleichzeitig erklären,<br />
weshalb ihr Kind an vier Nachmittagen<br />
die Woche irgendwelche Kurse besucht.“<br />
Sie spricht mit einer Mutter, die über<br />
die übertriebene Sorge räsoniert, ihrer<br />
Tochter dabei aber am Klettergerüst die<br />
ganze Zeit das Händchen hält.<br />
Inzwischen geht es auch in vielen Sachbüchern<br />
darum, dass die Kleinen ihre<br />
Kindheit einbüßen. Man solle die Kinder,<br />
heißt es meist darin, doch wieder einfach<br />
Kinder sein lassen, sie in den Wald schicken,<br />
sie toben lassen.<br />
Aber die Eltern, mit denen Hagemeyer<br />
zu tun hat, behandeln auch das wieder<br />
nur als eine Aufgabe. Im Hinterkopf, sagt<br />
Hagemeyer, ticke weiter der Wecker.<br />
„Nach dem Motto: Ich habe dem Jungen<br />
jetzt drei Stunden lang seine Ruhe gelassen,<br />
jetzt muss er doch mal um die Ecke<br />
kommen und ein tiefsinniges Gespräch<br />
führen wollen.“<br />
„Theoretisch“, sagt Hagemeyer, „ist<br />
diesen Eltern klar, dass es ein Zuviel geben<br />
kann.“ Aber praktisch sähen sie es<br />
nicht. Sie führten Methoden aus, sähen<br />
das Kind nicht als Person.<br />
„Die Eltern kommen aus der Denkfalle<br />
gar nicht mehr heraus“, sagt Hagemeyer.<br />
Alles in ihrem Leben sei messbar. Größe,<br />
Gewicht, die Leistungen in der Schule.<br />
„So werden die Kinder zu Mathematikaufgaben.“<br />
Die Rechnung der Eltern sehe meist so<br />
aus: Ich habe dich gestillt, dir Nähe und<br />
Zuneigung gegeben, dich bestmöglich gefördert<br />
– jetzt werde bitte zu dem Menschen,<br />
zu dem ich dich erzogen habe.<br />
Immer wenn die Eltern eine solche<br />
Rechnung aufmachten, sagt Hagemeyer,<br />
werde es gruselig.
noch alles in dieses Kind rein, damit es auf dem Arbeitsmarkt reüssiert?“<br />
Wie soll man es denn besser machen?<br />
So schwer sei das gar nicht, sagt Hagemeyer.<br />
Man müsse nur mit ein paar Dingen<br />
ins Reine kommen.<br />
Zum einen sei da die weitverbreitete<br />
Annahme, Kinder kämen wie weiße<br />
Püppchen auf die Welt, die man beliebig<br />
anmalen kann. „Aber Kinder“, sagt Hagemeyer,<br />
„die sind, wie sie sind.“<br />
Wenn sie einem in den eigenen Inter -<br />
essen und Fähigkeiten ähnlich sind, werde<br />
das familiäre Miteinander wahrscheinlich<br />
reibungsloser verlaufen. „Wenn sie<br />
aber ganz anders sind, dann muss man<br />
sich damit eben anfr<strong>eu</strong>nden. Dann muss<br />
man das füreinander organisieren.“<br />
Hagemeyers These: Es ist nicht die Aufgabe<br />
der Eltern, ihre Kinder glücklich zu<br />
machen. „Eltern sind dazu da, die Kinder<br />
auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen<br />
die Informationen und Fertigkeiten zu<br />
vermitteln, die sie brauchen, um sich in<br />
der Welt zurechtzufinden“, sagt die Psychologin.<br />
Das Projekt „Glückliches Kind“ berge<br />
die Gefahr in sich, dass das Kind nicht<br />
mehr die Möglichkeit habe, unbeschwert<br />
traurig zu sein. „Alle Emotionen, die wir<br />
Menschen mit auf die Welt bringen, sind<br />
wichtig und wertvoll für unsere Persönlichkeit.<br />
Wirklich hilfreiche Eltern sind<br />
diejenigen, die das Kind anerkennen, so<br />
wie es ist.“<br />
An der Universität Freiburg versucht<br />
die Studienberaterin Eva Welsch bei dieser<br />
Art von Anerkennung zu helfen. Vor<br />
ein paar Jahren hat sie begonnen, nicht<br />
nur Studenten, sondern auch Eltern<br />
Sprechstunden anzubieten.<br />
Welsch, 62, bittet in ihr Büro. An der<br />
Wand hängt ein Druck von Mark Rothko,<br />
beruhigendes Rot, die Couch ist hell und<br />
weich. Fast jeden Satz beendet Welsch<br />
mit einem Lächeln.<br />
Sie sagt, dass sie das Miteinander von<br />
Studenten und Eltern als fr<strong>eu</strong>ndschaftlich<br />
erlebe. „Entscheidungen treffen sie häufig<br />
gemeinsam, nicht wie früher, als Eltern<br />
noch sagten, ,Medizin oder gar nichts!‘“<br />
Doch Welsch ist nicht sicher, ob die<br />
jungen Erwachsenen sich nicht manchmal<br />
allzu willfährig den Ratschlägen der Eltern<br />
b<strong>eu</strong>gten. „Das sind alles empathische,<br />
reizende Eltern, wirklich“, sagt sie.<br />
„Aber es sind Eltern, die kurzatmig werden,<br />
weil sie sich so große Sorgen um<br />
ihre Kinder machen.“<br />
Zugleich sitzen in der Studienberatung<br />
häufig Studenten, Mitte, Ende zwanzig,<br />
die nach ihrem Abschluss kommen und<br />
sagen: „Jetzt habe ich studiert, wozu mir<br />
meine Eltern geraten haben. Aber glücklich<br />
werde ich damit nicht. Kann ich noch<br />
einmal von vorn beginnen?“<br />
Welsch fragt sich dann stets: Hätte man<br />
das nicht vorher merken können? Doch<br />
es sei schwer geworden, die Kinder zu<br />
ihrer eigenen Wahl zu ermuntern, die Eltern<br />
davon abzuhalten, allzu fürsorglich<br />
einzugreifen. Sie spürt, dass eine andere<br />
Art von Spannung zwischen Eltern und<br />
Kindern entstanden ist. Keine, die aus<br />
autoritärem Zwang entsteht. Sondern aus<br />
Angst.<br />
Manchmal wird es Eva Welsch in diesen<br />
Situationen eng ums Herz. Was nutzt<br />
ein VWL-Studium, wenn der Junge<br />
schlecht in Mathe ist? Was bringt Jura,<br />
nur weil der Vater als Rechtsanwalt gut<br />
ist? Sie sagt: „Fragt doch mal nach dem<br />
Glück der Kinder! Das tut keiner mehr.“<br />
Die Leichtigkeit sei weg.<br />
Sie versuche den Eltern zu sagen:<br />
„Lehnen Sie sich zurück, kommen Sie<br />
raus aus Ihrer Verkrampfung. Die Noten<br />
sind gut, Klavier kann er schon, Tennis<br />
spielt er auch. Was soll denn noch alles<br />
in dieses Kind rein, damit es auf dem Arbeitsmarkt<br />
reüssiert?“<br />
Die Studienberaterin will, dass bei den<br />
Heranwachsenden wieder die N<strong>eu</strong>gierde<br />
geweckt wird. Sie sagt: „Wir haben hier<br />
eine Universität, die hat Säcke voll Wissen.“<br />
Sie will den Eltern klarmachen, dass<br />
ihr Kind nur dann einmal gut im Beruf<br />
sein wird, wenn es etwas studiert, das es<br />
interessiert. „Nicht, was gerade opportun<br />
auf dem Arbeitsmarkt ist.“<br />
Häufig, sagt Welsch, habe sie in einer<br />
solchen Beratung Erfolg. Sie spüre dann<br />
ein tiefes Durchatmen – bei Kindern und<br />
Eltern.<br />
In Niederbayern bereitet sich Josef<br />
Kraus auf den nächsten Tag vor. Der Abschied<br />
von den diesjährigen Abiturienten<br />
steht an, für Kraus wird es der 20. Abiturjahrgang<br />
sein, den er ins Leben entlässt.<br />
Der Pädagoge muss noch seine Rede<br />
fertigschreiben.<br />
Kraus sagt: „Ich könnte jedes Jahr die<br />
gleiche halten, keiner würde es merken.“<br />
Aber er will das nicht. Er will, dass die<br />
Rede jedes Jahr n<strong>eu</strong> ist, dass sie etwas<br />
mit dem Leben seiner Schüler zu tun hat.<br />
Was will er dieses Mal sagen?<br />
„Ich möchte über Humor sprechen.“<br />
Über Humor als Chance, mit dem Leben<br />
fertig zu werden.<br />
Die letzte Schulglocke läutet, der Gymnasialdirektor<br />
trinkt Kaffee und erklärt:<br />
„Humor macht es leichter, mit den Unzulänglichkeiten<br />
des eigenen Lebens zurechtzukommen.“<br />
Humor mache es leichter,<br />
versöhnlich auf die Schwächen der<br />
Mitmenschen zu sehen. „Und Humor ist<br />
ein großes Stück innere Freiheit. In Situationen,<br />
in denen man sich ohnmächtig<br />
fühlt.“<br />
Warum will er ausgerechnet das seinen<br />
Schülern mit auf den Weg geben?<br />
„Damit sie Abstand gewinnen. Vom<br />
Perfektionismus, vom Verwertungsdenken.<br />
Von dieser sturen Ellbogenmentalität.“<br />
Denn seine Schüler, sagt Kraus, das<br />
seien mehr als nur Menschen, die man<br />
benote. „Das sind auch Töchter, Söhne,<br />
Brüder, Schwestern oder Fr<strong>eu</strong>nde.“ In<br />
jeder dieser Rollen sollen sie glücklich<br />
werden.<br />
Vor allem, sagt Kraus, möchte er das<br />
aber den Eltern sagen. „Denn die sitzen<br />
morgen ja auch da.“ KERSTIN KULLMANN<br />
Animation: Was für ein<br />
Elterntyp sind Sie?<br />
spiegel.de/app332013eltern<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 33/2013 125
Wissenschaft<br />
UMWELT<br />
Die Rettung der Maronen<br />
Ein Pilz hat die Amerikanische Kastanie dahingerafft, nur noch kärgliche<br />
Triebe kümmern im Forst. Genforscher lassen den<br />
prächtigen Baum jetzt auferstehen: mit eingebautem Schädlingsschutz.<br />
Willkommen auf dem Mond“, sagt<br />
Fred Hebard und zeigt in die<br />
Grube, die sich vor ihm auftut.<br />
Über graubraunes Geröll quälen sich vollbeladene<br />
40-Tonner den Berg empor,<br />
Staub wirbelt, weiter unten kratzen Schaufelbagger<br />
schwarze Halden zusammen.<br />
„Erstaunlich? Aufrüttelnd? Bestürzend?“<br />
Hebard sucht nach dem richtigen<br />
Wort. Am Ende findet er, dass „schockierend“<br />
die Sache am besten trifft. Hier, inmitten<br />
der nordamerikanischen Appalachen,<br />
sprengen Konzerne ganze Berge<br />
weg, um an die reichen Steinkohlevorkommen<br />
der Region heranzukommen.<br />
Doch Hebards Expertise gilt nicht der<br />
Zerstörung, sein Fachgebiet ist die Wiedergeburt.<br />
Sein Werk lässt sich auf einem<br />
kleinen Versuchsfeld bewundern. Dort<br />
wuchert, gehegt von Forstwirten, Bodenkundlern<br />
und Botanikern, junge Wildnis.<br />
Ahorne, Eichen und Platanen recken<br />
sich vier, fünf Meter hoch aus den Ritzen<br />
im Geröll, dazwischen ranken Dornen -<br />
büsche: Der Wald erobert sich das Terrain<br />
zurück. Und auch die Tierwelt kehrt allmählich<br />
heim. „Da, ein d<strong>eu</strong>tliches Zeichen,<br />
dass hier wieder Säugetiere leben“,<br />
sagt Hebard und zerquetscht eine Zecke<br />
zwischen den Fingernägeln.<br />
Dann bahnt er sich den Weg zum<br />
eigentlichen Symbol der Wiederauferstehung:<br />
einem wackeren Bäumchen, das<br />
die anderen überragt. „Sieht gesund aus“,<br />
sagt Hebard zufrieden, während er den<br />
fast armdicken Stamm inspiziert. Dass<br />
dieser Baum hier so gut gedeiht, ist in<br />
den USA von geradezu nationaler Bed<strong>eu</strong>tung.<br />
Denn vor dem Pflanzenpathologen<br />
Fred Hebard wächst eine fünfjährige<br />
Amerikanische Kastanie.<br />
Kaum zu glauben, dass dieser Baum,<br />
der h<strong>eu</strong>te so gut wie ausgestorben ist,<br />
einst die Wälder im Osten Nordamerikas<br />
beherrschte. Gut 30 Meter hoch, galt Castanea<br />
dentata als „Redwood des Ostens“.<br />
Jeder vierte Baum in den Appalachen<br />
war eine Kastanie, ihre Früchte nährten<br />
Hirsche, Waschbären und Truthühner.<br />
Ein Eichhörnchen hätte im Castanea-Kronendach<br />
von Georgia bis nach Maine gelangen<br />
können. Mehr als tausend Orte<br />
mit „Chestnut“ (englisch für „Kastanie“)<br />
im Namen hätten am Weg gelegen.<br />
126<br />
Im Herbst zogen die Bewohner ganzer<br />
Ortschaften morgens in den Wald, um<br />
abends mit Säcken voller Maronen zurückzukehren.<br />
In Eisenbahnwaggons wurde<br />
die Ernte dann nach Baltimore, Philadelphia<br />
oder New York verfrachtet, um<br />
dort geröstet auf den Straßen feilgeboten<br />
zu werden.<br />
Aus dem wetterfesten Holz der Kastanienbäume<br />
fertigte man mit Vorliebe Telefonmasten,<br />
Schindeln, Zäune oder Eisenbahnschwellen.<br />
Gerber nutzten die<br />
Tannine aus Holz und Rinde. Und die<br />
Hausfrauen kochten aus den Blättern Brühe<br />
gegen Husten oder Tee zur Stärkung<br />
des Herzens.<br />
Kastanienbäume in den Appalachen 1910<br />
Die Lebensader abgeschnitten<br />
H<strong>eu</strong>te ist all das Vergangenheit. Nur<br />
noch kärgliche Triebe der ehedem so riesigen<br />
Bäume kümmern im Unterholz.<br />
Wie einst Menschen die Kastanien, so<br />
sammeln jetzt Volkskundler die alten Geschichten<br />
über diese Bäume. Und der<br />
Truthahn zu Thanksgiving wird nun mit<br />
Austern statt mit Maronen gefüllt.<br />
Kaum dass ein Stämmchen auf Daumendicke<br />
herangereift ist, z<strong>eu</strong>gen schorfige<br />
Geschwülste an der Rinde davon,<br />
dass sich Cryphonectria parasitica hier<br />
eingenistet hat. Zwischen Holz und Borke<br />
breitet sich dieser Pilz aus, bis er den ganzen<br />
Stamm umschlossen und damit dem<br />
Baum die Lebensader abgeschnitten hat.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
THE AMERICAN CHESTNUT FOUNDATION / COURTESY OF THE FOREST HISTORY SOCIETY<br />
Im Jahr 1904 wurde der aus Asien eingeschleppte<br />
Pilz erstmals in Amerika gesichtet,<br />
als Kastanienbäume im Zoo der<br />
New Yorker Bronx ein rätselhaftes Siechtum<br />
befiel. Gut zehn Jahre später waren<br />
ganze Landstriche von den toten Gerippen<br />
der Kastanienbäume geprägt.<br />
Verzweifelt suchten die Förster dem<br />
Sterben Einhalt zu gebieten – und verschlimmerten<br />
damit nur den Schaden. Um<br />
dem Schädling seine Nahrung zu nehmen,<br />
fällten sie auch gesunde Kastanien. Manch<br />
ein mit natürlicher Resistenz ausgestatteter<br />
Baum dürfte dabei den Tod durch die<br />
Axt gefunden haben. Zudem trugen die<br />
Waldarbeiter in ihrem Eifer wahrscheinlich<br />
an den Stiefeln haftende Pilzsporen<br />
auch in den letzten noch nicht befallenen<br />
Winkel des Landes.<br />
Schließlich war es so weit: „Good bye,<br />
Chestnuts“ überschrieb die Zeitschrift<br />
„American Forests“ einen Nachruf auf<br />
Castanea dentata. Die Zahl der Bäume,<br />
die der Epidemie zum Opfer fielen, wird<br />
auf drei bis vier Milliarden geschätzt.<br />
Der Niedergang der Amerikanischen<br />
Kastanie ist damit zum Paradefall einer<br />
Baums<strong>eu</strong>che geworden, von der immer<br />
wieder ganze Weltregionen heimgesucht<br />
werden. So rafften in Europa eingeschleppte<br />
Pilze Millionen Ulmen dahin.<br />
Ein Pilz war es auch, der in der ersten<br />
Hälfte des 20. Jahrhunderts dem süd -<br />
amerikanischen Kautschukboom ein<br />
Ende setzte.<br />
In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ist das Siechtum der<br />
Rosskastanien zum Inbegriff eines Baumleidens<br />
geworden. Die Larven bestimmter<br />
Kleinschmetterlinge, sogenannter Miniermotten,<br />
fressen („minieren“) winzige<br />
Gänge in die Blätter, was diese schon im<br />
Hochsommer verwelken lässt. Weil diese<br />
Motten in Mittel<strong>eu</strong>ropa keine effektiven<br />
natürlichen Feinde haben, ist es schwer,<br />
ihnen Einhalt zu gebieten.<br />
Der Befall durch Mottenlarven ist für<br />
die Bäume allerdings nicht tödlich. In<br />
manchen Teilen Nordrhein-Westfalens jedoch<br />
ist ein zweiter Feind hinzugekommen,<br />
der die Rosskastanien (die im Übrigen<br />
mit der Amerikanischen Kastanie<br />
nicht mehr als den Namen und die Ähnlichkeit<br />
der Frucht gemein haben) ernsthaft<br />
schädigt: Ein stäbchenförmiges Bak-
Pflanzenpathologe Hebard<br />
Versuchsfeld in Meadowview<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
THE AMERICAN CHESTNUT FOUNDATION<br />
terium, vermutlich ein Zuwanderer aus<br />
Indien, lässt die Rosskastanien regelrecht<br />
verfaulen. Erstmals 2002 in den Niederlanden<br />
beobachtet, breitete sich die S<strong>eu</strong>che<br />
ostwärts aus.<br />
In den USA ist Castanea dentata mit<br />
der Zeit zum Symbol bedrohter Natur,<br />
ihre Wiederauferstehung zum nationalen<br />
Anliegen geworden. Das ganze Arsenal<br />
der Biotechnik wird in den Dienst dieses<br />
Ziels gestellt.<br />
„Sehr vielversprechend“ nennt William<br />
Powell die Ergebnisse seiner Experimente,<br />
die er an der State University of New York<br />
in Syracuse durchführt. Der Genforscher<br />
wappnet die Kastanie mit gentechnischer<br />
Hilfe gegen den Pilzbefall.<br />
Powell entschied sich dabei für ein Gen<br />
des Weizens, das die vom Pilz produzierte<br />
Oxalsäure n<strong>eu</strong>tralisiert und auf diese<br />
Weise den Schädling entwaffnet. 15 Jahre<br />
lang mühten sich Powell und sein Kollege<br />
Charles Maynard vergebens, das fremde<br />
Gen in Kastanienembryonen einzuschl<strong>eu</strong>sen.<br />
„Es war vertrackt“, erklärt Maynard.<br />
„Fast schien es, als hätte es die Kastanie<br />
darauf angelegt auszusterben.“<br />
Am Ende aber wurden die Forscher<br />
doch mit Erfolg belohnt. Inzwischen<br />
wachsen in Syracuse Bäumchen heran,<br />
die sich als weitgehend pilzresistent erweisen.<br />
Bis diese allerdings die Hänge<br />
der Appalachen zieren, wird noch mindestens<br />
ein Jahrzehnt vergehen. Zuvor<br />
stehen dem Forscherduo zähe Verhandlungen<br />
mit Umwelt-, Lebensmittel- und<br />
Forstbehörden bevor.<br />
Immerhin dürfte Powell und Maynard<br />
zugutekommen, dass sie für eine Sache<br />
kämpfen, die unter Umweltbewegten als<br />
eine gute gilt: „Selbst eingefleischte Gentech-Gegner<br />
zeigen sich meist milde,<br />
wenn sie hören, dass es um die Amerikanische<br />
Kastanie geht“, erzählt Powell.<br />
Andere Forscher setzen darauf, nicht<br />
den Baum zu stärken, sondern den Pilz<br />
zu schwächen – eine Strategie, dank der<br />
in Europa bei der Edelkastanie die Epidemie<br />
eingedämmt werden konnte. Dort<br />
gelang es, den Pilz seinerseits mit Viren<br />
zu infizieren, „Hypovirulenz“ nennen<br />
Forscher das Prinzip. Tatsächlich erholten<br />
sich die Bäume zusehends, am Ende<br />
erinnerten nur noch hässliche Schwielen<br />
in der Rinde an den überstandenen Pilzbefall.<br />
In Amerika allerdings ist der Pilz hartnäckiger.<br />
Alle Versuche, die Viren wirksam<br />
zu verbreiten, schlugen bisher fehl.<br />
Für das Überleben von Castanea dentata<br />
könnte die Schwächung des Pilzes trotzdem<br />
wichtig werden. „Wir erhoffen uns<br />
Unterstützung durch die verminderte<br />
Virulenz“, erklärt Pflanzenpathologe<br />
Hebard.<br />
Als Forschungschef der American<br />
Chestnut Foundation ist Hebard so etwas<br />
wie der Feldherr im Krieg gegen den Kastanienpilz.<br />
Niemand kennt die Launen<br />
127
Technik<br />
des Baums so gut wie er, keiner ist so vertraut<br />
mit den Tücken des Pilzes.<br />
Hebards wichtigster Verbündeter ist<br />
Castanea mollissima, die Chinesische Kastanie.<br />
Zwar ist sie zu klein, um im amerikanischen<br />
Forst langfristig bestehen zu<br />
können, doch ist sie mit natürlicher Resistenz<br />
gegen den Pilz ausgestattet. Hebards<br />
Ziel ist es, eine Mischform zu erschaffen,<br />
die chinesisch genug ist, um dem Pilz zu<br />
trotzen, aber so amerikanisch, dass sie im<br />
Bergwald der Appalachen gut gedeiht.<br />
Auf dem Weg dorthin ist der Forscher<br />
weit gekommen. Inzwischen wachsen auf<br />
den Versuchsfeldern der Foundation in<br />
Meadowview, US-Bundesstaat Virginia,<br />
Bäume der sechsten Zucht-Generation her -<br />
an. Die charakteristisch gezähnten Blattränder<br />
und die leicht rötliche Färbung weisen<br />
auf einen hohen Anteil amerikanischen<br />
Erbguts hin. Mit der Lupe überprüft<br />
Hebard, dass die Blätter nur wenige der<br />
für die Chinesische Kastanie so typischen<br />
Härchen an der Unterseite tragen.<br />
Von ihren chinesischen Ahnen haben<br />
Hebards Schützlinge dagegen Widerstandskraft<br />
gegen den Schädling geerbt.<br />
Regelmäßig impft der Forscher seine Versuchsbäume<br />
mit dem orangefarbenen<br />
Pilzgewebe. Im Jahr darauf vergibt er Noten:<br />
„3“ bed<strong>eu</strong>tet, dass eine tödliche Geschwulst<br />
am Stamm wuchert; „2“ steht<br />
für eine schwelende Infektion mit unklarem<br />
Ausgang; mit einer „1“ wird ein<br />
Baum belohnt, wenn nur noch eine verheilte<br />
Narbe an den Pilzbefall erinnert.<br />
Von Generation zu Generation sind die<br />
Noten „1“ und „2“ häufiger geworden.<br />
Ob das ausreicht für ein langfristiges<br />
Überleben? Hebard hält sich mit Versprechen<br />
zurück. Er will abwarten, ob seine<br />
Kreationen nun den Härtetest in den großen<br />
Tagebauen bestehen.<br />
Dass manch ein Umweltschützer ihm<br />
Kumpanei mit den Bergbaukonzernen<br />
vorwirft, nimmt der Forscher dabei in<br />
Kauf. „Das hier ist Kastanien-, aber auch<br />
Kohleland“, sagt er. An der Verwüstung<br />
durch Dynamit und Bagger könne er ohnehin<br />
nichts ändern. Aber zumindest trage<br />
er seinen Teil dazu bei, dass der Wald<br />
nach dem Raubbau wieder zurückkehre.<br />
Patrick Angel jedenfalls sieht in Hebard<br />
einen strategischen Verbündeten.<br />
Als Forstwissenschaftler entwickelt Angel<br />
Methoden, wie sich der Tagebau wieder<br />
aufforsten lässt. Auf lockerem, verwittertem<br />
Sandsteingeröll, so der wichtigste Befund,<br />
wuchert die Wildnis besonders gut.<br />
„Die Kohlekonzerne wollen davon aber<br />
oft nichts wissen“, sagt er. „Den Boden<br />
plattzuwalzen und dann Gras zu säen ist<br />
einfach billiger.“ Deshalb ist Angel dankbar,<br />
dass Hebard ihm ein Argument liefert,<br />
mit dem sich auch hartgesottene Kohlemanager<br />
überz<strong>eu</strong>gen lassen: „Wenn ich<br />
denen sage, dass wir auch Amerikanische<br />
Kastanien pflanzen, dann l<strong>eu</strong>chten ihre<br />
Augen.“<br />
JOHANN GROLLE<br />
128<br />
Passagierschiff „Queen Mary 2“ in Hamburg<br />
VERKEHR<br />
Rauch verboten<br />
In Nord- und Ostsee werden Schiffe zukünftig nicht mehr<br />
einfach mit Schweröl fahren dürfen. Doch saubere<br />
Alternativen sind t<strong>eu</strong>er. Flüssiges Erdgas könnte die Rettung sein.<br />
Die Wohngebiete am Hamburger<br />
Elbufer zählen zu den begehr -<br />
testen der Stadt. Ehrbare Kaufmannsfamilien<br />
residieren hier. Das Panorama<br />
ist herrlich, die Luft zuweilen getrübt.<br />
Schwarzer, fettiger Niederschlag legt<br />
sich regelmäßig auf Gartenmöbel und<br />
Fenstersimse. Die Betroffenen können<br />
sich allenfalls damit trösten, dass ihnen<br />
die Ausscheidungen einer Branche um<br />
die Ohren fliegen, die Hamburg reich gemacht<br />
hat.<br />
Schiffe sind die Dreckfresser der mobilen<br />
Gesellschaft, als globale Verschmutzer<br />
zwar kaum bed<strong>eu</strong>tend (siehe Grafik), lokal<br />
aber ein Ärgernis. Ihre Dieselmotoren<br />
verbrennen Schweröl, den Bodensatz der<br />
Raffinerien. „Das ist eher dicke Pampe<br />
als eine Flüssigkeit“, sagt Christoph<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Brockmann, Vizepräsident des Bundesamts<br />
für Seeschifffahrt und Hydrographie<br />
in Hamburg. Die Pampe muss auf über<br />
50 Grad angewärmt werden, damit sie<br />
überhaupt durch die Leitungen in den<br />
Motor gepresst werden kann.<br />
Aus dem Schlot quillt dann der<br />
Schmutz. Brockmann hat einige Fotos auf<br />
seinem Handy; sie zeigen Schiffsschornsteine,<br />
denen Schwaden von schwarzem<br />
und gelbem Rauch entweichen. Schwarz<br />
ist Ruß, gelb Schwefel. „Diese Bilder sind<br />
hässlich“, sagt Brockmann, „die wollen<br />
wir nicht mehr.“<br />
Der studierte Ozeanograf zählt zu den<br />
Treibern einer epochalen Umstellung der<br />
Schiffskraftstoffe von Schweröl auf Erdgas.<br />
Es ist der größtmögliche Sprung, den<br />
der Katalog der Kohlenwasserstoffe hergibt<br />
– vom schmutzigsten zum saubersten
Brennstoff fossiler Natur. Dieselmotoren,<br />
das fügt sich bestens, vertragen beides.<br />
Auch Bundesverkehrsminister Peter<br />
Ramsauer will diesen Wandel. Am Freitag<br />
besuchte er in Rostock-Warnemünde<br />
die Vorführung eines Caterpillar-Schiffsmotors<br />
auf dem Abgasprüfstand. Das Aggregat<br />
hat sechs Zylinder, leistet etwa<br />
fünf Megawatt und kann im laufenden<br />
Betrieb von Schweröl auf Gas umschalten.<br />
Die Leistung bleibt gleich, doch die<br />
Schadstoffe verschwinden fast komplett:<br />
Schwefeldioxid und Ruß sinken nahezu<br />
auf null, Stickoxide auf etwa 20 Prozent.<br />
Rückgrat der Wirtschaft<br />
90 Prozent des Welthandels werden per<br />
Schiff abgewickelt. Der Anteil des Schiffsverkehrs<br />
an den von Menschen verursachten<br />
Emissionen beträgt für ...<br />
... Kohlendioxid<br />
ca. 3%<br />
... Schwefeloxide<br />
ca. 6%<br />
... Stickoxide<br />
ca. 15 %<br />
IMAGO<br />
In seiner dichtesten Speicherform namens<br />
LNG (liquefied natural gas), auf unter<br />
minus 160 Grad abgekühlt und verflüssigt,<br />
ist Erdgas auf Schiffen tatsächlich<br />
nutzbar. In Skandinavien laufen bereits<br />
vereinzelt Fähren im LNG-Betrieb. Und<br />
auch die im Ostseeraum üblichen Frachtschiffe,<br />
schätzt Brockmann, ließen sich<br />
unter geringen Laderaumeinbußen mit<br />
LNG betreiben.<br />
Ramsauer spricht bereits von einem<br />
„Nationalen Aktionsplan LNG“, und der<br />
d<strong>eu</strong>tsche Gaskonzern Linde hat mit dem<br />
Hamburger Schiffstreibstoffanbieter Bomin<br />
im vergangenen Jahr ein Joint Venture<br />
gegründet, um in den großen Häfen<br />
des Nord- und Ostseeraums eine LNG-<br />
Infrastruktur aufzubauen. Erste Standorte<br />
sind in Hamburg, Bremerhaven und Rotterdam<br />
geplant.<br />
Die Terminals dürften jedoch eine Weile<br />
eher verwaist in den Häfen liegen.<br />
Nicht so glücklich über die Initiative zeigt<br />
sich nämlich der Verband D<strong>eu</strong>tscher Reeder.<br />
Eine Expertise nennt den LNG-Einsatz<br />
zwar, ganz brav, „wünschenswert im<br />
Sinne der Umwelt“ und auch „technisch<br />
machbar“, jedoch „wirtschaftlich (noch)<br />
unattraktiv“. Übersetzt heißt das: Spinnt<br />
ihr eigentlich?<br />
Die N<strong>eu</strong>baukosten für ein Schiff würden<br />
sich nach Berechnung des Reederverbands<br />
um 15 bis 20 Prozent, also durchaus<br />
um einen hohen einstelligen Millionenbetrag<br />
vert<strong>eu</strong>ern, vor allem wegen der<br />
aufwendigen Tankanlage.<br />
Die Rechnung der Reeder könnte jedoch<br />
schon im Januar 2015 zu anderen<br />
Ergebnissen führen. Dann treten nautische<br />
Abgasvorschriften in Kraft, die das<br />
Gasschiff zwar nicht direkt fördern, die<br />
Fahrt mit ölbasiertem Kraftstoff aber drastisch<br />
vert<strong>eu</strong>ern werden.<br />
Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation<br />
IMO (International Maritime<br />
Organization) hat Nord- und Ostsee zu<br />
einer „Emissions-Kontrollzone“ erklärt.<br />
Zwischen Ärmelkanal und Baltikum darf<br />
der Schwefelgehalt im Kraftstoff ab dem<br />
Jahr 2015 nicht mehr ein, sondern nur<br />
noch 0,1 Prozent betragen, höchstens.<br />
Schweröl ist damit praktisch aus dem<br />
Spiel; es bedarf eines wesentlich edleren<br />
Raffinats: Marinegasöl, chemisch vergleichbar<br />
mit dem Diesel für Autos und<br />
entsprechend t<strong>eu</strong>er.<br />
Das dreckige Schweröl kostet derzeit<br />
in den meisten Häfen etwa 600 US-Dollar<br />
pro Tonne, Marinegasöl über 900. Große<br />
Frachtschiffe verbrauchen in der Stunde<br />
bis zu zehn Tonnen, Fährschiffe etwa<br />
zwei. Für die Reeder, die seit 2008 in der<br />
Dauerkrise wirtschaften, ist der Schwerölbann<br />
ein Tiefschlag.<br />
„Da hätte mal einer auf die Preislisten<br />
schauen müssen“, sagt Hanns Conzen,<br />
Geschäftsführer der TT-Line, die sechs<br />
Fähren zwischen <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> und Skandinavien<br />
betreibt. Das IMO-Verdikt, das<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
auf Wunsch der Nord- und Ostseeanrainer,<br />
unter anderem <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s, zustande<br />
kam, sei „existenzbedrohend“, findet<br />
Conzen.<br />
Bei Fähren macht der Kraftstoff je nach<br />
Streckenlänge bis zur Hälfte der Betriebskosten<br />
aus, bei Frachtschiffen mehr als<br />
drei Viertel. Conzen rechnet mit Mehrkosten<br />
von 2,5 Millionen Euro pro Jahr<br />
und Schiff. Die muss er letztlich auf die<br />
Fahrpreise schlagen. Und seine wichtigste<br />
Fracht sind Lkw von Spedit<strong>eu</strong>ren, die sich<br />
auf der Stelle für den Landweg entscheiden,<br />
wenn der billiger ist.<br />
Das Rauchverbot im Fahrwasser könnte<br />
also eine höchst unerwünschte Nebenwirkung<br />
haben: die Rückverlagerung von<br />
Lkw-Verkehr vom Wasser auf die Straße.<br />
Ökologisch ist das nicht.<br />
Conzen sieht sich von der Verkehrs -<br />
politik im Stich gelassen. Seine Flotte ist<br />
noch relativ jung, und Fähren werden auf<br />
eine Lebenserwartung von gut 40 Jahren<br />
kalkuliert. Eine Nachrüstung von Gastechnik<br />
ist hier praktisch nicht möglich:<br />
kein Platz im Maschinenraum – Fährschiffe<br />
leben von größtmöglicher Ladefläche.<br />
Eine nachträgliche Tankinstallation wäre<br />
schier unbezahlbar.<br />
Für N<strong>eu</strong>bauschiffe, das bezweifelt<br />
auch Conzen nicht, wäre LNG die Lösung.<br />
Erdgas wird im Vergleich zu Rohöl<br />
seit langem billiger, und diese Entwicklung<br />
wird sich nach Einschätzung von<br />
Rohstoffexperten auch weiter fortsetzen.<br />
Der Preis für Flüssiggas liegt h<strong>eu</strong>te schon<br />
d<strong>eu</strong>tlich unter dem für das t<strong>eu</strong>re Marine -<br />
gasöl und nähert sich in manchen Regionen,<br />
beispielsweise in den USA, dem<br />
von Schweröl an.<br />
Zudem muss der Reeder, hat er einmal<br />
in LNG investiert, keine weiteren Aktionspläne<br />
oder sonstige Umweltinitiativen gegen<br />
ungewollte Stoffe im Abgas fürchten.<br />
Marinegasöl jedoch rußt. Emittiert Stickoxide.<br />
Dagegen wird die Internationale<br />
Seeschifffahrts-Organisation in Zukunft<br />
gewiss auch noch vorzugehen wissen.<br />
Vor allem die Passagierschifffahrt würde<br />
profitieren vom Rußausstieg, da sie<br />
mit ihrem Abgas unmittelbar die Kunden<br />
schädigt. Der Naturschutzbund <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />
untersuchte kürzlich 20 Kr<strong>eu</strong>zfahrtschiffe,<br />
die in den kommenden Jahren<br />
vom Stapel laufen. Das Expertenurteil:<br />
„Aus gesundheitlichen Gründen ist zurzeit<br />
auf keinem einzigen Kr<strong>eu</strong>zfahrtschiff<br />
Urlaub ratsam.“<br />
Die am schlechtesten bewertete Aida<br />
Cruises setzte kürzlich immerhin ein Zeichen<br />
guten Willens und legte eine n<strong>eu</strong>e<br />
Schiffsgeneration auf Kiel: Die Touri-Kähne<br />
können auch mit Flüssiggas fahren.<br />
CHRISTIAN WÜST<br />
Video: So funktionieren die<br />
Erdgas-Motoren<br />
spiegel.de/app332013schiffe<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
129
Technik<br />
Eigenbau-Objekte Akkuschrauberantrieb, Luftkissensessel, Roboter-Bassist: Überall ruckelt, flackert und brummt es<br />
Ostereier von Hand bemalen? Das<br />
ist altes Denken. Tüftler bauen<br />
h<strong>eu</strong>te Roboter, die das besser können:<br />
Das Ei kommt in ein Gestell, dann<br />
senken sich maschinengelenkte Stifte auf<br />
die Schale und verzieren sie rundum akkurat<br />
mit Sprüchen oder Tierfigürchen.<br />
Vorbei auch die Zeiten, da Kinder ihr<br />
Bobbycar mit den Füßen voranschubsen<br />
mussten. Moderne Gefährte sind mit<br />
Akku schraubern motorisiert; wagemutige<br />
Piloten montieren auch schon mal ein<br />
kleines Düsentriebwerk unter den roten<br />
Plastikrenner.<br />
Solche Kreationen sind Bastlern n<strong>eu</strong>en<br />
Typs zu verdanken. Sie nennen sich Maker,<br />
zu d<strong>eu</strong>tsch: Macher, und sie zeigen<br />
ihre Werke gern auf eigenen Messen, die<br />
sie meist „Maker Faire“ nennen. Darin<br />
steckt, in altertümlicher Schreibung, das<br />
englische Wort für Jahrmarkt. Und so<br />
geht es auch zu: bunt, wuselig – und oft<br />
sogar ein wenig spektakulär, wenn etwa<br />
eine tragbare Blitzeschl<strong>eu</strong>der vorgeführt<br />
wird, gefertigt aus billigen Kondensatoren<br />
und dem Trafo eines alten Fernsehers.<br />
Beim Publikum findet der Bastler -<br />
rummel wachsenden Zuspruch. Zur Schau<br />
130<br />
ERFINDER<br />
Jahrmarkt der Schrauber<br />
Rockende Roboter, tragbare Blitzeschl<strong>eu</strong>dern und Bobbycars<br />
mit Düsenantrieb – dank Internet und billiger<br />
Elektronik wagen sich Bastler an ausgefallene Projekte.<br />
im kalifornischen San Mateo kamen im<br />
Mai mehr als 120000 Besucher. Nördlich<br />
davon, im Städtchen Sebastopol, sitzt das<br />
Zentralorgan der Bewegung, die Zeitschrift<br />
„Make“, die den Anstoß zum<br />
Boom gab. Maker Faires gibt es bereits<br />
in New York, in Rom, in Singapur – insgesamt<br />
rund hundert in diesem Jahr, annähernd<br />
doppelt so viele wie 2012.<br />
Und jetzt treten die Macher auch in<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> auf den Plan.<br />
Das Kongresszentrum in Hannover<br />
erlebte kürzlich die erste d<strong>eu</strong>tsche Maker-Messe.<br />
In der schwülheißen Glashalle<br />
fertigten 3-D-Drucker unentwegt Schüsselchen<br />
und Zahnräder, und computer -<br />
gest<strong>eu</strong>erte Kochtöpfe ließen Risotto anbrennen.<br />
Draußen auf dem Freigelände<br />
schwirrten Selbstbau-Drohnen, bekannt<br />
als Quadrocopter, durch die Luft. Und<br />
auf der Bühne zupfte ein rostiger Roboter -<br />
koloss mit wildem Gebaren die Bass -<br />
gitarre – eine ingeniös zusammengeschweißte<br />
Ausgeburt des Schrotthandels.<br />
Die Zahlen sind noch vergleichsweise<br />
bescheiden – 80 Stände, gut 4000 Besucher.<br />
Doch zeigt sich schon ein typisches<br />
Muster: Familien mit Kindern sind auf<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
solchen Messen auffallend stark vertreten.<br />
Denn überall ruckelt, flackert und<br />
brummt es. Wer hätte gedacht, dass die<br />
braven Bastler mit ihrem Gefrickel das<br />
Z<strong>eu</strong>g zur Volksbelustigung haben?<br />
Schrauber und Heimwerker alten<br />
Schlags könnten hier freilich nicht mithalten.<br />
Wer einfach nur seine Wohnung<br />
tapeziert oder einen Gartenteich anlegt,<br />
ist kein echter Maker – es sei denn, in<br />
der Tapete steckten blinkende Lämpchen<br />
und im Teich zögen Roboterfische mit<br />
Internet anschluss ihre Kreise.<br />
Gefragt sind n<strong>eu</strong>erdings Dinge, in denen<br />
elektronischer Witz steckt. Die nötige<br />
Hardware wird zum Glück immer billiger.<br />
Für kaum 30 Euro ist der beliebte<br />
Schaltbaustein Arduino zu haben. Er ist<br />
leicht zu programmieren, und er bietet<br />
Anschlüsse für Sensoren aller Art. Das<br />
genügt etwa für eine Alarmanlage, die<br />
anschlägt, wenn die Topfpflanzen zu verdorren<br />
drohen.<br />
Fürs gleiche Geld gibt es auch schon<br />
einen kompletten Minicomputer, den<br />
Raspberry Pi. Er ist ziemlich vielseitig<br />
und nicht größer als eine Kreditkarte. Der<br />
Brite Dave Akerman zum Beispiel fotografiert<br />
damit den Heimatplaneten aus<br />
40 Kilometer Höhe. Er stöpselt eine billige<br />
Kamera an den Rechenzwerg, hängt<br />
die Gerätschaften an einen Wetterballon,<br />
und dann geht es hinauf in die Stratosphäre.<br />
Die magische Universalmaschine der<br />
Maker aber ist der 3-D-Drucker, der entfernt<br />
einer schnöden Mikrowelle ähnelt.<br />
In seinem Innern wächst Schicht für<br />
Schicht aus hauchdünn geschmolzenem<br />
Plastik fast jede wünschbare Form heran.
Schlichte Drucker aus Hongkong gibt es<br />
bereits für weniger als 400 Euro.<br />
Andreas Wand von der hannoverschen<br />
3D Printergroup hat sich für seinen selbstkonstruierten<br />
Quadrocopter fast alle Teile<br />
ausgedruckt, die Füße gleich 20fach auf<br />
Vorrat, weil es mit den weichen Landungen<br />
nicht so klappt. „Wer will“, sagt er,<br />
„kann sich auch einfach fertige Fliegermodelle<br />
aus dem Internet herunterladen.“<br />
Nur die Elektronik fehlt dann noch.<br />
Das Internet ist die Plattform, auf der<br />
das Basteln eine n<strong>eu</strong>e Stufe erreicht. Der<br />
Maker werkt nicht mehr abgeschieden im<br />
Keller, er steht jetzt im globalen Austausch<br />
mit seinesgleichen.<br />
Das bef<strong>eu</strong>ert nicht zuletzt den Ehrgeiz.<br />
Quadrocopter baut ja h<strong>eu</strong>te schon jeder –<br />
warum also nicht mal ein echtes Flugz<strong>eu</strong>g?<br />
Und siehe da, ein „Maker Plane“<br />
ist bereits in Arbeit. Ein Team um den<br />
kanadischen Piloten und Ingeni<strong>eu</strong>r John<br />
Nicol entwickelt eine zweisitzige Sportmaschine,<br />
einschließlich aller Instru -<br />
mente, der St<strong>eu</strong>erelektronik und der nötigen<br />
Software. Freiwillige in aller Welt<br />
sind aufgerufen, Geld und Werkstücke<br />
beizutragen. Baupläne und Vorlagen stehen<br />
hinterher, wie üblich, jedem Bastler<br />
offen. Der Jungfernflug ist für das Jahr<br />
2015 geplant.<br />
Das Netz ermöglicht Projekte, die das<br />
Pensum des einzelnen Tüftlers bei weitem<br />
übersteigen. Aber auch im echten Leben<br />
schreitet die Vergesellschaftung des Bastelns<br />
voran: In etlichen Städten gibt es<br />
bereits offene Werkstätten, die sich „Maker<br />
Spaces“ oder „FabLabs“ nennen.<br />
Hier kommen Hacker und Tüftler zusammen,<br />
um gemeinsam Schmuckschatullen<br />
zu fräsen oder einen Kurs in Platinen -<br />
löten zu absolvieren.<br />
Legendär ist die weitläufige Werkstatt<br />
Noisebridge in San Francisco, früher eine<br />
Näherei, jetzt ein gerümpeliges Paradies<br />
für Bastler. Es gibt eine Bandsäge und<br />
mächtige Laserschneidemaschinen, dazu<br />
Oszilloskope und ein gestrandetes EEG-<br />
Messgerät, falls mal wer eine Idee dafür<br />
hätte. Jeder kann hier sein Ding machen.<br />
In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zeigen sich erste Blüten<br />
der Subkultur: ein „Eigenbaukombinat“<br />
in Halle an der Saale, eine „Dingfabrik“<br />
in Köln, eine Handvoll „FabLabs“ in<br />
München, Erlangen oder Aachen. Auch<br />
das hergebrachte Heimwerken findet hier<br />
seinen Platz – sofern es technischen Pfiff<br />
hat (Weihnachtssterne aus dem Laser-Cutter)<br />
oder originelle Materialien nutzt<br />
(Schmuck aus Elektronikabfall).<br />
Die verbreitete Vorliebe der Maker für<br />
Billiges, für Ausschuss und Recycling ist<br />
auch eine Antwort auf das Diktat der Warenwelt.<br />
Was andere wegwerfen, erweckt<br />
der Maker zu überraschendem Leben.<br />
Was für eine Funktion bestimmt ist, funktioniert<br />
er um.<br />
Eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber<br />
dem Ding ist sein stärkster Antrieb.<br />
Der Konsument zum Beispiel sieht nur<br />
einen Sessel und ein Laubgebläse; vorm<br />
inneren Auge des Makers aber hebt sich<br />
ein Luftkissenfahrz<strong>eu</strong>g vom Boden.<br />
Auf der Maker Faire in Hannover<br />
schwebte so ein Sessel mit Getöse übers<br />
Gelände. Sieben Schüler haben das famose<br />
Gefährt in den Ferien zusammengebaut<br />
– eine abent<strong>eu</strong>erliche Art des Lernens,<br />
die auch dem regulären Unterricht<br />
guttäte, findet der Pädagoge Berthold<br />
FOTOS: STEFAN THOMAS KROEGER / DER SPIEGEL<br />
Sommer vom Berufskolleg Rheine. In der<br />
Werkstatt dieser rührigen Berufsschule<br />
ist der Sessel entstanden – so wie zuvor<br />
schon ein Liegedreirad mit frei aufgehängtem<br />
Sitz, das die Piloten durch Gewichtsverlagerung<br />
st<strong>eu</strong>ern. Als Nächstes wollten<br />
die Schüler eine Art motorisiertes Skateboard<br />
bauen, sagt Sommer, „faltbar auf<br />
Aktentaschenformat“.<br />
In den USA hat die Bewegung ihren<br />
ersten Kinderstar hervorgebracht: Die<br />
zwölfjährige Sylvia Todd macht Bastelfilme<br />
für YouTube. Ihre Serie „Sylvia’s Super-Awesome<br />
Maker Show“ verzeichnet<br />
mehr als anderthalb Millionen Klicks. Das<br />
Mädchen führt da mit großem Elan vor,<br />
wie man giftig l<strong>eu</strong>chtende Glibbermasse<br />
aus Polymeren anrührt oder einen Kettenanhänger<br />
lötet, der dank eines Pulssensors<br />
im Takt des Herzschlags blinkt.<br />
Als Sylvia fünf war, nahm ihr Vater sie<br />
mit auf eine der ersten Maker Faires. Seither<br />
ist das Kind dem Werken verfallen.<br />
Für eine n<strong>eu</strong>e Produktidee sucht Sylvia<br />
Todd gerade Investoren auf dem Web -<br />
portal Kickstarter. Sie will einen Bausatz<br />
für einen Roboter vertreiben, der Vor -<br />
lagen aus dem Computer mit Wasser -<br />
farben auf Papier pinselt. US-Präsident<br />
Barack Obama höchstselbst ließ sich einen<br />
Prototyp von ihr vorführen. Der<br />
Roboter malte ihm ein Aquarell des Weißen<br />
Hauses.<br />
Bei all der Bastelfr<strong>eu</strong>de gilt: Der Gebrauchswert<br />
ist ein schöner Nebeneffekt,<br />
aber es kommt nicht darauf an. Umso<br />
wunderlicher, was manche Visionäre in<br />
der Schrauberbewegung zu erkennen<br />
glauben. Von der „n<strong>eu</strong>en industriellen<br />
Revolution“ spricht der amerikanische<br />
Bestsellerautor Chris Anderson in seinem<br />
Buch „Makers“: Bald würden die L<strong>eu</strong>te<br />
nahezu alles, was sie brauchen, im heimischen<br />
3-D-Drucker herstellen.<br />
Bislang sieht es noch nicht danach aus.<br />
Auch die Maker von der 3D Printergroup<br />
in Hannover sind eher skeptisch. „Da werden<br />
überhöhte Erwartungen geweckt“,<br />
sagt Hobbydrucker Uwe Schmidt.<br />
Wer auf Online-Plattformen wie etwa<br />
Thingiverse.com nach digitalen Druckvorlagen<br />
stöbert, findet keine Bürolocher<br />
oder Ersatztrommeln für die Waschmaschine.<br />
So etwas können 3-D-Drucker<br />
noch lange nicht; das Material hält den<br />
Anforderungen nicht stand. Stattdessen:<br />
Drachenköpfe, Handyschalen, Armreife.<br />
Die Maker sind schon froh, wenn gelegentlich<br />
der Batteriedeckel der Fernbedienung<br />
kaputtgeht oder die Tochter sich<br />
einen Hockeyschläger für die Barbie-Puppe<br />
wünscht – das sind dann mal seriöse<br />
Aufträge.<br />
Aber sonst? Vasen, Teelichthalter,<br />
Zahnräder. Macht Spaß, braucht keiner.<br />
Die Bastler selbst, sagt Uwe Schmidt, hätten<br />
für ihre Werke einen Gattungsbegriff:<br />
„Sachen, die herumstehen“.<br />
MANFRED DWORSCHAK<br />
DER SPIEGEL 33/2013 131
Jungmediziner in Hannover: Das Kind verdreht die Augen, schreit vor Schmerzen<br />
PICTURE-ALLIANCE / DPA<br />
KRANKENHÄUSER<br />
Todesspritze<br />
vom Azubi<br />
Ein Medizinstudent bringt<br />
versehentlich einen<br />
Säugling um. Trifft seine<br />
Ausbilder in der<br />
Klinik eine Mitschuld?<br />
Am Morgen des 22. August 2011 bekommt<br />
der kleine Skerdilaid eine<br />
Spritze, die er nicht verträgt. Der<br />
zehn Monate alte Säugling, der im Evangelischen<br />
Krankenhaus in Bielefeld wegen<br />
L<strong>eu</strong>kämie behandelt wird, verdreht<br />
um 8.47 Uhr die Augen, schreit vor<br />
Schmerzen und hat plötzlich blaue Flecken<br />
an den Beinen.<br />
Die Ärzte versuchen, den Jungen zu<br />
retten. Doch gegen 11.15 Uhr sind Skerdilaids<br />
Pupillen laut Arztbericht „weit und<br />
lichtstarr“, etwas später werden die Eltern<br />
dazugebeten, um Abschied zu nehmen.<br />
Um 12.28 Uhr stirbt ihr Sohn an<br />
den Folgen eines allergischen Schocks.<br />
Der Schuldige scheint schnell gefunden:<br />
ein Student aus Münster, der gerade sein<br />
Praktisches Jahr (PJ) – den letzten Stu -<br />
dienabschnitt – an der Klinik absolviert.<br />
Der damals 29 Jahre alte Mediziner hatte<br />
die verhängnisvolle Spritze verabreicht.<br />
Er hätte das milchige Medikament nicht<br />
in Skerdilaids Venenkatheter injizieren<br />
dürfen, sondern es ihm nach und nach in<br />
den Mund träufeln müssen. „Ein Blackout“,<br />
sagt Chefarzt Johannes Otte, „ein<br />
Fehler, der nicht hätte passieren dürfen.“<br />
Doch trifft den Studenten wirklich die<br />
alleinige Schuld? Er wurde zwar in erster<br />
Instanz wegen fahrlässiger Tötung zu ei-<br />
132<br />
ner Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt.<br />
Doch im derzeit laufenden Berufungsprozess<br />
am Landgericht Bielefeld,<br />
der in dieser Woche mit einer milderen<br />
Strafe für den Jungmediziner zu Ende gehen<br />
dürfte, wird eines immer d<strong>eu</strong>tlicher:<br />
wie schlecht manche PJler hierzulande<br />
angeleitet und kontrolliert werden.<br />
„Viele Ärzte haben unter einem zunehmenden<br />
Kosten- und Effizienzdruck nicht<br />
mehr die Zeit, sich intensiv um die PJler<br />
zu kümmern“, sagt Bernhard Marschall.<br />
Der Studiendekan der medizinischen Fakultät<br />
Münster, der im Prozess als Sachverständiger<br />
auftrat, wirft dem Bielefelder<br />
Krankenhaus Organisationsmängel<br />
vor. Der Student aus Münster sei am<br />
22. August erst seit wenigen Tagen auf<br />
dieser Station gewesen und wohl unzureichend<br />
instruiert worden.<br />
„Es wurde uns während der Aus -<br />
bildung sehr viel Verantwortung über -<br />
tragen“, bilanzierte ein Ex-Kommilitone<br />
und ehemaliger PJler, der ebenfalls als<br />
Z<strong>eu</strong>ge gehört wurde. Nachfragen seien<br />
eher unerwünscht gewesen, außerdem<br />
habe bei der Arbeit oft die Maxime gegolten:<br />
learning by doing.<br />
Klar ist, dass der münstersche Medizinstudent<br />
falsche Schlüsse zog, als er dem<br />
krebskranken Skerdilaid Blut abnahm<br />
und eine Schwester die verhängnisvolle<br />
Spritze auf den Nachttisch legte. Ihm kam<br />
nicht in den Sinn, das Medikament oral<br />
zu verabreichen. Stattdessen reimte er<br />
sich zurecht, dass der Inhalt durch den<br />
Venenkatheter zu injizieren sei. Schließlich<br />
hatte die Spritze keine Nadel und<br />
passte genau in die Öffnung des Katheters.<br />
In Fachkreisen sei diese Verwechslungsgefahr<br />
schon lange gefürchtet, schreibt<br />
der Münchner Kinderarzt Reinhard Roos,<br />
ein von der Verteidigung bestellter Gutachter.<br />
Gerade in einem Lehrkrankenhaus<br />
müsse auf Risiken aufmerksam gemacht<br />
werden.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Zu den Hauptaufgaben der PJler zählt<br />
es in manchen Häusern, Medikamente zu<br />
geben. Offenbar fühlen sich aber längst<br />
nicht alle sicher dabei: Laut einer Umfrage<br />
der Universität Magdeburg würden<br />
Medizinstudenten gern mehr darüber<br />
wissen, wie sich Behandlungsfehler vermeiden<br />
lassen.<br />
Eine Befragung von etwa 300 Medizinstudenten<br />
in Münster ergab, dass viele<br />
von ihnen Medikamente ohne das nötige<br />
Wissen um Nebenwirkungen und Risiken<br />
verabreichen. Etwa 80 Prozent der befragten<br />
PJler handelten nach eigenen Angaben<br />
ohne Aufsicht, wenn sie Arzneien<br />
verabreichten. Werden bestimmte Mittel<br />
jedoch zu schnell mit einer Spritze injiziert,<br />
kann der Patient einen Herzstillstand<br />
erleiden.<br />
Die Ausbilder scheinen den jungen<br />
Mitarbeitern noch weit mehr zuzutrauen,<br />
als Spritzen zu setzen und Blut abzu -<br />
nehmen. Etwa 50 Prozent der in Münster<br />
befragten Studenten berichteten, dass<br />
ihre Befunde während der Trainings -<br />
phasen im Krankenhaus nur selten überprüft<br />
würden.<br />
Selbst Eingangsbefragungen, sogenannte<br />
Anamnesen, würden regelmäßig vollständig<br />
von den PJlern übernommen, berichtet<br />
Studiendekan Marschall. Dabei<br />
handle es sich hier um „originäre ärztliche<br />
Aufgaben“ – schließlich würden auf ihrer<br />
Grundlage auch Therapien beschlossen.<br />
Wie viele schwerwiegende Pannen den<br />
Nachwuchsärzten passieren, weist die Behandlungsfehlerstatistik<br />
der Bundesärztekammer<br />
nicht gesondert aus. Der Fall des<br />
kleinen Skerdilaid wurde durch einen an -<br />
onymen Brief bekannt, der nach dem tödlichen<br />
Vorfall an verschiedene Medien geschickt<br />
wurde. Die Eltern des Jungen sind<br />
bis h<strong>eu</strong>te in psychotherap<strong>eu</strong>tischer Behandlung.<br />
Gegenüber Ermittlern sagte die<br />
Mutter, sie verstehe nicht, dass ein krebskrankes<br />
Kind einem Praktikanten anvertraut<br />
worden sei. GUIDO KLEINHUBBERT
Trends<br />
Medien<br />
ZDF<br />
Flucht als Event<br />
Die ZDF-Sendung „Auf der Flucht“, in<br />
der Prominente Flüchtlingsschicksale<br />
simulieren, stößt auf Kritik bei Hilfsverbänden.<br />
In der Doku-Soap reisen<br />
unter anderem das Model Mirja du<br />
Mont und der ehemalige Böhse-Onkelz-<br />
Sänger Stephan Weidner in Teams<br />
nach Eritrea oder in den Irak. Sie sollen,<br />
so die Sendereigenwerbung, „am<br />
eigenen Leib“ erfahren, „was es heißt,<br />
auf der Flucht zu sein“. Pro Asyl kritisiert<br />
nun das am vergangenen Donnerstag<br />
auf ZDFneo zum ersten Mal ausgestrahlte<br />
Format. Es sei „in erster Linie<br />
darauf ausgerichtet, aus der Flucht ein<br />
Event zu machen“. Es stehe „ganz klar<br />
das Abent<strong>eu</strong>er im Vordergrund und<br />
nicht die Information“, so eine Vereinssprecherin. Den Teilnehmern<br />
sei zudem „gar nicht wirklich bewusst, auf was sie<br />
sich da eingelassen haben“, heißt es weiter. „Es wird als ein<br />
Erlebnis wahrgenommen und auch als solches verkauft.“<br />
Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen<br />
UNHCR, das die Macher vor der Sendung beraten hat, findet<br />
Du Mont (l.)<br />
das Format und die Umsetzung „fragwürdig“. Inhaltlich<br />
sei jedoch alles korrekt, so ein UNHCR-Sprecher. Zudem<br />
hat sich nach der Ausstrahlung im Internet eine Protest -<br />
bewegung gebildet. Sie fordert die „sofortige Absetzung“,<br />
eine entsprechende Online-Petition fand bereits mehrere<br />
tausend Unterstützer.<br />
JONAS DRESS / ZDF<br />
PARLAMENTSFERNSEHEN<br />
Bundestag<br />
sendet schwarz<br />
Der D<strong>eu</strong>tsche Bundestag verstößt mit<br />
seinem Parlamentsfernsehen gegen medienrechtliche<br />
Vorgaben. Zwei Kanäle<br />
werden von der Volksvertretung verbreitet:<br />
Kanal 1 wird über Satellit und<br />
das Berliner Kabelnetz ausgestrahlt,<br />
der zweite Sender kann ausschließlich<br />
über das Internet empfangen werden –<br />
und enthält auch redaktionelles Programm.<br />
Deshalb braucht der Bundestag<br />
hierfür eine Fernsehlizenz. Die würde<br />
er allerdings nicht bekommen, denn<br />
st<strong>eu</strong>erfinanzierte Sender sind<br />
in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> nicht vorgesehen.<br />
Den D<strong>eu</strong>tschen Bundestag<br />
kümmern solche gesetz -<br />
lichen Vorgaben bisher wenig.<br />
Der Kanal 2 sei nicht im TV<br />
verfügbar, heißt es in einer<br />
Stellungnahme. Wenn keine<br />
Ausschusssitzungen über -<br />
tragen würden, liefen zudem<br />
„in einem Loop Videos aus<br />
der Internet-Mediathek“.<br />
Doch ob die Filme nun aus<br />
einer Mediathek oder anderswoher<br />
kommen, spielt bei<br />
der Bewertung der Rechtmäßigkeit<br />
keine Rolle, sie dürfen nicht im Rahmen<br />
von Livestreams gesendet werden.<br />
„Wir haben mit dem Bundestag Gespräche<br />
aufgenommen“, sagt Jürgen<br />
Brautmeier, derzeit Vorsitzender der<br />
Direktorenkonferenz der Landes -<br />
medienanstalten. Nun sollen redaktionelle<br />
Elemente wie etwa Magazin -<br />
beiträge auf Abrufangebote umgestellt<br />
werden. „Dann ist es medienrechtlich<br />
unbedenklich“, sagt Brautmeier. Im<br />
Jahr 2012 produzierte der Bundestag<br />
768 Stunden Programm, 505 Stunden<br />
waren Übertragungen von Plenarsitzungen.<br />
Wie viele L<strong>eu</strong>te das Programm<br />
wirklich verfolgen, kann der Bundestag<br />
nicht sagen: Die Zuschauerzahl über<br />
Kabel und Satellit wird nicht gemessen.<br />
Bundestagsdebatte<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
MICHAEL KAPPELER / DPA<br />
ARD<br />
Foodwatch will<br />
Kanzler-Talk stoppen<br />
Die Verbraucherschutzorganisation<br />
Foodwatch versucht per Anzeige beim<br />
Rundfunkrat, die Ausstrahlung zweier<br />
Talkshows mit Kanzlerin Angela<br />
Merkel und deren Herausforderer Peer<br />
Steinbrück bei Phoenix und im <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>funk<br />
zu verhindern. Die Gespräche<br />
in der Reihe „Forum Politik“ werden<br />
aus der Hauptstadt repräsentanz<br />
der D<strong>eu</strong>tschen Bank gesendet. Foodwatch<br />
sieht darin ein Sponsoring<br />
von Sendungen zur politischen Information,<br />
das der Rundfunkstaatsvertrag<br />
verbietet. „Wir wollen ein Zeichen<br />
setzen gegen demokratieschädliches<br />
Lobbying“, sagt Foodwatch-Chef<br />
Thilo Bode. Eine Phoenix-Sprecherin<br />
wies die Kritik zurück. Ein Sendungssponsoring<br />
im Sinne des Rundfunkstaatsvertrags<br />
liege nicht vor. Um dem<br />
„Anschein unzulässiger Unterstützung<br />
durch Dritte entgegenzuwirken“,<br />
werden die Sender jedoch sicherstellen,<br />
dass das Logo der Bank nicht gezeigt<br />
wird. Zudem lassen sie sich die<br />
Bewirtung nun nicht mehr wie geplant<br />
von der D<strong>eu</strong>tschen Bank bezahlen.<br />
133
Präsident Putin, Chefredakt<strong>eu</strong>rin Simonjan im Studio von Russia Today in Moskau: „Monopol der angelsächsischen Medien brechen“<br />
AFP<br />
TV-KANÄLE<br />
Krieg der Bilder<br />
Mit dem Auslandssender Russia Today hat Kreml-Chef Wladimir Putin<br />
fürs westliche Publikum ein Anti-CNN geschaffen.<br />
Das Rezept: Stimmungsmache, Sex-Appeal und viel Geld.<br />
134<br />
Das politische Abendprogramm<br />
startet gern mit einer Mischung<br />
aus Amoklauf und Boulevard.<br />
Abby Martin, amerikanische Moderatorin<br />
im Dienste des Kreml, hat den Mund<br />
leicht geöffnet und trägt erst einmal roten<br />
Lippenstift auf, der zu ihrem schwarzen<br />
Top, den High Heels und dem Tattoo am<br />
Fußgelenk passt. Dann holt sie mit einem<br />
Vorschlaghammer aus und zertrümmert<br />
einen Fernseher, auf dem gerade CNN<br />
läuft, das amerikanische Vor- und Feindbild<br />
ihres Arbeitgebers, des russischen<br />
Auslandsfernsehsenders Russia Today.<br />
Dieser Vorspann der Sendung soll wohl<br />
vor allem illustrieren: Russland ist offensiv,<br />
aufklärerisch und sieht auch noch gut<br />
aus dabei.<br />
Die Regie wirft ein Foto von Edward<br />
Snowden an die Studiowand, dem<br />
Whistle blower, den die USA jagen. Es<br />
folgt ein Bericht über das Lager Guantanamo,<br />
das Amerika in Verruf gebracht<br />
hat. Die Vorlagen, die Amerika seinen<br />
Gegnern liefert, verwertet Russia Today<br />
gern und ausdauernd. Auch Washingtons<br />
kleinere Sünden bleiben nicht unbemerkt.<br />
So schafft es auch ein Mann<br />
namens Ali Bongo Ondimba in die<br />
Sendung, Gabuns Diktator, der von Barack<br />
Obama unterstützt wird.<br />
Kritik an der selbst -<br />
ernannten Weltmacht<br />
Nummer eins, das wollen<br />
auch im Westen viele<br />
Menschen sehen. In US-<br />
Großstädten wie San Francisco,<br />
Chicago und New<br />
York ist Russia Today<br />
mittlerweile erfolgreicher<br />
als jeder andere Auslandssender.<br />
In Washington<br />
schauen 13-mal so<br />
viele Menschen das Programm<br />
der Russen wie<br />
das der D<strong>eu</strong>tschen Welle.<br />
Zwei Millionen Briten<br />
gucken regelmäßig den<br />
Kreml-Kanal. Vor allem<br />
im Netz ist kein Konkurrent<br />
erfolgreicher. Im<br />
Juni durchbrach Russia<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Talkmaster King<br />
In illustrer Gesellschaft<br />
Today bei YouTube die Schallmauer von<br />
einer Milliarde Video-Abrufen – als erste<br />
TV-Station überhaupt.<br />
Noch größer ist der Triumph, den eine<br />
Legende des amerikanischen TV-Jour -<br />
nalismus dem Sender bescherte.<br />
Seit diesem Sommer<br />
arbeitet auch Larry<br />
King für Russia Today.<br />
King war vorher 25 Jahre<br />
lang das Gesicht von<br />
CNN. Seine Hosenträger<br />
sind noch markanter als<br />
Abby Martins Lippen-Bekenntnisse.<br />
„Der Doyen<br />
der amerikanischen Talkshows<br />
läuft zu den Russen<br />
über“, schrieb die<br />
Londoner „Times“.<br />
Der Auftrag an King<br />
und seine n<strong>eu</strong>en Kollegen<br />
ist schlicht: Sie sollen<br />
GETTY IMAGES<br />
„das Monopol der angelsächsischen<br />
Massenmedien<br />
brechen“, sagte Präsident<br />
Wladimir Putin
Medien<br />
Nachrichtenmoderatorin Martin: Smarter war Propaganda selten<br />
vor einigen Wochen bei einem Studio -<br />
besuch. Das Erfolgsrezept der Russen hat<br />
drei Zutaten: der für einen Nachrichtenkanal<br />
bisher untypische Einsatz von Sex-<br />
Appeal, ein stramm antiamerikanischer<br />
Kurs und ein nie versiegender Geldstrom<br />
aus dem Kreml.<br />
Seit 2005 hat Russlands Regierung das<br />
jährliche Budget des Kanals von 30 Millionen<br />
auf über 300 Millionen Dollar verzehnfacht.<br />
Damit bezahlt Russia Today<br />
2500 Mitarbeiter und Helfer weltweit, 100<br />
davon allein in Washington. Etatkürzungen<br />
muss der Kanal nicht fürchten: Putin<br />
hat sie seinem Finanzminister per Dekret<br />
verboten.<br />
Die Moskauer Führung sieht ihr Geld<br />
„gut investiert“, sagt Natalja Timakowa,<br />
die Sprecherin von Premierminister Dmitrij<br />
Medwedew. „Russia Today ist überdies<br />
– die D<strong>eu</strong>tschen mögen mir diese Bemerkung<br />
verzeihen – um einiges moderner<br />
als beispielsweise die D<strong>eu</strong>tsche Welle,<br />
hat aber auch mehr Geld.“<br />
Viel Geld hat die Regierung auch in<br />
die n<strong>eu</strong>e Sendezentrale im Nordosten der<br />
Hauptstadt gesteckt, die Russia Today im<br />
Mai bezogen hat. Wie viele Millionen genau,<br />
das mag der Sender nicht sagen, man<br />
habe sich zu Vertraulichkeit verpflichtet.<br />
Auf dem Areal einer ehemaligen sowje -<br />
tischen Teefabrik entstehen neben dem<br />
englischen Dienst nun Sendungen auf<br />
Arabisch und Spanisch. Die Abendnachrichten<br />
drehen sich um die Krise des Euro,<br />
Sozialproteste in Portugal und den NSA-<br />
Überwachungsskandal. Der Sender versteht<br />
sich als Vorkämpfer einer westkritischen,<br />
globalen Gegenöffentlichkeit.<br />
Russia Today soll wie ein Verstärker für<br />
die Selbstzweifel von Europäern und Ame -<br />
rikanern wirken, die sich derzeit fragen<br />
müssen, ob ihre Staaten womöglich ähnlich<br />
korrupt und von Geheimdiensten unterwandert<br />
sind wie Russland und China.<br />
Smarter war Propaganda jedenfalls selten.<br />
Der Altersdurchschnitt der russischen<br />
Redakt<strong>eu</strong>re liegt unter 30 Jahren, fast jeder<br />
spricht fließend Englisch. Nachrichtensendungen<br />
motzt die Regie schon mal<br />
auf mit Spezialeffekten wie aus Hollywood.<br />
Dem Moderator scheint dann ein<br />
vom Computer animierter Panzer fast<br />
über die Füße zu rollen. Israelische Kampfflugz<strong>eu</strong>ge<br />
drehen virtuell eine Runde<br />
durchs Studio, bevor sie ihre Bomben<br />
über einer syrischen Landkarte abwerfen.<br />
Die optische Aufrüstung hat Methode.<br />
Der Sender sieht sich als mediales Verteidigungsministerium<br />
des Kreml.<br />
Die Frau, die Russia Today zur schärfsten<br />
Waffe Russlands im Kampf um die<br />
Meinung der Weltöffentlichkeit geformt<br />
hat, sitzt im siebten Stock der Moskauer<br />
Zentrale. Im Büro von Chefredakt<strong>eu</strong>rin<br />
Margarita Simonjan flimmert ein Dutzend<br />
Bildschirme. Auf ihrem Schreibtisch<br />
stehen orthodoxe Ikonen. Putin hat Simonjan<br />
2005 zur Chefin des n<strong>eu</strong>en Senders<br />
gemacht. Damals war sie 25 Jahre<br />
alt und wurde belächelt als unbekannte<br />
Reporterin aus dem Journalistentross, der<br />
den Kreml-Herrn bei Terminen begleitet.<br />
Simonjan soll verhindern, dass Russland<br />
noch einmal einen Krieg der Bilder<br />
verliert wie im August 2008. Damals rückten<br />
Moskaus Panzer in den Südkaukasus<br />
vor, bis kurz vor Tiflis, die Hauptstadt<br />
des kleinen Georgien. Auf allen Kanälen<br />
verdammte der junge Staatschef Micheil<br />
Saakaschwili – eloquent und in Amerika<br />
ausgebildet – Russland als Aggressor. Dabei<br />
hatte er selbst den Krieg provoziert<br />
und als Erster den Befehl zum Sturm auf<br />
die mit Russland verbündete Separatisten -<br />
republik Südossetien gegeben.<br />
CNN zeigte Bilder zerstörter Häuser,<br />
angeblich aufgenommen nach einem russischen<br />
Bombenangriff auf die georgische<br />
Provinzstadt Gori. In Wahrheit, so Russia<br />
Today, seien es Aufnahmen der Separatistenhauptstadt<br />
Zchinwali nach einem<br />
Angriff der Georgier gewesen. „Objektivität<br />
gibt es nicht“, sagt Simonjan h<strong>eu</strong>te<br />
nüchtern, „nur Annäherungen an die<br />
Wahrheit durch möglichst viele unterschiedliche<br />
Stimmen.“<br />
Auch in den USA ist das Misstrauen in<br />
die eigenen Medien so groß wie nie zuvor.<br />
CNN kämpft gegen einen massiven Zuschauerschwund.<br />
Und manchmal macht die<br />
US-Politik den Russen ihre Angriffe auch<br />
einfach: Als Boliviens Präsident Evo Morales<br />
in Wien zur Landung gezwungen wurde,<br />
weil US-Geheimdienste Snowden an<br />
Bord seiner Maschine vermuteten, sprach<br />
Abby Martin aus, was viele denken: „Wer,<br />
zum T<strong>eu</strong>fel, glaubt Obama, dass er ist?“<br />
Doch zugleich setzt Russia Today auf<br />
ein wüstes Gemisch von Verschwörungstheorien<br />
und plumper Stimmungsmache.<br />
In der Sendung „The Truthseeker“ mutiert<br />
das Attentat auf den Boston-Marathon,<br />
bei dem im April zwei Tschetschenen<br />
drei Menschen mit Bomben töteten,<br />
zu einem Komplott der US-Behörden.<br />
Berlin-Korrespondent Peter Oliver bezichtigt<br />
absurderweise das ZDF der Bestechung.<br />
Der Sender habe Intellektuellen<br />
Geld gezahlt, damit sie fr<strong>eu</strong>ndliche<br />
Worte für die Anti-Putin-Gruppe Pussy<br />
Riot fänden. Als Kronz<strong>eu</strong>gen befragt er<br />
den Chefredakt<strong>eu</strong>r von „Zuerst!“, einem<br />
Blättchen d<strong>eu</strong>tscher Rechtsextremer.<br />
Das ist die Gesellschaft, in die sich auch<br />
die Talk-Legende Larry King begeben hat.<br />
Im Jahr 2000 hat er das erste große Gespräch<br />
im westlichen Fernsehen mit Wladimir<br />
Putin geführt. Seitdem schwärmt<br />
der Talkmaster vom Charisma des Russen:<br />
Putin habe Qualitäten, „die einen<br />
Raum ändern, einen Magnetismus“.<br />
Kings n<strong>eu</strong>e Show läuft seit Juni bei Russia<br />
Today. New Yorks ehemaliger Bürgermeister<br />
Rudy Giuliani war schon zu Gast<br />
und Ex-Senator Joe Lieberman, beides<br />
Männer, die sonst nie einen Fuß in ein<br />
russisches Studio setzen würden.<br />
Abby Martin, die Frau mit dem Hammer,<br />
hatte ihren n<strong>eu</strong>en Kollegen King<br />
kürzlich in ihrer eigenen Show zu Gast.<br />
Ob er CNN nicht auch für hoffnungslos<br />
parteiisch halte, wollte sie wissen. Nein,<br />
sagte King, das sehe er nicht so. Dann<br />
regte er sich über Journalisten wie Martin<br />
auf, die Gäste benutzten als „Requisite<br />
für die eigene Meinung“. Dass er genau<br />
das in Putins Sender nun selbst ist, eine<br />
Requisite und eine Trophäe, das hat der<br />
große Larry King möglicherweise noch<br />
nicht begriffen.<br />
BENJAMIN BIDDER<br />
DER SPIEGEL 33/2013 135
Szene<br />
Sport<br />
SURFEN<br />
Exot aus Germany<br />
Die Atlantikküste Frankreichs ist das beliebteste<br />
Reiseziel für d<strong>eu</strong>tsche Surftouristen.<br />
Vor allem in den Monaten Juli und August<br />
zieht es sie zu Tausenden an die Strände von<br />
Biarritz, Hossegor oder Lacanau. Den Traum<br />
vom perfekten Brecher können sich die<br />
Pilger in der Regel aber abschminken. Im<br />
Sommer herrschen an den <strong>eu</strong>ropäischen Küsten<br />
wegen des vergleichbar ruhigen Wetters<br />
auf der Nordhalbkugel die schlechtesten Wellenbedingungen.<br />
Surfer, die sich auskennen,<br />
reisen in dieser Zeit nach Indonesien oder<br />
Südafrika. Oder, wie der d<strong>eu</strong>tsche Profi<br />
Nicolau von Rupp, der in der Nähe von Lissabon<br />
lebt, an die Pazifikküste Mexikos. In<br />
Pascuales, einem Revier in der Nähe der<br />
Stadt Manzanillo, startete der 23-Jährige<br />
beim Pawa Tube Festival. Einige der besten<br />
Hardcore-Surfer der Welt hatten sich zu dem<br />
Wettkampf versammelt. Am Ende gewann<br />
der Exot aus Germany, der die Jury mit atemberaubenden<br />
Ritten überz<strong>eu</strong>gte. 7000 Dollar<br />
kassierte Rupp für den Sieg, von Experten<br />
wird er nun als Surfer einer „n<strong>eu</strong>en Gene -<br />
ration“ gefeiert. Ab September wird Rupp<br />
sein Können wieder an den Küsten Portugals<br />
zur Schau stellen. Dann beginnt in Europa<br />
die Wellensaison.<br />
Surfprofi Rupp in Mexiko<br />
Rupp bei der Siegerehrung<br />
PAWA<br />
PAWA<br />
RADSPORT<br />
Rasierte Waden<br />
Schwimmer gleiten schneller durchs<br />
Wasser, wenn sie am ganzen Körper<br />
rasiert sind, das hat eine Untersuchung<br />
der Ruhr-Universität Bochum erwiesen.<br />
Radprofis rasieren sich Arme und<br />
Beine, weil Massageöl leichter in glatte<br />
Haut einzieht und nach einem Sturz<br />
die Wunde besser zu reinigen ist. Bei<br />
den Jedermann-Rennen, wie etwa<br />
Ende August in Hamburg, eifern viele<br />
Hobbyfahrer ihren Vorbildern nach<br />
und starten mit haarlosen Waden und<br />
Schenkeln – offenbar weil sie meinen,<br />
so aerodynamischer zu sein. Diverse<br />
Internetforen befassen sich mit dem<br />
Thema. Beim Radfahren werden 60 bis<br />
70 Prozent des Luftwiderstands durch<br />
Radrennfahrer in Hamburg<br />
ROTH / AUGENKLICK / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
den eigenen Körper verursacht, da<br />
macht es auf den ersten Blick Sinn, die<br />
Windschnittigkeit durch eine Rasur zu<br />
verbessern. Sie bringt nur so gut wie<br />
nichts. Chester Kyle, ein amerikanischer<br />
Professor für Maschinenbau, hat<br />
errechnet, dass rasierte Beine bei einem<br />
Zeitfahren über 40 Kilometer mit<br />
Tempo 37 einen aerodynamischen<br />
Vorteil von 0,6 Prozent ausmachen.<br />
Bei einer Fahrzeit von einer Stunde<br />
und fünf Minuten entspricht das einem<br />
Zeitgewinn von fünf Sekunden.<br />
Wer auf die Trinkflasche inklusive<br />
Halterung verzichten würde, wäre<br />
26 Sekunden schneller im Ziel, wer<br />
sich vorn ein Scheibenrad leisten kann,<br />
macht immerhin 66 Sekunden gut.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 137
PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Einmarsch der westd<strong>eu</strong>tschen Olympiamannschaft 1972 ins Münchner Stadion, Funktionär Bach: Ist die Republik noch immer vers<strong>eu</strong>cht?<br />
KAI-UWE WÄRNER / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
138<br />
DER SPIEGEL 33/2013
Sport<br />
SPORTPOLITIK<br />
Weggucken, wegducken<br />
Der Aufschrei über das Dopingsystem der alten Bundesrepublik zeigt:<br />
Vielen Politikern und Funktionären fehlt das Interesse daran, die<br />
Vergangenheit aufzuklären und den Betrug von h<strong>eu</strong>te konsequent zu bekämpfen.<br />
Ein einziger Tag im September 2011<br />
hätte genügt, um im d<strong>eu</strong>tschen<br />
Sport ein Beben auszulösen. Damals<br />
präsentierten Historiker aus Berlin<br />
und Münster der Presse, was sie über den<br />
Betrug im westd<strong>eu</strong>tschen Sport erforscht<br />
hatten. Zwei Jahre lang hatten sie Archive<br />
durchforstet und Zeitz<strong>eu</strong>gen befragt, das<br />
Ergebnis war ein Bild des Schreckens: Vor<br />
der Wende existierte in der Bundesre -<br />
publik ein umfassendes Dopingsystem,<br />
betrieben von Sportärzten, gedeckt von<br />
Funktionären, gefördert vom Staat.<br />
Am selben Tag, dem 26. September,<br />
beschrieb der SPIEGEL (39/2011) auf fünf<br />
Seiten, was der damalige Zwischenbericht<br />
der Forscher im Detail enthielt. Es<br />
ging um kriminelle Energie und<br />
Cliquenwirtschaft, um medaillenhungrige<br />
Politiker, die im Kalten<br />
Krieg mit der DDR mithalten<br />
wollten, um rücksichtslose<br />
Mediziner und missbrauchte<br />
St<strong>eu</strong>ermillionen, um eine ganze<br />
Menge also, was einen Aufschrei<br />
hätte auslösen können.<br />
Es passierte: fast nichts. Die<br />
Resonanz unter Politikern, Funktionären<br />
und in der Öffentlichkeit<br />
blieb verhalten. Es überraschte<br />
wohl niemanden mehr, dass auch<br />
im Westen gedopt worden war, anders<br />
organisiert als im Osten, klüngelhafter,<br />
aber ebenfalls systematisch.<br />
Nun, im zweiten Anlauf, kommt es<br />
doch noch zu dieser Empörung. Am<br />
Samstag vor einer Woche berichtete die<br />
„Südd<strong>eu</strong>tsche Zeitung“ über die Studie;<br />
inhaltlich N<strong>eu</strong>es war darin kaum zu finden,<br />
allerdings stellte sich nun heraus,<br />
dass seit März 2012 ein rund 800 Seiten<br />
dicker Abschlussbericht der Berliner Forschergruppe<br />
existiert – ohne veröffentlicht<br />
worden zu sein. Sollte das Konvolut<br />
im Keller verstauben?<br />
Der Verdacht liegt nahe, da solle etwas<br />
vertuscht werden, weil es einigen nicht<br />
in den Kram passt. Das hat die Aufregung<br />
ebenso entfacht wie die Tatsache, dass<br />
die Studie ältere Erkenntnisse bestätigt<br />
und das Bild erweitert, strukturiert und<br />
zusammenfügt. Schon 1991, kurz nach<br />
der Wende und während der Enthüllungen<br />
um den DDR-Sport, war zum Beispiel<br />
eine Untersuchungskommission des<br />
D<strong>eu</strong>tschen Sportbundes Hinweisen auf<br />
der Spur, die stark an der Saga vom sauberen<br />
Westen kratzten.<br />
N<strong>eu</strong>e Fragen werden nun gestellt:<br />
Wenn damals so systematisch gedopt wurde,<br />
ist die Bundesrepublik immer noch<br />
vers<strong>eu</strong>cht? Wird genug dagegen unternommen?<br />
Manche bezweifeln das. So<br />
melden sich Befürworter eines d<strong>eu</strong>tschen<br />
Anti-Doping-Gesetzes wieder zu Wort,<br />
um die Gunst des Moments zu nutzen.<br />
Sie hoffen auf Gehör, denn ihr Unterfangen<br />
hat sich als mühsam erwiesen.<br />
Erkennbar ist, wie sehr es vielen Sportfunktionären<br />
und Politikern an Interesse<br />
SPIEGEL-Artikel 2011 über Doping im Westen: Kriminelle Energie<br />
fehlt, sich mit der Vergangenheit aus -<br />
einanderzusetzen. Auf die plötzliche<br />
Wucht, mit der debattiert wird, reagieren<br />
sie beschwichtigend.<br />
Das Bundesinnenministerium versucht,<br />
die Studie zu einem „bestenfalls stark<br />
überarbeitungsbedürftigen Zwischenprodukt“<br />
kleinzureden. Ähnlich bremst das<br />
Bundesinstitut für Sportwissenschaft, immerhin<br />
Auftraggeber der Historiker: Methodisch<br />
sei unsauber gearbeitet worden,<br />
so der Vorwurf. Der Sportausschuss des<br />
Bundestags fordert jetzt, näher aufgeklärt<br />
zu werden – nachdem sich seine Mitglieder<br />
lange vertrösten ließen, wenn sie<br />
mehr über die Inhalte des Berichts erfahren<br />
wollten.<br />
Und Thomas Bach, 59, Präsident des<br />
D<strong>eu</strong>tschen Olympischen Sportbundes<br />
(DOSB)? Hält sich zugute, schon als Athletensprecher<br />
gegen das Doping eingetreten<br />
zu sein, hatte einst als Fechter allerdings<br />
nie etwas davon mitbekommen.<br />
Sagt der oberste Sportwart der Nation,<br />
der doch sonst bestens vernetzt ist.<br />
Mit geringer Auskunftsfr<strong>eu</strong>de haben<br />
die Historiker bei ihrer dreijährigen Arbeit<br />
oft zu kämpfen gehabt, Archive waren<br />
schwer oder gar nicht zugänglich (siehe<br />
Interview Seite 140). Manchmal war<br />
der Widerstand grotesk. Als der SPIE-<br />
GEL (40/2011) meldete, die Forscher hätten<br />
einen Brief entdeckt, der belege, bei<br />
der Weltmeisterschaft 1966 seien bei drei<br />
Nationalspielern feine Spuren von Ephedrin<br />
gefunden worden, reagierte der<br />
D<strong>eu</strong>tsche Fußball-Bund. Doch während<br />
sich die englische Boulevardpresse über<br />
aufgeputschte d<strong>eu</strong>tsche WM-Verlierer<br />
amüsierte, verging dem DFB der Humor.<br />
Er ließ einen Juristen ein 16-seitiges<br />
Gutachten erstellen, das<br />
jeglichen Verdacht aus der Welt<br />
schaffen sollte, hierbei habe es<br />
sich um Doping gehandelt.<br />
In zwei bis drei Wochen will<br />
der Sportausschuss nun in einer<br />
Sondersitzung Fragen stellen.<br />
Innenminister Hans-Peter Friedrich<br />
hat sein Kommen zugesagt,<br />
auch Bach erhielt eine Einladung.<br />
Allerdings wird er keine Zeit<br />
haben – zu viele andere Termine.<br />
Er will am 10. September zum Präsidenten<br />
des Internationalen Olympischen Komitees<br />
(IOC) gewählt werden, es wäre der<br />
letzte Schritt auf seinem langen Weg zum<br />
mächtigsten Mann des Weltsports.<br />
Bach lässt sich zu allerlei Anlässen von<br />
der Politik hofieren, das gibt schöne Bilder.<br />
Rechenschaft gegenüber Volksvertretern<br />
mag er weniger gern ablegen. Kaum<br />
hatte die Aufregung um die Dopingstudie<br />
begonnen, da verkündete er, der DOSB<br />
werde zur Aufklärung eine unabhängige<br />
Kommission ins Leben rufen, geleitet<br />
vom ehemaligen Bundesverfassungsrichter<br />
Udo Steiner, 73. Er steht Bach nahe.<br />
Steiner hatte vor vier Jahren bereits geholfen,<br />
eine Debatte um Olympiapferde,<br />
die mit verbotenen Mitteln behandelt<br />
worden waren, geräuschlos zu beenden.<br />
Bachs Vorstoß klingt nach Tatkraft und<br />
d<strong>eu</strong>tscher Gründlichkeit, aber die Erfahrung<br />
mit solchen Kommissionen im Sport<br />
ist ernüchternd. Meist nützen sie nur je-<br />
DER SPIEGEL 33/2013 139
Sport<br />
CARSTEN SCHILKE/DER SPIEGEL<br />
„Sie blockierten unsere Arbeit“<br />
Der Historiker Erik Eggers über die Widerstände<br />
bei der Erforschung der westd<strong>eu</strong>tschen Dopingvergangenheit<br />
Eggers, 44, hat als einer von<br />
vier Wissenschaftlern an der<br />
Dopingstudie der Berliner<br />
Humboldt-Universität mitgearbeitet.<br />
Er schreibt auch<br />
als freier Journalist, unter<br />
anderem für den SPIEGEL.<br />
SPIEGEL: Herr Eggers, Sie haben für das<br />
Bundesinstitut für Sportwissenschaft<br />
(BISp) die bri sante Dopingstudie verfasst.<br />
Wie war die Zusammenarbeit mit<br />
dem Auftraggeber?<br />
Eggers: Mühsam. Wir durften nicht ohne<br />
weiteres Kopien aus den Akten ziehen,<br />
mussten alles abschreiben. Der Datenschutz,<br />
hieß es. Das hat unsere<br />
Arbeit sehr verzögert.<br />
SPIEGEL: Fühlten Sie sich<br />
schikaniert?<br />
Eggers: Uns wurde auch gesagt,<br />
wenn wir Kopien<br />
machten, sei alles in der<br />
Welt. Da kann ich nur sagen:<br />
Ja natürlich, das ist gerade<br />
das Ziel von Historikern,<br />
Transparenz zu schaffen.<br />
SPIEGEL: Damit gerieten Sie<br />
in Konflikt mit dem BISp?<br />
Eggers: Die großen Schwierigkeiten<br />
begannen, als wir<br />
2011 herausfanden und berichteten,<br />
dass das BISp<br />
eine Schaltzentrale der<br />
Dopingforschung war – und<br />
dass sich der damalige stellvertretende<br />
BISp-Direktor<br />
1977 für einen Einsatz von<br />
Anabolika eingesetzt hatte.<br />
Das hatte die h<strong>eu</strong>tige BISp-<br />
Führung wohl nicht erwartet.<br />
Die war regelrecht geschockt.<br />
SPIEGEL: Angeblich sollen wichtige BISp-<br />
Akten vernichtet worden sein.<br />
Eggers: Die Originalakten fast aller Forschungsvorhaben<br />
bis 1988 sind weg. Es<br />
gibt beim BISp auch keinen Hinweis,<br />
wo sie gelagert sein könnten. Uns wurde<br />
gesagt, sie seien ausgesondert. Für uns<br />
Historiker heißt das: Sie wurden geschreddert.<br />
Wir hatten Glück, dass wenigstens<br />
Kopien dopingrelevanter Akten<br />
aus 1991 vorhanden waren, die uns<br />
wichtige Einblicke in die Zeit vor 1989<br />
verschafften.<br />
SPIEGEL: Wollte das Institut etwas ver -<br />
tuschen? Das BISp behauptet, Sie hätten<br />
alle Unterlagen einsehen dürfen.<br />
Eggers: Es existiert dort noch eine Liste<br />
über alle Forschungsvorhaben der drei<br />
großen sportmedizinischen Zentren<br />
Freiburg, Köln und Saarbrücken. Ohne<br />
die Akten lässt sich aber nicht mehr<br />
nachvollziehen, ob unter diesen Arbeiten<br />
weitere Dopingstudien waren.<br />
SPIEGEL: Sie haben drei Jahre lang an Ihrem<br />
Bericht gearbeitet. Nahm das BISp<br />
auf Ihre Darstellung Einfluss?<br />
Eggers: Sie haben es zumindest versucht.<br />
Wir mussten um viele Formulierungen<br />
in unseren Berichten kämpfen.<br />
WM-Finale England– <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> 1966*: „Spuren von Ephedrin“<br />
SPIEGEL: Um was ging es?<br />
Eggers: Das BISp wollte anfangs tatsächlich<br />
durchsetzen, dass wir weder Namen<br />
noch Sportarten nennen. Dass dann ein<br />
solches Projekt sinnlos ist, wollte nicht<br />
in deren Köpfe. Sie blockierten unsere<br />
Arbeit. Und es wurden Fakten, die für<br />
das BISp bis h<strong>eu</strong>te unangenehm sind,<br />
angezweifelt. Zum Beispiel hatten wir<br />
herausgefunden, dass der Freiburger<br />
* Mit den Spielern Uwe Seeler und Bobby Moore<br />
sowie Schiedsrichter Gottfried Dienst (M.).<br />
Professor Joseph K<strong>eu</strong>l das Geld für Forschungsvorhaben<br />
vom BISp auf sein Privatkonto<br />
überwiesen bekam. Uns wurde<br />
erklärt, solche Überweisungen seien<br />
damals üblich gewesen. Als ich gebeten<br />
habe, dass sie mir dies schriftlich mitteilen<br />
sollten, damit wir es in den Bericht<br />
aufnehmen könnten, ist nichts<br />
mehr gekommen.<br />
SPIEGEL: Für ein mit St<strong>eu</strong>ergeldern bezahltes<br />
Projekt sollte es ausgeschlossen<br />
sein, dass der Auftraggeber sich einmischt.<br />
Eggers: Die Aktenlage war so, dass unser<br />
Auftraggeber zum Bad Guy wurde. Als<br />
Historiker kann ich aber darauf keine<br />
Rücksicht nehmen, meine<br />
Arbeit muss jederzeit überprüfbar<br />
sein. Und ich bin ja<br />
nicht der PR-Manager des<br />
BISp.<br />
SPIEGEL: Wo stießen Sie noch<br />
auf Widerstände?<br />
Eggers: Der D<strong>eu</strong>tsche Fußball-Bund<br />
hat uns gar nicht<br />
in sein Archiv gelassen. Wir<br />
hatten über andere Quellen<br />
herausgefunden, dass Dopingproben<br />
dreier Spieler<br />
der d<strong>eu</strong>tschen Mannschaft<br />
bei der WM 1966 Spuren<br />
von Ephedrin enthielten.<br />
Beim DFB hieß es auf Anfrage,<br />
es gebe keine doping -<br />
relevanten Akten für die<br />
sechziger Jahre. Später<br />
wollten wir gern erforschen,<br />
wie der DFB auf das Dopinggeständnis<br />
von Toni<br />
Schumacher 1987 reagiert<br />
hatte. Also gingen wir noch<br />
mal zum DFB.<br />
SPIEGEL: Was passierte dann?<br />
Eggers: Sie sagten, wir sollten besagte<br />
Quelle aus 1966 vorzeigen, bevor wir<br />
ins Archiv kämen. Und wir sollten unterschreiben,<br />
dass der DFB erst zustimmen<br />
muss, bevor wir etwas veröffent -<br />
lichen. Das ist Humbug, da haben wir<br />
uns die Reise nach Frankfurt erspart.<br />
SPIEGEL: Gab es weitere Verbände, die<br />
Ihre Arbeit erschwert haben?<br />
Eggers: Der D<strong>eu</strong>tsche Schwimm-Verband<br />
hat uns auch nicht ins Archiv gelassen.<br />
Dabei wissen wir aus anderen<br />
Quellen, dass es beim DSV durchaus<br />
LONDON EXPRESS / PICTURE-ALLIANCE / DPA<br />
140<br />
DER SPIEGEL 33/2013
Dopingvorgänge gab. Die Nationale<br />
Anti-Doping-Agentur, die Nada, war<br />
zunächst sehr kooperativ, aber dann<br />
verweigerte sie uns die zugesagten Kopien<br />
über wichtige Dopingvorgänge.<br />
SPIEGEL: Die Nada bestreitet das. Welche<br />
Dokumente meinen Sie?<br />
Eggers: Etwa Auseinandersetzungen der<br />
Anti-Doping-Kommission, also der Vorgänger-Institution<br />
der Nada, mit dem<br />
DFB, der sich zu Beginn der n<strong>eu</strong>nziger<br />
Jahre nicht dem zentralen Doping-Kontrollsystem<br />
unterwerfen wollte. Aber<br />
auch Kopien von Dokumenten aus dem<br />
Tennis, die wir dort nur eingesehen haben,<br />
hätten uns geholfen.<br />
SPIEGEL: Im März 2012 haben Sie Ihren<br />
Abschlussbericht abgegeben, er hat<br />
804 Seiten. Warum wurde die Studie damals<br />
nicht so veröffentlicht?<br />
Eggers: Das BISp wollte den wissenschaftlichen<br />
Wert der Arbeit nicht anerkennen.<br />
Forschungsleiter Giselher<br />
Spitzer hat den Bericht dann auf 117 Seiten<br />
gekürzt und diesen Ende März 2013<br />
abgegeben. Auch dann passierte erst<br />
mal nichts.<br />
SPIEGEL: Warum haben Sie die Arbeit<br />
nicht auf eigene Faust veröffentlicht?<br />
Eggers: Das war nicht möglich. Das BISp<br />
weigerte sich, uns für den Inhalt des<br />
Berichts Rechtssicherheit zu gewähren.<br />
Mögliche Klagen von Personen, die in<br />
dem Bericht vorkommen, wären an uns<br />
gegangen. Und wir wollen nicht zehn<br />
Jahre in Gerichtssälen verbringen. Hinzu<br />
kam, dass es immer hieß, es bestünden<br />
datenschutzrechtliche Bedenken. Tat -<br />
sache aber ist: Am 4. Juni hat das BISp<br />
Spitzers Kurzfassung dem Bundesdatenschutzbeauftragten<br />
vorgelegt. Einen Monat<br />
später sagte der: alles in Ordnung.<br />
Doch das wurde uns nicht mitgeteilt. Die<br />
gaben uns also das Gefühl, die Veröffentlichung<br />
sei allein unser Risiko. Vom<br />
positiven Bescheid der Datenschützer<br />
habe ich erst vorige Woche erfahren.<br />
SPIEGEL: Die Kurzfassung des Berichts<br />
wurde vorigen Montag ins Netz gestellt,<br />
die lange Version ging an den Bundestags-Sportausschuss.<br />
Ihre Ergebnisse haben<br />
eine erregte Debatte ausgelöst. Ist<br />
das für Sie eine Genugtuung?<br />
Eggers: Wir hätten lieber unsere Arbeit<br />
zu Ende geführt und auch den Zeitraum<br />
von 1990 bis 2007 erforscht.<br />
SPIEGEL: Das BISp behauptet, Sie hätten<br />
Ihre Untersuchungen fortführen können,<br />
das nötige Geld habe zur Verfügung gestanden.<br />
Warum kam es nicht dazu?<br />
Eggers: Eigentlich sollte unser Projekt<br />
bis März 2013 laufen. Aber das BISp hat<br />
uns mit der Finanzierung für das letzte<br />
Jahr so lange hingehalten, dass wir aufgeben<br />
mussten.<br />
nen, die Zeit gewinnen wollen, Zeit, in<br />
der die Affäre an Schwung verliert, die<br />
Empörung sich legt und Gras über die Sache<br />
wächst. Und Bach braucht Zeit, ein<br />
Skandal wäre das Letzte, was er gebrauchen<br />
kann, so kurz vor dem IOC-Thron.<br />
Als 2007 offenkundig geworden war,<br />
dass an der Freiburger Uni-Klinik die Radprofis<br />
vom Team T-Mobile im großen Stil<br />
gedopt wurden, begannen zwei Kommissionen,<br />
das Dopingsystem der badischen<br />
Sportmedizin zu durchl<strong>eu</strong>chten. Die größere<br />
der beiden ist mit ihrer Arbeit bis<br />
h<strong>eu</strong>te nicht fertig geworden.<br />
Nacheinander arbeiteten ein früherer<br />
Sozialgerichtspräsident und die Mafia-Expertin<br />
Letizia Paoli als Chefaufklärer.<br />
Mittlerweile haben sich Mitglieder wie<br />
der Anti-Doping-Experte Werner Franke<br />
frustriert aus der Kommission verabschiedet.<br />
Paoli kritisiert, wichtige Unterlagen<br />
seien vorenthalten worden, sie fühlt sich<br />
von der Uni-Leitung „getäuscht und hintergangen“.<br />
Man ist so zerstritten, dass<br />
nicht mehr viel Erhellendes aus Freiburg<br />
zu erwarten ist.<br />
Der Radsport ist in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> an seinen<br />
Dopingskandalen fast zugrunde gegangen,<br />
aber meistens hatten die Fälle<br />
ihren Ursprung im Ausland. Das Ende<br />
von Jan Ullrich und dem T-Mobile-Rennstall<br />
begann mit der spanischen Fuentes-<br />
Affäre und den Memoiren eines belgischen<br />
Betr<strong>eu</strong>ers. Den Gerolsteiner-Fahrern<br />
Stefan Schumacher und Bernhard<br />
Kohl waren positive Proben bei der Tour<br />
de France zum Verhängnis geworden, gerade<br />
erst wurde Erik Zabel durch eine<br />
nachträgliche Analyse in Frankreich als<br />
Lügner entlarvt. Spanien, Frankreich und<br />
Österreich haben Anti-Doping-Gesetze<br />
erlassen, sogar Italien hat das so gemacht,<br />
obwohl es nicht gerade für seine zackige<br />
Legislative berühmt ist. Staatsanwälte<br />
und Polizisten greifen ein, um Doper und<br />
ihre Hinterl<strong>eu</strong>te zu erwischen, Razzien<br />
werden angeordnet, um Beweismittel zu<br />
sichern, so läuft das, wenn Sportbetrug<br />
als Straftatbestand gilt.<br />
Die Lobby des d<strong>eu</strong>tschen Sports hat es<br />
bislang verhindert, dass die Politik etwas<br />
Strengeres als das Arzneimittelgesetz einführt.<br />
Stattdessen werden Niederlagen<br />
von Athleten gegen ausländische Konkurrenz<br />
gern als Beleg dafür hergenommen,<br />
wie sauber es hier im Hochleistungssport<br />
zugehe. Die Nationale Anti-Doping-<br />
Agentur wird in Festreden gelobt, leidet<br />
aber in der Praxis darunter, dass sie viel<br />
zu wenig Geld von Sport und Staat erhält,<br />
um mehr als ein paar kleinen Fischen auf<br />
die Schliche zu kommen. Im Vorjahr gingen<br />
bei 8567 Trainingskontrollen gerade<br />
einmal 8 Sportler ins Netz. Eine Erfolgsquote<br />
im Promillebereich.<br />
Kanzlerin Angela Merkel verspürt keinerlei<br />
Drang, etwas an der Rechtslage zu<br />
verändern. Ein Anti-Doping-Gesetz, hieß<br />
es vorige Woche aus Regierungskreisen,<br />
AUGENKLICK / ROTH-FOTO<br />
stehe auch jetzt nicht zur Debatte, das<br />
geltende Recht schrecke genügend ab.<br />
Eine Argumentation nach Bachs Geschmack.<br />
Er will staatliche Strafverfolger<br />
möglichst aus der Jagd auf Betrüger<br />
heraushalten, um autonom zu bleiben.<br />
Doch mit der Dopingstudie wird der<br />
Ruf nach einem eigenen Gesetz lauter.<br />
Der Sport scheint unfähig, mit seinem<br />
Radprofi Zabel 2002<br />
Als Lügner entlarvt<br />
größten Problem fertig zu werden. Athletenkontrollen<br />
allein, wie es die Verbände<br />
weismachen wollen, lösen es nicht. Damit<br />
lassen sich höchstens Sportler erwischen,<br />
die beim Betrug unvorsichtig vorgehen.<br />
Und Hintermänner noch seltener.<br />
Die Anhänger einer Gesetzesreform sehen<br />
sich nun bestätigt. Sie bekommen<br />
Aufwind. Er sei „sehr optimistisch“, dass<br />
auch in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> die Widerstände gegen<br />
ein Anti-Doping-Gesetz schwänden,<br />
sagt der baden-württembergische Justizminister<br />
Rainer Stickelberger (SPD). Bislang<br />
stand ihm als Mitstreiterin auf höherer<br />
Ebene nur seine bayerische Amtskollegin<br />
Beate Merk (CSU) zu Seite.<br />
Mit Rückendeckung von Ministerpräsident<br />
Winfried Kretschmann (Grüne) hat<br />
Stickelberger vor einigen Monaten eine<br />
Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht.<br />
Gestützt wird dieser Vorstoß durch einen<br />
Sinneswandel unter den Justizministern<br />
der Länder: Auf deren jüngster Sitzung<br />
Mitte Juni im saarländischen Perl sprach<br />
sich eine Zwei-Drittel-Mehrheit dafür aus,<br />
ein Anti-Doping-Gesetz einzuführen.<br />
Die Bundestagswahl am 22. September<br />
könnte weitere Risse in die bislang unverbrüchliche<br />
Allianz zwischen Sport,<br />
Kanzleramt und Bundesinnenministe -<br />
rium bringen. Sollten die Sozialdemokraten<br />
die Chance bekommen, an einer n<strong>eu</strong>en<br />
Regierung beteiligt zu werden, dann<br />
könnte in Koalitionsgesprächen über ein<br />
Anti-Doping-Gesetz verhandelt werden,<br />
sagt Stickelberger. Er könne sich das<br />
„sehr gut vorstellen, wenn das Thema Doping<br />
so weiterkocht wie derzeit“.<br />
DETLEF HACKE, UDO LUDWIG,<br />
MICHAEL WULZINGER<br />
DER SPIEGEL 33/2013 141
Impressum<br />
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, Telefon (040) 3007-0 · Fax -2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)<br />
HERAUSGEBER Rudolf Augstein (1923 – 2002)<br />
STELLV. CHEFREDAKTEURE Klaus Brinkbäumer,<br />
Dr. Martin Doerry (V. i. S. d. P.)<br />
ART DIRECTION Uwe C. Beyer<br />
Politischer Autor: Dirk Kurbjuweit<br />
DEUTSCHE POLITIK · HAUPTSTADTBÜRO Leitung: Konstantin von Hammerstein,<br />
Christiane Hoffmann (stellv.), René Pfister (stellv.). Redaktion<br />
Politik: Nicola Abé, Dr. Melanie Amann, Ralf Beste, Horand Knaup, Peter<br />
Müller, Ralf N<strong>eu</strong>kirch, Gordon Repinski. Autor: Markus Feldenkirchen<br />
Redaktion Wirtschaft: Sven Böll, Markus Dettmer, Cornelia Schmergal,<br />
Gerald Traufetter. Reporter: Alexander N<strong>eu</strong>bacher, Christian Reiermann<br />
Meinung: Dr. Gerhard Spörl<br />
DEUTSCHLAND Leitung: Alfred Weinzierl, Cordula Meyer (stellv.),<br />
Dr. Markus Verbeet (stellv.); Hans-Ulrich Stoldt (Panorama). Redaktion:<br />
Felix Bohr, Jan Friedmann, Michael Fröhlingsdorf, Hubert Gude,<br />
Carsten Holm, Charlotte Klein, Petra Kleinau, Guido Kleinhubbert,<br />
Bernd Kühnl, Gunther Latsch, Udo Ludwig, Maximilian Popp, Andreas<br />
Ulrich, Antje Windmann. Autoren, Reporter: Jürgen Dahlkamp, Dr.<br />
Thomas Darnstädt, Gisela Friedrichsen, Beate Lakotta, Bruno Schrep,<br />
Katja Thimm, Dr. Klaus Wiegrefe<br />
Berliner Büro Leitung: Frank Hornig (stellv.). Redaktion: Sven Becker,<br />
Markus Deggerich, Özlem Gezer, Sven Röbel, Jörg Schindler, Michael<br />
Sontheimer, Andreas Wassermann, Peter Wensierski. Autoren: Stefan<br />
Berg, Jan Fleischhauer<br />
WIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler, Michael Sauga (Berlin),<br />
Thomas Tuma, Marcel Rosenbach (stellv., Medien und Internet).<br />
Redaktion: Susanne Amann, Markus Brauck, Isabell Hülsen, Alexander<br />
Jung, Nils Klawitter, Alexander Kühn, Martin U. Müller, Ann-<br />
Kathrin Nezik, Jörg Schmitt, Janko Tietz. Autoren, Reporter: Markus<br />
Grill, Dietmar Hawranek, Michaela Schießl<br />
AUSLAND Leitung: Clemens Höges, Britta Sandberg, Juliane von Mittelstaedt<br />
(stellv.). Redaktion: Dieter Bednarz, Manfred Ertel, Jan Puhl,<br />
Sandra Schulz, Daniel Steinvorth, Helene Zuber. Autoren, Reporter:<br />
Ralf Hoppe, Hans Hoyng, Susanne Koelbl, Walter Mayr, Dr. Christian<br />
Neef, Christoph R<strong>eu</strong>ter<br />
Diplomatischer Korrespondent: Dr. Erich Follath<br />
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung: Rafaela von Bredow, Olaf<br />
Stampf. Redaktion: Dr. Philip Bethge, Jörg Blech, Manfred Dworschak,<br />
Marco Evers, Dr. Veronika Hackenbroch, Laura Höflinger, Julia Koch,<br />
Kerstin Kullmann, Hilmar Schmundt, Matthias Schulz, Samiha Shafy,<br />
Frank Thad<strong>eu</strong>sz, Christian Wüst<br />
KULTUR Leitung: Lothar Gorris, Dr. Joachim Kronsbein (stellv.).<br />
Redaktion: Lars-Olav Beier, Susanne Beyer, Dr. Volker Hage, Ulrike<br />
Knöfel, Philipp Oehmke, Tobias Rapp, Katharina Stegelmann, Claudia<br />
Voigt, Martin Wolf. Autoren, Reporter: Georg Diez, Wolfgang Höbel,<br />
Thomas Hüetlin, Dr. Romain Leick, Matthias Matussek, Elke Schmitter,<br />
Dr. Susanne Weingarten<br />
KulturSPIEGEL: Marianne Wellershoff (verantwortlich). Tobias<br />
Becker, Anke Dürr, Maren Keller, Daniel Sander<br />
GESELLSCHAFT Leitung: Matthias Geyer, Dr. Stefan Willeke, Barbara<br />
Supp (stellv.). Redaktion: Hauke Goos, Barbara Hardinghaus, Wiebke<br />
Hollersen, Ansbert Kneip, Katrin Kuntz, Dialika N<strong>eu</strong>feld, Bettina Stiekel,<br />
Jonathan Stock, Takis Würger. Reporter: Uwe Buse, Ullrich Fichtner,<br />
Jochen-Martin Gutsch, Guido Mingels, Cordt Schnibben, Alexander<br />
Smoltczyk<br />
SPORT Leitung: Gerhard Pfeil, Michael Wulzinger. Redaktion: Lukas<br />
Eberle, Maik Großekathöfer, Detlef Hacke, Jörg Kramer<br />
SONDERTHEMEN Leitung: Dietmar Pieper, Annette Großbongardt<br />
(stellv.). Redaktion: Annette Bruhns, Angela Gatterburg, Uwe Klußmann,<br />
Joachim Mohr, Bettina Musall, Dr. Johannes Saltzwedel, Dr.<br />
Eva-Maria Schnurr, Dr. Rainer Traub<br />
MULTIMEDIA Jens Radü; Roman Höfner, Marco Kasang, Bernhard<br />
Riedmann<br />
CHEF VOM DIENST Thomas Schäfer, Katharina Lüken (stellv.),<br />
Holger Wolters (stellv.)<br />
SCHLUSSREDAKTION Anke Jensen; Christian Albrecht, Gesine Block,<br />
Regine Brandt, Lutz Diedrichs, Bianca Hunekuhl, Sylke Kruse, Maika<br />
Kunze, Stefan Moos, Reimer Nagel, Manfred Petersen, Fred Schlotterbeck,<br />
Sebastian Schulin, Tapio Sirkka, Ulrike Wallenfels<br />
PRODUKTION Solveig Binroth, Christiane Stauder, Petra Thormann;<br />
Christel Basilon, Petra Gronau, Martina Tr<strong>eu</strong>mann<br />
BILDREDAKTION Michaela Herold (Ltg.), Claudia Jeczawitz, Claus-<br />
Dieter Schmidt; Sabine Döttling, Susanne Döttling, Torsten Feldstein,<br />
Thorsten Gerke, Andrea Huss, Antje Klein, Elisabeth Kolb, Matthias<br />
Krug, Parvin Nazemi, Peer Peters, Karin Weinberg, Anke Wellnitz<br />
E-Mail: bildred@spiegel.de<br />
SPIEGEL Foto USA: Susan Wirth, Tel. (001212) 3075948<br />
GRAFIK Martin Brinker, Johannes Unselt (stellv.); Cornelia Baumermann,<br />
Ludger Bollen, Thomas Hammer, Anna-Lena Kornfeld, Gernot<br />
Matzke, Cornelia Pfauter, Julia Saur, Michael Walter<br />
LAYOUT Wolfgang Busching, Jens Kuppi, Reinhilde Wurst (stellv.);<br />
Michael Abke, Katrin Bollmann, Fabian Eschkötter, Claudia Franke,<br />
Bettina Fuhrmann, Ralf Geilhufe, Kristian H<strong>eu</strong>er, Nils Küppers,<br />
Sebastian Raulf, Barbara Rödiger, Doris Wilhelm<br />
Besondere Aufgaben: Michael Rabanus<br />
Sonderhefte: Rainer Sennewald<br />
TITELBILD Suze Barrett, Arne Vogt; Iris Kuhlmann, Gershom Schwalfenberg<br />
Besondere Aufgaben: Stefan Kiefer<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN DEUTSCHLAND<br />
BERLIN Pariser Platz 4a, 10117 Berlin; D<strong>eu</strong>tsche Politik, Wirtschaft<br />
Tel. (030) 886688-100, Fax 886688-111; <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>, Wissenschaft,<br />
Kultur, Gesellschaft Tel. (030) 886688-200, Fax 886688-222<br />
E-Mail spiegel@spiegel.de<br />
DRESDEN Steffen Winter, Wallgäßchen 4, 01097 Dresden, Tel. (0351)<br />
26620-0, Fax 26620-20<br />
DÜSSELDORF Georg Bönisch, Frank Dohmen, Barbara Schmid, Fidelius<br />
Schmid , Benrather Straße 8, 40213 Düsseldorf, Tel. (0211) 86679-<br />
01, Fax 86679-11<br />
FRANKFURT AM MAIN Matthias Bartsch, Martin Hesse, Simone Kaiser,<br />
Anne Seith, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Tel. (069)<br />
9712680, Fax 97126820<br />
KARLSRUHE Dietmar Hipp, Waldstraße 36, 76133 Karlsruhe, Tel. (0721)<br />
22737, Fax 9204449<br />
MÜNCHEN Dinah Deckstein, Anna Kistner, Conny N<strong>eu</strong>mann, Rosental<br />
10, 80331 München, Tel. (089) 4545950, Fax 45459525<br />
STUTTGART Eberhardstraße 73, 70173 Stuttgart, Tel. (0711) 664749-20,<br />
Fax 664749-22<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND<br />
BOSTON Johann Grolle, 25 Gray Street, 02138 Cambridge, Massachusetts,<br />
Tel. (001617) 9452531<br />
BRÜSSEL Christoph Pauly, Christoph Schult, Bd. Charlemagne 45,<br />
1000 Brüssel, Tel. (00322) 2306108, Fax 2311436<br />
KAIRO Volkhard Windfuhr, 18, Shari’ Al Fawakih, Muhandisin, Kairo,<br />
Tel. (00202) 37604944, Fax 37607655<br />
KAPSTADT Bartholomäus Grill, P. O. Box 15614, Vlaeberg 8018, Kapstadt,<br />
Tel. (002721) 4261191<br />
LONDON Christoph Sch<strong>eu</strong>ermann, P. O. Box 64199, London WC1A<br />
9FP, Fax (004420) 34902948<br />
MADRID Apartado Postal Número 100 64, 28080 Madrid, Tel. (0034)<br />
650652889<br />
MOSKAU Matthias Schepp, Ul. Bol. Dmitrowka 7/5, Haus 2, 125009<br />
Moskau, Tel. (007495) 96020-95, Fax 96020-97<br />
NEU-DELHI Dr. Wieland Wagner, 210 Jor Bagh, 2F, N<strong>eu</strong>-Delhi 110003,<br />
Tel. (009111) 41524103<br />
NEW YORK Alexander Osang, 10 E 40th Street, Suite 3400, New York,<br />
NY 10016, Tel. (001212) 2217583, Fax 3026258<br />
PARIS Mathi<strong>eu</strong> von Rohr, 12, Rue de Castiglione, 75001 Paris, Tel.<br />
(00331) 58625120, Fax 42960822<br />
PEKING Bernhard Zand, P. O. Box 170, Peking 100101, Tel. (008610)<br />
65323541, Fax 65325453<br />
RIO DE JANEIRO Jens Glüsing, Caixa Postal 56071, AC Urca,<br />
22290-970 Rio de Janeiro-RJ, Tel. (005521) 2275-1204, Fax 2543-9011<br />
ROM Fiona Ehlers, Largo Chigi 9, 00187 Rom, Tel. (003906) 6797522,<br />
Fax 6797768<br />
SAN FRANCISCO Thomas Schulz, P.O. Box 330119, San Francisco, CA<br />
94133, Tel. (001212) 2217583<br />
TEL AVIV Julia Amalia Heyer, P. O. Box 8387, Tel Aviv-Jaffa 61083,<br />
Tel. (009723) 6810998, Fax 6810999<br />
WARSCHAU P.O. Box 31, ul. Waszyngtona 26, PL- 03-912 Warschau,<br />
Tel. (004822) 6179295, Fax 6179365<br />
WASHINGTON Marc Hujer, Dr. Gregor Peter Schmitz, Holger Stark,<br />
1202 National Press Building, Washington, D.C. 20045, Tel. (001202)<br />
3475222, Fax 3473194<br />
DOKUMENTATION Dr. Hauke Janssen, Cordelia Freiwald (stellv.), Axel<br />
Pult (stellv.), Peter Wahle (stellv.); Jörg-Hinrich Ahrens, Dr. Susmita<br />
Arp, Dr. Anja Bednarz, Ulrich Booms, Dr. Helmut Bott, Viola Broecker,<br />
Dr. Heiko Buschke, Andrea Curtaz-Wilkens, Johannes Eltzschig, Johannes<br />
Erasmus, Klaus Falkenberg, Catrin Fandja, Anne-Sophie Fröhlich,<br />
Dr. André Geicke, Silke Geister, Thorsten Hapke, Susanne Heitker,<br />
Carsten Hellberg, Stephanie Hoffmann, Bertolt Hunger, Joachim Immisch,<br />
Kurt Jansson, Michael Jürgens, Tobias Kaiser, Renate Kemper-<br />
Gussek, Jessica Kensicki, Ulrich Klötzer, Ines Köster, Anna Kovac, Peter<br />
Lakemeier, Dr. Walter Lehmann-Wiesner, Michael Lindner, Dr.<br />
Petra Ludwig-Sidow, Rainer Lübbert, Sonja Maaß, Nadine Markwaldt-<br />
Buchhorn, Dr. Andreas Meyhoff, Gerhard Minich, Cornelia Moormann,<br />
Tobias Mulot, Bernd Musa, Nicola Naber, Margret Nitsche, Malte<br />
Nohrn, Sandra Öfner, Thorsten Oltmer, Dr. Vassilios Papadopoulos,<br />
Axel Rentsch, Thomas Riedel, Andrea Sauerbier, Maximilian Schäfer,<br />
Marko Scharlow, Rolf G. Schierhorn, Mirjam Schlossarek, Dr. Regina<br />
Schlüter-Ahrens, Mario Schmidt, Thomas Schmidt, Andrea Schumann-<br />
Eckert, Ulla Siegenthaler, Jil Sörensen, Rainer Staudhammer, Tuisko<br />
Steinhoff, Dr. Claudia Stodte, Stefan Storz, Rainer Szimm, Dr. Eckart<br />
Teichert, Nina Ulrich, Ursula Wamser, Peter Wetter, Kirsten Wiedner,<br />
Holger Wilkop, Karl-Henning Windelbandt, Anika Zeller<br />
LESER-SERVICE Catherine Stockinger<br />
NACHRICHTENDIENSTE AFP, AP, dpa, Los Angeles Times / Washington<br />
Post, New York Times, R<strong>eu</strong>ters, sid<br />
SPIEGEL-VERLAG RUDOLF AUGSTEIN GMBH & CO. KG<br />
Verantwortlich für Anzeigen: Norbert Facklam<br />
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 67 vom 1. Januar 2013<br />
Mediaunterlagen und Tarife: Tel. (040) 3007-2540, www.spiegel-qc.de<br />
Commerzbank AG Hamburg<br />
Konto-Nr. 6181986, BLZ 200 400 00<br />
Verantwortlich für Vertrieb: Thomas Hass<br />
Druck: Prinovis, Dresden / Prinovis, Itzehoe<br />
VERLAGSLEITUNG Matthias Schmolz, Rolf-Dieter Schulz<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG Ove Saffe<br />
Service<br />
Leserbriefe<br />
SPIEGEL-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg<br />
Fax: (040) 3007-2966 E-Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />
Fragen zu SPIEGEL-Artikeln/Recherche<br />
Telefon: (040) 3007-2687 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: artikel@spiegel.de<br />
Nachdruckgenehmigungen für Texte und Grafiken:<br />
Nachdruck und Angebot in Lesezirkeln nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlags. Das gilt auch für die<br />
Aufnahme in elektronische Datenbanken und Mailboxen<br />
sowie für Vervielfältigungen auf CD-Rom.<br />
<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>, Österreich, Schweiz:<br />
Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: nachdrucke@spiegel.de<br />
übriges Ausland:<br />
New York Times News Service/Syndicate<br />
E-Mail: nytsyn-paris@nytimes.com<br />
Telefon: (00331) 41439757<br />
für Fotos:<br />
Telefon: (040) 3007-2869 Fax: (040) 3007-2966<br />
E-Mail: nachdrucke@spiegel.de<br />
Nachbestellungen<br />
SPIEGEL-Ausgaben der letzten Jahre sowie<br />
alle Ausgaben von SPIEGEL GESCHICHTE<br />
und SPIEGEL WISSEN können unter<br />
www.amazon.de/spiegel versandkostenfrei<br />
innerhalb <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s nachbestellt werden.<br />
Historische Ausgaben<br />
Historische Magazine Bonn<br />
www.spiegel-antiquariat.de<br />
Telefon: (0228) 9296984<br />
Kundenservice<br />
Persönlich erreichbar Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr,<br />
Sa. 10.00 – 16.00 Uhr<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg<br />
Telefon: (040) 3007-2700 Fax: (040) 3007-3070<br />
E-Mail: aboservice@spiegel.de<br />
Abonnement für Blinde<br />
Audio Version, D<strong>eu</strong>tsche Blindenstudienanstalt e.V.<br />
Telefon: (06421) 606265<br />
Elektronische Version, Frankfurter Stiftung für Blinde<br />
Telefon: (069) 955124-0<br />
Abonnementspreise<br />
Inland: zwölf Monate € 208,00<br />
Studenten Inland: 52 Ausgaben € 153,40 inkl.<br />
sechsmal UniSPIEGEL<br />
Österreich: zwölf Monate € 234,00<br />
Schweiz: zwölf Monate sfr 361,40<br />
Europa: zwölf Monate € 262,60<br />
Außerhalb Europas: zwölf Monate € 340,60<br />
Der digitale SPIEGEL: zwölf Monate € 197,60<br />
Befristete Abonnements werden anteilig berechnet.<br />
Abonnementsbestellung<br />
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service,<br />
20637 Hamburg – oder per Fax: (040) 3007-3070,<br />
www.spiegel.de/abo<br />
Ich bestelle den SPIEGEL<br />
❏ für € 4,00 pro Ausgabe<br />
❏ für € 3,80 pro digitale Ausgabe<br />
❏ für € 0,50 pro digitale Ausgabe zusätzlich zur<br />
Normallieferung. Eilbotenzustellung auf Anfrage.<br />
Das Geld für bezahlte, aber noch nicht gelieferte Hefte<br />
bekomme ich zurück. Bitte liefern Sie den SPIEGEL an:<br />
Name, Vorname des n<strong>eu</strong>en Abonnenten<br />
Straße, Hausnummer oder Postfach<br />
PLZ, Ort<br />
Ich zahle<br />
❏ bequem und bargeldlos per Bankeinzug (1/4-jährl.)<br />
Bankleitzahl<br />
Konto-Nr.<br />
Geldinstitut<br />
❏ nach Erhalt der Jahresrechnung. Eine Belehrung<br />
über Ihr Widerrufsrecht erhalten Sie unter:<br />
www.spiegel.de/widerrufsrecht<br />
INTERNET www.spiegel.de<br />
REDAKTIONSBLOG spiegel.de/spiegelblog<br />
TWITTER @derspiegel<br />
FACEBOOK facebook.com/derspiegel<br />
142<br />
DER SPIEGEL (USPS No. 0154520) is published weekly by SPIEGEL VERLAG. Subscription<br />
price for USA is $ 350 per annum. K.O.P.: German Language Pub., 153 S Dean St, Englewood,<br />
NJ 07631. Periodicals postage is paid at Englewood, NJ 07631, and additional mailing offices.<br />
Postmaster: Send address changes to: DER SPIEGEL, GLP, P.O. Box 9868, Englewood, NJ 07631.<br />
DER SPIEGEL 33/2013<br />
Datum, Unterschrift des n<strong>eu</strong>en Abonnenten<br />
SP13-001<br />
SD13-006<br />
SD13-008 (Upgrade)
Register<br />
GESTORBEN<br />
George Duke, 67. Der<br />
gebürtige Kalifornier<br />
hat mit Frank Zappa<br />
mehr als zehn Al ben<br />
aufgenommen, hat<br />
Mi chael Jackson beim<br />
Erwachsenwerden geholfen<br />
– auf dessen<br />
Album „Off the Wall“<br />
griff er in die Tasten<br />
des Keyboards und<br />
sorgte für den unverwechselbaren<br />
Jackson-Groove. Er produzierte<br />
Platten von Sängern wie Al Jarreau<br />
und Dianne Reeves, auch discotaugliche<br />
Songs wie „Let’s Hear It for the Boy“ für<br />
Deniece Williams – und doch wird er vor<br />
allem für seine Musik in Erinnerung bleiben,<br />
die er im beschaulichen Städtchen<br />
Villingen im Schwarzwald aufnahm. In<br />
den sechziger und siebziger Jahren gaben<br />
sich im Studio des Inhabers der Hi-Fi-<br />
Marke Saba, Hans Georg Brunner-Schwer,<br />
und dessen Label MPS (Musik Produktion<br />
Schwarzwald) US-Jazz-Größen die Klinke<br />
in die Hand, weil es nirgendwo perfektere<br />
Klangtechnik gab und nirgendwo künstlerisch<br />
so wenig reingeredet wurde wie<br />
dort. 496 Produktionen sind hier entstanden,<br />
an einem Großteil war Duke als Keyborder<br />
beteiligt. Sammler zahlen Unsummen<br />
für alte MPS-Platten. Noch Jahrzehnte<br />
später schwärmte Duke, wie toll die<br />
Fahrten vom Flughafen durch die Nebelschwaden<br />
des Hochschwarzwaldes hin<br />
zum Studio gewesen seien. „Bei MPS fand<br />
ich ein Zuhause.“ George Duke starb am<br />
5. August an L<strong>eu</strong>kämie in Los Angeles.<br />
JEAN-CHRISTOPHE BOTT / DPA<br />
RONALD WITTEK / DPA<br />
Robert Häusser, 88. Schon als Kind<br />
machte er seine ersten Fotos, und sehr<br />
bald wusste er, dass er damit seine<br />
Gefühle ausdrücken konnte. Nach einer<br />
Ausbildung und einem Studium an der<br />
Kunstschule in Weimar richtete sich der<br />
in Stuttgart geborene Häusser in Mannheim<br />
ein Studio ein, später wandte er sich<br />
von der kommerziellen Fotografie ab, um<br />
als freier Künstler zu wirken. Viele Bilder<br />
des Melancholikers – sein Fundus umfasst<br />
rund 64 000 Negative – lassen eine Ahnung<br />
von der stillen Bedrohung im<br />
scheinbar Normalen erkennen. Sie zeichnen<br />
sich durch harte Schwarzweiß -<br />
kontraste und durchkomponierte<br />
Linienführung<br />
aus. „Farbe<br />
ist zu geschwätzig<br />
und lenkt von der<br />
Beziehung zum Gegenstand<br />
nur ab“, be -<br />
fand der Fotokünstler.<br />
Konsequenz bewies<br />
Häusser auch,<br />
als er aufhörte zu fotografieren,<br />
weil es – als Folge der Di -<br />
gitaltechnik – das von ihm favorisierte<br />
Papier zum Entwickeln nicht mehr gab.<br />
1995 erhielt Häusser als erster D<strong>eu</strong>tscher<br />
den Hasselblad Award, der als Nobelpreis<br />
der Fotografie gilt. Robert Häusser starb<br />
am 5. August in Mannheim.<br />
Karen Black, 74. Sie wurde ein Star, als<br />
der Glamour des klassischen Hollywood<br />
abblätterte und auf der Leinwand der raue<br />
Alltag zum Vorschein kam. In den späten<br />
sechziger und frühen siebziger Jahren<br />
spielte Black in Filmen wie „Easy Rider“<br />
und „Five Easy Pieces“ Prostituierte oder<br />
Kellnerinnen, Frauen, die am Ende jedes<br />
Tages ihr Trinkgeld zählen. Von Emanzipation<br />
schienen sie noch nie gehört zu haben,<br />
sie waren es nicht gewohnt, über ihre<br />
eigene Rolle nachzudenken. Für ein paar<br />
Jahre war Black der n<strong>eu</strong>e Star zwischen<br />
allen Wunschbildern, den schillernden Diven<br />
der Vergangenheit und dem Ideal der<br />
selbstbestimmten modernen<br />
Frau. Black,<br />
die später mit Re -<br />
giss<strong>eu</strong>ren wie Alfred<br />
Hitchcock und Robert<br />
Altman drehte, gab<br />
der Einfachheit Würde,<br />
ihr leichter Sil -<br />
berblick, der oft etwas<br />
zu zaghaft nach<br />
einem besseren Leben<br />
Ausschau zu halten<br />
schien, verlieh ihr eine berührende<br />
Melancholie. Sie war die Ideal besetzung<br />
für die Nathanael-West-Adaption „Der<br />
Tag der H<strong>eu</strong>schrecke“ (1975). Darin verkörpert<br />
sie eine Schauspielerin, die gegen<br />
jede Chance davon träumt, in Hollywood<br />
ein Star zu werden. Karen Black starb am<br />
8. August in Los Angeles.<br />
SILVER SCREEN COLLECTION / GETTY IMAGES<br />
Guido Huonder, 71. Unter Intendant Peter<br />
Zadek wurde er in den Siebzigern in Bochum<br />
als Regiss<strong>eu</strong>r bekannt, in Dortmund<br />
fand er sein Theaterschicksal. Dort war<br />
der gebürtige Schweizer zunächst Spielleiter<br />
und von 1985 bis 1991 Schauspielchef,<br />
dort machte er Furore unter anderem<br />
mit einer Gedenkaktion für das ermor -<br />
de te schwule Genie Pier Paolo Pasolini.<br />
Huonder war ein ruhiger, ein bisschen<br />
braver, stets um ernsthafte künstlerische<br />
Arbeit bemühter Theatermann, wurde<br />
aber als Chef des Potsdamer Hans Otto<br />
Theaters (1991 bis 1993) Opfer politischer<br />
Streitereien. Als man ihm den Etat kürzte,<br />
schmiss er den Job zornig hin. Fortan inszenierte<br />
er mal in Heidelberg, mal in<br />
Salzburg; in seiner letzten Regiearbeit<br />
zeigte er in einem Dortmunder Mus<strong>eu</strong>m<br />
das Theaterstück „Himmel und Erde“, das<br />
unter Todkranken spielt, und sprach freimütig<br />
über seine Krebserkrankung. Guido<br />
Huonder starb am 6. August in Wien.<br />
SONNTAG, 18. 8., 22.05 – 23.05 UHR | RTL<br />
SPIEGEL TV MAGAZIN<br />
Der n<strong>eu</strong>e Treck nach Westen – Wie<br />
die Freizügigkeit die EU verändert<br />
Flüchtlingslager in Berlin<br />
Hunderttausende haben sich innerhalb<br />
Europas auf den Weg gemacht. Sie<br />
fliehen vor Arbeitslosigkeit, Armut<br />
und Diskriminierung. Und hoffen auf<br />
ein besseres Leben – auch in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />
Eine Schwerpunktsendung über<br />
die n<strong>eu</strong>en Migrationsströme, die<br />
Gewinner und die Verlierer und die<br />
offensichtlich machtlose Politik.<br />
MONTAG, 12. 8., 21.45 – 22.40 UHR | PAY TV<br />
BEI ALLEN FÜHRENDEN KABELNETZBETREIBERN<br />
SPIEGEL TV WISSEN<br />
Autowäsche am Tigris<br />
Bagdad Taxi – Eine ungewöhnliche<br />
Reise durch den Irak<br />
Wenige Monate nach dem Abzug der<br />
amerikanischen Truppen aus dem<br />
Irak macht sich Regiss<strong>eu</strong>r Frédéric<br />
Tonolli in einem Taxi auf eine Fahrt<br />
quer durch das Land. Unterwegs sammelt<br />
er Mitreisende aus verschiedenen<br />
Gesellschaftsschichten und unterschiedlichen<br />
Religionszugehörigkeiten<br />
ein, die ihn ein Stück des Weges begleiten<br />
und von ihrem Alltag, ihren<br />
Hoffnungen und Ängsten erzählen.<br />
Der Filmemacher und sein Taxifahrer<br />
passieren auf ihrer ungewöhnlichen<br />
Tour die Städte Kirkuk, Mossul, Tikrit,<br />
Falludscha, Bagdad, Babylon und<br />
Basra. Ein spannendes Roadmovie<br />
über eine gefährliche Reise durch ein<br />
vom Krieg gezeichnetes Land.<br />
SPIEGEL TV<br />
SPIEGEL TV<br />
DER SPIEGEL 33/2013 143
Personalien<br />
Ein Diplomat im Netz<br />
Der ehemalige US-Außenminister Colin<br />
Powell, 76, ist Opfer eines Internet -<br />
spions geworden. Ein Hacker mit dem<br />
Ps<strong>eu</strong>donym „Guccifer“ veröffentlichte<br />
im Netz Powells E-Mail-Korrespondenz<br />
mit der rumänischen Politikerin<br />
Corina Cretu, 46, die er 2003 auf einer<br />
inter nationalen Konferenz kennengelernt<br />
hatte. In der elektronischen Post<br />
aus den Jahren 2010 und 2011 geht es<br />
vor allem um Cretus Leidenschaft für<br />
den einstigen General. Diese dokumentierte<br />
sie auch mit Bildern von<br />
sich und Powell, die sie auf ihrer Website<br />
zeigte; inzwischen wurden diese<br />
Fotos wieder entfernt. Cretu, h<strong>eu</strong>te<br />
Abgeordnete im Europäischen Parlament,<br />
bet<strong>eu</strong>erte in ihren Mails, Powell<br />
sei die Liebe ihres Lebens, und beklagte<br />
sich immer<br />
wieder über seine<br />
mangelnde<br />
Zuwendung.<br />
2011 verkündete<br />
sie dann, sich einer<br />
„realistischeren<br />
Liebe“ zuzuwenden<br />
und zu<br />
heiraten. Powell,<br />
seit über 50 Jahren<br />
mit seiner<br />
Frau Alma verheiratet,<br />
bestreitet eine Affäre mit Cretu<br />
nachdrücklich, auch wenn die E-<br />
Mails im Ton „sehr persönlich“ gewesen<br />
seien. Dabei übte er sich in seinen<br />
Zeilen grundsätzlich in diplomatischer<br />
Zurückhaltung. Nur einmal schrieb er<br />
etwas, das man vielleicht als Flirt interpretieren<br />
könnte. Nachdem Cretu ihn<br />
um ein Treffen gebeten hatte, mit der<br />
An merkung, das Wetter sei sehr gut,<br />
ant wortete Powell, vielleicht werde er<br />
kommen: „Du und das Wetter, ihr<br />
könntet dafür sorgen.“<br />
QUELLE: HTTP:/ /CORINACRETU.WORDPRESS.COM<br />
Aus dem Schwimmerleben<br />
Schleierkampf<br />
Dem reichen Angebot an Büchern über Selbst -<br />
optimierung fügt Michael Groß, 49, <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s<br />
erfolgreichster Schwimmer, ein Werk hinzu: „Selbstcoaching“.<br />
Seine Tipps zur Eigenmotivation veranschaulicht<br />
Groß mit Episoden aus seinen aktiven<br />
Sportlertagen. So berichtet er etwa aus dem Jahr<br />
1985, als er nach zwei Weltrekorden bei den D<strong>eu</strong>tschen<br />
Meisterschaften auf vier Strecken die Weltbestzeit<br />
hielt, „als erster Mensch seit Mark Spitz<br />
1972“. Das sei jener Erfolg, auf den er bis h<strong>eu</strong>te am<br />
stolzesten sei – der aber von der Öffentlichkeit kaum<br />
beachtet wurde. „Wenn ich bei Veranstaltungen vorgestellt<br />
werde, bekomme ich meist zu hören: dreimal<br />
Olympiasieger, vier mal Sportler des Jahres, fünfmal<br />
Weltmeister.“ Groß rät seinen Lesern: „Niemand<br />
sollte sich davon abhän gig machen, ob der eigene Erfolg<br />
auch die Resonanz erfährt, die er verdient hat.“<br />
ALL ACTION / ACTION PRESS<br />
Anfang vergangener Woche war vorübergehend<br />
ein noch nicht veröffentlichtes Lied von Lady<br />
Gaga, 28, im Internet zugänglich. Es ist Teil des<br />
Albums „Artpop“, das im November erscheinen<br />
soll, und trägt möglicherweise den Titel „Burqa“.<br />
Darin enthalten sind Textzeilen wie „Mein<br />
Schleier schützt meine Schönheit“ oder „Die<br />
Burka ist Mode für sie“. Dass Letzteres auf Lady<br />
Gaga zutrifft, hat sie schon bewiesen, als sie<br />
durchsichtig verhüllt eine Modenschau er -<br />
öffnete. Der Blogger „postmodernveil“ findet<br />
Gagas Haltung scheinheilig, ignorant und gefährlich.<br />
Sie sei ein Sprachrohr für die „imperialistische<br />
und kapitalistische Propagandaindustrie der<br />
USA“, sie wolle muslimische Frauen mit ihrer<br />
westlichen Ideologie bevormunden. Ihr Lied<br />
habe außerdem rassistische Äußerungen provoziert.<br />
Während Gagas L<strong>eu</strong>te eilig alle Zugänge<br />
zu dem Song zu blockieren versuchten, posteten<br />
immer mehr Gaga-Fans im Netz Fotos von sich<br />
mit improvisierten Verhüllungen ihres Gesichts.<br />
Der Internetaktivist sammelte diese Bilder dann<br />
auf seinem Blog „racistlittlemonsters“.<br />
BEVILACQUA,GIULIANO / ACTION PRESS<br />
144<br />
NEWS INTERNATIONAL / BULLS PRESS<br />
Die Kunst der Wahrheit<br />
Sie weine nur sehr selten, sagte Jewgenija Timoschenko, 33,<br />
nachdem sie das Bühnenstück „Wer will Julija Timoschenko<br />
töten?“ beim Theaterfestival in Edinburgh gesehen hatte. Aber<br />
die Darbietung, die die Geschichte ihrer Mutter erzählt, habe<br />
sie zu Tränen gerührt. Julija Timoschenko, die ehemalige Präsidentin<br />
der Ukraine, sitzt seit nunmehr zwei Jahren im Knast,<br />
ihre Untersuchungshaft wurde vom Europäischen Gerichtshof<br />
für Menschenrechte als willkürlich kritisiert, sie gilt als politisch<br />
motiviert. Timoschenko ging mehrere Male in den Hungerstreik,<br />
um auf ihre schlechten Haftbedingungen aufmerksam zu<br />
machen, ihr Gesundheitszustand ist schlecht. Die Timoschenko-<br />
Figur auf der Bühne wird geschlagen, sie bekommt vergiftetes<br />
Essen. „Wenn die Wahrheit mit Hilfe der Kunst ans Licht<br />
kommt“, so Tochter Jewgenija, „dann ist das eindrucksvoller<br />
als jede Nachrichtensendung.“<br />
DER SPIEGEL 33/2013
VISION MEDIA / BULLS PRESS<br />
No Porno für Papa<br />
Zur Premiere in New York lud die amerikanische Schauspielerin<br />
Amanda Seyfried, 27, ihren Vater ein, weil sie so „stolz“<br />
auf den Film sei, in dem sie die Titelrolle spielt. Doch sehen<br />
durfte Herr Seyfried nicht alles von „Lovelace“. Seine Tochter<br />
hielt ihm immer wieder die Augen zu, damit er sie nicht<br />
nackt erlebte. Dazu gibt es einige Gelegenheiten in dem Film<br />
über Linda Lovelace, bürgerlich Linda Boreman, der wohl<br />
berühmtesten Pornodarstellerin der Welt. Sie wurde Anfang<br />
der siebziger Jahre ein Star, weil sie in „Deep Throat“ die<br />
Hauptrolle hatte. Sharon Stone spielt nun die verklemmte<br />
Mutter von Lovelace, James Franco tritt als Hugh Hefner auf.<br />
Die Vorbereitung für die d<strong>eu</strong>tsche Synchronisation läuft<br />
auf Hochtouren, allerdings nicht fürs Kino – der Film hat hierzulande<br />
keinen Verleih gefunden.<br />
Norbert Walter-Borjans, 60, Finanz -<br />
minister von Nordrhein-Westfalen, versucht<br />
sich im Urlaub als Bildhauer.<br />
Frau und Kinder bleiben zu Hause in<br />
Köln, während der Sozialdemokrat<br />
in einem kleinen toskanischen Ort mit<br />
zwei Dutzend Gleichgesinnten unter<br />
Anleitung aus 20 bis 30 Kilogramm<br />
schweren Marmorblöcken Kunstwerke<br />
hämmert und meißelt. „Marmor“,<br />
sagt er, „ist ein ziemlich harter Stein,<br />
abends weiß man, was man getan<br />
hat.“ Im vergangenen Jahr hat Walter-<br />
Borjans eine abstrakte Skulptur geschaffen,<br />
die jetzt in seinem Ministerzimmer<br />
steht. Spätestens am 31. August<br />
wird er sein n<strong>eu</strong>es Werk im Auto<br />
verstauen – für den Flieger wird es zu<br />
schwer sein – und die Heimreise an -<br />
treten. In dem Bergdorf gibt es weder<br />
Fernsehen noch Internet, und er<br />
will das TV-Duell von Merkel und<br />
Steinbrück nicht verpassen.<br />
Volker Bouffier, 61, hessischer CDU-<br />
Ministerpräsident, outet sich im Landtagswahlkampf<br />
als Fr<strong>eu</strong>nd des angelsächsischen<br />
Genitiv-Apostrophs. In<br />
seinem Auftrag verschickte die Verlags-<br />
und Werbegesellschaft für politische<br />
Meinungsbildung GmbH pfandfreie<br />
Dosen mit Apfelschorle. Sie<br />
trugen den Aufdruck „Volker’s Aktiv<br />
Apfel“. Daneben prangen Bouffiers<br />
Konterfei und der Hinweis „Erfolg -<br />
reiche Erfrischung“. Jetzt können<br />
nicht mal mehr die Konservativen rich -<br />
tiges D<strong>eu</strong>tsch.<br />
Bill Clinton, 66, ehemaliger Präsident<br />
der Vereinigten Staaten, hält gesunde<br />
Ernährung für eine patriotische<br />
Pflicht. Die durch Fettleibigkeit entstehenden<br />
Kosten seien nämlich Gift<br />
für die wirtschaftliche Entwicklung<br />
der USA, findet der Politiker, der sich<br />
2004 einer Bypass-Operation unter -<br />
ziehen musste. Er ist seit mehr als drei<br />
Jahren Veganer und hat seither über<br />
zehn Kilo abgenommen. Die Diät<br />
ohne jegliche tierische Produkte habe<br />
er gewählt, weil er so lange wie möglich<br />
leben wolle und hoffe, seine<br />
Enkel kinder heranwachsen zu sehen,<br />
sagte Clinton. Auf Fleisch und Wurst<br />
zu verzichten sei ihm von Anfang an<br />
leichtgefallen, Käse hingegen würde er<br />
h<strong>eu</strong>te noch manchmal vermissen.<br />
DER SPIEGEL 33/2013 145
Hohlspiegel<br />
Aus dem „Ostholsteiner Anzeiger“<br />
Aus dem „Tagesspiegel“: „Wahrscheinlich<br />
ist gar nichts dran an der tröstlichen Vorstellung,<br />
dass Wagnerfan Merkel und Regiss<strong>eu</strong>r<br />
Castorf bei diesem Ost-Berliner Bühnentreiben<br />
zusammen in der Königsloge<br />
sitzen und fest in ihre Programmhefte beißen<br />
müssen, um das Festspielhaus nicht mit<br />
hemmungslosem Lachen zu erschüttern.“<br />
Aus der Programmzeitschrift „Gong“<br />
Aushang eines Geschäfts in Bremen<br />
Aus dem „Stormarner Tageblatt“: „Aus<br />
Mangel an Bewerbern sollen beim Wachbataillon<br />
der Bundeswehr künftig auch<br />
kleingewachsene und kurzsichtige Bartträger<br />
aufmarschieren dürfen.“<br />
Aus der „Hildesheimer Allgemeinen<br />
Zeitung“<br />
Aus dem „Wittlager Kreisblatt“<br />
Aus dem „Nordbayerischen Kurier“: „Ein<br />
paar Schüler haben Stroh und lebendige<br />
Hühner im Schulhaus laufen lassen.“<br />
Aus der Fernsehbeilage „tv mit Edeka“<br />
146<br />
Rückspiegel<br />
Zitate<br />
Die „tageszeitung“ zum SPIEGEL-Essay<br />
„Der Plurimi-Faktor“ von Botho Strauß<br />
(Nr. 31/2013):<br />
Nein, der jüngste Essay aus der Feder von<br />
Botho Strauß ist kein Tabubruch von der<br />
Qualität seines Bocksgesangs aus dem<br />
Jahre 1993 … Doch auch Strauß’ n<strong>eu</strong>er<br />
Artikel im letzten SPIEGEL hat es in sich.<br />
Unter der Überschrift „Der Plurimi-Faktor.<br />
Anmerkungen zum Außenseiter“<br />
spitzt er seine Kulturkritik weiter zu und<br />
rehabilitiert eine dramatisch unterschätzte<br />
Figur: den Idioten. Scharf wie kaum<br />
einer vor ihm kritisiert Strauß den „Markt<br />
des breitgetretenen Quarks“ und das<br />
Regime der Quote. Gegen die allgegenwärtige<br />
Feier der Vernetzung erinnert er<br />
daran, dass wirkliche Kunst stets aus Vereinzelung,<br />
ja Einsamkeit erwächst.<br />
Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“<br />
zum SPIEGEL-Bericht „First<br />
Class in die Slums“ über einen Luxusflug<br />
des Limburger Bischofs Tebartz-van Elst<br />
nach Indien (Nr. 34/2012):<br />
Der Bischof von Limburg hat Kummer<br />
mit der Justiz. Er wollte dem SPIEGEL<br />
anwaltlich verbieten lassen zu schreiben:<br />
„Herr Bischof Dr. Tebartz-van Elst ist erste<br />
Klasse mit dem Flugz<strong>eu</strong>g nach Indien<br />
geflogen.“ Doch der Bischof war erster<br />
Klasse geflogen, auf einem der acht Luxusplätze<br />
im Oberdeck des Jumbojets,<br />
hin und zurück … Ein Bischof, der sich<br />
gutem Rat geöffnet hätte, wäre wohl auch<br />
nicht darauf verfallen, dem SPIEGEL-<br />
Journalisten im zweiten Schritt gerichtlich<br />
verbieten zu wollen, darüber zu berichten,<br />
wie der Bischof ihn durch irreführende<br />
Stellungnahmen zunächst hereingelegt<br />
hatte. Dazu versicherte Tebartz-van Elst<br />
an Eides statt: „Es trifft auf keinen Fall<br />
zu, dass ich die Antwort gegeben hätte,<br />
dass ich nicht erster Klasse geflogen sei.“<br />
Der Reporter allerdings hatte das Gespräch<br />
aufgezeichnet. Jeder kann das<br />
Video im Netz betrachten („Bischof von<br />
Limburg: Ein Drama in fünf Akten“).<br />
Dort antwortet der Bischof auf den Vorhalt,<br />
er sei erster Klasse geflogen: „Nein.“<br />
Weiter nahm der Bischof auf seinen Eid:<br />
„Es gab auch keine ern<strong>eu</strong>te Rückfrage des<br />
Redakt<strong>eu</strong>rs mit dem Vorhalt ,Aber Sie<br />
sind doch erster Klasse geflogen‘. Ich<br />
habe auch nicht auf einen solchen Vorhalt<br />
die Antwort gegeben ,Businessklasse sind<br />
wir geflogen‘.“ Handschriftlich unterzeichnet<br />
mit Kr<strong>eu</strong>z-Signatur. Im Video<br />
hört man den Reporter sagen: „Aber<br />
erster Klasse sind Sie geflogen.“ Der<br />
Bischof antwortet: „Businessclass sind<br />
wir ge flogen.“ Das ist besonders für<br />
Gläubige schmerzlich, weil ein Bischof<br />
die Menschen zum Licht führen soll,<br />
nicht dahinter.<br />
DER SPIEGEL 33/2013