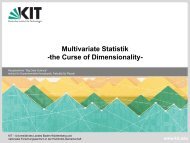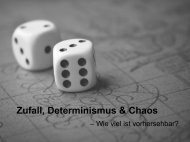IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Einleitung<br />
Die Teilchenphysik kommt mit Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider<br />
(LHC) am europäischen Kernforschungszentrum CERN 1 in Genf der Antwort auf die Frage<br />
nach den Bestandteilen der Materie immer näher. Doch aus astronomischen Messungen<br />
weiß man, dass nach derzeitigem Kenntnisstand nur ein Bruchteil der im Universum<br />
gemessenen Materie erklärt werden kann. Etwa 80% der Masse im Universum wird aus<br />
sogenannter Dunkler Materie gebildet, für die noch kein geeigneter Teilchenphysikalischer<br />
Kandidat identifiziert werden konnte.<br />
Um Teilchen der Dunklen Materie zu identifizieren werden aktuell verschiedene Ansätze<br />
verfolgt:<br />
• Direkte Messung durch Kernwechselwirkungen.<br />
• Erzeugung und Nachweis an Beschleunigerexperimenten.<br />
• Indirekte Messung aus Annihilationsprodukten in der kosmischen Strahlung.<br />
Das Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) als neuster und leistungsfähigster Detektor<br />
zur Vermessung der kosmischen Strahlung widmet sich der indirekten Messung Dunkler<br />
Materie und ist damit unter Punkt drei einzuordnen.<br />
Die Beobachtung kosmischer Strahlung begann 1912 mit deren Entdeckung durch Viktor<br />
Hess (Nobelpreis 1936) und bildet seit dem die grundlegende Methode der Astroteilchenphysik,<br />
als eine Disziplin die Methoden der Astrophysik und der Teilchenphysik gemeinsam<br />
nutzt und damit eine Verbindung zwischen dem Kleinsten und dem Größten bildet.<br />
Bahnbrechende Erfolge der Astroteilchenphysik waren die Entdeckung des Positrons, als<br />
erstes Teilchen der Antimaterie, durch Anderson 1932 (Nobelpreis 1936) und die Entdeckung<br />
der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung 1965 durch Penzias und Wilson<br />
(Nobelpreis 1978). Die Beobachtung dieser in der Urknalltheorie vorhergesagten elektromagnetischen<br />
Strahlung im infraroten Wellenlängenbereich bildete ein starkes Argument<br />
für das Urknallmodell. Dieses beschreibt die Entwicklung des Kosmos wie sie in Abbildung<br />
1.1 dargestellt ist.<br />
Heutzutage werden Teilchen der kosmischen Strahlung mit hochmodernen Detektoren und<br />
komplizierten Analysemethoden vermessen. Dazu werden unter anderem Detekorfelder, wie<br />
beim Auger Observatorium in Argentinien, errichtet, die durch kosmische Teilchen ausgelöste<br />
Teilchenschauer messen und daraus das Primärteilchen rekonstruieren. Die Erdatmosphäre<br />
fungiert dabei als Kalorimeter. Um kosmische Teilchen direkt vermessen zu<br />
1 franz.: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire<br />
1