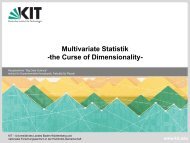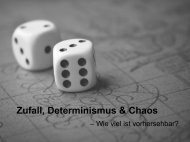IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-8 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6 2. Physikalischer Hintergrund<br />
Abbildung 2.1.: Relative Häufigkeit der Elemente in der kosmischen Strahlung als Funktion<br />
ihrer Kernladungszahl Z bei einer Energie von 1 GeV pro Nukleon,<br />
normiert auf Si=100 [3]. Gezeigt ist außerdem die Häufigkeit der Elemente<br />
im Sonnensystem (graue Dreiecke).<br />
direkt mit Satelliten oder Ballonexperimenten im oberen Bereich der Erdatmosphäre gemessen<br />
werden. Dabei können Satellitenexperimente durch ihre relativ hohen Kosten bei<br />
starker Gewichtsbeschränkung und damit relativ kleinen Abmessungen nur für niedrige<br />
Energien bis einige TeV verwendet werden. Sie bieten durch die Abwesenheit von atmosphärischen<br />
Einflüssen allerdings eine optimale Messumgebung. In diesem Bereich misst<br />
auch der AMS-02 Detektor. Wirtschaftlicher sind Ballonexperimente, bei denen ein Teilchendetektor<br />
zum Nachweis geladener Teilchen an einem Ballon auf bis zu 40 km Höhe<br />
an den Rand der Atmosphäre gebracht wird. Allerdings sind Ballonflüge nur über relativ<br />
kurze Zeiträume machbar, was die Menge gemessener Teilchen beschränkt. Außerdem<br />
wird die Messung durch Sekundärteilchen aus Wechselwirkungen in der über dem Detektor<br />
liegenden Atmosphäre verfälscht. Ballonexperimente wie das High Energy Antimatter Telescope<br />
(HEAT), das am 3. Mai 1994 seinen ersten Flug über 29 Stunden auf 36, 5 − 33 km<br />
Höhe absolvierte, bieten eine gute Möglichkeit kosmische Teilchen bis zu Energien im PeV<br />
Bereich zu Messen. HEAT war dabei mit einem Flugzeitdetektor, einem Übergangsstrahlungsdetekor,<br />
einem Spurdetektor aus Driftkammern innerhalb eines Magneten und einem<br />
elektromagnetischen Kalorimeter ausgerüstet. In Abbildung 2.3 ist eine Skizze des HEAT<br />
Detektors, sowie ein Foto des Ballons im oberen Teil der Atmosphäre beim Erstflug zu sehen.<br />
Messungen von Teilchen höherer Energie werden indirekt über Wechselwirkungen der<br />
Teilchen mit der Materie der Erdatmosphäre durchgeführt. Dabei werden geeignete Detektoren<br />
über eine große Fläche verteilt aufgestellt. Trifft ein Kern der kosmischen Strahlung<br />
auf Atome aus der Luft in der Erdatmosphäre, bildet sich ein hadronischer Schauer aus.<br />
Dieser setzt sich kaskadenartig zur Erdoberfläche fort. Hier können die entstandenen Sekundärteilchen<br />
nahezu gleichzeitig gemessen werden und aus ihrer Energie und Verteilung,<br />
sowie deren Zusammensetzung das primäre Teilchen rekonstruiert werden. Gleiches gilt für<br />
Elektronen und Photonen, wobei sich hier ein elektromagnetischer Schauer ausbildet, der<br />
vom hadronsichen unterschieden werden kann. Ein Nachteil dieser Methode ist ihre hohe<br />
Komplexität in der Schauerrekonstruktion. Außerdem kann keine Aussage über das Ladungsvorzeichen<br />
eines Teilchens gemacht werden, so dass Teilchen von deren Antiteilchen<br />
nicht unterschieden werden können. Experimente dieser Art sind der ehemalige Karlsruhe<br />
Shower Core and Array Detector (<strong>KA</strong>SCADE) am Campus Nord des Karlsruhe <strong>Institut</strong><br />
für Technologie, sowie das Pierre-Auger-Observatorium in Argentinien, das mit 1600<br />
Tscherenkow Detektoren, wie in Abbildung 2.4 rechts gezeigt, eine Fläche von 3000 km 2<br />
abdeckt. Eine weitere Möglichkeit der indirekten Messung besteht darin den Luftschauer<br />
6