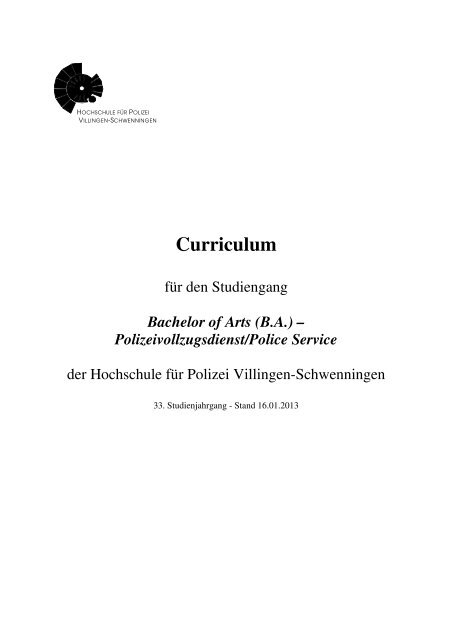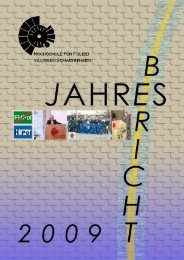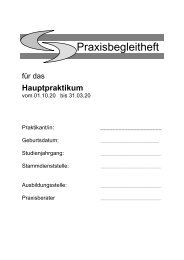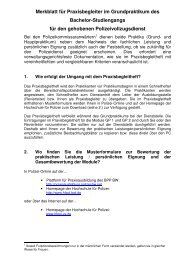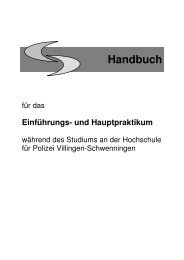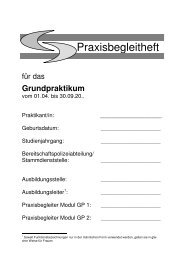Curriculum 33. Jg. 16.01.2013.pdf - Hochschule für Polizei
Curriculum 33. Jg. 16.01.2013.pdf - Hochschule für Polizei
Curriculum 33. Jg. 16.01.2013.pdf - Hochschule für Polizei
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HOCHSCHULE FÜR POLIZEI<br />
VILLINGEN-SCHWENNINGEN<br />
<strong>Curriculum</strong><br />
<strong>für</strong> den Studiengang<br />
Bachelor of Arts (B.A.) –<br />
<strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
der <strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong> Villingen-Schwenningen<br />
<strong>33.</strong> Studienjahrgang - Stand 16.01.2013
<strong>Curriculum</strong> Seite 1<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
INHALTSÜBERSICHT<br />
Seite<br />
Einleitung 3<br />
Tabellarische Übersicht über den Studiengang 12<br />
Grundpraktikum (Seiten 13 – 17)<br />
Modul GP 1 Ersterfahrungen mit polizeilicher Gefahrenabwehr /<br />
14<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Modul GP 2 Ersterfahrungen mit polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit 16<br />
Fachtheoretisches Grundstudium (Seiten 18 – 67)<br />
Modul 1 <strong>Polizei</strong> in Staat und Gesellschaft 19<br />
Teilmodul 1.1 Politikwissenschaftliche Grundlagen 20<br />
Teilmodul 1.2 Dienstverhältnis, Rechte und Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten 22<br />
Teilmodul 1.3<br />
Staats- und verfassungsrechtliche Grundlagen polizeilichen<br />
25<br />
Handelns<br />
Teilmodul 1.4 <strong>Polizei</strong>liche Berufsethik 27<br />
Modul 2 Grundlagen polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit 31<br />
Teilmodul 2.1 Grundlagen und Methoden des materiellen und formellen Strafrechts 32<br />
Teilmodul 2.2<br />
Kriminaltaktische und kriminaltechnische Grundlagen und<br />
35<br />
Methoden<br />
Teilmodul 2.3<br />
Ursachen, Erscheinungsformen und kriminologische Erfassung<br />
abweichenden Verhaltens<br />
40<br />
Modul 3<br />
Grundlagen des polizeilichen Einsatzes zur Gefahrenabwehr 43<br />
und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit<br />
Teilmodul 3.1 Grundlagen und Methoden der Einsatzwissenschaft 44<br />
Teilmodul 3.2 Grundlagen und Methoden des Verwaltungs-/ <strong>Polizei</strong>rechts 47<br />
Teilmodul 3.3 Grundlagen und Methoden der Verkehrswissenschaft 50<br />
Modul 4<br />
Grundlagen polizeilicher Kommunikation, Führung und 54<br />
Zusammenarbeit<br />
Teilmodul 4.1 Psychologische Grundlagen polizeilichen Handelns 55<br />
Teilmodul 4.2 Grundlagen polizeilicher Führung und Zusammenarbeit 58<br />
Teilmodul 4.3<br />
Informationstechnische und betriebswirtschaftliche Grundlagen<br />
polizeilichen Handelns und Entscheidens<br />
61<br />
Begleitfach 1 Einsatztraining/Sport Teil 1 65<br />
Bachelor-Arbeit 67
<strong>Curriculum</strong> Seite 2<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Modul HP 1<br />
Hauptpraktikum (Seiten 68 – 74)<br />
Praktizierte polizeiliche Gefahrenabwehr/<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
69<br />
Modul HP 2 Praktizierte polizeiliche Strafverfolgungstätigkeit 71<br />
Modul HP 3 Praktizierte Stabsarbeit 73<br />
Modul 5<br />
Modul 6<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium (Seiten 75 – 107)<br />
<strong>Polizei</strong>liche Kriminalitätsbekämpfung auf<br />
ausgewählten Deliktsfeldern<br />
<strong>Polizei</strong>licher Einsatz im Alltag und in ausgewählten<br />
Einsatzlagen / <strong>Polizei</strong>liche Verkehrssicherheitsarbeit<br />
76<br />
83<br />
Modul 7 Personalführung in ausgewählten Situationen 94<br />
Modul 8 Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus /<br />
<strong>Polizei</strong>arbeit im internationalen Kontext<br />
99<br />
Begleitfach 2 Einsatztraining/Sport Teil 2 103<br />
Begleitfach 3 <strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch/-französisch 105<br />
Bachelor-Arbeit 107<br />
Wahlmodul 108
<strong>Curriculum</strong> Seite 3<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Einleitung<br />
Ziele des Studienganges<br />
Der am Leitbild der <strong>Polizei</strong> des Landes Baden-Württemberg orientierte Studiengang „Bachelor of<br />
Arts – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service“ vermittelt durch praxisbezogene Lehre unter<br />
Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden die soziale Kompetenz sowie die<br />
berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben im gehobenen<br />
<strong>Polizei</strong>vollzugsdienst erforderlich sind. Das Studium dient insbesondere der Persönlichkeitsbildung<br />
und bereitet auf die besondere Verantwortung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen<br />
Rechtsstaat vor. Weiterhin vermittelt es die Befähigung, sich neuen Entwicklungen und Aufgaben<br />
anzupassen und konstruktiv bei der Aufgabenerfüllung und Weiterentwicklung des<br />
<strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes mitzuwirken (§ 2 Abs. 1 APrOPol gD). Eine besondere Sensibilisierung der<br />
Absolventinnen und Absoventen erfolgt auch hinsichtlich der Problematiken gesellschaftlicher<br />
Entwicklungen, wie beispielsweise dem Wertewandel, der demografischen Entwicklung, der<br />
Globalisierung oder der Migration, die sich in allen Aufgabenfelder der <strong>Polizei</strong> niederschlagen und<br />
eine Anpassung der Aufgaben und neue Schwerpunktsetzungen notwendig machen können.<br />
Nach einem vom Senat beschlossenen Zielkatalog sollen die Absolventinnen und Absolventen des<br />
Studienganges „Bachelor of Arts – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service“ der <strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong><br />
Villingen-Schwenningen…<br />
I. Persönliche Dimensionen<br />
(Persönlich-charakterliche Dimension / Berufsverständnis)<br />
• über eine hohe Berufsmotivation verfügen und sich auf die anstehenden Herausforderungen in den<br />
verschiedenen Aufgabenbereichen des gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes freuen<br />
• um die Notwendigkeit eines stetigen individuellen Erkenntnisgewinnes wissen und - in einer positiven<br />
Grundhaltung - zum lebenslangen Lernen befähigt sein<br />
• ihre charakterliche Eignung <strong>für</strong> den gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst während des gesamten Studiums unter<br />
Beweis gestellt haben<br />
• sich mit dem <strong>Polizei</strong>beruf identifizieren und in Verhalten und Erscheinungsbild dem hohen Maß an Ansehen<br />
Rechnung tragen, das die <strong>Polizei</strong> in der Gesellschaft genießt<br />
• mit einem hohen Maß an interkultureller Kompetenz Bürgern, Kollegen und Vorgesetzten vorurteilsfrei,<br />
empathiefähig und offen begegnen können<br />
• die grundsätzliche Bereitschaft entwickelt haben, sich außerhalb eines dienstlichen Pflichtenkanons zum Wohl<br />
von Mitarbeitern und Kollegen zu engagieren<br />
• sich in Wort und Schrift verständlich, präzise und regelkonform ausdrücken können<br />
• über ein hohes Maß an Stressresistenz verfügen<br />
• Aufgeschlossenheit <strong>für</strong> innovative Ideen besitzen und bereit sein, diese in der beruflichen Praxis ohne Scheu<br />
und offensiv zu vertreten<br />
(Allgemeine wissenschaftliche Dimension)<br />
• über einen analytisch-sachlichen Blick auch <strong>für</strong> komplexe Problemstellungen verfügen<br />
• die Fähigkeit besitzen, auf Fragestellungen, die sich aus der polizeilichen Aufgabenerfüllung ergeben oder mit<br />
ihr zusammenhängen, wissenschaftlich fundierte Antworten zu finden
<strong>Curriculum</strong> Seite 4<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
(Kommunikation / Repräsentation)<br />
• über eine vorbildliche Gesprächs- und Streitkultur verfügen, den Meinungen anderer aufgeschlossen<br />
gegenüber stehen und bei Diskussionen in der Lage sein, ihren Standpunkt inhaltlich überzeugend, im Stile<br />
angemessen und grundsätzlich kompromissbereit zu vertreten<br />
• Ideen, Konzepte und Arbeitsergebnisse überzeugend und zielgruppengerecht präsentieren können<br />
• über ihr Studium hinweg eine hohe Zahl kollegialer Kontakte und Beziehungen gewonnen haben und diese<br />
nicht nur als persönliche Bereicherung sondern auch als wichtiges Kapital <strong>für</strong> ihre berufliche Tätigkeit<br />
begreifen<br />
• an der Pflege bzw. dem weiterem Ausbau ihres individuellen Netzwerkes kollegialer Kontakte interessiert sein<br />
II. Fachliche Dimensionen<br />
(Führungswissenschaftliche Dimension)<br />
• Führung als notwendige, sinnvolle und zielgerichtete Verhaltensbeeinflussung begreifen<br />
• Anforderungsprofile <strong>für</strong> Vorgesetzte und Mitarbeiter kennen und befähigt werden, Initiative und Bereitschaft<br />
zu kooperativer Mitarbeit und Mitverantwortung zu entwickeln<br />
• wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bewältigung von Problemen bei der Führung und Zusammenarbeit<br />
anwenden können, um auf dieser Grundlage ihre eigene Handlungskompetenzen stetig zu erweitern<br />
• Führungsinstrumente kennen und anwenden können, um kooperatives Führen zu verstehen und zu praktizieren<br />
(Einsatzwissenschaftliche Dimension)<br />
• die gesamtgesellschaftliche Wirkung polizeilichen Handelns auf den Einzelfall bezogen erkennen und<br />
umsetzen können<br />
• unter Berücksichtigung der Grundlagen und Grundsätze der Einsatzwissenschaft handlungssicher Einsatzlagen<br />
bewältigen können<br />
• den Planungs- und Entscheidungsprozess polizeilicher Einsätze in Stabs- und Linienfunktionen anwenden<br />
können<br />
• die einsatztaktischen Maßnahmen und deren Zusammenhänge in der Wechselwirkung zu Kräften,<br />
Organisation und technisch-organisatorischen Maßnahmen begreifen und einer effiziente Planung und<br />
Umsetzung zuführen können<br />
• die Komplexität und Wechselwirkung des polizeilichen Handelns auch in der Zusammenarbeit mit anderen<br />
Behörden und Organisationen analysieren und bei der Einsatzbewältigung berücksichtigen können<br />
(Verkehrswissenschaftliche Dimension)<br />
• die volkswirtschaftliche Bedeutung des Straßenverkehrs sowie die verkehrsbezogenen Gefahrendimensionen<br />
und Verbesserungspotentiale kennen<br />
• die Systematik der Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr kennen und ausgewählte polizeirelevante<br />
Verbotsvorschriften aus den verschiedenen Rechtsbereichen sowie die polizeilichen<br />
Interventionsmöglichkeiten beherrschen<br />
• die Rechtslage und Risiken polizeilicher Streifen- und Einsatzfahrten kennen und beherrschen<br />
• Zuständigkeiten, Befugnisse und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Verkehrsunfallauswertung, der<br />
Verkehrssicherheitsberatung, der Verkehrsregelung und der Verkehrsraumgestaltung kennen und anwenden<br />
können<br />
• bei Veranstaltungen und anderen Anlässen die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen im Sinne einer<br />
ganzheitlichen Einsatzbewältigung treffen können<br />
• mit ausgewählten Problembereichen der Verkehrsunfallaufnahme und Verkehrsüberwachung vertraut sein
<strong>Curriculum</strong> Seite 5<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
(Kriminologisch-soziologische Dimension)<br />
• um die Relevanz der Erkenntnisse der kriminologischen Forschung <strong>für</strong> die praktische Kriminalitätskontrolle<br />
wissen<br />
• die Bedingungszusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen Tat, Täter, Opfer, sozialer Umwelt und<br />
gesellschaftlicher Verbrechenskontrolle kennen<br />
• die Erscheinungsformen der Kriminalität analysieren und Ansätze zur präventiven und repressiven<br />
Kriminalitätsbekämpfung entwickeln können<br />
• Möglichkeiten und Grenzen der (Kommunalen) Kriminalprävention und der Evaluation kriminalpräventiver<br />
Maßnahmen kennen und polizeiliche Beiträge entwickeln können<br />
• Möglichkeiten der kriminalprognostischen Einzelfallbeurteilung kennen und <strong>für</strong> die Einschätzung des<br />
Einzelfalles nutzen können<br />
• die soziologische Sicht der Organisation der <strong>Polizei</strong>, der "<strong>Polizei</strong>kultur" und des polizeilichen Alltags sowie<br />
den sozialen Aufbau der Gesellschaft, ihre Wandlungsprozesse und deren kriminologische Relevanz kennen<br />
(Kriminaltaktische Dimension)<br />
• Kriminaltaktik als wissenschaftliche Disziplin unter Einbeziehung insbesondere kriminologischer,<br />
psychologischer, soziologischer und juristischer Erkenntnisse begreifen<br />
• mit kriminalistischem Denken und den aktuellen analytischen Methoden und Verfahren unter<br />
Berücksichtigung psychologischer und soziologischer Einflüsse sowie rechtlicher Grenzen vertraut sein<br />
• die forensischen Ansprüche an die kriminalistische Beweisführung kennen<br />
• Ermittlungsverfahren professionell bearbeiten können<br />
• die Fähigkeit zur funktionsgerechten kriminalistischen Mitarbeit in besonderen Aufbauorganisationen besitzen<br />
(Kriminaltechnische Dimension)<br />
• Kriminaltechnik als wissenschaftliche Disziplin unter Einsatz der Physik, Chemie und Biologie sowie<br />
technischer Entwicklungen zur Aufklärung polizeirelevanter Ereignisse begreifen<br />
• die vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen den wissenschaftlichen Einzeldisziplinen sowie ihre<br />
Bedeutung <strong>für</strong> die polizeiliche Arbeit kennen<br />
• sich der Bedeutung der Kriminaltechnik <strong>für</strong> die repressive und präventive Kriminalitätsbekämpfung bewusst<br />
sein<br />
• mit den kriminaltechnischen Methoden vertraut sein<br />
• die Fähigkeit besitzen, sich selbständig mit den Ergebnissen kriminaltechnischer Forschung<br />
auseinanderzusetzen, sie zu beurteilen und in der Praxis anzuwenden<br />
(Materiell-strafrechtliche Dimension)<br />
• den aus dem materiellen Strafrecht abgeleiteten Strafanspruch der Allgemeinheit in seiner<br />
verfassungsrechtlichen Fundierung und Begrenzung verstanden und die daraus gebotenen methodischen<br />
Konsequenzen gezogen haben<br />
• die Bedeutung des materiellen Strafrechts als Grundlage der Verbrechensbekämpfung begriffen und seine<br />
praktische Bedeutung <strong>für</strong> polizeiliche Ermittlungstätigkeiten erkannt haben<br />
• die Rechtsinstitute des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs sicher anwenden können, um daraus die<br />
Anforderungen <strong>für</strong> polizeiliche Ermittlungstätigkeit auch im Einzelfall abzuleiten<br />
• die Vorschriften des Besonderen Teils des StGB und ausgewählte Vorschriften des Nebenstrafrechts kennen<br />
und die wesentlichen Strafbestimmungen unter Berücksichtigung ihres rechtstatsächlich-kriminologischen<br />
Hintergrundes in ihren Merkmalen sicher beherrschen, um dem Legalitätsprinzip genügen zu können<br />
• strafrechtliche Reformgesetze in die Anwendung des Strafgesetzes bei der praktischen<br />
Verbrechensbekämpfung umsetzen können<br />
• die Methodik und Systematik der Bearbeitung strafrechtlicher Fragestellungen beherrschen, um auch <strong>für</strong><br />
komplexe Sachverhalte angemessene Lösungen entwickeln zu können<br />
(Formell-strafrechtliche Dimension)
<strong>Curriculum</strong> Seite 6<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
• das Strafverfahrensrecht als angewandtes Verfassungsrecht begriffen und die Eingriffsbegrenzungen und<br />
rechtsstaatlichen Sicherungen verinnerlicht haben<br />
• die das Strafverfahren in seinen verschiedenen Phasen leitenden Grundsätze kennen und in der Lage sein,<br />
daraus Ableitungen bei der Auslegung einzelner Normen zu bilden<br />
• die <strong>für</strong> das Strafverfahren bedeutsamen Rechtsinstitute und Rechtsvorschriften kennen und ihre Anwendung<br />
und Auslegung vertieft beherrschen<br />
• das Verhältnis der <strong>Polizei</strong> zu den anderen Verfahrensbeteiligten einordnen und Rückschlüsse aus späteren<br />
Phasen des Strafverfahrens auf polizeiliche Ermittlungstätigkeit ziehen können<br />
(Dienstrechtliche Dimension)<br />
• die Zusammenhänge im öffentlichen Dienstrecht verstehen und damit Gestaltungsspielräume und<br />
Möglichkeiten der Weiterentwicklung nutzen können<br />
• das Beamtenrecht aus der Sicht der Betroffenen und der Vorgesetzten beherrschen<br />
• die fachliche und damit auch die soziale Kompetenz des gehobenen Dienstes stärken können<br />
• die Instrumente zeitgerechter Menschenführung in ihrer rechtlichen Seite erfassen<br />
• die Rechte und Pflichten eines <strong>Polizei</strong>beamten in Baden-Württemberg kennen<br />
• die Umsetzung der notwendigen und geeigneten Maßnahmen rechtlich einwandfrei beherrschen<br />
(Staats- und verfassungsrechtliche Dimension)<br />
• die staatsrechtlichen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland und die Grundstrukturen der Europäischen<br />
Union kennen<br />
• die verfassungsrechtlichen Bezüge polizeilichen Handelns im Rechtsstaat verstehen<br />
• die Struktur der Grundrechte erkennen und die Grundrechte anwenden können<br />
• die Schutzbereiche und die Grenzen der Einschränkbarkeit der Grundrechte mit besonderem <strong>Polizei</strong>bezug<br />
beherrschen<br />
(Verwaltungs- und polizeirechtliche Dimension)<br />
• die gesetzlichen Grundlagen polizeilichen Handelns verstehen und anwenden können<br />
• Organisation und Aufbau der <strong>Polizei</strong> als Teil der Landesverwaltung kennen und dementsprechend auch<br />
Zuständigkeiten richtig beurteilen können<br />
• <strong>Polizei</strong>zwang anwenden können<br />
• die Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Eingriffsmaßnahmen in Grundzügen kennen und ihre Erfolgsaussichten<br />
im Einzelfall beurteilen können<br />
• die rechtlichen Voraussetzungen möglicher Entschädigungsansprüche des Bürgers wegen polizeilicher<br />
Maßnahmen kennen und so Haftungsfälle der <strong>Polizei</strong> vermeiden können<br />
• die besondere Zuständigkeit der <strong>Polizei</strong> beim Schutz privater Rechte kennen<br />
(Aufenthaltsrechtliche Dimension)<br />
• die nationalen und europarechtlichen Grundlagen des Aufenthaltsrechts verstehen und so in der Lage sein, den<br />
aufenthaltsrechtlichen Status eines Ausländers zu bestimmen<br />
• ausländerrechtliche Maßnahmen im polizeilichen Zuständigkeitsbereich durchführen können<br />
• die Rolle der <strong>Polizei</strong> im Asylverfahren kennen und die gesetzlichen Maßnahmen durchführen können<br />
• die gesetzlichen Voraussetzungen der Abschiebehaft kennen und in der Lage sein, in eigener Zuständigkeit<br />
eine Haft zu beantragen<br />
• die die Erwerbstätigkeit von Ausländern regelnden Bestimmungen kennen und die notwendigen Maßnahmen<br />
ergreifen können<br />
• die Grundzüge des Ausweisungsrechts und die Bedeutung polizeilicher Ermittlungen <strong>für</strong> die Feststellung von<br />
Ausweisungsgründen kennen<br />
(Versammlungsrechtliche Dimension)
<strong>Curriculum</strong> Seite 7<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
• sich der verfassungsrechtlichen Bedeutung der Versammlungsfreiheit bewusst sein<br />
• die Rechtsnatur einer Versammlung bewerten können und sich im Klaren über Zuständigkeiten sein<br />
• Handlungssicherheit bei der Bewältigung von Versammlungslagen besitzen<br />
(Eingriffsrechtliche Dimension)<br />
• in der Lage sein, komplexe polizeirelevante Sachverhalte auf der Basis ihrer staats-, verfassungs-,<br />
strafverfahrens-, verwaltungs- und polizeirechtlichen Kenntnisse umfassend rechtlich zu würdigen<br />
• das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Belange der Inneren Sicherheit verstehen und im<br />
Einzelfall zum Ausgleich bringen können<br />
• die polizeirelevanten Bestimmungen über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten verstehen<br />
und in der vollzugspolizeilichen Praxis anwenden können<br />
(Europarechtliche Dimension)<br />
• die rechtlichen Grundlagen der polizeilichen Zusammenarbeit auf Europaebene beherrschen und fallbezogen<br />
anwenden können<br />
(Psychologische Dimension)<br />
• eigene psychosoziale Strukturen kennen und kritisch reflektieren können<br />
• befähigt sein, das Verhalten von Bürgern und Mitarbeitern angemessen zu beschreiben, zu erklären und zu<br />
beeinflussen<br />
• in der Lage sein, in den unterschiedlichen Situationen des polizeilichen Alltages adressatengerecht und<br />
erfolgreich kommunizieren zu können<br />
• ihre Einstellung und ihr Verhalten im Berufsalltag selbstkritisch reflektieren können<br />
• in der Lage sein, sich auch in belastenden Situationen und im Umgang mit psychisch auffälligen Personen<br />
professionell zu verhalten<br />
(Politikwissenschaftliche Dimension)<br />
• die normativen Grundlagen und Elemente der freiheitlichen Demokratie kennen und gegenüber anderen<br />
politischen Ordnungsmodellen abgrenzen können<br />
• die wesentlichen Strukturen, Verfahren und Prozesse des politischen und gesellschaftlichen Systems der<br />
Bundesrepublik Deutschland kennen und beurteilen können<br />
• die Rolle der <strong>Polizei</strong> als Teil der Exekutive im demokratischen Rechtsstaat kennen und in der Lage sein, das<br />
Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit professionell einzuschätzen<br />
• aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Relevanz <strong>für</strong> die <strong>Polizei</strong> erkennen und<br />
einordnen können<br />
• befähigt sein, den europäischen und internationalen Bezugsrahmen deutscher Politik und die Interdependenz<br />
der modernen Welt zu erkennen und zu analysieren<br />
• die besondere Herausforderung von Gesellschaft und <strong>Polizei</strong> durch Extremismus und Terrorismus erkennen<br />
können<br />
(DV-Kommunikationstechnische Dimension)<br />
• Grundkenntnisse über den gegenwärtigen Stand der Informations- und Kommunikationstechnik besitzen<br />
• mit der Handhabung von PCs und PC-Software vertraut sein<br />
• die technischen Hintergründe des Internets kennen<br />
• das Internet als Informationsressource nutzen können<br />
• Kenntnisse der informatischen Grundlagen zur Computer- und Internetkriminalität sowie Basiskenntnisse zur<br />
Computerforensik besitzen<br />
• Prinzipien des persönlichen Wissensmanagements kennen und anwenden können<br />
• Software zur Unterstützung des persönlichen Wissenmanagements einsetzen können
<strong>Curriculum</strong> Seite 8<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
(Wirtschaftswissenschaftliche Dimension)<br />
• Grundlagen, Fragestellungen und Lösungsansätze der Wirtschaftswissenschaften kennen<br />
• die Zusammenhänge von Wirtschaftssystemen und wirtschaftlicher, sozialer und politischer Entwicklung<br />
kennen<br />
• einen fundierten Standpunkt zu aktuellen betriebswirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb der öffentlichen<br />
Verwaltung erworben haben<br />
• die wichtigsten Unternehmensformen insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von<br />
Ermittlungsverfahren kennen<br />
• Verständnis <strong>für</strong> die dezentrale Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnungssysteme, Controlling und<br />
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 7 LHO entwickelt haben<br />
(Berufsethische Dimension)<br />
• mit grundlegender ethischer Fachbegrifflichkeit vertraut sein, Verfahren reflektierter ethischer Urteilsbildung<br />
und Formen ethischer Argumentation beherrschen und auf dieser Grundlage berufsbezogene moralische<br />
Urteile bewerten können<br />
• ausgehend vom Verfassungsgrundsatz der unantastbaren Menschenwürde die Normensysteme Recht und Ethik<br />
analytisch unterscheiden und in Bezug auf praktische polizeiliche Handlungssituationen angemessen<br />
zueinander in Beziehung setzen können<br />
• die ethische Fundierung des kooperativen Führungssystems verstehen, in der Lage sein, eigene<br />
Führungsentscheidungen an diesen Kriterien auszurichten und die eigene Führungsethik kompetent zu<br />
kommunizieren<br />
• die ethische Dimension ihrer Eingriffsbefugnisse und Eingriffspraxis verstehen, den Bereich ihrer persönlichen<br />
Verantwortung erkennen und in der Lage sein, Wertkonflikte wahrzunehmen und in ihrem Handeln zu<br />
berücksichtigen<br />
• die existenzielle Dimension des Umgangs mit Gewalt, Verletzung, Tod und Schuld verstehen, ein Bewusstsein<br />
<strong>für</strong> die eigenen und fremden Betroffenheiten in Grenzsituationen entwickelt haben und ihr Handeln in solchen<br />
Situationen unter dem Gesichtspunkt ihrer Berufsidentität und Berufsverantwortung reflektieren und<br />
begründen können<br />
• ihre eigenen Wertvorstellungen im Bereich der Kriminalitätskontrolle und Strafverfolgung reflektieren und die<br />
staatliche Gewaltenteilung als rechtliche Begrenzung ihres Handelns und ihrer eigenen moralischen Impulse<br />
akzeptieren<br />
(Fremdsprachliche Dimension)<br />
• einfache berufliche Situationen in den <strong>Polizei</strong>fachsprachen Englisch oder Französisch bewältigen können<br />
• grundlegende grammatikalische Strukturen der englischen oder französischen Sprache beherrschen<br />
• eine entwicklungsfähige kommunikative Kompetenz in der Zielsprache vorweisen<br />
• Grundkenntnisse über die englische oder die französische <strong>Polizei</strong> besitzen<br />
• Eine interkulturelle Kompetenz im Hinblick auf ein besseres Verständnis <strong>für</strong> die englische oder französische<br />
<strong>Polizei</strong>kultur entwickeln<br />
(Dimension des Einsatztrainings)<br />
• sich der Bedeutung des Einsatztrainings <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst bewusst sein<br />
• die grundlegenden Inhalte des Einsatztrainings kennen und beherrschen<br />
• mit persönlicher Handlungskompetenz <strong>für</strong> kritische Einsatzsituationen des polizeilichen Alltags ausgestattet<br />
sein und polizeiliche Einsatzlagen unter Eigensicherungsaspekten sicher lösen können<br />
• Mitarbeiter <strong>für</strong> ein regelmäßiges Einsatztraining motivieren können
<strong>Curriculum</strong> Seite 9<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
(Sportliche Dimension)<br />
• sich der Bedeutung des Sports <strong>für</strong> körperliche Entwicklung und persönliches Wohlbefinden und als<br />
Qualitätsmerkmal <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst bewusst sein<br />
• Grundlagen des Gesundheits- und Präventionssportes kennen und eigenverantwortlich ausführen können<br />
• sich eigenverantwortlich durch systematische sportliche Betätigung körperlich leistungsfähig halten sowie die<br />
konditionellen und koordinierenden Fähigkeiten erhalten und verbessern können<br />
• die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund gesundheitlicher Risiken kennen<br />
• Mitarbeiter <strong>für</strong> den Dienstsport motivieren können<br />
Diese Studienziele haben im Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung des <strong>Curriculum</strong>s durch die<br />
Fachgruppen der <strong>Hochschule</strong> (<strong>für</strong> das Fachtheoretische Studium) und zwei Workshops der<br />
<strong>Hochschule</strong> mit Vertretern der Landespolizei (<strong>für</strong> die Praktika) weitere Verfeinerungen erfahren.<br />
Zur Erreichung der Studienziele bietet die <strong>Hochschule</strong> - neben diesem <strong>Curriculum</strong> – seit jeher auch<br />
auf die polizeispezifischen Bedürfnisse abgestimmte, die persönliche und soziale Kompetenz<br />
fördernde Studienbedingungen.<br />
Module<br />
Begriffsdefinitionen<br />
Module sind thematisch und zeitlich abgerundete, in sich abgeschlossene und mit ECTS-<br />
Leistungspunkten versehene abprüfbare Lerneinheiten. Im Regelfall sind die Studierenden zur<br />
Teilnahme an diesen Lerneinheiten verpflichtet (Pflichtmodule). Daneben bietet die <strong>Hochschule</strong> im<br />
Fachtheoretischen Hauptstudium Module an, von denen die Studierenden entsprechend ihrer<br />
Interessen jeweils ein Angebot ihrer Wahl wahrnehmen können (Wahlmodule).<br />
Module können untergliedert werden, wenn dies aus didaktischen oder administrativen Gründen<br />
sinnvoll erscheint (§ 17 Abs. 1 APrOPol gD).<br />
ECTS-Leistungspunkte<br />
Das europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen<br />
(„European Credit Transfer and Accumulation System“ – ECTS) wurde 1989 im Rahmen des EU-<br />
Hochschulförderprogrammes Erasmus eingeführt und ist ein auf die Studierenden ausgerichtetes<br />
System, das unter anderem dazu dient, die Studierbarkeit von Studiengängen zu gewährleisten. Es<br />
findet in diesem <strong>Curriculum</strong> wie folgt Anwendung:<br />
Für erfolgreich abgeschlossene Module und Begleitfächer, sowie die erfolgreichen Leistungen zur<br />
Bachelor-Arbeit werden Leistungspunkte vergeben, die sich an dem <strong>für</strong> die jeweiligen<br />
Studienleistungen veranschlagten durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand ausrichten<br />
(ECTS-Leistungspunkte). Jeder im <strong>Curriculum</strong> <strong>für</strong> den Studiengang „Bachelor of Arts (B.A.) –<br />
<strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service“ ausgewiesene ECTS-Leistungspunkt entspricht einem<br />
geschätzten durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 30 vollen Stunden (§ 17 Abs. 2<br />
und 3 APrOPol gD).<br />
Kontaktstudium
<strong>Curriculum</strong> Seite 10<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Kontaktstudium im Sinne dieses <strong>Curriculum</strong>s ist ein Studieren nach klaren methodischen,<br />
inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben in einem didaktisch sinnvollen Modell und in direktem bzw.<br />
jederzeit herstellbarem persönlichem Kontakt (z.B. bei Gruppenarbeiten) mit einer<br />
fachkompetenten Lehrkraft.<br />
Selbststudium<br />
Selbststudium im Sinne dieses <strong>Curriculum</strong>s ist eigenständiges Studieren innerhalb eines<br />
vorgegebenen Zeitrahmens an frei gewählten Orten und bei freier Zeiteinteilung mit oder ohne<br />
konkrete Vorgaben.<br />
Charakter und Struktur des Studienganges<br />
Der Studiengang „Bachelor of Arts – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service“ der <strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Polizei</strong> Villingen-Schwenningen ist - dem Bedarf und der Personalpolitik der <strong>Polizei</strong> des Landes<br />
Baden-Württemberg entsprechend - generalistisch angelegt und an der so genannten dreigeteilten<br />
Laufbahn ausgerichtet.<br />
Das <strong>Curriculum</strong> trägt strukturell und inhaltlich dem Umstand Rechnung, dass in dem Studiengang<br />
sowohl so genannte Aufstiegsbeamte – im Ausbildungsdienst nach § 18 <strong>Polizei</strong>-<br />
Laufbahnverordnung (LVOPol) – als auch <strong>Polizei</strong>kommissaranwärter – im Vorbereitungsdienst<br />
nach § 19 LVOPol – studieren.<br />
Die voranschreitende Internationalisierung der <strong>Polizei</strong>arbeit spiegelt sich nicht nur in den<br />
vielgestaltigen Auslandsbeziehungen der <strong>Hochschule</strong> und den Rahmenbedingungen des Studiums<br />
(zum Beispiel Möglichkeit von Auslandsstudienfahrten) sondern auch im <strong>Curriculum</strong> wider.<br />
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere<br />
- die modular verankerte „<strong>Polizei</strong>arbeit im internationalen Kontext“<br />
- eine Reihe von Lehrveranstaltungen mit internationalen Bezügen<br />
- die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes im Hauptpraktikum und<br />
- die Fremdsprachenausbildung im Begleitfach „<strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch(-französisch“).<br />
Der Studiengang ist nach § 16 Abs. 1 APrOPol gD in die vier inhaltlich und chronologisch<br />
miteinander verzahnten Studienabschnitte „Grundpraktikum“ (6 Monate), „Fachtheoretisches<br />
Grundstudium“ (12 Monate), „Hauptpraktikum“ (6 Monate) und „Fachtheoretisches Hauptstudium“<br />
(12 Monate) gegliedert.<br />
Im dem aus zwei Pflichtmodulen bestehenden Grundpraktikum sollen die Studierenden ihr<br />
Berufsfeld in dessen Kernbereichen kennen lernen und die in der Vorausbildung erworbenen<br />
Grundfertigkeiten in typischen Situationen des Alltags anwenden. Hierbei werden sie von fachlich<br />
kompetenten und pädagogisch geeigneten <strong>Polizei</strong>beamten (Praxisbegleiter) begleitet (§ 21 APrOPol<br />
gD). Im Grundpraktikum sind 30 ECTS-Leistungspunkte zu erwerben; wegen ihrer im mittleren<br />
Dienst erworbenen Berufserfahrung wird Aufstiegsbeamten dieser Studienabschnitt unter<br />
Anrechnung der da<strong>für</strong> vorgesehen ECTS-Leistungspunkte erlassen (§ 24 Abs. 1 APrOPol gD).<br />
Das fachtheoretische Grundstudium (§ 26 APrOPol gD) dient dem systematischen Erwerb von<br />
fundiertem Grundlagen- und Methodenwissen in den einzelnen berufsfeldbezogenen<br />
wissenschaftlichen Bereichen. Es umfasst vier Pflichtmodule, die sich in drei oder vier disziplinäre<br />
Teilmodule untergliedern, sowie das Begleitfach „Einsatztraining/Sport Teil 1“. Im
<strong>Curriculum</strong> Seite 11<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Fachtheoretischen Grundstudium sind entsprechend einem studentischen Arbeitsaufwand von 1650<br />
Stunden insgesamt 55 ECTS-Leistungspunkte zu erwerben. Ein studentischer Arbeitsaufwand von<br />
weiteren 150 Stunden – entsprechend 5 ECTS-Leistungspunkten – ist in diesem Studienabschnitt<br />
<strong>für</strong> Leistungen zur Bachelor-Arbeit vorgesehen.<br />
Im Hauptpraktikum wenden die Studierenden das im fachtheoretischen Grundstudium erworbene<br />
Grundlagen- und Methodenwissen in typischen Aufgabenfeldern und Funktionen des gehobenen<br />
<strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes selbstständig, verantwortungsvoll und teamorientiert an. Hierbei werden sie<br />
jeweils von einem erfahrenen <strong>Polizei</strong>beamten beraten (Praxisberater) (§ 31 APrOPol gD). Der 900<br />
Stunden studentischer Arbeitsaufwand umfassende Studienabschnitt besteht aus drei<br />
Pflichtmodulen in einem frei wählbaren zeitlichen Umfang von jeweils 240, 300, 360 oder 420<br />
Stunden (entsprechend 8, 10, 12 oder 14 ECTS-Leistungspunkten). Sofern in den drei<br />
Pflichtmodulen jeweils mindestens 240 Stunden Dienst in den modulspezifischen Tätigkeitsfeldern<br />
abgeleistet wird, sind nach Maßgabe der Studienordnung auch Hospitationen bei polizeilichen oder<br />
<strong>für</strong> die polizeiliche Tätigkeit relevanten Einrichtungen in einem zeitlichen Umfang von insgesamt<br />
bis zu drei Wochen oder Auslandsaufenthalte von maximal 4,5 Wochen Dauer möglich.<br />
Das fachtheoretische Hauptstudium dient der weiteren Vertiefung von Fachwissen und dem<br />
Erwerb der Befähigung<br />
1. zur ganzheitlichen Analyse komplexer polizeilicher Problemlagen,<br />
2. zur Erarbeitung taktischer und strategischer Konzepte im Bewusstsein um die Vielschichtigkeit<br />
polizeilichen Handelns,<br />
3. zur Übernahme von Führungs- und Einsatzverantwortung im täglichen <strong>Polizei</strong>dienst (§ 36<br />
APrOPol gD).<br />
Es gliedert sich in vier komplexe Pflichtmodule und in die Begleitfächer „Einsatztraining/Sport Teil<br />
2“ und <strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch/-französisch“.<br />
Im Fachtheoretischen Hauptstudium sind entsprechend einem studentischen Arbeitsaufwand von<br />
1650 Stunden insgesamt 55 ECTS-Leistungspunkte zu erwerben. Ein studentischer Arbeitsaufwand<br />
von weiteren 150 Stunden – entsprechend 5 ECTS-Leistungspunkten – ist in diesem<br />
Studienabschnitt <strong>für</strong> Leistungen zur Bachelor-Arbeit vorgesehen.<br />
Daneben bietet die <strong>Hochschule</strong> Wahlmodule im Umfang von jeweils 150 Arbeitsstunden (5 ECTS-<br />
Leistungspunkten) an.
<strong>Curriculum</strong> Seite 12<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Kurzbezeichnung<br />
Tabellarische Übersicht über den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel ECTS ECTS-<br />
Summe je<br />
Abschnitt<br />
Studentischer<br />
Arbeitsaufwand<br />
gesamt in Std.<br />
davon<br />
Kontaktstudium<br />
Modul GP 1 Ersterfahrungen mit polizeilicherGefahrenabwehr/Verkehrsicherheitsarbeit 20<br />
600 nach<br />
30<br />
Dienstplan<br />
Modul GP 2 Ersterfahrungen mit polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit 10 300 nach<br />
Dienstplan<br />
Modul 1 <strong>Polizei</strong> in Staat und Gesellschaft 8<br />
240 109 131<br />
Modul 2 Grundlagen polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit 20 600 246 354<br />
Modul 3 Grundlagen des polizeilichen Einsatzes zur Gefahrenabwehr und<br />
13 390 172 218<br />
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit<br />
60<br />
Modul 4 Grundlagen polizeilicher Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit 12 360 149 211<br />
Begleitfach 1 Einsatztraining/Sport Teil 1 2 60 48 12<br />
BA Bachelor-Arbeit 5 150<br />
Modul HP 1 Praktizierte polizeiliche Gefahrenabwehr/Verkehrssicherheitsarbeit Je 8,<br />
240, 300, 360 nach<br />
Modul HP 2 Praktizierte polizeiliche Strafverfolgungstätigkeit<br />
10,12, 30 oder 420 Dienstplan<br />
Modul HP 3 Praktizierte Stabsarbeit<br />
od. 14<br />
Modul 5 <strong>Polizei</strong>liche Kriminalitätabekämpfung auf ausgewählten Deliktsfeldern 19<br />
570 227 343<br />
Modul 6 <strong>Polizei</strong>licher Einsatz im Alltag und in ausgewählten Einsatzlagen/<br />
16 480 196 284<br />
<strong>Polizei</strong>liche Verkehrsicherheitsarbeit<br />
Modul 7 Personalführung in ausgewählten Situationen 8 240 73 167<br />
Modul 8 Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus/<br />
5 60<br />
150 58 92<br />
<strong>Polizei</strong>arbeit im internationalen Kontext<br />
Begleitfach 2 Einsatztraining/Sport Teil 2 3 90 48 42<br />
Begleitfach 3 <strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch/-französisch 4 120 47 73<br />
BA Bachelor-Arbeit 5 150<br />
Wahlmodul n.n. 5 5 150 mind. 38<br />
davon<br />
Selbststudium
<strong>Curriculum</strong> Seite 13<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Grundpraktikum<br />
(Seiten 13 – 17)<br />
Modul GP 1 Ersterfahrungen mit polizeilicher Gefahrenabwehr /<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
14<br />
Modul GP 2<br />
Ersterfahrungen mit polizeilicher<br />
Strafverfolgungstätigkeit<br />
16
<strong>Curriculum</strong> Seite 14<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
Modul GP 1<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
<strong>Polizei</strong>praxis<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Grundpraktikum/1.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modultitel:<br />
Ersterfahrungen mit polizeilicher<br />
Gefahrenabwehr /<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Modulkoordinator:<br />
Praxiskoordinator der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong><br />
- lernen die <strong>Polizei</strong>praxis kennen<br />
- gewinnen erste Erfahrungen im Bereich des Streifendienstes<br />
- erleben sich als Mitglied der Teams Streifendienst<br />
- werden sich der Verantwortung ihres Berufes bewusst<br />
- stellen ihre persönliche Eignung und die ausreichende fachliche Leistung <strong>für</strong><br />
eine spätere Tätigkeit im gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst unter Beweis<br />
Lerninhalte:<br />
Typische Tätigkeitsfelder des Streifendienstes, wie<br />
- Durchführung einer Fahrzeugkontrolle<br />
- Verkehrsregelung an Unfall- und Kontrollstellen<br />
- Erkennen und Ahnden von Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />
- Entgegennahme von Meldungen und Notrufen sowie Einleitung von<br />
Sofortmaßnahmen<br />
- Durchführung von Vernehmungen<br />
- Durchführung einer Identitätsfeststellung<br />
- Durchsuchung von Personen oder Sachen – strafprozessual oder<br />
polizeirechtlich<br />
- Treffen polizeilicher Maßnahmen bei Familien- und<br />
Nachbarschaftsstreitigkeiten<br />
- Anwendung und Durchführung von Unmittelbarem Zwang<br />
- Treffen von polizeilichen Maßnahmen bei festgestellter Ungeeignetheit zum<br />
Führen von Fahrzeugen und bei technischen Mängeln<br />
- Aufnahme und Bearbeitung eines VU einschließlich der erforderlichen<br />
Verständigungs- und Sofortmaßnahmen
<strong>Curriculum</strong> Seite 15<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
20<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
600 Stunden<br />
(Dienst entsprechend des <strong>für</strong> die jeweilige<br />
Dienstgruppe gültigen Dienstplans, ausgerichtet<br />
an der Regelarbeitszeit)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Vorausbildung<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Fünf Bewertungsbögen <strong>für</strong> praktische Leistung und<br />
fünf Bewertungsbögen <strong>für</strong> persönliche Eignung
<strong>Curriculum</strong> Seite 16<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
Modul GP 2<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
<strong>Polizei</strong>praxis<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Grundpraktikum/1.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modultitel:<br />
Ersterfahrungen mit polizeilicher<br />
Strafverfolgungstätigkeit<br />
Modulkoordinator:<br />
Praxiskoordinator der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong><br />
- lernen die <strong>Polizei</strong>praxis kennen<br />
- gewinnen erste Erfahrungen im Bereich des Bezirks- oder Postendienstes<br />
- werden sich der Verantwortung ihres Berufes bewusst<br />
- stellen ihre persönliche Eignung und die ausreichende fachliche Leistung <strong>für</strong><br />
eine spätere Tätigkeit im gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst unter Beweis<br />
Lerninhalte:<br />
Typische Tätigkeitsfelder des Bezirks- und Postendienstes, wie<br />
- Durchführung von Vernehmungen<br />
- Betreten und Durchsuchen von Räumen/Wohnungen – strafprozessual oder<br />
polizeirechtlich<br />
- Aufnahme von Diebstahls- oder Sachbeschädigungsdelikten<br />
- Aufnahme von Betrugsdelikten<br />
- Aufnahme von Körperverletzungsdelikten<br />
- Durchführung einer Beschlagnahme oder Sicherstellung – strafprozessual oder<br />
polizeirechtlich<br />
- Durchsuchung von Personen oder Sachen – strafprozessual oder<br />
polizeirechtlich<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
10<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
300 Stunden<br />
(Dienst entsprechend des <strong>für</strong> den jeweiligen<br />
Arbeitsbereich gültigen Dienstplans, ausgerichtet an<br />
der Regelarbeitszeit)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Vorausbildung
<strong>Curriculum</strong> Seite 17<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Drei Bewertungsbögen <strong>für</strong> praktische Leistung und<br />
drei Bewertungsbögen <strong>für</strong> persönliche Eignung
<strong>Curriculum</strong> Seite 18<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Fachtheoretisches Grundstudium<br />
(Seiten 18 – 67)<br />
Modul 1 <strong>Polizei</strong> in Staat und Gesellschaft 19<br />
Teilmodul 1.1 Politikwissenschaftliche Grundlagen 20<br />
Teilmodul 1.2 Dienstverhältnis, Rechte und Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten 22<br />
Teilmodul 1.3<br />
Staats- und verfassungsrechtliche Grundlagen polizeilichen 25<br />
Handelns<br />
Teilmodul 1.4 <strong>Polizei</strong>liche Berufsethik 27<br />
Modul 2 Grundlagen polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit 31<br />
Teilmodul 2.1<br />
Teilmodul 2.2<br />
Teilmodul 2.3<br />
Modul 3<br />
Grundlagen und Methoden des materiellen und formellen<br />
Strafrechts<br />
Kriminaltaktische und kriminaltechnische Grundlagen und<br />
Methoden<br />
Ursachen, Erscheinungsformen und kriminologische Erfassung<br />
abweichenden Verhaltens<br />
Grundlagen des polizeilichen Einsatzes zur<br />
Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der<br />
öffentlichen Sicherheit<br />
Teilmodul 3.1 Grundlagen und Methoden der Einsatzwissenschaft 44<br />
Teilmodul 3.2 Grundlagen und Methoden des Verwaltungs-/ <strong>Polizei</strong>rechts 47<br />
Teilmodul 3.3 Grundlagen und Methoden der Verkehrswissenschaft 50<br />
Modul 4<br />
Grundlagen polizeilicher Kommunikation, Führung<br />
und Zusammenarbeit<br />
Teilmodul 4.1 Psychologische Grundlagen polizeilichen Handelns 55<br />
Teilmodul 4.2 Grundlagen polizeilicher Führung und Zusammenarbeit 58<br />
Teilmodul 4.3<br />
Informationstechnische und betriebswirtschaftliche<br />
Grundlagen polizeilichen Handelns und Entscheidens<br />
61<br />
Begleitfach 1 Einsatztraining / Sport 1 65<br />
Bachelor-Arbeit 67<br />
32<br />
35<br />
40<br />
43<br />
54
<strong>Curriculum</strong> Seite 19<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
1<br />
Modultitel:<br />
<strong>Polizei</strong> in Staat und Gesellschaft<br />
Modulkoordinator:<br />
Dr. Johannes Deger,<br />
Fakultät III<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät IV – Politikwissenschaft, Berufsethik<br />
Fakultät III – Recht des öffentlichen Dienstes, Staats- und Verfassungsrecht<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/2. und 3. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die normativen Grundlagen und Elemente der freiheitlichen Demokratie<br />
sowie die wesentlichen Strukturen, Akteure und Prozesse des politischen und<br />
rechtlichen Systems der Bundesrepublik Deutschland<br />
- verstehen die Rolle der <strong>Polizei</strong> als Teil der Exekutive im Rechtsstaat und das<br />
Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit<br />
- bringen die Normensysteme Recht und Ethik zueinander in Beziehung und<br />
beherrschen Verfahren ethischer Urteilsbildung<br />
- beherrschen die Auslegung und Anwendung der Grundrechte mit besonderem<br />
<strong>Polizei</strong>bezug, können dabei Wertkonflikte berücksichtigen<br />
- kennen die Rechte und Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten und die zu deren Umsetzung<br />
notwendigen rechtlichen Maßnahmen<br />
- erfassen die Methoden zeitgerechter Menschenführung rechtlich und ethisch<br />
Lerninhalte:<br />
- Politisches System und politische Prozesse: Deutschland und Baden-<br />
Württemberg<br />
- Politikfeld Innere Sicherheit<br />
- Verfahren ethischer Urteilsbildung und Formen ethischer Argumentation<br />
- Ethik als Bestandteil von Organisationskultur und Einsatzhandeln<br />
- Rechtsstaatsprinzip und rechtliche Einbindung Deutschlands in die Europäische<br />
Union<br />
- Grundrechte und grundrechtskonformes Handeln der <strong>Polizei</strong><br />
- Grundlagen des Beamtenrechts, Ernennung, Arten von Beamten, Rechte und<br />
Pflichten, Personalsteuerungsmaßnahmen, Entlassung<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
8<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240 Stunden<br />
(109 Kontakt-/131 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 20<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module Grundpraktikum 1 und Grundpraktikum 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausuren<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
1.1<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Politikwissenschaftliche<br />
Grundlagen<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Politikwissenschaft<br />
- kennen die normativen Grundlagen und Elemente der freiheitlichen Demokratie<br />
und können sie gegenüber anderen politischen Ordnungsmodellen abgrenzen<br />
- kennen die wesentlichen Strukturen, Verfahren und Prozesse des politischen<br />
Systems der Bundesrepublik Deutschland und können sie beurteilen<br />
- kennen die Rolle der <strong>Polizei</strong> als Teil der Exekutive im demokratischen<br />
Rechtsstaat und sind in der Lage, das Spannungsverhältnis von Freiheit und<br />
Sicherheit professionell einzuschätzen<br />
- erkennen aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen und ihre<br />
Relevanz <strong>für</strong> die <strong>Polizei</strong> und können diese einordnen<br />
Lerninhalte:<br />
- Politisches System und Strukturen: Deutschland und Baden-Württemberg<br />
- Politische Akteure und Prozesse<br />
- Politikfeld Innere Sicherheit<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Politisches System und Strukturen<br />
Lehrveranstaltung 2: Politische Akteure und Prozesse<br />
Lehrveranstaltung 3: Politikfeld Innere Sicherheit<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
52 Stunden (24 Kontakt-/28 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 21<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.1.1 Politisches System und Strukturen<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Politikwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die normativen Grundlagen und Elemente der freiheitlichen Demokratie<br />
und können sie gegenüber anderen politischen Ordnungsmodellen abgrenzen<br />
Lerninhalte:<br />
- Demokratie als Herrschaftsform<br />
- Strukturprinzipien: Republik, Bundesstaat, Sozialstaat<br />
- Parlamentarische Demokratie: Kanzler- und Koordinationsdemokratie<br />
- Der Deutsche Bundestag<br />
- Baden-Württemberg<br />
- Kommunalpolitik<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
19 Stunden (9 Kontakt-/10 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.1.2 Politische Akteure und Prozesse<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Politikwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die wesentlichen Strukturen, Verfahren und Prozesse des politischen<br />
Systems der Bundesrepublik Deutschland und können diese beurteilen<br />
Lerninhalte:<br />
- Parteien und Wahlen<br />
- Verbände, Tarifautonomie<br />
- Bürgerinitiativen, neue soziale Bewegungen, Non-Governmental Organizations<br />
(NGO's)<br />
- <strong>Polizei</strong>, gesellschaftliche Konflikte und ihre Austragungsform:<br />
Protest, Demonstrationen<br />
- Medien<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
20 Stunden (9 Kontakt-/11 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 22<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.1.3 Politikfeld Innere Sicherheit<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Politikwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Rolle der <strong>Polizei</strong> als Teil der Exekutive im demokratischen<br />
Rechtsstaat und sind in der Lage, das Spannungsverhältnis von Freiheit und<br />
Sicherheit professionell einzuschätzen<br />
- erkennen aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen und ihre<br />
Relevanz <strong>für</strong> die <strong>Polizei</strong> und können diese einordnen<br />
Lerninhalte:<br />
- <strong>Polizei</strong> im demokratischen Staat<br />
- Innere und äußere Sicherheit; Sicherheitsbegriffe<br />
- Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit<br />
- Aktuelle Themen der Innenpolitik<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
13 Stunden (6 Kontakt-/7 Selbststudium)<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
1.2<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Dienstverhältnis, Rechte und<br />
Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Öffentliches Dienstrecht<br />
- verstehen die Zusammenhänge im öffentlichen Dienstrecht und nutzen die<br />
Gestaltungsspielräume und die Möglichkeiten der Weiterentwicklung<br />
- beherrschen das Beamtenrecht aus der Sicht der Betroffenen und der<br />
Vorgesetzten<br />
- können die fachliche und die soziale Kompetenz des gehobenen Dienstes stärken<br />
- erfassen die Instrumente zeitgerechter Menschenführung in ihrer rechtlichen<br />
Seite<br />
- kennen die Rechte und Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten in Baden-Württemberg<br />
- beherrschen die Umsetzung der notwendigen und geeigneten Maßnahmen<br />
rechtlich einwandfrei
<strong>Curriculum</strong> Seite 23<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Grundlagen des öffentlichen Dienstrechts und die Regelungen des Art. 33 GG<br />
- Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn (Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter<br />
auch in der Öffentlichkeit, Konkrete Hilfe und ggf. auch die Gewährung von<br />
Rechtsschutz)<br />
- Die Grundrechte des Beamten und deren Einschränkungsmöglichkeiten<br />
- Die Arten der Beamtenverhältnisse, insbesondere der Widerrufs-, Probe- und<br />
Lebenszeitbeamte<br />
- Die Ernennung als zentraler Begriff des Beamtenrechts<br />
- Die Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten<br />
- Die Personalsteuerungsmaßnahmen Versetzung, Abordnung und Umsetzung<br />
- Die Entlassung des Beamten, insbesondere des Widerrufs- und Probebeamten<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Arten der Beamtenverhältnisse, insbesondere der Widerrufs-,<br />
Probe- und Lebenszeitbeamte, und die Ernennung als zentraler<br />
Begriff des Beamtenrechts<br />
Lehrveranstaltung 2: Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten, Personalsteuerungsmaßnahmen,<br />
Entlassung - insbesondere beim Beamten auf Probe und Widerruf<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
51 Stunden (24 Kontakt-/27 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.2.1 Arten der Beamtenverhältnisse, insbesondere der<br />
Widerrufs-, Probe- und Lebenszeitbeamte, und die<br />
Ernennung als zentraler Begriff des Beamtenrechts<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Öffentliches Dienstrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die unterschiedlichen Beamtenverhältnisse, die ein <strong>Polizei</strong>beamter<br />
durchläuft und können die diesbezüglichen Regelungen anwenden<br />
- kennen die verschiedenen Formen der Ernennung und deren Voraussetzungen<br />
- können die Regelungen rechtlich einwandfrei und praxisgerecht anwenden
<strong>Curriculum</strong> Seite 24<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Voraussetzung <strong>für</strong> die Einstellung als Beamter auf Widerruf<br />
- Voraussetzungen <strong>für</strong> die Übernahme als Beamter auf Probe und Beamter auf<br />
Lebenszeit<br />
- Bestehen, Nichtbestehen und Verlängerung der Probezeit<br />
- Die Arten der Ernennung: Einstellung, Umwandlung, Anstellung, Aufstieg<br />
- Das Ernennungsverfahren<br />
- Die Bewerberauswahl, Leistungsprinzip und Hilfskriterien<br />
- Rechtsschutz des Mitbewerbers und Konkurrentenklage<br />
- Nichternennung, Nichtigkeit und Rücknahme der Ernennung<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
26 Stunden (12 Kontakt-/14 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.2.2 Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten,<br />
Personalsteuerungsmaßnahmen, Entlassung -<br />
insbesondere beim Beamten auf Probe und Widerruf<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Öffentliches Dienstrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die wichtigsten Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten<br />
- kennen das Instrumentarium der Personalsteuerungsmaßnahmen aus Sicht des<br />
Vorgesetzten und des Mitarbeiters und können sie anwenden<br />
- kennen die verschiedenen Entlassungsverfahren und können sie rechtlich<br />
einwandfrei anwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Die wichtigsten Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten<br />
- Voraussetzungen von Versetzung, Abordnung und Umsetzung sowie der<br />
jeweilige Rechtsschutz gegen diese Maßnahmen<br />
- Konkurrenz zwischen Beförderungs- und Versetzungsbewerber<br />
- Die einzelnen Voraussetzungen der Entlassungsmöglichkeiten nach §§ 41 – 44<br />
LBG<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
25 Stunden (12 Kontakt-/13 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 25<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
1.3<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Staats- und<br />
verfassungsrechtliche<br />
Grundlagen polizeilichen<br />
Handelns<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Staats- und Verfassungsrecht<br />
- kennen die staatsrechtlichen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland und die<br />
Grundstrukturen der Europäischen Union<br />
- verstehen die verfassungsrechtlichen Bezüge polizeilichen Handelns im<br />
Rechtsstaat<br />
- können die Strukturen der Grundrechte erfassen und die Grundrechte anwenden<br />
- beherrschen die Schutzbereiche und die Grenzen der Einschränkbarkeit der<br />
Grundrechte mit besonderem <strong>Polizei</strong>bezug<br />
Lerninhalte:<br />
- Verfassungsentwicklung in Deutschland<br />
- Staatsprinzipien des GG, insbesondere Rechtsstaat und Bundesstaat sowie<br />
deren Wirkungen, freiheitlich demokratische Grundordnung<br />
- Rechtliche Einbindung Deutschlands in die Europäische Union<br />
- Internationale Entwicklung der Grund- und Menschenrechte<br />
- Allgemeine Grundrechtslehren<br />
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit<br />
- Einzelne Grundrechte des GG mit besonderem <strong>Polizei</strong>bezug<br />
- Fälle zu den Grundrechten<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Staatsorganisationsrecht<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundrechte<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
92 Stunden (37 Kontakt-/55 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 26<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.3.1 Staatsorganisationsrecht<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Staats- und Verfassungsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- erfassen die staatsrechtlichen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland<br />
- verstehen die Bedeutung der Strukturmerkmale Rechtsstaat und Bundesstaat auch<br />
<strong>für</strong> das polizeiliche Handeln<br />
- kennen die rechtliche Einbindung Deutschlands in die Europäische Union<br />
Lerninhalte:<br />
- Verfassungsentwicklung in Deutschland<br />
- Staatsprinzipien des GG im Überblick<br />
- Rechtsstaat mit Rechtsbindung, Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit,<br />
Rechtsschutz, Verfassungsgerichtsbarkeit<br />
- freiheitlich demokratische Grundordnung<br />
- Bundesstaat mit Kompetenzaufteilungen zwischen Bund und Ländern, Aufsicht<br />
des Bundes<br />
- die Europäische Union: Rechtsnatur, Strukturen und Kompetenzen,<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
22 Stunden (9 Kontakt-/13 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.3.2 Grundrechte<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Staats- und Verfassungsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die wichtigsten Konventionen über Grund- und Menschenrechte<br />
- erfassen die Strukturen der Grundrechte des GG und können diese Grundrechte<br />
anwenden<br />
- beherrschen die Schutzbereiche und die Grenzen der Einschränkbarkeit der<br />
Grundrechte mit besonderem <strong>Polizei</strong>bezug
<strong>Curriculum</strong> Seite 27<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Geschichtliche Entwicklung der Grund- und Menschenrechte<br />
- Internationaler Grundrechtsschutz<br />
- Allgemeine Grundrechtslehren des GG:<br />
Funktionen, Träger und Adressaten, staatliche Schutzpflichten, Schutzbereiche,<br />
Eingriffe in Grundrechte und deren Einschränkbarkeit<br />
- Einzelne Grundrechte mit besonderem <strong>Polizei</strong>bezug: Art. 1 - 5, 8 - 11, 13 GG<br />
- Fälle zu diesen Grundrechten bearbeiten und lösen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
70 Stunden (28 Kontakt-/42 Selbststudium)<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
1.4<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
<strong>Polizei</strong>liche Berufsethik<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Berufsethik<br />
- beherrschen Verfahren ethischer Urteilsbildung und Argumentation<br />
- können die Normensysteme Recht und Ethik zueinander in Beziehung setzen<br />
- sind in der Lage, Führungsentscheidungen an den ethischen Grundlagen des<br />
kooperativen Führungssystems zu messen und führungsethische Grundsätze<br />
angemessen zu kommunizieren<br />
- erkennen angesichts polizeilicher Eingriffsbefugnisse den Bereich ihrer<br />
persönlichen Verantwortung und können Wertkonflikte wahrnehmen und<br />
berücksichtigen<br />
- haben ein Bewusstsein <strong>für</strong> eigene und fremde Betroffenheiten in existenziellen<br />
Grenzsituationen und können ihr diesbezügliches Handeln begründen<br />
- reflektieren ihre Wertvorstellungen im Bereich der Strafverfolgung und<br />
akzeptieren die staatliche Gewaltenteilung als rechtliche Begrenzung ihres<br />
Handelns<br />
Lerninhalte:<br />
- Ethische Ansätze, Verfahren ethischer Urteilsbildung und Formen ethischer<br />
Argumentation<br />
- Legalität und Legitimität polizeilicher Arbeit<br />
- Berufsethik als Bestandteil von Organisationskultur<br />
- Ethik der Menschenwürde<br />
- Wertkonflikte und moralische Dilemmata im polizeilichen Alltag
<strong>Curriculum</strong> Seite 28<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- <strong>Polizei</strong>licher Umgang mit Verletzung, Tod und Trauer<br />
- Ethik der Selbstsorge: Umgang mit belastenden Erfahrungen<br />
- Gewalteindämmung als Ziel des staatlichen Gewaltmonopols<br />
- Sinn und Zielsetzung von Strafe<br />
- Führungsethik, Verantwortungs- und Fehlerkultur<br />
- Bedeutung und Reichweite von Kollegialität<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundsätze und Verfahren polizeilicher Berufsethik<br />
Lehrveranstaltung 2: Ethik polizeilichen Einsatzhandelns<br />
Lehrveranstaltung 3: Organisationsethik: Führung und Zusammenarbeit<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
45 Stunden (24 Kontakt-/21 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.4.1 Grundsätze und Verfahren polizeilicher Berufsethik<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Berufsethik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen ethische Grundbegriffe, Verfahren ethischer Urteilsbildung sowie Ansätze<br />
der Organisations- und Berufsethik und können diese auf polizeiliche<br />
Entscheidungssituationen anwenden<br />
- sind mit Theorien der Entwicklung moralischer Urteilskompetenz vertraut<br />
- sind sich ihrer eigenen beruflichen Wertestandards und ethischen Maximen<br />
bewusst und können diese kommunizieren<br />
- reflektieren die Bedeutung von Recht und Ethik als Normensysteme polizeilichen<br />
Handelns<br />
- können die Qualität ethischer Argumente unabhängig von der Übereinstimmung<br />
mit ihrer eigenen Position bewerten
<strong>Curriculum</strong> Seite 29<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Ethische Fachbegrifflichkeit und Verfahren ethischer Urteilsbildung<br />
- Ansätze der Berufs- und Organisationsethik<br />
- Entwicklung moralischer Urteilskompetenz<br />
- Legalität und Legitimität polizeilichen Handelns<br />
- Moralische Dichotomien als Bestandteil von <strong>Polizei</strong>kultur<br />
- Chancen und Gefahren moralischer Kommunikation<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
9 Stunden (6 Kontakt-/3 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.4.2 Ethik polizeilichen Einsatzhandelns<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Berufsethik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- reflektieren die Bedeutung der Menschenwürde in ihrem beruflichen<br />
Alltagshandeln<br />
- entwickeln angesichts ihrer Eingriffsbefugnisse ein reflektiertes Konzept ihrer<br />
persönlichen Verantwortung<br />
- können Wertkonflikte im polizeilichen Handeln identifizieren und verstehen die<br />
Bedeutung von Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz<br />
- entwickeln Grundsätze eines angemessenen Umgangs mit existenziellen<br />
Grenzsituationen<br />
- reflektieren Grenzen der Belastbarkeit des einzelnen im <strong>Polizei</strong>beruf<br />
- reflektieren ihre eigenen Wertvorstellungen im Bereich der Strafverfolgung und<br />
akzeptieren die staatliche Gewaltenteilung<br />
Lerninhalte:<br />
- Menschenwürde als berufsethisches Leitmodell<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Eingriffsbefugnisse und persönliche Verantwortung<br />
- Widersprüche und Wertkonflikte<br />
- Umgang mit Verletzung, Tod und Trauer<br />
- Ethik der Selbstsorge: Umgang mit belastenden Ereignissen<br />
- Sinn von Strafe, Ethik der Kriminalitätskontrolle und Strafverfolgung<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
18 Stunden (9 Kontakt-/9 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 30<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
1.4.3 Organisationsethik: Führung und Zusammenarbeit<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Berufsethik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- verstehen die ethische Dimension des kooperativen Führungssystems<br />
- reflektieren ihre eigenen Erwartungen an Führung und können eigene<br />
führungsethische Grundsätze kommunizieren<br />
- entwickeln ein reflektiertes Verständnis von Kollegialität<br />
- verstehen Konflikte als unausweichlichen Bestandteil sozialen Miteinanders,<br />
entwickeln vertiefte Analysekompetenz <strong>für</strong> die Wertedimension von Konflikten<br />
und können Verfahren deeskalativer Konfliktkommunikation anwenden<br />
- reflektieren den Leistungsbegriff und ihre eigene Berufsmotivation<br />
- kennen Merkmale einer menschenfreundlichen Fehlerkultur und reflektieren<br />
deren Chancen und Grenzen<br />
Lerninhalte:<br />
- Menschenbild des kooperativen Führungssystems<br />
- Führungsethische Grundsätze<br />
- Bedeutung und Reichweite von Kollegialität<br />
- Konflikte am Arbeitsplatz und ethische Voraussetzungen konsensueller<br />
Konfliktlösungen<br />
- Leistung, Berufserfolg und –misserfolg als ethische Herausforderung<br />
- Umgang mit Defiziten, Fehlern und schuldhaftem Versagen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
18 Stunden (9 Kontakt-/9 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 31<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
2<br />
Modultitel:<br />
Grundlagen polizeilicher<br />
Strafverfolgungstätigkeit<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät II – Kriminaltaktik, Kriminaltechnik, Kriminologie<br />
Fakultät III – Strafrecht, Strafverfahrensrecht<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/2. und 3. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Dr. Elmar Erhardt,<br />
Fakultät III<br />
- kennen und verstehen die allgemeinen Grundlagen und Methoden des materiellen<br />
und formellen Strafrechts und können diese bei der praktischen<br />
Verbrechensbekämpfung umsetzen<br />
- kennen die kriminaltaktischen und kriminaltechnischen Grundlagen und<br />
Methoden und können diese in konkreten Lagen anwenden<br />
- kennen die Ursachen, Erscheinungsformen und die kriminologische Erfassung<br />
abweichenden Verhaltens und können diese bei der Bewältigung polizeilicher<br />
Aufgabenstellungen heranziehen<br />
Lerninhalte:<br />
Die Grundlagen und Methoden polizeilicher Strafverfolgungstätigkeit in den Bereichen<br />
- des materiellen und formellen Strafrechts<br />
- der Kriminaltaktik und der Kriminaltechnik<br />
- der Kriminologie<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
20<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
600 Stunden<br />
(246 Kontakt-/354 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module Grundpraktikum 1 und Grundpraktikum 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausuren
<strong>Curriculum</strong> Seite 32<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
2.1<br />
Lernziele:<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Grundlagen und Methoden<br />
des materiellen und<br />
formellen Strafrechts<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Strafrecht<br />
Strafverfahrensrecht<br />
Die Studierenden<br />
- können die Rechtsinstitute des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs sowie<br />
ausgewählte Straftatbestände sicher anwenden, um daraus die Anforderungen<br />
<strong>für</strong> polizeiliche Ermittlungstätigkeit auch im Einzelfall abzuleiten (materielles<br />
Strafrecht)<br />
- kennen die <strong>für</strong> das Strafverfahren bedeutsamen klassischen Rechtsinstitute und<br />
Rechtsvorschriften und beherrschen vertieft ihre Anwendung und Auslegung<br />
(formelles Strafrecht)<br />
Lerninhalte:<br />
2. Semester - Materielles Strafrecht (ST)<br />
- Einführung in das Strafrecht, Grundbegriffe, Prinzipien, Methodik<br />
- Die Elemente der Straftat (Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld)<br />
2. Semester - Formelles Strafrecht (SP)<br />
- Einführung in das Strafverfahrensrecht, Grundbegriffe, Prinzipien, Methodik<br />
- Beschuldigter, Vernehmung, Festnahme und Haft, Beweismittel<br />
3. Semester - Materielles Strafrecht (ST)<br />
- Versuch, Fahrlässigkeit, Unterlassung<br />
- Täterschaft und Teilnahme<br />
3. Semester - Formelles Strafrecht (SP)<br />
- Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote<br />
- Ermittlungsauftrag und Ermittlungsverfahren<br />
- Klassische Eingriffsmaßnahmen<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
2. Semester:<br />
- Grundkurs Strafrecht I<br />
- Grundkurs Strafverfahrensrecht I<br />
3. Semester:<br />
- Grundkurs Strafrecht II<br />
- Grundkurs Strafverfahrensrecht II
<strong>Curriculum</strong> Seite 33<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240 Stunden (100 Kontakt-/140 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.1.1 Grundkurs Strafrecht I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Strafrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können die Rechtsinstitute des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs sowie<br />
ausgewählte Straftatbestände sicher anwenden, um daraus die Anforderungen <strong>für</strong><br />
polizeiliche Ermittlungstätigkeit auch im Einzelfall abzuleiten<br />
Lerninhalte:<br />
- Einordnung, Grundsätze und Methodik des Strafrechts, Subsumtion,<br />
Auslegungsmethoden, Rechtsfolgen der Tat, Unterschiede im JGG und OWiG<br />
- Deliktsaufbau und Deliktsarten<br />
- Objektiver Tatbestand<br />
- Subjektiver Tatbestand<br />
- Rechtswidrigkeit<br />
- Schuld<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
62 Stunden (26 Kontakt-/36 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.1.2 Grundkurs Strafrecht II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Strafrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- wenden die Rechtsinstitute des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs sowie<br />
ausgewählte Straftatbestände sicher an, um daraus die Anforderungen <strong>für</strong><br />
polizeiliche Ermittlungstätigkeit auch im Einzelfall abzuleiten
<strong>Curriculum</strong> Seite 34<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Versuchsstrafbarkeit<br />
- Unterlassungsdelikte<br />
- Täterschaft und Teilnahme<br />
- Fahrlässigkeit<br />
- Ausgewählte Straftatbestände<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (24 Kontakt-/36 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.1.3 Grundkurs Strafverfahrensrecht I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Strafrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die <strong>für</strong> das Strafverfahren bedeutsamen klassischen Rechtsinstitute und<br />
Rechtsvorschriften und beherrschen ihre Auslegung und Anwendung vertieft<br />
Lerninhalte:<br />
- Rechtsquellen des Strafverfahrensrechts einschl. Abgrenzung zu anderen<br />
Rechtsgebieten und verfassungsrechtliche Gesetzgebungskompetenz<br />
- Grundlagen der Verjährung<br />
- Der Beschuldigte, Status, Rechte und Pflichten<br />
- Vernehmung und unerlaubte Vernehmungsmethoden<br />
- Die Beweismittel, insbesondere der Zeugenbeweis<br />
- Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (26 Kontakt-/34 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 35<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.1.4 Grundkurs Strafverfahrensrecht II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Strafrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die <strong>für</strong> das Strafverfahren bedeutsamen klassischen Rechtsinstitute und<br />
Rechtsvorschriften und beherrschen vertieft ihre Auslegung und Anwendung<br />
Lerninhalte:<br />
- Vorläufige Festnahme und Untersuchungshaft<br />
- Ermittlungsauftrag und Ermittlungsverfahren<br />
- Klassische Eingriffsmaßnahmen im Strafverfahren (unter Berücksichtigung von<br />
Finanzermittlungen) einschließlich Einziehung und Verfall<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
58 Stunden (24 Kontakt-/34 Selbststudium)<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
2.2<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Kriminaltaktische und<br />
kriminaltechnische<br />
Grundlagen und Methoden<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Kriminaltaktik<br />
Kriminaltechnik<br />
- kennen wesentliche kriminalistische Begrifflichkeiten sowie die wesentlichen<br />
Aspekte kriminalistischer Beweisführung<br />
- verstehen die Grundlagen der kriminalistischen Handlungslehre,<br />
die Grundlagen der Vernehmungslehre und des Alibibeweises<br />
- kennen die forensischen Anforderungen und spezifischen Fehlerquellen von<br />
Wiedererkennungsverfahren und können Wiedererkennungsverfahren planen,<br />
vorbereiten und durchführen<br />
- kennen die Grundlagen zur Spurenentstehung und der kriminaltechnischen<br />
Organisation sowie Methoden zur Spurensuche und Spurensicherung unter<br />
Beachtung forensischer Anforderungen<br />
- kennen die Möglichkeiten der auswertenden Kriminaltechnik bei der<br />
Interpretation von Einzelspuren<br />
- kennen die Möglichkeiten zur Identifizierung von Personen<br />
- kennen Merkmale gefälschter oder verfälschter Legimitationspapiere in<br />
Kontrollsituationen
<strong>Curriculum</strong> Seite 36<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
2. Semester<br />
Kriminaltaktik:<br />
- Begriff und Inhalte der modernen Kriminaltaktik<br />
- Methodik analytischen Denkens und Kriminalistische Kombination<br />
- Grundzüge kriminalistischer Beweisführung<br />
- Methoden kriminalistischer Verdachtsgewinnung sowie Bestimmung und<br />
Beurteilung von Verdachtsindikatoren und Verdachtslagen<br />
- Grundregeln und Methoden der Fallanalyse<br />
- Entwicklung von Tat-/Täterhypothesen<br />
Kriminaltechnik:<br />
- Kriminaltechnik im System der Kriminalwissenschaften<br />
- Organisation und Aufgaben der tatortbezogenen und auswertenden<br />
Kriminaltechnik<br />
- Der Sachbeweis im Strafverfahren<br />
- Grundlagen der Aufnahme des objektiven Tatortbefundes unter forensischen<br />
Gesichtspunkten (Erster Angriff)<br />
- Daktyloskopie sowie Aufgaben und Ziele des Erkennungsdienstes und<br />
Durchführung einer ED-Behandlung<br />
- Grundlagen der DNA-Analytik und DNA-relevanter Spuren nebst der DNA-<br />
ED-Behandlung<br />
- Grundlagen der Spurensicherung bei Schusswaffendelikten<br />
3. Semester<br />
Kriminaltaktik:<br />
- Wissenschaftliche Grundlagen des Personalbeweises<br />
- Planung, Vorbereitung, Ablauf, Durchführung und Dokumentation von<br />
Vernehmungen<br />
- Glaubhaftigkeit/Glaubwürdigkeit<br />
- Alibibeweis<br />
- Forensische Anforderungen an, sowie Planung, Vorbereitung, Ablauf,<br />
Durchführung und Dokumentation von Wiedererkennungsverfahren<br />
Kriminaltechnik:<br />
- Erkennen von Dokumentenfälschungen<br />
- Entstehungsbedingungen und Erscheinungsformen einzelner Spurenarten<br />
- Fallbezogene Bedeutung einzelner Spurenarten<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen der Kriminaltaktik I<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundlagen der Kriminaltechnik I<br />
Lehrveranstaltung 3: Grundlagen der Kriminaltaktik II<br />
Lehrveranstaltung 4: Grundlagen der Kriminaltechnik II
<strong>Curriculum</strong> Seite 37<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
270 Stunden (110 Kontakt-/160 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.2.1 Grundlagen der Kriminaltaktik I<br />
Verantwortliche Fachgruppe:<br />
Kriminaltaktik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen wesentliche kriminaltaktische Begrifflichkeiten sowie die wesentlichen<br />
Aspekte kriminalistischer Beweisführung<br />
- verstehen die Grundlagen der kriminalistischen Handlungslehre<br />
- kennen die Grundlagen der Vernehmungslehre und des Alibibeweises<br />
Lerninhalte:<br />
- Begriff und Inhalte der modernen Kriminaltaktik<br />
- Methodik analytischen Denkens und Kriminalistische Kombination<br />
- Grundzüge kriminalistischer Beweisführung<br />
- Methoden kriminalistischer Verdachtsgewinnung sowie Bestimmung und<br />
Beurteilung von Verdachtsindikatoren und Verdachtslagen<br />
- Grundregeln und Methoden der Fallanalyse<br />
- Entwicklung von Tat-/Täterhypothesen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
88 Stunden (36 Kontakt-/52 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.2.2 Grundlagen der Kriminaltaktik II<br />
Verantwortliche Fachgruppe:<br />
Kriminaltaktik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Grundlagen der Vernehmungslehre und des Alibibeweises<br />
- kennen die forensischen Anforderungen und spezifischen Fehlerquellen von<br />
Wiedererkennungsverfahren und können Wiedererkennungsverfahren planen,<br />
vorbereiten und durchführen
<strong>Curriculum</strong> Seite 38<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Wissenschaftliche Grundlagen des Personalbeweises<br />
- Planung, Vorbereitung, Ablauf, Durchführung und Dokumentation von<br />
Vernehmungen<br />
- Glaubhaftigkeit/Glaubwürdigkeit<br />
- Alibibeweis<br />
- Forensische Anforderungen an, sowie Planung, Vorbereitung, Ablauf,<br />
Durchführung und Dokumentation von Wiedererkennungsverfahren<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
88 Stunden (36 Kontakt-/52 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.2.3 Grundlagen der Kriminaltechnik I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Kriminaltechnik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Organisationsformen, Aufgaben und Möglichkeiten der tatortbezogenen<br />
und der auswertenden Kriminaltechnik<br />
- verstehen die Grundlagen der kriminaltechnischen Spurensuche,<br />
Spurensicherung und Spurenauswertung sowie deren forensische Bedeutung<br />
- kennen Möglichkeiten der Personenerkennung und -identifizierung<br />
- kennen Grundlagen der DNA-Spur<br />
- kennen Grundlagen von Schussspuren<br />
Lerninhalte:<br />
- Kriminaltechnik im System der Kriminalwissenschaften<br />
- Organisationseinheiten der Kriminaltechnik, personelle und materielle<br />
Ressourcen<br />
- Stellung des Sachbeweises im Strafverfahren<br />
- Aufnahme des objektiven Tatortbefundes unter forensischen Gesichtspunkten<br />
(Erster Angriff)<br />
- Daktyloskopie sowie Aufgaben und Ziele des Erkennungsdienstes und<br />
Durchführung einer ED-Behandlung<br />
- Aufbau der DNA, DNA-Analytik und DNA-relevanter Spuren nebst der DNA-<br />
ED-Behandlung<br />
- Wirkweise von Schusswaffen, Schusswaffen- und Schussspuren,<br />
Schmauchentstehung und Aussagemöglichkeiten, spezielle<br />
Sicherungstechniken, Schusswaffenerkennungsdienst
<strong>Curriculum</strong> Seite 39<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
64 Stunden (26 Kontakt-/38 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.2.4 Grundlagen der Kriminaltechnik II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Kriminaltechnik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Merkmale von gefälschten und verfälschten Dokumenten<br />
- kennen die Entstehungsbedingungen und Erscheinungsformen einzelner<br />
Spurenarten<br />
- kennen fallbezogene Bedeutung einzelner Spurenarten<br />
Lerninhalte:<br />
- Dokumentenfälschung<br />
- Verfälschungen, Totalfälschungen, Papier (Wasserzeichen,<br />
Melierfasern), Druckverfahren, Foliensicherung, Mechanische und<br />
chemische Rasuren, Inhaltsplausibilität, Methoden der Fälscher und<br />
Möglichkeiten zur Erkennung<br />
- Übungen mit gefälschten und verfälschten Dokumenten<br />
- Spurenarten<br />
- Grundlagen von Werkzeug- und sonstigen Formspuren, Materialspuren<br />
und biologischen Spuren<br />
- Kriminalistische Bedeutung im Kontext strafbarer Handlungen –<br />
Interpretationsmöglichkeiten der tatortbezogenen und auswertenden<br />
Kriminaltechnik<br />
- Kriminaltechnische Sammlungen und Dateien<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
30 Stunden (12 Kontakt-/18 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 40<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des<br />
Teilmoduls:<br />
2.3<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Ursachen, Erscheinungsformen<br />
und kriminologische Erfassung<br />
abweichenden Verhaltens<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Kriminologie<br />
- erkennen die Bedingungszusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen<br />
Tat, Täter, Opfer, sozialer Umwelt und gesellschaftlicher Verbrechenskontrolle<br />
- können Erscheinungsformen der Kriminalität analysieren und Ansätze zur<br />
präventiven und repressiven Kriminalitätsbekämpfung entwickeln<br />
- erkennen die Relevanz der Erkenntnisse der kriminologischen Forschung <strong>für</strong><br />
die praktische Kriminalitätsbekämpfung<br />
Lerninhalte:<br />
2. Semester<br />
- Einführung in die Kriminologie<br />
- Ursachen der Kriminalität<br />
- Kriminalität und Kriminalisierung<br />
- Methoden der Erfassung und Registrierung von Kriminalität<br />
3. Semester<br />
- Jugenddelinquenz<br />
- Kriminalität von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
- Frauen und Kriminalität<br />
- Alte Menschen und Kriminalität<br />
- Medien und Kriminalität<br />
- Viktimologie<br />
- Kriminalgeographie, Wohnumwelt und Kriminalität<br />
- Kriminalprävention<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundkurs Kriminologie I<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundkurs Kriminologie II<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
90 Stunden (36 Kontakt-/54 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 41<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.3.1 Grundkurs Kriminologie I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Kriminologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- erkennen die Bedingungszusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen<br />
Tat, Täter, Opfer, sozialer Umwelt und gesellschaftlicher Verbrechenskontrolle<br />
Lerninhalte:<br />
- Einführung in die Kriminologie, Begriff, Gegenstand und Zielsetzung<br />
- Ursachen der Kriminalität, Positionen kriminologischen Denkens<br />
- Kriminalität und Kriminalisierung, Bewertungs- / Ausfilterungsprozess<br />
- Methoden der Erfassung und Registrierung von Kriminalität<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
30 Stunden (12 Kontakt-/18 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
2.3.2 Grundkurs Kriminologie II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Kriminologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können Erscheinungsformen der Kriminalität analysieren und Ansätze zur<br />
präventiven und repressiven Kriminalitätsbekämpfung entwickeln<br />
- können die Relevanz der Erkenntnisse der kriminologischen Forschung <strong>für</strong> die<br />
praktische Kriminalitätsbekämpfung erkennen<br />
Lerninhalte:<br />
- Phänomenologie, Erklärungs-/ Bekämpfungsansätze zu<br />
o Jugendkriminalität<br />
o Menschen mit Migrationshintergrund<br />
o Frauen und Kriminalität<br />
o Alte Menschen und Kriminalität<br />
- Medien und Kriminalität; Kriminalitätsdarstellung, Medienwirkungstheorien<br />
- Viktimologie; Theorien und Erklärungsansätze
<strong>Curriculum</strong> Seite 42<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Kriminalgeographie, Wohnumwelt und Kriminalität; Lagebild, kriminologische<br />
Regionalanalyse, Theorien und Erklärungsansätze<br />
- Kriminalprävention; Begriff, Dimensionen, Träger,<br />
Kommunale Kriminalprävention, Evaluation, Vernetzungsansätze zur<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (24 Kontakt-/36 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 43<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
3<br />
Modultitel:<br />
Grundlagen des polizeilichen<br />
Einsatzes zur Gefahrenabwehr und<br />
Aufrechterhaltung der öffentlichen<br />
Sicherheit<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät I - Einsatzwissenschaft, Verkehrswissenschaft<br />
Fakultät III - <strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/2. und 3. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Andreas Siegerstetter,<br />
Fakultät I<br />
- kennen die Grundlagen und die Methoden der Einsatzwissenschaft und können<br />
diese anwenden<br />
- können Einsatzlagen sowohl des täglichen Dienstes als auch komplexe Lagen mit<br />
den Kräften der Allgemeinen Aufbauorganisation (AAO) oder einer Besonderen<br />
Aufbauorganisation (BAO) und den dort jeweils zur Verfügung stehenden FEM<br />
bewältigen<br />
- kennen die Grundlagen des <strong>Polizei</strong>- und Verwaltungsrechts<br />
- verfügen über methodische Grundkenntnisse zur Rechtsanwendung und -<br />
auslegung und können diese fallbezogen anwenden<br />
- kennen das System Verkehr und konzeptionelle Strategieansätze der<br />
polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit<br />
- kennen die Gefahrendimensionen und die gesellschaftliche Bedeutung des<br />
Straßenverkehrs<br />
- kennen die wesentlichen Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr und deren<br />
Verortung in der Gesamtrechtsordnung<br />
- kennen die polizeilichen Einschreitemöglichkeiten zur Gefahrenabwehr im<br />
Straßenverkehr und können diese sachverhaltsbezogen anwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Relevante Vorschriften in der Einsatzwissenschaft<br />
- Methoden des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Organisationslehre<br />
- Einsatztaktische Maßnahmen in Lagen des täglichen Dienstes und bei<br />
besonderen Einsatzlagen<br />
- Rechtsquellen des allgemeinen <strong>Polizei</strong>rechts
<strong>Curriculum</strong> Seite 44<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Grundsätze des <strong>Polizei</strong>- und Verwaltungsrechts<br />
- Juristische Methodenlehre<br />
- Einzelmaßnahmen nach dem <strong>Polizei</strong>gesetz<br />
- Bedeutung des Straßenverkehrs<br />
- Übersicht über die polizeilichen Verkehrsmaßnahmen<br />
- Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Verkehr<br />
- Eingriffsbefugnisse nach der StVO und Anwendbarkeit des <strong>Polizei</strong>rechts<br />
- Einsatzfahrten in rechtlicher und taktischer Hinsicht.<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
13<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
390 Stunden<br />
(172 Kontakt-/218 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module Grundpraktikum 1 und Grundpraktikum 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausuren<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
3.1<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Grundlagen und Methoden der<br />
Einsatzwissenschaft<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Einsatzwissenschaft<br />
- kennen die <strong>für</strong> die Einsatzwissenschaft relevanten Vorschriften sowie deren<br />
Bedeutung und Zustandekommen<br />
- kennen die Methoden der Einsatzplanung und können diese an praktischen<br />
Beispielen anwenden<br />
- kennen die einzelnen taktischen Maßnahmen hinsichtlich ihres Inhalts und<br />
können diese zielorientiert anwenden<br />
- können Einsatzlagen des täglichen Dienstes mit den Kräften der Allgemeinen<br />
Aufbauorganisation (AAO) und den dort zur Verfügung stehenden FEM<br />
bewältigen<br />
- kennen die Grundregeln <strong>für</strong> die Entwicklung lageangepasster Besonderer<br />
Aufbauorganisationen (BAO) und können diese in Sofortlagen anwenden<br />
- kennen die Problemstellungen des Übergangs von der AAO zur BAO und<br />
können diesen im Rahmen der Einsatzplanung Rechnung tragen
<strong>Curriculum</strong> Seite 45<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Relevante Vorschriften in der Einsatzwissenschaft, ihre Bedeutung,<br />
Zustandekommen und beteiligte Gremien<br />
- Beurteilung der Lage, Entschluss, Befehlsgebung und Nachbereitung im Rahmen<br />
des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Organisationslehre<br />
- Einsatztaktische Maßnahmen und Planung von Einsatzkonzepten <strong>für</strong><br />
Einsatzlagen des täglichen Dienstes und deren Lösungen in der AAO<br />
- Besondere Gefahrenpotenziale und Einsatzaspekte<br />
- Planung des Wechsels von der AAO zur BAO<br />
- Planung von Einsatzkonzepten <strong>für</strong> Einsatzlagen des täglichen Dienstes und deren<br />
Lösungen in der BAO<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Methodische Grundlagen der Einsatzwissenschaft<br />
Lehrveranstaltung 2: Einsatzlagen des täglichen Dienstes in der AAO<br />
Lehrveranstaltung 3: Komplexe Einsatzlagen des täglichen Dienstes<br />
in der AAO und BAO<br />
Studentischer Arbeitsaufwand<br />
122 Stunden (50 Kontakt-/72 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.1.1 Methodische Grundlagen der Einsatzwissenschaft<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Einsatzwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die <strong>für</strong> die Einsatzwissenschaft relevanten Vorschriften sowie deren<br />
Bedeutung und Zustandekommen<br />
- kennen die Methoden der Einsatzplanung, insbesondere hinsichtlich der<br />
inhaltlichen Gestaltung von Leitlinien, Zielen, taktischen Maßnahmen, Kräften,<br />
Organisation und technisch-organisatorischen Maßnahmen und können diese<br />
anwenden
<strong>Curriculum</strong> Seite 46<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Relevante Vorschriften in der Einsatzwissenschaft, ihre Bedeutung,<br />
Zustandekommen und beteiligte Gremien<br />
- Beurteilung der Lage im Rahmen des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Entschluss im Rahmen des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Befehlsgebung im Rahmen des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Nachbereitung im Rahmen des Planungs- und Entscheidungsprozesses<br />
- Organisationslehre<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
41 Stunden (16 Kontakt-/25 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.1.2 Einsatzlagen des täglichen Dienstes in der AAO<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Einsatzwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können die Methodik der Einsatzplanung an praktischen Beispielen anwenden<br />
- kennen die einzelnen taktischen Maßnahmen hinsichtlich ihres Inhalts und<br />
können diese zielorientiert anwenden<br />
- kennen fallspezifische Gefahren und sonstige Besonderheiten<br />
- können Einsatzlagen des täglichen Dienstes mit den Kräften der Allgemeinen<br />
Aufbauorganisation (AAO) und den dort zur Verfügung stehenden FEM<br />
bewältigen<br />
Lerninhalte:<br />
- Taktische Maßnahmen gemäß der PDV 100<br />
- Anwendung von Methoden der Einsatzplanung<br />
- Planung von Einsatzkonzepten <strong>für</strong> Einsatzlagen des täglichen Dienstes und deren<br />
Lösungen in der AAO<br />
- Besondere Gefahrenpotenziale und Einsatzaspekte<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
19 Stunden (8 Kontakt-/11 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 47<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.1.3 Komplexe Einsatzlagen des täglichen Dienstes<br />
in der AAO und BAO<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Einsatzwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können die Methodik der Einsatzplanung an praktischen Beispielen anwenden<br />
- kennen die einzelnen taktischen Maßnahmen hinsichtlich ihres Inhalts und<br />
können diese zielorientiert anwenden<br />
- kennen fallspezifische Gefahren und sonstige Besonderheiten<br />
- kennen die Grundregeln <strong>für</strong> die Entwicklung lageangepasster Besonderer<br />
Aufbauorganisationen (BAO) und können diese in Sofortlagen anwenden<br />
- kennen die Problemstellungen des Übergangs von der Allgemeinen<br />
Aufbauorganisationen (AAO) zur BAO und können diesen im Rahmen der<br />
Einsatzplanung Rechnung tragen<br />
Lerninhalte:<br />
- Taktische Maßnahmen gemäß der PDV 100<br />
- Anwendung von Methoden der Einsatzplanung<br />
- Planung des Wechsels von der AAO zur BAO<br />
- Planung von Einsatzkonzepten <strong>für</strong> Einsatzlagen des täglichen Dienstes und deren<br />
Lösungen in der BAO<br />
- Besondere Gefahrenpotenziale und Einsatzaspekte<br />
- Einschreiten in konfliktbehafteten Alltagssituationen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
62 Stunden (26 Kontakt-/36 Selbststudium)<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
3.2<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls<br />
Grundlagen und Methoden des<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrechts<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsre<br />
cht<br />
- kennen die Rechtsquellen und Grundsätze des allgemeinen <strong>Polizei</strong>rechts<br />
- verfügen über methodische Grundkenntnisse und können diese bei der Falllösung<br />
anwenden<br />
- können die <strong>Polizei</strong> in das Gefüge der Landesverwaltung einordnen<br />
- kennen die verschiedenen Handlungsformen der <strong>Polizei</strong>
<strong>Curriculum</strong> Seite 48<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- kennen die Rechtsgrundlagen <strong>für</strong> polizeiliche Eingriffsmaßnahmen und können<br />
diese anwenden<br />
- kennen die verschiedenen Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Maßnahmen und<br />
können deren Erfolgsaussichten einschätzen<br />
- kennen die Grundlagen des <strong>Polizei</strong>zwangs<br />
Lerninhalte:<br />
- Arten/Unterscheidung der Rechtsquellen<br />
- Rechtsnatur von Verwaltungsvorschriften<br />
- Grundsätze des Verwaltungsrechts<br />
- Juristische Methodenlehre<br />
- Organisation und Aufbau der <strong>Polizei</strong> als Teil der Landesverwaltung<br />
- <strong>Polizei</strong>verfügung, Abgrenzung Realakt/Verwaltungsakt<br />
- Formelle Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakts<br />
- Zuständigkeitsabgrenzung PVD/<strong>Polizei</strong>behörde<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Generalklausel<br />
- Einzelmaßnahmen nach dem <strong>Polizei</strong>gesetz<br />
- Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Eingriffsmaßnahmen<br />
- Verwaltungsvollstreckung (<strong>Polizei</strong>zwang)<br />
- Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen und Methoden des <strong>Polizei</strong>- und Verwaltungsrechts I<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundlagen und Methoden des <strong>Polizei</strong>- und Verwaltungsrechts II<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
122 Stunden (50 Kontakt-/72 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 49<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.2.1 Grundlagen und Methoden des <strong>Polizei</strong>- und<br />
Verwaltungsrechts I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Rechtsquellen des allgemeinen <strong>Polizei</strong>rechts und die allgemeinen<br />
Grundsätze<br />
- verfügen über methodische Grundkenntnisse und können diese bei der Falllösung<br />
anwenden<br />
- können die <strong>Polizei</strong> in das Gefüge der Landesverwaltung einordnen<br />
- kennen die verschiedenen Handlungsformen der <strong>Polizei</strong><br />
Lerninhalte:<br />
- Arten der Rechtsquellen<br />
- Grundsätze des Verwaltungsrechts<br />
- Juristische Methodenlehre<br />
- Organisation und Aufbau der <strong>Polizei</strong> als Teil der Landesverwaltung<br />
- <strong>Polizei</strong>verfügung, Abgrenzung Realakt/Verwaltungsakt<br />
- Formelle Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakt<br />
- Zuständigkeitsabgrenzung PVD/<strong>Polizei</strong>behörde<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Generalklausel<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
61 Stunden (25 Kontakt-/36 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.2.2 Grundlagen und Methoden des <strong>Polizei</strong>- und<br />
Verwaltungsrechts II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht<br />
Studienziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Rechtsgrundlagen <strong>für</strong> polizeiliche Eingriffsmaßnahmen und können<br />
diese anwenden<br />
- kennen die verschiedenen Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Maßnahmen und<br />
können deren Erfolgsaussichten einschätzen<br />
- kennen die Grundlagen des <strong>Polizei</strong>zwangs
<strong>Curriculum</strong> Seite 50<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Einzelmaßnahmen nach dem <strong>Polizei</strong>gesetz<br />
- Rechtsbehelfe gegen polizeiliche Eingriffsmaßnahmen<br />
- Verwaltungsvollstreckung (<strong>Polizei</strong>zwang)<br />
- Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme<br />
Studentischer Arbeitsaufwand (Kontaktstudium/Selbststudium):<br />
61 Stunden (25 Kontakt-/ 36 Selbststudium)<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
3.3<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Grundlagen und Methoden der<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Verkehrswissenschaft<br />
- kennen die gesellschaftliche Bedeutung des Straßenverkehrs sowie dessen<br />
objektives Gefahrenpotential und die Auswirkungen auf das subjektive<br />
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung<br />
- kennen das System Verkehr und konzeptionelle Strategieansätze der polizeilichen<br />
Verkehrsunfallbekämpfung<br />
- kennen die wesentlichen Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr und deren<br />
Verortung in der Gesamtrechtsordnung<br />
- kennen die polizeilichen Interventionsmöglichkeiten zur Gefahrenabwehr im<br />
Straßenverkehr und können diese sachverhaltsbezogen anwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Bedeutung des Straßenverkehrs innerhalb der Verkehrsleistungsträger,<br />
Zukunftsprognosen, strategische Vorgaben zur Verkehrssicherheitsarbeit und<br />
Erwartungen der Bürger an die <strong>Polizei</strong><br />
- Übersicht über die polizeilichen Verkehrsmaßnahmen<br />
- Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Verkehr, insbesondere Systematik des<br />
Straßenverkehrsrechts, polizeirelevante Regelungen des Straßen- und<br />
Verkehrsrechts sowie rechtliche Bewertung des öffentlichen Verkehrsraumes<br />
- Eingriffsbefugnisse nach der StVO, Anwendbarkeit des <strong>Polizei</strong>rechts zur<br />
Gefahrenabwehr im Straßenverkehr<br />
- Zusammenarbeit mit Behörden<br />
- Einsatzfahrten in rechtlicher und taktischer Hinsicht
<strong>Curriculum</strong> Seite 51<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: <strong>Polizei</strong>liche Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Lehrveranstaltung 2: Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr<br />
Lehrveranstaltung 3: <strong>Polizei</strong>kompetenzen im Straßenverkehr<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
146 Stunden (72 Kontakt-/74 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.3.1 <strong>Polizei</strong>liche Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die gesellschaftliche Bedeutung des Straßenverkehrs sowie dessen<br />
objektives Gefahrenpotential und die Auswirkungen auf das subjektive<br />
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung<br />
- kennen das System Verkehr und die polizeilichen Interventionsmöglichkeiten zur<br />
Unfallbekämpfung<br />
Lerninhalte:<br />
- Bedeutung des Straßenverkehrs innerhalb der Verkehrsträger (Straße, Schiene,<br />
Luft, Wasser)<br />
- Objektive und subjektive Gefahrendimensionen des Straßenverkehrs<br />
- Zukunftsprognosen der Verkehrsentwicklung und deren Auswirkung<br />
- Strategische Vorgaben zur polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit und<br />
Bürgererwartungen an die <strong>Polizei</strong>arbeit<br />
- Grundlegende Strategieansätze der <strong>Polizei</strong> zur Unfallbekämpfung<br />
- Verkehrslagebild<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
22 Stunden (13 Kontakt-/9 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 52<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.3.2 Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die wesentlichen Rechtsvorschriften <strong>für</strong> den Straßenverkehr und deren<br />
Stellung in der Gesamtrechtsordnung<br />
- kennen exemplarisch ausgewählte Verbotstatbestände <strong>für</strong> den Straßenverkehr<br />
Lerninhalte:<br />
- Verfassungsrechtliche Grundlagen verkehrsbezogener Normen<br />
- <strong>Polizei</strong>relevante Regelungen des Straßenrechts<br />
- Systematik des Straßenverkehrsrechts<br />
- Ausgewählte Verbotstatbestände aus der StVO und deren Zusammenhänge mit<br />
Tatbeständen aus anderen Rechtsgebieten<br />
- Kriterien der Verkehrsraumklassifizierung (rechtlich öffentlich, tatsächlich<br />
öffentlich, nicht öffentlich) und rechtliche Zuordnungskonsequenzen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
65 Stunden (31 Kontakt-/34 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
3.3.3 <strong>Polizei</strong>kompetenzen im Straßenverkehr<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Möglichkeiten polizeilicher Intervention zur Gefahrenabwehr im<br />
Straßenverkehr und können diese sachverhaltsbezogen anwenden<br />
- kennen Rechtslage und Risiken polizeilicher Streifen- und Einsatzfahrten<br />
Lerninhalte:<br />
- Eingriffsbefugnisse nach der StVO<br />
- Anwendbarkeit des <strong>Polizei</strong>rechts zur Gefahrenabwehr im Straßenverkehr<br />
einschließlich der Eingriffssystematik<br />
- Abschleppen von Kraftfahrzeugen<br />
- Zusammenarbeit mit Verkehrsbehörden<br />
- Einsatzfahrten aus rechtlicher und taktischer Sicht (Sonder- und Wegerechte)
<strong>Curriculum</strong> Seite 53<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
59 Stunden (28 Kontakt-/31 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 54<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
4<br />
Modultitel:<br />
Grundlagen polizeilicher Kommunikation,<br />
Führung und Zusammenarbeit<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät IV – Psychologie, Informatik, BWL<br />
Fakultät I – Führungswissenschaft<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/2.und 3. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Dr. Harald Fiedler,<br />
Fakultät IV<br />
- erwerben psychologische Grundlagen polizeilichen Handelns, Grundlagen<br />
polizeilicher Führung und Zusammenarbeit und Grundkenntnisse über den<br />
gegenwärtigen Stand der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der<br />
Betriebswirtschaftslehre<br />
Lerninhalte:<br />
- Lern- und Arbeitstechniken, Test und Experiment, Wahrnehmung und<br />
Attribution, Gedächtnisfunktionen, Gedächtnisstörungen und<br />
Befragungsmethoden, Entstehung und Veränderung von Verhalten<br />
(Lerntheorien), Aggressionstheorien und Umgang mit aggressivem Verhalten,<br />
Kommunikation, Gesprächstechnik und Vernehmungspsychologie, Konflikt und<br />
Konfliktmanagement, Stress, Stressfolgeerkrankungen, Stressmanagement und<br />
Psychohygiene<br />
- Grundlagen der Mitarbeiterführung, Anforderungen an Mitarbeiter und<br />
Führungskräfte, Präsentation und Moderation, Teamarbeit, Konflikthandhabung,<br />
Motivation und Leistung, Führungsstile, Kooperatives Führen<br />
- Definition und Abgrenzung der Betriebswirtschaftslehre; Grundtatbestände der<br />
Wirtschaft, Wirtschaftssysteme, Betrieb, Unternehmung und<br />
Unternehmensformen, Verwaltungsreformmodelle,<br />
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR): Gestaltung der Kostenträger-,<br />
Kostenstellen- und Kostenartenrechnung,<br />
Controlling: Effizienzmessung bezogen auf polizeiliche Maßnahmen, Gestaltung<br />
des Controllings, Benchmarking, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
- Die wesentlichen Komponenten eines PC, die wesentlichen Merkmale moderner<br />
PC-Betriebssysteme, Merkmale unterschiedlicher Datenträger, die<br />
Funktionsprinzipien des Internet, Recherchieren im Internet, Recherchieren in<br />
Bibliotheken über das Internet, informatische Grundlagen der Internetkriminalität
<strong>Curriculum</strong> Seite 55<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
und der Ermittlung bei Straftaten im Internet, Speicherung und Verwaltung von<br />
Wissensbeständen nach den Prinzipien des Wissensmanagements, Unterstützung<br />
des individuellen Wissensmanagements durch Software, Umgang mit PC-<br />
Standardsoftware, Erstellung großer Dokumente (Diplomarbeit) mit Software zur<br />
Textverarbeitung, Präsentationen mit Präsentationsprogrammen unterstützen<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
12<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
360 Stunden<br />
(148 Kontakt-/212 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module Grundpraktikum 1 und Grundpraktikum 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausuren<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
4.1<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Psychologische Grundlagen<br />
polizeilichen Handelns<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Psychologie<br />
- können Psychologie als Wissenschaft verstehen<br />
- können grundlegende Erkenntnisse der Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und<br />
Lernpsychologie in ihrer polizeilichen Tätigkeit nutzbringend anwenden<br />
- können mit Kollegen und Bürgern effizient kommunizieren<br />
- können mit Stress und Konflikten professionell umgehen<br />
Lerninhalte:<br />
- Lern- und Arbeitstechniken<br />
- Test und Experiment<br />
- Wahrnehmung und Attribution<br />
- Gedächtnisfunktionen<br />
- Gedächtnisstörungen und Befragungsmethoden<br />
- Entstehung und Veränderung von Verhalten (Lerntheorien)<br />
- Aggressionstheorien und Umgang mit aggressivem Verhalten<br />
- Kommunikation, Gesprächstechnik und Vernehmungspsychologie<br />
- Konflikt und Konfliktmanagement<br />
- Stress und Stressfolgeerkrankungen, Stressmanagement und Psychohygiene
<strong>Curriculum</strong> Seite 56<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Psychologische Grundlagen polizeilichen Handelns I<br />
Lehrveranstaltung 2: Psychologische Grundlagen polizeilichen Handelns II<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
90 Stunden (38 Kontakt-/52 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.1.1 Psychologische Grundlagen polizeilichen<br />
Handelns I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Psychologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Psychologie als Wissenschaft<br />
- kennen Methoden polizeipsychologischer Arbeit und Forschung<br />
- kennen grundlegende Prinzipien der Wahrnehmung<br />
- kennen Techniken zur strukturierten Beschreibung von Personen und Prozessen<br />
- kennen Wahrnehmungsstörungen und deren Auswirkungen, z.B. bei Zeugen<br />
- kennen die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses<br />
- kennen Befragungsverfahren und gedächtniserleichternde Techniken<br />
- kennen Prinzipien der Entstehung und Beeinflussung menschlichen Verhaltens<br />
Lerninhalte:<br />
- Tätigkeitsfelder und Methoden der Psychologie und <strong>Polizei</strong>psychologie<br />
- Test und Experiment<br />
- Sinneswahrnehmung<br />
- Wahrnehmungsbegrenzungen und -probleme<br />
- Personenwahrnehmung und Einflussfaktoren, Selbstbild und Fremdbild<br />
- Attributionsprozesse<br />
- Gedächtnisfunktionen und Speichertheorien<br />
- Gedächtnisstörungen und Befragungsmethoden<br />
- Lerntheorien und Anwendungsbeispiele im polizeilichen Alltag<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
62 Stunden (26 Kontakt-/36 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 57<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.1.2 Psychologische Grundlagen polizeilichen<br />
Handelns II<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Psychologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Theorien der Entstehung anti- und prosozialen Verhaltens<br />
- kennen Erklärungsmodelle <strong>für</strong> aggressives Verhalten und wirkungsvolle<br />
Interventionsmöglichkeiten<br />
- kennen kommunikationstheoretische Grundlagen, Techniken der<br />
Gesprächsführung und Vernehmung, kommunikative Mittel der Beeinflussung<br />
und Manipulation<br />
- kennen Konflikt-Theorien und Möglichkeiten der konstruktiven Bearbeitung von<br />
Konflikten<br />
- kennen den Zusammenhang von Konflikten mit Stress, Stressfolgeerkrankungen<br />
und Möglichkeiten des Stressmanagements<br />
Lerninhalte:<br />
- Gruppendynamik, Konformität und Deindividuation, Soziale Unterstützung,<br />
Autorität, Gehorsam und Gewissen: Milgram- und Gefängnis-Experimente<br />
- Aggressionstheorien und Umgang mit aggressivem Verhalten:<br />
Verhaltensbiologische Modelle, Frustrations-Aggressions-Hypothese,<br />
Lerntheoretische Erklärungen<br />
- Theorie der Kommunikation, Kommunikationsmodelle<br />
- Beeinflussung durch kommunikative Mittel, Gesprächstechnik<br />
- Beeinflussung der Vernehmungssituation, Einschätzung der Persönlichkeit der<br />
Aussageperson, Beeinflussung der Vernehmungssituation, Unterschiedliche<br />
Vernehmungsstrategien, Realitätskriterien<br />
- Konflikt und Konfliktmanagement: Erkennen von Konflikten im polizeilichen<br />
Alltag, Analyse von Konflikten und ihren Bedeutungen, Handhabungsstrategien<br />
unter unterschiedlichen Bedingungen, Möglichkeiten der Konfliktminimierung<br />
- Stress und Stressfolgeerkrankungen, Stressmanagement und Psychohygiene<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
28 Stunden (12 Kontakt-/16 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 58<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
4.2<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls<br />
Grundlagen polizeilicher Führung<br />
und Zusammenarbeit<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Führungswissenschaft<br />
- können berufstypische Anforderungen <strong>für</strong> Vorgesetzte und Mitarbeiter erfassen<br />
und werden befähigt, Initiative und Bereitschaft zu kooperativer Mitarbeit und<br />
Mitverantwortung zu entwickeln<br />
- können ihr eigenes Verhalten reflektieren und dadurch weiterentwickeln<br />
- können die Reichweite und Aussagekraft der Motivationsforschung einschätzen<br />
und im eigenen Verantwortungsbereich anwenden<br />
- können Führung als leitbild- und zielorientierte gemeinsame und soziale<br />
Einflussnahme auf Menschen in und mit einer strukturierten Arbeitssituation<br />
erkennen<br />
- können ihr Verhalten als Mitarbeiter oder als Führungskraft im Sinne<br />
kooperativen Führens ausrichten<br />
Lerninhalte:<br />
- Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte<br />
- Präsentation und Besprechungsmoderation<br />
- Konfliktfähigkeit und Konflikthandhabung<br />
- Grundlagen der Teamarbeit und Teamentwicklung<br />
- Ausgesuchte Motivationstheorien<br />
- Grundlagen der Mitarbeiterführung<br />
- Führung und Autorität<br />
- Reflexion des eigenen Verhaltens (Selbstbild / Fremdbild)<br />
- Kooperative Führung und ausgewählte Führungsstile<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen polizeilicher Führung und Zusammenarbeit I<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundlagen polizeilicher Führung und Zusammenarbeit II<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
117 Stunden (49 Kontakt-/68 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 59<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.2.1 Grundlagen polizeilicher Führung und<br />
Zusammenarbeit I<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Führungswissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können berufstypische Anforderungen <strong>für</strong> Vorgesetzte und Mitarbeiter erfassen<br />
und werden befähigt, Initiative und Bereitschaft zu kooperativer Mitarbeit und<br />
Mitverantwortung zu entwickeln<br />
- können die Reichweite und Aussagekraft der Motivationsforschung einschätzen<br />
und diese im eigenen Verantwortungsbereich anwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte, das Kompetenzmodell,<br />
Bedeutung von Anforderungsprofilen<br />
- Präsentation, Ablauf und Gestaltung einer Präsentation, Präsentationstechniken<br />
- Moderation, Moderationsprozess, Besprechungsmoderation, der Moderator,<br />
Moderationstechniken<br />
- Konflikt, Konfliktfähigkeit, Konflikthandhabung, Präventionsansätze<br />
- Grundlagen der Teamarbeit, Bedeutung, Ziele, Vor- und Nachteile,<br />
Voraussetzungen, Teamentwicklung, Erfolgskriterien<br />
- Ausgesuchte Motivationstheorien, Zusammenhang zwischen Führung, Leistung<br />
und Motivation, Einflussfaktoren auf die Motivation, Arbeitszufriedenheit und<br />
Betriebsklima, Zusammenhang zwischen Motivation und Fehlzeiten sowie<br />
Personalfluktuation, Innere Kündigung, Möglichkeiten zur Motivation und<br />
Motivierung<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
58 Stunden (24 Kontakt-/34 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 60<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.2.2 Grundlagen polizeilicher Führung und<br />
Zusammenarbeit II<br />
Verantwortliche Fachgruppe:<br />
Führungswissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können Führung als leitbild- und zielorientierte gemeinsame und soziale<br />
Einflussnahme auf Menschen in und mit einer strukturierten Arbeitssituation<br />
erkennen<br />
- können ihr eigenes Verhalten reflektieren und dadurch weiterentwickeln<br />
- können ihr Verhalten als Mitarbeiter oder als Führungskraft im Sinne<br />
kooperativen Führens ausrichten<br />
Lerninhalte:<br />
- Grundlagen der Mitarbeiterführung, Führung und Autorität, Definitionen und<br />
Legitimation, Führungsziele und -aufgaben<br />
- Das Autoritätsmodell, Bezug zur Personalführung<br />
- Reflexion des eigenen Verhaltens (Selbstbild/Fremdbild), Analyse des<br />
Selbstbildes und des Fremdbildes, Mitarbeiterfeedback, Mitarbeiterbefragung<br />
Feedbackregeln<br />
- Grundlagen der Personalentwicklung, Ziel und Zweck, Instrumente<br />
- Kooperative Führung und ausgewählte Führungsstile, das Konzept kooperativer<br />
Führung, Beteiligung, Delegation, Transparenz, Repräsentation, Kontrolle,<br />
Leistungsfeststellung und –bewertung, Vertrauen, positive Kommunikation,<br />
Wirkungen kooperativer Führung, Vergleich zu anderen Führungsstilen,<br />
Managementmethoden, PDV 100 Neu – Kooperative Führung im polizeilichen<br />
Einsatz<br />
- Bedeutung von Zielen, Zielbildungsprozess, Anforderungen an Ziele, Führen mit<br />
Zielen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
59 Stunden (25 Kontakt-/34 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 61<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Teilmoduls:<br />
4.3<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
Titel des Teilmoduls:<br />
Informationstechnische und<br />
betriebswirtschaftliche<br />
Grundlagen polizeilichen<br />
Handelns und Entscheidens<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Informatik/BWL<br />
- besitzen Grundkenntnisse über den gegenwärtigen Stand der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
- sind mit der Handhabung von PC und PC-Software vertraut<br />
- kennen die technischen Hintergründe des Internets<br />
- besitzen Kenntnisse der informatischen Grundlagen zur Computer- und<br />
Internetkriminalität sowie Basiskenntnisse zur Computerforensik<br />
- können das Internet als Informationsressource nutzen<br />
- kennen Prinzipien des persönlichen Wissensmanagements und können diese<br />
anwenden<br />
- können Software zur Unterstützung des persönlichen Wissensmanagements<br />
einsetzen<br />
- können Grundlagen des Informationsmanagements mit<br />
wirtschaftswissenschaftlichen Konzepten verknüpfen<br />
- lernen die Grundlagen der BWL kennen<br />
- kennen die aktuellen Verwaltungsreformmodelle und können sie in den<br />
<strong>Polizei</strong>bereich adaptieren<br />
- können die Auswirkungen der Reformmodelle auf die Führungsstrukturen der<br />
<strong>Polizei</strong> erkennen<br />
- beherrschen die grundlegenden Kenntnisse im Bereich des Unternehmensrechts<br />
mit Schwerpunkt <strong>Polizei</strong>relevanz und Ermittlungsansätze<br />
Lerninhalte:<br />
- Die wesentlichen PC-Komponenten<br />
- Betriebssysteme<br />
- PC-Standardsoftware<br />
- Funktionsprinzipien des Internet<br />
- Grundlagen der PC-Sicherheit<br />
- Informatische Grundlagen der Computer- und Internetkriminalität<br />
- Recherchieren im Internet<br />
- Recherchieren in Bibliotheken über das Internet<br />
- Individuelles Wissensmanagement mit Unterstützung der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
- Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
<strong>Curriculum</strong> Seite 62<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Soziale Marktwirtschaft<br />
- Ökonomisches Prinzip<br />
- Produktionsfaktoren<br />
- Verwaltungsreformmodelle (NSI)<br />
- Dezentrale Budgetierung<br />
- Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)<br />
- Strategisches und operatives Controlling<br />
- Balanced Scorecard (BSC)<br />
- Exemplarische Darstellung von verschiedenen Rechtsformen und deren<br />
Bestimmungsgründe<br />
- Ermittlungsansätze insbesondere im Hinblick auf öffentliche Register<br />
Einzelveranstaltungen des Teilmoduls:<br />
Lehrveranstaltung 1: Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnik<br />
Lehrveranstaltung 2: Grundlagen der BWL<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
153 Stunden (61 Kontakt-/92 Selbststudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.3.1 Grundlagen der BWL<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
BWL<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Grundlagen, Fragestellungen und Lösungsansätze der<br />
Wirtschaftswissenschaften<br />
- kennen die Zusammenhänge von Wirtschaftssystemen und wirtschaftlicher,<br />
sozialer und politischer Entwicklung<br />
- erwerben einen fundierten Standpunkt zu aktuellen betriebswirtschaftlichen<br />
Entwicklungen innerhalb der öffentlichen Verwaltung<br />
- kennen die wichtigsten Unternehmensformen insbesondere im Hinblick auf die<br />
Durchführung von Ermittlungsverfahren<br />
- entwickeln Verständnis <strong>für</strong> die dezentrale Budgetierung, Kosten- und<br />
Leistungsrechnungssysteme, Controlling und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
nach § 7 LHO
<strong>Curriculum</strong> Seite 63<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- VWL und BWL als Wirtschaftswissenschaften<br />
- Produktionsfaktoren i.S. BWL<br />
- Ökonomisches Prinzip<br />
- Einführung in die Grundgedanken Neuer Steuerungsinstrumente<br />
- Grundzüge dezentraler Budgetierung/Budgetverantwortung<br />
- Wesentliche Grundlagen der KLR<br />
- Kostenarten- und Kostenstellenrechnung<br />
- Controlling als Steuerungsinstrument<br />
- Aufbau und Struktur einer BSC<br />
- Benchmarking<br />
- Rechtliche Grundlagen des Handels- und Gesellschaftsrechts<br />
- Personen- und Kapitalgesellschaften<br />
- Verantwortlichkeiten bei verschiedenen Unternehmensformen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
61 Stunden (24 Kontakt-/37 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
4.3.2 Grundlagen der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Informatik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- besitzen Grundkenntnisse über den gegenwärtigen Stand der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
- sind mit der Handhabung von PC und PC-Software vertraut<br />
- kennen die technischen Hintergründe des Internets<br />
- besitzen Kenntnisse der informatischen Grundlagen zur Computer- und<br />
Internetkriminalität sowie Basiskenntnisse zur Computerforensik<br />
- können das Internet als Informationsressource nutzen<br />
- kennen Prinzipien des persönlichen Wissensmanagements und können diese<br />
anwenden<br />
- können Software zur Unterstützung des persönlichen Wissensmanagements<br />
einsetzen<br />
Lerninhalte:<br />
- Die wesentlichen Komponenten eines PC<br />
- Die wesentlichen Merkmale moderner PC-Betriebssysteme<br />
- Merkmale unterschiedlicher Datenträger
<strong>Curriculum</strong> Seite 64<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Der Umgang mit Dateien und Verzeichnissen<br />
- Die Funktionsprinzipien des Internet<br />
- Dienste im Internet<br />
- Internetzugänge<br />
- Recherchieren im Internet<br />
- Recherchieren in Bibliotheken über das Internet<br />
- Spuren auf einem Client-Rechner<br />
- Spuren im Internet<br />
- Sicherheit im Internet<br />
- Verschlüsselung<br />
- Speicherung und Verwaltung von Wissensbeständen nach den Prinzipien des<br />
Wissensmanagements<br />
- Umgang mit PC-Standardsoftware<br />
- Erstellung großer Dokumente (Diplomarbeit) mit Software zur Textverarbeitung<br />
- Präsentationen mit Präsentationsprogrammen unterstützen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
92 Stunden (37 Kontakt-/55 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 65<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Begleitfachs:<br />
1<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät I – Einsatztraining/Sport<br />
Titel:<br />
Einsatztraining/Sport Teil1<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/2. und 3.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Koordinator:<br />
Uli Bruder,<br />
Fakultät I<br />
- kennen die Bedeutung des Einsatztrainings <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst<br />
- kennen und beherrschen die wesentlichen Inhalte des Einsatztrainings<br />
- besitzen persönliche Handlungskompetenz <strong>für</strong> kritische und gewalttätige<br />
Einsatzsituationen des polizeilichen Alltags<br />
- sind befähigt, polizeiliche Einsatzlagen unter Eigensicherungsaspekten sicher,<br />
professionell und lageangepasst zu lösen<br />
- können Mitarbeiter <strong>für</strong> ein regelmäßiges Einsatztraining motivieren<br />
(Einsatztraining)<br />
- sind sich der Bedeutung des Sports <strong>für</strong> körperliche Entwicklung und<br />
persönliches Wohlbefinden und als Qualitätsmerkmal <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst<br />
bewusst<br />
- kennen die Grundlagen des Gesundheits- und Präventionssports und können<br />
diesen eigenverantwortlich ausführen<br />
- können sich eigenverantwortlich durch systematische sportliche Betätigung<br />
körperlich leistungsfähig halten sowie die konditionellen Fähigkeiten erhalten<br />
und verbessern<br />
- kennen gesunde Ernährung und können diese umsetzen<br />
- kennen die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund<br />
gesundheitlicher Risiken<br />
- können Mitarbeiter <strong>für</strong> den Dienstsport motivieren<br />
(Sport)<br />
Lerninhalte:<br />
- Professioneller Einsatz einfacher körperlicher Gewalt, von Hilfsmitteln der<br />
körperlichen Gewalt und Waffengebrauch<br />
- Taktisches Vorgehen/Verhalten im Einsatz /Teamarbeit/Distanzen im Einsatz<br />
- Lebensrettende Maßnahmen <strong>für</strong> Notfallsituationen im polizeilichen Einsatz
<strong>Curriculum</strong> Seite 66<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Integrationstraining polizeilicher Standardsituationen und<br />
Verhaltensempfehlungen sowie Schwerpunkttrainings der <strong>Polizei</strong> des Landes<br />
Baden-Württemberg<br />
- Schießen gemäß PDV 211<br />
- Gesundheits- und kompensatorischer Sport<br />
- Gezieltes Herz-Kreislauf-Training<br />
- Funktionelles Dehnen und Kräftigen<br />
- Rückenschule und Ergonomie am Arbeitsplatz<br />
- Lockerungs- und Entspannungstechniken<br />
- Ernährung<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
2<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (48 Kontakt-/12 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module Grundpraktikum 1 und Grundpraktikum 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Im Hauptstudium, Teil 2
<strong>Curriculum</strong> Seite 67<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Bachelor – Arbeit<br />
Fachtheoretisches Grundstudium/3.Semester<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
5<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
150 Stunden (hiervon 17<br />
Stunden Kontaktstudium<br />
Methodik des wissenschaftlichen<br />
Arbeitens)<br />
Bachelor-Arbeit und deren mündliche Verteidigung im 5. und 6. Semester<br />
Methodik des<br />
wissenschaftlichen<br />
Arbeitens<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Politikwissenschaft<br />
Psychologie<br />
Lernziel:<br />
Die Studierenden sollen sich mit Blick auf die Bachelor-Thesis mit wesentlichen<br />
Aspekten der Erstellung und Verteidigung einer wissenschaftlichen Arbeit<br />
auseinandersetzen.<br />
Lerninhalte:<br />
1. Wie finde ich ein adäquates Thema?<br />
2. Wie finde ich relevante Literatur? Wie wähle ich Literatur aus?<br />
3. Wie baue ich<br />
a) eine wissenschaftliche Arbeit (mit dem Schwerpunkt von<br />
Literaturbearbeitung) auf?<br />
b) eine wissenschaftliche empirische Arbeit auf?<br />
4. Wie bringe ich eine Arbeit in eine wissenschaftliche Form?<br />
5. Wie präsentiere bzw. verteidige ich wesentliche Ergebnisse?<br />
Einzelveranstaltungen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand (Kontaktstudium/Selbststudium):<br />
17 Stunden Kontaktstudium
<strong>Curriculum</strong> Seite 68<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service
<strong>Curriculum</strong> Seite 69<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Hauptpraktikum<br />
(Seiten 68 – 74)<br />
Modul HP 1<br />
Praktizierte polizeiliche Gefahrenabwehr/<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
69<br />
Modul HP 2 Praktizierte polizeiliche Strafverfolgungstätigkeit 71<br />
Modul HP 3 Praktizierte Stabsarbeit 73
<strong>Curriculum</strong> Seite 70<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
Modul HP 1<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
<strong>Polizei</strong>praxis<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Hauptpraktikum/4.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modultitel:<br />
Praktizierte polizeiliche Gefahrenabwehr/<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Modulkoordinator:<br />
Praxiskoordinator der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Polizei</strong><br />
- lernen das Aufgabenfeld Streifendienst aus Sicht eines Beamten/einer Beamtin<br />
gehobener Dienst kennen<br />
- praktizieren selbständig teamorientiert ihr im Fachtheoretischen Grundstudium<br />
erworbenes Grundlagen- und Methodenwissen<br />
- stellen ihre persönliche Eignung und die ausreichende fachliche Leistung <strong>für</strong><br />
eine spätere Tätigkeit im gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst unter Beweis,<br />
insbesondere durch eine starke Kunden-/Bürgerorientierung, Konfliktfähigkeit<br />
und Durchsetzungsvermögen<br />
Lerninhalte:<br />
Typische Tätigkeitsfelder eines Beamten des gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes<br />
im Streifendienst, wie<br />
- Eingebunden sein in die Führung einer Dienstgruppe<br />
- Mitwirkung bei der Einsatzleitung/Abschnittsleitung<br />
- Abarbeiten eines Meldealarms<br />
- Errichten und Leiten einer Kontrollstelle<br />
- Abarbeiten komplexer Verkehrsunfalllagen<br />
- Planung und Mitwirkung bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen<br />
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung lagebildorientierter Präsenz zur<br />
Gefahrenabwehr<br />
- Erarbeitung von konzeptionellen Ansätzen/Überlegungen zur Beseitigung von<br />
Brennpunkten bei Ordnungsstörungen<br />
- Selbstständiges Bearbeiten von Widerstandsanzeigen und allen Delikten mit<br />
Strafantragsrecht des Dienstvorgesetzten
<strong>Curriculum</strong> Seite 71<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
Wahlweise 8, 10, 12 oder 14<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240, 300, 360 oder 420 Stunden<br />
(Dienst entsprechend des <strong>für</strong> die jeweilige<br />
Dienstgruppe gültigen Dienstplans, ausgerichtet an<br />
der Regelarbeitszeit)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 – 4 (Fachtheoretisches Grundstudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Leistungsbewertung <strong>für</strong> praktische Leistung und persönliche Eignung
<strong>Curriculum</strong> Seite 72<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
Modul HP 2<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
<strong>Polizei</strong>praxis<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Hauptpraktikum/4.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modultitel:<br />
Praktizierte polizeiliche<br />
Strafverfolgungstätigkeit<br />
Modulkoordinator:<br />
Praxiskoordinator der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong><br />
- lernen das Aufgabenfeld Strafverfolgungstätigkeit aus Sicht eines<br />
Beamten/einer Beamtin gehobener Dienst kennen<br />
- praktizieren selbstständig teamorientiert ihr im Fachtheoretischen<br />
Grundstudium erworbenes Grundlagen- und Methodenwissen<br />
- stellen ihre persönliche Eignung und die ausreichende fachliche Leistung <strong>für</strong><br />
eine spätere Tätigkeit im gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst unter Beweis,<br />
insbesondere durch die Fähigkeit zum analytischen und strukturierten Denken,<br />
die Anwendung von kriminaltechnischen Standardverfahren und die<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber einschlägigen und speziellen<br />
Ermittlungsmethoden (z.B. DNA-Probenahmen)<br />
Lerninhalte:<br />
Typische Tätigkeitsfelder eines Beamten des gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes<br />
in der Strafverfolgung, wie<br />
- Mitwirkung in der Leitung von Einsätzen zur Kriminalitätsbekämpfung<br />
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Durchsuchungsaktionen<br />
- Durchführung von Vernehmungen<br />
- Selbstständiges Bearbeiten von Widerstandsanzeigen und allen Delikten mit<br />
Strafantragsrecht des Dienstvorgesetzten<br />
- Mitwirkung bei der Durchführung kriminaltechnischer Maßnahmen am Tatort<br />
- Durchführung von ED-Behandlungen und DNA-Probenahmen<br />
- Mitwirkung bei Fahndung, verdeckter Aufklärung und Observation<br />
- Ermittlungen im Bereich der Telekommunikation<br />
- Mitarbeit bei Ermittlungsverfahren mit Haftsachen
<strong>Curriculum</strong> Seite 73<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
Wahlweise 8, 10, 12 oder 14<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240, 300, 360 oder 420 Stunden<br />
(Dienst entsprechend des <strong>für</strong> die jeweiligen<br />
Arbeitsbereiche gültigen Dienstplans, ausgerichtet<br />
an der Regelarbeitszeit)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 – 4 (Fachtheoretisches Grundstudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Leistungsbewertung <strong>für</strong> praktische Leistung und persönliche Eignung
<strong>Curriculum</strong> Seite 74<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
Modul HP 3<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
<strong>Polizei</strong>praxis<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Hauptpraktikum/4.Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modultitel:<br />
Praktizierte Stabsarbeit<br />
Modulkoordinator:<br />
Praxiskoordinator der<br />
<strong>Hochschule</strong> <strong>für</strong> <strong>Polizei</strong><br />
- lernen das Aufgabenfeld Stabsarbeit intensiv kennen<br />
- praktizieren selbständig teamorientiert ihr im Fachtheoretischen Grundstudium<br />
erworbenes Grundlagen- und Methodenwissen<br />
- stellen ihre persönliche Eignung und die ausreichende fachliche Leistung <strong>für</strong><br />
eine spätere Tätigkeit im gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst unter Beweis,<br />
insbesondere durch konzeptionelle und strategische Fähigkeiten und die<br />
Aufgeschlossenheit gegenüber speziellen DV-Anwendungen<br />
Lerninhalte:<br />
Typische Tätigkeitsfelder eines Beamten des gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugsdienstes<br />
in der Stabsarbeit, wie<br />
- Erstellen von Konzeptionen, Evaluationen und Statistiken<br />
- Beschwerdesachbearbeitung und Bearbeitung von Strafanträgen durch den<br />
Dienstvorgesetzten<br />
- Informationssteuerung<br />
- Mitwirkung an der Planung und dem Ablauf von Einsätzen<br />
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Dienstanweisungen und sonstigen<br />
Regelungen<br />
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Alarmplänen<br />
- Mitarbeit bei der Kriminalitätsanalyse auf Basis von PKS, LABIS und ZIA-<br />
Erkenntnissen<br />
- Unterstützung im Rahmen der dezentralen Budgetierung<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
Wahlweise 8, 10, 12 oder 14<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240, 300, 360 oder 420 Stunden<br />
(Dienst entsprechend des <strong>für</strong> die jeweiligen<br />
Arbeitsbereiche gültigen Dienstplans, ausgerichtet<br />
an der Regelarbeitszeit)
<strong>Curriculum</strong> Seite 75<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 – 4 (Fachtheoretisches Grundstudium)<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Leistungsbewertung <strong>für</strong> praktische Leistung und persönliche Eignung
<strong>Curriculum</strong> Seite 76<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium<br />
(Seiten 75 – 107)<br />
Modul 5<br />
Modul 6<br />
<strong>Polizei</strong>liche Kriminalitätsbekämpfung auf<br />
ausgewählten Deliktsfeldern<br />
<strong>Polizei</strong>licher Einsatz im Alltag und in<br />
ausgewählten Einsatzlagen / <strong>Polizei</strong>liche<br />
Verkehrssicherheitsarbeit<br />
76<br />
83<br />
Modul 7 Personalführung in ausgewählten Situationen 94<br />
Modul 8<br />
Bekämpfung von Terrorismus und<br />
Extremismus / <strong>Polizei</strong>arbeit im internationalen<br />
Kontext<br />
99<br />
Begleitfach 2 Einsatztraining / Sport 2 103<br />
Begleitfach 3 <strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch/-französisch 105<br />
Bachelor-Arbeit 107<br />
Wahlmodule 108
<strong>Curriculum</strong> Seite 77<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
5<br />
Modultitel:<br />
<strong>Polizei</strong>liche Kriminalitätsbekämpfung<br />
auf ausgewählten Deliktsfeldern<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät II – Kriminaltaktik, Kriminaltechnik, Kriminologie<br />
Fakultät III – Strafrecht, Strafverfahrensrecht und Eingriffsrecht<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Jochen Schröder,<br />
Fakultät II<br />
- kennen die Grundlagen und Methoden der Kriminaltaktik, der Kriminaltechnik<br />
und der Kriminologie und können diese bei der Bewältigung konkreter Lagen in<br />
der Praxis anwenden<br />
- kennen und verstehen die wesentlichen Bestimmungen des materiellen<br />
Strafrechts und können diese bei der praktischen Verbrechensbekämpfung<br />
umsetzen<br />
- sind in der Lage, polizeirelevante Sachverhalte auf der Basis ihrer staats-,<br />
verfassungs-, strafverfahrens-, verwaltungs- und polizeirechtlichen Kenntnisse<br />
umfassend rechtlich zu würdigen und zu beherrschen<br />
Lerninhalte:<br />
<strong>Polizei</strong>liche Kriminalitätsbekämpfung in den Bereichen<br />
- Gewalt- und Schwerkriminalität<br />
- Vermögenskriminalität<br />
- Eigentumskriminalität<br />
- Aktuelle/besondere Kriminalitätsformen<br />
Fächerübergreifende Fallstudien<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
19<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
570 Stunden<br />
(227 Kontakt-/343 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 und 2
<strong>Curriculum</strong> Seite 78<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
5.1 Gewalt- und Schwerkriminalität<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Kriminaltaktik, Kriminaltechnik,<br />
Kriminologie,<br />
Strafrecht, Strafverfahrensrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Bedeutung und Aufbau kriminalistischer Konzepte<br />
- kennen Bedeutung sowie Auswerte- und Recherchemöglichkeiten der<br />
polizeilichen Datensammlungen und Meldedienste<br />
- kennen Fahndungsmöglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene<br />
- kennen Grundlagen verdeckter Ermittlungen<br />
- kennen besondere Anforderungen im Zusammenhang mit der polizeilichen<br />
Intervention bei häuslicher Gewalt<br />
- kennen spezifische Befunde bei Sexualdelikten sowie deren Sicherung und<br />
Aussagewert<br />
- beherrschen den Sicherungsangriff bei Todesfällen und kennen Indikatoren zur<br />
Verdachtsgewinnung bei der Bearbeitung tödlicher Verkehrsunfälle<br />
- kennen die Vorgaben der PDV 389<br />
- kennen die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gewalt- und<br />
Schwerkriminalität, deren unterschiedliche Erscheinungsformen sowie die<br />
wesentlichen polizeilichen und gesellschaftlichen Präventions- und<br />
Bekämpfungsansätze in diesem Bereich<br />
- kennen die Vorschriften des Besonderen Teils des StGB und ausgewählte<br />
Vorschriften des Nebenstrafrechts und beherrschen die wesentlichen<br />
Strafbestimmungen unter Berücksichtigung ihres rechtstatsächlich-kriminologischen<br />
Hintergrundes in ihren Merkmalen sicher, um dem Legalitätsprinzip<br />
genügen zu können<br />
- kennen und beherrschen die Vorschriften über verdeckte Ermittlungsmaßnahmen<br />
und können diese sicher anwenden<br />
- erwerben die <strong>für</strong> sie nötigen Kenntnisse über Organisation und Aufgaben der<br />
Gerichte, der Staatsanwaltschaften und der <strong>Polizei</strong> im Strafverfahren und lernen<br />
diese anzuwenden
<strong>Curriculum</strong> Seite 79<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Bedeutung und Erarbeitung kriminalistischer Konzepte<br />
- polizeiliche Meldedienste und Informationssysteme, Grundlagen der DV-<br />
Recherche<br />
- verschiedene Formen der Fahndung<br />
- kriminaltaktische Aspekte bei verdeckten Ermittlungen<br />
- Häusliche Gewalt und Stalking<br />
bei Sexualdelikten<br />
- Entstehungsbedingungen, Erscheinungsformen und Aussagewert<br />
deliktsspezifischer Spuren und Übungen<br />
bei Todesfällen<br />
- Bestattungsgesetz<br />
- Dunkelfeldproblematik<br />
- Leichenerscheinungen<br />
- Methode der Differenzialdiagnostik<br />
bei Vermissten und unbekannten Toten<br />
- Möglichkeiten zur Identifizierung, Funktion der Datei VermiUTot<br />
- Begriffsverständnisse und Definitionen von Gewalt und Gewaltkriminalität sowie<br />
Schwerkriminalität<br />
- Aktuelle Lage und Entwicklung der Gewalt- und Schwerkriminalität<br />
- Phänomenologie der Gewaltkriminalität, insbesondere im Hinblick auf Gewalt<br />
im sozialen Nahraum, Stalking, Gewalt in der Schule (einschließlich des „Schul-<br />
Amoks“ bzw. „school shootings“) und sexualisierte Gewaltstraftaten<br />
- Begriff und Phänomenologie der Hassdelikte am Beispiel rechtsextremistischer<br />
Straftaten<br />
- Präventive und repressive polizeiliche Bekämpfungsansätze sowie<br />
gesellschaftliche und kriminalpolitische Präventionsansätze und<br />
Kontrollstrategien bei Gewalt- und Schwerkriminalität<br />
Straftaten gegen<br />
- Leben und körperliche Unversehrtheit<br />
- Ehre und Freiheit<br />
- sexuelle Selbstbestimmung<br />
- Staatsgewalt, Rechtspflege und Öffentliche Ordnung
<strong>Curriculum</strong> Seite 80<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Häufig in den Vorschriften über verdeckte Ermittlungsmaßnahmen<br />
vorkommende Begriffe (insbesondere Observation)<br />
- auf Datenerhebung, -sammlung und -auswertung gestützte Ermittlungen<br />
- Ermittlungen unter Einsatz technischer Mittel und verdeckt arbeitender Personen<br />
- Gerichte / Staatsanwaltschaften / <strong>Polizei</strong><br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
229 Stunden (92 Kontakt-/137 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
5.2 Vermögenskriminalität<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Kriminaltaktik, Kriminaltechnik,<br />
Kriminologie,<br />
Strafrecht, Strafverfahrensrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die wesentlichen Erscheinungsformen und besonderen<br />
Herausforderungen der IuK-Kriminalität und können einfach gelagerte IuK-<br />
Straftaten bearbeiten<br />
- kennen Erscheinungsformen und Erklärungsansätze der Korruption sowie die<br />
entsprechenden Präventions- und Bekämpfungsstrategien<br />
- kennen die Vorschriften des Besonderen Teils des StGB und ausgewählte<br />
Vorschriften des Nebenstrafrechts und beherrschen die wesentlichen<br />
Strafbestimmungen unter Berücksichtigung ihres rechtstatsächlich-kriminologischen<br />
Hintergrundes in ihren Merkmalen sicher, um dem Legalitätsprinzip<br />
genügen zu können<br />
- erwerben die <strong>für</strong> sie notwendigen Kenntnisse über den Verteidiger und lernen<br />
diese anzuwenden und erhalten einen Überblick über das Strafverfahren nach<br />
Abschluss der polizeilichen Ermittlungen<br />
Lerninhalte:<br />
- Erscheinungsformen und Problemstellungen der IuK-Kriminalität<br />
- Grundlagen der Spurensicherung und Verfahrensführung bei IuK-Kriminalität<br />
- Begriff der Korruption<br />
- Aktuelle Lage und Entwicklung der Korruption<br />
- Phänomenologie, Problemwahrnehmung und Erklärungsansätze der Korruption<br />
im Bereich staatlichen Handelns einerseits, im wirtschaftlichen, politischen und<br />
allgemeingesellschaftlichen Bereich andererseits
<strong>Curriculum</strong> Seite 81<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Präventive und repressive polizeiliche Bekämpfungsansätze sowie<br />
gesellschaftliche und kriminalpolitische Präventionsansätze und<br />
Kontrollstrategien im Bereich der Korruption<br />
- Überblick über Vermögensdelikte<br />
- Betrug und betrugsähnliche Delikte<br />
- Überblick über Anschlussstraftaten<br />
- Begünstigung und Strafvereitelung<br />
- Hehlerei und Geldwäsche<br />
- Verteidiger<br />
- Abschluss des Ermittlungsverfahrens<br />
- Verfahren vor Gericht und besondere Verfahrensarten, Rechtsbehelfe<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
62 Stunden (24 Kontakt-/38 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
5.3 Eigentumskriminalität<br />
und fächerübergreifende Fallstudien<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Kriminaltaktik, Kriminaltechnik,<br />
Kriminologie,<br />
Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Eingriffsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Anforderungen und Problembereiche bei der Bearbeitung umfangreicher<br />
Ermittlungsverfahren und wissen um Möglichkeiten, auf diese aufbau- und<br />
ablauforganisatorisch zu reagieren oder sie zu vermeiden<br />
- kennen unterschiedliche Formen der Verfahrensdokumentation und<br />
Aktenführung bei umfangreichen Ermittlungskomplexen<br />
- kennen kriminaltaktische Problemstellungen und Maßnahmen bei<br />
Durchsuchungsmaßnahmen<br />
- kennen die spezifischen Tatbegehungsweisen bei Kfz- und<br />
Wohnungsaufbrüchen, die erwartbaren objektiven Befunde und deren<br />
Interpretationsmöglichkeiten<br />
- kennen die Möglichkeiten zur Klärung forensischer Fragestellungen mittels<br />
digitaler Spuren im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen<br />
- kennen die aktuelle Lage und die Entwicklung der Eigentumskriminalität, ihre<br />
unterschiedlichen Erscheinungsformen in aktuellen Teilbereichen sowie die<br />
wesentlichen polizeilichen Präventions- und Bekämpfungsansätze<br />
- kennen die Vorschriften des Besonderen Teils des StGB und ausgewählte<br />
Vorschriften des Nebenstrafrechts und beherrschen die wesentlichen<br />
Strafbestimmungen unter Berücksichtigung ihres rechtstatsächlichkriminologischen<br />
Hintergrundes in ihren Merkmalen sicher, um dem<br />
Legalitätsprinzip genügen zu können
<strong>Curriculum</strong> Seite 82<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- kennen neuere Rechtsentwicklungen und können diese in die Praxis umsetzen<br />
- vertiefen ihre Fähigkeiten, das erlernte Wissen fächerübergreifend in der<br />
Fallbearbeitung einzusetzen<br />
- vertiefen ihre Kenntnisse über polizeiliche Eingriffsmaßnahmen<br />
- üben sich an den Schnittstellen repressiver und präventiver Aufgabenerfüllung<br />
Lerninhalte:<br />
- Anlassbezogene Organisations- und Einsatzformen<br />
- Schwachstellenanalyse bei der Bearbeitung umfangreicher Ermittlungsverfahren<br />
- Verfahrensdokumentation und Aktenführung bei umfangreichen<br />
Ermittlungsverfahren unter Beachtung forensischer Ansprüche<br />
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von<br />
Durchsuchungsmaßnahmen<br />
- deliktsspezifische Aufbruch- und Manipulationswerkzeuge und deren typische<br />
Spurencharakteristik sowie die Sicherungs- und Auswertemethoden<br />
- Digitale Spuren in Steuergeräten moderner Kfz<br />
- Begriffsverständnisse und Definitionen der verschiedenen Arten von<br />
Eigentumskriminalität<br />
- Aktuelle Lage und Entwicklung der Eigentumskriminalität<br />
- Phänomenologie ausgewählter Erscheinungsformen der Eigentumskriminalität<br />
- Präventive und repressive polizeiliche Bekämpfungsansätze sowie<br />
gesellschaftliche und kriminalpolitische Präventionsansätze und<br />
Kontrollstrategien bei diesen Kriminalitätsarten<br />
- Überblick über Eigentumsdelikte<br />
- Diebstahl und Unterschlagung<br />
- Raub, Räuberischer Diebstahl und Räuberische Erpressung<br />
- Überblick über Urkundendelikte, Begriff der Urkunde, Urkundenfälschung<br />
- Fälschung technischer Aufzeichnungen<br />
- Missbrauch von Ausweispapieren<br />
- Fächerübergreifende Fallbearbeitung<br />
- Aktuelle Rechtsfragen aus ausgewählten Bereichen der Strafverfolgung und der<br />
Gefahrenabwehr anhand von Übungsfällen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
124 Stunden (50 Kontakt-/ 74 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 83<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
5.4 Aktuelle/besondere<br />
Kriminalitätsformen und<br />
fächerübergreifende Fallstudien<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Kriminaltaktik, Kriminaltechnik,<br />
Kriminologie,<br />
Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Eingriffsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- sind in der Lage, das bis dahin im Fachtheoretischen Grundstudium und im<br />
Hauptpraktikum vermittelte Wissen fallspezifisch sachgerecht anzuwenden<br />
- können Sachverhalte und Aufgabenstellungen ganzheitlich erfassen und, darauf<br />
aufbauend, präventive und repressive Handlungsanleitungen erarbeiten<br />
- kennen die Vorschriften des Besonderen Teils des StGB und ausgewählte<br />
Vorschriften des Nebenstrafrechts und beherrschen die wesentlichen<br />
Strafbestimmungen unter Berücksichtigung ihres rechtstatsächlichkriminologischen<br />
Hintergrundes in ihren Merkmalen sicher, um dem<br />
Legalitätsprinzip genügen zu können<br />
- kennen neuere Rechtsentwicklungen und können diese in die Praxis umsetzen<br />
- vertiefen ihre Fähigkeiten, das erlernte Wissen fächerübergreifend in der<br />
Fallbearbeitung einzusetzen<br />
Lerninhalte:<br />
- Problemlagen und kriminalistische Anforderungen bei spezifischen<br />
Kriminalitätsformen sowie Entwicklung deliktsspezifischer kriminalistischer<br />
Konzepte, z.B. in Deliktsfeldern wie Politisch motivierte Straftaten, Btm-<br />
Kriminalität, Häusliche Gewalt, Gewalt gegen <strong>Polizei</strong>beamte u.a.<br />
- Aktuelle Lage, Entwicklung und Phänomenologie dieser Kriminalitätsformen<br />
- Präventive und repressive polizeiliche Bekämpfungsansätze sowie<br />
gesellschaftliche und kriminalpolitische Präventionsansätze bei dieser<br />
Kriminalität<br />
- Amtsdelikte<br />
- Gemeingefährliche Straftaten<br />
- Betäubungsmittelstrafrecht<br />
- Neuere Rechtsentwicklungen<br />
- Strafrechtliche und fächerübergreifende Fallbearbeitung<br />
- Übungen anhand von fächerübergreifenden Fallszenarien<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
155 Stunden (61 Kontakt-/94 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 84<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
6<br />
Modultitel:<br />
<strong>Polizei</strong>licher Einsatz im Alltag und in<br />
ausgewählten Einsatzlagen /<br />
<strong>Polizei</strong>liche Verkehrssicherheitsarbeit<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät I - Einsatzwissenschaft, Verkehrswissenschaft<br />
Fakultät II - Kriminaltechnik<br />
Fakultät III - <strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht<br />
Fakultät IV – Psychologie<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Andrea Merkle,<br />
Fakultät I<br />
- kennen die wesentlichen taktischen Maßnahmen, Organisationsformen und<br />
Einsatzkonzepte <strong>für</strong> ausgewählte Einsatzlagen sowie die grundlegenden<br />
Methoden der Einsatzlehre und können diese anwenden<br />
- kennen die grundlegenden methodischen und fachlichen Vorgehensweisen der<br />
Verkehrswissenschaft und können diese in ausgewählten Einsatzlagen anwenden<br />
- kennen die rechtswissenschaftlichen Grundlagen und Methoden in ausgewählten<br />
Einsatzlagen und können diese anwenden<br />
- sind befähigt, das Verhalten von Bürgern in besonderen polizeilichen<br />
Einsatzlagen zu beschreiben, zu erklären und zu beeinflussen<br />
Lerninhalte:<br />
- Veranstaltungen/Versammlungen/Ansammlungen<br />
- Große Gefahren- und Schadensereignisse<br />
- Besondere Gefährdungslagen<br />
- Banküberfälle, Bedrohungs- und Geisellagen<br />
- Allgemeine verkehrspolizeiliche Lagen<br />
- Einsatzlagen mit grenzüberschreitenden und ausländerrechtlichen Bezügen<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
16<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
480 Stunden<br />
(196 Kontakt-/284 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 und 3
<strong>Curriculum</strong> Seite 85<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.1 Allgemeine verkehrspolizeiliche Einsatzlagen<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Verkehrswissenschaft,<br />
Kriminaltechnik,<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die Grundlagen der polizeilichen Verkehrsunfallprävention und<br />
Verkehrsüberwachung und können diese anwenden<br />
- kennen die polizeilichen Interventionsmöglichkeiten zur Bekämpfung der<br />
Hauptunfall- und Haupttodesursachen im Straßenverkehr<br />
- kennen die bedeutendsten speziellen Unfallphänomene („Manipulierte<br />
Verkehrsunfälle“, „Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle“) und können die<br />
rechtlich und taktisch gebotenen Maßnahmen treffen<br />
- kennen spezielle Möglichkeiten zur Kriminalitätsbekämpfung bei der<br />
Verkehrsüberwachung und der -unfallaufnahme<br />
(Verkehrswissenschaft)<br />
- kennen die bei typischen Unfallverläufen entstehenden Verkehrsunfallspuren,<br />
deren Sicherungsmethoden und forensische Bedeutung<br />
(Kriminaltechnik)<br />
- kennen die besonderen Voraussetzungen der vollzugspolizeilichen Zuständigkeit<br />
zum Schutz privater Rechte und können diese anwenden<br />
(<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht)<br />
Lerninhalte:<br />
Verkehrswissenschaft:<br />
Verkehrsüberwachung und Unfallprävention<br />
- Grundsätze der Verkehrsüberwachung und Unfallprävention<br />
- Ziele der Verkehrsunfallprävention und der Verkehrsüberwachung und<br />
zentrale Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung<br />
- Behördliche und polizeiliche Zuständigkeit und Eingriffsermächtigungen<br />
- Geltungsbereich und Überwachung von Verkehrszeichen<br />
- Erstellen lagebildabhängiger Verkehrsunfallbekämpfungskonzeptionen<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Bekämpfung der Hauptunfallursachen „Geschwindigkeit und<br />
geschwindigkeitsaffine Delikte“ und „Alkohol-, Drogen- und Medikamenten-<br />
Beeinflussung“
<strong>Curriculum</strong> Seite 86<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Deliktbezogene Lagebilder<br />
- Erkennen von Alkohol-, Drogen und Medikamentenbeeinflussung<br />
(insbesondere: Ausfallerscheinungen, Vortests, nichtinstrumentelle Tests,<br />
sonstige Verdachtsindikatoren)<br />
- Verbotsvorschriften<br />
- technische und taktische Überwachungs- und Nachweismöglichkeiten<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung<br />
- Führerscheinrechtliche Maßnahmen<br />
Verkehrsunfallaufnahme<br />
- Spezielle Verkehrsunfallphänomene (manipulierte Verkehrsunfälle und<br />
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)<br />
- Deliktbezogene Lagebilder<br />
- Begehungsformen und Erkennensmerkmale manipulierter Unfälle<br />
- Unfallfluchtermittlungen<br />
- Rechtslage<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Maßnahmen<br />
- Physikalische Grundlagen<br />
Kriminaltechnik:<br />
- Verkehrsunfallaufnahme/Spuren bei Verkehrsunfällen<br />
- Entstehung, Aussagewert und Sicherungsmethoden zu<br />
verkehrsunfalltypischen Spuren, Vermeidbarkeitsbetrachtungen<br />
- Erkenntnisse der Unfallforschung<br />
- Wirkweise von Rückhaltesystemen sowie Steuer- und Regeleinheiten in<br />
modernen Kfz<br />
- Arbeitsmethoden moderner Unfallanalytik und deren Anforderungen an<br />
die polizeiliche Befundsaufnahme<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht:<br />
- Funktion der gesetzlichen Regelung zum Schutz privater Rechte<br />
- Zuständigkeitsabgrenzung<br />
- Einzelfälle<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
156 Stunden (63 Kontakt-/93 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 87<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.2 Banküberfälle, Bedrohungs- und Geisellagen<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Einsatzwissenschaft, Psychologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die grundlegenden Methoden und Regeln der Einsatzplanung,<br />
-organisation und -bewältigung und können diese auf Banküberfälle,<br />
Bedrohungs- und Geisellagen anwenden<br />
- kennen die spezifischen Regelungen der PDV 132 zu Einsatztaktik und<br />
-organisation und können diese anlassbezogen anwenden<br />
- kennen die Möglichkeiten von Spezialeinheiten und besonderen FEM im<br />
Zusammenhang mit Banküberfällen, Bedrohungs- und Geisellagen<br />
(Einsatzwissenschaft)<br />
- kennen alle Aspekte eines traumatischen Erlebnisses und können<br />
Interventionsmöglichkeiten anwenden<br />
(Psychologie)<br />
Lerninhalte:<br />
Einsatzwissenschaft:<br />
- Phänomenologie und Risikofaktoren bei Banküberfällen, Bedrohungs- und<br />
Geisellagen<br />
- Regelungen und Einsatzgrundsätze der PDV 100 und PDV 132 zu<br />
Einsatzleitung, taktischen Maßnahmen und Einsatzgliederung bei<br />
Banküberfällen, Bedrohungs- und Geisellagen<br />
- Spezielle Anforderungen an die Einsatzführung in der 1. Einsatzphase<br />
- Übergang von der 1. zur 2. Einsatzphase, insbesondere bei Geisellagen<br />
- Spezialeinheiten und Spezialkräfte<br />
Psychologie:<br />
- Traumatische Erlebnisse<br />
- Akute Belastungsreaktion und Posttraumatische Belastungsstörung,<br />
Angsterkrankungen<br />
- Psychische Erste Hilfe<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
43 Stunden (18 Kontakt-/25 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 88<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.3 Besondere Gefährdungslagen<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Einsatzwissenschaft,<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht,<br />
Psychologie<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die grundlegenden Methoden und Regeln der Einsatzplanung,<br />
-organisation und -bewältigung und können diese auf besondere<br />
Gefährdungslagen anwenden<br />
- kennen die spezifischen Regelungen und Interventionskonzepte zu<br />
Anschlagsdrohungen und Amoklagen und können diese anlassbezogen<br />
anwenden<br />
- kennen die Möglichkeiten von Spezialeinheiten und Spezialkräften<br />
(Einsatzwissenschaft)<br />
- kennen die Rechtsgrundlagen <strong>für</strong> Entschädigungsansprüche des Bürgers in Folge<br />
polizeilicher Maßnahmen und können die Voraussetzungen beurteilen<br />
(<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht)<br />
- kennen die Psychopathologie <strong>für</strong> Zielgruppen, die <strong>für</strong> Anschläge in Frage<br />
kommen<br />
- erkennen psychische Erkrankungen und Auffälligkeiten<br />
- kennen Regeln der deeskalierenden Kommunikation und der speziellen<br />
Gesprächsführung und können diese anwenden<br />
- analysieren Amoktaten aus kriminalpsychologischer Sicht und kennen die<br />
Grundlagen der Opferbetreuung<br />
(Psychologie)<br />
Lerninhalte:<br />
Einsatzwissenschaft:<br />
- Phänomenologie, Risikofaktoren und Lagebeurteilung bei Anschlagsdrohungen<br />
und Amoklagen<br />
- Regelungen und Einsatzgrundsätze der PDV 100 und landesspezifischer<br />
Regelungen zu Einsatzleitung, Interventionskonzepten, Eigensicherung,<br />
taktischen Maßnahmen und Einsatzgliederung bei Anschlagsdrohungen und<br />
Amoklagen<br />
- Mögliche Einsatzgliederungen in der 1. und 2. Phase bei Anschlagsdrohungen<br />
und Amoklagen und spezielle Anforderungen an die Einsatzführung<br />
- Möglichkeiten von Spezialeinheiten und Spezialkräfte bei Anschlagsdrohungen<br />
und Amoklagen
<strong>Curriculum</strong> Seite 89<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht:<br />
- Entschädigungsansprüche<br />
- Grundlagen der Staatshaftung<br />
Psychologie:<br />
- psychische Erkrankungen<br />
- Klassifikationssysteme<br />
- Epidemiologie<br />
- Erkrankungsbilder<br />
- Erkrankungsbilder im Zusammenhang mit Amok<br />
- Ablauf von Amoktaten<br />
- Motive (Suizid) und Auslöser<br />
- Ursachen, u.a. Schizophrenie, Depressionen<br />
- Betreuung von Opfern<br />
- Therapiemöglichkeiten<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
62 Stunden (25 Kontakt-/37 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.4 Einsatzlagen mit grenzüberschreitenden und<br />
ausländerrechtlichen Bezügen<br />
Lernziele:<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht,<br />
Einsatzwissenschaft,<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die grundlegenden Methoden und Regeln der Einsatzplanung,<br />
-organisation und -bewältigung und können diese auf komplexe Kontroll- und<br />
Durchsuchungsmaßnahmen anwenden<br />
- entwickeln unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Rahmenbedingungen,<br />
insbesondere des Ausländerrechts, zielorientierte Einsatzkonzepte<br />
(Einsatzwissenschaft)<br />
- kennen die Bedeutung des öffentlichen Verkehrsraums als Aufenthalts- und<br />
Bewegungsraum <strong>für</strong> einschlägige Täterkreise<br />
- kennen die Möglichkeiten zielgerichteter Verdachtsgewinnung im Rahmen<br />
ganzheitlicher Verkehrskontrollen und bei der Unfallaufnahme<br />
(Verkehrswissenschaft)
<strong>Curriculum</strong> Seite 90<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- kennen die polizeilichen Aufgaben im Aufenthalts- und Asylrecht<br />
- bestimmen den pass- und aufenthaltsrechtlichen Status eines Ausländers<br />
- kennen die Besonderheiten der jeweiligen Ausländerkategorie und ziehen die<br />
richtigen Konsequenzen daraus<br />
(<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht)<br />
Lerninhalte:<br />
Einsatzwissenschaft:<br />
- Zielorientierte Ausgestaltung von taktischen Maßnahmen bei komplexen<br />
Kontroll- und Durchsuchungsmaßnahmen, insbesondere Kontrolle,<br />
Durchsuchung und Razzia<br />
Verkehrswissenschaft:<br />
- Deliktsspezifische Lagebilder<br />
- polizeiliche Kontrollrechte und zulässige Folgemaßnahmen<br />
- Anwendung aktueller Verdachtsraster bei der Verkehrsüberwachung und<br />
-unfallaufnahme zur zielgerichteten Verdachtsgewinnung<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht:<br />
- Europarechtliche und nationale Rechtsquellen des Aufenthaltsrechts<br />
- Verschiedene Kategorien von Ausländern, insbesondere Drittstaatsangehörige<br />
und Unionsbürger<br />
- Aufgaben der <strong>Polizei</strong> nach dem Aufenthaltsgesetz und dem Asylverfahrensgesetz<br />
- Bestimmung des pass- und aufenthaltsrechtlichen Status eines Ausländers<br />
- Erwerbstätigkeit und Aufenthalt<br />
- Aufgaben der <strong>Polizei</strong> im Asylverfahren<br />
- Mitwirkung der <strong>Polizei</strong> bei der Aufenthaltsbeendigung<br />
- Festnahme und Haft<br />
- Ausländerstrafrecht<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
48 Stunden (19 Kontakt-/29 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 91<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.5 Große Gefahren- und Schadensereignisse<br />
Lernziele:<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Einsatzwissenschaft,<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht,<br />
Psychologie<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die grundlegenden Methoden und Regeln der Einsatzplanung,<br />
-organisation und -bewältigung und können diese auf große Gefahrens- und<br />
Schadensereignissen anwenden<br />
- kennen spezielle Organisationseinheiten und Infrastruktur der <strong>Polizei</strong> sowie die<br />
Strukturen und Möglichkeiten der Behörden und Organisationen mit<br />
Sicherheitsaufgaben (BOS)<br />
(Einsatzwissenschaft)<br />
- kennen die <strong>für</strong> die Geltendmachung von <strong>Polizei</strong>kosten wesentlichen<br />
Bestimmungen und können diese in der Praxis anwenden<br />
- kennen die zentralen Rechtsgrundlagen des Umweltrechts und wenden diese an<br />
- kennen die Aufgaben der <strong>Polizei</strong> im Umweltrecht<br />
- können Ermittlungsverfahren in Umweltstrafsachen führen<br />
(<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht)<br />
- kennen sozialpsychologische Grundlagen zum Verhalten von Gruppen,<br />
Menschenmengen und Massen und können das Verhalten erklären, vorhersagen<br />
und beeinflussen<br />
(Psychologie)<br />
Lerninhalte:<br />
Einsatzwissenschaft:<br />
- Szenarien <strong>für</strong> Große Gefahren- und Schadensereignisse und bedeutsame<br />
Lagefelder<br />
- Wichtige Regelungen und Einsatzgrundsätze der PDV 100<br />
- Eigensicherungsaspekte im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großen<br />
Gefahren- und Schadensereignissen<br />
- Mögliche Einsatzgliederungen in der 1. und 2. Phase sowie deren spezielle<br />
Anforderungen an die Einsatzführung<br />
- Spezielle Organisationseinheiten und Infrastruktur der <strong>Polizei</strong> und BOS zur<br />
Bewältigung von Großen Gefahren- und Schadensereignissen<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht:<br />
- Rechtliche Grundlagen <strong>für</strong> die Erhebung von <strong>Polizei</strong>kosten<br />
- Rechtsquellen des Umweltrechts<br />
- Zuständigkeiten und Zuständigkeitsabgrenzung im Umweltrecht
<strong>Curriculum</strong> Seite 92<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Grundbegriffe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Wasser- und<br />
Immissionsschutzrechts<br />
- Genehmigungsverfahren und Verantwortlichkeiten<br />
- zentrale Regelungen des Umweltstrafrechts, insbesondere des StGB<br />
- Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechts und Auswirkungen fehlerhaften<br />
Verwaltungshandelns<br />
- Umweltstrafrechtliche Verantwortlichkeit von Amtsträgern<br />
Psychologie:<br />
- Neugier und Schaulust<br />
- Panik<br />
- Psychologie der Hilfeleistung, Prosoziales Verhalten, Altruismusforschung<br />
- Interventionsmöglichkeiten<br />
- Sozialpsychologische Aspekte von Schadensereignissen<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
56 Stunden (24 Kontakt-/32 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
6.6 Veranstaltungen, Versammlungen,<br />
Ansammlungen<br />
Lernziele:<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht,<br />
Einsatzwissenschaft,<br />
Verkehrswissenschaft<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die grundlegenden Methoden und Regeln der Einsatzplanung,<br />
-organisation und -bewältigung und können diese auf Veranstaltungen,<br />
Versammlungen und Ansammlungen anwenden<br />
- kennen die besonderen Einflüsse des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit und<br />
der darauf basierenden einfachgesetzlichen Regelungen <strong>für</strong> polizeiliche<br />
Einsatztaktik und können diese im Rahmen polizeilicher Einsatzkonzepte<br />
anwenden<br />
(Einsatzwissenschaft)<br />
- kennen polizeiliche Zuständigkeiten, Befugnisse und Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
bei Verkehrslenkungsmaßnahmen und können diese anwenden<br />
- können bei Veranstaltungen/Versammlungen/Ansammlungen erforderliche<br />
Verkehrsmaßnahmen planen und durchführen<br />
(Verkehrswissenschaft)
<strong>Curriculum</strong> Seite 93<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- kennen die wichtigsten versammlungsrechtlichen Regelungen und können<br />
versammlungsrechtliche Lagen unter Beachtung der gesetzlichen und<br />
verfassungsrechtlichen Vorgaben bewältigen<br />
- kennen die Rechtsgrundlagen der polizeilichen Datenverarbeitung und können<br />
diese anwenden<br />
- kennen die wesentlichen gewerberechtlichen Bestimmungen und können diese in<br />
der polizeilichen Praxis anwenden<br />
(<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht)<br />
- kennen sozialpsychologische Grundlagen zum Verhalten von Gruppen,<br />
Menschenmengen und Massen und können das Verhalten erklären, vorhersagen<br />
und beeinflussen<br />
(Psychologie)<br />
Lerninhalte:<br />
Einsatzwissenschaft:<br />
- Verschiedene Fallgestaltungen von Ansammlungen, Veranstaltungen und<br />
Versammlungen und bedeutsame Lagefelder<br />
- Rolle der <strong>Polizei</strong> bei Veranstaltungen und Versammlungen sowie das<br />
Eingriffsinstrumentarium im Lichte des Versammlungs- und <strong>Polizei</strong>rechts<br />
- Regelungen, Einsatzgrundsätze und Unterscheidungskriterien der PDV 100 <strong>für</strong><br />
Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen<br />
- Mögliche Einsatzgliederungen bei Veranstaltungen und Versammlungen<br />
- Spezialkräfte, Konzepte und spezielle Infrastruktur im Zusammenhang mit der<br />
Bewältigung von Veranstaltungen und Versammlungen, insbesondere <strong>für</strong><br />
beweissichere Fest- und Ingewahrsamnahmen<br />
Verkehrswissenschaft:<br />
- Anlässe und Ziele der Verkehrslenkung<br />
- Normative Grundlagen – Zuständigkeiten und Eingriffsermächtigungen<br />
- Phasen und Prinzip der Verkehrslenkung<br />
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrslenkungsplänen<br />
- Verkehrslenkung in ausgewählten polizeilichen Einsatzlagen<br />
<strong>Polizei</strong>recht/Verwaltungsrecht:<br />
- Grundrecht der Versammlungsfreiheit<br />
- Versammlungsbegriff<br />
- Arten von Versammlungen<br />
- Vorbereitung einer Versammlung aus Sicht des Veranstalters, der<br />
Versammlungsbehörde und der <strong>Polizei</strong>, insbesondere präventive Maßnahmen<br />
- Durchführung der Versammlung, insbesondere Rechte und Pflichten des Leiters,<br />
Störungsverbot/Störerausschluss, Eingangskontrolle/Zutrittsverbot,<br />
Waffenverbot, Schutzwaffenverbot, Vermummungsverbot<br />
- Besondere polizeiliche Maßnahmen bei Versammlungen
<strong>Curriculum</strong> Seite 94<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Datenerhebung<br />
- Auflösung einer Versammlung<br />
- <strong>Polizei</strong>lich Durchsetzung einer Auflösung<br />
- Strafbestimmungen<br />
Psychologie:<br />
- Sozialpsychologische Massenphänomene<br />
- Gruppenprozesse, Menge und Masse<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
115 Stunden (47 Kontakt-/68 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 95<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
7<br />
Modultitel:<br />
Personalführung in ausgewählten<br />
Situationen<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät IV - Psychologie<br />
Fakultät I – Führungswissenschaft<br />
Fakultät III – Recht des öffentlichen Dienstes<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Christoph Eckstein,<br />
Fakultät III<br />
- eignen sich psychologische Kenntnisse der Personalführung auch in schwierigen<br />
Situationen an und lernen diese anzuwenden<br />
- erwerben führungswissenschaftliche Kenntnisse polizeilicher Führung und<br />
Zusammenarbeit und lernen diese anzuwenden<br />
- erlangen die erforderlichen rechtlichen Kenntnisse und lernen diese sachgerecht<br />
anzuwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Die dienstliche Beurteilung aus Sicht des Beurteilers und des Beurteilten<br />
- Probleme und Lösungsansätze bei Dienst(un)fähigkeit/Krankheit<br />
- Konfliktbewältigung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten<br />
- Fehlverhalten und Folgen von Fehlverhalten und mögliche<br />
Handlungsalternativen<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
8<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
240 Stunden<br />
(73 Kontakt-/167 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 und 4<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 96<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
7.1 Die dienstliche Beurteilung aus Sicht<br />
des Beurteilers und des Beurteilten<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Psychologie, Führungswissenschaft,<br />
Recht des öffentlichen Dienstes<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Vorschriften und Führungsinstrumente zur dienstlichen Beurteilung und<br />
können diese anwenden, um kooperatives Führen zu verstehen und zu<br />
praktizieren<br />
- kennen Prinzipien der Personenwahrnehmung und können häufige Fehler<br />
vermeiden, kennen Prinzipien der Personalselektion und der<br />
Personalauswahldiagnostik<br />
- kennen die rechtlichen Voraussetzungen, Inhalte und Bedeutung der dienstlichen<br />
Beurteilung und lernen diese in der Praxis anzuwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Personenwahrnehmung, Einfluss- und Verfälschungsfaktoren, Urteilsfehler,<br />
systematische/strukturierte Beobachtungen, Psychologische Tests<br />
- Systematisches Feedback, Mitarbeitergespräch, Personalbeurteilung, Situatives<br />
Führen<br />
- Anforderungen und rechtliche Voraussetzungen einer dienstlichen Beurteilung,<br />
die Inhalte der Beurteilungsverordnung (VwV-Beurteilung Pol),<br />
Beurteilungsgespräch, Inhalte einer dienstlichen Beurteilung, Bedeutung <strong>für</strong><br />
Personalentscheidungen, Rechtsschutzmöglichkeiten<br />
Studentischer Arbeitsaufwand (Kontaktstudium/Selbststudium):<br />
60 Stunden (18 Kontakt-/42 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 97<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
7.2 Dienst(un)fähigkeit/Krankheit<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Psychologie, Führungswissenschaft,<br />
Recht des öffentlichen Dienstes<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- erkennen Anforderungen an polizeiliche Dienstfähigkeit und kennen Handlungsalternativen,<br />
um repressiv und präventiv auf ausgesuchte Problembereiche von<br />
Krankheitsursachen reagieren zu können<br />
- kennen die wichtigsten psychischen Erkrankungen, deren Vorkommen und<br />
Merkmale, kennen Interventionsstrategien und beherrschen kommunikative<br />
Strategien und Techniken im Umgang mit betroffenen Mitarbeitern.<br />
- kennen die Organisation der Konfliktberatung, das Konzept der Suizidprävention<br />
und das Netzwerk der Psychosozialen Beratungskräfte innerhalb der <strong>Polizei</strong><br />
- kennen die Voraussetzungen der Dienst(un)fähigkeit beim Beamten auf<br />
Lebenszeit, Probe und Widerruf und können rechtlich und tatsächlich geeignete<br />
Handlungsmöglichkeiten <strong>für</strong> Vorgesetze aufzeigen<br />
Lerninhalte:<br />
- Sucht und Abhängigkeit von Substanzen<br />
- Psychische Erkrankungen, Epidemiologie, Klassifikationssysteme,<br />
Angststörungen, Depression und Suizid, Psychosen, Suchterkrankungen<br />
- Die verschiedenen Formen der <strong>Polizei</strong>dienstfähigkeit beim Beamten auf<br />
Lebenszeit, Probe und Widerruf<br />
- Organisation der Konfliktberatung, Netzwerk der psychosozialen Beratungskräfte<br />
in der <strong>Polizei</strong>, Suizidprävention<br />
- Die Zusammenarbeit mit dem <strong>Polizei</strong>arzt, Probleme von Alkohol und Drogen im<br />
Dienst und mögliche Lösungsansätze<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (18 Kontakt-/42 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 98<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
7.3 Konfliktbewältigung zwischen Mitarbeitern<br />
und Vorgesetzen<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Psychologie, Führungswissenschaft,<br />
Recht des öffentlichen Dienstes<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- können wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bewältigung von ausgesuchten<br />
Problemen bei der Führung und Zusammenarbeit anwenden, und auf dieser<br />
Grundlage ihre eigene Handlungskompetenzen stetig erweitern<br />
- können Konflikte konstruktiv bearbeiten und Prinzipien der Beratung anwenden<br />
- erkennen Konflikte zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, können<br />
Lösungsmöglichkeiten entwickeln und die rechtlichen Instrumentarien anwenden<br />
Lerninhalte:<br />
- Präventionsansätze, Verhinderung von und Reaktionen auf Mobbing am<br />
Arbeitsplatz<br />
- Stress und Stressmanagement in und nach besonderen dienstlichen<br />
Belastungssituationen wie Schusswaffengebrauch, Mitarbeiterbetreuung nach<br />
traumatischen Erlebnissen, Beratung<br />
- Verhalten von Vorgesetzten und Mitarbeitern in denkbaren Konflikt- und<br />
Ausnahmesituationen, Lösungsmöglichkeiten und rechtliches Instrumentarium<br />
Studentischer Arbeitsaufwand (Kontaktstudium/Selbststudium):<br />
60 Stunden (18 Kontakt-/42 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
7.4 Fehlverhalten und Folgen des Fehlverhaltens<br />
Lernziele:<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Führungswissenschaft, Recht des<br />
öffentlichen Dienstes, Psychologie<br />
Die Studierenden<br />
- lernen Führungsinstrumente kennen und anwenden, um kooperatives Führen in<br />
Konfliktlagen polizeilicher Zusammenarbeit zu verstehen und zu praktizieren<br />
- können bei Fehlverhalten und damit verbundenen Stresssituationen angemessen<br />
und konstruktiv reagieren; beherrschen kommunikative Strategien und können<br />
diese anwenden und kennen Beratungskonzepte<br />
- kennen die Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten und können bei Pflichtverstößen die<br />
angemessenen und rechtlich möglichen Reaktionsmöglichkeiten aufzeigen
<strong>Curriculum</strong> Seite 99<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Fehlverhalten von <strong>Polizei</strong>beamten, phänomenologische Erkenntnisse,<br />
Repressions- und Präventivansätze, Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Indikatoren von Fehlverhalten, Kritikgespräch, Stressbewältigung, Mediation in<br />
destruktiven Organisationen (z.B. Psychopathie, Korruption)<br />
- Rechte und Pflichten des <strong>Polizei</strong>beamten, Personalgespräch, Einleitung und<br />
Durchführung eines Disziplinarverfahrens, andere Reaktionsmöglichkeiten<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
60 Stunden (19 Kontakt-/41 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 100<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Moduls:<br />
8<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät IV – Politikwissenschaft<br />
Fakultät II – Kriminaltaktik<br />
Fakultät III – Europarecht<br />
Modultitel:<br />
Bekämpfung von Terrorismus<br />
und Extremismus/<strong>Polizei</strong>arbeit<br />
im internationalen Kontext<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6. Semester<br />
Qualifikationsziel:<br />
Die Studierenden<br />
Modulkoordinator:<br />
Dr. Hans-Peter Welte,<br />
Fakultät IV<br />
- erkennen den Zusammenhang von sicherheitsrelevanten gesellschaftlichen und<br />
politischen Entwicklungen einerseits und polizeilichem Handeln andererseits<br />
sowie den internationalen Bezugsrahmen moderner <strong>Polizei</strong>arbeit<br />
Lerninhalte:<br />
Es werden exemplarisch Politikfelder behandelt, die einen direkten Sicherheits- und<br />
<strong>Polizei</strong>bezug aufweisen: Islamistischer Terrorismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus,<br />
<strong>Polizei</strong> in Europa als Baustein einer gesamteuropäischen<br />
Sicherheitsarchitektur<br />
Die Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen ist variabel und wird nach<br />
Aktualitätsgesichtspunkten vorgenommen<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
5<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
150 Stunden<br />
(58 Kontakt-/92 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module 1 und 2<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 101<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
8.1 <strong>Polizei</strong> in Europa<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Politikwissenschaft, Kriminaltaktik,<br />
Europarecht<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen die politischen und rechtlichen Grundlagen sowie die polizeipraktischen<br />
Folgen einer fortschreitenden Europäisierung auf dem Gebiet der Inneren<br />
Sicherheit<br />
Lerninhalte:<br />
- Der europäische Einigungsprozess von den Römischen Verträgen bis heute<br />
- Das politische System der Europäischen Union: Institutionen, Willensbildungsund<br />
Entscheidungsprozess<br />
- Aktuelle europapolitische Themen<br />
- Die Europäische Union als sicherheits- und polizeigeographischer Raum<br />
- Institutionen und Handlungsinstrumente der Europäischen Union im Bereich<br />
Innere Sicherheit<br />
- Das Schengener Abkommen und das Europarecht<br />
- Abgrenzung zum Völkerrecht<br />
- Ziele, Aufgaben und perspektivische Entwicklung des Europäischen <strong>Polizei</strong>amtes<br />
(EUROPOL)<br />
- Europäische Kooperationsmodelle von <strong>Polizei</strong> und Justiz<br />
- Grenzüberschreitender polizeilicher Informationsaustausch<br />
- Internationale Fahndung und Fahndung im Schengen-Raum<br />
- Praktische Umsetzung bi- und multilateraler <strong>Polizei</strong>verträge<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
48 Stunden (18 Kontakt-/30 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
8.2 Linksextremismus<br />
Verantwortl. Fachgruppe:<br />
Politikwissenschaft<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Merkmale, Strukturen und Hintergründe des Linksextremismus und<br />
erkennen die daraus sich ergebende Herausforderung <strong>für</strong> Gesellschaft, Politik und<br />
<strong>Polizei</strong>
<strong>Curriculum</strong> Seite 102<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Lerninhalte:<br />
- Elemente der linksextremen Ideologie<br />
- Parteien, Organisationen, Gruppen<br />
- Aktionsfelder und Aktivitäten<br />
- Gewaltbereiter Linksextremismus<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
11 Stunden (5 Kontakt-/6 Selbststudium)<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
8.3 Rechtsextremismus<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Politikwissenschaft, Kriminaltaktik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Merkmale, Strukturen und Hintergründe des Rechtsextremismus und<br />
erkennen die daraus sich ergebende Herausforderung <strong>für</strong> Gesellschaft, Politik und<br />
<strong>Polizei</strong><br />
Lerninhalte:<br />
- Der Extremismus-Begriff<br />
- Elemente der rechtsextremen Ideologie<br />
- Parteien, Organisationen, Gruppen<br />
- Aktionsfelder und Aktivitäten<br />
- Gewaltbereiter Rechtsextremismus<br />
- Rechtsextremismus als soziale Bewegung<br />
- Erklärungsansätze <strong>für</strong> rechtsextreme Einstellungen und Verhaltensweisen<br />
- Das Konzept der „streitbaren Demokratie“<br />
- Täter- und Tattypologien<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Bekämpfungsstrategie: Erkenntnisgewinnung,<br />
Informationsverarbeitung, Fahndung und Prävention<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
43 Stunden (17 Kontakt-/26 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 103<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Titel der Lehrveranstaltung:<br />
8.4 Islamistischer Terrorismus<br />
Verantwortl. Fachgruppen:<br />
Politikwissenschaft, Kriminaltaktik<br />
Lernziele:<br />
Die Studierenden<br />
- kennen Merkmale, Strukturen und Hintergründe des islamistischen Terrorismus<br />
und erkennen die daraus sich ergebende besondere Herausforderung <strong>für</strong><br />
Gesellschaft, Politik und <strong>Polizei</strong><br />
Lerninhalte:<br />
- Der Begriff des Terrorismus<br />
- Islam – Islamismus – Dschihadismus<br />
- Die Ideologie des Dschihadismus<br />
- Das internationale Terrornetzwerk Al-Qaida<br />
- Charakteristika des neuen transnationalen Terrorismus<br />
- „Alter“ und „neuer“ Terrorismus in vergleichender Perspektive<br />
- Die islamistische Szene in Deutschland<br />
- Die aktuelle Gefährdungslage in Deutschland und Baden-Württemberg<br />
- Täter- und Tattypologien<br />
- <strong>Polizei</strong>liche Bekämpfungsstrategie: Erkenntnisgewinnung,<br />
Informationsverarbeitung, Fahndung und Prävention<br />
- Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden<br />
- Ansätze zur politisch-strukturellen Bekämpfung des Terrorismus<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
48 Stunden (18 Kontakt-/30 Selbststudium)
<strong>Curriculum</strong> Seite 104<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Begleitfachs:<br />
2<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät I – Einsatztraining/Sport<br />
Titel:<br />
Einsatztraining/Sport Teil 2<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6 Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
Die Studierenden<br />
Koordinator:<br />
Armin Berberich,<br />
Fakultät I<br />
- kennen die Bedeutung des Einsatztrainings <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst<br />
- kennen und beherrschen die wesentlichen Inhalte des Einsatztrainings<br />
- besitzen persönliche Handlungskompetenz <strong>für</strong> kritische und gewalttätige<br />
Einsatzsituationen des polizeilichen Alltags<br />
- sind befähigt, polizeiliche Einsatzlagen unter Eigensicherungsaspekten sicher,<br />
professionell und lageangepasst zu lösen<br />
- können Mitarbeiter <strong>für</strong> ein regelmäßiges Einsatztraining motivieren<br />
(Einsatztraining)<br />
- sind sich der Bedeutung des Sports <strong>für</strong> körperliche Entwicklung und<br />
persönliches Wohlbefinden und als Qualitätsmerkmal <strong>für</strong> den <strong>Polizei</strong>dienst<br />
bewusst<br />
- kennen die Grundlagen des Gesundheits- und Präventionssports und können<br />
diesen eigenverantwortlich ausführen<br />
- können sich eigenverantwortlich durch systematische sportliche Betätigung<br />
körperlich leistungsfähig halten sowie die konditionellen Fähigkeiten erhalten<br />
und verbessern<br />
- kennen gesunde Ernährung und können diese umsetzen<br />
- kennen die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit vor dem Hintergrund<br />
gesundheitlicher Risiken<br />
- können Mitarbeiter <strong>für</strong> den Dienstsport motivieren<br />
(Sport)<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
3<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
90 Stunden (48 Kontakt-/42 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Einsatztraining/Sport 1<br />
Art des Leistungsnachweises:
<strong>Curriculum</strong> Seite 105<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Praktischer Test
<strong>Curriculum</strong> Seite 106<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) - <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Begleitfachs:<br />
3<br />
Beteiligte Fachgebiete:<br />
Fakultät IV – Sprachen<br />
Titel:<br />
<strong>Polizei</strong>liches Fachenglisch/-<br />
französisch<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6.Semester<br />
Qualifikationsziele<br />
Die Studierenden<br />
Koordinator:<br />
Jacques Moreau<br />
Fakultät IV<br />
- können Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen<br />
von polizeilicher Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person,<br />
Zeugenaussagen)<br />
- können sich in einfachen, routinemäßigen Situationen aus dem <strong>Polizei</strong>alltag<br />
verständigen, in denen es um einen direkten Austausch von Informationen geht<br />
- sind in der Lage, kurze einfache Gespräche in gängigen Situationen zu führen,<br />
wenn es um vertraute Themen und Tätigkeiten der polizeilichen Arbeitswelt<br />
geht<br />
- können kurze klare Texte von polizeilicher Bedeutung lesen und daraus<br />
konkrete Informationen entnehmen<br />
- können in einfachen Sätze Mitteilungen und kurze Notizen verfassen<br />
- kennen die Geschichte, Organisation und Aufgaben der City of London Police<br />
und Metropolitan Police/London<br />
(Englisch)<br />
- kennen die Organisation, die Zuständigkeiten sowie die Aufgaben der<br />
französischen <strong>Polizei</strong><br />
(Französisch)<br />
Lerninhalte:<br />
- Begrüßung, Vorstellung, Wohnort, Beruf angeben und erfragen<br />
- Hilfe anbieten, nach dem Befinden fragen, Auskünfte erteilen, Wege<br />
beschreiben<br />
- Ratschläge geben (Wegbeschreibung, Verkehr, Parkmöglichkeiten, öffentliche<br />
Verkehrsmittel)<br />
- Feststellung der Identität einer Person<br />
- Personenbeschreibung (Kleidungsstücke, Körperteile, besondere Merkmale),<br />
Phantombild
<strong>Curriculum</strong> Seite 107<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
- Verkehr (Unfallaufnahme, Unfall mit Verletzten, Panne)<br />
- Verkehrskontrolle eines Pkw (Sicherheit, Mängel)<br />
- Alkoholkontrolle/Rauschgiftkontrolle<br />
- Verwarnungen aussprechen<br />
- Diebstahl (Diebstahlarten, Vernehmung einer verdächtigten Person,<br />
Zeugenbefragung)<br />
- Raub (Vernehmung einer verdächtigten Person, Zeugenbefragung)<br />
- Verbrechen<br />
- Mord/Totschlag/Stalking/Häusliche Gewalt//Kindesmissbrauch<br />
- Drogenhandel<br />
(Englisch)<br />
- Verkehrskontrolle eines Lkw (Fahrzeiten, Ruhezeiten, Ladung, Papiere)<br />
- Organisation und Befugnisse der französischen <strong>Polizei</strong>kräfte<br />
(Französisch)<br />
- Wesentliche Strukturen der englischen/französischen Sprache (Grammatik,<br />
Aussprache, Fachwortschatz)<br />
- Hauptzeiten/ Fragestellung und Verneinung/Modale Hilfsverben)<br />
(Englisch)<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
4<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
120 Stunden<br />
(47 Kontakt-/73 Selbststudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Module HP 1-3<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Klausur
<strong>Curriculum</strong> Seite 108<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor – Arbeit<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5.und 6. Semester<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
5<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
150 Stunden<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
Bachelor-Arbeit und deren mündliche Verteidigung
<strong>Curriculum</strong> Seite 109<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Bachelor of Arts (B.A.) – <strong>Polizei</strong>vollzugsdienst/Police Service<br />
Nr. des Wahlmoduls:<br />
(Fortlaufende Nr.)<br />
Titel:<br />
N.N.<br />
Beteiligte Fachgebiete: N.N.<br />
Studienabschnitt/Semester:<br />
Fachtheoretisches Hauptstudium/5. und 6. Semester<br />
Qualifikationsziele:<br />
(Vom jeweiligen Anbieter zu beschreiben)<br />
Koordinator:<br />
N.N.<br />
Lerninhalte:<br />
(Vom jeweiligen Anbieter zu beschreiben)<br />
Anzahl der Leistungspunkte (ECTS):<br />
5<br />
Studentischer Arbeitsaufwand:<br />
150 Stunden<br />
(mind. 38 Stunden Kontaktstudium)<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> die Teilnahme:<br />
Anmeldung + Verfügbarkeit des Angebots (ggf. Losentscheid);<br />
Module HP 1-3<br />
Art des Leistungsnachweises:<br />
(Vom Anbieter anzugeben - alle hochschuladäquaten Prüfungsformen möglich)