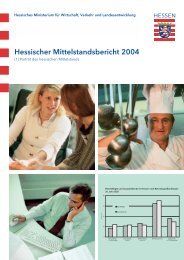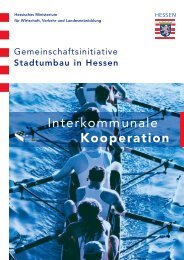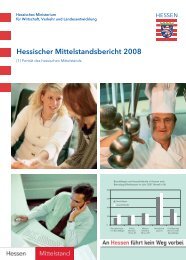PDF - HA Hessen Agentur GmbH
PDF - HA Hessen Agentur GmbH
PDF - HA Hessen Agentur GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale in <strong>Hessen</strong><br />
Eine exemplarische Untersuchung ausgewählter Technologiefelder<br />
Dr. Johannes Harsche<br />
unter Mitarbeit von:<br />
Dr. Gerrit Stratmann,<br />
Jürgen Herdt, Olaf Jüptner,<br />
Dr. Carsten Ott, Mirko Sander,<br />
Johannes Scholten, Alfred Stein<br />
Report Nr. 725<br />
Wiesbaden 2007
Eine Veröffentlichung der<br />
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Postfach 1811<br />
D-65008 Wiesbaden<br />
Abraham-Lincoln-Straße 38-42<br />
D-65189 Wiesbaden<br />
Telefon 0611 / 774-81<br />
Telefax 0611 / 774-8313<br />
E-Mail info@hessen-agentur.de<br />
Internet http://www.hessen-agentur.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Martin H. Herkströter<br />
Dr. Dieter Kreuziger<br />
Vorsitzender des Aufsichtsrates:<br />
Dr. Alois Rhiel,<br />
Hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe<br />
gestattet. Belegexemplar erbeten.
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale in <strong>Hessen</strong><br />
Inhalt<br />
Seite<br />
Kurzfassung 1<br />
1 Ausgangslage und Ziele der Untersuchung 13<br />
2 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes und methodische<br />
Vorgehensweise 15<br />
3 Personal und Studenten an den hessischen Hochschulen im Bereich<br />
ausgewählter Querschnittstechnologien 21<br />
3.1 Wissenschaftliches Personal 21<br />
3.2 An den hessischen Hochschulen eingeschriebene Studenten 22<br />
4 Merkmale der Forschungsaktivitäten im Bereich ausgewählter<br />
Querschnittstechnologien 25<br />
4.1 Einwerbung von Drittmitteln 25<br />
4.2 Publikationen und Innovationen 28<br />
4.3 Dissertationen und Habilitationen 30<br />
5 Facetten der hessischen Forschungslandschaft 35<br />
5.1 Energietechnologien 35<br />
5.1.1 Konventionelle Energietechnologien / Kraftwerkstechnik 35<br />
5.1.2 Brennstoffzellentechnik 40<br />
5.1.3 Thermische Verfahrenstechnik 46<br />
5.1.4 Regenerative Energietechnologien / Windenergie, Photovoltaik,<br />
Bioenergie, Wasserkraft und Meeresenergie 50<br />
5.1.5 Regenerative Energietechnologien / Solarthermie 56<br />
5.2 Umwelttechnologien 62<br />
5.2.1 Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement 62<br />
5.2.2 Abwassertechnik / Wasserwirtschaft 68<br />
5.3 Medizintechnik 74<br />
5.4 Life Sciences 80<br />
5.4.1 Bionik 80<br />
5.4.2 Rote Biotechnologie: Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik 86<br />
5.4.3 Rote Biotechnologie: Pharmazeutische Biologie 92<br />
5.4.4 Grüne Biotechnologie: Landnutzung / Ressourcenmanagement 98<br />
5.4.5 Weiße Biotechnologie / Biokatalyse und Biofermentation 102<br />
I
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.6 Ernährung des Menschen - Schwerpunkt Ernährungsphysiologische<br />
Bewertung von Lebensmitteln 108<br />
5.5 Produktionstechnologien 112<br />
5.5.1 Lebensmitteltechnologie 112<br />
5.5.2 Mechatronik / Regelungstechnik 118<br />
5.5.3 Umformtechnik 122<br />
5.5.4 Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung 128<br />
5.5.5 Adaptronik 132<br />
5.5.6 Produktentwicklung / Konstruktionsforschung 138<br />
5.6 Materialwissenschaften 142<br />
5.6.1 Materialwissenschaften / Oberflächenforschung 142<br />
5.6.2 Materialwissenschaften / Strukturforschung 146<br />
5.7 Informations- und Kommunikationstechnologien 150<br />
5.7.1 Multimedia Kommunikation 150<br />
5.7.2 E-Finance 156<br />
5.7.3 Graphische Datenverarbeitung 162<br />
5.7.4 Wireless Communications 166<br />
5.7.5 Sicherheitstechnologien 170<br />
Abbildungsverzeichnis 174<br />
Tabellenverzeichnis 176<br />
Übersichtsverzeichnis 177<br />
Literaturverzeichnis 179<br />
Anhang 179<br />
II
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Kurzfassung<br />
Forschung, Fachgebiete, Kompetenzen<br />
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, die im Auftrag des Hessischen Ministeriums<br />
für Wissenschaft und Kunst erstellt worden ist, sollen dazu dienen, für<br />
bedeutende Technologiefelder Ansatzpunkte für die Entwicklung zukunftsträchtiger<br />
Cluster zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der hessischen Forschungslandschaft<br />
zu identifizieren. Daher bestand ein wesentliches Untersuchungsziel darin,<br />
die Hochschullandschaft in <strong>Hessen</strong> im Hinblick auf wissenschaftliche Agglomerationen<br />
und besonders markante Potenziale zu analysieren. Zudem wurde das Ziel verfolgt,<br />
Kooperationen und Querbezüge zwischen wissenschaftlichen Institutionen<br />
bzw. Wissenschaftsdisziplinen aufzuzeigen.<br />
Im Fokus der Untersuchung standen insgesamt 27 Fachgebiete aus sieben Wissenschaftsfeldern<br />
(Energietechnologien, Umwelttechnologien, Medizintechnik, Life<br />
Sciences, Produktionstechnologien, Materialwissenschaften sowie Informationsund<br />
Kommunikationstechnologien), die in Absprache mit dem Auftraggeber und<br />
dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ausgewählt<br />
und exemplarisch untersucht wurden. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere<br />
Technologie- und Wissenschaftsfelder,<br />
- denen sowohl im Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms der EU<br />
als auch in der Hightech-Strategie des Bundes eine besondere Bedeutung als<br />
Querschnittstechnologie beigemessen worden ist 1 ,<br />
- und die zugleich bislang nicht im Fokus umfassender Unterstützungsmaßnahmen<br />
zur Cluster- und Netzwerkbildung seitens des Landes oder des Bundes<br />
standen (Beispiele für solche Initiativen sind das NanoNetzwerk <strong>Hessen</strong> im Wissenschaftsfeld<br />
Nanotechnologie oder Optence e.V. im Wissenschaftsfeld Optische<br />
Technologien).<br />
Die gewählte Vorgehensweise hat den Vorteil, Potenziale gerade auch in jenen Bereichen<br />
aufzuzeigen, die bislang nicht im Zentrum technologiepolitischer Maßnahmen<br />
des Landes standen. Dabei blieben für die hessische Wirtschaft bedeutende<br />
wissenschaftliche Innovationsfelder wie die Optischen Technologien, die Nanotechnologien<br />
und die Mikrosystemtechnologien mit ihren ausgereiften Vernetzungsstrukturen<br />
außerhalb des Rahmens dieser Untersuchung.<br />
Das breite Spektrum der untersuchten Forschungsaktivitäten bildet die Basis für vertiefende<br />
Analysen der Hochschullandschaft. Um die Technologiepotenziale in Hes-<br />
1 Der Auswahl zugrunde liegen sowohl das Siebte Forschungsrahmenprogramm der EU als auch die sich u.a. an diesem<br />
Programm orientierende High-Tech-Strategie des Bundes. Das Siebte Forschungsrahmenprogramm der EU bezieht sich<br />
auf zehn Technologiefelder: 1) Gesundheit; 2) Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei sowie Biotechnologie;<br />
3) Informations- und Kommunikationstechnologien; 4) Nanowissenschaften, Nanotechnologie, Werkstoffe und neue Produktuionstechnologien;<br />
5) Energie; 6) Umwelt (einschließlich Klimaänderung); 7) Verkehr (einschließlich Luftfahrt);<br />
8) Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften; 9) Weltraum; 10) Sicherheit.<br />
1
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
sen aufzuzeigen, wurden Expertengespräche mit ausgewählten Wissenschaftlern<br />
aus den betreffenden Fachgebieten geführt. Für jedes der Fachgebiete wurde ein<br />
Porträt erstellt, in dem sowohl wissenschaftliche Aktivitäten und Kooperationen als<br />
auch fachliche Trends Berücksichtigung fanden. Aus den Untersuchungsergebnissen<br />
lässt sich grundsätzlich folgern, dass die ausgewählten Forschungseinrichtungen<br />
ein sehr breites Spektrum an Fachkompetenzen aufweisen und bereits eng mit<br />
anderen Fachinstitutionen vernetzt sind. Dies gilt – innerhalb des Bundesgebiets wie<br />
auch international – für Partner sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Wirtschaft.<br />
Gleichwohl ergeben sich Ansatzpunkte zur Vertiefung und Verstetigung der<br />
betreffenden Kooperationen.<br />
Die untersuchten wissenschaftlichen Einrichtungen weisen allesamt eine sehr rege<br />
und vielfältige Forschungstätigkeit auf, wobei i.d.R. sowohl Grundlagenforschung<br />
als auch Angewandte Forschung betrieben wird. Die hohe wissenschaftliche<br />
Kompetenz geht mit einer umfangreichen Einwerbung von Drittmitteln einher. In<br />
Hinsicht auf die gesamten Drittmitteleinnahmen werden beachtliche Differenzen<br />
zwischen den hessischen Universitäten deutlich. Im Zeitraum 2001 bis 2003 konnte<br />
die Universität Frankfurt Drittmittel im Gesamtumfang von 185 Mio. Euro akquirieren.<br />
Die TU Darmstadt kam auf 166 Mio. Euro, die Universität Gießen auf 120 Mio.<br />
Euro und die Universität Marburg auf 104 Mio. Euro. An der Universität Kassel<br />
schließlich belief sich das Gesamtvolumen der Drittmittel auf 60 Mio. Euro.<br />
Was das aggregierte Drittmittelvolumen aus der DFG-Förderung anbelangt, so<br />
wurden im Zeitraum 2002 bis 2004 der Universität Frankfurt von der DFG Drittmittel<br />
in einem Gesamtumfang von 67 Mio. Euro bewilligt. Bezüglich des Drittmittelvolumens<br />
lag sie somit innerhalb des Bundesgebiets unter 84 berücksichtigten Hochschulen<br />
auf Rang 20. Der Vergleichswert für die TU Darmstadt beläuft sich auf<br />
54 Mio. Euro, was innerhalb der Auflistung Rang 25 impliziert. Die Universität Gießen<br />
und die Universität Marburg liegen mit jeweils gut 50 Mio. Euro (Rang 26 bzw.<br />
27) sehr nahe beieinander. Von der Universität Kassel wurde ein Betrag von<br />
11 Mio. Euro eingeworben. Je Professor weist die TU Darmstadt mit 200.000 Euro<br />
das höchste DFG-Drittmittelvolumen auf, gefolgt von der Universität Frankfurt mit<br />
141.000 Euro. Die Universität Gießen und die Universität Marburg liegen mit<br />
138.000 Euro wiederum in etwa gleichauf. Für die Universität Kassel ergibt sich ein<br />
Vergleichswert von 38.000 Euro, der nicht zuletzt in der tradierten Struktur dieser<br />
Hochschule begründet liegt.<br />
Ein Großteil der Drittmittel wird im Rahmen von wissenschaftlichen Kooperationen<br />
wie Graduiertenkollegs, Forschergruppen und Sonderforschungsbereichen eingeworben.<br />
Von herausragender Bedeutung sind auch interdisziplinäre Forschungszentren.<br />
Ausgewählte Beispiele an der TU Darmstadt sind die DFG-Sonderforschungsbereiche<br />
568 „Strömung und Verbrennung in zukünftigen Gasturbinenbrennkammern“<br />
und 666 „Integrale Blechbauweisen höherer Verzwei-<br />
2
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
gungsordnung - Entwicklung, Fertigung, Bewertung“. Nachwuchswissenschaftlern<br />
werden über Graduiertenprogramme vielfältige Forschungsperspektiven eröffnet,<br />
so etwa an den DFG Graduiertenkollegs 853 „Modellierung, Simulation und<br />
Optimierung von Ingenieuranwendungen“ und 1344 „Instationäre Systemmodellierung<br />
von Flugtriebwerken“, an dem auch Rolls Royce beteiligt ist.<br />
Am kürzlich gegründeten TU Darmstadt Energy Center, das von Wissenschaftlern<br />
aus zwölf Fachbereichen getragen wird, soll Fragestellungen zur Energieerzeugung<br />
und Energieeffizienz unter ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen wie<br />
auch sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten nachgegangen<br />
werden. Als Koordinationsstelle für den an der Hochschule angesiedelten Forschungsschwerpunkt<br />
„Biotechnik – biologisch-technische Systeme“ fungiert das Biotechnik-Zentrum<br />
(BitZ) der TU Darmstadt, das sich sowohl in der Forschung als<br />
auch in der Lehre betätigt.<br />
An der Universität Frankfurt ist das fachliche Spektrum im Bereich moderner<br />
Querschnittstechnologien ebenfalls sehr breit. Die biotechnologischen Forschungsaktivitäten<br />
sind in zahlreichen Forschungskooperationen angesiedelt, so etwa an<br />
der DFG-Forschergruppe „Pathologische Genprodukte und ihre Wirkmechanismen“<br />
und der Graduiertenschule Frankfurt Graduate School for Translational<br />
Biomedicine - FIRST, die gemeinsam von der Universität Frankfurt und dem Georg-Speyer-Haus<br />
– einem in Frankfurt ansässigen Chemotherapeutischen Forschungsinstitut<br />
– initiiert wurde. Am Zentrum für Arzneimittelforschung, -<br />
entwicklung und -sicherheit (ZAFES) der Universität Frankfurt beteiligen sich<br />
41 Professoren aus 28 Universitätsinstituten und klinischen Zentren der Fachbereiche<br />
„Biochemie, Chemie und Pharmazie“ und „Humanmedizin“; ferner fungieren<br />
12 wissenschaftliche Institutionen als assoziierte Partner. Interdisziplinären Fragestellungen<br />
aus Wirtschaftsinformatik und Finanzplatzforschung wird insbesondere<br />
im neu gegründeten House of Finance und im E-Finance-Lab, das zusammen mit<br />
der TU-Darmstadt gegründet wurde, nachgegangen.<br />
Als „Paradebeispiel“ für wissenschaftsorientierte Agglomerationen bzw. „Querschnittsinstitutionen“<br />
kann das Interdisziplinäre Forschungszentrum IFZ an der<br />
Universität Gießen gelten, ein Verbund aus 210 Wissenschaftlern von<br />
23 Lehrstühlen bzw. 12 Instituten aus den Agrarwissenschaften, den Ernährungswissenschaften<br />
und der Biologie. Ausgeprägte fachliche Schwerpunkte liegen in der<br />
Landnutzungsforschung, den Nutzpflanzenwissenschaften und der Pflanzenökologie;<br />
weitere bedeutende Forschungsfelder sind die Tierökologie und die Biochemie<br />
der Ernährung. Einige der Lehrstühle am IFZ partizipieren am DFG-Sonderforschungsbereich<br />
299 „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“, einem<br />
von insgesamt drei Sonderforschungsbereichen an der Universität Gießen, in<br />
dessen Mittelpunkt die naturwissenschaftliche und agrarökonomische Kulturlandschaftsforschung<br />
steht. Von der hessischen Landeregierung wird der Forschungs-<br />
3
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
schwerpunkt Mensch – Ernährung – Umwelt gefördert, an dem 13 Lehrstühle<br />
aus den Fachbereichen Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement,<br />
Medizin und Veterinärmedizin partizipieren.<br />
Im Hinblick auf die Universität Marburg ist insbesondere das Wissenschaftliche<br />
Zentrum für Materialwissenschaften zu erwähnen, das eher naturwissenschaftlich<br />
geprägt ist und sich daher deutlich von dem vornehmlich ingenieurwissenschaftlich<br />
ausgerichteten materialwissenschaftlichen Schwerpunkt an der TU Darmstadt unterscheidet.<br />
Die medizinische bzw. biotechnologische Forschungskompetenz der<br />
Universität Marburg manifestiert sich in vier Sonderforschungsbereichen, so u.a. im<br />
DFG-Sonderforschungsbereich TR 22 „Allergische Immunantworten der Lunge“,<br />
der zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen<br />
Universität München und der Universität zu Lübeck / Forschungszentrum Borstel ins<br />
Leben gerufen wurde.<br />
Ein bedeutender wissenschaftlicher Schwerpunkt der Universität Kassel liegt im<br />
Bereich der Energieforschung. Diese Forschungskompetenz schlägt sich auch im<br />
Studienprogramm dieser Hochschule nieder, so etwa im Projektstudium solarcampus<br />
und im Masterstudiengang „Regenerative Energien und Energieeffizienz - re 2 “,<br />
der von regional ansässigen Privatunternehmen gefördert wird. Die Lehrveranstaltungen<br />
dieses Studienganges werden im Wesentlichen von 14 Lehrstühlen aus<br />
fünf Fachbereichen getragen. Als An-Institut der Universität Kassel, das sich seit<br />
nahezu zwanzig Jahren im Forschungsfeld der regenerativen Energien betätigt,<br />
weist das Institut für Solare Energieversorgungstechnik - ISET eine weit über <strong>Hessen</strong><br />
hinausreichende hohe Reputation auf. Bezüglich der Produktionstechnologien<br />
ist insbesondere der von der DFG geförderte SFB / TR 30 "Prozessintegrierte<br />
Herstellung funktional gradierter Strukturen auf der Grundlage thermomechanisch<br />
gekoppelter Phänomene" zu nennen, an dem neben der Universität<br />
Kassel noch die Universität Paderborn sowie die Universität Dortmund beteiligt sind.<br />
In Kooperation mit der Hochschule Fulda offeriert die Universität Kassel einen Masterstudiengang<br />
IFBC - „International Food Business and Consumer Studies“. Hierdurch<br />
werden die Synergien, die sich aus den an beiden Hochschulen vorhandenen<br />
Fachkompetenzen ergeben, sinnvoll genutzt.<br />
Erfolgsbeispiele für die Entwicklung zukunftsträchtiger Cluster aus Wissenschaft und<br />
Wirtschaft<br />
An der TU Darmstadt ist ein bedeutsames Standbein der Energie- und Kraftwerkstechnik<br />
das zusammen mit Rolls Royce gegründete University Technology Center<br />
- UTC, das auf einer langjährigen Forschungskooperation aufbaut. Das UTC gehört<br />
zu einem weltweiten Forschungsnetzwerk, das die Fa. Rolls-Royce zusammen<br />
mit forschungsstarken Universitäten aufgebaut hat und an dem beispielsweise die<br />
Universitäten Cambridge und Oxford partizipieren. Vielfältige Kontakte bestehen zudem<br />
innerhalb der in Frankfurt angesiedelten Forschungsvereinigung Verbren-<br />
4
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
nungskraftmaschinen - FVV, deren Mitgliederstamm 120 Unternehmen aus den<br />
Segmenten Automobilmotoren, Industriemotoren, Turbomaschinen und Zulieferer<br />
umfasst. Gefördert wird die industrienahe Forschung u.a. von der AiF -<br />
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen.<br />
Dem Forschungssegment der regenerativen Energien widmet sich die Wasserstoffund<br />
Brennstoffzellen-Initiative <strong>Hessen</strong> (www.brennstoffzelle-hessen.de), ein Zusammenschluss<br />
von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die<br />
sich am Austausch mit der Wirtschaft beteiligenden Wissenschaftler sind zum überwiegenden<br />
Teil an der TU Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, der Universität<br />
Frankfurt sowie den Fachhochschulen Frankfurt und Wiesbaden tätig.<br />
Der nordhessische Wirtschaftsraum zeichnet sich insbesondere im Segment der<br />
Energietechnologien durch eine ausgeprägte Branchenagglomeration aus, woraus<br />
starke Impulse für die dortige Forschungslandschaft resultieren. Der Förderung von<br />
Forschungsaktivitäten dient der nordhessische Technologie-Cluster deENet, ein<br />
Verbund aus etwa 35 Industrie- und Versorgungsunternehmen (u.a. SMA, Viessmann,<br />
Roth-Werke, Areva-Energietechnik, Polyma-Energiesysteme, e.on Mitte) sowie<br />
verschiedener Forschungsinstitutionen (u.a. Fraunhofer-Institut Bauphysik, Universität<br />
Kassel) und anderer Partner aus dem Bereich der dezentralen Energietechnologien.<br />
Bei dem Unternehmen SMA, dem Weltmarktführer für Photovoltaik-<br />
Wechselrichter, handelt es sich um eine Ausgründung der Kasseler Hochschule.<br />
Einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der anwendungsorientierten Forschungsinfrastruktur<br />
im Großraum Kassel wie auch zur Intensivierung der Zusammenarbeit<br />
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft soll ferner das kürzlich am Standort Baunatal<br />
gegründete AWZ Anwendungszentrum Metallformgebung leisten, das mit industrietypischer<br />
Prozesstechnologie und Fertigungsmesstechnik ausgestattet ist, um in<br />
Kooperation mit lokal ansässigen Unternehmen Fertigungsprozesse zu simulieren<br />
und Komponenten zu entwickeln. Nach eigener Einschätzung könnten insgesamt<br />
etwa 600 Unternehmen mit mehr als 50.000 Beschäftigten von den im Anwendungszentrum<br />
offerierten Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen profitieren.<br />
Die Region RheinMainNeckar weist eine hohe Kompetenz im Bereich der Automatisierungstechnik<br />
auf. Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind in<br />
den Feldern Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Mechatronik, Mikrosystemtechnik<br />
und Informatik tätig. Um Kooperationen zwischen Hochschulen und mittelständischen<br />
Automatisierungsunternehmen in der Region RheinMainNeckar zu befördern<br />
und Kompetenzen zu bündeln, wurde im Frühjahr 2007 auf Initiative des TTN-<br />
<strong>Hessen</strong> und der IHK Darmstadt das Netzwerk Automatisierung RheinMainNeckar<br />
ins Leben gerufen.<br />
Im Fachgebiet Produktionsmanagement hat das Institut für Produktionsmanagement,<br />
Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) am Fachbereich Maschinenbau<br />
5
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
der TU Darmstadt mit der Prozesslernfabrik CiP - Center für industrielle Produktivität<br />
ein bundesweit führendes Kompetenzzentrum für die Zusammenarbeit mit<br />
Unternehmen im Weiterbildungs- und im Forschungsbereich geschaffen. Die Investitionskosten<br />
wurden gemeinsam von der TU Darmstadt und durch Förderung des<br />
Landes <strong>Hessen</strong> aufgebracht. Der Betrieb des CIP wird insbesondere von McKinsey<br />
& Company, ferner von Bosch-Rexroth und SEW-EURODRIVE unterstützt.<br />
Am DFG-Transferbereich 55 "Umweltgerechte Produkte durch optimierte Prozesse,<br />
Methoden und Instrumente in der Produktentwicklung", der ebenfalls an<br />
der TU Darmstadt angesiedelt ist, sind mehrere Industriepartner beteiligt, so z.B. die<br />
HILTI Entwicklungsgesellschaft mbH, die Alfred Kärcher <strong>GmbH</strong> & Co. KG und die<br />
TechniData AG.<br />
Das Fraunhofer LBF unterhält mit ca. 30 Wissenschaftlern bundesweit die größte<br />
Forschungs- und Entwicklungseinheit auf dem Gebiet der zukünftigen Schlüsseltechnologie<br />
Adaptronik. Insbesondere für die Rhein-Main-Region wird ein erhebliches<br />
Expansionspotenzial für adaptronische Lösungen, und zwar insbesondere in<br />
der Automobilindustrie und im Maschinenbau erwartet. Das Fraunhofer LBF errichtet<br />
mit Unterstützung des BMBF, des Landes <strong>Hessen</strong> sowie der Fraunhofer-<br />
Gesellschaft ein neues Transferzentrum „Adaptronik“, das den Nukleus für ein Innovationscluster<br />
„Rhein-Main Adaptronik“ zur systematischen Vernetzung mit<br />
Unternehmen bilden wird.<br />
Im Segment der Informations- und Kommunikationstechnologien arbeiten zahlreiche<br />
Unternehmen mit der TU Darmstadt zusammen, so etwa Siemens, Nokia, die Deutsche<br />
Telekom und Avaya-Tenovis wie auch Panasonic Deutschland. Besonders engagiert<br />
ist derzeit die Fa. SAP, und dies vor allem über den Aufbau eines Corporate<br />
Labs an der TU Darmstadt, an dem langfristig etwa 80 Mitarbeiter tätig sein werden.<br />
Intensiven Kontakten zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Partnern dient<br />
das Netzwerk httc - hessisches telemedia technologie kompetenz-center, das<br />
u.a. das Fraunhofer Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme -<br />
IPSI in Darmstadt (eine Ausgründung aus der TU Darmstadt) und die Hochschule<br />
Darmstadt zu seinen Gründungsmitgliedern zählt.<br />
Handlungsbedarfe bei der Stärkung von Vernetzungsprozessen<br />
Die Beispiele zeigen, dass die Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft<br />
dort besonders gut funktioniert, wo nachhaltige Strukturen zur Unterstützung<br />
der Anbahnung von Kontakten und zur organisatorischen Entlastung der Forschungspartner<br />
geschaffen wurden, die von beiden Seiten gemeinsam getragen<br />
werden.<br />
Solche Katalysatoren eines engen und kontinuierlichen Austauschs zwischen<br />
Hochschulen und Unternehmen können z.B.:<br />
6
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
- gemeinsame Forschungseinrichtungen oder<br />
- Anwendungs- und Kompetenzzentren an Hochschulen, in denen kooperativ mit<br />
regionalen Unternehmen geforscht wird, oder<br />
- Cluster und Kompetenznetzwerke mit Mitgliedern aus Forschung und Industrie<br />
sein.<br />
Auch im Fall zahlreicher Forschungskooperationen ist ein intensiver Wissenstransfer<br />
festzustellen, so etwa für das CiP - Center für industrielle Produktivität und<br />
den DFG-Transferbereich 55 "Umweltgerechte Produkte durch optimierte Prozesse,<br />
Methoden und Instrumente in der Produktentwicklung", die beide an der<br />
TU Darmstadt angesiedelt sind.<br />
Generell wird deutlich, dass Cluster- und Netzwerkstrukturen wie auch Anwendungs-<br />
und Kompetenzzentren für kooperative Forschung einen wichtigen Beitrag<br />
zu einer funktionierenden Transferinfrastruktur leisten, indem sie helfen, die an den<br />
wissenschaftlichen Einrichtungen gewonnenen Forschungsergebnisse in eine produktbezogene<br />
Anwendung zu überführen. Voraussetzung für den Erfolg von<br />
Clusterbildungsprozessen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in einem zukunftsrelevanten<br />
Bereich ist sowohl die wissenschaftliche Exzellenz, die an vielen in<br />
dieser Studie untersuchten Fachbereichen eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde,<br />
als auch eine kritische Masse an Unternehmen mit Forschungskompetenz.<br />
Zur Initiierung von Vernetzungsprozessen ist darüber hinaus oftmals ein aktiver Beitrag<br />
wirtschaftsfördernder und unterstützender Einrichtungen gefordert, um funktionierende<br />
Cluster- und Netzwerkstrukturen aufzubauen. Die hier untersuchten Fallbeispiele<br />
bestätigen den wichtigen Beitrag von Akteuren und Initiativen wie dem<br />
TTN-<strong>Hessen</strong> und seiner bei der IHK-Innovationsberatung <strong>Hessen</strong> angesiedelten regionalen<br />
Beratungsstellen (z.B. mst-Netzwerk Rhein-Main e.V. und Netzwerk Automatisierung<br />
RheinMainNeckar), den von der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> getragenen Aktionslinien<br />
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
(z.B. Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative <strong>Hessen</strong>, Aktionslinie <strong>Hessen</strong>-<br />
Umwelttech oder Frankfurt Biotech Alliance e.V.) und dem Regionalmanagement<br />
Nordhessen (z.B. deENet und AWZ Anwenderzentrum Metallformgebung) bei der<br />
erfolgreichen Initiierung von fachbezogenen Plattformen für den Austausch von<br />
Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Grund dafür liegt vielfach darin, dass die beteiligten<br />
Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Organisationslast des Aufbaus<br />
von transferorientierten Netzwerkstrukturen mit einer ganzen Reihe von Beteiligten<br />
nicht allein bewältigen können. Erfolgreiche Vernetzungsprozesse setzen allerdings<br />
das grundlegende Engagement der interessierten Trägergruppen aus Wissenschaft<br />
und Wirtschaft voraus.<br />
In vielen Technologiebereichen wird ein sehr spezifischer Unterstützungsbedarf<br />
beim weiteren Ausbau und der Stärkung der vorhandenen fachbezogenen Clusterund<br />
Netzwerkstrukturen gesehen. So sehen die Gesprächspartner in einer Reihe<br />
7
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
von Fällen weiteren Unterstützungs- und Handlungsbedarf bei der Professionalisierung<br />
bestehender Cluster und Netzwerke und Chancen bei der Initiierung neuer<br />
Vernetzungsprozesse. Im Rahmen der Untersuchung wurde z.B. festgestellt, dass<br />
- umfangreiche Chancen beim Aufbau eines Netzwerks für Werkzeug- und Formenbau<br />
um das Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen<br />
(PTW) der TU Darmstadt gesehen werden;<br />
- auf dem Gebiet der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie nach Einschätzung<br />
der Gesprächsteilnehmer die bestehenden wissenschaftlichen Potenziale<br />
noch gezielter als bisher mit den Anwendungsbereichen in der Wirtschaft<br />
in Übereinstimmung gebracht werden könnten, da Potenziale für eine<br />
Ausweitung des Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen<br />
des Wasserstoff- und Brennstoffzellennetzwerks gesehen werden;<br />
- sich im Hinblick auf das Unternehmensumfeld von Kompetenz- und Anwendungszentren<br />
wie etwa dem AWZ Metallformgebung in Kassel Handlungsbedarfe<br />
bei der kontinuierlichen Bearbeitung und Pflege der Kontakte zu den regional<br />
ansässigen Unternehmen durch die Schaffung eines Netzwerkmanagements erkennen<br />
lassen.<br />
Auch in den Bereichen Ressourcenmanagement, Wasserwirtschaft, Versicherungswirtschaft<br />
und Medizintechnik werden Potenziale für eine Intensivierung der Vernetzung<br />
zwischen den jeweiligen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen<br />
Einrichtungen (z.B. auch Wasserversorger) gesehen. Teilweise wird auch auf<br />
die Notwendigkeit der besseren Vermarktung bestehender Cluster wie im Bereich E-<br />
Finance hingewiesen, um eine Erhöhung der nationalen und internationalen Sichtbarkeit<br />
zu erreichen.<br />
Generell kann konstatiert werden, dass ein weiterer Ausbau von Plattformen, die<br />
der Anknüpfung von Forschungskontakten dienen, von der Mehrheit der Gesprächspartner<br />
als positiv erachtet wird, da sich diese als generell erfolgreich erwiesen haben,<br />
um den fachbezogenen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu<br />
organisieren. Aus diesem Grund sind Initiativen des Landes und Maßnahmen zur<br />
Stärkung der Transferinfrastruktur an den Hochschulen, z.B. durch die Professionalisierung<br />
des Kooperationsmanagements mit der regionalen Wirtschaft oder durch die<br />
Schaffung von Anwendungs- und Kompetenzzentren, wie auch Initiativen zur weiteren<br />
Förderung von Cluster- und Netzwerkbildungsprozessen zwischen Wissenschaft<br />
und Wirtschaft zu begrüßen.<br />
Allgemeine Handlungsempfehlungen<br />
Mehrere Vertreter der hessischen Forschungslandschaft plädieren dafür, auf Grundlage<br />
der bestehenden wissenschaftlichen Kompetenzen die „Stärken zu stärken“<br />
8
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
und hieran angelehnt die Profile der hessischen Hochschulen weiter zu schärfen. 2<br />
Einige Gesprächspartner halten es für angebracht, sich bei der Forschungsförderung<br />
noch stärker als bisher an Erfolgskriterien (eingeworbene Drittmittel, Veröffentlichungen<br />
etc.) zu orientieren. Die öffentlichen Hochschulen seien dazu angehalten,<br />
ihre „Science-Marketing“-Aktivitäten zu forcieren – und zwar im Sinne des vorgenannten<br />
„Übersetzens“ von Forschungsergebnissen in die Sprache der Praxis<br />
und mit Blick auf die konkrete Beeinflussung von Strategie und operativem Geschäft,<br />
um der Öffentlichkeit ihre Leistungen in der Forschung und Lehre zu verdeutlichen.<br />
Dies gilt nicht zuletzt für den Kontakt mit Vertretern aus der Privatwirtschaft.<br />
Im Hinblick auf die Forschungsaktivitäten an den hessischen Fachhochschulen lassen<br />
die Ergebnisse der Expertengespräche darauf schließen, dass innerhalb der<br />
betreffenden Hochschulen eine umfangreiche Bereitschaft dazu besteht, die praxisorientierte<br />
Forschung deutlich auszubauen.<br />
Die Mehrheit der Gesprächspartner erachtet einen Ausbau der industrienahen Forschungsförderung<br />
als sinnvoll, und dies nicht zuletzt hinsichtlich der Kooperationen<br />
zwischen Hochschulen und kleinen und mittleren Unternehmen. Als besonders<br />
gelungene Beispiele einer erfolgreichen Forschungs- und Technologieförderung<br />
werden häufig die Förderkonzepte in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-<br />
Westfalen herangezogen. Nötig seien vor allem Förderkonzepte, die zwar einerseits<br />
auf die Bedürfnisse der Antragsteller zugeschnitten sind, jedoch andererseits den<br />
Ansprüchen an eine hochkarätige Forschung gerecht werden. Auf die strategische<br />
Ausrichtung und die Transparenz der Forschungspolitik sollte bei der Neukonzipierung<br />
von Förderprogrammen ein besonderer Wert gelegt werden. Von einer Mehrheit<br />
der Gesprächspartner wird es als wichtig erachtet, dass in für <strong>Hessen</strong> relevanten<br />
und zukunftsorientierten Forschungsbereichen – gemessen einerseits an den<br />
technologischen Potenzialen, andererseits an den Kompetenzen der hessischen<br />
Unternehmen – ein gezielter Ausbau der Forschungsinfrastruktur angestrebt wird.<br />
Nach Abschluss der Untersuchung wurde das neue Forschungsförderprogramm<br />
LOEWE vorgestellt, mit dem das Land ab 2008 die hessische Forschungslandschaft<br />
nachhaltig stärken und Schwerpunkt- und Profilbildungen erleichtern will. Es ist zu<br />
erwarten, dass das LOEWE-Programm den in der Studie geäußerten Erwartungen<br />
an eine erfolgreiche Forschungsförderung entgegen kommt und voraussichtlich<br />
auch den Bedarf an Unterstützung von Kooperationen zwischen Hochschulen und<br />
Privatwirtschaft zumindest im Falle kleiner und mittlerer Unternehmen auffangen<br />
wird.<br />
Die Infrastruktur an den hessischen Hochschulen wird von den Gesprächspartnern<br />
unterschiedlich eingeschätzt; während einige Fachvertreter diesbezüglich einen<br />
Handlungsbedarf sehen, zeigen sich andere mit den Rahmenbedingungen für die<br />
Forschung sehr zufrieden. Im Rahmen des Programms HEUREKA werden inner-<br />
2 Allerdings ist bei der Bewertung dieser Aussage zu berücksichtigen, dass sich die weit überwiegende Mehrheit der Gesprächspartner<br />
selbst als Vertreter einer zu stärkenden Einrichtungen sieht.<br />
9
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
halb der kommenden zwölf Jahre insgesamt 3 Mrd. Euro in den Ausbau und die Sanierung<br />
der hessischen Hochschulen investiert.<br />
Als positiv wird offenbar die Intensivierung internationaler Forschungskontakte (Studienaustauschprogramme,<br />
Aufenthalte von Gastwissenschaftlern, Forschungs- bzw.<br />
Delegationsreisen) eingeschätzt.<br />
Fazit der Untersuchung<br />
Forschung, Fachgebiete, Kompetenzen<br />
• Sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der anwendungsorientierten Forschung weisen die hessischen<br />
Hochschulen eine hohe Kompetenz auf.<br />
• Die hohe wissenschaftliche Kompetenz geht mit einer umfangreichen Einwerbung von Drittmitteln einher.<br />
• An den hessischen Hochschulen existieren zahlreiche Forschungskooperationen und -netzwerke, insbesondere<br />
Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Forschergruppen, die von der DFG gefördert werden. Als<br />
weitere Förderinstitutionen engagieren sich u.a. die AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsvereinigungen und die Volkswagen-Stiftung.<br />
• Auf Seiten der Fachhochschulen liegt eine ausgeprägte Bereitschaft zum Ausbau der Forschungsaktivitäten vor.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft<br />
• In <strong>Hessen</strong> existieren mehrere anwendungsnahe Forschungs- und Transferzentren, welche der Kooperation<br />
zwischen Hochschulen und Industriepartnern sehr förderlich sind. Zu nennen sind insbesondere das CiP -<br />
Center für industrielle Produktivität der TU Darmstadt, das mit der Universität Kassel verbundene AWZ<br />
Anwendungszentrum Metallformgebung sowie das E-Finance Lab an der Universität Frankfurt. Beispiele für<br />
gemeinsam mit der Wirtschaft getragene „Corporate Labs“ sind das University Technology Centre (Rolls Royce)<br />
und das CEC Darmstadt (SAP) an der TU Darmstadt.<br />
• Cluster- und Netzwerkstrukturen wie auch Anwendungs- und Kompetenzzentren für kooperative Forschung<br />
leisten einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Transferinfrastruktur. Die hessischen<br />
Forschungseinrichtungen sind in den untersuchten Technologiefeldern in zahlreiche Technologienetzwerke<br />
eingebunden, so etwa in die Brennstoffzelleninitiative <strong>Hessen</strong>, in den nordhessischen Technologie-Cluster<br />
deENet, das Netzwerk Automatisierung RheinMainNeckar und das httc - hessisches telemedia technologie<br />
kompetenz-center. Der Entwicklungsstand der einzelnen Initiativen ist unterschiedlich - einige Netzwerke wie<br />
z.B. der Innovationscluster „Rhein-Main Adaptronik“ sind zur Zeit im Aufbau.<br />
• Die untersuchten Fallbeispiele bestätigen den wichtigen Beitrag wirtschaftsfördernder Akteure und Initiativen wie<br />
dem TTN-<strong>Hessen</strong>, den Aktionslinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und<br />
Landesentwicklung und dem Regionalmanagement Nordhessen bei der erfolgreichen Initiierung von Netzwerkund<br />
Clusterstrukturen für den Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft.<br />
• Der weitere Ausbau von Netzwerken und Cluster-Initiativen könnte zu einer zusätzlichen Vertiefung von<br />
Forschungskontakten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren beitragen. In vielen der untersuchten<br />
Technologiebereichen werden Chancen bei der Initiierung neuer Vernetzungsprozesse bzw. ein spezifischer<br />
Unterstützungsbedarf beim weiteren Ausbau derartiger Institutionen gesehen, um den fachbezogenen<br />
Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
10
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
• Die Profile der hessischen Hochschulen sollten auf Grundlage bereits vorhandener Komptenzen geschärft<br />
werden. Von einer Mehrheit der Gesprächspartner wird es als wichtig erachtet, dass in für <strong>Hessen</strong> relevanten<br />
und zukunftsorientierten Forschungsbereichen, gemessen einerseits an den technologischen Potenzialen,<br />
andererseits an den Kompetenzen der hessischen Unternehmen, ein gezielter Ausbau der<br />
Forschungsinfrastruktur angestrebt wird.<br />
• Die Hochschulen sollten noch umfangreicher als bisher mit ihren Forschungsleistungen an die Öffentlichkeit<br />
treten.<br />
• Die industrienahe Forschungsförderung wird von den Gesprächspartnern offenbar als noch ausbaufähig<br />
eingeschätzt, und dies nicht zuletzt hinsichtlich der Kooperationen zwischen Hochschulen und kleinen und<br />
mittleren Unternehmen. Den diesbezüglichen Unterstützungsbedarf wird voraussichtlich das nach Abschluss der<br />
Untersuchung vorgestellte Förderprogramm LOEWE ab 2008 auffangen können.<br />
• Eine weitere Internationalisierung des Forschungsbetriebes wird von den Gesprächspartnern als positiv<br />
erachtet.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
11
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
12
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
1 Ausgangslage und Ziele der Untersuchung<br />
Bildung, Forschung, Entwicklung und Innovation bilden zentrale Elemente für die<br />
Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Mit ihrer jüngst initiierten „Hightech-<br />
Strategie Deutschland“ hat die Bundesregierung eine Strategie entwickelt, die eine<br />
erfolgreiche Positionierung Deutschlands auf den wichtigen Zukunftsmärkten zum<br />
Ziel hat. Hierzu wurden insgesamt 17 Hightech-Sektoren ausgewählt, die einer speziellen<br />
Förderung unterliegen. Genannt seien etwa die Fachgebiete Energietechnologien,<br />
Umwelttechnologien, Biotechnologie, Gesundheitsforschung und Medizintechnik,<br />
Produktionstechnologien, Werkstofftechnologien sowie Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien.<br />
Die Förderung von Cluster-Strukturen ist dabei zunehmend ein Instrument der Innovationspolitik.<br />
Hierbei erfolgt eine Fokussierung auf Forschungsbereiche, in denen<br />
bereits besondere Stärken vorhanden sind, um diese weiter auszubauen. Durch die<br />
Vernetzung und Clusterbildung in identifizierten Branchen und Forschungsfeldern<br />
sollen Potenziale zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgeschöpft werden.<br />
Auch in der Strukturpolitik der EU-Ebene spielen Technologie- und Clusterförderung<br />
eine bedeutende Rolle. Schwerpunkte der Förderung bilden – beispielsweise im aktuellen<br />
Siebten EU-Forschungsrahmenprogramm – die Aktionsfelder Gesundheit,<br />
Biotechnologie, IKT, Nanotechnologien, Werkstoffe, Energie, Umwelt, Verkehr, Sicherheit<br />
und Raumfahrt. Bezüglich der Inanspruchnahme der Fördermittel aus dem<br />
6. EU-Forschungsrahmenprogramm liegt <strong>Hessen</strong> im Bundesländervergleich bereits<br />
im vorderen Feld, und zwar an vierter Stelle hinter Bayern, Baden-Württemberg und<br />
Nordrhein-Westfalen. Auf <strong>Hessen</strong> entfiel ein Anteil von 9 % der Fördermittel, während<br />
jedoch beispielsweise über 20 % der Mittel nach Bayern und knapp 18 % nach<br />
Baden-Württemberg flossen.<br />
Vor diesem Hintergrund besteht die Zielsetzung dieser im Auftrag des Hessischen<br />
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst erstellten Untersuchung darin, im Hinblick<br />
auf bedeutende Technologiefelder Ansatzpunkte für die Entwicklung zukunftsträchtiger<br />
Cluster in der hessischen Forschungslandschaft zu identifizieren. Im Einzelnen<br />
werden die nachstehenden Ziele verfolgt:<br />
• Es soll untersucht werden, in welchen der in der Hightech-Strategie des Bundes<br />
bzw. der Forschungsthemen des Siebten EU-Forschungsrahmenprogramms<br />
genannten Technologiefelder das Bundesland <strong>Hessen</strong> in der Wissenschaft<br />
spezifische Agglomerationen bzw. besonders markante Potenziale aufweist.<br />
• In Hinsicht auf wissenschaftliche Institutionen bzw. Wissenschaftsdisziplinen<br />
sollen spezifische Agglomerationen und Querbezüge aufgezeigt werden, die<br />
Ausgangspunkte für technologieorientierte Cluster bilden.<br />
13
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Im Hinblick auf die Untersuchungsziele ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den<br />
Forschungsinstitutionen, die im Rahmen von Expertengesprächen aufgesucht wurden,<br />
um exemplarische Einrichtungen handelt, die anhand fachlicher und regionaler Kriterien<br />
ausgewählt worden sind. Das aufgezeigte Muster der Forschungslandschaft lässt<br />
sich mit den regionalen Agglomerationen technologieintensiver Branchen vergleichen.<br />
Die Forschung und Entwicklung in der Industrie bildet zwar nicht das eigentliche Thema<br />
der vorliegenden Untersuchung, gleichwohl wird in ausgewählten Fällen der Versuch<br />
unternommen, die öffentlichen Forschungseinrichtungen in einen Zusammenhang<br />
mit der Privatwirtschaft zu setzen.<br />
14
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
2 Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes und methodische Vorgehensweise<br />
Im Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen sogenannte „Querschnittstechnologien“,<br />
die jeweils wiederum zu zahlreichen Einzeldisziplinen Bezüge aufweisen.<br />
Gerade in modernen Industrieländern, in denen ein Grossteil der industriellen Wertschöpfung<br />
über die Produktion von hochkomplexen Anlagen, Systemen und Komponenten<br />
erzielt wird, stehen die Querschnittstechnologien im Fokus der Wirtschafts-<br />
und Technologieförderung. Um den Untersuchungsgegenstand zu konkretisieren,<br />
wurden in Absprache mit dem Auftraggeber inhaltliche Schwerpunkte auf<br />
ausgewählten Technologiefeldern gesetzt. 3<br />
Vor diesem Hintergrund bilden die folgenden Technologiefelder den Untersuchungsgegenstand:<br />
• Energietechnologien,<br />
• Umwelttechnologien,<br />
• Medizintechnik,<br />
• Life Sciences,<br />
• Produktionstechnologien,<br />
• Materialwissenschaften,<br />
• Informations- und Kommunikationstechnologien.<br />
Diese Technologiefelder wurden disaggregiert untersucht, so dass letztlich<br />
27 Fachgebiete Berücksichtigung fanden (vgl. Tabelle 1). Für jedes einzelne dieser<br />
Fachgebiete wurde ein Porträt erstellt, in dem sowohl aktuelle fachliche Trends als<br />
auch Forschungskooperationen Berücksichtigung fanden.<br />
3 Technologiefelder, für die im Hinblick auf die hessische Forschungslandschaft bereits umfangreiche Analysen durchgeführt<br />
wurden (so beispielsweise die Nanotechnologien und Verkehrstechnologien), fanden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung<br />
nur am Rande Berücksichtigung.<br />
15
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Tabelle 1: Die im Rahmen der Untersuchung ausgewählten Technologiefelder<br />
Technologiefeld Einzeldisziplinen Überschneidungen / Berührungspunkte<br />
Energietechnologien Konventionelle Energietechnologien /<br />
Kraftwerkstechnik<br />
Brennstoffzelle<br />
Thermische Verfahrenstechnik<br />
Regenerative Energien / Windenergie, Photovoltaik,<br />
Bioenergie, Wasserkraft und Meerenergie<br />
Regenerative Energien / Solarthermie<br />
Umwelttechnologien<br />
Abwassertechnologie / Wasserwirtschaft<br />
Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
Maschinenbau, Verfahrenstechnik,<br />
Elektrotechnik, Physik, Chemie,<br />
Materialwissenschaften<br />
Maschinenbau, Agrarwissenschaften,<br />
Hydrologie, Bodenkunde<br />
Medizintechnik Diagnostik / Informatik in der Medizin Graphische DV, Maschinenbau, Optik,<br />
Prothetik, Biotechnologie<br />
Life Sciences Bionik Biotechnologie, Biologie, Zoologie,<br />
Phytologie, Physiologie, Orthopädie,<br />
Prothetik, Biomedizin,<br />
Materialwissenschaften, Produktentwicklung<br />
Produktionstechnologien<br />
Materialwissenschaften<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Rote Biotechnologie: Klinische Chemie und<br />
Molekuare Diagnostik<br />
Rote Biotechnologie: Biomedizin, Diagnostik<br />
Rote Biotechnologie: Ernährungsphysiologie<br />
Weiße Biotechnologie: Biofermentation, Biokatalyse<br />
Grüne Biotechnologie: Landnutzung,<br />
Ressourcenmanagement<br />
Lebensmitteltechnologie<br />
Mechatronik / Regelungstechnik<br />
Umformtechnik<br />
Spanende Formung /<br />
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
Adaptronik<br />
Oberflächenforschung<br />
Strukturforschung<br />
Multimedia Kommunikation<br />
Graphische Datenverarbeitung<br />
Sicherheitstechnologien<br />
E-Finance<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Wireless Communications<br />
Physiologie, Biologie,<br />
Medizin, Agrarwissenschaften<br />
Organische Chemie, Werkstoff- und<br />
Materialwissenschaften<br />
Biologie, Hydrologie, Bodenkunde, Zoologie,<br />
Chemie, Physik, Landtechnik, Medizin<br />
Maschinenbau, Elektrotechnik,<br />
Verfahrenstechnik Graphische DV,<br />
Bildgegebende Verfahren, Material- und<br />
Werkstoffwissenschaften, Physik<br />
Physik, Chemie, Energietechnologien,<br />
Elektrotechnik, Maschinenbau<br />
Biologie, Maschinenbau, Biometrie,<br />
Elektrotechnik, Optik<br />
Betriebswirtschaftslehre,<br />
Volkswirtschaftslehre, Elektrotechnik<br />
Eletrotechnik, Physik<br />
16
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Die konkrete Abgrenzung der Technologiefelder gestaltet sich als komplex, denn<br />
zwischen den betreffenden Fachdisziplinen existieren zahlreiche Überschneidungen<br />
und Berührungspunkte (vgl. Abbildung 1).<br />
Abbildung 1: Fachliche Bezüge zwischen den untersuchten Technologiefeldern<br />
Energietechnologien<br />
• Konventionelle Energien<br />
• Brennstoffzelle<br />
• Regenerative Energien<br />
Medizintechnik<br />
• Diagnostik / Informatik in der<br />
Medizin<br />
Umwelttechnologien<br />
• Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
• Abwassertechnologie / Wasserwirtschaft<br />
Produktionstechnologien<br />
• Lebensmitteltechnologie<br />
• Mechatronik / Regelungstechnik<br />
• Umformtechnik<br />
• Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
• Adaptronik<br />
• Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
Life Sciences<br />
• Bionik<br />
• Rote Biotechnologie<br />
• Grüne Biotechnologie<br />
• Weiße Biotechnologie<br />
• Ernährungswissenschaften<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
• Multimedia Kommunikation<br />
• Graphische Datenverarbeitung<br />
• Sicherheitstechnologien<br />
• E-Finance<br />
• Wireless Communications<br />
Materialwissenschaften<br />
• Oberflächenforschung<br />
• Strukturforschung<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Prägnante Beispiele sind hierfür die Brennstoffzellentechnologie oder die Sicherheitstechnologien.<br />
So steht die Brennstoffzellentechnologie in einem engen Zusammenhang<br />
mit dem Maschinenbau, der Verfahrenstechnik und der Elektrotechnik.<br />
Zu nennen sind des Weiteren die Physik, die Chemie wie auch die Werkstoffund<br />
Materialwissenschaften. Die Sicherheitstechnologien stehen wiederum in enger<br />
17
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Verbindung zur Biologie bzw. Biometrie wie auch zum Maschinenbau, zur Elektrotechnik<br />
und zu den Informations- und Kommunikationstechnologien. Derartige Berührungspunkte<br />
und Überschneidungen finden bei der vorliegenden Analyse der<br />
hessischen Forschungslandschaft Berücksichtigung.<br />
Die Analyse der Technologiefelder erfolgt in mehrfacher Hinsicht, woran sich der<br />
Aufbau der vorliegenden Untersuchung anlehnt. Zunächst werden im Hinblick auf<br />
hessische Hochschulen bzw. Forschungsinstitutionen für Wissenschaftsdisziplinen,<br />
die für die hier untersuchten Fragestellungen von Relevanz sind, grundlegende<br />
Strukturmerkmale aufgezeigt. Hierfür dienen als Datengrundlage insbesondere die<br />
Veröffentlichungen des Hessischen Statistischen Landesamtes, des Statistischen<br />
Bundesamtes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Centrums<br />
für Hochschulentwicklung (CHE). Als maßgebliche Indikatoren werden hierzu etwa<br />
die Anzahl der Wissenschaftler bzw. Studenten, der Umfang der eingeworbenen<br />
Drittmittel und die Anzahl der abgeschlossenen Dissertationen und Habilitationen<br />
herangezogen. Des Weiteren finden die Publikationstätigkeit und die Beantragung<br />
von Patenten Berücksichtigung. Hieraus lassen sich erste Rückschlüsse über forschungsbezogene<br />
Cluster-Strukturen in <strong>Hessen</strong> ziehen.<br />
In einem zweiten Teil der Untersuchung werden die Strukturen der Forschungslandschaft<br />
in den betreffenden Disziplinen anhand einer Primärerhebung identifiziert. Als<br />
Methodik wurden hierfür leitfadengestützte Experteninterviews gewählt. Insgesamt<br />
wurden 27 Gespräche mit Vertretern aus hessischen Forschungseinrichtungen<br />
durchgeführt. Die Gespräche umfassten jeweils ein breites Themenfeld, das unter<br />
anderem die grundlegenden Charakteristika der betreffenden Forschungseinrichtung,<br />
die Anwendungsfelder für die Forschungsergebnisse in der Privatwirtschaft<br />
und die Außendarstellung des Fachgebiets miteinschlossen. Weitere Themenfelder<br />
waren die Pflege von Forschungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnerinstitutionen,<br />
die Publikationstätigkeit und die Partizipation an der Wissenschafts-<br />
Community. Gefragt wurde hierbei auch nach der eigenen Organisation von Seminaren,<br />
Workshops und Kongressen. Zudem wurden von den Gesprächsteilnehmern<br />
bedeutende Problemfelder in Erfahrung gebracht, woraus sich im konkreten Fall ein<br />
etwaiger Handlungsbedarf ablesen lässt.<br />
Die Auswahl der Gesprächsteilnehmer erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber,<br />
wobei in mehrfacher Hinsicht auf Ausgewogenheit geachtet wurde. Vornehmlich<br />
standen fachliche Kriterien im Vordergrund. Zudem war die Zugehörigkeit zu einer<br />
Hochschule von Relevanz, denn die Forschungslandschaft im Bundesland <strong>Hessen</strong><br />
sollte unter einem möglichst breiten Blickwinkel untersucht werden. Im Kontext<br />
der untersuchten Fragestellung spielte die jeweilige fachliche Ausrichtung der einzelnen<br />
hessischen Hochschulen wiederum eine zentrale Rolle. Gegenstand der Befragung<br />
waren die in Tabelle 1 aufgeführten Technologiefelder. Im Hinblick auf die<br />
18
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
einzelnen Technologiefelder wurden den Gesprächsteilnehmern Fragen zu insgesamt<br />
sechs Themenbereichen gestellt:<br />
• Forschungsinstitution,<br />
• Forschungstätigkeit,<br />
• Anwendungsbereiche bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse,<br />
• Technologiefeld,<br />
• Kooperationen / Vernetzung,<br />
• Vordringliche Probleme / Handlungsbedarf.<br />
Die Stichprobe der Befragungsteilnehmer umfasste Hochschullehrer an sämtlichen<br />
hessischen Universitäten und drei Fachhochschulen sowie drei Fraunhofer-<br />
Instituten (vgl. Tabelle 2). Die Kategorie der Hochschule – Fachhochschule oder U-<br />
niversität – schlägt sich merklich in der institutionellen Einbettung wie auch der Größe<br />
der betreffenden Forschungseinrichtungen nieder. Bei der Selektion der Forschungsinstitutionen<br />
wurde letztlich sowohl fachlichen Aspekten als auch der möglichst<br />
weitgehenden Berücksichtigung sämtlicher hessischer Hochschulstandorte<br />
Rechnung getragen.<br />
Tabelle 2: Fachliche und institutionelle Zuordnung der Gesprächspartner<br />
Wissenschaftsdisziplin / Hoch-<br />
Energietech-<br />
Umwelttech-<br />
Medizin-<br />
Life<br />
Produktions-<br />
Materialwissen-<br />
I u K-Techno-<br />
schule<br />
nologien<br />
nologien<br />
technik<br />
Sciences<br />
technologien<br />
schaften<br />
logien<br />
TU Darmstadt 2 1 2 3 1 2<br />
Universität Frankfurt 1 1<br />
Hochschule Fulda 1<br />
Universität Gießen 1 2<br />
FH Gießen-Friedberg 1<br />
Universität Kassel 2 1<br />
Universität Marburg 1 1<br />
FH Wiesbaden 1<br />
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit<br />
und Systemzuverlässigkeit<br />
LBF Darmstadt<br />
1<br />
Fraunhofer-Institut für Graphische<br />
Datenverarbeitung IGD Darmstadt<br />
Fraunhofer-Institut für Sichere<br />
Informationstechnologie SIT Darmstadt<br />
1<br />
1<br />
Summe 5 2 1 6 6 2 5<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
19
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Gleichwohl bringt es die Auswahl der Technologiefelder mit sich, dass die Mehrzahl<br />
der befragten Hochschullehrer an der TU Darmstadt tätig ist. In fachlicher Hinsicht<br />
war die Auswahl der Hochschullehrer vergleichsweise ausgewogen, denn auf zwei<br />
Disziplinen entfielen jeweils sechs Gesprächspartner und auf zwei weitere Disziplinen<br />
jeweils fünf Gesprächspartner. Die restlichen fünf Gesprächspartner verteilen<br />
sich auf drei Disziplinen. Zu beachten ist hier wiederum, dass es sich bei den betrachteten<br />
Fachgebieten um Querschnittsdisziplinen handelt, woraus zahlreiche inhaltliche<br />
Querverbindungen und Überschneidungen resultieren.<br />
Die detaillierte Auswertung der einzelnen Gespräche erfährt innerhalb der vorliegenden<br />
Untersuchung eine bedeutende Gewichtung, denn gerade aus den Befragungsergebnissen<br />
lassen sich konkrete Schlussfolgerungen über die fachliche, regionale<br />
wie auch institutionelle Struktur der hessischen Forschungslandschaft ziehen.<br />
Aus den hieraus gewonnenen Erkenntnissen über Forschungsagglomerationen<br />
und -kooperationen können wiederum strukturelle Veränderungen bzw. Konturierungen<br />
der Forschungsinstitutionen skizziert werden. Zudem ergeben sich aus den<br />
Befragungsergebnissen Anknüpfungspunkte für künftige Förderkonzepte wie auch<br />
eine erfolgversprechende Positionierung bei bundesweiten bzw. europaweiten Förderprogrammen.<br />
Im Hinblick auf weiteren Untersuchungsbedarf lässt sich an die<br />
hier erarbeiteten Ergebnisse anknüpfen.<br />
Im Folgenden werden die Strukturen der hessischen Hochschullandschaft anhand<br />
ausgewählter Indikatoren skizziert. Hierbei wird zunächst auf das Hochschulpersonal<br />
und die eingeschriebenen Studenten eingegangen, woran sich eine Erörterung<br />
der Forschungsleistungen anschließt.<br />
20
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
3 Personal und Studenten an den hessischen Hochschulen im Bereich<br />
ausgewählter Querschnittstechnologien<br />
3.1 Wissenschaftliches Personal<br />
Zunächst soll die fachliche Ausrichtung der hessischen Universitäten in Bezug auf<br />
das wissenschaftliche Personal untersucht werden. Nach Maßgabe der absoluten<br />
Anzahl der beschäftigten Wissenschaftler ist die Universität Frankfurt mit gut<br />
2.600 Wissenschaftlern die größte Hochschule in <strong>Hessen</strong>, gefolgt von der Universität<br />
Gießen und der Universität Marburg mit jeweils etwa 2.000 Wissenschaftlern. An<br />
der TU Darmstadt sind rund 1.600 Wissenschaftler und an der Universität Kassel<br />
kapp 1.000 Wissenschaftler tätig. Was die Relation zwischen einzelnen Kategorien<br />
des Personals betrifft, so zeichnet sich die Universität Kassel im Vergleich zu den<br />
anderen hessischen Universitäten durch eine deutlich größere Proportion der Professoren<br />
aus, was in einer verhältnismäßig geringen Ausstattung mit wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiterstellen begründet liegt. Dieser Umstand erklärt sich im Wesentlichen<br />
aus der Entstehungsgeschichte dieser Hochschule und ist auch bei der Einordnung<br />
der Forschungsleistungen zu berücksichtigen.<br />
Tabelle 3: Wissenschaftliches Personal an den hessischen Universitäten 2003<br />
Hochschule Gesamt LEBENSWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN NATURWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN INGENIEURWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN<br />
Professoren 1) Wissensch. 2) Professoren Wissensch. Professoren Wissensch. Professoren Wissensch.<br />
TU Darmstadt 267 1.604 15 66 88 466 105 844<br />
U Frankfurt 475 2.628 128 1.296 89 424 8 37<br />
U Gießen 361 2.016 160 1.318 48 183 3 7<br />
U Kassel 280 967 26 100 34 119 80 325<br />
U Marburg 369 1.982 133 1.175 64 255 8 30<br />
Hessische Univ. gesamt 1.752 9.197 462 3.955 323 1.447 204 1.243<br />
1)<br />
Hauptberuflich tätige Professoren (Vollzeitäquivalente).<br />
2)<br />
Hauptberuflich tätiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Vollzeitäquivalente). Berücksichtigt ist das gesamte an Hochschulen<br />
haupt- und nebenberuflich tätige Personal, auch soweit kein Anstellungsverhältnis zum Land oder zur Hochschule besteht.<br />
Quelle: DFG (2006).<br />
Die Forschungsschwerpunkte der hessischen Hochschulen manifestieren sich in der<br />
Zuordnung des Personals zu einzelnen Wissenschaftsbereichen. Während sich etwa<br />
an den Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg ein Großteil der Wissenschaftler<br />
in den Lebenswissenschaften betätigt, sind die TU Darmstadt und die Universität<br />
Kassel in den Ingenieurwissenschaften mit besonders zahlreichem Personal<br />
ausgestattet.<br />
21
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
3.2 An den hessischen Hochschulen eingeschriebene Studenten<br />
Im Hinblick auf die an den Hochschulen eingeschriebenen Studenten liegen für die<br />
hier untersuchten Querschnittstechnologien nur punktuelle Angaben vor. Vorsichtige<br />
Rückschlüsse lassen sich aus den aggregierten Studentenzahlen ziehen. So waren<br />
im Wintersemester 2006 / 07 in <strong>Hessen</strong> rund 163.000 Studenten immatrikuliert,<br />
hiervon 28.000 Studenten in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen; in der Fächergruppe<br />
Mathematik und Naturwissenschaften waren es 30.000 Studenten und<br />
in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften knapp 5.000 Studenten (vgl.<br />
Tabelle 4). Auf die Fächergruppe Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften entfielen<br />
11.000 Studenten und auf die Veterinärmedizin 1.500 Studenten. Die Ingenieurwissenschaften<br />
und die Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften<br />
konnten somit Anteile von 19 % bzw. 17 % an sämtlichen hessischen Studenten auf<br />
sich vereinen.<br />
Tabelle 4: Studenten in ausgewählten Studienfächern an hessischen Hochschulen, Wintersemester 2006 / 07<br />
Ausgewählte Studienfächer<br />
Ausgewählte Hochschulen<br />
Fächergruppe Anzahl Hochschule Anzahl Hochschule Anzahl<br />
Ingenieurwissenschaften 28.000 TU Darmstadt 16.000 H Darmstadt 10.000<br />
Mathematik und Naturwissenschaften 30.000 U Frankfurt 34.000 FH Frankfurt 9.000<br />
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 5.000 U Gießen 21.000 H Fulda 5.000<br />
Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften 11.000 U Marburg 18.000 FH Gießen-Friedberg 10.000<br />
Veterinärmedizin 1.500 U Kassel 16.000 FH Wiesbaden 9.000<br />
Studenten insgesamt 163.000<br />
Quelle: HSL (2007).<br />
Die vorstehenden Angaben lassen sich in einen Zusammenhang mit den Studentenzahlen<br />
der hessischen Hochschulen setzen, um Erkenntnisse über fachliche und<br />
standortbezogene Agglomerationen zu gewinnen. Im Wintersemester 2006 / 07<br />
wies die Universität Frankfurt als größte hessische Hochschule 34.000 Studenten<br />
auf; hierauf folgen die Universität Gießen mit 21.000 Studenten und die Universität<br />
Marburg mit 18.000 Studenten. An diesen drei Universitäten bilden jeweils die Medizin<br />
und die Lebenswissenschaften ein sehr bedeutendes Standbein. An der<br />
TU Darmstadt und an der Universität Kassel, die beide stark ingenieurwissenschaftlich<br />
ausgerichtet sind, waren insgesamt gut 16.000 Studenten eingeschrieben.<br />
Die größten Fachhochschulen in <strong>Hessen</strong> sind die Hochschule Darmstadt und<br />
FH Gießen-Friedberg mit jeweils etwa 10.000 Studenten, gefolgt von der FH Frankfurt<br />
und der FH Wiesbaden mit jeweils etwa 9.000 Studenten. Diese vier Hochschulen<br />
weisen allesamt in den Ingenieurwissenschaften und den angewandten Naturwissenschaften<br />
ein breites Fächerspektrum auf. Hingegen liegt der Fokus der mit<br />
22
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
knapp 5.000 Studenten deutlich kleineren Hochschule Fulda auf den Fachgebieten<br />
Lebensmitteltechnologie, Ökotrophologie sowie Pflege und Gesundheit.<br />
Um detaillierte Angaben zu den fachlichen Schwerpunkten der hessischen Hochschulen<br />
zu gewinnen, lässt sich auf Berechnungen des Hessischen Statistischen<br />
Landesamtes zurückgreifen. Untersucht wurde die Verteilung hessischer Studenten<br />
auf einzelne Hochschulen bzw. Studiengänge, deren Bezeichnung und Curriculum<br />
direkt auf Querschnittstechnologien basieren (vgl. Tabelle 5).<br />
Die hierbei gewonnenen Ergebnisse spiegeln die Kompetenzfelder der berücksichtigten<br />
Hochschulen ansatzweise wider. Beispielsweise ist die hohe Bedeutung der<br />
Medizin an den Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg ersichtlich, während<br />
die Hochschule Fulda stark durch die Haushalts- und Ernährungswissenschaften<br />
geprägt ist.<br />
In den vorstehenden Ausführungen wurde auf das Personal und die Studenten an<br />
den hessischen Hochschulen eingegangen. Hieraus ließen sich Rückschlüsse auf<br />
die fachlichen Schwerpunkte der einzelnen Hochschulen ziehen. Nachfolgend soll<br />
untersucht werden, inwieweit sich die Strukturen der Forschungslandschaft in den<br />
wissenschaftlichen Leistungen niederschlagen. Untersucht werden hierzu unter anderem<br />
die Einwerbung von Drittmitteln und die Publikationstätigkeit.<br />
23
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Tabelle 5:<br />
Studenten an den hessischen Universitäten in ausgewählten Studiengängen<br />
im Sommersemester 2006<br />
Hochschule Studienfach 1) Studenten<br />
FH Frankfurt Produktionsmanagement und Automation 34<br />
FH Fulda Haushalts- und Ernährungswissenschaft 353<br />
FH Gießen-Friedberg Fertigungs-/Produktionstechnik / CIM-Techniken 2<br />
FH Gießen-Friedberg Gesundheitstechnik/ Krankenhaus- u. Medizintechnik / Körperpflege 4<br />
FH Gießen-Friedberg KMU Biotechnologie 132<br />
FH Gießen-Friedberg Medizintechnik 293<br />
FH Gießen-Friedberg Umwelttechnik / Umweltmesstechnik 184<br />
FH Wiesbaden Umweltmanagement und Strukturplanung in Ballungsräumen (UMIB) 21<br />
FH Wiesbaden Umwelttechnik / Umweltmesstechnik 190<br />
Hochschule Darmstadt Biotechnologie 213<br />
Hochschule Darmstadt Optotechnik und Bildverarbeitung 246<br />
TU Darmstadt Gesundheitstechnik / Krankenhaus- u. Medizintechnik / Körperpflege 32<br />
U Frankfurt Medizin (Allg.-Medizin) 2.558<br />
U Frankfurt Theoretische Medizin 6<br />
U Frankfurt Zahnmedizin 542<br />
U Gießen Agrarökonomie 9<br />
U Gießen Agrarwissenschaft/Landwirtschaft 420<br />
U Gießen Ernährungsökonomie 20<br />
U Gießen Ernährungswissenschaft 209<br />
U Gießen Haushalts- und Ernährungswissenschaft 1.122<br />
U Gießen Medizin (Allg.-Medizin) 2.368<br />
U Gießen Umwelt- und Ressourcenmanagement 10<br />
U Gießen Zahnmedizin 390<br />
U Kassel Agrarwissenschaft / Landwirtschaft 11<br />
U Kassel Nanostrukturwissenschaft 106<br />
U Kassel Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelttechnik 45<br />
U Marburg Medizin (Allg.-Medizin) 2.174<br />
U Marburg Zahnmedizin 346<br />
1)<br />
Berücksichtigt sind nur Studiengänge, die sich explizit auf Querschnittstechnologien beziehen. Somit sind keine Studiengänge erfasst, die<br />
Segmente aus Querschnittstechnologien als Wahlbereiche enthalten. Dies betrifft insbesondere die „klassischen“ Ingenieurwissenschaften<br />
wie etwa Maschinenbau und Elektrotechnik, und dies an der TU Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, der FH Frankfurt, der Fachhochschule<br />
Gießen-Friedberg, der Hochschule Fulda und der FH Wiesbaden.<br />
Quelle: HSL (2007).<br />
24
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
4 Merkmale der Forschungsaktivitäten im Bereich ausgewählter Querschnittstechnologien<br />
4.1 Einwerbung von Drittmitteln<br />
Ein bedeutender Indikator für die Forschungsaktivitäten an einer Hochschule ist das<br />
Volumen der eingeworbenen Drittmittel. Diesbezüglich sollen zunächst die aggregierten<br />
Drittmitteleinnahmen betrachtet werden. In Hinsicht auf die gesamten Drittmitteleinnahmen<br />
werden beachtliche Differenzen zwischen den hessischen Universitäten<br />
deutlich. Im Zeitraum 2001 bis 2003 konnte die Universität Frankfurt<br />
Drittmittel im Gesamtumfang von 185 Mio. Euro akquirieren. Die TU Darmstadt kam<br />
auf 166 Mio. Euro, die Universität Gießen auf 120 Mio. Euro und die Universität<br />
Marburg auf 104 Mio. Euro. An der Universität Kassel schließlich belief sich das Gesamtvolumen<br />
der Drittmittel auf 60 Mio. Euro.<br />
Tabelle 6: Von den hessischen Universitäten eingeworbene Drittmittel<br />
DFG-Bewilligungen, 2002 bis 2004, aggregierte<br />
Drittmittel bezogen auf Gesamtzeiträume 1)<br />
Kooperative Forschungsprogramme der DFG, 2002 bis 2004<br />
Hochschule Mio. Euro Rang in D<br />
je Prof.,<br />
Tsd. Euro<br />
je Wiss.,<br />
Tsd. Euro Anzahl der Beteiligungen Anzahl der Partnereinrichtungen<br />
TU Darmstadt 53,8 25 200 25 35 56<br />
U Frankfurt 66,5 20 141 19 37 37<br />
U Gießen 50,4 26 138 16 33 51<br />
U Kassel 2) 10,5 61 38 11<br />
U Marburg 50,3 27 138 19 28 47<br />
Direkte FuE-Projektförderung des<br />
Bundes, 2002 bis 2004 1)<br />
FuE-Förderung im 6. FRP der EU,<br />
Stand Januar 2006 1)<br />
Drittmitteleinahmen laut statistischem<br />
Bundesamt, 2001 bis 2003 1)<br />
Hochschule<br />
Mio. Euro<br />
je Prof.,<br />
Tsd. Euro<br />
je Wiss.,<br />
Tsd. Euro<br />
Mio. Euro<br />
je Prof.,<br />
Tsd. Euro<br />
je Wiss., Aggregierte Einnahmen<br />
Tsd. Euro Mio. Euro Rang in D<br />
je Prof.,<br />
Tsd. Euro<br />
je Wiss.,<br />
Tsd. Euro<br />
TU Darmstadt 18,2 68 8 11,6 43 6 165,8 26 616 75<br />
U Frankfurt 13,8 29 4 15,7 33 5 184,5 20 392 52<br />
U Gießen 15,2 42 5 9,1 25 3 120,7 31 331 38<br />
U Kassel 2) 0 0 60,0 49 214 62<br />
U Marburg 18,8 52 7 5,5 15 2 104,1 37 281 37<br />
1)<br />
jeweils aggregierte Drittmittel, bezogen auf Gesamtzeiträume.<br />
2)<br />
Für die Universität Kassel sind nur punktuelle Angaben verfügbar. Insgesamt waren 84 Hochschulen in die Betrachtung miteinbezogen.<br />
Quelle: DFG (2006).<br />
Was das aggregierte Volumen der DFG-Drittmittel anbelangt, so wurden im Zeitraum<br />
2002 bis 2004 der Universität Frankfurt von der DFG Drittmittel in einem Gesamtumfang<br />
von 67 Mio. Euro bewilligt. Bezüglich des Drittmittelvolumens lag sie<br />
25
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
somit innerhalb des Bundesgebiets unter 84 berücksichtigten Hochschulen auf<br />
Rang 20.<br />
Der Vergleichswert für die TU Darmstadt beläuft sich auf 54 Mio. Euro, was innerhalb<br />
der Auflistung Rang 25 impliziert. Die Universität Gießen und die Universität<br />
Marburg liegen mit jeweils gut 50 Mio. Euro (Rang 26 bzw. 27) sehr nahe beieinander.<br />
Die Universität Kassel konnte ein DFG-Fördervolumen von 11 Mio. Euro auf<br />
sich vereinen. Die Fördermittel, die aus der direkten Projektförderung des Bundes<br />
bzw. dem Sechsten Forschungsrahmenplan der EU resultieren, machen an sämtlichen<br />
hessischen Universitäten nur einen vergleichsweise geringen Anteil an den<br />
Drittmitteln aus (vgl. Tabelle 6).<br />
Je Professor weist die TU Darmstadt mit 200.000 Euro das höchste DFG-Drittmittelvolumen<br />
auf, gefolgt von der Universität Frankfurt mit 141.000 Euro. Die Universität<br />
Gießen und die Universität Marburg liegen mit jeweils 138.000 Euro wiederum in<br />
etwa gleichauf. Für die Universität Kassel ergibt sich ein Vergleichswert von<br />
38.000 Euro, der nicht zuletzt in der tradierten Struktur dieser Hochschule begründet<br />
liegt.<br />
Bei derartigen Vergleichen sind allerdings die spezifischen Gegebenheiten an den<br />
einzelnen Universitäten zu berücksichtigen. Während etwa an der Universität Frankfurt<br />
und der Universität Marburg die Fachgebiete Medizin und Pharmazie wie auch<br />
die Naturwissenschaften ein bedeutendes Drittmittelvolumen auf sich vereinen, entfällt<br />
an der Universität Gießen ein besonders umfangreicher Teil der Drittmittel auf<br />
die Fachgebiete Medizin, Veterinärmedizin und Agrarwissenschaften. Für die TU<br />
Darmstadt sind hier hingegen die technischen Fächer und die Informatik von eminenter<br />
Bedeutung.<br />
Das an den Hochschulen verankerte inhaltliche Spektrum spiegelt sich auch in der<br />
Förderung einzelner Fächergruppen durch die DFG wider (vgl. Tabelle 7). In den<br />
Lebenswissenschaften wurde den Universitäten Frankfurt, Marburg und Gießen<br />
während des Zeitraums 2002 bis 2004 von der DFG eine ähnlich hohe Forschungsförderung<br />
bewilligt. Hinsichtlich der Naturwissenschaften zeigen sich hingegen beachtliche<br />
Differenzen, denn die Universität Frankfurt konnte in dieser Fächergruppe<br />
ein merklich höheres Fördervolumen auf sich vereinen als die Universitäten Marburg<br />
und Gießen.<br />
Im Hinblick auf die Drittmittelvolumina in einzelnen Fachgebieten schärfen sich die<br />
Forschungsprofile der hessischen Universitäten (vgl. Tabelle 7). Nimmt man die gesamten<br />
Drittmitteleinnahmen zum Maßstab, so verdeutlichen sich die fachlichen<br />
Schwerpunkte der Universität Frankfurt ebenso wie der Universität Marburg auf den<br />
Naturwissenschaften und der TU Darmstadt auf den Ingenieurwissenschaften und<br />
Werkstoffwissenschaften.<br />
26
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Tabelle 7: Struktur der eingeworbenen Drittmittel im Hinblick auf die DFG-Fachgebiete<br />
Aggregierte Drittmitteleinnahmen 2001 bis 2003, Mio. Euro<br />
Gesamt DFG-Fachgebiet 1)<br />
Hochschule Betrag Rang in D GEI SOZ BIO MED AGR CHE PHY MAT GEO MVW ELE BAU<br />
keine<br />
Zuordn.<br />
TU Darmstadt 165,8 26 1,9 5,1 5,6 8,8 16,3 1,8 16,1 48,3 29,2 21,3 11,5<br />
U Frankfurt 184,5 20 18,9 17,1 8,9 100,2 8,7 12,9 0,8 5,7 1,3 10,0<br />
U Gießen 120,7 31 7,5 6,0 11,3 54,2 24,0 2,1 9,6 0,5 1,2 0,02 4,4<br />
U Kassel 60,0 49 2,1 5,9 0,6 8,3 0,5 4,0 0,6 0,01 11,0 10,5 9,3 7,2<br />
U Marburg 104,1 37 9,0 9,4 11,2 50,5 9,0 4,7 1,9 2,6 0,7 5,2<br />
Aggregierte Drittmittel aus DFG-Bewilligungen 2002 bis 2004, Mio. Euro<br />
Gesamt DFG-Fachgebiet 1)<br />
Hochschule Betrag Rang in D GEI SOZ BIO MED AGR CHE PHY MAT GEO MAS WAE WER ELE BAU<br />
TU Darmstadt 53,8 25 0,01 2,4 3,9 0,7 0,3 3,1 5,4 1,0 1,5 9,5 9,4 7,4 7,2 1,9<br />
U Frankfurt 66,5 20 12,4 7,8 18,1 13,9 4,3 4,3 1,1 3,5 0,1 0,1 0,8<br />
U Gießen 50,4 26 7,2 4,3 9,1 13,8 10,6 2,3 2,5 0,2 0,4<br />
U Kassel 10,5 61 0,6 1,5 0,6 0,3 0,9 0,2 1,5 0,2 0,2 1,5 0,1 1,3 0,5 1,1<br />
U Marburg 50,3 27 4,0 3,8 13,7 18,2 0,2 2,5 4,8 0,3 1,6 0,1 1,0<br />
1)<br />
Hierbei handelt es sich um die folgenden Fachgebiete:<br />
GEI: Geisteswissenschaften; SOZ: Sozial- und Verhaltenswissenschaften; BIO: Biologie; MED: Medizin; AGR: Tiermedizin, Agrar- und<br />
Forstwissenschaften; CHE: Chemie; PHY: Physik; MAT: Mathematik; GEO: Geowissenschaften; MAS: Maschinenbau und Produktionstechnik;<br />
WAE: Wärmetechnik und Verfahrenstechnik; WER: Werkstoffwissenschaften; ELE: Elektrotechnik, Informatik und Systemtechnik;<br />
BAU: Bauwesen und Architektur.<br />
Aufgrund von Abgrenzungsproblemen wurden in Hinsicht auf die gesamten Drittmittel die Fachgebiete MAS (Maschinenbau und Produktionstechnik),<br />
WAE (Wärmetechnik und Verfahrenstechnik) sowie WER (Werkstoffwissenschaften) zur Kategorie MVW) (Maschinenbau,<br />
Verfahrenstechnik und Werkstoffwissenschaften) zusammengefasst. Insgesamt waren 84 Hochschulen in die Betrachtung miteinbezogen.<br />
Quelle: DFG (2006).<br />
Die Universität Gießen zeichnet sich demgegenüber durch ein hohes Gewicht der<br />
Drittmitteleinwerbung in den Agrarwissenschaften und der Tiermedizin aus. Analoge<br />
Differenzierungen zeigen sich auch bei einer isolierten Betrachtung der DFG-<br />
Förderung.<br />
27
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
4.2 Publikationen und Innovationen<br />
Ein weiterer wichtiger Indikator für die Forschungstätigkeit in einer wissenschaftlichen<br />
Einrichtung ist die Zahl der Publikationen. Aufschlussreiche Angaben zu dieser<br />
Thematik liefern die Veröffentlichungen des Zentrums für Hochschulentwicklung<br />
(CHE). Aufgrund der Datengrundlage finden nachfolgend allerdings nicht Querschnittstechnologien,<br />
sondern Einzeldisziplinen Berücksichtigung (vgl. Tabelle 8).<br />
Tabelle 8: Publikationen an den hessischen Universitäten 2002 bis 2004<br />
Pro Jahr<br />
BIOLOGIE<br />
Publikationen<br />
Hochschule Anzahl Rang in D<br />
Je Wissenschaftler<br />
CHEMIE<br />
Publikationen<br />
Zitationen<br />
je Publi-<br />
Pro Jahr<br />
Je Wissenkation<br />
Anzahl Rang in D schaftler<br />
Zitationen<br />
je Publikation<br />
TU Darmstadt 41 35 6,9 6,8 55 42 6,9 4,4<br />
U Frankfurt 79 21 5,8 8,4 93 28 10,3 8,9<br />
U Gießen 60 26 6,2 8,3 34 49 12,6 8,1<br />
U Kassel 18 47 2,8 5,7<br />
U Marburg 53 29 6,2 7,1 144 12 16,6 6,6<br />
Pro Jahr<br />
PHYSIK<br />
Publikationen<br />
Hochschule Anzahl Rang in D<br />
Je Wissenschaftler<br />
TU Darmstadt 158 18 12,5 6,2<br />
P<strong>HA</strong>RMAZIE<br />
Publikationen<br />
Zitationen<br />
je Publi-<br />
Pro Jahr<br />
Je Wissenkation<br />
Anzahl Rang in D schaftler<br />
Zitationen<br />
je Publikation<br />
U Frankfurt 147 22 10,5 7,3 63 2 12,5 7,0<br />
U Gießen 124 29 14,3 6,5<br />
U Kassel 58 50 14,5 4,7<br />
U Marburg 83 40 10,4 5,0 58 3 10,9 11,3<br />
Pro Jahr<br />
MEDIZIN<br />
Publikationen<br />
Hochschule Anzahl Rang in D<br />
Je Wissenschaftler<br />
ZAHNMEDIZIN<br />
Publikationen<br />
Zitationen<br />
je Publi-<br />
Pro Jahr<br />
Je Wissenkation<br />
Anzahl Rang in D schaftler<br />
Zitationen<br />
je Publikation<br />
U Frankfurt 560 9 20,3 9,1 10,3 17 6,2 2,9<br />
U Gießen 305 32 14,5 5,7 10,0 18 3,8 1,8<br />
U Marburg 397 21 15,9 7,6 4,3 26 2,2 2,2<br />
Quelle: CHE (2006).<br />
Untersucht wurde die Zahl der Publikationen je Jahr bzw. je Wissenschaftler in den<br />
Disziplinen Biologie, Chemie und Physik sowie Pharmazie, Medizin und Zahnmedizin.<br />
Im bundesweiten Vergleich finden sich die hessischen Universitäten in nahezu<br />
sämtlichen der hier betrachteten Fachgebiete durchgehend im (gehobenen) Mittel-<br />
28
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
feld wieder. Insbesondere sind die Spitzenplätze der Universitäten Frankfurt und<br />
Marburg in der Pharmazie hervorzuheben.<br />
Die Innovationskraft und Forschungsstärke einer Hochschule lässt sich zudem an<br />
getätigten Erfindungen und erwirkten Patenten ablesen (vgl. Tabelle 9). Diesbezüglich<br />
fällt auf, dass die TU Darmstadt in der Fächergruppe Maschinenbau<br />
/ Verfahrenstechnik innerhalb der Bundesrepublik eine hervorragende Position einnimmt.<br />
Hinsichtlich der Pharmazie zeichnen sich wiederum die Universitäten Frankfurt<br />
und Marburg durch eine herausragende Forschungskompetenz aus. Die Universität<br />
Kassel konnten demgegenüber in der Physik besonders zahlreiche Patente erwirken.<br />
Tabelle 9: Erfindungen 1) und Patente 1) an den hessischen Universitäten<br />
BIOLOGIE CHEMIE PHYSIK<br />
Erfindungen (2002 bis 2004) Erfindungen (2002 bis 2004) Erfindungen (2002 bis 2004)<br />
Pro Jahr Je Wissen- Pro Jahr Je 10 Wissen Pro Jahr Je Wissen-<br />
Hochschule Anzahl Rang in D schaftler Anzahl Rang in D schaftler Anzahl Rang in D schaftler<br />
TU Darmstadt 0,0 48 0 4,7 21 0,66 1,0 41 0,11<br />
U Frankfurt 0,7 35 0,09 0,3 51 0,04 4,7 13 0,52<br />
U Gießen 1,7 22 0,28 1,7 45 0,43 0,7 43 0,15<br />
U Kassel 0,3 44 0,12 7,7 4 3,03<br />
U Marburg 1,0 31 0,18 5,3 15 1,34 2,7 27 0,58<br />
MEDIZIN<br />
P<strong>HA</strong>RMAZIE<br />
Erfindungen (2002 bis 2004) Erfindungen (2002 bis 2004)<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D<br />
Je Wissen- Pro Jahr<br />
schaftler Anzahl Rang in D<br />
Je 10 Wissenschaftler<br />
U Frankfurt 7,7 25 0,10 2,3 5 0,48<br />
U Gießen 3,3 33 0,03<br />
U Marburg 14,0 12 0,14 2,0 7 0,32<br />
MASCHINENBAU / VERFAHRENSTECHNIK<br />
ELEKTRO- UND INFORMATIONS-<br />
TECHNIK<br />
Patente (1998 bis 2001) Patente (1998 bis 2001)<br />
Pro Jahr<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D Je Professor Anzahl Rang in D Je Professor<br />
TU Darmstadt 23 3 4,0 8 14 1,3<br />
U Kassel 3 27 0,5 5 22 1,2<br />
1)<br />
Jeweils bezogen auf den gesamten Betrachtungszeitraum.<br />
Quelle: CHE (2006).<br />
29
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
4.3 Dissertationen und Habilitationen<br />
Die Anzahl der abgeschlossenen Dissertationen und Habilitationen bildet in mehrfacher<br />
Hinsicht einen Indikator für die Leistungen, die an einer Forschungsinstitution<br />
erbracht werden. Nachfolgend wird zunächst auf die Dissertationen eingegangen<br />
(vgl. Tabelle 10).<br />
Tabelle 10: Promotionen 1) an den hessischen Universitäten<br />
SoSe 2002 bis WS 2004/2005: BIOLOGIE CHEMIE<br />
Pro Jahr<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D Je Professor Anzahl Rang in D Je Professor<br />
TU Darmstadt 18 35 1,3 23 29 1,4<br />
U Frankfurt 34 22 1,2 23 28 1,7<br />
U Gießen 32 23 1,5 6 50 0,7<br />
U Kassel 8 46 0,7<br />
U Marburg 43 16 2,0 24 27 1,1<br />
SoSe 2002 bis WS 2004/2005: PHYSIK P<strong>HA</strong>RMAZIE<br />
Pro Jahr<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D Je Professor Anzahl Rang in D Je Professor<br />
TU Darmstadt 21 29 1,0<br />
U Frankfurt 24 23 0,8 26 2 2,6<br />
U Gießen 17 34 1,2<br />
U Kassel 9 49 0,9<br />
U Marburg 17 33 0,9 25 3 1,8<br />
SoSe 2001 bis WS 2002 / 2003: MASCHINENBAU / VERFAHRENSTECHNIK<br />
ELEKTRO- UND INFORMATIONSTECHNIK<br />
Pro Jahr<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D Je Professor Anzahl Rang in D Je Professor<br />
TU Darmstadt 48 10 2,1 32 4 1,5<br />
U Kassel 11 26 0,5 6 25 0,4<br />
SoSe 2002 bis WS 2004/2005: MEDIZIN ZAHNMEDIZIN<br />
Pro Jahr<br />
Pro Jahr<br />
Hochschule Anzahl Rang in D Je Professor Anzahl Rang in D Je Professor<br />
U Frankfurt 153 22 1,9 26 20 5,1<br />
U Gießen 138 28 1,4 31 15 3,9<br />
U Marburg 145 24 1,5 32 14 4,6<br />
1)<br />
Jeweils bezogen auf den gesamten Betrachtungszeitraum.<br />
Quelle: CHE (2006).<br />
Aus der Anzahl der Dissertationen lässt sich unter anderem auf die Förderung des<br />
wissenschaftlichen Nachwuchses schließen. Die Betreuung von Dissertationen<br />
30
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
ist für den betreffenden Hochschullehrer zeitintensiv und erfordert ein vielseitiges<br />
Engagement, das häufig weit über die eigentliche Forschungsarbeit hinausgeht. Zudem<br />
eröffnet der hier untersuchte Indikator Einblicke in die erbrachten Forschungsleistungen<br />
und die Einwerbung von Drittmitteln. Sehr häufig werden die in Dissertationen<br />
enthaltenen Forschungsergebnisse nämlich auch in wissenschaftlichen<br />
Fachzeitschriften publiziert. In besonderer Weise gilt dies für kumulative Dissertationen,<br />
die bereits veröffentlichte Artikel umfassen. Der Publikationstätigkeit wird wiederum<br />
von Förderinstitutionen wie etwa der DFG oder der Volkswagen-Stiftung bei<br />
der Bewilligung von Drittmitteln eine hohe Bedeutung zugemessen.<br />
Zu den abgeschlossenen Promotionsvorhaben liegt in Bezug auf die Querschnittstechnologien<br />
kein konkretes Datenmaterial vor, so dass auf die Angaben des<br />
Centrums für Hochschulentwicklung zu einzelnen Fachgebieten zurückgegriffen<br />
wird. Im Kontext des jeweiligen fachlichen Spektrums spielt an den hessischen Universitäten<br />
die Betreuung von Doktoranden in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen<br />
eine unterschiedliche Rolle. Was die absolute Zahl der jährlich abgeschlossenen<br />
Promotionsvorhaben angeht, so ragt hinsichtlich der Biologie die Universität<br />
Marburg besonders hervor, während bezüglich der Chemie die TU Darmstadt sowie<br />
die Universität Frankfurt und die Universität Marburg in etwa gleichauf liegen. Im<br />
Hinblick auf die Pharmazie gilt dies für die Universität Frankfurt und die Universität<br />
Marburg, die beide im konkreten Fall innerhalb des Bundesgebiets eine herausragende<br />
Position einnehmen.<br />
Im Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Informatik sind zwischen der<br />
TU Darmstadt und der Universität Kassel beachtliche Differenzen festzustellen. Dies<br />
gilt sowohl für die absolute Zahl der Dissertationen als auch für die Dissertationen je<br />
Lehrstuhlinhaber.<br />
Zur medizinischen Forschung tragen an den betreffenden hessischen Universitäten<br />
zahlreiche Dissertationen bei. In Bezug auf die jährliche Anzahl der Dissertationen<br />
weisen die Universitäten Frankfurt, Marburg und Gießen sehr ähnliche Größenordnungen<br />
auf und nehmen diesbezüglich unter den deutschen Universitäten einen<br />
mittleren Rang ein.<br />
Beim Vergleich zwischen den verschiedenen Fachrichtungen ist zu beachten, dass<br />
in einigen der hier untersuchten Disziplinen – so etwa in der Physik oder den Ingenieurwissenschaften<br />
– nur eine Minderheit der Studienabsolventen eine – zu einem<br />
Doktortitel führende – weitere wissenschaftliche Tätigkeit anstrebt. Demgegenüber<br />
findet die Promotion in anderen Fächern – beispielsweise in der Chemie und Biologie<br />
– eine sehr weite Verbreitung; in der Medizin und Zahnmedizin bildet sie gar die<br />
Regel.<br />
Aus den Angaben über die an einer Forschungseinrichtung abgeschlossenen Habilitationsverfahren<br />
lassen sich ebenfalls Rückschlüsse über die Forschungstätigkeit<br />
31
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
ziehen. Diese wird insbesondere über einschlägige Publikationen in wissenschaftlichen<br />
Zeitschriften dokumentiert, was mittlerweile in den meisten Disziplinen ein<br />
maßgebliches Kriterium für die Zulassung zur Habilitation darstellt. Neben der Habilitation<br />
eröffnet die Forschungs- und Lehrtätigkeit im Rahmen einer Juniorprofessur<br />
einen weiteren Zugang zur Hochschullehrerlaufbahn. Auch in den naturwissenschaftlichen<br />
und ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten wurden in jüngerer Zeit<br />
an den hessischen Universitäten zahlreiche Juniorprofessuren eingerichtet.<br />
Auch im Hinblick auf abgeschlossene Habilitationen liegen keine Daten zu den<br />
Querschnittstechnologien vor, weswegen die Angaben des Hessischen Statistischen<br />
Landesamtes zu ausgewählten Disziplinen herangezogen werden. Hieraus<br />
wird deutlich, dass im Jahre 2004 in den Naturwissenschaften an der TU Darmstadt<br />
und der Universität Frankfurt vergleichsweise viele Habilitationsverfahren erfolgreich<br />
abgeschlossen wurden (vgl. Tabelle 11).<br />
Tabelle 11: Erfolgreich abgeschlossene Habilitationen an den hessischen Universitäten 2004<br />
MATHEMATIK, NATURWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN<br />
HUMANMEDIZIN / GESUNDHEITSWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN<br />
Insgesamt<br />
darunter Physik<br />
Insgesamt<br />
Darunter Klinisch-Praktische<br />
Hochschule<br />
Astronomie<br />
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin)<br />
TU Darmstadt 15 5<br />
U Frankfurt 14 2 18 13<br />
U Gießen 4 2 11 6<br />
U Kassel 2 2 15 6<br />
U Marburg 7 1<br />
VETERINÄRMEDIZIN<br />
AGRAR-, FORST- UND ERNÄHRUNGSWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN<br />
Insgesamt<br />
darunter Vorklinische<br />
Insgesamt<br />
Darunter Agrarwissenschaften<br />
Hochschule<br />
Veterinärmedizin<br />
Lebensmittel- und Getränketechnologie<br />
U Gießen 3 2 4 2<br />
U Kassel 1 1<br />
INGENIEURWISSENSC<strong>HA</strong>FTEN<br />
Insgesamt<br />
darunter<br />
Hochschule<br />
Architektur<br />
TU Darmstadt 5 2<br />
U Kassel<br />
Quelle: HSL (2005).<br />
Was die Humanmedizin betrifft, so weist in dieser Disziplin die Universität Frankfurt<br />
die höchste Anzahl von Habilitationen auf, gefolgt von der Universität Marburg und<br />
von der Universität Gießen. Verglichen mit den Naturwissenschaften und der Humanmedizin<br />
wurden in der Veterinärmedizin, den Agrar- und Ernährungswissen-<br />
32
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
schaften wie auch in den Ingenieurwissenschaften nur wenige Habilitationsverfahren<br />
abgeschlossen.<br />
Die vorstehenden Ausführungen lassen zwar im Hinblick auf die Querschnittstechnologien<br />
nur punktuelle Schlussfolgerungen zu, sie ermöglichen jedoch erste Aussagen<br />
darüber, welche Bedeutung an den einzelnen Fachdisziplinen die Förderung<br />
des wissenschaftlichen Nachwuchses hat. Bezüglich der Anzahl der abgeschlossenen<br />
Promotionen liegen die hessischen Universitäten in den hier untersuchten Disziplinen<br />
innerhalb des Bundesgebietes zum weit überwiegenden Teil im gehobenen<br />
Mittelfeld und vereinzelt in der Spitzengruppe. Im Folgenden soll nun untersucht<br />
werden, wie sich die Forschungsleistungen konkret hinsichtlich ausgewählter Fachgebiete<br />
wie auch wissenschaftlicher Institutionen gestalten.<br />
33
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
34
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
5 Facetten der hessischen Forschungslandschaft<br />
Im Hinblick auf ausgewählte Querschnittstechnologien werden nachfolgend<br />
27 Einzelporträts exemplarischer Fachgebiete vorgestellt, deren Auswahl insbesondere<br />
anhand fachlicher Kriterien getroffen wurde. Zudem sollte eine möglichst weitgehende<br />
Berücksichtigung sämtlicher hessischer Hochschulstandorte gewährleistet<br />
sein. Bei der Auswertung der Expertengespräche wird ein Bild der Forschungsinstitutionen<br />
der Gesprächspartner mit den Kompetenzen und vielfältigen Vernetzungen<br />
gezeichnet, es werden aber auch Aussagen zu fachlichen Trends und Handlungsansätzen<br />
für die Stärkung der Forschungsfelder getroffen.<br />
5.1 Energietechnologien<br />
5.1.1 Konventionelle Energietechnologien / Kraftwerkstechnik<br />
Übersicht 1: Kurzprofil des Fachgebietes Konventionelle Energietechnologien / Kraftwerkstechnik<br />
Untersuchungsaspekte<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Grundlagenforschung wie auch anwendungsorientierte Forschung.<br />
• Die Hälfte der Drittmittel von Industriepartnern, ein weiteres Viertel jeweils von<br />
der DFG bzw. weiteren Förderinstitutionen.<br />
Anwendungsbereiche • Simulation und Optimierung von Prozessen in komplexen Energiesystemen.<br />
• Entwicklung und Anwendung moderner Lasermesstechnik zur Diagnostik in<br />
Flammen.<br />
Technologiefeld • Dezidierte mathematische Ausrichtung.<br />
• Arbeitsgruppe zählt innerhalb ihres Fachgebietes zu den fünf<br />
forschungsstärksten Einrichtungen in Europa.<br />
• Im Bereich der Simulation und Validierung von Verbrennungssystemen laut<br />
einem Gutachter der DFG innerhalb des Bundesgebietes die führende<br />
Forschungsstelle; weltweit unter den drei leistungsstärksten<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Partizpation am DFG-Sonderforschungsbereich 568 „Strömung und<br />
Verbrennung in zukünftigen Gasturbinenbrennkammern“, am<br />
Graduiertenkolleg 853 „Modellierung, Simulation und Optimierung von<br />
Ingenieuranwendungen“, am Projektverbund COORETEC – CO2 Reduction<br />
Technologies und am TU Darmstadt Energy Center sowie an der DFG-<br />
Forschergruppe 486 „Verbrennungslärm“.<br />
• Kooperationen u.a. mit Rolls Royce, Porsche, BMW, Fluent Deutschland,<br />
Bosch-Rexroth und der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen -<br />
FVV.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Erhaltung der sehr leistungsfähigen Forschungsgrundausstattung.<br />
• Forschungsförderung in <strong>Hessen</strong> zu wenig auf Kooperationen mit<br />
Industriepartnern zugeschnitten.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
35
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Gespräch wurde mit dem Leiter des Fachgebietes Energie- und Kraftwerkstechnik<br />
geführt, das am Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt angesiedelt<br />
ist. Die Arbeitsgruppe umfasst etwa 30 Mitarbeiter, von denen zwei als habilitierte<br />
Wissenschaftler über eine Dauerstelle verfügen. Der Gesprächsteilnehmer misst<br />
mittelfristigen Beschäftigungsperspektiven für die Mitarbeiter eine herausragende<br />
Bedeutung zu und sieht sich diesbezüglich in der Verantwortung. Seiner<br />
Aussage nach bilden diese eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Nachwuchswissenschaftler<br />
ein attraktives Forschungsumfeld vorfinden. Im Fokus der Arbeiten<br />
am Fachgebiet stehen sowohl die Grundlagenforschung als auch die anwendungsorientierte<br />
Forschung. Fachliche Überschneidungen bestehen insbesondere<br />
mit anderen Teildisziplinen des Maschinenbaus wie auch mit der Physik,<br />
der Mathematik und den Materialwissenschaften.<br />
Die anwendungsorientierte Forschung zum Betrieb von Turbinen wird in weiten Teilen<br />
von den Herstellern betrieben. Grundsätzlich werden für den Industriestandort<br />
Deutschland langfristig große Potenziale vornehmlich in der Herstellung komplexer<br />
Systeme und weniger in der Produktion von Einzelkomponenten gesehen. Weltweit<br />
resultieren etwa 85 Prozent der erzeugten Energie aus Verbrennungsprozessen,<br />
weswegen Fragestellungen zum Wirkungsgrad der Energieerzeugung und zur<br />
Schadstoffreduzierung eine hohe Priorität zukommt. Dies gilt insbesondere für die<br />
Entwicklung von Gasturbinen und Motoren. Vor diesem Hintergrund umfassen die<br />
wissenschaftlichen Aktivitäten am Fachgebiet im Wesentlichen die Erforschung<br />
von Diffusions- und Vormischflammen wie auch die theoretische bzw. numerische<br />
Analyse von Verbrennungsvorgängen. Bedeutende Tätigkeitsfelder liegen<br />
in der Simulation und Optimierung von Prozessen in komplexen Energiesystemen<br />
wie auch in der Entwicklung und Anwendung moderner Lasermesstechnik<br />
zur Diagnostik in Flammen. Die Forschung beinhaltet in weiten Teilen methodische<br />
Fragestelllungen wie etwa die Herleitung von Lösungsalgorithmen und hat<br />
daher eine dezidierte mathematische Ausrichtung.<br />
Laut Einschätzung des befragten Fachvertreters existieren innerhalb des Bundesgebietes<br />
etwa zehn Lehrstühle, die sich im Kontext der Energie- und Kraftwerkstechnik<br />
vornehmlich mit Verbrennungsprozessen befassen. Ungefähr zwei bis vier<br />
der betreffenden Arbeitsgruppen – hierunter auch diejenige des Gesprächspartners<br />
– zeichnen sich sowohl im nationalern als auch im internationalen Vergleich durch<br />
besonders herausragende Forschungsleistungen aus. In Europa gehört die Arbeitsgruppe<br />
innerhalb ihres Fachgebietes zu den fünf forschungsstärksten Einrichtungen.<br />
Laut einem Gutachter der DFG ist die Arbeitsgruppe innerhalb des Bundesgebietes<br />
die führende Forschungsstelle im Bereich der Simulation und Validierung von<br />
Verbrennungssystemen; weltweit befindet sie sich unter den drei leistungsstärksten<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
36
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Leistungsfähige Strukturen zur Erforschung von Verbrennungsprozessen finden sich<br />
insbesondere auch in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den USA. Während<br />
in Deutschland in diesem Fachgebiet die Universitäten die maßgeblichen Forschungsergebnisse<br />
erarbeiten, ist in den USA die diesbezügliche Forschung zum<br />
großen Teil an ausgiebig geförderten “National Labs“ angesiedelt; in Frankreich ist<br />
sie vornehmlich in den “Institutes Nationales“ lokalisiert. In die internationale Forschungs-Community<br />
ist die Arbeitsgruppe des Gesprächspartners vielfältig eingebunden.<br />
Im Rahmen der Grundausstattung trägt das Land <strong>Hessen</strong> mit einer jährlichen Summe<br />
von etwa 650.000 Euro zum Institutsbudget bei; hinzu kommen noch etwa<br />
1,4 Mio. Euro an Drittmitteln, deren Förderungsgrundlage vergleichsweise breit ist.<br />
Im Fachgebiet Energie- und Kraftwerkstechnik stammen 80 % der Drittmittel von der<br />
DFG, die verbleibenden 20 % entfallen auf Verbundforschung. Am Fachbereich Maschinenbau<br />
wird die Hälfte der Drittmittel von Industriepartnern bereitgestellt, ein<br />
weiteres Viertel stammt jeweils von der DFG bzw. weiteren Förderinstitutionen.<br />
Gleichwohl bezeichnet der Gesprächspartner die Drittmitteleinwerbung mit eigenen<br />
Worten als vergleichsweise „DFG-lastig“, was sich in mehreren Forschungsverbünden<br />
deutlich niederschlägt (vgl. Abbildung 2). So bekleidet der Gesprächspartner<br />
das Amt des Sprechers des DFG-Sonderforschungsbereiches 568 „Strömung<br />
und Verbrennung in zukünftigen Gasturbinenbrennkammern“, der insgesamt<br />
16 Teilprojekte umfasst. Daneben beteiligt sich die Arbeitsgruppe an der DFG-<br />
Forschergruppe 486 „Verbrennungslärm“, deren Sekretariat am Fachgebiet angesiedelt<br />
ist. Diese Forschergruppe umfasst Wissenschaftler aus den Technischen<br />
Universitäten in Karlsruhe, Dresden, München und Aachen. Weitere Partnerinstitutionen<br />
sind zwei Institute des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der<br />
Helmholtz-Gesellschaft) in Stuttgart und Berlin sowie die Technische Fachhochschule<br />
Berlin.<br />
Nachwuchswissenschaftlern werden über das Graduiertenkolleg 853 „Modellierung,<br />
Simulation und Optimierung von Ingenieuranwendungen“, an dem die<br />
Arbeitsgruppe beteiligt ist, vielfältige Forschungsperspektiven eröffnet. Der Gesprächspartner<br />
ist ferner Sprecher und Initiator des Graduiertenkollegs 1344 „Instationäre<br />
Systemmodellierung von Flugtriebwerken“, an dem auch Rolls<br />
Royce beteiligt ist. Der Bündelung der Forschungsaktivitäten zur Energieerzeugung<br />
und Energieeffizienz dient das TU Darmstadt Energy Center, das von Wissenschaftlern<br />
aus zwölf Fachbereichen getragen wird. Daneben engagiert sich der Gesprächspartner<br />
in der Arbeitsgruppe 3 des Projektverbundes COORETEC –<br />
CO 2 Reduction Technologies, das vom BMBF gefördert wird.<br />
37
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Abbildung 2: Vernetzung des Fachgebietes Energie- und Kraftwerkstechnik an der TU Darmstadt<br />
DFG-GK „Instationäre Systemmodellierung<br />
von Flugtriebwerken“<br />
DFG-SFB 568 „Strömung und Verbrennung in<br />
zukünftigen Gasturbinenbrennkammern“<br />
DFG-FG 486 „Verbrennungslärm“<br />
COORETEC<br />
TUD<br />
Energy Center<br />
Rolls Royce<br />
(UTC)<br />
BMW AG<br />
Energieund<br />
Kraftwerkstechnik<br />
DFG-GK 853<br />
„Modellierung,<br />
Simulation und<br />
Optimierung<br />
von Ingenieuranwendungen“<br />
Porsche<br />
Bosch-<br />
Rexroth<br />
AiF - Arbeitsgemeinschaft<br />
industrieller<br />
Forschungsvereinigungen<br />
Forschungsvereinigung<br />
Verbrennungskraftmaschinen<br />
- FVV<br />
Fluent<br />
Deutschland<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Ein weiteres bedeutsames Standbein ist das in einer Kooperation mit Rolls Royce<br />
an der Hochschule gegründete University Technology Center - UTC, das auf einer<br />
langjährigen Forschungskooperation aufbaut und gegenwärtig zwei Einzelprojekte<br />
zum Themenfeld “Future Design Methods and Laserdiagnostic Techniques for<br />
Applied Combustion Systems“ umfasst. Das UTC gehört zu einem weltweiten Forschungsnetzwerk,<br />
das die Fa. Rolls-Royce zusammen mit forschungsstarken Universitäten<br />
aufgebaut hat und an dem beispielsweise die Universitäten Cambridge<br />
und Oxford partizipieren. Im Bundesgebiet existieren lediglich noch zwei weitere<br />
derartige UTCs, und zwar an der TU Cottbus sowie an der TU Dresden.<br />
Mit Bosch-Rexroth kooperiert die Arbeitsgruppe im Rahmen eines Forschungsprojekts<br />
zum Thema „Laserbasierte Messmethoden zur Untersuchung zyklischer<br />
Schwankungen in motorischen Prozessen“. Eine intensive Zusammenarbeit besteht<br />
38
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
zudem mit der BMW AG und der Fluent Deutschland <strong>GmbH</strong>. Im Rahmen der letzteren<br />
Kooperation hat die Fa. Fluent der Arbeitsgruppe die Fördermittel für ein neues<br />
Laser-Labor zur Verfügung gestellt. Vielfältige Kontakte unterhält die Arbeitsgruppe<br />
zudem innerhalb der in Frankfurt angesiedelten Forschungsvereinigung<br />
Verbrennungskraftmaschinen - FVV, deren Mitgliederstamm 120 Unternehmen<br />
aus den Segmenten Automobilmotoren, Industriemotoren, Turbomaschinen und Zulieferer<br />
umfasst. Im Rahmen der FVV wird gegenwärtig in Kooperation mit der Fa.<br />
Porsche ein Forschungsvorhaben bearbeitet, das vom BMWI und der AiF -<br />
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen gefördert wird.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf die Forschungsbedingungen hebt der Gesprächsteilnehmer die sehr<br />
gute Grundausstattung am Fachgebiet hervor. Einen prioritären Handlungsbedarf<br />
sieht der Gesprächspartner gleichwohl in der baulichen Ausstattung der Universitäten.<br />
Über Jahrzehnte hinweg erfolgte zwar ein fortwährender Aufbau neuer Kapazitäten,<br />
aufgrund kameralistischer Prinzipien seien jedoch keine Abschreibungen vorgenommen<br />
worden. Im Ergebnis habe dies dazu geführt, dass die Erhaltung der<br />
Kapazitäten vernachlässigt worden sei.<br />
Die Forschungsaktivitäten an seiner Hochschule schätzt der Gesprächsteilnehmer<br />
differenziert ein; so bestünden in einigen Fachgebieten – etwa in den Materialwissenschaften<br />
und im Maschinenbau – deutlich profilierte Forschungsagglomerationen,<br />
während in anderen Fachgebieten die inhaltliche Verdichtung und Konturierung<br />
weniger stark ausgeprägt sei. Um die Forschungslandschaft am Standort Darmstadt<br />
zu bereichern, wäre nach Einschätzung des Gesprächspartners die Ansiedlung eines<br />
Max-Planck-Institutes sinnvoll. Die vom Land <strong>Hessen</strong> im Rahmen von spezifischen<br />
Programmen gewährte Forschungsförderung sei gerade im Hinblick auf<br />
Kooperationen mit der Industrie noch ausbaufähig. Dies gelte allerdings nicht allein<br />
für die eingesetzten Finanzmittel, sondern vor allem auch für die institutionelle Ausgestaltung<br />
und die Modalitäten der Förderung. Letztere sei in anderen Ländern<br />
weitaus besser auf die Bedürfnisse der Hochschulen wie auch der Privatunternehmen<br />
zugeschnitten.<br />
39
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.1.2 Brennstoffzellentechnik<br />
Übersicht 2: Kurzprofil des Fachgebietes Brennstoffzellentechnik an der FH Wiesbaden<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Anwendungsorientierte Forschung.<br />
• Drittmittel im Wesentlichen von Industriepartnern.<br />
Anwendungsbereiche • Entwicklung von Brennstoffzellensystemen mit dem Fokus auf AFC<br />
(alkalische Brennstoffzellen) und Hoch- bzw. Niedertemperatur-PEM<br />
(Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen).<br />
• Effizienzerhöhung und Gewährleistung der Sicherheit beim Einsatz<br />
von Wasserstoff.<br />
Technologiefeld • Anwendungsbereiche für die Brennstoffzelle insbesondere dort, wo<br />
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung unabdingbar ist.<br />
• Forschungsfragestellungen ergeben sich im Hinblick auf die<br />
eigentliche Brennstoffzelle, die mit der erzeugten Energie<br />
angetriebenen Antriebsaggregate und die Abspaltung des<br />
Wasserstoffes.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative <strong>Hessen</strong> als Netzwerk von<br />
Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit über<br />
30 Mitgliedern organisiert den Austausch zwischen Wissenschaft und<br />
Wirtschaft.<br />
• Involvierte Wissenschaftler zum überwiegenden Teil an der<br />
TU Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, der Universität Frankfurt<br />
und an den Fachhochschulen Frankfurt und Wiesbaden lokalisiert.<br />
• Industriepartner ebenfalls zum größten Teil in der Rhein-Main-Region<br />
ansässig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbearf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Die wissenschaftlichen Potenziale auf dem Gebiet der Wasserstoffund<br />
Brennstoffzellentechnologie müssen noch gezielter mit den<br />
Anwendungsbereichen in der Wirtschaft zusammen geführt werden.<br />
• Handlungsbedarf in der technischen Infrastruktur (Labore, EDV etc.)<br />
an den Hochschulen.<br />
• Anstrengungen zur Forcierung der Brennstoffzellentechnologie<br />
müssen noch verstärkt werden.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Die Gesprächspartnerin ist Inhaberin eines Lehrstuhls am Studienbereich Physik innerhalb<br />
des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften der FH Wiesbaden. Ihre Forschungsschwerpunkte<br />
liegen auf der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen mit<br />
dem Fokus auf AFC (alkalische Brennstoffzellen) und Hoch- bzw. Niedertemperatur-<br />
PEM (Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen) wie auch auf der Effizienzerhöhung<br />
und Gewährleistung der Sicherheit beim Einsatz von Wasserstoff. Die Ge-<br />
40
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
sprächsteilnehmerin misst der Brennstoffzellentechnologie im Hinblick auf die nähere<br />
Zukunft eine herausragende Bedeutung zu. Drei Aspekte sind hierbei von besonderer<br />
Relevanz: Die Klimaentwicklung, das wirtschaftliche Wachstum – insbesondere<br />
in zahlreichen Entwicklungsländern und Schwellenländern – wie auch die<br />
letztlich begrenzte Verfügbarkeit zahlreicher Rohstoffe. Vor diesem Hintergrund<br />
ist laut Aussage der Gesprächsteilnehmerin auf lange Sicht eine Fortentwicklung<br />
und Expansion der regenerativen Energietechnologien unabdingbar.<br />
Die Forschungsbedingungen am Lehrstuhl sind insbesondere durch eine geringe<br />
Personalausstattung gekennzeichnet. Weil an den Fachhochschulen kein akademischer<br />
Mittelbau existiert, sind der befragten Fachvertreterin lediglich anderthalb<br />
Stellen zugeordnet, hierunter eine volle Stelle zeitlich befristet und eine halbe Stelle<br />
auf Dauer. Die Gesprächspartnerin hat bereits mehrere Diplomarbeiten bzw. Bachelor-Arbeiten<br />
zur Brennstoffzellentechnologie betreut. Der Studienbereich Physik verfügt<br />
über ein mit verschiedenen Brennstoffzellen ausgestattetes Labor, das zum<br />
großen Teil über private Forschungsmittel finanziert wird. Die Drittmittel stammen<br />
überwiegend von Partnern, die in der Rhein-Main-Region ansässig sind. Es handelt<br />
sich hierbei vornehmlich um privatwirtschaftliche Unternehmen bzw. freie Träger.<br />
Im Wesentlichen fußt die Brennstoffzellentechnologie auf angewandter Forschung,<br />
welche die Umsetzung von Forschungsergebnissen in langfristig marktfähige<br />
Produkte zum Ziel hat. Die Bereitstellung des für die Brennstoffzellentechnologie<br />
notwendigen Wasserstoffes ist nach wie vor sehr kostenintensiv, allerdings fällt<br />
dieser bei zahlreichen Verarbeitungsprozessen als “By-Product“ an.<br />
Bedeutende Anwendungsbereiche für die Brennstoffzelle sieht die Gesprächspartnerin<br />
unter anderem in der Telekommunikation, im Überwachungs- und Sicherheitsbereich<br />
sowie im Brandschutz bzw. Katastrophenschutz, also überall dort, wo<br />
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung unabdingbar ist. Auch im Fahrzeugbau<br />
und in der Schiffstechnik ergeben sich vielfältige Anwendungsfelder. Grundsätzlich<br />
lässt sich zwischen vier verschiedenen Verwendungskategorien unterscheiden: Portable<br />
Systeme, mobile Systeme, Stationäre Systeme sowie Mikrosysteme.<br />
Derzeit handelt es sich zumeist noch um Nischenmärkte. Von Bedeutung ist zudem<br />
die Energiebilanz der Brennstoffzelle, denn der für diese Technologie benötigte<br />
Wasserstoff muss verfügbar gemacht werden, wofür wiederum Energie eingesetzt<br />
wird. In ökonomischer Hinsicht ist die Bereitstellung des Wasserstoffes nach wie vor<br />
sehr kostenintensiv. Für die Umsetzung der Forschungsergebnisse in Produktideen<br />
bzw. Produkte bieten sich bezüglich der einzelnen Technologiekomponenten mehrere<br />
Anknüpfungspunkte, so etwa bei der eigentlichen Brennstoffzelle, den mit der<br />
erzeugten Energie angetriebenen Antriebsaggregaten oder der Abspaltung des<br />
Wasserstoffes. Die fachliche Bandbreite reicht von der Physik über den Maschinenbau<br />
bis hin zu den Materialwissenschaften. Anknüpfungspunkte bestehen u.a. auch<br />
zur Elektrochemie, zum Maschinenbau und zur Verfahrenstechnik. Im Hinblick auf<br />
die Forschungsergebnisse ist zu beachten, dass – ähnlich wie in anderen Techno-<br />
41
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
logiefeldern – aus einer großen Anzahl innovativer Ideen letztlich nur eine geringe<br />
Zahl marktfähiger Produkte resultiert. Die Gesprächspartnerin beziffert die betreffende<br />
Quote auf 100 zu 2. Aufgrund der Vielfalt der Einsatzgebiete gibt es keine<br />
„Standardlösungen“: Was in einem Anwendungsfeld technologisch sinnvoll erscheint,<br />
kann sich in einem anderen Anwendungsfeld als nicht praktikabel erweisen.<br />
Gegenwärtig betätigen sich im Bundesgebiet etwa 1.000 Unternehmen in der<br />
Brennstoffzellentechnologie, in <strong>Hessen</strong> ca. 300. 4 Hierunter befinden sich auch zahlreiche<br />
Unternehmen aus der Automobil-Branche, jedoch ist in <strong>Hessen</strong> die Adam-<br />
Opel-AG nicht in die betreffenden Netzwerke involviert. Insbesondere in Nordrhein-<br />
Westfalen und in Baden-Württemberg befinden sich beachtliche Agglomerationen,<br />
was in einem engen Zusammenhang mit der dortigen Förderpolitik steht. Bedeutende<br />
Forschungseinrichtungen sind etwa das Zentrum für Brennstoffzellentechnik<br />
(ZBT) in Duisburg und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung<br />
(ZSW) in Stuttgart, die beide sowohl von öffentlichen als auch privaten Trägern gefördert<br />
werden.<br />
Gegenwärtig vollzieht sich insbesondere in den USA und in Japan eine sehr dynamische<br />
Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie. Analoges gilt für Korea, Dänemark<br />
und – in geringerem Ausmaß – für Frankreich. Diese Expansion betrifft<br />
vielfältige Anwendungsfelder, und zwar sowohl stationäre als auch mobile Systeme.<br />
Ein vordringliches Problem sieht die Gesprächspartnerin in der Ausbildung des<br />
Nachwuchses. So ist die Zahl der Studenten am Studienbereich Physik vergleichsweise<br />
gering, was sich wiederum in der hochschulpolitischen Mittelzuweisung niederschlägt.<br />
Nach Einschätzung der Gesprächspartnerin ist der naturwissenschaftliche<br />
und mathematische Kenntnisstand der Studienanfänger nicht hinreichend. In<br />
dieser Hinsicht sind offenbar Veränderungen in der schulischen Bildung – und zwar<br />
auch im Primarschulbereich – notwendig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Innerhalb des Bundeslandes <strong>Hessen</strong> bestehen mehrere fachbezogene Kooperationen,<br />
Netzwerke und Plattformen, an denen sich Akteure sowohl aus der Privatwirtschaft<br />
als auch der Hochschullandschaft beteiligen. Seit April 2002 besteht die<br />
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative <strong>Hessen</strong> (www.brennstoffzellehessen.de)<br />
als ein Zusammenschluss von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.<br />
Die Initiative bildet ein gut funktionierendes Netzwerk von regionalen Kompetenzträgern<br />
der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit über 30 Mitgliedern, darunter<br />
u.a. der Infraserv <strong>GmbH</strong> & Co. Höchst KG, der Umicore AG & Co. KG, der<br />
BASF Fuell Cell <strong>GmbH</strong> (vormals PEMEAS <strong>GmbH</strong>) sowie verschiedener mittelständischer<br />
Unternehmen und technologieorientierter Start-up Unternehmen (vgl. Abbil-<br />
4 Vgl. Rieping, M., A. Stein, C. Ott und D. Dittrich (2006), Kompetenzatlas Brennstoffzelle <strong>Hessen</strong>. Herausgegeben von: Hessisches<br />
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, <strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>, Wiesbaden.<br />
42
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
dung 3). Die am Austausch mit der Wirtschaft beteiligten Wissenschaftler sind zum<br />
überwiegenden Teil an der TU Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, der Universität<br />
Frankfurt sowie den Fachhochschulen Frankfurt und Wiesbaden tätig.<br />
Abbildung 3: Vernetzung des Fachgebietes Brennstoffzellentechnik an der FH Wiesbaden<br />
Brennstoffzellen-Initiative <strong>Hessen</strong><br />
FH Frankfurt<br />
FH Wiesbaden<br />
TU Darmstadt<br />
Hochschule<br />
Darmstadt<br />
u. a.<br />
Umicore AG<br />
Brennstoffzellentechnik<br />
BASF Fuell<br />
Cell <strong>GmbH</strong><br />
Infraserv <strong>GmbH</strong> &<br />
Co. Höchst KG<br />
SGL Carbon AG<br />
Dupont de Nemours<br />
(Deutschland) <strong>GmbH</strong><br />
Honda R & D Europe<br />
(Deutschland) <strong>GmbH</strong><br />
Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Sowohl öffentlich als<br />
auch privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Im Netzwerk sind die Kompetenzen in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie<br />
bis hin zur Herstellung von Brennstoffzellenstacks entlang der Wertschöpfungskette<br />
gebündelt. Es gibt aber auch noch Potenziale wie beispielsweise bei der<br />
Systemintegration von Brennstoffzellen und bei der stärkeren Mitwirkung von Automobilherstellern<br />
und Energieversorgern in der Initiative.<br />
Weiterer Handlungsbedarf besteht bei der systematischen Identifikation und Einbindung<br />
von relevanten Forschergruppen aus hessischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen<br />
in die Aktivitäten des Netzwerks. Die wissenschaftlichen Po-<br />
43
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
tenziale auf dem Gebiet der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie müssen<br />
nach Auskunft der Gesprächspartnerin noch gezielter mit den Anwendungsbereichen<br />
in der Wirtschaft zusammengeführt werden.<br />
Letztlich sollten die Anstrengungen zur Förderung der Brennstoffzellentechnologie –<br />
trotz der bereits vorhandenen, durchaus tragfähigen Kooperations- und Netzwerkstrukturen<br />
– noch verstärkt werden. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung bestünde<br />
u.a. im Ausbau des Netzwerks und in der personellen Aufstockung der hierbei<br />
involvierten Koordinationsstellen.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Ein gezielter Handlungsbedarf besteht offenbar hinsichtlich der technischen Infrastruktur<br />
(Labore, EDV etc.) an den Hochschulen. Für die Fortentwicklung der<br />
Brennstoffzellentechnologie wären laut Aussage der Gesprächsteilnehmerin Veränderungen<br />
bei der Normung von Bauteilen, Materialien und anderen Komponenten<br />
hilfreich. Zudem sollten die Einsatzmöglichkeiten für die dezentrale Energieversorgung<br />
und die Relevanz der Energieeffizienz noch stärker hervorgehoben werden.<br />
Bei der Regulierung gilt es, die Anreize für Forscher und Anwender im Auge zu behalten.<br />
44
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
45
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.1.3 Thermische Verfahrenstechnik<br />
Übersicht 3: Kurzprofil des Fachgebietes Thermische Verfahrenstechnik<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Entwicklung von Erklärungsmodellen auf Basis theoretischer<br />
Überlegungen wie auch empirischer Experimente und Simulationen.<br />
• Fortentwicklung gängiger Verfahren, Konzipierung neuartiger<br />
Verfahren, Entwicklung neuer Produkte.<br />
Anwendungsbereiche • Mikroverfahrenstechnik, Grenzflächennahe Strömungen,<br />
Brennstoffzellentechnologie, Biomedizinische Verfahrenstechnik.<br />
Technologiefeld • Analyse von Transportvorgängen, so etwa in Hinsicht auf<br />
Komponenten und Systeme wie auch thermische Wandlungs- und<br />
Erzeugungsverfahren.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Beteiligung an den DFG-Graduiertenkollegs 1114/1 - „Optische<br />
Messtechniken für die Charakterisierung von Transportprozessen an<br />
Grenzflächen“ und 853 - „Modellierung, Simulation und Optimierung<br />
von Ingenieuranwendungen“.<br />
• Enge hochschulübergreifende Zusammenarbeit mit Virginia Tech.<br />
• Kooperationen mit Merck, Boehringer Ingelheim, Bayer Technology<br />
Services und Siemens, die sowohl konkrete Forschungsvorhaben als<br />
auch grundlegende Konzepte für eine Forcierung der Zusammenarbeit<br />
umfassen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Alllgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Im Segment der Brennstoffzellentechnologie umfangreicher<br />
Forschungsbedarf hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wasserstoff.<br />
• Vergleichsweise geringes Innovationspotenzial in den kleinen und<br />
mittleren Unternehmen wegen komparativer Größennachteile.<br />
• Institutionelle Strukturen an den Universitäten günstig für die<br />
Forschung.<br />
• Grundständige Studiengänge sehr sinnvoll; deren Weiterentwicklung<br />
ist notwendig.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Befragt wurde der Leiter des Fachgebietes Thermische Verfahrenstechnik (TVT) am<br />
Fachbereich Maschinenbau der TU Darmstadt. Das Team am Lehrstuhl besteht aus<br />
insgesamt fünfzehn Mitarbeitern, hierunter sechs Wissenschaftlichen Mitarbeitern<br />
und zwei externen Lehrbeauftragten von Siemens bzw. BASF. Ferner existiert eine<br />
Werkstatt, in der zwei Mechaniker tätig sind. Die technische Infrastruktur umfasst<br />
u.a. einen Höchstleistungsrechner für Simulationen.<br />
Innerhalb der Hochschule beteiligt sich der Lehrstuhl an mehreren Kooperationen,<br />
so an den DFG-Graduiertenkollegs 1114/1 - „Optische Messtechniken für die<br />
46
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Charakterisierung von Transportprozessen an Grenzflächen“ und 853 -<br />
„Modellierung, Simulation und Optimierung von Ingenieuranwendungen“.<br />
Hochschulübergreifend partizipiert die Arbeitsgruppe u.a. an einer engen Zusammenarbeit<br />
mit dem Virginia Tech, die sowohl gemeinsame Forschungsaktivitäten als<br />
auch die Ausarbeitung von kooperativen Studiengängen umfasst, deren konkrete<br />
Planung sehr weit gediehen ist. Für diese Aktivitäten konnten bislang etwa Finanzmittel<br />
von 800.000 USD aus transatlantischen Förderprogrammen akquiriert werden.<br />
Nach Aussage des Gesprächspartners veranschaulichen sich gerade im Vergleich<br />
mit dem Virginia Tech, dessen Forschungskapazitäten ungefähr zehnmal so<br />
groß seien wie diejenigen der TU Darmstadt, sehr zutreffend komparative Nachteile<br />
der hiesigen Forschungslandschaft. Internationale Kontakte bestehen auch mit mehreren<br />
Forschungseinrichtungen in Israel.<br />
Die wissenschaftlichen Aktivitäten am Fachgebiet umfassen die Analyse von<br />
Transportvorgängen in Komponenten und Systemen, so etwa hinsichtlich thermischer<br />
Wandlungs- und Erzeugungsverfahren. Hierbei geht es vornehmlich um die<br />
physikalischen Grundlagen, also die Bestimmungsgrößen der Transportprozesse<br />
und die aus ihnen resultierenden Flüsse. Auf Basis theoretischer Überlegungen und<br />
empirischer Experimente ist das Ziel der Forschung vornehmlich die Entwicklung<br />
von Erklärungsmodellen. Anhand der konzipierten Modelle lassen sich wiederum<br />
gängige Verfahren fortentwickeln und neue Verfahren konzipieren. Dies dient der<br />
Entwicklung neuartiger Produkte.<br />
Im Fokus stehen vier Forschungsschwerpunkte. Weil es sich bei der Mikroverfahrenstechnik<br />
um eine Querschnittstechnologie handelt, ist der betreffende Forschungsschwerpunkt<br />
deutlich interdisziplinär ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen<br />
hierbei miniaturisierte Prozesse der Wärme- und Stoffübertragung. Der Forschungsschwerpunkt<br />
Grenzflächennahe Strömungen beinhaltet die Untersuchung von<br />
Grenzflächen-affinen Phänomenen wie etwa Viskositäten, Oberflächenwellen und<br />
Fallgeschwindigkeiten von Tropfen. Im Forschungsschwerpunkt Biomedizinische<br />
Verfahrenstechnik steht die Entwicklung von medizintechnischen Komponenten<br />
auf Grundlage der Analyse von Organsystemen im Fokus. Ein vierter Forschungsschwerpunkt<br />
umfasst die Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie, die<br />
laut Einschätzung des Gesprächspartners gegenwärtig die innovativste Art der<br />
Energieerzeugung darstellt.<br />
Im Kontext der Forschungsaktivitäten am Fachgebiet misst der Gesprächspartner<br />
strategischen Fragen der Energieerzeugung und Energieeffizienz eine eminente<br />
Bedeutung zu. Aus diesem Grunde hält er für die Zukunft umfangreiche Investitionen<br />
in die Energieforschung für unverzichtbar. Im Hinblick auf die Energieerzeugung<br />
plädiert er für einen an technologischen und gesamtwirtschaftlichen Erwägungen<br />
orientierten Energiemix und sieht daher auch für die Kernenergie ein beachtliches<br />
Zukunftspotenzial. Ein besonderer Handlungsbedarf besteht offenbar bezüglich der<br />
Energieeinsparung in Haushalten und Unternehmungen, denn diese bilde eine un-<br />
47
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
verzichtbare Komponente zukünftiger Energieversorgungskonzepte. Analoges gilt<br />
für Verkehrsmittel und Versorgungsnetze.<br />
Aufgrund von Effizienzaspekten sieht er die betreffenden Zukunftspotenziale weniger<br />
in den – gerade in jüngerer Zeit besonders ausgiebig geförderten – dezentralen<br />
Systemen, sondern eher in großtechnische Lösungen. Insofern erweise es sich als<br />
Nachteil, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutschland nur in geringem<br />
Maße in Großforschungsanlagen investiert worden sei. Eine vielversprechende<br />
Forschungsrichtung liege zudem in der Integration dezentraler Systeme in übergeordnete<br />
Netzstrukturen. Im Kontext der Energieversorgung hält er das kürzlich an<br />
der TU Darmstadt gegründete Energy Center für ein richtungweisendes Forschungskonzept,<br />
um die betreffenden Fragestellungen unter einem breiten und interdisziplinären<br />
Blickwinkel zu untersuchen.<br />
Im Hinblick auf andere Bundesländer schätzt der Gesprächspartner die Forschungslandschaft<br />
in Bayern und Baden-Württemberg als sehr leistungsfähig ein. Zutreffende<br />
Beispiele für besonders forschungsstarke Einrichtungen sind etwa das Forschungszentrum<br />
in Garching und das Kernforschungszentrum Karlsruhe. Innerhalb<br />
Europas existieren vor allem in Frankreich, Finnland und Schweden sehr kompetente<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Im Segment der Brennstoffzellentechnologie sieht der Gesprächspartner einen umfangreichen<br />
Forschungsbedarf hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wasserstoff. Diesbezüglich<br />
hätten in jüngerer Zeit im Rhein-Main-Gebiet die Großunternehmen<br />
Infraserv Höchst, Messer und Linde zukunftsweisende Konzepte zur Wasserstoffverflüssigung<br />
entwickelt. Eine sehr innovative Forschung betreibt die Firma BASF<br />
Fuell Cell <strong>GmbH</strong> (vormals Pemeas <strong>GmbH</strong>), eine Nachfolgegesellschaft der ehemaligen<br />
Hoechst AG. Was die Mikroverfahrenstechnik betrifft, so hält die Fa. Wella im<br />
Bereich der Mikrohydrosysteme einige wichtige Patente. In den kleinen und mittleren<br />
Unternehmen besteht demgegenüber nur ein vergleichsweise geringes Innovationspotenzial,<br />
was sich nicht zuletzt aus komparativen Größennachteilen erklärt.<br />
Enge Kontakte unterhält der Lehrstuhl zudem zu Merck, Boehringer Ingelheim, Bayer<br />
Technology Services und Siemens (vgl. Abbildung 4). Diese Kooperationen umfassen<br />
sowohl konkrete Forschungsvorhaben als auch grundlegende Konzepte für<br />
eine Forcierung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie. Eine<br />
Plattform für die Kontaktpflege bieten regelmäßig von der Arbeitsgruppe ausgerichtete<br />
Symposien und Workshops.<br />
48
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 4: Vernetzung des Fachgebietes Thermische Verfahrenstechnik an der TU Darmstadt<br />
DFG-GK 1114/1 - „Optische Messtechniken<br />
für die Charakterisierung von<br />
Transportprozessen an Grenzflächen“<br />
TUD<br />
Energy Center<br />
u. a.<br />
Virginia Tech<br />
u. a.<br />
Thermische<br />
Verfahrenstechnik<br />
DFG-GK 853 -<br />
„Modellierung,<br />
Simulation und<br />
Optimierung von<br />
Ingenieuranwendungen“<br />
Merck<br />
Boehringer<br />
Ingelheim<br />
Siemens<br />
Bayer Technology<br />
Services<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Die institutionellen Strukturen an den Universitäten schätzt der Gesprächsteilnehmer<br />
im Hinblick auf die Forschungsleistungen als durchaus günstig ein. Dies<br />
gelte insbesondere im Vergleich mit Großforschungseinrichtungen in Institutsverbünden,<br />
die nicht selten aufgrund organisatorischer Gegebenheiten vergleichsweise<br />
schwerfällig seien.<br />
Einen Handlungsbedarf sieht der Gesprächspartner in der Konzeption des Studienangebots.<br />
Auch vor dem Hintergrund der Bologna-Reformen sei es sinnvoll, die<br />
grundständigen Studiengänge weiterzuentwickeln. Zu stark spezialisierte Curricula<br />
wirkten sich negativ auf die Forschungs- und Lehrkompetenz der Hochschulen aus<br />
und führten darüber hinaus zu einer Verringerung der Beschäftigungschancen für<br />
die Absolventen.<br />
49
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.1.4 Regenerative Energietechnologien / Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie,<br />
Wasserkraft und Meeresenergie<br />
Übersicht 4: Kurzprofil des Fachgebietes Regenerative Energietechnologien / Windenergie, Photovoltaik,<br />
Bioenergie, Wasserkraft und Meeresenergie am ISET in Kassel<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierte<br />
Forschung.<br />
• Grundfinanzierung seitens des Landes <strong>Hessen</strong> trägt zu etwa 20 %<br />
zum Budget bei; die restlichen 80 % der Finanzierungsmittel stammen<br />
u.a. von der EU, dem Bund und von Industriepartnern.<br />
Anwendungsbereiche<br />
Beispiele:<br />
• Smart Grids und Microgrids,<br />
• Hybrid-Energieversorgungssysteme,<br />
• Hightech-Komponenten und Verfahren für dezentrale Energiesysteme,<br />
• Biomasseeinsatz bei Energiewandlungstechnologien.<br />
Technologiefeld • Spektrum der Forschungsaktivitäten umfasst die Windenergie, die<br />
Photovoltaik, die Bioenergie, die Wasserkraft und Meeresenergie.<br />
• Weitere Themenfelder sind Energiewandlung und<br />
Speichertechnologien, Stromrichtertechnik, Hybridsysteme und<br />
Energiewirtschaft.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Bedeutender Akteur des nordhessischen Technologie-Cluster deENet,<br />
einem Verbund aus etwa 35 Industrie- und Versorgungsunternehmen<br />
sowie verschiedener Forschungsinstitutionen und anderer Partner aus<br />
dem Bereich der dezentralen Energietechnologien.<br />
• Industriepartner nutzen die Infrastruktur des ISET: Modellfabrik<br />
DeMoTec, Messlabor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-<br />
Labor).<br />
• Insbesondere im Segment der Photovoltaik existiert eine ausgeprägte<br />
Branchenagglomeration in Nordhessen, hierdurch starke Impulse für<br />
die dortige Forschungslandschaft.<br />
• SMA, der Weltmarktführer für Photovoltaik, ist eine Ausgründung der<br />
Kasseler Hochschule.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Zentrale Bedeutung der Kostenrelationen im Bereich der<br />
Energieerzeugung.<br />
• Aufstockung der Grundfinanzierung, um im Forschungswettbwerb<br />
bestehen zu können.<br />
• Stärkeres Interesse seitens politischer Akteure an der im Kasseler<br />
Raum vorhandenen Forschungslandschaft wünschenswert.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
50
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Befragt wurden zwei Mitglieder des Vorstands und der Verwaltungsleiter des Instituts<br />
für Solare Energieversorgungstechnik - ISET. Als An-Institut der Universität<br />
Kassel, das sich seit nahezu zwanzig Jahren im Forschungsfeld der regenerativen<br />
Energien betätigt, weist das ISET eine weit über <strong>Hessen</strong> hinausreichende hohe<br />
Reputation auf. Das Institut unterhält zwei Standorte in Kassel und Hanau. Einer der<br />
Gesprächspartner ist zugleich Inhaber der Professur für Elektrische Energieversorgungssysteme,<br />
die am Fachbereich Elektrotechnik / Informatik der Universität Kassel<br />
angesiedelt ist. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit engagiert er sich insbesondere<br />
innerhalb des an der Hochschule verankerten Master-Programms „Regenerative<br />
Energien und Energieeffizienz (Re 2 )“, das sich nicht zuletzt auch an Studenten mit<br />
einem internationalen Hintergrund richtet. Über die Einrichtung dieses Studienganges<br />
ist es an der Universität Kassel gelungen, die in den Energietechnologien vorliegende<br />
Forschungskompetenz mit einem inhaltlich fokussierten Lehrangebot zu<br />
verknüpfen.<br />
Insgesamt sind am Institut etwa 140 Mitarbeiter tätig, hierunter gut<br />
70 Vollzeitangestellte bzw. 12 promovierte Wissenschaftler. Nach Aussage der Gesprächspartner<br />
sind aufgrund der derzeitigen Gebäudekapazitäten die Spielräume<br />
für eine weitere Expansion begrenzt. Zudem gestaltet es sich derzeit wegen eines<br />
unzureichenden Personalangebots als schwierig, Nachwuchswissenschaftler zu rekrutieren.<br />
Gegenwärtig verfügt das ISET über einen Jahresetat von 7 Mio. Euro, wovon<br />
1,5 Mio. Euro – also ein Anteil von gut 20 % – auf die Grundfinanzierung entfallen.<br />
Die restlichen Mittel resultieren aus Drittmitteln, die zu einem bedeutenden Teil<br />
vom Bund, von der EU und von der Industrie bereitgestellt werden. Der Vorstand<br />
des Instituts verfolgt das Ziel, den Finanzierungsanteil der Grundfinanzierung mittelfristig<br />
auf 30 % zu erhöhen. Dies ist eine Größenordnung, wie sie etwa in Fraunhofer-Instituten<br />
üblich ist. Die Ausweitung der Grundfinanzierung ist nicht zuletzt deshalb<br />
notwendig, weil öffentliche Drittmittelgeber i.d.R. einen finanziellen Eigenanteil<br />
voraussetzen.<br />
Die Aktivitäten am ISET, die intensiv in internationale wissenschaftliche Kooperationen<br />
eingebunden sind, umfassen sowohl die ingenieurwissenschaftliche Grundlagenforschung<br />
als auch die anwendungsorientierte Auftragsforschung. Darüber<br />
hinaus offeriert das Institut wissenschaftliche Serviceleistungen, und hierbei vornehmlich<br />
Consulting wie auch Normung und Zertifizierung. Den inhaltlichen Austausch<br />
fördert es über Informations- und Weiterbildungsmaßnahmen wie auch<br />
die Demonstration von Forschungsergebnissen.<br />
Das Spektrum der Forschungsinhalte umfasst die Windenergie, die Photovoltaik,<br />
die Bioenergie, die Wasserkraft und Meeresenergie. Weitere Themenfelder sind<br />
Energiewandlung und Speichertechnologien, Stromrichtertechnik, Hybridsysteme<br />
und Energiewirtschaft. Im Bereich der Elektro- und Systemtechnik bilden Leistungselektronik,<br />
Regelungstechnik, Verfahrenstechnik und Informationssysteme Schwer-<br />
51
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
punktbereiche. Beispielhaft seien folgende Einzelthemen des Forschungsspektrums<br />
genannt:<br />
• Smart Grids, d.h. intelligente Stromnetze, die einen Ausgleich zwischen Angebot<br />
und Nachfrage ermöglichen;<br />
• Microgrids und Hybrid-Energieversorgungssysteme, mit denen sich verschiedene<br />
Energiequellen kombinieren lassen;<br />
• Hightech-Komponenten und Verfahren für dezentrale Energiesysteme, so z.B.<br />
modulintegrierte Inverter;<br />
• Biomasseeinsatz bei neuen Energiewandlungstechnologien; etwa in Mikrogasturbinen,<br />
Brennstoffzellen, Stirlingmotoren und Thermovoltaiksystemen.<br />
Im Hinblick auf den Einsatz von Nutzpflanzen zur Energieerzeugung liegt ein langfristiges<br />
Forschungsziel darin, nicht allein die Früchte (so etwa bei Ölpflanzen), sondern<br />
die gesamte Pflanze zu verarbeiten. Allerdings sind die Kostenrelationen für<br />
die betreffenden Fermentierungsverfahren nach wie vor vergleichsweise ungünstig,<br />
so dass sich auch in dieser Hinsicht ein weites Forschungsfeld eröffnet. Ein besonderes<br />
Gewicht legen die Wissenschaftler des ISET auf die Langlebigkeit der entwickelten<br />
Komponenten und auf eine Orientierung an den Präferenzen der Abnehmer.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Das ISET fungiert in vielfacher Weise als Kooperationspartner und bildet innerhalb<br />
der Hochschule wie auch der regionalen Unternehmenslandschaft einen bedeutsamen<br />
Akteur im Technologiefeld der regenerativen Energien (vgl. Abbildung 5). Das<br />
Institut beteiligt sich am nordhessischen Technologie-Cluster deENet (Kompetenznetzwerk<br />
Dezentrale Energietechnologien e.V.), einem Verbund aus etwa<br />
35 Industrie- und Versorgungsunternehmen (u.a. SMA, Viessmann, Roth-Werke,<br />
Areva-Energietchnik, Polyma-Energiesysteme, e.on Mitte) sowie verschiedener Forschungsinstitutionen<br />
(u.a. Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Universität Kassel)<br />
und anderer Partner aus dem Bereich der dezentralen Energietechnologien. Der<br />
nordhessische Wirtschaftsraum zeichnet sich insbesondere im Segment der Photovoltaik<br />
durch eine ausgeprägte Branchenagglomeration aus, woraus starke Impulse<br />
für die dortige Forschungslandschaft resultieren. So handelt es sich bei dem Unternehmen<br />
SMA, dem Weltmarktführer für Photovoltaik-Wechselrichter, um eine Ausgründung<br />
der Kasseler Hochschule. In Nordhessen liegen also günstige Voraussetzungen<br />
für eine regionale Konzentration der Forschung und Entwicklung im Bereich<br />
der regenerativen Energietechnologien vor. Mit dem im Wetzlarer Raum ansässigen<br />
Unternehmen LUST-Antriebstechnik, einem Hersteller von Automatisierungskomponenten<br />
und -systemen, besteht ebenfalls eine intensive Kooperation. Innerhalb der<br />
Zusammenarbeit entwickelt das ISET i.d.R. bis zum Feinschliff einen Prototyp, der<br />
dann an die Industriepartner transferiert wird. Daneben nutzen Industriepartner die<br />
52
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Infrastruktur des ISET. Beispiele hierfür sind die Modellfabrik DeMoTec, die der<br />
Entwicklung, Simulation und Präsentation von Anlagen und Komponenten dient, und<br />
das Messlabor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Labor). Die regen Forschungsaktivitäten<br />
des ISET verdeutlichen sich auch in zahlreichen Innovationen,<br />
denn im Mittel der Jahre 2004/05/06 wurden am Institut je zwei Erfindungen getätigt<br />
und 32 Patente bzw. andere Schutzrechte erwirkt.<br />
Abbildung 5: Vernetzung des Fachgebietes des Fachgebietes Regenerative Energietechnologien / Windenergie,<br />
Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und Meeresenergie am ISET in Kassel<br />
u. a.<br />
Fraunhofer-Institut für<br />
Bauphysik IBP<br />
HeRo - Kompetenzzentrum<br />
<strong>Hessen</strong>-<br />
Rohstoffe e. V.<br />
ECN - Energy<br />
Research Centre<br />
ot the Netherlands<br />
CRES Center<br />
for Renewable<br />
Energy<br />
Sources<br />
u. a.<br />
Viessmann<br />
BP Solar<br />
Regenerative<br />
Energien<br />
Universität<br />
Kassel<br />
LUST Drive<br />
Tronics <strong>GmbH</strong><br />
e.on Mitte<br />
SMA Technologie AG IKS Photovoltaik<br />
Schmack Biogas AG<br />
deENet – Kompetenznetzwerk<br />
Dezentrale Energietechnologien<br />
Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Sowohl öffentlich als<br />
auch privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Bundesweit existieren etwa sieben weitere wissenschaftliche Einrichtungen, die<br />
sich zwar hinsichtlich der Forschungsinhalte mit dem ISET vergleichen lassen, jedoch<br />
i.d.R. ein weitaus umfangreicheres Finanzbudget aufweisen. Zu nennen sind<br />
hier in erster Linie das Fraunhofer ISE in Freiburg, das ZSW Baden-Württemberg,<br />
53
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
das ZAE Bayern und das ISFH Hameln, ferner das General Electric-<br />
Forschungszentrum in Garching, das ELFER in Karlsruhe und das e.on-Forschungsinstitut,<br />
das in Kooperation mit der RWTH Aachen betrieben wird.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf die Dynamik innerhalb des Fachgebiets merken die Gesprächspartner<br />
an, dass es letztlich zur innovativen Forschung und Entwicklung eines langen<br />
Atems bedarf. Bei der Bearbeitung von Forschungsfragestellungen führe eine kurzatmige<br />
Anvisierung von Fertiglösungen nur selten zum Erfolg.<br />
In Hinsicht auf die Expansion regenerativer Energietechnologien und die Steigerung<br />
der Energieeffizienz spiele – in Verbindung mit gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen<br />
– der „Leidensdruck“ der Unternehmen eine bedeutende Rolle. Ist dieser<br />
groß genug, so entsteht nicht selten ein Handlungsbedarf, woraus eine Anwendung<br />
bzw. Fortentwicklung der betreffenden Technologien resultiert. Beispielsweise sei<br />
gerade in jüngerer Zeit seitens der Versicherungswirtschaft ein reges Interesse an<br />
erneuerbaren Energien zu beobachten gewesen.<br />
Was die Unterstützung seitens der politischen Akteure anbelangt, so ist nach Aussage<br />
der Gesprächsteilnehmer ein noch stärkeres Interesse an der im Kasseler<br />
Raum vorhandenen Forschungslandschaft wünschenswert.<br />
54
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
55
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.1.5 Regenerative Energietechnologien / Solarthermie<br />
Übersicht 5: Kurzprofil des Fachgebietes Solarthermie an der Universität Kassel<br />
Untersuchungsaspekte<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Im Fachgebiet der Solarthermie, gemessen an der Zahl der<br />
Doktoranden, größte Arbeitsgruppe in Europa.<br />
• An der Hochschule lokalisierte Agglomeration von zehn Lehrstühlen<br />
im Bereich Energietechnologien bundesweit wie auch europaweit<br />
einzigartig.<br />
• Drittmittel stammen sowohl von öffentlichen als auch von privaten<br />
Institutionen. (Internationale Energie <strong>Agentur</strong> - IEA, EU, BMBF,<br />
BMWi, DFG, HMULV , VolkswagenStiftung, Deutsche<br />
Bundessstiftung Umwelt - DBU, Rudolf-Otto-Meyer-Umweltstiftung).<br />
Anwendungsbereiche • Komponenten solarthermischer Systeme (z.B. Kollektoren, Speicher).<br />
• Nutzung der solaren Prozesswärme (z.B. industrielle Prozesse,<br />
Lufttrocknung, Kühlung).<br />
Technologiefeld • Mathematische Optimierung und experimentelle Analyse thermischer<br />
Energiesysteme.<br />
• Entwicklung solarthermischer Mehrkomponentensysteme für<br />
Fernwärmeanwendungen, kostengünstiger Solarspeicher und der<br />
Speicherperipherie.<br />
• Untersuchung und Modellierung unabgedeckter Kollektoren und in<br />
der Analyse solarer Klimatisierungsprozesse.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Weltweite Kontakte zu etwa 60 Institutionen.<br />
• Maßgebliche Beteiligung am Doktorandenprogramm SOLNET, dem<br />
von der EU geförderten ersten internationalen Graduiertenprogramm<br />
im Bereich der Solarenergie.<br />
• Projektgebundene Zusammenarbeit mit dem Zentrum für die Nutzung<br />
erneuerbarer Energien (Kun) in Bischkek und der Kirgisischen<br />
Technischen Universität.<br />
• Partizipation am nordhessischen Technologie-Cluster deENet;<br />
Kontakte insbesondere zu den Unternehmen Wagner & Co.<br />
Solartechnik und Viessmann.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Arbeitsgruppe ist verantwortlich für die Koordinierung des<br />
Projektstudiums solarcampus und des neu aufgebauten<br />
Masterstudienganges „Regenerative Energien und Energieeffizienz -<br />
re2“, der von regional ansässigen Privatunternehmen gefördert wird.<br />
• Positive Einschätzung von Delegationreisen zur Anbahnung von<br />
Forschungskooperationen.<br />
• Besonderer Handlungsbedarf in der Profilbildung der Hochschulen.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
56
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Befragt wurde der Leiter des Fachgebiets Solar- und Anlagentechnik am Institut für<br />
Thermische Energietechnik an der Universität Kassel, das zum Fachbereich Maschinenbau<br />
gehört. Das Fachgebiet ist aus einer Arbeitsgruppe für Solarenergie, die<br />
ursprünglich an der Universität Marburg angesiedelt war, hervorgegangen und umfasst<br />
etwa 15 Mitarbeiter, hierunter eine Juniorprofessorin und zehn Doktoranden.<br />
Im Fachgebiet der Solarthermie handelt es sich hierbei, gemessen an der Zahl der<br />
Doktoranden, um die größte Arbeitsgruppe in Europa. Was die fachlichen<br />
Schwerpunkte an der Universität Kassel betrifft, so ist laut Einschätzung des Gesprächspartners<br />
die an der Hochschule lokalisierte Agglomeration von zehn Lehrstühlen<br />
im Bereich regenerativer Energietechnologien wohl europaweit einzigartig.<br />
Andere Forschungseinrichtungen, so etwa in Stuttgart, Berlin, und Oldenburg zeichnen<br />
sich zwar durch ähnliche fachliche Schwerpunkte aus, allerdings ist das an der<br />
Universität Kassel vertretene inhaltliche Spektrum erheblich breiter.<br />
Die akquirierten Drittmittel stammen sowohl von öffentlichen als auch von privaten<br />
Institutionen. Drei Forschungsvorhaben werden von der EU gefördert. Zu nennen<br />
sind ferner das BMU, das BMWi, das HMULV und die DFG wie auch die VolkswagenStiftung,<br />
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU und die Rudolf-Otto-<br />
Meyer-Umweltstiftung. Alle Doktoranden sind in internationale Arbeitszusammenhänge<br />
eingebunden, so z.B. in mehrjährige und inhaltlich fokussierte Arbeitsgruppen<br />
der Internationalen Energie <strong>Agentur</strong> (IEA).<br />
In der Doktorandenausbildung spielt das SOLNET, das ebenfalls von der EU geförderte<br />
erste internationale Graduiertenprogramm im Bereich der Solarenergie,<br />
eine bedeutende Rolle. Neben der Universität Kassel beteiligen sich an diesem<br />
Netzwerk, dessen Koordinierung bei der Arbeitsgruppe angesiedelt ist, die Universität<br />
Lund, die Dänische Technische Universität in Kopenhagen, die Hochschule Dalarna<br />
und die Universidad de Lleida sowie die Technische Universität Graz. Weitere<br />
Partner sind die Tschechische Technische Universität in Prag, die Fachhochschule<br />
Stuttgart und das Politecnico Milano. Zudem zeichnet sich die Arbeitsgruppe verantwortlich<br />
für die Koordinierung des Projektstudiums solarcampus und des Masterstudienganges<br />
„Regenerative Energien und Energieeffizienz - re 2 “, für den regional<br />
ansässige Privatunternehmen finanzielle Unterstützung angeboten haben. 5 An den<br />
Lehrveranstaltungen dieses Studienganges beteiligen sich 14 Lehrstühle aus<br />
fünf Fachbereichen. Grundsätzlich bescheinigt der Gesprächspartner dem Arbeitsmarkt<br />
im Bereich der regenerativen Energietechnologien eine stetige Expansion. So<br />
seien während der jüngeren Vergangenheit im jährlichen Durchschnitt etwa<br />
10.000 neue Arbeitsplätze entstanden, hierunter ungefähr 1.500 Arbeitsplätze für<br />
Akademiker.<br />
5 Vgl. zur Verbreitung neuartiger Masterstudiengänge Schedding-Kleis, U. (2006), Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge<br />
in <strong>Hessen</strong>. In: Staat und Wirtschaft in <strong>Hessen</strong>, 61. Jahrgang, Heft Nr. 10, S. 247-254.<br />
57
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Die Forschung am Fachgebiet beinhaltet die mathematische Optimierung und die<br />
experimentelle Analyse thermischer Energiesysteme wie auch die Entwicklung<br />
solarthermischer Mehrkomponentensysteme für Fernwärmeanwendungen,<br />
kostengünstiger Solarspeicher und der Speicherperipherie. Weitere Forschungsfelder<br />
bestehen in der Untersuchung und Modellierung unabgedeckter Kollektoren<br />
und in der Analyse solarer Klimatisierungsprozesse. Die gegenwärtigen<br />
Forschungsprojekte am Fachgebiet beziehen sich vornehmlich auf Komponenten<br />
solarthermischer Systeme (z.B. Kollektoren, Speicher etc.) wie auch Anwendungsbereiche<br />
der solaren Prozesswärme (z.B. industrielle Prozesse, Lufttrocknung, Kühlung).<br />
Weltweit unterhält die Arbeitsgruppe laufende Forschungskooperationen zu<br />
etwa 60 Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Privatunternehmen.<br />
Zur kirgisischen Hauptstadt Bischkek bestehen schon seit langem intensive Kontakte,<br />
welche die Entwicklung eines Multikomponentensystems zur simultanen Nutzung<br />
von Umgebungswärme und solarer Einstrahlung im Rahmen eines Nahwärmenetzwerkes<br />
umfassen. Kooperationspartner sind das Zentrum für die Nutzung<br />
erneuerbarer Energien (Kun) in Bischkek und die Kirgisische Technische Universität.<br />
Die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Technologien lassen sich<br />
auch auf andere Räume mit ähnlichen Klimakonditionen (Kontinentalklima mit ausgiebiger<br />
Sonneneinstrahlung) und analogen infrastrukturellen Gegebenheiten (weitere<br />
GUS-Staaten) übertragen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Bundesweit befindet sich im Großraum Kassel die bedeutendste Branchenagglomeration<br />
im Bereich der regenerativen Energien. Von der Solartechnik, Solarthermie,<br />
dem umweltgerechten Bauen, der rationellen Energienutzung über Anlagen<br />
der Kraft-Wärme-Kopplung bis hin zu Wärmepumpen und Brennstoffzellen findet<br />
sich in Nordhessen ein breites Erfahrungs- und Produktspektrum im Bereich dezentraler<br />
Energietechniken.<br />
Im „Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien“ (deENet e.V.) haben<br />
sich mehr als 70 Unternehmen, darunter namhafte Unternehmen wie Viessmann,<br />
SMA Technologie AG und Seeger Engineering AG, Forschungseinrichtungen und<br />
Dienstleister zusammengeschlossen. deENet fungiert seit Juli 2006 auch als thematischer<br />
Cluster „Dezentrale und erneuerbare Energien“ im Rahmen des Regionalmanagements<br />
Nordhessen.<br />
Der Gesprächspartner misst deENet eine hohe Bedeutung zu, und zwar sowohl für<br />
die generelle Fortentwicklung des Themenfeldes der regenerativen Energien als<br />
auch für die Ausarbeitung einzelner Projektideen. Die Gründung dieses Clusters hat<br />
offenbar eine fokussierte Interessenbündelung und eine Erhöhung der Schlagkraft<br />
der fachbezogenen “Community“ bewirkt.<br />
58
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Als Kooperationspartner des Lehrstuhls sind vor allem Wagner & Co. Solartechnik<br />
und Viessmann zu nennen. Insbesondere mit der Fa. Wagner & Co. besteht eine<br />
intensive Partnerschaft, die bislang zu mehreren gemeinsamen Forschungsprojekten<br />
geführt hat. Die Fa. Viessmann zeigt sich insbesondere an Technologien zur<br />
Nutzung von Prozesswärme interessiert. I.d.R. sind die Kooperationen so ausgestaltet,<br />
dass die Industrieunternehmen jeweils einen Anteil von mindestens 20 Prozent<br />
des Projektbudgets übernehmen.<br />
Abbildung 6: Vernetzung des Fachgebietes Solarthermie an der Universität Kassel<br />
Internationales<br />
Graduiertenprogramm SOLNET<br />
Zentrum für die Nutzung<br />
erneuerbarer Energien (ZUM) Bischkek<br />
Internationale<br />
Energie <strong>Agentur</strong><br />
- IEA<br />
Kirgisische<br />
Technische<br />
Universität<br />
Solarthermie<br />
u. a.<br />
Viessmann<br />
SMA Technologie AG<br />
Wagner & Co.<br />
Solartechnik<br />
weitere Partner aus dem<br />
Kompetenznetzwerk<br />
deENet<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Einen besonderen Handlungsbedarf sieht der Gesprächspartner bei der Profilbildung<br />
der Hochschulen. Zur Vertiefung des regionalen Schwerpunkts und als Beitrag<br />
zur Profilierung der Region und der Hochschule bietet die Universität Kassel<br />
seit Sommersemester 2005 einen neuen Master-Studiengang „Regenerative Energien<br />
und Energieeffizienz - re 2 “ an, der jährlich rund 40 Studierende aufnimmt. Die<br />
regionale Industrie hat Unterstützung für den Ausbau des Studiengangs angekün-<br />
59
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
digt, vom dem sie sich die Ausbildung qualifizierter Mitarbeiter erhofft. Von Hochschulseite<br />
würde sich der Gesprächspartner hierfür eine stärkere Unterstützung<br />
wünschen.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Als gegenwärtig besonders problematisch hebt der Gesprächspartner die zu geringen<br />
Kapazitäten am Fachgebiet hervor, denn diese bildeten einen Engpass für die<br />
Akquisition neuer Forschungsvorhaben bzw. die Einstellung neuer Mitarbeiter. Inzwischen<br />
nehmen auch verstärkt Firmen mit konkreten Kooperationswünschen direkt<br />
Kontakt auf. Wegen Überlastung musste das Fachgebiet in letzter Zeit allerdings<br />
ca. einmal im Monat die Durchführung neuer Forschungsvorhaben ablehnen.<br />
Vor dem Hintergrund umfangreicher Fördermöglichkeiten liegen zahlreiche Projektideen<br />
vor, die sich allerdings wegen einer zu geringen Grundausstattung nur zum<br />
Teil realisieren lassen. Dies gilt auch für die Intensivierung internationaler Forschungskontakte.<br />
Eine Möglichkeit zur weiteren Professionalisierung der Kooperationen<br />
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sieht der Gesprächsteilnehmer in der<br />
Einrichtung spezifischer – direkt einzelnen Forschungseinrichtungen zugeordneter –<br />
Mitarbeiterstellen, die im Wesentlichen Akquisitions- und Koordinationstätigkeiten<br />
beinhalten. Derartige Stellen könnten u.U. seitens des Landes teilfinanziert werden;<br />
der restliche Teil der Finanzierung ließe sich über akquirierte Projektmittel aufbringen.<br />
Um den betreffenden Mitarbeitern tragfähige Beschäftigungs- und Qualifizierungsperspektivenperspektiven<br />
zu eröffnen, böten sich hierzu auf einen Zeitraum<br />
von etwa drei Jahren befristete Arbeitsverhältnisse an.<br />
Generell sieht der Gesprächspartner die Universität in der Pflicht, leistungsfähige<br />
Schwerpunkte zur Profilierung zu bilden und dort die Forschungskompetenz auszubauen.<br />
Als positiv schätzt er eine weitere Internationalisierung der Forschungskontakte<br />
ein (u.a. über Delegationsreisen der hessischen Landesregierung).<br />
60
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
61
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.2 Umwelttechnologien<br />
5.2.1 Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
Übersicht 6: Kurzprofil des Fachgebietes Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement an der Universität<br />
Gießen<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und angewandter<br />
Forschung beläuft sich am Lehrstuhl auf etwa 30 zu 70.<br />
• Einwerbung von Drittmitteln orientiert sich stark an einzelnen<br />
Forschungsfragestellungen.<br />
Anwendungsbereiche • Deponiewesen ebenso wie Standortbewertung und<br />
Standortsanierung.<br />
• Entsorgung und Wiederverwendung von Abfällen.<br />
• Filterung wie auch die technologische, biologische und chemische<br />
Behandlung von Reststoffen und Altlasten.<br />
Technologiefeld • Naturwissenchaftliche Analysen von Stoffströmen wie auch<br />
chemischen und mikrobiologischen Prozessen.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Lehrstuhl ist am Interdisziplinären Forschungszentrum Gießen (IFZ)<br />
angesiedelt, das als „Paradebeispiel“ für wissenschaftsorientierte<br />
Agglomerationen bzw. „Querschnittsinstitutionen“ gelten kann.<br />
• Einbindung in den DFG-Sonderforschungsbereich 299<br />
„Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“.<br />
• Unter den Kooperationpartnern finden sich u.a. öffentliche<br />
Körperschaften wie Kommunen und Landkreise.<br />
• Bei den privatwirtschaftlichen Akteuren handelt es sich überwiegend<br />
um Industrieunternehmen, Versorger und Handelsunternehmen (u.a.<br />
Infraserv Höchst, Buderus, Fraport).<br />
• Ein weiteres Feld ist die Militärberatung (NATO in Afghanistan).<br />
• Ausgründung der Fa. ECOWIN.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Schaffung zentraler „Marktplätze“, die als Informations- und<br />
Kommunikationsforen dienen.<br />
• Patentrecht, das einen Patentschutz nicht dem einzelnen Forscher,<br />
sondern der Hochschule zuspricht, trägt zu einer Demotivierung der<br />
Forscher bei.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Lehrstuhl gehört zum Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement,<br />
das dem Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement<br />
zugeordnet ist. Das Institut ist am Interdisziplinären Forschungszentrum<br />
Gießen (IFZ) angesiedelt, das als „Paradebeispiel“ für wissenschaftsorientierte<br />
62
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Agglomerationen bzw. „Querschnittsinstitutionen“ gelten kann. Das IFZ umfasst<br />
einen lockeren Verbund aus 23 Lehrstühlen bzw. 12 Instituten aus den Agrarwissenschaften,<br />
den Ernährungswissenschaften und der Biologie. Ausgeprägte fachliche<br />
Schwerpunkte liegen in der Landnutzungsforschung, den Nutzpflanzenwissenschaften<br />
und der Pflanzenökologie; weitere bedeutende Forschungsfelder sind die<br />
Tierökologie und die Biochemie der Ernährung. Gegenwärtig arbeiten am IFZ etwa<br />
210 Wissenschaftler, von denen etwa 80 aus Landesmitteln und 130 aus Drittmitteln<br />
finanziert werden. Am Lehrstuhl des Gesprächspartners, der zudem in den DFG-<br />
Sonderforschungsbereich 299 „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“<br />
eingebunden ist, sind ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter und etwa<br />
zehn Doktoranden tätig.<br />
Das Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung beläuft<br />
sich am Lehrstuhl auf etwa 30 zu 70. Die Einwerbung von Drittmitteln orientiert<br />
sich stark an einzelnen Forschungsfragestellungen. Als Geldgeber fungieren sehr<br />
unterschiedliche Institutionen, so etwa die DFG und kommunale Körperschaften wie<br />
auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft (z.B. Infraserv, Buderus, Fraport AG)<br />
und die NATO.<br />
Es liegen ausgeprägte Überschneidungen mit anderen Fachdisziplinen vor, so etwa<br />
der Biologie, der Chemie, der Geographie und den Ingenieurwissenschaften, woran<br />
sich der Charakter als Querschnittstechnologie verdeutlicht. Die Anwendungsbereiche<br />
bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse liegen überwiegend in dem<br />
sehr weiten Feld des Ressourcenmanagements, das sowohl die Entsorgung als<br />
auch die Wiederverwendung von Abfällen umfasst; ein weiteres Feld ist die Abfalltechnik,<br />
so etwa die Filterung wie auch die technologische, biologische und chemische<br />
Behandlung bzw. Verwertung von Reststoffen und Altlasten. Weil die Forschungstätigkeiten<br />
beispielsweise die Entwicklung öffentlicher Gebührensysteme<br />
umfassen, sind zudem ökonomische, politische und geographische Aspekte von erheblicher<br />
Bedeutung. In naturwissenschaftlicher Hinsicht werden vor allem Stoffströme<br />
wie auch chemische und mikrobiologische Prozesse untersucht. Wichtige<br />
Anwendungsbereiche sind in diesem Zusammenhang das Deponiewesen ebenso<br />
wie die Standortbewertung und Standortsanierung. Zusammen mit dem TransMit<br />
Zentrum für Umwelt-, Abfall- und Ressourcenmanagement und der GBG -<br />
Gesellschaft für Boden- und Gewässerschutz hat der Gesprächspartner die Firma<br />
ECOWIN gegründet, die umweltbezogene Analysen durchführt und sich u.a. in der<br />
ökologischen Bewertung und Optimierung von Produktionsprozessen betätigt.<br />
Die Mitarbeiter des Fachgebiets betätigen sich rege als Verfasser von Publikationen,<br />
wobei Veröffentlichungen in begutachteten Zeitschriften im Vordergrund stehen.<br />
Darüber hinaus werden auch andere Wege beschritten, um mit Forschungsergebnissen<br />
an die Öffentlichkeit zu treten und diese einem breiten Publikum zugänglich<br />
zu machen. So wird in vielerlei Hinsicht eine aktive Außendarstellung des Technologiefeldes<br />
betrieben, und zwar vor allem auf Konferenzen, Workshops und Se-<br />
63
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
minaren, die teilweise selber organisiert werden (auch unter Beteiligung der <strong>Hessen</strong><br />
<strong>Agentur</strong>).<br />
Im internationalen Vergleich zeichnet sich die Abfallwirtschaft in Deutschland<br />
durch ein sehr hohes fachliches Niveau aus. Dies manifestiert sich nicht zuletzt<br />
darin, dass eine leistungsfähige Forschung mit einer vielschichtigen Anwendung in<br />
der kommunalen Infrastruktur und privatwirtschaftlichen Produktionsanlagen einhergeht.<br />
Dies gilt in ähnlicher Weise für die Niederlande, die Schweiz, Österreich wie<br />
auch die skandinavischen Länder und Japan. In den USA folgt die Abfallbehandlung<br />
aufgrund struktureller Gegebenheiten einem anderen technologischen Muster. Besonders<br />
dynamische Entwicklungen zeigen sich gegenwärtig in lateinamerikanischen<br />
Schwellenländern, und zwar insbesondere in Chile und Brasilien.<br />
Laut Einschätzung des Gesprächspartners wird in Zukunft die Relevanz der Abwassertechnologien,<br />
der Energieeffizienz und Energietechnik wie auch der Separierung<br />
einzelner Stoffe deutlich zunehmen. Die treibenden Kräfte für die Forschungsfragestellungen<br />
sind sehr vielfältig; zu nennen sind hier gesamtwirtschaftliche bzw.<br />
globale Trends wie etwa die Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten, die sich in<br />
Kostenrelationen niederschlagen, und eine zunehmende Siedlungsverdichtung in<br />
Agglomerationsräumen. Von Bedeutung sind aber auch staatliche Auflagen ebenso<br />
wie technologische und naturwissenschaftliche Fortschritte, welche die Nachweisgrenzen<br />
für einzelne Stoffe tangieren.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Es bestehen vielseitige Kooperationen mit Partnern aus dem öffentlichen Sektor<br />
und der Privatwirtschaft (vgl. Abbildung 7). Unter den öffentlichen Körperschaften<br />
finden sich vornehmlich Kommunen und Landkreise, bei den privatwirtschaftlichen<br />
Akteuren handelt es sich überwiegend um Industrieunternehmen, Versorger und<br />
Handelsunternehmen. In zahlreichen Fällen ist die Zusammenarbeit mittelfristig oder<br />
langfristig ausgelegt, was sich in zahlreichen Folgeaufträgen manifestiert. Ein weiteres<br />
bedeutsames Feld ist die Militärberatung, denn bei militärischen Interventionen<br />
in peripheren Räumen muss eine kostengünstige und standortgerechte Entsorgung<br />
gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang war der Gesprächspartner schon<br />
mehrfach als Berater in Afghanistan tätig.<br />
64
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 7: Vernetzung des Fachgebietes Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
an der Universität Gießen<br />
u. a.<br />
DFG-SFB 299 „Landnutzungskonzepte<br />
für periphere Regionen“<br />
Landkreis Gießen<br />
NATO<br />
u. a.<br />
Buderus<br />
Fraport<br />
Abfalltechnologie /<br />
Ressourcenmanagement<br />
Interdisziplinäres<br />
Forschungszentrum<br />
Gießen (IFZ)<br />
Infraserv<br />
Höchst<br />
Tegut…<br />
ECOWIN (Eigene Ausgründung)<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Als nachteilig sieht es der Gesprächspartner an, dass nach wie vor im Fachgebiet<br />
des Ressourcenmanagements zu wenig zentrale „Marktplätze“ existieren, die Akteuren<br />
aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Institutionen als Informationsund<br />
Kommunikationsforen dienen können. Hier sei auch das Land <strong>Hessen</strong> gefordert,<br />
sich noch stärker als bisher in der Organisation bzw. inhaltlichen Begleitung<br />
derartiger Plattformen zu engagieren. Eine solide Finanzierungsgrundlage, ein hoher<br />
Grad an Professionalität und eine fundierte fachliche Arbeit sind hierbei unabdingbar.<br />
Zudem gibt der Gesprächspartner zu bedenken, ob in ausgewählten Forschungsfeldern<br />
die klaren organisatorischen Trennlinien zwischen Universitäten und Fachhochschulen<br />
in fachlicher Hinsicht tatsächlich sinnvoll sind, denn letztlich gehe es<br />
65
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
doch um die inhaltliche Bearbeitung von Forschungsfragestellungen. Als weiteres<br />
besonders relevantes Themenfeld sieht der Gesprächspartner das Patentrecht an,<br />
denn dieses präge die Anreize für Forscher entscheidend mit. So sei zu bedenken,<br />
dass ein Patentrecht, das einen Patentschutz nicht dem einzelnen Forscher, sondern<br />
der Hochschule, an der dieser tätig ist, zuspricht, letztlich zu einer Demotivierung<br />
der Forscher beitrage.<br />
66
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
67
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.2.2 Abwassertechnik / Wasserwirtschaft<br />
Übersicht 7: Kurzprofil des Fachgebietes Abwassertechnik / Wasserwirtschaft an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Als Drittmittelgeber fungieren – je nach Fragestellung – neben<br />
öffentlichen Institutionen in beachtlichem Maße auch private<br />
Unternehmen bzw. Stiftungen wie z.B. die Faudi-Stiftung und die<br />
Willy-Hager-Stiftung.<br />
Anwendungsbereiche • Ressourcennutzung (z.B. Rückgewinnung und Verwertung von<br />
Reststoffen) und Bereitstellung einer Wasserversorgungsinfrastruktur<br />
in urbanen Ballungsräumen.<br />
• Verwendung von Abwasser in der Landwirtschaft (Ausbringung von<br />
Abwasser zur Bewässerung bzw. Nährstoffversorgung) und<br />
Entfernung organischer Spurenstoffe wie z.B. von<br />
Arzneimittelrückständen im Abwasserreinigungsprozess.<br />
Technologiefeld • Untersuchung von Fragestellungen zur Abwassertechnologie, wobei<br />
über die eigentlichen ingenieurwissenschaftlichen Aspekte hinaus<br />
sowohl naturwissenschaftliche und technologische als auch soziale<br />
und ökonomische Gesichtspunkte erörtert werden.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Vernetzung mit der Wirtschaft im Water Engineering Network e.V.<br />
noch ausbaufähig.<br />
• Vor allem hinsichtlich dezentral lokalisierter<br />
Wasserversorgungsanlagen bestehen intensive Kooperationen mit<br />
Partnern aus der Industrie, die sich wiederum in der<br />
Forschungsförderung niederschlagen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• In Punkto Befristung wie auch inhaltlicher Ausrichtung der<br />
Forschungsförderung verfolgen private Kooperationspartner – bedingt<br />
durch erwerbswirtschaftliche Kriterien - i.d.R. andere Zielsetzungen<br />
als öffentliche Institutionen.<br />
• Einheit von Forschung und Lehre ist notwendig für eine<br />
prosperierende Hochschullandschaft.<br />
• Grundausstattung der Hochschulinstitutionen stellt gleichsam das<br />
Startkapital für eine erfolgreiche Forschung dar, insbesondere<br />
hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Fachgebiet Abwassertechnik, dessen Leiter der Gesprächspartner ist, gehört<br />
zusammen mit vier weiteren Fachgebieten an der TU Darmstadt zum Institut für<br />
Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Industrielle<br />
Stoffkreisläufe und Umwelt- und Raumplanung (Institut WAR). Dieses ist dem<br />
Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie zugeordnet. Am Institut WAR sind<br />
68
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
rund 50 Mitarbeiter beschäftigt: 6 Professoren, 12 Mitarbeiter im administrativ-technischen<br />
Bereich und ca. 30 Wissenschaftliche Mitarbeiter.<br />
Dem Fachgebiet Abwassertechnik sind 10 Wissenschaftliche Mitarbeiterstellen zugeordnet,<br />
von denen acht als Promotionsstellen aus Drittmitteln finanziert werden.<br />
Es wird sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung betrieben.<br />
Als Drittmittelgeber fungieren – je nach Fragestellung – neben öffentlichen Institutionen<br />
wie etwa dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der<br />
deutschen Bundesstiftung Umwelt in beachtlichem Maße auch private Unternehmen<br />
bzw. Stiftungen wie z.B. die Faudi-Stiftung und die Willy-Hager-Stiftung. In Punkto<br />
Befristung wie auch inhaltlicher Ausrichtung der Forschungsförderung verfolgen private<br />
Kooperationspartner – bedingt durch erwerbswirtschaftliche Kriterien - i.d.R.<br />
andere Zielsetzungen als öffentliche Institutionen.<br />
Grundsätzlich ist die Forschung auf dem Gebiet der Abwassertechnologie an aktuellen<br />
Fragestellungen ausgerichtet, wobei über die eigentlichen ingenieurwissenschaftlichen<br />
Aspekte hinaus sowohl naturwissenschaftliche und technologische als<br />
auch soziale und ökonomische Gesichtspunkte erörtert werden. Daher bestehen<br />
deutliche Berührungspunkte zur Soziologie, Stadtforschung und Geographie wie<br />
auch zur Architektur und den Agrarwissenschaften. Für die Forschungsdisziplin<br />
besonders bedeutsame Themenfelder bilden u.a. die Ressourcennutzung (z.B.<br />
Rückgewinnung und Verwertung von Reststoffen) und die Bereitstellung einer Wasserversorgungsinfrastruktur<br />
in urbanen Ballungsräumen. Gerade die letzte Thematik<br />
hat während jüngerer Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen. Vor allem hinsichtlich<br />
dezentral lokalisierter Wasserversorgungsanlagen bestehen intensive Kooperationen<br />
mit Partnern aus der Industrie, die sich wiederum in der Forschungsförderung<br />
niederschlagen. Ein besonderer regionaler Forschungsschwerpunkt liegt auf den<br />
Ballungsräumen Ostchinas; gleichwohl merkt der Gesprächspartner an, dass sich<br />
ähnlich gelagerte Fragestellungen auch im Hinblick auf hochverdichtete Räume in<br />
anderen Teilen der Welt ergäben. Weitere Forschungsschwerpunkte sind u.a. die<br />
Verwendung von Abwasser in der Landwirtschaft (Ausbringung von Abwasser zur<br />
Bewässerung bzw. Nährstoffversorgung) und die Entfernung organischer Spurenstoffe<br />
wie z.B. von Arzneimittelrückständen im Abwasserreinigungsprozess.<br />
Die Außendarstellung des Fachgebietes ist sehr vielfältig und zeichnet sich durch<br />
umfangreiche Publikationsaktivitäten wie auch eine rege Teilnahme an (auch internationalen)<br />
Konferenzen, Seminaren und Workshops aus. Zudem wird gezielt<br />
der Dialog zu politischen Akteuren und Verbänden gesucht. Nach Aussagen des<br />
Gesprächsteilnehmers sind internationale Forschungskontakte i.d.R. zwar für sämtliche<br />
Beteiligten fruchtbar, allerdings entwickeln sich derartige Kooperationen – vor<br />
allem mit Partnern aus China – nicht selten zu einem regelrechten Forschungstransfer.<br />
69
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Die innerhalb des Bundesgebietes betriebene Forschung wie auch die technische<br />
Realisierung im Bereich der Abwassertechnologie kann man im internationalen Vergleich<br />
als herausragend einschätzen. Ähnlich wie in anderen Technologiefeldern e-<br />
xistieren vergleichbare Gegebenheiten lediglich in Japan und den USA. Allerdings<br />
ist in den USA die Forschung in dieser Fachrichtung anders ausgerichtet als in<br />
Deutschland, denn dort besteht ein Forschungszweig, der sich vornehmlich am Ziel<br />
einer Publikation in begutachteten Zeitschriften orientiert. Daneben existiert – ähnlich<br />
wie in Deutschland – eine weitere Forschungsrichtung, die gleichermaßen der<br />
Veröffentlichungstätigkeit wie auch der praxisnahen Bearbeitung von Forschungsfragestellungen<br />
einen Stellenwert einräumt. In anderen europäischen Ländern – so<br />
etwa in der Schweiz und in den Niederlanden – bestehen im Unterschied zu<br />
Deutschland im Bereich der Ingenieurwissenschaften jeweils ein oder zwei namhafte<br />
Hochschulen, denen der weit überwiegende Teil der öffentlichen Forschungsförderung<br />
zukommt. Offenbar können die betreffenden Institutionen aufgrund ihrer<br />
Größe und Innovationskraft im internationalen Wettbewerb besser bestehen als vergleichbare<br />
Einrichtungen an deutschen Universitäten.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die Arbeitsgruppe verfügt über eine reichhaltige Erfahrung mit Forschungskooperationen,<br />
und zwar sowohl im Hochschulbereich als auch bezüglich privatwirtschaftlicher<br />
Partner (vgl. Abbildung 8). Mit dem Water Engineering Network e.V. (WEN)<br />
gibt es einen Zusammenschluss von Hochschulinstituten, Unternehmen und freien<br />
Beratern zur Förderung, Verbreitung und Nutzbarmachung des in <strong>Hessen</strong> vorhandenen<br />
Know-Hows im Wassersektor für Drittländer. Mitglieder des WEN sind unter<br />
anderem das Institut WAR der TU Darmstadt sowie Institute verschiedener anderer<br />
hessischer Hochschulen und diverse Ingenieurgesellschaften. Kompetenzfelder des<br />
WEN sind Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Grundwasserschutz und Integriertes<br />
Ressourcenmanagement. Während die Wissenschaft im Netzwerk gut<br />
vertreten ist, ist die Vernetzung mit der Wirtschaft, insbesondere den Wasserversorgern<br />
und mittelständischen Unternehmen, noch ausbaufähig, so dass noch nicht<br />
von einem hessischen Wasserwirtschaftscluster gesprochen werden kann.<br />
70
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 8: Vernetzung des Fachgebietes Abwassertechnik / Wasserwirtschaft an der TU Darmstadt<br />
u. a.<br />
Lurgi<br />
DWA - Deutsche Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.<br />
Tongji Universität<br />
Shanghai<br />
IWW Zentrum<br />
Wasser<br />
u. a.<br />
Cranfield University<br />
Abwassertechnik /<br />
Wasserwirtschaft<br />
DECHEMA<br />
Qingdao<br />
Technological<br />
University<br />
Ruhrverband<br />
Diverse<br />
Ingeneurbüros<br />
Bayer<br />
Degussa<br />
Weitere Partner aus dem Water<br />
Engineering Network e.V. (WEN)<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Auch wenn der Gesprächspartner dezidiert die Ansicht vertritt, dass ein ausgiebiges<br />
Fördervolumen keine hinreichende Bedingung für den Forschungserfolg darstellt, so<br />
sieht er gleichwohl einen besonders vordringlichen Handlungsbedarf im gezielten<br />
Ausbau der öffentlichen Forschungsförderung. Langfristig sei diese unabdingbar,<br />
denn im Hinblick auf zahlreiche Forschungsfragestellungen gebe es letztlich für private<br />
Geldgeber aus ihrer Interessenlage heraus keinen wesentlichen Grund für ein<br />
Engagement. Dies gilt vor allem für langfristig ausgerichtete Themen wie etwa die<br />
sachgerechte Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur zur Wasserversorgung<br />
und Reststoffverwertung. Nicht zuletzt aufgrund des zeitlichen Horizonts und<br />
der Art der Nutzung habe die Forschung in derartigen Feldern in mehrfacher Hinsicht<br />
den Charakter eines öffentlichen Gutes.<br />
71
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Bei der Ausgestaltung des Förderetats sollte ein besonderes Augenmerk auf der Finanzierung<br />
einer leistungsfähigen Grundausstattung der Forschungseinrichtungen<br />
liegen. Diese stellt gleichsam das Startkapital dar, das für den Aufbau einer erfolgreichen<br />
Forschung unerlässlich ist. Gerade bei der Akquisition von Drittmitteln besitzt<br />
die Grundausstattung zudem eine zentrale Bedeutung, denn Geldgeber wie<br />
beispielsweise die EU oder die DFG orientieren sich bei ihren Bewilligungen stark<br />
an den bereits vorhandenen Kapazitäten. Im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung<br />
der Wissenschaftspolitik gibt der Gesprächspartner zu bedenken, dass die Einheit<br />
der Forschung und Lehre nach wie vor ein notwendiges Kriterium für eine<br />
prosperierende Hochschullandschaft darstellt: Eine fachlich anspruchsvolle Lehre<br />
bedarf – vor allem im Hinblick auf die Lehrinhalte – einer leistungsfähigen Forschung.<br />
Nach Aussage des Gesprächsteilnehmers liegen offenbar in anderen Bundesländern<br />
gelungene Beispiele der Förderung einer kompetitiven Forschungslandschaft<br />
vor. Zu nennen sind hier in erster Linie die Länder Bayern, Baden-<br />
Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die auch im Forschungsfeld der Abwassertechnologien<br />
im bundesweiten Vergleich außerordentlich umfangreiche Fördermittel<br />
bereitstellen.<br />
72
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
73
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.3 Medizintechnik<br />
Übersicht 8: Kurzprofil des Fachgebietes Medizintechnik an der FH Gießen-Friedberg<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Innerhalb Deutschlands haben mehr als die Hälfte der jährlichen<br />
Absolventen in der Fachrichtung Medizintechnik ihr Studium in<br />
Gießen absolviert.<br />
• Drittmitteln stammen zum weit überwiegenden Teil von<br />
privatwirtschaftlichen Kooperationspartnern.<br />
Anwendungsbereiche • Bildgebende Verfahren im Bereich der Diagnostik – so etwa bei der<br />
Magnetresonanztomographie – und der Dosimetrie.<br />
• Anknüpfungspunkte bestehen auch zum Molecular Imaging, das<br />
wiederum als Querschnittstechnologie anzusehen ist.<br />
Technologiefeld • Fachliches Spektrum am Fachbereich ist sehr breit und umfasst u.a.<br />
Medizintechnik und Medizininformatik, Orthopädie- und Rehatechnik,<br />
Krankenhausmanagement und Krankenhaustechnik, Biotechnologie<br />
und Umwelttechnik.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Kooperationen mit dem Zentrum für Radiologie der Universität<br />
Marburg, dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung<br />
(IGD) in Darmstadt, zur Klinik und Poliklinik für diagnostische und<br />
interventionelle Radiologie der Universität Mainz und zur Abteilung für<br />
Kinderradiologie der Universität Gießen.<br />
• Industriepartner (bspw. Drägerwerk, Siemens) überwiegend<br />
außerhalb <strong>Hessen</strong>s lokalisert.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• In den meisten Medizintechnikunternehmen wird die Forschung<br />
vergleichsweise autark betrieben.<br />
• Keine namhaften Anbieter im Bereich Bildgebende Verfahren in<br />
<strong>Hessen</strong>.<br />
• Zusammenarbeit zwischen HMWK und HMWVL in Bezug auf die<br />
Technologie- und Forschungsförderung ließe sich intensivieren.<br />
• Unterstützung des Landes bei Netzwerken und<br />
Kommunikationsplattformen.<br />
• Institutionelle Gegebenheiten an den Fachhochschulen (u.a. Fehlen<br />
eines akademischen Mittelbaus) wirken sich nachteilig auf die<br />
dortigen Forschungsaktivitäten aus.<br />
• Die hessischen Universitätskliniken weisen im Bereich der<br />
Medizintechnik sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung<br />
ein sehr umfangreiches Potenzial auf.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
74
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächspartner ist Professor am Fachbereich KMUB - Krankenhaus- und<br />
Medizintechnik, Umwelt- und Biotechnologie der FH Gießen-Friedberg, der in der<br />
Ausbildung von Ingenieuren für das Gesundheitswesen auf eine langjährige Tradition<br />
zurückblickt und bundesweit eine hohe Reputation genießt. Das fachliche<br />
Spektrum ist sehr weit und umfasst u.a. Medizintechnik und Medizininformatik, Orthopädie-<br />
und Rehatechnik, Krankenhausmanagement und Krankenhaustechnik,<br />
Biotechnologie und Umwelttechnik. Diese inhaltliche Bandbreite schlägt sich auch in<br />
der Anzahl der Studiengänge nieder; allerdings haben sich diesbezüglich in jüngerer<br />
Zeit bedeutende Umstrukturierungen vollzogen, denn nach einer zwischenzeitigen<br />
deutlichen Zunahme der inhaltlichen Differenzierung und Anzahl der Studiengänge<br />
werden demnächst die Kapazitäten über eine Neuausrichtung des Studienangebots<br />
wieder gebündelt. Hierzu wird ab 2008 die Anzahl der Studiengänge, die im Jahre<br />
2000 auf zehn erhöht worden war, wieder auf vier reduziert, was allerdings nicht<br />
mit Abstrichen an den Studieninhalten einhergehen wird.<br />
Die bundesweite Bedeutung des Fachbereichs wird auch daran deutlich, dass innerhalb<br />
Deutschlands weit mehr als die Hälfte der jährlichen Absolventen in der<br />
Fachrichtung Medizintechnik ihr Studium in Gießen absolviert hat. Ein nicht unbedeutender<br />
Teil der Studenten stammt aus Schwellenländern und Entwicklungsländern,<br />
in denen dem Aufbau eines funktionierenden Gesundheitswesens eine e-<br />
xistentielle Bedeutung zukommt. Als Herkunftsregionen sind gegenwärtig der arabische<br />
und der ostasiatische Raum, aber auch nach wie vor Westafrika von herausragender<br />
Bedeutung. Gerade in letzter Zeit erfolgte auch ein Zustrom von Studenten<br />
aus Bulgarien.<br />
An der Professur sind gegenwärtig etwa fünf Mitarbeiter tätig. Aufgrund der Ansiedlung<br />
des Lehrstuhls an einer Fachhochschule fehlt ein akademischer Mittelbau weitgehend,<br />
jedoch wurden gerade in jüngerer Zeit erhebliche Anstrengungen unternommen,<br />
um zusätzliches Personal einzustellen. Neue Mitarbeiterstellen werden<br />
vornehmlich aus Drittmitteln finanziert, die zum weit überwiegenden Teil von privatwirtschaftlichen<br />
Kooperationspartnern stammen. Hiermit einhergehend wird im<br />
Wesentlichen angewandte Forschung betrieben.<br />
Der Gesprächspartner bescheinigt der Medizintechnik ein erhebliches Zukunftspotenzial,<br />
was sich nicht zuletzt in den sehr günstigen Beschäftigungschancen für Studienabsolventen<br />
widerspiegelt. In besonderer Weise gilt dies für die Bildgebenden<br />
Verfahren im Bereich der Diagnostik (z.B. Magnetresonanztomographie), u.a. jedoch<br />
auch für die Dosimetrie. In letzterem Fachgebiet ist das am Fachbereich<br />
KMUB angesiedelte Institut für Medizinische Physik und Strahlenschutz (IMPS) sehr<br />
aktiv. Inhaltliche Überschneidungen ergeben sich insbesondere mit der Pharmazie,<br />
der Informatik, der Physik und zahlreichen Teilbereichen der Medizin. Besonders<br />
prägnante Anknüpfungspunkte bestehen zum Molecular Imaging, das wiederum als<br />
Querschnittstechnologie anzusehen ist. Den Aussagen des Gesprächspartners, der<br />
75
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
mehrere Jahre an der University of Chicago geforscht hat, lässt sich entnehmen,<br />
dass die medizintechnische Forschung in den USA deutlich anders strukturiert ist<br />
als in Deutschland. Einerseits ist in den USA die fachliche Ausbildung wesentlich<br />
besser, andererseits ist die inhaltliche Spezialisierung der Forscher weitaus stärker<br />
ausgeprägt. Aufgrund der weiten inhaltlichen Bandbreite umfangreicher Forschungsaktivitäten<br />
ist in Deutschland die Innovationsdichte und Kreativität innerhalb<br />
der Fachrichtung Medizintechnik im internationalen Vergleich sehr hoch. Als Beispiele<br />
für besonders erfolgreiche Forschungsverbünde in anderen Bundesländern<br />
lassen sich das Biomedizinzentrum in Dortmund und die sehr enge Kooperation<br />
zwischen der Universität Lübeck und der Fa. Drägerwerk anführen. Allerdings<br />
wird der Transfer zwischen Hochschulen und Industrie dadurch beeinträchtigt, dass<br />
in der Mehrzahl der Medizintechnikunternehmen zwar eine leistungsfähige eigene<br />
Forschung angesiedelt ist, diese jedoch vergleichsweise autark betrieben wird. Dies<br />
resultiert u.a. aus dem hohen Wettbewerbsdruck auf den Produktmärkten, die in den<br />
meisten Segmenten durch Oligopole gekennzeichnet sind.<br />
Der Medizintechnik-Sektor unterliegt ganz unterschiedlichen Einflussfaktoren, so<br />
insbesondere den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, den demografischen<br />
Gegebenheiten, der Besiedelungsstruktur und dem gesamtwirtschaftlichen<br />
Entwicklungsstand. Die großen Anbieter operieren auf globalen Märkten und müssen<br />
sich daher mit sehr heterogenen Standorteigenschaften auseinandersetzen. 6<br />
Die Entwicklung des Technologiefelds folgt zwar auf der einen Seite einem engen<br />
Innovationszyklus, auf der anderen Seite jedoch kommt die jeweils leistungsfähigste<br />
Technologie nicht selten erst verspätet zur Anwendung, was innerhalb des Gesundheitswesens<br />
mit einem erheblichen Investitionsstau korrespondiert.<br />
Die Außendarstellung des Fachgebiets erfolgt auf vielerlei Weise, wobei Veröffentlichungen<br />
sowohl in begutachteten Fachzeitschriften als auch in Organen für ein<br />
breiteres interessiertes Fachpublikum jeweils eine hohe Priorität eingeräumt wird.<br />
So ist der Gesprächsteilnehmer der verantwortliche Schriftleiter der Zeitschrift mtmedizintechnik,<br />
dem offiziellen Organ des VDI-Fachgebietes Medizintechnik und<br />
des Fachverbandes Biomedizinische Technik. Der Gesprächspartner nimmt regelmäßig<br />
an Fachtagungen teil und engagiert sich zudem in regionalpolitischen Arbeitskreisen<br />
und Gesprächsforen zur Entwicklung des Medizintechnik-Standortes<br />
Mittelhessen.<br />
Besonders intensive fachliche Kooperationen werden mit dem Zentrum für Radiologie<br />
der Universität Marburg unterhalten, wobei insbesondere die Strahlentherapie<br />
im Mittelpunkt steht (vgl. Abbildung 9). Insbesondere die geplante Einrichtung eines<br />
Positronen-Emissions-Tomografie-Zentrums (PET-Zentrums) am Universitätsklinikum<br />
Gießen-Marburg wird nach Einschätzung des Gesprächspartners zu einer weiteren<br />
Belebung der regionalen Forschungslandschaft führen. Offenbar suchen me-<br />
6 Vgl. Brenner, O. (2007), Export und Zulassung von Medizintechnikprodukten für den osteuropäischen Markt. In: mt –<br />
medizintechnik, Nr.1/07, S. 21-23.<br />
76
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
dizinische Forschungsinstitutionen intensiv den Kontakt zu medizintechnischen<br />
Fachbereichen. Enge fachliche Kontakte bestehen zudem zum Fraunhofer-Institut<br />
für Graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt, zur Klinik und Poliklinik für<br />
diagnostische und interventionelle Radiologie des Universität Mainz und zur Abteilung<br />
für Kinderradiologie der Universität Gießen. Ferner existieren vielseitige internationale<br />
Studienaustauschprogramme, an denen etwa ein Fünftel der Studenten<br />
am Fachbereich teilnimmt.<br />
Abbildung 9: Vernetzung des Fachgebietes Medizintechnik an der FH Gießen Friedberg<br />
u. a.<br />
Universitätsklinikum Gießen-Marburg<br />
Universitätsklinikum<br />
Mainz<br />
u. a.<br />
Institut für Medizinische Physik<br />
und Strahlenschutz (IMPS)<br />
Medizintechnik<br />
Fraunhofer-<br />
Institut für Graphische<br />
Datenverarbeitung<br />
IGD<br />
Siemens<br />
Drägerwerk<br />
Braun Melsungen<br />
Philips<br />
Medizin Systeme<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Im Hinblick auf Kooperationen mit der Privatwirtschaft schätzt es der Gesprächsteilnehmer<br />
als problematisch ein, dass im Bereich der Bildgebenden Verfahren in <strong>Hessen</strong><br />
keine namhaften Anbieter ansässig sind. Daher konnte sich bislang kein regionales<br />
Forschungsnetzwerk herausbilden. Des Weiteren sieht er die Zusammenar-<br />
77
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
beit zwischen HMWK und HMWVL in Bezug auf die Technologie- und Forschungsförderung<br />
als verbesserungswürdig an. Wünschenswert wären zudem eine<br />
Unterstützung seitens des Landes <strong>Hessen</strong> bei der Bearbeitung von Anträgen auf<br />
Teilnahme an der EU-Forschungsförderung und ein stärkeres Engagement des<br />
Landes bei der Herausbildung mittelfristig ausgerichteter Netzwerke und Kommunikationsplattformen,<br />
denn ein gemeinsames „Dach“ wäre für die Forschungskooperation<br />
sehr hilfreich. Beispielsweise habe sich bei einem kürzlich vom Oberbürgermeister<br />
der Universitätsstadt Gießen veranstalteten Round-the-table-<br />
Gespräch herausgestellt, dass bei Branchenvertretern ein großer Bedarf zum Austausch<br />
von Informationen (bspw. über Auslandsmärkte) besteht.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Was die Forschungsinfrastruktur am Fachbereich anbelangt, so ist laut Gesprächspartner<br />
eine Aufstockung des mittelfristig angestellten Fachpersonals notwendig.<br />
Grundsätzlich wirken sich die institutionellen Gegebenheiten an den Fachhochschulen<br />
eher nachteilig auf die dortigen Forschungsaktivitäten aus. Ferner sollte die Forschungsförderung<br />
des Landes mit den institutionellen bzw. fachlichen Strukturen der<br />
bereits bestehenden Forschungslandschaft besser in Einklang gebracht werden.<br />
Hierzu wäre es u.U. sinnvoll, auch Kooperationen mit Partnern, die in anderen Bundesländern<br />
ansässig sind, bei der Förderung zu berücksichtigen. In positiver Hinsicht<br />
ist hervorzuheben, dass die hessischen Universitätskliniken im Bereich der<br />
Medizintechnik sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung ein sehr umfangreiches<br />
Potenzial aufweisen.<br />
78
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
79
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4 Life Sciences<br />
5.4.1 Bionik<br />
Übersicht 9: Kurzprofil des Fachgebietes Bionik an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Biotechnik-Zentrum (BitZ) der TU Darmstad fungiert als<br />
Koordinationsstelle für den an der Hochschule angesiedelten<br />
Forschungsschwerpunkt „Biotechnik – biologisch-technische Systeme“<br />
und betätigt sich in der Forschung wie auch in der Lehre.<br />
Anwendungsbereiche • Beispielsweise Design intelligenter Werkstoffe und Oberflächen<br />
(Wärme- und Stofftransport, Adaptronik, Grenzflächen, Verbund- und<br />
Gradientmaterialien), Medizintechnik (Bioprothetik), Mikrosysteme,<br />
Verkehrs- und Logistiksysteme.<br />
Technologiefeld • Im Blickfeld stehen vor allem die Biomimetik, die Biomechatronik, die<br />
Biokybernetik sowie die Biosensorik. Besonders relevante<br />
Teildisziplinen sind die Robotik und die Lokomotion.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Das BitZ ist Mitglied im Bionik-Netzwerk BIOKON, das die bundesweit<br />
bedeutendsten Arbeitsgruppen im Bereich der Bionik umfasst.<br />
• Zudem arbeitet die TU Darmstadt im Europäischen Bionik-Netzwerk<br />
mit.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Trotz guter Kontakte zu einzelnen Industriepartnern bestehen<br />
Potenziale für einen engeren Austausch mit Unternehmen der<br />
hessischen Automobilwirtschaft und der Steuer-, Mess- und<br />
Regelungstechnik, sofern Lücken im Forschungsprofil der TU<br />
Darmstadt geschlossen werden können.<br />
• Passgenaue Forschungsförderung.<br />
• Stärkere Verankerung des Fachgebietes Bionik in der<br />
Forschungslandschaft und im Bildungswesen.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Biotechnik-Zentrum (BitZ) der TU Darmstadt, an dem insgesamt sechs Mitarbeiter<br />
beschäftigt sind, fungiert als Koordinationsstelle für den an der Hochschule<br />
angesiedelten Forschungsschwerpunkt „Biotechnik – biologisch-technische Systeme“<br />
und betätigt sich in der Forschung wie auch in der Lehre. Mit der Einrichtung<br />
des BitZ wurde insbesondere das Ziel verfolgt, die sehr vielfältigen Forschungsaktivitäten<br />
an der TU Darmstadt im Bereich der Biotechnik zu bündeln und hierdurch zu<br />
einer Schärfung des Profils der Hochschule beizutragen. Insgesamt bündelt das<br />
BitZ die Expertise von 28 Hochschullehrern. Das angebotene Lehrveranstaltungsprogramm<br />
umfasst sowohl Vorlesungen und Seminare innerhalb des Lehrbetriebs<br />
80
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
an der Universität, die Bestandteile des interdisziplinären Studienschwerpunktes<br />
„Biotechnik“ sind, als auch Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer und Unterrichtsveranstaltungen<br />
für Schüler. Geplant ist zudem ein Studiengang “Bio-<br />
Engeneering“. Darüber hinaus dient das BitZ als Anlaufstelle für Interessierte aus<br />
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung; zudem trägt es zur nachhaltigen Verankerung<br />
biotechnikbezogener Themen und konturierten Außenwirkung von Forschungsergebnissen<br />
bei. Hierzu dient nicht zuletzt eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die unter anderem über die Bereitstellung fundierter Informationsmaterialien,<br />
eine themenbezogene Medienpräsenz und die Teilnahme an Kongressen, Seminaren,<br />
Workshops und Messen erfolgt. Analoge Veranstaltungen richtet das BitZ ferner<br />
selber aus. Die vielfältigen Forschungsaktivitäten manifestieren sich außerdem<br />
in einer umfangreichen wissenschaftlichen Publikationstätigkeit, deren Fokus<br />
deutlich auf begutachteten Fachzeitschriften liegt.<br />
Die im BitZ zusammengeführten Forschungsaktivitäten beziehen sich u.a. auf die<br />
folgenden Themenfelder: Baubionik, Biosensorik, Strömungsbeeinflussung in Natur<br />
und Technik, Biomechanik, Biomedizintechnik, Robotik und Arbeitswissenschaften.<br />
Das BitZ bietet den institutionellen Rahmen für eine Zusammenarbeit zwischen den<br />
Fachbereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Biologie, Chemie, Physik, Materialund<br />
Geowissenschaften, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Humanwissenschaften<br />
sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Auch hieran wird der breite<br />
inhaltliche Fokus einer Querschnittstechnologie deutlich, der sich am Hochschulstandort<br />
in einer clusterartigen Agglomeration niederschlägt.<br />
Nach Aussage des Gesprächspartners verlaufen die Identifizierung und die Bearbeitung<br />
von Forschungsthemen sowohl über einen Top-down-Prozess, der sich im<br />
Wesentlichen an anvisierten Prototypen orientiert, als auch über einen Bottom-up-<br />
Prozess, d.h. innerhalb inhaltlich breitgefasster Forschungsaktivitäten kristallisieren<br />
sich einzelne Schwerpunkte heraus. In der mittleren Frist soll die biotechnische Forschung<br />
und Lehre an der Hochschule erheblich ausgebaut werden.<br />
Folgende Teildisziplinen stehen derzeit im Vordergrund der Forschung, wobei gleichermaßen<br />
biogene Strukturen ebenso wie biogene Prozesse untersucht werden,<br />
um technologische Komponenten und Systeme wie auch Verfahren zu entwickeln:<br />
a) Die Biomimetik. Konkrete Themenfelder bilden Adaptive Werkstoffe („Smart<br />
Materials“), Grenzflächen („Smart Interfaces“), Interaktionen zwischen Materialien<br />
(haften / kleben), Gradientmaterialien und Verbundmaterialien. Von besonderer<br />
Bedeutung ist die Eignung eines Werkstoffes zum Wärmetransport und<br />
Stofftransport. Im geplanten Exzellenzcluster "Smart Interfaces" entwerfen Natur-<br />
und Ingenieurwissenschaftler gezielt intelligente "Phasen"-Grenzen (der Bereich,<br />
in dem etwa Gas oder eine Flüssigkeit auf eine feste "Wand" trifft), um<br />
Massen-, Impuls- oder Wärmetransport besser steuern zu können.<br />
81
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
b) Die Biomechatronik und die Biosensorik. Besonders relevante Teildisziplinen<br />
sind die Robotik und die Lokomotion, die Automatisierungs- und Regelungstechnik.<br />
Innerhalb der Medizintechnik bildet beispielsweise die Bioprothetik ein bedeutendes<br />
Anwendungsgebiet. In Bezug auf einzelne Komponenten und Systeme liegen Anwendungsfelder<br />
vor allem in der Konstruktionsbionik, so z.B. im Segment der Advanced<br />
Devices bzw. der Mikrosysteme. In Hinsicht auf Verkehrs- und Logistiksysteme<br />
wie auch Gebäude- und Sicherheitssysteme ergibt sich beispielsweise aus der<br />
Untersuchung der Schwarm-Intelligenz ein umfangreicher Erkenntnisgewinn.<br />
Was die Forschungskooperation anbelangt, so ist das BitZ Mitglied im Bionik-<br />
Netzwerk BIOKON, das die bundesweit bedeutendsten Arbeitsgruppen im Bereich<br />
der Bionik umfasst und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert<br />
wird. So wird in den oben genannten Themenfeldern an anderen Hochschulen<br />
ebenfalls intensiv geforscht, und zwar insbesondere an der TU Berlin, der TU Ilmenau,<br />
der TU Karlsruhe, der TU München, der Universität Freiburg i.Br. und der Universität<br />
Jena. Innerhalb des Bundesgebietes ist das Fachgebiet der Bionik somit in<br />
der Forschungslandschaft tief verankert. In <strong>Hessen</strong> gibt es Kooperationsansätze mit<br />
der Hochschule Darmstadt und dem Universitätsklinikum Frankfurt.<br />
In anderen europäischen Ländern – vor allem im Vereinigten Königreich, in Frankreich,<br />
Österreich und der Schweiz – sind ebenfalls breitgefächerte Forschungsaktivitäten<br />
zu beobachten, was sich auch in einem Europäischen Bionik-Netzwerk<br />
manifestieren soll, an dessen Etablierung die TU Darmstadt beteiligt ist. Die Partizipation<br />
an den genannten Netzwerken ermöglicht es dem BitZ, einen intensiven Austausch<br />
von Forschungsergebnissen zu pflegen und aktuelle inhaltliche Trends intensiv<br />
zu beobachten.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Das BitZ und die beteiligten Hochschulpartner pflegen eine vielgestaltige Zusammenarbeit<br />
mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen der Privatwirtschaft,<br />
worunter vor allem die Automobilindustrie, Flugzeugbauer und Flughafenbetreiber<br />
zu nennen sind (vgl. Abbildung 10). Enge Kontakte bestehen auch zur Elektrotechnik-<br />
und Robotikindustrie. Bedeutende privatwirtschaftliche Partner sind etwa Daimler,<br />
BMW, Honda, Rolls Royce und Fraport. Einige der betreffenden Kooperationen<br />
sind langfristig ausgelegt und sehr intensiv, andere wiederum ließen sich durchaus<br />
noch vertiefen.<br />
Aufgrund der hohen Dichte von Unternehmen im Bereich der Mess-, Steuer- und<br />
Regelungstechnik im Rhein-Main-Gebiet ergeben sich zukünftig weitere Potenziale<br />
für eine intensivere Zusammenarbeit auf den Feldern der Biomechatronik und Biosensorik.<br />
Allerdings fehlen an der TU Darmstadt Forschungskapazitäten und Professuren<br />
für Biomechatronik, um die Vernetzung mit der Wirtschaft zu intensiveren.<br />
82
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Bei der Automobilwirtschaft und der Luftfahrtindustrie besteht ein generelles Interesse<br />
an einer Vertiefung der Kooperation auf dem Gebiet der gewichtsoptimierten<br />
Konstruktion, z.B. dem Faserleichtbau. Während gute Kontakte z.B. zu BMW bestehen,<br />
bleibt die Zusammenarbeit mit hessischen Automobilherstellern und Automobilzulieferern<br />
ausbaufähig.<br />
Die Bandbreite der im Rahmen der Kooperationen offerierten Leistungen reicht von<br />
der Erarbeitung konkreter Forschungsfragestellungen über die Erstellung von Machbarkeitsstudien<br />
bis hin zum Wissenstransfer (Durchführung von Management-<br />
Seminaren). Zudem unterhält das BitZ intensive Kontakte zu Fachverbänden wie<br />
dem VDI und dem VDMA wie auch zu Industrie- und Handelskammern. Sowohl<br />
hinsichtlich der Einbindung in Forschungsnetzwerke als auch bezüglich der Kontakte<br />
mit der Privatwirtschaft und öffentlichen Institutionen lässt sich das BitZ als bedeutender<br />
Akteur eines Bionik / Bioengineering-Clusters ansehen.<br />
Abbildung 10: Vernetzung des Fachgebietes Bionik an der TU Darmstadt<br />
Bionik Netzwerk<br />
BIOKON<br />
u. a.<br />
interdisziplinärer Studienschwerpunkt<br />
„Biotechnik“<br />
Hochschule<br />
Darmstadt<br />
Universitätsklinikum<br />
Frankfurt<br />
u. a.<br />
Bionik<br />
Honda<br />
Daimler<br />
Fraport<br />
BMW<br />
Rolls Royce<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
83
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Einen politischen Handlungsbedarf sieht der Gesprächsteilnehmer im Forschungsfeld<br />
der Bionik in mehrfacher Hinsicht. Um regional bzw. überregional verankerte<br />
und inhaltlich fokussierte Wissenschaftslandschaften zu gestalten, sind erhebliche<br />
Zukunftsanstrengungen bei der Forschungsförderung unabdingbar. Dies gilt nicht<br />
zuletzt für die Unterstützung von Kooperationen zwischen öffentlichen Institutionen<br />
und privatwirtschaftlichen Unternehmen. Diesbezüglich existieren gemäß den Angaben<br />
des Gesprächspartners in anderen Bundesländern – vornehmlich in Bayern,<br />
Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen – Förderprogramme, die wesentlich<br />
passgenauer als die hessische Förderkulisse auf Handlungsspielräume und Intentionen<br />
der Antragsteller zugeschnitten sind. Daneben hält es der Gesprächspartner<br />
für notwendig, das Themenfeld der Bionik bzw. Biotechnologie im Bildungswesen<br />
noch stärker zu verankern.<br />
84
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
85
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.2 Rote Biotechnologie: Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik<br />
Übersicht 10: Kurzprofil des Fachgebietes Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik an der Universität<br />
Marburg<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Bezogen auf die Forschungsleistungen lässt sich die Abteilung im<br />
bundesweiten Vergleich den fünf besten Institutionen zuordnen.<br />
• Im internationalen Vergleich gehört sie zu den zehn<br />
forschungsstärksten Einrichtungen.<br />
Anwendungsbereiche • Im Vordergrund steht die Erforschung von Krankheitsmechanismen,<br />
und zwar vor allem in Hinsicht auf Autoimmunerkrankungen und<br />
chronische Entzündungen.<br />
• Die Forschungsergebnisse gelangen sowohl in der Diagnostik als<br />
auch in der Therapie zur Umsetzung.<br />
• Ziel ist letztlich eine systemische Applikation nach dem Prinzip des<br />
Drug-Targeting.<br />
Technologiefeld • Medizinische Forschung vornehmlich im Fachgebiet Immunologie.<br />
• Forschung folgt im Wesentlichen einer translationalen Ausrichtung;<br />
Forschungsergebnisse sollen also möglichst zügig über die<br />
Entwicklung von Medikamenten und deren klinische Anwendung<br />
einem breiten Patientenpublikum zugute kommen.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Gesprächspartner ist Sprecher des DFG-Sonderforschungsbereiches<br />
TR 22 „Allergische Immunantworten der Lunge“, der zusammen mit<br />
der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen<br />
Universität München und der Universität zu Lübeck /<br />
Forschungszentrum Borstel ins Leben gerufen wurde.<br />
• Enge Zusammenarbeit mit bedeutenden Unternehmen der<br />
Pharmaindustrie, beispielsweise Sanofi-Aventis und Boehringer<br />
Ingelheim.<br />
• Rege Kontakte auch zu kleinen und mittleren Unternehmen, so etwa<br />
zur Firma Activaero, einem bedeutenden Hersteller von<br />
Inhalationsgeräten.<br />
• Ausgründung des Unternehmen sterna biologicals, das sich in der<br />
Entwicklung von Therapieansätzen für Bronchialasthma,<br />
Hauterkrankungen und rheumatische Arthritis betätigt.<br />
• Sowohl bei der Anbahnung von Kooperationen als auch bei<br />
Unternehmensausgründungen leistet das TransferZentrum<br />
Mittelhessen (TransMit) wertvolle Unterstützung.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Vergleichsweise geringe Grundausstattung der Hochschulen.<br />
• Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur in Mittelhessen.<br />
• Gezielter Ausbau der bereits vorhandenen fachlichen Stärken der<br />
hessischen Hochschulen.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
86
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächspartner ist Leiter der Abteilung für Klinische Chemie und Molekulare<br />
Diagnostik am Fachbereich Medizin der Philipps - Universität Marburg. Die Abteilung<br />
ist in mehrfacher Hinsicht mit anderen Institutionen verknüpft. Zum ersten<br />
werden für den Fachbereich Medizin Lehrveranstaltungen in den Studiengängen<br />
Humanmedizin, Humanbiologie und Physiotherapie angeboten.<br />
Zum zweiten wird medizinische Forschung betrieben, und zwar vornehmlich im<br />
Fachgebiet Immunologie; so fungiert der Gesprächspartner als Sprecher des DFG-<br />
Sonderforschungsbereiches TR 22 „Allergische Immunantworten der Lunge“,<br />
der zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen<br />
Universität München und der Universität zu Lübeck / Forschungszentrum Borstel ins<br />
Leben gerufen wurde und über den jährlich ca. 2 Mio. Euro an Drittmitteln zur Verfügung<br />
stehen. In diesem Rahmen hat die Forschergruppe die komplette Öffentlichkeitsarbeit<br />
nicht nur für den SFB TR 22, sondern auch für zwei andere – an den<br />
Universitäten in Mainz und Hannover angesiedelte Sonderforschungsbereiche –<br />
übernommen.<br />
Zum dritten erbringt die Abteilung als Diagnostik-Einheit umfangreiche Leistungen in<br />
der Krankenversorgung für das Uniklinikum und für andere Krankenhäuser im<br />
Raum Marburg, und dies vor allem über den Betrieb des Zentrallaboratoriums, in<br />
dem jährlich etwa 3,5 Mio. Proben untersucht werden. In der Abteilung sind etwa<br />
75 Mitarbeiter tätig, hierunter 14 Wissenschaftliche Mitarbeiter, die über Drittmittel<br />
finanziert werden, zehn Ärzte, die sich sowohl in der Krankenversorgung als auch in<br />
der Forschung betätigen, und ungefähr 50 MTAs.<br />
Die Forschung folgt im Wesentlichen einer translationalen Ausrichtung; die Forschungsergebnisse<br />
sollen also möglichst zügig über die Entwicklung von Medikamenten<br />
und deren klinische Anwendung einem breiten Patientenpublikum zugute<br />
kommen. 7 Interdisziplinäre Berührungspunkte existieren insbesondere mit der Biologie,<br />
der Pharmazie und der Chemie. Im Vordergrund steht die Erforschung von<br />
Krankheitsmechanismen, und zwar vor allem in Hinsicht auf Autoimmunerkrankungen<br />
und chronische Entzündungen. Die hierbei gewonnenen Forschungsergebnisse<br />
gelangen sowohl in der Diagnostik als auch der Therapie zur Umsetzung. Eine besondere<br />
Rolle spielt hierbei die Genomik bzw. das genetische Profiling, das in Anlehnung<br />
an die jeweiligen Charakteristika des einzelnen Patienten eine immer ausgeprägtere<br />
Differenzierung und Spezialisierung ermöglicht. Ziel ist letztlich eine<br />
systemische Applikation nach dem Prinzip des Drug-Targeting, bei der möglichst<br />
nur die jeweils krankheitsrelevanten Körperzellen von den Wirkungen eines Medikaments<br />
betroffen sind und daher die Nebenwirkungen minimiert werden. Bedeutende<br />
Anwendungsfelder liegen beispielsweise in der Aerosol-Therapie bei Asthma-<br />
7 Vgl. Perlitz, U. (2004), Rote Biotechnologie in Deutschland: Den Kinderschuhen noch nicht entwachsen. In: Deutsche Bank<br />
Research, Aktuelle Themen, Nr. 305. Frankfurt a.M.<br />
87
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Erkrankungen oder der Chemotherapie bei Tumoren. Im Hinblick auf die Behandlung<br />
von Nervenerkrankungen kommen zudem wichtige fachliche Impulse aus den<br />
Neurowissenschaften.<br />
Bezogen auf die fachbezogenen Forschungsleistungen lässt sich die Abteilung im<br />
bundesweiten Vergleich den fünf besten Institutionen zuordnen; im internationalen<br />
Vergleich gehört sie zu den zehn forschungsstärksten Einrichtungen. Dies manifestiert<br />
sich u.a. in einer vielfältigen Publikationstätigkeit, was nicht zuletzt an einem<br />
sehr hohen Impact-Factor zu erkennen ist. Zudem engagiert sich die Abteilung stark<br />
in der Ausarbeitung eines Qualitätsmanagements, was u.a. die Erstellung eines<br />
diesbezüglichen Handbuches umfasst.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die Forschungsgruppe arbeitet eng mit bedeutenden Unternehmen der Pharmaindustrie<br />
zusammen; zu nennen sind hier beispielsweise Sanofi-Aventis und Boehringer<br />
Ingelheim (vgl. Abbildung 11). Zu kleinen und mittleren Unternehmen bestehen<br />
ebenfalls rege Kontakte, so beispielsweise zur Firma Activaero, einem bedeutenden<br />
Hersteller von Inhalationsgeräten.<br />
Die Initiative geht hierbei von beiden Seiten aus: Die Wissenschaftler tragen Forschungsideen<br />
an die Kooperationspartner heran, die Partner eröffnen jedoch auch<br />
eigene Projektvorschläge. Angestrebt wird i.d.R. eine mittelfristige oder langfristige<br />
Zusammenarbeit. Ferner hat sich aus der Abteilung das Unternehmen sterna<br />
biologicals gebildet, das sich in der Entwicklung von Therapieansätzen für Bronchialasthma,<br />
Hauterkrankungen und rheumatische Arthritis betätigt und im neugeschaffenen<br />
Biomedizinischen Forschungszentrum Marburg seinen Sitz hat. Sowohl<br />
bei der Anbahnung von Kooperationen als auch bei Unternehmensausgründungen<br />
leistet offenbar das TransferZentrum Mittelhessen (TransMit) wertvolle Unterstützung.<br />
88
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 11: Vernetzung des Fachgebietes Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik<br />
an der Universität Marburg<br />
u. a.<br />
DFG-SFB TR 22 „Allergische<br />
Immunantworten der Lunge“<br />
LMU München<br />
TU München<br />
Universität<br />
zu Lübeck /<br />
Forschungszentrum<br />
Borstel<br />
u. a.<br />
Sanofi-Aventis<br />
Klinische Chemie<br />
und Molekulare<br />
Diagnostik<br />
Novartis<br />
Activaero<br />
Boehringer Ingelheim<br />
sterna biologicals<br />
(eigene Ausgründung)<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Ein vordringliches Problem sieht der Gesprächsteilnehmer in der viel zu geringen<br />
Grundausstattung der hessischen Forschungseinrichtungen. Gerade bei der Einwerbung<br />
von Drittmitteln sei dies im Vergleich etwa zu den Münchner Universitäten<br />
oder der Berliner Humboldt-Universität ein deutlicher Nachteil. Zwar bewege sich<br />
die medizinische Forschungsgrundausstattung je Student in <strong>Hessen</strong> in einer ähnlichen<br />
Größenordnung wie in Mecklenburg-Vorpommern, jedoch wolle das Land mit<br />
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern konkurrieren.<br />
Ein weiteres zentrales Problemfeld tangiert offenbar weniger die Forschungslandschaft,<br />
sondern die allgemeine Infrastruktur in Mittelhessen. Dies gilt etwa für die<br />
bauliche Ausstattung der Universitäten, die Kulturszene oder die Verkehrsinfrastruktur,<br />
zumal der Standort Marburg weitaus ungünstiger an das Straßennetz angebun-<br />
89
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
den ist als der Standort Gießen. Der Gesprächspartner vertritt den Standpunkt, dass<br />
von politischer Seite aus darauf hingewirkt werden sollte, die im Vergleich zur<br />
Rhein-Main-Region vorliegenden Standortnachteile des mittelhessischen Raumes<br />
zumindest teilweise über eine gezielte Förderung auszugleichen. Für den Ausbau<br />
einer prosperierenden Biotechnologie-Landschaft sei dies unabdingbar. Dies betrifft<br />
nicht zuletzt die Rekrutierung des Fachpersonals, denn auch im Hinblick auf die Forschungslandschaft<br />
gewinnen sowohl wissenschaftliche als auch regionalwirtschaftliche<br />
und „weiche“ Standortfaktoren zunehmend an Bedeutung. So hat der Gesprächspartner<br />
schon mehrere hochqualifizierte Mitarbeiter an die Rhein-Main-<br />
Region „verloren“, weil dort jeweils für den Ehepartner ein Arbeitsplatz vorhanden<br />
war. In Hinsicht auf die eigentliche Forschungsförderung plädiert er dafür, sich beim<br />
Ausbau der Hochschulstandorte an fachlichen Schwerpunkten zu orientieren, also<br />
bereits vorhandene Stärken zu erkennen und gezielt auszubauen.<br />
90
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
91
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.3 Rote Biotechnologie: Pharmazeutische Biologie<br />
Übersicht 11: Kurzprofil des Fachgebietes Pharmazeutische Biologie an der Universität Frankfurt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Grundlagenforschung und anwendungsnahe Forschung.<br />
• Wissenstransfer über Weiterbildungsmaßnahmen für approbierte<br />
bzw. bereits in der beruflichen Praxis stehende Apotheker.<br />
Anwendungsbereiche • Entwicklung neuartiger Vektoren für die Gentherapie.<br />
• Therapie von Leukämierekrankungen.<br />
Technologiefeld • Untersuchung von Transpositionsmechanismen und der Adaptation<br />
dieser Mechanismen an das humane System.<br />
• Erforschung von Leukämieerkrankungen, die durch chromosomale<br />
Translokationen des MLL Gens hervorgerufen werden.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Standort im Biozentrum der Universität Frankfurt, an dem sich<br />
mehrere Institute der Fachbereiche „Biochemie, Chemie und<br />
Pharmazie und Biologie“ und „Biowissenschaften“ befinden.<br />
• Mitglied der DFG-Forschergruppe „Pathologische Genprodukte und<br />
ihre Wirkmechanismen“.<br />
• Partizipation am Zentrum für Arzneimittelforschung, -entwicklung und<br />
-sicherheit (ZAFES)<br />
• Zum ZAFES gehört auch das Klinische Studienzentrum Rhein-Main<br />
(KSRM), das auf einer Kooperation des Frankfurter Uniklinikums mit<br />
in der Region ansässigen Lehrkrankenhäusern, Krankenhäusern und<br />
ambulanten Einrichtungen beruht.<br />
• Gründung des Diagnostic Center for Acute Leukemia (DCAL)<br />
gemeinsam mit dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des<br />
Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität.<br />
• Beteiligung an der Graduiertenschule Frankfurt Graduate School for<br />
Translational Biomedicine - FIRST, die gemeinsam von der<br />
Universität Frankfurt und der Frankfurt Bio Bech Alliance initiiert<br />
wurde.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Übergewicht der Konsortialanträge bei der Forschungsförderung führt<br />
zu einer Einschränkung der Forschungsfreiheit.<br />
• Außendarstellung bei Forschungsanträgen nimmt umfangreiche<br />
Ressourcen in Anspruch.<br />
• Vielfätige Kriterien bei der Veranschlagung der Forschungsbudgets.<br />
• Dynamik bei der Herausbildung von konturierten<br />
Forschungsschwerpunkten und Forschungszentren innerhalb der<br />
hessischen Hochschullandschaft ist positiv zu bewerten.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
92
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächsteilnehmer ist Professor am Institut für Pharmazeutische Biologie, einem<br />
der vier pharmazeutischen Institute des Fachbereichs Biochemie, Chemie und<br />
Pharmazie der Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt. Das Institut umfasst<br />
noch eine weitere Professur und zeichnet sich in organisatorischer Hinsicht dadurch<br />
aus, dass sämtliche – ursprünglich auch an einzelne Lehrstuhle gebundene – Ressourcen<br />
wie etwa Bibliothek, Laborausstattung, EDV-Kapazitäten gleichsam in einen<br />
einzigen Pool überführt worden sind und daher sämtlichen Mitarbeitern zur<br />
Verfügung stehen. Daher wird die Institutsausstattung sehr effizient genutzt. Generell<br />
wird in der Außendarstellung ein großer Wert darauf gelegt, nicht einzelne Lehrstühle,<br />
sondern das Institut als Einheit in den Vordergrund zu stellen. Das Institut<br />
hat seinen Standort im Biozentrum der Universität Frankfurt, an dem sich mehrere<br />
Institute der Fachbereiche „Biochemie, Chemie und Pharmazie und Biologie“ und<br />
„Biowissenschaften“ befinden und etwa 300 Mitarbeiter tätig sind. Die vom Institut<br />
an der Universität angebotenen Lehrveranstaltungen bewegen sich im inhaltlichen<br />
Rahmen der Approbationsordnung für Apotheker. Darüber hinaus engagiert sich die<br />
Arbeitsgruppe intensiv in der Weiterbildung für approbierte bzw. bereits in der beruflichen<br />
Praxis stehende Apotheker. Die betreffenden Lehrveranstaltungen finden<br />
bundesweit an unterschiedlichen Standorten statt.<br />
Die Arbeitsgruppe umfasst etwa 25 Mitarbeiter, die sich im Wesentlichen auf<br />
Grundlagenforschung und anwendungsnahe Forschung konzentrieren. Eine<br />
umfangreiche Einwerbung von Drittmitteln (etwa 320.000 Euro jährlich) geht mit<br />
zahlreichen Forschungskooperationen einher, so etwa mit der Partizipation an der<br />
DFG-Forschergruppe „Pathologische Genprodukte und ihre Wirkmechanismen“<br />
Bei der Akquisition von Einzelprojekten werden ebenfalls regelmäßig Erfolge<br />
erzielt.<br />
Das Spektrum der Forschungsaktivitäten des Institutes umfasst im Wesentlichen<br />
zwei inhaltliche Felder. Der erste Schwerpunkt liegt auf der Target-Identfizierung<br />
und der Untersuchung von Transpositionsmechanismen anhand des Modellorganismus<br />
des zellulären Schleimpilzes Dictyostelium discoideum, der Adaptation dieser<br />
Mechanismen an das humane System und der Entwicklung neuartiger Vektoren<br />
für die Gentherapie. Der zweite Schwerpunkt beinhaltet die Erforschung von Leukämieerkrankungen,<br />
die durch chromosomale Translokationen des MLL Gens hervorgerufen<br />
werden. Die vielseitigen Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe schlagen<br />
sich in zahlreichen Publikationen nieder, deren Bandbreite von Aufsätzen in begutachteten<br />
internationalen Fachzeitschriften über Organe für ein breiteres Fachpublikum<br />
bis hin zu Lehrbüchern reicht. Zudem fungiert der Gesprächspartner als<br />
Schriftleiter für die Fachorgane „Pharmazie in unserer Zeit“ und „Die Pharmazie“ wie<br />
auch als Mitglied in den Herausgebergremien folgender Zeitschriften: “Biotechnolo-<br />
93
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
gy Journal“ (senior editor), „Sciencia Pharmaceutica“, „Deutsche Apothekerzeitung“<br />
sowie „Gentechnik und Recht“.<br />
Das Institut partizipiert am Zentrum für Arzneimittelforschung, -entwicklung und<br />
-sicherheit (ZAFES) der Universität Frankfurt, an dem sich 41 Professoren aus<br />
28 Universitätsinstituten und klinischen Zentren der Fachbereiche „Biochemie,<br />
Chemie und Pharmazie“ und „Humanmedizin“ beteiligen; ferner fungieren<br />
12 wissenschaftliche Institutionen als assoziierte Partner. Das zentrale Ziel der Aktivitäten<br />
am ZAFES besteht darin, im Hinblick auf die medizinischen Indikationen<br />
Schmerz, Entzündungen und Krebs unter Berücksichtigung sämtlicher Phasen der<br />
Forschung und Erprobung zu einer Beschleunigung der Entwicklung innovativer<br />
Arzneimittel beizutragen. Das ZAFES bildet einen bedeutenden Akteur innerhalb<br />
des Pharmazie-Clusters Rhein-Main und weist eine intensive Vernetzung mit anderen<br />
in der Pharmaforschung tätigen Akteuren auf. 8 Zum ZAFES gehört das Klinische<br />
Studienzentrum Rhein-Main (KSRM), das auf einer Kooperation des Frankfurter<br />
Uniklinikums mit in der Region ansässigen Lehrkrankenhäusern, Krankenhäusern<br />
und ambulanten Einrichtungen beruht. Im Rahmen des KSRM werden klinische<br />
Studien durchgeführt, wobei die Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern<br />
– unter einer intensivierten Nutzung vorhandener Kapazitäten – die Rekrutierung<br />
teilnehmender Patienten erleichtert.<br />
Zudem hat das Institut gemeinsam mit dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin<br />
des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität das Diagnostic Center for<br />
Acute Leukemia (DCAL) gegründet. Hierbei handelt es sich um ein Diagnostikzentrum<br />
mit einer europaweit hohen Reputation, das sich der Erforschung chromosomaler<br />
reziproker Translokationen des menschlichen MLL-Genes im Zusammenhang<br />
mit akuten Leukämieerkrankungen (AML und ALL) widmet. Das DCAL unterhält enge<br />
Kooperationen mit Partnerinstitutionen in Deutschland und anderen EU-Ländern<br />
(u.a. Klinikum Großhadern München, Universitätsklinikum Heidelberg, Charité Berlin,<br />
University College London, Erasmus Medical Center Rotterdam, Universitätsklinikum<br />
Zürich, Queen Mary Hospital Hong Kong, Aarhus University Hospital, Baylor<br />
College of Medicine / Texas).<br />
Daneben pflegt die Arbeitsgruppe zahlreiche Einzelkooperationen mit Wissenschaftlern<br />
in Deutschland, Italien, Österreich, Tschechien, der Schweiz und dem Vereinigten<br />
Königreich. Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit mit einer<br />
Arbeitsgruppe an der Universität Jena. Insgesamt ist das Institut für Pharmazeutische<br />
Biologie also intensiv in verschiedene Forschungsnetzwerke eingebunden.<br />
8 Vgl. Krüger-Roth, D., F. Torns, M. Böss, A. Heumann und C. Junkersfeld ( 2006), Wissensatlas FrankfurtRheinMain. Herausgegeben<br />
von: Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main, IHK Forum Rhein-Main, Wirtschaftsinitiative<br />
FrankfurtRheinMain und INM - Institut für neue Medien. Frankfurt a.M., S. 31.<br />
94
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Vernetzung mit Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die Arbeitsgruppe war maßgeblich am Aufbau der Graduiertenschule Frankfurt<br />
Graduate School for Translational Biomedicine - FIRST beteiligt, die gemeinsam<br />
von der Universität Frankfurt und dem Georg-Speyer-Haus – einem in Frankfurt ansässigen<br />
Chemotherapeutischen Forschungsinstitut – initiiert wurde. (vgl. Abbildung<br />
12). Ferner ist der Gesprächspartner Mitbegründer bzw. Gesellschafter dreier Unternehmen<br />
(Socrates CSC, PharmaCon, Phenion) und Mitglied in mehreren Aufsichtsräten.<br />
Was die Mitarbeit in Gremien und wissenschaftlichen Vereinigungen<br />
anbelangt, so fungierte er von 2000 bis 2004 als Präsident der deutschen Pharmazeutischen<br />
Gesellschaft (DPhG) und seit 2004 als Mitglied des Executive Committees<br />
der European Federation of Pharmaceutical Sciences (EUFEPS). Ferner betätigt<br />
er sich als Biotechnologiebeauftragter im Technologiebeirat der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Abbildung 12: Vernetzung des Fachgebietes Pharmazeutische Biologie an der Universität Frankfurt<br />
u. a.<br />
Zentrum für Arzneimittelforschung,<br />
-entwicklung und -sicherheit (ZAFES)<br />
DFG-Forschergruppe „Pathologische Genprodukte<br />
und ihre Wirkmechanismen“<br />
Diagnostic Center<br />
for Acute<br />
Leukemia<br />
(DCAL)<br />
u. a.<br />
Pharmazeutische<br />
Biologie<br />
Frankfurt Graduate<br />
School for<br />
Translational<br />
Biomedicine<br />
- FIRST<br />
Merck<br />
Sanofi-Aventis<br />
Lilliy<br />
Phenion<br />
PharmaProjekthaus<br />
weitere Partner in der<br />
Frankfurt Bio Tech Alliance<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
95
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
In Hinsicht auf die Forschungslandschaft in <strong>Hessen</strong> hebt der Gesprächspartner<br />
die gerade in jüngerer Zeit zu beobachtende Dynamik in der Herausbildung von<br />
konturierten Forschungsschwerpunkten und Forschungszentren als besonders positiv<br />
hervor. Allerdings merkt er bezüglich der Forschungsförderung kritisch an,<br />
dass das mittlerweile doch deutliche Übergewicht der Konsortialanträge letztlich zu<br />
einer Einschränkung der Forschungsfreiheit geführt habe, denn gerade in der Beantragung<br />
von Einzelprojekten manifestierten sich nicht selten sehr kreative und innovative<br />
Forschungsideen. Auch ist nach seiner Einschätzung die Antragstellung –<br />
insbesondere bei Anträgen für EU-Förderprogramme – nicht zuletzt im Hinblick auf<br />
formale Kriterien sehr aufwendig und führt daher i.d.R. zu einer umfangreichen Inanspruchnahme<br />
von Ressourcen. Zudem schätzt der Gesprächspartner die Gewichtung<br />
von Forschungsbudgets anhand bereits eingeworbener Drittmittel als eher einseitig<br />
ein. Seiner Auffassung nach wäre eine Orientierung an weiteren Kriterien wie<br />
etwa der Publikationstätigkeit durchaus sinnvoll.<br />
96
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
97
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.4 Grüne Biotechnologie: Landnutzung / Ressourcenmanagement<br />
Übersicht 12: Kurzprofil des Fachgebietes Landnutzung / Ressourcenmanagement an der Universität Gießen<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Im Wesentlichen wird Grundlagenforschung mit<br />
Anwendungscharakter betrieben.<br />
• Förderung u.a. durch die DFG, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt -<br />
DBU und das BMBF.<br />
Anwendungsbereiche • Bewertung und Entwicklung von Landnutzungskonzepten unter<br />
ökologischen und agronomischen Gesichtspunkten.<br />
Technologiefeld • Hydrologische Modellierung, Analyse von Stoffströmen, der Dynamik<br />
von Oberflächengewässern und der Bodenerosion.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Einbindung in das Interdisziplinäre Forschungszentrum Gießen (IFZ).<br />
• Gesprächspartner fungiert als Sprecher des DFG-<br />
Sonderforschungsbereiches „Landnutzungskonzepte für periphere<br />
Regionen“ und als Hauptakteur der Forschergruppe zum Themenfeld<br />
„Water“ des Netzwerkes German Egyptian Year of Science and<br />
Technology 2007.<br />
• Beteiligung an der DFG-Forschergruppe 536 „Matter fluxes in<br />
grasslands of the Xilin river watershed, Inner Mongolia as influenced<br />
by stocking rate (MAGIM)“.<br />
• Projektgebundene Forschungskontakte mit privatwirtschaftlichen<br />
Partnern werden insbesondere über den Industrieverband Agrar<br />
geknüpft.<br />
• Zielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit bilden hierbei neben Vertretern<br />
aus der Wissenschaft auch Akteure aus öffentlichen Körperschaften<br />
und privatwirtschaftlichen Unternehmen und Branchenverbänden<br />
(z.B. Bauernverband).<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Arbeitsbedingungen am Standort hervorragend, und zwar sowohl<br />
hinsichtlich der baulichen Infrastruktur als auch bezüglich der<br />
technischen Ausstattung.<br />
• Fokussierung der Forschungsförderung auf bereits bestehende<br />
leistungsfähige Strukturen.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Gespräch wurde mit dem Inhaber der Professur für Ressourcenmanagement<br />
am Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen geführt. Am Lehrstuhl, der ebenfalls am oben erläuterten Interdisziplinären<br />
Forschungszentrum Gießen (IFZ) lokalisiert ist, sind etwa<br />
20 Mitarbeiter tätig, hierunter vier Postdoktoranden und sieben Doktoranden. Im<br />
Wesentlichen wird Grundlagenforschung mit Anwendungscharakter betrieben. Die<br />
98
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschungsaktivitäten werden in mehrfacher Hinsicht über Drittmittel gefördert, so<br />
etwa im Rahmen des an der Universität Gießen angesiedelten DFG-<br />
Sonderforschungsbereichs 299 „Landnutzungskonzepte für Periphere Regionen“,<br />
dessen Sprecher der Gesprächspartner ist, der DFG-Forschergruppe 536<br />
„Matter fluxes in grasslands of the Xilin river watershed, Inner Mongolia as influenced<br />
by stocking rate (MAGIM)“ und über mehrere Programme der Bundesregierung<br />
wie auch der Deutschen Bundessstiftung Umwelt - DBU. Zudem ist der<br />
Gesprächsteilnehmer der Koordinator des GUIDE - Giessen University Center for<br />
Infection, Desease and Environment, einer Forschungsinitiative in den Lebenswissenschaften,<br />
für den die Universitäten Gießen und Marburg im Rahmen der Exzelleninitiative<br />
des Bundes einen Gemeinschaftsantrag gestellt haben.<br />
Der Forschungsfokus liegt vor allem auf den Themenfeldern hydrologische Modellierung,<br />
Stoffströme, Dynamik von Oberflächengewässern und Bodenerosion.<br />
Gegenwärtig besonders intensiv untersuchte Fragestellungen bewegen sich im<br />
Spannungsfeld zwischen Landschaftsforschung und Medizin, wofür u.a. die Verknüpfung<br />
zwischen Hydrologie und Virologie ein zutreffendes Beispiel ist. Laut Aussage<br />
des Gesprächsteilnehmers wird in Zukunft die Relevanz der Zusammenhänge<br />
zwischen Landnutzung, Wasserversorgung und Gesundheit weiter zunehmen; 9<br />
weltweit gilt dies nicht allein für naturräumlich begünstigte hochverdichtete Regionen<br />
mit einer intensiven Agrarerzeugung – so etwa im Nildelta oder in Ostchina – , sondern<br />
auch in dünnbesiedelten semiariden bzw. ariden Regionen, in denen aufgrund<br />
ungünstiger Standortbedingungen extensive Landnutzungssysteme vorherrschen.<br />
Ausgeprägte fachliche Verflechtungen bestehen mit der Biologie, der Medizin, der<br />
Veterinärmedizin, der Geographie und der Geologie. Im Hinblick auf die Lehre ist<br />
vor allem der interdisziplinäre englischsprachige Master-Studiengang Agrobiotechnology<br />
zu erwähnen, der auf eine internationale Zielgruppe ausgerichtet ist.<br />
Im Kontext der bearbeiteten Themenfelder pflegt der Lehrstuhl vielfältige internationale<br />
Forschungskontakte. Den institutionellen Rahmen bilden hierfür mittelfristig<br />
oder langfristig ausgelegte Netzwerke, an denen auch andere deutsche Forschungsinstitutionen<br />
beteiligt sind. Der Gesprächspartner ist einer der Akteure der<br />
Forschergruppe zum Themenfeld „Water“ des Netzwerkes German Egyptian Year<br />
of Science and Technology 2007, das vom BMBF gefördert wird. Kooperationspartner<br />
in Ägypten sind u.a. das National Water Research Center in Kairo und die<br />
Faculty of Engeneering der Cairo University; in Deutschland sind neben der Justus-<br />
Liebig-Universität die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Fachhochschule<br />
Köln und die RWTH Aachen beteiligt. Innerhalb der DFG-Forschergruppe 536<br />
wird am Lehrstuhl ein Teilprojekt zur Thematik „Regionale Wasserflüsse und daran<br />
gekoppelte Transportpfade für C und N“ bearbeitet. Kooperationspartner sind hierbei<br />
u.a. das Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) in Garmisch-<br />
9 Vgl. Perlitz, U. (2004), Grüne Biotechnologie: Weg aus der Sackgasse in Europa gesucht. In: Deutsche Bank Research, Aktuelle<br />
Themen, Nr. 287. Frankfurt a.M.<br />
99
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Partenkirchen und das Institute of Botany der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.<br />
Laut Aussage des Gesprächspartners gestaltet sich die Zusammenarbeit<br />
mit den chinesischen Partnern als sehr kooperativ und fruchtbar.<br />
Intensive Forschungskontakte bestehen zudem mit der Ege-University in Izmir, der<br />
University of Edinburgh und mehreren lateinamerikanischen Hochschulen.<br />
Ferner beteiligt sich die Arbeitsgruppe an dem von der Deutschen Bundesstiftung<br />
Umwelt - DBU unterstützten Forschungsvorhaben „Schlagbezogene Risikoabschätzung<br />
zum Pflanzenschutzmitteleintrag in Oberflächengewässer als Bestandteil des<br />
‚Informationssystems Integrierte Pflanzenproduktion’ (ISIP)“. Am DFG-Sonderforschungsbereich<br />
299 „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“ partizipiert<br />
sie über ein Projekt zum Titel „Modellierung des mesoskaligen Landschaftswasserund<br />
Stoffhaushaltes“. Insgesamt ist der Lehrstuhl somit intensiv in nationale wie<br />
auch internationale Forschungskooperationen eingebunden. Das Schwergewicht<br />
der Publikationstätigkeit liegt auf begutachteten Zeitschriften.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Projektgebundene Forschungskontakte mit privatwirtschaftlichen Partnern werden<br />
insbesondere über den Industrieverband Agrar geknüpft (vgl. Abbildung 13). Untersuchte<br />
Themenfelder sind hierbei beispielsweise die Folgewirkungen des Düngemittel-<br />
und Pflanzenschutzmitteleinsatzes und die Zusammenhänge zwischen der<br />
Gestaltung der Kulturlandschaft und der Fremdenverkehrswirtschaft.<br />
Die Außendarstellung des Fachgebietes erfolgt in mehrfacher Hinsicht, nämlich über<br />
die Teilnahme an nationalen wie auch internationalen Kongressen und über die eigene<br />
Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Workshops und Gesprächsrunden.<br />
Zielgruppe bilden hierbei neben Vertretern aus der Wissenschaft auch Akteure<br />
aus öffentlichen Körperschaften und privatwirtschaftlichen Unternehmen und Branchenverbänden<br />
(z.B. Bauernverband). Bei der Organisation von Veranstaltungen<br />
beschreitet die Arbeitsgruppe auch unkonventionelle Wege; Tagungen werden<br />
beispielsweise in Kooperation mit dem Mathematikum in Gießen durchgeführt.<br />
100
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 13: Vernetzung des Fachgebietes Landnutzung / Ressourcenmanagement an der Universität<br />
Gießen<br />
u. a.<br />
u. a.<br />
DFG-SFB 299<br />
„Landnutzungskonzepte<br />
für<br />
periphere<br />
Regionen“<br />
German Egyptian Year<br />
of Science and Technology 2007<br />
DFG-FG 536 „Matter fluxes in grasslands of<br />
the Xilin river watershed, Inner Mongolia as<br />
influenced by stocking rate (MAGIM)“<br />
Landnutzung /<br />
Ressourcenmanagement<br />
GTZ<br />
Umweltbundesamt<br />
Interdisziplinäres<br />
Forschungszentrum<br />
Gießen (IFZ)<br />
Industrieverband Agrar<br />
Rheinische<br />
Braunkohle AG<br />
Deutscher Bauernverband<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen für die Forschung in <strong>Hessen</strong> hebt der Gesprächsteilnehmer<br />
besonders hervor, dass die Arbeitsbedingungen an seinem Institut<br />
hervorragend sind. Dies gilt sowohl für die bauliche Infrastruktur als auch die<br />
technische Ausstattung. Was die öffentliche Forschungsförderung betrifft, so ist<br />
nach seinen Aussagen eine Fokussierung auf schon bestehende leistungsfähige<br />
Strukturen sinnvoll, um diese weiter auszubauen. Zudem gilt es, die enormen wissenschaftlichen<br />
Potenziale, die sich am Hochschulstandort Gießen in den Disziplinen<br />
Agrarwissenschaften, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Medizin<br />
und Veterinärmedizin bieten, noch umfangreicher auszuschöpfen.<br />
101
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.5 Weiße Biotechnologie / Biokatalyse und Biofermentation<br />
Übersicht 13: Kurzprofil des Fachgebietes Biokatalyse und Biofermentation an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • In der Forschung über die Oligosaccharid-Synthese und Kohlenstoff-<br />
Kohlenstoff-Verbindungen hat die Arbeitsgruppe im europäischen<br />
Vergleich bahnbrechende Arbeiten geleistet.<br />
Anwendungsbereiche • Anwendungsfelder der Weißen Biotechnologie liegen beispielsweise<br />
in der Vitaminerzeugung und der Verarbeitung von Milchprodukten<br />
und Fruchtsäften.<br />
• Medizinische Anwendungsbereiche sind etwa die Tumortherapie und<br />
die Behandlung von Autoimmunerkrankungen.<br />
• Wachsende Bedeutung der Raffinierung nachwachsender Rohstoffe.<br />
Technologiefeld • Forschungsaktivitäten beziehen sich vornehmlich auf molekulare<br />
Ensembles, stereoisomere Bibliotheken, Zelloberflächen, die<br />
Enzymkatalyse und Syntheseleistungen.<br />
• Besonderes Erkenntnisziel besteht in der detaillierten<br />
Charakterisierung der Spezifizität der Verbindungen und Prozesse,<br />
und dies im Hinblick auf eine breite Anwendung bzw. charakterisierte<br />
Produktfamilien.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Partizipation am DFG-Schwerpunktprogramm 1170 "Gelenkte<br />
Evolution zur Optimierung und zum Verständnis molekularer<br />
Biokatalysatoren".<br />
• Erfolgreiche Forschung im Bereich der weißen Biotechnologie in<br />
einigen privaten Großunternehmen, so etwa bei der BASF, der<br />
Degussa und der DSM – Biotech.<br />
• Sitz der DECHEMA in Frankfurt von hoher Bedeutung für die<br />
Forschung im Rhein-Main-Gebiet.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeine Handlungsbedarfe<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Zielsetzungen öffentlicher Forschungsinstitutionen und diejenigen<br />
privatwirtschaftlicher Unternehmen unterscheiden sich deutlich, was<br />
Kooperationen verkompliziert.<br />
• Zahlreiche mittelständische Chemieunternehmen weisen offenbar zu<br />
geringe Kapazitäten auf, um sich in der Entwicklung<br />
biotechnologischer Produktionsprozesse zu betätigen.<br />
• Aufstockung der Grundausstattung an den Hochschulen.<br />
• Förderprogramme sollten die Lücke zwschen DFG<br />
(Grundlagenforschung) und BMBF (angewandte Forschung)<br />
schließen.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
102
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächspartner ist Inhaber der Professur für Organische Chemie und war<br />
über einen langen Zeitraum hinweg Studiendekan des Fachbereichs Chemie. Die<br />
Arbeitsgruppe, die vornehmlich Grundlagenforschung betreibt, besteht aus etwa<br />
zehn Mitarbeitern, hierunter zwei promovierten Forschern. Gegenwärtig engagiert<br />
sich der Gesprächspartner stark innerhalb des DFG-Schwerpunktprogramms<br />
1170 "Gelenkte Evolution zur Optimierung und zum Verständnis molekularer<br />
Biokatalysatoren". Ferner erfährt der Lehrstuhl über mehrere EU-Forschungsprogramme<br />
Unterstützung, und dies insbesondere bei Auslandsaufenthalten und<br />
Tagungsteilnahmen.<br />
In der Forschung über die Oligosaccharid-Synthese und Kohlenstoff-<br />
Kohlenstoff-Verbindungen hat die Arbeitsgruppe im europäischen Vergleich<br />
bahnbrechende Arbeiten geleistet, die teilweise im Kontext zur Habilitationsschrift<br />
des Gesprächspartners stehen. Die gegenwärtigen Forschungsaktivitäten beziehen<br />
sich vornehmlich auf molekulare Ensembles, stereoisomere Bibliotheken, Zelloberflächen,<br />
die Enzymkatalyse und Syntheseleistungen. Ein besonderes Erkenntnisziel<br />
besteht in der detaillierten Charakterisierung der Spezifizität der Verbindungen und<br />
Prozesse, und dies im Hinblick auf eine breite Anwendung bzw. charakterisierte<br />
Produktfamilien. Im Vordergrund stehen weniger konkrete „Endprodukte“, sondern<br />
vielmehr grundlegende Erkenntnisse über Methoden und Prozesse.<br />
Innerhalb des fachlichen Spektrums der Weißen Biotechnologie sind Aspekte der<br />
Chemie, der Ingenieurwissenschaften und der Biologie wie auch der Medizin, der<br />
Pharmazie und den Ernährungswissenschaften von hoher Relevanz. Bedeutende<br />
Anwendungsfelder der weißen Biotechnologie liegen beispielsweise in der Vitaminerzeugung<br />
und der Verarbeitung von Milchprodukten und Fruchtsäften. 10 Medizinische<br />
Anwendungsbereiche sind etwa in der Tumortherapie und der Behandlung von<br />
Autoimmunbehandlungen zu finden. Eine herausragende Bedeutung kommt auch<br />
der Raffinierung nachwachsender Rohstoffe zu, an deren Weiterentwicklung intensiv<br />
geforscht wird, und dies mit dem Ziel, Energie kostengünstig u.a. aus Pflanzenabfällen<br />
zu gewinnen.<br />
Nach Einschätzung des Gesprächspartners werden künftig zwei Hauptgebiete der<br />
Biokatalyse im Vordergrund stehen: Die Synthese zu einzelnen Zwischen- bzw.<br />
Endprodukten zur stofflichen Verwertung und die energetische Nutzung (z.B.<br />
Stärkeverwertung). Im Wesentlichen wird eine methodische Vereinfachung und Parallelisierung<br />
der Syntheseverfahren anvisiert, um diese kostengünstiger zu gestalten.<br />
Hierbei geht es um Kostenrelationen, d.h. die Kosten biokatalytischer Verfahren<br />
werden mit denjenigen konventioneller (i.d.R. chemischer) Verfahren verglichen.<br />
10 Vgl. Perlitz, U. (2007), Weiße Biotechnologie: Schlummerndes Potenzial wird geweckt. In: Deutsche Bank Research, Aktuelle<br />
Themen, Nr. 376. Frankfurt a.M.<br />
103
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Im Forschungsfeld der Weißen Biotechnologie existieren gegenwärtig europaweit<br />
etwa zehn international konkurrenzfähige öffentliche Forschungszentren bzw.<br />
-verbünde, unter denen in erster Linie das Forschungszentrum Jülich, die Universität<br />
Dortmund, die TU Graz, die University of Manchester und die ETH Zürich zu<br />
nennen sind. Innerhalb Europas wird erfolgreiche Forschung im Bereich der weißen<br />
Biotechnologie ebenfalls in einigen privaten Großunternehmen betrieben, so etwa<br />
bei der BASF, der Degussa und der DSM - Biotech; im südhessischen Zwingenberg<br />
befindet sich der Standort des innovativen Unternehmens BRAIN, das wiederum in<br />
engen Austauschbeziehungen zu mehreren Großunternehmen aus der Chemiebranche<br />
steht. Im Unterschied zu Europa, wo die Anwendungsfelder eher in der<br />
Feinchemie liegen, weist die Forschungslandschaft in den USA und Kanada einen<br />
deutlichen Schwerpunkt in der Bulk-Chemie auf und ist stark durch privatwirtschaftliche<br />
Akteure geprägt. In Japan ist sowohl die private als auch die öffentliche Forschungslandschaft<br />
sehr leistungsfähig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Laut Aussage des Gesprächsteilnehmers unterscheiden sich im Bereich der organischen<br />
Chemie die Zielsetzungen öffentlicher Forschungsinstitutionen und diejenigen<br />
privatwirtschaftlicher Unternehmen deutlich, was Kooperationen verkompliziert.<br />
Dies gilt etwa in Hinsicht auf die relevanten wissenschaftlichen Fragestellungen, die<br />
Art der Erkenntnisgewinnung und die theoretische wie auch die methodische Herangehensweise.<br />
Innerhalb der Unternehmenslandschaft zeichnet sich insbesondere<br />
die BASF als Chemieunternehmen durch ein intensives Engagement im Bereich<br />
der Weißen Biotechnologie aus, während bedeutende Anbieter auf dem Feld der Life<br />
Sciences (bspw. Bayer) kaum präsent sind.<br />
Zahlreiche mittelständische Chemieunternehmen weisen offenbar zu geringe<br />
Kapazitäten auf, um sich in der Entwicklung biotechnologischer Produktionsprozesse<br />
zu betätigen. Zudem ist die technische Umrüstung mit umfangreichen Investitionen<br />
verbunden. Die hierfür notwendigen Finanzmittel können von kleinen und mittleren<br />
Unternehmen nur selten aufgebracht werden, woran die Adaption neuartiger<br />
Verfahren der Biotechnologie letztlich scheitert. Zudem verfügt das Personal häufig<br />
nicht über hinreichende Fachkenntnisse, was die Umstellung auf biotechnologische<br />
Prozesse zusätzlich erschwert. Insgesamt existieren zu wenige Forschungskooperationen<br />
zwischen öffentlichen und privaten Institutionen. Die Arbeit, die zum<br />
Aufbau tragfähiger Netzwerke geleistet werden muss, gestaltet sich als schwierig<br />
und erfordert eine langfristige Perspektive.<br />
104
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 14: Vernetzung des Fachgebietes Biokatalyse und Biofermentation an der TU Darmstadt<br />
u. a.<br />
DFG-Schwerpunktprogramm 1170 "Gelenkte<br />
Evolution zur Optimierung und zum Verständnis<br />
molekularer Biokatalysatoren"<br />
TU Graz<br />
ETH Zürich<br />
u. a.<br />
Biokatalyse /<br />
Biofermentation<br />
Martin-Luther-<br />
Universität Halle<br />
BRAIN<br />
BASF<br />
DSM Biotech<br />
Degussa<br />
DECHEMA<br />
Merck<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen für die Biotechnologische Forschung in<br />
<strong>Hessen</strong> sieht es der Gesprächsteilnehmer eindeutig als positiven Standortfaktor an,<br />
dass die DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie<br />
in Frankfurt ihren Sitz hat (vgl. Abbildung 14). Die wesentlichen Tätigkeitsfelder der<br />
DECHEMA liegen darin, die Entwicklung chemischer Technologien und Verfahren<br />
inhaltlich zu begleiten und neue Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung für<br />
die Praxis aufzubereiten. Hierzu gehören auch die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen<br />
und die Weitergabe von Informationen über Publikationen<br />
und Tagungen.<br />
Als vorrangiges Strukturproblem bezeichnet der Gesprächspartner die unzureichende<br />
Grundausstattung der naturwissenschaftlichen Fachbereiche an den hessischen<br />
Hochschulen. Auch sieht er als sinnvoll an, die Kenntnisse über die tatsäch-<br />
105
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
lichen Forschungsbedingungen in den wissenschaftlichen Institutionen innerhalb der<br />
Ministerien und der Verwaltung zu erweitern. Aufgrund fehlender Transparenz werden<br />
offenbar nicht selten fachlich ungünstige Entscheidungen über die Hochschulausstattung<br />
getroffen. Im Hinblick auf die öffentliche Forschungsförderung erweist<br />
es sich als Nachteil, dass einerseits die DFG ein besonderes Schwergewicht auf die<br />
Grundlagenforschung setzt, während andererseits das BMBF deutlich auf angewandte<br />
Forschung bzw. die Entwicklung neuer technologischer Verfahren und Produkte<br />
fokussiert ist. Die hierdurch bedingte Diskrepanz müsste über spezifische<br />
Förderprogramme überbrückt werden, um den Forschungstransfer zu forcieren. Ein<br />
Förderprogramm, das speziell auf projektbezogene anwendungsorientierte Kooperationen<br />
angelegt ist, könnte hier Abhilfe schaffen. Ein derartiges Programm, das<br />
sehr rege in Anspruch genommen wird, existiert beispielsweise in Bayern. Besonders<br />
zukunftsträchtig erscheint dem Gesprächspartner die Fördermaßnahme "Bio-<br />
Industrie 2021 - Cluster-Wettbewerb zur Entwicklung neuer Produkte und Verfahren<br />
in der industriellen Biotechnologie" im Rahmenprogramm "Biotechnologie - Chancen<br />
nutzen und gestalten" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.<br />
106
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
107
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.4.6 Ernährung des Menschen - Schwerpunkt Ernährungsphysiologische Bewertung<br />
von Lebensmitteln<br />
Übersicht 14: Kurzprofil des Fachgebietes Ernährung des Menschen - Schwerpunkt<br />
Ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln an der Universität Gießen<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • In Gießen vorhandene Fächerkombination aus<br />
Ernährungswissenschaften, Agrarwissenschaften, Medizin und<br />
Veterinärmedizin bundesweit einmalig.<br />
Anwendungsbereiche • Anwendungsfelder in der Krankheitsprävention bzw. der Entwicklung<br />
und dem zielgenauen Einsatz funktioneller Lebensmittel, etwa im<br />
Segment der Kindernahrung.<br />
Technologiefeld • Themenfelder beziehen sich auf eine weite Bandbreite<br />
ernährungsphysiologischer Fragestellungen.<br />
• Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt auf Milchinhaltsstoffen.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Gesprächspartner ist Sprecher des Forschungsschwerpunktes<br />
Mensch – Ernährung – Umwelt, Modul A „Ernährung und<br />
Stoffwechsel“.<br />
• Kooperationen mit universitären und außeruniversitären Partnern<br />
einschl. ausgewählter Unternehmen der Ernährungsindustrie, die<br />
insbesondere die Durchführung ernährungsphysiologischer<br />
Funktionsstudien umfassen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Ausweitung des Branchenspektrums der Industriepartner läge nahe –<br />
so etwa auf die Lebensmitteltechnologiebranche.<br />
• Die Potenziale, die sich an der Universität Gießen aufgrund der<br />
fachlichen Schwerpunkte bieten, lassen sich noch umfangreicher als<br />
bisher ausschöpfen.<br />
• Beratungsbedarf bei Forschungsanträgen im Bereich der EU-<br />
Förderung.<br />
• Informationskampagne zu Forschungsfacetten in der hessischen<br />
Hochschullandschaft wäre sinnvoll.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Die Professur Ernährung des Menschen - Schwerpunkt Ernährungsphysiologische<br />
Bewertung von Lebensmitteln - ist am Institut für Ernährungswissenschaften angesiedelt,<br />
das zum Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement<br />
der Justus-Liebig-Universität Gießen gehört. Die Arbeitsgruppe engagiert<br />
sich in hohem Maße in der Lehre und Forschung. Aus Sicht des Gesprächspartners<br />
wäre es wünschenswert, wenn der akademische Mittelbau gestärkt würde,<br />
108
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
um jungen Forschern zumindest eine mittelfristige Beschäftigungsperspektive bieten<br />
zu können. Bei einer Gewährung entsprechender Spielräume für die betreffenden<br />
Postdoktoranden könnte hierdurch die Einwerbung von Drittmitteln forciert werden.<br />
Der Gesprächspartner ist Sprecher von Modul A, „Ernährung und Stoffwechsel“ des<br />
von der hessischen Landeregierung geförderten Forschungsschwerpunktes<br />
Mensch - Ernährung - Umwelt, an dem 13 Projekte gemeinsam mit Kolleginnen<br />
und Kollegen aus den Fachbereichen Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und<br />
Umweltmanagement, Medizin und Veterinärmedizin partizipieren. Die Intention bei<br />
der Einrichtung dieses Forschungsschwerpunktes war es, das an der Universität<br />
Gießen vorhandene fachliche Spektrum, das der Gesprächspartner als bundesweit<br />
„einmalig“ bezeichnet, gezielt in Forschungsleistungen umzusetzen. Zudem stellt die<br />
Arbeitsgruppe regelmäßig Forschungsanträge bei der DFG wie auch bei weiteren<br />
Förderinstitutionen.<br />
Die von der Professur untersuchten Themenfelder beziehen sich auf analytische,<br />
funktionelle und metabolische Aspekte im Zusammenhang mit ernährungsphysiologischen<br />
Fragestellungen. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt auf Milchinhaltsstoffen<br />
sowie, bedingt durch die wiss. Mitarbeiterin, Dr. S. Kuntz, auf sekundären<br />
Pflanzeninhaltsstoffen. Anwendungsfelder für die Forschungsergebnisse liegen<br />
u.a. in der Krankheitsprävention bzw. der Entwicklung und dem entsprechenden<br />
Einsatz funktioneller Lebensmittel, so beispielsweise im Segment der Kindernahrung.<br />
Wertvolle Impulse für die ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln<br />
kommen insbesondere aus der Medizin, der Biologie und der Chemie. Diese<br />
Verknüpfungen spiegeln sich auch im Forschungsschwerpunkt Mensch -<br />
Ernährung - Umwelt wider, an dem verschiedene Themenfelder untersucht werden.<br />
Zur weiteren Information siehe http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fsp/meu/startseite-1.<br />
Im Hinblick auf die in den Forschungsschwerpunkt eingebundenen Fachbereiche<br />
lässt sich demnach für die Universität Gießen das Vorliegen eines Forschungs-<br />
Clusters konstatieren. Der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in begutachteten<br />
Zeitschriften misst die Arbeitsgruppe eine sehr hohe Priorität bei.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Der Gesprächsteilnehmer sieht es als ratsam an, die Facetten der Forschungslandschaft<br />
in <strong>Hessen</strong> auch von Landesseite fundierter als bislang der Öffentlichkeit bekannt<br />
zu machen. Dies gilt insbesondere für die an einzelnen Hochschulen vorhandenen<br />
fachlichen Schwerpunkte. An der Universität Gießen bietet die Fächerkombination<br />
aus Ernährungswissenschaften, Medizin, Veterinärmedizin, Biologie, Chemie<br />
und Agrarwissenschaften erhebliche Forschungspotenziale, die sich nach Aussage<br />
des Gesprächspartners noch umfangreicher als bisher ausschöpfen lassen. Diese<br />
inhaltliche Bandbreite ermöglicht es, ernährungswissenschaftliche Fragestellungen<br />
unter ganz unterschiedlichen Blickwinkeln untersuchen. Das diesbezügliche<br />
109
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Spektrum reicht von der Ernährungsphysiologie und Medizin, der Betriebswirtschaftslehre<br />
und Marktforschung über die Gesundheitspolitik bis zur Prävention.<br />
Im Hinblick auf einen konkreten Handlungsbedarf merkt der Gesprächspartner an,<br />
dass gerade bei Forschungsanträgen im Bereich der EU-Förderung ein nicht unwesentlicher<br />
Unterstützungsbedarf für die ausgesprochen zeitaufwendigen Antragsformalitäten<br />
besteht und Bearbeitung auf Dauer nur schwer von einer einzigen Arbeitsgruppe<br />
durchgeführt werden können.<br />
110
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5 Produktionstechnologien<br />
5.5.1 Lebensmitteltechnologie<br />
Übersicht 15: Kurzprofil des Fachgebietes Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Fulda<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Einziger Fachbereich im Bereich der Lebensmitteltechnologie in der<br />
hessischen Hochschullandschaft.<br />
Anwendungsbereiche • Besonders umfangreiches Marktpotenzial im Produktsegment des<br />
„Functional Food“ und im Feld der “Food Convenience“.<br />
Technologiefeld • Lebensmitteltechnologie ist eine dezidierte Querschnittstechnologie,<br />
denn es fließen sehr unterschiedliche Fachinhalte in diese Disziplin<br />
hinein, so etwa aus der Physik, Chemie Biologie und Pharmazie wie<br />
auch aus dem Maschinenbau.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Gründung eines Masterstudienganges „International Food Business<br />
and Consumer Studies - IFBC“ zusammen mit dem Fachbereich<br />
Agrarwissenschaften der Universität Kassel.<br />
• Enge Kontakte mit Großunternehmen, u.a. mit Stabernack, Milupa,<br />
Cargill, Eifelmilch (Standort Hungen), Malvern und Master Foods.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen<br />
vergleichsweise schwierig (Bedenken bezüglich eines Know-How-<br />
Abflusses).<br />
• Technische Infrastruktur am Fachbereich vorbildlich.<br />
• Erarbeitung von aufwendigen Forschungsanträgen im Rahmen von<br />
EU-Förderprogrammen wäre u.U. in Kooperation mit anderen<br />
Hochschulen denkbar.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der befragte Fachvertreter ist Professor für Thermische Verfahrenstechnik und gegenwärtig<br />
Dekan am Fachbereich Lebensmitteltechnologie der Hochschule Fulda.<br />
Es handelt sich hierbei um den einzigen Fachbereich im Bereich der Lebensmitteltechnologie<br />
in der hessischen Hochschullandschaft. Am Fachbereich sind insgesamt<br />
zehn Professuren angesiedelt, die jeweils einer Teildisziplin des Fachgebietes<br />
zugeordnet sind. Das Personal am Fachbereich umfasst zudem zwölf wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter, die zum großen Teil – nicht selten in Kombination mit einer<br />
Tätigkeit bspw. als Laborleiter, Praktikumsbetreuer – an Partneruniversitäten (z.B.<br />
der Universität Leipzig) promovieren. Die Finanzierung der Forschung resultiert zum<br />
112
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
überwiegenden Teil aus Landesmitteln; ein Zehntel des Fachbereichsbudgets<br />
stammt aus Drittmitteln.<br />
Die Studienplätze am Fachbereich sind sehr begehrt. Beispielsweise existierten im<br />
vergangenen Wintersemester für den Bachelor-Studiengang „Lebensmitteltechnologie“<br />
371 Bewerbungen, von denen lediglich 75 angenommen werden konnten. Das<br />
Auswahlkriterium ist im Wesentlichen ein Numerus Clausus, im Master-Studiengang<br />
„Food Processing“ werden jedoch auch Gespräche mit den Bewerbern geführt. Etwa<br />
die Hälfte der Studenten hat vor dem Studium bereits eine Berufsausbildung absolviert.<br />
Gemäß den Ausführungen des Gesprächspartners war diese Proportion vor<br />
noch nicht allzu langer Zeit erheblich größer. Um das Fachgebiet künftigen Studenten<br />
zu veranschaulichen, führen Mitglieder des Fachbereichs regelmäßig themenbezogene<br />
Veranstaltungen in Fuldaer Schulen durch. Das Studienprogramm ist bereits<br />
seit zwei Jahren auf die Anforderungen des „Bologna-Prozesses“ zugeschnitten,<br />
d.h. es werden gestufte bzw. akkreditierte Studiengänge angeboten. Das Lehrprogramm<br />
umfasst einen Bachelor-Studiengang „Lebensmitteltechnologie“ sowie<br />
die zwei Masterstudiengänge „Foodprocessing“ und „Prozesstechnik“. Letzterer<br />
beruht auf einer Kooperation mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
der Hochschule Fulda. Eine enge Zusammenarbeit besteht zudem mit<br />
den Fachbereichen Oecotrophologie sowie Pflege und Gesundheit. Auch hierin<br />
kommt die fachliche Bündelung und Profilierung der Hochschule Fulda im Bereich<br />
der “Life Sciences“ zum Ausdruck.<br />
Hochschulübergreifend wurde zudem kürzlich zusammen mit dem Fachbereich Agrarwissenschaften<br />
der Universität Kassel ein Masterstudiengang „International<br />
Food Business and Consumer Studies - IFBC“ begründet. Einen externen Lehrauftrag<br />
hat der Gesprächspartner an der Universität zu Köln. Zudem fungiert er als<br />
Gutachter bei der AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen,<br />
als Mitglied im europäischen Solid Processing Industrial Network - SPIN und als berufenes<br />
Mitglied in den GVC / VDI-Fachausschüssen Agglomerations- und Schüttguttechnik<br />
bzw. Trocknungstechnik. Die wissenschaftliche Außendarstellung des<br />
Fachbereichs umfasst die regelmäßige Durchführung von Tagungen, Seminaren<br />
und Workshops, so etwa in Zusammenarbeit mit der APV (Arbeitsgemeinschaft für<br />
Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V.).<br />
Bei der Lebensmitteltechnologie handelt es sich um eine dezidierte Querschnittstechnologie,<br />
denn es fließen sehr unterschiedliche Fachinhalte in diese Disziplin<br />
hinein, so etwa aus der Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. Enge Bezüge<br />
bestehen zudem mit dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Informatik.<br />
Dies liegt insbesondere darin begründet, dass es sich bei Lebensmitteln und den<br />
betreffenden Grundstoffen um hochsensible Güter handelt, an deren Herstellung,<br />
Lagerung und Transport höchste Ansprüche gestellt werden, so etwa in Punkto Hygiene,<br />
Temperaturführung und Prozesssicherheit. Umfangreiche Qualitätsanforde-<br />
113
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
rungen gelten vor allem auch für die Endprodukte, die dem Ernährungskonsum zugeführt<br />
werden.<br />
Zudem sind die Grundstoffe – bspw. Getreide oder Schweinefleisch – auch innerhalb<br />
differenzierter Handelsklassen heterogen, was bei der Verarbeitung Berücksichtigung<br />
finden muss. Gerade in jüngerer Zeit hat sich eine ausgeprägte Verbindung<br />
zur pharmazeutischen Technologie herausgebildet, der mittlerweile auch im<br />
Studienprogramm des Fachbereichs eine hohe Bedeutung zukommt. Weitere Hochschulen<br />
im deutschsprachigen Raum, an denen die Lebensmitteltechnologie fachlich<br />
verankert ist, sind die TU München (Wissenschaftszentrum Weihenstephan), die<br />
FH Weihenstephan und die TU Karlsruhe sowie die FH Neubrandenburg, die<br />
FH Lemgo, die TU Berlin, die FH Bremerhaven und die ETH Zürich.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die fachinhaltlichen Entwicklungen spiegeln sich sehr deutlich im Spektrum der Ernährungsindustrie<br />
wider. Ein besonders umfangreiches Marktpotenzial sieht der<br />
Gesprächsteilnehmer im Produktsegment des „Functional Food“ (bspw. „Becel“),<br />
das zahlreiche Impulse aus der Pharmazie bezieht, und im Feld der “Convenience“,<br />
das sowohl die Lebensmittel als auch die Haushalts- bzw. Küchentechnologie<br />
umfasst. In der Branche der Lebensmitteltechnologie existieren gegenwärtig im<br />
Bundesgebiet etwa 5.600 Unternehmen, welche die ganze Breite dieses Wirtschaftszweiges<br />
abdecken: Von der Verfahrenstechnik über den Spezialmaschinenbau<br />
und die Verpackungsindustrie bis hin zur Lebensmittelerzeugung und Herstellung<br />
von Duft- und Geschmacksstoffen. Zahlreiche Unternehmen der Branche sind<br />
in <strong>Hessen</strong> bzw. dem Rhein-Main-Gebiet ansässig. Gerade mit Großunternehmen<br />
unterhält der Fachbereich enge Kontakte. Zu nennen sind u.a. Stabernack, Milupa,<br />
Cargill, Eifelmilch (Standort Hungen) und Malvern. Eine sehr intensive Zusammenarbeit<br />
besteht zur Firma Master Foods, einem der globalen Marktführer.<br />
Die Kontakte zu den betreffenden Anbietern umfassen sowohl die Bearbeitung von<br />
kurzfristigen Einzelprojekten als auch mittelfristig angelegte Forschungskooperationen<br />
(vgl. Abbildung 16). Gerade letztere werden nach Einschätzung des<br />
Gesprächspartners zukünftig expandieren. Als Förderinstitution fungiert i.d.R. die<br />
AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, bei welcher der<br />
Fachbereich bereits Forschungsvorhaben erfolgreich plazieren konnte, hierunter ein<br />
Antrag im Umfang von 250.000 Euro. Offenbar sind die Fördermodalitäten der AiF in<br />
besonders zutreffender Weise auf die Forschungskompetenzen von Fachhochschulen<br />
zugeschnitten. Eine wertvolle Unterstützung bei der Erarbeitung von Forschungsanträgen<br />
leistet das Hochschulzentrum Fulda Transfer.<br />
114
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 15: Vernetzung des Fachgebietes Lebensmitteltechnologie der Hochschule Fulda<br />
u. a.<br />
Europäisches Solids Processing<br />
Industrial Network - SPIN<br />
Universität<br />
Kassel<br />
Universität<br />
zu Köln<br />
u. a.<br />
Master Foods<br />
Lebensmitteltechnologie<br />
Eifelmilch<br />
Milupa<br />
Stabernack<br />
APV (Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische<br />
Verfahrenstechnik e.V.)<br />
Malvern<br />
Cargill<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Als vergleichsweise schwierig erachtet der Gesprächspartner die Zusammenarbeit<br />
mit kleinen und mittleren Unternehmen. Dies liegt insbesondere darin begründet,<br />
dass bei den betreffenden Unternehmenseigentümern bzw. Geschäftsleitern im Hinblick<br />
auf einen fachlichen Austausch zu Hochschulen ausgeprägte Barrieren bestünden.<br />
Diese hängen auch mit generellen Bedenken bezüglich eines Know-how-<br />
Abflusses aus den Firmen zusammen. Diese Aversion ist allerdings nicht allein unter<br />
Mittelständlern, sondern auch unter Großunternehmen der Ernährungsindustrie<br />
verbreitet. Im Gegensatz hierzu zeigt sich die Pharmaindustrie wesentlich offener,<br />
was sich nicht zuletzt mit dem Patentschutz erklärt.<br />
115
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Die technische Infrastruktur am Fachbereich schätzt der Gesprächspartner als<br />
vorbildlich ein. In zahlreichen mittelständischen Unternehmen der Lebensmitteltechnologie<br />
sei die technische Ausstattung weitaus ungünstiger, so dass der Hochschule<br />
die Funktion eines innovativen Schrittmachers zukomme. Im Hinblick auf die wissenschaftlichen<br />
Aktivitäten am Fachbereich merkt der Gesprächspartner an, dass<br />
einer eigenständigen Beantragung von größeren Forschungsprojekten durch die<br />
personellen Kapazitäten deutliche Grenzen gesetzt seien. In dieser Hinsicht wäre<br />
eine Flexibilisierung des Lehrdeputats durchaus sinnvoll. Gerade die Erarbeitung<br />
von aufwendigen Forschungsanträgen im Rahmen von EU-Förderprogrammen<br />
gestalte sich vor diesem Hintergrund als schwierig und wäre u.U. in Kooperation mit<br />
anderen Hochschulen denkbar.<br />
116
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
117
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5.2 Mechatronik / Regelungstechnik<br />
Übersicht 16: Kurzprofil des Fachgebietes Mechatronik / Regelungstechnik an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Entwicklung und Optimierung von Verfahren zur Analyse und<br />
Beeinflussung mechatronischer Systeme.<br />
Anwendungsbereiche • Hauptanwendungsgebiete sind der Fahrzeugbau, der Maschinenbau<br />
und die Verkehrssystemtechnik. Dynamische Entwicklung.<br />
Technologiefeld • Bedeutung komplexer Systeme, die sowohl auf elektronischen als<br />
auch mechanischen Komponenten bzw. Prozessen basieren, nimmt<br />
stetig zu.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Partizipation am Forschungsschwerpunkt „Mechatronische Systeme“<br />
an der TU Darmstadt.<br />
• Zahlreiche überregionale Kooperationen. Die Vernetzung in die Region<br />
RheinMainNeckar, die eine außergewöhnlich hohe Kompetenz<br />
im Bereich der Automatisierungstechnik aufweist, ist ausbaufähig.<br />
Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind in den<br />
Feldern Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Mechatronik, Mikrosystemtechnik<br />
und Informatik tätig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Bandlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Um die Vernetzung innerhalb der Branche zu intensivieren, wurde im<br />
Frühjahr das Netzwerk Automatisierung RheinMainNeckar initiiert. Ein<br />
weiterer Ausbau des Netzwerks ist konkret geplant.<br />
• Intensivere Verankerung der Hochschule in den Wirtschaftsraum<br />
Rhein-Main.<br />
• Publikumswirksame Darstellung des Profils der hessischen<br />
Hochschulen notwendig, gerade im Hinblick auf zukünftige<br />
Fördermaßnahmen.<br />
• Verstärkter Kontakt zwischen Hochschulen und HMWK.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Fachgebiet Regelungstechnik und Mechatronik ist am Institut für Automatisierungstechnik<br />
der TU Darmstadt angesiedelt, das zum Fachbereich Elektrotechnik<br />
und Informationstechnik gehört. Das Gros der 35 Mitarbeiter am Fachgebiet – nämlich<br />
25 – bilden Doktoranden. Drittmittel werden sowohl bei öffentlichen Institutionen<br />
– DFG, BMWi, EU – als auch bei Industriepartnern eingeworben. Als besonders vorteilhaft<br />
schätzt der Gesprächspartner das vom BMWi aufgelegte Förderprogramm<br />
Pro Inno II ein, weil dieses spezifisch auf die Gegebenheiten von Kooperationen<br />
zwischen Forschungsinstitutionen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten<br />
ist.<br />
118
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Der Lehrstuhl partizipiert am Forschungsschwerpunkt „Mechatronische Systeme“,<br />
der teilweise auf Vorarbeiten aufbaut, die im DFG-Sonderforschungsbereich<br />
241 „IMES - Integrierte mechanisch-elektronische Systeme“ geleistet<br />
wurden. Der Forschungsschwerpunkt „Mechatronische Systeme“, an dem sich insgesamt<br />
15 Arbeitsgruppen aus drei Fachbereichen beteiligen, bietet den institutionellen<br />
Rahmen für eine Forcierung der Forschung im Bereich der Mechatronik, die<br />
an der Hochschule schon seit langem intensiv verankert ist. Innerhalb des Forschungsschwerpunktes<br />
Mechatronik wird dem inhaltlichen Austausch – so etwa<br />
über ein regelmäßiges Fachkolloquium – eine hohe Priorität eingeräumt. Zudem ist<br />
der Forschungsschwerpunkt, der vornehmlich auf die Themenfelder Maschinenbau,<br />
Automobilbau, Antriebstechnik wie auch schall- und schwingungsverminderte Komponenten<br />
abzielt, eng mit der an der Hochschule angebotenen Studienrichtung<br />
„Mechatronik“ verzahnt. Innerhalb der Arbeitsgruppe wird zudem auf eine reichhaltige<br />
Publikationstätigkeit – schwerpunktmäßig in begutachteten Zeitschriften – großen<br />
Wert gelegt.<br />
Die wissenschaftlichen Aktivitäten am Fachgebiet sind vor allem auf die Entwicklung<br />
und Optimierung von Verfahren zur Systemanalyse und Systembeeinflussung fokussiert,<br />
wobei insbesondere die Modellbildung und die Automatisierung komplexer<br />
dynamischer Systeme im Blickpunkt stehen. Weil nach Aussage des Gesprächspartners<br />
in zahlreichen Technologiesparten bzw. Branchen die Bedeutung komplexer<br />
Systeme, die sowohl auf elektronischen als auch mechanischen Komponenten<br />
bzw. Prozessen basieren, stetig zunimmt, verbreitert sich das Anwendungsfeld der<br />
Mechatronik fortwährend. Zu nennen sind hier insbesondere der Fahrzeugbau, der<br />
Maschinenbau und die Verkehrssystemtechnik. Prägnante Beispiele für komplexe<br />
mechatronische Systeme sind schnelldrehende Motoren und Fahrzeuglenkungen.<br />
Im Segment der Fahrzeugtechnik hat der Gesprächspartner bereits sieben Patente<br />
angemeldet. Eine sehr dynamische Entwicklung prognostiziert er der Energietechnik<br />
und der Medizintechnik. Gerade im letzteren Feld ergeben sich umfangreiche Potenziale<br />
in der Prothetik, so etwa im Segment der „aktiven“ Prothesen. Hier bestehen<br />
intensive Kontakte mit der Universitätsklinik Heidelberg.<br />
Grundsätzlich hält es der Gesprächspartner für sinnvoll, dass wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
Partnerunternehmen über Praxiseinsätze kennenlernen. Gleichwohl legt er<br />
in seiner Funktion als Betreuer großen Wert darauf, dass auch die drittmittelfinanzierten<br />
Doktoranden einen Großteil ihrer Arbeitszeit am Institut verbringen. Dies bilde<br />
eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich die Doktoranden in das wissenschaftliche<br />
Umfeld an einem universitären Forschungsinstitut integrieren, was für ihren<br />
weiteren beruflichen Lebensweg ebenso wichtig sei wie berufspraktische Erfahrungen.<br />
Vollständig externe Promotionen, bei denen dem Betreuer lediglich die Aufgabe<br />
der Begutachtung zufällt, können diesem Anspruch offenbar nicht gerecht werden.<br />
Nicht selten bergen externe Promotionen für den Doktoranden den Nachteil,<br />
dass er sich während langer Arbeitsphasen nicht seinem eigentlichen Dissertations-<br />
119
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
vorhaben widmen kann, weil er im Kooperationsunternehmen anderweitig im Einsatz<br />
ist.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die Arbeitsgruppe pflegt vielfältige Beziehungen zu Industriepartnern, deren Ausgestaltung<br />
im konkreten Fall sehr unterschiedlich ist. Während nämlich einige Forschungsvorhaben<br />
im Rahmen von Einzelprojekten bearbeitet werden, sind andere<br />
eng in Kooperationsprogramme eingebunden. Eine intensive – über einen Rahmenvertrag<br />
definierte – Kooperation besteht mit dem Unternehmen Bosch-Rexroth, das<br />
sich über ein Stipendienprogramm intensiv in der Doktorandenförderung engagiert.<br />
Weitere Kooperationen bestehen mit BMW, VW, Daimler, Conti-Teves und<br />
ZF Friedrichshafen, also Unternehmen, deren Stammsitz jeweils nicht in <strong>Hessen</strong><br />
lokalisiert ist (vgl. Abbildung 17). Kürzlich haben sich Kooperationen mit der Firma<br />
Merck und mit zwei im Raum Darmstadt ansässigen mittelständischen Unternehmen<br />
herausgebildet, die vielversprechend erscheinen. Laut Einschätzung des Gesprächspartners<br />
ist es für eine gedeihliche Zusammenarbeit unabdingbar, dass innerhalb<br />
eines Forschungsprojekts die Aufgabenbereiche klar definiert sind. So versteht<br />
sich die Arbeitsgruppe nicht als verlängerte Werkbank und sieht ihr Betätigungsfeld<br />
eher in der Entwicklung von Verfahren und Prototypen. Deren Überführung<br />
in die Serienreife verbleibt beim Industriepartner.<br />
Die Region RheinMainNeckar weist eine außergewöhnlich hohe Kompetenz im Bereich<br />
der Automatisierungstechnik auf. Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen<br />
sind in den Feldern Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Mechatronik,<br />
Mikrosystemtechnik und Informatik tätig.<br />
Um Kooperationen zwischen Hochschulen und mittelständischen Automatisierungsunternehmen<br />
in der Region RheinMainNeckar zu befördern und Kompetenzen zu<br />
bündeln, wurde im Frühjahr 2007 auf Initiative des TTN-<strong>Hessen</strong> und der IHK Darmstadt<br />
das Netzwerk Automatisierung RheinMainNeckar ins Leben gerufen. Eine<br />
Umfrage bei ca. 300 regionalen Automatisierungsunternehmen hatte im Herbst<br />
2006 ein großes Interesse an einer gemeinsamen Plattform für Zusammenarbeit<br />
und Informationsaustausch ergeben.<br />
Der Gesprächspartner erachtet das sich noch im Aufbau befindliche Netzwerk Automatisierung,<br />
in das er selbst eingebunden ist, als sinnvolle Initiative zur Intensivierung<br />
des inhaltlichen Austausches zwischen Wissenschaft und Privatwirtschaft. Allerdings<br />
basiert das Netzwerk momentan noch auf einem losen Interessensverbund,<br />
der in einer zweiten Entwicklungsphase in die Trägerschaft von thematisch interessierten<br />
Unternehmen und Wissenschaftlern überführt werden sollte, um sich zu festigen.<br />
Hierzu werden gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten und weitere Unterstützung<br />
notwendig sein.<br />
120
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 16: Vernetzung des Fachgebietes Mechatronik / Regelungstechnik an der TU Darmstadt<br />
u. a.<br />
Forschungsschwerpunkt<br />
„Mechatronische Systeme“<br />
Forschungsgruppe Regelungstechnik<br />
und Prozessautomatisierung<br />
TU Karlsruhe<br />
Universität<br />
Clausthal<br />
u. a.<br />
Bosch-Rexroth<br />
Mechatronik /<br />
Regelungstechnik<br />
Volkswagen<br />
BMW<br />
Conti-Teves<br />
Netzwerk Automatisierung<br />
RheinMainNeckar<br />
ZF Friedrichshafen<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf das Technologiefeld der Mechatronik sieht der Gesprächsteilnehmer<br />
einen Handlungsbedarf in der Verankerung der Hochschule in den Wirtschaftsraum<br />
Rhein-Main. Gerade im Hinblick auf zukünftige Fördermaßnahmen ist zudem<br />
eine publikumswirksame Darstellung des Profils der hessischen Hochschulen<br />
notwendig. Hierbei wäre ein verstärkter Kontakt zwischen Hochschulen und HMWK<br />
hilfreich.<br />
121
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5.3 Umformtechnik<br />
Übersicht 17: Kurzprofil des Fachgebietes Umformtechnik an der Universität Kassel<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Große Freiräume zum Aufbau eines Forschungsschwerpunktes<br />
Umformtechnik am Standort Kassel.<br />
Anwendungsbereiche • Industriell gefertigte Massengeräte in unterschiedlichsten Branchen.<br />
Technologiefeld • Umfangreiches Zukunftspotenzial für Technologien zur innovativen<br />
Formgebung bzw. Profilierung.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Aufbau des hochschulübergreifenden DFG-Sonderforschungsbereiches<br />
TR 30 "Prozessintegrierte Herstellung funktional gradierter<br />
Strukturen auf der Grundlage thermo-mechanisch gekoppelter<br />
Phänomene" zusammen mit Wissenschaftlern der Universität<br />
Paderborn und der Universität Dortmund.<br />
• Gründung des AWZ Anwendungszentrum Metallformgebung in<br />
Baunatal, das hinsichtlich des anwendungsorientierten<br />
Technologietransfers einen bundesweiten Modellcharakter trägt.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Kontinuierliche Bearbeitung und Pflege des Unternehmensumfelds.<br />
• Differenzierung des Kriterienkatalogs der Forschungsförderung<br />
notwendig; Definition des Mittelstands ist zu eng gefasst.<br />
• Landesförderprogramme bieten deutliche Vorteile, so etwa aufgrund<br />
„kurzer Wege“.<br />
• Günstige Entwicklungsperspektiven für den nordhessischen<br />
Industrieraum.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Gespräch wurde mit dem Inhaber der Professur für Umformtechnik an der Universität<br />
Kassel geführt. Das Personal am Lehrstuhl, der dem Fachbereich Maschinenbau<br />
zugeordnet ist, besteht aus zehn Mitarbeitern und umfasst u.a. eine Postdoktorandin,<br />
fünf Doktoranden und drei technische Mitarbeiter. Die eingeworbenen<br />
Drittmittel beliefen sich im Jahre 2005 auf 300.000 Euro. Insbesondere ist der von<br />
der DFG geförderte SFB / TR 30 "Prozessintegrierte Herstellung funktional gradierter<br />
Strukturen auf der Grundlage thermo-mechanisch gekoppelter Phänomene"<br />
zu nennen, an dem neben der Universität Kassel noch die Universität Paderborn<br />
sowie die Universität Dortmund beteiligt sind. An diesem Forschungsverbund,<br />
dessen Geschäftsführung am Lehrstuhl des Gesprächspartners angesiedelt<br />
ist, partizipiert die Arbeitsgruppe über zwei Teilprojekte. Neben einer regen Publikationstätigkeit<br />
betätigt sich der Lehrstuhl intensiv in der Entwicklung innovativer Fertigungsverfahren<br />
und Produkte. Dies manifestiert sich nicht zuletzt darin, dass der<br />
122
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Gesprächspartner während der vergangenen zehn Jahre rund 50 Patente angemeldet<br />
hat.<br />
Die Standortvoraussetzungen für das Fachgebiet Umformtechnik im Großraum<br />
Kassel sieht der Gesprächsteilnehmer als nahezu einzigartig an. Die bereits beschlossene<br />
Einrichtung einer Professur für Gießereiwesen am Fachbereich wird<br />
voraussichtlich zu einer weiteren Verdichtung der Forschungsaktivitäten im Bereich<br />
der Formgebenden Verarbeitung führen. Während an anderen Hochschulen infolge<br />
tradierter Strukturen merkliche Restriktionen vorherrschten, sei es in Kassel möglich,<br />
einen fachlichen Schwerpunkt neu aufzubauen. Insgesamt bescheinigt der Gesprächspartner<br />
Technologien zur innovativen Formgebung bzw. Profilierung ein erhebliches<br />
Zukunftspotenzial, das sich insbesondere im Wachstum der Märkte für industriell<br />
gefertigte Massengeräte begründet. Gleichzeitig sei ein erheblicher Beitrag<br />
zur Profilierung der Universität Kassel zu erwarten.<br />
Mit im Großraum Kassel ansässigen Unternehmen unterhält der Lehrstuhl teilweise<br />
schon seit längerem intensive Forschungskontakte. Daneben besteht aber auch<br />
eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen in anderen Wirtschaftsräumen, insbesondere<br />
mit der Fa. Linde + Wiemann in Dillenburg, einem Marktführer im Bereich<br />
der Profiltechnik, Verbindungstechnik und Stanztechnik. Trotz intensiver Kooperationen<br />
mit der Industrie sieht der Gesprächspartner die Grundlagenforschung als<br />
eine Domäne der Hochschulen an, deren Funktion nicht diejenige einer „verlängerten<br />
Werkbank“ sei. Bei der vertraglich geregelten Entwicklung von Prototypen<br />
seien häufig – je nach Zuschnitt der beteiligten Akteure – Kompromisse notwendig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der anwendungsorientierten Forschungsinfrastruktur<br />
und zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft<br />
und Wirtschaft soll das kürzlich am Standort Baunatal gegründete AWZ Anwendungszentrum<br />
Metallformgebung leisten, das mit industrietypischer Prozesstechnologie<br />
und Fertigungsmesstechnik ausgestattet ist, um in Kooperation mit lokal ansässigen<br />
Unternehmen Fertigungsprozesse zu simulieren und Komponenten zu<br />
entwickeln. Von den im Anwendungszentrum offerierten Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen<br />
könnten insgesamt etwa 600 Unternehmen mit mehr als<br />
50.000 Beschäftigten profitieren.<br />
Das Anwendungszentrum Metallformgebung ist eine Einrichtung der hochschuleigenen<br />
Transfergesellschaft UniKasselTransfer <strong>GmbH</strong>, welche als Betreiber fungiert.<br />
Der Impuls zur Schaffung dieses international operierenden Technologietransferzentrums<br />
ging gemeinsam von namhaften Unternehmen der Mobilitätswirtschaft der<br />
Region Nordhessen, dem Regionalmanagement Nordhessen und der Universität<br />
Kassel aus. Für den Aufbau des Anwendungszentrums wurden Investitionen in einem<br />
Umfang von etwa zwei bis vier Millionen Euro von der Privatwirtschaft beige-<br />
123
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
steuert. Das Public Private Partnership wird vom Land <strong>Hessen</strong> aus Mitteln der Europäischen<br />
Strukturfonds unterstützt.<br />
Bedeutende Kooperationspartner aus der Privatwirtschaft sind Volkswagen AG,<br />
Hübner <strong>GmbH</strong>, Viessmann Werke <strong>GmbH</strong> & Co. KG, DaimlerChrysler AG, Verband<br />
der Metall- und Elektro-Unternehmen <strong>Hessen</strong> - Bezirksgruppe Nordhessen e.V.,<br />
Rudolph Logistik Gruppe, Krauss-Maffei Wegmann <strong>GmbH</strong> & Co. KG, Continental<br />
AG, Bombardier Transportation <strong>GmbH</strong>, F.W. Breithaupt & Sohn <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
(vgl. Abbildung 18).<br />
Abbildung 17: Vernetzung des Fachgebietes Umformtechnik an der Universität Kassel<br />
u. a.<br />
DFG-SFB / TR 30 "Prozessintegrierte<br />
Herstellung funktional gradierter Strukturen<br />
auf der Grundlage thermo-mechanisch<br />
gekoppelter Phänomene"<br />
Universität<br />
Paderborn<br />
AWZ Anwendungszentrum<br />
Metallformgebung<br />
Umformtechnik<br />
Universität<br />
Dortmund<br />
Volkswagen<br />
Daimler<br />
Viessmann<br />
u. a.<br />
F.W. Breithaupt<br />
& Sohn<br />
Bombardier Transportation<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Die Motive zur Unterstützung des Anwenderzentrums sind vielschichtig; beispielsweise<br />
hat die Volkswagen AG kürzlich für den Karosseriebau eine neuartige Presstechnik<br />
entwickelt und zeigt sich daher an industrienahen Simulationen sehr interessiert.<br />
In jüngster Zeit hat auch ein Großunternehmen aus der Stahlbranche – Arce-<br />
124
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
lor / Mittal – ein dezidiertes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem<br />
AWZ Metallformgebung bekundet.<br />
Die Mitwirkung der Unternehmen am Aufbau des AWZ Metallformgebung wird durch<br />
das Regionalmanagement Nordhessen koordiniert. Der Aufbau des Zentrums stellt<br />
das wichtigste Gemeinschaftsprojekt zwischen regionalen Unternehmen, dem Regionalmanagement<br />
und der Universität Kassel im Rahmen der Entwicklung des<br />
Clusters Mobilitätswirtschaft Nordhessen dar. Das vom Regionalmanagement koordinierte<br />
Cluster vernetzt über 90 Mitgliedsunternehmen miteinander und unterstützt<br />
den Interessensabgleich zwischen den Bedarfen der Unternehmen und der Universität<br />
Kassel.<br />
Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Zusammenarbeit weist der Gesprächspartner<br />
darauf hin, dass es erheblicher Anstrengungen bedarf, um zusätzliche Kooperationspartner<br />
zu gewinnen und die bereits involvierten Unternehmen zu kontinuierlichen<br />
Unterstützungsleistungen zu animieren. In die hierzu notwendigen Koordinationsaktivitäten<br />
ist das Regionalmanagement Nordhessen intensiv eingebunden.<br />
Das AWZ Metallformgebung kann als ein Beispiel der gemeinschaftlichen Organisation<br />
des anwendungsorientierten Technologietransfers zwischen Hochschule und<br />
Unternehmen mit bundesweitem Modellcharakter gelten. Durch das fortschrittliche<br />
Betreibermodell und die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen<br />
und Regionalmanagement können die Interessen und Bedarfe der Partner<br />
optimal aufeinander abgestimmt werden.<br />
Handlungsbedarf wird bei der kontinuierlichen Bearbeitung und Pflege des Unternehmensumfelds<br />
gesehen. Um das Ziel zu erreichen, das AWZ Metallformgebung<br />
in der mittelständischen Wirtschaft zu positionieren und entsprechende Transferdienstleistungen<br />
erbringen zu können, wird zusätzlicher Unterstützungsbedarf bei<br />
der Vermarktung des Zentrums und bei der Etablierung eines Netzwerkmanagements<br />
als notwenig erachtet.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
In Hinsicht auf die Ausgestaltung von Forschungsförderprogrammen merkt der<br />
Gesprächspartner an, dass eine Differenzierung des Kriterienkatalogs notwendig<br />
wäre. Gerade die eng gefasste Definition des Mittelstands sei mit beachtlichen<br />
Problemen behaftet, denn zahlreiche – unter technologischen Gesichtspunkten sehr<br />
interessante – „große Mittelständler“ kämen allein aufgrund ihrer Dimensionen für<br />
eine geförderte Forschungskooperation nicht infrage. Hierdurch bleiben offenbar<br />
zahlreiche Innovationspotenziale ungenutzt.<br />
Zudem sei eine Expansion der Landesförderprogramme sinnvoll, weil diese im Vergleich<br />
zu bundesweiten Förderprogrammen beachtliche Vorteile böten, so etwa in<br />
organisatorischer Hinsicht aufgrund der „kurzen Wege“. Ferner haben auf Landesebene<br />
die in die Bewilligung der Forschungsprojekte involvierten Fachleute sehr<br />
125
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
spezifische Kenntnisse über die Unternehmensstrukturen und die Forschungslandschaft.<br />
Unter der Voraussetzung, dass die regionalen Akteure aus Wissenschaft,<br />
Privatwirtschaft, Politik und Verwaltung tragfähige Ideen entwickeln, prognostiziert<br />
der Gesprächsteilnehmer dem nordhessischen Industrieraum günstige Entwicklungsperspektiven.<br />
126
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
127
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5.4 Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
Übersicht 18: Kurzprofil des Fachgebietes Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung an der<br />
TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Von den Drittmitteln stammen etwa die eine Hälfte von großen<br />
Industrieunternehmen bzw. kleinen und mittleren Unternehmen und<br />
die andere Hälfte von öffentlichen Förderinstitutionen.<br />
Anwendungsbereiche • Dynamische Zukunftsentwicklung bezüglich des synergetischen<br />
Zusammenwirkens verschiedener Einzeldisziplinen – wie etwa<br />
Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik.<br />
• Umfangreiches Potenzial auch im Bereich Wissensmanagement.<br />
Technologiefeld • Umweltgerechte Produktion, Prozessoptimierung in der Produktion,<br />
HSC-Cutting (Hochgeschwindigkeitsbearbeitung), Einsatz von<br />
Industrierobotern.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Beteiligung am DFG-Sonderforschungsbereich 666 „Integrale<br />
Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung - Entwicklung,<br />
Fertigung, Bewertung“ und am DFG-Transferbereich 55<br />
"Umweltgerechte Produkte durch optimierte Prozesse, Methoden und<br />
Instrumente in der Produktentwicklung".<br />
• Aufbau der Prozesslernfabrik CiP - Center für industrielle Produktivität<br />
als bundesweit führendes Kompetenzzentrum und Plattform für die<br />
Zusammenarbeit mit Unternehmen im Weiterbildungs- und im<br />
Forschungsbereich.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit mittelständischen<br />
Unternehmen durch den Aufbau eines Netzwerks für Werkzeug- und<br />
Formenbau.<br />
• Mangelnde Stetigkeit der Forschungförderung.<br />
• Stärkere Verankerung moderner Querschnittstechnologien im<br />
gesamtwirtschaftlichen Kontext.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächspartner ist Leiter des Instituts für Produktionsmanagement, Technologie<br />
und Werkzeugmaschinen (PTW) am Fachbereich Maschinenbau der TU<br />
Darmstadt. Die Arbeitsgruppe am Institut besteht aus etwa 40 Mitarbeitern, hierunter<br />
29 Wissenschaftliche Mitarbeitern und zwei Oberingenieuren. Ferner gehören<br />
zum Institut eine Elektronikwerkstatt und eine mechanische Werkstatt, in denen zusammen<br />
rund 25 Mitarbeiter tätig sind. Das Institut verfügt über eine umfangreiche<br />
technische Infrastruktur; zu nennen sind hier u.a. sechs Bearbeitungszentren, eine<br />
Robotorbearbeitungszelle und zwei Prüfstände sowie sieben Fräsmaschinen und<br />
eine Drehmaschine.<br />
128
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Am Institut sind fünf Forschungsgruppen angesiedelt. Die Forschungsgruppe Produktion<br />
und Management befasst sich mit der Analyse und Optimierung von Produktionsverfahren.<br />
Die Schwerpunkte der Forschungsgruppe Technologie liegen<br />
auf den Themenfeldern Hochgeschwindigkeitsbohren, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
und Gussbearbeitung sowie Werkzeugsicherheit. Die Forschungsgruppe<br />
Werkzeugmaschinen und Komponenten befasst sich mit Werkzeugmaschinen,<br />
rotierenden Komponenten, Mechatronik und industrieller Robotik. In der Forschungsgruppe<br />
Digitale Prozesskette sind die Aktivitäten auf die Themenfelder<br />
Featuretechnologie, NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)-basierte Fräsbahnen<br />
und Adaptive Prozesse fokussiert. Die Forschungsgruppe Umweltgerechte Produkte<br />
schließlich bearbeitet Fragestellungen hinsichtlich der Gestaltung und der ö-<br />
kologischen Bilanzierung des Produktlebenszyklus.<br />
Eine besonders dynamische Zukunftsentwicklung erwartet der Gesprächspartner für<br />
das synergetische Zusammenwirken verschiedener Einzeldisziplinen – wie etwa<br />
des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informationstechnik – innerhalb<br />
der Produktentwicklung und Prozessoptimierung. Ein umfangreiches Potenzial sieht<br />
er ebenfalls im Bereich Wissensmanagement, in dem die Forschungsgruppe Produktion<br />
und Management engagiert ist. Die Aktivitäten am Lehrstuhl umfassen zum<br />
überwiegenden Teil angewandte Forschung, daneben werden jedoch auch spezifische<br />
Dienstleistungen für die Industrie offeriert, insbesondere fachbezogene Analysen,<br />
Projektstudien und Konzeptstudien wie auch Weiterbildungsseminare.<br />
Die Finanzierung der wissenschaftlichen Aktivitäten am Institut basiert zu einem<br />
Großteil auf Drittmitteln. Der Haushalt beläuft sich im Jahresmittel auf ca. 5,2 Mio.<br />
Euro; davon sind etwa 90 % Drittmittel. Hiervon stammen etwa die eine Hälfte von<br />
großen Industrieunternehmen bzw. kleinen und mittleren Unternehmen und die andere<br />
Hälfte von öffentlichen Förderinstitutionen. Über zwei Teilprojekte beteiligt sich<br />
das Institut am DFG-Sonderforschungsbereich 666 „Integrale Blechbauweisen<br />
höherer Verzweigungsordnung - Entwicklung, Fertigung, Bewertung“, an dem<br />
rund 25 Wissenschaftler aus den Disziplinen Produktentwicklung, Produktionstechnik,<br />
Betriebsfestigkeit, Mathematik und Materialwissenschaften partizipieren. Eingeworbene<br />
Drittmittel stammen zudem aus der Projektförderung des BMBF, so etwa<br />
im Rahmen von sechs Verbundvorhaben, deren Betreuung jeweils am Forschungszentrum<br />
Karlsruhe (PTKA) angesiedelt ist. Im Forschungsfeld der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
besteht eine intensive Kooperation mit der Tongji-Universität<br />
Shanghai. In Kooperation mit den Fachgebieten Produktentwicklung und Maschinenelemente<br />
sowie Datenverarbeitung in der Konstruktion bearbeitet die Arbeitsgruppe<br />
des Gesprächspartners drei Teilprojekte des DFG-Transferbereichs 55<br />
"Umweltgerechte Produkte durch optimierte Prozesse, Methoden und Instrumente<br />
in der Produktentwicklung". Als Industriepartner sind hierbei die HILTI<br />
Entwicklungsgesellschaft mbH, die Alfred Kärcher <strong>GmbH</strong> & Co. KG und die Techni-<br />
Data AG involviert.<br />
129
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Enge Kontakte bestehen zudem mit der AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen,<br />
die stark auf die Förderung der Forschung und Entwicklung<br />
in kleinen und mittleren Unternehmen ausgerichtet ist, und dem VDA - Verband der<br />
Automobilindustrie. Ein weiterer Partner ist die Daimler Benz AG.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Mit der Gründung der Prozesslernfabrik CiP - Center für industrielle Produktivität<br />
hat das PTW ein bundesweit führendes Kompetenzzentrum und eine Plattform für<br />
die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Weiterbildungs- und im Forschungsbereich<br />
geschaffen (vgl. Abbildung 19).<br />
Abbildung 18: Vernetzung des Fachgebietes Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
an der TU Darmstadt<br />
DFG-SFB „Integrale Blechbauweisen<br />
Höherer<br />
Verzweigungsordnung<br />
- Entwicklung,<br />
Fertigung,<br />
Bewertung“<br />
u. a.<br />
McKinsey &<br />
Company<br />
u. a.<br />
DFG-TB 55 "Umweltgerechte Produkte<br />
durch optimierte Prozesse, Methoden und<br />
Instrumente in der Produktentwicklung"<br />
SEW-EURODRIVE<br />
Spanende Formung /<br />
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
CiP - Center für industrielle Produktivität<br />
Forschungszentrum<br />
Karlsruhe<br />
(PTKA)<br />
HILTI<br />
Alfred Kärcher<br />
Bosch-Rexroth<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
130
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Innerhalb des CiP lässt sich die vollständige industrielle Wertschöpfungskette - von<br />
der Bearbeitung der Rohmaterialien bis zur Montage des Endproduktes – simulieren,<br />
wobei vor allem die Weiterentwicklung der Methoden des “Lean Management“<br />
im Mittelpunkt steht. Das CiP dient sowohl der Simulation von Fertigungsprozessen<br />
innerhalb der Forschung als auch dem Wissenstransfer zwischen Universität und<br />
Privatwirtschaft. Ein zentrales Betätigungsfeld liegt in der Weiterbildung für Fachkräfte<br />
aus der mittelständischen Industrie, aber auch für Wissenschaftler und Berufsschullehrer.<br />
In der Erschließung des unternehmensorientierten Weiterbildungsmarkts<br />
durch die Hochschulen ist das CIP beispielgebend.<br />
Die Investitionskosten für den Aufbau dieser Einrichtung in Höhe von ca. 2 Mio. Euro<br />
wurden gemeinsam von der TU Darmstadt und dem Land <strong>Hessen</strong> aufgebracht.<br />
Der Betrieb des CIP wird insbesondere von McKinsey & Company unterstützt, ferner<br />
von Bosch-Rexroth und SEW-EURODRIVE.<br />
In Hinsicht auf die regionale Unternehmenslandschaft schätzt der Gesprächspartner<br />
die Zukunftsperspektiven für das Technologiefeld der Spanenden Formung sowie<br />
des Werkzeug- und Formenbaus in <strong>Hessen</strong> als günstig ein. Große Potenziale<br />
sieht der Gesprächspartner im Aufbau eines Netzwerks für Werkzeug- und Formenbau.<br />
Im Bundesland seien etwa 50 mittelständische Unternehmen ansässig, die ein<br />
unmittelbares Interesse an einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Hochschule<br />
auf diesem Gebiet hätten. Entsprechende Initiativen des Landes zur Stärkung<br />
der Produktion und zur Intensivierung des Wissenstransfers z.B. durch<br />
Clusterprogamme würden durch den Gesprächspartner begrüßt, da der Hochschule<br />
die dafür notwendigen Möglichkeiten fehlten.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Ein Problem liegt offenbar in der mangelnden Stetigkeit der Forschungsförderung.<br />
So erfordern die Aktivitäten zur Erlangung von Finanzierungsbewilligungen fortwährend<br />
die Bindung umfangreicher Ressourcen. Im Hinblick auf die Rahmenbedingungen<br />
für die Forschung weisen laut Einschätzung des Gesprächspartners Standorte<br />
wie München, Stuttgart, Karlsruhe und Aachen komparative Vorteile auf.<br />
Zudem müssten die öffentlichen Anstrengungen, die in <strong>Hessen</strong> zur Förderung von<br />
Querschnittstechnologien geleistet werden, erweitert werden, um die betreffenden<br />
Themenfelder in einem breiten Kontext zu verankern. Auch in dieser Hinsicht seien<br />
die Aktivitäten in Bayern und Baden-Württemberg geradezu vorbildlich.<br />
131
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5.5 Adaptronik<br />
Übersicht 19: Kurzprofil des Fachgebietes Adaptronik am Fraunhofer-Institut LBF in Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Schwerpunktforschung zur Adaptronik als Querschnittstechnologie im<br />
Bereich der Schwingungsisolation, Formkontrolle bis hin zur<br />
Leichtbau- und Zuverlässigkeitsoptimierung.<br />
• Das Institut umfasst bundesweit die größte Forschungs- und<br />
Entwicklungseinheit auf dem Gebiet der Adaptronik mit<br />
ca. 30 Wissenschaftlern.<br />
Anwendungsbereiche • Adaptronische Lösungen in den Sektoren Automotive, Transport,<br />
Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Umwelt und Gesundheit.<br />
Technologiefeld • Das Technologiefeld Adaptronik bezieht sich auf „Intelligente,<br />
adaptive Strukturen“ mit strukturintegrierter Sensorik, Aktorik und<br />
Regelungstechnik.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Aufbau eines Innovationscluster „Rhein-Main Adaptronik“, der sich an<br />
Anbieter aus den Teilbranchen Automotive, Maschinen- und<br />
Anlagenbau bzw. Sondermaschinenbau und Automation richtet.<br />
• Errichtung des Transferzentrums „Adaptronik“ zur Umsetzung von<br />
Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Unternehmen mit<br />
Unterstützung des BMBF, des Landes <strong>Hessen</strong> sowie der Fraunhofer-<br />
Gesellschaft.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Identifizierung von Unternehmen im Segment der Hochtechnologien.<br />
• Klare Vorgaben seitens des Landes zu strategischen<br />
Innovationsfeldern.<br />
• Plattformen für die Kommunikation mit kleinen und mittleren<br />
Unternehmen.<br />
• Gezielter Aufbau der Forschungsinfrastruktur im Bereich der<br />
„Funktionalen Werkstoffe“ im Einklang mit den Kompetenzen in der<br />
Region.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächsteilnehmer amtiert als Leiter des LBF - Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit<br />
und Systemzuverlässigkeit, in dem vielfältigste Aktivitäten im Technologiefeld<br />
der Adaptronik angesiedelt sind. Gleichzeitig ist er Professor im Fachgebiet<br />
Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik am Fachbereich Maschinenbau<br />
der TU Darmstadt, das als Kompetenzcenter Grundlagenforschung in das Fraunhofer<br />
LBF integriert ist. Innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft existiert eine Fraunhofer-Allianz<br />
Adaptronik - FAA, zu der sich Arbeitsgruppen aus elf Instituten zusammengeschlossen<br />
haben. Zu nennen sind hier etwa die Standorte Chemnitz,<br />
Dresden und Braunschweig. Das Fraunhofer LBF unterhält mit ca. 30 Wissenschaft-<br />
132
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
lern bundesweit die größte Forschungs- und Entwicklungseinheit auf dem Gebiet<br />
der Schlüsseltechnologie der Adaptronik.<br />
Die anwendungsorientierten Forschungsaktivitäten am Fraunhofer LBF sind in sieben<br />
Kompetenzcentern angesiedelt: CAx-Technologien, Last- und Beanspruchungsanalyse,<br />
Betriebslastensimulation und Bewertung, Ra / Nabe / Welle, Betriebsfester<br />
Leichtbau, Bauteilgebundenes Werkstoffverhalten sowie Mechatronik<br />
/ Adaptronik. Die Anwendungsbereiche für die Forschungsergebnisse lassen<br />
sich im Wesentlichen vier Geschäftsfeldern zuordnen. Im Geschäftsfeld Automotive<br />
liegt der Fokus auf den Anforderungen der Hersteller und Zulieferer in der Teilbranche<br />
der Personen-KFZ-Fertigung. Das Geschäftsfeld Transport ist auf Komponenten,<br />
Systeme und Prozesse in Verkehrsträgern bzw. Fahrzeugen zugeschnitten.<br />
Das Geschäftsfeld Maschinen- und Anlagenbau beinhaltet die Optimierung von<br />
Produktionsverfahren, so etwa hinsichtlich der Energieeffizienz, der Lärmemissionen<br />
und der Fertigungsgeschwindigkeit. Das Geschäftsfeld Energie, Umwelt und<br />
Gesundheit umfasst u.a. die Forschung über die Betriebssicherheit von Anlagen<br />
zur Energieerzeugung (bspw. Windenergieparks) und der umweltgerechten Erzeugung.<br />
Hierbei geht es insbesondere um Kontrollsysteme, Produktlebenszyklus-<br />
Konzepte und Alternative Antriebssysteme.<br />
Die wissenschaftlichen Aktivitäten am Fraunhofer LBF beinhalten zum ersten die<br />
theoretisch-mathematische Herleitung von Optimierungsalgorithmen und zum zweiten<br />
die experimentelle Konstruktionsforschung, welche auf die praxisbezogene Erarbeitung<br />
von technologischen Problemlösungen abzielt. Um Fragestellungen zur<br />
Strukturüberwachung und Strukturkontrolle zu untersuchen, wird i.d.R. eine eingehende<br />
Systemanalyse vorgenommen. Die Forschungsarbeiten stehen in einem engen<br />
Zusammenhang mit weiteren Dienstleistungen, die seitens des Instituts angeboten<br />
werden. Hierzu gehört beispielsweise die Durchführung von Projektstudien<br />
zur Steigerung der technischen Zuverlässigkeit, die insbesondere in hochkomplexen<br />
adaptronischen Systemen von herausragender Bedeutung ist. Außerdem offeriert<br />
das Fraunhofer LBF bereits ausgereifte Produktlösungen, so etwa LBF®<br />
WheelStrength / HubStrength, eine Spezialsoftware zur rechnerischen Auslegung<br />
von Fahrzeugrädern und Radnaben, und LBF®DAP, ein numerisches Werkzeug zur<br />
Datenanalyse und Datenverarbeitung im Hinblick auf die Betriebsfestigkeit. Aus dem<br />
Fraunhofer LBF sind im Zuge von Ausgründungen mehrere Unternehmen hervorgegangen,<br />
so etwa die Stress & Strength <strong>GmbH</strong>, die sich in der Umsetzung und Vermarktung<br />
von Spezialsoftware betätigt, und die ISYS Adaptive Solutions <strong>GmbH</strong>, die<br />
sich vornehmlich der Realisierung und Vermarktung von Produktlösungen widmet.<br />
Insbesondere für die Rhein-Main-Region mit ihrem sehr vielfältigen und technologisch<br />
hoch entwickelten Branchen-Mix erwartet der Gesprächsteilnehmer ein erhebliches<br />
Expansionspotenzial für adaptronische Lösungen, und zwar insbesondere<br />
in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, also zwei Schlüsselbranchen innerhalb<br />
der hessischen Wirtschaft. So geht er davon aus, dass mittelfristig in nahe-<br />
133
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
zu sämtlichen Bauteilen und Maschinen adaptronische Konzepte unverzichtbar sein<br />
werden. Dies gilt etwa für die Verringerung von Schwingungen oder die Lärmminderung.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Das Institut arbeitet mit zahlreichen Industriepartnern zusammen, so z.B. mit Porsche,<br />
Airbus, MTU Aero Engines, Fendt, Boehringer Ingelheim und MAN Roland.<br />
Ein besonderes Anliegen ist dem Gesprächsteilnehmer der weitere Ausbau der Kooperation<br />
zwischen öffentlichen Forschungsinstitutionen und Privatwirtschaft, um –<br />
nicht zuletzt über einen Wissenstransfer – die Entwicklung des Technologiefeldes<br />
der Adaptronik zu forcieren. Hierzu bedarf es allerdings eines – breit abgestützten –<br />
institutionalisierten Unterbaus, der sowohl den Forschungszielen öffentlicher Institutionen<br />
als auch den Interessen privatwirtschaftlicher Unternehmen gleichermaßen<br />
gerecht wird. Um dies zu realisieren, errichtet das Fraunhofer LBF mit Unterstützung<br />
des BMBF, des Landes <strong>Hessen</strong> sowie der Fraunhofer-Gesellschaft ein neues<br />
Transferzentrum „Adaptronik“ zur Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten<br />
mit Unternehmen, das intensiv mit dem Unternehmensumfeld in der<br />
Region Rhein-Main vernetzt werden soll (vgl. Abbildung 20).<br />
Dazu hat das Fraunhofer LBF ein detailliertes Konzept für den Aufbau eines Innovationscluster<br />
„Rhein-Main Adaptronik“ auf Basis des Transferzentrums A-<br />
daptronik ausgearbeitet, der sich vor allem an Anbieter aus den Teilbranchen Automotive,<br />
Maschinen- und Anlagenbau bzw. Sondermaschinenbau und Automation<br />
richtet. Als institutioneller Rahmen für das Cluster ist ein Verein vorgesehen, dessen<br />
Gründung in Kürze erfolgen wird. Die Geschäftsstelle zur Clusterbegleitung und Koordinierung<br />
der Einzelaktivitäten wird am Fraunhofer LBF angesiedelt sein.<br />
Die Ziele des geplanten Netzwerkes liegen insbesondere in der Auslotung von<br />
Wertschöpfungspotenzialen in ausgewählten Produktsegmenten und in der Vertiefung<br />
der Kooperation zwischen regional ansässigen Unternehmen und dem<br />
Transferzentrum Adaptronik. Im Vordergrund stehen hierbei sowohl thematisch breiter<br />
angelegte Diskussionsprozesse als auch konkrete Problemlösungen bei der Produktentwicklung.<br />
Des Weiteren soll der geplante Innovationscluster als Basis für den<br />
Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und als strategische Marketingplattform<br />
für die technologischen Kompetenzen in der Region dienen.<br />
Die anvisierten Aktivitäten werden sich im Zusammenwirken zwischen drei verschiedenen<br />
Ebenen vollziehen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um eine Informations-<br />
und Kommunikationsebene (Fraunhofer LBF fungiert als „Innovationsmultiplikator“),<br />
eine Marktfindungs- und Projektanbahnungsebene („Innovationsbroker“)<br />
sowie um eine Projektebene („Innovationstreiber“). Im Hinblick auf die Umsetzung<br />
des Clusterkonzepts wurden am Fraunhofer LBF bereits konkrete Projektideen ausgearbeitet.<br />
Diese beziehen sich z.B. auf die Aggregatelagerung und die Karosserieanbindung<br />
innerhalb eines Automobils und die Maschinenlagerung im Maschinen-<br />
134
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
und Anlagebau. Im Kontext der bearbeiteten Forschungs- und Entwicklungsfelder<br />
wird eine weitere Aufgabe des Innovationsclusters „Rhein-Main Adaptronik“ in der<br />
Ausarbeitung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen liegen.<br />
Abbildung 19: Vernetzung des Fachgebietes Adaptronik am Fraunhofer-Institut LBF in Darmstadt<br />
u. a.<br />
Fraunhofer-Allianz Adaptronik - FAA<br />
Forschungsschwerpunkt Funktionale<br />
Werkstoffe – Werkstoffe in Funktion an<br />
der TU Darmstadt<br />
EUCEMAN –<br />
European Center<br />
For Micro- and<br />
Nano Reliabilitiy<br />
u. a.<br />
Adaptronik<br />
MatFoRM -<br />
Material-<br />
Forschungs-<br />
Verbund<br />
Rhein–Main<br />
Fendt<br />
Porsche<br />
MAN Roland<br />
Airbus<br />
MTU Aero Engines<br />
Transferzentrum „Adaptronik“<br />
Boehringer Ingelheim<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
In Bezug auf die Technologie- und Forschungsförderung erkennt der Gesprächspartner<br />
in mehrfacher Hinsicht einen Handlungsbedarf. So gilt es insbesondere, die<br />
vielseitigen Facetten der hessischen Unternehmenslandschaft im Segment der<br />
Hochtechnologien zu identifizieren und in einen konkreten Zusammenhang mit der<br />
Forschungsinfrastruktur zu setzen. Hierauf aufbauend lassen sich dann die tatsächlichen<br />
Innovationspotenziale ausloten, an denen sich wiederum die Forschungsförderung<br />
orientieren sollte. Dabei erwartet der Gesprächspartner vom Land klare<br />
Vorgaben zu strategischen Innovationsfeldern.<br />
135
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Gerade hinsichtlich der Sparte der kleinen und mittleren Unternehmen liegen bislang<br />
nur unzureichende Informationen über die dort geleisteten Forschungs- und Innovationsaktivitäten<br />
vor, so dass es langfristig ausgelegter Kommunikationsplattformen<br />
bedarf. Der Gesprächspartner begrüßt die Beiträge, die hierzu bislang von<br />
Seitens des Landes <strong>Hessen</strong> geleistet worden sind, mahnt jedoch gleichzeitig eine<br />
Fortentwicklung der betreffenden politischen Konzepte und eine Ausdehnung der<br />
Maßnahmen an.<br />
Konkret benennt der Gesprächspartner ein Defizit in der Region im Bereich der<br />
„Funktionalen Werkstoffe“. Im Einklang mit den Kompetenzen in der Region sollte<br />
hier ein gezielter Aufbau der Forschungsinfrastruktur betrieben werden, z.B. durch<br />
Ansiedlung eines Max-Planck-Insituts.<br />
136
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
137
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.5.6 Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
Übersicht 20: Kurzprofil des Fachgebietes Produktentwicklung / Konstruktionsforschung an der<br />
TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Vier Arbeitsbereiche: Empirische Konstruktionsforschung<br />
(industrieller Einsatz von Konstruktionsmethoden, Strukturierung der<br />
Konstruktionsprozesse in betrieblichen Arbeitsgruppen), Wälzlager,<br />
Eco-Design (Entwicklung umweltgerechter Produkte), Lehr-, Lernund<br />
Anwendungssysteme für die industrielle Produktentwicklung.<br />
• Angebot von Dienstleistungen für Industrieunternehmen.<br />
Anwendungsbereiche • Unmittelbarer Einsatz der erforschten Methoden und Prozesse in<br />
Produktentwicklungsprozessen in der Industrie.<br />
Technologiefeld • Themenfeld des Produktdesigns ist sehr weit gefasst und umschreibt<br />
die unterschiedlichen Facetten der Produktentwicklung und<br />
Produktfertigung.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Partizipation am DFG-Sonderforschungsbereich 666 „Integrale<br />
Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung - Entwicklung,<br />
Fertigung, Bewertung“ und am DFG-Transferbereich 55<br />
"Umweltgerechte Produkte durch optimierte Prozesse, Methoden und<br />
Instrumente in der Produktentwicklung".<br />
• Mitarbeit im „Berliner Kreis - Wissenschaftliches Forum für<br />
Produktentwicklung“, einem Zusammenschluss von<br />
28 Universitätsprofessoren in Deutschland zur Förderung der<br />
Innovationsfähigkeit in der Industrie.<br />
• Projektgebundene Kooperationen und Partnerschaften mit<br />
Unternehmen wie HILTI Entwicklungsgesellschaft, Alfred Kärcher,<br />
Motorola und Heidelberger Druckmaschinen. Langjährige<br />
Zusammenarbeit mit Daimler Chrysler und Conti-Teves und den<br />
Beratungsgesellschaften Roland Berger und AT Kearney.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsebdarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsempfehlungen<br />
• Schaffung einer soliden Finanzierungsbasis für die Beschäftigung<br />
wissenschaftlichen Personals, das in kurzfristigen – von der Industrie<br />
geförderten – Forschungsprojekten tätig ist.<br />
• Unterstützung bei der organisatorischen Abwicklung von<br />
Drittmittelprojekten.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Gespräch wurde mit dem Leiter des Fachgebietes Produktentwicklung und Maschinenelemente<br />
(PMD) geführt, das dem Fachbereich Maschinenbau der<br />
TU Darmstadt zugeordnet ist. Insgesamt sind am Fachgebiet etwa 25 Mitarbeiter tätig,<br />
u.a. ein Akademischer Oberrat und 15 Wissenschaftliche Mitarbeiter. Zum<br />
Fachgebiet gehören ferner eine Werkstatt und ein Zeichenbüro mit insgesamt<br />
138
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
fünf Beschäftigten. Der Gesprächspartner legt großen Wert auf eine umfangreiche<br />
Förderung der Mitarbeiter und deren Einbindung in die verschiedenen Aktivitäten<br />
am Institut, insbesondere in die Lehre.<br />
Das inhaltliche Spektrum der wissenschaftlichen Aktivitäten am Fachgebiet umfasst<br />
im Wesentlichen vier Arbeitsbereiche. Der Arbeitsbereich Empirische Konstruktionsforschung<br />
bezieht sich u.a. auf die Kompetenzfelder industrieller Einsatz von<br />
Konstruktionsmethoden, Wissensmanagement, Methoden für das Training von Entwicklern<br />
und Strukturierung der Konstruktionsprozesse in betrieblichen Arbeitsgruppen.<br />
In diesem Kontext ist der Schlüsselbegriff Produktdesign sehr weit gefasst und<br />
umschreibt die unterschiedlichen Facetten der Produktentwicklung und Produktfertigung.<br />
Der Schwerpunkt des Arbeitsbereiches Wälzlager liegt in der Entwicklung einer<br />
Lebensdauertheorie für feststoffgeschmierte Wälzlager und orientiert sich vornehmlich<br />
an langfristigen Fragestellungen. Im Arbeitsbereich EcoDesign liegt der<br />
Fokus auf der Entwicklung umweltgerechter Produkte. Der Arbeitsbereich pinngate<br />
schließlich beinhaltet die Konzeption eines Lehr-, Lern und Anwendungssystems für<br />
die industrielle Produktentwicklung. Neben der eigentlichen Forschungstätigkeit bietet<br />
die Arbeitsgruppe zusätzliche Dienstleistungen für Fertigungsunternehmen an,<br />
und zwar vornehmlich Weiterbildungs- bzw. Trainingsmaßnahmen und Beratungsleistungen<br />
im Hinblick auf die Prozessmodellierung und das Prozessmanagement.<br />
Die Beratung, die nicht selten punktuell auf einzelne Teilaspekte der Konstruktion<br />
bzw. Fertigung ausgerichtet ist, hat hierbei sowohl den Hersteller als auch den Kunden<br />
im Blick. Eine besondere Bedeutung wird dem problemorientierten Wissenstransfer<br />
bzw. Methodiktransfer zugemessen.<br />
Die umfangreiche Einwerbung von Drittmitteln am Fachgebiet schlägt sich u.a. darin<br />
nieder, dass die Arbeitsgruppe des Gesprächsteilnehmers zwei Teilprojekte am<br />
DFG-Sonderforschungsbereich 666 „Integrale Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung<br />
- Entwicklung, Fertigung, Bewertung“ bearbeitet. Außerdem<br />
beteiligt sie sich an vier Teilprojekten des DFG-Transferbereiches 55 "Umweltgerechte<br />
Produkte durch optimierte Prozesse, Methoden und Instrumente in der<br />
Produktentwicklung", der teilweise auf den Forschungsergebnissen des DFG-<br />
Sonderforschungsbereiches 392 "Entwicklung umweltgerechter Produkte in<br />
Methoden, Arbeitsmittel und Instrumente" aufbaut, als dessen Sprecher der Gesprächsteilnehmer<br />
von 1994 bis 2001 fungierte.<br />
Von 2000 bis 2003 amtierte der Befragte als Präsident der Internationalen Gesellschaft<br />
für Produktentwicklung „The Design Society“. Im Hinblick auf das wissenschaftliche<br />
Veröffentlichungswesen fungiert er als Mitherausgeber der Fachzeitschrift<br />
„Die Konstruktion“, des Organs der VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion,<br />
Vertrieb und der VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik. Zudem betätigt er sich als<br />
Lehrbeauftragter an der ETH Zürich im Fach "Methodik industrieller Planung und<br />
Entwicklung".<br />
139
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Sowohl national als auch international ist die Arbeitsgruppe in mehrere Forschungsnetzwerke<br />
eingebunden (vgl. Abbildung 21). So engagiert sich der Gesprächspartner<br />
u.a. im „Berliner Kreis - Wissenschaftliches Forum für Produktentwicklung“,<br />
einem Zusammenschluss von 28 Universitätsprofessoren in Deutschland<br />
zur Förderung der Innovationsfähigkeit in der Industrie, der sich inhaltlich über etwa<br />
850 Einzelthemen erstreckt. Ein hoher Nutzen ergibt sich für Industrieunternehmen<br />
daraus, dass sie über eine Datenbank mit über 600 Einzeldokumenten und über<br />
200 Softwaretools verfügen können.<br />
Abbildung 20: Vernetzung des Fachgebietes Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
an der TU Darmstadt<br />
DFG-SFB 666 „Integrale<br />
Blechbauweisen höherer Verzweigungsordnung<br />
- Entwicklung, Fertigung,<br />
Bewertung“<br />
u. a.<br />
Berliner Kreis -<br />
Wissenschaftliches<br />
Forum<br />
für Produktentwicklung“<br />
u. a.<br />
Roland Berger<br />
Produktentwicklung /<br />
Konstruktionsforschung<br />
DFG-TB 55 "Umweltgerechte<br />
Produkte<br />
durch optimierte<br />
Prozesse,<br />
Methoden und<br />
Instrumente<br />
in der Produktentwicklung"<br />
Motorola<br />
Daimler<br />
Conti-Teves<br />
Heidelberger<br />
Druckmaschinen<br />
AT Kearney<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Im Rahmen des DFG-Transferbereichs 55 bestehen projektgebundene Kooperationen<br />
mit den Unternehmen HILTI Entwicklungsgesellschaft, Alfred Kärcher, Motorola<br />
140
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
und Heidelberger Druckmaschinen. Daneben existiert eine langjährige Zusammenarbeit<br />
mit weiteren Industrieunternehmen – so beispielsweise Daimler Chrysler und<br />
Conti-Teves – und den Beratungsgesellschaften Roland Berger und AT Kearney.<br />
Nicht selten werden Forschungsprojekte auch in Zusammenarbeit mit kleinen oder<br />
mittleren Technologieanbietern durchgeführt, die wiederum im Auftrag von Großunternehmen<br />
agieren. Ein aktuelles Beispiel ist hierfür die Kooperation mit der Firma<br />
BIT, die wiederum für die Firma Bayer tätig ist.<br />
Die Aufgabenbereiche der Kooperationspartner grenzen sich i.d.R. klar voneinander<br />
ab. So verbleibt die eigentliche Produktfertigung beim Industriepartner, die Arbeitsgruppe<br />
des Gesprächspartners übernimmt Beratungsleistungen zur Prozessanalyse<br />
und die Entwicklung von Prototypen. Die grundsätzliche Zusammenarbeit hat üblicherweise<br />
einen langfristigen Charakter, manifestiert sich jedoch häufig im Rahmen<br />
kurzfristiger Einzelprojekte, die über ca. drei bis sechs Monate laufen. Dabei verfolgt<br />
die Beratung das Ziel, in frühen Phasen der Produkt- und Variantenentwicklung<br />
beim Industriepartner eine Systematisierung der Produktentwicklung zu erreichen.<br />
Die Eigenheiten der jeweiligen Branche spielen dabei eine untergeordnete Rolle.<br />
Die Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Unternehmensberatungen dokumentiert<br />
die herausragende fachliche Expertise des Fachgebiets Produktentwicklung<br />
und Maschinenelemente, stellt aber auch die Frage nach der Verteilung der<br />
Gewinne aus den Projekten zwischen der Hochschule und den Beratungsgesellschaften.<br />
Notwendig sei zudem eine solide Finanzierungsbasis für die Beschäftigung<br />
wissenschaftlichen Personals, das in kurzfristigen – von der Industrie geförderten<br />
– Forschungsprojekten tätig ist.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Hinblick auf die Forschungslandschaft im Bundesland <strong>Hessen</strong> kritisiert der Gesprächspartner<br />
insbesondere die zunehmende Bürokratisierung in der Hochschulverwaltung<br />
und der Hochschulpolitik. Hierdurch würden positive Entwicklungen innerhalb<br />
der Forschungsförderung zumindest teilweise überkompensiert. Seitens der<br />
Hochschule wünscht sich der Gesprächspartner Unterstützung bei der organisatorischen<br />
Abwicklung der Drittmittelprojekte.<br />
141
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.6 Materialwissenschaften<br />
5.6.1 Materialwissenschaften / Oberflächenforschung<br />
Übersicht 21: Kurzprofil des Fachgebietes Materialwissenschaften / Oberflächenforschung an der<br />
TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Gemäß dem aktuellen Förderranking der DFG befinden sich die<br />
Darmstädter Materialwissenschaften innerhalb des Bundesgebietes in<br />
der Spitzengruppe der Forschungseinrichtungen.<br />
• Inhaltliche Schwerpunkte eher auf den Ingenieurwissenschaften.<br />
Anwendungsbereiche • Fachliches Spektrum umfasst u.a. physikalische Metallurgie, Keramik-<br />
Forschung, Analyse elektronischer Materialeigenschaften und<br />
Oberflächenforschung.<br />
• Lehrstuhl weist umfangreiche Forschungsaktivitäten im Bereich<br />
Photovoltaik auf.<br />
Technologiefeld • Dynamische Entwicklung, so etwa bezüglich sensorischer<br />
Eigenschaften und Absorptionsfähigkeiten von komplexen<br />
Werkstoffkombinationen wie auch neuartiger Schichtstrukturen in<br />
Materialien.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Einbindung in den DFG-Sonderforschungsbereich 595 „Elektrische<br />
Ermüdung in Funktionswerkstoffen“ und das Energy Center an der<br />
TU Darmstadt.<br />
• Partizipation am Forschungsnetzwerk Rhein-Main - MatFORM, in<br />
dessen Rahmen eine enge Kooperation mit der Staatlichen<br />
Materialprüfungsanstalt - MPA, dem Deutschen Kunststoff Institut -<br />
DKI und dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit - LBF besteht.<br />
• Enge Zusammenarbeit mit der Fa. Merck, u.a. im Rahmen des<br />
Mercklab.<br />
• Rege Kontakte mit Industriepartnern innerhalb des Clusters Materials<br />
Valley.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Verstärkung der Anstrengungen, um die Aktivitäten der<br />
Forschungsnetzwerke zu verstetigen.<br />
• Ansiedlung eines fachlich verwandten Max-Planck-Institutes in<br />
Darmstadt.<br />
• Forschungspolitik sollte sich sowohl am „Gießkannenprinzip“ als auch<br />
an einer gezielten Förderung von besonders zukunftsträchtig<br />
erscheinenden Disziplinen orientieren.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
142
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Gesprächspartner war der Leiter des Fachgebiets Oberflächenforschung am Fachbereich<br />
Material- und Geowissenschaften der TU Darmstadt. Das Team am Fachgebiet<br />
besteht aus 25 Mitarbeitern; dies sind u.a. fünf Postdoktoranden, acht Doktoranden<br />
und vier ausländische Gastwissenschaftler. Die wissenschaftlichen Arbeiten<br />
am Lehrstuhl konzentrieren sich auf vier Themenschwerpunkte. Der Forschungsschwerpunkt<br />
Dünnschichtsolarzellen umfasst die Überprüfung neuartiger Materialien<br />
im Hinblick auf ihre Eignung für den Einsatz in der Photovoltaik. In einem weiteren<br />
Forschungsschwerpunkt werden auf der Van der Waals-Epitaxie basierende<br />
Heterostrukturen und -Schichtsysteme in optoelektronischen Systemen untersucht.<br />
Der Forschungsschwerpunkt Elektrochemische Grenzflächen beinhaltet die<br />
Analyse und Fortentwicklung elektrochemischer Prozesse sowie die Modifizierung<br />
und Strukturierung von Materialien. In einem weiteren Forschungsschwerpunkt werden<br />
in Hinsicht auf Interkalationsbatterien Veränderungen elektronischer Strukturen<br />
mit Ein- und Auslagerung von Ionen analysiert.<br />
Der materialwissenschaftliche Schwerpunkt an der TU Darmstadt entwickelt sich<br />
gegenwärtig sehr dynamisch. Im Unterschied zum Wissenschaftlichen Zentrum für<br />
Materialwissenschaften an der Universität Marburg, das eine deutliche naturwissenschaftliche<br />
Ausrichtung aufweist, liegen die inhaltlichen Schwerpunkte an der<br />
TU Darmstadt eher auf den Ingenieurwissenschaften. Die fachliche Bandbreite<br />
reicht u.a. von der physikalischen Metallurgie und Keramik-Forschung über die Analyse<br />
elektronischer Materialeigenschaften und Oberflächenforschung bis hin zur Materialstrukturanalyse<br />
und Theoretischen Materialwissenschaft. Gemäß dem aktuellen<br />
Förderranking der DFG befinden sich die Darmstädter Materialwissenschaften<br />
innerhalb des Bundesgebietes mit einem jährlichen Drittmittelvolumen von etwa<br />
sechs Mio. Euro in der Spitzengruppe der Forschungseinrichtungen. Die Zahl der<br />
dortigen Professuren soll mittelfristig von zehn auf zwölf erhöht werden. Zudem sind<br />
acht Professuren aus anderen Fachbereichen (Mineralogie; Chemie, Elektrotechnik<br />
und Maschinenbau) assoziiert, woran sich der interdisziplinäre Charakter der Materialwissenschaften<br />
verdeutlicht. Die enge Einbindung in kooperative Forschungsstrukturen<br />
zeigt sich sehr ausgeprägt im 2002 gegründeten DFG-<br />
Sonderforschungsbereich 595 „Elektrische Ermüdung in Funktionswerkstoffen“,<br />
an dem insgesamt 15 wissenschaftliche Arbeitsgruppen aus unterschiedlichsten<br />
naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fachgebieten partizipieren.<br />
Sehr weit gediehen sind die Planungen für die Einrichtung eines SFBs oder<br />
einer DFG-Forschergruppe zum Themenkomplex „Leistungsgrenzen gedruckter<br />
Elektronik“ (in Kooperation mit der Elektrotechnik und der Drucktechnik an der TUD)<br />
und eines SFBs zum Themenfeld „Nanomaterialien – Anwendung in der Katalyse<br />
und Sensorik“ (in Kooperation mit dem Fachbereich Chemie). Der Fachbereich<br />
pflegt zudem vielfältige internationale Kontakte, die in Zukunft hinsichtlich kooperativer<br />
Lehr- und Forschungsaktivitäten noch deutlicher als bisher strukturiert werden<br />
sollen. Dies manifestiert sich beispielsweise in einem zusammen mit der Seoul<br />
143
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
National University abgeschlossenen “Memorandum of Understanding“ und einer<br />
analogen Vereinbarung mit der Pennsylvania State University.<br />
Für die Zukunft sieht der Gesprächspartner in zahlreichen Bereichen der Materialwissenschaften<br />
bedeutende Forschungsfragestellungen, so etwa bezüglich sensorischer<br />
Eigenschaften und Absorptionsfähigkeiten von komplexen Werkstoffkombinationen<br />
wie auch neuartiger Schichtstrukturen. Im Zusammenhang mit besonders innovativen<br />
Forschungsfragestellungen wird sich die wissenschaftliche Kompetenz<br />
am Fachbereich insbesondere auf die folgenden Themenfelder ausrichten: Multifunktionale<br />
Hybrid- und Kompositwerkstoffe, mikroelektronische Anwendungen und<br />
Materialien für nachhaltige Energietechnologien. Ein besonderer Forschungsbedarf<br />
besteht nämlich hinsichtlich der inhaltlichen Schnittstelle zwischen Materialwissenschaften<br />
und Energieforschung. Diesbezüglich wird an der TU Darmstadt mit dem<br />
kürzlich gegründeten Energy Center ein innovatives und breit abgestütztes wissenschaftliches<br />
Konzept verfolgt, denn es ist gelungen, Fachvertreter aus verschiedensten<br />
Disziplinen der Ingenieur- und Naturwissenschaften wie auch den Geistesund<br />
Sozialwissenschaften für diesen Forschungs- und Lehrverbund zu gewinnen.<br />
Gerade die Partizipation der Geistes- und Sozialwissenschaften hält der Gesprächspartner<br />
für besonders notwendig, denn seiner Einschätzung nach ist es unabdingbar,<br />
das Themenfeld der Energieerzeugung und Energiesicherheit in einem<br />
interdisziplinären Kontext zu verankern. Dies gilt nicht zuletzt auch für philosophische<br />
Forschungsfragestellungen. Auch die wissenschaftliche Konzeption der Graduiertenschule<br />
GENESIS - Graduate School of Energy Engeering Science and Interdisciplinary<br />
Studies, für welche die TUD einen Antrag im Rahmen der Exzellenzintiative<br />
gestellt hat, hält der Gesprächspartner für richtungsweisend.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Innerhalb des am Fachbereich angesiedelten Kompetenzzentrums Materialcharakterisierung<br />
werden Forschungseinrichtungen, Privatunternehmen und Verwaltungsinstitutionen<br />
Dienstleistungen zur Materialanalyse offeriert. Die Aktivitäten am<br />
Kompetenzzentrum sind eng in den Materialforschungsverbund Rhein-Main -<br />
MatFORM eingebunden, in dessen Rahmen eine enge Kooperation mit der Staatlichen<br />
Materialprüfungsanstalt - MPA, dem Deutschen Kunststoff Institut - DKI und<br />
dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit - LBF besteht (vgl. Abbildung 22). Die<br />
bislang schon sehr enge Zusammenarbeit mit der Fa. Merck mündet mit der gegenwärtigen<br />
Einrichtung des Mercklab an der TUD in eine zusätzliche institutionelle<br />
Grundlage.<br />
Rege Kontakte mit Industriepartnern bestehen auch im Rahmen des Clusters Materials<br />
Valley. Gleichwohl merkt der Gesprächspartner an, dass die diesbezüglichen<br />
Anstrengungen noch verstärkt werden müssten, um die Aktivitäten der Forschungsnetzwerke<br />
zu verstetigen.<br />
144
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 21: Vernetzung des Fachgebietes Materialwissenschaften / Oberflächenforschung<br />
an der TU Darmstadt<br />
DFG-SFB 666 595 „Elektrische<br />
Ermüdung in Funktionswerkstoffen“<br />
Fraunhofer-Institut für<br />
Betriebsfestigkeit - LBF<br />
u. a.<br />
TU Darmstadt<br />
Energy Center<br />
u. a.<br />
Materialwissenschaften<br />
/ Oberflächenforschung<br />
MatFoRM -<br />
Material-<br />
Forschungs-<br />
Verbund<br />
Rhein–Main<br />
Merck (u.a.<br />
über Mercklab)<br />
Schott<br />
Degussa<br />
Weitere Partner im Netzwerk<br />
Materials Valley<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Nach Auffassung des Gesprächspartners sollte sich die Ausstattung der TUD an der<br />
Infrastruktur anderer hochkarätiger wissenschaftlicher Einrichtungen wie etwa dem<br />
Forschungszentren Jülich und Karlsruhe und der ETH Zürich orientieren. Um die<br />
materialwissenschaftliche Expertise am Standort Darmstadt zu stärken, erscheint<br />
die Ansiedlung eines fachlich verwandten Max-Planck-Institutes notwendig.<br />
Grundsätzlich vertritt der Gesprächsteilnehmer den Standpunkt, dass sich die staatliche<br />
Forschungspolitik sowohl nach dem „Gießkannenprinzip“ als auch an einer<br />
gezielten Förderung von besonders zukunftsträchtig erscheinenden Disziplinen ausrichten<br />
sollte. Was die grundsätzlichen Überlegungen über eine Weiterentwicklung<br />
der hessischen Hochschullandschaft anbelangt, so gilt es, den in jüngerer Zeit sehr<br />
fruchtbaren Diskurs fortzuführen. Gerade von den umfangreichen Anstrengungen im<br />
Rahmen der Exzellenz-Initiative seien wertvolle Impulse ausgegangen, die eine<br />
Grundlage für den weiteren forschungspolitischen Diskussionsprozess bildeten.<br />
145
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.6.2 Materialwissenschaften / Strukturforschung<br />
Übersicht 22: Kurzprofil des Fachgebietes Materialwissenschaften / Strukturforschung an der<br />
Universität Marburg<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Deutliche naturwissenschaftliche Ausprägung.<br />
Anwendungsbereiche • Entwicklung von Nanofasern, multifunktionalen Hybridmaterialien und<br />
biokeramischen Werkstoffen.<br />
• Materialbezogene Untersuchungen zu Energieträgersystemen<br />
ebenso wie zur Energiespeicherung und Energiekonversion.<br />
Technologiefeld • Entwicklung von Halbleitermaterialien und Werkstoffen auf polymerer<br />
Basis.<br />
• Vielversprechendes Forschungsfeld bildet die Spintronik, die die<br />
Nutzung des magnetischen Moments von Elektronen in Materialien<br />
zum Ziel hat.<br />
• Umfangreiche Innovationspotenziale in den Themenbereichen „Drug<br />
Delivery“ und „Drug Targeting“.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Beteiligung an der DFG-Forschergruppe 483 „Metastabile<br />
Verbindungshalbleiter“ und der DFG-Forschergruppe 627 „Polymere<br />
Nanocarrier zur pulmonalen Verabreichung von Wirkstoffen<br />
(Nanohale)“.<br />
• Gründung des europäischen materialwissenschaftlichen<br />
Graduiertenkolleg „Electron-Electron Interactions in Solids“<br />
gemeinsam mit der Universität Budapest.<br />
• Anwendungsnahe Forschungskooperationen bestehen mit etwa<br />
20 Unternehmen, so etwa Akzo-Nobel, Bayer, BASF, Osram Opto-<br />
Semiconductors; kooperierende Mittelständler sind bspw. die H.C.<br />
Starck <strong>GmbH</strong>, die NAsP III/V <strong>GmbH</strong> und die Cognis <strong>GmbH</strong>.<br />
• Regelmäßige Ausrichtung des Materialforschungstags Mittelhessen<br />
zusammen mit der Universität Gießen und der Fachhochschule<br />
Gießen-Friedberg.<br />
Handlungsbedarf Vernetzung mit der<br />
Wirtschaft<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Unterstützung durch öffentliche Institutionen (auch von Seiten des<br />
Landes <strong>Hessen</strong>) bei der Einrichtung und Pflege von<br />
Kommunikationsplattformen.<br />
• Ansiedlung einer Großforschungseinrichtung der Max-Planck-<br />
Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Leibniz-<br />
Gemeinschaft im Raum Marburg.<br />
• Anschaffung von Forschungsgroßgeräten und kontinuierliche<br />
Instandhaltung der baulichen und technologischen Infrastruktur.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
146
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Interview wurde mit dem Geschäftsführenden Direktor des Wissenschaftlichen<br />
Zentrums für Materialwissenschaften an der Philipps-Universität Marburg<br />
geführt. Der Gesprächspartner ist Inhaber eines Lehrstuhls für Anorganische Chemie,<br />
an dem insgesamt elf Mitarbeiter tätig sind. Am Wissenschaftlichen Zentrum<br />
Materialwissenschaften beteiligen sich elf Professuren aus dem Fachbereich Chemie,<br />
acht Professuren aus dem Fachbereich Physik sowie zwei Professuren aus<br />
dem Fachbereich Pharmazie. Gegenwärtig forschen am Zentrum etwa<br />
35 promovierte Mitarbeiter, 95 Doktoranden sowie 50 Diplomanden. Einen zentralen<br />
Baustein der Infrastruktur bildet das Zentrale Materiallabor, das hauptamtlich von<br />
einem Wissenschaftler geleitet wird.<br />
Das Zentrum wurde 1989 gegründet und zunächst im Wesentlichen über die Grundfinanzierung<br />
des Landes <strong>Hessen</strong> gefördert, mittlerweile beruht die Finanzierung jedoch<br />
fast ausschließlich auf Drittmitteln, die zum überwiegenden Teil von der DFG<br />
und dem BMBF und zu einem geringen Teil vom Land <strong>Hessen</strong> bereitgestellt werden.<br />
Diese Drittmittel, deren Umfang sich im Mittel der vergangenen Jahre auf etwa<br />
3,5 Mio. Euro belief, sind sowohl an Einzelvorhaben als auch an Forschungsverbünde<br />
gekoppelt. So wurde kürzlich die DFG-Forschergruppe 483 „Metastabile<br />
Verbindungshalbleiter“ verlängert. Neu eingerichtet wurde die DFG-<br />
Forschergruppe 627 „Polymere Nanocarrier zur pulmonalen Verabreichung<br />
von Wirkstoffen (Nanohale)“. Daneben beteiligt sich das Zentrum an mehreren<br />
kollaborativen BMBF-Projekten. Wichtige außeruniversitäre Partnerinstitutionen sind<br />
beispielsweise das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, das Fraunhofer-Institut<br />
für Angewandte Festkörperphysik IAF und das Ferdinand-Braun-Institut<br />
für Höchstfrequenztechnik.<br />
Auch in die internationale Forschungs-Community ist das Forschungszentrum<br />
auf vielfältige Weise eingebunden. Intensive Kontakte bestehen u.a. mit der Cornell<br />
University und der Princeton University wie auch der Chinesischen Akademie<br />
der Wissenschaften und dem Indian Institute of Technology, die nicht zuletzt über<br />
Aufenthalte von Gastwissenschaftlern gepflegt werden. Eine lange Tradition – auch<br />
hinsichtlich des Zeitraums vor 1989 – haben Kooperationen mit Universitäten in Mittel-<br />
und Osteuropa, unter anderem in Tschechien, Bulgarien, Lettland, Litauen und<br />
Russland. Genannt seien hier beispielhaft die Lomonossov-Universität in Moskau,<br />
die Staatliche Universität in St. Petersburg und die Staatliche Universität in Nowosibirsk.<br />
Ein europäisches materialwissenschaftliches Graduiertenkolleg zum Themenfeld<br />
„Electron-Electron Interactions in Solids“ hat die Universität Marburg gemeinsam<br />
mit der Universität Budapest gegründet.<br />
Das Studienprogramm am Zentrum umfasst einen Bachelor-Studiengang Materialwissenschaften<br />
und einen Master-Studiengang Materialchemie. Der überwiegende<br />
Teil der Studenten stammt nicht aus dem mittelhessischen Raum, was die herausragende<br />
Reputation des Lehrangebots unterstreicht. Es bestehen Studienpartner-<br />
147
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
schaften im Rahmen des Europäischen Sokrates-Programms, so etwa mit Oxford<br />
und Cambridge in England wie auch Uppsala und Luleå in Schweden.<br />
Die materialwissenschaftliche Forschung in Marburg ist deutlich interdisziplinär<br />
ausgerichtet. Bedeutende Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung von Halbleitermaterialien<br />
und Werkstoffen auf polymerer Basis. Es bestehen enge Bezüge mit<br />
den Lebenswissenschaften bzw. der Medizin, Pharmazie und Biotechnologie. Ein<br />
vielversprechendes Forschungsfeld bildet die „Spintronik“, die die Nutzung des<br />
magnetischen Moments von Elektronen in Materialien zum Ziel hat. Umfangreiche<br />
Innovationspotenziale bieten auch die Themenbereiche „Drug Delivery“ und „Drug<br />
Targeting“, in denen es vor allem um die passgenaue und zielorientierte Applikation<br />
von Medikamenten geht, um schädliche Nebenwirkungen für den Patienten zu minimieren.<br />
Dies steht teilweise in Beziehung zu vielfältigen Verflechtungen mit den<br />
Nanotechnologien, so z.B. bei der Entwicklung von Nanofasern, multifunktionalen<br />
Hybridmaterialien und biokeramischen Werkstoffen. Ein weiteres bedeutendes Arbeitsfeld<br />
bilden materialbezogene Untersuchungen zu Energieträgersystemen e-<br />
benso wie zur Energiespeicherung und Energiekonversion.<br />
Nach Aussage des Gesprächsteilnehmers folgt die langfristige Entwicklung der wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisgewinnung in den betreffenden Forschungsfeldern einem<br />
deutlich ansteigenden Trend, der allerdings durch Zyklen gekennzeichnet ist.<br />
Leistungsstarke materialwissenschaftliche Forschungsagglomerationen befinden<br />
sich im Bundesgebiet u.a. in Rheinland-Pfalz (Universität Mainz, TU Kaiserslautern),<br />
Nordrhein-Westfalen (Universität Bochum, Universität Dortmund), Bayern (TU München)<br />
und Baden-Württemberg (TU Karlsruhe). Im internationalen Vergleich werden<br />
vor allem in den USA und in Japan materialwissenschaftliche Spitzenleistungen erbracht.<br />
Eine enorme Expansion der Forschungsaktivitäten sieht der Gesprächspartner<br />
in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften. Seiner Einschätzung nach<br />
werden vor allem China und Indien in etwa fünf bis acht Jahren die Europäische<br />
Union hinsichtlich der Innovationsstärke überholt haben.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Anwendungsnahe Forschungskooperationen bestehen mit etwa 20 Unternehmen.<br />
Als Industriepartner sind etwa Akzo-Nobel, Bayer, BASF, Osram Opto-<br />
Semiconductors zu nennen, ferner als Mittelständler die H.C. Starck <strong>GmbH</strong>, die<br />
NAsP III/V <strong>GmbH</strong> und die Cognis <strong>GmbH</strong> (vgl. Abbildung 23). Die wissenschaftlichen<br />
Arbeiten werden zum großen Teil im zentralen Materiallabor durchgeführt.<br />
Ein Forum für Kontakte mit in der Region ansässigen Unternehmen bildet der regelmäßig<br />
stattfindende Materialforschungstag Mittelhessen, der zusammen mit<br />
der Universität Gießen und der Fachhochschule Gießen-Friedberg ausgerichtet<br />
wird. Gerade die Pflege der Kontakte mit kleinen und mittleren Unternehmen erfordert<br />
erhebliche Anstrengungen. Kommunikationsplattformen müssen stetig bzw.<br />
148
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
langfristig ausgerichtet sein, wozu es einer Unterstützung durch öffentliche Institutionen<br />
(auch von Seiten des Landes <strong>Hessen</strong>) bedarf.<br />
Abbildung 22: Vernetzung des Fachgebietes Materialwissenschaften / Strukturforschung<br />
an der Universität Marburg<br />
DFG-FG 627 „Polymere<br />
Nanocarrier zur pulmonalen Verabreichung<br />
von Wirkstoffen (Nanohale)“<br />
Europäisches GK „Electron-Electron Interactions<br />
in Solids“ gemeinsam mit der Universität Budapest<br />
u. a.<br />
Zahlreiche Partnerschaften<br />
mit<br />
mittel- und osteuropäischen<br />
Universitäten<br />
Materialwissenschaften<br />
/ Strukturforschung<br />
u. a.<br />
Akzo-Nobel<br />
BASF<br />
DFG-FG 483<br />
„Metastabile<br />
Verbindungshalbleiter“<br />
Cognis <strong>GmbH</strong><br />
NAsP III/V<br />
<strong>GmbH</strong><br />
Bayer<br />
H.C. Starck <strong>GmbH</strong><br />
Osram Opto-Semiconductors<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Zur Stärkung und Profilierung der regionalen Forschungslandschaft erachtet es der<br />
Gesprächspartner als notwenig, mindestens ein Forschungsinstitut der Max-<br />
Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Leibniz-Gemeinschaft im<br />
Raum Marburg anzusiedeln. Zudem hält er die langfristige Vertiefung fachbezogener<br />
Kooperationen mit der Universität Gießen für sinnvoll, um synergetische Potenziale<br />
auszuschöpfen. Einen bedeutsamen Handlungsbedarf sieht der Gesprächsteilnehmer<br />
in der Anschaffung von Forschungsgroßgeräten wie auch der<br />
kontinuierlichen Instandhaltung der baulichen und technologischen Infrastruktur.<br />
All dies sei unabdingbar, um die bereits sehr hohe Attraktivität des Hochschulstandorts<br />
Marburg für Studenten und Wissenschaftler noch zu steigern.<br />
149
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.7 Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
5.7.1 Multimedia Kommunikation<br />
Übersicht 23: Kurzprofil des Fachgebietes Multimedia Kommunikation an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und Angewandter<br />
Forschung beläuft sich auf etwa eins zu drei.<br />
• Am Fachgebiet existieren fünf Arbeitsgruppen mit folgenden<br />
Forschungsschwerpunkten: Ubiquitous Communications, Mobile<br />
Networking, Peer-to-Peer-Networking, IT-Architecture sowie<br />
Knowledge Media.<br />
Anwendungsbereiche • Zur Anwendung kommen die Forschungsergebnisse vornehmlich in<br />
den Segmenten E-Learning, E-Business & E-Finance und<br />
Communication Services & IP Telephony.<br />
Technologiefeld • Vielfältige Multimedia-Anwendungen in IT-Systemen.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Beteiligung an den DFG-Graduiertenkollegs 853 „Modellierung,<br />
Simulation und Optimierung von Ingenieuranwendungen“,<br />
492 "Infrastruktur für den elektronischen Markt" und<br />
1223 "Qualitätsverbesserung im E-Learning durch rückgekoppelte<br />
Prozesse" wie auch an der DFG-Forschergruppe 733 „Verbesserung<br />
der Qualität von Peer-to-Peer-Systemen durch die systematische<br />
Erforschung von Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen<br />
Abhängigkeiten“.<br />
• Intensive Kooperation mit Industriepartnern in den Bereichen<br />
Knowledge Media und IT-Architecture. Intensive Kooperation mit der<br />
SAP AG im Rahmen des gemeinsamen Forschungszentrums CEC<br />
Darmstadt; intensive Kontakte sowohl zu öffentlichen als auch<br />
privatwirtschaftlichen Partnern durch das httc - hessisches telemedia<br />
technologie kompetenz-center.<br />
Handlungsbedarf Vernetzung mit der<br />
Wirtschaft<br />
• Potenzial für eine noch engere Zusammenarbeit mit Industriepartnern<br />
wird im Bereich zukünftiger technologischer Schlüsselfragen wie dem<br />
Wissensmanagement gesehen.<br />
• Integration von kleinen und mittleren Unternehmen in die<br />
Forschungsaktivitäten.<br />
• Unterstützung von Ausgründungen aus der Hochschule.<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf • Ausrichtung der staatlichen Forschungsförderung auf die zukünftigen<br />
Stärkefelder mit hohem technologischen und wirtschaftlichen<br />
Potenzial.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
150
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Befragt wurde der Leiter des Fachgebietes Multimedia Kommunikation, das am<br />
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Darmstadt angesiedelt<br />
ist. Daneben ist der Gesprächspartner Zweitmitglied im Fachbereich Informatik. Am<br />
Fachgebiet sind insgesamt etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt, u.a. ein Akademischer<br />
Rat, vier Postdoktoranden und rund dreißig Doktoranden. Als Humboldt-Stipendiat<br />
ist gegenwärtig ein ausländischer Gastwissenschaftler am Lehrstuhl tätig.<br />
Bezüglich der Ausrichtung der Forschung beläuft sich das Verhältnis zwischen<br />
Grundlagenforschung und Angewandter Forschung auf etwa eins zu drei. Im Jahresmittel<br />
werden am Lehrstuhl Drittmittel im Umfang von etwa 1 Mio. Euro eingeworben,<br />
die zu jeweils etwa 35 % auf die DFG bzw. privatwirtschaftliche Partner und<br />
zu rund 15 % auf die Europäische Kommission entfallen. Weitere Förderinstitutionen<br />
sind die VolkswagenStiftung, das BMWi, das BMBF, der DAAD und die Vereinigung<br />
von Freunden der Technischen Universität zu Darmstadt e.V. Als Institutionen des<br />
Landes <strong>Hessen</strong> engagieren sich das HMWK, das HMWVL und die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Am Fachgebiet existieren fünf Arbeitsgruppen mit folgenden Forschungsschwerpunkten:<br />
Ubiquitous Communications, Mobile Networking, Peer-to-Peer-<br />
Networking, IT-Architecture (Finanzierung vollumfänglich über Industriepartner)<br />
sowie Knowledge Media (Finanzierung zu 70 % über Industriepartner). Zur Anwendung<br />
kommen die Forschungsergebnisse vornehmlich in den Segmenten E-<br />
Learning, E-Business & E-Finance und Communication Services & IP Telephony.<br />
Von herausragender Bedeutung sind ferner die Bereiche Workflows, Network Mechanism<br />
wie auch Quality of Service, Dependability & Security. Für all diese Segmente<br />
sieht der Gesprächspartner in Zukunft einen erheblichen Forschungsbedarf,<br />
und zwar u.a. in den Themenfeldern „Aktive Objekte“, „Interaktive Multimediaanwendungen“,<br />
„Netzmechanismen“, „Internet-Telefonie“, „Workflows“, „Lebende Dokumente“<br />
wie auch „Dienstgüte und Verlässlichkeit“. In diesem Kontext spielen<br />
durchweg Aspekte der Dienstleistungsorientierung und Anwendungsorientierung eine<br />
wichtige Rolle. Fachliche Überschneidungen bestehen beispielsweise in den<br />
Themenfeldern Weiterbildung bzw. E-Learning mit den Erziehungswissenschaften<br />
und im Themenfeld Netzwerkarchitektur mit der Mathematik. Im Bereich der Entwicklungshilfe<br />
engagiert sich der Gesprächspartner in Projekten des Fördervereins<br />
Savalou / Benin.<br />
Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe schlagen sich in einer vielfältigen Publikationstätigkeit<br />
nieder. Zudem fungiert der Gesprächspartner als Mitherausgeber<br />
der folgenden Fachzeitschriften: Transactions on Multimedia Computing, Communications<br />
and Applications, Springer Multimedia Systems Journal, Elsevier Computer<br />
Communications, Elsevier Pervasive and Mobile Computing, International Journal<br />
of Pervasive Computing and Communications sowie International Journal of Advanced<br />
Media and Communication.<br />
151
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
An der Hochschule ist die Arbeitsgruppe in mehrere Kooperationen eingebunden.<br />
Zu nennen sind hier insbesondere die DFG-Graduiertenkollegs 853 „Modellierung,<br />
Simulation und Optimierung von Ingenieuranwendungen“, 492 "Infrastruktur<br />
für den elektronischen Markt" wie auch 1223 "Qualitätsverbesserung<br />
im E-Learning durch rückgekoppelte Prozesse". Weitere fachbezogene Hochschuleinrichtungen,<br />
die sich auch im Bereich der praxisorientierten Weiterbildung<br />
betätigen, sind das E-Learning Center der TU Darmstadt und der Forschungsschwerpunkt<br />
E-Learning. Ferner besteht eine maßgebliche Beteiligung an der<br />
DFG-Forschergruppe 733 „QuaP2P - Verbesserung der Qualität von Peer-to-<br />
Peer-Systemen durch die systematische Erforschung von Qualitätsmerkmalen<br />
und deren wechselseitigen Abhängigkeiten“, deren Sekretariat am Lehrstuhl angesiedelt<br />
ist, des Weiteren am Darmstädter Zentrum für IT-Sicherheit (DZI), am<br />
IT Transfer Office (ITO) der TU Darmstadt und am Forschungsschwerpunkt „Integrierte<br />
Verkehrssysteme“.<br />
Hochschulübergreifend kooperiert der Lehrstuhl mit sechs weiteren Lehrstühlen der<br />
Universität Frankfurt im Rahmen des E-Finance Lab. Außerdem unterhält er Kontakte<br />
zur Universität Gießen, TU Kaiserslautern, Universität Mannheim und<br />
TU München. Weitere Partnerinstitutionen befinden sich an der Universität Marburg<br />
und der Universität Magdeburg sowie der ETH Zürich, der University of Ottawa, der<br />
University of Oslo und dem Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas<br />
La Plata, Argentina. Außerdem engagiert sich die Arbeitsgruppe im Forschungsnetzwerk<br />
Multimedia Operating Systems and Networking (MONET) Research<br />
Group.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Intensive Kontakte sowohl zu öffentlichen als auch privatwirtschaftlichen Partnern<br />
unterhält die Arbeitsgruppe innerhalb des Netzwerkes httc - hessisches telemedia<br />
technologie kompetenz-center, das u.a. das Fraunhofer Institut für Integrierte<br />
Publikations- und Informationssysteme - IPSI in Darmstadt (eine Ausgründung aus<br />
der TU Darmstadt) und die Hochschule Darmstadt zu seinen Gründungsmitgliedern<br />
zählt (vgl. Abbildung 24).<br />
Eine besondere intensive Kooperation mit der SAP AG besteht im Rahmen eines<br />
gemeinsamen Forschungszentrums, das 2006 eröffnet wurde. Einen Forschungsschwerpunkt<br />
am sogenannten CEC Darmstadt bildet das Leitthema "Arbeitsumgebungen<br />
der Zukunft". Langfristig soll die Anzahl der Mitarbeiter an dem Corporate<br />
Lab von momentan 20 auf ca. 80 gesteigert werden. Bislang hat SAP Finanzmittel<br />
im Umfang von etwa 2 Mio. Euro in das in den Konzern integrierte Forschungszentrum<br />
investiert. Die Kooperation mit der TUD umfasst auch ein kooperatives Doktorandenprogramm,<br />
das teils von SAP, teils von der TUD mit Unterstützung des Europäischen<br />
Sozialfonds finanziert wird.<br />
152
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 23: Vernetzung des Fachgebietes Multimedia Kommunikation an der TU Darmstadt<br />
DFG-FG 733<br />
„QuaP2P – Verbesserung der<br />
Qualität von Peer-to-Peer-Systemen<br />
durch die Systematische Erforschung von<br />
Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen<br />
E-Finance Lab u. a. Abhängigkeiten“<br />
DFG-GK 1223<br />
„Qualitätsverbesserung<br />
im E-Learning<br />
durch rückgekoppelte<br />
Prozesse"<br />
u. a.<br />
Multimedia<br />
Kommunikation<br />
DFG-GK 853<br />
„Modellierung,<br />
Simulation und<br />
Optimierung von<br />
Ingenieur-<br />
Anwendungen“<br />
Siemens<br />
SAP<br />
Software AG<br />
Nokia<br />
Software AG<br />
Avaya Tenovis<br />
Springer Verlagsgruppe<br />
httc - hessisches telemedia<br />
technologie kompetenz-center<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Weitere privatwirtschaftliche Kooperanten sind u.a. Siemens, Nokia, die Deutsche<br />
Telekom und Avaya-Tenovis wie auch Panasonic Deutschland, die Software AG<br />
und die Springer Verlagsgruppe. Potenzial für eine zukünftig noch engere Zusammenarbeit<br />
mit Industriepartnern wird in Bereichen zukünftiger technologischer<br />
Schlüsselfragen wie z.B. dem Wissensmanagement und der Semantik, dem automatischen<br />
Verstehen von Dateninhalten im Internet gesehen.<br />
Laut Aussage des Gesprächspartners müssten im Bundesland <strong>Hessen</strong> die Aktivitäten<br />
zur Einbindung von kleinen und mittleren Unternehmen in die Forschung<br />
noch forciert werden. In Hinsicht auf sein Fachgebiet nennt er beispielhaft die erfolgreichen<br />
Kooperationen mit den Unternehmen Amadee und Kimeta. Zudem besteht<br />
offenkundig ein Handlungsbedarf bei der Unterstützung von Ausgründungen aus<br />
den Hochschulen.<br />
153
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien sieht der Gesprächspartner<br />
die Forschungsförderung in Baden-Württemberg als beispielhaft<br />
an. Dies gilt offenbar nicht allein für den Umfang des Forschungsbudgets, sondern<br />
vor allem auch für die aktive Gestaltung des Wandels in der Hochschullandschaft.<br />
So sei die dortige Differenzierung und Konturierung der wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
– gerade vor dem Hintergrund gegenwärtiger Entwicklungen in den Forschungsfeldern<br />
– als sehr fortschrittlich einzustufen. Dies hätte sich nicht zuletzt bei<br />
der Antragstellung für die Exzellenzinitiative des Bundes als markanter komparativer<br />
Vorteil erweisen. Im Hinblick auf das Bundesland <strong>Hessen</strong> rät der Gesprächspartner<br />
dazu, die Facetten der Forschungslandschaft deutlicher herauszustellen und bereits<br />
vorhandene Stärken weiter auszubauen. Ein Beitrag hierzu sei ein Road-<br />
Mapping der zukünftigen Entwicklung auf den wichtigsten Technologie- und Anwendungsfeldern.<br />
Auf Seiten der politischen Akteure seien hierfür Mut und Risikobereitschaft<br />
gefragt.<br />
154
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
155
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.7.2 E-Finance<br />
Übersicht 24: Kurzprofil des Fachgebietes Wirtschaftsinformatik / E-Finance an der Universität Frankfurt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Erforschung der Wertschöpfungsprozesse im<br />
Finanzdienstleistungssektor, insbesondere IT- und<br />
Geschäftsprozesse.<br />
Anwendungsbereiche • Elektronischer Zahlungsverkehr, Betriebliche Finanzierung,<br />
Kapitalmärkte, Kapitalverkehr, Absatzwirtschaftliche Fragestellungen.<br />
Technologiefeld • Fragestellungen im Kontext der Wirtschaftsinformatik /<br />
Betriebswirtschaftslehre zur Finanzindustrie.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Das E-Finance Lab ist Nukleus eines “E-Finance“-Clusters mit<br />
zahlreichen privatwirtschaftlichen Kooperationspartnern. Die<br />
institutionelle Ausgestaltung des E-Finance Lab (Private Public<br />
Partnership) kann als beispielhaft angesehen werden, um die<br />
zukünftige Leistungsfähigkeit des Hochschulwesens zu sichern und<br />
Kooperationen mit der Praxis zu befördern.<br />
• Die Bündelung der finanzwirtschaftlichen Forschung an der<br />
Universität Frankfurt erfolgt im „House of Finance“.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Von Seiten der Privatwirtschaft könnten mehr Fragestellungen aus<br />
der Praxis an die Hochschulen herangetragen werden.<br />
• Die Potenziale für Kooperationen im Bereich der<br />
Versicherungswirtschaft sind noch nicht ausgeschöpft.<br />
• Handlungsbedarf besteht beim Ausbau der<br />
Vermarktungsmaßnahmen zur Erhöhung der nationalen und<br />
internationalen Sichtbarkeit des E-Finance Clusters.<br />
• Orientierung der Forschungsförderung noch ausgeprägter als bisher<br />
an Erfolgskriterien (insbesondere an der Veröffentlichung von<br />
Forschungsergebnissen in internationalen Spitzenzeitschriften mit<br />
Peer Review).<br />
• Weitere Öffnung der Forschungsförderung in Richtung der<br />
Privatwirtschaft – so etwa über Public Private Partnerships.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Gespräch wurde mit dem Inhaber der Professur für Betriebswirtschaftslehre,<br />
insbesondere Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, und einem an<br />
dieser Professur tätigen Wissenschaftlichen Assistenten geführt. Sowohl an der<br />
Universität Frankfurt als auch hochschulübergreifend ist der Lehrstuhl in verschiedene<br />
institutionelle Strukturen eingebunden. Er gehört zum Fachbereich Wirtschaftswissenschaften<br />
und partizipiert ferner durch das von ihm gegründete<br />
156
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
E-Finance Lab (siehe folgender Absatz) am “House of Finance“, an dem im Umfeld<br />
von etwa 20 Lehrstühlen die finanzwirtschaftliche Forschung und Lehre an der Universität<br />
Frankfurt – bei gleichzeitigem Ausbau der Kapazitäten – gebündelt wird. Am<br />
“House of Finance“, das zehn Teilinstitutionen umfasst und dessen Neubau auf dem<br />
Campus Westend gerade fertiggestellt wird, werden ab Bezug im Februar 2008 insgesamt<br />
rund 150 Wissenschaftler tätig sein.<br />
Ferner hat der Gesprächspartner im Rahmen einer Kooperation zwischen der Uni<br />
Frankfurt und der TU Darmstadt ein An-Institut – das E-Finance Lab – gegründet, an<br />
dem etwa 40 Mitarbeiter, alle Doktoranden, tätig sind. Der Aufbau eines akademischen<br />
Mittelbaus, der auch mittelfristig bzw. langfristig angelegte Stellen umfassen<br />
soll, wird gegenwärtig forciert. Ein bedeutender Schritt hierzu besteht in der – anstehenden<br />
– Einrichtung von drei Juniorprofessuren.<br />
Am Lehrstuhl wie auch am Forschungsinstitut werden sowohl Grundlagenforschung<br />
als auch angewandte Forschung betrieben, wobei eine adäquate theoretische<br />
Fundierung besondere Priorität genießt. Das E-Finance Lab finanziert sich zu<br />
etwa 70 Prozent über Drittmittel, die zum überwiegenden Teil von Großunternehmen<br />
der Finanzbranche bzw. aus der Informations- und Kommunikationsindustrie<br />
stammen. Die betreffenden Unternehmen fungieren weit über ihre Rolle als<br />
Förderinstitutionen hinaus, so etwa als „Türöffner“ oder als potenzielle Arbeitgeber<br />
für Absolventen. Darüber hinaus bringen die Kooperationsuntenehmen auch Personalkapazität<br />
und Expertise in gemeinsame Forschungsprojekte ein. Letztlich bieten<br />
derartige Kooperationen, die i. d. R. langfristig angelegt sind, für sämtliche Beteiligte<br />
konkrete Vorteile. Das E-Finance Lab lässt sich somit als Nukleus eines “E-<br />
Finance“-Clusters ansehen. Bedeutende Partner sind u. a. die Deutsche Bank, die<br />
DZ-Bank Gruppe, FinanzIT (das ist die Backend-Organisation der norddeutschen<br />
Sparkassen), IBM, Microsoft und Siemens.<br />
Die Anwendungsfelder für die erarbeiteten Forschungsergebnisse im E-Finance<br />
Lab liegen in fünf thematisch definierten Bereichen des Finanzsektors, wobei vor allem<br />
die Industrialisierung des Geschäfts beispielsweise hinsichtlich der Arbeitsverrichtung<br />
und der Prozesssteuerung sowie die damit verbundenen unternehmensstrategischen<br />
Fragestellungen im Vordergrund stehen. Inhaltliche Bezüge ergeben<br />
sich vornehmlich zur Bankbetriebslehre, zum Operations-Management, zur Finanzwirtschaft<br />
und zum Teil zur Analyse der Kapitalmärkte. Das inhaltliche Spektrum der<br />
wissenschaftlichen Aktivitäten reicht vom Börsenwesen über den Zahlungsverkehr<br />
bis hin zur betrieblichen Finanzierung. Von Relevanz sind zudem absatzwirtschaftliche<br />
Fragestellungen, die thematisch auf die Kundenorientierung der Finanzindustrie<br />
abzielen. Den Aussagen der Gesprächspartner zufolge könnte ein zukünftiger ergänzender<br />
Forschungsschwerpunkt insbesondere auf dem Asset Management, bei<br />
längerfristigerer Betrachtung auch auf der Versicherungswirtschaft liegen. Von hoher<br />
Relevanz für die Auswahl der Fragestellungen ist der aktuelle Bezug zu den<br />
Entwicklungen in der Finanzbranche, der über die zahlreichen Kontakte in die Un-<br />
157
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
ternehmenspraxis hergestellt wird. Insgesamt sind nach Aussagen der Gesprächspartner<br />
die Prozesse bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen erst „rudimentär“<br />
erforscht.<br />
Die Forschungsergebnisse werden weitestgehend veröffentlicht, und zwar parallel<br />
in herausragenden internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften, Tagungsbänden<br />
und Monographien – ergänzt durch spezifisch aufbereitete Darstellungen von Ergebnissen<br />
und deren Implikationen für das praktische Geschäft in Beiträgen für Zeitungen<br />
und Publikumszeitschriften. Eine wichtige Rolle beim intensiv betriebenen<br />
Wissenstransfer in die Praxis spielen des Weiteren – teilweise selber organisierte –<br />
Konferenzen, Workshops und Seminare. Den spezifischen Bedürfnissen der privatwirtschaftlichen<br />
Kooperationspartner wird über Inhouse-Seminare Rechung getragen,<br />
deren Inhalte sich vornehmlich auf aktuelle Themen zum Finanzsektor beziehen.<br />
Zur Außendarstellung des Fachgebietes wird zudem eine intensive PR-Arbeit<br />
betrieben, die allerdings nach Einschätzung der Gesprächspartner noch verbessert<br />
werden könnte.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Kooperationen mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen liegen in vielfältiger<br />
Hinsicht vor (vgl. Abbildung 25). Gefragt nach den Feldern, in welchen gleichwohl<br />
Verbesserungen möglich sind, antworten die Interviewten, dass auf Seiten der<br />
Privatwirtschaft durchaus die Wertschätzung bzw. Anerkennung der Forschungsleistungen<br />
der Hochschulen gesteigert werden kann. So merkt einer der Gesprächspartner<br />
kritisch an, dass „die Privatwirtschaft vielfach letztlich nicht weiß, was sie an<br />
der Wissenschaft hat“. Dies ist auch daran bemerkbar, dass im Gegensatz zur klassischen<br />
produzierenden Industrie (z. B. Automobilsektor) in Banken in aller Regel<br />
keine hauseigenen Forschungsabteilungen existieren, deren zentrale Aufgabe die<br />
Fortentwicklung der eigenen Produkte und Prozesse ist. Zudem wäre es wünschenswert,<br />
wenn noch mehr Fragestellungen aus der Praxis an die Hochschulen<br />
herangetragen würden. Hierzu könnten Forschungsaufenthalte von Wissenschaftlern<br />
in der Industrie einen wertvollen Beitrag leisten.<br />
Die institutionelle Ausgestaltung des E-Finance Lab kann als beispielhaft angesehen<br />
werden, um die zukünftige Leistungsfähigkeit des Hochschulwesens zu sichern<br />
und Kooperationen mit der Praxis zu befördern. Nach Auskunft der Gesprächspartner<br />
könnte der Austausch mit der Finanzwirtschaft insbesondere auch durch die Erhöhung<br />
der nationalen und internationalen Sichtbarkeit des E-Finance Clusters bei<br />
der relevanten Zielgruppe und durch den Aufbau eines Alumni-Netzwerks für ehemalige<br />
Mitarbeiter weiter ausgebaut werden. Allerdings stünden die für zusätzliche<br />
Vermarktungsmaßnahmen notwendigen Mittel nicht zur Verfügung, so dass hier<br />
ein großer Handlungsbedarf bestehe. Auf dem Gebiet der Versicherungswirtschaft<br />
sehen die Gesprächspartner Potenziale für eine ähnliche enge Kooperation in der<br />
RheinMain Region.<br />
158
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Abbildung 24: Vernetzung des Fachgebietes Wirtschaftsinformatik / E-Finance an der Universität Frankfurt<br />
House of Finance<br />
University of<br />
Irvine, California<br />
u. a.<br />
TU Darmstadt<br />
E-Finance Lab<br />
TU Berlin<br />
E-Finance<br />
u. a.<br />
DZ-Bank<br />
Gruppe<br />
Deutsche Bank<br />
Microsoft<br />
IBM<br />
Finanz IT<br />
Siemens<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Allgemein vorrangige Handlungsbedarfe werden auf Seiten der Gesprächspartner in<br />
der Finanzierung und der institutionellen Ausgestaltung der Forschung – nach dem<br />
Muster des E-Finance Lab und diese erfolgreichen Grundstrukturen durchaus erweiternd<br />
– gesehen. So sei eine weitere Öffnung in Richtung der Privatwirtschaft – etwa<br />
über Public Private Partnerships – unumgänglich, um die Leistungsfähigkeit eines<br />
forschungsintensiven Hochschulwesens zu sichern. Als institutioneller Rahmen bieten<br />
sich hierfür vor allem mit Hochschulen verbundene An-Institute an, die nicht nur<br />
über langfristige Vertragsverhältnisse teilweise in der Trägerschaft privater Institutionen<br />
liegen, sondern darüber hinaus auch im Hinblick auf einzelne Forschungsvorhaben<br />
sehr flexibel bei der Akquisition von Drittmitteln sind. Eine tragfähige Zukunftsoption<br />
sehen die Gesprächsteilnehmer ferner im institutionellen Rahmen einer<br />
Stiftungsuniversität.<br />
Was die öffentliche Forschungsförderung betrifft, so sollte sich diese zukünftig<br />
noch stärker als bisher an Erfolgskriterien orientieren – und ein zentrales Erfolgskri-<br />
159
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
terium ist die Veröffentlichung von Ergebnissen in internationalen Spitzenzeitschriften<br />
mit Peer Review. Zudem sind die öffentlichen Hochschulen dazu angehalten, ihre<br />
PR-Aktivitäten zu forcieren – und zwar im Sinne des vorgenannten „Übersetzens“<br />
von Forschungsergebnissen in die Sprache der Praxis und mit Blick auf die konkrete<br />
Beeinflussung von Strategie und operativem Geschäft –, um der Öffentlichkeit ihre<br />
Leistungen in der Forschung und Lehre zu verdeutlichen. Dies gilt nicht zuletzt für<br />
den Kontakt mit Vertretern aus der Privatwirtschaft.<br />
160
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
161
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.7.3 Graphische Datenverarbeitung<br />
Übersicht 25: Kurzprofil des Fachgebietes Graphische Datenverarbeitung am Fraunhofer-Institut IGD in<br />
Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Visualisierung, Interaktion und Kommunikation im Bereich der<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien.<br />
Anwendungsbereiche • Applikationen u.a. in den Feldern Verkehr und Logistik,<br />
Medizintechnik, Architektur und Raumplanung, E-Business,<br />
IT-Sicherheit, E-Learning.<br />
Technologiefeld • Drei Forschungslinien: Semantik im Modellierungsprozess;<br />
Wechselwirkung zwischen Bildgenerierung und Bildanalyse;<br />
Verallgemeinerte digitale Dokumente.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Kooperationen mit etwa dreißig anderen<br />
Großforschungseinrichtungen innerhalb des Fraunhofer-<br />
Institutsverbundes.<br />
• Kontakte zu zahlreichen Industriepartnern – beispielsweise großen<br />
Anbietern wie Alcatel, BMW, Merck, SAP oder Sony – ebenso wie zu<br />
kleinen und mittleren Unternehmen.<br />
• Auftraggeber sind ferner Wissenstransferzentren,<br />
Bildungseinrichtungen, Kliniken, Verbände wie auch öffentliche Ämter<br />
und Behörden.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Förderung einer Industriellen Vorlaufforschung, die sich an<br />
langfristigen forschungspolitischen Zielen orientiert.<br />
• Außendarstellung der wissenschaftlichen Kompetenz, um die<br />
Wahrnehmung bei forschungsstrategisch wichtigen Gutachtern zu<br />
verstärken.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Der Gesprächspartner ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung<br />
- IGD in Darmstadt und gleichzeitig Inhaber eines Lehrstuhls für Graphisch<br />
Interaktive Systeme am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Am<br />
Fraunhofer IGD sind an vier Standorten in Darmstadt, Rostock, Graz und Singapur<br />
insgesamt 140 Mitarbeiter beschäftigt. Das jährliche Institutsbudget beläuft sich auf<br />
16 Mio. Euro und liegt somit in einer ähnlichen Größenordnung wie der Finanzrahmen<br />
vergleichbarer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik. Das Institutsbudget<br />
resultiert zu zwei Dritteln aus Forschungsvorhaben, die zusammen mit Industriepartnern<br />
oder unter Förderung durch öffentliche Institutionen bearbeitet werden.<br />
Das restliche Drittel wird über die Grundausstattung bereitgestellt. Im jährlichen<br />
Durchschnitt werden am Fraunhofer - IGD etwa 350 Beratungsprojekte, For-<br />
162
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
schungsvorhaben und Studien durchgeführt. Innerhalb des Fraunhofer-<br />
Institutsverbundes existieren Kooperationen mit etwa dreißig anderen Großforschungseinrichtungen,<br />
hierunter beispielsweise dem Fraunhofer-Institut für Integrierte<br />
Publikations- und Informationssysteme - IPSI, dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit<br />
- LBF in Darmstadt und dem Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur<br />
und Softwaretechnik - FIRST in Berlin. Des Weiteren bestehen weltweite Kontakte<br />
zu zahlreichen Forschungseinrichtungen und Universitäten im In- und Ausland.<br />
Die wesentlichen Kompetenzfelder des Fraunhofer IGD liegen in der Visualisierung,<br />
Interaktion und Kommunikation im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien.<br />
So bildet die graphische Datenverarbeitung eine wesentliche<br />
technologische Voraussetzung für die benutzernahe Anwendung von Informationsund<br />
Kommunikationstechnologien. Die wissenschaftliche Expertise am Institut verdeutlicht<br />
sich in drei Forschungslinien:<br />
• Semantik im Modellierungsprozess,<br />
• Wechselwirkung zwischen Bildgenerierung und Bildanalyse,<br />
• Verallgemeinerte digitale Dokumente.<br />
Vor diesem Hintergrund sind die Forschungsaktivitäten in neun Geschäftsfelder<br />
eingebettet:<br />
• Software für die Produkt- und Produktionsentwicklung,<br />
• Visualisierung und Interaktion für Verkehr und Telematik,<br />
• Ambient Intelligence,<br />
• Medizinische Informationstechnik,<br />
• IT-Sicherheit,<br />
• eApplications, eServices und eBusiness,<br />
• Edutainment,<br />
• Usability and Utility Engineering.<br />
Umfangreiche Innovationspotenziale sieht der Gesprächspartner in dem sehr breit<br />
angelegten Fachgebiet des Visual Computing. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten<br />
die semantischen Technologien, so z.B. bei der Modellierung in Architektur und<br />
Raumplanung wie auch in Geographischen Informationssystemen. Digitale Dokumente<br />
kommen vor allem in Multimedia-Kommunikationen, Audio / Video-<br />
Installationen und CAD-Modellierungen zur Anwendung. Eine weite Verbreitung finden<br />
ebenfalls graphisch-interaktive E-Learning- und E-Business-Applikationen. Bedeutende<br />
Anwendungsfelder liegen auch in der Telemedizin, im Medical Computing<br />
und im Maschinenbau. Der Bereich IT-Sicherheit umfasst etwa die biometrische dreidimensionale<br />
Gesichtserkennung, sichere mobile Systeme wie auch die Inhalts-,<br />
Dokumenten- und Produktsicherheit.<br />
163
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Den Märkten für graphisch basierte IT-Produkte und -Dienstleistungen, die international<br />
stark verflochten sind, bescheinigt der Gesprächspartner eine ausgeprägte Dynamik.<br />
Um angesichts der hohen Wettbewerbsintensität über Innovationen Vorsprünge<br />
erzielen zu können, ist eine an zukunftsträchtigen Entwicklungen orientierte<br />
Forschung und Entwicklung notwendig.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Das Fraunhofer - IGD operiert mit seinen Forschungsaktivitäten sehr nah an den relevanten<br />
Märkten und verfügt über projektbezogene wie auch längerfristig ausgelegte<br />
Kontakte zu zahlreichen Industriepartnern (vgl. Abbildung 26). Zu nennen sind<br />
hier beispielsweise sehr große Anbieter wie Alcatel, BMW, Merck, SAP oder Sony<br />
ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen.<br />
Abbildung 25: Vernetzung des Fachgebietes Graphische Datenverarbeitung am Fraunhofer-Institut IGD in<br />
Darmstadt<br />
Fraunhofer-Institut<br />
für Integrierte<br />
Publikationsund<br />
Informationssysteme<br />
- IPSI<br />
TU Darmstadt<br />
u. a.<br />
Alcatel<br />
Kooperationen mit etwa dreißig<br />
anderen Großforschungseinrichtungen<br />
u. a.<br />
Graphische<br />
Datenverarbeitung<br />
Fraunhofer-Institut<br />
für Betriebsfestigkeit<br />
- LBF<br />
Fraunhofer-Institut<br />
für Rechnerarchitektur<br />
und<br />
Softwaretechnik<br />
- FIRST<br />
Merck<br />
BMW<br />
SAP<br />
Zahlreiche Verbände,<br />
Bildungseinrichtungen,<br />
Transferzentren, Behörden etc.<br />
Sony<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Unter den Auftraggebern finden sich des Weiteren Wissenstransferzentren, Bildungseinrichtungen,<br />
Kliniken, Verbände wie auch öffentliche Ämter und Behörden.<br />
164
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Um die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu stärken und Forschungspotenziale<br />
auszuschöpfen, ist eine industrielle Vorlaufforschung notwendig,<br />
die sich an langfristigen forschungspolitischen Zielen orientiert.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Einen wichtigen Schritt zu einer Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich<br />
Visual Computing am Standort Darmstadt sieht der Gesprächspartner in der geplanten<br />
Zusammenarbeit zwischen dem Fraunhofer IGD und dem Max-Planck-Institut für<br />
Informatik in Saarbrücken. Ein besonderer Schwerpunkt struktureller Veränderungen<br />
sollte auf dem gezielten Ausbau der Grundlagenforschung liegen.<br />
Ein weiteres Anliegen ist dem Gesprächsteilnehmer die Außendarstellung der wissenschaftlichen<br />
Kompetenz, um die Wahrnehmung bei forschungsstrategisch wichtigen<br />
Gutachtern zu verstärken. Über eine gezielte inhaltliche Verankerung der Forschungsleistungen<br />
im wissenschaftlichen Diskurs lässt sich in Verbindung mit günstigen<br />
lokalen Arbeitsbedingungen die Attraktivität des Standortes Darmstadt für<br />
hochqualifizierte Nachwuchswissenschaftler weiter erhöhen.<br />
165
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.7.4 Wireless Communications<br />
Übersicht 26: Kurzprofil des Fachgebietes Wireless Communications an der TU Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Forschungsgegenstände sind beispielsweise Antennengruppen,<br />
Funkkanäle und elektromagnetische Eigenschaften von Materialien.<br />
• In zwei Forschungsfeldern (Smart Antennas und Liquid Crystals)<br />
befindet sich der Lehrstuhl innerhalb des Bundesgebiets in der<br />
Spitzengruppe der betreffenden Forschungseinrichtungen.<br />
Anwendungsbereiche • Stetige Verbreiterung des Anwendungsspektrums für “Smart<br />
Antennas“.<br />
• Sensorische Applikationen, beispielsweise in der Automobilindustrie.<br />
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Metamaterialien, etwa in<br />
Radomen, Phasenschiebern und Wellenleitern.<br />
Technologiefeld • Komponenten und Systeme zur drahtlosen Nachrichtenübertragung.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Beteiligung am DFG-Graduiertenkolleg 1037 „Steuerbare<br />
integrierbare Komponenten der Mikrowellentechnik und Optik“ und<br />
am DFG-Graduiertenkolleg 410 „Physik und Technik von<br />
Beschleunigern“.<br />
• Aufbau des Forschungsnetzwerks “Liquida“, das vom Deutschen<br />
Zentrum für Luft- und Raumfahrt -DLR und dem BMWi gefördert wird.<br />
Beteiligte Partner sind Hereaus, IMST und Merck (einer der<br />
weltweiten Marktführer für Flüssigkristalle) sowie die Bundesanstalt<br />
für Materialforschung und -prüfung.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft:<br />
Allgemeiner Handlungsbedarf<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Vergleichsweise geringe Kenntnisse in mittelständischen<br />
Unternehmen über die Forschungskompetenzen der Hochschulen.<br />
• Günstige Rahmenbedingungen für die technologische Forschung in<br />
<strong>Hessen</strong> aufgund der Kombination leistungsfähiger Hochschulen mit<br />
einem vielfältigen industriellen Branchen-Mix; diese Stärken müssen<br />
kommuniziert werden.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Das Interview wurde mit dem Inhaber des Lehrstuhls für Funkkommunikation am Institut<br />
für Hochfrequenztechnik der TU Darmstadt geführt. Am Institut, das zum<br />
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik gehört, sind zwei weitere Professuren<br />
angesiedelt, und zwar für Höchstfrequenztechnik sowie Optische Nachrichtentechnik.<br />
Hierdurch ist eine enge interdisziplinäre Verbindung zwischen der<br />
Mikrowellenelektronik und der Optik gewährleistet. Das Team am Lehrstuhl für<br />
Funkkommunikation umfasst insgesamt 14 Wissenschaftliche Mitarbeiter, von denen<br />
vier aus Landesmitteln und zehn über Drittmittel finanziert werden. Die techni-<br />
166
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
sche Infrastruktur besteht u.a. aus einem Netzwerkanalysator sowie mehreren<br />
Messgeräten zur Gleichstromanalyse und Rauschanalyse. In den vergangenen drei<br />
Jahren wurden vom gesamten Institut jeweils aggregierte Drittmittel im Umfang von<br />
1 bis 1,4 Mio. Euro eingeworben.<br />
Das Fachgebiet ist sowohl inneruniversitär als auch hochschulübergreifend intensiv<br />
in Forschungs- und Lehrkooperationen eingebunden. So amtiert der Gesprächspartner<br />
als Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs 1037 „Steuerbare integrierbare<br />
Komponenten der Mikrowellentechnik und Optik“, an dem sich insgesamt elf<br />
Wissenschaftler aus den Fachbreichen Elektrotechnik und Informationstechnik, Material-<br />
und Geowissenschaften, Physik sowie Chemie beteiligen. Außerdem engagiert<br />
sich die Arbeitsgruppe im DFG-Graduiertenkolleg 410 „Physik und Technik<br />
von Beschleunigern“, das von insgesamt elf Akteuren getragen wird, die an drei<br />
Instituten der TU Darmstadt, einem Institut der Universität Mainz sowie der Gesellschaft<br />
für Schwerionenforschung - GSI in Darmstadt tätig sind. Nicht zuletzt an den<br />
hier erörterten Kooperationen wird deutlich, dass das Fachgebiet des Gesprächspartners,<br />
das in die Elektrotechnik und Informationstechnik eingebettet ist, deutliche<br />
Berührungspunkte mit der Physik und Chemie, dem Maschinenbau und den Materialwissenschaften<br />
aufweist.<br />
Die Forschungsergebnisse werden regelmäßig auf nationalen und internationalen<br />
Tagungen sowie in begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften und Monographien<br />
publiziert. Der Gesprächspartner engagiert sich ferner als Herausgeber der<br />
wissenschaftlichen Zeitschrift “Frequenz“, einem internationalen Fachmagazin für<br />
Telekommunikation und Radio Frequency-Anwendungen.<br />
Die Forschung am Fachgebiet konzentriert sich auf Komponenten und Systeme<br />
zur drahtlosen Nachrichtenübertragung. Genannt seien als Forschungsgegenstände<br />
beispielsweise Antennengruppen, Funkkanäle und elektromagnetische Eigenschaften<br />
von Materialien. Die wissenschaftlichen Aktivitäten umfassen sieben<br />
inhaltliche Schwerpunkte; im Einzelnen sind dies Channel Modeling, Reflectarrays<br />
und Smart Antennas; weitere Schwerpunkte sind Efficient Handover for<br />
Hybrid Networks, Ferroelectrics, Liquid Crystals und Meta Materials. In zweien<br />
dieser Felder (Smart Antennas und Liquid Crystals) befindet sich der Lehrstuhl innerhalb<br />
des Bundesgebiets in der Spitzengruppe der betreffenden Forschungseinrichtungen.<br />
Weitere bedeutende Arbeitsgruppen befinden sich an der Universität<br />
Duisburg-Essen und der TU München. Im internationalen Kontext sind insbesondere<br />
Forschungsgruppen an der ETH Zürich, der Stanford University und am Georgia Institute<br />
of Technology in Atlanta zu erwähnen.<br />
Der Gesprächspartner bescheinigt dem Fachgebiet der Drahtlosen Kommunikation<br />
ein erhebliches Zukunftspotenzial, und dies gleichermaßen sowohl hinsichtlich der<br />
Hochschulforschung als auch bezüglich der Entwicklung marktfähiger Produkte.<br />
Beispielsweise verbreitert sich das Anwendungsspektrum für “Smart Antennas“<br />
in Kommunikationssystemen fortwährend. Dies gilt analog für sensorische Applikati-<br />
167
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
onen, deren Verbreitung etwa in der Automobilindustrie stetig zunimmt. Im Zuge<br />
technologischer Innovationen vergrößern sich die Einsatzmöglichkeiten für Metamaterialien,<br />
die beispielsweise in Radomen, Phasenschiebern und Wellenleitern zur<br />
Anwendung gelangen.<br />
Vernetzung mit der Wirtschaft / Handlungsbedarfe<br />
Die Kontakte der Arbeitsgruppe zu privatwirtschaftlichen Partnern sind sehr breit<br />
angelegt und tangieren sowohl Industrieunternehmen als auch kleine und mittlere<br />
Unternehmen (vgl. Abbildung 27).<br />
Abbildung 26: Vernetzung des Fachgebietes Wireless Communications an der TU Darmstadt<br />
DFG-GK 1037 „Steuerbare<br />
integrierbare Komponenten der<br />
Mikrowellentechnik und Optik“<br />
Bundesanstalt für<br />
Materialforschung<br />
und -prüfung<br />
u. a.<br />
DFG-GK 410<br />
„Physik und Technik<br />
von Beschleunigern“<br />
u. a.<br />
Wireless<br />
Communications<br />
Heraeus<br />
IMST<br />
Merck<br />
Forschungsnetzwerk „Liquida“<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Im Hinblick auf mittelständische Unternehmen merkt der Gesprächsteilnehmer kritisch<br />
an, dass bei diesen häufig nur vage Vorstellungen von den Forschungskompetenzen<br />
an öffentlichen Hochschulen bestünden. So erreichten ihn häufig Anfragen<br />
von Unternehmensvertretern wegen einzelner Projektideen, jedoch ergäben sich<br />
letztlich nur aus etwa einem Zehntel der geäußerten Ideen konkrete Forschungskooperationen.<br />
Gleichwohl wurden gerade in jüngerer Zeit vielversprechende Kontakte<br />
168
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
zu einigen mittelständischen Unternehmen im Raum Darmstadt geknüpft. Im Rahmen<br />
von Projektstudien wird am Lehrstuhl i.d.R. ein Prototyp entwickelt, die Entwicklung<br />
der Serienreife sowie die Fertigung erfolgen dann beim Industriepartner.<br />
Um die Forschungskooperationen im Segment der Flüssigkristall-Antennen in einen<br />
institutionalisierten Rahmen zu stellen, hat der Gesprächsteilnehmer kürzlich mit<br />
weiteren – öffentlichen und privatwirtschaftlichen – Partnern das Forschungsnetzwerk<br />
“Liquida“ gegründet, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt -<br />
DLR und dem BMWi gefördert wird. Beteiligte Partner sind die Unternehmen Hereaus,<br />
IMST und Merck (einer der weltweiten Marktführer für Flüssigkristalle) sowie<br />
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Ein umfangreiches Potenzial<br />
sehen die beteiligten Akteure insbesondere im Einsatz von Flüssigkristallen in Keramik-Vielschichtkondensatoren.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Grundsätzlich sieht der Gesprächspartner die Rahmenbedingungen für die technologische<br />
Forschung in <strong>Hessen</strong> als günstig an, denn die forschungsstarke hessische<br />
Hochschullandschaft schaffe in Kombination mit einem vielfältigen industriellen<br />
Branchen-Mix ein günstiges Umfeld für Innovationen. Diese Stärken würden bislang<br />
gleichwohl bei den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung zu wenig erkannt.<br />
Schwächen sieht der Gesprächsteilnehmer in der strategischen Ausrichtung, der<br />
konzeptionellen Ausrichtung und der Transparenz der hessischen Forschungspolitik.<br />
Bislang sei es noch nicht in ausreichendem Maße gelungen, Förderkonzepte zu<br />
entwickeln, die zwar einerseits auf die Bedürfnisse der Antragsteller zugeschnitten<br />
seien, jedoch andererseits den Ansprüchen an eine hochkarätige Forschung gerecht<br />
würden. Beispielsweise existierten in Bayern Förderprogramme, in denen –<br />
ähnlich wie bei der DFG – einzelne Projektskizzen einem anspruchsvollen Begutachtungsverfahren<br />
unterzogen würden, bei gleichzeitig nur geringem bürokratischem<br />
Aufwand. In Nordrhein-Westfalen böten sich ähnlich vorteilhafte Rahmenbedingungen.<br />
Als problematisch sieht es der Gesprächspartner zudem an, dass man<br />
in <strong>Hessen</strong> im Bereich der Forschungspolitik zu ausgeprägt modischen Trends folge,<br />
die anderenorts schon überholt seien. Vielmehr gelte es, aktuelle technologische<br />
Entwicklungen schon in Ansätzen zu erkennen und im konkreten Fall auch in der<br />
Forschungspolitik als Innovator vorzupreschen.<br />
169
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
5.7.5 Sicherheitstechnologien<br />
Übersicht 27: Kurzprofil des Fachgebietes Sicherheitstechnologien am Fraunhofer-Institut SIT in Darmstadt<br />
Untersuchungsaspekt<br />
Merkmale / Schlussfolgerungen<br />
Forschungstätigkeit • Aktivitäten am Institut umfassen sowohl die anwendungsnahe<br />
Grundlagenforschung als auch die Erarbeitung von Projektstudien<br />
und die Entwicklung von Prototypen.<br />
Anwendungsbereiche • Absicherung IT-gestützter Prozesse in komplexen Komponenten und<br />
Systemen, u.a. in der Verkehrs- und Logistikbranche, der<br />
Fertigungsindustrie wie auch öffentlichen Einrichtungen.<br />
Technologiefeld • Sechs Forschungsbereiche: Sicherheitsmodellierung und<br />
-validierung, Sichere mobile Systeme, Transaktions- und<br />
Dokumentensicherheit, Sichere Prozesse und Infrastrukturen,<br />
Praktische Systemsicherheit sowie Smart Devices und Embedded<br />
Security.<br />
• Vielfältige Forschungsfragestellungen bezüglich der ubiquitären<br />
Sicherheit.<br />
Kooperationen / Vernetzung • Zahlreiche Beteiligungen an Kooperationsprojekten, beispielsweise<br />
an der DFG-Forschergruppe 733 „QuaP2P - Verbesserung der<br />
Qualität von Peer-to-Peer-Systemen durch die systematische<br />
Erforschung von Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen<br />
Abhängigkeiten“ und dem DFG-Graduiertenkolleg 492 „Infrastruktur<br />
für den elektronischen Markt“.<br />
• Enge Kontakte sowohl zu Großunternehmen wie etwa Fraport,<br />
Lufthansa oder Deutsche Bahn als auch zu kleinen und mittleren<br />
Unternehmen.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine<br />
Handlungsansätze<br />
• Standort Darmstadt im bundesweiten Vergleich ein „Leuchtturm“ im<br />
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien.<br />
Quelle: <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Forschung, Fachgebiet, Kompetenzen<br />
Befragt wurde die Leiterin des Fraunhofer-Instituts SIT in Darmstadt, die in Doppelfunktion<br />
einen Lehrstuhl für das Fachgebiet „Sicherheit in der Informationstechnik“<br />
am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt innehat. Hierdurch sind enge Forschungskontakte<br />
zwischen der Hochschule und dem Fraunhofer SIT gewährleistet.<br />
An der Großforschungseinrichtung sind insgesamt etwa 160 Mitarbeiter tätig, hierunter<br />
60 als Wissenschaftliche Angestellte mit unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen<br />
und 40 Doktoranden.<br />
Im Kontext breit angelegter Aktivitäten gliedert sich das Fraunhofer - SIT in sechs<br />
Forschungsbereiche. Dies sind im Einzelnen Sicherheitsmodellierung und<br />
-validierung, Sichere mobile Systeme, Transaktions- und Dokumentensicherheit,<br />
Sichere Prozesse und Infrastrukturen, Praktische Systemsicherheit sowie<br />
170
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Smart Devices und Embedded Security. Als öffentliche Drittmittelgeber fungieren<br />
u.a. die DFG, das BMWi, das BMG, BMBF und die EU, bei denen – teilweise in Kooperation<br />
mit der TU Darmstadt – sowohl Einzelvorhaben als auch Konsortialprojekte<br />
beantragt werden. Genannt seien exemplarisch die DFG-Forschergruppe 733<br />
„QuaP2P - Verbesserung der Qualität von Peer-to-Peer-Systemen durch die<br />
systematische Erforschung von Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen<br />
Abhängigkeiten“ und das DFG-Graduiertenkolleg 492 „Infrastruktur für<br />
den elektronischen Markt“. Intensive Kontakte bestehen auch zu anderen Fraunhofer-Instituten,<br />
so etwa dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung -<br />
IGD in Darmstadt, dem Fraunhofer-Institut für Software- & Systemtechnik ISST in<br />
Berlin und dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE<br />
in Kaiserslautern.<br />
Die Aktivitäten am Institut umfassen sowohl die anwendungsnahe Grundlagenforschung<br />
als auch die Erarbeitung von Projektstudien und die Entwicklung von<br />
Prototypen. Die wissenschaftlichen Arbeiten beziehen sich vornehmlich auf die Absicherung<br />
IT-gestützter Prozesse in komplexen Komponenten und Systemen. Im<br />
Bereich der Verkehrssicherheit betrifft dies etwa Infrastrukturträger wie Flughäfen<br />
oder Bahnhöfe ebenso wie Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrsnetze. Bedeutende<br />
Anwendungsfelder liegen ferner in der Sicherung öffentlicher Einrichtungen wie<br />
auch privatwirtschaftlicher Bürokomplexe und Produktionsanlagen.<br />
Hinsichtlich anwendungsnaher IT-Architekturen beziehen sich zahlreiche Forschungsfragestellungen<br />
auf die ubiquitäre Sicherheit, so etwa hinsichtlich der Unversehrtheit<br />
des “Content“ bei EDV-Anwendungen. Dies gilt generell für die Administration,<br />
das Personalwesen und das Controlling in der öffentlichen Verwaltung<br />
(E-Government) wie auch nahezu sämtlichen Branchen, ferner im Speziellen etwa<br />
für Zahlungs- und Produktströme im Groß- und Einzelhandel (E-Commerce) oder<br />
den Zahlungsverkehr in Bank- und Versicherungsunternehmen (E-Finance). Erwähnt<br />
sei auch die Betriebssicherheit in Energieversorgungsunternehmen und im<br />
Gesundheitswesen.<br />
In Zukunft werden nach Einschätzung der Gesprächspartnerin sicherheitsrelevante<br />
Fragestellungen erheblich an Bedeutung gewinnen, was sich vor allem aus<br />
den Begleiterscheinungen der Internationalisierung bzw. Globalisierung erklärt. Dies<br />
gilt vor allem für die ständig zunehmenden Geld- und Warenströme im Rahmen der<br />
internationalen Handels- und Finanzverflechtungen. Weitere bedeutende Anwendungsbereiche<br />
sind die innere und die äußere Sicherheit, so etwa in den Bereichen<br />
der Verbrechensbekämpfung und Terrorabwehr. In diesem Zusammenhang bildet<br />
nicht zuletzt die Militärtechnologie ein äußerst relevantes Feld. Wichtige Wachstumsmärkte<br />
befinden sich sowohl in Industrieländern – hierunter insbesondere in<br />
Japan, im Vereinigten Königreich und den USA – als auch in aufstrebenden Schwellenländern<br />
und Entwicklungsländern, so etwa im arabischen Raum.<br />
171
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Handlungsbedarfe Vernetzung mit der Wirtschaft<br />
Für Industrieunternehmen und öffentliche Institutionen offeriert das Fraunhofer SIT<br />
vielseitige Dienstleistungen (vgl. Abbildung 28). Die Angebotspalette beinhaltet die<br />
Entwicklung von Systemlösungen, Prozessen und Geschäftsmodellen ebenso<br />
wie die Verbesserung von Produkten. Ferner betätigt sich das Fraunhofer SIT intensiv<br />
im Weiterbildungswesen und in der Lizensierung von Sicherheitswerkzeugen.<br />
Ein wichtiges Kompetenzfeld bilden Überprüfungen der Software- und<br />
Hardware-Sicherheit, so beispielsweise über Schwachstellenanalysen und die<br />
Entwicklung von Testszenarien.<br />
Abbildung 27: Vernetzung des Fachgebietes Sicherheitstechnologien am Fraunhofer-Institut SIT<br />
in Darmstadt<br />
u. a.<br />
DFG-FG 733<br />
„QuaP2P – Verbesserung der<br />
Qualität von Peer-to-Peer-Systemen<br />
durch die Systematische Erforschung von<br />
Qualitätsmerkmalen und deren wechselseitigen<br />
Abhängigkeiten“<br />
Uniklinikum<br />
Heidelberg<br />
DFG-492 „Infrastruktur<br />
für den<br />
elektronischen<br />
Markt“<br />
u. a.<br />
Sicherheitstechnologien<br />
DLR<br />
Fraunhofer-<br />
Institut für<br />
Graphische<br />
Datenverarbeitung<br />
- IGD<br />
Fraport<br />
FlexSecure<br />
T-Systems<br />
MediaSec Technologies<br />
Philips Semiconductors<br />
Deutsche Bahn<br />
Überwiegende Ausprägung des Kooperationspartners / Netzwerkes<br />
öffentlich<br />
privatwirtschaftlich<br />
Quelle: Darstellung der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.<br />
Die Außendarstellung des Instituts erfolgt u.a. über eine intensive Präsenz auf Messen<br />
(bspw. CEBIT oder Medizintechnik-Messen) und Fachkonferenzen, die auch<br />
der Anbahnung von Forschungs- bzw. Geschäftskontakten dienen. Im Blickfeld stehen<br />
sowohl Großunternehmen wie etwa T-Systems, Fraport, die Lufthansa und die<br />
172
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Deutsche Bahn als auch kleine und mittlere Unternehmen wie etwa MediaSec<br />
Technologies und FlexSecure. Gerade in Kooperation mit der im Rhein-Main-Gebiet<br />
sehr umfangreich vertretenen Verkehrs- und Logistikbranche ergeben sich vielfältige<br />
sicherheitsbezogene Forschungsfragestellungen und Produktideen.<br />
Rahmenbedingungen / Allgemeine Handlungsansätze<br />
Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien sieht die Gesprächspartnerin<br />
den Standort Darmstadt im bundesweiten Vergleich als einen<br />
„Leuchtturm“ an. Dies begründet sich vor allem in einer in Deutschland nahezu einzigartigen<br />
fachbezogenen Agglomeration aus Hochschulinstitutionen und Großforschungseinrichtungen,<br />
die in eine gleichermaßen technologieorientierten und wie<br />
auch dienstleistungsbezogenen Branchenstruktur eingebettet ist. An diese Expertise<br />
sollte bei einer weiteren Stärkung und Profilierung der hessischen Forschungslandschaft<br />
angeknüpft werden.<br />
173
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung<br />
Seite<br />
1 Fachliche Bezüge zwischen den untersuchten Technologiefeldern 17<br />
2 Vernetzung des Fachgebietes Energie- und Kraftwerkstechnik<br />
an der TU Darmstadt 38<br />
3 Vernetzung des Fachgebietes Brennstoffzellentechnik an der<br />
FH Wiesbaden 43<br />
4 Vernetzung des Fachgebietes Thermische Verfahrenstechnik an der TU<br />
Darmstadt 49<br />
5 Vernetzung des Fachgebietes des Fachgebietes Regenerative<br />
Energietechnologien / Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie,<br />
Wasserkraft und Meeresenergie am ISET in Kassel 53<br />
6 Vernetzung des Fachgebietes Solarthermie an der Universität Kassel 59<br />
7 Vernetzung des Fachgebietes Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
an der Universität Gießen 65<br />
8 Vernetzung des Fachgebietes Abwassertechnik / Wasserwirtschaft<br />
an der TU Darmstadt 71<br />
9 Vernetzung des Fachgebietes Medizintechnik an der<br />
FH Gießen Friedberg 77<br />
10 Vernetzung des Fachgebietes Bionik an der TU Darmstadt 83<br />
11 Vernetzung des Fachgebietes Klinische Chemie und Molekulare<br />
Diagnostik an der Universität Marburg 89<br />
12 Vernetzung des Fachgebietes Pharmazeutische Biologie an der<br />
Universität Frankfurt 95<br />
13 Vernetzung des Fachgebietes Landnutzung / Ressourcenmanagement<br />
an der Universität Gießen 101<br />
14 Vernetzung des Fachgebietes Biokatalyse und Biofermentation<br />
an der TU Darmstadt 105<br />
15 Vernetzung des Fachgebietes Lebensmitteltechnologie der Hochschule<br />
Fulda 115<br />
16 Vernetzung des Fachgebietes Mechatronik / Regelungstechnik<br />
an der TU Darmstadt 121<br />
17 Vernetzung des Fachgebietes Umformtechnik an der Universität Kassel 124<br />
18 Vernetzung des Fachgebietes Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
an der TU Darmstadt 130<br />
19 Vernetzung des Fachgebietes Adaptronik am Fraunhofer-Institut LBF<br />
in Darmstadt 135<br />
20 Vernetzung des Fachgebietes Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
an der TU Darmstadt 140<br />
174
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
21 Vernetzung des Fachgebietes Materialwissenschaften /<br />
Oberflächenforschung an der TU Darmstadt 145<br />
22 Vernetzung des Fachgebietes Materialwissenschaften / Strukturforschung<br />
an der Universität Marburg 149<br />
23 Vernetzung des Fachgebietes Multimedia Kommunikation an der<br />
TU Darmstadt 153<br />
24 Vernetzung des Fachgebietes Wirtschaftsinformatik / E-Finance<br />
an der Universität Frankfurt 159<br />
25 Vernetzung des Fachgebietes Graphische Datenverarbeitung am<br />
Fraunhofer-Institut IGD in Darmstadt 164<br />
26 Vernetzung des Fachgebietes Wireless Communications an der TU<br />
Darmstadt 168<br />
27 Vernetzung des Fachgebietes Sicherheitstechnologien am<br />
Fraunhofer-Institut SIT in Darmstadt 172<br />
175
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle<br />
Seite<br />
1 Die im Rahmen der Untersuchung ausgewählten Technologiefelder 16<br />
2 Fachliche und institutionelle Zuordnung der Gesprächspartner 19<br />
3 Wissenschaftliches Personal an den hessischen Universitäten 2003 21<br />
4 Studenten in ausgewählten Studienfächern an hessischen Hochschulen,<br />
Wintersemester 2006 / 07 22<br />
5 Studenten an den hessischen Universitäten in ausgewählten Studiengängen<br />
im Sommersemester 2006 24<br />
6 Von den hessischen Universitäten eingeworbene Drittmittel 25<br />
7 Struktur der eingeworbenen Drittmittel im Hinblick auf die DFG-Fachgebiete<br />
27<br />
8 Publikationen an den hessischen Universitäten 2002 bis 2004 28<br />
9 Erfindungen und Patente an den hessischen Universitäten 29<br />
10 Promotionen an den hessischen Universitäten 30<br />
11 Erfolgreich abgeschlossene Habilitationen an den hessischen<br />
Universitäten 2004 32<br />
176
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Übersichtsverzeichnis<br />
Übersicht<br />
Seite<br />
1 Kurzprofil des Fachgebietes Konventionelle Energietechnologien /<br />
Kraftwerkstechnik 35<br />
2 Kurzprofil des Fachgebietes Brennstoffzellentechnik an der FH Wiesbaden 40<br />
3 Kurzprofil des Fachgebietes Thermische Verfahrenstechnik 46<br />
4 Kurzprofil des Fachgebietes Regenerative Energietechnologien / Windenergie,<br />
Photovoltaik, Bioenergie, Wasserkraft und Meeresenergie am ISET in Kassel 50<br />
5 Kurzprofil des Fachgebietes Solarthermie an der Universität Kassel 56<br />
6 Kurzprofil des Fachgebietes Abfalltechnologie / Ressourcenmanagement<br />
an der Universität Gießen 62<br />
7 Kurzprofil des Fachgebietes Abwassertechnik / Wasserwirtschaft an der<br />
TU Darmstadt 68<br />
8 Kurzprofil des Fachgebietes Medizintechnik an der FH Gießen-Friedberg 74<br />
9 Kurzprofil des Fachgebietes Bionik an der TU Darmstadt 80<br />
10 Kurzprofil des Fachgebietes Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik<br />
an der Universität Marburg 86<br />
11 Kurzprofil des Fachgebietes Pharmazeutische Biologie an der<br />
Universität Frankfurt 92<br />
12 Kurzprofil des Fachgebietes Landnutzung / Ressourcenmanagement<br />
an der Universität Gießen 98<br />
13 Kurzprofil des Fachgebietes Biokatalyse und Biofermentation an der<br />
TU Darmstadt 102<br />
14 Kurzprofil des Fachgebietes Ernährungsphysiologie an der<br />
Universität Gießen 108<br />
15 Kurzprofil des Fachgebietes Lebensmitteltechnologie an der<br />
Hochschule Fulda 112<br />
16 Kurzprofil des Fachgebietes Mechatronik / Regelungstechnik an der<br />
TU Darmstadt 118<br />
17 Kurzprofil des Fachgebietes Umformtechnik an der Universität Kassel 122<br />
18 Kurzprofil des Fachgebietes Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
an der TU Darmstadt 128<br />
19 Kurzprofil des Fachgebietes Adaptronik am Fraunhofer-Institut LBF<br />
in Darmstadt 132<br />
20 Kurzprofil des Fachgebietes Produktentwicklung / Konstruktionsforschung<br />
an der TU Darmstadt 138<br />
21 Kurzprofil des Fachgebietes Materialwissenschaften / Oberflächenforschung<br />
an der TU Darmstadt 142<br />
177
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
22 Kurzprofil des Fachgebietes Materialwissenschaften / Strukturforschung<br />
an der Universität Marburg 146<br />
23 Kurzprofil des Fachgebietes Multimedia Kommunikation an der<br />
TU Darmstadt 150<br />
24 Kurzprofil des Fachgebietes Wirtschaftsinformatik / E-Finance an der<br />
Universität Frankfurt 156<br />
25 Kurzprofil des Fachgebietes Graphische Datenverarbeitung am Fraunhofer-<br />
Institut IGD in Darmstadt 162<br />
26 Kurzprofil des Fachgebietes Wireless Communications an der<br />
TU Darmstadt 166<br />
27 Kurzprofil des Fachgebietes Sicherheitstechnologien am Fraunhofer-Institut<br />
SIT in Darmstadt 170<br />
178
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Literaturverzeichnis<br />
Brenner, O. (2007), Export und Zulassung von Medizintechnikprodukten für den<br />
osteuropäischen Markt. In: mt – medizintechnik, Nr.1/07, S. 21-23.<br />
CHE - Centrum für Hochschulentwicklung (2006). CHE- ForschungsRanking 2006.<br />
Arbeitspapier Nr. 79, Bonn.<br />
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006), Förder-Ranking 2006. Bonn.<br />
Hessisches Statistisches Landesamt (2006), Personal und Habilitationen an Hochschulen<br />
in <strong>Hessen</strong> 2004.<br />
Hessisches Statistisches Landesamt (2007), Studierende und Gasthörer an den<br />
Hochschulen in <strong>Hessen</strong> im Wintersemester 2006/2007.<br />
Krüger-Roth, D., F. Torns, M. Böss, A. Heumann und C. Junkersfeld ( 2006), Wissensatlas<br />
FrankfurtRheinMain. Herausgegeben von: Planungsverband Ballungsraum<br />
Frankfurt / Rhein-Main, IHK Forum Rhein-Main, Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain<br />
und INM - Institut für neue Medien. Frankfurt a.M.<br />
Perlitz, U. (2004), Rote Biotechnologie in Deutschland: Den Kinderschuhen noch<br />
nicht entwachsen. In: Deutsche Bank Research, Aktuelle Themen, Nr. 305. Frankfurt<br />
a.M.<br />
Perlitz, U. (2007), Weiße Biotechnologie: Schlummerndes Potenzial wird geweckt.<br />
In: Deutsche Bank Research, Aktuelle Themen, Nr. 376. Frankfurt a.M.<br />
Perlitz, U. (2004), Grüne Biotechnologie: Weg aus der Sackgasse in Europa gesucht.<br />
In: Deutsche Bank Research, Aktuelle Themen, Nr. 287. Frankfurt a.M.<br />
Rieping, M., A. Stein, C. Ott und D. Dittrich (2006), Kompetenzatlas Brennstoffzelle<br />
<strong>Hessen</strong>. Herausgegeben von: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und<br />
Landesentwicklung, <strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong>, Wiesbaden.<br />
Schedding-Kleis, U. (2006), Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge in<br />
<strong>Hessen</strong>. In: Staat und Wirtschaft in <strong>Hessen</strong>, 61. Jahrgang, Heft Nr. 10, S. 247-254.<br />
179
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
180
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Anhang<br />
181
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Liste der Gesprächspartner<br />
Fachgebiet Gesprächspartner Institution<br />
Energietechnologien<br />
Konventionelle Energietechnologien / Kraftwerkstechnik<br />
Prof. Dr.-Ing. Johannes Janicka TU Darmstadt<br />
Brennstoffzellentechnologie Prof. Dr. Birgit Scheppat FH Wiesbaden<br />
Thermische Verfahrenstechnik Prof. Dr.-Ing. Manfred J. Hampe TU Darmstadt<br />
Erneuerbare Energien / u.a. Windenergie,<br />
Photovoltaik, Bioenergie<br />
Dr. Oliver Führer<br />
Dipl.-Ing. Uwe Krengel<br />
Prof. Dr.-Ing. Peter Zacharias<br />
ISET, Kassel<br />
ISET, Kassel<br />
ISET, Kassel<br />
Solarthermie Prof. Dr. Klaus Vajen Universität Kassel<br />
Umwelttechnologien<br />
Abfalltechnologie /<br />
Ressourcenmanagement Prof. Dr. Stefan Gäth Universität Gießen<br />
Abwassertechnik / Wasserwirtschaft Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel TU Darmstadt<br />
Medizintechnik Prof. Dr. Martin Fiebich FH Gießen-Friedberg<br />
Life Sciences<br />
Bionik Dr. Hendrik Bargel TU Darmstadt<br />
Rote Biotechnologie: Klinische Chemie und<br />
Molekulare Diagnostik Prof. Dr. med. Harald Renz Universität Marburg<br />
Rote Biotechnologie: Pharmazeutische Biologie<br />
Prof. Dr. Theodor Dingermann Universität Frankfurt<br />
Grüne Biotechnologie: Landnutzung / Ressourcenmanagement<br />
Prof. Dr. Hans-Georg Frede Universität Gießen<br />
Weiße Biotechnologie: Biokatalyse und<br />
Biofermentation Prof. Dr. Wolf-Dieter Fessner TU Darmstadt<br />
Ernährungsphysiologie Prof. Dr. Clemens Kunz Universität Gießen<br />
Produktionstechnologien<br />
Lebensmitteltechnologie Prof. Dr. Günter Esper Hochschule Fulda<br />
Mechatronik / Regelungstechnik Prof. Dr.-Ing. Ulrich Konigorski TU Darmstadt<br />
Umformtechnik Prof. Dr.-Ing. habil. Kurt Steinhoff Universität Kassel<br />
Spanende Formung / Hochgeschwindigkeitsbearbeitung<br />
Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele TU Darmstadt<br />
Adaptronik Prof. Dr. Holger Hanselka LBF Fraunhofer, Darmstadt<br />
Produktentwicklung Prof. Dr. h.c. Dr.-Ing. Herbert Birkhofer TU Darmstadt<br />
Materialwissenschaften<br />
Oberflächenforschung Prof. Dr. Wolfram Jaegermann TU Darmstadt<br />
Strukturforschung Prof. Dr. Bernd Harbrecht Universität Marburg<br />
Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
Multimedia Kommunikation Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmetz TU Darmstadt<br />
E-Finance<br />
Prof. Dr. Wolfgang König<br />
Dr. Roman Beck<br />
Universität Frankfurt<br />
Universität Frankfurt<br />
Graphische Datenverarbeitung Prof. Dr. techn. Dieter W. Fellner Fraunhofer IGD, Darmstadt<br />
Wireless Communications Prof. Dr.-Ing. Rolf Jakoby TU Darmstadt<br />
Sicherheitstechnologien Prof. Dr. habil. Claudia Eckert Fraunhofer SIT, Darmstadt<br />
182
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
Gesprächsleitfaden<br />
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale in <strong>Hessen</strong><br />
Gesprächspartner:………………………………………………………………………..……<br />
Forschungsinstitution / Unternehmen: …………………………………………….…..……<br />
Technologiefeld: …………………………………………………………………………..…..<br />
Datum: ……………………………………………………………………………………….…<br />
Gesprächseinleitung (Hintergrund und Zielsetzung der Untersuchung)<br />
Forschungsinstitution / Unternehmen<br />
Skizzenhafte Darstellung<br />
der Forschungsinstitution<br />
Einordnung in die Hochschule<br />
bzw. in die (außeruniversitäre)<br />
Einrichtung<br />
Anzahl und Qualifikationsprofil<br />
der Mitarbeiter<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
Forschungstätigkeit<br />
Schwerpunkte der Forschungstätigkeit<br />
(Grundlagenforschung<br />
/ angewandte<br />
Forschung, Bedeutung der<br />
Auftragsforschung)<br />
Einwerbung von Drittmitteln<br />
(Umfang, Förderinstitutionen)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
Anwendungsbereiche bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse<br />
Gegenwärtige Anwendungsbereiche<br />
Für die Zukunft zu erwartende<br />
Anwendungsbereiche<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
183
Wissenschaftsorientierte Clusterpotenziale<br />
Spezielle Charakteristika<br />
des Transfers zwischen<br />
Forschung und Produktentwicklung<br />
/ Fertigung<br />
•<br />
•<br />
…<br />
Technologiefeld<br />
Generelle fachliche Trends<br />
und Entwicklungspotenziale,<br />
spezifische Trends und<br />
Schwerpunkte in <strong>Hessen</strong><br />
Spezifische Trends international<br />
/ in ausgewählten<br />
Ländern; Einordnung der<br />
hessischen Aktivitäten<br />
Spezifische Trends im Bundesgebiet<br />
und anderen<br />
Bundesländern; Einordnung<br />
der hessischen Aktivitäten<br />
Nähe zu anderen Technologiefeldern<br />
Außendarstellung, Kommunikation,<br />
internationale Kontakte<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
…<br />
Kooperationen / Vernetzung mit der Wirtschaft im Technologiefeld<br />
Bestehende Ansätze der<br />
Kooperation („wer kooperiert<br />
mit wem“)<br />
Ausgestaltung der Kooperationen,<br />
institutioneller Rahmen<br />
(Netzwerke / Einzelakteure,<br />
Sonderforschungsbereiche<br />
/ Graduiertenkollegs)<br />
Kooperationen mit Partnern<br />
aus der Industrie (gegebenenfalls<br />
Defizite)<br />
Internationale Aspekte<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
184
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong> – Standortentwicklung –<br />
…<br />
Fazit<br />
Vordringliche Probleme<br />
Gezielter Handlungsbedarf<br />
Einschätzung der Gesamtsituation<br />
(u.a. offene Frage:<br />
„Welche Empfehlungen<br />
hätten Sie…?“)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
•<br />
•<br />
•<br />
…<br />
185