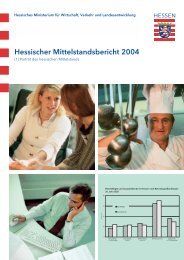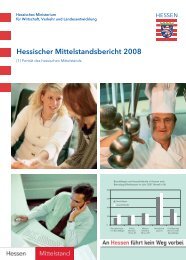Interkommunale Kooperation in Hessen - Opus
Interkommunale Kooperation in Hessen - Opus
Interkommunale Kooperation in Hessen - Opus
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative<br />
Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong><br />
U1
Herausgeber:<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
des Innern und für Sport<br />
Hessisches Kultusm<strong>in</strong>isterium<br />
Hessisches Sozialm<strong>in</strong>isterium<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Umwelt,<br />
ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
Bearbeitung:<br />
<strong>Hessen</strong>Agentur<br />
HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
1<br />
1
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Vorwort<br />
Während früher vielfach Kirchturmdenken das kommunalpolitische Handeln bestimmte,<br />
wird <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit heute zunehmend als Chance begriffen.<br />
Diese Zusammenarbeit wird auch zukünftig weiter an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen.<br />
H<strong>in</strong>tergrund hierfür ist der demographische und wirtschaftsstrukturelle Wandel, der<br />
die Entwicklungsmöglichkeiten e<strong>in</strong>zelner Kommunen e<strong>in</strong>zuschränken droht und<br />
damit e<strong>in</strong>e Reaktion auf die sich verändernde Bevölkerungsstruktur erforderlich<br />
macht. <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> eröffnet hierbei neue Gestaltungsspielräume,<br />
<strong>in</strong>dem etwa Entwicklungspotenziale s<strong>in</strong>nvoll gebündelt und Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />
geme<strong>in</strong>sam unterhalten werden können.<br />
Das Land unterstützt die Zusammenarbeit von Städten, Geme<strong>in</strong>den und Landkreisen<br />
im Rahmen unterschiedlicher Politikbereiche und Förderprogramme. Die besondere<br />
Bedeutung der <strong>in</strong>terkommunalen <strong>Kooperation</strong> für die Kommunalentwicklung unter<br />
veränderten Vorzeichen kommt <strong>in</strong>sbesondere beim Förderprogramm Stadtumbau<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> zum Tragen. Geme<strong>in</strong>deübergreifende Zusammenarbeit stellt hier e<strong>in</strong>en<br />
Schwerpunkt des Programms dar. Dies bedeutet, dass <strong>in</strong>terkommunale Stadtumbaustrategien,<br />
also die geme<strong>in</strong>same Planung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen<br />
im Rahmen <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>sstrukturen, ausdrücklich<br />
erwünscht ist.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Dieser Ansatz ist bei Städten und Geme<strong>in</strong>den auf breite Resonanz gestoßen.<br />
E<strong>in</strong>e große Zahl <strong>in</strong>terkommunaler Gruppen hat sich um die Aufnahme <strong>in</strong> das Förderprogramm<br />
beworben und damit e<strong>in</strong>drucksvoll die Bereitschaft zur <strong>Kooperation</strong><br />
unter Beweis gestellt. Von diesen wurden aktuell 14 <strong>in</strong>terkommunale Gruppen<br />
mit 63 beteiligten Kommunen <strong>in</strong> das Förderprogramm aufgenommen und erhalten<br />
jetzt die Gelegenheit, ihre <strong>in</strong>terkommunalen Stadtumbaustrategien weiterzuentwickeln<br />
und umzusetzen.<br />
Die vorliegende Veröffentlichung wurde durch e<strong>in</strong>e ressortübergreifende Arbeitsgruppe<br />
unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände begleitet. Sie soll Mut<br />
machen, den von e<strong>in</strong>er Reihe hessischer Städte und Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>geschlagenen<br />
Weg e<strong>in</strong>er verstärkten Zusammenarbeit aufzugreifen und mitzugestalten. Die im<br />
Bericht dargestellten <strong>Kooperation</strong>sbeispiele sollen Anregungen für eigene Projekte<br />
geben. Mit den identifizierten Erfolgsfaktoren e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit<br />
erhalten kooperations<strong>in</strong>teressierte Kommunen darüber h<strong>in</strong>aus die Möglichkeit,<br />
von den Erfahrungen der aufgeführten Beispiele zu lernen.<br />
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> im Kontext des demographischen und wirtschaftsstrukturellen<br />
Wandels ist für vielfältige kommunale Handlungsfelder e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Schlüsselstrategie und bedarf e<strong>in</strong>er breit getragenen Initiative. Die Landesregierung<br />
wird die hessischen Kommunen auch zukünftig aktiv bei der Weiterentwicklung<br />
<strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit unterstützen.<br />
Dr. Alois Rhiel<br />
Hessischer M<strong>in</strong>ister für Wirtschaft,<br />
Verkehr und Landesentwicklung
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Inhalt<br />
Vorwort 2<br />
1 Zukunftsaufgabe <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> 6<br />
1.1 Aktuelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen der Kommunalentwicklung 6<br />
1.2 Auswirkungen auf Städte und Geme<strong>in</strong>den 8<br />
1.3 Neue Spielräume durch Zusammenarbeit 13<br />
1.4 Förderung <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> durch die Landespolitik 14<br />
2 Akteure und Organisationsformen <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> 16<br />
Inhalt<br />
4<br />
2.1 Akteure 16<br />
2.2 Organisationsformen 17<br />
2.2.1 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und rechtliche Basis 17<br />
2.2.2 Kurzbeschreibung ausgewählter Organisationsformen 18<br />
Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft 18<br />
Zweckverband 19<br />
Planungsverband 19<br />
Öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung 19<br />
Anstalt des öffentlichen Rechts 20<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 20<br />
Stiftung 21<br />
E<strong>in</strong>getragener Vere<strong>in</strong> (e.V.) 21<br />
Projektbeiräte 22<br />
Runde Tische/Gesprächsforen 22<br />
Koord<strong>in</strong>ierungsbüros 22<br />
3 <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Stand und Perspektive 23<br />
3.1 Datengrundlage und Fragestellung 23<br />
3.2 Umfrageergebnisse 24<br />
4 Gute Beispiele <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> 30<br />
4.1 Auswahl 30<br />
4.2 Gute Beispiele 32<br />
4.2.1 Handlungsfeld: Siedlungs- und Freiflächen 32<br />
<strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal 32<br />
Zweckverband Raum Kassel 36<br />
Teilprojekt: E<strong>in</strong>zelhandelskonzept für die Stadtregion Kassel 36<br />
Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler 39<br />
Teilprojekt: Wohnungsmarktkooperation 39
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
4.2.2 Handlungsfeld: Lokale Wirtschaft 46<br />
Virtuelles Gründerzentrum <strong>in</strong> der Schwalm 46<br />
Innovationsregion Mitte 51<br />
4.2.3 Handlungsfeld: Soziale Infrastruktur 55<br />
Regionalforum Fulda Südwest 55<br />
Teilprojekt: Geme<strong>in</strong>deübergreifende Jugendarbeit 55<br />
Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Hofheim-Kelkheim 60<br />
4.2.4 Verwaltung 63<br />
Zweckverband „Kommunale Dienste Immenhausen-Espenau“ 63<br />
4.2.5 Themenübergreifende <strong>Kooperation</strong> 68<br />
Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“ 68<br />
5 Fazit: Erfolgsfaktoren <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> 73<br />
5.1 Grundpr<strong>in</strong>zipien der Zusammenarbeit 73<br />
5.2 E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Akteuren und Partnern 74<br />
5.3 Zusammenarbeit als Prozess 77<br />
5.4 F<strong>in</strong>anzierung 79<br />
6 Empfehlungen zur weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit 82<br />
Quellenverzeichnis 84<br />
Inhalt<br />
5<br />
Verzeichnis von Infoboxen, Abbildungen und Tabellen 85<br />
Impressum 86<br />
Bestellh<strong>in</strong>weis 87
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
1 Zukunftsaufgabe <strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
1.1 Aktuelle Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Kommunalentwicklung<br />
Die derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die Entwicklung<br />
von Städten und Geme<strong>in</strong>den unterliegen e<strong>in</strong>em grundlegenden Paradigmenwechsel.<br />
Während <strong>in</strong> der Vergangenheit stets Wachstum – von Bevölkerung und<br />
Wirtschaft – treibende Kraft der Kommunalentwicklung war, sehen sich Städte<br />
und Geme<strong>in</strong>den durch den demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel<br />
heute Stagnation beziehungsweise Schrumpfungsprozessen ausgesetzt.<br />
■ Demographischer Wandel: Mengenphänomen<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
6<br />
Der demographische Wandel <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> ist gekennzeichnet durch e<strong>in</strong>en langfristig zu<br />
erwartenden Bevölkerungsrückgang. Bis zum Jahr 2020 wird von e<strong>in</strong>er stagnierenden<br />
E<strong>in</strong>wohnerzahl, bis zum Jahr 2050 von e<strong>in</strong>em Bevölkerungsrückgang um etwa<br />
10 % (bezogen auf 2002) ausgegangen.<br />
Die Bevölkerungsentwicklung verläuft dabei <strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>nerregional gesehen<br />
höchst unterschiedlich. Während für die meisten Landkreise Nord- und Mittelhessens<br />
bis 2020 bereits e<strong>in</strong> Rückgang der Bevölkerung erwartet wird, ist für die<br />
Landkreise <strong>in</strong> Südhessen bis 2020 vorwiegend von e<strong>in</strong>er Stagnation oder leichtem<br />
Bevölkerungswachstum auszugehen. Ursache hierfür s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>terregionale Wanderungsgew<strong>in</strong>ne,<br />
die <strong>in</strong>sbesondere auf das differenzierte Arbeitsplatzangebot <strong>in</strong> der<br />
Region zurückgeführt werden. Zeitverzögert, bis zum Jahr 2050, s<strong>in</strong>d auch <strong>in</strong> Teilen<br />
Südhessens Bevölkerungsverluste zu erwarten.<br />
■ Demographischer Wandel: Strukturphänomen<br />
Die Veränderung der Altersstruktur <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> folgt weniger klaren räumlichen<br />
Mustern. Grundsätzlich ist <strong>in</strong> allen Landkreisen und kreisfreien Städten <strong>Hessen</strong>s e<strong>in</strong><br />
deutlicher Anstieg des Altersquotienten (Personen über 65 Jahre) vorhersehbar.<br />
Ebenso ist für weite Teile <strong>Hessen</strong>s von e<strong>in</strong>er Zunahme des Bevölkerungsanteils mit<br />
Migrationsh<strong>in</strong>tergrund auszugehen.<br />
Presseecho
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Abbildung 1<br />
Bevölkerungsveränderungen <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> von 2002 bis 2020 und 2050<br />
2020 2050<br />
Wetteraukreis<br />
Lahn-<br />
Dill-<br />
Kreis<br />
LK<br />
Limburg-<br />
Weilburg<br />
Darmstadt<br />
Hochtaunus-<br />
Rhe<strong>in</strong>gau- kreis<br />
Taunus-<br />
Ma<strong>in</strong>- Frankfurt a.M.<br />
Kreis<br />
Wiesbaden<br />
Kreis LK<br />
Taunus- Offenbach<br />
Offenbach<br />
LK<br />
Groß-<br />
Gerau<br />
LK<br />
Marburg-<br />
Biedenkopf<br />
LK<br />
Bergstraße<br />
LK<br />
Gießen<br />
Quelle: van den Busch (2004)<br />
Odenwaldkreis<br />
LK<br />
Darmstadt-<br />
Dieburg<br />
LK<br />
Kassel<br />
Kassel<br />
Schwalm-<br />
Eder-<br />
Kreis<br />
Vogelsbergkreis<br />
Ma<strong>in</strong>-<br />
K<strong>in</strong>zig-<br />
Kreis<br />
Werra-<br />
Meißner-<br />
Kreis<br />
LK<br />
Hersfeld-<br />
Rotenburg<br />
LK<br />
Fulda<br />
Wetteraukreis<br />
Lahn-<br />
Dill-<br />
Kreis<br />
LK<br />
Limburg-<br />
Weilburg<br />
Darmstadt<br />
Hochtaunus-<br />
LK<br />
Groß-<br />
Gerau<br />
LK<br />
Marburg-<br />
Biedenkopf<br />
LK<br />
Waldeck-<br />
Frankenberg<br />
Rhe<strong>in</strong>gau- kreis<br />
Taunus-<br />
Ma<strong>in</strong>- Frankfurt a.M.<br />
Kreis<br />
Wiesbaden<br />
Kreis LK<br />
Taunus- Offenbach<br />
Offenbach<br />
LK<br />
Bergstraße<br />
LK<br />
Waldeck-<br />
Frankenberg<br />
LK<br />
Gießen<br />
Odenwaldkreis<br />
LK<br />
Darmstadt-<br />
Dieburg<br />
LK<br />
Kassel<br />
Kassel<br />
Schwalm-<br />
Eder-<br />
Kreis<br />
Vogelsbergkreis<br />
Ma<strong>in</strong>-<br />
K<strong>in</strong>zig-<br />
Kreis<br />
Werra-<br />
Meißner-<br />
Kreis<br />
LK<br />
Hersfeld-<br />
Rotenburg<br />
LK<br />
Fulda<br />
5 bis 15<br />
0 bis 5<br />
-5 bis 0<br />
-10 bis -5<br />
-20 bis -10<br />
-50 bis -20<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
7<br />
Damit wird deutlich, dass auch diejenigen Städte und Geme<strong>in</strong>den, die zunächst<br />
nicht von E<strong>in</strong>wohnerverlusten betroffen s<strong>in</strong>d, sich den Herausforderungen e<strong>in</strong>er<br />
älteren und „bunteren“ Bevölkerungsstruktur stellen müssen. Wichtige Ansätze im<br />
Umgang mit diesen Herausforderungen s<strong>in</strong>d beispielsweise e<strong>in</strong>e Anpassung der<br />
gebauten Umwelt an die Bedürfnisse e<strong>in</strong>er älteren Bevölkerung und die Verstärkung<br />
der Integrationsbemühungen.<br />
■ Wirtschaftsstruktureller Wandel<br />
Globalisierung, technologische Innovationen und veränderte Verteilungsstrukturen<br />
für Waren und Dienstleistungen s<strong>in</strong>d wesentliche Ursachen für den wirtschaftsstrukturellen<br />
Wandel. E<strong>in</strong>e wesentliche Rolle spielt auch die Tertiärisierung – der<br />
Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft.<br />
Der wirtschaftsstrukturelle Wandel führt zu Arbeitsplatzverlusten, Standortschließungen<br />
sowie Verlagerungen <strong>in</strong> traditionellen Branchen und schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
<strong>in</strong> jungen Branchen und Dienstleistungsunternehmen. Der<br />
Strukturwandel darf nicht als vorübergehendes Phänomen begriffen, sondern muss<br />
aufgrund immer kürzerer Innovationszyklen als dauerhafter Prozess betrachtet werden.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Schwierige Lage der öffentlichen Hauhalte<br />
Die kommunale Ebene erfüllt e<strong>in</strong>e wachsende Zahl an Aufgaben und Pflichten. Im dreigliedrigen<br />
Staatssystem stellen Städte, Geme<strong>in</strong>den und Landkreise die zentrale operative<br />
Ebene dar, die die wirtschaftliche, ökologische sowie soziale und kulturelle Dase<strong>in</strong>svorsorge<br />
für den Bürger gewährleistet.<br />
Gleichwohl erodiert die f<strong>in</strong>anzielle Basis der Kommunen. Ursachen hierfür s<strong>in</strong>d Veränderungen<br />
der Steuergesetzgebung und die konjunkturelle Lage, aber auch Auswirkungen<br />
des demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels. Im Ergebnis führt die<br />
angespannte Lage der öffentlichen Haushalte zu e<strong>in</strong>er erheblichen E<strong>in</strong>schränkung kommunaler<br />
Gestaltungsspielräume, die aber vor dem H<strong>in</strong>tergrund der aktuellen und<br />
zukünftigen Herausforderungen dr<strong>in</strong>gend erforderlich s<strong>in</strong>d.<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
8<br />
1.2 Auswirkungen auf Städte und Geme<strong>in</strong>den<br />
Der beschriebene Wandel existenzieller Rahmenbed<strong>in</strong>gungen wirkt sich maßgeblich<br />
auf die Städte und Geme<strong>in</strong>den aus und erfordert <strong>in</strong> vielen Fällen deren Umbau.<br />
Dieser Stadtumbau betrifft die Funktion der Kommunen als Standort für Wohnen und<br />
Gewerbe, für E<strong>in</strong>zelhandel und Dienstleistungen sowie als Standort beziehungsweise<br />
Knotenpunkt von Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen und -netzen.<br />
■ Wohnen<br />
Für die Entwicklung des Wohnungsmarkts ist nicht die E<strong>in</strong>wohnerzahl, sondern<br />
die Zahl, Größe und Struktur der Privathaushalte maßgebend. Bed<strong>in</strong>gt durch<br />
den steigenden Anteil an älteren Menschen, aber vor allem durch e<strong>in</strong>en mit dem<br />
demographischen Wandel e<strong>in</strong>hergehenden sozialen Wandel (Individualisierung,<br />
Pluralisierung der Lebensstile) ist die durchschnittliche Haushaltsgröße durch<br />
Zunahme der E<strong>in</strong>- und Zweipersonenhaushalte rückläufig. In der Konsequenz steigt<br />
zunächst die Zahl der Haushalte, was bei stagnierender Bevölkerung zu e<strong>in</strong>em<br />
höheren Bedarf an Wohnungen führt beziehungsweise bei leicht s<strong>in</strong>kender Bevölkerung<br />
ausgleichend auf den Wohnungsmarkt wirken dürfte. Langfristig ist<br />
nach heutigem Erkenntnisstand allerd<strong>in</strong>gs von e<strong>in</strong>er rückläufigen Nachfrage auf<br />
dem Wohnungsmarkt auszugehen.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Darüber h<strong>in</strong>aus muss der Wohnungsmarkt auf die Veränderung der Bevölkerungsund<br />
Haushaltsstruktur reagieren. E<strong>in</strong>e ältere und „buntere“ Gesellschaft bedarf<br />
e<strong>in</strong>es differenzierteren Wohnungsangebotes als dies bisher der Fall ist. Gefragt s<strong>in</strong>d<br />
flexible Grundrisse und die Möglichkeit, Wohne<strong>in</strong>heiten mite<strong>in</strong>ander zu verb<strong>in</strong>den<br />
beziehungsweise zu teilen, um auf die unterschiedlichen Haushaltsgrößen reagieren<br />
zu können.<br />
Insbesondere die Alterung der Gesellschaft führt zu e<strong>in</strong>em spezifischen Bedarf an<br />
besonderen Wohnangeboten wie beispielsweise betreutem Wohnen. In diesem<br />
Zusammenhang ist zu beachten, dass e<strong>in</strong> ausreichendes, breit gefächertes und<br />
attraktives Wohnungsangebot e<strong>in</strong>en wichtigen Standortfaktor für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung e<strong>in</strong>er Region darstellt.<br />
■ Gewerbe<br />
Strukturwandel führt <strong>in</strong> vielen Fällen zur Aufgabe von Betrieben und Standorten.<br />
Neue und wachsende Branchen haben ihre eigenen Standortpräferenzen, die sich<br />
häufig nicht mit brach gefallenen Altstandorten decken. In der Folge werden aufgegebene<br />
Standorte alter Industrien und Gewerbebetriebe oft nur sehr zögerlich,<br />
erst nach erheblichen öffentlichen Investitionen oder <strong>in</strong> Extremfällen gar nicht wieder<br />
genutzt. Die Kommunen stehen vor der Aufgabe, Konzepte für diese Brachen<br />
zu f<strong>in</strong>den. Darüber h<strong>in</strong>aus müssen die Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e Anpassung der<br />
örtlichen Wirtschaft an die veränderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen geschaffen werden.<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
9<br />
Während Ballungsräume mit guter Verkehrs- und Bildungs<strong>in</strong>frastruktur über gute<br />
Voraussetzungen zur Bewältigung des Strukturwandels verfügen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> ländlich-peripheren Räumen <strong>in</strong>novative Konzepte und e<strong>in</strong> langer Atem bei der<br />
wirtschaftsstrukturellen Neuausrichtung erforderlich.<br />
Anpassung im Bestand
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ E<strong>in</strong>zelhandels- und Zentrenstruktur<br />
Auch die E<strong>in</strong>zelhandels- und Zentrenstruktur wird von der Entwicklung von<br />
Bevölkerung und Wirtschaft bee<strong>in</strong>flusst. Weitere maßgebliche Faktoren s<strong>in</strong>d der<br />
hohe Motorisierungsgrad und das veränderte E<strong>in</strong>kaufs- und Konsumverhalten,<br />
aber auch Standortentscheidungen von Dienstleistungsunternehmen. Im Ergebnis<br />
ist häufig e<strong>in</strong> Funktionsverlust der Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne<br />
festzustellen, der durch Leerstände und e<strong>in</strong>e Verschlechterung des E<strong>in</strong>zelhandelsund<br />
Dienstleistungsangebotes sichtbar wird. In der Folge verlieren zentrale Lagen an<br />
Aufenthaltsqualität. Darüber h<strong>in</strong>aus ist e<strong>in</strong>e Abnahme der kulturellen Bedeutung<br />
von Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen festzustellen.<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
10<br />
Leerstand im E<strong>in</strong>zelhandel<br />
■ Technische, soziale und kulturelle Infrastruktur<br />
Trotz regionaler Unterschiede ist <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im Allgeme<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>e gute Infrastrukturausstattung<br />
gegeben. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der zu erwartenden demographischen<br />
Entwicklungen s<strong>in</strong>d zukünftig Tragfähigkeitsprobleme <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Teilen<br />
Nord- und Mittelhessens zu erwarten. 1) Diese können zu e<strong>in</strong>er regionalen Unterschreitung<br />
von Qualitäts- und M<strong>in</strong>deststandards und damit zu e<strong>in</strong>er Verschlechterung<br />
der Lebensbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> den betroffenen Teilräumen führen.<br />
Im Bereich der technischen Infrastruktur s<strong>in</strong>d Auslastung und Wirtschaftlichkeit<br />
der Ver- und Entsorgungs<strong>in</strong>frastruktur (<strong>in</strong>sbesondere Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung<br />
und Wasserver- und Entsorgungsnetze) aber auch des öffentlichen<br />
Personennahverkehrs (ÖPNV) betroffen. Als Folge der demographischen Veränderungen<br />
s<strong>in</strong>d Gebührenerhöhuneng beziehungsweise Angebotse<strong>in</strong>schränkungen<br />
durch den jeweiligen Träger zu erwarten. Insbesondere im Bereich des ÖPNVs<br />
ist dies problematisch, da vor dem H<strong>in</strong>tergrund der Alterung der Gesellschaft e<strong>in</strong><br />
kostengünstiges und leistungsfähiges ÖPNV-Angebot notwendig ist.<br />
1) Vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2005), S. 110f.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Die demographische und wirtschaftsstrukturelle Entwicklung hat darüber h<strong>in</strong>aus<br />
Auswirkung auf die soziale und kulturelle Infrastruktur:<br />
➔ Das Schulwesen ist vor allem durch e<strong>in</strong>en Rückgang der Schülerzahlen und der<br />
daraus resultierenden ger<strong>in</strong>geren Auslastung der Schulen, aber auch durch<br />
e<strong>in</strong>en wachsenden Integrationsbedarf betroffen. Bereits heute unterschreiten<br />
zahlreiche Schulen <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> die Landesrichtwerte für Klassengrößen. Insbesondere<br />
im Grundschulbereich ist die Verschlechterung der wohnortnahen Versorgung<br />
mittelfristig zu erwarten. Bei den weiterführende Schulen bedeuten die<br />
s<strong>in</strong>kenden Schülerzahlen, dass parallele Schulangebote <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Entfernung<br />
vielerorts nicht mehr tragfähig se<strong>in</strong> werden.<br />
➔ Gleiches gilt für K<strong>in</strong>derbetreuungse<strong>in</strong>richtungen. Auch wenn die heute häufig<br />
praktizierte Öffnung für K<strong>in</strong>der vor dem dritten Lebensjahr die Auslastung von<br />
K<strong>in</strong>dergärten/-tagesstätten verbessern kann, ist <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en<br />
Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der Angebotsdichte zu erwarten.<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
➔ Trotz der Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppen ist bei der Pflege- und<br />
Gesundheits<strong>in</strong>frastruktur <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> aus heutiger Sicht ke<strong>in</strong>e Unterversorgung<br />
mit stationären E<strong>in</strong>richtungen wie beispielsweise Krankenhäusern und Pflegeheimen<br />
zu erwarten. In ländlichen Räumen muss allerd<strong>in</strong>gs davon ausgegangen<br />
werden, dass <strong>in</strong>sbesondere spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen nicht<br />
immer wohnortnah vorgehalten werden können.<br />
11<br />
➔ Kultur- und Freizeite<strong>in</strong>richtungen (Bühnen, Museen, Schwimmbäder, Jugendräume,<br />
Sporte<strong>in</strong>richtungen, Büchereien, Dorfgeme<strong>in</strong>schaftshäuser/Bürgerhäuser,<br />
Seniorenbüros, etc.) als freiwillige Aufgaben stehen bei s<strong>in</strong>kender Auslastung<br />
und ger<strong>in</strong>geren kommunalen E<strong>in</strong>nahmen immer stärker unter F<strong>in</strong>anzierungsvorbehalt.<br />
Insbesondere kosten<strong>in</strong>tensive Infrastrukturen wie beispielsweise<br />
Schwimmbäder werden für viele Städte und Geme<strong>in</strong>den nicht mehr im bisherigen<br />
Umfang f<strong>in</strong>anzierbar se<strong>in</strong>.<br />
■ Enge Wechselwirkungen<br />
Von großer Bedeutung s<strong>in</strong>d enge Wechselwirkungen zwischen den ausgeführten<br />
Auswirkungen auf die Kommunen als Standort für Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung<br />
und E<strong>in</strong>zelhandel sowie Infrastruktur. Städte und Geme<strong>in</strong>den mit E<strong>in</strong>wohnerverlusten<br />
müssten Nachteile bei der Entwicklung des Gewerbes, der Dienstleistungs- und<br />
Zentrenstruktur sowie bei der Infrastrukturausstattung erwarten.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Umgekehrt wirken sich negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, der E<strong>in</strong>zelhandels-<br />
und Zentrenstruktur sowie der Infrastrukturausstattung massiv auf die<br />
E<strong>in</strong>wohnerentwicklung aus. Ländlich periphere Gebiete, die E<strong>in</strong>wohner- und/oder<br />
Arbeitsverluste verzeichnen, drohen daher <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Abwärtsspirale aus Arbeitsplatzabbau,<br />
Funktionsverlust und Abwanderung zu geraten.<br />
■ Chancen des demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
12<br />
Neben Risiken verb<strong>in</strong>den sich aber auch Chancen mit dem demographischen und<br />
wirtschaftsstrukturellen Wandel. So fallen beispielsweise Flächen <strong>in</strong> zentraler Lage<br />
brach, für die unter Umständen neue attraktive Nutzungen gefunden werden<br />
können. Grundsätzlich eröffnet der Stadtumbau auch die Möglichkeit, mehr Grün<br />
<strong>in</strong> die Stadt zu <strong>in</strong>tegrieren und so die Umfeldqualität und den Freizeitwert von<br />
städtischen Quartieren und Ortskernen zu erhöhen. Schließlich können auch<br />
Veränderungen im Boden- und Mietpreisgefüge Wohnen und Gewerbe <strong>in</strong> zentralen<br />
Lagen erschw<strong>in</strong>glicher machen. Insgesamt gilt es daher, die anstehenden Herausforderungen<br />
als Gestaltungsspielraum zu begreifen, der neue Perspektiven<br />
eröffnen kann.<br />
1.3 Neue Spielräume durch Zusammenarbeit<br />
Städte und Geme<strong>in</strong>den bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em grundlegenden Dilemma. E<strong>in</strong>erseits<br />
erfordert der Paradigmenwechsel von der wachsenden zur stagnierenden oder<br />
schrumpfenden Stadt entschlossenes kommunalpolitisches Handeln, andererseits<br />
schränkt die Lage der kommunalen Haushalte die notwendigen Handlungs- und<br />
Gestaltungsmöglichkeiten erheblich e<strong>in</strong>.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund sieht e<strong>in</strong>e wachsende Zahl von Städten und Geme<strong>in</strong>den<br />
<strong>in</strong> <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit e<strong>in</strong>e wichtige Strategie, den strukturellen<br />
Herausforderungen zu begegnen und die kommunale Handlungsfähigkeit zu wahren.<br />
H<strong>in</strong>zu kommt, dass die gegenwärtigen strukturellen Probleme häufig nicht durch<br />
Kirchturmpolitik gelöst werden können. Vielfach bedarf es <strong>in</strong>terkommunal getragener<br />
beziehungsweise abgestimmter Lösungsansätze.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Die Vorteile <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit lassen sich<br />
wie folgt zusammenfassen: 2)<br />
➔ Vermeidung ru<strong>in</strong>öser Konkurrenz/Entwicklung im Konsens: E<strong>in</strong> unbeschränkter<br />
Wettbewerb um e<strong>in</strong>e schrumpfende Zahl an Bürgern und Betrieben führt zu<br />
Gew<strong>in</strong>nern und Verlierern unter den Kommunen. Im ungünstigsten Fall entsteht<br />
e<strong>in</strong>e Situation, die letzten Endes ausschließlich Verlierer generiert. Notwendig<br />
ist stattdessen e<strong>in</strong>e Entwicklung im regionalen Konsens. Hierzu bedarf es der<br />
Abstimmung überörtlich bedeutsamer Vorhaben und der Entwicklung geme<strong>in</strong>samer<br />
Entwicklungsleitl<strong>in</strong>ien. E<strong>in</strong>e solche Vorgehensweise bietet Planungssicherheit<br />
und Schutz vor Fehlentwicklungen.<br />
➔ Synergien durch Bündelung von Potenzialen: Benachbarte Städte und<br />
Geme<strong>in</strong>den haben vielfach sehr unterschiedliche spezifische Stärken, die sich<br />
im S<strong>in</strong>ne differenzierter Funktionsschwerpunkte und e<strong>in</strong>er optimierten arbeitsteiligen<br />
Nutzung des Raums wechselseitig ergänzen können. Durch geme<strong>in</strong>sames<br />
und planvolles Handeln können diese Stärken wirksam weiterentwickelt und<br />
vorhandene Schwächen ausgeglichen werden.<br />
➔ Geme<strong>in</strong>same Profilierung und Positionierung: Für e<strong>in</strong>zelne, <strong>in</strong>sbesondere<br />
kle<strong>in</strong>ere Kommunen ist es schwer, sich zu profilieren. Geme<strong>in</strong>sam mit Nachbarn<br />
fällt es im Standortwettbewerb leichter den eigenen Standort und se<strong>in</strong>e Stärken,<br />
Vorzüge und Möglichkeiten öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren.<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
13<br />
➔ F<strong>in</strong>anzierung von Infrastruktur und Verwaltungse<strong>in</strong>richtungen: Der Rückgang<br />
kommunaler E<strong>in</strong>nahmen führt vielerorts dazu, dass Verwaltungs- und Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />
zunehmend schwerer zu f<strong>in</strong>anzieren s<strong>in</strong>d. H<strong>in</strong>zu kommt,<br />
dass aufgrund des demographischen Wandels die Auslastungsgrade bestimmter<br />
Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>ken. Geme<strong>in</strong>same Organisations- und Trägermodelle<br />
können die Wirtschaftlichkeit und somit die langfristige F<strong>in</strong>anzierbarkeit<br />
öffentlicher Infrastruktur- und Verwaltungse<strong>in</strong>richtungen sichern.<br />
Die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit ist auch angesichts der Siedlungsstrukturen<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> von besonderer Bedeutung. Aufgrund der großen Zahl an kle<strong>in</strong>en<br />
und mittleren Städten und Geme<strong>in</strong>den wird das geme<strong>in</strong>same Handeln von Nachbarkommunen<br />
zur Schlüsselstrategie für die Zukunftsfähigkeit der hessischen<br />
Städte und Geme<strong>in</strong>den.<br />
2) Ausführlich: Flug; Schwart<strong>in</strong>g; Wackerl (2003)
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
1. 4 Förderung <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
durch die Landespolitik<br />
Die besondere Bedeutung <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit für die kommunale<br />
Ebene <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> wird von Seiten der Landespolitik aufgegriffen. <strong>Kooperation</strong> von<br />
Städten und Geme<strong>in</strong>den wird im Rahmen unterschiedlicher Politikfelder gefördert<br />
beziehungsweise empfohlen:<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
14<br />
➔ Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen Dienstleistungszentren:<br />
Zur Stärkung der Selbstverwaltung kle<strong>in</strong>erer Geme<strong>in</strong>den (unter 15.000 E<strong>in</strong>wohnern)<br />
werden Verwaltungsverbände/Verwaltungsgeme<strong>in</strong>schaften gefördert<br />
(siehe Infobox 5: „Rahmenvere<strong>in</strong>barung zur Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen<br />
Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den“, S. 67).<br />
➔ Förderung der regionalen Entwicklung: Landesteile, die <strong>in</strong> ihrer Wirtschaftskraft<br />
den Landesdurchschnitt nicht erreichen, werden bei der Bewältigung des<br />
Strukturwandels unterstützt. Gefördert werden zu diesem Zweck unter anderem<br />
regionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, regionales Standortmarket<strong>in</strong>g<br />
und wirtschaftsnahe Infrastrukturen wie beispielsweise Gewerbegebiete.<br />
Infrastrukturprojekten, die im Rahmen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen <strong>Kooperation</strong><br />
verwirklicht werden, wird ausdrücklich Vorrang e<strong>in</strong>geräumt (siehe Infobox 2:<br />
„Förderprogramm: Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Förderung der regionalen<br />
Entwicklung“, S. 35).<br />
➔ Förderung der ländlichen Entwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Zur Verbesserung der Entwicklungsperspektiven<br />
im ländlichen Raum werden <strong>in</strong>terkommunal abgestimmte<br />
Entwicklungskonzepte und e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Regionalmanagement gefördert.<br />
Nach Maßgabe der Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative LEADER+ werden Regionen unterstützt,<br />
<strong>in</strong> denen neben den beteiligten Kommunen auch die sonstigen relevanten<br />
Akteure e<strong>in</strong>er Region kooperieren (siehe Infobox 4: „Programm zur Förderung<br />
der ländlichen Entwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>“, S. 59).<br />
➔ Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Aktuell wurde <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> als e<strong>in</strong><br />
Schwerpunkt <strong>in</strong> das Programm Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>in</strong>tegriert. Dies bedeutet,<br />
dass das von ausgewählten Kommunen zu erstellende gesamtstädtische Stadtumbaukonzept<br />
zum<strong>in</strong>dest mit den Umlandkommunen abgestimmt werden<br />
muss. E<strong>in</strong>e weitergehende Planung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen<br />
im Rahmen tragfähiger <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>sstrukturen ist<br />
darüber h<strong>in</strong>aus ausdrücklich erwünscht und wird gegenwärtig von 14 <strong>in</strong>terkommunalen<br />
Gruppen angestrebt. Auch nicht geförderten Städten und Geme<strong>in</strong>den<br />
wird <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit als e<strong>in</strong> wichtiger Strategiebauste<strong>in</strong> zur<br />
Verwirklichung von Stadtumbauvorhaben empfohlen (siehe Infobox 1: „Förderprogramm:<br />
Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>“, S. 15).
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Infobox 1<br />
Förderprogramm: Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Fördergegenstand:<br />
Förderfähig s<strong>in</strong>d Gesamtmaßnahmen auf der Grundlage e<strong>in</strong>es städtebaulichen Entwicklungskonzepts,<br />
<strong>in</strong> dem die Ziele und Maßnahmen im Untersuchungsgebiet dargestellt s<strong>in</strong>d.<br />
Das städtebauliche Entwicklungskonzept ist mit den Umlandgeme<strong>in</strong>den abzustimmen,<br />
<strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong>en s<strong>in</strong>d ausdrücklich gewünscht. Mit der Aufnahme <strong>in</strong> das<br />
Programm ist e<strong>in</strong>e Regelförderung von 10 Jahren vorgesehen.<br />
Die Fördermittel können für folgende Maßnahmen e<strong>in</strong>gesetzt werden:<br />
➔ die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme wie Erarbeitung und Fortschreibung von<br />
städtebaulichen Entwicklungskonzepten (gesamtstädtischer Teil und gebietsbezogener Teil)<br />
e<strong>in</strong>schließlich <strong>in</strong>terkommunaler Abstimmung,<br />
➔ die städtebauliche Neuordnung von Innenstädten und Kernbereichen,<br />
➔ die Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen,<br />
Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
➔ die Anpassung der städtischen Infrastruktur und die Sicherung der Grundversorgung,<br />
➔ die Aufwertung und den Umbau des für den Stadtumbau bedeutsamen Gebäudebestands,<br />
➔ den Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder<br />
Gebäudeteile oder der dazu gehörenden Infrastruktur,<br />
15<br />
➔ die Wieder- und Zwischennutzung von Flächen und Gebäuden,<br />
➔ sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen, die für den Stadtumbau erforderlich s<strong>in</strong>d,<br />
➔ die Leistungen von Beauftragten e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>es Stadtumbaumanagements<br />
sowie<br />
➔ die Bürgermitwirkung und die Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Ansprechpartner:<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft,<br />
Verkehr und Landesentwicklung<br />
Rudolf Raabe<br />
Kaiser-Friedrich-R<strong>in</strong>g 75<br />
65185 Wiesbaden<br />
Telefon: (0611) 815-29 60<br />
E-Mail: rudolf.raabe@hmwvl.hessen.de<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
www.stadtumbau-hessen.de
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
2 Akteure und Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
2.1 Akteure<br />
Unter <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit wird die Zusammenarbeit von Gebietskörperschaften<br />
auf der kommunalen Ebene, also von Städten, Geme<strong>in</strong>den und<br />
Landkreisen verstanden. Dabei können unterschiedliche <strong>Kooperation</strong>skonstellationen<br />
unterschieden werden, wie beispielsweise Städtenetze, Stadt-Umland <strong>Kooperation</strong>,<br />
Ballungsraumverbände und sach-/aufgabenorientierte <strong>Kooperation</strong>en.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
Die Landkreise treten <strong>in</strong> zweifacher H<strong>in</strong>sicht als Akteure <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
auf. Zum e<strong>in</strong>en führen sie als Teil der kommunalen Ebene selbst <strong>Kooperation</strong>sprojekte<br />
durch. Beispiele hierfür s<strong>in</strong>d das Regionalmanagement Nordhessen<br />
oder die Region Starkenburg, die jeweils aus Zusammenschlüssen mehrerer<br />
Landkreise bestehen. Zum anderen s<strong>in</strong>d sie Partner (siehe auch Beispiel Innovationsregion<br />
Mitte) oder Berater (siehe Beispiele Virtuelles Gründerzentrum Schwalmstadt<br />
und Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“)<br />
bei <strong>Kooperation</strong>en zwischen Städten und Geme<strong>in</strong>den.<br />
16<br />
Die Rolle privater Dritter kommt <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise zum Tragen:<br />
➔ Als Ideengeber im Rahmen von Bürgerbeteiligungsprozessen wie<br />
beispielsweise Bürgerworkshops und Ideenwettbewerben,<br />
➔ als Förderer, beispielsweise im Rahmen e<strong>in</strong>es Fördervere<strong>in</strong>s, <strong>in</strong> dem<br />
Unternehmen und Bürger direkt an <strong>Kooperation</strong>sprojekten mitwirken,<br />
➔ als direkter Investor, der im Idealfall die <strong>in</strong>terkommunal abgestimmten<br />
Vorhaben umsetzt und dauerhaft wirtschaftlich betreibt<br />
(zum Beispiel Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Hofheim-Kelkheim).<br />
Zusammenführung von Akteuren
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
2.2 Organisationsformen<br />
2.2.1 Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und rechtliche Basis<br />
Grundsätzlich hat jede Kommune das Recht zur Zusammenarbeit. In <strong>Hessen</strong> s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung (HGO) und dem Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit<br />
(KGG) konkrete Grundlagen für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit<br />
formuliert.<br />
Neben der freiwilligen <strong>Kooperation</strong> von Städten und Geme<strong>in</strong>den sieht der Gesetzgeber<br />
ausdrücklich auch die Möglichkeit des Pflichtverbandes bzw. des Pflichtanschlusses<br />
vor, wenn „die Erfüllung dieser Aufgaben aus Gründen des öffentlichen<br />
Wohles dr<strong>in</strong>gend geboten ist und ohne den Zusammenschluss oder Anschluss nicht<br />
wirksam oder zweckmäßig erfolgen kann“ (§ 13 KGG). Auf die aufsichtsbehördlichen<br />
Möglichkeiten zur staatlich verordneten <strong>Kooperation</strong> wird im vorliegenden<br />
Bericht nicht weiter e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Bei der Organisation der kommunalen Zusammenarbeit besteht nach den e<strong>in</strong>schlägigen<br />
Landesgesetzen Wahlfreiheit. Es dürfen sowohl Formen des öffentlichen<br />
als auch des privaten Rechts gewählt werden. Dies gilt aber nur dann, wenn die<br />
Erledigung der Aufgabe nicht hoheitlich vorgenommen werden muss und zw<strong>in</strong>gende<br />
Vorgaben im KGG formuliert s<strong>in</strong>d. Daneben wird <strong>in</strong> der Praxis zwischen formellen<br />
und <strong>in</strong>formellen <strong>Kooperation</strong>en unterschieden.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
17<br />
Formelle Strukturen haben den Vorteil der größeren Verb<strong>in</strong>dlichkeit, die zum Beispiel<br />
bei Projekten mit längerfristiger f<strong>in</strong>anzieller B<strong>in</strong>dung oder bei der Beantragung<br />
von Fördermitteln notwendig ist. Die vielfältigen <strong>in</strong>formellen <strong>Kooperation</strong>sgremien<br />
basieren nicht auf e<strong>in</strong>er unmittelbaren gesetzlichen Grundlage, tragen jedoch<br />
dazu bei, eventuelle Vorbehalte gegenüber e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen <strong>Kooperation</strong><br />
abzubauen, Akzeptanz bei den Verantwortlichen zu schaffen und die Zusammenarbeit<br />
auf e<strong>in</strong>e breite Basis der Zustimmung zu stellen.<br />
Die Wahl der Organisations- und Rechtsform ist abhängig vom jeweiligen <strong>Kooperation</strong>sgegenstand.<br />
Dabei spielen beispielsweise die Zusammensetzung der Partner,<br />
die F<strong>in</strong>anz- und Verwaltungskraft, der Aufgabenumfang, die Größenordnung<br />
des Projektes, die angestrebte Zielsetzung e<strong>in</strong>e Rolle. Auch die zukünftige Entwicklung,<br />
zum Beispiel die perspektivische Übernahme weiterer Aufgaben und/oder<br />
die Erweiterung des Kreises der <strong>Kooperation</strong>spartner sollte als Entscheidungsgrundlage<br />
herangezogen werden.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Relativ häufig entscheiden sich Kommunen für e<strong>in</strong>e kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
e<strong>in</strong>en Zweckverband oder e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung. Diese<br />
öffentlich-rechtlichen Organisationsformen s<strong>in</strong>d im KGG ausdrücklich erwähnt<br />
und es gibt langjährige Erfahrungen mit deren E<strong>in</strong>satz. Bei der Auswahl von privatrechtlichen<br />
Rechtsformen muss darauf geachtet werden, dass die Haftung der<br />
Geme<strong>in</strong>de auf e<strong>in</strong>en bestimmten Höchstbetrag begrenzt ist.<br />
Diese <strong>in</strong> der Bundesrepublik durch Landesgesetze geregelte Bed<strong>in</strong>gung erfüllen<br />
personalisierte Rechtsformen wie OHG 3) , KG 4) oder auch e<strong>in</strong>e GbR 5) <strong>in</strong> der Regel<br />
nicht 6) . Auch Aktiengesellschaften 7) sche<strong>in</strong>en nur schwer mit den gesetzlichen<br />
Vorgaben vere<strong>in</strong>bar zu se<strong>in</strong>. Hier besteht das Problem <strong>in</strong> der Verpflichtung der<br />
Kommune, die Steuerung und Kontrolle ihrer Gesellschaft auszuüben (§ 122 HGO).<br />
Dies kollidiert mit der grundsätzlichen Eigenverantwortlichkeit, die den Vorstandsund<br />
Aufsichtsratsmitgliedern e<strong>in</strong>er Aktiengesellschaft zukommt.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
2.2.2 Kurzbeschreibung ausgewählter Organisationsformen<br />
18<br />
Im Folgenden werden die Kennzeichen der <strong>in</strong> der Praxis am häufigsten ausgewählten<br />
Organisationsformen kurz beschrieben. Die Darstellung soll e<strong>in</strong>en knappen<br />
Überblick ermöglichen und hat nicht das Ziel, e<strong>in</strong>e vollständige Aufarbeitung der<br />
rechtlichen und steuerlichen Aspekte vorzunehmen.<br />
■ Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Mitglieder der kommunalen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft nach §§ 3 bis 4 KGG s<strong>in</strong>d Geme<strong>in</strong>den<br />
und Geme<strong>in</strong>deverbände, aber auch andere Körperschaften sowie natürliche<br />
und juristische Personen des Privatrechts. Grundlage ist e<strong>in</strong> schriftlicher Vertrag<br />
zwischen den beteiligten Kommunen.<br />
Die Zuständigkeiten der e<strong>in</strong>zelnen Mitglieder bleiben unverändert. Die kommunale<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft hat ke<strong>in</strong>e eigene Rechtspersönlichkeit. Bei der kommunalen<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft handelt es sich um e<strong>in</strong>e mit relativ wenig bürokratischem<br />
und organisatorischem Aufwand zu realisierende Organisationsform. Sie wird aus<br />
diesem Grund oftmals am Anfang e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit oder<br />
bei Projekten ger<strong>in</strong>gerer Komplexität gewählt.<br />
3) E<strong>in</strong>e offene Handelsgesellschaft (Abkürzung: OHG oder oHG) ist e<strong>in</strong>e Personengesellschaft, <strong>in</strong> der sich zwei oder mehr natürliche Personen und/oder juristische<br />
Personen zusammengeschlossen haben, um unter e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Firma e<strong>in</strong> Handelsgewerbe zu betreiben.<br />
4) E<strong>in</strong>e Kommanditgesellschaft (Abkürzung: KG) ist e<strong>in</strong>e Personengesellschaft, <strong>in</strong> der sich zwei oder mehr natürliche Personen und/ oder juristische Personen<br />
zusammengeschlossen haben, um unter e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Firma e<strong>in</strong> Handelsgewerbe zu betreiben. Von der OHG (Offene Handelsgesellschaft) unterscheidet<br />
sich e<strong>in</strong>e KG dadurch, dass bei e<strong>in</strong>em oder mehreren Gesellschaftern die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag e<strong>in</strong>er bestimmten<br />
Vermögense<strong>in</strong>lage beschränkt ist (Kommanditist, Kommanditisten), während m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong> anderer Gesellschafter persönlich haftet (Komplementär).<br />
5) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder auch BGB-Gesellschaft ist <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Vere<strong>in</strong>igung von (natürlichen oder juristischen) Personen, die sich<br />
durch e<strong>in</strong>en Gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten, die Erreichung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Zwecks <strong>in</strong> der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern,<br />
<strong>in</strong>sbesondere die vere<strong>in</strong>barten Beiträge zu leisten (§ 705 BGB). Zum Beispiel: Zusammenschluss von Bauunternehmen zur geme<strong>in</strong>samen Durchführung e<strong>in</strong>es Bauvorhabens<br />
(sog. AR-GE). Auch beim Zusammenschluss von Personen zu e<strong>in</strong>er Fahr- oder Spielgeme<strong>in</strong>schaft oder e<strong>in</strong>em Investmentclub kann es sich um e<strong>in</strong>e GbR<br />
handeln. Liegt der geme<strong>in</strong>same Zweck <strong>in</strong> dem Betrieb e<strong>in</strong>es Handelsgewerbes unter geme<strong>in</strong>schaftlicher Firma, handelt es sich allerd<strong>in</strong>gs nicht um e<strong>in</strong>e GbR,<br />
sondern um e<strong>in</strong>e Offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Ke<strong>in</strong>e GbR, sondern e<strong>in</strong>e Bruchteilsgeme<strong>in</strong>schaft liegt <strong>in</strong> der Regel vor, wenn bloß e<strong>in</strong>e<br />
Sache geme<strong>in</strong>sam gehalten und verwaltet wird.<br />
6) Siehe hierzu: Holtel; Wuschansky (2002), S. 29f.<br />
7) E<strong>in</strong>e Aktiengesellschaft (AG) ist e<strong>in</strong>e privatrechtliche Ausgestaltung e<strong>in</strong>er Gesellschaft als Unternehmensform, bei der das Gesellschaftsvermögen (Grundkapital/<br />
Aktienkapital) <strong>in</strong> Aktien aufgeteilt ist. Neben der GmbH und der KG gehört sie zu den Kapitalgesellschaften.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Zweckverband<br />
Mitglieder des Zweckverbands nach §§ 5 bis 23 KGG s<strong>in</strong>d Geme<strong>in</strong>den und<br />
Geme<strong>in</strong>deverbände. Die Beteiligung von anderen Körperschaften, Anstalten<br />
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, natürlichen und juristischen Personen<br />
des Privatrechts s<strong>in</strong>d möglich, wenn die Erfüllung der Verbandsaufgabe dadurch<br />
gefördert wird.<br />
Grundlage ist die Übertragung beziehungsweise Zuweisung von Aufgaben durch<br />
den jeweiligen kommunalen Rechtsträger im Rahmen e<strong>in</strong>er Verbandssatzung,<br />
die durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss. Organe s<strong>in</strong>d der Verbandsvorsitzende<br />
und die Verbandsversammlung, die aus Vertretern der Verbandsmitglieder<br />
besteht.<br />
Der Zweckverband ist e<strong>in</strong>e eigene Rechtspersönlichkeit und verwaltet die ihm<br />
übertragenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze <strong>in</strong> eigener Verantwortung.<br />
Diese Organisationsform stellt relativ hohe organisatorische Anforderungen und<br />
bed<strong>in</strong>gt im Vorfeld e<strong>in</strong>e klare Aufgabendef<strong>in</strong>ition. Der Zweckverband bietet e<strong>in</strong><br />
hohes Maß an Verb<strong>in</strong>dlichkeit und gewährleistet über die Verbandsversammlung<br />
die Kontrolle durch die politisch gewählten Kommunalvertreter.<br />
■ Planungsverband<br />
E<strong>in</strong>e sondergesetzliche Spezialform des Zweckverbandes ist der Planungsverband<br />
gemäß § 205 BauGB. Es handelt sich hierbei um e<strong>in</strong>en Zusammenschluss von<br />
Geme<strong>in</strong>den und sonstigen öffentlichen Rechtsträgern mit dem Ziel, durch geme<strong>in</strong>same<br />
zusammengefasste Bauleitplanung den Ausgleich der verschiedenen Belange<br />
zu erreichen.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
19<br />
■ Öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung<br />
Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barung nach §§ 24 bis 29 KGG s<strong>in</strong>d<br />
Geme<strong>in</strong>den, Geme<strong>in</strong>deverbände und Zweckverbände. Diese vere<strong>in</strong>baren, dass<br />
e<strong>in</strong>er der Beteiligten e<strong>in</strong>zelne Aufgaben der übrigen Beteiligten <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Zuständigkeiten<br />
übernimmt. Grundlage ist e<strong>in</strong> schriftlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag<br />
über die Aufgabenübertragung, der von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist.<br />
Bei der Aufgabendelegation handelt es sich um die Änderung der gesetzlich<br />
bestimmten Zuständigkeit. Bei der Aufgabenübernahme werden Verwaltungshandlungen<br />
<strong>in</strong> fremder Zuständigkeit und <strong>in</strong> fremden Namen durchgeführt.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Anstalt des öffentlichen Rechts<br />
Es handelt sich hierbei um e<strong>in</strong>e Rechtsform zwischen kommunalem Eigenbetrieb<br />
und Eigengesellschaft. Die Anstalt ist e<strong>in</strong>e juristische Person des öffentlichen Rechts,<br />
die organisatorisch und rechtlich eigenständig arbeiten kann.<br />
Die Leitung wird durch den Vorstand wahrgenommen, der <strong>in</strong> eigener Verantwortung<br />
handelt. Er wird durch den Verwaltungsrat bestellt und überwacht. Für die wirtschaftliche<br />
Tätigkeit der Anstalt gelten landesrechtliche Vorgaben, die auch sonst<br />
für die wirtschaftliche Tätigkeit von Geme<strong>in</strong>den gelten. Die Anstalt des öffentlichen<br />
Rechts ist mit e<strong>in</strong>er GmbH vergleichbar, aber <strong>in</strong> das öffentliche Recht e<strong>in</strong>gebunden.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
20<br />
In aktuellen Veröffentlichungen wird dieser Organisationsform e<strong>in</strong>e wachsende<br />
Bedeutung zugesprochen. 8) Die Anstalt öffentlichen Rechts ermöglicht e<strong>in</strong>erseits<br />
e<strong>in</strong>e wesentlich bessere Steuerung der wirtschaftlichen Aktivitäten als privatrechtliche<br />
Organisationsformen durch die Kommunen. Andererseits lässt sie die an<br />
ihr beteiligten Kommunen an den Vorteilen, die ansonsten nur für privatrechtliche<br />
Betriebe gelten, teilhaben.<br />
■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)<br />
Die GmbH ist e<strong>in</strong>e Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, die für<br />
jeden gesetzlich zulässigen – wirtschaftlichen oder nicht-wirtschaftlichen – Zweck<br />
durch e<strong>in</strong>e oder mehrere Personen gegründet werden kann. Die Gründung bedarf<br />
e<strong>in</strong>es Gesellschaftsvertrages, e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>tragung <strong>in</strong>s Handelsregister und des Stammkapitals<br />
<strong>in</strong> Höhe von 25.000,– EUR (dieses kann auch durch Sachmittel erbracht<br />
werden). E<strong>in</strong>e Kommune muss ihre Beteiligung an e<strong>in</strong>er GmbH der Aufsichtsbehörde<br />
anzeigen.<br />
Die gesetzlich vorgeschriebenen Organe s<strong>in</strong>d der Geschäftsführer und die Gesellschaftsversammlung.<br />
Gesellschafter e<strong>in</strong>er GmbH kann jede natürliche Person, jede<br />
Gebietskörperschaft, aber auch sonstige Gesellschaften oder Rechtspersönlichkeiten<br />
werden. Bei Verlusten ist die Haftung der GmbH auf das Stammkapital beschränkt.<br />
Die GmbH übernimmt nicht-hoheitliche, kommunale Aufgaben, die auf das <strong>Kooperation</strong>sprojekt<br />
bezogen s<strong>in</strong>d, mit der Verpflichtung, diese <strong>in</strong> wirtschaftlicher und<br />
gew<strong>in</strong>norientierter Art und Weise zu bewältigen. Hoheitliche Aufgaben können von<br />
e<strong>in</strong>er GmbH nicht wahrgenommen werden.<br />
8) Deutscher Städte- und Geme<strong>in</strong>debund (2004), S. 5
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
In der Praxis der <strong>in</strong>terkommunalen <strong>Kooperation</strong> werden häufig zwei Vorteile dieser<br />
Rechtsform herausgestellt. Zum e<strong>in</strong>en können Geme<strong>in</strong>den mit privaten Partnern<br />
zusammenarbeiten, beispielsweise wird bei Vorhaben mit hohem F<strong>in</strong>anzbedarf<br />
häufig die Beteiligung von Banken, Sparkassen oder f<strong>in</strong>anzkräftigen Unternehmen<br />
notwendig. Zum anderen kann auf e<strong>in</strong>e bestehende GmbH, zum Beispiel die kommunalen<br />
oder regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, zurückgegriffen<br />
werden. Diese kann die übertragenen Aufgaben zusätzlich mit übernehmen, ohne<br />
dass e<strong>in</strong>e neue Rechtsform gegründet werden muss.<br />
E<strong>in</strong>e Sonderform der GmbH ist die geme<strong>in</strong>nützige Gesellschaft mit begrenzter<br />
Haftung (gGmbH). Sie f<strong>in</strong>det bei geme<strong>in</strong>nützigen und mildtätigen Gesellschaftszwecken<br />
Anwendung. Besonderheiten s<strong>in</strong>d, dass <strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e Gew<strong>in</strong>nerzielungsabsicht<br />
zugrunde liegt und dass der Geschäftsführer auch unentgeltlich die<br />
Geschäftsbesorgungen übernehmen kann.<br />
■ Stiftung<br />
Stiftungen dienen e<strong>in</strong>em vom Stifter bestimmten Zweck, zu dessen Erfüllung das<br />
vom Stifter zur Verfügung gestellte Vermögen e<strong>in</strong>gesetzt wird. Bereits beim<br />
Stiftungsakt müssen Gegenstand, Vermögenszuwendung, Zweckbestimmung und<br />
Vermögensverwendung def<strong>in</strong>iert werden. E<strong>in</strong>e Änderung oder Erweiterung der<br />
Aufgabenstellung ist danach nicht mehr ohne Weiteres möglich.<br />
Stiftungen f<strong>in</strong>den sich häufig bei der Erfüllung von Aufgaben im kulturellen, sozialen<br />
und wissenschaftlichen Bereich. Die Kommunen können der Stiftung Aufgaben übertragen,<br />
die diese dann mit eigenen Mitteln erfüllt.<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
21<br />
■ E<strong>in</strong>getragener Vere<strong>in</strong> (e.V.)<br />
Der Vere<strong>in</strong> stellt e<strong>in</strong>e eigenständige juristische Person dar. Allerd<strong>in</strong>gs sieht das<br />
Vere<strong>in</strong>srecht ke<strong>in</strong>e Haftungsbeschränkung vor, so dass vor diesem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>e<br />
kommunale Mitgliedschaft genau zu prüfen ist. Auch h<strong>in</strong>sichtlich der Kont<strong>in</strong>uität<br />
der Vere<strong>in</strong>sarbeit s<strong>in</strong>d Risiken zu kalkulieren, da der Beitritt von Mitgliedern<br />
genauso leicht ist wie der Austritt. Der Vere<strong>in</strong> ist ausschließlich auf die freiwillige<br />
Mitarbeit se<strong>in</strong>er Mitglieder angewiesen.<br />
Vere<strong>in</strong>e übernehmen bisher vor allem solche Leistungen, die die kulturellen und<br />
sozialen Bereiche betreffen. Üblicherweise beteiligen sich die Kommunen durch<br />
Zuschüsse an der Vere<strong>in</strong>sf<strong>in</strong>anzierung.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Projektbeiräte<br />
Projektbeiräte stellen e<strong>in</strong>e Möglichkeit dar, sowohl Vertreter der beteiligten Kommunen<br />
aus Verwaltung und Wirtschaftsförderung sowie Vertreter privatrechtlicher<br />
Institutionen <strong>in</strong> e<strong>in</strong> <strong>Kooperation</strong>sprojekt e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den. Hier kann kont<strong>in</strong>uierlicher<br />
Informationsaustausch und geme<strong>in</strong>same Abstimmung gewährleistet werden. Als<br />
ständiges Gremium kann er beispielsweise die Koord<strong>in</strong>ationsaufgaben im Vorfeld<br />
der politischen Entscheidungen wahrnehmen und eventuelle Planungsschritte auf<br />
politischer Seite begleiten.<br />
■ Runde Tische /Gesprächsforen<br />
Akteure und<br />
Organisationsformen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
In e<strong>in</strong>em solchen Gremium, <strong>in</strong> dem die politisch relevanten Repräsentanten wie<br />
beispielsweise Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende vertreten s<strong>in</strong>d, können<br />
Grundsatzentscheidungen getroffen, weit reichende Zielrichtungen festgelegt und<br />
auch der geme<strong>in</strong>deübergreifende politische Konsens vorbereitet werden.<br />
22<br />
■ Koord<strong>in</strong>ierungsbüros<br />
Bei großen und umfangreichen Vorhaben kann e<strong>in</strong> zentrales Koord<strong>in</strong>ierungsbüro –<br />
als e<strong>in</strong>e Art geme<strong>in</strong>same Geschäftsstelle – durch die beteiligten Kommunen e<strong>in</strong>gerichtet<br />
werden. Hier würden <strong>in</strong>sbesondere koord<strong>in</strong>ierende und zentrale Aufgaben<br />
wahrgenommen. Beispielsweise könnte von e<strong>in</strong>em solchen zentralen Ansprechpartner<br />
die Öffentlichkeitsarbeit leichter und zielgerichteter durchgeführt werden.<br />
Zusammenfassend ergibt sich folgende Übersicht der <strong>Kooperation</strong>sformen:<br />
öffentlich-rechtlich privatrechtlich <strong>in</strong>formell<br />
Kommunale<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Zweckverband Sonderform:<br />
Planungsverband<br />
Öffentlich-rechtliche<br />
Vere<strong>in</strong>barung<br />
Anstalt des<br />
öffentlichen Rechts<br />
Regional- und<br />
Umlandverbände<br />
Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung (GmbH)<br />
Stiftung<br />
E<strong>in</strong>getragener Vere<strong>in</strong> (e.V.)<br />
Aktiengesellschaft (AG)<br />
Runde Tische/<br />
Gesprächskreise<br />
Projektbeiräte<br />
Koord<strong>in</strong>ierungsbüros<br />
Städtenetze, Regionalkonferenzen<br />
und -foren<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
3 <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und Perspektive<br />
3.1 Datengrundlage und Fragestellung<br />
Im vierten Quartal 2004 wurde e<strong>in</strong>e schriftliche Umfrage <strong>in</strong> hessischen Städten<br />
und Geme<strong>in</strong>den durchgeführt. Ziel der Umfrage war es, e<strong>in</strong>e Übersicht über den<br />
Stand und die Perspektive <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> zu erhalten.<br />
Grundlage der Befragung waren die folgenden zentralen Fragestellungen:<br />
➔ Wie verbreitet s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong>sansätze <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>?<br />
➔ Welchen Inhalt hat die Zusammenarbeit zwischen Kommunen?<br />
➔ Welche Hemmnisse und Chancen werden mit <strong>in</strong>terkommunaler<br />
Zusammenarbeit verbunden?<br />
➔ Gibt es gute Beispiele <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit?<br />
➔ Welche Absichten und Unterstützungsbedarfe bestehen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
zukünftiger <strong>Kooperation</strong>sprojekte?<br />
Von den angeschriebenen 426 Kommunen, der Gesamtzahl der hessischen Städte<br />
und Geme<strong>in</strong>den, hat sich etwa die Hälfte (217) an der Umfrage beteiligt. Die hohe<br />
Rücklaufquote (50,9 %) unterstreicht das Interesse der hessischen Städte und<br />
Geme<strong>in</strong>den am Thema und gewährleistet die Repräsentativität der von der Umfrage<br />
abgeleiteten Aussagen. Zur Repräsentativität trägt darüber h<strong>in</strong>aus die Tatsache bei,<br />
dass die Rücklaufquote <strong>in</strong> allen drei Regierungsbezirken sowie <strong>in</strong> allen E<strong>in</strong>wohnergrößenklassen<br />
m<strong>in</strong>destens 40 % beträgt.<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
23<br />
Tabelle 1<br />
Beteiligungen nach Regionen und E<strong>in</strong>wohnergrößenklassen<br />
bis über über über<br />
10 Tausend 10 Tsd. bis 25 Tsd. 25 Tsd. bis 50 Tsd. 50 Tausend<br />
E<strong>in</strong>wohner E<strong>in</strong>wohner E<strong>in</strong>wohner E<strong>in</strong>wohner Summe<br />
Gesamt Befragt <strong>in</strong> % Gesamt Befragt <strong>in</strong> % Gesamt Befragt <strong>in</strong> % Gesamt Befragt <strong>in</strong> % Gesamt Befragt <strong>in</strong> %<br />
RB Darmstadt 86 31 36,0 72 35 48,6 22 9 40,9 7 3 42,9 187 78 41,7<br />
RB Gießen 63 33 52,4 33 17 51,5 2 1 50,0 3 3 100,0 101 54 53,5<br />
RB Kassel 106 62 58,5 28 19 67,9 2 2 100,0 2 2 100,0 138 85 61,6<br />
<strong>Hessen</strong> 255 126 49,4 133 71 53,4 26 12 46,2 12 8 66,7 426 217 50,9<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Anmerkung zur Zahlenbasis:<br />
Die Zahlenbasis im Weiteren beträgt 218 Fragebögen, da neben den dargestellten Städten<br />
und Geme<strong>in</strong>den auch der der Zweckverband Raum Kassel an der Umfrage teilgenommen hat.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
3.2 Umfrageergebnisse<br />
■ Grundsätzliche E<strong>in</strong>stellung zum Thema<br />
Die hessischen Städte und Geme<strong>in</strong>den stehen <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> sehr<br />
positiv gegenüber: 92% halten <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> grundsätzlich für<br />
e<strong>in</strong> geeignetes Mittel zur Bewältigung kommunaler Aufgaben und Probleme. Die<br />
Befragten begründen diese Sichtweise vor allem mit der Möglichkeit, Sach- und<br />
Personalkosten e<strong>in</strong>zusparen, Synergieeffekte zu nutzen und Fachwissen zu bündeln.<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
24<br />
Tabelle 2<br />
Glauben Sie, dass <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> grundsätzlich e<strong>in</strong> geeignetes<br />
Mittel zur Bewältigung kommunaler Aufgaben und Probleme ist?<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Gesamt RB Darmstadt RB Gießen RB Kassel<br />
Ja 201 69 51 81<br />
entspricht 92% 88% 94% 94%<br />
Ne<strong>in</strong> 17 9 3 5<br />
entspricht 8% 12% 6% 6%<br />
Zur Zusammenarbeit eignet sich nach Auffassung der Städte und Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e<br />
große Bandbreite an kommunalen Handlungsfeldern. Dies gilt besonders für die<br />
Bereiche Verwaltungskooperation (zum Beispiel bei E<strong>in</strong>kauf, Personalverwaltung,<br />
EDV, Rechnungsprüfung und Bauhöfen), Freizeit und Tourismus, geme<strong>in</strong>same<br />
Nutzung von Infrastruktur und Wirtschaftsförderung.<br />
Abbildung 2<br />
Handlungsfelder mit besonderer Eignung<br />
für <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> aus Sicht der Befragten<br />
<strong>Kooperation</strong> von Teilen der Verwaltung<br />
Freizeit und Tourismus<br />
Geme<strong>in</strong>same Nutzung von Infrastruktur<br />
Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Interkommunale</strong> Gewerbegebiete<br />
Standortmarket<strong>in</strong>g<br />
Landschaft und Ökologie<br />
Flächennutzungsplanung<br />
Siedlungsrahmenkonzeption<br />
E<strong>in</strong>zelhandel<br />
Volkshochschule<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH Angaben <strong>in</strong> %
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Gegenwärtiger Stand der Zusammenarbeit <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Städte und Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> befürworten Zusammenarbeit nicht nur grundsätzlich,<br />
sondern setzen dies auch <strong>in</strong> die Tat um. 88% geben an, mit e<strong>in</strong>er oder<br />
mehreren Kommunen zu kooperieren.<br />
Tabelle 3<br />
Gibt es e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> Ihrer Stadt/Geme<strong>in</strong>de mit anderen?<br />
Gesamt RB Darmstadt RB Gießen RB Kassel<br />
Ja 176 53 44 79<br />
entspricht 88% 77% 86% 98%<br />
Ne<strong>in</strong> 25 16 7 2<br />
entspricht 12% 23% 14% 2%<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der räumlichen Verteilung der <strong>Kooperation</strong>saktivitäten ist – wenn auch<br />
auf hohem Niveau – e<strong>in</strong> klares Nord-Süd-Gefälle festzustellen. Während <strong>in</strong> Nordhessen<br />
annähernd alle Kommunen (98%) e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> angeben, ist dies <strong>in</strong><br />
Mittelhessen bei 86% und <strong>in</strong> Südhessen bei nur etwa drei Vierteln (77%) der Fall.<br />
Abbildung 3<br />
Gibt es e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> mit e<strong>in</strong>er anderen Kommune?<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
25<br />
98 %<br />
86%<br />
RB Kassel<br />
2%<br />
14 %<br />
RB Gießen<br />
77%<br />
23%<br />
RB Darmstadt<br />
Ja<br />
Ne<strong>in</strong><br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Art der <strong>Kooperation</strong>sprojekte <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Gegenstand der angegebenen <strong>Kooperation</strong>sprojekte s<strong>in</strong>d häufig klassische <strong>Kooperation</strong>sfelder<br />
wie etwa die Wasserver- und -entsorgung (über 70 Nennungen),<br />
geme<strong>in</strong>same Gefahrgut- und Ordnungsbehördenbezirke (über 20 beziehungsweise<br />
30 Nennungen) sowie die Abfallwirtschaft (über 20 Nennungen). Häufig genannt<br />
werden darüber h<strong>in</strong>aus <strong>Kooperation</strong>en zur Förderung des Tourismus beispielsweise<br />
<strong>in</strong> Form von Tourismusverbänden (über 30 Nennungen) und im Bereich Verkehr<br />
e<strong>in</strong>schließlich Radwege und Nahverkehrskooperationen (über 20 Nennungen).<br />
Auch zahlreiche <strong>in</strong>terkommunale Gewerbegebiete s<strong>in</strong>d derzeit <strong>in</strong> der Umsetzung<br />
(über 20 Nennungen).<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
26<br />
Im Bereich der Verwaltung f<strong>in</strong>den darüber h<strong>in</strong>aus weitere <strong>Kooperation</strong>en <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
breiten Themenspektrum statt: Personalverwaltung/-verbünde und Ausbildungsverbünde,<br />
Bauhof, F<strong>in</strong>anzwesen, Haushalts- und Rechnungswesen sowie E<strong>in</strong>kaufsgeme<strong>in</strong>schaften<br />
werden je 10- bis 20mal angegeben.<br />
Lediglich sporadisch wird Zusammenarbeit im Bereich der Flächennutzungsplanung,<br />
Wirtschaftsförderungse<strong>in</strong>richtungen, Standortmarket<strong>in</strong>g und Gründerförderung<br />
genannt (je 5 bis 10 Nennungen). 9)<br />
Tabelle 4<br />
<strong>Kooperation</strong>sprojekte <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Anzahl Siedlungs- und Technische und<br />
Nennungen Freiflächenplanung Lokale Wirtschaft Freizeit und Tourismus soziale Infrastruktur Verwaltung<br />
5 bis • Flächennutzungs- • Gründerzentren, • Naturschutz, • Jugendpflege • Vollstreckung<br />
unter 10 • planung • Gründerberatung, • Natur- und<br />
• Schwimmbadbetrieb • EDV<br />
• Gründerfonds • Regionalparke<br />
• Alten- und Kranken-<br />
• Regional- und • Kulturzusammenarbeit,<br />
pflege, Sozialstationen<br />
• Standortmarket<strong>in</strong>g • Veranstaltungskalender •<br />
• Wirtschafsförderungs-<br />
•<br />
• gesellschaften, -vere<strong>in</strong>e<br />
• etc.<br />
10 bis • Feuerwehr<br />
unter 20<br />
• Personalverwaltung<br />
• und -verbünde,<br />
• Ausbildungsverbünde<br />
• Bauhof<br />
• F<strong>in</strong>anzwesen, Haushalts-<br />
• und Rechnungswesen<br />
• E<strong>in</strong>kaufsgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
• Beschaffung<br />
20 bis • Verkehr (e<strong>in</strong>schließ- • Abfallwirtschaft<br />
unter 30 • lich Radwege<br />
• und Nahverkehr)<br />
• Gefahrgutbezirk<br />
• <strong>Interkommunale</strong>s<br />
• Gewerbegebiet<br />
30 und • Fremdenverkehrs- • Geme<strong>in</strong>samer<br />
mehr • förderung • Ordnungsbehördenbezirk<br />
• Wasserver- und<br />
• Entsorgung e<strong>in</strong>schl.<br />
• Abwasserre<strong>in</strong>igung<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
9) Die Anzahl der Nennungen entspricht der Zahl der Kommunen, die diese Angabe machen. E<strong>in</strong> Rückschluss auf die Zahl der <strong>Kooperation</strong>sprojekte ist nicht möglich.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Diese Zusammenarbeit deckt <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> breites Spektrum an kommunalen<br />
Handlungsfeldern ab. In der Regel ist die <strong>Kooperation</strong> auf kommunaler Ebene<br />
aber auf die Zusammenarbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em der oben genannten Handlungsfelder<br />
beschränkt. Die Möglichkeit e<strong>in</strong>er strategischen, themenübergreifenden<br />
<strong>Kooperation</strong> von Nachbarkommunen wird bislang nur vere<strong>in</strong>zelt genutzt.<br />
■ Erfahrungen mit geme<strong>in</strong>deübergreifender Zusammenarbeit<br />
Von den 176 Städten und Geme<strong>in</strong>den, die <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> praktizieren,<br />
verweisen 72% auf überwiegend positive <strong>Kooperation</strong>serfahrungen. Etwa e<strong>in</strong><br />
Viertel (24%) hat teils positive, teils negative Erfahrungen gemacht. Überwiegend<br />
negative Erfahrungen werden von ke<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigen hessischen Kommune angegeben.<br />
Im regionalen Vergleich fällt auf, dass die Kommunen im Regierungsbezirk<br />
Kassel <strong>in</strong> stärkerem Maße positive <strong>Kooperation</strong>serfahrungen gemacht haben.<br />
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> sche<strong>in</strong>t im Regierungsbezirk Kassel also nicht nur<br />
verbreiteter, sondern auch mit positiveren Erfahrungen verbunden zu se<strong>in</strong>.<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
Abbildung 4<br />
<strong>Kooperation</strong>serfahrungen nach Regierungsbezirken<br />
80%<br />
27<br />
66%<br />
RB Kassel<br />
14 %<br />
6%<br />
34 %<br />
RB Gießen<br />
66%<br />
32%<br />
RB Darmstadt<br />
2%<br />
Überwiegend positive<br />
Teils positive, teils negative<br />
Ke<strong>in</strong>e Angaben<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Hemmnisse <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
Die Befragten identifizierten mehrere Hemmnisse für die Durchführung <strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong>sprojekte. Als Gründe für e<strong>in</strong> Absehen von geme<strong>in</strong>deübergreifender<br />
Zusammenarbeit wird vor allem die unterschiedliche Leistungsfähigkeit<br />
von möglichen <strong>Kooperation</strong>spartnern angegeben (45%). Von je 36%<br />
der Befragten wird e<strong>in</strong> Verlust eigener Gestaltungsfreiheit sowie e<strong>in</strong> Verlust an<br />
Bürgernähe befürchtet. Weitere Hemmnisse für <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong><br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Mangel an <strong>Kooperation</strong> mit den Nachbargeme<strong>in</strong>den (26%), organisatorischer<br />
Mehraufwand (24%), unterschiedliche Leistungsbereitschaft der möglichen<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner (21%), rechtliche Unsicherheiten (21%) und ungleiche<br />
Berücksichtigung der Interessen der <strong>Kooperation</strong>spartner (14%).<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
28<br />
E<strong>in</strong> Drittel der Befragten begründet den Verzicht auf geme<strong>in</strong>deübergreifende<br />
Zusammenarbeit damit, dass es bislang ke<strong>in</strong>en Anlass für e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong><br />
gegeben habe.<br />
Abbildung 5<br />
Hemmnisse <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
Unterschiedliche Leistungsfähigkeit<br />
Verlust an Bürgernähe<br />
Verlust an eigener Gestaltungsfreiheit<br />
Ke<strong>in</strong> <strong>Kooperation</strong>sanlass vorhanden<br />
Mangel an <strong>Kooperation</strong> mit<br />
Nachbargeme<strong>in</strong>den<br />
Organisatorischer Mehraufwand<br />
Unterschiedliche Leistungsbereitschaft<br />
Rechtliche Unsicherheiten<br />
Ungleiche Berücksichtigung<br />
von Interessen<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Angaben <strong>in</strong> Prozent
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Zukunftsaussichten<br />
Für den Großteil der hessischen Kommunen ist <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> von<br />
großer Bedeutung. 83% der Befragten beabsichtigen, <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit<br />
zukünftig zu <strong>in</strong>tensivieren. Dies betrifft vor allem e<strong>in</strong>e verstärkte Zusammenarbeit/Zusammenführung<br />
kommunaler Verwaltungen (82%) und e<strong>in</strong>e verstärkte<br />
<strong>Kooperation</strong> im Bereich Freizeit und Tourismus (55%). Über 40% beabsichtigen<br />
e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Nutzung von Infrastruktur sowie e<strong>in</strong>e verstärkte <strong>Kooperation</strong> zur<br />
Förderung der Wirtschaft, über 30% planen e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit beim Standortmarket<strong>in</strong>g<br />
sowie bei der Ausweisung von Gewerbegebieten. <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong><br />
den Bereichen Landschaft und Ökologie (22%) und Flächennutzungsplanung (19%)<br />
werden <strong>in</strong> vergleichsweise ger<strong>in</strong>gem Umfang angestrebt.<br />
Abbildung 6<br />
Geplante Intensivierung von <strong>Kooperation</strong> nach Handlungsfeldern<br />
<strong>Kooperation</strong> von Teilen der Verwaltung<br />
Freizeit und Tourismus<br />
Geme<strong>in</strong>same Nutzung von Infrastruktur<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Standortmarket<strong>in</strong>g<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>:<br />
Stand und<br />
Perspektiven<br />
29<br />
<strong>Interkommunale</strong> Gewerbegebiete<br />
Landschaft und Ökologie<br />
Flächennutzungsplanung<br />
Siedlungsrahmenkonzeption<br />
E<strong>in</strong>zelhandel<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Angaben <strong>in</strong> Prozent<br />
■ Unterstützungsbedarf<br />
Die Intensivierung der <strong>in</strong>terkommunalen <strong>Kooperation</strong> ist allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong> Selbstläufer.<br />
Etwa zwei Drittel der Befragten sehen Unterstützungsbedarf bei der Umsetzung<br />
<strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>en. Der Unterstützungsbedarf bezieht sich vor allem<br />
auf f<strong>in</strong>anzielle Unterstützung (75%) und Beratung <strong>in</strong> rechtlichen Fragen (67%).<br />
Wichtig aus Sicht der Städte und Geme<strong>in</strong>den ist auch Beratung <strong>in</strong> fachlichen<br />
(themenbezogenen) und organisatorischen Fragenstellungen. Etwa e<strong>in</strong> Viertel der<br />
Befragten sieht die Notwendigkeit, die örtlichen <strong>Kooperation</strong>sprozesse durch<br />
externe Moderation zu unterstützen.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
4 Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
4.1 Auswahl<br />
Im Rahmen der durchgeführten Umfrage unter hessischen Städten und Geme<strong>in</strong>den<br />
wurde e<strong>in</strong>e Reihe guter <strong>Kooperation</strong>sbeispiele erhoben. E<strong>in</strong>e Auswahl dieser guten<br />
Beispiele wird nachfolgend dargestellt. Ziel ist es, den Städten und Geme<strong>in</strong>den,<br />
die e<strong>in</strong>e Intensivierung ihrer Zusammenarbeit planen oder bislang von <strong>Kooperation</strong>en<br />
abgesehen haben, Anregungen für eigene <strong>Kooperation</strong>sprojekte zu geben.<br />
Zu diesem Zweck be<strong>in</strong>halten die Projektbeschreibungen e<strong>in</strong>e ausführliche Darstellung<br />
der jeweiligen <strong>Kooperation</strong>sidee und deren Umsetzung e<strong>in</strong>schließlich der wesentlichen<br />
organisatorischen und f<strong>in</strong>anziellen Aspekte.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
30<br />
Die getroffene Auswahl bezieht sich auf Handlungsfelder, die im Rahmen des<br />
Stadtumbaus besondere Bedeutung haben (siehe auch Kapitel 1 Zukunftsaufgabe<br />
<strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong>). Im E<strong>in</strong>zelnen s<strong>in</strong>d dies die Themenfelder<br />
➔ Siedlungs- und Freiflächen,<br />
➔ lokale Wirtschaft,<br />
➔ Infrastruktur und<br />
➔ Verwaltung.<br />
Im Handlungsfeld Infrastruktur beschränkt sich die Auswahl auf Beispiele im Bereich<br />
der sozialen Infrastruktur. Auf e<strong>in</strong>e Beschreibung guter Beispiele im Bereich der<br />
technischen Infrastruktur wird verzichtet, da <strong>Kooperation</strong>en <strong>in</strong> diesem Feld <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
bereits fest etabliert und weit verbreitet s<strong>in</strong>d (siehe Kapitel 3 <strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Stand und Perspektive). Abschließend wird ergänzend zu<br />
den Beispielen <strong>in</strong> den genannten Handlungsfeldern e<strong>in</strong>e themenübergreifende<br />
<strong>Kooperation</strong> beschrieben.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus wird zusätzlich zu den ausgewählten hessischen Beispielen die<br />
Wohnungsmarktkooperation <strong>in</strong> der Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler dargestellt.<br />
Zwar bestehen auch <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Kooperation</strong>sansätze im Bereich der Wohnraumversorgung,<br />
e<strong>in</strong>e wie im Beispiel der Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler weit entwickelte<br />
<strong>Kooperation</strong> ist nach Kenntnisstand der Verfasser <strong>in</strong> diesem für die zukünftige<br />
Entwicklung von Städten und Geme<strong>in</strong>den wichtigen Themenfeld <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> noch<br />
nicht vorhanden.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Übertragbarkeit der Beispiele muss beachtet werden, dass es<br />
sich bei den <strong>Kooperation</strong>sprojekten um Reaktionen auf die spezifischen örtlichen<br />
Gegebenheiten handelt. Die gewählten <strong>Kooperation</strong>saufgaben, Organisationsformen,<br />
F<strong>in</strong>anzierungsarten und Arbeitsweisen stellen Ansätze dar, die vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund der jeweiligen lokalen Verhältnisse zu bewerten s<strong>in</strong>d.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Tabelle 5<br />
Übersicht der ausgewählten guten Beispiele nach Handlungsfeldern<br />
Siedlungs- und Lokale Soziale Verwaltung Themenübergreifende<br />
Freiflächen Wirtschaft Infrastruktur <strong>Kooperation</strong><br />
<strong>Interkommunale</strong>s Virtuelles Regionalforum Zweckverband Zweckverband<br />
Gewerbegebiet Gründerzentrum Fulda-Südwest „Kommunale „<strong>Interkommunale</strong><br />
Mittleres Fuldatal <strong>in</strong> der Schwalm Teilprojekt: Dienste Zusammenarbeit<br />
Geme<strong>in</strong>de- Immenhausen- Schwalm-Eder-West“<br />
übergreifende Espenau“<br />
Jugendarbeit<br />
Zweckverband Innovationsregion Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Zweckverband<br />
Raum Kassel Mitte Hofheim-Kelkheim „<strong>Interkommunale</strong><br />
Teilprojekt:<br />
Zusammenarbeit<br />
E<strong>in</strong>zelhandels-<br />
Schwalm-Eder-West“<br />
konzept für die<br />
(siehe auch Spalte<br />
Stadtregion Kassel<br />
themenübergreifende<br />
<strong>Kooperation</strong>)<br />
Region<br />
Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/<br />
Ahrweiler<br />
Teilprojekt:<br />
Wohnungsmarktkooperation<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
31<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
4.2 Gute Beispiele<br />
4.2.1 Handlungsfeld: Siedlungs- und Freiflächen<br />
<strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
<strong>Kooperation</strong>spartner: Stadt Felsberg, Geme<strong>in</strong>de Malsfeld, Stadt Melsungen, Geme<strong>in</strong>de<br />
Morschen, Stadt Spangenberg, Landkreis Schwalm-Eder<br />
Organisations-/Rechtsform: Zweckverband<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 1997<br />
Kontakt:<br />
Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal“<br />
Kurt Stöhr (Geschäftsführer)<br />
L<strong>in</strong>denstrasse 1 · 34323 Malsfeld<br />
Telefon: (0 56 61) 92 78 10 · Telefax: (0 56 61) 92 78 12<br />
E-Mail: zweckverband-gmf@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
www.gewerbegebiet-mittleres-fuldatal.de<br />
32<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
Für e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit bei der Entwicklung e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terkommunalen Gewerbegebiets<br />
sprachen e<strong>in</strong>erseits die naturräumlichen Gegebenheiten. Durch gesetzliche<br />
Vorschriften, wie Auenschutzgesetz (Ederaue/Fuldaaue), Freihaltung von Überschwemmungsgebieten<br />
und die Ausweisung von FFH-Gebieten gab es erhebliche<br />
E<strong>in</strong>schränkungen für die bauliche Entwicklung. Andererseits stiegen die qualitativen<br />
Anforderungen an vermarktbare Gewerbeflächen beispielsweise h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Verkehrsanb<strong>in</strong>dung.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund haben sich 1996 die Bürgermeister der nordhessischen<br />
Kommunen Felsberg, Malsfeld, Melsungen, Morschen und Spangenberg zur Zusammenarbeit<br />
entschlossen. Diese Entscheidung war verbunden mit dem Ziel, e<strong>in</strong>en<br />
wirksamen Strukturimpuls für die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung<br />
von Arbeitsplätzen zu setzen: Die Beteiligten s<strong>in</strong>d überzeugt, dass die geme<strong>in</strong>same<br />
Entwicklung der großen und attraktiven Gewerbefläche e<strong>in</strong> hochwertiges Angebot<br />
schafft, das die e<strong>in</strong>zelnen Kommunen alle<strong>in</strong>e nicht realisieren könnten.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Der erste Schritt der Zusammenarbeit war die Gründung des Zweckverbandes,<br />
der gleichzeitig die Funktion e<strong>in</strong>es Planungsverbandes nach § 205 Baugesetzbuch<br />
übernahm. Neben der Schaffung des Baurechts durch den Zweckverband wurde<br />
geme<strong>in</strong>sam die komplette Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur erstellt. Hier ist im Besonderen die<br />
Wiedere<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er Anschlussstelle an die BAB 7 und die Straßenverb<strong>in</strong>dung<br />
<strong>in</strong> das Fuldatal zur B 83 zu nennen.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Nach der grundsätzlichen E<strong>in</strong>igung auf den Standort im Geme<strong>in</strong>degebiet von<br />
Malsfeld begann man frühzeitig die Flächen anzukaufen. 10) Als ausgesprochen günstig<br />
für die Flächenakquise hat sich das parallel laufende Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren<br />
des Katasteramtes (heute: Amt für Bodenmanagement) erwiesen. Es wurde auch<br />
<strong>in</strong> größerem Umfang landwirtschaftliches Ersatzland gekauft, das bei Bedarf <strong>in</strong>teressierten<br />
Landwirten angeboten werden konnte. Die Grundstücksgeschäfte wurden<br />
vom Geschäftsführer des Zweckverbandes durchgeführt. Die genannten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
e<strong>in</strong>schließlich des persönlichen Engagements und der langjährigen<br />
Kontakte des Geschäftsführers machten es möglich, dass alle Flächen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es<br />
Jahres auf vollständig freiwilliger Basis erworben werden konnten. Nach Abschluss<br />
des Grunderwerbs im Jahr 1999 wurde im Jahr 2002 mit der Vermarktung begonnen.<br />
Das entstandene Gewerbeflächenangebot richtet sich vor allem an Logistikbetriebe.<br />
Zum e<strong>in</strong>en ist diese Zielrichtung kompatibel mit dem für die Gesamtregion Nordhessen<br />
formulierten Prioritätscluster 11) „Mobilität/Verkehrstechnologien/Logistik“.<br />
Zum anderen s<strong>in</strong>d die qualitativen Bed<strong>in</strong>gungen für diese Branche auf der entwickelten<br />
Fläche <strong>in</strong> hohem Umfang gegeben. Voraussetzung für e<strong>in</strong>e gute Vermarktung<br />
ist auch die vere<strong>in</strong>barte Selbstb<strong>in</strong>dung der beteiligten Kommunen, der<br />
zufolge ke<strong>in</strong>e konkurrierenden Gewerbeflächen im Verbandsgebiet ausgewiesen<br />
werden. Erste Vermarktungserfolge stellten sich auch sehr kurzfristig e<strong>in</strong>, <strong>in</strong>dem<br />
4 Unternehmen rund 15 ha Fläche erwarben.<br />
Die qualitativ hochwertige Gewerbefläche zeichnet sich aus durch die direkte Lage<br />
an der Autobahn, die Nachbarschaft zum Werk des Mediz<strong>in</strong>- und Pharmaherstellers<br />
B. Braun Melsungen und dem Sitz der EDEKA-Handelsgesellschaft <strong>Hessen</strong>r<strong>in</strong>g mbH.<br />
Aus dieser räumlichen Situation resultierte die erste Ansiedlung, e<strong>in</strong> Logistik-<br />
Unternehmen, welches eng mit der Fa. B. Braun <strong>in</strong> Melsungen zusammenarbeitet.<br />
Weitere Qualitätskriterien s<strong>in</strong>d der <strong>in</strong> der Nachbarschaft gelegene Bahnanschluss<br />
mit Conta<strong>in</strong>er-Bahnhof (Malsfeld), der direkte Autobahnanschluss (Malsfeld-Ostheim)<br />
und die neue Verb<strong>in</strong>dungsstraße zum Fuldatal (B 83). Die so geschaffene Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur<br />
ermöglicht e<strong>in</strong>en 24-Stunden-Betrieb, weitgehend ohne behördliche<br />
E<strong>in</strong>schränkungen, wie zum Beispiel Nachtfahrverbote.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
33<br />
Das <strong>in</strong>terkommunale Gewerbegebiet<br />
umfasst derzeit <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e Fläche<br />
von 40 ha. Die Entwicklung erfolgte<br />
<strong>in</strong> Teilabschnitten, begonnen wurde<br />
mit 30 ha, die aktuell um 10 ha<br />
ergänzt werden. Bei Bedarf ist e<strong>in</strong>e<br />
Erweiterung auf e<strong>in</strong>e Gesamtfläche<br />
von 50 bis 60 ha an diesem Standort<br />
möglich.<br />
<strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal<br />
10) Für den Ankauf wurde e<strong>in</strong>e Obergrenze von 7,50 EUR /m 2 für bebaubare Fläche und das 8fache der Bodenmesszahl (<strong>in</strong> DM) für Vekehrsflächen festgelegt.<br />
11) Zielsetzung des Regionalmanagements Nordhessen, vgl. www.regionnordhessen.de
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Organisation/Akteure<br />
Die anfängliche Befürchtung, durch die <strong>Kooperation</strong> eigene E<strong>in</strong>flussmöglichkeiten<br />
abzugeben, spielte bei der Wahl der Rechtsform e<strong>in</strong>e nicht unerhebliche Rolle.<br />
Mit der Gründung des Zweckverbandes konnte e<strong>in</strong>e weitgehende E<strong>in</strong>flussnahme<br />
der geme<strong>in</strong>dlichen Gremien gesichert werden. Es war ausdrücklicher Wunsch, dass<br />
Vertreter der Geme<strong>in</strong>deparlamente <strong>in</strong> den Entscheidungsgremien vertreten s<strong>in</strong>d,<br />
um den „Durchgriff“ der Kommunalpolitik zu gewährleisten. Des Weiteren bed<strong>in</strong>gt<br />
auch die Funktion als Planungsverband im S<strong>in</strong>ne des § 205 des Baugesetzbuches<br />
die gewählte Rechtsform.<br />
Verbandsorgane des Zweckverbands:<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
34<br />
➔ Die Verbandsversammlung (mit 18 stimmberechtigten Vertretern<br />
der beteiligten Kommunen und e<strong>in</strong>em nicht stimmberechtigten Vertreter<br />
des Schwalm-Eder-Kreises) tagt 2-3 mal pro Jahr.<br />
➔ Der Verbandsvorstand (die 5 Bürgermeister und der Landrat<br />
des Schwalm-Eder-Kreises) tagt nach Bedarf, um die aktuellen Aufgaben<br />
zu erledigen.<br />
➔ Der Geschäftsführer arbeitet ehrenamtlich mit e<strong>in</strong>er Aufwandsentschädigung<br />
und wird durch e<strong>in</strong>e Halbtags-Sekretär<strong>in</strong> unterstützt.<br />
Für E<strong>in</strong>zelaspekte werden zusätzliche öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barungen<br />
geschlossen. Beispielsweise mussten die bei der Herstellung der Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur<br />
anfallenden Kosten <strong>in</strong> Höhe von 2,85 Mio. EUR vom Zweckverband und damit<br />
von den beteiligten Kommunen getragen werden. Die Kostenaufteilung wurde<br />
durch e<strong>in</strong>e gesonderte öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung geregelt, die die direkten<br />
Nutznießer, zum Beispiel durch Entlastung der Innerortslagen, stärker an den<br />
Kosten beteiligt.<br />
Die Beratung <strong>in</strong> der Startphase erfolgte durch die GKH (Gesellschaft für Kommunalbau,<br />
Kassel). Auf längerfristige externe Beratung wurde weitgehend verzichtet.<br />
Nur auf Projektebene wird bei Bedarf Beratung <strong>in</strong> Anspruch genommen. Dauerhafte<br />
Unterstützung gewährt die Wirtschaftsförderungsabteilung des Landkreises<br />
Schwalm-Eder.<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Der Zweckverband nahm die notwendigen Kredite auf und verwendet die erzielten<br />
Vermarktungserlöse zur Reduzierung der Schulden. Die Umlage 12) dient der F<strong>in</strong>anzierung<br />
von Z<strong>in</strong>s und Tilgung. Die Gewerbesteuere<strong>in</strong>nahmen fließen anteilmäßig<br />
an die Kommunen. Dieses Modell hat sich bewährt, da durch dieses Verfahren unter<br />
anderem die Kreditgrenzen der E<strong>in</strong>zelkommunen nicht berührt werden.<br />
12) Der <strong>in</strong> der Zweckverbandssatzung festgelegte Verteilungsschlüssel ist an den E<strong>in</strong>wohnerzahlen der Kommunen orientiert.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Die für die Erschließung des <strong>in</strong>terkommunalen Gewerbegebietes notwendigen<br />
Ausgaben konnten mit Hilfe der Fördermittel aus dem Ziel 2-Programm des<br />
Europäischen Regionalfonds verhältnismäßig niedrig gehalten werden.<br />
Für die Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur (ausgenommen Ingenieurleistungen) konnten 70 %<br />
der Ausgaben aus GVFG 13) -Mitteln f<strong>in</strong>anziert werden.<br />
Infobox 2<br />
Förderprogramm: Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Förderung<br />
der regionalen Entwicklung<br />
Fördergegenstand:<br />
Ansprechpartner:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Für Landesteile, die <strong>in</strong> ihrer Wirtschaftskraft den Landesdurchschnitt nicht<br />
erreichen, Unterstützung bei der Bewältigung des Strukturwandels durch<br />
gezielte Hilfen an Unternehmen und durch den Ausbau der wirtschaftsnahen<br />
Infrastrukturen. Das Programm umfasst die Förderbereiche:<br />
a. Betriebliche Investitionen<br />
b. Regionale Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement<br />
c. Regionales Standortmanagement<br />
d. Infrastrukturen für die Ansiedlung und Entwicklung von<br />
Unternehmen/Projekten, die im Rahmen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen<br />
<strong>Kooperation</strong> verwirklicht werden, wird ausdrücklich Vorrang<br />
e<strong>in</strong>geräumt!<br />
e. Tourismus<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Dr. Re<strong>in</strong>hard Cuny<br />
Kaiser-Friedrich-R<strong>in</strong>g 75<br />
65185 Wiesbaden<br />
Telefon: (0611) 815-22 59<br />
E-Mail: re<strong>in</strong>hard.cuny@hmwvl.hessen.de<br />
www.wirtschaft.hessen.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
35<br />
■ Ausblick<br />
Es war von Anfang an beabsichtigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den<br />
beteiligten Kommunen perspektivisch über die Umsetzung des <strong>Interkommunale</strong>n<br />
Gewerbegebietes h<strong>in</strong>ausgehen sollte.<br />
Aktuell wurde der Zweckverband <strong>in</strong> das Programm Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
aufgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer<br />
Bauhof und/oder e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Personalverwaltung umgesetzt werden kann.<br />
Die Zusammenarbeit im Tourismus soll zum Beispiel durch e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Verkehrsbüro verstärkt werden. Als Fazit formulieren die Beteiligten, dass die<br />
Zusammenarbeit als Strategie verstanden und zukünftig weiterentwickelt wird.<br />
13) Geme<strong>in</strong>deverkehrsf<strong>in</strong>anzierungsgesetz
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Zweckverband Raum Kassel<br />
Teilprojekt: E<strong>in</strong>zelhandelskonzept für die Stadtregion Kassel<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Organisations-/Rechtsform:<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit:<br />
Kontakt:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Ahnatal, Baunatal, Fuldabrück, Fuldatal, Kassel,<br />
Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, Schauenburg, Vellmar<br />
Zweckverband<br />
1976 (Thema E<strong>in</strong>zelhandel)<br />
Zweckverband Raum Kassel<br />
Henrik Krieger<br />
Ständeplatz 13<br />
34117 Kassel<br />
Telefon: (05 61) 1 09 70 -19<br />
E-Mail: henrik.krieger@zrk-kassel.de<br />
www.zrk-kassel.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
36<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
Der Zweckverband Raum Kassel (ZRK) wurde auf der Basis des sog. Kassel-Gesetzes<br />
aus 1972 im Jahr 1974 gegründet. Ziel der Gründung war es, durch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Planung (Entwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung) im Verdichtungsbereich<br />
Kassel (Stadt und Umland) e<strong>in</strong>e geordnete städtebauliche Entwicklung zu<br />
gewährleisten.<br />
Unter dem E<strong>in</strong>druck massiver Ansiedlungs<strong>in</strong>teressen großflächiger Verbrauchermärkte,<br />
die die Entwicklung der gewachsenen Innenstädte, Stadtteilzentren und<br />
Ortskerne <strong>in</strong> Frage stellte, wurde schon 1976 das Handlungsfeld E<strong>in</strong>zelhandel<br />
<strong>in</strong> die geme<strong>in</strong>same Planung e<strong>in</strong>bezogen. Um die wohnortnahe Versorgung der<br />
Bevölkerung mit e<strong>in</strong>er breiten Palette an Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen,<br />
beschloss die Verbandsversammlung 1979 erstmals e<strong>in</strong>en kommunalen<br />
Entwicklungsplan Zentren (KEP-Zentren). Dieser steuert seitdem die Richtung<br />
des E<strong>in</strong>zelhandels <strong>in</strong> der Stadtregion Kassel und stellt so e<strong>in</strong>e nachhaltige Entwicklung<br />
der E<strong>in</strong>zelhandels- und Zentrenstruktur sicher. Dabei stehen die folgenden<br />
Ziele im Vordergrund:<br />
1. Nahversorgung 2. Zentren 3. Dezentrale Ansiedlung<br />
sichern stärken begrenzen<br />
■ Gegenstand/Ablauf 14)<br />
Der KEP-Zentren legt im Kern drei Versorgungsstufen fest: 15)<br />
➔ Nahversorgung sichern und entwickeln/Nahversorgungszentren: Hier kann<br />
mit der Baugebietsfestsetzung „Sonderfläche Nahversorgung“ gegebenenfalls<br />
e<strong>in</strong> Vollsortimenter bis 800 m 2 Verkaufsfläche (zzgl. 400 m 2 Getränkemarkt)<br />
planungsrechtlich gesichert werden. Mit weiteren kle<strong>in</strong>eren Geschäften kann<br />
auch e<strong>in</strong>e Ladengruppe („Sondergebiet Läden“) bis <strong>in</strong>sgesamt 1.700 m 2<br />
Verkaufsfläche entstehen.<br />
14) Siehe ausführlich: Zweckverband Raum Kassel: KEP-Zentren 4 /1998, ergänzt: 8/2000<br />
15) Vgl. Zweckverband Raum Kassel: E<strong>in</strong>zelhandelskonzept für die Stadtregion Kassel, Kommunaler Entwicklungsplan (KEP) Zentren
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
➔ Für die Stadtteil-/Nebenzentren s<strong>in</strong>d zentrale Bereiche <strong>in</strong> Plänen dargestellt.<br />
Hier gibt es zunächst ke<strong>in</strong>e Begrenzung der Verkaufsflächen; diese Zentren<br />
s<strong>in</strong>d die Schwerpunkte für die E<strong>in</strong>zelhandelsversorgung im Verbandsgebiet.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Ansiedlung ist allerd<strong>in</strong>gs das vorhandene E<strong>in</strong>zelhandelsangebot sowie<br />
die Verkehrserschließung zu berücksichtigen.<br />
➔ Für die Innenstadt Kassel als Mittelpunkt des Oberzentrums gibt es nach<br />
KEP-Zentren ke<strong>in</strong>erlei Flächen- oder Sortimentsbegrenzungen.<br />
Der KEP-Zentren wird jeweils nach fünf bis acht Jahren fortgeschrieben. Vor der<br />
erneuten Beschlussfassung werden jeweils Gutachten <strong>in</strong> Auftrag gegeben, um<br />
neue Entwicklungstendenzen zu erkennen, die Zentrenstruktur zu überprüfen und<br />
die Strategie zur Umsetzung zu optimieren.<br />
Wegen der besonderen Bedeutung des Lebensmittele<strong>in</strong>zelhandels für die wohnortnahe<br />
Versorgung werden darüber h<strong>in</strong>aus die Verkaufsflächen der großen<br />
Lebensmittelanbieter regelmäßig Ende des Jahres im Rahmen e<strong>in</strong>er Ortsbegehung<br />
erhoben. Hierdurch verfügt der ZRK über stets aktuelle Daten, die gegebenenfalls<br />
e<strong>in</strong>e Reaktion auf e<strong>in</strong>e veränderte Versorgungslage ermöglichen.<br />
Von Vorteil für die Umsetzung des E<strong>in</strong>zelhandelskonzeptes ist, dass der Zweckverband<br />
Planungsträger des geme<strong>in</strong>samen Flächennutzungsplanes ist. Die Aussagen<br />
des Zentrenkonzepts <strong>in</strong>sbesondere h<strong>in</strong>sichtlich der Zulässigkeit von großflächigem<br />
E<strong>in</strong>zelhandel können so optimal mit der Flächennutzungsplanung verzahnt werden.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
37<br />
Der KEP-Zentren bietet Kommunen Sicherheit bei der Beurteilung von E<strong>in</strong>zelhandelsprojekten<br />
und E<strong>in</strong>zelhandelsbetrieben verlässliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen sowie<br />
Planungssicherheit. Liegen Ansiedlungsvorhaben vor, die e<strong>in</strong>zelnen Bestimmungen<br />
des Zentrenkonzeptes widersprechen, lässt sich der Zweckverband von e<strong>in</strong>em<br />
Fachbeirat beraten. In diesem s<strong>in</strong>d der E<strong>in</strong>zelhandelsverband, das Koord<strong>in</strong>ierungsbüro<br />
der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer, das Regierungspräsidium,<br />
die Planungs- und Bauaufsichtsämter der Stadt Kassel sowie<br />
des Landkreises Kassel und die Verbraucherberatung vertreten. Der Fachbeirat<br />
erfüllt e<strong>in</strong>e wichtige Funktion, da hier kritische Ansiedlungsfragen abgestimmt<br />
werden. Hierdurch besteht e<strong>in</strong> breiter regionaler Konsens h<strong>in</strong>sichtlich der E<strong>in</strong>zelhandels-<br />
und Zentrenstruktur.<br />
Die über 20jährige <strong>Kooperation</strong> auf dem Gebiet des E<strong>in</strong>zelhandels ist äußerst<br />
erfolgreich. Die letzte gutachterliche Überprüfung der E<strong>in</strong>zelhandelsstuktur belegt,<br />
dass sich der Raum Kassel se<strong>in</strong>e hohe Versorgungsqualität und e<strong>in</strong>e stabile<br />
Zentrenstruktur bewahrt hat.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Organisation/Akteure<br />
Die zentralen Organe des Zweckverbands s<strong>in</strong>d entsprechend dem Hessischen<br />
Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit (KGG) Verbandsversammlung und<br />
Verbandsvorstand.<br />
Oberstes Organ des Verbandes ist die Verbandsversammlung. Sie wird unmittelbar<br />
durch die Gremien der Verbandsmitglieder besetzt, derzeit 51 Vertreter,<br />
abhängig von der E<strong>in</strong>wohnerzahl. Die Verbandsversammlung trifft alle grundsätzlichen<br />
Entscheidungen des Zweckverbands.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
38<br />
Der Verbandsvorstand stellt geme<strong>in</strong>sam mit dem Geschäftsführer die Exekutive<br />
des Zweckverbandes dar. Der Verbandsvorstand besteht aus dem Oberbürgermeister<br />
der Stadt Kassel und dem Landrat des Landkreises Kassel sowie e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Magistratsmitglied der Stadt Kassel und e<strong>in</strong>em Bürgermeister e<strong>in</strong>er kreisangehörigen<br />
Verbandskommune. Der Geschäftsführer wird vom Verbandsvorstand berufen;<br />
er ist Leiter der Dienststelle, <strong>in</strong> der die Verbandsarbeit vorbereitet und ausgeführt<br />
wird. Die konkreten Aufgaben s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Verbandssatzung festgelegt.<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Die Verbandsaktivitäten werden durch e<strong>in</strong>e Verbandsumlage f<strong>in</strong>anziert. Ca. 30%<br />
bis 40% s<strong>in</strong>d als vom Verband erbrachte Leistungen e<strong>in</strong>zelnen Verbandsmitgliedern<br />
direkt zuzuordnen. Hierzu führen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Leistungsnachweise,<br />
die jährlich rückwirkend berechnet werden. Von den verbleibenden 60% bis<br />
70% trägt die Stadt Kassel die Hälfte, die andere Hälfte teilen sich der Landkreis<br />
und die kreisangehörigen Verbandskommunen nach ihrer jeweiligen E<strong>in</strong>wohnerzahl.<br />
■ Weitere <strong>Kooperation</strong>en im Zweckverband Raum Kassel<br />
Der ZRK ist zuständig für die Flächennutzungsplanung und erstellt den Landschaftsplan<br />
gemäß § 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes. Im Rahmen der Kommunalen<br />
Entwicklungsplanung wird neben dem KEP-Zentren e<strong>in</strong> KEP-Verkehr und e<strong>in</strong> Siedlungsrahmenkonzept<br />
erstellt. Das Siedlungsrahmenkonzept stellt e<strong>in</strong>en umfassenden<br />
kommunalen Entwicklungsplan dar, der die Siedlungsentwicklung im Verbandsgebiet<br />
bis 2005 umreißt und derzeit fortgeschrieben wird.<br />
Auf Wunsch der Verbandsmitglieder führt der Zweckverband auch geme<strong>in</strong>deübergreifende<br />
Entwicklungsmaßnahmen nach § 165 BauGB durch. E<strong>in</strong> Beispiel hierfür<br />
ist die Entwicklung des Güterverkehrszentrums mit ca. 60 ha auf drei Gemarkungen<br />
des Verbandsgebietes.<br />
■ Ausblick<br />
Die Aufgaben des Zweckverbands entwickeln sich prozesshaft. Auf Anforderungen<br />
seitens der Verbandsmitglieder kann somit flexibel reagiert werden.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler<br />
Teilprojekt: Wohnungsmarktkooperation<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Organisation:<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit:<br />
Kontakt:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Stadt Bonn, Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis, Landkreis Ahrweiler, Städte und<br />
Geme<strong>in</strong>den der genannten Landkreise<br />
Informelle <strong>Kooperation</strong> im Rahmen e<strong>in</strong>es regionalen Arbeitskreises<br />
(:rak), projektbezogene öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barungen<br />
1991 Gründung des :rak<br />
1993 Beg<strong>in</strong>n der <strong>Kooperation</strong> im Bereich Wohnungsmarkt<br />
:rak – Geschäftsstelle<br />
Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis<br />
Gabriele Strüwe<br />
Walter Wiehlpütz<br />
Kaiser-Wilhelm-Platz 1<br />
53721 Siegburg<br />
Telefon: (0 22 41) 13-24 00, 13-24 49<br />
E-Mail: gabriele.struewe@rhe<strong>in</strong>-sieg-kreis.de<br />
walter.wiehlpuetz@rhe<strong>in</strong>-sieg-kreis.de<br />
www.wohnregion-bonn.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
Die Entscheidung des Deutschen Bundestags, se<strong>in</strong>en Sitz und den Kernbereich<br />
der Regierungsfunktionen von Bonn nach Berl<strong>in</strong> zu verlagern, stellte die Stadt Bonn<br />
und ihren Verflechtungsbereich (Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis, Landkreis Ahrweiler) vor die<br />
Perspektive e<strong>in</strong>es grundlegenden und im Zeitraffer stattf<strong>in</strong>denden Strukturwandels.<br />
Diesen zu bewältigen und die Region neu im nationalen und <strong>in</strong>ternationalen<br />
Standortwettbewerb zu positionieren, erforderte die Bündelung regionaler Kräfte<br />
und e<strong>in</strong>e regional abgestimmte Strategie. Als Plattform für die regionale <strong>Kooperation</strong><br />
wurde e<strong>in</strong>en Tag nach dem Hauptstadtbeschluss der „Regionale Arbeitskreis<br />
Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler“ (:rak) gegründet.<br />
39<br />
Schwerpunkt der regionalen Zusammenarbeit war zunächst die Wohnungsmarktkooperation.<br />
Es wurde davon ausgegangen, dass nur e<strong>in</strong> Teil der Bundesbeschäftigten<br />
se<strong>in</strong>en Wohnsitz <strong>in</strong> der Region aufgibt. Da die „Vere<strong>in</strong>barung über die<br />
Ausgleichsmaßnahmen <strong>in</strong> der Region Bonn“ als Kompensation die Verlagerung<br />
beziehungsweise die Ansiedlung öffentlicher und wissenschaftlicher E<strong>in</strong>richtungen<br />
sowie privatwirtschaftlicher Unternehmen <strong>in</strong> der Region Bonn vorsah, war kurzbis<br />
mittelfristig mit e<strong>in</strong>er Nettozunahme des Wohnraumbedarfes zu rechnen. E<strong>in</strong>e<br />
nach Art und Menge bedarfsgerechte Wohnraumversorgung wurde damit zur<br />
Voraussetzung für den anvisierten Strukturwandel.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Darüber h<strong>in</strong>aus wurden der hohe Wohn- und Freizeitwert sowie das reizvolle Landschaftsbild<br />
der Region als wichtige Stärke des Raums im Standortwettbewerb<br />
e<strong>in</strong>geschätzt. E<strong>in</strong>er weiteren Zersiedelung des Raums und e<strong>in</strong>er unkontrollierten<br />
Verkehrszunahme sollte durch e<strong>in</strong>e Orientierung der Siedlungsentwicklung am<br />
schienengebundenen Personennahverkehr/leistungsfähigen ÖPNV sowie durch e<strong>in</strong>e<br />
angemessene Siedlungsdichte entgegengewirkt werden. Ziel war es, <strong>in</strong>nerhalb der<br />
Wohnungsmarktkooperation e<strong>in</strong>e besondere Bau- und Planungskultur zu etablieren,<br />
die das Image der Region positiv prägt und so e<strong>in</strong>en Beitrag zu Bewältigung des<br />
erforderlichen Strukturwandels leistet.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
40<br />
Grundlage für die Zusammenarbeit war die Verständigung auf zwei geme<strong>in</strong>same<br />
Leitbilder. Der :rak entwickelte e<strong>in</strong> „Fünf-Säulen-Konzept“, das das strukturpolitische<br />
Leitbild für die Region darstellt. 16) Als raumordnerische Zielvorgabe verpflichtet<br />
sich der :rak dem Leitbild der dezentralen Konzentration. Es sieht e<strong>in</strong>e ausgewogene<br />
Entwicklung vor, die sich nicht auf das Oberzentrum Bonn beschränkt, sondern<br />
auch die zahlreichen Mittelzentren der Region stärkt. Damit wird das Ziel formuliert,<br />
die weitere Entwicklungsdynamik zu bündeln und auf die bestehenden Siedlungsstrukturen<br />
zu konzentrieren. Vorrang genießen Nachverdichtungen im <strong>in</strong>nerstädtischen<br />
Bereich und Neuentwicklungen <strong>in</strong> räumlicher Nähe möglichst zum Schienenverkehr,<br />
zum<strong>in</strong>dest im Bereich e<strong>in</strong>es leistungsfähigen ÖPNV.<br />
Von 1993 bis 1995 wurde e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Wohnungsmarktuntersuchung durchgeführt.<br />
Ziel war nicht nur die gutachterliche Analyse des regionalen Wohnungsmarkts.<br />
Wesentlicher Bestandteil war auch e<strong>in</strong> moderierter Informationsaustausch<br />
und Diskussionsprozess, der alle beteiligten Kommunen und weitere relevante<br />
regionale Wohnungsmarktakteure e<strong>in</strong>band und so e<strong>in</strong>e Verständigung über die zu<br />
erwartenden Entwicklungen und wohnungsmarktpolitischen Ziele herbeiführte.<br />
Im Ergebnis be<strong>in</strong>haltet die Wohnungsmarktuntersuchung e<strong>in</strong>e nach Art und Menge<br />
differenzierte Bestimmung des Wohnungsbedarfes bis zum Jahr 2010. Gegenüberstellend<br />
wurden die regionalen Wohnbaulandpotenziale identifiziert und nach<br />
geme<strong>in</strong>sam vere<strong>in</strong>barten Kriterien bewertet. Die Untersuchung unterteilt die Baulandpotenziale<br />
<strong>in</strong> drei Lagekategorien (A bis C) und gibt Empfehlungen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Ausrichtungen auf Nutzergruppen, baulichen Dichte und Geschossigkeiten.<br />
Die Wohnungsmarktuntersuchung def<strong>in</strong>iert schließlich Anforderungen an städtebauliche,<br />
soziale, ökologische und ökonomische Qualitäten als Orientierungshilfe<br />
für die beteiligten Städte und Geme<strong>in</strong>den. 17)<br />
16) Die folgenden fünf Säulen tragen die Zukunft der Region: Wissenschaft und Forschung, umweltgerechte Städtelandschaft und Kulturregion,<br />
zukunftsorientierte Wirtschaftsstruktur, Zentrum für europäische und <strong>in</strong>ternationale Zusammenarbeit, Bonn als Bundesstadt.<br />
17) Ausführlich: Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (1995).
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Abbildung 7<br />
Wohnungsmarktuntersuchung: Ablauf und Ergebnisse der Analyse<br />
des regionalen Wohnbaulandpotenzials<br />
Ablauf und Ergebnisse der Potenzialanalyse<br />
Sonstige<br />
von den<br />
Kommunen<br />
nicht<br />
angegebenen<br />
Flächen<br />
? ha<br />
306 von den Städten und Geme<strong>in</strong>den<br />
angegebene Wohnbaulandpozentiale<br />
≥ 1 Hektar<br />
Gesamtgröße: 1.440 -1.470 ha<br />
Kriterium 1<br />
Anb<strong>in</strong>dung an den<br />
schienengebundenen ÖPNV<br />
und/oder Bezug zu<br />
Arbeitsplatzschwerpunkten<br />
Kriterium 2<br />
Anb<strong>in</strong>dung an den<br />
nicht schienengebundenen<br />
ÖPNV (Busl<strong>in</strong>ien)<br />
Lage<br />
günstig<br />
930 -940 ha<br />
Lage<br />
ungünstig<br />
930 -940 ha<br />
Lage<br />
günstig<br />
160 -<br />
180 ha<br />
Lage<br />
ungünstig<br />
230 ha<br />
Rest:<br />
120 ha 1)<br />
Rest:<br />
120 ha 1)<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
41<br />
Kriterium 3<br />
• kurz-/mittelfristige<br />
Verfügbarkeit<br />
• langfristige<br />
Verfügbarkeit<br />
Kategorie<br />
A/A*<br />
840 - 850 ha<br />
90 ha<br />
Kat.<br />
B/B*<br />
140 -<br />
160 ha<br />
20 ha<br />
Kat.<br />
C<br />
110 ha<br />
120 ha<br />
Rest:<br />
120 ha 1)<br />
1) Die Kategorie „Rest“ enthält Wohnbaulandpotenziale, deren Entwicklung entweder zu weit fortgeschritten ist<br />
oder die aus sonstigen Gründen nicht <strong>in</strong> die Analyse e<strong>in</strong>bezogen wurden.<br />
Quelle: Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Das Impulsprogramm (1996 bis 1999) g<strong>in</strong>g als Empfehlung aus der Wohnungsmarktuntersuchung<br />
hervor. Ziel dieses regionalen Programms war es, die qualitativen<br />
wie quantitativen Maßgaben der Wohnungsmarktuntersuchung sowie den angestrebten<br />
Imagegew<strong>in</strong>n zeitnah zu realisieren. Die Städte und Geme<strong>in</strong>den der Region<br />
wurden aufgerufen, modellhafte Neubau- und Bestandsprojekte zu benennen.<br />
Diese sollten auf den <strong>in</strong> der Wohnungsmarktuntersuchung empfohlenen Bauflächen<br />
realisiert werden und den dort def<strong>in</strong>ierten Qualitätsmerkmalen (siehe Abbildung<br />
unten) entsprechen. Etwa 8.500 Wohne<strong>in</strong>heiten wurden mit Hilfe des Impulsprogramms<br />
errichtet. Die Förderung modellhaften Wohnungsbaus wurde im Jahr 2000<br />
mit dem Wettbewerb „Impulsauszeichnung“ fortgesetzt. Im Rahmen dieses<br />
Wettbewerbs wurden die bedeutendsten Impulsprojekte prämiert und e<strong>in</strong>er breiten<br />
Öffentlichkeit vorgestellt. 18)<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
Abbildung 8<br />
Auswahlkriterien des Impulsprogramms<br />
42<br />
Meldung von Projekten<br />
für das Impulsprogramm<br />
Orientierungshilfen für die Aufnahme<br />
<strong>in</strong> das Impulsprogramm und für<br />
die Aufnahme <strong>in</strong> Sonderprogramme<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>e Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
• ökologisch<br />
• ökonomisch<br />
• sozial<br />
Aufnahme <strong>in</strong> das<br />
Impulsprogramm<br />
Projekt 1<br />
Projekt 2<br />
Projekt 3<br />
projektspezifischer Filter<br />
2. Quantitative Kriterien<br />
• Herstellungskosten < 2.000 DM/m 2<br />
• Lage im E<strong>in</strong>zugsbereich<br />
e<strong>in</strong>es Haltepunkts<br />
3. Qualitätsmerkmale<br />
• städtebaulich-architektonisch<br />
– Nachverdichtung<br />
– Gebäudetypenmischung<br />
• sozial<br />
– flexible Grundrisse<br />
– betreutes Wohnen<br />
– Nutzer-/Mieterbeteiligung<br />
• ökologisch<br />
– Niedrighausstandard<br />
– Blockheizkraftwerk<br />
• ökonomisch<br />
– verdichtete Bauweise<br />
– Kostenobergrenze<br />
Quelle: Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler<br />
18) Siehe auch: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (2002)
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Aufbauend auf den etablierten <strong>Kooperation</strong>sstrukturen hat das Land Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen 2001 für die Teilregion Stadt Bonn und Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis e<strong>in</strong>en Modellversuch<br />
zur Wohnungsbauförderung gestartet. An die Stelle der Zuteilung von<br />
Förderkont<strong>in</strong>genten an e<strong>in</strong>zelne Kommunen tritt e<strong>in</strong>e regionale Budgetierung.<br />
Dies bedeutet, dass die Teilregion Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg e<strong>in</strong> Globalbudget zur Wohnungsbauförderung<br />
erhält, über dessen E<strong>in</strong>satz die Region im Konsens bestimmt.<br />
Durch die regionale Budgetierung wird die Teilregion Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg <strong>in</strong> die Lage<br />
versetzt, flexibler auf die konkreten örtlichen Verhältnisse reagieren zu können.<br />
Des Weiteren dienen die Mittel dazu, die <strong>in</strong> der Wohnungsmarktuntersuchung und<br />
im Impulsprogramm def<strong>in</strong>ierten Qualitätskriterien umzusetzen, <strong>in</strong>dem weitere<br />
<strong>in</strong>novative Wohnungsbauprojekte gefördert werden.<br />
Das Internetportal „wohnregion-bonn.de“ schließlich erweitert das über den<br />
Zeitraum der <strong>Kooperation</strong> aufgebaute Informations- und Kommunikationsnetzwerk<br />
<strong>in</strong> der Region. Da Standort- und Investitionsentscheidungen nicht auf lokaler,<br />
sondern <strong>in</strong> der Regel auf regionaler Ebene gefällt werden, führt die Informationsplattform<br />
verfügbare Bauflächen <strong>in</strong> der Region zu e<strong>in</strong>er Datenbank zusammen.<br />
Diese <strong>in</strong>formiert private Bauträger und private Bauherren umfangreich über<br />
die Merkmale der e<strong>in</strong>zelnen Bauflächen (Lage, Erschließung, Eigentümerstruktur,<br />
E<strong>in</strong>kaufsmöglichkeiten, Baurecht, etc.) und ermöglicht e<strong>in</strong>e nutzerspezifische<br />
Auswertung: Bauherren und Bauträger können die vorhandenen Angebote entsprechend<br />
ihren Anforderungen an Flächenzuschnitt, bauliche Dichte, Infrastrukturausstattung,<br />
etc. gezielt filtern und so schnell für ihr Vorhaben geeignete Bauflächen<br />
identifizieren. Das Internetportal <strong>in</strong>formiert des Weiteren über spezielle<br />
Wohnangebote <strong>in</strong> der Region (Wohnen im Alter, studentisches Wohnen) und bietet<br />
L<strong>in</strong>ks zu regionalen Immobilienplattformen für Kauf- und Miet<strong>in</strong>teressenten.<br />
Die Informationsplattform ist auf diese Weise e<strong>in</strong> wesentliches Element des regionalen<br />
Standortmarket<strong>in</strong>gs.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
43<br />
■ Organisation/Akteure<br />
Der Regionale Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/<br />
Ahrweiler ist e<strong>in</strong>e freiwillige <strong>Kooperation</strong>sform, <strong>in</strong> der alle 28 Städte und Geme<strong>in</strong>den<br />
der Region <strong>in</strong> Aufgabenfeldern der räumlichen Planung aktiv s<strong>in</strong>d. Seit 2001<br />
s<strong>in</strong>d die grundsätzlichen Fragen der regionalen Zusammenarbeit durch e<strong>in</strong>en<br />
<strong>Kooperation</strong>svertrag geregelt.<br />
Grundsätzlich vollzieht sich die Zusammenarbeit <strong>in</strong> der Region <strong>in</strong> zwei Schritten:<br />
Auf der regionalen Ebene wird zunächst e<strong>in</strong> Konsens über die Entwicklungsziele<br />
durch die Beteiligung der Städte und Geme<strong>in</strong>den der Region sowie der regionalen<br />
Akteure erzielt. Diese Absprachen be<strong>in</strong>halten die Umsetzungsstrategien konkreter<br />
Projekte und die <strong>in</strong>dividuell festgelegten Qualitätsmerkmale. Auf der lokalen<br />
Ebene erfolgt die Umsetzung der Projekte vor Ort unter Beachtung der geme<strong>in</strong>sam<br />
def<strong>in</strong>ierten Qualitätsvere<strong>in</strong>barung.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Der Regionale Arbeitskreis Entwicklung, Planung, Verkehr Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/<br />
Ahrweiler (:rak) ist das zentrale Gremium auf regionaler Ebene. Er tagt drei- bis<br />
viermal pro Jahr. In ihm s<strong>in</strong>d alle beteiligten Städte und Geme<strong>in</strong>den sowie die Landkreise<br />
vertreten. Die ständigen Mitglieder werden von den Kommunen entsendet;<br />
themenbezogen werden Berater und Gutachter h<strong>in</strong>zugezogen. Der :rak hat ke<strong>in</strong>e<br />
Beschlusskraft, spricht jedoch Empfehlungen aus, die von den entsprechenden<br />
Planungsgremien (Kreistagen, Stadt- bzw. Geme<strong>in</strong>deräten) umgesetzt werden.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
Zur Umsetzung spezieller auf regionale Ebene abgestimmter Projekte werden auch<br />
öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barungen getroffen, zu deren E<strong>in</strong>haltung beziehungsweise<br />
Umsetzung sich die Beteiligten verpflichten (Selbstb<strong>in</strong>dung). Zur Begleitung der<br />
Umsetzung von <strong>Kooperation</strong>sprojekten werden <strong>in</strong> der Regel Lenkungs- beziehungsweise<br />
Arbeitsgruppen gebildet. Darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong> regelmäßiger Austausch<br />
zwischen den Planungsgremien der Stadt Bonn, dem Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis und dem<br />
Landkreis Ahrweiler statt. Die Koord<strong>in</strong>ierung der laufenden <strong>Kooperation</strong>saufgaben<br />
erfolgt durch e<strong>in</strong>e Geschäftsstelle, die turnusmäßig zwischen der Stadt Bonn,<br />
dem Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis und dem Landkreis Ahrweiler wechselt.<br />
44<br />
Ergänzend f<strong>in</strong>den regionale Informationsveranstaltungen statt, zu der <strong>in</strong>sbesondere<br />
die relevanten regionalen Akteure sowie die Fachöffentlichkeit e<strong>in</strong>geladen werden.<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Die F<strong>in</strong>anzierung der Geschäftsstelle und des :rak (Prozessf<strong>in</strong>anzierung) erfolgt<br />
durch e<strong>in</strong>e im <strong>Kooperation</strong>svertrag geregelte Umlage zwischen der Stadt Bonn,<br />
dem Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis und dem Landkreis Ahrweiler. Der Verteilungsschlüssel für<br />
diese Umlage orientiert sich an der E<strong>in</strong>wohnerzahl der Beteiligten.<br />
F<strong>in</strong>anzierungsbedarfe zur Umsetzung vere<strong>in</strong>barter Projekte (Projektf<strong>in</strong>anzierung)<br />
werden <strong>in</strong> den projektbezogenen öffentlich-rechtlichen Vere<strong>in</strong>barungen geregelt.<br />
E<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag zur F<strong>in</strong>anzierung von E<strong>in</strong>zelprojekten leisten Sponsor<strong>in</strong>g<br />
und Sonderzahlungen (zum Beispiel durch Public-Private-Partnership) sowie<br />
Landes- und/oder Bundeszuschüsse. <strong>Interkommunale</strong> beziehungsweise regionale<br />
<strong>Kooperation</strong> war vielfach Voraussetzung für den Erhalt dieser Mittel.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Weitere <strong>Kooperation</strong>en der Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler<br />
Die Kommunen des :rak kooperieren außer im Bereich des Wohnungsmarkts auch<br />
auf anderen Gebieten räumlicher Planung. Zu nennen ist hier <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Erstellung e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>zelhandels- und Zentrenkonzeptes, das e<strong>in</strong> präventives<br />
Strategiekonzept zur Ansiedlung, Erweiterung und Umnutzung von E<strong>in</strong>zelhandels-,<br />
Freizeit- und Kulture<strong>in</strong>richtungen darstellt. 19)<br />
■ Ausblick<br />
Die Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler ist bei der Bewältigung des durch den<br />
Hauptstadtbeschluss ausgelösten Strukturwandels weit fortgeschritten. Im Zentrum<br />
der <strong>Kooperation</strong>saktivitäten steht heute die Anpassung der Region an die sich<br />
laufend wandelnden demographischen und wirtschaftsstrukturellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Dabei profitiert die Region von den etablierten <strong>Kooperation</strong>sstrukturen,<br />
die Teil e<strong>in</strong>es neuen Planungsmodells s<strong>in</strong>d. Die Steuerung der räumlichen<br />
Entwicklung durch Regional- beziehungsweise Gebietsentwicklungspläne „von oben“<br />
wird ergänzt durch die Aktivierung der regionalen Potenziale im Rahmen der<br />
<strong>Kooperation</strong> der Kommunen im :rak, also e<strong>in</strong>er Entwicklung „von unten“. Ziel ist<br />
es, mit Hilfe e<strong>in</strong>es regionalen Entwicklungs- und Bodenmanagements e<strong>in</strong> flexibleres<br />
und schnelleres Reagieren auf die sich immer rascher ändernden gesellschaftlichen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu ermöglichen.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund erfolgt derzeit e<strong>in</strong>e Fortführung der Wohnungsmarktkooperation,<br />
die mit e<strong>in</strong>er Konzeption für die Wohnraumversorgung bis 2020<br />
abschließen soll. Zu diesem Zweck werden die aus dem demographischen Wandel<br />
und der Differenzierung der Lebensstile resultierenden Anforderungen an<br />
e<strong>in</strong>e Wohnraumversorgung untersucht und dargestellt. Wichtiger Bestandteil der<br />
Fortführung der Wohnungsmarktuntersuchung ist darüber h<strong>in</strong>aus die Analyse<br />
<strong>in</strong>ter- und <strong>in</strong>traregionaler Wanderungen. 20)<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
45<br />
19) Ausführlich: Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (2002)<br />
20) Ausführlich: Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (2005)
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
4.2.2 Handlungsfeld: Lokale Wirtschaft<br />
Virtuelles Gründerzentrum <strong>in</strong> der Schwalm<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Geme<strong>in</strong>de Frielendorf, Geme<strong>in</strong>de Gilserberg, Geme<strong>in</strong>de<br />
Schrecksbach, Stadt Schwalmstadt, Geme<strong>in</strong>de Will<strong>in</strong>gshausen<br />
Organisation:<br />
Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft mit öffentlich-rechtlicher<br />
Vere<strong>in</strong>barung<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 2002<br />
Kontakt:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Rolf Herter (Gründungsmanager)<br />
Magistrat der Stadt Schwalmstadt<br />
Marktplatz 3 · Johannisstube<br />
34613 Schwalmstadt-Treysa<br />
Telefon: (0 66 91) 207-124<br />
E-Mail: gruenderzentrum@schwalmstadt.de<br />
www.vgz-schwalm.de<br />
46<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
H<strong>in</strong>tergrund der <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit ist die Erkenntnis, dass wirtschaftliche<br />
Entwicklung im ländlichen Raum nur <strong>in</strong> <strong>Kooperation</strong> erfolgreich se<strong>in</strong> kann.<br />
1996 wurde durch die Gründung des Vere<strong>in</strong>s für Regionalentwicklung <strong>in</strong> der Schwalm<br />
die Basis für die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit der Kommunen Schwalmstadt,<br />
Will<strong>in</strong>gshausen und Schrecksbach <strong>in</strong> den Bereichen Wirtschaft und Verkehr, Kultur,<br />
Tourismus, Gesundheitse<strong>in</strong>richtungen und soziale Infrastruktur geschaffen. Im<br />
Bereich Tourismus entwickelte sich beispielsweise e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit mit den<br />
Geme<strong>in</strong>den Schrecksbach und Will<strong>in</strong>gshausen, die im Jahr 1998 zum geme<strong>in</strong>sam<br />
getragenen Vere<strong>in</strong> Schwalm-Touristik e.V. führte.<br />
Im Sommer 2002 wurde zwischen den Geme<strong>in</strong>den Schwalmstadt und Frielendorf<br />
die Ausweisung e<strong>in</strong>es <strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebietes (Hollenbach II) vere<strong>in</strong>bart.<br />
Im gleichen Jahr wurden erste Überlegungen zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Gründerzentrums<br />
angestellt. Die Zusammenarbeit mehrerer Orte ist s<strong>in</strong>nvoll, um erstens die<br />
notwendige Menge an potenziellen Existenzgründern und zweitens e<strong>in</strong>e ausreichende<br />
Anzahl an Unternehmern für e<strong>in</strong> begleitendes Netzwerk zur Verfügung zu<br />
haben. In den folgenden beiden Jahren wurde e<strong>in</strong> Konzept für e<strong>in</strong> Gründerzentrum<br />
entwickelt, das sich zunächst an den Erfahrungen vergleichbarer E<strong>in</strong>richtungen<br />
orientierte. Am Ende dieses Prozesses rückte man von dem Grundgedanken des<br />
klassischen immobiliengebundenen Gründerzentrums ab. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtung <strong>in</strong> dieser<br />
Form mit Gebäude, Personal und Geschäftsführer erschien nicht s<strong>in</strong>nvoll, da <strong>in</strong><br />
der Region viele Liegenschaften leer stehen bzw. untergenutzt s<strong>in</strong>d und e<strong>in</strong> Mangel<br />
an geeigneten Büro- oder Produktionsräumen nicht besteht.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Das Ziel des kommunalen Zusammenschlusses war, effektiv und ohne E<strong>in</strong>satz von<br />
hohen F<strong>in</strong>anzmitteln gründungswillige Personen zu unterstützen. Gründer sollen<br />
motiviert werden, ihre Idee <strong>in</strong> der Region zu verwirklichen und nicht <strong>in</strong> die Oberzentren<br />
Kassel und Marburg abzuwandern.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Aus der Analyse der bestehenden hessischen Gründerzentren ergab sich, dass<br />
neben den räumlichen Angeboten und der Bereitstellung von Servicedienstleistungen<br />
die Kernaufgabe im Coach<strong>in</strong>g der Gründer besteht. Für diese Personengruppe soll der<br />
Gründungsaufwand reduziert und e<strong>in</strong> Beitrag zur Existenzsicherung geleistet werden.<br />
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde e<strong>in</strong>e Geschäftsstelle <strong>in</strong> den Räumen der Stadtverwaltung<br />
Schwalmstadt mit Gründungsmanager (ehrenamtlich) und e<strong>in</strong>er teilzeitbeschäftigten<br />
Projektassistent<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gerichtet. Teil des Angebotes ist auch die Internetplattform.<br />
Dort wird neben den notwendigen Informationen auch e<strong>in</strong> Chatroom<br />
zur Verfügung gestellt, der den Austausch unter den Existenzgründern ermöglicht.<br />
In der Region ansässige Unternehmen wurden angesprochen, damit sie ihre Erfahrungen<br />
und Kontakte zur Verfügung stellen, um so e<strong>in</strong> Unterstützungsnetzwerk<br />
aufzubauen. Die Idee, Patenschaften für Gründer zu vermitteln, ist maßgeblich <strong>in</strong><br />
den Gesprächen mit den Unternehmen entwickelt worden. Ziel ist es, die Erfahrungen<br />
und Sachkunde der bestehenden Betriebe und Personen zu nutzen, die<br />
Gründer bei der Geschäftsidee zu beraten und bei der Aufstellung des Geschäftsund<br />
F<strong>in</strong>anzierungsplanes zu unterstützen. Auf diesem Wege wurden Patenschaften<br />
mit Firmen und Kredit<strong>in</strong>stituten aufgebaut. Die fachliche Kompetenz der Gründungsberatung<br />
ist hierdurch nicht ausschließlich beschränkt auf die Person des Gründungsmanagers.<br />
Bestehende Institutionen werden selbstverständlich <strong>in</strong> das Netzwerk<br />
e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
47<br />
Wichtig ist auch der Austausch mit anderen aktiven E<strong>in</strong>richtungen dieser Art.<br />
Er wird ermöglicht durch die Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Hessischen Technologieund<br />
Gründerzentren. 21)<br />
Abbildung 9<br />
Netzwerk für Existenzgründer<br />
Soziales •<br />
Logistik •<br />
Kunststoff •<br />
Quelle: PLANUNGSGRUPPE IKOS, Berl<strong>in</strong><br />
Wirtschaftsförderung<br />
•<br />
Gründungsmanager<br />
•<br />
Banken/Sparkassen<br />
Vertreter der Vorstände<br />
• Technik<br />
• Handel<br />
• Fremdenverkehr<br />
21) Informationen unter: www.technologiezentren-hessen.de
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Die Kontaktaufnahme mit den Paten und E<strong>in</strong>richtungen des Netzwerkes erfolgt über<br />
den Gründungsmanager.<br />
Die Erfahrungen des seit knapp 3 Monaten tätigen Gründungsmanagers zeigen,<br />
dass die bisherigen Probleme der Gründungswilligen bzw. der am Beg<strong>in</strong>n ihrer<br />
Selbstständigkeit stehenden Unternehmer überwiegend im bürokratischen Bereich<br />
liegen. Hier wurden beispielsweise die langen Wartezeiten auf notwendige Genehmigungen<br />
oder die Vielfalt von Vorschriften im Wettbewerbsbereich genannt.<br />
Von besonderer Bedeutung s<strong>in</strong>d Fragen und Probleme der F<strong>in</strong>anzierung. E<strong>in</strong>e<br />
spezielle Form der Patenschaft übernehmen hier Banken und Sparkassen.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
Die Aufgabe des Gründungsberaters liegt schwerpunktmäßig <strong>in</strong> der Mittlerfunktion<br />
und der Grundberatung bezüglich der Chancen und Risiken der spezifischen<br />
Existenzgründung. Hier geht es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um Fragen der Kreditmittelaufnahme<br />
und den E<strong>in</strong>satz vorhandener Sicherheiten. Diese Beratung wird ergebnisoffen<br />
durchgeführt, so dass unter schwierigen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen evtl. auch von der<br />
Gründungsidee Abstand genommen wird.<br />
48<br />
Über den Gründungsmanager werden auch folgende Serviceleistungen angeboten:<br />
➔ Buchhaltungsservice: Das Gründerzentrum trägt die Kosten für die Tätigkeit<br />
e<strong>in</strong>es Steuerberaters, die bei der Durchführung der Buchhaltung für die<br />
Gründungsfirma entstehen (für die Dauer von 2 Jahren).<br />
➔ Schreibservice: Das Gründerzentrum organisiert e<strong>in</strong>en kostenlosen<br />
Schreibservice für Berichte etc.<br />
➔ Vermittlung von Kontakten zur Arbeitsverwaltung zum Beispiel für Teilzeitkräfte<br />
im Sekretariats- und/oder buchhalterischen Bereich.<br />
Abbildung 10<br />
Organisation der Gründungsberatung<br />
Schwalmstadt<br />
Anlaufstelle:<br />
Assistent<strong>in</strong> des<br />
Gründungsmanagers<br />
Frau Damm<br />
Telefon: (0 66 91) 207-124<br />
Netzwerk für<br />
Existenzgründer<br />
Quelle: PLANUNGSGRUPPE IKOS, Berl<strong>in</strong><br />
Existenzgründer/<strong>in</strong><br />
• Mobil-Telefon: (0174) 6 12 88 86<br />
• E-Mail: gruenderzentrum@schwalmstadt.de<br />
• Internet: www.vgz-schwalm.de<br />
Gründungsmanager<br />
Herr Rolf Herter<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner<br />
• IHK<br />
• Kreishandwerkerschaft<br />
• Arbeitsamt<br />
• Uni<br />
• E<strong>in</strong>zelhandelsverband<br />
Frielendorf<br />
Anlaufstelle:<br />
Herr Bgm. Fey<br />
Ziegenha<strong>in</strong>er Straße 2<br />
34621 Frielendorf<br />
Telefon: (0 66 84) 99 99- 20<br />
Gilserberg<br />
Anlaufstelle:<br />
Herr Bgm. Vestweber<br />
Bahnhofstraße 40<br />
34630 Gilserberg<br />
Telefon: (0 66 98) 9619- 0<br />
Schrecksbach<br />
Anlaufstelle:<br />
Herr Bgm. Diehl<br />
Alsfelder Straße 14<br />
34637 Schrecksbach<br />
Telefon: (0 66 98) 98 00- 0<br />
Will<strong>in</strong>gshausen<br />
Anlaufstelle:<br />
Herr Bgm. Vesper<br />
Loshäuser Weg 9<br />
34628 Will<strong>in</strong>gshausen/<br />
Wasserberg<br />
Telefon: (0 66 91) 96 39- 0
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Organisation/Akteure<br />
Es wurde die Organisationsform der Kommunalen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft nach KGG<br />
§3 gewählt. Aktives Organ ist der Arbeitsausschuss, der von den 5 Bürgermeistern<br />
der beteiligten Kommunen gebildet wird. Dieses Gremium benennt beispielsweise<br />
den Gründungsmanager.<br />
Der Gründungsmanager arbeitet flexibel nach Bedarf und erhält e<strong>in</strong>e Aufwandsentschädigung.<br />
Er wird unterstützt durch die bei der Stadt Schwalmstadt beschäftigte<br />
Projektassistent<strong>in</strong>. Mit dieser Organisationsform können bedarfsorientierte<br />
Angebote geschaffen werden und es besteht bei ger<strong>in</strong>ger Nachfrage nicht<br />
die Notwendigkeit, e<strong>in</strong>e Infrastruktur bereitstellen und f<strong>in</strong>anzieren zu müssen.<br />
Die aktuell laufende Modellphase ist auf 2 Jahre angelegt. Die bisherige Rechtsform<br />
hat sich aus Sicht der Beteiligten als niedrigschwellige Organisationsform<br />
bewährt. Allerd<strong>in</strong>gs könnte aus Sicht der Kommunen nach Ablauf der Modellphase<br />
e<strong>in</strong>e Überführung dieses Projektes <strong>in</strong> den <strong>in</strong> Gründung bef<strong>in</strong>dlichen kommunalen<br />
Zweckverband s<strong>in</strong>nvoll werden.<br />
Abbildung 11<br />
Organisation der <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit<br />
Vere<strong>in</strong>barung e<strong>in</strong>er kommunalen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
(Basis: Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit)<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
49<br />
Schwalmstadt<br />
Frielendorf<br />
Gilserberg<br />
Schrecksbach<br />
Will<strong>in</strong>gshausen<br />
Beschlussfassung durch die Gremien der Geme<strong>in</strong>den<br />
Beschlussvorlage<br />
Externe Berater<br />
• Wirtschaftsförderung<br />
des Kreises<br />
• N.N.<br />
Arbeitsausschuss<br />
• berät sämtliche Angelegenheiten<br />
•Vorschläge an die Gremien<br />
der Geme<strong>in</strong>den<br />
Bürgermeister<br />
der Geme<strong>in</strong>den<br />
Geschäftsführung<br />
Vorsitzender und Stellvertreter aus<br />
der Mitte des Arbeitsausschusses<br />
Gründungsmanager<br />
Verwaltung<br />
Quelle: PLANUNGSGRUPPE IKOS, Berl<strong>in</strong>
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Das virtuelle Gründerzentrum wird als Modell vom Hessischen Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium<br />
für 2 Jahre gefördert (siehe Infobox 2: „Förderprogramm: Richtl<strong>in</strong>ien des Landes<br />
<strong>Hessen</strong> zur Förderung der regionalen Entwicklung“, S. 35).<br />
Die Förderung des Landes <strong>Hessen</strong> umfasst die Personalkosten für Gründungsmanager<br />
und Assistent<strong>in</strong>. Ebenso die steuerliche/buchhalterische E<strong>in</strong>gangsberatung<br />
für die Gründungswilligen.<br />
Der restliche F<strong>in</strong>anzbedarf wird zwischen den beteiligten Kommunen – nach jeweiliger<br />
E<strong>in</strong>wohnerzahl – aufgeteilt.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
50<br />
■ Ausblick<br />
Die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit wird <strong>in</strong> Zukunft weiter zunehmen. So ist <strong>in</strong> der<br />
nächsten Zeit die Gründung e<strong>in</strong>es Zweckverbandes Schwalm-Eder-Süd geplant,<br />
unter dessen Dach die beteiligten Kommunen e<strong>in</strong>e Vielzahl von Geme<strong>in</strong>schaftsaufgaben<br />
bewältigen werden. So wurde beispielsweise der Antrag zum Programm<br />
Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> schon als Zweckverband gestellt. Das Entwicklungspotenzial<br />
der <strong>Kooperation</strong> wird perspektivisch <strong>in</strong> den folgenden Bereichen gesehen:<br />
➔ Tourismus<br />
➔ Geme<strong>in</strong>same Personalverwaltung<br />
➔ Wasser- und Abwasser<br />
(auch zur Sicherung bisheriger Arbeits- und Ausbildungsplätze)<br />
➔ <strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet<br />
(nur bei Ausbau der A 49)<br />
➔ Verwendung e<strong>in</strong>er Konversionsfläche für Wohnen, Freizeit, Sport<br />
(Teil des Antrages zum Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>)<br />
➔ Gründungszentrum nach Ablauf der 2jährigen Modellphase
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Innovationsregion Mitte<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner: Eisenach, Eschwege, Mühlhausen, Wartburgkreis,<br />
Werra-Meißner-Kreis<br />
Organisations-/Rechtsform: Informelle <strong>Kooperation</strong><br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 2004<br />
Kontakt:<br />
Stadtverwaltung Eschwege<br />
Stabsstelle Wirtschaftsförderung<br />
Wolfgang Conrad<br />
Obermarkt 22<br />
37269 Eschwege<br />
Telefon: (0 56 51) 304-337<br />
E-Mail: wolfgang.conrad@eschwege-rathaus.de<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
www.<strong>in</strong>novationsregion-mitte.de (wird derzeit aufgebaut)<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele 22)<br />
Obwohl Eisenach, Eschwege und Mühlhausen mit dem Fall der Mauer über Nacht<br />
von der Peripherie <strong>in</strong> die Mitte Deutschlands gerückt s<strong>in</strong>d, haben sich die wirtschaftsstrukturellen<br />
Probleme verschärft. H<strong>in</strong>zu kommt, dass die Region bis<br />
heute ke<strong>in</strong> vermarktungsfähiges wirtschaftsstrukturelles Profil entwickeln konnte.<br />
Gleichzeitig haben Strukturbrüche <strong>in</strong> der Wirtschaftsentwicklung der drei Städte zu<br />
noch anhaltendem kont<strong>in</strong>uierlichem Beschäftigungs- und damit zu Erwerbstätigenverlust<br />
sowie <strong>in</strong> der Folge zu Bevölkerungsverlust geführt. Nach e<strong>in</strong>er aktuellen<br />
Bevölkerungsvorausschätzung wird sich unter Status-quo-Bed<strong>in</strong>gungen der Bevölkerungsrückgang<br />
im Werra-Meißner-Kreis dramatisch verschärfen: Im Vergleich zu<br />
2002 wird sich die E<strong>in</strong>wohnerzahl bis 2050 halbieren. Bei der Gruppe der unter<br />
20jährigen und der Gruppe der 20- bis 60jährigen fällt der Werra-Meißner-Kreis im<br />
Landesdurchschnitt auf den letzten Platz. Die kont<strong>in</strong>uierlichen Wanderungsverluste<br />
dieser Gruppe, das heißt der Schwund an jungen Erwachsenen und Arbeitskräften<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem Geburtenrückgang, lassen e<strong>in</strong>en Fachkräftemangel befürchten,<br />
der den Wirtschaftsstandort gefährdet. Die demographische Entwicklung im<br />
Nachbarbundesland Thür<strong>in</strong>gen verläuft noch dramatischer. Nach wissenschaftlichen<br />
Untersuchungen wird Thür<strong>in</strong>gen im Jahr 2020 das „älteste“ von allen Bundesländern<br />
se<strong>in</strong>, anders ausgedrückt, e<strong>in</strong> Drittel aller Thür<strong>in</strong>ger wird voraussichtlich über 60 Jahre<br />
alt se<strong>in</strong>.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
51<br />
Im ökonomischen und stadtsoziologischen Interesse des Wirtschaftsdreiecks bedarf<br />
es daher e<strong>in</strong>er Doppelstrategie für die Bewältigung des Strukturwandels und zur<br />
Bewältigung des demographischen Schrumpfungsprozesses mit e<strong>in</strong>hergehendem<br />
Funktions- bzw. Zentralitätsverlust.<br />
22) Ausführlich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stadt Eschwege (2004). Conrad (2004)
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Voraussetzung für e<strong>in</strong>e wirksame Strukturpolitik <strong>in</strong> den ane<strong>in</strong>andergrenzenden<br />
Teilräumen ist die Schaffung e<strong>in</strong>es regionalen Konsenses über e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
wirtschafts- und technologiepolitische Zielrichtung sowie die Bündelung der wirtschaftspolitisch<br />
relevanten Kräfte. Um diese Konsensbildung zu forcieren, haben<br />
die Wirtschaftsbüros der drei Nachbarstädte Eisenach, Eschwege und Mühlhausen,<br />
des Wartburgkreises und die Netzwerkbüros für das Eschweger Netzwerk NIWE 23)<br />
und die Thür<strong>in</strong>ger LINAT 24) und KONAT 25) die Innovationsregion Mitte <strong>in</strong>s Leben gerufen.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
52<br />
Die vorrangige geme<strong>in</strong>same Aufgabe der Wirtschafts- und Netzwerkbüros ist die<br />
systematische Verbesserung der lokalen Innovationspotenziale, <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Stärkung der Innovationsfähigkeit der Unternehmen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit e<strong>in</strong>er<br />
strategieorientierten Qualifizierungs- und Weiterbildungsarbeit. Ziel ist, die<br />
Innovationsregion Mitte im <strong>in</strong>ternationalen Standortwettbewerb als „Entwicklungsund<br />
Anwenderzentrum für <strong>in</strong>novative Produktionstechnologien <strong>in</strong> den Bereichen<br />
Metall und Kunststoff“ zu profilieren.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Grundlage der <strong>Kooperation</strong> im Rahmen der Innovationsregion Mitte ist der Ansatz,<br />
die Potenziale kle<strong>in</strong>er und mittlerer Unternehmen (KMU) im Rahmen sich ergänzender<br />
Unternehmensnetzwerke auszuschöpfen und weiter zu entwickeln. Die vorhandenen<br />
Netzwerke NIWE, LINAT und KONAT ergänzen sich h<strong>in</strong>sichtlich ihrer<br />
Themenschwerpunkte und ergeben geme<strong>in</strong>sam das leistungsfähige Gesamtnetzwerk<br />
Innovationsregion Mitte. Dieses hat im Wesentlichen folgende Aufgaben:<br />
➔ Förderung von Innovation durch Informationsaustausch und <strong>Kooperation</strong> von KMU.<br />
➔ Akquisition von Aufträgen „von außen“ durch geme<strong>in</strong>sames Auftreten der<br />
Unternehmensnetzwerke der Innovationsregion Mitte und das damit mögliche<br />
differenziertere Leistungsangebot (Marktauftritt im Netzwerkverbund).<br />
➔ Intensivierung von Geschäftsbeziehungen <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Unternehmensnetzwerke.<br />
➔ Geme<strong>in</strong>same Messeauftritte, zum Beispiel Teilnahme an der Netzwerkmesse<br />
Bad Salzuflen.<br />
➔ Ausgleich vorhandener Über- und Unterkapazitäten <strong>in</strong>nerhalb des Netzwerkes<br />
im Bereich CAD durch Etablierung e<strong>in</strong>es entsprechenden Arbeitskreises zur<br />
Schaffung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Arbeitsplattform.<br />
➔ Bearbeitung von konkreten Kundenanfragen nach Teilefertigungen sowohl<br />
aus dem Netzwerk als auch von Externen, hier speziell von größeren Automobilzulieferern.<br />
Diese Aufgaben werden im Rahmen e<strong>in</strong>es engen Austausches zwischen dem<br />
Bildungswerk Eisenach und der Wirtschaftsförderung der Städte Eschwege und<br />
Mühlhausen, die jeweils als Netzwerkbüro dienen, gesteuert. Die Koord<strong>in</strong>ierungsaufgabe<br />
be<strong>in</strong>haltet <strong>in</strong>sbesondere die folgenden Aktivitäten:<br />
23) Netzwerk-Initiative Wirtschaft Eschwege<br />
24) Lieferantennetzwerk Automotive Thür<strong>in</strong>gen<br />
25) Konstruktionsnetzwerk Automotive Thür<strong>in</strong>gen
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
➔ Die Netzwerkbüros <strong>in</strong> Eisenach, Eschwege und Mühlhausen stehen den Netzwerkpartnern<br />
sowie externen Interessenten als Ansprechpartner zur Verfügung.<br />
Sie bündeln für das Netzwerk relevante Informationen und geben diese an die<br />
Netzwerkpartner weiter. Dies be<strong>in</strong>haltet auch die Weitergabe von Liefer- beziehungsweise<br />
Produktionsanfragen an geeignete Unternehmen des Netzwerkes.<br />
➔ Um persönliche Kontakte herzustellen und damit Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
zwischen den KMU zu erleichtern, werden Netzwerktreffen veranstaltet,<br />
bei denen die Netzwerkpartner sich und die Leistungspalette der beteiligten<br />
Unternehmen besser kennen lernen können.<br />
➔ Die Innovationsregion Mitte benötigt zur Weiterentwicklung der Innovationspotenziale<br />
strategische Partner beispielsweise aus dem Bereich Forschung und<br />
Weiterbildung. Des Weiteren werden neue Kundenbeziehungen angestrebt.<br />
Die Netzwerkbüros koord<strong>in</strong>ieren die Kontaktaufnahme zu neuen Partnern und<br />
zukünftigen Kunden.<br />
E<strong>in</strong>e zentrale Funktion des Netzwerkes ist schließlich das geme<strong>in</strong>same Market<strong>in</strong>g<br />
„nach außen“. Die Dachmarke Innovationsregion Mitte wird von den beteiligten<br />
Netzwerkbüros aktiv beworben. Auf diese Weise ist e<strong>in</strong>e stärkere Profilierung der<br />
Region und ihrer Unternehmen im <strong>in</strong>ternationalen Standortwettbewerb möglich.<br />
Die Innovationsregion Mitte fügt sich dabei <strong>in</strong> die Aktivitäten des Regionalmanagements<br />
Nordhessen e<strong>in</strong>. Der Schwerpunkt Metall und Kunststoff und die häufige<br />
Ausrichtung von Unternehmen als Zulieferer der Automobil<strong>in</strong>dustrie stützen die auf<br />
die Mobilitätswirtschaft ausgerichtete Clusterstrategie des Regionalmanagements.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
53<br />
■ Organisation/Akteure 26)<br />
Die Innovationsregion Mitte versteht sich als Wirtschaftsforum. Dieses soll mit<br />
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Politik und Wissenschaft<br />
besetzt werden und als <strong>in</strong>formelles Gremium die Schwerpunkte der technologiepolitisch<br />
relevanten Aktivitäten besprechen. Angesichts der Tatsache, dass<br />
die Innovationsregion Mitte e<strong>in</strong> sehr junges <strong>Kooperation</strong>sprojekt ist, bef<strong>in</strong>det<br />
sich dieses Wirtschaftsforum noch im Aufbau.<br />
Aus der Notwendigkeit heraus, die jeweils gebietskörperschaftbezogene und vor<br />
allem netzwerkbezogene Wirtschafts- und Technologiepolitik auf e<strong>in</strong>e länderübergreifende<br />
Arbeitsbasis zu stellen, hat sich das kle<strong>in</strong>e Wirtschaftsforum <strong>in</strong> Form<br />
e<strong>in</strong>er Nachbarschaftskonferenz der Städte Eisenach, Eschwege, Mühlhausen und<br />
der Landkreise Wartburg und Werra-Meißner gebildet. Hier werden die länderübergreifenden<br />
<strong>Kooperation</strong>en der e<strong>in</strong>zelnen Unternehmensnetzwerke, die<br />
geme<strong>in</strong>samen Probleme und <strong>in</strong>sbesondere die technologiepolitischen Aktivitäten<br />
und Geme<strong>in</strong>schaftsprojekte <strong>in</strong> der Region besprochen.<br />
Auf der Arbeitsebene s<strong>in</strong>d die Wirtschaftsförderungen der Städte Eschwege und<br />
Mühlhausen sowie das Bildungswerk Eisenach maßgeblich. Diese fungieren als Netzwerkbüros<br />
und leisten die erforderlichen Koord<strong>in</strong>ierungs- und Market<strong>in</strong>gaufgaben.<br />
26) Ausführlich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stadt Eschwege, a.a.O.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Als <strong>in</strong>formelles <strong>Kooperation</strong>sprojekt verfügt die Innovationsregion Mitte bislang<br />
über ke<strong>in</strong> Budget. E<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierung der Aktivitäten erfolgt ausschließlich durch<br />
die Netzwerkbüros (teilweise unterstützt durch Fördermittel, siehe auch Infobox 3)<br />
beziehungsweise durch die beteiligten Unternehmen. Derzeit wird e<strong>in</strong>e ergänzende<br />
F<strong>in</strong>anzierung durch Mittel des Europäischen Sozialfonds angestrebt, die e<strong>in</strong>e<br />
weitere Vertiefung der <strong>Kooperation</strong>saktivitäten ermöglichen würde.<br />
Infobox 3<br />
Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Innovationsförderung<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
54<br />
Fördergegenstand:<br />
Ansprechpartner:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Ziel ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen,<br />
die Schaffung und Erhaltung zukunftssicherer Arbeitsplätze sowie der<br />
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.<br />
Die Richtl<strong>in</strong>ien umfassen folgende Förderangebote des Landes <strong>Hessen</strong><br />
zur Innovationsförderung:<br />
• Forschung und Entwicklung<br />
• Innovationszentren<br />
•Technologieorientierte Gründerzentren<br />
•Telearbeit<br />
• Innovationsassistenten/<strong>in</strong>nen<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Friedrich-Ebert-R<strong>in</strong>g 75, 65185 Wiesbaden<br />
Das Land <strong>Hessen</strong> hat für e<strong>in</strong>e umfassende Information und die<br />
zielgerichtete <strong>in</strong>dividuelle Beratung von Unternehmen und Kommunen das<br />
BeratungsZentrum für Wirtschaftsförderung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> e<strong>in</strong>gerichtet:<br />
HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Abraham-L<strong>in</strong>coln-Str. 38-42<br />
65189 Wiesbaden<br />
Dipl.-oec. Ulrich Lohrmann: Telefon: (0611) 774-83 35<br />
E-Mail: ulrich.lohrmann@hessen-agentur.de<br />
Forschung und Entwicklung:<br />
Dipl.-Ing. Frank Syr<strong>in</strong>g: Telefon: (0611) 774-8615<br />
E-Mail: frank.syr<strong>in</strong>g@hessen-agentur.de<br />
www.wirtschaft.hessen.de<br />
■ Ausblick<br />
Die Innovationsregion Mitte ist bislang e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> im Aufbau. Mittelfristig<br />
wird e<strong>in</strong>e Verstärkung der personellen und f<strong>in</strong>anziellen Ressourcen angestrebt,<br />
um e<strong>in</strong>e weitere Intensivierung der Netzwerk- und Market<strong>in</strong>gaktivitäten zu erreichen.<br />
Als konkretes Projekt steht für 2006 auch die Gründung e<strong>in</strong>er Ausbildungs-GmbH<br />
an. Diese wird überbetriebliche Ausbildung durchführen und dazu beitragen, den<br />
spezifischen Facharbeiterbedarf der Netzwerkpartner zu befriedigen. Aktuell wird<br />
als Vorstufe für die geplante Ausbildungs-GmbH der erste Mechatroniker-Jahrgang<br />
vom NIWE-Modulgeberverbund durchgeführt.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Innerhalb e<strong>in</strong>er Förderung bis Ende 2006 wird mit Unterstützung von EU-F<strong>in</strong>anzmitteln<br />
auf hessischer Seite (Netzwerk NIWE) der weitere Aus- und Aufbau des<br />
Netzwerkes, <strong>in</strong>sb. zum Ausbau als Automobilzuliefernetzwerk, mittels Potenzialanalysen,<br />
Workshops, Aufbau e<strong>in</strong>er Datenbank, etc. betrieben. Ebenfalls mit Hilfe<br />
europäischer Unterstützung wird <strong>in</strong> Thür<strong>in</strong>gen (Netzwerke LINAT und KONAT)<br />
mit gleicher Zielsetzung und zusätzlich strategischer Ausrichtung auf den<br />
Forschungs- und Entwicklungsbereich die Etablierung und Weiterentwicklung<br />
des Gesamtnetzwerkes verfolgt.<br />
4.2.3 Handlungsfeld: Soziale Infrastruktur<br />
Regionalforum Fulda Südwest<br />
Teilprojekt: Geme<strong>in</strong>deübergreifende Jugendarbeit<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
<strong>Kooperation</strong>spartner: Bad Salzschlirf, Eichenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, 27)<br />
Kalbach, Neuhof,<br />
Organisation:<br />
Informeller Zusammenschluss und Kommunale<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft mit öffentlich-rechtlicher Vere<strong>in</strong>barung 28)<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 1998<br />
Kontakt:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Stephan Büttner (Geschäftsführer)<br />
Landrat des Landkreises Fulda,<br />
Abt. Dorferneuerung und ländliche Entwicklung<br />
Wash<strong>in</strong>gtonallee 4<br />
36041 Fulda<br />
Telefon: (06 61) 24 27-233<br />
E-Mail: buettners@ulf.hessen.de<br />
www.rffs.de<br />
www.jugend-fuldasuedwest.de<br />
55<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
Die Region Fulda Südwest wird durch sieben Geme<strong>in</strong>den im Landkreis Fulda gebildet.<br />
Es handelt sich um e<strong>in</strong>en ländlich geprägten Raum, der im E<strong>in</strong>flussbereich<br />
der Verdichtungsräume Fulda und Rhe<strong>in</strong>/Ma<strong>in</strong> zum Teil hohe Bevölkerungszuwächse<br />
zu verzeichnen hat und entsprechendem raumstrukturellen Veränderungsdruck<br />
ausgesetzt ist. In der Region leben 54.000 E<strong>in</strong>wohner auf 404 qkm Fläche (Bevölkerungsdichte<br />
von 134 E<strong>in</strong>wohnern/km 2 ) <strong>in</strong> 49 Ortsteilen. Der Südwestkreis fühlt<br />
sich zwar zur Region Fulda zugehörig, aber aufgrund der besonderen Lage und<br />
der anders entwickelten Wirtschafts- und Sozialstruktur werden eigene Entwicklungspotenziale<br />
gesehen. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund existiert seit 1998 das Regionalforum<br />
Fulda-Südwest. Dieser Zusammenschluss hat das Ziel, geme<strong>in</strong>sam die Entwicklung<br />
der Region voranzutreiben.<br />
27) Die Geme<strong>in</strong>de Hosenfeld ist Mitglied im Regionalforum Fulda Südwest, allerd<strong>in</strong>gs am Teilprojekt der geme<strong>in</strong>deübergreifenden Jugendarbeit nicht beteiligt.<br />
28) Für die geme<strong>in</strong>deübergreifende Zusammenarbeit wurde e<strong>in</strong>e öffentlich-rechtliche Vere<strong>in</strong>barung zwischen den beteiligten 7 Kommunen geschlossen.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Im Handlungsfeld Jugend und Soziales wurde e<strong>in</strong>es der ersten <strong>Kooperation</strong>sprojekte<br />
praktisch umgesetzt, da weitgehender Konsens über die hohe Bedeutung aktiver<br />
Jugendarbeit für die Region bestand. Durch die ländlich geprägte Struktur, verbunden<br />
mit e<strong>in</strong>em relativen guten sozialen Zusammenhalt, gibt es <strong>in</strong> der Region<br />
ke<strong>in</strong>e sozialen Brennpunkte. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d, wie <strong>in</strong> den meisten ländlichen Gebieten,<br />
eher wenig differenzierte Angebote für Jugendliche vorhanden, was zum Entstehen<br />
<strong>in</strong>formeller Jugendtreffpunkte etwa an überdachten Bushaltestellen oder Spielplätzen<br />
beitrug. Dies führte zu Konflikten mit der Nachbarschaft und der örtlichen<br />
Verwaltung. Auch der verhältnismäßig hohe Anteil der unter 14jährigen – im<br />
Südwestkreis liegt diese Bevölkerungsgruppe mit e<strong>in</strong>em Anteil von 18,7% um 4%<br />
höher als im <strong>Hessen</strong>durchschnitt – unterstützte die Schwerpunktsetzung des<br />
Regionalforums im Bereich Jugend und Soziales.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
56<br />
Freie Jugendarbeit, die e<strong>in</strong>e wichtige Funktion als Ergänzung zu konfessionellen<br />
und vere<strong>in</strong>sgebundenen Aktivitäten übernimmt, ist für e<strong>in</strong>zelne Kommunen des<br />
Regionalforums nur schwer dauerhaft zu f<strong>in</strong>anzieren. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der<br />
zunehmenden Anzahl von K<strong>in</strong>dern und Jugendlichen mit Migrationsh<strong>in</strong>tergrund <strong>in</strong><br />
der Region s<strong>in</strong>d aber besondere Angebote zur Integration notwendig.<br />
Zur Bewältigung dieser Problemstellung entwickelte die Region Fulda Südwest<br />
den folgenden Zielkatalog:<br />
➔ Jugend für Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n und Europa gew<strong>in</strong>nen<br />
➔ Förderung der offenen Jugendarbeit<br />
➔ Organisation von Jugendbegegnungen auf europäischer Ebene<br />
➔ Integration von Jugendlichen aus den GUS-Ländern<br />
➔ Schaffung von Jugendräumen<br />
➔ Gestaltung e<strong>in</strong>es Internetportals für die Jugend<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Nach diesen konzeptionellen Vorarbeiten wurde 1999 mit der geme<strong>in</strong>samen<br />
Anstellung e<strong>in</strong>es Sozialarbeiters durch sechs der sieben Kommunen des Regionalforums<br />
der erste Schritt zur Umsetzung geleistet. Es wurde e<strong>in</strong> präzises Anforderungsprofil<br />
für die Personalauswahl entwickelt. In Anbetracht des Ziels, Jugendliche<br />
aus den GUS-Ländern besser zu <strong>in</strong>tegrieren, wurde beispielsweise auf Kenntnisse<br />
der russischen Sprache besonderer Wert gelegt.<br />
Das Arbeitsfeld des Jugendpflegers umfasst die folgenden Aufgabenbereiche:<br />
➔ Erstellung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Jugendprogramms<br />
➔ Planung und E<strong>in</strong>richtung von Jugendräumen<br />
➔ Durchführung von Maßnahmen zur Integration von Problemgruppen<br />
➔ E<strong>in</strong>richtung und Betreuung von K<strong>in</strong>der- und Jugendprojekten<br />
➔ Beratung und Unterstützung von Vere<strong>in</strong>en bei Jugendprojekten
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Insbesondere die Schaffung von geeigneten Treffpunkten für die Jugendlichen <strong>in</strong><br />
den <strong>in</strong>sgesamt 41 Ortsteilen hat sich zu e<strong>in</strong>em Tätigkeitsschwerpunkt des Jugendpflegers<br />
entwickelt. Hier wurden <strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen,<br />
die vielfältige Eigenleistung zu erbr<strong>in</strong>gen hatten, zwischenzeitlich 25 Jugendräume<br />
neu geschaffen beziehungsweise renoviert und ausgebaut. Der Jugendpfleger<br />
versteht sich darüber h<strong>in</strong>aus als Sprachrohr der Jugendlichen und vermittelt bei<br />
Konflikten zwischen Jugendlichen, Kommunen und Bürgern.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Projekt ist die Erstellung und Pflege e<strong>in</strong>er eigenen Internetseite<br />
durch die Jugendlichen. Auch die regelmäßige Durchführung e<strong>in</strong>es Fußballturniers<br />
unter Beteiligung von Mannschaften aus verschiedenen Jugendräumen trägt zum<br />
besseren Kennenlernen, zur Identifikation mit dem eigenen Ortsteil und zur Integration<br />
von Problemgruppen bei.<br />
■ Organisation/Akteure<br />
Im Mai 1998 haben sich die sieben Geme<strong>in</strong>den im Südwesten des Landkreises<br />
Fulda, Bad Salzschlirf, Eichenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach und<br />
Neuhof zu dem Regionalforum zusammengeschlossen. Weiterh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d im Regionalforum<br />
der Landkreis Fulda, die Agentur für Arbeit Fulda, die Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
der Naturschutzverbände im Landkreis Fulda, der Kreis Fulda-Vogelsberg des<br />
Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege <strong>in</strong> der<br />
Stadt und im Landkreis Fulda, der Kreisbauernverband Fulda-Hünfeld, die Kreishandwerkerschaft,<br />
das Regionale Zentrum für Wissenschaft, Technik und Kultur<br />
sowie der Fremdenverkehrsverband Rhön e.V. vertreten.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
57<br />
Das Regionalforum trifft sich turnusmäßig e<strong>in</strong>- bis zweimal jährlich. Die Mitglieder<br />
wählen aus den Reihen der Bürgermeister für zwei Jahre e<strong>in</strong>e/n Vorsitzende/n<br />
und zwei stellvertretende Vorsitzende, die den Zusammenschluss nach außen<br />
vertreten und die Aktivitätsschwerpunkte vorbereiten. Die notwendigen <strong>in</strong>stitutionellen<br />
und organisatorischen Dienstleistungen werden von der Geschäftsführung<br />
erbracht. Diese wird derzeit von der Abteilung Dorferneuerung und Ländliche<br />
Entwicklung beim Landrat des Landkreises Fulda wahrgenommen. Teil des Regionalforums<br />
ist die Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der 7 Geme<strong>in</strong>den, deren<br />
Bürgermeister sich <strong>in</strong> monatlichen Treffen über Entwicklungsfragen austauschen.<br />
E<strong>in</strong>e überaus wichtige Funktion haben die Arbeitskreise des Regionalforums.<br />
An der Umsetzung der vere<strong>in</strong>barten Entwicklungsziele mit Hilfe konkreter Projekte<br />
arbeiten sechs Arbeitskreise <strong>in</strong> den folgenden Themenbereichen:<br />
➔ Wirtschaft<br />
➔ Landwirtschaft (umbenannt <strong>in</strong> Landnutzung, Gewässerschutz und Grundwasser)<br />
➔ Kultur/Fremdenverkehr<br />
➔ Energiee<strong>in</strong>sparung/Umweltschutz<br />
➔ Jugend/Soziales<br />
➔ Bürger und Verwaltungen
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Innerhalb des Regionalforums wird die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit für das<br />
Teilprojekt „Geme<strong>in</strong>deübergreifende Jugendarbeit“ auf Grundlage e<strong>in</strong>er öffentlich-rechtlichen<br />
Vere<strong>in</strong>barung geregelt. Anstellungsträger des Jugendpflegers<br />
ist die Geme<strong>in</strong>de Eichenzell. E<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeit besteht mit dem Jugendund<br />
Sportamt des Landkreises Fulda, welche sich <strong>in</strong> vielfältigen geme<strong>in</strong>samen<br />
Angeboten (Freizeiten, Kurse etc.) ausdrückt.<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
58<br />
Die Kosten werden zu 50 % gleichmäßig und zu 50 % nach E<strong>in</strong>wohnerzahlen auf<br />
alle sechs Kommunen verteilt. Ke<strong>in</strong>e der beteiligten Kommunen wäre alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> der<br />
Lage gewesen, e<strong>in</strong>en hauptamtlichen Jugendpfleger zu beschäftigen. Nur durch<br />
diese <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> ist e<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzierbare, professionelle und<br />
dauerhafte Betreuung und Weiterentwicklung e<strong>in</strong>es soziokulturellen Angebotes<br />
für Jugendliche <strong>in</strong> dieser ländlichen Region zu gewährleisten.<br />
Durch die geleisteten konzeptionellen Vorarbeiten des Regionalforums Fulda Südwest<br />
und das seit November 2001 vorliegende Regionale Entwicklungskonzept<br />
konnten im Rahmen des damaligen Ländlichen Regionalprogramms (Hessisches<br />
M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) rund 500.000,– EUR<br />
an Zuschüssen für Jugendprojekte akquiriert werden. Konkret konnten hier 21<br />
der 25 geschaffenen Jugendräume, die teilweise <strong>in</strong> Eigenleistung errichtet wurden,<br />
f<strong>in</strong>anziell unterstützt werden.<br />
■ Weitere <strong>Kooperation</strong>en des Regionalforums Fulda Südwest<br />
Innerhalb der weiteren Aktivitäten ist <strong>in</strong>sbesondere die Errichtung e<strong>in</strong>es Biomassekraftwerkes<br />
zu nennen. Hier wurde im Auftrag des Regionalforums mit Hilfe der<br />
f<strong>in</strong>anziellen Förderung durch das Hessische M<strong>in</strong>isterium für Umwelt, Ländlichen<br />
Raum und Verbraucherschutz e<strong>in</strong>e Machbarkeitsstudie erstellt. Des Weiteren konnte<br />
e<strong>in</strong>e Radwanderkarte für die Region erstellt und e<strong>in</strong> Museumsverbund aufgebaut<br />
werden.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Infobox 4<br />
Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
(Staatsanzeiger des Landes <strong>Hessen</strong> Nr.15 vom 11. 04. 2005)<br />
Fördergegenstand:<br />
Ansprechpartner:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
■ Ausblick<br />
Ziel ist der Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiver Lebensraum<br />
und Wahrung se<strong>in</strong>er Zukunftschancen durch Entwicklung se<strong>in</strong>er sozialen,<br />
wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale.<br />
Das Programm umfasst die Förderbereiche:<br />
• Regionale Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement<br />
• Eigenständige Entwicklung und Lebensqualität<br />
• Landtourismus<br />
• Bio-Rohstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft<br />
• Dorferneuerung<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium für Umwelt,<br />
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz<br />
Klaus Schüttler (Referatsleiter)<br />
Ma<strong>in</strong>zer Str. 80<br />
65189 Wiesbaden<br />
Telefon: (06 11) 815 -17 50<br />
E-Mail: k.schuettler@hmulv.hessen.de<br />
www.hmulv.hessen.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
59<br />
Durch die <strong>Kooperation</strong> der beteiligten Geme<strong>in</strong>den konnte e<strong>in</strong>e tragfähige<br />
<strong>Kooperation</strong>skultur aufgebaut werden. Damit s<strong>in</strong>d auch andere Felder der<br />
Zusammenarbeit, zum Beispiel geme<strong>in</strong>same Nutzung von Bauhöfen, vorstellbar.<br />
Diese Möglichkeiten sollen <strong>in</strong> Zukunft verstärkt geprüft werden.<br />
Der bisher <strong>in</strong>formelle Zusammenschluss soll <strong>in</strong> Kürze <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>getragenen<br />
Vere<strong>in</strong> überführt werden um somit e<strong>in</strong>e eigene Rechtsform zu haben und evtl.<br />
als Antragsteller für staatliche Förderprogramme auftreten zu können.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Hofheim-Kelkheim<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Organisations-/Rechtsform:<br />
Städte Hofheim am Taunus und Kelkheim (Taunus)<br />
Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft bis 2001, heute <strong>in</strong>formelle<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 1996<br />
Kontakt:<br />
Bürgermeister<strong>in</strong> Gisela Stang<br />
Ch<strong>in</strong>onplatz 2<br />
65719 Hofheim<br />
Telefon: (0 61 92) 202-216<br />
gstang@hofheim.de<br />
Bürgermeister Thomas Horn<br />
Gagernr<strong>in</strong>g 6<br />
65779 Kelkheim/Taunus<br />
Telefon: (0 61 95) 803-300<br />
E-Mail: buergermeister.horn@kelkheim.de<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
www.hofheim.de und www.kelkheim.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
60<br />
Die Städte Hofheim am Taunus und Kelkheim (Taunus) hatten <strong>in</strong> den 70er Jahren<br />
unabhängig vone<strong>in</strong>ander e<strong>in</strong> Hallenbad beziehungsweise e<strong>in</strong> komb<strong>in</strong>iertes Hallenund<br />
Freibad errichtet. Anfang der 90er Jahre waren diese Bäder hoch defizitär und<br />
massiv sanierungsbedürftig. Die Sanierung hätten <strong>in</strong> beiden Städten Ausgaben <strong>in</strong><br />
Millionenhöhe erfordert. H<strong>in</strong>zu kam e<strong>in</strong>e starke f<strong>in</strong>anzielle Belastung der städtischen<br />
Haushalte durch jährliche Betriebskostenzuschüsse von mehreren Hunderttausend Euro.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund angespannter kommunaler F<strong>in</strong>anzen sahen sich beide Städte<br />
nicht <strong>in</strong> der Lage, die Hallenbäder zu sanieren und den bisherigen Betrieb aufrecht<br />
zu erhalten. Es lag daher nahe, geme<strong>in</strong>sam nach Lösungen zu suchen. Ziel war es vor<br />
allem, Schul- und Vere<strong>in</strong>sschwimmern sowie regelmäßigen „Gesundheitsschwimmern“<br />
die Nutzung e<strong>in</strong>es nahe gelegenen Hallenbades zu ermöglichen. Dabei wurde<br />
frühzeitig auf Public-Private-Partnership (PPP) gesetzt: Die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung privaten<br />
Know-hows und Kapitals bei Planung, Bau und Betrieb des Hallenbades sollten die<br />
erforderlichen Investitionskosten m<strong>in</strong>imieren und die Städte von den wirtschaftlichen<br />
Risiken des Hallenbadbetriebes befreien.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Die Grundlage für e<strong>in</strong>e kooperative Lösungssuche wurde bereits Mitte der 90er<br />
Jahre geschaffen. Als 1996 das Hallenbad der Stadt Hofheim geschlossen werden<br />
musste, erfolgte für e<strong>in</strong>e Übergangszeit e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Nutzung des Hallenund<br />
Freibades Kelkheim unter Aufteilung der entstehenden f<strong>in</strong>anziellen Lasten.<br />
Da dies ke<strong>in</strong>e dauerhafte Lösung darstellen konnte, wurde die Errichtung e<strong>in</strong>es<br />
geme<strong>in</strong>samen Hallenbades angestrebt. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme gründeten<br />
die Städte 1998 e<strong>in</strong>e Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft (KAG) „Geme<strong>in</strong>sames<br />
Hallenbad Hofheim-Kelkheim“.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Diese sollte <strong>in</strong>sbesondere die folgenden Aufgaben erfüllen:<br />
➔ Ausarbeitung e<strong>in</strong>es konkreten F<strong>in</strong>anzierungs- und Betriebskonzeptes<br />
➔ Suche nach privaten Investoren und/oder Betreibern<br />
sowie künftigen Gesellschaftern<br />
➔ Koord<strong>in</strong>ierung, Bündelung und Abstimmung offener Fragen<br />
Nach Gesprächen mit mehreren privaten Investoren wurde 1999 e<strong>in</strong> privater<br />
Betreiber ausgewählt, mit dem geme<strong>in</strong>sam e<strong>in</strong> Betriebskonzept entwickelt wurde,<br />
das die Interessen der kooperierenden Städte optimal berücksichtigte. Angegliedert<br />
an e<strong>in</strong> Freizeitbad mit umfangreichen Bade- und Wellnessangeboten entstand<br />
e<strong>in</strong>e separate Schwimmhalle mit 25-Meter-Becken und Lehrschwimmbecken.<br />
Diese so genannte Vere<strong>in</strong>s- und Schulsport-Schwimmhalle ist baulich vom Freizeitbad<br />
getrennt und verfügt über gesonderte Duschen und Umkleiden sowie über<br />
e<strong>in</strong>en getrennten E<strong>in</strong>gang, was e<strong>in</strong>e konfliktfreie Nutzung durch Schulen und<br />
Vere<strong>in</strong>e aus Hofheim und Kelkheim, aber auch aus anderen Kommunen des Landkreises<br />
ermöglicht. Derzeit nutzen <strong>in</strong>sgesamt 13 Vere<strong>in</strong>e und 39 Schulen das<br />
Angebot. Der Betrieb, die Pflege und die Instandhaltung fallen <strong>in</strong> die Verantwortung<br />
des privaten Betreibers. Die Belegung durch Vere<strong>in</strong>e und Schulen wird durch<br />
die Stadtverwaltungen von Hofheim und Kelkheim gesteuert.<br />
Die E<strong>in</strong>trittspreise für die Nutzung des Freizeitbades außerhalb des Vere<strong>in</strong>s- und<br />
Schulsports wurden <strong>in</strong> der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert, da diese naturgemäß<br />
höher s<strong>in</strong>d als die der kommunalen Hallenbäder. Um die E<strong>in</strong>trittspreise für Bürger<br />
der kooperierenden Städte möglichst sozialverträglich zu gestalten, wurde geme<strong>in</strong>sam<br />
mit dem Investor e<strong>in</strong>e Bürger-Card entwickelt. Diese erlaubt den Bürgern<br />
aus Hofheim und Kelkheim e<strong>in</strong>e vergünstigte Nutzung des Freizeitbades. Aktiven<br />
„Gesundheitsschwimmern“ steht das zusätzlich verbilligte Frühschwimmen offen.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
61<br />
Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Hofheim-Kelkheim<br />
29) Gesetz über kommunale Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Organisation/Akteure<br />
Während der Investorensuche und der Konzeptionsphase war e<strong>in</strong>e klare Regelung<br />
der Zusammenarbeit erforderlich. In dieser Phase wurde die oben genannte<br />
Kommunale Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft gegründet. Auf Grundlage e<strong>in</strong>es schriftlichen<br />
Statuts im S<strong>in</strong>ne des §4 Abs. 2 KGG 29) wurden Aufgaben, Befugnisse und<br />
Geschäftsordnung der KAG vere<strong>in</strong>bart. Die Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft setzte sich aus<br />
14 Mitgliedern zusammen: Vertreten waren je 2 hauptamtliche Mitglieder aus<br />
den Magistraten und je 5 Mitglieder aus den Stadtverordnetenversammlungen.<br />
Die KAG wählte e<strong>in</strong>en Vorsitzenden, der als Verhandlungsführer und Sprecher<br />
gegenüber Dritten auftrat.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
62<br />
Nach Realisierung des Hallenbades wurde die KAG aufgelöst. Die laufende Zusammenarbeit,<br />
zum Beispiel die Abstimmung der Belegung durch Schulen und Vere<strong>in</strong>e,<br />
erfolgt heute <strong>in</strong> Form von <strong>in</strong>formeller <strong>Kooperation</strong> zwischen den Stadtverwaltungen.<br />
Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen den Städten und dem Investor ist e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>samer Vertrag. Dieser regelt sämtliche Pflichten und Rechte der Vertragspartner.<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Als Gegenleistung für den Bau der Schul- und Vere<strong>in</strong>ssporthalle durch den privaten<br />
Investor beteiligten sich die Städte mit e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>maligen Baukostenzuschuss von<br />
jeweils ca. 2,5 Mio. EUR (plus Mehrwertsteuer).<br />
Für die Nutzung des Hallenbades durch Schulen und Vere<strong>in</strong>e sowie zur F<strong>in</strong>anzierung<br />
der Vergünstigungen der Bürger-Card entrichten die Städte ferner e<strong>in</strong> jährliches<br />
Nutzungsentgelt von ca. 250.000 EUR (plus Mehrwertsteuer).<br />
Über den e<strong>in</strong>maligen Baukostenzuschuss und das jährliche Nutzungsentgelt h<strong>in</strong>aus<br />
bestehen ke<strong>in</strong>erlei f<strong>in</strong>anzielle Pflichten für die Städte. Sämtliche Betriebs- und<br />
Instandhaltungskosten werden vom privaten Betreiber getragen. Dies gilt auch<br />
für zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt erforderliche Modernisierungskosten. Der Vorteil<br />
für die Städte besteht zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> der besseren Planbarkeit der kommunalen<br />
Ausgaben. Im Gegensatz zum früheren Betrieb von Hallenbädern <strong>in</strong> kommunaler<br />
Trägerschaft s<strong>in</strong>d die jährlichen Aufwendungen der Städte für die Hallenbadnutzung<br />
genau fixiert. Das betriebswirtschaftliche Risiko und damit potenziell e<strong>in</strong>hergehende<br />
Verluste liegt beim privaten Betreiber.<br />
Neben Planungssicherheit konnten durch die <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit PPP<br />
erhebliche E<strong>in</strong>spareffekte erzielt werden. Der oben genannte e<strong>in</strong>malige Baukostenzuschuss<br />
liegt deutlich unter den für die Modernisierung der alten Hallenbäder<br />
veranschlagten Kosten. Gleiches gilt für das jährliche Nutzungsentgelt im Vergleich<br />
zum frühen Betriebskostenzuschuss für die kommunalen Bäder. Die Stadt Kelkheim<br />
beziffert die jährliche E<strong>in</strong>sparung auf ca. 200.000 bis 250.000 EUR, die Stadt<br />
Hofheim auf ca. 500.000 EUR pro Jahr. Damit stellt die gefundene Hallenbadlösung<br />
e<strong>in</strong>e nachhaltige Entlastung der kommunalen Haushalte dar.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Ausblick<br />
Durch die <strong>Kooperation</strong> der Städte Hofheim und Kelkheim wurde e<strong>in</strong>e dauerhaft<br />
tragfähige Lösung für die F<strong>in</strong>anzierung e<strong>in</strong>es Hallenbades gefunden. Darüber h<strong>in</strong>aus<br />
ist mit der Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme e<strong>in</strong> Unternehmen am Standort entstanden,<br />
das zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Mittelfristig werden e<strong>in</strong> Ausbau<br />
der Angebote der Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme und damit e<strong>in</strong>e weitere Stärkung der<br />
Erholungsfunktion beider Städte angestrebt.<br />
4.2.4 Verwaltung<br />
Zweckverband „Kommunale Dienste Immenhausen-Espenau“<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner: Immenhausen und Espenau<br />
Organisations-/Rechtsform: Zweckverband<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit: 2002<br />
Kontakt:<br />
Bürgermeister<br />
Andreas Güttler<br />
Marktplatz 1<br />
34376 Immenhausen<br />
Telefon: (0 56 73) 503 -120<br />
E-Mail: andreas.guettler@immenhausen.de<br />
L<strong>in</strong>k: –<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
63<br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
Wie viele andere Städte und Geme<strong>in</strong>den stehen Immenhausen und Espenau vor<br />
der Herausforderung, bei stagnierenden oder zurückgehenden E<strong>in</strong>nahmen wachsende<br />
Anforderungen an kommunale Aufgaben zu bewältigen. Voraussetzung<br />
hierfür ist e<strong>in</strong> höheres Maß an Effizienz und Leistungsfähigkeit. Dies kann bei der<br />
Unterhaltung von technischer Infrastruktur (zum Beispiel im Bereich Wasserversorgung)<br />
sowie bei der Pflege und Instandhaltung des öffentlichen Raums und der<br />
Grünflächen <strong>in</strong>sbesondere durch e<strong>in</strong>e Spezialisierung des Personals und durch den<br />
E<strong>in</strong>satz von modernen Gerätschaften beziehungsweise Masch<strong>in</strong>en erreicht werden.<br />
Da es sich bei Immenhausen und Espenau um kle<strong>in</strong>ere Kommunen handelt (ca. 7.300<br />
E<strong>in</strong>wohner/ca. 5.000 E<strong>in</strong>wohner), ist die Beschäftigung von spezialisiertem Personal<br />
beziehungsweise dessen qualifikationsadäquater E<strong>in</strong>satz teilweise problematisch.<br />
Gleiches gilt für die Auslastung von Geräten beziehungsweise Masch<strong>in</strong>en. Diese<br />
haben oftmals lange Standzeiten und somit Kapazitäten für e<strong>in</strong>e Nutzung durch<br />
andere Kommunen.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund und angesichts geme<strong>in</strong>samer positiver <strong>Kooperation</strong>serfahrungen<br />
im Bereich Wasserbeschaffung haben Immenhausen und Espenau e<strong>in</strong>en<br />
geme<strong>in</strong>samen Zweckverband „Kommunale Dienste“ (ZKD) gegründet. Neben den<br />
oben genannten Zielen e<strong>in</strong>er Spezialisierung des Personals und e<strong>in</strong>er höheren<br />
Auslastung von Geräten und Fuhrpark verfolgt dieser das Ziel, durch geme<strong>in</strong>same<br />
Neuanschaffung von Geräten Kosten e<strong>in</strong>zusparen und <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e effizientere<br />
Aufgabenerfüllung zu erreichen.<br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
64<br />
Mit dem Zweckverband „Kommunale Dienste“ kooperieren Immenhausen und<br />
Espenau <strong>in</strong> mehreren kommunalen Aufgabenfeldern. In den Bereichen Wasserversorgung,<br />
Straßenbeleuchtung und -re<strong>in</strong>igung sowie Entwässerung führt der ZKD<br />
den Betrieb, die Unterhaltung und die Pflege sämtlicher Anlagen und Netze mit<br />
Ausnahme der Klärwerke durch. Unter dem Dach des ZKD haben die Kommunen<br />
darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Fuhrpark e<strong>in</strong>gerichtet und die vorher getrennten<br />
Bauhöfe vere<strong>in</strong>igt und an e<strong>in</strong>em Standort zusammengeführt. Durch die Zusammenlegung<br />
der beiden Bauhöfe konnten direkte E<strong>in</strong>nahmen durch den Verkauf überzähliger<br />
Gerätschaften erzielt werden. Die durch den geme<strong>in</strong>samen Standort frei<br />
gewordenen Flächen können nun als Lager- und Geräteunterstellmöglichkeiten<br />
genutzt werden.<br />
Zwar hat die <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> den genannten Bereichen zu Beg<strong>in</strong>n zu e<strong>in</strong>em höheren<br />
Koord<strong>in</strong>ierungs- und Kommunikationsaufwand geführt, dennoch überwiegen die<br />
Vorteile der Zusammenarbeit: Durch die Gründung des ZKD konnten die Standzeiten<br />
von Geräten und Fahrzeugen deutlich reduziert werden. Das <strong>in</strong> den Zweckverband<br />
überführte Personal (Bauhofarbeiter, Wasserwerker, etc.) wird heute <strong>in</strong><br />
stärkerem Maße entsprechend se<strong>in</strong>er Qualifikation e<strong>in</strong>gesetzt, was sich positiv auf<br />
Motivation und Engagement der Mitarbeiter auswirkt. Beispielsweise konnten<br />
durch die Zusammenarbeit im Wasserbereich die Personalstellen von 2,5 auf 2,0<br />
reduziert werden. Im Rahmen der <strong>Kooperation</strong> war es darüber h<strong>in</strong>aus möglich,<br />
durch Neue<strong>in</strong>stellung das zur Verfügung stehende Berufsspektrum abzurunden.<br />
Insgesamt ist e<strong>in</strong>e deutliche Steigerung der Professionalität und Leistungsfähigkeit<br />
des Verwaltungshandelns festzustellen.<br />
■ Organisation/Akteure<br />
Die Verbandsorganisation entspricht der klassischen Zweckverbandsstruktur, bestehend<br />
aus Verbandsversammlung und Verbandsvorstand.<br />
Die Verbandsversammlung setzt sich zu je 8 Vertretern aus Immenhausen und<br />
Espenau zusammen, die e<strong>in</strong>en Vorsitzenden aus ihren Reihen wählen. Sie stellt das<br />
oberste Organ des Zweckverbandes dar und trifft alle grundsätzlichen Entscheidungen.<br />
Demgegenüber ist der Verbandsvorstand mit dem Verbandsvorsitzenden für<br />
sämtliche Entscheidungen und Aufgaben der laufenden Verwaltung verantwortlich.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Die Arbeitsverhältnisse der technischen Mitarbeiter s<strong>in</strong>d von den Verbandskommunen<br />
auf den Zweckverband übergegangen. Da die <strong>Kooperation</strong>spartner Wert<br />
darauf legen, dass ke<strong>in</strong> neuer Verwaltungsapparat parallel zu den bestehenden<br />
Kommunalverwaltungen entsteht, hat der Zweckverband ke<strong>in</strong> eigenes Verwaltungspersonal.<br />
Dies gilt auch für die Geschäftsführung des Zweckverbandes und die<br />
<strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den beschäftigten Personen. Die drei bestellten Geschäftsführer<br />
(kaufmännisch, buchhalterisch, technisch) s<strong>in</strong>d Mitarbeiter der Verbandskommunen<br />
und führen die Geschäftsführung im Rahmen ihrer Beschäftigung bei den Kommunen<br />
ehrenamtlich durch.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
65<br />
Mannschaftsfoto Zweckverband Kommunale Dienste<br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Der Zweckverband rechnet die von ihm erbrachten Leistungen gegenüber den<br />
Mitgliedskommunen kostendeckend ab. Hierzu werden die Kosten für Arbeitsstunden<br />
und Material ermittelt und von den Kommunen entsprechend dem tatsächlich<br />
auf ihrer Gemarkung entstandenen Aufwand erstattet.<br />
Die auf diese Weise neu entstandene Kostentransparenz erleichtert den Verbandskommunen<br />
die Beurteilung, ob Kosten und Nutzen der angeforderten Dienste <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em s<strong>in</strong>nvollen Verhältnis stehen. In e<strong>in</strong>zelnen Fällen führt die verbesserte Kostentransparenz<br />
auch dazu, dass private Dritte mit Leistungen beauftragt werden,<br />
sofern sie diese wirtschaftlicher erbr<strong>in</strong>gen können. Dies gilt auch für Anforderungen<br />
außerhalb der kommunalen Pflichtaufgaben beispielsweise Leistungen für örtliche<br />
Vere<strong>in</strong>e (Aufbau von Weihnachtsmärkten, Vere<strong>in</strong>sfesten etc.).<br />
Im Bereich der Wasserversorgung erfolgt die F<strong>in</strong>anzierung auf anderem Wege. Hier<br />
haben Immenhausen und Espenau die Satzungs- und Gebührenhoheit auf den Zweckverband<br />
übertragen. Die Kosten für Betrieb und Instandhaltung von Anlagen und<br />
Netzen werden direkt aus den vom Verbraucher zu zahlenden Gebühren f<strong>in</strong>anziert.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Insgesamt trägt die Monetarisierung der Leistungserbr<strong>in</strong>gung im Rahmen e<strong>in</strong>es<br />
eigenen Wirtschaftsplans für den Zweckverband zu e<strong>in</strong>em stärkeren Kostenbewusstse<strong>in</strong><br />
und e<strong>in</strong>er Steigerung der Kosteneffizienz bei. Die erzielten E<strong>in</strong>spareffekte<br />
müssen differenziert betrachtet werden und betragen <strong>in</strong> Teilbereichen schätzungsweise<br />
bis zu 20%.<br />
Die Zusammenarbeit der beiden Kommunen wird f<strong>in</strong>anziell durch das Hessische<br />
M<strong>in</strong>isterium des Innern und für Sport im Rahmen des Förderprogramms zur Bildung<br />
von geme<strong>in</strong>samen Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den unterstützt<br />
(siehe Infobox 5: Rahmenvere<strong>in</strong>barung zur Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen<br />
Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den, S. 67).<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
66<br />
Abbildung 12<br />
Übersicht der F<strong>in</strong>anzierungsarten<br />
1. Übertragung der Satzungs- und Gebührenhoheit für die Wasserversorgung<br />
• die Leistungen der Geme<strong>in</strong>debediensteten erstattet der Verband<br />
• die F<strong>in</strong>anzierung sämtlicher Leistungen des Verbandes erfolgt über die<br />
Gebührene<strong>in</strong>nahmen der Abgabepflichtigen<br />
2. Straßenbeleuchtung<br />
• die anfallenden Kosten (Neuanschaffung, Reparaturen, Strom) können<br />
für jede e<strong>in</strong>zelne Geme<strong>in</strong>de getrennt nachgewiesen werden<br />
• die Erstattung erfolgt <strong>in</strong> der tatsächlich anfallenden Höhe an den Verband<br />
3. Straßenre<strong>in</strong>igung<br />
• Kosten für die e<strong>in</strong>gesetzte Kehrmasch<strong>in</strong>e als Fremdleistungen<br />
können für jede e<strong>in</strong>zelne Geme<strong>in</strong>de getrennt nachgewiesen werden<br />
• Kostenerstattung für e<strong>in</strong>gesetztes Personal etc., siehe 5.<br />
4. Unterhaltung Entwässerungsanlagen (ohne Kläranlagen)<br />
• die Aufgabe bleibt bei beiden Geme<strong>in</strong>den erhalten<br />
• der Verband übernimmt lediglich die technische/organisatorische Durchführung<br />
der Unterhaltungsaufgaben für die Geme<strong>in</strong>den<br />
• die Kosten werden für jede Maßnahme von der jeweiligen Geme<strong>in</strong>de erstattet<br />
5. Fuhrpark und Bauhof<br />
• Erbr<strong>in</strong>gen von Leistungen für die Erledigung geme<strong>in</strong>dlicher Aufgaben<br />
• personelle und sachliche Aufwendungen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Stundenverrechnungssatz kalkuliert<br />
• die erbrachten Leistungen werden durch die beiden Geme<strong>in</strong>den und auch<br />
durch sonstige Personen/Institutionen, die die Leistungen <strong>in</strong> Anspruch nehmen,<br />
aufgrund der nachweislich e<strong>in</strong>gesetzten Stunden erstattet<br />
Quelle: Stadt Immenhausen 08/2005
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Infobox 5<br />
Rahmenvere<strong>in</strong>barung zur Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen<br />
Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den<br />
(Hessisches M<strong>in</strong>isterium des Innern und für Sport v. 01.03.2004, AZ: IV 31 – 3 v 03/1)<br />
Fördergegenstand:<br />
Ansprechpartner:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Förderung von Verwaltungsverbänden/Verwaltungsgeme<strong>in</strong>schaften<br />
von Geme<strong>in</strong>den mit <strong>in</strong> der Regel nicht mehr als 15.000 E<strong>in</strong>wohnern.<br />
Die Aufgabenbereiche, <strong>in</strong> denen kooperiert werden soll, s<strong>in</strong>d:<br />
•Verwaltungsmäßige Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung<br />
• Durchführung der Kassen- und Rechnungsgeschäfte, Veranlagung<br />
und E<strong>in</strong>ziehung der geme<strong>in</strong>dlichen Abgaben<br />
Weitere Aufgaben können zusätzlich erfüllt werden.<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium des Innern und für Sport<br />
Markus Karger (Referatsleiter)<br />
Friedrich-Ebert-Allee 12<br />
65185 Wiesbaden<br />
Telefon: (0611) 353-15 32<br />
E-Mail: m.karger@hmdi.hessen.de<br />
www.hmdi.hessen.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
■ Weitere <strong>Kooperation</strong>en der Kommunen Immenhausen und Espenau<br />
Außerhalb des Zweckverbandes kooperieren Immenhausen und Espenau im Bereich<br />
Personalwesen. Gegen Erstattung des erzeugten Aufwandes führt Immenhausen<br />
die Personalabrechung, neben der für den Zweckverband auch für die weiteren<br />
Mitarbeiter der Geme<strong>in</strong>de Espenau durch. Auch hier wurde durch e<strong>in</strong>e Zusammenführung<br />
der Verwaltungskapazitäten e<strong>in</strong>e effizientere Aufgabenerfüllung ermöglicht.<br />
67<br />
■ Ausblick<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>er zunehmend schwierigeren F<strong>in</strong>anzierbarkeit kommunalen<br />
Verwaltungshandelns prüfen Immenhausen und Espenau, <strong>in</strong>wieweit die Zusammenarbeit<br />
auf andere kommunale Handlungsfelder ausgedehnt werden kann. Denkbar<br />
ist beispielsweise e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit der Standesämter der Kommunen. Auch<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> anderen hoheitlichen Aufgabenfeldern wird <strong>in</strong> Erwägung<br />
gezogen. Nach Überzeugung der Beteiligten könnte hier auch e<strong>in</strong> erster Ansatz<br />
für die geme<strong>in</strong>same Aufgabenwahrnehmung für Stadt und Landkreis Kassel liegen.<br />
Angesichts der bisherigen Erfahrungen und des f<strong>in</strong>anziellen Drucks, der auf den<br />
Kommunen lastet, wird selbst e<strong>in</strong>e Kommunalreform für das gesamte Land <strong>Hessen</strong><br />
zum<strong>in</strong>dest als diskussionswürdig angesehen.<br />
Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“<br />
Die Verwaltungszusammenarbeit <strong>in</strong> den Kommunen Bad Zwesten, Borken (<strong>Hessen</strong>),<br />
Jesberg, Neuental und Wabern ist Teil e<strong>in</strong>er umfassenden themenübergreifenden<br />
<strong>Kooperation</strong> der Zweckverbandskommunen. Die Verwaltungskooperation <strong>in</strong> diesem<br />
Raum ist daher im folgenden Kapitel 4.2.5 Themenübergreifende <strong>Kooperation</strong><br />
dargestellt.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
4.2.5 Themenübergreifende <strong>Kooperation</strong><br />
Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner:<br />
Organisations-/Rechtsform:<br />
Beg<strong>in</strong>n der Zusammenarbeit:<br />
Kontakt:<br />
L<strong>in</strong>k:<br />
Bad Zwesten, Borken (<strong>Hessen</strong>), Jesberg, Neuental, Wabern<br />
Zweckverband<br />
2003 (Gründung des Zweckverbandes)<br />
Zweckverband Schwalm-Eder-West<br />
Werner Wittich (Geschäftsführer)<br />
Am Rathaus 7<br />
34582 Borken (<strong>Hessen</strong>)<br />
Telefon: (0 56 82) 80 81 02<br />
E-Mail: bueroleitung@borken-hessen.de<br />
www.schwalm-eder-west.de<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
■ Anlass/H<strong>in</strong>tergrund/Ziele<br />
68<br />
Die Entwicklung <strong>in</strong> den Kommunen Bad Zwesten, Borken (<strong>Hessen</strong>), Jesberg,<br />
Neuental und Wabern war seit Anfang des 20. Jahrhunderts eng mit der<br />
Bedeutung Borkens als Braunkohlestandort verknüpft. Das Ende der Braunkohleförderung<br />
nach e<strong>in</strong>em schweren Grubenunglück 1988 führte zu e<strong>in</strong>em massiven<br />
Wegfall von Arbeitsplätzen und zu e<strong>in</strong>er Abwanderung junger Bevölkerungsgruppen.<br />
Spätestens seit 1997 s<strong>in</strong>d der Rückgang beziehungsweise die Alterung<br />
der Bevölkerung offensichtlich.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund waren die Kommunen im Raum Schwalm-Eder-West von<br />
der Notwendigkeit neuer Entwicklungsperspektiven überzeugt. E<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
„Vision 2030 Schwalm-Eder-West“ wurde von 2002 bis 2004 im Rahmen des Forschungsprojekts<br />
Stadt 2030 des Bundesm<strong>in</strong>isteriums für Bildung und Forschung<br />
entwickelt. E<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil der geme<strong>in</strong>samen Vision war die Erkenntnis,<br />
dass die Herausforderungen, denen sich der Raum Schwalm-Eder-West stellen<br />
muss, nicht durch isolierte kommunale Handlungsansätze bewältigt werden können.<br />
Es bestand Konsens darüber, dass e<strong>in</strong>e Weiterentwicklung beziehungsweise<br />
e<strong>in</strong>e Neuausrichtung der Region nur im Rahmen e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>deübergreifenden<br />
Strategie gel<strong>in</strong>gen kann. Die Vision 2030 zeigt die Leitl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>er solchen Strategie<br />
auf und identifiziert e<strong>in</strong>e breite Palette von Projektideen.<br />
Zur Umsetzung der Vision 2030 wurde Ende 2003 e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer Zweckverband<br />
gegründet. Er hat das Ziel, im Rahmen von <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
➔ die Bevölkerung an den Raum zu b<strong>in</strong>den,<br />
➔ zukunftsfähige Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und<br />
➔ die Bereiche Freizeit und Tourismus sowie Gesundheit auszubauen und zu stärken.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Gegenstand/Ablauf<br />
Der Schwerpunkt der Verbandstätigkeiten liegt gegenwärtig auf vier Handlungsfeldern:<br />
Stadtumbau, Verwaltung, Gewerbeentwicklung und Tourismus.<br />
Durch die Aufnahme des Raums Schwalm-Eder-West <strong>in</strong> das Forschungsprogramm<br />
Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), Forschungsfeld Stadtumbau<br />
West im Jahr 2004 ist zunächst die Querschnittsaufgabe Stadtumbau e<strong>in</strong> zentrales<br />
Handlungsfeld des Zweckverbands. Bis 2007 will man <strong>in</strong> den Handlungsfeldern<br />
Infrastrukturanpassung und Boden- und Immobilienmanagement Ansätze für den<br />
Umgang mit Bevölkerungsrückgang und Alterungsprozessen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em strukturschwachen<br />
ländlichen Raum f<strong>in</strong>den. Basierend auf der Vision 2030 wurden drei<br />
thematische Leitpläne (Infrastruktur, Tourismus, Flächennutzung) für die Steuerung<br />
des Stadtumbaus entwickelt. Auf Grundlage dieser Leitpläne, die zu e<strong>in</strong>em Masterplan<br />
zusammengeführt wurden, werden aus Programmmitteln Impulsprojekte gefördert,<br />
wie etwa der Umbau des Maximilianschlösschens <strong>in</strong> Jesberg <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Seniorendienstleistungszentrum<br />
oder das Projekt „Dorf im Dorf“ <strong>in</strong> Bad Zwesten, <strong>in</strong> dessen<br />
Rahmen leer stehende Bausubstanz zu Ferienwohnungen umgebaut werden soll.<br />
Im Bereich der Verwaltungszusammenarbeit werden aktuell mehrere E<strong>in</strong>zelmaßnahmen<br />
vorbereitet beziehungsweise umgesetzt:<br />
➔ Als Grundlage für die Zusammenarbeit wird zunächst e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
IT-Plattform für die Zweckverbandskommunen geschaffen. Diese fungiert als<br />
Intranet, auf das alle Zweckverbandskommunen zugreifen können. Es enthält<br />
die wesentlichen Arbeitsgrundlagen für geme<strong>in</strong>same Projekte und ist somit<br />
die Voraussetzung für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>schaftliche Bearbeitung von Aufgaben.<br />
Die geme<strong>in</strong>same IT-Plattform ermöglicht darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e effizientere<br />
EDV-Beschaffung und -Betreuung.<br />
➔ Die Zweckverbandskommunen setzen derzeit e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit der<br />
Bürgerbüros um. Seit Januar 2006 können Bürger Verwaltungsangelegenheiten<br />
wie etwa die Beantragung e<strong>in</strong>es Personalausweises <strong>in</strong> allen Bürgerbüros des<br />
Zweckverbands erledigen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht e<strong>in</strong>e Ausweitung<br />
der Öffnungszeiten, so dass im Wechsel jeden Samstag e<strong>in</strong> Bürgerbüro<br />
im Zweckverband geöffnet ist. Insbesondere berufstätigen Bürgern wird so<br />
der Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen erheblich erleichtert.<br />
➔ Weitere Synergieeffekte können im Bereich des Versicherungsmanagements<br />
erzielt werden. Die Verbandskommunen prüfen derzeit, <strong>in</strong> welchen Bereichen<br />
Versicherungsrisiken zusammengeführt, geme<strong>in</strong>sam abgedeckt und abgewickelt<br />
werden können. Ziel ist es, hiermit neben E<strong>in</strong>spareffekten e<strong>in</strong>e Arbeitsvere<strong>in</strong>fachung<br />
für die beteiligten Verwaltungen zu erreichen.<br />
➔ Zur Umsetzung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Personalverwaltung, F<strong>in</strong>anz- und Steuerverwaltung<br />
sowie zur Zusammenführungen der Kommunalkassen (e<strong>in</strong>schließlich<br />
Vollstreckung) und Baubetriebshöfe erarbeiten die Verbandskommunen<br />
gegenwärtig differenzierte Betriebsmodelle. Zweck der <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> diesen<br />
Verwaltungsbereichen ist e<strong>in</strong>e Optimierung der Verwaltungsprozesse h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Durchführung und Kosten.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
69
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
70<br />
Um die wirtschaftliche Entwicklung im Raum Schwalm-Eder-West zu stärken, haben<br />
die Kommunen des Zweckverbandes beschlossen, e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Gewerbegebiet<br />
auszuweisen. Statt mehrere kle<strong>in</strong>ere von E<strong>in</strong>zelkommunen getragene Gewerbegebiete<br />
zu entwickeln, konzentrieren sich die Verbandskommunen auf e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Gewerbegebiet nahe der Ortslage Wabern. Die Fläche wurde im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
verbandsweiten Standortsuche bestimmt, <strong>in</strong> der sich die jetzt ausgewählte Fläche<br />
als die beste herausgestellt hat. Sie liegt außerordentlich verkehrsgünstig nahe dem<br />
Schnittpunkt A 49 (Nord-Süd) zur B 253 (West-Ost), dies verspricht beste Vermarktungschancen.<br />
Geme<strong>in</strong>sam ist es den 5 Kommunen so möglich, e<strong>in</strong> Gewerbegebiet<br />
mit optimalen Standorteigenschaften auszuweisen. E<strong>in</strong>e Aufteilung der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Lasten versetzt die Verbandsmitglieder darüber h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> die Lage, e<strong>in</strong> Gewerbegebiet<br />
größeren Maßstabs zu entwickeln: Die geme<strong>in</strong>same Gewerbefläche hat e<strong>in</strong>e<br />
Größe von etwa 25 ha mit Erweiterungsmöglichkeiten und ist daher geeignet, auch<br />
größere Betriebe anzusiedeln, die dem Standort Schwalm-Eder-West wichtige<br />
Strukturimpulse geben können. Zur Förderung der gewerblichen Entwicklung wird<br />
des Weiteren e<strong>in</strong> <strong>in</strong>terkommunales Gründerzentrum realisiert. In <strong>Kooperation</strong> mit<br />
e<strong>in</strong>em privaten Partner stellen die Verbandskommunen durch die E<strong>in</strong>richtung<br />
des Gründerzentrums jungen und <strong>in</strong>novativen Unternehmen Räumlichkeiten und<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsdienstleistungen zu günstigen Konditionen zur Verfügung.<br />
E<strong>in</strong> wichtiges Ziel der Zusammenarbeit ist schließlich, den Raum Schwalm-Eder-<br />
West als attraktiven Standort für Tourismus- und Freizeitaktivitäten zu profilieren.<br />
Der Zweckverband hat daher die Aufgabe, geme<strong>in</strong>sam das Angebot <strong>in</strong> der Region<br />
zu entwickeln und e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Tourismusmarket<strong>in</strong>g voranzutreiben. E<strong>in</strong> erstes<br />
Projekt <strong>in</strong> diesem Themenfeld ist der Archäologische Altenburg-Wanderweg. Auf<br />
e<strong>in</strong>er Strecke von ca. 6 km wird auf Informationstafeln anschaulich über Geschichte,<br />
Kultur und Natur der Altenburg <strong>in</strong>formiert. Das Projekt ist e<strong>in</strong>e Idee, die von Bürgern<br />
im Rahmen der Vision 2030 entwickelt wurde. Auch die derzeitige Umsetzung wird<br />
durch bürgerschaftliches Engagement begleitet: Die Heimat- und Geschichtsvere<strong>in</strong>e<br />
aus Bad Zwesten, Borken und Neuental und der Fördervere<strong>in</strong> Schwalm-Eder-West<br />
e.V. s<strong>in</strong>d maßgebliche Unterstützer und wirken bei der Projektgestaltung mit.<br />
Abbildung 13<br />
Stadtumbau West <strong>in</strong> Schwalm-Eder-West: Vorgehensweise<br />
Handlungsleitfaden<br />
Vision 2030 Schwalm-Eder-West<br />
Leitpläne<br />
Infrastruktur Tourismus Flächennutzung<br />
Impulsprojekte<br />
Maßnahmenbauste<strong>in</strong>e<br />
Quelle: Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Organisation/Akteure<br />
Der Zweckverband dient der Verwirklichung der Verbandsziele und ist für die<br />
Koord<strong>in</strong>ierung geme<strong>in</strong>samer Projekte verantwortlich.<br />
Die Verbandsversammlung als oberstes Organ des Zweckverbandes besteht neben<br />
Mitgliedern der Verbandskommunen aus e<strong>in</strong>em Vertreter des Schwalm-Eder-Kreises<br />
sowie drei beratenden Vertretern des Fördervere<strong>in</strong>s Schwalm-Eder-West e.V. Der<br />
Fördervere<strong>in</strong> ist das B<strong>in</strong>deglied zum bürgerschaftlichen Engagement: Mitglieder<br />
des Fördervere<strong>in</strong>s können alle <strong>in</strong>teressierten Bürger, Vere<strong>in</strong>e und Unternehmen aus<br />
dem Zweckverbandsgebiet se<strong>in</strong>. Die Verbandsversammlung entscheidet bei allen<br />
grundsätzlichen Fragen, wie zum Beispiel Satzungsänderungen und sämtlichen<br />
haushalts- und vermögensrechtlichen Entscheidungen.<br />
Der Verbandsvorstand, bestehend aus den Bürgermeistern, dem Landrat und dem<br />
Vorsitzenden des Fördervere<strong>in</strong>s, entscheidet über alle laufenden Verwaltungsangelegenheiten.<br />
Der Geschäftsführer unterstützt den Vorstand und führt dessen<br />
Beschlüsse aus.<br />
Abbildung 14<br />
Aufbau Zweckverband<br />
„<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
71<br />
Zweckverband<br />
„<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“<br />
Vorstand, Verbandsversammlung<br />
Bad<br />
Zwesten<br />
Borken<br />
(<strong>Hessen</strong>)<br />
Jesberg Neuental Wabern Schwalm-Eder-Kreis<br />
(beratende Stimme)<br />
Fördervere<strong>in</strong><br />
Schwalm-Eder-West e.V.<br />
(beratende Stimme)<br />
Quelle: Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ F<strong>in</strong>anzierung/E<strong>in</strong>spareffekte<br />
Die Aufteilung von Ausgaben und E<strong>in</strong>nahmen im Rahmen der Zweckverbandstätigkeit<br />
erfolgt durch e<strong>in</strong>e Umlage. Der Umlageschlüssel entspricht dabei<br />
dem Verhältnis der E<strong>in</strong>wohnerzahlen.<br />
Gute Beispiele<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
72<br />
Projektbezogen spielt darüber h<strong>in</strong>aus die Unterstützung durch Fördermittel<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Neben Fördermitteln aus dem Programm zur Bildung von<br />
geme<strong>in</strong>samen Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den (siehe Infobox 5:<br />
„Rahmenvere<strong>in</strong>barung zur Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen Dienstleistungszentren<br />
bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den“, S. 67) erhielt der Zweckverband<br />
Förderung aus EU-Strukturfondsmitteln (siehe Infobox 2: „Förderprogramm:<br />
Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Förderung der regionalen Entwicklung“, S. 35)<br />
sowie Mittel von Land und Bund zur Umsetzung des ExWoSt-Programms Stadtumbau<br />
West. Bereits für die Erstellung der Vision 2030 erhielt der Zweckverband<br />
e<strong>in</strong>e Förderung im Rahmen des Programms Stadt 2030. Die <strong>in</strong>terkommunale<br />
Zusammenarbeit war für die 5 kooperierenden Kommunen <strong>in</strong> der Regel der<br />
Schlüssel für den Erhalt dieser Fördermittel. Ohne die <strong>Kooperation</strong> hätte<br />
der Raum Schwalm-Eder-West sich beispielsweise nicht für die Programme Stadt<br />
2030 und Stadtumbau West qualifizieren können.<br />
■ Ausblick<br />
In den nächsten Jahren steht die Umsetzung der zahlreichen angestoßenen Projekte<br />
im Vordergrund. Insbesondere die Impulsprojekte im Bereich Stadtumbau s<strong>in</strong>d für<br />
den Zweckverband von zentraler Bedeutung.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus werden aber bereits neue Themenfelder <strong>in</strong> den Bereichen Familie,<br />
Freizeit und Tourismus sowie Infrastruktur angedacht, die der Zweckverband<br />
mittel- bis langfristig umsetzen möchte.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
5 Fazit: Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
In den Gesprächen mit Akteuren gelungener <strong>Kooperation</strong>sprojekte konnten e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Erfolgsfaktoren identifiziert werden, die Voraussetzung e<strong>in</strong>er <strong>Kooperation</strong><br />
s<strong>in</strong>d beziehungsweise maßgeblich zum Gel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
beitragen.<br />
■ Voraussetzung: Klarer politischer Willen<br />
Vor den aufgeführten Erfolgsfaktoren ist e<strong>in</strong> klarer politischer Wille als Grundvoraussetzung<br />
für e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit von Kommunen zu nennen. Dieser ist <strong>in</strong> der<br />
Regel nur dann gegeben, wenn entweder e<strong>in</strong> besonderer Leidensdruck – häufig<br />
der Zwang zu E<strong>in</strong>sparung – gegeben ist, oder die <strong>Kooperation</strong> e<strong>in</strong>en sonst nicht<br />
zu erreichenden Mehrwert verspricht. In letzterem Fall handelt es sich <strong>in</strong> der Regel<br />
um Vorhaben, die sachlich, räumlich oder f<strong>in</strong>anziell für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne Kommune<br />
nicht realisierbar s<strong>in</strong>d. Immer häufiger besteht der Mehrwert auch dar<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>terkommunale Herangehensweise Voraussetzung für die Förderung von Seiten<br />
des Landes, des Bundes oder der EU ist.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
5.1 Grundpr<strong>in</strong>zipien der Zusammenarbeit<br />
73<br />
Die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und die damit e<strong>in</strong>hergehende Verpflichtung,<br />
Entscheidungen geme<strong>in</strong>sam zu treffen und gegebenenfalls Infrastrukturen,<br />
Gerätschaften und Personal geme<strong>in</strong>sam zu nutzen, wird von vielen Kommunen als<br />
Verlust an Gestaltungsfreiheit empfunden. Gleichzeitig besteht die Furcht vor<br />
Fremdbestimmung und Benachteiligung. Um diesen Befürchtungen entgegenzuwirken,<br />
ist e<strong>in</strong>e solide Vertrauensbasis zwischen den <strong>Kooperation</strong>spartnern wichtig.<br />
Hierfür s<strong>in</strong>d die folgenden Erfolgsfaktoren von zentraler Bedeutung:<br />
■ Freiwilligkeit<br />
Von Seiten der befragten <strong>Kooperation</strong>spartner wird die zentrale Bedeutung der<br />
Freiwilligkeit der Zusammenarbeit betont. <strong>Kooperation</strong>sprojekten, die durch Verordnung<br />
„von oben“ oder durch externen Druck entstehen, wird von den beteiligten<br />
Städten und Geme<strong>in</strong>den mit großer Skepsis begegnet. In diesen Fällen ist es sehr<br />
schwer, regionale Akteure von den Vorteilen der <strong>Kooperation</strong> zu überzeugen und<br />
sie als Promotoren der <strong>Kooperation</strong> zu gew<strong>in</strong>nen. Stattdessen besteht die Gefahr<br />
e<strong>in</strong>es Aushöhlens der Zusammenarbeit aufgrund gegenseitiger Blockade der <strong>Kooperation</strong>spartner,<br />
langwieriger „Verfassungsdiskussionen“ oder – im ungünstigsten<br />
Fall – gerichtlicher Ause<strong>in</strong>andersetzungen. <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> auf<br />
freiwilliger Basis ist daher zunächst die Ideallösung, der Vorrang e<strong>in</strong>zuräumen ist.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ <strong>Kooperation</strong> auf gleicher Augenhöhe/Konsenspr<strong>in</strong>zip<br />
Um <strong>in</strong>sbesondere den emotionalen Hemmnissen <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong><br />
– wie etwa der Furcht vor Fremdbestimmung – wirksam entgegenzuwirken, ist e<strong>in</strong>e<br />
<strong>Kooperation</strong> auf gleicher Augenhöhe notwendig. E<strong>in</strong>e Rollenverteilung im S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>er Junior- und Seniorpartnerschaft wird <strong>in</strong>sbesondere von den kle<strong>in</strong>eren <strong>Kooperation</strong>spartnern<br />
<strong>in</strong> der Regel nicht akzeptiert. Wichtig ist daher e<strong>in</strong> partnerschaftliches<br />
Mite<strong>in</strong>ander, das sich auch <strong>in</strong> den Entscheidungsstrukturen der <strong>Kooperation</strong>sprojekte<br />
widerspiegelt, <strong>in</strong>dem ausschließlich nach dem Konsenspr<strong>in</strong>zip entschieden<br />
oder kle<strong>in</strong>eren Partnern e<strong>in</strong>e Sperrm<strong>in</strong>orität zugebilligt wird. E<strong>in</strong>e solche Regelung<br />
trägt auch zu e<strong>in</strong>er höheren Akzeptanz der Zusammenarbeit bei Bürgern und<br />
Ratsmitgliedern bei.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
74<br />
■ Fairer Interessenausgleich<br />
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> muss durch e<strong>in</strong>e Berücksichtigung der Interessen aller<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner gekennzeichnet se<strong>in</strong>. Ziel ist es, Lösungen zu f<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> denen<br />
alle Beteiligten gleichermaßen an den Vorteilen der <strong>Kooperation</strong> teilhaben. In Fällen,<br />
wo dies nicht s<strong>in</strong>nvoll oder umsetzbar ist, besteht die Möglichkeit e<strong>in</strong>es themenübergreifenden<br />
Gebens und Nehmens. Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit im<br />
Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“, <strong>in</strong> dem<br />
sich die <strong>Kooperation</strong>spartner mit unterschiedlichen funktionalen Schwerpunkten<br />
profilieren und diese geme<strong>in</strong>sam weiterentwickeln. E<strong>in</strong> solcher themenübergreifender<br />
Interessenausgleich erfordert auf allen Seiten die Bereitschaft, die spezifischen<br />
Stärken der anderen <strong>Kooperation</strong>spartner anzuerkennen und diese geme<strong>in</strong>schaftlich<br />
zu fördern.<br />
5.2 E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Akteuren und Partnern<br />
Die Praxis zeigt, dass <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit <strong>in</strong> vielen Fällen durch<br />
Initiatoren – E<strong>in</strong>zelpersonen oder Gruppen – mit besonderer Überzeugungskraft<br />
und der Bereitschaft, unkonventionelle Lösungen zu suchen, e<strong>in</strong>geleitet wurden.<br />
Dieses hohe Maß an Abhängigkeit von den handelnden Personen darf aber nicht<br />
darüber h<strong>in</strong>wegtäuschen, dass die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der weiteren relevanten Akteure<br />
e<strong>in</strong> Schlüsselfaktor für das Gel<strong>in</strong>gen von <strong>Kooperation</strong>en ist.<br />
■ Frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung möglicher Partnerkommunen<br />
Die Strategie, zunächst e<strong>in</strong> Konzept auszuarbeiten und mögliche Partnerkommunen<br />
erst e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, wenn die <strong>Kooperation</strong> e<strong>in</strong>en gewissen Reifegrad erreicht hat,<br />
birgt die Gefahr, dass das <strong>Kooperation</strong>sprojekt nicht den spezifischen Anforderungen
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
der angestrebten Partner entspricht. Des Weiteren kann der E<strong>in</strong>druck entstehen,<br />
dass das Projekt vor allem im Interesse der vorschlagenden Kommune ist. Für den<br />
Erfolg von <strong>Kooperation</strong>sprojekten ist es daher wichtig, <strong>Kooperation</strong>s<strong>in</strong>teressen<br />
möglicher Partner gleich zu Anfang zu sondieren und diese zu berücksichtigen.<br />
E<strong>in</strong>e frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung erhöht die für die Durchführung e<strong>in</strong>er <strong>Kooperation</strong><br />
erforderliche Identifikation aller Partner mit dem Projekt.<br />
■ E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Akteuren <strong>in</strong> Kommunalpolitik, Bürgerschaft und Verwaltung<br />
Neben der E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von zur <strong>Kooperation</strong> bereiten Städten und Geme<strong>in</strong>den –<br />
der Integration externer Partner – ist die Integration <strong>in</strong>terner Partner erforderlich:<br />
➔ Kommunalpolitische Gremien: Zur Durchführung <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>sprojekte<br />
ist auf Seiten der kommunalpolitischen Gremien die Bereitschaft erforderlich,<br />
die Zusammenarbeit dauerhaft mitzutragen. Dem stehen <strong>in</strong> manchen<br />
Fällen anfängliche Vorbehalte der Mandatsträger gegenüber geme<strong>in</strong>samen Projekten<br />
mit Nachbarkommunen entgegen (siehe auch strukturelle/emotionale<br />
Hemmnisse). Hier ist e<strong>in</strong> hohes Maß an Transparenz und die Wahl e<strong>in</strong>er geeigneten<br />
Organisationsform notwendig. Konkret bedeutet dies, kommunalpolitische<br />
Gremien frühzeitig und regelmäßig über den Stand der Zusammenarbeit<br />
zu <strong>in</strong>formieren. Abhängig vom <strong>Kooperation</strong>sgegenstand kann es des Weiteren<br />
s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, für das <strong>Kooperation</strong>sprojekt e<strong>in</strong>e Organisationsform zu wählen,<br />
die die direkte E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung kommunaler Mandatsträger zulässt. Beispiel hierfür<br />
ist etwa der Zweckverband, dessen oberstes Organ, die Verbandsversammlung,<br />
mit kommunalen Mandatsträgern aus den Mitgliedskommunen besetzt wird.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
75<br />
➔ Bürgerschaft: Ohne die Zustimmung der Bürgerschaft wird ke<strong>in</strong> <strong>Kooperation</strong>sprojekt<br />
dauerhaft durchsetzbar se<strong>in</strong>. Von Vorteil ist daher wie auch bei der<br />
Integration kommunalpolitischer Gremien e<strong>in</strong> hohes Maß an Transparenz und<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung. Dies kann durch e<strong>in</strong>e aktive Öffentlichkeitsarbeit geschehen,<br />
die die konkreten Vorteile der <strong>Kooperation</strong> für die Bürger herausstellt. S<strong>in</strong>nvoll<br />
können auch Partizipationsprozesse se<strong>in</strong>, die die Bürger beispielsweise im<br />
Rahmen von Ideenwettbewerben oder Workshops zur Mitwirkung e<strong>in</strong>laden.<br />
➔ Mitarbeiter der Verwaltung: Den Mitarbeitern der Verwaltung kommt im Rahmen<br />
<strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu, da diese die <strong>Kooperation</strong>sideen<br />
letztendlich umsetzen müssen. Vielfach ist hierzu e<strong>in</strong> besonderes<br />
Engagement erforderlich, das e<strong>in</strong> hohes Maß an Identifikation mit dem <strong>Kooperation</strong>sprojekt<br />
voraussetzt. S<strong>in</strong>nvoll ist daher auch e<strong>in</strong>e frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
der Verwaltungsmitarbeiter, die im Rahmen der politischen Zielvorgabe Mitgestaltungsmöglichkeiten<br />
bietet.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
■ Privates Know-how und Kapital nutzen<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
76<br />
Angesichts zunehmend komplexerer Herausforderungen für Städte und Geme<strong>in</strong>den<br />
bei gleichzeitig abnehmenden f<strong>in</strong>anziellen Gestaltungsspielräumen ist die Nutzung<br />
privaten Know-hows und Kapitals für viele Kommunen e<strong>in</strong>e attraktive Handlungsoption.<br />
An die Stelle des Neubaus von Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren mehr und mehr die Modernisierung und Sanierung vorhandener kommunaler<br />
E<strong>in</strong>richtungen getreten. Neben den konventionellen, durch Kommunalkredite<br />
f<strong>in</strong>anzierten Eigen<strong>in</strong>vestitionen existiert e<strong>in</strong>e Vielzahl von Public-Private-Partnership-<br />
Modellen (PPP), die sich h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Organisationsformen, der F<strong>in</strong>anzierung<br />
von Projekten und der vertraglichen Ausgestaltung unterscheiden, die aber erst<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Größe für die private Hand <strong>in</strong>teressant s<strong>in</strong>d. Gerade für<br />
kle<strong>in</strong>ere und mittlere Kommunen bietet hier die <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> die<br />
Möglichkeit, anspruchsvolle, effiziente und nachhaltig sichere PPP-Projekte<br />
geme<strong>in</strong>sam auf den Weg zu br<strong>in</strong>gen. Neben e<strong>in</strong>em direkten <strong>in</strong>vestiven Engagement<br />
(siehe <strong>Kooperation</strong>sprojekt Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme Hofheim-Kelkheim) s<strong>in</strong>d private<br />
Trägerschaftsmodelle denkbar. Auch die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung privater Unternehmen und<br />
Vere<strong>in</strong>e im Rahmen e<strong>in</strong>es Fördervere<strong>in</strong>s wie etwa im Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong><br />
Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“ ist e<strong>in</strong>e Möglichkeit, privates Knowhow<br />
und Engagement für <strong>Kooperation</strong>sprojekte nutzbar zu machen.<br />
■ E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung externen Sachverstands<br />
Zum Erfolg <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit trägt auch die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung externen<br />
Sachverstands bei. Häufig handelt es sich hierbei um die Landkreise, Fachbüros<br />
oder wissenschaftliche E<strong>in</strong>richtungen sowie Moderatoren.<br />
➔ Landkreise: Als gleichfalls kommunale Gebietskörperschaft s<strong>in</strong>d die Landkreise<br />
zumeist orig<strong>in</strong>äre Ansprechpartner <strong>in</strong> übergeme<strong>in</strong>dlichen Belangen und werden<br />
häufig auch von den kooperierenden kle<strong>in</strong>eren Kommunen entsprechend wahrgenommen.<br />
Die Kreisverwaltungen mit ihren umfangreichen Dienstleistungsund<br />
Beratungsangeboten können <strong>in</strong>sbesondere bei fachlichen, organisatorischen<br />
und rechtlichen Fragen partnerschaftlich Hilfe leisten. Die Repräsentanten und<br />
Mitarbeiter der Kreise s<strong>in</strong>d beratend tätig und stellen <strong>in</strong> den entsprechenden<br />
Gremien ihren Sachverstand sowie ihre überörtlichen Kontakte und Netzwerke<br />
zur Verfügung (siehe Beispiele Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit<br />
Schwalm- Eder-West“ und Zweckverband Raum Kassel). Die Landkreise handeln<br />
hierbei <strong>in</strong> Wahrnehmung ihrer Bündelungs- und Ergänzungsfunktion zugunsten<br />
der kreisangehörigen Städte und Geme<strong>in</strong>den.<br />
➔ Fachbüros und wissenschaftliche E<strong>in</strong>richtungen: Externe Fachgutachter und<br />
Wissenschaftler s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den analytischen und konzeptionellen Phasen<br />
e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit hilfreich. Aufgrund besonderer fachlicher<br />
Kenntnisse und e<strong>in</strong>er unvore<strong>in</strong>genommenen Außenperspektive können<br />
sie die Öffentlichkeit <strong>in</strong> der Regel wirksamer für Probleme sensibilisieren als die<br />
eigene Kommunalverwaltung. Auch bei der Entwicklung von Lösungsansätzen<br />
können sie als wichtige und <strong>in</strong>novative Impulsgeber e<strong>in</strong>bezogen werden.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Schließlich können Fachbüros und wissenschaftliche E<strong>in</strong>richtungen wesentliche<br />
Beiträge zur Professionalisierung der Steuerung und des Managements der<br />
<strong>Kooperation</strong>saktivitäten leisten.<br />
➔ Moderatoren: Da der <strong>Kooperation</strong> zwischen Städten und Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> vielen<br />
Fällen anfänglich mit Skepsis begegnet wird, ist die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Moderatoren<br />
s<strong>in</strong>nvoll. Dies erhöht <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Fällen, <strong>in</strong> denen schwierige Kompromisse<br />
gefunden werden müssen, die Erfolgschancen <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
und erhöht im Allgeme<strong>in</strong>en die Akzeptanz der gefundenen Lösungen.<br />
Externer Sachverstand kann darüber h<strong>in</strong>aus helfen, rechtliche Unsicherheiten e<strong>in</strong>er<br />
Zusammenarbeit zu klären. Dies bezieht sich <strong>in</strong>sbesondere auf mögliche vergaberechtliche<br />
30) und kartellrechtliche 31) Hemmnisse e<strong>in</strong>er Zusammenarbeit.<br />
5.3 Zusammenarbeit als Prozess<br />
■ Geme<strong>in</strong>sames Problemverständnis, klare Leitbilder und realisierbare Ziele<br />
Grundlage für e<strong>in</strong>e Zusammenarbeit ist e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Problemverständnis.<br />
Zu dessen Klärung ist e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Problembeschreibung oder – bei komplexeren<br />
Fragestellungen – e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sam beauftragtes Gutachten erforderlich.<br />
Auf Grundlage des geme<strong>in</strong>samen Problemverständnisses s<strong>in</strong>d klare Leitbilder und<br />
realistische Ziele für die Zusammenarbeit zu bestimmen. Insbesondere die Zielsetzungen<br />
der Zusammenarbeit müssen e<strong>in</strong>deutig def<strong>in</strong>iert se<strong>in</strong>, um unterschiedlichen<br />
Erwartungen an die Zusammenarbeit vorzubeugen.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
77<br />
■ Projektpr<strong>in</strong>zip/<strong>Kooperation</strong>sthemen schrittweise entwickeln<br />
<strong>Kooperation</strong>en dürfen sich <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Anfangsphase nicht <strong>in</strong> theoretischen<br />
Erwägungen verstricken. S<strong>in</strong>nvoll ist es, frühzeitig konkrete und überschaubare<br />
E<strong>in</strong>zelprojekte sowie Teilprojekte zu identifizieren und diese zeitnah umzusetzen.<br />
Ziel muss es se<strong>in</strong>, Erfolgserlebnisse zu generieren, um die Beteiligten und die<br />
Öffentlichkeit vom Nutzen der <strong>Kooperation</strong> zu überzeugen. Voraussetzung hierfür<br />
ist e<strong>in</strong>e geeignete Themenwahl am Anfang der <strong>Kooperation</strong>. Von Vorteil ist, zunächst<br />
weitgehend konfliktfreie <strong>Kooperation</strong>sthemen wie beispielsweise die geme<strong>in</strong>same<br />
Beschaffung von Material und Gerätschaften anzugehen, deren Umsetzung für<br />
alle Beteiligten Nutzen br<strong>in</strong>gt (W<strong>in</strong>-W<strong>in</strong>-Situation). Ist die <strong>Kooperation</strong> weitgehend<br />
etabliert und e<strong>in</strong> entsprechendes <strong>Kooperation</strong>svertrauen hergestellt, besteht die<br />
Basis auch für konfliktträchtigere Themen, bei denen die Vorteile der <strong>Kooperation</strong><br />
30) Aktuell wird diskutiert, <strong>in</strong>wieweit die Beauftragung von <strong>in</strong>terkommunal getragenen Unternehmen und Organisationen<br />
vergaberechtlich relevant ist. Vgl. Rottmann (2005), S.2f.<br />
31) Bei <strong>in</strong>terkommunalen E<strong>in</strong>kaufsgeme<strong>in</strong>schaften muss deren kartellrechtliche Relevanz beachtet werden. Zu prüfen ist hier, ob e<strong>in</strong>e spürbare,<br />
den kartellrechtlichen Bestimmungen entgegenstehende Marktmacht vorliegt. Vgl. Bayrische Staatszeitung (2002).
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
nicht für alle Beteiligten gleich erkennbar s<strong>in</strong>d beziehungsweise sich erst langfristig<br />
e<strong>in</strong>stellen oder nur durch e<strong>in</strong> projektübergreifendes Geben und Nehmen<br />
entstehen.<br />
■ Organisationsstrukturen wachsen lassen<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
78<br />
Die Zusammenarbeit von Kommunen erzeugt zunächst Abstimmungs- und Organisationsbedarf.<br />
Abhängig vom <strong>Kooperation</strong>sgegenstand müssen neue Organisations-<br />
und Entscheidungsstrukturen geschaffen werden, was zu Unsicherheiten<br />
führt, da diese von der e<strong>in</strong>geübten Verwaltungspraxis abweichen. Für die Akzeptanz<br />
<strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit ist es daher wichtig, mit möglichst ger<strong>in</strong>gem<br />
f<strong>in</strong>anziellem und zeitlichem Aufwand aufgabenadäquate Organisationsstrukturen<br />
zu schaffen. Am Anfang e<strong>in</strong>er <strong>Kooperation</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regel <strong>in</strong>formelle oder wenig<br />
verb<strong>in</strong>dliche Organisationsformen wie etwa Runde Tische oder kommunale<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften s<strong>in</strong>nvoll. Solche Organisationsformen ermöglichen e<strong>in</strong>en<br />
niederschwelligen E<strong>in</strong>stieg und verh<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong>e Selbstblockade durch langwierige<br />
„Verfassungsdiskussionen“. Gleichzeitig stellen sie e<strong>in</strong>en geeigneten Rahmen dar,<br />
<strong>Kooperation</strong>sprojekte zu konzipieren und – sofern nicht zu komplex – umzusetzen.<br />
Mit wachsenden <strong>Kooperation</strong>saufgaben kann es abhängig vom Gegenstand der<br />
Zusammenarbeit zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt erforderlich se<strong>in</strong>, die Organisationsform<br />
schrittweise weiterzuentwickeln und verb<strong>in</strong>dlicher zu gestalten.<br />
Besteht e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong>spartnerschaft aus e<strong>in</strong>er größeren Zahl von Partnern,<br />
kann es darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>nvoll se<strong>in</strong>, flexible Allianzen, also e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> von<br />
nur e<strong>in</strong>em Teil der <strong>Kooperation</strong>spartner, für e<strong>in</strong>zelne Teilprojekte im Rahmen der<br />
geme<strong>in</strong>samen Organisationsstrukturen zu ermöglichen. Organisatorisch kann dies<br />
durch Aufteilung <strong>in</strong> Rahmenvertrag und projektbezogene Verträge geregelt werden<br />
(siehe Beispiel Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler).<br />
■ Geme<strong>in</strong>same Außendarstellung/Öffentlichkeitsarbeit<br />
E<strong>in</strong>e aktive Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der Bürgerschaft dient der Vermittlung<br />
der positiven Effekte der Zusammenarbeit und kann so wesentlich zur Akzeptanz<br />
der <strong>Kooperation</strong>saktivitäten beitragen. Des Weiteren erhöht e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Außendarstellung über die Region h<strong>in</strong>aus die Identifikation mit dem <strong>Kooperation</strong>sgegenstand,<br />
auch <strong>in</strong>dem eigene Interessen gegenüber dem Bund und dem Land<br />
geme<strong>in</strong>sam besser artikuliert oder Investoren und Touristen gezielter angesprochen<br />
werden können. Zu beachten ist, dass trotz der geme<strong>in</strong>samen Öffentlichkeitsarbeit/<br />
Außendarstellung allen <strong>Kooperation</strong>sbeteiligten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vere<strong>in</strong>barten Rahmen<br />
ausreichend Raum zur eigenen Profilierung e<strong>in</strong>geräumt werden muss.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
5.4 F<strong>in</strong>anzierung<br />
■ Transparenter Ausgleich von Lasten und Nutzen<br />
Zur Aufteilung der Lasten und Nutzen sollte frühzeitig e<strong>in</strong> Vorteils-/Nachteilsausgleich<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es umfassenden F<strong>in</strong>anzierungs- und Ertragsverteilungskonzeptes<br />
gefunden werden. Wichtig s<strong>in</strong>d möglichst transparente und e<strong>in</strong>fache Verteilungsmodelle,<br />
die für alle Seiten nachvollziehbar s<strong>in</strong>d und ke<strong>in</strong>en unverhältnismäßigen<br />
Verwaltungsaufwand erzeugen. Bei Projekten, die für alle <strong>Kooperation</strong>spartner<br />
gleichermaßen von Vorteil s<strong>in</strong>d, bieten sich die E<strong>in</strong>wohnerzahlen als Verteilungsschlüssel<br />
an. In Fällen e<strong>in</strong>er ungleichen Inanspruchnahme von Leistungen ist die<br />
etwas aufwändigere Verteilung nach tatsächlich <strong>in</strong> Anspruch genommenen Leistungen<br />
notwendig. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es <strong>in</strong> vielen Fällen nicht<br />
möglich se<strong>in</strong> wird, f<strong>in</strong>anzielle Lasten und Nutzen „auf den Cent genau“ zu verteilen.<br />
So können zum Beispiel bei Gewerbegebieten Herstellungskosten und Steueraufkommen<br />
(primäre Effekte) problemlos aufgeteilt werden, sekundäre Effekte, die<br />
etwa durch Zuzug von E<strong>in</strong>wohnern <strong>in</strong> die nächst gelegene Kommune entstehen,<br />
können <strong>in</strong> der Regel nicht nachgewiesen werden und sollten von allen Beteiligten<br />
als nicht ausgleichbar akzeptiert werden. Statt kontroverse Diskussionen über<br />
diese f<strong>in</strong>anziellen Sonderaspekte zu führen, sollten die <strong>Kooperation</strong>spartner auf<br />
den langfristigen Mehrwert der <strong>Kooperation</strong> für alle Beteiligte vertrauen.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
79<br />
■ Fördermöglichkeiten erschließen und nutzen<br />
Die konsequente Nutzung f<strong>in</strong>anzieller Fördermöglichkeiten ist schließlich e<strong>in</strong> entscheidender<br />
Erfolgsfaktor <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>. Mit Hilfe geme<strong>in</strong>deübergreifender<br />
Zusammenarbeit lassen sich heute vermehrt Fördermöglichkeiten nutzen<br />
(siehe Kapitel 1.4 Förderung <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> durch die Landespolitik).<br />
Förderung durch Bundes- oder Landesmittel s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Anfangsphase<br />
<strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong>en e<strong>in</strong> wichtiger Anreiz, e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Projekt<br />
zu entwickeln. Der Erhalt von Fördermitteln hat darüber h<strong>in</strong>aus den Effekt, dass<br />
die <strong>Kooperation</strong>spartner verpflichtet s<strong>in</strong>d, das geplante Projekt wie vere<strong>in</strong>bart<br />
durchzuführen, e<strong>in</strong> Ausscheren e<strong>in</strong>zelner Projektpartner wird erheblich erschwert.<br />
In späteren Phasen der Zusammenarbeit s<strong>in</strong>kt die Bedeutung von Fördermitteln,<br />
da e<strong>in</strong>e etablierte <strong>Kooperation</strong>sstruktur vorliegt und die Beteiligten konkret die<br />
Vorteile der Zusammenarbeit erfahren.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Abbildung 15<br />
Übersicht über Erfolgsfaktoren <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit<br />
Erfolgsfaktoren <strong>in</strong>terko<br />
Grundpr<strong>in</strong>zipien<br />
der Zusammenarbeit<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
von Akteuren und Partnern<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
80<br />
Freiwilligkeit<br />
➔ „Von oben“ auferlegter<br />
<strong>Kooperation</strong> wird mit<br />
Skepsis begegnet<br />
➔ Initiierung „von unten“/<br />
Freiwilligkeit<br />
ist Ideallösung<br />
Frühzeitige E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
möglicher<br />
Partnerkommunen<br />
➔ Berücksichtigung<br />
der spezifischen Anforderungen<br />
der Partner<br />
➔ Fördert Identifikation<br />
der Beteiligten<br />
mit der <strong>Kooperation</strong><br />
Privates<br />
Know-how und Kapital<br />
nutzen<br />
➔ E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung Privater<br />
(Investoren, Fördervere<strong>in</strong>)<br />
verbessert die<br />
kommunale<br />
Leistungsfähigkeit<br />
und Umsetzbarkeit der<br />
<strong>Kooperation</strong>sziele<br />
<strong>Kooperation</strong> auf<br />
gleicher Augenhöhe/<br />
Konsenspr<strong>in</strong>zip<br />
➔ Ke<strong>in</strong>e Dom<strong>in</strong>anz durch<br />
e<strong>in</strong>zelne Partner<br />
➔ Partnerschaftliches<br />
Mite<strong>in</strong>ander<br />
➔ Geeignete Entscheidungsstrukturen,<br />
die e<strong>in</strong> gleichberechtigtes<br />
Mite<strong>in</strong>ander<br />
widerspiegeln<br />
Fairer<br />
Interessenausgleich<br />
➔ Berücksichtigung und<br />
Ausgleich der Interessen<br />
aller <strong>Kooperation</strong>spartner<br />
➔ Themenübergreifendes<br />
Geben und Nehmen<br />
eröffnet Spielräume<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
von Akteuren <strong>in</strong> ...<br />
... kommunale Gremien<br />
➔ Transparenz und<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung baut etwaige<br />
Vorbehalte bei<br />
Mandatsträgern ab<br />
... Bürgerschaft<br />
➔ Öffentlichkeitsarbeit und<br />
Partizipationsprozesse<br />
dienen der Vermittlung<br />
der <strong>Kooperation</strong>sziele<br />
und der Nutzung bürgerlichen<br />
Engagements<br />
... Verwaltung<br />
➔ Mitarbeiter der Verwaltung<br />
setzen <strong>Kooperation</strong> um<br />
➔ Gestaltungsspielräume<br />
im Rahmen der<br />
politischen Zielvorgaben<br />
fördern Engagement<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
externen Sachverstands<br />
Landkreise<br />
➔ Beratungsangebote<br />
der Kreisverwaltung<br />
können <strong>in</strong>sbesondere<br />
bei fachlichen,<br />
organisatorischen und<br />
rechtlichen Fragen<br />
Hilfe leisten<br />
Fachbüros und wissenschaftliche<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
➔ Wichtige Impulsgeber<br />
bei Analyse, Konzeption<br />
und Management von<br />
<strong>Kooperation</strong>saktivitäten<br />
Moderatoren<br />
➔ Externe Moderatoren<br />
verbessern Chancen,<br />
tragfähige Kompromisse/<br />
Lösungen zu f<strong>in</strong>den<br />
Quelle: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
mmunaler <strong>Kooperation</strong><br />
Zusammenarbeit<br />
als Prozess<br />
F<strong>in</strong>anzierung<br />
Geme<strong>in</strong>sames<br />
Problemverständnis,<br />
klare Leitbilder<br />
und realisierbare Ziele<br />
➔ Um unterschiedlichen<br />
Erwartungen<br />
an die <strong>Kooperation</strong><br />
vorzubeugen, s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sames<br />
Problemverständnis<br />
sowie klar def<strong>in</strong>ierte<br />
Zielsetzungen notwendig<br />
Organisationsstrukturen<br />
wachsen lassen<br />
➔ Langwierige Verfassungsdiskussionen<br />
können<br />
<strong>Kooperation</strong>sansätze im<br />
Keim ersticken<br />
➔ Am Anfang s<strong>in</strong>d oft<br />
niederschwellige<br />
Organisationsformen<br />
ausreichend<br />
➔ Organisationsstrukturen<br />
können mit<br />
<strong>Kooperation</strong>s<strong>in</strong>halten<br />
wachsen<br />
Transparenter<br />
Ausgleich von Lasten<br />
und Nutzen<br />
➔ Transparenz und Nachvollziehbarkeit<br />
für alle<br />
<strong>Kooperation</strong>spartner<br />
➔ e<strong>in</strong>fache Verteilungsmodelle<br />
erhöhen Akzeptanz<br />
➔ E<strong>in</strong>e Abrechnung<br />
„auf den Cent genau“<br />
ist oftmals nicht möglich.<br />
Vielmehr gilt es,<br />
auf den langfristigen<br />
Mehrwert der <strong>Kooperation</strong><br />
zu vertrauen.<br />
Fazit:<br />
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>in</strong>terkommunaler<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
81<br />
Projektpr<strong>in</strong>zip/<br />
<strong>Kooperation</strong>sthemen<br />
schrittweise entwickeln<br />
Geme<strong>in</strong>same<br />
Außendarstellung/<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Fördermöglichkeiten<br />
erschließen<br />
und nutzen<br />
➔ <strong>Kooperation</strong>sprozesse<br />
leben von der Umsetzung<br />
➔ Es gilt, frühzeitig<br />
überschaubare Projekte<br />
zu realisieren<br />
➔ Auf Grundlage<br />
von Erfolgserlebnissen<br />
können auch<br />
komplexere Probleme<br />
angegangen werden<br />
➔ Vermittlung der<br />
positiven Effekte der<br />
Zusammenarbeit<br />
schafft Akzeptanz<br />
➔ Geme<strong>in</strong>same Darstellung<br />
erhöht Identifikation mit<br />
<strong>Kooperation</strong><br />
➔ Raum für Profilierung<br />
der <strong>Kooperation</strong>spartner<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em vere<strong>in</strong>barten<br />
Rahmen<br />
➔ Mit <strong>in</strong>terkommunaler<br />
Zusammenarbeit<br />
lassen sich vermehrt<br />
Fördermöglichkeiten<br />
nutzen<br />
➔ Fördermittel können<br />
für alle <strong>Kooperation</strong>spartner<br />
e<strong>in</strong> zusätzlicher<br />
Anreiz dafür se<strong>in</strong>,<br />
e<strong>in</strong> <strong>Kooperation</strong>sprojekt<br />
durchzuführen
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
6 Empfehlungen zur weiteren<br />
Intensivierung der Zusammenarbeit<br />
<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit stellt ke<strong>in</strong>en Selbstzweck dar! Wie die dargestellten<br />
guten Beispiele <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> aufzeigen, bietet geme<strong>in</strong>deübergreifende<br />
Zusammenarbeit Städten und Geme<strong>in</strong>den die Chance, e<strong>in</strong>e nachhaltige<br />
Entwicklung der eigenen Kommune und der Region e<strong>in</strong>zuleiten. Die Umfrage<br />
unter hessischen Städten und Geme<strong>in</strong>den belegt, dass <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> bereits vielfache<br />
<strong>Kooperation</strong>sansätze vorhanden s<strong>in</strong>d und die Absicht zur Weiterentwicklung<br />
besteht. Diese Weiterentwicklung sollte verstärkt an den folgenden drei Zielen<br />
ausgerichtet se<strong>in</strong>:<br />
1. <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> als strategischer Ansatz<br />
Empfehlungen zur<br />
weiteren Intensivierung<br />
der Zusammenarbeit<br />
82<br />
<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit ist <strong>in</strong> hessischen Kommunen derzeit <strong>in</strong> den<br />
meisten Fällen auf e<strong>in</strong> oder zwei sachlich begrenzte E<strong>in</strong>zelprojekte beschränkt.<br />
Angesichts der umfassenden Herausforderungen, denen sich Städte und<br />
Geme<strong>in</strong>den (siehe Kapitel 1„Zukunftsaufgabe <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong>“)<br />
stellen müssen, sollte <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> zukünftig stärker als strategischer<br />
Ansatz für die gesamte Bandbreite kommunalen Handelns verstanden<br />
werden. Solche themen- oder handlungsfeldübergreifende <strong>Kooperation</strong>snetzwerke<br />
s<strong>in</strong>d erforderlich, da sich komplexe Problemstellungen wie der<br />
demographische und wirtschaftsstrukturelle Wandel nicht durch punktuelle,<br />
sondern nur durch umfassende <strong>in</strong>tegrierte Ansätze bewältigen lassen.<br />
2. Schaffung e<strong>in</strong>er <strong>Kooperation</strong>skultur<br />
Voraussetzung für umfassende <strong>Kooperation</strong>snetzwerke ist die Schaffung e<strong>in</strong>er<br />
entsprechenden <strong>Kooperation</strong>skultur. Diese setzt bei den kommunalen Akteuren<br />
die Bereitschaft voraus, auch außerhalb des verpflichtenden Rahmens benachbarte<br />
Städte und Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> relevante Entscheidungen e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den und<br />
kommunale Planungen mit diesen abzustimmen. Grundlage für e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong>skultur<br />
ist e<strong>in</strong>e solide Vertrauensbasis, die nur durch e<strong>in</strong>en fairen Interessenausgleich<br />
und e<strong>in</strong>e verlässliche Partnerschaft erzielt werden kann (siehe<br />
auch Kapitel 5.1 „Grundpr<strong>in</strong>zipien der Zusammenarbeit“).<br />
Zu e<strong>in</strong>er umfassenden <strong>Kooperation</strong>skultur gehört neben der <strong>in</strong>terkommunalen<br />
<strong>Kooperation</strong> auch die <strong>in</strong>trakommunale <strong>Kooperation</strong> – die Zusammenarbeit<br />
mit Bürgerschaft und privaten Unternehmen. Diese ist anzustreben, da privates<br />
Engagement angesichts der ger<strong>in</strong>ger werdenden Handlungsspielräume der<br />
Kommunen e<strong>in</strong> wertvolles Potenzial darstellt.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
3. Vernetzung <strong>in</strong> die Region<br />
Lokale <strong>Kooperation</strong>snetzwerke mehrerer benachbarter Kommunen dürfen sich<br />
nicht als geschlossene E<strong>in</strong>heiten betrachten. Vielmehr gilt es, abhängig von<br />
unterschiedlichen <strong>Kooperation</strong>sgegenständen flexible räumliche Zuschnitte für<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> zu f<strong>in</strong>den. Die Vernetzung <strong>in</strong> die Region ist darüber h<strong>in</strong>aus<br />
<strong>in</strong> Handlungsfeldern von Bedeutung, <strong>in</strong> denen aufgrund regionaler Verflechtungen<br />
e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>räumliche Betrachtung nicht ausreicht und daher regionale<br />
Lösungen gefunden werden müssen.<br />
In diesem Zusammenhang kommt <strong>in</strong>tegrierten regionalen Entwicklungskonzepten<br />
e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu. Diese Entwicklungskonzepte stellen den Zusammenhang<br />
zwischen Entwicklungszielen für e<strong>in</strong>e Region und konkreten Projekten<br />
her. Bei <strong>in</strong>terkommunaler <strong>Kooperation</strong> <strong>in</strong> Regionen, <strong>in</strong> denen es auf e<strong>in</strong>er<br />
größeren regionalen Ebene e<strong>in</strong> regionales Entwicklungskonzept und e<strong>in</strong> professionelles<br />
Regionalmanagement gibt, ist unbed<strong>in</strong>gt darauf zu achten, dass<br />
die Handlungsfelder und Konzepte der beiden Initiativen <strong>in</strong> sich widerspruchsfrei<br />
s<strong>in</strong>d oder aufe<strong>in</strong>ander abgestimmt werden.<br />
■ Stadtumbau <strong>in</strong>terkommunal umsetzen<br />
Für den Stadtumbau hat die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit und deren angeregte<br />
Weiterentwicklung herausgehobene Bedeutung, da es geme<strong>in</strong>deübergreifender<br />
Lösungsansätze zur Bewältigung des demographischen und wirtschaftsstrukturellen<br />
Wandels bedarf. Diese Tatsache ist von zahlreichen Städten und Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong><br />
<strong>Hessen</strong> aufgegriffen worden, die beabsichtigen, ihren Stadtumbau im Rahmen<br />
<strong>in</strong>terkommunal getragener beziehungsweise abgestimmter Konzepte umzusetzen.<br />
Empfehlungen zur<br />
weiteren Intensivierung<br />
der Zusammenarbeit<br />
83<br />
Um hierbei erfolgreich zu se<strong>in</strong>, wird sich die <strong>in</strong>terkommunale Zusammenarbeit<br />
auch <strong>in</strong>haltlich weiterentwickeln müssen. Konkret bedeutet dies, dass stärker e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>same Siedlungs- und Freiflächenplanung vorgenommen werden muss.<br />
Mögliche Steuerungs<strong>in</strong>strumente für e<strong>in</strong>e wirkungsvolle Lenkung der Siedlungsentwicklung<br />
und für die Umsetzung e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terkommunalen Bodenmanagements s<strong>in</strong>d<br />
etwa geme<strong>in</strong>same Siedlungsrahmenkonzepte, Flächennutzungspläne, E<strong>in</strong>zelhandelsund<br />
Zentrenkonzepte, Wohnraumversorgungskonzepte und Gewerbeflächenpools.<br />
Auch h<strong>in</strong>sichtlich der sozialen und kulturellen Infrastruktur ist e<strong>in</strong>e Intensivierung<br />
der Zusammenarbeit erforderlich, um weiterh<strong>in</strong> die F<strong>in</strong>anzierbarkeit dieser Infrastrukturen<br />
zu gewährleisten. Dies betrifft <strong>in</strong>sbesondere den Bereich der Freizeit-,<br />
Kultur- und Bildungs<strong>in</strong>frastruktur.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Quellenverzeichnis<br />
Literatur<br />
Quellenverzeichnis<br />
84<br />
Bayrische Staatszeitung (2002): Kommunale E<strong>in</strong>kaufsgeme<strong>in</strong>schaften, Ausgabe 47.<br />
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2005): Raumordnungsbericht 2005, Bonn.<br />
Busch, Uwe van den (2004): Bevölkerungsvorausschätzung für die hessischen Landkreise und<br />
kreisfreien Städte bis 2050, Report 672, Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft <strong>Hessen</strong><br />
(heute: HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH) (Hrsg.), Wiesbaden.<br />
Conrad, Wolfgang (2004): Innovationsregion Mitte, Onl<strong>in</strong>emagaz<strong>in</strong> Stadtanalyse, 1. Jg. Nr. 9.<br />
Deutscher Städte- und Geme<strong>in</strong>debund (Hrsg.) (2004): <strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit,<br />
Dokumentation Nr. 39.<br />
Flug, Friedhelm; Schwart<strong>in</strong>g, Henn<strong>in</strong>g; Wackerl, Wolfgang (2003): <strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong> –<br />
Notwendigkeit und Chancen e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiveren Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene,<br />
Hessische Akademie der Forschung und Planung im ländlichen Raum, Mitteilungen Heft 25, Kassel.<br />
Holtel, Ulrike; Wuschansky Bernd (2002): <strong>Interkommunale</strong> Gewerbegebiete NRW, Dortmund.<br />
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (Hrsg.) (2002):<br />
Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr: Standort Wohnen Region<br />
Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler – Wohnungsbauprojekte mit Impulsauszeichnung.<br />
Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (Hrsg.) (1995):<br />
Wohnungsmarktuntersuchung für die Region Bonn – Abschlussbericht/Kurzfassung.<br />
Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (Hrsg.) (2002):<br />
E<strong>in</strong>zelhandels- und Zentrenkonzept für die Region Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler als Bauste<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er nachhaltigen Regionalentwicklung – Kurzfassung.<br />
Regionaler Arbeitskreis Entwicklung, Planung und Verkehr (Hrsg.) (2005):<br />
Von der „Ich- zur Wir-Region“.<br />
Rottmann, Manuela (2005): Das neue Vergaberecht muss kommunale Spielräume erhalten,<br />
Difu-Berichte 1/2.<br />
Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stadt Eschwege (2004): <strong>Kooperation</strong>sarbeitspapier für die<br />
Gründung der Innovationsregion Mitte.<br />
Zweckverband Raum Kassel: E<strong>in</strong>zelhandelskonzept für die Stadtregion Kassel, Kommunaler<br />
Entwicklungsplan (KEP) Zentren, www.zrk-kassel.de/e<strong>in</strong>zelhandelskonzept.pdf.<br />
Zweckverband Raum Kassel: KEP-Zentren 4/1998, ergänzt: 8/2000, www.zrk-kassel.de/kep.pdf.<br />
Fotos<br />
Seite 33: Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong>s Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal“<br />
Seite 61: Rhe<strong>in</strong>-Ma<strong>in</strong>-Therme<br />
Seite 65: Zweckverband „Kommunale Dienste Immenhausen-Espenau“<br />
Alle weiteren Fotographien wurden von der HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH zur Verfügung gestellt.
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Verzeichnis von Infoboxen, Abbildungen und Tabellen<br />
Infoboxen<br />
Infobox 1: Förderprogramm: Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 15<br />
Infobox 2: Förderprogramm: Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Förderung<br />
der regionalen Entwicklung 35<br />
Infobox 3: Richtl<strong>in</strong>ien des Landes <strong>Hessen</strong> zur Innovationsförderung 54<br />
Infobox 4: Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 59<br />
Infobox 5: Rahmenvere<strong>in</strong>barung zur Förderung der Bildung von geme<strong>in</strong>samen<br />
Dienstleistungszentren bei kle<strong>in</strong>eren Geme<strong>in</strong>den 67<br />
Abbildungen<br />
Abb. 1: Bevölkerungsveränderungen <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> von 2002 bis 2020 und 2050 7<br />
Abb. 2: Handlungsfelder mit besonderer Eignung<br />
für <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> aus Sicht der Befragten 24<br />
Abb. 3: Gibt es e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> mit e<strong>in</strong>er anderen Kommune? 25<br />
Abb. 4: <strong>Kooperation</strong>serfahrungen nach Regierungsbezirken 27<br />
Abb. 5: Hemmnisse <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit 28<br />
Abb. 6: Geplante Intensivierung von <strong>Kooperation</strong> nach Handlungsfeldern 29<br />
Abb. 7: Wohnungsmarktuntersuchung:<br />
Ablauf und Ergebnisse der Analyse des regionalen Wohnbaulandpotenzials 41<br />
Abb. 8: Auswahlkriterien des Impulsprogramms 42<br />
Abb. 9: Netzwerk für Existenzgründer 47<br />
Abb.10: Organisation der Gründungsberatung 48<br />
Abb. 11: Organisation der <strong>in</strong>terkommunalen Zusammenarbeit 49<br />
Abb. 12: Übersicht der F<strong>in</strong>anzierungsarten 66<br />
Abb. 13: Stadtumbau West <strong>in</strong> Schwalm-Eder-West: Vorgehensweise 70<br />
Abb. 14: Aufbau Zweckverband „<strong>Interkommunale</strong> Zusammenarbeit Schwalm-Eder-West“ 71<br />
Abb. 15: Übersicht über Erfolgsfaktoren <strong>in</strong>terkommunaler Zusammenarbeit 80<br />
Verzeichnis<br />
von Infoboxen,<br />
Abbildungen<br />
und Tabellen<br />
85<br />
Tabellen<br />
Tab. 1: Beteiligungen nach Regionen und E<strong>in</strong>wohnergrößenklassen 23<br />
Tab. 2: Glauben Sie, dass <strong>in</strong>terkommunale <strong>Kooperation</strong> grundsätzlich e<strong>in</strong> geeignetes<br />
Mittel zur Bewältigung kommunaler Aufgaben und Probleme ist? 24<br />
Tab. 3: Gibt es e<strong>in</strong>e <strong>Kooperation</strong> Ihrer Stadt/Geme<strong>in</strong>de mit e<strong>in</strong>er anderen? 25<br />
Tab. 4: <strong>Kooperation</strong>sprojekte <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 26<br />
Tab. 5: Übersicht der ausgewählten guten Beispiele nach Handlungsfeldern 31
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit (M1)<br />
Kaiser-Friedrich-R<strong>in</strong>g 75<br />
65185 Wiesbaden<br />
E-Mail: hmwvl@wirtschaft.hessen.de<br />
Impressum<br />
Redaktion<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Referat Städtebau und Städtebauförderung<br />
Rudolf Raabe<br />
Kar<strong>in</strong> Brandtönnies<br />
Telefon: (06 11) 815-29 63<br />
Telefax: (06 11) 815-49 29 63<br />
E-Mail: kar<strong>in</strong>.brandtoennies@hmwvl.hessen.de<br />
86<br />
Bearbeitung/Verfasser<br />
HA <strong>Hessen</strong> Agentur GmbH<br />
Landes- und Kommunalentwicklung<br />
Abraham-L<strong>in</strong>coln-Straße 38-42<br />
65189 Wiesbaden<br />
Henn<strong>in</strong>g Schwart<strong>in</strong>g<br />
Telefon: (06 11) 774-83 31<br />
E-Mail: henn<strong>in</strong>g.schwart<strong>in</strong>g@hessen-agentur.de<br />
Kar<strong>in</strong> Krökel<br />
Telefon: (06 11) 774-89 36<br />
E-Mail: kar<strong>in</strong>.kroekel@hessen-agentur.de<br />
Gestaltung<br />
Studio Oberländer<br />
Rubensstraße 33<br />
60596 Frankfurt am Ma<strong>in</strong><br />
Telefon: (069) 63 15 20 - 85<br />
www.studio-oberlaender.de<br />
Druck<br />
Frotscher Druck<br />
Riedstraße 8<br />
64295 Darmstadt<br />
1. Auflage: 4.000<br />
Wiesbaden, Juni 2006
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
Bestellh<strong>in</strong>weise<br />
Bestellh<strong>in</strong>weis<br />
Diese Druckschrift kann beim Hessischen M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung bestellt werden.<br />
Bitte senden Sie Ihre Bestellung schriftlich<br />
(per Fax, E-Mail oder Postkarte) an:<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Kaiser-Friedrich-R<strong>in</strong>g 75<br />
65185 Wiesbaden<br />
Telefax: (06 11) 815 - 49 29 63<br />
E-Mail: kar<strong>in</strong>.brandtoennies@hmwvl.hessen.de<br />
Download im Internet unter:<br />
www.stadtumbau-hessen.de (siehe L<strong>in</strong>k Infomaterial)<br />
und<br />
www.wirtschaft.hessen.de (siehe L<strong>in</strong>k Infomaterial)<br />
Bestellh<strong>in</strong>weise<br />
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br />
der Hessischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf<br />
weder von Parteien noch von Wahlbewerber<strong>in</strong>nen und Wahlbewerbern,<br />
Wahlhelfer<strong>in</strong>nen und Wahlhelfern während e<strong>in</strong>es<br />
Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet<br />
werden. Dies gilt für Europa-, Bundestags-, Landtags- und<br />
Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist <strong>in</strong>sbesondere die Verteilung<br />
auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das E<strong>in</strong>legen, Aufdrucken oder Aufkleben<br />
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.<br />
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke<br />
der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu e<strong>in</strong>er bevorstehenden<br />
Wahl darf die Druckschrift nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise<br />
verwendet werden, die als Parte<strong>in</strong>ahme der Landesregierung<br />
zugunsten e<strong>in</strong>zelner politischer Gruppen verstanden werden<br />
könnte.<br />
Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon,<br />
wann, auf welchem Weg und <strong>in</strong> welcher Anzahl diese Druckschrift<br />
dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist<br />
es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer<br />
eigenen Mitglieder zu verwenden.<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative<br />
Stadtumbau <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
87<br />
<strong>Interkommunale</strong><br />
<strong>Kooperation</strong><br />
87
<strong>Interkommunale</strong> <strong>Kooperation</strong><br />
???<br />
??
Hessisches<br />
M<strong>in</strong>isterium für<br />
Wirtschaft,<br />
Verkehr und<br />
Landesentwicklung<br />
Kaiser-Friedrich-R<strong>in</strong>g 75<br />
65185 Wiesbaden<br />
www.wirtschaft.hessen.de