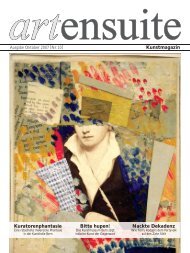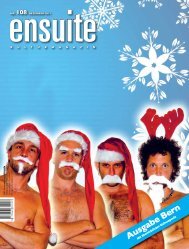Ausgabe Zürich - Ensuite
Ausgabe Zürich - Ensuite
Ausgabe Zürich - Ensuite
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ensuite<br />
K U L T U R M A G A Z I N<br />
NR. 84 DEZ. 2009 | 7. JAHRGANG<br />
K U L T U R M A G A Z I N<br />
Inkl. Kunstbeilage artensuite<br />
Schweiz sFr. 7.90,<br />
Deutschland, Österreich,<br />
Frankreich, Italien € 6.50<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>Zürich</strong><br />
Mit übersichtlicher Kulturagenda
Habib Asal<br />
Zora Berweger<br />
Boris Billaud<br />
Manuel Burgener<br />
Raffaella Chiara<br />
Jürg Grünig<br />
Christoph Gugger<br />
Stefan Guggisberg<br />
Haus am Gern<br />
Nina Heinzel<br />
Peter Iseli<br />
Alain Jenzer<br />
Heidi Künzler<br />
Karin Lehmann<br />
Andrea Loux<br />
Marius Lüscher<br />
Renée Magaña<br />
Christina Niederberger<br />
Mariann Oppliger<br />
Nadin Maria Rüfenacht<br />
Irene Schubiger<br />
Dominik Stauch<br />
Sereina Steinemann<br />
Weihnachtsausstellung<br />
09/10<br />
Kunsthalle Bern<br />
-<br />
19.12.09 − 31.01.10<br />
SIMONE<br />
AUGHTERLONY<br />
&<br />
ISABELLE<br />
SCHAD<br />
«SWEET DREAMS<br />
ARE MADE»<br />
FR, 18. & SA, 19. DEZEMBER<br />
20:00 UHR<br />
VVK: WWW.STARTICKET.CH / INFOS: WWW.DAMPFZENTRALE.CH<br />
DAMPFZENTRALE BERN, MARZILISTRASSE 47, 3005 BERN<br />
UNTERSTÜTZT VON: STADT BERN, KANTON BERN, BURGERGEMEINDE BERN,<br />
ERNST GÖNER STIFTUNG, MIGROS KULTURPROZENT, HOTEL NATIONAL BERN.<br />
Geschichten<br />
mit Sáppho, Dido und Steffi<br />
22. und 23. Januar 2010<br />
INNOVANTIQUA WINTERTHUR - das andere Alte Musik Festival<br />
Meisterkonzert<br />
Sonderkonzert – Junge Meister<br />
Patronat:<br />
Maja Ingold, Fritz Näf<br />
Juliane Heutjer, Barockflöte; Katharina Heutjer, Barockvioline;<br />
Jonathan Pešek, Barockvioloncello; Sebastian Wienand, Cembalo.<br />
1. Preis und Publikumspreis «Musica Antiqua Brügge»<br />
Melpomen (CH,I)<br />
Contraband (D)<br />
Morethanmusic (Basel)<br />
Les haulz et les bas (D)<br />
Basler Madrigalisten<br />
Freitagsakademie Bern<br />
www.innovantiqua.ch<br />
Vorverkauf ab<br />
4. Januar 2010<br />
Winterthur Tourismus<br />
im Hauptbahnhof<br />
www.ticket.winterthur.ch<br />
Tel. 052 267 67 00<br />
Werke von RC. Monteverdi, T. Merula, D. Castello, G. Fr. Händel,<br />
A. Vivaldi, L. Boccherini<br />
So 13. Dezember 2009, 17 Uhr<br />
Auditorium Martha Müller, ZPK<br />
Vorverkauf: www.kulturticket.ch,<br />
Tel. 0900 585 887 (CHF 1.20/Min.)<br />
Eintritt inkl. Willkommensgetränk<br />
und Ausstellungsbesuch.<br />
www.zpk.org
12<br />
Inhalt<br />
30<br />
28<br />
34<br />
24<br />
PERMANENT<br />
6 SENIOREN IM WEB<br />
6 KURZNACHRICHTEN<br />
8 FILOSOFENECKE<br />
11 ÉPIS FINES<br />
18 KULTUR DER POLITIK<br />
19 CARTOON / MENSCHEN & MEDIEN<br />
21 LITERATUR-TIPPS<br />
25 INSOMNIA<br />
36 TRATSCHUNDLABER<br />
38 IMPRESSUM<br />
39 KULTURAGENDA ZÜRICH<br />
Bild Titelseite: Die legendären «Depeche Mode» spielen<br />
am 6. und 7. Dezember im ausverkauften Hallenstadion.<br />
5 KULTURESSAYS<br />
5 Hochkultur<br />
Von Lukas Vogelsang<br />
7 «Kultur ist etwas vom Wichtigsten»<br />
Von Barbara Neugel<br />
9 Zukuntfsmusik<br />
Von Irina Mahlstein<br />
10 Samichlaus in der Badewanne<br />
Von Barbara Roelli<br />
11 Herbstwetterklassiker<br />
Von Simone Weber<br />
12 Kunst zwischen Apfelkuchen<br />
und Anrufbeantworter<br />
Von Rebecka Domig und Sonja Gasser<br />
14 KunstLiebeGeld<br />
Von Jarom Radzik<br />
16 Inne- und Aushalten<br />
Von Ursula Lüthi<br />
38 Sensorreiniger, YB und harter Kaugummi<br />
Von Isabelle Haklar<br />
20 LITERATUR<br />
20 Seit jeher unterwegs<br />
Von Konrad Pauli<br />
23 TANZ & THEATER<br />
22 Theater Zinnober / o.N. aus Berlin<br />
Von Robert Salzer<br />
23 Weltbürger oder Neandertaler?<br />
Von Alexandra Portmann<br />
24 «Bern ist mein Gotthard»<br />
Von Luca D’Alessandro<br />
27 MUSIC & SOUNDS<br />
27 15 Jahre Subversiv Records<br />
Von Ruth Kofmel<br />
28 Das Monster von Losone<br />
Interview: Luca D’Alessandro<br />
30 «...das Symphonieorchester als<br />
verzaubernder Klangkörper, ein Ort<br />
passionierter Konzentration»<br />
Interview: Karl Schüpbach<br />
32 KINO & FILM<br />
32 A Serious Man - eine Hommage<br />
ans Jüdischsein<br />
Von Guy Huracek<br />
33 Vom Film zurück zur Geschichte<br />
Von Florian Imbach<br />
34 Weihnachtskino: Fürsorger,<br />
Breath Made Visible, Amerrika<br />
Von Lukas Vogelsang<br />
36 Law abiding citizen<br />
Von Sonja Wenger<br />
36 New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde<br />
Von Sonja Wenger<br />
37 Gutes Genrekino? Im TV!<br />
Von Morgane A. Ghilardi<br />
ensuite.ch<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 3
Klaus Huber in Bern<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
anlässlich des 85. Geburtstages des Komponisten<br />
Donnerstag—Samstag, 10.—12. Dezember 2009<br />
Hochschule der Künste Bern, Papiermühlestrasse 13, 3014 Bern<br />
10. 12. 2009, 17.00 Uhr, Kammermusiksaal<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
Podiumsdiskussion<br />
11. / 12. 12. 2009, diverse Säle<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
Kompositions- und Interpretationsworkshops<br />
11. 12. 2009, 20.00 Uhr, Grosser Konzertsaal<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
öffentliche Probe von «… à l’âme de descendre de sa monture …»<br />
12. 12. 2009, Grosser Konzertsaal<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
14.30 Uhr, «El pueblo nunca muere»<br />
Film von Matthias Knauer zum Werk «erniedrigt, geknechtet, beleidigt»<br />
17.00 Uhr, «… à l’âme de descendre de sa monture …»<br />
weitere Informationen: www.hkb.bfh.ch<br />
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />
Eine Koproduktion der IGNM Bern und der Hochschule der Künste Bern<br />
Herzlichen Dank für die Unterstützung durch
Kulturessays<br />
Immer mehr<br />
Menschen<br />
brauchen ein<br />
ensuite-Abo.<br />
Dank für die finanzielle Unterstützung an:<br />
EDITORIAL<br />
Hochkultur<br />
ensuite im Dezember<br />
Künstler beharren heute sehr präzise auf<br />
dem Wert ihrer Arbeit. Kunst kostet – das<br />
stellten wir in der Redaktion wieder mal fest,<br />
als wir die Preise eines klassischen Konzertes<br />
oder einer Oper vor Augen hatten und als uns<br />
die Fachstelle Kultur aus <strong>Zürich</strong> mitteilte, dass<br />
sie nur «professionelles, das heisst angemessen<br />
entlöhntes Kulturschaffen mit Kulturfördermitteln»<br />
finanzieren wolle. Es ist so: Den Preis für<br />
Kulturelles und Kunst zu bezahlen setzt die Bereitschaft<br />
dafür voraus – sonst funktioniert der<br />
Kunstmarkt nicht und dabei ist es egal, ob wir<br />
von einem Konzert, Theater oder einem Bild<br />
sprechen. Ohne dieses Geld bleibt jede künstlerische<br />
Tätigkeit brotlos. Dem Gegenüber ist<br />
der Inhalt, der Sinn und die Idee hinter einem<br />
Projekt oder einem Werk selten Gegenstand einer<br />
Diskussion. Das Philosophieren gehört nicht<br />
mehr zu unserem getwitterten und facebookenen<br />
Alltag. Wir leben heute flüchtig – auch finanziell.<br />
Der Staat oder die öffentliche Hand sind deswegen<br />
wichtige Förderstellen, ein gutes Beispiel<br />
ist dabei der Film. Ein kultureller Film (wie das<br />
auch zu definieren sein soll) kostet in der Entstehung<br />
viel Geld und man geht nicht davon aus,<br />
dass jener durch Aufführungsgewinne dies wieder<br />
einspielt – zumindest im Filmmarkt Schweiz.<br />
Also muss ein Film vor der Produktion bereits<br />
durchfinanziert sein.<br />
Da entsteht natürlich ein Problem für die<br />
Filmbranche und bei den Fördergeldern herrscht<br />
Gedränge: Der Bund muss seine Kulturausgaben<br />
politisch und juristisch erklären können. Ihm<br />
geht es nicht um die Wichtigkeit des Inhalts,<br />
sondern um die Repräsentation gegenüber der<br />
Politik oder den anderen Staaten im allgemeinen<br />
Wettbewerb. So hat das Bundesamt für Kultur<br />
(BAK) die Leuchtturm-Philosophie durchgesetzt<br />
und stärkt vor allem Erfolgsprojekte – ausgerechnet<br />
jene, die an der Kinokasse noch am meisten<br />
Erfolg haben könnten. Doch im Gegenzug erhält<br />
die Schweiz dadurch Filme, die sich im internationalen<br />
Wettbewerb zeigen und damit wieder<br />
Geld für den Film, durch Co-Produktionen zum<br />
Beispiel mit anderen Ländern, in die Schweiz<br />
bringen könnten. «Könnten», denn das ist ein<br />
Prozess, der Zeit braucht. Ergebnisse sind noch<br />
keine greifbar, was die Branche verständlicherweise<br />
ärgert.<br />
Die vielen Filmschaffenden, die nicht zu dieser<br />
Erfolgskategorie oder zu diesen Hype-FilmerInnen<br />
gehören, müssen mit der regionalen<br />
Filmförderung zurechtkommen. Das heisst weniger<br />
Geld und mehr Konkurrenz und dadurch<br />
weniger Möglichkeiten aufzusteigen. Für die<br />
regionale Filmförderung hingegen ist die Situation<br />
ganz blöd: Sie ermöglichen das Überleben<br />
der Filmschaffenden so lange, bis diese ihren<br />
Film beim BAK unterbringen können oder keine<br />
Kraft mehr haben und aufgeben. Die Regionalen<br />
mutieren damit zur Sozialhilfe – denn diese<br />
Filme haben kaum eine Chance im Wettbewerb.<br />
Wer’s trotzdem schafft, wird von der nationalen<br />
Politik gelobt und gehätschelt – als wären sie<br />
die Helden und verantwortlich dafür. Irgendwie<br />
auch verständlich, dass dies Frust hervorruft –<br />
für alle Beteiligten. Es scheint, dass hier ein Gedanke<br />
nicht wirklich gedacht worden ist.<br />
Aber wer jetzt meint, dass die Verbände oder<br />
die Filmschaffenden selber an einer konstruktiven<br />
Lösung interessiert wären, ist getäuscht.<br />
Das Einzige, was gefordert wird, ist noch mehr<br />
Geld für den Film. Dabei bräuchte es schlaue Lösungen.<br />
40 Millionen werden jährlich vom BAK<br />
für den Film ausgegeben – und eben, irgendjemand<br />
muss das bezahlen. Dass die Steuerzahler-<br />
Innen nicht unbedingt Lust haben, jeden Rappen<br />
in die Wirtschaftsförderung zu stecken, die<br />
schlussendlich, wie wir von der Krise her wissen,<br />
den anschliessenden Erfolg für sich behalten,<br />
ist doch verständlich. Die Filmschaffenden<br />
wollen Geld, das BAK will qualitativen Film und<br />
gestärkt werden durch die Politik – und irgendwie<br />
finden diese Gruppen nicht zusammen. Und<br />
vielleicht hat dann irgendwann das Publikum<br />
auch noch was zu sagen.<br />
Lukas Vogelsang<br />
Chefredaktor<br />
ensuite.ch<br />
Die nächste ensuite-<strong>Ausgabe</strong> erscheint erst am<br />
7. Januar 2010! Frohe Weihnachten und so...<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 5
SENIOREN IM WEB<br />
Von Willy Vogelsang, Senior<br />
Verstehen Sie Denglisch? Oder sprechen<br />
Sie selbst dieses Sprachgemisch,<br />
wenn Sie von Ihrem Handy, dem beweglichen,<br />
handlichen Telefonkästchen oder von Ihrem<br />
Laptop, der flachen, kompakten, tragbaren<br />
elektronischen Datenverarbeitungsmaschine<br />
erzählen? Das berühmteste denglische Wort<br />
ist wohl «gedownloadet». Wir haben schlicht<br />
vergessen, dass ein Programm über das Internet<br />
(weltweites Kommunikationsnetzwerk)<br />
heruntergeladen werden kann.<br />
Wenn Sie gar keinen PC (persönlichen,<br />
elektronischen Datenrechner) im Haus haben,<br />
dann lesen Sie nicht weiter. Es wird sowieso<br />
«spanisch» für Sie!<br />
Wer in den vergangenen zehn Jahren den<br />
Einstieg in die elektronische, digitale Kommunikation<br />
und Datenverarbeitung nicht mitgemacht<br />
hat – ich sage bewusst nicht «verpasst»<br />
–, wird es je länger je schwieriger haben, die<br />
damit verbundene Fachsprache zu verstehen.<br />
Ich habe zwar längst begriffen, dass die Bestandteile,<br />
Programme, Funktionen, Befehle<br />
oder Anweisungen in digitaler Form in Englisch<br />
quasi als «Muttersprache» definiert<br />
werden. So ist gewährleistet, dass der grösste<br />
Teil der Weltbevölkerung mit einer einzigen<br />
Terminologie zurechtkommt. Zudem weiss der<br />
Rechner heute mit einem kleinen Aufwand die<br />
Begriffe in die meisten Sprachen der Welt zu<br />
übersetzen. Nicht umsonst heisst er ja auch<br />
Interpreter!<br />
Haben Sie dennoch Mühe, sich in der Sprache<br />
der Computerei zurecht zu finden? Läuft<br />
Ihnen bei «interner Festplatte» das Wasser<br />
im Mund zusammen, weil es Sie an eine reich<br />
gedeckte Berner-Platte oder Züri Gschnätzlets<br />
denken lässt? Dann besuchen (surfen) Sie die<br />
Seite von seniorweb.ch. Sie wird von Senioren<br />
wie Sie und ich gemacht, für die Generation<br />
über 50, die nur zu einem Teil mit dieser modernen<br />
Technik in Berührung gekommen, geschweige<br />
denn damit aufgewachsen ist.<br />
Die Seite ist interaktiv. Das bedeutet, Sie<br />
können erste Schritte machen, mit Ihren eigenen<br />
Worten auf Artikel oder Forenbeiträge reagieren,<br />
sich zu Wort melden, Ihre Meinung,<br />
aber auch Ihre Fragen anbringen. Das ist doch<br />
eine Chance. Sie werden Übersetzer finden,<br />
einfühlsame Menschen, die ihre Erfahrungen<br />
mit Ihnen teilen, einen fachlichen Rat geben;<br />
oder mit der Zeit sogar Freunde, die gerne mit<br />
Ihnen etwas zusammen unternehmen. Es muss<br />
gar nichts mit dem Computer zu tun haben!<br />
Und – man spricht Deutsch auf<br />
www.seniorweb.ch<br />
BONE 12<br />
Kurznachrichten<br />
Die 12. <strong>Ausgabe</strong> des internationalen Festivals<br />
für Aktionskunst BONE findet vom<br />
2. bis 6. Dezember im Schlachthaus Theater<br />
und im Progr (Sonntag, 6. Dezember) statt.<br />
BONE 12 trägt den Titel «An den Rändern der<br />
Performance Art». Bone möchten die Grauzone<br />
zwischen traditionellen Kunstsparten (wie<br />
Theater, Tanz, Oper, bildender Kunst) und der<br />
Performance Art erkunden. Wann ist zum Beispiel<br />
eine theatralische Darbietung nicht mehr<br />
nur Theater, sondern wird zu etwas, was man<br />
Performance nennt? Es existieren auch viele<br />
alltägliche Darbietungen, die nicht als «Kunst»<br />
gedacht sind, die aber, wenn man sie in einem<br />
solchen Kontext erlebt, durchaus als Performance<br />
Art bezeichnet werden könnten. So hat<br />
die Festivalleitung, Norbert Klassen und Peter<br />
Zumstein, verschiedene KünstlerInnen beauftragt,<br />
sich konkret mit den Rändern der Performance<br />
zu beschäftigen. Bone ist seit Jahren<br />
eines der spannendsten und provokativsten<br />
Performance-Festivals in der Schweiz. (Pressetext/vl)<br />
Mehr zum Festival ist auf unserer Website<br />
www.ensuite.ch zu finden.<br />
DER HKB-<br />
ADVENTSKALENDER<br />
Weihnachten steht bald vor der Tür und<br />
wie dieses Fest Bestandteil unserer<br />
Kultur ist, so ist es auch der Adventskalender.<br />
Als Countdown schreibt er die vergangenen<br />
Tage und weckt Erwartungen auf das Kommende.<br />
Um die Vorfreude gemeinsam zu feiern, laden<br />
Sarah Tenthorey und Oliver Frei zu einem<br />
Adventskalender der besonderen Art ein. Die<br />
HKB öffnet im Dezember die Pforte der CabaneB<br />
und überrascht mit einem abwechslungsreichen<br />
Programm: Studenten, Kultur- und<br />
Kunstschaffende aus diversen Bereichen der<br />
HKB setzen sich mit der Thematik des Advents<br />
auseinander und gewähren Einblick in vierundzwanzig<br />
«Kalenderfenster». Im Vordergrund<br />
stehen die Studierenden der HKB aus den verschiedenen<br />
Studienbereichen Gestaltung und<br />
Kunst, Konservierung und Restaurierung, Musik,<br />
Oper/Theater, sowie des Schweizerischen<br />
Literaturinstitutes und Y. Die CabaneB wird in<br />
der Adventszeit täglich von neuem von Studierenden<br />
bespielt und steht ihnen während dieser<br />
Zeit als offene Plattform für Ideen und Projekte<br />
zur Verfügung. Die Aktionen können zwischen<br />
4 Minuten und 24 Stunden dauern.<br />
Die CabaneB ist eine vom Pariser Architekten<br />
Jean Nouvel für die Expo02 entworfene<br />
Stahlkonstruktion, welche nun beim Bahnhof<br />
Bümpliz Nord als Kunstraum dient. (Pressetext/<br />
vl)<br />
Initianten: Sarah Tenthorey und Oliver Frei (Master<br />
Art Education), Hochschule der Künste Bern<br />
6
Kulturessays<br />
10 JAHRE KULTURVEREIN MURI-GÜMLIGEN<br />
«Kultur ist etwas<br />
vom Wichtigsten»<br />
Von Barbara Neugel Foto: XXX<br />
Kultur findet überall statt. Nur redet man<br />
nicht davon. Oder besser: Man spricht<br />
nur von den sogenannten Highlights, von Kulturveranstaltungen,<br />
die in grossen und grösseren<br />
Städten stattfinden, von grossen Künstlerinnen<br />
und Künstlern. Man geht hin zum Sehen<br />
und Gesehen werden. Nun, das sind ja alles Klischees.<br />
Und trotzdem ist etwas Wahres dran.<br />
Aber es gibt noch eine andere Kultur. Kultur,<br />
die nicht in den grossen Zentren stattfindet,<br />
sondern in der Agglomeration, in kleineren<br />
und grösseren Gemeinden ausserhalb der Städte.<br />
Diese Kultur ist nicht in aller Leute Munde,<br />
oft steht nichts davon in der Zeitung, weder<br />
vor einem Anlass noch danach. Und trotzdem<br />
ist diese Kultur sehr lebendig. Da finden Veranstaltungen<br />
statt für ein kleines Publikum,<br />
manchmal auch nur für wenige Interessierte.<br />
Da werden Veranstaltungen organisiert,<br />
Gäste eingeladen, da wird kommentiert und<br />
Hintergrundinformation geliefert. Diejenigen,<br />
die sich für solche Anlässe einsetzen und auf<br />
freiwilliger Basis engagieren, sind Leute aus<br />
der Gemeinde. Das ist lebendige und gelebte<br />
Kultur.<br />
Kultur in der Region also. Nehmen wir als<br />
Beispiel dafür die Gemeinde Muri-Gümligen.<br />
Seit genau zehn Jahren besteht in Muri-Gümligen<br />
der Kulturverein. Da setzen sich Leute<br />
ein, engagieren sich auf freiwilliger Basis, versuchen,<br />
anderen etwas zu bieten, Kommentare<br />
und Hintergrundinformationen zu liefern. Ueli<br />
Thomet, Gründungsmitglied, erster Präsident<br />
und heutiger Ehrenpräsident des Vereins, erzählt<br />
aus der Anfangszeit: «Jede Gemeinde hat<br />
verschiedene Kommissionen – eine Sportkommission,<br />
eine Bau- und eine Schulkommission<br />
und so weiter und eben auch eine Kulturkommission<br />
beziehungsweise einen Ausschuss für<br />
Erwachsenenbildung. Dieser Ausschuss wurde<br />
politisch zusammengestellt, die Leute wurden<br />
hineindelegiert. Nicht alle von ihnen waren<br />
aber auch an Kultur interessiert, und politisch<br />
waren in diesem Ausschuss auch keine Lorbeeren<br />
zu holen. Der damalige Gemeinderat Hans<br />
Aeschbacher hatte das Problem erkannt und<br />
festgestellt, dass eine Trennung vorgenommen<br />
werden müsste. Kultur sollte nicht mit Politik<br />
verbunden sein, und es sollten sich Leute um<br />
die Kultur kümmern, die auch wirklich an der<br />
Sache interessiert sind. Die Kulturkommission<br />
war überfordert mit all den Anfragen, die an sie<br />
gerichtet wurden. Darauf wurde der Kulturverein<br />
gegründet, im November 1999, mit einem<br />
harten Kern von 40 Leuten. Und das war eine<br />
Chance für die Gemeinde. Ein bescheidener<br />
Anfang wurde gemacht, finanzielle Unterstützung<br />
erfolgte durch die Gemeinde, da der Kulturverein<br />
ja auch die Idee der Gemeinde war.<br />
Auf dem Programm stand jeden Monat eine<br />
Veranstaltung. Viel wurde selber gemacht.»<br />
Und das Unternehmen Kulturverein begann<br />
sich zu entwickeln. Heute zählt der Verein 400<br />
Mitglieder, was gemäss Thomet «extrem erfreulich»<br />
ist. Auch Gründungsmitglieder seien<br />
noch dabei, sagt er. Dann blickt Thomet zurück<br />
auf die Anfangszeit. Ja, damals sei alles<br />
viel weniger professionell gemacht worden. Sie<br />
hätten viel gelernt, vor allem aus Fehlern und<br />
aus Dingen, die nicht so gut gelaufen seien. Er<br />
selber hätte Volkshochschulkurse besucht für<br />
Public Relations, um den richtigen Umgang mit<br />
Journalistinnen und Journalisten zu lernen. Die<br />
neue Präsidentin, Regula Mäder, sei Gymnasiallehrerin<br />
und ausgebildete Kulturmanagerin,<br />
also prädestiniert für dieses Amt.<br />
«Die Idee, die dem Kulturverein zugrunde<br />
liegt, ist Kulturvermittlung für Leute, die sich<br />
nicht unbedingt für Kultur interessieren. Mit<br />
einem sanften Einstieg sollen die Leute an die<br />
Sache herangeführt werden. Sehr wichtig dabei<br />
ist auch ein breit gefächertes Angebot», sagt<br />
Ueli Thomet. Gerade in Muri-Gümligen hätte es<br />
sofort Stimmen gegeben, die gesagt hätten, die<br />
Leute gingen für Kultur nach Bern oder nach<br />
London oder irgendwohin, die könnten sich<br />
das leisten, führt Thomet aus. Er hätte das zur<br />
Kenntnis genommen. Es war aber überhaupt<br />
nicht so: «Der Aufbau war schnell möglich.<br />
Heute ist der Kulturverein aus der Kulturszene<br />
Muri nicht mehr wegzudenken. Viele Anfragen<br />
kommen auch dank Mund-zu-Mund-Propaganda.»<br />
Weiter erzählt Ueli Thomet, dass vor zwei<br />
Jahren eine Anfrage aus Münchenbuchsee gekommen<br />
sei. Man wollte wissen, wie der Kulturverein<br />
Muri-Gümligen funktioniere. Er sei nach<br />
Münchenbuchsee gegangen und hätte darüber<br />
referiert. Aber seither hätte er nichts mehr gehört.<br />
Schade eigentlich. Schade findet Ueli Thomet<br />
auch, dass seine Idee, dass die Gemeinden<br />
der näheren Umgebung sich gemeinsam für<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 7
8<br />
FILOSOFENECKE<br />
NUR KRÜPPEL<br />
WERDEN<br />
ÜBERLEBEN.<br />
Peter Sloterdijk 2009<br />
Nein, nicht sorglose Unempfindsamkeit<br />
des arrivierten Gegenwartsphilosophen<br />
setzt sich über den correctness-Zeitgeist hinweg,<br />
Sloterdijk stützt sich auf die Krüppelanthropologie,<br />
welche in der Wissenschaftssprache<br />
bis ins 20. Jh. ihren unbedenklichen<br />
Platz hatte. In ihr erscheint der Mensch als<br />
Animal, das sich damit zu befassen hat, wie<br />
es in diesem Leben vorankommen kann, trotzdem<br />
es behindert wird. Unter diesem Aspekt<br />
wird Sloterdijks Ansatz zur Philosophie des<br />
Trotzdem, zur Trotzanthropologie – was nicht<br />
die Existenz einer Minderheit meint, es geht<br />
um die Konvergenz der Begrifflichkeit von<br />
Krüppel und Mensch. In der vermeintlichen<br />
Standard-Perfektion der Einen wird die Nähe<br />
zu den tatsächlichen Lebensumständen, verkörpert<br />
durch die «behinderten» Anderen,<br />
verdrängt. Die Täuschung von der Ganzheit<br />
erweist sich als lebensfern im Vergleich zum<br />
Torso Mensch. Es gilt die Geworfenheit in<br />
die Behinderung Leben zu begreifen. Dies<br />
ist Ausgangspunkt für das Üben der Lebenskunst,<br />
für die Selbstwahl des Menschen in<br />
der Zwangslage seines Daseins im Krüppelexistentialismus.<br />
Wir sind behinderte, übende<br />
Wesen im Versuch, unser Leben zu leben.<br />
Diese Einsicht hindert uns daran, Mitläufer<br />
zu werden in einer schönen neuen Welt des<br />
kollektiven Selbstbetrugs. Doch dazu «sind<br />
die meisten Menschen nicht behindert genug»,<br />
denkt Sloterdijk.<br />
Wo lässt sich im philosophischen Denkgebäude<br />
diese Sicht der Welt festmachen? In<br />
der existenzialistischen Absurdität des Nichtwissens<br />
woher und wohin, der Grundbehinderung<br />
des menschlichen Daseins. Am radikalsten<br />
wohl im Anarchismus, wo das Trotzdem<br />
konsequent zur Philosophie des Ohne gedacht<br />
wird: ohne die politische Krücke Staat,<br />
ohne die ökonomische Krücke Kapitalismus,<br />
ohne die religiöse Krücke Kirche. Allerdings<br />
gehen diese aufklärerischen und Bewusstsein<br />
schaffenden Entwürfe vom real existierenden<br />
mündigen Menschen aus, der nicht nur in der<br />
Lage ist, diese «Behinderung» zu erkennen,<br />
sondern auch seine Handlungsentscheide<br />
dementsprechend trifft und den Gefahren der<br />
Krücken-Illusionen nicht erliegt.<br />
Bleibt die Frage, wo der Schritt vom Überleben<br />
zum Leben ist. Und ob unsereiner erst<br />
im Verzicht zum relativen Glück findet.<br />
Das Gespräch: Mittwoch, 30. Dezember,<br />
19:15h, Kramgasse 10, 1. Stock<br />
Kulturessays<br />
ein Kulturprojekt engagieren könnten, nicht<br />
zustande gekommen sei. «Das Konkurrenzdenken<br />
ist immer noch vorhanden. Dabei könnte<br />
man sich gemeinsam gewisse Dinge leisten, die<br />
sonst nicht möglich sind. Man könnte bekannte<br />
Leute einladen, die in jeder Gemeinde gastieren<br />
und dafür nur einmal anreisen müssten.<br />
Aber jeder schaut für sich. Das ist schade. Gemeinsam<br />
ist man stärker.» Weiter stellt Thomet<br />
fest, dass auch nie eine Anfrage von anderen<br />
Kulturvereinen komme für eine grössere, speziellere<br />
Veranstaltung in der Region.<br />
Dafür funktioniert die Zusammenarbeit in<br />
der Gemeinde. Ueli Thomet: «Wir haben die<br />
Zusammenarbeit mit anderen gesucht. In Muri-<br />
Gümligen wird beispielsweise eine sehr gute<br />
und enge Zusammenarbeit mit der Musikschule<br />
Muri gepflegt. Konzerte werden von der Musikschule<br />
organisiert, der Kulturverein grenzt sich<br />
ab. Trotzdem profitieren beide Seiten von den<br />
Kontakten.»<br />
Das Programm für 2010 steht bereits. «Vorausarbeit<br />
ist nötig. Wenn man gute Sachen machen<br />
will, muss man die Leute rechtzeitig anfragen,<br />
sonst sind sie bereits ausgebucht», sagt<br />
Thomet. Ein weiteres wichtiges Anliegen von<br />
Ueli Thomet ist der Einbezug von jungen Leuten.<br />
Sie werden immer wieder angesprochen, und es<br />
wird auch einiges für sie gemacht. Der Kulturverein<br />
will ihnen eine Plattform bieten. «Trotzdem,»<br />
stellt Ueli Thomet fest, «ist die Kundschaft<br />
des Kulturvereins vorwiegend im Alter von 40<br />
bis 90 Jahren. Auch wenn die älteren Leute nicht<br />
unbedingt an den Veranstaltungen teilnehmen,<br />
so sind sie immerhin informiert und können mitreden.»<br />
«Kultur ist etwas vom Wichtigsten,» sagt<br />
Ueli Thomet. Er hat sich während all der Jahre<br />
für Kultur und für den Kulturverein engagiert.<br />
Nun ist er erster Ehrenpräsident geworden.<br />
«Das macht Freude,» stellt Thomet fest. Er arbeitet<br />
immer noch im Vorstand mit und erläutert,<br />
dass jedes Vorstandsmitglied auch eine<br />
Aufgabe habe. Selbstverständlich ist auch eine<br />
Vertreterin der Gemeinde von Amtes wegen<br />
dabei, da die Gemeinde finanzielle Mittel zur<br />
Verfügung stellt. Auch dabei sind ein Vertreter<br />
der Musikschule und ein Vertreter der Kulturkommission.<br />
«Das Wichtigste ist die Gesinnung.<br />
Die Freude an der Sache spielt eine grosse<br />
Rolle. Aus Kostengründen wird viel selber gemacht.<br />
Aber es war bisher nie ein Problem,<br />
Leute zu finden für die Kasse an Anlässen oder<br />
zum Aufbau und andere Arbeiten.» Ansonsten<br />
arbeitet der Kulturverein heute professioneller<br />
als früher. Es gibt eine Presseverantwortliche,<br />
die elektronischen Medien werden eingesetzt,<br />
eine Homepage ist eingerichtet worden. «Wir<br />
verschicken einen Mitgliederbrief, aber wir schreiben<br />
die Leute auch per E-Mail an, auch wenn<br />
ein Teil der Mitglieder über keine E-Mail-Adresse<br />
verfügt. Ganz wichtige Sachen schicken wir<br />
per Post, wenn’s rasch gehen muss, schicken wir<br />
E-Mails,» hält Ueli Thomet fest.<br />
Das Geburtstagsfest des Kulturvereins Muri-<br />
Gümligen hat Anfang November stattgefunden.<br />
Man wollte nicht zu viel Werbung dafür machen,<br />
sondern eher unter Gleichgesinnten bleiben.<br />
Trotzdem seien etwas mehr als 100 Leute gekommen,<br />
erzählt Ueli Thomet erfreut. Im Programm<br />
für 2010 sollen gemäss den Worten von<br />
Ueli Thomet wiederum einige Rosinen zu finden<br />
sein. Aber zunächst steht noch der Dezember-<br />
Anlass vor der Tür, als Abschluss des Jubiläumsprogamms<br />
2009: «In 80 Minuten um die Welt»,<br />
eine «exklusive Ballonfahrt von und mit Gerhard<br />
Tschan», am Donnerstag, 31. Dezember 2009,<br />
17.00 Uhr im Bärtschihus in Gümligen.<br />
Infos: www.kulturverein-muri.ch<br />
Ruedi Geiser:<br />
«KalberMatten bringt die Nöte unseres<br />
Lebens in Kürze gefasst auf den Punkt.»<br />
edition ■ ensuite<br />
ISBN 978-3-9523061-2-3<br />
www.edition.ensuite.ch
Kulturessays<br />
Es ist soweit! Ich habe mein Datum gekriegt.<br />
Ich habe mir immer vorgestellt, wenn man<br />
sein Datum kennt, dass dann der Stresslevel in<br />
unvorstellbare Höhen klettert. Irgendwie, dachte<br />
ich mir, geht das doch gar nicht anders. Und<br />
genau so ist es auch gekommen. Für eine Sekunde<br />
stockt der Atem und irgendwann sickert es<br />
durch, bis in die hinterste und letzte Hirnwindung:<br />
Es geht zu Ende. Die Zeit als Doktorandin<br />
ist ab jetzt nur noch ein Countdown. Obwohl,<br />
in meinem Fall, ein speziell langer Countdown.<br />
Aber langsam sieht man Licht am Ende des Tunnels.<br />
Unvorstellbar. Innerhalb von ein paar wenigen<br />
Tagen haben sich viele Fragen geklärt. Die<br />
erste eben wie gesagt: «Wann entscheidet sich<br />
endgültig, ob ich Frau Doktor werde?» Und die<br />
zweite: «Wo und bei wem arbeite ich danach?»<br />
Es ist wie immer ein wenig erstaunlich, und<br />
dies möchte ich hier wirklich ohne anzugeben<br />
schreiben, schulische und berufliche Dinge sind<br />
mir immer ein wenig in den Schoss gefallen. Klar<br />
bin ich brav und fleissig, aber in so vielen Situationen<br />
hatte ich auch einfach die nötige Portion<br />
Glück. Tja, den Dummen gehört die Welt.<br />
Ich bin gerade dran, mir ein kleines Stück dieser<br />
Welt zu erobern. Vorausgesetzt, alle Mäuse<br />
kommen mit an Bord des Schiffs in die Staaten.<br />
Die Chancen stehen nämlich gerade sehr gut,<br />
dass es mich in diese Gegend verschlägt. Und<br />
KOLUMNE AUS DEM BAU<br />
Zukunftsmusik<br />
Von Irina Mahlstein Bild: Barbara Ineichen<br />
wo werde ich wohl sein? Die Leser, die auch<br />
brav über den Sommer meine Kolumne gelesen<br />
haben, wissen es schon. Und den anderen reibe<br />
ich es gerne unter die Nase: Ich werde vielleicht<br />
nach Boulder, Colorado, gehen.<br />
Ihr seht, mein Leben danach formt sich gerade,<br />
die Zukunftsmusik dudelt mir so laut in die<br />
Ohren, dass ich bald einen Hörschaden davon<br />
trage. Und es verdreht mir den Kopf, aber zünftig!<br />
Doch als erstes muss ich jetzt eine anständige<br />
Doktorarbeit auf den Tisch bringen. Sonst<br />
wird die Zukunftsmusik bald zur schmerzenden<br />
Dissonante. Denn meine zukünftige Chefin wird<br />
die Ehre haben (oder wohl eher ich habe die<br />
Ehre) meine Doktorarbeit auf das Genaueste zu<br />
prüfen. Soweit scheint also alles in Ordnung zu<br />
sein. Doch je mehr ich versuche, meiner Zukunft<br />
Form zu geben, umso mehr Hürden stellen sich<br />
mir in den Weg. Denn zwei Leben für einen<br />
zweijährigen Auslandaufenthalt zu koordinieren,<br />
ist echt eine Herausforderung! Zurzeit herrscht<br />
Chaos. Ich mag kein Chaos. Ich benötige zu jedem<br />
Zeitpunkt einen Lebensplan, und genau<br />
dies wird mir im Moment nicht vergönnt.<br />
Der Tiger will da nämlich studieren. Die<br />
da drüben meinen nun, es sei sinnvoll, zu dem<br />
Zeitpunkt das Semester zu beginnen, welcher<br />
für meinen (unseren?) Lebensplan extrem nicht<br />
sinnvoll ist. Können die da drüben nicht einmal<br />
ein wenig Rücksicht auf die alte Welt nehmen?<br />
Uns gibt’s schon länger, also wissen wir auch,<br />
wie man gewisse Dinge richtig macht! Ich werde<br />
davon ausgehen müssen, dass mein Appell ungehört<br />
bleibt. Irgendwie müssen sich die Dinge<br />
folglich sonst irgendwie fügen. Und das werden<br />
sie wohl auch. Nur hindert mich meine dämliche<br />
Ungeduld daran, dies alles gelassen zu nehmen.<br />
Denn ich brauche jetzt einen Plan. Es ist mir<br />
schon klar, dass dies eine doofe und nicht flexible<br />
Einstellung ist, welche gerade heutzutage<br />
nicht haltbar ist, weil heute jedermann flexibel<br />
ist. Aber ich bin nun mal nur bedingt flexibel.<br />
Und es gibt auch Blöderes als das. Zum Beispiel<br />
den Welttoilettentag (Nicht, dass ich die Sache<br />
an sich, also das Klo, nicht schätzen täte. Die<br />
Wichtigkeit dieser Erfindung ist mir absolut bewusst,<br />
vor allem als Stadtbewohnerin). Und aus<br />
Freude dieses Anlasses war im Netz eine Bildstrecke<br />
mit den spektakulärsten stillen Örtchen<br />
der Welt zu sehen. Da hat jemand tatsächlich<br />
sein Klo mit Swarovski-Kristallen überzogen.<br />
Ob dies meiner Prinzessin wohl gefallen würde?<br />
So lange meine Zukunft nicht die Toilette<br />
runtergespült wird, ist auch ein Gedenktag an<br />
diese Dinger verkraftbar.<br />
Notiz: Es dauert noch sieben Monate, bis ich<br />
meine Arbeit abgeben muss.<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 9
Kulturessays<br />
ESSEN UND TRINKEN<br />
Samichlaus in der Badewanne<br />
Von Barbara Roelli Bild: Barbara Roelli<br />
Sie heisst Nuss, ist aber eigentlich eine<br />
Hülsenfrucht. Ihr Samen hat zwei Samenlappen,<br />
der vom Keim zusammengehalten wird.<br />
Und aus diesem Keim wird - trennt man die<br />
zwei Samenlappen mit dem Fingernagel ganz<br />
vorsichtig voneinander - ein Samichlaus in der<br />
Badewanne. Ein Zaubertrick, mit dem man Kinderaugen<br />
zum Leuchten bringt. Aber nicht in<br />
jedem Samen ist sein Kopf so ausgeprägt, sind<br />
Barthaare und Kapuze so detailreich gelungen.<br />
Etwas Glück braucht es, um schöne Exemplare<br />
zu finden. Erfreulicherweise liegt es in der<br />
Natur dieser Nuss, dass sich pro Schale ein<br />
bis vier Samen befinden. Was die Chance, auf<br />
schöne Badewannen-Chläuse zu stossen, ungemein<br />
steigert. Praktischerweise gibt es die<br />
Nuss auch immer in grossen Mengen zu kaufen.<br />
Oder der Samichlaus bringt sie und verteilt<br />
so seinen Samen unter den Menschen - auf<br />
dass die Kinder ihre schlechten Gewohnheiten<br />
verlieren und sich seine weisen Worte mit den<br />
Nüsslisamen einverleiben. Doch der Chlaus-<br />
Samen ist heimtückisch. Hat man nämlich erst<br />
einmal begonnen mit dem Ritual, ihn aus der<br />
Schale zu lösen, von dem feinen, rotbraunen<br />
Häutchen zu befreien und ihn zum Mund zu<br />
führen, ist man seinem Geschmack auch schon<br />
verfallen.<br />
Beim Zerkleinern im Mund knackt der<br />
Samen noch – aber kaum werden seine Geschmacksstoffe<br />
durch die mahlende Bewegung<br />
der Zähne freigelegt, kommt sein herzhaft cremiger<br />
Geschmack zum Tragen. Und auf diesen<br />
mag sich irgendwie kein Sättigungsgefühl einstellen.<br />
Als ob es ewig so weitergehen könnte<br />
mit Schälen, Samen vom Häutchen trennen<br />
und ab in den Mund... Bis wir uns eine Reserve<br />
Winterspeck angefressen haben, diesen unter<br />
dicken Wollpullovern warm halten und so der<br />
Kälte trotzen.<br />
Die spanischen Nüssli treffen in der kalten<br />
Jahreszeit bei uns ein und setzen sich gekonnt<br />
in Szene. Mit ihren Chlaus-Samen sind sie die<br />
Begleiter des Dezembers schlechthin. Während<br />
sich die Menschen am Glühwein wärmen und<br />
bei langen Gesprächen in der warmen Stube<br />
sitzen, schälen sie spanische Nüssli in rohen<br />
Mengen. Ihr Fett gibt Energie. Vielleicht werden<br />
die Nüssli vermehrt in den Beizen angeboten<br />
(natürlich auf Kosten des Hauses), um<br />
den Rauchern, die ihrem Laster dort nicht<br />
mehr frönen dürfen, wenigstens als eine Art<br />
Beschäftigungstherapie zu dienen.<br />
Fraglich ist, ob man sich überhaupt so eingehend<br />
mit einer Nuss beschäftigen sollte, deren<br />
Fettanteil bei rund 50 Prozent liegt und<br />
die einem zum gedankenlosen «Reinschaufeln»<br />
verleitet. Aber einfach «reinschaufeln» kann<br />
man die spanischen Nüssli eigentlich nicht,<br />
zeigen sie ihre Haut doch erst – anders als ihre<br />
Mitstreiter auf dem Erdnussmarkt - wenn die<br />
Schale aufgebrochen ist. Die Mitstreiter sind<br />
einfacher zu handhaben. Sie sind bereits nackt<br />
und verarbeitet: Geschält, kräftig gesalzen,<br />
ummantelt von Wasabi, Chili oder Schokolade.<br />
Mit immer neuen Geschmackskombinationen<br />
schreien sie nach Aufmerksamkeit, stehen<br />
dann aber als Fernsehnüsschen neben Fussballmatch<br />
und Krimi doch an zweiter Stelle.<br />
Die spanischen Nüssli in der Schale müssen<br />
sich nicht verstellen. Sie kokettieren im natürlichen<br />
Look. Doch gleicht dieser Look einem<br />
Aschenputtel-Gewand: Unscheinbares Beige<br />
mit Linienstruktur, die sich wie Adern vom<br />
oberen Ende der Schale, wo manchmal noch<br />
ein Stiel vorhanden ist, ans untere Ende ziehen.<br />
Und zwischen diesen Längslinien bilden<br />
kurze Querlinien ein netzartiges Geflecht. Wie<br />
bei einem Jutesack. Aber von weitem betrachtet<br />
verschwindet das Geflecht und man sieht<br />
vor allem die Dellen in der Schale – wie Dellen<br />
in der narbigen Haut eines Menschen, der in<br />
jungen Jahren mit Akne kämpfte.<br />
Die Form der Nüssli gleicht denen von Engerlingen,<br />
Maden – irgendetwas proteinreich<br />
Weichem, dessen Verzehr in unseren Breitengraden<br />
keine Tradition hat. Trotzdem lassen<br />
wir uns nicht beirren vom Äusseren dieser vermeintlichen<br />
Nuss. Was einmal mehr beweist:<br />
Nur das Innere zählt.<br />
10
ÉPIS FINES<br />
Von Michael Lack<br />
TIRAMISU<br />
CLASSICO<br />
Tiramisu, ein alter Klassiker aus Norditalien,<br />
ist auch hier zu Lande eine sehr bekannte<br />
Süssspeise. In der Herstellung nicht aufwändig,<br />
wirkt sie doch so verführerisch gut.<br />
Zutaten<br />
250g Mascarpone<br />
50g Puderzucker<br />
40g Eigelb<br />
Ω Vanilleschote<br />
80g leicht geschlagene Sahne<br />
1 dl Kaffee<br />
Ωdl Rum oder Cognac<br />
80g Löffelbisquits<br />
Vorbereitung<br />
Eigelb und Puderzucker schaumig schlagen.<br />
Vanilleschote auskratzen. Löffelbisquits in<br />
eine Form geben. Kaffee und Rum oder Cognac<br />
mischen. Rahm leicht schlagen und kalt<br />
stellen.<br />
Zubereitung<br />
Löffelbisquits mit dem Kaffee-Alkohol-Mix<br />
überträuffeln. Schaumig geschlagenes Ei und<br />
Zuckermasse mit der Mascarpone und der ausgekratzten<br />
Vanilleschote verrühren und den<br />
geschlagenen Rahm vorsichtig darunter ziehen.<br />
Nun die Mascarponemasse auf die mit Kaffee<br />
und Alkohol eingezogenen Löffelbisquits streichen<br />
und kalt stellen. Etwa 2- 3 Stunden kühlen<br />
lassen. Zum Abschluss etwas Kakaopuder darüber<br />
streuen und servieren.<br />
Kulturessays<br />
KLEIDER MACHEN LEUTE<br />
Herbstwetterklassiker<br />
Von Simone Weber<br />
Audrey Hepburn trug ihn im legendären<br />
Film «Frühstück bei Tiffany» und<br />
Humphray Bogart, als er Ingrid Bergmann am<br />
Flughafen von Casablanca für immer verabschiedete.<br />
Beworben von der amerikanischen<br />
Filmindustrie schaffte er es, unsere Modeherzen<br />
im Sturm zu erobern. Und die Verliebtheit<br />
dauert an. Gerade bietet das nasskühle Herbstwetter<br />
die ideale Voraussetzung zum Tragen<br />
dieses absolut zeitlosen Klassikers. Die Rede<br />
ist vom Trenchcoat. Erfunden wurde dieses<br />
wunderbare Stück Ende des 19. Jahrhunderts<br />
von dem Engländer Thomas Burberry. Und<br />
noch heute ist der Allwettermantel Aushängeschild<br />
des gleichnamigen britischen Modehauses.<br />
Verwunderlich ist es ja nicht, dass der<br />
Ursprung dieses Kleidungsstücks das verregnete<br />
Grossbritannien ist. Seine Aufgabe war<br />
es, den Körper vor Regen und Feuchtigkeit zu<br />
schützen. Deshalb schneiderte Mister Burberry<br />
sein Werk aus Gabardine - ein imprägnierter,<br />
äusserst strapazierfähiger und wetterfester<br />
Baumwollstoff, der zudem atmungsaktiv und<br />
angenehm zu tragen ist.<br />
Der neue Mantel erfreute sich innert kürzester<br />
Zeit grosser Beliebtheit und wurde zur<br />
Standardausrüstung der britischen Armee. Die<br />
englischen Soldaten schütze er im Ersten Weltkrieg<br />
vor Wind und Regen, woher der Trenchcoat<br />
übrigens seinen Namen hat: «Trench» ist<br />
das englische Wort für Schützengraben. Die<br />
typischen Elemente des Mantels, namentlich<br />
die Bindegürtel, Schulterriegel, Ärmelspangen<br />
und eine zweite Lage Stoff über Schulter- und<br />
Brustpartie erinnern bis heute an Kriegszeiten.<br />
Denn diese Details hatten damals natürlich<br />
tatsächlich praktischen Nutzen: An den Schulterriegeln,<br />
den Brustklappen und Gürtelringen<br />
konnten beispielsweise Rangabzüge, Gasmasken,<br />
Ferngläser oder Handgranaten befestigt<br />
werden.<br />
Den Soldaten gefielen ihre Militärmäntel so<br />
gut, dass sie sie nach dem Krieg mit nach Hause<br />
nahmen und ihn zur Alltagskleidung machten<br />
– für sich und für ihre Frauen. So wurde der<br />
Trenchcoat populär und auch die Filmindustrie<br />
entdeckte das tolle Kleidungsstück, machte es<br />
zum Erkennungszeichen von Agenten und Privatdetektiven.<br />
So weckte der englische Mantel<br />
immer grösseres Interesse auf der ganzen Welt.<br />
Er sah nicht nur total lässig aus, sein gerader<br />
Schnitt mit der doppelreihigen Knopfleiste<br />
streckte optisch die Silhouette. Im Trenchcoat<br />
sah einfach jeder elegant aus.<br />
Und genau deshalb erfreut er sich bis heute<br />
grosser Beliebtheit. Seine besonderen Merkmale<br />
hat der Militärmantel behalten. Noch immer<br />
hat er Schulterschnallen, ein breites Revers, die<br />
typische doppelreihige Knopfreihe und einen<br />
Taillengürtel – dieser muss übrigens geknotet<br />
und nicht wie ein normaler Gürtel geschlossen<br />
werden. Trotzdem ist heute einiges ganz<br />
anders. Knöchellang wie das Ursprungsmodell<br />
sieht man ihn nur noch selten. Vor allem Frauen<br />
lieben den Trench figurbetont, zeigen gerne<br />
Bein und tragen den kultigen Mantel knielang<br />
oder sogar noch kürzer, bis knapp über den<br />
Hintern – also eher als Jacke. Wird der Trenchcoat<br />
zugeknöpft und mit eng anliegendem Gürtel<br />
getragen, wirkt er sehr feminin. Aber auch<br />
offen oder etwas lockerer getragen sieht der<br />
Mantel grossartig aus – egal, wie der Körper,<br />
den er umhüllt, geformt ist. Im Gegensatz zu<br />
den Frauen mögen die Männer den Trenchcoat<br />
eher altbewährt, etwas länger, gerader und weniger<br />
eng anliegend. Schliesslich wurde er ursprünglich<br />
auch für sie entworfen. Und Hollywood<br />
sei Dank sehen sie darin heute noch genauso<br />
so gut aus wie Bogart damals.<br />
In Stoff und Farbe ist der englische Armeemantel<br />
enorm vielseitig geworden. Die Trenchcoatfarbe<br />
schlechthin - beige - ist heute nicht<br />
mehr typisch. Es gibt ihn in schwarz, weiss,<br />
rot, blau, braun, gelb, grau und allen weiteren<br />
erdenklichen Farben. Und auch die Stoffe, aus<br />
denen er geschneidert wird, sind längst nicht<br />
mehr auf wasserfeste Gabardine und Popeline<br />
beschränkt. Wollstoffe sorgen für nötige Wärme,<br />
Polyester für Glanzeffekte, Leder für Coolness<br />
und Baumwolle für Leichtigkeit. Natürlich<br />
ist der Trenchcoat von heute nicht mehr in jeder<br />
Ausführung allwettertauglich.<br />
Die enorme Vielseitigkeit des Klassikers<br />
macht es möglich, dass er der perfekte Begleiter<br />
für unzählige Looks ist. Der farbige Baumwolltrench<br />
passt zu Jeans und T-Shirt, ein glänzig<br />
schwarzer zu eleganten Röcken an edlen<br />
Abenden. Er kann mit Anzügen, Hüten, Sonnenbrillen,<br />
Turnschuhen, Ballerinas, High-Heels<br />
und Gummistiefel getragen werden. Kurz: Sein<br />
klassischer Schnitt passt zu fast allem. Sogar<br />
Queen Elisabeth soll ein Modell tragen, wenn<br />
sie zur Jagd geht.<br />
Seit über hundert Jahren ist der Trenchcoat<br />
nun auf dem Markt. Die Sportlichen, die<br />
Schicken, die Modischen und die Lässigen<br />
tragen einen und sogar die Queen rennt in<br />
diesem Ding durch Wald und Wiese! Wie viele<br />
hundert Jahre dauert es wohl noch, bis der<br />
Menschheit das Trenchcoattragen verleidet ist?<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 11
Kulturessays<br />
KUNST FÜR MENSCHEN<br />
Kunst zwischen Apfelkuchen<br />
und Anrufbeantworter<br />
Von Rebecka Domig und Sonja Gasser – Ein Gespräch mit Chantal Michel<br />
auf dem Schloss Kiesen Bild: zVg.<br />
Zahlreiche Ausflügler und Kunstbegeisterte<br />
durchwanderten vier Monate<br />
lang die Gemeinde Kiesen. Ziel war<br />
das Schloss, auf einem bewaldeten<br />
Hügel gelegen. In zwanzig Räumen<br />
zeigte Chantal Michel eigene Werke.<br />
Ihre Foto- und Videoarbeiten hatte<br />
sie in stimmige Rauminstallationen<br />
eingebunden, die zum Eintauchen in<br />
eine andere Welt einluden. Wer vom<br />
Umherirren im Schloss müde geworden<br />
war, setzte sich im Garten an einen<br />
der bereitgestellten Tische. An der<br />
Sonne servierte die Künstlerin Kaffee<br />
und selbstgebackenen Kuchen.<br />
<strong>Ensuite</strong> - kulturmagazin: Beim Eintreten in<br />
das Schloss Kiesen liest man einleitend:<br />
«Die Künstlerin zeigt keine Ausstellung, sondern<br />
öffnet ein Phantasiereich für alle.» Was<br />
kann man sich darunter vorstellen; wie ist das<br />
gemeint mit dem Phantasiereich?<br />
Chantal Michel: Eine Ausstellung ist es,<br />
wenn man die Bilder in ein Museum hängt. Das<br />
hier ist viel mehr; es ist eine ganze Installation,<br />
in der alles dazugehört – auch der Gemüsegarten.<br />
Das gesamte Haus ist inszeniert. Ich<br />
habe nicht Fotos in ein schon besetztes Haus<br />
gehängt, es war vielmehr ein Miteinander. Ich<br />
habe die Dinge einander anverwandelt. Ich<br />
möchte einfach, dass man in eine Welt eintaucht,<br />
die einen ein wenig entführt; an die<br />
man glaubt; in der alles möglich ist. Eine Welt,<br />
in der die Dinge zu leben beginnen. Eine sinnliche<br />
Welt, in der sich Geruch, Ton, Visuelles<br />
bis hin zum Kulinarischen vermischen.<br />
Beduftest du die Räume auch?<br />
Ja. Also, nicht alle. Manche duften schon von<br />
sich aus, da muss man gar nicht nachhelfen.<br />
Einige riechen modrig – und wenn ich unten<br />
Apfelkuchen backe, duftet das bis oben hin,<br />
durchs ganze Haus.<br />
Das Schloss Kiesen befindet sich ja in einer<br />
kleinen Gemeinde im Grünen. Es wird Kunst<br />
ausgestellt und ein Publikum angesprochen,<br />
das vielleicht sonst nicht unbedingt in ein Museum<br />
gehen würde. Warum bist du interessiert,<br />
im Schloss etwas zu machen und nicht in einem<br />
Museum?<br />
Du hast es ja schon gesagt. Eben, um möglichst<br />
ein neues Publikum anzusprechen und<br />
den Leuten diese Hemmschwelle zu nehmen.<br />
Die Leute haben Angst vor der Kunst. Man<br />
muss versuchen diese Hemmungen aufzulösen<br />
und ich glaube, das ist mir hier wirklich gelungen.<br />
Es kommen Menschen hierher, die noch<br />
nie in einem Museum waren. Manche habe ich<br />
im Dorf gesehen und eingeladen und sie haben<br />
abgelehnt: «Nein, das ist doch nichts für<br />
mich. Ich verstehe doch nichts von Kunst!» Ich<br />
antworte auf so etwas dann: «Du brauchst es<br />
ja auch nicht zu verstehen. Komm nur und ich<br />
bin sicher, es wird dir gefallen!» Die Leute sind<br />
dann ganz skeptisch, sagen aber zu. Nach ihrem<br />
Besuch sind mir manche fast um den Hals<br />
gefallen. Die waren so begeistert und haben<br />
gemeint, dass sie so etwas noch nie gesehen<br />
hätten. Das berührt, wenn man das erreicht.<br />
Hat sich in Kiesen etwas verändert seit die<br />
Ausstellung existiert?<br />
Nicht nur in Kiesen. Ich habe das Ganze<br />
ja auch schon mal in Bern gemacht, im Hotel<br />
Schweizerhof. Da kamen 5 000 Leute in<br />
drei Tagen. Das ist Wahnsinn; das kriegt kein<br />
Museum hin! Das war für mich auch der ausschlaggebende<br />
Punkt, an dem ich mir gedacht<br />
habe: «Okay, wenn die Leute nicht ins Museum<br />
wollen, dann muss ich das irgendwie anders<br />
machen.» Ich mache ja auch diese Essen, und<br />
12 ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09
wenn dann ein Bauer neben der Museumsdirektorin<br />
von Thun sitzt und die miteinander<br />
ein normales Gespräch führen können, dann<br />
finde ich das einfach toll. Und dass dabei alles<br />
ein bisschen normaler wird und nicht so<br />
abgehoben. Das hier ist ein sehr offener und<br />
«normaler» Ort. Man kann hier Kaffee trinken,<br />
man kann Pasta essen. Man kann hier sein und<br />
bleiben. Die Leute fühlen sich wohl.<br />
Du betonst die Gesamtwirkung des Schlosses.<br />
Doch auch hier hat man das Gefühl, sich<br />
in einem klassischen Ausstellungskontext zu<br />
befinden. Immerhin hängen Bilder an den Wänden.<br />
Wie siehst du das?<br />
Es sind nicht nur die Bilder, die wichtig sind.<br />
Es ist das ganze Schloss als Gesamtinstallation,<br />
in der jedes Detail seine Berechtigung hat und<br />
eine wichtige Rolle spielt. Ich möchte mich<br />
nicht festlegen auf ein bestimmtes Medium.<br />
Ich glaube, ich arbeite doch sehr vielschichtig.<br />
Ich mache Fotos, Videos, Performances und Installationen.<br />
Vielleicht müsste ich auch einfach<br />
mal gar kein Bild zeigen. Nächstes Jahr mache<br />
ich etwas im Keller, vielleicht nur mit Ton und<br />
Licht.<br />
Du konzipierst jetzt im Winter deine nächste<br />
Ausstellung?<br />
Ich arbeite diesen Winter daran, so dass sie<br />
im nächsten Sommer gezeigt werden kann. Die<br />
Stadtbehörden verstehen das nicht und wollen<br />
mich deshalb nicht unterstützen. Sie fragen:<br />
«Wieso wieder am selben Ort?» Das hier ist<br />
ein solch positiver Ort. Solange die Leute hierher<br />
kommen und begeistert sind, muss ich das<br />
doch ausnutzen. Solange ich hier leben kann<br />
sowieso. Zum ersten Mal fühle ich mich komplett.<br />
Hier kommt wirklich alles zusammen.<br />
Kunst und Leben ist nicht mehr trennbar.<br />
Wenn mich jemand anruft, dann hören diejenigen,<br />
die gerade Video schauen, mit. Aber das<br />
ist doch irgendwie schön. Die Besucher finden<br />
mich dann und erzählen mir, was da abgegangen<br />
ist auf meinem Anrufbeantworter: «Deine<br />
Mutter hat dich angerufen. Ich gratuliere dir<br />
auch zum Geburtstag!» (lacht)<br />
Wie wird diese Ausstellung denn aussehen?<br />
Könntest du dir vorstellen, andere bildende<br />
Künstler einzuladen? Beim jetzigen Rahmenprogramm<br />
wirken ja auch andere Leute mit.<br />
Bildende Künstler weniger, das ist mir zu<br />
nah. Das wäre dann fast wie eine Konkurrenz<br />
– oder ich würde ganz einfach zur Kuratorin.<br />
Aber wenn es ein anderes Medium ist, dann<br />
ist das befruchtend und gut. Mit der Tänzerin<br />
Anna Huber zum Beispiel möchte ich gerne etwas<br />
machen. Ich finde sie eine tolle Frau und<br />
es geht uns in unserer Arbeit eigentlich um genau<br />
dasselbe, um Körper und Raum. Das passt<br />
einfach super zusammen. Eine ähnliche Zusammenarbeit<br />
kann ich mir mit einer Sängerin<br />
vorstellen. Ich möchte Medien vermischen und<br />
vor allem dieses Denken in festen Kategorien<br />
aufheben.<br />
Du hast in Thun in einer Ateliergemeinschaft<br />
gearbeitet. Wie ist das denn, wenn man<br />
auf so engem Raum mit anderen Künstlern zusammenarbeitet?<br />
Ich konnte das eben nie. Ich habe dort selten<br />
gearbeitet und wenn, dann nachts. Ich fühlte<br />
mich dann immer beobachtet. Ich schliesse<br />
mich lieber in Häuser ein und komme erst wieder<br />
heraus, wenn eine Arbeit fertig ist. Auf<br />
dem Bürgenstock habe ich ein halbes Jahr gelebt<br />
und gearbeitet. Im Schweizerhof in Bern<br />
auch. Das war toll, total intensiv. Ich war ganz<br />
alleine mit diesem Haus und konnte mich wirklich<br />
austoben. Und doch war dieses konstante<br />
Alleinsein ein bisschen krank, fand ich; die totale<br />
Vereinsamung. Dagegen bin ich hier so offen<br />
wie noch nie. Ich komme besser mit Leuten<br />
klar. Alles ist anders und das tut mir gut.<br />
Du hast hier im Schloss also keinen Raum,<br />
von dem du sagen könntest, dass er dir gehört?<br />
Hältst du dich überall auf?<br />
Ja, genau. Die Leute fragen mich immer:<br />
«Wo wohnst du eigentlich?» Ich wohne überall<br />
und nirgends. Zum Wohnen habe ich nicht<br />
viel Zeit. Alles ist öffentlich. Mein Büro ist in<br />
die hinterste Ecke gedrängt, hinter die grosse<br />
Leinwand mit dem Video. Mein Privatleben ist<br />
beschränkt auf das Minimum. Am persönlichsten<br />
ist noch die Küche, da lasse ich nur meine<br />
engsten Freunde hinein.<br />
Gibt es für dich denn auch keine Trennung<br />
zwischen Privatsphäre und Kunst?<br />
Nein. Ich finde das auch schön; alles ist offen<br />
und läuft ineinander über. Ich weiss auch<br />
nicht genau, wo meine Kunst anfängt und wo<br />
sie aufhört, wo meine Inszenierungen anfangen.<br />
Bin ich jetzt inszeniert? (Chantal Michel<br />
zeigt auf ihre Kleidung.) Ich weiss es nicht.<br />
Schon bei der Kleidung war es immer so. Ich<br />
wusste nie, ob das jetzt übertrieben ist. Sind<br />
wir Menschen nicht alle total inszeniert?<br />
Am Wochenende kochst du für die Gäste und<br />
trittst dabei als Dienstmädchen oder Köchin in<br />
Erscheinung. In Berichten wirst du aber auch<br />
oft als Schlossherrin bezeichnet. Was bist du<br />
denn, Serviertochter oder Schlossbesitzerin?<br />
Ich bin von allem ein bisschen. Ich bin das,<br />
was es gerade braucht. Wieso muss man alles<br />
so trennen? Wieso muss man alles so definieren?<br />
Ich bin das, was ich bin und zum ersten<br />
Mal fühle ich mich komplett, weil ich alles leben<br />
kann, was in mir steckt. Man ist doch nicht<br />
nur das eine oder andere.<br />
Dies bringt uns auch auf die Inhalte deiner<br />
Arbeiten. Sobald man sich als Frau vor der Kamera<br />
inszeniert, wird man in einem feministischen<br />
Diskurs verhandelt. Wie wohl fühlst du<br />
dich damit?<br />
Ich verstehe nie, wieso man diese Inhalte<br />
direkt auf meine Person überträgt. Ich thematisiere<br />
einfach Dinge, die mich beschäftigen,<br />
die um mich herum passieren. Ich bin ein Spiegel<br />
der Gesellschaft. Aber ich bin keine Feministin,<br />
überhaupt nicht. Ich bin einfach eine<br />
Frau, die ihren Körper als Material verwendet,<br />
ähnlich wie eine Tänzerin vielleicht. Wenn ich<br />
ein Mann wäre, würde es ein wenig anders<br />
aussehen, aber ich denke, es würde im Prinzip<br />
um dasselbe gehen. Um Männerklischees<br />
vielleicht.<br />
Ich finde es in diesem Zusammenhang interessant,<br />
dass du bei der Bilderserie Victor nicht<br />
deinen eigenen Körper verwendet hast, sondern<br />
einen männlichen Körper.<br />
Das war ein Zufall. Ich kann nicht zu jemandem<br />
sagen: «Hey, stell dich da hin und mach<br />
das!» Ich muss den Raum selber erleben, ihn<br />
mit meinem Körper erforschen und aufspüren.<br />
Ich kann das auch nicht erklären. Es ist wie ein<br />
Verliebtsein, irgendwie passiert da etwas zwischen<br />
mir und dem Raum und dann kommen<br />
auch die Ideen. Doch ich habe nicht wirklich<br />
eine Idee oder ein Konzept, ich gehe ganz intuitiv<br />
auf den Raum ein. Und dann brauche ich<br />
immer einen Assistenten. Jemanden, den ich<br />
vor die Kamera stelle, damit ich das Licht einstellen<br />
und die Position der Figur bestimmen<br />
kann. Der Mann auf den Fotos ist ein Freund<br />
von mir, den ich damals bei den Vorbereitungen<br />
im Hotel Schweizerhof in Bern kennengelernt<br />
habe und der wissen wollte, wie ich arbeite.<br />
Er konnte sich nicht vorstellen, was ich ein<br />
halbes Jahr lang in diesem Hotel getan habe. So<br />
habe ich ihn zu meinem Assistenten gemacht<br />
und ihn mitgenommen zu einem neuen Fotoshooting.<br />
Als er vor der Kamera stand, war das<br />
einfach super; dieser eckige Mann mit diesen<br />
Polstermöbeln. Mit mir funktionierte das halb<br />
so gut. Darum hat sich das dann mit Victor ergeben.<br />
Heute ist er einer meiner besten Freunde.<br />
Wenn durch das harte Arbeiten auch noch<br />
menschliche Dinge passieren, finde ich das<br />
wunderschön. Ich kann dann sagen: «Hey, es<br />
hat sich gelohnt!»<br />
Was machst du denn, wenn eine künstlerische<br />
Blockade eintritt?<br />
Ich hatte das früher oft. Heute habe ich dieses<br />
Vertrauen, dass es immer irgendwie weitergeht.<br />
Die Welt ist voller Überraschungen, die<br />
ich mir nie hätte träumen lassen. Man muss die<br />
Dinge in Angriff nehmen und sie einfach tun.<br />
Nicht träumen – machen!<br />
Mittlerweile sind die Tore von Schloss Kiesen<br />
geschlossen. Aber nicht ganz: Wer im neuen<br />
Jahr an einem Dinner von Chantal Michel<br />
teilnimmt, den lässt die Künstlerin noch einmal<br />
in die unveränderten Räume eintreten. Zum<br />
Essen lädt sie am 30. Januar sowie am 6., 13.,<br />
20. und 27. Februar ein. Der Abend kostet 48<br />
Franken. Anmeldungen obligatorisch unter der<br />
Nummer 031 311 21 90 (Tel./Fax.). Hinterlassen<br />
Sie Name und Telefonnummer!<br />
Infos: www.chantalmichel.ch<br />
13
Kulturessays<br />
KUNST IN DER DEFINITION<br />
KunstLiebeGeld<br />
Von Jarom Radzik - Die Suche nach guter Kunst im Geld<br />
Jeder weiss, mit Kunst lässt sich gut<br />
Geld verdienen. Angebot und Nachfrage<br />
verteilen Kunst besser als jeder<br />
Weihnachtsmann. Nicht zuletzt, weil<br />
Kunst neben Autos, Häusern und leichten<br />
Mädchen als wirtschaftliches Statussymbol<br />
fungiert, wird es in seiner<br />
Qualität in erster Linie nach seinem<br />
Preis bemessen. Aber kann anhand des<br />
Preises tatsächlich abgelesen werden,<br />
ob Kunst gut ist? Entgegen den gegen<br />
ihn herrschenden Vorurteilen zeigt der<br />
Schweizer Kunstmäzen, Willy Michel,<br />
mit einem Kunstkauf, dass sich Kunst<br />
mehr als an wirtschaftlichen Kriterien<br />
messen lässt.<br />
Seit dem Spätsommer 2009 steht im Schlosspark<br />
des Kunstmäzens Willy Michel ein<br />
Kunstwerk von Christian Bolt. Die dreiteilige<br />
Bronzeskulptur trägt den Werktitel «Trapasso».<br />
Mit ihren zweieinhalb Metern Höhe ist die Skulptur<br />
am Eingang des Parks auch kaum zu übersehen.<br />
Grosse Skulpturen sind aufwändig: «Trapasso»<br />
zu konzipieren und umzusetzen dauerte<br />
fast ein Jahr. Was ist so besonders daran, dass ein<br />
Mann wie Willy Michel ein grosses Kunstwerk<br />
von Christian Bolt kauft? Der Künstler wurde bisher<br />
noch von keiner namhaften Galerie vertreten<br />
und auch noch auf keiner einschlägigen Kunstmesse<br />
ausgestellt. Das ist besonders, denn der<br />
Kunstmäzen hat «Trapasso» nicht einfach wegen<br />
des Künstlers gekauft, sondern wegen seiner<br />
Formsprache, seiner Ausdruckskraft und seiner<br />
Inhalte. Ein Antibeispiel für die Kunstwelt sozusagen.<br />
Was «Trapasso» für Willy Michel übrigens<br />
so besonders macht, ist sein Inhalt. In diesem<br />
Werk ist nichts Geringeres als die Lebensgeschichte<br />
des Sammlers verarbeitet.<br />
Kriterien guter Kunst «Trapasso», ein Werk à<br />
la Werkvertrag, ein übliches Rechtsgeschäft, aber<br />
unüblich für die Kunstbranche. Auftragskunst ist<br />
heute eher selten, das sagt auch das allwissende<br />
Wikipedia und verbannt diese Art des Verkaufs<br />
deshalb gerne ins Mittelalter. Richtig, über die<br />
Qualität sagt dies freilich noch nicht viel aus. Immerhin<br />
gab es bei «Trapasso» weder in Bezug auf<br />
das Material, die Ausführung oder den Inhalt etwas<br />
zu beanstanden. Das ist im Zeitalter der Discounter<br />
gar nicht so selbstverständlich. Im Gegenteil,<br />
die Erwartungen des Sammlers wurden<br />
sogar noch übertroffen. Logisch, ist ja auch echte<br />
Schweizer Handarbeit. Wenn es nach ihm und<br />
dem Künstler Christian Bolt geht, ist mit «Trapasso»<br />
ein exzellentes Kunstwerk entstanden.<br />
Nach Massstäben der Branche stehen die beiden<br />
mit ihrer Meinung aber ziemlich alleine da. Die<br />
Qualität misst Kunst nämlich anhand ganz anderer<br />
Kriterien. Kriterien beispielsweise von einer<br />
Zürcher Galeristin, vorgetragen während einer<br />
Veranstaltung an der Kunstmesse Kunst <strong>Zürich</strong><br />
2009. Auch viele andere hätten ihr in etwa zugestimmt.<br />
Die Kriterien guter Kunst sind Preis und<br />
Preisentwicklung, Neuheit im Lichte der Kunstgeschichte,<br />
Authentizität von Kunstwerk und<br />
Künstler und Bauchgefühl. Klingt logisch. Aber<br />
machen wir doch die Probe aufs Exempel und<br />
schauen wir, ob diese gut klingenden Kriterien<br />
tatsächlich etwas taugen.<br />
Preis Für gute Kunst gibt es eine Nachfrage.<br />
Deshalb liegen die Preise für gute Kunst höher.<br />
Zudem besitzt gute Kunst eine Preisstabilität mit<br />
einer kontinuierlichen Tendenz zur Preissteigerung.<br />
«Trapasso» ist neu. Eine Preisentwicklung<br />
gibt es nicht, das Werk wurde direkt vom Sammler<br />
erworben. Den Preis haben Willy Michel und<br />
Christian Bolt vor allem auf Herstellungskosten<br />
abgestellt. Der Marktwert des Künstlers ist<br />
schwierig zu bestimmen, weil die Werke Christian<br />
Bolts bisher nicht in grösserem Umfang gehandelt,<br />
sondern einmal verkauft wurden. Verkauft<br />
hat der Künstler bisher immer gut – was<br />
also ist sein Marktwert und welcher Preis ist für<br />
«Trapasso» angemessen?<br />
Neuheit Manche, die Christian Bolt kennen,<br />
nennen ihn den Michelangelo des 21. Jahrhunderts.<br />
Seine Formsprache bedient sich genauso<br />
der Figuration wie der Abstraktion. Er besitzt<br />
ausgezeichnete Kenntnisse der Anatomie und<br />
beherrscht alte wie neue Bildhauertechniken.<br />
Chritstian Bolt arbeitet mit der Masse des Körpers.<br />
Das zentrale Motiv, der menschliche Körper,<br />
macht es für den Betrachter einfach, Parallelen<br />
zur Geschichte zu ziehen. Da mag die Formsprache<br />
neu und eigenständig sein, der menschliche<br />
Körper ist der gleiche geblieben. Auch die Arbeitsweise<br />
des Künstlers: Überhosen und Spitzeisen<br />
erinnern eher an vergangene Zeiten als an<br />
die Moderne. Selbst das Medium, Skulpturen und<br />
Bilder sind traditionell. Schliesslich ist der Künstler<br />
der Meinung, dass Kunst die Geschichte fortführen<br />
sollte. In Anbetracht all dieser Umstände<br />
wird die Kunst von Christian Bolt rasch als alt<br />
abgetan.<br />
Authentizität Ein Werk ist Ausdruck seines<br />
Erschaffers. Wenn Kunst tatsächlich ein Teil des<br />
Lebens des Künstlers ist, entspricht es dem, was<br />
der Künstler sagt, denkt und lebt. Christian Bolt<br />
ist freischaffender Künstler, ganz der Kunst verpflichtet.<br />
Wer ihn persönlich kennt, weiss, dass<br />
das, was er tut, mit dem übereinstimmt, was er<br />
sagt. Rein äusserlich entspricht Christian Bolt allerdings<br />
nicht dem Stereotyp eines Künstlers. Die<br />
Haare sind kurz geschnitten, das Gesicht frisch<br />
rasiert, die Kleider ordentlich. Er trinkt nicht,<br />
raucht nicht und ist obendrein auch noch stubenrein.<br />
Kann das, diese langweilig gewöhnliche<br />
Figur, ein authentischer Künstler sein?<br />
Bauchgefühl Nun, mir gefällt «Trapasso». Das<br />
ist mein Bauchgefühl. Ich finde «Trapasso» auch<br />
nach zehnmaligem Betrachten noch spannend.<br />
Zufrieden? Nein? Aber so ist mein Bauchgefühl<br />
nun mal. Jemand, der sich zum Beispiel der Neuheit<br />
verpflichtet hat und menschliche Körper<br />
14 ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09
nicht ausstehen kann, würde mir in diesem Punkt<br />
aber nicht beipflichten.<br />
Bilanz Soweit anhand der vier Kriterien allgemeingültige<br />
Aussagen gemacht werden können,<br />
entspricht «Trapasso» nicht dem, was man unter<br />
guter Kunst verstehen würde. Für das Kunstwerk<br />
selbst gibt es noch keine Preisentwicklung. Und<br />
weil die Kunstwerke des Künstlers noch nicht<br />
auf dem Kunstmarkt gehandelt werden, hat der<br />
Künstler noch keinen Marktwert. In diesem Sinne<br />
spricht der Preis gegen die Güte von «Trapasso».<br />
Neu ist das Werk im Lichte der Kunstgeschichte<br />
nur für den, der Kunstwerke als Weiterführung<br />
der Kunstgeschichte versteht. Die anderen beiden<br />
Kriterien, Authentizität und Bauchgefühl,<br />
sind subjektiv. Sie färben die Meinung über das<br />
Kunstwerk je nach Eindruck und Geschmack.<br />
Schlussfolgerungen In diesem Sinne kann der<br />
Preis als sicheres Kriterium angesehen werden.<br />
Das Kriterium Preis heisst konkret, dass Kunst<br />
erst dann gut sein kann, wenn sie verkauft werden<br />
kann. Erst ein gewisser Erfahrungswert im<br />
Verkauf lässt zu, dass auch tatsächlich ein Urteil<br />
abgegeben werden kann. Neuheit kann zwar<br />
fachlich begründet werden, hängt aber immer<br />
von den persönlichen Ansichten des Interpreten<br />
ab. Neue Kunst ist gute Kunst. Und Kunst<br />
ist heute genial, wenn sie an nichts erinnert,<br />
was vorher gewesen ist. Wird dieses Kriterium<br />
gedanklich aber konsequent durchgespielt, darf<br />
Kunst eigentlich keine Farbe, keine Form und<br />
keinen Geruch mehr besitzen. Selbst die Idee an<br />
sich darf in keinster Weise mehr an irgendetwas<br />
in der uns umgebenden Wirklichkeit erinnern.<br />
Denn jedes Element, egal welcher Beschaffenheit,<br />
das in der gemeinsamen Wirklichkeit der<br />
Menschen vorkommt, provoziert Erinnerungen<br />
an bereits gemachte Erfahrungen und damit an<br />
Geschichte. Neu ist aber per Definition etwas,<br />
was bisher noch nicht existiert hat. Alles, was aus<br />
bereits Bestehendem herausgearbeitet wird, ist<br />
also per Definition alt. Neue Kunst darf deshalb<br />
nachweislich keinen Bezug zu etwas Bestehendem<br />
haben. Aber haben Sie schon einmal Kunst<br />
gesehen, die dieses Kriterium erfüllt? Wenn ja,<br />
dann ist sie leider bereits nicht mehr neu, denn<br />
sie können sich ja daran erinnern. Das Kriterium<br />
der Neuheit ist also untauglich.<br />
Besser als Neuheit wäre ein Begriff wie Weiterentwicklung,<br />
denn Innovation in der Technik,<br />
im Recht oder in der Literatur baut immer auf<br />
der Geschichte auf. Nur die Kunst darf, wenn sie<br />
gemäss den Kunstexperten gut sein soll, keine<br />
Geschichte haben. In der Kunstgeschichte hat<br />
dies dazu geführt, dass Künstler sich davor hüten,<br />
selbst explizite Bezüge zur Kunstgeschichte<br />
zu machen. Natürlich baut jede Kunst auf Vorangehendem<br />
auf, nur darf man nichts verraten,<br />
sonst ist sie ja nicht mehr eigenständig.<br />
Authentizität ist da zwar als Kriterium realistischer,<br />
allerdings stellt sich die Frage, wie lange<br />
man einen Menschen kennen muss, bis man<br />
wirklich sagen kann, er sei in seinem Sein und<br />
Schaffen authentisch. Auch für dieses Kriterium<br />
gibt es keine allgemeine Regelung, deshalb ist<br />
sie genauso eine Leerformel wie das Kriterium<br />
der Neuheit. Oder glauben sie ernsthaft, ein Experte<br />
ziehe jeweils in eine Wohngemeinschaft<br />
mit Künstlern, damit er sie nach Jahren des Zusammenlebens<br />
auch wirklich in ihrer Authentizität<br />
beurteilen kann?<br />
Bleibt noch das berühmte und beliebte Bauchgefühl.<br />
Das Tolle am Bauchgefühl ist, dass es garantiert<br />
immer rein subjektiv ist. Als allgemeinverbindliches<br />
Kriterium ist es also völlig unnütz.<br />
Bauchgefühl meint einen emotionellen Rapport.<br />
Ein Gefühl, das sich einstellt, weil ich, der Betrachter,<br />
mit dem Wahrgenommenen irgendeine<br />
Erinnerung verbinde. Das würde das Kriterium<br />
der Neuheit zwar ausschliessen, wurde bisher<br />
aber noch nicht in Frage gestellt. Das liegt wohl<br />
daran, dass das Bauchgefühl ein so wunderbar<br />
einfaches Kriterium ist. Spricht das Kunstwerk<br />
mein Inneres an. Ja oder nein? Fertig. Der Wahrnehmende<br />
muss nicht einmal hinterfragen, was<br />
denn das Wahrgenommene eigentlich anspricht,<br />
Hauptsache es spricht an. Zudem ist mit dem<br />
Bauchgefühl implizit immer auch das Gefallen<br />
verbunden. Natürlich nur implizit, weil gefallen<br />
muss Kunst ja nicht.<br />
Mit Geld und Gefühl zu guter Kunst Schlimm<br />
daran ist aber nicht, dass es gleichgültig ist, ob<br />
sich ein zustimmendes oder ablehnendes Bauchgefühl<br />
einstellt, schlimm ist, wozu dieses Bauchgefühl<br />
eingesetzt wird. So wird mit dem Bauchgefühl<br />
und alleine mit dem Bauchgefühl darüber<br />
entschieden, was überhaupt als Kunst wahrgenommen<br />
werden soll und was nicht. Galeristen<br />
und Kuratoren vertrauen bei der Auswahl von<br />
Kunst auf ihr Bauchgefühl, zumindest bei Newcomers<br />
und No Names. Bei Stars und Cash Cows<br />
vertrauen sie hingegen wie manch ein Banker<br />
oder Auktionator auf das Prinzip des kleinsten<br />
Risikos. Dort spricht das sichere Kriterium des<br />
Preises für sich. Ach ja, und wenn wir gerade bei<br />
Risiko und Bauchgefühl sind. Damit könnte auch<br />
die Tendenz erklärt werden, warum viele Entscheidungsträger<br />
Newcomer unter den Bildhauern<br />
meiden wie der Teufel das Weihwasser. Hohe<br />
Herstellungs- und Transportkosten, die Versicherungskosten<br />
schon gar nicht zu erwähnen. Nein,<br />
da würde sich doch jedem der Bauch umdrehen.<br />
Ob Bildhauer oder nicht, Newcomer unter den<br />
Kunstschaffenden sind für alle im Markt, die<br />
nicht selbst Kunst machen oder kaufen wollen,<br />
ein finanzielles Risiko. Das Prädikat «gut» erhält<br />
also nur jene Kunst, die sich auch gut verkaufen<br />
lässt. Laut dieser Logik war Van Gogh sein Leben<br />
lang ein miserabler Künstler. Die genau gleiche<br />
Kunst nach seinem Tod aber genial.<br />
Was gute Kunst nicht ist Der Preis als sicheres<br />
Kriterium ist ja gut und recht, aber ist es<br />
nicht ein wenig tragisch, dass es eigentlich keine<br />
verbindlichen Kriterien für die Qualität von<br />
Kunst an sich gibt? In Erwägung dieser Umstände<br />
verstehe ich zumindest, warum sich viele beim<br />
Kauf von Kunst lieber den harten Fakten als dem<br />
Bauchgefühl zuwenden. Leider ist selbst diese<br />
Sicherheit trügerisch, vor allem wenn man gute<br />
Kunst sucht. Rekapitulieren wir kurz: Kuratoren<br />
und Galeristen sagen, dass gute Kunst ist, was sie<br />
bei sich ausstellen. Gute Kunst ist in erster Linie<br />
jene Kunst, die verkauft werden kann. Und Kunst<br />
muss verkauft werden, damit sie dem Preiskriterium<br />
gute Kunst entspricht. Ein Zirkelschluss, oh<br />
nein! Und zudem hat er eigentlich nichts mehr<br />
mit Kunst zu tun, denn dasselbe könnte man von<br />
jedem x-beliebigen Gut behaupten. Wenn Galeristen<br />
behaupten, Kunst gemäss ihrer Qualität<br />
auszuwählen, Qualität aber bedeutet, dass Kunst<br />
von einem Galeristen ausgestellt und verkauft<br />
wird, bedeutet das, dass der Kunstmarkt, seit er<br />
existiert, eigentlich nie darauf geachtet hat, was<br />
gute Kunst ist, sondern nur darauf, ob das, was<br />
ausgestellt wird, auch verkauft werden kann.<br />
Das heisst, der Galerist verkauft Kunstwerke, die<br />
er vielleicht selber nicht kaufen würde, weil er<br />
weiss, dass sie sich besser verkaufen lassen. Und<br />
in diesem Dilemma stecken alle, die Kunst für<br />
die Öffentlichkeit zugänglich machen, Galeristen,<br />
Kuratoren wie auch Auktionatoren. Die Prämisse<br />
ist nicht die Liebe zur Kunst, sondern der Umsatz.<br />
Museen müssen möglichst viele Besucher<br />
anziehen, damit Einnahmen erzielt werden und<br />
die Gelder der öffentlichen Hand rechtfertigt<br />
werden können. Fixkosten wie Mieten und Löhne<br />
müssen gezahlt sein. Laufen sie in der Befolgung<br />
dieses Kriteriums nicht Gefahr, vor allem Kunst<br />
für den breiten Geschmack zu verkaufen? Und<br />
was nicht angeboten wird, kann auch nicht verkauft<br />
werden.<br />
KunstLiebeGeld Ich bezweifle, dass gute<br />
Kunst einfach mit verkaufbarer Kunst gleichgestellt<br />
werden kann. Wenn dem so ist, kauft man<br />
sich besser eine Deko, die ist nämlich wesentlich<br />
billiger. Andererseits, wird Kunst nur noch nach<br />
dem Kriterium Geld bewertet, wird alles viel einfacher.<br />
Das Vertrauen in den Analysten bereitet<br />
relative Unbeschwertheit und grösste Befriedigung.<br />
Nicht nur punkto Preis und Performance,<br />
sondern auch in Bezug auf persönliche Zufriedenheit.<br />
Hat man doch in etwas investiert, was<br />
lange währen wird und eine breite Anerkennung<br />
einbringt. Ein Warhol, ach wie schön und stattlich<br />
im Preis.<br />
Leider kann man nicht zwei Herren dienen.<br />
Entweder liebt man Kunst um der Kunst oder um<br />
des Geldes willen. Dumm nur, dass alle Entscheidungsträger<br />
auf Geld angewiesen sind, und ihre<br />
Entscheidungen deshalb stets auch wirtschaftlich<br />
begründet sein müssen. Dafür erklärt dies, warum<br />
Inhalt oder Fertigungsweise nicht als Kriterien<br />
für gute Kunst herangezogen werden. Vielleicht<br />
wird Kunst einst wie das Geld selbst nur noch<br />
zur fiktiven Währung. Gute Ideen ausgedrückt in<br />
den Bytes elektronischer Zahlen, und man kann<br />
sagen: «Hey, ich habe gerade mit einem Giacometti<br />
Brot gekauft, toll, nicht?» – Oder aber, man<br />
kauft Kunst, die man liebt und lässt sie zu dem<br />
Grossartigen werden, die sie tatsächlich ist.<br />
15
Kulturessays<br />
In den drei vergangenen Heften wurden einerseits<br />
allgemeine Gedanken, Definitionen<br />
und Umfelder, in denen es Burnout geben kann,<br />
dargestellt. In diesem Beitrag wird das Empfinden<br />
von Menschen und Arbeiten beleuchtet.<br />
Ein letzter Bericht im nächsten Heft dieser kurzen<br />
Serie zum Phänomen Burnout wird sich mit<br />
aufblühenden Aussichten befassen. Wo immer<br />
die eigene körperliche, seelische und geistige<br />
Gesundheit steht, jeder kann seine Ausgewogenheit<br />
und das damit verbundene Glücksempfinden<br />
beziehungsweise die Zufriedenheit mit<br />
sich selber mit bestem Gewissen und Empfinden<br />
selber gestalten oder erobern. Etwas Mut<br />
zur Veränderung, wenn es nicht mehr gut geht<br />
oder schon lange nicht mehr geht, und ein Bestreben<br />
nach dem Wohlsein und der Freude<br />
sind die Ratgeber in dieser Sache. Diese Bestreben<br />
stehen jedem eigens zur Verfügung<br />
und lassen sich bestens nutzen.<br />
Ehrliche Zufriedenheit aushalten Burnout-<br />
Forscher meinen: «Es ist weder möglich, Burnout<br />
sicher zu diagnostizieren, noch, einem Menschen,<br />
der sich ausgebrannt fühlt, zu beweisen,<br />
dass er kein Burnout(-Syndrom) hat». Die Studie<br />
von Hillert und Marwitz halten fest: «Es ist<br />
schlicht Energiemangel infolge von vorangegangener<br />
Überstrapazierung. Die Batterien der<br />
Betroffenen sind leer.» Burnout hat keine deutlichen<br />
Anfänge oder Enden. Es schleicht sich<br />
über unterschiedlichen Energieverbrauch ein<br />
und lässt sich durch individuelle Aufarbeitung<br />
eindämmen. In welcher Hinsicht Rückstände<br />
bleiben, so lässt sich höchstens sagen, dass der<br />
Betroffene sich mit seinen Grenzen und Kräften<br />
seinen Möglichkeiten und Freuden besser<br />
kennenlernt. Aronson, Pines und Ditsa fassen<br />
zusammen und schreiben einfühlend: «Dieses<br />
ausserordentlich schmerzliche und quälende<br />
Erlebnis ist durch geeignete Gegenmassnahmen<br />
zu bewältigen. Es kann den Weg zu<br />
klareren Einsichten in das Selbst weisen, das<br />
Einfühlungsvermögen anderer Menschen gegenüber<br />
verfeinern und wichtige Lebensveränderungen,<br />
Wachstum und Entwicklung einleiten.<br />
Menschen, die das Ausbrennen erlebt und<br />
überwunden haben, finden fast ausnahmslos zu<br />
allgemein besseren, anregenderen und weniger<br />
einengenden Lebensbedingungen.» Mit dem<br />
Zurückgewinnen der Kontrolle über die realistischen<br />
Leistungsmöglichkeiten sowie den<br />
PSYCHOLOGIE IM ALLTAG<br />
Inne- und Aushalten<br />
Von Ursula Lüthi<br />
eigenen Bedürfnissen und Wünschen, kann<br />
dem Ausbrennen entgegengewirkt werden und<br />
Kraftquellen wieder belebt werden. Dies erfordert<br />
jedoch ein Bewusstwerden der eigenen<br />
Bedürfnisse und Wünsche und eine ernstzunehmende<br />
Zeitspanne der Reserveschaffung<br />
für eigene Kräfte; das heisst, der Mensch muss<br />
sich selber wieder lieb werden und Leistung<br />
für sein Wohlbefinden erbringen lernen. Das<br />
Nein-Sagen gegenüber nächsten Personen ist<br />
oftmals beizuziehen, Pausen machen darf nicht<br />
mit schonungslosem Freizeitstress ausgefüllt<br />
sein und es gilt zu akzeptieren, dass auch die<br />
Stärksten irgendwann einmal ihre Ressourcen<br />
verbraucht haben und dies keine Unmenschlichkeit<br />
an sich ist, sondern zum Zyklus von<br />
Leistung und Wertschätzung im Zusammenleben<br />
mit Arbeit, Familie und Freunden jedem widerfahren<br />
kann - so beraten Litzcke und Schuh.<br />
Das Ausbrennen «hält uns nicht den Spiegel<br />
vor, sondern bietet Hilfen zur Bewältigung<br />
der beschriebenen Zustände. Das Ausbrennen<br />
kann man meiden. Wo es eingesetzt hat, kann<br />
man den Prozess bremsen und rückgängig machen»,<br />
schreiben Aronson, Pines und Ditsa. Es<br />
bedarf in gewissem Sinne einer Trauerphase,<br />
um sich von alten, verfahrenen Mustern von<br />
Beruf und Leben zu verabschieden und sich<br />
neuer Lebensqualität und Leistung bewusst zu<br />
werden. Aronson, Pines und Ditsa raten weiter:<br />
«Wir empfehlen allen Leuten, nicht immer zu<br />
wiederholen, was sie gut können, sondern ihr<br />
Leben und ihren Beruf durch Abwechslung und<br />
neue Herausforderung vielfältiger zu gestalten.<br />
Wenn man mit neuen Ideen, Fertigkeiten und<br />
Annäherungsversuchen experimentiert, kann<br />
man sich selbst auch einmal gestatten, nicht<br />
ganz perfekt zu sein»; und: «Um Erfolg zu einem<br />
positiven Lebensereignis zu machen, muss<br />
man lernen, erfolgreich vollbrachte Leistungen<br />
in Ruhe zu geniessen und dieses Erlebnis zu<br />
einem Teil des Selbst zu verarbeiten, ehe man<br />
sich aufmacht, um neuen Herausforderungen<br />
zu begegnen»,so Aronson, Pines und Ditsa.<br />
(Alle Quellenreferenzen sind aus gestalterischen<br />
Gründen unterlassen.)<br />
Signale von Innen empfangen Im Buch «Das<br />
psychosomatische Lexikon, das schon beim Lesen<br />
hilft: Mein Körper - Barometer der Seele»<br />
von Jacques Martel (Psychotherapeut) findet<br />
sich folgende Sprache zum Burnout-Syndrom<br />
oder zur Erschöpfung: Ein Burnout-Syndrom<br />
äussert sich im Allgemeinen, wenn ich einen<br />
Kampf um ein bestimmtes Ideal erfolglos aufgegeben<br />
habe. Die in die Umsetzung dieses<br />
Ideals investierte Zeit und Energie sind so<br />
gross, dass ich erschöpft und krank geworden<br />
bin. Es handelt sich um eine tiefe innere Leere,<br />
weil ich eine Situation ablehne, in der ich eine<br />
wirkliche, konkrete und dauerhafte Veränderung<br />
sehen möchte, beispielsweise an meinem<br />
Arbeitsplatz, in meiner Familie oder meiner<br />
Partnerschaft. Ich bin Perfektionist und opfere<br />
mich auf, ich will meine Ideale erreichen.<br />
Vielleicht ist es auch ein Teil meiner selbst,<br />
den ich nicht akzeptiere. Ich fühle mich so, als<br />
ob ich gegen die ganze Menschheit kämpfen<br />
müsste, da es mir so scheint, als ob sie meinen<br />
Erwartungen und tiefen Überzeugungen nicht<br />
entspricht. Warum weitermachen? Ich gebe<br />
auf, es wird mir zu viel. Es handelt sich um<br />
eine Art Zwang, denn ich will das System mit<br />
neuzeitlicheren Methoden um jeden Preis ändern.<br />
Wenn ich den Eindruck habe, dass ich die<br />
Welt retten muss, dann muss ich sofort meine<br />
Einstellung überprüfen. Ein Burnout-Syndrom<br />
ist auch eine Art Flucht. Ich sollte mich fragen:<br />
Wovor will ich durch mein exzessives Arbeiten<br />
flüchten? Habe ich Angst, mit mir alleine<br />
zu sein? Brauche ich einen Vorwand, um nicht<br />
mit einem Lebenspartner zusammen zu sein,<br />
den ich nicht mehr ertrage? Was will ich beweisen,<br />
während ich gleichzeitig vor der Angst<br />
vor Misserfolg flüchte? Die Symptome eines<br />
Burnout-Syndroms sind ziemlich deutlich:<br />
geistige und körperliche Erschöpfung, nachlassende<br />
Lebensenergie, unzusammenhängende<br />
Gedanken! Zuerst kommt die Erschöpfung und<br />
dann die Ruhe und Erholung, damit ich meine<br />
Energien wieder aufladen kann. Vor allem<br />
muss ich aufhören zu glauben, dass ich es allen<br />
recht machen muss! Das ist eine Idealvorstellung<br />
und die Wirklichkeit liegt darin zu wissen,<br />
dass ich für das, was ich zu tun habe, mein<br />
Bestes gebe und mich vollständig einbringe. So<br />
finde ich wieder Gelassenheit, inneren Frieden<br />
und wirkliche Liebe in meinem Handeln. In<br />
der Kurzform schreibt Martel zur Bedeutung<br />
des Burnout-Syndroms: «Das Burnout-Syndrom<br />
steht oft im Zusammenhang mit der Flucht vor<br />
einer starken Gemütsbewegung, die bei der Arbeit<br />
oder anderen Beschäftigungen auftritt.»<br />
16
ensuite<br />
Das Abonnement<br />
Monatlich, 11 <strong>Ausgabe</strong>n,<br />
inkl. Kunstmagazin artensuite<br />
K U L T U R M A G A Z I N<br />
<br />
Ja, ich will ab sofort ensuite abonnieren (nur im ABO inklusive Beilage artensuite)!<br />
✓Pro Jahr 11 <strong>Ausgabe</strong>n (Juni/Juli ist eine Doppelnummer)<br />
«Ein Kulturmagazin ist selbst ein Stück<br />
Kultur - und Kultur ist Kultur und bleibt<br />
diese im Herzen. Es geht dabei nicht um<br />
Unterhaltung oder Nachrichten, sondern<br />
um die dauernde Definition und<br />
Standortbestimmung unseres Selbst.»<br />
Bestellen Sie noch heute Ihr Abonnement<br />
und tun Sie damit nicht nur etwas für Ihr<br />
persönliches Sozialleben: Ein Verlag lebt von<br />
der Unterstützung der Abonnenten und damit<br />
wird Kulturellem und der Kunst weiterhin ein<br />
wichtiger Platz in der Medienwelt garantiert.<br />
Die kulturelle Berichterstattung wird in den<br />
Tagesmedien zum Massenprodukt gekürzt.<br />
Berichtet wird noch, was alle oder nur Insider<br />
interessiert - nicht aber, was entdeckt werden<br />
muss. Täglich hören und sehen wir in den Tagesmedien<br />
und Fernsehstationen Glimmer und<br />
Glamour, Stars und Sternchen. Das Kleine, Feine,<br />
Sensible geht dabei oftmals verloren.<br />
ensuite kann natürlich nicht alles thematisch<br />
auffangen. Aber wir versuchen zumindest,<br />
ohne zu Werten Themen darzustellen<br />
und sichtbar zu machen. Wir sind sozusagen<br />
die Nase im Wind: Viele KünstlerInnen und<br />
Kulturschaffende haben wir entdeckt, bevor<br />
diese in der Masse vorgestellt wurden. Dass<br />
uns dabei die Tagesmedien über die Schultern<br />
gucken, ist kein Geheimnis mehr.<br />
Ein Kulturmagazin ist selbst ein Stück Kultur.<br />
Tragen wir Sorge darum - mit einem Abonnement,<br />
welches uns selbst verpflichtet, unsere<br />
Kultur weiterhin im Dialog zu behalten.<br />
Für jene, die ein ensuite-Abonnement verschenken,<br />
haben wir auch ein kleines Geschenk<br />
bereit: «The artist’s residence: Donal McLaughlin».<br />
Donal war von Februar bis Juli 2004 in<br />
Bern und hat seine Erlebnisse in einem kleinen<br />
Büchlein verewigt. Das «artist’s-in-residence»-<br />
Programm wurde von der Stadt Bern und dem<br />
Kanton Bern mitfinanziert. Das Büchlein ist<br />
mehrheitlich in englischer Sprache geschrieben<br />
- in original Irisch-Schottisch eben -, bis auf das<br />
Interview von Stephan Fuchs mit dem Autor.<br />
Füllen Sie einfach den untenstehenden Talon<br />
aus und überlassen Sie uns den Rest. Apropos:<br />
Mit einem Geschenk kann man auch ohne<br />
Abonnement bei ensuite jemandem eine Freude<br />
machen - das Büchlein gehört auf jeden Fall Ihnen.<br />
Lukas Vogelsang<br />
Chefredaktor<br />
✄<br />
Das Abonnement kostet je Stadt Fr. 77.00<br />
Name, Vorname des neuen Abonennten<br />
Strasse, Nummer<br />
PLZ, Wohnort<br />
<strong>Ausgabe</strong> Bern / inkl. artensuite<br />
<strong>Ausgabe</strong> <strong>Zürich</strong> / inkl. artensuite<br />
Reduktion für Studierende/AHV/IV Fr. 52.00<br />
Ich möchte ein Abo verschenken.<br />
Hier mein Name, Adresse und Wohnort:<br />
E-Mail<br />
☞<br />
oder Telefonnummer<br />
Ort, Datum und Unterschrift<br />
Ein Abonnement ist ab Rechnungsdatum für ein Jahr gültig. Ohne Kündigung<br />
wird es automatisch um ein Jahr verlängert. Eine Kündigung ist jeweils jährlich,<br />
2 Monate vor Ablauf des Abonnements, möglich.<br />
Ausschneiden und Einsenden an:<br />
ensuite - kulturmagazin | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern<br />
<strong>Ausgabe</strong> Bern, <strong>Zürich</strong> & artensuite<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 17<br />
Wissen, was in Deiner Stadt lebt - monatlich im Briefkasten
Kulturessays<br />
KULTUR DER POLITIK<br />
Keiner mag ihn hören<br />
Von Peter J. Betts<br />
«<br />
Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, /<br />
Und die Hunde knurren um den alten Mann.<br />
/ Und er lässt es gehen, alles wie es will», so lauten<br />
drei Zeilen aus dem letzten Lied von Schuberts<br />
«Winterreise». Der Titel: «Der Leiermann»,<br />
und den Text hat Wilhelm Müller (genannt<br />
Griechen-Müller) geschrieben. Der Dichter hat<br />
als Freiwilliger an den Befreiungskriegen teilgenommen<br />
und starb vierunddreissigjährig 1827.<br />
Das herzzerreissende Lied setzt sich mit einer<br />
Gesellschaft auseinander, die, kurz charakterisiert,<br />
zur Empathie unfähig ist. Sie denken<br />
an das erste Drittel des neunzehnten Jahrhunderts?<br />
Sie sind gebildet. Im Text geht es um einen<br />
Randständigen, der barfuss auf dem Eis am<br />
Leierkasten dreht, auch wenn sein kleiner Teller<br />
immer leer bleibt; dieser Randständige wird<br />
durch einen randständigen Sänger eingeladen,<br />
zusammenzuspannen. Beide werden ungehört<br />
und übersehen bleiben. Mit der Zeit wurde das<br />
Lied selber aber durchaus gehört: in Salons, in<br />
Konzertsälen, es liegt in Diskotheken und Plattensammlungen<br />
auf, und heute habe ich es mit<br />
einer originellen Begleitung durch ein kanadisches<br />
Bläserensemble am Radio gehört. Dietrich<br />
Fischer-Dieskau und Gerald Moore haben uns<br />
zusammen sehr eindrückliche Interpretationen<br />
hinterlassen. Andere auch. Kulturerbe: gepflegt.<br />
Im Bahnhof Bern finden sich keine Bettlerinnen<br />
oder Bettler. Der Fluss der Eilenden repräsentiert<br />
eine Gesellschaft, in der es jeder und jedem<br />
einzelnen gut geht: Einzeln fotografiert, zeigen<br />
sie alle zähnefletschendes Lächeln. Das entblösste<br />
Gebiss deutet nicht nur auf Aggression hin.<br />
Die u.a. fotografischen Kosmetikvorschriften<br />
haben uns schon längst das Lesen natürlicher<br />
Zeichen unzugänglich gemacht. Haltung, bitte<br />
schön. Auch nach dem kleinen Rückschlag der<br />
UBS und den unstetig, aber stets ansteigenden<br />
Krankenkassenprämien, der zunehmenden Menge<br />
Arbeitsloser, der Zwang der Spekulierenden,<br />
nach neuen Jagdgründen zu suchen, den nachlassenden<br />
Exportzahlen der Metallbranche. In<br />
der Laube unter dem Käfigturm sitzen am Eingang<br />
links und rechts am Samstag während des<br />
Einkaufwettrennens je ein altersloser Mann auf<br />
einem Stühlchen. Auf ihrem Plakätchen steht:<br />
«Wir sammeln für die Gassenküche». Keiner<br />
mag sie hören, keiner sieht sie an. Am Radio hat<br />
kürzlich ein Neurobiologe erklärt, warum gerade<br />
auch bei jüngeren Menschen die Fähigkeit<br />
zur Empathie abnimmt. Durch vorgeburtliche<br />
und frühkindliche Traumata entstünden u.a.<br />
mess- und nachweisbare Veränderungen in den<br />
jungen Gehirnen, die offenbar für alle Zeiten<br />
Unfähigkeit zur Empathie zementierten. So erklärten<br />
sich nicht nur die Lust, mit groben Schuhen<br />
so lange nach liegenden Opfern zu treten,<br />
bis sie tot oder lebenslänglich behindert seien,<br />
sondern es erkläre auch, warum zahllose Menschen<br />
in Managementpositionen, ohne Rücksicht<br />
auf jegliche Verluste anderer, sich selbst<br />
bereicherten. Was muss also den gewissenlosen<br />
Spitzenmagern (und den vereinzelten Spitzenmanagerinnen)<br />
in ihren Mutterbäuchen oder<br />
kurz nach der Geburt zugestossen sein? Auch<br />
ich begreife, dass, wenn man bis ein paar Tage<br />
vor der Geburt unter Vollstress arbeiten muss,<br />
wenig Zeit, Musse, Zuwendungsmöglichkeit<br />
auf das im Bauch wachsende Kind mobilisiert<br />
werden können. Nein, ich bin nicht dagegen,<br />
dass Frauen im Erwerbsleben eine entscheidende<br />
Rolle spielen, im Gegenteil; aber vielleicht<br />
müsste nach kindförderlichen Möglichkeiten<br />
bei Zusammenarbeitsformen gesucht werden?<br />
Nach kindförderlicher Zusammenarbeit in der<br />
Gesellschaft überhaupt? In unserer Gesellschaft<br />
gäbe es doch Möglichkeiten dazu, wenn nicht<br />
alle, Männlein und Weiblein und möglichst früh<br />
schon Kindlein dem allen physikalischen Prinzipien<br />
spottenden Mehr, Mehr, Mehr nachhechelten?<br />
Anderseits: Einem Grossteil der Bevölkerung<br />
Deutschlands muss von 1933 bis 1945<br />
zunehmend jegliche Empathie völlig abhanden<br />
gekommen sein. Wie erklärte sich sonst das von<br />
fast allen mitgetragene Morden an Millionen<br />
von Menschen in den KZs? Es kann sich bei diesem<br />
Gewissensmangel nicht nur um die Bösen<br />
in Deutschland gehandelt haben. Es hat sicher<br />
vor allem auch bei den Guten funktioniert. Das<br />
macht Angst. Was ist in Deutschland nach dem<br />
Zusammenbruch 1945 abgelaufen? Und 1929:<br />
global? Wann hat die Kreativität in Destruktion<br />
umgeschlagen? Warum? Und was eigentlich<br />
ermöglicht die globalisierte Ausbeutung heute,<br />
von uns allen mitgetragen? Wenn man still die<br />
hetzenden Ströme im Bahnhof Bern, unbehindert<br />
durch Bettlerinnen und Bettler, beobachtet;<br />
wenn man das durchstrukturierte, zahlenmässig<br />
stetig abnehmende Pflegepersonal in Spitälern<br />
erlebt, alle politisch korrekt, freundlich die entblössten<br />
Zähne bleckend, ungeheuer effizient<br />
und bis zum Brechen unter Druck; wenn man<br />
das Publikum beim Laubenbogen am Käfigturm<br />
an den beiden Männern, die für die Gassenküche<br />
sammeln, vorbeiströmen sieht, kommt einem<br />
vor allem unsere Unfähigkeit zu Empathie<br />
in den Sinn. Anderseits: In München gab es zum<br />
Beispiel bereits 1946 (bis 1949) «die Schaubude»;<br />
mitten im Trümmerfeld des Landes entstand<br />
ein Kabarett, das Tausende von Verzweifelten,<br />
Mut- und Perspektivelosen besuchten; zeitkritische<br />
Kunst, Kunst als Motor zu Selbstkritik, als<br />
Ansporn, im Interesse aller kreativ zu werden,<br />
die Menschlichkeit wieder zu entdecken. Empathie<br />
im Verbund mit Vernunft. Schriftsteller<br />
mit Berufsverbot während der Nazizeit, andere,<br />
die emigriert und zum Wiederaufbau zurückgekehrt<br />
waren, hochkarätige Künstlerinnen und<br />
Künstler verwendeten Geist als unverzichtbaren<br />
Rohstoff gegen das Chaos. Der «Pinguin», eine<br />
Kinderzeitschrift, wurde gegründet und im Rowohlt<br />
Verlag herausgegeben («Pinguin ist mein<br />
Name... Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen<br />
ist... Ich lache, wie es mir gefällt... Ich will<br />
euch begeistern für all das, was wir selber tun<br />
können, um uns selbst ein besseres Leben zu<br />
schaffen...»). Von der Destruktion zur Kreation.<br />
Damals ein langer Weg. Und dann kam das<br />
Wirtschaftswunder. Und heute? Den Blick starr<br />
auf den Bildschirm fixiert, im Ohr das akustische<br />
Individualprogramm: effiziente Vorstudien<br />
zum Autismus. Und dabei, glaube ich, dass<br />
Kinder noch immer kreativ wären. Ich klaue<br />
Kästner eine Idee. Erich Kästner, eine zentrale<br />
Kraft in jenem existentiellen geistigen Aufbau<br />
in den Nachkriegsjahren in Deutschland, plädiert<br />
(damals...) erfolglos für eine geniale Idee:<br />
ein Projekt zur Errichtung ständiger Kindertheater<br />
(«Die Klassiker stehen Pate», Oktober 1946,<br />
«Neue Zeitung»). In festen Häusern spielen Kinder<br />
für Kinder, einmal als Zuschauende, einmal<br />
als Schreibende, Spielende, Regieführende, Bühnenbildmalende,<br />
und all das in Zusammenarbeit<br />
mit hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern,<br />
die einen glaubwürdigen Zugang zu Kindern<br />
haben und anständig bezahlt werden. Das<br />
Theater: Drehscheibe der Kultur. Wie finanzieren?<br />
Eben: Oft gespielte Autoren und Autorinnen,<br />
für deren Stücke, fünfzig Jahre nach ihrem<br />
Tod, keine Tantiemen bezahlt werden müssen<br />
und wohl nicht zuletzt deshalb bei Theaterleitungen<br />
beliebt sind, werden wieder tantiemenpflichtig.<br />
So würden Sophokles, Shakespeare,<br />
Molière, Büchner und so weiter und so fort eben<br />
zu Paten... Vielleicht würde, da ja eh Tantiemen<br />
bezahlt werden müssen, sogar gelegentlich mit<br />
zeitgenössischen DamatikerInnen zusammengearbeitet:<br />
ein schönes Nebenergebnis. Die<br />
Plüschpaläste und deren hehre Besucherschaft<br />
bekämen endlich wieder existentiellen Sinn.<br />
Lächeln ohne Zähnefletschen? Ein Beitrag, die<br />
Fähigkeit zur Empathie in unserer Gesellschaft<br />
wieder zu entdecken? Warum nicht angesichts<br />
der keineswegs unproblematischen Gegenwartssituation<br />
HEUTE DIE VERANTWORTUNG FÜR<br />
MORGEN ÜBERNEHMEN?<br />
18
CARTOON<br />
Kulturessays<br />
www.fauser.ch<br />
VON MENSCHEN UND MEDIEN<br />
Wenn Berner Medien tagen<br />
Von Lukas Vogelsang<br />
Es kommt mir vor wie ein Besuch in einem<br />
Sozitreff. Der 19. Berner Medientag<br />
ist besucht von hoffnungsvollen VisionistInnen,<br />
die nichts zu sagen haben, entlassenen<br />
GewerkschaftlerInnen, die viel fordern, und<br />
einem Mittelfeld, welches man sofort vergessen<br />
hat. Ich zähle mich zu der ersten Kategorie.<br />
Das Fordern der zweiten Gruppe ist nicht<br />
mein Ding und mit dem langsamen Sterben des<br />
Mittelfeld will ich nichts zu tun haben. Doch<br />
der Medientag ist eine hervorragende Sache,<br />
da sich hier eine Branche begegnen kann, die<br />
zwar täglich in den Medien präsent ist, jedoch<br />
kaum Zeit findet, den KollegInnen mal die<br />
Hand zu schütteln – auch wenn es schlussendlich<br />
nur ein Kragenweinen ist. Der Ort des<br />
Treffens, das neu renovierte Gebäude der SRG,<br />
Radiostudio Bern, war ein ideal neutraler und<br />
protziger Ort.<br />
Das Tagesthema «Ist die abonnierte Zeitung<br />
am Ende?» hatte aber diesmal so wenig Spuren<br />
hinterlassen wie die Frage selbst. Das hat zum<br />
einen mit der falschen Zusammensetzung der<br />
Referenten zu tun, zum anderen mit der flachen<br />
Diskussion. Immerhin sind am Medientag nur<br />
professionelle Medienschaffende anwesend.<br />
Als dann ein Journalist an dieser Form Kritik<br />
übte, wurde er mit einer übermässigen Tirade<br />
abgekanzelt. Zu Unrecht, denn der Einwurf<br />
war an diesem Nachmittag mit Abstand die<br />
lebendigste Interaktion. Denn die Verlegerrepräsentatoren<br />
von Tamedia, Ueli Eckstein (Verlag)<br />
und Arthur Vogel («Bund»), taten, was sie<br />
in solchen Momenten immer tun: Schönreden.<br />
Auffallend dabei war die sichtliche Distanzierung<br />
vom ehemaligen «Bund»-Chefredaktor<br />
Hanspeter Spörri, der sich von dem immer unsinnigere,<br />
arrogante Haltungen einnehmenden<br />
Arthur Vogel zentimeterweise entfernte. In den<br />
Diskussionen auf der Bühne wurde dann auch<br />
schnell klar, dass Vogel und Eckstein keine Ahnung<br />
haben – wohl von Zahlen, aber nicht von<br />
ihrer funktionellen Aufgabe. So selbstherrlich<br />
kann kein nüchterner Medienverlagsvertreter<br />
daherreden – oder wenn, dann müssten die Resultate<br />
entsprechend stimmen.<br />
Beat Soltermann vom DRS konnte mit seinem<br />
Referat am meisten Punkte sammeln –<br />
leider ist mir nichts hängen geblieben davon.<br />
Aber in Erinnerung habe ich Souveränität,<br />
klare Argumente und dass er keinen Anzug,<br />
dafür ein fürchterliches rosa Hemd trug. Urs<br />
Rueb von der Media Plus glänzte typisch als<br />
Vertreter der Werbebranche, der mit sehr<br />
vielen Worten immer weniger sagte und jede<br />
Diskussionsmöglichkeit zum Erliegen brachte.<br />
Das Einzige, was er auslöste, war ein Stöhnen<br />
im Publikum. This Born, ein jüngerer Nachzögling<br />
der «Berner Zeitung» und Student der Uni<br />
Freiburg, erzielte mit seinem Vortrag über die<br />
E-Reader, also den elektronischen Papierlesegeräten,<br />
über die er anscheinend eine Studie<br />
geschrieben hatte, keine Aussage. Während<br />
seinem Referat fragte ich mich ernsthaft,<br />
ob Universitäten noch in irgendeiner Weise<br />
brauchbar sind. Er hätte genauso gut Rüstmesser<br />
für die Gemüseküchen verkaufen können.<br />
Neu war hier nichts – schon gar nicht für die<br />
JournalistInnen.<br />
Was mich allerdings faszinierte, war der<br />
Fakt, dass die Verlage mit der Swisscom im<br />
E-Reader-Bereich Arbeitsgruppen gebildet haben.<br />
Damit zeigten sich die Medienleute wieder<br />
bereit, den Markt an die Konkurrenz weiterzugeben.<br />
Den Autohandel haben die Medien<br />
an die IT-Firmen verloren, die Immobilien und<br />
die Stellenmärkte ebenfalls. Jetzt bereiten sie<br />
sich vor, auch den elektronischen Vertrieb der<br />
Zeitungen der Telekommunikationsbranche<br />
abzugeben. Die Schweizer Medien haben keine<br />
Märkte geschaffen, sondern sich immer wieder<br />
nur als Trittbrettfahrer versucht und schlussendlich<br />
klein beigegeben. Jetzt jammern sie.<br />
Investitionen wurden nur im Gratisbereich gemacht<br />
– neue Märkte wurden nicht erschlossen.<br />
So investierten die Tamedias, Ringiers, NZZs<br />
Millionen in neue Gratiszeitungen oder Gratisangebote.<br />
Doch ins Internet wurde nicht ein<br />
Bruchteil davon investiert – und wenn, dann<br />
schrecklich schlecht und unwissend.<br />
Wenn Berner Medien tagen, dann bringen<br />
sie die ganze Visionslosigkeit ans Licht. Schade.<br />
Dafür brauchen wir keinen Medientag. Das<br />
demotiviert die Hoffnung der letzten JournalistInnen<br />
und freut all jene, die erkannt haben,<br />
dass immer noch nicht die Quantität, sondern<br />
die Qualität Massstäbe setzt. Und zum Schluss:<br />
Der Berner Medientag hat zwar eine eigene<br />
Webseite, doch in der Presse war kaum ein<br />
Wort über den Nachmittag in der SRG/DRS<br />
nachzulesen. Und wieder eine vertane Chance,<br />
neue Medien zu nutzen...<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 19
Literatur<br />
An diesem sonnigen Märztag gestattete<br />
er sich auf dem Fussweg in die Stadt einen<br />
Umweg und geriet in ein schmales, abfallendes<br />
Strässchen überm Fluss. Hier standen<br />
Villen und Vorgärten, wo man eben dran war,<br />
den Kies zu rechen und den Boden unter den<br />
Büschen zu säubern. Still war es sonst um diese<br />
frühe Nachmittagsstunde - die Stille schien<br />
aus der Vornehmheit der Villen mit den verschwiegenen<br />
Parks zu kommen, und ein langsam<br />
fahrendes Auto vermochte sie kaum zu<br />
durchbrechen.<br />
Aus einem halboffenen Gartentor kam unvermutet<br />
eine Tigerkatze herangerannt, drückte<br />
sich auch gleich mit hochgestelltem Schwanz<br />
LITERARISCHE FRAGMENTE 1<br />
Seit jeher unterwegs<br />
Von Konrad Pauli<br />
zwischen seine Beine. Er fuhr ihr über das<br />
knisternde Fell, und zum Dank bohrte sie ihre<br />
feuchte Nase und auch den Kopf in seine hohle<br />
Hand. Die Katze schnurrte so vernehmlich, als<br />
wolle sie mitteilen, er möge doch nie mehr aufhören<br />
mit seinen Zärtlichkeiten. Er hatte Zeit<br />
und war neugierig, wie lange die Katze Lust<br />
zum Verweilen haben würde. Ihr und ihm gefiel<br />
das Beisammensein so sehr, dass sie sich<br />
wechselseitig diesen Gefallen taten.<br />
Auf einmal knirschten Schritte im Kies hinter<br />
der Hecke, und ein kleines blondes Mädchen<br />
schlüpfte aus dem Tor, kauerte zu der Katze<br />
hin und half sogleich mit, sie zu streicheln.<br />
Wohlig streckte und reckte und kugelte sich<br />
ensuite<br />
<br />
<br />
«Kultur braucht Plattform»<br />
die Katze und genoss die doppelte Zuwendung<br />
in vollen Zügen. Bald fanden der Mann und das<br />
Mädchen zu ungezwungener Plauderei. Ohne<br />
Scheu erzählte das Mädchen von dem Tier, das<br />
sie zu Weihnachten von Mama geschenkt bekommen<br />
habe. Jetzt sei Frühling, endlich dürfe<br />
sie mit der Katze im Garten spielen, sie habe<br />
bloss ein wenig Angst, das Tier laufe weg. Der<br />
Mann und das Mädchen gerieten plaudernd<br />
und streichelnd in einen Eifer, dass sich ihre<br />
Hände im Katzenfell zuweilen berührten, und<br />
zum feinen Haar kam die zarte Kinderhaut.<br />
Lange hatten die Drei so miteinander zu tun,<br />
ohne dass ein falscher Ton, gar ein Missgriff<br />
die Innigkeit und Schönheit des Augenblicks<br />
getrübt oder zerstört hätte.<br />
In seinem Rücken spürte der Mann auf einmal<br />
ein Auto langsam heranfahren, und wie er<br />
sich umwandte, sah er zwei Polizisten aus dem<br />
Wagen steigen. Als gäbe es etwas zu verscheuchen,<br />
blieben die Uniformierten stehen, hatten<br />
freilich nicht im Sinn, sich am Streicheln zu beteiligen.<br />
Höflich verlangte man seine Ausweispapiere.<br />
Diesen Unterbruch nutzte die Katze,<br />
endlich zum Haus zurückzueilen, und das<br />
Mädchen rannte ihr nach. Die Papiere waren<br />
in Ordnung, aber im Gesicht der Beamten klebte<br />
das Misstrauen. Endlich vernahm der Mann,<br />
die Polizei habe einen Anruf erhalten, draussen<br />
auf dem Gehsteig spiele ein Mann mit einem<br />
blonden Mädchen, eine Katze sei auch dabei,<br />
und man wisse ja, so etwas diene oft bloss als<br />
Vorwand zu Schlimmem. Der Mann verzichtete<br />
auf die Rechtfertigung, es sei ganz und gar<br />
nichts dabei gewesen im Spiel mit der Katze<br />
und dem Mädchen, zu sehr hatte er das Verweilen<br />
genossen. Während die Beamten ins Auto<br />
stiegen und lange nicht wussten, ob sie weiterfahren<br />
wollten, setzte der Mann seinen Weg<br />
fort. In seiner Hand nahm er den Duft von Tier<br />
und Mädchenhaut mit. An einem Brunnen ging<br />
er vorbei, hütete sich aber, sie zu waschen, war<br />
sie doch in keinerlei Weise schmutzig geworden.<br />
Konrad Pauli ist Schriftsteller aus Bern.<br />
20
Literatur-Tipps<br />
Djebar, Assia: Nirgendwo im<br />
Haus meines Vaters. Roman. Aus<br />
dem Französischen von Marlene<br />
Frucht. S. Fischer Verlag. Frankfurt<br />
am Main 2009. 442 Seiten.<br />
ISBN 978-3-10-014500-0.<br />
Krausser, Helmut: Einsamkeit<br />
und Sex und Mitleid. Roman.<br />
DuMont. Köln 2009. 223 Seiten.<br />
ISBN 978-3-8321-8092-8.<br />
Krohn, Tim: Ans Meer. Roman.<br />
Galiani. Berlin 2009. 303 Seiten.<br />
ISBN 978-3-86971-002-0.<br />
Eine Reise in eine andere Welt<br />
Assia Djebar: Nirgendwo im Haus meines Vaters.<br />
Roman. Aus dem Französischen von Marlene<br />
Frucht.<br />
«<br />
Nirgendwo im Haus meines Vaters» ist<br />
wohl das persönlichste Buch der bekannten<br />
algerischen Autorin Djebar.<br />
Sie schildert hier ihre Kindheit und Jugend,<br />
ihrem strengen, doch liebevollen Vater<br />
scheint sie aufs Tiefste ergeben. Die elegante,<br />
europäisch anmutende Mutter bewundert und<br />
liebt sie. Sie erzählt uns von ihrem Leben in<br />
der Lehrerwohnung, von ihren Gängen durch<br />
das Dorf an der Hand ihrer im städtischen Stil<br />
verhüllten Mutter, welche nicht nur unter den<br />
Einheimischen, sondern auch unter den französischen<br />
Kolonialisten Begehrlichkeiten weckt.<br />
Diese fühlt sie, wenn sie sie auch als Kleinkind<br />
nicht in Wort fassen könnte.<br />
Wir erfahren vom Tod ihres kleinen Bruders,<br />
der mit nur sechs Monaten verstorben ist,<br />
und über den in der Familie nicht gesprochen<br />
werden darf.<br />
Sowohl im Dorf als auch später in der Internatschule,<br />
wo die arabischen Mädchen unter<br />
den «Französinnen» eine Minderheit darstellen,<br />
repräsentiert Fatima/Assia das Andere.<br />
Sie ist ein Hybrid in einer Welt, welche sich<br />
mit klaren Grenzen konstitutiert: hier sind die<br />
Besatzer, dort die Einheimischen. Doch sie,<br />
das kleine und später das grössere Mädchen,<br />
scheint keines von beidem zu sein.<br />
Auf diesem Weg, der ein einsamer ist, weil<br />
sie in einer Welt des Ausschlusses gross wird,<br />
verleiht ihr die Literatur Flügel. Das erste französische<br />
Gedicht, welches ihr von ihrer Französischlehrerin<br />
Madame Blasi vorgetragen wird,<br />
empfindet sie als Offenbarung. Sie, die schüchterne<br />
Elfjährige sieht einen Kosmos jenseits<br />
ihres bisherigen vertrauten.<br />
Assia Djebar ist ein sensibles, kluges Buch<br />
über ihre ersten und ganz persönlichen Schritte<br />
als Beobachterin und Schriftstellerin gelungen.<br />
Sie lässt uns eintauchen in ein Leben, das heute<br />
so fern und in ihren Beschreibungen doch so<br />
nah scheint. (sw)<br />
Bäumchen wechsle dich in der Grossstadt<br />
Helmut Krausser: Einsamkeit und Sex und Mitleid.<br />
Roman.<br />
Vincent, ein Berliner Callboy, sitzt an Weihnachten<br />
allein über seinem Bier, um kurz<br />
darauf in seiner Wohnung eine Einbrecherin<br />
zu überraschen, doch statt die Polizei zu rufen,<br />
lässt er die vor Schmutz starrende junge Frau<br />
ein Bad nehmen und verliebt sich ins sie. Ekki,<br />
zwangspensionierter Lateinlehrer, trifft ebenfalls<br />
am Weichnachtsabend in seiner Stammkneipe<br />
Nachtmar auf die beleibte Kellnerin Minnie,<br />
deren grosse Leidenschaft den teuren Cauldron<br />
Chips gehört. Julia König hingegen beschliesst,<br />
sich gerade an diesem Abend bei ihrem alljährlichen<br />
Sushi-Ritual von ihrem Mann Uwe, einem<br />
Marktleiter, zu trennen.<br />
Im Mai, fünf Monate später also, werden Dr.<br />
Thomas Stern im ICE von Berlin nach Bielefeld<br />
die Schuhe geklaut. Diese, weisse Sneakers, tauchen<br />
kurze Zeit später an den Füssen von Holger,<br />
einem Punk, in Berlin wieder auf. Holger, seines<br />
Zeichens etwas exaltiert, mischt eine Gruppe von<br />
jungen Obdachlosen in einem Abbruchhaus neu<br />
auf und gebärdet sich als neuer Leader, wozu<br />
ihm unter anderem der Überfall auf Uwe König<br />
verhilft. Janine hingegen, Primaballerina aus<br />
Darmstadt, heute Tanzlehrerin in Berlin, macht<br />
mit eben diesem Uwe alias Brandbeschleuniger<br />
im Internet Bekanntschaft. Seine baldige Exfrau<br />
Julia hingegen bestellt sich Vincent zu sich nach<br />
Hause. Ekki, der seinen Rauswurf aus dem Gymnasium<br />
bis heute nicht ganz verwunden hat, entführt<br />
Sonia, die kleine Schwester von Swentja,<br />
welche damals das Gerücht von einem sexuellen<br />
Übergriff gestreut hat. Swentja verliebt sich Hals<br />
über Kopf in Muhammad, obwohl eigentlich mit<br />
dem gläubigen Johnny liiert.<br />
Der Reigen, welchen Krausser in seinem Roman<br />
entspinnt, erinnert nicht nur von ungefähr an<br />
Schnitzler und dessen gleichnamiges Werk. Doch<br />
fehlt es ihm, wenn man sich auch der Situationskomik<br />
oftmals nicht zu entziehen vermag, einerseits<br />
an Leichtigkeit, und andererseits an Tiefe.<br />
Die Charaktere geraten zu reinen Abziehbildern,<br />
Anekdote folgt auf Anekdote. Berlin verkommt<br />
hier zum Dorf mit der Dorfkneipe Nachtmar, die<br />
alle früher oder später betreten, in der sie feiern,<br />
sich betrinken, verlieben und demütigen lassen.<br />
Ein etwas zweifelhaftes Lesevergnügen. (sw)<br />
Von Glarus an die Ostsee<br />
Tim Krohn: Ans Meer. Roman.<br />
Unser Schweizer Kultautor schenkte uns<br />
«Quatemberkinder» und «Vrenelis Gärtli».<br />
Nun hat er aber offenbar Grösseres im Sinn. Den<br />
deutschen Markt nämlich gilt es zu erobern.<br />
Nicht ungeschickt und ganz in der Manier<br />
eines waschechten Enthüllungsromans beginnt<br />
er im Jetzt und arbeitet sich dann mittels Rückblenden<br />
zu des Pudels Kern vor.<br />
Wir lernen Anna kennen, eine junge Psychologin,<br />
deren drängender Kinderwunsch dazu<br />
führt, dass sie ihren zeugungsunfähigen Freund<br />
Kalle verlässt, nachdem dessen Geheimnis<br />
durch Dritte enthüllt wird. Sie sehnt sich nach<br />
ihrer einstigen Weggefährtin Josefa zurück,<br />
welche nach dem Tod ihrer Mutter Margot, an<br />
dem Anna nicht unbeteiligt war, das Dorf und<br />
vor allem das Wochenendhäuschen sowie ihr<br />
geliebtes Segelboot an der Ostsee verlassen hat.<br />
Der draufgängerische Vater trinkt sich danach<br />
innerhalb nur weniger Monate zu Tode. Josefa,<br />
inzwischen im Tessin, nimmt die Nachricht offenbar<br />
ohne grosse Gefühlsregung entgegen. Sie<br />
wird bald darauf Mutter von Jens, den sie, nach<br />
einem Ortswechsel nach <strong>Zürich</strong> alleine grosszieht.<br />
Mehr schlecht als recht bringt sie sich und<br />
ihren Jungen durchs Leben, dennoch gehören<br />
die Kapitel, welche sich Josefa und Jens widmen,<br />
zu den stärksten des Buches. Hier erleben<br />
wir Krohn als feinfühligen Beobachter und nicht<br />
als verkappten Psychologen. Denn sein neuer<br />
Roman verkommt allzu oft zu einem psychologischen<br />
Ratgeberbuch mit der Kernbotschaft:<br />
Man muss die Vergangenheit aufarbeiten, wenn<br />
man im Hier und Jetzt leben will.<br />
Josefa nun hat nämlich nie erfahren, dass<br />
ihre Mutter nicht etwa Suizid begangen hat,<br />
nachdem sie ihren Vater mit einer anderen überrascht<br />
hatte, sondern dass sie an einem Aneurysma<br />
gestorben ist, welches nun auch Josefas<br />
Leben bedroht. Ein Seilziehen um Jens beginnt.<br />
Der Enthüllungen sollen noch so einige folgen.<br />
Insgesamt vermag Krohn mit seinem Roman<br />
nicht zu überzeugen, dies mag vor allem daran<br />
liegen, dass er sich allzu oft in Klischees verfängt.<br />
Fazit: Etwas weniger dick aufgetragen,<br />
wäre eindeutig mehr. (sw)<br />
buchhandlung@amkronenplatz.ch<br />
www.buchhandlung-amkronenplatz.ch<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 21
Tanz & Theater<br />
PAPPTHEATER<br />
Theater Zinnober / o.N.<br />
aus Berlin<br />
Von Robert Salzer – Ein freies Theater seit 1979 Bild: zVg.<br />
«Es war einmal ein Mann, der hatte<br />
einen Esel, welcher schon lange Jahre<br />
unverdrossen die Säcke in die Mühle<br />
getragen hatte. Nun aber gingen die<br />
Kräfte des Esels zu Ende, so daß er zur<br />
Arbeit nicht mehr taugte...» So beginnt<br />
die Geschichte der «Bremer Stadtmusikanten»,<br />
wohl einem der bekanntesten<br />
Märchen der Brüder Grimm, das auch<br />
heute noch, fast 200 Jahre nach dessen<br />
Erscheinen, den Zuschauern und<br />
Zuhörern Freude bereitet.<br />
Um die Phantasie von Kindern anzuregen<br />
braucht es oft nicht viel. Eine Leinwand,<br />
Schattenfiguren aus Pappkarton, einige Kerzen<br />
und drei Spieler: So sieht die Anordnung der<br />
Stadtmusikanten in der Version von Uta Schulz,<br />
Günther Lindner und Iduna Hegen, dreien Mitgliedern<br />
des Theater Zinnobers, aus. Mit einfachen<br />
Musikinstrumenten und viel Gesang wird<br />
das Märchen untermalt.<br />
Das Theater Zinnober wurde 1979/1980 von<br />
Puppen- und Schauspielern gegründet. Es war<br />
das erste und lange Zeit einzige freie Theater<br />
der DDR. Dass die Aufführung vor 25 Jahren in<br />
Berlin Premiere hatte, kann ein Kind nicht verstehen.<br />
Muss es auch nicht, denn die Freude an<br />
der Geschichte vom Esel, dem Hund, der Katze<br />
und dem Hahn, die in ihrer Funktion nicht<br />
mehr gebraucht werden und nun Stadtmusikanten<br />
werden wollen, überwiegt. Die «Bremer<br />
Stadtmusikanten» sind eines der ersten Stücke<br />
im deutschsprachigen Raum, in welchem die<br />
Puppenspieler sich nicht mehr hinter Wänden<br />
und im Dunkeln hinter den Figuren verstecken,<br />
sondern offen zeigen. Was heute eigentlich<br />
gang und gäbe ist – der Spieler nimmt als<br />
Erzähler, Spielender oder Figur der Geschichte<br />
selbst eine Rolle auf der Bühne ein - hatte damals<br />
seine Wurzeln. Erst haben das Stück die<br />
eigenen Kinder der Spieler gesehen und nun<br />
sind gar schon die Enkelkinder an der Reihe,<br />
was eigentlich so nicht gedacht gewesen sei.<br />
Im Interview sagt die Gruppe, dass sich in<br />
dieser langen Zeit nicht viel verändert habe.<br />
Die Geschichte sei die gleiche geblieben, die<br />
Figuren immer noch aus der alten DDR-Pappe.<br />
Sie staunen heute wie damals, wie sich die Kinder<br />
im Zeitalter von Elektronik und Fernseher<br />
auf einfache Dinge konzentrieren, auf die reduzierte<br />
Ästhetik des Stücks einlassen können.<br />
Die Spieler seien mittlerweile etwas älter und<br />
faltiger geworden. Wichtig ist den dreien, dass<br />
sie das Stück nicht durchgängig spielen, sondern<br />
selten, damit es auch für sie frisch bleibt.<br />
Ganz bestimmt verändert hat sich die Interpretation<br />
des Stücks. In der DDR-Zeit hatte es<br />
auch eine politische Komponente. Wenn Tiere<br />
sich aufmachen nach Bremen zu gehen - das<br />
kann auch anders verstanden werden. Eine<br />
gewisse Sprengkraft habe das Stück schon<br />
gehabt, aber die DDR-Obrigkeit konnte ein<br />
Kindermärchen nicht gut verbieten. Wenn Uta<br />
Schulz jeweils sagte: «Da machten sich die drei<br />
Landesflüchtigen auf...» habe es im Osten jedes<br />
Mal einen Lacher gegeben. «Landesflüchtige»<br />
war damals ein Reizwort, ist aber auch original<br />
Grimmsche Sprache. Diese politische Komponente<br />
war so von den Künstlern gar nicht intendiert.<br />
Man wollte einfach nur dieses schöne<br />
Stück machen, mit Tieren und Räubern.<br />
Im Abendprogramm der Gruppe war im Zürcher<br />
Theater Stadelhofen das Kunstmärchen<br />
«Zar Saltan» von Puschkin zu sehen. Diesmal<br />
steht Uta Schulz alleine auf der Bühne. Erst<br />
ist sie nur Erzählerin, beginnt die Geschichte<br />
des Zaren Saltan, seiner Gattin und deren Sohn<br />
zu berichten. Plötzlich aber bricht sie aus ins<br />
Spiel, ist mal Zar Saltan, dann dessen Ehefrau,<br />
Sohn Gwidon und dessen Schwanenprinzessin.<br />
Rasch wechselt sie zwischen den Charakteren,<br />
zwischen Kopfbedeckungen, Kostümen,<br />
Stimmfärbungen und singt, spielt, erzählt oder<br />
tanzt, dass es eine wahre Freude ist. Puschkins<br />
Märchen erzählt eine Geschichte über das Erwachsenwerden,<br />
über einen Jungen, der Respekt<br />
von seinem abwesenden Vater erlangen<br />
will, bis er diesen nicht mehr braucht, weil er<br />
seinen eigenen Weg gefunden hat und geht.<br />
Aber auch Magie, Neid und Liebe kommen bei<br />
Puschkin nicht zu kurz. Uta Schulz schafft es<br />
auf eindrückliche Weise, all dies in einer Person<br />
zu bündeln. Mit traumwandlerischer Sicherheit<br />
navigiert sie durch den in Versform<br />
abgefassten Text von 1840 - dabei helfen ihr<br />
Holzorgelpfeifen, die sie mal zu Schiffshörnern<br />
wandelt, mal als Teile der Stadt in Szene setzt.<br />
Von diesen einfachsten Mitteln verzaubert,<br />
lässt man sich bereitwillig in eine andere Welt<br />
entführen, in der es noch Zaren gibt und sprechende<br />
Schwäne...<br />
Das Theater Zinnober zeigt sich an diesem<br />
Nachmittags- und Abendprogramm von zwei<br />
völlig unterschiedlichen Seiten und genau diese<br />
Vielfalt zeichnet die Truppe aus. Die Freude<br />
am Geschichtenerzählen, sei es mit Figurenoder<br />
Sprechtheater, führt dazu, dass die Truppe<br />
auch 30 Jahre nach ihrer Gründung jung<br />
und alt begeistert.<br />
Nächste Spieltermine:<br />
16. bis 20. Dezember: «Die Weihnachtsgans<br />
Auguste» (der Kinderbuchklassiker als farbiges<br />
Schattentheater für Kinder ab 6) und «Marley»<br />
(ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens,<br />
Abendprogramm)<br />
Infos: www.theater-stadelhofen.ch<br />
22
Tanz & Theater<br />
BÜHNE<br />
Weltbürger oder Neandertaler?<br />
Von Alexandra Portmann Foto: Philipp Zinniker<br />
«Die Kunst des zivilisierten Umgangs»<br />
ist das brüchige Schlagwort in Yasmina<br />
Rezas «Der Gott des Gemetzels».<br />
Seit dem 6. November ist das Erfolgsstück<br />
in der Inszenierung von Gabriel<br />
Diaz in den Vidmarhallen des Berner<br />
Stadttheaters zu sehen.<br />
Das Publikum trifft auf eine in ein Terrarium<br />
versetzte Designerwohnlandschaft,<br />
in der verschiedene Repräsentationsgüter der<br />
modernen Wohlstandsgesellschaft angeführt<br />
sind. Die weisse, zum Sofa passende Nespressomaschine<br />
steht auf einem separaten Tisch mit<br />
weissem Service, bereit, die Gäste reichlich mit<br />
Kaffee zu versorgen. Kunstbücher und frisch<br />
aus Holland importierte Tulpen unterstreichen<br />
die zivilisierte Idylle, die von Paolo Contes «Via<br />
con me» begleitet wird. Der sterile Glasboden<br />
unterstreicht die tadellose Ordnung eines Mittelklassenhaushaltes.<br />
Die angestrengt wirkende<br />
Gemütlichkeit wird von Bühnenbildner Beni<br />
Küng offensichtlich durchbrochen. Unter dem<br />
Glasboden befindet sich ein wild mit Pflanzen<br />
überwucherter Erdboden, der mit einzelnen<br />
Versatzstücken der westlichen Zivilisation, beispielsweise<br />
einer Coladose, versehen ist. Die<br />
grüne Pflanzenwand im Hintergrund der Bühne<br />
entpuppt sich während der Vorstellung als<br />
multifunktionale Küche und die Toilette ist mit<br />
Schilf überwachsen. Das Wilde scheint in Diaz’<br />
Inszenierung in die geometrische Ordnung des<br />
Menschen einzubrechen. Das Thema des Stückes<br />
ist expliziert und ein Theaterabend voller<br />
Gegensätze kann beginnen. Mensch gegen Natur,<br />
Nespresso gegen Rum, Weltbürger gegen<br />
Neandertaler.<br />
Ausgangspunkt des Stücks ist das Treffen<br />
zweier Elternpaare, dessen Anlass ein Streit<br />
zwischen ihren Söhnen ist. Der elfjährige Ferdinand<br />
hat seinem Klassenkameraden Bruno<br />
während eines Streits mit einem Bambusstock<br />
einen Schneidezahn ausgeschlagen. Diese<br />
scheinbar absichtliche Aggressivität seitens<br />
Ferdinands wird von Brunos Eltern nicht einfach<br />
hingenommen. Deshalb laden sie Ferdinands<br />
Eltern zum gemeinsamen Erfassen des<br />
Tatprotokolls ein. Es soll ein vernünftiges, fast<br />
freundschaftliches Gespräch über die pädagogischen<br />
Konsequenzen des Vorfalls werden,<br />
doch das Treffen läuft anders als geplant. Mit<br />
den zwei Elternpaaren treffen zwei Lebenskonzepte<br />
aufeinander. Auf der einen Seite stehen<br />
die Eltern des Opfers, Véronique und Michel,<br />
gespielt von Sabine Martin und Ernst C. Sigrist.<br />
Sie sind die Repräsentanten der integren<br />
Kunstliebhaber, versucht, ihren Kindern all das<br />
beizubringen, was die Schule versäumt. Auf<br />
der anderen Seite sind Alain und Annette, die<br />
Eltern des Täters. Heiner Take und Marianne<br />
Hamre zeigen, gestylt und gestresst, die Stereotypen<br />
der erfolgreichen Upperclassgesellschaft.<br />
Alain, Anwalt eines Pharmakonzerns,<br />
stört den Verlauf des Gesprächs durch ständige<br />
Handytelefonate. Sein offensichtlicher<br />
Wunsch, die erzwungene Zusammenkunft so<br />
schnell wie möglich zu beenden, provoziert Michel<br />
und Véronique umso mehr, die Dringlichkeit<br />
des Gesprächs immer wieder aufs Neue<br />
zu betonen. In einer zivilisierten Welt ist das<br />
Gespräch der einzige Weg zur Konfliktlösung.<br />
Ausfallendes Verhalten ist unerwünscht, wird<br />
aber gerade dadurch herbeigerufen. Je länger<br />
sich die vier Personen gemeinsam im Terrarium<br />
aufhalten, desto häufiger werden Verhaltensregeln<br />
gebrochen. Das Gespräch entwickelt sich<br />
von der geschickten Argumentation über die<br />
plakative Schuldzuweisung bis hin zur offenen<br />
Beleidigung. Der Kaffee wird durch Rum aus<br />
Guadeloupe ersetzt und das nervige Handy landet<br />
in der Tulpenvase. Die Paargemeinschaften<br />
werden aufgebrochen, deren Zugehörigkeit<br />
hinterfragt und die Wohnlandschaft verwüstet.<br />
Dabei wird nichts ausgelassen. Der Kreativität<br />
der Zerstörung sind keine Grenzen gesetzt.<br />
Das Chaos bricht in die Ordnung ein.<br />
Rezas Stück parodiert den Kosmos der modernen,<br />
zivilisierten, bürgerlichen Gesellschaft<br />
und untersucht so deren Konfliktpotential. Das<br />
Stück läuft, vom Motor des Textes angetrieben,<br />
wie «geschmiert». Die treffsicheren Pointen<br />
sind platziert und ansprechend. Rhythmus und<br />
Ruhe, Nähe und Distanz sind die Pulsadern des<br />
Stücks. Gabriel Diaz und sein Ensemble zeigen<br />
die Gegensätze und Widersprüche, die bereits<br />
durch das originelle Bühnenbild eingeführt<br />
wurden. Die Situationskomik wird durch Rezas<br />
bissige Dialoge garantiert und in Rekurs<br />
auf unser aller Alltagserfahrung sowie auf die<br />
kleinen Nachbarschaftskämpfe verspricht die<br />
Berner Inszenierung von «Der Gott des Gemetzels»<br />
einen unterhaltsamen Theaterabend.<br />
Weitere Vorstellungen:<br />
05. Dezember: Vidmar1<br />
13. Dezember: Vidmar1<br />
19. Dezember: Vidmar1<br />
27. Dezember: Vidmar1<br />
08. Januar 2010: Vidmar1<br />
09. Januar 2010: Vidmar1<br />
Infos: www.stadttheaterbern.ch<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 23
Tanz & Theater<br />
ROCCHIPEDIA<br />
«Bern ist mein Gotthard»<br />
Von Luca D’Alessandro Bild: Michael Stahl<br />
«RocCHipedia» ist eine Parodie auf die<br />
Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft;<br />
eine Schweiz-Enzyklopädie<br />
aus der Feder des Kabarettisten Massimo<br />
Rocchi. Die Geschichte beginnt mit<br />
den drei Vertretern von Uri, Schwyz und<br />
Unterwalden, die sich auf der Rütliwiese<br />
«zum Brätlä» treffen und aus purer<br />
Geselligkeit – typisch schweizerisch<br />
– einen Verein gründen: die Eidgenossenschaft.<br />
Rocchi durchstreift die Ereignisse<br />
der vergangenen Jahrhunderte<br />
und bringt sie in Verbindung mit dem<br />
heutigen Schweizer Alltag – zu dem<br />
übrigens auch er gehört: Er legt seinen<br />
italienischen Mantel ab und zieht sich<br />
das Schweizer Trikot über.<br />
Massimo Rocchi hat sich mit der Kultur<br />
seiner neuen Heimat befasst wie kaum<br />
ein anderer. Er hat sich in die Bibliotheken<br />
und Archive begeben, Universitätsprofessoren<br />
um Rat gebeten und Museen besucht. Er<br />
ist eingetaucht in die Eigentümlichkeiten der<br />
Eidgenossenschaft, die geschichtlichen Ereignisse<br />
hat er bis ins letzte Detail studiert. Entstanden<br />
ist «RocCHipedia», eine Lektion der<br />
besonderen Art.<br />
In «RocCHipedia» lässt der Komiker keine<br />
Wissenschaft aus: Er nimmt die Konkordanz<br />
auf die Schippe, steckt Calvin und Zwingli in<br />
den Zwinger, analysiert Gesellschaft und Religion,<br />
Sport und Technik, Kunst und Kultur.<br />
Es ist eine Enzyklopädie, die uns in die Täler<br />
der Urschweiz führt, hinauf ins Gotthardmassiv,<br />
dann wieder hinunter nach Mailand,<br />
genauer nach Marignano, wo 1515 eidgenössische<br />
Söldner erfolglos das Herzogtum Mailand<br />
gegen ein übermächtiges französisches Heer<br />
verteidigten. «Seither leiden Schweizerinnen<br />
und Schweizer am Marignano-Komplex», so<br />
Rocchi, «die Geburtsstunde der Neutralitätspolitik.»<br />
Rocchi selbst hat einen Wandel vollzogen.<br />
War er 1994 in seinem Bühnenprogramm<br />
«Äuä» noch der überwältigte Italiener, der seine<br />
ersten Eindrücke vom Grenzübertritt Italien-<br />
Schweiz und die Begegnung mit den Bernern<br />
beschreibt, wandelte er sich in den darauf folgenden<br />
zehn Jahren zum Italo-Schweizer. Dieses<br />
Thema führte er in «Circo Massimo» aus.<br />
«RocCHipedia» vollendet die Trilogie: Rocchi<br />
macht den Schritt und wird Schweizer. «Rocchipedia<br />
war ein grosser Schritt für mich.»<br />
Ist das jetzt dein letzter gewesen?<br />
Ich weiss es nicht. Die Arbeit an «RocCHipedia»<br />
hat meine gegenwärtige Identität eindeutig<br />
definiert.<br />
Deine Identität als Kabarettist oder als<br />
Mensch?<br />
Ein Kabarettist bezieht sich immer auf das<br />
Leben. Er braucht die Fiktion, um sich mit der<br />
Realität zu konfrontieren. In «Äuä» thematisierte<br />
ich den typischen Italiener, in «Roc-<br />
CHipedia» hingegen lebe ich meine Rolle als<br />
Schweizer. Es brauchte Zeit, mich zu diesem<br />
Schritt zu überwinden, ganze sechzehn Jahre.<br />
Was ist deine Botschaft?<br />
Ich will zu meiner Aussage stehen und bekräftigen,<br />
Schweizer zu sein. Ich kann nicht<br />
den Schweizer Pass benutzen und gleichzeitig<br />
so tun, als wäre ich Franzose, Engländer oder<br />
Italiener. Ein Pass ist kein Taschentuch, das<br />
man sich bei Bedarf unter die Nase reibt. Er<br />
symbolisiert eine Identität. Immer bekomme<br />
ich von Italo-Schweizern zu hören: «Wir sind<br />
Italiener» oder «Ich fahre heim nach Italien».<br />
Mit solchen Äusserungen kann ich nichts anfangen.<br />
Ich lebe in der Schweiz, benutze die<br />
Infrastruktur, bezahle Steuern. Kurzum: Ich<br />
interagiere mit meinem Umfeld. Wenn ich also<br />
ins Ausland fahre, bekenne ich mich zu meiner<br />
Identität als Schweizer, zu den Privilegien<br />
und Rechten, die ich hier geniessen darf. Ich<br />
wünschte mir, alle Einwanderer, die heute in<br />
Italien leben, hätten ähnliche Privilegien. Das<br />
ist leider nicht der Fall. Sie dürfen sich am politischen<br />
Geschehen nicht beteiligen. Ich als<br />
24
Auslanditaliener habe quasi mehr Mitspracherecht<br />
als die Einwanderer in Italien. Das finde<br />
ich nicht gerecht.<br />
Wie ist diese Aussage in Zusammenhang<br />
mit «RocCHipedia» zu verstehen?<br />
Ich habe eine Bühnenshow verfasst, die<br />
sich nicht auf ein geografisches Territorium<br />
bezieht, sondern auf eine Kultur, die mich von<br />
Anfang an geschätzt hat. Diese Kultur wird von<br />
Menschen geprägt, die mir zugehört haben, als<br />
es schwer war, mich überhaupt zu verstehen.<br />
Zu ihr bekenne ich mich heute, obwohl es<br />
trendiger wäre zu sagen «I am English», «Je<br />
suis français» oder «Je suis marocain». Wenn<br />
wir sagen, wir seien Schweizer, geben wir<br />
uns bescheiden und erwecken den Eindruck,<br />
Bürger eines Zweitliga-Landes zu sein: Profiteure,<br />
geldbesessen, reich und protzig. Warum<br />
eigentlich? Wir leben in einem wunderbaren<br />
Land, das wir tagtäglich aufs Neue mitgestalten.<br />
In «RocCHipedia» will ich die Leute motivieren,<br />
sich als Teil der Schweiz zu sehen.<br />
Da fällt mir dein Leitspruch ein: «Es isch<br />
eso und fertig.»<br />
Ein Leitmotiv, das am Ende der aktuellen<br />
Show mit dem Satz «Es isch eso und faht ersch<br />
aa» durchbrochen wird. Wir Schweizer müssen<br />
selbstbewusster werden und nach vorne schauen.<br />
Sind es externe Faktoren, die dich dazu<br />
bringen, dich so deutlich zur Schweiz zu bekennen?<br />
Unter anderem auch. Es gibt Menschen in<br />
Italien, die – wenn ich sie sehe – immer wieder<br />
behaupten: «Für euch in der Schweiz ist alles<br />
einfach». Ich bin Schauspieler, ich gehe nicht<br />
um halb zehn in eine Bar, um es mir bei einem<br />
Cornetto und Cappuccino gut gehen zu lassen.<br />
Ich stehe um halb sieben auf und beginne zu<br />
arbeiten. In der Schweiz ist nichts einfach, du<br />
musst etwas leisten. Es ist ein Land mit einer<br />
starken sozialen Kultur und das Denken ist<br />
gemeinhin liberal. Als Einwanderer habe ich<br />
erleben dürfen, wie gut ich in der Schweiz aufgenommen<br />
worden bin.<br />
Trotzdem: Schweiz ist nicht gleich Schweiz.<br />
Am deutlichsten sind die Unterschiede entlang<br />
der Sprachgrenzen erkennbar…<br />
…das ist korrekt…<br />
…und nächstens wirst du im Théâtre Boulimie<br />
in Lausanne auf der Bühne stehen. Wirst<br />
du da dieselben Anekdoten bringen wie in <strong>Zürich</strong>?<br />
Wieso nicht? Ich spreche überall von denselben<br />
Dingen – sowohl in der Westschweiz,<br />
als auch in <strong>Zürich</strong> oder in Bern. Da mache<br />
ich keinen Unterschied. Wenn ich in <strong>Zürich</strong><br />
einen Witz über die Romandie mache, werde<br />
ich diesen auch in Lausanne bringen. Wir<br />
müssen aufhören, allbekannte Klischees unter<br />
den Teppich zu kehren. Es gibt sie ja! Es ist<br />
notwendig, dass darüber geredet wird. Ich setze<br />
mich für den offenen Dialog ein. Ich habe<br />
schwarzafrikanische Freunde, die mir gegenüber<br />
immer wieder betonen «I am black». Ich<br />
antworte jeweils «Schatz, ig bi e Tschingg.» Solange<br />
ich nämlich von mir selbst behaupte, ein<br />
«Tschingg» zu sein, kann mein Gegenüber das<br />
nicht mehr sagen. Ich sage es ja selbst.<br />
Willst du damit einer möglichen Beleidigung<br />
zuvorkommen?<br />
Ich will die Worte befreien – die Angst wegnehmen.<br />
Welche Angst?<br />
In der Schweiz hat man stets das Gefühl,<br />
sich für alles rechtfertigen zu müssen. In<br />
«RocCHipedia» spreche ich vom «Marignano-<br />
Komplex», sprich: sich nirgends einmischen<br />
wollen und es möglichst allen Recht machen.<br />
Wieso diese Bescheidenheit? Die Schweiz war<br />
im neunzehnten Jahrhundert eines der ersten<br />
Länder, das Eisenbahnlinien gebaut hat und<br />
heute über ein vorbildliches ÖV-Netz verfügt.<br />
Wir dürfen zu dem stehen, was wir sind.<br />
Dann würdest du also behaupten, in der<br />
Schweiz funktioniere alles reibungslos?<br />
Nein, nicht alles. Aber es funktioniert – «ça<br />
marche.»<br />
Und in Italien?<br />
Italien ist mir egal. Wenn ein Volk dreimal<br />
denselben Premierminister an die Macht stellt,<br />
liegt das Problem nicht in der gewählten Person,<br />
sondern im Land selbst. Ich mag nicht<br />
über ihn sprechen, denn er interessiert mich<br />
nicht. Ich habe mein Zuhause in Basel gefunden,<br />
wo ich meine eigene Kultur erschaffen<br />
durfte. Alle Italiener, die in der Schweiz leben,<br />
haben sich ihre eigene Kultur geschaffen. Sie<br />
sind Schweizer.<br />
Trotzdem werden sie im Alltag als Italiener<br />
gesehen.<br />
Das mag sein, aber sie verhalten sich wie<br />
Schweizer. Sie stehen um halb sieben Uhr auf,<br />
fahren zur Arbeit, gehen am Abend ins Kino<br />
oder ins Theater.<br />
Dich zieht es schon bald nach Bern. Für Dezember<br />
und Januar sind Auftritte im «Zelt» geplant.<br />
Welche Bedeutung hat Bern für dich?<br />
Ah, Bern! Ich liebe es. Hier hat alles angefangen.<br />
Bern ist mein Gotthard.<br />
Infos: www.massimorocchi.ch<br />
Viele Aufführungen von Massimo Rocchi sind<br />
ausverkauft. Hier hat es noch Tickets:<br />
Donnerstag 17.12 / 20 h<br />
Kursaal, Interlaken<br />
Freitag 15.01 / 20 h<br />
Casino, Frauenfeld<br />
Montag 18.01 & Dienstag 19.01. / 20 h<br />
Das Zelt, Langenthal<br />
Freitag 22.01 / 20 h<br />
Bürenmatte, Suhr<br />
Samstag 23.01 20 h & Sonntag 24.01. / 18 h<br />
Kreuz, Jona-Rapperswil<br />
Freitag 29.01 / 20 h<br />
Das Zelt, Lenk<br />
INSOMNIA<br />
Von Eva Pfirter<br />
DÄHEI<br />
Jeweils ab der dritten Stunde, in der ich<br />
durch <strong>Zürich</strong>s Strassen schlendere, überfällt<br />
mich der unerklärliche Drang, den Zug<br />
Richtung Bern zu besteigen. Ich denke zwar<br />
daran, dass ich noch ins Landesmuseum könnte,<br />
dass ich noch dieses und jenes sollte – aber<br />
ich tue es nicht. Plötzlich überkommt mich<br />
die Sehnsucht nach Bern, nach den Strassen<br />
von Bern, nach der Sonne von Bern, nach dem<br />
Licht von Bern. Warum? Jedes Mal, wenn ich<br />
im Hirschengraben ankomme, frage ich mich<br />
das: Warum? Warum kann ich hier ankommen?<br />
Was macht Bern aus? Was macht dieses<br />
Gefühl von Zuhause, von «dähei» aus?<br />
Das Zuhause ist nicht nur der Ort, wo unser<br />
Bett steht und ein paar gute Freunde wohnen.<br />
Es ist mehr als das. Das richtige Zuhause ist<br />
ein Ort, wo wir uns auch bei den Menschen in<br />
den Strassen zu Hause fühlen. Zumindest bei<br />
den meisten von ihnen.<br />
Von diesem Ort gibt es manchmal mehr als<br />
nur einen, aber doch nur ganz, ganz wenige.<br />
Denn es ist eine geheimnisvolle Mischung, die<br />
das Gefühl von «dähei» ausmacht. Es ist die<br />
Art, wie die Luft in der Abendsonne flimmert,<br />
es ist das Rattern des Trams, das gemächlich<br />
um die Ecke biegt, es ist das Gesicht der<br />
Bäckersfrau, die uns wohlwollend anschaut,<br />
wenn wir ihr am Morgen in Trainerhosen und<br />
ungekämmt begegnen. Es ist die hügelige<br />
Landschaft, in der wir uns geborgen fühlen, es<br />
ist die Art, wie der Mond vom Himmel scheint,<br />
es sind die Fussgänger, die uns nicht hastig<br />
abdrängen von unserem Plätzchen auf dem<br />
Trottoir. Es ist der Geruch der Aare, der in<br />
der Luft hängt, es ist das Lachen der Kinder<br />
in der Quartierstrasse, es ist der Duft des Kaffees<br />
unserer Lieblingsbar.<br />
Es mag pathetisch klingen, aber der Ort,<br />
den wir Zuhause nennen, ist derjenige, an dem<br />
unsere Seele ankommen kann. Milan Kundera<br />
hat so Liebe definiert: Wenn die Seele an die<br />
Oberfläche des Körpers steigt. Ich glaube, bei<br />
dem Ort unseres Herzens ist es genau so: Die<br />
Seele schaut vorsichtig hinter dem Ohrläppchen<br />
hervor, weil es ihr wohl ist, weil sie sich<br />
strecken und recken kann.<br />
Manchmal gibt es zwei dieser Orte auf der<br />
Welt und jedes Mal, wenn man den einen verlässt,<br />
zieht es in der Brust und man hätte Lust,<br />
sich unter einem Rockzipfel zu verstecken<br />
und nicht mehr fortgehen zu müssen. Und<br />
doch gehen wir immer wieder fort und das ist<br />
auch gut so. Denn irgendwo da draussen liegt<br />
vielleicht ein anderes Fleckchen Erde, das uns<br />
ganz unverhofft ankommen und bleiben lässt.<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 25
KONZERTE<br />
IM PROGR<br />
CabaneB<br />
Mühledorfstr. 18<br />
3018 Bern<br />
1. – 24.<br />
Dezember<br />
HKB<br />
Adventskalender<br />
Jazz, Weltmusik, neues Songwriting und Elektronik: bei bee-flat<br />
prägen schweizer ische und internationale Bands ein Live-Programm,<br />
das Innovation und Qualität bietet – jeden Mittwoch und jeden<br />
Sonntag in einem der stimmungsvollsten Lokale in Berns Stadtmitte.<br />
02.12.09 Selah Sue (Belgium) / Aliose (CH)<br />
04.12.09 Electronic Tribal Dancefloor<br />
06.12.09 Hell's Kitchen (CH)<br />
09.12.09 In The Country (Norway)<br />
13.12.09 Dhafer Youssef Quartet (Tunisia)<br />
16.12.09 Emily Loizeau (France)<br />
20.12.09 Hildegaard lernt fliegen (CH)<br />
23.12.09 Feigenwinter 3 (CH)<br />
27.12.09 Erika Stucky – Bubbles & Bangs (CH)<br />
06.01.10 Stefan Aeby Trio (CH)<br />
08.01.10 Electronic Tribal Dancefloor<br />
10.01.10 Rupa & The April Fishes (USA)<br />
13.01.10 Eivind Aarset Sonic Codex 4tet (Norway)<br />
17.01.10 Fatoumata Diawara (Mali)<br />
20.01.10 Anna Aaron (CH)<br />
24.01.10 Gutbucket (USA)<br />
27.01.10 Filewile (CH)<br />
31.01.10 New Generation Orchestra (CH)<br />
dezembern<br />
adventen<br />
plattformen<br />
cabanen<br />
Studierende der HKB adventen in<br />
der CabaneB. An 24 Tagen<br />
öffnen sie deren Pforte für 24 überraschende<br />
Einblicke in Musik,<br />
Medienkunst, Literatur, Bildende<br />
Kunst oder Visuelle Kommunikation.<br />
Dezembern Sie mit und lassen<br />
Sie sich verzaubern.<br />
Details unter:<br />
www.hkb.bfh.ch<br />
www.cabaneb.ch<br />
Konzertort: Turnhalle im PROGR<br />
Speichergasse 4<br />
3011 Bern<br />
Programminfos: www.bee-flat.ch<br />
Vorverkauf/Tickets:<br />
www.starticket.ch<br />
www.petzi.ch<br />
OLMO Ticket,<br />
Zeughausgasse 14, 3011 Bern
Music & Sounds<br />
Music & Sounds<br />
SZENE BERN<br />
15 Jahre Subversiv Records<br />
Ich weiss ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn<br />
Sie sich so richtig in ein Thema reinknien -<br />
bei mir besteht immer die Gefahr, dass mir das<br />
eine oder andere dann auch verleidet. Momentan<br />
geht es mir mit meiner Musik so. Sie ist<br />
mir über, es tönt gerade alles gleich. Soul, Jazz,<br />
Hip-Hop: na ja... Gähhhn. Und weil die Welt irgendwie<br />
doch ganz gut eingerichtet scheint,<br />
komme ich auf Umwegen dazu, einen Artikel<br />
zu schreiben, der sich um ein Label dreht, das<br />
all den Sound vertritt, von dem ich keine Ahnung<br />
habe. Subversiv Records wird fünfzehn<br />
Jahre alt und ich muss - damit ich nicht ganz<br />
unwissend bin - Musik hören, die mir die Zähne<br />
zum Flattern bringt. Es ist ein Riesenspass,<br />
sag ich Ihnen. Ich schlage mir hier lauter Genres<br />
um die Ohren, die ich in keinster Weise<br />
zuordnen kann, mir fehlt jede Referenz, ich<br />
drehe die Anlage auf und lasse mir von Gitarren,<br />
Schlagzeug, Bass und rauen Stimmen das<br />
Testosteron erklären.<br />
Ziel eines jeden Labels, welches mehr als<br />
einen Musikstil vertritt, ist es wohl, die geneigten<br />
Zuhörer ein wenig aufzuknöpfen und einen<br />
Musikgeschmack soweit auszudehnen, dass<br />
mehrere Stilrichtungen darin Platz finden. Im<br />
besten Fall ist ein Label eine Qualitätsgarantie,<br />
welches allen Musikliebenden ermöglicht, im<br />
heutigen Überfluss zu ihrem Stoff zu kommen,<br />
ohne sich gross zu verfransen. Auch wenn Musik<br />
zum festen Bestandteil fast jeden Alltags<br />
gehört, ist es abseits vom Mainstream extrem<br />
schwierig, sich zurechtzufinden. Die Suche<br />
nach guter Musik wird also durch das Label<br />
Von Ruth Kofmel Bild: zVg.<br />
des Vertrauens enorm erleichtert und Subversiv<br />
Records ist ganz offensichtlich eines dieser<br />
Labels, welches sogar Novizinnen innerhalb eines<br />
Nachmittags dazu bringt, mit dem festen<br />
Vorhaben durch die Welt zu gehen, mehr «so<br />
Gitarremusig» zu hören.<br />
Angefangen hat das alles aber natürlich viel<br />
bescheidener: Wie tönen Berge eigentlich?<br />
Massiv. Kein Wunder also, verschreibt sich<br />
eine Horde Teenager, umgeben von hohen Gipfeln,<br />
massiver Musik. Subversiv Records fand<br />
seinen Anfang auf einem Pausenhof im Berner<br />
Oberland, dort war die Tauschbörse für Kassetten<br />
mit Musik der härteren Gangart. Es musste<br />
anders klingen als das übliche Pop-Rock-Gesäusel,<br />
welches einem Teenager in ländlichen<br />
Schweizer Regionen Mitte der Neunzigerjahre<br />
serviert wurde. Am besten war Musik aus Amerika;<br />
wo Grosses auch gross klingt. Rund zehn<br />
Jungs fanden sich also zusammen - aber nur<br />
Musik zu hören und darüber zu lesen reichte<br />
als ernstzunehmende Revolution gegen das Alteingesessene<br />
nicht aus und sie wollten selbst<br />
Hand anlegen. Also fuhren sie nach Bern, kauften<br />
ein paar Instrumente und legten los. So entstanden<br />
zwei Bands: Unhold und Amokadatum,<br />
sie spielten bald die ersten Konzerte, und auf<br />
Kassetten aufgenommen und vervielfältigt wurden<br />
diese ihren Fans zugänglich gemacht; das<br />
Grafiktalent unter ihnen erschuf ein zeitloses<br />
Sujet - Subversiv Records war aus der Wiege<br />
gehoben. Dieser eingeschworene Kreis huldigte<br />
der Musik und weitete sich im Verlauf der<br />
Jahre von den Höhen aus in die Niederungen.<br />
In den Jugendtagen wurde das Fundament gelegt<br />
und man war mit Feuereifer, Improvisation<br />
und durchwachten Nächten mit dabei. Das Anderssein<br />
war Programm, dem Untergrund anzugehören<br />
ist es gewissermassen immer noch.<br />
Die Lebensläufe der Bergbuben entwickelten<br />
sich selbstverständlich in verschiedene Richtungen,<br />
ein harter Kern hat aber die fünfzehn<br />
Jahre überdauert und ist mit ungebrochener<br />
Energie am Werke. Dazu gehören Dani Fischer<br />
und Philipp Thöni, die zwei «Chefs» von Subversiv<br />
Records.<br />
Für viele stellt sich einmal die Frage, wie<br />
es mit den jugendlichen Passionen weiter geht:<br />
Entweder abgeklärt werden oder aber die Idee<br />
verfolgen, das Feuer weiter brennen lassen.<br />
Professioneller versteht sich, organisierter,<br />
vielleicht etwas vernünftiger - aber es ist immer<br />
noch dasselbe Feuer und es schlägt einem im<br />
Gespräch mit Dani auch ungebremst entgegen.<br />
Der Treibstoff ist an diesem Abend Koffein in<br />
seinen verschiedenen Erscheinungsformen, die<br />
Sätze sprudeln und zwischendurch eignet sich<br />
ein Holzstäbchen und ein Glas optimal, um die<br />
Erzählungen nebenbei mit kleinen Rhythmen<br />
zu unterlegen. Dani erzählt davon, wie das Label<br />
kontinuierlich gewachsen ist. Wie er mit<br />
24 Jahren nicht mehr in der Bank, sondern<br />
im Plattenladen arbeiten wollte und das auch<br />
tat. Wie er immer mehr über Musik lernte und<br />
lernte, seinem Gespür für Qualität zu vertrauen.<br />
Wie er sich immer noch die Nächte um die<br />
Ohren schlägt, um Bands zu hören, die vielleicht<br />
auf das Label passen würden. Kurz: Er<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 27
Music & Sounds<br />
erzählt davon, wie er die Musik zu seinem Lebensinhalt<br />
gemacht hat. Wie sein Alltag davon<br />
durchdrungen ist, das Private ins Berufliche<br />
spielt und umgekehrt, er also eigentlich immer<br />
mehr oder weniger am Arbeiten ist - es klingt<br />
anstrengend und sehr, sehr spannend.<br />
Der zweite im Bunde, Philipp Thöni, ist einerseits<br />
als Grafiker eine bestehende Grösse<br />
und widmet sich andererseits mit ebenso viel<br />
Begeisterung der Musik. Bei der Labelarbeit<br />
ist er vor allem für den visuellen Auftritt zuständig,<br />
berät, setzt um und hilft auch sonst<br />
wo er kann. Grafik und Musik sind für ihn eng<br />
verknüpft, genaustes Analysieren der Plattencover<br />
gehörte für ihn von Anfang an dazu und<br />
hat seinen Zeichenstil massgeblich geprägt.<br />
Auch für ihn war es immer Ziel und Wunsch,<br />
die Musik fest in seinem Leben verankert zu<br />
wissen, auch er lebt ein Leben, dass sich nicht<br />
in Arbeit und Freizeit einteilen lässt - es sind<br />
lediglich verschiedene Formen der Umsetzung<br />
von Gedanken und Empfindungen. Philipp<br />
kommt ins Philosophieren, wenn er nach den<br />
Beweggründen für das fünfzehnjährige Bestehen<br />
sucht: Es sei eine Eigenart von ihnen,<br />
dieser Zusammenhalt, das Weitermachen, wohl<br />
auch eine gewisse Sturheit; und es sei auch<br />
nicht immer lustig, aber je länger man dabei<br />
sei, desto mehr fühle man sich irgendwie auch<br />
verpflichtet und zugehörig - ganz ähnlich einer<br />
Familie.<br />
Selbstverständlich muss auch die Familienfeier<br />
zum Fünfzehnten mächtig werden. Mehrere<br />
Nächte lang gibt es in der Stadt Bern einen<br />
regelrechten Subversiv-Marathon, praktisch<br />
alle Bands des Labels werden im Verlauf dieses<br />
Wochenendes ihre Verstärker hochschrauben<br />
und in alles reinhauen, was da an Tasten, Saiten,<br />
Klangkörpern zur Verfügung steht, Stimmorgane<br />
frohgemut in den Ruin treiben und dem<br />
lieben Gott Musik seine Ehre erweisen. Damit<br />
auch der visuelle Hunger gestillt wird, ist ein<br />
abendfüllender Film abgedreht, der die Labelgeschichte<br />
nacherzählt: «Unter Strom» von Jan<br />
Mühlethaler und Matthias Hämmerly ist eine<br />
Collage von altem und neuem Filmmaterial aus<br />
der Subversiv-Welt und dürfte für Neulinge wie<br />
alte Hasen ein wahrer Leckerbissen sein.<br />
JAZZ MUSIK<br />
Das Monster von Loson<br />
Interview: Luca D’Alessandro Bild: zVg.<br />
Der Tessiner Pianist Gabriele Pezzoli<br />
kommt ins Moods nach <strong>Zürich</strong>. Am 22.<br />
Dezember stellt er gemeinsam mit Cédric<br />
Gysler am Bass und Roberto Titocci<br />
am Schlagzeug sein Konzept eines<br />
Rendez-vous vor. Das gleichnamige Album<br />
führt er mit im Gepäck.<br />
Am Lago Maggiore lebt ein Monster – «il<br />
mostro del pianoforte», wie der Jazzpianist<br />
aus Losone, Gabriele Pezzoli, in Tessiner<br />
Jazzkreisen hochachtungsvoll bezeichnet wird.<br />
Nach Abschluss seines Musikstudiums in Lausanne<br />
macht sich der Tessiner gemeinsam mit<br />
dem Kontrabassisten Cédric Gysler und dem<br />
Schlagzeuger Roberto Titocci auf, um schrittweise<br />
die Jazzbühnen im Tessin und Norditalien<br />
zu erobern. Das Unterfangen gelingt. So gut,<br />
dass das Montreux Jazz Label Gefallen an Pezzoli<br />
findet und die Kosten für die Produktion<br />
zweier Tonträger übernimmt. «Rendez-vous»,<br />
das zweite Album, ist seit April 2009 auf dem<br />
Markt und setzt im Bereich des Piano-Jazz<br />
neue Massstäbe.<br />
ensuite - kulturmagazin hat sich das Album<br />
geschnappt und sich über das Coverbild mit<br />
dem kargen Baum und den daran hängenden<br />
roten Pullis gewundert. Gabriele Pezzoli half<br />
mit bei der Deutung des Bildes und gab mit<br />
seinen Argumenten einen Vorgeschmack auf<br />
das bevorstehende Konzert im Moods in <strong>Zürich</strong>.<br />
ensuite - kulturmagazin: Gabriele Pezzoli,<br />
das Feedback auf dein Album ist – durchs Band<br />
weg – positiv. Wie erklärst du dir diesen Erfolg?<br />
Gabriele Pezzoli: Vermutlich hat das mit der<br />
ausserordentlich guten Qualität der Aufnahmen<br />
zu tun.<br />
Du gibst dich bescheiden. Die musikalische<br />
Substanz ist doch auch was Wert.<br />
Natürlich, ich möchte jedoch die Qualität<br />
der Aufnahmen hervorheben. Diese sind im Artesuono<br />
Recording Studio in Udine, Norditalien,<br />
entstanden. Artesuono ist eines der besten<br />
Aufnahmestudios überhaupt in Europa, dessen<br />
Besitzer, Stefano Amerio, sich im Gebiet der<br />
Akustikaufnahmen einen Namen gemacht hat<br />
und genau weiss, worauf es ankommt.<br />
Im Albumbooklet ist ein weiteres Studio erwähnt:<br />
Das Canaa Studio in Losone, deiner Heimatgemeinde.<br />
Gehört das dir?<br />
Nein, Mauro Fiero. Im Canaa haben Roberto<br />
Titocci, Cédric Gysler und ich den Feinschliff<br />
gemacht, also jenes Material, welches wir in<br />
Udine aufgenommen hatten, gestrafft und passend<br />
zusammengefügt. Am Ende ist das entstanden,<br />
was wir uns vorstellten.<br />
Das wäre?<br />
Die Vertonung unseres Konzepts einer Begegnung<br />
– eines Rendez-vous.<br />
In deinem Fall keine einfache Aufgabe: Jedes<br />
Mitglied des Trios lebt in einer anderen Schweizer<br />
Stadt.<br />
Cédric Gysler und Roberto Titocci haben<br />
mit mir in Lausanne Musik studiert. Bereits<br />
während des Studiums arbeiteten wir gemeinsam<br />
in verschiedenen Projekten. Danach trennten<br />
sich zwar unsere Wege, trotzdem ist der<br />
Kontakt geblieben. Wir pflegen einen regen<br />
Austausch, dies mithilfe der modernen Kommunikationsmittel.<br />
Man könnte demzufolge behaupten, dass die<br />
CD «Rendez-vous» die Begegnung unter euch<br />
Musikern versinnbildlicht?<br />
Durchaus. In einem Rendez-vous fliessen<br />
verschiedene Energien zusammen. Zwei oder<br />
mehrere Personen beschliessen, sich zu treffen,<br />
mit der Absicht, Erlebtes und Bevorstehendes<br />
zu diskutieren. Dafür legen sie einen Termin<br />
28
fest. Ob das Rendez-vous am Ende telefonisch,<br />
übers Internet oder an einem definierten Ort<br />
stattfindet, ist sekundär. Einzig der Zeitpunkt<br />
muss harmonieren.<br />
Und vermutlich auch der Inhalt der Diskussion.<br />
Am Anfang nein, am Ende ja. Wenn wir<br />
uns treffen, geht es erst einmal darum, unsere<br />
Ideen und Visionen, seien sie noch so unterschiedlich,<br />
unter einen Hut zu bringen. Das ist<br />
gar nicht so einfach, der Nebeneffekt aber ist<br />
sehr positiv: Die Kreativität geht uns nicht aus,<br />
dadurch sind auch unsere Konzerte nie gleich.<br />
Es gibt kaum etwas, das wir vorhersagen könnten.<br />
Die Improvisation geniessen wir in vollen<br />
Zügen.<br />
Auch eine Improvisation muss nach einem<br />
vordefinierten Schema ablaufen.<br />
Den Pfad, den wir an unseren Konzerten<br />
begehen, geben wir in den ersten drei Tönen<br />
vor. Wir definieren einen Startpunkt und<br />
der Rest ergibt sich von selbst. Wir sind ein<br />
eingespieltes Team, hören uns zu, jeder wagt<br />
einen Schritt nach vorne, dann wieder einen<br />
zurück. Schritt für Schritt entsteht aus dieser<br />
Arbeit eine Geschichte, von der nicht einmal<br />
wir wissen, wie sie enden wird. Die Stimmung<br />
während des Konzerts beeinflusst diesen Weg<br />
wesentlich.<br />
Zuerst kommt also die Stimmung und dann<br />
die Geschichte?<br />
So ist es.<br />
Eure scheint eine abstrakte Geschichte zu<br />
sein. Beim Betrachten des Albumcover fällt ein<br />
Baum ohne Blätter auf. An ihm hängen vier rote<br />
Pullis. Das Ganze macht einen bedrückten Eindruck.<br />
Nein, das finde ich nicht. Ein Baum, der<br />
keine Blätter trägt, kann voller Hoffnung sein.<br />
Die Hoffnung, dass etwas wachsen wird, oder<br />
anders gesagt, dass aus diesem leblosen Zue<br />
stand Leben entsteht. Ehrlich gesagt, weiss ich<br />
auch nicht, weshalb wir uns am Ende für dieses<br />
Coverbild entschlossen haben. Vermutlich deshalb,<br />
weil das Bild während der Produktion des<br />
Albums die hitzigsten Diskussionen entfacht<br />
hat. Oftmals haben wir uns gefragt: «Weshalb<br />
spricht uns dieses Bild so an? Weshalb hängen<br />
an ihm vier Pullis und nicht drei? Wir sind<br />
doch ein Trio.»<br />
Habt ihr eine Antwort auf eure Fragen gefunden?<br />
Für mich steht der vierte Pulli für all die<br />
Leute, die wir auf unserem musikalischen Weg<br />
getroffen haben und in Zukunft treffen werden:<br />
Journalisten, Tour-Manager, Techniker, Publikum.<br />
Wer auch immer: Für mich ist das Cover<br />
das perfekte Symbol eines «Rendez-vous».<br />
Gabriele Pezzoli Trio in concert<br />
22. Dezember: Gabriele Pezzoli Trio.<br />
Moods im Schiffbau, <strong>Zürich</strong>, 20:30h<br />
Diskographie<br />
Rendez-vous, 2009 (TCB)<br />
Improvviso, 2006 (TCB)<br />
Infos: www.tcb.ch<br />
Celtic<br />
tunes<br />
Neujahrskonzert<br />
Sa, 02. Januar 2010<br />
17h00, Kultur-Casino Bern<br />
Andrey Boreyko Dirigent<br />
Máiréad Nesbitt, Celtic Violin<br />
Christian Holenstein, Horn<br />
Michael Reid<br />
Dudelsack<br />
Emilie und<br />
Sophie Rupp<br />
Tap-Dancers<br />
Karl Nesbitt<br />
Flöte, Low Whistle, Bouzouki,<br />
Bodhrán<br />
Werke von:<br />
Mendessohn, Balfe<br />
Gould, McNeely, Downes<br />
Sir Arnold, Sir Davies,<br />
O’Foghl<br />
«Wahlverwandtschaften»<br />
Das Abonnement<br />
Für BSO-Chefdirigent Andrey Boreyko<br />
sind Seele und Mentalität von Mozart,<br />
Tschaikowsky und Strawinsky sehr eng<br />
miteinander verbunden. Ab Januar 2010<br />
geht er diesen Bezügen in drei Konzerten unter<br />
dem Titel «Wahlverwandtschaften» nach.<br />
Folgen Sie dieser musikalischen Entdeckungsreise:<br />
Sie werden die «Wahlverwandtschaften» besonders<br />
eindrücklich erleben, wenn Sie alle<br />
drei Konzerte besuchen – deshalb gibt es sie<br />
auch im Abonnement mit 15% Rabatt<br />
zum Einzelkartenpreis!<br />
Alle Infos unter:<br />
www.bernorchester.ch<br />
Beratung und Verkauf bei:<br />
Bern Billett, T: 031 329 52 52<br />
www.bernbillett.ch<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 29
«...das S<br />
verzaubern<br />
passion<br />
Ingo Becker, Jahrgang 1944, ist im damaligen<br />
Ost-Berlin aufgewachsen, ab 1958 in<br />
West-Berlin, wo er nach vielen beruflichen<br />
Umwegen ab 1966 an der Musikhochschule<br />
Fagott studierte. 1971 erhielt er seine erste<br />
Orchester-Stelle in Biel, von 1974-2009 war<br />
er Solo-Fagottist im Berner Symphonieorchester.<br />
In diesen langen Orchesterjahren<br />
entfaltete er neben seinem musikalischen<br />
Einsatz eine rege Anteilnahme am Geschick<br />
des BSO mit gewerkschaftlich-hoffnungsvollem<br />
Engagement.<br />
Während mehr als 25 Jahren wirkte er an<br />
der Musikschule Konservatorium Bern und<br />
an der Berner Musikhochschule als Lehrer<br />
für Fagott. Als Mitbegründer des Ensembles<br />
«Die Schweizer Bläser-Solisten» hat er zahlreiche<br />
Bearbeitungen für Bläserensembles<br />
verfasst. Seit 1994 leitet er das Jugend-Sinfonieorchester<br />
des Konservatoriums Bern.<br />
Ingo Becker, mit dem Eintritt in das Bieler<br />
Symphonieorchester hast du deine Laufbahn<br />
als Fagottist begonnen. Das war im Jahre 1971.<br />
Ende 2009 verlässt du als alternierender Solo-<br />
Fagottist das Berner Symphonieorchester (BSO).<br />
Das Erreichen des Pensionsalters erlaubt dir einen<br />
Rückblick auf eine beträchtliche Zeitspanne.<br />
Welche Veränderungen des Phänomens Symphonieorchester<br />
ortest du von 1971 bis 2009?<br />
Ingo Becker: Möglicherweise erleben wir einen<br />
Bedeutungsverlust der klassischen Musik,<br />
der Rechtfertigungsdruck fürs BSO war jedenfalls<br />
noch nie so gross wie jetzt, und die Gewissheiten<br />
von damals schwinden (was ja auch<br />
schon unseren Vorgängern auffiel).<br />
Auch bei meinem Start in Bern war das Orchester<br />
keine Insel der Seligen, aber alles war<br />
schön übersichtlich. Heute ist der Musikkonsum<br />
deutlich anders, wir können auf «YouTube»<br />
sehen, wie unterschiedlich weltweit Musik<br />
gemacht wird, und wir stehen vor der Frage,<br />
mit welchen Attraktionen man den Zuhörer<br />
aufhorchen lassen kann.<br />
Deine Ehefrau Elisabeth Becker-Grimm<br />
führt ihre anspruchsvolle Arbeit als Mitglied<br />
des Registers der 1. Violinen im BSO weiter. Du<br />
bist ein Experte für die Anforderungen, die an<br />
einen Solisten eines Symphonieorchesters gestellt<br />
werden. Jedes Orchestermitglied kennt<br />
den Dualismus Solo-Tutti. Wie definierst du ihn<br />
gegenüber einem breiteren Publikum?<br />
Unsere interne Hierarchie ist dem Publikum<br />
ziemlich egal. Wichtig war mir immer die<br />
Anerkennung für die Kollegen im Tutti, die<br />
im Gegensatz zu uns Bläsern alles gemeinsam<br />
spielen müssen, sie müssen eine unglaubliche<br />
Anpassungsleistung an ihre Gruppe zeigen. Dafür<br />
ernten sie aber immer wieder Missachtung<br />
durch die Dirigenten, die hinteren Pulte werden<br />
ja kaum wahrgenommen. Als Solobläser ist<br />
man privilegiert, man darf Impulse setzen und<br />
sich wichtig fühlen, und nach einer exponierten<br />
Stelle gibt es ein freundliches «Bravo!» der<br />
Kollegen und einen dankbaren Blick meiner<br />
Frau. Anders an schlechten Tagen: Da bläst<br />
man so schön ins Instrument und es kommt so<br />
scheusslich raus!<br />
In deinem Register arbeitet Monika Schneider<br />
als gleichberechtigte Partnerin. Wenn man<br />
euch auf dem Konzertpodium zuhört – aber<br />
30 ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09
INGO BECKER<br />
ymphonieorchester als<br />
der Klangkörper, ein Ort<br />
ierter Konzentration»<br />
Interview: Karl Schüpbach Bild: zVg.<br />
auch zusieht – fällt eine grosse Übereinstimmung<br />
auf, wie zuletzt während des Konzertes<br />
für Orchester von Bela Bartok. Welches sind<br />
die Bedingungen für eine solche Harmonie zwischen<br />
zwei Musikern in einer Position, die bestimmt<br />
auch ihre Probleme beinhaltet?<br />
Diese als verschworen erlebten Orchestermomente,<br />
wenn es zwischen zwei Kollegen<br />
kammermusikalisch knistert, sind unbeschreiblich!<br />
Das Sich-Zuspielen, der musikalisch inspirierte<br />
Dialog, der ja in die Partituren hineinkomponiert<br />
wurde – das schafft Euphorie und<br />
Dankbarkeit, umso mehr, wenn die Kollegin<br />
etwas vom Tuten und Blasen versteht. Zuhören<br />
können, aufeinander eingehen, sich anpassen:<br />
Wir Orchestermusiker müssten doch eigentlich<br />
die perfekten Lebens-Partner sein!<br />
Das BSO ist ein Konzertorchester, das einen<br />
Teil seiner Arbeit als Opernorchester im Stadttheater<br />
Bern leistet. Wie hast du diese Doppelbelastung<br />
empfunden?<br />
Das war eher ein doppeltes Glück, in diesen<br />
beiden Welten zu spielen. Schon der Blick hoch<br />
in die 1. Reihe, und das Publikum strahlen oder<br />
heulen sehen! «Figaros Hochzeit», «Salome»,<br />
«Falstaff» sind selbst für uns Kellerkinder im<br />
Orchestergraben ein Fest mit grossen Gefühlen.<br />
Der Wahnsinn auf der Opernbühne, das<br />
herzerweichende Singen (und die verschleppten<br />
Tempi) dringen ja zu uns durch. Regenerierend<br />
sind dann wieder die Ansprüche auf dem<br />
Konzert-Podium: Hier geht es um musikalische<br />
Inhalte, um das Symphonieorchester als verzaubernder<br />
Klangkörper, ein Ort passionierter<br />
Konzentration.<br />
Als Leiter des Jugend-Sinfonieorchesters des<br />
Konservatoriums Bern leistest du Jugendarbeit<br />
und du hast dadurch Einblick in Probleme, die<br />
unsere Jugend beschäftigen. Wie erklärst du<br />
dir die enorme Spannbreite zwischen höchstem<br />
Engagement – wie bei deinen jungen Musikerinnen<br />
und Musikern – und sinnloser, stetig zunehmender<br />
Gewaltbereitschaft der heranwachsenden<br />
Generation?<br />
Diese (männliche!) Generation wächst in<br />
einer gewalttätigen Welt auf, aber es gibt ja<br />
Hoffnung: Viele Projekte, die die Jugend an die<br />
Musik heranführen, zzum Beispiel Menuhins<br />
«MUSE» oder die Sistema-Bewegung in Venezuela<br />
(«Gib mir deine Pistole und ich gebe dir<br />
eine Geige»). Wir müssen allen Eltern und Erziehern<br />
dankbar sein, wenn sie die Kinder instrumental<br />
fördern können. Und ich erlebe junge<br />
Leute, die mit glühenden Ohren richtig ernste,<br />
grosse Kunst machen wollen - Kunst nicht<br />
als Schmerzmittel fürs falsche Leben, sondern<br />
als Schlüssel zur Überhöhung und Grenzerfahrung.<br />
Etwas weniger geschwollen: Sie suchen<br />
die Lust am Zusammenspiel und entwickeln<br />
beträchtlichen Stolz aufs eigene Orchester.<br />
Zurück zum Orchester: Die Struktur des<br />
Orchesters und die Zusammenarbeit mit dem<br />
Stadttheater sind Gegenstand von Diskussionen<br />
auf politischer Ebene, mit vorläufig ungewissem<br />
Ausgang. Wenn ich dich frage, wo das<br />
BSO in zehn Jahren stehen wird, würdest du in<br />
die Haut eines Propheten schlüpfen?<br />
Unser absolut nicht elitäres Publikum sollte<br />
unbedingt verhindern, dass sein Sinfonieorchester<br />
als Opernorchester verkümmert, mit<br />
gelegentlichen Auftritten im Casino - das wäre<br />
die schlimmstmögliche Wendung. Der Verzicht<br />
auf grosse Symphonik – eigentlich ist das un-<br />
Music & Sounds<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
denkbar! Ein Abbau beim BSO hinterlässt Verarmung,<br />
Kultur aber ist ein Lebensmittel! Ich<br />
bin sicher: Je kleiner das Angebot, umso kleiner<br />
das Publikumsinteresse. Es bleiben dann<br />
nur noch massentaugliche Wohlfühlmusik und<br />
Kuschel-Klassik.<br />
Ingo, jeder Mensch, der das Pensionsalter erreicht,<br />
wird von der Frage begleitet: «Was nun?»<br />
Deine Familie, deine Freundinnen und Freunde,<br />
deine Kolleginnen und Kollegen, deine Schülerinnen<br />
und Schüler, dein Publikum stellen sie.<br />
Wir sind gespannt auf deine Antwort und deine<br />
Pläne.<br />
Jetzt kommt erstmal ein selbstkritisches<br />
kurzes Aufräumen der Biografie, kein Durchatmen,<br />
sondern voller Einsatz für das Jugend-<br />
Sinfonieorchester. Dieses Kraftfeld «Orchester»<br />
vibriert für mich immer weiter, ich bin süchtig<br />
nach diesen wabernden symphonischen Entladungen.<br />
Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch<br />
und ich wünsche dir für die Zukunft<br />
alles Gute!<br />
<br />
31
Kino & Film<br />
FILMROSINEN<br />
«A Serious Man» - eine<br />
Hommage ans Jüdischsein<br />
Von Guy Huracek Bild: zVg.<br />
Larry Gropnik lebt ein beschauliches<br />
Leben in einer kleinen jüdischen Gemeinde<br />
im Mittleren Westen der USA.<br />
Er ist ein liebender Ehemann, fürsorglicher<br />
Vater und erfolgreicher Physikprofessor.<br />
Doch plötzlich läuft alles aus<br />
dem Ruder: Seine Frau Judith verlangt<br />
plötzlich die Scheidung, Sohn Danny<br />
schwänzt die Schule, Tochter Sarah<br />
bestiehlt ihn, anonyme Briefschreiber<br />
verbreiten falsche Anschuldigungen<br />
über ihn, und ein Student versucht ihn<br />
zu bestechen. Larry sucht Hilfe und<br />
hofft, diese bei einem Rabbi zu finden,<br />
doch dieser ist zu sehr mit Denken beschäftigt,<br />
um ihm helfen zu können.<br />
Ein fast schon klassischer Hollywood-Plot,<br />
wäre Gropnik nicht konservativer Jude -<br />
die Coens zeigen einmal mehr die komödiantischen<br />
Seiten ihres Glaubens. Ein Film, der ihre<br />
Kindheit wiederspiegelt. Auf ihre Herkunft aus<br />
einer jüdisch-amerikanischen Akademikerfamilie<br />
bezieht sich die Geschichte ihres Films.<br />
Die Coen-Brüder sind in St. Louis Park, einem<br />
Vorort von Minneapolis, in einer jüdischen<br />
Nachbarschaft aufgewachsen. Ihre Eltern, Edward<br />
und Rena Coen, waren Professoren, der<br />
Vater im Bereich Wirtschaft und die Mutter im<br />
Bereich Kunstgeschichte. Joel Coen sparte sich<br />
als Kind durch Rasenmähen genug Geld zusammen,<br />
um sich eine Super-8-Kamera zu kaufen,<br />
und die beiden Brüder drehten zusammen mit<br />
einem Nachbarsjungen Filme aus dem Fernsehen<br />
nach. Den Bezug von «A Serious Man» zu<br />
ihrer Kindheit streiten die Coen-Brüder jedoch<br />
in ihren Interviews ab. Unbeantwortet bleibt<br />
somit die Frage, warum zahlreiche Figuren<br />
nach ihren Jugendfreunden benannt sind.<br />
Ein schräger Heimatfilm, gespickt mit tragischen<br />
und komischen Elementen. Genickschläge<br />
folgen auf Genickschläge. Obwohl das<br />
Drehbuch konsequent einem roten Faden folgt,<br />
geschehen unvorhersehbare Handlungen, die<br />
dem ganzen Film einen absurden Touch verleihen.<br />
Beispielsweise muss er ausgerechnet dem<br />
Rabbi erklären, was ein «Gett», eine kirchlich<br />
sanktionierte Scheidung, ist, die seine Frau<br />
braucht, um wieder heiraten zu dürfen.<br />
Genau wie in «Burn After Reading» spielen<br />
auch diesmal Kino-Unbekannte. Weiter fällt<br />
auf, dass die Frauen bei den Coens die Hosen<br />
anhaben - vor allem jüdische Mütter sind unbesiegbar.<br />
Das macht schon der Jiddisch gehaltene<br />
Vorspann klar, eine kleine Geschichte aus<br />
dem Shtetl, in der eine resolute Ehefrau dem<br />
Dybbuk die Tür weist - nachhaltig und endgültig.<br />
Eine weitere Eigenart der Coens ist das<br />
Pseudonym Roderick Jaynes, dass sie benützen,<br />
wenn sie als Cutter an ihren Filmen arbeiten.<br />
Die Message des Films könnte folgendermassen<br />
zu deuten sein: Lerne deine Probleme<br />
schätzen, denn es kann immer noch schlimmer<br />
kommen. Der Film wirft viele Fragen auf, doch<br />
beantwortet die wenigsten. Es ist wie im wahren<br />
Leben - man hat das Gefühl, es trifft immer<br />
nur einen selber, man weiss nicht, ob alles nur<br />
Zufall ist oder ob man einen Gott beleidigte.<br />
Unter den vielen absurden Charakteren wirkt<br />
Larry fast schon normal, als ob er im falschen<br />
Film sitzt. Der Humor von «A Serious Man» ist<br />
schwierig zu beschreiben. Es ist die Art und<br />
Weise, wie die Charaktere ihre Dialoge sprechen,<br />
weniger der Inhalt. Die Mimik und Gestik<br />
der Figuren bergen einen ausgefeilten, hintergründigen<br />
Humor, der auch in den Dialogen<br />
vorwiegend wegen dem Nichtgesagten funktioniert.<br />
Für eine unheimliche Vorahnung sorgt<br />
die musikalische Untermalung, die, wie bei<br />
einem Horrorfilm, den Zuschauern Angst einflösst.<br />
So baut sich in vielen Szenen Spannung<br />
auf, die sich jedoch nicht in den erwarteten Ereignissen<br />
entlädt, sondern ihre Bedeutung erst<br />
später offenbart - oder eben nicht -; ganz wie<br />
im wahren Leben.<br />
Wer «A Serious Man» sehen will, muss<br />
sich noch ein wenig gedulden. Er kommt am<br />
im 21. Januar 2010 ins Kino. Ein kleiner Vorgeschmack<br />
liefert der Trailer: Geräusche von<br />
Schlägen, Röcheln und die Stimme von Larrys<br />
künftiger Ex-Frau fliessen ineinander und verleihen<br />
dem Trailer eine enorme Spannung.<br />
32
Kino & Film<br />
FILM MAL ANDERS<br />
Vom Film zurück zur Geschichte<br />
Von Florian Imbach<br />
Ein Festival des Filmnacherzählens ist<br />
wahrlich nicht der Publikumsrenner –<br />
könnte man meinen. Doch siehe da, die<br />
Zürcher Szene rennt den Veranstaltern<br />
die Bude ein.<br />
Der Saal ist schon recht voll. Nach und<br />
nach laufen gestylte schöne Menschen<br />
hinein, bis der letzte Platz des grossen Saals<br />
besetzt ist. Die Gessnerallee ist ausverkauft,<br />
einige Unglückliche stehen am Rand. Mit imposanter<br />
Musik wird das Festival eröffnet. Bereits<br />
zum vierten Mal findet es in <strong>Zürich</strong> statt,<br />
daneben jährlich noch in Fribourg und Berlin.<br />
Die Veranstalter Bernd Terstegge und Axel<br />
Ganz machen gleich zu Anfang darauf aufmerksam,<br />
dass sich einige Teilnehmer abgemeldet<br />
hätten. Offensichtlich: Im Programmheft sind<br />
nur die Hälfte der «Sprechplätze» belegt, die<br />
Hälfte des Abends sozusagen «ungeplant». Die<br />
Szene hat den Anlass in Beschlag genommen,<br />
was leidet, ist der Anlass selbst. Sollte sich niemand<br />
spontan zum Nacherzählen melden, droht<br />
das Festival zum Desaster zu werden. Wie soll<br />
das gehen? Meldet sich wohl wer? Soll etwa<br />
ich… Fragt sich der Zuschauer und wird gleich<br />
durchzuckt vom Gefühl des Improvisierten –<br />
ein wahres Festival –, hier entsteht etwas.<br />
Die Spielregeln sind simpel Es gilt, einen<br />
Film nachzuerzählen. Hilfsmittel sind nicht<br />
erlaubt. Man darf alleine oder zu zweit auftreten.<br />
Wie das gemacht wird, darüber gibt es<br />
keine Vorgaben. Das Nacherzählen könne laut<br />
Veranstalter «ein neues Licht auf das Medium<br />
Film und die Erinnerung daran werfen». Unterschiedliche<br />
Vorstellungen, wie das zu realisieren<br />
ist, gibt es, wie die Teilnehmer dieses<br />
Jahres zeigen.<br />
Das Publikum entscheidet. Auf einer Skala<br />
von Null bis Neun dürfen Punkte vergeben<br />
werden, die beste Nacherzählung erhält den<br />
Festivalpreis, die «Silberne Linde». Dieses Jahr<br />
gewann eine Nacherzählung des Filmes «Die<br />
Klavierspielerin» mit Isabelle Huppert. Leider<br />
war die Nacherzählung nicht wirklich nacherzählend.<br />
Die Gewinnerin erzählte eine wahrlich<br />
lustige Geschichte über ein misslungenes Date.<br />
Sie, die Erzählerin, wählte für das Treffen eben<br />
diesen Film aus, was dann zu einigen peinlichen<br />
Szenen im Kino und einem alles in allem<br />
ziemlich absurden Date führte. Ausserdem war<br />
da noch die sexy Mutter der Erzählerin, die anscheinend<br />
gerne einen über den Durst trank.<br />
Mit gut bedienten Klischees und einer interessanten<br />
Erzählweise, immer den roten Faden<br />
haltend, schaffte es die Österreicherin, eine<br />
Mehrheit des Publikums zu überzeugen. Dass<br />
ihre Geschichte nicht viel mit dem Film an sich<br />
zu tun hatte, ging völlig unter. Schade.<br />
Von Star Trek zu Hot Fuzz Einige der Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer mochten aber<br />
wirklich zu überzeugen. Die humoristische Abrechnung<br />
mit Jean-Luc Piccard, Will Riker und<br />
all den anderen aus «Star Trek: Next Generation»<br />
brachte nicht nur den Science-Fiction-liebenden<br />
Verfasser dieses Artikels zum Lachen.<br />
Eine französische Erzählerin kokettierte zwar<br />
mit ihrem Akzent, erzählte aber «Le Diner de<br />
Cons» auf eine solch witzige Art, das man den<br />
Fakt, dass der Text wohl einstudiert war, gerne<br />
übersah. Ja, die witzige Art. Beiträge, die nicht<br />
zum Lachen anregten, hatten es schwer. So<br />
etwa die Erzählung von «Wie im Himmel». Eine<br />
nette Gutenachtgeschichte, aber leider, leider<br />
nicht mehr. Auch Sonja Wenger, die wohl rüberbrachte,<br />
dass «Hot Fuzz» ein witziger Film<br />
ist, aber die Begeisterung nicht übertragen<br />
konnte, ging leider unter. Übrigens ist «Hot<br />
Fuzz» ein Film, den ich auch sehr empfehlen<br />
kann (GB, 2007). Eine nette Idee, wenn auch<br />
keine neue, setzte der Erzähler von «Star Wars<br />
IV» um. Er dachte darüber nach, wie wohl der<br />
Film mit Schweizerdeutschen Dialekten herausgekommen<br />
wäre. «Dr Todesstärn» wirkt<br />
eben wirklich witzig – dem Publikum gefiels.<br />
Ganz und gar nicht passte die blonde Schönheit,<br />
die derart offensichtlich mit ihren weiblichen<br />
Vorzügen spielte und auf Dummerchen<br />
machte, dass selbst gut umgesetzte Elemente<br />
ihrer Aschenbrödelerzählung billig wirkten.<br />
Eine nette Nebennote schrieb ein Deutscher,<br />
der sich ausgerechnet den Film «Dutti,<br />
der Riese» aussuchte und in einer sehr überzeugenden<br />
Darbietung witzige Details erzählte,<br />
die manchen hart gesottenen Zürcher überraschten.<br />
Das Festival ist gerettet In der Mitte der<br />
Veranstaltung fühlte das Publikum die erwähnte<br />
Improvisation. Eben das, dass jetzt etwas<br />
gerade im Moment entsteht, das nicht reproduzierbar<br />
ist. Eine Nacherzählung ist eben etwas<br />
Einmaliges und im Idealfall nicht wiederholbar.<br />
«Wir machen das Festival so lange, bis<br />
niemand mehr auftritt», erklärt Bernd Terstegge<br />
vor vollem Saal. Und dies könnte heute der<br />
Fall sein, fügt er an. Nach einigen peinlichen<br />
Augenblicken und Momenten bangen Wartens<br />
melden sich dann doch tatsächlich spontan Erzählerinnen<br />
und Erzähler, was zu lang anhaltendem<br />
Applaus führt. Die Spontanmeldungen<br />
führen zu einer Kettenreaktion, das Programm<br />
ist gefüllt, das Festival aufs Neue gerettet. Der<br />
Szene sei Dank. Oder doch eher der Szene zum<br />
Trotz?<br />
Besuchte Veranstaltung:<br />
Internationales Festival des<br />
nacherzählten Films<br />
7. November in der Gessnerallee<br />
Infos: www.total-recall.org<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 33
DIE ANDERE<br />
DVD-EDITION<br />
Filmische Perlen<br />
aus Süd und Ost<br />
Faszinierendes<br />
Indochina<br />
Nach dem Roman<br />
von Marguerite<br />
Duras<br />
Pulsierendes<br />
Musikdokument<br />
James Brown,<br />
Miriam Makeba,<br />
B.B. King und<br />
viele mehr<br />
Roadmovie<br />
durch die<br />
Anden<br />
Der Publikumsliebling<br />
aus<br />
Ecuador<br />
Dostojewskis<br />
Idiot<br />
Von Akira Kurosawa<br />
in Japans Winter<br />
getragen<br />
Und ein Blick ins 2010 verrät<br />
Auf keinen Fall verpassen:<br />
Die skurrile Komödie aus Mexiko<br />
ab 7. Januar in den Kinos<br />
www.trigon-film.org<br />
Tel. +41 56 430 12 30<br />
Kino & Film<br />
Weihnachtskino<br />
Von Lukas Vogelsang<br />
FÜRSORGER<br />
Hanspeter Streit war in den 70ern ein kleiner<br />
«Madoff» und schaffte es als «Millionenbetrüger»<br />
in die Schweizer Presse. Im Film heisst<br />
Streit Stalder und ist Fürsorger und stolpert im<br />
Leben. Er erfindet eine Strategie zum Glück, ein<br />
Geheimcode, und lockt damit die Anleger und Finanzheinis<br />
und auch die Frauen. Saus und Braus<br />
– so die Idee – endet nach dreizehn Jahren durch<br />
einen plumpen Fehler. Es waren schlussendlich<br />
nicht die selbstgemalten Aktien, die ihn zu Fall<br />
brachten, sondern fehlende Identitätspapiere.<br />
Doch im Film fängt das Ganze erst an: Zeit, die<br />
Geschichte nochmals aufzurollen.<br />
Mit Roeland Wiesnekker in der Hauptrolle ist<br />
dem Film mit der aktuellen und wirren Geschichte<br />
eine wunderbare Schweizerkomödie gelungen.<br />
Man versteht, dass ein Betrüger eben nur ein<br />
Teil, ein Mechanismus im Getriebe ist. Geld, Gier,<br />
Frauen und Blindheit haben schon immer die<br />
Welt regiert. Doch immerhin haben wir hier einen<br />
Betrüger, der «andere glücklich machen wollte».<br />
Madoff lässt grüssen.<br />
Es ist fast schade, dass der Film mehrheitlich<br />
Schweizerdeutsch gesprochen ist. Es wäre<br />
ein wunderbar selbstkritischer Film für unsere<br />
Nachbarländer geworden. Auf jeden Fall ein lustiger<br />
Schweizer Film mit einem wunderbaren Geschichtenerzähler.<br />
BREATH MADE<br />
VISIBLE<br />
Anna Halprin ist eine Tanzpionierin aus den<br />
USA. Schon früh stellte die sich die Frage:<br />
«Was ist Tanz?» Ihre Suche nach einer Antwort<br />
dauerte über achtzig Jahre und hinterliess tiefe<br />
Spuren in der Tanzgeschichte. Sie experimentierte<br />
mit den verschiedensten Kunstformen und beeinflusste<br />
viele KünstlerInnen über Generationen<br />
hinweg.<br />
«Before I had cancer I lived my life for my art,<br />
after I had cancer I lived my art for my life.» Anna<br />
Halprin erkrankte mit fünfzig Jahren an Krebs.<br />
Sie selber meinte danach, sie habe sich den Weg<br />
zur Heilung freigetanzt. Nach der Krankheit war<br />
sie nicht mehr auf der Bühne anzutreffen, sie gab<br />
Tanzkurse für Krebs- und Aidskranke und arbeitete<br />
später mit älteren Menschen zusammen. Doch<br />
dann wurde ihr Mann, der Landschaftsarchitekt<br />
Lawrence Halprin, schwer krank. Anna Halprin,<br />
durch die vielen Spitalaufenthalte inspiriert, ist<br />
wieder auf die Bühne zurückgekommen: 2004,<br />
mit achtzig Jahren, steht sie mit «Intensive Care»<br />
mit grossem Erfolg wieder auf den Brettern, beginnt<br />
zu touren und ruft ins Publikum: «Es sind<br />
noch so viele Tänze zu machen!»<br />
«Breath Made Visible» ist ein unheimlich faszinierendes<br />
Porträt über eine noch viel beeindruckendere<br />
Frau. Sie verkörpert das Alter in einer<br />
neuen Dimension und zeigt uns, als selber wahrhaftig<br />
physisch gewordener Tanz, wie mit inniger<br />
Intensität in einer Bewegung Leben entsteht.<br />
Wer diese Frau im Film sieht, beginnt selber die<br />
Bewegungen zu fühlen. Anna Halprin stellt uns<br />
die Frage, was Tanz ist und bewegt uns, damit<br />
wir die Antwort selber finden können. Noch selten<br />
wurde Tanz so wunderbar verständlich und<br />
einfühlsam vermittelt. Ein grosses Lob an den<br />
Schweizer Regisseur Ruedi Gerber: «Danach<br />
folgte ein 15-minütiges Solo, in dem sie ihre Lebensgeschichte<br />
tanzte und erzählte. Im Laufe des<br />
Stücks bemerkte ich, dass manchen Zuschauern<br />
die Tränen kamen. Und plötzlich fühlte auch ich<br />
mich tief von dieser Frau berührt. In einer Welt<br />
von Posen und konkurrierenden Stilisierungen<br />
war die Präsenz von jemandem, den ich als ganz<br />
und gar authentisch empfand und dessen Botschaft<br />
universell war, eine erholsame Befreiung.»<br />
Berner Kunstmuseum Datum: 05.01 / 10 h<br />
AMERRIKA<br />
Den Kritikerpreis in Cannes (2009) muss<br />
man sich erst verdienen. Doch mit Charme<br />
und der richtigen Filmidee ist das zu schaffen:<br />
«Amerrika». Dazu nimmt man ein hochaktuelles<br />
Thema, wie zum Beispiel Palästina, und setzt dem<br />
gegenüber die fast surreal anmutenden USA oder<br />
eben Amerrika. Der grosse Traum und die Illusion<br />
- was dann auch gleich die einzigen Gemeinsamkeiten<br />
dieser Länder sind. Es spielt keine Rolle,<br />
in welcher Ecke dieses Planeten wir illusorisch<br />
Leben wollen und oft vergessen wir, dass Träume<br />
die einzige Funktion haben, Träume zu bleiben –<br />
alles andere würde man einen Plan nennen.<br />
«Amerrika» bleibt den Zuschauern tief unter<br />
der Haut sitzen. Da sind zum einen die eindrücklichen<br />
Realitäten beider Länder, zum anderen die<br />
Kulturunterschiede, die so weit nicht auseinander<br />
liegen – und doch grundverschieden sind. «Amerrika<br />
ist besser, als gefangen im eigenen Land»,<br />
meint der sechzehnjährige Fadi zu seiner Mutter<br />
Muna noch vor der Abreise. Wir begleiten die beiden<br />
zu ihren Verwandten in Illinois. Viele Scherben<br />
bringen anscheinend Glück, aber es müssen<br />
erst noch mehr werden.<br />
Sehr schön ist im Film die Darstellung der<br />
Palästinenser als «normale» und «moderne» Menschen<br />
(was sie eigentlich immer waren). Es sind<br />
keine Aliens, die keine Ahnung von der Welt haben.<br />
So zeigt «Amerrika» einen sehr wertvollen<br />
Teil der arabischen Kultur groteskerweise durch<br />
den Vergleich mit den USA. Fantastisches Kino<br />
mit feinem Humor.<br />
34
Sieht so ein<br />
Lügner aus?<br />
JETZT IM KINO<br />
Roeland WIESNEKKER ist<br />
DERFÜRSORGER<br />
in einem Film von Lutz KONERMANN<br />
Ab 10. Dezember im Kino<br />
Johanna<br />
BANTZER<br />
Katharina<br />
WACKERNAGEL<br />
Claude<br />
DE DEMO<br />
Andrea<br />
GUYER<br />
Leonardo<br />
NIGRO<br />
www.fuersorger.ch<br />
Thierry<br />
VAN WERVEKE<br />
Michael<br />
NEUENSCHWANDER<br />
A film by Cherien Dabis<br />
<br />
AB 23. DEZEMBER IM KINO<br />
MÜNSTERGASSE 47 3011 BERN TEL/FAX 031 312 14 01<br />
Ein Film von Fatih Akin<br />
ADAM BOUSDOUKOS MORITZ BLEIBTREU BIROL ÜNEL
TRATSCHUNDLABER<br />
36<br />
Von Sonja Wenger<br />
In einer Zürcher Bar wird ein Barhocker gestohlen,<br />
und die Redaktion von «20Minuten»<br />
findet Platz für einen Aufruf. Da hat ein Leser<br />
«trotz Grippe Lust auf Selbstbefriedigung» und<br />
holt sich Rat bei Doktorsex. Und ein Musikvideo<br />
von Rihanna ist «schwere Kost» – nicht etwa das<br />
lächerliche Resultat des Welthungergipfels in<br />
Rom.<br />
Es ist eine perverse Welt, alleine durch die<br />
Tatsache, dass es das Wort Welthunger überhaupt<br />
gibt; dass statt Grippeviren offenbar Hirnzellen<br />
absterben; dass der Autokannibalismus<br />
der Gratismedien dazu geführt hat, auch noch die<br />
letzte Banalität als Information zu tarnen - und<br />
alle damit ungestraft davon kommen.<br />
Um in den Medien zu arbeten, braucht es keinen<br />
Ehrgeiz mehr, gute Fragen stellen zu wollen.<br />
Beten allein genügt: Denn lasset uns lobpreisen<br />
all jene, die ohne Inhalt und mit schöner Verpackung<br />
die Welt, die veröffentlichte Meinung, unser<br />
Sinnen und Streben beherrschen. «Gegrüsset<br />
seist du, Hohepriesterin Paris, voll von Nichts.<br />
Die Presse ist mit dir. Gelobt sei dein Stil und verehrt<br />
dein Geschäftssinn. Mutter aller Tussis, zeig<br />
uns wie es geht, jetzt und in der Stunde unseres<br />
Begreifens. Gib uns unser tägliches Bild», ach ne<br />
- das ist ja wieder was anderes. Aber immerhin:<br />
Das Tussitum lebt, das schrieb gar die NZZ.<br />
Keine Wunder aber auch, sei doch alles in<br />
unserer Gesellschaft in Watte gepackt. Das sagte<br />
kürzlich eine Freundin aus Südmexiko, wo die<br />
Leute andere Probleme haben als mit perversen<br />
Prophetinnen. Unser Denken, unser Handeln, unsere<br />
Prioritäten, nichts ist noch gefährlich: Kanten<br />
abgedeckt, Ecken geschliffen, Fragen erstickt<br />
und die Erkenntnis verzögert. Und statt uns zusammenzutun<br />
gegen die pervers Reichen und<br />
ihren Kampf gegen den Rest der Welt, gieren<br />
wir brav gesteuert nach einem perversen Konsum,<br />
den man nicht einmal mehr verdauen muss.<br />
Lieber glauben wir auch nach der hundertsten<br />
perversen Lüge weiter unseren politischen, wirtschaftlichen<br />
und religiösen VertreterInnen, weil<br />
Angst doch so viel leichter fällt als verstehen. Selber<br />
denken: Pfui!<br />
«Erklär mir die Welt», der Wunsch aller Kinder,<br />
war nämlich noch nie so schwer zu erfüllen<br />
wie heute. Der verantwortungsvolle Umgang mit<br />
dem hochexplosiven Gut Information ist perversen<br />
Verlockungen ausgesetzt. Kein Ritter in<br />
scheinender Rüstung verteidigt noch ein aufgeklärtes<br />
Volk oder die Integrität der Medien. Unsere<br />
Helden sind Blutsauger, egal ob im Kino oder<br />
im realen Leben. «Yes, we can» hatte wie wenig<br />
zuvor den Nerv der Zeit getroffen. Der Leitspruch<br />
ist Ausdruck des kollektiven Wunsches nach Veränderung,<br />
aber bitte ohne Konsequenzen. Denn<br />
«wir» heisst nicht «ich», und anfangen sollen immer<br />
die anderen: ein perverser Teufelskreis.<br />
Kino & Film<br />
LAW ABIDING<br />
CITIZEN Bild: zVg.<br />
Ein gesetzestreuer Bürger vertraut auf das<br />
Recht und darauf, dass es ihm Gerechtigkeit<br />
bringt – so die Idee eines Justizsystems,<br />
so unser Wunsch. Doch dass die Gerechtigkeit<br />
auf einer Etage wohnt, zu der die Justiz keinen<br />
Zutritt hat, schrieb schon Friedrich Dürrenmatt.<br />
Und auch der Ingenieur Clyde Shelton<br />
(Gerard Butler) muss schmerzhaft erfahren,<br />
dass Wunsch und Realität nicht immer Hand<br />
in Hand gehen.<br />
Gleich in der ersten Szene von «Law abiding<br />
Citizen» muss Shelton mitansehen, wie seine<br />
Frau und seine Tochter bei einem Raubüberfall<br />
ermordet werden. Schwer verletzt überlebt er.<br />
Die Täter sind schnell gefasst. Mit ihm als Augenzeuge<br />
sollte eine Verurteilung kein Problem<br />
sein.<br />
Wenn da nur der Staatsanwalt Nick Rice (Jamie<br />
Foxx) etwas mehr Lust auf einen Prozess<br />
gehabt hätte. Stattdessen macht Rice einen<br />
dürftig begründeten Deal mit einem der Mörder.<br />
Der um Gerechtigkeit geprellte Shelton ist<br />
im Büro des Staatsanwalts den Tränen nahe.<br />
Vor dem Gericht sieht er, wie Rice dem freigelassenen<br />
Killer die Hand schüttelt.<br />
Zehn Jahre später kehrt er zurück und will -<br />
man ahnt es - Rache für seine Familie. Shelton<br />
ist, wie sich herausstellt, dafür auch noch gut<br />
gerüstet. Er sei ein Meisterplaner für superspezielle<br />
Morde im Auftrag des CIA, flüstert ein<br />
Informant. Rice und seinem Team dämmert es<br />
bald, dass Shelton über eine geballte Ladung<br />
krimineller Energie, eine sarkastische Ader und<br />
ziemlich viel Sadismus verfügt.<br />
Den Frauen- und Kindesmörder schneidet<br />
er in kleine Stücke und auch sonst bringt Shelton<br />
noch jede Menge Leute um, damit Rice endlich<br />
kapiert, dass Deals mit bösen Buben eine<br />
schlechte Sache sind. Es geht also nicht nur um<br />
Gerechtigkeit, sondern auch um Moral, oder<br />
so etwas Ähnliches. Denn ganz klar wird im<br />
Film nie, was Shelton mit seinen Brachialmethoden<br />
denn nun beweisen oder verändern will.<br />
Aus Opfer wird Täter, und dieser Täter macht<br />
wieder neue Opfer. Aber egal. In «Law abiding<br />
Citizen» streiten sich zwei Alphatierchen unter<br />
der Regie von F. Gary Gray um Leinwandpräsenz.<br />
Das bietet kurzweilige Unterhaltung ohne<br />
Nachhaltigkeit, Ablenkung ohne Tiefgang, Drama<br />
ohne Gehalt. Ideal für unsere Zeit. (sjw)<br />
Der Film dauert 109 Minuten und kommt am<br />
10. Dezember ins Kino.<br />
NEW MOON<br />
– BIS(S) ZUR<br />
MITTAGSSTUNDE<br />
Zugegeben, es ist hart, ein Teenager zu sein.<br />
Die Suche nach dem Selbstbewusstsein,<br />
der Liebe und dem Sinn des Lebens. Romeo<br />
und Julia sind daran dramatisch gescheitert.<br />
Und selbst wenn man bis zum Erwachsensein<br />
durchhält, bleiben jede Menge Probleme. Besonders,<br />
wenn die grosse Liebe ein Vampir ist,<br />
der auch noch als Klonvorlage für Adonis herhalten<br />
könnte.<br />
Das kann ja nicht gut gehen, denkt man sich<br />
und weiss gleichzeitig, dass es einfach länger<br />
dauert, bis das Paar zueinander finden wird.<br />
Denn «New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde»<br />
ist schliesslich ein Hollywoodfilm, ein modernes<br />
Märchen, eine mystische Liebesgeschichte<br />
- und eine Geldmaschine. «New Moon» ist<br />
der zweite Teil der vierteiligen Bis(s)-Serie der<br />
US-Autorin Stephenia Meyer. Filme wie Bücher<br />
erfreuen sich einer riesigen Fangemeinde, die<br />
es nach Romantik und bedingungsloser Liebe<br />
dürstet. Eine Liebe, die alle Hürden überwindet,<br />
die den Raum relativiert und über die Zeit<br />
hinausreicht.<br />
Oh ja, man kann Bella Swan (Kristen Steward)<br />
verstehen, dass sie ihr Herz an den schönen<br />
Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson)<br />
verloren hat. Der erste Film, «Twilight», handelte<br />
im Wesentlichen vom Finden dieser Liebe.<br />
Nur ein Jahr später erfahren wir in «New<br />
Moon» bereits, wie es weitergeht. Aber ach,<br />
diesmal dauert es länger, ist alles langsamer,<br />
passiert so gut wie nichts. Dies, obwohl genug<br />
zwischenmenschlicher Zündstoff und Potenzial<br />
für rasante Action vorhanden wäre.<br />
Denn Bella und Edward haben sich inzwischen<br />
mit Jacob Black (Taylor Lautner) zu einem<br />
Trio ergänzt. Beide Jungs lieben Bella,<br />
aber beide können nicht mit ihr zusammen sein,<br />
ohne sie zu verletzen. So was tut weh. Edward<br />
trennt sich gar von seiner Liebsten, damit sie<br />
ein «normales, glückliches Leben führen kann».<br />
Verständlich, dass Bella wenig Begeisterung<br />
dafür zeigt.<br />
Bis das Publikum dann das zweite Viertels-<br />
Happyend vorgeführt bekommt, tauchen noch<br />
ein paar gute, böse und halbböse Vampire auf,<br />
sowie neu auch Werwölfe. Und natürlich wird<br />
wieder selten schön gelitten und gegrübelt. Er<br />
liebt mich, er liebt mich nicht. Nur eines geht<br />
bei all dem Herzschmerz vergessen: Die Spannung,<br />
das Knistern und das Fleisch am Knochen<br />
der Filmgeschichte, damit man mit den<br />
Charakteren mitfühlen mag. Im Gegensatz zu<br />
«Twilight», der das ganz gut hingekriegt hat, ist<br />
«New Moon» nur eine teure Schlafpille. (sjw)<br />
Der Film dauert 131 Minuten und ist bereits<br />
in den Kinos.
Kino & Film<br />
GROSSES KINO<br />
Gutes Genrekino? Im TV!<br />
Von Morgane A. Ghilardi – Wie und wo Science-Fiction und Horror im Serienformat<br />
besser umgesetzt werden. Bild: Die Schlafpille im Kino: The Twilight Saga - New Moon<br />
Science-Fiction, Fantasy und Horror<br />
– drei Genres, die auf Grossleinwand<br />
nicht immer gut umgesetzt werden.<br />
Im Jahr 2009 sind drei von sechs grossen<br />
SciFi-Filmen Fortsetzungen von Franchises,<br />
der Serienform des Kinos: «Transformers<br />
2», «Terminator: Salvation» und «Star Trek».<br />
Keiner der drei wurde von Kritikern besonders<br />
geschätzt. Aber wenn wir ehrlich sind, können<br />
wir seit langem nicht mehr mit grossen Erwartungen<br />
solche Blockbuster sehen gehen. Wir<br />
lassen uns begeistern von den überwältigenden<br />
Möglichkeiten des CGI und erfreuen uns<br />
an den smarten Sprüchen, die der Held ab und<br />
zu klopfen darf. Doch manchmal schützen uns<br />
auch die niedrigen Erwartungen und genialen<br />
Effekte nicht vor grottenschlechten Plots. Die<br />
Plotentwicklungen in «Star Trek» waren unerträglich<br />
schmerzhaft – Hommage an das Original<br />
hin oder her. Wo Potential für cooles Actionkino<br />
der anderen Art besteht, macht sich<br />
Hollywood daran, alles auf das intellektuelle<br />
Niveau eines Zwölfjährigen zu bringen. Die Devise<br />
ist leichte, hirnlose Unterhaltung und ein<br />
Vermarktungskonzept, das den Verkauf vieler<br />
Spielzeuge erlaubt. Gute Schauspieler und Ressourcen<br />
werden verschwendet.<br />
Aber vielleicht sind es eben die grossen Ressourcen,<br />
die gutem Genrekino im Weg stehen.<br />
Das Format, welches überzeugend SciFi, Fantasy<br />
und Horror umsetzt, ist die Fernsehserie. Natürlich<br />
erlaubt dieses Format, komplexere Plots<br />
und Charaktere zu entwickeln, aber auch dies<br />
hängt von der Qualität der Drehbücher und der<br />
Originalität der Ideen ab.<br />
In den letzten 15 Jahren waren es Serien wie<br />
«Babylon 5», «Stargate», «Farscape», «X-Files»,<br />
«Battlestar Galactica» und «Doctor Who»,<br />
welche im Bereich SciFi-Serien den Standard<br />
für Qualität und Originalität gesetzt haben.<br />
«Babylon 5» aus den 90ern war eine sehr gut<br />
geschriebene Serie, die einen mit komplexen<br />
Plotentwicklungen mitriss und unter Fans Kultstatus<br />
geniesst. Die in der fernen Zukunft angesiedelte<br />
Story handelt von Rassenkonflikten<br />
und intergalaktischer Politik. «Battlestar Galactica»<br />
ist das Remake einer trashigen Serie<br />
aus den 70ern. Von der komplexen Thematik<br />
zur Kameraführung und Musik beeindruckt<br />
die Serie auf der ganzen Linie. Und zuletzt ist<br />
natürlich «Doctor Who» zu erwähnen, welche<br />
ursprünglich erstmals in den 60ern von BBC<br />
ausgestrahlt wurde. Die Geschichte um den<br />
wandelbaren und unsterblichen Zeitreisenden<br />
wurde im Jahr 2005 neu aufgenommen und mit<br />
einer genialen Crew umgesetzt. Das Resultat<br />
sind (bis jetzt) vier Staffeln einer originellen,<br />
menschlichen und tragisch-komischen Serie, die<br />
einen mit jeder Episode aus den Socken haut.<br />
Es ist der Traum eines jeden SciFi-Liebhabers,<br />
dass sich die Drehbuchautoren und Produzenten<br />
all dieser Serien (ausser J. J. Abrahms – der<br />
soll beim TV bleiben, bitte) ab und zu dem Kino<br />
widmen und ein geniessbares SciFi-Spektakel<br />
auf Grossleinwand herstellen, welches man<br />
auch schätzen kann.<br />
Horror und Fantasy, zwei Genre, die sich<br />
gegenseitig oft einschliessen, haben in letzter<br />
Zeit wieder mehr an Prestige gewonnen. Sie<br />
sind nicht mehr ausschliesslich für Legolas-<br />
Anbeter und Splatterfans. Mit «Twilight» hat<br />
sich das Horror-Genre den Bedürfnissen der<br />
(weiblichen) Teenies angepasst. Der Vampir<br />
bewegte sich schon immer auf dem schmalen<br />
Grad zwischen Horror und Fantasy. Er ist in<br />
unseren Köpfen eher eine mythisch-magische<br />
Kreatur mit Sexappeal geworden als zu einem<br />
blutrünstigen Monster. Denn wenn Vampire in<br />
der Sonne glitzern, anstatt in Flammen aufzugehen,<br />
ist der Horror-Aspekt definitiv nicht mehr<br />
so prominent. Die Romantik hat die Überhand<br />
gewonnen, und das ist keinesfalls zu beklagen,<br />
vor allem nicht, wenn Werwölfe und andere<br />
scharfe Beisserchen dazukommen.<br />
Aber auch in diesem Bereich sind die TV-<br />
Versionen mit mehr Pep realisiert. Die Kultserie<br />
«Buffy – The Vampire Slayer» hat das von Anne<br />
Rice stark romantisierte Genre für Teenies brillant<br />
umgesetzt. Pubertät, Schulstress, Dämonen,<br />
Zombies – nichts wird ausgelassen. Das gute<br />
Setting, die intelligenten und zackigen Dialoge,<br />
sowie viel Humor und Tragik garantieren gute<br />
Unterhaltung. Den Buffy-Macher Joss Whedon<br />
hat es übrigens auch in die Welt des SciFi verschlagen.<br />
Seine Serie «Firefly» besteht leider<br />
nur aus 14 Episoden, wurde dann aber mit dem<br />
Kinofilm «Serenity» abgeschlossen.<br />
«True Blood» von «Six-Feet-Under»-Macher<br />
Alan Ball ist ebenfalls eine Buchadaption und<br />
stellt eine erwachsenere Version des Vampirthemas<br />
dar. Etwas Blut, etwas Sex und der<br />
hinreissende Südstaatencharme – diese Elemente,<br />
neben guten Darstellern wie Anna Paquin,<br />
entzücken immer wieder. Hier übrigens ein<br />
anderer Hinweis, dass das Serienformat einen<br />
neuen Status errungen hat: Die Hollywoodstars,<br />
die zum Serienformat konvertieren.<br />
Dies ist kein Aufruf dazu, dem Kino völlig<br />
abzuschwören. Aber es ist eine Aufforderung,<br />
sich mit der Genrevielfalt des Serienformat des<br />
TVs auseinanderzusetzen, da sich dort oft der<br />
originellere Stoff wiederfindet.<br />
ensuite - kulturmagazin Nr. 84 | Dezember 09 37
Kulturessays<br />
INTERMEZZO<br />
Sensorreiniger, YB<br />
und harter Kaugummi<br />
Von Isabelle Haklar<br />
Ich mag es, wenn der Milchschaum meines<br />
Kaffees mit mir spricht. Ich mag den<br />
Ton, der zu hören ist, wenn ein soeben ausgelöschtes<br />
Streichholz mit Wasser in Berührung<br />
kommt. Ich mag das Zischen eines Zigarettenstummels,<br />
wenn er auf einen nassen Teebeutel<br />
trifft. Ich mag das leise Geräusch einer Canon,<br />
das bei der Sensorreinigung ertönt.<br />
Ich mag ungerade Zahlen. Ich mag es, in<br />
fremden Städten zum Frisör zu gehen. Ich mag<br />
die kleinen Schönheitsprodukte-Gratismuster.<br />
Ich mag es, als Lehrfahrer zu hupen.<br />
Ich mag den kurzen Moment im Winter,<br />
wenn das Bett langsam warm wird. Ich mag<br />
es, wenn mich mein Kater beim Kursaal abholt<br />
und nach Hause eskortiert. Ich mag es, wenn<br />
die Abendsonne ein orangefarbenes Gitter an<br />
meine Zimmerwand wirft.<br />
Ich mag Gratins, doch nicht das Abwaschen<br />
der Form. Ich mag den Augenblick, wenn ich<br />
meine Linsen eingesetzt habe und die Welt<br />
plötzlich an Tiefe gewinnt, doch nicht das Herausklauben<br />
der Sehhilfen nach dem Tragen. Ich<br />
mag es, als Beifahrer im Auto die Füsse hoch<br />
zu halten, doch nicht die Spuren, die die feuchten<br />
Socken am Fenster hinterlassen. Ich mag<br />
Kaugummiautomaten, nicht jedoch, dass die<br />
bunten Bälle schon nach fünfminütigem Kauen<br />
hart und bitter werden. Ich mag es, wenn<br />
YB gewinnt, nicht jedoch die Tatsache, dass<br />
für Seydou Doumbia 22 Millionen Euro geboten<br />
werden. Ich mag grosse Handtaschen, doch<br />
nicht das minutenlange darin Herumangeln<br />
nach meinem Portemonnaie. Ich mag Museen,<br />
doch nicht das Feststellen, dass die Ausstellung<br />
am Vortag gewechselt hat, wenn ich bereits vor<br />
dem Gebäude stehe. Ich mag Zeitungen, deren<br />
Blätter die Grösse von Leintüchern haben,<br />
doch nicht deren Wirtschaftsteil. Ich mag das<br />
Schnitzel im «Tramway», doch ich mag nie das<br />
Ganze.<br />
Ich mag es nicht, wenn man mir nach dem<br />
Bezahlen das Wechselgeld nicht in die Hand<br />
drückt. Ich mag keine Warenhauskassen, die<br />
nach dem Rollband eine statische Ablage haben.<br />
Ich mag es nicht, wenn nach dem Haarewaschen<br />
nasse Haare an meinem Rücken kleben.<br />
Ich mag keine Rollkoffer. Ich mag es nicht,<br />
mit nackten Füssen auf Hotelteppichböden zu<br />
laufen. Ich mag den letzten Schluck in meinem<br />
Glas nicht. Ich mag es nicht, dass ich mich<br />
immer noch nicht bei Facebook abgemeldet<br />
habe.<br />
Ich mag das Arbeiten in meiner Küche,<br />
wenn die Blumenlichterkette brennt. Ich mag<br />
die Lichterkette so sehr, dass ich sie oft nachts<br />
brennen lasse. Ich mag den Vermicelles-Block<br />
aus der Migros. Ich mag ihn so sehr, dass ich<br />
oft den Ganzen aufs Mal esse.<br />
Ich mag elektronische Gadgets und das<br />
Wort «Nippes». Ich mag Marienbilder und das<br />
Suchen auf Flohmärkten und in Trödelläden danach.<br />
Ich mag den Start und die Landung beim<br />
Fliegen. Ich mag die Vorfreude auf die Ferien<br />
und ein Abendessen im Postgässli. Ich mag es,<br />
ohne je einen Reiseführer gelesen zu haben,<br />
in fremden Ländern anzukommen und in den<br />
Städten ohne Stadtplan herumzuspazieren.<br />
Ich mag Brotaufstriche aus dem Osten. Ich<br />
mag bengalische Wunderkerzen am Tannenbaum.<br />
Ich mag es, nicht zu wissen, was das<br />
neue Jahr bringt.<br />
interwerk gmbh<br />
Kulturmanagement | Consulting<br />
Sandrainstrasse 3 | CH-3007 Bern<br />
Telefon +41(0)31 318 6050<br />
Fax +41(0)31 318 6051<br />
Email info@interwerk.ch<br />
Web www.interwerk.ch<br />
Kommunikationskultur in der<br />
Kulturkommunikation<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber: Verein WE ARE, Bern Redaktion:<br />
Lukas Vogelsang (vl); Anna Vershinova,<br />
Janine Reitmann (jr, Prakt.), Nicole Marmet<br />
(nm, Prakt.) // Peter J. Betts (pjb), Luca<br />
D’Alessandro (ld), Morgane A. Ghilardi, Isabelle<br />
Haklar, Guy Huracek (gh), Florian Imbach,<br />
Ruth Kofmel (rk), Mariel Kreis, Hannes Liechti<br />
(hl), Ursula Lüthi, Irina Mahlstein, Barbara<br />
Neugel (bn), Eva Pfirter (ep), Barbara Roelli,<br />
Anna Roos, Karl Schüpbach, Kristina Soldati<br />
(kso), Willy Vogelsang, Simone Wahli (sw),<br />
Simone Weber, Sonja Wenger (sjw), Gabriela<br />
Wild (gw), Ueli Zingg (uz).<br />
Cartoon: Bruno Fauser, Bern; Kulturagenda:<br />
kulturagenda.ch; ensuite - kulturmagazin,<br />
allevents, Biel; Abteilung für Kulturelles Biel,<br />
Abteilung für Kulturelles Thun, interwerk<br />
gmbh. Korrektorat: Lukas Ramseyer<br />
Abonnemente: 77 Franken für ein Jahr / 11<br />
<strong>Ausgabe</strong>n, inkl. artensuite (Kunstmagazin)<br />
Abodienst: 031 318 6050 / abo@ensuite.ch<br />
ensuite – kulturmagazin erscheint monatlich.<br />
Auflage: 10 000 Bern, 20 000 <strong>Zürich</strong><br />
Anzeigenverkauf: inserate@ensuite.ch Layout:<br />
interwerk gmbh, Lukas Vogelsang Produktion<br />
& Druckvorstufe: interwerk gmbh,<br />
Bern Druck: Fischer AG für Data und Print<br />
Vertrieb: Abonnemente, Gratisauflage in Bern<br />
und <strong>Zürich</strong> - interwerk gmbh 031 318 60 50;<br />
Web: interwerk gmbh<br />
Hinweise für redaktionelle Themen erwünscht<br />
bis zum 11. des Vormonates. Über die Publikation<br />
entscheidet die Redaktion. Bildmaterial<br />
digital oder im Original senden. Wir senden<br />
kein Material zurück. Es besteht keine Publikationspflicht.<br />
Agendahinweise bis spätestens<br />
am 18. des Vormonates über unsere Webseiten<br />
eingeben. Redaktionsschluss der <strong>Ausgabe</strong> ist<br />
jeweils am 18. des Vormonates (www.kulturagenda.ch).<br />
Die Redaktion ensuite - kulturmagazin ist politisch,<br />
wirtschaftlich und ethisch unabhängig<br />
und selbständig. Die Texte repräsentieren die<br />
Meinungen der AutorInnen, nicht jene der Redaktion.<br />
Copyrights für alle Informationen und<br />
Bilder liegen beim Verein WE ARE in Bern und<br />
der edition ensuite. «ensuite» ist ein eingetragener<br />
Markenname.<br />
Redaktionsadresse:<br />
ensuite – kulturmagazin<br />
Sandrainstrasse 3; CH-3007 Bern<br />
Telefon 031 318 60 50<br />
Fax 031 318 60 51<br />
E-Mail: redaktion@ensuite.ch<br />
www.ensuite.ch<br />
38