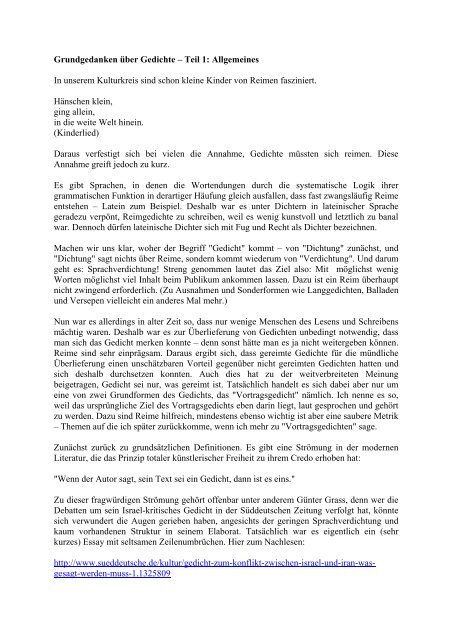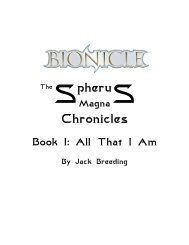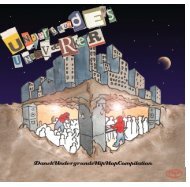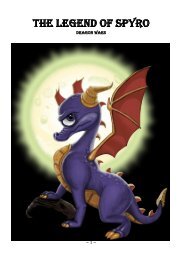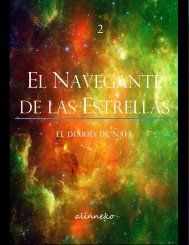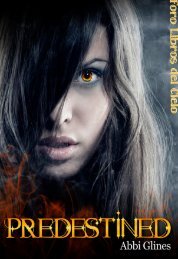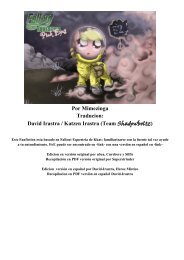Grundgedanken über Gedichte – Teil 1: Allgemeines ... - deviantART
Grundgedanken über Gedichte – Teil 1: Allgemeines ... - deviantART
Grundgedanken über Gedichte – Teil 1: Allgemeines ... - deviantART
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grundgedanken</strong> <strong>über</strong> <strong>Gedichte</strong> <strong>–</strong> <strong>Teil</strong> 1: <strong>Allgemeines</strong><br />
In unserem Kulturkreis sind schon kleine Kinder von Reimen fasziniert.<br />
Hänschen klein,<br />
ging allein,<br />
in die weite Welt hinein.<br />
(Kinderlied)<br />
Daraus verfestigt sich bei vielen die Annahme, <strong>Gedichte</strong> müssten sich reimen. Diese<br />
Annahme greift jedoch zu kurz.<br />
Es gibt Sprachen, in denen die Wortendungen durch die systematische Logik ihrer<br />
grammatischen Funktion in derartiger Häufung gleich ausfallen, dass fast zwangsläufig Reime<br />
entstehen <strong>–</strong> Latein zum Beispiel. Deshalb war es unter Dichtern in lateinischer Sprache<br />
geradezu verpönt, Reimgedichte zu schreiben, weil es wenig kunstvoll und letztlich zu banal<br />
war. Dennoch dürfen lateinische Dichter sich mit Fug und Recht als Dichter bezeichnen.<br />
Machen wir uns klar, woher der Begriff "Gedicht" kommt <strong>–</strong> von "Dichtung" zunächst, und<br />
"Dichtung" sagt nichts <strong>über</strong> Reime, sondern kommt wiederum von "Verdichtung". Und darum<br />
geht es: Sprachverdichtung! Streng genommen lautet das Ziel also: Mit möglichst wenig<br />
Worten möglichst viel Inhalt beim Publikum ankommen lassen. Dazu ist ein Reim <strong>über</strong>haupt<br />
nicht zwingend erforderlich. (Zu Ausnahmen und Sonderformen wie Langgedichten, Balladen<br />
und Versepen vielleicht ein anderes Mal mehr.)<br />
Nun war es allerdings in alter Zeit so, dass nur wenige Menschen des Lesens und Schreibens<br />
mächtig waren. Deshalb war es zur Überlieferung von <strong>Gedichte</strong>n unbedingt notwendig, dass<br />
man sich das Gedicht merken konnte <strong>–</strong> denn sonst hätte man es ja nicht weitergeben können.<br />
Reime sind sehr einprägsam. Daraus ergibt sich, dass gereimte <strong>Gedichte</strong> für die mündliche<br />
Überlieferung einen unschätzbaren Vorteil gegen<strong>über</strong> nicht gereimten <strong>Gedichte</strong>n hatten und<br />
sich deshalb durchsetzen konnten. Auch dies hat zu der weitverbreiteten Meinung<br />
beigetragen, Gedicht sei nur, was gereimt ist. Tatsächlich handelt es sich dabei aber nur um<br />
eine von zwei Grundformen des Gedichts, das "Vortragsgedicht" nämlich. Ich nenne es so,<br />
weil das ursprüngliche Ziel des Vortragsgedichts eben darin liegt, laut gesprochen und gehört<br />
zu werden. Dazu sind Reime hilfreich, mindestens ebenso wichtig ist aber eine saubere Metrik<br />
<strong>–</strong> Themen auf die ich später zurückkomme, wenn ich mehr zu "Vortragsgedichten" sage.<br />
Zunächst zurück zu grundsätzlichen Definitionen. Es gibt eine Strömung in der modernen<br />
Literatur, die das Prinzip totaler künstlerischer Freiheit zu ihrem Credo erhoben hat:<br />
"Wenn der Autor sagt, sein Text sei ein Gedicht, dann ist es eins."<br />
Zu dieser fragwürdigen Strömung gehört offenbar unter anderem Günter Grass, denn wer die<br />
Debatten um sein Israel-kritisches Gedicht in der Süddeutschen Zeitung verfolgt hat, könnte<br />
sich verwundert die Augen gerieben haben, angesichts der geringen Sprachverdichtung und<br />
kaum vorhandenen Struktur in seinem Elaborat. Tatsächlich war es eigentlich ein (sehr<br />
kurzes) Essay mit seltsamen Zeilenumbrüchen. Hier zum Nachlesen:<br />
http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischen-israel-und-iran-wasgesagt-werden-muss-1.1325809
Denkt man diesen Ansatz jedoch in aller Konsequenz zu Ende, könnte der Verfasser eines<br />
Zeitungsartikels oder einer betriebswirtschaftlichen Diplomarbeit sich hinstellen und sein<br />
Werk zu einem Gedicht erklären <strong>–</strong> und folglich wäre es eins. Wie unsinnig das ist, dürfte<br />
leicht einsichtig sein, denn beides ist eben nicht auf Sprachverdichtung angelegt!<br />
Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass ein Text, der ein Gedicht sein will, dem<br />
Anspruch der Sprachverdichtung genügen sollte. Dies ist das entscheidende Kriterium!<br />
Wir können nun im nächsten Schritt <strong>Gedichte</strong> in zwei große Familien unterteilen: Die bereits<br />
angesprochenen "Vortragsgedichte", für die Reim und Rhythmus definitiv von Vorteil sind,<br />
da sie beim Konsumenten <strong>über</strong> das Gehör Eingang finden können sollen <strong>–</strong> man könnte sie<br />
alternativ auch "Hörgedichte" nennen <strong>–</strong> sind die eine Gruppe. Die andere Gruppe will ich<br />
"Lesegedichte" nennen, da sie sich metrischen Strukturen häufig entziehen und nicht darauf<br />
ausgelegt sind, flüssig vorgetragen werden zu können. (Was natürlich nicht heißt, dass man<br />
sie nicht auch flüssig vortragen können darf!)