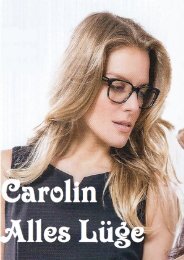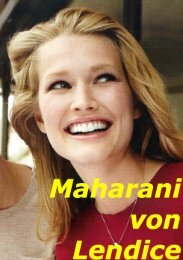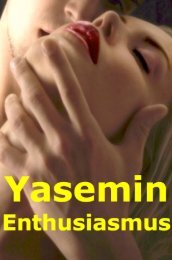Mein Bewusstsein versteht davon nichts
Ich konnte noch träumen. Das war doch auch etwas Schönes. Natürlich musste ich mich sofort näher erkundigen. Sonja hieß sie, war verheiratet und hatte ein Kind, dass sie nach ihrem Examen bekommen hatte. Wenn sie es als Historikerin geschafft hatte, im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben, musste sie schon einiges vorzuweisen haben. Ihre Dissertation wollte ich mir mal ansehen. Jetzt schrieb sie an ihrer Habilitation, wollte also Professorin werden. Entsetzlich, warum musste diese Frau für mich so unerreichbar sein? Wenn sie wüsste, wie glücklich sie mich machen würde, dachte ich und musste über meine eigene Idiotie lachen. Meine liebe Guilia, ich habe dich so lieb, aber jetzt muss ich einfach an Sonja denken. In meinen Gedanken bewegte sich Frau Dr. Lenhardt nur noch als Sonja. Natürlich war es völlig abstrus, an irgendeine Art von Beziehung zu denken, es war nur einfach ein Genuss, sie jede Woche zu hören. Im Laufe des Semesters hatte ich Sonja doch noch näher kennengelernt. Wir redeten uns sogar mit Vornamen an, aber plötzlich war sie verschwunden. Hatte sich wohl anderswo auf einen Lehrstuhl beworben. Auch wenn sie nicht mehr da war und ich sie voraussichtlich nie wiedersehen würde, aus meiner Gedanken- und Traumwelt würden die Bilder und Visionen von Sonja nie wieder verschwinden. Ob Eric Sonja doch wiedertraf und was sich daraus entwickelte, erzählt die Geschichte.
Ich konnte noch träumen. Das war doch auch etwas Schönes. Natürlich musste ich mich sofort näher erkundigen. Sonja hieß sie, war verheiratet und hatte ein Kind, dass sie nach ihrem Examen bekommen hatte. Wenn sie es als Historikerin geschafft hatte, im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben, musste sie schon einiges vorzuweisen haben. Ihre Dissertation wollte ich mir mal ansehen. Jetzt schrieb sie an ihrer Habilitation, wollte also Professorin werden. Entsetzlich, warum musste diese Frau für mich so unerreichbar sein? Wenn sie wüsste, wie glücklich sie mich machen würde, dachte ich und musste über meine eigene Idiotie lachen. Meine liebe Guilia, ich habe dich so lieb, aber jetzt muss ich einfach an Sonja denken. In meinen Gedanken bewegte sich Frau Dr. Lenhardt nur noch als Sonja. Natürlich war es völlig abstrus, an irgendeine Art von Beziehung zu denken, es war nur einfach ein Genuss, sie jede Woche zu hören. Im Laufe des Semesters hatte ich Sonja doch noch näher kennengelernt. Wir redeten uns sogar mit Vornamen an, aber plötzlich war sie verschwunden. Hatte sich wohl anderswo auf einen Lehrstuhl beworben. Auch wenn sie nicht mehr da war und ich sie voraussichtlich nie wiedersehen würde, aus meiner Gedanken- und Traumwelt würden die Bilder und Visionen von Sonja nie wieder verschwinden. Ob Eric Sonja doch wiedertraf und was sich daraus entwickelte, erzählt die Geschichte.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auch. Irgendwann sah sie plötzlich zu mir rüber, lachte und meinte: „Aber das<br />
macht ihnen Spaß, nicht wahr, Bier trinken?“ „Ja, natürlich.“ antwortete ich lachend,<br />
„Ich trinke sonst nie Bier. Da können sie sich vorstellen, wie ich mich<br />
freue, wenn ich jetzt mal darf.“ „Das kann ich mir vorstellen.“ antwortete Frau<br />
Lenhardt immer noch lächelnd, „Und was trinken sie sonst, Brause?“ „Nein, nur<br />
Nepenthes. Ich muss ständig meinen Kummer ertränken.“ antwortete ich.<br />
„Wenn sie mir jetzt noch erklären, worum es sich bei Nepenthes handelt, weiß<br />
ich zwar <strong>nichts</strong> über ihren Kummer, aber zumindest, was sie dagegen tun.“<br />
meinte Frau Lenhardt. „Frau Dr. Lenhardt, da muss ich einer promovierten Historikerin<br />
die Odyssee erklären?“ antwortete ich gespielt erstaunt. „Nein, bloß<br />
nicht, aber der Passus mit dem Nepenthes muss mir wohl entglitten sein.“ reagierte<br />
sie und lachte. Ich erklärte ihr, dass es sich um eine ägyptische Glücks-<br />
Droge handle, die die Griechen, und zuerst eben Helena, dem Wein beimischten.<br />
Um etwas Opium ähnliches handele es sich dabei, von dem sogar Edgar<br />
Allan Poe noch spreche. „Nehmen sie Drogen?“ fragte mich Frau Lenhardt mit<br />
ernstem Blick. „Nein, ja doch, ich trinke Wein.“ antwortete ich lachend. „Und<br />
welchen Kummer haben sie in ihrem Nepenthes-Wein zu ertränken, wenn ich<br />
fragen darf? Hat ihre Liebste sie verlassen?“ fragte Frau Lenhardt. Ich erklärte<br />
ihr, dass es sich um mein Archäologiestudium handle, und sie zeigte mir die<br />
Möglichkeiten auf, die es dort doch außer meiner düsteren Perspektive gäbe.<br />
„Da müssen sie nur eben etwas tun.“ schloss sie. Mit einem aus Wehmut und<br />
Fragen gemischten Blick schaute ich sie an, und ihr Blick sagte, dass ich mich<br />
jetzt erklären müsse. „Ich habe ein Problem. Mit dem „eben etwas tun“ das<br />
funktioniert bei mir nicht. Ich möchte schon etwas lernen und können, aber<br />
wenn ich es dann kann, reicht es auch. Ein großer Künstler oder herausragender<br />
Wissenschaftler könnte ich nie werden. Mir fehlt das Sieger-Gen. Ich habe<br />
immer gedacht, es läge daran, dass ich mit meiner Mutter aufgewachsen wäre,<br />
und sie mir das nicht vermittelt hätte, aber sie sind ja auch eine Frau und<br />
scheinen offensichtlich darüber zu verfügen.“ antwortete ich darauf. Frau Lenhardt<br />
belehrte mich ausführlich über mein antiquiertes Frauenbild. „Es mag ja<br />
sein, dass ich mich in feministischen Diskussionen und Argumentationszusammenhängen<br />
nicht besonders gut auskenne, aber dass ich mich frauendiskriminierend<br />
oder gar frauenfeindlich verhalten würde, das wollen sie mir doch wohl<br />
nicht anlasten.“ ich dazu. Dann erklärte ich ihr, warum die Welt für mich primär<br />
aus Frauen bestünde, ich Männern keine Beachtung schenken würde und dass<br />
dies mit sexistischen Ambitionen überhaupt <strong>nichts</strong> zu tun habe. Auch wenn das<br />
Bild der Frau in der patriarchalen Gesellschaft von Männern geprägt sei, würde<br />
ich sie doch im Allgemeinen wesentlich besser verstehen als die Männer selbst.<br />
Unabhängig von der Sozialisation trügen die Menschen schon Bedürfnisse in<br />
sich, die losgelöst vom Patriarchat und sonstigen kulturellen Einflüssen existierten,<br />
war meine Ansicht. Darüber konnten wir natürlich endlos diskutieren,<br />
unterschiedliche Vorstellungen austauschen, und mir viel zwischendurch auf,<br />
dass ich bei der angeregten Diskussion überhaupt nicht mehr auf ihre Stimme<br />
achtete. Ich sah auch nicht mehr die Distanz zwischen der arrivierten Wissenschaftlerin<br />
und dem kleinen Studenten. Plötzlich stellte sie fest: „Ich kenne ihren<br />
Namen überhaupt nicht.“ „Eric“ antwortete ich nur. Als sie mich erwartend<br />
anschaute, fügte ich hinzu: „Ach ja, Sailer, natürlich.“ Sie blickte lächelnd und<br />
fragte, ob ich lieber mit meinem Vornamen angesprochen werden würde. „Ja,<br />
<strong>Mein</strong> <strong>Bewusstsein</strong> <strong>versteht</strong> <strong>davon</strong> <strong>nichts</strong> – Seite 8 von 31