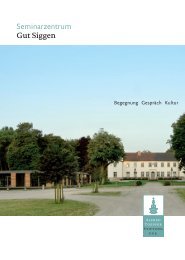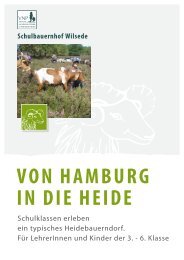0.1 Titelbild - Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
0.1 Titelbild - Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
0.1 Titelbild - Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
NETZWERK<br />
magazin<br />
In dieser Ausgabe u.a.<br />
Martin Tröndle<br />
Leiter der Akademie<br />
Concerto 21.<br />
Thema<br />
Bildung für<br />
Kinder und Jugendliche<br />
Max-Brauer<br />
Brauer-Preis<br />
Faszination für Lesen<br />
und Musik<br />
Horizonterweiterung<br />
Stipendiatenseminare in<br />
Siggen<br />
Museumspädagogik<br />
Nicht nur für Kinder<br />
09<br />
09
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Editorial<br />
Sehr geehrte, liebe Mitglieder des europäischen Fördernetzwerks,<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
die Spätsommerausgabe des Netzwerkmagazins legt den Schwerpunkt auf Projekte<br />
im Kinder- und Jugendbereich. Es sind kleine und große Aufbrüche an verschiedenen<br />
Orten, die für eine gewisse Zeit von der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. begleitet,<br />
punktuell unterstützt oder ausgezeichnet wurden.<br />
Ein Museum kann der Motor für eine lernende Gesellschaft sein, wenn es sein junges<br />
Publikum ernst nimmt, neue Wege der Auseinandersetzung ermöglicht und<br />
seine Gegenstände im besten Sinne erfahrbar macht, so erläutert Katarzyna Warpas<br />
ihre Studie zu „Child inclusive exhibition design“. Für die Musik ist das „Klingende<br />
Museum Hamburg“ solch ein Ort und wurde dafür mit dem Max-Brauer-Preis ausgezeichnet.<br />
Diese Ehrung erfuhr zugleich „MENTOR — Die Leselernhelfer Hamburg<br />
e.V.“ — auch dies ein Ort des Lernens, der über die üblichen Bildungsorte hinaus<br />
für Kinder und Jugendliche neue Möglichkeiten des Aufbruchs erfahrbar macht.<br />
Das Netzwerkmagazin berichtet des Weiteren über die Bildungsaktivitäten der <strong>Stiftung</strong><br />
und zeigt die Perspektiven auf, die sich mit neuen Gegenwartsfragen im Gepäck<br />
für die <strong>Stiftung</strong>sarbeit der nächsten Jahre abzeichnen.<br />
Nicht zuletzt ist auch das Magazin selbst von einen kleinen Aufbruch betroffen:<br />
Dies ist die letzte Ausgabe unter der Redaktion und Gestaltung von Lutz Ohlendorf,<br />
der dem Heft zum neuen Gesicht verhalf und Stil wie Inhalt für ein Jahr geprägt<br />
hat. Wir wünschen ihm für den weiteren Lebensweg das Allerbeste. An seiner<br />
Stelle wird fortan Julia Christin Aye das Magazin betreuen, die ebenso wie ihr Vorgänger<br />
ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur in unserer <strong>Stiftung</strong> absolviert.<br />
Neben den Informationen aus unseren Projekten, über Alumni und aktuelle Stipendiaten,<br />
finden Sie wie immer Berichte, Tipps und Links zu Partnern und zum<br />
<strong>Stiftung</strong>sumfeld in diesem Heft. Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche Lektüre<br />
und freue mich über Ihre Rückmeldungen, Nachrichten und Anregungen…<br />
Ihre Dr. Antje Mansbrügge<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de<br />
2
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Editorial 2<br />
Kurz gemeldet | Wettbewerbe und Ausschreibungen 5<br />
Die Kunst(, zu) vermitteln — Martin Tröndle 9<br />
Menschen<br />
Auf musikalischer Bärenjagd 15<br />
Wertvolles Lernen 19<br />
Nicht nur für Kinder 23<br />
Thema<br />
3<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Inhalt<br />
Horizonte erweitern 27<br />
Komplex 31<br />
„Die <strong>Stiftung</strong> soll eine Plattform für Ideen sein“ 33<br />
Projekte / Aus der <strong>Stiftung</strong><br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Texte publik gemacht<br />
Hans Mommsen: Repräsentant des „anderen Deutschland“ 39<br />
Katarzyna Warpas: Child Inclusive Exhibition Design 49<br />
Termine 55<br />
Links zu interessanten Projekten in Europa 57<br />
Ihre Beiträge 59<br />
Impressum | Bildnachweise 61<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de<br />
4
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Reflexionen am Bosporus<br />
Die unter dem Titel „Europäische Reflexionen“<br />
entstandene Fotorecherche zu<br />
europäischen Werten machte im Sommer<br />
Station in Istanbul. Ausgewählte<br />
Arbeiten von Pepa Hristova und André<br />
Lützen wurden dort in der Galerie fotografevi<br />
gezeigt. Der lokale Bezug ist<br />
dort besonders groß: Für ihre Recherche<br />
begab sich Pepa Hristova nicht nur nach<br />
Bulgarien, sondern auch zur bulgarischen<br />
Minderheit in der Türkei. Auch<br />
André Lützen erkundete für seine Fotografien<br />
die „Außenlinie Europas“ (Foto:<br />
„Flüchtlingsboot“, Teneriffa, 2006).<br />
Kurz gemeldet<br />
Gleich zwei Eurolecture-<br />
Gastdozenturen werden dank eines<br />
Mittelvortrags im Sommersemester<br />
2010 gefördert werden können, beide<br />
im Bereich der Geisteswissenschaften.<br />
Dr. Kawla Dobrochna von der Universität<br />
Jagiellonski in Krakow bringt eine<br />
reiche Erfahrung in der Erforschung der<br />
Frauen und Geschlechtergeschichte an<br />
die Universität Erfurt mit, wo sie zusammen<br />
mit Prof. Dr. Claudia Kraft<br />
unter anderem dieses Thema in der<br />
Form des Teamteaching unterrichten<br />
wird. Außerdem werden sich die Wissenschaftlerinnen<br />
zusammen mit ihren<br />
Studenten mit der historische Gedächtnisforschung<br />
in den postkommunistischen<br />
Gesellschaften befassen. Auch<br />
eine Tagung in Erfurt ist geplant.<br />
5<br />
Geisteswissenschaftlicher Akzent<br />
Mit einem Semesterschwerpunkt<br />
Christologie befasst sich die Gastdozentur<br />
von Prof. Dr. Gerard Mannion von<br />
der Katholieke Universiteit Leiden, der<br />
diesen zusammen mit PD Dr. Annemarie<br />
Mayer von der Universität Tübingen<br />
entwickelt hat. Beide möchten sich<br />
nicht auf formale akademische Aspekte<br />
des Themas beschränken, sondern vor<br />
allem die Einflüsse anderer Fachrichtungen<br />
würdigen und den Lehrstoff in Exkursionen<br />
erweitern.<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Kurz gemeldet<br />
Abpfiff beim Auswärtsspiel<br />
Die Saison 2009 des Siggener Kultursommers,<br />
die unter dem Titel „Auswärtsspiel“<br />
steht, befindet sich in den<br />
letzten Spielminuten: Mit einem Konzert<br />
des eigens zu diesem Termin gebildeten<br />
Bläserensembles „Siggen Brass“,<br />
zu dem auch die aktuellen Masefield-<br />
Stipendiaten Björn Kadenbach und<br />
Sönke Klegin gehören, endet eine Reihe<br />
von Konzerten und Vorträgen, die wiederum<br />
auf große Resonanz in der Umgebung<br />
des Ostholsteiner Seminarzentrums<br />
stießen. Auch im kommenden Jahr<br />
werden StipendiatInnen und andere<br />
Persönlichkeiten aus dem <strong>Stiftung</strong>sumfeld<br />
in Siggen musizieren und referieren.<br />
Einen Artikel über das Kunstprojekt<br />
„Komplex“, das ebenfalls im Rahmen<br />
des Kultursommers stattfindet, können<br />
Sie in dieser Ausgabe des Netzwerkmagazin<br />
lesen.<br />
Graphische Reduktion<br />
Die Arbeiten der ehemaligen <strong>Alfred</strong>-<br />
<strong>Toepfer</strong>-Programmstipendiatin Anja<br />
Klafki zeichnen sich durch eine einzigartige<br />
Reduziertheit aus, die das Thema<br />
der Landschaft aus der Sicht der Radierung<br />
neu erschließt und durch unkonventionelle<br />
Techniken unterstrichen<br />
wird. Arbeiten der Künstlerin waren in<br />
der Galerie im Georgshof zu sehen und<br />
bildeten dort auch einen spannenden<br />
Kontrast zu den wenige Monate zuvor<br />
ausgestellten Landschaftsradierungen<br />
Anthonie Waterloos. (Bild: „Ashore IX“,<br />
2007)<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de<br />
6
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Wettbewerbe und Ausschreibungen<br />
PlusPunkt KULTUR<br />
Kurz gemeldet<br />
Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ)<br />
schreibt zum zweiten Mal den Wettbewerb PlusPunkt KULTUR aus.<br />
Bewerben können sich Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren mit eigenen<br />
Projekten oder Projektideen sowie Einrichtungen, die gemeinsam<br />
mit jungen Engagierten ein Projekt planen oder umsetzen. Es sind<br />
Konzepte gefragt, die wichtige gesellschaftspolitische Themen mittels<br />
Kunst und Kultur thematisieren und junge Menschen zu einem freiwilligen<br />
Engagement in der Kultur motivieren. Den BewerberInnen sind<br />
innerhalb der Themenschwerpunkte „InterKultur“, „Mehr Kultur an<br />
Schulen“, „Kultur im Brennpunkt“, „Kultur von Jung und Alt“ und „Kultur<br />
und globale Verantwortung“ keine Grenzen gesetzt.<br />
Die 30 Gewinner/innen erwarten professionelle Qualifizierungsmaßnahmen,<br />
etwa im Bereich Projektmanagement oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
sowie ein Preisgeld in Höhe von je 1000 Euro. Einsendeschluss<br />
ist der 1. November 2009<br />
www.plus-punkt-kultur.de<br />
20 Jahre Mauerfall im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft<br />
Das Deutsch-Französische Jugendwerk möchte daran erinnern, dass für<br />
viele Menschen das Erlebnis deutsch-französischer Freundschaft erst<br />
mit dem Mauerfall begann. Mit einem Wettbewerb sucht das DFJW nun<br />
Texte, Bilder, Videos und Audioaufnahmen, in denen ihre Urheber berichten,<br />
welcher Moment für sie das Ereignis des Mauerfalls mit der<br />
deutsch-französischen Freundschaft verbindet. Die besten Einsendungen<br />
gewinnen eine Reise zum Fest des DFJW in Berlin am 9. November.<br />
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.<br />
Weitere Informationen zu diesem Projekt finden sich unter<br />
http://www.dfjw.org<br />
7<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Kurz gemeldet<br />
Bewerbungsverfahren um ein <strong>Alfred</strong>-<strong>Toepfer</strong><br />
<strong>Toepfer</strong>-Stipendium<br />
läuft<br />
Die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. fördert die Abschlussphase eines Studiums,<br />
eines Aufbaustudiums oder einer Promotion von osteuropäischen Studierenden<br />
an einer Hochschule in Deutschland. Es werden pro Jahr 30 bis 50 Stipendien<br />
mit einem Förderungsumfang von je 920 € monatlich vergeben. Gefördert werden<br />
vor allem europäische Studien auf dem Gebiet der Kultur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften,<br />
aber auch Studien der bildenden und darstellenden<br />
Künste, der Architektur, sowie der Agrar- und Forstwissenschaften.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Zielgruppe sind begabte und engagierte Studierende unter 30 Jahren aus Mittelund<br />
Osteuropa in Vorbereitung eines Studienabschlusses mit Ausnahme von<br />
Bachelor-Studiengängen. Doktoranden können bis zu ihrem 35sten Lebensjahr<br />
in das Stipendienprogramm aufgenommen werden. Deutsche Studierende können<br />
sich um die Förderung eines Studienaufenthalts in den Ländern Mittel- und<br />
Osteuropas bewerben. Die Dauer der Förderung beträgt bis zu einem Jahr. Die<br />
Stipendiaten werden von einer unabhängigen Kommission ausgewählt und das<br />
Bewerbungsverfahren endet am 30. November 2009.<br />
Weitere Informationen finden sich unter<br />
http://www.toepfer-fvs.de/toepfer-stipendium.html<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de<br />
8
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Die Kunst(, zu) vermitteln<br />
Zur künstlerischen Forschung mit Martin Tröndle<br />
Menschen<br />
Mit Erfahrung, wissenschaftlich motiviertem Engagement und Witz leitet Dr. Martin<br />
Tröndle Concerto 21. Die Sommerakademie für Aufführungskultur und Musikmanagement<br />
der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> er <strong>Stiftung</strong> F.V.S., die jüngst wieder im Seminarzentrum Gut Siggen stattt-<br />
fand. Das Netzwerkmagazin<br />
magazin, , in dem vergangenes Jahr schon sein Beitrag zu der Frage „Wie<br />
kommt das neue in die Kultur?“ zu lesen war, porträtiert den Kunstwissenschaftler und<br />
seine Projekte, die über die Bestrebungen nach einer Modernisierung des bürgerlichen<br />
Konzerts weit hinausgehen.<br />
hen.<br />
Dass soziale Ereignisse bestimmten<br />
Konventionen und Riten folgen, ist ein<br />
Befund, der die lateinische Messe mit<br />
dem Breakdance Battle verbindet. Auch<br />
das klassische Konzert folgt weitgehend<br />
festen Regeln, die sich Ende des 19.<br />
Jahrhunderts in der noch heute gültigen<br />
Form etabliert haben. Man kann in dieser<br />
Verfestigung den Endpunkt eines<br />
historischen Ziels in der Entwicklung<br />
der Aufführungstradition „klassischer“<br />
Musik entdecken, an dem sie ihre<br />
höchstmögliche Verfeinerung erreicht<br />
hat, die das Werk in gleichsam sakraler<br />
Weise feiert und ihm unbedingten<br />
Raum bietet. Dann allerdings liegt es<br />
nicht fern, angesichts der statistischen<br />
Erhebungen zur Besucherzahl und -<br />
struktur der Konzerte zu befürchten,<br />
dass dieser Höhe- gleichzeitig ein<br />
Schlusspunkt ist. Ändert sich an diesen<br />
Kennzahlen nämlich nichts, dann wird<br />
das bürgerliche Konzertwesen schon die<br />
nächsten Jahrzehnte nicht in der heutigen<br />
Ausdehnung überleben, sondern<br />
zur Randkultur in wenigen Metropolen<br />
schrumpfen.<br />
Martin Tröndle<br />
Dieser Niedergangsvision begegnen<br />
zahlreiche Orchester und größere Ensembles<br />
schon seit einiger Zeit mit<br />
Programmen, die unter der Überschrift<br />
„Education“ oder „Audience Development“<br />
darauf ausgerichtet sind, Interes-<br />
9<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Menschen<br />
sierte mit den Strukturen des Konzerts<br />
und der Musik vertraut zu machen und<br />
sie an die beschriebene Tradition heranzuführen.<br />
Diese — verdienstvolle — Arbeit<br />
reicht dem Kulturwissenschaftler<br />
Martin Tröndle nicht. „Man muss das<br />
Konzert verändern, um es zu erhalten.<br />
Denn die Krise der klassischen Musik ist<br />
keine Krise der Musik, sondern eine<br />
ihrer Aufführungskultur.“ So schreibt er<br />
in dem von ihm herausgegebenen und<br />
jüngst erschienenen Sammelband „Das<br />
Konzert“, der vor allem die Beiträge<br />
zweier Tagungen versammelt, von denen<br />
eine im Mai 2008 unter dem Titel<br />
„Auf der Suche nach dem Publikum“<br />
von der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
veranstaltet wurde.<br />
Covern massentauglicher Sampler lächeln<br />
und deren Repertoire sich wie die<br />
Playlist weichgespülter „Klassik“-<br />
Radioprogramme liest. Eine Beschäftigung<br />
mit dem Publikum, seiner Struktur<br />
und seinen Wünschen, einer ihm angepassten<br />
Inszenierung von Musik und<br />
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit ist<br />
aber dennoch notwendig und bildet<br />
daher den Lehrstoff der Akademie.<br />
Nicht der ernsthafte Umgang mit dem<br />
Werk steht zur Disposition, sondern der<br />
Rahmen, in dem dieser präsentiert wird.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Das Engagement für eine Fortentwicklung<br />
des Konzertwesens und seiner<br />
Aufführungskultur ist seitdem ein Anliegen<br />
Tröndles, das er als Leiter von<br />
Concerto 21. weiterverfolgt. Diese<br />
„Sommerakademie für Aufführungskultur<br />
und Musikmanagement“, die im Juli<br />
und August zum zweiten Mal im Seminarzentrum<br />
Gut Siggen stattfand, geht<br />
über einen Anstoß zu neuen Formen<br />
des Konzertierens allerdings hinaus. In<br />
Kooperation mit dem Deutschen Musikrat<br />
möchte die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
F.V.S. vielmehr umfassend junge Künstler<br />
und Ensembles auf die Selbstständigkeit<br />
in einem veränderten Umfeld<br />
vorbereiten. Dabei geht es nicht um<br />
möglichst Umsatz steigernde Popularisierung,<br />
deren hochgestylte Protagonisten<br />
mittlerweile seit Jahren von den<br />
Vortrag im Grünen bei Concerto 21.<br />
Die Verbindung von Management und<br />
Musik, von Ökonomie und Kultur, das ist<br />
eine Leitlinie, die auch den Lebenslauf<br />
von Martin Tröndle bestimmt. Schon<br />
während seiner Schulzeit in Donaueschingen,<br />
einer Hochburg der zeitgenössischen<br />
Musik, übte er für das Ziel<br />
einer Karriere als Gitarrist und erhielt<br />
außerdem mit 18 Jahren Kompositionsunterricht.<br />
Konsequenterweise folgte<br />
auf das Abitur ein Studium der Musik,<br />
das er in Bern abschloss und in Luzern in<br />
der Konzertklasse weiterführte. Das<br />
Lebensziel des professionellen Musikers<br />
stand bis dahin indes noch nicht fest;<br />
10<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Tröndle wollte sich bewusst nicht zu<br />
früh auf den von vielen Unwägbarkeiten<br />
bestimmten Weg festlegen und entschloss<br />
sich , seine künstlerische Ausbildung<br />
um ein Studium der Kulturwissenschaften<br />
und des Kulturmanagements<br />
in Ludwigsburg zu ergänzen.<br />
Dass er dort eine Passion fand, die derjenigen<br />
des Musizierens zumindest<br />
gleichkommt, das merkt jeder Gesprächspartner,<br />
der sich von Tröndle die<br />
Stationen und Forschungsprojekte auf<br />
seinem Weg seither berichten lässt. Mit<br />
ebenso breiten wie in die Tiefe gehenden<br />
Kenntnissen, vor allem aber mit<br />
Leidenschaft für eine präzise und gegenüber<br />
Neuerungen aufgeschlossene<br />
geistige Durchdringung des Kulturschaffens<br />
und -vermittelns fügt er Projekte<br />
wie Bausteine zusammen, die am<br />
Schluss im besten Falle in eine umfassende<br />
Kunsttheorie münden. Das Interdisziplinäre<br />
ist dabei sein stetiger Begleiter.<br />
In der Überschreitung scheinbar fest<br />
gemauerter Kategorien hat auch sein<br />
erstes größeres Projekt nach dem Studium<br />
seinen Ursprung. Die Biennale Bern,<br />
die er zusammen mit Stephan Schmidt<br />
gründete, hat sich mittlerweile als spartenübergreifendes<br />
Festival für zeitgenössische<br />
Kunst etabliert. Ihre Entstehung<br />
verdankt sich der Vorgabe des<br />
schweizerischen Gesetzgebers, der den<br />
Hochschulen ausnahmslos vorschrieb,<br />
fortan forschend tätig zu sein. Die<br />
Kunsthochschulen sahen sich dabei mit<br />
dem Problem konfrontiert, dass nicht<br />
Menschen<br />
etwa z. B. die kunsthistorische Forschung<br />
gemeint war, sondern sie vielmehr<br />
aufgefordert wurden, Wissenschaft<br />
mit den Mitteln des Künstlers zu<br />
betreiben. Diese Methode der Kunstforschung<br />
hat in den letzten Jahren enorme<br />
Fortschritte gemacht; als Tröndle und<br />
Schmidt sich damit befassten, mussten<br />
sie hingegen noch viele neue Wege<br />
beschreiten. Die Ergebnisse wurden<br />
schließlich 2001 in der ersten Biennale<br />
Bern präsentiert.<br />
Tröndle wandte sich anschließend seiner<br />
Dissertation zu, in der er sich ausführlich<br />
mit dem Thema des Entscheidens<br />
im Kulturbetrieb befasste. Das<br />
Werk ist der Praxis verpflichtet, die es<br />
sich zum Gegenstand wählt, analysiert<br />
diese aber in einer methodisch stringenten<br />
Weise anhand einer abstrakten<br />
Theorie zur Entstehung und Durchsetzung<br />
von Entscheidungen in den Organisationen<br />
der Kultur. Bis heute verfolgt<br />
Tröndle diesen Ansatz weiter, der Entscheidungen<br />
zum maßgeblichen Untersuchungsgegenstand<br />
erklärt. Er selbst,<br />
geprägt durch systemtheoretische Vorstellungen,<br />
erläutert sein Erkenntnisinteresse<br />
so: „Wie werden systemrationale<br />
Entscheidungen gefällt, also Entscheidungen,<br />
die einer bestimmten Systemlogik<br />
entsprechen und zwar nur dieser<br />
Systemlogik? Ich versuche, diese spezifischen<br />
Systemlogiken des Kulturbetriebs<br />
freizulegen.“ Am Ende seines Ansatzes<br />
steht eine Analyse der Entscheidungen<br />
durch die gesamte Kette hindurch: Von<br />
der Schaffung des Werkes über seine<br />
11<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Menschen<br />
Transformation in ein Kunstwerk und<br />
die Bewertung durch den Kunstbetrieb<br />
als ein ästhetisches und auch monetär<br />
wertvolles Objekt bis hin zur Rezeption<br />
durch den Betrachter und den Erwerb<br />
durch den Käufer. Diesen Prozess in<br />
seiner Gänze mit den Mitteln der Entscheidungstheorie<br />
zu verstehen, ist das<br />
Vorhaben, dem sich Tröndle mit seinen<br />
Projekten widmet. Der nächste Baustein<br />
dazu wird die Untersuchung zur Frage<br />
Eine Teilnehmerin von eMotion mit Datenhandschuh<br />
vor einem Werk von On Kawara<br />
„Wie wird Kunst?“ sein.<br />
Eine Entscheidung, über die mancher<br />
Protagonist des Ausstellungsbetriebs<br />
wohl lieber nicht besonders viel mehr<br />
wissen möchte, ist diejenige des Museumsbesuchers,<br />
wie lange er welches Bild<br />
betrachtet und warum. Zwar sind Untersuchungen<br />
zur Wanderung des Blicks<br />
bei der Betrachtung eines Einzelkunstwerks<br />
wie etwa der Nofretete-Büste<br />
schon längst Allgemeingut. Für ganze<br />
Ausstellungen gilt das jedoch nicht,<br />
zumal wenn subtilere Besucherreaktionen<br />
gemessen werden. Im Kunstmuseum<br />
St. Gallen wurden die Besucher der<br />
Ausstellung „11 : 1 (+ 3). Elf Sammlungen<br />
für ein Museum“ in den Sommermonaten<br />
zu Teilnehmern einer „psychogeographischen<br />
Kartierung“. Das<br />
Nationalforschungsprojekt eMotion<br />
hatte sich vorgenommen, die Wirkung<br />
des Museums empirisch und experimentell<br />
zu untersuchen; an der Spitze<br />
des interdisziplinären Forschungsteams<br />
steht Martin Tröndle. Die Museumsbesucher<br />
werden mit Messgeräten ausgerüstet,<br />
die ihre Wegstrecke in der Ausstellung<br />
nachzeichnen und emotionale<br />
Aktivität anhand von Schweiß- und<br />
Blutdruckmessungen registrieren.<br />
Durch die Veränderung der Ausstellung,<br />
etwa das Umhängen der Bilder, hoffen<br />
die Initiatoren Aussagen über die Auswirkungen<br />
kuratorischer Entscheidungen<br />
auf das Besucherverhalten machen<br />
zu können. Tröndles Ansatz der Entscheidungsanalyse<br />
kommt hier also<br />
gleich mehrfach zur Anwendung, fügt<br />
sich allerdings gleichzeitig mit den<br />
beiden anderen Schwerpunkten seiner<br />
Arbeit zusammen.<br />
Da ist zum einen wiederum die Kunstforschung,<br />
für die er übrigens auch seit<br />
1. September 2009 eine Juniorprofessur<br />
an der Zeppelin Universität Friedrichshafen<br />
innehat. An eMotion wirken nicht<br />
nur Psychologen, Soziologen und Programmierer<br />
zusammen, auch der Medienkünstler<br />
Steven Greenwood und<br />
der Klangexperte Chadrasekhar Ramakrishnan.<br />
Sie werden die Ergebnisse<br />
des Projekts als visuelle und akustische<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
12<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Eindrücke erfahrbar machen, das Datenmaterial<br />
also künstlerisch-ästhetisch<br />
transformieren. Dabei sollen, wie auch<br />
sonst in der Kunstforschung, die methodische<br />
Offenheit und die situativ<br />
bestimmte Arbeitskultur der Künstler<br />
Erkenntnisse befördern, die mit dem<br />
festgefügten Methodenkanon der beteiligten<br />
Wissenschaften allein nicht erreicht<br />
werden könnten. Ebenso spiegelt<br />
sich in eMotion aber auch Tröndles<br />
Interesse am „Display“, also für die Erscheinung<br />
der Dinge in der Gesellschaft.<br />
Wie wird Kunst präsentiert? Wie tritt sie<br />
in unseren Alltag, wie rezipieren wir sie?<br />
Tröndle selbst fasst es so: „Letzten Endes<br />
bin ich insoweit eine Art Oberflächenwissenschaftler.<br />
Ich interessiere<br />
mich für die Oberfläche der Dinge, für<br />
ihr Erscheinen.“ Dieser Ansatz sollte<br />
nicht mit Oberflächlichkeit verwechselt<br />
werden, schließt er doch gerade die für<br />
die Existenz des Künstlers und die Anerkennung<br />
seines Schaffens existenzielle<br />
Lücke zwischen dem Kunstwerk und<br />
seinem Publikum.<br />
Gerade diese Distanz möchten auch die<br />
teilnehmenden Musiker von Concerto 21.<br />
überwinden. Verschiedene Ansätze<br />
sollen ihnen ihr Vorhaben erleichtern<br />
und werden in Siggen von Experten auf<br />
dem jeweiligen Gebiet vermittelt. Analysen<br />
der Publikumssoziologie und des<br />
Musikmarktes stehen am Anfang des<br />
Kursprogramms, das nach dem Grundlagenbefund<br />
mit Einheiten zur Dramaturgie<br />
und Inszenierung des Konzerts<br />
fortgesetzt wird. Patentrezepte werden<br />
Menschen<br />
an dieser Stelle allerdings nicht vermittelt,<br />
denn das zukunftsfähige Konzert<br />
gibt es nicht, wie Tröndle betont. Wofür<br />
den Teilnehmern allerdings die Augen<br />
geöffnet werden sollen, ist die Vielzahl<br />
der Darbietungsformen neben dem<br />
herkömmlichen Konzert der bürgerlichen<br />
Tradition. Im abschließenden Feld<br />
von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit<br />
sind die Methoden dann weniger experimentell,<br />
hier verlangt die in dieser<br />
Hinsicht nur sehr begrenzte Ausbildung<br />
der Musikhochschulen oftmals, überhaupt<br />
erst einmal eine Professionalisierung<br />
zu erreichen. Trotzdem kopiert<br />
Tröndle nicht etwa das gängige Handwerkszeug<br />
der Konsumgüterindustrie,<br />
sondern vermittelt spezifische Kenntnisse<br />
für den Musikmarkt, die in diesem<br />
gegenüber multimedialem Marketing<br />
höchst affinen Bereich auch die Nutzung<br />
des Internets und der gängigen<br />
Portale und Kommunikationsinstrumente<br />
einschließt. Von den Methoden<br />
der Wirtschaft zu lernen, ohne dabei das<br />
Kunstwerk zum bloßen Verkaufsobjekt<br />
zu degradieren, das ist das Ziel dieses<br />
Lernprozesses.<br />
Solches Lernen durch den Blick über<br />
den Tellerrand funktioniert übrigens<br />
auch umgekehrt. Unter dem Stichwort<br />
„Wirtschaftsästhetik“ versammelt<br />
Tröndle seine Untersuchungen zu der<br />
Frage, welche Lehren die Betriebswirtschaftslehre<br />
durch Transformation aus<br />
dem Kunstbetrieb ziehen könne. Seit<br />
jeher integriert sie in Wellen Strukturen<br />
und Denkmodelle aus anderen Wissen-<br />
13<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Menschen<br />
schaften, beispielsweise den Ingenieurswissenschaften,<br />
der Soziologie, der<br />
Psychologie, der Mathematik oder der<br />
Biologie und adaptiert diese für die<br />
Formung betrieblicher Prozesse. „Mit<br />
dem Begriff Wirtschaftsästhetik versuche<br />
ich die Kunst als Lern- und Referenzfeld<br />
zu öffnen für die Wirtschaftswissenschaft“,<br />
erläutert Tröndle sein<br />
Konzept. Ein Beispiel ist seine Veröffentlichung<br />
zu der Frage, welche Prinzipien<br />
der Organisation eines Orchesters auch<br />
in der freien Wirtschaft anwendbar sein<br />
könnten. „Die Orchester arbeiten in<br />
einer Produktionsform, die seit über<br />
hundert Jahren gleich geblieben ist. Das<br />
ist faszinierend für die Organisationsforschung.<br />
Wie schaffen es etwa so viele<br />
Musiker, so präzise und nach dem gleichen<br />
ästhetischen Grundgedanken<br />
einen Ton zu spielen?“. Auch diese<br />
Fragen tragen wie Tröndles übrige Arbeit<br />
indirekt zum Verstehen des Kunstwerks,<br />
seiner Entstehung und Rezeption<br />
bei. So steht am Ende aller seiner Projekte<br />
im Idealfall ein zugänglicheres, besser<br />
auf die Bedürfnisse des Publikums zugeschnittenes<br />
und in seiner Vermittlung<br />
reflektiert arbeitendes Kulturwesen. Nur<br />
eines wird sich nicht ändern: Die Auseinandersetzung<br />
und Kommunikation mit<br />
dem Kunstwerk, die Entwicklung eines<br />
Geschmacks und die Bildung eines<br />
ästhetischen Urteils bleiben die schwierige<br />
Aufgabe und zugleich das bereichernde<br />
Vorrecht des Betrachters und<br />
Zuhörers selbst.<br />
lo<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
LINKS UND LITERATUR<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
www.kunstpartner.com Webseite von Martin Tröndle mit Informationen zu allen<br />
Projekten und der dahinter stehenden Forschungsphilosophie<br />
http://www.mapping-museum-experience.com Webseite des Projekts eMotion<br />
Tröndle, Martin (Hrsg.), Das Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische<br />
Form, transcript, 2009, ISBN 978-3-8376-1087-1<br />
Tröndle, Martin, Entscheiden im Kulturbetrieb: Integriertes Kunst- und Kulturmanagement,<br />
Ott, 2006, ISBN 978-3-7225-0041-6<br />
14<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Auf musikalischer Bärenjagd<br />
Der Hamburger Max-Brauer-Preis 2009<br />
Thema<br />
Wie können Kinder an Musik und Literatur herangeführt werden? Auf welchen Wegen ist<br />
es möglich, sie für Lesen und Musizieren zu begeistern? Eine Antwort auf diese Fragen gibt<br />
die Arbeit der Max-Brauer<br />
Brauer-Preisträger 2009, die für ihr erfolgreiches Engagement in einem<br />
ebenso ungewöhnlichen wie festlichem Rahmen geehrt wurden.<br />
Wissensvermittlung ist nicht leicht,<br />
auch nicht auf Preisverleihungen. Dort<br />
soll schließlich nicht nur der oder die<br />
geehrte Person oder Institution in würdigem<br />
Rahmen eine Auszeichnung<br />
erfahren. Preisverleihungen sind auch<br />
ein Rahmen, in dem ihre verdienstvolle<br />
Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt<br />
wird und vermittelt werden soll, worin<br />
gerade das Neuartige, Überdurchschnittliche,<br />
Besondere, kurzum: Preiswürdige<br />
dieser Tätigkeit liegt. Die Leselernhelfer<br />
von MENTOR HAMBURG<br />
e.V. und die Mitarbeiterinnen des Klingenden<br />
Museums Hamburg kennen aus<br />
eigener Erfahrung die Schwierigkeiten,<br />
denen solche Informationsvermittlung<br />
begegnen kann, ist es doch ihre selbstgestellte<br />
Aufgabe, Kindern Kenntnisse,<br />
Fertigkeiten und vor allem Neugier<br />
weiterzugeben. Das klappt, ob beim<br />
Entdecken der Literatur, dem Spielen<br />
eines Instruments oder eben auf einer<br />
Preisverleihung, am Besten durch eigenes<br />
Ausprobieren. Und wer auch nach<br />
den visuellen Eindrücken filmischer<br />
Kurzporträts und der akustischen Information<br />
durch ebenso eindrückliche<br />
wie liebevolle Laudationes noch nicht<br />
recht wusste, was er sich unter den<br />
Trägern des Max-Brauer-Preises 2009<br />
Anke Fischer bei der Bärenjagd<br />
vorzustellen habe, der wurde spätestens<br />
durch Anke Fischer von der unwiderstehlichen<br />
Wirkung aktiven Lernens<br />
überzeugt. Selten dürfte eine Festgesellschaft<br />
so einmütig im Takt geklatscht,<br />
getrampelt und fröhlich gelärmt haben,<br />
15<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
wie bei der Rhythmusübung, mit der die<br />
museumspädagogische Leiterin für den<br />
Bereich „Piccolo“ (5 bis 7 Jahre) das<br />
Publikum auf eine imaginierte Bärenjagd<br />
mitnahm.<br />
Durch niedrige Hürden und altersgerechte<br />
Ansprache Kinder für Kultur<br />
begeistern zu wollen, das ist das Element,<br />
das beide Max-Brauer-Preisträger<br />
verbindet. Das Klingende Museum<br />
schafft dies bereits seit 20 Jahren. Gegründet<br />
wurde es durch den damaligen<br />
Generalmusikdirektor der Hamburgischen<br />
Staatsoper, Professor Gerd Albrecht,<br />
der auf der Preisverleihung ein<br />
Dankeswort sprach. Seine Idee hat inzwischen<br />
Ableger gefunden, in Berlin<br />
und München, entstanden ist sie aber in<br />
Hamburg. Programme wie Classico für<br />
Menschen ab acht Jahren und Piccolo für<br />
kann. Wie deutlich sich dieses Konzept<br />
von manch überkommener Vorstellung<br />
eines Museums unterscheidet, das unterstrich<br />
die Librettistin Theresita Colloredo<br />
in ihrer Laudatio, in der Sie solche<br />
lebendigen Erfahrungen mit ihrer ersten<br />
Kindheitserinnerung an einen Besuch<br />
im Naturhistorischen Museum kontrastierte,<br />
wo staubige Vitrinen und trocken<br />
formulierte Hinweisschilder sie abschreckten.<br />
Während man sich kaum<br />
vorstellen kann, dass von einem solchen<br />
Eindruck ein weitergehendes Interesse<br />
im Kind geweckt wird, ist das Klingende<br />
Museum Hamburg für viele Besucher<br />
ein Ausgangspunkt für den Unterricht<br />
an einem Instrument. Der Erfolg, den die<br />
Einrichtung mit ihrem Konzept erlebt,<br />
soll demnächst mit einem „Klingenden<br />
Mobil“ — ein mit Instrumenten beladener<br />
Transporter — auch außerhalb der<br />
Räume der Laeiszhalle — Musikhalle<br />
Hamburg, in denen das Museum untergebracht<br />
ist, erzielt werden.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Kinder von fünf bis sieben Jahren ermöglichen<br />
es den potentiellen Nachwuchsmusikern,<br />
die über 200 Instrumente<br />
der Sammlung des Museums<br />
anzufassen, auszuprobieren und schließlich<br />
ein Stück von jener Faszination der<br />
Musik mit nach Hause zu nehmen, die<br />
nur durch das eigene Erlebnis entstehen<br />
Der Alltag der Leselernhelfer, die seit<br />
2004 in Hamburg unter dem Dach von<br />
MENTOR HAMBURG e.V. tätig sind, ist<br />
im Vergleich atmosphärisch naturgemäß<br />
ruhiger, das Engagement der Beteiligten<br />
aber genauso tatkräftig vorwärtsdrängend<br />
wie im Klingenden Museum<br />
Hamburg. Die Aufgabe, die sich der<br />
Verein stellt, ist es, mit den Schülerinnen<br />
und Schülern, die von ihren Schulen<br />
vorgeschlagen werden, Texte gemeinsam<br />
zu erarbeiten und das Lesen zu<br />
üben. Gleichzeitig tauchen die Kinder,<br />
die von zuhause häufig keine Erfahrung<br />
16<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
mit Büchern haben, in die Welt der<br />
Literatur ein und erleben so die Kraft,<br />
die aus der Verbindung von gelesenen<br />
Geschichten und ihrer Fantasie entstehen<br />
kann. Das geschieht nicht in einer<br />
bloß anderen Form der Schulklasse,<br />
sondern in der freundlichen Atmosphäre<br />
der Mentor-Stunde, in der zwischen<br />
Mentor und Schüler ein Betreuungsverhältnis<br />
von 1:1 herrscht. Der Kreis der<br />
Mentorinnen und Mentoren bildet sich<br />
ausschließlich durch das freiwillige<br />
Engagement der zahlreichen Vereinsmitglieder.<br />
In den Worten der Laudatio<br />
von Dr. Claudia Langen, Geschäftsführerin<br />
von Big Brother Big Sisters Deutschland:<br />
„Sie schenken Kindern Zeit, um bei<br />
ihnen Verständnis, Interesse und<br />
schließlich sogar Begeisterung für das<br />
Lesen zu wecken“. Sie wies auch nicht<br />
zuletzt noch einmal auf den schweren<br />
Stand hin, unter dem das Lesen inzwischen<br />
in der kindlichen Bildung allen<br />
Erhebungen zu Folge leidet. Zumindest<br />
für die 1200 Kinder, denen MENTOR —<br />
Die Leselernhelfer e.V. in den fünf Jahren<br />
seines Bestehens das Lesen erleichtert<br />
hat, hat sich dieser beklagenswerte<br />
Umstand zum Besseren gewendet.<br />
Thema<br />
Zu den bereits erwähnten Merkmalen<br />
einer Preisverleihung gehören auch der<br />
Ort und das Rahmenprogramm. Sie<br />
sprachen bei der Übergabe des Max-<br />
Brauer-Preises am 15. Juni die Sprache<br />
der Preisträger: Auf der Bühne des Thalia-Zeltes<br />
im Hamburger Seelemannpark<br />
erlebten die 450 Besucher Lustiges<br />
und Traumhaftes: Die „MENTOR-<br />
Clowns“ — Kinder, die bei MENTOR Die<br />
Leselernhelfer HAMBURG e.V. lesen<br />
üben und sich für die Preisverleihung<br />
von der Zirkusschule „Die Rotznasen“<br />
zu Clowns „schulen“ ließen — bescherten<br />
der Verleihung einen schwungvollen<br />
Einstieg. Und in einer Zusammenarbeit<br />
beider Preisträger begaben sich später<br />
lesende und musizierende Kinder auf<br />
eine Fantasiereise zum Mond. Und<br />
wieder wurde auf solche Weise anschaulich<br />
und plastisch, was selbst die treffenden<br />
Worte des Kuratoriums nicht besser<br />
deutlich machen können: „Das Klingende<br />
Museum und MENTOR — Die Leselernhelfer<br />
HAMBURG e.V. sind zwei<br />
Einrichtungen, deren Ziel es ist, Kindern<br />
den Zutritt zu ihnen verborgenen Welten<br />
zu öffnen. Ob Musik oder Geschichten<br />
– beides beflügelt die Phantasie, die<br />
notwendig ist, um das eigene Leben<br />
gestalten zu können.“<br />
lo<br />
17<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
Der Hamburger Max-Brauer-Preis der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. ist mit 15.000 € dotiert<br />
und zeichnet Persönlichkeiten und Einrichtungen in der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
aus, die sich besondere Verdienste um das kulturelle, wissenschaftliche oder geistige<br />
Leben der Stadt erworben oder außerordentliche Impulse für die Erhaltung und Erneuerung<br />
der Stadt, ihrer Architektur und Baudenkmäler, ihres Stadt- und Landschaftsbildes<br />
sowie ihrer Tradition und ihres Brauchtums gegeben haben. Die Preisträger werden durch<br />
ein unabhängiges Kuratorium gewählt.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Der Preis wird seit 1993 vergeben und ist der letzte Preis, den der Stifter geschaffen hat.<br />
Der Preis ist dem Andenken an den bedeutenden letzten Oberbürgermeister von Altona<br />
vor 1933 und ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg nach 1946, Max<br />
Brauer (1887-1973), gewidmet. In seinem Zusammenhang wurden letztmals 2009 auch<br />
die Europäischen Schulwanderstipendien an Hamburger Schulen vergeben.<br />
LINKS<br />
<br />
<br />
<br />
www.klingendes-museum.de Die Web-Präsenz der Klingenden Museen in Hamburg<br />
und Berlin und des Klingenden Mobils<br />
www.mentor-hamburg.de Der Verein MENTOR — Die Leselernhelfer HAM-<br />
BURG e.V.<br />
www.elbphilharmonie.de Die Arbeit des Klingenden Museums bildet einen Baustein<br />
im Jugendprogramm der Elbphilharmonie Hamburg<br />
18<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Wertvolles Lernen<br />
Die Bildungsförderung der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
Thema<br />
Kinder brauchen Anregungen. Sie benötigen eine an Angeboten reiche Umwelt, in der sie<br />
ihre Talente entdecken und ihre Kreativität entfalten können. Die Max-Brauer<br />
Brauer-Preisträger<br />
2009 leisten hierzu einen wichtigen Beitrag und setzten neue Impulse in der Hamburger<br />
Bildungslandschaft. Als Partner der Kinder stellen die Initiativen eine wertvolle Ergänzung<br />
zu den Programmen der Hamburger Bildungsinstitutionen stitutionen dar. Im Fokus der <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. standen dieses Jahr, neben der Vergabe des Max-Brauer<br />
Brauer-Preises,<br />
weitere Förderungsaktivitäten im Bildungsbereich. Der folgende Beitrag blickt auf abge-<br />
schlossene zurück und auf kommende voraus.<br />
In den letzten Jahren waren, ausgelöst<br />
durch die PISA-Studie, starke Veränderungsprozesse<br />
im Bildungssystem zu<br />
beobachten. Neue Schwerpunkte, wie<br />
eine stärkere Individualisierung des<br />
Unterrichts, wurden in der Lehrerbildung<br />
sowie auch in der Unterrichtspraxis<br />
aufgenommen und umgesetzt. Zu<br />
den im Ansatz flächendeckenden Förderinitiativen<br />
des Bundes und der Länder<br />
gesellten sich bald mittlere und<br />
kleinere Programme anderer Akteure,<br />
darunter auch aus dem <strong>Stiftung</strong>ssektor.<br />
Die Vielzahl der Baustellen, an denen<br />
augenblicklich gleichzeitig im deutschen<br />
Bildungssystem gearbeitet wird,<br />
macht auch diese auf ganz bestimmte<br />
Aspekte konzentrierten Aktivitäten<br />
notwendig und lässt sie zu Puzzleteilen<br />
im großen Ganzen werden.<br />
Die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. versammelt<br />
ihre Programmaktivitäten auf<br />
diesem Feld in ihrem Programmbereich<br />
WerteDialog, die sich entsprechend<br />
unter der übergreifenden Frage „Was ist<br />
wichtig?“ vor allem auf das Thema der<br />
Werte konzentrieren, aber auch andere<br />
Aspekte wie etwa die Kooperation von<br />
Schule und Jugendhilfe im Blick haben.<br />
Den Ausgangspunkt bildete der Wett-<br />
Gruppenarbeit während eines Mentorenseminars<br />
19<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
bewerb zur Werteerziehung an Hauptschulen,<br />
in dessen Rahmen die <strong>Stiftung</strong><br />
in Kooperation mit dem Bundesverband<br />
der deutschen Arbeitgeberverbände<br />
zehn Schulen für gute Konzepte und<br />
Ideen auszeichnete, die die Vermittlung<br />
von Werten auf erfolgreiche Weise in<br />
den schulischen Unterricht einbinden.<br />
Dabei geht es nicht um die bevormundende<br />
Erziehung zu bestimmten Weltbildern<br />
oder Wertanschauungen, sondern<br />
um die Einübung grundlegender<br />
Verhaltensmaximen wie etwa respektvollen<br />
Umgangs und gewaltfreier Konfliktlösung.<br />
Wie dringend diese Themen<br />
gerade, wenn auch nicht nur im Bereich<br />
der Hauptschulen sind, zeigte die kurz<br />
zuvor in Gang gekommene Debatte im<br />
Gefolge offener Brandbriefe einiger<br />
Lehrerkollegien. Diejenigen Schulen<br />
unter den Wettbewerbsteilnehmern<br />
und —gewinnern, die ihre Projekte auf<br />
einer auch theoretischen Grundlage<br />
weiter zu entwickeln suchten, nahmen<br />
anschließend an dem Mentorenprogramm„Worauf<br />
es ankommt“ teil, dessen<br />
Abschlussseminar im vergangenen<br />
Juni stattfand. In insgesamt vier Seminareinheiten<br />
wurden Blöcke zur<br />
Werterziehung und zur systemischen<br />
Beratung und Kommunikation zusammengefasst<br />
und den 27 Teilnehmenden<br />
aus 13 Haupt- und Volksschulen vorgestellt.<br />
Nicht nur diese grundlegende<br />
Arbeit war indes für die partizipierenden<br />
Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet<br />
von Gewinn, sondern auch der<br />
Erfahrungsaustausch über die Grenzen<br />
der Bundesländer hinweg, der auch nach<br />
dem Ende des Programms fortgeführt<br />
werden soll.<br />
Anders als das Mentorenprogramm, das<br />
lokal weit und hinsichtlich des Schultyps<br />
eng gefasst war, sprach der Fachtag 360°<br />
zur Zusammenarbeit von Schule und<br />
Jugendhilfe im November 2008 sämtliche<br />
Schulformen an, beschränkte sich<br />
aber auf das Gebiet Hamburgs. Das hat<br />
seinen Sinn: Gerade die Kooperation der<br />
unterschiedlichen Bildungsträger und<br />
Jugendeinrichtungen, die Verknüpfung<br />
der formellen und informellen Lernorte<br />
sowie zwischen Politik und Zivilgesellschaft<br />
muss notwendigerweise auf einer<br />
lokalen Ebene gelingen. Nur wenn dort<br />
ein enges Netz aus Auffangmöglichkeiten<br />
und Angeboten geknüpft wird,<br />
können auch jene Schüler und Schülerinnen<br />
Teil des Bildungssystems bleiben,<br />
die von diesem bisher meist verloren<br />
gegeben werden mussten. Wie diese<br />
Kooperation gelingen kann, das diskutierten<br />
über 220 teilnehmende Vertreter<br />
der beteiligten Institutionen in einem<br />
Tagungsprogramm aus Vorträgen,<br />
Podiumsdiskussionen, Workshops und<br />
Exkursionen.<br />
Auf dem Fachtag 360°<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
20<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Thema<br />
Dass die stetige Verbesserung der<br />
Schullandschaft einen lokalen Ansatz<br />
erfordert ist auch die leitende Ansicht<br />
des Programms „Lernen vor Ort“. Dabei<br />
handelt es sich um eine in diesem Umfang<br />
einzigartige öffentlich-private Partnerschaft<br />
zwischen dem Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung und<br />
einem <strong>Stiftung</strong>sverbund, die Bildungsinstitutionen<br />
vor Ort miteinander vernetzen<br />
soll. Seit diesem Jahr haben Kommunen<br />
die Möglichkeit, am Förderprogramm<br />
teilzunehmen und mit Unterstützung<br />
örtlicher <strong>Stiftung</strong>en ihre Bildungslandschaft<br />
mithilfe eines integrierten<br />
Management zu verbessern. Auch<br />
die Freie und Hansestadt Hamburg ist<br />
eine ausgewählte Förderregion. Ihr<br />
werden in den nächsten Jahren Patenstiftungen<br />
zur Seite stehen, die ihre<br />
Expertise zur Verfügung stellen und eine<br />
jährliche Bildungskonferenz organisieren.<br />
Neben der Körber-<strong>Stiftung</strong> und der<br />
Haspa Hamburg <strong>Stiftung</strong> wird auch die<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. zu diesem<br />
Kreis zählen.<br />
lo<br />
LINKS<br />
Ein Kurzporträt des Mentorenprogramms sowie ein Bericht über den Fachtag 360°<br />
sind auf der Homepage der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. abrufbar.<br />
www.lernen-vor-ort.info Webseite des Programms „Lernen vor Ort“<br />
21<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
Ihre <strong>Stiftung</strong>szwecke verfolgt die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. grundsätzlich operativ, das<br />
heißt mit eigenen Projekten. In sehr begrenztem Umfang werden allerdings Förderungen<br />
für einzelne Projekte ausgesprochen, darunter auch im Bildungsbereich. Zwei Beispiele aus<br />
den letzten Monaten illustrieren dies:<br />
Zum dritten Mal fand in der vergangenen Spielzeit die Kinderbuchmatinee der Hamburger<br />
Autorenvereinigung statt. In den Räumlichkeiten des Deutschen Schauspielhauses Hamburg<br />
wird an jedem dritten Sonntag im Monat um 11 Uhr eine Lesung organisiert, die<br />
Kindern den Zugang zur Literatur näher bringen und ihr Interesse am Lesen wecken soll.<br />
Auch die Hamburger Öffentlichen Bücherhallen wirken bei der Veranstaltungsreihe mit<br />
und Teilnehmer von Jugend musiziert begleiten einige Termine musikalisch. Mit einer<br />
breiten Variation von Themen schafft die Hamburger Autorenvereinigung Abwechslung<br />
im Programm, entsprechend schwankt das vorgeschlagene Mindestalter der Zuhörer<br />
zwischen vier und neun Jahren. Sie können erleben, wie Marie und Jonathan ihrem Vater,<br />
einem Komponisten, zu einem Konzert in der Musikhalle verhelfen. Sie folgen Lale bei<br />
seinen Abenteuern, als er von seiner kranken Großmutter gebeten wird, einen goldenen<br />
Brief zuzustellen. Und sie hören, wie es in der Freundschaft zwischen Katja und Kristin<br />
kriselt, als ein Umzug und die erste Liebe das Ende der Grundschulzeit einläuten.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Längst weit über Hamburg hinaus bekannt ist Kampnagel, ein Zentrum für zeitgenössische<br />
darstellende Kunst auf dem Gelände einer alten Maschinenfabrik. Beim internationalen<br />
YoungStar Fest findet Kunst von Jugendlichen für Jugendliche statt. Choreographen, Regisseure,<br />
Musiker und andere Künstler präsentieren die Ergebnisse der Projekte, in denen<br />
sie mit Hamburger Jugendlichen zusammengearbeitet haben; vier Gastspiele ergänzten<br />
2009 das Programm. Außerdem finden im Rahmen des Festivals Workshops, Bandkonzerte,<br />
ein Symposium und eine Schultheaterwoche statt. Auch dieses Feuerwerk ungewöhnlicher,<br />
frischer und dynamischer Ideen wurde unter anderem von der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
F.V.S. gefördert. Dabei versteht sich das YoungStar Fest als eine neue Form ästhetischen<br />
Lernens und kultureller Bildung, deren Kennzeichen die Orientierung am Alltag und<br />
den Erfahrungen der Jugendlichen ist. Konkret wird dies zum Beispiel anhand des Projekts<br />
„Young Writers“, in dem die Autoren Feridun Zaimoglu und Günter Senkel mit Schülern<br />
an der Gesamtschule Kirchdorf/Wilhelmsburg Theaterstücke zu Themen der Jugendlichen<br />
schreiben. Auch die Teilnehmer von „660@k6“ erzählen ihre Geschichten, allerdings<br />
unter Leitung von Samir Akika in Bildern, Choreographien und Musik aus der HipHop-<br />
Kultur.<br />
www.kampnagel.de<br />
www.hamburger-autorenvereinigung.de<br />
22<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Nicht nur für Kinder<br />
Das Museum als Bildungsort für alle Altersstufen<br />
Thema<br />
Das Klingende Museum Hamburg ist das erste und einzige Museum, in dem die Besucher<br />
alle Instrumente anfassen und ausprobieren dürfen. In der Museumspädagogik ist dieses<br />
Konzept unter dem d<br />
Stichwort „Hands on“ mittlerweile zu einer beliebten Methode ge-<br />
g<br />
worden, um vom klassischen Typus der um wenige Anmerkungen ergänzten Vitrinenprä-<br />
sentation wegzukommen. Aber auch andere Konzepte tragen zur Erneuerung der Inhalts-<br />
vermittlung im Museum bei.<br />
Drei Programme werden im Souterrain<br />
der Laeiszhalle — Musikhalle Hamburg<br />
angeboten, gestaffelt nach dem Alter<br />
der Besucher des Klingenden Museums:<br />
An Menschen zwischen vier und sieben<br />
Jahren richtet sich „Piccolo“: Durch eine<br />
Geschichte lernen die Kinder ausgewählte<br />
Instrumente kennen. Breiter<br />
gefächert ist das Angebot „Classico“, in<br />
dem Besucher ab 8 Jahren nach einer<br />
kurzen Einführung die über 100 Instrumente<br />
der Sammlung in die Hand nehmen<br />
und ausprobieren dürfen. Unter<br />
Anleitung von Profis werden sie mit der<br />
Musik auf diesem Wege nicht einfach<br />
konfrontiert, sondern erleben die Entstehung<br />
von Tönen unmittelbar. In einer<br />
dritten Variante für Menschen ab 10<br />
Jahren schließlich, die unter dem Titel<br />
„speciale“ läuft, werden in gleicher Weise<br />
die Holz- und Blechblasinstrumente<br />
näher unter die Lupe genommen. Im<br />
Zentrum dieses Ausprobierens und<br />
Benutzens der Ausstellungsobjekte<br />
steht die eigene Aktivität der Besucher,<br />
weshalb die Museumspädagogik für<br />
solche Konzepte den Begriff der handlungsorientierten<br />
Methoden entwickelt<br />
hat. Der Museumsbesuch herkömmlicher<br />
Form wird dagegen vorrangig mit<br />
medialer und personaler Informationsvermittlung<br />
begleitet. Auch hinter diesen<br />
Begriffen können sich allerdings<br />
äußerst verschiedene Wege verbergen,<br />
dem Publikum ein Exponat näher zu<br />
bringen, vom dürr beschrifteten Hinweisschild<br />
bis zum multimedial unterstützten<br />
Museumsguide mit Hintergrundinformationen<br />
und zahlreichen<br />
Verweisen.<br />
„Hands on!“, diese Forderung wird bisher<br />
vor allem im Bereich der Kinderund<br />
Jugendpädagogik in den Museen<br />
umgesetzt. Im Hubertus Wald Kinderreich<br />
des Museums für Kunst und Gewerbe<br />
Hamburg können die Besucher<br />
aus ähnlichen Altersgruppen wie auch<br />
23<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
im Klingenden Museum Gegenstände<br />
des Alltags in spielerischer Form kennen<br />
lernen. Dieser „Garten der Dinge“ wirkt<br />
aber nur auf den ersten Blick wie eine<br />
Realität gewordene Illustration zu einem<br />
Kinderbuch. Bei genauerem Hinsehen<br />
entdeckt man zahlreiche Objekte,<br />
die voneinander isoliert auch in der<br />
Design-Abteilung des Museums und<br />
anderer vergleichbarer Häuser gezeigt<br />
werden. Hier gruppieren sie sich als<br />
buntes Sammelsurium der Sitzgelegenheiten<br />
um den Tisch in der Mitte des in<br />
verschiedene Erlebniswelten unterteilten<br />
Raumes oder verstecken sich in der<br />
„Hecke zu Nachbars Garten“. Dieses<br />
Konzept kommt an, in den ersten elf<br />
Monaten nach der Eröffnung im Februar<br />
2008 besuchten 6.500 Kinder die Kellerräume<br />
des Museums. Im Augenblick<br />
wird das Hubertus Wald Kinderreich<br />
daher um neue Spielstationen und eine<br />
Werkstatt ergänzt. Außerdem entwickelte<br />
das Museum einen Audioguide,<br />
der gerade die schüchternen Kinder<br />
motivieren soll, das Angebot des Gartens<br />
der Dinge umfassend zu nutzen.<br />
Diese Erweiterungs- und Umbausmaßnahmen<br />
werden auch mit Förderung der<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. verwirklicht.<br />
Hinter der Idee des Kinderreichs steht<br />
vor allem der Leiter der Abteilung<br />
Kommunikation, Gestaltung/Pädagogik<br />
des Museums, Nils Jockel. Er sieht den<br />
Raum als eine Form des „idealen Museums“,<br />
das den Besucher verwickelt und<br />
dessen Aufforderungscharakter den<br />
Besucher in seinen Bann schlägt. Denn<br />
museumspädagogische Konzepte müssen<br />
keinesfalls nur die Jüngsten betreffen:<br />
Auch erwachsenen Besuchern muss<br />
Kunst erst nahe gebracht werden. Auch<br />
sie benötigen Hintergrundinformationen<br />
und können zum Beispiel durch<br />
Berühren und Verwenden bestimmte<br />
Exponate besser verstehen. Während<br />
Sonderausstellungen auf diese Bedürfnisse<br />
meist mehr oder weniger gut<br />
eingestellt sind, weil sie eine bestimmte<br />
Grundaussage und ein thematisches<br />
Konzept beinhalten, werden die Sammlungen<br />
vieler Museen in der ständigen<br />
Ausstellung meist vernachlässigt. Karge<br />
Hinweisschilder setzen einen Bildungshorizont<br />
des Betrachters voraus, der ein<br />
Studium in Kunst- oder Kulturgeschichte<br />
erfordert. Museumsführer spulen ihr<br />
angelerntes Programm ab, ohne auf die<br />
Zusammensetzung der Besuchergruppe<br />
oder ihre Erwartungen einzugehen. Nils<br />
Jockel bezeichnet diese Form museumspädagogischer<br />
Ignoranz ironisch als<br />
„klassische Schlossführung“. Auch für<br />
die doch eigentlich erstaunliche Tatsache,<br />
dass solche Verkennung der Nutzerinteressen<br />
meist nicht auf Widerspruch<br />
stößt, gibt Jockel eine Erklärung:<br />
„Museen sind grundsätzlich einschüchternde<br />
Orte. Zwar soll Kunst durchaus<br />
verunsichern und Gewissheiten erschüttern.<br />
Trotzdem ist es nicht das Ziel, dass<br />
sich die Besucher unecht verhalten, was<br />
sie heute meist tun. Deshalb müssen sie<br />
durch geeignete Methoden entspannt<br />
werden, um sich wirklich für die ausgestellte<br />
Kunst zu öffnen.“ Die Ursache der<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
24<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Einschüchterung, nämlich die Ritualisierung<br />
des Museumsbesuchs, hat viele<br />
Gründe. Dazu gehört die Scheu, Wissenslücken<br />
zu offenbaren und nachzufragen.<br />
Ein Beispiel: Das Museum, das<br />
wie selbstverständlich davon ausgeht,<br />
dass der Betrachter eines barocken<br />
Gemäldes bei der schlichten Kennzeichnung<br />
„Amor und Psyche“ die dahinter<br />
stehende Handlung der griechischen<br />
Mythenwelt kennt, verfehlt in der<br />
Regel die Realität der Besucher. Dann<br />
aber bleibt das Werk faktisch gänzlich<br />
kommentarlos. Die ausgestellte Kunst<br />
wird häufig dennoch wirken, aber ein<br />
Lernort entsteht auf diese Weise nicht.<br />
Viele Museen haben die Problematik<br />
längst erkannt und versuchen, mit speziellen<br />
Angeboten und Programmen<br />
oder durch die Neukonzeption ihrer<br />
Ausstellungen darauf zu reagieren.<br />
Trotzdem ist das „ideale Museum“ noch<br />
weit entfernt, in dem, wie Nils Jockel<br />
betont, auch keine speziellen Abteilungen<br />
für Kinder mehr notwendig wären:<br />
„Ein gutes Museum ist bereits an sich so<br />
spannend, dass es auch von Kindern<br />
erlebt werden kann.“ Für transferierbar<br />
hält er die Idee des Hubertus-Wald-<br />
Kinderreichs allerdings nicht, sondern<br />
plädiert vielmehr dafür, aus den Besonderheiten<br />
und dem Stil heraus eigene<br />
Antworten und Konzepte für die Museumspädagogik<br />
zu finden. Berücksichtigen<br />
muss man dabei auch, dass nicht<br />
jede Ausstellung ein „Hands-on“-<br />
Konzept erlaubt. Die Designobjekte des<br />
Museums für Kunst und Gewerbe sind<br />
Thema<br />
nicht unersetzlich, historische Exponate<br />
dagegen müssen zwingend vor dem<br />
Publikum geschützt werden. Trotzdem<br />
ist Innovation auch unter anderen Umständen<br />
möglich, wenn sie andere Wege<br />
geht. Die Forschungen von Dr. Martin<br />
Tröndle sind ein Beispiel dafür, wie auf<br />
ernsthafte Weise das Erlebnis Museum<br />
wahrnehmungspsychologisch und kulturwissenschaftlich<br />
hinterfragt werden<br />
kann (Seite 9). Häufig bleiben Initiativen,<br />
die die Öffnung des Museums für<br />
neue Besuchergruppen bezwecken,<br />
dagegen an der Oberfläche. Die mittlerweile<br />
bundesweit etablierten „Langen<br />
Nächte der Museen“ etwa setzen auf<br />
den Event-Charakter. Wie viel damit für<br />
das Museum als Bildungseinrichtung<br />
gewonnen ist, bleibt die Frage.<br />
Die Erkenntnis, dass museumspädagogische<br />
Fragen nicht nur Kinder betreffen<br />
und außerdem nicht mit PR verwechselt<br />
werden dürfen, stand auch am Anfang<br />
des Fellowships für Kulturinnovation<br />
von Dr. Carolin Kollewe, das die <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. von 2007 bis<br />
2009 förderte. Zu den Projekten, die sie<br />
bei den Staatlichen Ethnographischen<br />
Sammlungen Sachsen verwirklichte,<br />
gehörte eine Untersuchung zu der Frage,<br />
welche museumspädagogischen<br />
Anforderungen ältere Menschen stellen<br />
und wie diese berücksichtigt werden<br />
können. Das Ergebnis: Spezielle Angebote<br />
für Senioren schrecken eher ab,<br />
denn die negative Konnotation des<br />
Alterns in unserer Gesellschaft hat zur<br />
Folge, dass viele Besucher sich nur un-<br />
25<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Thema<br />
gern dieser Gruppe zurechnen. Ausnahmen<br />
gelten selbstverständlich für<br />
Besucher mit eingeschränkter Mobilität<br />
oder in Details, wie etwa bei der Uhrzeit<br />
des Museumsbesuchs, die aufgrund der<br />
Beiträge von Frau Kollewe nun mit einer<br />
neuen Mittagsführung berücksichtigt<br />
wird. Die übrigen Forderungen, die von<br />
Besuchern höherer Altersgruppen erhoben<br />
werden, kommen allen zugute:<br />
Eine höhere Nutzerfreundlichkeit, klare<br />
Ausschilderung, Sitzgelegenheiten in<br />
den Ausstellungsräumen, Serviceorientierung.<br />
Betrachtet man diese Ergebnisse<br />
auch im Licht der Erfahrungen aus der<br />
Kinderpädagogik, so liegt die Schlussfolgerung<br />
nahe, dass ein auf das Publikum<br />
abgestimmtes und gut konzipiertes<br />
Museum weniger Spezialangebote für<br />
bestimmte Altergruppen benötigt,<br />
sondern vielmehr von vornherein intergenerativ<br />
angelegt ist. Die dennoch<br />
notwendige Differenzierung kann sich<br />
dann von dieser Grundannahme aus<br />
entwickeln. So beschäftigen sich mit<br />
dem Thema der kulturellen Bildung für<br />
SeniorInnen schon jetzt verschiedene<br />
Initiativen, darunter das Institut für<br />
Bildung und Kultur e.V. in Nordrhein-<br />
Westfalen. Der gemeinnützige Verein<br />
koordiniert unter anderem das Europäische<br />
Zentrum für Kultur und Bildung im<br />
Alter („KUBIA“). Und gute Konzepte für<br />
den Museumsnachwuchs bleiben zukünftig<br />
ein wichtiges Thema, wie das<br />
Beispiel der Masterarbeit der <strong>Alfred</strong>-<br />
<strong>Toepfer</strong>-Stipendiatin Katarzyna Warpas<br />
zeigt. Eine Zusammenfassung ihrer<br />
Ergebnisse können Sie in diesem Netzwerkmagazin<br />
finden.<br />
lo<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
LINKS UND LITERATUR<br />
<br />
<br />
<br />
www.garten-der-dinge.de Das Hubertus-Wald-Kinderreich des Museums für<br />
Kunst und Gewerbe Hamburg<br />
www.ses-sachsen.de Die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen<br />
www.ibk-kultur.de Das Institut für Bildung und Kultur e.V.<br />
26<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Horizonte erweitern<br />
Die Sommerakademien des Stipendiatenkollegiums 2009<br />
Projekte<br />
Jedes Jahr im Sommer lädt die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. die Mitglieder ihres Stipendia-<br />
tenkollegiums sowie Stipendiaten der Gerda Henkel <strong>Stiftung</strong> und der Haniel <strong>Stiftung</strong> zu<br />
einer Akademiewoche in das Seminarzentrum Gut Siggen ein. Die vier angebotenen Se-<br />
S<br />
minarkurse, die sich immer auch an fachfremde Studierende wenden, finden in zwei Wo-<br />
W<br />
chen im Juni und Juli statt, auf die sich die Teilnehmenden verteilen. Die folgenden Erfah-<br />
rungsberichte richte geben einen Eindruck von der Struktur und Atmosphäre dieses Angebots,<br />
das einen Kernbestandteil der Stipendiatenförderung im Programm der <strong>Stiftung</strong> tung bildet.<br />
Erste Woche, 22. bis 27. Juni<br />
Vom ostholsteinischen Strand auf die<br />
Ostsee blickend erstreckt sich das typische<br />
Bild norddeutscher Küstenlandschaften:<br />
In alle Richtungen erkennt der<br />
Betrachter kaum den fernliegenden<br />
Horizont, hinter dem sich die Staaten<br />
Skandinaviens und des Baltikums leicht<br />
vermuten lassen. Die Horizonterweiterung,<br />
zu der die sommerlichen Seminare<br />
des Stipendiatenkollegiums der <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. herausfordern,<br />
geht darüber indes noch hinaus: Aus elf<br />
Ländern stammten die 18 teilnehmenden<br />
Mitglieder in der ersten Woche<br />
Mitte Juni und ähnlich differenziert<br />
zeigte sich das im Seminarzentrum Gut<br />
Siggen vertretene Fächerspektrum. Die<br />
Sommerakademien verstehen sich als<br />
Ort, an dem Menschen mit solch unterschiedlichen<br />
Hintergründen sich austauschen<br />
und einander kennenlernen.<br />
Gleichzeitig funktionieren sie als „Blockkurs“<br />
zu einem Thema, das den Blick der<br />
Stipendiaten über den Tellerrand der<br />
eigenen Fachdisziplin fokussiert. In der<br />
ersten Seminarwoche, die Ende Juni<br />
stattfand, beschäftigte sich in diesem<br />
Rahmen eine Gruppe mit der Entwicklung<br />
der Kunst zwischen den Kriegen in<br />
Europa, eine andere mit der Selbstfindung<br />
im autobiographischen Schreiben<br />
in der europäischen Literaturgeschichte.<br />
Auch insofern kam also der Blick über<br />
die Grenzen nicht zu kurz.<br />
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg<br />
verließ die Kunst in vielerlei Hinsicht<br />
bis dahin bestehende Konventionen<br />
und entwickelte zahlreiche neue<br />
Stile und Strömungen. Diese auf sich<br />
wirken zu lassen, zu analysieren und in<br />
ihren größeren Zusammenhang einzuordnen<br />
war der Gegenstand des Seminars<br />
von PD Dr. Walther Lang. Die Viel-<br />
27<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
falt von Expressionismus, Kubismus,<br />
Dadaismus, Surrealismus, sowjetischer<br />
Kunst und anderer neuer Ausdrucksweisen<br />
der Maler boten mehr als genug<br />
Stoff für die Seminargruppe. Im Seminar<br />
von Prof. Dr. Jürgen Schlaeger waren<br />
stattdessen Texte Gegenstand der Betrachtung,<br />
die allerdings ihrem autobiographischen<br />
Charakter entsprechend oft<br />
nicht minder bildhaft waren, als es ein<br />
Werk der Malerei sein könnte. Die Seminargruppe<br />
konnte über die Vielfalt<br />
der Selbstbekundungen staunen, die<br />
sich zwischen der religiös bestimmten<br />
Schilderung der eigenen Glaubensfestigung<br />
des Kirchenvaters Augustinus und<br />
der schonungslosen Offenheit in Rosseaus<br />
„Confessions“ bewegten.<br />
Die Nachmittage gehörten dann den<br />
Teilnehmenden und gaben Gelegenheit,<br />
eigene Aktivitäten zu organisieren,<br />
diesmal zum Beispiel einen Mini-<br />
Sprachkurs zu den slawischen Sprachen,<br />
ihren Beziehungen und Unterschieden.<br />
Der Abend schließlich war das Forum<br />
der Dozenten: Hier war Einsicht zu<br />
nehmen in die jeweilige Fachdisziplin.<br />
Dr. Lang nahm die Tätigkeit des Voltaire-Stipendiaten<br />
Mikael Serre am<br />
Maxim-Gorki-Theater in Berlin zum<br />
Anlass, über das Leben Maxim Gorkis zu<br />
referieren, dessen Biographie wie die<br />
vieler seiner Zeitgenossen einen Spiegel<br />
der russischen Geschichte auf dem Weg<br />
vom Zarenreich zum Sowjetstaat bildet.<br />
Professor Schlaeger hingegen widmete<br />
sich der evolutionsgeschichtlichen<br />
Bedeutung der Langsamkeit. Am Mittwoch<br />
schließlich brach das gesamte<br />
Seminar zur Exkursion auf, die nach<br />
einer kurzen „Kreuzfahrt“ über die Ostsee<br />
den Besuch einer Ausstellung zum<br />
Werk Horst Janssens im Kloster Cismar<br />
vorsah.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Die Teilnehmenden der ersten Woche<br />
Im Seminar von Prof. Mommsen und Dr. Bajohr<br />
Die abschließende Feedbackrunde<br />
zeigte, dass nicht nur die Lernumgebung<br />
des Seminarzentrums, sondern auch die<br />
gute interkulturelle Atmosphäre die<br />
Sommerakademien des Stipendiatenkollegs<br />
zu einer bereichernden Erfahrung<br />
machen.<br />
lo<br />
28<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Zweite Woche, 6. bis 11. Juli<br />
Was passiert, wenn kreative, neugierige<br />
und überaus talentierte junge Menschen<br />
aus acht verschieden Nationen aufeinander<br />
treffen, eine Woche lang auf dem<br />
Gut Siggen in Ostholstein verbringen<br />
und sich dabei fernab von jeglicher<br />
Zivilisation befinden?<br />
Richtig, sie bauen sich ihre eigene Welt,<br />
ihren eigenen Kosmos. Natürlich gibt es<br />
Dinge, die von außen vorgegeben werden:<br />
Die umfassende Verpflegung, die<br />
Seminarangebote, die Ausflüge, die<br />
Vorträge. Doch es scheinen mehr die<br />
Inhalte zu sein, die ein eigenes Universum<br />
schaffen: Die Gespräche beim Essen,<br />
das Nachdenken und Diskutieren in<br />
den Seminaren, die Art auf fremde<br />
Menschen, fremde Ansichten zuzugehen.<br />
Es sind auch die eigenen Ideen, die<br />
die Stipendiaten der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong><br />
<strong>Stiftung</strong> F.V.S., der Haniel <strong>Stiftung</strong> sowie<br />
der Gerda Henkel <strong>Stiftung</strong> in das Programm<br />
der Sommerakademie mit einbrachten,<br />
die etwas ganz eigenes geschaffen<br />
haben.<br />
Das Konzert von Sarolta Turkovic (Pianistin,<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> Stipendiatin<br />
2008) und Nicoleta—Iuliana Radu (Sopranistin,<br />
Herder—Stipendiatin 2008)<br />
zum Beispiel. Die beiden Künstlerinnen<br />
hatten sich vergangenes Jahr zum ersten<br />
Mal in der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
in Hamburg getroffen und gleich die<br />
Idee entwickelt, einmal einen gemeinsamen<br />
Abend zu gestalten. Diese Idee<br />
Projekte<br />
konnten sie nun auf der diesjährigen<br />
Sommerakademie umsetzten. Das Ergebnis<br />
war ein dynamischer Konzertabend<br />
auf musikalisch hohem Niveau.<br />
Auch von der spontanen Kreativität der<br />
Teilnehmer war ich sehr angetan. Es<br />
steht ein schwarzer Steinway Flügel im<br />
Seminargebäude — er wird gespielt.<br />
Operngesang dazu — kein Problem.<br />
Etwas easy listening — etliche Stipendiaten<br />
sind dabei. An einem Abend setzten<br />
sich die Opernsängerin Nicoleta, die<br />
Pianistin Sarolta und der auf dem Gebiet<br />
„Experimentelles Musiktheater“ studierende<br />
Tom Lane (Hanseatic Scholar<br />
2007) unvermittelt an den Steinway<br />
und improvisierten mit großem Spaß<br />
aus der Schatzkiste ihres Könnens. Es ist<br />
toll, Menschen zuzusehen, die ihre<br />
Leidenschaft ausleben.<br />
Doch was wären Geschichtswissenschaftliche<br />
Seminare ohne HistorikerInnen,<br />
die durch abwechslungsreiche<br />
Seminarstunden und ihr Fachwissen die<br />
Teilnehmer herausfordern und zu spannenden<br />
Gesprächen anregen können?<br />
Sicherlich war es nicht für alle Teilnehmer<br />
einfach, Geschichte in deutscher<br />
Sprache zu verstehen. Doch die leitenden<br />
Professoren Dr. Frank Bajohr, Prof.<br />
Dr. Hans und Prof. Dr. Margareta<br />
Mommsen sowie Prof. Dr. Otto Luchterhandt<br />
hatten diese Schwierigkeit<br />
bestens im Blick und konnten die unterschiedliche<br />
Herkunft der TeilnehmerInnen<br />
gut in ihre Seminarthemen integrieren.<br />
29<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
Kann es, bezogen auf den Holocaust<br />
zum Beispiel, eine globale Erinnerungskultur<br />
geben? Lässt sich das Gedenken<br />
internationalisieren? Oder hat doch jede<br />
Nation, jede Stadt, jedes Dorf, jede Familie,<br />
jeder Einzelne eine individuelle Sicht<br />
auf die Geschichte, die sich gar nicht<br />
„globalisieren“ lässt?<br />
Die Antworten waren und bleiben vielfältig.<br />
Der Austausch darüber konnte<br />
mit den Stipendiaten vertieft werden.<br />
Außerdem hatten sie die Möglichkeit,<br />
das Team und die Projektbereiche der<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. besser<br />
kennen zu lernen. Und wer weiß: Vielleicht<br />
wird die gebürtige Rumänin Nicoleta-Iuliana<br />
Radu bald als Nachfolgerin<br />
von Anna Netrebko gefeiert. Dann kann<br />
ich zumindest schon mal ein Autogramm<br />
von ihr vorweisen.<br />
js<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
30<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Komplex<br />
Projekte<br />
31<br />
Stimmen dringen gedämpft durch das<br />
Grau des Nebels, der den Raum verschluckt.<br />
Ab und zu zeichnen sich<br />
Schatten ab vor einer Wand, die gasförmig<br />
ist und doch massiv wirkt wie Beton.<br />
Manche kommen näher, undeutlich sind<br />
Gesichtszüge zu erkennen, doch sind<br />
sie, bis der Betrachter meint, seinen<br />
Blick hinreichend geschärft zu haben,<br />
schon wieder verschwunden, gespenstergleich<br />
entgeschwebt. Macht sich der<br />
Besucher schließlich orientierungslos<br />
auf die Suche nach Halt und gewöhnt<br />
sich gerade an den Gedanken unabänderlicher<br />
Verlorenheit,<br />
dann erkennt er<br />
in der Ferne<br />
eine Helligkeit,<br />
die stofflos,<br />
ohne Quelle im<br />
Raume zu<br />
schweben<br />
scheint, geht<br />
darauf zu, findet<br />
einen Tisch,<br />
durch einen Glassturz bedeckt, eine<br />
Glühbirne darüber angebracht, drumherum<br />
in alle Richtungen das bloße<br />
Nichts sich erstreckend. Unter dem<br />
Glassturz schließlich entdeckt er ein<br />
Objekt, einen vielfarbigen Stern aus<br />
Papier gefaltet, dessen Strahlen in alle<br />
Richtungen deuten als sei er das einzige<br />
Schaustück in einem geheimnisvollen<br />
Museum der Einsamkeit, das seiner<br />
Funktion beraubte Zentrum eines zu<br />
Staub zerfallenen Universums, einer<br />
materialisierten Erinnerung gleich, die<br />
zu wundersamer Ruhe gefunden hat.<br />
Natürlich lässt sich die Erfahrung der<br />
Rauminstallation, die Elin Hansdóttir<br />
und Darri Lorenzen als Auftakt zu ihrem<br />
langjährig konzipierten Projekt „Komplex“<br />
in einer<br />
Scheune des<br />
Seminarzentrums<br />
Gut Siggen<br />
konzipierten, auch<br />
ganz anders<br />
erleben und<br />
beschreiben. Die<br />
Deutungshoheit<br />
über ihr Werk<br />
geben die<br />
Künstler aber ganz<br />
bewusst aus der Hand: Es bildet den<br />
Startpunkt einer Residenz, die es fortan<br />
jeden Sommer einem Künstler ermöglichen<br />
wird, ein ortsspezifisches Werk in<br />
Siggen zu schaffen und in der Phase des<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
Auf- und Abbaus an anderen Projekten<br />
weiterzuarbeiten. Den geforderten<br />
Bezug zu den lokalen Gegebenheiten<br />
unterstrichen Hansdóttir und Lorenzen,<br />
indem sie sich für ihr Projekt die räumliche<br />
Weite der Siggener Scheune zunutze<br />
machten, die zu den größten ihrer<br />
Art in Norddeutschland zählen. Sie<br />
beschreiben ihr Konzept folgendermaßen:<br />
„Komplex ist ein sich ständig veränderndes<br />
Ganzes, zusammengesetzt aus<br />
zahlreichen verstrickten und miteinander<br />
verwobenen Bestandteilen, die<br />
zueinander in Beziehung stehen. Auf<br />
diese Weise wird sich das Projekt wie<br />
eine organische Struktur von Jahr zu Jahr<br />
kontinuierlich entwickeln. Der gesamte<br />
Komplex wird auf der Homepage sichtbar<br />
gemacht - durch ein Netzwerk aus<br />
Dokumentationen und Bezügen zu den<br />
mit dem Arbeitsprozess verbundenen<br />
Ideen. Je weiter Komplex über die Jahre<br />
wächst, desto mehr wird ein imaginärer<br />
Ort entstehen: locos — ein sich ausdehnender,<br />
grenzenloser Raum. Ein ortsgebundenes<br />
Projekt, das sich dennoch aus<br />
den Fesseln des physischen Raumes<br />
befreit.“ Die nächste Vernissage mit<br />
Ergebnissen der Residenz „Komplex“<br />
wird im Rahmen des Siggener Kultursommers<br />
2010 stattfinden.<br />
lo<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
LINK<br />
<br />
www.komplex.cc Die Homepage zum Projekt<br />
32<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Projekte<br />
„Die <strong>Stiftung</strong> soll eine Plattform für Ideen sein“<br />
Anlässlich des traditionell mit dem Ende des Juni einhergehenden Abschlusses des Ge-<br />
G<br />
schäftsjahres 2008/2009 sprach das Netzwerk<br />
werkmagazin<br />
mit dem Vorstand der <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. über die Auswirkungen der Finanzkrise, die Perspektiven der Stif-<br />
tungstätigkeit im Bildungsbereich und die Grenzen und Chancen gesellschaftlicher Prob-<br />
lemlösung in der Rechtsform von <strong>Stiftung</strong>en.<br />
Netzwerkmagazin<br />
magazin: Herr Wimmer, Herr<br />
Holz, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit<br />
vom <strong>Stiftung</strong>ssektor ist das<br />
vergangene Geschäftsjahr vor allem von<br />
den Folgen der Finanzkrise bestimmt<br />
worden. Ist die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
F.V.S. von dieser betroffen?<br />
Andreas Holz: Wir sind mittelbar insofern<br />
betroffen, als ein Zeichen der Finanzkrise<br />
historisch niedrige Zinssätze<br />
sind. Das heißt, dass jeder Euro, der hier<br />
zur Anlage im Wertpapierbereich ansteht,<br />
sich schlechter verzinst als vor<br />
fünf Jahren, und bedeutet für alle Kapitalanleger,<br />
dass die Erträge in diesem<br />
Bereich zurückgehen werden. Bei den<br />
Immobilien, die ein Drittel unserer<br />
Vermögenserträge ausmachen, gibt es<br />
bisher keine Auswirkungen, da sind wir<br />
beim Leerstand besser als der Markt. Die<br />
Wirtschaftskrise führt dazu, dass viele<br />
Leute sich selbstständig machen und<br />
dafür ist unser Bürocenterkonzept die<br />
richtige Antwort. Mittelfristig ist das<br />
Niveau der Büromieten allerdings leicht<br />
rückläufig.<br />
NM: Und das Budget für 2009/2010?<br />
AH: Das ist dank unserer vorausschauenden<br />
Dreijahresplanungen erfreulicherweise<br />
finanziert, wir werden also im<br />
laufenden Geschäftsjahr und in den<br />
beiden folgenden keine Einschränkungen<br />
machen müssen. Es wird aber auch<br />
keine Ausweitung des <strong>Stiftung</strong>sprogramms<br />
geben, die mit höheren Zinssätzen<br />
vielleicht möglich gewesen wäre.<br />
Ansgar Wimmer: Uns hilft ebenso wie<br />
vielen anderen <strong>Stiftung</strong>en das Steuerungsinstrument<br />
der freien Rücklage<br />
dabei, das Programm nicht einschränken<br />
zu müssen. Notfalls ermöglicht es außerdem<br />
die Jährlichkeit einiger Programmteile,<br />
Einschränkungen zu machen,<br />
ohne dass dies zulasten individueller<br />
Geförderter geht.<br />
NM: Sind die Probleme, mit denen sich<br />
auch <strong>Stiftung</strong>en konfrontiert sehen, auf<br />
unvermeidliche konjunkturelle Schwankungen<br />
zurückzuführen, oder müssen<br />
daraus auch Lehren für die Anlagepolitik<br />
33<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
gezogen werden?<br />
AW: In unserem Falle profitieren wir von<br />
einer Weisheit, die nicht unsere eigene<br />
ist, sondern die des Stifters, der selber<br />
Kind von turbulenten Zeiten in den<br />
zwanziger und dreißiger Jahren des<br />
letzten Jahrhunderts war. Er hat deshalb<br />
eine <strong>Stiftung</strong> mit zunächst sehr konservativer<br />
Anlagepolitik aufgestellt.<br />
AH: Meine persönliche Meinung ist,<br />
dass wir noch sehr viel länger ein niedriges<br />
Zinsniveau haben werden, das trotz<br />
möglicher geringer Steigerungen nicht<br />
das auskömmliche Niveau errichen wird,<br />
das es Anfang des Jahrzehnts hatte.<br />
Deshalb wird es auch bei fast allen <strong>Stiftung</strong>en<br />
Einschränkungen geben müssen,<br />
auch wenn die Hoffnung etwa des Bundesverbandes<br />
deutscher <strong>Stiftung</strong>en ist,<br />
dass das Gesamtniveau der Förderungen<br />
durch die stetigen Gründungen neuer<br />
<strong>Stiftung</strong>en nicht sinken wird.<br />
NM: Da Sie den Blick schon in die Zukunft<br />
werfen, möchte ich gerne zum<br />
neuen Programmbereich „Gegenwartsfragen“<br />
kommen. Er soll zum Geschäftsjahr<br />
2010/11 den von vornherein auf<br />
fünf Jahre befristeten „WerteDialog“<br />
ablösen, wie der <strong>Stiftung</strong>srat der <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. vor einiger Zeit<br />
beschlossen hat. Was darf ich mir darunter<br />
vorstellen?<br />
AW: Unter dieser Überschrift werden<br />
wir uns zehn verschiedenen Fragestellungen<br />
widmen, die aus Sicht der <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. zentrale Gegenwartsfragen<br />
sind. Sie betreffen nicht erst<br />
die nächste Generation im Sinne von<br />
Zukunftsfragen, sondern beschäftigen<br />
uns bereits heute. Sie sind auch wie<br />
schon im „WerteDialog“ nicht mit erhobenem<br />
Zeigefinger formuliert, sondern<br />
aus genuiner Neugier heraus. Entsprechend<br />
schlicht sind die Fragen.<br />
Was ist wichtig?<br />
Was wirkt?<br />
Wer bestimmt eigentlich?<br />
Was macht Mut?<br />
Wo findet Erziehung statt?<br />
Was ist gerecht?<br />
Wo ist zuhause?<br />
Wie verstehen wir uns?<br />
Wie funktioniert Bildung?<br />
Wie entstehen Ideen?<br />
Sie erlauben es, zusammen mit Projektpartnern<br />
punktuell in spannende gesellschaftliche<br />
Themen einzutauchen und<br />
beruhen auf der Freiheit, die vielleicht<br />
auch nur eine <strong>Stiftung</strong> hat, Leute zu<br />
diesen Fragen zusammenzuführen und<br />
eine Bearbeitung zu ermöglichen, keine<br />
Beantwortung. Keine der Fragen kann<br />
endgültig gelöst werden, dazu sind sie<br />
zu grundsätzlich. Aber sie sind der Anstoß,<br />
sich als mittelgroße <strong>Stiftung</strong> Vielem<br />
zu stellen und sich insbesondere im<br />
Bildungsbereich Anderes zu erschließen.<br />
NM: Worin sehen Sie denn im Rückblick<br />
Erfolge des Programmbereichs Werte-<br />
Dialog?<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
34<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
AW: Wir haben in einer wenn auch<br />
begrenzten Fachöffentlichkeit Aufmerksamkeit<br />
für das Thema Werterziehung<br />
an Hauptschulen erzeugt und sind der<br />
Ort geworden, an dem das diskutiert<br />
wird. Außerdem konnten wir in einer<br />
klugen Zielgruppe von Schulleitern und<br />
engagierten Lehrern das Nachdenken<br />
dazu anstoßen und Raum zur Vertiefung<br />
in einer Serie von Mentorenseminaren<br />
geben. Ein zweiter Punkt ist, dass wir für<br />
die <strong>Stiftung</strong> das Thema Bildung wieder<br />
aufgeschlossen haben. <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong><br />
fühlte sich als Jugendbewegter ursprünglich<br />
dem Thema Jugend sehr<br />
verbunden, hat sich aber nach der<br />
Gleichschaltung der Jugendbewegung in<br />
der Zeit des Nationalsozialismus auf die<br />
Kulturförderung und die Vergabe von<br />
Kulturpreisen verlegt. So ist das Thema<br />
Jugend aus dem Programm der damaligen<br />
<strong>Stiftung</strong> F.V.S. herausgerutscht,<br />
obgleich es dem Stifter ein besonderes<br />
Anliegen war. Ohne an diese Tradition<br />
anzuknüpfen haben wir über den Programmbereich<br />
WerteDialog das Thema<br />
Schule noch einmal neu für uns entdeckt.<br />
Das wollen wir natürlich auch in<br />
den neuen Programmbereich mitnehmen.<br />
NM: Welche Erfahrungen können Sie<br />
noch übertragen? Gibt es schon konkrete<br />
Projektideen?<br />
AW: Nun, das Nachdenken über konkrete<br />
Projekte beginnt erst. Wir werden das<br />
kommende Geschäftsjahr für Gespräche<br />
mit vielen Partnern und auch anderen<br />
Projekte<br />
<strong>Stiftung</strong>en nutzen. Dass es Sinn hat,<br />
dieses Thema in Kooperationen anzugehen,<br />
haben wir auch beim Bundeswettbewerb<br />
Werterziehung an Hauptschulen<br />
wieder einmal gemerkt, der<br />
zusammen mit dem Bundesverband der<br />
Arbeitgeberverbände organisiert wurde.<br />
Zweitens ist es meist kein besonders<br />
positives Merkmal von <strong>Stiftung</strong>sarbeit<br />
im Bildungsbereich, dass „modische“<br />
Themen aufgegriffen, nach zwei Jahren<br />
aber wieder beiseite gelegt werden.<br />
Unsere Partner sollen sich darauf verlassen<br />
können, dass wir an unseren Projekten<br />
längerfristig dranbleiben.<br />
NM: Ein anderes Thema, indem der<br />
Fokus der <strong>Stiftung</strong> im vergangenen Jahr<br />
geschärft wurde, ist der Bereich der<br />
Lehre an Hochschulen. Stellt dieses<br />
Engagement einen neuen Schwerpunkt<br />
Ihrer Arbeit dar?<br />
AW: Tatsächlich ist das ein Schwerpunkt,<br />
der uns in den letzten drei Jahren<br />
vehement zugewachsen ist. Wir begreifen<br />
ihn auch weiter als Nische, denn es<br />
ist zwar in den vergangenen Jahren eine<br />
Vielzahl von Preisen für gute Lehre<br />
entstanden, aber ohne dass dieses eine<br />
nachhaltige Verbesserung der Lehre an<br />
deutschen Hochschulen erzeugt hätte.<br />
Da haben wir eine Chance, wiederum<br />
nicht als „Platzhirsch“, sondern hochvernetzt<br />
mit anderen <strong>Stiftung</strong>en eine<br />
Allianz zu schmieden, die eine substantielle,<br />
nachhaltige Initiative für gute<br />
Lehre hervorbringt. Unserem Fortbildungsformat,<br />
das wir in den vergange-<br />
35<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
nen vier Jahren aufgebaut haben, haben<br />
die Teilnehmer attestiert, dass es ihnen<br />
wirklich geholfen hat. Darauf würden wir<br />
mit der Multiplikatorenschulung von<br />
Lehre n gerne aufbauen.<br />
NM: Wird es denn weitere Neuerungen<br />
im kommenden Geschäftsjahr geben?<br />
AW: Ein Detail ist, dass wir die Förderung<br />
der Europäischen Schulwanderstipendien<br />
gegen ein anderes Förderformat<br />
eintauschen werden, das die Hamburger<br />
Schullandschaft befruchtet und<br />
vielleicht auf das Thema Natur hinweist.<br />
Wichtig ist mir aber vor allem, die operative<br />
Arbeit der <strong>Stiftung</strong> weiter zu stärken,<br />
nämlich einen Marktplatz für Ideen<br />
zu schaffen. Das bedeutet, dass die<br />
Kolleginnen nicht nur Förderanträge<br />
bewilligen, sondern dass sie Ansprechpartnerinnen<br />
sind für Ideenträger in den<br />
Bereichen wie etwa Wissenschaft, Kultur,<br />
Naturschutz und Bildung. Auch die<br />
Orte, die wir zur Verfügung stellen, also<br />
das Elbehaus und das Seminarzentrum<br />
Gut Siggen, bilden dafür eine Plattform.<br />
Um von einer Ideenfabrik zu sprechen,<br />
ist die <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
sicherlich zu klein, aber wenn wir die<br />
Garage sein können für die eine oder<br />
andere Tüftelei, die da entsteht, dann<br />
wäre das schön.<br />
NM: Und was möchten Sie in Zukunft<br />
verbessern?<br />
AW: Ich würde unseren Geförderten<br />
manchmal gerne noch besser durch die<br />
Schaffung von Publizität auf den Weg<br />
helfen können. Das Ziel, ihnen so Möglichkeiten<br />
zu eröffnen, kann man aber<br />
nicht rein handwerklich erreichen, wenn<br />
man feststellt, dass in der Mediengesellschaft<br />
um die merkwürdigsten Dinge<br />
Hypes entstehen. So etwas können wir<br />
nicht antizipieren und man es auch<br />
nicht sozusagen naturwissenschaftlichmathematisch<br />
planen. Insofern haben<br />
wir gelernt, dass es dafür immer auch<br />
Glück braucht, was ich uns aber für die<br />
Preisträger und für die Stipendiaten<br />
wünschen würde.<br />
AH: Wir haben mit diesem Geschäftsjahr<br />
den Ganzjahresbetrieb im Seminarzentrum<br />
Gut Siggen begonnen. Statt<br />
Veranstaltungen aus Zeitgründen ablehnen<br />
zu müssen haben wir jetzt Fenster,<br />
die sinnvoll zu füllen sind. Wenn wir<br />
da das richtige Händchen haben und<br />
weiter das Niveau eigener Veranstaltungen<br />
halten und die Lücken für die Nutzung<br />
durch Kooperationspartner nutzen<br />
können, dann wäre ich sehr zufrieden.<br />
NM: Wenn wir den Blick wieder auf den<br />
gesamten <strong>Stiftung</strong>ssektor weiten: Gibt<br />
es Themen, die dort bisher vernachlässigt<br />
werden und mehr Beachtung durch<br />
die Arbeit der <strong>Stiftung</strong>en verdienen?<br />
AW: Durch das rapide Wachstum der<br />
<strong>Stiftung</strong>szahl in den vergangenen zehn<br />
bis fünfzehn Jahren ist eigentlich eher<br />
festzustellen, dass es viele Doppelungen<br />
gibt. Da sollen dann mit großer Verve<br />
Themen besetzt werden, die schon<br />
längst besetzt sind. Deshalb geht es<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
36<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
vorrangig darum, sich stärker in Kooperationen<br />
hinein zu begeben, die nicht<br />
nur formaler, sondern auch inhaltlicher<br />
Natur sind. Dabei kommt auch dem<br />
Bundesverband deutscher <strong>Stiftung</strong>en<br />
eine gewisse Rolle zu, ebenso auch der<br />
individuellen Offenheit der in den <strong>Stiftung</strong>en<br />
Verantwortlichen. Ein strukturelles<br />
Problem ist, dass Stifter häufig etwas<br />
tun möchten, das so noch nicht da war,<br />
dann aber wegen unvollständiger Information<br />
oder bei Unterschieden in bloßen<br />
Nuancen thematische Überscheidungen<br />
schaffen. Ich glaube, dass das die<br />
größte Herausforderung ist.<br />
NM: Inwieweit kann denn das <strong>Stiftung</strong>swesen<br />
auch im Hinblick auf die<br />
Umwandlung öffentlicher Institutionen<br />
in <strong>Stiftung</strong>en überhaupt zur Lösung<br />
gesellschaftlicher Probleme beitragen?<br />
Projekte<br />
AW: Solche Umwandlungen sind leider<br />
häufig mit der naiven Vorstellung verbunden,<br />
es komme dadurch von irgendwo<br />
her mehr Geld. Manche Universitäten<br />
oder die Hamburger Museen<br />
sind so ein Beispiel. Das gelingt aber im<br />
seltensten Fall und ich stehe dem sehr<br />
skeptisch gegenüber. Die große Chance<br />
liegt auf dem Feld der Gemeinschaftsstiftungen.<br />
In Deutschland hat es den<br />
letzten zehn Jahren einen rasanten<br />
Anstieg bei den Bürgerstiftungen gegeben.<br />
Zwar gibt es auch da viele, die nicht<br />
besonders wohlhabend sind, aber immer<br />
mehr gewinnen an Wohlstand.<br />
Auch bei atypischen Gemeinschaftsstiftungen<br />
wie etwa der <strong>Stiftung</strong> Polytechnische<br />
Gesellschaft denke ich, dass<br />
gegenüber der klassischen Verfasstheit<br />
als eingetragener Verein für Personenmehrheiten<br />
ein großer Vorteil mit der<br />
Rechtsform der <strong>Stiftung</strong> verbunden ist.<br />
<strong>Stiftung</strong>en sind aber weder ein gutes<br />
Substitut für öffentliche Aufgaben noch<br />
sind sie ein besonders gutes Fundraising-Instrument.<br />
Zur gemeinschaftlichen<br />
Bewältigung von überschaubaren<br />
gesellschaftlichen Aufgaben bieten sie<br />
aber überzeugende Möglichkeiten.<br />
AH: Dort, wo der Staat eine <strong>Stiftung</strong><br />
gründet, möchte er sich zurückziehen<br />
und private Gelder sammeln, eigentlich<br />
also eine versteckte Privatisierung<br />
betreiben. Das kann in der Außenwahrnehmung<br />
die Bereitschaft, private Mittel<br />
beizusteuern, gegenüber der Organisation<br />
als Behörde durchaus steigern, so<br />
dass dieses Vorgehen aus staatlicher<br />
Sicht durchaus Sinn ergibt. Aus der<br />
Perspektive des <strong>Stiftung</strong>ssektors ist es<br />
dagegen verwerflich, denn die vorhandenen<br />
<strong>Stiftung</strong>en möchten den Staat<br />
nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen.<br />
Dieser Konflikt wird auch bisher nicht<br />
transparent diskutiert, weshalb ich denke,<br />
dass es zum einen mehr Offenheit<br />
braucht und zum anderen klare Positionen<br />
auf Seiten der <strong>Stiftung</strong>en und des<br />
Staates. Dann könnte es am Schluss<br />
auch Modelle geben, auf die sich beide<br />
Seiten einigen können. Ich glaube allerdings<br />
nicht, dass das kurzfristig möglich<br />
ist.<br />
37<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Projekte<br />
NM: Ist die Kooperation der gemeinsamen<br />
Interessenvertretung innerhalb des<br />
<strong>Stiftung</strong>ssektors also verbesserungsfähig?<br />
AH: Ja, bestimmt.<br />
NM: Zum Abschluss möchte ich gerne<br />
noch einmal mit zwei Fragen auf das<br />
vergangene Geschäftsjahr zurückblicken.<br />
Auch in dieser Zeit wurden von<br />
verschiedener Seite die Vorwürfe gegen<br />
die Person <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong>s erneuert.<br />
Muss die Biographie des Stifters im<br />
Zuge dessen an der einen oder anderen<br />
Stelle neu bewertet werden?<br />
AW: Die kontinuierliche Auseinandersetzung<br />
mit der Geschichte des Stifters<br />
und der <strong>Stiftung</strong> gehört zur Identität der<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. heute und<br />
alle die für sie arbeiten sind in besonderer<br />
Weise sensibilisiert. Wir leben damit,<br />
dass sich inzwischen Leute an der <strong>Stiftung</strong><br />
abarbeiten ohne sie genau zu kennen.<br />
Und es ist auch seit der Forschung<br />
der Historikerkommission keine wirklich<br />
neue Erkenntnis dazugekommen, es<br />
wird allerdings das, was wir wissen und<br />
auch offensiv kommunizieren, immer<br />
mal wieder dramatisch neu verpackt.<br />
Auch damit versuchen wir respektvoll<br />
umzugehen und wenn uns ernsthafte<br />
Fragen erreichen auch denen nachzugehen.<br />
Gleichzeitig muss man sagen, dass<br />
an vielen Stellen die Grenze der Seriösität<br />
weit überschritten ist und häufig<br />
unsicher bleibt, welche Eigeninteressen<br />
mit manchen Kampagnen gegen die<br />
<strong>Stiftung</strong> verfolgt werden.<br />
NM: Schließlich: Gab es einen Moment<br />
im Jahr 2008/2009, den sie aus Ihrer<br />
persönlichen Sicht als Höhepunkt bezeichnen<br />
würden?<br />
AW: Man ist immer versucht, dabei an<br />
die Preisverleihungen zu denken, weil<br />
man diese Moment natürlich gerne<br />
festhalten würde, in Wirklichkeit geht es<br />
aber um die vielen Begegnungen mit<br />
den individuell Geförderten. Wir merken<br />
immer wieder, dass das Konzept<br />
erfolgreich ist, als mittelgroße <strong>Stiftung</strong><br />
den Menschen zugewandt zu sein, danach<br />
zu fragen, wo nicht nur mit Geld,<br />
sondern auch mit Kontakten und Ideen<br />
oder durch ein Netzwerk auf den Weg<br />
geholfen werden kann. Als Momente<br />
sind zum Beispiel die Stipendiatentreffen<br />
zu nennen und auch die anderen<br />
Veranstaltungen in Siggen, diesem Ort,<br />
der immer wieder seinen Charme entfaltet<br />
und Leute in den Bann schlägt. Das<br />
sind rein atmosphärisch gesprochen die<br />
Augenblicke, in denen man das Gefühl<br />
gewinnt, dass die <strong>Stiftung</strong> da eine ganz<br />
spezielle Existenzberechtigung hat. Die<br />
knüpft durchaus auch an die positiven<br />
Seiten des Stifters an, der eben auch<br />
neugierig auf Menschen war und versucht<br />
hat, diese zu fördern.<br />
NM: Herzlichen Dank für dieses Gespräch.<br />
Interview: lo<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
38<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Texte publik gemacht<br />
Repräsentant des „anderen Deutschland“<br />
Claus Graf Schenk von Stauffenberg und der deutsche Widerstand<br />
Prof. Dr. Hans Mommsen, Feldafing<br />
Zum Programm der Sommerakademien des Stipendiatenkollegium der <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong><br />
<strong>Stiftung</strong> F.V.S. gehören auch abendliche Vorträge der Dozenten zu Themen ihres Fachge-<br />
biets, losgelöst von den Inhalten der morgendlichen Seminararbeiten. Im Folgenden geben<br />
wir mit freundlicher Genehmigung von Herrn Professor Mommsen sein Referat zu Claus<br />
Graf Schenk von Stauffenberg wieder, das er während der zweiten Akademiewoche im<br />
Seminarzentrum Gut Siggen gab.<br />
Der Stauffenberg-Film mit Tom Cruise<br />
in der Hauptrolle hat das Interesse auf<br />
Claus Schenk Graf von Stauffenberg<br />
gelenkt, der mit Recht als Repräsentant<br />
der deutschen Opposition gegen Hitler<br />
gilt. Hätte sein Attentat auf Hitler Erfolg<br />
gehabt, hätten viele Millionen Tote, die<br />
der sinnlosen Fortsetzung eines längst<br />
verlorenen Krieges geopfert wurden,<br />
überlebt und wären weite Teile Ost- und<br />
Mitteleuropas von der Zerstörung teils<br />
durch die deutsche Strategie der „verbrannten<br />
Erde“, teils durch die alliierten<br />
Flächenbombardements, teils durch die<br />
Kriegshandlungen selbst verschont<br />
geblieben.<br />
Während Hitler die Explosion in der<br />
Lagebaracke in der Wolfschance mit<br />
leichten Verletzungen überstand, wurde<br />
Stauffenberg zusammen mit Friedrich<br />
Olbrichts, Albrecht Ritter Merz von<br />
Quirnheim und Werner von Haeften im<br />
Hof des Bendlerblocks von einem eilig<br />
zusammengestellten Hinrichtungskommando<br />
standrechtlich erschossen.<br />
Auch danach ruhte der Diktator nicht,<br />
ihr Andenken auszulöschen. Heinrich<br />
Himmler ließ die in der Nacht auf dem<br />
St. Matthei-Friedhof in Berlin bestatteten<br />
Leichen durch ein SS-Kommando<br />
ausgraben und verbrennen und ihre<br />
Asche über die Felder verstreuen. Eine<br />
Gedenktafel im Friedhof erinnert daran.<br />
Die Absicht, die Erinnerung an die Verschwörer<br />
zu zerstören und ihre Familien<br />
auszulöschen, schlug ins Gegenteil um.<br />
Heute wird Stauffenberg als der mutige<br />
Attentäter und Führer des Umsturzversuchs<br />
vom 20. Juli 1944 als Repräsentant<br />
des „Anderen Deutschland“ und<br />
Bewahrer der nationalen Ehre gefeiert.<br />
39<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
Stauffenberg war der Sprössling eines<br />
angesehenen schwäbischen Adelsgeschlechts,<br />
leidenschaftlicher Soldat und<br />
zugleich ein Verehrer Stefan Georges,<br />
dessen Dichtungen das deutsche Verhängnis<br />
vorhersagten. Er gehörte zu den<br />
begabtesten Generalstabsoffizieren der<br />
Deutschen Wehrmacht. Er begrüßte<br />
den 30. Januar 1933, rückte aber bald in<br />
innere Distanz zum NS-Regime, übte<br />
frühzeitig Kritik an Hitler und dessen<br />
Führungsstil und war sich seit dem<br />
Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni<br />
1941 darüber im klaren, dass Deutschland<br />
in eine militärische Niederlage<br />
hineintrieb. Sarkastisch äußerte er<br />
schon 1939 „Der Narr macht Krieg“,<br />
aber er hoffte noch, dass es möglich sein<br />
werde, mit der „braunen Pest“ nach dem<br />
gewonnenen Krieg aufzuräumen. Noch<br />
nach der verlorenen Schlacht vor Moskau<br />
hoffte er, dass die Fehlentscheidungen<br />
Hitlers bei Anspannung aller Kräfte<br />
noch korrigiert werden könnten.<br />
Dazu gehörte aber auch, dass die bisherige<br />
Unterdrückung der Ostvölker beendet<br />
und Hitlers Vorhaben, nicht nur<br />
das sowjetische Herrschaftssystem,<br />
sondern auch den russischen Staat zu<br />
zerschlagen und einen Rassenvernichtungskrieg<br />
zu führen, fallen gelassen<br />
wurde. In der Überzeugung, dass der<br />
Krieg nicht länger gegen das russische<br />
Volk geführt werden dürfe, stimmte<br />
Stauffenberg mit Generalmajor Henning<br />
von Tresckow, der zunächst als Ia der<br />
Heeresgruppe Mitte, dann als Chef der<br />
Operationsabteilung tätig war, überein.<br />
Gegen den erklärten Willen des Diktators<br />
bauten beide Offiziere eine russische<br />
Hilfswilligenarmee mit dem Ziel<br />
auf, die Völker der Sowjetunion für<br />
einen Befreiungskampf gegen das verhasste<br />
bolschewistische System zu<br />
gewinnen. Sie verlangten zugleich eine<br />
bessere Behandlung der russischen<br />
Zivilbevölkerung und der russischen<br />
Kriegsgefangenen, die in den Stalags zu<br />
Hunderttausenden verhungerten. Insbesondere<br />
Stauffenberg wandte sich gegen<br />
die Menschenjagden für die Deportation<br />
von Zwangsarbeitern. Sie drangen<br />
mit ihren Vorstellungen jedoch nicht<br />
durch. Erst als die militärische Lage sich<br />
extrem verschlechtert hatte, kam es zu<br />
Verhandlungen mit dem kriegsgefangenen<br />
russischen General Alxeji Wlassow<br />
zur Aufstellung einer Freiwilligenarmee,<br />
doch kam der Zusammenbruch der<br />
Ostfront dem zuvor.<br />
Den Hintergrund für diese Bemühungen<br />
bildete die Erkenntnis, dass die nach der<br />
Niederlage von Moskau gleich bleibenden<br />
Verluste immer weniger ausgeglichen<br />
werden konnten, so dass eine<br />
militärische Niederlage schon auf Grund<br />
des demographischen Faktors unausweichlich<br />
war. Daher waren auch die<br />
300 000 russischen Hilfswilligen für das<br />
Ostheer, das verglichen mit Juni 1941<br />
nur noch über die Hälfte des ursprünglichen<br />
Mannschaftsbestandes verfügte,<br />
unentbehrlich.<br />
Stauffenberg hatte den Angriff auf die<br />
Sowjetunion für einen Verlegenheits-<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
40<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
schritt und unverzeihlichen Fehler Hitlers<br />
gehalten und betonte wiederholt,<br />
dass der Feldzug auch bei besserer<br />
Führung nicht durchgestanden werden<br />
konnte. Noch vor Stalingrad plädierte er<br />
nachdrücklich dafür, einen Friedensschluss<br />
herbeizuführen, solange die<br />
militärische und politische Handlungsfähigkeit<br />
des Reiches noch gegeben war.<br />
Da er im Generalstab nicht zuletzt für<br />
die Bereitstellung von „Ersatz“ angesichts<br />
der eskalierenden Verluste der<br />
Wehrmacht, die mehr als 100 000<br />
Mann im Monat umfassten, zuständig<br />
war, bedrückte ihn die Last der Mitverantwortung<br />
dafür, täglich viele Tausende<br />
in den Tod zu schicken, ohne dass eine<br />
Perspektive zur Beendigung der Kampfhandlungen<br />
sichtbar war.<br />
Durch die Berufung in den Generalstab<br />
des Heeres gelangte Stauffenberg in das<br />
militärische Entscheidungszentrum,<br />
und er erkannte zunehmend, dass die<br />
von Hitler befohlenen Strategien die<br />
vorhandenen Kräfte immer mehr überforderte.<br />
Die Bestrebungen Henning<br />
von Tresckows als Ia der Heeresgruppe<br />
Mitte, durch Einwirkung auf die Armeebefehlshaber<br />
eine Reform der Spitzengliederung<br />
zu erreichen, die Hitler den<br />
direkte Einfluss auf die operativen Entscheidungen<br />
nehmen sollte, wurde von<br />
Stauffenberg voll geteilt, der am 18.<br />
Januar 1943 in einer denkwürdigen,<br />
aber völlig fehlgehenden Unterredung<br />
mit Feldmarschall Erich von Manstein<br />
im gleichen Sinn intervenierte. Manstein,<br />
der ihn abwies und an die Front<br />
Texte publik gemacht<br />
schicken wollte, bemerkte abschätzig:<br />
„er hat mir weismachen wollten, der<br />
Krieg sei verloren“, während Stauffenberg,<br />
von dem das geflügelte Wort von<br />
„den Teppichlegern im Generalsrang“<br />
bereits die Runde machte, kommentierte:<br />
„Das ist nicht die Antwort eines<br />
Generalfeldmarschalls“.<br />
Stauffenberg gab sich keinerlei Illusionen<br />
mehr hin, dass eine Reform der<br />
Spitzengliederung nicht erreichbar war.<br />
Ebenso wie Henning von Tresckow, mit<br />
dem er in diesen Monaten Kontakt<br />
aufnahm, war er davon überzeugt, dass<br />
die einzige realistische Chance, einen<br />
totalen militärischen Zusammenbruch<br />
abzuwenden, in der Ausschaltung Hitlers<br />
im Wege eines Attentats lag. Die<br />
verbreitete Vorstellung, Hitler durch<br />
gemeinsame Demarchen der Generalität<br />
zum Nachgeben zu bringen, hielt er<br />
mit Recht für völlig illusorisch, ebenso<br />
wie er später entsprechende Vorschläge<br />
Carl Friedrich Goerdelers als absurd<br />
verwarf.<br />
Auf Grund der Untätigkeit der Generalfeldmarschälle<br />
sah Stauffenberg nur<br />
noch den Ausweg, den Diktator umzubringen,<br />
und äußerte zu einem seiner<br />
Mitarbeiter schon im Spätsommer<br />
1942, Hitler sei “der eigentliche Verantwortliche.<br />
Eine grundsätzliche Änderung<br />
ist nur möglich, wenn er beseitigt<br />
wird. Ich bin bereit, es zu tun“. In dieser<br />
Überzeugung stimmte Hitler mit Henning<br />
von Tresckow überein, der seit dem<br />
Frühsommer 1942 ein Netzwerk oppo-<br />
41<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
sitionell eingestellter Offiziere ins Leben<br />
gerufen hatte, das sich dem Ziel verschworen<br />
hatte, Hitler im Wege eines<br />
Attentats auszuschalten. Diese im Umkreis<br />
der Heeresgruppe Mitte entstehende<br />
zweite Opposition stand anfänglich<br />
nur mit der Widerstandsgruppe um<br />
Hans Oster in der Militärischen Abwehr<br />
in Verbindung, doch nahm Tresckow<br />
schon im Herbst 1941 über Fabian von<br />
Schlabrendorff Kontakte zu Beck, dem<br />
ehemaligen Generalstabschef, auf, damals<br />
noch in der Absicht, die Chancen<br />
einer eventuellen Verständigung mit<br />
Großbritannien auszuloten. Seit 1943<br />
knüpfte Tresckow, der nun auch Stauffenberg<br />
im Generalstab zu seinen Gesinnungsgenossen<br />
zählte, enge Verbindungen<br />
zu Ludwig Beck, und über ihn<br />
zur zivilen Opposition um Goerdeler.<br />
Stauffenberg hatte einen Moment lag<br />
gezögert, sich durch die Versetzung an<br />
die Front dem auf ihm lastenden Entscheidungsdruck,<br />
der ihm als Chef der<br />
Operationsabeilung zufiel, zu entziehen,<br />
doch blieb er im Zentrum der militärischen<br />
Entscheidungen. Als er überraschend<br />
zum Ia der 10. Panzerdivision in<br />
Tunis ernannt wurde, nahm er an den<br />
schweren Kämpfen in Nordafrika teil,<br />
doch endete die Abordnung schon nach<br />
wenigen Wochen am 7. April 1943 mit<br />
seiner schweren Verwundung. Die<br />
schweren Verletzungen änderten nichts<br />
an seiner Entschlossenheit, sich für eine<br />
Ausschaltung Hitlers aktiv einzusetzen.<br />
Obwohl nur unzureichend wiederhergestellt,<br />
trat er als Chef des Stabes beim<br />
Allgemeinen Heeresamt im Bendlerblock<br />
am 1. Oktober 1943 rasch in<br />
den Mittelpunkt der inzwischen von<br />
Tresckow und Olbricht unter dem<br />
Deckmantel der Operation „Walküre“<br />
vorangetriebenen Putschvorbereitungen.<br />
Die knappe Zeit seiner Genesung hatte<br />
Stauffenberg in seiner Überzeugung<br />
bestärkt, dass der Krieg ohne weiteren<br />
Verzug beendigt werden müsse, In einem<br />
Gespräch mit seinem Onkel, Graf<br />
Uxküll, erklärte er im Mai 1943: „Nachdem<br />
die Generäle bisher nichts erreicht<br />
haben, müssen sich nun die Obersten<br />
einschalten“, und er teilte Olbricht<br />
brieflich mit, in drei Monaten „zur Verfügung“<br />
zu stehen. Schon im August<br />
weihten ihn Olbricht und Tresckow in<br />
den von ihnen konzipierten Umsturzplan<br />
ein, der in der Ausnützung des für<br />
den Fall eines Aufstandes unter den acht<br />
Millionen im Reichsgebiet lebenden<br />
Zwangsarbeiter entwickelten Einsatzplan<br />
des Ersatzheeres bestand — dem<br />
Unternehmen „Walküre“. Diese geniale<br />
Tarnung des Umsturzvorhabens ermöglichte<br />
es, Teile des militärischen Apparats<br />
in die logistischen Vorarbeiten<br />
einzuschalten. Als Tresckow im November<br />
an die Front versetzt wurde, lag die<br />
Vorbereitung des Umsturzes in erster<br />
Linie bei Stauffenberg, der trotz seiner<br />
Verletzungsfolgen eine ungewöhnliche<br />
Energie und Tatkraft an den Tag legte<br />
und zum Kern der Verschwörung wurde.<br />
Stauffenberg begriff die geplante Ver-<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
42<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
schwörung nicht als „Widerstand“ — er<br />
vermied es, diesen Ausdruck zu gebrauchen<br />
— sondern als „nationale Erhebung“,<br />
und dabei stand ihm das Vorbild<br />
August Neithard von Gneisenaus, des<br />
preußischen Militärreformers, auch<br />
vermittelt durch die Ideengänge Stefan<br />
Georges, klar vor Augen. Zusammen mit<br />
seinem an dem Umsturz beteiligten<br />
Bruder Berthold erwog er eine umfassende<br />
Erneuerung, die „in ganz andere<br />
Lebensschichten reichen sollte als die<br />
Revolutionen von 1918 und 1933“. Er<br />
ging von der Überzeugung aus, es sei<br />
notwendig, dass der Krieg, der gerade<br />
nicht für eine konstruktive Neuordnung<br />
geführt wurde und daher ein „sinnloses<br />
Verbrechen“ darstelle, noch zu einem<br />
Zeitpunkt beendet wurde, der vor der<br />
alliierten Landung in Frankreich lag und<br />
zu dem die militärische Handlungsfähigkeit<br />
des Reiches noch nicht verloren<br />
gegangen war.<br />
Stauffenberg begriff sich in erster Linie<br />
als Soldat, und militärische Erwägungen<br />
bildeten den Ausgangspunkt seines<br />
Handelns. Aber die militärischen Beweggründe,<br />
die Stauffenberg veranlassten,<br />
sich rückhaltlos für die Verschwörung<br />
und schließlich für die Durchführung<br />
des Attentats zu entscheiden,<br />
verknüpften sich aufs engste mit humanitären<br />
Erwägungen. Er übte bittere<br />
Kritik an der Gesinnungslosigkeit seiner<br />
Offizierskollegen, die im Vertrauen auf<br />
den Führer ihren Urlaub und ihre Beförderung<br />
genossen, sonst aber über den<br />
„Dienst im Gliede“ nicht hinwegkamen.<br />
Texte publik gemacht<br />
Mit größter Schärfe protestierte er<br />
gegen die Versklavung der Ostarbeiter,<br />
die beginnende Auslöschung der jüdischen<br />
Bevölkerung und die unmenschliche<br />
Behandlung der sowjetischen<br />
Kriegsgefangenen durch die Wehrmacht.<br />
Dass die verbrecherische Vernichtungspolitik<br />
des NS-Regime im<br />
Osten nicht nur militärisch kontraproduktiv<br />
war, sondern auch die Ehre der<br />
Nation verletzte, drängte ihn dazu, unverzüglich<br />
zu handeln.<br />
Aus seiner militärischen Grundhaltung<br />
heraus betonte er die politische und<br />
gesellschaftliche Verantwortung des<br />
Offiziers, den er als Staatsdiener und<br />
nicht als Professionellen betrachtete,<br />
und erblickte im Offizierskorps „den<br />
wesentlichen Träger des Staates und die<br />
eigentliche Verkörperung der Nation“.<br />
Diese an der idealistischen Sicht der<br />
preußischen Reform entspringende<br />
„Militarismus“ stellte das gerade Gegenteil<br />
dessen dar, was er angesichts des<br />
Verfalls der preußischen Militärtradition<br />
an Brutalisierung und moralischer Indifferenz<br />
täglich erlebte. In Reminiszenz an<br />
Gneisenau lehnte Stauffenberg das<br />
verbreitete Bild vom Offizier als bloßem<br />
Militärtechniker nachdrücklich ab und<br />
hob dessen Verpflichtung zu öffentlichem<br />
Handeln und Verantwortung<br />
nachdrücklich hervor.<br />
Gegenüber dem ihm befreundeten<br />
Freiherrn von Thüngen erhob er für die<br />
Armee den Anspruch auf Teilhabe an<br />
der politischen Führung; wie er umge-<br />
43<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
kehrt das Versagen der Generalität<br />
geißelte, die ihm das bittere Wort von<br />
den „Teppichlegern“ im Generalsrang<br />
entlockte. Demgegenüber begründete<br />
er den Anspruch der Militärs, an die<br />
Spitze des Umsturzes zu treten und<br />
nicht nur deren Handlanger zu sein,<br />
offensiv und betonte: „Wir sind auch die<br />
Führung des Heeres und auch des Volkes,<br />
und wir werden diese Führung in die<br />
Hand nehmen“. Dieses mit Willenskraft<br />
gepaarte Selbstbewusstsein Stauffenbergs,<br />
seiner Brüder und seiner Mitverschwörer<br />
stellte einen entscheidenden<br />
Faktor dafür das, dass der Umsturzversuch<br />
trotz aller innerer und äußerer<br />
Widrigkeiten Wirklichkeit wurde.<br />
Stauffenbergs Vorstellung von der Verankerung<br />
der Armee in der Bevölkerung<br />
erinnerte an die preußische Erhebung,<br />
die auch für Julius Leber, mit dem er<br />
bald in eine enge Gesinnungsfreundacht<br />
eintrat, historischen Vorbildcharakter<br />
besaß und eine Schlüsselphase in der<br />
deutschen Geschichte darstellte, im<br />
Unterschied zu Goerdeler und dessen<br />
engeren Mitstreitern, die auf das Vermächtnis<br />
der preußischen Reform zurückgriffen.<br />
Stauffenbergs romantisierende<br />
Sicht der bewaffneten Macht<br />
schlug sich in der Erwägung nieder, dass<br />
das Offizierskorps nicht wie im November<br />
1918 versagen und sich die Initiative<br />
aus der Hand nehmen lassen dürfe.<br />
Die Wehrmacht, argumentierte Stauffenberg,<br />
sei schließlich „in unserem<br />
Staat die konservativste Einrichtung“,<br />
die aber „gleichzeitig im Volk verwurzelt“<br />
sei. Aus dieser Sicht heraus sah er<br />
die legitime Aufgabe der Wehrmacht<br />
nicht nur darin, die drohende Niederlage<br />
abzuwenden, sondern auch den Staat<br />
vor dem Zerfall zu bewahren. Daraus<br />
folgte die Notwendigkeit, die Rückkehr<br />
zu Recht und Ordnung mittels eines<br />
vorübergehenden militärischen Ausnahmezustandes<br />
sicherzustellen, um die<br />
zu erwartenden Gegenkräfte gegen die<br />
angestrebte Übergangsregierung zu<br />
neutralisieren.<br />
Andererseits lag eine unerkennbare<br />
Schwäche der Umsturzplanung darin,<br />
dass deren Erfolg in erster Linie davon<br />
abhing, dass die militärische Befehlskette<br />
und Unterstellungsverhältnisse intakt<br />
blieben. Dies war in Paris und in Wien,<br />
wo der militärische Ausnahmezustand<br />
ohne größere Widerstände durchgesetzt<br />
werden konnte, der Fall, nicht<br />
jedoch im Reichsgebiet, wo die Wehrkreisbefehlshaber<br />
die trotz des gescheiterten<br />
Attentats ergehenden Befehle<br />
der Zentrale nicht oder nur schleppend<br />
befolgten.<br />
Es war kennzeichnend, dass die „politischen<br />
Beauftragten“, entgegen den<br />
Vorstellungen Helmuth von Moltkes,<br />
den Militärbefehlshabern untergeordnet<br />
waren und dass gleichsam die Vorschriften<br />
des preußischen Ausnahmezustands<br />
von 1860 erneut umgesetzt<br />
wurden. Es handelte sich soweit um eine<br />
Militärrevolution von oben. Es gab auch<br />
ansatzweise keine Vorbereitungen, um<br />
die Bevölkerung, aber auch die einfa-<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
44<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
chen Soldaten für den Umsturz, der<br />
anfänglich der Fiktion einer Ermordung<br />
Hitlers durch „frontfremde Parteiführer“<br />
folgen sollte, zu mobilisieren. Die Erörterungen<br />
der zivilen Verschwörer, eine<br />
überparteiliche Volksbewegung ins<br />
Leben zu rufen, fanden bei Stauffenberg<br />
und Beck, die in der Endphase auf engste<br />
zusammenarbeiteten, keine Resonanz.<br />
Unter bestehenden Bedingungen bestand<br />
wohl auch keine Möglichkeit,<br />
anders als durch den Rekurs auf den<br />
militärischen Obrigkeitsstaat zu verfahren,<br />
zumal die Verschwörer zunächst<br />
noch hofften, die Ostfront aufrechtzuerhalten<br />
Nach dem Scheitern der ersten Attentatspläne<br />
Anfang 1943 rückte Stauffenberg<br />
immer mehr in das Zentrum der<br />
Verschwörung, vor allem auch nach der<br />
Verhaftung von Helmuth James von<br />
Moltke im Januar 1944. Dies hing auch<br />
mit der immer kritischer werdenden<br />
militärischen Lage und der damit korrespondierenden<br />
Radikalisierung des<br />
NS-Regimes nach innen und nach außen<br />
zusammen. Sie bewog namentlich<br />
die Mitglieder des Kreisauer Kreises, im<br />
Gegensatz zu ihrer ursprünglichen<br />
Intention, nicht an den konkreten Attentatsvorbereitungen<br />
beteiligt zu sein -<br />
Moltke hatte in der Unterredung der<br />
verschiedenen Verschwörergruppen<br />
Anfang 1943 die Zeit für den Umsturz<br />
für noch nicht reif gehalten -, mit Stauffenberg<br />
Verbindung aufzunehmen und<br />
dessen Attentatsvorhaben aktiv zu<br />
unterstützen. Adam von Trott, York von<br />
Texte publik gemacht<br />
Wartenburg, Fritz-Dietlof von der Schulenburg,<br />
und nicht zuletzt Julius Leber<br />
gehörten nun zum engsten Zirkel der<br />
Verschwörer.<br />
Zugleich übernahm Ludwig Beck die<br />
Führung des in sich zersplitterten zivilen<br />
Verschwörerkreises. Beck hatte sich<br />
nach Stalingrad endgültig zur Konsequenz<br />
des Tyrannenmordes durchgerungen<br />
und stellte sich voll hinter die<br />
Umsturzplanung Olbrichts und Tresckows.<br />
Über Olbricht knüpfte sich zu<br />
Stauffenberg, dem ehemaligen Untergebenen,<br />
eine enge persönliche Beziehung<br />
und weitgehende Gesinnungsgemeinschaft.<br />
In ihrer Auffassung von der<br />
politischen Führungsrolle der Wehrmacht<br />
stimmten beide Persönlichkeiten,<br />
trotz so unterschiedlicher Herkunft,<br />
völlig überein, und so konnte Beck zum<br />
Hauptverbindungsmann Stauffenbergs<br />
zur zivilen Verschwörergruppe werden<br />
und den Führungsanspruch des eigenwilligen<br />
Goerdeler begrenzen,, der seine<br />
Aufgabe auch darin erblickte zu verhindern,<br />
„dass die Generäle etwas Politisches<br />
unternehmen“.<br />
Stauffenberg nutzte die Verzögerung,<br />
die infolge des wiederholten Scheiterns<br />
des Attentatsvorhabens eintrat, um die<br />
Basis der Verschwörung im militärischen<br />
Apparat auszuweiten und<br />
zugleich die Kontakte zur zivilen Opposition<br />
zu intensivieren. Es fehlte anfänglich<br />
nicht an Mißverständnissen. So rief<br />
seine Äußerung gegenüber Hermann<br />
Maaß, den Vertrauensmann Wilhelm<br />
45<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
Leuschners, dass „die geschichtlichen<br />
Leistungen des Adels“ nicht über Bord<br />
geworfen werden sollten, erhebliches<br />
Misstrauen hervor, während die Zusicherung<br />
Josef Wirmers, dass „nach keiner<br />
Richtung alte Zustände wieder<br />
aufgewärmt werden sollten“, bei Stauffenberg<br />
deutliche Beruhigung auslöste.<br />
Unzweifelhaft lehnte Stauffenberg die<br />
Rückkehr zu „Weimarer Verhältnissen“,<br />
damit den parteienstaatlichen Parlamentarismus,<br />
nachdrücklich ab. Er war<br />
stark von korporatistischen Vorstellungen<br />
geprägt und näherte sich neokonservativen<br />
Ideengängen, wie sie im Kreisauer<br />
Kreis vorherrschten. Mit dem Blick<br />
auf Gneisenau erwog er, „einen staatstragenden<br />
Stand zu schaffen und so<br />
stark zu machen, dass er eine weise und<br />
feste Führung auszuüben fähig sei“. Es<br />
ist offen, wie weit diese paternalistischen<br />
Züge, die in den Beratungen des<br />
Lautlinger Kreises im Vordergrund<br />
standen, später zurücktraten. Mit der<br />
Hervorhebung der sozialen Komponente<br />
wies sein politisches Weltbild eine<br />
gewisse Verwandtschaft mit der Idee des<br />
„preußischen Sozialismus“ auf.<br />
Indessen vermieden Stauffenberg wie<br />
Beck ,sich direkt in die Pläne der zivilen<br />
Oppositionsgruppen einzuschalten. Für<br />
beide stand — darin waren sie sich mit<br />
dem Sozialdemokraten Julius Leber<br />
einig — die Notwendigkeit des Handelns<br />
im Vordergrund. Daher vermieden<br />
sowohl Beck wie Stauffenberg, die zunehmenden<br />
Spannungen mit Carl Friedrich<br />
Goerdeler, der als Reichskanzler<br />
vorgesehen war, auszutragen. Der Leipziger<br />
Ex-Oberbürgermeister sah in den<br />
Militärs ein bloßes Vollzugsorgan der<br />
bürgerlichen Opposition, was auf einer<br />
fragwürdigen Bewertung des Verhältnisses<br />
von Politik und Kriegführung beruhte.<br />
Goerdelers blauäugige Verkennung<br />
des schwindenden außenpolitischen<br />
Handlungsspielraums der Verschwörung,<br />
zugleich deren Gefährdung durch<br />
dessen „geräuschvolles“ Auftreten<br />
stießen bei Stauffenberg auf Unverständnis.<br />
Er blieb gleichwohl darum<br />
bemüht, Goerdeler weiterhin einzubinden,<br />
obwohl dieser noch immer das<br />
Attentat ablehnte und sich in der Haft<br />
zu der Vorstellung verstieg, in dessen<br />
Scheitern ein Gottesurteil zu erblicken.<br />
Stauffenberg hatte ursprünglich die<br />
Zusammensetzung der Umsturzregierung<br />
in Rücksicht auf den zu erwartenden<br />
Einfluss der KPD stärker nach links<br />
auszurichten. Die Loyalität Wilhelm<br />
Leuschner und auch Julius Leber, den<br />
Stauffenberg für die Position des<br />
Reichskanzlers anstelle von Goerdeler<br />
favorisierte, bewirkten, dass dieser an<br />
ihm weiterhin festhielt. Trotzdem fühlte<br />
sich Goerdeler politisch isoliert und<br />
betrachtete Stauffenberg mit zunehmendem<br />
Misstrauen, der seinerseits aus<br />
guten Gründen weitere Zusammenkünfte<br />
im Blick auf die Gestapoüberwachung<br />
vermied. Das führte dazu, dass<br />
Goerdelers Vertrauensmann Hans-<br />
Bernd Gisevius, der eine führende Stelle<br />
in der künftigen Umsturzregierung<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
46<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
anstrebte, gegen Stauffenberg intrigierte<br />
und ihn bei dem amerikanischen Geschäftsträger<br />
in Bern, Allen Welch Dulles,<br />
anschwärzte, sich für eine „Ostlösung“<br />
einzusetzen und die Bildung einer<br />
„Arbeiter- und Bauernregierung“ anzustreben.<br />
Das ging bestenfalls auf Missverständnisse<br />
in einer Unterredung mit<br />
Stauffenberg zurück.<br />
An derlei später von der DDR-<br />
Geschichtswissenschaft aufgebauschten<br />
Spekulationen war nur so viel wahr, dass<br />
Stauffenberg, der das Auftreten des<br />
Nationalkomitees Freies Deutschland<br />
als politisches Warnsignal auffasste, der<br />
Initiative Julius Lebers und Adolf Reichweins<br />
zustimmte, mit der illegalen<br />
Reichsleitung der KPD Kontakt aufzunehmen,<br />
um sie zu einer Politik des<br />
Stillhaltens gegenüber der Umsturzregierung<br />
zu bewegen. Auf der gleichen<br />
Linie lag der Versuch Helmuth James<br />
von Moltkes, Ende 193 mit Vertretern<br />
der US-Diplomatie zusammenzutreffen<br />
und um größeres Verständnis der westlichen<br />
Alliierten für die angestrebte<br />
Linksorientierung des Übergangskabinetts<br />
zu werben. Hingegen war Stauffenberg<br />
zu keinem Zeitpunkt bereit, ein<br />
Arrangement mit der Sowjetunion<br />
ernsthaft ins Auge zu fassen und hoffte,<br />
die Ostfront bis zum Eintreffen der<br />
Westmächte stabilisieren zu können.<br />
Texte publik gemacht<br />
Aber die Erwägungen, den Westen doch<br />
noch zu einem Entgegenkommen zu<br />
bewegen, und die im letzten Moment<br />
über Madrid aufgenommenen Kontaktversuche<br />
scheiterten auf der ganzen<br />
Linie. Die vage Hoffnung auf eine Öffnung<br />
der Westfront musste abgeschrieben<br />
werden. Im Gegensatz zu dem noch<br />
immer in außenpolitischen Illusionen<br />
befangenen Goerdeler war sich Stauffenberg<br />
über die mangelnden diplomatischen<br />
Erfolgsaussichten, von denen<br />
auch Adam von Trott immer noch<br />
träumte, völlig im klaren, und er war<br />
darin durch Otto John bestärkt, der eine<br />
ernüchternde Lageanalyse vorlegte.<br />
Trotz allem musste der Umsturz um des<br />
Ansehens Deutschlands willen in der<br />
Welt gewagt werden. Mit Ludwig Beck<br />
stimmte er in der Überzeugung überein,<br />
dass ein Attentat, auch wenn die Erfolgsaussichten<br />
äußerst gering waren,<br />
„schon aus sittlichen Gründen für die<br />
deutsche Zukunft“ unternommen werden<br />
musste.<br />
In einer Aufzeichnung, die Stauffenberg<br />
am 20. Juli 1944 bei sich trug und die in<br />
einer Zusammenfassung durch die<br />
Gestapo überliefert ist, wies es darauf<br />
hin, „das derzeitige Regime habe kein<br />
Recht, das ganze deutsche Volk mit in<br />
seinen Untergang hineinzuziehen. Nach<br />
einem Regimewechsel sei es das wichtigste<br />
Ziel, dass Deutschland noch einen<br />
im Spiel der Kräfte einsetzbaren Machtfaktor<br />
darstelle.“ Die Denkschrift, die<br />
offenbar vor dem 6. Juni 1944, dem<br />
Tage der alliierten Landung in Nordfrankreich<br />
entstand, zog ein Fazit aus<br />
dem Versagen der NS-Führung: „Den<br />
Anfang vom Ende der gesamten militärischen<br />
Entwicklung bilde der russische<br />
47<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
Feldzug, der mit dem Befehl zur Tötung<br />
aller Kommissare begonnen habe und<br />
mit dem Verhungernlassen der Kriegsgefangenen<br />
und der Durchführung von<br />
Menschenjagden zwecks Gewinnung<br />
von Zivilarbeitern fortgesetzt worden<br />
sei“. In anderem Zusammenhang wies<br />
Stauffenberg auf die Ermordung der<br />
Juden hin und die Gewaltpolitik gegen<br />
ethnische Minderheiten. Die als „Memorandum“<br />
überschriebene Aufzeichnung<br />
lässt die innere Einheit des militärischen<br />
und des humanitären Motivs für<br />
sein Handeln klar hervortreten. Eine der<br />
Wurzeln dafür bestand in dem Bekenntnis<br />
zum „wahren Preußentum“, mit dem<br />
der „Begriff der Freiheit“ untrennbar<br />
verbunden war, wie er seinen Söhnen<br />
auf den Lebensweg mitgab. Die Verantwortung<br />
für die ihm untergebenen<br />
Soldaten, aber auch sein Gefühl für<br />
nationale Ehre, zugleich moralische<br />
Empörung gegen die sich häufenden, in<br />
der Person Hitler kulminierenden, aber<br />
dem System innewohnenden Korruption<br />
und Gewaltverherrlichung trieben<br />
ihn zum Handeln. Ohne seinen unbeugsamen<br />
Tatwillen, seine moralische Energie<br />
und die Bereitschaft, sein Leben für<br />
Deutschland zu opfern, wäre das Attentat<br />
des 20. Juli 1944 nicht erfolgt, und<br />
den Nachlebenden bleibt nur, ihn in<br />
Ehrfurcht und Stolz in lebendiger Erinnerung<br />
zu halten.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Prof. Dr. Hans Mommsen übernahm 1968 den Lehrstuhl für Neuere Geschichte an der<br />
Ruhr-Universität Bochum und begründete dort das Institut für die Geschichte der europäischen<br />
Arbeiterbewegung. Seitdem war er u. a. Fellow des Institute for Advanced Study in<br />
Princeton, Visiting Professor an der Harvard-University und an der University of Berkeley<br />
sowie Gastprofessor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Der mittlerweile emeritierte<br />
Historiker erhielt 1998 den Carl Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg.<br />
LITERATUR<br />
<br />
<br />
Mommsen, Hans, Alternativen zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen<br />
Widerstandes, München 2000<br />
Hoffmann, Peter, Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Biographie, München<br />
2007<br />
48<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Child Inclusive Exhibition Design<br />
Texte publik gemacht<br />
Supplementing the Needs of Children in Conventional Exhibitions<br />
Katarzyna Warpas, Hildesheim<br />
How to let museums better perform their role as a “motor for the learning society” is a<br />
leading question throughout this issue of the Netzwerk<br />
werkmagazin<br />
magazin. . In the following summary<br />
of her Master Thesis, submitted at the University of Applied Arts and Science in Hilde-<br />
sheim, Katarzyna Warpas outlines her design concept for an exhibition at the Römer<br />
R<br />
mer- und<br />
Pelizaeus Museum Hildesheim. It aims at conveying the culture of ancient Peru to the<br />
younger museum visitors who become users through well-directed<br />
interaction.<br />
tion.<br />
Museums are often seen as irrelevant,<br />
rigid, boring and stuffy, especially by the<br />
youngest generation. Often they are<br />
indeed like that. However, these features<br />
are not included in the definition of<br />
museum and are rather part of attitude<br />
which has developed during last fifty<br />
years. Now more than ever, in a fast<br />
developing, globalised modern society,<br />
museums are under pressure to motivate<br />
young visitors to examine their past<br />
in order to understand current issues<br />
better and to shape the future with<br />
greater awareness. Although children<br />
constitute a major part of the museum<br />
audience, their needs, perspectives and<br />
museum experiences are still largely<br />
ignored. The main aim of my master<br />
thesis was to examine the importance of<br />
including children’s needs into the<br />
planning of conventional exhibitions.<br />
This work should also form a basis for<br />
future design research in this field.<br />
An example of an information board to an exhibit<br />
49<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
Modern museum m as a user-driven place<br />
James Bradbourne, the director of the<br />
Museum für Angewandte Kunst in<br />
Frankfurt am Main, stated that “Now<br />
more than ever, society needs to use its<br />
museums as a ‘motor for the learning<br />
society’ — and if we fail to meet this<br />
challenge, museums risk becoming<br />
marginalised and irrelevant.” The modern<br />
museum is expected not only to<br />
allow a continuous knowledge gain but<br />
also interaction between visitors. In<br />
other words, the visitor must be seen no<br />
longer as an observer but as a user. Supporting<br />
interaction, rather than communication<br />
of facts, results in conversion<br />
from an exhibition to an informal<br />
learning environment. In this context, a<br />
museum becomes a user-driven place,<br />
where the visitors make choices rather<br />
than being merely presented with information.<br />
As an example, consider a<br />
showcase with a collection of Peruvian<br />
ceramics and a label ‘Moche Ceramic —<br />
100 AD’. This involves the visitor<br />
much less than the same<br />
showcase with a label ‘One of this<br />
items is a fake’, which confronts<br />
visitors with a task and automatically<br />
drives them to examine the<br />
objects more carefully. What<br />
does this mean as far as child<br />
visitors are concerned?<br />
of their age or developmental stage. First<br />
of all, children use the present as an<br />
initial point of all their activities. From<br />
this standpoint, they investigate the past<br />
and the future. Additionally, children<br />
learn mostly through their senses.<br />
Touching, smelling and tasting are as<br />
important as listening and observing.<br />
The third important issue is the need of<br />
children for active participation and<br />
interaction. Games in particular play a<br />
significant role in this process. Unlike<br />
other user groups, children undergo<br />
continuous and some times rapid<br />
change. For this reason, it is advisable to<br />
consider them according to different<br />
age groups. These groups are: Infants<br />
and Toddlers, Small children, Children<br />
and Adolescents. Some children, however,<br />
develop much faster than others.<br />
For that reason, clear borders between<br />
particular groups do not exist and this<br />
division is only a generalisation. To fully<br />
include children in museums, it is essential<br />
not only get to know their physical<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Needs change as children grow<br />
There are features that can be<br />
applied to all children regardless<br />
A sketch of the hands-on exhibit on the subject of the Nazca<br />
lines<br />
50<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
capabilities and limits, but also to examine<br />
their ability to learn and the ways it<br />
develops. Because children’s cognition is<br />
mostly based on experiences of here and<br />
now, it is important to choose subjects<br />
that are essential and current for them.<br />
In order to become a lifelong learning<br />
environment, museums should try to<br />
encourage children to everyday use of<br />
the museum. To involve children, the<br />
museum has to find a way to consider<br />
their various needs in exhibition planning.<br />
A solution to this problem might<br />
be child inclusive exhibition design.<br />
What is child inclusive e exhibition de-<br />
d<br />
sign?<br />
It is an approach to the design of exhibitions<br />
that are accessible to and usable by<br />
not only adults but also children with all<br />
their limits, capabilities and needs.<br />
This derives from inclusive design,<br />
which is a model mostly considered in<br />
relation to elderly and disabled people.<br />
According to this model, a person is<br />
excluded by design, when the demands<br />
of a product usage go beyond the capabilities<br />
of the user. In the museum context,<br />
this model also relates to children<br />
who do not comply with common design<br />
standards and are therefore often<br />
excluded. There are several ways of<br />
improving museum learning in the<br />
terms of design requirements including<br />
the creation of child friendly environments,<br />
preparing clear orientation and<br />
labelling system, organisation of child<br />
Texte publik gemacht<br />
suitable spaces, usage of different media<br />
and senses, and advertising campaigns<br />
for children and child centred web design.<br />
Strategic concept<br />
Taking these suggestions into consideration<br />
and working in cooperation with<br />
the Roemer- und Pelizaeus Museum<br />
Hildesheim, I have developed an additional<br />
layer for children for the permanent<br />
exhibition ‘Ancient Peru: Cultures<br />
in the realm of the Incas’. This exhibition<br />
aims to give an impression of the cultural<br />
diversity of old Peru over the centuries.<br />
It is targeted to adults, mostly to<br />
specialists interested in the subjects and<br />
well informed citizens. Children are<br />
considered only in the terms of school<br />
groups or as participants of workshops.<br />
For this reasons, the main focus of my<br />
project lays on attracting the attention<br />
of children and families to the exhibition<br />
as well as awakening an interest in different<br />
cultures and nations. It is also<br />
essential to make the old Peru exhibition<br />
more appealing by the involvement of<br />
different senses and media. By following<br />
these goals, the position of the museum<br />
as a lifelong learning environment can<br />
be established and strengthened.<br />
The project is targeted to the group of 8<br />
to 12 year olds. This age group is already<br />
able to actively participate and understand<br />
the subjects presented. Through<br />
supplementing the needs of children in<br />
51<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
an exhibition primarily directed towards<br />
adults, families will be included as an<br />
important visitor group. In order to<br />
encourage autonomous exploration by<br />
the young visitors in the museum, several<br />
design solutions were taken into<br />
consideration: interactive stations, child<br />
suitable labels, exhibition guide, worksheets<br />
designed to be fun to use, redesigned<br />
website and an advertising campaign.<br />
The network<br />
A test run of the prototype of the exhibit<br />
“Vermessung der Nazca-Welt”<br />
All of these elements will be integrated<br />
into the network, which should encourage<br />
the audience to actively participate<br />
in the exhibition and museum’s life. This<br />
network connects the analogue world of<br />
the museum space and digital world of<br />
internet. Such a network might be created<br />
around an online platform accessible<br />
at home and at the museum. The<br />
main idea is to motivate children to take<br />
part in a knowledge expedition, where<br />
typical steps of an adventure have to be<br />
taken: preparation, journey and report.<br />
The preparation starts on the e-learning<br />
platform, where the children can choose<br />
the destination of their journey, learn<br />
basic terminology, geography and names.<br />
After completing the first level<br />
they are asked to continue their journey<br />
in the museum. The exhibition area<br />
shows them not only artefacts, but also<br />
provides them with learning aids such as<br />
interactive stations and worksheets. The<br />
last part of the journey is an online quiz,<br />
which checks the level of the knowledge<br />
gained, and sharing with other users in<br />
the online forum. Such a model creates a<br />
community around the museum. The<br />
name of the network is Reiselogie as it<br />
underlines the idea of children who<br />
explore the world of knowledge in a free<br />
and playful way.<br />
Hands-on!<br />
After completing the preparation level,<br />
children are encouraged to continue<br />
their journey by visiting the exhibition in<br />
the museum. There they can find interactive<br />
stations on the chosen subject. I<br />
have developed ten ideas for hands-on<br />
exhibits. Of the ten, the exhibit ‘Vermessung<br />
der Nazca Welt’ was chosen to<br />
be realised as a prototype. The lines of<br />
the Nazca consist of a series of designs<br />
which are up to nine kilometres long.<br />
Visitors learn about scale of the pictures<br />
by using their own feet as measuring<br />
tools. As learning aids models of an<br />
elephant, whale and a bus can be used.<br />
As they are exactly in the same scale as<br />
the pictures, the scale can be better<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
52<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
understood. I also developed an example<br />
of information board and worksheet for<br />
this exhibit.<br />
Summary<br />
Texte publik gemacht<br />
In conclusion, this thesis reveals several<br />
empirical results, which are relevant to<br />
the future life of museums. First of all, an<br />
analysis of conventional museums and<br />
related child-orientated institutions<br />
revealed that children’s needs are still<br />
not focused on by museums. For that<br />
reason, these institutions are perceived<br />
by the youngest part of modern society<br />
as irrelevant and boring. This unwelcoming<br />
impression and negative attitude is<br />
strengthened by subjects unrelated to<br />
daily life, stiff atmosphere, antiquated<br />
methods of education and high entrance<br />
fees. As a result, the museum not only<br />
loses in competition with a huge edutainment<br />
industry, but also barely exists<br />
in the consciousness of the local society.<br />
In order to avoid such a situation for the<br />
future, museums have to make an effort<br />
to get to know modern society and the<br />
ways of communication most appropriate<br />
for it. The keywords in this discussion<br />
are networking and interactivity.<br />
The ideas presented in this thesis are<br />
conceptually developed to the point<br />
that they can be produced and tested in<br />
real museum life. Moreover, some of the<br />
parts of the project might be applied to<br />
other museums or even developed into<br />
a national system, which connects many<br />
museums in the country. As far as the<br />
theoretical work is concerned, this thesis<br />
reveals an urgent need for design<br />
research in the field of exhibition design<br />
for conventional museums. As for exhibition<br />
design practice, an attempt has<br />
been made to draw the attention of<br />
designers and planners to the issue of<br />
design inclusion, understood broadly as<br />
supplementing the needs of different<br />
people. It also thematises the child as an<br />
equal and essential user. This work<br />
opens the following questions for future<br />
discussion; Are we able to design for<br />
broader audiences? How can a designer<br />
support an individual’s process of learning?<br />
How can interactivity and noninteractive<br />
museum objects work together?<br />
What design requirements are<br />
there for multigenerational usage?<br />
Katarzyna Warpas was born in Goldap / Poland and studied Intermedia at the Nicolaus<br />
Copernicus University in Torun. In 2005, she came to Hildesheim as an exchange Student<br />
to the design Faculty of HAWK Hildesheim, where she received a diploma in Graphic Design.<br />
At the same university, she has just finished her Master Studies.<br />
53<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Texte publik gemacht<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
54<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Termine<br />
17. September 2009 — Vernissage zu „Wand(lungen)“<br />
Die Ausstellung „Wand(lungen)“ ist eine fotografische Revision<br />
bzw. Weiterführung des kuratorischen Projektes „Ri-Pikturim“<br />
(Re-Paintings), das von Sonja Lau, <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> Fellow für Innovation<br />
in der Kultur 2008/2010, in Zusammenarbeit mit André<br />
Siegers im September 2008 an der Nationalgalerie Tirana, Albanien,<br />
entstand. Dort wurde die grundlegende Renovierung des<br />
Ausstellungsgebäudes genutzt, um auf den roten Wandflächen<br />
temporäre Gemälde entstehen zu lassen. Albanische Künstler waren<br />
eingeladen, eines ihrer Werke aus der kommunistischen Zeit<br />
des Landes neu zu interpretieren. Im Zuge der fortschreitenden<br />
Renovierungsarbeiten verschwanden die neuen Werke wie in einer<br />
umgekehrten kulturellen Archäologie unter dem neuen weißen<br />
Anstrich der Galerie und markierten das Ende der Ausstellung.<br />
Das Bemalen der Wände wurde so zu einer symbolischen<br />
Geste: zu einem Kommentar über das Erscheinen und Verschwinden,<br />
zu parallelen Kunst(ge)schichten und nicht zuletzt zu einer<br />
Reflexion über das Persönliche und das Institutionelle. Die Ausstellung<br />
„Wand(lungen)“, die bis 9. Oktober in der Galerie im Georgshof<br />
gezeigt werden wird, ist eine fotografische Dokumentation<br />
des Projekts.<br />
Links<br />
55<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Links<br />
15. Oktober 2009 — Eröffnung der Ausstellung „Reflexionen“<br />
In der Ausstellung „Reflexionen“ werden Darstellungen einer<br />
noch wenig berührten Natur mit Aufnahmen kontrastiert, die die<br />
immer noch fortschreitende Zerstörung bisher intakter Ökosysteme<br />
in Bulgarien dokumentieren. Hinter der Ästhetik des Motivs,<br />
die alle Fotografien verbindet, verbirgt sich eine Entwicklung unkontrollierten<br />
wirtschaftlichen Wachstums und häufiger Gesetzesmissachtung,<br />
die die verbliebenen bulgarischen Naturlandschaften<br />
bedroht. Ziel der Ausstellung ist es, diese Problematik ins<br />
Bewusstsein der lokalen Öffentlichkeit zu heben. Sie ist Kern des<br />
Projekts „Stolen Heritage“, das der Forstwissenschaftler Angel<br />
Ispirev im Rahmen des Projekts „NatuRegio“ in Zusammenarbeit<br />
mit dem mehrfach ausgezeichneten bulgarischen Fotografen Alexander<br />
Ivanov, dessen künstlerischer Schwerpunkt Naturfotografie<br />
ist, verwirklichte. Die Ausstellung wird in der Galerie im Georgshof<br />
gezeigt.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
28. Oktober 2009 — Konzert von „Siggen Brass“<br />
Der Kultursommer in Siggen, dessen Saison unter der Überschrift<br />
„Auswärtsspiel“ steht, geht in die Verlängerung mit dem Bläserensemble<br />
„Siggen Brass“. Näheres unter<br />
www.toepfer-fvs.de/kultursommer.html<br />
Öffnungszeiten der Galerie im Georgshof: Mo — Do: 14 — 17 Uhr,<br />
Fr: 14 — 16 Uhr. Eine Einladung zur Ausstellungseröffnung wird<br />
Ihnen auf Wunsch zugesendet, Kontakt: luthe@toepfer-fvs.de<br />
56<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Links zu interessanten Projekten in Europa<br />
Links<br />
An dieser Stelle werden Links zu Förderprogrammen und Organisationen<br />
mit den Schwerpunkten Kultur und Europa gesammelt.<br />
1989 — 20 Jahre danach<br />
Das Netzwerk n-ost beleuchtet die politische Wende von 1989 aus unterschiedlichen<br />
Blickwinkeln in mehreren Artikelserien.<br />
www.n-ost.de/1989<br />
KULTUR-Programm der Europäischen Union<br />
Das über sieben Jahre laufende Förderrahmenprogramm (2007 —<br />
2013) ist mit 400 Millionen Euro dotiert.<br />
www.ccp-deutschland.de<br />
European Cultural Foundation<br />
Die unabhängige Organisation fördert grenzüberschreitende Projekte<br />
in Europa.<br />
www.eurocult.org<br />
Jugend in Aktion<br />
Fast eine Milliarde Euro stellt die EU im Rahmen dieses Programms für<br />
europäische Jugendarbeit zur Verfügung<br />
www.jugend-in-aktion.de<br />
Eurozine<br />
Das Netzwerk verbindet über 70 Kulturmagazine aus ganz Europa.<br />
www.eurozine.org<br />
euro|topics<br />
Hier präsentiert sich die Bundeszentrale für politische Bildung mit einem<br />
aktuellen europäischen Themenportal.<br />
www.eurotopics.net<br />
57<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Links<br />
Ploteus<br />
Die EU-Kommission fasst hier sämtliche europäischen Programme<br />
zum Bildungsaustausch und zum Lernen in Europa zusammen.<br />
http://ec.europa.eu/ploteus<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Kulturstiftung des Bundes<br />
Die Kulturstiftung des Bundes fördert bundesweit internationale Kulturprojekte<br />
im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes.<br />
www.kulturstiftung-des-bundes.de<br />
Deutsches Informationszentrum Kulturförderung<br />
Die umfangreiche Datenbank versammelt kulturelle Förderprogramme<br />
aus allen Bereichen.<br />
www.kulturfoerderung.org/de<br />
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde<br />
Unter Leitung von Dr. Rita Süssmuth engagiert sich die Gesellschaft für<br />
den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch mit Osteuropa.<br />
www.dgo-online.org<br />
58<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Wir freuen uns über Ihre Beiträge.<br />
Ihre Projekte<br />
Das Netzwerkmagazin soll ein möglichst breites Bild von allen Aktivitäten<br />
rund um die <strong>Stiftung</strong> vermitteln. Deshalb freuen wir uns<br />
über Hinweise auf Ihre Projekte. Auch Links und Terminankündigungen<br />
sind interessant.<br />
Ihr Beitrag im Magazin<br />
Haben Sie eine Idee für einen Bericht, eine Reportage? Gibt es für<br />
die Alumni interessante Neuigkeiten aus Sofia, London, Zagreb,<br />
Warschau, Paris . . . ? Möchten Sie Auszüge aus Ihrem literarischen<br />
Schaffen veröffentlichen, eine Ausstellung, Veranstaltung oder ein<br />
Wissenschaftsprojekt ankündigen? Das Magazin lebt von Ihren Beträgen.<br />
Senden Sie uns Ihre Texte oder kontaktieren Sie uns, um<br />
Ihren Beitrag abzusprechen.<br />
Ihre Texte publik gemacht<br />
Unter der Rubrik Texte publik gemacht veröffentlicht die <strong>Alfred</strong><br />
<strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. regelmäßig ausgewählte Vorträge, Reden<br />
und Texte aus dem <strong>Stiftung</strong>sgeschehen sowie Abstracts wissenschaftlicher<br />
Arbeiten. Hier können Sie auch Auszüge und Abstracts<br />
Ihrer Studienarbeiten und Dissertationen veröffentlichen.<br />
Gern nehmen wir Ihre Vorschläge und Texte entgegen.<br />
Wir informieren ebenfalls gern über Buchveröffentlichungen der<br />
<strong>Toepfer</strong>-Alumni. Wenn Sie etwas veröffentlicht haben, senden Sie<br />
bitte eine kurze Notiz.<br />
59<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de
Ihre Anregungen und Kritik<br />
Was können wir besser machen? Welche Angebote wünschen Sie<br />
sich als Ehemalige der <strong>Stiftung</strong>? Von Ihren Wünschen und Anregungen<br />
profitiert das Netzwerk. Teilen Sie uns gerne Ihre Kommentare<br />
mit.<br />
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Kontakt: aye@toepfer-fvs.de<br />
60<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. www.toepfer-fvs.de
Netzwerkmagazin 12|08<br />
Redaktion:<br />
Beiträge<br />
Herausgeberin:<br />
Bildnachweise:<br />
Lutz Ohlendorf (lo)<br />
Dr. Antje Mansbrügge<br />
Julia Schwerbrock (js)<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
Georgsplatz 10, 20099 Hamburg<br />
Christian Enger (Titel, 15, 20) | André Lützen<br />
(5) | Kirsten Haarmann (6, 30) | Anja<br />
Klafki (6) | Dr. Martin Tröndle (9, 10, 12) |<br />
Klingendes Museum Hamburg e.V. (16) |<br />
MENTOR — Die Leselernhelfer HAMBURG<br />
e.V. (17) | <strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S. (19)<br />
| [Fotos zu Museumspädagogik] (20) | [Fotos<br />
zu Museumspädagogik] (23) | Lutz Ohlendorf<br />
(30) | Elín Hansdottir (33) | Katarzyna<br />
Warpas (51, 52, 54, 56) | kim czuma (60)<br />
Kontakt: (040) 33 402 26<br />
aye@toepfer-fvs.de<br />
61<br />
<strong>Alfred</strong> <strong>Toepfer</strong> <strong>Stiftung</strong> F.V.S.<br />
www.toepfer-fvs.de