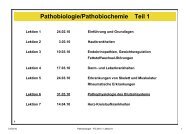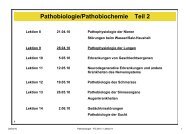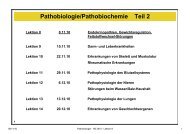Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle
Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle
Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Pathobiologie</strong>/<strong>Pathobiochemie</strong> <strong>Teil</strong> 2<br />
Lektion 8 21.04.10 Pathophysiologie der Nieren<br />
Störungen beim Wasser/Salz-Haushalt<br />
Lektion 9 28.04.10 Pathophysiologie der Lungen<br />
Lektion 10 5.05.10 Erkrankungen von Geschlechtsorganen<br />
Lektion 11 12.05.10 Neurodegenerative Erkrankungen und andere<br />
Krankheiten des Nervensystems<br />
Lektion 12 19.05.10 <strong>Pathobiologie</strong> des Schmerzes<br />
Lektion 13 26.05.10 <strong>Pathobiologie</strong> der Sinnesorgane<br />
Augenkrankheiten<br />
Lektion 14 2.06.10 Gedächtnisstörungen<br />
<strong>Pathobiologie</strong> der Sucht<br />
1<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 1
Stoff aus dem Lehrbuch zu Lektion 13<br />
G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel<br />
Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie<br />
des Menschen (6. Auflage)<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH<br />
Stuttgart, 2007.<br />
Grundlagen aus der Anatomie/Physiologie:<br />
Kapitel 19 (Sinnesorgane): Seiten 694-771<br />
Pathophysiologie der Sinnesorgane:<br />
Kapitel 19: Seite 724 (Störungen des Geschmackssinns)<br />
Seite 728 (Störungen des Geruchssinns)<br />
Seiten 736-737 (Hörstörungen)<br />
Seiten 741-742 (Störungen des Gleichgewichtssinns)<br />
Seiten 770-771 (Erkrankungen der Retina)<br />
2<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 2
Krankheiten der Sinnesorgane<br />
Allgemeine Sinnesphysiologie<br />
Störungen des somatosensorischen Systems<br />
Hörstörungen<br />
Gleichgewichtsstörungen<br />
Geschmacksstörungen<br />
Geruchsstörungen<br />
Augenkrankheiten<br />
3<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 3
Rekapitulation<br />
Allgemeine Sinnesphysiologie<br />
Die Sinnesphysiologie hat zwei Dimensionen:<br />
Objektive Sinnesphysiologie<br />
Kette physikochemischer Ereignisse, die von der Aufnahme der Sinnesreize bis zur Verarbeitung in den<br />
sensorischen Gehirnzentren durchschritten werden<br />
Wahrnehmumgspsychologie<br />
subjektive Empfindungen des Patienten, früher als subjektive Sinnesphysiologie bezeichnet<br />
Die aufgenommenen Sinnesreize induzieren subjektive Sinneseindrücke, die wir als Empfingungen<br />
bezeichnen. Wahrnehmumgen beruhen auf diesen Empfindungen, sie werden aber durch Erfahrungen<br />
geprägt und modifiziert.<br />
4<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 4
*<br />
Einteilung der Sinne<br />
5 klassische Sinne<br />
In der klassischen Medizin des Altertums und der frühen Neuzeit wurden 5 Sinne unterschieden:<br />
• Sehen<br />
• Hören<br />
• Schmecken<br />
• Riechen<br />
• Fühlen<br />
Der “6. Sinn”<br />
Amerikanische Forscher haben im Gehirn das Frühwarnsystem vor Risiken und Gefahren<br />
lokalisiert. Der sog. Anterior Cingulate Cortex (ACC) am oberen Ende des<br />
Frontallappens puzzelt Umwelteindrücke und vergangene Erfahrungen zusammen und<br />
vermittelt ein Gefühl für bevorstehende Schwierigkeiten. (Science 307:1118-1121, 2005)<br />
Weitere Sinne<br />
• Gleichgewicht<br />
• Temperatur<br />
• Tiefensensibilität<br />
• Schmerz<br />
5<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 5
Rekapitulation<br />
Informationsvermittlung in Sensoren<br />
Damit die Information über einen Reiz bis ins<br />
ZNS übermittelt werden kann, muss dieser<br />
zweimal “übersetzt” werden:<br />
Transduktion<br />
Die Reize werden von speziellen Abschnitten der<br />
Zellmembran, den Sensoren, aufgenommen und<br />
in eine nervöse Erregung übersetzt. Das so<br />
entstehende Potential nennt sich Sensorpotential<br />
und bildet die Reizgrösse durch seine<br />
Amplitude ab.<br />
Transformation<br />
Damit dieses Potential über die afferenten<br />
Neuronen weitergeleitet werden kann, muss es in<br />
eine Folge von Aktionspotentialen umcodiert<br />
werden. Die Amplitude des Sensorpotentials wird<br />
dabei durch die Frequenz der Aktionspotentiale<br />
abgebildet.<br />
6<br />
A. Haarzelle aus der Kochlea oder dem Vestibularorgan<br />
B. Muskelspindel des Frosches C. Pacini-Körperchen<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 6
(*)<br />
Molekulare Mechanismen der Transduktion<br />
Bei den Transduktionsprozessen kann man grob die<br />
Transduktion chemischer, thermischer und mechanischer<br />
Reize unterscheiden.<br />
Chemische Reize reagieren in vielen Fällen mit spezifischen<br />
Rezeptoren, die G-Protein-gekoppelt sind. Durch<br />
die Aktivierung der G-Proteine kommt es zur Aktivierung<br />
einer Second-Messenger-Kaskade, die eine Erhöhung<br />
der Leitfähigkeit von Kationenkanälen bewirkt, so dass<br />
das Generatorpotential entsteht.<br />
Bei der Transduktion thermischer Reize entsteht das<br />
Sensorpotential durch Konfigurationsänderungen der<br />
Rezeptor-Kanalkomplexe, die auch deren Leitfähigkeit<br />
für einen Kationenstrom verändert.<br />
Mechanische Reize bewirken ebenfalls eine Permeabilitätsänderung<br />
der Rezeptormoleküle in den Sensormembranen,<br />
die mit Membrankanälen verbunden sind.<br />
Chemosensoren<br />
- Sinneszellen der Riechschleimhaut<br />
- Geschmackszellen<br />
Thermosensoren<br />
- Kaltsensoren: CMR 1<br />
-Rezeptor<br />
- Warmsensoren: VR 1<br />
-Rezeptor<br />
(TRP-Rezeptormoleküle)<br />
Mechanosensoren<br />
- Vater-Pacini-Körperchen<br />
Bei den meisten Sensoren sind die Membrankanäle,<br />
welche für Sensorpotentiale verantwortlich sind, nichtselektive<br />
Kationenkanäle. Sie sind nicht identisch mit den<br />
spannungsabhängigen Membrankanälen, von denen die<br />
Aktionspotentialbildung abhängt.<br />
7<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 7
(*)<br />
Somatoviszerales sensorisches System<br />
Das somatoviszerale System umfasst die Wahrnehmungsfunktionen<br />
der Haut, der inneren Organe und des Bewegungssystems.<br />
Die Qualitäten dieses Sinnessystems sind die folgenden:<br />
• Druck/Berührung:<br />
• Wärme/Kälte:<br />
• Schmerz:<br />
• Eingeweidegefühl:<br />
• Lagesinn:<br />
Mechanorezeption<br />
Thermorezeption<br />
Nozizeption<br />
Viszerozeption<br />
Propriozeption<br />
Die peripheren somatoviszeralen Nerven durchziehen mit<br />
ihren feinen Verästelungen alle Regionen und Organe des<br />
Körpers wie ein Flechtwerk (A-Fasern und C-Fasern).<br />
Es gibt zwei dominierende aufsteigende Bahnsysteme des<br />
somatoviszeralen Systems: das Hinterstrangsystem (Mechanorezeption<br />
der Haut, Propiozeption) und das Vorderstrangsystem<br />
(Thermorezeption, Nozizeption, Viszerozeption).<br />
Sie sind in Rückenmark, Hirnstamm, Thalamus und<br />
Kortex lokalisiert.<br />
8<br />
Funktionell-anatomische Übersicht des somatosensorischen Systems.<br />
Rot: Bahnen und Kerne des Hinterstrangsystems. Blau: Bahnen und Kerne des Vorderstrangsystems.<br />
Rote Pfeile: Somatotopie=räumlich geordnete Beziehung zwischen peripherer<br />
Sinnesflächen und dem jeweiligen Gebiet im Zentralnervensystem.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 8
(*)<br />
Mechanorezeption (Tastsinn)<br />
Der Tastsinn wird durch niederschwellige Mechanosensoren<br />
der Haut vermittelt (SA-, RA- und PC-Sensoren). Sie adaptieren<br />
unterschiedlich schnell auf mechanische Reize.<br />
SA = “slowly adapting” = langsam adaptierende Mechanosensoren,<br />
die bei langdauernden Hautreiz ständig Aktionspotentiale<br />
erzeugen (z.B. Körpergewicht auf Fusssohlen).<br />
RA = “rapidly adapting” = schnell adaptierender Mechanosensor,<br />
der nur bei bewegten mechanischen Hautreizen antwortet.<br />
PC = “Pacinian Corpuscle” = sehr schnell adaptierender<br />
Mechanosensor, der vor allem auf Vibrationsreize anspricht.<br />
Die klassischen psychophysiologischen Qualitäten Druck,<br />
Spannung, Berührung und Vibration des Tastsinns können<br />
diesen Sensoren zugeordnet werden.<br />
(Druck)<br />
(Spannung)<br />
(Berührung)<br />
(Vibration)<br />
9<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 9
(*)<br />
Mechanosensoren der Haut<br />
unbehaarte Haut<br />
Meissner-Körperchen<br />
Merkel-Zellen<br />
Ruffini-Körperchen<br />
Pacini-Körperchen<br />
behaarte Haut<br />
Haarfollikel-Sensoren<br />
Tastscheiben<br />
Ruffini-Körperchen<br />
Pacini-Körperchen<br />
Freie Nervenendigungen vermitteln<br />
Schmerz- und Kitzelempfindungen.<br />
10<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 10
(*)<br />
Mechanosensoren der Haut<br />
11<br />
Diversity of somatosensenory neurons in the skin. The skin is innervated by somatosensory neurons that project<br />
to the spinal cord. Aβ-fibres, such as those that innervate Merkel cells and those around hair shafts, are thought<br />
to be touch receptors. Aδ-fibres and C-fibres include thermoreceptors and nociceptors. Aδ-fibres terminate in<br />
the dermis. Peptidergic and non-peptidergic C-fibres terminate in different epidermal layers59 and have different<br />
projection patterns to the spinal cord.<br />
Lumpkin & Caterina, Nature 445:858-865, 2007<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 11
(*)<br />
Störungen des somatosensorischen Systems<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
Ausfall von Rezeptoren, welche die verschiedenen Reize in der<br />
Peripherie in neuronale Aktivität umwandeln, führen zu völligem oder<br />
teilweisem Ausfall der Sinneswahrnehmung (Anästhesie, Hypästhesie),<br />
verstärkte Wahrnehmung (Hyperästhesie), Sinneswahrnehmungen<br />
ohne adäquaten Reiz (Parästhesien, Dysästhesien).<br />
Läsionen in peripheren Nerven können auch An-, Hyp-, Hyper-,<br />
Para- und Dysästhesien hervorrufen, beeinträchtigen jedoch gleichzeitig<br />
Tiefensensibilität und Motorik.<br />
Brown-Séquard-Syndrom (Halbseitenquerschnitt): dissoziierte Empfindungsstörung.<br />
Unterbrechung der Hinterstrangbahnen unterbindet die adäquate<br />
Vibrationsempfindung und mindert die Fähigkeit, mechanische Reize<br />
räumlich und zeitlich exakt zu definieren und ihre Intensität richtig<br />
einzuschätzen. Tiefensensibilität: Kontrolle der Muskeltätigkeit gestört<br />
(Ataxie).<br />
Läsion im Vorderseitenstrang beeinträchtigt Druck-, Schmerz- und<br />
Temperaturempfindung. Es können An-, Hyp-, Hyper-, Para- und<br />
Dysästhesien auftreten.<br />
Bei Läsionen im somatosensorischen Kortex sind häufig räumliches<br />
und zeitliches Auflösungsvermögen von Empfindungen sowie<br />
Stellungs- und Bewegungssinn aufgehoben. Einschätzung der Intensität<br />
des Reizes ist beeinträchtigt.<br />
Läsionen in assoziativen Bahnen oder Rindenabschnitten: gestörte<br />
Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen. Folgen sind Astereognosie<br />
(Unfähigkeit, Gegenstände durch Betasten zu erkennen),<br />
Topagnosie (Verlust räumlicher Wahrnehmung), Störungen des<br />
Körperschemas und des Lagesinns, Auslöschphänomene (Ignoranz<br />
von Reizen), Hemineglekt (Ignoranz der kolateralen Körperhälfte).<br />
12<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 12
Rekapitulation<br />
Hörsinn<br />
Das Ohr ist das empfindlichste Sinnesorgan des Menschen und verarbeitet Schallwellen, also Kompressionswellen<br />
oder Druckschwankungen der Luft. Diese Druckschwankungen werden durch Schalldruck<br />
und Frequenz beschrieben. Zunehmender Schalldruck führt zu zunehmender Lautstärkeempfindung; eine<br />
Zunahme der Frequenz wird als zunehmende Tonhöhe wahrgenommen.<br />
13<br />
Schematische Darstellung des Ohres<br />
Schema von Mittelohr und Kochlea<br />
Das Ohr des Menschen besteht aus dem äusseren Ohr, durch das der Schall per Luftleitung zum Trommelfell<br />
gelangt, dem Mittelohr, in dem der Schall über die Gehörknöchelchen weitergeleitet wird und dem Innenohr,<br />
in dem das Hörsinnesorgan liegt. Trommelfell und Gehörknöchelchen sind für die Impedanzanpassung<br />
verantwortlich. Das Innenohr kann auch ohne Luftschall über die Schädelkalotte angeregt werden.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 13
(*)<br />
Schalltransduktion im Innenohr<br />
Kochlea<br />
Corti-Organ<br />
In der Kochlea löst das Schallsignal wellenförmige Auf- und Abwärtsbewegungen<br />
der kochleären Strukturen aus. Diese sog. Wanderwelle hat in<br />
Abhängigkeit von der jeweiligen Reizfrequenz an einem bestimmten Ort<br />
entlang des Corti-Organs ihr Maximum.<br />
Über den Haarzellen befindet sich eine gelatinöse Masse, die Tektorialmembran.<br />
Durch die schallinduzierte Auf- und Abwärtsbewegung kommt es<br />
im Bereich des Wanderwellen-Maximums zu einer Relativbewegung (Scherbewegung)<br />
zwischen Tektorialmembran und Corti-Organ, die zu Auslenkungen<br />
der Stereozilien führt - dem adäquaten Reiz der Sinneszellen.<br />
14<br />
Es öffnen sich Transduktionskanäle in den Stereozilien. Dadurch treten K + -<br />
Ionen aus der Endolymphe in die Haarzellen ein. Sie lösen das Rezeptorpotential<br />
aus. Dies führt zur Freisetzung von Glutamat aus inneren Haarzellen.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 14
Schalltransduktion im Innenohr<br />
The Cochlea<br />
The cochlear duct is embedded in the<br />
perilymph. It is filled with endolymph<br />
and contains the organ of Corti<br />
between the tectorial and the basilar<br />
membranes. The relative movement of<br />
the two membranes leads to the<br />
deflection of the stereocilia of the inner<br />
hair cells (one row) and the outer hair<br />
cells (three rows), which generates the<br />
influx of potassium ions through<br />
channels at the tip links of the<br />
stereocilia. Mutations in the α-tectorin<br />
gene probably impair the function of<br />
the tectorial membranes as a<br />
resonator. The hair cell is the<br />
mechanoelectrical transducer that<br />
produces an electrical signal that is<br />
transmitted through nerve fibres and<br />
the spinal ganglion to the cochlear<br />
nerve and the auditory cortex of the<br />
brain.<br />
15<br />
The influx of potassium ions from the endolymph activates the hair cells, which leads to stimulation of the underlying nerve cells that<br />
convey the auditory signal to the auditory cortex. The potassium ions probably leave the hair cells at their basolateral side through<br />
potassium channels formed by the KCNQ4 gene product and enter the supporting cells. The potassium ions then flow through these<br />
cells and the cochlear fibrocytes to the stria vascularis by means of connexins. There they are secreted back into the endolymph<br />
through another potassium channel formed by the KCNQ1 and KCNE1 gene products. Epithelial supporting cells that express<br />
connexin 26 are shown in red.<br />
Willems, New Engl J Med, 2000<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 15
Schalltransduktion im Innenohr<br />
An Outer Hair Cell Crowned with an Array<br />
of Stereocilia Connected by Tip Links<br />
The vibrations of the basilar membrane caused by<br />
the oscillations of the perilymph induce shearing of<br />
the tectorial membrane. This leads to bending of the<br />
stereocilia, which stretches the filaments that link<br />
neighboring stereocilia, thereby opening unidentified<br />
potassium channels in the membrane of the<br />
stereocilia through the action of myosin. Myosin 7A<br />
and myosin 15 are probably involved in the<br />
movement of these stereocilia. The protein<br />
diaphanous is also expressed in hair cells, in which it<br />
recruits actin-binding proteins to the cell membrane,<br />
thereby regulating actin dynamics. The myosindiaphanous-actin<br />
cytoskeleton is responsible for the<br />
structural integrity and dynamics of the hair cells.<br />
Otoferlin may be involved in the transport of synaptic<br />
vesicles to the plasma membrane. The potassium<br />
channels formed by the KCNQ4 protein (yellow) and<br />
by the connexins (red) allow recirculation of the<br />
potassium ions from the hair cells to the stria<br />
vascularis and the endolymph. Connexin channels<br />
are shown in red.<br />
16<br />
Willems, New Engl J Med, 2000<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 16
Schalltransduktion im Innenohr<br />
Sound waves induce vibrations at the basilar membrane. Since the hair cells are connected,<br />
via their stereocilia, with the tectorial membrane, oscillations of the basilar membrane lead to<br />
deflections of the stereocilia, which in turn triggers the activation of the transduction channels.<br />
17<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 17
(*)<br />
Hörstörungen<br />
Schallleitungsschwerhörigkeit (Lufftleitung eingeschränkt, Knochenleitung normal)<br />
Die Schallleitung über den äusseren Gehörgang, das Trommelfell und die Kette der Gehörknöchelchen bis zum<br />
ovalen Fenster kann an verschiedenen Stationen beeinträchtigt sein: Ohrschmalzpropf, Perforation des Trommelfells,<br />
Flüssigkeitsansammlungen in den Paukenhöhlen (z.B. nach Mittelohrentzündung).<br />
18<br />
Wird die Schallübertragung durch die Gehörknöchelchen vollständig unterbrochen, kann nur noch etwa 2% der<br />
Schallenergie das Innenohr erreichen. Dieser Zustand tritt ein bei Läsionen infolge einer Fraktur an der seitlichen<br />
Schädelbasis, bei Ankylose (Versteifung der Gehörknöchelchen), Otosklerose (Erkrankung der knöchernen<br />
Labyrinthkapsel, was zu Unbeweglichkeit der Steigbügelplatte führt).<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 18
(*)<br />
Hörstörungen<br />
Innenohrschwerhörigkeit (Luft- und Knochenleitung gleichermassen beeinträchtigt)<br />
wird v.a. durch eine Schädigung der Haarzellen oder durch eine Störung in der Zusammensetzung der Endolymphe<br />
verursacht. Dabei kommt es zu einem graduellen Hörverlust (insbesondere für hohe Töne).<br />
Die Ursachen für die genannten Schädigungen<br />
sind vielfältig:<br />
Die Haarzellen können durch Schallbelastung,<br />
Ischämie, seltene genetische Defekte oder Toxine<br />
geschädigt werden (1).<br />
Eine Versteifung der Basilarmembran stört die<br />
Mikromechanik und trägt so wahrscheinlich zur<br />
Altersschwerhörigkeit bei (1).<br />
Gestörte Endolymphsekretion (3)<br />
Gestörte Endolymphresorption: Der Endolymphraum<br />
wird ausgebuchtet und die Beziehung von<br />
Haarzellen und Tektorialmembran verzerrt (6).<br />
Seltene genetische Kanaldefekte (3)<br />
Erhöhte Permeabilität zwischen Endo- und Perilymphraum:<br />
Morbus Menière (Anfälle von Schwerhörigkeit<br />
und Schwindel) (7)<br />
19<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 19
Rekapitulation<br />
Gleichgewichtssinn<br />
Die Endorgane des Bewegungs- und Raumorientierungssinnes liegen im<br />
Labyrinth des Innenohres und bilden das Vestibularorgan. Die Informationen<br />
dieses Sinnessystems, die zu Bewegungs- und Lageempfindungen führen,<br />
werden durch das visuelle und das propiozeptive System ergänzt.<br />
Der Vestibularapparat besteht aus beidseitig jeweils<br />
• 2 Makulaorganen und<br />
• 3 Bogengangsorganen<br />
Alle fünf Sinnesorgane besitzen Sinnesepithelien, deren Sinneszellen als<br />
Haarzellen bezeichnet werden. Diese ragen in eine gallertige Masse, die in<br />
den Bogengangsorganen als Cupula und in den Makulaorganen, aufgrund<br />
kleiner Calciumkristalle, als Otolithenmembran bezeichnet wird.<br />
20<br />
Das Labyrinth des Innenohrs im<br />
Schema. Endolymphe (hell) und<br />
Perilymphe (dunkel) des Labyrinths<br />
und der Kochlea stehen miteinander<br />
in Verbindung.<br />
Mechano-elektrische Transduktion.<br />
Die Reizung der Haarzellen<br />
erfolgt durch eine Deflektion ihrer<br />
Stereocilien. Durch die Abscherung<br />
der Stereozilien kommt es zu<br />
einer Änderung des elektrischen<br />
Potentials der Haarzelle (Rezeptorpotential)<br />
und in der Folge zu<br />
einer Freisetzung des Transmitters<br />
Glutamat am unteren Ende der<br />
Haarzelle. Glutamat gibt das Signal<br />
biochemisch von der Haarzelle zur<br />
afferenten Nervenfaser weiter.<br />
Die Information wird vom Labyrinth über den Nervus vestibularis und seinen Kerngebieten im<br />
Hirnstamm zu den Augenmuskeln übertragen.<br />
→ Stabilisierung des Blickfeldes bei Kopf- und Körperbewegungen<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 20
(*)<br />
Gleichgewichtsstörungen - Schwindel<br />
21<br />
Gleichgewichtskontrolle: Durch das Zusammenspiel von<br />
optischen, propriozeptiven und vestibulären Informationen<br />
kann das ZNS einen Gleichgewichtszustand herstellen.<br />
Bei widersprüchlichen Wahrnehmumgen der einzelnen<br />
Systeme kommt es zu Schwindel. Schwindel äussert sich<br />
als Verlust der Körpersicherheit im Raum (Störung der<br />
Raumorientierung). Er lässt sich nicht als einheitliches<br />
Symptom definieren → subjektives Missempfinden eintreffender,<br />
meist widersprüchlicher sensorischer Reize.<br />
Vestibulärer (systematischer) Schwindel<br />
• Periphere vestibuläre Funktionsstörung<br />
Funktionsstörung des peripheren sensorischen<br />
Systems (Auge, Vestibularorgan, propriozeptives<br />
System) − Drehschwindel, Liftschwindel;<br />
Störung der Wahrnehmung im Raum, der sich zu<br />
bewegen scheint<br />
• Kinetosen<br />
bei unphysiologischen und ungewohnten Erregungen<br />
des Vestibularapparates (z.B. im Auto, Flugzeug<br />
oder Schiff) kann es zu Unwohlsein, Schwindel,<br />
Schweissausbrüchen und Erbrechen kommen<br />
• Nystagmen<br />
reflektorische Einstellbewegungen der Augen, die<br />
durch das Zusammenspiel von Vestibularapparat<br />
und Kernen von Hirnnerven für die äusseren<br />
Augenmuskeln bewirkt werden<br />
Nicht-vestibulärer (unsystematischer) Schwindel<br />
• Zentrale nicht-vestibuläre Funktionsstörung<br />
Störung der zentralen Verarbeitung auf Höhe<br />
des Hirnstamms oder des Kleinhirns − Schwankschwindel,<br />
Unsicherheit, Bewusstseinstrübung.<br />
Der unsystematische Schwindel ist meist Folge<br />
von Durchblutungsstörungen im Gehirn<br />
(Ursachen: Epilepsien, Lähmungen der<br />
Augenmuskeln, psychiatrische Erkrankungen)<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 21
(*)<br />
Vestibulärer und nicht-vestibulärer Schwindel<br />
Ursachen peripherer vestibulärer Funktionsstörungen<br />
Ursachen zentraler nicht-vestibulärer Funktionsstörungen<br />
Benigner paroxysomaler Lagerungsschwindel<br />
Durch Änderungen der Kopfhaltung ausgelöst, bei<br />
Rotation und Extension, Dauer: 20−30 Sek.,,<br />
Kristallablagerungen (Otholithen) in den Bogengängen<br />
Morbus Menière<br />
Einige Minuten bis Stunden dauernde Anfälle von<br />
Rotationsschwindel, Hörverminderung und Tinnitus,<br />
starke Übelkeit, Erbrechen<br />
- Ursache meist vaskulärer Natur<br />
- Schwindel intermittierend oder konstant<br />
- weitere neurologische Symptome kommen dazu<br />
- selten Tumor als Ursache<br />
- selten Entzündung (Multiple Sklerose) als Ursache<br />
- parainfektiöses Geschehen (Syphilis, Varizellen)<br />
- bei Migräne (Basilarismigräne)<br />
- bei epileptischen Anfällen<br />
22<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 22
(*)<br />
Gleichgewichtsstörungen<br />
23<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 23
Rekapitulation<br />
Geschmackssinn<br />
Die Trägerstrukturen für die Geschmackssinneszellen sind die<br />
Geschmacksknospen, die wiederum in den Wänden und<br />
Gräben der Geschmackspapillen liegen. Es gibt verschiedene<br />
Typen von Papillen auf der Zunge:<br />
• Pilzpapillen<br />
• Blätterpapillen<br />
• Wallpapillen<br />
• Fadenpapillen (nur taktile Funktion)<br />
24<br />
Vier Grundqualitäten des Geschmacks<br />
Geschmackssinneszellen<br />
sind sekundäre Sinneszellen,<br />
d.h. sie selber haben<br />
keinen Nervenfortsatz.<br />
Sie werden von afferenten<br />
Hirnnervenfasern (Nervus<br />
facilis, glossopharyngeus,<br />
vagus) versorgt, die die<br />
Informationen zum Nucleus<br />
solitarius der Medulla<br />
oblongata leiten. Von dort<br />
ziehen Fasern zum Gyrus<br />
postzentralis und zum<br />
Hypothalamus, wo sie<br />
gemeinsame Projektionsgebiete<br />
mit olfaktorischen<br />
Eingängen haben.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 24
Geschmackssinn<br />
25 Chandrashekar et al., Nature 444:288-294, 2006<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 25
Signaltransduktion in Geschackssinneszellen<br />
Den vier Grundqualitäten lassen sich spezifische Rezeptoren zuordnen, die durch Reizsubstanzen definierter molekularer<br />
Struktur aktiviert werden. In den meisten Geschmackssinneszellen sind Rezeptortypen für mehrere Qualitäten<br />
representiert. Die molekularen Signaltransduktionsmechanismen sind für jede Geschmacksqualität spezifisch:<br />
• Sauer und salzig werden durch einen einfachen, selektiv permeablen Kationenkanal geregelt.<br />
• Für süss und bitter existieren spezifische Rezeptormoleküle, die über Botenstoffe an Ionenkanäle gekoppelt sind.<br />
26<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 26
(*)<br />
Geschmacksstörungen<br />
Die Geschmacksrezeptoren können genetisch defekt sein sowie durch Bestrahlung und einige Pharmaka<br />
geschädigt werden. Hypothyreose mindert ihre Empfindlichkeit. Bei Diabetes mellitus ist die Süssempfindung,<br />
bei Aldosteronmangel die Salzigempfindung herabgesetzt. Die Weiterleitung in den Nerven kann durch Traumen,<br />
Tumoren und Entzündungen unterbrochen werden. Die zentrale Weiterleitung und Verarbeitung kann durch<br />
Tumoren, Ischämie und Epilepsie gestört sein.<br />
Man teilt Geschmacksstörungen in verschiedene Schweregrade ein:<br />
• Totale Ageusie (Empfindung für alle Qualitäten verloren)<br />
• Partielle Ageusie (Empfindung nur für eine oder mehrere Qualitäten fehlend)<br />
• Dysgeusien (unangenehme Geschmacksempfindungen)<br />
• Hypogeusie (pathologisch verminderte Geschmacksempfindung)<br />
27<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 27
Rekapitulation<br />
Geruchssinn<br />
Bulbus olfactorius<br />
(hemmende Interneurone)<br />
Das Riechepithel besteht aus drei Zelltypen:<br />
• Stützzellen<br />
• Basalzellen<br />
• Riechzellen<br />
Die Riechzellen sind primäre, bipolare Sinneszellen, die am<br />
apikalen <strong>Teil</strong> dünne Sinneshaare (Zilien) und am anderen Ende<br />
einen Nervenfortsatz (Axon) tragen. Zu tausenden gebündelt<br />
laufen die Axone der Riechzellen durch die Siebbeinplatte, um<br />
zusammen als Nervus olfactorius direkt zum Bulbus olfactorius<br />
zu ziehen, der als vorgelagerter Hirnteil zu betrachten ist.<br />
Die Axone der Riechzellen endigen in den Glomeruli. Hier<br />
kommt es zu einer deutlichen Reduktion der Duftinformationskanäle<br />
(Konvergenz).<br />
Die Mitralzellen ziehen direkt zum Limbischen System und weiter<br />
zu vegetativen Kernen des Hypothalamus und der Formatio<br />
reticularis sowie zu Projektionsgebieten im Neokortex.<br />
28<br />
Schema der Transduktionskaskade<br />
in Riechzellen<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 28
(*)<br />
Störungen des Geruchssinns<br />
29<br />
Quantitative Störungen<br />
Hyposmie = verminderte Geruchsempfindlichkeit. Beim Erwachsenen erhöht sich bei zunehmendem Alter<br />
aufgrund einer Atrophie des Riechepithels die Schwelle für Geruchsempfindung (Presbyosmie). Bei Frauen<br />
kann Östrogen-bedingt eine gesteigerte Geruchsempfindung (Hyperosmie) während der Menstruation und<br />
Schwangerschaft auftreten. Anosmie ist der vollständige Ausfall der Geruchsempfindung, z.B. bei Schnupfen,<br />
toxischen Schädigungen, Pharmaka/Anästhetika, Schädel-Hirn-Traumen etc.<br />
Qualitative Störungen (Störungen bei der zentralnervösen Verarbeitung)<br />
Parosmie (falsche Geruchsempfindung), Kakosmie (üble Geruchsempfindung) bei Tumorerkrankungen oder<br />
Schizophrenie. Phantosomien = Geruchshalluzinationen, z.B. bei Migräne, epileptischen Anfällen, Schizophrenie.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 29
*<br />
Augenkrankheiten<br />
ICD-10 (Internationale Klassifikation der Augenkrankheiten), 2007<br />
Affektionen des Augenlids, des Tränenapparates und der Orbita<br />
Affektionen der Konjunktiva<br />
Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers<br />
Affektionen der Linse<br />
Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut<br />
Glaukom<br />
Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels<br />
Affektionen des Nervus opticus und der Sehbahn<br />
Affektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie<br />
Akkomodationsstörungen und Refraktionsfehler<br />
Sehstörungen und Blindheit<br />
Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde<br />
30<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 30
Rekapitulation<br />
Auge und optische Abbildung<br />
Äussere Augenhaut<br />
(Cornea + Sklera)<br />
Mittlere Augenhaut = Uvea<br />
(Iris + Ziliarkörper + Chorioidea)<br />
Innere Augenhaut<br />
(Retina)<br />
(Cornea)<br />
(Netzhaut)<br />
(Aderhaut)<br />
(Lederhaut)<br />
31<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 31
Rekapitulation<br />
Augenmuskeln und Augenhintergrund<br />
Nerven und Muskeln der Orbita (Augenhöhle)<br />
Augenhintergrund eines rechten Auges<br />
(im umgekehrten Spiegelbild)<br />
links: Papilla nervi optici (Papille);<br />
Arterien hellrot, Venen dunkelrot;<br />
rechts: Macula lutea mit Fovea centralis<br />
32<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 32
Rekapitulation<br />
Aufbau der Netzhaut<br />
skotopisches<br />
Sehen<br />
photopisches<br />
Sehen<br />
33<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 33
Rekapitulation<br />
Sehprozess<br />
B<br />
A. Schematischer Aufbau eines Stäbchens der<br />
Netzhaut und einer Zelle des Pigmentepithels.<br />
B. Schema eines Rhodopsinmoleküls und Struktur<br />
von 11-cis-Retinal. 11-cis-Retinal ist über Lysin an<br />
den Proteinteil des Rhodopsins gebunden. Nach<br />
Photonenabsorption tritt eine Photoisomeration am<br />
am C-Atom 11 ein (rot).<br />
34<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 34
Rekapitulation<br />
Phototransduktion<br />
Rhodopsin - Metarhodopsin II - Zyklus<br />
Metarhodopsin II - Transducin - Zyklus<br />
Steuerung des cGMP und des Ca 2+ -<br />
Zyklus durch T α -aktivierte Phosphodiesterase<br />
35<br />
(1. Verstärkung > 1 : 1000) (2. Verstärkung ∼ 1 : 1000)<br />
Beim Transduktionsprozess des Sehens sind 4 biochemische Regelkreise beteiligt: Nach Absorption eines<br />
Lichtquants entsteht durch Isomerisation des Rhodopsins (R) über mehrere Zwischenstufen Metarhodopsin II<br />
(R*). Durch Bindung des G-Protein-GDP-Komplexes an R* und Energieaufnahme entsteht ein t α<br />
GTP-<br />
Komplex, der Phosphodiesterase (PDE) bindet. Der t α<br />
GTP PDE-Komplex bewirkt eine Inaktivierung von<br />
cGMP und dadurch eine Schliessung der Na + /Ca 2+ -Kanäle und damit eine Hyperpolarisation (Rezeptorpotential<br />
der Photorezeptoren). Nimmt der intrazelluläre Ca 2+ -Gehalt ab, kommt es zu einer Aktivierung der<br />
Guanylylzyklase. Bei der Dunkelreaktion regeneriert sich das System wieder (Depolarisation).<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 35
(*)<br />
Refraktionsanomalien<br />
Refraktionsanomalien sind Brechungsfehler<br />
des Auges, die Abweichungen<br />
von der Normalsichtigkeit<br />
(Emmetropie) bedingen. Sie können<br />
durch Brillen oder Kontaktlinsen<br />
korrigiert werden.<br />
Myopie (Kurzsichtigkeit)<br />
Ist der Bulbus länger als normal, so<br />
können ferne Gegenstände nicht<br />
mehr scharf gesehen werden, da die<br />
Bildebene vor der Fovea liegt.<br />
Die Einstellung der Sehschärfe<br />
beim Sehen naher und ferner<br />
Objekte erfolgt durch Änderung der<br />
Linsenform (Akkommodation).<br />
Hypermetropie (Weitsichtigkeit)<br />
Der Bulbus ist im Verhältnis zur<br />
Brechkraft des dioptrischen Apparates<br />
zu kurz.<br />
Astigmatismus (Stabsichtigkeit)<br />
Die Hornhautoberfläche ist nicht dieal<br />
rotationssymmetrisch, sondern<br />
meist in vertikaler Richtung gekrümmt.<br />
36<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 36
Krankheiten des äusseren Auges<br />
Erkrankungen der Lider<br />
Erkrankungen der Tränenorgane<br />
Erkrankungen der Orbita<br />
Entzündungen der Bindehaut (Konjunktivitis)<br />
Entzündungen der Hornhaut (Keratitis)<br />
Degenerationen und Dystrophien der Hornhaut<br />
37<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 37
(*)<br />
Erkrankungen der Lider<br />
Entzündungen der Lider<br />
- Entzündungen der Lidhaut (1)<br />
- Entzündungen des Lidrands<br />
- Entzündungen der Liddrüsen (2,3)<br />
1 2 3<br />
Zoster ophthalmicus Hordeolum externum Chalazion<br />
Lidfehlstellungen<br />
Ptosis<br />
Herabhängen eines oder beider Oberlider<br />
4 5 6<br />
Ptosis (links) Entropium mit Hornhautulkus Ektropium<br />
Entropium<br />
Einwärtskippung des Lids (häufiger am Unterlid als am Oberlid)<br />
Entropium senile: Erschlaffung des Aufhängeapparats des Unterlids, erhöhter Tonus<br />
der lidrandnahen Fasern des M. orbicularis oculi<br />
38<br />
Ektropium<br />
Auswärtskippung fast ausschliesslich des Unterlids<br />
Ektropium senile: Erschlaffung des Unterlids und der Lidbändchen<br />
7<br />
Noduläres Basaliom<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 38
(*)<br />
Erkrankungen der Tränenorgane<br />
Zu den Tränenorganen zählen die Tränendrüse und die ableitenden Tränenwege.<br />
Erkrankungen äussern sich in einem Zuviel oder Zuwenig an Produktion bzw. Abfluss der Tränen.<br />
Das trockene Auge (Keratoconjunctivitis sicca)<br />
Benetzungsstörung von Horn- und Bindehaut mit dadurch bedingter Reizung des Auges<br />
Das tränende Auge (Epiphora)<br />
Hypersekretion der Tränendrüse oder Tränenabflussstörung<br />
- Angeborene oder erworbene Stenosen der abführenden Tränenwege<br />
- Canaliculitis (Entzündung der Tränenkanälchen durch Infektion mit Pilzen, Bakterien oder Viren)<br />
- Dacryocystitis acuta (Entzündung des Tränensacks durch Pneumokokken)<br />
39<br />
Canaliculitis<br />
Akute Dakryozystitis<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 39
(*)<br />
Erkrankungen der Orbita<br />
Vaskuläre Orbitaveränderungen<br />
Exophthalmus (Hervortreten des Bulbus aus der Augenhöhle)<br />
Entzündliche Orbitaveränderungen<br />
Orbitaphlegmone (Entzündung des orbitalen Weichteilgewebes)<br />
Endokrine Orbitopathie<br />
Im Rahmen der Hyperthyreose bei Morbus Basedow kann es<br />
durch einen Autoimmunprozess zu entzündlichen Veränderungen<br />
und zur Fibrose des Orbitainhalts und der Lider kommen.<br />
Verletzungen der Orbita (z.B. Bruch des Orbitabodens)<br />
Tumoren der Orbita<br />
Hämangiom, Rhabdomyosarkom (geht von den äusseren Augenmuskeln<br />
aus)<br />
Carotis-Sinus-cavernosus-Fistel<br />
mit gestauten Bindehaut- und episkleralen Venen<br />
40<br />
Endokrine Orbitopathie (Exophthalmus)<br />
Orbitaphlegmone<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 40
(*)<br />
Konjunktivitis<br />
Infektiöse Konjunktivitis (bakteriell, viral, mykotisch)<br />
Leitsymptome<br />
- rotes Auge (verstärkte Durchblutung)<br />
- Sekretion (wässrig, schleimig, eitrig)<br />
- Bindehautschwellung (Chemosis)<br />
- Follikel (Lymphozytenansammlungen)<br />
- Papillen<br />
- Lichtscheu<br />
- verstärkter Tränenfluss (Epiphora)<br />
- krampfhafter Lidschluss (Blepharospasmus)<br />
Chlamydienkonjunktivitis (Erreger: Chlamydia trachomatis)<br />
- Einschlusskörperchenkonjunktivitis (Serotypen D-K) (Abb. 1)<br />
okulogenitale Infektion, Erreger beim Geschlechtsverkehr<br />
übertragen, gelangen über die Hände ins Auge<br />
- Trachom (Serotypen A-C) (Abb. 2)<br />
durch Fliegen übertragen, die sich in den Lidwinkel von<br />
Kindern setzen, „ägyptische Körnerkrankheit“<br />
Bindehautfollikel<br />
Bindehautpapillen<br />
1 2<br />
41<br />
Nichtinfektiöse Konjunktivitis (Allergische Konjunktivitis)<br />
Riesenpapillen<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 41
(*)<br />
Keratitis<br />
Entzündungen der Hornhaut<br />
Infektiöse Keratitis<br />
- Bakterielle Keratitis (Staphylokokken, Pneumokokken)<br />
Über 90% aller Keratitiden sind bakteriell bedingt. Häufig bei<br />
Trägern von Kontaktlinsen und bei geschwächter Abwehr des<br />
Auges. Verletzung des Epithels als Eintrittspforte für Keime. Eiteransammlungen<br />
in der Vorderkammer (Hypopyon).<br />
- Virale Keratitis (Herpes-simlex-V., Varizella-zoster-V., Adenoviren)<br />
- Akanthamöben-Keratitis<br />
vor allem bei Kontaktlinsenträgern, hartnäckige Infektion des Hornhautstromas,<br />
kleine fleckige anteriore Stromainfiltrate<br />
Hypopyon bei bakterieller Keratitis<br />
Nichtinfektiöse Keratitis<br />
Störungen des Tränenfilms führen oft zu Keratitiden im Sinne einer<br />
Keratitis superficialis punctata bzw. bei stärkerer Ausprägung zu<br />
einer Keratitis filiformis.<br />
Akanthamöben-Keratitis<br />
mit anterioren Stromainfiltraten<br />
42<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 42
(*)<br />
Degenerationen und Dystrophien der Hornhaut<br />
43<br />
Hornhautdegenerationen<br />
Degeneration tritt durch Schädigung primär gesunden Gewebes ein<br />
(Alterungsprozess eingeschlossen) und muss nicht beidseitig sein.<br />
Pterygium<br />
Gefässhaltige Bindehaut wächst vom Limbus ausgehend dreieckförmig<br />
auf die Hornhaut im Lidspaltenbereich ein. Ursache: limbaler<br />
Barrieredefekt aufgrund von Stammzellinsuffizienz der Bowman-<br />
Membran oder des Hornhautepithels. Chronische äussere Reize wie<br />
UV-Strahlenexposition oder Staubexposition.<br />
Arcus lipoides<br />
Ringförmige Ablagerung von Lipoproteinen am Rand der Hornhaut, die<br />
durch eine schmale Zone vom Limbus getrennt ist. Bei Auftreten nach<br />
dem 50. Lebensjahr: Fettstoffwecheselstörung möglich. Keine Beschwerden,<br />
keine Therapie nötig.<br />
Hornhautdystrophien<br />
Dystrophien sind erblich bedingte, immer beidseitige Störungen des<br />
Hornhautstoffwechsels.<br />
Keratokonus<br />
Kegelförmige Vorwölbung der Hornhautmitte mit Verdünnung der<br />
Kegelspitze und Trübung des Hornhautepithels. Anlagebedingte<br />
Veränderung, die meist schon im Jugendalter auftritt, häufiger bei<br />
Frauen. Oft in Kombination mit allergischen Erkrankungen.<br />
Pterygium<br />
Arcus lipoides<br />
Keratokonus<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 43
Krankheiten des inneren Auges<br />
Uveitis anterior (Iritis, Zyklitis), Uveitis posterior (Chorioiditis)<br />
Erkrankungen der Linse (Katarakt)<br />
Diabetische Retinopathie<br />
Retinale Gefässverschlüsse<br />
Makuladegeneration<br />
Hereditäre Erkrankungen der Netzhaut (Retinopathia pigmentosa)<br />
Netzhautablösung<br />
Glaukom<br />
44<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 44
(*)<br />
Uveitis (Iritis, Zyklitis)<br />
Iritis (anteriore Uveitis)<br />
Oft beidseitig auftretende Entzündung der Iris. Häufigste<br />
Uveitis-Form. Hyperämische, wegen Stromaschwellung<br />
verwachsene Iris mit verengter Pupille.<br />
Zyklitis (intermediäre Uveitis)<br />
Entzündung des Ziliarkörpers, meist mit einer Iritis kombiniert.<br />
Pigmentabdruck auf der Linse nach der Lösung von<br />
hinteren Synechien<br />
45<br />
Mögliche Ursachen einer Uveitis<br />
Komplikationen einer chronischen Iridozyklitis<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 45
(*)<br />
Uveitis (Chorioiditis)<br />
Die Chorioiditis (hintere Uveitis) ist eine Entzündung der Aderhaut, die aufgrund der engen Beziehung zur<br />
Netzhaut meist eine Retinitis nach sich zieht (Chorioretinitis). Geht die Entzündung primär von der Netzhaut aus<br />
(Toxoplasmose, Sporotrichose) spricht man von Retinochorioiditis.<br />
Die Chorioiditis verläuft schmerzfrei. Eine Retinochorioiditis zieht immer Nevenfaserausfälle nach sich, bei einer<br />
Chorioretinitis kann die Nervenfaserschicht unversehrt bleiben. Von der Lokalisation der Entzündungsherde<br />
hängt ab, ob und wie ausgeprägt Sehstörungen auftreten. Glaskörpertrübungen sehen die Patienten als<br />
Schleier. In der Fundoskopie finden sich Entzündungsherde am Augenhintergrund.<br />
Fundoskopische Befunde bei einer Chorioiditis<br />
Akute multifokale Chorioiditis<br />
46<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 46
(*)<br />
A<br />
B<br />
C<br />
Erkrankungen der Linse: Katarakt (1)<br />
Trübungen der Linse werden als Katarakt (grauer Star)<br />
bzeichnet. In 90% der Fälle ist die Veränderung altersbedingt<br />
(Cataracta senilis).<br />
Symptome und Therapie<br />
Die Patienten sehen unscharf und werden leicht geblendet.<br />
Farben verlieren an Intensität. Durch die<br />
Trübungen verändert sich die Brechkraft der Linse, was zu<br />
Kurzsichtigkeit führen kann. Es kann zu einer verzerrten<br />
Abbildung kommen; Doppel- und Mehrfachbilder.<br />
Ursachen<br />
Genetische Disposition, exogene Einflüsse (UV-Licht,<br />
Mangel an essentiellen Aminosäuren, Diabetes mellitus,<br />
Rauchen, Alkoholismus.<br />
Einteilung<br />
A. Cataracta corticalis (Rindestar)<br />
Flüssigkeitsgefüllte Vakuolen zwischen den zerfallenden<br />
Faserbündeln der Linsenrinde (Wasserspalten). Im weiteren<br />
Verlauf speichenförmige gräulich-weisse Trübungen<br />
der Linse.<br />
B. Cataracta subcapsularis posterior<br />
Trübung sitzt direkt der hinteren Linsenkapsel auf und<br />
schreitet schnell fort. Frühe Sehstörungen.<br />
C. Cataracta nuclearis (Kernstar)<br />
Sehr langsam fortschreitende bräunliche Trübung und<br />
Brechkraftzunahme des Linsenkerns.<br />
47<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 47
(*)<br />
Katarakt (2)<br />
Diagnose<br />
Spaltlampenuntersuchung, womit eine mikroskopische Betrachtung des<br />
äusseren Auges möglich ist und ein optischer Schnitt durch das Auge<br />
gelegt werden kann. Bei reifem oder überreifem Katarakt kann die<br />
Pupille weiß erscheinen.<br />
Therapie<br />
• keine gesicherte medikamentöse Therapie<br />
• Entfernen der eingetrübten Linse unter örtlicher Betäubung<br />
(1) Intrakapsulär (Die Linse wird komplett mitsamt ihrer Kapsel aus dem<br />
Auge entfernt - nur noch selten angewandt.)<br />
(2) Extrakapsulär (Die vordere Linsenkapsel wird eröffnet, um anschließend<br />
das Innere der Linse zu entfernen, während die hintere<br />
Kapselwand bestehen bleibt. Die natürliche Barriere zwischen hinterem<br />
und vorderem Augenabschnitt bleibt dadurch erhalten. Die modernste<br />
und gebräuchlichste Form der extrakapsulären Operationstechnik ist die<br />
Phakoemulsifikation. Der Linsenkern wird durch Ultraschall zerkleinert<br />
und anschließend abgesaugt.)<br />
• Korrekturmöglichkeiten: Starbrille, Kontaktlinse, intraokulare Linse<br />
48<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 48
(*)<br />
Diabetische Retinopathie<br />
Netzhautveränderungen in Folge einer<br />
Mikroangiopathie bei Diabetes mellitus<br />
werden als diabetische Retinopathie<br />
bezeichnet. Hierbei entstehen durch<br />
Veränderungen der Gefässwände Mikroaneurysmen.<br />
Die Schädigung des<br />
Gefässendothels führt zu einem Zusammenbruch<br />
der Blut-Retina-Schranke im<br />
Bereich dieser Mikroaneurysmen, wodurch<br />
Serum und Liporoteine in das<br />
Netzhautgewebe austreten (diabetisches<br />
Makulaödem).<br />
Veränderungen bei diabetischer Retinopathie<br />
49<br />
Netzhautveränderungen<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 49
(*)<br />
Retinale Gefässverschlüsse<br />
Retinale Venenverschlüsse<br />
Zentralvenenverschlüsse zählen zu den häufigsten Erblindungsursachen ältere Menschen und stellen somit neben<br />
der diabetischen Retinopathie die wichtigste Gefässerkrankung der Netzhaut dar. Die meisten Betroffenen sind über<br />
50 Jahre alt. Bei hohem Blutdruck und Augeninnendruck treten Venenverschlüsse gehäuft auf.<br />
Der Venenverschluss ist schmerzlos. Makula- oder Papillenödem: plötzliche Sehverschlechterung (“Schleier vor dem<br />
Auge”). Fundoskopie: prall gefüllte und gestaute Netzhautvenen und streifige Blutungen über den ganzen Fundus.<br />
Nevenfaserinfarkte (Cotton-wool-Herde).<br />
Retinale Arterienverschlüsse<br />
Selten, vorwiegend bei älteren Patienten. Verschluss der Zentralarterie oder eines Zentralarterienasts ist meist durch<br />
eine Embolie bedingt. Plötzliche schmerzlose Erblindung des betroffenen Auges.<br />
50<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 50
(*)<br />
Weitere Retinopathien<br />
Hypertensive Retinopathie<br />
I Verengung der Arteriolen in der<br />
Retina<br />
II Fokale Arterienverengungen<br />
III Hämorrhagien (flammenförmig);<br />
cotton-wool spots; harte, wachsige<br />
Exudate; Makulastern<br />
Arteriosklerotische Retinopathie<br />
I Hyalin-Ablagerung; verdickte Media der Arteriolen; Lichtreflex an den Arteriolen<br />
II Zunahme des Lichtreflexes. Ausbildung einer gemeinsamen Adventitia von Arteriole und<br />
Venole an den Kreuzungspunkten<br />
III Zusätzlich Ausbildung von “Kupferdraht”-Arteriolen und vermehrte Hyalinabscheidung<br />
IV Sklerotische Veränderungen in den Arteriolen-Wänden (“Silberdraht”-Arteriolen).<br />
51<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 51
(*)<br />
Makuladegeneration (1)<br />
Es gibt verschiedene erworbene und erbliche Makulaerkrankungen. Sie alle führen zu einer irreversiblen<br />
Störung der zentralen Sehschärfe. Die häufigste Form ist die altersbedingte Makuladegeneration (AMD).<br />
Ursache der AMD ist eine Funktionsstörung<br />
des retinalen Pigmentepithels<br />
(RPE).<br />
Die Pigmentepithelzellen kommen<br />
ihrer Transportfunktion nicht mehr<br />
nach, so dass sich Stoffwechselprodukte<br />
anhäufen, welche sich in<br />
Form von sog. Drusen zwischen<br />
RPE und Bruchmembran ablagern.<br />
Die Pigmentepithelzellen gehen zugrunde,<br />
in der Bruchmembran entstehen<br />
Lücken. Es kommt zum<br />
Zusammenbruch der äusseren Blut-<br />
Retina-Schranke und Blutgefässe<br />
der Chorioidea sprossen ein.<br />
52<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 52
Man unterscheidet zwei Formen der AMD:<br />
Trockene Makuladegeneration<br />
Makuladegeneration (2)<br />
- häufigste Form (90% der Fälle)<br />
- Atrophie des Pigmentepithels und der sensorischen Netzhaut<br />
- Verschlechterung der zentralen Sehschärfe (grauer Schatten immer da, wo man gerade hinblickt)<br />
- meist beide Augen betroffen, häufig aber in unterschiedliche fortgeschrittenem Stadium<br />
- scharf umschriebene atrophische Areale des retinalen Pigmentepithels und der Choriokapillaris<br />
- keine kausale Therapie, sondern nur unterstützende Massnahmen (Lupenbrille)<br />
Feuchte Makuladegeneration<br />
- geschädigte Bruchmembran, subretinale Exsudate aus der Chorioidea<br />
- Einwachsen pathologischer Blutgefässe durch das Pigmentepithel unter die Netzhaut<br />
(chorioidale Neovaskularisation, CNV)<br />
- Sehverschlechterung verläuft schneller als bei der trockenen Form<br />
- plötzliche Verzerrung der fixierten Objekte (Metamorphosie) durch zentrales Ödem der Netzhaut<br />
- gleichzeitige Abnahme der Sehschärfe<br />
- Blutungen aus neu gebildeten Gefässen führen zu einer rapiden und ausgeprägten Sehverschlechterung<br />
- unbehandelt kommt es häufig zu Komplikationen der CNV (Blutgefässrupturen, Pigmentepithelabhebungen)<br />
- Lasertherapie (nur wenn CNV noch nicht geblutet hat, 15% der Fälle, hohe Rezidivrate)<br />
- photodynamische Therapie (Verödung der CNV durch Verteporfin, Stabilisierung der Sehschärfe 50%)<br />
53<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 53
Retinopathia pigmentosa<br />
Unter der Bezeichnung wird eine Gruppe von Krankheiten<br />
zusammengefasst, die alle durch eine Verminderung der Anzahl<br />
von Photorezeptoren und durch eine Funktionsstörung<br />
des retinalen Pigmentepithels (RPE) gekennzeichnet sind.<br />
Man unterscheidet eine primäre und eine sekundäre Form. Die<br />
primäre Form wird als Einzelerkrankung vererbt, die sekundäre<br />
tritt im Symptomenkomplex bei generalisierten Stoffwechselerkrankungen<br />
auf.<br />
Ursache: Gendefekt auf dem Opsingen, wodurch vermutlich<br />
das pathologische Rhodopsin vermehrt in die Zellen des<br />
Pigmentepithels aufgenommen wird und dort für die vermehrte<br />
Pigmentablagerung und Degeneration verantwortlich ist.<br />
Verlauf: Zuerst sind nur die Stäbchen betroffen, sodass<br />
vielfach bereits in der Kindheit Störungen im Dämmerungssehen<br />
auftreten. Erst viel später verschlechert sich das Sehen<br />
durch die fortschreitende Degeneration, die allmählich auf<br />
zentralere Bereiche der Retina übergreift. In einem engen<br />
zentralen Bereich bleibt das Sehen bestehen, führt jedoch<br />
trotzdem praktisch zu Blindheit wegen Orientierungsschwierigkeiten.<br />
Therapie: Eine kausale Therapie ist nicht möglich. Der Nutzen<br />
von Vitamin-A-Einnahme ist nicht gesichert. Die sich entwickelnde<br />
Katarakt schränkt das Sehen zusätzlich ein und wird<br />
operiert.<br />
Knochenbälkchen-Pigmentierung<br />
54<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 54
(*)<br />
Netzhautablösung (1)<br />
Als Netzhautablösung wird die Abhebung der neurosensorischen Netzhaut vom Pigmentepithel bezeichnet.<br />
Nach der Entstehungsursache lassen sich drei<br />
Formen von Netzhautablösung unterscheiden.<br />
1.<br />
3.<br />
1. Rhegmatogene Netzhautablösung<br />
Netzhautriss, bedingt durch das Zusammentreffen<br />
einer anlagebedingten Verdünnung der<br />
peripheren Netzhaut mit einem Zug des<br />
Glaskörpers an der Netzhaut. Risikofaktoren:<br />
Alter, hohe Myopie, Aphakie, Bulbustraumen.<br />
2. Traktionsablatio<br />
Kontraktion von Glaskörper-Netzhautmembranen,<br />
welche die Netzhaut von ihrer Unterlage<br />
abziehen. Membranbildung z.B. bei diabetischer<br />
Retinopathie.<br />
2.<br />
Ursachen für eine Netzhautablösung<br />
3. Exudative Netzhautablösung<br />
Flüssigkeitsaustritt aus der Chorioidea unter die<br />
Netzhaut in Folge eines geschädigten Pigmentepithels.<br />
Kommt u.a. vor bei Aderhautmelanomen,<br />
Morbus Harada.<br />
55<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 55
(*)<br />
Netzhautablösung (2)<br />
Symptome<br />
- Lichtblitze (bei rhegmatogener und Transaktionsablatio)<br />
- Russregen (bei rhegmatogener und Transaktionsablatio)<br />
- periphere Gesichtsfelddefekte in Form von Schatten<br />
Therapie und Prognose<br />
1. Netzhautrisse (ohne Ablösung) werden verschweisst.<br />
Bei Ablösung werden Netzhaut und RPE durch das<br />
Aufnähen einer eindellenden Silikonplombe wieder zusammengebracht.<br />
Bei Netzhautlöchern Vitrektomie und<br />
Auffüllen des Bulbus mit Silikonöl oder Gas. Prognose<br />
hängt von Dauer und Lokalisation der Netzhautablösung<br />
ab. Wiederanlegen gelingt in 90% der Fälle bei unkomplizierter<br />
Netzhautablösung.<br />
2. Therapie wie oben. Prognose ist jedoch ungünstiger.<br />
Ablösungsprozess lässt sich nicht immer stoppen.<br />
3. Es muss die Grunderkrankung therapiert werden, von<br />
der auch die Prognose abhängt.<br />
Therapie der Netzhautablösung<br />
56<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 56
(*)<br />
Glaukom (1)<br />
Unter Glaukom (grüner Star) versteht man eine Sehnervschädigung infolge eines Missverständnisses zwischen<br />
Augeninnendruck (erhöht) und Perfusionsdruck der Papille (arterieller Druck). Der Augeninnendruck<br />
übersteigt den mittleren Blutdruck der Gefässe der Sehnervenpapille und die Papille wird komprimiert. Bei niedrigem<br />
Blutdruck kann ein Glaukom schon bei normalem Augeninnendruck entstehen (Normaldruckglaukom).<br />
Wenn ein erhöhter Augeninnendruck keinerlei Schäden verursacht, weil der Blutdruck in den Gefässen<br />
ausreichend hoch ist, bezeichnet man das als okulare Hypertension.<br />
Das Glaukom zählt zu den häufigsten Erblindungsursachen.<br />
57<br />
Ein erhöhter Druck im Glaskörperraum<br />
drückt auf den Sehnerv im Bereich der<br />
Papille. Durch den Druck werden die<br />
feinen Nervenfasern zusammengequetscht<br />
und können absterben.<br />
Augenhintergrund: Im gesunden<br />
Auge (oben) ist die Papille rund<br />
und flach. Die Druckschädigung<br />
des Sehnervs ist an einer Aushöhlung<br />
erkennbar.<br />
Die Augenkammern sind mit Kammerwasser gefüllt, das<br />
im Ziliarkörper produziert wird, an dem auch die Linse<br />
befestigt ist. Durch eine Lücke zwischen Linse und Iris<br />
gelangt es von der hinteren in die vordere Augenkammer.<br />
Im Kammerwinkel wird das Kammerwasser durch winzige<br />
Spalten in einen kleinen Kanal aufgenommen und in das<br />
Blut abgegeben. Ist dieser Abfluss behindert, steigt der<br />
Innendruck.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 57
(*)<br />
Glaukom (2)<br />
Klassifikation der Glaukome<br />
A<br />
58<br />
Weitwinkelglaukom<br />
Häufigste Glaukomform des Erwachsenen.<br />
Das Kammerwasser kann das<br />
Trabekelmaschenwerk durch den Kammerwinkel<br />
ungehindert erreichen, kann<br />
jedoch wegen strukturellen Veränderungen<br />
schwer hindurchtretetn. Weitere<br />
Hindernisse sind ein erhöhter Widerstand<br />
im Schlemmkanal und eine<br />
Drucksteigerung in den das Kammerwasser<br />
ableitenden Venen.<br />
Engwinkelglaukom<br />
Drucksteigerung wird durch den engen<br />
Kammerwinkel verursacht, was zu<br />
einem erschwerten Abfluss führt. Bei<br />
vollständiger Verlegung des Abflusses<br />
kommt es zu einem akuten Winkelblockglaukom<br />
mit Druckwerten von<br />
60-80 mm Hg, extrem starken Kopfschmerzen,<br />
Übelkeit und Erbrechen<br />
(akuter Glaukomanfall).<br />
B<br />
Die Schädigung des Sehnervs durch<br />
einen erhöhten Augeninnendruck führt<br />
dazu, dass die Wahrnehmumg des<br />
Patienten zunächst in kleinen Bereichen<br />
zwischen Zentrum und Peripherie des<br />
Gesichtsfeldes beeinträchtigt ist.<br />
A. Normales Gesichtsfeld eines rechten<br />
Auges eines gesunden Menschen.<br />
B. Gesichtsfeld eines rechten Auges bei<br />
einem Glaukom-Patienten.<br />
26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 58