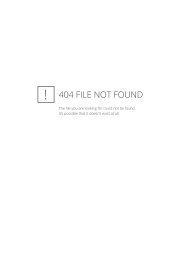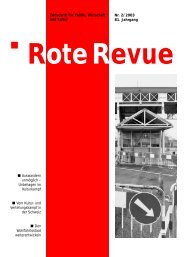Wirtschaft – sozial und ökologisch gestalten - SP Schweiz
Wirtschaft – sozial und ökologisch gestalten - SP Schweiz
Wirtschaft – sozial und ökologisch gestalten - SP Schweiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
OSITIONEN<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig | <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
<strong>Wirtschaft</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>sozial</strong> <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong><br />
<strong>gestalten</strong>
OSITIONEN<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik der <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Was sagt die <strong>SP</strong> zu<br />
1. Globalisierung<br />
2. EU-Beitritt<br />
3. Strukturwandel<br />
4. Markt <strong>und</strong> Wettbewerb<br />
5. Wachstum <strong>und</strong> Umwelt<br />
6. Arbeit <strong>und</strong> Lohn<br />
7. Gleichstellung<br />
8. Service public<br />
9. Sparen beim Staat<br />
10. Steuern<br />
<strong>und</strong> was fordert sie?<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>
OSITIONEN<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong> bestimmt in zentralen Bereichen die Lebenssituation der Menschen in<br />
der <strong>Schweiz</strong> <strong>und</strong> weltweit. Deshalb gehört die <strong>Wirtschaft</strong> mit ins Zentrum der Politik der<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>. Mit dem <strong>Wirtschaft</strong>skonzept für die Jahre 2006 bis 2015 leistet die <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
einen Beitrag, um die <strong>Wirtschaft</strong> <strong>sozial</strong>, <strong>ökologisch</strong> <strong>und</strong> feministisch zu erneuern.<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong>spolitik der <strong>SP</strong> muss dazu führen, dass die <strong>Schweiz</strong> sich nachhaltig entwickelt,<br />
Wohlstand <strong>und</strong> Lasten gerechter verteilt werden, die Gleichstellung von Frau<br />
<strong>und</strong> Mann voran kommt <strong>und</strong> auch in der <strong>Wirtschaft</strong> die Demokratie ausgebaut wird.<br />
Die <strong>SP</strong> unterstützt den wirtschaftlichen Wandel. Dabei muss sichergestellt werden, dass<br />
die Mehrheit der Menschen vom wirtschaftlichen Fortschritt profitiert. Der <strong>Wirtschaft</strong>sstandort<br />
<strong>und</strong> der Sozialstaat müssen gleichzeitig gestärkt werden. Staat <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />
sind nicht von Gr<strong>und</strong> auf Widersacherinnen, sondern sie haben unterschiedliche Funktionen,<br />
die sich ergänzen.<br />
Bausteine für eine <strong>sozial</strong>ere, <strong>ökologisch</strong>ere <strong>und</strong> demokratischere <strong>Schweiz</strong><br />
Die vorliegende Broschüre greift einige wirtschaftspolitische Schwerpunkte des neuen<br />
<strong>SP</strong>-<strong>Wirtschaft</strong>skonzepts 2006<strong>–</strong>2015 auf. Es sind Bausteine für eine <strong>Schweiz</strong>, die in den<br />
nächsten Jahren auch durch eine bessere <strong>Wirtschaft</strong>spolitik <strong>sozial</strong>er, <strong>ökologisch</strong>er <strong>und</strong><br />
demokratischer werden muss.<br />
<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
OSITIONEN<br />
Die nachfolgend behandelten zehn Themen, von der Globalisierung bis zu den Steuern,<br />
entsprechen den folgenden Anforderungen an die <strong>Wirtschaft</strong>spolitik der <strong>SP</strong>:<br />
Vollbeschäftigung. Im Zentrum der <strong>Wirtschaft</strong>spolitik der <strong>SP</strong> steht die Vollbeschäftigung.<br />
Alle Personen sollen so viel arbeiten können, wie sie wollen. Die Entlöhnung einer<br />
Vollzeitstelle muss die Existenzsicherung einer Person <strong>und</strong> ihrer Kinder gewährleisten.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swachstum. Die <strong>Schweiz</strong> braucht ein stärkeres <strong>Wirtschaft</strong>swachstum,<br />
das mehr Arbeitsplätze schafft <strong>und</strong> mit dem <strong>ökologisch</strong>en Umbau gekoppelt wird. Die<br />
Kaufkraft der <strong>Schweiz</strong>er Haushalte muss gestärkt werden, um die Binnennachfrage in<br />
Schwung zu bringen.<br />
Bildung <strong>und</strong> Forschung. Die Bildungs- <strong>und</strong> Forschungspolitik muss forciert werden.<br />
Das stärkt den Standort, die Chancengleichheit sowie den <strong>ökologisch</strong>en Umbau <strong>und</strong> ist<br />
beschäftigungswirksam.<br />
Verwendung des Produktivitätszuwachses. Von der steigenden Produktivität<br />
muss ein grösserer Anteil auf die Seite der Lohnabhängigen kommen. Hier kann er für<br />
kürzere Arbeitszeiten <strong>und</strong> höhere Löhne eingesetzt werden. Bei anhaltender Nachfrageschwäche<br />
optiert die <strong>SP</strong> prioritär für höhere Reallöhne.<br />
Ökologischer Umbau. Eine <strong>Wirtschaft</strong>spolitik, die die Anwendung neuer Umwelttechniken<br />
forciert, den Ressourceneinsatz minimiert <strong>und</strong> die Energieeffizienz steigert,<br />
fördert zugleich das Wachstum. Die <strong>Schweiz</strong> soll international an die Spitze der nachhaltigen<br />
Technologien zur Schonung der Ressourcen geführt werden.<br />
Verteilungsgerechtigkeit. In der <strong>Schweiz</strong> hat in den letzten Jahren eine Umverteilung<br />
von unten nach oben stattgef<strong>und</strong>en. Untere <strong>und</strong> mittlere Einkommen stagnierten<br />
real, während Einkommen vieler Spitzenmanager explodierten. Das schadet dem Standort,<br />
dem Wachstum <strong>und</strong> dem <strong>sozial</strong>en Frieden. Nötig sind eine gerechtere Einkommens<strong>und</strong><br />
Vermögensverteilung, der regionale Ausgleich <strong>und</strong> die Solidarität zwischen den Generationen<br />
<strong>und</strong> Geschlechtern.<br />
Gleichstellung der Geschlechter. Trotz Verfassungsauftrag <strong>und</strong> Gesetz sind die<br />
Frauen in der <strong>Schweiz</strong> noch nicht gleichgestellt. Die ungleiche Arbeitsverteilung der bezahlten<br />
<strong>und</strong> unbezahlten Arbeit <strong>und</strong> die Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern<br />
führen zu einem ineffizienten Einsatz des Faktors Arbeit <strong>und</strong> zur ungleichen Verteilung<br />
von Einkommen <strong>und</strong> Vermögen.<br />
Für einen starken Staat. Nur ein starker <strong>und</strong> effizienter Staat ist ein zukunftsweisender<br />
Staat. Mit einer guten <strong>sozial</strong>en Absicherung <strong>und</strong> mit leistungsfähigen öffentlichen<br />
Unternehmen leistet der Staat einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt des Landes<br />
<strong>und</strong> für einen guten Standort. Nötig ist ein mittelfristig ausgeglichener Staatshaushalt.<br />
Internationale Mitgestaltung. Die internationalen <strong>Wirtschaft</strong>sbeziehungen sind<br />
für die <strong>Schweiz</strong> wichtig. Die <strong>Schweiz</strong> muss international mitbestimmen können. Dazu<br />
braucht es den EU-Beitritt <strong>–</strong> dies auch aus wirtschaftlichen Gründen. Zur Gestaltung der<br />
Globalisierung braucht es neue internationale Regulierungen mit <strong>sozial</strong>en <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong>en<br />
Leitplanken.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sdemokratie. Ohne <strong>sozial</strong>e Gerechtigkeit <strong>und</strong> ein Minimum an <strong>Wirtschaft</strong>sdemokratie<br />
wird das Vertrauen in die politische Demokratie untergraben. Die <strong>SP</strong><br />
setzt sich dafür ein, dass die <strong>Wirtschaft</strong> demokratischer wird. In der Privatwirtschaft müssen<br />
insbesondere die Mitbestimmungsrechte der Lohnabhängigen ausgebaut werden.<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
1.<br />
Globalisierung<br />
Globalisierung <strong>sozial</strong> <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong> <strong>gestalten</strong><br />
Die Globalisierung prägt das Exportland <strong>Schweiz</strong>. Sie ist nichts Neues. Verändert haben<br />
sich das Tempo <strong>und</strong> die regionalen Disparitäten. Die Frage heisst nicht: Sind wir für oder<br />
gegen die Globalisierung, sondern: Welche Globalisierung wollen wir? Die <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> will<br />
keine unkontrollierte Globalisierung, die dem Kapitalismus freien Lauf lässt. Sie will den<br />
Prozess mit <strong>sozial</strong>en <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong>en Leitplanken mit<strong>gestalten</strong>.<br />
Globalisierung als Chance<br />
Die Globalisierung <strong>–</strong> die weltweite Verflechtung von Kulturen <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sräumen<br />
<strong>–</strong> geht weiter. In der <strong>Schweiz</strong> wird fast jeder zweite Franken im Export verdient, Tendenz<br />
steigend. Das Zusammenwachsen der Märkte verstärkt die internationale Arbeitsteilung.<br />
Es werden Arbeitsplätze in der Industrie abgebaut <strong>und</strong> ins Ausland verlagert. <strong>Schweiz</strong>er<br />
Unternehmen <strong>–</strong> auch KMU <strong>–</strong> erobern entlegene Märkte. Gleichzeitig werden schweizerische<br />
Unternehmen im Binnenmarkt vermehrt durch ausländische Unternehmen<br />
konkurrenziert, z. B. im Detailhandel, im Tourismus <strong>und</strong> im Verkehr. Die Globalisierung<br />
bringt der <strong>Schweiz</strong> mehr Chancen als Risiken, wenn wir sie nutzen.<br />
Verlagerung zu den Dienstleistungen<br />
Die De-Industrialisierung wird von einer Verlagerung zu den Dienstleistungen begleitet<br />
(Banken, Versicherungen, Ges<strong>und</strong>heitswesen etc.). Der Finanzplatz behält auch künftig<br />
seine wichtige Rolle. In den wertschöpfungsintensiven, wissensbasierten Produktionssektoren<br />
ist eine Re-Industrialisierung im Gang. Sie muss unterstützt werden. Gut ausgebildete<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter bleiben der zentrale Standortfaktor.<br />
Entwicklungszusammenarbeit bleibt zentrale Aufgabe<br />
Globalisierung heisst auch: Verstärkter Einbezug der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft.<br />
Durch den wirtschaftlichen Aufstieg von China, Indien <strong>und</strong> Brasilien geht die<br />
Armut in diesen «Schwellenländern» zwar zurück, die Kluft zwischen arm <strong>und</strong> reich wird<br />
aber auch in diesen Ländern grösser. An gewissen Weltregionen, insbesondere einem<br />
Teil Afrikas, geht der wirtschaftliche Aufschwung vorbei. Entwicklungszusammenarbeit<br />
bleibt deshalb eine zentrale Aufgabe der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Offene Märkte brauchen Regulierungen<br />
Die Öffnung von Märkten erhöht den Regulierungsbedarf. Es braucht faire Regeln für<br />
die Arbeitnehmenden, Leitplanken für die Schonung der natürlichen Ressourcen <strong>und</strong><br />
Richtlinien für die globalen Finanzmärkte. Die globale Arbeitsteilung führt zu einem<br />
steigenden Verkehrsvolumen. Die Transportpreise müssen die wirklichen Kosten widerspiegeln.<br />
<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Aussenwirtschaftspolitik mit breiter Optik. Auch in der Aussenwirtschaft<br />
müssen die aussenpolitischen Ziele der B<strong>und</strong>esverfassung gelten: Wohlfahrt, Linderung<br />
von Not <strong>und</strong> Armut in der Welt, Achtung der Menschenrechte, Förderung der<br />
Demokratie, friedliches Zusammenleben der Völker sowie die Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensgr<strong>und</strong>lagen.<br />
2. Finanzielle Ziele der Entwicklungszusammenarbeit umsetzen. Im Finanzplan<br />
des B<strong>und</strong>es muss das Ziel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit<br />
bis 2015 (0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts) glaubwürdig aufgezeigt werden. Nur<br />
so kann die <strong>Schweiz</strong> den versprochenen Beitrag zur Erreichung der Milleniums-Ziele<br />
der UNO leisten.<br />
3. Mehr Multilateralismus. Multilaterale Beziehungen <strong>und</strong> Abkommen müssen gegenüber<br />
dem Bilateralismus gestärkt werden. Sie schützen die Interessen der schwächeren<br />
Staaten <strong>und</strong> der <strong>Schweiz</strong> besser.<br />
4. Soziale <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong>e Standards. Für wirtschaftliche Tätigkeiten in den<br />
Ländern des Südens <strong>und</strong> Ostens braucht es <strong>sozial</strong>e Mindeststandards, namentlich<br />
gegen die Ausbeutung der Frauen <strong>und</strong> Kinder auf dem Arbeitsmarkt, <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong>e<br />
Mindeststandards gegen die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen.<br />
5. Marktzugang erleichtern. Die Industrieländer müssen die Exportsubventionen<br />
abschaffen, die Agrarmärkte schrittweise öffnen <strong>und</strong> der Gruppe der ärmsten Länder<br />
den Marktzugang für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte erleichtern. Im Gegenzug<br />
sollen die dynamischen Schwellenländer ihre Zollschranken abbauen.<br />
6. Spekulation besteuern. Zur Stabilisierung der globalen Finanzmärkte <strong>und</strong> zur<br />
Finanzierung globaler Aufgaben ist eine international koordinierte Steuer auf kurzfristigen<br />
spekulativen Devisengeschäften einzuführen.<br />
Exporte global <strong>und</strong> in einzelnen Kontinenten in Milliarden Dollar <strong>und</strong> Prozent<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: WTO 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
2.<br />
EU-Beitritt<br />
Mehr Souveränität mit der EU<br />
Die <strong>Schweiz</strong> steht abseits der Europäischen Union (EU). Das führt zu erheblichen wirtschaftlichen<br />
Nachteilen: Hohe Preise, verlangsamter Strukturwandel, Hürden für die Exportwirtschaft,<br />
anhaltende Wachstumsschwäche, weniger Rechte für Arbeitnehmende,<br />
Konsumentinnen <strong>und</strong> Konsumenten. Die <strong>SP</strong> ist für den EU-Beitritt <strong>–</strong> das nicht nur, aber<br />
auch aus wirtschaftlichen Gründen.<br />
Alleingang schadet der <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
Mit dem Nein zum EWR 1992 hat sich die <strong>Schweiz</strong> isoliert. Mit bilateralen Verträgen versucht<br />
sie seither, die gravierendsten Nachteile dieses Alleingangs wettzumachen. Mit<br />
mässigem Erfolg: Kein vergleichbares Land in Europa hatte in den letzten zehn Jahren ein<br />
tieferes <strong>Wirtschaft</strong>swachstum. Der Alleingang bremst den notwendigen Strukturwandel<br />
in der <strong>Schweiz</strong>er <strong>Wirtschaft</strong>. Hohe Preise schwächen die Kaufkraft der Arbeitnehmenden<br />
<strong>und</strong> verteuern die Produktion. Für viele Klein-<strong>und</strong> Mittelbetriebe (KMU) ist der Zugang<br />
zum europäischen Binnenmarkt erschwert.<br />
Die <strong>Schweiz</strong> braucht die EU.<br />
Die <strong>Schweiz</strong> ist existenziell auf einen funktionierenden Aussenhandel mit der EU angewiesen.<br />
81 Prozent der schweizerischen Importe kamen 2004 aus der EU, 60 Prozent<br />
unserer Exporte gingen dorthin. Die Osterweiterung hat die wirtschaftliche Bedeutung<br />
der EU nochmals verstärkt.<br />
Handelshemmnisse belasten die KMU.<br />
Komplizierte Zolltarife <strong>und</strong> technische Handelshemmnisse belasten den Handel mit der<br />
EU. Für KMU sind solche Behinderungen schwerwiegend. Grosskonzerne können sich<br />
mit Niederlassungen im Ausland arrangieren. Beim Import wird die <strong>Schweiz</strong>er Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> die <strong>Wirtschaft</strong> mit überhöhten Preisen benachteiligt.<br />
Freier Zugang zum Europäischen Markt.<br />
Bei einem EU-Beitritt erhalten <strong>Schweiz</strong>er Unternehmen freien <strong>und</strong> gleichberechtigten<br />
Zugang zum EU-Binnenmarkt mit seinen 450 Mio. Konsumentinnen <strong>und</strong> Konsumenten.<br />
Teure Grenzkontrollen, Formalitäten, Zölle <strong>und</strong> damit viele Kosten <strong>und</strong> Komplikationen<br />
fallen weg. Damit wird das Exportland <strong>Schweiz</strong> gestärkt, Arbeitsplätze werden gesichert.<br />
Mehr Rechte für die Lohnabhängigen.<br />
Ein EU-Beitritt bringt den Lohnabhängigen bessere Bedingungen in den Bereichen Arbeitszeit,<br />
Temporär-<strong>und</strong> Teilzeitarbeit, Kündigungsschutz, betriebliche Mitbestimmung,<br />
Mutterschaftsversicherung <strong>und</strong> Elternurlaub.<br />
<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Volle Mitbestimmung in der EU. Die <strong>Schweiz</strong> übernimmt heute schon aus Eigeninteresse<br />
viele EU-Regelungen, ohne bei deren Beschluss mitbestimmt zu haben<br />
(«autonomer Nachvollzug»). Sie kann nur mitentscheiden, wenn sie beitritt. Bilaterale<br />
Verträge schliessen Mitbestimmung aus. Ein EU-Beitritt stärkt deshalb die Souveränität<br />
der <strong>Schweiz</strong>.<br />
2. Tiefere Preise <strong>und</strong> mehr Gesamtarbeitsverträge. Mit dem Eintritt in den europäischen<br />
Binnenmarkt werden die Preise durch die freien Importe <strong>und</strong> den intensiveren<br />
Wettbewerb sinken. Damit steigt die Kaufkraft im Inland. Mehr Wettbewerb<br />
bedeutet auch mehr Druck auf die Binnenwirtschaft <strong>und</strong> ihre Arbeitnehmenden.<br />
Deshalb braucht es flankierende Massnahmen. Die Lohnabhängigen müssen vor<br />
Lohndumping auch durch Gesamtarbeitsverträge geschützt werden.<br />
3. Höhere Mehrwertsteuer <strong>sozial</strong> kompensieren. Bei einem Beitritt muss die<br />
<strong>Schweiz</strong> ihre Mehrwertsteuer von 7,6 Prozent auf das EU-Minimum von 15 Prozent<br />
anheben. Dies soll schrittweise erfolgen. Die Mehreinnahmen müssen <strong>sozial</strong> eingesetzt<br />
werden: Ein Teil der Erhöhung dürfte auch ohne einen Beitritt für die langfristige<br />
Finanzierung von AHV <strong>und</strong> IV gebraucht werden. Der grösste Teil soll pro Kopf<br />
an die Bevölkerung zurückerstattet werden. Haushalte mit Kindern <strong>und</strong> tiefem bis<br />
mittlerem Einkommen würden gegenüber heute finanziell entlastet.<br />
4. Den Franken behalten. Im Falle eines EU-Beitritts soll die <strong>Schweiz</strong> wie das EU-<br />
Mitglied Schweden ihre Währung behalten <strong>und</strong> bis auf Weiteres nicht den Euro übernehmen.<br />
So behält die <strong>Schweiz</strong> einen Spielraum in der Geld-<strong>und</strong> Währungspolitik.<br />
Die wichtigsten Handelspartner der <strong>Schweiz</strong> Anteil an den gesamten Exporten <strong>und</strong> Importen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Statistik 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
3.<br />
Strukturwandel<br />
Die Chancen des Strukturwandels nutzen<br />
Wer sich nicht verändert, wird verändert <strong>und</strong> überholt. Der wirtschaftliche Strukturwandel<br />
darf nicht blockiert, er muss aktiv begleitet werden. Mit einer Bildungsoffensive <strong>und</strong><br />
einem Strukturanpassungsfonds will die <strong>SP</strong> dafür sorgen, dass der Strukturwandel <strong>sozial</strong><br />
<strong>und</strong> regional verträglich erfolgt.<br />
Mit Investitionen den Strukturwandel bewältigen<br />
Strukturwandel bedeutet Veränderungen der <strong>Wirtschaft</strong>ssektoren <strong>und</strong> Branchen, der Arbeitswelt<br />
<strong>und</strong> Berufe. Die <strong>Wirtschaft</strong> verändert sich immer schneller. Eine Blockierung<br />
dieser Entwicklung würde in eine Sackgasse führen. Strukturelle Veränderungen bedeuten<br />
auch <strong>sozial</strong>e <strong>und</strong> <strong>ökologisch</strong>e Chancen. Den Strukturwandel positiv bewältigen,<br />
bedeutet Investitionen in die Menschen (bessere Bildung, mehr Integration) <strong>und</strong> in die<br />
Umwelt (weniger Verbrauch, bessere Energie-Effizienz). Dafür müssen wir kämpfen.<br />
Grössere Ungleichheiten<br />
Der rasante Strukturwandel führt bei vielen Unternehmen zu untragbaren Resultaten.<br />
Auf der einen Seite steigen die Profite der Aktienbesitzenden <strong>und</strong> die Gehälter der Topmanager.<br />
Auf der anderen Seite werden Arbeitsplätze abgebaut <strong>und</strong> die Löhne gedrückt.<br />
Die gesellschaftlichen Ungleichheiten vergrössern sich.<br />
Negative Effekte des Strukturwandels<br />
Auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt der Strukturwandel tiefe Spuren. Die Arbeitsplätze<br />
sind nicht mehr sicher. Vollbeschäftigung wird von der <strong>Wirtschaft</strong> nicht mehr als Aufgabe<br />
anerkannt. Die Unterschiede zwischen den Regionen werden grösser. Randregionen<br />
bek<strong>und</strong>en vielfach Mühe, Schritt zu halten. Standorte sind einem starken Wettbewerb<br />
ausgesetzt.<br />
Bildung treibt die <strong>Wirtschaft</strong> an<br />
Um diesen Strukturwandel <strong>sozial</strong>verträglich zu <strong>gestalten</strong>, braucht die <strong>Schweiz</strong> eine aktive<br />
Bildungs-<strong>und</strong> Forschungspolitik. Die fängt bei den Kindern an. Nur mit hervorragend<br />
ausgebildeten Menschen kann die <strong>Schweiz</strong>er <strong>Wirtschaft</strong> auf dem Weltmarkt einen technologischen<br />
Vorsprung halten. Personen, deren Berufsbildung veraltet ist oder die ihren<br />
Arbeitsplatz verlieren, muss bei der Umschulung <strong>und</strong> Arbeitssuche geholfen werden.<br />
Aktive Technologiepolitik<br />
Technologische Innovation lebt von einem intensiven Wissenstransfer von den Hochschulen<br />
in die <strong>Wirtschaft</strong>. Beim Aufbau technologieorientierter Unternehmen braucht<br />
es gute Rahmenbedingungen. Sinnvollerweise wird die Innovationsförderung direkt mit<br />
der Regionalpolitik verknüpft. Im Zentrum der Technologiepolitik sollen Umwelttechnologien<br />
stehen: Innovationen, bei denen einer hohen gesellschaftlichen «Rendite» eine zu<br />
tiefe privatwirtschaftliche Rentabilität gegenübersteht. Hier ist der Staat gefragt.<br />
<br />
<strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Investitionen ins Bildungssystem. Eine bessere Bildung vom Vorschulbereich<br />
über die Hochschulen bis zum lebenslangen Lernen ist die beste Voraussetzung für<br />
die Bewältigung des Strukturwandels. Dazu braucht es mehr Investitionen in die Bildung<br />
<strong>und</strong> mehr Chancengleichheit beim Zugang zur Bildung.<br />
2. Recht auf Weiterbildung. Alle Erwerbstätigen sollen das Recht auf einen bezahlten<br />
Weiterbildungsurlaub von jährlich mindestens fünf Tagen haben. Für die teuren<br />
Weiterbildungen braucht es Finanzierungshilfen für die Auszubildenden (Weiterbildungsgutscheine),<br />
die gezielter wirken als Steuerabzüge. Sicherzustellen ist der<br />
gleichberechtigte Zugang der Frauen <strong>und</strong> Teilzeitarbeitenden zur Weiterbildung.<br />
3. Besserer Wissenstransfer. Zwischen Hochschulen <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> muss der<br />
Wissenstransfer massiv intensiviert werden.<br />
4. Innovation beschleunigen. Mit einem «Fonds für Innovation <strong>und</strong> Strukturanpassung»<br />
soll der schwierige Übergang von der Forschung <strong>und</strong> Entwicklung zur Produktion<br />
in neu entstehenden kleinen Unternehmen gefördert werden. Damit können<br />
auch regionalpolitische Effekte erzielt werden.<br />
5. Innovationsanreize statt Steuerwettbewerb. Die schweizerische Regionalpolitik<br />
muss konsequent auf Innovationsanreize setzen. An Stelle eines exzessiven<br />
Standortwettbewerbs durch Steuererleichterungen braucht es eine bessere Koordination<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>sförderung der Kantone. Kantonale Schwerpunktbildungen in<br />
der Ansiedlung neuer Unternehmen müssen national koordiniert werden.<br />
Erwerbstätige nach <strong>Wirtschaft</strong>ssektoren in 1000<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Statistik 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
4.<br />
Markt <strong>und</strong> Wettbewerb<br />
Markt <strong>und</strong> Wettbewerb brauchen Regeln<br />
Markt <strong>und</strong> Wettbewerb in der Privatwirtschaft sollen zur besseren Versorgung mit Gütern<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen <strong>und</strong> zu günstigen Preisen führen. Der Markt neigt dazu, die Konkurrenz<br />
auszuschalten. Der Staat muss mit klaren Regeln dafür sorgen, dass der Wettbewerb<br />
spielt. Spezielle Regelungen braucht es für die Güter <strong>und</strong> Dienste der Gr<strong>und</strong>versorgung.<br />
Markt <strong>und</strong> Wettbewerb im Dienst der Konsumierenden<br />
Der Markt ist ein geeigneter Mechanismus für die effiziente Verteilung von Gütern<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen, für den möglichst effizienten Einsatz von Kapital <strong>und</strong> Arbeit,<br />
für die Preisbildung. Der Markt funktioniert aber nur bei Wettbewerb. Markt <strong>und</strong><br />
Wettbewerb beschränken die wirtschaftliche Macht Einzelner <strong>und</strong> stärken die Position<br />
der Konsumentinnen <strong>und</strong> Konsumenten.<br />
Markt braucht Regeln<br />
Die Unternehmen im Markt versuchen Mitkonkurrenten möglichst auszuschalten, denn<br />
der Wettbewerb drückt die Margen <strong>und</strong> damit die Gewinne. Jeder Markt braucht deshalb<br />
Wettbewerbsregeln, um die schwächeren MarktteilnehmerInnen zu schützen.<br />
Staatliche Monopole notwendig<br />
Bei bestimmten Gütern bringt ein staatliches Angebot eine bessere Verteilung als der<br />
Wettbewerb. Das gilt überall dort, wo mit dem staatlichen Monopol spezielle Ziele wie<br />
etwa eine flächendeckende Versorgung erreicht werden sollen. Das sind die Güter <strong>und</strong><br />
Dienste, die zur Gr<strong>und</strong>versorgung (Service public) gehören, aber auch «natürliche Monopole»<br />
wie etwa das Hochspannungsnetz in der Stromversorgung.<br />
Überhöhte Preise<br />
Überhöhte Preise belasten die Konsumentinnen <strong>und</strong> Konsumenten, aber auch die <strong>Wirtschaft</strong>,<br />
die zu teure Produkte einkaufen muss. Überhöhte Preise deuten auf mangelnden<br />
Wettbewerb hin. Ein Hemmnis ist unser Patentrecht. Die eigentlich sinnvollen Erfindungspatente<br />
werden so stark geschützt, dass der Wettbewerb behindert wird. Der Markt<br />
wird an der Grenze zum Teil durch speziell geschützte Rechte aus geistigem Eigentum<br />
abgeschottet. Sie sind vielfach der Gr<strong>und</strong> für die überhöhten Preise in der <strong>Schweiz</strong>. Mit<br />
Parallelimporten könnte der Handel angekurbelt werden, ohne dass dadurch der Schutz<br />
der Erfindungen geschmälert würde.<br />
10 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Bissigere Wettbewerbskommission. Das schweizerische Kartellrecht ist<br />
ein gutes Instrument. Gleichwohl ist die Wirkung der Wettbewerbskommission zu<br />
schwach. Anstatt die volkswirtschaftlich schädlichen vertikalen Preisbindungen (Absprachen<br />
zwischen Hersteller, Importeur <strong>und</strong> Vertrieb), die überhöhten Zinsmargen<br />
<strong>und</strong> Gebühren im Hypothekar-, Geschäftskredit-<strong>und</strong> Spareinlagengeschäft zu knacken,<br />
beschäftigt sich die Kommission mit den volkswirtschaftlich unbedeutenden<br />
Buchpreisen in den Deutschschweizer Buchhandlungen.<br />
2. Mehr Kompetenzen für die Preisüberwachung. Die Preisüberwachung ist<br />
für die Überwachung der administrierten Preise (z. B. der staatlichen Unternehmen<br />
Post <strong>und</strong> SBB) zuständig, aber auch für die Kontrolle der Preise marktmächtiger Unternehmen,<br />
die in keinem funktionierenden Wettbewerb stehen (z. B. die Energiekonzerne).<br />
Für eine effektive Preiskontrolle fehlen ihr nicht nur das nötige Personal,<br />
sondern auch die Kompetenzen, um Preise effektiv herabzusetzen. Die <strong>SP</strong> will eine<br />
Stärkung der Preisüberwachung.<br />
3. Durchsetzung von Parallelimporten. Parallelimporte sind ein wirksames Mittel,<br />
um die hohen Preise in der <strong>Schweiz</strong> unter Druck zu setzen. Die <strong>Schweiz</strong>er Löhne<br />
werden durch eine Verstärkung der Parallelimporte nicht negativ beeinflusst, da billigere<br />
Importe keine Einfuss auf <strong>Schweiz</strong>er Arbeitsplätze haben.<br />
4. Abbau der technischen Handelshemmnisse. Der <strong>Schweiz</strong>er Markt wird nach<br />
aussen durch eine Unzahl von «technischen Handelshemmnissen» abgeschottet. Sie<br />
sind eine der Ursachen für die Hochpreisinsel <strong>Schweiz</strong>. Es gibt viel zu viele Detailvorschriften,<br />
die mit den umliegenden Ländern nicht harmonisiert sind <strong>und</strong> für die<br />
<strong>Schweiz</strong>er Konsumierenden nichts bringen. Sie verteuern oder verhindern Importe.<br />
5. Einheitliche Submissions-<strong>und</strong> Baugesetze. In der <strong>Schweiz</strong> werden öffentliche<br />
Aufträge zu teuer vergeben. Lokale Behörden versuchen, über ausgeklügelte<br />
Kriterienkataloge das einheimische Gewerbe zu schützen. Verteuernd wirkt auch<br />
die Vielzahl von Baugesetzen. Die <strong>SP</strong> fordert ein einheitliches Submissionsrecht <strong>und</strong><br />
Baurecht für B<strong>und</strong>, Kantone <strong>und</strong> Gemeinden.<br />
Preisvergleiche nach Güterkategorie EU-15 = 100<br />
<strong>Schweiz</strong> Deutschland Frankreich Italien<br />
Fleisch 183 110 109 93<br />
Milch, Käse, Eier 182 83 109 108<br />
Früchte, Gemüse, Kartoffeln 137 106 110 92<br />
Tabakwaren 136 92 103 88<br />
Wohnungsmiete 133 115 106 69<br />
Heizung <strong>und</strong> Beleuchtung 133 105 100 108<br />
Haushaltgeräte 124 93 101 101<br />
Nachrichtenübermittlung 97 101 66 96<br />
Hotels <strong>und</strong> Gaststätten 92 86 97 94<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Statistik 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
11
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
5.<br />
Wachstum <strong>und</strong> Umwelt<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swachstum mit <strong>ökologisch</strong>em Umbau verbinden<br />
Die langjährige Wachstumsschwäche hat der <strong>Schweiz</strong> viele Probleme verursacht: Arbeitslosigkeit,<br />
Finanzierung der Sozialversicherungen, ungenügende Erwerbsintegration der<br />
Frauen. Gleichzeitig erschwerte dies den <strong>ökologisch</strong>en Umbau der <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
Wachstum <strong>–</strong> Ziel <strong>und</strong> Mittel zum Zweck<br />
Für die <strong>SP</strong> bleibt das <strong>Wirtschaft</strong>swachstum für die nächsten zehn Jahre ein zentrales wirtschaftspolitisches<br />
Ziel. Die <strong>Schweiz</strong> braucht 2 bis 3 Prozent Wachstum pro Jahr. Auch<br />
wenn wir uns ein «Wachstumsziel» setzen, so ist <strong>Wirtschaft</strong>swachstum dennoch kein Ziel<br />
für sich, sondern ein Mittel zum Zweck.<br />
Wachstum bleibt zentral<br />
Ohne kräftiges Wachstum ist Vollbeschäftigung nicht möglich. Die Finanzierung der Sozialversicherungen<br />
erfordert ein Wachstum der Lohnsumme. Gleichstellungsforderungen<br />
lassen sich besser durchsetzen. Verteilungsprobleme sind in einer wachsenden Volkswirtschaft<br />
einfacher lösbar. Der <strong>ökologisch</strong>e Umbau kann mit einer Wachstumspolitik<br />
kombiniert <strong>und</strong> dadurch beschleunigt werden.<br />
Wachstum richtig messen<br />
Die üblichen Messgrössen wie das Bruttoinlandprodukt (BIP) sagen nichts aus über die<br />
Verteilung des geschaffenen Wohlstands oder über die <strong>ökologisch</strong>en Auswirkungen des<br />
<strong>Wirtschaft</strong>ens. Beide Dimensionen sind Eckpfeiler in einer <strong>sozial</strong>demokratischen Wachstumspolitik.<br />
Ökologisches Potential nutzen<br />
Eine verantwortungsvolle Wachstumspolitik muss mit Fortschritten bei der Schonung<br />
von Ressourcen (Energie, Rohstoffen) verknüpft sein. Die technischen Möglichkeiten<br />
dazu bestehen, insbesondere im Energiebereich. Es fehlt am politischen Willen, lenkend<br />
einzugreifen. Umgekehrt bringt ein Nullwachstum nicht automatisch mehr Umweltqualität,<br />
wie die Stagnation des zurückliegenden Jahrzehnts belegt. Entscheidend ist die Verbindung<br />
des Wachstumsziels mit <strong>ökologisch</strong>en Zielen.<br />
Wohlstandsverteilung <strong>und</strong> Binnennachfrage<br />
Bei steigender Produktivität blieb in den vergangenen Jahren die Binnennachfrage<br />
schwach. Die verfügbaren Einkommen stagnierten. Die öffentliche Hand erhöhte den<br />
Spardruck. Wir brauchen eine Wachstumspolitik, welche die Binnennachfrage endlich<br />
stärkt.<br />
12 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Stärkung der Kaufkraft. Zur Stärkung der Binnennachfrage müssen die verfügbaren<br />
Einkommen der privaten Haushalte erhöht werden. Neben besseren Löhnen<br />
<strong>und</strong> sicheren Renten braucht es eine Entlastung der unteren <strong>und</strong> mittleren Einkommen<br />
bei den Krankenkassenprämien. Auch der Kampf gegen überhöhte Preise <strong>und</strong><br />
für die Senkung der Wohnkosten stärkt die Kaufkraft der Bevölkerung.<br />
2. Starke Rolle der öffentlichen Hand. Eine wichtige Stütze der Nachfrage <strong>und</strong><br />
der Beschäftigung sind die Ausgaben der öffentlichen Hand. Ihre Löhne sollen vorbildliche<br />
Referenzgrössen für die Privatwirtschaft sein <strong>–</strong> mit guten Löhnen in der<br />
Breite <strong>und</strong> Masshalten an der Spitze. Die Investitionspolitik soll antizyklisch wirken.<br />
3. Investitionen in Bildung <strong>und</strong> Forschung. Bildung, Forschung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
sind zentrale Wachstumstreiber. Die <strong>Schweiz</strong> muss hier bis ins Jahr 2010 international<br />
an die Spitze. Die Harmonisierung der Bildungssysteme <strong>und</strong> der Lernziele<br />
sowie der Wille, überdurchschnittlich in die Bildung zu investieren, sind dafür eine<br />
unverzichtbare Voraussetzung.<br />
4. Gleichstellung ist ein Wachstumsfaktor. Die Durchsetzung der Gleichstellung<br />
eröffnet ein weiteres Wachstumspotenzial. Frauen müssen mehr Erwerbsarbeit<br />
leisten können. Nötig sind die Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf <strong>und</strong> gleichstellungsgerechte<br />
Arbeitsbedingungen. Ein Massnahmenplan muss bis 2015 die Umsetzung<br />
der Gleichstellung sicherstellen.<br />
5. Mehr Energieeffizienz bringt Wachstum. Eine effizientere Energienutzung<br />
(Produktionsprozesse, Renovationen, Wärmedämmung) <strong>und</strong> die gezielte Förderung<br />
der Alternativenergien lösen auch Wachstums-<strong>und</strong> Beschäftigungsimpulse aus. Für<br />
die Schonung der natürlichen Ressourcen braucht es klare Zielvorgaben.<br />
Jährliche Wachstumsraten des realen Bruttoinlandprodukts BIP in %<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: OECD 2005<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 13
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
6.<br />
Arbeit <strong>und</strong> Lohn<br />
Vollbeschäftigung bleibt oberstes Ziel<br />
Jede Frau <strong>und</strong> jeder Mann muss die Möglichkeit haben, mit der eigenen Erwerbsarbeit die<br />
Existenz zu sichern. Von der Vollbeschäftigung sind wir derzeit weit entfernt. Ältere Erwerbslose<br />
haben kaum mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele Junge finden keinen<br />
Einstieg ins Erwerbsleben. Die Löhne vieler Lohnabhängiger werden unter dem Vorwand<br />
der Standortkonkurrenz gedrückt, während die Managerlöhne explodieren.<br />
Arbeitslosigkeit ist inakzeptabel<br />
Arbeitslosigkeit ist individuell untragbar <strong>und</strong> wirtschaftlich eine Verschleuderung von<br />
Ressourcen. Diese könnten für mehr Einkommen, kürzere Arbeitszeiten <strong>und</strong> damit für<br />
mehr Lebensqualität eingesetzt werden. Arbeitslosigkeit führt zur Isolierung <strong>und</strong> ist eines<br />
der grössten Probleme bei den Sozialversicherungen <strong>und</strong> den öffentlichen Finanzen.<br />
Gravierende Jugendarbeitslosigkeit<br />
Wenn Jugendliche nach der Ausbildung keinen Anschluss ins Erwerbsleben finden,<br />
kommt uns das langfristig teuer zu stehen. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit<br />
ist ein zentrales Anliegen der <strong>SP</strong>. Dazu müssen auch die Arbeitgebenden in die Pflicht<br />
genommen werden.<br />
Neue Verteilung der Arbeit<br />
Vollbeschäftigung erfordert auch eine Neuverteilung der bezahlten <strong>und</strong> unbezahlten<br />
Arbeit zwischen den Geschlechtern (siehe Kapitel Gleichstellung). Methoden zu einer<br />
verbesserten Aufteilung der Arbeit sind: mehr Teilzeitstellen, Reduktion der Wochenarbeitszeit<br />
<strong>und</strong>/oder der Lebensarbeitszeit.<br />
Angepasste Arbeitsbedingungen für ältere Lohnabhängige<br />
Arbeitskräfte ab 55 Jahren aus dem Arbeitsprozess auszuschliessen, ist volkswirtschaftlich<br />
kurzsichtig. In wenigen Jahren wird aufgr<strong>und</strong> der demografischen Entwicklung ein<br />
Arbeitskräftemangel entstehen. Der vorzeitige unfreiwillige Ausschluss aus dem Erwerbsleben<br />
wird sich rächen. Es braucht eine Flexibilisierung des Rentenalters in beide<br />
Richtungen. Wer nicht mehr arbeiten kann, soll zu anständigen Bedingungen in Pension<br />
gehen können. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmende so<br />
zu verbessern, dass diese auch länger arbeiten können.<br />
Gerechtere Arbeitsbedingungen<br />
Unter dem Druck der schlechten <strong>Wirtschaft</strong>slage <strong>und</strong> der Standortkonkurrenz versuchen<br />
viele Unternehmen, die Löhne der Beschäftigten mit tiefen bis mittleren Einkommen zu<br />
drücken. Gleichzeitig steigen die Löhne der Topmanager in unverhältnismässige Höhen.<br />
Die Lohnunterschiede sind eine Zeitbombe für den <strong>sozial</strong>en Frieden in der <strong>Schweiz</strong>.<br />
14 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Lehrstellen <strong>und</strong> Berufseinstieg für alle. Jeder junge Mensch muss nach der<br />
obligatorischen Schulzeit eine Ausbildung machen können. Wer nach Abschluss der<br />
Ausbildung keinen Arbeitsplatz findet, muss dennoch einen Berufseinstieg finden<br />
können. Vor allem Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, sollen Praktikumsplätze<br />
für BerufseinsteigerInnen anbieten müssen.<br />
2. Flexiblere Arbeitsmodelle. Die Arbeitswelt muss sich modernisieren. Es müssen<br />
Auszeiten möglich werden, ohne den Arbeitsplatz zu verlieren. Ältere Arbeitnehmende<br />
müssen ihr Pensum reduzieren können.<br />
3. Stärkere Integration in den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktliche Massnahmen<br />
der Arbeitslosenversicherung, der Invalidenversicherung <strong>und</strong> der Sozialhilfe müssen<br />
auf die dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ausgerichtet sein. Die<br />
Zeit der Erwerbslosigkeit soll für die berufliche Qualifizierung genutzt werden.<br />
4. Staatliche Lohnzuschüsse in Ausnahmefällen. Ein Zweiter Arbeitsmarkt<br />
(z. B. Beschäftigungsprogramme) kann dort unterstützt werden, wo eine Nähe zum<br />
Ersten Arbeitsmarkt <strong>und</strong> das Hauptaugenmerk auf der Integration besteht. Unter solchen<br />
Voraussetzungen können befristete Lohnzuschüsse sinnvoll sein.<br />
5. Mindestlöhne in prekären Branchen. Die Löhne müssen existenzsichernd<br />
sein. Dazu sind Gesamtarbeitsverträge mit verbindlichen Mindestlöhnen in allen Bereichen<br />
mit prekären Arbeitsbedingungen nötig: Transport, Detailhandel, Reinigung,<br />
Gastronomie, Landwirtschaft.<br />
6. Stopp der Abzockerei. Die Löhne der Topmanager von Publikumsgesellschaften<br />
sind demokratisch festzulegen <strong>und</strong> auf eine Spanne von höchstens zehn mal den<br />
tiefsten Lohn im Betrieb festzulegen.<br />
Arbeitslosenquote in % der erwerbsfähigen Bevölkerung<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Statistik 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 15
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
7.<br />
Gleichstellung<br />
Gleichstellung ist auch ökonomisch richtig<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong>spolitik muss die Gleichstellung voran bringen. Trotz Verfassungsartikel <strong>und</strong><br />
zehn Jahre Gleichstellungsgesetz sind die Frauen in der <strong>Schweiz</strong>er <strong>Wirtschaft</strong> noch immer<br />
stark benachteiligt. Der Gr<strong>und</strong>satz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit» muss durchgesetzt<br />
werden. Unbezahlte Arbeit darf bei den Sozialversicherungen nicht länger zu Nachteilen<br />
führen.<br />
Frauen sind in der <strong>Wirtschaft</strong> schlechter gestellt<br />
Frauen verdienen r<strong>und</strong> 20 Prozent weniger als Männer für vergleichbare Arbeiten bei<br />
gleicher Qualifikation. Sie sind stärker von Erwerbslosigkeit betroffen <strong>und</strong> arbeiten deutlich<br />
mehr Teilzeit. Das benachteiligt sie bei den Sozialversicherungen <strong>und</strong> beim beruflichen<br />
Aufstieg. Arbeit auf Abruf ist bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern. Sie<br />
sind in schlecht bezahlten <strong>und</strong> hierarchisch tieferen Stufen übervertreten, in den obersten<br />
Kaderstufen kaum anzutreffen. Frauen wählen häufiger Berufe mit geringeren Gehalts-<strong>und</strong><br />
Aufstiegschancen als Männer.<br />
Gerechte Verteilung der Arbeit<br />
In der <strong>Schweiz</strong> werden pro Jahr 6,7 Milliarden St<strong>und</strong>en bezahlte Arbeit <strong>und</strong> 8 Milliarden<br />
St<strong>und</strong>en ohne Bezahlung geleistet. Zwei Drittel der unbezahlten Arbeit erbringen die<br />
Frauen. Aber die Gewichte verschieben sich: Die Erwerbstätigkeit der Frauen nimmt zu.<br />
Bei den jüngeren Menschen wächst die Bereitschaft, einen Teil der bisher unbezahlten<br />
Arbeit zu monetarisieren (bezahlte Kinderbetreuung, Haushalthilfen). Die Lohndiskriminierung<br />
<strong>und</strong> die Trennung des Arbeitsmarktes in «Frauen-» <strong>und</strong> «Männerbereiche»<br />
sind wirtschaftliche Bremsklötze. Frauen sollten mehr Erwerbsarbeit, Männer mehr<br />
Haus-<strong>und</strong> Familienarbeit leisten.<br />
Unbezahlte Arbeit anrechnen<br />
Die tatsächliche Gleichstellung ist erst erreicht, wenn Frauen den gleichen Zugang zu Arbeit,<br />
Einkommen <strong>und</strong> Vermögen haben. Die unbezahlt erbrachten volkswirtschaftlichen<br />
Leistungen müssen im Beruf <strong>und</strong> bei den Sozialversicherungen wie die bezahlte Arbeit<br />
(Gutschriften, Dienstalterseinstufung) angerechnet werden.<br />
Schutz für Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen<br />
Viele Frauen sind in prekären Arbeitsverhältnissen mit unüblichen Arbeitszeiten beschäftigt.<br />
Das birgt Risiken: Je unqualifizierter die Tätigkeit, desto grösser die Gefahr,<br />
dass die Unternehmen die Einsatzplanung nur nach ihren Interessen <strong>gestalten</strong> ohne<br />
Rücksicht auf die Lebenssituation der Angestellten.<br />
16 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Familiengerechte Arbeitsbedingungen. Die Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong><br />
Beruf muss auch bei den Arbeitsbedingungen integral berücksichtigt werden. Arbeit<br />
am Abend <strong>und</strong> an den Wochenenden soll nur bei Freiwilligkeit möglich sein. Hier<br />
muss der Schutz der Arbeitnehmenden ausgebaut werden <strong>–</strong> im Arbeitsgesetz oder<br />
durch mehr Gesamtarbeitsverträge.<br />
2. Familienergänzende Kinderbetreuung. Die familienergänzende Betreuung<br />
der Kinder muss gewährleistet werden. Es braucht mehr qualifizierte Tagesfamilien,<br />
bezahlbare Krippenplätze schulische Betreuungs-<strong>und</strong> Ferienangebote. In der ganzen<br />
<strong>Schweiz</strong> sollen Ganztagesschulen eingeführt werden.<br />
3. Gerechtere Arbeitsverteilung. Die Gewichte sollen sich von der unbezahlten<br />
zur bezahlten Arbeit verschieben. Der verbleibende Teil der unbezahlten Arbeit muss<br />
gerechter auf beide Geschlechter verteilt werden.<br />
4. Besserer Schutz vor Diskriminierung. Das Gleichstellungsgesetz muss die<br />
Frauen besser schützen. Jede Form von Diskriminierung am Arbeitsplatz muss ohne<br />
Angst vor Rachekündigungen einklagbar sein. Die Gleichstellungsbüros sollen auch<br />
klagen können.<br />
5. Unternehmen auf die Gleichstellung verpflichten. Die börsenkotierten Publikumsgesellschaften<br />
<strong>und</strong> die öffentlichen Unternehmen sollen verpflichtet werden,<br />
in einem jährlichen Gender-Report die Entwicklung ihrer Gleichstellungspolitik<br />
aufzuzeigen. Innerhalb von zehn Jahren muss der Anteil der Verwaltungsrätinnen in<br />
den Unternehmen auf 40 Prozent gesteigert werden.<br />
Frauenlöhne in % der Männerlöhne<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Statistik 2006<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 17
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
8.<br />
Service public<br />
Für einen starken <strong>und</strong> effizienten Service public<br />
Der Staat muss eine qualitativ hochstehende Gr<strong>und</strong>versorgung mit Gütern des Service public<br />
für die ganze Bevölkerung in allen Regionen sicherstellen. Er leistet damit einen wichtigen<br />
Beitrag zum wirtschaftlichen <strong>und</strong> <strong>sozial</strong>en Zusammenhalt des Landes. Ein guter<br />
Service public mit einer hohen Versorgungssicherheit ist auch ein entscheidender Faktor<br />
im internationalen Standortwettbewerb.<br />
Für den Zusammenhalt der Gesellschaft<br />
Als Service public bezeichnet man die Versorgung der gesamten Bevölkerung <strong>und</strong> der<br />
Unternehmen mit wesentlichen Waren <strong>und</strong> Dienstleistungen. Welche Angebote darunter<br />
fallen, wird demokratisch bestimmt. Wir zählen dazu: Post, Telekommunikation, öffentlicher<br />
Verkehr, Versorgung mit Wasser, Strom <strong>und</strong> Gas, öffentliche Sicherheit, Umweltschutz,<br />
Raumordnung <strong>und</strong> Justiz sowie Bildung <strong>und</strong> Forschung, Ges<strong>und</strong>heit, <strong>sozial</strong>e<br />
Sicherheit, familienergänzende Kinderbetreuung sowie Kultur. Die Versorgung erfolgt<br />
durch die Leistungserbringung der öffentlichen Hand oder mittels Leistungsaufträgen<br />
an Private. Der Zugang für die ganze Bevölkerung sichert den <strong>sozial</strong>en <strong>und</strong> regionalen<br />
Zusammenhalt der Gesellschaft.<br />
Hohe Anforderungen an Service public-Unternehmen<br />
Der Inhalt der Gr<strong>und</strong>versorgung muss periodisch überprüft <strong>und</strong> an die gesellschaftlichen<br />
<strong>und</strong> technischen Entwicklungen angepasst werden. Dazu braucht es Kontrollen<br />
der erbrachten Leistungen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Innovation, Effizienz<br />
<strong>und</strong> Ökologie des Angebots sowie auf die Arbeitsbedingungen. Überprüft werden müssen<br />
auch die Transparenz der Organisation der Unternehmen <strong>und</strong> die Durchsetzung der<br />
Gleichstellung von Frau <strong>und</strong> Mann.<br />
Ein Pluspunkt im internationalen Wettbewerb<br />
Der Service public ist ein wichtiger Faktor im internationalen Standortwettbewerb. Die<br />
Versorgungssicherheit <strong>und</strong> die Qualität der staatlichen Leistungen vor allem im Verkehr,<br />
in der Kommunikation <strong>und</strong> der Bildung sind für die Ansiedlung von Unternehmen <strong>und</strong><br />
damit von neuen Arbeitsplätzen wichtiger als die Höhe der Steuerbelastung. Wer beim<br />
Service public abbaut, um Steuern senken zu können, fährt in die falsche Richtung.<br />
18 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1 . Kostengünstige <strong>und</strong> gute Leistungen. Die <strong>SP</strong> fordert einen flächendeckenden,<br />
qualitativ hoch stehenden, kostengünstigen, effizienten <strong>und</strong> innovativen Service<br />
public.<br />
2. Kernelemente des Service public sind:<br />
<strong>–</strong> Universaldienst: Die Gr<strong>und</strong>versorgung muss für alle Personen, insbesondere auch<br />
in Randregionen, zu gleichen Preisen <strong>und</strong> in gleicher Qualität zugänglich sein.<br />
<strong>–</strong> Solidarische Finanzierung: Über den Service public wird vielfach auch ein <strong>sozial</strong>er<br />
<strong>und</strong> regionaler Ausgleich angestrebt (z. B. einkommensabhängige Finanzierung,<br />
Subventionen <strong>und</strong> Quersubventionen).<br />
<strong>–</strong> Vorreiterrolle: Öffentliche Unternehmen müssen vorbildliche Arbeitgeberinnen<br />
sein. Auch private Leistungsanbietende des Service public müssen auf die branchenüblichen<br />
Arbeitsbedingungen verpflichtet werden.<br />
3. Es braucht auch staatliche Monopole. Aus technischen oder wirtschaftlichen<br />
Gründen ist beim Service public ein monopolistisches Angebot vielfach effizienter<br />
(z. B. Stromübertragung, Schienennetz) als ein privates Angebot im Wettbewerb.<br />
Dem Monopolunternehmen muss unternehmerische Autonomie gewährt werden.<br />
Über einen Leistungsauftrag werden das Angebot <strong>und</strong> die Transparenz über Kosten,<br />
Preise <strong>und</strong> Löhne bestimmt.<br />
4. Öffentliches Eigentum: Monopole gehören ins Eigentum der öffentlichen<br />
Hand.<br />
5. Keine Privatisierung. Die <strong>SP</strong> ist gegen die Privatisierung von Service public-Unternehmen,<br />
die sich im Eigentum der öffentlichen Hand befinden. Die <strong>Schweiz</strong> verfügt<br />
über vergleichsweise wenig öffentliche Unternehmungen.<br />
Personalbestand (CH) bei den grossen Unternehmen des Service public, gerechnet in Vollzeitstellen<br />
1998 2000 2002 2004<br />
SBB 30 037 28 116 27 632 26 548<br />
Post (Stammhaus) 41 475 42 884 41 955 38 972<br />
Swisscom 21 946 17 459 17 171 15 477<br />
Skyguide 848 919 1 088 1 159<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 19
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
9.<br />
Sparen beim Staat<br />
Für einen zukunftsorientierten Staatshaushalt<br />
Die Sparpolitik beeinträchtigt zunehmend die Handlungsfähigkeit des Staates. Der kurzsichtige<br />
Blick auf den jährlichen Budgetausgleich verhindert eine konjunkturgerechte<br />
Finanzpolitik, die mit Investitionen die Voraussetzungen für Wachstum schafft <strong>und</strong> in<br />
Krisenzeiten mit Ausgaben stabilisierend wirkt. Die <strong>SP</strong> bekennt sich zu einem langfristig<br />
ausgeglichenen Haushalt.<br />
Staatsquote <strong>und</strong> Verschuldung relativ tief<br />
Die Staatsquote der <strong>Schweiz</strong>, also der Anteil der staatlichen Ausgaben am Bruttoinlandprodukt<br />
BIP, ist unter anderem wegen des tiefen Wachstums <strong>und</strong> wegen der hohen Erwerbslosigkeit<br />
in den 1990er Jahren angestiegen. Im internationalen Vergleich ist sie aber<br />
immer noch ziemlich tief. Die Staatsverschuldung der <strong>Schweiz</strong> liegt wesentlich unter<br />
dem Durchschnitt der EU-Mitgliedsländer.<br />
Staatsausgaben: In die Zukunft investieren<br />
Staatsausgaben <strong>und</strong> -einnahmen sind langfristig ausgeglichen <strong>und</strong> konjunkturgerecht<br />
zu <strong>gestalten</strong>. Die Finanzpolitik steht im Dienste der Sachpolitik <strong>und</strong> nicht umgekehrt.<br />
Primär gilt es, die Staatsaufgaben zum Wohl der Bevölkerung bestmöglich zu erfüllen.<br />
Die wichtigsten Rahmenbedingungen für eine florierende <strong>Wirtschaft</strong> sind eine gute öffentliche<br />
Infrastruktur, ein effizienter Staat, der seine Dienstleistungen zuverlässig anbietet,<br />
eine hochstehende Aus-<strong>und</strong> Weiterbildung für alle <strong>und</strong> ein gut funktionierendes<br />
System der <strong>sozial</strong>en Sicherheit.<br />
Keine Steuergeschenke für Grossverdienender<br />
Eine kluge Finanzpolitik berücksichtigt die konjunkturelle Lage, stärkt bei schwacher<br />
Nachfrage die Kaufkraft der Bevölkerung <strong>und</strong> legt in einer dynamischen Konjunkturphase<br />
Reserven für die Zukunft beiseite. Dies trägt mehr zu einem langfristig ausgeglichenen<br />
Haushalt bei als Steuersenkungen für Wohlhabende, die nicht einmal zu einer höheren<br />
Investitionstätigkeit führen. Die <strong>Schweiz</strong>er <strong>Wirtschaft</strong> hat keinen Mangel an Kapital, sondern<br />
derzeit an privater Nachfrage. Schlimm für die wirtschaftliche Zukunft wären ein<br />
Abbau beim Bildungswesen <strong>und</strong> nicht ein Verzicht auf Steuersenkungen.<br />
Sparprogramme <strong>und</strong> Steuersenkungen jagen sich<br />
Die bürgerliche Parlamentsmehrheit will mit der Schuldenbremse die Staatstätigkeit<br />
über die Einnahmen steuern. Kurzfristige Sparübungen <strong>und</strong> der rasche Budgetausgleich<br />
dominieren die Diskussion. Eine langfristige Investitions-<strong>und</strong> eine antizyklische Finanzpolitik<br />
sind so nicht möglich. Zugleich verhindern Steuersenkungen für Reiche <strong>und</strong> Aktienbesitzende<br />
einen nachhaltigen Budgetausgleich.<br />
20 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Für einen starken Staat. Die <strong>SP</strong> bekennt sich zu einem starken Staat, der <strong>sozial</strong>e<br />
Gerechtigkeit sichert, den <strong>ökologisch</strong>en Umbau aktiv unterstützt <strong>und</strong> mit einem ges<strong>und</strong>en<br />
Finanzhaushalt die Voraussetzungen für ein langfristiges Wachstum schafft.<br />
2. Budgetausgleich bis 2010. Der Budgetausgleich beim B<strong>und</strong> soll bis 2010 erreicht<br />
sein. Voraussetzung dafür ist ein <strong>Wirtschaft</strong>swachstum von mindestens 1,5 Prozent.<br />
Ohne das kann das strukturelle Defizit des B<strong>und</strong>es nicht beseitigt werden.<br />
3. Mit Effizienzsteigerung Kosten sparen. Die <strong>SP</strong> will eine Finanzpolitik, die die<br />
Ausgaben durch klare Prioritäten steuert. Alle Aufgaben, Subventionen <strong>und</strong> Steuervergünstigungen<br />
sind periodisch auf ihre Zweckmässigkeit zu überprüfen. Ein effizienter<br />
Staat dient der Bevölkerung am besten. Nötig sind Reformen in der Verwaltung,<br />
im Submissionswesen <strong>und</strong> bei den Subventionen.<br />
4. Beim Sparen Prioritäten setzen. Kurzfristige Sparmassnahmen müssen in Einklang<br />
mit den politischen Prioritäten <strong>und</strong> den strategischen Reformprojekten stehen.<br />
Blosse Ausgabenverlagerungen auf Kantone <strong>und</strong> Gemeinden sind keine Lösungen.<br />
5. Gender-Budgeting flächendeckend. Finanzpolitische Massnahmen haben unterschiedliche<br />
Auswirkungen auf die Geschlechter. Dies ist bei den Budgets, Finanzplänen<br />
<strong>und</strong> Sparprogrammen sichtbar zu machen.<br />
Vergleich der Bruttoverschuldung gesamtstaatliche Schulden in Prozent des BIP<br />
In den Bruttoschulden ist das Vermögen nicht aufgerechnet.<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
<strong>Schweiz</strong> Ø EU-15 OECD<br />
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 21
WAS SAGT DIE<br />
ZU …<br />
10.<br />
STEUERN<br />
Mehr Steuergerechtigkeit<br />
Ein gerechtes <strong>und</strong> einfaches Steuersystem ist eine Voraussetzung für das Vertrauen der<br />
Menschen in den Staat. Wer Steuerschlupflöcher zulässt, untergräbt die Steuermoral. Alle<br />
Personen sollen nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden <strong>–</strong> unabhängig<br />
von Zivilstand, Haushaltsform, Nationalität, Wohnform, seien sie nun Arbeitgebende<br />
oder Lohnabhängige.<br />
Tiefere Steuern bringen nicht mehr Wachstum<br />
Steuern sind der Preis für staatliche Leistungen. Tiefe Steuer-<strong>und</strong> Sozialabgaben führen<br />
nicht automatisch zu höherem <strong>Wirtschaft</strong>swachstum. Entscheidend ist die Verwendung<br />
der Steuereinnahmen. Europäische Länder mit einer höheren Steuerbelastung erreichten<br />
in den Jahren 1992<strong>–</strong>2002 ein höheres <strong>Wirtschaft</strong>swachstum (Dänemark, Finnland,<br />
Österreich). Die <strong>Schweiz</strong> hat eine vergleichsweise tiefe Steuerbelastung. Nur gerade Australien,<br />
Japan, die USA <strong>und</strong> Irland hatten 2003 tiefere Fiskalquoten. Die Unternehmen<br />
zahlen im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich wenig Steuern.<br />
Mehr Gerechtigkeit bringt tiefere Steuern für alle<br />
Ein gerechtes Steuersystem muss so ausgestaltet sein, dass alle Steuersubjekte <strong>und</strong> alle<br />
Einkommens-<strong>und</strong> Vermögensteile der Besteuerung unterliegen. Löhne, Gewinne, Zins<strong>und</strong><br />
Kapitaleinkommen, Erträge aus Immobilien, Erbanteile müssen vollständig erfasst<br />
werden. Je umfassender die Bemessungsgr<strong>und</strong>lage ist, desto tiefer können die Steuersätze<br />
sein. Mehr Steuergerechtigkeit führt tendenziell zu tieferen Steuern für alle.<br />
Keine Privilegien für Reiche <strong>und</strong> Grossverdiener<br />
In der <strong>Schweiz</strong> werden die Einkommen der Lohnabhängigen überproportional besteuert.<br />
Zwischen den Arbeitnehmenden gibt es krasse Ungerechtigkeiten. Wer <strong>–</strong> wie viele<br />
Spitzenmanager <strong>–</strong> einen Teil des Lohnes in Form von Aktien <strong>und</strong> Optionen erhält, wird<br />
systematisch bevorzugt. Kleinsparerinnen <strong>und</strong> Kleinsparer müssen die Erträge auf ihren<br />
Sparheften voll versteuern. Private Kapitalgewinne entgehen der Besteuerung. Die<br />
Abschaffung der Erbschaftssteuer für die direkten Nachkommen schuf ein neues Steuerprivileg<br />
für Vermögende. Der Verzicht auf Steuereinnahmen wird vielfach mit höheren<br />
Gebühren <strong>und</strong> Tarifen kompensiert. Gebühren belasten die unteren <strong>und</strong> mittleren Einkommen<br />
am stärksten.<br />
Stossende kantonale Unterschiede<br />
Die kantonalen Unterschiede in der Steuerbelastung sind hoch.Wer in Delsberg (JU) lebt,<br />
zahlt bei gleichem Einkommen <strong>und</strong> Vermögen viermal mehr Steuern als Steuerpflichtige<br />
von Freienbach (SZ). Auch innerhalb eines Kantons variiert die Steuerlast bis zu einem<br />
Drittel. Der angeheizte Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen schadet allen.<br />
22 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig
DIE<br />
FORDERT…<br />
1. Einführung der Individualbesteuerung. Eine zivilstandsunabhängige Besteuerung<br />
hebt die Ungleichbehandlung von Ehe-<strong>und</strong> Konkubinatspaaren auf. Das begünstigt<br />
zugleich eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbstätigkeit.<br />
2. Einschränkung des Steuerwettbewerbs. Der Wettbewerb zwischen den Kantonen<br />
muss auf ein erträgliches Mass eingeschränkt werden. Der schädliche Steuervermeidungstourismus,<br />
den sich nur vermögende, mobile Personen leisten können,<br />
soll sich nicht mehr lohnen. Die <strong>SP</strong> fordert deshalb eine materielle Steuerharmonisierung<br />
zwischen den Kantonen.<br />
3. Alle Einkommensteile besteuern. Jede Einkommensart ist zu erfassen <strong>und</strong><br />
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu besteuern. Die<br />
tiefere Besteuerung von Einkommen aus Aktienbesitz kommt nicht in Frage. Mit der<br />
Einführung einer Erbschafts-<strong>und</strong> Schenkungssteuer auf B<strong>und</strong>esebene kann die Steuergerechtigkeit<br />
verstärkt werden.<br />
4. Steuerschlupflöcher stopfen. Die Beseitigung von Steuerschlupflöchern kann<br />
neue Einnahmen generieren.<br />
5. Umsetzung einer <strong>ökologisch</strong>en Steuerreform. Es braucht <strong>–</strong> neben der CO 2<br />
-<br />
Abgabe <strong>–</strong> einen neuen Anlauf in Sachen <strong>ökologisch</strong>er Steuerreform. Die Lenkungsabgaben<br />
müssen staatsquotenneutral ausgestaltet sein.<br />
6. Steuer-Bschiss bleibt Steuer-Bschiss. Die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung<br />
<strong>und</strong> Steuerbetrug muss beseitigt werden. Steuerhinterziehung soll<br />
gleich bekämpft werden können wie Steuerbetrug.<br />
Internationale Steuerkonkurrenz: Stand der Steuerbelastung in %<br />
effektive Steuerbelastung: hoch qualifizierte Arbeitskräfte<br />
60<br />
Helsinki<br />
55<br />
Stockholm<br />
Cremona<br />
50<br />
Budapest<br />
Doubs<br />
45<br />
Prag<br />
Dublin<br />
Wien<br />
40<br />
Boston<br />
Wallis Genf<br />
London<br />
35<br />
Zürich<br />
30<br />
Zug Nidwalden<br />
25<br />
20<br />
10 15 20 25 30 35 40<br />
effektive Steuerbelastung: Unternehmen<br />
Quelle: BAK Basel Economics 2004<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> 23
OSITIONEN<br />
Herausgeberin<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Spitalgasse 34<br />
3001 Bern<br />
Redaktion<br />
Hans-Jürg Fehr, Nicolas Galladé, Reto Gamma, Susanne Leutenegger Oberholzer,<br />
Matthias Manz, Jean-Noël Rey<br />
Produktion<br />
Atelier Kurt Bläuer<br />
Umschlagbild<br />
Fotoagentur ex-press<br />
2. überarbeitete Auflage<br />
November 2006<br />
24 <strong>Wirtschaft</strong>spolitik | kurz&bündig