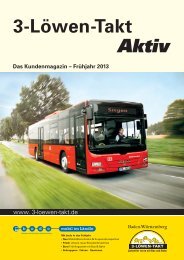Oberschwäbische Seitenblicke - Bodo
Oberschwäbische Seitenblicke - Bodo
Oberschwäbische Seitenblicke - Bodo
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Oberschwäbische</strong><br />
<strong>Seitenblicke</strong><br />
Unterwegs mit der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
und dem Radexpress Oberschwaben<br />
Mit freundlicher Unterstützung von
Streckenabschnitte Württemberg-Allgäu-Bahn und Radexpress Oberschwaben<br />
Strecke Aulendorf – Hergatz<br />
Verkehrsdrehscheibe Aulendorf<br />
Wo Allgäu und Oberschwaben sich treffen 6<br />
Bad Waldsee<br />
müsste eigentlich „Bad Waldseen“ heißen 10<br />
Hergatz – Es gibt Gemeinsamkeiten mit<br />
Aulendorf! Aber es gibt auch Unterschiede ... 36<br />
Strecke Leutkirch – Memmingen<br />
Leutkirch – Von den „Freien Leut<br />
uf der Lütkircher Hayd“ 42<br />
Hoßkirch-Königsegg – Eine Zwergstadt<br />
ohne Zwerge, dafür voller Spuren der Eiszeit! 62<br />
Ostrach – „Dreiländergemeinde“.<br />
Und Stätte einer großen Schlacht 64<br />
(Fast) eine Insel, aber wo ist der See? 66<br />
Alttann – Letzte Wildnisse: Durch Tobel<br />
zertobelte Tobel 14<br />
Wolfegg – Von Holz, Wald und ... Räubern! 16<br />
Von Seen und Weihern. Und warum Natur<br />
auf den zweiten Blick oft gar keine ist ... 20<br />
Leben unterm „Krummstab“<br />
oder „Wie sie Einödinen gemachet ...“ 22<br />
Kißlegg – Zwei Schlösser, zwei Bahnstrecken,<br />
zwei Ortsnamen 24<br />
Von Seen und Mooren.<br />
Oder: „Das Allgäu im Kleinen“ 28<br />
Ein Keilbahnhof weist den Weg! 44<br />
Noblesse oblige – vom oberschwäbischen<br />
Adel und seiner Bedeutung 46<br />
Aichstetten – Blutsberg: Nomen est Omen? 48<br />
Marstetten-Aitrach – Gold glänzt.<br />
Aber nicht immer ... 50<br />
Tannheim – Wasser ist eine große Kraft.<br />
Vor allem, wenn es aus den Alpen kommt! 52<br />
Memmingen – Stadt der Menschenrechte? 54<br />
Strecke Altshausen – Pfullendorf<br />
Was Pfullendorf mit Neapel verbindet 68<br />
Strecke Roßberg – Bad Wurzach<br />
Die Roßberger Steige.<br />
Und das Wahrzeichen der Allgäubahn ... 74<br />
Vom „oberschwäbischen Gold“ 76<br />
Das Wurzacher Ried – Größtes Hochmoorgebiet<br />
Mitteleuropas! 78<br />
Torf: Gut zum Heizen und zum Baden.<br />
Aber nicht nur ... 80<br />
Bad Wurzach – (Moor-) baden im Barock 82<br />
Von Arguna, der Silbernen und dem Millionenjoch 30<br />
Wangen – Von Seelen. Und Käse. Und einer Grenze 32<br />
2<br />
Altshausen – „Mein Name? Württemberg.<br />
Von Württemberg.“ 60<br />
Geschichte der<br />
Württemberg-Allgäu-Bahn 86
WÜrttemberg-Allgäu-bAhn<br />
rAdexpress OberschWAben<br />
Mit diesen „<strong>Seitenblicke</strong>n“ laden wir Sie ein, die Landschaft Oberschwabens bewusst zu „erfahren“.<br />
Die „<strong>Seitenblicke</strong>“ begleiten Sie auf Ihrer Fahrt und erzählen Wissenswertes und Anekdotisches<br />
über die Menschen, über Landschaft, Natur, Kultur, Geschichte, Wirtschaft und auch die<br />
Eisenbahn selbst. Ihre <strong>Seitenblicke</strong> aus dem Zugfenster lassen Sie teilhaben an der lebendigen<br />
Geschichte und Gegenwart Oberschwabens.<br />
Ich danke den vielen Beteiligten für ihr Engagement, ganz besonders Herrn Dr. Andreas Megerle<br />
von der Uni Karlsruhe für die profunde Textrecherche und Herrn Thomas Scherer für den eisenbahnhistorischen<br />
Beitrag.<br />
Die finanzielle Förderung durch PLENUM hat eine Realisierung überhaupt erst möglich gemacht,<br />
auch dafür herzlichen Dank.<br />
Steigen Sie ein – und entdecken Sie die wunderbare Welt Oberschwabens.<br />
Jürgen Löffler<br />
Geschäftsführer Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund<br />
Seitenblick<br />
Sehenswürdigkeiten, die vom Zug aus zu sehen sind<br />
Hintergrundinformation<br />
Landschaftliche und kulturelle Besonderheiten<br />
Touren<br />
Vorschläge für Wanderungen, Radtouren oder Stadttouren<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Rückblicke auf die Geschichte der Eisenbahn<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Auswahl besonderer Sehenswürdigkeiten<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
Auswahl von Gaststätten entlang der Strecke<br />
1 Station<br />
Angabe des jeweiligen Haltepunktes<br />
3
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
VON AULENDORF NACH HERGATZ<br />
Einmal Eiszeit und zurück: Mit der Wurstbahn ins Allgäu. Wurstbahn? Keine Angst!<br />
Es erwarten Sie keine Wurstverkäufer im Zug! Dieser Spitzname für die Allgäubahn<br />
kommt von ihrer „verwurschtelten“, sprich kurvenreichen Linienführung.<br />
Eine Anpassung an die Besonderheiten der Eiszeitlandschaft.<br />
Denn trotz ihrer Schönheit hat diese manchmal so<br />
ihre Tücken ...<br />
Obwohl diese Beschreibung sinnvollerweise erst ab dem<br />
Eisenbahnknotenpunkt Aulendorf beginnt: Der eigentliche<br />
Anfangspunkt der von 1868 bis 1874 erbauten Allgäubahn<br />
ist Herbertingen, noch immer kenntlich an der Bahnkilometrierung,<br />
die bis heute hier bei „0“ startet.<br />
1870 drängte das Militär erfolgreich auf die Schließung<br />
der letzten Schienenlücken zwischen den südbayerischen<br />
Garnisonen und dem südlichen Elsaß. Als die Strecke Wangen-Hergatz<br />
1890 an die bereits bestehende Württemberg-<br />
Allgäu-Bahn angeschlossen wurde, ahnte man noch nicht,<br />
welche Bedeutung diese Verbindung über 100 Jahre später<br />
haben wird: Ein großer Teil des Fernverkehrs zwischen<br />
München bzw. Augsburg und dem Bodenseegebiet bis zur<br />
Schweiz rollt heute durch das württembergische Allgäu.<br />
Die Fahrt mit der Württemberg-Allgäu-Bahn ist ein Genuss<br />
und bietet vielfältige Ausblicke. Bei schönem Wetter zeigen<br />
sich die schneebedeckten Berge der Alpen. Aber auch sonst<br />
lockt die Fahrt durch die hügelige Landschaft mit vielen Besonderheiten.<br />
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr<br />
über den Reiz dieser außergewöhnlichen Bahnstrecke.<br />
Seitenblick aus der Perspektive einer Allgäukuh bei Bärenweiler<br />
5
Verkehrsdrehscheibe Aulendorf<br />
Wo Allgäu und Oberschwaben sich treffen<br />
© Carsten Przygoda/Pixelio<br />
6<br />
Die umfangreichen Verkehrsanlagen um den Bahnhof von<br />
Aulendorf herum beweisen: Aulendorf, hier das Schloss, ist<br />
ein wichtiger Knoten, nicht nur für die Eisenbahn. Doch warum<br />
kreuzen sich Bahnen und Straßen ausgerechnet hier?
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Aulendorf 1<br />
Blühende Residenzstadt im Schussental<br />
Reise in die Vergangenheit. Wir befinden uns im Jahr<br />
20.000 vor unserer Zeitrechnung. Kraftvoll hat der Rheingletscher<br />
das spätere Schussental ausgeschürft. Das dabei<br />
gewonnene Gesteinsmaterial schiebt er als Moräne vor sich<br />
her und lagert es als Wall an seiner Stirn ab. Nach seinem<br />
Zurückweichen wird diese girlandenähnliche Endmoräne<br />
jedoch an manchen Stellen von Flüssen durchbrochen. Ein<br />
Beispiel für ein solches „Gletschertor“ ist das Durchbruchstal<br />
der Schussen südlich von Aulendorf, die spätere Leitlinie<br />
für die Südbahn.<br />
Nicht nur die Eiszeittopographie, auch die Funktion als<br />
„kleine Residenzstadt“ einer der oberschwäbischen Adelsstämme,<br />
der Grafen zu Königsegg-Aulendorf, hat zur Entstehung<br />
als Verkehrsdrehscheibe beigetragen. Vor allem<br />
aber die Lage an wichtigen Verbindungsstraßen zwischen<br />
den oberschwäbischen Städten. Nach der Eröffnung der<br />
Bahnlinie Biberach – Aulendorf – Ravensburg (1849, Lückenschluss<br />
der Südbahn nach Ulm 1850), einem Teil der<br />
„schwäbischen Eisenbahn“, später nach dem Bau der Zollern-<br />
und Allgäubahn wurde die Stadt Eisenbahnknotenpunkt.<br />
Bis heute wird dies an der Größe des Bahnhofsareals<br />
und der nahe gelegenen Eisenbahnersiedlung sichtbar.<br />
Wie stark die Eisenbahn Aulendorf geprägt hat, zeigt die<br />
stattliche Bahnhofstraße, die mit ihren dreigeschossigen<br />
verschindelten Bahnhäusern dem beschaulichem Dorf zu<br />
Beginn des 20. Jahrhunderts ein städtisches Gepräge gab.<br />
Und auch die ersten „Lutherischen“, gemeint sind evan-<br />
Blick auf den Bahnhof Aulendorf<br />
gelische Gläubige, im ursprünglich katholischen Milieu der<br />
Stadt waren – Eisenbahnarbeiter.<br />
Unter den Betriebsgebäuden der Bahn finden sich archihistorische<br />
Holzhäuser, gebaut aus einem der wichtigsten<br />
Rohstoffe der Region (vgl. Station 4). Über allen Gebäuden<br />
thront das stattliche Empfangsgebäude, das 1868 eingeweiht<br />
wurde. Im württembergischen Landhausstil errichtet,<br />
zeigt es mit seiner starken Gliederung der Baumassen,<br />
seinen Vorsprüngen, wechselnden Gebäudebreiten und<br />
Auskragungen eine Lockerheit, die ganz im Gegensatz<br />
steht zum massiven Kubismus der bayerischen Staatsbahnen.<br />
Auch beim Empfangsgebäude dominieren Baustoffe<br />
aus dem „Ländle“: Die Ziegel sind aus eiszeitlichem Ton<br />
gebrannt, der zwischenzeitlich unter Putz verschwundene<br />
Muschelsandstein stammt aus Sießen bei Bad Saulgau.<br />
Heute sichtbar ist leider nur noch der grünliche Rorschacher<br />
Sandstein und das nur an Stellen mit abblätterndem Putz.<br />
Regionales Holz findet sich im Fachwerk, in Verschindelungen<br />
aber auch in Bretterverkleidungen. Diese Elemente<br />
tragen zu einer wichtigen Funktion des Bahnhofs Aulendorf<br />
bei, die ausnahmsweise nichts mit dem Verkehr zu tun hat:<br />
Für die Einheimischen ist es ein wichtiges Stück Heimat.<br />
Seitenblick<br />
Hinter dem Abzweig führt die Bahntrasse durch das Moorgebiet<br />
Tann. Fluch und Segen für die Bahn: So musste der<br />
Bahndamm beim Bau auf geflochtene Schachtruten geschüttet<br />
werden, von denen 11.000 Stück spurlos im Moor<br />
versanken. Gleichzeitig lieferte das Moor jedoch einen für<br />
das kohlearme Württemberg wichtigen Rohstoff zum Betreiben<br />
der Dampfloks: Torf. Bei Bahn-km 32,98 sind noch<br />
Geländespuren der ehemaligen Torfverladestelle Herdtle<br />
zu sehen. Von dort aus kam der Torf in riesige hölzerne<br />
Torfschuppen am Bahnhof von Aulendorf. Warum Torf so<br />
wichtig war und was davon heute noch zu erleben ist: Das<br />
erfahren Sie an den Stationen der Bad Wurzach Bahn.<br />
7
Aulendorfer Hexeneck<br />
Schloss Aulendorf<br />
Aulendorf<br />
In der jungen Kurstadt Aulendorf ist eine<br />
harmonische Verbindung von historischen<br />
Sehenswürdigkeiten und modernen<br />
Kur- und Freizeiteinrichtungen gelungen. Das Kurzentrum<br />
liegt im Schlosspark und ist vom Bahnhof aus<br />
in fünf Gehminuten erreichbar. Zahlreiche Straßencafes<br />
laden ein zu einem gemütlichen Mittag oder Spaziergang<br />
durch die großzügige Parkanlage.<br />
Gästeinformation Aulendorf, im Schloss:<br />
Hauptstraße 35, 88326 Aulendorf<br />
Tel. 07525/93-4203 Fax. 07525/93-4210<br />
info@aulendorf.de | www.aulendorf.de<br />
8<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Schlossmuseum Aulendorf – zeigt Kunst des Klassizismus<br />
und altes Spielzeug vom Beginn des 18. Jahrhunderts<br />
bis zur Gegenwart<br />
• Schwaben-Therme – einzigartig ist die große Glaskuppel,<br />
die sich im Sommer bis zur Hälfte öffnen lässt<br />
• Bürgermuseum im Alten Kino – präsentiert einen kurzweiligen<br />
Rundgang durch die Stadtgeschichte<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Gasthaus zum Rad mit Ritteressen im historischen<br />
Ritterkeller, Radgasse 1<br />
• Bistro Kaktus, Hauptstraße 46<br />
• Wirtshaus Alte Apotheke, Hauptstraße 41<br />
• Eiscafe am Schloss, Hauptstraße 26<br />
• Gasthaus Jägerhäusle, Ebisweiler 5<br />
Schwaben-Therme
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Aulendorf 1<br />
Empfangsgebäude Bahnhof Aulendorf<br />
Tour 1<br />
Vom Bahnhof aus geht es links die Poststraße entlang<br />
der Vorfahrtstraße bis zur Ampelkreuzung. Dort links<br />
über die Brücke Richtung Reute auf dem Radweg<br />
entlang der L285, durch die Unterführung Richtung<br />
Eisenfurt.<br />
Dann geht es links den Berg hoch und 1 km rechts in<br />
die Tannenweilerstraße, die sich durch einen Linksknick<br />
fortsetzt. Dieser folgen wir immer geradeaus durch<br />
Untermöllenbronn bis nach Reute. In Reute folgen wir<br />
dem markierten Strassenradweg auf der L 285, am<br />
Kloster vorbei in Richtung Bad Waldsee. Am Ortsende<br />
kommen wir auf einen Radweg parallel zur K7941, welcher<br />
direkt nach Bad Waldsee führt.<br />
9
Bad Waldsee<br />
müsste eigentlich „Bad Waldseen“ heißen,<br />
denn schließlich gibt es hier gleich zwei davon. Doch was<br />
hat das mit der Eisenbahn zu tun? Und was mit der Eiszeit?<br />
10
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Bad Waldsee 2<br />
Blick auf den Stadtsee<br />
Waldseer Findlinge und Heilkräfte<br />
Ob Bad Waldsee wirklich seinen Namen von seinen Seen<br />
hat, ist umstritten. Sicher ist dagegen, dass beide, Schlossund<br />
Stadtsee, Gletscheraktivitäten der letzten Eiszeit zu<br />
verdanken sind. Gleich vor dem Bahnhof steht schon der<br />
erste Zeuge dieser vor ungefähr 12.000 Jahren zu Ende<br />
gegangenen Klimaschwankung: ein tonnenschwerer Findling,<br />
auch Erratiker genannt. Er hat eine lange Reise hinter<br />
sich, von den Alpen bis hierher. Zuerst sprengte ihn in seiner<br />
Heimat der Frostwechsel aus seinem Gesteinsverband heraus.<br />
Dann fiel er auf den gerade wachsenden Gletscher, von<br />
dem er viele Kilometer weit ins Vorland transportiert und<br />
danach in der Nähe des heutigen Bad Waldseer Bahnhofs<br />
als Moräne abgelagert wurde. Der zum Ende der Eiszeit<br />
hin abschmelzende Gletscher überdeckte ihn schließlich<br />
mit Schutt. Erst mehr als zehntausend Jahre später wurde<br />
er endlich aus seinem „Geröll-Gefängnis“ befreit: Von<br />
Bauarbeitern der Allgäubahn. Der Waldseer Findling ist<br />
nicht der einzige seiner Art. Ein anderer Koloss steht vor<br />
dem Bahnhof in Roßberg. Dieser hat sogar eine ganz besondere<br />
Bedeutung (vgl. Station 18). Das Ausgraben, der<br />
Transport und das Aufstellen dieser eiszeitlichen Ungetüme<br />
vor den jeweiligen Bahnhöfen war nicht die einzige<br />
Herausforderung beim Eisenbahnbau. Die kleinräumig<br />
wechselnde eiszeitliche Hügellandschaft mit Mooren und<br />
Seen machte die Trassenführung besonders schwierig. Immerhin<br />
führte die als Lösung gewählte Hochlage der Bahn<br />
dazu, dass neue Aussichtspunkte entstanden. Der Waldseer<br />
Bahnhof habe die „schönste Aussicht ins Schussental und<br />
den Stadtsee“ – so schwärmte einst der für den württembergischen<br />
Eisenbahnausbau zuständige Verkehrsminister<br />
Friedrich Karl Gottlob Freiherr Varnbüler von und zu Hemmingen<br />
sogar schon vor dem Bahnbau auf der Weinhalde.<br />
Waldsee-Therme<br />
Wie so manches andere Bad war auch das erste „Touristenbad“<br />
in Bad Waldsee ein Schwefelbad. Bereits in der frühen<br />
Neuzeit suchten und fanden „Gesundheitstouristen“ hier<br />
Linderung gegen ihr „Gliederreißen“. Seit 1956 wird diese<br />
Linderung jedoch von einem anderen Landschaftsschatz<br />
geboten: Vom Torf der hier zahlreichen Moore, das nicht<br />
zu Unrecht heute als „schwarzes Gold der Reha-Medizin“<br />
bezeichnet wird. Vor allem seine Huminsäuren sind es,<br />
die Entzündungen an Gelenken hemmen. Die Moore sind<br />
hier übrigens nichts anderes als verlandete Seen. Und<br />
die wiederum sind dem Gletscher der letzten Eiszeit und<br />
seinen Aktivitäten zu verdanken. Natürlich stammt dieser<br />
Badetorf heute nur aus zerstörten, naturfernen Mooren<br />
wie dem Steinacher Ried bei Bad Waldsee. Die naturnahen<br />
Feuchtgebiete stehen alle unter Schutz. Warum das so ist?<br />
Darüber erfahren Sie mehr an den Stationen des Radexpress<br />
Oberschwaben (KBS 752).<br />
Doppelter Kirchturm St. Peter der Stiftskirche<br />
11
Stiftskirche St. Peter<br />
Hochseilgarten Tannenbühl<br />
Wallfahrtskapelle Volkertshaus<br />
Bad Waldsee<br />
Malerisch liegt sie zwischen zwei Naturseen<br />
– die knapp 20.000 Einwohner zählende<br />
Stadt Bad Waldsee. In der historischen Innenstadt<br />
thront das spätgotische Rathaus. Gegenüber<br />
stehen die barockisierte Stiftskirche und das ehemalige<br />
Kornhaus. Ein Bummel durch die Altstadt ist spannend<br />
und geruhsam zugleich. Restaurants und alteingesessene<br />
Traditionshäuser mit schwäbischen Spezialitäten<br />
laden zum Verweilen und Genießen ein.<br />
Tourist-Information Bad Waldsee<br />
Ravensburger Straße 3, 88339 Bad Waldsee<br />
Tel.: 07524/94 13-42<br />
info@bad-waldsee.de, www.bad-waldsee.de<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Die frühere Augustinerchorherrenstiftskirche St. Peter –<br />
ihre markanten Doppeltürme grüßen von weither und<br />
spiegeln sich im Stadtsee<br />
• Erwin-Hymer-Museum – das „Museum des mobilen<br />
Reisens“ in Bad Waldsee Nord<br />
• Der Stadtsee – sogar per Tretboot erforschbar<br />
• Das Stadtseemuseum – hier werden Tauchschätze aus<br />
dem Stadtsee ausgestellt<br />
• Hochseilgarten im Tannenbühl – hier erwarten Sie 9<br />
Parcours mit 170 verschiedenen Übungen<br />
• Strand- und Freibad inmitten der Stadt – zweifelsohne<br />
eines der schönsten der Region<br />
• Waldseetherme – die heißeste Quelle in ganz Oberschwaben<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Grüner Baum, Hauptstraße 34<br />
• Marktwirtschaft Hirsch, Hauptstraße 37<br />
• Scala Café & Restaurant am Stadtsee,<br />
Wurzacher Straße 55<br />
• Weinstube zum Hasen, Ravensburger Straße 12<br />
• Bar Lounge Restaurant Amadeus, Ravensburgerstr. 23<br />
• Gasthof Sonne, Elisabeth-Achler-Str. 23<br />
• Café am Entenmoos, Entenmoos 19<br />
• Galerie, Herrgottsgasse 4<br />
• Die Möhre, Wurzacherstraße 12<br />
(vegetarische Küche)<br />
12
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Bad Waldsee 2<br />
Grabener Höhe<br />
2<br />
Tour 2<br />
Vom Bahnhof aus radeln wir die Bahnhofstraße entlang<br />
und biegen nach rechts in die Schützenstraße ab. Dann<br />
nehmen wir die linke Abzweigung in den Hopfenweilerweg<br />
und folgen diesem 5 km bis nach Osterhofen.<br />
Dort biegen wir erst rechts auf die Eggmannsrieder<br />
Straße, dann die nächste Möglichkeit rechts in die<br />
Mahlgasse und dann nochmals rechts auf die Grabener<br />
Straße. Dieser folgen wir bis zur Grabener Höhe. Von<br />
dort hat man bei schönem Wetter eine wunderbare<br />
Fernsicht. Wir radeln weiter Richtung Süden bis wir auf<br />
die Wengener Straße kommen. Dort biegen wir links in<br />
die Dorfstraße ab und folgen dieser bis zur nächsten<br />
großen Kreuzung bei der wir uns links halten und der<br />
Ravensburgerstraße bis nach Bad Wurzach folgen.<br />
KBS 752<br />
18<br />
13
Letzte Wildnisse:<br />
durch Tobel zertobelte Tobel<br />
Tobel sind eine der Markenzeichen der Landschaft<br />
dieser Region. Doch was genau sind<br />
Tobel? Und warum sind sie so wertvoll?<br />
14 © Daniel Litzinger/Pixelio
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Alttann 3<br />
Erfrischender Höllenspaziergang<br />
Flurnamen wie „Höll“ zeigen: Für unsere Vorfahren waren<br />
sie die Hölle, die meist dunklen, tiefen und geheimnisvollen<br />
Waldschluchten, die im Alemannischen „Tobel“ genannt<br />
werden. Und bewohnt von Erdgeistern, Hexen und Teufeln.<br />
Angeblich verfiel jeder, der in den Tobeln um Alttann<br />
dem Teufel begegnete, dem Bösen und nahm des Teufels<br />
Gestalt an. Immerhin waren die schwer zugänglichen Tobel<br />
bis in das 19. Jahrhundert hinein Rückzugsgebiete für<br />
Räuber wie dem „Schwarzen Veri“ (vgl. Station 4). Heute<br />
sind sie „Wildnisse im Kleinen“ und Inseln der Ruhe, nur an<br />
wenigen Stellen durch Siedlungen, Straßen oder intensive<br />
Nutzungen gestört.<br />
Erdgeschichte“, aber auch dynamische Lebensräume für<br />
besondere Tiere und Pflanzen. Hohe Luftfeuchte, frische Mineralien<br />
und im Winter milde Temperaturen lassen Orchideen<br />
wachsen, aber auch Eiszeitrelikte aus den Alpen finden<br />
hier ihre Außenposten. Das charakteristische Mosaik aus<br />
verschiedenen Lebensräumen auf kleinem Raum machen<br />
jeden Tobel zu einem einzigartigen Landschaftselement.<br />
Entlang der großen, tiefer ausgeschürften Gletscherzungenbecken<br />
wie dem Schussen- oder dem Argental häufen<br />
sie sich und bilden naturnahe Vernetzungsadern in der<br />
ansonsten intensiv genutzten Kulturlandschaft. Gerade im<br />
Zuge der Klimaänderung werden Tobel an Bedeutung gewinnen,<br />
da sie für viele Pflanzen und Tiere Rückzugsmöglichkeiten<br />
bieten. Nur für Pflanzen und Tiere? Wer einmal<br />
eine solche Naturoase durchstreift hat, weiß, wie wichtig<br />
Tobel auch für den Menschen sein können ...<br />
Übrigens:<br />
Die Höllteufel gibt es wirklich. Allerdings nur zur „fünften<br />
Jahreszeit“. Dafür aber live zu erleben auf den Fasnetsumzügen<br />
in der Region.<br />
Tobel sind wahre „Jungspunde“, denn sie entstanden erst<br />
seit Ende der letzten Eiszeit: Zuerst stürzten die Flüsse und<br />
Bäche als Wasserfälle in die von den abschmelzenden Gletscherzungen<br />
frei gegebenen Tälern. Dann begannen sie<br />
sich einzuschneiden. Relativ rasch und recht tief. Zuerst in<br />
die lockeren Kies- und Moräneablagerungen der Eiszeit,<br />
stellenweise auch in darunter liegende Sande und Tone.<br />
Diese Ablagerungen sind älter als zwei Millionen Jahre und<br />
stammen aus dem Zeitalter des Tertiärs. Da sie oft ziemlich<br />
wasserundurchlässig sind, entspringen an der Schichtgrenze<br />
zwischen Eiszeit- und Tertiärablagerungen bevorzugt<br />
Quellen. Die dauerhafte Feuchtigkeit wirkt wie Schmierseife<br />
und bringt die darüber liegenden Ablagerungen an<br />
manchen Stellen ins Rutschen. So entstehen „Fenster in die<br />
Die Wolfegger-Ach bei der Löffelmühle, © Daniel Litzinger/Pixelio<br />
15
Von Holz, Wald und ... Räubern!<br />
Der bei Wolfegg beginnende Altdorfer Wald ist das größte zusammenhängende<br />
Waldgebiet Oberschwabens. Und nicht nur wegen<br />
seiner Tobel interessant. Doch warum gibt es hier überhaupt<br />
Wald? © Axel Kleinknecht/Pixelio<br />
16
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wolfegg 4<br />
Im Wald, da sind die Räuber ...<br />
Es ist Freitag, der 16. April 1819. Vorsichtig nähern sich<br />
die Räuber der einsam in der Nähe von Ostrach gelegenen<br />
Laubbachmühle. Zum wiederholten Male dringen sie in die<br />
Mühle ein. Ihr Ziel: der Raub von Lebensmitteln. Doch gerade<br />
als sie die Bewohner fesseln wollen, schlägt ein Bandenmitglied<br />
Alarm: aus Richtung Königseggwald nähern sich<br />
bewaffnete Forstknechte! Blitzschnell fliehen die Räuber,<br />
werden jedoch vom Forstpraktikanten Langen verfolgt. Er<br />
entdeckt sie schließlich mitten im Wald, wie sie gerade<br />
hungrig ihre gestohlenen Lebensmittel hinunterschlingen.<br />
Langen wartet, bis Verstärkung nachgerückt ist. Doch erst<br />
nach mehreren dramatischen Handgemengen können die<br />
Räuber schließlich überwältigt werden. Für die Verfolger<br />
ein großer Fang. Schließlich ist ihnen der „Schwarze Vere“<br />
mitsamt seiner Bande ins Netz gegangen! (vgl. Station 16)<br />
Moorgebiete, aber auch Waldgebiete wie der Altdorfer<br />
Wald, waren die bevorzugten Rückzugsgebiete dieser bis<br />
heute in Oberschwaben weithin bekannten Räuberbande.<br />
Wie es heißt, verschonten sie Bauern und Jungfrauen. Doch<br />
nicht Romantik, sondern Hungersnöte und Armut sind die<br />
Erklärungen für das häufige Auftreten von Räubern in der<br />
Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Heute ist der Altdorfer<br />
Wald zwar frei von Räuberbanden, doch noch immer beeindrucken<br />
seine Tobel (vgl. Station 3), Moore und Stillgewässer.<br />
Doch Vorsicht: Ein vermeintlicher See ist oft gar kein<br />
See, ein vermeintliches Moor manchmal keine ungestörte<br />
Natur! Und selbst den Bächen ist im Altdorfer Wald nicht<br />
zu trauen. Denn allzu oft entpuppt sich ein auf den ersten<br />
Blick vermeintlich naturnaher Bach als ... jahrhunderte alter<br />
Kanal. Ein Musterbeispiel dafür ist der „Stille Bach“.<br />
Schon der Name weist auf seine Besonderheit hin, fließt<br />
er doch aufgrund seines gleichmäßigen, sanften Gefälles<br />
nahezu geräuschlos. Und das auch noch am Hang? In der<br />
Tat: Kein Bach, sondern ein zu den ältesten Kanalsystemen<br />
Süddeutschlands gehörendes Fließgewässer, welches im<br />
Altdorfer Wald ein rund 25 km 2 großes Gewässernetz aus<br />
zehn Kanälen sowie etwa 20 Weihern vernetzt. Angelegt<br />
wurde dieses System von Benediktinern des Klosters Weingarten,<br />
die damit eine fast ganzjährig konstante Wassermenge<br />
zum Betrieb ihrer Mühlen, Tränken und Brunnen erreichen<br />
konnten. Eine ingenieurtechnische Meisterleistung,<br />
die bereits im 11. Jahrhundert begonnen wurde. Während<br />
für den Rohstoff Wasser keine Bahn benötigt wurde, sah<br />
das für den Rohstoff Holz ganz anders aus: Zahlreiche Sägewerke<br />
sorgten in der Vergangenheit für die Nachfrage<br />
nach Transportkapazitäten auf der Allgäubahn. Während<br />
früher u. a. Hopfenstangen hoch im Kurs standen, aber<br />
auch die Zellstoffindustrie den Rohstoff nutzte, sind es heute<br />
vielfältige Spezialprodukte bis hin zu Holzhackschnitzeln<br />
für eine moderne Energieversorgung.<br />
Doch warum gibt es den Altdorfer Wald hier überhaupt?<br />
Von der Luft aus verrät seine markante, längsgerichtete<br />
Form bereits einen engen Zusammenhang mit seinem<br />
Untergrund: eine Moräne aus der Eiszeit. Diese „innere<br />
Jungendmoräne“ bildet den zweiten Endmoränenkranz<br />
aus der letzten Eiszeit. Aufgrund ihrer Erhebung bildet<br />
sie oft trockene und nährstoffärmere Standorte, die landwirtschaftlich<br />
nicht so interessant sind wie die nährstoffreicheren<br />
und feuchteren Senkenlagen. Aus diesem Grund<br />
blieben solche Moränenstandorte oftmals dem Wald überlassen.<br />
Und damit auch den Räubern ...<br />
Seitenblick<br />
Hinter Wolfegg dominiert endgültig die typische Landschaft<br />
des Westallgäus: Viele Einzelhöfe und kleinere Weiler prägen<br />
die Siedlungslandschaft. Meist liegen sie am Fuße von<br />
sanften, waldbedeckten Hügeln. Dazwischen sind Mulden<br />
eingelagert, mit Mooren, Seen und Weihern. Nur gelegentlich<br />
unterbrochen von eingeschnittenen, tieferen Tälern.<br />
Enge Kurven, unzählige Dämme, Einschnitte und Brücken<br />
zeigen, welche Herausforderung diese Landschaft den Erbauern<br />
der Allgäubahn bot.<br />
17
Bauernhaus-Museum Wolfegg Putte in der Pfarrkirche Wasserrad der Löffelmühle<br />
Wolfegg<br />
Die Gemeinde Wolfegg liegt im Westallgäu<br />
im Herzen des Landkreises<br />
Ravensburg. Ein außergewöhnliches kulturelles<br />
Angebot mit verschiedenen klassischen Konzertzyklen,<br />
Museen, Kunstausstellungen und unzähligen<br />
Veranstaltungen der örtlichen Vereine sowie die<br />
reizvolle Landschaft im hügligen Alpenvorland machen<br />
die Gemeinde attraktiv und liebenswert.<br />
Wolfegg Information<br />
Rötenbacherstraße 13, 88364 Wolfegg<br />
Tel: 07527/9601-51<br />
wolfegg.info@wolfegg.de, www.wolfegg.de<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Automobilmuseum von Fritz B. Busch – auf rund<br />
3000m 2 ist das Museum ein wahres Oldtimer-Paradies<br />
• Bauernhaus-Museum Wolfegg – erfahren Sie etwas<br />
über regionaltypische Bauernhäuser und die Menschen,<br />
die darin gewohnt und gearbeitet haben<br />
• Schloss Wolfegg – das Schloss ist zu großen internationalen<br />
Konzertreihen zweimal im Jahr für Gäste geöffnet<br />
• Pfarrkirche St. Katharina<br />
• Orangerie – Gewächshaus aus dem 18. Jahrhundert<br />
• Loretokapelle – liegt am südlichen Ortsrand. Von hier<br />
lassen sich die Alpen bestaunen<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Museumsgaststätte Fischerhaus am Wolfegger Schloss,<br />
Fischergasse 29<br />
• Gasthof zur Post, Rötenbacher Straße 5<br />
• Café am Schlossplatz, Wette 2<br />
• Gasthaus am Schlossberg, Fischergasse 34<br />
• Gasthof Jäger, Bahnhofstraße 9<br />
• Gasthaus zur Rose, Kirchberg 11<br />
• Gasthof zum Bräuhaus, Rossberg 1<br />
• Gästehaus & Weinstube „Oliva“, Kirchberg 18<br />
• Gasthof Adler, Eintürnerstraße 38<br />
18
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wolfegg 4<br />
Tour 3<br />
Wir starten vom Bahnhof Wolfegg geradeaus, überqueren<br />
die Hauptstraße und biegen rechts in den Wald ein.<br />
Dort nehmen wir den Pfad halbrechts hoch auf einen<br />
Waldweg, der sich nach 300 m gabelt. Dort gehen wir<br />
geradeaus am Zaun entlang, bis der Weg an einer Hütte<br />
endet. Wir wechseln auf einen Pfad, der später auf<br />
den Talgrund zurückführt. An den Fischweihern liegt<br />
eine große Wegkreuzung und wir nehmen den Wanderweg<br />
rechts nach Alttann über die Höll. Nach 100 m<br />
weiter nach rechts. Bei der Gabelung auf der Höhe des<br />
Waldrückens wählen wir den zweiten Weg nach links<br />
bis wir die Bahnlinie Aulendorf – Kißlegg überqueren<br />
und auf die Straße nach Alttann kommen. Wir erreichen<br />
die Kirche, wo der steile Pfad in die Höll beginnt. Drunten<br />
in der Höll wandern wir entlang der Ach zur Talmühle,<br />
über die Ach und geradeaus auf einem Wiesenweg<br />
nach Bainders, dann links um die Ecke nach rechts<br />
hoch in den Wald. Von dort wandern wir durch den Ort<br />
Berg bis zum Waldrand dem Weg Wolfegg-Wassers<br />
nach. Wir biegen links ab und über den Schafhof erreichen<br />
wir Wassers. Von dort geht ein steiler Fußweg<br />
hinauf zur Schlossmauer, geradeaus durch den Ort, am<br />
Ortsausgang links in den Wald, über die Ach, an der<br />
Grillhütte vorbei wieder zum Ausgangspunkt Bahnhof.<br />
KBS 753/971<br />
19
Von Seen und Weihern<br />
Und warum Natur auf den zweiten Blick oft gar keine ist ...<br />
Der Brendenweiher ist nur einer von Hunderten von Weihern in<br />
Oberschwaben. Dazu kommen die Seen. Und natürlich die Moore.<br />
Doch wie hängen sie alle zusammen? © Rainer Sturm/Pixelio<br />
20
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wolfegg 4<br />
Lebendiges Allroundtalent: Der Weiher<br />
Ein Tag im Spätherbst des Jahres 1723. Schon seit Tagen<br />
fühlt sich Bruder Xaver, Mönch des südlich von Ravensburg<br />
gelegenen Prämonstratenserklosters Weißenau, schlapp<br />
und krank. Schließlich lässt er einen Mitbruder rufen, der<br />
als Medicus des Klosters Erfahrung im Heilen von Krankheiten<br />
hat. Aus einem kleinen Tonbehälter holt dieser einige<br />
längliche kleine Tiere hervor, die er auf die Haut des<br />
Kranken setzt: Blutegel, frisch gefangen aus einem eigens<br />
dafür angelegten, klostereigenen Weiher. So oder so ähnlich<br />
muss man sich eine ärztliche Behandlung zu jener Zeit<br />
vorstellen. Sie zeigt eine wichtige Funktion von Weihern,<br />
aber sicher nicht die einzige.<br />
In der Regel wurden diese Stillgewässer mehrfach genutzt.<br />
So waren vor allem die in ihnen gehaltenen Fische aber<br />
auch Frösche und Wasserschildkröten über Jahrhunderte<br />
hinweg ein gefragtes Luxusgut und Fastenspeise für die<br />
zahlreichen oberschwäbischen Klöster, den wohl wichtigsten<br />
Wissensträgern in Sachen Wasserbau und Weiherwirtschaft.<br />
Wie wichtig diese Klöster waren zeigt der Begriff<br />
„Mönch“, der heute noch für die Wasserablassvorrichtung<br />
von Weihern verwendet wird. Mühlen profitierten von der<br />
Möglichkeit, Wasser in Form von Weihern zu speichern und<br />
kontinuierlich abzugeben, so dass sie selbst in trockeneren<br />
Zeiten mahlen konnten. Auch als Vorratsbehälter für<br />
Brauch- und Löschwasser oder als Bestandteil städtischer<br />
Wehranlagen waren Weiher wertvoll. Daneben hatten Weiher<br />
beim „Rösten“, also Einweichen des Flachses zur Gewinnung<br />
seiner Fasern eine große Bedeutung. Denn Flachs<br />
war zeitweise ein so wichtiges Anbauprodukt, dass man<br />
vom „blauen Allgäu“ sprach, wenngleich das meist mehr<br />
einem subjektiven Farbeindruck als der Größe der Anbaufläche<br />
entsprach.<br />
Mit dem Rückgang des Ansehens des Luxusgutes Fisch im<br />
18. Jh. begann der Niedergang der Weiher. Viele wurden für<br />
immer abgelassen, etliche verlandeten zu Mooren, manche<br />
wurden zu landwirtschaftlichen Nutzflächen umgewandelt.<br />
Die verbliebenen Weiher sind heute beliebte Badeweiher<br />
oder dienen dem Naturschutz – zur Sicherung der Biodiversität,<br />
also der Vielfalt an Arten und Lebensräumen. Allen<br />
Weihern gemeinsam ist ihr wichtigster Unterschied zu<br />
Seen: sie sind menschengemacht. So besitzen die Wörter<br />
„Weiher“ und „Wehr“ gemeinsame Wurzeln, denn mit<br />
Ausnahme des Bibers kann nur der Mensch über die Anlage<br />
eines Wehres Wasser aufstauen, welches er über wasserbauliche<br />
Regelwerke dann nach Bedarf nutzen kann. Ein<br />
Beispiel dafür ist einer der ältesten Weiher Europas: der<br />
Rößler Weiher bei Weingarten, der sein gestautes Wasser<br />
an das „Stille-Bach“-System abgibt.<br />
Im Gegensatz zu den eiszeitlichen oberschwäbischen Seen<br />
weisen also Weiher immer Wehre oder Dämme auf. Ein sicheres<br />
Kennzeichen, denn ansonsten sind sich die beiden<br />
Stillgewässertypen manchmal zum Verwechseln ähnlich!<br />
Dazu kommt, dass es durchaus sein kann, dass ein heutiges<br />
Moor aus einem verlandeten Weiher entstand, der<br />
über einem Vorgängermoor aufgestaut wurde, welches sich<br />
wiederum aus der Verlandung eines eiszeitlich entstandenen<br />
Sees entwickelte. Dass Sie den letzten Satz zweimal<br />
lesen müssen, ist übrigens völlig normal. Er zeigt aber, wie<br />
dynamisch Landschaft sein kann. Und dass Natur auf den<br />
zweiten Blick oft menschengemacht ist ...<br />
Die Möglichkeit, in den eiszeitlichen Mulden auch auf den<br />
Hochflächen von Oberschwaben und dem Westallgäu Weiher<br />
anlegen zu können, war einer der Erfolgsfaktoren für<br />
die Vereinödung. Vereinödung? Diese Geschichte wird auf<br />
der nächsten Seite erzählt ...<br />
Grüner Schwimmer, © Martina Friedl/Pixelio<br />
21
Leben unterm „Krummstab“<br />
oder „Wie sie Einödinen gemachet ...“<br />
Einzelhofsiedlungen und kleine Weiler prägen die Siedlungslandschaft<br />
des Westallgäus. Natürlich war und ist das Leben<br />
hier oftmals einsam. Doch „Einöde“ kommt gar nicht von<br />
Einsamkeit.<br />
22
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wolfegg 4<br />
Agrarreform nach Art der Mönche<br />
Nicht nur bei Weihern, auch bei der Vereinödung zeigt sich<br />
die Rolle der oberschwäbischen Klöster als „Innovationsträger“.<br />
Denn schließlich handelte es sich dabei um eine<br />
geniale Idee: Landwirtschaftliche Betriebe werden aus der<br />
Enge der Dörfer ausgesiedelt. Und zwar in die Mitte ihrer<br />
neuen Nutzflächen („Ein Od“ = Ver“ein“ter Besitz). Gleich<br />
mehrere Fliegen wurden auf diese Weise mit einer Klappe<br />
geschlagen. Für die Bauern entfielen die oftmals langen<br />
Anfahrtswege zu ihren vormals häufig verstreut liegenden<br />
Besitzparzellen. Und: Sie wurden vom Flurzwang befreit,<br />
also der Verpflichtung, in einem Teil der Flur (Ösch oder<br />
Zelge) alle das gleiche Produkt anzubauen, denn Feldwege<br />
gab es damals noch keine. Kein Wunder also, dass die<br />
Vereinödung heute in Analogie zur Bauernbefreiung (vgl.<br />
Station 12) als „Bodenbefreiung“ bezeichnet wird. Aussiedlerhöfe<br />
und Flurneuordnung sind somit keine Erfindung<br />
des 20. Jahrhunderts.<br />
Schließlich begann die Agrarreform der Vereinödung in<br />
Dörfern der Fürstabtei Kempten bereits im 17. Jahrhundert!<br />
Von dort aus weitete sich diese Bewegung zügig bis an die<br />
Westgrenze von Oberschwaben aus, wo sie dann Anfang<br />
des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam. Natürlich waren<br />
wirtschaftliche Motive der Grundherrschaften ein wichtiger<br />
Grund dieses Erfolgs: Betriebswirtschaftliche Hindernisse<br />
wie die Grundstückszersplitterung wurden beseitigt, rationellere<br />
Wirtschaftsweisen führten zu Wertsteigerungen der<br />
Güter und zur Stärkung ihrer Leistungs- und Steuerkraft.<br />
Auch die günstigen Potenziale der Landschaft spielten eine<br />
Rolle. Vor allem aber gab der Wille der Mehrzahl der Bauern<br />
den Ausschlag. Im Zuge einer „bottom-up“-Bewegung<br />
griffen diese die „top-down“-Initiativen ihrer Grundherren<br />
bereitwillig auf und unterstützten diese intensiv und auf<br />
freiwilliger Basis. „Unterm Krummstab (gemeint ist der<br />
Abtsstab des Klosterchefs) ist gut leben“ lautete ein Slogan<br />
der damaligen Zeit. Doch die weit reichende Agrarreform<br />
hat Folgen bis in die Gegenwart.<br />
Während beispielsweise im Raum um Stuttgart herum die<br />
Landwirtschaft durch die Zersplitterung ihrer Felder immer<br />
größere Probleme bekam, konnte sie in Oberschwaben<br />
zumindest bis in die jüngste Zeit hinein profitabel wirtschaften.<br />
Doch die Vereinödung brachte nicht nur Vorteile:<br />
Viele Bauern auf den Einödhöfen hatten Probleme, eine<br />
Frau zu finden, die bereit war, auf den einsam gelegenen<br />
Höfen zu leben. In den Landkreisen der Region Bodensee-<br />
Oberschwaben ließ die Vereinödung Tausende neuer Siedlungsplätze<br />
entstehen, deren Anschluss an Anlagen zur<br />
Ver- und Entsorgung heute noch immer finanzielle und organisatorische<br />
Probleme aufwirft. So wurde der Bau eines<br />
der dichtesten Straßennetze Deutschlands notwendig, um<br />
jeden Einzelhof mit dem Auto erreichen zu können. Damit<br />
verbunden war eine intensive und ökologisch negativ zu<br />
bewertende Landschaftszerschneidung. Eine weitere Folge<br />
schließlich werden die einen positiv, die anderen negativ<br />
Geheimnisvolle Landschaft bei Wolfegg<br />
beurteilen: Einödhöfe bieten die Möglichkeit, ein Leben<br />
ohne Rücksicht auf den oft weit entfernten Nachbarn führen<br />
zu können. Damit verbunden war die Entwicklung einer<br />
oberschwäbischen Mentalität, die man entweder als „Leben<br />
und leben lassen“ und damit als Zeichen oberschwäbischer<br />
Toleranz werten kann – oder als „Eigenbrötelei und<br />
Kauztum“. Oder als irgendetwas dazwischen ...<br />
23
Zwei Schlösser, zwei Bahnstrecken, zwei Ortsnamen<br />
Gibt es in Kißlegg wirklich alles doppelt? Und wenn ja, warum?<br />
24
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Kißlegg 5<br />
Blick auf die Alpen<br />
in der Hand zweier Herrschaftslinien zu liegen kamen, kein<br />
Wunder also, dass in diesem „Ort der Duplizitäten“ auch<br />
zwei Schlösser zu finden sind.<br />
Und schließlich finden sich auch zwei Bahnlinien, zweigt<br />
doch von Kißlegg die Bahn nach Memmingen ab. Das ist<br />
durchaus nicht selbstverständlich, gab es über die Trassenführung<br />
der Allgäubahn gerade hier durchaus heftige<br />
Konflikte. So kämpfte die Stadt Wurzach für eine über ihren<br />
Bahnhof führende Alternativtrasse. Kein Wunder also, dass<br />
der „Sieg“ von Kißlegg nach dem Beschluss in der württembergischen<br />
Ständeversammlung mit Freudenfeuern und<br />
59 Böllerschüssen gefeiert wurde. Die Bedeutung dieses<br />
„Eisenbahnknotens“ zeigt sich im Empfangsgebäude.<br />
Anders als andere Gebäude dieser Art entlang der Allgäubahn<br />
weicht der Baustil vom sonst üblichen „württembergischen<br />
Landhausstil“ mit seinen zahlreichen Holzelementen<br />
deutlich ab. So finden sich hier statt Holz auch in den<br />
Obergeschossen Ziegel und Werksteine. Die ursprünglich<br />
stark gegliederte, zum Teil als „früheklektisch“ bezeichnete<br />
Fassade mit ihren Vorsprüngen aus rotem Backsteinmauerwerk<br />
wirkt heute durch den gleichmäßigen Verputz jedoch<br />
eher eintönig.<br />
Ort der Doppelgänger<br />
Nicht alles, aber doch so manches scheint es in Kißlegg<br />
doppelt zu geben, beispielsweise zwei Ortsnamen. Der<br />
„Zeller See“ weist in seinem Namen noch auf die ursprüngliche<br />
Bezeichnung dieses Siedlungsplatzes hin. Und auf die<br />
damaligen Grundherrn – schließlich ist eine „Zelle“ häufig<br />
der Wohnplatz eines Mönchs, in diesem Fall des Klosters St.<br />
Gallen. Ähnlich wie auch im Falle von „Wolfegg“ bezeichnet<br />
der neue, ab dem 15. Jahrhundert eingeführte Ortsname<br />
„Kißlegg“ ein „Eck“, also eine erhöhte Spornlage über<br />
tiefer gelegenen Mulden oder Tälern. Doch die Stadt selbst<br />
befindet sich gar nicht an einem solchen Eck, sondern bekam<br />
diesen Namen von einer nahe gelegenen Ministerialenburg<br />
des Klosters St. Gallen. Eine Herrschaftsteilung im<br />
14. Jahrhundert führte dazu, dass die Geschicke der Stadt<br />
Übrigens:<br />
Natürlich gibt es im Kißlegger Raum auch Weiher. Natürlich<br />
doppelt! Und in beiden kann man baden (Holzmühleweiher,<br />
Metzisweiler Weiher). Doppelt gibt es hier im Westallgäu<br />
übrigens auch den größten Fluss, die Argen. Doch<br />
deren Geschichte wird an der Station 6 erzählt.<br />
Kißlegg mit Zeller See<br />
25
EuroCity bei Bärenweiler<br />
Arrisrieder Moos<br />
Holzmühleweiher bei Kißlegg<br />
Kißlegg<br />
Kißlegg ist bekannt für seine Köstlichkeiten,<br />
denn in kaum einer anderen<br />
Gemeinde werden so viele beliebte<br />
Lebensmittel hergestellt wie hier im Westallgäu. Außerdem<br />
bietet Kißlegg gleich zwei Schlösser, ausgezeichnete<br />
Barockkirchen und Kapellen, die in ein Band von<br />
rund 20 Seen und hunderten Hektar an Mooren und<br />
sanften Hügeln eingebettet sind.<br />
Bürgermeisteramt Kißlegg<br />
Gäste- und Bürgerbüro<br />
Schlossstraße 5, 88353 Kißlegg<br />
Tel. 07563/ 936-143<br />
gemeinde@kisslegg.de, www.kisslegg.de<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Neues Schloss – mit Heimatmuseum und Museum Rudolf<br />
Wachter (Holzbildhauer)<br />
• Altes Schloss – ein Kißlegger Wahrzeichen<br />
• Stiftskirche Bärenweiler – eine Spitalkirche der besonderen<br />
Art<br />
• Wallfahrtskirche Rötsee – zu Ehren der Mutter Gottes<br />
• Burgermoos – auf den Spuren der Torfstecher<br />
• Kißlegger Seenplatte – ein Stück ursprünglicher Natur<br />
• Arrisrieder Moos – der Naturlehrpfad lehrt einen, woher<br />
das Moor kommt und welche Tiere und Pflanzen in ihm<br />
leben<br />
• Zeppelindenkmal – die Geschichte einer Bruchlandung<br />
• Pfarrkirche St. Gallus und Ulrich<br />
• Zahlreiche Kapellen in der Stadt verstreut<br />
• Heiliger Stein – ein Geschenk aus der letzten Eiszeit<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Hotel Gasthof Ochsen, Herrenstraße 21<br />
• Wagnerstub mit Biergarten, Wangenerstraße 6<br />
• Schlossparkcafé Restaurant, Schlossstr. 26<br />
• Hotel-Gasthof Schlosskeller, Fürst-Maximilian-Straße 3<br />
• Gasthaus zur Linde, Dr.-Franz-Reich-Str. 1<br />
• Gasthaus Hirsch, Rötsee 2<br />
• Eiscafé Dolomiti, Schlossstraße 3<br />
• Café Fatima, Hauptstraße 22<br />
• Musikbar Zappa, Herrenstraße 17<br />
• Gasthof Grüner Baum, Wiggenreute 15<br />
• Gleis Neun, Bahnhof Kißlegg<br />
26
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Kißlegg 5<br />
Tour 4 (Rundfahrt)<br />
Unsere Tour beginnt am Bahnhof in Kißlegg. Wir überqueren<br />
den Bahnübergang und biegen gleich rechts<br />
in den Stolzenseeweg ein. Wir halten uns links und<br />
fahren am Obersee und am Hof Stolzensee vorbei. Der<br />
Weg schwenkt nach rechts und wir radeln geradewegs<br />
durch das Maierholz. Hinter dem Hof Hasenfeld biegen<br />
wir links ab, fahren durch den Wald, über den Moosbach<br />
nach Blöden am Rötsee. Dort radeln wir links und<br />
über Rahmhaus gelangen wir nach Immenried. Bei der<br />
Kirche St. Ursula biegen wir links ab auf die Hauptstraße,<br />
überqueren den Bach, biegen rechts ab und<br />
verlassen auf der Straße zur Holzmühle den Ort. Durch<br />
ein Waldstück passieren wir den Holzmühleweiher und<br />
fahren wieder durch ein Waldstück, am Nordufer des<br />
Langwuhrweihers entlang nach Eintürnenberg. Dort<br />
halten wir uns links, radeln nach Weitprechts und dann<br />
auf der Landstraße nach Metzisweiler. Dort biegen wir<br />
links in die Kastanienstraße ein und fahren am Metzisweiler<br />
Weiher und der Abzweigung zum Stockweihervorbei<br />
und über Neuhaus nach Straß. Hier fahren wir<br />
links in die Kreisstraße, biegen nach ca. 300 m rechts<br />
ab, radeln an den Höfen Hinterhub und Vorderhub vorbei<br />
und durch Matzenweiler hindurch zur Landstraße<br />
nach Hahnensteig. Wir biegen links ab und kommen<br />
dann auf direktem Weg zurück nach Kißlegg.<br />
KBS 753/971<br />
27
Von Seen und Mooren.<br />
Oder: „Das Allgäu im Kleinen“<br />
28<br />
Die Kißlegger Seen bilden eine kleine Seenplatte.<br />
Doch manche der früheren Seen wurden bereits Teil der<br />
Kißlegger Moorlandschaft. Auch das Alpenpanorama<br />
beweist: Hier herrscht Allgäuvielfalt auf kleinem Raum ...
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Kißlegg 5<br />
Ried gleich Moos und Moos gleich Filz<br />
Nicht nur das bei guter Sicht eindrucksvolle Alpenpanorama<br />
mit den markanten Gipfeln Mädelegabel und Säntis<br />
zeigt, dass Kißlegg zu Recht als eines der Tore zum Allgäu<br />
bezeichnet wird. Auch die Landschaft entlang der Bahn<br />
zeigt Allgäuvielfalt auf kleinem Raum: Einerseits hat der<br />
letzte Eiszeitgletscher hier tiefe Mulden in der Landschaft,<br />
andererseits aber auch Schutt in Form höherer Moränehügel<br />
hinterlassen. Während es in den Mulden mit ihren<br />
Seen und Weihern, Sümpfen (oft Flachmoore; alemannisch<br />
„Ried“; bajuwarisch „Moos“) und Hochmooren (alemannisch<br />
„Moos“; bajuwarisch „Filz“) ziemlich feucht ist, ist es<br />
gleich daneben, auf den waldbedeckten Moränenhügeln,<br />
oft ziemlich trocken. Dazwischen finden sich eingestreut<br />
Einödhöfe und kleine Weiler, immer wieder unterbrochen<br />
durch Grünland für die Viehwirtschaft. Im Unterschied zu<br />
den Weihern, etwa bei Wolfegg, dominieren hier Seen. Viele<br />
von ihnen sind „toten“, also vom Gletscher abgetrennten<br />
Eiskörpern zu verdanken, die nach ihrem Abschmelzen<br />
meist kreisförmige wassergefüllte Mulden, „Toteisseen“,<br />
hinterlassen haben.<br />
Moore wie das Gründlenried sind meist aus verlandeten<br />
Seen entstanden. Aber nicht alle! Das Arrisrieder Moos<br />
beispielsweise ist ein Versumpfungsmoor. Es entstand<br />
nicht aus einem See, sondern direkt auf dauerhaft nassen<br />
Schmelzwasserablagerungen des Gletschers.<br />
Dass Moore für den Bahnbau alles andere als unproblematisch<br />
sind, hat bereits das Beispiel Aulendorf gezeigt (vgl.<br />
Station 1). Aber auch das Teilstück von Kißlegg nach Wangen<br />
hatte es in sich ...<br />
Seitenblick<br />
• Erster See (in Fahrtrichtung Wangen links): Zeller See;<br />
Entstehung gegen Ende der letzte Eiszeit vor 16.000<br />
Jahren, heute Naturschutzgebiet<br />
• Zweiter See (in Fahrtrichtung Wangen links): Schlingsee;<br />
Toteissee<br />
• Dritter See (in Fahrtrichtung Wangen rechts): Lauter See;<br />
Toteissee, heute Naturdenkmal<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Die Strecke von Kißlegg nach Hergatz misst zwar nur 18,6<br />
km. Wegen der hügeligen Eiszeitlandschaft verlaufen davon<br />
jedoch fast 3 km im Einschnitt und mehr als 4 km auf<br />
Dämmen. Dazu kommen Brückenbauwerke und zahlreiche<br />
Straßenübergänge. Kein Wunder, dass dieser Streckenabschnitt<br />
zum teuersten in ganz Württemberg wurde! (vgl.<br />
Station 6)<br />
Übrigens: Zu diesem Streckenabschnitt gibt es Filme von<br />
Ansgar Friemelt , die als DVD bei den Büchereien in Kißlegg<br />
und Wangen ausgeliehen werden können.<br />
Wollgras, © Hannana/Pixelio<br />
29
Einschnittslage hinter . HP und Argenquerung<br />
Von Arguna, der Silbernen,<br />
und dem Millionenjoch<br />
Hart und erfolgreich focht die Stadt Wangen um ihren<br />
Bahnanschluss. Doch kaum einer ahnte, zu welchem<br />
Preis ...<br />
30
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wangen 6<br />
Wässriger Untergrund verschlingt Millionen<br />
Sommer 1878, Kaibacheinschnitt zwischen Kißlegg und<br />
Argen. Der Bauunternehmer G. Voß aus Gera ist am<br />
Rand der Verzweiflung. Sein Auftrag: Das Ausheben eines<br />
1.600 m langen und 30 m tiefen Einschnitts und den Bau<br />
eines daran anschließenden 500 m langen und durchschnittlich<br />
27 m hohen Damms. Grund: Das Durchstechen<br />
der Wasserscheide zwischen Schussen und Argen und die<br />
Querung eines Teils des Tales der Unteren Argen für die geplante<br />
Bahntrasse Kißlegg – Wangen. Doch dieser Auftrag<br />
hat es in sich: Immer wieder schütten Schlammlawinen<br />
über Nacht den mühevoll gegrabenen Einschnitt einfach<br />
wieder zu. Kein Wunder, denn die Moräneablagerungen<br />
des Rheingletschers sind hier besonders wasserreich. Dabei<br />
hatte Herr Voß bei der Einrichtung der Baustelle keinen<br />
Aufwand gescheut: Spezielle Bahnen der Spurweite<br />
90 cm wurden verlegt, auf deren viel verzweigtem Netz acht<br />
Züge gleichzeitig fuhren! Auf diese Weise konnten bis zu<br />
6.000 m 3 /Tag an Material vom Einschnitt zum Damm bewegt<br />
werden. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Signalsystems<br />
und eines extra angelegten temporären Rangierbahnhofs<br />
konnten täglich bis zu 60 Baustellenzüge fahren, ohne dass<br />
auch nur einer den anderen behinderte. Dank dieses für die<br />
damalige Zeit innovativen und massiven Einsatzes von Baustellentechnik<br />
konnte schließlich der Bau doch noch erfolgreich<br />
übergeben werden. Die Kosten dafür allerdings waren<br />
so hoch, dass der Volksmund für den Kaibacheinschnitt<br />
gleich einen neuen Namen erfand: „Millionenschlucht“.<br />
Heute ist von alledem fast nichts mehr zu sehen. Der Damm<br />
von 1878 ist teilweise abgetragen, und gemeinsam mit<br />
dem Ratzenrieder Viadukt durch eine Betonbrücke ersetzt.<br />
Doch Kosten verursacht das „Millionenloch“ bis heute,<br />
denn immer wieder rutscht die Moräne, so dass Streckensanierungen<br />
an der Tagesordnung sind. Doch nicht vom dafür<br />
benötigten Geld kommt der Name der Argen, sondern<br />
von Arguna, der Glitzernden. Schließlich war ihr silbernes<br />
Wildfluss-Glitzern bereits für die damaligen Taufpaten, die<br />
Kelten, etwas Besonderes. Neben der Unteren Argen gibt<br />
es noch die Obere.<br />
Seitenblick<br />
Nach Erreichen der Hochfläche jenseits der Unteren Argen<br />
erscheint links das frühere Empfangsgebäude des Bahnhofs<br />
Ratzenrieds. Mit seinem gemauerten Erdgeschoss, seinem<br />
geschindelten Obergeschoss und seinem mit Brettern versehenen<br />
Dachgeschoss zeigt es heute noch typische Merkmale<br />
des damaligen „württembergischen Landhausstils“.<br />
Ehemaliges Empfangsgebäude von Ratzenried<br />
Argen, © Günther Schad/Pixelio<br />
31
Von Seelen. Und Käse.<br />
Und einer Grenze ...<br />
Eine der schönsten Altstädte der Region<br />
zeugt vom früheren Reichtum der Stadt.<br />
Heute ist Wangen bei Insidern auch als die<br />
„Stadt der guten Seelen“ bekannt. Nur<br />
deren Belag kommt mittlerweile leider oft<br />
von auswärts ...<br />
© Birgit Friebel/Pixelio<br />
32
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wangen 6<br />
Wo die Seele mit Allgäuer Käse schmeckt<br />
Hätten Sie es gewusst? Ein Oberschwabe hat zeitweise<br />
zwei Seelen! Doch nur eine davon wohnt in seiner Brust.<br />
Die andere isst er auf und das auch noch mit Genuss! Kein<br />
Wunder, handelt es sich doch dabei um eine wunderbar<br />
schmeckende, in ihrer Urform aus Dinkelmehl gebackene<br />
und mit Kümmel bestreute oberschwäbische Spezialität.<br />
Ein „Muss“ für jede oberschwäbische Bäckerei, vor allem<br />
hier in Wangen. Der Belag dazu kam früher auch von hier,<br />
hatte doch, neben anderen Käsereien, auch das Adler-<br />
Käsewerk sein Werksgelände direkt am Bahnhof. Bereits<br />
1892 gründeten die Gebrüder Wiedmann dieses Werk als<br />
Käse- und Buttergroßhandlung. Stetig wurde das Sortiment<br />
erweitert: Ab 1896 wurden Weichkäse und Emmentaler<br />
hergestellt. 1922 wurde gar der erste deutsche Schmelzkäse<br />
hier erfunden, die „Adler-Edelcreme“! Dass diese Spezialitäten<br />
auch gerne am Stuttgarter Hof genossen wurden,<br />
beweist die Ernennung der innovativen Unternehmer 1905<br />
zu „königlich württembergischen Hoflieferanten“. Doch<br />
der Käse ging in viele Regionen Europas, schließlich konnte<br />
per Bahn ein großer Markt erschlossen werden. Dieses Beispiel<br />
zeigt: Nicht zuletzt dank der Bahn wurde die Allgäuer<br />
Milchwirtschaft, verbunden mit einer „Vergrünlandung“<br />
des früher stellenweise „blauen“ Allgäus, zur wichtigsten<br />
Säule der hiesigen Landwirtschaft. Doch die Globalisierung<br />
machte auch vor dem Adlerwerk nicht halt. 1989 wurde die<br />
zwischenzeitlich in „Adler Allgäu“ umbenannte Käsefabrik<br />
durch das französische Unternehmen „Bel“ übernommen<br />
und zu „Bel-Adler Allgäu“ umbenannt. 2006 schließlich<br />
musste das Werk schließen. Doch keine Angst! Auch heute<br />
noch können die berühmten Wangener Seelen mit bestem<br />
Allgäuer Käse genossen werden. Zum Beispiel auf der<br />
Westallgäuer Käsestraße.<br />
Übrigens:<br />
Ein für die Bahn weiterer wichtiger Industriezweig war die<br />
Wangener Zellstofffabrik, basierend auf dem Rohstoff Holz.<br />
Doch der Reichtum der früheren Reichsstadt Wangen kam<br />
aus anderen Einnahmequellen.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Der Bahnhof Wangen war ursprünglich als Endbahnhof<br />
konzipiert. Schließlich war eine „grenzüberschreitende“ Linie<br />
zu Bayern lange Zeit undenkbar, obwohl die Wangener<br />
alles dafür taten. Dafür wurden sie jedoch fast in die Nähe<br />
von Landesverrätern gerückt: „Ein Bezirk, der mit dem<br />
Ausland (=Bayern) konspiriert, geht des Rechtes auf eine<br />
Eisenbahn verlustig“, lautete die Stellungnahme aus Stuttgart.<br />
Als die Beharrlichkeit, manche sagen Dickschädeligkeit,<br />
der Wangener dann 1890 mit dem Weiterbau der Strecke<br />
nach Hergatz schließlich doch noch erfolgreich war, gab<br />
es bei der Umwandlung zum Durchgangsbahnhof erhebliche<br />
technische Probleme: Ein scharfer Knick nach Süden<br />
musste angelegt und die Trasse auf einem riesigen Damm<br />
geführt werden, schließlich war das Tal der Oberen Argen<br />
Argenbrücke bei Wangen<br />
zu queren. Noch heute stecken das 16 m hohe Schüttgerüst<br />
sowie die Leiche eines Wangener Bürgers darin, wie dessen<br />
Mörder auf seinem Totenbett gestanden haben soll. Aufgrund<br />
der eiszeitlichen Kuppenlandschaft musste das hinter<br />
dem Gehrenberg abzweigende Industriegleis zur Zellstofffabrik<br />
ebenfalls auf einem hohen Damm geführt werden.<br />
Heute befindet sich hier ein beliebter Spazierweg, ganz<br />
in der Nähe der Grenze zu Bayern (Landesgrenze Bayern<br />
km 15,57 ab Kißlegg). Der Damm der Hauptstrecke geht<br />
über in die längste Eisenbahnbrücke Oberschwabens, die<br />
hier in 17 m Höhe und auf 117 m Länge die Obere Argen<br />
überspannt. Wie das frühere Ratzenrieder Viadukt über die<br />
Untere Argen, war auch diese Brücke bei Kriegsende von<br />
deutschen Truppen gesprengt worden. Wangen war damit<br />
eisenbahntechnisch einige Zeit lang von der Umwelt abgeschnitten.<br />
33
Martinstor<br />
Fidelisbäck<br />
Museumslandschaft<br />
Wangen<br />
Stadt historischer Gebäude<br />
und zahlreicher Brunnen,<br />
der lauschigen Gassen und stillen Winkel, der<br />
gepflegten Gastronomie und der netten Menschen.<br />
Es heißt: In Wange bleibt ma hange...! Warum bloß?<br />
Finden Sie‘s raus ...<br />
Gästeamt - Tourist Information<br />
Bindstraße 10<br />
88239 Wangen im Allgäu<br />
Tel. 07522/74-211<br />
Fax 07522/74-214<br />
tourist@wangen.de, www.wangen.de<br />
34<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Heimatmuseum in der Eselsmühle – gibt Einblick in die<br />
Geschichte der Stadt<br />
• Franziskaner Klostergarten – hier eine „Oase der Stille“<br />
geschaffen<br />
• Ravensburger Tor – das Wahrzeichen der Stadt finden<br />
Sie am Ende der Herrenstraße<br />
• Oberstadtkirche St. Martin – gehört zu den ältesten<br />
Baudenkmälern der Stadt<br />
• Berger Höhe – Aussichtsplatte im Südwesten der Stadt<br />
• St. Martins Kirche – gehört zu den ältesten Baudenkmälern<br />
der Stadt<br />
• Spitalkirche – befindet sich am Scheitelpunkt der Bindund<br />
Spitalstraße, hier kann man die fast lebensgroße<br />
Muttergottes-Skulptur bestaunen<br />
• Burgruine Neuravensburg – steht hoch über dem Ort<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Fidelisbäck, Paradiesstraße 3<br />
• Gasthaus Lamm, Bindstraße 60,<br />
• Restaurant am Kreuzplatz, Bindstraße 70<br />
• Gasthaus zum Rad, Bindstraße 23<br />
• Blaue Traube, Zunfthausgasse 10<br />
Rathaus auf dem Marktplatz
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Wangen 6<br />
Tour 5<br />
Vom Bahnhof in Wangen fahren wir zum Martinstorplatz,<br />
weiter zum Festplatz und rechts auf den Aumühleweg.<br />
Wir überqueren die Obere Argen und biegen<br />
rechts in den Herzmannser Weg ein. Wir unterqueren<br />
die Bahngleise, folgen der Oberen Argen, unterqueren<br />
den Südring, folgen weiter dem Herzmannser Weg und<br />
verlassen so die Stadt. Vor einem kleinen Wald geht es<br />
rechts über Elitz nach Welbrechts. Zunächst fahren wir<br />
links in Richtung Hergatz, dann gleich wieder rechts.<br />
In Untermooweiler angelangt, geht es weiter nach<br />
Degetsweiler. In Degetsweiler radeln wir links nach<br />
Volkings. Wir halten uns links, queren die Bahnlinie<br />
und gelangen nach Stockenweiler. Wir überqueren<br />
die B 12 und fahren rechts durch den Ort Hergensweiler.<br />
Nach etwa 1 km fahren wir links zu einem<br />
Wäldchen und dann rechts ab zur B 308. Nach ca.<br />
500 m biegen wir links ab, um nach etwa 100 m allerdings<br />
wieder rechts nach Thumen abzubiegen. In Thumen<br />
geht es links. Wir passieren den Ort Laiblachsberg<br />
und folgen der Laiblach. Beim Zollamt biegen wir rechts<br />
in die Straße nach Reutin ein, folgen der Oberhochstegstraße<br />
in die Rickenbacher Straße und erreichen die<br />
B 31. Nach ca. 600 m fahren wir nach rechts in Richtung<br />
Friedrichshafen, biegen dann links ab und fahren<br />
über die Seebrücke zur Insel Lindau.<br />
KBS 970/971<br />
KBS 753/971<br />
KBS 970<br />
35
Es gibt Gemeinsamkeiten mit Aulendorf!<br />
Aber es gibt auch Unterschiede ...<br />
36<br />
Hergatz ist das Ende der Württemberg-Allgäu-Bahn. Sie mündet ein in die bayerische<br />
Allgäubahn. Ähnlich wie Aulendorf ist auch Hergatz eine „Verkehrsdrehscheibe“. Und<br />
das nicht erst seit dem Bahnbau ...
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Hergatz 7<br />
Weißes Gold auf Reisen<br />
Wohmbrechts (Teil der heutigen Gemeinde Hergatz), Sommer<br />
1811. Rumpelnd nähert sich ein schwerbeladener Karren<br />
von Isny her. Er hat eine lange Reise hinter sich, schließlich<br />
kommt er aus Reichenhall bei Salzburg. Der Kutscher<br />
ist müde, aber frohen Mutes. Denn bald schon hat er sein<br />
Ziel erreicht: Im Lindauer Hafen wartet bereits eine Lädine,<br />
ein Bodensee-Segelschiff, auf die Übernahme und den Weitertransport<br />
seiner besonderen und wertvollen Fracht, Salz.<br />
Es ist einer der letzten Salzfuhren auf der „Salzstraße“, die<br />
von Reichenhall über Rosenheim, Tölz, Murnau, Kempten<br />
nach Wohmbrechts und von hier an den Bodensee führte.<br />
Die Konkurrenz anderer Salzliefergebiete war zu groß<br />
geworden.<br />
In der Tat war der Salzhandel für das Westallgäu und den<br />
Bodenseeraum jahrhundertelang eine Art „weißes Gold“.<br />
Denn nicht nur mit dem Salz selbst konnten große Gewinne<br />
erzielt werden, auch und vor allem mit den Nebeneinnahmen,<br />
die entlang der Salzstraße zu erzielen waren. Für Vorspanndienste<br />
(Bereitstellen zusätzlicher Zugtiere) bei steilen<br />
Straßenabschnitten genauso wie für das Bereitstellen<br />
von Übernachtungsplätzen oder Wirtschaften für die Fuhrleute.<br />
Vor allem aber für Lagergebühren und Zollabgaben.<br />
Die pfiffigen Wangener erkannten schnell das wirtschaftliche<br />
Potenzial von Territorien entlang der Salzstraße und<br />
erwarben aus diesem Grund 1521 als erstes die Landeshoheit<br />
über die Pfarreien Maria-Thann und Wohmbrechts.<br />
Ein Schnäppchen, litt doch der Verkäufer, Graf Hugo von<br />
Montfort-Bregenz, unter chronischem Geldmangel. 1613<br />
schließlich kauften die Wangener dem Kloster Weingarten<br />
sogar das gesamte Dorf Wohmbrechts ab. Erst als Folge der<br />
„Napoleonischen Flurbereinigung fiel Wohmbrechts-Thann<br />
dann 1810 an Bayern und wurde später zum jetzigen Hergatz.<br />
Noch heute aber zeugt der alte Salzstadel in Wohmbrechts<br />
von der schon früh genutzten „Verkehrsgunst“ des<br />
Hergatzer Raums.<br />
Am 15. Juli 1890 wurde die württembergische Allgäubahn<br />
an die bayerische Allgäubahn angeschlossen, seit jüngerer<br />
Zeit sorgen zusätzlich zwei Bundesstraßen für Mobilität –<br />
die noch abschnittsweise „Salzstraße“ heißende B12 sowie<br />
die B 32. Für viele Reisende ist Hergatz übrigens nicht nur<br />
Blick auf die Nagelfluhkette bei Hergatz<br />
Umsteige-, sondern Endbahnhof. Von dort aus gelangen sie<br />
entweder zu Fuß oder mit bereitgestellten Fahrzeugen zu<br />
ihrem wenige Kilometer entfernten Ziel, dem Kloster Wigratzbad.<br />
Es ist heute eines der größten Pilgerzentren von<br />
Allgäu und Oberschwaben und beweist, wie „in“ heute das<br />
Wallfahren geworden ist. Und das nicht nur nach Santiago<br />
de Compostela.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Neben der sichtbaren Verkehrsgunst zeigt Hergatz eine<br />
weitere Ähnlichkeit mit dem Bahnhof Aulendorf. Hier wie<br />
dort wurde Torf abgebaut, als Betriebsstoff für Lokomotiven.<br />
In Hergatz kam der Torf aus dem Degermoos, einem<br />
ganz in der Nähe des Bahnhofs liegenden Moorgebiet.<br />
37
Hergatz ist in Kürze errreicht<br />
Glückliche Kühe<br />
Hergatz<br />
Die Gemeinde Hergatz ist landschaftlich<br />
in die Voralpenregion des 3-Länder-Ecks<br />
Deutschland – Österreich<br />
– Schweiz eingebettet. Ihre zentrale Lage zeichnet sich<br />
durch die Nähe zum Bodensee und den Alpen aus.<br />
Die Nähe zu den Städten Wangen, Lindau, Ravensburg<br />
und Kempten ist schon fast selbstverständlich. Aber<br />
auch ein Ausflug nach Bregenz (Österreich) oder St.<br />
Gallen (Schweiz) bedeutet keine „Weltreise“.<br />
Informationen für Touristen<br />
Gemeinde Hergatz<br />
Salzstraße 18, 88145 Hergatz-Wohmbrechts<br />
gemeinde@hergatz.de, www.hergatz.de<br />
38<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Marienkirche – die Wallfahrtskirche ist eine der ältesten<br />
Kirchen des Allgäus und bildet den Ursprung der<br />
Pfarrei Maria-Thann<br />
• Schloss Syrgenstein – ist die einzige erhaltene Schlossburg<br />
im Landkreis Lindau (Bodensee)<br />
• Hämmerlebrücke – eine Eisenbahnbrücke auf der Strecke<br />
Lindau-Immenstadt, auf der Züge das Leiblachtal<br />
überqueren<br />
• Das ehemalige Schloss und die Kirche St. Georg in<br />
Wohmbrechts – das ehemalige Wasserschloss ist nicht<br />
nur in Wort und Bild überliefert, sondern in Teilen heute<br />
noch vorhanden und zu besichtigen<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Pizzeria San Remo, Salzstraße 6, Wohmbrechts<br />
• Gaststätte Tanne, Salzstraße 16, Wohmbrechts<br />
• Gaststätte Alois Stiefenhofer, Itzlings 1<br />
• Gasthaus Sonne, Bodenseestraße 12, Opfenbach<br />
• Musik- Café, Salzstraße 6, Wohmbrechts<br />
Bahnhof Hergatz
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Hergatz 7<br />
Tour 6 (Rundweg)<br />
Zwei der schönsten Naturschönheiten des Westallgäus<br />
erschließt diese gemütliche Halbtageswanderung<br />
rund um Hergatz, Hergensweiler und Opfenbach: Die<br />
beiden Naturschutzgebiete Degermoos und Stockenweiler<br />
Weiher genießen heute höchsten Schutzstatus.<br />
Zuvor wurden sie allerdings jahrhundertelang für den<br />
Torfabbau und zur Fischzucht genutzt.<br />
Unsere Tour beginnt am Bahnhof Hergatz. Von der<br />
Bahnhofstraße biegen wir erst links auf die Bregenzer<br />
Straße und dann nach ca. 400m links in den Höhenweg<br />
ab. Diesem folgen wir über Adelgunz bis nach<br />
Obernützenbrugg.<br />
Von dort wandern wir nach Degermoos, wo wir einen<br />
ehemaligen Torfstich besichtigen können, der uns viel<br />
über die Geschichte der Torfgewinnung im Moor erzählt.<br />
Über Volklings führt der Weg zum Stockenweiler<br />
Weiher. Weiter geht es an der Leiblach entlang nach<br />
Beuren und Ruhlands. Hier finden wir etwas abseits<br />
des Weges die Bruggmühle aus dem Jahr 1269. Von<br />
Ruhlands führt der Weg nach Opfenbach und über<br />
Göritz zurück nach Obernützenbrugg. Auf dem Weg<br />
werfen wir einen Blick auf die Kleyenmühle, eine<br />
ehemalige Mahlmühle an der Leiblach. Dann wandern<br />
wir auf dem gleichen Weg zurück nach Hergatz.<br />
KBS 753/971<br />
39
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg<br />
Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
VON KIßLEGG NACH MEMMINGEN<br />
Eine Bahn, zwei Bundesländer und viele Geschichten. Auf dieser Strecke ist jede<br />
Menge geboten! Schaurige Sagen ranken sich etwa um den Blutsberg bei<br />
Aichstetten. Und in Memmingen kämpften Bauern unerschrocken für die Freiheit.<br />
Willkommen im Keilbahnhof! Die Freie Reichsstadt Leutkirch<br />
beeindruckt nicht nur mit einer spannenden, von der<br />
Zunft der Leinenweber geprägten Altstadt, sondern auch<br />
mit einem originellen Bahngebäude. Denn früher wurden<br />
hier gleich zwei Zugstrecken zur selben Zeit bedient.<br />
Entlang der Aitrach führt die Trasse weiter zum früheren<br />
Marktflecken Aichstetten und zum Haltepunkt Marstetten-<br />
Aitrach. Eine geschichtsträchtige Gegend: Schon die Kelten<br />
nutzten den Illerübergang bei Aitrach. Der Iller folgend,<br />
erreicht die Württemberg-Allgäu-Bahn mit Tannheim den<br />
letzten auf württembergischem Gebiet liegenden Bahnhof<br />
– danach geht die Fahrt auf bayerischem Territorium<br />
weiter bis nach Memmingen.<br />
Auf den folgenden Seiten begegnen Ihnen selbstbewusste,<br />
streitbare Bauern, Flößer, die um ihre Zukunft bangen und<br />
Goldgräber der besonderen Art. Denn ihr Schatz glänzte<br />
nicht, sondern war grau und matt – aber zur Zeit des<br />
Eisenbahnbaus trotzdem ein kleines Vermögen wert.<br />
Seitenblick auf den Ellrazhofer Weiher<br />
Welcher Geschichts-Spur möchten Sie zuerst folgen? Zieht<br />
es Sie an geheimnisvolle Plätze wie etwa zur Burgruine in<br />
Marstetten? Oder wollen Sie lieber mit Memmingen eine<br />
der ältesten Städte Deutschlands entdecken? Egal, wie<br />
Sie sich entscheiden, langweilig wird es Ihnen entlang der<br />
Württemberg-Allgäu-Bahn garantiert nicht!<br />
41
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
Von den „Freien Leut uf der Lütkircher Hayd“<br />
Freie Leute? Eine Besonderheit? Und warum ausgerechnet hier?<br />
42
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Leutkirch 8<br />
Selbstbewusste Bauern<br />
„...sie dürfen in des Reiches Stätte nach ihrem alt hergebrachten<br />
Recht hinfahren, wo sie wöllen, sie seien Frau<br />
oder Man, Pfaff oder Laye, auch soll sie Niemand pfänden<br />
noch nöthen, diese freien Leut uf der lütkircher Hayd“. So<br />
lautet der Text des kaiserlichen Freiheitsbriefes aus dem 14.<br />
Jahrhundert. Damit wurde besiegelt, was hier schon seit<br />
Jahrhunderten Tradition hatte: Die Rechte freier, bäuerlicher<br />
Grundbesitzer, die keinem lokalen Herrn, sondern nur dem<br />
König selbst verpflichtet waren. Ohne Zweifel eine große<br />
Besonderheit, waren doch die bereits anklingenden Rechte<br />
wie „Freizügigkeit“, oder „Gleichberechtigung zwischen<br />
Mann und Frau“ zu jener Zeit alles andere als verbreitet.<br />
Die hier entstehende Mentalität selbstbewusster Menschen<br />
hatte Auswirkungen. So hatten beim Bahnbau Politiker wie<br />
Planer nichts zu lachen: Nur mit Hilfe von Enteignungen<br />
konnte der Staat mancherorts die für den Bahnbau notwendigen<br />
Flächen von den „freien Bauern“ beschaffen.<br />
Und: „... es hat daher auf der ganzen Linie auch kein einziger<br />
Allgäuer Spate und Hacken berührt, um beim Bau einer<br />
Bahn zu arbeiten, ...“, so Oscar Fraas 1880.<br />
(Vielleicht musste deshalb die preußische Armee beim Bau<br />
helfen). Manch einer munkelt gar, dass sich sogar heute<br />
noch so mancher Politiker und Planer die Zähne ausbeißt.<br />
An den „Freien von der Leutkircher Hayd“ ...<br />
Auswirkungen hatten diese verbrieften Freiheitsrechte weit<br />
über die „Leutkircher Hayd“ hinaus: So wurden im Rahmen<br />
des Bauernkriegs 1525 die Rechte der „Freien“ in die<br />
zwölf Artikel der Bauern mit aufgenommen. Und damit eine<br />
wichtige Grundlage für einen langen Kampf um uns heute<br />
selbstverständlich scheinende Freiheitsrechte geschaffen<br />
(vgl. Station 12).<br />
Übrigens:<br />
Der Landschaftsbegriff Heide ist hier mehr als berechtigt,<br />
denn zeitweise ist der Boden ganz schön trocken. Kein<br />
Wunder, schließlich besteht der Untergrund der Leutkircher<br />
Heide aus eiszeitlichen Schmelzwasserschottern, die sehr<br />
wasserdurchlässig sind und daher wie natürliche Drainagen<br />
wirken. Doch selten wird es so „richtig“ trocken, denn eine<br />
natürliche Bewässerung von oben in Form von Niederschlägen<br />
gibt es hier im Allgäu mehr als reichlich.<br />
Touren und Ausflüge starten: ab Bahnhof Leutkirch<br />
43
Ein Keilbahnhof weist den Weg!<br />
Wahrlich ein historisches Empfangsgebäude!<br />
Doch warum steht es so – schief?<br />
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
44
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Leutkirch 8<br />
Die Leinenweber von Leutkirch<br />
Egal ob mit einer oder zwei Strecken – Leutkirch mit seiner<br />
zum Teil aus dem Mittelalter stammenden Altstadt ist<br />
auf jeden Fall einen Aufenthalt wert. Wo sonst kann man<br />
beispielsweise ein gotisches Wohnhaus aus dem Jahr 1377<br />
bewundern? Die ehemalige freie Reichsstadt verdankte ihren<br />
früheren Wohlstand einer Zunft, die für das Allgäu bis<br />
ins 17. Jahrhundert typisch war: Die Leinenweber. War doch<br />
Rathaus<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Keilbahnhof heißt ein Bahnhof, der gleich zwei Strecken bedienen<br />
muss, die sich hier gabeln bzw., je nach Perspektive,<br />
zu einem Keil zusammen laufen. Und der aus diesem Grund<br />
zu jeder dieser Schienenstränge etwas schief steht. Diese<br />
spezielle Lösung ist sinnvoll, wenn beide Strecken bedient<br />
werden. Im Fall von Leutkirch ist das nicht mehr so, wurde<br />
doch der 16 km lange Bahnabschnitt von Leutkirch nach<br />
Isny bereits 1976 für den Personenverkehr stillgelegt. 2001<br />
folgte dann die Einstellung des Güterverkehrs. Heute enden<br />
die Gleise etwa 300 m nach der Verzweigung am Keilbahnhof.<br />
Die Strecke war zunächst Teil der Hauptbahn Herbertingen<br />
– Aulendorf – Leutkirch – Isny und wurde 1899 zur<br />
Nebenbahn degradiert. Der Grund: In diesem Jahr ging die<br />
bayrisch-württembergische Verbindungsstrecke Leutkirch<br />
– Memmingen in Betrieb. Dieses Stück bildet heute noch<br />
den anderen Teil der „Gabel“.<br />
der Flachs vor der Einführung der Viehwirtschaft ein wichtiges<br />
Anbauprodukt dieser niederschlagsreichen Region. Mit<br />
dem Aufkommen der Industrie verloren diese jedoch ihre<br />
Schlüsselfunktion.<br />
Leutkirch<br />
Ruhe und Erholung, Wiesen und Wälder,<br />
Seen und Weiher, Erlebnis und<br />
Entspannung, Tradition und Brauchtum,<br />
Lebensfreude und Kultur, Tradition und Fortschritt,<br />
freundliche Menschen: Das ist Leutkirch im Allgäu.<br />
In der historischen Altstadt erwarten Cafés, Bars und<br />
Restaurants ihre Gäste mit Allgäuer Schmankerln und<br />
internationalen Spezialitäten.<br />
Touristinfo Leutkirch<br />
Marktstraße 32<br />
88299 Leutkirch im Allgäu<br />
Tel.: 07561/87-154, Fax: 07561/87-5186<br />
touristinfo@leutkirch.de, www.leutkirch.de<br />
Bockturm<br />
45
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
Noblesse oblige –<br />
vom oberschwäbischen Adel und seiner Bedeutung<br />
Hoch auf der Endmoräne der Würmeiszeit thront das Schloss derer<br />
von Waldburg-Zeil. Zwar ist ihr Territorium seit Napoleon abgeschafft.<br />
Trotzdem war und ist der oberschwäbische Adel wichtig.<br />
46
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Leutkirch 8<br />
Überwachung!<br />
Die Lage des Schlosses lässt keinen Zweifel: Zumindest die<br />
Vorgängerburg wurde zur Überwachung gebaut. Denn weit<br />
und breit hat der Gletscher nur hier ein Tor in seiner steilen<br />
und daher verkehrsfreundlichen Endmoräne gelassen, ein<br />
Tor, das durch die Wurzacher Ach freigehalten wird und ein<br />
Treffpunkt aller Verkehrsachsen ist. Früher verlief hier eine<br />
Fernhandelsstraße, heute gibt es die Bahnlinie und die Autobahn<br />
A 96. Endmoränen waren in Oberschwaben wie im<br />
Allgäu gesuchte Burgenstandorte, kein Wunder also, dass<br />
auch hier, wohl schon seit dem 11. Jahrhundert, Burgen<br />
bestanden. 1598 wurde die letzte davon abgebrochen<br />
und machte dem heutigen Renaissance-Schloss Platz. In<br />
der künstlerisch gestalteten Brunnenanlage des Schlosses<br />
wird die Geschichte des Hauses Waldburg dargestellt. Unter<br />
anderem findet sich hier der wohl berühmteste, aber<br />
auch berüchtigtste Vertreter dieses Adelshauses, Georg III.<br />
von Waldburg (1488-1531), oberster Feldhauptmann des<br />
Schwäbischen Bundes, auch Bauernjörg genannt. Diesen<br />
Übernamen hat er nicht von ungefähr, denn er war es, der<br />
den Aufstand der Bauern im 16. Jahrhundert brutal niederschlug.<br />
Und das, obwohl deren Forderungen alles andere<br />
als unbotmäßig waren.<br />
So wie alle anderen oberschwäbischen Territorien (Ausnahme:<br />
Hohenzollern) wurde auch das der Waldburg-<br />
Zeiler von Napoleon kurzerhand aufgehoben, Folge des<br />
Reichsdeputationshauptschlusses von 1806. Doch der<br />
oberschwäbische Adel war auch danach von Bedeutung.<br />
So setzte sich 1887 Fürst Wilhelm von Waldburg-Zeil in seiner<br />
Funktion als Präsident der württembergischen Kammer<br />
der Standesherrn vehement für den Bau der Allgäubahn<br />
ein und unterstützte den Bau des Bahnhofs Unterzeil mit<br />
dem Verkauf von Grundstücken – die zum halben Preis angeboten<br />
wurden.<br />
Auch heute noch ist der oberschwäbische Adel ein wichtiger<br />
Einflussfaktor in der Region, erkennbar nicht nur an den<br />
vielen Schlössern, sondern auch an den häufig im Besitz<br />
von Adeligen befindlichen großen Privatwäldern und ausgedehnten<br />
landwirtschaftlichen Gütern.<br />
Übrigens:<br />
Nicht nur hier, auch andernorts bilden Moränenrücken beliebte<br />
Standorte für Burgen und Schlösser. Doch manche<br />
von ihnen sind heute verschwunden. Die Gründe dafür sind<br />
häufig unbekannt.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Viele Jahre lang hatte der Bahnhof Unterzeil Bedeutung<br />
durch den dort ansässigen Holzhof, der konsequent auf die<br />
Bahn setzte. Der Güterverkehr endete im Frühjahr 2000.<br />
Holzhof und Schloss Unterzeil<br />
47
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
Blutsberg:<br />
Nomen est Omen?<br />
Scheinbar in das Tal hineinspringende Moränenrücken<br />
wie der Blutsberg bieten ideale Voraussetzungen für<br />
Burgen. Doch wer hat sie wann gebaut? Und wer zerstört?<br />
48
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Aichstetten 9<br />
Schauerliches Schicksal<br />
Einst erhob sich auf dem Blutsberg ein großes Schloss. Dessen<br />
Bewohner waren so reich, dass sie ihre Kinder statt<br />
mit Tüchern mit „Kiachla“, also kleinen Kuchen, reinigen<br />
ließen. Eine damit beauftragte Magd empfand dies als<br />
sündhafte Verschwendung. Sie bekam so starke Gewissensbisse,<br />
dass sie all ihren Mut zusammen nahm und<br />
die Schlossfrau ansprach: „Ich will gerne meine schönste<br />
seidene Schürze zum Reinigen der Kinder hergeben, wenn<br />
ich nur nicht mehr „Kiachla“ dazu verwenden muss“. Die<br />
Schlossbesitzer jedoch blieben unnachgiebig und die Magd<br />
musste weiterhin die Schlosskinder mit „Kiachla“ reinigen.<br />
Eines Tages kam ein Bettler an das Tor des Schlosses und<br />
bat um Almosen. Voller Verachtung gab ihm die Schlossherrin<br />
einen kleinen Kuchen, mit dem zuvor die Kinder geputzt<br />
worden waren. Der Bettler bemerkte dies sofort und veranlasste<br />
die Magd zum sofortigen Verlassen des Schlosses.<br />
Als sie und er draußen waren, kehrte sich der Bettler um<br />
und sprach einen Fluch aus. Sofort spaltete sich der Boden!<br />
Das große Schloss wankte kurz und versank dann mit allen<br />
seinen Insassen in der Tiefe. Kurz danach zog sich der<br />
Boden über dem Spalt wieder zusammen. Nichts deutete<br />
mehr auf den Vorfall hin. Nur einige Waldgänger behaupteten<br />
später, dass sie an der Stelle noch nach drei Tagen<br />
einen Hahn aus der Tiefe haben krähen hören. Und angeblich<br />
wartet eine weiße Frau auf dem Blutsberg bis heute<br />
darauf, vom Fluch erlöst zu werden. Vielleicht eine Aufgabe<br />
für wagemutige Blutsberg-Besucher? Immerhin soll als Gegenleistung<br />
der Schlossschatz winken ...<br />
Soweit die Sage. Tatsächlich ist die nordöstliche Spitze des<br />
Blutsbergs durch „zwei bis zu sechs Meter tiefe, mächtige<br />
Gräben gegliedert und gut gesichert“. Dem Archäologen<br />
Christoph Morrissey zufolge sind es „zweifellos die Reste<br />
einer mittelalterlichen Adelsburg“. Eine Adelsburg, von der<br />
es allerdings weder bauliche Zeugen noch Urkunden gibt.<br />
Wahrscheinlich wird die Geschichte dieser Burg daher für<br />
immer ein Geheimnis bleiben ...<br />
Der Aichstettener Ortsteil Altmannshofen mit Schloss<br />
49
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
Gold glänzt.<br />
Aber nicht immer ...<br />
Kies war und ist ein wertvoller Rohstoff. Übrigens auch für<br />
die Bahn. Doch warum wird er gerade hier abgebaut?<br />
© Tommy S./Pixelio<br />
50
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Marstetten-Aitrach 10<br />
Schotterbett aus der Eiszeit<br />
Das „oberschwäbische Gold“ spielt auch in Roßberg eine<br />
Rolle. Hier liegt der Kies nicht weit weg von der Endmoräne<br />
des Rheingletschers. Schmelzwasserflüsse haben ihn<br />
aus dem Moränenschutt herausgespült und hier wieder<br />
abgelagert. Und das auch noch der Größe nach sortiert! So<br />
entstanden Lagerstätten mit Kies allerbester Qualität. Kein<br />
Wunder also, dass sich der Raum Marstetten zu einer Art<br />
„Kieskompetenz-Zentrum“ entwickelt hat.<br />
Übrigens:<br />
Echtes Gold gibt es in Oberschwaben wirklich – hergeschwemmt<br />
von den Flüssen aus den Alpen. Die schlechte<br />
Nachricht für Goldgräber: Die Menge des kostbaren Edelmetalls<br />
ist allerdings sehr gering!<br />
Das erste Kies- und Betonwerk entstand hier bereits vor<br />
dem ersten Weltkrieg. Die geförderten Rohstoffe waren<br />
auch für die Bauten der Deutschen Reichsbahn von so großer<br />
Bedeutung, dass diese 1924 das Werk sogar übernahm,<br />
um hier „Eisenbahnkies“ zu fördern, der früher natürlich<br />
per separatem Gleisanschluss abtransportiert wurde. Der<br />
Bauboom nach dem zweiten Weltkrieg brachte eine besonders<br />
starke Nachfrage nach Kies, vor allem aber nach<br />
Betonfertigteilen mit sich.<br />
Weitere Industriebetriebe entstanden, so dass heute nicht<br />
nur ein Sand- und Kieswerk, sondern auch Betonwerke das<br />
Bild der Kiesindustrielandschaft prägen. Im heute in Privatbesitz<br />
befindlichen Betonwerk werden vor allem Trafo- und<br />
Mobilfunkstationen sowie WC-Anlagen für Autobahnparkplätze<br />
hergestellt.<br />
Ortskern Aitrach<br />
51
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
Wasser ist eine große Kraft.<br />
Vor allem, wenn es aus den Alpen kommt!<br />
Bitte nicht verwechseln! Zuerst kommt der Illerkanal, dann<br />
erst die Iller selbst. Doch Kraft haben beide. Und die wurde<br />
und wird auch genutzt.<br />
52<br />
© Florian Blas/Pixelio
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Tannheim 11<br />
Bahn schlägt Iller-Flößer<br />
Zuerst gab es natürlich die Iller. Und ihre Kraft. Und es<br />
gab die Flößer, die auf ihr das Holz aus den waldreichen<br />
Alpen Richtung Donau steuerten. Und das mit 100% regenerativer<br />
Muskel- und Wasserenergie! Fast zumindest<br />
– denn Flößer zu sein war ein harter Job, verbunden mit<br />
einer häufig geringen Lebenserwartung. Doch ihre Waren<br />
wurden dringend gebraucht, beispielsweise in den großen<br />
Donaustädten als Bau- und Brennholz.<br />
Wild war die Iller damals. So wild, dass sie immer wieder ihren<br />
Lauf änderte. Mal spülte sie Land weg, mal brachte sie<br />
neues mit. In diesen dynamischen Lebensräumen konnten<br />
sich viele Arten aus den Alpen bis ins Vorland hinein wagen.<br />
Die meisten von ihnen verschwanden, als die Iller verkürzt<br />
und begradigt wurde. Eine gemeinsame Aktion von Bayern<br />
und Württemberg. Ziel war nicht nur die Bekämpfung<br />
des häufig verheerenden Hochwassers, sondern auch die<br />
Gewinnung von Land für die Landwirtschaft. Die Baustellen<br />
der damals „Iller-Correction“ genannten Eingriffe, vor<br />
allem jedoch der Bau der Bahn von Memmingen nach Ulm,<br />
versetzte der Illerflößerei schließlich den Todesstoß: 1918<br />
war das letzte Floß auf der Iller zu sehen. Denn die Bahn<br />
erwies sich trotz der negativen Energiebilanz als wirtschaftlichere<br />
Alternative.<br />
Königreich Württemberg den Bau von mehreren Laufwasserkraftwerken<br />
und den Bau des Illerkanals. Heute erzeugen<br />
die Kraftwerke an der Iller wie am Illerkanal jährlich<br />
225 Millionen Kilowattstunden Strom, genug für 70.000<br />
Zweipersonenhaushalte. Damit sind sie nach dem Wasserkraftwerk<br />
Rheinfelden das zweitgrößte Kraftwerk für regenerative<br />
Energie in Baden-Württemberg!<br />
Übrigens:<br />
Die Iller bildet zwar die Staatsgrenze zwischen Baden-<br />
Württemberg und Bayern, nicht jedoch die zwischen<br />
Schwaben und Bayern.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Hätten Sie es geahnt? Der Bahnhof Tannheim war früher<br />
Verladebahnhof für „schwäbisches Erdöl“. Das im ca. 10<br />
km entfernten Mönchsrot (bei Rot an der Rot) geförderte<br />
Öl wurde per Rohrleitung nach Tannheim gepumpt und<br />
hier auf Kesselwagen verladen. Danach wurde das Öl per<br />
Bahn nach Ingolstadt in die dortigen Raffinerien gebracht<br />
und weiter verarbeitet. Vom Ende der 1950er Jahre an bis<br />
1995 wurden immerhin ca. 1.770.000 Kubikmeter Erdöl,<br />
das entspricht etwa 29.500 Kesselwagen voller Erdöl gefördert.<br />
Trotzdem war auch diese Menge zu klein, um einen<br />
oberschwäbischen Ölrausch auszulösen ...<br />
„Iller-Energie“ gab und gibt es auch in Form von „Wasserstrom“:<br />
1909 beschlossen das Königreich Bayern und das<br />
Querung des Illerkanals<br />
53
Memmingen – Stadt der Menschenrechte?<br />
Die reiche Altstadt zeigt: Memmingen ist eine bedeutende historische<br />
Stadt. Doch welche Rolle spielen hier die Menschenrechte?<br />
Strecke Kißlegg – Memmingen (KBS 971)<br />
54
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Memmingen 12<br />
Freiheit! Freiheit?<br />
Memmingen, März 1525. Es rumort in Süddeutschland.<br />
Bauernkrieg – die Bevölkerung Memmingens hat sich mit<br />
den Bauern verbündet. Im Zunfthaus der Kramer versammeln<br />
sich etwa 50 Vertreter aller drei oberschwäbischen<br />
Bauerngruppen, des Baltringer-, Allgäuer- und Bodensee-<br />
Haufens. Nach langen Diskussionen werden ihre Forderungen<br />
in Form von „Zwölf Artikeln“ zu Papier gebracht<br />
und beschlossen. Einer davon zielt auf die Abschaffung der<br />
Leibeigenschaft: „... dass wir frei sind und sein wollen ...“.<br />
Sie begründen diese Forderung mit der Gleichheit aller vor<br />
Gott. Diese wie andere Forderungen demonstrieren den<br />
Freiheitswillen, aber auch die Reformbereitschaft des unterdrückten<br />
Standes. In einer für die damalige Zeit gigantischen<br />
Auflage von 25.000 Exemplaren werden die „Zwölf<br />
Artikel“ gedruckt und in ganz Deutschland verbreitet.<br />
Diese für damalige Zeiten äußerst moderne „PR-Aktion“<br />
beweist: Die Bauern sind kein „grober“, unorganisierter<br />
Haufen. Doch die wichtigsten Adressaten der „Zwölf“ Artikel“,<br />
die im „Schwäbischen Bund“ vereinigten Adelshäuser,<br />
sind alles andere als verhandlungsbereit. Sie setzen auf<br />
eine „militärische Lösung“. In mehreren Schlachten werden<br />
die nur unzureichend ausgerüsteten und nicht ausgebildeten<br />
Bauern total aufgerieben. Doch der Hauptmann der<br />
Bundestruppen, der als „Bauernjörg“ bekannt werdende<br />
Georg III. von Waldburg (vgl. Station 8, Leutkirch), kennt<br />
auch nach der Entscheidungsschlacht keine Gnade. Tausende<br />
Bauern werden erschlagen oder auf noch brutalere<br />
Weise hingerichtet. Die Freiheit bekommt keine Chance.<br />
Erst Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sollten die<br />
Bauern endgültig frei werden. Durch die Bauernbefreiung.<br />
Bauern ebnen Boden für das Grundgesetz<br />
Memmingen, März 2000. Der Bundespräsident ist in Memmingen.<br />
In seiner Rede würdigt Johannes Rau die Verdienste<br />
der revoltierenden Bauern um die Menschenrechte: „Die<br />
zwölf Artikel enthalten im Kern die Überzeugung von der<br />
Steuerhaus am Marktplatz<br />
Universalität der Menschenrechte. Mit dieser Überzeugung<br />
weisen sie weit über ihre Zeit hinaus“. Der Historiker Peter<br />
Blickle sieht in der Memminger Bauernversammlung gar<br />
die „erste verfassungsgebende Versammlung auf deutschem<br />
Boden“. Artikel 1 des Grundgesetzes („Die Würde<br />
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen<br />
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. ...“) wird<br />
damit zu einem „fernen Echo“ (Johannes Rau) der Bauernforderungen.<br />
Steuerhaus, © Janina Senkbeil/Pixelio<br />
55
Blick auf Marktplatz, © Stefan/Pixelio<br />
Memmingen<br />
Lernen Sie eine der ältesten Städte<br />
Deutschlands kennen und entdecken<br />
Sie kulturelle Sehenswürdigkeiten<br />
und historisches Flair. Die liebenswerte Altstadt lädt zu<br />
Entdeckungstouren ein. Ehrwürdige Kirchen sowie alte<br />
Bürger- und Patrizierhäuser verleihen der Stadt einen<br />
ganz besonderen Charme. Überzeugen Sie sich selbst!<br />
Stadtinformation Memmingen<br />
Marktplatz 3 <br />
87700 Memmingen <br />
Tel.08331/850-172,-173<br />
Fax.08331/850-178<br />
info@memmingen.de, www.memmingen.de<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Stadtmuseum im Hermansbau – im größten Museum<br />
der Stadt wird in historischen Räumen die Geschichte<br />
Memmingens erläutert<br />
• Heimatmuseum Freudenthal/Altvater – ist eines der 43<br />
vom Bundesinnenministerium anerkannten ostdeutschen<br />
Heimatmuseen<br />
• Antoniter- und Strigelmuseum im Antoniterkloster –<br />
gibt Einblicke in die Schnitz- und Malkunst der Künstlerfamilie<br />
Strigel und in die Arbeit des Klosters<br />
• Antoniter-Kloster – die im Jahr 1996 restaurierte<br />
Anlage des ursprünglich französischen Klosters ist die<br />
besterhaltene und größte dieser Art weltweit<br />
• MeWo-Kunsthalle – zeigt Bilder der Memminger Maler<br />
Max Unold und Josef Madlener sowie wechselnde<br />
Ausstellungen anderer Künstler<br />
• Mittelalterliche Altstadt – bei verschiedenen Stadtführungen<br />
können Sie die zum großen Teil erhaltene<br />
mittelalterlichen Altstadt erkunden<br />
• Kirche Unser Frauen oder auch Frauenkirche – die vermutlich<br />
älteste Kirche wartet mit bedeutenden Fresken<br />
des 15. und 16. Jahrhunderts auf<br />
• Kreuzherrensaal – Saal mit spätbarocker Stuckdecke<br />
• Parishaus – Kunst im einem barocken Palais<br />
Memminger Rathaus, © Stihl024/Pixelio<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Gasthof zum Schwanen, Kalchstr. 27<br />
• Weinstube Weber am Bach, Untere Bachgasse 5<br />
• Ristorante Toscana, Hirschgasse 7<br />
• Grünes Haus, Lindentorstraße 11<br />
• Zur Blauen Traube, Kramerstraße 8<br />
• Las Carretas, Rabenstraße 1<br />
• Restaurant Klösterle, Im Klösterle 1<br />
• Moritz Memmingen, Weinmarkt 6-8<br />
• Adler, Untere Str. 19<br />
• Amendinger Stuben, Obere Straße 24<br />
• Café Auszeit, Augsburger Str. 65<br />
• Café Hampton`s, Marktplatz 16<br />
• Café Martin, Roßmarkt 3-5<br />
56
Bad Wurzach<br />
Leutkirch Aichstetten Marstetten-Aitrach Tannheim (Württ.) Memmingen<br />
Aulendorf Bad Waldsee Alttann Wolfegg Kißlegg Wangen (Allgäu) Hergatz<br />
Memmingen 12<br />
Kramerzunft<br />
Tour 7 (Stadtrundgang)<br />
Unsere Tour beginnt am Bahnhof Memmingen. Von der<br />
Bahnhofsstraße biegen wir nach rechts in die Kalchstraße<br />
und folgen dieser bis zum Marktplatz. Von hier aus<br />
starten wir den Stadtrundgang mit Sehenswürdigkeiten<br />
und historische Bauten.<br />
Dauer der Tour 0:40 Std.<br />
Schwierigkeitsgrad leicht<br />
57
Bad Wurzach<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Radexpress Oberschwaben<br />
VON ALTSHAUSEN NACH PFULLENDORF<br />
Kleine Zeitreise gefällig? Kein Problem – gehen Sie mit dem Radexpress auf Tour.<br />
Und tauchen Sie ein in wild-romantische, von Gletschern geformte Landschaften,<br />
voller Seen und Moore. Tschüss, Alltag. Wir sind dann mal weg ...<br />
Alle Drahtesel an Bord? Dann viel Spaß auf der Fahrt zwischen<br />
Altshausen und Pfullendorf! Denn die stillliegende,<br />
historische Bahnstrecke wird von Mai bis Oktober zu neuem<br />
Leben erweckt. An ausgewählten Sonn- und Feiertagen<br />
reisen Sie bequem durch die idyllische Landschaft Oberschwabens<br />
– und können dabei sogar Ihr Fahrrad kostenlos<br />
mitnehmen. Ausgeschilderte Radwege führen Sie zu<br />
geschichtsträchtigen Orten.<br />
Wussten Sie etwa, dass der „Schwarze Veri“, ein berüchtigter<br />
Räuberhauptmann, ganz clever von der Kleinstaaterei<br />
profitierte? Nachdem er Bauernhöfe um Fleischstücke,<br />
Branntwein und sogar Stiefel erleichtert hatte, floh er einfach<br />
durch die wilden Moorlandschaften. Und überquerte<br />
so flugs eine der vielen Landesgrenzen. Die Ordnungsmacht<br />
hatte das Nachsehen – denn in einem fremden Fürsten-<br />
oder Herzogtum durfte sie nicht zugreifen.<br />
Seitenblick auf die Linzgaulandschaft bei Pfullendorf<br />
Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche, spannende<br />
Geschichten, die sich in der Gegend zwischen Altshausen<br />
und Pfullendorf abgespielt haben. Besuchen Sie den barocken<br />
Stammsitz der Familie Württemberg oder entdecken<br />
Sie Biber, die in Hoßkirch-Königsegg in einem Eiszeitsee<br />
baden. Und dann wartet noch in der Pfullendorfer Altstadt<br />
eines der ältesten Wohnhäuser Süddeutschlands auf<br />
Neugierige. Lassen Sie sich von zahlreichen Ausflugstipps<br />
inspirieren und genießen Sie typisch oberschwäbische<br />
Gastlichkeit!<br />
59
„Mein Name? Württemberg.<br />
Von Württemberg.“<br />
Namensgebend für das „Ländle“: Die herzogliche Familie<br />
von Württemberg. Ihr Schloss in Altshausen dient ihnen<br />
noch heute als Stammsitz. Doch warum?<br />
Altshausen – Pfullendorf (KBS XXX)<br />
60
Bad Wurzach<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Altshausen 13<br />
Eiszeitgrazie trifft barocke Schönheit<br />
9. September 1806: Fahnenwechsel über dem Schloss von<br />
Altshausen. Mehr als 600 Jahre lang wehte hier die Flagge<br />
der Deutschen Ordensritter. Für kurze Zeit muss sie zuerst<br />
der bayerischen, danach für längere Zeit der württembergischen<br />
Fahne weichen. Der Grund dafür heißt Napoleon.<br />
Denn selbst die Schlacht bei Ostrach (vgl. Station 15) konnte<br />
das Vordringen der Franzosen nicht verhindern. Zum<br />
Ausgleich für den Verlust linksrheinischer Gebiete an die<br />
„Grande Nation“ erhalten größere mit Frankreich verbündete<br />
süddeutsche Territorien wie Württemberg und Bayern<br />
kleinere Gebiete zugeschlagen. Darunter auch solche<br />
des Deutschen Ordens, der dazu einfach aufgelöst wird.<br />
Wenig später gelangt Altshausen sogar in den Privatbesitz<br />
des Königs von Württemberg. Das ist einer der Gründe,<br />
warum das auf einer eiszeitlichen Moräne schön gelegene<br />
Schloss bis heute von der Familie Württemberg genutzt<br />
wird. Ein Besuch im Schlosspark und im Schlosshof lohnt<br />
sich also gleich mehrfach – der barocken Schönheit der Anlage<br />
und der Schönheit der Eiszeitlandschaft wegen. Und:<br />
Es kann gut sein, dass Sie sogar die Schlossherren treffen,<br />
wenn sie zu Hause sind.<br />
Übrigens:<br />
Der neben dem Schloss liegende „Alte Weiher“ ist kein<br />
See! Zumindest hier in Oberschwaben nicht. Das gilt auch<br />
dann, wenn vor dem Weiher mal ein See da war.<br />
Schloss Altshausen<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Ein seltener Bahnhofstyp zeigt, dass sich hier zwei Strecken<br />
treffen: Der „Keilbahnhof“ bedient beide gleichermaßen,<br />
weil er wie ein Keil in die spitzwinklig aufeinander stoßenden<br />
Bahnlinien hinein gebaut wurde. Ganz ähnlich übrigens<br />
wie der Bahnhof von Leutkirch. Doch diese Geschichte<br />
wird bei Station 8 erzählt …<br />
Keilbahnhof Altshausen<br />
Altshausen<br />
Diese Gemeinde ist ein wunderbarer<br />
Ausgangspunkt für Erkundungstouren<br />
in alle Himmelsrichtungen.<br />
Die „Schwäbische Barockstraße“ und die schönsten<br />
Wanderrouten sind von hier aus bequem zu erkunden,<br />
sei es zu Fuß, per Rad oder per Bus. Sehr schön und<br />
idyllisch gelegen ist auch der Altshauser „Alte Weiher“<br />
mit gepflegtem Naturfreibad – eine Oase zum Erholen.<br />
Gemeindeinformation Altshausen<br />
Hindenburgstraße 3<br />
88361 Altshausen<br />
www.altshausen.de<br />
61
Altshausen – Pfullendorf (KBS XXX)<br />
Eine Zwergstadt ohne Zwerge,<br />
dafür voller Spuren der Eiszeit!<br />
Hoßkirch ist kein Dorf. Aber auch keine richtige Stadt.<br />
Dafür hat der Ort Eiszeiterlebnisse zu bieten. Für fast alle<br />
Sinne …<br />
62
Bad Wurzach<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Hoßkirch-Königsegg 14<br />
Mit Bibern baden gehen<br />
Die städtisch anmutenden Gebäude am kleinen Marktplatz<br />
zeigen: Hoßkirch ist kein „richtiges“ Dorf. Für eine Stadt<br />
aber ist die Siedlung zu klein. Wie viele andere Städte zu<br />
dieser Zeit wurde auch Hoßkirch von einem Territorialherrn<br />
gegründet, hier 1269 von Abt Hermann von Biechtenweiler,<br />
dem Vorsteher des damals mächtigen Klosters<br />
Weingarten. Und wie auch sonst geschah dies voller<br />
Hoffnung – auf mehr Wirtschaftskraft. Und natürlich auf<br />
mehr Image. Schließlich war ein Territorialherr umso angesehener,<br />
je mehr Städte er auf seinen Gebieten gründen<br />
konnte. Doch in diesem Fall ging keine dieser Hoffnungen<br />
in Erfüllung: Nahe liegende „starke Städte“ wie Pfullendorf<br />
und Saulgau gruben dem neuen „Städtle“ wirtschaftlich<br />
gesehen schnell das Wasser ab. Kein Wunder also, dass<br />
Hoßkirch heute nur eine „Zwergstadt“ ist.<br />
Dafür aber bietet diese Gemeinde eine Eiszeitlandschaft<br />
par excellence: Wie eine Planierraupe hat der Rheingletscher<br />
hier vor 15.000 Jahren große Beckenlandschaften<br />
ausgeschürft. Und den anfallenden Aushub auch gleich<br />
deponiert: direkt vor ihm als girlandenförmige Endmoräne.<br />
Noch heute ist diese leicht an ihrer Waldbedeckung zu erkennen.<br />
Am Ende der Eiszeit jedoch ging dem Gletscher die<br />
Kraft aus. Langsam zog er sich wieder in Richtung Alpen<br />
zurück. Immerhin schaffte er es, noch eine zweite, kleinere<br />
„Moränengirlande“ aufzubauen, so dass sein dazwischen<br />
liegendes Schmelzwasser nicht abfließen konnte. Seen entstanden<br />
wie der Königseggsee oder der Vorsee des Pfrunger-Burgweiler<br />
Riedes. Dieser ist mittlerweile zu einem der<br />
schönsten und größten oberschwäbischen Hochmoore geworden.<br />
Doch dafür bietet der Königseggsee, auch Hoßkircher<br />
See genannt, bis heute das Erlebnis, in einem echten<br />
„Eiszeitsee“ zu baden. Übrigens gemeinsam mit Bibern!<br />
Seitenblick<br />
Achtung Grenze! Die württembergisch-hohenzollerische<br />
(preußische) Grenze kommt kurz nach dem Bahn-km<br />
12+200. An der darüber liegenden Straße zeugt noch heute<br />
ein Grenzstein davon. Auf seiner Ostseite trägt er die<br />
Inschrift „KW“ (Königreich Württemberg), an seiner Westseite<br />
„H“ (Hohenzollern).<br />
Freibad Königseggsee<br />
Bahnhof Hoßkirch-Königsegg<br />
Biber, © ich/Pixelio<br />
63
Altshausen – Pfullendorf (KBS XXX)<br />
„Dreiländergemeinde“.<br />
Und Stätte einer großen Schlacht<br />
Die Gemeinde Ostrach besteht aus Orten aller<br />
drei hier früher zusammentreffenden Staaten.<br />
Doch das war nicht der Grund für die „Schlacht<br />
bei Ostrach“<br />
64
Bad Wurzach<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Ostrach 15<br />
Uralte Endmoräne hilft beim Kämpfen<br />
Ostrach 1799. Mit lautem Schreien und unter starkem<br />
Feuer ihrer Kanonen greifen österreichische Soldaten ihre<br />
französischen Gegner an. Nach heftigem Ringen treiben<br />
sie diese schließlich zurück. Erzherzog Carl kann zumindest<br />
diese Schlacht für sich entscheiden. Doch der Preis ist hoch:<br />
Mehr als 4.000 Tote bleiben auf dem Ostracher Schlachtfeld<br />
liegen. Und auch dieser „Sieg“ vermag die Franzosen<br />
nicht an ihrem Vordringen in Südwestdeutschland zu hindern<br />
(vgl. Station 13).<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Heimatmuseum – die Schlacht bei Ostrach wird hier<br />
lebendig.<br />
• Grenzsteinmuseum mit Freilichtanlage in Ostrach-<br />
Burgweiler – drei Länder, eine Gemeinde!<br />
• Buchbühldenkmal – das 1903 errichtete Denkmal<br />
erinnert an die Kämpfe vom 21. März 1799. Von hier<br />
aus erhält man einen schönen Blick über Ostrach.<br />
Zu verdanken hat Erzherzog Carl sein Schlachtenglück auch<br />
der Eiszeitlandschaft, vor allem dem Endmoränenwall, von<br />
dem aus seine Artillerie die Franzosen wirkungsvoll beschießen<br />
und seine ungarischen Husaren sie gut angreifen<br />
konnten. Dem Schlachtenführer war dies sehr bewusst,<br />
schließlich hatte er die Landschaft „bei dem Dorfe Osterach“<br />
vor der Schlacht gezielt dafür ausgesucht. Dieser<br />
Ort sei dafür „der günstigste“. Manch einen flüchtenden<br />
Soldaten rettete damals übrigens ein großes Moorgebiet.<br />
Doch diese Geschichte wird an Station 16 erzählt …<br />
Bahnhof Ostrach<br />
Brücke über die Ostrach<br />
Seitenblick<br />
Vorsicht Grenze! Die hohenzollerisch (preußisch)-badische<br />
Grenze kommt kurz nach km 17, wenige Meter vor dem<br />
Bahnhof des heute zu Ostrach gehörenden Ortsteils Burgweiler.<br />
Grenzsteinmuseum Burgweiler<br />
65
Altshausen – Pfullendorf (KBS XXX)<br />
(Fast) eine Insel,<br />
aber wo ist der See?<br />
Im Gegensatz zum Königseggsee<br />
ist der Burgweiler-Pfrunger<br />
See heute verschwunden. Doch<br />
nicht nur Inseln bezeugen seine<br />
frühere Existenz<br />
66<br />
Bild: Montage
Bad Wurzach<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Burgweiler 16<br />
Flucht durchs Moor<br />
Die namensgebende Burg von Burgweiler lag auf einer<br />
richtigen Insel: Es ist das mineralische Eiland einer Moränenkuppe,<br />
10 m hoch und umringt von Moor. Kein Wunder,<br />
dass die Burg als schwer einnehmbar galt. Denn vom<br />
Weiler aus war sie nur über einen schmalen Knüppeldamm<br />
zu erreichen.<br />
Nach dem Zurückschmelzen des Gletschers vor 10.000 Jahren<br />
war diese Kuppe eine Insel in einem echten See. Dieser<br />
aus Schmelzwasser gespeiste See lag in einem vom Gletscher<br />
ausgeschürften Becken, das vom Endmoränenwall<br />
beim heutigen Ostrach bis in das Gebiet des heutigen Wilhelmsdorf<br />
reicht. Doch im Unterschied zum Königseggsee<br />
verlandete dieser Burgweiler-Pfrunger See vollständig. Und<br />
wurde zum Burgweiler-Pfrunger Ried, der zweitgrößten<br />
Moorlandschaft Oberschwabens.<br />
Moore sind heute ganz besonders wichtige Landschaften<br />
und dienen u.a. als Refugium für „Eiszeitrelikte“, also<br />
Pflanzen und Tiere, die im heutigen Klima selten geworden<br />
sind. Seit langem schon waren sie auch Rückzugsgebiet<br />
für den Menschen, in Kriegen für flüchtende Soldaten<br />
oder auch für Räuber. Der berühmteste unter ihnen, der<br />
„Schwarze Veri“, profitierte bei seinen Fluchten aber auch<br />
vom hiesigen Dreiländereck. Kaum hatte er in einem Land<br />
einen Überfall durchgeführt, floh er auf kurzem Weg ins<br />
Nachbarland. Selbst wenn er von Gendarmen verfolgt<br />
wurde, reichte ihm ein kleiner Vorsprung zum Entkommen<br />
aus. Denn ein Nachsetzen ausländischer Polizisten über die<br />
Grenzen hinweg, wie heute im Schengenraum, war damals<br />
streng verboten! Doch einmal, nur einmal, war er nicht<br />
schnell genug. Aber diese Geschichte wird bei Station 4<br />
erzählt …<br />
Übrigens:<br />
Auf den Mooren verlandeter Eiszeitseen wurden früher öfters<br />
Gewässer mit einem künstlichen Wall aufgestaut, um<br />
die Wassermenge zu vergrößern. Ein Beispiel ist der „Alte<br />
Weiher“ in Altshausen (vgl. Station 13).<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Ausblick auf den Einschnitt hinter Burgweiler:<br />
Ein Tag im März 1945, es ist kurz nach 15 Uhr. Langsam<br />
schnaubend fährt der Dampfzug von Pfullendorf in Richtung<br />
Burgweiler. Plötzlich passiert es kurz vor dem Weiler<br />
Hahnennest: Der 13-jährige Schüler Wilhelm Megerle aus<br />
Jettkofen sieht Flugzeuge auftauchen! Bange Angstsekunden<br />
vergehen, schließlich hatten die alliierten Piloten ihr<br />
Kommen mit Flugblättern angekündigt: „Wir sind die lustigen<br />
Acht, wir kommen bei Tag und Nacht“.<br />
Glücklicherweise scheint der Zug vor Angriffen bestens<br />
geschützt, verläuft doch die Bahntrasse kurz<br />
vor Hahnennest in einem 500 m langen Einschnitt,<br />
die den Moränenzug „Spitz“ vom „Fohrenbühl“ abtrennt.<br />
Doch der Lokführer leitet die Bremsung zu<br />
spät ein. Damit wird der Bremsweg länger als geplant:<br />
Erst nach dem Einschnitt kommt der Zug zum Stehen.<br />
Beherzt tritt ein zufällig mitfahrender Soldat die Türen ein.<br />
Die Fahrgäste stürzen aus dem Zug und werfen sich flach<br />
auf den schneebedeckten Bahndamm. Keine Sekunde zu<br />
früh, denn aus allen Rohren feuernd nähern sich die Tiefflieger!<br />
Gott sei Dank kommen keine Personen zu Schaden.<br />
Der Dampfkessel der Lokomotive aber wird so schwer<br />
getroffen, dass eine Weiterfahrt unmöglich ist. Die Bahnreisenden<br />
flüchten zu Fuß über die verschneite Moränenlandschaft.<br />
Kaum einer wird dieses Erlebnis jemals wieder<br />
vergessen können.<br />
Auch in anderen Fällen boten solche Einschnitte in der<br />
Landschaft Schutz vor Angriffen ähnlicher Art. Zu verdanken<br />
sind sie dem eiszeitlichen Gletscher, dessen Endmoräne<br />
sich hier wie ein Querriegel der Bahnlinie bei deren Bau<br />
entgegen stellte. Sie musste daher an mehreren Stellen<br />
mittels Einschnitten gequert werden. Beim Abschnitt „Roßlauf“<br />
kurz vor Pfullendorf wurde deshalb sogar der Bau<br />
eines Tunnels erwogen, aufgrund des schwierigen Baugrundes<br />
jedoch wieder verworfen. Heute sind diese steilwandigen<br />
Einschnitte zu wertvollen Biotopen geworden.<br />
Viele Steilwände in den Einschnitten bieten darüber hinaus<br />
einen Blick auf den geologischen Untergrund – als Fenster<br />
in die Erdgeschichte.<br />
67
Was Pfullendorf mit Neapel verbindet<br />
Die mittelalterliche Altstadtsilhouette beweist: Pfullendorf<br />
ist eine Stadt. Und was für eine!<br />
Altshausen – Pfullendorf (KBS XXX)<br />
68
Bad Wurzach<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf Pfullendorf 17<br />
Das „Sumpfdorf“ wird freie Reichsstadt<br />
2. Juni 1220: Nur wenige Monate vor seiner Krönung zum<br />
Kaiser in Rom erhebt Friedrich II. das „Dorf am Phoul“,<br />
also am Sumpf oder Ried, zur königlich-staufischen<br />
Stadt. Vielleicht eine strategische Tat, schließlich ist Friedrich<br />
II. kein gebürtiger Schwabe, sondern waschechter<br />
Italiener aus der Nähe von Ancona. Und darüber hinaus<br />
noch Herrscher von Sizilien. Da spielen die Alpenpässe<br />
und der Schutz ihrer Zugangswege durch ihm ergebene<br />
Städte eine ganz besondere Rolle! Diesem „ersten<br />
Europäer“ verdanken viele Städte und Hochschulen<br />
ihre Gründung – wie zum Beispiel die Universität von<br />
Neapel. Noch heute trägt sie den Namen des Herrschers,<br />
„Federico II“, und im Siegel sein Bild.<br />
Eine gewisse Weltläufigkeit prägt bis heute die Mentalität<br />
der Pfullendorfer. Schließlich wurde ihre freie Reichsstadt<br />
erst 1803 badisch. Und das auch nur wegen… richtig, Napoleon.<br />
Denn wie Bayern und Württemberg, so wurde auch<br />
Baden für seine Verbundenheit zu diesem Korsen mit Territorien<br />
freier Reichsstädte belohnt, die wie der Deutsche<br />
Orden dazu erhoben wurden (vgl. Station 13).<br />
Die Bedeutung ihrer Geschichte zeigt sich in der Altstadt<br />
mit ihren vielen Schätzen. Kein Wunder also, dass hier eines<br />
der ältesten Häuser Süddeutschlands steht, ein Bürgerhaus<br />
alemannischer Bauart aus dem Jahr 1317. Doch das ist<br />
nicht die einzige Perle in diesem pittoresken Ensemble.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Erstaunen beim Ausstieg: Kein Bahnhof! Und der Kilometerstein<br />
zeigt hier 16,5 km. Nach Altshausen sind es<br />
aber rund 24 km. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um<br />
badische Kilometer der früheren Strecke Schwackenreute<br />
– Pfullendorf, gemessen ab dem Ausgangsbahnhof. Im<br />
Einschnitt „Rosslauf“ kurz vor Pfullendorf wechselt die<br />
Zählweise: Hier zeigt ein Kilometerstein in der Nähe des<br />
Abzweigs zum Alno-Werk 23,4 württembergische Kilometer<br />
der Strecke Altshausen-Pfullendorf, ebenfalls gemessen<br />
ab dem Ausgangsbahnhof. Die Schwackenreuter Bahn<br />
wurde ziemlich genau 100 Jahre nach ihrer Eröffnung<br />
Haltepunkt in Höhe des Stadtgartens<br />
stillgelegt, und zwar 1983. Auch der Bahnhof Pfullendorf<br />
wurde später abgehängt: Seit 2009 ist er ohne Gleisanlagen<br />
und kann so auch nicht mehr aus Richtung Altshausen<br />
angefahren werden. Als Ersatz wurde 2011 ein Haltepunkt<br />
in Höhe des Stadtgartens am Streckenendpunkt<br />
angelegt. Von der Schwackenreuter Bahn sind nur<br />
wenige Reste erhalten, vor allem längere Abschnitte<br />
des Bahndamms. Heute bilden diese brachliegenden<br />
Flächen ein wichtiges Rückgrat für die regionale Biotopvernetzung.<br />
69
Oberes Tor<br />
Abenteuer-Golf im Seepark<br />
Pfullendorf<br />
Mitten im herrlichen Linzgau liegt die<br />
ehemalige freie Reichsstadt Pfullendorf.<br />
Die historische Altstadt mit ihren liebevoll<br />
restaurierten Fachwerkhäusern ist zu jeder Jahreszeit<br />
einen Besuch wert. Als geschichtsträchtiger Ort<br />
verbindet Pfullendorf heute Historie, Gegenwart und<br />
Zukunft gleichermaßen.<br />
Ferienregion Nördlicher Bodensee<br />
Tourist-Information Pfullendorf<br />
Kirchplatz 1, 88630 Pfullendorf<br />
Tel. 07552/25 11 33<br />
tourist-information@stadt-pfullendorf.de<br />
www.pfullendorf.de<br />
70<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Seepark Linzgau – lockt mit schönen Spazierwegen,<br />
verschiedenen Spielplätzen und einer Wassererlebniswelt<br />
für Kinder<br />
• Heimat- und Handwerksmuseum „Bindhaus“ – gehörte<br />
dem Pfullendorfer Spital und diente als Fruchtspeicher<br />
• Museum der Stadtgeschichte Pfullendorf – eines der<br />
ältesten Wohnhäuser Süddeutschlands<br />
• Das Obere Tor von 1505 – ist das Wahrzeichen der<br />
Stadt und die schönste Doppeltoranlage im Bodenseegebiet<br />
• Städtische Galerie „Alter Löwen“ – zeigt wechselnde<br />
Ausstellungen verschiedener hauptsächlich einheimischer<br />
Künstler<br />
• Das Alte Haus oder Schoberhaus – das bislang ungenutzt<br />
leer stehende Kulturdenkmal gilt als eines der<br />
ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser Süddeutschlands<br />
Historische Altstadt<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Deutscher Kaiser, Am Alten Spital 1<br />
• Flairhotel Adler, Heiligenberger Straße 20<br />
• Felsenkeller, Heiligenberger Straße 20<br />
• Pizzeria Ristorante Positano, Überlinger Straße 5<br />
• Restaurant Odysseus, Hauptstraße 21
Bad Wurzach<br />
Reaktivierung in Planung<br />
Bad Waldsee<br />
Aulendorf<br />
Altshausen Hoßkirch-Königsegg Ostrach Burgweiler Pfullendorf<br />
Pfullendorf 17<br />
Freibad im Seepark Linzgau<br />
Tour 8<br />
Wir starten am Bahnhof Pfullendorf. Von der Franz-Xaver-Heilig-Straße<br />
biegen wir rechts in die Paul-Heilig-<br />
Straße und von dort links ins die Sigmaringerstraße.<br />
Weiter nach rechts in die Otterswangerstraße und dann<br />
links in den Litzelbacherweg. Diesem folgen wir ca.<br />
1 km bis zum Seepark Linzgau.<br />
Von dort führt uns der Wanderweg entlang des Nordoder<br />
Südufers zum Ausgang West bis Gaisweiler. In der<br />
Dorfmitte rechts halten und leicht ansteigend die Richtung<br />
nach Bethlehem einschlagen. Dann die Kreisstraße<br />
queren und über die Burraumühle sowie die Kläranlage<br />
zum Kloster Wald mit der Barockkirche St. Bernhard<br />
wandern. Rückweg über Bethlehem, Vorderstock und<br />
Hundesportplatz zurück zum Seepark Linzgau.<br />
71
.<br />
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf<br />
Bad Waldsee<br />
Radexpress Oberschwaben<br />
VOn bad waLdsee nach bad wURZach<br />
Nein, den Roßberg müssen Sie nicht mit dem Fahrrad hochschnaufen! Das erledigt<br />
der Radexpress für Sie. Nicht nur bei Sonderfahrten ist der Schienenverkehr äußert<br />
praktisch – er war es auch lange Zeit für den Transport von Kies und Torf.<br />
Endlich! Am 20. Juni 1904 wird die Bahnstrecke nach<br />
Wurzach feierlich eröffnet. Die Freude ist groß: 36 Jahre<br />
lang hatten die Wurzacher für einen Bahnanschluss<br />
gekämpft. Besonders wichtig sollen die dampfenden und<br />
schnaufenden Eisenrösser für den Transport von Torf werden.<br />
Den gibt es in Hülle und Fülle im Wurzacher Ried, dem<br />
größten noch intakten Hochmoor Mitteleuropas. Bis 1996<br />
wurde Badetorf dort abgebaut – heute ist das nicht mehr<br />
erlaubt. Denn diese faszinierende Urlandschaft wurde mit<br />
dem Europadiplom als Naturschutzgebiet von internationaler<br />
Bedeutung ausgezeichnet.<br />
Durchs verwunschene Ried geht es zu Fuß auf Bohlenpfaden<br />
auf Entdeckungstour. Oder, ganz bequem, mit der<br />
kleinen originellen Torfbahn. Seltene Pflanzen gibt es zu<br />
entdecken wie beispielsweise Wollgras, Sumpfrosmarin<br />
oder Torfmoos. Und wer Glück hat, sieht vielleicht auch ein<br />
paar Grasfrösche und Erdkröten vorbeihüpfen!<br />
Riedsee Bad Wurzach<br />
Mit barocker Pracht lockt die Altstadt von Bad Wurzach.<br />
So versetzt etwa die opulente Decke im Wurzacher Schloss<br />
die Besucher in himmlische Sphären. Wunderschön ist auch<br />
die Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg, von wo aus man<br />
bei klarer Sicht das Alpenpanorama bewundern kann.<br />
Wer das Gebiet mit allen Sinnen entdecken möchte, fährt<br />
auf schönen Radwegen bis nach Leutkirch. Oder taucht ein<br />
in den jahrtausendealten Schatz aus den Mooren. Lesen Sie<br />
mehr dazu auf den folgenden Seiten!<br />
73
Die Roßberger Steige.<br />
Und das Wahrzeichen der Allgäubahn ...<br />
Ursprünglich war der kleine Ort Roßberg nur eine Ausweichstation<br />
der Allgäubahn. Doch 1904 wurde er zum „echten“<br />
Bahnhof. Mit dem Bau der damaligen Roßbergbahn nach Bad<br />
Wurzach. Nicht nur deren Steige erzählt Eiszeitgeschichten.<br />
Auch das Wahrzeichen der Allgäubahn. Doch wo ist das?<br />
74
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
zentralen Teil der Alpen. Wie er mit den anderen, kleinen<br />
Gesteinsblöcken hierher kam, ist noch heute ein Rätsel.<br />
Übrigens: In der Familie eines der ersten Roßberger Bahnhofsvorstände<br />
wurde 1871 eine Frau geboren, von deren<br />
Sohn man noch viel hören sollte: Wilhelmine Brecht. Die<br />
Mutter von Berthold Brecht.<br />
Roßberger Steige: nur mit guten Bremsen!<br />
Es ist der 12. November 1960, ein Samstag. Noch bevor er<br />
vom Bahnhof Roßberg aus zu sehen ist, kann man ihn hören:<br />
der vormittägliche „GmP“ (Güterzug mit Personenbeförderung)<br />
aus Bad Wurzach. Mit stampfenden Geräuschen<br />
erscheint er dann auf der Kuppe. Langsam fährt er auf die<br />
Rampe der Roßberger Steige, bergab auf den Bahnhof<br />
Roßberg zu. Da plötzlich passiert es: Der Versuch des Lokführers<br />
zu bremsen, misslingt. Nahezu in voller Fahrt rast<br />
der Zug den Hügel herunter, auf den Bahnhof zu. Erst der<br />
Prellbock am östlichen Bahnhofsende bringt den Zug dann<br />
durch Entgleisen zum Stehen. Zwei der fünf Reisenden und<br />
der Lokführer werden leicht verletzt – Glück im Unglück!<br />
In der Tat hat es die Roßberger Steige in sich: Mit einer<br />
maximalen Steigung von immerhin 1:35 überwindet die<br />
Bahnstrecke hier eine große wallartige Hügelkette. Es ist<br />
die Endmoräne der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit. Sie<br />
Der mächtige Findling am Bahnhof von Roßberg<br />
markiert die größte Ausdehnung des Rheingletschers vor<br />
ca. 20.000 Jahren. Gleichzeitig bildet sie die europäische<br />
Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Und ausgerechnet<br />
hier hinauf mussten und müssen auch heute<br />
noch besonders schwere Züge fahren. Denn Roßberg war<br />
immer schon ein wichtiger Umschlagplatz für verschiedene<br />
Rohstoffe. Wie etwa für das Holz aus den Allgäuer<br />
Moränewäldern – doch auch noch für andere Schätze.<br />
Auf der folgenden Seite lernen Sie einen davon kennen.<br />
Die Nähe zur Endmoräne zeigt auch das „Wahrzeichen der<br />
Allgäubahn“, so formuliert es zumindest der Geowissenschaftler<br />
Oscar Fraas im Jahr 1880. Zu finden sei sie am<br />
„Eingang zur Station“. Dieses Wahrzeichen ist zwar hinter<br />
einem Holzschuppen gelegen, dennoch ist es von den<br />
Gleisanlagen aus in Fahrtrichtung Kißlegg gut zu sehen.<br />
Haben Sie „es“ oder besser „ihn“ entdeckt? Zu übersehen<br />
ist er nicht – ein mächtiger Findling, ein Gneis aus dem<br />
Seitenblick<br />
Gleich hinter der Steige erreicht die Bahn eine Schotterebene,<br />
mit einer herrlichen Aussicht auf die Alpen jenseits<br />
des Ortes Molpertshaus. Grubenartige Geländemulden in<br />
der Nähe der Bahntrasse (z. B. hinter Mennisweiler links<br />
in Höhe Baumgruppe) weisen auf einen wichtigen Allgäurohstoff<br />
hin: Kies.<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Kleiner Ort ganz groß! Noch heute hegen manche Philatelisten<br />
einen großen Schatz. Aus einer Zeit, als die Bahn<br />
auch große Bedeutung für die Post hatte und man noch<br />
Briefe direkt in einen Briefkasten eines Bahnpostwagens<br />
geben konnte. Abgestempelt wurden diese dann mit einem<br />
speziellen Bahnpoststempel. Eine besondere Rarität ist<br />
der Bahnpoststempel der früheren Roßbergbahn. Neben<br />
der Zugnummer sind Ausgangs- (Wurzach) und Endpunkt<br />
(Roßberg) der Strecke angegeben.<br />
75
Vom oberschwäbischen Gold<br />
Oberschwaben und das Allgäu sind „anders“. Das zeigt sich<br />
nicht zuletzt an ihrem besonderen „Gold“, das kurz hinter<br />
dem Bahnhof Roßberg verladen wird ...
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
Grauer Kies ist Gold wert<br />
Der mitgebrachte Moränenschutt ist es, der während und<br />
nach dem Rückzug des Gletschers von seinen Schmelzwässern<br />
zu dem umgewandelt wurde, was man durchaus als<br />
„oberschwäbisches Gold“ bezeichnen kann: Kies. Keine<br />
Straßen, Brücken oder Hochhäuser wären denkbar ohne<br />
diesen Schatz der Eiszeit, handelt es sich doch um den<br />
wichtigsten Rohstoff für Beton. Ein bedeutendes Kiesabbaugebiet<br />
liegt gleich in der Nähe, jenseits des bewaldeten<br />
Moränenwalls: Molpertshaus. Von dort aus wird der geförderte<br />
Kies zur Bahnverladestelle am Roßberger Bahnhof<br />
transportiert, gelegen an einem separaten Anschlussgleis<br />
(auf Höhe Bahn-km 46,4 in Fahrtrichtung links). Hier wird<br />
er in spezielle Kieswaggons verladen und nach Kressbronn<br />
am Bodensee zur Weiterverarbeitung transportiert. Doch<br />
Kiesvorkommen sind auch noch in anderer Hinsicht wichtig:<br />
Sie sind hervorragende Grundwasserspeicher und damit<br />
möglicherweise unsere Trinkwasserlieferanten von morgen.<br />
Den Konflikt zwischen Grundwasserschutz und Kiesabbau<br />
zu lösen, ist nicht einfach. Diese Aufgabe hat übrigens die<br />
bei vielen noch recht unbekannte Regionalplanung. Und<br />
das ist beileibe nicht ihre einzige Herausforderung ...<br />
Übrigens: Kies war und ist natürlich auch für die Bahn<br />
selbst ein wichtiger Rohstoff. Doch diese Geschichte wird<br />
an Station 10 erzählt.<br />
Kieszug an der Verladeanlage in Roßberg<br />
77
Das Wurzacher Ried<br />
Größtes Hochmoorgebiet<br />
Mitteleuropas!<br />
...doch was hat das mit der Bad Wurzach-Bahn zu tun?
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
Historische Ansicht der Torfbahn<br />
Brenntorf setzte Lokomotiven unter Dampf<br />
Auf der Höhe von Bad Wurzach, vor ca. 20.000 Jahren.<br />
Kalte Phasen wechseln mit etwas wärmeren. Dazu kommt<br />
mal mehr, mal weniger Schnee. Das Eis des Rheingletschers<br />
reagiert auf diese Klimawechsel, in dem er mal vorstößt,<br />
mal sich zurückzieht. Doch seit einigen Jahrhunderten ist es<br />
sehr kalt. Dazu kommen schneereiche Winter. Kein Wunder<br />
also, dass der Gletscher immer gewaltiger wird und sich<br />
ausbreitet. Er ist so mächtig, dass er die Kraft hat, große<br />
Wannen aus der Landschaft auszugraben. Wie eine Planierraupe<br />
schiebt er dabei Gesteinsmaterial vor sich her und<br />
häuft sie zu einem großen Berg auf. Ein Zungenbecken inklusive<br />
einem Endmoränenwall ist entstanden! So wie hier<br />
im Raum Bad Wurzach schürfte der Rheingletscher in Oberschwaben<br />
zahlreiche Zungenbecken aus. In ihnen bildeten<br />
sich nach dem klimabedingten Rückzug dieses Gletschers<br />
zuerst Stauseen. Denn das Schmelzwasser konnte zwischen<br />
den Endmoränenwällen der vorletzten (Risseiszeit) und der<br />
letzten (Würmeiszeit) nicht ohne weiteres abfließen. Später<br />
verlandeten diese Seen teilweise, einige sogar vollständig.<br />
Die Wasserpflanzen wurden aufgrund der Nässe nicht zersetzt,<br />
so dass sich Torf bilden konnten. Vor allem die hier<br />
relativ hohen Niederschläge ließen die Torfmoose schnell in<br />
die Höhe wachsen. Ein Hochmoor entstand.<br />
Bis 1956 wurde Brenntorf im Wurzacher Ried gewonnen,<br />
bis zu dieser Zeit ein bedeutender Rohstoff zum Heizen,<br />
Kochen und auch Befeuern von Bahnlokomotiven. Badetorf<br />
für die oberschwäbischen Kurorte wurde hier sogar<br />
bis 1996 abgebaut. Heute ist hier die Torfge-<br />
Wurzacher Ried<br />
winnung aus Gründen des Naturschutzes eingestellt.<br />
Denn trotz des teilweise sogar industriellen<br />
Torfabbaus blieben die Eingriffe des Menschen in das<br />
Wurzacher Ried so begrenzt, dass es immer noch als das<br />
größte zusammenhängende natürliche Hochmoor Mitteleuropas<br />
gilt. Mit Tieren und Pflanzen, die es andernorts<br />
kaum mehr gibt: Insekten fressende Pflanzen wie der Sonnentau<br />
haben sich ideal an die Nährstoffarmut des Hochmoors<br />
angepasst. Die ist im Zentrum des Moors so groß,<br />
dass hier selbst kleinere Bäume keine Chance mehr haben,<br />
wachsen zu können. Eine Besonderheit sind Eiszeitrelikte<br />
– Tiere oder Pflanzen, die hier seit dem Ende der letzten Eiszeit<br />
vor ca. 12.000 Jahren alle nachfolgenden Warmzeiten<br />
überdauert haben. Ob diese Organismen jedoch noch weitere<br />
tausend Jahre hier überleben können, ist angesichts<br />
der aktuellen Klimaänderung fraglich ....<br />
Bei dieser Art von Schätzen ist es kein Wunder, dass diese<br />
Landschaft bereits 1989 mit einem Europadiplom des<br />
Europarates ausgezeichnet wurde: als eine der ersten<br />
Landschaften Baden-Württembergs von besonderer europäischer<br />
Bedeutung.<br />
Seitenblick<br />
Schon von weitem sind sie zu sehen: Die beiden imposanten<br />
Industrietürme der Glasfabrik. Was Glas mit Eisenbahnen<br />
und Moor zu tun hat? Auf der nächsten Seite werden<br />
Sie es erfahren ...<br />
79
Torf: Gut zum Heizen und zum Baden.<br />
Aber nicht nur ...<br />
Torf war nicht nur für den täglichen Hausgebrauch da. Auch<br />
zum Betrieb spezieller Lokomotiven war er wichtig. Und<br />
sogar zur Herstellung von Glas. Wie das?
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
Überreste des Haidgauer Torfwerks<br />
Eine heiße Angelegenheit<br />
Es ist ein sonniger Sommertag im Jahr 1920. Mittagszeit.<br />
Im Hochmoor des „Wurzacher Rieds“ ist nur leise das Sirren<br />
der Mücken zu hören. Einzig eine Libelle macht mit<br />
lautem Schwirren auf sich aufmerksam. Plötzlich rattert es<br />
gewaltig. Voll beladen mit Torf fährt eine kleine Feldbahn<br />
zuckelnd aus dem Moorgebiet hinaus. Nach kurzer Zeit endet<br />
die Fahrt ca. 200 m nordöstlich der heutigen Glasfabrik<br />
im „Zeiler Torfwerk“– ursprünglich gegründet vom Fürst<br />
von Waldburg-Wurzach. Hier wird der Torf weiter verarbeitet.<br />
Auf die fertigen Torfblöcke wartet bereits ein Zug der<br />
Roßbergbahn, in den der Torf verladen wird. Ungeduldig<br />
schnaubend wartet die Lokomotive auf die Abfahrt. Ihr spezieller<br />
Tender, das ist der Waggon hinter der Lok mit den<br />
Brennstoffvorräten, ist besonders hoch und mit Ladeklappen<br />
ausgestattet. Denn kein Funken darf von der Lok in den<br />
Tender gelangen – fährt die Lok doch nicht (nur) mit Kohle,<br />
sondern mit einem Brennstoff der besonderen Art: Torf.<br />
In der Tat wurde nicht nur im Moorgebiet Tann bei Aulendorf<br />
„Bahntorf“ abgebaut (vgl. Station 1), sondern auch<br />
im Wurzacher Ried und auch in der Nähe des Bahnhofs<br />
von Hergatz (vgl. Station 7). Doch die Bahn war nicht nur<br />
Torfverbraucher, sondern auch Torftransporteur – mithilfe<br />
des Anschlusses der Torfwerke an die Roßbergbahn konnte<br />
Brenntorf überregional abgesetzt werden. Torf war es auch,<br />
der die Glasfabrik nach Bad Wurzach lockte. Zwar wurden<br />
durch Verbrennung von Torf nicht die benötigten hohen<br />
Temperaturen zur Glasherstellung erreicht. Aber mit einem<br />
Trick gelang es: durch die Umwandlung von Torf in Gas.<br />
Allerdings war die Energieausbeute dabei trotzdem noch<br />
sehr gering, so dass die heutige Saint Gobain Oberland AG<br />
nach dem Krieg bald auf Erdöl zum Erreichen der hohen<br />
Temperaturen umsteigen musste. Doch dank Eiszeit, Torf,<br />
vor allem aber Dank der heutigen Saint Gobain Oberland<br />
AG, der Stadt Bad Wurzach und dem Landkreis Ravensburg<br />
gibt es sie noch, die Roßbergbahn, heute Bad Wurzach<br />
Bahn genannt. Auch wegen des Güterverkehrs, der vor allem<br />
die Rohstoffe zur Glasherstellung nach Bad Wurzach<br />
transportiert, darunter jede Menge Sand und Soda! Die<br />
Strecke selbst gehört der Stadt, die Betriebskosten werden<br />
unter allen Partnern aufgeteilt. Doch die Signale stehen seit<br />
der Inbetriebnahme des Radexpress Oberschwaben für den<br />
Personenverkehr wieder auf „freie Fahrt“.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Das <strong>Oberschwäbische</strong> Torfmuseum ist in den Originalgebäuden<br />
des früheren Oberrieder bzw. Zeiler Torfwerks untergebracht<br />
und bietet alle Informationen rund um Torfabbau<br />
und Torfverarbeitung. Eines der Highlights: Die Fahrt<br />
mit der historischen Torfbahn hinein in das Riedgebiet.<br />
Infos unter www.torfbahn.de<br />
Auf dem Torflehrpfad im Wurzacher Ried<br />
81
(Moor-) baden im Barock<br />
Kein Wunder: Bad Wurzach als „Hauptstadt“ des<br />
Wurzacher Rieds ist das älteste Moorheilbad Baden-<br />
Württembergs. Doch als ehemalige Residenzstadt<br />
hat es durchaus noch andere Kostbarkeiten zu<br />
bieten ...
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
Vollbad im schwarzen Gold<br />
Der Eingang zum Wurzacher Schloss scheint bescheiden:<br />
eine einfache Holztür. Mit einem leisen Knarren öffnet sie<br />
sich. Doch der Anblick dahinter ... lässt einem den Atem<br />
stocken: Ein von barocken Gemälden und Stuckverzierungen<br />
überquellendes Treppenhaus. Sie stehen im vielleicht<br />
schönsten barocken Treppenhaus der Welt!<br />
Nicht nur dieser Geheimtipp macht die Altstadt von Bad<br />
Wurzach zur Attraktion. Auch das Stadtbild selbst mit den<br />
sanften Pastellfarben verführt zu einer Zeitreise in die barocke<br />
Vergangenheit. Auch außerhalb der Altstadt locken<br />
barocke Highlights wie die Klosterkirche „Zum heiligen<br />
Kreuz“ der Salvatorianer auf dem Gottesberg oder die<br />
Rokoko-Hauskapelle im Kloster Maria Rosengarten, die als<br />
„schönste Hauskapelle der Welt“ gilt. Diese sehenswerte<br />
Ausstattung kommt nicht von ungefähr, war diese Stadt<br />
doch viele Jahre lang auch Residenzstadt – und zwar die<br />
der Adelsfamilie von Waldburg-Wurzach.<br />
Doch nicht alle, die zur Barockzeit in Wurzach lebten, durften<br />
sich am Wohlstand der Stadt erfreuen: Das Leprosenhaus<br />
vor den Toren der Altstadt beherbergte die Aussätzigen,<br />
denen das Betreten der Stadt strengstens verboten<br />
war. Immerhin fanden sie hier in einem Spital ein Obdach<br />
und eine gewisse Pflege. Nicht zuletzt dank den Mooren<br />
ist Bad Wurzach heute eine der wichtigsten Kurstädte<br />
Oberschwabens. So wurden im Kloster Maria Rosengarten<br />
bereits 1936 die ersten Moorbäder verabreicht. Heute<br />
können Sie das „schwarze Gold“ noch viel intensiver<br />
genießen, beispielsweise im nostalgischen Holzzuber mit<br />
Riedambiente ...<br />
Eisenbahnnostalgie<br />
Hören die Schienen tatsächlich seitlich vor dem Empfangsgebäude<br />
des Bahnhofs auf? Heute ja, beim Bau der Bahnli-<br />
Moorbad im Vitalium<br />
nie natürlich nicht, denn schließlich sollten die Fahrgäste ja<br />
bequem vom Zug zum Empfangsgebäude und umgekehrt<br />
wechseln können.<br />
Obwohl die Bahnhofsgleise heute fehlen, ist vom früheren<br />
Flair noch einiges zu spüren. So ist etwa das Gebäudeensemble<br />
auf der Vorderseite des Empfangsgebäudes erhalten<br />
geblieben, wie auch die frühere Bahnhofsrestauration<br />
(jetzt Jugendhaus). Sogar die Baumallee gibt es noch, eine<br />
der wenigen im Stadtbereich von Bad Wurzach.<br />
83
Bad Wurzach<br />
Leprosenhaus<br />
Schloss Wurzach<br />
Vitalium Bad Wurzach<br />
Bad Wurzach<br />
Moor, Thermal und Natur pur – der<br />
traditionsreiche Allgäuer Kurort Bad<br />
Wurzach ist weithin bekannt für seine<br />
ausgezeichneten Kur- und Wellnessangebote<br />
und die einmalige Naturlandschaft des<br />
Wurzacher Rieds. Ob drei Tage oder drei Wochen, ein<br />
Aufenthalt in Bad Wurzach ist immer eine Wohltat für<br />
Leib und Seele.<br />
Bad Wurzach Info<br />
Rosengarten 1<br />
88410 Bad Wurzach<br />
Tel.: 07564 302150<br />
Fax.: 07564 302154<br />
www.bad-wurzach.de<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Barocktreppenhaus des Bad Wurzacher Schlosses –<br />
die elegant geschwungene Treppe und das schöne<br />
Deckenfresko gelten als eines der Juwele der <strong>Oberschwäbische</strong>n<br />
Barockstraße<br />
• Gesundheits- und Wellnessoase Vitalium –<br />
hier können Sie die Seele baumeln lassen und sich<br />
vom Alltag erholen<br />
• Leprosenhaus mit Sepp Mahler Museum – das<br />
sorgsam restaurierte Leprosenhaus, die Geburtsstätte<br />
Sepp Mahlers, ist heute ein Museum<br />
• Rokoko Hauskapelle im Kloster Maria Rosengarten –<br />
hier wurden die ersten Moorbäder verabreicht<br />
• Katholische Pfarrkirche St. Verena – die Kirche erhebt<br />
sich über dem Kurhaus am Kurpark<br />
Einkehrmöglichkeiten<br />
• Höhencafé im Kurhotel am Reischberg, Karl-Wilhelm-<br />
Heck-Straße 12<br />
• Museumswirtschäftle Zum Wurzelsepp, Dr.-Harry-<br />
Wiegand-Str. 4<br />
• Italienische Bar – Gelateria Aldo, Parkstr. 2<br />
• Casa Rossa, Ravenburgerstr. 2<br />
• Dudelsack Pils- und Steakbar, Marktstraße 26<br />
• Ristorante Pizzeria La Fontana, Weberweg 14<br />
• Pizzeria Ristorante da Roberto, Mühltorstr. 11<br />
• Kurhaus am Kurpark, Kirchbühlstr. 1<br />
• Schwarzer Bären, Marktstr. 33<br />
• Gasthaus Ochsen, Herrenstraße 3<br />
84
Bad Wurzach<br />
Pfullendorf Burgweiler Ostrach Hoßkirch-Königsegg Altshausen Aulendorf Bad Waldsee<br />
Bad Wurzach 18<br />
Sonnentau<br />
Tour 9<br />
Wir starten am Bahnhof Bad Wurzach. Von der Bahnhofstraße<br />
laufen wir nach rechts in die Biberacherstraße<br />
und über einen linken Schwenker nach links in die<br />
Markstraße. Dann biegen wir nochmals links in die<br />
Kirchbühlstraße ab und laufen bis zum Kurhaus. Vom<br />
Kurhaus gehen wir durch den schönen Kurpark ins<br />
angrenzende Naturschutzgebiet Wurzacher Ried. Der<br />
Weg überquert die Bundesstraße 465, folgt nach dem<br />
Riedsee rechts dem Torflehrpfad und führt, vorbei am<br />
Stuttgarter See, durch das Ried in Richtung Haidgau.<br />
Beim Gehöft Riedschmiede lohnt sich ein Abstecher zur<br />
Aussichtsplattform an den Achquellseen. Zurück gehen<br />
wir über das Ziegelbacher Ried auf dem ursprünglichen<br />
Weg zum Kurpark und Kurhaus.<br />
KBS 752<br />
85
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Geschichte der<br />
Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
86<br />
Dampf über dem Schienenstrang – ein Güterzug verlässt im November 1975 den Bahnhof Altshausen
Die Schwäbische Eisenbahn –<br />
Schienen vom Neckarstrand an DAS Schwäbische Meer<br />
Die Suche nach den Ursprüngen der Schienenwege im<br />
Allgäu führt uns in behagliche biedermeierlichen Zeiten<br />
zurück. 1842 errechnete der in württembergischen Staatsdiensten<br />
stehende Straßenbau-Inspektor Seeger die Baukosten<br />
für eine Pferdebahn von Ferthofen über Leutkirch<br />
und Wangen nach Friedrichshafen mit 74.000 Gulden „je<br />
Stunde“, viel Geld für rund 3,7 km einfache Kutschenbahn.<br />
Weitere 6.030 Gulden „je Stunde“ hätten die notwendigen<br />
Pferde, Schienenkutschen und Frachtwagen gekostet. Die<br />
Idee der Pferdebahn mag zu dieser Zeit im Allgäu hoch im<br />
Kurs gestanden haben, doch bestimmten die Beamten im<br />
„Unterland“ den Lauf der Geschehnisse.<br />
Zwei Jahre nach dem Baubeschluss im Jahre 1843 für eine<br />
Dampf-Eisenbahn von Stuttgart an den Bodensee fuhr<br />
1845 der erste Eisenbahnzug von Cannstatt nach Esslingen<br />
am Neckar. Da man zeitgleich den Eisenbahnbau vom<br />
Bodensee und von der Landeshauptstadt über die Schwäbische<br />
Alb nach Ulm vorantrieb, konnte bereits 1850 der<br />
durchgehende Verkehr von Stuttgart bis Friedrichshafen<br />
aufgenommen werden. Der bis 1853 gebauten Stammbahn<br />
von der nördlichen Landesgrenze bei Bretten bzw.<br />
Heilbronn über Stuttgart und Ulm nach Friedrichshafen<br />
folgten weitere Ergänzungen: 1853 der Anschluss an das<br />
bayerische Eisenbahnnetz in Neu-Ulm, 1861 eine Bahn von<br />
Cannstatt über Aalen bis nach Wasseralfingen mit Verlängerung<br />
im Jahre 1863 ins bayerische Nördlingen, 1862<br />
bis 1869 Strecken im nördlichen Landesteil nach Jagstfeld,<br />
Crailsheim und Bad Mergentheim. Als 1869 der Schienenstrang<br />
die Landesgrenze bei Tuttlingen erreicht hatte, war<br />
die Bahnverwaltung schon eifrigst dabei, die bedenkliche<br />
„Nordlastigkeit“ des Eisenbahnnetzes durch zusätzliche<br />
Bahnlinien südlich der Schwäbischen Alb auszugleichen.<br />
Eine Kutsche auf Schienen – mit diesen<br />
Pferdebahnwagen sollten die Fahrgäste<br />
durch das Allgäu reisen<br />
87
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Joseph von Schlierholz –<br />
Ein Leben für die Eisenbahn und die Baukunst<br />
Wie in vielen Regionen und Städten Württembergs sprachen<br />
sich nach den ersten Bewährungsjahren der Schwäbischen<br />
Eisenbahn auch in Oberschwaben örtliche Gruppen<br />
für einen Anschluss an das neue Verkehrsmittel aus. Für<br />
die Beamten in den Stuttgarter Amtsstuben war es kein<br />
leichtes Unterfangen, die teilweise sehr unterschiedlichen<br />
Wünsche der Eisenbahn-Vereine zu bündeln. In diesen Situationen<br />
war das Verhandlungsgeschick von Oberbaurat Joseph<br />
Schlierholz gefordert. Der 1817 in Biberach an der Riß<br />
geborene Techniker und Architekt zählte zum „Urgestein“<br />
der Schwäbischen Eisenbahn, denn er war bereits 1845 in<br />
die Bauverwaltung der Staatseisenbahnen eingetreten.<br />
Postkartenansicht des Bahnhofs Bad Wurzach nach der Eröffnung im Jahr 1904<br />
1862 wurde nach seinen Plänen das Bahnhofsgebäude in<br />
Tübingen errichtet und an der Donautalbahn zwischen Ulm<br />
und Blaubeuren von ihm die ersten nur aus Beton gegossenen<br />
Bahnwärterhäuschen erbaut, damals eine bautechnische<br />
Sensation. Der Baustil der Bahnhofsgebäude und der<br />
Bahnwärterhäuschen an der Allgäubahn trägt die Handschrift<br />
eines erfahrenen Architekten, der es meisterhaft verstanden<br />
hat, die Zweckbauten der Eisenbahn in die Land-<br />
schaft einzufügen. In späteren Jahren arbeitete Schlierholz<br />
als Architekt auch für andere amtliche Stellen. Aus dieser<br />
Zeit stammt ein Musterentwurf für eine „Irrenanstalt“ und<br />
der Bau des Physiologischen Instituts der Universität Tübingen.<br />
Vom württembergischen König Karl erhielt Oberbaurat<br />
Josef Schlierholz als Lohn für sein umfangreiches Arbeitsleben<br />
einen Adelstitel verliehen.<br />
88
Verkehrsader von der Donau bis zum FuSS der Alpen<br />
In seiner Funktion als zuständiger Projektbearbeiter entwarf<br />
Josef Schlierholz für Oberschwaben ein ganzes Netz waren. 1869 verkehrten die ersten Züge zwischen Waldsee<br />
und Herbertingen durch einen Schienenstrang verbunden<br />
von Eisenbahnstrecken mit einem zentralen Verknüpfungspunkt<br />
in der bisher einsamen Bahnstation Aulendorf an später konnte man schon von Waldsee weiter nach Kiß-<br />
über Aulendorf und Saulgau nach Herbertingen, ein Jahr<br />
der Südbahn Ulm – Friedrichshafen. Von dort aus sollten legg fahren und 1872 hatte die Schienenspitze Leutkirch<br />
die Bahnen ins Allgäu bis nach Isny und in der westlichen erreicht. Nach weiteren zwei Jahren dampften die Züge<br />
Richtung bis ins badische Pfullendorf und ins hohenzolle- auch bis zur Endstation Isny.<br />
rische Sigmaringen führen, wo die gleichfalls von Schlierholz<br />
geplante Donautalbahn aus Richtung Ulm anschließen Die oberschwäbische Hügellandschaft entsprach kaum<br />
Der Bau dieser Bahnen verlief nicht ohne Komplikationen.<br />
sollte. Dem 1865 für die Allgäubahnen in Stuttgart erlassenen<br />
Eisenbahngesetz folgte eine längere Planungs- und ideal“ der Eisenbahnplaner. Im Allgäu galt es zwischen den<br />
dem geraden oder nur leicht geschwungenen „Schönheits-<br />
Bauzeit, bis in mehreren Zwischenetappen die Zielorte Isny grünen Wiesen und den tief eingeschnittenen Bachtälern<br />
eine Trasse zu finden, bei der sich der bauliche Aufwand mit<br />
dem späteren Betrieb der Bahn gut vertragen konnte. Die<br />
überall anzutreffenden Torflager erschwerten zusätzlich die<br />
Bauarbeiten, denn auf schwankendem Torfboden kann keine<br />
Bahn sicher fahren. Den nassen Torf durch geschüttete<br />
Kiesdämme zu ersetzen war eine schweißtreibende Aufgabe.<br />
Doch was sich für den Bau als hinderlich erwies, bildete<br />
gleichzeitig die Grundlage für den Betrieb der neuen Strecke<br />
von der Donau bis an den Fuß der Alpen.<br />
Königliche Eisenbahner des Bf Waldsee um 1900 Stationsvorsteher des Bahnhofs Leutkirch um 1914<br />
89
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Torf –<br />
die heimische Kohle für die Dampfrösser oBerschWABens<br />
Als die ersten Lokomotiven der Schwäbischen Eisenbahn<br />
mit ihren Rauchfahnen die Bahndämme einhüllten, befand<br />
sich die Industriegesellschaft des Königreiches mitten im<br />
„Hölzernen Zeitalter“. Es gab keine verwertbaren Kohlevorkommen<br />
im Lande. Und wenn sich ein Unternehmer<br />
eine Dampfmaschine leistete, dann kostete es ihn ein<br />
Vermögen, die nötigen Kohlen auf Rhein und Neckar heranzuschaffen.<br />
Wohlweislich lautete deshalb die Bauvorgabe<br />
für die ersten Dampflokomotiven der Schwäbischen<br />
Eisenbahn: Es muss auch mit Holz und Torf geheizt werden<br />
können! Ab 1850 verfeuerten die Lokomotiven zwischen<br />
Ulm und Friedrichshafen teils heimisches Holz, teils auch<br />
Torf – und man fuhr ganz gut damit. 20 Jahre später, als<br />
die ersten Züge über die Allgäubahn rollten, gestaltete sich<br />
der süddeutsche Brennstoffmarkt keineswegs besser: Kohle<br />
aus dem Saargebiet war in Ulm immer noch so teuer, dass<br />
es billiger war, oberschwäbischen Torf in die Feuerkessel der<br />
Lokomotiven zu legen. Die durch den Bau der Allgäubahn<br />
erschlossenen Torflager wurden nun als Brennstoff für die<br />
Lokomotiven genutzt. In der Nähe von Aulendorf errichtete<br />
die Eisenbahnverwaltung ein bahneigenes Torfwerk, das<br />
den Hauptteil des Bedarfs befriedigte. Größere Mengen<br />
kaufte die Staatseisenbahn auch von privaten Torfstechern<br />
mit Abbaustellen bei Schussenried und Saulgau. Große<br />
Schuppen dienten auf der zum Eisenbahnknoten aufgewerteten<br />
Dorfstation Aulendorf zur trockenen Lagerung der<br />
„Allgäuer Kohle“.<br />
Der gegenüber Kohlen deutlich geringere Heizwert des<br />
Torfs erforderte an den Lokomotiven bauliche Änderungen.<br />
Statt eines offenen Kohlenwagens hing an den oberschwäbischen<br />
Torflokomotiven ein besonderen Torfvorratswagen.<br />
Dieser war mit hohen Wänden und einem Dach versehen,<br />
um den empfindlichen Brennstoff gegen Nässe zu schützen.<br />
Der bei Holz- und Torffeuerung unvermeidliche Funkenflug<br />
musste durch einen bauchigen Torfschornstein mit<br />
einer Einrichtung zum Funkenlöschen unterbunden werden.<br />
Südlich der Donau gab es bis zur Jahrhundertwende<br />
in Oberschwaben und im bayerischen Voralpenland nur<br />
ganz wenige Dampflokomotiven mit Kohlefeuerung; der<br />
überwiegende Teil aller Personen- und Güterzüge zwischen<br />
Donau, Bodensee und Chiemsee wurde von Lokomotiven<br />
mit Torffeuerung gezogen. Die einzige Ausnahme waren<br />
die schweren Schnellzüge auf der Hauptstrecke zwischen<br />
Stuttgart und Salzburg, darunter auch der berühmte Orient-<br />
Express.<br />
Und weil der Schwäbischen Eisenbahn seit jeher der Ruf der<br />
sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit anhaftet, sei<br />
an dieser Stelle auch verraten, dass so manches einstmals<br />
stolze Dampfross seine letzten Tage im Allgäu nutzbringend<br />
verlebte. Wenn das Zügle von Kißlegg nach Wangen<br />
von Lokomotiven mit den Namenstafeln „Stuttgart“ oder<br />
„Ludwigsburg“ gezogen wurde, dann war dies der beste<br />
Beweis schwäbischer Handwerkskunst. Denn hinter der<br />
„Stuttgart“ und der „Ludwigsburg“ verbargen sich die ersten<br />
in Württemberg gebauten Dampflokomotiven, die nach<br />
zahllosen Fahrten auf der Hauptstrecke nun nach gründlicher<br />
Modernisierung im Allgäu „aufgebraucht“ wurden.<br />
Die Dampflokomotive mit dem Namen „Saulgau“ hingegen<br />
war ein echter Oberschwabe, gebaut 1869 von der Maschinenfabrik<br />
Esslingen am Neckar für die Güterzüge auf der<br />
Allgäubahn.<br />
90
Dampflokomotive WOLFEGG der Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen mit Torffeuerung<br />
91
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Geisterbahnhöfe für den internationalen Verkehr<br />
In ihren Verhandlungen mit dem benachbarten Großherzogtum<br />
Baden hatte die württembergische Regierung auch<br />
das Projekt einer Bahnverbindung zwischen Ulm und Basel<br />
ins Gespräch gebracht. Beide Seiten einigten sich auf eine<br />
Linienführung, die vom badischen Radolfzell ausging und<br />
Verknüpfungspunkte mit dem württembergischen Netz in<br />
Mengen bzw. Sigmaringen an der Donautalbahn und in<br />
Pfullendorf zur Allgäubahn vorsah. Die mit einem Staatsvertrag<br />
besiegelte Bahnverbindung zwischen Aulendorf<br />
und Pfullendorf ging 1875 in Betrieb; sie bildete die Fortsetzung<br />
der schon 1873 eröffneten badischen Bahn von<br />
Radolfzell über Schwackenreute nach Pfullendorf. Die beiden<br />
Bahnverwaltungen hegten zu Beginn große Hoffnungen<br />
bezüglich einer „internationalen“ Bedeutung dieser<br />
Strecke; man sah in ihr ein wichtiges Glied der Verkehrsachse<br />
zwischen Süddeutschland und der Schweiz. Aber<br />
bald stellte sich heraus, dass beide Seiten sich bei diesem<br />
Projekt gründlich verschätzt hatten. Die opulenten Bahnhofsbauten<br />
– Beispiele hierfür sind die Bahnhöfe Hoßkirch-<br />
Königsegg und Schwackenreute – waren für das bescheidene<br />
Verkehrsaufkommen einer einfachen Nebenbahn von<br />
Letzte Fahrt – Dampflokomotive der Baureihe 051 im Bahnhof Leutkirch 1975<br />
nur lokaler Bedeutung viel zu groß.<br />
92
Die Wangener kAlamität und der Neid des nAchbarn<br />
Etwas anders sah die Situation am südlichen Streckenast<br />
der Allgäubahn aus. Die alte Reichsstadt Wangen wurmte<br />
es gewaltig, dass sie beim Bau der Allgäubahn bisher ohne<br />
direkten Anschluss geblieben war. Nach vielen Eingaben<br />
erklärte sich die Bahnverwaltung bereit, mit einer kurzen<br />
Stichbahn nach Kißlegg die Wangener „Kalamität“ aus der<br />
Welt zu schaffen. Dem gesetzlichen Baubeschluss im Jahre<br />
1876 folgten vier Jahre mit umfangreichen Bauarbeiten,<br />
erschwert durch die besonderen geologischen Untergrundverhältnisse<br />
mit sehr wasserreichen, schlüpfrigen Gesteinsschichten<br />
und den Bau des Ratzenrieder Viadukts über die<br />
Argen. Als 1880 der erste Zug in Wangen einfuhr, war dies<br />
Postkartensicht des Bahnhof Leutkirch um 1900<br />
der Stadt die Ehrenbürgerschaft des Erbauers der Strecke<br />
Joseph Schlierholz wert. Und dies, obwohl der Bahnhof nur<br />
eine bessere Baracke war. Der schlichte Bretterbau hatte<br />
jedoch seinen tieferen Sinn, weil Bahnverwaltung und Stadt<br />
schon zu diesem Zeitpunkt einer Verlängerung der Bahn bis<br />
ins bayerische Hergatz im Auge hatten.<br />
In der östlichen Richtung harrte man in Leutkirch immer<br />
noch einer Verbindung nach Memmingen, die bei Ferthofen<br />
die Landesgrenze zwischen Württemberg und Bayern überschreiten<br />
sollte. In den Amtsstuben der bayerischen Eisenbahnverwaltung<br />
dachte man mit Sorgenfalten an die Auswirkungen<br />
dieser Verbindung. Sie hätte nämlich zusammen<br />
mit einer Verlängerung der Wangener Bahn nach Hergatz<br />
eine neue durchgehende Verbindung zwischen Augsburg<br />
bzw. München und Lindau geschaffen. Diese neue Strecke<br />
durch das württembergische Ausland wäre trotz ihrer<br />
kurvenreichen Linienführung wesentlich kürzer gewesen<br />
als die bayerische Allgäubahn von Buchloe über Kempten<br />
an den Bodensee. Nach längeren Verhandlungen stimmte<br />
Bayern dann doch dem Bau der Bahnen von Leutkirch nach<br />
In schneller Fahrt durch Kißlegg<br />
Memmingen und von Wangen nach Hergatz zu; sie wurden<br />
1889 und 1890 eröffnet. Die von Bayern befürchtete Verlagerung<br />
des Fernverkehrs auf die württembergische Seite<br />
trat durch eine geschickte Fahrplangestaltung nicht ein;<br />
unbequeme Anschlussverbindungen in Memmingen und<br />
in Hergatz verhinderten, dass die württembergischen Allgäubahn<br />
keine Konkurrenz für ihr bayerisches Gegenstück<br />
bilden konnte.<br />
93
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Allgäuer Verhältnisse –<br />
die Sorgen der Bahnverwaltung und die Nöte der fAhrgäste<br />
1880 machte sich die Bahnverwaltung in Stuttgart Gedanken<br />
wegen der Rentabilität der Bahnen im Allgäu. Man<br />
hatte viel (Steuer-)Geld in die Schienenstränge zwischen<br />
Donau und Argen verbaut, doch der bescheidene Personenverkehr<br />
und die transportierten Güter brachten zu<br />
wenig Einnahmen, um die Einstufung als Haupt-Eisenbahn<br />
zu rechtfertigen. Die Abwertung zur Nebenbahn gestattete<br />
ab 1880 Betriebsvereinfachungen und Einsparungen<br />
beim Bahnbewachungspersonal. Die zunehmend lauter<br />
werdenden Stimmen nach weiteren Erschließungsbahnen<br />
versuchte die Bahnverwaltung durch neue Verkehrskonzepte<br />
zu besänftigen. Der Versuch, mit Schmalspurbahnen den<br />
94<br />
Flur aus 1875 im Bahnhof Burgweiler um 1965 Großer Bahnhof – Besuch der württembergischen Königin in Saulgau
abseits der Hauptbahnen liegenden größeren Orten eine<br />
Anschluss an den Weltverkehr zu verschaffen, wurde nach<br />
einigen gebauten Bahnen wieder aufgegeben. Das „Öchsle“<br />
zeugt noch heute als Museumsbahn von dieser Epoche.<br />
Auch die Pläne für eine Schmalspurbahn von Tannheim<br />
nach Ochsenhausen verschwanden wieder in den Archiven.<br />
Nur für einen Anschluss der Gemeinde Wurzach an die<br />
Allgäubahn bei Roßberg konnte sich die Bahnverwaltung<br />
erwärmen. Das ursprünglich für schmale Spur geplante<br />
Projekt wurde mit normaler Spurweite im Jahre 1904 in<br />
Betrieb genommen.<br />
Ungeachtet aller Sparsamkeit blieb die Allgäubahn ein<br />
Sorgenkind der Bahnverwaltung. Mit vier bis fünf Zügen<br />
am Tag in jede Richtung war zwar ein gewisses Grundbedürfnis<br />
an Mobilität befriedigt. Doch weil die Bahnverwaltung<br />
jeden zusätzlichen Zugkilometer scheute, bestanden<br />
die meisten Verbindungen im Fahrplan aus sogenannten<br />
„Gemischten Zügen“. Elegant gekleidete Städter und<br />
Amtspersonen fuhren 2. Klasse, weil es sich auf gepolsterten<br />
Sitzplätzen angenehmer reiste; einfache Bauernknechte<br />
und mit Körben und Schachteln beladenen Marktleute<br />
begnügten sich mit der „Holzklasse“. Diese wurde 1907<br />
nochmals vereinfacht: die drittklassigen „körpergerechten“<br />
Lattenbänke wurden durch glattgehobelte Holzbretter der<br />
4. Klasse ersetzt. Ungeachtet dieses bescheidenen Komforts<br />
hatte man es im Allgäu mit den luftigen Durchgangswagen<br />
besser als auf vielen anderen Bahnen des Kaiserreiches,<br />
wo sich das Volk in enge Abteile im überkommenen<br />
Postkutschen-Format zwängen musste. Doch auch mit dem<br />
schwäbischen Großraumwagen war das reisende Publikum<br />
mitunter überfordert, wie aus der Frage eines älteren Weibleins<br />
an den Schaffner zu entnehmen ist: „Herr Kondukteur<br />
– an welchem Wagenende soll ich aussteigen? – Antwort<br />
des Uniformierten: „Des isch egal; der Wagen hält an beiden<br />
Enden!“<br />
Die andere Hälfte des typischen Allgäubahn-Zuges bestand<br />
aus Gütern aller Art. Im Gepäckwagen verstauten die Ladeschaffner<br />
große Koffer und eilige Expressgüter wie zum<br />
Beispiel die runden Schweizer Käse aus Allgäuer Milch. Ein<br />
besonderer gedeckter Güterwagen diente der Beförderung<br />
der schwergewichtigen Stückgüter. Nicht zu vergessen der<br />
Postwagen: In ihm sortierten die flinke Hände der württembergischen<br />
Bahnpostbeamten die aufgegebenen Briefe in<br />
viele Fächer, um dann in Aulendorf säckeweise ihre Fracht<br />
an die Kollegen in den Anschlusszügen zu übergeben und<br />
neue Postsendungen für das Allgäu einzuladen. Zusätzlich<br />
wurden bei Bedarf weitere beladene und leere Güterwagen<br />
den Zügen angehängt. Dieses zeitaufwendige Gütergeschäft<br />
war in den Fahrzeiten schon mit eingebaut, weshalb<br />
die Fahrgäste der Allgäubahn vor allem eines mitbringen<br />
mussten: viel Geduld!<br />
95
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Ein LückenbüSSer als Ur-Ahn<br />
des modernen Schienenverkehrs<br />
Doch mitunter wurde die Geduld des reisewilligen Publikums<br />
Parallel zur motorisierten Kutsche rüstete Daimler auch<br />
auch überstrapaziert. Noch zu königlich-württember-<br />
einige Schienenfahrzeuge mit seinem Benzinmotor aus.<br />
gischen Zeiten wurde lauthals nach mehr Zugverbindungen Darunter befand sich auch ein Straßenbahnwagen. Dieser<br />
zwischen den kleineren Amtsstädten und den umliegenden war aber für die steigungsreichen Strecken im Stuttgarter<br />
Dörfern gerufen. Wie es sich für eine sparsame, aber dennoch<br />
Stadtgebiet doch etwas zu schwach auf der Motor-Brust,<br />
fortschrittliche Bahnverwaltung gehörte, wurden Mit-<br />
weshalb man die Versuche mit diesem Benzin-Triebwagen<br />
tel und Wege gefunden, um diesem Missstand abzuhelfen. auf den Gleisen der Schwäbischen Eisenbahn fortsetzte.<br />
Möglich macht dies ein Mechaniker mit dem Namen Gottlieb<br />
Warum ausgerechnet die Allgäubahn den Vorzug erhielt,<br />
Daimler. Er befasste sich im Allgäu-fernen Cannstatt erste Einsatzstrecke eines Motor-Triebwagens zu werden,<br />
mit Experimenten an neuartigen Benzinmotoren. Einmal verschließt sich dem Kundigen. Dass jedoch der Daimlerins<br />
Laufen gebracht, baute der findige Mechanikus Daimler Triebwagen zwischen Saulgau und Riedlingen verkehrte,<br />
seine Motoren sogleich in allerlei Verkehrsmittel ein. Das ist durch den Fahrplan belegt. Dem rauhen Alltagsbetrieb<br />
Fahrgestell einer Pferdekutsche wurde auf diese Weise mit zeigte sich die neueste Motortechnik durchaus gewachsen.<br />
einem Benzinmotor „automobil“ gemacht – und somit Ab 1904 füllten neue in Saulgau und Kißlegg stationierten<br />
zum Stammvater aller Kraftfahrzeuge mit einem Stern am Benzin-Triebwagen die Fahrplanlücken auf der Allgäubahn.<br />
Kühlergrill. Dass dieses erste Kunstwerk automobiler Technik<br />
Somit sind die Daimler-Triebwagen die Ur-Form des heutigen<br />
in der Lokomotivabteilung der Maschinenfabrik Esslingen<br />
Triebwagenverkehrs. Auch wenn der Kraftstoff für den<br />
entstand, sei nicht nur am Rande vermerkt. Die Zusammenarbeit<br />
Motor heutzutage Diesel ist, hat sich das Grundkonzept<br />
dieser Maschinenfabrik mit Gottlieb Daimler war von damals nur unwesentlich verändert: 1 motorgetriebe-<br />
der Auslöser für eine Entwicklung, die den Schienenverkehr ner Personenwagen + 1 Wagenführer = preiswerter Eisenbahnbetrieb<br />
auch im Allgäu prägen sollte.<br />
mit mehr Verbindungen im Fahrplan.<br />
Allgäuer Bauer beim Fahrplanstudium<br />
96
Auf die Dauer waren die Benzin-Triebwagen zu leistungsschwach,<br />
um auch bei den Wetterbedingungen<br />
der strengen Allgäuer Winter störungsfrei zu fahren. In<br />
dieser Situation setzte die Bahnverwaltung auf die bewährte<br />
Dampf-Technik, aber nun in verbesserter Form. In der<br />
Maschinentechnischen Abteilung der Stuttgarter Generaldirektion<br />
hatte der Obermaschinenmeister Eugen Kittel<br />
einen leistungsfähigen Dampferzeuger entwickelt, der sich<br />
bestens für Triebwagen eignete. Die nach ihm benannten<br />
Kittel-Dampftriebwagen ersetzten die Benzintriebwagen<br />
und waren bis zum Ausbruch des I. Weltkrieges fester<br />
Bestandteil des Verkehrsangebotes auf der Allgäubahn.<br />
Personenzug mit bester Aussicht – Schienenbus im Bahnhof Leutkirch 1975<br />
97
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Unruhige Zeiten mit ungeliebten AbteilWAGen<br />
und besonderen Zügen für Rindviecher<br />
Der I. Weltkrieg bewirkte eine Zäsur; in der Gesellschaft, Unternehmen formte: die Deutsche Reichsbahn. Unter<br />
in der Wirtschaft und auch für die Allgäubahn. Statt Personenzügen<br />
verkehrten Truppentransportzüge an die Front, der Allgäubahn. Statt Torflokomotiven wurden nun mit<br />
dem Zwang der unruhigen Zeiten wandelte sich das Bild<br />
und mit zeitlicher Verzögerung in umgekehrter Richtung die Kohle gefeuerte Lokomotiven vor die Züge gespannt und<br />
Verwundetenzüge zu den über das Land verteilten Lazaretten.<br />
Gesellschaft und Wirtschaft zeigten Mangelerscheigestrichen.<br />
Die schwäbischen Großraumwagen mussten<br />
der Fahrplan auf wenige Hauptverbindungen zusammennungen,<br />
in bester Weise erkenntlich auch am Fahrplan, der den ungeliebten Abteilwagen weichen, weil es in Preußen<br />
sich zusehends ausdünnte. Durch die Revolution verlor zuviele dieser Gattung gab. Das Publikum war wenig begeistert<br />
von dieser neuen Art des Reisens. Bei jedem Halt<br />
das Land den König und die Staatseisenbahn ihr Prädikat<br />
„königlich“. Gebeugt von der Schuldenlast, verkaufte das wurden die Abteiltüren von den platzsuchenden Reisenden<br />
Land wie alle anderen deutschen Staaten seine Bahnen auf dem Bahnsteig aufgerissen, was im Winter nicht gerade<br />
an das Reich, das aus der Hinterlassenschaft ein neues Freudenstürme bei den schon im Abteil Sitzenden auslöste.<br />
Erst Mitte der dreißiger Jahre zeigten sich bescheidene<br />
Ansätze einer Modernisierung. Mit Dieseltriebwagen versuchte<br />
die Reichsbahn, dem Kostendruck gegenzusteuern.<br />
Es blieb bei wenigen Fahrten; der überwiegende Teil der<br />
Züge wurde auf der Hauptstrecke Herbertingen – Aulendorf<br />
– Memmingen und auf den Nebenbahnen wie bisher mit<br />
Dampflokomotiven bespannt. Diese waren zwar etwas moderner<br />
als die alten Torflokomotiven, doch stecken in ihrer<br />
Bauart immer noch viel von den früheren königlichen Ei-<br />
Weinlieferung im Bf Wangen um 1910 Versand von neuen Mistwagen um 1955<br />
98
Pendelgüterwagen für Stückgüter<br />
ein ausgeklügeltes System von besonderen Viehzügen reiste<br />
das Allgäuer Viehzeug ins Unterland, um dort die Kochtöpfe<br />
der Stuttgarter Industriearbeiter zu füllen.<br />
Entgegen allen Visionen der Machthaber im nun großen<br />
Deutschen Reich blieb die Bahn das Rückgrat des Verkehrs<br />
in allen Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen. Daran änderte<br />
auch der Ausbruch des II. Weltkrieges nichts. Mehr<br />
denn je war die Bevölkerung auf die Schienenstränge angewiesen.<br />
Spürbar betroffen vom Krieg wurde die Allgäubahn<br />
erst ab 1943, als die ersten Bomben auf Bahnhöfe fielen.<br />
Spätestens Mitte 1944 war an einen geregelten Bahnbetrieb<br />
kaum noch zu denken. Angriffe von feindlichen Flugzeugen<br />
auf einzelne Züge und Bombenabwürfe auf Bahnsenbahnen<br />
der Länder Württemberg, Preußen oder Bayern.<br />
Es gab immer noch gemischte Züge mit langen Aufenthalten<br />
durch das Rangieren der Güterwagen. Entgegen<br />
allen Vorstellungen war der Transport von Milch auf der<br />
Allgäubahn nie ein großes Geschäft. Dieses Frachtgut war<br />
zu empfindlich, um einen langen Transport in die größeren<br />
Städte ohne Schaden zu überstehen. Größere Bedeutung<br />
hatten jedoch die Produkte der Allgäuer Käsereien. Für<br />
die Milchwirtschaft hatte man einen täglich verkehrenden<br />
Eilgüterzug mit Personenbeförderung eingeführt, um Käse,<br />
Butter und andere leichtverderbliche Waren schnell ans Ziel<br />
zu befördern.<br />
Dreh- und Angelpunkt der Viehwirtschaft war der Viehzug<br />
nach Stuttgart. Einmal in der Woche füllten sich auf den<br />
größeren Bahnhöfen die Ladegleise mit Viehzeug, das die<br />
Landwirte der Umgebung zum Verkauf den Großhändlern<br />
anboten. Dem Feilschen um einen für Bauer und Viehhändler<br />
annehmbaren Preis folgte der per Handschlag geschlossene<br />
Verkaufsvertrag, womit das Schicksal der Kuh oder des<br />
Schweins besiegelt war: Ab in den Güterwagen zur Fahrt<br />
mit anderen Artgenossen in den Stuttgarter Viehhof. Über<br />
höfe machten das Eisenbahnfahren äußerst gefährlich. Auf<br />
den Ausweichgleisen der Landbahnhöfe sammelten sich<br />
beschädigte Lokomotiven aus Polen, Frankreich und anderen<br />
Ländern – Strandgut eines Krieges, der zusehends<br />
auch in das Allgäu eindrang. Vom übermächtigen Gegner<br />
bedrängt, zogen sich die deutschen Truppen durch das Allgäu<br />
in Richtung auf die imaginäre Alpenfestung zurück. Gesprengte<br />
Brücken wie jene über die Iller zwischen Tannheim<br />
und Memmingen waren die letzten Hinterlassenschaften<br />
des Untergangs. Als sich der Befehlszug der Reichsbahndirektion<br />
Stuttgart zur letzten Fahrt nach Isny in Bewegung<br />
setzte, war die Besetzung des Allgäus durch die französischen<br />
Truppen nur noch eine Frage von Stunden.<br />
Rangierarbeiten im Bf Marstetten-Aitrach 1970<br />
99
Geschichte der Württemberg-Allgäu-Bahn<br />
Aufbruch in die Eisenbahn-Zukunft<br />
Rund fünf Jahre benötigte die neu geschaffene Deutsche<br />
Bundesbahn, um die Wunden des Krieges zu schließen.<br />
Und weitere fünf Jahre, um mit dem Schienenbus als Ersatz<br />
für die Dampfzüge auch im Allgäu ein völlig neues Reisegefühl<br />
anzubieten. Vorschnell als Nebenbahnretter angepriesen,<br />
konnten aber auch diese modernen Triebwagen den<br />
Niedergang der Nebenbahnen nicht aufhalten. 1963 wurde<br />
zwischen Roßberg und Wurzach der Personenverkehr auf<br />
der Schiene eingestellt, ab 1966 ersetzten Bahnbusse die<br />
Personenzüge zwischen Leutkirch und Isny. 1971 fuhr auch<br />
Bis 1975 wurden schwere Güterzüge von Dampflokomotiven gezogen<br />
zwischen Altshausen und Pfullendorf der allerletzte Personenzug.<br />
Als 1966 Diesellokomotiven die letzten Dampflokomotiven<br />
vor den Personenzügen ersetzten, hatte sich der Fahrplan<br />
gegenüber früheren Zeiten stark gewandelt. Nun verkehrten<br />
auch Eilzüge und sogar Schnellzüge auf den Schienen<br />
im Allgäu. Die Zielschilder an den Wagen vermittelten einen<br />
kleinen Hauch von der weiten Welt des Schienenverkehrs:<br />
Freiburg, München, Augsburg, Zürich, Genf, Mailand.<br />
Doch die Zeiten ändern sich, und mit ihnen auch die Ansprüche<br />
der Kunden an einen modernen Schienenverkehr.<br />
1 Million Tonnen Erdöl aus Tannheim Viele Container aus Pfullendorf<br />
100
Die Umstellung auf den Allgäu-Schwaben-Takt im Jahre<br />
1993 war der entscheidende Schritt für eine völlig neue<br />
Standortbestimmung der Schienenwege im Allgäu. Mit<br />
einem auf optimale Anschlüsse zu den Fernverkehrsknoten<br />
Ulm, Augsburg, München, Lindau und Aulendorf ausgerichteten<br />
Fahrplanangebot wurde die Funktion der Allgäubahn<br />
in der Flächendienung neu definiert. Das Ergebnis sprach<br />
für sich: nach zehn Jahren Probezeit ergab sich zwischen<br />
den genannten Knotenpunkten ein Fahrgastzuwachs von<br />
43%! Mit diesem Ergebnis war der Fortbestand gesichert.<br />
Die inzwischen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen<br />
bei der Sicherungs- und Betriebstechnik und der<br />
Einsatz von Niederflurtriebwagen brachten weitere Verbesserungen<br />
bei Pünktlichkeit, Geschwindigkeit und Komfort.<br />
Wenn es tatsächlich gelingt, den Schienenstrang zwischen<br />
Memmingen und Hergatz als Teil einer Internationalen<br />
Verkehrsachse zwischen München und der Schweiz aufzuwerten,<br />
wird dies weitere positive Auswirkungen auf das<br />
gesamte Allgäu haben. Die Schwäbische Eisenbahn hat<br />
auch im Allgäu Zukunft!<br />
Hochbetrieb auf der Allgäubahn um 1980 – Zugkreuzungen im Bahnhof Saulgau<br />
Schienenbus nach Aulendorf in Leutkirch um 1980<br />
101
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Bodensee-Oberschwaben<br />
Verkehrsverbundgesellschaft mbH (bodo)<br />
Bahnhofplatz 5<br />
88214 Ravensburg<br />
www.bodo.de<br />
Stand: April 2013<br />
Der Herausgeber übernimmt für eventuelle Druckfehler<br />
und die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.<br />
Änderungen vorbehalten.<br />
Konzept, Gestaltung<br />
ÖkoMedia GmbH, Stuttgart<br />
Textredaktion<br />
ÖkoMedia GmbH, Stuttgart<br />
Thomas Scherer,<br />
Dr. Andreas Megerle,<br />
Beiträge von Annette Hildinger und Yvonne Ernst<br />
Fotos<br />
Bernd Hasenfratz, Titel, Seiten 5, 7, 9, 26, 28, 30, 31, 33,<br />
37, 38, 41, 47, 53, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 81<br />
Bruno Kickner, Seite 43<br />
Felix Löffelholz, Seite 77<br />
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH<br />
Dank geht auch an viele Städte und Gemeinden, die Bilder<br />
und Text zur Verfügung gestellt haben.<br />
www.pixelio.de<br />
Druck<br />
Bodenseemedien Zentrum (BMZ), Tettnang<br />
Weiterführende Informationen gibt es u.a. über:<br />
Tourist-Informationen, Bürgerämter und Servicestellen der<br />
Städte und Gemeinden<br />
www.bodo.de<br />
www.bodo.de/freizeitland<br />
www.radexpress-oberschwaben.de<br />
Sie haben Anregungen, Ideen oder Wünsche zur<br />
Broschüre?<br />
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht<br />
per Email: info@bodo.de<br />
per Fax: 0751 361 41 51<br />
per Brief oder Postkarte: Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund<br />
(bodo), Bahnhofplatz 5, 88214, Ravensburg<br />
Diese Broschüre wurde gefördert von PLENUM.<br />
106