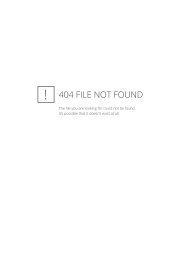Rote Revue Nr. 2-2003: Auswandern ... - SP Schweiz
Rote Revue Nr. 2-2003: Auswandern ... - SP Schweiz
Rote Revue Nr. 2-2003: Auswandern ... - SP Schweiz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeitschrift für Politik, Wirtschaft<br />
und Kultur<br />
<strong>Nr</strong>. 2/<strong>2003</strong><br />
81. Jahrgang<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong><br />
■ <strong>Auswandern</strong><br />
unmöglich –<br />
Unbehagen im<br />
Kulturkampf<br />
■ Vom Kultur- und<br />
Verteilungskampf in<br />
der <strong>Schweiz</strong><br />
■ Den<br />
Wohlfahrtsstaat<br />
weiterentwickeln
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Editorial 1<br />
Schwerpunkt<br />
Jacqueline Fehr, Andrea Hämmerle und Peter Peyer:<br />
Den Leistungs- und Wohlfahrtsstaat weiterentwickeln 2<br />
Regula Stämpfli:<br />
Vom Plappern über rechte und linke Denkverbote 7<br />
André Daguet:<br />
Linke Positionen für eine soziale <strong>Schweiz</strong> statt politischer Ratlosigkeit 11<br />
Beat Baumann:<br />
Verkäuferinnen, Chauffeure und linke Politik 17<br />
Michael Pfister:<br />
<strong>Auswandern</strong> unmöglich – Das Unbehagen im Kulturkampf 23<br />
Zur Diskussion gestellt<br />
Günter Baigger:<br />
Staatsverschuldung und Finanzierung der Altersvorsorge<br />
in Rahmen der zweiten Säule 30<br />
Repliken<br />
Linda Stibler:<br />
Replik auf <strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 1/<strong>2003</strong> 35<br />
Patricia M. Schiess Rütimann:<br />
Replik auf Peter Knoepfel 37<br />
Chronos<br />
Christian Koller:<br />
Sozialismus in einer Stadt? – Vor 75 Jahren entstand das rote Zürich 40<br />
Bücherwelt<br />
Beat Mazenauer:<br />
Das Individuum an der Globalisierungsfront 45<br />
Lisa Schmuckli:<br />
Analysen linker (Ohn-)Macht-Politik 47<br />
Die Fotos zeigen Grenzgänge – aus der Sicht von Friederike Baetcke<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
EDITORIAL<br />
Nach dem Abstimmungswochenende im November 2002 prägte Claude<br />
Longchamps das Wort der «zwei <strong>Schweiz</strong>en», die sich unversöhnlich gegenüberstehen<br />
und den Fortschritt der <strong>Schweiz</strong> behindern würden. In dieselbe<br />
Kerbe schlug auch der Zürcher Philosoph Georg Kohler, der in einem Interview<br />
im Tages-Anzeiger vom 26. November 2002 von einem Kulturkampf<br />
spricht, der in der <strong>Schweiz</strong> geführt werde. Auch für Kohler stehen zwei Konzepte<br />
der <strong>Schweiz</strong> – politisch repräsentiert in der nach Öffnung und Weltzugewandtheit<br />
bestrebten <strong>SP</strong> und einer die <strong>Schweiz</strong> verklärenden und diese<br />
als Idealstaat abschottenden SVP – in einer Konfrontationsstellung, und<br />
es geht heute gerade darum, dass dieser Kampf öffentlich geführt wird. Entscheidend<br />
ist für Kohler dabei nicht die SVP oder die <strong>SP</strong>, sondern vielmehr<br />
die FDP und die CVP.<br />
Es ist bezeichnend, dass diese beiden Parteien weder in der Asylfrage noch<br />
bei den Fragen um eine Stärkung oder Schwächung des Sozialstaates eine<br />
klare Position beziehen, obwohl gerade diese Fragen zum Kerngeschäft einer<br />
jeden Regierung gehören, die WählerInnen umtreiben und nach einer<br />
Orientierung verlangen. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Frage<br />
nach der verstärkten Regierungsbeteiligung der SVP, die ja für <strong>2003</strong> vorbereitet<br />
wird. FDP und CVP müssen sich entscheiden oder, wie es Kohler formuliert:<br />
«Das heisst... für CVP und FDP, dass man mit dieser Politik (jener<br />
der SVP) in keiner Weise mehr Kompromisse eingehen kann. Denn diese Politik<br />
zerstört die politische Kultur, aber auch alle Zukunftsmöglichkeiten der<br />
<strong>Schweiz</strong>. Dieser Kulturkampf muss jetzt geführt werden. Die regierenden Eliten<br />
müssen in der Lage sein, den Leuten zu sagen: Wer auf dieser Seite ist,<br />
findet unsere Gegnerschaft, mit ihnen gibt es keine Koalition.» Leider ist festzustellen,<br />
dass weder die CVP noch die FDP klar Position beziehen wollen.<br />
Vielmehr hält ihre Konzeptlosigkeit und Führungsschwäche unvermindert<br />
an. Dies zeigt sich etwa bei der FDP des Kantons Zürich sehr deutlich, die<br />
sich mit dem erneuten Wahlbündnis mit der SVP richtiggehend vorführen<br />
lässt.<br />
In dieser Situation der verstärkten inhaltlich-positionierenden Auseinandersetzung<br />
stellt sich die Frage, welche Politik die <strong>SP</strong> betreiben soll und<br />
welche linken Projekte lanciert werden können, um die Erstarrung aufgrund<br />
der lähmenden Pattsituation zu überwinden.<br />
Die Offenheit der <strong>Schweiz</strong> zeigt sich mit jeder Grenzüberschreitung. Die Fotografin<br />
Friederike Baetcke hat kulturelle Überschreitungen zu Bildern gemacht.<br />
Die Redaktion<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 1
SCHWERPUNKT<br />
Den Leistungs- und<br />
Wohlfahrtsstaat weiterentwickeln<br />
Hegemonie als Prinzip<br />
in Gesellschaft...<br />
Die Politik der SVP unter Christoph Blocher<br />
hat Ausdauer, System und ist programmatisch<br />
nicht dem Zufall überlassen.<br />
Jacqueline Fehr, Andrea Hämmerle<br />
und Peter Peyer<br />
Sie lehnt sich stark an die Glaubenssätze<br />
der Weissbuch-Autoren an respektive an<br />
die von Ex-CS-Chef Lukas Mühlemann<br />
anfangs 2000 im Tages-Anzeiger-Magazin<br />
präsentierte Kurzfassung. Unter dem Titel<br />
«Was die Politik von einem Unternehmen<br />
lernen muss» 1 redete Mühlemann dem Abbau<br />
der staatlichen Kontroll- und Ausgleichsfunktion<br />
das Wort: die Staatsbetriebe<br />
SBB, Post und Swisscom vollständig<br />
privatisieren, den Preisüberwacher<br />
abschaffen, das Gesundheits- und Sozialwesen<br />
dem Markt überlassen, heissen<br />
die Rezepte. NPM für die Verwaltung,<br />
mehr Eigenverantwortung für alle und die<br />
Forderung nach Beschränkung von Umweltschutz<br />
und Raumplanung rundeten<br />
die Sache ab. In der Folge orchestrierte die<br />
SVP im Parlament, was Ebner an der Börse<br />
dirigierte. Shareholder-Value wurde<br />
zum gesamtgesellschaftlichen Projekt 2 .<br />
...und Parteiengefüge<br />
Am berühmt-berüchtigten Sonderparteitag<br />
der SVP <strong>Schweiz</strong> in Lupfigen sagte<br />
Christoph Blocher: «Seit dieser Zürcher<br />
Flügel [der SVP <strong>Schweiz</strong>] identisch ist mit<br />
unserer Gesamtpartei, wird die ganze SVP<br />
einer Dauerkritik ausgesetzt und legt dafür<br />
gesamtschweizerisch von Urnengang<br />
zu Urnengang zu.» 3 Und weiter: «Die vereinigte<br />
Linke aus <strong>SP</strong>, FDP und CVP hat es<br />
weit gebracht. [...] Die SVP ist noch die<br />
einzige Partei, die zur <strong>Schweiz</strong> steht.» 4 Der<br />
SVP-Alleinvertretungsanspruch auf die gesamte<br />
nicht linke Politik war damit festgelegt.<br />
Dies kommt nicht von ungefähr.<br />
In Zürich muss beginnen,<br />
was leuchten soll im Vaterland<br />
Ein rudimentärer Überblick über eine Zürcher<br />
Erfolgsgeschichte mit Auswirkungen<br />
auf Bundesbern zeigt, wie die FDP systematisch<br />
zermürbt wurde. 1987 will Blocher<br />
den SVP-Sitz im Ständerat von Jakob<br />
Stucki verteidigen; die FDP hält nicht viel<br />
von einer Zusammenarbeit: Blocher verliert,<br />
Monika Weber (LdU) wird gewählt.<br />
Seit dieser Niederlage rächt sich Blocher<br />
am Freisinn. Der Kampf um die bürgerliche<br />
Hegemonie beginnt.<br />
1<br />
Das Magazin, 1. Januar 2000, <strong>Nr</strong>. 52, Seite 4.<br />
2<br />
siehe auch Die WochenZeitung, 8. August 2002, Nachruf<br />
auf Martin Ebner von Constantin Seibt.<br />
3<br />
Sonderparteitag der SVP <strong>Schweiz</strong> vom 16. November<br />
2002 in Lupfingen AG; siehe auch www.blocher.ch: Was<br />
Christoph Blocher am SVP-Sonderparteitag wirklich gesagt<br />
hat, «Regierungspartei oder Opposition?».<br />
4<br />
ebenda.<br />
2<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
1988 ist der Abstimmungskampf ums neue<br />
Eherecht die erste grosse Kraftprobe zwischen<br />
FDP und SVP. Blocher verliert. Fünf<br />
Jahre später folgt die EWR-Abstimmung.<br />
Blocher gewinnt. Dieser Sieg hat eine für<br />
<strong>Schweiz</strong>er Verhältnisse wohl einmalige<br />
Nachhaltigkeit – zugunsten der SVP!<br />
Im Frühling 1999 wird die SVP stärkste<br />
Fraktion im Zürcher Kantonsrat. Sie<br />
verdrängt die FDP aus dieser Position. Die<br />
SVP hat sich kantonal durchgesetzt. Im<br />
Herbst ist die SVP die Siegerin der Nationalratswahlen.<br />
Die Kantone auf Blocher-Linie<br />
legen zu. Die Zürcher SVP hat<br />
sich national durchgesetzt.<br />
<strong>2003</strong> tritt die SVP mit drei Kandidaten zu<br />
den Regierungsratswahlen an, verpasst<br />
diesen Sitz aber. Im Kantonsrat bleibt die<br />
SVP stärkste Fraktion: die FDP verliert<br />
massiv Sitze, Stimmenprozente und praktisch<br />
ihre gesamte SVP-kritische Führungsriege.<br />
Einen Monat später stimmen<br />
die FDP-Delegierten einer Listenverbindung<br />
mit der SVP im Kanton Zürich für<br />
die National- und Ständeratswahlen zu.<br />
Der stolze Zürcher Freisinn kapituliert vor<br />
der Zürcher SVP. Nach dem neuesten<br />
Wahlbarometer hat die FDP auch ihre Ur-<br />
Domäne, die Glaubwürdigkeit in der Wirtschaftspolitik,<br />
an die SVP abtreten müssen.<br />
Der Kreis ist geschlossen.<br />
Die «Schlüsselfrage»<br />
des 21. Jahrhunderts<br />
Christoph Blocher hat nach den Zürcher<br />
Wahlen eine strategische Kehrtwende<br />
gemacht und die <strong>SP</strong> wieder ins Angriffszentrum<br />
gestellt, was programmatisch logisch<br />
und mit dem Pamphlet «Freiheit statt<br />
Sozialismus» 5 schon länger angekündigt<br />
ist. Es empfiehlt sich aus zwei Gründen,<br />
darin zu lesen: Erstens entlarvt sich das<br />
5<br />
«Freiheit statt Sozialismus», Aufruf an die Sozialisten<br />
in allen Parteien, von Nationalrat Christoph Blocher, 3. April<br />
2000; zu finden unter www.blocher.ch, Rubrik Aktuell.<br />
Werk als das ideologische Fundament für<br />
die fortwährend beschworene «Eigenverantwortung»<br />
als höchste Form des<br />
menschlichen Daseins. Zweitens biegt es<br />
das Staatsbild für die SVP so zurecht, dass<br />
alle Leistungen, die der Staat im Dienste<br />
seiner BürgerInnen erbringt, als Versuch<br />
gewertet werden, das Individuum einem<br />
knechtenden Kollektivismus zu unterwerfen.<br />
Christoph Blochers Kurz-Schluss<br />
lautet: «Freiheit oder Sozialismus – Schlüsselfrage<br />
des 21. Jahrhunderts».<br />
Hinter diesen Entwicklungen steht eine<br />
ganz grundsätzliche Frage, die nur in einem<br />
grösseren historisch-internationalen<br />
Kontext zu verstehen ist. Es lohnt sich, in<br />
diesem Zusammenhang in Eric Hobsbawms<br />
brillanter Weltgeschichte des 20.<br />
Jahrhunderts die Kapitel über das goldene<br />
Zeitalter 6 und in Harald Müllers neustem<br />
Buch über die Weltordnung nach dem<br />
11. September 7 nachzulesen.<br />
Vom Polizei- zum Wohlfahrtsstaat<br />
Der moderne Staat ist vereinfacht gesagt<br />
in drei Etappen gewachsen. Diese drei<br />
Etappen sind in Schichten oder Jahrringen<br />
deutlich sichtbar und unterscheidbar. Zuerst<br />
erlangt der Staat das Gewaltmonopol.<br />
Seine Polizei und sein Militär sorgen für<br />
Sicherheit im Innern und gegen aussen.<br />
Als Zweites wird das Gewaltmonopol demokratisch<br />
organisiert und kontrolliert<br />
und rechtsstaatlich abgestützt: es gelten für<br />
alle die gleichen sauberen Verfahren und<br />
es gibt keine Willkür. Dies ist eine liberale<br />
Errungenschaft. International entspricht<br />
dieser zweite Schritt dem Völkerrecht,<br />
das massgeblich von der UNO geprägt<br />
und getragen wird. Der demokratische<br />
Rechtsstaat – aber auch das Völ-<br />
6<br />
Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme, dtv 1998,<br />
S. 285ff.<br />
7<br />
Harald Müller: Amerika schlägt zurück, Fischer <strong>2003</strong>,<br />
besonders S. 93ff.<br />
Der moderne Staat<br />
ist, vereinfacht<br />
gesagt, in drei<br />
Etappen gewachsen:<br />
Errichtung<br />
erstens eines<br />
staatlichen<br />
Gewaltmonopoles,<br />
zweitens eines<br />
Rechtsstaates<br />
und schliesslich<br />
eines Wohlfahrtsstaates.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 3
Im Wohlfahrtsstaat<br />
erbringt der Staat<br />
Leistungen:<br />
Er sorgt für den<br />
sozialen Ausgleich,<br />
soziale Gerechtigkeit,<br />
Sicherheit und für<br />
Chancengleichheit.<br />
kerrecht – schützt die Schwachen vor den<br />
Starken, die Ohnmächtigen vor den<br />
Mächtigen.<br />
Drittens schliesslich kommt die entscheidend<br />
von der Arbeiterbewegung erstrittene<br />
Wohlfahrt hinzu. Der Staat erbringt<br />
Leistungen, sorgt für den sozialen<br />
Ausgleich, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit,<br />
für Chancengleichheit in Bildung<br />
und Beruf, für einen flächendeckenden<br />
und kostengünstigen Service public. Es ist<br />
der real existierende, wesentlich sozialdemokratisch<br />
mitgeprägte europäische<br />
Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit.<br />
Zwei Modelle im Wettstreit<br />
Beginnend mit Reagan und Thatcher, verstärkt<br />
in den 90er Jahren und jetzt dramatisch<br />
beschleunigt, gibt es die fatale Entwicklung,<br />
dass die äusseren Jahrringe abgehobelt<br />
werden: Der Sozialstaat wird<br />
zurückgebaut, der Service public kommt<br />
unter Druck und wird privatisiert, aber<br />
auch der demokratische Rechtsstaat gerät<br />
in Gefahr. Gleichzeitig erfolgt ein massiver<br />
Aufrüstungsschub und der Ruf nach<br />
mehr Polizei und mehr Gefängnissen wird<br />
lauter. Diese Entwicklung ist international,<br />
aber – mit Ausnahme der militärischen<br />
Aufrüstung – auch schweizerisch. Parallel<br />
dazu wird, wie der Irak-Krieg in aller<br />
Deutlichkeit zeigt, das Völkerrecht abgewürgt<br />
und ersetzt durch das alte archaische<br />
Prinzip: Der Stärkere hat Recht. Dies<br />
ist zugleich der aktuelle Hintergrund der<br />
SVP-Politik, nämlich: Sparen und Steuernabbauen<br />
zum Ersten; mehr Eigenverantwortung<br />
und weniger soziale Sicherheit<br />
bei gleichzeitiger Aufrüstung von Polizei<br />
und (Miliz-)Armee zum Zweiten; die Abschottung<br />
gegen aussen und damit verbunden<br />
die Ablehnung jeder internationalen<br />
Kooperation zum Dritten.<br />
Der SVP-Politik des Steuer- und Leistungsabbaus,<br />
des Sozialdumpings und<br />
der Isolation müssen wir konsequent den<br />
sozialdemokratischen Wohlfahrts- und<br />
Leistungsstaat, eine Politik des Ausgleichs<br />
und der internationalen Zusammenarbeit<br />
gegenüberstellen. Im Zentrum<br />
steht die Finanzpolitik. Der aktuelle<br />
<strong>SP</strong>-Spardiskurs nach dem Muster<br />
«Ja zum Sparen, aber nicht jetzt und<br />
nicht so» zeigt, dass programmatische<br />
Schnellschüsse nicht genügen und auf<br />
dünnes Eis führen. Eine grundsätzlichere<br />
Position und Argumentation wäre<br />
nötig.<br />
An Hand von drei Beispielen wollen wir<br />
skizzieren, wie mit wechselnden Allianzen<br />
die SVP-Hegemonialmacht leer läuft, da<br />
ihr Gesellschaftskonzept nur für eine<br />
schmale, reiche Elite attraktiv und damit<br />
letztendlich nicht mehrheitsfähig ist.<br />
Steuerrefom: Mehr Ökologie<br />
für mehr Gerechtigkeit<br />
Vor rund vier Jahren überwiesen die eidgenössischen<br />
Räte eine Motion des heutigen<br />
Bundesrates Samuel Schmid (SVP),<br />
die eine Verlagerung der Bundessteuern<br />
auf die Mehrwertsteuern verlangt. Wenn<br />
das heutige Gesetz über die direkten<br />
Bundessteuern 2006 ausläuft 8 , steht genau<br />
die Frage wieder im Zentrum der Debatte,<br />
ob und wie der Staat seine Umverteilungs-<br />
und Ausgleichsfunktion wahr<br />
nimmt und damit den Boden für eine gerechte<br />
und ökologische Entwicklung unserer<br />
Gesellschaft legt.<br />
Das Modell der <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong> ist klar: Kein<br />
Abbau der direkten Bundessteuern und<br />
keine Schwächung der Progression, stattdessen<br />
Steuergutschriften vom Steuerbetrag.<br />
Diese sind «progressionsneutral», der<br />
Abzug ist in allen Einkommensklassen<br />
frankenmässig gleichviel wert. Wenn die<br />
Steuerschuld kleiner ist als der Abzug, soll<br />
8<br />
Gemäss Übergangsbestimmung zu Art. 128 BV ist die<br />
Befugnis des Bundes, direkte Bundessteuern zu erheben, bis<br />
Ende 2006 befristet.<br />
4<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
die Differenz im Sinne einer negativen<br />
Einkommenssteuer ausbezahlt werden.<br />
Ein weiteres zentrales Element einer zukunftstauglichen<br />
Steuerordnung wird die<br />
Erbschaftssteuer sein. Als Folge der grossen<br />
Nachkriegsvermögen ist in den nächsten<br />
20 Jahren damit zu rechnen, dass in<br />
der <strong>Schweiz</strong> insgesamt 900 Mrd. Franken<br />
vererbt werden. Bereits eine sehr moderate<br />
Erbschaftssteuer mit einem grosszügigen<br />
Freibetrag von 1 Mio. Franken brächte<br />
Einnahmen von rund 1 bis 2 Mrd. Franken<br />
pro Jahr in die Bundeskassen, was etwa<br />
dem geschätzten strukturellen Defizit<br />
des Bundeshaushaltes entspricht.<br />
Prüfenswert ist auch das Steuerharmonisierungsmodell,<br />
das vom Mathematikprofessor<br />
Carl August Zehnder 9 bereits<br />
1998 vorgeschlagen wurde. Hohe Einkommen<br />
und Vermögen besteuert danach<br />
ausschliesslich der Bund, da diese Einkommen<br />
nicht regional, sondern im nationalen<br />
und internationalen Geschäft erwirtschaftet<br />
werden. Hohe Einkommen<br />
haben dazu die Eigenschaft, dass sie mobil<br />
sind und mit ihren permanenten Wegzugsdrohungen<br />
den Steuerwettbewerb<br />
anheizen. Als Kompensation werden<br />
mittlere und tiefe Einkommen nur von den<br />
Gemeinden und den Kantonen besteuert.<br />
Damit der Staat seine Ausgleichsfunktion<br />
wahrnehmen kann, braucht er also grundsätzlich<br />
nicht nur genügend Mittel, sondern<br />
er muss diese Mittel auch gerecht und<br />
ökologisch sinnvoll einnehmen.<br />
Kinder an die Macht<br />
9<br />
Zehnder, Carl August (1998): Steuertourismus eindämmen<br />
– kantonale Fiskalhoheit achten, in NZZ <strong>Nr</strong>.<br />
27/1998, Zürich.<br />
Eine linke und fortschrittliche Familienpolitik<br />
basiert auf der Forderung nach<br />
Chancengleichheit. Kinder sollen unabhängig<br />
von ihrer Herkunft und ihren Lebensumständen<br />
die Möglichkeit haben, ihre<br />
Fähigkeiten und Talente zu nutzen und<br />
auszubauen. Die Pisa-Studie zeigte jedoch,<br />
dass es dem schweizerischen Schulsystem<br />
nicht gelingt, diese Herkunftsunterschiede<br />
auszugleichen. Das Rezept der SVP auf<br />
diesen Befund: Familie ist Privatsache, der<br />
Staat hat in diesem Bereich nichts zu<br />
unternehmen. Um aber doch nicht ganz<br />
tatenlos zu sein, fordert die SVP separate<br />
Schulen für <strong>Schweiz</strong>er Kinder.<br />
Spannend ist die Tatsache, dass in der Familienpolitik<br />
noch nicht entschieden ist,<br />
ob das SVP-Verelendungsprogramm die<br />
Hegemonie im bürgerlichen Lager hat.<br />
War diese Frage nach dem Abstimmungsdebakel<br />
über die Mutterschaftsversicherung<br />
1999 noch klar, haben sich<br />
FDP und CVP in den letzten zwei Jahren<br />
in familienpolitischen Fragen aus den<br />
Klauen der SVP befreit und sind Koalitionen<br />
mit der <strong>SP</strong> eingegangen (Anstossfinanzierung<br />
für familienergänzende Betreuungsplätze,<br />
Neuanlauf zur Mutterschaftsversicherung,<br />
Ergänzungsleistungen<br />
für Familien, Harmonisierung und Erhöhung<br />
der Kinderzulagen).<br />
Das Konzept der <strong>SP</strong> ist klar: Zur Stärkung<br />
der Chancengleichheit müssen die Familien<br />
finanziell mehr und gezielter unterstützt<br />
werden (Erhöhung der Kinderzulagen,<br />
Steuergutschriften statt Steuerabzüge,<br />
Ergänzungsleistungen, verbesserte<br />
und eidgenössische Regelung der Alimentenbevorschussung,<br />
Mutterschaftsversicherung,<br />
tiefere Eintrittsschwelle in<br />
2. Säule). Daneben braucht es Blockzeiten<br />
sowie einen massiven Ausbau von familienergänzenden<br />
Betreuungsangeboten<br />
wie Krippen, Horte, Tagesschulen und<br />
Mittagstischen.<br />
Flug über die Alpen<br />
Die <strong>Schweiz</strong> wird als Offshore-Insel in Europa<br />
kaum überleben. Eine kluge Öff-<br />
Zur Frage<br />
einer sozialen<br />
Gerechtigkeit<br />
wird die<br />
Erbschaftssteuer<br />
werden:<br />
in den nächsten<br />
20 Jahren wird<br />
in der <strong>Schweiz</strong><br />
insgesamt<br />
900 Mrd. Franken<br />
vererbt werden.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 5
nungspolitik mit vertraglich geregelten Beziehungen<br />
der <strong>Schweiz</strong> zur Welt muss die<br />
Antwort der <strong>SP</strong> sein. Zwei «kleinere» Geschäfte<br />
zeigen, wie die Partei, welche die<br />
<strong>Schweiz</strong>erfahne am penetrantesten hochhält,<br />
unserm Land wirtschaftlich und politisch<br />
den grössten Schaden zufügt.<br />
Erstes Beispiel: Der Staatsvertrag hätte die<br />
Verteilung des Fluglärms zwischen<br />
Deutschland und der <strong>Schweiz</strong> einvernehmlich<br />
geregelt. Das Parlament lehnt den Vertrag<br />
unter Führung von SVP und (Zürcher)<br />
Freisinn ab. Deutschland erlässt wie<br />
angekündigt für die Bewirtschaftung seines<br />
Luftraums eine Verordnung, die härter<br />
ist und kürzere Fristen setzt als der abgelehnte<br />
Staatsvertrag. Jetzt versucht der<br />
Bundesrat, bei der europäischen Kommission<br />
eine Aufschiebung der Verordnung zu<br />
erreichen. Die vielgeschmähten «fremden<br />
Richter von Brüssel» sollen entscheiden.<br />
Der Parteipräsident der SVP <strong>Schweiz</strong><br />
nimmt vor laufender Fernsehkamera unverfroren<br />
das Wort «Krieg» in den Mund. Wir<br />
sehen ihn schon kampfbereit mit dem<br />
Sturmgewehr am Rhein. Wer aber in einem<br />
Konflikt sich selber über- und den Gegner<br />
unterschätzt, verliert mit Sicherheit.<br />
Es ist dringend nötig, dass die <strong>SP</strong> zusammen<br />
mit ihrem Bundesrat beharrlich den<br />
Weg der aussen- und innenpolitischen Vernunft<br />
weitergeht. Schauen wir den Tatsachen<br />
in die Augen, ob sie uns gefallen oder<br />
nicht: Deutschland sitzt am längeren Hebel<br />
– immerhin geht es um den deutschen<br />
Luftraum – und ist nicht bereit, mehr Fluglärm<br />
zu akzeptieren, damit der Züriberg<br />
und die Goldküste ruhig schlafen können.<br />
Drehen und Wenden nützen nichts: Der<br />
Schlüssel zur Lösung liegt bei der Zürcher<br />
Regierung und heisst Südanflüge.<br />
Zweites Beispiel: Die Alpenkonvention 10<br />
ist das erste internationale Vertragswerk,<br />
10<br />
Die besten Hintergrundseiten zur Alpenkonvention finden<br />
sich unter www.cipra.org<br />
das eine gemeinsame Wirtschafts- und<br />
Umweltschutzpolitik des wichtigsten europäischen<br />
Erholungsraums formuliert<br />
und das dünn besiedelte, strukturschwache<br />
Berggebiet gegenüber den Zentren<br />
stärkt. In den Bereichen Landwirtschaft<br />
und Verkehr sind Positionen und Errungenschaften<br />
verankert, die wesentlich<br />
sozialdemokratisch mitgeprägt sind. Nachteile<br />
für die <strong>Schweiz</strong> sind nicht ersichtlich.<br />
Die Ratifizierung wird im Parlament – in<br />
einer bisher erfolgreichen Speckgürtelkoalition<br />
SVP-FDP-Economisuisse –<br />
hintertrieben. Hier läuft die SVP-Arche<br />
aber langfristig auf den Berggipfeln auf:<br />
Die <strong>SP</strong> zimmert zusammen mit ihrem<br />
Bundesrat, den Regierungen der Gebirgskantone,<br />
mit den Grünen, den weitsichtigen<br />
Berggebietsvertretern und den<br />
Gemeindevertretern – die lieber ihren Bio-<br />
Geisskäs in Europa verkaufen als auf granithartem<br />
<strong>Schweiz</strong>er Franken versauern –<br />
eine solide Mehrheit.<br />
Die alten Werte gelten noch<br />
Nur ein starker Staat kann ein sozialer<br />
Staat sein. Dem ist an sich nach wie vor<br />
nichts anzufügen. Ausser, dass die <strong>SP</strong> programmatisch<br />
klarer, transparenter und<br />
konsequenter sein muss als die SVP. Links<br />
der SVP bietet sich damit ein grosses Feld<br />
mit viel Platz und Heimatlosen. Nutzen<br />
wir das!<br />
Jacqueline Fehr ist Nationalrätin<br />
aus Winterthur (ZH) und Vizepräsidentin<br />
der Pro Fa5milia <strong>Schweiz</strong>.<br />
Andrea Hämmerle ist Nationalrat aus<br />
Pratval (GR) und Präsident der Nationalparkkommission.<br />
Peter Peyer ist Präsident der <strong>SP</strong><br />
Graubünden und Gewerkschaftssekretär.<br />
6<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Vom Plappern über rechte<br />
und linke Denkverbote<br />
Zur Verführungskraft eines SVP-nahen Denkens<br />
Im Kanton Baselland mehr als 6 Sitze, im<br />
roten Genf auf Anhieb über 10 Sitze, im<br />
Kanton Luzern 4 und schliesslich im Blocher<br />
Kanton Zürich einen Zuwachs auf<br />
Regula Stämpfli<br />
hohem Niveau von immerhin noch einem<br />
Sitz (2% Zunahme). Was passiert denn eigentlich<br />
in der <strong>Schweiz</strong>? Die SVP verliert<br />
zwar laufend Abstimmungen – zuletzt bei<br />
der Asylinitiative zwar nur knapp, aber<br />
immerhin – doch bei den regionalen und<br />
lokalen Wahlen ist sie seit 1999 klare<br />
Punkterin. Dabei fällt auf, dass bei Abstimmungen<br />
die SVP-Unterstützung am<br />
grössten ist, wenn auch die Stimmbeteiligung<br />
hoch ausfällt, dass bei Wahlen die<br />
SVP jedoch dann gewinnt, wenn die Mobilisierung<br />
eher gering ist. Übersetzt könnte<br />
dies bedeuten, dass bei polarisierten<br />
Themen der Mainstream gerne mit Ja oder<br />
Nein mitpolitisiert, dass aber das alltägliche<br />
Politikgeschäft nach wie vor Anliegen<br />
einer Elite bleibt. Einer ausgewählten<br />
Minderheit (von rund einem Drittel bei<br />
kantonalen Wahlen und bei National- und<br />
Ständeratswahlen ca. 42%), welche vorwiegend<br />
rechtsbürgerlich orientiert ist.<br />
Dies allen Meinungs- und Trendforschungen<br />
zum Trotz, welche im Vorfeld<br />
der Wahlen meistens nicht nur der SVP,<br />
sondern vor allem auch der <strong>SP</strong> einen<br />
Wahlsieg vorhersagen. Was machen denn<br />
die anderen Parteien falsch, dass sie im<br />
Wahlfrühling und –sommer <strong>2003</strong> immer<br />
gegen die SVP einschauen?<br />
Nicht viel, aber doch einiges. Der Mitgliederschwund<br />
bei den Parteien ist ein<br />
internationaler Trend und hängt mit der<br />
gewandelten politischen Parteienkultur<br />
hin zur Mediendemokratie zusammen. Es<br />
misslingt allen drei Regierungsparteien<br />
FDP, CVP und <strong>SP</strong>, mehr Mitglieder zu mobilisieren;<br />
einzig die SVP hat in allen Kantonen<br />
(ausser in Bern) zugelegt. Die<br />
Widerstandskraft der Parteien gegen die<br />
SVP ist durch mangelnde eigene und wählerattraktive<br />
Themen geschwächt. Der Blocher<br />
Flügel der SVP schafft es immer wieder,<br />
die politische Agenda zu setzen und<br />
die Gegner zu reaktivem statt zu aktivem<br />
Verhalten zu verführen. Die SVP vereinfacht<br />
Politik. Sie schaut dem Volke aufs<br />
Maul. Sie setzt Themen, portiert Meinungsführer<br />
und polarisiert. Sie liefert eine<br />
träfe Mischung von Allerweltspartei<br />
und Polemik. Die FDP, CVP und <strong>SP</strong> agieren<br />
klassisch, funktionieren in einer politischen<br />
Kompromisssuche, wo der Begriff<br />
Politik eben vom griechischen Politeia,<br />
dem Aushandeln und Verhandeln, und<br />
nicht von Polemos, dem Gegensätze aufbauen,<br />
kommt. Und genau da liegt das<br />
Problem. Die SVP verschärft ihre Gangart<br />
mit niveaulosen Plakaten und einer<br />
Schlagwortpolitik und dominiert mit den<br />
Gegenreaktionen die öffentliche Debatte.<br />
Nach verlorenen Abstimmungen wie der<br />
UNO und der Goldinitiative baut die SVP<br />
auf Zuspitzungen und lanciert Biertischthemen.<br />
Das schafft Resonanz und zahlt<br />
sich aus.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 7
Bundesrat<br />
und Parlament<br />
haben in der<br />
letzten Legislatur<br />
weit über 60 %<br />
aller<br />
Regierungsvorlagen<br />
an der Urne<br />
vor dem Volk<br />
durchgebracht.<br />
Keine<br />
schlechte Bilanz.<br />
Drei von fünf <strong>Schweiz</strong>er und <strong>Schweiz</strong>erinnen<br />
wählen heute nicht mehr eine Partei,<br />
sondern Personen aus verschiedenen<br />
Parteien. Deshalb sind im politischen Diskurs<br />
knackige politische Aussagen gefragt<br />
und weniger Mittelmass. Der <strong>SP</strong> gelingt es<br />
nicht, trotz grossem Ja der Bevölkerung<br />
zur Chancengleichheit – nieder mit der<br />
Abzockergesellschaft, besserer Bildung,<br />
Ausbau der AHV – die Leute allgemein<br />
und vor allem auch die eigenen Leute zu<br />
mobilisieren. Im besten Falle verbessert<br />
sich die <strong>SP</strong> um ein, zwei Prozentpunkte,<br />
im schlechtesten Falle kann sie sich bei<br />
den kommenden National- und Ständeratswahlen<br />
im Herbst noch knapp halten.<br />
Die SVP dagegen räumt im rechten Rand<br />
vollständig auf, knabbert gleichzeitig in der<br />
Mitte und höhlt die Stammlande von CVP<br />
und FDP stetig, aber sicher aus. Diesen<br />
Trend unterstützen die beiden angegriffenen<br />
Parteien. Während sich beispielsweise<br />
die FDP-Parteipräsidentin Langenberger<br />
klar von der Blocher-Partei distanziert,<br />
gleichen die inhaltlichen Postulate der<br />
Freisinnigen immer mehr der SVP. Was die<br />
FDP-Delegierten am 14. März <strong>2003</strong> mit<br />
Bundesrat Villiger und dem Vorschlag, die<br />
Erbschaftssteuer auf nationaler Ebene einzuführen<br />
(eigentlich ein uraltes liberales<br />
Postulat), machten, sprach Bände. Mit einer<br />
derartigen Politik unterscheidet sich<br />
die FDP nicht von der SVP.<br />
Ganz ähnlich die CVP, die nun in ihrer<br />
Torschlusspanik meint, während Abstimmungskämpfen<br />
vor allem die <strong>SP</strong> diffamieren<br />
zu müssen. Antisozialistisch war<br />
zwar schon immer eine Trendmarke der<br />
CVP, doch als SVP-Bremse wird dies der<br />
Zahnbürstenpartei nicht viel bringen.<br />
Dummerweise spielen auch die Grünen im<br />
Wahljahr <strong>2003</strong> nicht die beste Rolle. Das<br />
Umfrage-Unterstützungspotenzial für linke<br />
Anliegen ist in der <strong>Schweiz</strong> erstaunlich<br />
hoch; es liegt bei fast einem Drittel. Was<br />
jedoch fehlt ist eine breitere Mobilisierung<br />
von links für soziale und grüne Themen.<br />
Politstrategisch werden mehrere Varianten<br />
diskutiert, wie der SVP denn beizukommen<br />
wäre. Die Vorschläge reichen von Isolation<br />
über Integration, von der Aus- oder<br />
Einklammerung Blochers in den Bundesrat.<br />
Die Ideen sind zwar reizvoll, zielen<br />
aber völlig an der politischen Realität vorbei.<br />
Solange ein Grossteil der Stimmberechtigten<br />
nicht merkt, dass Politik kein<br />
Game mit Siegern und Gewinnern, sondern<br />
ein hartes Verhandeln, Aushandeln<br />
und Kompromissfinden ist, wird die SVP<br />
mit ihrem Doppelkurs der Oppositionsund<br />
Regierungspartei Erfolg finden. Nehmen<br />
wir einmal an, Christoph Blocher<br />
würde tatsächlich in den Bundesrat gewählt.<br />
Viele erhoffen sich damit einen Pazifizierungseffekt.<br />
Sie liegen damit aber<br />
völlig falsch. Denn der Zürcher Unternehmer<br />
lässt sich nicht einbinden. Und<br />
welcher Art ein zweiter SVP-Sitz im<br />
Bundesrat wäre, zeigt der Kanton Zürich.<br />
Dort ist die SVP zwar in der Exekutive eingebunden,<br />
im Parlament aber Teil der Opposition,<br />
und das Resultat ist in Finanzund<br />
Budgetfragen eine ausgesprochene<br />
Katastrophe. Klar, die <strong>Schweiz</strong> ist nicht<br />
mit der Zauberformel geboren und die<br />
SVP wird nach dem 19. Oktober <strong>2003</strong><br />
zweifellos und mit gutem Recht einen weiteren<br />
Sitz für sich im Bundesrat beanspruchen.<br />
Doch ebenso gut kann die Parlamentsmehrheit<br />
ihr diesen Sitz verweigern.<br />
Denn selbst wenn es arithmetisch<br />
unstimmig ist, kann es politisch klug sein,<br />
die CVP auf Kosten der SVP zu stützen.<br />
Schliesslich geht es ums Regieren, das<br />
heisst darum, Mehrheiten zu finden und<br />
politische Kompromisse zu suchen. In der<br />
letzten Legislatur haben Bundesrat und<br />
Parlament weit über 60% aller Regierungsvorlagen<br />
an der Urne vor dem Volk<br />
durchgebracht. Keine schlechte Bilanz für<br />
die eigene Regierungstätigkeit, selbst wenn<br />
die Zwischentöne mittlerweile reichlich<br />
laut und aggressiv werden!<br />
Doch all diese politikwissenschaftlichen<br />
Ausführungen bilden eigentlich nur einen<br />
8<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Teil der Analyse, weshalb die SVP die politische<br />
Kultur in diesem Land so wahlerfolgreich<br />
vergiftet. Denn das Phänomen<br />
SVP reicht viel weiter. In die Grundverfassung<br />
dieses Landes und in die Medienstruktur,<br />
die wahrhaft kulturkämpferische<br />
Blüten treibt. Mittlerweile gehört es<br />
nämlich zum guten Ton, auf die Classe politique<br />
und die Politisierenden in diesem<br />
Lande einzuprügeln. Auf der Rechten passiert<br />
das relativ plump und plakativ, auf der<br />
salonlinken Ebene etwas subtiler. Schauen<br />
wir mal genauer hin, wie der Boden für<br />
SVP-nahe Ideen beackert wird:<br />
Vor ein paar Wochen komplimentierte der<br />
«Monsterkopf» der WoZ, Constantin<br />
Seibt, seinen Journikollegen und Weltwoche-Chefredaktor<br />
Roger Köppel mit:<br />
«Du leistest Aussergewöhnliches.» Klar,<br />
einem klugen, witzigen, ironischen und<br />
zwischendurch selbstgefälligen Brillantschreiber<br />
wie Seibt passieren keine undifferenzierten<br />
Komplimente. Deshalb<br />
durchsetzt er seine scherzhaft und doch<br />
sinnigen Symbiosephantasien von WoZ<br />
und Weltwoche mit ein paar kritischen<br />
Krümeln. Beide Wochenzeitungen frönen<br />
gerne dem schweizerischen Besserwissertum<br />
und geben am liebsten Journis Papier,<br />
die zwar nicht recht bellen, dafür aber<br />
umso gezielter beissen können. Versteckt<br />
hinter einer Designersprache zerstört vor<br />
allem die Weltwoche mit Texten zu Asyl,<br />
Frauenhandel, Drogen und Sex die letzten<br />
Überreste der mittlerweile so verpönten<br />
Political Correctness. Die Gradlinigkeit<br />
des Denkens verschwindet hinter einer<br />
Haltung des «anything goes», welches sich<br />
in der Weltwoche in einem Underdog-<br />
Bashing und in der WoZ in einer regelmässigen<br />
Sozi-Schelte manifestiert. Was<br />
hat dies alles mit dem von Prof. Georg<br />
Kohler im Tages-Anzeiger vom 26. November<br />
2002 angesprochenen Kulturkampf<br />
und der SVP zu tun? Der Philosoph<br />
Kohler meinte in besagtem Artikel,<br />
dass es zwei <strong>Schweiz</strong>en gäbe: eine Reformschweiz<br />
und eine auf ländlich-konservativ<br />
fixierte Blocher-<strong>Schweiz</strong>. Wenn es<br />
doch nur so einfach wäre! Denn der Zusammenhang<br />
zwischen Weltwoche-Artikel<br />
und dem SVP-Siegeszug ist verdammt<br />
komplex, aber zwingend, und liegt in der<br />
Struktur der schweizerischen politischen<br />
Kommunikation. Das Plappern über «jenseits<br />
von rechten und linken Denkverboten»<br />
ist nämlich mittlerweile hip. Nicht<br />
unter den Rechten, denn die kannten noch<br />
nie irgendwelche Verbote punkto Menschlichkeit,<br />
Grundrechten, Toleranz und Diskurs,<br />
sondern frönten von Anfang an der<br />
Worthurerei, der Tabubrüche und der<br />
Menschenverachtung. Nein. Die Aufhebung<br />
von Denkverboten ist besonders cool<br />
bei den Linken. Die Materialienverehrung<br />
der schon immer etwas anal fixierten<br />
<strong>Schweiz</strong> verdichtet sich in der Designersprache<br />
von Weltwoche und in der wahnwitzigen<br />
Subkulturinszenierung der WoZ.<br />
In dieser Schludrigkeit, sich selten in die<br />
Haut des anderen zu versetzen, für sich<br />
aber Beobachtungsmacht zu reklamieren,<br />
steckt politisches Dynamit. Setzt den<br />
Raum frei, in welchem sich die Rechten<br />
schliesslich mit Rassismus, grober Vereinfachung<br />
und Ausgrenzung wohl fühlen<br />
und sich breit machen können. Denn die<br />
Sucht, um jeden Preis aufzugeilen und zu<br />
unterhalten, ist beleibe kein ausschliesslich<br />
rechtes Phänomen. Während die<br />
Rechten in Fussballstadien grölen und<br />
«Wir sind wieder wer» schreien, zerstören<br />
wir Linksintellektuellen mit indifferenzierten,<br />
von oben herab geäusserten Statements<br />
und der vor allem auch mit der in<br />
der Kunst verehrten Perversion, mit der<br />
Entzauberung der Welt, mit der öffentlichen<br />
Inszenierung von Intimität, Werte,<br />
die herzlich wenig mit Humanität und politischer<br />
Verantwortung zu tun haben.<br />
Denn schliesslich gilt die Moral auch bei<br />
den Linken nur noch als Ausfluss eines<br />
unreflektierenden und vor allem unmodernen<br />
Geistes.<br />
Die kulturelle und auch von links praktizierte<br />
Zelebrierung des Anstössigen hält<br />
Es gehört zum<br />
guten Ton,<br />
auf die Classe<br />
politique und die<br />
Politisierenden in<br />
diesem Lande<br />
einzuprügeln.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 9
der SVP das Trottoir frei, damit sie umso<br />
schneller durch die Gassen rasen kann. Es<br />
gibt gerade in der <strong>Schweiz</strong> das Phänomen<br />
der Kritik an allem. Doch dummerweise<br />
erstreckt sich diese Kritik gerne auf Personen<br />
und Werte, welche der demokratischen<br />
Gesellschaft wichtig sein sollten: Politiker<br />
sind nicht nur in rechter Betrachtungen<br />
Idioten oder bestensfalls Tollpatschige,<br />
der politische Kompromiss<br />
und die Verhandlungsfähigkeit nicht nur<br />
bei den Konservativen «ein fauler Zauber»<br />
und die meisten Reformvorschläge zu<br />
Steuer- und Finanzregelungen «unbrauchbar».<br />
Die Meinungsmacher in diesem<br />
Land beschäftigen sich vor allem mit<br />
Destruktivität und Dekonstruktion. Damit<br />
nehmen sie aber all denjenigen die Kraft,<br />
die nach politischen Lösungen suchen und<br />
die Widerstandskraft gegen rechten Plakativismus<br />
üben. Als Bundesrat Villiger die<br />
Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer<br />
bekannt gab, hätten alle – die Medien,<br />
die <strong>SP</strong>, das Oltener Bündnis und die<br />
liberalen Vordenker – laut jubilieren und<br />
die Zeitungsspalten füllen sollen. Mit grossem<br />
Tamtam und wirkungsvollen Arena-<br />
Auftritten. Denn zum ersten Mal seit langem<br />
wurde das grösste politische Problem<br />
der <strong>Schweiz</strong>, nämlich die Ungleichheit,<br />
thematisiert. Doch alle – mit Ausnahme<br />
des hervorragenden Kommentars von<br />
Iwan Städler im Tages-Anzeiger – blieben<br />
still. Meinten in vorauseilendem Defaitismus,<br />
dass Villigers Vorschlag von den<br />
Bürgerlichen abgeschossen würde. Was<br />
dann auch mit schöner Sicherheit an der<br />
besagten Delegiertenversammlung passierte.<br />
Doch einmal mehr wurde auf der<br />
linken Seite eine gute Gelegenheit verpasst,<br />
einen spannenden, politisch hoch<br />
explosiven und zukunftsweisenden Issue<br />
auf die politische Agenda zu setzen. Von<br />
den publikumswirksamen elektronischen<br />
Medien ganz zu schweigen.<br />
Nicht was die SVP sagt, ist anstössig, denn<br />
sie sagte dies schon immer und blieb eine<br />
Weile auch eine Minderheit, sondern wie<br />
wir mittlerweile auf die SVP reagieren und<br />
ihr den Boden mit beliebigem Wortstilismus<br />
oder Stillschweigen freischaufeln,<br />
ist pornographisch. Es gibt in der <strong>Schweiz</strong><br />
ein Klima, wo es schon fast müssig geworden<br />
ist, darüber zu spekulieren, welche<br />
politische Taktik die Linke gegen die<br />
SVP anwenden sollte. Denn sämtliche<br />
Vorschläge der Rezepte zwischen Integration<br />
und Isolation zeigen eine politische<br />
Praxis, die das Land im Jahre <strong>2003</strong> dazu<br />
gebracht hat, dass ernsthaft darüber diskutiert<br />
wird, ob das Bankgeheimnis in der<br />
Bundesverfassung verankert werden soll<br />
oder nicht. Die <strong>Schweiz</strong> steht nicht vor einem<br />
Kulturkampf, sondern vor einem<br />
Scherbenhaufen. Denn die von Prof.<br />
Kohler angesprochene Reformschweiz<br />
ist relativ kleinlaut und wenn hörbar, dann<br />
im Designerkostüm. Auch die Blocher-<br />
<strong>Schweiz</strong> allein gibt es nicht. Denn dafür ist<br />
das Land zu bunt. Was es aber zur Genüge<br />
gibt: ein politisches Flickwerk an allen<br />
Ecken und Enden. Der Reformstau und<br />
die Rezession sind mittlerweile tägliches<br />
Brot, die Gemeinden ersticken in den eigenen<br />
Schulden, die Arbeitslosigkeit<br />
steigt, die soziale Ungleichheit in der Vermögensverteilung<br />
macht sich noch breiter,<br />
der Kantönligeist der Schulen und Universitäten<br />
befördern nach wie vor nur<br />
Mittelmass und-und-und.<br />
Die civitas maxima, ganz gleich, ob man<br />
sie praktisch für möglich oder wünschenswert<br />
hält, ist zumindest eine theoretisch<br />
einwandfreie, den menschlichen<br />
Wesensanalgen nicht widersprechende<br />
Setzung. Es täte Not, mehr Zivilcourage<br />
zu zeigen und gewisse Wahrheiten auch<br />
als solche zu benennen.<br />
Regula Stämpfli ist promovierte Politologin<br />
und lebt und arbeitet in Brüssel<br />
und Bern. Neustes Werk: Vom<br />
Stumm- zum Stimmbürger. Das Abc<br />
der <strong>Schweiz</strong>er Politik, Zürich / Orell<br />
Füssli <strong>2003</strong>.<br />
10<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Linke Positionen für eine<br />
soziale <strong>Schweiz</strong> statt<br />
politischer Ratlosigkeit<br />
Die politische Landschaft der <strong>Schweiz</strong> ist<br />
in Bewegung. Die These von zwei verschiedenen<br />
<strong>Schweiz</strong>en, welche heute die<br />
Öffentlichkeit polarisieren, ist aufgrund<br />
der Wahlen und Abstimmungen der letzten<br />
zehn Jahre plausibel. Dass FDP und<br />
CVP, verunsichert durch die SVP-Wahlerfolge,<br />
auf diese Entwicklung konfus,<br />
André Daguet<br />
widersprüchlich und ohne stringente<br />
nachvollziehbare Strategie reagieren,<br />
ist überhaupt nicht erstaunlich. Wenn<br />
sich dagegen die <strong>SP</strong> und die Linke, aufgeschreckt<br />
durch das letzte Abstimmungswochenende,<br />
selber verunsichern,<br />
ist es höchste Zeit daran zu erinnern,<br />
dass ohne starke linke Bewegung die<br />
<strong>Schweiz</strong> nicht sozialer wird.<br />
These 1:<br />
Die SVP ist realpolitisch bei weitem nicht<br />
so erfolgreich wie das Image der Partei<br />
in den Medien und in der Öffentlichkeit.<br />
Blocher und Co. verstehen das populistische<br />
Handwerk ganz einfach weit besser<br />
als alle andere Parteien, einschliesslich der<br />
linken Parteien in der <strong>Schweiz</strong>. Dennoch:<br />
Die SVP ist realpolitisch bei weitem<br />
nicht so erfolgreich wie das Image der Partei<br />
in den Medien, das seit Mitte der neunziger<br />
Jahre viele eingebettete Journalisten<br />
verbreiten, die sich für Blocher, seine SVP<br />
und dessen grössten Abzocker Martin Ebner<br />
die Finger während Jahren wund geschrieben<br />
haben.<br />
Die politische Bilanz der SVP ist vielmehr<br />
äusserst mager, wenn wir die Zahl der verlorenen<br />
strategisch relevanten Abstimmungen,<br />
die Zahl der gescheiterten Exekutivwahlen<br />
auf kantonaler und kommunaler<br />
Ebene sowie das mediokre<br />
politische SVP-Führungspotential in<br />
Bund, Kantonen und Gemeinden in Betracht<br />
ziehen.<br />
Die SVP weist auf nationaler Ebene<br />
nicht einmal einen Wähleranteil von einem<br />
Viertel aus, ist nicht stärker als die <strong>SP</strong><br />
und hat sich ihren Zuzug an WählerInnen<br />
seit zehn Jahren praktisch ausschliesslich<br />
über die vollständige Absorption der<br />
Rechtsaussenparteien, <strong>Schweiz</strong>er Demokraten<br />
und Autopartei sowie der Rechten<br />
von CVP und FDP alimentiert.<br />
These 2:<br />
Umgekehrt stimmt: Die SVP nimmt eine<br />
hegemoniale Position innerhalb des<br />
bürgerlichen Lagers ein, derweil FDP<br />
und CVP durch ihre Führungsschwäche<br />
in der Politlandschaft herumeiern.<br />
Mit ihrem rechtspopulistische Programm<br />
der Abschottung der <strong>Schweiz</strong> und der<br />
Fremdenfeindlichkeit verhindert die SVP<br />
nicht nur den sozialen Fortschritt in der<br />
<strong>Schweiz</strong>, sondern hat durch ihre hegemoniale<br />
Stellung innerhalb des bürgerlichen<br />
Lagers eine eigentliche Krise von<br />
FDP und CVP ausgelöst. Dass die beiden<br />
Parteien, verunsichert durch die Wahlerfolge<br />
der SVP, seit Jahren konfus, widersprüchlich<br />
und ohne klar nachvollzieh-<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 11
Fotos: Friederike Baetcke<br />
12<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 13
Die soziale Frage<br />
bleibt die grösste<br />
Herausforderung<br />
für die Linke.<br />
bare Strategie reagieren, erstaunt nicht angesichts<br />
der Führungsschwäche beider<br />
Parteien, spätestens seit dem durch Filz<br />
und Abzockereien ausgelösten freien Fall<br />
der mit der FDP und CVP verbandelten<br />
Wirtschaftselite. Der gnadenlose Absturz<br />
von Andres Leuenberger, der langjährigen<br />
Vorzeigefigur der <strong>Schweiz</strong>er Wirtschaftsbosse,<br />
spricht Bände.<br />
These 3:<br />
Die SVP wird ihre jetzige hegemoniale<br />
Rolle rechtsaussen nur so lange halten,<br />
als Blocher als der einzige reale Kopf der<br />
herrschenden SVP in der Politik verbleibt.<br />
Dann ist Schluss mit dem politischen<br />
Marionettentheater.<br />
Parteipräsident Ueli Maurer ist eine Marionette<br />
von Blocher, was auch immer<br />
Köppels Weltwoche schreibt. Maurer und<br />
die durch Blochers Schutzschirm gedeckte<br />
Zürcher Führungscrew im rechten<br />
Sumpf von Auns und anderen rechtsextremen<br />
Bewegungen werden ihre Marionettenrolle<br />
solange spielen, als Blocher der<br />
SVP die Politik diktiert. Sie werden den<br />
Abgang von Blocher politisch nicht überleben.<br />
Die SVP verfügt national, kantonal<br />
und kommunal im rechten Spektrum über<br />
derart wenig qualifizierte politische Kader,<br />
dass mit dem Ausscheiden von Blocher und<br />
seiner Millionenspenden die SVP an der<br />
Rechtsaussenfront rapide bröckeln wird.<br />
Die fähigeren Köpfe der SVP auf nationaler<br />
Ebene wollen ihre politischen Rollen<br />
nicht aufs Spiel setzen. Doch im<br />
Hintergrund wird die Ablösung der Prätorianergarde<br />
von Blochers Gnaden bereits<br />
jetzt vorbereitet. Das wird die Politlandschaft<br />
zwischen SVP, FDP und CVP<br />
noch einmal heftig durchschütteln.<br />
These 4:<br />
Für die Linke in der <strong>Schweiz</strong> gilt weiterhin:<br />
Links der <strong>SP</strong> gibt es kein politisch<br />
relevantes nationales Projekt. Und bei<br />
den Grünen dominiert die politische Unklarheit<br />
wie seit langem nicht mehr.<br />
Links der <strong>SP</strong> gibt es kein politisch relevantes<br />
nationales Projekt. Diese These, die<br />
im Januar 1996 von Peter Bodenmann zusammen<br />
mit dem Autor dieses Artikels<br />
1996 in der <strong>Rote</strong>n <strong>Revue</strong> publiziert worden<br />
ist, hatte damals eine breite politische<br />
und kontroverse Diskussion provoziert.<br />
Für die Einschätzung sieben Jahre später<br />
gilt weiterhin: Es gibt kein relevantes nationales<br />
politisches Projekt links der <strong>SP</strong>.<br />
Und auch eine zweite These hat unverändert<br />
Gültigkeit: Die soziale Frage bleibt<br />
die grösste Herausforderung für die Linke<br />
und die Gewerkschaftsbewegung in der<br />
<strong>Schweiz</strong>. Diese Feststellung gilt heute nach<br />
dem jüngsten Angriff von Sozialminister<br />
Couchepin auf Rentenalter, AHV-Rente,<br />
BVG-Rente und die Krankenversicherung<br />
erst recht. Die Frage, die sich dabei stellt:<br />
Hat die <strong>SP</strong> und die Linke insgesamt gelernt,<br />
mit dieser politischen Einschätzung<br />
richtig umzugehen?<br />
Wichtig für die Linke in der <strong>Schweiz</strong> ist die<br />
Erfahrung der neunziger Jahre: Die <strong>SP</strong> hat<br />
ihren grössten historischen Wahlsieg seit<br />
1918 im Herbst 1995 errungen, weil die<br />
Partei mit linken Positionen angetreten ist,<br />
die soziale Frage ins Zentrum ihrer Politik<br />
gestellt hat und damit die politische Zuspitzung<br />
zwischen rechts und links mit Erfolg<br />
vollzogen hat.<br />
Die Grünen, die soeben das zwanzigjähriges<br />
Jubiläum begossen haben, streiten<br />
heute darüber, ob sie sich von der Linken<br />
wieder verabschieden sollen. Das Streitgespräch<br />
zwischen zwei wichtigen Exponenten<br />
der Grünen, Ruth Genner und<br />
Bernhard Pulver in der Berner Zeitung<br />
vom 24. Mai ist sehr aufschlussreich. Bernhard<br />
Pulver im Originalton: «Ich finde, die<br />
GPS sollte sich aus der Links-rechts-Konfrontation<br />
heraushalten.» Und Ruth Genner:<br />
«Ich spreche hier lieber über politische<br />
Entscheidungskriterien als vom<br />
Rechts-links-Schema.»<br />
14<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
These 5:<br />
Der Versuch, die <strong>SP</strong> politisch in der Mitte<br />
zu positionieren, war keine brauchbare<br />
Antwort in den achtziger Jahren, und ist<br />
es schon gar nicht auf die Politik der<br />
Rechten heute.<br />
Schon in der zweiten Hälfte der achtziger<br />
Jahre hat ein sozialdemokratischer Arbeitskreis,<br />
vorwiegend <strong>SP</strong>-Bundesbeamte,<br />
mit ihrer Schrift «Sozialdemokratie 2000»<br />
den Versuch unternommen, die Partei in<br />
der Mitte neu zu positionieren und sich<br />
aus dem politischen Schema von linker<br />
und rechter Politik zu verabschieden. Ihr<br />
politisches Rezept der Modernisierung,<br />
unter anderem mit dem Abbau direktdemokratischer<br />
Institutionen, das Abschminken<br />
linker Positionen, z.B. in der<br />
Armeefrage, und die damit verbundene<br />
Öffnung für neue Mittelschichten blieben<br />
ohne nachhaltige Wirkung, ganz einfach<br />
weil die Realanalyse nicht stimmte. Die<br />
politische Mitte ist kein politischer Standort,<br />
sondern eine virtuelle Konstruktion<br />
des Unpolitischen. Der Versuch, sich aus<br />
dem politischen Schema von links und<br />
rechts zu verabschieden, entbehrt einer<br />
sauberen Analyse der gesellschaftlichen,<br />
politischen und wirschaftlichen Verhältnisse<br />
in der Realentwicklung. Nicht weniger<br />
zum politischen Flop geworden ist<br />
das «Gurtenmanifest» vom Mai 2001, das<br />
inhaltlich und analytisch aber noch dünner<br />
war als der erste Versuch einer politischen<br />
Neuorientierung nach rechts in den<br />
achtziger Jahren.<br />
These 6:<br />
Um eine hegemoniale linke Politik zu<br />
entwickeln, steht sich die politische Linke<br />
in der <strong>Schweiz</strong> vorab selber im Weg,<br />
solange sich linke Parteien und kleinere<br />
Politsekten über den hegemonialen<br />
Anspruch innerhalb der Linken streiten.<br />
Die Zersplitterung der Linken in der<br />
<strong>Schweiz</strong>, namentlich die fortlaufende<br />
Spaltungsbewegung innerhalb politischer<br />
Gruppierungen links der <strong>SP</strong>, trägt oft die<br />
Züge eine politischen Sektarismus, der für<br />
die Durchsetzung der Grundwerte einer<br />
sozialen <strong>Schweiz</strong> wenig hilfreich ist. Für<br />
eine soziale <strong>Schweiz</strong> braucht es eine starke<br />
Linke in der <strong>Schweiz</strong>, die in der Lage<br />
ist, eine linke politische Debatte zu führen,<br />
sich aber nicht in einem Kleinkrieg über<br />
dogmatisierte Positionen selber lähmt, wie<br />
dies z.B. in jüngster Zeit mit der Abspaltung<br />
des «Mouvement pour le socialisme»<br />
aus der Solidarité oder mit den politisch<br />
sterilen Querelen von ExponentInnen des<br />
Oltner Bündnisses mit der Sozialdemokratie<br />
geschehen ist. Statt sich auf eine linke<br />
politische Plattform zu einigen, findet<br />
ein politischer Kleinkrieg statt, der nicht<br />
mehr den Kampf um die soziale <strong>Schweiz</strong><br />
stärkt, sondern ein gemeinsames politisches<br />
Projekt der Linken hintertreibt.<br />
Und oft ebenso schwer tut sich die <strong>SP</strong> und<br />
die politische Linke insgesamt gegenüber<br />
der Gewerkschaftsbewegung, die spätestens<br />
seit Mitte der neunziger Jahre als soziale<br />
Bewegung und politische Kraft des<br />
Landes an Profil gewonnen hat. Die Gewerkschaften<br />
sind die grösste soziale Bewegung<br />
der <strong>Schweiz</strong>, die nicht nur in der<br />
Gesamtarbeitsvertragspolitik die entscheidende<br />
Rolle spielt, sondern ihrerseits<br />
das grösste politische Mobilisierungsund<br />
Vetopotential im Kampf um eine soziale<br />
<strong>Schweiz</strong> und gegen den massiv drohenden<br />
Sozialabbau repräsentiert.<br />
These 7:<br />
Die soziale Frage ist die entscheidende<br />
Frage, welche die Menschen in der<br />
<strong>Schweiz</strong> bewegt. Das definiert die Position<br />
der <strong>SP</strong> als linke politische Kraft im<br />
Bündnis mit der Gewerkschaftsbewegung.<br />
Was vor sieben Jahren in der Analyse der<br />
politisch-gesellschaftlichen Situation der<br />
neunziger Jahre galt, zeigt sich heute in<br />
noch grösserer Schärfe als in der Krise der<br />
neunziger Jahre:<br />
Der politische<br />
Kleinkrieg innerhalb<br />
der Linken<br />
schwächt den<br />
Kampf um die<br />
soziale <strong>Schweiz</strong>.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 15
• Immer mehr Menschen auch in den industrialisierten<br />
Ländern werden pauperisiert<br />
und marginalisiert. Praktisch<br />
alle Gesellschaften werden unsozialer,<br />
obwohl die wachsende ungleiche Verteilung<br />
der Einkommen und Vermögen<br />
das Wachstum behindert.<br />
• Wir brauchen eine nachhaltige und<br />
wachstumorientierte Wirtschafts- und<br />
Konjunkturpolitik, um den offenen<br />
und schleichenden Sozialabbau zu<br />
stoppen, die soziale Sicherung zu stärken<br />
und die Lohn- und Chancengleichheit<br />
zwischen Frauen und Männern<br />
endlich durchzusetzen. Die These<br />
stimmt: Die Totengräber des Wachstums<br />
sind nicht die Gewerkschaften und die<br />
politische Linke, sondern die Parteien<br />
der Rechten und der Wirtschaftsdachverband<br />
Economie Suisse.<br />
• Der Erhalt des Service public gegen die<br />
Politik der Liberalisierung, Deregulierung<br />
und Privatisierung ist ein Angelpunkt<br />
linker Politik. Dass diese Auseinandersetzung<br />
für die Linke nicht nur<br />
zentral, sondern auch erfolgreich sein<br />
kann, haben die Abstimmungserfolge<br />
gegen das EMG und andere Vorlagen in<br />
der Elektrizitätswirtschaft gezeigt.<br />
• Der radikale ökologische Umbau zahlt<br />
sich ökonomisch aus und generiert Beschäftigung.<br />
Und dennoch ist er in den<br />
letzten zehn Jahren nicht wesentlich<br />
vorangekommen. Im Gegenteil: Weite<br />
Teile der Wirtschaft haben den ökologischen<br />
Umbau bisher erfolgreich verhindert,<br />
obschon er für Industrie und<br />
Gewerbe in der <strong>Schweiz</strong> eine der spannendsten<br />
wirtschaftlichen und technologischen<br />
Herausforderungen wäre.<br />
These 8:<br />
Die Linke muss wieder lernen, ihre eigene<br />
Sprache zu pflegen. So wie das die<br />
SVP seit Jahren mit Erfolg tut.<br />
Die Linke hat ihre eigene ökonomische<br />
Analyse und Logik, die mit den neoliberalen<br />
Theorien und Dogmen der Bürgerlichen<br />
und der Arbeitgeber nicht kompatibel<br />
ist. Die <strong>SP</strong> und die linke Bewegung<br />
insgesamt muss wieder lernen, einen politischen<br />
Diskurs zu pflegen, den uns die<br />
politische und ökonomische Analyse nahe<br />
legt. Die schleichende Übernahme politischer<br />
und ökonomischer Diskurse der<br />
politischen Rechten oder der Arbeitgeberverbände<br />
hilft uns nicht weiter und<br />
macht uns zu Gefangenen einer bürgerlichen<br />
Logik. Hier müssen wir unsere eigenen<br />
politische Logik entgegensetzen:<br />
• Die Finanzierung der AHV als das effizienteste<br />
System der Altersvorsorge ist<br />
auch langfristig nicht gefährdet, sondern<br />
bedarf im Gegenteil eines Ausbaus zur<br />
existenzsichernden Rente, unter anderem<br />
mit der 13. Monatsrente, ohne Rentenaltererhöhung<br />
und einschliesslich einer<br />
sozialverträglichen Flexibilisierung<br />
des Rentenalters ab 62 oder 60 Jahren.<br />
• Mehr Lohngerechtigkeit durch höhere<br />
Einkommen für tiefere und mittlere Einkommensgruppen<br />
sind wirtschaftlich<br />
und volkswirtschaftlich keine Belastung,<br />
sondern fördern das Wirtschaftswachstum<br />
und die Beschäftigung.<br />
• In Zeiten der wirtschaftlichen Krise<br />
braucht es aus sozialen und ökonomischen<br />
Gründen nicht neoliberale Sparprogramme<br />
und Steuerentlastungen für<br />
höhere Einkommen, sondern eine antizyklische<br />
Finanz- und Geldpolitik<br />
mittels vorgezogener öffentlicher Investitionen<br />
und branchenbezogener Impulsprogramme.<br />
André Daguet, Jg. 1947, lic.rer.pol.,<br />
Vizepräsident der Gewerkschaft<br />
Smuv, bis 1996 Generalsekretär der<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>, lebt in Bern.<br />
16<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Verkäuferinnen,<br />
Chauffeure und<br />
linke Politik<br />
Die fast 50-prozentige Unterstützung für<br />
die Asyl-Initiative der SVP kann als Votum<br />
gegen Flüchtlinge und eine offene und<br />
solidarische <strong>Schweiz</strong> interpretiert werden.<br />
Es tobe ein Kulturkampf – so die Einschätzung<br />
von Georg Kohler 1 –, der jetzt<br />
geführt werden müsse und bei welchem<br />
die CVP und FDP entschieden gegen die<br />
SVP und die Zerstörung der politischen<br />
Beat Baumann<br />
Kultur und den Zukunftsmöglichkeiten<br />
der <strong>Schweiz</strong> auftreten müssten. Besonders<br />
enttäuschend mag sein, dass die Initiative<br />
auch bei linken Wählerinnen und Wählern<br />
eine gewisse Unterstützung fand. Engagierte<br />
Bürgerinnen und Bürger wenden<br />
sich frustriert und angewidert von der Politik<br />
ab, da sie hinter diesem Abstimmungsverhalten<br />
fremdenfeindliche und<br />
nur langfristig veränderbare Einstellungen<br />
vermuten.<br />
Ich gehe in diesem Artikel von einer anderen<br />
These aus. In diesem Abstimmungsverhalten<br />
kommen Verunsicherung,<br />
Protest und Projektion eigener Existenzängste<br />
zum Ausdruck, die mit der<br />
Unzufriedenheit über eine zunehmend ungerechte<br />
Verteilungssituation zu tun haben.<br />
Die ökonomische Lage der Ärmsten,<br />
aber auch der unteren Mittelschicht, der<br />
Verkäuferinnen und der Chauffeure hat<br />
sich in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert.<br />
Im neoliberalen Projekt wird<br />
1<br />
Georg Kohler im Tages-Anzeiger vom 24. November<br />
2002.<br />
eine grössere Ungleichheit in Kauf genommen,<br />
weil eine prosperierende Wirtschaft<br />
nur über eine finanzielle Entlastung<br />
der Unternehmen und Grossverdiener zu<br />
erzielen sei. Das galt lange Zeit als starkes<br />
Argument gegen eine politische Aufwertung<br />
der sozialen Gleichheit, auch in Kreisen<br />
der Sozialdemokratie 2 . Nun ist die<br />
Nebenwirkung der neoliberalen Medizin<br />
– eine grössere Ungleichheit – zwar eingetreten,<br />
nur blieb leider deren Wirkung –<br />
Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand<br />
für alle – aus.<br />
Liegt hier ein Ansatzpunkt einer linken<br />
Politik mit der sozialen Gleichheit als zentralem<br />
Wert? Die Kunst der Politik bestünde<br />
in einer Verbindung des Interesses<br />
der unteren Mittelschicht an einer Einkommensumverteilung<br />
mit dem Anliegen<br />
der linksliberalen Mittelschicht, allen gesellschaftlichen<br />
Gruppen, unabhängig von<br />
Geschlecht, Sexualität, Aufenthaltsstatus,<br />
Nationalität usw., die gleiche Anerkennung<br />
zukommen zu lassen 3 .<br />
Massive Umverteilung<br />
in den 90er Jahren<br />
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist<br />
die Beobachtung und Bestätigung eines<br />
allgemeinen Eindrucks, dass es in den 90er<br />
2<br />
Mahnkopf, Birgit (2000): Formel 1 der neuen Sozialdemokratie:<br />
Gerechtigkeit durch Ungleichheit. Zur Neuinterpretation<br />
der sozialen Frage im globalen Kapitalismus;<br />
in PROKLA <strong>Nr</strong>. 4.<br />
3<br />
Fraser, Nancy (2002): Soziale Gerechtigkeit in der Wissensgesellschaft:<br />
Umverteilung, Anerkennung und Teilhabe;<br />
in Heinrich-Böll-Stiftung (Hrs.), Gut zu Wissen – Links<br />
zur Wissensgesellschaft, Verlag Westfälisches Dampfboot.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 17
Jahren zu einer unerwünschten Umverteilung<br />
der Einkommen gekommen ist. Eine<br />
im Auftrag des Staatssekretariats für<br />
Wirtschaft (seco) erstellte Studie belegt eine<br />
zunehmende soziale Ungleichheit bei<br />
den Haushalten 4 . Die Autoren stützen sich<br />
auf Daten der Verbrauchserhebung 1990<br />
sowie der Einkommens- und Verbrauchserhebung<br />
1998 des Bundesamtes für Statistik.<br />
Sie berechnen das Einkommen pro<br />
Äquivalenzperson 5 für die Jahre 1990 und<br />
1998 und teilen die Haushalte im Erwerbsprozess<br />
in Abhängigkeit der Einkommenshöhe<br />
in 6 Gruppen. Dabei sind<br />
die ärmsten 10 Prozent der Haushalte die<br />
4<br />
Müller André / Michael Marti / Renger van Nieuwkoop<br />
(2002): Globalisierung und die Ursachen der Umverteilung<br />
in der <strong>Schweiz</strong>, Studie im Auftrag des Staatssekretariats für<br />
Wirtschaft seco, Bern.<br />
3<br />
Das Einkommen pro Äquivalenzperson gibt das Einkommen<br />
eines Haushaltes im äquivalenten Einkommen eines<br />
Einpersonenhaushaltes mit gleichem Wohlstandsni<br />
veau an.<br />
kinderreichsten mit einem Schnitt von 1,3<br />
Kindern pro Haushalt. In den reichsten 10<br />
Prozent der Haushalte leben dagegen im<br />
Durchschnitt lediglich 0,3 Kinder.<br />
Von den Einnahmen der Haushalte (Löhne,<br />
Sozialleistungen, Kapitaleinkommen)<br />
werden die Zwangsausgaben (Steuern,<br />
Beiträge an die Sozialversicherungen,<br />
Prämien, Miete) subtrahiert und so das<br />
verfügbare Einkommen (für Nahrungsmittel,<br />
Mobilität, Kleidung usw.) ermittelt.<br />
Was sagt die Tabelle aus? Die Einnahmen<br />
haben in allen Gruppen zugenommen, am<br />
stärksten bei den reichsten 10 Prozent, was<br />
nicht überrascht. Deutlich aber auch bei<br />
den ärmsten 10 Prozent, aber am schwächsten<br />
bei den unteren 10–25 Prozent. Entscheidend<br />
für den Lebensstandard sind jedoch<br />
nicht die Einnahmen, sondern das<br />
Tabelle: Das verfügbare Einkommen pro Jahr, geordnet nach Einkommensstärke,<br />
1990 und 1998, in CHF<br />
zu Preisen von 1990,<br />
Quelle: MÜLLER / MARTI /<br />
NIEUWKOOP (Fn 4),<br />
ärmste 10%<br />
Armutsbevölkerung<br />
10%–25%<br />
25%–50%<br />
untere Mittelschicht<br />
50%–75%<br />
75%–90%<br />
reichste 10%<br />
obere Mittelschicht (inkl.<br />
linksliberale Mittelschicht) Oberschicht<br />
18<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
verfügbare Einkommen, und dies hat sich<br />
an den Rändern der Verteilung, bei den<br />
ärmstes 10 Prozent und den reichsten<br />
10 Prozent, extrem differenziert. Für die<br />
ärmsten 10 Prozent der Haushalte ist das<br />
frei verfügbare Jahreseinkommen in den<br />
90er Jahren deutlich zurückgegangen.<br />
Wie die Tabelle zeigt, war es 1998 pro<br />
Äquivalenzperson real um rund 2300<br />
Franken tiefer als 1990. Betrug sein Anteil<br />
am Gesamteinkommen 1990 noch 68 Prozent,<br />
so waren es 8 Jahre später nur noch<br />
53 Prozent, was einem Rückgang von 14<br />
Prozentpunkten entspricht!<br />
Anders die Situation der reichsten 10 Prozent<br />
der Haushalte: Zwar sind auch hier<br />
die Zwangsausgaben stärker angestiegen<br />
als das gesamte Einkommen. Das frei verfügbare<br />
Einkommen pro Äquivalenzperson<br />
ist aber im betrachteten Zeitraum<br />
noch um 10249 Franken (oder gut 12 Prozent)<br />
gestiegen.<br />
Die zunehmende Ungleichheit ist nicht auf<br />
die ärmsten und reichsten Haushalte beschränkt.<br />
Insgesamt ging bei den ärmeren<br />
50 Prozent der Haushalte das frei verfügbare<br />
Einkommen zurück, bei den darüber<br />
liegenden 40 Prozent der reicheren Haushalte<br />
stagnierte es und bei den reichsten<br />
10 Prozent stieg es – wie wir schon gesehen<br />
haben – deutlich an.<br />
Eine vereinfachte Zuordnung von Gesellschaftsschichten<br />
zu den statistischen<br />
Kategorien zeigt folgendes Bild: Die Lage<br />
der Armutsbevölkerung hat sich massiv<br />
verschlechtert und der Lebensstandard der<br />
unteren Mittelschicht ist ebenfalls markant<br />
gesunken. Die obere Mittelschicht lebt am<br />
Ende der 90er Jahre etwa gleich gut wie zu<br />
Beginn. Einzig die Oberschicht konnte ihr<br />
verfügbares Einkommen steigern. Dieses<br />
Muster der verstärkten Ungleichverteilung<br />
könnte aus dem Lehrbuch stammen.<br />
Interessant ist, wie diese zustande gekommen<br />
ist. Die Erkenntnis lautet, dass<br />
für die zunehmende Schieflage der Verteilung<br />
primär die Mechanismen des Nationalstaats<br />
verantwortlich sind und nicht<br />
etwa die Globalisierung. Konkret sind es<br />
die gestiegenen Ausgaben bei Kindern,<br />
Mieten, Krankenkassenprämien und Steuern,<br />
welche zu einem tieferen Lebensstandard<br />
der ärmeren Gesellschaftshälfte<br />
geführt haben.<br />
Enttäuschte Gerechtigkeit<br />
der unteren Mittelschicht...<br />
Eine klare Verschlechterung musste die<br />
untere Mittelschicht in den 90er Jahren<br />
hinnehmen. Doch wer gehört eigentlich<br />
zur unteren Mittelschicht? Ich habe als<br />
Kriterium die Höhe des verfügbaren Einkommens<br />
gewählt, was natürlich nicht die<br />
ganze soziale Lage widerspiegelt und auch<br />
von der Lebensphase abhängig ist; so reduzieren<br />
Kinder beispielsweise das verfügbare<br />
Einkommen ganz stark. Die untere<br />
Mittelschicht umfasst die traditionelle Arbeiterschicht,<br />
die Beschäftigten der Produktion<br />
des zweiten Sektors (Textil, Maschinenindustrie,<br />
Bau usw.), FacharbeiterInnen<br />
ohne besonderen Status oder<br />
ArbeiterInnen ohne Berufsabschluss. Zur<br />
unteren Mittelschicht gehören aber auch<br />
Angestellte in den privaten Dienstleistungsbetrieben<br />
(Servicemonteure, Service-<br />
Angestellte, technische Angestellte usw.)<br />
sowie RentnerInnen mit bescheidenen<br />
Rentenleistungen.<br />
Kennzeichen für die untere Mittelschicht<br />
sind relativ geringe Löhne und zunehmend<br />
auch unsichere berufliche Perspektiven.<br />
Sie ist besonders stark von Statusverlust,<br />
Erwerbslosigkeit, Aussteuerung und Verarmung<br />
bedroht. Neoliberale Veränderungen<br />
schmälern zudem auch den Status<br />
jener Angestellten bei der öffentlichen<br />
Hand, die bis vor kurzem eine sichere, vergleichsweise<br />
gut bezahlte Stelle hatten; so<br />
sind beispielsweise die Chauffeure jene Berufsgruppe<br />
mit dem grössten Lohnverlust<br />
in den vergangenen Jahren. Durch den so-<br />
Für die untere<br />
Mittelschicht<br />
hat sich das<br />
«Tauschverhältnis»<br />
mit dem Staat<br />
negativ verändert.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 19
Der unteren<br />
Mittelschicht<br />
ist die<br />
Kontrolle<br />
über ihren<br />
Lebensstandard<br />
entglitten.<br />
zialen Wandel, durch Scheidung oder Einelternfamilien<br />
steigen Personen, v.a. Frauen,<br />
materiell in die untere Mittelschicht ab.<br />
Ein beträchtlicher Teil der unteren Mittelschicht<br />
hat keinen <strong>Schweiz</strong>er Pass.<br />
Für die untere Mittelschicht hat sich das<br />
«Tauschverhältnis» mit dem Staat negativ<br />
verändert. Steuern, Abgaben, Prämien und<br />
Sozialversicherungsbeiträge nahmen zu<br />
und das verfügbare Einkommen ab. Viele<br />
sind working poor, leben knapp über<br />
der Armutsgrenze, aber mit der Begleichung<br />
von Steuern und Krankenkassenprämien<br />
fallen sie darunter. Gleichzeitig<br />
scheint der Staat weder ihre künftigen Altersrenten<br />
noch die Ausbildungsperspektiven<br />
ihrer Kinder sichern zu können.<br />
Die untere Mittelschicht fühlt sich durch<br />
den Staat ungerecht behandelt und versucht<br />
dort Korrekturen vorzunehmen, wo es ihr<br />
möglich scheint, indem sie Steuerreduktionen<br />
unterstützt, obwohl sie davon nicht<br />
profitiert hat, wie die Statistik zeigt. Wer zur<br />
unteren Mittelschicht zählt, ist stolz darauf,<br />
ein finanziell unabhängiges Leben zu<br />
führen, das auf die eigene Leistung zurückgeführt<br />
wird. Das zunehmend ungünstigere<br />
Verhältnis von Kosten und Nutzen mit<br />
dem Staat verletzt den für die Mittelschicht<br />
wichtigen Wert der Leistungsgerechtigkeit.<br />
Der unteren Mittelschicht ist die Kontrolle<br />
über ihren Lebensstandard entglitten;<br />
trotz erhöhten Anstrengungen in den 90er<br />
Jahren ist das verfügbare Einkommen zurückgegangen<br />
und die Zukunftsperspektiven<br />
unsicherer geworden. Gerechtigkeitserwartungen<br />
der unteren Mittelschicht<br />
sind zutiefst enttäuscht worden.<br />
Die Leistungsgerechtigkeit, der zentrale<br />
Wert der unteren Mittelschicht, wird von<br />
Staat und Markt unterhöhlt 6 . Die Erwerbsarbeit<br />
wird zunehmend anspruchsvoller<br />
und intensiver, aber die Entlöhnung<br />
verbleibt auf dem alten Niveau. Verstärkt<br />
wird das Gefühl, dass das Einkommen mit<br />
Leistung nur bedingt kontrollierbar ist,<br />
auch durch die Entwicklung bei den Löhnen<br />
der Manager, die jede Relation zur<br />
Leistung verloren haben und einzig mit ihrer<br />
aussergewöhnlichen Machtpositionen<br />
zu tun haben. Der Flexibilisierungszwang<br />
des Neoliberalismus bringt eine<br />
neue und oft unzumutbare Verfügbarkeit<br />
der Menschen hervor und verstärkt das<br />
Gefühl einer starken Fremdbestimmung.<br />
Aus Kontrollverlust und sozialer Verunsicherung<br />
können intolerante und ausgrenzende<br />
Einstellungen folgen. Das Kontrollkonzept<br />
besagt, dass Personen, deren<br />
Handlungen stark external bestimmt sind,<br />
autoritär und ausgrenzend reagieren und<br />
als Folge davon Rassismus, Fremdenfeindlichkeit<br />
und Ausgrenzung von sozialen<br />
Schwachen zunehmen 7 . Die in der<br />
unteren Mittelschicht populäre Forderung<br />
nach «mehr Leistungsgerechtigkeit» wendet<br />
sich unter solchen Umständen gegen<br />
Ausgesteuerte, SozialhilfeempfängerInnen<br />
oder AsylbewerberInnen, indem deren<br />
finanzielle Unterstützung von einer<br />
«Gegenleistung» abhängig gemacht wird.<br />
Eine Position, die mit dem «Dritten<br />
Weg» auch in der Sozialdemokratie eine<br />
Basis gefunden hat.<br />
...und der linksliberalen<br />
Mittelschicht<br />
Personen der linksliberalen Mittelschicht<br />
sind materiell gut gestellt und konnten ihren<br />
Status in den 90er Jahren auf hohem<br />
Niveau halten. Sie streben sinnerfüllte Lebensstile<br />
an, die mit ihren Wertvorstellungen<br />
übereinstimmen, wie beispielsweise<br />
eine gleichmässigere Verteilung der Erwerbs-<br />
und Familienarbeit zwischen den<br />
6<br />
Mahnkopf, Birgit (2000): Formel 1 der neuen Sozialdemokratie:<br />
Gerechtigkeit durch Ungleichheit. Zur Neuinterpretation<br />
der sozialen Frage im globalen Kapitalismus;<br />
in PROKLA <strong>Nr</strong>. 4.<br />
7<br />
Heitmeyer, Wilhelm (2001): Autoritärer Kapitalismus,<br />
Demokratieentleerung und Rechtspopulismus; in Loch,<br />
Dietmar und Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.), Schattenseiten der<br />
Globalisierung, edition suhrkamp.<br />
20<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Geschlechtern. Viele von ihnen engagieren<br />
sich bei den Organisationen der Zivilgesellschaft<br />
und einige auch bei den linken<br />
Parteien. Ihr politisches Interesse gilt<br />
einem guten Zusammenleben der unterschiedlichen<br />
Gruppen und einem würdigen<br />
und gerechten Umgang mit den<br />
Schwächsten in der Gesellschaft. Selbstverständlich<br />
ist der Sozialstaat auch im<br />
materiellen Interesse dieser Gruppe. Sie ist<br />
materiell so gut positioniert, dass sie im<br />
Allgemeininteresse auch einer Umverteilung<br />
zu ihren Ungunsten zustimmen<br />
kann. Doch auch ihre Gerechtigkeitserwartungen<br />
werden durch Fremdenfeindlichkeit,<br />
eine zunehmend repressivere<br />
Flüchtlingspolitik und dem fehlenden<br />
politischen Willen für eine bessere Integration<br />
der Ausländer und Ausländerinnen<br />
stark enttäuscht. Die Folgen davon sind<br />
Politikverdrossenheit, Rückzug aus der Politik,<br />
fehlendes Engagement und letztlich<br />
ein Verlust der Ideale.<br />
Enttäuschte Gerechtigkeit, die es bei beiden<br />
für die Linke relevanten Gesellschaftsschichten<br />
gibt, ist der Nährboden<br />
für Rechtspopulismus und Politikabstinenz.<br />
Ein linke Politik mobilisiert nur<br />
dann ausreichend, wenn beide Gruppen<br />
– untere sowie linksliberale Mittelschicht<br />
sich und ihre Gerechtigkeitsvorstellungen<br />
darin wiederfinden. Wie können Verteilungsfragen<br />
und Fragen der Anerkennung<br />
zusammengebracht werden? Die untere<br />
Mittelschicht wird dann die offene <strong>Schweiz</strong><br />
mittragen, wenn sie sich gerecht behandelt<br />
fühlt. Und die linksliberale Mittelschicht<br />
wird nur dann zu Verteilungskorrektur zu<br />
ihren Ungunsten bereit sein, wenn sich eine<br />
Perspektive für eine solidarische Gesellschaft<br />
abzeichnet. Vor diesem Hintergrund<br />
plädiere ich für eine linke Politik,<br />
welche Anerkennung aller gesellschaftlichen<br />
Gruppen und insbesondere Bedarfsgerechtigkeit<br />
der sozial Schwächsten<br />
mit einer leistungsgerechteren materiellen<br />
Besserstellung der unteren Mittelschicht<br />
in Zusammenhang bringt.<br />
Soziale Ungleichheit kein Thema?<br />
Der Trend zu einer immer egalitäreren Einkommensverteilung<br />
hat sich seit den<br />
80er Jahren in allen westlichen Industrieländern<br />
markant umgekehrt und die<br />
soziale Ungleichheit müsste eigentlich ein<br />
grosses Thema unserer Zeit sein, erst recht<br />
einer linken Politik 8 . Warum das nicht so<br />
ist, liegt natürlich an der langwährenden<br />
Dominanz des Neoliberalismus. Aber<br />
nicht darauf, sondern auf einen anderen<br />
Punkt möchte ich hinweisen. Was in der<br />
Sprache über Gesellschaft nicht abgebildet<br />
wird, kann auch nicht zu einem politischen<br />
Thema werden. Denn häufig wird<br />
ausgeblendet, dass die Gesellschaft vertikal,<br />
d. h. einkommensabhängig gegliedert<br />
ist. Bei den Verteilungskonflikten beobachten<br />
wir eine Verlagerung von der vertikalen,<br />
einkommensabhängigen zur horizontalen<br />
Ebene zwischen unterschiedlichen<br />
Gruppen. Leben die Alten auf<br />
Kosten der Jungen, Singles auf Kosten der<br />
Familien? Bei solchen Fragen werden die<br />
Gruppen als homogen betrachtet, ungeachtet<br />
dessen, dass es reiche und arme Alte,<br />
reiche und arme Singles wie Familien<br />
gibt. Im Zuge des «Individualismus» ist<br />
der Gesellschaft das Verständnis für die soziale<br />
Schichtung, das Klassenbewusstsein<br />
abhanden gekommen.<br />
8<br />
Nolte, Paul (2001): Unsere Klassengesellschaft, in die<br />
ZEIT <strong>Nr</strong>. 2.<br />
«Ein Plädoyer für mehr Klassenbewusstsein<br />
– das mag sich antiquiert anhören, wie<br />
die Aufforderung zur Rückkehr in die<br />
Denkwelten der Arbeiterbewegung vor<br />
hundert Jahren. Es heisst aber nur, dass wir<br />
ein geschärftes Bewusstsein dafür brauchen,<br />
in einer Welt zu leben, die immer<br />
noch durch soziale Ungleichheit, durch<br />
Schichtung und Klassendifferenzen geprägt<br />
wird. Das weiter zu verdrängen,<br />
kann angesichts der rasanten Veränderungen,<br />
wie wir sie zum Beispiel in der Informations-<br />
und Wissensökonomie erle-<br />
Enttäuschte<br />
Gerechtigkeit<br />
bei den für die<br />
Linken relevanten<br />
Gesellschaftsschichten<br />
ist der Nährboden<br />
für Rechtspopulismus<br />
und<br />
Politikabstinenz.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 21
en, und angesichts der demografischen<br />
Veränderungen, denen wir nicht ausweichen<br />
können, politisch gefährlich sein...<br />
Mit Klassenkampf hat das gar nichts zu<br />
tun, wohl aber mit gesellschaftlicher<br />
Selbstaufklärung.» 9<br />
Werden in der Politik Gruppenbezeichnungen<br />
gewählt, die eine Schichtung der<br />
Gesellschaft zum Ausdruck bringen, so<br />
sind es in der Regel drei, die präsent sind:<br />
Die grösste Aufmerksamkeit erheischen<br />
die «Grossverdiener» und der «Mittelstand».<br />
Die Linke sorgt zusammen mit den<br />
Organisationen der Zivilgesellschaft für eine<br />
Repräsentation der «Armutsbevölkerung».<br />
Die untere Mittelschicht ist nicht<br />
präsent oder allenfalls im Bild vom «kleinen<br />
Mann von der Strasse». Die im politischen<br />
Raum konkurrierenden Massnahmen<br />
der Armutsbekämpfung und der steuerlichen<br />
Entlastung bringen der unteren<br />
Mittelschicht keinen grösseren Nutzen.<br />
Konzept für die klassische<br />
Verteilungspolitik nötig<br />
Die Linke hat sich immer wieder und auch<br />
mit Erfolg für den sozialen Ausgleich und<br />
eine bessere Stellung der unteren Mittelschicht<br />
eingesetzt. Es sind viele einzelne,<br />
für sich allein unspektakuläre Massnahmen<br />
wie z. B. die gebrochene Rentenformel<br />
bei der AHV, eine Erhöhung der Kinderzulagen<br />
oder die Verteidigung des Mischindexes<br />
von AHV/IV. Zwei Volksinitiativen<br />
vom 18. Mai setzten bei den<br />
stärksten Ungleichheitsfaktoren der 90er<br />
Jahre an, bei den Mieten und den Prämien<br />
der Krankenkassen (und ihre Ablehnung<br />
verschärft wohl die finanzielle Stellung der<br />
unteren Mittelschicht). Warum genügt dies<br />
9<br />
Nolte, Paul (2001): Unsere Klassengesellschaft, in die<br />
ZEIT <strong>Nr</strong>. 2.<br />
allein nicht? Es gibt keinen klaren Adressaten<br />
– ein vages «Viele würden profitieren»<br />
reicht nicht, Zusammenhänge werden<br />
zu wenig deutlich, Kontinuität nicht<br />
ersichtlich. Nötig wäre ein eigentliches<br />
Konzept zur Verteilungspolitik, welches<br />
Zielsetzung, Adressaten, Spannungsfelder,<br />
Zusammenhänge und zentrale Massnahmen<br />
beinhaltet, ein Konzept, wie es die<br />
<strong>SP</strong>S in der Familienpolitik entwickelt hat.<br />
Ein konzeptionell zu bearbeitendes Spannungsfeld<br />
beispielsweise besteht darin,<br />
dass die untere Mittelschicht immer wieder<br />
für Steuersenkungen votiert, obwohl<br />
die Ungleichheit damit eher zunimmt. Soziale<br />
Steuern wie eine Erbschaftssteuer<br />
oder eine Reichtumssteuer haben bei ihr<br />
keine Chance; aber sie gehören zweifellos<br />
in Instrumentenkasten einer linken Umverteilungspolitik.<br />
Und wo sollte eine Umverteilungspolitik<br />
ansetzen? Eine vorläufige<br />
Antwort liefert die Statistik mit vier<br />
hauptsächlichen Ansatzpunkten: Mieten,<br />
Prämien der Krankenversicherung,<br />
Steuern und Kinderkosten 10 . Nicht ein<br />
Kulturkampf, sondern ein Verteilungskampf<br />
tobt. Nicht Positionierung allein ist<br />
gefragt, sondern eine finanzielle Entlastung<br />
der unteren Mittelschicht und vor allem<br />
der Familien. Denn so werden Vertrauen<br />
in den Staat zurückgewonnen und fremdenfeindliche<br />
Einstellungen abgebaut.<br />
Die Stärkung einer offenen und solidarischen<br />
<strong>Schweiz</strong>, die alle gesellschaftlichen<br />
Gruppen gleichermassen akzeptiert, führt<br />
nicht über pädagogische Massnahmen und<br />
Moralappelle, sondern über eine gerechtere<br />
Verteilung, von der insbesondere die<br />
untere Mittelschicht profitieren müsste.<br />
10<br />
Bauer, Tobias Baumann, Beat (<strong>2003</strong>): Familien, Armut<br />
und Politik; in FamPra.ch <strong>Nr</strong>. 2.<br />
Beat Baumann ist Ökonom und<br />
Redaktor der <strong>Rote</strong>n <strong>Revue</strong><br />
22<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
<strong>Auswandern</strong> unmöglich<br />
Das Unbehagen im Kulturkampf (Brief aus Mexiko-Stadt)<br />
Si la scie scie la scie<br />
Et si la scie qui scie la scie<br />
Est la scie que scie la scie<br />
Il y a suisscide métallique.<br />
(Marcel Duchamp zu Jean Tinguelys<br />
«Homage to New York», 1960)<br />
Der liebe Gott der Christenheit sei nicht<br />
mehr wert als der Osiris der Ägypter oder<br />
der «Viztzilipuzli» (so die Verballhornung<br />
des kriegerischen Gottes Huitzilopochtli)<br />
der mexikanischen Azteken, schrieb der<br />
junge Theologe Jakob Heinrich «Henri»<br />
Michael Pfister<br />
Meister (1744–1826), Pfarrerssohn aus<br />
Küsnacht am Zürichsee, in seinem religionspsychologischen<br />
Traktat «Des origines<br />
des principes religieux» (Vom Ursprung<br />
der religiösen Grundsätze). Es war<br />
im Jahre des Herrn (nicht etwa des Viztzilipuzli)<br />
1768 – im ersten Schrecken über<br />
den Effekt seiner auf dem Hintergrund der<br />
französischen Aufklärung eigentlich harmlosen<br />
Gedankengänge flüchtete Henri<br />
Meister «zu einer Molkenkur» in den<br />
Thurgau und von dort weiter nach Paris.<br />
Das war wohlgetan, denn in Zürich wurde<br />
seine «verworrene, zweydeutige, tükische,<br />
spöttische Schrift» von Henkershand<br />
verbrannt, ihr Autor seiner Priesterwürde<br />
und seines Bürgerrechts enthoben und<br />
«contumaciter»zu Kerkerhaft im Wellenbergturm<br />
verurteilt. Von Voltaire hochgelobt,<br />
verkehrte der junge <strong>Schweiz</strong>er in<br />
Paris mit Diderot, Grimm und anderen<br />
Köpfen der Aufklärung, mässigte sich<br />
allerdings mit zunehmendem Alter und<br />
kehrte nach zwanzig Jahren, aufs Blut entsetzt<br />
über die Französische Revolution, in<br />
seine Heimatstadt zurück, wo er sich in einem<br />
Bändchen mit dem Titel «Reise von<br />
Zürich nach Zürich» an die «Zurückhaltung<br />
und Beengung» erinnerte, «die üblicherweise<br />
den lebendigsten Regungen sowohl<br />
durch den Geist unserer politischen<br />
Verfassung als auch durch die Strenge unserer<br />
Sitten und unserer religiösen Ansichten<br />
aufgezwungen werden».<br />
Den «Diskurs in der Enge» gab es also<br />
schon in der <strong>Schweiz</strong> des 18. Jahrhunderts.<br />
Erst durch das 20. zieht er sich aber<br />
wie ein roter Faden. Der Volksschullehrer<br />
und Erzähler Albin Zollinger schildert in<br />
den 30er Jahren «Die grosse Unruhe» seines<br />
Protagonisten Urban von Tscharner,<br />
der nach Paris flieht, getrieben vom<br />
«Instinkt, mit dem Gewohnten zu brechen,<br />
sehnlich ausschweifend Bewegung<br />
ins Dasein zu bringen, sich an den<br />
Gegensätzen zu entzünden». Das «Leben<br />
des Herzens» lässt sich Tscharner nicht<br />
«verkrümeln», denn «in der Heimat regierte<br />
der Geist der Frauenvereine, ungefähr<br />
das Widerwärtigste, was ihm in die<br />
Nase riechen konnte». «Die Welt ist eng,<br />
ich muss weiter hinweggehen, um vor den<br />
Nachstellungen der Heimat sicher zu<br />
sein», feuert sich Zollingers Emigrant selber<br />
an und freut sich darüber, in einem Pariser<br />
Bordell «prickelnd aufgewühlt mit<br />
dem neuen, anders duftenden, anders at-<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 23
Stabile<br />
Unterhosen<br />
sind für potente<br />
Weltschweizer<br />
im Stile Zollingers<br />
und Nizons<br />
natürlich<br />
unentbehrlich.<br />
menden Weibe allen ihm nur genehmen<br />
Möglichkeiten gegenüberzusitzen». In<br />
der Weltstadt sind die Frauen nicht in Vereinen<br />
organisiert, dafür haben manche eine<br />
andere Hautfarbe: «Tscharner, die Nase<br />
erhebend, stiess auf einen Nebel Parfüm,<br />
die Spur einer Negerin, die soeben<br />
die Strasse zu überqueren sich anschickte.<br />
Ihr Antlitz aus Kohle und Schnee dämmerte<br />
sonderbar drohend durch die Regenluft,<br />
obwohl sie sich, in der ständigen<br />
leisen Verlegenheit ihrer Rasse, Gleichmut<br />
wie einen Pelz umgelegt hatte.» Keine Frage,<br />
dass Tscharner das von ihm «Pharaonin»<br />
getaufte «schöne, sonderbare Wild»<br />
im Sturmlauf erobert.<br />
Zollingers Held kehrt gestählt wie ein<br />
Reisläufer von seinem Ego-Trip in die<br />
<strong>Schweiz</strong> zurück, ganz anders als Max<br />
Frischs trübsinniger Stiller, dessen Auswanderung<br />
eher einer Hegelschen Reise<br />
ins Negative gleicht, wobei die glückliche<br />
Aufhebung in der Synthese einer vermittelten<br />
Identität allerdings ungesichert<br />
bleibt. Ein fröhlicher Exilant ist hingegen<br />
Paul Nizon, der sich in Paris ebenfalls auf<br />
die Suche nach der exquisiten Schneekohle<br />
begibt und in der Rue St-Denis genauso<br />
unentgeltlich betreut wird wie<br />
weiland Zollingers Tscharner an der Rue<br />
Victoire. Nizon ist darüber hinaus eine<br />
Analyse des «Diskurses in der Enge»<br />
(1970) zu verdanken: «Das Fluchtmotiv<br />
zieht sich durch die schweizerische Literatur<br />
wie eine ansteckende Krankheit. (…)<br />
In unserer Literatur reissen die Helden<br />
aus, um Leben unter die Füsse zu bekommen<br />
– wie in Wirklichkeit die Schriftsteller<br />
ins Ausland fliehen, um erst einmal<br />
zu leben, um Stoffe zu erleben. Flucht als<br />
Kompensation von Ereignislosigkeit und<br />
Stoffmangel.»<br />
Doch die «sonderfall-mässige Enge», die<br />
peinigende Muse schreibender <strong>Schweiz</strong>er<br />
Männer, scheint aufgesprengt: Die<br />
<strong>Schweiz</strong> ist modern und international geworden,<br />
wenigstens ihre Städte bilden ein<br />
Quartier im «global village» – auf den<br />
Strassen gibt es Cafés, an der Langstrasse<br />
Pharaoninnen noch und noch, allenthalben<br />
Sushi, Subkultur und Street Parade<br />
bis zum Abwinken; der Zürcher Philosophieprofessor<br />
Georg Kohler konstatiert<br />
eine «Mediterranisierung (…) samt den<br />
mehr oder weniger echten Palmen auf den<br />
Trottoirs», die Alpen dürfen als geschleift<br />
bezeichnet werden. Dementsprechend<br />
ist das «Malaise»-Gequengel trotz Swissair,<br />
Gotthard und Zuger Massaker allgemeiner<br />
Zufriedenheit gewichen. Sogar den<br />
von Dürrenmatt in seiner legendären Havel-Rede<br />
über das «Gefängnis <strong>Schweiz</strong>»<br />
(1990) vermissten Zivildienst gibt es heute,<br />
wenn auch durch eine moralische Deklarationspflicht<br />
verbrämt. Das NZZ-<br />
Folio verzeichnete «Neopatriotismus»<br />
und «<strong>Schweiz</strong>er Erfolgsgeschichten», und<br />
der brillanteste Realsatiriker unter unseren<br />
«opinion leaders», «Weltwoche»-<br />
Chefredaktor Roger Köppel, lobte das<br />
«Genie des Mittelmasses», das just die<br />
internationale Kompetitionsfähigkeit verbürgt:<br />
«Kein Land der Welt dürfte mit<br />
hochwertigeren Ampeln, Tunnelbeleuchtungen<br />
und Strassenlaternen ausgerüstet<br />
sein. (…) Ein Kleiderfabrikant wie Calida<br />
produziert die weltweit vermutlich stabilsten<br />
Herrenunterhosen.» Langsamkeit und<br />
Vorsicht entlarvt Köppel als Schlüssel zum<br />
Erfolg und betont, «dass die <strong>Schweiz</strong> mit<br />
ihrem Hang zur Bedächtigkeit in der Geschichte<br />
vor allem erfreuliche Erfahrungen<br />
machte».<br />
Stabile Unterhosen sind für potente Weltschweizer<br />
im Stile Zollingers und Nizons<br />
natürlich unentbehrlich. Doch brauchen<br />
wir sie in unserem urbanisierten Paradies<br />
überhaupt noch? Vielleicht schon bald<br />
wieder. Deuten nicht die knappen Resultate<br />
in den Volksabstimmungen über den<br />
UNO-Beitritt und die Asyl-Initiative der<br />
SVP darauf hin, dass die böse, alte<br />
<strong>Schweiz</strong> nicht aufgesteckt hat? Wenn<br />
schon Old Europe bockt, warum sollte<br />
nicht auch Old Switzerland einen zweiten<br />
24<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Frühling spüren? Nachdem im letzten Jahr<br />
49,9% der EidgenossInnen jegliche Einwanderung<br />
in die <strong>Schweiz</strong> hatten unterbinden<br />
wollen, diagnostizierte oberwähnter<br />
Professor Kohler die Existenz<br />
«zweier <strong>Schweiz</strong>en» und rührte die Trommeln<br />
zu einem Kulturkampf «zwischen<br />
den urbanen Gebieten der Gegenwartsmoderne<br />
und ländlichen Gebieten, wo<br />
noch andere Tempi herrschen». Nur<br />
Haaresbreite trennt uns von der alten<br />
Enge.<br />
Dürfen wir es also doch wieder mit den<br />
Altvorderen halten und Auswanderungsgelüste<br />
hegen? Aber wohin? Als <strong>Schweiz</strong>er<br />
mit angeblich erfolgsträchtigem Hang<br />
zur Bedächtigkeit kann ich nicht aufs Rekognoszieren<br />
verzichten und gönne mir<br />
zur Zeit ein sechswöchiges Probiererli Mexico<br />
City. Eine Tequila-Idee vielleicht, sollte<br />
es denn ausgerechnet in der zweitgrössten<br />
Megalopolis der Welt (geschätzte<br />
Einwohnerzahl zwischen 20 und 25 Millionen)<br />
Freiraum für einen Flüchtling aus<br />
dem engen Tal geben? Der hohe Himmel<br />
ist hier bekanntlich bräunlich getrübt,<br />
auch wenn es in den letzten fünfzehn Jahren<br />
gebessert haben soll. Der eine oder andere<br />
Bekannte hat mir vor der Abreise hämisch<br />
geraten, Gasmaske (Smog), Helm<br />
(Erdbeben) und Maschinenpistole (Kriminalität)<br />
nicht zu vergessen.<br />
Mexiko ist stolz auf seine Revolutionstradition,<br />
dennoch spreizt sich hier die<br />
Schere von Reichtum und Armut noch<br />
weiter als in der <strong>Schweiz</strong> – eine mögliche<br />
Erklärung für die starke Zunahme von<br />
Raubüberfällen und Entführungen. Auch<br />
das soll aber bald besser werden: Der Held<br />
von New York, Rudy Giuliani, ist angetreten,<br />
in der Stadt der Toleranz die «zerotolerance»-Diät<br />
einzuführen. Im Unterschied<br />
zur <strong>Schweiz</strong> ist Mexiko natürlich<br />
auch schon lange UNO-Mitglied; zurzeit<br />
verfügt es sogar über einen Sitz im Sicherheitsrat,<br />
der ihm im Vorfeld des<br />
Irak-Kriegs schwer zu schaffen machte.<br />
Sollte man aus Überzeugung und traditioneller<br />
Aversion gegen die Gringos<br />
«Nein» sagen zum Krieg oder doch lieber<br />
Realpolitik betreiben, auf das Veto der<br />
Russen und Franzosen vertrauen und mit<br />
einem «Ja» den drohenden Sanktionen<br />
der USA entgehen. Das angestammte<br />
Reich der Freiheit und der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten verabreicht dem ärmeren<br />
Nachbarn wenig Zuckerbrot und viel Peitsche.<br />
Jederzeit können Massnahmen getroffen<br />
werden, die es den Millionen von<br />
illegalen mexikanischen MigrantInnen<br />
in den Staaten verunmöglichen, ihre<br />
Lohngelder ohne enorme Verluste nach<br />
Hause zu schicken. An der Grenze, der<br />
«frontera», die über weite Strecken dem<br />
Rio Grande entlang verläuft, machen sich<br />
amerikanische Waffennarren einen Sonntagsspass<br />
daraus, klandestine Einwanderer<br />
abzuknallen. Im Frühling <strong>2003</strong> trat jedoch<br />
eine grosszügige Regelung in Kraft:<br />
Junge Mexikaner konnten sich freiwillig<br />
bei der US-Armee melden und erhielten<br />
als Gegenleistung für den Einsatz im Irak<br />
die amerikanische Staatsbürgerschaft –<br />
«carne de cañon» heisst das auf Spanisch.<br />
Nicht dass es die «frontera» in unserer<br />
mittelmässig-paradiesischen <strong>Schweiz</strong> nicht<br />
gäbe. Dass die so genannte SVP-<strong>Schweiz</strong><br />
der imaginären Landesmauer mit der Asyl-<br />
Inititative noch eine Zinne aufsetzen wollte,<br />
hat niemanden überrascht. Doch was<br />
ist die Haltung der so genannten <strong>SP</strong>-<br />
<strong>Schweiz</strong> in dieser Sache? Stimmt es<br />
wirklich, dass die urbane Partei im von<br />
Georg Kohler geforderten Kulturkampf<br />
zur «Kontrollidee nicht mehr ein so inniges<br />
Verhältnis unterhält»? Diesen Eindruck<br />
hat man nicht, wenn sich die <strong>SP</strong> für<br />
die Säuberung des Rotlichtmilieus im Zürcher<br />
Stadtkreis einsetzt, aber wenig dafür<br />
tut, dass Ausländerinnen anderswo als in<br />
Massagesalons Arbeitsbewilligungen erhalten<br />
können. Ökonomisch und machtpolitisch<br />
leuchtet die Halbherzigkeit in Sachen<br />
Sans-Papiers und Immigration freilich<br />
ein – schliesslich haben Ausländer<br />
keine von jenen Stimmzetteln zu bieten,<br />
Dürfen wir also<br />
doch wieder mit<br />
den Altvorderen<br />
halten und<br />
Auswanderungsgelüste<br />
hegen?<br />
Aber wohin?<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 25
Wäre eine<br />
«urbane», weltoffene<br />
Strategie<br />
gegen diese<br />
alte <strong>Schweiz</strong><br />
der Kampf<br />
für ein «Land<br />
ohne Eigenschaften»?<br />
dank denen die <strong>SP</strong> auf einer ähnlichen Erfolgswelle<br />
surft wie die SVP. Und ist es<br />
nicht erfreulich, dass es einer Mehrheit der<br />
Einheimischen so gut geht, dass mit<br />
Mieterschutzvorlagen oder einer entschlossenen<br />
Politik gegen Steueroasen<br />
kaum Staat zu machen ist? Ein gewisses<br />
Unbehagen im Kulturkampf kommt auf.<br />
Das Urbane gegen das Ländliche zu stellen,<br />
ist eine nicht besonders neue, nicht<br />
besonders mutige und nicht besonders<br />
selbstkritische Strategie. Ehrlicherweise<br />
musste man dem grundsätzlich unsäglichen<br />
Christoph Mörgeli doch ein kleines<br />
bisschen Recht geben, als er sich in einer<br />
Kolumne in der Pendlerzeitung «Metropol»<br />
unter der Überschrift «Moritz, Markus<br />
und Sepp lachen» an den «Cüplisozialisten»<br />
stiess, die sich in Christoph Marthalers<br />
«Hotel Angst» über eine provinzielle<br />
Knorr-Aromat- und Cervelat-<br />
<strong>Schweiz</strong> mokieren.<br />
Zweieinhalb Stunden südlich von Mexico<br />
City, im malerischen Silberstädtchen<br />
Taxco, lerne ich den <strong>Schweiz</strong>er Musiker<br />
und Filmemacher Cyrill Schläpfer kennen,<br />
der mit seinem (jetzt auf DVD erhältlichen)<br />
Film «Ur-Musig» und mit seinem<br />
Plattenlabel «csr-records» einer der wenigen<br />
Brückenbauer zwischen der «ländlichen»<br />
und der «urbanen» <strong>Schweiz</strong> ist.<br />
Schläpfer kommt seit sieben Jahren immer<br />
wieder für ein paar Monate oder gar ein<br />
Jahr nach Mexiko, um Energie zu tanken,<br />
sich seiner eigenen Musik zu widmen oder<br />
auch Projekte in Zusammenarbeit mit mexikanischen<br />
Kollegen in Angriff zu nehmen.<br />
Er schätzt das hiesige Traditionsbewusstsein<br />
und bedauert, dass die «modernen»<br />
<strong>Schweiz</strong>er ihre angeblich «hinterwäldlerische»<br />
Volksmusik so schnöde<br />
ablehnen, wie Schläpfer es sonst nur bei<br />
den Deutschen und den Japanern feststellt.<br />
Leider seien Ländler in der <strong>Schweiz</strong> nach<br />
wie vor «nicht die Musik, die man der<br />
Freundin schenken kann», meint Cyrill<br />
Schläpfer.<br />
Paul Nizon sprach in seinem «Diskurs in<br />
der Enge» von der <strong>Schweiz</strong>er «Igelpsychose»<br />
als von «einer immerwährenden<br />
verdächtigen Angst, unsere «Eigenart» zu<br />
verlieren». Wäre dann die «urbane»,<br />
weltoffene Strategie gegen diese alte<br />
<strong>Schweiz</strong> der Kampf für ein «Land ohne Eigenschaften»?<br />
Es käme sehr darauf an, ob<br />
eine solche Eigenschaftslosigkeit Raum<br />
böte für das Nebeneinander verschiedener,<br />
stark ausgeprägter Identitäten – oder ob es<br />
mehr um eine opportunistisch-neutrale<br />
Mitte im Stil der expo.02 ginge, von der<br />
aus man sich das grösste Publikum und<br />
damit die grössten Renditen im Mainstream<br />
der Märkte sichern könnte.<br />
So wie der Ländler automatisch als<br />
Soundtrack zum «Puurezmorge» abgestempelt<br />
wird, freuen sich die Medien darüber,<br />
dass sich Christoph Blocher als Albert-Anker-Sammler<br />
in Szene setzt. Diese<br />
simplen Zuordnungen in Musik und<br />
bildender Kunst werden wenigstens durch<br />
die <strong>Schweiz</strong>er Literatur etwas ins Wanken<br />
gebracht: Gottfried Keller eignete sich<br />
schlecht als Schutzpatron der Diamantfeiern.<br />
Robert Walser, zeitweiliger Auswanderer<br />
in Berlin, und Friedrich Glauser,<br />
Fremdenlegionär und Weltenbürger,<br />
haben vor langem eine ländliche <strong>Schweiz</strong><br />
beschrieben, die nicht bloss hinterwäldlerisch<br />
ist: Glausers Porträt des marokanischen<br />
Wüstenpostens «Gourrama» und<br />
seiner zusammengewürfelten Besatzung ist<br />
sogar lesbar als eine Utopie eines Landes<br />
ohne Eigenschaften oder besser eines<br />
Treffpunktes prägnanter, aber grundverschiedener<br />
Eigenschaften, die sich in den<br />
Legionären aus verschiedenen Nationen<br />
verkörpern. Aber auch in jüngerer Zeit haben<br />
<strong>Schweiz</strong>er Autoren wie Peter Weber<br />
oder Tim Krohn den kulturkämpferischen<br />
Zwang zum Urban-Modernen mit Toggenburger<br />
Landschaftspanoramen («Der<br />
Wettermacher») und Glarner Sprachexperimenten<br />
(«Die Quatemberkinder»)<br />
unterlaufen und dabei weltfrischeste Heimatliteratur<br />
geschaffen.<br />
26<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Handkehrum kritisieren jüngere Mexikaner<br />
das traditionelle Tequila-und-Tod-Klischee.<br />
Die «mexicanidad» im Sinne von<br />
Octavio Paz’ erfolgreichem Heimatporträt<br />
«Das Labyrinth der Einsamkeit» wird heute<br />
entlarvt als künstliche nationale Identität<br />
im Dienste der Zementierung einer<br />
Einparteienherrschaft, die im Jahr 2000<br />
nach gut sieben Jahrzehnten auf demokratischem<br />
Weg gefallen ist. Sollte man also<br />
nicht auch die «suicidad» der <strong>Schweiz</strong><br />
lieber ein für alle Mal ad patres schicken<br />
den Suizid begehen, der im analog zur<br />
«mexicanidad» gebildeten spanischen<br />
Neologismus steckt? Wer in Mexiko lebt<br />
und von einer <strong>Schweiz</strong>er Firma oder vom<br />
<strong>Schweiz</strong>er Staat bezahlt wird, der geniesst<br />
Nationalprivilegien, wie es früher Adels–<br />
privilegien gab. Ein Vorrecht der Geburt,<br />
das es seit der – mit reichlich terroristischer<br />
Energie vorangetriebenen – Französischen<br />
Revolution eigentlich nicht mehr geben<br />
sollte. Was, wenn die SVP-<strong>Schweiz</strong> für einen<br />
wirklich konsequenten Liberalismus<br />
auf der ganzen Welt, für einen freien Markt<br />
ohne Arbeitsverbote und ohne <strong>Schweiz</strong>er<br />
Schutzzölle einträte? Für Demokratie<br />
auch in jenen Gebieten, die «dafür noch<br />
nicht reif» sind, wie sich westlich-nördliche<br />
Wirtschaftsführer voller Stolz auf besagte<br />
Französische Revolution gerne ausdrücken?<br />
Was, wenn sich die <strong>SP</strong>-<strong>Schweiz</strong><br />
für schwächere «Sozialpartner» ohne<br />
<strong>Schweiz</strong>er Pass genauso einsetzen würde<br />
wie für Einheimische? Wenn der nationale<br />
Kampf der beiden grössten Parteien durch<br />
die Abschaffung des Nationalstaates überflüssig<br />
würde? Wenn sich der Kulturkampf<br />
zwischen Hinterwald und Vorderstadt auf<br />
diese Weise erledigte? Dann gäbe es keinen<br />
rettenden Horizont für beengte Literaten<br />
mehr. Man könnte nicht mehr auswandern.<br />
Transzendenz und erlösendes<br />
Jenseits wären endgültig abgeschafft.<br />
Den Konkurrenzkampf auf dem Unterwäschemarkt<br />
müssten die <strong>Schweiz</strong>er<br />
Qualitätsunternehmen jedenfalls nicht<br />
fürchten – die Herrenunterhosen, die ich<br />
mir für wenig Geld bei einem mexikanischen<br />
Strassenhändler gekauft habe, fallen<br />
bereits nach dem ersten Tragen aus der<br />
Naht.<br />
Michael Pfister ist Philosoph, Übersetzer<br />
und Journalist.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 27
Fotos: Friederike Baetcke<br />
28<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 29
ZUR DISKUSSION GESTELLT<br />
Staatsverschuldung und<br />
Finanzierung der<br />
Altersvorsorge<br />
Günter Baigger<br />
Im Rahmen der zweiten Säule der Altersvorsorge<br />
wird zurzeit ein Deckungskapital<br />
von rund 600 Milliarden Franken<br />
verwaltet. Das Problem der öffentlichen<br />
Verschuldung (rund 220 Milliarden Franken)<br />
wird gewöhnlich getrennt davon<br />
diskutiert, obwohl beide Themen zusammenhängen.<br />
Eine höhere Staatsverschuldung<br />
könnte mehr Kapital der zweiten<br />
Säule absorbieren. Nicht das Ausmass<br />
der Staatsverschuldung ist das Hauptproblem<br />
der <strong>Schweiz</strong>er Wirtschaft, sondern<br />
das Anlagevolumen der zweiten Säule.<br />
Staatliches Sparen verstärkt hingegen<br />
den rezessiven Einfluss der zweiten<br />
Säule.<br />
Verschiedene, vor allem sozialdemokratisch<br />
orientierte Politiker weisen mit<br />
Recht darauf hin, dass die öffentliche<br />
Hand in der heutigen konjunkturellen Situation<br />
weniger sparen sollte. Eine Verschuldung<br />
der öffentlichen Hand von<br />
mehreren Milliarden Franken sei angesichts<br />
der momentanen rezessiven Tendenzen<br />
weniger problematisch, als manche<br />
bürgerlichen Politiker uns glauben<br />
machen wollten.<br />
Sosehr diese Argumentation überzeugt,<br />
ein anderer Vorgang beeinflusst die Konjunktur<br />
weit stärker, nämlich der Sparprozess<br />
im Rahmen der zweiten Säule. In<br />
seinen Ausmassen übertrifft dieser die<br />
Staatsverschuldung bei weitem. Heute liegen<br />
die im Rahmen der zweiten Säule angesparten<br />
Kapitale (inkl. Gruppenversicherungsverträge)<br />
über 600 Milliarden<br />
Franken. Dagegen nimmt sich die öffentliche<br />
Verschuldung mit ihren derzeit<br />
rund 220 Milliarden Franken 1 geradezu<br />
bescheiden aus. Nicht die öffentliche Verschuldung<br />
ist das Problem, sondern das<br />
Sparvolumen der zweiten Säule.<br />
Der Kapitalstock der zweiten Säule hat<br />
seinen Höhepunkt jedoch noch nicht erreicht.<br />
Der jährliche Zuwachs an Ersparnissen<br />
übertrifft die Neuverschuldung der<br />
öffentlichen Hand bei weitem. Ein Beharrungszustand<br />
ist in den nächsten Jahren<br />
nicht in Sicht. Die jährliche Gesamtzunahme<br />
des Kapitals der zweiten Säule<br />
betrug im Jahr 1998 über 50 Milliarden<br />
Franken. Heute liegt sie zwar darunter.<br />
Wertsteigerungen und Kapitalerträge fallen<br />
kleiner aus als damals. Bei einem<br />
Deckungskapital von rund 600 Milliarden<br />
Franken (fast das Dreifache der gesamten<br />
Schulden der öffentlichen Hand [Bund,<br />
Kantone und Gemeinden] in der <strong>Schweiz</strong>)<br />
dürfte die Verzinsung auch im Jahr <strong>2003</strong><br />
bei mehr als 20 Milliarden Franken liegen.<br />
Dank des positiven Beitragsleistungssaldos<br />
sind somit in der zweiten Säule auch<br />
heute noch jedes Jahr 20 bis 30 Milliarden<br />
Franken neu anzulegen. In diesem Ausmass<br />
werden jedes Jahr Gelder dem<br />
1<br />
Die öffentliche Verschuldung betrug im Jahr 2000 207<br />
Milliarden Franken und im Jahr 2002 217 Milliarden Franken.<br />
Somit betrug der mittlere jährliche Zuwachs in diesen<br />
Jahren 5 Milliarden Franken.<br />
30<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Konsum entzogen. Bei Debatten über<br />
Staatsverschuldung sind allenfalls Beträge<br />
von 5 bis maximal 10 Milliarden Franken<br />
strittig, also geringfügige Beträge im<br />
Vergleich zu dem, was im Rahmen der<br />
zweiten Säule jedes Jahr neu anzulegen ist.<br />
Nicht die öffentliche Verschuldung belastet<br />
den Kapitalmarkt, sondern das Deckungskapital<br />
der zweiten Säule.<br />
Zu beachten ist die Komplementarität von<br />
öffentlicher Verschuldung und Sparen im<br />
Rahmen der beruflichen Vorsorge: Der<br />
Staat kann Obligationen ausgeben, welche<br />
die Vorsorgeeinrichtungen kaufen können.<br />
Die Ersparnisse der Vorsorgeeinrichtungen<br />
können somit die Verschuldung des<br />
Staates auffangen. In der heutigen Situation<br />
könnten Schulden den Kapitalmarkt<br />
entlasten. Ein Staat, welcher auf die<br />
Schuldenbremse tritt, nimmt hingegen den<br />
Pensionskassen Anlagemöglichkeiten, erschwert<br />
die Aufnahme des Kapitalzuwachses<br />
der zweiten Säule. Gleichzeitig<br />
verstärkt er die rezessiven Tendenzen der<br />
zweiten Säule.<br />
Hinzu kommt Folgendes: Das BVG befreit<br />
die öffentlich-rechtlichen Kassen vom<br />
Prinzip der Bilanzierung in geschlossener<br />
Kasse. Öffentlich-rechtliche Kassen müssen<br />
nicht alle Deckungskapitale ausfinanzieren.<br />
Sie dürfen ihren Deckungsgrad<br />
reduzieren. Begründet wurde dies mit der<br />
Perennitätsbedingung: Öffentlich-rechtliche<br />
Pensionskassen bestehen «ewig» und<br />
können deshalb immer mit dem nötigen<br />
Mittelzufluss rechnen. Mit der Privatisierung<br />
öffentlicher Dienstleistungen hat sich<br />
dies geändert. Ein erheblicher Teil der heute<br />
vorhandenen öffentlichen Schulden<br />
rührt daher, dass der Staat bei der Privatisierung<br />
den entsprechenden Pensionskassen<br />
das für eine volle Kapitalisierung<br />
notwendige Geld nachgeschossen hat 2 .<br />
Wir stehen vor folgendem Paradoxon: Der<br />
2<br />
Und dabei hiess es doch, Privatisierungen entlasten den<br />
Staat finanziell.<br />
Staat nimmt Schulden auf, damit die Pensionskassen<br />
mehr sparen können. Einerseits<br />
zwingt man die Kassen zu voller Finanzierung,<br />
obwohl es ihnen fast unmöglich<br />
ist, diese Gelder zu einem<br />
vernünftigen Zinssatz anzulegen. Andererseits<br />
hindern bürgerliche Politiker den<br />
Staat trotz Rezession (!) Schulden zu machen,<br />
welche bei Pensionskassen angelegt<br />
werden könnten.<br />
Dies entkräftet auch den häufig von bürgerlicher<br />
Seite geäusserten Einwand, mit<br />
Hilfe einer geringeren öffentlichen Verschuldung<br />
wolle man vermeiden, allzu hohe<br />
Belastungen künftigen Generationen<br />
aufzubürden. Wenn der Staat in diesem<br />
Ausmass Gelder in die zweite Säule<br />
presst, anstatt zu investieren, werden künftige<br />
Generationen mehr als durch Schulden<br />
bestraft. Zu beachten ist auch, dass<br />
das Erwirtschaften der Verzinsung auf diesem<br />
Kapital künftige Generationen ebenfalls<br />
belastet.<br />
Die Kapitalisierung der zweiten Säule hat<br />
folgende Nachteile:<br />
1. Die zweite Säule entzieht dem Konsum<br />
Gelder und verstärkt die rezessive Tendenz<br />
der Wirtschaft. Einschränkend ist<br />
hinzuzufügen, dass das andere Extrem,<br />
Sparquote Null und keine Kapitaldeckung<br />
in der Rentenversicherung, der<br />
Wirtschaft ebenfalls nicht förderlich wäre.<br />
Die Wirtschaftstheorie favorisiert deshalb<br />
einen optimalen Kapitalisierungsgrad,<br />
jenseits dessen die Wirtschaft in<br />
der Rezession landet und diesseits dessen<br />
die Wirtschaft zu wenig investiert,<br />
was ebenfalls das Wachstum hemmt.<br />
Die Sparquote der <strong>Schweiz</strong> dürfte oberhalb<br />
des optimalen Wertes liegen. Obwohl<br />
die <strong>Schweiz</strong> die höchste Pro-Kopf-<br />
Kapitalisierung der Altersvorsorge aller<br />
europäischer Staaten (wahrscheinlich<br />
sogar der ganzen Welt) aufweist, hat die<br />
<strong>Schweiz</strong> seit den achtziger Jahren in Europa<br />
die tiefsten Wachstumsraten. Da-<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 31
ei wurde anlässlich der Einführung des<br />
Obligatoriums der zweiten Säule vorgebracht,<br />
das Deckungskapital belebe<br />
die <strong>Schweiz</strong>er Wirtschaft.<br />
Man mag einwenden, dass nicht die Kapitalbildung<br />
im Rahmen der zweiten<br />
Säule, sondern andere Variablen die<br />
Wirtschaft negativ beeinflusst haben<br />
könnten. Gegen diesen Einwand spricht<br />
das gewaltige Volumen der zweiten Säule.<br />
Man muss nur fragen: Wie würde die<br />
<strong>Schweiz</strong>er Wirtschaft aussehen, wenn<br />
pro Jahr 30 Milliarden Franken weniger<br />
gespart würden, und in den Konsum<br />
fliessen könnten?<br />
2. Man hat auch vorgebracht, dass Investition<br />
in Aktien die Anlageprobleme lösen<br />
würde. Wenn man davon absieht,<br />
dass viele Statistiken über Aktienanlagen<br />
Fehler enthalten, zeigt die Erfahrung<br />
der vergangenen Jahre, dass Anlagen in<br />
Aktien weder die Wirtschaft beflügelt<br />
haben noch die Anlageprobleme der<br />
Pensionskassen lösen konnten. Man<br />
hatte zu Beginn der neunziger Jahre die<br />
Anlagebestimmungen für Pensionskassen<br />
wesentlich gelockert zugunsten eines<br />
hohen Aktienanteils. Die Kassen haben<br />
dies stark ausgenutzt. Der Aktienanteil<br />
stieg von unter 5 auf über 20<br />
Prozent, mit zunächst rasanten Erfolgen<br />
und mit dem Katzenjammer, der heute<br />
Platz gegriffen hat. Die Erhöhung des<br />
Aktienanteils ging übrigens auch zulasten<br />
der Anlagen in Staatspapieren.<br />
Wahrscheinlich hätte man das Geld besser<br />
beim Staat angelegt 3 .<br />
3<br />
Längerfristig kann die Aktienrendite die nominalen<br />
Wachstumsraten der Wirtschaft nicht übersteigen. Denn die<br />
Rendite gemessen in Franken gehorcht dem gleichen exponentiellen<br />
Wachstumsgesetz wie das verzinste Kapital.<br />
Falls die Rendite über der Wachstumsrate der Wirtschaft<br />
liegt, würde der Frankenbetrag der Rendite schliesslich das<br />
Bruttoinlandprodukt übertreffen. Dies wäre unmöglich. Die<br />
Erfahrung zeigt aber, dass die Aktienrendite schon lange vorher<br />
sinkt. Für den Anlagezeitraum einer Vorsorgeeinrichtung,<br />
welcher sich über mehr als 30 Jahre erstreckt, ist also<br />
mit einer realen (= inflationsbereinigten) Rendite von<br />
1 bis 3 Prozent zu rechnen.<br />
3. Das Deckungskapitalverfahren wird<br />
unter anderem damit begründet, dass<br />
es Sicherheit biete gegenüber demographischen<br />
Veränderungen. Das Verhältnis<br />
zwischen Beitragszahlern und<br />
Rentnern werde sich im Laufe der nächsten<br />
20 Jahre verschlechtern. Nur das<br />
Deckungskapitalverfahren biete den<br />
Rentnern genügend Sicherheit. Dagegen<br />
spricht jedoch folgende Überlegung.<br />
Wenn die Zahl der Beitragszahler zurückgeht,<br />
beginnen die Deckungskapitale<br />
zu schrumpfen. Vorsorgeeinrichtungen<br />
müssen Aktiven auflösen, d. h.<br />
verkaufen. Der Erlös daraus fliesst als<br />
Rente an die Pensionierten. Da dieser<br />
Verkaufsprozess gewaltige Beträge<br />
(mehrere Milliarden Franken pro Jahr)<br />
umsetzt, hat er Rückwirkungen auf<br />
den Preis des Kapitals. Es ist mit einer<br />
Entwertung des Kapitals zu rechnen,<br />
was zu einer Reduktion der Renten<br />
führen kann. Das Deckungskapitalverfahren<br />
bietet somit keine Immunität<br />
gegenüber demographischen Veränderungen.<br />
Hinzu kommt, dass demographische<br />
Veränderungen und der<br />
daraus resultierende Kapitalabbau auf<br />
mehrere Jahre im Voraus absehbar<br />
sind. Privatleute können auf Baisse<br />
spekulieren und damit den Kursverfall<br />
der einschlägigen Papiere verstärken<br />
mit Gewinnen zu Lasten der Pensionskassen.<br />
4. Das Ausmass an sicheren Anlagen ist<br />
begrenzt. Je mehr Geld die Pensionskassen<br />
anzulegen haben, desto höher<br />
steigt das Anlagerisiko. Dabei sind es<br />
erhebliche Beträge, welche verloren gehen<br />
können. Beispiel Swissair: Swissairaktien<br />
und -obligationen waren im<br />
Anlage-Portefeuille vieler Pensionskassen<br />
vertreten. Beim Grounding der<br />
Swissair verloren <strong>Schweiz</strong>er Pensionskassen<br />
deshalb an die 5 Milliarden<br />
Franken. Ähnlich negative Wirkungen<br />
hatten auch die Kursverluste anderer<br />
Firmen 4 . Staatsanleihen hingegen bie-<br />
32<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
ten mehr Sicherheit. Staatsanleihen gibt<br />
es aber nur, wenn der Staat sich verschuldet.<br />
5. Das gewaltige Anlagevolumen senkt bereits<br />
jetzt die Rendite der Pensionskassen<br />
5 . Wenn die Pensionskassen nicht<br />
mehr den technischen Zins erwirtschaften,<br />
führt dies zu einem Anlageproblem.<br />
Wie dramatisch mittlerweile<br />
die Situation ist, konnte man der «NZZ<br />
am Sonntag» vom 30.3.<strong>2003</strong> entnehmen.<br />
Versicherer wie Vaudoise oder<br />
Helvetia Patria wollen keine neuen<br />
BVG-Geschäfte abschliessen. Paul Müller,<br />
Chef <strong>Schweiz</strong> der Rentenanstalt,<br />
spricht für eine Reduktion des Zinssatzes<br />
auf zwei Prozent. Er wäre «nicht unglücklich,<br />
wenn wegen Prämienerhöhungen<br />
verärgerte Kunden selber künden<br />
würden». Eigentlich müssten bei<br />
Politikern die Alarmglocken läuten,<br />
wenn wesentliche Träger der zweiten<br />
Säule sich in dieser Weise aus dem BVG<br />
verabschieden wollen.<br />
4<br />
Risikoreiche Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass<br />
sie entweder sehr hohe Gewinne oder sehr hohe Verluste<br />
erzeugen. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitstheorie<br />
gibt es dabei Verlierer und Gewinner. Viele sehen<br />
die Verlierer als Versager und die Gewinner als Könner an.<br />
Es wird übersehen, dass der Erfolg zufallsabhängig ist. In<br />
Zeiten hoher Volatilität wächst der Druck der Destinatäre<br />
von Vorsorgeeinrichtungen auf die Verantwortlichen, in risikoreiche<br />
Anlagen zu flüchten, um von kurzfristigen Zufallsschwankungen<br />
zu profitieren. Ökonomen, welchen der<br />
den Börsengewinnen zugrunde liegende Zufallsmechanismus<br />
unbekannt ist, sagen dann, das Kapital wandert an<br />
die Orte, wo es am meisten Nutzen abwirft. Aus der Theorie<br />
ergibt sich hingegen, dass ähnlich wie beim Roulett der<br />
Ertrag durch Martingalbedingungen determiniert ist, d. h.,<br />
dass kein Spielsystem die Gewinnchancen verbessert. Der<br />
Kenner ist nicht überrascht, wenn Kinder (oder zufällige Systeme)<br />
an der Börse den gleichen Anlageerfolg wie so genannte<br />
Experten oder Analysten ernten.<br />
5<br />
Dieser Effekt kann folgenden Verlauf nehmen: Aufgrund<br />
der Nachfrage der Pensionskassen steigen die Kurse. Diese<br />
Kurssteigerungen scheinen zunächst alle Anlageprobleme<br />
zu lösen. Deshalb treten weitere Anleger hinzu (z. B.<br />
auch der AHV-Ausgleichsfonds). Der Wert von Aktien steigt<br />
wie bei seltenen Briefmarken weiter. Eines Tages wird aber<br />
den Börsenteilnehmern klar, dass die Papiere überbewertet<br />
sind. Dann bricht die Seifenblase zusammen.<br />
6. Rückkoppelungen verstärken das Anlageproblem.<br />
Sinken die Zinsen, so haben<br />
Pensionskassen die Möglichkeit, die<br />
Beiträge anzuheben, um tiefere Renditen<br />
zu kompensieren und den Leistungsstand<br />
zu halten. Damit steigen<br />
Spar- und Anlagevolumen. Eine andere<br />
Möglichkeit besteht darin, Leistungen<br />
zu senken. Damit verringert sich der Abbau<br />
der Kapitale, was per Saldo ebenfalls<br />
zu einer Kapitalerhöhung führen<br />
kann. Der Mix aus Beitragserhöhung<br />
und Leistungssenkung vieler <strong>Schweiz</strong>er<br />
Pensionskassen wird die anzulegenden<br />
Kapitale insgesamt erhöhen. Hinzu<br />
kommt, dass auch die private Sparneigung<br />
(und damit die gesamtwirtschaftliche<br />
Ersparnisbildung) steigt, wenn die<br />
Renten der zweiten Säule nicht sicher<br />
sind. Dies ist bereits der Fall, wenn die<br />
Unsicherheit nur vermeintlich ist. Privates<br />
Sparen wirkt ähnlich wie Sparen<br />
in der zweiten Säule. Falls man die zweite<br />
durch die dritte Säule substituieren<br />
möchte, ist aufgrund der geringeren Effizienz<br />
des privaten Sparens sogar mit<br />
einem zusätzlichen Anstieg der Kapitalbildung<br />
zu rechnen 6 .<br />
7. Aufgrund des gewaltigen Anlagevolumens<br />
besteht die Gefahr, dass das Kapital<br />
in ungeeignete Hände kommt:<br />
– Wirtschaftspublizisten haben Aktien<br />
hochgeschrieben und mit grossem<br />
Nachdruck die Aktienanlage für Pensionskassen<br />
propagiert. Pensionskassen<br />
haben daraufhin wie erwähnt ihr Aktienportefeuille<br />
aufgestockt. Profitiert<br />
haben diejenigen, welche damals ihre<br />
Papiere zu günstigen Preisen verkaufen<br />
konnten.<br />
– Im Übrigen wäre zu prüfen, wie viel<br />
Pensionskassengeld durch schlichte<br />
Kriminalität wie Insidervergehen oder<br />
Unterschlagungen verloren geht. Diesbezügliche<br />
Zeitungsmeldungen sind<br />
relativ häufig. Geld – besonders in enormen<br />
Mengen – zieht zwielichtige Existenzen<br />
an.<br />
6<br />
Dies als Seitenbemerkung an die Adresse von Sozialabbauern.<br />
Eine private Vorsorge könnte aus rein ökonomischen<br />
Gründen kaum die in der Bundesverfassung geforderte<br />
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung leisten.<br />
Das Sparen würde die Wirtschaft ersticken und damit auch<br />
die private Vorsorge.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 33
Aus sozialpolitischen Überlegungen ist es<br />
schliesslich paradox, wenn in einer Situation,<br />
in welcher bei Rentenkassen ein eigentlicher<br />
Anlagenotstand herrscht, über<br />
eine Kürzung der Renten nachgedacht<br />
wird. Man fragt sich, ob man vor vollen<br />
Fleischtöpfen verhungern will. Angesichts<br />
von Leistungskürzungen mutet das<br />
seinerzeitige Versprechen, dass die zweite<br />
Säule das Gleiche leiste wie die Volkspension,<br />
aber sicherer sei, wie ein Witz an 7 .<br />
Die Sicherheit des Deckungskapitalverfahrens<br />
war auch ein Grund dafür, dass<br />
man das Eintrittsgenerationenproblem<br />
in Kauf nahm. Ausgerechnet jetzt, wo es<br />
immer noch Eintrittsgenerationen gibt,<br />
und wo immer noch nicht alle Versicherten<br />
die vollen BVG-Leistungen erhalten,<br />
denkt man an Rentenkürzungen. Hinzu<br />
kommt, dass den Pensionskassen die Bewährungsprobe<br />
noch bevorsteht. Wie sicher<br />
werden die Renten sein, wenn sich<br />
das Verhältnis von Beitragszahlern und<br />
Rentnern den Prognosen entsprechend<br />
verschlechtern wird, wo doch die Verzinsung<br />
bereits jetzt ein Problem darstellt?<br />
Aus wirtschaftspolitischen Überlegungen<br />
hingegen stellt die zweite Säule in der heutigen<br />
Form eine wirtschaftspolitische<br />
Zeitbombe dar 8 .<br />
Zur Frage, was man jetzt tun könne und<br />
solle, nenne ich abschliessend einige<br />
konkrete Vorschläge:<br />
• Es ist zu prüfen, inwieweit Pensionskassen<br />
vom Prinzip der vollen Kapitalisierung<br />
befreit werden sollen. Eventuell<br />
muss ein umlagefinanzierter Pool aufgebaut<br />
werden, welcher Beiträge an<br />
Pensionskassen mit ungünstiger Altersstruktur<br />
leistet. Man sollte auch den<br />
seinerzeitigen Vorschlag von Prof. Dr.<br />
Schwartz prüfen 9 , die Kapitalisierung<br />
der Pensionskassen an die wirtschaftliche<br />
Lage anzupassen.<br />
• Eine andere Möglichkeit bestünde darin,<br />
die Pensionskassen zu verpflichten,<br />
Anleihen anderer Sozialversicherungszweige<br />
(etwa der Arbeitslosenversicherung)<br />
zu zeichnen, welche diese in der<br />
Hochkonjunktur wieder zurückzahlen<br />
müssten.<br />
• Der <strong>Schweiz</strong>er Staat sollte das unsinnige<br />
Gesetz der Schuldenbremse annullieren.<br />
Sonst sieht es düster aus für die <strong>Schweiz</strong>er<br />
Wirtschaft.<br />
• Rentenkürzungen sind abzulehnen. Sie<br />
wären Gift für die Konjunktur. Aus sozialpolitischen<br />
Gründen sind sie nicht<br />
zu verantworten.<br />
7<br />
Die vielfach schlecht geredete AHV steht heute besser da.<br />
8<br />
Ähnlich argumentiert auch der emeritierte freisinnige<br />
ETH-Professor Hans Würgler, welcher in den siebziger Jahren<br />
die Expertenkommission zur Behandlung der volkswirtschaftlichen<br />
Fragen der Sozialversicherungen präsidierte.<br />
In einem Interview mit der Sonntagszeitung vom 20.4. äussert<br />
er sich drastisch. Er sagt: «Das Drei-Säulen-System<br />
müsste theoretisch zerschlagen und die zweite Säule aufgeteilt<br />
werden: Ein Teil kommt in die AHV zur Verstärkung<br />
der ersten Säule, der Rest wird der dritten Säule, dem privaten<br />
Sparen, zugewiesen. Die Konzentration auf zwei Säulen<br />
würde das Zwangssparen teilweise entschärfen.»<br />
9<br />
Jean-Jacques Schwartz, Gesamtwirtschaftliche Probleme<br />
der zweiten Säule, <strong>Schweiz</strong>erische Z. für Sozialversicherung<br />
1977, 199–219.<br />
Günter Baigger, Dr. sc. math., lebt in<br />
Kriens. Er ist Mitglied der <strong>SP</strong>S und arbeitet<br />
in der sozialpolitischen und in<br />
der finanzpolitischen Kommission<br />
mit.<br />
34<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
REPLIKEN<br />
Replik auf<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 1/<strong>2003</strong><br />
Die letzte Nummer der <strong>Rote</strong>n <strong>Revue</strong> war<br />
der aktuellen Bildungspolitik gewidmet.<br />
Hohe Erwartungen waren damit verknüpft.<br />
Die Enttäuschung war entsprechend<br />
gross. Da war zwar viel von Bildung<br />
Linda Stibler<br />
die Rede, vom internationalen Wettbewerb<br />
und nicht zuletzt vom europäischen<br />
Selbstverständnis – von einer wirklichen<br />
linken Bildungspolitik oder auch nur dem<br />
Ansatz zu einer alternativen Denkweise<br />
auf diesem Gebiet keine Spur!<br />
Im Gegenteil: Da stimmen Sozialdemokraten<br />
in hohen Tönen ins Lied des allgemeinen<br />
Konkurrenz- und Wettbewerbsdenkens<br />
ein, das die Bildungsdebatte im<br />
letzten Jahrzehnte beinahe total überlagert<br />
hat, ohne zu merken, dass sie von einer<br />
neoliberalen Doktrin vereinnahmt werden.<br />
Nach diesem Muster ist Bildung der wichtigste<br />
Rohstoff, den die Wirtschaft braucht.<br />
Und sie braucht ihn so genormt und vergleichbar<br />
wie irgend möglich. Also sind<br />
Schulen und Universitäten dazu verpflichtet,<br />
diesen Rohstoff so aufzubereiten,<br />
dass er unter kleinstmöglichen Verlusten<br />
und Risiken zum richtigen Zweck eingesetzt<br />
werden kann. Selbstverständlich sollen<br />
die Kosten für die in dieser Weise vorgenommene<br />
«Veredelung» von der Allgemeinheit<br />
getragen werden, den Gewinn<br />
streicht die Wirtschaft ein; schliesslich trägt<br />
sie zum allgemeinen Wohlstand bei und<br />
gibt den Leuten Arbeit – solange es ihr<br />
passt und so lange es rentiert.<br />
Zugegeben, diese Skizze ist etwas holzschnittartig<br />
und vielleicht auch überzeichnet.<br />
Aber kommen wir auf den<br />
konkreten Inhalt des Heftes zurück:<br />
Die Pisa-Studie vergleicht den Wissensoder<br />
Fertigkeitsstand in Schlüsselqualifikationen<br />
unter Schülern verschiedener<br />
Länder. Sie vergleicht aber nicht Bildung,<br />
und sie definiert auch nicht, was Bildung<br />
sein könnte oder welche Art von Bildung<br />
die Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren<br />
nötig hat, wenn diese Generation ins<br />
Erwachsenenleben tritt. Diese Debatte<br />
könnte allenfalls in der Öffentlichkeit geführt<br />
werden. Das Gegenteil ist der Fall,<br />
Die öffentliche Reaktion (und diejenige<br />
der Bildungspolitiker) auf die Pisa-Studie<br />
wird lediglich auf dem Konkurrenzniveau<br />
geführt: Welches Land ist besser? Warum<br />
ist ein Land besser als das andere? Was<br />
kann getan werden, damit ein Land die<br />
Konkurrenzfähigkeit ihrer Schulabgänger<br />
verbessern kann?<br />
Die Debatte um die Bologna-Studie wird<br />
nicht anders geführt. Kann der Wert eines<br />
Hochschulstudiums an den möglichst<br />
vergleichbaren Abschlüssen gemessen<br />
werden? Seit wann ist Mobilität ein Bildungsinhalt?<br />
Global vergleichbare Abschlüsse<br />
machen es vor allem den Abnehmern<br />
von Hochschulabgängern leichter,<br />
sich weltweit (und nicht etwa europaweit)<br />
die scheinbar Tüchtigsten auszusuchen<br />
und sie in die entsprechenden Zentren abzuziehen.<br />
Sie sind auf mobilitätswillige<br />
und mobilitätsgewohnte Leute angewie-<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 35
sen, die den Beruf über ihre persönlichen<br />
und örtlichen Bindungen zu stellen vermögen.<br />
Was das aber alles mit europäischem<br />
Bewusstsein zu tun hat, ist schleierhaft.<br />
Den wortreich beschworenen Nutzen,<br />
den diese Bologna-Reform für die<br />
europäischen Bürger und ihr demokratisches<br />
Selbstverständnis haben soll, ist<br />
ebenso wenig offensichtlich.<br />
Da müsste konkret gesagt werden, dass die<br />
Universitäten bereit und in der Lage dazu<br />
sind, das Bindeglied zwischen Hochschule<br />
und einfachem Bürger zu schaffen, ihr<br />
Wissen und ihre Einsichten nach unten –<br />
oder nach hinten – zu transferieren und in<br />
einen Austausch mit der übrigen Gesellschaft<br />
zu treten. Das wäre eine demokratische<br />
und vornehme Aufgabe der Universitäten,<br />
die notabene von der öffentlichen<br />
Hand finanziert sind, mehr und<br />
mehr aber in der so genannten Eigenverantwortung<br />
von wirtschaftlichen Interessen<br />
dominiert werden. (Die Universität Basel<br />
ist ein bedenkliches Beispiel.) Darüber<br />
wird in der Bologna-Diskussion kein Wort<br />
verloren. Stattdessen werden Forderungen<br />
aufgestellt. Etwa 15 Prozent mehr finanzielle<br />
Mittel sollen aufgewendet werden für<br />
die Anpassung der Hochschulen ans Bologna-Modell<br />
und für Stipendien (damit<br />
nicht nur die Kinder wohlhabender Leute<br />
aufsteigen). Das ist, gelinde gesagt, in<br />
der heutigen Situation eine Anmassung,<br />
auch eine Anmassung so genannt linker<br />
Bildungspolitik. Wenn überhaupt noch<br />
Geld für Bildung aufzutreiben ist, dann<br />
müsste es zuerst und ohne Einschränkung<br />
jenen zugute kommen, die in den letzten<br />
schwierigen Jahren zu kurz gekommen<br />
sind. Es müsste in den vierten Bildungssektor<br />
für die Aus- und Weiterbildung von<br />
Erwachsenen gesteckt werden, um jenen<br />
Leuten eine Nachholbildung und auch jenen<br />
Selbstwert zu geben, der sie erst zu<br />
selbstbewussten, kritischen und mündigen<br />
Bürgern macht. Wenn hier nicht rasch ein<br />
Ausgleich geschafft wird, schlittern wir<br />
weiter auf dem Weg zur Zweidrittelsgesellschaft,<br />
auf deren einen Seite die Reichen,<br />
Mächtigen, Arroganten und Gutverdienenden<br />
stehen und auf der andern<br />
Seite die Ausgegrenzten, die werktätigen<br />
Armen, der dumme Normalverdiener, die<br />
Frustrierten, das grosse Heer jener, die auf<br />
der Strecke geblieben sind. Es lohnt sich,<br />
in diesem Zusammenhang den Streifen<br />
«Bowling for Columbine» von Michael<br />
Moore über die Hintergründe des Amoklaufs<br />
in der gleichnamigen Schule anzusehen.<br />
Da erklärt zum Beispiel ein Mitglied<br />
einer gewalttätigen Schülergang seinen<br />
Standpunkt: Die Eltern sagen dir,<br />
wenn du den Abschluss für die höhere<br />
Stufe nicht hinkriegst, ist dein Leben versaut;<br />
du wirst zu den Untersten und zu den<br />
Armen gehören. Dasselbe pauken sie dir<br />
auch in der Schule ein. Was also, so könnte<br />
man sich fragen, bleibt an Hoffnung<br />
noch übrig, wenn man die obere Stufe<br />
nicht schafft? Man kann nur noch zum<br />
Gewehr greifen.<br />
Linke Bildungspolitik, die diesen Namen<br />
verdient, muss grundsätzlich von der<br />
Gleichwertigkeit der Menschen ausgehen<br />
und demnach den Bildungsanspruch aller<br />
– der Dummen und der Gescheiten, der<br />
Privilegierten und weniger Privilegierten –<br />
gegen die Übergriffe der globalisierten Profitwirtschaft<br />
verteidigen (was keineswegs<br />
mit den Interessen einer gesellschafts- und<br />
sozialverträglichen Wirtschaft zu verwechseln<br />
ist).<br />
Linda Stibler, Journalistin, <strong>SP</strong>-Mitglied<br />
und Bildungsaktivistin, Basel<br />
36<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Replik auf Peter Knoepfel<br />
zur Eigentumsdebatte<br />
Peter Knoepfel hat in der letzten Nummer<br />
der <strong>Rote</strong>n <strong>Revue</strong> unter dem Titel «Die <strong>SP</strong><br />
braucht eine neue Eigentumsdebatte»<br />
seine Überlegungen zur schweizerischen<br />
Eigentumsordnung und vor allem zum<br />
Umgang mit den natürlichen Ressourcen<br />
Patricia M. Schiess Rütimann<br />
dargelegt. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten<br />
muss es ein Anliegen sein,<br />
dass jeder Mann und jede Frau eine Chance<br />
hat, Eigentum oder andere langfristig<br />
geschützte Rechte am Boden und an anderen<br />
Gütern zu erlangen. Ich stimme Peter<br />
Knoepfel zu: Die Verteilung von Eigentum<br />
ist heute ungerecht, und es ist<br />
auch noch in einem anderen Bereich eine<br />
«Umverteilung» notwendig: Es geht<br />
nicht an, dass auch denen die saubere und<br />
elektrosmogfreie Luft ausgeht, die sich bemühen,<br />
auf umweltbelastend hergestellte<br />
Produkte und die Mobiltelefonie zu verzichten;<br />
dass immer noch grosse Flächen<br />
überbaut werden, womit wir nicht nur unseren<br />
eigenen Lebensraum einengen, sondern<br />
auch den von unseren Kindern und<br />
Kindeskindern, von den Pflanzen und Tieren<br />
ganz zu schweigen; oder dass sich ein<br />
immer dichterer Lärmteppich ausbreitet,<br />
genährt von Flugzeugen, Autos und einer<br />
zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiven<br />
Unterhaltungsindustrie. Es regt sich auch<br />
zu Recht Widerstand, wenn Quartiere,<br />
Dörfer und Täler durch den Abbruch charakteristischer<br />
Gebäudegruppen oder<br />
durch phantasielose Neubauten ihr Gesicht<br />
verlieren oder zwecks touristischer<br />
Vermarktung auf ein Postkartenidyll mit<br />
entsprechender nächtlicher Beleuchtung<br />
reduziert werden.<br />
Peter Knoepfel bezeichnet diese Vorgänge,<br />
mit denen sich einzelne auf Kosten der<br />
übrigen Einwohnerinnen und Einwohner<br />
bereichern und nicht selten der Umwelt<br />
schwere Schäden zufügen, als «schleichende<br />
Privatisierung». Dieser Begriff ist<br />
einprägsam. Er zeigt: Einzelne tun etwas,<br />
womit sie alle anderen von der Nutzung<br />
oder vom harmlosen, stillen Genuss eines<br />
Gutes ausschliessen.<br />
Diese Usurpation insbesondere der natürlichen<br />
Ressourcen möchte Peter<br />
Knoepfel folgendermassen bekämpfen:<br />
Der Staat solle an Luft, Landschaft, Wasser<br />
etc. neue eigentumsähnliche Titel<br />
schaffen. Diese Titel würden den Inhaberinnen<br />
und Inhabern keine unbeschränkte<br />
Verfügungsmacht gewähren, sondern nur<br />
beschränkte Verfügungs- und Nutzungsrechte.<br />
Der Staat würde bei der Zuteilung<br />
dieser Titel auf eine breitere Streuung achten,<br />
indem jeder Person gewisse minimale,<br />
für ihre Entfaltung notwendige Rechte<br />
garantiert würden. Er behielte auch die<br />
Kompetenz, die Berechtigungen bei Bedarf<br />
abzuändern. Diese Verleihung von beschränkten<br />
Rechten hätte gemäss Peter<br />
Knoepfel auch den Vorteil, dass Verantwortlichkeiten<br />
klar festgemacht würden<br />
und die Berechtigten motivierter wären,<br />
mit den ihnen anvertrauten Gütern verantwortungsvoll<br />
umzugehen.<br />
Tatsächlich ist die beunruhigende Tendenz<br />
festzustellen, dass private Eigentümer<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 37
versuchen, ihr Eigentum immer weiter in<br />
die Höhe und in die Tiefe auszudehnen.<br />
Einerseits, indem von Sportbahnen und<br />
Kraftwerken Eigentum an kulturunfähigem<br />
Land im Hochgebirge reklamiert<br />
wird, andererseits, indem sich immer<br />
häufiger Fragen stellen, wer denn nun<br />
Rechte am Erdinnern, insbesondere am<br />
Grundwasser, geltend machen kann 1 .<br />
Diese Entwicklungen dürfen wir nicht aus<br />
den Augen verlieren. Peter Knoepfel<br />
spielt jedoch auf anderes an: Auf die negativen<br />
Auswirkungen der häufig kostenlosen<br />
Nutzung natürlicher Ressourcen auf<br />
die Allgemeinheit. Die Fahrzeuge, die in<br />
der <strong>Schweiz</strong> herumfahren, sind hierzu zugelassen.<br />
Ihre Beeinträchtigungen der<br />
Luft, der Wohnqualität, der Erdölvorkommen,<br />
der sicheren Fortbewegung von<br />
Fussgängerinnen und Velofahrern etc. werden<br />
jedoch weder durch Steuern und Abgaben<br />
der Automobilindustrie noch durch<br />
die den einzelnen Fahrzeughalterinnen<br />
und -haltern auferlegten Kosten in genügende<br />
Masse gedeckt. Dasselbe gilt für den<br />
Flugverkehr, für ganze Industriezweige<br />
und Kraftwerke, die ihre Produkte so gesehen<br />
zu billig anbieten können, weil sie<br />
eben nicht für die so genannten externen<br />
Kosten aufkommen müssen. Und selbst<br />
wenn das Finanzielle befriedigend geregelt<br />
wäre, bliebe die störende Tatsache, dass<br />
die Umwelt geschädigt wird und alle Menschen,<br />
nicht nur die Verursacher, in ihrer<br />
Lebensqualität beeinträchtigt werden.<br />
Nur, ich sehe darin – anders als Peter<br />
Knoepfel – kein Problem des im Privatrecht<br />
geregelten Eigentums. Die Ressourcen,<br />
die solchermassen unverantwortlich<br />
genutzt und übernutzt werden, sind mit<br />
wenigen Ausnahmen eben gerade nicht<br />
Privateigentum der Autofahrenden, der<br />
Aktionäre eines Betriebes, der Discobesucher,<br />
Stromlieferanten oder -bezüger.<br />
Dass gentechnisch veränderte Organismen<br />
1<br />
Eine aktuelle Übersicht bietet: Christina Schmid-Tschirren,<br />
Wem gehört das Finsteraarhorn? – Artikel 664 ZGB im<br />
Lichte der Praxis, in: Festschrift 100 Jahre Verband bernischer<br />
Notare, Langenthal <strong>2003</strong><br />
eine Gefährdung umliegender Kulturen<br />
darstellen, hängt nicht damit zusammen,<br />
dass die Forschungsanstalt Eigentum an<br />
ihnen oder der Versuchsfläche erlangt hat.<br />
Das Eigentum an den verschiedenen<br />
Strassenkategorien gehört nicht den Automobilistinnen<br />
und -mobilisten, genauso<br />
wenig wie sie Rechte an der Luft beanspruchen<br />
wollen. Diese Privaten, die ihre<br />
Interessen rücksichtslos durchsetzen, behaupten<br />
meist nicht einmal, dass ihnen<br />
dieses Recht allein zukomme oder dass sie<br />
so etwas wie Eigentum an den unveräusserlichen<br />
Gütern hätten. Insofern ist der<br />
Begriff der «schleichenden Privatisierung»<br />
nicht glücklich gewählt.<br />
Selbst wenn solche problematischen Nutzungen<br />
am Eigentum anknüpfen – z.B. am<br />
Eigentum am Grund und Boden, auf dem<br />
der Flughafen errichtet worden ist, oder an<br />
der privatrechtlichen Herrschaft über eine<br />
Unternehmung so sind es nicht die privatrechtlichen<br />
Bestimmungen, welche<br />
diese ungesunden Entwicklungen fördern.<br />
Die Kompetenzen, welche das schweizerische<br />
Sachenrecht dem Eigentümer verleiht,<br />
reichen niemals dazu aus, dass sein<br />
Auto weiter als auf seinem Grundstück<br />
herumfahren kann. Das Eigentum am Boden<br />
allein erlaubt die Erstellung und Inbetriebnahme<br />
einer Produktionsstätte<br />
oder eines Flughafens noch nicht. Vielmehr<br />
muss der an einer solchen Aktivität<br />
Interessierte verschiedene Bewilligungen<br />
einholen.<br />
Nutzungen von Luft, Wasser, Boden etc.,<br />
die über das Übliche hinausgehen und andere<br />
von der (gleichzeitigen) Ausübung<br />
derselben Tätigkeit ausschliessen, unterstehen<br />
bereits heute einer Bewilligungspflicht.<br />
Die Bewilligungen werden von der<br />
zuständigen Behörde auf Gemeinde-,<br />
Kantons- oder Bundesebene erteilt. Die öffentliche<br />
Hand ist also involviert in die Zuweisung<br />
der Nutzungsrechte. Es würde darum<br />
nichts bringen, die Güter, die gemäss<br />
geltendem Recht nicht im Eigentum eines<br />
Privaten stehen können, dem Staat zuzu-<br />
38<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
weisen mit der Aufgabe, die Nutzung an<br />
Private unter besonderen Auflagen zu gestatten.<br />
Einerseits müssen wir abklären, welche<br />
Tätigkeiten, die wegen ihrer Auswirkungen<br />
auf andere Menschen und/oder die<br />
Umwelt unter eine Bewilligungspflicht gestellt<br />
werden müssten, es noch nicht sind.<br />
So kann man sich z.B. fragen, ob wirklich<br />
jede und jeder voraussetzungslos unbeschränkt<br />
lange von überall her nach überall<br />
hin telefonieren können soll, ob jedes<br />
Verkaufsgeschäft alle Kundinnen und<br />
Kunden mit Musik berieseln darf.<br />
Andererseits müssen wir die Bewilligungsvoraussetzungen<br />
und -verfahren<br />
unter die Lupe nehmen. Genügen die Voraussetzungen,<br />
die erfüllt sein müssen, den<br />
heutigen Anforderungen? Auch auf dem<br />
Gebiet der so genannten Koordination gibt<br />
es noch viel zu tun. Einerseits, weil immer<br />
mehr Tätigkeiten nicht nur in einem Bereich<br />
negative oder unbekannte Auswirkungen<br />
zeitigen, sondern im Zusammenspiel<br />
mit anderen Umweltbelastungen eine<br />
ganze Reihe von Reaktionen auslösen.<br />
Andererseits, weil sehr viele Projekte –<br />
vom Flusskraftwerk, der Umfahrungsstrasse<br />
über den Flughafen bis zu Versuchen<br />
mit gentechnisch veränderten Pflanzen<br />
– nicht nur Folgen für eine Gemeinde<br />
oder einen Kanton haben.<br />
In vielen Fällen stellt sich denn auch die<br />
Frage, ob es sinnvoll ist, eine kantonale Behörde<br />
als Bewilligungsinstanz vorzusehen.<br />
Sind unsere Kantone nicht viel zu klein,<br />
um Abklärungen alleine und vor allem<br />
auch unabhängig von kurzfristigen wirtschaftlichen<br />
Interessen zu treffen? Stichworte:<br />
eine für den Tourismus wichtige<br />
Massnahme, der grösste Arbeitgeber im<br />
Kanton, mehr Lebensqualität durch vergrössertes<br />
Freizeitangebot, Schaffung einer<br />
guten Wohnlage für gute Steuerzahler.<br />
Genügt es, wenn nur die Anwohner, deren<br />
Gartenhag direkt an ein Unternehmen<br />
grenzt und die zudem Eigentümer und<br />
nicht nur Mieter sind, Einsprache erheben<br />
dürfen? Müssten nicht auch die Interessen<br />
von Kindern sowie Ausländerinnen<br />
und Ausländern berücksichtigt werden,<br />
die im Planungsprozess auf politischer<br />
Ebene keine Stimme haben?<br />
Änderungen an der privatrechtlichen Eigentumsordnung<br />
bringen diesbezüglich<br />
keine Verbesserung. Sie tut ihren Dienst<br />
zuverlässig und beständig und schützt von<br />
ihrem Grundgedanken her die natürlichen<br />
Ressourcen insbesondere im (Hoch-)Gebirge<br />
vor den Interessen Privater.<br />
Anzusetzen ist vielmehr bei der Ausgestaltung<br />
der Bewilligungsverfahren. Viel<br />
häufiger sollten die Entscheide auf höherer<br />
Ebene, beim Bund, gefällt werden, und<br />
nicht in den mit wirtschaftlichen Argumenten<br />
leichter erpressbaren Gemeinden<br />
und Kantonen. Teilt man die Ansicht, dass<br />
Erwachsene wirksam über das Portemonnaie<br />
erzogen werden, so eröffnen sich<br />
weitere Möglichkeiten. Oder ist die ökologische<br />
Steuerreform bereits tot? Ich hoffe<br />
es nicht. Gibt es doch genügend Beispiele,<br />
in denen man für unsoziales, umweltschädigendes<br />
Verhalten wie tägliches<br />
Autofahren über lange Strecken oder Bewohnen<br />
einer viel zu grossen Liegenschaft<br />
steuerlich sogar noch belohnt wird.<br />
Diese Gedanken sind leider nicht neu. Das<br />
bedeutet, dass sie noch immer nicht umgesetzt<br />
worden sind. Das bedeutet aber<br />
gleichzeitig auch, dass das Denken nicht<br />
bei Null beginnen muss.<br />
Patricia M. Schiess Rütimann hat sich<br />
in ihrer Doktorarbeit «Nachverdichtung<br />
von Liegenschaften mit Mietwohnungen»<br />
u.a. mit der haushälterischen<br />
Bodennutzung auseinander<br />
gesetzt. Sie arbeitet als Oberassistentin<br />
im Privatrecht an der Universität<br />
Zürich.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 39
CHRONOS<br />
Sozialismus in einer<br />
Stadt?<br />
Vor 75 Jahren entstand das rote Zürich<br />
«Erobert Zürich dem Sozialismus!» Mit<br />
diesem Slogan warb im Frühjahr 1928 die<br />
Sozialdemokratische Partei der grössten<br />
<strong>Schweiz</strong>er Stadt für ihre Kandidaten. Auch<br />
die Gegenseite betrachtete die anstehenden<br />
Wahlen als Richtungsentscheidung.<br />
Christian Koller<br />
«Für ein freies und fortschrittliches Zürich<br />
– Gegen rote Parteidiktatur», hiess es auf<br />
einem Flugblatt für die «bürgerliche Einheitsliste»<br />
zum Stadtrat. Seit dem Ende<br />
des Ersten Weltkrieges hielten sich Rechte<br />
und Linke wählermässig in etwa die<br />
Waage. Ein «rotes Zürich» lag förmlich in<br />
der Luft. 1919 hatten die Bürgerlichen die<br />
Mehrheit im Gemeinderat verloren, das<br />
Zünglein an der Waage zwischen den 60<br />
Sozialdemokraten und 57 Bürgerlichen<br />
spielten acht Grütlianer, die sich als «Sozialdemokratische<br />
Volkspartei» rechts<br />
von der <strong>SP</strong> abgespalten hatten. Diese<br />
Konstellation konnte aber sozialpolitisch<br />
nicht ausgenutzt werden, da die Stadt<br />
nach einer Kreditsperre der Banken unter<br />
der Finanzaufsicht des Kantons stand.<br />
1919/20 mussten die Sozialausgaben von<br />
6,4 auf 4 Millionen gesenkt und über ein<br />
Viertel der städtischen Angestellten entlassen<br />
werden. 1922 errangen die Bürgerlichen<br />
eine hauchdünne Mehrheit von<br />
einem Sitz, die sie drei Jahre später wieder<br />
verloren. Nun sassen den 60 Bürgerlichen<br />
55 Sozialdemokraten, 9 Kommunisten<br />
und 1 Grütlianer gegenüber. In der Exekutive<br />
war die Linke aber nur mit drei von<br />
neun Sitzen vertreten.<br />
Diese Pattsituation drängte zu einer Entscheidung.<br />
Im Wahlkampf von 1928<br />
konnte jedes Lager die Schuld für die<br />
Probleme der Stadt der Gegenseite in die<br />
Schuhe schieben. Die Freisinnigen reimten<br />
in einem Pamphlet mit dem Titel «Zürcher<br />
Bilderbogen» gekonnt: «Doch wer<br />
saniert jetzt die Finanzen/ Befreit den Leu<br />
von roten Wanzen?/ Das darf dann wieder<br />
treu und stumm/ Das gute Zürcher<br />
Bürgertum.» 1 Das freisinnige Emblem, ein<br />
Züri-Leu mit Stadtfahne, veranlasste die<br />
<strong>SP</strong>, von der «Raubtierpartei» zu sprechen.<br />
Sie wollte nicht nur die linke Mehrheit im<br />
Gemeinderat halten, sondern auch die<br />
Majorität in der Exekutive erobern. Ein<br />
erster Schritt dazu gelang im Januar<br />
1928, als in einer Nachwahl die <strong>SP</strong> zu Lasten<br />
des Freisinns ein viertes Stadtratsmandat<br />
gewann. Zu den allgemeinen Erneuerungswahlen<br />
drei Monate später traten<br />
die Sozialdemokraten mit einer<br />
Fünferliste an, für das Stadtpräsidium kandidierte<br />
Emil Klöti, der bereits seit 21 Jahren<br />
im Stadtrat sass, gegen den demokratischen<br />
Amtsinhaber Hans Nägeli. Am 15.<br />
April 1928 wurde das «rote Zürich» Realität:<br />
Bei den Stadtratswahlen landeten<br />
die <strong>SP</strong>-Kandidaten auf den ersten fünf<br />
Plätzen, im Gemeinderat blieb das bisherige<br />
Kräfteverhältnis gewahrt, und bei der<br />
Wahl für das Stadtpräsidium distanzierte<br />
der Herausforderer den bisherigen um<br />
rund tausend Stimmen.<br />
1<br />
<strong>Schweiz</strong>erisches Sozialarchiv 32/114a, Wahlen Stadt<br />
Zürich 1914–1928.<br />
40<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
Zürich war nicht die erste «rote» <strong>Schweiz</strong>er<br />
Gemeinde. Bereits vor dem Ersten<br />
Weltkrieg war den Sozialdemokraten etwa<br />
in Altstetten (1907) und in La Chauxde-Fonds<br />
(1912) die Eroberung der Mehrheit<br />
gelungen. In den frühen zwanziger<br />
Jahren wurden neben La Chaux-de-Fonds<br />
und seiner Nachbarstadt Le Locle Biel<br />
(1921 bis 1947) und Arbon (1925 bis 1957)<br />
«rote Städte». Nach Zürich folgten Schaffhausen,<br />
Basel, Lausanne und Genf. Ende<br />
1933 verfügte die <strong>SP</strong> in etwa 40 Gemeinden<br />
über die Verwaltungsmehrheit. Nach<br />
dem Landesstreik war die von der auf ihren<br />
Obrigkeitsstaat fixierten deutschen Sozialdemokratie<br />
übernommene Idee, die<br />
Macht im Gesamtstaat sei das alles Entscheidende,<br />
durch die Strategie des «Gemeindesozialismus»<br />
ergänzt worden:<br />
Durch die Eroberung von Mehrheitspositionen<br />
in den Gemeinden sollten wichtige<br />
soziale Ziele verwirklicht werden, etwa<br />
der Ausbau der kommunalen Dienstleistungen<br />
und der gemeindeeigenen<br />
industriellen Betriebe, die Verbesserung<br />
der Anstellungsverhältnisse der Gemeindeangestellten,<br />
die Förderung des kommunalen<br />
und genossenschaftlichen Wohnungsbaus<br />
und die Fusion von Gemeinden<br />
mit unterschiedlicher Steuerkraft.<br />
Entgegen den bürgerlichen Befürchtungen<br />
verfolgte das «rote Zürich» eine zwar konsequente,<br />
aber auch auf Ausgleich bedachte<br />
Politik. Als kurz nach den Wahlen<br />
ein bürgerlicher Stadtrat verstarb, verzichtete<br />
die <strong>SP</strong> bei der Ersatzwahl auf eine<br />
eigene Kandidatur oder auf die Unterstützung<br />
des kommunistischen Bewerbers<br />
und ermöglichte damit die Wahl eines Freisinnigen.<br />
Auch auf der symbolischen Ebene<br />
widerspiegelte sich diese Grundhaltung:<br />
Am 1. Mai 1928 wurden zwar erstmals die<br />
städtischen Amtsgebäude beflaggt, allerdings<br />
nicht mit roten, sondern mit <strong>Schweiz</strong>er<br />
und Zürcher Fahnen. Das «rote Zürich»<br />
verstand sich nicht als ein sozialistisches<br />
Experimentierfeld, sondern wollte<br />
Symbol und Paradebeispiel solider sozialdemokratischer<br />
Verwaltungsarbeit werden.<br />
Unverzüglich wurde indessen der als<br />
«Linkenfresser» bekannte Polizeiinspektor<br />
Otto Heusser entlassen, der ein halbstaatliches<br />
Spitzelnetz aufgebaut hatte,<br />
welches er dann allerdings noch bis nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg weiterbetrieb.<br />
Das ungeliebte Polizeiamt, das die Bürgerlichen<br />
bis anhin den Sozialdemokraten<br />
überantwortet hatten, wurde dankend an<br />
die neue Minderheit weitergegeben.<br />
In der Zeit bis zur Weltwirtschaftskrise<br />
konnten nun zahlreiche Reformmassnahmen<br />
an die Hand genommen werden.<br />
Das 1924 gestartete Programm der Unterstützung<br />
von Wohnbaugenossenschaften<br />
wurde weitergeführt. 1929 erfolgte die Einführung<br />
der beitragslosen Altersbeihilfe sowie<br />
die Schaffung einer Spar- und Hilfskasse<br />
für das nicht versicherte städtische<br />
Hilfspersonal. Das grösste Projekt war die<br />
zweite Eingemeindung. Zahlreiche Vorortsgemeinden<br />
gehörten wirtschaftlich<br />
längst zur Stadt und hatten auch ähnliche<br />
soziale Probleme. Namentlich die Glattalgemeinde<br />
Affoltern drohte finanziell zusammenzubrechen.<br />
Durch die Schaffung<br />
von «Gross-Zürich» sollte die Planbarkeit<br />
der Wirtschaftsregion Zürich vergrössert<br />
und ein finanzieller Ausgleich zwischen armen<br />
und reichen Quartieren geschaffen<br />
werden. Nachdem ein erster Vorstoss 1929<br />
noch in der kantonalen Volksabstimmung<br />
gescheitert war, wurde 1931 eine neue Vorlage<br />
gutgeheissen, die die reichen Gemeinden<br />
Kilchberg und Zollikon von der<br />
Eingemeindung ausnahm. Damit verdoppelte<br />
sich die Stadtfläche und die EinwohnerInnenzahl<br />
stieg von 250000 auf<br />
320000.<br />
Bald wurde die Weltwirtschaftskrise aber<br />
auch im «roten Zürich» spürbar. Die Zahl<br />
der Arbeitslosen sprang von 1795 im Jahre<br />
1930 auf 12415 im Jahre 1934. Die<br />
Stadtregierung reagierte mit verschiedenen<br />
sozialpolitischen und interventionistischen<br />
Massnahmen. 1931 wurde die<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 41
obligatorische, von der Stadtkasse subventionierte<br />
Arbeitslosenversicherung eingeführt.<br />
Ab 1933 gewährte die Stadt (wie<br />
auch der Kanton) Exportrisikogarantien.<br />
Als die Firma Escher Wyss nahe am Konkurs<br />
stand, kaufte die Stadt 1935 ihre Liegenschaft<br />
und vermietete sie ihr zu günstigen<br />
Konditionen, um die 1000 Arbeitsplätze<br />
zu retten. Als Arbeitsbeschaffungsmassnahme<br />
wurden Renovationsarbeiten<br />
städtisch unterstützt.<br />
Allerdings kam es nun teilweise zu Konflikten<br />
mit der Basis. Ein wilder Streik der<br />
Heizungsmonteure, die einen vom SMUV<br />
mit den Arbeitgebern ausgehandelten<br />
Lohnabbau ablehnten und dabei bei der<br />
KP Unterstützung fanden, gipfelte am 15.<br />
Juni 1932 in Strassenschlachten zwischen<br />
Aussersihler Arbeitern und der Polizei<br />
mit einem Toten. Auch die JungsozialistInnen<br />
übten immer stärkere Kritik an<br />
der Stadtregierung und näherten sich der<br />
KP an. Im Dezember 1934 wurden ihre<br />
Organisationen von der <strong>SP</strong> aufgelöst.<br />
Mit der nationalsozialistischen Machtübernahme<br />
in Deutschland im Januar<br />
1933 wurde auch in Zürich eine neue politische<br />
Kraft wichtig: die «Fronten». Sie<br />
agitierten «gegen den antireligiösen, bolschewistischen<br />
und jüdischen Zersetzungsgeist»<br />
sowie «gegen den Parteienstaat<br />
und gegen den unverantwortlichen<br />
Parlamentarismus» 2 und stiessen zunächst<br />
im Bürgertum trotz ihres antidemokratischen<br />
und antiliberalen Programms durchaus<br />
auf Sympathien. Am 28. Mai 1933,<br />
dreieinhalb Wochen nach der Zerschlagung<br />
der deutschen Gewerkschaften,<br />
widmeten die Freisinnigen ihren Kantonaltag<br />
der Frage der Zusammenarbeit mit<br />
den Fronten. Parteipräsident Heinrich<br />
Weisflog meinte dabei, der Freisinn begrüsse<br />
«von ganzem Herzen den Grundton<br />
der neuen Bewegungen ‘Alles für das<br />
2<br />
<strong>Schweiz</strong>erisches Sozialarchiv 32/116, Wahlen Stadt Zürich<br />
1933.<br />
Vaterland’ und ist mit ihnen einverstanden,<br />
wenn sie es unternehmen, unsere<br />
Ratssäle vom russischen Ungeziefer zu<br />
säubern». Ein gemeinsames Handeln sei<br />
möglich «schon mit Rücksicht auf das<br />
nächste Kriegsziel, die Befreiung der<br />
Stadt Zürich von der roten Herrschaft» 3 .<br />
Und Karl Pestalozzi meinte namens der<br />
Jungfreisinnigen, sie begrüssten «die nationale<br />
Erneuerung und unterstützen die<br />
Fronten aufs kräftigste» 4 .<br />
Tatsächlich schlossen sich die bürgerlichen<br />
Parteien und verschiedene «Fronten»<br />
und «Bünde» für die ersten «gross-zürcherischen»<br />
Gemeinderatswahlen vom<br />
September 1933 in einer Listenverbindung<br />
zusammen, und auf dem Sechserticket des<br />
bürgerlichen «Vaterländischen Blocks» für<br />
den Stadtrat figurierte auch der «Führer»<br />
der Nationalen Front. Paradoxerweise<br />
warnten die Freisinnigen jedoch gleichzeitig<br />
in ihrer Wahlpropaganda vor den<br />
Fröntlern. Die Reaktion auf die sozialdemokratische<br />
«Misswirtschaft» müsse kommen<br />
und der «Systemwechsel» könne nun<br />
noch «auf legale Weise» erfolgen; ob dies<br />
in einem Jahr noch möglich sei, wisse kein<br />
Mensch: «Wehe, Bürger, wenn Du schläfst!<br />
Dann werden die Fronten mit eisernem<br />
Besen kehren, und was dann an Freiheiten<br />
noch übrig bleibt, das siehst Du am<br />
heutigen Hitler-Deutschland: Nichts!» 5<br />
Der Wahlkampf war nicht frei von Gewalt.<br />
Immer wieder kam es zu Handgreiflichkeiten<br />
zwischen rechten und linken Aktivisten.<br />
Als am Abend vor dem Wahltag<br />
die Bürgerlichen einen Werbefackelzug mit<br />
Beteiligung des frontistischen «Harst» als<br />
«Weiheakt der vaterländischen Aktion» 6<br />
nach Aussersihl hinein lenken wollten,<br />
wurden sie trotz Ermahnungen der sozialdemokratischen<br />
Presse zur Besonnen-<br />
3<br />
NZZ, <strong>Nr</strong>. 967, 29.5.1933.<br />
4<br />
ebd.<br />
5<br />
<strong>Schweiz</strong>erisches Sozialarchiv 32/116, Wahlen Stadt Zürich<br />
1933.<br />
6<br />
NZZ, <strong>Nr</strong>. 1707, 22.9.1933.<br />
42<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
heit von aufgebrachten Arbeitern regelrecht<br />
aus dem Quartier hinausgeprügelt.<br />
Schliesslich obsiegten die Sozialdemokraten,<br />
die ihre fünf Stadtratsmandate sowie<br />
die 1931 errungene alleinige absolute<br />
Mehrheit im Gemeinderat mit einem<br />
Wähleranteil von 47,8% verteidigen konnten.<br />
Die Frontisten erreichten einen Wähleranteil<br />
von 7,7%, der vor allem zu Lasten<br />
der Freisinnigen ging. Nach geschlagener<br />
«Wahlschlacht» triumphierte der spätere<br />
Bundesrat Ernst Nobs: «Nie ist von bürgerlicher<br />
Seite ein Wahlkampf ordinärer<br />
geführt worden als diesmal. Der Wettbewerb<br />
in reaktionärem Radikalismus hat<br />
seine schlimmsten Orgien gefeiert. […] Es<br />
war eine Lust, die dicken, plumpen Lügen<br />
der reaktionären Wahlhetze Stück um<br />
Stück abzustechen. […].» 7<br />
Mit dem Andauern von Krise und Massenarbeitslosigkeit<br />
wurde der finanzielle<br />
Spielraum für die gemeindesozialistische<br />
Reformpolitik immer kleiner. Trotz massiver<br />
Steuererhöhungen musste 1934<br />
auch das «rote Zürich», das sich nach den<br />
Erfahrungen der unmittelbaren Nachkriegszeit<br />
nicht wieder in die Abhängigkeit<br />
vom Kapitalmarkt begeben wollte, die<br />
Löhne seiner Angestellten kürzen. Das mit<br />
Zustimmung der Gewerkschaften erbrachte<br />
«Krisenopfer» beinhaltete zwar<br />
nicht wie andernorts einen linearen, sondern<br />
einen sozial abgestuften Lohnabbau,<br />
bedeutete aber dennoch einen Verlust an<br />
Glaubwürdigkeit, der von Bürgerlichen<br />
wie Kommunisten hämisch ausgeschlachtet<br />
wurde.<br />
7<br />
Nobs, Ernst: Die Zürcher Wahlschlacht, in: <strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong><br />
13 (1933), S. 37.<br />
Bei den Wahlen von 1938 wurde die<br />
Mehrheit im Stadtrat zwar behauptet, im<br />
Gemeinderat fiel die <strong>SP</strong> aber mit einem<br />
Wähleranteil von nur noch 41,6% von 63<br />
auf 60 Mandate zurück, womit erstmals<br />
seit 1925 keine linke Mehrheit mehr bestand.<br />
Grosser Gewinner war der Landesring<br />
der Unabhängigen, der auf Anhieb<br />
auf 16% kam und mit seiner Mischung aus<br />
sozialliberalem Migros-Konsumismus und<br />
Volksgemeinschaftsideologie auch in den<br />
Arbeiterquartieren regen Zulauf hatte. Bei<br />
den nächsten Wahlen mitten im Krieg setzte<br />
sich dieser Trend fort: Die <strong>SP</strong> behauptete<br />
1942 zwar ein weiteres Mal ihre fünf<br />
Stadtratssitze, fiel aber auf einen Wähleranteil<br />
von 36,5% zurück und verlor 12<br />
Gemeinderatsmandate. Demgegenüber<br />
wuchs der Landesring auf 28,6% der Stimmen,<br />
war nun beinahe doppelt so stark<br />
wie der Freisinn und zog auch mit einem<br />
Vertreter in die Stadtregierung ein.<br />
Gegen Kriegsende musste die <strong>SP</strong> mit der<br />
Gründung der Partei der Arbeit, der sich<br />
nicht nur ehemalige Mitglieder der 1940<br />
verbotenen KP, sondern auch linke SozialdemokratInnen<br />
anschlossen, nochmals<br />
einen Aderlass hinnehmen. Bei den Gemeinderatswahlen<br />
von 1946 kam sie nur<br />
noch auf einen Wähleranteil von 29,1%,<br />
während die PdA 15,3% erreichte. Bei den<br />
Stadtratswahlen hatte die Liste der beiden<br />
Linksparteien indessen einen durchschlagenden<br />
Erfolg: Neben zwei Freisinnigen<br />
und einem Landesringler wurden<br />
wiederum fünf Sozialdemokraten sowie<br />
der PdA-Kandidat Edgar Woog gewählt.<br />
Bald sollte der Kalte Krieg aber auch in<br />
Zürich Einzug halten. Im Oktober 1947<br />
wurde Woog wegen Veruntreuung verhaftet<br />
– er hatte der PdA-Zeitung «Vorwärts»<br />
aus den Sammelgeldern der «Koordinationsstelle<br />
für Nachkriegshilfe» ein<br />
Darlehen von 5000 Franken gewährt, das<br />
zum Zeitpunkt seiner Verhaftung allerdings<br />
bereits zurückbezahlt war – und vom<br />
Bezirksrat im Amt «eingestellt». Im April<br />
1949 erfolgte seine Amtsenthebung.<br />
Im September gleichen Jahres verstarb der<br />
sozialdemokratische Stadtpräsident Adolf<br />
Lüchinger. In der Ersatzwahl ging das Präsidium<br />
an den Freisinnigen Emil Landolt<br />
und der Stadtratssitz an den Landesring,<br />
womit die linke Mehrheit auch in der<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 43
Stadtregierung für vier Jahrzehnte beendet<br />
war. Die kantonale <strong>SP</strong> musste den Sektionen<br />
mitteilen, «dass lieben alten Vertrauensleuten,<br />
die selbstlos und opferfreudig<br />
mitgeholfen hatten, das <strong>Rote</strong> Zürich<br />
zu schaffen, beim Bekanntwerden des<br />
Wahlresultates Tränen in die Augen stiegen.<br />
Dieses <strong>Rote</strong> Zürich war der Brükkenkopf<br />
des sozialen Fortschritts». Resignieren<br />
mochte man aber nicht: «Zum<br />
Köpfehängenlassen besteht allerdings<br />
kein Anlass. Im Gegenteil! Die Arbeiterbewegung<br />
wird die gegenwärtige Epoche<br />
der «politischen Wundermänner und<br />
Kurpfuscher» bestimmt überwinden. […]<br />
Wir sind da und bleiben unseres Erfolges<br />
gewiss, trotz alledem!» 8<br />
8<br />
Rundschreiben <strong>SP</strong> Kanton Zürich an die Sektionsvorstände,<br />
26.9.1949.<br />
Christian Koller ist promovierter Historiker<br />
und lebt in Zürich.<br />
44<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
BÜCHERWELT<br />
Das Individuum an der Globalisierungsfront<br />
Rüdiger Safranski: Wie viel Globalisierung<br />
verträgt der Mensch? Hanser Verlag,<br />
München <strong>2003</strong>. 118 S., Fr. 26.20.<br />
Naomi Klein: Über Zäune und Mauern.<br />
Berichte von der Globalisierungsfront.<br />
Campus Verlag, Frankfurt <strong>2003</strong>. 304 S.,<br />
Fr. 29.80.<br />
Die «globale Selbstwahrnehmung des<br />
Menschen» könne kaum noch von einer<br />
Depression unterschieden werden. Rüdiger<br />
Safranski ist skeptisch gestimmt. Der<br />
Überblick über das «global village» erinnert<br />
ihn an ein Diktum Schopenhauers,<br />
wonach die Erde verloren im Kosmos driftet,<br />
überzogen von einer Schimmeldecke,<br />
die «lebende und erkennende Wesen erzeugt<br />
hat». In die Lichtung seines Arbeitsplatzes<br />
winken ihm die weiten Horizonte<br />
der «ganzen» Welt als bedrohlich<br />
herüber. Auf diesen Horizonten aber eilt<br />
die kanadische Aktivistin Naomi Klein<br />
von einem Brennpunkt zum nächsten, um<br />
zu dokumentieren, was sich an den Globalisierungsfronten<br />
tut.<br />
»Globalisierung» ist ein höchst variabler<br />
Kampfbegriff, den Neoliberale und Anti-<br />
Globalisierer je eigensinnig ins Feld führen.<br />
Meist bleibt er zudem in sich widersprüchlich.<br />
Die Kritiker agieren global,<br />
wenn sie den Globalisierern Widerstand<br />
leisten, denen wiederum der heimische, also<br />
eigene Profit am nächsten liegt. Globalisierung<br />
als Effekt, als Ideologie oder als<br />
Lebensform; meist ist dabei das Lokale<br />
nicht weit. In diesem Punkt sind sich der<br />
akkurate Denker und die agile Journalistin<br />
einig. «Globalismus», wie es Safranski<br />
nennt, «ist Legitimationsideologie für die<br />
ungehemmte Bewegung des Kapitals auf<br />
der Suche nach günstigen Verwertungsbedingungen»,<br />
also Profitmehrung. Im Gefolge<br />
dessen, ergänzt Naomi Klein, sind alle<br />
geschützten Räume «aufgebrochen<br />
worden, nur um vom Markt wieder eingezäunt<br />
zu werden». Die Einigkeit zwischen<br />
den beiden endet, wo es um die Einschätzung<br />
der Chancen und Vorteile der<br />
Globalisierung geht.<br />
«Über Zäune und Mauern» versammelt eine<br />
Reihe von Aufsätzen und Kolumnen,<br />
die Naomi Klein an den Brennpunkten<br />
des antiglobalen Kampfes zwischen Seattle,<br />
Porto Alegre und Prag verfasst hat.<br />
Mitunter kokettiert die überzeugte Internationalistin<br />
mit ihrer Nähe zur Globalisierungsfront,<br />
etwa, wenn sie in Quebec<br />
auf den von Tränengas umnebelten Barrikaden<br />
ihren Text in einen «betagten<br />
Computer» tippt. So werden die Mythen<br />
des antiglobalen Widerstands geschrieben,<br />
doch Naomi Klein ist sich der eigenen<br />
Widersprüche ebenso bewusst wie der aussichtslosen<br />
Eigendynamik, die zwischen<br />
Polizei und Demonstranten zusehends<br />
entbrennt. Dagegen versucht sie weiter<br />
führende Perspektiven zu entwickeln.<br />
«Wir können global kommunizieren und<br />
reisen, wir können aber nicht im Globalen<br />
wohnen», hält ihr Rüdiger Safranski kritisch<br />
entgegen. «Je mehr emotional gesättigte<br />
Ortsbindung, desto grösser die Fähigkeit<br />
und Bereitschaft zur Weltoffenheit.»<br />
Das eine bedingt das andere also mit. «Wie<br />
viel Globalisierung verträgt der Mensch?»,<br />
fragt er mit anthropologischem Aplomb<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 45
und spiegelt die Frage nach einem kurzen<br />
begrifflichen Exkurs über das «Globale»<br />
in die Philosophiegeschichte zurück.<br />
«Das Ganze lässt sich denken, aber nicht<br />
leben», konzentriert er den grundsätzlichen<br />
Vorbehalt und nimmt dafür Hegel<br />
zum Zeugen: «Etwas ist nur in seiner<br />
Grenze und durch seine Grenze das, was<br />
es ist. Man darf somit die Grenze nicht als<br />
dem Dasein bloss äusserlich betrachten…<br />
Wer gegen das Endliche zu ekel ist, der<br />
kommt zu gar keiner Wirklichkeit, sondern<br />
er verbleibt im Abstrakten und verglimmt<br />
in sich selbst.» Der Traum vom<br />
Ganzen kommt also nicht ohne Rückbezug<br />
aufs Nahe, Eigene aus. Um gegen den<br />
Selbstverlust vorzubauen, muss der<br />
Mensch eine Grenze ziehen, sich eine<br />
(möglichst handyfreie) Lichtung schlagen,<br />
um Raum und Orientierung im Dickicht<br />
der Zeichen zu schaffen. Die menschliche<br />
Vernunft bedarf einer solchen Lichtung gegen<br />
die «globale Platzangst». Mit Bezug<br />
auf Rousseau plädiert Safranski für diesen<br />
Weg nach innen, wo «das wahre Leben»<br />
vermutet wird. Die Weltgeschichte als Appendix<br />
der Lebensgeschichte?<br />
Mit Blick auf Naomi Klein erzeugt dieser<br />
Rückzug auch Unbehagen. «Es ist kein<br />
Zufall», schreibt sie, «dass die Polizeigewalt<br />
immer in gesellschaftlichen Randgruppen<br />
gedeiht», bei den Chiapas oder<br />
den Obdachlosen, die gemeinhin zur Masse<br />
aufsummiert nicht als Individuen gelten.<br />
Der Widerstand, der von ihrer Seite der<br />
ökonomischen Globalisierung erwächst,<br />
resultiert aus der begründeten Furcht,<br />
nicht nur das individuelle Wohlbefinden,<br />
sondern die Freiheit an den Konzernkapitalismus<br />
zu verlieren. Auf dem Spiel stehen<br />
reale Individuen (von ausserhalb der<br />
westlichen Gesellschaft), die systematisch<br />
ausgegrenzt und von der Lichtung des<br />
Westens fern gehalten werden.<br />
Die totale Ökonomisierung des Privaten<br />
hat für Klein zur Folge, dass sie sich als Teil<br />
der Widerstandsnetzwerke sieht, darum<br />
wissend, «dass die Würde des Menschen<br />
und der Schutz der Umwelt zu wichtig<br />
sind, als dass man tatenlos darauf wartet<br />
wie auf den Regen nach einer Dürre». Ihre<br />
Texte sind Versuche, sich selbst als Individuum<br />
zu beweisen und sich innerhalb<br />
des antiglobalen Widerstands eine Rolle,<br />
eine Lichtung zu schaffen, indem sie aufklärt<br />
und differenziert.<br />
Dabei ist sich auch Naomi Klein bewusst:<br />
«Wir wissen zu viel». Vergleichbar mahnt<br />
Safranski: «Nicht nur der Körper, auch unser<br />
Geist braucht einen Immunschutz;<br />
man darf nicht alles in sich hineinlassen,<br />
sondern nur so viel, wie man sich anverwandeln<br />
kann.» Die Differenz besteht darin,<br />
dass der zurückhaltende Intellektuelle<br />
den Frieden zwischen seiner ersten und<br />
seiner zweiten, also der kulturellen Natur<br />
erstrebt, während die Aktivistin die beiden<br />
Naturen in produktiver Spannung zueinander<br />
hält.<br />
Die Bücher von Rüdiger Safranski und<br />
Naomi Klein stehen in vielerlei Hinsicht<br />
konträr zueinander. Wo jener mit Platon,<br />
Kant, Goethe oder Schiller das Individuum<br />
vor den Zumutungen der globalen Vernetzung<br />
in Schutz nimmt, stürzt sich diese<br />
in den internationalen Kampf, um gegenüber<br />
den «Kamikaze-Kapitalisten» die<br />
«globale Vielfalt» zu retten. Zwei Wege,<br />
dennoch ein gemeinsames Ziel: das «Pluriversum»<br />
(Safranski) aus freien Individuen.<br />
Mit Bezug auf die biblische Geschichte<br />
von Kain und Abel notiert Safranski: «Die<br />
Sorge um Selbsterhaltung und der Kampf<br />
gegen die Ungleichbehandlung – diese<br />
Komponenten zusammen wirken explosiv<br />
und lassen den Menschen zugleich schöpferisch<br />
und gefährlicher werden.» Wer<br />
durch die neoliberale Gleichschaltung von<br />
öffentlich und privat in seinen Grundrechten<br />
und -bedürfnissen verletzt wird,<br />
muss sich zur Wehr setzen. Die Aktionen<br />
der «tutte bianche» in Italien, der Sozial-<br />
46<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
gipfel in Porto Alegre, die legendäre Figur<br />
des Subcommandante Marcos symbolisieren<br />
einen schöpferischen Widerstand,<br />
der an Rückhalt gewinnt, je mehr sichtbar<br />
wird, dass «Globalisierung» im ökonomischen<br />
Sinn oft wenig mehr bedeutet als<br />
Privatisierung des Gemeinwesens und<br />
Internationalisierung der Innenpolitik.<br />
Naomi Klein belegt es anhand von zahlreichen<br />
Beispielen. An der kanadisch-amerikanischen<br />
Grenze etwa werden für teures<br />
Geld «intelligente» Verfahren entwickelt,<br />
die das reibungslose Passieren von<br />
Gütern mit dem Schutz vor illegaler Einwanderung<br />
verbinden.<br />
«Welche Werte sollen das Zeitalter der<br />
Globalisierung beherrschen?» fragt Klein.<br />
Gleichsam als ein Friedensangebot über<br />
Grenzen und Lichtung hinaus antwortet<br />
ihr Safranski mit Kants Abhandlung «Zum<br />
ewigen Frieden» von 1795. Die Eckpunkte<br />
von Kants Überlegungen sind eine unbedingte<br />
«Achtung fürs Recht», die zivilisierende<br />
Kraft des Welthandels und das Prinzip<br />
der demokratischen Publizität. Durch<br />
die Vernunft wird dieses System geadelt.<br />
Safranski beurteilt es wie folgt: «Wer die<br />
«Menschheit» in sich ehrt, überwindet das<br />
blosse Selbsterhaltungsinteresse und wird fähig<br />
zur Solidarität. Diese Vernunft, so Kant,<br />
macht den Menschen zum Weltbürger.»<br />
Globalisierung ist ein ausgesprochen heterogener<br />
Begriff, der das Gute meint und<br />
(oft nur) das Egoistische schafft. Rüdiger<br />
Safranski und Naomi Klein geben aus<br />
ganz unterschiedlich subversiver Perspektive<br />
– mit Rekurs auf die sozialen Kämpfe<br />
bzw. den sozialen Gedanken – ein paar<br />
differenzierte Hinweise zur Begriffsklärung.<br />
Wir sind gerne blind für die Tatsache,<br />
dass wir alle freimütig Globalisierte sind.<br />
Der sich wechselseitig bespiegelnde Blick<br />
aufs globalisierte Individuum durch Safranski<br />
und Klein birgt vergleichsweise<br />
auch den Appell in sich, nicht nur Kritik<br />
an der ökonomischen Globalisierung zu<br />
üben, sondern uns selbst dessen Gesetzen<br />
von Eigennutz und Eigenprofit zu entziehen.<br />
Erst das selbstbewusste Individuum<br />
an der Globalisierungsfront gewinnt seine<br />
Handlungsfähigkeit gegenüber dem<br />
Konzernkapitalismus zurück.<br />
Beat Mazenauer<br />
Analysen linker (Ohn-)Macht-Politik<br />
Widerspruch: Linke und Macht, Zürich<br />
2002, Heft 43, Fr. 25.- Im Buchhandel erhältlich<br />
oder bei: Widerspruch, Postfach,<br />
8026 Zürich. www.widerspruch.ch<br />
Nicht nur die vorliegende <strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> befasst<br />
sich mit der Linken; der Widerspruch<br />
– umfangreich, analysestark, wortgewaltig<br />
und autorenlastig wie immer – widmet sich<br />
der Frage nach der Krise der Linken und<br />
der Macht. «In diesem Heft», so versprechen<br />
es die Herausgeber Pierre Franzen,<br />
Walter Schöni und Urs Sekinger, «werden<br />
zentrale Konzepte der Kapitalismuskritik<br />
wie z.B. jenes einer umfassenden Wirtschaftsdemokratie<br />
bilanziert und aktualisiert.<br />
Die kritische Reflexion des Klassenkonzeptes<br />
und die Analyse der Arbeit<br />
im Zeitalter hochtechnisierter kapitalistischer<br />
Produktionsweise eröffnen höchst<br />
aktuelle Einsichten in Diskussionsstränge,<br />
von denen sich nicht nur die Macher<br />
der ‚Neuen Mitte‘, sondern ebenso die<br />
Theorien der Individualisierung, des Postindustrialismus<br />
und der ,Wissensgesellschaft‘<br />
längst verabschiedet hatten. Diskutiert<br />
werden neue Ansätze zur Globalisierungskritik<br />
und zur emanzipativen<br />
Konzeption von Macht wie auch die Perspektive<br />
der aktuellen globalisierungskri-<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong> 47
tischen Mobilisierungen und Kampagnen.»<br />
(S. 4) Die Rezension muss da notwendigerweise<br />
fragmentarischer bleiben.<br />
Wer erinnert sich nicht an den in den Medien<br />
als «historisch» kommentierten Händeschlag<br />
zwischen Tony Blair und Gerhard<br />
Schröder – damals, als sich die internationale<br />
Linke gegenseitig noch zu ihren<br />
nationalen Wahlsiegen und den sogenannten<br />
«modernisierten» Sozialdemokratien<br />
gratulieren konnten. Zu den politischen<br />
Siegen gesellte sich eine kulturelle<br />
Aufbruchstimmung: Europa werde nicht<br />
nur rot regiert, sondern von einer kapitalistischen<br />
in die Wissensgesellschaft transformiert.<br />
Die Euphorie kühlte rasant ab:<br />
Wurden 1998 noch dreizehn von fünfzehn<br />
EU-Staaten von sozialdemokratischen<br />
Parteien oder linksalternativen Koalitionen<br />
regiert, waren es Ende 2002 nur noch<br />
deren sechs. Die Modernisierung wurde<br />
als Öffnung hin zur politischen Mitte entlarvt.<br />
Und eine «linke» Aussenpolitik fand<br />
kaum statt, sofern man mehr erhoffte als<br />
bloss ein Agieren im Rahmen einer engen<br />
Pragmatik.<br />
In diesem Kontext diskutiert der Widerspruch<br />
zwei Hauptthesen, nämlich das<br />
Scheitern der sozialdemokratischen Regierungen<br />
in den Staaten der EU und,<br />
zweitens, die Herausbildung einer äusserst<br />
vielfältigen, pluralen Bewegung gegen<br />
die Globalisierung.<br />
Der ersten Thesen geht u.a. Klaus Dräger<br />
nach, der das Scheitern des Mitte-Links-<br />
Projektes in der EU zum einen im linken<br />
Drang zur Mitte und zum andern in der<br />
Modernisierung von Rechts verortet. Für<br />
die <strong>SP</strong> mischt sich Franco Cavalli ein, der<br />
die erfrischende Frage aufwirft, ob die Sozialdemokratie<br />
noch zu retten sei. Schnell<br />
teilt er die GenossInnen in drei Gruppen<br />
ein, in das rechtssozialdemokratische<br />
Lager (S. Sommaruga, E. Ledergerber, K.<br />
Loepfe), den Ex-Bodenmann-Kreis (W.<br />
Marti, A. Hämmerle, H. Fässler, S. Leutenegger)<br />
und in den linken Flügel (P.Y.<br />
Maillard, C. Goll, P. Rechsteiner) – und<br />
suggeriert damit eine linke Orientierungskrise,<br />
die er mit einem prononcierten<br />
Linkskurs bewältigt haben will: Die<br />
Linke müsse endlich von einer Mittelschichtspolitik<br />
Abschied nehmen, die<br />
Fragen nach den Eigentumsverhältnissen<br />
neu beantworten und sich gegenüber den<br />
globalisierungskritischen Bewegungen<br />
öffnen. Natürlich darf bei der Auseinandersetzung<br />
zu dieser These die Diskussion<br />
um den Arbeitsbegriff (W. F.<br />
Haug), um Arbeitslosigkeit (M. Wendl)<br />
und um eine Demokratisierung der Wirtschaft<br />
(F. Vilmar und ebenso M. Krätke)<br />
nicht fehlen.<br />
Im zweiten Themenschwerpunkt – jenem<br />
der Bewegungen gegen die Globalisierung<br />
– geht J. Holloway der Frage nach, wie die<br />
Welt zu verändern sei, ohne dass man die<br />
Macht übernehmen müsse. Natürlich<br />
orientiert er sich an Marx, Adorno und<br />
Foucault, in klassisch modernen Tradition<br />
also, wo doch Feministinnen den Machtbegriff<br />
interessant weitergedacht und für<br />
einen Politikbegriff nutzbar gemacht haben,<br />
denkt frau da an Judith Butler<br />
und/oder Luisa Muraro!<br />
Die Auseinandersetzung um einen Machtbegriff<br />
in der Gender-Debatte greift in der<br />
Rubrik ‚Diskussion‘ Sove Toiland profund,<br />
einleuchtend und anregend auf. Die in der<br />
Diskussion aufgenommenen Analysen –<br />
darauf sei ausdrücklich hingewiesen – bereichern<br />
die dringend notwendige Debatte<br />
einer inhaltlichen Klärung zu Sozialismus<br />
bzw. Sozialdemokratie.<br />
Und wie immer runden reichhaltige Rezensionen,<br />
die sich nicht nur mit den im<br />
Schwerpunkt aufgeworfenen Themen –<br />
Globalisierung, New Labour, Staat und<br />
Macht – konzentrieren, sondern auf andere<br />
wichtige Themen wie den Israel-Palästina-Konflikt,<br />
soziale Gerechtigkeit<br />
und die Achtziger Jugendunruhen verweisen,<br />
das Heft ab.<br />
Lisa Schmuckli<br />
48<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
IMPRESSUM<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> <strong>Nr</strong>. 2, <strong>2003</strong>, 81. Jahrgang.<br />
Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Erscheint viermal jährlich.<br />
Herausgeberin: Sozialdemokratische Partei der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Verantwortliche RedaktorInnen:<br />
Peter A. Schmid (Tel./Fax 01 492 92 63, E-Mail: paschmid@datacomm.ch)<br />
Lisa Schmuckli (Tel. 041 241 01 52, Fax 041 241 01 51, E-Mail: l.schmuckli@bluewin.ch)<br />
Mitglieder der Redaktion:<br />
Beat Baumann, Ökonom, Bern.<br />
Birgit Christensen, Philosophin, Zürich.<br />
Madeleine Grimm Köppel, Architektin, Bern.<br />
Urs Hänsenberger, Sozialwissenschafter, Bern.<br />
Walter Joos, Philosoph und Germanist, Zürich.<br />
Katharina Kerr, Germanistin/Journalistin, Grossrätin, Aarau.<br />
Lisa Schmuckli, Philosophin, Luzern.<br />
Peter A. Schmid, Philosoph, Zürich.<br />
Irene Soltermann, Historikerin, Bern.<br />
Redaktionsadresse: <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>, Postfach, 3001 Bern.<br />
Abonnementsverwaltung: <strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>, Postfach, 3001 Bern.<br />
Satz und Druck: S&Z Print, 3902 Brig-Glis, E-Mail: suzprint@rhone.ch<br />
Jahresabonnement: Fr. 40.–<br />
Unterstützungsabonnement: Fr. 60.–<br />
Einzelnummer: Fr. 10.–<br />
ISSN: 14211-8763<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Revue</strong> 2/<strong>2003</strong>
AZB 3000 Bern<br />
PP/Journal<br />
CH – 3000 Bern<br />
Retouren und Mutationen:<br />
<strong>SP</strong> <strong>Schweiz</strong>, Postfach, 3001 Bern<br />
Themen der nächsten Nummer:<br />
■ Nationale Drogenpolitik –<br />
internationale Tendenzen<br />
■ Ist eine liberale Drogenpolitik<br />
per se links?<br />
■ Ökonomie der Drogen