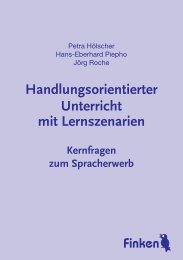Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
86<br />
die Saiten gestrichen, so dass eine große Bewegung, aus der Weite herangeführt, im Innenraum<br />
der Bewegung <strong>den</strong> Klang erstehen lässt.<br />
Oder auf einer anderen Stufe: Lehrer und Schüler stehen sich gegenüber, breiten die Arme aus,<br />
wobei die linke Hand die Leier hält, und im Aufeinander-Zugehen wer<strong>den</strong> die Hände <strong>zu</strong>sammengeführt,<br />
so dass die Finger der rechten Hand über die Saiten des Instrumentes streichen können.<br />
Diese Übung wird möglichst mit gestreckten Armen gemacht, die Instrumente streben <strong>zu</strong>einander,<br />
die Menschen halten noch Abstand. Oft kann ein Schüler diese Übung <strong>zu</strong>nächst nur geführt, ohne<br />
ein menschliches Gegenüber durchführen. Der Ton erklingt dann frei im Raum, er spricht keinen<br />
Menschen an, der Schüler fühlt sich nicht bedrängt.<br />
Die Leier setzen wir besonders gerne ein, weil sie auch extrem unruhige Kinder in eine innere Ruhe<br />
und <strong>zu</strong>m Lauschen bringt. „Die Klarheit ihres Tones gibt ihr die Möglichkeit, Klangempfindungen<br />
auch dort <strong>zu</strong> wecken, wo sie noch nicht vorhan<strong>den</strong> waren. Ich durfte es oft erleben, dass Kinder,<br />
die auf kein anderes Instrument reagieren wollten, durch <strong>den</strong> Klang der Leier <strong>zu</strong> einem ersten musikalischen<br />
Erlebnis gebracht wer<strong>den</strong> konnten“ (König 1969, 265).<br />
e) Die tiefste Wirkung zeigen eurythmische Übungen. Eurythmie ist eine von Rudolf Steiner geschaffene<br />
Bewegungskunst, die von ihm als „sichtbare Sprache“ (Lauteurythmie) und „sichtbarer<br />
Gesang“ (Toneurythmie) bezeichnet wird. Die Eurythmie gibt die Möglichkeit, das autistische Kind<br />
aus seiner Beengung heraus<strong>zu</strong>führen. Das Erleben des Vokalischen führt <strong>zu</strong> einer Erweiterung<br />
des Seelenraums, das Erleben des Konsonantischen <strong>zu</strong> einem Erfassen und Ergreifen der Umwelt,<br />
die Eurythmie als „sichtbar gewor<strong>den</strong>e Sprache“ erschließt dem Kind die Umwelt als Vertrauensraum<br />
(Schumacher 1985, 53).<br />
Zu 2.: Gestörte Wahrnehmungsprozesse<br />
Dem autistischen Kind fehlt, um wahrnehmen <strong>zu</strong> können, das Interesse an seiner Umwelt. Die richtige<br />
Methode wäre eine, die Individualität und Freiheit nicht <strong>zu</strong>gunsten der Vorstellung, die Eltern,<br />
Lehrer oder Betreuer von Respektabilität und gutem Eindruck haben, verraten würde. Der Schüler<br />
muss sich in einer Atmosphäre erleben, die <strong>den</strong> Wunsch in ihm erweckt, aus seiner Isolierung heraus<br />
auf<strong>zu</strong>wachen in die ihn umgebende Welt. Individuell verschie<strong>den</strong> müssen Situationen in der<br />
Umgebung des Kindes geschaffen wer<strong>den</strong>, die sein Interesse wecken und so aus einem inneren<br />
Interesse <strong>zu</strong>r Wahrnehmung dessen führen, was geschieht. So kann z.B. Freude am fließen<strong>den</strong><br />
Wasser über das Ineinanderlaufen von flüssigen Farben Farberlebnisse anregen. Es kann aber<br />
auch der Geruch von Gebackenem ein Kind aus seiner Ecke hervorlocken; es können Töne oder<br />
auch Sprache aus <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>sten Ecken des Raumes erklingen, die dann doch irgendwann<br />
das eine oder andere Kind erreichen. Uns war hierbei immer wichtig, dass das Hin<strong>zu</strong>kommen und<br />
später auch Mittun aus eigenem Impuls, also ohne Aufforderung geschah und dass die Mitarbeiter<br />
sich innerlich ganz stark dem Kind öffneten, es sich aufgenommen erleben konnte, aber auch auf<br />
Verständnis traf, wenn dieser Schritt noch nicht gelang. Dabei hängt das Gelingen wesentlich davon<br />
ab, ob das „Thema“ vom Kind bestimmt und in einer überspitzten oder übersteigerten Form<br />
dargeboten wird; z.B. in der Umgebung eines Jungen mit einem Schuhtick wer<strong>den</strong> Schuhe aus<br />
Ton plastiziert, bis der Junge davon so angezogen wird, dass er seine Scheu überwindet und<br />
selbst <strong>zu</strong>m Ton greift, um einen Schuh <strong>zu</strong> gestalten. Er ist damit nicht nur aus seiner Isolierung