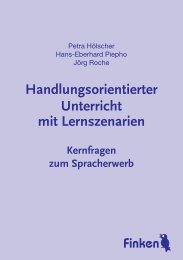Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Handreichungen zu den Empfehlungen zur - individuelle Förderung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
13<br />
2.5. Beobachten - Verstehen - Beurteilen<br />
Da normierte Texte und Aussagen über messbare Leistungen die Gesamtpersönlichkeit eines<br />
Schülers mit autistischem Verhalten nur unvollständig und verkürzt erfassen können, sind Beobachtungen<br />
und daraus resultierende Interpretationen und Beschreibungen bzw. Beurteilungen<br />
das wesentliche diagnostische Mittel, um Fördermaßnahmen planen und einleiten <strong>zu</strong> können. Aufgrund<br />
der vielfältigen, häufig nur schwer verstehbaren Verhaltenseigentümlichkeiten und Schwierigkeiten<br />
in der Lebensbewältigung bedarf es über eine Beschreibung von Häufigkeiten hinaus<br />
einer Erhebung und Dokumentation situativer und soziokultureller Bedingungen (Verhalten in der<br />
Schule, <strong>zu</strong> Hause, im Umgang mit <strong>den</strong> Eltern, <strong>den</strong> Geschwistern ...), unter <strong>den</strong>en ein Verhalten<br />
auftritt.<br />
Beobachten ist mehr als nur ein Feststellen momentan ablaufender Ereignisse und situativer Vorkommnisse,<br />
sondern der Beginn einer Beurteilung von Modalitäten im Erlebnis- und Daseinsbereich<br />
eines Menschen, der in seiner besonderen Individualität Hilfe benötigt. Beobachten richtet<br />
sich <strong>zu</strong>nächst auf die Ganzheit Mensch, löst dann Teilkomponenten seiner Persönlichkeit <strong>zu</strong>r Erforschung<br />
von besonderen und eigentümlichen Verhaltensweisen heraus, fügt sinnfällig gewonnene<br />
Ergebnisse in Kenntnis des Wirk<strong>zu</strong>sammenhangs eines Bedingungsgeflechtes ins Gesamtgeschehen<br />
wieder ein, um alle Besonderheiten nach objektiven Beschreibungen und wertender Beurteilung<br />
mit pädagogischen Mitteln angehen <strong>zu</strong> können.<br />
Die Beobachtung beginnt meist in ungebun<strong>den</strong>er freier Form, um erste Eindrücke <strong>zu</strong> vermitteln<br />
und aus der objektiven Erstbeschreibung heraus gezielter (gebun<strong>den</strong>er) vorgehen <strong>zu</strong> können. Oft<br />
gibt uns bereits die Anamnese die Zielrichtung vor. So führt eine Kette von Beobachtungen in objektiver<br />
Bedeutungseinschät<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> vertiefender Systematik.<br />
Beschreibungsergebnisse, welche <strong>zu</strong>r Beurteilung führen, sollten jedoch erst dann als gesichert<br />
und objektiv angesehen wer<strong>den</strong>, wenn sie durch gezielt durchgeführte Handlungsproben, wie sie<br />
standardisierten Entwicklungsgittern und Verhaltensprofilen entnommen wer<strong>den</strong> können, abgesichert<br />
und gefestigt wur<strong>den</strong>.<br />
Im Vordergrund steht bei allem der Versuch, das Verhalten des Kindes - und sei dies auch noch so<br />
eigentümlich und sonderbar - als eine individuell angemessene Antwort auf eine wahrgenommene<br />
Lebenssituation <strong>zu</strong> begreifen (vgl. Fischer 1995).<br />
Vorschnelle Interpretationen lassen falsche Diagnosen <strong>zu</strong> und leiten unzweckmäßige Fördermaßnahmen<br />
ein. Erstellte Diagnosen bedürfen der dauern<strong>den</strong> Überprüfung, da nach jeder Änderung<br />
der Vorbedingungen, des Verhaltens und der Lernausgangslage lebensbegleitende Fördermaßnahmen<br />
notwendig sind.<br />
In dem folgen<strong>den</strong> Beispiel wer<strong>den</strong> die Gefahren deutlich, die sich aus einer verkürzten, „monokausalen“<br />
Betrachtungs- und Beurteilungsperspektive ergeben. Häufig ist es schwierig, eindeutig <strong>zu</strong><br />
beurteilen, ob und inwieweit ein Schüler sprachliche Verständigungsmittel versteht, da in der Regel<br />
die Lehrperson bei einer sprachlichen Äußerung auch gleichzeitig gestisch-mimische Mitteilungen<br />
macht, Hinweise aus der Sprechmelodie <strong>zu</strong> entnehmen sind und im Zusammensein mit anderen<br />
Schülern durch deren Beobachtung auch Kontextinformationen genutzt wer<strong>den</strong> können.