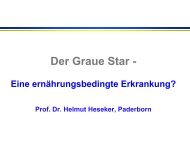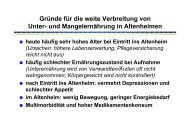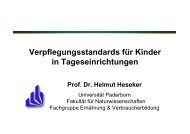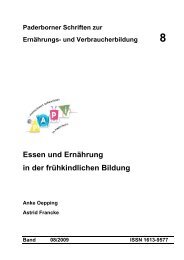Deutschland - ein Selenmangelland? - Universität Paderborn
Deutschland - ein Selenmangelland? - Universität Paderborn
Deutschland - ein Selenmangelland? - Universität Paderborn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Deutschland</strong> -<br />
<strong>ein</strong> <strong>Selenmangelland</strong>?<br />
Helmut Heseker<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong>
Das Spurenelement Selen<br />
Selen, engl. (IUPAC): selenium<br />
Entdecker: Berzelius (1817)<br />
Ordnungszahl: 34<br />
rel. Atommasse:<br />
78,96 g/mol<br />
Atomradius:<br />
116 pm<br />
Dichte: 4,82 g/cm 3<br />
Schmelzpunkt: 217 °C<br />
Elektronenkonfiguration: 3d 10 4s 2 4p 4<br />
Oxidationszahlen: 6, 4, 2<br />
Kristallstruktur:<br />
hexagonal<br />
Atomvolumen: 16,5<br />
Häufigkeit in der Erdkruste: 0,05 ppm<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Selenquellen in unserer Nahrung<br />
Fleisch 5-10 µg/100 g Linsen 10 µg/100 g<br />
Fisch 20-60 µg/100 g Bohnen 15 µg/100 g<br />
Hühnereier 10 µg/100 g Buchweizen 15 µg/100 g<br />
● Einbau in pflanzliche Lebensmittel ist abhängig vom<br />
Selengehalt im Boden. Deutsche Böden sind eher<br />
selenarm; USA und Kanada >> selenreiche Böden.<br />
● Nutztiere akkumulieren Selen > bessere Selenquellen<br />
außerdem >> Futtermittel sind mit Selen angereichert<br />
(bis 500 µg/kg Futter).<br />
● In Finnland, Neuseeland >> auch Selendüngung<br />
(aber wenig erfolgreich).<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Mittlere Selenzufuhr in <strong>Deutschland</strong>,<br />
Europa und USA<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
D B S F A USA<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Selenzufuhr in Abhängigkeit von der<br />
Energieaufnahme<br />
80<br />
µg Selen/Tag<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1000 1500 2000 2500<br />
kcal/Tag<br />
3000 3500<br />
5er Perz. 25er Perz. Median 75er Perz. 95er Perz.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Bioverfügbarkeit von Mineralstoffen<br />
und Spurenelementen<br />
● Menge/Dosis<br />
● Art der Verbindung (z.B. Selenocyst<strong>ein</strong>, Na- Selenit)<br />
● Bindungsform im Lebensmittel (z.B. Oxalate, Phytate)<br />
● Art des Lebensmittels (tierisch/pflanzlich)<br />
● Lebensmittelverarbeitung (z.B. Teigführung)<br />
● Effektivität der Digestion (z.B. HCl, Verdauungsenzyme)<br />
● Interaktion mit anderen Spurenelementen<br />
● Versorgungsstatus<br />
● Begleitsubstanzen (z.B. Vit. C, Aminosäuren)<br />
● Absorptions- und Transportmechanismus<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Absorptionsrate von Mineralstoffen<br />
und Spurenelementen<br />
Calcium 20 - 40 %<br />
Magnesium 20 - 30 %<br />
Zink 10 - 90 % (~20 %)<br />
Kupfer 35 - 70 %<br />
Eisen<br />
10 - 25 % (5-8 % pfl. LBM)<br />
Chrom 1 - 10 % (~ 2 %)<br />
Selen 50 - 95 %<br />
Jod 50 - 95 %<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Selen-Stoffwechsel<br />
● Absorption im oberen Dünndarm<br />
● außerordentlich hohe Absorptionsrate<br />
>> Selenomethionin sogar über 90 %<br />
● Absorption ohne homöostatische Kontrolle<br />
● Verteilung über Blut auf Organe und Gewebe<br />
● höchste Selenkonzentration in Leber und Niere<br />
● größter Speicher ist in der Muskulatur >> retiniertes<br />
Selenomethionin steht biologisch nicht zurVerfügung,<br />
nur Selenocyst<strong>ein</strong>; 25 % an GSHPx retiniert<br />
● k<strong>ein</strong>e Plazentaschranke<br />
● anorganisches Selen >> Elimination mit dem Urin<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Spurenelementgehalte des menschlichen<br />
Körpers<br />
Gehalt [g/70 kg]<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
4,2<br />
2,33<br />
0,11 0,03 0,02 0,005 0,003<br />
Fe Zn Cu I Se Cr Co<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Biochemische Funktionen der<br />
14 Selenocyst<strong>ein</strong>haltige Prot<strong>ein</strong>e<br />
● 4 Glutathionperoxidasen (GSHPx) >> bauen H 2 O 2 ,<br />
Hydroperoxide und Phospholipid-Hydroperoxide ab<br />
● 3 Dejodasen >> essentiell für die Aktivierung des<br />
Prohormons Thyroxin (T 4 ) zum biologisch aktiven T 3 und<br />
dessen Abbau<br />
● 3 Thioredoxinreduktasen >> Einbau von Selenocyst<strong>ein</strong>;<br />
Reduktion von Prot<strong>ein</strong>disulfidbrücken; Vit.C-Regeneration<br />
● 2 Selenocyst<strong>ein</strong>prot<strong>ein</strong>e (P u. W) >> antioxidative<br />
Eigenschaften<br />
● 2 Selenophosphat-Synthetasen >> Selenstoffwechsel<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Risikogruppen für <strong>ein</strong>e unzureichende<br />
Selenversorgung in <strong>Deutschland</strong><br />
● Patienten mit chronischer Dialyse >> niedrige Pl.-Selenkonzentrationen,<br />
geringe Glutathionperoxidaseaktivitäten<br />
● totale parenterale Ernährung Neugeborener<br />
● spezielle Diäten >> z.B. PKU-Diät<br />
● Absorptionsstörungen >> Mukoviszidose, Kurzdarmsyndrom<br />
etc.<br />
● Traumapatienten, schwere Verbrennungen ??<br />
● Personen mit <strong>ein</strong>seitiger Ernährung >> z.B. strikte<br />
Veganer; Personen mit energiereduzierter Kost<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Selenmangel beim Menschen<br />
Bei chronischer Selenzufuhr unter 20 µg/Tag:<br />
● schuppige Haut<br />
● Nagelveränderungen<br />
● Pseudoalbinismus<br />
● Makrozytose<br />
● Myopathien mit <strong>ein</strong>geschränktem Gehvermögen<br />
● selten auch Kardiomyopathien<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Symptomatik der Keshan-Krankheit<br />
(akute Verlaufsform <strong>ein</strong>es schweren Selenmangels)<br />
● endemischeErkrankung bei Kindern unter 15 Jahren<br />
und bei Schwangeren in China<br />
● geografisch bedingter Selenmangel<br />
● nur bei Selenzufuhr > vermehrte Hämolyse mit Methämoglobinbildung<br />
>> myofibrilläre Dystrophie von Skelett- und Herzmuskulatur<br />
>> kongestive Herzinsuffizienz und Myokardnekrosen<br />
(= Kardiomyopathien)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Symptomatik der Kashin-Beck-Krankheit<br />
(chronische Verlaufsform <strong>ein</strong>es schweren Selenmangels)<br />
Selenmangel wird als Ursache diskutiert, aber nicht<br />
abschließend bestätigt (Mykotoxine?, Jodmangel?,<br />
Coxsackie-Virus?)<br />
● Vorkommen im Transbaikal und Ostasien<br />
● beginnend im frühen Kindesalter<br />
● schmerzhafte symmetrische Gelenkschwellungen,<br />
gefolgt von Epiphysennekrosen und sekundärer<br />
Osteoarthritis<br />
● Gelenkdeformationen<br />
● Wachstumshemmung mit Zwergenwuchs (je nach<br />
Manifestationsalter)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Methoden zur Bestimmung<br />
des Selenstatus<br />
● Selenkonzentration im Serum oder in Erythrozyten ist<br />
<strong>ein</strong> Indikator für <strong>ein</strong>e niedrige Selenzufuhr; korreliert<br />
im Mangel mit GSHPx-Aktivitäten.<br />
● Ausscheidung im 24h-Urin liefert k<strong>ein</strong>en sicheren<br />
Hinweis auf <strong>ein</strong>en funktionell bedeutsamen Mangel.<br />
● Haaranalysen oft verfälscht durch Haarwaschen,<br />
-färben, Umwelt<strong>ein</strong>flüsse daher ungeeignet.<br />
● Möglicherweise sind die Aktivitäten der Glutathionperoxidasenim<br />
Plasma geeignete Parameter.<br />
es gibt z.Zt. k<strong>ein</strong>en absolut sicheren Marker zum<br />
Nachweis <strong>ein</strong>es marginalen Selendefizits<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
DACH-Referenzwerte für die tägliche<br />
Nährstoffzufuhr<br />
Empfehlungen: experimentell ermittelte Zufuhrwerte<br />
für normalen Stoffwechsel<br />
(Prot<strong>ein</strong>, ess. FS, Vit. A, D, C, B 1 , B 2 , B 6 ,<br />
B 12 , Niacin, Folat, Ca, P, Mg, Fe, J, Zn)<br />
Schätzwerte: wenn Bedarf nicht genau bestimmt<br />
werden konnte (Vitamine E, K, Biotin,<br />
Pantothenat, Se, Cu, Mn, Cr, Mo)<br />
Richtwerte: Orientierungshilfen bei nichtessentiellen<br />
Nährstoffen<br />
(H 2 0, kcal, Fett, Chol., Ball., Na, K, F)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Schätzwerte<br />
● falls k<strong>ein</strong>e wissenschaftlich abgesicherten<br />
Daten vorliegen, um Bedarf zu kalkulieren<br />
● <strong>ein</strong> Schätzwert basiert auf <strong>ein</strong>e beobachtete<br />
oder experimentell ermittelte Nährstoffaufnahme<br />
<strong>ein</strong>er definierten Bevölkerungsgruppe<br />
(z.B. Ableitung <strong>ein</strong>es Schätzwertes für Säuglinge aus den<br />
Nährstoffgehalten der Muttermilch)<br />
● Schätzwert ist <strong>ein</strong> Ersatz für <strong>ein</strong>e Empfehlung<br />
● Schätzwert > Bedarf<br />
Schätzwert > Empfehlung (möglicherweise)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Referenzwerte für die tägliche Selenzufuhr<br />
Risiko <strong>ein</strong>es Mangels<br />
1<br />
0,5<br />
durchschnittlicher<br />
Bedarf (?)<br />
empfohlene<br />
Zufuhr(?)<br />
Schätzwert<br />
sicherer Zufuhrbereich<br />
sichere<br />
Obergrenze<br />
-<br />
Risiko für Nebenwirkungen<br />
0<br />
30 - 70 µg 400 µg<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Vergleich der alten DGE- mit den neuen DACH-Schätzwerten<br />
für <strong>ein</strong>e angemessene tägliche Selenzufuhr<br />
Selenzufuhr [µg/Tag]<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
alt (min)<br />
neu (min)<br />
alt (max)<br />
neu (max)<br />
0<br />
0-3 M 4-12 M 1-3 J 4-6 J 7-9 J 10-14 J 15-18 J >18 J<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Bewertung der Selenzufuhr in<br />
<strong>Deutschland</strong><br />
HohenheimerSelen- Konsensuskonferenz (1995):<br />
● „Es kann angenommen werden, dass der tägliche<br />
Selenbedarf durch die übliche westeuropäische<br />
Kost gedeckt ist.“<br />
● „Hauptselenquelle ist tierisches Eiweiß.“<br />
● „In der Bundesrepublik <strong>Deutschland</strong> liegt k<strong>ein</strong>e<br />
endemisch vorkommende klinische Symptomatik<br />
vor, die <strong>ein</strong>em Defizit von Selen in der Nahrung<br />
zuzuordnen ist.“<br />
nach Biesalski et al: Akt Ernähr Med 22: 224-231 (1997)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Toxikologische Aspekte <strong>ein</strong>er hohen<br />
Selenzufuhr<br />
Letale Dosis: 3 - 6 mg Selen/kg KG als Selenit oder<br />
(LD50) Selenat bei Ratte, Maus, Hund, Katze<br />
Selenose: akut: 3,2-6,7 mg Se/Tag<br />
chronisch: 0,6-0,8 mg Se/Tag<br />
● zunächst: Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit<br />
● später: knoblauchartiger Atemgeruch (Dimethylselenid),<br />
Haarausfall, Hautläsionen, Deformation und Verlust der<br />
Fingernägel, Durchfall, Herzmuskelschwäche,<br />
Leberzirrhose, periphere Neuropathie mit Parästhesien<br />
USA: Eine Frau hat die Einnahme von 2,4 g Selen in<br />
Form von Natriumselenit-Tabletten überlebt.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Tolerierte Spurenelementgehalte in<br />
Nahrungsergänzungsmitteln (BgVV, 1997)<br />
Tagesdosen:<br />
Chrom 60 µg/Tag Mangan 2 mg<br />
Eisen 5 mg/Tag Molybdän 80 µg<br />
Jod 100 µg/Tag Selen 30 µg<br />
Kupfer 1 mg/Tag Zink 5 mg<br />
Spurenelementverbindungen:<br />
● in Anlage 2 zu § 7 DiätVO genannte Verbindungen<br />
● von SCF oder JECFA beurteilte Verbindungen<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Gründe für <strong>ein</strong>e Beschränkung<br />
der Selenzufuhr<br />
● Verwertung des Selens hängt von der zugeführten<br />
Selenverbindung ab<br />
● Selenomethionin (z.B. Selenhefen) wird im Körper besonders<br />
in inneren Organen unkontrolliert gespeichert<br />
>> Unbedenklichkeit ist nicht erwiesen<br />
>> wird in katabolen Zuständen in größeren Mengen<br />
freigesetzt<br />
● <strong>Deutschland</strong> ist Jodmangelgebiet. Durch Selen<br />
aktivierte Dejodasen könnten über <strong>ein</strong>e vermehrte<br />
Umsetzung von T4 in T3 und durch Hemmung der<br />
TSH-Freisetzung <strong>ein</strong>e Hypothyreose verursachen.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Beliebte Hypothesen der Hersteller<br />
Verbraucher wird verunsichert: to take or not to take ist die Frage<br />
●<br />
●<br />
Herstellerhypothesen<br />
- Lebensmittel sind verarmt an Nährstoffen<br />
- Stress und Umweltbedingungen erhöhen den Bedarf an Selen<br />
- Fast-Food-Verzehr führt zu <strong>ein</strong>er allgem<strong>ein</strong>en Unterversorgung<br />
- >> Vitamin- und Mineralstoffmängel sind weit verbreitet<br />
Worauf stützen sich diese Hypothesen?<br />
- Früher-heute-Vergleich von Angaben in Nährwerttabellen<br />
(z.B. Carotin, Folsäure)<br />
- Ausnutzen des schlechten Images der Landwirtschaft<br />
- bei Spurenelementen >>> Haaranalysen<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Hypothese: Intensivnutzung der Böden führt<br />
zum Nährstoffmangel<br />
Wissenschaftliche Überprüfung der Hypothese zeigt:<br />
● Selenanalyse von Weizen- und Roggenkornproben aus<br />
den Jahren 1946-1995 hat k<strong>ein</strong>en Zeittrend ergeben<br />
● Zn- und Cu-Gehalte der Böden sind heute höher<br />
● fehlende Kaliumdüngung führt zu erhöhten Natriumgehalten<br />
in Lebensmitteln (z.B. Karotten)<br />
● N-Düngung erhöht den Carotinoid- und Thiamingehalt<br />
● Mineralstoffmängel führen relativ schnell bei pflanzlichen<br />
Lebensmitteln zu sichtbaren Mangelersch<strong>ein</strong>ungen<br />
● Jod- und Fluoridmangel der Böden hat andere Ursachen<br />
und kann nicht verallgem<strong>ein</strong>ert werden<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Von der Hypothese zu <strong>ein</strong>er<br />
Ernährungsrichtlinie<br />
Ernährungsepidemiologie Hypothese<br />
Konsistente Ergebnisse Prüfung der Hypothese<br />
- Biochemie/Molekularbiologie<br />
- Dosis-/Wirkungsbeziehungen<br />
Konsensus über die - Interventionsstudien<br />
Bedeutung<br />
des Zusammenhangs<br />
Referenzwert<br />
(DACH, SCF, DRI)<br />
Ernährungsrichtlinien<br />
(Ernährungskreis, -pyramide)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Wirksamkeitsnachweis hoher<br />
Selenaufnahmen<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
Untersuchung am Menschen<br />
ausreichend große Probandenzahl<br />
Placebo-kontrollierter Doppelblindversuch<br />
zufällige Einteilung in Verum- oder Placebogruppe<br />
Aufrechterhaltung der Doppelblindbedingungen bis<br />
Versuchsende<br />
Berücksichtigung möglicher Stör<strong>ein</strong>flüsse<br />
korrekte statistische Auswertung<br />
angemessene Interpretation der Ergebnisse<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Wirksamkeit erhöhter Selenaufnahmen<br />
Vorbeugung von:<br />
● Herzinfarkt<br />
● Krebserkrankungen<br />
● Störungen des Immunsystems<br />
>>Bisher nicht ausreichend geklärt. Es fehlen<br />
überzeugende Placebo-kontrollierte klinische Studien.<br />
>>Bisherige Interventionsstudien zur Krebsprophylaxe<br />
durch Selen haben k<strong>ein</strong>e Schutzfunktion gezeigt.<br />
>> Ungeklärt ist auch, ob zusätzliches Selen das<br />
antioxidative Schutzsystem überhaupt stärken kann.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Abschließende Bewertung<br />
● Der Selengehalt von Getreide ist seit 50 Jahren<br />
unverändert.<br />
● <strong>Deutschland</strong> ist k<strong>ein</strong> Selenmangelgebiet.<br />
● Ein Selenmangel kommt weltweit sehr selten vor.<br />
● Selen wird sehr effektiv und ohne homöostatische<br />
Kontrolle absorbiert.<br />
● Vielversprechende Hypothesen, dass Selen das<br />
Herzinfarkt- und Krebsrisiko reduziert. Es ist aber zu<br />
früh, Selentabletten zu nehmen.<br />
● Eine über die DACH-Schätzwerte hinausgehende<br />
Zufuhr kann daher nicht empfohlen werden.<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)
Wissenschaftliche Literatur über Selen<br />
Biesalski HK et al.: Kenntnisstand Selen - Ergebnisse des Hohenheimer<br />
Konsensusmeetings. Akt Ernähr Med 22: 224-231 (1997<br />
DGE/ÖGE/SGE/SVE: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. S. 195-200<br />
1. Auflage. Umschau/Braus, Frankfurt (2000)<br />
FNB/IOM: Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and<br />
carotenoids. S. 284-324. Natioanl Academy Press, Washington (2000)<br />
Gassmann B: Selen. Ernährungs-Umschau 43: 464-467 (1996)<br />
WHO: Trace elements in human nutrition and health. S. 105-122. WHO-<br />
Office of Publications, Genf, 1996<br />
Burk RF, Levander OA: Selenium. S. 265-276. In: Shils, M.E., Olson, J.A.,<br />
Shike, M., Ross, A.C. (Hrsg .): Modern nutrition in health and disease.<br />
9. Auflage. Williams&Wilkins, Baltimore (1999)<br />
<strong>Universität</strong> <strong>Paderborn</strong> (2001)