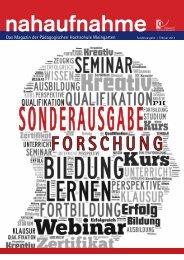5/2004 - Pädagogische Hochschule Weingarten
5/2004 - Pädagogische Hochschule Weingarten
5/2004 - Pädagogische Hochschule Weingarten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
e t h i k –<br />
r e p o r t<br />
IBE<br />
Nr. 5/ Juni <strong>2004</strong><br />
Editorial<br />
Informationen und Rezensionen<br />
zu ethischen Themen aus Tagespresse,<br />
Fachzeitschriften,<br />
Gremien und von Fachtagungen<br />
herausgegeben<br />
vom Institut für Bildung und Ethik<br />
der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong><br />
<strong>Weingarten</strong><br />
Leibnizstraße 3<br />
88250 <strong>Weingarten</strong><br />
Tel.: 0751/5018377<br />
e-mail: ibe@ph-weingarten.de<br />
• Schwerpunkte der Ausgabe<br />
• Interna IBE<br />
Presse- und Literaturspiegel<br />
• Forschungserfolg mit adulten<br />
Stammzellen in der Kritik<br />
• Legalisierung „anonymer Geburten“?<br />
Rezension<br />
• Film: Mein kleines Kind – ein<br />
persönlicher Dokumentarfilm<br />
von Katja Baumgarten<br />
• Buch: Andreas Heller, Thomas<br />
Krobath (Hrsg.): Organisationsethik.<br />
Organisationsentwicklung<br />
in Kirchen, Caritas<br />
und Diakonie, Freiburg<br />
i.B. 2003<br />
Tagung<br />
• Wie wir sterben. Öffentliche<br />
Tagung des Nationalen Ethikrates<br />
am 31. März <strong>2004</strong> in<br />
Augsburg
2<br />
Editorial<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
die Juniausgabe des ethik-reports beschäftigt sich mit fünf Schwerpunkten. Wir gehen<br />
in unserem Pressespiegel auf die Reaktionen zu den deutschen Forschungserfolgen<br />
in der adulten Stammzellforschung ein. Wir geben die Diskussion wider zur<br />
Frage, ob so genannte „anonyme Geburten“ legalisiert werden sollen, wie dies eine<br />
Gesetzesinitiative der unionsregierten Länder vorsieht. Unter der Rubrik „Rezensionen“<br />
erproben wir mit einer Filmbesprechung Neues: Julia Horlacher hat sich den<br />
Film „Mein kleines Kind“ von Katja Baumgarten angesehen. Er schildert in einfühlsamer<br />
Weise die Erfahrungen einer Mutter vor, während und nach der Geburt ihres<br />
Kindes, dessen Fehlbildungen ihr schon in der pränatalen Diagnose prognostiziert<br />
wurden. Hans-Martin Brüll bespricht den Sammelband „Organisationsethik“, herausgegeben<br />
von Andreas Heller und Thomas Krobath. Die Autoren thematisieren und<br />
reflektieren Organisationsprozesse in kirchlichen und karitativen Einrichtungen und<br />
werben für eine systemische Orientierung in der Personal- und Organisationsentwicklung<br />
mit Organisationen, die christliche Werte in Strukturen und Abläufe implementieren<br />
möchten. Den Schluss bildet ein Tagungsbericht von Eike Bohlken und<br />
Julia Horlacher. Sie haben eine öffentliche Tagung des Nationalen Ethikrates zum<br />
Thema „Wie wir sterben“ besucht und geben den auf der Tagung sichtbar gewordenen<br />
Wissensstand und die Diskussionen um eine möglichst humane Sterbebegleitung<br />
wider.<br />
Drei Interna aus dem IBE sind uns noch wichtig:<br />
Am 1.8.<strong>2004</strong> wird Frau Beate Luther-Kirner in das Forschungs- und Nachwuchskolleg<br />
(FuN-Kolleg): „Bioethik im Horizont ethischer Bildung - Grundfragen und Handlungsfelder“<br />
einsteigen. Sie ist Biologielehrerin in der Edith-Stein-Schule in Ravensburg<br />
und wird sich besonders den biologischen Schwerpunkten des Projektes widmen.<br />
Unsere letzte Studie „Sterbebegleitung im Heim“ wird eifrig von Fachleuten aus dem<br />
Krankenhaus, der Altenpflege und der Hospizbewegung nachgefragt. Falls Sie auch<br />
Interesse an der Lektüre haben, steht Ihnen die Studie auf unserer homepage zum<br />
Herunterladen zur Verfügung (http://www.ph-
3<br />
weingarten.de/homepage/hochschule/fakultaeten/institute/ibe/veroeffentlichungen.html)<br />
.<br />
Am 16. Juni <strong>2004</strong> hielt der Historiker Dr. Heiko Stoff, Stipendiat des Max-Planck-<br />
Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, auf Einladung des IBE einen Vortrag<br />
mit dem Titel: „Ewige Jugend! Spuren eines biotechnischen Projektes.“ Im Anschluss<br />
an eine historische Untersuchung der Methoden und Zielvorstellungen der „Verjüngungsmedizin“<br />
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging es zum einen um die Frage, was<br />
die Wissenschaft aus und mit dem menschlichen Körper zu machen im Stande ist;<br />
zum anderen um die ethischen Implikationen des Wunsches nach ,ewiger Jugend‘ in<br />
einer konsum- und technikorientierten Gesellschaft.<br />
Die Thesen von Dr. Stoff stießen auf eine rege Resonanz der Zuhörerinnen und Zuhörer<br />
im Schlossgebäude der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong> in <strong>Weingarten</strong>.<br />
Für die Redaktion:<br />
Hans-Martin Brüll und Elisabeth Schlemmer<br />
Literatur- und Pressespiegel<br />
Forschungserfolg mit adulten Stammzellen in der Kritik<br />
Forscher am Institut für Medizinische Molekularbiologie der Universität Lübeck haben<br />
in Kooperation mit dem Frauenhofer Institut für Biomedizinische Technik im saarländischen<br />
St.Ingbert laut eigenen Angaben einen Forschungserfolg in der adulten<br />
Stammzellenforschung erzielt. Erstmals konnten experimentell aus Bauchspeicheldrüsen<br />
von Menschen und Ratten adulte Stammzellen gewonnen werden, die pluripotent<br />
sind, d.h. sich in verschiedene Zelltypen des menschlichen Körpers verwandeln<br />
können. Aus diesen Zellen ließe sich – so die Hoffnung der Forscher - Ersatzgewebe<br />
züchten, das Krankheiten heilen oder als Organersatz eingesetzt werden<br />
könnte. Der Leiter der Forschungsgruppe, Charli Kruse, behauptet, die entdeckten<br />
Zellen seien so vielseitig brauchbar wie embryonale Stammzellen und es gebe Hinweise,<br />
dass sich Gewebe wie Nerven, Muskeln, Knorpel, Leber sowie Insulin produzierende<br />
Zellen entwickelt hätten. Ein weiterer Vorteil adulter Stammzellen sei ihre
4<br />
Wiederverwendbarkeit im Körper des Zellspenders. Damit würden die Chancen einer<br />
gelungenen Implantation von aus Stammzellen gewonnenen Geweben und Organen<br />
steigen. Zudem könne man mit der Verwendung adulter Stammzellen den e-<br />
thischen Konflikt um die Embryonennutzung umgehen.<br />
Das Lübecker Forschungsergebnis löste bei Politikern Jubel aus, bei Biowissenschaftlern<br />
offene Skepsis. Der saarländische Wirtschaftsminister Georgi (CDU)<br />
sprach von einer „Sternstunde der Wissenschaftsgeschichte“ (FAZ), Forschungspolitiker<br />
aller Parteien werteten die Lübecker Forschungsergebnisse als „Sensation“ und<br />
„großen Durchbruch“. Die Vizevorsitzende der CDU-Fraktion des Bundestages und<br />
engagierte Gegnerin einer Stammzellenforschung an Embryonen, Maria Böhmer<br />
(CDU), hält die ethisch unbedenkliche Forschung an Stammzellen von Erwachsenen<br />
in Deutschland für „weit vorangeschritten“. Deutschland stehe in der Stammzellforschung<br />
„keineswegs, wie vielfach behauptet, hinten an“ ( Südkurier). Die Rektoren<br />
der beiden Forschungsinstitute regten gar eine „Forschungsallianz“ mit den Max-<br />
Planck-Instituten für biophysikalische Chemie in Göttingen und für molekulare Biomedizin<br />
in Münster an. Diese sollen die Ergebnisse aus Lübeck und St. Ingbert überprüfen.<br />
Letzteres ist für führende Biowissenschaftler auch notwendig. Ihre Kritik bezieht sich<br />
zunächst auf die Art der Veröffentlichung. Die Forscher wählten für die Veröffentlichung<br />
ihrer Ergebnisse nicht die international angesehenen Zeitschriften „Nature“<br />
und „Science“, die die Publikation erst nach eingehender Überprüfung durch angesehene<br />
Fachkollegen hinsichtlich Stichhaltigkeit und Bedeutung genehmigen. Die<br />
Lübecker und St. Ingberter Forscher wählten stattdessen das Internet-Magazin „Applied<br />
Physics A“, das eigentlich auf Materialwissenschaften spezialisiert ist. Zu beweisen<br />
hätten die Forscher zweierlei: Einmal, dass ein „gezüchtetes Gebilde, das wie<br />
eine Nervenzelle aussieht, auch wirklich eine Nervenzelle ist. Dies lässt sich erst beweisen,<br />
wenn sie in ein Lebewesen implantiert ist und dort die gewünschte Funktion<br />
erfüllt. Zweitens wäre zu beweisen, dass eine Stammzelle wirklich alle Zelltypen ausbilden<br />
kann, indem man sie im Tierversuch in einem Embryo einführt und darlegt,<br />
dass aus ihr die verschiedensten funktionstüchtigen Organe entstanden sind“ (FAZ).<br />
Ohne diese Beweise besitzen die verkündeten Erfolge „null Evidenz“ laut Rudolf Jänisch<br />
vom Whitehead Institute in Boston, dass es sich bei den adulten Stammzellen<br />
wirklich um Alleskönner handle. Catherine Verfaillie von der Universität in Minnesota
5<br />
vermisst Angaben zur biologischen Aktivität der Zellen und zu ihrer Funktionalität im<br />
menschlichen Körper.<br />
Kruse und seine Kollegen sicherten den Kritikern die geforderten Testexperimente in<br />
den nächsten Monaten zu. Erst dann wird sich zeigen, ob wirklich von einem Durchbruch<br />
in der Stammzellforschung gesprochen werden kann.<br />
Quellen:<br />
Bernard Bernarding: Hoffnung für chronisch Kranke. In: Südkurier vom<br />
29.05.04<br />
Renate Murschall: Durchbruch bei den Stammzellen. Südkurier vom 29.05.04<br />
Christian Schwägerl: Ernüchterung nach dem Jubel. In: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung vom 01.06.04<br />
Rainer Klüting: Deutsche Stammzellenforscher melden Erfolg. In: Stuttgarter<br />
Zeitung vom 01.06.04<br />
Legalisierung „anonymer Geburten“?<br />
Derzeit bereiten die Justizminister der unionsregierten Länder eine Gesetzesinitiative<br />
zur Legalisierung so genannter „„anonymer Geburten““ vor. Die Mütter verlassen in<br />
diesen Fällen ihre neugeborenen Kinder. Hintergrund für diese Aktion ist die Tatsache<br />
von 40 bis 50 jährlich ausgesetzten Kindern. Zudem gibt es schon eine große<br />
Zahl von geheimen Geburten, die in oder außerhalb des Krankenhauses – letztere<br />
meist ohne qualifizierte Hilfe - stattfinden. Ein neues Gesetz soll nun verhindern,<br />
dass Frauen ohne medizinische Hilfe gebären und dabei sich und das Neugeborene<br />
gefährden. Eine qualifizierte Beratung der Mütter wird gesetzlich sichergestellt. Dabei<br />
soll die anonyme Geburt eine – allerdings straffrei bleibende – Ausnahme sein. Das
6<br />
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung bleibt insofern gewährleistet, als<br />
die Mutter dem Kind einen Brief hinterlassen kann, der dann dem Kind im Alter von<br />
16 Jahren ausgehändigt wird.<br />
Gegen dieses Gesetzesvorhaben und seine Intentionen werden nun von verschiedenen<br />
Seiten erhebliche Bedenken geltend gemacht. Georg Paul Hefty von der FAZ<br />
hat die wichtigsten Einwände zusammengetragen. Eine Legalisierung der anonymen<br />
Geburt würde in einen ähnlichen Zwiespalt von Rechtswidrigkeit und Straffreiheit führen<br />
wie im Fall des § 118, weil das Verschweigen des Namens und die namenlose<br />
Überlassung des Kindes an Dritte verfassungswidrig ist. In Artikel 6, Absatz 2 verfügt<br />
das Grundgesetz: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der<br />
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die<br />
staatliche Gemeinschaft.“ Der Staat darf sich – so die Gegner der Legalisierung -<br />
nicht zum Unterstützer einer rechtswidrigen Handlung machen. Die Befürworter der<br />
Legalisierung führen vier Bedarfsfälle für die Legalisierung anonymer Geburten an:<br />
Die berechtigte Angst der Frauen vor ihren Eltern oder Partnern, die Illegalität des<br />
Aufenthaltes in Deutschland, Obdachlosigkeit oder extreme kulturelle oder weltanschauliche<br />
Zwänge. Mit Ausnahme der Obdachlosigkeit seien dies, so die Kritiker der<br />
Legalisierung, allesamt Fälle, in denen der Staat sich entweder schützend vor die<br />
Frauen stellen müsse oder aus Eigeninteresse einen gesetzwidrigen Zustand wie<br />
den illegalen Aufenthalt beenden muss. Es könne niemand wollen, dass namenlose<br />
Mütter unbekannter Herkunft in Deutschland gebären, ihre Kinder hinterlassen und<br />
dann im Land untertauchen oder es in andere Richtung verlassen“. (FAZ)<br />
Einwände kommen auch aus dem Bund deutscher Hebammen, dem deutschen Ärztinnenbund,<br />
den Jugendämtern und vom früheren Ministerialdirigent Alfred Wolf. Sie<br />
fragen: „Wie lässt sich die „Notlage“ bestimmen, in der eine Frau sein muss, um ihr<br />
die Missachtung aller Gesetze zu gestatten? Wer garantiert, dass eine Frau aus eigenem<br />
Willen handelt und nicht von Eltern, Partner oder etwa einem Zuhälter zur<br />
Aufgabe ihres Kindes … gezwungen wird? Wer schützt die Rechte des Vaters, der<br />
…niemals die Chance bekäme, sich um sein Kind zu kümmern? Wer schützt aber<br />
auch die Solidargemeinschaft davor, dass ihr unbekannte Eltern, über deren finanzielle<br />
Leistungsfähigkeit die Behörden wegen der „anonymen Geburt“ nichts erfahren<br />
könnten, einfach ihre Kinder überlassen?“(FAZ)<br />
Den zentralen Einwand gegen die Legalisierung anonymer Geburten bilden jedoch<br />
die Rechte des Kindes. Über seine eigene Abstammung Bescheid zu wissen, gehört
7<br />
zur Würde des Menschen. Dieses Recht ist vom Bundesverfassungsgericht und in<br />
den Menschenrechtskonventionen verbürgt. „Die anonyme Mutter bringt ihr zurückgelassenes<br />
Kind um dieses Recht“, resümiert Hefty.<br />
Quellen:<br />
Schwäbische Zeitung vom 29.05.04: Gesetzentwurf aus Baden-Württemberg.<br />
Anonyme Geburt soll Säuglinge retten<br />
Georg Paul Hefty: Mutter ohne Namen, Kind ohne Rechte. In: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung vom 26.05.04<br />
Rezensionen<br />
Mein kleines Kind – ein persönlicher Dokumentarfilm von Katja Baumgarten<br />
„Der Öffentlichkeit zurückgeben, was gewöhnlich verschwiegen im Privaten vollzogen<br />
wird“ - mit dieser Absicht erzählt Katja Baumgarten in ihrem Film „Mein kleines Kind“<br />
von der Schwangerschaft, der Geburt und dem Sterben ihres Sohnes Tim.<br />
Nachgezeichnet wird dabei der Weg, den die Hebamme und Filmemacherin geht,<br />
nachdem sie in der Mitte der Schwangerschaft mit der Diagnose „komplexes Fehlbildungssyndrom“<br />
konfrontiert wird.<br />
Viele Fragen und Probleme, die mit der Pränatalen Diagnostik zusammenhängen,<br />
werden den Zuschauern in diesem sehr persönlich gehaltenen Film vor Augen geführt.<br />
Deutlich wird dabei vor allem die Entscheidungsnot, die entsteht, wenn bei einem<br />
ungeborenen Kind nicht alles „in Ordnung“ ist.<br />
Zunächst einmal scheint es nach der Diagnose für Katja Baumgarten nur zwei Möglichkeiten<br />
zu geben: Die Schwangerschaft abzubrechen oder aber das Kind auszutragen<br />
und dann seinem Sterben unter intensiven medizinischen Behandlungen ins<br />
Auge sehen zu müssen. „Vor beidem fürchte ich mich“, so erzählt Katja Baumgarten<br />
vor der Kamera.
8<br />
Sie fühlt sich überfordert und allein gelassen mit der Entscheidung über die Dauer<br />
des Lebens und die Art und Weise des Sterbens ihres ungeborenen Kindes. Nachdem<br />
sie die entsprechende Unterstützung gefunden hat, entschließt sich Katja<br />
Baumgarten schließlich, ihr Kind auszutragen und zu Hause zur Welt zu bringen.<br />
Dort lebt „Klein Tim“ dreieinhalb Stunden.<br />
Festgehalten werden diese Erfahrungen mit viel Sensibilität und persönlicher Nähe<br />
von der Kamerafrau Gisela Tuchhagen, einer Freundin Baumgartens. Dabei weist<br />
der Film gleichzeitig über das rein Persönliche hinaus. Der Film führt manches vor<br />
Augen, was in der Diskussion bislang vielleicht zu wenig beachtet wurde: Er macht<br />
aufmerksam auf den großen Graben, der die Welt der Medizin immer noch von der<br />
des einzelnen Menschen trennt, auf die Notwendigkeit eines unterstützenden Umfeldes<br />
sowie auf die Problematik der „Schuld“, mit der sich die Betroffenen auseinander<br />
zu setzen haben. Vor allem aber zeigt er nicht nur die Dringlichkeit sondern auch die<br />
Möglichkeit alternativer, je individueller Wege für das „Danach“ einer pränatalen<br />
Diagnostik auf.<br />
Weitere Informationen zum Film (auch zu aktuellen Vorführungsterminen und zum<br />
Verleih) sind im Internet unter der Adresse: www.MeinkleinesKind.de zu finden.<br />
Julia Horlacher<br />
Andreas Heller, Thomas Krobath (Hrsg.): Organsiationethik. Organisationsentwicklung<br />
in Kirchen, Caritas und Diakonie, Freiburg i.B. 2003<br />
Unter der Federführung des IFF (Instituts für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung<br />
der Universitäten Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Graz: Palliative Care und<br />
OrganisationsEthik, www.iff.ac.at) ist ein bemerkenswerter Sammelband im Lambertusverlag<br />
erschienen. Thematisiert wird auf verschiedenen Ebenen die Anwendung<br />
einer systemisch orientierten Organisationsentwicklung (OE) in Kirchen, Caritas und<br />
Diakonie. Im Zentrum des Buches stehen „Berichte und Reflexionen von Projekten<br />
und Modellen, die ermutigende Aussichten und unvermeidbare Schwierigkeiten aufzeigen“(9).<br />
Die Kirche und diesen angegliederte Wohlfahrtsorganisationen befinden<br />
sich in einer Identitätskrise. Der äußere und innere Druck zur Veränderung wächst.
9<br />
Die Erkenntnis „so zu bleiben wie man ist, erfordert oft mehr Energie als das Wagnis<br />
der Veränderung“ lässt nach dem Ziel und den Instrumenten der Veränderung fragen.<br />
Dabei kommt es nach Andreas Heller und Thomas Krobath nicht nur auf ein<br />
verbindliches, organisiertes und beauftragtes Bemühen um ein erkennbares christliches<br />
Profil der kirchlichen Organisationen an, sondern es geht auch um die Klärung,<br />
wie sich christliche Werte innerhalb kirchlicher Organisationen abbilden, konkretisieren<br />
und in die Praxis umsetzen lassen. Auf der Basis einer theologisch-ethisch reflektierten<br />
systemischen Sicht von Kirche und deren Besonderheiten in der Organisationsgestaltung<br />
werden in vier Kapiteln OE-Projekte im kirchlich-karitativen Kontext<br />
thematisiert.<br />
Im ersten Kapitel mit der Überschrift: „Kirchen als Organisationen gestalten“ wird das<br />
OE-Projekt „Offen evangelisch“ der Evangelischen Kirche Österreichs vorgestellt. Die<br />
Beteiligung von Ehrenamtlichen in kirchlichen Veränderungsprozessen wird untersucht,<br />
der Versuch einer systemischen Evaluation der Neustrukturierung eines Seelsorgebezirks<br />
reflektiert und der Prozess des Wissensmanagements in der Pastoral<br />
am Beispiel einer lebensraumorientierten Seelsorge wird thematisiert. Der Leser<br />
nimmt Teil an einem Leitbildprozess in einem Caritasunternehmen und an dem Versuch,<br />
mittels wertorientierter Zielvereinbarung und netzwerkgestütztem Qualitätsmanagement<br />
zu einer erfolgreichen Wahrnehmung von Marktchancen und zu einer<br />
deutlich verbesserten Ergebnisqualität für die „Kunden“ zu kommen.<br />
Dass Organisationsentwicklung eng mit Personalentwicklung verbunden ist, macht<br />
das zweite Kapitel des Buches deutlich. Der Schwerpunkt der Beiträge liegt hier auf<br />
der Professionalisierung kirchlichen Leitungshandelns. Der lesenswerte Grundlagenartikel<br />
von Andreas Heller zum Thema „Leiten in der Kirche“ wird illustriert von einer<br />
kompetenten Zusammenfassung von Leitungskurskonzepten und -curricula in der<br />
Pastoral und Diakonie. Als besonders originell und innovativ fällt dabei der Aufsatz<br />
von Klaus Roos auf. Er macht auf die Gefahr aufmerksam, dass immer mehr in Fortbildung<br />
investiert wird, auch wenn die Organisation „dumm“ bleibt. Er fordert daher<br />
Managementqualitäten, die den Erfordernissen einer lernenden Organisation angemessen<br />
sind (226).<br />
Wer schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass Leitbilder in ihrer Bedeutung verblassen<br />
und nach z.T. aufwändigen Leitbildprozessen vergessen werden, wird wirksame<br />
Gegenmittel im dritten Kapitel mit dem Leitmotto: „Christliche Identitäten in Strukturen<br />
umsetzen“ finden. Gezeigt wird, wie kirchliche Krankenhäuser „intelligenter“ werden
10<br />
können, wie eine erfolgreiche Leitbildentwicklung aussehen kann, wie mit Leitbildern<br />
Werte in Werke „eingestiftet“ werden können. Besonders eindrucksvoll wird die Verknüpfung<br />
von Leitbild und Struktur am Beispiel der Sterbebegleitung und der Entwicklung<br />
einer „OrganisationsKultur des Sterbens“ aufgezeigt. Interessante Einblicke<br />
in die Spezifika von Beratungs- und Entwicklungsprozessen von Orden sowie in die<br />
Implementierung von Wertemanagementprozessen in konfessionellen Krankenhäusern<br />
werden anregend dargeboten. Wie mit dem Verhältnis von Geld und Moral im<br />
Krankenhaus umgegangen werden kann, wird von Michael Fischer exemplarisch anhand<br />
der Arbeitsweise eines Ethikkomitees vorgestellt (404ff).<br />
Im Schlusskapitel werden Wegzeichen einer kirchlichen Beratungskulturentwicklung<br />
benannt: Kirche als wertgebundene und hierarchiebetonte Organisation macht es<br />
notwendig, in Widersprüchen beraten zu lernen. Wie so etwas umgesetzt werden<br />
kann, zeigt Sigrit Düringer auf. Kritisch reflektiert wird, wie es zurzeit zu einem Beratungsboom<br />
in der Gemeindeberatung kommt und welche Probleme damit offenbar,<br />
welche aber auch verdeckt werden können. Der Umgang mit erlebter, institutioneller<br />
Macht in Beratungsprozessen wird kompetent beschrieben und die Rolle von interner<br />
Organisationsentwicklung als möglichem Verhinderungsfaktor von Entwicklung wird<br />
von Ludwig Zeier kritisch reflektiert. In guter systemischer Manier macht Doris Gabriel<br />
in ihrem Schlussartikel deutlich, wie der „andere Blick“ von außen für kirchliche<br />
Organisationen irritierend und zugleich hilfreich sein kann.<br />
Insgesamt stellt der Sammelband eine innovative Fundgrube kirchlicher Entwicklungsarbeit<br />
für Leitungskräfte und interne und externe Organisations- und Personalentwickler<br />
dar. Die theologische Herkunft der meisten Autoren macht auch deutlich,<br />
wo die Grenzen und Möglichkeiten einer sich normativ verstehenden systemischen<br />
Arbeit mit Organisationen liegen. Der Band lässt sich gut auch „quer“ lesen. Der Verlag<br />
hat jedem Artikel eine Kurzfassung vorangestellt, die die Übersicht erleichtert.<br />
Hans-Martin Brüll<br />
Wie wir sterben.<br />
Öffentliche Tagung des Nationalen Ethikrates, 31. März <strong>2004</strong>, IHK Augsburg<br />
und Schwaben, Augsburg
11<br />
Mit der Tagung „Wie wir sterben“ ging es dem Nationalen Ethikrat um die Themen<br />
der Sterbehilfe und Sterbebegleitung, die in der Bioethikdebatte kaum einen geringeren<br />
Stellenwert besitzen als die Fragen um die Verwendung embryonaler Stammzellen.<br />
Dabei wurde mit Augsburg erstmals ein Veranstaltungsort außerhalb der Hauptstadt<br />
für eine öffentliche Tagung des Ethikrates gewählt, um die Diskussion auch in<br />
die Bundesländer zu verlegen. Unter bewusster Hintanstellung rechtlicher Aspekte<br />
wollte man sich einerseits über die faktische Situation klar werden und andererseits<br />
die ethische Reflexion voranbringen.<br />
In den Begrüßungsansprachen wurden vor allem zwei Aspekte hervorgehoben: dass<br />
es sich beim Sterben und dem Tod um stark mit Ängsten besetzte Tabuthemen handele<br />
und dass den heutigen Möglichkeiten der Medizin eine Ambivalenz zwischen<br />
Hilfe und Gefährdung innewohne.<br />
Hoffnungen und Ängste<br />
Es war vor allem die Kommunikation mit den Sterbenden, die Pastor i. R. Udo<br />
Schaudraff in seinem Einführungsreferat in den Mittelpunkt stellte. Dabei wies der<br />
langjährige Direktor des Zentrums für Gesundheitsethik in Hannover und ehemalige<br />
Klinikseelsorger zunächst auf die ganz unterschiedlichen Ängste und Unsicherheiten<br />
hin, die das Sterben begleiten: Angehörige müssten sich nicht nur mit der Angst vor<br />
dem Verlust eines vertrauten Menschen auseinander setzen, sie stünden gleichzeitig<br />
zusammen mit den Ärzten der Unsicherheit gegenüber, wann der Zeitpunkt gekommen<br />
sei, jemanden endgültig gehen zu lassen.<br />
Die Sterbenden selbst fänden nur schwer eine Sprache für die erfahrene Ambivalenz<br />
von Todesangst und Todessehnsucht. Diese Kombination von Unsicherheiten und<br />
Ängsten führe dazu, dass die Kommunikation und damit auch der Umgang mit den<br />
Sterbenden so oft misslinge. „Wir hören nicht auf die Botschaft der Sterbenden.“,<br />
meinte Schlaudraff, und so bleibe die Kultur des Sterbens sowohl auf der Ebene der<br />
individuellen Beziehungen als auch auf gesellschaftlicher Ebene eine „Unkultur.“<br />
Ungeklärt seien des Weiteren die Ziele der Medizin im Umgang mit Sterbenden sowie<br />
der Aufbau einer verlässlichen Versorgungsstruktur. Es bestehe außerdem Anlass<br />
zur Sorge, dass eine Gesellschaft, die den Tod nicht zulassen kann, diesen eines<br />
Tages zuteilen muss. Trotz aller Probleme gäbe es aber auch gute Erfahrungen<br />
im Umgang mit dem Sterben, vor allem in der Hospizarbeit und der Palliativversor-
12<br />
gung. Mit ihnen verbinde sich die Hoffnung auf eine neue Qualität der Sterbebegleitung.<br />
Sterben als Teil eines gelingenden Lebens?<br />
Im Anschluss an die Thematisierung der Ängste, die für die meisten Menschen mit<br />
dem Tod verbunden sind, fragte der Philosoph Prof. Christoph Horn (Bonn), ob der<br />
Tod nur als Übel oder nicht auch als Gut gesehen werden könne. Mit der Frage nach<br />
dem ,guten Tod‘ könne „Das Sterben als Teil eines gelingenden Lebens“ – so der<br />
Titel von Horns Vortrag – in den Blick kommen. Auf der einen Seite habe der Tod<br />
zunächst einmal die ,positive‘ Funktion, dem Leben als äußere Grenzlinie eine besondere<br />
Bedeutung zu verleihen; es ist auch der Tod, der unser Leben, die Zeit, die<br />
uns zur Verfügung steht, wertvoll macht. Auf der anderen Seite stelle das gelingende<br />
Sterben selbst einen wichtigen Bestandteil eines gelingenden Lebens dar, nämlich<br />
im Idealfall den Schlussstein eines „erfüllten, erfolgreichen und erfahrungsgesättigten<br />
Lebens“. In der Frage, wie ein gelingendes Sterben aussehe, gäbe es jedoch heute<br />
sehr unterschiedliche Vorstellungen. Als drei typische Auffassungen nannte Horn<br />
den „Wunsch nach einem sanften Sterben (leicht, schnell, unbewusst und schmerzfrei)“,<br />
den „Wunsch nach einem autonomen oder authentischen Sterben“ und den<br />
„Wunsch nach einem unverkürzten, nicht-beeinflussten Sterben“. Er sprach zwar allen<br />
drei Auffassungen eine relative Berechtigung zu, betonte in seinem Versuch einer<br />
Synthese aber insbesondere das der dritten Auffassung entsprechende Prinzip der<br />
„Interventionsfreiheit“, das allenfalls schmerzlindernde Maßnahmen der Palliativmedizin<br />
zulasse.<br />
Das Verhältnis Sterbender zu ihrer eigenen Endlichkeit<br />
Einen Einblick in die Ergebnisse seiner Arbeit am Institut für Gerontologie an der<br />
Universität Heidelberg gab Prof. Andreas Kruse. Unter anderem berichtete er von<br />
einer Studie, in der der Frage „Wie erleben tumorkranke Patienten ihre eigene Endlichkeit?“<br />
nachgegangen wurde. Deutlich wurde dabei, dass es eine sehr große<br />
Bandbreite an Deutungsformen und Verarbeitungsformen bei den Patienten gibt, die<br />
manche Lehren von festen Phasen des Sterbens in ein eher kritisches Licht tauchen.
13<br />
Fünf Gruppen der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit wurden vorgestellt:<br />
Das Akzeptieren der Krankheit, die Resignation und Niedergeschlagenheit, die<br />
Suche nach einem neuen Sinn, das Verdrängen der Verletzlichkeit sowie die Entwicklung<br />
von der Depression zur Hinnahme der Krankheit. Aufgezeigt wurden außerdem<br />
zentrale Einflussfaktoren für die Krankheitsverarbeitung bei sterbenden Patienten.<br />
Als erster und wichtigster Faktor wurde dabei der Grad der Schmerzkontrolle<br />
angeführt. Kruse machte deutlich: „Gelingendes Leben im Prozess des Sterbens ist<br />
ohne eine adäquate Schmerztherapie nicht möglich.“<br />
Ein weiterer zentraler Faktor sei die Selbstständigkeit im Alltag. Auch die Art und<br />
Stärke der Krankheitssymptome spiele eine bedeutende Rolle bei der Krankheitsverarbeitung.<br />
Nicht nur der Primärerkrankung, auch den begleitenden Erkrankungen sei<br />
daher verstärkt von der Medizin Aufmerksamkeit zu schenken. Einfluss auf den Umgang<br />
mit der eigenen Endlichkeit habe auch der Grad der sozialen Teilhabe. Wichtig<br />
sei in diesem Zusammenhang vor allem eine wahrhaftige Kommunikation.<br />
All diese Faktoren sollten auch bei der Therapie und Pflege der Kranken und Sterbenden<br />
besondere Aufmerksamkeit bekommen.<br />
Perspektiven in der Begleitung Sterbender<br />
Der zweite Teil der Tagung wurde durch fünf Referentinnen und Referenten eröffnet,<br />
die dem Publikum ihre eigenen Erfahrungen sowie Anregungen zur Begleitung von<br />
Sterbenden in Form von kurzen Statements vorstellten. So brachten sie die Perspektive<br />
der Angehörigen, der Hausärzte, der Palliativmedizin, der Pflegekräfte und der<br />
seelsorgerlichen Begleitung in die Diskussion um das Sterben ein.<br />
Den Anfang machte Chris Paul, die als Trauerbegleiterin die Perspektive der Angehörigen<br />
vertrat. Anders als die ausgebildeten Kräfte stünden Angehörige vor der<br />
Aufgabe, den Sterbeprozess eines Nahestehenden „learning by doing“ zu bewältigen.<br />
Außerdem müssten sie einen Weg finden, mit dem Verlust weiterzuleben. Insbesondere<br />
sei es wichtig, den Angehörigen in der Sterbebegleitung ein Recht auf<br />
ihre ganz eigenen Bedürfnisse, Ängste und Widersprüche zuzugestehen. Dazu brauche<br />
es veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen wie z.B. eine der Elternzeit analoge<br />
Auszeit zur Begleitung nahe stehender Sterbender.
14<br />
Der Mediziner Dr. Jakob Berger führte die Vorstellung der unterschiedlichen Perspektiven<br />
mit einem Einblick in seine Tätigkeit als Hausarzt fort. Ein wichtiger<br />
Schwerpunkt der Sterbebegleitung durch die Hausärzte sei die Schmerzbehandlung<br />
der Sterbenden. Auch die psychische Betreuung wurde als ein bedeutender Bestandteil<br />
der ärztlichen Begleitung vorgestellt. Zeit, Geduld, Einfühlungsvermögen,<br />
aber auch der Mut zur Wahrheit könnten den Arzt dabei zu einem wichtigen Begleiter<br />
werden lassen. Hinzu komme die Betreuung der Angehörigen in der Zeit vor und<br />
nach dem Sterben eines Familienmitgliedes als hausärztliche Aufgabe sowie die Organisation<br />
der Pflegeleistungen. Berger machte deutlich: Die allermeisten Hausärzte<br />
seien bereit, diese Anforderungen auf sich zu nehmen. Allerdings bestehe in mehrerer<br />
Hinsicht dringender Handlungsbedarf. Eine verbesserte Honorierung der Hausbesuche<br />
würde auch die Bedeutung, die dieser Arbeit zugemessen wird, sichtbar machen.<br />
Die Qualifizierung einer genügenden Anzahl von Hausärzten sei außerdem<br />
Grundvoraussetzung dafür, dass sie auch weiterhin Sterbebegleiter sein könnten.<br />
Die fachliche Qualifikation in der Palliativmedizin müsse darüber hinaus dringend<br />
verbessert werden, wenn man ein Sterben in Würde weiterhin ermöglichen wolle.<br />
Die Perspektive der Palliativmedizin stellte Prof. Lukas Radbruch von der Klinik für<br />
Palliativmedizin in Aachen vor. Anhand zweier Fallbeispiele wurde nachvollziehbar,<br />
dass das Sterben von der Palliativmedizin als dynamischer Prozess betrachtet wird,<br />
dem eine dynamische medizinische Behandlung entspricht. Wichtig sei dabei vor<br />
allem die Arbeit in einem Team, das die unterschiedliche und sich verändernde Bedürftigkeit<br />
der Patienten aus einem größeren Blickwinkel heraus wahrnehmen und<br />
beachten könne. Radbruch berichtete von einem großen Wachstum in der Palliativmedizin<br />
in den letzten Jahren, das durch die Reformen im Gesundheitswesen inzwischen<br />
aber bereits wieder gefährdet sei. Auch er schloss sein Statement mit Anregungen<br />
zur Verbesserung der Sterbebegleitung: Er forderte einen Ausbau des ambulanten<br />
und des stationären Sektors der Palliativmedizin, eine verbesserte Ausbildung<br />
der Mediziner in diesem Bereich sowie eine verstärkte gesellschaftliche Auseinandersetzung<br />
mit der Frage: Was ist uns das Sterben wert?<br />
Beate Augustyn, Palliativfachkraft am Universitätsklinikum München-Großhadern,<br />
vertrat die Perspektive der klinischen und ambulanten Pflege. Augustyn machte<br />
sich vor allem für einen ganzheitlichen Ansatz in der Palliativpflege stark. Neben dem
15<br />
physischen und psychischen Bereich gehöre auch der spirituelle Bereich zu einer<br />
solchen ganzheitlichen Pflege dazu. Dieser beinhalte die Auseinandersetzung mit<br />
den Themen Sterben, Tod und Trauer von Seiten der Pflegenden. Ermöglicht werden<br />
sollten durch einen solchen Ansatz unkonventionelle neue Wege, um Geborgenheit,<br />
Sicherheit und Unabhängigkeit im Sterbeprozess gewährleisten zu können. Immer<br />
noch sei jedoch im Beruf der Pflegenden keine Kultur des Umgangs mit dem Sterben<br />
vorhanden. Eine solche könne nur dann entstehen, wenn man miteinander ins Gespräch<br />
komme und vor allem damit anfange, einander zuzuhören.<br />
Zuhören und nicht bereits fertige Konzepte an die Sterbenden herantragen, dieses<br />
Grundanliegen vertrat auch Karl Freihalter, Klinikpfarrer in Augsburg. Mit seinen Einblicken<br />
in die seelsorgerische Sterbebegleitung beschloss er die Vorstellung der<br />
unterschiedlichen Perspektiven. „Wir wissen vom Sterben noch ganz wenig“, meinte<br />
Freihalter, und als Sterbebegleiter bleibe man „letztlich immer Anfänger“.<br />
Drei Schlussfolgerungen waren es, die er aus diesen grundsätzlichen Annahmen<br />
heraus für die seelsorgerische Begleitung Sterbender vorstellte: Fachleute des Sterbens<br />
seien erstens die Sterbenden selbst: „Nur der Sterbende hat eine für ihn gültige<br />
Antwort.“ Aufgabe des Seelsorgers sei es, diese auch zu hören. Dabei brauche es<br />
zweitens in der Sterbebegleitung eine Spiritualität, die von Ehrfurcht lebe und geprägt<br />
sei von der Offenheit für die geistlichen und religiösen Bedürfnisse der Menschen.<br />
Seelsorgerische Sterbebegleitung basiere drittens auf der Würdigung und der<br />
Kostbarkeit des Lebens auch im Sterben. Werde der Weg des Sterbens gemeinsam<br />
gegangen, könne schließlich eine Annahme des Sterbens möglich werden – ein Prozess,<br />
der für Freihalter „heilig“ ist.<br />
Die Vergesellschaftung des Sterbens<br />
Im Anschluss an die Berichte aus der Praxis des konkreten Umgangs mit Sterbenden<br />
und mit dem Tod folgten am Nachmittag theoretische Reflexionen aus soziologischer<br />
und philosophischer Sicht. Der Soziologie Prof. Armin Nassehi (München) stellte sich<br />
die Frage, wie die Gesellschaft mit dem Tod umgehe bzw. wie sie in den Sterbeprozess<br />
eingreife. Dabei gehe es nicht nur um die konkrete empirische Praxis, sondern<br />
auch um die gesellschaftliche Kommentierung, Beurteilung und Deutung des Ster-
16<br />
bens sowie um die aus verschiedenen Deutungen entwickelten Positionen und Ansprüche.<br />
Nassehi beschränkte sich dabei – dem vorherrschenden Selbstverständnis seiner<br />
Profession gemäß – auf eine Reihe von Beobachtungen. Auffällig sei zunächst, dass<br />
der Sterbeprozess zunehmend vom Tod abgekoppelt werde. Man spreche vom Sterben,<br />
das als „eine eigene Realität“ betrachtet werde, aber kaum noch vom Tod. Gegen<br />
die verbreitete Vorstellung von der Privatheit bzw. Individualität des Sterbens<br />
wies Nassehi drauf hin, dass das Sterben heutzutage sehr viel stärker in die Gesellschaft<br />
eingebunden sei als in früheren Epochen. Gestorben werde kaum noch in der<br />
Sphäre des Privaten, sondern in den sozialen „Organisationsroutinen“ von Heimen<br />
oder Krankenhäusern. Dabei entstehe eine „spannende Paradoxie“, wenn in einer<br />
Gegenbewegung versucht werde, persönliche Nähe und Bindungen in die Routinen<br />
dieser Organisationen hineinzubringen, da sowohl die Einrichtung als auch das<br />
Funktionieren von Institutionen strukturell gerade auf der professionalisierenden Versachlichung<br />
von Beziehungen beruhe. Moderne Gesellschaften basierten wesentlich<br />
darauf, dass es Bereiche gebe, in denen man nicht jedem Menschen offen und authentisch<br />
begegnen müsse.<br />
Das Verhältnis von Arzt und Patient am Ende des Lebens aus ethischer Sicht<br />
Der Göttinger Philosoph Prof. Dietmar von der Pfordten untersuchte „Ethische Aspekte<br />
der Arzt-Patienten-Beziehung am Ende des Lebens“. Im Unterschied zu der<br />
symmetrischen ethischen Beziehung von Mensch zu Mensch bzw. von moralischem<br />
Subjekt zu moralischem Subjekt sei die Beziehung zwischen Arzt und Patient durch<br />
eine starke Asymmetrie gekennzeichnet. Während der Arzt aufgrund seiner beruflichen<br />
Rolle zunehmend die Situation und das zu Tuende bestimme, reduziere sich<br />
die Situation des Patienten weitgehend auf ein passives Betroffensein. Ein<br />
,Vorsprung‘ des Patienten bestehe lediglich im Hinblick auf den unmittelbaren Zugang<br />
zu seiner Krankheit. Dieser Asymmetrie entspreche allerdings auch, dass allein<br />
der Patient die körperlichen Folgen von Krankheit und Behandlung zu spüren bekomme.<br />
Für den Arzt ergebe sich aus der besagten Asymmetrie eine besondere Fürsorgepflicht<br />
gegenüber dem Patienten. Maßgeblich könne hier nur ein partnerschaftliches,<br />
nicht ein paternalistisches Verhältnis (wie zwischen Vater [(lat.: pater)] und Kind)
17<br />
sein. Die Aufgabe des Arztes bestehe darin, „die sachlich nicht zu vermeidende A-<br />
symmetrie einzugrenzen und sie symbolisch und kommunikativ auszugleichen“. Als<br />
konkrete Punkte nannte von der Pfordten eine weitestmögliche Einschränkung der<br />
Zweckrationalität und des Technizismus einer reinen Apparatemedizin sowie Raum<br />
für eine persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patient – sofern eine solche vom<br />
Patienten gewollt werde.<br />
Zum Ende seines Vortrages zog von der Pfordten folgende Schlussfolgerungen für<br />
das Problem der Sterbehilfe: Wer die Selbstbestimmung als Grundprinzip der Ethik<br />
verstehe, müsse dieser auch gegenüber dem Prinzip der Leidvermeidung den Vorrang<br />
geben. Ein „ernsthaftes und aufgeklärtes Verlangen des Patienten nach Behandlungsabbruch“<br />
dürfe daher von Ärzten nicht einfach übergangen werden. Gemäß<br />
dem Vorrang der Selbstbestimmung seien passive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid<br />
und indirekte Sterbehilfe (Schmerzlinderung unter Inkaufnahme einer Verkürzung<br />
des Lebens) strafrechtlich und mit Abstrichen auch ethisch zulässig. Problematisch<br />
bleibe aber die Forderung nach einer aktiven Sterbehilfe, weil hier Selbstbestimmung<br />
des Patienten und Selbstbestimmung bzw. Selbstverständnis des Arztes miteinander<br />
in Konflikt geraten könnten. Von der Pfordten riet hier einerseits zu besonderer Vorsicht,<br />
da der Gewinn an Selbstbestimmung, der durch liberalere Regelungen im Bereich<br />
der Sterbehilfe erreicht werden könne, seiner Meinung nach geringer ausfalle<br />
als der potenzielle Druck auf alte Menschen und insbesondere auf chronisch Kranke,<br />
der Gesellschaft nicht länger zur Last zu fallen. Auf der anderen Seite empfahl er ein<br />
Abwarten, zu welchen Ergebnissen die neue Sterbehilferegelung in den Niederlanden<br />
in den nächsten Jahren führen werde. Sie könne als eine Art kollektiver Selbstversuch<br />
betrachtet werden, der eine genaue und lange Beobachtung erfordere.<br />
Fazit<br />
Wie schon die letzte Jahrestagung des Nationalen Ethikrates („Der Umgang mit vorgeburtlichem<br />
Leben in anderen Kulturen“) hatte auch „Wie wir sterben“ über weite<br />
Strecken den Charakter einer hochkarätig besetzten Informationsveranstaltung. Positiv<br />
waren vor allem die ausgeprägte Praxisnähe der Tagung und die große Vielfalt<br />
der berücksichtigten Perspektiven, die einen Einblick in ganz unterschiedliche Aspekte<br />
des Sterbens ermöglichten. Vor diesem Hintergrund erschien es jedoch merkwürdig,<br />
dass nicht ein einziger Befürworter einer Liberalisierung der (aktiven) Sterbehilfe
18<br />
eingeladen worden war. Schon Christoph Horn hatte auf das Fehlen der eigentlichen<br />
ethischen Debatte um eine Liberalisierung der Sterbehilfe bzw. um ein Recht auf<br />
Sterben hingewiesen, was auch in einzelnen Diskussionsbeiträgen aus dem Publikum<br />
beklagt wurde. So blieb es einerseits bei dem Versuch, Alternativen zur aktiven<br />
Sterbehilfe aufzuzeigen, andererseits bei der Hervorhebung von Risiken, die mit einer<br />
Liberalisierung derselben verbunden seien.<br />
Eike Bohlken, Julia Horlacher