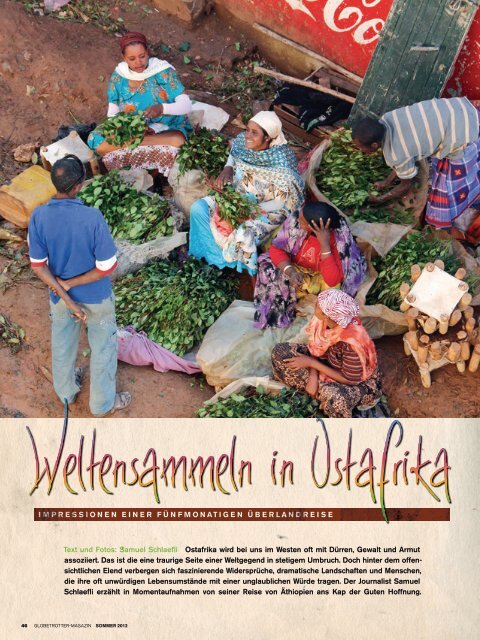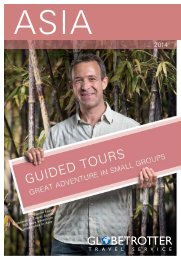Artikel lesen (PDF) - Globetrotter
Artikel lesen (PDF) - Globetrotter
Artikel lesen (PDF) - Globetrotter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Impressionen einer fünfmonatigen Überlandreise<br />
Text und Fotos: Samuel Schlaefli Ostafrika wird bei uns im Westen oft mit Dürren, Gewalt und Armut<br />
assoziiert. Das ist die eine traurige Seite einer Weltgegend in stetigem Umbruch. Doch hinter dem offensichtlichen<br />
Elend verbergen sich faszinierende Widersprüche, dramatische Landschaften und Menschen,<br />
die ihre oft unwürdigen Lebensumstände mit einer unglaublichen Würde tragen. Der Journalist Samuel<br />
Schlaefli erzählt in Momentaufnahmen von seiner Reise von Äthiopien ans Kap der Guten Hoffnung.<br />
46 GLOBETROTTER-MAGAZIN sommer 2012
afrika<br />
Stadt des Khat und der<br />
domestizierten Hyänen<br />
Harar, Äthiopien,<br />
September 2011<br />
Wären im 16. Jahrhundert nicht die Portugiesen<br />
den orthodoxen Christen zu Hilfe geeilt,<br />
wäre Äthiopien heute wahrscheinlich muslimisch.<br />
Der gefürchtete Kriegstreiber Ahmed<br />
Gragn hatte kurz davor seinen Dschihad in<br />
Harar begonnen, im äussersten Osten des Landes,<br />
rund 100 Kilometer von der Grenze zum<br />
heutigen Somaliland entfernt. Bis heute ist<br />
Harar das muslimische Zentrum Äthiopiens.<br />
Im Roman «Dark Star Safari» zeichnet der amerikanische<br />
Reiseautor Paul Theroux ein mystisches<br />
Bild der Stadt. Basierend auf seinen Erzählungen<br />
hatte ich mir eine Art riesige Sandburg<br />
vorgestellt, aus der ockerfarbenen Erde<br />
erschaffen und aus dem Niemandsland einer<br />
Allabendliche Hyänenfütterung vor den Toren Harars.<br />
verlassenen Wüste herausragend. Nicht unähnlich<br />
den Kasbahs, die mich vor Jahren in Marokko<br />
in Staunen versetzt hatten. Doch während<br />
meiner Einfahrt in Harar zerbröselt mein<br />
literarisch verklärtes Bild sogleich. Zwar gibt<br />
es nach wie vor einen historischen Kern, doch<br />
wirkt er, eingeklemmt zwischen lauter Wellblechsiedlungen<br />
und Betongeschwüren neueren<br />
Datums, etwas verloren. Nur die gefrässigen<br />
Geier, die schon Theroux beschrieben hatte,<br />
kreisen auf der Suche nach einem Fetzen<br />
Fleisch auch heute noch über den Stadtmauern.<br />
In Addis Abeba im Westen, wo ich herkomme,<br />
war die Natur grün und das Klima<br />
feucht. In Harar ist es heiss und trocken. Die<br />
Umgebung ist karg. Ein Klima wie geschaffen<br />
für Schirmakazien, Kamele und Khat. Letzteres<br />
ist ein Busch mit dunkelgrünen Blättern,<br />
nicht unähnlich dem Lorbeer. Wer die Blätter<br />
längere Zeit kaut, wird leicht euphorisiert. Die<br />
Annäherung ans Zentrum des äthiopischen<br />
Khat-Anbaus hatte sich bereits im Bus durch<br />
einen lichten Teppich aus grünen Zweigen auf<br />
dem Boden angekündigt, dem Abfall, den die<br />
Kauenden zurückgelassen hatten.<br />
Nach der zehnstündigen Fahrt trinke ich<br />
vor dem Kim Café einen Macchiato, einen Espresso<br />
mit Milchschaum, der in Äthiopien etwa<br />
dieselbe soziale und tagesstrukturierende<br />
Funktion hat wie der Minzentee in Marokko.<br />
Ein junger Typ mit glänzenden Augen steckt<br />
mir einige Zweige Khat entgegen. Es schmeckt,<br />
wie es aussieht: Als würde man in einen Busch<br />
beissen. Kath ist bitter und trocknet den Mund<br />
Auf dem Markt von Harar.<br />
aus. Mittlerweile gehört das Grünzeug<br />
zu den Hauptexportgütern Äthiopiens,<br />
und auf dem lebendigen Markt im Zentrum<br />
Harars werden neben allerlei Tomaten,<br />
Kohl, Zuckerrohr, Kartoffeln<br />
und chinesischem Ramsch in erster Linie<br />
grüne Büschel aus dem lokalen Anbau<br />
verkauft. Das grosse Kauen beginnt<br />
bereits frühmorgens. Die Herren fläzen<br />
Daniel Felekes Wunsch: Dokumentarfilm drehen.<br />
sich vor den kleinen Teeshops oder vor ihren<br />
Geschäften und kauen sich in eine angenehme<br />
Redseligkeit. Am frühen Nachmittag beschleicht<br />
mich das Gefühl, als sei die halbe<br />
Stadt mit nichts anderem mehr beschäftigt.<br />
Abends sind die Gehsteige von gezupften Zweigen<br />
übersät, an denen sich herumstreunende<br />
Ziegen erfreuen.<br />
In Harar lasse ich mich zu etwas<br />
hinreissen, das ich sonst nie mache: Ich<br />
nehme mir zur Erkundung des historischen<br />
Stadtkerns einen Guide. Es hat<br />
sich einfach so ergeben: Daniel Feleke,<br />
ein Mitzwanziger, teilt mir am Nachmittag<br />
meiner Ankunft mit, er wolle<br />
mit mir ein wenig Geld verdienen. Er<br />
ist mir sofort sympathisch – unter anderem<br />
weil er mich mit seiner John-<br />
Lennon-Brille und klugen Art an einen<br />
guten Freund in der Schweiz erinnert.<br />
Daniel ist in Harar aufgewachsen und<br />
lebt hier zusammen mit seiner Mum,<br />
den beiden Schwestern und Brüdern.<br />
Wo sein Vater ist, weiss er nicht und will<br />
es auch gar nicht wissen. Daniel<br />
schreibt Novellen und möchte irgendwann<br />
einen Dokumentarfilm über<br />
seine Heimatstadt drehen.<br />
47
Harar: Nur in der Imagination eine aus der Wüste ragende Sandburg – in der Realität trotzdem faszinierend.<br />
Nachmittags wird Khat gekaut.<br />
Wir streifen einen Vormittag lang gemeinsam<br />
durch die engen Gassen des alten Zentrums,<br />
in welchem meist mehrere befreundete<br />
Familien in arabischer Manier um einen zentralen<br />
Innenhof wohnen. Ihre Häuser sind den<br />
Blicken von Fremden durch hohe Mauern entzogen.<br />
Immer zum Ramadan würden die bröckelnden,<br />
aus Eukalyptus und Lehm errichteten<br />
Mauern und Gebäude wieder renoviert, erzählt<br />
Daniel. In den Gemäuern finden sich oft<br />
auch kleine Moscheen. Die Stadt fasziniert<br />
mich, trotz anfänglicher Enttäuschung, mit ihrem<br />
Eigensinn. Dazu gehört auch der Brauch,<br />
die Hyänen, die Nacht für Nacht vor den Stadttoren<br />
herumlungern, mit Schlachtabfällen zu<br />
füttern. So werden sie davon abgehalten, auf<br />
Essenssuche durch die Stadt zu streunen.<br />
Theroux hatte in seinem Roman gefürchtete<br />
Biester beschrieben, deren Besänftigung sich<br />
nur die waghalsigsten Männer der Stadt widmen.<br />
Doch zu meiner Enttäuschung sind die<br />
«Biester» mittlerweile dermassen zahm und domestiziert,<br />
dass von ihrer Gefährlichkeit, die<br />
an den enormen Kieferknochen durchaus zu<br />
erahnen ist, nicht mehr viel rüberkommt. Da<br />
nützt es auch nichts, dass sich die Hyänenfütterer<br />
die Fleischstücke von den Tieren – zur<br />
Schau für den «Ferenji» (den Weissen) – aus<br />
dem Mund reissen lassen.<br />
500 Kilometer<br />
Schlaglöcher und Dürre<br />
Überlandfahrt von Äthiopien nach Kenia,<br />
Mitte Oktober 2011<br />
In Moyale, meinem Eintrittstor von Äthiopien<br />
nach Kenia, fragt mich ein älterer Amerikaner,<br />
der soeben im Dorf angekommen ist und ziemlich<br />
fertig wirkt, nach meinem Ziel. Seine gestrige<br />
Route steht bei mir morgen auf dem Programm,<br />
worauf er meint: «Oh man, you ain't<br />
seen nothing yet!» Die 500 Kilometer lange Piste<br />
von Moyale nach Isiolo, der ersten grösseren<br />
Siedlung im Norden Kenias, gilt als das<br />
schlimmste Stück Strasse Ostafrikas. Die Strecke<br />
wird heute nur noch von Land Cruisern<br />
und sechsrädrigen Mitsubishi-Trucks befahren.<br />
Wer sich das Stück Niemandsland antun will,<br />
muss selbstständig einen Transport organisieren.<br />
Man rät mir zudem, etwas Proviant einzukaufen.<br />
Entlang der Strecke gäbe es zwar durchaus<br />
einige Verpflegungsmöglichkeiten, doch die<br />
Wahrscheinlichkeit, irgendwo steckenzubleiben,<br />
sei relativ hoch. Lange feilsche ich zusammen<br />
mit anderen Passagieren mit einem Lastwagenfahrer<br />
und dessen Mittelsmann um den Mitfahrpreis<br />
für den Transport nach Kenia. Nach<br />
zwei Stunden Warten kriege ich für 2500 Schilling,<br />
rund 25 Dollar, einen Platz in der Fahrerkabine<br />
zugewiesen, die ich mit dem Chauffeur,<br />
Halbzeit der langen Fahrt. Bald wird kein Grün mehr sichtbar sein.<br />
einem zusätzlichen Fahrgast und einer jungen<br />
Familie teile. Acht weitere Mitfahrer sitzen entweder<br />
auf dem Kabinendach oder liegen auf<br />
Bohnensäcken, die wir geladen haben. Das<br />
Brummen des Motors wird während der kommenden<br />
26 Stunden zu unserem kleinen gemeinsamen<br />
Mikrokosmos. Eigentlich wäre ich<br />
auch lieber auf dem Dach, denn der Chauffeur<br />
ist ein mürrischer Misanthrop, der mich nur<br />
mit «hey, white man» anspricht und die jungen<br />
Eltern anherrscht, sobald der Kleine mal pinkeln<br />
muss. Er kaut Büschel um Büschel Khat,<br />
um sich wach zu halten, steckt sich von Zeit zu<br />
Zeit einen Wurm Kautabak unter die Lippe und<br />
spuckt im Halbminutentakt aus dem Fenster.<br />
Kurz nach Moyale beginnen die berüchtigten<br />
Schlaglöcher, gross wie Basketbälle. Wo die Piste<br />
einst befestigt war, liegen heute nur noch vereinzelte<br />
Teerfetzen. Im Schritttempo dringen<br />
wir in eine über weite Strecken unbewohnte<br />
Steppe ein, die je länger, je karger wird und<br />
nahtlos in eine Steinwüste übergeht. Zu Beginn<br />
verfolgen uns noch einige Baboons, später kommen<br />
wir an kleinen Karawanen mit mageren<br />
Kamelen vorbei. Danach sehe ich lange Zeit<br />
keine Tiere mehr – nur noch Kadaver von Antilopen,<br />
die auf der Sandpiste kleben, und überall<br />
Fetzen von zerrissenen Pneus.<br />
Die Trucks auf dieser Strecke sind ein konstantes<br />
«work in progress». Wir führen auf der<br />
Ladefläche zwei blutjunge Mechaniker mit, die<br />
sich auch als Statisten in einem Piratenfilm gut<br />
gemacht hätten. Mit Buschmessern schneiden<br />
sie von Zeit zu Zeit einen Lappen vom Pneu<br />
ab, den die spitzen Steine auf der Strasse aus<br />
dem Gummi geschält haben. Dreimal müssen<br />
sie auf der Strecke ein Rad wechseln, wobei mir<br />
beim Betrachten der Reserveräder jeweils nicht<br />
ganz klar ist, ob der Wechsel tatsächlich eine<br />
Besserung ist. In unregelmässigen Abständen<br />
steht ein gestrandeter Lastwagen im Niemandsland.<br />
Einmal stehen Männer im Kreis<br />
um eine Kurbelwelle, die sie aus dem Gefährt<br />
operiert haben und zu flicken versuchen.<br />
Am Horizont stundenlang ein klarer Strich,<br />
der die vom Wind leergefegte Wüste vom<br />
blauen Himmel trennt. Eine dramatische und<br />
eindrückliche Landschaft für den Reisenden –<br />
ein purer Albtraum für die Nomaden, die nach<br />
wie vor durch diese Wüste ziehen, um ein Stück<br />
48
afrika<br />
Die mitfahrenden Mechaniker bei einem von drei Reifenwechseln.<br />
Bauern lauschen den Worten von Helfern zum Thema Dürre.<br />
Grasfläche für ihre Vieh- oder Kamelherden<br />
zu finden. Die Menschen hier leiden genauso<br />
wie ihre Nachbarn in Somalia und Äthiopien<br />
an der seit August herrschenden katastrophalen<br />
Dürre.<br />
In der Vergangenheit ist es auf der Strecke<br />
zwischen Moyale und Isiolo immer wieder zu<br />
Überfällen durch Banditen gekommen. Seit die<br />
Strecke vom kenianischen Militär rudimentär<br />
gesichert wird, ist die Situation besser. Wir passieren<br />
sechs Checkpoints, und auf meine Frage<br />
hin, wie es um die Sicherheit in der Gegend<br />
steht, erzählt mir einer der Soldaten, dass es in<br />
der Nähe von Isiolo am Vortag zu Schiessereien<br />
gekommen sei. Doch kein Grund zur Sorge,<br />
meint er, wir würden auf diesem Abschnitt von<br />
der Polizei eskortiert. Das werden wir zwar<br />
nicht, doch glücklicherweise bekommen wir<br />
von den Ausschreitungen aber nichts mit. Im<br />
Gegenteil: Die Einfahrt in Isiolo frühmorgens<br />
gehört nach einer schlaflosen, durchrüttelten<br />
Nacht zu den Höhepunkten meiner Reise. Im<br />
Morgenrot erkenne ich in den niederen Büschen<br />
plötzlich eine Giraffenherde. Und vor<br />
mir taucht aus der schnurgeraden Ebene der<br />
Mount Kenia auf – ein Koloss von einem Berg.<br />
Es ist ein Bild wie aus dem Safarikatalog, ein<br />
Stück heile Urwelt.<br />
Auf der Weiterfahrt nach Nanyuki werden<br />
die Strassen allmählich besser, die Umgebung<br />
wird grüner und das Klima wieder lebensbejahend.<br />
Am Abend in Nanyuki lese ich in der<br />
«Daily Nation» von einem getöteten Polizisten<br />
und abgebrannten Hütten um Isiolo: Kämpfe<br />
um Viehherden zwischen unterschiedlichen<br />
Stämmen, wie mir später Bekannte in Kenia<br />
erklären. Grauen und Schönheit liegen in Ostafrika<br />
oft sehr nahe beieinander.<br />
Die ruhige Schwester<br />
Sansibars<br />
Insel Pemba,<br />
Ende November 2011<br />
Sansibar ist, abgesehen von der historischen<br />
Hauptstadt Stone Town, über weite Strecken<br />
der Horror jedes Abenteurers. Die paradiesischen<br />
Strandgemeinden sind so austauschbar<br />
wie die trockenen Samosas, die man auf der<br />
Insel an jeder Strassenecke kriegt. Man könnte<br />
auch in Ko Samui oder Goa sein. Die Gegenwelt<br />
dazu findet sich auf der kleinen Schwesterinsel<br />
Pemba, drei Stunden Fähre von Sansibar<br />
entfernt. Das eigensinnige Fischervolk würde<br />
sich gegen zu viel Entwicklung und touristische<br />
Infrastruktur wehren, hatte mir ein Tourenorganisator<br />
erzählt. Tatsächlich muss man sich<br />
die Schätze dieser Insel, die unglaublich fruchtbare<br />
und unberührte Natur sowie die Hilfsbereitschaft<br />
der Menschen erst erkämpfen. Auf<br />
Pemba ist es brütend heiss und tropisch feucht.<br />
Schwitzen ist hier nicht mehr an eine Tätigkeit<br />
gekoppelt, sondern ein Dauerzustand. Auf den<br />
Ladeflächen von kleinen Lastern, den einzigen<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln, sitzen die Menschen<br />
mehr aufeinander als nebeneinander<br />
und es riecht nach Schweiss, Fisch und Nelken.<br />
Der einzige Basketballkorb hängt in einer improvisierten Mehrzweckhalle.<br />
Letztere liegen vor den Lehmhäusern auf Plachen<br />
ausgebreitet zum Trocknen – die frisch<br />
gepflückten Stäbchen grün, die halbtrockenen<br />
rot und die trockenen schwarz. Die wassergesättigte<br />
Luft der gesamten Insel ist durchtränkt<br />
von ihrem süssen, frischen Parfüm.<br />
Ich und Sarah, die mich von Uganda bis<br />
nach Tansania begleitet, sind die einzigen Touristen<br />
in Wete, einem Städtchen im Nordwesten<br />
der Insel. Vielleicht weil hier Flut und Ebbe<br />
besonders stark und die Strände steinig und<br />
voller Seegras sind. Unser Plan war es, später<br />
von hier aus direkt nach Tanga auf dem Festland<br />
Tansanias überzusetzen, wenige Stunden<br />
von Dar es Salaam entfernt. Dass es keine offizielle<br />
Fährverbindung gibt, wussten wir. Doch<br />
wir vertrauten darauf, eine Mitfahrgelegenheit<br />
in einer kleinen «Dhow», einem traditionellen<br />
Holzsegelschiff, oder einem Frachter zu finden.<br />
Dafür gehen wir hinunter zum kleinen Hafen,<br />
dort, wo in den Baumwipfeln tagsüber die «Flying<br />
foxes» schlafen, eine Art übergrosse Fledermaus<br />
mit einem fuchsähnlichen Kopf, die<br />
auf Ostafrikas Inseln heimisch sind. Kaum<br />
Abendstimmung im Hafen von Wete auf der Insel Pemba.<br />
sommer 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 49
Omar, Immigration Officer am Hafen.<br />
dunkelt es ein, kann man ihr Geflatter und Gekreische<br />
von weit her hören. Wir freunden uns<br />
im Hafen von Wete mit Omar an, dem Immigration<br />
Officer, und hoffen, dass er uns ein Boot<br />
für die Rückreise vermitteln kann. Das sei problematisch,<br />
erklärt er mit viel Pathos. Wenige<br />
Wochen zuvor sei ein überladener Frachter mit<br />
3000 Passagieren gesunken. Danach<br />
habe die Regierung das<br />
Mitnehmen von «Muzungus»<br />
(Weissen) verboten. Er gibt uns<br />
jedoch zu verstehen, dass es in<br />
seiner Kompetenz liegt, zu bestimmen,<br />
wer hier auf ein Boot<br />
steigt und wer nicht: Irgendwann<br />
in den nächsten Tagen<br />
laufe ein Zementfrachter in Wete<br />
ein, er würde es uns rechtzeitig<br />
wissen lassen.<br />
Bis es so weit ist, handeln wir<br />
in einer Werkstatt die Miete für<br />
zwei alte Velos aus und machen<br />
uns auf, die Umgebung Wetes<br />
zweirädrig zu entdecken. Pemba<br />
ist ein Wunder der Fruchtbarkeit:<br />
uralte, stolze Mangobäume,<br />
Fast alles, was das Herz begehrt: der alte Markt in Wete.<br />
deren reife Früchte von Kindern von den<br />
Ästen geschüttelt werden, Hügel voller Bananenstauden,<br />
Kokospalmen, Zitronenbäume<br />
und Äcker, bepflanzt mit Papayabäumen.<br />
Auf den Märkten werden Zwiebeln,<br />
Tomaten, Orangen, Avocados und<br />
Zuckerrohr feilgeboten. Hinzu kommen<br />
grillierte Muschelspiesse und getrocknete<br />
Tintenfische. Diese werden, in einer Suppe<br />
eingeweicht, gerne auch zum Frühstück<br />
verspeist. Wir radeln über einen kleinen<br />
Weg durch das «Ngezi Vumawimbi Forest<br />
Reserve», ein Stück geschützter Regenwald.<br />
Colobus-Äffchen mit ihren weiss<br />
umrahmten Trauergesichtern und Vögel<br />
in grellen Farben begleiten uns. Von mächtigen<br />
Bäumen tropft kondensiertes Wasser, und der<br />
Farn am Wegrand ist so hoch, dass er ein hübsches<br />
Spalier bildet. Verdrehte Lianen zwischen<br />
den Bäumen sind kleine Kunstwerke und die<br />
pechschwarzen Tausendfüssler so gross wie bei<br />
Im überfüllten Kleinlaster riecht es nach Schweiss, Fisch und Nelken.<br />
Getrocknete Tintenfische – Spezialität der Insel.<br />
uns zu Hause Blindschleichen. Von einem Jackfruit-Baum<br />
schneide ich mir eine leuchtend<br />
grüne Frucht mit dem Umfang eines Rugbyballs<br />
ab. Doch leider bin ich mit der Ernte<br />
der stacheligen Monster ungeübt<br />
und erwische eine unreife Frucht,<br />
deren gelbes Fleisch unglaublich<br />
bitter ist.<br />
Am zweiten Abend auf<br />
Pemba kommt Omar, der Immigration<br />
Officer, in unser Gasthaus<br />
zu Besuch. Eine Stunde<br />
lang sprechen wir über Gott und<br />
die Welt, ohne meine ursprüngliche<br />
Anfrage für eine Schiffsverbindung<br />
zu erwähnen. Das Leben<br />
auf dem vermeintlichen Inselparadies<br />
scheint Omar zu<br />
langweilen. Er geniesst den kleinen<br />
Ausblick in die Welt, den er<br />
sich über die beiden Reisenden<br />
einholen kann. Kurz vor der Verabschiedung<br />
komme ich nochmals<br />
auf unsere ursprüngliche<br />
Anfrage zurück. «Ah, die Fahrt nach Tanga,<br />
genau», er werde rasch per SMS nachfragen.<br />
Kurz darauf: «Kein Zementfrachter morgen»,<br />
und ein «Dhow» sei für uns schlicht zu gefährlich.<br />
Das bedeutet: Am kommenden Morgen<br />
um 5.30 Uhr auf der Matte stehen, mit Kleinlastern<br />
über die Insel nach Mkoani brausen, sodass<br />
wir um 9 Uhr die Fähre nach Sansibar erwischen,<br />
von wo uns ein weiteres Boot nach<br />
Dar es Salaam zurückbringen wird. Omar versteht<br />
unsere Hast nicht, vielleicht liefe ja übermorgen<br />
oder überübermorgen ein Transporter<br />
in Wete ein. Es scheint, als möchte er uns noch<br />
ein bisschen hier behalten. Dann könnten wir<br />
nämlich nächtelang über europäische Geschichte<br />
diskutieren, Omars Lieblingsfach früher<br />
in der Schule. Seit damals träumt er von<br />
einem Geschichtsstudium – ein Wunsch, dem<br />
hier draussen im Indischen Ozean etwas Dramatisches<br />
anhaftet. Um ein zusätzliches Argument<br />
für unser Bleiben nicht verlegen, sagt<br />
Omar: «Wenn ihr morgen Abend noch hier<br />
seid, wird euch meine Grossmutter einen Tintenfisch<br />
kochen, wie ihr ihn noch nie zuvor<br />
gegessen habt.»<br />
50 GLOBETROTTER-MAGAZIN sommer 2012
afrika<br />
Mit der «Ilala»<br />
durch Malawi<br />
Lake Malawi,<br />
Anfang Dezember 2011<br />
Der Lake Malawi gleicht eher einem Meer. Von<br />
der Grenze Tansanias im Norden zieht er sich<br />
560 Kilometer hinunter in den Süden Malawis.<br />
Ich habe Glück, als ich im kleinen Hafendorf<br />
Nakatha Bay auf halber Strecke des Sees ankomme:<br />
Die «Ilala», das einzige Passagierschiff<br />
auf dem Lake Malawi, nimmt nach mehrwöchigen<br />
Reparaturen just zwei Tage später wieder<br />
ihren Betrieb auf. Den Frachter hatten die<br />
Schotten in den 50er-Jahren gebaut. Ein Relikt<br />
aus der Kolonialzeit, das ein wenig ausschaut<br />
wie die Schiffe in den Tintin-Comics: dunkles,<br />
Fisch, flatternde Hühner, greise Männer mit<br />
Stöcken, friedlich schlafende Babys und Kübel<br />
voller Tomaten werden in die kleinen<br />
Boote gehievt. Wie wild springen einige der<br />
38 Besatzungsmitglieder zwischen dem<br />
Frachter und den Nussschalen hin und her.<br />
Diejenigen Reisenden, die sich eine eigene<br />
Kabine oder eine dünne Matratze auf<br />
dem Oberdeck leisten können, treffen sich<br />
tagsüber an der Bar. Um acht Uhr morgens<br />
fliegen die ersten Carlsberg-Kronkorken,<br />
und auch der Captain ist ab Mittag ein gern<br />
gesehener Gast. Das ist nur deshalb nicht<br />
beunruhigend, weil wir während den drei<br />
Tagen kein einziges Schiff kreuzen, das auch<br />
nur annähernd so gross ist wie die «Ilala».<br />
Am zweiten Abend geht das Trinkwasser<br />
aus. An der Bar gibts nur noch «Stout». Am<br />
OSTAFRIKA<br />
Reiseroute des Autors<br />
Handlungsraum<br />
der fünf Episoden<br />
KENIA<br />
UGANDA<br />
Moyale<br />
Kampala Nanyuki<br />
Isiola<br />
RUANDA<br />
Mt. Kenya<br />
Kigali<br />
Bujumbura<br />
Nairobi<br />
BURUNDI TANSANIA Pemba island<br />
Sansibar<br />
Mbeya<br />
Dar es Salaam<br />
Victoria Falls<br />
Harare<br />
SIMBABWE<br />
Addis Abeba<br />
Gonder<br />
Lalibela<br />
ÄTHIOPIEN<br />
Nakatha Bay<br />
MALAWI<br />
Lake Malawi<br />
Monkey Bay MOSAMBIK<br />
Milange Macuba<br />
Harar<br />
Pretoria<br />
Johannesburg<br />
Maputo<br />
SÜDAFRIKA<br />
Kapstadt<br />
Die letzten Säcke werden eingeladen, bevor die «Ilala» aus Nakatha Bay ausläuft.<br />
geöltes Holz, Druck- und Temperaturanzeigen<br />
aus Kupfer und eine mit Holzintarsien und afrikanischen<br />
Skulpturen verzierte Bar auf dem<br />
offenen Oberdeck. Die dreitägige Fahrt ist eine<br />
Ode an die Schönheit des langsamen Reisens.<br />
Teils stehen wir eine halbe Nacht in der Bucht<br />
vor einer Insel, ohne genau zu wissen, weshalb.<br />
Doch das ist auch egal: Die frühen Nächte auf<br />
dem windig-kühlen Deck eröffnen einen Sternenhimmel,<br />
der wie eine mit Gold gefüllte<br />
Schatztruhe funkelt. Die Lampen der Fischerboote<br />
auf dem See verstärken den Zauber. «The<br />
Lake of Stars» hatte der britische Entdecker David<br />
Livingstone den See genannt.<br />
Tagsüber ankern wir für Stunden vor kleinen<br />
Dörfern, wobei unser Boot für sie oft die<br />
einzige Verbindung zur Aussenwelt ist. Die<br />
Rettungsboote werden zu Wasser gelassen, bullige<br />
Nussschalen mit einem kleinen Motor.<br />
Gleichzeitig schippern Motorboote und aus<br />
Eukalyptus geschlagene Einbäume zur «Ilala».<br />
Dann wird es hektisch: Bündel mit Feuerholz,<br />
100-Kilogramm-Säcke mit Bohnen, Mais und<br />
Reis, Pakete, prall gefüllt mit getrocknetem<br />
dritten Tag kreuzen wir mitten auf dem See ein<br />
stillstehendes Fischerboot. Mit einem Kran<br />
wird es auf die Ladefläche der «Ilala» gehievt.<br />
Die erschöpften Fischer erzählen, dass ihnen<br />
der Diesel ausgegangen sei.<br />
Wahrscheinlich sind sie nicht<br />
die einzigen. Malawi erlebt<br />
zur Zeit meines Besuchs seinen<br />
wirtschaftlichen Tiefpunkt.<br />
In Blantyre, der zweitgrössten<br />
Stadt, sah ich vor ein<br />
paar Tagen lange Schlangen<br />
von wartenden Autos vor den<br />
Tankstellen. Dem Land geht<br />
das Benzin und der Diesel<br />
aus, die Tankstellen werden<br />
nur noch sporadisch beliefert.<br />
Minibusfahrer kaufen auf<br />
dem Schwarzmarkt Benzin,<br />
das aus Mosambik geschmuggelt<br />
oder nachts aus den<br />
Tanks der am Zoll wartenden<br />
Lastwagen abgezapft wurde.<br />
All das hat dazu geführt, dass<br />
das Reisen und die Lebensmittel im Land in<br />
wenigen Monaten beinahe doppelt so teuer geworden<br />
sind. Man hört unterschiedliche Geschichten<br />
darüber, wie es zur aktuellen Krise<br />
kam. Die glaubwürdigste erzählt mir später Silas,<br />
ein ehemaliger Vertreter Malawis in der<br />
Welthandelsorganisation: Vor einigen Monaten<br />
hat sich der britische Botschafter bei seiner Regierung<br />
darüber beklagt, dass der amtierende<br />
Präsident je länger, je autokratischer regiere.<br />
Die Depesche gelangte irgendwie an die Öffentlichkeit,<br />
was dazu führte, dass der Präsident<br />
William Mhone, der Second Motorman im Maschinenraum.<br />
51
Die malawischen Jungs haben Spass, die Touristen schlafen.<br />
den Botschafter des Landes verwies. England<br />
stoppte daraufhin seine finanzielle Unterstützung.<br />
Andere Länder folgten dem Exempel.<br />
Dabei muss man wissen, dass sich das malawische<br />
Haushaltsbudget zu 80 Prozent aus Hilfsgeldern<br />
aus dem Ausland zusammensetzt. Seither<br />
fehlen dem Land ausländische Devisen, um<br />
sich Erdöl und Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt<br />
zu kaufen.<br />
Nach der zweiten Nacht beginnt die Moral<br />
der Schiffsreisenden zu sinken. Der Kapitän<br />
wird nun in regelmässigen Abständen danach<br />
gefragt, wie lange es noch dauere bis nach<br />
Monkey Bay, unserem Zielhafen im Süden.<br />
Trotz den genüsslichen Blicken auf unbewohnte,<br />
paradiesische Küstenabschnitte und<br />
einer wohltuenden Ereignislosigkeit, die dem<br />
Geist Ruhe schenkt. Doch meine Haut ist fettig<br />
Der coole Jon – für einmal nicht mit Joint, sondern mit frisch gefangenem Fisch.<br />
geworden, das Haar strähnig, die<br />
Fingernägel schwarz und das Gepäck<br />
ist voller Maschinenfett. Zudem beginnt<br />
die Diät aus Bohnen, Reis und<br />
Rind zu nerven. 600 verschiedene<br />
Fischarten soll es im Lake Malawi geben,<br />
darunter schmackhafte Tigerfische,<br />
Tilapias und Seebarsche. Und<br />
obwohl das Schiff aus allen Ritzen<br />
nach getrocknetem Fisch stinkt,<br />
heisst es im kleinen Bootrestaurant<br />
Abend für Abend: «Sorry, no fish today.<br />
Maybe tomorrow.» Bei meiner<br />
letzten Sternschnuppe vor dem Einlaufen<br />
in Monkey Bay wünsche ich<br />
mir deshalb ein rechtes Stück Fisch.<br />
Es wirkt: Am Folgetag lerne ich Jon<br />
kennen, einen Malawi, der das Venice<br />
Beach Hotel führt, benannt nach<br />
seinem heutigen Wohnort in den<br />
USA. Er läuft die meiste Zeit mit einem<br />
dicken Joint im Mund herum<br />
und bringt seine Jobs als Programmierer<br />
in den USA und Hotelmanager<br />
in Malawi mit einem unglaublichen<br />
Drang zum Feiern unter einen Hut. Er<br />
schippert mich und einige seiner malawischen<br />
Freunde im Motorboot hinüber in die Bucht<br />
von Cape Mc Clea, einen ehemaligen Magneten<br />
für afrikanische Touristen, als es Malawi<br />
noch besser ging. Wir kreuzen Fischer in Einbäumen,<br />
die ihren Fang zur Präsentation über<br />
die hölzerne Aussenwand legen. Mit einem<br />
Dutzend prächtiger Exemplare legen wir an einem<br />
isolierten Sandstrand zum Mittagessen an.<br />
Jon und seine Freunde spiessen die Fische mit<br />
langen Holzstöcken der Länge nach auf, bestreuen<br />
sie mit etwas Salz und stellen sie seitlich<br />
ans offene Feuer. Wenige Minuten später<br />
lösen wir von Hand das saftige Fleisch, kompakt<br />
wie ein Filet, von den Gräten und füllen<br />
unsere Bäuche mit dem, was zu Hause meist<br />
nur Beilage ist.<br />
Mosambik – im<br />
Südamerika Ostafrikas<br />
Grenzübergang Malawi/Mosambik,<br />
Weihnachten 2011<br />
Ich liebe Grenzübergänge. Nirgends offenbaren<br />
sich kulturelle, soziale und wirtschaftliche Unterschiede<br />
zweier Länder deutlicher. Und nirgends<br />
ist das Eintauchen in ein neues, einem<br />
noch gänzlich unbekanntes Universum intensiver,<br />
dieses erfüllende Gefühl des «Weltensammelns»,<br />
um es angelehnt an einen Buchtitel von<br />
Ilija Trojanow zu beschreiben. Oft ist dieses Eintauchen<br />
nicht ganz umsonst, und der Zugang<br />
zum neuen Land will erkämpft sein. So geht es<br />
dem Reisenden, der vom Südosten Malawis, bei<br />
den mächtigen Mulanje-Mountains, die Küste<br />
Mosambiks ansteuert. Ich konnte im Vornherein<br />
nicht ausfindig machen, ob mir an der Grenze<br />
in Milange überhaupt ein Einreisevisum für<br />
Mosambik ausgestellt wird. Entsprechend<br />
glücklich bin ich, als mir der Beamte einen<br />
Stempel in den Pass drückt, selbst wenn dieser<br />
horrende 79 Dollar kostet. Auf der anderen Seite<br />
des Schlagbaums wartet bereits eine Meute<br />
junger Burschen mit alten Fahrrädern, die sich<br />
ob der Tatsache, dass der Dorfkern Milanges<br />
einige Kilometer von der Grenze entfernt liegt,<br />
ein kleines Geschäft aufgebaut haben.<br />
Die einzige Verbindung von Milange ins<br />
200 Kilometer entfernte Mocuba, die nächste<br />
grössere Stadt mit Anschluss an die Nord/Süd-<br />
Route durch Mosambik, ist eine unbefestigte,<br />
staubige Piste. Einen regulären öffentlichen<br />
Verkehr gibt es nicht, nur kleine Isuzu-Trucks<br />
mit ungedeckten Ladeflächen, die mit Menschen<br />
und Material überfüllt sind. Vierzig Passagiere<br />
sind wir zu Spitzenzeiten, auf vielleicht<br />
vier Mal eineinhalb Meter. Schon bald beschweren<br />
sich die ersten. Die Enge macht aggressiv,<br />
und immer wieder kommt es zu kleinen Querelen.<br />
Nach einer halben Stunde Fahrt, bei etwas<br />
über 40° Celsius, beginnt eine jammernde,<br />
mollige Frau unter einem dunklen Stofftuch zu<br />
kotzen – beissender Duft von Magensäure sticht<br />
in unsere Nasen. Staub, Enge, Lärm und ekelhafte<br />
Gerüche bin ich mir mittlerweile gewohnt.<br />
Doch der fehlende Sonnenschutz ist mehr als<br />
ein Luxusproblem. Eine siebenstündige Fahrt<br />
an praller Sonne kann unter diesen Bedingungen<br />
durchaus zum Kollaps führen. Die meisten<br />
sind vorbereitet und schützen sich mit Kappen,<br />
Tüchern und breiten Schals, in die sie sich einwickeln.<br />
Ich habe glücklicherweise vor der<br />
Fahrt meine Regenjacke aus dem Rucksack gekramt<br />
und auch den Faserpelz, mit dem ich<br />
meine bleichen Schenkel abdecke. Auch den<br />
vier Hühnern, die mit Säcken, Koffern und Plastikkanistern<br />
in einem Bündel mit einem Seil auf<br />
der Fahrerkabine festgezurrt sind, scheint die<br />
Reise anzuhängen: Ununterbrochen kacken sie<br />
aufs darunterliegende Gepäck.<br />
Stundenlang fahren wir durch lichten<br />
Busch, vereinzelt tauchen ein paar Felsen auf.<br />
Hunderte von Quadratkilometern weitgehend<br />
52
afrika<br />
Kleine Schicksalsgemeinschaft. Zu Spitzenzeiten sitzen 40 Personen auf der Ladefläche.<br />
Mocuba: positiv überrascht von der Stadt.<br />
unbewohntes Land und eine einzige Piste, die<br />
hindurchführt. Die unendlichen Weiten Afrikas<br />
faszinieren mich immer wieder. Wie viel<br />
mehr Raum schenkt dieser Kontinent seinen<br />
Menschen im Vergleich zu meiner Heimat!<br />
Von Zeit zu Zeit fahren wir an kleinen Dörfern<br />
mit Hütten aus luftgetrockneten Lehmbacksteinen<br />
und mit Strohdächern vorbei. Die<br />
Dorfbewohner sind sich des anstrengenden<br />
Reisens bewusst und versorgen uns mit Früchten.<br />
Becher mit Wasser werden herumgereicht,<br />
und Händler kommen mit langen Spiessen<br />
frisch gebratener Pouletstücke angerannt.<br />
Gleichzeitig flösst sich ein verlorener Trinker<br />
Gin aus einem Plastikbeutel ein und tanzt im<br />
Delirium zur Musik aus unserem Lastwagen.<br />
Der Alkohol: ein schlechter Freund vieler afrikanischer<br />
Männer, denen ich während meiner<br />
Reise begegnet bin.<br />
Als unsere Schicksalsgemeinschaft am späten<br />
Nachmittag erschöpft in Mocuba ankommt,<br />
wundere ich mich über die befremdlichen<br />
Blicke der Passanten.<br />
Erst später im Hotel merke<br />
ich, dass nicht nur meine Kleider<br />
und das Gepäck von einer dicken<br />
Dreckschicht überzogen<br />
sind, sondern auch mein Gesicht<br />
ausschaut, als wäre ich in eine<br />
Pfütze gefallen. Zwar ging es<br />
meinen Mitfahrern gleich, doch<br />
in deren dunklen Gesichtern war<br />
der braune Film nicht aufgefallen.<br />
«Tu, was du kannst, um zu<br />
vermeiden, dass du hier übernachten<br />
musst», steht im Lonely-<br />
Planet-Reiseführer zu Mocuba.<br />
Autor Samuel Schlaefli. Frisch rasiert fotografiert sichs am besten.<br />
Morgen ist Weihnacht. Nicht nur die Kinder freuen sich.<br />
Entweder waren die Autoren nicht<br />
in der Stadt oder sie irren gewaltig.<br />
Kommt man aus Malawi, ist Mocuba<br />
nämlich das Eintrittstor in<br />
eine andere Welt: Vor den Kneipen<br />
isst man «Omelettes simples con<br />
salsichas» und trinkt dazu ein Laurentina-Bier.<br />
Die Bäckereien sind<br />
voller Zuckerbomben, und nach<br />
Wochen der hellbraunen Brühe<br />
aus Schwarztee und Milch, welche<br />
die Briten einst in ihren Kolonien<br />
eingeführt hatten, gibts hier wieder<br />
Espressi mit Schäumchen. Das<br />
«Piscina» und «Governo de Mocuba»<br />
zeigen die strengen, klaren<br />
Formen der Moderne, wie man sie<br />
in Oskar Niemeyers Brasilia, aber<br />
nirgends sonst auf meiner Reiseroute<br />
findet. Die Frauen sind selbstbewusster<br />
im Auftreten und freizügiger in ihrer Bekleidung.<br />
Die Musik erinnert an Reggaeton, den<br />
ich zuletzt in Kolumbien oft gehört hatte. All<br />
das ist ein Bruch mit dem Afrika meiner bisherigen<br />
Reise. Als hätte ich den Kontinent kurzerhand<br />
verlassen und wäre in Südamerika gelandet.<br />
Die Stimmung im Städtchen ist lebendig.<br />
Es ist der Tag vor Weihnacht, und man scheint<br />
sich aufs kommende Fest zu freuen.<br />
Kinder tragen zum Spass rote Sankt-<br />
Nikolaus-Mützen. Vor den Geschäften<br />
stehen bullige Lautsprecher, die<br />
in voller Lautstärke treibende<br />
Rhythmen auf die Strasse schmettern.<br />
Vor den Alkoholgeschäften<br />
bilden sich lange Schlangen. In<br />
20er-Packs werden Whiskey, Rum<br />
und Gin in 3-dl-Plastikflaschen gekauft.<br />
Männer füllen die Ladeflächen<br />
ihrer Pick-ups mit Bierkästen.<br />
Auch bei mir macht sich allmählich<br />
Vorfreude auf ein rauschendes<br />
Weihnachtsfest breit.<br />
text@samuelschlaefli.ch<br />
www.samuelschlaefli.ch<br />
© <strong>Globetrotter</strong> Club, Bern<br />
sommer 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 53
Weitere exklusive<br />
Reise reportagen <strong>lesen</strong>?<br />
Für 30 Franken pro Kalenderjahr liegt das <strong>Globetrotter</strong>-Magazin alle 3 Monate im Briefkasten. Mit spannenden Reisegeschichten,<br />
Interviews, Essays, News, Tipps, Infos und einer Vielzahl von Privatannoncen (z.B. Reisepartnersuche,<br />
Auslandjobs etc.). Dazu gibts gratis die <strong>Globetrotter</strong>-Card mit attraktiven Rabatten aus der Welt des Reisens.<br />
Inklusive <strong>Globetrotter</strong>-Card<br />
<strong>Globetrotter</strong>-Card 2012<br />
★ Jahres-Abo <strong>Globetrotter</strong>-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen<br />
★ Büchergutschein CHF 25.– einlösbar bei Reisebuchung bei <strong>Globetrotter</strong><br />
★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei TRANSA (1 Einkauf)<br />
★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei <strong>Globetrotter</strong><br />
★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen<br />
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (ab CHF 2500.–/Person)<br />
der <strong>Globetrotter</strong> Tours AG und der bike adventure tours AG<br />
(nicht kumulierbar/nicht übertragbar/bei der Buchung anzugeben)<br />
Transa-Gutschein 2012<br />
1 x 10% Rabatt<br />
einlösbar bis<br />
31.12.12<br />
02-1380 <strong>Globetrotter</strong>-Card_12.indd 1 07.09.11 15:54<br />
Informieren und Abo abschliessen:<br />
www.globetrottermagazin.ch