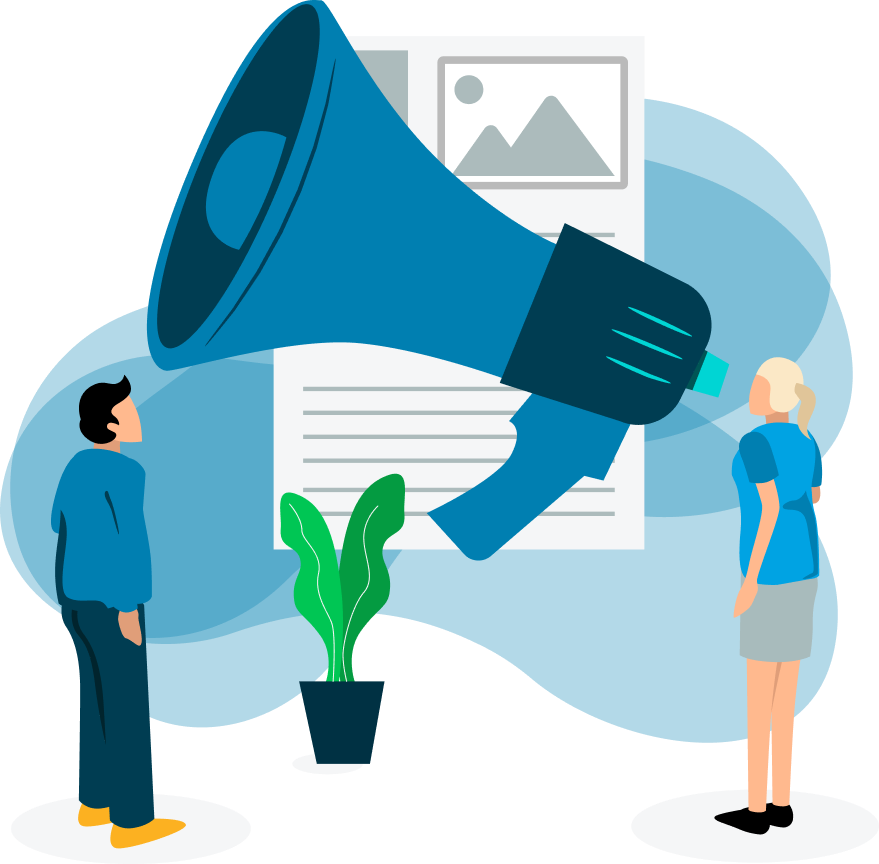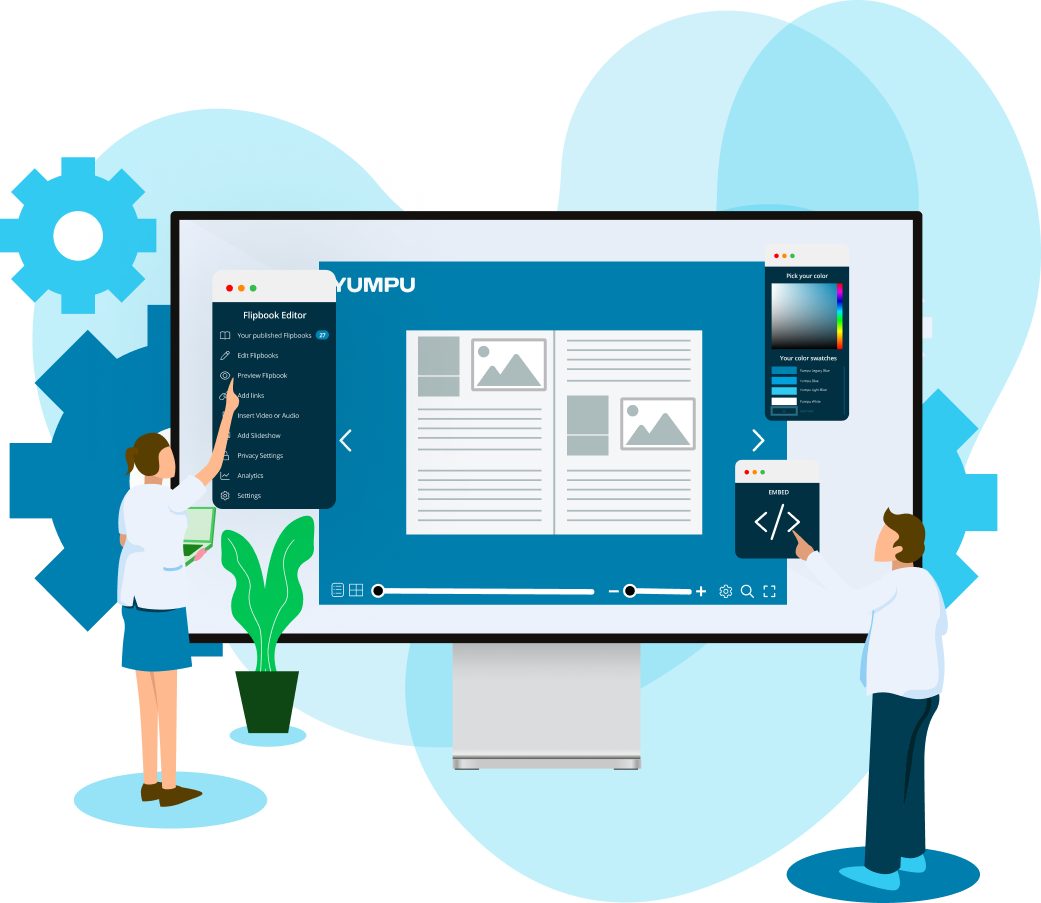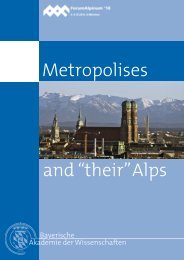Umweltrelevante Grundlagen der Geologie - Technische Universität ...
Umweltrelevante Grundlagen der Geologie - Technische Universität ...
Umweltrelevante Grundlagen der Geologie - Technische Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Geologie</strong> für<br />
Studenten <strong>der</strong> Physischen Geographie<br />
Skriptum zu den Vorlesungen <strong>Geologie</strong> I und II und zu den Praktika zur <strong>Geologie</strong> 2006 / 07<br />
am Lehrstuhl für Physische Geographie <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> Augsburg<br />
von Prof. Dr. Herbert Scholz<br />
Zusammengestellt aus verschiedenen Skripten für Vorlesungen an <strong>der</strong> TU München<br />
von H. Scholz, M. Rie<strong>der</strong> und H. Tauchmann<br />
——————<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1. GESCHICHTE DER GEOLOGIE ALS WISSENSCHAFT<br />
2. KREISLAUF DER GESTEINE<br />
3. DIE GESTEINSBILDENDEN MINERALE<br />
3.1 Definition <strong>der</strong> Begriffe Mineral, Kristall und Gestein<br />
3.2 Entstehungsmöglichkeiten von Mineralien<br />
3.3 Bestimmungswichtige äußere Kennzeichen von Mineralien<br />
3.4 Gesteinsbildende und in Gesteinen häufig vorkommende Minerale<br />
3.5 Wichtige Nachschlagewerke und Bestimmungsbücher zur Mineralogie<br />
4. PETROLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
4.1 Erstarrungsgesteine (magmatische Gesteine o<strong>der</strong> Magmatite)<br />
4.2 Sedimentgesteine (Sedimente, Sedimentite o<strong>der</strong> Absatzgesteine)<br />
4.3 Umwandlungsgesteine (Metamorphite): Tonschiefer, Schieferton, Knotenschiefer, Phyllit etc.<br />
4.4 Wichtige Nachschlagewerke und Bestimmungsbücher für Gesteine<br />
5. EINIGE WEITERE GRUNDLAGEN DER ALLGEMEINEN GEOLOGIE<br />
5.1 Verwitterung und Bodenbildung<br />
5.2 Abtragung und Massenbewegungen<br />
5.3 Tektonik<br />
5.4 Gebirgsbildung und Plattentektonik<br />
5.5 Geologische Zeitmessung<br />
5.6 Literaturauswahl zu weiteren <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> Allgemeinen <strong>Geologie</strong><br />
6. QUARTÄRGEOLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
6.1 Frühe Geschichte <strong>der</strong> Eiszeitforschung<br />
6.2 Die eiszeitlichen Gletscher in Europa<br />
6.3 Meeresspiegelabsenkung und Glazial-Isostasie<br />
6.4 Physische Quartärgeologie<br />
6.6 Literaturauswahl zu den quartäegeologischen <strong>Grundlagen</strong>
7. HYDROGEOLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
7.1 Rund ums Grundwasser<br />
7.2 Grundwasser bewegt sich<br />
7.3 Karst<br />
7.4 Beschaffenheit des Grundwassers<br />
7.5 Gefährdung des Grundwassers<br />
7.6 Aufsuchung und Schutz von Grundwasservorkommen<br />
7.7 Literaturauswahl zu den hydrogeologischen <strong>Grundlagen</strong><br />
8. PALÄONTOLOGICHE GRUNDLAGEN<br />
8.1 Vom lebenden Organismus zum Fossil<br />
8.2 Gewöhnliche Fossilien: Hartteilerhaltung<br />
8.3 Seltene Fossilien: Weichteilerhaltung<br />
8.4 Auswahl beson<strong>der</strong>s wichtiger Fossilgruppen<br />
8.5 Literaturauswahl zu den paläontologischen <strong>Grundlagen</strong><br />
2<br />
9. ERDGESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN<br />
9.1 Ablauf <strong>der</strong> Erdgeschichte in groben Zügen<br />
9.1 Literaturauswahl zu den erdgeschichtlichen <strong>Grundlagen</strong><br />
10. GRUNDLINIEN EINER REGIONALEN GEOLOGIE VON DEUTSCHLAND<br />
10.1 Der paläozoische Sockel Deutschlands<br />
10.2 Das Rotliegende und <strong>der</strong> Zechstein<br />
10.3 Die Gesteine des Schwäbisch-Bayerischen Stufenlandes<br />
10.4 Die Kreide- und Tertiärbecken in Deutschland<br />
10.5 Tertiäre Vulkangebiete in Deutschland<br />
10.6 Tertiäre Meteoritenkrater in Süddeutschland<br />
10.7 Die Bayerischen Alpen und das Alpenvorland<br />
10.8 Das Quartär in Deutschland<br />
10.9 Grundwasserlandschaften im Süden Bayerns<br />
10.10 Literaturauswahl zur Regionalen <strong>Geologie</strong> von Süddeutschland<br />
10.11 Literaturauswahl zur Quartärgeologie von Süddeutschland<br />
11. VOM NUTZEN GEOLOGISCHER KARTEN<br />
Tabellen: Für Bautechnik, Trinkwasser etc. relevante Mineraleigenschaften: Tabelle 1<br />
Diagenese <strong>der</strong> Hartteile von Organismen: Tabelle 2<br />
Die wichtigsten Baustoff <strong>der</strong> Hartteile von Organisme: Tabelle 3<br />
System paläont. wichtiger Organismengruppen (ohne Wirbeltiere): Tabelle 4<br />
Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erdgeschichte in Deutschland: Tabelle 5<br />
Glie<strong>der</strong>ung des Quartärs in Deutschland: Tabelle 6
3<br />
1. GESCHICHTE DER GEOLOGIE ALS WISSENSCHAFT<br />
Die <strong>Geologie</strong> ist, zusammen mit <strong>der</strong> Mineralogie und Petrographie, eine sehr junge Wissenschaft, die sich erst im<br />
Laufe des 18. und 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts als eigene Disziplin herauszubilden begann. Obwohl sich schon antike Philosophen<br />
über Gesteine und die Entstehung <strong>der</strong> Erde Gedanken gemacht haben, steuerten erst neuzeitliche Denker<br />
und Praktiker entscheidende Erkenntnisse und Ideen für ein mo<strong>der</strong>nes geologisches Weltbild bei. Neben<br />
Bergleuten waren es zunächst Philosphen, Mediziner, Mathematiker und Physiker, teilweise auch Ingenieure und<br />
Biologen, vielfach Privatgelehrte, die fortschrittliche Gedanken über die Entstehung von Gesteinen, Fossilien und<br />
die Geschichte <strong>der</strong> Erde hatten und diese auch aufschrieben. Einige dieser Ideen beeinflussten das Denken ihrer<br />
Zeit entscheidend, an<strong>der</strong>e wurden erst viel später als bahnbrechend erkannt. Erst zu Beginn des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
bildete sich das heraus, was man heute als <strong>Geologie</strong> und als Geologen bezeichnet. Diese wurden ursprünglich<br />
freilich "Geognosten" genannt. Einige wenige Namen aus <strong>der</strong> Frühzeit <strong>der</strong> <strong>Geologie</strong> sollen hier kurz<br />
aufgeführt und ihre wesentlichen Leistungen stichwortartig gewürdigt werden.<br />
Georg Bauer, nannte sich "Agricola" (1494-1535) – Arzt und Bergmann aus Sachsen, schrieb ein umfassendes<br />
Buch über den Bergbau und das Hüttenwesen: "De re metallica".<br />
Baron G.W. von Leibnitz (1646-1716) – Philosoph, Physiker, Mathematiker aus Deutschland. Er nahm u.a. an,<br />
dass die Erde ursprünglich geschmolzen war, erst später erstarrte und im Inneren immer noch heiß ist.<br />
Nils Pe<strong>der</strong>sen, nannte sich "Nikolaus Steno" (1638-1687) – Er stammte aus Dänemark, lebte aber lange in den<br />
Nie<strong>der</strong>landen und in Italien, machte später Karriere in <strong>der</strong> Katholischen Kirche. Erkannte die organische Natur<br />
von Fossilien, die man bis dahin als "Launen <strong>der</strong> Natur" abgetan hatte. Außerdem betrachtete er Schichtgesteine<br />
als Ablagerungen des Meeres. Er war <strong>der</strong> Ansicht, dass die Erdgeschichte rekonstruierbar sein müsse, wenn man<br />
sich nur mit diesen Ablagerungen genau beschäftigte.<br />
John Woodward (1665-1722) – Prof. für Physik in London. Unabhängig von Steno erkannte er die organische<br />
Natur von Fossilien. Er sah auch die Altersabhängigkeit von Fossilien, dass also bestimmte Formen an bestimmte<br />
unterschiedlich alte Horizonte gebunden sind.<br />
Immanuel Kant (1724-1804) – Philosoph aus Ostpreußen. Entwickelte eine bis heute weitgehend akzeptierte<br />
Hypothese von <strong>der</strong> Entstehung des Sonnensystems durch Akkretion von Staub und Gasen aus einem Urnebel.<br />
James Hutton (1726-1797) – Physiker und Privatgelehrter aus Schottland. Dachte aktualistisch ("The present is<br />
the key to the past"), war <strong>der</strong> Ansicht, dass viele Gesteine, wie Basalt und Granit, durch das Erstarren von<br />
Gesteinsschmelzen entstanden seien und war damit <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> "Plutonisten"-Schule, die in scharfem<br />
Gegensatz zur "Neptunisten"-Schule Werners stand. Er schrieb ein Buch mit dem Titel "Theory of the Earth", in<br />
dem er den Kreislauf <strong>der</strong> Gesteine unter <strong>der</strong> Beteiligung exogener und endogener Kräfte beschrieb.<br />
Horace Benedict de Saussure (1740-1799) – Prof. <strong>der</strong> Philosophie in Genf, Alpinist und Mineraloge. Mo<strong>der</strong>ne<br />
Gedanken zu den Sedimenten, den Gesteinen <strong>der</strong> Alpen und zur ursprünglich größeren Ausdehnung <strong>der</strong> Gletscher.<br />
Schrieb ein sehr wichtiges Buch mit dem Titel "Voyages dans les Alpes", in dem viele wichtige geologische<br />
Beobachtungen nie<strong>der</strong>gelegt sind.<br />
Abraham Gottlob Werner (1749-1817) – Mineralogie-Professor an <strong>der</strong> Bergakademie Freiberg, war mit Goethe<br />
befreundet. Unter seinem Einfluss wird die Mineralogie populär. Entwickelte ein erstes einfaches erdgeschichtliches<br />
System (Primitives Gebirge, Übergangsgebirge, Flözgebirge, aufgeschwemmtes Gebirge). Er nahm an,<br />
dass alle Gesteine, auch Basalt, im Wasser entstanden und die Kristalle des Granits in einem Ur-Ozean ausgefällt<br />
worden seien. Er war damit Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> "Neptunisten"-Schule, die in scharfem Gegensatz zur "Plutonisten"-Schule<br />
Huttons stand. Seine teilweise nicht zutreffenden Ideen hatten in ganz Europa großen Einfluss.<br />
Alexan<strong>der</strong> von Humboldt (1769-1859) – Stammte aus Berlin, Naturforscher und Privatgelehrter. Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
mo<strong>der</strong>nen Geographie, bedeuten<strong>der</strong> Geologe. Begreift die <strong>Geologie</strong> als Teil <strong>der</strong> physischen Erdbeschreibung.<br />
Erkennt u.a., dass Granite und an<strong>der</strong>e Tiefengesteine nicht unbedingt "Urgesteine" sein müssen, son<strong>der</strong>n auch<br />
recht jung sein können. Führt den Jura als erdgeschichtlichen Begriff in die Literatur ein.<br />
George Cuvier (1769-1832) – Stammte aus einem heute französischen Teil des Herzogtums Baden. Berühmter<br />
Zoologe und Tieranatom in Paris, <strong>der</strong> sich auch intensiv mit fossilen Wirbeltieren beschäftigte. Er spielte während<br />
<strong>der</strong> Französichen Revolution eine wichtige Rolle und war <strong>der</strong> Überzeugung, dass es in <strong>der</strong> Erdgeschichte eine
4<br />
ganze Reihe von Schöpfungen gegeben hat. Die dabei erschaffene Fauna sei jeweils durch Katastrophen<br />
vernichtet und durch Neuschöpfungen wie<strong>der</strong> ersetzt worden. Dieser "Katastrophismus" hatte im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
großen Einfluss.<br />
William Smith (1769-1839) – Ingenieur aus England, <strong>der</strong> mit dem Bau von Kanälen in Südengland beschäftigt<br />
war. Er nutzte als erster Leitfossilien zur Alterseinstufung von Gesteinen und zeichnet die ersten geologischen<br />
Karten und Profile.<br />
Charles Lyell (1797-1839) – Privatgelehrter aus Schottland, war überzeugter Plutonist und Anhänger des<br />
Uniformismus, d.h. er glaubte an eine kontinuierliche Entwicklung <strong>der</strong> Erde und ihrer Lebewelt, ohne Katastrophen<br />
anzunehmen ("Die Natur macht keine Sprünge"). Er führte den Aktualismus als konsequente Methode in <strong>der</strong><br />
<strong>Geologie</strong> ein. Wichtige Beiträge zur mo<strong>der</strong>nen <strong>Geologie</strong> und Stratigraphie. Er erkannte die Bedeutung von<br />
Gebirgsbildungen und Winkeldiskordanzen für die Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erdgeschichte, entwickelte die glaziale<br />
Drifttheorie zur Erklärung <strong>der</strong> Geschiebelehme in Norddeutschland, die lange als die Lehrmeinung akzeptiert war<br />
und schrieb das erste mo<strong>der</strong>ne Lehrbuch zur Allgemeinen <strong>Geologie</strong> "Principles of Geology", das sehr viel Einfluss<br />
auf die weitere Entwicklung <strong>der</strong> <strong>Geologie</strong> und <strong>der</strong> Naturphilosophie hatte.<br />
Die bis heute gültige Unterteilung <strong>der</strong> Erdgeschichte in Äratheme (Paläozoikum, Mesozoikum etc.) und Systeme<br />
(Kambrium, Ordovizium etc.) und die Feinglie<strong>der</strong>ung dieser Systeme in Stufen (Cenoman, Turon etc.) und Zonen<br />
wurde im Wesentlichen zwischen 1820 und 1850 entwickelt. Daran waren u.a. die Englän<strong>der</strong> A. Sedgwick und<br />
R.J. Murchison, die Deutschen F.A. Quenstedt und F. Roemer, <strong>der</strong> Österreicher E. Freiherr von Mojsisovics<br />
sowie die Franzosen J. Barrande , P. Deshayes und J. Gosselet maßgeblich beteiligt.<br />
2. KREISLAUF DER GESTEINE<br />
Im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t begann sich die Erkentnis durchzusetzen, dass am Entstehen von Gesteinen und an ihrem<br />
Vergehen exogene und endogene Kräfte beteiligt sind. Heute nehmen wir an, dass die Stoffe, aus denen die<br />
Gesteine bestehen, einem ständigen Stoffkreislauf unterworfen sind. Sedimente entstehen an <strong>der</strong> Erdoberfläche<br />
aus Abtragungsprodukten älterer Gesteine und akkumulieren sich in Senkungszonen. Durch Senkungsbewegungen<br />
geraten sie in immer größere Tiefen, werden hier durch diagenetische Vorgänge zu festen Sedimentgesteinen,<br />
werden unter erhöhten Drucken und Temperaturen in Metamorphite umgewandelt und schließlich<br />
aufgeschmolzen. Diese Gesteinsschmelzen können in höhere Krustenstockwerke eindringen und hier in Form<br />
von Intrusionskörpern als Plutonite erstarren. Durch Hebungsvorgänge können die plutonischen und metamorphen<br />
Gesteine aufsteigen, schließlich verwittern und abgetragen werden. Die Abtragungsprodukte werden in<br />
Senkungszonen wie<strong>der</strong> als Sedimente abgelagert.<br />
Alle Gesteine <strong>der</strong> Erdkruste und Teile des Erdmantels sind an diesem ständigen Kreislauf <strong>der</strong> Gesteine beteiligt.<br />
Er funktioniert schon, seit die Erde vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist und sorgt dafür, dass die<br />
Materie, aus <strong>der</strong> die Gesteine bestehen, meist schon mehrfach diesen Kreislauf durchlaufen hat. Angesichts <strong>der</strong><br />
Abtragungsgeschwindigkeit, die auf den Festlän<strong>der</strong>n direkt messbar ist, müsste theoretisch alle 2 Milliarden Jahre<br />
die komplette festländische Kruste „recykelt“ sein. Allerdings sind Teile alter Festlandskerne diesem Kreislauf<br />
entzogen worden, und deshalb sind gerade hier Gesteine mit radiometrischen Altern von über 4,1 Milliarden<br />
Jahren erhalten geblieben.<br />
Die gesamten folgenden Ausführungen sind im Zusammenhang mit diesem Kreislauf <strong>der</strong> Gesteine zu betrachten.<br />
Zuerst werden einige Minerale und ihre Entstehungsbedingungen vorgestellt. Dann kommen die Gesteine dran,<br />
die aus diesen Mineralien bestehen. Dann werden einige endogene und exogene Vorgänge behandelt, unter<br />
denen sich die Gesteine verän<strong>der</strong>n. Schließlich wird am Beispiel Süddeutschlands die Verbreitung <strong>der</strong> Gesteine<br />
und die geologische Geschichte von Landschaften besprochen.
5<br />
3. DIE GESTEINSBILDENDEN MINERALE<br />
3.1 Definition <strong>der</strong> Begriffe Mineral, Kristall und Gestein<br />
Ein Mineral ist ein stofflich einheitlicher, natürlich entstandener, fester Körper – ein chemischer Grundstoff (Element)<br />
o<strong>der</strong> eine chemische Verbindung – <strong>der</strong> Bestandteil <strong>der</strong> festen Kruste <strong>der</strong> Erde o<strong>der</strong> eines Himmelskörpers<br />
ist. Für alle Minerale (o<strong>der</strong> Mineralien) können also chemische Formeln angegeben werden, die allerdings teilweise<br />
sehr kompliziert sind.<br />
Ein Kristall ist ein Mineral o<strong>der</strong> ein an<strong>der</strong>er, auch künstlich hergestellter, stofflich einheitlicher Körper, dessen<br />
kleinste Bausteine (Atome, Ionen o<strong>der</strong> Moleküle) eine gesetzmäßige (kristalline) Anordnung nach Art eines dreidimensionalen<br />
Gitters (Raumgitter) besitzen. Kristalle können mikroskopisch klein, aber auch Dekameter groß<br />
sein. Bei ungehin<strong>der</strong>tem Wachstum bilden Kristalle für das Mineral jeweils charakteristische, polyedrische Körper<br />
aus – mit ebenen Flächen, Ecken und geraden Kanten. In diesem Fall spiegelt die regelmäßige äußere Form<br />
eines <strong>der</strong>artigen idiomorphen Kristalls seinen gesetzmäßigen inneren Aufbau wi<strong>der</strong>. Das muss aber nicht so<br />
sein. Behin<strong>der</strong>n sich Kristalle gegenseitig beim Wachstum, haben die so entstandenen, u.U. ganz unregelmäßig<br />
geformten xenomorphen Kristalle im Innern trotzdem eine regelmäßige Gitterstruktur. Die meisten Minerale sind<br />
kristallin, auch wenn die Kristalle oft so klein sind, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Es gibt<br />
allerdings auch feste Stoffe, die nicht kristallin, son<strong>der</strong>n amorph sind, also (ähnlich wie Flüssigkeiten) keinen<br />
gesetzmäßigen inneren Aufbau besitzen – etwa das Mineral Opal o<strong>der</strong> natürliche Gesteinsgläser.<br />
Ein Gestein ist ein locker o<strong>der</strong> fest gefügtes, natürliches Gemenge von Mineralkörnern und/o<strong>der</strong> Gesteinsbruchstücken,<br />
das in größeren Massen vorkommt und eine allgemeine Verbreitung besitzt. Die monomineralischen<br />
Gesteine (z.B. Marmor o<strong>der</strong> Quarzit) sind nur aus einer einzigen Mineralart aufgebaut, die polymineralischen<br />
Gesteine (z.B. Granit o<strong>der</strong> Gabbro) dagegen aus mehreren unterschiedlichen Mineralarten.<br />
3.2 Entstehungsmöglichkeiten von Mineralien<br />
Mineralien bilden sich unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Manche entstehen an o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong><br />
Erdoberfläche und können beim Wachstum direkt beobachtet werden, an<strong>der</strong>e nur unter sehr hohen Temperaturen<br />
und Drucken, extremen Bedingungen, wie sie nur im Inneren <strong>der</strong> Erde verwirklicht sind. Einige Mineralien<br />
wachsen sehr schnell, an<strong>der</strong>e dagegen nur in geologischen Zeiträumen.<br />
Entstehung in Gesteinsschmelzen: Mineralien können in natürlichen, heißen Gesteinsschmelzen (Magmen)<br />
wachsen, wenn diese zu magmatischen Gesteinen erstarren. Magmen kühlen im Inneren <strong>der</strong> Erde nur sehr langsam<br />
ab, da die umgebenden Gesteine schlechte Wärmeleiter sind. Der Abkühlungsprozess kann Tausende o<strong>der</strong><br />
gar Millionen von Jahren dauern, je nachdem, wie groß <strong>der</strong>artige geologische Körper sind. In diesen langsam<br />
erstarrenden Schmelzen können u.U. idiomorphe Kristalle von Zentimetern o<strong>der</strong> Dezimetern Größe wachsen<br />
(z.B. Glimmer o<strong>der</strong> Feldspäte). Gesteinsschmelzen, die z.B. als Laven die Erdoberfläche erreichen, kühlen dagegen<br />
vergleichsweise rasch ab. Die Kristalle bleiben meist mikroskopisch klein, die in solchen im Laufe von Stunden,<br />
Tagen o<strong>der</strong> bestenfalls Jahren erstarrenden Schmelzen wachsen.<br />
Entstehung in heißen Festgesteinen: Mineralien können auch in festen Gesteinen wachsen, wenn diese heiß<br />
werden o<strong>der</strong> sich die bisherigen Druck- und Temperaturbedingungen im Erdinneren än<strong>der</strong>n. Diesen Vorgang<br />
nennt man Metamorphose (Umwandlung), bei dem Mineralien wie Granat o<strong>der</strong> Hornblende entstehen können.<br />
Ein vergleichbarer künstlicher Vorgang ist das Brennen von Ton, bei dem sich unter hohen Temperaturen, aber<br />
unterhalb des Schmelzpunktes Tonmineralen z.B. in das Mineral Mullit umwandeln können.<br />
Entstehung in heißen wässrigen Lösungen o<strong>der</strong> Gasen: Heiße Wässer o<strong>der</strong> Gase, die z.B. beim Abkühlen<br />
von Magmen im Erdinneren entstehen können (Hydrothermen), suchen sich entlang von Gesteinsfugen (Klüften)<br />
ihren Weg zur Erdoberfläche. Darin gelöste Stoffe fallen nicht selten in Form von Mineralien aus (z.B. Quarz,<br />
Fluorit, Bleiglanz, Schwerspat und Zinkblende), die nach und nach die spaltenförmigen Aufstiegswege (Gänge)<br />
„verheilen“. Da sich die Zusammensetzung <strong>der</strong> heißen Lösungen im Laufe <strong>der</strong> Zeit än<strong>der</strong>n kann, überziehen sich<br />
die Wände dieser Spalten manchmal mit Tapeten unterschiedlicher Mineralarten. Das führt mitunter zu einer im
6<br />
Querschnitt symmetrischen Lagenstruktur (Zonarbau) <strong>der</strong> Gänge. Ein großer Teil wichtiger Erzlagerstätten ist auf<br />
diese Weise entstanden.<br />
Entstehung in kalten wässrigen Lösungen: Mineralien können aber auch bei „normalen“ Temperaturen und<br />
Drucken entstehen, wie sie an <strong>der</strong> Erdoberfläche herrschen. Aus kalten wässrigen Lösungen können Stoffe als<br />
Mineralien ausgeschieden werden, die vorher an an<strong>der</strong>er Stelle im Wasser gelöst worden sind. So kann z.B. das<br />
im Boden versickernde, saure Nie<strong>der</strong>schlagswasser Karbonat lösen, das später aus dem Grundwasser in Gesteinsporen<br />
als Calcit ausfällt. Dieser Prozess führt u.a. dazu, dass ehemals lockere Ablagerungen mit <strong>der</strong> Zeit zu<br />
festen Gesteinen werden.<br />
Biomineralisation: Viele Organismen, z.B. Schnecken, Muscheln, Korallen, Schwämme o<strong>der</strong> Wirbeltiere, scheiden<br />
mineralische Hartteile aus, die meist aus Karbonat (Calcit und Aragonit), seltener auch aus Kieselsäure o<strong>der</strong><br />
Phosphat bestehen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Biomineralisation. Millionen von Schalen können sich zu<br />
mächtigen Schillbänken anhäufen, aus denen mit <strong>der</strong> Zeit dann harte Kalksteine hervorgehen.<br />
3.3 Bestimmungswichtige äußere Kennzeichen von Mineralien<br />
Jede Mineralart unterscheidet sich von allen an<strong>der</strong>en durch die chemische Zusammensetzung und/o<strong>der</strong> durch<br />
ihre Gitterstruktur. Diese Eigenschaften werden vor allem mit nasschemischen, polarisationsmikroskopischen<br />
o<strong>der</strong> röntgenographischen Methoden untersucht. Diese Untersuchungsmethoden sind jedoch meist ziemlich aufwendig<br />
und teuer. Abgesehen davon besitzen die meisten Mineralien jedoch charakteristische äußere Merkmale,<br />
die sich schon mit recht einfachen (und billigen) Methoden bestimmen lassen. Für die Bestimmung <strong>der</strong> häufigen<br />
Mineralarten sind diese simplen Methoden schon vielfach ausreichend und erlauben es, diese sicher zu erkennen<br />
und von an<strong>der</strong>en zu unterscheiden.<br />
Ausbildung: Die gleiche Mineralart kann, aufgrund unterschiedlicher Bildungsbedingungen, in Form großer idiomorpher<br />
Einzelkristalle o<strong>der</strong> als xenomorphe Kristallaggregate ausgebildet sein. Bestimmte Mineralien bilden<br />
auch für diese charakteristische Zwillinge. Die Ausbildung einer Mineralart als beson<strong>der</strong>s feinkörnige, strukturlose<br />
Massen wird als „<strong>der</strong>b“ bezeichnet. Manche Mineralien, wie etwa Gips und Quarz, kommen in allen möglichen<br />
Ausbildungen vor.<br />
Bruch und Spaltbarkeit: Die Beschaffenheit <strong>der</strong> Bruchflächen eines Kristalls ist von seinem Feinbau (Kristallgitter)<br />
abhängig. So zeigen z.B. Quarzkristalle glatte, muschelige Bruchflächen (wie Glas), Turmalinkristalle dagegen<br />
rauhe, unebene Bruchflächen (wie Beton). Kristalle bestimmter Mineralien, wie Gips, Calcit, Fluorit, Feldspat<br />
o<strong>der</strong> Glimmer, sind hingegen spaltbar, d.h. die Kristalle brechen bevorzugt in bestimmten Richtungen entlang<br />
ebener, oft spiegelglatter Flächen auseinan<strong>der</strong>, die im Kristallgitter vorgezeichnet sind. Die Spaltbarkeit kann<br />
unterschiedliche Qualitäten haben (undeutlich, deutlich, vollkommen), je nachdem wie eben die Spaltflächen<br />
ausgebildet sind. Während z.B. die Glimmer nur in einer Richtung spaltbar sind, lassen sich Hornblende- o<strong>der</strong><br />
Augit-Kristalle in 2, Gips- o<strong>der</strong> Salz-Kristalle in 3 unterschiedlichen Richtungen spalten. Die Spaltbarkeit kann<br />
auch in verschiedenen Richtungen unterschiedlich deutlich ausgebildet sein, z.B. bei den Feldspäten. Beim<br />
Zertrümmern spaltbarer, ebenflächig begrenzter Kristalle entstehen gleichfalls ebenflächig begrenzte Spaltkörper,<br />
die aber ganz an<strong>der</strong>s aussehen können als diese. So lassen sich z.B. würfelförmige Salzkristalle in würfelförmige<br />
Spaltkörper zerlegen, während gleichfalls würfelförmige Fluoritkristalle in oktaedrische Spaltkörper zerbrechen.<br />
Strichfarbe: Die Eigenfarbe größerer Kristalle eines Minerals muss nicht mit <strong>der</strong> Färbung des gleichen Minerals<br />
in pulverisierter Form übereinstimmen. Die Pulverfarbe des dunkelgrauen Magnetits und des messinggelben<br />
Pyrits ist z.B. schwarz, die des schwarzvioletten Hämatits rotbraun und die des dunkelbraunen Limonits ockerbraun.<br />
Der schwärzliche Rauchquarz, <strong>der</strong> transparente Bergkristall und viele an<strong>der</strong>e harte Mineralien zeigen<br />
dagegen eine weiße Pulverfarbe. Man bestimmt sie für Minerale bis zur Härte 5, indem man das zu bestimmende<br />
Mineral über ein weißes unglasiertes Porzellantäfelchen reibt und damit einen Strich aus Mineralpulver erzeugt.<br />
Härte: Die unterschiedliche Ritzhärte von Mineralien (jedoch nicht <strong>der</strong>en Zähigkeit!) wird durch gegenseitigen<br />
Ritzversuch ermittelt. Ein Mineral ist härter als ein an<strong>der</strong>es, wenn mit <strong>der</strong> Kante des einen auf einer Fläche des<br />
an<strong>der</strong>en ein Kratzer erzeugt werden kann. Eines <strong>der</strong> Mineralien mit beson<strong>der</strong>s geringer Härte ist <strong>der</strong> Talk, die<br />
härteste Mineralart überhaupt <strong>der</strong> Diamant. Talk und Diamant sind auch die Endglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> zehnteiligen „Mohs’-
7<br />
schen Härteskala“, mit <strong>der</strong>en Hilfe man durch Ritzversuche an entsprechenden Normmineralien die Härte eines<br />
zu bestimmenden Minerals ermitteln kann. Die Minerale <strong>der</strong> Mohs’schen Härteskala sind:<br />
Härte 1 – Talk Härte 6 – Orthoklas<br />
Härte 2 – Gips Härte 7 – Quarz<br />
Härte 3 – Calcit Härte 8 – Topas<br />
Härte 4 – Fluorit Härte 9 – Korund<br />
Härte 5 – Apatit Härte 10 – Diamant<br />
Spezifisches Gewicht: Das genaue Bestimmen des spezifischen Gewichtes (Dichte) einer Mineralart ist ziemlich<br />
aufwendig, lässt sich aber bei einiger Übung grob abschätzen. Die meisten Minerale, vor allem die häufigen,<br />
haben spezifische Gewichte zwischen 2,0 und 3,0, im Mittel 2,6 g/cm ³ . In dieser Größenordnung liegen denn<br />
auch die spezifischen Gewichte <strong>der</strong> meisten Gesteine. Es gibt nicht sehr viele Mineralarten, die deutlich höhere<br />
spezifische Gewichte haben und trotzdem häufig sind. Dazu gehören vor allem Verbindungen mit einigen schwereren<br />
Metallen, etwa <strong>der</strong> Baryt (4,5), <strong>der</strong> Hämatit (5,1) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bleiglanz (7,5).<br />
Chemische Tests: Die meisten chemischen Bestimmungsmethoden für Minerale sind ziemlich aufwendig und<br />
teilweise gefährlich, da – vor allem bei Silikaten – vielfach aggressive Flusssäure verwendet werden muss. Ganz<br />
einfach ist dagegen <strong>der</strong> Karbonat-Test durchzuführen, mit dem sich Calciumkarbonat (Calcit und Aragonit) von<br />
an<strong>der</strong>en, in <strong>der</strong>ber Form zum Verwechseln ähnlichen Mineralen unterscheiden lässt. Mit einem Tropfen verdünnter<br />
Salzsäure beginnen Calcit und Aragonit lebhaft zu schäumen, Dolomit, Quarz o<strong>der</strong> Gips dagegen nicht.<br />
Röntgenographische Verfahren: Für genaue qualitative Bestimmungen, vor allem von sehr kleinen Mineralen in<br />
Gesteinen, werden heute vor allem unterschiedliche röntgenographische Verfahren verwendet. Meist werden fein<br />
gemahlene Mineral- und Gesteinspulver mit einem Röntgenstrahl beleuchtet und die Beugungsmuster des in<br />
unterschiedliche Richtungen reflektierten Röntgenlichtes untersucht. Diese Methoden sind alle aufwändig und<br />
setzen voraus, dass man über entsprechende Geräte verfügt.<br />
Polarisationsmikroskopie: Eine Methode, die eine quantitative und qualitative Bestimmung auch von kleinen<br />
Mineralkörnern in Gesteinen erlaubt, ist die Polarisationsmikroskopie von Dünn- und Anschliffen. Bei Anschliffen<br />
wird die zu untersuchende Gesteinsprobe angesägt und die Fläche plangeschliffen und poliert. Man untersucht<br />
sie unter Auflicht in einem Polarisationsmikroskop. Dünnschliffe stellt man aus dem Anschliff eines Gesteins her,<br />
den man auf eine Glasplatte klebt und so lange wegschleift, bis eine hauchdünne Gesteinsscheibe auf dem Glas<br />
übrig ist. Diese kann man mit polarisiertem Licht durchstrahlen und im Polarisationsmikroskop untersuchen.<br />
Anhand <strong>der</strong> Formen, Strukturen und des Verhaltens im polarisierten Licht lassen sich auch sehr kleine Minerale<br />
zuverlässig bestimmen.<br />
3.4 Gesteinsbildende und in Gesteinen häufig vorkommende Minerale<br />
Heute sind etwa 3000 Mineralarten bekannt. Nur eine Handvoll Mineralarten ist auf <strong>der</strong> Erdoberfläche wirklich<br />
häufig, die sog. gesteinsbildenden Mineralien. Das sind vor allem – mit weitem Abstand – Feldspäte und<br />
Quarz, dann Pyroxene und Amphibole, Glimmer, Tonminerale, Granat, Olivin, Serpentin, Calcit und Dolomit.<br />
Diese Mineralarten treten als Hauptgemengteile von häufigen Gesteinen auf. Die meisten an<strong>der</strong>en Minerale<br />
kommen entwe<strong>der</strong> nur als Nebengemengteile <strong>der</strong> wichtigsten Gesteine vor o<strong>der</strong> sind recht selten und nur an ganz<br />
wenigen, beson<strong>der</strong>en Plätzen, etwa in Lagerstätten, konzentriert. Im Folgenden sind einige beson<strong>der</strong>s wichtige<br />
Minerale bzw. Mineralgruppen kurz beschrieben, die gesteinsbildend auftreten o<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s häufig in<br />
Gesteinen vorkommen:<br />
3.4.1 Elementminerale<br />
Elementminerale sind in <strong>der</strong> Natur in reiner Form vorkommende Elemente. In Gesteinen kommen nur Graphit und<br />
Schwefel häufiger vor.<br />
Schwefel – S<br />
Härte 2, Dichte 2,0; Strichfarbe weiß.<br />
Meist als feine Kristallnädelchen o<strong>der</strong> in <strong>der</strong>ben Massen, gelb.
8<br />
Entsteht vor allem in jungen Vulkangebieten (Solfataren). Wichtiger Rohstoff für die chemische Industrie. Bei <strong>der</strong><br />
Oxidation an <strong>der</strong> Erdoberfläche entsteht schwefelige Säure. Sekundär kann wasserlöslicher Gips in Gesteinen<br />
entstehen, die Karbonate enthalten!<br />
Graphit – C<br />
Härte 1, Dichte 2,2; Strichfarbe schwarz.<br />
Meist als fein verteilte Schüppchen in metamorphen Gesteinen vorkommend; färbt diese tief schwarz. Entsteht<br />
meist durch Metamorphose aus organischen Materialien. Graphit wirkt auf Klüften und Schieferungsflächen im<br />
Gestein als Gleitmittel und för<strong>der</strong>t daher Kriechbewegungen und Rutschungen.<br />
3.4.2 Sulfide<br />
Sulfide sind einfache Verbindungen von Metallen mit Schwefel. In Gesteinen kommen nur Pyrit und Kupferkies<br />
häufiger vor, meist in fein verteilter Form.<br />
Pyrit – FeS 2<br />
Härte 6-6½, Dichte 5,1; Strichfarbe schwarz.<br />
Oft in messinggelben, metallisch glänzenden, <strong>der</strong>ben Massen, Knollen o<strong>der</strong> würfelförmigen Kristallen. Entsteht<br />
unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Kommt fein verteilt in vielen Magmatiten und Metamorphiten, vor<br />
allem aber in bituminösen Sedimentgesteinen und zusammen mit Kohle vor. Früher mit Stahl und Zun<strong>der</strong> Bestandteil<br />
<strong>der</strong> Feuerzeuge. Bei seiner Oxidation an <strong>der</strong> Erdoberfläche entsteht schwefelige Säure. Sekundär kann<br />
wasserlöslicher Gips in Gesteinen entstehen, die sowohl Sulfide als auch Karbonate enthalten (z.B. in bituminösen<br />
Mergeln o<strong>der</strong> Kalken!).<br />
Kupferkies (Chalkopyrit) – CuFeS 2<br />
Härte 3½-4, Dichte 4,2; Strichfarbe schwarz.<br />
Oft in messinggelben, metallisch glänzenden, <strong>der</strong>ben Massen, Krusten o<strong>der</strong> Knollen. Farbe dunkler als die von<br />
Pyrit, mit bunten Anlauffarben. Häufig in hydrothermalen Gängen (oft gemeinsam mit Pyrit) o<strong>der</strong> fein verteilt in<br />
basischen Tiefengesteinen und manchen Sedimentgesteinen. Als wichtigstes Kupfererz gesucht. Bei seiner Oxidation<br />
an <strong>der</strong> Erdoberfläche entsteht schwefelige Säure, betonaggressiv, siehe oben.<br />
Bleiglanz (Galenit) – PbS<br />
Härte 2½, Dichte 7,5; Strichfarbe grauschwarz.<br />
Dunkelgraue, metallisch glänzende, würfelige Kristalle, spaltbar; oft als <strong>der</strong>be, spätige Massen. Häufig in hydrothermalen<br />
Gängen. Kommt fast immer gemeinsam mit Quarz, Bleiglanz und manchmal auch Schwerspat vor. Als<br />
wichtigstes Bleierz gesucht. Bei <strong>der</strong> Oxidation an <strong>der</strong> Erdoberfläche entsteht schwefelige Säure (betonaggressiv!),<br />
siehe oben.<br />
Zinkblende – ZnS<br />
Härte 3½-4, Dichte 4,0; Strichfarbe hellgelb bis hellbraun.<br />
Glänzende Kristalle, spaltbar; meist jedoch als gelbbraune bis dunkelbraune, spätige, <strong>der</strong>be Massen. Häufig in<br />
hydrothermalen Gängen, kommt fast immer gemeinsam mit Quarz, Bleiglanz und manchmal auch Schwerspat<br />
vor. Als wichtigstes Zinkerz gesucht. Bei <strong>der</strong> Oxidation an <strong>der</strong> Erdoberfläche entsteht schwefelige Säure<br />
(betonaggressiv!), siehe oben.<br />
3.4.3 Halogenide<br />
Halogenide sind Verbindungen von Metallen mit Halogenen. Gesteinsbildend tritt nur Steinsalz auf.<br />
Steinsalz (Halit) – NaCl<br />
Härte 2, Dichte 2,1; Strichfarbe weiß.<br />
Durchsichtige Kristalle, spaltbar, mit würfelförmigen Spaltkörpern; meist als weißliche, gelbliche o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>sfarbige,<br />
körnige Massen. Kommt oft gemeinsam mit Gips und Ton vor, meist geschichtet. Entsteht durch Eindampfung<br />
unter aridem Klima. Große Steinsalzvorkommen werden zur Speisesalzgewinnung und als Rohstoff für die<br />
chemische Industrie abgebaut. Steinsalz kann unter Druck bruchlos deformiert werden und ist in hohem Maße<br />
wasserlöslich (Verkarstung!).
9<br />
Fluorit (Flussspat) – CaF 2<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 4, Dichte 3,18; Strichfarbe weiß.<br />
Durchsichtige, oft würfelige Kristalle, spaltbar, mit oktaedrischen Spaltkörpern; meist als weiße, bläuliche, grünliche<br />
o<strong>der</strong> violette, körnige Massen. Häufig in hydrothermalen Gängen, kommt fast immer gemeinsam mit Quarz<br />
und Calcit vor. Als wichtiges Flussmittel in <strong>der</strong> Hüttentechnik, <strong>der</strong> Optik und in <strong>der</strong> Fluor-Chemie genutzt.<br />
3.4.4 Oxide und Hydroxide<br />
Oxide und Hydroxide sind Verbindungen von Metallen mit Sauerstoff o<strong>der</strong> Hydroxyl-Komplexen. In Gesteinen<br />
sind nur Magnetit, Hämatit und Limonit häufiger, meist in fein verteilter Form; nur Quarz ist gesteinsbildend.<br />
Magnetit – Fe 3 O 4<br />
Härte 5½-6, Dichte 5,0; Strichfarbe schwarz.<br />
Dunkelgraue, stumpf metallisch glänzende, oktaedrische, magnetische Kristalle; oft als <strong>der</strong>be o<strong>der</strong> körnige Massen.<br />
Entsteht auf sehr unterschiedliche Weise. Primär häufig fein verteilt in basischen Magmatiten; ist sekundär in<br />
Form von Körnchen in Sanden und Kiesen angereichert (sog. "Seifen"; z.B. dunkle Streifen in Küstensanden!).<br />
Große Vorkommen als wichtigste Eisenerze genutzt.<br />
Hämatit (Eisenglanz, Eisenglimmer etc.) – Fe 2 O 3<br />
Härte 6½, Dichte 5,1; Strichfarbe dunkelrot bis rotbraun.<br />
Als grauviolette o<strong>der</strong> stahlgraue, metallisch glänzende Schüppchen (dünne Splitter blutrot durchscheinend) o<strong>der</strong><br />
rötliche bis braunschwarze, <strong>der</strong>be, teilweise auch erdige Massen. Entsteht auf sehr unterschiedliche Weise. Fein<br />
verteilt für die Rotfärbung vieler Gesteine verantwortlich (z.B. <strong>der</strong> Buntsandstein). Angereichert in tropischen Lateritböden.<br />
Als erdiger "Rötel" wichtiges Pigment. Große Vorkommen als wichtige Eisenerze gesucht.<br />
Limonit (Brauneisen) – FeOOH+H O 2<br />
Härte 5, Dichte 4,3; Strichfarbe ockergelb bis dunkelbraun.<br />
Als ockergelbe, oft rostfarbene o<strong>der</strong> dunkelbraune, <strong>der</strong>be, teilweise auch erdige Massen; wasserhaltig. Entsteht<br />
auf sehr unterschiedliche Weise. Fein verteilt für die Braunfärbung vieler Gesteine verantwortlich. Als erdiger<br />
"Ocker" wichtiges Pigment. Angereichert in Böden, vor allem in tropischen Lateriten. Größere Vorkommen als<br />
wichtige Eisenerze genutzt.<br />
Quarz – SiO 2<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 7, Dichte 2,65; Strichfarbe weiß.<br />
Kommt in einer großen Zahl ganz unterschiedlicher Gittermodifikationen und Varietäten vor; ist eines <strong>der</strong> häufigsten<br />
Minerale. Entsteht auf sehr unterschiedliche Weise. Primär eines <strong>der</strong> wichtigsten Gemengteile von vielen<br />
magmatischen und metamorphen Gesteinen. Sekundär in vielen Sanden und klastischen Gesteinen angereichert.<br />
Große Vorkommen von reinem Quarz werden für die Keramik-, Glas- und Baustoffindustrie abgebaut.<br />
a) Bergkristall: durchsichtige sechsseitige Säulen, die in Pyramiden enden und wie Glas brechen; meist hydrothermal<br />
auf Klüften. Schwärzliche Varietäten als Rauchquarz, violette als Amethyst, rosa gefärbte als Rosenquarz<br />
bezeichnet; manchmal als Edelstein genutzt.<br />
b) Gangquarz ("Milchquarz"): <strong>der</strong>be o<strong>der</strong> körnige, weißliche Füllung hydrothermaler Gänge.<br />
c) Feuerstein: rundliche, nierenförmige o<strong>der</strong> plattige, grau o<strong>der</strong> bräunlich gefärbte Knollen in Kalkstein, muschelig<br />
brechend. Ist aus wasserhaltigen Gelen entstanden. Wurde in <strong>der</strong> Steinzeit zu Werkzeugen verarbeitet.<br />
Korund – Al 2 O 3<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 9, Dichte 4,0; Strichfarbe weiß.<br />
Meist tonnenförmige Kristalle mit Glasglanz, durchsichtig o<strong>der</strong> trüb, farblos o<strong>der</strong> in ganz unterschiedlichen Farben.<br />
Kommt primär meist in Form von fein verteilten Körnern in manchen Plutoniten und Metamorphiten vor; kann<br />
sekundär in Sanden angereichert sein. Größere Vorkommen werden als Schleifmittel (Schmirgel) genutzt; rot und<br />
blau gefärbte Varietäten (Rubin und Saphir) als Edelsteine geschätzt, wenn sie klar und durchsichtig sind.<br />
Korundhaltige Gesteine wirken auf Werkzeuge in hohem Maße abrasiv!<br />
3.4.5 Karbonate<br />
Karbonate sind Verbindungen von Metallen mit Karbonat-Komplexen. Gesteinsbildend treten nur Calcit und<br />
Dolomit auf.<br />
Calcit (Kalkspat) – CaCO 3<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)
10<br />
Härte 3, Dichte 2,71; Strichfarbe weiß.<br />
Durchsichtige, gelblich- o<strong>der</strong> weißlich-trübe Kristalle; vollkommen spaltbar, mit rhomboedrischen Spaltkörpern;<br />
doppelbrechend (nur bei wasserklaren Kristallen sichtbar!). Meist als weißliche, graue, gelbliche o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>sfarbige,<br />
körnige o<strong>der</strong> dichte Massen. Dem Dolomit zum Verwechseln ähnlich, schäumt aber mit verdünnter Salzsäure!<br />
Entsteht auf sehr unterschiedliche Weise, oft aus Schalen von Organismen. Verbreitet als Füllung von<br />
Klüften und in hydrothermalen Gängen (gemeinsam mit an<strong>der</strong>en Mineralien). Große Vorkommen von reinem<br />
Kalkstein werden als Baustoffe gewonnen. Calcit kann unter sehr hohem Druck bruchlos deformiert werden.<br />
Calcit ist wasserlöslich (Verkarstung!), beeinflusst die Härte des Trinkwassers und den pH-Wert <strong>der</strong> Böden.<br />
Dolomit (Dolomitspat) – CaMg(CO 3 ) 2<br />
Härte 3½-4, Dichte 2,9; Strichfarbe weiß.<br />
Durchsichtige (selten), gelblich- o<strong>der</strong> weißlich-trübe Kristalle; spaltbar, mit rhomboedrischen Spaltkörpern. Meist<br />
als weißliche, gelbliche, graue o<strong>der</strong> bräunliche, körnige o<strong>der</strong> dichte Massen. Dem Calcit oft zum Verwechseln<br />
ähnlich, schäumt aber mit verdünnter Salzsäure nicht! Entsteht auf sehr unterschiedliche Weise, letztlich oft aus<br />
Schalen von Organismen. Verbreitet als Füllung von Klüften und in hydrothermalen Gängen (gemeinsam mit<br />
an<strong>der</strong>en Mineralien). Große Vorkommen reinen Dolomits werden mitunter zur Herstellung feuerfester Materialien<br />
abgebaut. Dolomit ist wasserlöslich (Verkarstung!), beeinflusst Härte des Trinkwassers und pH-Wert <strong>der</strong> Böden.<br />
3.4.6 Sulfate<br />
Sulfate sind Verbindungen von Metallen mit Sulfat-Komplexen. Gesteinsbildend nur Gips und Ahydrit.<br />
Gips (Selenit) – CaSO 4<br />
. 2H2 O<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 2, Dichte 2,32; Strichfarbe weiß.<br />
Durchsichtige, bräunlich-, gelblich- o<strong>der</strong> weißlich-trübe Kristalle; oft als Zwillinge ausgebildet; spaltbar in Plättchen<br />
mit parallelogrammförmigen Umrissen. Meist als weißliche, graue, gelbliche, körnige o<strong>der</strong> dichte Massen. In <strong>der</strong>ber<br />
Form Calcit und Dolomit zum Verwechseln ähnlich, ist jedoch viel weicher als diese! Entsteht primär durch<br />
Eindampfung unter aridem Klima und kommt dann oft gemeinsam mit Ton und Anhydrit, manchmal auch mit<br />
Steinsalz vor. Kann durch Zutritt von Sauerstoff sekundär in Gesteinen entstehen, die sowohl Carbonate als auch<br />
Sulfide enthalten (z.B. in bituminösen Mergeln o<strong>der</strong> Kalken!). Größere Vorkommen als Rohstoff für die Baustoff-<br />
Industrie gesucht. Ist wasserlöslich (Verkarstung!) und beeinflusst die Qualität des Trinkwassers und <strong>der</strong> Böden.<br />
Anhydrit – CaSO 4<br />
Härte 3-4, Dichte 2,9; Strichfarbe weiß.<br />
Meist als hell- bis dunkelgraue, körnig-spätige o<strong>der</strong> dichte Massen. In <strong>der</strong>ber Form Calcit, Dolomit und Gips zum<br />
Verwechseln ähnlich, ist jedoch schwerer und/o<strong>der</strong> härter als diese! Entsteht durch Eindampfung unter aridem<br />
Klima. Durch Wasseraufnahme manchmal teilweise in Gips umgewandelt und kommt gemeinsam mit Ton, Dolomit,<br />
Gips und Steinsalz vor. Ist wasserlöslich (Verkarstung!) und beeinträchtigt die Qualität des Trinkwassers.<br />
Anhydrit ist quellfähig und baut bei Kontakt mit Wasser extreme Quelldrucke auf; bei Tiefbaumaßnahmen ein<br />
großes Problem.<br />
Baryt (Schwerspat) – BaSO 4<br />
Härte 3-3½, Dichte 4,5; Strichfarbe weiß.<br />
Meist durchscheinend-trübe o<strong>der</strong> weiße, tafelige o<strong>der</strong> blättrige, vollkommen spaltbare Kristalle. In <strong>der</strong>ber Form<br />
Calcit und Dolomit ähnlich, jedoch deutlich schwerer. Verbreitet als Füllung von hydrothermalen Gängen, oft<br />
gemeinsam mit sulfidischen Erzen. Baryt ist ein gesuchter Rohstoff für die Papier-, Keramik- und Textilindustrie.<br />
Außerdem spielt er als Beton-Zuschlagsstoff (Schwerbeton) im Strahlenschutz eine wichtige Rolle.<br />
3.4.7 Phosphate<br />
Phosphate sind Verbindungen von Metallen mit Phosphat-Komplexen. Von den meist recht seltenen Phosphaten<br />
kommt nur <strong>der</strong> Apatit in Tiefengesteinen und manchen Sedimenten häufiger vor.<br />
Apatit (Phosphorit) – Ca 5 [(F,Cl,OH) (PO 4 ) 3 ] (Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 5, Dichte 3,15; Strichfarbe weiß.<br />
Als bräunliche o<strong>der</strong> schwärzliche, <strong>der</strong>be Krusten und Knollen in Sedimentgesteinen, auch als unterschiedlich<br />
gefärbte, stängelige Kristall-Aggregate in hydrothermalen Gängen. Vor allem als fein verteilte Kriställchen in sau-
11<br />
ren Tiefengesteinen. Größere Vorkommen als Rohstoffe für die Düngemittel-Industrie gesucht. Beeinflusst die<br />
Bodenfruchtbarkeit.<br />
3.4.8 Silikate<br />
Silikate sind Verbindungen von Metallen mit Silikat-Komplexen. Die Silikate sind die Stoffklasse mit den meisten<br />
Mineralarten. Der Grundbaustein aller Silikate ist ein Tetrae<strong>der</strong> aus 4 Sauerstoffatomen, die ein Siliziumatom<br />
einschließen. Je nachdem, wie diese SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong> im Gitter angeordnet und untereinan<strong>der</strong> verbunden sind<br />
(über gemeinsame Sauerstoffatome an den Ecken, nicht jedoch über Kanten o<strong>der</strong> Flächen), unterscheidet man:<br />
3.4.8 a) Inselsilikate<br />
Bei Inselsilikaten ist das Gitter aus einzelnen SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong>n und Metallionen aufgebaut. Nur Minerale <strong>der</strong><br />
Olivin- und Granat-Gruppe treten in manchen magmatischen und metamorphen Gesteinen gesteinsbildend auf.<br />
Olivin – (Mg,Fe) 2 [SiO 4]<br />
Härte 6½-7, Dichte 3,0-4,0; Strichfarbe weiß.<br />
Glasig durchscheinende, flaschengrüne Körner, oft fein verteilt in basischen Vulkaniten und Tiefengesteinen;<br />
treten manchmal in Form von körnigen Massen auf. Wegen ihres Eisengehaltes verwittern olivinhaltige Gesteine<br />
rostig. Klare, große Kristalle als Edelsteine (Peridot) begehrt.<br />
Granat – (Mg,Fe,Mn,Ca) 3 (Al,Fe,Cr) 2 [SiO 4 ] 3<br />
Härte 6½-7½, Dichte 3,5-4,2; Strichfarbe weiß.<br />
Als Granat-Reihe werden Mineralien (Grossular, Almandin, Pyrop etc.) ganz unterschiedlicher Zusammensetzung,<br />
aber mit ähnlichem Aussehen bezeichnet. Meist ziemlich isometrische, stecknadelkopf- bis erbsengroße,<br />
seltener faustgroße Kristalle (Ikosidodekae<strong>der</strong>) mit Glasglanz, durchscheinend bis trüb, bröckelig brechend, oft<br />
rotbraun bis tiefrot, seltener auch farblos o<strong>der</strong> grün. Granate sind vor allem ein wichtiges Gemengteil vieler<br />
Metamorphite, z.B. von Glimmerschiefern. Sekundär gelegentlich in Sanden angereichert. Manchmal als Schleifmittel<br />
gewonnen. Klare Varietäten roter Granate werden als Edelsteine verwendet. Wegen ihrer Härte wirken<br />
Granate, die oft in sehr weichen Glimmerschiefern vorkommen, auf Werkzeuge stark abrasiv.<br />
Turmalin – (Na,Ca) (Mg,Fe,Li) 3 (Al,Mg) 6 [(OH) 4 (BO 3 ) Si 6 O 18 ]<br />
Härte 7-7½, Dichte 3,0-3,25; Strichfarbe weiß.<br />
Als Turmaline werden Mineralien unterschiedlicher Zusammensetzung bezeichnet, die meist säulige o<strong>der</strong> stengelige,<br />
häufig ziemlich große Kristalle, oft mit abgerundet-dreieckigem Querschnitt bilden. Sie besitzen Glasglanz,<br />
sind schwarz o<strong>der</strong> bräunlich, aber manchmal auch klar-durchsichtig, farblos, rot o<strong>der</strong> grün. Turmaline finden sich<br />
in manchen Tiefengesteinen, vor allem aber in extrem grobkörnigen Pegmatit-Gängen zusammen mit Quarz und<br />
Feldspat. Turmalinkristalle verwachsen gern zu garbenartigen Aggregaten ("Turmalin-Sonnen"). Fe-reiche,<br />
schwarze Turmaline werden als Schörl, Mg-reiche bräunliche als Dravit bezeichnet. Li-reiche, klare, oft grünlich<br />
bis violett gefäbte Turmaline sind Edelsteine. Turmalin wirkt auf Werkzeuge stark abrasiv.<br />
Topas – Al 2 [(F,OH) SiO 4 ]<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 8, Dichte 3,5; Strichfarbe weiß.<br />
Die kurzsäuligen, vollkommen spaltbaren, oft ziemlich großen Topaskristalle sind meist durchsichtig und farblos,<br />
manchmal auch unterschiedlich gefärbt und besitzen Glasglanz. Topase finden sich gelegentlich in hydrothermalen<br />
Gängen, vor allem aber in sehr grobkörnigen Pegmatit-Gängen zusammen mit Turmalin, Quarz und Feldspat.<br />
Sekundär in bestimmten Sanden und Kiesen angereichert. Klare Topas-Kristalle sind Edelsteine, gelegentlich<br />
auch als kratzfeste Topas-„Gläser“ für teure Armbanduhren verwendet. Wirkt auf Werkzeuge stark abrasiv.<br />
3.4.8 b) Ketten- und Bandsilikate<br />
Bei Ketten- und Bandsilikaten ist das Gitter aus Ketten und Doppelketten von SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong>n aufgebaut. Nur<br />
Minerale <strong>der</strong> Pyroxen- und Amphibol-Gruppe treten in bestimmten magmatischen und metamorphen Gesteinen<br />
gesteinsbildend auf.<br />
Pyroxene (Augite) – (Ca,Mg,Fe,Na,Al) [Si 2 O 6 ]<br />
Härte 5½-6½, Dichte 3,3; Strichfarbe weiß.<br />
Zur Pyroxen-Gruppe werden Mineralien (Diopsid, Augit, Spodumen, Hypersthen etc.) ganz unterschiedlicher<br />
Zusammensetzung, aber ähnlicher Struktur (SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong> zu Einfachketten verknüpft) gerechnet. Daraus resultieren<br />
teilweise verwandte Eigenschaften, etwa das verbreitete Auftreten säuliger, stängeliger o<strong>der</strong> nadeliger
12<br />
Kristalle mit Glasglanz und die Spaltbarkeit in 2 Richtungen parallel zur Hauptachse dieser Kristalle, vielfach mit<br />
Prismen als Spaltkörper, die einen rechteckigen Grundriss haben. Die meisten Pyroxene sind undurchsichtig und<br />
schwärzlich, durchsichtige und unterschiedlich gefärbte Kristalle sind selten. Pyroxene sind überaus wichtige,<br />
dunkle Gemengteile vor allem von basischen Magmatiten und Metamorphiten. Klare Varietäten werden mitunter<br />
als Edelsteine verwendet. Wirken auf Werkzeuge stark abrasiv.<br />
Amphibole (Hornblenden) – (Ca,Mg,Fe,Na,Al) 7 [OH Si 4 O 11 ] 2<br />
Härte 5½-6, Dichte 2,9-3,3; Strichfarbe weiß.<br />
Zur Hornblende-Gruppe werden Minerale (Strahlstein, Gemeine Hornblende, Glaukophan etc.) ganz unterschiedlicher<br />
Zusammensetzung, aber ähnlicher Struktur (SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong> zu Doppelketten verknüpft) gerechnet.<br />
Daraus resultieren teilweise verwandte Eigenschaften, etwa das verbreitete Auftreten säuliger, stängeliger o<strong>der</strong><br />
nadeliger Kristallformen mit Glasglanz und die Spaltbarkeit in 2 Richtungen parallel zur Hauptachse dieser Kristalle,<br />
vielfach mit Prismen als Spaltkörper, die einen rautenförmigen Grundriss besitzen. Die meisten Amphibole<br />
sind undurchsichtig und schwärzlich-grün bis hellgrün. Hornblenden sind überaus wichtige, dunkle Gemengteile<br />
vor allem in Metamorphiten und Magmatiten. Bestimmte Amphibole (z.B. Strahlstein) sind vor allem in Glimmerschiefern<br />
auffällig, wo sie zu garbenartigen Aggregaten verwachsen. Wegen ihrer Härte wirken Amphibole, die oft<br />
in weichen Glimmerschiefern vorkommen, auf Werkzeuge stark abrasiv. Eingeatmeter Staub des faserig wachsenden<br />
Tremolit-Asbests ist sehr ungesund (Asbestose!).<br />
3.4.8 c) Netz- o<strong>der</strong> Schichtsilikate<br />
Bei Netz- o<strong>der</strong> Schichtsilikaten ist das Gitter aus Stapeln schichtförmig vernetzter SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong> aufgebaut.<br />
einige Netzsilikate treten in Sedimenten sowie magmatischen und metamorphen Gesteinen gesteinsbildend auf.<br />
Serpentin (Blätterserpentin, Antigorit) – Mg 6 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]<br />
Härte 3-4, Dichte 2,6; Strichfarbe weiß.<br />
Serpentin tritt meist in Form schwärzlicher, dunkelgrüner, dunkelroter o<strong>der</strong> rot-grün-geflammter, <strong>der</strong>ber Massen<br />
(Serpentinit) auf, die oft hellgrün gefärbte, wachsartig schimmernde Kluftflächen besitzen. Serpentinite kommen<br />
sehr oft zusammen mit Olivin vor und enthalten Klüfte mit Talk o<strong>der</strong> Serpentin-Asbest. Serpentin-Asbest (Faserserpentin,<br />
Chrysotil) ist chemisch gesehen mit dem Blätterserpentin identisch, hat aber eine an<strong>der</strong>e Struktur. Tritt<br />
in Form faseriger, manchmal filz- o<strong>der</strong> wolleähnlicher Aggregate auf, oft als Füllung von Klüften in Serpentiniten.<br />
Eingeatmeter Staub des Serpentin-Asbests ist sehr gefährlich (Asbestose!).<br />
Talk – Mg 3 [(OH) 2 Si 4 O 10 ]<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 1, Dichte 2,7-2,8; Strichfarbe weiß.<br />
Talk tritt oft in Form weißlicher, cremefarbener o<strong>der</strong> grünlicher, <strong>der</strong>ber Massen auf (Speckstein), manchmal<br />
zusammen mit Calcit. Hauptgemengteil in manchen Schiefern (Talkschiefer). In olivin- und serpentinhaltigen<br />
Gesteinen ist Talk auf Klüften häufig. Reiner Talk wird in Form von Speckstein gewonnen und als feuerfestes<br />
Material verwendet; gemahlen als Pu<strong>der</strong> (Talkum) genutzt. Auf Klüften wirkt Talk als Gleitmittel; för<strong>der</strong>t daher<br />
Kriechvorgänge und Rutschungen von Felsmassen.<br />
Muskovit (Hellglimmer) – KAl 2 [(OH,F) 2 AlSi 3 O 11 ]<br />
Härte 2-2,5, Dichte 2,8; Strichfarbe weiß.<br />
Glimmermineral mit glasklar durchsichtigen und silbrig glänzenden Kristallen („Katzensilber“), in Form sechseckiger<br />
Blättchen o<strong>der</strong> kurzsäuliger Prismen mit sechseckigem Querschnitt; nur in einer Richtung vollkommen spaltbar.<br />
Wichtiges Gemengteil in vielen Magmatiten, Metamorphiten und Sedimentgesteinen (z.B. Graniten, Gneisen,<br />
Glimmerschiefern). Beson<strong>der</strong>s große Kristalle werden als feuerfeste Materialien verwendet (z.B. Fenster von<br />
Brennöfen).<br />
Biotit (Dunkelglimmer) – K(Mg,Fe) 3 [(OH) 2 (Al,Fe) Si 3 O 10 ]<br />
Härte 2,5-3, Dichte 3,0; Strichfarbe weiß.<br />
Glimmermineral mit bräunlich durchscheinenden o<strong>der</strong> schwärzlich undurchsichtigen, golden glänzenden Kristallen<br />
(„Katzengold“), in Form sechseckiger Blättchen o<strong>der</strong> kurzsäuliger Prismen mit sechseckigem Querschnitt; nur in<br />
einer Richtung vollkommen spaltbar. Wichtiges Gemengteil in vielen magmatischen und metamorphen Gesteinen<br />
(z.B. Granit, Gneis o<strong>der</strong> Glimmerschiefer). Wegen des Eisengehaltes verwittern biotithaltige Gesteine rostig.<br />
Tonminerale (z.B. Illit, Kaolinit o<strong>der</strong> Montmorillonit)<br />
Zur Tonmineral-Gruppe werden Schichtsilikate ganz unterschiedlicher, oft komplizierter Zusammensetzung<br />
gerechnet; sie haben teilweise komplex aufgebaute Einzelschichten. Allen ist gemeinsam, dass sie nur in erdigen,
13<br />
<strong>der</strong>ben Massen auftreten und Einzelkristalle besitzen, die gewöhnlich erst im Elektronenmikroskop sichtbar werden.<br />
Sie entstehen durch Zersetzung an<strong>der</strong>er Silikate (vor allem Feldspäte) und sind ein wichtiger Bestandteil von<br />
Böden und Sedimentgesteinen (Tone, Tonsteine, Mergel, Schiefertone). Viele Tonminerale können große Mengen<br />
von Wasser aufnehmen (quellen). Daher sind Tone im feuchten Zustand knetbar und fühlen sich seifig an,<br />
schrumpfen aber beim Austrocknen und bekommen Risse. Einige haben ein hohes Schadstoffrückhaltevermögen<br />
o<strong>der</strong> können spontan ihre Konsistenz än<strong>der</strong>n (Thixotropie). Tone mit beson<strong>der</strong>en Eigenschaften sind begehrte<br />
Rohstoffe und in <strong>der</strong> Bauindustrie, im Deponiebau, in <strong>der</strong> chemischen Industrie und als keramische Rohstoffe<br />
vielseitig verwendbar.<br />
Tonhaltige Gesteine machen bei Baumaßnahmen oft Probleme, da sie meist quellfähig, gering belastbar und<br />
extrem rutschungsanfällig sind. Schon dünne Tonzwischenlagen können als Gleitmittel für sonst kaum zum Rutschen<br />
neigende Gesteinsverbände dienen. Wegen ihrer Feinkörnigkeit und dem mitunter sehr hohen Schadstoffrückhaltevermögen<br />
können tonhaltige Gesteine im Deponieuntergrund als natürliche Barriere wirken.<br />
3.4.8 d) Gerüstsilikate<br />
Bei Gerüstsilikaten ist das Gitter aus räumlich vernetzten SiO 4 -Tetrae<strong>der</strong>n aufgebaut. Feldspäte sind in den<br />
meisten magmatischen und metamorphen Gesteinen die wichtigsten gesteinsbildenden Minerale. Feldspatvertreter<br />
(Foide) kommen in einigen magmatischen Gesteinen gesteinsbildend vor.<br />
Orthoklas (Kalifeldspat) – K [AlSi 3 O 8 ]<br />
(Mineral <strong>der</strong> Härteskala!)<br />
Härte 6, Dichte 2,5-2,6; Strichfarbe weiß.<br />
Zu den Alkalifeldspäten werden verschiedene Na-arme Gerüstsilikate <strong>der</strong> Feldspatgruppe gerechnet (Orthoklas,<br />
Sanidin, Adular). Orthoklaskristalle treten meist in Form von Platten o<strong>der</strong> kurzen Prismen auf, sind oft porzellanartig<br />
weiß, gelblich, rötlich o<strong>der</strong> rot gefärbt und trüb. Sie sind in 3 unterschiedlichen Richtungen spaltbar, allerdings<br />
nur in eine Richtung gut. Sie neigen zur Ausbildung von Kristallzwillingen, die man schon mit bloßem Auge<br />
erkennen kann. Orthoklas ist ein wichtiges Gemengteil von vielen magmatischen und metamorphen Gesteinen<br />
(Granit, Syenit, Quarzporphyr, Gneis etc.). Mit die häufigsten gesteinsbildenden Minerale sind Orthoklase. Alle<br />
Feldspäte sind relativ verwitterungsanfällig, werden schnell brüchig und setzen damit die Gesteinsfestigkeit herab.<br />
Plagioklase (Kalknatronfeldspäte) – (Na,Ca) [Al(Al,Si) Si 2 O 8 ]<br />
Härte 6-6½, Dichte 2,6-2,8; Strichfarbe weiß.<br />
Zu den Plagioklasen werden verschiedene Mineralien <strong>der</strong> Feldspatgruppe mit sehr unterschiedlichen Ca- und Na-<br />
Gehalten gerechnet (Albit, Labradorit, Anorthit etc.). Auch die Plagioklase treten meist als platten- o<strong>der</strong> prismenförmige<br />
Kristalle auf, sind meist weißlich o<strong>der</strong> gelblich gefärbt und trüb. Auch sie sind in 3 unterschiedlichen<br />
Richtungen spaltbar, aber nur in eine Richtung gut. Sie neigen nicht dazu Zwillinge zu bilden, die man schon mit<br />
bloßem Auge erkennen könnte. Plagioklase sind wichtige Gemengteile von vielen magmatischen und metamorphen<br />
Gesteinen (Granit, Gabbro, Basalt, Amphibolit etc.). Mit die häufigsten gesteinsbildenden Minerale sind<br />
Plagioklase. Alle Feldspäte sind relativ verwitterungsanfällig, werden schnell brüchig und setzen damit die<br />
Gesteinsfestigkeit herab.
14<br />
Feldspatvertreter (z.B. Nephelin, Leucit etc.)<br />
Viele magmatische Gesteine, etwa bestimmte „Basalte“, enthalten keine Feldspäte, son<strong>der</strong>n an<strong>der</strong>s zusammengesetzte,<br />
helle Gerüstsilikate, die man Feldspatvertreter o<strong>der</strong> Foide nennt. Sie kommen niemals zusammen mit<br />
Quarz, oft aber mit Feldspäten in einem Gestein vor. Die Feldspatvertreter sind beson<strong>der</strong>s verwitterungsanfällig,<br />
werden schnell brüchig und setzen damit die Festigkeit foidhaltiger Gesteine herab.<br />
Tabelle 1. Für Bautechnik, Trinkwasser, Umweltschutz und Gesundheit relevante Mineraleigenschaften<br />
Minerale, aus denen durch Verwitterung schwefelige Säure entsteht:<br />
Schwefel, Pyrit und alle an<strong>der</strong>en Sulfide; aus Karbonaten mit geringen Sulfidanteilen (aber auch aus den karbonatischen<br />
Anteilen von Beton) entsteht durch Säureangriff Gips, dadurch Vermin<strong>der</strong>ung ihrer Festigkeit, Zunahme <strong>der</strong><br />
Löslichkeit und Beeinflussung <strong>der</strong> Chemie des Trinkwassers.<br />
Minerale, die als Schmiermittel dienen:<br />
– selbst wenn Gesteine nur geringe Anteile an diesen Mineralen enthalten, för<strong>der</strong>n sie Hangbewegungen:<br />
Graphit, Tonminerale, Talk und an<strong>der</strong>e Schichtsilikate (wirken als Schmiermittel).<br />
Quellfähige Minerale<br />
viele Tonminerale und beson<strong>der</strong>s Anhydrit (dadurch bei Kontakt mit Wasser bautechnisch ein Problem).<br />
Wasserlösliche Minerale<br />
– alle Gesteine, die im Wesentlichen aus diesen Mineralien bestehen, sind verkarstungsfähig:<br />
Steinsalz (ist in neutralem Wasser löslich, macht Wasser schon in geringen Konzentrationen ungenießbar);<br />
Gips und Anhydrit (machen das Wasser hart und für die Nutzung als Trinkwasser unbrauchbar, enge Grenzwerte);<br />
Calcit und Dolomit (sind nur in saurem Wasser löslich, machen das Wasser hart).<br />
Als Erze gesucht<br />
Magnetit, Hämatit und Limonit (wichtigste Eisenerze);<br />
Bleiglanz (wichtigstes Bleierz);<br />
Zinkblende (wichtigstes Zinkerz);<br />
Kupferkies (wichtigstes Kupfererz).<br />
Als sonstige Rohstoffe gesucht<br />
Graphit (elektisch leiten<strong>der</strong> Schmierstoff, Bleistiftherstellung, Hütten- und Reaktortechnik);<br />
Schwefel (Rohstoff für Schwefelsäure- und Gummi-Herstellung);<br />
Pyrit (Rohstoff für Schwefelsäure-Herstellung);<br />
Fluorit (Flussmittel in <strong>der</strong> Hüttentechnik, Linsensysteme für Infrarot-Optik, Rohstoff für Fluor-Chemie);<br />
Hämatit und Limonit (Rötel und Ocker als Pigmente);<br />
Baryt (Rohstoff für Papier-, Keramik- und Textilindustrie, Bautechnik, Beton-Zuschlagstoff, Strahlenschutz);<br />
Apatit (Dünger, Rohstoff für Phosphor-Chemie);<br />
Quarz (Glasherstellung, Keramikindustrie);<br />
Korund, Diamant und Granat (Schleifmittel, Bohrtechnik, Schmuck);<br />
Topas (als „Gläser“ für teure Armbanduhren);<br />
Talk (Pu<strong>der</strong>herstellung, feuerfestes Material, Isolatoren);<br />
Muskovit (feuerfestes Material, Isolatoren, Sichtfenster von Brennöfen);<br />
bestimmte Tonminerale (Keramik-Rohstoffe, Ionenaustauscher etc.)<br />
Orthoklas (Keramikindustrie, z.B. Magerungsmittel für Porzellanherstellung)<br />
Wirken beson<strong>der</strong>s abrasiv auf Werkzeuge<br />
– selbst wenn Gesteine nur geringe Mengen dieser gesteinsbildenden Minerale enthalten<br />
– falls das nicht erkannt wird, werden Bohrungen, Tunnelvortriebe etc. in diesen Gesteinen viel teuer als erwartet<br />
Korund (Härte 9) – Quarz (Härte 7) – Granat (Härte 6½-7½) – Turmalin (Härte 7-7½) – Topas (Härte 8)<br />
und viele an<strong>der</strong>e beson<strong>der</strong>s harte Silikate.<br />
Beson<strong>der</strong>s gesundheitsschädlich<br />
Quarzstaub (verursacht Staublunge);<br />
Hornblende-Asbest-Staub, vor allem aber Chrysotil-Asbest-Staub (verursacht Asbestose);<br />
Bleiglanz, Zinkblende, Arsenkies o<strong>der</strong> Kupferkies und an<strong>der</strong>e schwermetallhaltige Minerale (wirken toxisch).<br />
3.5 Wichtige Nachschlagewerke und Bestimmungsbücher zur Mineralogie
15<br />
BAYER. GEOL. LANDESAMT (1984): Oberflächennahe Mineralische Rohstoffe von Bayern.– Geologica Bavarica, 86, 563 S.; München.<br />
BÖGEL, H. (1979): Knaurs Mineralienbuch.– 280 S.; München und Zürich (Knaur-Verl.).<br />
DIETRICH, R.V. & SKINNER, B.J. (1984): Die Gesteine und ihre Mineralien.– 357 S.; Thun (Ott-Verl.).<br />
HOCHLEITNER, R., PHILIPSBORN, H. von & WEINER, K.L. (1996): Minerale: Bestimmen nach äußeren Kennzeichen.– 390 S.; Stuttgart<br />
(Schweizerbart-Verl.).<br />
MEDENBACH, O. & SUSSIECK-FORNEFELD, C. (1996): Mineralien.– In: STEINBACH, G. [Hrsg.] (1996), Steinbachs Naturführer, 287 S.;<br />
München (Mosaik Verl.)<br />
MARKL, G. (2004): Mineralien und Gesteine. Eigenschaften, Bildung, Untersuchung.– 355 S.; München (Elsevier / Spektrum-Verl.)<br />
RAMDOHR, K. & STRUNZ H. (1980): Klockmanns Lehrbuch <strong>der</strong> Mineralogie.– 876 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
RÖSLER, H.J. (1991): Lehrbuch <strong>der</strong> Mineralogie.– 5. Aufl. 833 S.; Leipzig (Deutscher Verl. für Grundstoffindustrie / Spektrum-Verl.).<br />
SCHMID, H. & WEINELT, W. (1978): Lagerstätten in Bayern.– Geologica Bavarica, 77, 160 S., 1 Lagerstättenkarte 1:500000; München.<br />
SCHUMANN, W. (1973): Steine und Mineralien.– BLV Bestimmungsbuch, 2. Aufl., 227 S.; München, Bern, Wien (BLV-Verl.).<br />
SEIM, R. (1981): Minerale sammeln und bestimmen.– 379 S.; Melsungen etc. (Neumann-Neudamm-Verl.).<br />
4. PETROLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
Die gesamte Erdoberfläche wird von Gesteinen unterschiedlicher Genese und Zusammensetzung aufgebaut.<br />
Nach ihrer Genese, ihrer Textur und ihrer Zusammensetzung lassen sich Hun<strong>der</strong>te von Gesteinen unterscheiden.<br />
In <strong>der</strong> Petrologie (Gesteinskunde) wird zur Grobglie<strong>der</strong>ung meist eine einfache genetische Einteilung benutzt:<br />
Man unterscheidet Erstarrungsgesteine (Magmatite), die aus Gesteinsschmelzen erstarrt sind, Sedimentgesteine<br />
(Sedimente und Sedimentite), die Ablagerungen von Flüssen, Seen, Meeren, des Eises und des Windes<br />
darstellen, sowie Umwandlungsgesteine (Metamorphite), die unter erhöhten Drucken und/o<strong>der</strong> Temperaturen<br />
aus an<strong>der</strong>en Ausgangsgesteinen (Magmatiten o<strong>der</strong> Sedimenten) hervorgegangen sind.<br />
Darstellung <strong>der</strong> am Aufbau von Gesteinen beteiligten Mineralien im Konzentrationsdreieck: In den meisten<br />
Gesteinen sind mehrere Mineralarten enthalten; es sind sog. Mehrstoffsysteme. Je nach Art und Anteil <strong>der</strong> darin<br />
enthaltenen Minerale, aber auch nach ihrer Genese werden die Gesteine unterschiedlich benannt. Ganz ähnlich<br />
ist das auch mit Speisen, die Mehrstoffsysteme sind. Eine Speise, die aus Schokolade, Rosinen und Nüssen<br />
besteht, wird unterschiedlich benannt, je nachdem, welche und in welchen Anteilen die Stoffe an ihrem Aufbau<br />
beteiligt sind. Man unterscheidet z.B. Milchschokolade, Rosinen, Nüsse, Nussschokolade, Trauben-Nuss-Schokolade,<br />
Florentiner, Nüsse mit Schokoladenüberzug, Rosinen mit Schokoladenüberzug und Studentenfutter.<br />
Außerdem spielt bei <strong>der</strong> Benennung von Speisen nicht nur die Zusammensetzung, son<strong>der</strong>n auch die Art <strong>der</strong><br />
Zubereitung eine wichtige Rolle, also <strong>der</strong>en Genese. Müsli und Porridge bestehen aus den gleichen Zutaten,<br />
werden aber wegen ihrer unterschiedlichen Zubereitung unterschiedlich benannt.<br />
Die graphische Darstellung <strong>der</strong> Anteile <strong>der</strong> am Aufbau von Gesteinen beteiligten Minerale bereitet große Schwierigkeiten,<br />
da in einem herkömmlichen Diagramm nur zwei von einan<strong>der</strong> abhängige Größen darstellbar sind. Deshalb<br />
verwendet man in <strong>der</strong> Petrologie sogenannte Konzentrationsdreiecke als Diagramme, in denen immerhin<br />
Dreistoff-Systeme anschaulich darstellbar sind. Da viele Gesteine mehr als drei Mineralarten enthalten, muss<br />
man diese in einem räumlichen Koordinatensystem (Tetrae<strong>der</strong>) darstellen o<strong>der</strong> einfach welche weglassen, um<br />
ihre Zusammensetzung trotzdem veranschaulichen zu können. Verwendet man sog. Doppeldreiecke, können in<br />
den Fällen, wo sich das Auftreten zweier Mineralgruppen ausschließt (Quarz und Foide), Vierstoffsysteme auch in<br />
<strong>der</strong> Ebene dargestellt werden.<br />
4.1 Erstarrungsgesteine (magmatische Gesteine o<strong>der</strong> Magmatite)
16<br />
Als Magmatite werden Gesteine bezeichnet, die aus natürlichen heißen Gesteinsschmelzen (Magmen) erstarrt<br />
sind. Je nachdem, ob <strong>der</strong> Erstarrungsprozess im Erdinneren o<strong>der</strong> an bzw. nahe <strong>der</strong> Erdoberfläche abgelaufen ist,<br />
unterscheidet man Ergussgesteine (Vulkanite) und Tiefengesteine (Plutonite). Eine Son<strong>der</strong>stellung nehmen<br />
die Ganggesteine ein, bei denen es sich um manchmal nur knapp unter <strong>der</strong> Oberfläche erstarrte, gangförmige<br />
Magmatite handelt. Sie sehen manchmal Tiefengesteinen, oft aber auch den äquivalenten Ergussgesteinen zum<br />
Verwechseln ähnlich.<br />
Die Magmen entstehen im Erdinneren. Bei einer Temperaturzunahme von 3 °C je 100 m (entspricht einer Geothermischen<br />
Tiefenstufe von 33 m) werden schon in 20 km Tiefe Temperaturen von 600 °C, in 40 km Tiefe von<br />
1200 °C erreicht. Die meisten Gesteine beginnen an <strong>der</strong> Erdoberfläche erst bei Temperaturen über 1000 °C zu<br />
schmelzen. Von Experimenten in „Autoklaven“ ist jedoch bekannt, dass sich unter hohen Drucken, wie sie unter<br />
<strong>der</strong> Erdoberfläche in 20 bis 40 km Tiefe tatsächlich herrschen, zudem bei Anwesenheit von Wasser und flüchtigen<br />
Substanzen, <strong>der</strong> Schmelzpunkt von manchen Gesteinen auf unter 600 °C erniedrigen kann. Bei Druckentlastung<br />
können die im Magma gelösten Gase teilweise freigesetzt werden. Diese Magmen-Gas-Gemische sind hoch<br />
mobil, können in höhere Krustenstockwerke aufsteigen und sich entlang von Spalten u.U. bis an die Erdoberfläche<br />
durchzwängen, wo sie schließlich abkühlen und erstarren. Der Vorgang des Magmenaufstiegs ist mit<br />
dem Überschäumen einer Sektflasche gut vergleichbar.<br />
4.1.1 Ergussgesteine (vulkanische Gesteine o<strong>der</strong> Vulkanite)<br />
Als Ergussgesteine werden Magmatite bezeichnet, die aus an o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Erdoberfläche bzw. unter<br />
Wasser erstarrten Gesteinsschmelzen (Magmen) hervorgegangen sind. Sie sind bei atmosphärischem Druck,<br />
aber ziemlich hohen Temperaturen entstanden. Der Erstarrungsprozess läuft dabei vergleichsweise schnell ab<br />
und dauert, je nach <strong>der</strong> Dimension des erstarrenden Gesteinskörpers, gewöhnlich einige Monate, Jahre o<strong>der</strong><br />
Jahrzehnte. Die in <strong>der</strong> Gesteinsschmelze wachsenden Kristalle bleiben daher meist mikroskopisch klein.<br />
Das Auftreten von Ergussgesteinen ist an alten o<strong>der</strong> jungen Vulkanismus gebunden. Vulkane sind die wohl faszinierendsten<br />
geologischen Erscheinungen auf <strong>der</strong> Erde. Aktiven Vulkanismus kann man zwar nicht in Deutschland<br />
selbst, wohl aber im südlichen Italien, auf den Kanaren o<strong>der</strong> auf Island studieren. „Junge“ (tertiäre o<strong>der</strong> quartäre)<br />
Vulkangebiete, in denen oft noch die Vulkane selbst in <strong>der</strong> Landschaft zu erkennen sind, finden sich in<br />
Deutschland u.a. in <strong>der</strong> Eifel, Rhön, im Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg, Kaiserstuhl o<strong>der</strong> im Hegau.<br />
„Alte“ (paläozoische) Vulkangebiete, an die meist nur noch vulkanische Gesteine erinnern, die in Sedimente<br />
eingelagert sind, finden sich in Deutschland u.a. im Frankenwald, Südschwarzwald, Saarland, im Lahntal,<br />
Thüringer Wald o<strong>der</strong> im Harz.<br />
Vulkane bilden sich an Stellen, wo Gesteinsschmelzen an Schwächezonen in <strong>der</strong> Erdkruste – vor allem entlang<br />
von tiefreichenden Störungen – aufsteigen können. Diese Schmelzen stammen letztlich aus tiefen Teilen <strong>der</strong><br />
Erdkruste o<strong>der</strong> gar aus dem oberen Erdmantel, also aus Tiefen von 30 bis mehr als 50 km. Wenige Kilometer<br />
unter <strong>der</strong> Erdoberfläche liegen nicht selten Magmenkammern, die durch vulkanische Gänge in direkter Verbindung<br />
mit den Vulkangebäuden an <strong>der</strong> Erdoberfläche stehen. Im Laufe <strong>der</strong> Zeit kann sich die Zusammensetzung<br />
<strong>der</strong> in diesen Kammern langsam erstarrenden Schmelzen erheblich verän<strong>der</strong>n, da die Magmen teilweise mit dem<br />
Nebengestein entlang <strong>der</strong> Aufstiegswege reagieren können. Bei Ausbrüchen fließen die Gesteinsschmelzen in<br />
Form von Laven an Spalten aus, die sich gewöhnlich an den Flanken <strong>der</strong> Vulkane öffnen. Die zuunterst liegenden<br />
Teile <strong>der</strong> meter- bis dekametermächtigen Lavaströme erstarren meist zu dichten vulkanischen Gesteinen,<br />
die durch Abkühlungsrisse in plattige o<strong>der</strong> säulenförmige Körper (Abson<strong>der</strong>ungen) zerlegt werden können. Die<br />
Oberflächen <strong>der</strong> Lavaströme sind dagegen durch blasenreiche Schaumlaven und Schlacken charakterisiert.<br />
Lavaströme aus kieselsäurereichen, nie<strong>der</strong>temperierten und zähen Schmelzen erstarren nicht selten zu vulkanischen<br />
Gläsern (z.B. Obsidian). Solche und an<strong>der</strong>e extrem saure und niedrig temperierte Schmelzen sind oft so<br />
zäh, dass sie schon in den Aufstiegswegen stecken bleiben und die Eroberfläche gar nicht erreichen o<strong>der</strong> über<br />
dem Schlot mächtige Stau- bzw. Quellkuppen bilden.<br />
Die im Magma gelösten Gase entweichen während <strong>der</strong> Ausbrüche meist über den Vulkanschlot, über dem sich<br />
ein Krater bilden kann. Bei explosionsartiger Entgasung werden Teile <strong>der</strong> Schmelze mitgerissen, ausgeschleu<strong>der</strong>t<br />
und in Form sog. Pyroklastite abgelagert. Durch die plötzliche Druckentlastung werden die Gesteinsschmelzen<br />
durch die gelösten Gase zu blasenreichen Schlacken o<strong>der</strong> feinporigem Bims aufgeschäumt, <strong>der</strong> so leicht sein<br />
kann, dass er auf dem Wasser schwimmt. Wegen <strong>der</strong> schlagartigen Abkühlung <strong>der</strong> Schmelze bestehen Schlacken<br />
und Bims aus Gesteinsglas. Größere Wurfschlacken und zu Stromlinienkörpern geformte vulkanische<br />
Bomben fallen meist nicht weit vom Krater entfernt herunter. Lapilli, vor allem aber die fein zerstäubte Tephra
17<br />
(vulkanische Aschen) werden viel weiter transportiert und u.U. erst viele Kilometer vom Ausbruchszentrum<br />
entfernt abgeregnet. Hier kann sich das Material zu Dekameter dicken (mächtigen), geschichteten vulkanischen<br />
Tuffen anhäufen. Mit heißen Gasen vermischte Wolken glühen<strong>der</strong> Aschen sintern zu festen Gesteinen, die als<br />
Schmelztuffe (Ignimbrite) bezeichnet werden. Die Kegel <strong>der</strong> Stratovulkane bestehen aus Wechselfolgen von<br />
Laven und Pyroklastiten.<br />
Gewöhnlich sind die Mineralkörner von Laven so klein, dass sie sich nur unter dem Mikroskop bestimmen lassen.<br />
In einigen Fällen hat das aufsteigende Magma größere Kristalle mitgebracht, die vorher schon in <strong>der</strong> Magmenkammer<br />
auskristallisiert waren. Die Textur <strong>der</strong>artiger Laven, die aus zentimetergroßen, oft idiomorphen Kristallen,<br />
den Einsprenglingen bestehen, die in einer dichten, feinstkristallinen Grundmasse „schwimmen“, wird als<br />
porphyrisch bezeichnet. Bei älteren Laven ist es nicht immer einfach, auf den ersten Blick zwischen primären<br />
Einsprenglingen und sekundär entstandenen, mineralischen Füllungen von Blasenhohlräumen zu unterscheiden.<br />
Meist jedoch erstarren Laven zu feinkörnigen, dichten, vulkanischen Gesteinen, die – in Abhängigkeit von <strong>der</strong><br />
chemischen Zusammensetzung <strong>der</strong> Gesteinsschmelzen – aus einem Filz unterschiedlicher Mineralarten und /<br />
o<strong>der</strong> Glas aufgebaut sind. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen sauren (extrem kieselsäurereichen, >65%<br />
SiO 2 ), intermediären (etwas weniger kieselsäurereichen, 65-52% SiO 2 ), basischen (relativ kieselsäurearmen,<br />
52-45% SiO 2 ) und ultrabasischen (extrem kieselsäurearmen, mitunter sogar kieselsäurefreien,
18<br />
Melaphyr (Mandelstein)<br />
Als Melaphyre bezeichnet man chemisch und/o<strong>der</strong> mineralogisch verän<strong>der</strong>te, blasenreiche, alte (meist paläozoische),<br />
basische bis intermediäre vulkanische Gesteine von grünlicher, rötlicher o<strong>der</strong> schwärzlicher Farbe. Die<br />
ehemaligen Blasenhohlräume sind sekundär oft mit Calcit, Achat o<strong>der</strong> Zeolithen ausgefüllt. Wenn Melaphyre verwittern,<br />
bleiben diese Füllungen als „Achatmandeln“ übrig. Weit verbreitet z.B. im Saar-Nahe-Gebiet, dem Thüringer<br />
Wald o<strong>der</strong> in den Dolomiten. Als Tiefengesteinsäquivalente gelten manche Gabbros und Diorite. Fast alle<br />
bedeutenden Achatvorkommen sind an Melaphyre gebunden. Nutzung wie beim Basalt.<br />
Andesit (Porphyrit)<br />
Intermediäres, hell- bis dunkelgraues, oft porphyrisches vulkanisches Gestein, das etwa zur Hälfte aus Plagioklas,<br />
daneben aus Pyroxenen, Hornblende und Biotit besteht. Sehr oft sind diese Minerale nicht nur in <strong>der</strong> feinkörnigen<br />
Grundmasse, son<strong>der</strong>n auch als Einsprenglinge zu finden (daher Porphyrite). Die Gesteine sind oft quarzfrei. Als<br />
Tiefengesteinsäquivalente gelten Diorite. Porphyrische Gesteine andesitischer Zusammensetzung sind z.B. im<br />
Paläozoikum des Oslogebietes verbreitet (Rhombenporphyr). Nutzung wie beim Basalt.<br />
Trachyt<br />
Trachyte sind relativ hell gefärbte Vulkangesteine, die v.a. aus Kalifeldspat und Hornblende bestehen. Sie enthalten<br />
Einsprenglinge des wasserklaren Feldspates Sanidin. Da Trachytschmelzen meist überaus zäh sind, bilden<br />
sie oft Quellkuppen o<strong>der</strong> erreichen die Erdoberfläche nicht und bleiben im Vulkanschlot stecken. Der Drachenfels<br />
im Siebengebirge und <strong>der</strong> Puy de Dome in <strong>der</strong> Auvergne bestehen aus Trachyten. Als Tiefengesteinsäquivalente<br />
gelten Syenite. Nutzung wie beim Basalt.<br />
Phonolith<br />
Phonolithe sind relativ hell gefärbte Vulkangesteine, die neben Pyroxenen auch bestimmte Feldspäte und den<br />
Feldspatvertreter Nephelin enthalten. Einsprenglinge des wasserklaren Feldspates Sanidin sind häufig. Da Phonolithschmelzen<br />
gewöhnlich sehr zäh sind, erreichen viele die Erdoberfläche nicht und bleiben in den Vulkanschloten<br />
stecken. Derartige Phonolithstöcke treten z.B. im Kaiserstuhl und im Hegau auf (Hohentwiel, Hohenkrähen).<br />
Tiefengesteinsäquivalente sind nephelinführende Syenite. Nutzung wie beim Basalt.<br />
Tephrit<br />
Als Tephrite bezeichnet man basische bis intermediäre, oft Feldspatvertreter enthaltende Laven, die einen hohen<br />
Anteil von Glas in <strong>der</strong> Grundmasse haben. Häufig sind Nephelin-Tephrite mit idiomorphen Nephelin-Einsprenglingen.<br />
Übergänge zu an<strong>der</strong>en vulkanischen Gesteinen sind häufig, z.B. Phonotephrite. Tephrite sind z.B. in den<br />
mittelitalienischen Vulkangebieten verbreitet. Eine Mischung aus bestimmten Tephrit-Tuffen (Pozzolano) und<br />
Branntkalk war <strong>der</strong> "Naturzement" <strong>der</strong> Römer.<br />
Rhyolith (Quarzporphyr)<br />
Sehr saures, hell gefärbtes, gelbliches, rotes o<strong>der</strong> hellgraues, immer porphyrisches vulkanisches Gestein, das in<br />
typischer Form vor allem aus dem Paläozoikum stammt. Besteht zu etwa gleichen Teilen aus Quarz, Plagioklas<br />
und Alkalifeldspat sowie etwas Biotit. Diese Minerale finden sich nicht nur in <strong>der</strong> feinkörnigen Grundmasse, son<strong>der</strong>n<br />
auch als Einsprenglinge. Quarzporphyr tritt vor allem in Form von Gängen und mächtigen Decken auf, bei<br />
denen es sich größtenteils um Ignimbrite handelt. Da Rhyolithschmelzen meist extrem zäh sind, bilden sie oft<br />
Quellkuppen o<strong>der</strong> erreichen die Erdoberfläche nicht und bleiben in ihren Aufstiegswegen stecken. Rhyolithe son<strong>der</strong>n<br />
selten säulig, meist jedoch in dicken Qua<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Platten ab. Größere Vorkommen in <strong>der</strong> Pfalz, im<br />
Schwarzwald und Thüringer Wald o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Umgebung von Bozen (Bozener Quarzporphyr). Als Tiefengesteinsäquivalente<br />
gelten Granite. Quarzporphyr wird häufig in Steinbrüchen zur Herstellung von Pflastersteinen<br />
und Platten gebrochen.<br />
Obsidian<br />
Sehr saures, glasiges, schwärzliches vulkanisches Glas, das vor allem in Form von kurzen Lavaströmen o<strong>der</strong><br />
Quellkuppen auftritt. Chemisch ist es mit dem Quarzporphyr verwandt, enthält aber nur Glas und keine Kristalle.<br />
Entsteht aus extrem zähen, nicht hoch temperierten, sauren Gesteinsschmelzen durch beson<strong>der</strong>s rasche Abkühlung.<br />
Als Tiefengesteinsäquivalente gelten Granite.Obsidian wird heute gelegentlich als Schmuckstein abgebaut<br />
und war in <strong>der</strong> Steinzeit ein begehrter Rohstoff zur Herstellung von Steinwerkzeugen.
19<br />
Bims (Bimstuff)<br />
Feinporig aufgeschäumtes Obsidianglas, das weiß erscheint. Tritt in Brockenform v.a. in Bimstuffen auf. Manche<br />
Obsidiane verwandeln sich in Bims, wenn man sie mit dem Schweißbrenner über den Schmelzpunkt erhitzt. Weil<br />
isolierte Bimsbrocken trotz hoher Porosität eine sehr geringe Durchlässigkeit besitzen, schwimmen sie auf dem<br />
Wasser. Vorkommen von Bims z.B. in <strong>der</strong> Eifel. Als Tiefengesteinsäquivalente gelten Granite. Bims ist ein<br />
gesuchter Rohstoff, <strong>der</strong> als Füllstoff, Zuschlagstoff für Leichtbeton o<strong>der</strong> als Poliermittel Verwendung findet.<br />
4.1.2 Tiefengesteine (plutonische Gesteine o<strong>der</strong> Plutonite)<br />
Als Tiefengesteine werden Magmatite bezeichnet, die aus wenige bis viele Kilometer unter <strong>der</strong> Erdoberfläche erstarrten<br />
Gesteinsschmelzen (Magmen) hervorgegangen sind. Sie sind gewöhnlich bei hohen Drucken und ziemlich<br />
hohen Temperaturen entstanden. Die meisten Tiefengesteine sind durch Aufschmelzung (Anatexis bis<br />
Diatexis) an<strong>der</strong>er, vordem einmal fester Ausgangsgesteine (Sedimentite, Vulkanite, Metamorphite) in größeren<br />
Tiefen <strong>der</strong> Erdkruste entstanden. Da diese Schmelzen ein vergleichsweise geringes spezifisches Gewicht besitzen<br />
und hoch mobil sind, haben sie die Neigung, in höhere Stockwerke <strong>der</strong> Kruste aufzusteigen, in die dortigen<br />
Gesteine zu intrudieren (einzudringen), diese zu zerbrechen und zu verdrängen. Viele Plutonite enthalten noch<br />
nicht völlig aufgeschmolzene Restbestände <strong>der</strong> Ausgangsgesteine (Xenolithe).<br />
Da die den Intrusionskörper umgebenden Nebengesteine schlechte Wärmeleiter sind, läuft <strong>der</strong> Erstarrungsprozess<br />
dieser Schmelzen unendlich langsam ab und braucht, je nach Größe dieses Gesteinskörpers, gewöhnlich<br />
einige Jahrzehntausende bis einige Jahrmillionen. Deshalb können die in diesen Gesteinsschmelzen wachsenden<br />
Kristalle mehrere Zentimeter o<strong>der</strong> gar Dezimeter groß werden. Die Tiefengesteine treten meist in Form kuppelartiger<br />
Plutone o<strong>der</strong> plattenförmiger Gänge auf. Von Plutonen können Gänge und Apophysen ausgehen, die das<br />
Nebengestein durchschwärmen. Viele Lagerstätten sind an <strong>der</strong>artige Gänge gebunden.<br />
Der First kuppelförmiger Tiefengesteinskörper wird als „altes Dach“ bezeichnet. Vom „alten Dach“ haben sich<br />
nicht selten größere Gesteinsmassen gelöst und sind ein Stück weit in die Schmelze eingesunken. In <strong>der</strong> längst<br />
zu körnigen Tiefengesteinen erstarrten Schmelze sind diese Nebengesteinsschollen nicht selten bis heute zu erkennen.<br />
Durch Hebung und Erosion werden Tiefengesteinskörper, die in großer Tiefe erstarrt sind, schließlich<br />
an <strong>der</strong> Erdoberfläche freigelegt und sind dann einer direkten Beobachtung zugänglich. Die kuppelförmigen Plutone<br />
zeigen an <strong>der</strong> Erdoberfläche oft rundliche o<strong>der</strong> elliptische Anschnitte, <strong>der</strong>en Durchmesser viele Kilometer,<br />
manchmal Zehnerkilometer o<strong>der</strong> gar Hun<strong>der</strong>te von Kilometern betragen können.<br />
Das Gefüge <strong>der</strong> Tiefengesteine ist meist gleichkörnig granular, oft aber auch porphyrisch. Im Gegensatz zu<br />
porphyrischen Vulkaniten schwimmen die großen Einsprenglinge (Kristalle, oft Feldspäte) in einer gleichfalls körnigen<br />
Grundmasse. Die meisten Tiefengesteine sind in hohem Maße isotrop und sehr kluftarm. Deshalb lassen<br />
sich aus Plutoniten metergroße Bausteinqua<strong>der</strong>, mitunter sogar Dekameter lange Säulen aus einem Stück gewinnen<br />
(ägyptische Obelisken!). Zudem stellen sie i.d.R. einen idealen Baugrund und im Hohlraumbau sog. standfeste<br />
Gesteine dar. Wegen des Fehlens einer nennenswerten primären Porosität und ihrer Kluftarmut sind Tiefengesteine<br />
kaum wasserdurchlässig. Deshalb werden Tiefengesteinskörper als ideale Standorte für Endlager<br />
radioaktiven Abfalls angesehen.<br />
Wie bei den Vulkaniten unterscheidet man grundsätzlich zwischen sauren, intermediären, basischen und ultrabasischen<br />
Plutoniten (vergl. Abschnitt 4.1.1). Für den überwiegenden Teil <strong>der</strong> Tiefengesteine lassen sich<br />
bedeutend feinerkörnige Ergussgesteine finden, die zwar eine an<strong>der</strong>e Textur, aber die gleiche chemische und<br />
eine verwandte mineralogische Zusammensetzung haben. Sie werden als Ergussgesteinsäquivalente bezeichnet.<br />
Je nachdem, aus welchen Mineralarten in welchen Mengenverhältnissen Tiefengesteine bestehen, haben sie<br />
ganz unterschiedliche Namen. Die Zusammensetzung <strong>der</strong> meisten Tiefengesteine lässt sich gleichfalls mit Hilfe<br />
eines doppelten Konzentrationsdreieckes, dem Streckeisen-Diagramm, recht anschaulich darstellen. Man<br />
begnügt sich mit <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> "hellen" Mineralarten (Alkalifeldspäte, Plagioklase, Feldspatvertreter und<br />
Quarz), die "dunklen" (Pyroxene, Amphibole, Glimmer u.a.), die sog. Mafite, werden einfach weggelassen, sofern<br />
sie nicht mehr als 90% des Gesamtmineralbestandes eines Gesteins ausmachen. Einige wenige Beispiele<br />
beson<strong>der</strong>s häufiger Tiefengesteine seien hier kurz beschrieben:
20<br />
Granit<br />
Sehr saures, grau, auch rosa o<strong>der</strong> rot gefärbtes, meist grobkörniges Tiefengestein. Es besteht zu etwa gleichen<br />
Teilen aus Quarz, Plagioklas und Alkalifeldspat sowie etwas Biotit. Bei porphyrischen Graniten liegen in einer<br />
körnigen Grundmasse aus Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz und Glimmer (Biotit und/o<strong>der</strong> Muskovit) größere Einsprenglinge<br />
aus großen Kalifeldspatkristallen, die als deutliche Kristallzwillinge ausgebildet sind. Die Ergussgesteinsäquivalente<br />
<strong>der</strong> Granite sind Rhyolithe. Es gibt Granite mit einer schwachen Foliation (siehe unten), denn<br />
<strong>der</strong> Übergang von Graniten zu Orthogneisen ist fließend. Granite gehören zu den häufigsten Gesteinen und sind<br />
z.B. im Schwarzwald, Oberpfälzer Wald, Erzgebirge, Harz, aber auch in den Zentralalpen weit verbreitet. Granit<br />
wird in zahlreichen Steinbrüchen als Baustein gewonnen. Kluftarme Granitplutone werden für Endlager als beson<strong>der</strong>s<br />
geeignet angesehen.<br />
Diorit<br />
Intermediäres, dunkelgraues, grobkörniges Tiefengestein. Diorit ist oft granitähnlich, meist aber deutlich dunkler.<br />
Er enthält viel Plagioklas, weniger Alkalifeldspäte, Quarz sowie viel Amphibole, Biotit und gelegentlich Pyroxene.<br />
Die Ergussgesteinsäquivalente von Dioriten sind Andesite (Porphyrite). Diorite gehören zu den häufigsten Tiefengesteinen<br />
und sind in allen Gebieten mit Kristallingesteinen verbreitet. Gelegentlich werden Diorite als Bausteine<br />
gewonnen, z.B. im Bayerischen Wald o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Lausitz.<br />
Syenit<br />
Intermediäres, oft hellgraues, manchmal auch dunkel gefärbtes, meist grobkörniges, oft porphyrisches Tiefengestein.<br />
Es enthält viel Kalifeldspat, etwas Plagioklas, gelegentlich Quarz, sowie Amphibole und/o<strong>der</strong> Pyroxene.<br />
Als Ergussgesteinsäquivalente gelten Trachyte. Syenite gehören zu den häufigeren Tiefengesteinen und sind z.B.<br />
in Gegenden mit Kristallingesteinen und in vielen Vulkangebieten verbreitet. Viele Syenite sind sehr dekorativ und<br />
werden als Bausteine gewonnen.<br />
Foidsyenite (Alkalisyenite)<br />
Intermediäre, oft dunkel gefärbte und meist grobkörnige Tiefengesteine, die neben mafischen Mineralen (Amphibole<br />
und/o<strong>der</strong> Pyroxene) vor allem Kalifeldspäte und Feldspatvertreter enthalten. Je nachdem, welche Foide vorhanden<br />
sind, spricht man z.B. von Nephelin- o<strong>der</strong> Leucit-Syeniten. Bei einigen Alkalisyeniten, z.B. beim Larvikit,<br />
sind die Kalifeldspäte ungewöhnlich dunkel gefärbt und irisieren wie Perlmutt. Alkalisyenite sind weniger häufig<br />
und weisen oft Konzentrationen sehr seltener Elemente und Mineralien auf. Große Alkali-Syenitplutone sind z.B.<br />
aus dem Oslogebiet, <strong>der</strong> Kolahalbinsel und Südgrönland bekannt. Ergussgesteinsäquivalente mancher Alkalisyenite<br />
sind Phonolithe. Manche Alkalisyenite, z.B. <strong>der</strong> Larvikit aus Südnorwegen (mit bunt schillernden Feldspäten,<br />
"Labrador"), sind sehr dekorativ und werden als Dekorsteine gewonnen.<br />
Pegmatit<br />
Vor allem gangförmig auftretendes, extrem grobkörniges Gestein aus dm- o<strong>der</strong> gar m-großen Einkristallen. Kristallisiert<br />
aus wasserreichen Restschmelzen, die vor allem beim Erstarren bestimmter Tiefengesteinskörper entstehen.<br />
Pegmatite bestehen größtenteils aus großen bis riesigen Quarz-, Kalifeldspat -und Glimmer-Kristallen,<br />
teilweise auch aus geometrischen Verwachsungen von Quarz und Feldspat ("Schriftgranit"). Sie enthalten oft<br />
auch Turmalin, mitunter auch extrem seltene Mineralien. Pegmatitgänge sind sehr häufig und finden sich in <strong>der</strong><br />
Peripherie fast jedes sauren und intermediären Plutons. Beson<strong>der</strong>s die Pegmatite von Alkalisyeniten sind berühmt<br />
wegen ihres Reichtums an seltenen Mineralien. Viele Pegmatite finden sich in allen Kristallingebieten, wo<br />
auch Granite auftreten, z.B. in <strong>der</strong> Oberpfalz o<strong>der</strong> in Südnorwegen. Große Pegmatite werden zur Gewinnung von<br />
Quarz- und Feldspat abgebaut (z.B. Oberpfalz, Südnorwegen), an<strong>der</strong>e wegen beson<strong>der</strong>er Minerale (z.B. Kryolith,<br />
Beryll) und seltener Elemente (z.B. Beryllium, Lithium).<br />
Gabbro<br />
Häufigstes basisches Tiefengestein. Kommt stellenweise in Gebieten mit Kristallingesteinen vor, etwa im<br />
Schwarzwald o<strong>der</strong> den Zentralalpen. Dunkelgrau bis schwärzlich, oft auch schwarzgrünlich, grobkörnig, spezifisch<br />
schwer, leicht verwitternd. Besteht etwa zur Hälfte aus Plagioklas (<strong>der</strong> hier meist relativ dunkel wirkt), zur an<strong>der</strong>en<br />
Hälfte aus schwärzlichen Pyroxenen. Enthält oft auch Amphibole, Sulfide, gelegentlich auch Olivin. Als Ergussgesteinsäquivalente<br />
gelten feldspatführende Basalte. Als Baustein selten genutzt; oft sulfidhaltig.
21<br />
Peridotit<br />
Ein auf Festlän<strong>der</strong>n ziemlich seltenes, ultrabasisches Tiefengestein, das vor allem entlang <strong>der</strong> mittelozeanischen<br />
Rücken am Boden von Ozeanen entsteht. Kommt stellenweise in <strong>der</strong> Oberpfalz, im Engadin o<strong>der</strong> Südnorwegen<br />
vor. Dunkelgrau, schwarzgrünlich bis schwärzlich, rostig anwitternd. Reich an Erzmineralen, vor allem an Sulfiden<br />
o<strong>der</strong> Chromit; spezifisch sehr schwer. Das Gestein besteht vor allem aus Olivin und Pyroxen. Als Ergussgesteinsäquivalente<br />
gelten bestimmte feldspatfreie Basalte (Pikrit). Oft sulfidhaltig, kann Magnetit, Chromerze, Gold o<strong>der</strong><br />
Platin in abbauwürdigen Konzentrationen enthalten.<br />
Dunit<br />
Ein auf Festlän<strong>der</strong>n ziemlich seltenes, ultrabasisches Tiefengestein, stammt aus dem oberen Erdmantel. Stellenweise<br />
in größeren Massen in <strong>der</strong> Oberpfalz, im Engadin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Westtürkei, vor allem aber tritt es in Form von<br />
Knollen ("Olivin-Bomben") in Basalten auf. Olivgrün, rostig anwitternd. Reich an Erzmineralen, vor allem an<br />
Chromit; spezifisch sehr schwer. Das Gestein besteht fast nur aus Olivin. Dunite können gelegentlich Diamanten,<br />
Gold o<strong>der</strong> Platin in abbauwürdigen Konzentrationen enthalten.<br />
4.2 Sedimentgesteine (Sedimente, Sedimentite o<strong>der</strong> Absatzgesteine)<br />
Sedimente werden vom Wasser, Eis, Wind o<strong>der</strong> durch die Schwerkraft auf <strong>der</strong> Erdoberfläche abgelagert (sedimentiert).<br />
Ihre Bildung setzt voraus, dass vorher ältere Ausgangsgesteine irgendwo durch Verwitterung und Erosion<br />
zerkleinert und abgetragen bzw. aufgelöst wurden und das Material von einem Medium ein Stück weit transportiert<br />
wird. Die Ablagerungen können aus Gesteinsfragmenten bestehen o<strong>der</strong> aus wässrigen Lösungen ausgefällt<br />
werden – mit und ohne Beteiligung von Organismen. Die meisten Sedimente sind mehr o<strong>der</strong> weniger deutlich<br />
geschichtet (Schichtgesteine). Die parallelen Trennflächen <strong>der</strong> Schichtung (Bankung) beeinflussen die<br />
mechanischen Eigenschaften <strong>der</strong> meisten Sedimentgesteine ganz entscheidend, die vor allem dann geringe Festigkeiten<br />
aufweisen, wenn sie scherend parallel zu den Schichtflächen beansprucht werden.<br />
Je nach Art des Transportmittels können äolische (Wind), aquatische (Wasser) und glaziäre (Eis) Sedimente<br />
unterschieden werden. Nach Art des Ablagerungsraumes unterscheidet man zudem terrestrische (Festland),<br />
fluviatile (Fluss), limnische (See) o<strong>der</strong> marine (Meer) Ablagerungen. Grundsätzlich spricht man von klastischen<br />
Sedimenten, die aus Gesteinsfragmenten unterschiedlicher Größe, Mineralzusammensetzung und Kornform<br />
bestehen, organogenen Sedimenten, die aus den mineralischen Hartteilen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> organischen Substanz<br />
von Tieren und Pflanzen bestehen, sowie chemischen Sedimenten, die aus wässrigen Lösungen ausgefällt<br />
werden.<br />
Der Vorgang <strong>der</strong> Verfestigung von primär lockeren und/o<strong>der</strong> porösen Ablagerungen, <strong>der</strong> in geologischen Zeiträumen<br />
aus lockeren, wasserdurchlässigen Sedimenten schließlich feste, vielfach wasserundurchlässige Sedimentgesteine<br />
entstehen lässt, wird als Diagenese bezeichnet. Diagenetische Prozesse benötigen Zeit, Wasser<br />
und normalerweise auch Druck. Wenn sich <strong>der</strong> eingeschwemmte Schlamm von Flüssen am Grunde eines Meeres<br />
o<strong>der</strong> eines Sees Mineralkorn um Mineralkorn absetzt, bis <strong>der</strong> wasserhaltige Sedimentstapel einige Dekameter<br />
dick geworden ist, werden die zuunterst liegenden Schichten durch das Gewicht des überlagernden Schlammes<br />
stark gepresst. Dieser Auflastdruck führt zu einer Verdichtung <strong>der</strong> Ablagerungen, wobei die Mineralkörner<br />
aneinan<strong>der</strong>gedrückt, die Porenwässer ausgepresst und die Porenhohlräume zwischen den einzelnen Partikeln<br />
immer kleiner werden.<br />
Dazu kommt noch, dass im Laufe <strong>der</strong> Zeit im Wasser gelöste Substanzen (meist Calciumkarbonat o<strong>der</strong> Kieselsäure)<br />
in den Gesteinsporen ausgefällt werden und die Körner miteinan<strong>der</strong> verkleben (Bindemittel, Zementationsprozess).<br />
So wird mit <strong>der</strong> Zeit z.B. aus einem weichen Ton ein fester Tonstein, aus einem lockeren Sand ein<br />
fester Sandstein, aus lockerem Kies ein festes Konglomerat o<strong>der</strong> aus einem weichen Kalkschlamm ein fester<br />
Kalkstein. Auch primär schon feste, aber wasserdurchlässige, poröse o<strong>der</strong> gar löcherige Gesteine, wie Riffkalke,<br />
Quelltuffe o<strong>der</strong> vulkanische Laven, sind diagenetischen Prozessen unterworfen. Auch <strong>der</strong>en Poren werden im<br />
Laufe <strong>der</strong> Zeit mit mineralischen Substanzen verfüllt. Die Diagenese führt bei Sedimentgesteinen (aber auch bei<br />
vulkanischen Tuffen) i.d.R. zu einer Zunahme <strong>der</strong> Festigkeit und zu einer Abnahme von Porosität und<br />
Durchlässigkeit.<br />
4.2.1 Klastische Sedimente bzw. Sedimentgesteine
22<br />
Die klastischen Sedimente (klastisch, nicht klassisch!) werden meist, unabhängig von ihrer Zusammensetzung,<br />
nach ihrer Korngröße (Durchmesser ihrer Komponenten) in verschiedene Gruppen unterteilt:<br />
ein Sediment, das aus Körnern mit einem Ø 63 mm besteht (Steine, Blöcke), wird Blockwerk genannt.<br />
Kiese und Konglomerate bezeichnet man gelegentlich auch als Psephite, Sande und Sandsteine als Psammite,<br />
Tone und Schluffe, bzw. Ton- und Schluffsteine werden oft zu Peliten zusammengefasst. Tatsächlich bestehen<br />
klastische Sedimente bzw. Sedimentgesteine meistens aus Gemischen unterschiedlicher Korngrößen, sehr selten<br />
nur aus einer einzigen Korngrößenfraktion. Gemischtkörnige Sedimente, die aus Gemischen aller Korngrößen in<br />
etwa gleichen Anteilen bestehen, vom Ton bis zum Blockwerk, werden Diamikton genannt. Hinsichtlich ihrer<br />
Zusammensetzung können klastische Sedimente nur aus Komponenten einer einzigen Materialart (monomikte<br />
Sedimente) o<strong>der</strong> aus Fragmenten unterschiedlicher Materialien (polymikte Sedimente) bestehen. Allerdings gilt<br />
das weitgehend nur für Konglomerate und manche Sande. Viele Sande und Schluffe bestehen vorwiegend aus<br />
Quarzkörnern, die Tone weitgehend aus winzigen Tonmineral-Schüppchen.<br />
Ton, Mergel und Lehm<br />
Als Tone o<strong>der</strong> Tonsteine bezeichnet man Gesteine, die vor allem aus Ton, als Schluffe o<strong>der</strong> Schluffsteine, die<br />
vor allem aus Schluff bestehen. Meist handelt es sich jedoch um feinkörnige Korngemische, die vor allem aus<br />
Tonmineralen und Quarzfragmenten zusammengesetzt sind und als Tonschluffsteine zusammengefasst werden.<br />
Kalkhaltige Tonschluffsteine bezeichnet man als Mergel o<strong>der</strong> Mergelsteine. Durch ihren Gehalt an Tonmineralen<br />
macht man sich an feuchten Tonschluff- und Mergelsteinen schmutzig; sie weichen auf, lassen sich<br />
kneten und fühlen sich seifig an. Unreine, meist gelblich gefärbte Tone mit hohem Sandgehalt werden als Lehme<br />
bezeichnet. Schiefertone (z.B. <strong>der</strong> Posidonienschiefer) zerfallen in dünne Platten, die an die Schieferung <strong>der</strong><br />
metamorphen Tonschiefer erinnern (vergl. unten). Im Gegensatz zu diesen sind sie aber nicht schwach metamorph<br />
überprägt, son<strong>der</strong>n nur extrem gut geschichtet.<br />
Die Eigenschaften von Tonschluff- und Mergelsteinen hängen stark von den Tonmineralen ab, aus denen<br />
sie aufgebaut sind. Obwohl sie sehr fest sein können, weichen sie mit Wasser auf, werden plastisch, quellen und<br />
zerfallen schließlich zu Brei. An<strong>der</strong>erseits neigen sie aber beim Austrocknen zum Schrumpfen und zur Bildung<br />
von Schrumpfungsrissen. Für Wasser sind sie schwer durchlässig und viele haben ein hohes Schadstoffrückhaltevermögen.<br />
Als Baugrund können sie allerdings problematisch, in einigen Fällen sogar gefährlich sein, da<br />
wasserhaltige Ton-Schluff-Gemische bestimmter Zusammensetzung thixotrope Eigenschaften aufweisen können<br />
(Quicktone). In Hanglagen för<strong>der</strong>n sie Rutschungen. An<strong>der</strong>erseits sind sie wichtige Rohstoffe und spielen bei <strong>der</strong><br />
Anlage von Deponien als natürliche wie künstliche Barrieren eine wichtige Rolle. Tonschluffsteine sind wesentlich<br />
am Aufbau <strong>der</strong> Nordalpen (Nördliche Kalkalpen, Helvetikum- und Flyschzone), des Alpenvorlandes (Molassemergel<br />
o<strong>der</strong> die als sog. „Geschiebelehme“ o<strong>der</strong> „Moränen“ bezeichneten eiszeitlichen Diamikte) und des<br />
Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes beteiligt (z.B. Keupertone, Tone / Mergel des Schwarzen und Braunen<br />
Jura). Als Schieferton werden Tone bezeichnet, die ein sedimentäres Parallelgefüge aufweisen, aber keine<br />
echten Schiefer sind.<br />
Sand bzw. Sandstein<br />
Sande bzw. Sandsteine sind körnige Gesteine, die oft aus Quarz- (Quarzsandsteine) o<strong>der</strong> Kalkkomponenten<br />
(Kalksandsteine) zusammengesetzt sind. Allerdings sind neben feldspatreichen Sandsteinen (Arkosen) auch<br />
solche häufig, die große Mengen an Gesteinsbruchstücken enthalten (Grauwacken). Die Verfestigung vom Sand<br />
zum Sandstein ist vor allem durch das Ausfällen von Calcit- und Quarzzementen (Bindemittel) in den Gesteinsporen<br />
bedingt. Ihre Festigkeit, Wasserdurchlässigkeit und ihr chemisches Verhalten hängen stark von <strong>der</strong> Art des<br />
Bindemittels und vom Grad <strong>der</strong> Diagenese ab. Lockere Sande sind hoch durchlässig, können bei Anwesenheit<br />
von Wasser sehr geringe Festigkeiten aufweisen (Schwimmsande) o<strong>der</strong> gar zum Fließen neigen (Quicksande).<br />
Ist die Diagenese dagegen weit fortgeschritten, können Sandsteine sehr fest und fast wasserundurchlässig sein.<br />
Sie besitzen i.d.R. kein Schadstoffrückhaltevermögen. Sande sind wichtige Rohstoffe für die Bauindustrie, Sandsteine<br />
dienen vielfach als Bausteine (z.B. Buntsandstein). Viele Grundwasserleiter, vor allem die von tiefen<br />
Grundwässern, sind poröse Grobsandsteine. Sande und Sandsteine sind wesentlich am Aufbau <strong>der</strong> Nordalpen
23<br />
(Flyschzone), des Alpenvorlandes (Molassesandsteine) und des Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes (z.B.<br />
Buntsandstein, Keuper- und Doggersandsteine) beteiligt.<br />
Kies, Konglomerat und Brekzie<br />
Kiese bzw. Konglomerate sind grobkörnige Gesteine, die manchmal aus Quarz, meistens aber aus vielen unterschiedlichen<br />
Komponenten zusammengesetzt sind. Die Zwickel zwischen den groben Komponenten sind meist<br />
von Sand erfüllt. Die Verfestigung vom Kies zum Konglomerat ist vor allem durch das Ausfällen von Calcit- und<br />
Quarzzementen (Bindemittel) in den Gesteinsporen <strong>der</strong> sandigen Zwickelfüllungen bedingt. Ihre Festigkeit,<br />
Wasserdurchlässigkeit und ihr chemisches Verhalten hängen, wie bei Sandsteinen, stark von <strong>der</strong> Art des Bindemittels<br />
und vom Grad <strong>der</strong> Diagenese ab. Konglomerate („Nagelfluh“), <strong>der</strong>en Komponenten (Gerölle) gerundet<br />
sind, können aussehen wie Beton. Bestehen die Komponenten aus eckigen Gesteinsbruchstücken, werden die<br />
Gesteine als Brekzie (auch Breccie geschrieben) bezeichnet.<br />
Lockere Kiese und kantiger Hangschutt sind hoch wasserdurchlässig. Ist die Diagenese weit fortgeschritten,<br />
können sie dagegen als Konglomerate und Brekzien sehr fest, aber nur ganz selten wasserundurchlässig sein.<br />
Sie besitzen i.d.R. keinerlei Schadstoffrückhaltevermögen. Kiese sind wichtige Rohstoffe für die Bauindustrie,<br />
sowohl karbonatische (z.B. als Betonzuschlagstoff) als auch karbonatfreie (z.B. als Filterkies). Konglomerate sind<br />
wesentlich am Aufbau des Alpenvorlandes (Molassekonglomerate) und des Schwäbisch-Fränkischen<br />
Stufenlandes (z.B. Rotliegend-Brekzien, Buntsandsteinkonglomerate) beteiligt. Viele Grundwasserleiter, vor allem<br />
die <strong>der</strong> obersten Grundwasserstockwerke, bestehen meist aus hoch durchlässigen eiszeitlichen Flusskiesen und<br />
Konglomeraten.<br />
4.2.2 Organogene Sedimente bzw. Sedimentgesteine<br />
Organogene Sedimente werden von Organismen gebildet. Entwe<strong>der</strong> sind es mineralische Schalen und Skelette,<br />
meist aus Karbonaten, als Ergebnis <strong>der</strong> Biomineralisation, die sich zu lockeren o<strong>der</strong> primär schon festen Sedimenten<br />
anreichern. Es kann aber auch die organische Substanz selbst sein, die sich ablagert und unter günstigen<br />
Bedingungen erhalten bleibt.<br />
Kalk und Kalkstein<br />
Die meisten Kalke entstehen unter Beteiligung von Organismen. Das im Meer- o<strong>der</strong> Süßwasser gelöste Calciumkarbonat<br />
wird von verschiedenen im Wasser lebenden Organismen, z.B. Korallen, Schnecken, Muscheln, manchen<br />
Algen etc. in Form von Calcit und/o<strong>der</strong> Aragonit ausgefällt und in die Schalen und Skelette eingebaut. Aragonit<br />
wandelt sich im Laufe <strong>der</strong> Zeit in Calcit um. Kalksteine können primär als weiche bzw. lockere Sedimente<br />
abgelagert werden, z.B. als feinkörniger Kalkschlamm, Kalksand o<strong>der</strong> grobkörniger Schill. Diese lockeren Ablagerungen<br />
härten mit <strong>der</strong> Zeit durch Ausfällung von Calcit aus dem Porenwasser aus und werden zu festen Kalksteinen.<br />
Stellenweise entstehen allerdings auch schon primär feste Kalksteine, etwa Riffkalke o<strong>der</strong> Kalktuffe (Quelltuffe),<br />
die schon bei <strong>der</strong> Bildung zahlreiche Hohlräume aufweisen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den<br />
sog. Rauhwacken um zellige, hohlraumreiche Kalksteine, die immer zusammen mit Gipsvorkommen auftreten.<br />
Sie sind nicht so abgelagert worden, son<strong>der</strong>n erst nachträglich, als Ergebnis komplizierter chemischer Umsetzungen<br />
aus Dolomit- und Gipssteinen, nahe <strong>der</strong> Erdoberfläche entstanden.<br />
Kalksteine werden in zahlreichen Steinbrüchen zur Kalkgewinnung (vor allem für die Herstellung von Zement) und<br />
als Bausteine gewonnen. Die meisten Kalksteine weisen Schichtflächen und Klüfte auf, entlang <strong>der</strong>er Wasser<br />
zirkulieren kann. Da Kalke leicht verkarsten, sind die Schichtfugen und Klüfte durch Lösung oft erweitert. Dadurch<br />
sind Kalksteine in hohem Maße wasserdurchlässig und enthalten vielfach ausgedehnte Höhlensysteme. Als<br />
Lösungsrückstände bleiben vielfach Höhlenlehme übrig. Kalksteine sind ausgezeichnete Grundwasserleiter,<br />
haben allerdings keinerlei Filterwirkung und beeinflussen die Härte des Grundwassers. Kalksteine sind wesentlich<br />
am Aufbau <strong>der</strong> Nordalpen (Wettersteinkalk <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen, Schrattenkalk im Helvetikum) und des<br />
Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes beteiligt (Muschelkalk, Jurakalke <strong>der</strong> Schwäbisch-Fränkischen Alb).<br />
Dolomit und Dolomitstein<br />
Auch Dolomit wird zumeist primär als Kalkschlamm o<strong>der</strong> Kalksand von Organismen im Meer abgelagert und<br />
unmittelbar danach o<strong>der</strong> auch erst später durch Mg-reiche Porenwässer in Dolomit bzw. Dolomitstein umgewandelt.<br />
Bei tektonischer Beanspruchung reagieren Dolomite viel sprö<strong>der</strong> als Kalke und zerbrechen zumeist sehr<br />
klüftig. Die Klüfte in Dolomiten sind sehr oft wie<strong>der</strong> mit Calcit verheilt.<br />
Dolomit wird nur gelegentlich als Rohstoff gewonnen, vor allem zur Herstellung von feuerfesten Produkten. Da<br />
Dolomite gleichfalls verkarsten, gilt für sie auch das oben schon für Kalksteine Gesagte. Dolomite sind wesentlich
24<br />
am Aufbau <strong>der</strong> Nordalpen (Hauptdolomit), <strong>der</strong> Südalpen (Dolomiten) und <strong>der</strong> Fränkischen Alb (Frankendolomit)<br />
beteiligt.<br />
Torf-Lignit-Braunkohle-Steinkohle<br />
Stellenweise können sich Blätter, Stängel und Holzreste anhäufen und mächtige Lager bilden (z.B. Torf). Die<br />
organische Substanz (Zellulose und Lignin) wird unter Luftabschluss nicht vollständig abgebaut und kann über<br />
geologische Zeiträume erhalten bleiben. Werden solche Torflager von an<strong>der</strong>en Ablagerungen bedeckt und<br />
gepresst, entstehen aus den Hölzern mit <strong>der</strong> Zeit harte Lignite. Durch Inkohlung, einen Prozess, <strong>der</strong> unter hohem<br />
Druck und erhöhter Temperatur zur relativen Anreicherung von Kohlenstoff bei gleichzeitiger Abreicherung von<br />
Wasserstoff und Sauerstoff führt, entstehen mit <strong>der</strong> Zeit Braunkohle und schließlich Steinkohle.<br />
Viele Kohlen sind reich an Sulfiden, die sich bei Sauerstoff-Zutritt zersetzen. Die dabei entstehende Schwefelige<br />
Säure ist betonaggressiv und kann in benachbarten Kalken und Mergeln zur Entstehung von Gips führen. Damit<br />
beeinflussen sie auch die Qualität des Grundwassers. Abgesehen davon, dass kohleführende Sedimente rutschanfällig<br />
sind, werden sie vor allem durch Stollen alter Bergbaue und damit verbundene Setzungen äußerst problematisch.<br />
Bergbau auf Steinkohle (Oberkarbon-Unterperm) ist bzw. war vor allem im Saarland, im Ruhrgebiet,<br />
Münsterland und in Thüringen verbreitet. Braunkohlen (Eozän-Miozän) werden bzw. wurden bei Halle und Leipzig,<br />
in <strong>der</strong> Kölner Bucht und im Alpenvorland abgebaut (Peißenberg, Penzberg und Hausham).<br />
4.2.3 Chemische Sedimente bzw. Sedimentgesteine<br />
Als chemische Sedimente werden Ablagerungen bezeichnet, die ohne Mitwirkung von Organismen aus wässrigen<br />
Lösungen ausgefällt werden. Die Fällung wird meist durch Eindampfen, Druckentlastung o<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen des<br />
pH-Wertes <strong>der</strong> Wässer ausgelöst. Auch ein Teil <strong>der</strong> karbonatischen Sedimente wird auf rein chemischem Wege<br />
ausgefällt, z.B. Tropfsteine in Höhlen. Die Abgrenzung von organisch und anorganisch ablaufenden Fällungsprozessen<br />
ist nicht immer einfach.<br />
Gips<br />
Gips wird und wurde vor allem in Meeresbuchten und Salzseen in den Subtropen gebildet, wo Gipskristalle aus<br />
dem eindampfenden Meerwasser ausgefällt und als Gipsschlamm am Boden abgesetzt werden. Mit <strong>der</strong> Zeit können<br />
so mächtige Gipslager entstehen. Große Gipsvorkommen entstanden auf diese Weise vor allem während <strong>der</strong><br />
Perm- und Triaszeit. Heute noch laufen vergleichbare Prozesse in strandnahen Salzseen, aber auch z.B. in <strong>der</strong><br />
Etoschapfanne, den Schotts Nordafrikas o<strong>der</strong> am Großen Salzsee in den USA ab.<br />
Gipshaltige Gesteine verkarsten leicht, sind deshalb hoch durchlässig, beeinflussen die Qualität des Trinkwassers<br />
und sind bei entsprechendem Überlagerungsdruck plastisch verformbar. Gips kommt z.B. im Mittleren Muschelkalk<br />
und im Keuper des Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes o<strong>der</strong> in den Raibler Schichten <strong>der</strong> Nördlichen<br />
Kalkalpen vor. Gips hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung, z.B. als Zuschlagstoff für Zement.<br />
Anhydrit<br />
Auch Anhydritkristalle können in konzentrierten Salzlaugen direkt aus eindampfendem Meerwasser ausgefällt und<br />
als Anhydritschlamm am Boden abgesetzt werden. Zudem kann sich Anhydrit sekundär aus Gips bilden, wenn<br />
Gipslager von mächtigen Sedimenten bedeckt, versenkt und dadurch erhöhten Drucken und Temperaturen<br />
ausgesetzt werden. Kommt Anhydrit durch Erosion darüberliegen<strong>der</strong> Gesteine in die Nähe <strong>der</strong> Erdoberfläche,<br />
nimmt er Wasser auf und wandelt sich in Gips um. Diese Umwandlung ist mit einer Volumenszunahme bis zu<br />
62% verbunden, bei <strong>der</strong> ungeheure Quelldrucke auftreten. Das Quellen von Anhydrit kann bei Baumaßnahmen<br />
zu erheblichen Problemen führen. Im übrigen treten die gleichen Probleme wie bei Gips auf. Gips und Anhydrit<br />
kommen oft gemeinsam und zusammen mit Steinsalz vor. Wie Steinsalz fehlt Anhydrit aber in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Erdoberfläche.<br />
Steinsalz<br />
Werden Salzseen o<strong>der</strong> Meeresbuchten restlos eingedampft, kommt es zur Ausfällung von den im Wasser gelösten<br />
Salzen, vor allem von Steinsalz und an<strong>der</strong>en Salzen, z.B. Kalisalzen. Unter bestimmten Bedingungen können<br />
so mächtige Steinsalzlager entstehen. Steinsalz, das noch viel leichter löslich ist als Gips, ist extrem verkarstungsanfällig<br />
und es beeinflusst die Qualität des Trinkwassers. Bei entsprechendem Überlagerungsdruck ist es<br />
zudem plastisch verformbar und äußerst mobil. Steinsalz kommt zusammen mit Gips bzw. Anhydrit vor, z.B. im<br />
Mittleren Muschelkalk des Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes, im Zechstein Norddeutschlands (Salzstöcke),<br />
im „Haselgebirge“ <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen o<strong>der</strong> in Persien (Salzgletscher!). Steinsalz und an<strong>der</strong>e Salze (Kalisalz)<br />
haben eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Ernährung und die chemische Industrie.
25<br />
Radiolarit, Hornstein und Feuerstein<br />
Viele Kieselgesteine, die als harte Knollen und Platten in Kalke und Dolomite eingelagert sein können, entstehen<br />
auf chemischem Wege im noch weichen Sediment. Allerdings gibt es auch mächtigere, geschichtete Kieselgesteine,<br />
die aus den kieseligen Hartteilen von Organismen (Radiolarien, Schwämme, Kieselalgen) entstanden sind.<br />
Diese Gesteine sind meist wegen ihrer großen Härte problematisch, vor allem wegen ihrer abrasiven Wirkung auf<br />
Werkzeuge. Mächtigere Schichtfolgen aus reinen Kieselgesteinen kommen z.B. in den Nördlichen Kalkalpen<br />
(Radiolarit) o<strong>der</strong> im Frankenwald (Kieselschiefer) vor. Kieselknollen (Feuerstein- und Hornsteinknollen) sind als<br />
Einlagerungen in fast allen Kalksteinen (z.B. in <strong>der</strong> Schreibkreide sowie in den weißen Jurakalken <strong>der</strong> Alb) zu<br />
finden und waren in <strong>der</strong> Steinzeit ein begehrter Rohstoff zur Herstellung von Steinwerkzeugen.<br />
4.3 Umwandlungsgesteine (Metamorphite)<br />
Als Metamorphite werden Gesteine bezeichnet, die durch Umwandlung des ursprünglichen Mineralbestandes<br />
aus vorher schon existierenden Gesteinen (Magmatite, Sedimentite o<strong>der</strong> ältere Metamorphite) hervorgegangen<br />
sind. Die Umwandlung geht dabei im Erdinneren im festen Zustand vor sich und ist abhängig von den jeweiligen<br />
Druck- und Temperatur-Bedingungen, den sog. p/T-Bedingungen, die in unterschiedlichen Tiefen <strong>der</strong> Erdkruste<br />
herrschen. Jedes Mineral hat einen begrenzten Stabilitätsbereich und wird instabil, wenn sich die p/T-<br />
Bedingungen än<strong>der</strong>n. Das gleiche gilt für Gruppen koexistieren<strong>der</strong> Minerale, die Gesteine aufbauen, sog. Paragenesen.<br />
Sie reagieren unter neuen p/T-Bedingungen miteinan<strong>der</strong> und werden allmählich durch neue Paragenesen<br />
ersetzt, die diesen neuen äußeren Bedingungen angepasst sind. Entscheidend ist dabei eine intergranulare<br />
Wan<strong>der</strong>ung von fluiden Phasen, die Ionen von einem Korn zum an<strong>der</strong>en transportieren können.<br />
Wie oben schon erläutert, ist davon auszugehen, dass parallel zu einer „normalen“ Temperaturzunahme von 3 °C<br />
je 100 m Tiefe auch <strong>der</strong> Druck jeweils um etwa 26 kg/cm² je 100 m Tiefe ansteigt. In 20 km Tiefe können so<br />
schon Gesteinstemperaturen von 600 °C und Drucke von 5200 kg/cm² erreicht werden. Bei <strong>der</strong> allmählichen<br />
Versenkung von Gesteinen in größere Tiefen bilden sich immer wie<strong>der</strong> neue Minerale, die in den jeweiligen<br />
Tiefen eine Zeitlang stabil sind. Die Mineralparagenesen sind aber nicht nur von den hier herrschenden p/T-<br />
Bedingungen, son<strong>der</strong>n auch von <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> Ausgangsgesteine abhängig. Die Umwandlung in<br />
neue Mineralparagenesen kann ohne jeden Materialverlust o<strong>der</strong> Stoffzufuhr von außen erfolgen (isocheme<br />
Metamorphose). Mitunter kann es aber auch zu einem Verlust bzw. einer Zufuhr von Stoffen kommen (allocheme<br />
Metamorphose). Der Faktor Zeit spielt in allen Fällen bei diesen Vorgängen eine wesentliche Rolle. Die<br />
vollständige Mineralumwandlung und die Sprossung makroskopisch sichtbarer Kristalle beansprucht jedenfalls<br />
geologische Zeiträume.<br />
Anhand <strong>der</strong> Mineralparagenesen lassen sich die p/T-Bedingungen abschätzen, unter denen sie entstanden sind.<br />
Mit zunehmen<strong>der</strong> Versenkung wird die Metamorphose immer stärker, wird zunächst als niedriggradige und<br />
schließlich als hochgradige Metamorphose bezeichnet. Kehrt sich die abwärts gerichtete Bewegung um, sinken<br />
Druck und Temperatur wie<strong>der</strong> ab, und die Metamorphose kann bis zu einem gewissen Grad rückläufig sein<br />
(retrograde Metamorphose). Geht das Absinken von Temperatur und Druck sehr rasch, haben die Mineralparagenesen<br />
keine Zeit, sich auf die verän<strong>der</strong>ten Bedingungen einzustellen. Hochgradig metamorphe Gesteine können<br />
so konserviert werden und weitgehend unverän<strong>der</strong>t durch Erosion an <strong>der</strong> Erdoberfläche freigelegt werden.<br />
Wenn Druck und Temperatur in dem Maße zunehmen, wie es einer Versenkung mit einer „normalen“ Temperaturzunahme<br />
von etwa 3 °C pro 100 m entspricht, spricht man von einer „normalen“ Regionalmetamorphose<br />
(Versenkungsmetamorphose). Sind die Drucke extrem hoch und die Temperaturen vergleichsweise niedrig,<br />
was z.B. in jungen Gebirgen vorkommt, wo kühle Gesteine relativ rasch in große Tiefen versenkt werden, spricht<br />
man von einer druckbetonten Metamorphose (Hochdruckmetamorphose). Sind dagegen die Drucke sehr<br />
niedrig und die Temperaturen im Vergleich dazu sehr hoch, etwa in <strong>der</strong> Umgebung von heißen Magmenkörpern,<br />
die in höhere Krustenteile eingedrungen sind, spricht man von einer temperaturbetonten Metamorphose (Kontaktmetamorphose).<br />
Den meisten metamorphen Gesteinen ist ein ausgeprägtes Parallelgefüge (Schieferung, Foliation) eigen, das<br />
an eine Schichtung erinnern kann, aber genetisch mit einer echten sedimentären Schichtung nur selten etwas zu<br />
tun hat. Meist sind stängelige o<strong>der</strong> plattige und spaltbare Mineralkörner, wie Glimmer, Amphibole o<strong>der</strong> Pyroxene,<br />
parallel zu den Schieferungsflächen eingeregelt. Schieferung entsteht durch Spannungen, denen die Gesteine vor<br />
und während <strong>der</strong> Metamorphose ausgesetzt sind. Diese parallelen Trennflächen beeinflussen die mechani-
26<br />
schen Eigenschaften <strong>der</strong> meisten Metamorphite ganz entscheidend, die vor allem dann geringe Festigkeiten aufweisen,<br />
wenn sie scherend parallel zu den Schieferungsflächen beansprucht werden. Deshalb verhalten sich die<br />
meisten Metamorphite mechanisch ähnlich wie gut geschichtete Sedimente.<br />
Ist das Ausgangsgestein, das Edukt, bekannt, aus dem ein Metamorphit hervorgegangen ist, kann man das<br />
metamorphe Gestein (unabhängig von seinem Mineralbestand) einfach durch den Zusatz „Meta-“ charakterisieren:<br />
so wird z.B. aus einer Grauwacke eine Metagrauwacke, aus einem Granit ein Metagranit und aus einem<br />
Vulkanit ein Metavulkanit. Abgesehen davon haben die Metamorphite aber, abhängig von Aussehen, Korngröße,<br />
Gefüge, Mineralbestand und Metamorphosegrad, unterschiedliche Namen.<br />
Tonschiefer<br />
Tonschiefer sind schwach metamorph überprägte Tonschluffsteine, die eine ausgeprägte Schieferung besitzen.<br />
Trotz ihrer Ähnlichkeit mit Schiefertonen weichen sie beim Kontakt mit Wasser nicht mehr auf, da sich die Tonminerale<br />
größtenteils in submikroskopisch winzige Glimmerschüppchen (Serizit) umgewandelt haben. In Tonschiefern<br />
sind oft gut erhaltene Fossilien zu finden, z.B. Graptolithen. Übergänge zu Phylliten sind vorhanden. Der<br />
hohe Gehalt an (in Serizit) umgewandelten Tonmineralen und das ausgeprägte Parallelgefüge beeinflussen die<br />
mechanischen Eigenschaften <strong>der</strong> Tonschiefer entscheidend. Die Gesteine sind primär fast wasserun Als<br />
durchlässig, verwittern aber leicht und för<strong>der</strong>n Hangbewegungen, werden dadurch entfestigt und blättern auf. Bei<br />
ungünstiger Lagerung können schon geringe Anteile von Tonschiefern große Rutschungen auslösen (vergl.<br />
Tone). Früher sind manche Schiefer als Dachschiefer und zur Herstellung von Schiefertafeln und Griffeln gebrochen<br />
worden. Tonschiefer sind z.B. in Teilen <strong>der</strong> Alpen, im Rheinischen o<strong>der</strong> im Thüringischen Schiefergebirge<br />
verbreitet.<br />
Fruchtschiefer und Knotenschiefer<br />
Fruchtschiefer sind metamorphe Tonschluffsteine, in denen bei einer temperaturbetonten Kontaktmetamorphose<br />
lang- o<strong>der</strong> kurzstängelige Mineralien (z.B. Andalusit bzw. Chiastolith) neu gesprosst sind. Die mechanischen<br />
Eigenschaften von Frucht- o<strong>der</strong> Knotenschiefern sind mit denen von Tonschiefern vergleichbar (siehe oben). Sie<br />
finden sich in <strong>der</strong> Peripherie vieler Granitplutone (Kontakthof), etwa im Schwarzwald o<strong>der</strong> im Bayerischen Wald.<br />
Phyllit<br />
Phyllite sind schiefrige, schwach metamorphe Gesteine, die an Tonschiefer erinnern, aber viel kräftiger glänzende<br />
Schieferungsflächen besitzen, was mit <strong>der</strong> Sprossung größerer Serizit-Schüppchen zusammenhängt. Die Edukte<br />
<strong>der</strong> Phyllite waren meist Tonschluffsteine, aber im Gegensatz zu diesen enthalten sie keinerlei Tonminerale mehr.<br />
Je nachdem, welche an<strong>der</strong>en Minerale zusätzlich vorkommen bzw. dominieren, werden z.B. Quarzphyllite,<br />
Talkphyllite o<strong>der</strong> tiefschwarze (und schwarz abfärbende) Graphitphyllite unterschieden. Fossilien sind in Phylliten<br />
nur ganz selten und sehr schlecht erhalten. Es gibt Übergänge zu Glimmerschiefern. Die mechanischen<br />
Eigenschaften von Phylliten sind mit denen von Tonschiefern vergleichbar (siehe oben). Phyllite sind z.B. in den<br />
Zentralalpen und im Frankenwald verbreitet.<br />
Glimmerschiefer<br />
Glimmerschiefer sind schiefrige Metamorphite, die vor allem aus parallel eingeregelten Glimmern (Serizit, Biotit<br />
und/o<strong>der</strong> Muskovit) bestehen und unterschiedliche Mengen von feinkörnigem Quarz und/o<strong>der</strong> Feldspat enthalten,<br />
sehr oft zusätzlich auch Granat. Die Glimmerplättchen sind gewöhnlich mit bloßem Auge erkennbar und parallel<br />
zur Foliation eingeregelt. Viele Glimmerschiefer sind gefaltet. Je nachdem, welche Mineralarten überwiegen o<strong>der</strong><br />
zusätzlich auftreten, werden z.B. Granatglimmerschiefer, Biotitglimmerschiefer etc. unterschieden. Als Hornblende-Garbenschiefer<br />
werden teilweise granatführende Glimmerschiefer bezeichnet, die cm- o<strong>der</strong> dm-große,<br />
stängelige Hornblendekristalle enthalten. Die Hornblenden liegen in den Schieferungsebenen und bilden garbeno<strong>der</strong><br />
sonnenartige Aggregate. Glimmerschiefer sind relativ hochgradige Metamorphite, die bei <strong>der</strong> Regionalmetamorphose<br />
vor allem aus Tonschluffsteinen, aber z.B. auch aus Arkosen o<strong>der</strong> Grauwacken hervorgehen können.<br />
Es gibt alle Übergänge zu Gneisen. Die mechanischen Eigenschaften von Glimmerschiefern sind mit denen von<br />
Tonschiefern vergleichbar (siehe oben). Glimmerschiefer sind z.B. in den Zentralalpen, im Bayerischen Wald und<br />
im Schwarzwald zu finden.<br />
Gneis<br />
Gneise sind, ähnlich wie Granite, ziemlich grobkörnige, meist helle Metamorphite, die aus Feldspäten, Quarz und<br />
Glimmer (Biotit und/o<strong>der</strong> Muskovit) bestehen, aber auch etwas Amphibole, Pyroxene o<strong>der</strong> Granat enthalten können.<br />
Die meisten dieser Minerale sind mit bloßem Auge erkennbar. Im Gegensatz zu Graniten zeigen sie immer<br />
ein deutliches Parallelgefüge; die Glimmer und an<strong>der</strong>e mafische Minerale sind meist parallel zur Foliation ein-
27<br />
geregelt. Viele Gneise sind gefaltet. Je nachdem, welche Mineralarten überwiegen o<strong>der</strong> zusätzlich auftreten, werden<br />
z.B. Biotitgneise, Muskovitgneise, Pyroxengneise, Granatgneise etc. unterschieden. Gneise mit großen Feldspatkristallen<br />
werden als Augengneise bezeichnet. Gneise sind hochgradige Metamorphite, die aus unterschiedlichen<br />
Sedimenten (Grauwacken, Tonschluffsteine etc.) genauso wie aus sauren Magmatiten (Rhyolithe, Bimstuffe,<br />
Granite etc.) unter sehr unterschiedlichen Metamorphosebedingungen entstehen können. Gneise, die Metasedimente<br />
sind, werden als Paragneise bezeichnet, solche die Metagranite sind, als Orthogneise. Der Übergang<br />
von Graniten zu Orthogneisen ist fließend. Gneise können wie Granite sehr standfest sein, haben aber ein<br />
paralleles Trennflächengefüge, das zu Gleitungen führen kann. Manche Gneise werden als Bau- und Dekorsteine<br />
gebrochen. Gneise sind z.B. in den Zentralalpen, dem Bayerischen Wald, dem Schwarzwald o<strong>der</strong> dem<br />
Erzgebirge zu finden.<br />
Marmor<br />
Als Marmore werden monomineralische Metamorphite bezeichnet, die aus Calcit o<strong>der</strong> Dolomit bestehen. Dabei<br />
handelt es sich meist um reine sedimentäre Karbonatgesteine, die metamorph geworden sind. Der Mineralbestand<br />
hat sich dabei nicht verän<strong>der</strong>t, wohl aber die Korngröße: Calcit- und Dolomitmarmore sind, im Gegensatz<br />
zu ihren sedimentären Ausgangsgesteinen, durch Sammelkristallisation meist so grobkörnig, dass man die<br />
Spaltflächen einzelner Kristalle mit bloßem Auge glitzern sehen kann. Reine Marmore sind unter allen isochemen,<br />
auch höchstgradigen Metamorphosebedingungen stabil. Primäre Sedimentstrukturen ihrer Ausgangsgesteine<br />
sind fast nie erhalten. Marmore sind nur selten geschiefert. Die mechanischen und chemischen Eigenschaften<br />
von reinen Marmoren sind denen ihrer sedimentären Edukte (Kalke, Dolomite) vergleichbar: Wie Kalksteine<br />
verkarsten Marmore leicht, sind dadurch sehr wasserdurchlässig. Verkarstete Marmore können ausgezeichnete<br />
Karstwasserleiter sein, haben allerdings keinerlei Filterwirkung und beeinflussen die Härte des Grundwassers.<br />
Marmore sind z.B. in den Zentralalpen, im Bayerischen Wald und Schwarzwald zu finden. Manche Marmore sind<br />
weiß, an<strong>der</strong>e farbig gebän<strong>der</strong>t und werden in Steinbrüchen als Bau- und Dekorsteine gewonnen.<br />
Quarzit<br />
Als Quarzite werden monomineralische, sowohl niedriggradige als auch hochgradige Metamorphite bezeichnet,<br />
die fast nur aus Quarz bestehen. Ihre Edukte waren meist Sand- und Schluffsteine, die ursprünglich schon nur<br />
aus Quarzkörnern bestanden haben. Der Mineralbestand hat sich bei <strong>der</strong> Metamorphose nicht verän<strong>der</strong>t, wohl<br />
aber Korngröße und Kornbindung. Im Vergleich zu sedimentären Quarzsandsteinen sind Quarzite oft gröberkörnig<br />
und frei von primären Gesteinsporen. Reine Quarzite sind unter allen isochemen, auch höchstgradigen<br />
Metamorphosebedingungen stabil. Manche Quarzite erscheinen massig, an<strong>der</strong>e haben eine deutliche Foliation.<br />
Selbst in hochgradig metamorphen Quarziten können noch primäre Sedimentstrukturen (z.B. Schrägschichtung,<br />
Rippelmarken) erhalten sein. Die Eigenschaften von reinen Quarziten sind denen ihrer sedimentären Ausgangsgesteine<br />
vergleichbar (siehe oben). Manche Quarzite werden in Steinbrüchen als Bausteine gewonnen.<br />
Grünschiefer<br />
Grünschiefer sind dunkle, weiche, schiefrige Metamorphite, die vor allem aus dem grünen Mineral Chlorit bestehen.<br />
Es handelt sich um relativ niedriggradige Metamorphite, die vor allem aus sedimentären (Mergel) und vulkanischen<br />
(basische Tuffe) Ausgangsgesteinen bei <strong>der</strong> Regionalmetamorphose und bei <strong>der</strong> druckbetonten Metamorphose<br />
hervorgehen können. Manche Grünschiefer, die Talk enthalten o<strong>der</strong> fast nur aus Talk bestehen,<br />
werden als Talkschiefer bezeichnet. Die mechanischen Eigenschaften von Grünschiefern und Talkschiefern sind<br />
mit denen von Tonschiefern vergleichbar (siehe oben); sie sind extrem rutschungsanfällig. Grünschiefer sind z.B.<br />
in den Zentralalpen, im Bayerischen Wald und im Schwarzwald zu finden.<br />
Amphibolit<br />
Amphibolite sind, ähnlich wie Gneise, recht grobkörnige Metamorphite, die im Wesentlichen aus Plagioklas und<br />
Hornblende bestehen. Daneben können sie Biotit, Pyroxen und Granat enthalten. Wie Gneise zeigen sie immer<br />
ein deutliches Parallelgefüge. Sie sind recht dunkel und weisen oft eine leicht grünliche Färbung auf. Amphibolite<br />
mit großen Granatkristallen sind Granatamphibolite. Amphibolite sind hochgradige Metamorphite, die aus basischen<br />
Magmatiten (z.B. Gabbros, Basalten) sowie Sedimentgesteinen (z.B. Mergel) vor allem bei <strong>der</strong> Regionalmetamorphose<br />
hervorgehen können. Die mechanischen Eigenschaften von Amphiboliten sind denen von Gneisen<br />
vergleichbar. Ihr paralleles Trennflächengefüge kann zu Gleitungen Anlass geben. Amphibolite sind z.B. in<br />
den Zentralalpen, dem Bayerischen Wald und dem Schwarzwald verbreitet.<br />
Serpentinit
28<br />
Serpentinite sind dunkle, grünliche o<strong>der</strong> rötliche, feinkörnige Metamorphite, die im Wesentlichen aus dem Mineral<br />
Serpentin bestehen. Als Kluftminerale treten neben Calcit vor allem Asbest und Talk auf. Serpentinite zeigen<br />
meist kein deutliches Parallelgefüge. Serpentinite sind hochgradige Metamorphite, die aus ultrabasischen, olivinund<br />
pyroxenreichen Magmatiten (z.B. Peridotiten) hervorgehen können. Die mechanischen Eigenschaften von<br />
Serpentiniten sind sehr stark von <strong>der</strong> Klüftigkeit und den vorkommenden Kluftmineralen (z.B. Talk) abhängig.<br />
Serpentinite kommen stellenweise z.B. in den Zentralalpen (Tauern, Samnaun), <strong>der</strong> Oberpfalz, dem Schwarzwald<br />
o<strong>der</strong> dem Erzgebirge vor.<br />
Eklogit<br />
Eklogite sind dunkelgrüne, höchstgradig metamorphe Gesteine, die im Wesentlichen aus bestimmten grün<br />
gefärbten Pyroxenen (Omphacit) bestehen und rot gefärbte Granate enthalten. Mit an<strong>der</strong>en ähnlichen Gesteinen<br />
werden sie zu den ultrametamorphen Gesteinen <strong>der</strong> „Eklogitfazies“ gerechnet, die bei extrem hohen Drucken und<br />
mäßig hohen Temperaturen entstanden sind. Sie sind Produkte <strong>der</strong> sog. Versenkungsmetamorphose und finden<br />
sich in den stark gehobenen zentralen Teilen vieler Gebirge, z.B. in den Ötztaler Alpen.<br />
Granulit<br />
Granulite sind helle, meist feinkörnige, höchstgradig metamorphe Gesteine, die vor allem aus Quarz und beson<strong>der</strong>en<br />
Feldspäten bestehen. Im Gegensatz zu Graniten, denen sie ähnlich sehen können, enthalten sie primär<br />
we<strong>der</strong> Glimmer noch Amphibole, son<strong>der</strong>n Pyroxene und Granat. Die Quarzkörner sind plattig ausgebildet und<br />
werden „Scheibenquarze“ genannt. Mit an<strong>der</strong>en ähnlichen Gesteinen, z.B. den gleichfalls granatführenden Charnockiten,<br />
werden sie zu den ultrametamorphen Gesteinen <strong>der</strong> „Granulitfazies“ gerechnet, die bei so extremen<br />
Drucken und hohen Temperaturen (teilweise über 800°C) entstanden sind, dass sie eigentlich hätten aufschmelzen<br />
müssen. Dass sie nicht geschmolzen sind, verdanken sie beson<strong>der</strong>s „trockenen“ (fluidarmen) Metamorphosebedingungen.<br />
Durch die extrem hohen Drucke haben sich in diesen Gesteinen teilweise Diamanten und Hochdruckmodifikationen<br />
des Quarzes gebildet. Granulite gibt es in den alten Festlandskernen dieser Erde, z.B. in<br />
Skandinavien o<strong>der</strong> Indien, aber auch in den Vogesen und im „Sächsischen Granulitgebirge“. Bestimmte granathaltige<br />
Granulite werden gelegentlich als Bau- o<strong>der</strong> Dekorsteine verwendet.<br />
Migmatit<br />
Migmatite sind höchstgradig metamorphe, körnige Gesteine, die vor allem aus Feldspäten, Quarz und unterschiedlichen<br />
Mafiten bestehen. Sie besitzen ein mehr o<strong>der</strong> weniger ausgeprägtes Parallelgefüge und erinnern<br />
dadurch an Gneise. Manchmal ist es nur ganz schwach entwickelt und deutlich verfaltet. Vielfach sind jedoch die<br />
Glimmer und an<strong>der</strong>e mafische Minerale nicht parallel dazu eingeregelt, im Gegensatz zu Gneisen. Lagenweise<br />
können im Gestein grobkörnige, granitähnliche Partien mit einem echten magmatischen Gefüge auftreten. Migmatite<br />
sind bei hohen Drucken so stark aufgeheizt worden, dass sie aufzuschmelzen begannen. Deshalb vereinigen<br />
sie typische Merkmale metamorpher (Parallelgefüge, Faltung) mit denen magmatischer (abschnittsweise<br />
fehlende Einregelung <strong>der</strong> Mafite und Gefüge plutonischer Gesteine) Gesteine. Je nachdem, wie weit die Aufschmelzung<br />
des Gesteins vorangekommen war, werden Anatexite, Metatexite und Diatexite unterschieden. Die<br />
Frage, ob es sich bei dem Gestein tatsächlich um einen Migmatit handelt o<strong>der</strong> nicht, lässt sich oft nicht anhand<br />
eines einzigen Handstückes entscheiden. Migmatite sind z.B. im Schwarzwald, in Böhmen o<strong>der</strong> in Skandinavien<br />
weit verbreitet. Interessant gemaserte Migmatite werden heute als Bau- und Dekorsteine geschätzt.<br />
4.4 Wichtige Nachschlagewerke und Bestimmungsbücher für Gesteine<br />
BAYER. GEOL. LANDESAMT (1984): Oberflächennahe Mineralische Rohstoffe von Bayern.– Geologica Bavarica, 86, 563 S.; München.<br />
DIETRICH, R.V. & SKINNER, B.J. (1984): Die Gesteine und ihre Mineralien.– 357 S.; Thun (Ott-Verl.).<br />
GRUNDMANN, G. & SCHOLZ, H. (1985): Kieselsteine im Alpenvorland. Iller, Lech, Isar, Inn.– 72 S.; München (Weise-Verl.).<br />
JUBELT, R. & SCHREITER, P. (1972): Gesteinsbestimmungsbuch.– 178 S.; Hanau (Dausien-Verl.).<br />
MARESCH, W. & MEDENBACH, O. (1987): Gesteine.– In: STEINBACH, G. ed. (1987), Steinbachs Naturführer, 287 S.; München (Mosaik V.).<br />
MARKL, G. (2004): Mineralien und Gesteine. Eigenschaften, Bildung, Untersuchung.– 355 S.; München (Elsevier / Spektrum-Verl.)<br />
NICKEL, E. (1975): Aufbaukurs Petrographie.– In: Grundwissen in Mineralogie, Teil 3, 2. Aufl., 300 S. Thun (Ott-Verl.).<br />
PAPE, H. (1981): Leitfaden zur Gesteinsbestimmung.– 4. Aufl., 152 S.; Stuttgart (Enke-V.).<br />
SCHUMANN, W. (1973): Steine und Mineralien.- BLV Bestimmungsbuch, 2. Aufl., 227 S.; München, Bern, Wien (BLV-Verl.).
TUCKER, M.E. (1985): Einführung in die Sedimentpetrologie.– 262 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
WIMMENAUER, W. (1985): Petrographie <strong>der</strong> magmatischen und metamorphen Gesteine.– 382 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
29<br />
5. EINIGE WEITERE GRUNDLAGEN DER<br />
ALLGEMEINEN GEOLOGIE<br />
Was bisher über die Eigenschaften von Gesteinen gesagt worden ist, gilt uneingeschränkt nur für frische, „gesunde“<br />
und unverwitterte Gesteine. Die geologischen Körper, mit denen wir es bei allen Fragen des Umweltschutzes,<br />
<strong>der</strong> Baugeologie o<strong>der</strong> Hydrogeologie zu tun haben, waren aber schon während und unmittelbar nach ihrer<br />
Bildung tektonischen Spannungen im Erdinnern ausgesetzt, weisen dadurch vielfach Risse auf o<strong>der</strong> sind bis in<br />
den mikroskopischen Bereich hinein zerbrochen. Außerdem liegen diese geologischen Körper heute alle direkt an<br />
o<strong>der</strong> zumindest nahe <strong>der</strong> Erdoberfläche. In <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Erdoberfläche liegen sie aber meist schon seit geraumer<br />
Zeit (u.U. viele Millionen Jahre). Sie waren und sind hier <strong>der</strong> Erosion und <strong>der</strong> Verwitterung ausgesetzt, die die<br />
Eigenschaften von Gesteinen entscheidend verän<strong>der</strong>n können. Mit <strong>der</strong> Zeit kann so aus einem eigentlich<br />
wasserundurchlässigen ein hoch durchlässiger geologischer Körper werden. Eigentlich stabile, standfeste<br />
Gesteine können so gefährlich instabil werden.<br />
5.1 Verwitterung und Bodenbildung<br />
Von den Faktoren, die Standfestigkeit, Durchlässigkeit und Schadstoffrückhaltevermögen geologischer Körper<br />
entscheidend beeinflussen können, ist die Verwitterung einer <strong>der</strong> wichtigsten. Grundsätzlich werden folgende<br />
Arten <strong>der</strong> Verwitterung unterschieden:<br />
Unter physikalischer Verwitterung fasst man eine Reihe von Vorgängen zusammen, die geeignet ist, das<br />
Gefüge von Gesteinen mechanisch zu lockern, zu zermürben und schließlich zu zerstören. Dazu gehört u.a. das<br />
Zermürben von Gesteinsoberflächen durch Temperaturunterschiede, denen sie an <strong>der</strong> Erdoberfläche ausgesetzt<br />
sind. Diese Temperaturverwitterung ist vor allem durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten verschiedener<br />
Mineralkörner und ihre unterschiedliche Fähigkeit bedingt, Wärme zu absorbieren (u.a. von <strong>der</strong>en<br />
Farbe abhängig). Sie ist vor allem in Gebieten mit fehlen<strong>der</strong> Vegetationsdecke wirksam. In vegetationsbedeckten<br />
Gebieten spielt dagegen die physikalisch-biologische Verwitterung im Boden eine wichtige Rolle, die mechanische<br />
Erweiterung von Fissuren durch den Wachstumsdruck von Pflanzenwurzeln, die als Wurzelsprengung<br />
bezeichnet wird. Die Frostsprengung zermürbt die Gesteine dagegen durch das Frieren von Wasser, das von <strong>der</strong><br />
Oberfläche her in Fissuren (Klüfte) eingedrungen ist, vor allem in den arktischen und gemäßigten Klimazonen<br />
sowie in Hochgebirgen. Sie ist vor allem dort beson<strong>der</strong>s effektiv, wo häufige Frost/Tau-Wechsel auftreten. In<br />
Gebieten mit starker Verdunstung, in Trockengebieten, kann es in Gesteinsporen und -fissuren zur Abscheidung<br />
von Salzen kommen, die bei <strong>der</strong> Kristallisation einen erheblichen Druck ausüben. Diese Salzverwitterung führt zu<br />
einer Lockerung des Gefüges. Salzverwitterung spielt auch an felsigen Küsten <strong>der</strong> gemäßigten Breiten eine<br />
gewisse Rolle.<br />
Unter chemischer Verwitterung werden alle Vorgänge zusammengefasst, bei denen Gesteine durch das<br />
Regenwasser o<strong>der</strong> durch im Wasser gelöste Stoffe chemisch verän<strong>der</strong>t, zersetzt und gelöst werden. Gips, Steinsalz<br />
und an<strong>der</strong>e Salze werden schon von reinem Wasser aufgelöst. Diese Lösungsverwitterung ist umso<br />
effektiver, je wärmer das Wasser ist. Kalkstein, Dolomit, an<strong>der</strong>e Karbonate und karbonathaltige Gesteine (z.B.<br />
Sandsteine) werden allerdings erst durch säurehaltiges Wasser angegriffen und langsam aufgelöst. Das kann<br />
Kohlensäureverwitterung (natürlicher CO2-Gehalt des Regenwassers) o<strong>der</strong> Rauchgasverwitterung sein (SO3-<br />
Gehalt des Regenwassers in Industriegebieten und Städten). Die Oxidationsverwitterung greift vor allem an <strong>der</strong><br />
Luft instabile Mineralkörner in Gesteinen an, vor allem Sulfide. Die hydrolytische Verwitterung greift kieselsäure-
30<br />
haltige Gesteine durch Hydrolyse an, und zersetzt viele Silikate (vor allem Feldspäte) mit <strong>der</strong> Zeit zu Tonmineralen<br />
und Quarz o<strong>der</strong> löst sie ganz auf. Durch die biologische Aktivität von bodenbewohnenden Mikroorganismen<br />
entstehen u.a. Huminsäuren. Durch diese organischen Stoffe werden bei <strong>der</strong> chemisch-biologischen Verwitterung<br />
die meisten Silikate und Nichtsilikate (sogar Quarz) angegriffen und mit <strong>der</strong> Zeit völlig zersetzt.<br />
5.2 Abtragung und Massenbewegungen<br />
Gesteine an <strong>der</strong> Erdoberfläche sind nicht nur <strong>der</strong> Verwitterung, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Abtragung (Erosion) ausgesetzt.<br />
Als Abtragungsmedien kommen Schwerkraft, Wasser, Gletscher und Wind in Betracht. Die Schwerkraft<br />
sorgt dafür, dass sich <strong>der</strong> Frostschutt zu großen Schutthalden anhäuft o<strong>der</strong> sich große Gesteinsmassen talwärts<br />
in Bewegung setzen, Vorgänge die als Massenbewegungen bezeichnet werden (Bodenfließen, Rutschungen,<br />
Felsstürze etc.). Fließendes Wasser von Bächen und Flüssen erodiert vor allem linear, erzeugt V- o<strong>der</strong> kastenförmige<br />
Erosionstäler und Schluchten. Durch Zunahme des Gefälles wird die Erosion beschleunigt. Die Brandung<br />
erodiert Meeresküsten und Ufer großer Seen; es entstehen Steilküsten (Kliff) mit vorgelagerten Brandungsschorren.<br />
Gletscher erodieren manche Landschaften flächenhaft und schürfen U-Täler, Fjorde und große<br />
Wannen in den Untergrund, die sich später mit Seen füllen können. Durch die Wirkung sand- und staubbefrachteter<br />
Starkwinde werden Hartgesteine wie von einem Sandstrahlgebläse abgeschliffen (Windkorrasion), vor<br />
allem in Trockengebieten und an Küsten. Starkwinde können auch weite Wannen in feinkörnigen Ablagerungen<br />
ausblasen (Deflation). Durch Wasser und Eis werden Lockergesteine (z.B. Kiese, Sande, Tone, vulkanische<br />
Tuffe) und diagenetisch nur schwach verfestigte Sedimente beson<strong>der</strong>s leicht abgetragen.<br />
Voraussetzung für alle Arten von Erosion ist das Vorhandensein eines Reliefs. Je größer die relativen Höhenunterschiede<br />
in einem Gebiet sind, desto schneller und effizienter wirken die meisten Arten <strong>der</strong> Erosion. Lockergesteine<br />
sowie Festgesteine, die viele Trennflächen enthalten (z.B. gut geschichtete Sedimentgesteine, Tonschiefer,<br />
Glimmerschiefer und an<strong>der</strong>e Metamorphite, stark geklüftete Tiefen- und Ergussgesteine), werden durch<br />
die Schwerkraft leicht in kantigen Schutt zerlegt. Bei mächtigen Ton- und Mergelfolgen, Ton-Sandstein-Wechselfolgen,<br />
Schiefern, Glimmerschiefern u.a. kann die Schwerkraft – ein hinreichend kräftiges Relief vorausgesetzt<br />
– beson<strong>der</strong>s leicht große Massenbewegungen auslösen. Bergflanken können dadurch in Bewegung geraten und<br />
sich in Form von langsam o<strong>der</strong> schnell kriechenden Rutschmassen o<strong>der</strong> Felsstürzen auf die Täler zubewegen.<br />
Bei vielen Massenbewegungen sind Gesteinsmassen von mehr als 1 km³ in Bewegung! Auch an und für sich sehr<br />
standfeste Gesteine können von solchen Massenbewegungen betroffen sein, wenn nur Gleitbahnen mit einer<br />
Orientierung vorhanden sind (z.B. dünne Tonzwischenlagen, Schieferungsflächen), die ein Talwärtsgleiten<br />
erlauben. Massenbewegungen führen immer zu einer Öffnung von Klüften und damit zu einer erhöhten, manchmal<br />
extrem hohen Wasserwegsamkeit. Über geöffnete Klüfte eindringendes Wasser kann u.U. bis dahin trockene<br />
Tonzwischenlagen unter Gleitmassen aufweichen, was die Gleitvorgänge wie<strong>der</strong>um beschleunigt. Zudem kann<br />
sich in offenen Klüften ein nicht zu unterschätzen<strong>der</strong> Kluftwasserschub aufbauen.<br />
Die Erosionsanfälligkeit <strong>der</strong> Gesteine ist aber nicht nur von <strong>der</strong> Gesteinsart, <strong>der</strong> Gesteinsfestigkeit, dem erodierenden<br />
Medium und von Art, Dichte und Orientierung <strong>der</strong> Trennflächen abhängig, son<strong>der</strong>n und vor allem auch<br />
vom Klima. Lockere Kiese z.B. werden normalerweise durch Schwerkraft, Wasser und Gletscher leichter abgetragen<br />
als Granit, nicht aber durch Wind. Gipsvorkommen erweisen sich unter humiden Klimaten als erosionsanfällig<br />
(Löslichkeit!) und werden leichter abgetragen als viele Lockergesteine. Unter voll ariden Bedingungen dagegen ist<br />
Gips o<strong>der</strong> Steinsalz überraschend erosionsresistent. In Wüsten werden Gipslager durch die Abtragung <strong>der</strong><br />
umgebenden Gesteine häufig als Hügel herauspräpariert. Feinkörnige Basalte bilden bei uns oft felsige Bergkuppen<br />
(z.B. in <strong>der</strong> Rhön), da sie sich in kühlen Klimaten als wesentlich erosionsresistenter als etwa Granite erweisen,<br />
<strong>der</strong>en grobes Korngefüge durch Spaltenfrost und Temperaturverwitterung beson<strong>der</strong>s leicht zermürbt werden<br />
kann. In den feuchten Tropen dagegen werden gerade Basalte bevorzugt zersetzt und abgetragen, vor allem<br />
wegen <strong>der</strong> vergleichsweise großen Oberfläche <strong>der</strong> chemisch leicht angreifbaren, mikroskopisch kleinen Feldspatkriställchen,<br />
die in den meisten Basalten wesentliche Teile des Gesteins aufbauen.<br />
5.3 Tektonik<br />
Manche Gesteine, die an <strong>der</strong> Erdoberfläche entstehen, sind unmittelbar nach <strong>der</strong> Bildung überaus porös und<br />
extrem wasserdurchlässig, etwa Flusskiese, grobe Küstensande, Riffkalke, Kalktuffe, vulkanische Tuffe o<strong>der</strong> bla-
31<br />
senreiche Laven. Durch die Prozesse <strong>der</strong> Diagenese (Auspressen des Wassers durch Kompaktierung, Fällung<br />
von Mineralen in den Poren etc.) vermin<strong>der</strong>t sich im Laufe <strong>der</strong> Zeit meist das ursprüngliche Porenvolumen und<br />
damit auch die Wasserdurchlässigkeit dieser Gesteine, bei gleichzeitiger Zunahme <strong>der</strong> Festigkeit (zur Diagenese<br />
vergl. Abschnitt 4.2). Die Diagenese kann so weit gehen, dass aus ursprünglich hoch durchlässigen Lockergesteinen<br />
Festgesteine ohne nennenswerte Permeabilität werden. Am Ende <strong>der</strong> Diagenese verbleibt den Gesteinen<br />
also eine gesteinsspezifische primäre Durchlässigkeit. Diesen Vorgängen sind jedoch an<strong>der</strong>e Prozesse<br />
entgegengerichtet, die letztlich auf die tektonische Geschichte <strong>der</strong> Festgesteine zurückgehen. Tektonische Zerlegung<br />
und gegebenenfalls nachfolgende Verkarstung können zu einer neuerlich erhöhten Wasserwegsamkeit,<br />
zu einer sekundären Durchlässigkeit entlang tektonischer Trennflächen (Klüfte) bzw. Karstspalten und<br />
Karsthöhlen führen, die im Extremfall um Zehnerpotenzen größer sein kann als die primäre.<br />
5.3.1 Klüfte<br />
Klüfte sind in allen Festgesteinen zu finden. In löslichen Festgesteinen (z.B. Kalkstein, Dolomit, Gips, Steinsalz)<br />
können sie auch zu Karstspalten und Höhlen erweitert sein. Klüfte treten meist in parallel orientierten Kluftscharen<br />
auf, die die Gesteine in bestimmten, die Beanspruchung dieser Gesteine wi<strong>der</strong>spiegelnden Richtungen<br />
durchsetzen. Mehrere Kluftscharen können sich in unterschiedlichen Winkeln kreuzen und qua<strong>der</strong>förmige o<strong>der</strong><br />
polyedrische Gesteinskörper mit vielfach glatten Außenflächen begrenzen, die als Kluftkörper bezeichnet werden.<br />
Die Kluftabstände sind u.a. von <strong>der</strong> Gesteinsart abhängig und können bei unterschiedlichen Kluftscharen<br />
des gleichen Gesteins sehr verschieden sein. Kluftabstände von vielen Metern, manchmal sogar Dekametern (vor<br />
allem bei grobkörnigen Tiefengesteinen), aber auch nur Zentimetern o<strong>der</strong> gar Bruchteilen von Millimetern<br />
kommen vor.<br />
Offene Klüfte bilden sich schon während <strong>der</strong> tektonischen Beanspruchung, sind aber in Reliefhochlagen beson<strong>der</strong>s<br />
häufig, wo selbst ursprünglich geschlossene Gesteinsfugen durch kriechende Hangbewegungen aufgedehnt<br />
sein können. Die weitgehend unverän<strong>der</strong>ten Kluftkörper, Gesteinspartien, die we<strong>der</strong> von tektonischen Trennflächen<br />
noch von Karstspalten durchsetzt werden, sind oft viel größer als die Probekörper, an denen im Labor<br />
Durchlässigkeiten ermittelt werden können. An diesen Probekörpern können i.d.R. deshalb nur Durchlässigkeiten<br />
ermittelt werden, die <strong>der</strong> primären Porosität <strong>der</strong> Gesteine entsprechen. Entscheidend für alle praktischen Fragen,<br />
die z.B. mit dem Schutz o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nutzbarkeit von Grundwasser zusammenhängen, ist aber weniger die im Labor<br />
ermittelte Gesteinsdurchlässigkeit, son<strong>der</strong>n die Gebirgsdurchlässigkeit größerer geologischer Gesteinsverbände,<br />
die nur mit Hilfe von aufwändigeren Untersuchungen im Gelände (Bohrungen, Pumpversuche etc.) zuverlässig<br />
gemessen werden kann. Die so ermittelte und realistischere Gebirgsdurchlässigkeit kann aber zuweilen um<br />
mehrere Zehnerpotenzen größer sein, als uns die im Labor ermittelten Werte glauben machen wollen!<br />
Abstand, Öffnung, Größe, Beschaffenheit und Orientierung von tektonischen Trennflächen sind nicht nur vom<br />
Gestein abhängig, son<strong>der</strong>n auch von Art und Intensität <strong>der</strong> Beanspruchung. Grundsätzlich reißen Klüfte in<br />
Gesteinen auf, wenn sie in <strong>der</strong> Tiefe dehnend, stauchend, biegend o<strong>der</strong> scherend beansprucht worden sind. Aber<br />
auch wenn höhere Stockwerke eines geologischen Körpers <strong>der</strong> Erosion zum Opfer fallen, können durch die<br />
Entlastung oberflächenparallel orientierte Kluftscharen entstehen. Die Art <strong>der</strong> Beanspruchung lässt sich häufig<br />
schon direkt an bestimmten Strukturen ablesen, die an Felswänden und in Steinbrüchen zu sehen sind.<br />
5.3.2 Sättel und Mulden<br />
Falten in Gesteinen entstehen meist durch einengende Bewegungen, wobei die Faltenachsen (b) etwa senkrecht<br />
zur Richtung <strong>der</strong> tektonischen Verkürzung (a) zu stehen pflegen. Innerhalb <strong>der</strong> Falten kann man Sättel (Antiklinalen)<br />
und Mulden (Synklinalen) unterscheiden. In den Sattelkernen findet man die älteren Gesteine <strong>der</strong> gefalteten<br />
Schichtfolge, in den Muldenkernen die jüngeren. Schöne, eindrucksvolle Falten sind z.B. in den helvetischen<br />
Bergen des Allgäus, Vorarlbergs und <strong>der</strong> Ostschweiz zu finden. Man kann unterschiedliche Typen von Falten<br />
unterscheiden, z.B. aufrechte, schiefe, überkippte, liegende o<strong>der</strong> tauchende. Mehrere Falten hintereinan<strong>der</strong> können<br />
zu Synklinorien eingemuldet o<strong>der</strong> zu Antiklinorien (z.B. Ifen-Antiklinorium) aufgewölbt sein.<br />
Auf die gleiche Beanspruchung, bei <strong>der</strong> sprö<strong>der</strong>e und dickbankige Gesteine zerbrechen o<strong>der</strong> sich höchstens<br />
weitspannig verbiegen lassen, reagieren dünnbankige und tonreiche Schichtfolgen mit <strong>der</strong> Ausbildung zahlreicher<br />
kleiner Falten. Beson<strong>der</strong>s faltungsfreudig sind tonreiche Gesteine o<strong>der</strong> Schichtstapel, die aus Wechselfolgen von<br />
festen o<strong>der</strong> kompetenten Kalk- o<strong>der</strong> Sandsteinbänken und weichen inkompetenten, tonig-mergeligen Zwischenlagen<br />
bestehen (z.B. Allgäuschichten <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen o<strong>der</strong> Drusbergschichten des Helvetikums).
32<br />
Bei kleineren Falten, mit Schenkellängen von einigen Metern, kann man häufig direkt sehen, dass die weicheren<br />
Tonzwischenlagen im Bereich <strong>der</strong> Faltenschenkel ausgequetscht wurden und ausdünnen, während sie in die<br />
Umbiegungsstellen (Faltenscheitel) eingewan<strong>der</strong>t und hier stark verdickt sein können.<br />
Mächtige, kompetente Gesteinsplatten, die gemeinsam mit inkompetenten, tonreichen Schichtfolgen verfaltet<br />
sind, lassen sich unter allseitigem hohen Druck fast bruchlos zu weitspannigen Sätteln und Mulden verbiegen,<br />
während die inkompetenten Gesteine eine enge „Spezialfaltung“ aufweisen. Große Falten kommen an vielen<br />
Stellen <strong>der</strong> Nordalpen vor, sind aber oft nur schwer zu erkennen. Viele riesige, nach Norden überkippte, ebenmäßig<br />
gebaute Falten sind im Helvetikum des Gottesackergebietes zu sehen. Die Sattelumbiegungen sind durch<br />
größere Störungen, meist Blattverschiebungen, immer wie<strong>der</strong> versetzt. Die Schenkel dieser Falten können Längen<br />
von mehr als 2 km aufweisen. Ein schönes Beispiel stellt auch die „Murnauer Mulde“ <strong>der</strong> Faltenmolasse dar,<br />
eine große Muldenstruktur, die sich zwischen Grünten und Murnau über mehr als 50 km Länge verfolgen lässt.<br />
5.3.3 Schieferung<br />
Ton- und Mergelsteine, die ursprünglich einmal in Tiefen von vielen Kilometern deformiert worden waren, durch<br />
Hebung und Erosion aber heute wie<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Erdoberfläche liegen, sind als blättrig zerfallende Schiefer ausgebildet.<br />
Die Schieferungsflächen haben nichts mit <strong>der</strong> ursprünglichen Schichtung <strong>der</strong> Gesteine zu tun, denn sie<br />
sind manchmal spitzwinklig o<strong>der</strong> gar senkrecht zu den sedimentär gebildeten Bankfugen orientiert. Diese Transversalschieferung<br />
ist beson<strong>der</strong>s schön in den paläozoischen, schwach metamorphen Tonschiefern des Rheinischen<br />
Schiefergebirges ausgebildet, die beim Kontakt mit Feuchtigkeit nicht mehr aufweichen und aus denen<br />
man Dachplatten o<strong>der</strong> Schiefertafeln herstellen kann. Eine schwache Schiefrigkeit ist aber schon in den Allgäuschichten<br />
und Drusbergschichten <strong>der</strong> Nordalpen zu beobachten.<br />
Die Schiefrigkeit beginnt sich als Ergebnis einer Auflösung <strong>der</strong> das Gestein aufbauenden Minerale unter hohen<br />
tektonischen Spannungen zu entwickeln, entlang von parallel orientierten Flächen, die man als Querplattung<br />
bezeichnet. Diese Lösungsschieferung beginnt in Sedimentgesteinen weit unterhalb <strong>der</strong> Metamorphose. Durch<br />
die tektonisch bedingte Drucklösung können bis 50 % des ursprünglichen Gesteinsvolumens spurlos verschwinden.<br />
Die Schiefrigkeit wird durch scherende Bewegungen entlang dieser Flächen „gestrafft“. Durch das gerichtete<br />
Wachstum und die Einregelung von neu sprossenden Mineralen parallel zu diesen Flächen entsteht bei<br />
beginnen<strong>der</strong> Metamorphose schließlich eine Kristallisationsschieferung. Am Ende wird das Gestein von<br />
engständigen, auffällig parallel orientierten Flächenscharen durchsetzt; das Gestein besitzt jetzt eine sog. Schiefrigkeit<br />
o<strong>der</strong> Foliation. Durch Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Spannungsrichtung können in Gesteinen nacheinan<strong>der</strong> zwei o<strong>der</strong> drei<br />
unterschiedlich orientierte Scharen von Schieferungsflächen entstehen.<br />
5.3.4 Verwerfungen und Störungszonen<br />
Spannungen in Gesteinen können sich abbauen, indem in den Gesteinen Klüfte aufreißen. Wo größere Klüfte<br />
aufhören sind auf den Kluftflächen sog. „Besenstrukturen“ zu sehen. Flächen, an denen sich Gesteinspakete<br />
relativ zueinan<strong>der</strong> verschieben, werden Störungen (Verwerfungen) genannt. Der messbare Versatz an solchen<br />
Störungen kann Zentimeter, Meter, Dekameter o<strong>der</strong> auch Kilometer betragen. Man kann unterschiedliche Arten<br />
von Störungen unterscheiden – je nach Lage <strong>der</strong> Fläche im Raum und dem relativen Bewegungssinn. Auch an<br />
Störungsflächen, entlang <strong>der</strong>er die angrenzenden Gesteinspartien deutlich gegeneinan<strong>der</strong> versetzt sind, kann<br />
vielfach die Art <strong>der</strong> Beanspruchung ermittelt werden. Durch dehnende Beanspruchung werden die Gesteine vor<br />
allem durch Störungen zerlegt, die als Abschiebungen bezeichnet werden. Aufschiebungen genannte Störungen<br />
deuten demgegenüber auf eine einengende Beanspruchung hin. Scherende Bewegungen parallel zur Erdoberfläche<br />
können zu horizontalen Versätzen entlang steilstehen<strong>der</strong> Störungen (Blattverschiebungen) o<strong>der</strong> an<br />
flach liegenden Bewegungsflächen führen (Überschiebungen). Manche steilstehende Störungen sind in Felswänden<br />
als „Verschneidungen“ sichtbar. Durch Verwitterung und Erosion haben sich an ihrer Stelle oft Rinnen<br />
eingetieft. Allerdings ist es nicht immer einfach, in undeutlich gebankten Gesteinen Schichtfugen von Störungen<br />
zu unterscheiden. Störungsflächen selber können wie ein Gletscherschliff poliert sein (Harnisch) und parallel<br />
orientierte Rillen (Striemen) aufweisen. Anhand <strong>der</strong> Striemung einer Harnischfläche kann <strong>der</strong> Bewegungssinn <strong>der</strong><br />
angrenzenden Gesteinspakete ermittelt werden. Entlang von großen Störungszonen, die oft Dekameter o<strong>der</strong><br />
sogar Hun<strong>der</strong>te von Metern breit werden, kann <strong>der</strong> Zerrüttungsgrad <strong>der</strong> Gesteine sehr stark sein. Die Gesteine<br />
können durch Kataklase zu Grus, Gesteinsmehl („Mylonite“) o<strong>der</strong> schieferartigen Phylloniten zerbrochen o<strong>der</strong><br />
zerrieben sein. Bedeutende Störungen werden von <strong>der</strong> Erosion bevorzugt ausgeräumt und durch Täler und<br />
Depressionen nachgezeichnet.
33<br />
Störungszonen können hoch wasserdurchlässig sein, vor allem an Stellen, wo sie weiter geöffnet sind. Dieser<br />
letztlich durch tektonische Spannungen bedingten sekundären Wasserwegsamkeit wirken allerdings wie<strong>der</strong>um<br />
Prozesse entgegen, die mit <strong>der</strong> Zeit zu einer erneuten Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Durchlässigkeit führen können. Zunächst<br />
lockere, oft pulverförmige o<strong>der</strong> knetbare Kataklasite sind wie klastische Sedimente <strong>der</strong> Diagenese ausgesetzt<br />
und können mit <strong>der</strong> Zeit durch chemische Ausfällungen zu festen Gesteinen verkittet werden, z.B. zu<br />
Störungsbrekzien. Die Ausfällungen stammen aus <strong>der</strong> Lösungsfracht <strong>der</strong> in Klüften, Störungen und Poren zirkulierenden<br />
warmen o<strong>der</strong> kalten Wässern. Die Kluftminerale kristallisieren an den Kluftwänden und auf <strong>der</strong> Oberfläche<br />
von Gesteinsbruchstücken (Kataklasten) aus, was mit <strong>der</strong> Zeit zu einer sekundären Verringerung <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Durchlässigkeit geöffnete Klüfte und Poren führt. Als Kluftminerale treten neben Schwerspat, Erzen und vielen<br />
an<strong>der</strong>en vor allem Quarz, Calcit und Dolomit auf. Die Kluftminerale lassen oft eine gewisse Abhängigkeit von <strong>der</strong><br />
chemischen Zusammensetzung des Gesteins erkennen, das von <strong>der</strong> Kluft durchschlagen wird. In Kristallingesteinen<br />
sind die Klüfte meist mit Quarz, in Karbonaten meist mit Calcit gefüllt. Dieser Prozess kann bis zu<br />
einer vollständigen „Verheilung“ und Abdichtung <strong>der</strong> Klüfte mit Kluftmineralen führen, die dann als weiße „A<strong>der</strong>n“<br />
das Gestein durchziehen. Schöne Kristallrasen und Kristalldrusen mit idiomorphen Kristallen sind nur dort zu<br />
finden, wo die Klüfte zumindest noch nicht wie<strong>der</strong> ganz geschlossen sind.<br />
5.3.5 Überschiebungen, Schuppen und Decken<br />
Die bedeutendsten Störungen in den Nordalpen und vielen an<strong>der</strong>en Gebirgen sind Überschiebungen. Entlang <strong>der</strong><br />
ursprünglich horizontal liegenden Überschiebungsbahnen haben sich Teile <strong>der</strong> Erdkruste als Decken übereinan<strong>der</strong>geschoben.<br />
Sind die Überschiebungsweiten relativ gering, spricht man von Schuppen. Eine bedeutende<br />
Überschiebung ist in beson<strong>der</strong>s eindrucksvoller Weise am Allgäuer Hauptkamm (Aggenstein, Trettachspitze)<br />
sichtbar, die Überschiebung <strong>der</strong> Lechtal- auf die Allgäudecke. Hier liegt <strong>der</strong> triassische (Trias-zeitliche)<br />
Hauptdolomit auf jurassischen (Jura-zeitlichen) Allgäu- bzw. Aptychenschichten, also hier liegt Älteres auf<br />
Jüngerem, eine Umkehrung <strong>der</strong> sog. geologischen Lageregel (vergl.Abschnitt 5.5) !<br />
Die Existenz von tektonischen Decken wurde in den Nördlichen Kalkalpen zeitweise in Frage gestellt, obwohl im<br />
belgischen Kohlerevier, in den Glarner Alpen in <strong>der</strong> Schweiz o<strong>der</strong> in den Skanden Norwegens die Existenz von<br />
tektonischen Decken schon seit mehr als 100 Jahren bekannt ist und hier eindeutig nachgewiesen werden kann.<br />
Unter den Geologen gab es leidenschaftliche Befürworter („Nappisten“) und Gegner („Antinappisten“ o<strong>der</strong><br />
„Autochthonisten“) <strong>der</strong> Deckentheorie. Die Gegner bemühten sich nachzuweisen, dass die kalkalpinen Decken –<br />
und darber hinaus die ganzen Alpen – „verwurzelt“ seien, d.h. dass nur ganz unbedeutende Aufschiebungen<br />
vorkommen und die „Decken“ seitlich in Falten übergehen. In dieser Diskussion spielten gerade die Allgäuer<br />
Alpen eine zentrale Rolle. In den östlichen Allgäuer Alpen liegt die Front <strong>der</strong> Lechtaldecke nahe des Nordrandes<br />
<strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen. Mehr als 20 km weiter im Süden, z.B. im Hornbachtal, kommen Juragesteine unter den<br />
Dolomitklötzen <strong>der</strong> Lechtaldecke zum Vorschein. Die Anhänger <strong>der</strong> Deckentheorie nahmen an, dass es sich<br />
dabei um tektonische Fenster handelt, wo tiefere tektonische Stockwerke unter <strong>der</strong> Lechtaldecke herauskommen.<br />
Wenn das aber wirklich so zu beobachten ist, musste man Überschiebungsweiten von mehr als 20 km<br />
annehmen! Die Gegner <strong>der</strong> Deckentheorie deuteten die gleichen Strukturen als kompliziert gebaute, pilzförmige<br />
Falten.<br />
Tiefbohrungen in den Alpen – z.B. die Bohrungen Vor<strong>der</strong>riss 1 im Isartal o<strong>der</strong> Hindelang 1 an <strong>der</strong> Ostrach –<br />
haben mehrere übereinan<strong>der</strong>liegende Decken durchbohrt und dadurch den „Deckenstreit“ im Laufe <strong>der</strong> 70er und<br />
80er Jahre endgültig zugunsten <strong>der</strong> „Nappisten“ entschieden. Man hat dadurch an mehreren Stellen nicht nur den<br />
Deckenbau <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen bestätigen können. Die ganzen Alpen bestehen demnach – wie viele<br />
an<strong>der</strong>e Gebirge auch – tatsächlich aus einem ganzen Stapel von Decken, die mindestens mehrere zehn Kilometer<br />
weit übereinan<strong>der</strong> geschoben sind. Auch die deckenförmige Auflagerung <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen auf dem<br />
Flysch, die des Flysches auf dem Helvetikum und die des Helvetikums auf <strong>der</strong> Molasse ist inzwischen erwiesen.<br />
Auf welche Weise sich Decken genau vorwärtsbewegen ist bis heute nicht ganz geklärt. Viele Decken scheinen<br />
sich auf Deckenbahnen <strong>der</strong> Schwerkraft folgend als Gleitdecken vorwärtszubewegen. Hohe Wassergehalte an<br />
<strong>der</strong> Deckenbasis sowie Porenwasserüberdrücke scheinen die Reibung stark herunterzusetzen. Die ursprünglich<br />
einige Kilometer mächtige Lechtaldecke <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen ist zumindest 30 km weit auf die Allgäudecke<br />
aufgefahren. Für den Überschiebungsbetrag <strong>der</strong> Kalkalpen auf den Flysch muss man ein Vielfaches davon annehmen.<br />
Diese Decken, die vor allem in <strong>der</strong> Kreidezeit aktiv waren, sind heute stark erodiert. Vielfach sind Teile<br />
einer Decke durch Erosion entfernt worden, so dass <strong>der</strong> unter <strong>der</strong> Decke liegende überfahrene Untergrund in
34<br />
einem Deckenfenster sichtbar wird. Oft sind Decken so stark abgetragen, dass nur noch Erosionsreste von ihnen<br />
als Deckenklippen auf dem von <strong>der</strong> Decke einmal überfahrenen Untergrund liegen.<br />
5.3.6 Großtektonische Strukturen<br />
Manche tektonische Strukturen sind nicht viele Meter, Dekameter o<strong>der</strong> Kilometer groß, son<strong>der</strong>n haben Dimensionen,<br />
die nach Hun<strong>der</strong>ten o<strong>der</strong> gar Tausenden von Kilometern zählen. Dazu gehören bedeutende Störungszonen,<br />
sog. tektonische Lineamente. Viele große Lineamente sind Blattverschiebungen, wie <strong>der</strong> San Andreas Fault<br />
(fault = Störung) in Kalifornien, <strong>der</strong> Alpine Fault in Neuseeland, die Periadriatische Naht in den Alpen, die vom<br />
Pustertal o<strong>der</strong> Gailtal nachgezeichnet wird, die Nordanatolische Störungszone in <strong>der</strong> Türkei o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Great Glen<br />
Fault in Schottland. Einige dieser Blattverschiebungen am Festland setzen sich als Transform-Störungen am<br />
Ozeanboden fort (siehe unten). An an<strong>der</strong>en Lineamenten sind vor allem große Vertikalbewegungen abgelaufen,<br />
wie z.B. an <strong>der</strong> Inntalstörung o<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Fränkischen Linie. Manche bedeutende Lineamente können mehrere<br />
zehn Kilometer breit und sehr komplex gebaut sein. Vielfach sind hier zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche<br />
Bewegungen abgelaufen, etwa im Bereich <strong>der</strong> durch Schonen laufenden Fennoskandischen Randzone o<strong>der</strong><br />
am Highland Boundary Fault am Nordrand des Midland Valleys in Schottland. Jedenfalls sind an allen diesen<br />
Störungszonen über lange Zeit hinweg sehr bedeutende Bewegungen abgelaufen. Die Schollen haben sich hier<br />
nachweislich teilweise um mehrere zehn o<strong>der</strong> sogar Hun<strong>der</strong>te von Kilometern gegeneinan<strong>der</strong> verschoben,<br />
verschieben sich teilweise immer noch und sind vielfach immer noch seismisch aktiv.<br />
Zu solchen tektonischen Großstrukturen zählen auch die großen tektonischen Gräben und Grabensysteme<br />
dieser Erde. Der Ostafrikanische und <strong>der</strong> Zentralafrikanische Graben sind bis zu 100 km breite Großstrukturen,<br />
bei denen die Grabensohle relativ zu den Grabenrän<strong>der</strong>n stellenweise um mehr als 4000 m abgesunken ist. Sie<br />
lassen sich quer durch Afrika auf einer Länge von über 3500 km verfolgen. Baikalsee, Rhônetal, Vätternsee o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Oslofjord liegen in großen Grabenstrukturen. Auch in Mitteleuropa gibt es bedeutende tektonische Gräben,<br />
z.B. <strong>der</strong> Oberrheingraben, <strong>der</strong> Egergraben o<strong>der</strong> <strong>der</strong> kleine, aber seismisch beson<strong>der</strong>s aktive Hohenzollerngraben.<br />
An viele dieser Grabenstrukturen ist lebhafte vulkanische Aktivität gebunden. Gerade die Vulkane des Ostafrikanischen<br />
Grabens gehören zu den größten Vulkanen <strong>der</strong> Erde (Kilimandscharo, Meru).<br />
Zu den großen tektonischen Strukturen gehören auch die meisten Hochgebirge dieser Erde. Abgesehen von<br />
Krustenteilen, die ohne richtige Gebirgsbildungsprozesse „anorogen“ zu Hochgebirgen aufstiegen (z.B. die Skanden<br />
o<strong>der</strong> das Ostgrönländische Gebirge), sind es die Decken- und Faltengebirge dieser Erde. Es handelt sich<br />
um beson<strong>der</strong>s langlebige, mitunter zehntausende von Kilometern lange, hun<strong>der</strong>te von Kilometern breite tektonische<br />
Großstrukturen, in denen lang andauernde, mehrphasige, komplexe Deformation <strong>der</strong> Gesteine sich mit<br />
Metamorphose, Magmenbildung, Vulkanismus und großräumigen Senkungs- und Herbungsbewegungen verbinden.<br />
Lange bevor hier Faltung, Metamorphose und Magmatismus ablaufen, werden an den Stellen, aus denen<br />
sich später Gebirge entwickeln, beson<strong>der</strong>s mächtige Schichtfolgen abgelagert. Mit mächigen Sedimenten gefüllte<br />
schmale Tröge, <strong>der</strong>en Inhalte zwar gefaltet worden, in denen aber we<strong>der</strong> Metamorphose noch Magmatismus<br />
festzustellen sind (z.B. Donez-Becken), werden als Aulakogene bezeichnet.<br />
Gebiete, die mit mächtigen Sedimenten bedeckt sind, ohne dass sie große tektonische Deformationen erlebt<br />
hätten, nennt man Plattformen o<strong>der</strong> Tafeln, z.B. die Russische Tafel. Auf Plattformen sind mitunter über weite<br />
Strecken flexurartige Verbiegungen <strong>der</strong> Plattformsedimente verfolgbar, die als Monoklinen bezeichnet werden,<br />
etwa die Weymouth-Monokline in Südengland. Hier treten auch beson<strong>der</strong>e sog. epirogenetische Großstrukturen<br />
auf, etwa riesige, extrem flache Einmuldungen mit Durchmessern von mehr als 1000 km, die als Syneklisen<br />
bezeichnet werden. In ihren Zentren können sich mehr als 10 000 m mächtige Sedimente akkumulieren. Ihnen<br />
gegenüber stehen ganz flache Beulenstrukturen, die Anteklisen, an denen die Sedimente stark ausdünnen.<br />
Handelt es sich um richtige, weite, über ihre Umgebung erhabene Beulen, werden sie als Brachyantiklinalen<br />
bezeichnet. Werden auf solchen flachen Beulenstrukturen über geologische Zeiträume hinweg keine Sedimente<br />
abgelagert und liegt das kristalline Grundgebirge hier frei, nennt man diese Strukturen Schilde. Beispiele hierfür<br />
sind <strong>der</strong> Fennoskandische („Baltische“), <strong>der</strong> Ukrainische o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Laurentische Schild in Kanada.<br />
5.4 Gebirgsbildung und Plattentektonik<br />
In den letzten 80 Jahren hat man nicht nur die Zusammenhänge zwischen den großen und den kleinen tektonischen<br />
Strukturen zu begreifen begonnen; man hat auch plausible Theorien über die Zusammenhänge und die
35<br />
letztlichen Ursachen von Spannungen und Verschiebungen in <strong>der</strong> Erdkruste, <strong>der</strong> Verteilung <strong>der</strong> Kontinente und<br />
Ozeane auf <strong>der</strong> Erdoberfläche, dem Vulkanismus und <strong>der</strong> Gebirgsbildung entwickelt. Zum Verständnis dieser<br />
Zusammenhänge haben die Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen viel beigetragen.<br />
5.4.1 Erdkruste und Erdmantel – Lithosphäre und Asthenosphäre<br />
Mit geophysikalischen Methoden hat man auch entscheidende Erkenntnisse über den Aufbau des Erdinneren<br />
gewonnen. Man geht heute davon aus, dass die Erde einen ausgeprägten konzentrischen Schalenbau aufweist:<br />
Außen die einige Kilometer bis Zehnerkiometer dicke Erdkruste, die hauptsächlich aus sauren Silikatgesteinen<br />
aufgebaut ist und sich in eine Ober- und Unterkruste glie<strong>der</strong>n lässt. Darunter folgt <strong>der</strong> Erdmantel, in dem ein im<br />
Wesentlichen aus basischen Silikaten und Oxiden bestehen<strong>der</strong> Oberer und ein vorwiegend aus Oxiden aufgebauter<br />
Unterer Erdmantel unterschieden werden können. Zwischen Kruste und Mantel liegt eine Zone, in <strong>der</strong><br />
die Dichte nach unten hin sprunghaft zunimmt, die als Mohorovičić-Diskontinuität o<strong>der</strong> kurz Moho bezeichnet<br />
wird. Unter dem Erdmantel folgt in einer Tiefe von ca. 2900 km <strong>der</strong> im Wesentlich aus Eisen und Nickel bestehende<br />
Erdkern, in dem wie<strong>der</strong>um ein Innerer (fester) und ein Äußerer (liqui<strong>der</strong>) Erdkern unterscheidbar sind.<br />
Wie man heute zu wissen glaubt, sind nur die obersten 70 bis 150 km des Erdballs, die Lithosphäre (griech.<br />
„harte Schale“), mehr o<strong>der</strong> weniger starr. Dieses oberste Stockwerk, das nur etwa ein Hun<strong>der</strong>tstel des Erddurchmessers<br />
ausmacht, ist jedoch keineswegs einheitlich zusammengesetzt: Die ersten 5 bis 70 km bestehen aus<br />
vergleichsweise recht leichten Gesteinen <strong>der</strong> Erdkruste (im Schnitt 2,7 g/cm³), darunter folgen die deutlich<br />
schwereren Gesteine des Erdmantels (im Schnitt 3,3 g/cm³), aus denen das Erdinnere auch weit unterhalb <strong>der</strong><br />
Lithosphäre besteht, allerdings in einem ganz an<strong>der</strong>en physikalischen Zustand. Aber auch die Erdkruste ist nicht<br />
überall gleich aufgebaut: Unter den Ozeanen ist die Kruste meist nur etwa 5 bis 10 km dick und besteht aus verhältnismäßig<br />
schwerem Material (im Schnitt 2,9 g/cm³), vor allem aus basaltischen Laven und an<strong>der</strong>en Erstarrungsgesteinen.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Kontinente schwillt sie aber auf 30 bis 40, unter jungen Hochgebirgen manchmal<br />
sogar auf 70 km Dicke an und besteht aus spezifisch etwas leichteren, meist granitähnlichen Tiefengesteinen,<br />
sauren Metamorphiten und Sedimenten (im Schnitt 2,6 g/cm³). Wie Eisschollen auf dem Wasser kann man sich<br />
auch die leichteren Kontinente auf dem spezifisch schwereren Erdmantel schwimmend vorstellen, in den sie tief<br />
eintauchen, den sie aber wegen ihrer geringen Dichte immer noch um mehrere Tausend Meter überragen können.<br />
Wie bei schwimmenden Eisschollen gilt dabei auch bei den Kontinenten ein isostatisches Gleichgewicht:<br />
je dicker sie sind, desto tiefer tauchen sie ein, desto weiter schauen sie aber auch heraus.<br />
Das unter <strong>der</strong> starren Lithosphäre folgende Material <strong>der</strong> weichen Asthenosphäre (griech. „weiche Schale“) wäre<br />
unter normalen Bedingungen aufgrund seiner hohen Temperatur flüssig, hat jedoch wegen des in <strong>der</strong> Tiefe herrschenden<br />
enormen Druckes von mehr als 10 t/cm² Eigenschaften, die am ehesten mit denen von Eis o<strong>der</strong> Teer<br />
vergleichbar sind. Obwohl sich diese Materialien gegenüber plötzlicher Beanspruchung relativ spöde verhalten,<br />
sind sie doch, über längere Zeit hinweg betrachtet, in <strong>der</strong> Lage langsam zu fließen. Auch das spröde Eis hat<br />
ähnliche Eigenschaften, wie langsam fließende Gletscher beweisen.<br />
Man nimmt heute an, dass dieses „sekular-plastische“ Material <strong>der</strong> Asthenosphäre tatsächlich – aufgrund ungleichmäßiger<br />
Wärmeverteilung im Erdinnern – ständig in Bewegung ist. Mit Geschwindigkeiten von nur einigen<br />
Dezimetern im Jahr steigt es auf und ab, strömt wohl auch über weite Strecken parallel zur Erdoberfläche. Wie in<br />
einer Zentralheizung gibt es durch die von unten her angetriebene Erwärmung sog. Konvektionsströme im<br />
Erdmantel. Da die starre Lithosphäre dabei mitgeschleppt wird, können ganze Kontinente in Bewegung geraten.<br />
Sich einheitlich bewegende Abschnitte <strong>der</strong> Lithosphäre, an <strong>der</strong>en Aufbau gewöhnlich sowohl ozeanische als auch<br />
kontinentale Kruste beteiligt ist, werden Lithosphärenplatten o<strong>der</strong> einfach Platten genannt. Die Linien, wo<br />
kontinentale und ozeanische Kruste innerhalb solcher Platten aneinan<strong>der</strong> grenzen, sind tektonisch nicht aktiv und<br />
werden als passive Kontinentalrän<strong>der</strong> bezeichnet.<br />
An Stellen, wo heißes Material aus den Tiefen des Erdmantels aufsteigt, wird die Kruste gedehnt, zerrissen und<br />
die Dehnungsfugen durch eindringende Gesteinschmelzen verfüllt. Gezerrte Krustenabschnitte dieser divergierenden<br />
Plattengrenzen geben sich an <strong>der</strong> Erdoberfläche zunächst als Grabenbrüche zu erkennen (z.B. Oberrheingraben,<br />
Ostafrikanischer Graben). Geht die Dehnung weiter, entstehen schließlich schmale Ozeanbecken<br />
(z.B. Rotes Meer), <strong>der</strong>en Böden sich durch Aufreißen unter ständigem Nachdrängen basischer Magmen immerfort<br />
ausweiten und schließlich Tausende von Kilometern breit werden können (z.B. Atlantik). An Stellen, wo kühleres<br />
Material nach unten sinkt und in den Tiefen des Erdmantels verschwindet, wird die Erdkruste gestaucht und<br />
oberflächlich eingemuldet. An solchen konvergierenden Plattengrenzen können Tiefseerinnen, Akkretionskeile,<br />
Inselbögen und Faltengebirge entstehen. Diese tektonisch aktiven, konvergierenden Plattengrenzen sind meist an
36<br />
Stellen zu finden, wo ozeanische und kontinentale Kruste zweier unterschiedlicher Platten aneinan<strong>der</strong> grenzen,<br />
an aktiven Kontinentalrän<strong>der</strong>n.<br />
5.4.2 Divergierende Plattengrenzen<br />
Die junge, heiße ozeanische Kruste hat ein vergleichweise geringes spezifisches Gewicht und erhebt sich deshalb<br />
in Form langgestreckter untermeerischer Gebirge, als mittelozeanische Rücken, weit über ihre kühlere<br />
Umgebung. Im Zentrum des Atlantischen Ozeans liegt <strong>der</strong> Mittelatlantische Rücken. Auch <strong>der</strong> Indische Ozean<br />
und <strong>der</strong> Pazifik werden von vergleichbaren Strukturen durchzogen, die zusammen ein weltumspannendes<br />
System mittelozeanischer Rücken bilden. Der First dieser Rücken wird durch grabenartige Senken nachgezeichnet,<br />
Zonen mit aktivem Vulkanismus, <strong>der</strong> sich durch För<strong>der</strong>ung heißer, gasarmer und dünnflüssiger, basaltischer<br />
Schmelzen (Toleiite) auszeichnet. Es handelt sich hier um die Nahtstellen, an denen ständig neue ozeanische<br />
Kruste entsteht und nach beiden Seiten weggedrückt wird. Durch dieses sea floor spreading o<strong>der</strong> die<br />
„Ozeanboden-Spreizung“ entfernt sich zum Beispiel Europa von Nordamerika mit einer Geschwindigkeit von 2 bis<br />
4 cm im Jahr, was heute mit Hilfe <strong>der</strong> Satelliten-Geodäsie direkt gemessen werden kann. Im Ostpazifik beträgt<br />
die „spreading-Rate“ sogar 7 cm/a. Das ist zwar nur etwa die Geschwindigkeit, mit <strong>der</strong> Fingernägel wachsen,<br />
doch in Jahrmillionen summiert sich dieser bescheidene Betrag zu Tausenden von Kilometern.<br />
Die mittelozeanischen Rücken sind immer wie<strong>der</strong> seitlich durch große, quer zu ihrer Längserstreckung verlaufende,<br />
große Transform-Störungen seitlich versetzt, die am Ozeanboden als gradlinig verlaufende, tiefe Senken<br />
zu verfolgen sind. Meist bleiben auch die höchsten Teile dieser mittelozeanischen Rücken mehr als 1000 m unter<br />
dem Meeresspiegel. Nur an wenigen Stellen, z.B. in Island, können Teile eines solchen Rückens unter freiem<br />
Himmel studiert werden. An wenigen Stellen nähern sich aktive Rücken Kontinentalrän<strong>der</strong>n, wo sie sich in kontinentalen<br />
Grabenbrüchen (Ostafrikanischer Graben, Jordan-Graben) o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en bedeutenden tektonischen<br />
Lineamenten (San Andreas Fault) fortsetzen können. Über Dimension, Geschwindigkeit und Richtung <strong>der</strong> Bewegungen<br />
sowie über das Alter <strong>der</strong> an den mittelozeanischen Rücken produzierten ozeanischen Kruste erhält man<br />
sehr detaillierte Informationen über das magnnetische Streifenmuster auf den Ozeanböden (5.5.4). Danach sind<br />
die Ozeanböden, im Gegensatz zu den Kontinenten, vergleichsweise geologisch jung. Die älteste bekannte<br />
ozeanische Kruste liegt im NW des Pazifiks und stammt aus <strong>der</strong> Jurazeit.<br />
5.4.3 Konvergierende Plattengrenzen<br />
Alte, längst abgekühlte ozeanische Kruste mit vergleichweise hohem spezifischen Gewicht findet man eher an<br />
den Rän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Ozeane in <strong>der</strong> Nähe benachbarter Kontinente, wo die Ozeanböden auf 5000 bis 6000 m Tiefe<br />
abgesunken sind. Solche schweren Teile <strong>der</strong> Lithosphäre können an Stellen, wo konvergierende Strömungen im<br />
oberen Erdmantel absteigen, mit in die Tiefe geschleppt o<strong>der</strong> subduziert, mit zunehmen<strong>der</strong> Versenkung immer<br />
stärker aufgeheizt, schließlich aufgeschmolzen und im oberen Erdmantel „verdaut“ werden. Solche Verschluckungs-<br />
o<strong>der</strong> Subduktionszonen geben sich oberflächlich als längliche Depressionen am Ozeanboden, als<br />
Tiefseerinnen zu erkennen, wie <strong>der</strong> Tonga- o<strong>der</strong> Marianen-„Graben“, die keine tektonischen Gräben (also Zerrungszonen)<br />
sind. Zwischen den schräg nach unten abtauchenden, ozeanischen und den unterfahrenen, vielfach<br />
kontinentalen Teilen <strong>der</strong> Lithosphärenplatte liegen seismisch hoch aktive Zonen. Anhand <strong>der</strong> Hypozentren von<br />
Erdbeben lässt sich so eine Reibungszone als schief liegende Benioff-Zone (o<strong>der</strong> Wadati-Benioff-Zone) noch bis<br />
in Tiefen von über 700 km verfolgen. Seichtere Beben an den konvergierenden Plattenrän<strong>der</strong>n (z.B. südamerikanische<br />
Pazifikküste, Ostküste Japans) haben an <strong>der</strong> Erdoberfläche oft katastrophale Auswirkungen.<br />
Das Verschlucken von ozeanischer Kruste gelingt oft nicht vollständig. Ihre obersten Teile – meist am Ozeanboden<br />
entstandene Tiefseeablagerungen, basaltische Kissenlaven und ultrabasische Gesteine (Serpentinite) –<br />
können an <strong>der</strong> Nahtstelle zwischen <strong>der</strong> abtauchenden und <strong>der</strong> unterfahrenen Platte hängen bleiben. Sie werden<br />
von <strong>der</strong> Oberseite <strong>der</strong> abtauchenden Platte abgeschürft und obduziert. Sie können, zusammen mit gefalteten<br />
und zerscherten Sedimentmassen, <strong>der</strong> ozeanwärtigen Seite einer Subduktionszone in Form eines stark tektonisierten<br />
Akkretionskeiles angelagert werden (z.B. <strong>der</strong> Mediterrane Rücken südlich von Kreta) und schließlich als<br />
Inselbogen auftauchen.<br />
Die in den heißen Erdmantel abtauchende ozeanische Kruste nimmt viel Wasser mit in die Tiefe. Die Fluide<br />
erniedrigen den Schmelzpunkt <strong>der</strong> Gesteine, die, wenn sie genügend tief versenkt worden sind, schließlich aufschmelzen.<br />
Die dabei entstehenden, gasreichen und viskosen, meist intermediären Gesteinsschmelzen steigen<br />
auf, dringen in seichtere Krustenstockwerke ein und führen an <strong>der</strong> Erdoberfläche zu einem lebhaften Vulkanis-
37<br />
mus. Über konvergierenden Plattenrän<strong>der</strong>n bilden sich deshalb oft hoch explosive Andesitvulkane (z.B. die Vulkane<br />
<strong>der</strong> Anden, <strong>der</strong> Nordamerikanischen Kordillere, <strong>der</strong> Aleuten o<strong>der</strong> von Kamtschatka).<br />
5.4.4 Manteldiapire und „hot spots“<br />
An vielen Stellen dieser Welt gibt es große, sehr aktive Vulkangebiete. Die meisten von ihnen sind lang gestreckt,<br />
da sie an konvergierende und divergierende Plattengrenzen, also an mittelozeanische Rücken, Transform-Störungen,<br />
Inselbögen o<strong>der</strong> Hochgebirge gebunden sind, teilweise auch an tiefreichende Störungen und tektonischen<br />
Gräben. Einige <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s aktiven und großen Vulkangebiete scheinen aber unabhängig von solchen<br />
Strukturen entstanden zu sein. Hierzu gehören z.B. die Vulkane des Yellowstone-Gebietes o<strong>der</strong> die von Hawaii.<br />
Man nimmt an, dass unter solchen Gebieten riesige Mengen heißer Magmen aus dem Erdmantel in die Erdkruste<br />
aufsteigen, sog. Manteldiapire, die sich durch die Kruste schmelzen und auf <strong>der</strong> Erdoberfläche als hot spot zu<br />
erkennen geben, also als aktives Vulkangebiet. Im Gegensatz zu den sich ständig horizontal verschiebenden<br />
Platten sind diese Manteldiapire relativ stationär. Das führt dazu, dass sich mit <strong>der</strong> einsinnigen Bewegung <strong>der</strong><br />
Platten auch <strong>der</strong> aktive Vulkanismus scheinbar seitlich verlagert.<br />
Am besten lässt sich das am Beispiel <strong>der</strong> Hawaii-Inseln im Pazifik demonstrieren. Diese rein vulkanischen Inseln<br />
schließen sich mit zahlreichen Untiefen zu einem mehr als 2500 km langen, geradlinig verlaufenden untermeerischen<br />
Gebirgszug zusammen. Diese NW-orientiere Vulkankette liegt mitten auf <strong>der</strong> pazifischen Platte und ist<br />
Tausende von Kilometern vom nächsten mittelozeanischen Rücken bzw. aktiven Kontinentalrand entfernt. Aktive<br />
Vulkane gibt es nur auf <strong>der</strong> südöstlichsten dieser Inseln, auf Hawaii selbst, wo Jahr für Jahr gewaltige Mengen<br />
basaltischer Lava ausfließen. Auf den in nordwestlicher Richtung folgenden Inseln Maui, Molokai, Oahu und<br />
Kauai etc. sind die Vulkane längst erloschen; <strong>der</strong> Vulkanismus wird immer älter, je weiter man sich von Hawaii<br />
nach WNW entfernt.<br />
Unter <strong>der</strong> Insel Hawaii sitzt offensichtlich ein gewaltiger Manteldiapir. Die pazifische Platte wird vom aktiven Ostpazifischen<br />
Rücken her ständig über diesen stationären „hot spot“ in nordwestlicher Richtung geschoben.<br />
Dadurch wan<strong>der</strong>t <strong>der</strong> aktive Vulkanismus scheinbar nach SE. Viele geradlinig verlaufende untermeerische vulkanische<br />
Rücken, Ketten ozeanischer Vulkane und vulkanischer Inseln (z.B. Tuamoto-Archipel, Walfisch-Rücken,<br />
Réunion, Kerguelen) werden ähnlich gedeutet.<br />
5.4.5 Orogenese und Plattentektonik<br />
Während die größten Teile ozeanischer Kruste, die im Laufe <strong>der</strong> Erdgeschichte entstand, auf diese Weise fast<br />
spurlos wie<strong>der</strong> im Erdinneren verschwunden sind, lassen sich kontinentale Krustenteile an <strong>der</strong>artigen Subduktionszonen<br />
nicht so einfach in die Tiefe ziehen. Zum Einen bringen die Auftriebskräfte <strong>der</strong> relativ leichten kontinentalen<br />
Gesteine die abwärts gerichtete Bewegung irgendwann wie<strong>der</strong> zum Stillstand. Zum An<strong>der</strong>en scheinen<br />
die viele Zehnerkilometer dicken Schollen kontinentaler Kruste den Mechanismus letztlich zu blockieren. An konvergierenden<br />
Plattengrenzen, an solchen Presszonen, wo ozeanische Kruste unter ozeanischer Kruste verschwindet,<br />
vor allem aber dort, wo ozeanische Kruste unter kontinentale Kruste gedrückt wird o<strong>der</strong> gar Kontinentalschollen<br />
miteinan<strong>der</strong> kollidieren, entstanden und entstehen Falten- und Deckengebirge (Kordillere, Alpen,<br />
Varisziden).<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Erdgeschichte ist es immer wie<strong>der</strong> zur Bildung von Gebirgen, zu Orogenesen gekommen. Gebirge<br />
entstehen in orogenen Zyklen, die mit dem Aufreißen neuer Ozeanbecken beginnen und mit <strong>der</strong>en Schließen<br />
enden. Öffnet sich ein neuer Ozean, so beginnen die angrenzenden Schelfe am Kontinentalrand abzusinken und<br />
werden im selben Maße mit gewaltigen Sedimentmengen beladen – mit Riffkarbonaten o<strong>der</strong> dem Abtragungsschutt<br />
<strong>der</strong> dahinter liegenden Festlän<strong>der</strong>. Während die neu entstandene ozeanische Kruste schließlich an einer<br />
Subduktionszone wie<strong>der</strong> in die Tiefe gesaugt und verdaut wird, kann ein Teil davon (Tiefseesedimente und<br />
Vulkanite) abgeschürft, obduziert und als „Ophiolithe“ in Akkretionskeilen dem benachbarten Kontinentalrand<br />
angeglie<strong>der</strong>t werden. Auch kleinere Kontinentalschollen, sog. Terranes, werden z.T. verschluckt, teilweise aber<br />
auch obduziert. Sobald aber früher schon einmal zusammenhängende, größere Kontinentalmassen miteinan<strong>der</strong><br />
kollidieren, schließt sich <strong>der</strong> Ozean endgültig. Wie in einem Schraubstock werden dazwischengeratene Schelfablagerungen,<br />
ozeanische Sedimente <strong>der</strong> Akkretionskeile, obduzierte Ophiolithe und Terranes eingeengt, gefaltet,<br />
aus dem Pressspalt gequetscht und in Form von Decken übereinan<strong>der</strong>gestapelt, bis die Bewegung endlich zum<br />
Stillstand kommt.
38<br />
Da bei <strong>der</strong> Kollision vergleichsweise leichtes kontinentales Krustenmaterial gewaltsam in die Tiefe gepresst wird,<br />
beginnen junge Gebirge aufzusteigen, sobald die einengenden Bewegungen abgeklungen sind. Bei <strong>der</strong> kräftigen<br />
Heraushebung des Gebirgskörpers legt die Erosion mit <strong>der</strong> Zeit sehr tiefe Stockwerke <strong>der</strong> Erdkruste frei, in <strong>der</strong><br />
die Gesteine ursprünglich einmal hohen Drucken und Temperaturen ausgesetzt waren. Dies ist einer <strong>der</strong> Gründe,<br />
warum in den zentralen Teilen <strong>der</strong> Hochgebirge Europas (Alpen, Pyrenäen) oft metamorphe Gesteine o<strong>der</strong> gar<br />
Tiefengesteinskörper zu finden sind.<br />
5.4.6 Von <strong>der</strong> Tethys zu den jungen Hochgebirgen Europas<br />
Auf ganz ähnliche Weise haben wir uns wohl auch die Entstehung <strong>der</strong> Alpen o<strong>der</strong> Varisziden in Europa vorzustellen.<br />
Nur ist hier das Geschehen durch ein Nebeneinan<strong>der</strong> mehrerer Zerrungs- bzw. Verschluckungszonen<br />
stark verkompliziert. Erst in den letzten Jahren beginnt man hier den Ablauf einigermaßen zu verstehen.<br />
Im jüngsten Teil des Erdaltertums, vor knapp 300 Jahrmillionen, lagen die Kontinente an<strong>der</strong>s als heute. Die großen<br />
Erdteile hingen mehr o<strong>der</strong> weniger eng zusammen und bildeten einen riesigen Superkontinent, den die Geologen<br />
„Pangaea“ nennen. Der Rest <strong>der</strong> Erdoberfläche wurde im Wesentlichen von einem einzigen, riesigen<br />
Ozean eingenommen, dem Urpazifik „Panthalassa“. We<strong>der</strong> Indischer und Atlantischer Ozean noch das Mittelmeer<br />
existierten damals. Dieser Urpazifik hatte einen keilförmigen Ausläufer, <strong>der</strong> als breite Bucht das spätere<br />
Afrika von Eurasien trennte, die Tethys. Nun bedeckte das Meer nicht nur die Tiefseeböden <strong>der</strong> Tethys, die von<br />
ozeanischer Kruste gebildet wurden, son<strong>der</strong>n auch die Rän<strong>der</strong> <strong>der</strong> angrenzenden Festlän<strong>der</strong> (Schelfe). Ganz<br />
ähnlich erfüllen heute die Wassermassen des Nordatlantik nicht nur das Tiefseebecken <strong>der</strong> Norwegischen See,<br />
son<strong>der</strong>n überdecken als relativ seichte Nordsee auch Teile des europäischen Kontinentalrandes.<br />
Diese Schelfe sanken langsam ab, wurden aber im selben Maße mit gewaltigen Sedimentmassen beladen, so<br />
dass ihr Flachmeercharakter letztlich erhalten blieb. Zu Beginn des Erdmittelalters, vor rund 250 Millionen Jahren,<br />
begann <strong>der</strong> Superkontinent Pangaea in einzelne Schollen zu zerbrechen, ähnlich wie heute Afrika am Ostafrikanischen<br />
Graben auseinan<strong>der</strong>reißt. Diese Schollen haben sich seither als Kontinente verselbständigt. Die Risse an<br />
den Nahtstellen <strong>der</strong> auseinan<strong>der</strong>rückenden Lithospärenplatten füllten sich immer wie<strong>der</strong> mit nachdrängenden<br />
basaltischen Gesteinsschmelzen. Dieser Prozess ist heute noch in vollem Gange. Im Laufe des Mittelalters und<br />
<strong>der</strong> Neuzeit <strong>der</strong> Erde sind auf diese Weise neue Ozeane entstanden, die sich bis heute stetig verbreitern, wie <strong>der</strong><br />
Indik o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Atlantik.<br />
Das Aufreißen des Atlantischen Ozeans, <strong>der</strong> heute fast den halben Erdball umspannt, ging selbstverständlich<br />
nicht überall gleichzeitig vonstatten. So begann sich <strong>der</strong> Atlantik zwischen Nordamerika und Westafrika schon zu<br />
Beginn <strong>der</strong> Jurazeit zu öffnen, während Nordamerika, Grönland und Eurasien noch weiter zusammenhingen.<br />
Dadurch verschob sich <strong>der</strong> afrikanische Kontinent relativ zu Europa stark nach Osten. Im Gebiet des heutigen<br />
Mittelmeeres entstand deshalb eine breite Störungszone, entlang <strong>der</strong> sich die europäische und afrikanische Platte<br />
(linkssinnig) gegeneinan<strong>der</strong> verschieben konnten. Hier rissen während <strong>der</strong> Jura- und Kreidezeit schmale<br />
Ozeanbecken auf, etwa <strong>der</strong> Südpenninische und <strong>der</strong> Nordpenninische Ozean, zwischen denen kleine „Mikrokontinente“<br />
aus kontinentaler Kruste lagen, z.B. das Mittelpenninikum. Während <strong>der</strong> ausgehenden Kreidezeit<br />
begann sich auch Europa vom nordamerikanischen Kontinent zu lösen. Eurasien holte Afrika auf seinem Weg<br />
nach Osten langsam ein, was zu einer Umkehrung <strong>der</strong> Relativbewegung (rechtssinnig) zwischen beiden Kontinenten<br />
führte. Schließlich drehte sich Afrika langsam gegen den Uhrzeigersinn und stieß mit seinem nordöstlichen<br />
Sporn, <strong>der</strong> sich als Adriatische Platte inzwischen verselbständigt hatte, weit nach Norden vor. Die Zone mit<br />
den kleinen Ozeanbecken und Kontinentalschollen wurde jetzt in die Zange genommen.<br />
Schon in <strong>der</strong> Mittelkreide hatte sich am Südostrand des Südpenninischen Ozeans eine Subduktionszone herausgebildet,<br />
an <strong>der</strong> die eben erst entstandene ozeanische Kruste wie<strong>der</strong> verschluckt wurde. Die im südlich anschließenden<br />
kalkalpinen Ablagerungsraum während des Erdmittelalters entstandenen Sedimente wurden gefaltet und<br />
endlich, als die Einengung weiterging, zusammen mit Teilen ihrer Unterlage abgeschert und in Decken übereinan<strong>der</strong>geschoben.<br />
In <strong>der</strong> mittleren Tertiärzeit stieß dieser Deckenstapel mit dem Südrand des eurasischen Kontinentes<br />
zusammen. Unter dem steten Schub des nachdrängenden afrikanischen Kontinentes überfuhr ihn das<br />
nordwestliche Ende <strong>der</strong> Adriatischen Platte und schob die darauf liegenden Sedimente wie ein Bulldozer vor sich<br />
her nach Norden. Auf diese o<strong>der</strong> ähnliche Weise entstanden in mehreren Akten alle jungen europäischen<br />
Decken-Falten-Gebirge, wie Pyrenäen, Karpaten, Apennin o<strong>der</strong> Kaukasus. Im Einzelnen sind die Verhältnisse<br />
aber äußerst kompliziert und erst zu einem Teil befriedigend geklärt.<br />
Die tektonischen Vorgänge, welche zur Entstehung <strong>der</strong> Alpen geführt haben, gehen bis in unsere Tage weiter,<br />
wie uns die Meldungen von schweren Erdbeben <strong>der</strong> letzten Jahrzehnte, vor allem aus dem Friaul, aus Maze-
39<br />
donien, <strong>der</strong> türkischen Schwarzmeerküste o<strong>der</strong> Armenien drastisch vor Augen führen. In den Nordalpen selbst<br />
scheinen zwar die einengenden Prozesse inzwischen schwächer geworden zu sein, die vertikalen Bewegungen<br />
allerdings sind immer noch bedeutend. Obwohl Verwitterung und Erosion ständig an den Bergen nagen, sind die<br />
Alpen seit vielen Jahrmillionen ein Hochgebirge. Bei <strong>der</strong> heute messbaren Abtragungsgeschwindigkeit müssten<br />
die Alpen innerhalb weniger Jahrmillionen aber zu einem flachwelligen Hügelland „eingerumpft“ sein – würden sie<br />
nicht ständig um Millimeterbeträge pro Jahr angehoben werden. Diese Hebungsraten haben sich während <strong>der</strong><br />
letzten Jahrmillionen in den Ostalpen zu mehr als 4 km addiert. In den Westalpen rechnet man gar mit einer<br />
Heraushebung des Alpenkörpers um mehr als 16 km!<br />
Die Alpidische Orogenese, die ihre Höhepunkte während <strong>der</strong> Oberkreide (vor etwa 100 Jahrmillionen) und im<br />
Alttertiär (vor etwa 40 Jahrmillionen) erlebt hat, ist nur die jüngste von mehreren Gebirgsbildungen, die Europa<br />
entscheidend geformt haben. Im Erdaltertum war schon einmal ein Ozean aufgerissen, in ähnlicher Richtung wie<br />
später die Tethys, und hatte sich im Devon und Karbon wie<strong>der</strong> geschlossen. Das damals entstandene Variszische<br />
Gebirge ist heute tiefgründig abgetragen. Seine Reste sind in den Mittelgebirgen Deutschlands, z.B. im<br />
Erzgebirge, im Rheinischen Schiefergebirge, Bayerischen Wald, Schwarzwald, aber auch in einigen zentralalpinen<br />
Gebirgsmassiven erhalten geblieben. Etwas früher im Erdaltertum, im Silur und Devon, war schon einmal ein<br />
Gebirge aus einem Ozean hervorgegangen, <strong>der</strong> sich parallel zum heutigen Atlantischen Ozean geöffnet hatte.<br />
Reste dieses Kaledonischen Gebirges sind z.B. in den Hochlän<strong>der</strong>n von Norwegen, Schottland und Wales<br />
erhalten geblieben.<br />
5.5 Geologische Zeitmessung<br />
Die Geologen haben inzwischen eine ganze Reihe von Methoden zur Verfügung, um das Alter von Gesteinen zu<br />
messen, um herauszufinden, wann ein bestimmtes Sedimentgestein o<strong>der</strong> ein vulkanischer Tuff abgelagert wurden,<br />
welche Zeit in einem Schichtpaket mit einer definierten Mächtigkeit steckt, wann ein Tiefengestein intrudiert<br />
und wann eine Lava ausgeflossen ist. Die Frage nach dem Bildungsalter von Gesteinen kann bei <strong>der</strong> Beurteilung<br />
des genauen Ablaufes von geologischen Prozessen von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung sein. Sicher ist es interessant<br />
zu wissen, welches genaue Alter z.B. ein bestimmtes vulkanisches Gestein hat, ausgedrückt in Jahren vor heute.<br />
Bei den meisten Fragestellungen ist es aber schon absolut ausreichend und oft auch viel wichtiger herauszufinden,<br />
ob ein Gestein deutlich älter, jünger o<strong>der</strong> gleich alt ist wie ein an<strong>der</strong>es Gestein.<br />
Es gibt eine Reihe von äußerst wichtigen, schon lange bekannten und teilweise sehr einfachen chronostratigraphischen<br />
Methoden, die nur solche älter-jünger-Entscheidungen zulassen. Dazu gehört die simple „Lageregel“:<br />
Ein Sedimentpaket o<strong>der</strong> ein vulkanischer Tuff, die in einer Schichtfolge unten liegen, sind – wenn keine<br />
tektonischen Komplikationen angenommen werden müssen – i.d.R. älter als solche, die oben drauf liegen. Auch<br />
muss ein Gestein, das als Geröll in einem Kies auftritt, auf jeden Fall älter sein als es dem Ablagerungsalter<br />
dieses Kieses entspricht, ein Verwitterungsboden jünger als das Gestein, das verwittert ist. Ein vulkanischer Gang<br />
muss in jedem Falle jünger sein als das Gestein, das von diesem Gang durchschlagen wird. Mit dieser simplen<br />
Methode hat man z.B. schon Anfang des 19. Jh. herausgefunden, dass kristalline Gesteine, etwa Granit, nicht<br />
unbedingt beson<strong>der</strong>s alte Gesteine sein müssen und deshalb nicht pauschal als „Urgesteine“ bezeichnet werden<br />
dürfen: Im Fassatal in den Südalpen gibt es Kristallingesteine (Monzonit), die gangförmig Dolomitgesteine <strong>der</strong><br />
Triaszeit durchschlagen, also eindeutig jünger sein müssen als diese.<br />
Inzwischen steht eine ständig steigende Anzahl teilweise sehr ausgefeilter, bewährter, wenn auch oft recht komplizierter<br />
Methoden <strong>der</strong> geologischen Zeitmessung zur Verfügung. Die meisten kann man nur von Fall zu Fall<br />
benutzen, da sie nur an bestimmten, teils recht seltenen Mineralen, Gesteinen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Materialien angewendet<br />
werden können bzw. an bestimmte Gegebenheiten gebunden sind, die es nicht überall gibt. Gerade die<br />
Altersbestimmungsmethoden, die auf physikalischen <strong>Grundlagen</strong> beruhen und scheinbar exakte Zahlen liefern,<br />
sind mit erheblichen Unsicherheiten und großen Fehlern behaftet und können mitunter kräftig danebenhauen. Im<br />
Zweifelsfalle sind die oben dargestellten simplen Methoden viel eindeutiger und zuverlässiger.<br />
Bei den hoch entwickelten Methoden <strong>der</strong> geologischen Altersbestimmung unterscheidet man die relative Biochronologie,<br />
bei <strong>der</strong> man auf die Bestimmung von Fossilien angewiesen ist und bei <strong>der</strong> auf direktem Wege keine<br />
Alter in Jahren zu ermitteln sind sowie die chronometrischen Methoden, die meist auf dem zeitabhängigen<br />
Zerfall radioaktiver Isotope beruhen und im Idealfall das „absolute“ Alter in Jahren angeben können. Daneben gibt<br />
es unterschiedliche meist einfachere chronostratigraphische Methoden, die zur Datierung an<strong>der</strong>e zeitabhängige<br />
Gesetzmäßigkeiten nutzen, oft periodische klimatische Schwankungen, die in Sedimenten o<strong>der</strong>
40<br />
Organismen Spuren hinterlassen. Im Folgenden wird eine Auswahl häufig angewendeter Datierungsmethoden<br />
kurz vorgestellt:<br />
5.5.1 Biochronologie und Biostratigraphie<br />
Bei <strong>der</strong> Biochronologie datiert man mit Hilfe von Fossilien und Fossilgruppen, die in bestimmten, möglichst kurzen<br />
Abschnitten <strong>der</strong> Erdgeschichte auftreten, häufig vorkommen, weit verbreitet und einfach zu bestimmen sind, sog.<br />
Leitfossilien bzw. Leitfossilgruppen. Grundsätzlich kann man die meisten tierischen und pflanzlichen Reste von<br />
Lebewesen zur Datierung verwenden; man hat aber mit bestimmten Leitfossilgruppen beson<strong>der</strong>s gute<br />
Erfahrungen gemacht und mit ihrer Hilfe eine biostratigraphische Standard-Skala festgelegt, mit <strong>der</strong> die gesamte<br />
Erdgeschichte geglie<strong>der</strong>t und in Zeitscheiben zerlegt werden kann (Biostratigraphie).<br />
Die größten, meist mit dem Auftreten von bestimmten Leitfossilgruppen biostratigraphisch definierten Kategorien<br />
(Zeitscheiben) sind Äratheme (Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum). Dem sind die Systeme (Kambrium,<br />
Ordovizium, Silur etc.) und diesen wie<strong>der</strong>um die Stufen (Cenoman, Turon, Coniac etc.) untergeordnet. Die kürzesten<br />
biochronologisch fassbaren Zeitscheiben sind die sog. Zonen (Biozonen), die mit den Artnamen <strong>der</strong><br />
entsprechenden Zonenleitfossilien bezeichnet werden, z.B. die marshi-Zone nach dem Ammoniten Choristoceras<br />
marshi o<strong>der</strong> die plenus-Zone nach dem Belemniten Actinocamax plenus. Die genaue Bestimmung <strong>der</strong><br />
Leitfossilien und damit die exakte biostratigraphische Einstufung von Gesteinen ist eine Sache von Spezialisten.<br />
Die genaue Einstufung eines Gesteins in eine bestimmte Zone mit Hilfe eines Leitfossils bedeutet aber an und<br />
für sich noch keine Datierung in Jahren. Allerdings ist die Biostratigraphie inzwischen eine so gut abgesicherte<br />
und hochentwickelte Methode, dass man angeben kann, welcher „absoluten“ Zeit ein biochronologisch ermitteltes<br />
Alter entspricht, denn man hat unzählige Male mit Erfolg versucht, biostratigraphisch eingestufte Sedimentgesteine<br />
zusätzlich mit den unterschiedlichsten chronometrischen Methoden zu datieren, etwa indem man vulkanische<br />
Tuffe aus <strong>der</strong> gleichen Schichtfolge radiometrisch datiert hat. Folglich hat man mit <strong>der</strong> Zeit herausgefunden,<br />
dass z.B. ein Gestein, in dem man den für das Rhät (Obertrias) leitenden Ammoniten Choristoceras marshi<br />
gefunden hat und das folglich dem Rhät angehört, etwa 206 bis 210 Ma. (Millionen Jahre) alt sein muss. Man hat<br />
mit ähnlichen Methoden festgestellt, dass die Jurazeit vor 206 Ma. begonnen hat und vor 144 Ma. zu Ende<br />
gegangen ist. Mit Hilfe von Zonenleitfossilien lässt sich <strong>der</strong> Jura in insgesamt 52 Zonen glie<strong>der</strong>n, d.h. dass die<br />
Zeitscheibe einer Biozone einen zeitlichen Umfang von durchschnittlich etwas mehr als 1 Ma. hat.<br />
5.5.2 Chronostratigraphische Methoden<br />
a) Dendrochronologie<br />
Die Dendrochronologie nutzt zur Datierung jahreszeitliche und längerperiodische Klimaschwankungen, die sich in<br />
den Jahresringen von Bäumen abbilden. Sie beruht im Prinzip auf dem Abzählen dieser Jahresringe. Wenn man<br />
nicht nur einfach die Anzahl <strong>der</strong> Jahresringe abzählt, son<strong>der</strong>n auch die Jahresringbreite und die Dichte von Frühund<br />
Spätholz misst, kann man charakteristische Abfolgen von Jahresringen auch an an<strong>der</strong>en Bäumen eindeutig<br />
wie<strong>der</strong>erkennen und zeitlich parallelisieren, sogar an Hölzern, die aus <strong>der</strong> weiteren Umgebung stammen. Mit Hilfe<br />
sehr alter leben<strong>der</strong> Bäume lässt sich eine Jahresringskala erstellen, die bestenfalls 500 bis 1000 Jahre, in<br />
Ausnahmefällen (USA) bis zu 4000 Jahre zurückreicht. Diese Skala lässt sich benutzen, um Hölzer unbekannten<br />
Alters zu datieren. In einigen Fällen ist es gelungen, die Jahresringskala weit in die Vergangenheit hinein zu<br />
verlängern, indem man neben Holzbalken aus alten Dachstühlen und Kirchen auch fossile Hölzer aus Flusskiesen<br />
benutzt. Dadurch reichen dendrochronologische Skalen in manchen Gegenden bis etwa 10 000 Jahre<br />
zurück. Damit lassen sich Hölzer unbekannten Alters, die nicht älter als 10 000 Jahre sind, zuverlässig datieren.<br />
Wichtig ist, dass man mit <strong>der</strong> Dendrochronologie Fehler korrigieren kann, die <strong>der</strong> Radiokohlenstoff-Methode<br />
anhaften (5.5.3 c).<br />
b) Warvenchronologie<br />
Auch die Warvenchronologie nutzt zur Datierung jahreszeitliche und längerperiodische Klimaschwankungen, die<br />
sich in bestimmten Sedimenten als Schichtung abbilden. Sie wurde schon vor etwa 100 Jahren entwickelt, beruht<br />
im Prinzip auf dem Abzählen von Jahresschichten (Warven) in feinschichtigen pleistozänen Seesedimenten<br />
(Warventonen), die in Schmelzwasserseen in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> zurückschmelzenden Eisrän<strong>der</strong> entstanden. Wenn<br />
man nicht einfach nur die Anzahl <strong>der</strong> Warven abzählt, son<strong>der</strong>n auch ihre Breite misst, kann man charakteristische<br />
Warvensequenzen auch an an<strong>der</strong>en Warventon-Vorkommen eindeutig wie<strong>der</strong>erkennen und zeitlich paral-
41<br />
lelisieren, sogar an solchen, die weit davon entfernt abgelagert wurden. Mit Hilfe <strong>der</strong> Warvenchronologie ist es<br />
gelungen, in Norddeutschland, Dänemark o<strong>der</strong> Schweden das Rückschmelzen des Nordeuropäischen Inlandeises<br />
praktisch aufs Jahr genau zu verfolgen.<br />
Im Übrigen besitzen vielfach auch Evaporite (Steinsalz, Anhydrit) eine warvenähnliche Feinschichtung, bei <strong>der</strong> es<br />
sich gleichfalls um eine Jahresschichtung handelt. Inzwischen wendet man die Methodik <strong>der</strong> Warvenchronologie<br />
auch in Zechsteinsalzen an, mit <strong>der</strong>en Hilfe es gelungen ist, die unterschiedlich alten Evaporitfolgen im gesamten<br />
norddeutschen Zechsteinbecken miteinan<strong>der</strong> zeitlich zu parallelisieren, ohne indes ihr tatsächliches genaues Alter<br />
angeben zu können.<br />
c) Lichenometrie<br />
Die Lichenometrie nutzt zur Datierung das kontinuierliche und extrem langsame Wachstum bestimmter Flechten<br />
(lat. lichenes). Manche Flechten, <strong>der</strong>en Thalli als Pioniere den nackten Felsuntergrund überkrusten, wachsen<br />
äußerst langsam und haben überaus konstante Zuwachsraten. Wenn die mittlere Zuwachsrate <strong>der</strong> Thalli bekannt<br />
ist, lässt sich an den größten hier vorkommenden Flechten ermitteln, seit wann diese Gesteinsfläche frei liegt,<br />
also z.B. vom Gletschereis freigegeben wurde. In den Alpen wird dazu beson<strong>der</strong>s gern die Landkartenflechte<br />
(Rhizocarpon geographicum) benutzt. Mit Hilfe <strong>der</strong> Lichenometrie ist es gelungen, im Vorfeld vieler Alpengletscher<br />
die Moränen unterschiedlicher Eisstände aus <strong>der</strong> Kleinen Eiszeit miteinan<strong>der</strong> zu parallelisieren.<br />
5.5.3 Chronometrische Methoden, die den Zerfall von Nukleiden ausnützen<br />
Die meisten chronometrischen Methoden nutzen den zeitabhängigen Zerfall von instabilen Isotopen bestimmter<br />
Elemente (Mutternukleide). Es gibt relativ viele natürlich vorkommende instabile Mutternukleide ( 87 Rb, 40 K, 187 Re),<br />
die sich durch radioaktiven Zerfall in an<strong>der</strong>e, in den meisten Fällen stabile Tochternukleide umwandeln ( 87 Sr, 40 Ar,<br />
187 Os). Einige instabile Mutternukleide ( 238 U, 235 U) durchlaufen auch ganze Zerfallsreihen, d.h. es entstehen durch<br />
radioaktiven Zerfall immer wie<strong>der</strong> neue, gleichfalls instabile Tochternukleide, bis schließlich stabile Endglie<strong>der</strong><br />
erreicht werden ( 206 Pb, 207 Pb). Zusammen mit stabilen werden auch viele instabile Nukleide in Kristallgitter von<br />
Mineralien eingebaut (z.B. Uran in Uraninit), in Verbindungen, in denen die Zerfallsprodukte selbst (Blei) normalerweise<br />
nicht vorkommen.<br />
In vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass sich solche stabilen Isotope, die man in einem solchen Mineral<br />
nachweisen kann, obwohl sie kein Teil <strong>der</strong> entsprechenden Verbindung sind, hier durch radioaktiven Zerfall<br />
angereichert haben. Solange die Temperatur über einem von <strong>der</strong> Mineralart und Korngröße abhängigen Punkt<br />
liegt (Schließungstemperatur), ist das Gitter nicht dicht und die Zerfallsprodukte können das System verlassen –<br />
unterhalb dieser Temperatur aber nicht mehr. Kennt man die Halbwertszeit des instabilen Isotopes, ist die Menge<br />
<strong>der</strong> Zerfallsprodukte ein Maß für die Zeit, die vergangen ist, seit dem sich das Mineral neu gebildet hat bzw. seine<br />
Schließungstemperatur unterschritten wurde. Ist das Mineral aus einer Schmelze kristallisiert, erhält man das<br />
Kristallisations- bzw. das Abkühlungsalter <strong>der</strong> Schmelze. Zum Bestimmen <strong>der</strong> Isotopen-Verhältnisse braucht man<br />
ein Massenspektrometer. Am häufigsten werden folgende radiometrische Altersbestimmungen durchgeführt:<br />
a) Kalium-Argon-Methode<br />
Neben den relativ häufigen stabilen Kalium-Isotopen 41 K und 39 K ist auch das instabile Kalium-Isotop 40 K vertreten,<br />
das nur einen Anteil von 0,01 % am natürlich vorkommenden Kalium besitzt. Es wandelt sich durch Elektroneneinfang<br />
in das stabile Argon-Isotop 40 Ar um. Die Halbwertszeit beträgt 1,27 Ga (Milliarden Jahre).<br />
Gemessen wird <strong>der</strong> Gehalt an im Gitter gefangenem 40 Ar im Verhältnis zum Kalium. Datiert werden können alle<br />
kaliumreichen Minerale, z.B. Sanidin (ein K-haltiger Feldspat), Hornblende, Biotit, Muskovit, Illit (ein Tonmineral)<br />
o<strong>der</strong> Glaukonit. Damit sind neben den Abkühlungsaltern von magmatischen Gesteinen (Granite, Syenite, Quarzporphyr,<br />
vulkanische Tuffe) in wenigen Fällen über Glaukonit o<strong>der</strong> Illit auch die Ablagerungsalter von Sedimenten<br />
direkt messbar.<br />
b) Uran-Blei-Methode<br />
Die instabilen Uran-Isotope 238 U, 235 U und 234 U weisen Anteile von 99,3 bzw. 0,7 und 0,0006 % an dem in <strong>der</strong><br />
Natur vorkommenden Uran auf. 238 U durchläuft eine Zerfallsreihe mit vielen Zwischenglie<strong>der</strong>n, zu <strong>der</strong> neben<br />
verschiedenen an<strong>der</strong>en instabilen Isotopen auch 234 U gehört. Am Ende steht das stabile Blei-Isotop 206 Pb. 235 U<br />
durchläuft eine an<strong>der</strong>e Zerfallsreihe mit vielen Zwischenglie<strong>der</strong>n, an <strong>der</strong>en Ende das stabile Blei-Isotop 207 Pb<br />
steht. Die Halbwertszeit von 238 U beträgt 1,54 Ga., die von 235 U 9,71 Ga.
42<br />
Gemessen werden kann das U/Pb-Verhältnis, man kann aber auch die unterschiedlichen Blei- und Uran-Isotope<br />
getrennt bestimmen. Zudem hat man die Möglichkeit, die Anteile sämtlicher Zerfallsprodukte einschließlich <strong>der</strong> α-<br />
Teilchen, die bei einigen Zerfällen ausgeschleu<strong>der</strong>t werden und im Gitter als Heliumkerne gefangen sind. Durch<br />
diese Kontrollmöglichkeiten kann die Genauigkeit <strong>der</strong> Messung extrem gesteigert werden.<br />
Datiert werden können im Prinzip alle uranhaltigen Mineralien. In <strong>der</strong> Praxis spielen vor allem weniger die eigentlichen<br />
Uranmineralien eine Rolle, wie Uraninit o<strong>der</strong> Torbernit, son<strong>der</strong>n ganz an<strong>der</strong>e Minerale, in denen ein kleiner<br />
Anteil von Uran enthalten ist, etwa Zirkon, Monazit o<strong>der</strong> Xenotim. Darüber hinaus kommt Uran in Spuren auch in<br />
Molluskenschalen vor. Je nach Bildungsraum dieser Minerale können die Entstehungsalter <strong>der</strong> Minerale, das<br />
Alter von Metamorphosen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Zeitpunkt <strong>der</strong> Bildung einer Schneckenschale bestimmt werden.<br />
c) C-14-Methode ( 14 C-Methode, Radiokarbon- o<strong>der</strong> Radio-Kohlenstoff-Methode)<br />
Neben dem stabilen Kohlenstoff-Isotop 12 C kommt auch das instabile Kohlenstoff-Isotop 14 C vor. Das Verhältnis<br />
von 12 C zu 14 C ist in <strong>der</strong> Natur 1 : 10 -12 . Angesichts <strong>der</strong> sehr kurzen Halbwertszeit von nur 5580 a dürfte es in <strong>der</strong><br />
Natur eigentlich gar kein 12 C geben, wenn dieses radioaktive Isotop nicht ständig nachgeliefert würde. Die Quelle<br />
hierfür ist in <strong>der</strong> Hochatmosphäre zu suchen, wo aus dem Stickstoff-Isotop 14 N durch energiereiche Höhenstrahlung<br />
14 C entsteht. Von dort aus verteilt es sich in <strong>der</strong> gesamten Atmosphäre, wird von Pflanzen als CO 2 aufgenommen<br />
und über die Nahrungskette verbreitet. CO 2 wird auch von Mollusken zum Aufbau ihrer Kalkschalen<br />
aus dem Wasser aufgenommen. So lange ein Organismus lebt, entspricht <strong>der</strong> 14 C-Anteil am Gesamtkohlenstoff in<br />
seinem Körper dem 14 C-Anteil am Gesamtkohlenstoff <strong>der</strong> Atmosphäre. Nach dem Tod dieses Organismus aber<br />
nimmt <strong>der</strong> Gehalt an radioaktivem Kohlenstoff ständig ab.<br />
Datiert werden können alle kohlenstoffhaltigen Substanzen wie Knochen, Zähne, Zellulose, Holz, Nussschalen,<br />
Holzkohle, Haare, Fasern, Stoffe o<strong>der</strong> Kalkschalen. Der Gehalt an radioaktivem Kohlenstoff im Verhältnis zum<br />
Gesamtkohlenstoff in diesen organischen Materialien ist ein Maß für das Alter, d.h. für den Todeszeitpunkt des<br />
Organismus. Man kann entwe<strong>der</strong> einfach die Radioaktivität dieser Substanzen mit Szintillationszählern messen<br />
(konventionelle 14 C-Altersbestimmung), o<strong>der</strong> man misst den 14 C-Gehalt <strong>der</strong> Probe direkt mit Hilfe eines Beschleuniger-Massenspektrometers<br />
(AMS).<br />
Inzwischen hat man herausgefunden, dass 14 C-Jahre keineswegs Kalen<strong>der</strong>jahren entsprechen, denn die 14 C-<br />
Produktion in <strong>der</strong> Hochatmosphäre scheint, an<strong>der</strong>s als man ursprünglich angenommen hatte, starken Schwankungen<br />
zu unterliegen. Inzwischen kann man allerdings die 14 C-Jahre in Kalen<strong>der</strong>jahre umrechnen, da man Dank<br />
<strong>der</strong> Dendrochronologie gelernt hat, diese Fehler zu korrigieren. Angesichts <strong>der</strong> kurzen Halbwertszeit ist die Radiokarbon-Methode<br />
nur in den jüngsten Abschnitten des Quartärs anwendbar. Man kann damit keinsfalls Objekte<br />
datieren, die älter sind als etwa 70 000 Jahre.<br />
d) Spaltspuren-Methode (FT-Methode o<strong>der</strong> fission-track dating)<br />
Die Isotope von Elementen mit beson<strong>der</strong>s hohen Atomgewichten sind zum größten Teil instabil. Bei ihrem radioaktiven<br />
Zerfall kommt es zum Ausschleu<strong>der</strong>n von α-Teilchen (Helium-Kernen), β-Teilchen (Elektronen) und energiereichen<br />
γ-Quanten – und damit verbunden zum Entstehen neuer instabiler, seltener stabiler Tochterisotope,<br />
die oft ein o<strong>der</strong> zwei Ordnungszahlen unter o<strong>der</strong> über <strong>der</strong> des Mutterisotopes liegen. Es ist bekannt, dass man bei<br />
den natürlich vorkommenden Elementen mit den höchsten Ordnungszahlen, Uran und Thorium, zudem durch den<br />
Beschuss mit Neutronen einen Neutroneneinfang erzwingen kann. Dadurch wird eine Kernspaltung (nuclear<br />
fission) ausgelöst, bei <strong>der</strong> sehr große Energiemengen freigesetzt werden. Weniger bekannt ist, dass Uran- und<br />
Thorium-Isotope sich auch spontan spalten, regelrecht zerplatzen können, wenn auch mit einer sehr kleinen<br />
Wahrscheinlichkeit (spontaneous fission, spontane Kernspaltung). Die Halbwertszeit für diese spontane Kernspaltung<br />
(„fission halflife“) beträgt beim häufigsten dieser schweren Isotope, beim Uran-Isotop 238 U, ca. 0,86 10 16<br />
Jahre. Sie liegt damit um viele Größenordnungen höher als die Halbwertszeit für den normalen radioaktiven<br />
Zerfall dieses Uran-Isotops, d.h. auf etwa 10 7 normale Zerfälle von 238 U kommt im Schnitt eine spontane<br />
Kernspaltung.<br />
Bei je<strong>der</strong> dieser spontanen Kernspaltungen entstehen zwei Tochterisotope mit annähernd gleichen Atomgewichten.<br />
Außerdem wird ein kleiner Teil <strong>der</strong> Masse in Energie umgewandelt. Ein Teil dieser Energie wird in Form<br />
von Wärme, <strong>der</strong> größte Teil aber als kinetische Energie frei, insgesamt ca. 200 MeV. Mit dieser gewaltigen<br />
Energie werden die beiden Tochterisotope in entgegengesetzte Richtungen davongeschleu<strong>der</strong>t. War dieser zerplatzende<br />
Urankern ursprünglich einmal in einen Kristall eingebaut, entfaltet <strong>der</strong> Impuls <strong>der</strong> beiden Tochterisotope<br />
eine gewaltige Zerstörungskraft im Kristallgitter. In einem Schusskanal werden alle Atome aus ihren Gitterplätzen<br />
gerissen und das Kristallgitter in einem zylindrischen Bereich von etwa 30 Å Durchmesser und 0,015 mm Länge
43<br />
völlig zerstört. Diese Fehlstellen im Kristallgitter (Spaltspuren) können über geologische Zeiträume hinweg<br />
erhalten bleiben, wenn man diese Kristalle nicht über ein bestimmtes Maß hinaus erwärmt. Werden Quarzkristalle<br />
auf 1100°, Calcitkristalle auf 400° o<strong>der</strong> Gläser auf etwa 600°C erhitzt, verheilen die Fehlstellen wie<strong>der</strong>, indem<br />
sich die aus ihren Verbänden gerissenen Atome neu ordnen. Diese für jede Mineralart charakteristische Temperatur<br />
wird Verheilungstemperatur genannt.<br />
Uran – und damit auch 238 U – ist ein sehr verbreitetes Element, das im ppm-Bereich in allen möglichen Mineralien<br />
vorkommt, die von ihrer chemischen Formel her eigentlich gar kein Uran enthalten sollten. So kommen z.B. in<br />
Apatit-, Fluorit-, Quarz- o<strong>der</strong> Calcit-Kristallen, aber auch in natürlichen o<strong>der</strong> künstlichen Gläsern, meist kleine<br />
Mengen von Uran vor, natürliche Zirkone (ZrSiO 4 ) enthalten sogar zwischen 100 und 2000 ppm! Die Urankerne<br />
zerfallen im Laufe <strong>der</strong> Zeit, wobei die weitaus meisten von einem normalen radioaktiven Zerfall betroffen sind, <strong>der</strong><br />
im Kristallgitter keinerlei Spuren hinterlässt. Nur ein sehr kleiner Teil von ihnen zerplatzt und erzeugt die oben<br />
geschil<strong>der</strong>ten, kaum sichtbaren Fehlstellen im Gitter. Man kann sie aber deutlich sichtbar machen, wenn man die<br />
Kristalle mit geeigneten Säuren anätzt. Die Säuren greifen bevorzugt diese Gitterfehlstellen an und erzeugen an<br />
ihrer Stelle kleine Ätzgruben, die Spaltspuren i.e.S., die man unter einem Lichtmikroskop deutlich sehen kann. Die<br />
Dichte <strong>der</strong> Ätzgruben ist einerseits vom Uran- (und Thorium-) Gehalt des Kristalls, an<strong>der</strong>erseits von <strong>der</strong> Zeit abhängig.<br />
Kann man den ursprünglichen Urangehalt <strong>der</strong> Probe ermitteln, lässt sich die Zeit ausrechnen die vergangen<br />
ist, seit <strong>der</strong> Kristall o<strong>der</strong> das Glas entstanden bzw. unter die spezifische Schließungstemperatur abgekühlt<br />
wurden.<br />
Im Prinzip geht man bei <strong>der</strong> Datierung so vor, dass man die zu bestimmende Probe teilt – ein Glas, ein größeres<br />
Mineral o<strong>der</strong> ein Konzentrat kleinerer geeigneter Minerale. Aus <strong>der</strong> einen Hälfte stellt man gleich Dünnschliffe her,<br />
aus <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en erst, nachdem man die Probe in einem Atomreaktor o<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en Neutronenquelle mit<br />
Neutronen bestrahlt hat. Die Neutronenquelle muss einen sehr hohen Fluss thermischer Neutronen aufweisen,<br />
<strong>der</strong> bei allen verbliebenen schweren Atomkernen eine Kernspaltung erzwingt. Dann werden beide Proben mit<br />
geeigneten Säuren angeätzt, um die Spaltspuren sichtbar zu machen, die man anschließend unter einem Lichtmikroskop<br />
auszählen kann. Alle Spaltspuren in <strong>der</strong> unbehandelten Probe sind in <strong>der</strong> Zeit entstanden, die seit <strong>der</strong><br />
Bildung bzw. <strong>der</strong> Unterschreitung <strong>der</strong> Schließungstemperatur des Minerals o<strong>der</strong> des Glases verstrichen ist. Die<br />
Spaltspuren, die man auf einer bestimmten Fläche in <strong>der</strong> bestrahlten Probe zählt, zeigen, wie viele Uranatome<br />
auf dieser Fläche ursprünglich noch vorhanden waren, wenn man die davon abzieht, die auf <strong>der</strong> gleichen Fläche<br />
einer unbestrahlten Probe zu finden sind. Daraus lassen sich <strong>der</strong> ursprüngliche Urangehalt <strong>der</strong> Probe und ihr<br />
Alter bestimmen.<br />
Die Spaltspuren-Methode ermöglicht sehr genaue Altersbestimmungen und lässt sich genauso gut zur Datierung<br />
des Abkühlungsalters eines Granits, einer Metamorphose als auch zur Beantwortung <strong>der</strong> Frage verwenden, ob<br />
ein antikes Glas gefälscht ist o<strong>der</strong> nicht. Die Methode ist allerdings aufwendiger, als es klingt, denn es ist oft sehr<br />
schwierig, genügend geeignete, oft winzige Kriställchen aus dem Gestein zu gewinnen, zu konzentrieren und für<br />
die Messung vorzubereiten.<br />
5.5.4 Chronometrische Methoden, die an<strong>der</strong>e Gesetzmäßigkeiten ausnützen<br />
a) Paläomagnetik<br />
Die Erde ist von einem bipolaren Magnetfeld umgeben, das auch in großen Teilen <strong>der</strong> erdgeschichtlichen Vergangenheit<br />
existent war. Die letztliche Ursache dieses Magnetfeldes ist unbekannt. Es geht vom äußeren Erdkern<br />
aus und kann als geozentrischer Dipol aufgefasst werden, dessen Achse sich in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Rotationsachse<br />
<strong>der</strong> Erde befindet. An einer beliebigen Stelle auf <strong>der</strong> Erdoberfläche lässt sich das Magnetfeld durch folgende vier<br />
Eigenschaften charakterisieren:<br />
1. Deklination – Winkel, <strong>der</strong> die Abweichung <strong>der</strong> magnetischen Feldlinien von den Meridianen des<br />
geographischen Gradnetzes auf <strong>der</strong> Erdoberfläche angibt,<br />
2. Inklination – Winkel, <strong>der</strong> die Neigung <strong>der</strong> magnetischen Feldlinien relativ zur Erdoberfläche angibt<br />
3. Intensität – die im Zeitraum von mehreren Jahren stark schwanken kann sowie<br />
4. Polarität – die angibt, ob <strong>der</strong> magnetische Nordpol geographisch auf <strong>der</strong> Nordhalbkugel liegt o<strong>der</strong> nicht<br />
Viele Gesteine enthalten ferromagnetische Minerale (z.B. Magnetit, Magnetkies, Hämatit) die sich bei ihrer Bildung<br />
o<strong>der</strong> Ablagerung nach dem momentan an dieser Stelle herrschenden Magnetfeld ausrichten und es in Form<br />
ihres remanenten Magnetismus abbilden.
44<br />
Eine beson<strong>der</strong>s große magnetische Suszeptibilität (Empfänglichkeit) besitzen basische und ultrabasische<br />
Magmatite (z.B. basaltische Laven, basische Gangesteine, Gabbros), die beson<strong>der</strong>s reich an eisenhaltigen, ferromagnetischen<br />
Mineralkörnern sind. Diese richten sich nach dem Erdmagnetfeld aus wenn, die Gesteinsschmelze<br />
unter den sog. Curiepunkt abgekühlt wird (Thermoremanenz). Auch klastische Sedimente zeigen<br />
eine magnetische Suszeptibilität, die z.B. entstehen kann, wenn ferromagnetische Schwerminerale (Sandkörner,<br />
vor allem Magnetit) am Boden abgesetzt werden und sich nach dem Erdmagnetfeld ausrichten, solange sie<br />
schweben (Sedimentationsremanenz). In bereits fertigen Sedimenten können auch nachträglich ferromagnetische<br />
Minerale wachsen, die sich am Magnetfeld orientieren (Kristallremanenz). Der remanente Magnetismus<br />
verschwindet wie<strong>der</strong>, wenn Gesteine z.B. durch eine Metamorphose über den Curiepunkt erhitzt werden.<br />
Deklination, Inklination und Intensität des Magnetfeldes än<strong>der</strong>n sich mit <strong>der</strong> geographischen Position auf <strong>der</strong> Erdoberfläche.<br />
Sie verän<strong>der</strong>n sich aber auch im Laufe von Jahren und Jahrzehnten. Auch die magnetische Polarität<br />
verän<strong>der</strong>t sich und hat sich im Laufe <strong>der</strong> Erdgeschichte sehr oft umgekehrt (Inversionen). Es hat offensichtlich<br />
mehrfach Phasen gegeben, in denen war die Polarität wie heute (normal), und solche, in denen waren <strong>der</strong><br />
magnetische Nord- und Südpol im Vergleich zu heute vertauscht (revers).<br />
Das weiß man, seitdem man die Magnetisierung <strong>der</strong> Ozeanböden zu untersuchen begonnen hat. Am Ozeanboden<br />
lässt sich ein charakteristisches magnetisches Streifenmuster erkennen, das parallel orientiert und symmetrisch<br />
zu den zentralen Gräben <strong>der</strong> mittelozeanischen Rücken angeordnet ist. Je<strong>der</strong> dieser Streifen entspricht<br />
einer Zone, in <strong>der</strong> das Erdmagnetfeld verstärkt o<strong>der</strong> abgeschwächt wird, je nach dem ob die unterlagernden vulkanischen<br />
Gesteine normal o<strong>der</strong> revers magnetisiert sind. Dieses Muster entsteht, da an den mittelozeanischen<br />
Rücken fast kontinuierlich basische Magmen geför<strong>der</strong>t und seitlich weggedrückt werden, so dass eine ununterbrochene<br />
Dokumentation <strong>der</strong> jeweils vorherrschenden magnetischen Polarität erfolgt. Auch die Untersuchung von<br />
mächtigen vulkanischen Sukzessionen am Festland zeigt die mehrfache Umkehrung des Erdmagnetfeldes. In<br />
Island, auf den Inneren Hebriden Schottlands o<strong>der</strong> in Ostgrönland gibt es beispielsweise Tausende von Metern<br />
mächtige, aus vielen übereinan<strong>der</strong>liegenden, geringmächtigen Lavaflüssen (Flutbasalten) aufgebaute Basaltdecken,<br />
die hier in enger zeitlicher Folge während des Tertiärs und Quartärs ausgeflossen sind. In solchen Sukzessionen<br />
(Folgen) sind mehrfache Inversionen <strong>der</strong> magnetischen Polarität zu erkennen. Sie lassen sich sogar<br />
datieren, wenn man das Alter <strong>der</strong> einzelnen Basaltströme radiometrisch bestimmt. Die Magnetisierung dieser<br />
Laven ist oft so stark, dass man schon mit einem gewöhnlichen Kompass nachprüfen kann, ob sie normal o<strong>der</strong><br />
revers magnetisiert sind.<br />
Im Känozoikum dauerte eine Phase normaler o<strong>der</strong> reverser Polarität jeweils 10 000 bis etwas über 1000 000<br />
Jahre lang. Im Mesozoikum lassen sich solche Magnetozonen nachweisen, die mehr als 20 Ma lang waren (mit<br />
normaler Polarität). Inzwischen ist es gelungen, eine paläomagnetische Zeitskala zu erstellen, die allerdings immer<br />
lückenhafter und ungenauer wird, je weiter wir in <strong>der</strong> erdgeschichtlichen Vergangenheit zurückgehen. Recht<br />
detailliert und zuverlässig ist sie bisher im Känozoikum, also im Tertiär und Quartär. Meist werden in dieser<br />
paläomagnetischen Zeitskala mehrere Magnetozonen zu paläomagnetischen Epochen zusammengefasst, die<br />
durch eine jeweils vorherrschende Polarität charakterisiert sind und Namen tragen. So werden die letzten 5 Ma<br />
durch vier paläomagnetische Epochen geglie<strong>der</strong>t: Gilbert (revers), Gauss (normal), Matuyama (revers) und<br />
Brunhes (normal), in <strong>der</strong> wir heute noch leben. Die meisten Epochen werden von Events (Ereignissen) unterbrochen<br />
und geglie<strong>der</strong>t, also durch kürzere Inversionen (Magnetozonen). Die Gauss-Epoche wird z.B. durch das<br />
Mammooth- und das Kaena-Event mit normaler Polarität, die Matuyama-Epoche durch das Reunion-, Olduvaiund<br />
Jaramillo-Event mit reverser Polarität unterbrochen.<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> paläomagnetischen Zeitskala gelingt es, Laven und Sedimentgesteine unbekannten Alters sowie<br />
ganze Schichtfolgen zu datieren, was aber meist nur in Kombination mit an<strong>der</strong>en Altersbestimmungsmethoden<br />
zufriedenstellend gelingt. Zwei Gesteine, die einen remanenten Magnetismus mit gegensätzlicher Polarität zeigen,<br />
können unmöglich gleich alt sein, solche, die eine Magnetisierung mit gleicher Polarität besitzen, können,<br />
aber müssen nicht gleich alt sein. Die Möglichkeiten einer Datierung werden besser, wenn man in einer Schichtfolge<br />
von unten nach oben eine Inversion <strong>der</strong> Polarität feststellen kann, also einen Umschlag von normal nach<br />
revers o<strong>der</strong> von revers nach normal. Am einfachsten datierbar sind Schichtfolgen, die heute noch in Bildung sind,<br />
z.B. Bohrkerne, die vom Grund des Meeres o<strong>der</strong> sehr alter Seen stammen. Im einfachsten Falle gelingt eine<br />
zuverlässige Datierung eines bestimmten Horizontes durch einfaches Abzählen <strong>der</strong> Inversionen von oben nach<br />
unten. Die Methode ist vor allem wichtig, um marine und festländische Schichtfolgen parallelisieren zu können.<br />
b) Thermolumineszenz-Methode (TL-Methode)
45<br />
Thermolumineszenz ist die Fähigkeit bestimmter Minerale (z.B. Fluorit, Calcit, Quarz o<strong>der</strong> Feldspat) kurz aufzuleuchten,<br />
wenn man sie im Dunkeln erwärmt. Dieses schwache o<strong>der</strong> helle Aufleuchten wie<strong>der</strong>holt sich nicht,<br />
wenn man es mit <strong>der</strong>selben Probe ein zweites Mal versucht. Man kann den Versuch allerdings erfolgreich wie<strong>der</strong>holen,<br />
wenn man die Probe vorher im Dunkeln einer radioaktiven Bestrahlung aussetzt, sie etwa neben ein<br />
Stück stark strahlende Pechblende legt. Die Fähigkeit zu leuchten verlieren die Minerale aber wie<strong>der</strong>, wenn man<br />
die Proben nach <strong>der</strong> Bestrahlung <strong>der</strong> Sonne aussetzt. Durch Erwärmen o<strong>der</strong> Sonnenlicht werden diese Minerale<br />
gewissermaßen „gebleicht“.<br />
Die Bestrahlung führt den Atomen im Kristallgitter Energie zu. Dadurch werden ihre Elektronen auf höhere<br />
Energieniveaus in den Schalen angehoben; die Atome geraten in einen angeregten Zustand. Um die aufgenommene<br />
Energie wie<strong>der</strong> in Form von Lichtquanten abgeben zu können, brauchen die Atome eine gewisse<br />
Anregungsenergie, die von außen in Form von Wärme o<strong>der</strong> Licht zugeführt werden muss. Die Energiemenge,<br />
die von einem Mineral maximal aufgenommen und bei <strong>der</strong> Thermolumineszenz auch wie<strong>der</strong> abgegeben werden<br />
kann, ist von Mineral zu Mineral verschieden. Irgendwann erreicht jedes Mineral eine artspezifische Sättigung;<br />
darüber hinaus kann keine Energie mehr gespeichert werden. Wann diese Sättigung erreicht wird, hängt von<br />
Dauer und Intensität <strong>der</strong> Bestrahlung ab. Eine hohe Strahlungsdosis führt u.U. schon nach wenigen Minuten zur<br />
Sättigung, eine sehr schwache Dosis u.U. erst nach Jahrhun<strong>der</strong>ttausenden.<br />
Da die bei <strong>der</strong> Thermolumineszenz abgegebene Lichtmenge, abgesehen von <strong>der</strong> Mineralart, vor allem von <strong>der</strong><br />
Dauer und von <strong>der</strong> Intensität <strong>der</strong> Bestrahlung abhängig ist, kann die Bestrahlungszeit errechnet werden, wenn die<br />
Strahlungsdosis bekannt ist. Das gilt aber nur, wenn das Mineral bei Beginn <strong>der</strong> Bestrahlung vollständig<br />
„gebleicht“ war. Die Zeitabhängigkeit <strong>der</strong> Lichtmenge, die bei <strong>der</strong> Thermolumineszenz abgegeben wird, lässt sich<br />
vor allem zum Bestimmen <strong>der</strong> Ablagerungszeit von Sedimenten verwenden.<br />
Um eine nachträgliche Bleichung zu verhin<strong>der</strong>n, müssen Proben, die mit <strong>der</strong> TL-Methode datiert werden sollen,<br />
möglichst bei Dunkelheit aus dem Sedimentkörper entnommen und im Dunkeln aufbewahrt werden. Man sticht<br />
die Proben am besten mit einem Filmdöschen heraus, nachdem man die obersten Sedimentschichten entfernt<br />
hat. In dem Loch, das durch die Probenentnahme entstanden ist, wird mit einem Szintillationszähler die Strahlung<br />
gemessen, <strong>der</strong> die Probe ausgesetzt war, die externe Dosis. Im Labor misst man mit einem Szintillationszähler<br />
die Strahlungsmenge, welche die Probe selbst aussendet, die interne Dosis.<br />
Anschließend wird die Probe geteilt. Die eine Hälfte dient zur Datierung, bei <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Hälfte wird geprüft, wie<br />
weit sie durch Strahlung gesättigt werden und wie viel Licht sie maximal abgeben kann. Um das herauszufinden<br />
wird sie zunächst gebleicht, dann durch künstliche Bestrahlung aufgesättigt und durch langsames Aufheizen wie<strong>der</strong><br />
gebleicht. Der Vorgang wird mehrmals wie<strong>der</strong>holt, und dabei mit einem empfindlichen Photometer die jeweils<br />
ausgesendete Lichtmenge gemessen. Hat man das Verhalten <strong>der</strong> Probe auf diese Weise genau kennengelernt,<br />
wird die zweite bisher aufgesparte Hälfte langsam aufgeheizt und die dabei abgegebene Lichtmenge genau<br />
gemessen. Im günstigsten Falle kann man so den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die mineralischen Körner des<br />
Dünensandes zum letzten Mal von <strong>der</strong> Sonne beschienen worden sind, also vollständig gebleicht wurden.<br />
Wirklich zuverlässig funktioniert die TL-Methode bisher nur bei Dünensanden und Lössen, weniger gut bei fluviatilen<br />
Sedimenten. Vermutlich sind die Sandkörner vor ihrer Ablagerung im Wasser nicht ausreichend dem Sonnenlicht<br />
ausgesetzt und deshalb auch nicht immer vollkommen gebleicht worden. Mit <strong>der</strong> TL-Methode lassen sich<br />
sogar quartäre Sedimente datieren, die mehr als 1 Ma alt sind.<br />
5.6 Literaturauswahl zur Allgemeinen <strong>Geologie</strong><br />
BAHLBURG, H. & BREITKREUZ, C. (2004): <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Geologie</strong>.– 403 S.; München (Elsevier / Spektrum-Verl.).<br />
BESCHEL, R.B. (1950): Flechten als Altersmaßstab rezenter Moränen.– Z. Gletscherk. Glazialgeol., 1, S.152-161; Innsbruck.<br />
FECKER, E. & REIK, G. (1987): Baugeologie.– 418 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
FRISCH, W. & MESCHEDE, M. (2005): Plattentektonik, Kontinentalverschiebung und Gebirgsbildung.– 196 S.; Darmstadt (Primus-Verl.,<br />
Wiss. Buchgesellschaft).<br />
GERMAN, R. (1981): Einführung in die <strong>Geologie</strong>.– 207 S.; Stuttgart (Klett-Verl.).<br />
GEYH, M.A. & SCHLEICHER, H. (1990): Absolute Age Determination. Physical and Chemical Dating Methods and Their Application.– 503<br />
S.; Berlin, Heidelberg etc. (Springer-Verl.).<br />
MILLER, H. (1992): Abriß <strong>der</strong> Plattentektonik.– 149 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
PRESS, F. & SIEVER, R. (1995): Allgemeine <strong>Geologie</strong>: eine Einführung.– 602 S.; Heidelberg etc. (Spektrum-Verl.).
46<br />
PRINZ, H. (1982): Abriß <strong>der</strong> Ingenieur-<strong>Geologie</strong>.– 419 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
REY, J. (1991): Geologische Altersbestimmung.– 195 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
RICHTER, D. (1986): Allgemeine <strong>Geologie</strong>.– 412 S.; Berlin, New York (de Gruyter-Verl.).<br />
MURAWSKI, H. (1992): Geologisches Wörterbuch.– 254 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
WAGNER, G.A. & VAN DEN HAUTE, P. (1992): Fission-Track Dating.– 285 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
ZEIL, W. (1984): Brinkmanns Abriß <strong>der</strong> <strong>Geologie</strong>, Bd. 1, Allgemeine <strong>Geologie</strong>.– 276 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
6. QUARTÄRGEOLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
6.1 Frühe Geschichte <strong>der</strong> Eiszeitforschung<br />
Schon lange ist bekannt, dass in Norddeutschland o<strong>der</strong> Dänemark unzählige große Felsblöcke in <strong>der</strong> Landschaft<br />
herumliegen (Findlinge, Irrblöcke). In <strong>der</strong> gleichen Gegend fallen merkwürdige Hügelgruppen, lang hinziehende<br />
Hügelketten (Moränen), extrem breite, oft ganz trockene Täler (Urstromtäler) und zahlreiche, an Krater erinnernde,<br />
rundliche Senken auf, die oft mit Wasser gefüllt sind (Sölle).<br />
Ursprünglich dachte man, die Blöcke seien vielleicht vulkanische Bomben (vulkanische Sprengtheorie). Ende<br />
des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts stellte v. Ahrenswald fest, dass diese Felsblöcke aus Kristallingesteinen bestehen, die es in<br />
dieser Form nur in Skandinavien gibt. Gleichzeitig häuften sich Meldungen katastrophaler Überflutungen von<br />
Alpentälern, die durch Gletscherläufe in Folge <strong>der</strong> „Kleinen Eiszeit“ verursacht worden waren. Unter ihrem Einfluss<br />
nahm er eine katastrophale Schlammflut an, die sog. „petridelaunische Flut“, mit denen die Blöcke über die<br />
Ostsee nach Norddeutschland gekommen sein sollten (Schlammflut-Theorie). Eine an<strong>der</strong>e Hypothese wurde<br />
Anfang des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts von Ch. Lyell entwickelt. Er ging davon aus, dass die Gletscher Skandinaviens ursprünglich<br />
einmal viel größer waren als heute und teilweise ins Meer gekalbt haben. Moränen und Findlinge<br />
sollten danach Absätze driften<strong>der</strong> Eisberge sein. Diese glaziale Drift-Theorie erschien lange als die beste<br />
Lösung des Problems, da man tatsächlich nachweisen konnte, dass Teile von Norddeutschland noch im Quartär<br />
von Meer bedeckt gewesen sein müssen. Aber auch im süddeutschen Alpenvorland und im Schweizer Mittelland<br />
fand man ähnliche Hügelgruppen, Seen und Irrblöcke, die hier offensichtlich nicht aus Skandinavien, son<strong>der</strong>n aus<br />
den Alpen stammten. Driftende Eisberge konnten diese Blöcke nicht mitgebracht haben, denn im Alpenvorland<br />
waren Ablagerungen we<strong>der</strong> von riesigen Süßwasserseen noch von einem Meer nachzuweisen, jedenfalls nicht im<br />
Quartär.<br />
An den Stirnen von Schweizer Gletschern kann man die Bildung von Moränen und das Absetzen großer Blöcke<br />
direkt beobachten. Einem Hinweis eines Bergführers verdankte <strong>der</strong> Schweizer Naturforscher H. de Saussure<br />
schon an <strong>der</strong> Wende vom 18. zum 19. Jahrhun<strong>der</strong>t die Erkenntnis, dass die gleichen Moränen mit großen Blöcken<br />
auch weit unten in den Alpentälern zu finden sind. Der Englän<strong>der</strong> Playfair deutete Moränen im Schweizer<br />
Jura im Jahre 1802 erstmals im Sinne einer Vergletscherung des gesamten Schweizer Alpenvorlandes. Für viele<br />
war es aber zunächst einfach undenkbar, dass die Alpengletscher aus den Zentralalpen bis ins Alpenvorland<br />
vorgestoßen sein könnten. Noch unwahrscheinlicher schien die Annahme einer Eiskappe, die von Skandinavien<br />
über die Ostsee bis nach Berlin gereicht haben sollte. Als man aber immer mehr Beweise dafür zusammentrug,<br />
verbreitete sich die Idee einer großen Vergletscherung <strong>der</strong> Alpen und Nordeuropas (Eiszeit-Theorie) allmählich,<br />
vor allem unter dem Einfluss des berühmten Schweizer Paläontologen L. d'Agassiz. Um das Jahr 1840 wurde<br />
diese Theorie in <strong>der</strong> Schweiz und Frankreich, bald darauf auch in Süddeutschland, Österreich und England<br />
akzeptiert. In Norddeutschland allerdings dauerte es noch deutlich länger, bevor sich die Eiszeit-Theorie gegen<br />
die Drift-Theorie durchsetzen konnte. Erst <strong>der</strong> Schwede Torell konnte deutsche Fachkollegen, die im Jahre 1875<br />
an einer Exkursion <strong>der</strong> Deutschen Geologischen Gesellschaft nach Rü<strong>der</strong>sdorf bei Berlin teilgenommen hatten,<br />
davon überzeugen, dass die Schliffspuren, die hier auf Muschelkalk erhalten waren, von Gletschern stammen<br />
müssen. Bald danach entbrannte ein neuer Streit, indem einige behaupteten, es hätte mehr als eine Eiszeit<br />
gegeben: die Monoglazialisten standen den Polyglazialisten gegenüber. Vor allem durch die Argumente A.<br />
Pencks, <strong>der</strong> erst in Norddeutschland, dann auch in Süddeutschland die <strong>Grundlagen</strong> für die Quartärstratigraphie<br />
schuf, wurde <strong>der</strong> Streit an <strong>der</strong> Wende vom 19. zum 20. Jahrhun<strong>der</strong>t im Sinne <strong>der</strong> Polyglazialisten entschieden.
47<br />
6.2 Die eiszeitlichen Gletscher in Europa<br />
Heute wissen wir, dass die letzten beiden Jahrmillionen <strong>der</strong> Erdgeschichte durch eine Reihe weltweit nachweisbarer<br />
Klimakatastrophen gekennzeichnet waren, die sich in unseren Breiten als Eiszeiten auswirkten. Dieser<br />
jüngste Abschnitt <strong>der</strong> Erdgeschichte, <strong>der</strong> noch heute andauert, wird als Eiszeitalter o<strong>der</strong> Quartär bezeichnet.<br />
In Kaltzeiten (Eiszeiten, Glaziale) sanken die Jahresmitteltemperaturen in Mitteleuropa, die heute etwa zwischen<br />
6 und 8°C liegen, um mehr als 10°C ab, die Sommer wurden kurz und kühl, die Winter lang und streng. In<br />
<strong>der</strong> Folge begannen die Gletscher <strong>der</strong> gemäßigten Breiten zu wachsen und aus den Hochlagen <strong>der</strong> Gebirge talwärts<br />
zu kriechen. Schließlich ertranken die Alpen im Gletschereis, aus dem nur noch die höchsten und schroffsten<br />
Gipfel herausragten. Nach Norden hin traten die Gletscher durch die Pforten <strong>der</strong> großen Alpentäler ins<br />
Alpenvorland und stießen hier als flach ausgebreitete Vorlandgletscher weit nach Norden vor. Während die<br />
Gletscher am Alpenrand oft Hun<strong>der</strong>te von Metern dick waren, dünnten sie nach Norden zu langsam aus und<br />
erreichten am Eisrand schließlich ein labiles Gleichgewicht zwischen Nachfließen und Abschmelzen des Eises.<br />
Zur gleichen Zeit waren auf den Landmassen im nördlichen Europa und im arktischen Nordamerika kontinentale<br />
Eisschilde entstanden. Die Vergletscherung hatte vermutlich auch hier in Gebirgsregionen begonnen, im Norwegischen<br />
Hochgebirge und in den Schottischen Highlands. Skandinavien war schließlich vom mehr als 3000 m<br />
dicken Nordeuropäischen Inlandeis bedeckt, dessen Zentrum im Gebiet von Mittelschweden und <strong>der</strong> Ostsee<br />
lag und dessen Eiszungen bis in die Nordsee nach Osten und über die Ostsee und Mecklenburg hinaus bis Berlin<br />
und Hamburg nach S und W vorstießen.<br />
Ihre größte Ausdehnung erreichte we<strong>der</strong> das Nordeuropäische Inlandeis noch die alpinen Vorlandgletscher<br />
während <strong>der</strong> letzten, <strong>der</strong> Weichsel-Eiszeit bzw. Würmeiszeit, son<strong>der</strong>n während <strong>der</strong> <strong>der</strong> Elster- bzw. Riss-Eiszeit<br />
(vergl. Tab. 6). Die klimatische Schneegrenze lag in Süddeutschland damals so niedrig, dass selbst einige Mittelgebirge<br />
vergletschert waren, wie Harz, Vogesen, Schwarzwald o<strong>der</strong> Bayerischer Wald. Spuren eiszeitlicher Kargletscher<br />
finden sich in Teilen des Alpenvorlandes noch bis in Höhen von etwa 1100 m!<br />
6.3 Meeresspiegelabsenkung und Glazial-Isostasie<br />
In den Eisschilden waren während <strong>der</strong> Kaltzeiten so gewaltige Wassermengen gebunden, dass <strong>der</strong> Meeresspiegel<br />
<strong>der</strong> Ozeane zeitweise mehr als 120 m unter seinem heutigen Niveau lag. Weite Teile <strong>der</strong> Schelfgebiete fielen<br />
trocken, wie Nordsee, Adria o<strong>der</strong> Beringstraße. In dieser Zeit waren Rhein, Loire und Themse Nebenflüsse <strong>der</strong><br />
Elbe, die durch das weitgehend trockene Nordseebecken über den Ärmelkanal abfloss und erst weit vor <strong>der</strong> bretonischen<br />
Küste in den Nordatlantik mündete. Auch große Teile <strong>der</strong> Adria waren landfest; das Podelta lag damals<br />
bis zu 300 km südöstlich von Venedig.<br />
Die Geographie Europas war aber nicht nur wegen <strong>der</strong> Absenkung des Meeresspiegels ganz an<strong>der</strong>s als heute.<br />
Mehr als 6 Millionen km³ Eis lagen damals in Nord- und Westeuropa auf dem Festland. Durch das gewaltige<br />
Gewicht, das auf <strong>der</strong> Erdkruste lastete, wurde die Erdoberfläche langsam nach unten gedrückt. Die Erde ist<br />
nämlich nicht starr, son<strong>der</strong>n reagiert, wegen <strong>der</strong> hohen Gesteinstemperaturen im Erdinneren, zäh-plastisch. Im<br />
Zentrum des Nordeuropäischen Inlandeises, wo es mehr als 3000 m dick war und einen Druck von mindestens<br />
300 t/m² auf den Untergrund ausübte, wurde das Festland um mehrere 100 m in die Tiefe gedrückt. Umgekehrt<br />
stiegen die nicht vergletscherten Gebiete in <strong>der</strong> Umgebung <strong>der</strong> Eisschilde langsam auf. Diesen Vorgang, <strong>der</strong> sich<br />
beim Abschmelzen des Eises wie<strong>der</strong> umkehrte, nennt man Glazial-Isostasie.<br />
6.4.1 Erosion und Akkumulation von Gletschern<br />
6.4 Physische Quartärgeologie<br />
Gletscher und ihre Schmelzwässer hinterlassen Spuren, die man in <strong>der</strong> Landschaft noch erkennen kann, wenn<br />
das Eis schon längst abgeschmolzen ist. Teilweise sind es bestimmte Ablagerungen o<strong>der</strong> charakteristische Erosionsformen,<br />
die noch Jahrzehntausende o<strong>der</strong> gar Jahrmillionen später erhalten bleiben können. Wenn man<br />
diese Spuren richtig zu deuten versteht ist es möglich, die Ausdehnung <strong>der</strong> eiszeitlichen Gletscher, die Fließrich-
48<br />
tung des Eises o<strong>der</strong> die Geschichte einer Vereisung genau zu rekonstruieren. Allerdings muss man die Vorgänge<br />
im Detail kennen, die unter, am Rand und vor heutigen Gletschern ablaufen, damit man die Ablagerungen, die sie<br />
hinterlassen, richtig deuten kann. Modellhaft können diese Prozesse heute an den Gletschern <strong>der</strong> Alpen, besser<br />
aber Islands, Spitzbergens, Grönlands und Alaskas untersucht werden.<br />
Talgletscher füllen Täler aus, z.B. in den höchsten Teilen <strong>der</strong> Alpen. Ihre Eisströme können Hun<strong>der</strong>te von Metern<br />
dick, Kilometer breit und Zehnerkilometer lang sein. Solche Talgletscher formen im Laufe vieler Jahrtausende<br />
ehedem V-förmige Flusstäler zu Trogtälern o<strong>der</strong> U-Tälern mit einem U-förmigen Querschnitt um. Der Felsboden<br />
wir vom Gletscher abgeschürft und ausgebrochen, Gehängesporne weggeschliffen, die Talwände allmählich<br />
versteilt und so ein glattwandiger Taltrog geschaffen, durch den <strong>der</strong> Gletscher möglichst hin<strong>der</strong>nisfrei abfließen<br />
kann. Viele eiszeitlichen Trogtäler Norwegens wurden zu Fjorden, als <strong>der</strong> Meeresspiegel beim Abschmelzen <strong>der</strong><br />
Gletscher anstieg und das Meerwasser in die Mündungen von Trogtälern eindrang. Die glaziäre Übertiefung<br />
führt dazu, dassTrogtäler und Fjorde keine einheitlich tiefen, rinnenförmigen Tröge sind, son<strong>der</strong>n aus einer ganzen<br />
Kette von tiefen Becken, manchmal Hun<strong>der</strong>te von Metern tiefen durch Felsschwellen voneinan<strong>der</strong> getrennten<br />
Wannen. In den Alpen sind die meisten dieser Wannen in den eiszeitlichen Trogtälern mit Flussablagerungen,<br />
Seesedimenten o<strong>der</strong> Süßwasser gefüllt, wie im Falle des Königssees o<strong>der</strong> Gardasees. Wegen ihrer vom<br />
Gletscher übersteilten Talwände sind viele Trogtäler von Bergstürzen und Muren bedroht. Die zum Eisstromnetz<br />
verbundenen Talgletscher <strong>der</strong> Eiszeiten drangen über Transfluenzpässe auch in benachbarte Talsysteme ein.<br />
Die vom Eis überschliffenen und im Laufe <strong>der</strong> Zeit stark erniedrigten Pässe, wie Fernpass, Reschenpass o<strong>der</strong><br />
Brenner, waren immer schon die wichtigsten Verkehrswege in den Alpen.<br />
An den Hängen unterhalb <strong>der</strong> Gipfel und Grate frästen Kargletscher tiefe, steilwandige Mulden in den Felsuntergrund,<br />
die man als Kare o<strong>der</strong> Karmulden bezeichnet. Talauswärts werden diese oft kilometergroßen Wannen<br />
häufig von einem eisüberschliffenen Karriegel begrenzt. Wie natürliche Dämme stauen sie heute kristallklare<br />
Karseen auf. Von den Karwänden ergießen sich heute mächtige Schuttkegel auf den Karboden und haben so<br />
manchen einstigen See endgültig verschüttet. Die Felsen zwischen zwei benachbarten Karen versteilten immer<br />
mehr und wurden zuletzt zu Pyramiden und Kämmen mit scharfen, schartigen Graten umgeformt, den Karlingen.<br />
Auch Teile des norwegischen Hochgebirges schauten aus dem Eispanzer heraus, etwa die schroffen Gipfel von<br />
Galdhöppigen o<strong>der</strong> Glittertind in Jotunheimen. In <strong>der</strong> Eiszeit firnfreie Berge, die von Gletscherströmen umflossen<br />
wurden, nennt man Nunatakker (Einzahl: Nunatak). Pfän<strong>der</strong>, Auerberg o<strong>der</strong> Peißenberg z.B. waren Nunatakker<br />
im Alpenvorland und schauten in <strong>der</strong> letzten Eiszeit (<strong>der</strong> Würm- o<strong>der</strong> Weichseleiszeit) aus dem Eispanzer heraus.<br />
Die Sohle des darüberströmenden Eises hat Hügel und Kuppen des Untergrundes teilweise zu Stromlinienkörpern<br />
zurechtgeschliffen. Auf den Stoßseiten dieser Rundhöcker trägt <strong>der</strong> Felsuntergrund oft spiegelglatt polierte<br />
Gletscherschliffe, auf denen Gletscherschrammen zu sehen sind – Rillen, die von harten, im Eis eingefrorenen<br />
Geschieben ins Gestein gepflügt wurden. Wo die Druckfestigkeit <strong>der</strong> Gesteine überschritten worden ist, sind<br />
kegelförmige Risse entstanden. Mit diesen Sichelmarken und Parabelrissen lässt sich die Strömungsrichtung<br />
des Eises exakt bestimmen. Regelmäßig geformte, walrückenartige Hügel, die in ganzen Schwärmen auftreten<br />
und einen Kern aus Geschiebelehm o<strong>der</strong> Kies besitzen, nennt man dagegen Drumlins. Das Eis arbeitet aber<br />
auch in die Tiefe und schürft große und kleine Wannen aus. Diese Hohlformen füllen sich nach dem Eisrückzug<br />
mit Wasser. Deshalb sind ehemals vergletscherte Gebiete mit großen und kleinen Seen förmlich übersät. Die<br />
Zungenbecken sind beson<strong>der</strong>s tief ausgeschürfte Wannen, die im Bereich <strong>der</strong> Zungenenden großer Vorlandgletscher<br />
entstanden und sich nach dem Abschmelzen des Eises mit Zungenbeckenseen füllten. Zungenbeckenseen<br />
sind etwa <strong>der</strong> Ammersee, <strong>der</strong> Starnberger See o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bodensee.<br />
Der Schutt, den <strong>der</strong> winterliche Frost unentwegt von den nackten Felsen sprengt, sammelt sich am Fuße <strong>der</strong><br />
Steilhänge an und füllt langsam die Talböden auf. Wird aber das Tal von einem Talgletscher ausgefüllt, wird <strong>der</strong><br />
Gesteinsschutt, <strong>der</strong> mit Lawinen, Steinschlägen und Felsstürzen auf die Oberfläche <strong>der</strong> Gletscher nie<strong>der</strong>geht,<br />
vom Eis „huckepack“ als Obermoräne mitgeschleppt. Material wird aber auch aus den Talflanken sowie dem<br />
Gletscherbett ausgebrochen und an <strong>der</strong> schmutzigen Basis des Gletschers als Grundmoräne mitgenommen.<br />
Beim Transport im Eis werden die Gesteinsbrocken teilweise geglättet und zu Sand und Gesteinsmehl zerrieben.<br />
An <strong>der</strong> Basis des Eises schmilzt ein Teil dieses grob- und feinkörnigen Materials als Geschiebelehm aus und<br />
wird mit hohem Druck so in Unebenheiten des Untergrundes gespachtelt, dass <strong>der</strong> Gletscher mit möglichst wenig<br />
Reibung auf seinem Bett dahingleiten kann. Eingeschlossene Gesteinsbrocken, <strong>der</strong>en geglättete Oberflächen<br />
beim Transport im Eis mit tiefen Kratzern versehen werden, nennt man gekritzte Geschiebe. Die so entstandene,<br />
hoch verdichtete „Grundmoräne“ (Belastungsmoräne) überdeckt großflächig die ehemals vergletscherten<br />
Teile des Alpenvorlandes o<strong>der</strong> Norddeutschlands.
49<br />
An <strong>der</strong> Gletscherstirn schmilzt <strong>der</strong> mitgebrachte Gesteinsschutt aus und häuft sich mit <strong>der</strong> Zeit zu niedrigen<br />
Rücken und Kuppen an, die als Moränenwälle bezeichnet werden. Je nachdem, ob Wälle an <strong>der</strong> Gletscherstirn<br />
o<strong>der</strong> an den Seiten eines Gletscherstromes entstehen, nennt man sie Stirnmoränen o<strong>der</strong> Ufermoränen. Wälle,<br />
die während <strong>der</strong> Maximalstände einer Eiszeit entstanden sind, werden als Endmoränen bezeichnet. Gelegentlich<br />
finden sich flache Wannen und an Bombentrichter erinnernde Senken, die ihre Existenz ausgeschmolzenen<br />
Gletscherteilen (Toteis) verdanken und als Toteislöcher o<strong>der</strong> Sölle bezeichnet werden.<br />
In Zeiten, in denen die Rän<strong>der</strong> <strong>der</strong> eiszeitlichen Gletscher in Etappen zurückschmolzen, konnten ganze Wallsysteme<br />
entstehen. Zog sich die Gletscherstirn dagegen vergleichsweise rasch und kontinuierlich zurück, entstanden<br />
keine Moränenwälle. Die mitgeführte Obermoräne blieb als lockere Moränendecke liegen, in die einzelne<br />
metergroße, manchmal riesige Findlinge (Irrblöcke, Erratiker) eingebettet sind. Diese vom Eis mittransportierten,<br />
metergroßen Felsblöcke sind oft mit Bergstürzen auf die Gletscheroberflläche gelangt und werden vom<br />
Gletscher beim Zurückschmelzen in <strong>der</strong> Landschaft liegengelassen. Schöne Beispiele für riesige Findlingsblöcke<br />
sind z.B. aus dem Westallgäu bekannt, wo ein (inzwischen zerstörter) riesiger, aus dem Rätikon stammen<strong>der</strong><br />
Kalksteinfindling im Ellhofer Moor zu finden war. Er hatte ursprünglich ein Volumen von etwa 4000 m ³ , ist aber in<br />
einem Steinbruch abgebaut worden, da man aus dem Material Branntkalk herstellte.<br />
6.4.2 Erosion und Akkumulation <strong>der</strong> Schmelzwässer<br />
Jedes Frühjahr und im Sommer fallen auf <strong>der</strong> Oberfläche von Gletschern große Schmelzwassermengen an. In<br />
zahllosen Rinnsalen fließen die Schmelzwässer auf <strong>der</strong> tauenden Gletscheroberfläche dahin, stauen sich bisweilen<br />
zu Seen auf dem Eis, bis sie an Spalten o<strong>der</strong> an schachtförmigen Gletschermühlen rauschend in <strong>der</strong><br />
Tiefe verschwinden. Unter dem Eis sammeln sie sich und strömen in Höhlungen und Tunnelsystemen zwischen<br />
Gletscherbasis und Untergrund dahin. Dabei entstehen subglaziäre Erosionsformen, die in Norddeutschland und<br />
an <strong>der</strong> Ostseeküste bis heute als Tunneltäler, Rinnenseen und Förden sichtbar sind.<br />
An den Eisrän<strong>der</strong>n treten die milchig-trüben Schmelzwässer (Gletschermilch) schließlich in Gletschertoren<br />
zutage. Sie fließen in peripheren Schmelzwasserrinnen so lange am Eisrand entlang, bis es ihnen gelingt, sich<br />
in den terminalen Schmelzwasserrinnen von <strong>der</strong> Gletscherfront zu lösen. Eiszeitliche Schmelzwasserrinnen<br />
fallen heut noch als breite Kastentäler in <strong>der</strong> Landschaft auf, mit brettebenen Talböden und steilen Talhängen.<br />
Bis auf einige, die abschnittsweise immer noch von Flüssen und Bächen verwendet werden, sind sie heute meist<br />
Trockentäler. Beson<strong>der</strong>s breite Täler des peripheren Entwässerungssystems, die am Rande des Nordeuropäischen<br />
Inlandeises entstanden sind, werden in Norddeutschland Urstromtäler genannt. Abschnittsweise werden<br />
diese Urstromtäler noch heute von Flüssen verwendet, etwa von Elbe, O<strong>der</strong>, Spree o<strong>der</strong> Peene.<br />
Am Ende tief ausgeräumter Zungenbecken müssen die unter hydrostatischem Druck stehenden Schmelzwässer<br />
vielfach sogar aufsteigen, bis sie am Gletscherrand wie<strong>der</strong> an die Oberfläche kommen. Wo sich die Wassermassen<br />
über den Endmoränenwall ergießen, setzen sie sogleich einen Teil ihrer Geröllfracht ab. Dadurch entstehen<br />
mit <strong>der</strong> Zeit schräge Schotterrampen am Fuß <strong>der</strong> Endmoränen, die man als Übergangskegel bezeichnet.<br />
Die Schmelzwasserströme, die auf oft kilometerbreiten Talböden abfließen, den San<strong>der</strong>n, sind in unzählige Wasserläufe<br />
aufgespalten, die ständig ihren Lauf verlagern, sich teilen und erneut vereinigen. Diese Zopfströme<br />
lagern im Laufe <strong>der</strong> Zeit dekametermächtige, geschichtete Schmelzwasserkiese ab. Die fast völlig ebenen Oberflächen<br />
eiszeitlicher San<strong>der</strong>kiese sind im Alpenvorland kaum merklich nach Norden hin geneigt. Aufgrund des<br />
geringeren Gefälles haben die Schmelzwasserflüsse in Norddeutschland hingegen vor allem Sande abgelagert.<br />
Das Lechfeld o<strong>der</strong> die Münchner Schotterebene sind auch nichts an<strong>der</strong>es als extrem breite, eiszeitliche San<strong>der</strong>.<br />
Vielfach schneiden sich die Schmelzwasserflüsse in ihre eigenen Ablagerungen ein. Dadurch fallen Teile <strong>der</strong><br />
breiten San<strong>der</strong> trocken. Diese älteren, inaktiven Kiesflächen (Terrassen) sind mit scharfen Erosionskanten (Terrassenkanten)<br />
gegen den weiterhin aktiven San<strong>der</strong> abgesetzt. Eiszeitliche Schmelzwasserkiese und -sande sind<br />
wichtige Rohstoffe und werden in zahlreichen, teilweise sehr großen Kies- und Sandgruben gewonnen.<br />
Beim Rückschmelzen des Eises sammelt sich das Schmelzwasser in Wannen des Untergrundes und bildet kleinere<br />
und größere trübe Schmelzwasserseen, vielfach Eisrandstauseen, die vom Gletschereis selbst abgedämmt<br />
und aufgestaut werden. Ein solcher See war z.B. <strong>der</strong> riesige Baltische Eissee, <strong>der</strong> sich in <strong>der</strong> ausgehenden<br />
Eiszeit vorübergehend im Ostseebecken staute. Am Boden dieser mit Gletschermilch gefüllten Seen<br />
setzen sich die feinsten Schwebstoffe in Form von fein geschichteten, grauen Bän<strong>der</strong>tonen ab (auch Beckentone,<br />
Warventone, Bän<strong>der</strong>schluffe o<strong>der</strong> Beckenschluffe genannt). Auf diesen milchig-trüben Seen schwimmen<br />
oft große Mengen von Eisbergen. Gesteinsfragmente, die aus Eisbergen schmelzen, bleiben in glaziären<br />
Seesedimenten als „dropstones“ erhalten. Eiszeitliche Bän<strong>der</strong>tone waren früher gesuchte keramische Rohstoffe,
50<br />
heute werden sie gelegentlich noch von Ziegeleien verwendet. Über ihnenentwickeln sich in Verebnungsflächen<br />
und Senken gerne Feuchtwiesen und Moore, z.B. das Wurzacher Ried o<strong>der</strong> das Murnauer Moos.<br />
In die Seebecken einmündende Schmelzwasserflüsse bauen Deltas vom Gilbert-Typ in die Seen vor. In diesen<br />
Deltas werden seewärts schräggeschichtete, kiesig-sandige foresets („Übergussschichten“) von horizontal<br />
geschichteten kiesigen topsets („Deckschichten“) überlagert und von gleichfalls horizontal geschichteten schluffig-sandigen<br />
bottomsets unterlagert. Innerhalb dieser bottomsets lassen sich wie<strong>der</strong>um eine tonig-schluffige, fein<br />
laminierte Beckenfazies im Liegenden und eine sandige, oft rippelgeschichtete Prodeltafazies im Hangenden<br />
unterscheiden. In Seebecken, die mit Sedimenten völlig aufgefüllt sind, dünnen die grundwasserleitenden<br />
Deltasedimente beckenwärts aus und werden durch grundwasserstauende Seesedimente ersetzt. Das hat<br />
erhebliche Bedeutung für die Hydrologie heutiger Oberflächengewässer und ihren Grundwasserbegleitstrom.<br />
6.4.3 Erosion und Akkumulation des Windes<br />
Da aktive Moränen und San<strong>der</strong>flächen gewöhnlich keine Vegetation tragen, können die kräftigen, trockenen<br />
Gletscherfallwinde die Oberfläche <strong>der</strong> Ablagerungen austrocknen und den Feinanteil (Sand und Staub) ausblasen.<br />
Das feinkörnige Material wird allerdings nicht weit transportiert, son<strong>der</strong>n in Form von Sand und Staubsand<br />
auf bewachsenen Höhenrücken zwischen den San<strong>der</strong>flächen wie<strong>der</strong> abgelagert. Diese Sand- und Lössablagerungen<br />
zeigen manchmal noch erkennbare Dünen-Formen. Die Corioliskraft sorgt für eine antizyklonische Ablenkung<br />
dieser Fallwinde und führt zu einer bezüglich <strong>der</strong> terminalen Rinnen asymmetrischen Verteilung <strong>der</strong> äolischen<br />
Sedimente. Solche ursprünglich einmal kalkhaltigen, mineralstoffreichen äolischen Ablagerungen sind im<br />
Alpenvorland vor allem nördlich <strong>der</strong> Endmoränen verbreitet, in Norddeutschland im Wesentlichen südlich davon.<br />
Äolische Ablagerungen bestehen in Gebieten mit hohen Nie<strong>der</strong>schlägen fast immer aus kalkfreien Lösslehmen,<br />
die durch Verwitterung aus den Lössen entstanden sind. Sie werden in zahlreichen Lehmgruben als Ziegeleirohstoff<br />
gewonnen. Glaziale Dünensande und Lösse sind meist sehr schlecht geschichtet. Wie man durch Untersuchungen<br />
rezenter Beispiele in <strong>der</strong> Arktis weiß, hängt das u.a. damit zusammen, dass es sich manchmal um<br />
„niveoäolische“ Sedimente handelt, d.h. die Sandkörner sind hier ursprünglich vielfach zusammen mit Schnee<br />
verfrachtet und abgelagert worden. Beim Austauen des Schnees werden primäre Schichtungsgefüge oft zerstört.<br />
Durch das Ausblasen des Sandes reichern sich auf unbewachsenen Fluss-Sedimenten, die ursprünglich zu wesentlichen<br />
Teilen aus Sand bestanden haben, mit <strong>der</strong> Zeit Gerölle an und es entstehen Steinpflaster. Die mit<br />
Sand beladenen Fallwinde erzeugen auf solchen Steinpflastern nicht selten Windschliffe. Die Gerölle werden dadurch<br />
zu Windkantern (Ventifakten) umgeformt, <strong>der</strong>en Schliffflächen typische Rillen (Windkanneluren) zeigen.<br />
Durch Drehung <strong>der</strong> Gerölle können „Mehrkanter“ entstehen. Da Windkanter direkt an <strong>der</strong> Oberflächen entstehen,<br />
die <strong>der</strong> Verwitterung ausgesetzt ist, bleibt nur auf kieseligen Geröllen <strong>der</strong> Windschliff langfristig erkennbar.<br />
6.5 Literaturauswahl zu den quartärgeologischen <strong>Grundlagen</strong><br />
CATT, J.A. & EHLERS, J. (1992): Angewandte Quartärgeologie.– 357 S.; Stuttgart (Enke).<br />
EHLERS, J. (1994): Allgemeine und historische Quartärgeologie.– 357 S.; Stuttgart (Enke).<br />
HUSEN, D. van (1984): Die Ostalpen und ihr Vorland zur letzten Eiszeit (Würm) 1:500000.– Beil. In: HUSEN, D. van (1984): Die Ostalpen<br />
in den Eiszeiten; Wien (Geol. B.-A.).<br />
JÄCKLI, H. (1970): Die Schweiz zur letzten Eiszeit.– In: Atlas <strong>der</strong> Schweiz, Bl. 6, 1 Kt. 1:500000.; Wabern-Bern (Eidgen. Landestopogr.).<br />
JERZ, H. (1984): Das Eiszeitalter in Bayern.– In: Geologoie von Bayern, Bd. 2, 243 S. Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
KAHLKE, H.D. (1981): Das Eiszeitalter.– 192 S.; Köln (Aulis-Verl.).<br />
LIEDKE, H. [Hrsg.] (1990): Eiszeitforschung.– 354 S.; Darmstadt (Wissenschaftl. Buchgemeinschaft).<br />
MAHANEY, W.C. [Hrsg.] (1984): Quatenary Dating Methods.– Amsterdam, Oxford, New York (Elsevier-Publ.).<br />
PENCK, A. & BRÜCKNER, E. (1901-1909): Die Alpen im Eiszeitalter.– Bde. 1-3, 1199 S.; Leipzig (Tauchnitz-Verl.).<br />
SCHREINER, A. (1992): Einführung in die Quartär-<strong>Geologie</strong>.– 257 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).
51<br />
7. HYDROGEOLOGISCHE GRUNDLAGEN<br />
Als Grundwasser (abgekürzt Gw) wird Wasser bezeichnet, das die kleinen und großen Hohlräume (Gesteinsporen,<br />
Klüfte, Höhlen) <strong>der</strong> porösen Gesteine des Untergrundes zusammenhängend erfüllt. Grundwasser entsteht<br />
durch das Einsickern eines Teiles des Nie<strong>der</strong>schlagswassers in den Untergrund, also des Wassers, das Regen<br />
und geschmolzener Schnee bringen. Ins Grundwasser gelangt jedoch nur ein gewisser Prozentsatz des Nie<strong>der</strong>schlagswassers,<br />
denn ein an<strong>der</strong>er Teil verdunstet o<strong>der</strong> fließt oberflächlich bzw. oberflächennah ab. Die Grundwasserneubildung<br />
ist daher in erster Linie von <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schläge und von <strong>der</strong> Durchlässigkeit des Bodens<br />
und <strong>der</strong> Gesteine abhängig).<br />
In einer städtischen Siedlung, wo fast die ganze Oberfläche durch wasserundurchlässigen Beton o<strong>der</strong> Asphalt<br />
versiegelt ist, fließt <strong>der</strong> größte Teil des Nie<strong>der</strong>schlagswassers oberflächlich ab und das Grundwasser wird kaum<br />
erneuert. Ähnlich ist es auch in Gebieten, wo <strong>der</strong> Untergrund aus weitgehend impermeablen Gesteinen besteht,<br />
z.B. aus Graniten und Gneisen, wie im Bayerischen Wald o<strong>der</strong> in Schweden. Hier findet kaum eine Gw-Neubildung<br />
statt, ja es gibt hier vielfach überhaupt kein richtiges Grundwasser! In Gegenden, wo <strong>der</strong> Untergrund dagegen<br />
aus porösen o<strong>der</strong> klüftigen Gesteinen aufgebaut wird, z.B. aus wasserdurchlässigen Kiesen, kann fast das<br />
ganze Regenwasser im Untergrund versickern und die Grundwasservorräte rasch auffüllen. Aus porösen Kiesen<br />
aber bestehen große Teile des Alpenvorlandes, etwa die Umgebung von Memmingen, Marktoberdorf, Schongau<br />
o<strong>der</strong> die Münchner Schotterebene.<br />
7.1 Rund ums Grundwasser<br />
In wasserdurchlässigen Kiesen füllt das Grundwasser (Gw) die Lücken zwischen den Sandkörnern und Geröllen<br />
aus, ähnlich wie das Wasser im Blumentopf einer Hydrokultur die Zwickel zwischen den einzelnen Keramikkugeln.<br />
Nimmt man z.B. einen Würfel mit einem Volumen von 1 m³ und füllt diesen mit Kies komplett bis oben auf,<br />
dann kann man je nach Kieszusammensetzung etwa 150 bis 300 l Wasser in diesen Kieswürfel füllen, bevor es<br />
oben herausläuft. Der Kieskörper ist in diesem Falle <strong>der</strong> Grundwasserleiter o<strong>der</strong> Aquifer. Er bildet das poröse<br />
Gerüst, durch das das Gw fließt bzw. hindurchgeleitet wird. Der mit Gw gefüllte Teil zwischen den Kieskörnern<br />
wird als Grundwasserkörper bezeichnet. Kieskörper sind nicht unendlich groß, werden gewöhnlich einige Meter<br />
bis maximal einige Dekameter dick und sind auch nach <strong>der</strong> Seite hin nach einigen hun<strong>der</strong>t Metern o<strong>der</strong> Kilometern<br />
irgendwo zu Ende.<br />
Gw-Leiter werden normalerweise nicht komplett vom Grundwasser ausgefüllt. Der Grundwasserkörper wird von<br />
einer oft sehr unebenen Grundwassersohle und einer Grundwasseroberfläche begrenzt. Die Sohle bildet meist<br />
eine weitgehend wasserundurchlässige als Grundwasserstauer bezeichnete Schicht. Nach <strong>der</strong> Seite hin hört <strong>der</strong><br />
Gw-Körper dort auf, wo auch <strong>der</strong> Aquifer seine Grenzen hat.<br />
Kiese, genauso wie Sande, poröse Konglomerate, unverkarstete Korallenkalke, Sandsteine, Brekzien etc. gehören<br />
zu den sog. Porengrundwasserleitern, die wassergefüllte Porenräume besitzen. Davon werden Kluftgrundwasserleiter<br />
unterschieden, zu denen fast alle nicht porösen Festgesteine zählen, die wassergefüllte,<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger geöffnete Klüfte besitzen. Die ursprünglich tektonisch angelegten Klüfte öffnen sich unter dem<br />
Einfluss <strong>der</strong> Schwerkraft vor allem dort, wo diese Gesteine Hügel o<strong>der</strong> Berge bilden. Als Karstgrundwasserleiter<br />
werden lösliche Festgesteine mit wassergefüllten Karstspalten und Höhlen bezeichnet, z.B. Kalksteine, Dolomit<br />
o<strong>der</strong> Gips. Grundwasserhemmer (Aquitarde) o<strong>der</strong> Grundwasserstauer (Aquiclude) hingegen sind kaum<br />
wasserdurchlässige Fest- und Lockergesteine, wie kluftarme Tiefengesteine o<strong>der</strong> Metamorphite (z.B. Granite,<br />
Gabbros, Gneise), feinkörnige und porenarme Sedimente und Sedimentgesteine (z.B. Tone, Mergel,<br />
Tonschluffsteine, porenfreie Sandsteine etc.). Absolut wasserundurchlässige Gesteine gibt es nicht.<br />
Gw-Körper, die in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> Erdoberfläche liegen, füllen meist nur den tieferen Teil des Gw-Leiters aus. Der<br />
Bereich innerhalb des Gw-Körpers, in dem alle Poren wassergefüllt sind, wird als gesättigte Zone bezeichnet.<br />
Darüber folgt ein Kapillarsaum, in dem ein Teil <strong>der</strong> Poren mit Kapillarwasser, ein an<strong>der</strong>er Teil mit Luft gefüllt ist.<br />
Über dem Kapillarsaum sind die Poren des Gw-Leiters im Wesentlichen luftgefüllt. Langfristig hält sich hier nur<br />
etwas Haftwasser in den engsten Teilen <strong>der</strong> Poren. Nur bei Nie<strong>der</strong>schlägen werden die Poren kurzfristig vom<br />
einsickernden und <strong>der</strong> Gravitation folgenden Nie<strong>der</strong>schlagswasser durchströmt. Zusammen mit dem Kapillarsaum
52<br />
wird dieser Bereich als ungesättigte Zone bezeichnet. Der meist ebenflächige Grundwasserspiegel, <strong>der</strong> sich in<br />
Brunnen und Grundwassermessstellen („Pegeln“) beobachtbar einstellt, korrespondiert mit einem Niveau im<br />
Gw-Leiter, das zwischen gesättigter Zone und Kapillarsaum liegt. Es ist also eine theoretische Grenzfläche, die<br />
durch die beobachtbaren Grundwasserstände an Gw-Messstellen o<strong>der</strong> in Brunnen beschrieben werden kann.<br />
Der Gw-Spiegel steigt und fällt mit dem Nachschub an Gw und gibt daher vor allem den Gang <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schläge<br />
wie<strong>der</strong>, wenn auch mehr o<strong>der</strong> weniger verzögert und gedämpft. Die Menge des einsickernden Nie<strong>der</strong>schlages<br />
wird als Grundwasserneubildungsrate bezeichnet. Sie hängt sehr stark von <strong>der</strong> Durchlässigkeit des<br />
Untergrundes sowie vom Gelän<strong>der</strong>elief und vom Bewuchs ab. Die mittleren Gw-Neubildungsraten variieren<br />
deshalb relativ stark und liegen in Südbayern in einer Größenordnung von ca. 5 l/s x km² bis 30 l/s x km². Entlang<br />
von Flussläufen kann das Gw zudem durch versickerndes Flusswasser angereichert werden. Dies ist vor allem<br />
bei Wildbächen und Flüssen am Alpenrand gegeben, da sie meist eine relativ durchlässige Sohle aus Kies, Sand<br />
und Geröll aufweisen. Gw-Spiegel können um Meterbeträge, in einigen Fällen auch um mehr als einen Dekameter<br />
steigen und fallen.<br />
7.2 Grundwasser bewegt sich<br />
Wird <strong>der</strong> Gw-Leiter vom Grundwasser (Gw) vollständig ausgefüllt und von grundwasserstauenden Gesteinen<br />
überlagert, kann es unter Druck stehen. Der Gw-Spiegel eines <strong>der</strong>artigen gespannten Grundwassers heißt<br />
Druckspiegel und stellt sich erst nach Anbohren des Gw-Leiters durch Aufstieg des Wassers im Bohrloch ein.<br />
Steigt <strong>der</strong> Druckspiegel bis über das Geländeniveau an, spricht man von artesisch gespanntem Grundwasser.<br />
In diesem Fall läuft das Gw frei aus dem Bohrloch oben heraus, teilweise in Form eines regelrechten natürlichen<br />
Springbrunnens. Liegen mehrere durchlässige und stauende Schichten übereinan<strong>der</strong> (z.B. Wechsel von Kiesund<br />
Tonhorizonten), so bilden sich oft mehrere Grundwasserstockwerke aus. Gw-Leiter mit gespanntem Gw<br />
bilden oft zweite o<strong>der</strong> noch tiefere Gw-Stockwerke, die in Wechselwirkung mit über- o<strong>der</strong> unterlagernden Gw-<br />
Stockwerken stehen. Maßgeblich für den Wasseraustausch sind hierbei die Druckdifferenzen zwischen den einzelnen<br />
Gw-Stockwerken sowie die Durchlässigkeiten <strong>der</strong> trennenden Schichten (z.B. Tone o<strong>der</strong> Mergel). Meist<br />
erfolgen die Austauschvorgänge entlang von Klüften, wo die trennenden Schichten aufgelockert und damit etwas<br />
durchlässiger sind sowie dort, wo die trennenden Stauer seitlich auskeilen o<strong>der</strong> Lücken aufweisen. Das Gw kann<br />
sich innerhalb des Gw-Leiters langsam bewegen. Die Strömungsgeschwindigkeit hängt einerseits vom Druckgefälle<br />
ab, dem sog. hydraulischen Gradienten, an<strong>der</strong>erseits von <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Poren bzw. <strong>der</strong>en Verbindungen<br />
untereinan<strong>der</strong>. Da die Porengröße bei den aus Körnern aufgebauten klastischen Lockergesteinen, also z.B.<br />
bei Kies und Sand, vor allem von <strong>der</strong> Korngröße bestimmt wird, können Körnung und Kornverteilung als ein Maß<br />
für ihre Durchlässigkeit verwendet werden. Die Durchlässigkeit von Gesteinen wird gewöhnlich in Form vom k f -<br />
Wert angegeben, dem Durchlässigkeitsbeiwert. Er beschreibt den Wi<strong>der</strong>stand, den das Wasser beim Durchströmen<br />
des Gesteins überwinden muss. Je kleiner <strong>der</strong> k f -Wert, desto undurchlässiger ist das Gestein. Die Durchlässigkeit<br />
steigt natürlich mit <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Poren an, und diese hängt bei den aus Körnern aufgebauten Lockergesteinen<br />
wie<strong>der</strong>um vor allem von <strong>der</strong> Körnung <strong>der</strong> Sedimente ab: Je kleiner die Körner, aus denen ein Sediment<br />
aufgebaut ist, desto kleiner sind die Lücken zwischen den Körnern und desto kleiner ist die Durchströmungsgeschwindigkeit.<br />
Reine Kiese weisen k f -Werte zwischen 10 -1 und 10 -3 m/s auf, reine Sande zwischen 10 -3 und 10 -5<br />
m/s, reine Schluffe zwischen 10 -5 und 10 -9 m/s, reine Tone zwischen 10 -9 und weniger als 10 -13 m/s.<br />
Ein Sediment aus Körnern . . .<br />
mit einem Ø kleiner als 0,002 mm, ist ein Ton<br />
mit 0,002 bis 0,06 mm Ø, ist ein Schluff (Silt)<br />
mit 0,06 bis 2 mm Ø, ist ein Sand<br />
mit 2 bis 63 mm Ø, ist ein Kies<br />
mit einem Ø größer als 63 mm, ist Blockwerk<br />
Durchlässigkeitsbeiwerte:<br />
k f -Werte von reinemTon: 10 -9 bis 10 -1 m/s<br />
Gleichkörnige Lockergesteine sind am durchlässigsten, gemischtkörnige, also Lockergesteine, die z.B. aus einer<br />
Mischung von Sand und Kies bestehen, entsprechend weniger durchlässig als ein reiner Kies. Die Durchlässigkeit<br />
wird aber nicht nur durch die Korngrößenverteilung von körnigen Ablagerungen bestimmt, son<strong>der</strong>n auch durch<br />
ihre Verfestigung. Mineralische Ausfällungen, die für die Verfestigung vieler Sedimente verantwortlich sind, meist<br />
Calcit, verkleinern o<strong>der</strong> verstopfen mit <strong>der</strong> Zeit die Gesteinsporen. Diesen Vorgang nennt man Zementation.
53<br />
Folglich sind feste, gut zementierte Sandsteine o<strong>der</strong> feste Konglomerate gewöhnlich deutlich weniger durchlässig<br />
als lockerer Sand o<strong>der</strong> lockerer Kies. Obwohl die tertiären Molassekonglomerate <strong>der</strong> Immenstädter Nagelfluhberge<br />
ursprünglich lockere und wasserdurchlässige Kiese waren, sind sie heute durch Zementation <strong>der</strong><br />
Gesteinsporen keine Porengrundwasserleiter mehr und weitgehend impermeabel (wasserundurchlässig). Bei den<br />
quartären Konglomeraten, die viele Höhenrücken im Unterallgäu aufbauen, ist die Zementation noch nicht so weit<br />
fortgeschritten. Diese Gesteine sind trotz ihrer Festigkeit noch immer porenreich und in hohem Maße wasserdurchlässig.<br />
Vergleicht man die Grundwasserstände verschiedener Gw-Messstellen innerhalb eines Gw-Leiters, stellt man<br />
im Allgemeinen unterschiedliche Höhen fest, selbst wenn sie zum gleichen Zeitpunkt gemessen wurden (Stichtagsmessungen).<br />
Hieraus lässt sich das Gefälle <strong>der</strong> Gw-Oberfläche ermitteln und auf Grundwasserkarten in<br />
Form von sog. Grundwassergleichen darstellen, Linien gleicher Gw-Stände, die in m über NN angegeben werden.<br />
Die Strömungsrichtung des Gws folgt immer dem Gefälle <strong>der</strong> Gw-Oberfläche, dem hydraulischen Gradienten,<br />
und ist senkrecht zu den Gw-Gleichen orientiert. Oft hat man nicht genügend Gw-Messstellen, um die<br />
Fließrichtung des Gws ermitteln zu können. Die mutmaßliche Strömungsrichtung des Gws lässt sich aber auch<br />
aus dem Gefälle <strong>der</strong> Gw-Sohle ableiten, vor allem dort, wo die Basis eines Gw-Leiters durch Erosion angeschnitten<br />
und bloßgelegt o<strong>der</strong> „exponiert“ ist.<br />
Grundsätzlich bewegt sich das Gw immer auf die Stelle mit dem niedrigsten hydraulischen Gradienten zu, z.B. auf<br />
einen Flusslauf, einen Entwässerungsgraben o<strong>der</strong> einen See, was man als Vorfluter bezeichnet. Gegebenenfalls<br />
tritt das Gw aber auch vor dem Erreichen des Vorfluters an Quellen zu Tage.<br />
7.3 Karst<br />
Die weit verbreitete Vorstellung, die das Grundwasser (Gw) generell als unterirdische Seen in großen Hohlräumen<br />
o<strong>der</strong> „Wassera<strong>der</strong>n“ begreifen will, ist in den allermeisten Fällen falsch und trifft nur in Karstgebieten<br />
einigermaßen zu. Hier schaffen mächtige verkarstungsfähige Festgesteine wie Kalksteine, Dolomite, Gips u.a.<br />
beson<strong>der</strong>e Gegebenheiten. Durch Lösung werden vorgegebene Trennflächen (Klüfte, Schichtfugen) zu Karstspalten<br />
und Karsthöhlen erweitert und bilden ein kompliziertes Netz von Röhren, Spalten und Höhlen im<br />
Gestein. Die Wasserstände in diesem Netz kommunizieren<strong>der</strong> und teilweise mit Wasser gefüllter Röhren können<br />
zum Karstgrundwasserspiegel verbunden werden.<br />
Hinweise auf einen verkarsteten Untergrund sind Lösungserscheinungen an <strong>der</strong> Erdoberfläche, z.B. parallele<br />
Rinnen, die das abfließende Regenwasser auf Gesteinsoberflächen hinterlässt; sie werden als Rinnenkarren<br />
bezeichnet. Auch Schicht- o<strong>der</strong> Kluftflächen werden durch Lösung zu Schichtkarren und Kluftkarren erweitert.<br />
An <strong>der</strong> Erdoberfläche entstehen Dolinen, dekametergroße, trichterförmige Sackungsstrukturen, die sich u.a. beim<br />
Einsturz von Karsthöhlen im Untergrund bilden. Am Boden mancher Dolinen gibt es offene Löcher o<strong>der</strong> Ponore.<br />
Dolinen dienen generell als Schlucklöcher, über die das Nie<strong>der</strong>schlagswasser rasch in den Untergrund eindringen<br />
kann, gleichgültig ob man die Ponore sehen kann o<strong>der</strong> nicht. In Gebieten mit verkarstungsfähigen Gesteinen<br />
wird dadurch im Laufe von Jahrhun<strong>der</strong>ttausenden die oberirdische allmählich durch eine unterirdische Entwässerung<br />
ersetzt. An schüttungsstarken Karstquellen tritt das Karstwasser, das sich entlang von Spalten und Höhlen<br />
in Form unterirdischer Wasserläufe auf den Vorfluter zubewegt, wie<strong>der</strong> an die Erdoberfläche. Viele Karstquellen<br />
können in feuchten Perioden große Wassermengen schütten, bei Trockenheit aber genauso schnell wie<strong>der</strong><br />
versiegen. Ponore, die zeitweise als Karstquellen, manchmal auch als Schlucklöcher dienen, werden als<br />
Estavellen bezeichnet.<br />
Das Wasser durchströmt einen Karstgrundwasserleiter u.U. genauso schnell, wie es an <strong>der</strong> Erdoberfläche in<br />
einem Bach fließt. Wegen <strong>der</strong> extrem kurzen Verweildauer im Untergrund, des Fehlens jeglicher Filterwirkung des<br />
Aquifers und des häufigen Mangels an filternden Deckschichten sind oberflächennahe Karstwässer oft nur stark<br />
eingeschränkt als Trinkwasser nutzbar. Verschmutztes o<strong>der</strong> mit Bakterien belastetes Wasser, das nach einem<br />
Regenguss auf den Almwiesen eines Karstgebietes versickert, kommt nach wenigen Stunden o<strong>der</strong> Tagen<br />
genauso trüb und bakteriell belastet in einer Karstquelle wie<strong>der</strong> ans Tageslicht.<br />
Mit dem Einschneiden <strong>der</strong> Flussläufe, die in einem Karstgebiet als Vorfluter dienen, wird mit <strong>der</strong> Zeit auch <strong>der</strong><br />
Karst tiefer gelegt. Dadurch verlieren Höhlen, die ursprünglich von Wässern aktiv geformt worden sind, mit <strong>der</strong><br />
Zeit ihre Funktion als Drainagesysteme und fallen trocken, während sich im Untergrund neue aktive Höhlen bilden.<br />
Die von Höhlenforschern (Speläologen) begangenen Höhlen sind meistens inaktive Höhlensysteme. Ihre<br />
Verkarstung ist teilweise überraschend alt. In <strong>der</strong> Alb begann die Verkarstung schon im Alttertiär, stellenweise
54<br />
sogar schon in <strong>der</strong> Oberkreide, ist also teilweise schon älter als 50 Millionen Jahre, geht aber natürlich bis heute<br />
weiter. Auch die Höhlensysteme <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen stammen nicht überall aus dem Quartär, die Verkarstung<br />
ist auch hier oft schon hun<strong>der</strong>ttausende o<strong>der</strong> gar viele Millionen Jahre alt. Der Verkarstung entgegengerichtet<br />
ist die anorganische Kalk-Ausfällung von Höhlensinter und Tropfsteinen (Speläothemen) in den nicht<br />
mehr aktiven Höhlensystemen, die im Laufe <strong>der</strong> Zeit zu einer deutlichen Verengung o<strong>der</strong> gar zum völligen Verschluss<br />
<strong>der</strong> alten Abflussröhren führen kann. Man hat gerade erst begonnen, diese Speläotheme als Klimaarchive<br />
zu nutzen. Die Ausfällung von Höhlensinter geht im Dunkeln vor sich, im Gegensatz zur Bildung von Kalktuffen,<br />
die damit nichts zu tun hat. Meist an o<strong>der</strong> unterhalb von kalkreichen Quellen wird die Kalktuffbildung größtenteils<br />
von Organismen bewerkstelligt, die vom Sonnnenlicht abhängig sind.<br />
Grundsätzlich können alle Dolomit- und Kalksteine verkarsten, die wir in den Alpen finden. Intensiv verkarstet sind<br />
vor allem die mächtigen, massigen und schlecht gebankten Dolomit- und Kalksteine, wie Hauptdolomit, Wettersteinkalk,<br />
Oberrhätkalk, Schrattenkalk und Nummulitenkalk. Zögerlich o<strong>der</strong> gar nicht verkarsten Kalksteine, die<br />
dünne tonige Zwischenlagen besitzen, wie die Aptychenschichten o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Seewerkalk. Großartige Karstlandschaften<br />
finden sich z.B. im Gottesacker-Gebiet (Schrattenkalk) o<strong>der</strong> am Steinernen Meer (Dachsteinkalk). Verkarstet<br />
sind aber auch manche massigen und mächtigen Konglomerate und Brekzien, wie sie in Ablagerungen<br />
<strong>der</strong> kalkalpinen Kreide und in <strong>der</strong> Faltenmolasse vorkommen. Diese klastischen Gesteine enthalten stellenweise<br />
so viele lösliche Kalk- und Dolomitkomponenten sowie ein karbonatisches Bindemittel, dass sie verkarsten können<br />
wie ein gewöhnlicher Kalkstein.<br />
7.4 Beschaffenheit des Grundwassers<br />
Es gibt natürlich enge Wechselwirkungen zwischen <strong>der</strong> Grundwasserbeschaffenheit (Hydrogeochemie) und <strong>der</strong><br />
chemischen Beschaffenheit des Gw-Leiters. Die gelösten Stoffe im Grundwasser (Gw) stammen zum größten<br />
Teil aus dem Gw-Leiter o<strong>der</strong> Aquifer (MATTHESS 1990). Aus karbonatreichen Aquiferen (verkarsteten Kalksteinen<br />
und Dolomiten, Kiesen mit vielen Karbonatgeröllen etc.) kann nur hartes, karbonatreiches Wasser gewonnen<br />
werden. Der hohe Karbonatgehalt des Wassers ist oft schon an kalkigen Absätzen in Quellen (Kalktuff) o<strong>der</strong> an<br />
den Kalkkrusten im heimischen Wasserkocher (Kesselstein) erkennbar. Grundwässer aus klüftigen<br />
Kristallingesteinen o<strong>der</strong> karbonatfreien Quarzkiesen sind dagegen vielfach weich und sauer. Wässer, die Kontakt<br />
mit sulfathaltigen Gesteinen (Gips) haben, sind wie<strong>der</strong>um hart, reich an gelöstem Sulfat und enthalten manchmal<br />
auch Salze, da Gips nicht selten zusammen mit Steinsalz auftritt. Im Gegensatz zu hohen Karbonat-Gehalten, die<br />
bei <strong>der</strong> Nutzung als Trinkwasser toleriert werden, gelten für Sulfat- und Chlorid-Gehalte enge Grenzwerte; bei<br />
Sulfat liegt er bei 240 mg/l. Wenn sie überschritten werden, gilt das Wasser als Trinkwasser für ungeeignet. Durch<br />
das Salzen <strong>der</strong> winterlichen Straßen weisen inzwischen auch viele eigentlich nicht mineralisierte oberflächennahe<br />
Grundwässer messbare NaCl-Gehalte auf.<br />
Die süddeutschen Gw-Vorkommen, in den Nordalpen genauso wie im Alpenvorland, weisen meist eine hohe<br />
Karbonathärte auf. Die Gesteine, die die Nördlichen Kalkalpen, das Helvetikum o<strong>der</strong> die Molasse aufbauen, sind<br />
zum größten Teil Kalke, Dolomite und karbonatreiche Sandsteine, Konglomerate und Tone (Mergel). Die Wässer,<br />
die mit diesen Gesteinen in Karsthöhlen o<strong>der</strong> offenen Klüften Kontakt haben, sind folglich immer reich an gelöstem<br />
Karbonat. Die Gw-Vorkommen in den quartären Ablagerungen des Alpenvorlandes befinden sich meist in<br />
Kiesen, die immer sehr viele Kalk- o<strong>der</strong> Dolomitgerölle enthalten und vielfach zu mehr als 80 % aus Karbonat<br />
bestehen. So sind auch die Wässer aus eiszeitlichen Ablagerungen gewöhnlich sehr hart. Der Kalkreichtum dieser<br />
Grundwässer in eiszeitlichen Schottern wird auch dadurch deutlich, dass viele Quellen kalkige Quelltuffe<br />
abscheiden.<br />
Sulfathaltige Wässer treten vor allem innerhalb <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen auf und zwar hauptsächlich an den<br />
Stellen, wo gipsführende Gesteine <strong>der</strong> Raibler Schichten an die Erdoberfläche kommen (z.B. Notburgaquelle im<br />
Faulenbacher Tal). Wasser, das u.a. Kochsalz gelöst hat, tritt in einigen Quellen in <strong>der</strong> Molasse an die Erdoberfläche.<br />
Dieses als Sole bezeichnete salzhaltige Wasser stammt aus den Poren von Molassegesteinen, die vor<br />
vielen Jahmillionen im Meer abgelagert worden sind. Reste des Natriumchlorid-haltigen Meerwassers haben sich<br />
bis heute in den Lücken zwischen Körnern von Sandsteinen <strong>der</strong> Unteren und Oberen Meeresmolasse erhalten.<br />
Schwach salzhaltige Quellwässer sind z.B. am Nordhang des Sulzberges bei Seeg vor allem wegen ihres Jodgehaltes<br />
für Kurzwecke genutzt worden.
55<br />
7.5 Gefährdung des Grundwassers<br />
Die Einzugsgebiete <strong>der</strong> oberirdischen Gewässer können, aber müssen keinesfalls mit den Einzugsgebieten des<br />
Gws übereinstimmen. So muss die Strömungsrichtung des Grundwassers (Gw) in einem Gw-Leiter konkret<br />
ermittelt werden, um z.B. Trinkwasserschutzgebiete sinnvoll ausweisen zu können. Das Gw ist durch den Eintrag<br />
anthropogener Schadstoffe gefährdet, die vor allem von <strong>der</strong> Landwirtschaft (Dünge- und Pflanzenschutzmittel),<br />
dem Straßenverkehr (Salz, Öl, Treibstoffe und gefährliche Transportgüter), <strong>der</strong> Industrie, den Deponien<br />
und belasteten Oberflächenwässern ausgehen. Beson<strong>der</strong>s gefährdet sind gerade die ergiebigen Gw-Vorkommen<br />
mit hohen Gw-Neubildungsraten. Demgegenüber erscheinen die tieferen Gw-Stockwerke ideal nutzbare Gw-<br />
Vorkommen zu enthalten, vielfach gut geschützt unter mächtigen Gw-Überdeckungen mit hohem Schadstoffrückhaltevermögen.<br />
Diese „geologische Barriere“ behin<strong>der</strong>t aber auch die Gw-Neubildung, so dass sich <strong>der</strong>artige<br />
Gw-Vorkommen nur ganz langsam regenerieren. Sie enthalten daher sehr oft recht altes Gw, teilweise gar<br />
fossiles Grundwasser aus <strong>der</strong> Eiszeit. Jede Nutzung dieser Gw-Vorkommen verän<strong>der</strong>t die geohydraulischen<br />
Verhältnisse gravierend und kann so auch die Qualität dieser begrenzten Reserven gefährden (MATTHESS &<br />
UBELL 1983).<br />
7.6 Aufsuchung und Schutz von Grundwasservorkommen<br />
Normalerweise macht man sich keine großen Gedanken über das Trinkwasser, we<strong>der</strong> wo es herkommt, noch wie<br />
es geschützt wird. Bedenkt man aber, dass unser Trinkwasser sehr hohen Qualitätsansprüchen genügen muss,<br />
Grundwasser (Gw) sehr ungleichmäßig verteilt ist und manche Gebiete in Europa nahezu grundwasserfrei sind,<br />
viele Gw-Vorkommen durch menschliche Einflüsse bereits mit Schadstoffen belastet sind, viele Flächen durch<br />
Siedlungen, Straßen, alte Deponien o<strong>der</strong> sonstige Nutzungen für eine Gw-Erschließung nicht mehr zur Verfügung<br />
stehen und zudem die Ausweisung von Wasserschutzgebieten auf immer größere Wi<strong>der</strong>stände bei den<br />
betroffenen Grundstückseigentümern stößt, dann wird eines klar: Die Suche, die Erschließung und <strong>der</strong> Schutz<br />
von Trinkwasservorkommen ist eine komplizierte Aufgabe, bei <strong>der</strong> sehr viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigt<br />
werden müssen und bei <strong>der</strong> neben einer gehörigen Portion Erfahrung heute auch mo<strong>der</strong>nste Techniken<br />
zum Einsatz kommen.<br />
In Südbayern dominiert die dezentrale Wasserversorgung mit zahlreichen kleinen und mittleren Wassergewinnungsanlagen,<br />
<strong>der</strong>en För<strong>der</strong>mengen zumeist im Bereich zwischen ca. 50 bis 5000 m³ pro Tag liegen. Große<br />
Fernwasserversorgungen, die mehrere zehntausend m³ pro Tag liefern, sind hier eher selten zu finden. Die meisten<br />
Städte, Gemeinden o<strong>der</strong> Streusiedlungen haben eigene Wasserversorgungen, die bereits seit vielen Jahrzehnten<br />
bestehen und bei denen das Trinkwasser vorwiegend aus Brunnen o<strong>der</strong> Quellen stammt. Vereinzelt<br />
haben sich aber auch Zweckverbände gegründet, bei denen mehrere Ortschaften eine gemeinsame Wasserversorgung<br />
betreiben. Eine eigene Wasserversorgung gehört zum Selbstverständnis <strong>der</strong> meisten Gemeinden; sie ist<br />
in <strong>der</strong> Regel historisch gewachsen und bedeutet ein Stück Unabhängigkeit, auch wenn die Anfor<strong>der</strong>ungen an die<br />
Qualität und den Schutz des Trinkwassers immer höher werden und so manchem Wasserversorger deshalb in<br />
letzter Zeit etwas Kopfzerbrechen bereiten. Manchmal entspricht die Qualität <strong>der</strong> vorhandenen Wasserversorgung<br />
nicht mehr den heutigen Anfor<strong>der</strong>ungen, sei es durch Belastungen des Gws mit Schadstoffen o<strong>der</strong> durch<br />
bautechnische Mängel bei veralteten Quellfassungen und Brunnen. Manchmal ist aber auch ein bisher genutztes<br />
Gw-Vorkommen wegen <strong>der</strong> vorhandenen Gefährdungspotentiale im Einzugsgebiet (z.B. geringe Gw-Überdeckung,<br />
Straßen, Altlasten) o<strong>der</strong> wegen konkurrieren<strong>der</strong> Nutzungen (z.B. Bebauung, Kiesabbau, Landwirtschaft)<br />
nur schwer schützbar. Dann ist die Ausweisung eines wirksamen Wasserschutzgebietes oft nicht möglich.<br />
Zuweilen ist <strong>der</strong> Wasserverbrauch <strong>der</strong> Gemeinden durch die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete<br />
soweit gestiegen, dass eine Ergänzung <strong>der</strong> bestehenden Wassergewinnungsanlage durch einen neuen Brunnen<br />
o<strong>der</strong> eine neue Quellfassung notwendig wird. Auch wenn in einigen Fällen ein Anschluss an die Nachbargemeinde<br />
prinzipiell möglich wäre, so versuchen doch die meisten Gemeinden ihre Selbständigkeit in punkto Wasserversorgung<br />
zu erhalten. Deshalb ist es auch heute noch notwendig, neue Gw-Vorkommen zu erkunden, die für<br />
eine Trinkwassererschließung in Betracht kommt.<br />
Die großen Gw-Vorkommen Südbayerns sind weitgehend bekannt und werden seit Jahrzehnten durch teilweise<br />
ergiebige Brunnenanlagen genutzt. Es handelt sich um ganz unterschiedliche Typen von Gw-Vorkommen, die im<br />
Abschnitt über die Gw-Landschaften Bayerns ausführlich dargestellt werden (9.9). Die ergiebigsten befinden sich
56<br />
fast immer in den breiten Tälern <strong>der</strong> Alpenflüsse wie Iller, Wertach, Lech, Loisach, Isar und Inn, die zumeist mit<br />
gut durchlässigen Kiesen gefüllt sind, Schmelzwasserschottern aus <strong>der</strong> letzten Eiszeit. Auch auf den bewaldeten,<br />
die Flußtäler randlich begleitenden Höhenrücken gibt es grundwasserführende, poröse Schotter und Nagelfluh-<br />
Platten – Schmelzwasserkiese, die meist aus älteren Eiszeiten stammen. Wenn sie durchlässige Kiese enthalten,<br />
kann man Trinkwasser gelegentlich auch aus den eiszeitlichen Moränen gewinnen, die direkt an den Rän<strong>der</strong>n<br />
eiszeitlicher Gletscher entstanden. Gelegentlich nutzt man auch Gw, das in durchlässigen Sanden und Kiesen <strong>der</strong><br />
Molasse gespeichert ist (Tiefengrundwässer). Nur zögernd greift man auch auf Karstwässer zurück, die in<br />
Jurakalken unter dem Molassebecken gespeichert sind, und die in Tiefen von mehreren hun<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> gar mehreren<br />
tausend Metern unter dem Alpenvorland erbohrt werden können (übertiefe Grundwässer). Das sind in aller<br />
Kürze die typischen „Gw-Landschaften“ des Alpenvorlandes.<br />
7.6.1 Hydrogeologische Untersuchungen<br />
Wie aber schaut eigentlich die konkrete Suche nach Grundwasser (Gw) aus? Wie geht man vor, wenn für ein<br />
Wasserwerk o<strong>der</strong> eine Gemeinde ein neues Gw-Vorkommen gefunden werden soll und wer erledigt diese Arbeit,<br />
wenn man den Künsten eines Wünschelrutengängers nicht vertrauen will? Die nachfolgenden Ausführungen<br />
stellen einige Methoden zur Gw-Erkundung vor, die je nach Untersuchungsgebiet und geologischen Verhältnissen<br />
zur Anwendung kommen und z.T. auch aufeinan<strong>der</strong> aufbauen.<br />
Die hydrogeologischen Untersuchungen sollten mit einer gründlichen Datenrecherche beginnen. Die meisten<br />
Gw-Erkundungen werden heute von hydrogeologischen Büros durchgeführt, die über gute Kenntnisse <strong>der</strong> lokalen<br />
geologischen Verhältnisse verfügen müssen, im Falle Südbayerns also am besten nicht in England o<strong>der</strong> im<br />
Rheinland ansässig sein sollten. Wenn nun ein Wasserversorger an ein solches Büro herantritt um zusätzliches<br />
Gw zu erschließen, ist <strong>der</strong> erste Schritt zumeist eine sorgfältige Datenrecherche zur bestehenden und zur<br />
zukünftig geplanten Wasserversorgung. Zu den notwendigen Daten zählen vor allem Angaben zum Versorgungsgebiet<br />
(Anzahl <strong>der</strong> zu versorgenden Einwohner, angeschlossene Ortsteile), zur Wassergewinnung (Gw-<br />
Erschließung durch Brunnen o<strong>der</strong> Quellfassungen), zum Gewinnungsgebiet (geologische und hydrogeologische<br />
Verhältnisse, Tiefe des genutzten Gw-Vorkommens), zur Versorgungsstruktur (Wassergewinnung aus einem o<strong>der</strong><br />
mehreren Gewinnungsgebieten, vorhandene Wasseraufbereitungsanlagen; Wasserspeicherung in einem o<strong>der</strong><br />
mehreren Hochbehältern; Anzahl <strong>der</strong> Druckzonen im Versorgungsnetz), zur benötigten Wassermenge (<strong>der</strong>zeitiger<br />
und zukünftiger Verbrauch), zur Wasserqualität (chemisch-physikalische und bakteriologische Wassereigenschaften),<br />
zum bestehenden Trinkwasserschutz (vorhandene Wasserschutzgebiete) sowie zu bereits bekannten<br />
möglichen Gefährdungspotentialen im Einzugsbereich <strong>der</strong> Wassergewinnungsanlagen (Siedlungen,<br />
Straßen, Altlasten etc.). Diese Daten sind meist beim Wasserversorgungsunternehmen o<strong>der</strong> den zuständigen<br />
Behörden (Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt) vorhanden und geben bereits einen ersten Überblick über die<br />
örtlichen Verhältnisse. Anhand dieser Unterlagen lässt sich häufig schon abschätzen, ob eine zusätzliche Gw-<br />
Erschließung im Nahbereich <strong>der</strong> bestehenden Anlagen (Brunnen o<strong>der</strong> Quellfassungen) in Frage kommt o<strong>der</strong> ob<br />
ein komplett neues Wassererschließungsgebiet gesucht werden muss. Wenn es aufgrund <strong>der</strong> örtlichen hydrogeologischen<br />
Verhältnisse möglich ist, die bestehende Wasserversorgungsanlage durch einen zusätzlichen<br />
Brunnen o<strong>der</strong> eine zusätzliche Quellfassung zu ergänzen, sind in <strong>der</strong> Regel keine umfangreichen Untersuchungen<br />
notwendig. Das wird z.B. dann möglich sein, wenn ein breiter Talaquifer mit reichlich Gw vorhanden ist. Hier<br />
reichen meist wenige Erkundungsbohrungen um einen geeigneten Brunnenstandort zu finden. Gleiches gilt, wenn<br />
neben einer bestehenden Quellfassung noch zusätzliche natürliche Quellaustritte vorhanden sind, die durch ein<br />
Quellfassungsbauwerk für die Wasserversorgung erschlossen werden können. Deutlich aufwändiger werden die<br />
Erkundungsmethoden, wenn ein neues, bisher nicht erschlossenes Gw-Gewinnungsgebiet gefunden werden soll.<br />
Von gleichfalls entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung ist im Vorfeld <strong>der</strong> Erschließung eines neuen Gw-Vorkommens die<br />
gründliche Auswertung von Karten, von vorhandenem möglichst großmaßstäblichem topographischem, geologischem<br />
und sonstigem thematischen Kartenmaterial. Dabei ist vor allem auf Folgendes zu achten: Das Gw-Einzugsgebiet<br />
muss schützbar sein, d.h. es sollte eine ausreichende Gw-Üüberdeckung besitzen und zudem sollten<br />
keine nennenswerten Gefährdungspotentiale (z.B. Siedlungen, Straßen, Industriebetriebe, Altlasten, Flusswasserversickerungen<br />
etc.) in <strong>der</strong> Nähe vorhanden sein. Es muss die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes<br />
möglich sein, d.h. die betroffenen Grundstückseigentümer müssen bereits bei den Voruntersuchungen kooperieren<br />
und z.B. Erkundungsbohrungen o<strong>der</strong> sonstige Messungen auf ihren Grundstücken erlauben. Das Erkundungsgebiet<br />
muss ein ausreichend ergiebiges Gw-Vorkommen aufweisen, dessen Wasserqualität die strengen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Trinkwasserverordnung erfüllt.
57<br />
Außerdem sollte das neue Gw-Erschließungsgebiet nicht allzu weit von <strong>der</strong> bestehenden Wasserversorgungsanlage<br />
<strong>der</strong> Gemeinde entfernt sein und nach Möglichkeit auf dem Gebiet <strong>der</strong> eigenen Gemeinde liegen. Es dürfte<br />
einleuchtend sein, dass es recht schwierig ist, alle diese Kriterien unter einen Hut zu bekommen. Nicht selten ist<br />
das Gelände bereits bebaut, wird von Straßen gequert, ist intensiv landwirtschaftlich genutzt, es sind<br />
Altlastenflächen (ehemalige Mülldeponien o<strong>der</strong> Industriebrachen) vorhanden o<strong>der</strong> es gibt sonstige konkurrierende<br />
Nutzungen (z.B. Kiesgruben). Manchmal liegt <strong>der</strong> Gw-Spiegel auch nur knapp unter <strong>der</strong> Oberfläche und ist damit<br />
nicht ausreichend geschützt. Oft ist das Gw-Vorkommen aber einfach nicht ergiebig genug.<br />
Eine wesentliche Voraussetzung für eine Gw-Erkundung ist, neben den bereits oben erläuterten Untersuchungsschritten,<br />
eine möglichst sorgfältige Geländebegehung, bei <strong>der</strong> die bisher gewonnenen Daten vor Ort überprüft<br />
und zudem die bislang unbekannten Verhältnisse erkundet werden. Sowohl die Geländeformen wie auch <strong>der</strong><br />
Bewuchs können Aufschluss über den Bodenaufbau und die Gw-Verhältnisse liefern. Kleine, aneinan<strong>der</strong>gereihte<br />
Geländesenken können auf Lösungsvorgänge bzw. Auswaschung (Subrosion) im Untergrund hindeuten, die<br />
durch das Gw verursacht sein können (Dolinen, Erdfälle). Feuchtigkeitsliebende Pflanzen (Schilf, Binsen, Sauergräser,<br />
Schachtelhalme etc.) und Vernässungsflächen deuten auf oberflächennahes Gw hin. Durch viele <strong>der</strong>artige<br />
Beobachtungen erhält man mitunter schon erste Anhaltspunkte für die ungefähre Fließrichtung des Gws.<br />
„Quellhorizonte“ an den Flanken von Höhenrücken sind entlang einer Linie aufgereihte Quellen und Feuchtflächen,<br />
die durch Wasseraustritte verursacht werden. Solche Quellhorizonte deuten auf die ungefähre Höhenlage<br />
des Gw-Spiegels im Berg hin. Damit kann abgeschätzt werden, wie tief man auf diesem Höhenrücken bohren<br />
muss, um das Gw zu erreichen. Liegen die Wasseraustritte eines solchen Quellhorizontes nicht in einer Höhe,<br />
son<strong>der</strong>n zeigen ein deutliches Gefälle, ist das ein Hinweis auf das Gw-Gefälle im Berg.<br />
Ein ganz wesentlicher Aspekt bei <strong>der</strong> hydrogeologischen Beschreibung eines Untersuchungsgebietes ist die Ermittlung<br />
<strong>der</strong> Gw-Bilanz. In einer Gw-Bilanz wird diejenige Wassermenge, die einem bestimmten Gebiet über Nie<strong>der</strong>schläge<br />
o<strong>der</strong> das Versickern von Oberflächengewässern zugeführt wird, <strong>der</strong>jenigen gegenübergestellt, die in<br />
Form von Quellen und Bächen (untergeordnet auch durch Verdunstung) dieses Gebiet wie<strong>der</strong> verlässt. Die Gw-<br />
Bilanz gibt folglich Auskunft über die Gw-Menge, die den Untergrund dieses Gebietes durchströmen muss. Die<br />
abströmende (und verdunstende) Wassermenge muss gleich groß sein wie die Summe <strong>der</strong> über die Nie<strong>der</strong>schläge<br />
neu gebildeten o<strong>der</strong> aus an<strong>der</strong>en Gebieten zuströmenden Wassermenge – an<strong>der</strong>nfalls stimmt die Bilanz<br />
nicht.<br />
Im Bereich von Höhenrücken o<strong>der</strong> Hochflächen lassen sich die Gw-Bilanzen häufig mit vergleichsweise geringem<br />
Aufwand durch Abflussmessungen <strong>der</strong> Bäche und Quellen ermitteln. Bei den langgestreckten Höhenrücken, die<br />
die Talflächen im Alpenvorland seitlich begleiten, liegen die wasserstauenden Schichten meist über dem Talniveau,<br />
d.h. die Basis des jeweiligen Gw-Leiters ist hier „exponiert“. Deshalb tritt alles Gw in diesen Höhenrücken,<br />
das durch die Nie<strong>der</strong>schläge immer wie<strong>der</strong> neu gebildet wird, entlang <strong>der</strong> Hangflanken in Quellen zu Tage. Nach<br />
längeren Trockenwetterperioden stammt das gesamte Wasser, das in Gräben und Bächen abfließt,<br />
ausschließlich aus Quellen, die direkt vom Gw gespeist werden. Am einfachsten lassen sich die Abflüsse in Gräben<br />
und kleinen Bächen mit Eimer und Stoppuhr ermitteln. Bei größeren Wassermengen kann <strong>der</strong> Abfluss mit<br />
speziellen Geräten zur Messung <strong>der</strong> Fließgeschwindigkeit des Wassers ermittelt werden.<br />
Gelingt es, bei Trockenwetter alle Quellabläufe rund um einen Höhenrücken quantitativ zu erfassen, erhält man<br />
recht zuverlässig die Gw-Menge, die permanent durch diesen Höhenrücken strömt und damit auch annäherungsweise<br />
die Gw-Neubildungsrate. Teilt man die Wassermenge (l/s), die sich aus <strong>der</strong> Summe aller hier ermittelten<br />
Quellschüttungen ergibt, durch die Oberfläche des Höhenrückens (km²), erhält man auf einfache Weise die<br />
mittlere Gw-Neubildungsrate, die für hydrogeologischen Überlegungen von elementarer Bedeutung ist. Im Schnitt<br />
beträgt die mittlere Gw-Neubildungsrate im Bereich des voralpinen Hügellandes etwa 15 l/s x km². Dies bedeutet,<br />
dass auf einer Fläche von einem Quadratkilometer pro Sekunde durchschnittlich 15 Liter Nie<strong>der</strong>schlagswasser<br />
versickern und dadurch das Gw permanent erneuert wird.<br />
Der nächste Schritt bei <strong>der</strong> Gw-Suche ist die Erkundung <strong>der</strong> Untergrundverhältnisse. Wenn das Gw nicht allzu<br />
tief unter <strong>der</strong> Geländeoberfläche liegt, wie dies in den Tälern des Alpenvorlandes häufig <strong>der</strong> Fall ist, eignen sich<br />
hierfür sog. Rammkernsondierungen. Hierbei werden Stahlrohre (30-80 mm Ø) mit Hilfe eines Elektro- o<strong>der</strong><br />
Motorhammers in den Boden gerammt. Wenn <strong>der</strong> Gw-Spiegel tiefer liegt und zudem die Ergiebigkeit des Gw-<br />
Vorkommens ermittelt werden soll, dann müssen sehr viel teurere Bohrungen mit größerem Durchmesser (meist<br />
220-330 mm) nie<strong>der</strong>gebracht werden. In den eiszeitlichen Lockergesteinen des Alpenvorlandes werden hierfür in<br />
<strong>der</strong> Regel Trockenbohrungen im sog. Rammkernverfahren eingesetzt. Das Bodenmaterial (Lehm, Kies, Sand,<br />
Ton etc.) schiebt sich dabei in das 1 bis 2 m lange Stahlrohr. Danach zieht man das Rohr wie<strong>der</strong> heraus und<br />
macht sich Aufzeichnungen über die übereinan<strong>der</strong> folgenden Schichten, die durch einen seitlichen Schlitz im
58<br />
Stahlrohr zu erkennen sind. Anschließend leert man die Sonde aus, schraubt eine Verlängerung auf, sondiert in<br />
dem Loch tiefer nach unten, zieht die Sonde wie<strong>der</strong> heraus, verlängert die Sonde erneut, fährt wie<strong>der</strong> in das<br />
Sondierloch usw. Mit dieser Methode lassen sich die Untergrundverhältnisse unter günstigen Bedingungen bis 10<br />
m, im Idealfall sogar bis zu 15 m Tiefe erkunden. Durch Rammkernsondierungen lassen sich auch die Gw-Stände<br />
sowie <strong>der</strong> Aufbau <strong>der</strong> Gw-führenden Schichten erkunden.<br />
In das verrohrte Bohrloch werden anschließend meist PVC-Rohre (120-150 mm Ø) eingesetzt, die dort, wo sie<br />
Kontakt mit dem Gw haben, perforiert sind. Die PVC-Rohre werden mit Filterkies umhüllt und die obersten Meter<br />
mit Beton o<strong>der</strong> Ton abgedichtet. Danach wird die Stahlverrohrung wie<strong>der</strong> herausgezogen. Nachdem eine solche<br />
Gw-Messstelle fertiggestellt ist, schaut nur noch <strong>der</strong> oberste Meter aus dem Boden, <strong>der</strong> meist aus einem einbetonierten<br />
Stahlrohr mit einer Abdeckkappe besteht.<br />
Hier können die Gw-Stände eingemessen und Wasserproben entnommen werden. Mit Gw-Messstellen lässt sich<br />
auch die Fließrichtung des Gws in einem Erkundungsgebiet ermitteln. Dafür braucht man im einfachsten Falle<br />
allerdings mindestens drei Gw-Messstellen. Sollten aber komplexe Gw-Strömungsverhältnisse mit schwankenden<br />
Fließrichtungen vorliegen, wie dies bei den Gw-Vorkommen im Alpenvorland häufig <strong>der</strong> Fall ist, sind deutlich<br />
mehr Messstellen notwendig. Die Gw-Stände in den einzelnen Messstellen werden genau eingemessen und die<br />
Wasserstände zwischen den Messstellen miteinan<strong>der</strong> verglichen. Auf dieser Grundlage lassen sich sog. Gw-<br />
Gleichenpläne erstellen, auf denen die geneigten Gw-Oberflächen, ähnlich <strong>der</strong> Landoberfläche auf einer toporgaphischen<br />
Karte, mit Hilfe von Höhenlinien dargestellt sind. Daraus lässt sich das Gw-Gefälle und damit auf<br />
einfache Weise auch die Gw-Ffließrichtung ermitteln.<br />
In einer Gw-Messstelle können aber auch sog. Pumpversuche durchgeführt werden. Pumpversuche sind zwar<br />
etwas aufwändig, aber sie sind das wichtigste Hilfsmittel bei <strong>der</strong> Gw-Erkundung, da mit ihnen sowohl die Gw-<br />
Ergiebigkeiten als auch weitere „geohydraulische Kennwerte“ (k f -Werte, Transmissivitäten, Speicherkoeffizienten,<br />
Porositäten) eines Aquifers ermittelt werden können, die zusammen mit <strong>der</strong> Gw-Fließrichtung die Grundlage für<br />
die Berechnung des Anstrombereiches eines Brunnens bilden. Je mehr Messstellen zur Verfügung stehen, um so<br />
genauer können die hydrogeologischen Verhältnisse ermittelt werden.<br />
Die hydrogeologischen Untersuchungen werden ergänzt durch unterschiedliche geophysikalische Untersuchungen<br />
des Untergrundes. Während Bohrungen zwar recht detaillierte, aber dafür nur punktuelle Aufschlüsse über<br />
den Untergrund geben, lassen geophysikalische Messmethoden großräumigere Aussagen über Beschaffenheit<br />
und Struktur des Untergrundes zu. Hierbei gilt: Je mehr Bohrungen für die Eichung <strong>der</strong> geophysikalischen Messungen<br />
zur Verfügung stehen, umso genauer lässt sich ein dreidimensionales Bild von den Untergrundstrukturen<br />
entwickeln. Vor allem unterschiedliche seismische und geoelektrische Verfahren kommen dabei zur Anwendung.<br />
7.6.2 Grundwassererschließung durch Quellfassungen und Brunnen<br />
Grundwasser (Gw) kann prinzipiell durch zwei verschiedene Methoden erschlossen werden: mit einer Quellfassung<br />
o<strong>der</strong> einem Brunnen. Die Frage, ob eine Wasserversorgung durch einen Brunnen o<strong>der</strong> eine Quellfassung<br />
erfolgt, hängt primär von den geologischen Verhältnisse im Erschließungsgebiet ab. Im Gebirge sowie im voralpinen<br />
Moränenhügelland sind Quellfassungen – geologisch bedingt – wesentlich häufiger als Brunnen, wobei es<br />
sich meist um kleine Quellen mit vergleichsweise geringer Schüttung von 1 bis 10 l/s handelt. Allerdings gibt es<br />
auch hier punktuell z.T. sehr ergiebige Quellen mit Schüttungen in <strong>der</strong> Größenordnung von 10 bis 100 l/s. In den<br />
Tälern <strong>der</strong> Alpen und den Talnie<strong>der</strong>ungen des Alpenvorlandes sowie in den ebenen Schotterflächen nördlich <strong>der</strong><br />
Endmoränen wird das Gw zumeist durch Brunnen erschlossen. Die Brunnen för<strong>der</strong>n das Gw dabei überwiegend<br />
aus ergiebigen eiszeitlichen Schottern. Hier reichen in <strong>der</strong> Regel Bohrtiefen von einigen Metern bis zu wenigen<br />
Zehnermetern aus, um ausreichend Wasser zu bekommen. Die För<strong>der</strong>mengen von Brunnen in gut durchlässigen<br />
quartären Schmelzwasserschottern können durchaus in <strong>der</strong> Größenordnung von 100 bis 200 l/s und z.T. auch<br />
darüber liegen, wodurch auch große Städte ausreichend versorgt werden können.<br />
In Bayern ist sowohl die Gw-Erschließung durch Quellfassungen wie auch durch Brunnen gebräuchlich. Bei <strong>der</strong><br />
Fassung einer Quelle versucht man, das hier natürlich austretende Gw schon vor bzw. unter ihrem Austrittspunkt<br />
in einem künstlichen Becken zu sammeln, um die Verschmutzung des Wassers an <strong>der</strong> Erdoberfläche auszuschließen.<br />
Heute werden Quellfassungen mit großen Baumaschinen errichtet, wodurch diese Fassungsbauwerke<br />
zumeist Tiefen von 4 bis 7 m aufweisen und dadurch deutlich besser vor Oberflächeneinflüssen geschützt sind<br />
als die früheren Quellfassungen. Das grundlegende Prinzip, durch ein mehr o<strong>der</strong> weniger aufwändiges Bauwerk<br />
das zuströmende Gw zu fassen und im Freispiegelgefälle abzuleiten, ist aber über die Jahrtausende gleich<br />
geblieben.
59<br />
Mit Brunnen wird Gw erschlossen, das sich mehrere Meter bis Zehnermeter unter <strong>der</strong> Geländeoberfläche befindet<br />
und an dieser Stelle nicht natürlich austritt. Im Unterschied zu einer Quelle muss das Wasser bei einem Brunnen<br />
durch Schöpfgeräte o<strong>der</strong> Pumpen geför<strong>der</strong>t werden. Brunnen wurden früher von Hand gegraben und hatten<br />
deshalb zumeist einen so großen Durchmesser, dass ein Mannn mit Schaufel und Pickel darin arbeiten konnte.<br />
Heutzutage werden Brunnen meist durch große Bohrgeräte mit unterschiedlichsten Bohr- und Ausbautechniken<br />
erstellt, wodurch Brunnentiefen von mehreren tausend Metern möglich sind.<br />
Das Brunnenwasser wurde früher mittels Eimer und Winde geför<strong>der</strong>t. In den heutigen Brunnen wird das Gw durch<br />
leistungsstarke Tauchpumpen oft über viele Zehnermeter bis in die Hochbehälter geför<strong>der</strong>t, von denen das<br />
Wasser dann über ein verzweigtes Leitungsnetz in die Häuser gelangt.<br />
7.6.3 Grundwasserschutz<br />
Grundwasser (Gw) ist in <strong>der</strong> heutigen Zeit durch die menschlichen Eingriffe in die Natur und durch die allgemeine<br />
Umweltverschmutzung vielen Gefährdungen ausgesetzt. Die Liste <strong>der</strong> Gefährdungspotentiale ist lang: sie reicht<br />
von Siedlungen, Industriegebieten und Straßen über Altlasten, Deponien und Rohstoffabbau bis zur Land- und<br />
Forstwirtschaft. Dabei ergeben sich nicht nur Gefahren durch direkte Schadstoffeinträge in den Boden, wie z.B.<br />
durch Lecks in Tankanlagen, durch auslaufendes Benzin nach Unfällen, durch versickerndes Abwasser aus<br />
Kanälen, durch Sickerwässer von Deponien, durch den unsachgemäßen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln o<strong>der</strong><br />
durch übermäßige Düngung. Auch die aus Verkehr und Industrie stammenden Schadstoffe in <strong>der</strong> Luft werden<br />
durch den Regen ausgewaschen und gelangen somit in den Boden. Die Deckschichten über dem Gw bieten zwar<br />
meist einen guten Schutz vor tiefreichenden Verunreinigungen, allerdings hat <strong>der</strong> Boden auch nur ein begrenztes<br />
Reinigungsvermögen. Schadstoffe, die nicht durch Mikroorganismen abgebaut werden, reichern sich im Boden an<br />
und werden je nach Durchlässigkeit <strong>der</strong> Bodenhorizonte unterschiedlich schnell nach unten verlagert. Neben<br />
einem intakten Boden und gering durchlässigen Deckschichten kommt deswegen dem vorbeugenden Gw-Schutz<br />
eine ganz wesentliche Rolle zu.<br />
Aus diesem Grund weist man schon seit vielen Jahrzehnten Trinkwasserschutzgebiete aus, die das Gw vor<br />
nachteiligen Verän<strong>der</strong>ungen schützen sollen. In Bayern beträgt <strong>der</strong> Anteil an Wasserschutzgebieten <strong>der</strong>zeit rund<br />
3,5 % <strong>der</strong> Landesfläche, wobei zahlreiche bestehende Schutzgebiete zukünftig noch ausgeweitet und auch neue<br />
hinzukommen werden. Um für einen Brunnen o<strong>der</strong> eine Quelle ein wirksames Schutzgebiet ausweisen zu können,<br />
muss aber zunächst das zugehörige Gw-Einzugsgebiet erkundet werden. Diese Arbeiten werden in <strong>der</strong><br />
Regel durch unabhängige Ingenieurbüros im Auftrag <strong>der</strong> Wasserversorgungsunternehmen durchgeführt.<br />
Durch die Auswertung vorhandener Unterlagen und umfangreiche Geländearbeiten, wie z.B. Bohrungen, Gw-<br />
Standsmessungen, Pump- und Markierungsversuche, Abflussmessungen, geophysikalische Untersuchungen,<br />
Boden- und Wasseranalysen etc. werden die hydrogeologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet möglichst genau<br />
erkundet. Hierzu gehört neben <strong>der</strong> Ermittlung von Fließrichtung und Strömungsgeschwindigkeit des Gws auch die<br />
Untersuchung des Aufbaues <strong>der</strong> das Gw schützenden Deckschichten sowie die Erfassung und Bewertung <strong>der</strong><br />
möglichen Gefährdungspotentiale im Einzugsgebiet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden dann in<br />
einem sog. hydrogeologischen Gutachten dargestellt. Dieses Gutachten enthält in <strong>der</strong> Regel bereits auch einen<br />
Schutzgebietsvorschlag für die untersuchte Wassergewinnungsanlage.<br />
Wasserschutzgebiete decken meist den empfindlichen Teil des Gw-Einzugsgebietes von Brunnen und Quellen<br />
ab. Ihre Größe und Lage hängt von <strong>der</strong> Fließrichtung und Strömungsgeschwindigkeit des Gws sowie von <strong>der</strong><br />
natürlichen Schutzwirkung <strong>der</strong> Deckschichten ab. Ein Wasserschutzgebiet wird in <strong>der</strong> Regel in drei Zonen unterteilt,<br />
in denen unterschiedlich strenge Auflagen einen grundwasserverträglichen Umgang mit <strong>der</strong> Natur sicherstellen<br />
sollen. Sämtliche Handlungen, die möglicherweise Boden- und Gw-Verunreinigungen verursachen könnten,<br />
sind in den Schutzzonen verboten o<strong>der</strong> nur unter strengen Auflagen zulässig. Die Verbote und Auflagen sind<br />
in einer speziell auf das jeweilige Schutzgebiet abgestimmten Schutzgebietsverordnung aufgelistet. Da die Risiken<br />
für das Trinkwasser meist mit <strong>der</strong> Entfernung vom Brunnen bzw. von <strong>der</strong> Quelle abnehmen, werden auch die<br />
Einschränkungen in den Schutzzonen mit zunehmendem Abstand von <strong>der</strong> Wassergewinnungsanlage geringer.<br />
Das Schutzgebiet wird deshalb in Fassungsbereich (Zone I), Engere Schutzzone (Zone II) und Weitere Schutzzone<br />
(Zone III) unterteilt.<br />
Zone I (Fassungsbereich): Der Fassungsbereich ist abgezäunt und hat einen Durchmesser von 20 bis 40 m.<br />
Zone II (Engere Schutzzone): In <strong>der</strong> Engeren Schutzzone sind alle Handlungen verboten, die ein erhöhtes<br />
Risiko für bakteriologische Verunreinigungen beinhalten, wie z.B. die Ausbringung von Abwasser, Gülle o<strong>der</strong>
60<br />
Festmist. Auch die Beweidung o<strong>der</strong> Freilandhaltung von Tieren ist hier nicht erlaubt. Ihre Größe hängt vor allem<br />
von <strong>der</strong> Fließgeschwindigkeit des Gws ab. Vom Außenrand <strong>der</strong> Zone II soll das Gw mindestens 50 Tage unterwegs<br />
sein, bevor es im Brunnen o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Quelle eintrifft (50-Tage-Regel). Sie umfasst daher i.d.R. Flächen in<br />
<strong>der</strong> Größenordnung von 10 bis 50 ha.<br />
Zone III (Weitere Schutzzone): Die Weitere Schutzzone soll den Schutz vor schwer abbaubaren Verunreinigungen<br />
in größerer Entfernung vom Brunnen bzw. von <strong>der</strong> Quelle gewährleisten. Hier geht es speziell um Einschränkungen<br />
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, bei <strong>der</strong> Bebauung, bei <strong>der</strong> Rohstoffgewinnung, bei<br />
Bodeneingriffen und bei <strong>der</strong> Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie bei <strong>der</strong> Düngung. Die Dimensionierung<br />
<strong>der</strong> Zone III variiert in Abhängigkeit von den speziellen hydrogeologischen Verhältnissen und den Entnahmemengen<br />
in <strong>der</strong> Größenordnung von einigen Zehnerhektar bis zu mehreren Quadratkilometern.<br />
7.7 Literaturauswahl zu den hydrogeologischen <strong>Grundlagen</strong><br />
BALKE, K.-D., BEIMS, U., HEERS, F.-W., HÖLTING, B., HOMRIGHAUSEN, R. & MATTHESS, G. (2000): Grundwassererschließung.– In:<br />
Lehrbuch <strong>der</strong> Hydrogeologie Bd. 4, 740 S.; Berlin-Stuttgart (Borntraeger-Verl.).<br />
DIN 2000 (1973): Zentrale Trinkwasserversorgung; Leitsätze für die Anfor<strong>der</strong>ungen an Trinkwasser, Planung, Bau- und Betrieb <strong>der</strong><br />
Anlagen.– 29 S.; Berlin, Köln (Beuth-Verl.).<br />
DVGW (1995): Schutzgebiete für Grundwasser.– In: Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, 1. Teil, Regelwerk W101, 23+15 S.;<br />
Frankfurt a. M. (ZfGW-Verl.).<br />
HÖLTING, B. (1996): Hydrogeologie.– 5. Aufl., 441 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
KNÖDEL, K., KRUMMEL, H. & LANGE, G. (1997): Geophysik.– In: Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten,<br />
Bd. 3, 1063 S.; Berlin, Heidelberg (Springer-Verl.).<br />
KUISLE, A.: Wasser. Vom Hausbrunnen zum Wasserhahn.– Begleitbuch für die Ausstellung zur Geschichte <strong>der</strong> Wasserversorgung im<br />
ländlichen Oberbayern im Freilichtmuseum an <strong>der</strong> Glentleiten, 140 S.; Großweil, 1994 (Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern).<br />
MATTHESS, G. & UBELL, K. (1983): Allgemeine Hydrogeologie, Grundwasserhaushalt.– In: Lehrbuch <strong>der</strong> Hydrogeologie, Bd. 1, 438 S.;<br />
Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
MEYER DE STADELHOFEN, C. (1991): Anwendung geophysikalischer Methoden in <strong>der</strong> Hydrogeologie.– 226 S.; Berlin, Heidelberg, New<br />
York (Springer-Verl.).<br />
8. PALÄONTOLOGICHE GRUNDLAGEN<br />
Unter „Fossilien“ o<strong>der</strong> „Petrefakten“ verstand man ursprünglich alle auffälligen und eigentümlichen Bildungen, die<br />
man in Gesteinen und im Boden fand und durch Graben gewinnen musste, also Quarzkristalle und Dendriten<br />
genauso wie Lösskindl, Feuersteinknollen o<strong>der</strong> Ammoniten. Heute verwendet man den Begriff Fossilien o<strong>der</strong><br />
Versteinerungen nur noch für Reste o<strong>der</strong> Spuren von Tieren und Pflanzen. In früheren Jahrhun<strong>der</strong>ten hielt man<br />
Versteinerungen für mehr o<strong>der</strong> weniger zufällig im Gestein entstandene „Konkretionen“ und „Koagulationen“,<br />
anorganisch entstandene Kuriositäten, die nichts an<strong>der</strong>es als „Launen <strong>der</strong> Natur“ waren und nur zufällig einmal<br />
einer Muschel o<strong>der</strong> einer Pflanze glichen, ähnlich wie man in Tropfsteinen menschliche Gestalten zu erkennen<br />
glaubt.<br />
Der aus Dänemark stammende Arzt und Anatom Nils Pe<strong>der</strong>sen, <strong>der</strong> sich „Nikolaus Steno“ nannte (1638-1687),<br />
wies Mitte des 17. Jahrhun<strong>der</strong>ts als erster nach, dass es sich bei den Fossilien, die in tertiären Ablagerungen<br />
Mittelitaliens vorkommen, keineswegs um „Launen <strong>der</strong> Natur“, son<strong>der</strong>n tatsächlich um fossile Muschelschalen<br />
und Haizähne handelt. Er konnte zeigen, dass diese Fossilien nicht nur die äußere Form von Schalen und Zähnen<br />
besitzen, son<strong>der</strong>n auch in ihrer inneren Struktur absolut identisch mit den heutigen sind. Er erkannte auch<br />
als erster, dass es sich bei den Gesteinen, die diese Versteinerungen enthalten, um Meeresablagerungen handeln<br />
muss, auch wenn sie heute Hun<strong>der</strong>te von Metern über dem Mittelmeer liegen.<br />
Unter dem Begriff „Fossilien“ o<strong>der</strong> „Versteinerungen“ versteht man heute vor allem Reste von Schalen, Skeletten,<br />
Panzern und an<strong>der</strong>en Hartteilen, die ursprünglich schon aus mineralischen Substanzen o<strong>der</strong> schwer abbaubaren<br />
organischen Stoffen bestanden haben. Viele Tiere, z.B. Schnecken, Muscheln, Korallen, Schwämme o<strong>der</strong> Wir-
61<br />
beltiere, scheiden mineralische Hartteile aus, die meist aus Karbonat (Calcit und Aragonit), seltener auch aus<br />
Kieselsäure o<strong>der</strong> Phosphat bestehen. Den Vorgang <strong>der</strong> Mineralausscheidung durch Organismen bezeichnet man<br />
als Biomineralisation. An<strong>der</strong>e Gruppen, wie Glie<strong>der</strong>füßler o<strong>der</strong> Graptolithen, besitzen Chitinpanzer aus einem<br />
organischen Material (Polysacharid), während Pflanzen u.a. den Holzstoff Lignin o<strong>der</strong> Sporopollenin verwenden.<br />
Als Fossilien bezeichnet man aber nicht nur ihre Hartteile. Auch Spuren <strong>der</strong> Lebensaktivität von Organismen, wie<br />
Grabspuren von Seeigeln o<strong>der</strong> Muscheln im Sand o<strong>der</strong> Trittsigel von Dinosauriern auf Schichtflächen werden als<br />
Spurenfossilien (Ichnofossilien) bezeichnet. Außerdem gibt es charakteristische Schichtgefüge, die Lebensgemeinschaften<br />
primitiver Organismen (Mikrobenmatten) den Sedimenten aufprägen können, auf <strong>der</strong>en Oberfläche<br />
sie leben. Auch solche als Stromatolithe bezeichnete manchmal sehr komplexe Strukturen werden zu den Fossilien<br />
gerechnet.<br />
8.1 Vom lebenden Organismus zum Fossil<br />
Mit dem Entstehen von Fossilien beschäftigt sich die Biostratonomie (Fossilisationslehre). Grundvoraussetzung<br />
für die Bildung von Fossilien ist ihre möglichst rasche Einbettung in geeignete Sedimente. Die Frage was und wie<br />
viel von einem Organismus erhalten bleibt und unter günstigen Verhältnissen fossil werden kann, entscheidet sich<br />
teilweise schon unmittelbar nach ihrem Tod. Mit den Vorgängen zwischen Tod und Einbettung von Organismen<br />
beschäftigt sich die Taphonomie. Nur ein Bruchteil <strong>der</strong> prinzipiell erhaltungsfähigen Skelette o<strong>der</strong> Schalen von<br />
Organismen wird tatsächlich fossil, die meisten werden schon vor ihrer Einbettung zerstört.<br />
Nach dem Tode sorgen sog. nekrotische Vorgänge für einen Abbau des organischen Materials. Von Verwesung<br />
spricht man, wenn die Zersetzung unter O 2 -Zutritt von aeroben Mikroorganismen, von Fäulnis wenn sie durch<br />
anaerobe Bakterien unter O 2 -Abschluss besorgt wird. Durch nekrotische Vorgänge fallen z.B. die beiden Klappen<br />
von Muschelschalen bald auseinan<strong>der</strong>, während Wirbeltiere leicht an ihren Gelenken zerglie<strong>der</strong>t werden und sich<br />
in Einzelteile auflösen. Fische, die eines natürlichen Todes sterben, drehen sich mit <strong>der</strong> Bauchseite nach oben<br />
und treiben so lange an <strong>der</strong> Wasseroberfläche, bis die Schwimmblase platzt und <strong>der</strong> Körper auf den Boden sinkt.<br />
Vorher aber schon können Teile des Kadavers abfallen und über den Meeresboden verstreut werden, etwa<br />
Schuppen, Gräten, Flossen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kopf, so dass, abgesehen von einigen Ausnahmen, meist nur Teile von<br />
Fischen zusammenhängend fossil erhalten bleiben.<br />
Eine wichtige Rolle bei <strong>der</strong> Zerglie<strong>der</strong>ung von Organismen vor ihrer Einbettung spielen auch Aasfresser. Längere<br />
Zeit an <strong>der</strong> Oberfläche liegende Schalen o<strong>der</strong> Knochen werden hingegen leicht mechanisch zerstört, zertreten,<br />
durch Wellenwirkung abgerollt und zertrümmert, wenn sie nicht bald von Sediment überdeckt werden.<br />
8.2 Gewöhnliche Fossilien: Hartteilerhaltung<br />
Sind sie einmal eingebettet, können Hartteile von Organismen über geologische Zeiträume weitgehend unverän<strong>der</strong>t<br />
erhalten bleiben, vor allem unter Sauerstoffabschluss. Oft aber werden sie chemisch-mineralogisch stark<br />
verän<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> sogar gänzlich aufgelöst. Was passiert, hängt davon ab, woraus die Hartteile ursprünglich bestanden<br />
haben, unter welchen Bedingungen sie in welche Sedimente eingebettet werden und wie diese Sedimente<br />
durch Druck, Temperatur und Chemie <strong>der</strong> Porenwässer im Laufe <strong>der</strong> Zeit verän<strong>der</strong>t werden. Alle diese Vorgänge<br />
zusammen nennt man Fossildiagenese. Auch wenn die Hartteile nicht wesentlich verän<strong>der</strong>t werden, kommt es<br />
dadurch zumindest zu einem Verschließen von Poren und Hohlräumen, meist durch das Ausfällen mineralischer<br />
Substanzen. Dadurch haben i.d.R. fossile Wirbeltierknochen ein höheres spezifisches Gewicht als heutige. Durch<br />
Diagenese werden beispielsweise Seeigelstacheln zu makroskopisch erkennbaren Calcit-Einkristallen. Eigentlich<br />
sind die aus Hochmagnesiumcalcit bestehenden Skeletteile von Stachelhäutern schon vor <strong>der</strong> Diagenese poröse<br />
Skelettkristalle, denen man die Einkristall-Natur allerdings nicht sofort ansieht. Durch das orientierte Anwachsen<br />
von Calcit in den Poren werden die Calcit-Einkristalle auch makroskopisch sichtbar. Bruchflächen von Kalksteinen<br />
mit Resten von Seelilien o<strong>der</strong> -igeln glitzern deswegen wie Marmor (sog. Echino<strong>der</strong>men-Spatkalke).<br />
Tabelle 2. Hartteile von Organismen, die primär aus unten aufgelisteten häufigen Substanzen aufgebaut<br />
sind, machen im Laufe <strong>der</strong> Fossildiagenese folgende charakteristische Verän<strong>der</strong>ungen durch:<br />
gewöhnlicher Calcit – CaCO3 → bleibt häufig mit Skelett-Feinstruktur erhalten, wird selten weggelöst<br />
Aragonit – CaCO3 → wird meistens weggelöst o<strong>der</strong> unter Zerstörung <strong>der</strong> Skelett-Feinstruktur in Calcit umgewandelt
62<br />
Hochmagnesiumcalcit – CaCO3 mit 11% Mg → bleibt häufig samt Skelett-Feinstruktur erhalten, wird selten weggelöst<br />
Calciumphosphat – Ca5 [(F,Cl,OH) (PO4) 3] → bleibt meist samt Skelett-Feinstruktur erhalten, Poren oft Calcit-verfüllt<br />
Skelettopal – Si (OH)4 → wird weggelöst o<strong>der</strong> wandelt sich unter Zerstörung <strong>der</strong> Skelett-Feinstruktur in Chalcedon um<br />
agglutinierende Schalen – Hartteile aus Sandkörnern zusammengeklebt → Hartteile bleiben oft komplett erhalten<br />
Lignin – Holzstoff von Landpflanzen → inkohlt, wird dadurch schwarz, bleibt unter O2-Abschluss samt Zellstruktur erhalten<br />
Zellulose – Zellwände von Landpflanzen u. Algen → wird auch bei O2-Abschluss meist zerstört und verschwindet spurlos<br />
Sporopollenin – Pollen- und Sporenexine → in Säuren extrem stabil, bleibt i.d.R. in feinkörnigen Sedimenten erhalten<br />
Schalen von Tieren, etwa die von Schnecken, Muscheln o<strong>der</strong> Brachiopoden, sind oft insgesamt hohl o<strong>der</strong> haben<br />
hohle Kammern, z.B. Ammonitengehäuse o<strong>der</strong> Korallenskelette. Diese primären Hohlräume enthalten ursprünglich<br />
meist lebendes Gewebe, Gas o<strong>der</strong> Flüssigkeiten. Nach <strong>der</strong> Einbettung und dem Abbau <strong>der</strong> organischen<br />
Substanz werden viele mit eindringendem o<strong>der</strong> durch wühlende Tiere eingeschlepptem Sediment teilweise<br />
o<strong>der</strong> ganz aufgefüllt. In viele kommt erst dann von oben her Schlamm, wenn die durch bohrende Organismen<br />
(vor allem endolithische Algen o<strong>der</strong> Pilze) zermürbten und aufgelösten Schalen einbrechen. Verbleibende<br />
Hohlräume bleiben so lange leer, bis die Schalen durch die Auflast des überlagernden Sedimentes kollabieren<br />
o<strong>der</strong> die Hohlräume durch drusenförmig wachsende mineralische Ausfällungen, meist Calcit, Pyrit o<strong>der</strong><br />
Chalcedon, plombiert und damit ausgesteift werden. Je zur Hälfte mit Sediment und mineralischen Drusen<br />
ausgefüllte Hohlräume können als sog. fossile Wasserwaagen verwendet werden, an denen man auch bei<br />
später verkippten Schichtfolgen ablesen kann, wo z.Z. <strong>der</strong> Einbettung oben und wo unten war.<br />
Hartteile, die ursprünglich aus Aragonit (metastabiles CaCO 3 ) bestanden haben, z.B. die Schalen von Schnecken<br />
und Ammoniten o<strong>der</strong> Korallenskelette, bleiben selten unverän<strong>der</strong>t erhalten. Das Material wird zu einer mürben,<br />
kreideartigen Substanz zersetzt, gänzlich weggelöst o<strong>der</strong> rekristallisiert und wandelt sich dabei in körnigen Calcit<br />
um. Die sekundär entstandenen Hohlräume, die weggelöste Schalen im Gestein zurücklassen, können über geologische<br />
Zeiträume hinweg hohl bleiben o<strong>der</strong> mit fremden mineralischen Substanzen ausgefüllt werden. Bekannt<br />
sind etwa die Fossilien im Weißen Jura von Nattheim, wo Hohlräume, die weggelöste Korallenskelette im Gestein<br />
hinterlassen haben, sekundär mit Kieselsäure ausgefüllt worden sind. Die dadurch entstandenen kieseligen<br />
Pseudomorphosen <strong>der</strong> Korallen lassen sich mit Salzsäure aus dem umgebenden Kalkstein herausätzen.
Tabelle 3. Die wichtigsten Baustoffe, aus denen die Hartteile / Skelette von unterschiedlichen Organismengruppen<br />
primär bestehen und die in irgendeiner Form erhalten bleiben, in Sedimentgesteinen<br />
häufig angetroffen werden bzw. gesteinsbildend auftreten können.<br />
63<br />
t ■ Verhältnis Calcit / Aragonit temperaturabhängig<br />
◘ Material in Form größerer Einkristalle verwendet<br />
( ■) Material von wenigen Vertretern <strong>der</strong> Gruppe o<strong>der</strong> nur für beson<strong>der</strong>e Strukturen verwendet + Gruppe ist ausgestorben<br />
■ gewöhnlich ist das Material selbst erhalten (oft aber in stark verän<strong>der</strong>ter Form) □ das Material bleibt selten / nie erhalten<br />
Baustoffe:<br />
Organismengruppen<br />
Sandkörner<br />
agglut.<br />
Skelett<br />
-opal<br />
Hoch-<br />
Mg-<br />
Calcit<br />
gewöhnl.<br />
Calcit<br />
Aragonit<br />
Ca-<br />
Phosphat<br />
Eubacteria (■) (■) (■)<br />
Cyanobacterien („Blaua.,“) ■ ■<br />
Höhere Algen ■ ■ ■ ■ ■<br />
Radiolarien ■ (■)<br />
Foraminiferen ■ ■ (■) □<br />
Schwämme ■ ■ ■ □<br />
Korallen ■ ■ □<br />
Muscheln ■ ■ □<br />
Schnecken ■ □ (■)<br />
Cephalopoden ■ ■ □ (■)<br />
Trilobiten + ■ ■<br />
Krebse ■ ■<br />
Röhrenwürmer t ■ t ■<br />
Bryozoen (Moostierchen)<br />
■<br />
Brachiopoden ■ (■)<br />
Stachelhäuter<br />
◘<br />
Conodonten +<br />
■<br />
Graptolithen +<br />
■<br />
Wirbeltiere ■ □<br />
Holz von Landpflanzen ■ □<br />
Pollen von Landpflanzen<br />
■<br />
Solche Lösungshohlräume stellen Unstetigkeiten und Schwachstellen im Gestein dar, genauso wie erhaltene<br />
Schalen aus an<strong>der</strong>en, stabileren Materialien. Entlang dieser Schwachstellen werden Gesteine durch Verwitterung<br />
und Spaltenfrost bevorzugt angegriffen. Dadurch brechen Gesteine gerne entlang von fossilen Schalen<br />
auseinan<strong>der</strong>. Bei ursprünglich hohlen Schalen von Ammoniten, Schnecken, Muscheln o<strong>der</strong> Brachiopoden entstehen<br />
dadurch Steinkerne – innere Ausfüllungen o<strong>der</strong> Abdrücke <strong>der</strong> Außenfläche, die man als Fossilien<br />
aufsammeln kann. Natürlich findet man auch Steinkerne, die noch von den Schalen umhüllt sind. Steinkerne und<br />
Abdrücke <strong>der</strong> gleichen Art können dabei so unterschiedlich aussehen, dass man sie für völlig verschiedene<br />
Formen halten könnte. Auf Steinkernen von gerippten Muschelschalen ist oft von den Rippen nichts zu erkennen.<br />
Dafür sind etwa Schließmuskeleindrücke, Schlosszähne und Mantellinie zu sehen, die man auf den Außenabdrücken<br />
vergeblich sucht. Auf Steinkernen von Ammonitengehäusen sind Lobenlinien zu erkennen, an Schädelnähte<br />
erinnernde Linien, an denen die Kammerscheidewände an <strong>der</strong> Innenseite <strong>der</strong> Außenschale angewachsen<br />
sind. Auf <strong>der</strong> Außenseite intakter Schalen o<strong>der</strong> auf Abdrücken ist von <strong>der</strong> Unterglie<strong>der</strong>ung von den Kammern <strong>der</strong><br />
Ammonitengehäusen indes nichts zu erkennen.<br />
Mn.<br />
Oxide<br />
Magnetit<br />
Coelestin<br />
Conchyolin<br />
Tectin/<br />
Chitin<br />
Lignin<br />
Gorg /<br />
Spongiin<br />
Sporopollenin<br />
Zellulose<br />
8.3 Seltene Fossilien: Weichteilerhaltung<br />
In sehr seltenen Fällen können Tiere mitsamt ihrer Weichteile als Mumien erhalten bleiben, gewissermaßen mit<br />
Haut und Haar fossil werden. Das kann z.B. durch Einfrieren im Boden passieren. Bekannt sind vor allem tiefgefrorene<br />
Mumien von Mammuten und an<strong>der</strong>en eiszeitlichen Tieren, die sich im Permafrost Sibiriens o<strong>der</strong> Alaskas<br />
erhalten haben. Weichteilerhaltung kann in seltenen Fällen aber auch dadurch zustande kommen, dass Tierleichen<br />
in konzentrierten Salzlaugen versinken o<strong>der</strong> in größere Vorkommen von Asphalt- bzw. Paraffin eingebettet<br />
werden, wie sie an natürlichen Erdölaustritten entstehen können. Berühmte pleistozäne Mumien von Elefanten,
64<br />
Nashörnern, Säbelzahntigern etc. dieses Typs sind aus Galizien (Starania) o<strong>der</strong> Kalifornien (Rancho La Brea)<br />
bekannt.<br />
Mumien können auch durch Austrocknen von Kadavern in Wüstengebieten entstehen. Werden diese mitsamt<br />
ihrer vollig dehydrierten Weichteile komplett von rasch aushärtenden Ablagerungen überdeckt, bleiben diese zwar<br />
i.d.R. nicht erhalten, es können aber stabile Hohlräume entstehen, <strong>der</strong>en Innenseiten exakte Abdrücke <strong>der</strong><br />
Körperoberflächen darstellen, ganz ähnlich wie Hohlräume, die an Stelle menschlicher Leichen in den Pyroklastiten<br />
von Pomjeii zurückgeblieben sind. Ähnlche Erhaltungsbedingungen sind etwa in festländischen Ablagerungen<br />
<strong>der</strong> Unterkreide (Wealden) Südenglands o<strong>der</strong> dem Oberjura aus Wyoming bekannt, wo man gelegentlich<br />
Hohlräume im Gestein entdeckt hat, auf <strong>der</strong> Wänden Hautabdrücke von Dinosauriern erhalten sind.<br />
Am häufigsten aber kommen Reste von Weichteilen in bituminösen, dunkel gefärbten euxinischen Sedimenten<br />
vor, wo fehlen<strong>der</strong> Sauerstoff im Bodenwasser den Abbau <strong>der</strong> organischen Substanz verzögert o<strong>der</strong> effektiv verhin<strong>der</strong>t<br />
hat. Berühmt ist die Mumienerhaltung von marinen Reptilien im Posidonienschiefer des unteren Jura von<br />
Baden-Württemberg (Holzmaden), wo gelegentlich noch die Umrisse des Körpers von Ichthyosauriern und innere<br />
Organe zu erkennen sind. Bekannt sind auch alttertiäre Seeablagerungen im Krater eines eozänen Vulkans, die<br />
früher als Ölschiefer in <strong>der</strong> Grube Messel bei Darmstadt abgebaut wurden. Hier sind u.a. zahlreiche komplette<br />
Säugetier-Mumien mit Hautresten, Behaarung, Muskelresten und mikroskopisch untersuchbaren Mageninhalten<br />
gefunden worden.<br />
Die Fossilien in einigen marinen Schwarzschiefern, die in euxinischen Faziesräumen entstanden sind, wurden<br />
unmittelbar nach ihrer Einbettung mit Pyrit imprägniert. Die massive Imprägnierung mit Pyritkristallen erleichtert<br />
es zuweilen, Fossiliene (z.B. Schlangensterne) mit Hilfe einer Messingbürste aus vergleichsweise weichen<br />
Schiefern herauspräparieren. Stellenweise ist die Pyritimprägnierung im devonischen Wissenbacher Schiefer<br />
sehr schwach und hat vor allem die Weichteile <strong>der</strong> Organismen betroffen. Mit Hilfe spezielle Präparationstechniken<br />
und mit Röntgengeräten lassen sich dann in sog. Mikroröntgenaufnahmen darin vergängliche Strukturen,<br />
wie Nervenfasern, Blutgefäße o<strong>der</strong> den Verdauungstrakt von Trilobiten sichtbar machen.<br />
Organische Substanzen kann unter Luftabschluss zwar grundsätzlich erhalten bleiben, wird aber bei erhöhten<br />
Drucken und Temperaturen in geologischen Zeiträumen stark verän<strong>der</strong>t. Die Diagenese führt dabei zu einer<br />
Anreicherung von Kohlenstoff bei gleichzeitiger Abreiherung von Sauerstoff und Wasserstoff. Zellulose und<br />
Lignin (Holzstoff) von Pflanzen können auf diese Weise durch Inkohlung verän<strong>der</strong>t und in Form von Kohle konserviert<br />
werden. Tierische, hochmolekulare organische Substanzen, z.B. Fette und Eiweiße, werden dagegen in<br />
nie<strong>der</strong>molekulare Verbindungen überführt, die als Bitumen, Paraffin, Erdöl und Erdgas erhalten bleiben können<br />
und, wenn diese Kohlenwasserstoffe aus ihren sog. Muttergesteinen aus- und in geeignete Speichergesteine<br />
einwan<strong>der</strong>n, eine große wirtschaftliche Bedeutung haben.<br />
An und für sich nicht erhaltungsfähige Hartteile aus organischer Substanz können auch dadurch erhalten bleiben,<br />
dass sie bald nach ihrer Einbettung von Konkretionen umwachsen und mit mineralischen Substanzen<br />
imprägniert werden, vor allem durch Kieselsäure, Phosphat o<strong>der</strong> Karbonat. Bekannt sind z.B. Bakterien, die<br />
mitsamt ihren Geißeln in Feuersteinknollen <strong>der</strong> Schreibkreide erhalten geblieben sind. In „Torfdolomite“ eingebettete<br />
Pflanzenreste – frühdiagenetisch entstandene Karbonatkonkretionen in Kohleflözen <strong>der</strong> Karbonzeit – sind<br />
teilweise so gut erhalten, dass Präparate von ihnen in Dünnschliffen fast genauso gut untersucht werden können<br />
wie histologische Dünnschnitte rezenter Pflanzen. Auch Kieselhölzer, wie sie etwa im Rotliegenden o<strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Molasse häufig vorkommen, sind durch selektive Einkieselung oft „strukturbietend“ erhalten geblieben, haben<br />
also ihre ursprüngliche mikroskopische Holzstruktur weitgehend bewahrt. Manche vergängliche Objekte bleiben<br />
durch Überkrustung durch an<strong>der</strong>e, kalkabscheidende Organismen als Hohlräume erhalten. Durch diesen als<br />
Biomuration bezeichneten Vorgang sind z.B. Blätter o<strong>der</strong> Holzreste in manchen Travertinen erhalten geblieben.<br />
8.4 Knappe Auswahl beson<strong>der</strong>s wichtiger Fossilgruppen<br />
8.4.1 Bakterien und Algen: Stromatolithe, Kalktuffe und Algenkalke<br />
Als Stromatolithe bezeichnet man eine spezielle Art von Feinschichtung, die in bestimmten Kalksteinen o<strong>der</strong><br />
Dolomiten zu beobachten ist. Sie besteht aus millimeterdünnen, schichtparallelen Lagen. Jedes dieser dünnen<br />
Bän<strong>der</strong> sieht meist etwas krakelig verbogen aus und erinnert an einen aufgeriffelten Wollfaden. Diese Strukturen<br />
werden von Mikroben erzeugt, vor allem von Cyanobakterien („Blaualgen“), die im subtropischen Watt wachsen.
65<br />
Diese Strukturen entstehen heute noch z.B. an den Gezeitenküsten des Persischen Golfes, wo ganz ungewöhnlich<br />
lebensfeindliche Bedingungen herrschen. Während <strong>der</strong> Ebbe brennt die Sonne gnadenlos auf die kilometerbreiten<br />
feuchten Wattflächen. Das Wasser verdunstet, Salzgehalt und Wassertemperatur steigen stark an. Bei<br />
Flut sinken Temperatur und Salzgehalt des Wassers wie<strong>der</strong> ab. Diesen krassen Wechsel halten die meisten Tiere<br />
und Pflanzen nicht aus. Nur ganz wenige, speziell an diese Bedingungen angepasste Lebewesen können hier<br />
existieren. Dazu gehören vor allem Mikroben, zu denen auch bestimmte Cyanobakterien zählen, von denen<br />
einige Kalk fällen können. Diese den Bakterien verwandte Organismen wachsen in dünnen Matten auf <strong>der</strong><br />
Wattfläche. Spuren <strong>der</strong> dünnen Mikrobenmatten, die im Rhythmus von Ebbe und Flut übereinan<strong>der</strong> folgen, bleiben<br />
als Stromatolithe im Gestein erhalten. Fossile Stromatolithe findet man vor allem im Hauptdolomit o<strong>der</strong> im<br />
Plattenkalk <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen. Mit die ältesten Fossilien die man kennt sind Stromatolithe, manche von<br />
ihnen mehr als 3,5 Ga alt.<br />
Von Cyanobakterien ausgefällte stromatolithische Kalkkrusten wachsen nicht nur am Meeresgrund, son<strong>der</strong>n können<br />
auch bewegliche Objekte wie Muschel- und Schneckensschalen o<strong>der</strong> Gerölle umkrusten. Dadurch können<br />
mit <strong>der</strong> Zeit aus konzentrischen Schalen aufgebaute kartoffelförmige Kalkknollen entstehen, die als Onkoide<br />
bezeichnet werden. Onkoide gibt es nicht nur im Meer son<strong>der</strong>n auch in Seen und Flüssen. Sie besitzen gewöhnlich<br />
die Größe von Erbsen, Weinbeeren o<strong>der</strong> Kartoffeln, in Ausnahmefällen werden sie auch einmal deutlich<br />
größer. Auch an <strong>der</strong> Bildung <strong>der</strong> porösen Kalk- o<strong>der</strong> Quelltuffen, die unterhalb kalkreicher Quellen, in Quellbächen<br />
o<strong>der</strong> an Wasserfällen ausgefällt werden, sind Moose, Grünalgen, vor allem aber Cynobakterien wesentlich<br />
beteiligt. Ältere, gut verfestigte Kalktuffe werden als Travertine bezeichnet. Größere Kalktuff- bzw. Travertin-<br />
Vorkommen sind z.B. aus Polling bei Weilheim, Kohlhunden bei Marktoberdorf, Bad Urach, Bad Cannstadt<br />
(Stuttgart) o<strong>der</strong> Weimar-Ehringsdorf bekannt.<br />
Neben Cyanobakterien spielen auch höhere Algen eine wichtige Rolle als Gesteinsbildner, sowohl im Meer als<br />
auch im Süßwasser. Hierzu gehören z.B. die Steinalgen (Corallinaceen), eine bestimmte Gruppe meeresbewohnen<strong>der</strong><br />
Rotalgen (Rhodophyta), die massive, feste Kalkkrusten o<strong>der</strong> korallenähnliche Stöcke aus Mg-haltigem<br />
Calcit aufbauen können. Auf riffartigen Untiefen, wo sich die Wellen brechen, wachsen Steinalgen beson<strong>der</strong>s gut.<br />
Zusammen mit an<strong>der</strong>en Organismen (z.B. mit bestimmten Foraminiferen) überkrusten sie den Meeresboden o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>e Organismen, wie Schalen o<strong>der</strong> Korallen. Im Nummulitenkalk sind sie beson<strong>der</strong>s verbreitet, wo ganze<br />
Schichten aus kartoffelförmigen Rotalgenknollen aufgebaut sein können. Dasycladaceen (Wirtelalgen) sind eine<br />
an<strong>der</strong>e Gruppe meeresbewohnen<strong>der</strong> Algen (Grünalgen), die aragonitische Hartteile besitzen. Die gewöhnlich nur<br />
wenige Zentimeter langen Pflanzen, die aussehen wie Flaschenbürsten, bestehen aus einem Zentralfaden, von<br />
dem seitlich Wirteläste abzweigen. Der Zentralfaden überzieht sich mit Kalk (Aragonit), und nach dem Absterben<br />
<strong>der</strong> Pflanzen bleiben Kalkröhren zurück, in <strong>der</strong>en Wänden Poren zu finden sind, Durchtrittsstellen für die<br />
Wirteläste. Fossile Wirtelalgen kennt man schon aus Kalksteinen des Erdaltertums. Beson<strong>der</strong>s häufig sind sie im<br />
kalkalpinen Wettersteinkalk, wo Teile des Gesteins fast nur aus Kalkröhren von Wirtelalgen bestehen.<br />
8.4.2 Foraminiferen<br />
Einzellige Tiere aus <strong>der</strong> Verwandtschaft <strong>der</strong> Amöben, die trotz ihres formverän<strong>der</strong>lichen Weichkörpers feste, teilweise<br />
kompliziert gekammerte Schalen besitzen, werden Foraminiferen genannt. Trotz ihres formverän<strong>der</strong>lichen<br />
Weichkörpers besitzen Foraminiferen feste, kompliziert gekammerte Schalen mit einer unglaublichen Formenfülle.<br />
Ihren Namen haben sie von charakteristisch geformten, großen Poren in ihren meist winzig kleinen Gehäusen,<br />
den Foramina. Bei lebenden Tieren ist das Gehäuse von Zellplasma erfüllt, es wird aber ebenfalls von einer<br />
dünnen Schicht Zellplasma eingehüllt. Foraminiferen sind seit dem Erdaltertum bekannt, seit dem Jungpaläozoikum<br />
bis heute sehr häufig und in allen Meeren verbreitet. Manche Foraminiferen, die sog. benthonischen<br />
Formen, leben bzw. lebten am Meeresboden o<strong>der</strong> gar unter <strong>der</strong> Sedimentoberfläche. An<strong>der</strong>e Foraminiferen, die<br />
sog. planktonischen Formen, schweben in den obersten, durchlichteten Bereichen des Meerwassers. Benthonische<br />
Foraminiferen, die ihre Schalen vor allem aus. Tektin- und Kalk sowie aus zusammengeklebten Sandkörnern<br />
(sog. agglutinierende Schalen) aufbauen, sind vor allem in Flachwasserablagerungen häufig zu finden.<br />
Bei ihnen unterscheidet man die kaum 1 mm großen Kleinforaminiferen und Großforaminiferen, die mehrere<br />
Zentimetern Größe erreichen können. Manche dieser benthonischen treten o<strong>der</strong> traten in solchen Massen auf,<br />
dass sie Kalksteine aufbauen können, die man dann als Foraminiferenkalke bezeichnet. Beispiele hierfür sind<br />
etwa die Nummuliten (Nummulitenkalk) im Alttertiär o<strong>der</strong> die Fusulinen (Fusulinenkalke) im Jungpaläozoikum. Die<br />
Kalkschalen von planktonischen Foraminiferen, die immer klein sind, reichern sich hingegen bevorzugt am<br />
Grunde tiefer Schelfmeere an. Hierzu gehören z.B. die ausgestorbenen Globotruncanen aus <strong>der</strong> Oberkreide
66<br />
(Globotruncanenkalke) o<strong>der</strong> Globigerinen (Globigerinenschlamm), die während <strong>der</strong> Tertiärzeit genauso verbreitet<br />
waren wie in heutigen Meeren. Planktonische Foraminiferen spielen als Leitfossilien bei <strong>der</strong> zeitlichen Einstufung<br />
von Sedimenten eine beson<strong>der</strong>e Rolle.<br />
8.4.3 Korallen und an<strong>der</strong>e Rifforganismen<br />
Korallen sind recht primitive, mehrzellige Organismen, die wie Seefe<strong>der</strong>n, Seeanemonen o<strong>der</strong> Quallen zur Gruppe<br />
<strong>der</strong> Hohltiere gerechnet werden. Das Korallentier ist ein Polyp, <strong>der</strong> einen sackförmigen Körper mit Tentakeln<br />
und einer Mundöffnung, aber keinem After besitzt. Korallen sehen aus wie kleine Seeanemonen, leben aber nicht<br />
einzeln, son<strong>der</strong>n in großen Kolonien, oft mit Zehntausenden von Polypen, die zeitlebens durch Gewebebrücken<br />
miteinan<strong>der</strong> verbunden bleiben. Die Korallenpolypen scheiden gemeinsam mit diesen Gewebebrücken feste, aus<br />
Aragonit bestehende Skelette aus.<br />
Es gibt einige Korallenarten, die sich wie Seeanemonen ernähren, indem sie winzige Tiere und an<strong>der</strong>e Nahrungspartikel<br />
aus dem Wasser fangen und davon leben. Diese sog. ahermatypischen Korallen leben vor allem<br />
am Grund tieferer o<strong>der</strong> kühlerer Meere. Die allermeisten Korallen sind aber tropische Warmwasserformen, die in<br />
bestimmten Körperzellen symbiontische Algenzellen beherbergen, sog. Zooxanthellen. Die Algen in den Polypen<br />
dieser hermatypischen Korallen werden im seichten Wasser dem Sonnenlicht ausgesetzt, assimilieren, vermehren<br />
sich und versorgen das Wirtstier mit Zucker und Sauerstoff. Im Gegenzug verbrauchen die Zooxanthellen<br />
Kohlendioxid und an<strong>der</strong>e Abfallstoffe <strong>der</strong> Polypen. Überschüssige Algenzellen verlassen die Wirtszelle und<br />
werden verdaut. Durch diesen kurzgechlossenen Stoffkreislauf können Korallen das extrem warme und<br />
sauerstoffarme Wasser von tropischen Flachmeeren besiedeln, einen Lebensraum, <strong>der</strong> eigentlich sehr lebensfeindlich<br />
ist. Sie sind vom Nährstoffangebot und Sauerstoffgehalt des Meerwassers unabhängig und damit die<br />
wichtigsten Organismen, die primären Produzenten von Nährstoffen <strong>der</strong> Lebensgemeinschaften tropischer<br />
Korallenriffe.<br />
Mo<strong>der</strong>ne Riffkorallen gibt es seit <strong>der</strong> mittleren Triaszeit. Vereinzelt kommen Korallen tatsächlich auch schon in<br />
den Riffen des kalkalpinen Wettersteinkalkes vor. Häufig waren sie aber erst zur Zeit <strong>der</strong> Obertrias, als im Meer<br />
<strong>der</strong> Kössener Schichten richtige Korallenriffe wuchsen, die sich im kalkalpinen Oberrhätkalk erhalten haben. Eine<br />
Lebensgemeinschaft aus ganz unterschiedlichen Korallen und an<strong>der</strong>en Rifforganismen (z.B. Stromatoporen) ist<br />
im helvetischen Schrattenkalk <strong>der</strong> Unterkreide fossil geworden.<br />
8.4.4 Schnecken und Muscheln<br />
Schnecken sind sehr häufige Fossilien, die es schon seit dem Kambrium gibt. Da die asymmetrisch aufgewundenen<br />
Kalkgehäuse dieser Weichtiere hauptsächlich aus dem wenig stabilen Aragonit bestehen, wird die<br />
Schalensubstanz meist weggelöst o<strong>der</strong> ist zumindest sehr schlecht erhalten. Ganz unterschiedliche Schneckenformen<br />
kommen z.B. in den helvetischen Ablagerungen <strong>der</strong> Kreide- und Tertiärzeit sowie in kalkalpinen Kreidegesteinen<br />
vor. In den Ablagerungen <strong>der</strong> Kalkalpinen Kreide sind gelegentlich Kalksteinhoritonte zu finden, die fast<br />
nur aus dickschaligen Schneckengehäusen bestehen. Land- und Süßwasserschnecken gibt es seit dem<br />
Oberjura. Reste ihrer Schalen sind z.B. in den tertiären Molasseablagerungen häufig.<br />
Schalen von Muscheln, also von zweiklappigen Weichtieren, sind in vielen Sedimentgesteinen zu finden, gleichfalls<br />
schon seit dem Kambrium. Muschelschalen bestehen ursprünglich aus dem Calciumkarbonat Calcit, oft aber<br />
auch aus Aragonit, einer weniger stabilen Form des Calciumkarbonates. Calcitische Muschelschalen bleiben<br />
gewöhnlich gut erhalten, aragonitische dagegen nicht. Diese wandeln sich im Laufe <strong>der</strong> Zeit in Calcit um o<strong>der</strong><br />
werden ganz weggelöst. Viele Gesteine <strong>der</strong> Alpen, des Alpenvorlandes und <strong>der</strong> Alb enthalten so viele Muschelschalen,<br />
dass man sie als Lumachellen o<strong>der</strong> als Schillkalke bzw. Schillsandsteine bezeichnet, z.B. manche Horizonte<br />
in den kalkalpinen Kössener Schichten o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Meeresmolasse. Eine beson<strong>der</strong>e Gruppe von Muscheln<br />
sind Austern, Verwandte <strong>der</strong> essbaren Auster (Ostrea). Es ist eine Gruppe von beson<strong>der</strong>s dickschaligen und<br />
großwüchsigen Muscheln, die seit <strong>der</strong> Triaszeit bis heute in seichten Gewässern verbreitet sind. Im Gegensatz zu<br />
den meisten an<strong>der</strong>en Muscheln besitzen sie nur einen Schließmuskel und kein Scharnier (Schloss), dafür aber<br />
ein extrem großes Ligament, eine kräftige Scheibe aus einem gummiähnlichen, organischen Material<br />
(Conchyolin), welches die beide ungleich großen Klappen fest zusammenhält. Da die blättrigen, manchmal<br />
mehrere Zentimeter dicken und oft am Untergrund festgewachsenen Austernschalen aus Calcit bestehen, bleiben<br />
sie meist recht gut erhalten. Wegen ihrer Dickschaligkeit und <strong>der</strong> geringen Empfindlichkeit für schwankende<br />
Salzgehalte des Meerwassers sind viele Austern in <strong>der</strong> Lage, u.a. Brandungszonen, Korallenriffe, Brack-
67<br />
wasserlagunen und Flussmündungen zu besiedeln. Austern sind in vielen Meeresablagerungen <strong>der</strong> Nordalpen<br />
und des Alpenvorlandes zu finden, etwa in Konglomeraten und Sandsteinen <strong>der</strong> Oberen Meeresmolasse, im<br />
helvetischen Nummulitenkalk, Schrattenkalk o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Garschella-Formation genau so wie in den kalkalpinen<br />
Kössener Schichten. Das Vorkommen von Austernschalen spricht für eine Entstehung dieser Sedimente in<br />
bewegtem Flachwasser.<br />
8.4.5 Cephalopoden (Tintenfisch-Verwandte)<br />
In Ablagerungen des Paläozoikums sind konische, gekammerte Kalkschalen häufig, die Gehäusereste urtümlicher<br />
Tintenfisch-Verwandte darstellen, <strong>der</strong> Nautiloideen. Neben tütenförmigen o<strong>der</strong> hornförmig gekrümmten<br />
„Orthoceraten“ treten auch schneckenartig aufgerollte Gehäusetypen auf. Ähnlich gekammerte Gehäuse besitzen<br />
heute nur noch sehr urtümliche Kopffüßer, das Perlboot o<strong>der</strong> Nautilus, die einzigen noch lebenden Nautiloideen,<br />
die mit wenigen Arten im Schelfmeer <strong>der</strong> Sundainseln vorkommen. Diese Gruppe von urtümlichen Tintenfisch-<br />
Verwandten war vor allem im Ordovizium, Silur und Devon verbreitet. Aber einzelne Formen finden sich auch,<br />
zusammen mit den mo<strong>der</strong>neren aber teilweise ähnlich ausschauenden Ammoniten (siehe unten) auch im<br />
Jungpaläozoikum, Mesozoikum und im Tertiär, damals schon „lebende Fossilien“, wie Nautilus heute noch.<br />
Schalen von Nautilus-Verwandten sind z.B. in Ammoniten-reichen Ablagerungen <strong>der</strong> Jurazeit, innerhalb <strong>der</strong><br />
Kalkalpen wie im Schwäbisch-Fränkischen Jura verbreitet. Auch in den Grünsandsteinen <strong>der</strong> Mittel- und Oberkreide<br />
sowie in alttertiären Grünsandsteinen und Kalken (Nummulitenkalk) des Helvetikums sind gelegentlich<br />
Nautilusschalen zu finden.<br />
Beson<strong>der</strong>s schöne und bei Sammlern beliebte Fossilien sind die schneckenförmig eingerollten, oft mit Rippen und<br />
Knoten besetzten Schalen von Ammoniten. Beson<strong>der</strong>s viele Ammoniten sind z.B. in den kalkalpinen Allgäuschichten<br />
o<strong>der</strong> in den Glaukonitsandsteinen <strong>der</strong> Garschella-Formation im Helvetikum zu finden. Ihre sehr dünnwandigen<br />
Gehäuse waren hohl und – an<strong>der</strong>s als bei Schnecken – durch zahlreiche Querwände (Septen)<br />
gekammert. Ähnlich wie bei den Nautiloideen bestanden die Kalkschalen ursprünglich aus Perlmutt und besaßen<br />
farbige Muster. Davon ist freilich normalerweise nichts erhalten geblieben. Vielfach sind die Schalen im Laufe <strong>der</strong><br />
Zeit überhaupt aufgelöst worden und nur noch die bald nach <strong>der</strong> Einbettung mit Calcit o<strong>der</strong> Phosphorit<br />
ausgefüllten Kammern als „Steinkerne“ erhalten geblieben. Ammoniten waren nur äußerlich den urtümlichen<br />
Nautiloideen ähnlich, waren aber bedeutend höher entwickelt wie diese. Sie besaßen vermutlich besser entwickelte<br />
Augen, weniger Tentakel und Kiemen als Nautilus und waren näher mit den mo<strong>der</strong>nen Kalmaren o<strong>der</strong><br />
Tintenfischen verwandt. Über die genaue Lebensweise <strong>der</strong> Ammoniten kann man allerdings nur Vermutungen<br />
anstellen, da sie am Ende <strong>der</strong> Kreidezeit, vor ca. 65 Millionen Jahren, nachkommenlos ausgestorben sind. Da<br />
Reste <strong>der</strong> Gehäuse von Ammoniten in Seichtwasserablagerungen fehlen, waren sie vermutlich Bewohner tieferer<br />
Schelfmeere. Ammoniten spielen als Leitfossilien bei <strong>der</strong> zeitlichen Einstufung von Sedimenten zwischen dem<br />
Devon und <strong>der</strong> Oberkreide eine beson<strong>der</strong>e Rolle.<br />
Als Aptychen bezeichnet man schalenartig gewölbte Fossilien aus Kalk, die in Ablagerungen <strong>der</strong> Jura- und<br />
Kreidezeit verbreitet sind. Da Aptychen immer paarweise auftreten und glattschalige sowie berippte Formen vorkommen,<br />
erinnern sie an doppelklappig erhaltene Muschelschalen. Häufig findet man ein streng symmetrisches<br />
Paar von Aptychen im inneren von Ammonitengehäusen. Manchmal sind sogar <strong>der</strong>en Mündungen mit Aptychen<br />
verschlossen. Deshalb hielt man diese lange für Deckel von Ammoniten; tatsächlich aber handelt es sich um ihre<br />
Kieferapparate.<br />
Belemniten o<strong>der</strong> „Donnerkeile“, genauer Belemnitenrostren, sind an Bleistifte o<strong>der</strong> Projektile erinnernde Objekte<br />
aus Calcit. Sie gehören zu den häufigsten Fossilien <strong>der</strong> Jura- und Kreidezeit. Es handelt sich um spindelartige,<br />
kalkige Hartteile von Kalmar-ähnlichen Tintenfisch-Verwandten, die am Ende <strong>der</strong> Kreidezeit, vor ca. 65 Millionen<br />
Jahren, nachkommenlos ausstarben.. Diese Belemnitentiere besaßen keine Außenschale wie Ammoniten, son<strong>der</strong>n<br />
einen Stützapparat im Inneren des Weichkörpers, <strong>der</strong> das torpedoartige Hinterende <strong>der</strong> Belemnitentiere<br />
aussteifte. Dieser Stützapparat bestand aus dem zarten, tütenförmigen Phragmocon und dem schon zu Lebzeiten<br />
massiven Rostrum. Der Phragmocon war eine äußerst dünnwandige, zerbrechliche, hohle und gekammerten<br />
Kalkschale. Sie war mit Gas o<strong>der</strong> Flüssigkeit gefüllt und diente <strong>der</strong> Auftriebsregulierung, ähnlich wie die Tauchund<br />
Ballasttanks eines U-Bootes. Der Phragmocon steckte in einer konischen Höhlung (Alveole) am breiten Ende<br />
des Rostrums. Belemnitenrostren sind z.B. in den kalkalpinen Allgäuschichten o<strong>der</strong> Gesteinen <strong>der</strong> Garschella-<br />
Formation im Helvetikum zu finden. In manchen Horizonten sind sie in solchen Massen angereichert, dass man<br />
von „Belemniten-Schlachtfel<strong>der</strong>n“ spricht.
8.4.6 Trilobiten (Dreilapper)<br />
68<br />
Trilobiten (Dreilapper) sind sehr primitive Glie<strong>der</strong>füßler, die während des Erdaltertums verbreitet waren, erstmals<br />
im Unterkambrium auftreten und in <strong>der</strong> Permzeit ausstarben. Sie sind vor allem in den altpaläozoischen<br />
Ablagerungen Skandinaviens und Böhmens sowie im Rheinischen Schiefergebirge verbreitet. Die meist zwischen<br />
1 und etwa 30 cm großen Tiere besaßen mit Calcit verstärkte Chitinpanzer, die eine ausgeprägte Dreigliedrigkeit<br />
aufweisen: Ein großes Kopfschild (Cephalon), eine segmentierte, bewegliche Thorax und ein Schwanzschild<br />
(Pygidium). Am Kopfschild sind eine zentrale Aufwölbung (Glabella) und Facettenaugen unterscheidbar. Bei gut<br />
erhaltenen Exemplaren ist zu erkennen, dass Trilobiten Spaltbeine, Antennen und keinerlei Mundwerkzeuge<br />
besaßen. Trilobiten ernährten sich überwiegend als Detritusfresser, d.h. sie weideten die Sedimentoberfläche ab<br />
o<strong>der</strong> wühlten sich ins Sediment ein und fraßen den Schlamm. Viele besaßen die Fähigkeit sich bei Gefahr<br />
einzurollen. Neben winzigen, blinden Arten gab es vor allem im Devon bizarr bestachelte Formen, die riesige<br />
Facettenaugen mit Calcit-Linsen besaßen. Trilobiten spielen als Leitfossilien bei <strong>der</strong> zeitlichen Einstufung von<br />
paläozoischen Sedimenten, vor allem im Kambrium, eine hervorragende Rolle.<br />
8.4.7 Brachiopoden (Armkiemer)<br />
Die muschelartig aussehenden, teilweise glatten o<strong>der</strong> berippten Schalen von Armkiemer (Brachiopoden) sind in<br />
vielen Gesteinen <strong>der</strong> Allgäuer Alpen zu finden. Mit ihren doppelklappigen Kalkschalen erinnern Armkiemer stark<br />
an Muscheln, sind mit diesen jedoch überhaupt nicht verwandt. Bei gut erhaltenen Exemplaren erkennt man, dass<br />
die beiden Klappen, an<strong>der</strong>s als bei den meisten Muscheln, nicht gleich groß sind. Man kann eine kleinere und<br />
eine deutlich größere Klappe, die schnabelartig die kleinere überragt, unterscheiden. Am Ende dieses Schnabels<br />
befindet sich ein Loch, weswegen gelegentlich auch <strong>der</strong> Name „Lochmuschel“ verwendet wird. Im Inneren <strong>der</strong><br />
Schalen vieler Brachiopoden finden sich zudem zarte, kompliziert geformte Kalkspangen, das sog. Armgerüst,<br />
das man aber bei fossilen Formen nur sehen kann, falls <strong>der</strong> Erhaltungszustand ungewöhnlich gut ist.<br />
Im Gegensatz zu Ammoniten und Belemniten sind Brachiopoden keineswegs ausgestorben. Noch heute kommen<br />
zahlreiche Formen vor, unter an<strong>der</strong>em im Mittelmeer, in norwegischen Fjorden o<strong>der</strong> im Südatlantik vor den<br />
Falklandinseln. Es sind zwar nicht die gleichen Arten wie in <strong>der</strong> Jurazeit, aber doch nahe verwandte Formen. Da<br />
die heutigen Arten meist in tiefem Wasser o<strong>der</strong> untermeerischen Höhlen leben, werden sie bei Stürmen nicht ans<br />
Ufer geworfen. Folglich kann man ihre Schalen auch nicht zusammen mit denen von Muscheln und Schnecken<br />
am Strand aufsammeln. Von lebenden Brachiopoden wissen wir, dass sie mit einem muskulösen Stiel, <strong>der</strong> aus<br />
dem Loch in <strong>der</strong> „Stielklappe“ austritt, am Untergrund festgewachsen sind. Das kalkige Armgerüst im Inneren <strong>der</strong><br />
Schale spannt fleischige, mit feinen Tentakeln besetzte Arme auf. Mit diesem Kiemenapparat kann das Tier Nahrungspartikel<br />
aus dem Atemwasser filtern. Wie im Erdmittelalter gibt es heute noch die an Pistazien erinnernden,<br />
glattschaligen Terebrateln und die wie Lampenschirme gefalteten Rhynchonellen.<br />
Brachiopodenschalen finden wir vor allem in den triassischen Kössener Schichten o<strong>der</strong> in den bunten Jura-<br />
Schwellenkalken <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen. Im Vilser Kalk können sie in solchen Massen auftreten, dass ihre<br />
Schalen das Gestein aufbauen können und dieses dadurch einem Konglomerat ähnelt. Gelegentlich findet man<br />
Brachiopoden auch im Schrattenkalk, in den Grünsandsteinen <strong>der</strong> Garschella-Formation o<strong>der</strong> in altertiären<br />
Gesteinen des Helvetikums.
69<br />
Tabelle 4. System paläontologisch wichtiger Organismengruppen (ohne Wirbeltiere).<br />
Überreich: Procaryonta (Organismen ohne Organellen und Zellkern, RNA)<br />
Reich: Monera<br />
Stamm: Archaeobacteria<br />
Stamm: Bacteriophyta – Unterstämme: z.B. Eubakteria o<strong>der</strong> Cyanobacteria<br />
Überreich: Eucaryonta (Organismen mit Organellen und Zellkern, DNA)<br />
Reich: Fungi (Pilze)<br />
Reich: Plantae (Pflanzen)<br />
Unterreich: Thallophyta (auch Kryptogamen o<strong>der</strong> echte Algen)<br />
Stamm: Flagellatae (Geißelalgen)<br />
– z.B. Klassen: Dinoflagellata, Silicoflagellata, Coccolithophorida etc.<br />
Stamm: Acritarchen (winzige Organismenreste, viell. Dauerformen von Dinoflagellaten)<br />
Stämme: Kieselalgen, Braunalgen, Rotalgen, Grünalgen, Armleucheralgen<br />
Unterreich: Kormophyta (auch Phanerogamen o<strong>der</strong> Sproßpflanzen)<br />
Stamm: Bryophyta (Moose)<br />
Stamm: Pteridophyta (Gefäßkryptogamen)<br />
– Klassen: Nacktfarne†, Schachtelhalme, Farne, Bärlappe<br />
Stamm: Spermatophyta (Samenpflanzen) –<br />
Klasse: Gymnospermen (Nacktsamer)<br />
Unterklassen: Cycadeen, Pteridophyten†, Ginkgogewächse, Cordaïten†, Nadelbäume<br />
Klasse: Angiospermen (Blütenpflanzen o<strong>der</strong> Bedecktsamer)<br />
Unterklassen: einkeimblättrige und zweikeimblättrige Blütenpflanzen<br />
Reich: Animalia (Tiere)<br />
Unterreich: Protozoa (einzellige Tiere)<br />
Stamm: Flagellata (Geißeltierchen) – z.B. Klassen: Dinoflagellata, Silicoflagellata<br />
Stamm: Rhizopoda (Wurzelfüßler) – z.B. Klassen: Amöben,<br />
Radiolaria, Foraminifera<br />
Stamm: Ciliata (Wimpertierchen) – z.B. Klasse: Tintinnida<br />
Unterreich: Parazoa (Mesozoa, mehrzellige Tiere ohne echte Gewebe und Organe)<br />
Stamm: Porifera (Schwämme)<br />
Klassen: Hornschwämme, Glasschwämme, Kalkschwämme etc.<br />
Klasse: Archaeocyathida† (werden teilweise auch als eigener Stamm betrachtet)<br />
– vielleicht gehören auch Teile <strong>der</strong> Tabulozoa† sowie die Chaetetida† und<br />
Stromatoporoidea† in die Verwandtschaft <strong>der</strong> Porifera<br />
Unterreich: Eumetazoa (mehrzellige Tiere mit echten Geweben und differenzierten Organen)<br />
Überstamm: Protostomata (bauchseitiges Zentralnervensystem und rückenseitiges "Herz")<br />
Stamm: Acnidaria (Ctenophora, Kammquallen) (Hohltiere ohne Cnidien)<br />
Stamm: Cnidaria (Nesseltiere) (Hohltiere mit Cnidien)<br />
Klasse: Zoantharia (Anthozoa, Blumentiere) – hierher gehören z.B. die Korallen<br />
Klassen: Skyphozoa, Hydrozoa, vielleicht auch Teile <strong>der</strong> Tabulaozoa†<br />
Stamm: Mollusca (Weichtiere)<br />
Klassen: Monoplacophora, Käferschnecken, Grabfüßer<br />
Klasse: Pelecypoda (auch Lamellibranchiata, Bivalvia o<strong>der</strong> Muscheln)<br />
Klasse: Gastropoda (Schnecken) – hierher gehören u.a. auch die Pteropoden<br />
Klasse: Cephalopoda (Kopffüßer)<br />
– hierher gehören Unterklassen u.a. Nautiloidea, Ammonoidea†, u. Belemnoidea†<br />
Stamm: Annelida (Ringelwürmer)<br />
Klassen: Oligochaeta, Polychaeta<br />
Stamm: Protarthropoda – z.B. Klasse: Onychophora (Stummelfüßer)
70<br />
Stamm: Arthropoda (Glie<strong>der</strong>füßer)<br />
Unterstamm: Chelicerata (Scherenhörnler)<br />
Klassen: Pfeilschwanzkrebse, Seeskorpione†, Spinnen, Skorpione<br />
Unterstamm: Pycnogonida (Asselspinnen)<br />
Unterstamm: Trilobitomorpha† – hierher gehören u.a. die Trilobita† (Dreilapper)<br />
Unterstamm: Mandibulata<br />
Klassen: Krebse, Tausendfüßler, Insekten<br />
Stamm: Tentaculata<br />
Unterstamm: Bryozoa (Moostierchen)<br />
Unterstamm: Brachiopoda (Armfüßer)<br />
Überstamm: Deuterostomata (bauchseitiges „Herz“ und rückenseitiges Zentralnervensystem)<br />
Stamm: Branchiotremata (Hemichordata) – hierher gehören z.B. die Graptolithida†<br />
Stamm: Echino<strong>der</strong>mata (Stachelhäuter)<br />
Unterstamm: Homalozoa†<br />
Unterstamm: Crinozoa (Pelmatozoa)<br />
Klassen: Beutelstrahler†, Knospenstrahler†, Seelilien<br />
Unterstamm: Asterozoa<br />
Klassen: Schlangensterne, Seesterne<br />
Unterstamm: Echinozoa<br />
Klassen: Edrioasteroidea†, Seegurken, Seeigel<br />
Stamm: Chaetognatha (Pfeilwürmer)<br />
– mit dieser Gruppe sind vielleicht die Tiere verwandt, die Conodonten† trugen<br />
8.4.8 Seelilien und Haarsterne<br />
Viele paläozoische und mesozoische Kalksteine bestehen zum größten Teil aus weiß gefärbten Skelettresten von<br />
Seelilien o<strong>der</strong> Crinoiden, weitläufigen Verwandten <strong>der</strong> Seesterne und Seeigel. Meist findet man mühlsteinartige<br />
Stielglie<strong>der</strong>, mit denen diese Stachelhäuter am Untergrund festgeheftet waren. Am Ende des teilweise<br />
meterlangen Stieles saß das kelchförmige Tier und filterte mit fünf langen, mehrfach gegabelten Armen Nahrung<br />
aus dem Meermasser. Man weiß das deshalb so genau, weil Seelilien bis heute in größeren Meerestiefen überlebt<br />
haben. Wie alle Skelette von Stachelhäutern bestehen auch Stielglie<strong>der</strong> von Seelilien aus Calcit-Einkristallen.<br />
Das wird vor allem bei angebrochenen Stücken deutlich, <strong>der</strong>en spiegelglatte Bruchflächen nichts an<strong>der</strong>es sind als<br />
die Spaltflächen von Kalkspatkristallen. Kalkspat bricht in bestimmten Winkeln entlang ebener, spiegelglatter<br />
Spaltflächen des Kristallgitters. Bruchflächen von Kalksteinen, die reich an Crinoidenresten sind, glitzern wie<br />
Marmor und werden als Crinoidenspatkalke bezeichnet.<br />
Eine beson<strong>der</strong>e Gruppe von Crinoiden sind Schwebcrinoiden o<strong>der</strong> Haarsterne. Es handelt sich hier um Seelilien,<br />
die nur in ihrer Jugend mit einem Stiel festgeheftet sind. Die ausgewachsenen Tiere verlieren ihren Stiel und<br />
schwimmen mit Hilfe ihrer filigranen Arme frei umher. Heutige Haarsterne leben in Bodennähe, teilweise in Riffen.<br />
An<strong>der</strong>e waren planktonische Organismen, die in den obersten Wasserschichten des offenen Meeres lebten. Rot<br />
o<strong>der</strong> weiß gefärbte Crinoidenspatkalke kommen z.B. im Jura <strong>der</strong> Nördlichen Kalkalpen häufig vor, etwa<br />
Hierlatzkalk o<strong>der</strong> Vilser Kalk. Seelilienreste sind aber auch in den kalkalpinen Kössener Schichten o<strong>der</strong> im<br />
Schrattenkalk verbreitet. Kleine Schwebcrinoiden lassen sich etwa in den kalkalpinen Ammergauer Schichten<br />
nachweisen, Reste größerer Haarsterne findet man gelegentlich in den helvetischen Drusbergschichten.<br />
8.4.9 Graptolithen<br />
In vielen paläozoischen Gesteinen, die man z.B. im Rheinischen Schiefergebirge, in Böhmen o<strong>der</strong> Südskandinavien<br />
findet, sind Fossilien verbreitet, die an schwärzliche Abdrücke von Weidenblättern, Fe<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Laubsägeblättern<br />
erinnern und Graptolithen genannt werden. Sie treten vor allem in dunkel gefärbten Schiefern<br />
(Schwarzschiefer) oft als einzige Fossilien auf, die man hier finden kann. Es handelt sich um die meist kohlig<br />
erhaltenen Hartteile ausgestorbenen tierischer Organismen (Branchiothremata), einer Gruppe von relativ hoch<br />
entwickelten Tieren, die weitläufig mit den heutigen Seescheiden verwandt sind. Die winzigen, polypenartigen<br />
Tiere bildeten Kolonien, die im Paläozoikum als Teil des Planktons in den obersten, durchlichteten Wasserschichten<br />
des offenen Meeres lebten. Die Kolonien besaßen Hartteile, die ursprünglich aus einer Chitin-artigen,
71<br />
organischen Substanz bestand, die durch Inkohlung heute meistens in stark verän<strong>der</strong>ter Form vorliegt. Gut<br />
erhaltene Graptolithen lassen einen komplizierten Aufbau aus vielen becherförmigen, an Chitinfäden aufgereihten<br />
Theken erkennen, in denen die polypenartigen Tiere <strong>der</strong> Kolonien einst gelebt haben. Graptolithen waren ab dem<br />
höheren Kambrium weltweit verbreitet und starben im Karbon wie<strong>der</strong> aus. Sie spielen als Leitfossilien bei <strong>der</strong><br />
zeitlichen Einstufung von Sedimenten vor allem im Ordovizium, Silur und Devon eine entscheidende Rolle.<br />
8.5 Literaturauswahl zu den paläontologischen <strong>Grundlagen</strong><br />
BEURLEN, K. (1966): Welche Versteinerung ist das? Tabellen zum Bestimmen von Versteinerungen Mitteleuropas.– 6. Aufl., Kosmos-<br />
Naturführer, 176 S.; Stuttgart (Kosmos, Frankh-Verlag).<br />
BEURLEN, K. & LICHTER, G. (1986): Versteinerungen. Fossilien <strong>der</strong> Wirbellosen mit Anhang Wirbeltiere und Pflanzen.– In: STEINBACH, G.<br />
[Hrsg.] (1996): Steinbachs Naturführer, 287 S.; München (Mosaik Verlag)<br />
FRAAS, E. (1972): Der Petrefaktensammler. Ein Leitfaden zum Bestimmen von Versteinerungen.– Neudruck 1972, 312 S. mit<br />
ausführlichem Fossilregister, 71 Fossiltaf.; Stuttgart (Kosmos, Frankh-Verlag).<br />
LEHMANN, U. & HILLMER, G. (1980): Wirbellose Tiere <strong>der</strong> Vorzeit. Leitfaden <strong>der</strong> systematischen Paläontologie.– 340 S.; Stuttgart (Enke-<br />
Verlag).<br />
MAYR, H. (1985): Fossilien.Über 500 Versteinerungen in Farbe.– BLV Bestimmungsbuch, 125 S.; München (BLV-Verlag).<br />
MAYR, H. (1985): Versteinerungen. Häufige Fossilien von wirbellosen Tieren und von Pflanzen nach Farbfotos bestimmen.– BLV<br />
Naturführer, 255 S.; München (BLV-Verlag).<br />
SIMPSON, G.G. (1983): Fossilien.– 250 S.; Heidelberg (Spektrum-Verlag).<br />
9. ERDGESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN<br />
Schichtfolgen lassen sich zeitlich ordnen. Bei Sedimenten geht das am einfachsten mit <strong>der</strong> sog. Lageregel: Wenn<br />
die Sedimentgesteine nicht von tektonischen Deformationen betroffen worden sind, liegen ältere Sedimente unten<br />
und jüngere oben.<br />
Wenn man nach diesem Prinzip eine zeitliche Ordnung in Schichtfolgen bringt, sie nach lithologischen (gesteinskundlichen)<br />
Kriterien glie<strong>der</strong>t und beschreibt, betreibt man Lithostratigraphie. Die kleinste unterscheidbare lithostratigraphische<br />
Einheit ist die Bank, die immer aus einem bestimmten Gestein besteht und durch Bankfugen<br />
nach oben und unten abgegrenzt wird. Manche lithologisch auffällige Bänke haben Namen, z.B. die Bleiglanzbank<br />
im unteren Muschelkalk. Ihr übergeordnet ist das Glied (Formationsglied, Member), das aus vielen Bänken<br />
besteht. Dem übergeordnet ist die Formation, die aus mehreren Formationsglie<strong>der</strong>n bestehen kann, die lithologisch<br />
unterschiedlich sind. Und Formationen übergeordnet ist schließlich die Gruppe (Formationsgruppe), die<br />
aus mehreren Formationen aufgebaut ist. Bank, Glied, Formation und Gruppe sind lithostratigraphische Kategorien,<br />
die streng von <strong>der</strong> Lithologie <strong>der</strong> Gesteine im Aufschluss bestimmt werden und vom tatsächlichen Alter <strong>der</strong><br />
Gesteine weitgehend unabhängig sind. Grenzen zwische lithostratigraphischen Einheiten sind immer Grenzen<br />
zwischen unterschiedlichen Gesteinen. Wenn man im Aufschluss ein Profil nach gesteinskundlichen Kriterien aufnimmt,<br />
zeichnet und beschreibt, betreibt man also Lithostratigraphie.<br />
Man kann aber auch eine zeitliche Ordnung in Schichtfolgen bringen, wenn man das Ablagerungsalter <strong>der</strong> Gesteine<br />
mit physikalischen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Altersbestimmungsmethoden (vor allem mit Hilfe von Fossilien) direkt<br />
bestimmt. Wenn man nach diesen Prinzipien eine zeitliche Ordnung in Schichtfolgen bringt, also eine Folge von<br />
Sedimentgesteinen unabhängig von ihrer Lithologie in Zeitscheiben glie<strong>der</strong>t, nennt man das Chronostratigraphie.<br />
Die wichtigste Altersbestimmungsmethode für Sedimente stellt, seitdem es überhaupt Reste von Lebewesen<br />
häufig gibt (im sog. Phanerozoikum), die Biostratigraphie (Biochronologie) mit Hilfe von Leitfossilien dar.<br />
Man kann mit ihrer Hilfe größere und kleinere Zeitscheiben bestimmen und gegeneinan<strong>der</strong> abgrenzen, völlig un-
72<br />
abhängig von <strong>der</strong> Lithologie <strong>der</strong> Schichtfolgen. Die kleinste definierbare Zeitscheibe, in die man die Erdgeschichte<br />
glie<strong>der</strong>t, ist die Zone (Art-Zone). Zonen werden meist nach einem bestimmten Zonenleitfossil benannt, z.B.<br />
Plenus-Zone <strong>der</strong> Oberkreide nach dem Belemniten Actinocamax plenus, o<strong>der</strong> die Parkinsoni-Zone des Jura nach<br />
dem Ammoniten Parkinsonia parkinsoni. Der Jura lässt sich beispielsweise in 60 Ammonitenzonen unterglie<strong>der</strong>n,<br />
also Zeitscheiben, von denen jede im Schnitt etwas über 1 Million Jahre lang dauert. Den Zonen übergeordnet ist<br />
die Stufe. Stufen <strong>der</strong> Kreidezeit sind z.B. Cenoman, Turon, Coniac etc., Stufen des Ordoviziums sind z.B.<br />
Tremadoc, Arenig, Llanvirn etc. Stufen sind durch Fossilgruppen definiert, z.B. durch das Auftreten bestimmter<br />
Familien o<strong>der</strong> langlebigerer Arten, z.B. <strong>der</strong> mittlere Teil des Mittelkambriums durch das Vorkommen des Trilobiten<br />
Paradoxides paradoxissimus. Den Stufen übergeordnet ist die Abteilung (Serie). Abteilungen <strong>der</strong> Jurazeit sind<br />
z.B. Lias, Dogger und Malm. Abteilungen sind durch Fossilgruppen definiert, z.B. durch das Auftreten <strong>der</strong><br />
Ammonitenfamilie <strong>der</strong> Perisphinctida im Malm. Den Abteilungen übergeodnet ist das System. Systeme sind z.B.<br />
Kambrium, Ordovizium, Perm o<strong>der</strong> die Kreide. Ihre Ober- und Untergrenzen sind in <strong>der</strong> internationalen<br />
Standardglie<strong>der</strong>ung als Grenzen zwischen 2 Art-Zonen definiert, etwa die Grenze Silur / Devon als Grenze zwischen<br />
<strong>der</strong> Transgrediens- und Uniformis-Zone, die mit dem Auftreten zweier leiten<strong>der</strong> Graptolithen-Arten definiert<br />
sind (Monograptus transgrediens und Monograptus uniformis). Den Systemen <strong>der</strong> Erdgeschichte sind schließlich<br />
Äratheme übergeordnet. Äratheme sind z.B. Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum. Sie sind durch die<br />
Vorherrschaft bestimmter Tiergruppen definiert, z.B. durch die Verbreitung <strong>der</strong> Trilobiten (Paläozoikum), das<br />
beson<strong>der</strong>s häufige Auftreten von Ammoniten (Mesozoikum) o<strong>der</strong> die Vorherrschaft <strong>der</strong> Säugetiere (Känozoikum).<br />
Zonen, Stufen, Abteilungen, Systeme und Äratheme sind chronostratigraphische Kategorien, die von <strong>der</strong> Lithologie<br />
<strong>der</strong> Gesteine im Aufschluss unabhängig sind und nur vom tatsächlichen Alter <strong>der</strong> Gesteine bestimmt werden.<br />
Sie werden mit Hilfe von Leitfossilarten o<strong>der</strong> Leitfossilgruppen definiert und sind in international gültigen Standards<br />
genau festgelegt. Grenzen zwischen chronostratigraphischen Einheiten sind im Aufschluss nur in Ausnahmefällen<br />
durch einen Gesteinswechsel erkennbar und können mitten in lithologisch völlig homogen erscheinenden<br />
Schichtfolgen liegen. Wenn man im Aufschluss Fossilien o<strong>der</strong> unter dem Mikroskop Mikrofossilien sucht und<br />
damit herauszufinden trachtet, wie alt die Gesteine tatsächlich sind, betreibt man also Chronostratigraphie.
73<br />
Tabelle 5. Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erdgeschichte in Deutschland, vereinfacht.<br />
————————————————— heute ——————————————————————————————————————————————————————<br />
erste Hochkulturen<br />
Holozän (Nacheiszeit)<br />
Quartär — — — — 10300 Jahre — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —<br />
Pleistozän QUARTÄRES EISZEITALTER<br />
KÄNOZOIKUM / — 1,8 / 2,4 Millionen Jahre — — — — — — — — Neogen — — — — — — erste Menschen (Homo habilis)<br />
Pliozän<br />
erste Hominiden (Australopithecinen)<br />
ERDNEUZEIT Miozän ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Ausbreitung grasfressen<strong>der</strong> Huftiere<br />
Tertiär<br />
Oligozän<br />
Eozän Paläogen Höhepunkt <strong>der</strong> jungalpidischen Orogenese<br />
Paläozän<br />
Entwicklung und Ausbreitung <strong>der</strong> Säugetiere<br />
————————————————— 65 Millionen Jahre —————————————————————————— letzte Ammoniten, Dinosaurier und Rudisten —<br />
Oberkreide (Cenoman, Turon bis Maastricht) Höhepunkt <strong>der</strong> altalpidischen Orogenese<br />
Kreide 97,5 Mio. J. — — Grenze Mesophytikum / Känophytikum — — — — — — — — — — — — — — — — —<br />
— 144 Millionen Jahre ————————————————<br />
Unterkreide (Berrias, Valangin bis Alb)<br />
erste Laubbäume und Laubwäl<strong>der</strong><br />
MESOZOIKUM / Oberjura / Malm (Oxford, Kimmeridge, Tithon) erste Vögel, Landschnecken und Rudisten<br />
Jura<br />
Mitteljura / Dogger (Aalen bis Callovium)<br />
ERDMITTELALTER<br />
Unterjura / Lias (Hettangium bis Toarcium)<br />
— 213 Millionen Jahre ———————————————— letzte Conodonten<br />
Obertrias (Karn, Nor, Rhät)<br />
erste Säugetiere und Dinosaurier<br />
Trias Mitteltrias (Anis, Ladin) erste Hexakorallen<br />
Untertrias (Skyth)<br />
————————————————— 248 Millionen Jahre ————————————————————————————————————————————————<br />
Oberperm / Zechstein<br />
letzte Rugose Korallen und erste Nadelwäl<strong>der</strong><br />
Perm 258 Mio. J. — — Grenze Paläophytikum / Mesophytikum letzte Trilobiten — — — — — — — — — — —<br />
Unterperm / Rotliegendes<br />
Jungpaläo-<br />
— 290 Millionen Jahre ————————————— GONDWANA-VEREISUNG letzte Graptolithen<br />
Oberkarbon zoikum Höhepunkt <strong>der</strong> variszischen Orogenese<br />
Karbon 325 Mio. J. — — — — — — — erste Reptilien und Großforaminiferen<br />
Unterkarbon<br />
— 354 Millionen Jahre ———————————————————————————<br />
Oberdevon<br />
erste Amphibien, Bärlapp- und Farnwäl<strong>der</strong><br />
Devon<br />
Mitteldevon<br />
PALÄOZOIKUM / Unterdevon erste Ammoniten<br />
— 408 Millionen Jahre ——————————————— Höhepunkt <strong>der</strong> kaledonischen Orogenese<br />
ERDALTERTUM Obersilur erste Glie<strong>der</strong>füßer am Lande<br />
Silur 421 Mio. Jahre — — — — — — — Altpaläo- — erste höhere Landpflanzen (Nacktfarne) — —<br />
Untersilur<br />
erste echte Fische<br />
— 438 Millionen Jahre ———————————————— zoikum<br />
SAHARA-VEREISUNG<br />
Oberordovizium<br />
Ordovizium Mittelordovizium erste Korallen und Wirbeltiere (Kieferlose)<br />
Unterordovizium<br />
erste Ostrakodenr und Seelilien<br />
— 505 Millionen Jahre ————————————————<br />
Oberkambrium<br />
Kambrium Mittelkambrium letzte Archaeocyathidenr<br />
Unterkambrium<br />
erste Kopffüßer, Moostiechen und Graptolithen<br />
erste Trilobiten und reiche marine Faunen<br />
————————————————— 540 / 570 Millionen Jahre ———————————————————————— Höhepunkt <strong>der</strong> cadomischen Orogenese —<br />
Wendium / Sinium<br />
PROTEROZOIKUM Riphäikum<br />
WARÄGISCHE VEREISUNG erste mehrzellige Lebewesen (Ediacara-Fauna)<br />
— ca. 800 Millionen Jahre —————————————————————————<br />
erste Einzeller (Eucaryonten)<br />
— ca. 1600 Millionen Jahre —————————————————————————<br />
Karelium / Hudsonium<br />
Stromatolithen<br />
————————————————— ca. 2500 Millionen Jahre ——————————————————————————————————————————————<br />
ARCHÄIKUM<br />
erste primitive Lebewesen (Procaryonten)<br />
— — — — — — — — — — — — — ca. 4500 Millionen Jahre — — — — — — — — — — — — — — — — — —
74<br />
9.1 Ablauf <strong>der</strong> Erdgeschichte in groben Zügen<br />
Die Erde ist wahrscheinlich vor etwa 4,5 Ga (Milliarden Jahren) durch Akkretion von Staub und Gasen in<br />
unmittelbarer Nähe <strong>der</strong> Sonne zusammen mit den meisten an<strong>der</strong>en Planeten entstanden. Die ältesten<br />
metamorphen Gesteine, die wir bisher kennen, stammen aus Australien und sind nach radiometrischen Bestimmungen<br />
etwa 4,1 Ga alt, die ältesten Sedimentgesteine stammen aus Grönland und haben ein radiometrisch<br />
ermitteltes Ablagerungsalter von 3,7 Ga. Sie enthalten bereits organisches Material, bei dem es sich um Reste<br />
früher Lebewesen (Bakterien) handelt. Die frühe Atmosphäre <strong>der</strong> Erde im Archäikum dürfte CH 4 , NH 3 , H 2 O und<br />
H 2 und keinen freien Sauerstoff enthalten haben. Durch Höhenstrahlung, UV-Strahlung, Vulkanismus und durch<br />
die Photosynthese <strong>der</strong> schon vor mehr als 3 Ga im Meer lebenden photoautothrophen Bakterien, vor allem durch<br />
Cyanobakterien („Blaualgen“), verän<strong>der</strong>te sich diese Atmosphäre. Es reicherten sich langsam mit CO 2 , N 2 und O 2<br />
an, während <strong>der</strong> Gehalt an CH 4 und NH 3 immer mehr abnahm. Sichtbare Spuren <strong>der</strong> Tätigkeit von Organismen<br />
sind die seit mehr als 3,3 Ga verbreiteten Stromatolithe, geschichtete Karbonate mit komplexen Feinstrukturen,<br />
die von Cyanobakterien ausgefällt worden sind. Der Sauerstoff, den diese Bakterien produzierten, wurde größtenteils<br />
durch Oxidation von im Meerwasser gelöstem Eisen verbraucht, bevor er in die Atmosphäre entweichen<br />
konnte. Auf diese Weise entstanden im Zeitraum zwischen 3,7 und 2,2 Ga am Meeresboden sog. Quarzgebän<strong>der</strong>te<br />
Eisenerze (Banded Iron Formation, BIF). An solche BIFs sind die größten Eisenerzlagerstätten gebunden.<br />
Trotzdem stieg <strong>der</strong> O 2 -Gehalt <strong>der</strong> Atmosphäre langsam an und war vor etwa 1,4 Milliarden Jahren erstals groß<br />
genug (0,1% <strong>der</strong> heutigen Konzentration), dass am Festland rot gefärbte Sedimente (Red Beds) entstanden. Kurz<br />
vor Beginn des Kambriums scheint <strong>der</strong> O 2 -Gehalt <strong>der</strong> Atmosphäre und des Meeres Werte um 1% <strong>der</strong> heutigen<br />
Konzentration erreicht zu haben, was die explosionsartige Ausbreitung höher organisierter Organismen überhaupt<br />
erst ermöglichte. Im Silur und Devon begünstigten hohe CO 2 -Konzentrationen und ein O 2 -Gehalt von etwa 10%<br />
des heutigen die Ausbreitung <strong>der</strong> Landpflanzen (Beginn des Paläophytikums), die Entstehung erster Wäl<strong>der</strong> und<br />
die Besiedlung des Festlandes durch die ersten Spinnen, Skorpione, Insekten (Schaben) und Amphibien. Im<br />
Karbon scheint die O 2 - und CO 2 -Konzentration Werte erreicht zu haben, die <strong>der</strong> heutigen entspricht o<strong>der</strong> sogar<br />
noch etwas darüber lag. Die ersten Reptilien entwickelten sich im Oberkarbon, die ersten Säugetiere in <strong>der</strong><br />
Obertrias und die ersten Vögel im Jura.<br />
Das Klima <strong>der</strong> Erde war über lange Zeiträume hinweg bedeutend wärmer und ausgeglichener als heute, d.h. es<br />
gab keine vereisten Pole und keine so großen Klimagegensätze zwischen Äquator und Polen. Es sind aber auch<br />
vergleichsweise kürzere Perioden nachweisbar, in denen die Pole vergletscherten und das Klima in den Polargebieten<br />
ähnlich rauh war wie heute und während des ganzen quartären Eiszeitalters. Im südlichen Afrika, Südamerika,<br />
Indien, Australien und <strong>der</strong> Antarktis lassen sich im Oberkarbon und Perm polare Eiskappen nachweisen<br />
(Permokarbone o<strong>der</strong> Gondwana-Vereisung). Im oberen Ordovizium und im unteren Silur lässt sich eine Eiskappe<br />
in Nordafrika nachweisen (Sahara-Vereisung). Beson<strong>der</strong>s massiv scheint eine Vereisung im jüngsten Abschnitt<br />
des Präkambriums kurz vor Beginn des Kambriums gewesen zu sein (Varanger- bzw. Eokambrische Vereisung),<br />
die weltweit nachweisbar ist und zu einer Vergletscherung aller größeren Festlandskerne geführt hat.<br />
9.2 Literaturauswahl zu den erdgeschichtlichen <strong>Grundlagen</strong><br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1981): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:500000.– 168 S., 1 geol.<br />
Kt. 1:500000; München.<br />
KRÖMMELBEIN, K. (1986): Historische <strong>Geologie</strong>.– Stuttgart (Enke).<br />
SCHOLZ, H. (1995): Bau und Werden <strong>der</strong> Allgäuer Landschaft.– 305 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
STANLEY, S.M. (1994): Historische <strong>Geologie</strong>.– Heidelberg, Berlin, Oxford (Spektrum).<br />
WAGNER, G. (1950): Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte.– Öhringen; (Hohenlohesche Buchh.).
75<br />
10. GRUNDLINIEN EINER REGIONALEN GEOLOGIE<br />
VON DEUTSCHLAND<br />
Der Untergrund Deutschlands lässt sich – geologisch betrachtet – in mindestens drei übereinan<strong>der</strong>liegende<br />
Stockwerke glie<strong>der</strong>n:<br />
1. Ein tiefstes, ältestes Stockwerk, das aus Kristallingesteinen und Sedimentgesteinen aufgebaut wird. Es handelt<br />
sich um schwach bis nicht metamorphe Sedimentgesteine (Schiefer, Grauwacken, Kalksteine), hochgradige<br />
Metamorphite (Granulite, Gneise, Amphibolite, Glimmerschiefer, Marmore, Serpentinite etc.), Vulkanite (Quarzporphyre,<br />
Keratophyre, Diabase, Melaphyre etc.) und Tiefengesteine (Granite, Diorite, Gabbros etc.). Diese<br />
Gesteine sind vor allem während des Erdaltertums (Paläozoikum), vor mehr als 300 Jahrmillionen in ihrer heutigen<br />
Form entstanden, vielfach durch Metamorphose älterer (alt- und jungpaläozoischer, aber auch präkambrischer)<br />
Sedimentgesteine und Vulkanite.<br />
2. Über einer welligen Erosionsfläche folgt ein höheres und jüngeres Stockwerk, das aus mächtigen, mehr o<strong>der</strong><br />
weniger verfestigten Ablagerungen (Sedimentgesteinen) von verlandeten Meeren und längst versiegten Flüssen<br />
besteht, die größtenteils im Jungpaläozoikum, in <strong>der</strong> Trias, im Jura, in <strong>der</strong> Kreide und im Tertiär entstanden sind,<br />
also in einem Zeitraum, <strong>der</strong> zwischen etwa 300 und 10 Millionen Jahren zurückliegt. Aussehen und Lagerung<br />
dieser Gesteine haben sich in <strong>der</strong> jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit, also während <strong>der</strong> letzten<br />
Jahrmillionen, kaum mehr entscheidend verän<strong>der</strong>t.<br />
3. Über einer welligen, auf- und absteigenden Erosionsfläche folgt schließlich ein höchstes und jüngstes Stockwerk<br />
aus den meist lockeren Ablagerungen des Quartärs, die in <strong>der</strong> Eiszeit von den Gletschern und ihren<br />
Schmelzwässern sowie während <strong>der</strong> Nacheiszeit gebildet wurden bzw. teilweise sogar heute noch gebildet werden.<br />
Sie sind selten älter als einige Jahrhun<strong>der</strong>ttausende, verglichen mit den Gesteinen des tieferen Stockwerkes<br />
also noch recht jung. Wie ein löchriges Tuch verhüllen diese quartären Bildungen, die bisweilen mehrere Dekameter<br />
mächtig werden können, die Gesteine des tieferen Stockwerkes, die meist nur in tief eingeschnittenen Erosionstälern,<br />
an Prallhängen von Flüssen, an Steilhängen, Wänden und Berggipfeln an die Erdoberfläche kommen<br />
und nur hier einer direkten Beobachtung zugänglich sind.<br />
10.1 Der paläozoische Sockel Deutschlands<br />
Das älteste, vor allem aus Schiefern und kristallinen Gesteinen bestehende Stockwerk ist größtenteils nicht direkt<br />
sichtbar, son<strong>der</strong>n weitflächig von mächtigen jungpaläozoischen, mesozoischen und/o<strong>der</strong> tertiären Sedimentgesteinen<br />
bedeckt. Diese Gesteine liegen meist Hun<strong>der</strong>te o<strong>der</strong> gar Tausende von Metern tief unter <strong>der</strong> Erdoberfläche,<br />
sind hier aber bei zahlreichen Tiefbohrungen immer wie<strong>der</strong> angetroffen worden. Wo die überlagernden<br />
jüngeren Sedimentgesteine aber durch Hebung und Erosion entfernt wurden, kommen die darunterliegenden<br />
älteren Schiefer und Kristallingesteine zum Vorschein und sind dann an <strong>der</strong> Erdoberfläche direkt zugänglich: im<br />
Schwarzwald, in den Vogesen, im Odenwald, Spessart, im Rheinischen und Thüringischen Schiefergebirge, Harz,<br />
Frankenwald, Fichtelgebirge, Erzgebirge, Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald. Es handelt sich vor allem<br />
um unterschierdlich stark metamorphe Gesteine, um verschiedene Gneise, Amphibolite, Quarzite, Marmore,<br />
Glimmerschiefer und Phyllite. Im Schwarzwald und in <strong>der</strong> Oberpfalz findet man vereinzelt auch Serpentinite.<br />
Daneben spielen aber auch schwächer bis gar nicht metamorphe Tonschiefer, Sandsteine und Kalksteine eine<br />
wichtige Rolle.<br />
Auch die Metamorphite waren ursprünglich einmal größtenteils Sedimentgesteine, die während des Paläozoikums<br />
(vor allem im Karbon) unter hohen Drücken deformiert, in einer durchgreifenden Metamorphose aufgeheizt und in<br />
metamorphe Gesteine umgewandelt worden sind. Deformation und Metamorphose werden einer Gebirgsbildung<br />
im Paläozoikum zugerechnet, <strong>der</strong> sog. Variszischen Orogenese, die ihren Höhepunkt im Karbon erreichte. Die<br />
Aufheizung ging stellenweise so weit, dass die Gesteine aufschmolzen, die neu entstandenen Gesteinsschmelzen<br />
in höhere Krustenstockwerke intrudierten (eindrangen) und hier erstarrten. Über die Entstehung <strong>der</strong><br />
Varisziden macht man sich folgende Vorstellungen:
76<br />
Zu Beginn des Paläozoikums existierte im Gebiet des heutigen Europas, zwischen dem Gondwanakontinent und<br />
Ureuropa (Baltica) ein kompliziert geglie<strong>der</strong>tes Meer, das auch als Paläo- o<strong>der</strong> Prototethys bezeichnet wird. In<br />
diesem Meeresraum gab es neben Bereichen mit ozeanischer auch "Mikrokontinente" mit kontinentaler Kruste. In<br />
kühlen Klimaperioden des Altpaläozoikums (Kambrium, Ordovizium) wurden hier Sand- und Tonsteine (heute<br />
Quarzite und Tonschiefer) abgelagert. Am Nordrand dieses Meeres schütteten Flüsse ausgedehnte Deltas vor. In<br />
beson<strong>der</strong>s tiefen Becken entstanden Graptolithen- und Kieselschiefer (Lydite). Als in extrem kalten Perioden des<br />
Oberordoviziums Teile Gondwanas vergletschert waren (Sahara-Vereisung), lagerten im Meer driftende Eisberge<br />
glazigene Sedimente (Gerölltone, sog. Le<strong>der</strong>schiefer) ab. Durch stetige Absenkung <strong>der</strong> Sedimentationsbecken<br />
und <strong>der</strong> damit verbundenen Dehnung und Krustenausdünnung kam es im Devon zu einem intensiven<br />
Vulkanismus. Es entstanden die Spilite und Keratophyre des Rheinischen Schiefergebirges, Thüringens und des<br />
Harzes. In wärmeren Abschnitten (z.B. im Mitteldevon) wuchsen am Schelf und auf vulkanischen Inseln dieses<br />
Meeres ausgedehnte Riffe.<br />
Im Laufe des Paläozoikums wurde <strong>der</strong> ozeanische Raum immer kleiner, da sich Gondwana und Ureuropa aufeinan<strong>der</strong><br />
zubewegten. Es kam zu einer Einengung des Sedimentationsraumes, zu einer Faltung <strong>der</strong> Gesteine und<br />
<strong>der</strong> Bildung tektonischer Decken. Vor seiner endgültigen Schließung wurde von den Rän<strong>der</strong>n her und vor den<br />
nach N vorrückenden Deckenstirnen im Unterkarbon <strong>der</strong> sog. Kulm in die Restbecken eingeschüttet, Schichtfolgen<br />
aus Grauwacken, Konglomeraten und Schiefern, die mit den Flysch-Sedimenten in den Alpen vergleichbar<br />
sind. Gleichzeitig entstanden in den angrenzenden Epikontinentalmeeren Flachwasserkalke (Kohlenkalk), die<br />
z.B. in Belgien, im Ruhrgebiet o<strong>der</strong> in England erhalten geblieben sind. Im Oberkarbon griffen die <strong>der</strong> Faltung des<br />
Beckeninhaltes vorauseilenden Senkungsbewegungen auf die randlichen Schelfe im N über. In Norddeutschland<br />
und den westlich anschließenden Gebieten bildete sich ein Sedimentationsbecken heraus, das als subvariszische<br />
Vortiefe bezeichnet wird. Dieses Becken, genauso wie einige Senken innerhalb des Gebirges selbst (z.B.<br />
im Saarland), wurden mit dem Abtragungschutt des aufsteigenden variszischen Gebirges gefüllt, <strong>der</strong> von S her in<br />
Form von Deltas eingeschüttet wurde. Im Gebiet dieser ausgedehnten Deltaflächen wuchsen im Oberkarbon<br />
Sumpfwäl<strong>der</strong>, <strong>der</strong>en organische Substanz bis heute z.B. in Oberschlesien, im Ruhrgebiet o<strong>der</strong> in Belgien als<br />
Kohleflöze ("produktives Karbon") erhalten geblieben.<br />
Der Höhepunkt <strong>der</strong> variszischen Gebirgsbildung fand im Karbon statt und ist mit einer Faltung, Schieferung<br />
und einer teilweise kräftigen Metamorphose verbunden. Im Oberkarbon und im untersten Perm stiegen saure<br />
Gesteinsschmelzen in höhere Krustenstockwerke <strong>der</strong> Varisziden auf. Deshalb werden heute große Flächen <strong>der</strong><br />
Kristallingebiete (z.B. im Schwarzwald, im Erzgebirge, in <strong>der</strong> Oberpfalz) von spätvariszischen Tiefengesteinen<br />
eingenommen, vor allem von oft porphyrischen Graniten, Dioriten und an<strong>der</strong>en. Das Orogen entwickelte sich<br />
dabei von innen (S) nach außen (N) fortschreitend; die externen Bereiche im N wurden also später deformiert. Im<br />
höchsten Oberkarbon wurden schließlich auch die Sedimente im südlichsten Teile <strong>der</strong> subvariszischen Saumtiefe<br />
gefaltet. Mit Abschluss <strong>der</strong> variszischen Orogenese war <strong>der</strong> Superkontinent Pangaea entstanden, eine große<br />
Kontinentalmasse, die den größten Teil aller damaligen Kontinente zu einem riesigen Festland vereinte.<br />
Viele Gesteine <strong>der</strong> Varisziden werden von hydrothermalen Gängen durchschlagen. Dabei handelt es sich um<br />
mineralgefüllte Spalten, die vor allem Quarz, Feldspat, Calcit, Fluorit, Hämatit, Baryt, Bleiglanz, Zinkblende, Pyrit,<br />
Kupferkies und viele an<strong>der</strong>e Sulfide, Karbonate, Phosphate sowie Sulfate enthalten können. Einige dieser Gänge<br />
sind früher bergmännisch abgebaut worden, vor allem um die darin vorkommenden Buntmetall-Erze zu gewinnen.<br />
Der Erzbergbau spielt heute keine Rolle mehr. Allerdings werden noch einige Quarz- und Feldspatgänge (Pegmatite)<br />
für die Glas- und Keramikindustrie sowie Schwerspatgänge für die Papierindustrie abgebaut.<br />
10.2 Das Rotliegende und <strong>der</strong> Zechstein<br />
Mit dem Aufhören <strong>der</strong> einengenden Tektonik und <strong>der</strong> Metamorphose im Bereich des Variszischen Gebirges an<br />
<strong>der</strong> Wende vom Karbon zum Perm endet diese Orogenese. Das in <strong>der</strong> Karbonzeit entstandene Gebirge wurde<br />
noch während des Jungpaläozoikums wie<strong>der</strong> abgetragen und stellenweise völlig eingeebnet. Im Laufe von Oberkarbon<br />
und unterem Perm wurde diese Rumpffläche in Horste und Gräben geglie<strong>der</strong>t, die entlang von E-W- o<strong>der</strong><br />
WSW-ENE-streichenden Störungen einsanken bzw. herausgehoben wurden. Damit wurde <strong>der</strong> Zerfall Pangaeas<br />
eingeleitet. Die tief einsinkenden jungpaläozoischen Gräben nahmen den Abtragungsschutt des variszischen<br />
Gebirges auf, <strong>der</strong> hier in Form von Sandsteinen, Arkosen, Tonsteinen, Konglomeraten und Brekzien (Fanglomeraten)<br />
abgelagert wurde. Diese tiefen sog. Permokarbontröge nahmen teilweise hun<strong>der</strong>te, stellenweise sogar<br />
mehr als 1000 m dieser bunt gefärbten klastischen Ablagerungen auf. Sie entstanden unter einem wüstenhaften
77<br />
Klima und werden als „Rotliegendes“ bezeichnet, obwohl sie nicht nur aus dem unteren, son<strong>der</strong>n teilweise auch<br />
aus dem oberen Perm o<strong>der</strong> gar dem Oberkarbon stammen.<br />
Der größte Teil Süddeutschlands blieb auch im oberen Perm noch ein wüstenhaftes Festland, als im Nordseeraum<br />
und damit auch in Norddeutschland vorübergehend das Meer eingedrungen war, das Zechsteinmeer, in<br />
dem große Salzlagerstätten entstanden (siehe unten). An <strong>der</strong> Erdoberfläche sind die bunten Ablagerungen des<br />
Rotliegenden nur dort sichbar, wo die Erosion darüberliegende, jüngere Ablagerungen entfernt hat, im<br />
Nordschwarzwald, im Saarland, in Nordbayern o<strong>der</strong> Thüringen. Bei Tiefbohrungen hat man festgestellt, dass sie<br />
wesentlich weiter verbreitet sind, als es auf geologischen Karten ersichtlich ist.<br />
Die Störungen wurden vor allem in <strong>der</strong> unteren Permzeit stellenweise als Aufstiegswege von Magmen verwendet,<br />
die an <strong>der</strong> Erdoberfläche in Form von Lavadecken, Ignimbriten und vulkanischen Tuffen erstarrten. Diese<br />
jungpaläozoischen Vulkanite sind als Quarzporphyre und Melaphyre bis heute erhalten geblieben. Die genaue<br />
Verbreitung dieser Gesteine kann den einschlägigen geologischen Karten entnommen werden.<br />
In <strong>der</strong> oberen Permzeit kam von N her das Meer ins Nordseebecken zurück, überflutete große Teile von Norddeutschland<br />
und drang bis in den nordbayerischen Raum vor. Da dieses Zechsteinmeer nur über einen<br />
schlauchförmigen Meeresarm mit dem Weltmeer verbunden und zeitweise auch komplett abgeschnürt war, entstanden<br />
hier unter einem heißen, ariden Klima Evaporite, vor allem Gips und Steinsalz, untergeordnet auch<br />
Kalisalz. Am Südrand des Zechsteinmeeres wurden teilweise auch Ton und Dolomit abgelagert. Beson<strong>der</strong>e wirtschaftliche<br />
Bedeutung hatten früher schwarze, bituminöse und Cu- und Ag-sulfidreiche Tone im untersten<br />
Zechstein, <strong>der</strong> sog. Mansfel<strong>der</strong> Kupferschiefer. Hatten die Evaporite schon primäre Mächtigkeiten von stellenweise<br />
mehreren hun<strong>der</strong>t Metern, schwollen sie nachträglich noch bedeutend an, da sie im Laufe des Mesozoikums<br />
von zunehmend mächtiger werdenden Sedimenten überdeckt wurden. Durch Halokinese (Salztektonik)<br />
entstanden mit <strong>der</strong> Zeit mächtige Salzkissen, die schließlich als Salzdiapire o<strong>der</strong> Salzmauern überlagernde<br />
Schichten durchbrachen und teilweise bis an die Erdoberfläche vordrangen. An solche Salzdiapire, die als Endlager<br />
für atomaren Abfall in Diskussion sind, sind auch viele Erdöl- und Erdgaslagerstätten in Norddeutschland<br />
gebunden.<br />
10.3 Die Gesteine des Schwäbisch-Bayerischen Stufenlandes<br />
In <strong>der</strong> Untertrias griff die Ablagerung bunt gefärbter Sandsteine, Tonsteine und Konglomerate von den Permokarbontrögen<br />
auf die Kristallinschwellen zwischen den Permokarbontrögen über, die bisher noch nicht von Sedimenten<br />
bedeckt waren. Große Teile Süddeutschlands wurden damit zu einem einheitlichen Ablagerungsraum, in<br />
dem <strong>der</strong> Buntsandstein entstand, größtenteils unter einem ziemlich trockenen Klima entststandene Flussablagerungen.<br />
Das in das Becken geschüttete Material stammte aus Abtragungsgebieten mit Kristallingesteinen, die<br />
das Buntsandsteinbecken im SW (Gallisches Land), im S (Vindelizisches Land) und im SE (Böhmische Masse)<br />
umrahmten. Am Rande des Beckens in <strong>der</strong> Nähe dieser Abtragungsgebiete enthält <strong>der</strong> Buntsandstein<br />
Konglomerate und feldspatreiche Sandsteine. Außerdem sind in den Buntsandstein immer wie<strong>der</strong> karneolhaltige<br />
Dolomithorizonte eingeschaltet, die durch Bodenbildung bei Sedimentationsunterbrechungen im Buntsandsteinbecken<br />
entstanden. Im Zentrum des Beckens in Süddeutschland, zwischen dem Nordschwarzwald und Mittelfranken,<br />
erreicht <strong>der</strong> Buntsandstein Mächtigkeiten bis über 600 m.<br />
In <strong>der</strong> Mitteltrias drang in dieses Becken vorübergehend das Meer ein und <strong>der</strong> meist grau gefärbte Muschelkalk<br />
entstand. Im Muschelkalkmeer, einem recht salzhaltigen Nebenmeer <strong>der</strong> Tethys, wurden zunächst vor allem<br />
Mergel und Kalksteine abgelagert (Unterer Muschelkalk). Vorübergehend verlor dieses Nebenmeer seine Verbindung<br />
zum Weltmeer, dampfte teilweise ein und es entstanden Evaporite (Mittlerer Muschelkalk); vor allem wurden<br />
Gips und Anhydrit, teilweise sogar Steinsalz abgelagert, das z.B. in Schwäbisch Hall bergmännisch gewonnen<br />
wurde. Im jüngsten Abschnitt <strong>der</strong> Mitteltrias wurden schließlich dickbankige, teilweise fossilreiche Kalksteine und<br />
Dolomite mit Resten von Brachiopoden, Muscheln, Seelilien, Ammoniten und im Wasser lebenden Reptilien<br />
(Nothosaurus, Placodus) abgelagert (Oberer Muschelkalk). Die Gesamtmächtigkeit des Muschelkalkes beträgt<br />
kaum mehr als 250 m.<br />
In <strong>der</strong> Obertrias zog sich das Meer aus Süddeutschland größtenteils wie<strong>der</strong> zurück. In Brackwasserseen, Lagunen,<br />
Deltas, Salzpfannen (Sabkhas) und am Festland wurden teilweise graue, oft aber auch bunt gefärbte Tone,<br />
Kalkmergel mit Sandstein-, Gips- und Kohleeinschaltungen abgelagert, eine bis zu 500 m mächtige Schichtfolge,<br />
die man Keuper nennt. Der Keuper wird von unten nach oben in den Lettenkeuper (mit Kohleflözen), den<br />
Gipskeuper (mit teilweise abbauwürdigen Gipslagern) und den Sandsteinkeuper (mit mehreren mächtigen Sand-
78<br />
stein-Einschaltungen) unterglie<strong>der</strong>t. Aus dem Keuper stammen übrigens die ältesten Skelettreste von Dinosauriern<br />
(Plateosaurus). Der oberste Keuper wird schließlich vom marinen Rhät-Sandstein gebildet.<br />
Die Transgression des Jurameeres begann im westlichen Süddeutschland also schon in <strong>der</strong> obersten Triaszeit,<br />
war aber erst im untersten Jura völlig abgeschlossen. Während <strong>der</strong> Jurazeit war ganz Mitteleuropa mehr als 60<br />
Millionen Jahre lang bis auf ein paar Inseln vom Jurameer bedeckt. Hier wurden im unteren Jura, dem Lias, vor<br />
allem Mergel mit Kalkbänken und Tone abgelagert. Da dieses Meer teilweise schlecht durchlüftet, das Bodenwasser<br />
teilweise völlig frei von Sauerstoff war, entstanden hier vor allem dunkle, teilweise bituminöse Ablagerungen,<br />
die ausgezeichnet erhaltene Reste von Ammoniten, Belemniten, Fischen und im Wasser lebenden Reptilien<br />
(Ichthyosaurus, Plesiosaurus) enthalten. Abschnittsweise sind die Ablagerungen dieses Schwarzen Jura so reich<br />
an Öl, dass die Ölschiefer brennen, wenn man sie anzündet (Posidonienschiefer).<br />
Im mittleren Jura, dem Dogger, wurden im seichten Wasser des Jurameeres vor allem Tone, Mergel mit Kalksteinbänken<br />
und limonitische, bräunliche Sandsteine abgelagert (Eisensandstein). Neben zahlreichen ausgezeichnet<br />
erhaltenen Fossilien (Ammoniten, Belemniten, Muscheln etc.) enthält diese Schichtfolge des Braunen<br />
Jura gelegentlich Brauneisenerze. Flöze dieser oolithischen Eisenerze wurden früher bei Aalen o<strong>der</strong> Blumberg<br />
sowie an vielen an<strong>der</strong>en Stellen <strong>der</strong> Alb bergmännisch abgebaut und verhüttet.<br />
Im oberen Jura, dem Malm, wurden vor allem helle Mergel und fossilreiche weiße Kalksteine abgelagert. Die<br />
meisten Gesteine dieses Weißen Jura sind am Boden eines flachen, tropisch warmen Schelfmeeres, teilweise<br />
sogar in Korallenriffen entstanden. Reste <strong>der</strong> Ammoniten, Belemniten, Brachiopoden, Fische, Schwämme und<br />
Korallen, die in diesem Meer gelebt haben, sind vielfach ausgezeichnet erhalten geblieben. Die Kalksteine und<br />
Mergel werden in zahlreichen Steinbrüchen zur Zementherstellung gebrochen. Im obersten Jura zog sich das<br />
Meer aus großen Teilen Mitteleuropas zurück. Bei <strong>der</strong> Regression des Meeres an <strong>der</strong> Wende vom Jura zur Kreidezeit<br />
entstanden im N wie im S Deutschlands ausgedehnte Gipsvorkommen (Purbeck).<br />
10.4 Die Kreide- und Tertiärbecken in Deutschland<br />
Nachdem sich das Meer am Ende <strong>der</strong> Jurazeit zurückgezogen hatte, blieben große Teile Süd- und Mitteldeutschlands<br />
bis heute landfest und wurden seither nur noch abgetragen. Im Osten Bayerns, im Bereich des Alpenvorlandes,<br />
im Oberrheingebiet und in Norddeutschland kehrte das Meer nochmal in <strong>der</strong> oberen Kreidezeit bzw. in <strong>der</strong><br />
Tertiärzeit zurück und hinterließ hier entsprechende marine Ablagerungen.<br />
10.4.1 Kreide und Tertiär im Norddeutschen Tiefland<br />
Nach dem Verschwinden des Jurameeres entstanden im Bereich des Norddeutschen Tieflandes und des Nordseebeckens<br />
große Süß- und Brackwasserseen, in denen vor allem Tone und Sande abgelagert wurden (Wealden).<br />
In <strong>der</strong> Mittel- und Oberkreide begann das Meer, sowohl in Norddeutschland als auch im Gebiet des östlichen<br />
Alpenvorlandes und Ostbayerns, wie<strong>der</strong> vorzudringen. In Norddeutschland und im Nordseebecken wurden<br />
in <strong>der</strong> Mittelkreide zunächst glaukonitreiche marine Quarzsandsteine und Tone abgelagert (Gault), in <strong>der</strong> Oberkreide<br />
dann die Schreibkreide, die etwa das Kliff von Rügen aufbaut. Diese Gesteine sind als Kalkschlamm in<br />
einem tiefen, warmen Meer abgelagert worden und werden stellenweise fast 3000 m mächtig. Aus diesen weichen<br />
und weißen Kalken sind ungewöhnlicherweise größtenteils keine diagenetisch verfestigten Kalksteine geworden.<br />
Sie enthalten dafür Lagen aus glasharten Feuersteinknollen, die darin auf chemischem Wege während<br />
<strong>der</strong> Diagenese entstanden sind. Nach S zu werden die Kalke <strong>der</strong> Schreibkreide fester (Plänerkalk) und gehen<br />
schließlich in Sandsteine über, eine küstennahe Bildung des Oberkreidemeeres. Aus diesem gleichfalls <strong>der</strong><br />
Oberkreide angehörenden Qua<strong>der</strong>sandstein besteht das Elbsandsteingebirge. Gleiches Alter haben auch große<br />
Vorkommen von Brauneisenerzen, die sog. Trümmereisenerze, hervorgegangen aus umgelagerten kreidezeitlichen<br />
Verwitterungsbildungen. Sie wurden früher bei Salzgitter bergmännisch abgebaut.<br />
In <strong>der</strong> Tertiärzeit wurden, abgesehen vom allertiefsten Teil, wo teilweise noch Kalksteine entstanden (Bryozoenkalk),<br />
vor allem Sande und Tone abgelagert, teilweise im Meer, teilweise auch im Süßwasser. Diese Ablagerungen<br />
können in einigen Senkungsgebieten gleichfalls erhebliche Mächtigkeiten erreichen. In <strong>der</strong> Kölner Bucht, im<br />
Thüringer Becken o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Lausitz sind in diese alt- bzw. jungtertiären Ablagerungen Braunkohleflöze eingelagert,<br />
die teilweise erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Der alttertiäre, poröse Bryozoenkalk (Dan) ist<br />
eines <strong>der</strong> wichtigsten Speichergesteine für Erdöl und Erdgas im Nordseebecken.
10.4.2 Kreide in Ostbayern und unter dem Molassebecken<br />
79<br />
Im östlichen Teil des Alpenvorlandes begann das Meer in <strong>der</strong> höheren Unterkreide nach N vorzustoßen. Es drang<br />
über die Oberpfalz bis nach Nordböhmen vor, wo es in <strong>der</strong> Oberkreide im Gebiet des Elbsandsteingebirges mit<br />
dem Kreidemeer im Norddeutschland in Verbindung stand. Die unter den Molassesedimenten verborgenen Kreideablagerungen,<br />
die bis zu 1000 m mächtig werden, sind durch eine an <strong>der</strong> Erdoberfläche nicht sichtbare<br />
Schwelle (Landshut-Neuöttinger Hoch), auf <strong>der</strong> keine Kreidesedimente existieren, in einen westlichen Wasserburger<br />
und einen östlichen Braunauer Trog geteilt. Nördlich des Molassebeckens, in <strong>der</strong> Regensburger Gegend,<br />
in <strong>der</strong> südlichen Oberpfalz und in <strong>der</strong> östlichen Fränkischen Alb, folgen über verwitterten und verkarsteten Kalken<br />
des Weißen Jura zunächst Ablagerungen <strong>der</strong> Oberkreide, vor allem Quarzsandsteine. Eine wirtschaftliche Bedeutung<br />
hat die sog. Neuburger Kieselkreide, kaolin- und quarzreiche, aber karbonatfreie, am Westrand <strong>der</strong><br />
„Münchner Bucht“ des Kreidemeeres abgelagerte Staubsande, die in alten Dolinen erhalten geblieben sind und<br />
bei Neuburg als Füllstoffe abgebaut werden. Eine wirtschaftliche Bedeutung hatten früher Brauneisenerze, die<br />
früher bei Amberg bergmännisch abgebaut und in <strong>der</strong> Maxhütte verhüttet wurden, Verwitte- rungsbildungen, die<br />
ursprünglich am Ostrand des Oberpfälzer Kreidemeeres entstanden waren. Die Hauptmasse <strong>der</strong> bis zu mehr als<br />
200 m mächtigen „Regensburger Kreide“ besteht jedoch aus marinen kaolin- o<strong>der</strong> glauko- nitreichen<br />
Sandsteinen, kieseligen Kalksteinen und Mergeln. Der Regensburger Grünsandstein wurde und wird teilweise<br />
als Baustein gebrochen. Zum Tertiär des Molassebeckens vergl. Abschnitt 10.7.4.<br />
10.4.3 Das Tertiär im Oberrheingraben<br />
Dieser gewaltige, weit über 1000 m mächtige Schichtstapel permomesozoischer Sedimente, die über dem variszisch<br />
überprägten paläozoischen Grundgebirge in Süddeutschland abgelagert worden sind, wurde herausgehoben<br />
und ist seit <strong>der</strong> Kreidezeit großflächig <strong>der</strong> Verwitterung und Abtragung ausgesetzt. Schon im Alttertiär waren<br />
die mesozoischen Schichtstapel so kräftig erodiert worden, dass hier das Grundgebirge stellenweise freilag.<br />
Reste eisenreicher Verwitterungsdecken aus dem Alttertiär, die sich stellenweise auf <strong>der</strong> Albhochfläche und in <strong>der</strong><br />
Umgebung des Oberrheintales erhalten haben, wurden früher als Bohnerze abgebaut und verhüttet. In dieser Zeit<br />
(Eozän) entstand im Westen des Schwäbisch-Fränkischen Stufenlandes eine breite Zerrungszone aktiv zu werden.<br />
Der NNW-SSE-orientierte Oberrheingraben sank zwischen dem Mainzer Becken im N und dem Schwei- zer<br />
Faltenjura ein. Dieser bis zu 30 km breite und über 300 km lange tektonische Graben ist Teil einer breiten Störungszone<br />
mit einem ganzen System von Gräben, die vom Zentralgraben im Nordseebecken über die nie<strong>der</strong>rheinische<br />
Bucht, Eifel, Hessische Senke und Wetterau bis zum Rhône-Bresse-Graben in Südfrankreich verfolgbar<br />
ist.<br />
Der Oberrheingraben wurde im Verhältnis zu seinen Flanken stellenweise um mehr als 3000 m abgesenkt. Dafür<br />
wurden die Gebiete an den Grabenschultern beson<strong>der</strong>s hoch herausgehoben und dort die mesozoischen Gesteine<br />
teilweise restlos erodiert (Vogesen, Schwarzwald, Odenwald). Die dadurch entstehende trogförmige Depression<br />
konnte mehr als 2000 m mächtige, teilweise marine Ablagerungen aufnehmen, die im S vor allem aus dem<br />
Alttertiär, im N größtenteils aus dem Jungtertiär stammen. Neben Tonen, Mergeln, Sanden und Konglomeraten<br />
wurden im Elsass während <strong>der</strong> Tertiärzeit stellenweise auch Gips und Steinsalz, stellenweise sogar Edelsalze<br />
abgelagert. Teile <strong>der</strong> alttertiären Ablagerungen sind dunkel gefärbt und reich an Bitumen (Pechelbronner Schichten).<br />
Daraus sind Erdöllagerstätten entstanden, die Anlass für eine intensive Bohrtätigkeit vor allem im S des<br />
Oberrheingrabens waren. Der Elsass gilt als Wiege <strong>der</strong> europäischen Bohrtechnik und <strong>der</strong> Erdölindustrie.<br />
Große Teile des Kaiserstuhls und an<strong>der</strong>er Hügel am Rande des Grabens sind mit mächtigen eiszeitlichen Lössen<br />
bedeckt. Die äolischen Ablagerungen sind während <strong>der</strong> Kaltzeiten aus den Schmelzwasserablagerungen des<br />
Rhein- und des Rhônegletschers im Oberrheintal ausgeblasen worden. Stellenweise sind hier Lössmächtigkeiten<br />
von mehr als 60 m bekannt. Bei Freiburg und bei Heidelberg gibt es Abschnitte des Grabens, die sich noch<br />
während des Quartärs kräftig abgesenkt haben müssen, denn hier erreichen auch die quartären Rheinablagerungen<br />
noch Mächtigkeiten von mehr als 200 m.<br />
10.5 Tertiäre Vulkangebiete in Deutschland<br />
Während <strong>der</strong> Tertiärzeit wurde die Erdkruste in Deutschland an vielen Stellen stark gedehnt. In <strong>der</strong> Folge kam es<br />
zu einer Bildung tiefreichen<strong>der</strong> Störungen und dem Einsinken von tektonischen Becken und Gräben. Einige
80<br />
dieser Störungen dienten als Aufstiegswege für vulkanische Schmelzen aus dem oberen Erdmantel. Eine beson<strong>der</strong>s<br />
heftige vulkanische Tätigkeit gab es im Jungtertiär in <strong>der</strong> Schwäbischen Alb, im Hegau, Kaiserstuhl,<br />
Vogelsberg, Westerwald, in <strong>der</strong> Rhön, Eifel, Oberpfalz und im Egerland.<br />
Schon in <strong>der</strong> Oberkreide sind die tektonischen Störungen des Oberrheingrabens an mehreren Stellen von Magmen<br />
als Aufstiegswege benutzt worden. Im Jungtertiär (Miozän) ist bei Breisach sogar ein richtiger Stratovulkan<br />
entstanden, <strong>der</strong> im Kaiserstuhl, trotz starker Erosion, immer noch als Bergland erkennbar geblieben ist. Geför<strong>der</strong>t<br />
wurden vor allem Tephrit-, Limburgit- und Nephelinit-Laven sowie Tuffe, die die Flanken des Kaiserstuhls<br />
aufbauen. Im Zentrum dieses Stratovulkans sind durch die Erosion zahlreiche vulkanische Intrusionskörper, Gänge<br />
und Explosionsbrekzien freigelegt worden, die ursprünglichen För<strong>der</strong>kanäle. Sie enthalten vor allem recht<br />
exotische Gesteine, wie Nephelinsyenite, Essexite, Phonolithe, Karbonatite und Tinguaite.<br />
Auch im Molassebecken des Bodenseegebietes hat es während des Jungtertiärs Vulkane gegeben. Die Vulkane<br />
des Hegau sind vor allem dort entstanden, wo sich N-S-orientierte Störungen mit WNW-ENE-streichenden Störungen<br />
verschneiden. Auch <strong>der</strong> Überlinger See o<strong>der</strong> die Wutachschlucht folgen WNW-streichenden Störungssystemen.<br />
Die Kreuzungspunkte wurden von den Magmen als Aufstiegswege verwendet. Geför<strong>der</strong>t wurden vor<br />
allem Tuffe, Foidbasalte (Olivin-Nephelinite und Melilith-Nephelinite) und Phonolithe. Der weit verbreitete sog.<br />
Deckentuff, <strong>der</strong> reich an zertrümmerten mesozoischen Gesteinen aus dem Untergrund ist, liegt als über 100 m<br />
mächtige Tuffdecke noch immer <strong>der</strong> alten Landoberfläche auf. Die Foidbasalt-Berge Hohenhewen, Höveneck und<br />
Hohenstoffeln haben mit den tertiären Vulkanen kaum mehr etwas zu tun. Die ehemaligen Vulkangebäude sind<br />
größtenteils abgetragen. Die kegelförmigen Basaltkuppen sind ehemalige Schlotfüllungen, die von <strong>der</strong> Erosion<br />
aus den umgebenden Molasseablagerungen präpariert worden sind. Auch die Phonolithberge Hohentwiel,<br />
Hohenkrähen und Mägdeberg sind keine Vulkane im eigentlichen Sinne. Es handelt sich um ca. 8 Millionen Jahre<br />
alte subvulkanische Intrusionskörper, die durch Erosion freigelegt worden sind.<br />
Jungtertiäre Vulkane gibt es auch auf <strong>der</strong> Schwäbischen Alb und im Bereich <strong>der</strong> Fil<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Umgebung von Bad<br />
Urach. Bei den ca. 350 bekannten Eruptionszentren des Uracher Vulkangebietes zwischen Münsingen und<br />
Stuttgart hat es sich ursprünglich um Maarvulkane gehandelt, die an <strong>der</strong> Erdoberfläche alle von einem Tuffring<br />
umgeben gewesen sein dürften. Viele Krater waren früher von Maarseen erfüllt. Die Krater entstanden über<br />
phreatischen Durchschlagsröhren. Ausgelöst wurden die gewaltigen Dampfexplosionen von Foidbasalt-Schmelzen,<br />
die bei ihrem Aufstieg das Karstwasser an <strong>der</strong> Basis des Weißen Jura erreichten. Die Vulkane waren jeweils<br />
nur sehr kurze Zeit tätig und för<strong>der</strong>ten nur vulkanische Tuffe. Die ehemaligen Tuffringe sind restlos abgetragen;<br />
erhalten sind meist nur die Schlotfüllungen, die vor allem aus zertrümmerten mesozoischen Gesteinen aus dem<br />
tieferen Untergrund bestehen und mit wenig vulkanischem Material vermischt sind. Ganz selten sind Gänge aus<br />
Foidbasalten (Melilitithe o<strong>der</strong> Ankaratrite) und fossilführende Maarsee-Sedimente (z.B. Randecker Maar) erhalten<br />
geblieben. Auf <strong>der</strong> verkarsteten Albhochfläche selbst sind die restlos aufgefüllten Maare meist nur daran zu<br />
erkennen, dass Maarseesedimente und Schlotfüllungen Grundwasserstauer bilden. Gelegentlich sind hier über<br />
Schloten sogar Moore entstanden (Schopflocher Moor). Dort wo die Kalksteine des Weißen Jura <strong>der</strong> Abtragung<br />
restlos zum Opfer gefallen sind, bilden die aus den weichen Mergeln des Braunen Jura herauspräparierten festeren<br />
Schlotfüllungen kleine Berge und Kuppen (Culverbühl, Limburg, Jusi).<br />
10.6 Tertiäre Meteoritenkrater in Süddeutschland<br />
Auch das Ries, ein weites Becken, das an <strong>der</strong> Grenze zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb in die Albhochfläche<br />
eingesenkt ist, wurde früher als Vulkankrater gedeutet. Schon lange ist bekannt, dass das Ries, mit<br />
seinen 20 bis 25 km Durchmesser und seinem ziemlich ebenen Boden, nicht nur landschaftlich etwas Beson<strong>der</strong>es<br />
ist. Die Gesteine im und in <strong>der</strong> Umgebung des Rieses weisen zahlreiche Eigenarten auf. Sie sind teilweise<br />
stark gestört, zertrümmert und oft chaotisch gelagert. So findet man hier Schollen aus kristallinen Gesteinen an<br />
<strong>der</strong> Erdoberfläche, z.B. Granite und Gneise, die in <strong>der</strong> unmittelbaren Umgebung des Rieses Hun<strong>der</strong>te von Metern<br />
tiefer liegen, unter den Schichten <strong>der</strong> Trias und des Jura verborgen. Verbreitet sind riesige, vielfach zerrüttete<br />
Schollen aus Trias- und Juragesteinen, die im Vorries, also in <strong>der</strong> unmittelbaren Umgebung des Rieses,<br />
"wurzellos" auf jüngeren Ablagerungen liegen, die Ries-Trümmermassen.<br />
Zudem kommen hier rätselhafte Gesteine vor, die man sonst kaum wo in Europa findet, und <strong>der</strong>en Entstehung<br />
schwer zu deuten ist: Die Bunte Brekzie, ein chaotisches Gemenge aus Sedimentgesteinen, die aus dem Untergrund<br />
<strong>der</strong> Alb stammen, und <strong>der</strong> Suevit, ein mit Kristallinbrocken durchsetztes, poröses, glashaltiges Gestein.<br />
Außer vom Ries sind Gesteine, die <strong>der</strong> Bunten Brekzie gleichen, auch vom viel kleineren Steinheimer Becken
81<br />
bekannt, das westlich von Heidenheim in <strong>der</strong> Schwäbischen Alb liegt. Während die Bunte Brekzie entfernt an<br />
eiszeitliche Moränen des Alpenvorlandes erinnert, ähnelt <strong>der</strong> Suevit bestimmten vulkanischen Tuffen – sog.<br />
Ignimbriten. Ignimbrite o<strong>der</strong> Schmelztuffe sind vulkanische Gesteine, die von überhitzten Glutwolken abgesetzt<br />
worden sind.<br />
Seit Mitte des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts wurde eine Reihe unterschiedlicher Erklärungen für die Entstehung <strong>der</strong> beiden<br />
Becken gegeben. Frühe Hypothesen, die im Ries ein eiszeitliches Kar o<strong>der</strong> gar einen Meteoritenkrater sehen<br />
wollten, konnten leicht wi<strong>der</strong>legt werden o<strong>der</strong> klangen zu unwahrscheinlich, um ernsthaft diskutiert zu werden. Die<br />
Deutung des Rieses und des Steinheimer Beckens als vulkanische Bildungen wurde dagegen immer wie<strong>der</strong><br />
erwogen. Aber auch ganz unterschiedliche Vulkanhypothesen, die im Laufe <strong>der</strong> Zeit entwickelt wurden,<br />
befriedigten nicht und wussten auf einen Teil <strong>der</strong> beobachteten Phänomene keinen Reim. Sicher war nur, dass<br />
Rieskessel und Steinheimer Becken während <strong>der</strong> Tertiärzeit, im Mittelmiozän vor rund 14,5 Millionen Jahren, in<br />
einem offensichtlich katastrophalen Akt entstanden waren. Wie fossilreiche Ablagerungen in beiden Becken<br />
beweisen, müssen die Hohlformen nach ihrer Entstehung eine Zeitlang mit Seen gefüllt gewesen sein.<br />
In den 60er Jahren fanden amerikanische Wissenschaftler neue Argumente, die zur Deutung des Rieses als<br />
Meteoritenkrater zwangen. Dazu zählt <strong>der</strong> Nachweis von Stishovit, einer Hochdruckmodifikation des Quarzes.<br />
Stishovit ist chemisch mit Quarz identisch, besitzt aber ein an<strong>der</strong>es, dichter gepacktes Kristallgitter, das nur bei<br />
hohen Drucken entsteht. Das natürliche Vorkommen von Stishovit ist an zweifelsfreie Meteoritenkrater gebunden.<br />
Die zu seiner Entstehung notwendigen Drucke sind so hoch, dass sie nur kurzfristig in energiereichen<br />
Schockwellen auftreten können, wie sie beim Einschlag kosmischer Körper auf <strong>der</strong> Erdoberfläche o<strong>der</strong> bei<br />
Explosionen von Kernwaffen entstehen. Auch an<strong>der</strong>e Erscheinungen, die nur auf eine Beanspruchung <strong>der</strong><br />
Gesteine durch eine <strong>der</strong>artige Schockwelle zurückzuführen sind, haben die Deutung von Rieskessel und Steinheimer<br />
Becken als Meteoritenkrater abgesichert. Dazu zählt das Auftreten von Gesteinsgläsern, die aus ungewöhnlich<br />
hoch temperierten Schmelzen erstarrt sind, wie sie bei vulkanischen Laven niemals beobachtet werden,<br />
o<strong>der</strong> das Vorkommen von shattercones. Schlagkegel o<strong>der</strong> shattercones sind kegelförmige Strukturen in<br />
Gesteinen, die durch eine energiereiche Schockwelle entstanden sind. Zusätzliche Beweise für die "Impakt-<br />
Theorie" brachten auch Forschungsbohrungen, die den Untergrund des Rieses erforschten. Heute gelten beide<br />
Becken als bemerkenswert gründlich untersuchte, relativ junge und gut erhaltene Meteoritenkrater, wenn man sie<br />
mit dem halben Hun<strong>der</strong>t irdischer Meteoritenkrater vergleicht, die inzwischen gefunden worden sind.<br />
Nach heutiger Vorstellung hat sich vor etwa 14,5 Millionen Jahren im Gebiet nordwestlich von Donauwörth Folgendes<br />
abgespielt: Im Mittelmiozän, zu <strong>der</strong> Zeit, als im Molassebecken die Obere Süßwassermolasse entstand,<br />
schlug in <strong>der</strong> Gegend nordöstlich von Nördlingen ein riesiger Meteorit ein. Man hat berechnet, dass er bei einem<br />
Durchmesser von etwa 1 km mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 bis 40 km pro Sekunde auf dem<br />
Erdboden aufgeprallt sein muss. Der dabei erzeugte Stoßdruck von einigen Millionen Atmosphären hatte eine<br />
blitzartige Temperaturerhöhung auf 10 000 bis 30 000 °C zur Folge und führte zur augenblicklichen Verdampfung<br />
des Meteoriten sowie eines Teils <strong>der</strong> Gesteine am Einschlagsort. Eine dadurch bedingte gewaltige Explosion, die<br />
<strong>der</strong> Energie von 250 000 Atombomben des Hiroschima-Typs entsprechen würde, sprengte einen primären Krater<br />
von mehreren Kilometern Tiefe und über 10 km Durchmesser aus. Unmittelbar nach dem Ende <strong>der</strong> Explosion<br />
kollabierte dieser Primärkrater und es bildete sich durch Einsinken des Untergrundes ein mehr als doppelt so<br />
großer sekundärer Krater. Obwohl die ausgeworfenen Gesteinsmassen (150 km³) größtenteils wie<strong>der</strong> in den<br />
Krater zurückfielen, war seine nähere Umgebung mit Auswurfsmassen bedeckt, die heute noch im südlichen Vorfeld<br />
des Rieses als Dekameter mächtige Decke zu finden sind.<br />
Das Riesereignis muss auch noch Hun<strong>der</strong>te von Kilometern vom Ries entfernt spürbare Auswirkungen gehabt<br />
haben. Die Bunte Brekzie muss ursprünglich auch südlich <strong>der</strong> Donau verbreitet gewesen sein, wo sie als südwärts<br />
ausdünnen<strong>der</strong> Horizont eigentlich in die Obere Süßwassermolasse eingelagert sein sollte; davon ist freilich<br />
nichts zu entdecken. In <strong>der</strong> Gegend um Augsburg werden aber gelegentlich faust-, kopf- und mitunter sogar<br />
metergroße, eckige Kalkstein-Brocken gefunden. Beim Material dieser Brocken handelt es sich ausschließlich um<br />
Jurakalke aus <strong>der</strong> Alb. Wie man bei Agawang, Ziemetshausen o<strong>der</strong> Hohenraunau bei Krumbach beobachten<br />
kann, sind sie in einem dünnen in Ablagerungen <strong>der</strong> OSM eingelagerten Horizont angereichert, <strong>der</strong> als Brockhorizont<br />
o<strong>der</strong> „Weißjura-Brockhorizont“ bezeichnet wird. Abgesehen von manchen quartären Schottern <strong>der</strong> Umgebung<br />
von Augsburg, in denen solche aus <strong>der</strong> Molasse umgelagerte Reutersche Blöcke auftreten, sind sie<br />
ausschließlich im Brockhorizont anzutreffen.<br />
Diese Blöcke sind während des Riesereignisses an ihren heutigen Fundort gelangt. Den gleichen Brockhorizont<br />
kann man östlich des Lechs weiterverfolgen, bis in die Gegend von Freising und Landshut. Die tertiären Flüsse,<br />
die das Molassetiefland durchflossen, scheinen die ursprünglich hier liegenden Ries-Auswurfmassen rasch abge-
82<br />
tragen und nur die relativ wi<strong>der</strong>standsfähigen Jurakalk-Brocken übriggelassen zu haben. Sie zeugen noch heute<br />
von einem fürchterlichen Ereignis, das weite Teile Bayerns, Frankens und Schwabens binnen Minuten in ein<br />
lebloses Trümmerfeld verwandelt haben dürfte. Aber so wie im Ries selbst <strong>der</strong> entstandene Kratersee bald von<br />
miozänen Pflanzen und Tieren besiedelt wurde, kehrte wohl auch in die schrecklich verwüstete Umgebung des<br />
Meteoritenkraters schon nach wenigen Jahren das Leben zurück.<br />
10.7 Die Bayerischen Alpen und das Alpenvorland<br />
Die Alpen sind ein sog. Decken-Falten-Gebirge, dessen Bildung im Mesozoikum begann und das seit dem<br />
Alttertiär ein Hochgebige darstellt. Durch starke Einengung <strong>der</strong> vorher schon im Meer entstandenen Gesteine seit<br />
<strong>der</strong> Oberkreide wurden die Schichtfolgen gefaltet und schließlich in Form sog. tektonischer Decken übereinan<strong>der</strong>gestapelt.<br />
In einigen dieser Decken findet man Gesteinsfolgen, die trotz jeweils gleichen Alters ein sehr unterschiedliches<br />
Aussehen haben. An<strong>der</strong>e unmittelbar übereinan<strong>der</strong>folgende Decken sind dagegen aus Gesteinsfolgen<br />
mit ähnlicher Ausbildung aufgebaut, d.h. ihre Gesteine sehen bei gleichem Alter auch ähnlich aus und sind<br />
daher offenbar unter vergleichbaren Bedingungen entstanden. Diese Decken fasst man als tektonisch-geologische<br />
Einheiten zusammen. Im Allgäu, und darüber hinaus im gesamten deutschen Anteil des Alpenvorlandes und<br />
<strong>der</strong> Alpen, können mehrere übereinan<strong>der</strong>liegende tektonisch-geologische Einheiten unterschieden werden, von<br />
denen die wichtigsten als Kalkalpin, Flysch, Helvetikum und Molasse bezeichnet werden. Jede dieser<br />
Einheiten kommt in langen, mehr o<strong>der</strong> weniger schmalen Zonen an die Erdoberfläche, die parallel zum Nordrand<br />
<strong>der</strong> Alpen und von Norden nach Süden hintereinan<strong>der</strong> angeordnet sind. Bei einer Wan<strong>der</strong>ung, die vom Alpenvorland<br />
in die Alpen hinein führt, überquert man also eine dieser Einheiten nach <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en.<br />
10.7.1 Das Oberostalpin (Kalkalpin)<br />
Die höchste und südlichst gelegene tektonisch-geologische Einheit in den Bayerischen Alpen ist das sog.<br />
Oberostalpin o<strong>der</strong> Kalkalpin (bzw. die Nördlichen Kalkalpen im engeren Sinne), das die größten Teile <strong>der</strong> Berchtesgadener,<br />
<strong>der</strong> Bayerischen und <strong>der</strong> Allgäuer Alpen, <strong>der</strong> Tannheimer Berge, <strong>der</strong> Lechtaler Alpen und des Rätikons<br />
umfasst. Es baut die Berge mit den markantesten Gipfeln und schroffsten Bergformen auf, wie Säuling,<br />
Gimpel, Aggenstein, Sorgschrofen, Hochvogel, Nebelhorn, Krottenkopf, Höfats, Trettachspitze, Hohes Licht o<strong>der</strong><br />
Wid<strong>der</strong>stein. Das Kalkalpin ist Teil des Ostalpin, einer größeren tektonisch-geologischen Einheit, aus <strong>der</strong> große<br />
Teile <strong>der</strong> Ostalpen bestehen.<br />
Die Nördlichen Kalkalpen werden vor allem aus im Meer abgelagerten Sedimentgesteinen aufgebaut, die in <strong>der</strong><br />
Trias- und Jura-, untergeordnet auch in <strong>der</strong> Kreidezeit entstanden sind. Am Aufbau des Gebirges sind völlig unterschiedliche,<br />
oft fossilreiche Schichtfolgen beteiligt, von denen einige primäre Mächtigkeiten von weit über 1000 m<br />
erreichen können. Diese Schichtfolgen bestehen aus Dolomit- und Kalksteinen, Mergeln, Tonen, zum kleineren<br />
Teil auch aus Konglomeraten, Sandsteinen, Hornsteinen und Gips. Während die standfesten, mächtigen und<br />
vielfach verkarsteten Dolomit- und Kalksteinfolgen die schroffen, weitgehend vegetationslosen Berggipfel <strong>der</strong><br />
Allgäuer Alpen aufbauen (z.B. Hauptdolomit, Wettersteinkalk und Oberrhätkalk), bilden die leicht verwitternden<br />
und wenig standfesten mergeligen Schichtfolgen Hangverflachungen, feuchte Senken und Sättel o<strong>der</strong> dachförmig<br />
zugeschnittene Grasberge (z.B. Partnachschichten, Kössener Schichten, Allgäuschichten, Aptychenschichten<br />
o<strong>der</strong> das "Cenoman"), die oft ein üppig grünes Pflanzenkleid tragen. Neben diesen Gesteinen, die alle einen<br />
deutlichen Karbonatgehalt aufweisen, kommen stellenweise auch geringmächtige kieselige Gesteine vor, die<br />
weitgehend o<strong>der</strong> gar völlig karbonatfrei sind (z.B. Alpiner Buntsandstein, Radiolarit, Teile <strong>der</strong> Allgäuschichten, die<br />
als Kieselkalke o<strong>der</strong> Manganschiefer bezeichnet werden, Abschnitte <strong>der</strong> Aptychenschichten, Diabasporphyrit).<br />
Obwohl diese Gesteine leicht verwittern, sind einige von ihnen beson<strong>der</strong>s standfest und bauen gerade in den<br />
Allgäuer Alpen abenteuerlich steile Grashänge mit einer kieselliebenden Flora auf, die zahlreiche zentralalpine<br />
Florenelemente enthält (z.B. Höfats o<strong>der</strong> Schneck).<br />
An <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> kalkalpinen Decken kommen stellenweise Gesteine heraus, die we<strong>der</strong> innerhalb <strong>der</strong> Nördlichen<br />
Kalkalpen noch in <strong>der</strong> unterlagernden Flyschzone zu finden sind. Sie gehören zu einem Schollenteppich, <strong>der</strong> in<br />
seiner Gesamtheit zu einem weiteren tektonischen Stockwerk gerechnet wird: die Aroser Zone. Charakteristische<br />
Gesteine, die in dieser Zone vorkommen, sind u.a. Kristallinschollen (Glimmerschiefer und Gneise) sowie<br />
basische vulkanische Gesteine ("Diabasporphyrit").
10.7.2 Der Rhenodanubische Flysch<br />
83<br />
Unter den Kalkalpinen Decken bzw. <strong>der</strong> Aroser Zone kommt eine tiefere geologisch-tektonische Einheit heraus,<br />
die man mit einem Schweizer Dialektausdruck als Flysch (sprich "Fliesch") bezeichnet. Östlich <strong>der</strong> Iller schließt<br />
sich die Flyschzone als mehrere Kilometer breiter Streifen an die Nördlichen Kalkalpen an und baut Teile <strong>der</strong><br />
relativ niedrigen, vielfach bewaldeten Vorbergzone auf. Zwischen Iller- und Rheintal, im Gebiet <strong>der</strong> nordwestlichen<br />
Allgäuer Alpen und des Bregenzer Waldes, ist <strong>der</strong> Flysch in zwei breite Zonen aufgespalten, die das Helvetikum<br />
einrahmen (siehe unten). Die Flyschgesteine sind zum größten Teil in <strong>der</strong> Kreidezeit entstanden, sind damit<br />
zwar teilweise gleich alt wie <strong>der</strong> jüngste Teil <strong>der</strong> kalkalpinen Ablagerungen, sehen aber ganz an<strong>der</strong>s aus als<br />
diese.<br />
Bei den Flyschgesteinen handelt es sich um mächtige Wechselfolgen von leicht verwitternden Mergeln und<br />
Tonen, in die in mehr o<strong>der</strong> weniger regelmäßigen Abständen Kalk- und/o<strong>der</strong> Sandsteinbänke eingelagert sind.<br />
Manche Flyschserien, etwa die Quarzitserie ("Flyschgault") enthalten harte, kieselig gebundene Quarzsandsteine<br />
("Ölquarzite"), die, ebenso wie die begleitenden Tonzwischenlagen, völlig karbonatfrei sind. Alle gewöhnlich völlig<br />
fossilleeren Flyschgesteine werden heute als Tiefseeablagerungen gedeutet. Durch die hohen Anteile von tonigmergeligen<br />
Gesteinen am Aufbau <strong>der</strong> Schichtfolgen fehlen den meist dachförmig zugeschnittenen Flyschbergen<br />
schroffe Gipfel. Dafür tragen sie fast immer ein dichtes Pflanzenkleid, neigen aber wegen <strong>der</strong> allgegenwärtigen,<br />
wasserstauenden Tone und Mergel zur Vernässung, zur Bildung von Hangmooren und zum Rutschen. Viele<br />
Allgäuer Grasberge mit <strong>der</strong> höchsten Artenvielfalt gehören <strong>der</strong> Flyschzone an. Hier liegen aber auch die wichtigsten<br />
Schigebiete <strong>der</strong> Allgäuer Alpen, etwa bei Bal<strong>der</strong>schwang, in <strong>der</strong> Hörnergruppe o<strong>der</strong> am Fellhorn.<br />
Zwischen Flysch und Helvetikum sind stellenweise Schollen enigeklemmt, die zu weiteren Deckeneinheiten<br />
gerechnet werden müssen. Man fasst sie zum Ultrahelvetikum (Liebensteiner Decke) und zum Feuerstätter<br />
Flysch (Feuerstätter Decke) zusammen. Die Gesteine, die diese Deckeneinheiten aufbauen, zeigen teilweise<br />
Anklänge an die helvetische Schichtfolge, teilweise aber auch an Flyschgesteine, sind aber an<strong>der</strong>s aufgebaut und<br />
zu einem Teil jünger als diese. Auch bei ihnen handelt es sich größtenteils um Mergel, Tone und Sandsteine.<br />
Zusätzlich kommen hier stellenweise karbonatfreie Kristallinbrekzien und Quarzsandsteine, stellenweise sogar<br />
vulkanische Gesteine vor (z.B. Feuerstätter Sandstein, Bolgenkonglomerat).<br />
10.7.3 Das Helvetikum<br />
Die nächst nördlich und tiefer gelegene geologisch-tektonische Einheit, die unter den Flyschdecken herauskommt,<br />
ist das Helvetikum. Wie schon <strong>der</strong> Name vermuten lässt, haben die helvetischen Gesteine ihre Hauptverbreitung<br />
in den Schweizeralpen. Aber auch in den westlichen Allgäuer Alpen und im Bregenzerwald hat das<br />
Helvetikum noch eine beachtliche Ausdehnung, wo seine Gesteine in einer Breite von mehr als 10 km bloßgelegt<br />
sind – eingerahmt von den Ketten <strong>der</strong> beiden Flyschzonen. Einzelne Berge, wie <strong>der</strong> Ifen, erreichen hier Höhen<br />
von mehr als 2200 m. Nach Osten zu verschmälert sich die Zone jedoch rasch und begleitet den Alpennordrand<br />
als ein Streifen von kaum mehr als ein paar hun<strong>der</strong>t Meter Breite.<br />
Die marinen Sedimentgesteine, aus denen das Helvetikum im Allgäu besteht, vor allem Kalksteine und Mergel,<br />
sind größtenteils während <strong>der</strong> Kreide- und in <strong>der</strong> älteren Tertiärzeit entstanden, als Ablagerungen in einem relativ<br />
seichten, mitunter auch ziemlich tiefen Schelfmeer. Die auffälligsten Gesteine dieser Zone sind Kalksteine. Neben<br />
dem Nummulitenkalk, <strong>der</strong> vor allem im Grüntengebiet vorkommt, sowie dem Seewerkalk, ist hier vor allem <strong>der</strong><br />
Schrattenkalk zu nennen, eine teilweise über 100 m mächtige Platte aus hellem Kalkstein, die von weniger<br />
verwitterungsresistenten Sedimenten unter- und überlagert wird. Aus verkarstetem Schrattenkalk bestehen die<br />
meisten Felsgipfel <strong>der</strong> helvetischen Berge, wie <strong>der</strong> Hohe Ifen, das Gottesackerplatt, die Gottesackerwände, <strong>der</strong><br />
Besler, Grünten o<strong>der</strong> die Alpspitze. Daneben sind vor allem mächtige Mergelfolgen verbreitet (z.B. Drusbergschichten,<br />
Leistmergel, Wangschichten o<strong>der</strong> Stadschiefer), die Weiden, aber auch Hang- und Hochmoore tragen<br />
können. Neben diesen karbonathaltigen Schichtfolgen sind im Helvetikum jedoch auch karbonatfreie Gesteine<br />
verbreitet, die vor allem in <strong>der</strong> Garschella-Formation vorkommen, eine dem Schrattenkalk direkt auflagernde, abschnittsweise<br />
völlig karbonatfreie Schichtfolge aus hellen, teilweise auch grünlichen o<strong>der</strong> schwärzlichen Quarzsandsteinen<br />
und Tonen (z.B. Grüntenschichten, Brisisandstein). Wo <strong>der</strong> Brisisandstein den Untergrund bildet,<br />
gedeiht eine kalkmeidende Vegetation mit zentralalpinen Florenelementen.<br />
10.7.4 Die Molasse
84<br />
Das Alpenvorland wird fast ganz von den tertiären Gesteinen <strong>der</strong> Molasse aufgebaut, <strong>der</strong> tiefsten, aber gleichzeitig<br />
doch jüngsten und nördlichsten geologischen Einheit. Sie umfasst flächenmäßig den größten Teil des<br />
Allgäus, darüber hinaus praktisch das gesamte Alpenvorland zwischen dem Genfer See und dem Wienerwald.<br />
Nach Norden sind Gesteine <strong>der</strong> Molasse bis zur Donau verbreitet; ihre Südgrenze fällt östlich <strong>der</strong> Iller streckenweise<br />
mit <strong>der</strong> morphologischen Grenze zwischen Alpenvorland und den Alpen zusammen. Westlich <strong>der</strong> Iller<br />
weicht sie nach Süden zurück und liegt innerhalb des Gebirges. Hier ist die Molasse ein Teil des Hochgebirges<br />
und erreicht in den Immenstädter Nagelfluhbergen Gipfelhöhen von über 1800 m.<br />
Die Sedimentgesteine <strong>der</strong> Molasse sind in <strong>der</strong> Tertiärzeit (Oligozän und Miozän) abgelagert worden, größtenteils<br />
Mergel- und Sandsteine, in <strong>der</strong> Nähe des Alpennordrandes auch grobkörnige Konglomerate („Nagelfluh“). Bei<br />
diesem Material handelt es sich ursprünglich um die Abtragungsprodukte <strong>der</strong> zum Hochgebirge aufsteigenden<br />
tertiären Alpen, die in Form von Schlamm, Sand und Kies nach Norden geschwemmt und im Alpenvorland abgelagert<br />
wurden. An <strong>der</strong> Donau lagern die tertiären Molasseablagerungen den Jurakalken <strong>der</strong> Schwäbischen Alb als<br />
geringmächtiges Schichtpaket auf. Nach Süden zu nimmt die Mächtigkeit <strong>der</strong> Molasse langsam aber stetig zu, um<br />
in <strong>der</strong> Nähe des Alpennordrandes auf über 5000 m anzuschwellen. Anhand entsprechen<strong>der</strong> Versteinerungen<br />
lässt sich nachweisen, dass bestimmte Abschnitte <strong>der</strong> Molasse aus Fluss- o<strong>der</strong> Seeablagerungen, an<strong>der</strong>e aus<br />
marinen Sedimenten aufgebaut sind. Der Allgäuer Anteil am Molassebecken wurde zweimal vom Meer überflutet.<br />
Die damals entstandenen Schichtfolgen werden als Untere und Obere Meeresmolasse bezeichnet. In <strong>der</strong> Zeit<br />
dazwischen zog sich das Meer wie<strong>der</strong> weit nach Osten zurück. Entsprechend liegen zwischen beiden, aber auch<br />
über <strong>der</strong> Oberen Meeresmolasse mächtige Flussablagerungen, die Untere und die Obere Süßwassermolasse.<br />
Der Untergrund des Alpenvorlandes muss über längere Zeit hinweg ungefähr in dem Maße, wie die Flüsse<br />
Material in das Becken brachten, ständig langsam eingesunken sein. Im Beckeninneren konnten so, im Laufe von<br />
fast 30 Jahrmillionen, Tausende von Metern mächtige Ablagerungen entstehen, die fast immer einen hohen Karbonatgehalt<br />
aufweisen.<br />
Der alpennächste Teil <strong>der</strong> Molasse ist im Jungtertiär von den nach Norden vorrückenden alpinen Decken gestaucht<br />
worden. Die bis dahin flachliegenden Molasseablagerungen wurden dabei zu weitspannigen Mulden verfaltet.<br />
Gegen Norden nimmt die Intensität <strong>der</strong> Deformation ab. Etwa an <strong>der</strong> Linie Bregenz-Kempten-Peiting grenzt<br />
die sogenannte Subalpine Molasse (Faltenmolasse) an die heute noch flachlagernde Vorlandmolasse (Ungefaltete<br />
Molasse). Wo in <strong>der</strong> Faltenmolasse abtragungsresistentere Molassegesteine steil o<strong>der</strong> gar senkrecht aufgerichtet<br />
worden sind, lassen sie sich als lang hinziehende, Ost-West- o<strong>der</strong> Nordost-Südwest-orientierte Bergrücken<br />
und Hügelketten verfolgen.<br />
10.8 Das Quartär in Deutschland<br />
Die letzten beiden Jahrmillionen sind durch eine Reihe weltweit nachweisbarer Klimakatastrophen gekennzeichnet,<br />
die sich in unseren Breiten als Eiszeiten auswirkten. Dieser letzte Abschnitt <strong>der</strong> Erdgeschichte, <strong>der</strong> noch<br />
heute andauert, wird daher als Eiszeitalter o<strong>der</strong> Quartär bezeichnet. In einer Kaltzeit (Eiszeit, Glazial) sanken<br />
die Jahresmitteltemperaturen in Mitteleuropa, die heute etwa zwischen 6 und 8°C liegen, um mehr als 10°C ab,<br />
die Sommer wurden kurz und kühl, die Winter lang und streng. In <strong>der</strong> Folge begannen die Gletscher <strong>der</strong> gemäßigten<br />
Breiten zu wachsen und aus den Hochlagen <strong>der</strong> Gebirge talwärts zu kriechen.<br />
10.8.1 Die Eiszeit im Alpenvorland und in Norddeutschland<br />
Schließlich ertranken vor allem die Alpen in einem Panzer aus Gletschereis, aus dem nur noch die höchsten und<br />
schroffsten Gipfel herausragten. Nach Norden hin traten die Gletscher durch die Pforten <strong>der</strong> großen Alpentäler<br />
ins Alpenvorland und stießen hier als flach ausgebreitete Vorlandgletscher weit nach Norden vor. Während die<br />
Gletscher am Alpenrand oft Hun<strong>der</strong>te von Metern dick waren, dünnten sie nach Norden zu langsam aus und<br />
erreichten am Eisrand schließlich ein labiles Gleichgewicht zwischen Nachfließen und Abschmelzen des Eises.<br />
Zur gleichen Zeit waren auf den Landmassen im nördlichen Europa und im arktischen Nordamerika kontinentale<br />
Eisschilde entstanden. Auch hier dürfte die Vergletscherung zunächst in Hochgebirgen begonnen haben, die<br />
bald große Vorlandgletscher ernährten. Aus diesen Vorlandgletschern haben sich wahrscheinlich mit <strong>der</strong> Zeit<br />
Deckgletscher entwickelt, die ihre Nährgebiete selber trugen. Skandinavien z.B. war vom mehr als 3000 m dicken<br />
Nordeuropäischen Inlandeis bedeckt, dessen Zentrum im Gebiet von Mittelschweden lag und dessen Eiszun-
85<br />
gen bis in die Nordsee nach Osten und über die Ostsee und Mecklenburg hinaus bis über Berlin und Hamburg<br />
nach S und W vorstießen. Als die Gletscher während <strong>der</strong> drittletzten, <strong>der</strong> Elster-Eiszeit, ihre größte Ausdehnung<br />
hatten, erreichten die Eisrän<strong>der</strong> des Nordeuropäischen Inlandeises sogar Amsterdam, Münster, Erfurt und Dresden.<br />
In den Eisschilden waren während <strong>der</strong> Kaltzeiten so gewaltige Wassermengen gebunden, dass <strong>der</strong> Meeresspiegel<br />
<strong>der</strong> Ozeane zeitweise mehr als 100 m unter seinem heutigen Niveau lag. Dann fielen weite Teile <strong>der</strong> Schelfgebiete<br />
trocken, wie die Nordsee, die Adria o<strong>der</strong> die Beringstraße. In dieser Zeit waren Rhein, Loire und Themse<br />
Nebenflüsse <strong>der</strong> Elbe, die durch das weitgehend trockene Nordseebecken und den Ärmelkanal floss und erst weit<br />
vor <strong>der</strong> bretonischen Küste in den Nordatlantik mündete.<br />
Der Bereich zwischen dem Nordeuropäischen Inlandeis und dem alpinen Vereisungsgebiet blieb dagegen weitgehend<br />
eisfrei. In diesem damals völlig waldlosen Gebiet breiteten sich karge Tundren und Steppen aus, wie<br />
heute noch in Grönland o<strong>der</strong> den Bergen Norwegens. Geschlossene Wäl<strong>der</strong> gab es erst viel weiter im Süden, am<br />
Mittelmeer o<strong>der</strong> in den heute wüstenhaften Gebieten Nordafrikas und Vor<strong>der</strong>asiens. Die klimatische Schneegrenze<br />
lag in Süddeutschland so niedrig, dass selbst einige Mittelgebirge vergletschert waren, wie Harz, Vogesen,<br />
Schwarzwald o<strong>der</strong> Bayerischer Wald.<br />
Die Gletscher hatten aber nur während relativ kurzer Perioden so große Ausdehnungen. In dazwischenliegenden<br />
wärmeren Perioden schmolzen sie immer wie<strong>der</strong> stark zurück. Manchmal stiegen die Temperaturen für einige<br />
Jahrzehntausende so stark an, dass sich die Gletscher in die Hochlagen <strong>der</strong> Gebirge zurückziehen mussten.<br />
Wenn die Gletscher aber in einer solchen Warmzeit (auch Zwischeneiszeit o<strong>der</strong> Interglazial genannt) weltweit<br />
abschmolzen, stieg <strong>der</strong> Meeresspiegel wie<strong>der</strong>.<br />
Nicht lange nachdem die Gletscher <strong>der</strong> letzten Eiszeit (Würm- o<strong>der</strong> Weichseleiszeit) ihre größte Ausdehnung erreicht<br />
hatten, vor 25 000 bis 20 000 Jahren, setzte bereits eine zögernde Klimaerwärmung ein. Sie führte im<br />
Alpenvorland wie in Norddeutschland zu einem allmählichen Zurückschmelzen <strong>der</strong> Eisrän<strong>der</strong>. Vor etwa 15 000<br />
Jahren, als das Nordeuropäische Inlandeis zwar deutlich zurückgeschmolzen war, das Ostseebecken aber noch<br />
immer unter Gletschern verborgen lag, war das Alpenvorland schon größtenteils eisfrei. Dann wurde die Klimaerwärmung<br />
dramatisch. Vor etwa 13 000 Jahren wurde <strong>der</strong> südliche Teil des Ostseebeckens vom Inlandeis freigegeben.<br />
Hier entstand ein riesiger Eisrandstausee, auf dem Eisberge herumschwammen, <strong>der</strong> Baltische Eissee.<br />
Vor ca 11 000 Jahren lief dieser See aus; das Meer drang über Südschweden in die Ostsee ein.<br />
Vor etwa 10 200 Jahren beginnt die Nacheiszeit. Diese Grenze ist als Ende <strong>der</strong> Eiszeit (Würm- bzw. Weichseleiszeit)<br />
einfach so festgelegt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich allerdings die Alpengletscher bereits längst<br />
in die Hochlagen <strong>der</strong> Alpen zurückgezogen. Nur das schrumpfende Nordeuropäische Inlandeis bedeckte immer<br />
noch große Teile Finnlands und Schwedens. Das vom Eis freigegebene Land wurde teilweise wie<strong>der</strong> vom steigenden<br />
Meeresspiegel überflutet, <strong>der</strong> Rest überzog sich mit ausgedehnten Wäl<strong>der</strong>n. Vor etwa 8000 Jahren war<br />
das Nordeuropäische Inlandeis restlos abgeschmolzen.<br />
10.8.2 Gletscher und Klima<br />
Gletscher reagieren empfindlich auf Klimaverän<strong>der</strong>ungen. Man kann nachweisen, dass die eiszeitlichen Gletscher<br />
als Reaktion auf eine drastische Klimaerwärmung zurückgeschmolzen sind. Während des Eishöchststandes <strong>der</strong><br />
letzten Eiszeit betrug die Jahresmitteltemperatur im Alpenvorland längere Zeit hindurch zwischen -3 und -5°C.<br />
Nach einer Übergangszeit von mehreren Jahrtausenden (im Spätglazial, vor 15 000 bis 10 000 Jahren), die sich<br />
durch heftige Temperaturschwankungen auszeichnete, haben sich die Jahresmitteltemperaturen auf einem recht<br />
hohen Niveau von etwa +7 bis +9 °C stabilisiert. Seit mindestens 12 000 Jahren sind die Gletscher auf die Hochlagen<br />
<strong>der</strong> Alpen beschränkt.<br />
Trotzdem lassen sich nacheiszeitliche Gletscherschwankungen nachweisen, die freilich im Vergleich zu den eiszeitlichen<br />
Vorstößen <strong>der</strong> Gletscher eher bescheiden waren. Den letzten größeren Eisvorstoß nennt man „Kleine<br />
Eiszeit“. Das Mittelalter war, klimatisch gesehen, eine relativ günstige Periode. Die Vikinger hatten Südgrönland<br />
und Island besiedelt und dort sogar Getreide anbauen können, was heute undenkbar wäre. Gegen Ende des<br />
Mittelalters begann sich das Klima drastisch zu verschlechtern. Die Gletscher begannen immer weiter in besiedelte<br />
Alpentäler vorzustoßen. Im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t mussten eine Reihe von hochgelegenen Almen und Bergwerken<br />
aufgegeben werden, weil sie von den vorrückenden Gletschern überrannt wurden. Höchststände erreichten<br />
die Gletscherzungen während <strong>der</strong> Kleinen Eiszeit jeweils um 1640, 1750, 1840 und 1920. Die Moränenwälle dieser<br />
Eisstände sind vielfach noch heute gut zu sehen. Nach alten Bil<strong>der</strong>n und Berichten kann man die Eisstände
86<br />
vielfach auch gut datieren. Die Gletscherzungen von größeren Gletschern haben sich seither oft mehr als 1 km<br />
zurückgezogen, z.B. <strong>der</strong> Rhônegletscher.<br />
Die Zusammenhänge scheinen auf den ersten Blick ganz einfach zu sein. Wird das Klima kälter, sinkt also die<br />
durchschnittliche Temperatur, so stoßen die Gletscher vor, wird es dagegen wärmer, schmelzen die Gletscher<br />
weg. Das Ende <strong>der</strong> Kleinen Eiszeit und die momentan messbare Erhöhung <strong>der</strong> Durchschnittstemperaturen werden<br />
mit <strong>der</strong> Industrialisierung und <strong>der</strong> Freisetzung von Treibhausgasen in Verbindung gebracht. Sie werden für<br />
den Rückgang <strong>der</strong> Gletscher verantwortlich gemacht – aber ganz so einfach ist es offenbar nicht.<br />
Die Frage ob die Gletscherbilanz positiv o<strong>der</strong> negativ ist, d.h. ob im Nährgebiet eines Gletschers mehr (o<strong>der</strong><br />
weniger) Wasser in Form von Schnee akkumuliert wird, als im Zehrgebiet wegschmilzt, hängt nicht von den<br />
Durchschnittstemperaturen alleine ab. Wichtig ist vor allem die Nie<strong>der</strong>schlagshöhe und die Verteilung <strong>der</strong> Temperaturen<br />
und Nie<strong>der</strong>schläge auf Sommer und Winter. Die relativ warme Periode im Mittelalter, die mit <strong>der</strong> Kleinen<br />
Eiszeit zu Ende ging, kann kaum etwas mit Treibhausgasen zu tun gehabt haben, denn die Industrialisierung hat<br />
erst zu Beginn des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts begonnen.<br />
Tatsache ist aber trotzdem, dass zumindest die kleineren Gletscher momentan weltweit drastisch zurückschmelzen.<br />
Es gibt sogar Hinweise darauf, dass einige von ihnen offenbar sogar den niedrigsten Stand innerhalb <strong>der</strong><br />
letzten Jahrtausende erreicht haben. Dafür spricht die Entdeckung einer Mumie im Ötztal, die Eis auf einem<br />
hochgelegenen Pass freigegeben hatte. Dieser „Ötzi“ genannte jungsteinzeitliche Mann war hier vor ca. 5000<br />
Jahren umgekommen und eingefroren, aperte aber erst 1992 wie<strong>der</strong> aus dem Eis heraus.<br />
Einige Zungen und Auslassgletscher des Grönländischen Inlandeises ziehen sich gleichfalls zurück, aber mindestens<br />
ebenso viele stoßen im Augenblick vor. Die Zusammenhänge zwischen Gletscherbewegungen und<br />
Klima scheinen doch komplizierter zu sein und man hat sie noch lange nicht verstanden. Niemand kann sagen,<br />
wie sich das Klima im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t ohne menschliches Zutun entwickelt hätte. Jedenfalls sind große Klimaschwankungen,<br />
etwa die drastische Erwärmung <strong>der</strong> Erde am Ende <strong>der</strong> letzten Eiszeit, ganz sicher ohne eine<br />
menschliche Beteiligung abgelaufen. Deshalb wissen wir auch nicht mit Sicherheit, ob <strong>der</strong> neuerliche Rückgang<br />
<strong>der</strong> kleinen Gletscher wirklich ursächlich etwas mit dem Anstieg <strong>der</strong> Treibhausgase in <strong>der</strong> Atmosphäre und mit<br />
<strong>der</strong> dadurch verursachten Klimaerwärmung zu tun hat.<br />
10.8.3 Die eiszeitliche Lebewelt Deutschlands<br />
Der Bereich zwischen dem Nordeuropäischen Inlandeis und dem alpinen Vereisungsgebiet war dagegen weitgehend<br />
frei von Gletschern. In diesem damals völlig waldlosen Gebiet breiteten sich karge Tundren und Steppen<br />
aus, wie heute noch z.B. in Grönland, in hohen Lagen <strong>der</strong> Alpen o<strong>der</strong> den Bergen Norwegens. Tundren (Zwergstrauchheiden)<br />
sind Miniwäl<strong>der</strong>, Pflanzengesellschaften aus kaum kniehohen Holzpflanzen. Neben zwergwüchsigen<br />
Birken- und Weidenarten gedeihen hier z.B. Rauschbeere, Krähenbeere o<strong>der</strong> Alpenrose. Steppen (Grasheiden)<br />
sind Pflanzengesellschaften von Kräutern, in denen neben verschiedenen Gräsern auch viele Blumen<br />
vorkommen. Hier wachsen z.B. Seggen, Süßgräser, Wollgräser, Arnika, Glockenblume, Weidenröschen o<strong>der</strong><br />
Wintergrün. Während <strong>der</strong> Kaltzeiten gab es höchstens in einigen windgeschützten Tälern <strong>der</strong> Alb o<strong>der</strong> des Rheinischen<br />
Schiefergebirges schütteres Birken- und Weidengestrüpp. Kleinere Bestände von Bäumen konnten die<br />
Kaltzeiten in den Tälern Siebenbürgens, des Balkan und <strong>der</strong> Pyrenäen überdauern. Große, geschlossene Wäl<strong>der</strong><br />
gab es erst am Mittelmeer o<strong>der</strong> in den heute wüstenhaften Gebieten Nordafrikas und Vor<strong>der</strong>asiens.<br />
Wie zahlreiche Knochenfunde in Deutschland zeigen, wurden die eiszeitlichen Steppen und Tundren von einer<br />
Anzahl kälteangepasster Tiere bevölkert. Einige dieser Tiere kann man auch heute noch in arktischen Län<strong>der</strong>n<br />
o<strong>der</strong> den Zentralasiatischen Steppen beobachten, wie Moschusochse, Rentier, Saiga-Antilope, Steppenwildpferd,<br />
Polarfuchs, Wolf, Schneehase, Eistaucher o<strong>der</strong> Schneeammer. An<strong>der</strong>e sind inzwischen ausgestorben bzw. ausgerottet<br />
worden, wie Mammut, Auerochs, Steppenwiesent, Höhlenbär o<strong>der</strong> Höhlenlöwe.
87<br />
Tabelle 6: Stark vereinfachte Glie<strong>der</strong>ung des Quartärs in Deutschland. Zusammengestellt aAus<br />
WIEGANK (1990), JERZ (1993) und EHLERS (1994).<br />
GLIEDERUNG DES QUARTÄRS<br />
IN NORDDEUTSCHLAND<br />
GLIEDERUNG DESS QUARTÄRS<br />
IN SÜDDEUTSCHLAND<br />
—————————————————————— heute ———————————————————————<br />
„Nacheiszeit“ (Postglazial)<br />
„Nacheiszeit“ (Postglazial)<br />
—————————————————————————— 10 200 J.v.h. ————————————————————————————<br />
Weichsel-Eiszeit<br />
Würm-Eiszeit<br />
———————————————————— 115 000 J.v.h. ——————————————————————<br />
Eem-Interglazial<br />
Riss-Würm-Interglazial<br />
———————————————————— 130 000 J.v.h. ——————————————————————<br />
Saale-Eiszeit<br />
Riss-Eiszeit<br />
———————————————? ? —————————————————<br />
Holstein-Interglazial<br />
Mindel-Riss-Interglazial<br />
———————————————? 420 000 ? 380 000 —————————————————<br />
Elster-Eiszeit<br />
Mindel-Eiszeit<br />
———————————————? 480 000 ? —————————————————<br />
Cromer-Komplex<br />
Günz-Mindel-Interglazial<br />
———————————————? 780 000 ? —————————————————<br />
Dorst-Kaltzeit<br />
Günz-Eiszeit<br />
———————————————? 780 000 ? —————————————————<br />
Leerdam-Warmzeit<br />
Donau-Günz-Interglazial<br />
———————————————? ? — — — — — — — — — — — — —<br />
Linge-Kaltzeit<br />
———————————————?<br />
Bavel-Warmzeit<br />
Donau-Kaltzeitengruppe<br />
———————————————?<br />
Menap-Kaltzeit<br />
———————————————? 1,7 Millionen ? — — — — — — — — — — — — —<br />
Waal-Warmzeit<br />
———————————————?<br />
Eburon-Kaltzeit<br />
Biber-Kaltzeitengruppe<br />
———————————————? 1,7 Millionen<br />
Tegelen-Warmzeit<br />
———————————————?<br />
Prätegelen-Kaltzeit<br />
———————————————————————— 1,7 / 2,4 Millionen — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —<br />
Reuver-Komplex<br />
Pliozän<br />
10.8.4 Eisrückzug und Nacheiszeit<br />
Wir leben heute in einem Interglazial, einer Postglazial („Nacheiszeit“) o<strong>der</strong> Holozän genannten Warmzeit. Nicht<br />
lange nachdem die Gletscher <strong>der</strong> letzten Eiszeit (Würm- o<strong>der</strong> Weichsel-Eiszeit) ihre größte Ausdehnung erreicht<br />
hatten, vor 25 000 bis 18 000 Jahren, setzte bereits eine zögernde Klimaverbesserung ein. Sie führte im<br />
Alpenvorland wie in Norddeutschland zu einem allmählichen Zurückschmelzen <strong>der</strong> Eisrän<strong>der</strong>. Vor etwa 14000<br />
Jahren, als das Nordeuropäische Inlandeis zwar schon etwas zurückgegangen war, das Ostseebecken aber noch<br />
immer noch unter Gletschern verborgen lag, war das Alpenvorland schon weitgehend eisfrei. Dann wurde die<br />
Klimaerwärmung dramatisch. Vor etwa 13 000 Jahren wurde <strong>der</strong> südliche Teil des Ostseebeckens vom Inlandeis<br />
freigegeben. Hier entstand ein riesiger Eisrandstausee, auf dem Eisberge herumschwammen, <strong>der</strong> Baltische<br />
Eissee. Vor etwa 11 000 Jahren brach <strong>der</strong> Baltische Eissee in Südschweden am Billingen nach W durch und lief<br />
aus. Über die südschwedische Vänern-Senke drang anschließend das Meer in die Ostsee ein.<br />
Das komplizierte Wechselspiel zwischen dem Zurückschmelzen <strong>der</strong> Eisrän<strong>der</strong>, dem Meeresspiegelanstieg und<br />
<strong>der</strong> in den eisfreien Gebieten einsetzenden glazial-isostatischen Landhebung führt zu einer ständigen Verschiebung<br />
<strong>der</strong> Küstenlinien im Nord- und Ostseegebiet. Die durch Eisentlastung bedingte Landhebung geht im übrigen<br />
bis heute weiter und beträgt im ehemaligen Zentrum des Eisschildes (Bottnischer Meerbusen) immer noch<br />
mehr als 1 cm pro Jahr! Weite Teile Skandinaviens, vor allem die beson<strong>der</strong>s fruchtbaren Gebiete in Süd- und<br />
Mittelschweden, sind deshalb ehemaliger Meeresboden und mit jungen Meeresablagerungen bedeckt. Umge-
88<br />
kehrt sinken die Gebiete, die an die ehemaligen Eisschilde angrenzen, langsam ab. Diese Landsenkung führte in<br />
historischer Zeit zu einem dramatischen Vordringen des Meeres an <strong>der</strong> deutschen und nie<strong>der</strong>ländischen Nordseeküste.<br />
Um das Kulturland zu erhalten, werden hier seit dem Mittelalter Deiche gebaut. Da das Land aber bis<br />
heute unerbittlich weiter sinkt, müssen diese ständig erhöht werden, um Überflutungen zu vermeiden.<br />
Vor etwa 10 200 Jahren beginnt die Nacheiszeit. Diese Grenze ist als Ende <strong>der</strong> Eiszeit, besser als Ende <strong>der</strong><br />
Würm- bzw. Weichsel-Eiszeit, einfach so festgelegt worden, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt die Alpengletscher<br />
bereits längst in die Hochlagen <strong>der</strong> Alpen zurückgezogen hatten, während das schrumpfende Nordeuropäische<br />
Inlandeis immer noch große Teile Finnlands und Schwedens bedeckte. Das vom Eis freigegebene Land wurde<br />
teilweise wie<strong>der</strong> vom steigenden Meeresspiegel überflutet, <strong>der</strong> Rest überzog sich mit ausgedehnten Wäl<strong>der</strong>n. Vor<br />
etwa 8000 Jahren waren auch die letzten Reste des Nordeuropäischen Inlandeises abgeschmolzen, die sich bis<br />
dahin noch in Nordschweden gehalten hatten.<br />
10.8.5 Glazial-Stratigraphie<br />
Die klassische Glie<strong>der</strong>ung des quartären Eiszeitalters in Nordeutschland und in Süddeutschland ist sehr unterschiedlich.<br />
In Süddeutschland wurde durch A. Penck eine Stratigraphie kaltzeitlicher Bildungen entwickelt und<br />
später immer weiter ausgebaut, die auf einer zeitlichen Glie<strong>der</strong>ung von Schmelzwasserkiesen großer Vorlandgletscher<br />
beruht. Die Warmzeiten äußern sich hier meist nur als Verwitterungsbildungen auf diesen Kiesen und<br />
durch das Einschneiden <strong>der</strong> Flusstäler. Im nordischen Vereisungsgebiet ist durch A. Penck zunächst auch eine<br />
Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kaltzeiten versucht worden, in <strong>der</strong> Zeit nach ihm ist die Glie<strong>der</strong>ung des Quartärs aber mehr und<br />
mehr zu einer Stratigraphie warmzeitlicher Bildungen geworden, vor allem deshalb, weil die vollständigsten Profile<br />
im Rheindelta zu finden sind. Hier handelt es sich vor allem um interglaziale, pflanzenführende Ablagerungen. Die<br />
Kaltzeiten machen sich hier meist nur durch Verschiebungen in den Pflanzengesellschaften und den Pollenspektren,<br />
mitunter auch durch Lössbildung bemerkbar. Sicher parallelisierbar sind nur die jüngsten Abschnitte <strong>der</strong><br />
beiden Zeitskalen. Die zeitlichen Beziehungen <strong>der</strong> älteren (mittel- und altpleistozänen) Kalt- und Warmzeiten sind<br />
dagegen bis heute völlig unklar.<br />
10.9 Grundwasserlandschaften im Süden Bayerns<br />
Von <strong>der</strong> englischen Queen wird erzählt, dass sie immer eine Flasche mit Quellwasser aus dem Schottischen<br />
Hochland mit sich führt, wenn sie verreist. Das Wasser dient <strong>der</strong> Zubereitung von Tee – offensichtlich <strong>der</strong> reine<br />
Snobismus!? Wer aber einmal in London war und dort das Wasser gekostet hat, das aus den Wasserleitungen<br />
kommt, hat tiefes Verständnis für die Queen: Das Londoner Wasser schmeckt nach Desinfektionsmittel und ist für<br />
einen, <strong>der</strong> gutes Trinkwasser gewöhnt ist, schlichtweg ungenießbar. Die Versorgung <strong>der</strong> Bevölkerung mit<br />
Trinkwasser ist in vielen Län<strong>der</strong>n und vor allem in Ballungsgebieten ein großes Problem. In dicht besiedelten<br />
Gegenden mit nur unbedeutenden und durch die intensive Landwirtschaft stark belasteten Grundwasservorkommen,<br />
etwa in England, Belgien o<strong>der</strong> den Nie<strong>der</strong>landen, muss zur Gewinnung von Trinkwasser größtenteils auf<br />
Oberflächenwasser zurückgegriffen werden, das man entsprechend aufbereitet, damit es genießbar wird und<br />
hygienisch unbedenklich ist.<br />
Tatsächlich würde man auch hier natürlich lieber auf die jeweils zur Verfügung stehenden Grundwasservorräte<br />
zurückgreifen, wenn diesen Vorkommen nur ausreichende Trinkwassermengen entnommen werden könnten. In<br />
Abhängigkeit von den jeweiligen geologischen Verhältnissen gibt es in jedem Lande charakteristische Grundwasservorkommen,<br />
die dort genutzt werden können, wenn sie nur genügend ergiebig sind. In Mittelschweden verwendet<br />
man Grundwasservorkommen, die in eiszeitlichen Kiesrücken zu finden sind, den sog. Osern. In <strong>der</strong><br />
Libyschen Wüste nutzt man fossile Grundwässer in porösen Sanden, die man aber über Bohrungen aus größerer<br />
Tiefe för<strong>der</strong>n muss. Welche Grundwasservorkommen stehen uns im südlichen Bayern zur Verfügung?<br />
10.9.1 Grundwasser aus jungen eiszeitlichen Schmelzwasserkiesen<br />
Da sind zunächst die großen Vorkommen junger eiszeitlicher Kiese in den Talebenen zu nennen, die z.B. den<br />
Lech zwischen Landsberg und <strong>der</strong> Lechmündung (Lechfeld) begleiten o<strong>der</strong> die die Ebene zwischen Isar und<br />
Amper aufbauen, die Münchner Schotterebene. Die teilweise dekametermächtigen Kiese werden von bedeutend<br />
älteren, wasserstauenden Gesteinen <strong>der</strong> Molasse, dem sog. „Flinz“ unterlagert und nach <strong>der</strong> Seite hin begrenzt.
89<br />
Sie sind nur am Grunde einiger die Kiese durchschneiden<strong>der</strong> Täler sichtbar. Die in den Kiesen vorhandenen<br />
Grundwasservorkommen sind zumeist sehr ergiebig und werden deshalb häufig für die Trinkwassergewinnung<br />
genutzt. Ihre Einzugsgebiete weisen hohe Grundwasserneubildungsraten auf, wobei das entnommene Wasser<br />
überwiegend durch die einsickernden Nie<strong>der</strong>schläge, teilweise aber auch durch versickerndes Flusswasser<br />
erneuert wird. Da diese Kiese vergleichsweise jung sind – sie entstanden als Ablagerungen von Schmelzwässern<br />
erst vor rund 20 000 bis 25 000 Jahren – tragen sie nur eine dünne lehmige Verwitterungsdecke (20-50 cm), die<br />
nur einen geringen Schutz für die darunterliegenden Grundwasservorkommen vor einsickernden Schadstoffen<br />
gewährleistet. Durch die dichte Besiedelung, die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Ackerbau, Güllewirtschaft),<br />
die Schadstoffbelastung <strong>der</strong> Oberflächengewässer und zahllose „Altablagerungen“ (mit Müll verfüllte ehemalige<br />
Kiesgruben), sind diese Grundwasservorkommen meist nicht ausreichend zu schützen, daher häufig<br />
gefährdet. Um das Grundwasser hier langfristig schützen zu können, müssen deshalb in den Talebenen meist<br />
große Wasserschutzgebiete und Wasservorrangflächen ausgewiesen werden.<br />
10.9.2 Grundwasseranreicherung mit Oberflächenwasser<br />
Werden aus den oben beschriebenen Kiesen sehr große Grundwassermengen entnommen, ist die Regeneration<br />
des Grundwassers nur über die Nie<strong>der</strong>schläge oft nicht ausreichend. Man muss dann u.U. auf Oberflächenwasser<br />
ausweichen o<strong>der</strong> dieses zumindest zusätzlich nutzen.<br />
In Brunnen am Stadtrand von Sonthofen nahe <strong>der</strong> Ostrach, die in Schwemmfächerkiesen <strong>der</strong> Starzlach stehen,<br />
werden große Grundwassermengen entnommen, um damit Teile des Allgäus mit Trinkwasser versorgen zu können.<br />
Der größte Teil des entnommenen Wassers wird durch weitgehend unbelastetes Oberflächenwasser ersetzt,<br />
das die Starzlach in das Grundwasser einspeist, sobald sie den Kieskörper bei Winkel erreicht. Die Starzlach<br />
bringt kaum Schadstoffe mit, weil sie aus einem großflächig bewaldeten Gebiet kommt, in dem es keine Siedlungen<br />
und kaum landwirtschaftliche Nutzung gibt.<br />
Einen grundsätzlich vergleichbaren Weg beschreitet man z.B. bei <strong>der</strong> Wasserversorgung des fränkischen Wirtschaftsraumes.<br />
Bei Rain nahe <strong>der</strong> Lechmündung werden große Mengen von Grundwasser aus einem größtenteils<br />
eiszeitlichen Kieskörper gepumpt, in den <strong>der</strong> Lech eingeschnitten ist. Die dadurch bedingte lokale Grundwasserabsenkung<br />
führt dazu, dass mäßig belastetes Flusswasser in den Kieskörper einsickert und in Richtung<br />
auf die einige Kilometer vom Lech entfernte Grundwasserentnahmestelle zuströmt. Man reichert hier das Grundwasser<br />
mit mäßig belastetem Oberflächenwasser an und setzt dabei auf die Reinigungswirkung des Kieses.<br />
Die Nutzung des Grundwasserbegleitstromes von Flüssen ist naturgemäß umso bedenklicher, je stärker das<br />
Flusswasser belastet ist. Wenn in Ballungsräumen keine an<strong>der</strong>en großen Grundwasservorkommen zur Verfügung<br />
stehen, bleibt in vielen Gegenden Mitteleuropas allerdings nichts an<strong>der</strong>es übrig, als <strong>der</strong>artige „Uferfiltrate“ zur<br />
Trinkwassergewinnung heranzuziehen.<br />
10.9.3 Grundwasser aus Moränen<br />
In den Eiszeiten war <strong>der</strong> südliche Teil des Alpenvorlandes mehrmals großflächig von Eis bedeckt. Vor etwa<br />
20 000 Jahren haben die Gletscher <strong>der</strong> letzten Eiszeit ihre größte Ausdehnung erreicht und waren in mehreren<br />
breiten Zungen bis Schussenried, Leutkirch, Dietmannsried, Kaufbeuren, Schongau, Geltendorf, Fürstenfeldbruck<br />
und Starnberg nach Norden vorgestoßen, wo sich eine Zeitlang ein labiles Gleichgewicht zwischen Abschmelzen<br />
und Nachfließen des Eises einstellte.<br />
An <strong>der</strong> Gletscherstirn schmolz <strong>der</strong> mitgebrachte Gesteinsschutt aus und häufte sich mit <strong>der</strong> Zeit zu niedrigen<br />
Rücken und Kuppen an, die als Moränenwälle bezeichnet werden. Diese Eisrandablagerungen bestehen größtenteils<br />
aus Kiesen mit unterschiedlichen Gehalten an Schluff, Ton und Sand und dementsprechend sehr unterschiedlichen<br />
Wasserdurchlässigkeiten. Teilweise treten hier auch weitgehend wasserundurchlässige Geschiebelehme<br />
und Seeablagerungen auf. Bei kurzfristigen Vorstößen des Eisrandes wurden ältere Eisrandbildungen u.U.<br />
in Falten gelegt und zu Stauchmoränen zusammengeschoben. Durch „Oszillationen“ des Eisrandes um eine<br />
Randlage konnten sich mit <strong>der</strong> Zeit komplexe Wallsysteme bilden. Wallsysteme, die während <strong>der</strong> Maximalstände<br />
einer Eiszeit entstanden sind, werden als Endmoränen bezeichnet, solche, die beim Rückschmelzen <strong>der</strong> Gletscher<br />
entstanden, „Rückzugsmoränen“ genannt.<br />
Heute noch kann man Endmoränen und Rückzugsmoränen als kilometerbreite Hügelstränge quer durch das südliche<br />
Alpenvorland verfolgen. Diese hügeligen Moränenlandschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie überaus<br />
heterogen und komplex aufgebaut sind. Unmittelbar neben durchlässigen Kiesen liegen wasserstauende
90<br />
Schluffe, unter kaum durchlässigen Geschiebelehmen findet man Rollkiese, die von wasserstauenden Tonen<br />
unterlagert werden, und darunter u.U. erneut Kiese. Alle Gesteinskörper halten seitlich nicht lange durch, sind<br />
meist relativ klein und kompliziert geformt. Oft gibt es hier mehrere Grundwasserstockwerke übereinan<strong>der</strong>; die<br />
Aquifere zeigen meistens komplexe hydraulische Wechselwirkungen. Der geologische Aufbau von Moränen ist<br />
nicht selten sehr kompliziert und manchmal auch mit extrem großem Aufwand an teuren Bohrungen nicht mit<br />
letzter Sicherheit herauszufinden.<br />
In den Eisrandablagerungen von Moränen ist es normalerweise kein großes Problem, wasserführende Kiese zu<br />
finden. Hin und wie<strong>der</strong> wird man auch auf Grundwasservorkommen treffen, aus denen man größere Mengen von<br />
Wasser entnehmen kann. Aber es ist meist fast unmöglich herauszufinden, woher dieses Wasser letztlich kommt<br />
und wohin es strömt. Das bedeutet aber, dass es kaum durchführbar ist, diese Grundwasservorkommen hinreichend<br />
zu schützen. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite müssen solche Gegenden so gut wie möglich auch von potentiellen<br />
Verschmutzungsquellen (z.B. Deponien) freigehalten werden, denn es ist kaum vorhersagbar, wohin die bei<br />
einem Unfall eingetragenen Stoffe letztlich gelangen.<br />
10.9.4 Grundwasser aus alten eiszeitlichen Schmelzwasserkiesen<br />
An vielen Stellen in Südbayern, vor allem im Gebiet zwischen Iller und Lech, gibt es eine große Zahl niedriger,<br />
bewaldeter Höhenrücken, die im Kern aus vergleichsweise alten, teilweise zu porösen Konglomeraten verbackenen<br />
eiszeitlichen Kiesen bestehen. Die Kiese liegen bedeutend älteren, wasserstauenden Molasseablagerungen<br />
(„Flinz“) auf, die den Sockel dieser oft plateauförmigen Höhen aufbauen. An den Bergflanken tritt das Grundwasser<br />
in zahlreichen Quellen zu Tage, genau dort, wo die Grenzfläche zwischen Schotter und Flinzmergeln vom<br />
Hang angeschnitten wird. Da die Kiese zwischen 0,4 und mehr als 1 Million Jahre alt sind und seit ihrer Entstehung<br />
ständig <strong>der</strong> Verwitterung ausgesetzt waren, tragen sie gewöhnlich sehr mächtige, lehmige Deckschichten,<br />
die auf den Plateaus stellenweise an die 10 m dick werden können. Diese Deckschichten sind teilweise so stark<br />
entkalkt, die Böden daher so sauer, dass sie weithin nur forstwirtschaftlich genutzt werden. Die eingeschränkte<br />
Nutzung und die Mächtigkeit dieser nur gering wasserdurchlässigen Deckschichten bilden einen ausgezeichneten<br />
Schutz für die darunterliegenden Grundwasservorkommen. Viele dieser Quellen werden deshalb schon lange für<br />
die Wasserversorgung genutzt, wobei die Quellschüttungen in <strong>der</strong> Regel nur wenige Liter pro Sekunde betragen.<br />
Solche Quellen versorgen zumeist kleinere Gemeinden, Weiler und Einzelhöfe. Allerdings gibt es auch einzelne<br />
sehr ergibige Quellen, <strong>der</strong>en Schüttungen mehrere Zehnerliter pro Sekunde betragen. Damit können sie auch für<br />
die Versorgung größerer Städte (z.B. Kaufbeuren) genutzt werden.<br />
10.9.5 Tiefengrundwässer aus <strong>der</strong> Vorlandmolasse<br />
Um möglichst unbelastetes Grundwasser zu erschließen, wurden früher die tiefer liegenden Grundwasserstockwerke<br />
angebohrt. Viele Bohrungen, die teilweise schon Tiefen von mehreren hun<strong>der</strong>t Metern erreichen, waren<br />
erfolgreich. So wird z.B. Trinkwasser aus wasserführenden Horizonten innerhalb <strong>der</strong> Molasse gewonnen. Die<br />
Molasse ist eine stellenweise mehrere tausend Meter mächtige, vergleichsweise alte Wechselfolge von Mergeln,<br />
Sanden und Kiesen aus <strong>der</strong> Tertiärzeit, die überall im Alpenvorland unter den eiszeitlichen Sedimenten liegt. Der<br />
größte Teil dieser Gesteine, vor allem Sande und Mergel, sind Grundwasserhemmer bzw. Grundwasserstauer, es<br />
gibt aber auch durchlässige kiesig-sandige Horizonte, die wasserführend sein können. Diese Aquifere sind oft<br />
breite schlauch- o<strong>der</strong> strangförmige Gebilde, denn es handelt sich meist um Füllungen alter Flussrinnen. Tiefengrundwässer,<br />
die man aus solchen Aquiferen för<strong>der</strong>t, haben in <strong>der</strong> Regel beste Qualität, wenn sie auch sauerstofffrei<br />
und – dadurch bedingt – reich an gelöstem Eisen sind. Würde man dieses Wasser direkt in die Haushalte<br />
leiten, käme aus den Wasserhähnen eine unappetitlich braune Brühe heraus, denn das im Wasser gelöste Eisen<br />
oxidiert an <strong>der</strong> Erdoberfläche auf und flockt als Eisenhydroxid aus. Das Wasser muss daher gezielt belüftet und<br />
das ausflockende gelbbraune Eisenhydroxid abgefiltert werden, bevor es ins Leitungsnetz eingespeist und<br />
getrunken werden kann. Viele Brauereien, aber auch einige Gemeinden beziehen ihr Wasser aus diesen tiefen<br />
Grundwasserstockwerken.<br />
Was an <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Tiefengrundwässer stört, ist die Tatsache, dass es sich größtenteils um alte (fossile)<br />
Grundwasservorkommen handelt, die sich natürlicherweise entwe<strong>der</strong> überhaupt nicht o<strong>der</strong> nur extrem langsam<br />
regenerieren. Durch die permanente Grundwasserentnahme wird <strong>der</strong> Druck in den wasserführenden Horizonten<br />
erniedrigt. Dadurch wird Wasser aus höheren Grundwasserstockwerken angesaugt und die Regeneration enorm<br />
beschleunigt. Bei dieser erzwungenen Regeneration können aber die Schadstoffe, denen man ausweichen wollte,
91<br />
langfristig auch in größere Tiefe vordringen. Wenn sie dort erst einmal angekommen sind, ist eine Sanierung<br />
praktisch unmöglich. Ziel einer zukunftsorientierten Trinkwasserversorgung muss deshalb wie<strong>der</strong> eine stärkere<br />
Nutzung <strong>der</strong> oberflächennahen Grundwasservorkommen sein, wobei <strong>der</strong>en Wasserqualität durch eine Verringerung<br />
<strong>der</strong> Schadstoffeinträge und eine schonen<strong>der</strong>e Bodennutzung verbessert und durch Schutzgebiete dauerhaft<br />
gesichert werden sollte.<br />
10.9.6 Karstgrundwasser aus Kalksteinen, Dolomit und Nagelfluh<br />
Wie oben bereits dargestellt wurde, sind in Gebieten, <strong>der</strong>en Untergrund aus dichten, porenarmen Festgesteinen<br />
besteht, keine größeren Grundwasservorkommen zu erwarten. Eine Ausnahme bilden hier nur Kalksteine, Dolomite<br />
und an<strong>der</strong>e lösliche Festgesteine, die verkarstet sein können. Solche Karstgebiete, die man in Südbayern<br />
vor allem in <strong>der</strong> Schwäbisch-Fränkischen Alb und innerhalb <strong>der</strong> Alpen findet, zeichnen sich dadurch aus, dass es<br />
kaum einen oberirdischen Abfluss gibt, da das Nie<strong>der</strong>schlagswasser entlang von Klüften, die durch Lösung<br />
erweitert sind, und Dolinen sehr schnell in den Untergrund einsickert. Abdichtende Deckschichten, die eine Reinigungswirkung<br />
auf einsickernde Wässer haben, sind meistens nicht vorhanden. Das Grundwasser bewegt sich<br />
sehr schnell und kommt nach kurzer Zeit in Karstquellen wie<strong>der</strong> an die Erdoberfläche. Karstquellen schütten deshalb<br />
meist sehr unregelmäßig und reagieren beson<strong>der</strong>s schnell auf Nie<strong>der</strong>schläge. Das Wasser hat nur kurze<br />
Verweilzeiten im Untergrund und wird beim Durchströmen <strong>der</strong> Karsthöhlen kaum gereinigt. Alles zusammen<br />
bewirkt, dass man bei Karstwässern sehr oft mit bakteriologischen Verunreinigungen zu kämpfen hat. Deshalb ist<br />
die Nutzung von Karstwässern als Trinkwasser auch in dünn besiedelten und bewaldeten Gebieten problematisch.<br />
In Gegenden, die von Oolithkalk, Schrattenkalk, Wettersteinkalk, Oberrhätkalk, Kössener Kalk, Hauptdolomit<br />
und an<strong>der</strong>en gebankten o<strong>der</strong> massigen Karbonatgesteinen aufgebaut sind, werden Karstquellen denn<br />
auch nur ausnahmsweise zur Wasserversorgung genutzt, wenn man keine an<strong>der</strong>en Möglichkeiten <strong>der</strong> Wassererschließung<br />
hat (GOLDSCHEIDER & HÖTZL 2000). Am Alpennordrand, wo vorwiegend Ablagerungen <strong>der</strong> Molasse<br />
verbreitet sind, ist man bisher jedoch davon ausgegangen, dass es hier keine verkarstungsfähigen Gesteine gibt.<br />
Das hat sich in jüngster Zeit indes als falsch herausgestellt.<br />
Die dominierenden Gesteine innerhalb <strong>der</strong> Faltenmolasse im Allgäu und in Vorarlberg sind Konglomerate, die hier<br />
als „Nagelfluh“ bezeichnet werden. Die Hochgratkette z.B. wird aus einer Schichtfolge aufgebaut, die zu 90 % aus<br />
Konglomeraten besteht, daneben treten aber auch Mergel und untergeordnet Sandsteine auf. Der obere Teil des<br />
Nordhanges und <strong>der</strong> Gipfelgrat <strong>der</strong> Hochgratkette besteht fast nur aus gröbstkörnigen Konglomeraten, von denen<br />
einzelne Bänke bis zu 60 m mächtig werden und Komponenten mit Durchmessern bis zu 70 cm enthalten<br />
können. Die oft sehr grobkörnigen und mächtigen Konglomeratbänke vor allem <strong>der</strong> Unteren Süßwassermolasse<br />
bestehen überwiegend aus Dolomit- und Kalkgeröllen (LEMCKE 1988). Der durchschnittliche Karbonatgehalt <strong>der</strong><br />
hierin vorkommenden Konglomerate beträgt 74 % und kann bis auf 90 % steigen. Es handelt sich also, nur von<br />
<strong>der</strong> Mineralogie her betrachtet, eigentlich um Karbonatgesteine, die bekanntlich zur Verkarstung neigen.<br />
Auf den Bankoberflächen dieser Konglomerate sind oft Karrenfel<strong>der</strong> zu beobachten, sowohl Rinnenkarren als<br />
auch Kluftkarren, ganz ähnlich wie im Gottesackergebiet (SCHOLZ & STROHMENGER 1999). Außerdem gibt es hier<br />
Hun<strong>der</strong>te von Dolinen, große, abflusslose Senken, die oft in Reihen auftreten und in denen mitunter sogar Bäche<br />
versinken. In vielen Bereichen <strong>der</strong> Faltenmolasse fehlt ein oberirdisches Entwässerungsnetz, da die Entwässerung<br />
über weite Strecken unterirdisch erfolgt. Außerdem sind hier viele schüttungskräftige Quellen bekannt,<br />
<strong>der</strong>en Ergiebigkeit wie bei Karstquellen in hohem Maße von den Nie<strong>der</strong>schlägen abhängt. Alles zusammen sind<br />
deutliche Hinweise auf einen verkarsteten Untergrund. Im Lecknertal bewiesen Färbeversuche, dass sich das<br />
Wasser im Untergrund mit 150 bis 300 m pro Stunde so rasch wie in den Höhlensystemen des Gottesackers<br />
bewegt, was als Hinweis auf die Existenz von Höhlen auch im Untergrund <strong>der</strong> Faltenmolasse zu werten ist<br />
(GÖPPERT et al. 2002). In <strong>der</strong> Westschweizer Molasse sind sogar große Karsthöhlen in Konglomeraten bekannt<br />
geworden, die begehbar sind. Folglich muss man Teile des Alpennordrandes sowie des Bayerischen Alpenvorlandes<br />
als Karstgebiete einstufen, in denen die gleichen Probleme mit <strong>der</strong> Wasserversorgung auftreten wie in den<br />
alpinen Karstgebieten.<br />
10.9.7 Übertiefe Grundwässer aus dem Weißen Jura (Malmkarst)<br />
Vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren galt das südbayerische Molassebecken als ein erdölhöffiges Gebiet,<br />
in dem zahlreiche Tiefbohrungen abgeteuft wurden, von denen einige über 6000 m Tiefe erreichten. Die Hoffnungen<br />
auf reiche Ölfunde wurden zwar enttäuscht, aber die geför<strong>der</strong>ten Erdöl- und Erdgasmengen waren immerhin
92<br />
ausreichend, um das Interesse an immer neuen Bohrungen über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Inzwischen ist<br />
die Bohrtätigkeit allerdings weitgehend eingestellt worden.<br />
Als gelegentlich erdölführend erwiesen sich einige Horizonte mit porösen Gesteinen in <strong>der</strong> bis zu 5000 m mächtigen<br />
Schichtfolge tertiärer Molassesedimente, aber auch im darunter liegenden mesozoischen Schichtstapel. Bei<br />
diesen mesozoischen Gesteinen handelt es sich um die gleichen Abfolgen, die auch das Schwäbisch-Fränkische<br />
Stufenland aufbauen: Über dem kristallinen Untergrund folgen Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper sowie<br />
Schwarzer, Brauner und Weißer Jura, ein Schichtstapel, <strong>der</strong> insgesamt über 1000 m mächtig wird. Direkt unter<br />
den Molasseablagerungen folgen gewöhnlich die Kalke des Weißen Jura, wie wir sie von <strong>der</strong> Schwäbischen und<br />
Fränkischen Alb her kennen.<br />
Bei <strong>der</strong> Suche nach Erdöl hat man in den Jurakalken eine interessante Feststellung gemacht: In diesen Kalksteinen<br />
wurden immer wie<strong>der</strong> wassergefüllte Hohlräume und Spalten angebohrt; teilweise fand man große Höhlen,<br />
die untereinan<strong>der</strong> in Verbindung zu stehen schienen. Dass die Jurakalke <strong>der</strong> Alb verkarstet und löchrig sind wie<br />
ein Schweizer Käse, ist ja schon seit langem bekannt. Dort gibt es riesige Höhlensysteme, die freilich nur zum<br />
Teil bekannt und erforscht sind, etwa die Laichinger Tiefenhöhle, Falkensteiner Höhle o<strong>der</strong> Bärenhöhle. Einige<br />
dieser Höhlen sind weitgehend trocken und offensichtlich schon seit längerer Zeit inaktiv, an<strong>der</strong>e werden auch<br />
heute noch von unterirdischen Wasserläufen durchströmt.<br />
Das Überraschende war, dass sich die Jurakalke, die unter Tausenden von Metern mächtigen jüngeren Ablagerungen<br />
verborgen liegen, als genauso löchrig und wasserdurchlässig erwiesen wie diejenigen, die in <strong>der</strong> Alb an<br />
<strong>der</strong> Oberfläche zu sehen sind. Nur gibt es in dieser Tiefe offensichtlich keine trockenen son<strong>der</strong>n nur komplett mit<br />
Wasser gefüllten Hohlräume. Die Verkarstung, <strong>der</strong> wir diese Hohlräume verdanken, ist teilweise uralt und schon<br />
vor <strong>der</strong> Ablagerung <strong>der</strong> darüber folgenden Molasse angelegt worden, zu einer Zeit, als das Alpenvorland im Alttertiär<br />
für längere Zeit landfest war. Auch die Malmkalke in <strong>der</strong> Schwäbisch-Fränkischen Alb sind nachgewiesenermaßen<br />
schon in <strong>der</strong> Oberkreide und im Alttertiär verkarstet, also in einem Zeitraum, <strong>der</strong> zwischen 90 und 40<br />
Millionen Jahren zurückliegt.<br />
Das Wasser in den Karsthöhlen unter dem Alpenvorland ist nicht kalt, wie in <strong>der</strong> Alb, son<strong>der</strong>n warm o<strong>der</strong> gar heiß.<br />
Je tiefer die Kalksteine unter <strong>der</strong> Oberfläche angebohrt wurden, desto heißer war das Wasser, das man in den<br />
Hohlräumen fand. Es ist <strong>der</strong> Wärmefluss aus dem Erdinneren, <strong>der</strong> das Wasser erhitzt. Die Gesteinstemperatur<br />
nimmt mit <strong>der</strong> Tiefe langsam zu, alle 100 m um etwa 2,5 bis 3 °C. Nahe <strong>der</strong> Erdoberfläche hat das Wasser eine<br />
Temperatur von nur etwa 7 °C, in 1000 m Tiefe sind es schon über 30 °C, unter München hatte das in über 2000<br />
m Tiefe erbohrte Wasser schon Temperaturen um 80 °C. Lei<strong>der</strong> interessierte die Erdölindustrie das wenig. Sie<br />
hatte die Auflage, die nicht mehr genutzten Bohrlöcher wie<strong>der</strong> möglichst bald mit Beton zu verfüllen. Um sich die<br />
Kosten hierfür zu sparen, wurden die Bohrungen dem Staat, Städten, Gemeinden o<strong>der</strong> Privatpersonen angeboten,<br />
wenn kein Öl o<strong>der</strong> Gas zu finden war. So manche Bohrung im Alpenvorland war für billiges Geld zu kaufen.<br />
Aber in den 50er und 60er Jahren fanden sich hierfür kaum Interessenten. Nur wenige Bohrungen, an denen<br />
heißes Wasser geför<strong>der</strong>t werden konnte, wurden zu Thermalbä<strong>der</strong>n ausgebaut, so z.B. in Bad Füssing, in Bad<br />
Abbach o<strong>der</strong> in Moosburg. An<strong>der</strong>e Bohrungen nutzte die chemische Industrie, um Abfälle (z.B. Schwermetall- und<br />
FCKW-belastete Dünnsäure) loszuwerden und in den Malmkarst zu verpressen, da die Abfallbeseitigung durch<br />
„Verklappung“ im Meer zunehmend auf Wi<strong>der</strong>stand stieß. Aber die meisten Bohrlöcher wurden wie Sauerbier<br />
angeboten und blieben unverkäuflich.<br />
Heute gäbe es viele Interessenten für die Nutzung <strong>der</strong> kostengünstigen und umweltfreundlichen Thermalwässer<br />
in großem Umfang. Man könnte ausreichend heißes Wasser direkt zum Heizen von Städten benutzen o<strong>der</strong>, bei<br />
niedriger temperierten Wässern, Wärmepumpen damit betreiben. Es ist natürlich bedeutend mehr Energie zu<br />
gewinnen, wenn man 50 °C warmes Wasser für den Betrieb einer Wärmepumpe zur Verfügung hat, als wenn<br />
man Grundwasser mit 7 °C zur Energiegewinnung ein wenig abkühlt. Aber an die Nutzung <strong>der</strong> Energie, die in<br />
dem heißen Wasser steckt, dachte damals noch kaum jemand. Deshalb blieben die meisten Bohrlöcher unverkäuflich,<br />
wurden schließlich wie<strong>der</strong> verfüllt – und sind jetzt nicht mehr nutzbar. Will man heute geothermische<br />
Energie nutzen, muss man neuerlich mit riesigem Kostenaufwand bohren, und das erweist sich oftmals als zu<br />
teuer.<br />
An<strong>der</strong>erseits sind <strong>der</strong> Nutzung des heißen Wassers aus dem Malmkarst enge Grenzen gesetzt. Lei<strong>der</strong> besitzt<br />
man über dieses Thermalwasser bis heute ziemlich wenig Kenntnisse. Man weiß nicht genau, wo es herkommt,<br />
man weiß nicht, ob es, und wenn ja, wie es sich regeneriert. Man weiß auch nicht genau, ob dieses Wasser und<br />
wie es die Höhlen <strong>der</strong> Jurakalke durchströmt und wie es sich auswirken würde, wenn man viel davon herauspumpt<br />
o<strong>der</strong> wenigstens die Wärme in großem Umfang nutzen und das abgekühlte Wasser danach wie<strong>der</strong> einleiten<br />
würde. Auch bei diesen Thermalwässern dürfte es sich, ähnlich wie bei den Tiefengrundwässern aus <strong>der</strong>
93<br />
Molasse, um fossile Grundwässer handeln. Entnimmt man dieses Wasser in großem Stil, lebt man von <strong>der</strong> Substanz.<br />
Die Nutzung dieser geothermischen Energie könnte aber zukünftig einen kleinen Beitrag zu einer CO 2 -<br />
neutralen und damit umweltfreundlichen Energieversorgung leisten.<br />
10.10 Literaturauswahl zur Regionalen <strong>Geologie</strong> von Süddeutschland<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1981): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:500000.– 168 S., 1 geol.<br />
Kt. 1:500000; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1975): Die oberbayerische Pechkohle.– Geologica Bavarica, 73, 142 S.; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1977): Ergebnisse <strong>der</strong> Ries-Forschungsbohrung 1973: Struktur des Kraters und<br />
Entwicklung des Kratersees.– Geologica Bavarica, 75, 470 S.; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1979/1983): Interglaziale und Interstadiale des Pleistozäns im Bayerischen<br />
Alpenvorland (Teil 1 und 2).– Geologica Bavarica, 80 und 84, 188/212 S.; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1986): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von Bayern, Lagerstätten und<br />
Hauptverbreitungsgebiete <strong>der</strong> Steine und Erden.– Geologica Bavarica, 86, 216 S.; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1987): Der Bergbau in Bayern.– Geologica Bavarica, 91, 216 S.; München.<br />
BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT [Hrsg.] (1989): Zur Kenntnis <strong>der</strong> Molasse in Bayern und angrenzenden Gebieten, <strong>Geologie</strong>,<br />
Paläontologie, Klima.– Geologica Bavarica, 94, 484 S.; München.<br />
BÖGEL, H. & SCHMIDT, K. (1976): Kleine <strong>Geologie</strong> <strong>der</strong> Ostalpen.– 231 S.; Thun (Ott-Verl.).<br />
EBERL, B. (1930): Die Eiszeitenfolge im nördlichen Alpenvorlande.– 427 S.; Augsburg (Filser-Verl.).<br />
GAUPP, R. (1980): Sedimentgeschichte und Paläotektonik <strong>der</strong> Kalkalpinen Mittelkreide.– Zitteliana, 8, S. 33-72; München.<br />
GEYER, O. & GWINNER, M. (1991): <strong>Geologie</strong> von Baden-Württemberg.– 472 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
GÖPPERT, N., GOLDSCHEIDER, N. & SCHOLZ, H.: Karsterscheinungen und Hydrogeologie karbonatischer Konglomerate <strong>der</strong> Subalpinen<br />
Molasse im Gebiet Hochgrat und Lecknertal (Bayern/Vorarlberg).– Beiträge zur Hydrogeologie, 53, S. 21-44; Graz, 2002.<br />
HENNINGSEN, D. & KATZUNG, G. (2006): Einführung in die <strong>Geologie</strong> Deutschlands.– 7. Aufl., 234 S.; München (Spektrum-Verl., Elsevier).<br />
JERZ, H. (1966): Untersuchungen über Stoffbestand, Bildungsbedingungen und Paläogeographie <strong>der</strong> Raibler Schichten zwischen Lech<br />
und Inn (Nördliche Kalkalpen) .– Geologica Bavarica, 56, S. 3-100; München.<br />
JERZ, H. (1993): Quartärgeologie von Bayern.– In: <strong>Geologie</strong> von Bayern, Bd. 2.- 243 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
KOHLER, E. (1977): Der historische Erzbergbau im Iller- und Ostrachtal.– Allgäuer Geschichtsfreund, 77, S. 82-95; Kempten.<br />
LEMCKE, K. (1976): Übertiefe Grundwässer im süddeutschen Alpenvorland.– Bull. Ver. schweizer. Petr.-Geol. u. Ing., 42 (103), S. 9-18;<br />
Basel.<br />
LEMCKE, K. (1978): Gespanntes Malmkarstwasser im Untergrund des süddeutschen Alpenvorlandes.– In: Hydrogeologischer Atlas <strong>der</strong><br />
Bundesrepublik Deutschland, Textband, S. 240-245; Boppard (Boldt-Verl.).<br />
LEMCKE, K. (1988): Das Bayerische Alpenvorland vor <strong>der</strong> Eiszeit.– In: <strong>Geologie</strong> von Bayern, Bd. 1.- 175 S.; Stuttgart (Schweizerbart-<br />
Verl.).<br />
Penck, A. & Brückner, E. (1909): Die Alpen im Eiszeitalter.– Bd. 2., 1197 S.; Leipzig (Tauchnitz-Verl.).<br />
RAD, U. von (1972): Zur Sedimentologie und Fazies des Allgüuer Flysches.– Geologica Bavarica, 66, S. 92-147; München.<br />
RICHTER, D. (1984): Allgäuer Alpen.– Sammlung geologischer Führer Bd. 77; Stuttgart (Verl. Gebr. Borntraeger).<br />
RICHTER, M. (1978): Vorarlberger Alpen.– 2. Aufl., Sammlung geologischer Führer, Bd. 49; Stuttgart (Verl. Gebr. Borntraeger).<br />
ROTHE, P. (2005): Die <strong>Geologie</strong> Deutschlands.– 240 S.; Darmstadt (Wiss. Buchgemeinschaft, Primus-Verl.).<br />
SCHEUENPFLUG, L. (1993): Zur Erd- und Landschaftsgeschichte des Landkreises Augsburg.– In: Der Landkreis Augsburg, Bd. 1,<br />
Landschaft und Natur, S. 5-165; Augsburg (Landratsamt Augsburg).<br />
SCHÖNENBERG, R. & NEUGEBAUER, J. (1987): Einführung in die <strong>Geologie</strong> Europas.– 294 S.; Freiburg i. Br. (Rombach-Verl.).<br />
SCHOLZ, H. (1989): Die Obere Meeresmolasse (OMM) am Südrand des Molassebeckens im Allgäu.– Geologica Bavarica, 94, S. 49-81;<br />
München.<br />
SCHOLZ, H. (1995): Bau und Werden <strong>der</strong> Allgäuer Landschaft.– 305 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
SCHOLZ, H. & STROHMENGER, M. (1999): Dolinenartige Sackungsstrukturen in den Molassebergen des südwestbayerischen<br />
Alpenvorlandes.– Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F. 81: 275-283; Stuttgart.<br />
SCHREINER, A. (1992): Einführung in die Quartärgeologie.– 257 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.)
WAGNER, G. (1950): Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte, mit beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung Süddeutschlands.– 2. Aufl.,<br />
664 S.; Öhringen (Hohenlohesche Buchhandlung F. Rau).<br />
Wagner, G. (1950): Rund um Hochifen und Gottesackergebiet.– 116 S.; Öhringen (Hohenlohesche Buchhandlung F. Rau).<br />
WALTER, R. (1992): <strong>Geologie</strong> von Mitteleuropa.– 561 S.; Stuttgart (Schweizerbart-Verl.).<br />
94<br />
WEINHARDT, R. (1973): Rekonstruktion des Eisstromnetzes <strong>der</strong> Ostalpennordseite zur Zeit des Würmmaximums mit einer Berechnung<br />
seiner Flächen und Volumina.– Heidelberger Geogr. Arb., 38, S. 158-178; Heidelberg.<br />
10.11 Literaturauswahl zur Quartärgeologie von Süddeutschland<br />
BAYER. GEOL. LANDESAMT [Hrsg.] (1979/1983): Interglaziale und Interstadiale des Pleistozäns im Bayerischen Alpenvorland (Teil 1 und<br />
2).– Geologica Bavarica 80 und 84, 186 und 212 S.; München.<br />
EHLERS, J. (1994): Allgemeine und historische Quartärgeologie.– 357 S.; Stuttgart (Enke).<br />
EHLERS, J. & Smed, P. (1994): Steine aus dem Norden. Geschiebe als Zeugen <strong>der</strong> Eiszeit in Norddeutschland.– 193 S.; Berlin, Stuttgart<br />
(Borntraeger).<br />
HANTKE, R. (1978/1983): Eiszeitalter, die jüngste Erdgeschichte <strong>der</strong> Schweiz und ihrer Nachbargebiete.– Bd. 1-3, 698,704/730 S.; Thun<br />
(Ott-Verl.).<br />
HANTKE, R. (1993): Flußgeschichte Mitteleuropas. Skizzen zu einer Erd-, Vegetations- und Klimageschichte <strong>der</strong> letzten 40 Millionen<br />
Jahre.– 459 S.; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
HUSEN, D. van (1984): Die Ostalpen und ihr Vorland zur letzten Eiszeit (Würm) 1:500000.– Beil. In: HUSEN, D. van (1984): Die Ostalpen<br />
in den Eiszeiten; Wien (Geol. B.-A.).<br />
JÄCKLI, H. (1970): Die Schweiz zur letzten Eiszeit.– In: Atlas <strong>der</strong> Schweiz, Bl. 6, 1 Kt. 1:500000.; Wabern-Bern (Eidgenössische<br />
Landestopographie).<br />
JERZ, H. (1984): Das Eiszeitalter in Bayern.– <strong>Geologie</strong> von Bayern 2, 243 S. Stuttgart (Schweizerb.-Verl.).<br />
KLEBELSBERG, R. von (1948 / 49): Handbuch <strong>der</strong> Gletscherkunde und Glazialgeologie, Bd. 1/2, 302 bzw. 1028 S.; Wien (Deuticke-Verl.).<br />
PENCK, A. & BRÜCKNER, E. (1901 / 09): Die Alpen im Eiszeitalter.– Bd. 1-3, 1199 S.; Leipzig (Tauchnitz-Verl.).<br />
SCHEUENPFLUG, L. (1993): Zur Erd- und Landschaftsgeschichte des Landkreises Augsburg.– In: Der Landkreis Augsburg, Bd. 1,<br />
Lanschaft und Natur, S. 5-165; Augsburg (Landratsamt Augsburg)<br />
SCHOLZ, H. (1995): Bau und Werden <strong>der</strong> Allgäuer Landschaft.– 305 S.; Stuttgart (Schweizerbart).<br />
SCHREINER, A. (1992): Einführung in die Quartär-<strong>Geologie</strong>.– 257 S.; Stuttgart (Schweizerbert-Verl.).<br />
WIEGANK, F. (1990): Magnetostratigraphisch-geochronologische Untersuchungen zur Geschichte des Plio-Pleistozäns in Mitteleuropa<br />
und ihrer Beziehungen zur globalen geologischen, paläoklimatischen und paläoökologischen Entwicklung.– Veröffentl. des<br />
Zentralinstituts für Physik <strong>der</strong> Erde, 113, 8. INQUA-Kongress 1981 in China, 307 S., 1 Anlagenband; Potsdam.<br />
WOLDSTEDT, P. (1974): Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeitalter.– 3. Aufl., bearb. v. DUPHORN; Stuttgart (Enke-Verl.).<br />
ZUMBÜHL, H.J. & HOLZHAUSER, H. (1988): Alpengletscher in <strong>der</strong> Kleinen Eiszeit.– Die Alpen, 64 (3), Jubiläumsheft des SAC, 322 S.;<br />
Bern.<br />
11. VOM NUTZEN GEOLOGISCHER KARTEN<br />
Geologische Karten werden in <strong>der</strong> Regel auf <strong>der</strong> Grundlage von vorhandenen topographischen Karten erstellt.<br />
Die sog. Systemkarten sind bei topographischen und geologischen Karten vom Blattschnitt her absolut identisch<br />
und weisen daher auch dieselben Blattnummern auf.<br />
Auf geologischen Karten ist in erster Linie die flächenhafte Verbreitung unterschiedlicher Gesteine wie<strong>der</strong>gegeben.<br />
An den Verbreitungsgrenzen („geologische Grenzen“) können u.U. Gesteine mit ganz unterschiedlicher<br />
lithologischer Ausbildung und sehr großen Altersdifferenzen nebeneinan<strong>der</strong> zu liegen kommen. Bei <strong>der</strong> geologischen<br />
Geländeaufnahme werden die oberste Verwitterungsschicht (Boden) und < 1m mächtige Deckschichten<br />
nicht berücksichtigt. Ohne dieses „gedankliche Abräumen“ könnte man nicht viel Information aus <strong>der</strong> Karte ziehen,<br />
weil ja zumindest in den gemäßigten Breiten nahezu überall „Boden“ vorhanden ist. Die Verbreitung verschiedenartiger<br />
Bodentypen wird in eigens angefertigten Bodenkarten erfasst, die in einigen Fällen zusätzlich zu<br />
geologischen Karten erscheinen. Neben <strong>der</strong> reinen Dokumentation geologischer Geländedaten fließt in eine<br />
geologische Spezialkarte also auch Interpretation durch den Bearbeiter ein, z.B. was Art und Verlauf von
95<br />
Gesteinsgrenzen in unzugänglichen Gebieten o<strong>der</strong> auf Grund von Verwitterungsschichten nicht direkt beobachtbaren<br />
Bereichen betrifft.<br />
Eine geologische Karte vermag jedoch mehr zu leisten, als Auskunft über die flächenhafte, also zweidimensionale<br />
Verbreitung von Gesteinen zu geben. Mit sog. Fallzeichen wird die Schichtlagerung (Raumlage) von<br />
Sedimentgesteinen bzw. das Parallelgefüge von Metamorphiten dargestellt. Auch tektonische Linien (Störungen,<br />
Verwerfungen) sind eingetragen. Berücksichtigt man zudem Überlegungen, in welchem Verhältnis genetisch und<br />
altersmäßig die verschiedenen kartierten Gesteine zueinan<strong>der</strong> stehen, so lässt sich mit einiger Sicherheit ein<br />
dreidimensionales geologisches Bild entwickeln. So gehen u.a. Überlegungen ein, ob ein Gestein Bestandteil<br />
einer ungestörten kompletten Schichtfolge ist o<strong>der</strong> ob es sich um eine jüngste quartäre Bildung handelt, die nur<br />
als Schleier über einer Folge aus an<strong>der</strong>en Gesteinen liegt.<br />
Die geologischen und tektonischen Gegebenheiten können dann in senkrechten Schnitten zur Erdoberfläche –<br />
sog. geologischen Profilen – dargestellt werden. Aus <strong>der</strong> stets nach dem Entstehungsalter <strong>der</strong> Gesteine geordneten<br />
geologischen Kartenlegende lassen sich die notwendigen Informationen über Art und Alter <strong>der</strong> Gesteine<br />
entnehmen. In günstigen Fällen können überraschend genaue Voraussagen über den geologischen Aufbau des<br />
Untergrundes gemacht werden, die auf den Meter zutreffen und auch durch Bohrungen nicht genauer erkundbar<br />
sind. Die Genauigkeit einer Aussage, die sich aus dem Studium einer geologischen Karte o<strong>der</strong> eines geologischen<br />
Profils ableiten lässt, ist natürlich sehr stark vom Maßstab abhängig. So wird geologische Karteninterpretation<br />
in ungünstigeren Fällen vielfach prognostischen Charakter behalten, ohne im Detail Angaben etwa im<br />
Meterbereich machen zu können. Viele Fehleinschätzungen und grundlegende Planungsfehler würden sich<br />
jedoch vermeiden lassen, wenn man nur zur rechten Zeit vorhandene geologische Karten zu Rate ziehen würde.<br />
Zu sehr vielen geologischen Karten, v.a. den amtlichen Blättern im Maßstab 1 : 25 000, gibt es eigene Erläuterungshefte,<br />
in denen die geologischen Verhältnisse des Blattgebietes umfassend dargestellt sind. Auf diese<br />
Weise ist es auch dem Nicht-Geologen möglich, sich einen groben Überblick über Art, Alter, Lagerungsverhältnisse,<br />
geologische Geschichte und bautechnische Eigenschaften <strong>der</strong> Gesteine eines bestimmten Gebietes zu<br />
verschaffen. Ferner finden sich in den Erläuterungen auch Angaben zu wirtschaftlich nutzbaren Gesteinen<br />
(Sande, Kiese) bzw. zu Lagerstätten. Zur Bearbeitung spezieller Fragestellungen bzw. für geologische Detailuntersuchungen<br />
sollte jedoch nicht auf die Beteiligung eines erfahrenen Geologen verzichtet werden.<br />
Adressen wichtiger geologischer Dienste in Deutschland:<br />
Geologischer Dienst im Bayerischen Umweltministerium (früher einmal Bayerisches Geologisches Landesamt),<br />
Heßstr. 128, 80797 München<br />
Geologisches Landesamt Baden-Württemberg (Geol. L.-Amt Bad.-Württ.), Postfach, 79095 Freiburg i.Br.<br />
In fast allen Bundeslän<strong>der</strong>n gibt es ähnliche Ämter, bei denen man u.a. Verzeichnisse <strong>der</strong> von diesen<br />
hergestellten Karten bekommen kann!<br />
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Stilleweg 2, 30655 Hannover.<br />
Serien geologischer Karten (Systemkarten):<br />
GK 25: Geologische Karte von Bayern 1 : 25 000 (Geol. Dienst im Bayer. Umweltmin. / Bayer. Geol. L.-Amt).<br />
Geologische Karte 1 : 25 000 von Baden-Württemberg (Geol. L.-Amt Bad.-Württ.).<br />
Blattschnitt und Höhenlinien wie TK 25. Jede Karte mit einem ausführlichen Erläuterungsheft; Kartenwerk<br />
deckt z.B. in Bayern mit bisher über 230 erschienenen Einzelkarten etwa 40% <strong>der</strong> Landesfläche ab. Von<br />
allen an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n gibt es auch geologische Kartenwerke im Maßstab 1 : 25 000, die gleichfalls<br />
von den entsprechenden Landesämtern herausgegeben werden.<br />
GK 50: Geologische Karte von Bayern 1 : 50 000 (Geol. Dienst im Bayer. Umweltmin. / Bayer. Geol. L.-Amt).<br />
Blattschnitt und Höhenlinien wie TK 50. Nur wenige Karten sind erschienen, teilweise mit<br />
Erläuterungsheften, meist anstelle von entsprechenden Blättern <strong>der</strong> GK 25 (z.B. Augsburg, München,<br />
Landshut, Mühldorf). Außerdem gibt es einige Umgebungskarten von Städten im gleichen Maßstab,<br />
teilweise mit Erläuterungen (Ries, Freiburg, Konstanz etc.).<br />
GK 100: Geologische Karte von Bayern 1 : 100 000 (Bayer. Geol. L.-Amt).
96<br />
Karten ohne Höhenlinien erschienen; Kartenwerk deckt im wesentlichen mit 7 Einzelkarten nur die<br />
Bayerischen Alpen ab, wird jedoch nicht weitergeführt. Daneben gibt es verschiedene Spezialkarten mit<br />
unterschiedlichen Formaten im gleichen Maßstab (Iller-Mindel-Gebiet, Ehingen etc.).<br />
GK 200: Geologische Übersichtskarte <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 (BGR).<br />
Blattschnitt und Höhenlinien wie TK 200; Kartenwerk deckt mit bisher über 30 Einzelkarten etwa 70% <strong>der</strong><br />
Fläche <strong>der</strong> neuen Bundesrepublik ab.<br />
Wichtige geologische Übersichtskarten:<br />
Geologische Übersichtskarte von Bayern 1 : 500 000 (Bayer. Geol. L.-Amt).<br />
Geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg 1 : 500 000 (Geol. L.-Amt Bad.-Württ.).<br />
Jede Karte besteht nur aus einem Blatt. Die Bayerische Karte ist mit einem Erläuterungsheft erschienen. Von<br />
an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n gibt es vergleichbare Übersichtskarten im gleichen Maßstab (z.T. auch 1 : 300 000), die<br />
ebenso von den entsprechenden Landesämtern herausgegeben werden.<br />
Geologische Karte <strong>der</strong> Bundesrepublik Deutschland 1 : 1000 000 (BGR).<br />
Karte besteht nur aus einem Blatt. Auch von den meisten Nachbarlän<strong>der</strong>n (Österreich, Schweiz, Tschechien,<br />
Frankreich) gibt es vergleichbare Übersichtskarten, die von den jeweiligen geologischen Diensten dieser Län<strong>der</strong><br />
herausgegeben werden.<br />
Geologische Karten können bezogen werden über:<br />
Geologischer Dienst im Bayerischen Umweltministerium, Heßstr. 128, 80797 München;<br />
Landesvermessungsamt von Baden-Württemberg, Büchsenstr. 54, 70174 Stuttgart;<br />
GeoCenter, Internationales Landkartenhaus, Postfach 800830, 70508 Stuttgart;<br />
Geo-Buchhandlung, Rosental 6, 80331 München;<br />
sowie über alle an<strong>der</strong>en Buchhandlungen.<br />
— Copyright: Prof. Dr. Herbert Scholz, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie <strong>der</strong> TU München, Arcisstr. 21, D-80290 München —