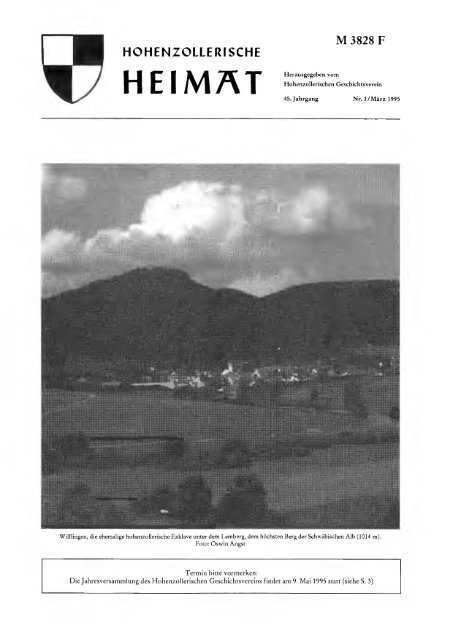Ausgabe 1995 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Ausgabe 1995 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Ausgabe 1995 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
M 3828 F<br />
Herausgegeben vom<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
45. Jahrgang Nr. 1 / März <strong>1995</strong><br />
Wilflingen, die ehemalige hohenzollerische Exklave unter dem Lemberg, dem höchsten Berg der Schwäbischen Alb (1014 m).<br />
Foto: Oswin Angst<br />
Termin bitte vormerken:<br />
Die Jahresversammlung des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s findet am 9. Mai <strong>1995</strong> statt (siehe S. 3)
CASIMIR BUMILLER<br />
900 Jahre Wilflingen - Geschichte einer hohenzollerischen Exklave<br />
Als am 15. Januar <strong>1995</strong> die Bevölkerung von Wilflingen (Teilgemeinde<br />
von Wellendingen, Kreis Rottweil) das Jubiläumsjahr<br />
mit einem kleinen Festakt zur Vorstellung des neuen Geschichts-<br />
und Heimatbuches beging, intonierte der traditionsreiche<br />
Musikverein Wilflingen zum Auftakt das »Hohenzollernlied«.<br />
Nichts vermochte die Anhänglichkeit der<br />
Wilflinger an Hohenzollern und seine Geschichte besser zu<br />
demonstrieren. Während in Wilflingen das Bewußtsein, Hohenzollern<br />
zu sein, bis heute also wach ist, ist den meisten Bewohnern<br />
der hohenzollerischen Stammlande das Wissen um<br />
die ehemals hohenzollerische Exklave am Fuß des Lembergs,<br />
unweit von Rottweil, verloren gegangen.<br />
1974 stimmten die Wilflinger nach einem schmerzhaften Prozeß<br />
der Eingemeindung in den Nachbarort Wellendingen zu.<br />
Das Sträuben gegen diese Fusion hatte nicht zuletzt mit der<br />
jahrhundertealten hohenzollerischen Tradition zu tun: Man<br />
war immer hohenzollerische Exklave gewesen, die umliegenden<br />
Orte gehörten immer zu Vorderösterreich bzw. seit<br />
1806 zu Württemberg.<br />
Die herrschaftlichen<br />
Verhältnisse<br />
Dabei läßt sich nicht genau ergründen, seit wann Wilflingen<br />
tatsächlich hohenzollerisch war. Gelegentlich ist zu lesen, daß<br />
dies schon zur Zeit der Ersterwähnung im Jahr 1095 der Fall<br />
gewesen sein soll. Aber belegen läßt sich dies nicht. Die Schenkung<br />
vom 10. Januar 1095 auf der Burg Haigerloch - die<br />
Ersterwähnung Haigerlochs verdankt sich derselben Quelle<br />
- erwähnt lediglich, daß ein Ritter Wortwin und seine Familie<br />
zwei Höfe bei Wilflingen an das damals noch junge Kloster<br />
St. Georgen im Schwarzwald geschenkt habe. Von Zollern<br />
ist da nicht die Rede.<br />
Gesicherte Herrschaftsverhältnisse in Wilflingen offenbaren<br />
sich erst um das Jahr 1300. Erst da läßt sich von einer hohenzollerischen<br />
Ortsherrschaft in Wilflingen sprechen, aber<br />
immer noch mit einer Einschränkung. Eine Urkunde von<br />
1318, in dem Graf Friedrich Ostertag den Ort als Lehen vergab,<br />
spricht davon, daß das Haus Zollern das Dorf von alter<br />
her von dem Gotzhuse ze der Richen owe ze rechtem Mannlehen<br />
gehabt habe. Die Oberherrschaft an Wilflingen stand<br />
also bis ins 14. Jahrhundert dem Kloster Reichenau zu. Dies<br />
ist allerdings die einzige Erwähnung dieses Rechtes, es bleibt<br />
unklar, wie die Reichenau in den Besitz des Ortes gelangte<br />
und wann es sich wieder zurückgezogen hat. Um die Mitte<br />
des 14. Jahrhunderts gab das Inselkloster mehrere Besitztitel<br />
in nächster Umgebung auf, vielleicht auch die Lehenschaft an<br />
dem kleinen Ort unterhalb des Lembergs.<br />
Geblieben sind die hohenzollerischen Rechte. Zur Orts- und<br />
Gerichtsherrschaft gesellte sich eine Grundherrschaft, die im<br />
15. Jahrhundert fünf Höfe umfaßte, darunter den umfangreichen<br />
zollerischen Maierhof (1413 erstmals genannt), und<br />
Rechte über leibeigene Bauern. Dabei war Hohenzollern in<br />
Wilflingen weder der größte Leibherr noch der größte<br />
Grundherr. Noch 1548 im ältesten Leibeigenenverzeichnis<br />
waren nur 19 von 75 Einwohnern dem Haus Hohenzollern<br />
mit dem Leib verwandt, und es dauerte bis weit in die frühe<br />
Neuzeit, bis es Hohenzollern gelang, die Mehrzahl der Wilflinger<br />
unter die eigene Leibherrschaft zu zwingen.<br />
Was die Grundherrschaft anging, so verfügte Hohenzollern<br />
allenfalls über ein Siebtel der gesamten Gemarkungsfläche.<br />
Der größte Grundherr im Dorf war dagegen das Zisterzienserinnenkloster<br />
Rottenmünster bei Rottweil, das seit dem<br />
14. Jahrhundert in Wilflingen über sechs, später sogar acht<br />
Höfe gebot. Daneben gab es zahlreiche weitere Grundherren,<br />
so z. B. das Kloster Alpirsbach, die Dominikaner und die<br />
Johanniter in Rottweil, die St.-Michaels-Pflege in Feckenhausen<br />
und Vorderösterreich.<br />
Wilflingen war seit dem frühen 15. Jahrhundert der einzige<br />
hohenzollerische Ort, der getrennt vom Territorium unter<br />
der weiß-schwarzen Fahne fortexistierte. Es wird sich kaum<br />
je ergründen lassen, warum die Grafen an der abgelegenen<br />
Exklave festhielten. Es könnte aber sein, daß sich die Hohenzollern<br />
in der Nähe der Reichsstadt Rottweil mit ihrem<br />
Reichsgerichtshof einen kleinen Besitz bewahren wollten.<br />
Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir<br />
sehen, daß Hohenzollern das Dorf seit 1311 an die Rottweiler<br />
Patrizierfamilie von Balgingen zu Lehen vergab. Im Jahr<br />
1314 stellte Graf Friedrich II. von Zollern-Schalksburg für<br />
Konrad von Balgingen, seinen »Wirt«, einen Schutz- und<br />
Schirmbrief aus. Es ist also denkbar, daß diese herausragende<br />
Patrizierfamilie in jenen Jahren so etwas wie die Statthalterschaft<br />
der Grafen von Zollern in und um Rottweil innehatte.<br />
Es ist übrigens zu vermuten, daß die Familie von Balgingen<br />
aus dem Baiinger Ortsadel hervorgegangen ist. Aber bereits<br />
vor der Stadterhebung Balingens um 1250 war das Geschlecht<br />
in die Reichsstadt übersiedelt und dort in die ersten Kreise<br />
der Stadtgeschlechter aufgestiegen.<br />
Bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts versank die Familie allerdings<br />
in Schulden und damit in die Bedeutungslosigkeit. Das<br />
hohenzollerische Lehen Wilflingen, das die von Balgingen bis<br />
1426 innehatten, ging nun an die weitläufige Verwandtschaft<br />
dieser Familie über. Die Hohenzollern haben für den Rest<br />
des Mittelalters keine Ordnung mehr in die Lehensverhältnisse<br />
gebracht, ja sie gingen aus ihrer eigenen pekuniären Bedrängnis<br />
immer mehr dazu über, den abgelegenen Ort zu einem<br />
Pfandobjekt zu machen. Die Entwicklung kannte verschiedene<br />
Abstufungen. Verschiedentlich mußten die Bürger<br />
Wilflingens Bürgschaften für die Schulden ihres Herrn übernehmen,<br />
dann in der frühen Neuzeit gingen die Grafen von<br />
Hohenzollern dazu über, Teile des Dorfes zu verpfänden -<br />
so war seit 1654 das hohenzollerische Hofgut an den Schaffhauser<br />
Handelsmann Hans Conrad Peyer versetzt. Dies führte<br />
unweigerlich zur Verpfändung des gesamten Ortes an interessierte<br />
reiche Adlige.<br />
Die Pfandschaft<br />
Wilflingen<br />
Der erste Pfandherr Wilflingens von 1688 bis 1697 war der<br />
österreichische Obervogt von Spaichingen, Baron Meinrad<br />
von Arzt. Dieser erneuerte hier das zollerische Hofgut und<br />
errichtete sogar eine Brauerei. Aber als guter Rechner hat er<br />
es auch verstanden, seine Einkünfte in dem Dorf von den Untertanen<br />
einzutreiben. Er betrieb dies so erbarmungslos, daß<br />
sich im Januar 1697 die Wilflinger Bauern gegen ihren Pfandherrn<br />
erhoben und dieser sich aus der Wilflinger Pfandschaft<br />
zurückzog.<br />
An seine Stelle trat der exaltierte Abenteurer Sigmund Regnat<br />
von Schellenberg, der sich an seinem bisherigen Wohnsitz<br />
Bräunlingen unmöglich gemacht hatte und nun am Fuß<br />
der Schwäbischen Alb ein ruhigeres Leben suchte. Seine<br />
Skandalgeschichten verfolgten ihn jedoch bis hierher. Ein<br />
Blutschandeverdacht brachte ihn mehrere Jahre in Verwahrsam,<br />
unter anderem auf Burg Hohenzollern. Als er - angeb-<br />
2
SÜßifeSofrenaoHerifd*<br />
•vOTittetiungen au£ bem<br />
I. Mitgliederversammlung <strong>1995</strong><br />
©efcE)tcf)töt>eretn<br />
Die Jahresversammlung <strong>1995</strong> findet am Dienstag, 9. Mai,<br />
um 18.30 Uhr im Nebenzimmer des Hotels »Bären« in<br />
Sigmaringen statt. Hierzu sind alle Mitglieder des Hohenzollerischen<br />
<strong>Geschichtsverein</strong>s e. V. herzlich eingeladen.<br />
Tagesordnung<br />
1. Begrüßung und Nachrufe<br />
2. Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden und des Schatzmeisters<br />
3. Veranstaltungen in den kommenden Monaten<br />
4. Anträge und Verschiedenes<br />
Anträge sind bis spätestens 2. Mai an das Sekretariat des<br />
<strong>Geschichtsverein</strong>s, Karlstraße 3, 72488 Sigmaringen<br />
(Telefon 07571) 101558) zu richten.<br />
An die Mitgliederversammlung schließt sich um 20 Uhr<br />
ein öffentlicher Vortrag an:<br />
Sibylle Rebholz M.A., Kunsthistorikerin, Bayreuth:<br />
»Die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen und<br />
ihre Denkmäler im 19. und 20. Jahrhundert«.<br />
Die Referentin, die über dieses Thema ihre Magisterarbeit<br />
an der Universität Bamberg verfaßt hat, zeigt mit Lichtbildern<br />
die Entstehung der einzelnen Fürstendenkmäler<br />
und deren kunsthistorischen Bezüge auf und macht auf<br />
ihre Bedeutung als historische Quelle aufmerksam.<br />
Rektor Otto Werner, Hechingen:<br />
»Die jüdischen Gemeinden in Hohenzollern«<br />
Montag, 22. Mai, um 20 Uhr im Spiegelsaal des Prinzenbaus<br />
Dr. Andreas Zekorn, Balingen:<br />
»Die Stadt Sigmaringen zwischen dem Fürstenhaus<br />
und Habsburg im 17. und 18. Jahrhundert«<br />
Montag, 29. Mai, um 20 Uhr im Spiegelsaal des Prinzenbaus<br />
Weitere Vorträge über Aspekte der hohenzollerischen<br />
Geschichte finden im September und Oktober statt. Diese<br />
Veranstaltungen werden in Heft 2 der Hohenzollerischen<br />
Heimat <strong>1995</strong> sowie in der Hechinger und Sigmaringer<br />
Lokalpresse noch rechtzeitig angekündigt.<br />
III.<br />
Exkursion<br />
Am 1. Juli <strong>1995</strong>: Ganztagesexkursion zum Hohentwiel<br />
und nach Stein am Rhein unter der Leitung von<br />
Herrn Dr. Casimir Bumiller mit örtlichen Führern.<br />
Abfahrt: Hechingen um 8 Uhr (Obertorplatz)<br />
Sigmaringen um 9 Uhr (Bushaltestelle bei der ehemaligen<br />
EZS)<br />
Rückkehr: Sigmaringen um ca. 19 Uhr<br />
Hechingen um ca. 20 Uhr<br />
Anmeldungen sind zu richten:<br />
Teilnehmer von Hechingen an Herrn Dr. Vees<br />
(Telefon 07471/5620)<br />
Teilnehmer von Sigmaringen an Frau Liebhaber<br />
(Telefon 07571) 101558<br />
Dr. Otto Becker:<br />
II.<br />
Vorträge<br />
»Das Kriegsende 1945 in Sigmaringen«<br />
Am Montag, 24. April, um 20 Uhr im Sitzungssaal<br />
»Kapelle« des Landratsamtes Sigmaringen, Leopoldstraße,<br />
72488 Sigmaringen<br />
(Vortrag des Kreisarchivs Sigmaringen in Verbindung<br />
mit dem Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>)<br />
Sibylle Rebholz M. A.:<br />
»Die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen und<br />
ihre Denkmäler im 19. und 20. Jahrhundert« (hierzu<br />
s.o. Mitgliederversammlung)<br />
Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg <strong>1995</strong> in<br />
Sigmaringen veranstaltet der Hohenzollerische <strong>Geschichtsverein</strong><br />
e. V. mit Unterstützung des Arbeitskreises<br />
Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e.V. zwei<br />
Vortragsreihen mit Themen zur Geschichte Hohenzollerns.<br />
Im ersten Zyklus werden die folgenden Vorträge<br />
angeboten:<br />
Prof. Dr. Wilfried Schöntag, Stuttgart:<br />
»Die schwäbisch-brandenburgischen Hohenzollern.<br />
Dynastische Verbindungen und deren politische<br />
Wirkkraft«<br />
Montag, 15. Mai, um 20 Uhr im Spiegelsaal des Prinzenbaus<br />
(Staatsarchiv) in Sigmaringen<br />
Aus organisatorischen und Kostengründen wurde das<br />
Konto beim Postgiroamt Stuttgart Nr. 12363707 aufgelöst.<br />
Für den Verein besteht somit nur noch das Konto<br />
Nr. 803 843 bei der Hohenz. Landesbank, Kreissparkasse<br />
Sigmaringen (BLZ 653 510 50)<br />
Wir bitten Mitglieder, die den Vereinsbeitrag mit Dauerauftrag<br />
bisher auf das Postscheckkonto überwiesen haben,<br />
diesen zu ändern. Andere Überweisungen sind ebenfalls<br />
auf das Konto der Landesbank-Kreissparkasse Sigmaringen<br />
zu leiten.<br />
Beitragseinzug durch Abbuchungsermächtigung<br />
Es kommt immer wieder vor, daß Mitglieder oder Bezieher<br />
ihren Wohnsitz wechseln und sich damit auch die<br />
Bankverbindung ändert. Meist wird es dann vergessen,<br />
dem <strong>Geschichtsverein</strong> diese Veränderung mitzuteilen.<br />
Damit verbunden ist:<br />
1. daß Sendungen unzustellbar an uns zurückkommen<br />
2. daß Lastschrift mit dem Bankeinzug für Beiträge unbezahlt<br />
mit Gebühren zurückbelastet werden.<br />
Dies alles ist mit Kosten und enormer Mehrarbeit für das<br />
Sekretariat und die Kasse verbunden. Aus diesem Grund<br />
bitten wir alle Mitglieder und Abonnenten, Veränderungen<br />
des Wohnsitzes oder der Bankverbindung dem Sekretariat<br />
schriftlich oder telefonisch<br />
(Telefon 07571/101-558) mitzuteilen. Sie erleichtern uns<br />
damit die Arbeit.
lieh rehabilitiert - wohl 1702 nach Wilflingen zurückkehrte,<br />
hatte sein Stiefsohn alles verscherbelt, was nicht niet- und nagelfest<br />
war, so daß Sigmund Regnat von Schellenberg mit seinen<br />
eigenen Worten nichts mehr besaß als einen Stecken in<br />
der Hand, 1 Gulden bares Geld und ein alt zerrissenes Hemd,<br />
worin 7 Katzen würden keine Maus erwischt haben.<br />
Der für das Dorf Wilflingen wichtigste Pfandinhaber war die<br />
Familie von Baratti, die mit einer Unterbrechung von 1703<br />
bis 1764 hier gebot. Der aus Südtirol stammende Johann Paul<br />
von Baratti diente am Hechinger Hof seit 1696 als Kammerrat<br />
und Landrichter. In der Geschichte des Hauses Hohenzollern<br />
ist Baratti als Admodiator, als Unternehmer in Sachen<br />
Steuerpacht, bekannt geworden. Admodiation, Steuerverpachtung<br />
war damals ein gebräuchliches Mittel kleinerer Landesherren,<br />
sich die mühselige Steuerverwaltung ihrer Territorien<br />
vom Hals zu halten und sie interessierten Admodiatoren<br />
gegen eine bestimmte Summe in die Hand zu legen. Da<br />
solche Steuerpächter ihr vorgeschossenes Geld natürlich mit<br />
Gewinn hereinzuholen trachteten, waren sie als rigide Steuereintreiber<br />
gefürchtet.<br />
Baratti hatte zwischen 1712 und 1731 verschiedentlich die<br />
Grafschaften Hohenzollern-Hechingen, Sigmaringen und<br />
die Herrschaften Haigerloch und Wehrstein in Pacht. Er<br />
machte sich wegen seiner teilweise perfiden Politik nicht nur<br />
bei den hohenzollerischen Untertanen unbeliebt, sondern zuletzt<br />
auch beim Haus Hohenzollern selbst, weil er in den Verdacht<br />
von Unterschlagungen geriet. Dieser Steuerpächter Johann<br />
Paul von Baratti erwarb also 1703 erstmals und 1717<br />
wieder das Pfandobjekt Wilflingen, lebte aber weiterhin vorwiegend<br />
in Hechingen und ist so in der Wilflinger Geschichte<br />
nicht so sehr in Erscheinung getreten wie sein Sohn Franz<br />
von Baratti, der 1737 nach dem Tod des Vaters den Ort übernahm<br />
und sich hier mit seiner Familie seßhaft machte. Die<br />
Barattis haben sich sehr um die maroden kirchlichen Verhältnisse<br />
der kleinen Pfarrei angenommen, im Jahr 1742 stifteten<br />
sie etwa ein ewiges Licht.<br />
Aber durch die Nähe der Herrschaft zu den Wilflingern wurde<br />
das Untertanenverhältnis zunehmend belastet, bis es unter<br />
dem strengen Herrn zwischen 1750 und 1753 erneut zu<br />
erheblichen Unruhen im Dorfe kam. Die Wilflinger baten den<br />
Fürsten damals schon, den Fleckhen Wilflingen Zu dero gnädigsten<br />
Herrschafft widerum zu nemen und außzulösen, weil<br />
bey denen Barattischen in diesem grossen Elend... nit mer zu<br />
leben sei. Es dauerte allerdings bis 1764, daß das Haus Hohenzollern<br />
die Barattis auslöste. Die 27300 Gulden, die Baratti<br />
erhielt, stammten übrigens zum größten Teil von den<br />
Wilflingern selbst, die im Jahr 1765 dem Haus Hohenzollern<br />
das alte Hofgut um 20000 Gulden abkauften.<br />
Wie vergiftet am Ende des Verhältnis zwischen Baratti und<br />
den Wilflingern war, zeigte sich in zwei Brandfällen 1761 und<br />
1766, denen einmal das Wohnhaus, das andere Mal Scheune<br />
und Stallungen der Barattis zum Opfer fiel. Der Verdacht der<br />
Brandstiftung konnte damals nicht erwiesen werden, hat sich<br />
aber bis heute im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung erhalten.<br />
Der Streit zwischen Hohenzollern-Hechingen<br />
VOrderösterreich um Wilflingen<br />
und<br />
Nebeneffekt der Neuordnung von 1764/1765, bei der Wilflingen<br />
wieder direkt der hohenzollerischen Verwaltung unterstellt<br />
wurde, war also der Verkauf des zollerischen Hofgutes<br />
an die Gemeinde, d. h. Hohenzollern besaß seit damals<br />
in Wilflingen gar keine Grundherrschaft mehr. Das fügt sich<br />
in die politische Linie der Fürsten gegenüber ihrer Exklave<br />
während des 18. Jahrhunderts. Es ging den Hohenzollern zunehmend<br />
darum, mit dem entfernten Flecken Wilflingen so<br />
wenig wie möglich, am besten jedoch gar nicht mehr belastet<br />
zu sein. Schon im Jahr 1727 hatte Fürst Friedrich Ludwig,<br />
den Wert Wiblingens veranschlagen lassen, um das Dorf zu<br />
verkaufen. Kaufverhandlungen mit dem Kloster Salem zerschlugen<br />
sich jedoch damals. Und erst als Verhandlungen mit<br />
dem Deutschen Orden und mit Württemberg 1740 ebenfalls<br />
im Sand verlaufen waren, hatte sich Hohenzollern auf eine<br />
Verlängerung der Barattischen Pfandschaft eingelassen.<br />
Es ist übrigens interessant, weshalb ein Verkauf um 1730/40<br />
nicht zustande gekommen ist. Alle Interessenten hatten letztendlich<br />
deshalb abgelehnt, weil Hohenzollern gar nicht die<br />
volle Hoheit über das Dorf Wilflingen besaß. Tatsächlich geht<br />
aus verschiedenen Dokumenten seit dem 15. Jahrhundert hervor,<br />
daß die Hohe Gerichtsbarkeit über Wilflingen nicht bei<br />
Hohenzollern, sondern bei Osterreich lag. Die Herkunft dieses<br />
Rechtes läßt sich nicht genau klären. Entweder war Österreich<br />
im 14. Jahrhundert zum Nachfolger der Abtei Reichenau<br />
in der Oberherrschaft geworden oder aber die Teilung<br />
der Gerichtsbarkeit zwischen Hohenzollern und Osterreich<br />
in Wilflingen geht auf die ursprüngliche Trennung dieser<br />
Rechte zwischen Zollern und Hohenberg zurück - Osterreich<br />
trat hier ja bekanntlich 1371 die Rechtsnachfolge der<br />
Hohenberger an.<br />
Dieses alte Recht Österreichs, das die Grafen von Zollern z.B.<br />
im Pfefferschen Lagerbuch von 1598 anerkannten, hatte offensichtlich<br />
nie Probleme bereitet bzw. war von den vorderösterreichischen<br />
Behörden nicht in Anspruch genommen<br />
worden. Es ist sogar möglich, daß Fürst Friedrich Ludwig so<br />
etwas wie schlafende Hunde weckte, als er 1739 in Wien mit<br />
der Bitte einkam, er wolle dieses dorff geren auff art und weiß<br />
wie mein übrigens Land mit all- und jeden Herrlichkeiten...<br />
besitzen. Jedenfalls sollten schon wenige Jahre darauf heftige<br />
juristische, aber auch handgreifliche Auseinandersetzungen<br />
zwischen Zollern und Österreich beginnen, in denen Österreich<br />
aufgrund der hohen Gerichtsbarkeit die Territorialherrschaft<br />
über Wilflingen einforderte.<br />
Zankäpfel waren nacheinander die Salpetergräberei in Wilflingen,<br />
um die es zu militärischen Interventionen Österreichs<br />
kam (1745 ff.), das Jagdrecht und schließlich 1797 der Zollstock,<br />
den Österreich für sich reklamierte. Wäre nicht der<br />
große Franzose Napoleon in jenen Jahren mit seinen Truppen<br />
in unser Land eingefallen, es wäre zu befürchten gewesen,<br />
Österreich hätte mit seiner Ubermacht die Rechtsverhältnisse<br />
in Wilflingen zu seinen Gunsten umgekehrt. Aber<br />
durch die Protektion Napoleons konnte Hohenzollern seine<br />
Rechte in Wilflingen wahren, auch wenn Württemberg als<br />
Rechtsnachfolger Österreichs in Hohenberg das österreichische<br />
Spiel noch eine Zeitlang fortsetzte.<br />
1806 besetzte Württemberg das hohenzollerische Dorf und<br />
beanspruchte die alten österreichischen Rechte, also auch die<br />
Territorialherrschaft. In jenen Jahren wußte niemand so<br />
recht, ob Wilflingen hohenzollerisch oder württembergisch<br />
war. Nicht zuletzt die Anhänglichkeit der Wilflinger an Hohenzollern<br />
und ihr passiver Widerstand gegen die württembergischen<br />
Ansprüche ließ Württemberg im Jahr 1821 auf das<br />
Dorf unter dem Lemberg verzichten. Erst seit damals war<br />
Wilflingen erstmals in seiner Geschichte ohne jegliche Einschränkung<br />
hohenzollerisch. In diesen unsicheren Zeiten war<br />
das Fürstenhaus erneut versucht, Wilflingen an Württemberg<br />
zu verkaufen oder zu vertauschen. Entsprechende Verhandlungen<br />
waren schon 1811 aufgenommen worden und verliefen<br />
1820 im Sande, als sich Württemberg doch ganz zum Verzicht<br />
auf das unverdauliche Wilflingen entschloß.<br />
Nur 30 Jahre noch verblieb Wilflingen damals uneingeschränkt<br />
beim Fürstentum Hohenzollern, bis dieses sich aufgrund<br />
der Revolutionswirren von 1848 zwei Jahre später an<br />
die Brust des großen preußischen Bruders warf. Von 1850 an<br />
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges lebte Wilflingen unter<br />
dem preußischen Adler. Die Jahre nach 1850 bedeuteten<br />
4
Älteste Ansicht Wiblingens auf der<br />
Rottweiler Pirschgerichtskarte<br />
von 1564.<br />
für Wilflingen wie für ganz Hohenzollern den Eintritt in die<br />
Moderne, mit der ein Zeitalter äußerst labiler wirtschaftlicher<br />
und sozialer Verhältnisse zu Ende ging.<br />
Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse<br />
Das Dorf am Fuß des Lembergs lebte immer unter bescheidenen<br />
Verhältnissen. Es läßt sich aufgrund der Quellenlage<br />
kaum vermeiden, große Passagen der Ortsgeschichte unter<br />
dem Stichwort drückender Armut abzuhandeln. Zwar läßt<br />
sich schon im Mittelalter zeigen, daß es hier langlebige bäuerliche<br />
Familien gab, die auf auskömmlichen Bauerngüter<br />
recht gut lebten, aber an einigen mittelalterlichen Familien<br />
kann auch nachvollzogen werden, wie eng Auskömmlichkeit<br />
und Verarmung beisammen lagen. Uberhaupt ist die mittelalterliche<br />
Geschichte Wiblingens durch die überaus gute<br />
Uberlieferung der Reichsstadt Rottweil und des Klosters<br />
Rottenmünster mit über 70 Urkunden bis zum Jahr 1500 wesentlich<br />
besser dokumentiert als in jedem anderen hohenzollerischen<br />
Dorf.<br />
Das Dorf war immer sehr klein. Im 16. Jahrhundert lebten in<br />
Wilflingen nie wesentlich mehr als hundert Personen. Zu Beginn<br />
des Dreißigjähjrigen Krieges war die 200-Einwohner-<br />
Grenze erreicht, erst im 18. Jahrhundert erfolgte die für Europa<br />
typische Bevölkerungsexplosion. Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
beherbergte Wilflingen rund 350 Einwohner, um<br />
1800 wurde die 500-Einwohner-Marke überschritten, 1905<br />
lebten hier 597 Menschen und 1994 858 Einwohner.<br />
Die schlechten landwirtschaftlichen Grundlagen in Verbindung<br />
mit verheerenden Kriegszeiten (Dreißigjähriger Krieg<br />
1618-1648; Franzoseneinfälle 1677 und 1692) und einer anwachsenden<br />
Bevölkerung führten zu extremen Besitzverhältnissen<br />
im Dorf. Um 1740 verfügten 15 Familien über rund<br />
180 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, während 53 weiteren<br />
Familien nur knapp 200 ha zur Verfügung standen.<br />
Allgemeine drückende Armut ist schon im 16. Jahrhundert<br />
spürbar. Diesem Umstand war es schon zu verdanken, daß<br />
die Gemeinde zwar im Jahr 1545 mit Hilfe Graf Jos Niclas'<br />
von Zollern die Loslösung der seit 1472 belegten Kapelle von<br />
der Mutterkirche St. Pelagius in Rottweil-Altstadt erreichte,<br />
dann aber jahrzehntelang wegen der geringen Dotation der<br />
Pfründe keinen Pfarrer gewinnen konnte und gleich als eine<br />
Herde Vieh, so keinen Hirten hat, leben mußte.<br />
Verheerende wirtschaftliche und soziale Verhältnisse herrschten<br />
endgültig seit Ende des Dreißigjährigen Krieges. Jetzt waren<br />
auch die reichsten Wilflinger Familien durch die Kriegsschäden<br />
in Armut geraten und hatten Schulden gemacht (bei<br />
reichen Bürgern, bei den Klöstern Stetten und Rottenmünster),<br />
aus denen sie nicht mehr herauskamen. Der Tiefpunkt<br />
der Entwicklung war erreicht, als im Jahr 1675 ein Kaufmann<br />
aus Stein am Rhein den ganzen Flecken Wilflingen wegen seiner<br />
Zahlungsunfähigkeit in die Reichsacht tat. Da auch das<br />
Haus Hohenzollern, das ja selbst unter notorischem Geldmangel<br />
litt, der Gemeinde nicht aufhelfen konnte, sondern<br />
sie eher noch durch Schätzungen (so 1669) auspreßte, ist<br />
in diesen Jahren die Idee der Verpfändung der Gesamtgemeinde<br />
herangereift. Das hat zwar das Haus Hohenzollern<br />
entlastet, aber die Wilflinger Bauernfamilien zusätzlich<br />
gefordert und somit die schon erwähnten Unruhen hervorgerufen.<br />
Als Versuch, die allgemeine wirtschaftliche Zerrüttung zu lindern,<br />
muß der Aufkauf des hohenzollerischen Hofgutes mit<br />
73 ha Land durch die Gemeinde im Jahr 1765 angesehen werden.<br />
Doch auch die Verteilung dieser Felder auf die armen<br />
Familien brachte nur vorübergehend Besserung. Tatsächlich<br />
hat sich die ökonomische Zerrüttung des Ortes trotz aller gemeindlichen<br />
Rettungsversuche über das Ende des Alten Reiches<br />
erhalten und im frühen 19. Jahrhundert noch verstärkt.<br />
Seit 1831 nahm die Gemeinde beim Württembergischen Kreditverein<br />
in sieben Tranchen insgesamt 66860 Gulden auf,<br />
der mit großem Abstand höchste Betrag, den eine hohenzollerische<br />
in jenen Jahren anforderte. Tatsächlich waren fast alle<br />
hohenzollerischen Dörfer damals gezwungen, sich über die<br />
gerade entstehenden Banken zu verschulden, aber als die<br />
preußischen Behörden nach Übernahme des Landes 1854 die<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse prüften, sah sich der Beamte zu<br />
der Bemerkung veranlaßt: Eigentlich verzweifelt ist der Zustand<br />
nur in Wilflingen.<br />
Der Weg in die Moderne<br />
Bald war klar, daß die Gemeinde aus eigener Kraft die Situation<br />
damals nicht meistern konnte. Den Vogt Karl Burkhard<br />
aus Hausen im Killertal hielt man indes für den geeigneten<br />
Mann, um die »ökonomische Zerrüttung« Wilflingens zu<br />
meistern. Tatsächlich ist ihm dies in seiner Wilflinger Amtszeit<br />
(1852-1868) auch gelungen. Der Preis war allerdings der<br />
5
Einschlag eines riesigen Gemeindewaldes, der unter Wert, allerdings<br />
immer noch mit Gewinn verkauft werden mußte.<br />
Vogtamtsverweser Burkhard war auch der Initiator verschiedener<br />
frühindustrieller Anschubmaßnahmen wie der<br />
Errichtung einer Webermusterwerkstätte 1856, wie sie damals<br />
auch in Grosselfingen oder Jungingen betrieben wurden,<br />
und einer mechanischen Werkstätte, die zu ersten industriellen<br />
Versuchen des Drehers Karl Leibold führte. Diese<br />
Maßnahmen führten zwar noch nicht zu einer eigenständigen<br />
Industrialisierung, trugen aber bereits zur Linderung der<br />
Armut auf dem Dorf bei.<br />
Ein ganz eigener und erfolgreicher Versuch zur Uberwindung<br />
der Armut war die Entstehung des saisonalen Wanderhandwerks,<br />
ebenfalls in den Jahren nach 1850. In zunehmendem<br />
Maße wandten sich junge Wilflinger Männer dem<br />
Maurer- und Gipserberuf zu, um in kleineren Gruppen oder<br />
Kolonnen nach auswärts auf Arbeitssuche zu gehen. Anlaufstellen<br />
waren zunächst die großen Bahnbaustellen in den 60er<br />
und 70er Jahren, später die Stadterweiterungsmaßnahmen<br />
zum Beispiel in Freiburg, wo jahrzehntelang um die Jahrhundertwende<br />
zahlreiche Wilflinger Bauhandwerker über<br />
den Sommer Arbeit fanden.<br />
Zwar argwöhnten schon im Jahr 1855 Vogt Burkhard und<br />
der damalige Pfarrverweser, daß das Umherziehen der dortigen<br />
arbeitsfähigen Bevölkerung den Sommer hindurch<br />
hauptsächlich zu ihrer sittlichen Verwilderung führe, doch<br />
nahm das Arbeiten auf der Walz unaufhaltsam zu. Um die<br />
Jahrhundertwende war eine große Anzahl der Waffenfähigen,<br />
ungefähr 65 Mann, in Württemberg und Baden, im<br />
Schwarzwald arbeiten. Das saisonale Wanderhandwerk in<br />
Wilflingen spielte für die wirtschaftliche Gesundung des<br />
Dorfes in etwa dieselbe Rolle wie gleichzeitig der Hausierhandel<br />
für die Killertalgemeinden.<br />
Als schließlich im Jahr 1899 die Industrie nach Wilflingen<br />
vordrang, war die Gemeinde, gestützt auf das Handwerk, eine<br />
erweiterte Gewerbestruktur, Nebenerwerbslandwirtschaft<br />
und Fabrikarbeit wirtschaftlich über dem Berg. Allerdings<br />
kam dieser erfolgreiche Industrialisierungsschub immer<br />
noch nicht aus eigener Kraft. Es war der Harmonikahersteller<br />
Andreas Koch in Trossingen, der in den Expansionsjahren<br />
um die Jahrhundertwende in Wilflingen wie in<br />
vielen Heuberggemeinden eine Filiale errichtete. Diese Filiale,<br />
im Volksmund die »Bläslefabrik«, gab jahrzehntelang<br />
zahlreichen Arbeiterinnen und Arbeitern in Wilflingen Lohn<br />
und Brot. 1930 wurde die Fa. Koch vom Konkurrenten Hohner<br />
übernommen, der die Wilflinger Filiale bis zur Schließung<br />
1987 fortführte.<br />
Eine wichtige Quelle für die Verhältnisse um die Jahrhundertwende<br />
ist die Chronik des gebürtigen Wilflingers Johann<br />
Muschal (1862-1934), der jahrzehntelang in Neufra Lehrer<br />
war, aber getreulich Buch geführt hat über die sozialen Veränderungen<br />
seiner Heimatgemeinde in jener Zeit. Ihm verdanken<br />
wir zahlreiche wertvolle Einblicke in Sitten und<br />
Brauchtum Wilflingens, aber auch in die Begleitphänomene<br />
des kulturellen Wandels, auch in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen<br />
um die Jahrhundertwende.<br />
Der Weg aus der wirtschaftlichen Misere in die Moderne war<br />
von heftigen sozialen Erschütterungen begleitet, die zur Spaltung<br />
der Bevölkerung in zwei Parteiungen führte, wie man<br />
dies in anderen Orten ähnlich findet. Diese Spaltung des Dorfes<br />
in die »Roten« und die »Schwarzen« offenbarte sich erstmals<br />
im Kulturkampf der Jahre 1874 bis 1884. Vordergründig<br />
wurde hier um die Einsetzung eines neuen Pfarrers unter<br />
Bismarcks Maigesetzen von 1873 gestritten, die dem Staat eine<br />
Mitwirkung bei Pfarreibesetzungen einräumte. Im Grunde<br />
ging es jedoch in diesem Kampf um die Zurückdrängung<br />
kirchlichen Einflusses auf die politischen Verhältnisse.<br />
Opfer dieses Streites in Wilflingen war der Pfarrer Josef Pfister,<br />
der hier tatsächlich nicht eingesetzt wurde. Ahnlich hohe<br />
Wellen schlug der Kulturkampf in Hohenzollern nur noch<br />
in Bärental und Hausen im Killertal.<br />
Erneut kam die Spaltung des Dorfes Wilflingen in den Jahren<br />
nach 1896 zum Ausdruck, als es um den Bau der Wasserleitung<br />
ging, der hier wie anderswo in Hohenzollern die<br />
Bevölkerung in eine Partei der Erneuerer und der Bewahrer<br />
schied. Die Kämpfe zwischen den »Roten« und den<br />
»Schwarzen« setzten sich fort anläßlich der Bürgermeisterwahlen<br />
von 1906 und 1913, wo es jeweils zu heftigen handgreiflichen<br />
Auseinandersetzungen mit gefährlicher Körperverletzung<br />
kam.<br />
Es ist kaum verwunderlich, daß sich die Kämpfe zwischen<br />
den »Roten« und »Schwarzen« damals auch im kulturellen<br />
Bereich niederschlugen. Der erst im Jahr 1906 gegründete<br />
Musikverein spaltete sich bald schon in den »Musikverein«<br />
und die »Musikkapelle«, die beide 1911 beim Preisspielen in<br />
Gammertingen einen ersten Preis errangen. Anders als bei der<br />
Musik, der im Ersten Weltkrieg die Vereinigung gelang, ist<br />
der damals existierende Gesangverein über dem Fahnenstreit<br />
zwischen »Roten« und »Schwarzen« zerbrochen.<br />
Um beim Vereinswesen zu bleiben, so ist zu erwähnen, daß<br />
es in Wilflingen früh schon vereinsähnliche Gruppierungen<br />
aller Art gab, daß aber die Vereinsbildung im rechtlichen Sinn<br />
sehr spät erfolgte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind Musikantengesellschaften<br />
in Wilflingen erwähnt, eine Vereinsgründung<br />
erfolgte jedoch erst 1906. Der älteste bekannte Verein<br />
Wilflingens war der Militärverein von 1867, der bis in den<br />
Zweiten Weltkrieg hinein bestand. Eine organisierte Fastnacht<br />
in Wilflingen ist schon zum Jahr 1845 als damals neuer<br />
Brauch belegt. Die Narrenzunft wurde jedoch erst 1930<br />
gegründet. Der Fußballverein VfR Wilflingen wurde ebenfalls<br />
1930 gegründet, der erfolgreiche Radfahrerverein »Alpenrose«<br />
geht ins Jahr 1925 zurück. Zu erwähnen ist noch<br />
der Kirchenchor, der schon einmal um die Jahrhundertwende<br />
existierte und 1988 neu gegründet wurde.<br />
Stationen des 20.<br />
Jahrhunderts<br />
Eine herausragende Persönlichkeit der Wilflinger Geschichte<br />
in unserem Jahrhundert war der langjährige Pfarrer Dr.<br />
Emil Dimmler, der die Pfarrei St. Gallus von 1904 bis 1949<br />
betreute. Er war in den zwanziger Jahren als religiöser Volksschriftsteller<br />
bekannt und zeigt sich in seiner Betreuung des<br />
Pfarrarchivs auch als ein Mann mit lokalhistorischem Interesse.<br />
In dem von ihm geordneten Archiv finden sich Quellen,<br />
die man ansonsten in einem Pfarrarchiv nicht vermutet,<br />
unter anderem die Abschrift aller Karten und Briefe, die ihn<br />
während des Ersten und Zweiten Weltkrieges von Wilflinger<br />
Soldaten im Feld erreichten. Dies ist eine einmalige, aber auch<br />
erschütternde Quelle für die Erfahrungen und die Mentalität<br />
der Weltkriegsteilnehmer.<br />
Pfarrer Dimmler gehörte zwar nicht zu den katholischen<br />
Geistlichen, die sich in die erste Reihe des Widerstands gegen<br />
den Nationalsozialismus stellten, dennoch spielte er in<br />
den Jahren der Machtentfaltung der Nazis in Wilflingen eine<br />
nicht zu unterschätzende Rolle, als er sich mit einem mutigen<br />
Brief öffentlich gegen den Lehrer und NS-Ortsgruppenleiter<br />
Alois Erath, einen nationalsozialistischen Scharfmacher,<br />
wandte und 1934 dessen Versetzung nach Gammertingen<br />
erreichte. Damit blieben dem Dorf möglicherweise noch<br />
bittere Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus erspart.<br />
Von den unmenschlichen Greueln des Nazi-Regimes konnten<br />
die Wilflinger spätestens gegen Ende des Krieges erfahren,<br />
als im Rahmen des Unternehmens »Wüste« im benachbarten<br />
Schörzingen ein KZ für ausländische Zwangsarbeiter<br />
errichtet wurde. Die Schüsse der Exekutionen habe man<br />
6
nachts bis nach Wilflingen gehört, ist einem zeitgenössischen<br />
Bericht des Gosheimer Pfarrers Schilling zu entnehmen.<br />
In der Nachkriegszeit wurde wiederum ein Pfarrer, Dimmlers<br />
Nachfolger Andreas Mors (1949-1961), zu einer wichtigen<br />
Persönlichkeit in Wilflingen. Ihm verdankt die Gemeinde<br />
eine Gedenkkapelle für die Opfer der Weltkriege auf dem<br />
Friedhof von 1953 und den Umbau der Pfarrkirche St. Gallus<br />
im Jahre 1957. Zu den Glanzpunkten des Bauprogramms<br />
gehört ein Zyklus von neun Kirchenfenstern von Prof. Albert<br />
Birkle, das sog. »Wilflinger Credo«.<br />
In der politischen Gemeinde Wilflingen der Nachkriegszeit<br />
ist insbesondere Bürgermeister Hugo Kiene (1960-1974) zu<br />
erwähnen, dessen Wahl 1958 zwar noch ein letztes Mal die<br />
Kräfte des »roten« und des »schwarzen« Wilflingen in Bewegung<br />
setzte, der dann aber nach seiner Einsetzung die Entwicklung<br />
des Dorfes zur modernen Gemeinde erfolgreich betrieben<br />
hat. Kiene konnte allerdings 1973 die Eingemeindung<br />
Wilflingens nach Wellendingen nicht verhindern und stimmte<br />
der »Vernunftehe« zu. Schon früher, im Jahr 1969, wurde<br />
die Eingliederung Wilflingens in den Kreis Rottweil vollzogen.<br />
Mit dem Abschied vom Kreis Hechingen war die Brücke<br />
zu Hohenzollern verwaltungsmäßig abgebrochen. Der Abschied<br />
nach einem so langen, gemeinsamen geschichtlichen<br />
Weg ist nicht leicht, sagte damals Landrat Dr. Mauser in einer<br />
Sitzung des Kreisrates in Wilflingen.<br />
Umso erstaunlicher ist es, wie stark die innere Verbundenheit<br />
der Wilflinger mit Hohenzollern heute noch zum Ausdruck<br />
kommt. Im heutigen Gemeindeleben Wilflingens spielen<br />
die Vereine eine wichtige Rolle. Sie tragen wesentlich zur<br />
Identität des Dorfes als ehemals hohenzollerischer Ort auch<br />
unter dem Dach der neuen Gemeinde Wellendingen bei.<br />
Literatur<br />
Casimir Bumiller, Wilflingen. Ein Geschichts- und Heimatbuch.<br />
Horb a. N. 1994 (erhältlich über das Bürgermeisteramt 78669 Wellendingen).<br />
OTTO H. BECKER<br />
Über das Tanzen im 18. Jahrhundert<br />
Die urwüchsige Lebensfreude der vornehmlich bäuerlichen<br />
Landbevölkerung in der Neuzeit äußerte sich neben den häufigen<br />
Gastereien bei Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen und<br />
zur Kirchweih, bei denen in der Regel unmäßig gegessen und<br />
getrunken wurde, und der Narretei an Fastnacht vor allem in<br />
den beliebten Tanzvergnügungen. Auch bei den zuletzt genannten<br />
Veranstaltungen ging es zumeist recht derb und ausgelassen<br />
zu. So gehörten damals, wie es Peter Thaddäus Lang<br />
einmal formuliert hat, »das Drehen und Hochwerfen der<br />
Mädchen zum Grundrepertoire der Tanzfiguren«. Dabei<br />
sollten sich die Röcke heben, unter welchen keine Unterwäsche<br />
die Körper weiters verhüllte. Nicht selten arteten solche<br />
Belustigungen auch zu richtigen Wirtshausschlägereien aus,<br />
die in dieser Epoche zu den häufigsten Delikten zählten.<br />
In den damals gültigen Landes-, Stadt- und Polizeiordnungen<br />
waren das Saitenspiel und das Tanzen an Sonn- und Feiertagen<br />
denn auch generell verboten. Diese Vorschriften zum<br />
Schutz der Feiertage waren jedoch keineswegs unumstritten.<br />
Auch ließen die Regierenden je nach Umständen Ausnahmen<br />
von dieser Norm zu, wie wir aus einem Vorgang erfahren,<br />
der im Bestand Ho 171 (Herrschaft Jungnau) des Staatsarchivs<br />
Sigmaringen verwahrt wird. Danach übertrug der Fürst<br />
von Fürstenberg mit Reskript vom 11. August 1778 auf Bitten<br />
der Wirte den Obervögten in seinem Territorium die Befugnis,<br />
nach ihrem Gutdünken Tanzveranstaltungen an<br />
Sonn- und Feiertagen gegen die Entrichtung einer Gebühr<br />
zwischen dreißig Kreuzern und einem Gulden zu gestatten,<br />
sofern die »gute Ordnung« gewährleistet war.<br />
Wie wir aus einer Anordnung der Fürstl. Fürstenbergischen<br />
Regierung in Donaueschingen vom 12. November 1784 dann<br />
aber entnehmen können, wurde bald danach das strikte Tanzverbot<br />
an Feiertagen wieder eingeführt, was bei dem damals<br />
häufigen Ausarten dieser Lustbarkeiten nicht verwunderlich<br />
ist. Die Obervögte und Amtleute durften jeweils nur noch an<br />
einem Werktag pro Woche in einem Ort das Tanzen genehmigen.<br />
Wohl in der Einsicht, daß solche Lustbedürfnisse weiter<br />
Kreise durch behördliche Maßnahmen kaum zu reglementieren<br />
waren, hatten Obervögte dann aber die Forderung<br />
erhoben, das Tanzverbot an Sonn- und Feiertagen ganz aufzuheben.<br />
Der Landesherr blieb gegenüber dieser Initiative jedoch hart.<br />
In der erwähnten Anordnung heißt es hierzu: »Serenissimus<br />
wollen aber dessen ohngeachtet die ergangene Verordnung<br />
beharret wissen, an denen Wärktäg, doch in jedem Ort in der<br />
Woche niehmals mehr als nur an einem Tage das Tanzen gegen<br />
die in den Schulfond zu entrichtende Recognition zu erlauben«.<br />
Quellennachweis<br />
StA Sigmaringen Ho 171 (Herrschaft Jungnau) NVA II 15.196<br />
Literaturnachweis<br />
Peter Thaddäus Lang: Die Polizeiordnung der Herrschaft Lautlingen<br />
aus dem Jahre 1587. In: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte<br />
27 (1991) S. 29-51, hier S. 30.<br />
ROLF VOGT<br />
Hechingen und der 30. Juni 1934<br />
Überlegungen zu den Auswirkungen der SA-Entmachtung auf eine südwestdeutsche<br />
Kleinstadt<br />
Röhm-Putsch oder Röhm-Affaire sind nach wie vor die gängigen<br />
Begriffe für das Blutbad, das am 30. Juni 1934 und den<br />
folgenden Tagen Adolf Hitler und die ihm ergebene SS mit<br />
wohlwollender Duldung der Reichswehr im Deutschen<br />
Reich anrichteten. Gleichwohl besteht seit langem Einigkeit<br />
darüber, daß der Staatsstreich von oben eine gewollte Inszenierung<br />
war, die die SA unvorbereitet und weitgehend arglos<br />
traf, weil sie trotz der Machtansprüche ihres Stabschefs<br />
Ernst Röhm nicht an eine gewaltsame Lösung des Konflikts<br />
mit der Parteihierarchie der NSDAP dachte 1 . Für die Ge-<br />
7
schichte des NS-Staates markierte jener hemmungslose<br />
Ausbruch der Gewalt auf jeden Fall einen Einschnitt. Die<br />
NSDAP entledigte sich ihres revolutionären Flügels und<br />
wurde hoffähig für Deutschlands konservative Führungsschicht,<br />
die - auf Seiten des greisen Reichspräsidenten Paul<br />
von Hindenburg - am neuen Regime vor allem Hitlers Leistung<br />
bei der Ausschaltung der Gefahr von links schätzte, die<br />
radikalen Töne der »Bewegung« aber als Bedrohung auffaßte.<br />
Nach dem 30. Juni 1934 wurde das Verhältnis einfacher.<br />
Was bedeutete das folgenschwere Wochenende für eine<br />
Kleinstadt wie »des Reiches älteste Zollernstadt« Hechingen?<br />
Die Entwaffnung der SA-Schule auf dem Lindich<br />
Der Martinsberg, jenseits des Eisweihers vor den Toren der<br />
Stadt, war schon immer ein gern besuchtes Naherholungsziel<br />
der Hechinger. Doch die Insassen des Mietautos, das in den<br />
Abendstunden des 30. Juni 1934 den Hügel hinaufschnaufte,<br />
hatten nicht die Schönheiten der Landschaft und das satte<br />
Grün von Büschen und Bäumen im Blick. In dem Wagen, den<br />
sie sich bei der Autovermietung Johann Wiest geholt hatten,<br />
saßen Bedienstete des Landratsamts Hechingen. Sie waren<br />
auf dem Weg zum Lindich. Ihr Auftrag: Erkundigungen über<br />
das Verhalten des Personals der SA-Sportschule einzuholen,<br />
die Anfang Mai des Jahres in dem ehrwürdigen Schloß ihren<br />
Einzug gehalten hatte.<br />
Alarmiert worden war das Landratsamt vorsorglich vom Regierungspräsidenten<br />
in Sigmaringen 2 . Dort, in der Funkstelle<br />
der Staatspolizei, gingen im Laufe jenes Samstags laufend<br />
neue Funksprüche aus Berlin ein, von denen einer beunruhigender<br />
war als der andere. In der Hauptstadt ging es drunter<br />
und drüber, Klarheit über die verworrene Situation zu erhalten,<br />
war nicht einfach. Regierungspräsident Dr. Carl Simons<br />
zog es deshalb vor, selbst aktiv zu werden. Konnte es<br />
nicht sein, daß auch die Hechinger SA-Schule an den vermeintlich<br />
hochverräterischen Umtrieben beteiligt war, die im<br />
ganzen Reich eine Polizeiaktion sondergleichen ausgelöst<br />
hatten?<br />
Die Hechinger Schule war daran nicht beteiligt, jedenfalls<br />
wurden vom Hechinger Landratsamt keine beunruhigenden<br />
Meldungen an das Regierungspräsidium weitergeleitet. So<br />
blieb der SA-Schule auf dem Lindich noch ein Tag bitterer<br />
Ungewißheit.<br />
Als am Abend des Sonntag, 1. Juli 1934, aus Berlin der Funkspruch<br />
einging, der preußische Ministerpräsident Hermann<br />
Göring habe der Polizei Befehl zu einer »allgemeinen Entwaffnungsaktion«<br />
bei der SA erteilt, schaltete sich der Regierungspräsident<br />
erneut ein. Von Sigmaringen aus setzte sich<br />
eine Kolonne von Gendarmeriebeamten unter der Leitung<br />
des Gendarmeriehauptmanns Dorgerloh in Bewegung, die<br />
zuerst in Gammertingen Station machte. Mit Unterstützung<br />
eines dort in Alarm liegenden SS-Zuges wurden kurz nach<br />
22 Uhr die Gammertinger SA-Schule besetzt und die Straße<br />
nach Hechingen gesperrt, »damit die Aktion nicht vorzeitig<br />
bei der Schule im Schloß Lindich bekannt werden konnte« 3 .<br />
Gammertingens SA-Schule leistete keinen Widerstand, ihre<br />
Besatzung lieferte ihre Waffen zwar mit »Bedenken«, aber<br />
ohne Zögern aus.<br />
Die Hechinger Schule war nicht so einfach zu überwältigen.<br />
Die Sigmaringer Gendarmerie hatte das erwartet und deshalb<br />
Unterstützung von der Hechinger Gendarmerie angefordert<br />
und sich der Hilfe eines aus Tübingen angerückten SS-Zuges<br />
versichert. 4 Gegen 1.15 Uhr in der Nacht zum 2. Juli standen<br />
die Einsatzkräfte, insgesamt etwa 60 Mann, vor dem Tor des<br />
Schlosses. Ihr Befehlshaber Dorgerloh forderte den Posten<br />
auf, das Tor zu öffnen, und verlangte, zum Schulleiter gebracht<br />
zu werden. Doch dem Befehl wurde nicht Folge geleistet.<br />
Vielmehr kamen mehr und mehr SA-Angehörige hinter<br />
dem Tor zusammen, die ihre Gewehre zu laden und zu<br />
sichern begannen. Der Gendarmeriebefehlshaber gab darauf<br />
hin seinen Männern den Befehl, über das Tor zu klettern und<br />
die Schule von innen zu öffnen. Der Coup gelang, die SAMänner<br />
am Eingang konnten entwaffnet werden, das Schloß wurde<br />
von Gendarmerie und SS besetzt. Dorgerloh selbst begab<br />
sich zu Schulleiter Anton Gabel 5 und forderte die Herausgabe<br />
der in der Schule gelagerten Waffen. Der Schulleiter zögerte.<br />
Ihm war mitgeteilt worden, daß Sportschulen der SA<br />
von der Entwaffnung ausgeschlossen seien. 6 Wohl nicht zuletzt<br />
deshalb hatten Gendarmerie und SS die wohl etwa<br />
40köpfige Belegschaft der Schule - ein Kurs war gerade nicht<br />
im Schloß - schlafend angetroffen. Sich entwaffnen zu lassen,<br />
widerstrebte Gabel trotzdem. »Gabel zeigte fast die ganze<br />
Zeit über ein Wesen, das seine Leute in der Neigung zu Widersetzlichkeiten<br />
bestärken oder diese wecken mußte«, notierte<br />
Dorgerloh am nächsten Tag in seinem Bericht.<br />
Bei der Suche nach den Waffen kam es deshalb mehrfach zu<br />
brenzligen Situationen. Die Besatzung der Schule provozierte<br />
die Polizeibeamten, indem sie Kampflieder, darunter das<br />
Horst-Wessel-Lied, sang und immer wieder lautstark »Sieg<br />
Heil« und »Deutschland erwache« ausrief. Einzelne Gendarmen<br />
wurden bedrängt und beschimpft. Fast zwei Stunden<br />
dauerte es, bis alle Waffen gefunden und auf zwei Lastwagen<br />
verladen waren, die die Brauerei St. Luzen und die Autovermietung<br />
Wiest gestellt hatten. Zusammen kamen dabei 197<br />
Gewehre und mehrere Munitionskisten. Die Schlüssel für ein<br />
größeres Munitionslager im Schloß wurden beschlagnahmt.<br />
Die Entwaffnung der SA-Schulen in Gammertingen und Hechingen<br />
war nicht die einzige Aktion, mit der sich Behörden<br />
in Hohenzollern an der staatlich verordneten Racheaktion an<br />
der SA beteiligten.<br />
Bereits in der Nacht zum 1. Juli 1934 war die SA-Standarte,<br />
die ihren Sitz in Haigerloch hatte, von einer SS-Einheit entwaffnet<br />
worden, einzelnen Angehörigen der Wehrformation<br />
wurden ihre Waffen ebenfalls abgenommen. Weitere 65 Gewehre,<br />
Karabiner und Pistolen lieferte die SA-Standarte am<br />
5. Juli 1934 der Gendarmerie aus, nachdem Standartenführer<br />
Vincenz Stehle dem Landratsamt das Vorhandensein einer<br />
weiteren Waffenkammer angezeigt hatte. 7 Insgesamt wurden<br />
im Regierungsbezirk Sigmaringen - vornehmlich im Kreis<br />
Hechingen - gut 100 Gewehre beschlagnahmt, die sich im Besitz<br />
der SA befunden hatten. Weil angeblich Anhaltspunkte<br />
dafür vorlagen, daß Teile der Standarte auf einen Einsatz am<br />
30. Juni 1934 vorbereitet waren, leitete die Staatspolizeistelle<br />
in Sigmaringen ein Ermittlungsverfahren gegen Standartenführer<br />
Stehle ein, das aber zu keinem Ergebnis führte. 8<br />
Die Nacht- und Nebel-Aktion im Schloß Lindich dürfte sich<br />
in Hechingen schnell herumgesprochen haben, auch wenn<br />
sich in den beiden Zeitungen der Stadt, dem katholischen Zoller<br />
und den nationalsozialistischen Hohenzollerischen Blättern,<br />
kein Wort darüber fand. Die Schule auf dem Lindich<br />
war den Hechingern ein Ärgernis. Mit großem Aufwand hatte<br />
die Stadt in dem vom Fürsten Friedrich von Hohenzollern<br />
bereitgestellten Schloß Anfang des Jahres 1934 den Wasseranschluß<br />
herstellen und die Räumlichkeiten renovieren lassen.<br />
Anfang Mai wurde die Schule, die auf dem Truppenübungsplatz<br />
Heuberg der Reichswehr weichen mußte, mit<br />
einer pompösen Kundgebung auf dem Marktplatz eingeweiht.<br />
9 Etwa 250 Männer belegten das Schloß während der<br />
Kurse. 10 Mit monatlichen Kameradschaftsabenden bemühte<br />
sich die Schule zwar um ein freundschaftliches Verhältnis zu<br />
den Hechingern, doch blieb der Erfolg aus: »Das Verhältnis<br />
der auf dem Schloß Lindich untergebrachten SA-Führerschule<br />
zur Bevölkerung der Stadt Hechingen ... ist bedauerlicherweise<br />
nach wie vor äußerst gespannt«, beschrieb Landrat<br />
Paul Schraermeyer Ende Juni in seinem Lagebericht an<br />
die Staatspolizei das Zusammenleben. 11<br />
8
Mehrere unerfreuliche Vorgänge hatten zu den Spannungen<br />
beigetragen. Im Mai etwa war es in zwei Wirtshäusern in<br />
Schlatt und in Hechingen zu Schlägereien gekommen, an denen<br />
Angehörige der Schule beteiligt waren. Bei dem Zwischenfall<br />
in Hechingen hatte ein Unterführer der Schule ein<br />
Mitglied des Turnvereins angepöbelt, weil es eine Uniform<br />
des Stahlhelm trug. Als der SA-Mann dem Turner die Uniform<br />
zerriß, wurde er von anderen Mitgliedern des Turnvereins,<br />
die bei dem Vorfall zugegen waren, verprügelt. Auch im<br />
Schützenhaus, wo die Schule ihre Schießübungen absolvierte,<br />
hatten Kursteilnehmer und Personal wenig Einfühlungsvermögen<br />
in das nationale Empfinden der Hechinger gezeigt.<br />
Ehrenscheiben, die der Schützengilde besonders wertvoll waren,<br />
wurden von den Schulangehörigen bedenkenlos zertrümmert,<br />
wenn ihnen die Darstellungen nicht zeitkonform<br />
erschienen. Hinzu kam, daß Kursteilnehmer und Personal in<br />
Gasthäusern immer wiederüber die Stränge schlugen. Im Hotel<br />
Rad widersetzten sie sich mehrfach sogar den städtischen<br />
Polizeibeamten. Der Korpsgeist in der Schule erschwerte die<br />
Aufklärung der Vorfälle. Die Polizei stieß dort auf eine Mauer<br />
des Schweigens, die die Ermittlung der Täter unmöglich<br />
machte.<br />
Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit: Das Cafe'<br />
Röcker zu besuchen, hatte Schulleiter Anton Gabel sowohl<br />
Personal als auch Kursteilnehmern der Schule verboten, weil<br />
die »Frau Konditormeister« mit abfälligen Bemerkungen<br />
über das Verhalten der Schule aufgefallen sein soll. 12<br />
Nach dem 30. Juni 1934 drängten Landrat und Regierungspräsident<br />
deshalb mit Nachdruck auf die Ablösung des Schulleiters,<br />
dem die Schuld an den Spannungen gegeben wurde.<br />
Da der von Hitler nach der Ermordung Röhms als SA-Chef<br />
eingesetzte Viktor Lutze in seinem ersten Stabsbefehl angeordnet<br />
hatte, daß »SA-Führer, die sich ... vor den Augen der<br />
Öffentlichkeit unwürdig benehmen, randalieren oder gar Exzesse<br />
veranstalten«, aus der SA zu entfernen seien, und von<br />
staatlichen Stellen in solchen Fällen bei Strafverfahren härtere<br />
Urteile forderte 13 , fühlten sich Landrat und Regierungspräsident<br />
ermutigt, gegen die SA-Schule vorzugehen.<br />
Bei der Hechinger Staatsanwaltschaft lag seit dem Mai 1934<br />
eine Anzeige gegen Schulleiter Anton Gabel wegen Widerstands<br />
gegen die Staatsgewalt, Nötigung, Beamtenbeleidigung<br />
und groben Unfugs vor. Beim Regierungspräsidenten<br />
verwandte sich der Hechinger Landrat Paul Schraermeyer energisch<br />
dafür, das Verfahren voranzutreiben, und Regierungspräsident<br />
Dr. Simons machte sich in einem Bericht an<br />
das preußische Innenministerium die Forderung des Landrats<br />
nach einer Ablösung des Schulleiters zu eigen, »insbesondere<br />
auch wegen seines Auftretens bei der Entwaffnung«.<br />
Erfolg hatte ihre Intervention nicht. Obwohl der Hechinger<br />
Oberstaatsanwalt Dr. Poth Anfang August beim Amtsgericht<br />
Hechingen einen Strafbefehl beantragte, blieb der Schulleiter<br />
unbehelligt. Sein Vergehen fiel unter die Amnestie, die das<br />
nationalsozialistische Regime nach dem Tode von Reichspräsident<br />
Paul von Hindenburg und dem Ubergang der obersten<br />
Staatsgewalt auf Adolf Hitler verkündete. Für die Abberufung<br />
des Schulleiters war das Innenministerium zudem<br />
nicht zuständig. Der Kanzlei des preußischen Ministerpräsidenten<br />
Hermann Göring, an die die Forderung des Sigmaringer<br />
Regierungspräsidenten weitergeleitet worden war, erschien<br />
die Hechinger SA-Schule möglicherweise zu unbedeutend<br />
für eine Reaktion. In den Akten des Regierungspräsidiums<br />
findet sich jedenfalls kein Hinweis auf eine Antwort<br />
aus Berlin. 14<br />
(2. Teil folgt im nächsten Heft)<br />
Anmerkungen<br />
1 Vgl. in Handbüchern Erdmann, Karl Dietrich, Deutschland unter<br />
der Herrschaft des Nationalsozialismus 1933 - 1939, (= Gebhardt,<br />
Handbuch der deutschen Geschichte), München, 1980, S. 94 ff.,<br />
oder in Monographien Broszat, Martin, Der Staat Hitlers, München,<br />
1969, S. 244 ff.<br />
2 Staatsarchiv Sigmaringen (StaS), Ho 235, 20, I, VIII, F 18 (neue<br />
Nummer 334), Röhm-Revolte vom 30.6.34. Die Akte erwähnt die<br />
Erkundung nur beiläufig.<br />
3 StaS, ebd., Bl. 19 ff., Der Bericht, an den sich die Darstellung der<br />
Entwaffnungsaktion anschließt, wurde vom Leiter der Einsatztruppe,<br />
Dorgerloh, verfaßt. Beurteilungen der Entwaffnungsaktion<br />
finden sich auch in den politischen Lageberichten, StaS, Ho 235,<br />
20, I, VIII, A 21 (neue Nummer 57), Neuorganisation der politischen<br />
Polizei hier Lageberichte.<br />
4 StaS, Ho 235, 20,1, VIII, F 18, Bl. 19 ff., 54 f.<br />
5 Anton Gabel, geboren 18. 9. 1894 in Heilbronn, gestorben 26. 6.<br />
1935 in Heilbronn. Gabel war Weltkriegsteilnehmer und<br />
Freikorpskämpfer. Seit dem 15. 10. 1933 leitete er die SA-Unterführerschule<br />
auf dem Heuberg, mit der er Anfang Mai 1934 nach<br />
Hechingen kam. 1935 wurde er Hauptmann der Wehrmacht in<br />
Heilbronn. Bei einer Übung erlitt er einen tödlichen Unfall. Vgl.<br />
Hohenzollerische Blätter (Hz Bl.) 148/28.6.1935,149/29. 6.1935,<br />
152/3. 7. 1935.<br />
6 Eine entsprechende Anordnung lag dem Regierungspräsidenten<br />
in Sigmaringen zum Zeitpunkt der Entwaffnung nicht vor. Der<br />
Funkspruch Nr. 112 des SSD Berlin mit der Anordnung, »daß<br />
sa-sportschulen und sa-führerschulen nicht zu entwaffnen sind<br />
wo dies schon geschah, sind Waffen ... zurück zu geben«, trägt<br />
in den Akten des Regierungspräsidiums den Eingangsstempel mit<br />
Datum vom 3. 7. 1934. Der Regierungspräsident sah sich nach<br />
der Entwaffnungsaktion massivem Druck seitens des Beauftragten<br />
des Chefs des Ausbildungswesens der SA, Gruppe Südwest,<br />
in Stuttgart, Zybon, ausgesetzt. Das Regierungspräsidium wollte<br />
die Rückgabe der Waffen von der Abberufung des Schulleiters<br />
abhängig machen und intervenierte deshalb beim preußischen<br />
Innenministerium in Berlin, s. u. Das Innenministerium verfügte<br />
die Rückgabe der Waffen, ohne auf die Forderung des Sigmaringer<br />
Regierungspräsidenten einzugehen, StaS, Ho 235, 20,1, VIII, Fl 8,<br />
Bl. 54 ff. 61,67 f.<br />
7 StaS, Ho 235, 20, I, VIII, A 21, Lagebericht Regierungspräsident<br />
8. 8. 1934, Ho 235, 20,1, VIII, F 18, Bl. 29 ff., 85 f., 100.<br />
8 StaS, Ho 235, 20, I, VIII, A 21, Lagebericht Landrat Hechingen<br />
26. 7. 1934, Lagebericht Regierungspräsident 8. 8. 1934.<br />
9 Hz. Bl. 104/ 7. 5. 1934, Zoller (Z) 104/ 7. 5.1934. Das Schloß stand<br />
zuvor leer. Die Stadt Hechingen stellte für den Umbau 50000 RM<br />
und für die Herstellung des Wasseranschlusses 45 000 RM zur Verfügung,<br />
Hz. Bl. 287/14.12.1933. Der Umbau begann Anfang 1934,<br />
Hz. Bl. 27/2.2. 1934, Z 27/2. 2. 1934. Im März 1934 schaltete die<br />
Stadt Hechingen im katholischen Zoller eine Anzeige, mit der zehn<br />
Wohnungen für das Lehrpersonal der Schule gesucht wurden,<br />
Z 65/ 19. 3. 1934. Die Eröffnung der Schule wurde in den Zeitungen<br />
mehrfach angekündigt, Hz. Bl. 100/2. 5. 1934, 102/4. 5. 1934,<br />
Z 103/ 5. 5. 1934. Eine Einladungskarte ist in der Hohenzollerischen<br />
Heimatbücherei, K 64 II, archiviert. Die Eröffnung der Schule<br />
wurde als Großkundgebung organisiert, bei der die Hechinger<br />
SA Personal und Kursteilnehmer am Brielhof abholte. Auf dem<br />
Marktplatz wurden sie von Bürgermeister Paul Bindereif empfangen,<br />
der den »herzlichsten Willkommensgruß unserer schönen Zollernstadt«<br />
entbot, Hz. Bl. 104/ 7. 5. 1934. Die Schule selbst wurde<br />
in Anwesenheit von Regierungspräsident Dr. Carl Simons und des<br />
Kreisleiters Dr. Theodor Johannsen offiziell eingeweiht. Am nächsten<br />
Tag schlossen sich eine Totengedenkfeier an der Hechinger<br />
Kriegergedächtnisstätte und ein Kameradschaftsabend im Museum<br />
an.<br />
StaS, Ho 235, 20, 1, VIII, Fl 8, Bl. 24.<br />
11 ebd., s. a. StaS, Ho 235, 20, 1, VIII, A 21, Lageberichte Staatspolizeistelle<br />
2. 6. 1934, 5. 7. 1934, Tagesbericht 5. 7. 1934.<br />
12 ebd., Bl. 24, 25 f.<br />
13 Völkischer Beobachter, Sondernummer, 1. 7. 1934. Ein Exemplar<br />
ist in der Akte des Regierungspräsidiums, Bl. 48, abgelegt worden.<br />
14 StaS, Ho 235,20,1, VIII, F18, Bl. 61, 79, 80 f.<br />
9
HERBERT RÄDLE<br />
Der Bingener Hochaltar, Vorbild für Exportaltäre der<br />
Ulmer Weckmann-Werkstatt in die Schweiz<br />
Die Reichsstadt Ulm, im Spätmittelalter eines der wichtigsten<br />
Kunstzentren Süddeutschlands, bot vielen bedeutenden<br />
Bildhauern und Malern reiche Arbeitsmöglichkeiten. Unter<br />
den Bildschnitzern war Nikiaus Weckmann (Schaffenszeit<br />
1481-1528) der bedeutendste. Die Weckmann-Werkstatt lieferte<br />
in den Jahrzehnten um 1500 Schnitzaltäre auch für das<br />
Gebiet des heutigen Kreises Sigmaringen, Meisterwerke, die<br />
sich teilweise noch am ursprünglichen Standort befinden wie<br />
die Altarfiguren der Pfarrkirchen Bingen und Ennetach, zum<br />
größeren Teil jedoch abgewandert sind in verschiedene Museen,<br />
wie das Retabel von Roth bei Meßkirch (heute Riss-<br />
Museum Mannheim) oder der Meßkircher Eligius-Altar<br />
(heute Schnütgen-Museum Köln).<br />
Weckmann arbeitete seit der Wende zum 16. Jahrhundert<br />
auch für den Export in die Schweiz. An der Verbreitung seiner<br />
Werke bis nach Graubünden läßt sich in besonderer Weise<br />
die Bedeutung dieses Ulmer Meisters und seiner Werkstatt<br />
ablesen 1 .<br />
In dem zum Bistum Chur gehörigen Kanton Graubünden<br />
wurde im 15. und 16. Jahrhundert eine Reihe neuer Kirchen<br />
gebaut. Da jedoch für deren künstlerische Ausstattung die<br />
einheimische Produktion nicht ausreichte - selbst in der alten<br />
Bischofsstadt Chur sind keine nennenswerten malerischen<br />
oder bildhauerischen Traditionen faßbar - ging ein<br />
Großteil der Aufträge für die Ausstattung der neugebauten<br />
Kirchen mit Altären an oberschwäbische Werkstätten.<br />
Den Löwenanteil der Aufträge sicherte sich Ivo Strigel aus<br />
Memmingen, dessen Werkstatt ab 1486 eine Vielzahl von Flügelaltären<br />
nach Graubünden lieferte, von denen noch rund<br />
20 als Ganzes oder in Teilen nachweisbar sind. Der bedeutendste<br />
Auftrag, der Hochaltar des Domes zu Chur von 1492,<br />
ging an Jakob Ruß aus Ravensburg. Aus Ravensburger Werkstätten<br />
stammt mit großer Wahrscheinlichkeit auch der 1477<br />
datierte Hochaltar der Klosterkirche des 10 km südlich von<br />
Chur gelegenen Churwalden 2 .<br />
Die Altäre der nahen, ebenfalls zum Bistum Chur gehörigen<br />
Graubündner Orte Alvaneu, Salouf und Domat (Ems) wurden<br />
1935 von Gertrud Otto als Export der Ulmer Weckmann-<br />
Werkstatt erkannt. Darüberhinaus stellte Gertrud Otto die<br />
Abhängigkeit der Skulpturen dieser drei Graubündner Altäre<br />
von denen des Bingener Hochaltars heraus 3 .<br />
Bei dem Altar der katholischen Pfarrkirche St. Maria Geburt<br />
in Alvaneu handelt es sich um einen großen barocken Hochaltar,<br />
in den gotische Teile eingebaut sind. Die gotischen Teile<br />
wurden so wiederverwendet, daß die Schreinfiguren aus<br />
der Weckmann-Werkstatt das Zentrum über dem Tabernakel<br />
bilden und darüber die ehemaligen Altarflüge 4 montiert<br />
wurden. Der »Schrein« enthält - entsprechend der Anordnung<br />
in Bingen - in der Mitte die Muttergottes und rechts<br />
und links zwei Heiligenpaare: Mauritius und Johannes Baptista,<br />
sowie Magdalena und Ursula. Besonders bei den Figuren<br />
der Magdalena und Johannes des Täufers in Alvaneu<br />
springt die Abhängigkeit von den gleichnamigen Figuren des<br />
Bingener Altars ins Auge. Die Magdalena stellt dabei eine<br />
vorzügliche, der Johannes eine eher durchschnittliche Arbeit<br />
der Weckmann-Werkstatt dar.<br />
Auch die Kreuzigungsgruppe aus dem Gesprenge des ursprünglichen,<br />
gotischen Altars von Alvaneu und die Halbfiguren<br />
der Apostel, die beim gotischen Altar wohl an der Predella<br />
angebracht waren, haben im Barockaltar Wiederver-<br />
9 i<br />
1<br />
u<br />
Abb. 1: Hl. Magdalena, Pfarrkirche Bingen, Ulm 1503<br />
wendung gefunden: die Kreuzigungsgruppe ist im Auszug<br />
des heutigen - barocken - Altars zu sehen, während die Halbfiguren<br />
der Apostel nunmehr in die Rahmung des Hauptgeschosses<br />
des Barockaltars eingefügt sind.<br />
Auch bei dem vollständig in alter Fassung erhaltenen, etwas<br />
kleineren Retabel von Salouf (um 1500) ist als Vorbild der<br />
Bingener Altar ersichtlich. Der rechteckige Saloufer Schrein<br />
enthält - wie die Altäre in Bingen und Alvaneu - in der Mitte<br />
die Muttergottes, flankiert von je zwei weiblichen und zwei<br />
10
männlichen Heiligen, wobei es sich in Salouf um die hll. Jungfrauen<br />
Katharina und Barbara und die hll. Ritter Georg und<br />
Mauritius handelt. (Die Saloufer Kirche ist eine St. Georgskirche).<br />
Auch der ebenfalls gut erhaltene 1504 datierte Hochaltar der<br />
alten Pfarrkirche von Domat (Ems) entspricht im Typus dem<br />
Bingener Altar. Doch steht hier in der Mitte nicht die Muttergottes,<br />
sondern der Kirchenpatron Johannes d. T., der flanf<br />
V<br />
% ft<br />
Sf 5 \f-<br />
gesprochen werden muß. Der Domat-Emser Johannes ist<br />
aber eine Kopie, die vorzüglich die Qualitäten des »Urbilds«<br />
wiederholt. In beiden Fällen beeindruckt vor allem die »expressive<br />
Gestaltung des Kopfes, der mit seinen zahlreichen<br />
Falten und den eingefallenen Wangenpartien das Gesicht eines<br />
Asketen zeigt« (Claudia Lichte). Zum Schluß ist es interessant,<br />
noch eine Graubündener und eine Bingener<br />
Weckmann-Figur zum Vergleich einander gegenüberzustellen,<br />
um daran verbindende Stilmerkmale sichtbar zu machen.<br />
Es sei dazu die Bingener Magdalena (Abb. 1) und die Saloufer<br />
Madonna (Abb. 2) herausgegriffen.<br />
Bei einem Vergleich stellt man zunächst fest, daß beide Figuren<br />
einen ähnlichen Gesamtumriß aufweisen bei gleichzeitiger<br />
Seitenverkehrtheit. Auffallend ähnlich ist aber vor allem<br />
die Gewandgestaltung: sowohl die Gewandführung wie<br />
auch die Faltengebung des Mantels, dessen freies Ende jeweils<br />
hochgezogen und mit dem Unterarm festgehalten wird, ist<br />
bei beiden Figuren fast identisch 6 . Die Gestalt der Magdalena<br />
wirkt dabei etwas aufrechter, ein Eindruck, der durch den<br />
erhobenen Blick und den geraden, unterhalb der rechten<br />
Hand niederfallenden Mantelzipfel unterstützt wird. Beide<br />
Figuren zeigen eine ovale, nach unten spitz zulaufende Gesichtsform<br />
mit schmalem Mund und leichtem Doppelkinn.<br />
Auch die Gestaltung der lang wallenden Haare und die hochgeschnürte<br />
Taille verbindet die Figuren.<br />
Der Bingener Altar ist im übrigen wahrscheinlich mit Mitteln<br />
des Klosters Zwiefalten angeschafft worden. Dieses hatte<br />
bis 1803 in Bingen Patronatsrechte. Auch der Bau des Bingener<br />
Pfarrhauses aus dem Jahr 1602 geht auf einen Zwiefalter<br />
Abt, Michael Müller, zurück, dessen Wappen und Name<br />
über der Tür zu sehen ist 7 .<br />
Anmerkungen<br />
f» TT<br />
N Ji; fl<br />
iT<br />
WJ<br />
Abb. 2: Saloufer Madonna, Pfarrkirche St. Georg, Ulm um 1500<br />
kiert wird von den hll. Florinus und Urban, sowie den Jungfrauen<br />
Katharina und Dorothea. Der stilistische Befund entspricht<br />
weitgehend dem Werk in Salouf. Auch hier basieren<br />
die Schreinfiguren »auf dem Stil Weckmanns der Zeit des Bingener<br />
Altars« 5 . Der im Domat-Emser Altar im Zentrum stehende<br />
Kirchenpatron entspricht dabei so weitgehend dem Johannes<br />
des Bingener Altars, daß wiederum von einer Kopie<br />
1 Die Zollern hatten übrigens bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts<br />
Herrschaftsbesitz in Graubünden: 1497 tauscht Eitelfriedrich II.<br />
(1452-1512) die Herrschaft Rhäzüns (bei Chur) mit Kaiser Maximilian<br />
gegen die Herrschaft Haigerloch. Vgl. R. Seigel, Schloß Sigmaringen,<br />
Thorbecke 1966, S. 10.<br />
2 Alle Informationen entstammen dem Aufsatz von Albrecht Müller,<br />
Nikiaus Weckmann und Graubünden, in: Ausstellungskatalog<br />
Stuttgart 1993, S. 357. Vgl. ebd. S. 40.<br />
3 Gertrud Otto, Der Export der Weckmann-Syrlin-Werkstatt nach<br />
Graubünden, in: Anzeiger für Schweiz. Altertümerkunde, 1935,<br />
S. 283 ff., 288 f.<br />
4 Es handelt sich um zwei Flügelreliefs: eine Anbetung der Könige<br />
und eine Marienkrönung aus der Weckmann-Werkstatt. Abb. im<br />
Katalog, wie Anm. 2, S. 359.<br />
5 Albrecht Müller, wie Anm. 2, S. 259.<br />
6 Der gleichsam vom Wind hochgewehte Mantelsaum der Saloufer<br />
Madonna ist übrigens ein Motiv, das zum Repertoire der Weckmann-Werkstatt<br />
gehörte. Vgl. die Abbildungen im Katalog (wie<br />
Anm. 2) S. 80.<br />
7 Vgl. Genzmer, Kunstdenkmäler des Kreises Sigmaringen, Stuttgart<br />
1948, S. 81, 91. Über Abt Michael Müller als Bauherrn in Zwiefalten<br />
vgl. H. J. Pretsch (Hrsg.), 900 Jahre Zwiefalten, Ulm 1989,<br />
S. 189 ff. Weckmann hatte übrigens um 1515 für Zwiefalten die<br />
großen Passionsreliefs geliefert, die sich heute im Württ. Landesmuseum<br />
Stuttgart (Inv. Nr. 375 a-g) befinden. Sie standen ursprünglich<br />
in den Schreinen der Seitenschiffaltäre der Zwiefalter<br />
Klosterkirche. Als diese 1740 abgebrochen wurde, gelangten die Tafeln<br />
zunächst in die Armenhauskapelle in Tigerfeld, von dort 1846<br />
als Staatseigentum nach Stuttgart. Die ebenfalls in. der Weckmann-<br />
Werkstatt geschnitzten Seitenflügel wurden 1761 in das Frauenkloster<br />
Mariaberg gebracht und sind heute verschollen.<br />
H.J. Pretsch, wie oben, S. 182 und Katalog, wie Anm. 2, S. 438.<br />
11
HANS PETER MÜLLER<br />
Bechtoldsweiler anno 1295<br />
Bechtoldsweiler ist nicht nur einer der kleinsten altzollerischen<br />
Orte, sondern, historisch gesehen, auch einer der quellenärmsten.<br />
Von daher kommt es, daß laut Landesbeschreibung,<br />
der Ortsname erst ab 1363 urkundlich überliefert ist.<br />
Aufgrund eines Dokuments aus dem Bestand der ehemaligen<br />
Johanniterkommende Hemmendorf im Hauptstaatsarchiv<br />
Stuttgart (B 352 Bü 44) läßt sich dieses relativ späte Erstnennungsdatum<br />
möglicherweise um einige Jahrzehnte vorverlegen.<br />
Es handelt sich um ein Archivverzeichnis der besagten<br />
Kommende aus der Zeit um 1600, das zwar nur sehr flüchtig<br />
geschrieben ist, jedoch einige ältere Urkunden erwähnt, die<br />
weder im Original, noch als Abschrift erhalten sind.<br />
Eine dieser verlorenen Urkunden stammt aus dem Jahre 1295<br />
und betrifft Bechtoldsweiler. Die Notiz hat folgenden Wortlaut:<br />
»Ein gesigleter Kauffbrieff über 2 Höfe zu Bechtoldsweyhler,<br />
so Hug Frige von Werstein an Herrn Bruder Bertolden<br />
den Luppen Commenthur zue Hemmendorff verkauft<br />
anno 1295«.<br />
Da die genannten Personen durchaus historisch sind, läßt sich<br />
weder am Datum, noch am Sachverhalt zweifeln. Berthold<br />
Liupe ist von 1290 bis 1302 als Komtur der Hemmendorfer<br />
Kommende bezeugt. Bei dem Wehrsteiner Adligen handelt<br />
es sich um den Edelfreien (nobilis) Hugo, der von 1294 bis<br />
1310 nachweisbar ist. Sein mutmaßlicher Sohn Hugo war<br />
übrigens 1322/43 Kirchherr oder Pfarrer in Stein, dem Mutterort<br />
von Bechtoldsweiler. Vermutlich besaßen die<br />
Wehrsteiner sogar den Kirchensatz von Stein; jedenfalls sind<br />
sie dort bis zum Ende des 14. Jahrhunderts begütert.<br />
Leider läßt sich der Johanniterbesitz in Bechtoldsweiler in<br />
den Lagerbüchern nicht verfizieren, so daß anzunehmen ist,<br />
daß er bald wieder veräußert wurde. Das älteste Hemmendorfer<br />
Lagerbuch über zollerische Ortschaften stammt erst<br />
von 1605 (H 218 Bd 49) und enthält nur Besitz in Starzein,<br />
Jungental, Hausen, Jungingen, Burladingen, Ringingen, Salmendingen<br />
und Hechingen.<br />
Eine weitere zollerische Urkunde aus dem Archiwerzeichnis<br />
datiert von 1291 und scheint ebenfalls verloren zu sein:<br />
»Ein Verzügsbreiff uff die Altendickinger Wise Graff Friderichs<br />
von Zollern de anno 1291«.<br />
Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf eine hohenbergische<br />
Urkunde von 1280, die besagt, daß Graf Albrecht von<br />
Hohenberg ein Gut in Schwalldorf an die Johanniterkommende<br />
abtrat.<br />
Als Ergänzung zu den Studien von K. F. Eisele (1956) lassen<br />
sich für das Amt Stein noch folgende Grundherren anführen.<br />
Die Gemeinde Frommenhausen dotierte 1428 eine Kaplaneipfründe<br />
in ihrer Kirche mit Gütern und Zinsen zu<br />
Bechtoldsweiler, Stein und Sickingen (B 19 PU 346). Im Jahre<br />
1431 verkauften die Gebrüder Baiinger von Hechingen an<br />
die Heiligenpflege in Ringingen mehrere Lehengüter zu Stein,<br />
Weiler vor dem Rötenberg und Sickingen um 138 1/2 Pfund<br />
Heller (B 201 PU 435).<br />
Über die politischen Verhältnisse Bechtoldsweilers ist dagegen<br />
nur wenig bekannt, weshalb man annimmt, daß es wie<br />
auch Sickingen das Schicksal des Mutterortes Stein geteilt hat.<br />
Stein gehörte den Schwarzgrafen von Zollern, war aber vor<br />
1404 an die Herren von Ow von Bodelshausen verpfändet<br />
worden. Letztere konnten 1407 vom Kloster Alpirsbach auch<br />
das Gut Schönrain bei Stein als Zinslehen erwerben. Im Jahre<br />
1409 trugen die von Ow ihren gesamten Besitz, bestehend<br />
aus Burg und Dorf Bodelshausen sowie Oberhausen, Schönrain,<br />
Stein, Sickingen und Weiler den Grafen von Württemberg<br />
zu Lehen auf, ehe sie dies alles 1446/53 an Württemberg<br />
verkauften. Ein Schiedsgericht stellte j edoch 1456/57 fest, daß<br />
die Lehensauftragung und Veräußerung Steins widerrechtlich<br />
gewesen war und sprach den Grafen von Zollern das Lösungsrecht<br />
zu. Schließlich kaufte Graf Josnikiaus von Zollern<br />
1472 die Orte Stein, Weiler, Sickingen und Schönrain um 1836<br />
Gulden von Württemberg zurück.<br />
EMIL GRUPP<br />
Siedlungsspuren der mittleren Bronzezeit auf der Gemarkung von Hausen i. K.<br />
Wenngleich zahlreiche Hügelgrabfunde auf der Schwäbischen<br />
Alb, vor allem auch in unserer Gegend, eine verhältnismäßig<br />
dichte Besiedlung während der mittleren Epoche<br />
der Bronzezeit anzeigen, fehlt es weitgehend an Spuren von<br />
Niederlassungen. Der Lochenstein, Erlaheim, Binsdorf und<br />
Dautmergen konnten 1979 als einzige Örtlichkeit im Kreis<br />
Balingen genannt werden, die Befunde aufzuweisen hatten 1 .<br />
Nur wenige Jahre später, beim Straßenbau 1984 anläßlich der<br />
Neutrassierung der B 32 zwischen Hausen und Burladingen,<br />
gelang nun die von der Öffentlichkeit kaum registrierte Entdeckung<br />
einer weiteren Siedlung. H. Schaudt aus Bitz meldete<br />
Ende September Lesefunde an das Landesdenkmalamt.<br />
Dessen Außenstelle Tübingen führte dann umgehend im Oktober<br />
eine Notgrabung durch 2 .<br />
Das Flurstück Kälberwiesen, auf einer Höhe von 695 m am<br />
Albaufstieg gelegen, zeigte durch dunkle Verfärbungen des<br />
Bodens, durch eingebettete Scherben und eine Feuersteinklinge<br />
an: hier waren prähistorische Spuren zu sichern.<br />
Hauptsächlich aus Scherben und Tierknochen setzte sich das<br />
Fundmaterial zusammen. Eine beinahe rechteckige Verfärbung<br />
von 2 auf 2,6 m enthielt, ebenso wie eine etwa 1,2 m 2<br />
große Grube und der Kalkschotter des Geländes, außerdem<br />
noch Holzkohleneinschlüsse. Einige der Scherben scheinen<br />
von der sich anschließenden kleinen Terrasse angeschwemmt<br />
worden zu sein. Metallsachgut tauchte bei den Untersuchungen<br />
nicht auf.<br />
Die keramischen Bruchstücke wurden dem Beginn der mittleren<br />
Bronzezeit zugeordnet, dürften also etwa 1500 v. u. Z.<br />
entstanden sein 3 . Nicht nur die günstige Lage der Kälberwiesen,<br />
sie befinden sich in der Nähe des Neubrunnens und<br />
sind durch Berge geschützt, sondern auch das zahlreiche<br />
Fundmaterial veranlaßte die Archäologen, davon auszuge-<br />
12
hen, daß hier, trotz nicht ganz eindeutiger Befunde, eine Siedlung<br />
bestanden haben muß.<br />
Diese Siedler sind der Alb-Gruppe der süddeutschen Hügelgräberkultur<br />
zuzurechnen. In der Bronzezeit lebten die Menschen<br />
in der Regel von Ackerbau und Viehzucht, wobei in<br />
unserer Region die Weidewirtschaft aller Voraussicht nach<br />
im Vordergrund gestanden hat, denn die Alb war in jener<br />
Epoche schwächer bewaldet und bot mit grasreichen Hochflächen,<br />
Hängen und Auen Nahrung den Herden und<br />
Uberblick ihren Hirten. Die Siedlungen entsprachen sicher<br />
der Wirtschaftsweise und waren selten auf Dauer angelegt.<br />
Erwies sich die Gegend nach einigen Jahren als abgeweidet,<br />
dann zog die Dorfgemeinschaft weiter und ließ sich an einem<br />
unberührten Flecken Erde nieder.<br />
Erst in der Hügelgräberzeit wurde die Schwäbische Alb in<br />
die Bronzekultur einbezogen. Da die Siedlung auf der Hausemer<br />
Gemarkung an den Beginn dieser Epoche datiert ist<br />
und keine Kupfer- bzw. Bronzefunde freigab, könnte sogar<br />
angenommen werden, daß sie vielleicht noch nicht von dieser<br />
Bewegung integriert worden war.<br />
Anmerkungen<br />
1 H. Reim, Vor- und Frühgeschichte, in: K. Theiss/H. Schleuning<br />
(Hg.), Der Zollernalbkreis, Stuttgart/Aalen 1979, S. 65.<br />
2 P. Streicher, Eine Siedlung der mittleren Bronzezeit bei Hausen<br />
i. K., Gemeinde Burladingen, Zollernalbkreis, in: Archäologische<br />
Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1984, Stuttgart 1985,<br />
S. 49f.<br />
3 Zeittafel der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg<br />
und Hohenzollern, Stuttgart 1994.<br />
JOSEF SCHULER<br />
Junginger Dorfgeschichten<br />
Kindereia<br />
Ema Flecka uff dr Alb doba, it weit vo Burladinga hot a junger<br />
Maa a Mädle gheired, dia vo ma Andera a Kind ghett hot.<br />
D'Leit hand en z-daud-gfopped. Ma kennt jo dia alta, kuttriga<br />
Schbrüch. Aber dear glückleg Hauzeiter isch im siebeta<br />
Himmel - und dees isch weit doba, do ka-ma sozuasaga uff<br />
andere ra-gucka. Sei oazege Antwort isch gsei: »I hett se noch<br />
au gheired, und wenn se koi Kind gheet het.«<br />
Reschbekt!<br />
JOHANN ADAM KRAUS f<br />
Aus den Visitationsakten des ehemaligen Kapitels Trochtelfingen 1574-1709<br />
(Fortsetzung)<br />
Oberstetten, dem Gotteshaus Zwiefalten untertänig. Hier ist<br />
Pfarrer der Magister Martin Benkler von Sentenhart, der seine<br />
Schwester bei sich hat. Er beichtet alle 14 Tage in Zwiefalten,<br />
hält auch Katechese. Gegen die Pfleger hat er eine Klage<br />
wegen der Kirchengüter. Deren Rechnungstellung will ich<br />
selber beiwohnen. In der Kirche ist alles Nötige vorhanden.<br />
Der Pfarrer ist ein großer Gelehrter und führt ein priesterliches<br />
Leben.<br />
Feldhausen, den Spethen zugehörig. Der Pfarrer Johannes<br />
Heß von Pfullendorf will weg, und zwar nach Dürrenwaldstetten.<br />
Seine Schwester führt den Haushalt. Er beichtet, so<br />
oft Gelegenheit, führt ein priesterliches Leben und kommt<br />
seinen Pflichten in allem nach.<br />
Kettenacker. Der Pfarrer Udalrich Rättich von Sigmaringen<br />
hat beide Eltern bei sich. In der Kirche war nichts zu beanstanden,<br />
die sie neu erbaut und geweiht ist. Er genügt nach<br />
Kräften seinen Pflichten und führt ein ehrbares Leben.<br />
Neiffren (Neufra) an der Fehlen. Der Pfarrer Johannes Forster<br />
v on Pfullendorf hat seine Schwester bei sich. An Lebenführung,<br />
fleißiger Verwaltung und Zustand der Kirche ist<br />
nichts zu wünschen übrig.<br />
Trochtelfingen in der Grafschaft Fürstenberg hat z. Zt. keinen<br />
Pfarrer. Die vier Kapläne sind nicht investiert, aber zur<br />
Seelsorge zugelassen und leisteten dem Dekan den gewohnten<br />
Eid. Sie verwalten die Pfarrei bis zur Ankunft des neuen<br />
Pfarrers. Alle sind ehrbar geboren und beichten im Kloster<br />
Mariaberg. In der Pfarrkirche fehlt nichts, doch ist die Pyxis<br />
für Aufbewahrung des Allerheiligsten nur aus Holz. Da keine<br />
andere aus Gold oder Silber zu beschaffen ist, ordneten<br />
wir an, sie wollen innen mit einem weißen Tüchlein ausgelegt<br />
werden. Kaplan Jakob Langenstein aus Lautlingen wird<br />
wegen häufigen Hausbesuchen getadelt. Wir trugen ihm auf,<br />
wegzubleiben, da er sich verteidigt, er habe nur Krankenbesuche<br />
gemacht. Der zweite Kaplan Michael Wertz stammt aus<br />
einem Dorf bei Meßkirch (Hörschwag bei Trochtelfingen?).<br />
Von ihm sagt man ähnliches, auch besuche er die Wirtshäuser<br />
zu viel. Bücher zum Studieren haben beide genügend. Der<br />
dritte, Johannes Seufried von Sigmaringen, hat den Vater und<br />
die Schwester bei sich. Uber ihn klagen die Trochtelfinger,<br />
daß er mit seinem Hund auf die Wachteljagd gehe und dabei<br />
schon mehrere Male Feldfrüchte verderbt habe. Ihm wurde<br />
auch neulich beim Gastmahl wegen verweigertem Geldbetrag<br />
ein Faustschlag versetzt von dem Müller Matthias Nollhart<br />
von Trochtelfingen. Dieser ging dann nach Hechingen<br />
zu den Franziskanern, um die Absolution zu erhalten, was<br />
auch erreicht wurde.<br />
Der vierte ist Georg Dietmann von Trochtelfingen, der seine<br />
Eltern noch hat und ein guter Priester ist. Nur liebt er den<br />
Wein etwas zu sehr. Geschehen den 3.-10. Oktober 1612, niedergeschrieben<br />
am 23. Oktober in Gammertingen«.<br />
1614<br />
(Fol. 660). Am 17. Februar dieses Jahres erging ein neuer Bericht<br />
des gleichen Dekans an den Generalvikar, der naturgemäß<br />
nicht viel neues bringt. Daraus sei entnommen:<br />
Pfarrer von Trochtelfingen ist Martin Benckler von Senten-<br />
13
hart, zuvor in Oberstetten. Kaplan Mich. Wertz könne gut<br />
predigen, lasse sich aber vom Besuch des öffentlichen Wirtshauses<br />
nicht abhalten. Der andere, Joh. Seyfried, gehe auf die<br />
Jagd, verkehre viel mit dem Schultheiß. Der dritte Johann<br />
Mock von Pfullendorf führe sich, durch Erfahrungen belehrt,<br />
jetzt gut. Der vierte, Mathias Binger von Trochtelfingen,<br />
wohne als Neupriester noch bei seinen Eltern.<br />
Der Pfarrer von Ringingen heißt hier Jakob Böler, der sich<br />
nicht immer in Gewalt habe. Der von Salmendingen ist Johannes<br />
Wochner, schon sehr alt, mache hie und da seinem<br />
Unmut den Hausleuten gegenüber Luft mit Schimpfen, Verfluchen<br />
und selbst mit der Peitsche. Pfarrer Martin Numachius<br />
zu Melchingen stammt aus Beuren bei Heiligenberg, ist<br />
fromm und bewährt. Oberstetten hat als Seelsorger Andreas<br />
Wurwetzel, von unehel. Geburt, sonst gelehrt, der gut predigt<br />
und eifrig ist. Die Fehler des Pfr. Küferle von Stetten u.<br />
Holst, sind bekannt. Er scheint zum Händelstiften geboren.<br />
Er sei neuerlich von einem genannt der Geiger und seinen<br />
Söhnen mit Wort und Schlägen angegriffen worden. Hat auch<br />
eine Magd aus andersgläubigem Ort (Erpfingen), die mit<br />
Häretikern in die Kirche geht, und die ich dringend zu entlassen<br />
empfahl. In Hettingen ist Laurentius Wild von Mengen<br />
Pfarrer, der teils im Predigen lässig sei. Außerdem sind<br />
dort in der Stadt zwei Priester Alexander Herp von Riedlingen<br />
und Johannes Glattis von Kettenacker. Beide haben guten<br />
Ruf. Pfarrer in Feldhausen (mit Harthausen) ist Magister<br />
Johannes Dreher, der in allem sorgfältig ist. Nur hält er gelegentlich<br />
keine Kinderleiche, weiß nicht ob aus Nachlässigkeit<br />
oder Scheu. Wirds in Zukunft bleiben lassen. In Kettenacker<br />
hatte Pfr. Udalrich Rättich von Sigmaringen im vorigen<br />
Jahre unter seinen Pfarrkindern schwere Mißhelligkeiten<br />
und Feindschaften, die jetzt beigelegt sind. Zur Zeit leidet der<br />
gute Mann an großen Schulden, die er sich auflud, als in den<br />
letzten Jahren bei der Seuche sein gesamtes Vieh einging. Teils<br />
hat auch die ungünstige Witterung seinen Fruchtertrag zunichte<br />
gemacht. Und endlich ist seine Pfründe so mager und<br />
nimmt noch täglich ab, daß sie kaum hinreicht, den Geistlichen<br />
auch nur frugal zu ernähren.<br />
1615<br />
(Fol. 665) Der Dekan Johann Rieger von Gammertingen berichtet<br />
u. a. an Generalvikar Johannes Hausmann nach Konstanz:<br />
Der neueingesetzte Pfarrer von Oberstetten Mag. Jakob Loser<br />
mußte widerrechtlich 45 Gulden zum Wiederaufbau des<br />
vor 3 Jahren abgebrannten Pfarrhauses zahlen und zwar auf<br />
Befehl des Heiligenberger »Erzschreibers«, dessen Graf die<br />
Baupflicht hat.<br />
In Großengstingen werden vom Edlen von Neuhausen dem<br />
neuen Pfarrer- Michael Wertz einige Fruchteinkünfte abverlangt<br />
zum Bezahlen von Schulden eines früheren Pfarrers.<br />
Dann beklagt sich unser Kammerer und Pfarrer von Burladingen<br />
über die (ehem.) Pfarrei Gauselfingen, daß die Ortsbehörde<br />
ungerechter, sakrilegischer und geiziger Weise schon<br />
früher einige Zehnten in weltliche Hände gebracht habe. Der<br />
Herr von Jungingen, Mich. Agrikola, habe Feindschaft mit<br />
seinen Pfarrkindern, auch gebrauche er Feuerrohre und suche<br />
solche nach Art der Weltkinder zu erwerben. Lasset sich<br />
beim öffentlichen Schießen finden.«<br />
Die Kinderlehre (catechistica institutio) war einige Monate<br />
hindurch wegen einfallenden Kirchweihen und anderen weltlichen<br />
Veranstaltungen behindert und wurde meist nicht gehalten.<br />
Jetzt aber wird eifrig darauf gedrängt. Kaplan Alexander<br />
Herp in Hettingen ist bisher weder vom Herrn von<br />
Speth präsentiert, noch investiert, trotz der Mahnung des<br />
bischöfl. Fiskals.<br />
Endlich sind je 2 Personen zu Salmendingen und Kettenacker<br />
noch nicht vom Ehebruch dispensiert. Sie können nicht nach<br />
Konstanz kommen wegen zu großer Armut. Wir bitten, einen<br />
Priester hier herum zur Absolution zu bevollmächtigen.<br />
Endlich bitten wir, den Überbringer dieses Schreibens, Stephan<br />
Gnupfer, zu dispensieren. Er hat seine zänkische und<br />
weinsüchtige Frau versehentlich mit der Schere gestochen.<br />
Die Frau kommt nächstens nieder und seine Kinder sind<br />
arm.«<br />
1650. Dezember<br />
(Ha. 76, fol. 676-697) Beim Fehlen eines Dekans berichtet in<br />
besonderem Auftrag Johann Emmanuel Schmidt, der seit<br />
3 Monaten Pfarrer in Trochtelfingen ist über den Stand des<br />
Landkapitels:<br />
»Die Dekanstelle ist seit Pfingsten vakant durch den Tod<br />
(29. 5.) des Mag. Martin Benkler. Daher wurde auch dieses<br />
Jahr keine Kapitelskonferenz gehalten. Kammerer ist der<br />
Ringinger Pfarrer Jakob Böler, der an Leib und Geist wegen<br />
hohen Alters gebrechlich ist und selbst zugibt, die Geschäfte<br />
des Kapitels nicht weiterführen zu können. Deputate (heute<br />
Definitoren) sind die Pfarrer zu Gammertingen und Engstingen.<br />
Einkünfte hat das Kapitel an jährlichen Zinsen ungefähr<br />
41 Pfund Heller, die jedoch seit einigen Jahren noch<br />
ausstehen. Es zählt z. Zt. 15 Pfarreien, deren Inhaber ich einzeln<br />
befragte und folgendes erfuhr:<br />
1. Stadt Trochtelfingen. Hier bestehen außer der Pfarrkirche<br />
noch fünf Kapellen und außerdem gehören drei Filialkirchen<br />
hierher. An der Pfarrkirche existieren 4 Kaplaneien mit Seelsorge.<br />
Patron aller ist der Graf zu Heiligenberg. Seit Oktober<br />
ist Inhaber der Pfründe Johann Emmanuel Schmidt, Bürger<br />
der Stadt und Doktor der Theologie.<br />
An jährlichen Einkünften aus Trochtelfingen und den Dörfern<br />
Steinhilben, Wilsingen, Herschwag und Meidelstetten<br />
sind, soweit ich sehe folgende zu nennen:<br />
An Geld: Aus Grundzinsen und 5 Lehengütern der Pfründe,<br />
genannt Widemgüter, ehemals 20 Pfund Heller, jetzt aber wegen<br />
Armut der Leute kaum 3-4 Pfund. An Opfergeld etwa<br />
30 Pfund, an tägl. Präsenzgeldern für Anwesenheit im Chor<br />
einst 26 Pfund, jetzt nichts. Für Jahrtage einst etwa 10 Pfund,<br />
jetzt nur 6 Pfund. -<br />
An Getreide, teils Dinkel, teils Haber: Ein Fixum vom Herzog<br />
von Württemberg als Zehntherrn zu Steinhilben 11<br />
Scheffelsäcke, vom Patron (von Heiligenberg) 18 Sack und<br />
von 2 Pfarrlehen 14 Sack, von denen jedoch mangels einer Lehensbeschreibung<br />
8 Sack fehlen. Vom Großzehnten (Vi zu<br />
Wilsingen und Hörschwag und vor der GlaubensspaltungVb<br />
zu Meidelstetten) hatte die Pfründe einst etwa 129 Scheffel<br />
Frucht aller Art, jetzt aber nicht über 88 Scheffelsäcke. -<br />
An Novalzehnten (ganz in Steinhilben und Hörschwag, in<br />
Wilsingen Vi. in Meidelstetten vor der Spaltung Vi) ehedem<br />
etwa 60 Sack, jetzt etwa 15. Der Novalzehnt zu Trochtelfingen<br />
steht dem Pfarrer ganz zu, nicht nur kraft der Synodalbeschlüsse,<br />
sondern auch laut eines besonderen Vertrags zwischen<br />
dem Bischof und dem Patron vom J. 1600. Er wird aber<br />
bis heute nicht vollständig geliefert, weil wie sie sagen, die<br />
Vertragsakten nicht zu Stelle seien. Unterdessen gibt man der<br />
Pfründe 15 Säcke Getreide. Ein Drittel des Novalzehnten von<br />
Wilsingen erhält der Hochw. Abt von Zwiefalten aus mir unbekanntem<br />
Rechtstitel, denn es sind Schriften aus dem J. 1481<br />
da, nach denen er ganz der Pfarrei Trochtelfingen zusteht. -<br />
An Kleinzehnten von Erbsen, Hanf, Raps und Gemüse hat<br />
die Pfarrei in Trochtelfingen 'A, wo seit alters her kein Heuzehnt<br />
gegeben wird, außer von der einen oder anderen Wiese.<br />
In Steinhilben hat sie Vi aller Zehnten, also auch von Heu,<br />
Hülsenfrüchten, Hanf, Raps, Obst und Kraut. In Wilsingen<br />
nur Vi vom Hanf und Flachs. Andere Kleinzehnten kennen<br />
14
sie dort nicht, angeblich laut eines Privilegs von Konstanz,<br />
dessen Erlangung mir aber unbekannt ist. In Hörschwag hat<br />
sie nur Vi vom Hanf- und Rapszehnten. Von all diesen Kleinzehnten<br />
wird vom Pfarrer nur der Familienbedarf gesammelt,<br />
alles übrige verkauft, was einst 60, jetzt aber nur 22 Pfund<br />
Heller einbringt.<br />
(Fortsetzung<br />
folgt)<br />
Berichtigung<br />
In Nr. 4/1994 auf S. 51 vom Beitrag »Ende der Meßkircher Fürstenherrlichkeit«<br />
wurde der letzte Satz vergessen. Er lautet »Die<br />
ehemalige Residenzstadt Meßkirch sank nach 1744 in einen<br />
über hundert Jahre währenden Dornröschenschlaf, ehe die Entstehung<br />
eines liberalen Bürgertums dem Städtchen um die Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts neues Leben einzublasen begann.<br />
Buchbesprechungen<br />
Walter Fauler, Geschichte der<br />
Fauler-Familien<br />
Die heute weit verbreitete Familie Fauler dürfte wohl die älteste<br />
namentlich bekannt bürgerliche Familie in Hohenzollern<br />
sein. Als Müller waren die Fuler, wie sie sich früher<br />
schrieben, schon vor Jahrhunderten in Veringendorf und<br />
Hettingen ansäßig. 1469 wird in Veringendorf ein Kaplan Jodokus<br />
Fuler erwähnt, 1478 stiftete Adelheid Fulerin die Fauler-Frühmesse<br />
in Hettingen. Die Hettinger Fuler waren<br />
wohlhabende Müller. Schon 1521 und 1528 studierten ihre<br />
Söhne in Freiburg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gab es<br />
jedoch in Hettingen keine Fauler mehr. Das Wappen der Familie,<br />
ein gevierter Schild mit je einem halben Mühlrad und<br />
einer Forelle läßt sich erstmals im 17. Jahrhundert nachweisen.<br />
Stammvater der heutigen Familien ist der Müller Johannes<br />
Fauler, der 1616 in Veringendorf geboren wurde. Sein zweiter<br />
Sohn, Michael, wurde Wirt in Kettenacker, von ihm stammen<br />
die Kettenacker, Burladinger, Ittenhauser und die Gammertinger<br />
Fauler ab. Im Lauf der Zeit gab es an 22 Orten Fauler<br />
Familien, sogar in Amerika. Soweit bekannt, gingen aus<br />
den Familien 13 Geistliche und sechs Klosterfrauen hervor.<br />
Aber auch in weltlichen Berufen standen die Fauler ihren<br />
Mann, als Verwaltungsbeamte, Freiberufler, Kaufleute und<br />
Handwerker.<br />
Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg kam der Wunsch auf,<br />
der Geschichte der weit verzweigten Familie nachzugehen.<br />
Zu nennen sind Anton Fauler, Bürgermeister von Freiburg<br />
i.B. und Eugen Fauler in Sigmaringen. Auch Dr. Gustav<br />
Hebeisen, der aus Veringendorf stammte, befaßte sich mit der<br />
Faulergeschichte. 1977 wurde eine Stammtafel gedruckt, die<br />
Frau Maria Doldinger, geb. Fauler aufgestellt hatte. Dr. Walter<br />
Fauler aus Bad Krozingen übernahm die Herausgabe eines<br />
Buches, das seine und frühere Forschungsergebnisse und<br />
vor allem auch zahlreiche Abbildungen bringt. Etwa 200 Exemplare<br />
wurden an die Faulerfamilien zum Preis von 50.- DM<br />
abgegeben. Weitere Exemplare sind beim Verfasser, Herrn<br />
Dr. Walter Fauler, Hofackerstraße 8; 79189 Bad Krozingen<br />
erhältlich.<br />
Zwischen Wallfahrt, Armut und Liberalismus, Die Ortsgeschichte<br />
von Engelswies in dörflichen Selbstzeugnissen.<br />
Heimatkundliche Schriftenreihe des Landkreises Sigmaringen<br />
Band 3.<br />
Anläßlich der ersten Erwähnung des Ortes in einer Urkunde<br />
des Klosters St. Gallen am 27. März 793 beging die Gemeinde<br />
Engelswies 1993 eine 1200-Jahr-Feier. Im Lauf des<br />
Jahres wurden zwei Vorträge gehalten, die im Rahmen dieses<br />
Bandes in überarbeiteter Form veröffentlicht werden.<br />
»Von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert« berichtet Dr.<br />
Wolf Gerhard Frenkel und Dr. Edwin Ernst Weber führt die<br />
Ortsgeschichte weiter »Vom Wallfahrtsdorf zum Industriestandort.«<br />
Das Buch, an dem auch Rektor Willy Deifel mitgearbeitet<br />
hat, ist mit über 70, teilweise farbigen Abbildungen<br />
versehen, welche den Text anschaulich machen.<br />
Schon 1717 schrieb der Pfarrvikar Johann Georg Brendle eine<br />
Wallfahrtschronik, die im vorliegenden Band von Edwin<br />
Ernst Weber ediert wird. Bei den Vorbereitungen für die<br />
1200-Jahr-Feier wurden außerdem eine Ortschronik aus dem<br />
vorigen Jahrhundert von Bürgermeister Erasmus Bücheler<br />
und 1963/64 niedergeschriebene »Lebenserinnerungen« des<br />
Bürgers Alfons Gitschier gefunden. Dazu kamen Erinnerungen<br />
an Kindheit und Jugend in Engelswies des 1993 verstorbenen<br />
Lehrers und Heimatforschers Anton Teufel. 1112<br />
wird in Engelswies, heute Teilort der Gemeinde Inzigkofen,<br />
eine kleine Kirche erwähnt mit einem Gnadenbild der<br />
Schmerzhaften Mutter Gottes. In den kriegerischen Zeiten<br />
um 1230 ging der Ort jedoch zugrunde. Eine Neugründung<br />
im 14. Jahrhundert scheiterte. Erst durch Graf Gottfied Werner<br />
von Zimmern, der ab 1516 die Wallfahrtskirche neu erbaute,<br />
kam es zur Wiedergründung von Engelswies. In der<br />
Wallfahrtskirche wurden zwei Wallfahrtsbilder verehrt, eine<br />
Schmerzhafte Mutter Gottes und die hl. Verena von der eine<br />
Hauptreliquie vorhanden ist. In der Brendleschen Wallfahrtschronik<br />
wird über zahlreiche Gebets-Erhörungen und<br />
Wunderheilungen vom 16. bis 18. Jahrhundert berichtet. Der<br />
Neubau einer prächtigen barocken Wallfahrtskirche erfolgte<br />
seit 1721. Durch die Aufklärung zu Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
kam die Wallfahrt weitgehend zum Erliegen.<br />
Verschiedene Faktoren wie Bevölkerungszunahme bei<br />
gleichbleibender landwirtschaftlicher Nutzfläche, Verschuldung<br />
durch Kriegskontributationen und die Ablösung von<br />
Feudallasten führten zu einer Verarmung der Gemeinde und<br />
der Bevölkerung, die sich vorwiegend in der ersten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts auswirkte. Es dauerte immerhin bis zum Ende<br />
des Jahrhunderts bis die Gemeinde durch die allgemeine<br />
Verbesserung der Verhältnisse und kluges Wirtschaften den<br />
gewaltigen Schuldenberg abtragen konnte. Eine speziell badische<br />
Angelegenheit war das Anwachsen eines militanten<br />
und antiklerikalen Liberalismus in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg übertrafen<br />
die Stimmen für das katholische Zentrum die der<br />
Liberalen.<br />
Nach Drittem Reich, Krieg und Besatzung brachte die Mitte<br />
des 20. ¡Jahrhunderts die Umwandlung vom Bauerndorf<br />
zum Industriestandort.<br />
Ein Einblick in die Verhältnisse des Dorfes zu verschiedenen<br />
Zeiten wird durch die »Ortskronick« von Erasmus Bücheler,<br />
die Lebenserinnerungen von Alfons Gitschier und die Erinnerungen<br />
von Anton Teufel in interessanter Weise vermittelt.<br />
Ein Zitat aus der Chronik von Erasmus Bücheler: »Nach<br />
meines seligen Vaters Aussage war ihnen (den Engelswiesern)<br />
die Losreißung vom Kaiser und Reich ein Donnerschlag, und<br />
an Württemberg wollten sie gar nicht kommen. Lieber noch<br />
wurden sie badisch. Aber solange mein Vater lebte, schlug<br />
sein Herz östreichisch, war sein Verlangen, wieder dasselbe<br />
zu werden, und so mag es kommen, daß sein Alltagslied in<br />
den Ohren des Sohnes Wiederhall gefunden hat.«<br />
15
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 72488 Sigmaringen<br />
M 3828<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Heimatgeschichtlicher Wanderweg Straßberg<br />
mit Kaiseringen<br />
Herausgegeben vom Arbeitskreis Jan von Werth in Straßberg<br />
Die Broschüre mit zwei Kartenskizzen bringt eine Einleitung<br />
mit der Geschichte von Straßberg und von Kaiseringen. Insgesamt<br />
werden 18 Baudenkmäler bzw. Kunstwerke beschrieben,<br />
deren Bedeutung kurz und prägnant erläutert<br />
wird. Teilweise sind sie als hübsche Federzeichnungen abgebildet.<br />
Gedacht wird auch der abgegangenen Gebäude. Um<br />
den handlichen und preiswerten Führer, in dem eine Menge<br />
von orts- und kunstgeschichtlichem Wissen vermittelt wird,<br />
kann man Straßberg nur beneiden.<br />
Peter Thaddäus Lang, Tagolf der Siedler<br />
Ein spannender und witzig geschriebener historischer Roman<br />
um eine Alemannensippe, die nach vielen Abenteuern<br />
auf der Schwäbischen Alb seßhaft wird.<br />
Auf der Suche nach einem fruchtbaren Land im Westen<br />
kommt eine Alemannengruppe ins heutige Württemberg. Im<br />
Remstal schlagen sich die Tagolfinge, wie sie nach ihrem Anführer<br />
heißen, mit einem Trupp Römer. Dann ziehen sie<br />
neckaraufwärts bis zum Schwarzwald. In Sumelocenna, dem<br />
heutigen Rottenburg lernt Tagolf den Hebräer Simon kennen,<br />
der ihm rät, lieber die Richtung Bodensee einzuschlagen.<br />
In der Nähe von Hechingen besetzen sie das römische<br />
Landgut Stein und Tagolf nimmt sich die (glücklicherweise)<br />
verwitwete Hausherrin Aurelia, die zudem Christin ist, zur<br />
Frau. Nach einem Umweg durch das Donautal, Lauchertund<br />
Fehlatal, kommen sie zu dem Dorf der Eboniter (Ebingen).<br />
Nach einem Zweikampf Tagolfs mit deren Häuptling<br />
Ebo, lassen sie sich schließlich in der Nähe nieder, wo heute<br />
noch die Stadt Tailfingen an die Tagolfinger erinnert.<br />
Mit seiner Gattin Aurelia kommt Tagolf auch zu einem römischen<br />
Knecht, Sedulius der ein gewandter Schreiber ist.<br />
Ohne ihn gäbe es dieses Buch nicht, denn er hat die Geschichte<br />
seines neuen Herrn unter dem Titel »Memorabilia Tagolfi<br />
Cultoris« aufgeschrieben. Leider ging der Kodex, der wohl<br />
aus einem oberitalienischen Kloster stammte, in den Wirren<br />
des Zweiten Weltkrieges verloren. Auch ein Exzerpt, das später<br />
unerwartet aufgetaucht war, ist spurlos verschwunden, so<br />
daß der ursprüngliche Text mühsam aus dem Gedächtnis rekonstruiert<br />
werden mußte.<br />
Peter Thaddäus Lang, Tagolf der Siedler, 280 Seiten mit vier<br />
Abbildungen, DM 29,80, Silberburg-Verlag, Tübingen und<br />
Stuttgart.<br />
Heinz Rainer Reinhardt, Mein immergrüner Christian<br />
Eine heitere Erzählung aus Schwaben<br />
Im Mittelpunkt dieser reizvollen Erzählung steht Christian<br />
August Balthasar Sonntag, der sich lieber Christian Immergrün<br />
nennet. Nach dem Schulabgang, man schreibt die zwanziger<br />
Jahre, lernt er in Tübingen Liane kennen, die wenig später<br />
als Diebin gefaßt wird. Während sie in Schwäbisch Gmünd<br />
ihre Strafe verbüßt, kümmert sich Christian um sie. Doch Liane<br />
erwidert seine schüchterne Zuneigung nicht, sondern bereitet<br />
ihm eine herbe Enttäuschung. Zu dieser Zeit studiert<br />
Christian schon in Stuttgart Architektur und Bildhauerei. Seine<br />
erste Stelle findet er als Assistent bei Professor Schönfeld.<br />
Doch als er mit einer Bauaufgabe betraut wird, kommt ihm<br />
Veronika Fechter, die Tochter des Bauherrn ins Gehege.<br />
Prompt tappt Christian in die Falle, die sie ihm stellt. Aber<br />
er läßt sich nicht unterkriegen und das Schicksal ist ihm hold:<br />
Das Unglück wandelt sich in Glück.<br />
Heinz Rainer Reinhardt, Mein immergrüner Christian,<br />
DM 24,80, Silberburg-Verlag Tübingen und Stuttgart.<br />
Scho gschwätzt. Heitere und zornige schwäbische Gedichte,<br />
gesprochen von den Autoren.<br />
Diese CD erschien ebenfalls im Silberburg-Verlag. Mancher<br />
hört gern Schwäbisch, aber es ist ihm ein Graus, schwäbische<br />
Texte zu lesen. Fritz Schray, Manfred Mai, Thaddäus Troll,<br />
Peter Schlack und Helmut Pfisterer lesen insgesamt siebzig<br />
ihrer Gedichte und Geschichten. Über eine Stunde ungetrübtes<br />
Mundartvergnügen.<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
ISSN 0018-3253<br />
Erscheint vierteljährlich.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der Geschichte<br />
ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: DM 11,00 jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Dr. Otto H. Becker<br />
Hedinger Straße 17,<br />
72488 Sigmaringen<br />
Dr. Casimir Bumiller<br />
Hexental 32, 79283 Bollschweil<br />
Emil Grupp<br />
Panoramastraße 70,<br />
72393 Burladingen<br />
Hans Peter Müller<br />
Weiherplatz 7, 72186 Empfingen<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13a,<br />
92318 Neumarkt<br />
Josef<br />
Schuler<br />
Killertalstraße 55, 72417 Jungingen<br />
Rolf Vogt<br />
Marktplatz 6, 72379 Hechingen<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
Verlagsanstalt<br />
72488 Sigmaringen, Karlstraße 10<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
Eichertstraße 6, 72501 Gammertingen<br />
Telefon 07574/4407<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge verantwortlich.<br />
Mitteilungen der Schriftleitung sind<br />
als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare werden<br />
an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.<br />
16
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMÄT<br />
M 3828<br />
Herausgegeben vom<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
45. Jahrgang Nr. 2/Juni <strong>1995</strong><br />
Die Donautalstraße bei Gutenstein. Holzstich aus den Blättern des Schwäbischen Albvereins 1896, S. 233<br />
WILHELM ROSSLER<br />
Der Bau der Donautalstraße 1847 bis 1860<br />
Die Situation vor 1850<br />
Die Erschließung des Tales erfolgte erst in der zweiten Hälfte<br />
des letzten Jahrhunderts. Darüber machen sich sicher viele<br />
Autofahrer heute keine Gedanken mehr. Die Weiler im<br />
Donautal waren vor 1850 nicht direkt untereinander verbunden;<br />
ebensowenig das Kloster Beuron mit den Ortsadeligen<br />
von Hausen, Thiergarten, Gutenstein oder Dietfurt. Die<br />
Felsen setzen vor allem auf der Nordseite der Donau ihren<br />
Fuß an vielen Stellen in den Fluß, so daß für einen Weg kein<br />
Platz blieb. Alle Wege führten über den Berg, meist auf der<br />
Südseite der Donau.<br />
Wer von Laiz nach Dietfurt wollte, mußte über Inzigkofen,<br />
mit dem Fuhrwerk besser gleich über Vilsingen, weil der Weg<br />
über den Buzach immer in schlechtem Zustand war. Von<br />
Dietfurt aus mußte man über das »Dietfurter Staigle« des<br />
Benzenberges nach Gutenstein. Nach Thiergarten konnte
T<br />
man nur über den sogenannten Sauhaldenweg. Er führte vom<br />
Schloß aus aufwärts auf die Straße Langenhart-Thiergarten.<br />
Die Albbauern fuhren ihr Getreide über die »Mühlsteigen«<br />
nach Gutenstein, Neidingen, Thiergarten, Langenbrunn und<br />
Beuron, vom 17. bis zum 19. Jahrhundert auch die Bohnerze,<br />
den Torf und die Holzkohle nach Thiergarten ins Eisenwerk.<br />
Von Thiergarten führte eine Straße etwa auf der heutigen<br />
Trasse nach Hausen, Langenbrunn bis zum Schmiedebrunnen.<br />
Beuron konnte von Hausen aus nicht erreicht werden.<br />
Zugänge gab es nur von Buchheim, von Leibertingen über<br />
den ehemaligen Steighof, von Irndorf und von Bärenthal über<br />
die Kohlplatte.<br />
trug. Vorgesehen war eine Straße, die von Thiergarten links<br />
der Donau unterhalb des Bröllers entlangführte, dann den<br />
Donauwiesen entlang etwa parallel zur Donau bis zur oberen<br />
Brücke von Gutenstein; hier sollte die Straße durch<br />
Gutenstein verlaufen, über die untere Brücke donauabwärts<br />
wieder links der Donau, unter dem Teufelslochfelsen vorbei<br />
in Richtung Dietfurt. Bei der Schmeiemündung war eine<br />
Brücke vorgesehen, sodann sollte die Straße immer dem Felshang<br />
entlang bis Laiz führen. Für die damalige Zeit war dies<br />
ein mutiges Unternehmen. Sicher hat man die Schwierigkeiten<br />
unterschätzt, die sich aus »den von Natur geschaffenen<br />
Hindernissen des Donauthales und der drei verschiedenen<br />
Ländern angehörigen Besitzverhältnisse« ergaben, sonst hätte<br />
man nicht eine Bauzeit von etwas über zwei Jahren geplant.<br />
Wege zum Donautal vor dem Bau der Talstraße (Topogr. Atlas des Königreichs Württemberg 1850)<br />
Der Ausbau der Straße Langenhart-Beuron um den Umlaufberg<br />
Käpfle an Maurus vorbei und entlang der Donau<br />
durch ein Tunnel erfolgte erst in den Jahren 1835 bis 1837.<br />
Fürst Karl von Hohenzollern ließ durch den Oberforstmeister<br />
Carl den Weg anlegen. Letzterer hatte beim Straßenbau<br />
den reichhaltigen Pflanzenwuchs und die würzigen Kräuter<br />
an den Hängen des Donautales erkannt und hat über den Fürsten<br />
dem Besitzer des Klosterwirtshauses »Zudrelli« vorgeschlagen,<br />
in Beuron eine Molkekuranstalt zu errichten. »Im<br />
Frühjahr 1837 weideten Ziegenherde munter meckernd an<br />
den steinigen Felsabhängen«, sie lieferten die würzige Ziegenmilch.<br />
Schon im ersten Jahr zählte man in Beuron 54 Kurgäste.<br />
So hat der Straßenbau Beuron zu einem Kurort gemacht.<br />
Die Planungen des Fürstenhauses<br />
Hohenzollern<br />
Die Idee zum Bau einer Donautalstraße links der Donau ging<br />
von der Fürstlich Hohenzollerischen Domänenverwaltung<br />
aus. Das Haus Hohenzollern hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
durch die Einbeziehung des Klosterbesitzes Beuron<br />
erheblichen landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen<br />
Grundbesitz erworben. Der Zugang zu diesen Besitztümern<br />
sollte erleichtert werden. Zwischen Beuron und<br />
Thiergarten war die Talstraße mit 18 Fuß Breite bereits ausgebaut<br />
worden, es fehlte das Verbindungsstück von Thiergarten<br />
nach Laiz. Es war vor allem Oberforstmeister Carl,<br />
der auf diesen Ausbau drängte. Er konnte Geheimrat von<br />
Weckherlin von der Notwendigkeit des Ausbaues überzeugen,<br />
der am 5. Juli 1847 das Vorhaben dem Fürstenhaus vor-<br />
Die Straße sollte eine Kronenbreite von 18 Fuß erhalten, es<br />
lag eine Kostenberechnung von 55000 Gulden vor. Schon bei<br />
der Geländeausmessung mußte man erkennen, daß wegen der<br />
außerordentlich schwierigen Lage Kostenerhöhungen notwendig<br />
würden.<br />
Der Vertrag mit der Gemeinde<br />
Gutenstein<br />
Auch die Gutensteiner drängten auf den Ausbau der Donautalstraße,<br />
war doch ein 1845 geplanter Straßenbau von<br />
Gutenstein über Dietfurt nach Vilsingen wegen zu hoher Kosten<br />
gescheitert. In einem Vertrag mit der Gemeinde Gutenstein,<br />
unterzeichnet von Bezirksamtmann Heuberger für die<br />
Gemeinde und Oberforstmeister Carl für das Haus Hohenzollern,<br />
wurde am 20. August 1847 folgendes festgestellt:<br />
1. Die Notwendigkeit des Straßenbaues wird von der Gemeinde<br />
Gutenstein anerkannt.<br />
2. Das Haus Hohenzollern übernimmt die Kosten der Herstellung<br />
der Straße einschließlich des Grunderwerbs.<br />
3. Die Gemeinde Gutenstein gibt unentgeltlich gemeindeeigene<br />
Grundstücke für den Straßenbau ab.<br />
4. Die Gemeinde übernimmt die künftige Unterhaltung der<br />
Straße.<br />
5. Die Rechte an den beiden Brücken verbleiben bei der Gemeinde<br />
beziehungsweise dem Haus Langenstein. Sie sollen<br />
im bisherigen Zustand verbleiben.<br />
Hierzu muß vermerkt werden, daß die Brücken vermutlich<br />
in keinem besonders guten Zustand waren und die Gutensteiner<br />
Brückenzoll verlangten. Für beladene Wagen wurden<br />
18
ittet [ungen auö bcm<br />
@efcf)icf)tgDeretn<br />
Dr. Casimir Bumiller, Bollschweil:<br />
Die Hohenzollerische Landessammlung. Eine viel<br />
gerühmte, aber wenig beachtete museale Einrichtung.<br />
Montag, 9. Oktober, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Landeshauses<br />
(Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
I. Die Mitgliederversammlung am 9. Mai<br />
in Sigmaringen<br />
Im Mittelpunkt der Aussprache auf der Jahresversammlung,<br />
die in diesem Jahr turnusgemäß in Sigmaringen stattfand,<br />
standen die Finanzen des <strong>Geschichtsverein</strong>s, die vor<br />
allem infolge der drastischen Gebührenerhöhungen der<br />
Deutschen Post AG und der gestiegenen Druckkosten angespannt<br />
sind. Bereits im Herbst 1993 hatte der Vorsitzende,<br />
um Portokosten zu sparen, vorgeschlagen, auf die<br />
Versendung von Einladungsschreiben und Ankündigungen<br />
an die einzelnen Mitglieder zu verzichten und statt<br />
dessen solche Mitteilungen in der vierteljährlich erscheinenden<br />
Hohenzollerischen Heimat, dem zweiten Publikationsorgan<br />
des <strong>Geschichtsverein</strong>s, zu veröffentlichen.<br />
Dieser Vorschlag ist im Vorstand und im Beirat auf eine<br />
positive Resonanz gestoßen. Am 30. November 1994 beschlossen<br />
diese beiden Vereinsorgane, Einladungen und<br />
Mitteilungen für die Vereinsmitglieder in Zukunft nur<br />
noch in der Hohenzollerischen Heimat sowie in der Hechinger<br />
und Sigmaringer Lokalpresse zu publizieren. Da<br />
jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder auch<br />
Bezieher der Hohenzollerischen Heimat sind, sollte nach<br />
der Auffassung der beiden Organe fortan der Bezug dieser<br />
Zeitschrift für alle Mitglieder obligatorisch sein.<br />
Der Vorstand und der Beirat faßten überdies einstimmig<br />
den Beschluß, auf der Mitgliederversammlung den Antrag<br />
zu stellen, den jährlichen Mitgliedsbeitrag einschließlich<br />
Bezugsgeld für die Hohenzollerische Heimat,<br />
die zur Zeit 30 DM - seit 1984 übrigens - plus 11 DM<br />
pro Jahr betragen, auf insgesamt 50 DM zu erhöhen. Die<br />
Mitgliederversammlung hat nach sehr lebhafter Aussprache<br />
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag inklusive Bezug<br />
der Hohenzollerischen Heimat auf 45 DM zu erhöhen.<br />
II. Veranstaltungen in den kommenden<br />
Monaten<br />
1. Hohenzollern-Vorträge im Rahmen der Heimattage<br />
Baden-Württemberg <strong>1995</strong> in Sigmaringen:<br />
Prof. Dr. Fritz Kallenberg, Darmstadt:<br />
Die Sonderentwicklung Hohenzollerns im 19. und<br />
20. Jahrhundert.<br />
Montag, 25. September, um 20 Uhr im Sitzungssaal des<br />
Landeshauses (Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
Dr. Otto Becker, Sigmaringen:<br />
Die Kreisreform 1973 und Hohenzollern.<br />
Montag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Landeshauses<br />
(Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
Diese Vortragsveranstaltungen werden vom Arbeitskreis<br />
Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e. V. im<br />
Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg <strong>1995</strong> in Sigmaringen<br />
unterstützt. Der Vorsitzende wird sich aber<br />
darum bemühen, daß die Vorträge im November/Dezember<br />
in Hechingen wiederholt werden.<br />
2. Besuch des Vorstandes des Freiberger Altertumsvereins<br />
e. V.:<br />
Mitglieder des Vorstandes und des Beirates statteten vom<br />
21. bis 23. Oktober 1994 dem Freiberger Altertumsverein<br />
e. V. in Sachsen (s. hierzu den Bericht in der HH 44,<br />
1994, S. 62) einen Besuch ab. Inzwischen hat der Vorstand<br />
des Altertumsvereins auf unsere Einladung hin beschlossen,<br />
dem Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong> vom 1. bis<br />
3. Oktober <strong>1995</strong> in Hechingen und Sigmaringen einen Gegenbesuch<br />
zu machen. - Das Programm für den Besuch<br />
wird zur Zeit noch erörtert.<br />
3. Tagung der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg<br />
und des Staatsarchivs Sigmaringen:<br />
Geschichtswerkstätten, Historische Vereine und Archive<br />
- Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit.<br />
Samstag, 9. September, um 10.15 bis 13 Uhr im Sitzungssaal<br />
des Landeshauses (Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
An die Veranstaltung schließen sich um 14.30 Uhr<br />
Führungen durch das Staatsarchiv Sigmaringen und die<br />
Ausstellung »Preußen in Hohenzollern« an.<br />
Die Mitglieder des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />
sind zu der Tagung und den anschließenden Führungen<br />
herzlich eingeladen.<br />
gez. Dr. Otto Becker<br />
Vorsitzender<br />
26. Mai <strong>1995</strong><br />
vier, für leichte Wagen zwei Heller verlangt. Die Domänenverwaltung<br />
beantragt eine Verbilligung des Brückengeldes<br />
mit Rücksicht auf die Weganlage.<br />
Das badische Ministerium des Inneren in Karlsruhe machte<br />
nach Prüfung des Vertrags die Gemeinde Gutenstein mit<br />
Schreiben vom 10. März 1848 aufmerksam, daß sie die<br />
»Brücken durch neue ersetzen müsse, wenn die vorhandenen<br />
nicht mehr benutzt werden könnten«. Da die Unterhaltung<br />
der Straße der Gemeinde Gutenstein obliegt, könnte Sigmaringen<br />
den Neubau der Brücken verlangen. Vielleicht war<br />
dies ein Grund, weshalb sich die Königlich preußische Regierung<br />
1852 entschloß, die Straße nicht durch den Ort<br />
Gutenstein zu führen.<br />
Wegen des Vertrags erheben die Städte Meßkirch und<br />
Stockach Einspruch. Nachdem jedoch bei einer Befragung<br />
der Gutensteiner nur vier Bürger gegen den Ausbau stimmten,<br />
hat Meßkirch seinen Einspruch zurückgezogen (8. Oktober<br />
1847).<br />
Der Vertrag mit dem Fürstenhaus Fürstenberg<br />
Neben der Gemeinde Gutenstein mußte mit der Fürstlich<br />
Fürstenbergischen Domänenverwaltung ein Vertrag geschlossen<br />
werden. Dieser Vertrag wird mit Beschluß vom 16.<br />
Oktober 1847 von der Fürstlich Hohenzollerischen Domänenverwaltung<br />
Sigmaringen ausgefertigt und am 2. Dezem-<br />
19
er 1847 von der Fürstlich Fürstenbergischen Domänenkanzlei<br />
gegengezeichnet. Er sieht vor:<br />
1. Das Haus Hohenzollern übernimmt die Anlage und Ausführung<br />
eines Verbindungsweges vom Hüttenwirtshaus<br />
Thiergarten bis zum Ort Laiz auf seine Rechnung. Der Weg<br />
wird nach Plan in einer Kronenbreite von 18 Fuß durchgehend<br />
linksseitig - mit Ausnahme von Gutenstein - verlaufen.<br />
2. Die Vollendung der Straße ist bis 1. Mai 1850 vorgesehen.<br />
3. Die Kosten für das Haus Fürstenberg werden auf 12000<br />
Gulden veranschlagt. Enthalten sind hierbei die Kosten für<br />
die Vorarbeiten, den Straßenbau, den Grunderwerb, das<br />
Schutzgeländer und die Baumpflanzung.<br />
4. Die Straße soll »in einer die höchsten Wasserstände übersteigenden<br />
Höhe und ohne Einengung des Donaubettes zu<br />
Thiergarten« in guter »Soliditätund Sicherheit« ausgeführt<br />
werden.<br />
In vielen weiteren Schreiben wurde von der Fürstenbergischen<br />
Domänenkanzlei eine Auslegung der Solidität verlangt;<br />
man zweifelte die Wahrhaftigkeit des Vertrages an.<br />
Daraufhin erwiderte am 3. Februar 1848 Geheimrat von<br />
Weckherlin, daß die Straße entsprechend der »neuen Straße<br />
nach Beuron« ausgeführt wird. Dieser Straße fehlten jedoch<br />
Steinsatz und Straßengräben. Weckherlin sicherte später lediglich<br />
zu, »daß die Straße mit schwereren Fuhrwerken als<br />
die Beuroner Straße befahren werden kann«.<br />
Der Schriftverkehr mit dem Haus Fürstenberg wegen der Donautalstraße<br />
endet im März 1848.<br />
Auf eine Anfrage des Hauses Fürstenberg teilt die Domänenverwaltung<br />
Sigmaringen mit Schreiben vom 20. April<br />
1849 mit, daß wegen der »Schwierigkeiten und Umstände,<br />
welche durch die Zeitverhältnisse gegeben waren, der Bau der<br />
Donauthalstraße eingestellt werden mußte«. Auf eine andere<br />
Anfrage teilt Oberforstmeister Carl mit, daß er seit Frühjahr<br />
1848 nicht mehr die Verantwortung für den Straßenbau<br />
habe.<br />
Das Fürstenhaus Hohenzollern hat wegen der politischen Ereignisse<br />
der Jahre 1848/49 die Weiterführung der Maßnahme<br />
aufgegeben. Fürst Karl dankt am 27. August 1848 ab, sein<br />
Sohn Karl Anton tritt das Fürstentum Hohenzollern am 7.<br />
Dezember 1848 an die Königlich preußische Regierung ab.<br />
Dennoch begannen die Straßenbauarbeiten im Herbst 1847.<br />
Oberforstmeister Carl war der Straßenbau übertragen worden.<br />
Er beantragte am 11. September 1847 beim Fürsten:<br />
-dem Rentmeister Huber Vollmachten zur Bereitstellung<br />
des Geldes zu geben;<br />
- den Bau der Schmeiebrücke zu genehmigen;<br />
- Verhandlungen mit dem Haus Fürstenberg über den Ausbau<br />
Gutenstein-Thiergarten aufzunehmen;<br />
- mit dem Bau von Laiz bis zur unteren Brücke Gutenstein<br />
baldmöglichst zu beginnen.<br />
In der Tat wurde bereits im Frühjahr 1848 mit Planierungsarbeiten<br />
bei Laiz begonnen. Ab März 1848 (Märzrevolution)<br />
wird der Bau eingestellt und für vier Jahre unterbrochen.<br />
Baumaßnahme durch die Königlich preußische Landesregierung<br />
1852 bis 1858<br />
Die Königlich preußische Landesregierung, vertreten durch<br />
Oberinspektor Flaminius nahm 1850 neue Verhandlungen<br />
mit der Gemeinde Gutenstein und der Fürstenbergischen<br />
Domänenkanzlei aufgrund der abgeschlossenen Verträge auf.<br />
Über die Weiterführung der Straße von Beuron über Fridingen<br />
nach Tuttlingen wird mit der Württembergischen Hofkammer<br />
verhandelt. Die Donautalstraße soll als Staatsstraße<br />
über Ländergrenzen hinweg ausgebaut werden.<br />
Am 19. Oktober 1852 wird Geometer Schwenk von Haigerloch<br />
beauftragt, die Planungsarbeiten der Donautalstraße<br />
zwischen Laiz und Thiergarten zu übernehmen. In dem Vertrag<br />
war die Aufnahme des bereits ausgeführten Teils, die<br />
Herstellung der Längs- und Querprofile, beinhaltet. Am 25.<br />
Februar 1853 legt Schwenk die Planung vor, die jetzt eine<br />
linksseitige Führung auch bei Gutenstein »in einer die höchsten<br />
Wasserstände übersteigenden Höhe« vorsieht. Die Breite<br />
der Straße wird auf 24 Fuß erweitert. Man kann annehmen,<br />
daß wegen der »baufälligen Brücken« in Gutenstein die<br />
schwierige Straßenführung links der Donau gewählt wurde.<br />
Schwenk berichtet, daß die Vermessungsarbeiten zeitraubend,<br />
ja lebensgefährlich seien, weil man nur vom Kahn aus<br />
mit Leitern die entsprechenden Teilstücke erreichen könne.<br />
Er bittet deshalb um Zeitaufschub.<br />
Der Grundstückserwerb im Raum Gutenstein ergab ebenfalls<br />
Schwierigkeiten, mit 51 Grundstücksbesitzern mußte<br />
verhandelt werden. Wegen der unterschiedlichen Bonitäten<br />
lagen die Grundstückspreise weit auseinander. Wegen der<br />
Zerschneidung der Grundstücke wurden Nachforderungen<br />
gestellt. Die Akten zeigen eine Fülle von Verhandlungen und<br />
Prozessen.<br />
Am 3. April 1853 erhält Baumeister Laur den Auftrag, die<br />
Straße zu bauen. Seine monatlichen Berichte an die Königlich<br />
preußische Verwaltung geben einen chronologischen<br />
Überblick über den Fortgang der Baumaßnahmen. »Der Bau<br />
wird gleichzeitig am oberen und unteren Ende in Angriff genommen«,<br />
das heißt vom Hüttenwirtshaus Thiergarten und<br />
vom Ortsrand von Laiz. Am 19. April 1853 erfolgt die Genehmigung<br />
zum Bau durch die königlichen Majestäten.<br />
Die Gesamtstrecke wird in Sektionen und Lose aufgeteilt. Begonnen<br />
wird im März 1853 auf der Strecke Laiz-Schmeiemündung<br />
(1590 Ruthen lang). Die Straße wird 24 Fuß breit<br />
gebaut mit einer Steinbahn von 18 Fuß. Die Straßenbauarbeiten<br />
umfassen:<br />
- Abtragen des Gerölls, Sprengen<br />
- Planieren<br />
- Steinbahn setzen, Zwischenräume auffüllen<br />
- Abwälzen, Feinschüttung und<br />
- Durchlässe, Dohlen für Entwässerungen<br />
- Böschungen und Setzmauern errichten<br />
- Randsteine setzen, eventuell mit Geländer versehen<br />
- Schutzbäume pflanzen<br />
Die Gemeinden drängen auf den raschen Beginn der Arbeiten.<br />
Im Raum des unteren Donautales hat es 1852 einen starken<br />
Hagelschlag gegeben. Die betroffenen Landwirte suchen<br />
für den Ausfall einen Nebenverdienst. Auf die Ausschreibungen<br />
im März melden sich sodann:<br />
- von Laiz 8 Maurer, 25 Handlanger<br />
- von Jungnau 2 Maurer, 8 Steinhauer, 19 Handlanger<br />
- von Vilsingen 3 Maurer, 1 Steinhauer, 56 Handlanger<br />
und 43 weibliche<br />
- von Inzigkofen 12 Handlanger<br />
- von Frohnstetten 12 Maurer<br />
- von Straßberg 30 Maurer<br />
In den Jahren 1853 bis 1857 arbeiten auf der Gesamtstrecke<br />
90 bis 120 Arbeiter, während der Erntezeit und im Winter<br />
weniger. Dennoch wurde während der Wintermonate vor allem<br />
in den Tunnels ohne Unterbrechung weitergearbeitet.<br />
Für die Arbeiten mußten zunächst die notwendigen Gerätschaften<br />
besorgt werden: zweirädrige Karren zum Transport<br />
des Materials, Kähne und Leitern, um vom Fluß aus an die<br />
Baustelle heranzukommen.<br />
Bis die Arbeiten richtig anlaufen, wird es Sommer 1853. Ein<br />
Fond von 5000 Gulden (2. Juli 1853) für den 1. Bauabschnitt<br />
wird geschaffen; die Gesamtkosten müssen erhöht werden.<br />
20
Vor 106 Jahren war der Verkehr<br />
auf der Donautalstraße noch recht<br />
gemütlich. Neben der Straße die<br />
neue Bahnstrecke, noch ohne<br />
Schienen. Das Foto wurde 1889<br />
von Baurat E. Eulenstein aufgenommen.<br />
Die Planierarbeiten, der Steinsatz, das Setzen der Begrenzungssteine<br />
und der Bäume von Laiz bis zur Schmeiemündung<br />
nimmt noch die erste Jahreshälfte 1854 in Anspruch.<br />
Die Straße erhielt eine 15 bis 18 Zentimeter starke Packlage.<br />
Die für den Steinsatz notwendigen Kalksteine waren vorhanden.<br />
Die groben Steine wurden sodann mit kleineren verkeilt.<br />
Dann wurde zunächst einmal abgewalzt. Uber den<br />
Steinsatz wurde eine 6 bis 15 Zentimeter starke Lage aus Feinmaterial<br />
aufgebracht. Dieses Feinmaterial wurde durch Zerschlagen<br />
der Grobsteine gewonnen. Das Abwälzen war sehr<br />
wichtig, der Belag mußte dicht werden, damit kein Wasser in<br />
die Hohlräume eindringen konnte und die Straße vor Auffrieren<br />
geschützt wurde. Gewalzt wurde mit einer bis zu 70<br />
Zentner schweren Walze, einer Eisenwalze, die mit Wasser<br />
gefüllt wurde. Es handelte sich um Gespannwalzen, die von<br />
4 Pferden gezogen wurden. Nach jedem Walzengang mußte<br />
umgespannt werden. Die notwendige Dichte war erst nach 5<br />
bis 8 Walzengängen erreicht.<br />
Ab Juli 1 854 beginnt der Ausbau der Strecke bis Dietfurt. Allerdings<br />
scheint hier eine Stockung eingetreten zu sein, denn<br />
erst im März 1855 beginnt man mit dem Abbruch der alten<br />
Schmeiebrücke, im Juni sind die Fundamente gesetzt, im Oktober<br />
wird das Gewölbe fertig und im November wird die<br />
Decke aufgetragen, das Steingemäuer und das gußeiserne<br />
Geländer gesetzt. Die Quadersteine zum Bau der Brücke<br />
stammen aus Frohnstetten.<br />
Die Sprengarbeiten an den Galerien unterhalb des Bröller laufen<br />
schon seit 1854/55. Im Mai 1855 erhalten die Steinhauer<br />
Amman und der Maurer Bix, beide aus Thiergarten, den Auftrag<br />
zum Bau des großen Durchlasses bei Thiergarten. In<br />
Thiergarten bestand bereits ein Steinbruch, hier wurden<br />
Grabsteine gebrochen. Ebenfalls im Jahr 1855 wird die Aussprengung<br />
des Tunnels bei der Schmeiemündung, der drei<br />
Tunnel unterhalb des Teufelslochfelsens in Angriff genommen.<br />
Die Tunnelsprengung wird beidseitig vorangetrieben.<br />
Je 6 bis 8 Mann arbeiten an einer Seite. Es war eine mühsame<br />
Arbeit. Mit Kronenbohrer oder Kreuzmeißel wurden die<br />
Bohrlöcher auf eine Tiefe von 30 bis 50 Zentimeter geschlagen,<br />
dazu verwendete man einen 4,5 Kilogramm schweren<br />
Bohrfäustel. Nach jedem Schlag wurde der Bohrer gedreht.<br />
Die Bohrer mußten immer wieder neu geschärft werden.<br />
Nach Beseitigen des Bohrstaubes wurde die Patrone mit der<br />
Sprengladung eingeschoben, die Zündschnur befestigt, die<br />
Bohröffnung verschlossen und abgefeuert. In der Regel wurden<br />
mehrere Bohrlöcher auf einmal gezündet.<br />
Das Gestein ist teilweise so hart, daß die Arbeiter im Monat<br />
nur 6 bis 7 Fuß (1,8 bis 2,1 Meter) vorankommen. Gearbeitet<br />
wird in zwei Lagen, zunächst wird die obere Lage abgesprengt,<br />
das Steinmaterial abtransportiert auf zweirädrigen<br />
Karren, sodann erfolgt die Absprengung der unteren Lage.<br />
Das Tunnel bei der Schmeiemündung wird im Herbst 1855,<br />
die Tunnel unterhalb des Teufelslochfelsens im Oktober 1856<br />
und das Tunnel gegenüber dem Thiergarter Hof im Dezember<br />
1856 fertig. Die »Chaussierungsarbeiten« (Planieren und<br />
Steinsatz) wurden jeweils bis zum Tunnel soweit vorangetrieben,<br />
daß diese Straßenstücke mit Fuhrwerken befahrbar<br />
waren.<br />
Im Oktober 1856 beginnt der Ausbau der Straße gegenüber<br />
dem Ort Gutenstein, wohl das schwierigste Stück der Baumaßnahme.<br />
Zwei Tunnel müssen ausgebrochen werden, der<br />
größere mit 256 Fuß; zwischen den Tunnels sind im Bereich<br />
der Galerien ebenfalls große Felsbereiche zu sprengen. Hierzu<br />
werden zur Sicherheit der Arbeiter Stege um die Felsen<br />
errichtet. Uber die Sprengungen berichtet Baumeister Laur:<br />
»Gutensteiner Bürger werden von den Sprengungen unterrichtet,<br />
um Menschen und Thiere vor Schaden zu schützen.<br />
Jeweils vor der Sprengung wird eine Fahne ausgehängt. Ebenso<br />
wird einigemal geläutet, so daß jeder, der die Fahne nicht<br />
sah, durch Glockengeläut rechtzeitig erinnert wird - meist<br />
zur Mittagszeit, wo sich die Bürger in Häusern befinden.«<br />
Klagen und Ersatzansprüche von Grundstücksanliegern gibt<br />
es über Beschädigung von Obstbäumen und Gebäuden. Der<br />
Müller beanstandet, daß oberhalb vom Wehr das Flußbett etwas<br />
eingeengt wurde - obwohl im Vertrag ausdrücklich untersagt;<br />
er befürchtet einen »verstärkten Wasserangriff auf<br />
seine gegenüberliegenden Wiesen« und fordert Schadenersatz.<br />
Im Januar 1857 wird mit der Sprengung der Galerien und der<br />
Errichtung der Böschungsmauern begonnen; im Juni ist das<br />
kleine Tunnel in der Wölbung (oberer Satz) fertig; im Oktober<br />
der große Tunnel im oberen Satz. Von der Sohle sind nur<br />
noch 110 Fuß zu sprengen; am 13. Januar 1858 konnte Laur<br />
melden, daß der große Tunnel in seiner ganzen Länge ausgesprengt<br />
ist.<br />
Im Laufe des Jahres 1857/58 werden die Planierungsarbeiten<br />
21
fortgesetzt. Im Bereich Gutenstein wurde eine »Steinbahn«<br />
auf Schienen zeitweise eingesetzt. Sie diente auch zum Transport<br />
von »Wassertonnen mit Brausen«. Mit diesen hat man<br />
die Straße vor dem Abwälzen abgespritzt, weil der Herbst<br />
1857 sehr trocken gewesen sein muß.<br />
Im Jahr 1858 geht der Straßenbau der Donautalstraße mit dem<br />
Setzen von Begrenzungssteinen und der Bäume zu Ende.<br />
Große Sorgfalt wurde auf das Setzen der Begrenzungssteine<br />
verwendet, sie wurden aus dem Schwarzwald herbeigeschafft,<br />
mit Schutzstangen versehen. An der alten Straße stehen diese<br />
Randsteine heute noch. Zum damaligen Straßenbau war<br />
das Pflanzen von Bäumen gerade Pflicht. Sie sollten einerseits<br />
den Zugtieren Schatten spenden, andererseits boten sie<br />
Schutz vor dem Abstürzen von Fahrzeugen.<br />
Im November 1858 wird die Donautalstraße wohl dem Verkehr<br />
übergeben, von einer offiziellen Verkehrsübergabe wurde<br />
keine Aufzeichnung gefunden. Die Höhe der Baukosten<br />
zwischen 1854 und 1858 wird mit 103000 Gulden angegeben,<br />
also fast die doppelte Summe des Voranschlages.<br />
In dem Wanderführer von Schlude aus dem Jahr 1859 wird<br />
die Straße wie folgt beschrieben: »Gleich hinter Thiergarten<br />
wandern wir die neue Donauthalstraße von Laiz her, die eben<br />
und glatt wie ein Tanzboden uns durch eine Reihe kleiner<br />
Tunnels führt. Rechts hart an der Straße wälzt sich die Donau<br />
in stürmischer Hast über die Steine und Felstrümmer<br />
(vermutlich noch vom Bau her), links ragen die nakten Scheitel<br />
der Felsklippen drohend über unseren Häuptern herein.«<br />
Die Donautalstraße von Sigmaringen nach Beuron wurde zu<br />
einem wichtigen Bindeglied der Orte im Tal. Die Beförderung<br />
von Erzen, Kohle und Eisenerzeugnissen spielte kaum<br />
mehr eine Rolle, weil das Eisenwerk Thiergarten bereits 1863<br />
den Betrieb einstellte. Der Ausbau von Beuron nach Tuttlingen<br />
über Fridingen wurde vorangetrieben. Besucher des<br />
Unterlandes kamen in Eilwagen von Stuttgart über Tübingen,<br />
Rottweil nach Tuttlingen; täglich befuhren zwei Postwagen<br />
diese Linie. Sigmaringen wurde täglich von einem Eilwagen<br />
von Balingen her angefahren. 1871 drängte das Kloster<br />
Beuron auf einen Postanschluß nach Beuron.<br />
Die Bahnlinie Sigmaringen-Tuttlingen bringt neue Akzente<br />
ins Donautal<br />
Die Situation ändert sich mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes<br />
Ende des letzten Jahrhunderts. Sigmaringen konnte ab<br />
1872 von Ulm her, ab 1878 von Tübingen her erreicht werden.<br />
Der Bau der Donautalstrecke erfolgte in den Jahren<br />
1889/1890. »Sie wurde als strategische Bahn und Teilstück einer<br />
wichtigen Verbindung von Ulm zum Oberelsaß erstellt.«<br />
Viele italienische Arbeiter wurden hierfür angeworben, aber<br />
einheimische Landwirte fanden mit Fuhrarbeiten einen guten<br />
Nebenverdienst. Im Gegensatz zur Straße konnte sich die<br />
Bahn nicht den topographischen Verhältnissen, vor allem den<br />
vielen Mäandern der Donau anpassen. So mußten viele<br />
Brücken und Tunnels gebaut werden. Die Straßenführung<br />
änderte sich kaum, allerdings mußten mehrere Unter- und<br />
Uberführungen gebaut werden.<br />
Die Bahn sollte nicht nur die Einwohner des Tales aufnehmen,<br />
die Bewohner der Albdörfer sollten in die Beförderung<br />
einbezogen werden. Hierzu waren jedoch Verbindungswege<br />
zu den Bahnhöfen notwendig. So wurden die Bergstraßen<br />
von Hausen nach Schwenningen und Kreenheinstetten sowie<br />
die Straße Thiergarten-Stetten ausgebaut.<br />
Die Bahn brachte von nun an viele Besucher in das Donautal.<br />
Es waren einerseits Wallfahrer, die nach Beuron kamen, andererseits<br />
Wanderer. Die 1863 errichtete Benediktinerabtei<br />
Beuron ließ die Wallfahrt zum Gnadenbild der Schmerzhaften<br />
Maria neu aufleben. Die Pilger reisten zunächst zu Fuß<br />
oder mit dem Wagen über die neu errichtete Donautalstraße<br />
an; bis zu 10 000 Pilger pro Jahr wurden in den ersten Jahren<br />
gezählt. Später brachten Pilgerzüge mit bis zu 1000 Fahrgästen<br />
wesentlich mehr Pilger nach Beuron. Mit dem Ersten<br />
Weltkrieg flaute die Wallfahrt allerdings ab.<br />
Ende des letzten Jahrhunderts setzte eine starke Wanderbewegung<br />
ein. Die Wanderer nutzten die Eisenbahn für ihre<br />
Ausflüge. Der Fahrplan der Züge ließ es zu - es gab damals<br />
noch Frühzüge -, daß Wanderer vom Unter- und Oberland<br />
das Donautal mit dem Zug leicht erreichen konnten. Der<br />
Schwäbische Albverein schilderte um die Jahrhundertwende<br />
Wanderwege aus und errichtete Aussichtspunkte an beherrschenden<br />
Felsköpfen. Viele begeisterte Wanderberichte über<br />
die Schönheit des Oberen Donautales stammen aus der Zeit<br />
vor dem Ersten Weltkrieg.<br />
Der Autoverkehr fordert den Ausbau der<br />
Donautalstraße<br />
Bis in die zwanziger Jahre hinein wurde die Donautalstraße<br />
nur von Fußgängern und Gespannfuhrwerken benutzt. Der<br />
Autoverkehr kam erst in den dreißiger Jahren, vor allem auch<br />
durch den Verkehr des Truppenübungsplatzes Stetten am<br />
kalten Markt. Die Donautalstraße wurde in dieser Zeit mit<br />
einem Teerbelag versehen.<br />
Der letzte große Ausbau der Straße erfolgte genau 100 Jahre<br />
nach der Anlage. Im Juni 1959 wurde die Strecke Gutenstein<br />
vom letzten Tunnel in Richtung Thiergarten ausgebaut. Die<br />
Tunnel bei Gutenstein.<br />
Foto Kreisarchiv Sigmaringen<br />
22
neue Straße wurde nun nördlich der Bahnlinie verlegt, zwei<br />
schienengleiche Bahnübergänge konnten damit aufgehoben<br />
werden. Auf der alten Straße verläuft heute der Radweg.<br />
Am 23. Januar 1961 begann der Ausbau der Strecke vom<br />
Schmiedebrunnen (westlich von Langenbrunn) nach Beuron.<br />
Die Linienführung um das Käpfle herum an St. Maurus vorbei<br />
wurde aufgegeben, die neue Straße wurde in einem großen<br />
Einschnitt zwischen Käpfle und Vögelesruh angelegt. Die<br />
Strecke wurde dadurch um einen Kilometer verkürzt und begradigt.<br />
Im weiteren Verlauf wurde die Straße auf 7,5 Meter<br />
verbreitert und das Tunnel mit einer Halbröhre eingeschalt.<br />
Diese Maßnahme wurde 1962 abgeschlossen.<br />
Die Strecke Bahnhof Inzigkofen-Dietfurt wurde in den Jahren<br />
1962 bis 1967 gebaut. Der Bau der Schmeietalbrücke<br />
nahm sehr viel Zeit in Anspruch, des weiteren wurde die<br />
Straße westlich der Schmeiemündung oberhalb der Bahnlinie<br />
verlegt. Dies erforderte nicht nur einen starken Eingriff<br />
in die Felspartien des Schmeierberges, es mußte auch eine hohe<br />
Stützmauer zur Bahn hin gebaut werden. Hierbei wurden<br />
drei Unterführungen und zwei schienengleiche Bahnübergänge<br />
überflüssig. Sehr gut erhalten ist heute noch die alte<br />
Straße zwischen Dietfurt und der Schmeiemündung.<br />
1965/66 folgte der Ausbau zwischen Laiz und Inzigkofer<br />
Bahnhof. Die Straße wurde entlang der Bahnlinie geführt, sie<br />
wurde dadurch übersichtlicher und kürzer. Leider wurde die<br />
Strecke unterhalb des Gespaltenen Felsens verbreitert und ein<br />
Tunnel gesprengt und beseitigt. Mit der Umgehung Laiz in<br />
den Jahren 1970/71 wurde der Ausbau der Donautalstraße<br />
abgeschlossen.<br />
In den siebziger und achtziger Jahren war die Straßenbauverwaltung<br />
bemüht, weitere Ausbaumaßnahmen zwischen<br />
Thiergarten und Neumühle vorzunehmen. Ebenso war eine<br />
Verbreiterung der Tunnel vorgesehen. Aus Gründen des Natur-<br />
und Denkmalschutzes unterblieb bis heute der Ausbau,<br />
so daß die Tunnelstrecken als Denkmale des Gebirgs-<br />
Tunnel zwischen Dietfurt und Gutenstein. Foto Kreisarchiv Sigmaringen<br />
straßenbaues des letzten Jahrhunderts erhalten blieben. Es<br />
gibt heute in deutschen Mittelgebirgen kaum eine Strecke,<br />
welche so stark in den Fels eingehauen ist und sich so stark<br />
an die topographischen Verhältnisse anpassen muß. Die<br />
Straße ist einmalig im deutschen Raum und für die Zukunft<br />
erhaltenswert. Sehr interessant sind natürlich die erhaltenen<br />
Strecken der alten Straße, die teilweise als Radweg benutzt<br />
wird.<br />
ROLF VOGT<br />
Hechingen und der 30. Juni 1934<br />
(Fortsetzung)<br />
Überlegungen zu den Auswirkungen der SA-Entmachtung auf eine südwestdeutsche Kleinstadt<br />
Die »Zweite Revolution« in Hechingen<br />
Da schließlich auch die Waffen zurückgegeben werden mußten,<br />
blieb der 30. Juni 1934 für die SA-Sportschule in Hechingen<br />
letztlich eine Episode. 15 Nicht so für die »Bewegung«.<br />
Wie andernorts hatte sich in der Zollernstadt der Kern<br />
der NS-Kämpfer in den letzten Monaten zunehmend radikalisiert.<br />
Die SA - aber auch die Hitlerjugend und andere Organisationen<br />
- war unzufrieden mit dem Fortgang der nationalsozialistischen<br />
Umgestaltung: Zu viele der alten Honoratioren<br />
saßen noch an den Hebeln der Macht und entschieden<br />
über Wohl und Wehe der Stadt. Landrat und Bürgermeister<br />
waren das beste Beispiel. Paul Schraermeyer hatte Rückendeckung<br />
aus dem Regierungspräsidium, gegen die nicht anzukommen<br />
war, Bürgermeister Paul Bindereif war das Paradebeispiel<br />
der »Konjunkturritter« - so hießen damals die<br />
»Wendehälse« 16 -. die auf den fahrenden Zug aufgesprungen<br />
waren und jetzt in Uniform und strammer Haltung dasselbe<br />
taten wie zuvor.<br />
Das »ungehörige Vordrängen der neuen Parteigenossen«<br />
rügte der Sigmaringer Kreisleiter Karl Maier beim ersten<br />
Kreiskongreß der Hechinger NSDAP im September 1933<br />
ebenso wie der Ulmer Gauinspekteur Maier, der über die<br />
»Tröpfe« herzog, »die glauben, auf dem Rücken der Bewegung<br />
ihre persönlichen Vorteile ergattern zu können und auf<br />
diese Art und Weise die Volksgemeinschaft bewußt zerstören«.<br />
17<br />
Der Aufbau dieser »Volksgemeinschaft« ging nur schleppend<br />
voran. Zwar hatten sich die Hechinger 1933 an den öffentlichen<br />
Kundgebungen in überwältigender Form beteiligt, doch<br />
vielen in der Bewegung schienen das allenfalls Lippenbekenntnisse<br />
zu sein. Der erste Kreiskongreß, den die NSDAP<br />
im September 1933 in Hechingen veranstaltete, zeigte das:<br />
»So selten«, klagten die Hohenzollerischen Blätter, die sich<br />
gern zum Sprachrohr der radikalen Kräfte in der Hechinger<br />
NSDAP machten, seien die Hakenkreuzfahnen an den Häusern<br />
zu sehen gewesen, wobei besonders auffiel, daß »an den<br />
Häusern der Geschäftsleute« kein Fahnenschmuck angebracht<br />
war. 18 Die »teilweise sehr spärliche Beflaggung« kritisierte<br />
die Zeitung auch beim Erntedankfest, das mit immerhin<br />
10000 Kundgebungsteilnehmern aus dem ganzen<br />
Kreis die wohl größte Demonstration in der Geschichte der<br />
Stadt war. 19 23
7<br />
Das Hechinger Bürgertum benötigte einige Zeit, um zu lernen,<br />
was von ihm verlangt wurde, so daß »eine leise Warnung«<br />
ausgesprochen werden mußte, den deutschen Gruß -<br />
der in Behörden und Schulen schon Pflicht war - auch in der<br />
Öffentlichkeit nicht zu verweigern. 20<br />
Die Interessenlage der Hechinger - allen voran Geschäftswelt<br />
und Beamtenschaft - zeigte nicht zuletzt die Entwicklung der<br />
von der NSDAP ins Leben gerufenen sozialen Organisationen.<br />
Das Winterhilfswerk 1933/34, deren öffentlichen Sammlungen<br />
die Spende zwar kaum verweigert werden konnte,<br />
mußte noch von der Stadt organisiert werden, weil die NS-<br />
Volkswohlfahrt in Hechingen noch nicht errichtet war. Auch<br />
als es ein Hechinger Kreisamt der NSV gab, blieb der Zuspruch<br />
dünn. Im August 1934 rangierte die Hechinger NSV<br />
bei den Mitgliederzahlen an letzter Stelle im ganzen Gau<br />
Württemberg-Hohenzollern. Mit seinen 283 Mitgliedern<br />
hatte sie den Kreis der Parteimitglieder und engagierten NS-<br />
Aktivisten nicht überschritten. 21<br />
Obwohl Hitler im Juli 1933 verkündet hatte, die nationalsozialistische<br />
Revolution sei beendet, wurde der Ruf nach einer<br />
»zweiten Revolution« lauter. Auch in Hechingen. »Die Revolution<br />
ist im großen Ganzen beendet, für uns aber keineswegs«,<br />
erklärte im Januar 1934 der Unterbannführer der Hitlerjugend,<br />
Rudolf Oppermann, und betonte, die HJ werde<br />
sich »allem, was sich uns entgegenstemmt, den Kampf ansagen.«<br />
22 Der Hitlerjugend waren vor allem die kirchlichen Vereine<br />
ein Dorn im Auge. Als der katholische Gesellenverein<br />
im April 1934 im Museum einen Theaterabend veranstaltete,<br />
störte die HJ die Aufführung massiv mit einer Flugblattaktion.<br />
23<br />
Daß Hohenzollern ein »Spießbürgernest« geblieben sei, war<br />
sich die Hitlerjugend mit anderen Organisationen der Partei<br />
einig. Hort des Unmuts war neben der SA vor allem die Deutsche<br />
Arbeitsfront (DAF), die seit der Machtergreifung von<br />
Eduard Her aufgebaut und Anfang 1934 von Willy Paul übernommen<br />
worden war. Mit den Möglichkeiten der Arbeitsfront<br />
ließ sich immerhin ein gewisser Ausgleich schaffen für<br />
die Benachteiligung, denen sich die »alten Kämpfer« der Bewegung<br />
weiterhin ausgesetzt fühlten. Aber viel war das nicht.<br />
»Gerade in Hohenzollern ist die nationale Revolution nichts<br />
als eine Gleichschaltung gewesen«, klagte der DAF-Leiter im<br />
April 1934 und forderte die »zweite Welle«, die »vollbringen«<br />
müsse, »was uns nicht gelungen ist«. 24<br />
NS-Hago, die in den Kinderschuhen steckengebliebene Parteiorganisation<br />
des Mittelstands, und die NS-Frauenschaft,<br />
die weiterhin ein kleines Häuflein unverdrossener Volksgenossinnen<br />
war, gehörten ebenfalls zu den Gruppen, denen die<br />
nationalsozialistische Neuordnung nicht weit genug gegangen<br />
war. 25<br />
In der SA prallten die Gegensätze unmittelbar aufeinander.<br />
Die einstige Elitetruppe, die bei Parteiveranstaltungen Leibwächter<br />
und Saalschutz gestellt hatte, war im Laufe des Jahres<br />
1933 zu einer Massenformation geworden, in der auch Zuflucht<br />
suchte, wer durch den Mitgliederstopp der NSDAP<br />
das Parteiabzeichen nicht mehr direkt erwerben konnte.<br />
Trotzdem wurde ihren Mitgliedern immer wieder beteuert,<br />
daß sie die Keimzelle der neuen Gesellschaft seien. Die SA<br />
sei die »revolutionäre Garde« der Bewegung und »Garant des<br />
neuen Staates«, betonte etwa der Reichstagsabgeordnete Vincenz<br />
Stehle aus Bittelbronn bei der Aufnahme der Stahlhelmangehörigen<br />
in die Hechinger SA. 26 Die »alten Kämpfer« hätten<br />
die Aufgabe, über den reinen Nationalsozialismus zu wachen,<br />
forderte Kreisleiter Dr. Theodor Johannsen bei der Feierstunde<br />
zum Führergeburtstag am 20. April 1934. 27<br />
Für die »alten Kämpfer«, ein Titel, der sich auch in Hechingen<br />
zunehmend einbürgerte, dürften die Loblieder vielmals<br />
wie blanker Hohn geklungen haben. Schon im Winter<br />
1933/34 stellte die Staatspolizeistelle in Sigmaringen eine »erhebliche<br />
Beunruhigung« in der SA fest, weil »Angehörige der<br />
früher nicht nationalen Parteien« zu Trupp- und Sturmführern<br />
avanciert waren. Auch die Neuordnung der SA nach der<br />
Eingliederung des Stahlhelm führte zu Mißtönen. 28 Viele der<br />
Angehörigen der SA fühlten sich benachteiligt, weil sie an<br />
dem Aufschwung nach der Machtergreifung nicht teilgenommen<br />
hatten. Die nationalsozialistische Revolution war<br />
an ihnen vorbeigegangen.<br />
Die »Kameraden der alten SA« begannen auch in Hechingen,<br />
sich abzusondern. Ende Juni 1934 luden sie zu einem Kameradschaftsabend<br />
ein, für den sie nicht das damalige Parteilokal<br />
»Mohren«, sondern das Gasthaus »Traube« wählten. 29<br />
Die »Traube« war 1932, vor der Machtergreifung, Treffpunkt<br />
der damals noch kleinen Gruppe Hechinger Nationalsozialisten<br />
gewesen. Das Treffen der »alten Garde« im Juni 1934<br />
blieb aber nicht in Erinnerungen haften. Deutliche Klage geführt<br />
wurde auch über die »mangelhafte Unterbringung vieler<br />
Kameraden, die vordem aus politischen Gründen ohne<br />
Arbeit und Brot waren«. 30<br />
Für die Hechinger Öffentlichkeit bedenklicher als die interne<br />
Verärgerung waren die massiven Propagandafeldzüge, die<br />
die Partei 1934 begann. Im Jahr davor hatten die Massenkundgebungen<br />
vor allem politische Entwicklungen begleitet,<br />
die auf Reichsebene oder in der internationalen Politik auch<br />
die Sympathien der meisten Hechinger gefunden haben dürften.<br />
Im Frühjahr 1934 nahm die »Versammlungswelle« ganz<br />
neue Formen an. Diesmal ging es gegen »Miesmacher und<br />
Kritikaster«. Erfaßt wurden von der Kampagne nahezu alle<br />
Städte und Gemeinden im weiten Umkreis. Die Hechinger<br />
Kundgebung war für den 28. Juni 1934 angesetzt. Sie sollte<br />
eine »gründliche Abrechnung mit jenen erbärmlichen Wichten<br />
mit sich bringen ..., die gerade in letzter Zeit, aus dem<br />
Schwarzen Lager kommend, in die Reihen unserer Gegner<br />
gestoßen sind«, brachten die Hohenzollerischen Blätter im<br />
Vorfeld der Versammlung die Erwartungen zum Ausdruck:<br />
»Wer an diesem Tage durch Nichterscheinen glänzt, zeigt damit<br />
sein schlechtes Gewissen.« 31<br />
Die massive Einschüchterung hatte Erfolg. Die Rede von<br />
Gauinspekteur Richard Blankenhorn aus Ehingen hörten<br />
sich etwa 800 Hechinger im Museum an, eine »Massenkundgebung,<br />
wie sie Hechingen selten sah«. Für viele Zuhörer muß<br />
es ein ungemütlicher Abend gewesen sein. Für manchen<br />
Zuhörer aber mag der Abend erhebliche Genugtuung gebracht<br />
haben, als der Gauinspekteur hemmungslos begann,<br />
gegen die »bestimmte Sorte schwarzer Reaktionäre« zu wettern,<br />
»die sich in die Reihen der Parteigenossenschaft gedrängt<br />
haben und hier eifrig dabei sind, die besten Plätze für<br />
sich zu gewinnen«. 32<br />
Nachspiele<br />
Zwei Tage später gab es eine vollkommen neue Situation. Die<br />
Vorgänge im Reich wurden anhand der Verlautbarungen der<br />
NS-Spitze auch von den beiden Hechinger Zeitungen in<br />
großer Aufmachung verbreitet. Es galt, sich neu zu orientieren.<br />
Schockierend für die Öffentlichkeit war an der Ausschaltung<br />
der SA und ihrer Führung um Ernst Röhm vor allem<br />
die Offenheit, mit der die nationalsozialistische Partei die<br />
homosexuellen Verfehlungen der zuvor als Prototypen des<br />
neuen Menschen dargestellten SA-Spitze ausbreitete.<br />
Die Gerüchteküche brodelte auch in Hechingen. Der Führer<br />
der SA-Standarte, zu der Hohenzollern zusammengefaßt<br />
worden war, der Reichstagsabgeordnete Stehle, sah sich jedenfalls<br />
im Juli 1934 genötigt, darauf hinzuweisen, daß »die<br />
von gedankenlosen Schwätzern ... in Umlauf gesetzten<br />
Gerüchte jeder Grundlage entbehren«. Stehle lancierte in der<br />
national-sozialistischen Zeitung Hechingens eine Meldung,<br />
die deutlich machte, daß er auch nach dem Scherbengericht<br />
vom 30. Juni zur politischen Elite zählte. 33 Handlungen<br />
»mehr oder weniger anrüchiger Natur« wurden dem Kreis-<br />
24
Feier auf dem Marktplatz in Hechingen am 7. Mai 1934 zur Eröffnung der SA-Schule auf dem Lindich<br />
walter der DAF, Willy Paul, nachgesagt, den mancher Hechinger<br />
zeitweise auch für ein Opfer der Verfolgungswelle<br />
hielt, weil er seit Ende Juni einen Lehrgang auf einer Reichsführerschule<br />
in Berlin besuchte. Paul wehrte sich gegen die<br />
Gerüchte, indem er ihren vermeintlichen Urheber zur Rede<br />
stellte. Er handelte sich damit ein Verfahren wegen Körperverletzung<br />
ein, das mit seiner Verurteilung endete. 34<br />
Die nationalsozialistische Welt geriet für kurze Zeit in Unordnung.<br />
Beim Aufmarsch des HJ-Bannes 127 am Sonntag,<br />
1. Juli 1934, in Sigmaringen waren »infolge der neuesten politischen<br />
Ereignisse Hunderte am Kommen verhindert«. 35<br />
Aufführungen des zuvor hochgelobten Parteitagsfilms »Der<br />
Sieg des Glaubens« mußten abgesagt werden 36 : Die Darstellung<br />
der bisherigen SA-Spitze paßte nach dem 30. Juni 1934<br />
nicht mehr in das Bild, das die NSDAP von sich und ihrer<br />
Arbeit verbreiten wollte.<br />
Insgesamt aber kehrte die NSDAP rasch zum Alltag zurück.<br />
Noch am Abend des 1. Juli 1934 - vor der Entwaffnungsaktion<br />
in der Hechinger SA-Schule also - ließ sich der Hechinger<br />
Kreisleiter der NSDAP, Dr. Theodor Johannsen, bei einer<br />
Schulungstagung des Reichsbunds der Deutschen Beamten<br />
in Hechingen zu den erst in Ansätzen erkennbaren Ereignissen<br />
vernehmen. Seine »Ausführungen über die Politik<br />
des Tages fanden den ungeteilten Beifall aller Anwesenden«,<br />
hieß es am nächsten Tag in den Hohenzollerischen Blättern,<br />
auch wenn die Zeitung sich vornehm zurückhielt bei der inhaltlichen<br />
Wiedergabe. 37 Der Aufmarsch der Hitlerjugend in<br />
Sigmaringen am selben Tag mündete in ein Treuebekenntnis<br />
zum Führer: »Kein einziger«, meinte der Sigmaringer Kreisleiter<br />
Karl Maier, sei »hier, der nicht voll hinter dem Führer<br />
steht«, und er wandte sich verächtlich gegen die »Verschwörer,<br />
die auf Schleichwegen an die Macht kommen wollten«.<br />
Daß das »Gerede« über die zweite Revolution angesichts der<br />
Ereignisse des Vortages nun »endgültig zu verstummen habe«,<br />
forderte Regierungspräsident Dr. Carl Simons in seiner<br />
Ansprache. 38 Schon bald war das Thema erledigt: »Politisch<br />
denken und handeln verlangt kaltes, der Person des Einzelnen<br />
ungeachtetes Durchgreifen«, schrieb HJ-Führer Rudolf<br />
Oppermann Mitte Juli in den Hohenzollerischen Blättern:<br />
»Die Arbeit in der HJ ... ist keine Gefühlsduselei«. Oppermann<br />
verwies dabei ausdrücklich auf die Ereignisse nach dem<br />
30. Juni. 39<br />
Die Ausschaltung der SA als ernstzunehmender und unabhängiger<br />
Machtfaktor, der »definitive Stop der Parteirevolution<br />
von unten« 40 wird als wichtigstes Ergebnis der Ereignisse<br />
im Gefolge des 30. Juni 1934 angesehen. Auch für Hechingen<br />
läßt sich erkennen, daß die »Bewegung« an Schwungkraft<br />
verlor. Die SA blieb zwar noch einige Zeit ein Unruheherd,<br />
wie nicht zuletzt die Zwischenfälle bei der Gedenkfeier<br />
am Tage der Beerdigung von Reichspräsident Paul von<br />
Hindenburg und beim Christkönigsfest in Hechingen zeigen<br />
sollten. Bei der Gedenkfeier zu Ehren Hindenburgs am 7.<br />
August 1934 war die Hechinger SA nicht bereit, die verabredete<br />
Umzugsordnung einzuhalten, die ihr zugunsten der<br />
Weltkriegsteilnehmer nur einen hinteren Platz eingeräumt<br />
hatte. Als sich der Zug in Bewegung setzte, marschierte die<br />
SA geschlossen an den übrigen Formationen vorbei und setzte<br />
sich an die Spitze der Kolonne. 41 Beim Christkönigsfest am<br />
28. Oktober 1934 mündete ein Propagandamarsch der Hechinger<br />
SA in eine massive Störung der Lichterprozession,<br />
die die Pfarrgemeinde St. Jakobus von St. Luzen hinauf zur<br />
Stiftskirche führte. 42<br />
Doch die Disziplinierung der Wehrformation auf Reichsebene<br />
verfehlte ihre Wirkung auf Hechingens SA nicht. Sie<br />
fand mit ihren Unterabteilungen ihren Platz im Konzept der<br />
Wehrertüchtigung, das für das nationalsozialistische<br />
Deutschland seit 1935 - der Einführung der Wehrpflicht -<br />
höchste Priorität erlangte. In Reichswettkämpfen durften die<br />
SA-Männer fortan ihre Tüchtigkeit erproben. Soweit sie sich<br />
nicht disziplinieren lassen wollten, wurde ihre Energie zunehmend<br />
auf die »Judenfrage« gelenkt. 43<br />
Eliteeinheit der Partei wurde auch in Hechingen die SS. Sie<br />
hatte zuvor nur vereinzelt Mitglieder in der Stadt. Nach der<br />
Niederwerfung der SA auf Reichsebene, die zur Stärkung der<br />
SS und ihrer Ausgliederung aus der SA führte, erhielt auch<br />
die Zollernstadt einen eigenen Zug. Im August 1934 wandte<br />
sich Walter Wuttke, Personalamtsleiter der DAF und einziger<br />
Ehrendolchträger der SS in Hohenzollern, in einer Anzeige<br />
an die Hechinger. Bei arischer Abstammung, einer Mindestgröße<br />
von 1,70 Metern, einwandfreiem Gesundheitszustand<br />
und einem Alter von 18 bis 23 Jahren konnte unter Vorlage<br />
eines Führungszeugnisses die Mitgliedschaft im neuen<br />
Hechinger SS-Trupp beantragt werden. 44 Der Hechinger Zug<br />
übernahm ein Jahr später das frühere Stahlhelm-Heim - das<br />
Weiße Häusle im Fürstengarten - als »Vereinsheim«. 45 Spätestens<br />
von da an hatte die Hechinger SS der SA den Rang abgelaufen.<br />
Der Bedeutungsverlust wurde auch deutlich in der Rathauspolitik.<br />
Die Suche nach einer dem Nationalsozialismus angemessenen<br />
Form der Gemeindeverwaltung hatte zur Ablö-<br />
25
~r<br />
sung der bisherigen Selbstverwaltung durch ein auf das Führerprinzip<br />
aufgebautes Ratsherrensystem geführt, das in Hechingen<br />
am 28. Juni 1934 mit der Vereidigung der neuen Gemeinderäte<br />
eingeführt wurde. Der SA wurde in diesem System<br />
ein bevorzugter Platz eingeräumt, indem dem dienstältesten<br />
Führer der Wehrformation ein Sitz im Rat garantiert<br />
wurde. Ihn nahm in Hechingen Franz Josef Simmendinger<br />
ein, einer der Veteranen der Hechinger NSDAP. Simmendinger<br />
behielt zwar sein Mandat, als 1935 die Gemeindeverfassung<br />
erneut reformiert wurde. Doch in dem neuen Gemeinderat<br />
gab es keinen Sitz mehr, der speziell für die SA reserviert<br />
gewesen wäre. Deren eigentliche Spitze - Sturm- und<br />
Sturmbannführer - war allerdings schon 1934 nicht mehr<br />
berücksichtigt worden. Franz Xaver Haug, Sturmbannführer,<br />
war zwar Ende 1933 bei den unzähligen Rochaden, die<br />
die Gleichschaltung des Gemeinderats bewirkte, für den zum<br />
Beigeordneten gewählten Amtsgerichtsrat Karl Lutterbeck<br />
in die Gemeindevertretung nachgerückt, aber 1934 nicht wieder<br />
berufen worden.<br />
Der Gemeinderat, der 1935 berufen wurde, war weitgehend<br />
entpolitisiert. Ein Jahr zuvor hatten die eigentlichen NS-Aktivisten<br />
noch fünf der zehn Sitze eingenommen. Es waren Parteigenossen<br />
berufen worden, die sich allesamt schon in der<br />
»Kampfzeit« der Sache der NSDAP verpflichtet gefühlt hatten.<br />
1935 wurde ihre Dominanz zurückgedrängt, das Hechinger<br />
Bürgertum gewann seinen Vorrang zurück. Da die<br />
Hechinger NSDAP - wie es scheint - in der großen Mehrheit<br />
demselben Mittelstand entstammte, der schon in der Weimarer<br />
Republik den Gemeinderat dominiert hatte 46 , läßt sich<br />
die Veränderung zwar nicht an der sozialen Herkunft der<br />
»Ratsherren« festmachen. Doch hatten im Gemeinderat seit<br />
1935 Vertreter dieses Mittelstands die Oberhand, die erst nach<br />
der Machtergreifung zur NSDAP gefunden hatten. Sie hatten<br />
sich vor 1933 politisch kaum betätigt und waren so für<br />
die Partei tragbar. 47<br />
Ausgeschaltet aus dem politischen Leben der Stadt war die<br />
Arbeiterschaft. Die Machtergreifung 1933 hatte ihr ihre traditionelle<br />
politische Heimat - SPD und KPD, aber auch das<br />
Zentrum - genommen. Als Mitte 1934 auch der Ruf nach der<br />
»zweiten Revolution« verstummte, verlor auch der Flügel in<br />
der NSDAP an Gewicht, der in den unteren sozialen Lagen<br />
der Stadt den meisten Rückhalt hatte.<br />
Aus dem Kreuzfeuer der Kritik genommen, konnte die konservative<br />
Führungsschicht der Stadt beruhigter der Zukunft<br />
entgegensehen. Sie arrangierte sich bis auf Einzelfälle, die wegen<br />
ihrer Verbindung zu Parteien der sogenannten »Systemzeit«<br />
diskreditiert waren, mit dem nationalsozialistischen<br />
Staat.<br />
Diese Wendung war schon unmittelbar nach der blutigen<br />
Ausschaltung der SA-Spitze festzustellen. Die Ereignisse des<br />
30. Juni 1934 und die Reichstagssitzung vom 13. Juli 1934, in<br />
der Hitler sein Vorgehen rechtfertigte und über die vorgeblichen<br />
Putschpläne Bericht erstattete, hätten in der Bevölkerung<br />
den »stärksten Eindruck« hinterlassen, schrieb Hechingens<br />
Landrat Paul Schraermeyer in seinen Lagebericht:<br />
»Man hat erkannt, daß ohne das mutige persönliche Zugreifen<br />
des Führers Bürgerkrieg und Chaos unvermeidlich geblieben<br />
wären.« »Das Zutrauen zur Reichsregierung hat sich<br />
durchweg gefestigt«, setzte Regierungspräsident Dr. Simons<br />
hinzu, und die Staatspolizeistelle Sigmaringen meldete dem<br />
Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin, daß nach dem 30. Juni<br />
1934 »eine allgemeine Befreiung eingetreten und die Gesamtheit<br />
von einem ganz außerordentlichen Vertrauen zu<br />
dem Führer erfüllt« sei. 48 Hechingens Bürgertum, jetzt zwar<br />
braun gewandet, hatte seine Stellung behauptet.<br />
Anmerkungen<br />
15 Die Schule wurde Mitte 1935 aufgelöst, seit April 1935 gab es dort<br />
keine Kurse mehr. Die Einführung der Wehrpflicht führte zu einer<br />
Neuordnung des Ausbildungswesens bei der SA. Die Hechinger<br />
Schule gab am 12. 7. 1935 noch einen Abschiedsabend, Hz. Bl.<br />
161/13.7.1934. Anfang August hatten die »letzten Mannschaften«<br />
der SA den Lindich verlassen, Hz. Bl. 179/ 3. 8. 1934.<br />
16 Im Sprachgebrauch gab es auch die »Märzgefallenen« oder die<br />
»Maiveilchen«, vgl. Martin Broszat, a. a. O., S. 252, 254, oder Benigna<br />
Schönhagen, Tübingen unterm Hakenkreuz, Stuttgart, 1991,<br />
S. 181.<br />
" Hz. Bl. 220/ 25. 9. 1933.<br />
18 Hz. Bl. 222/ 27. 9. 1933.<br />
19 Hz. Bl. 235/ 12.10.1933.<br />
20 Hz. Bl. 223/ 28. 9. 1933. Noch 1935 gab es nach Feststellung des<br />
NS-Organs »viele Volksgenossen«, die den deutschen Gruß nicht<br />
erwiderten, Hz. Bl. 113/ 15. 5. 1935.<br />
21 Hz. Bl. 194/ 25. 8. 1934. Die Mitgliederzahl zum 15. 8. 1934 entsprach<br />
0,75 Prozent der gesamten Kreisbevölkerung.<br />
22 Hz. Bl. 25/ 31.1. 1934. Oppermann wurde im Juni 1933 Standortführer<br />
der HJ in Hechingen und im Juli Kreisbeauftragter der nationalsozialistischen<br />
Jugendorganisation. Ende des Jahres wurde<br />
das Kreisgebiet zum Unterbann VII/ 127 zusammengefaßt, dessen<br />
Führer Oppermann auch blieb, als er im Februar 1934 zum Führer<br />
des die Kreise Hechingen, Sigmaringen, Balingen und Rottweil<br />
umfassenden HJ-Bannes 127 ernannt wurde. Im Juli 1934 gab er<br />
den Unterbann ab, im Oktober 1934 auch die Bannführung. Er<br />
wechselte nach Stuttgart, wo er Führer des HJ-Traditions-Bannes<br />
180 wurde. Oppermann war Mitte 1934 in die Kritik geraten, nachdem<br />
die HJ im Kreis Hechingen im Mai 1934 Betriebe und Handwerksmeister<br />
aufgefordert hatte, Lehrlingen einen 14tägigen Urlaub<br />
und Taschengeld zu gewähren, Hz. Bl. 118/ 25.5.1934. Staatspolizei<br />
und Regierungspräsidium beobachteten darauf hin aufmerksam<br />
die Verlautbarungen des Hechinger HJ-Führers, dem<br />
nach dem 30. Juni 1934 - möglicherweise von der Kreisleitung -<br />
untersagt wurde, »Zeitungsartikel zu schreiben, da er mit diesen<br />
besonderen Anstoß erregt hatte«, StaS, Ho 235, 20,1, VIII, A 21,<br />
Lagebericht Staatspolizeistelle 4. 8. 1934, s. a. Lageberichte 2. 6.<br />
1934, 5. 7. 1934, Tagesbericht 5. 7. 1934.<br />
23 Z 99/ 30. 4.1934. Der Gegensatz zwischen HJ und kirchlichen Jugendvereinen<br />
hatte schon 1933 zu heftigen Auseinandersetzungen<br />
im Vorfeld des von der NSDAP reichsweit organisierten »Festes<br />
der Deutschen Jugend« geführt. Damals war den kirchlichen Jugendorganisationen<br />
das Führen von Fahnen im Umzug untersagt<br />
worden, weshalb diese ihre Teilnahme absagten, Hz. Bl. 140/ 21.<br />
6. 1933, 143/ 24. 6. 1933, Z 139/ 20. 6. 1933, 143/ 24. 6. 1933. Der<br />
Disput um das Jugendfest ist im Zusammenhang mit dem Konflikt<br />
zu sehen, der das Zentrum etwa zeitgleich zur Selbstauflösung trieb.<br />
24 Hz. Bl. 84/12. 4. 1934.<br />
25 Die NS-Hago verfolgte einen an die radikalen Thesen des Parteiprogramms<br />
von 1920 angelehnten Kurs, der im Hechinger Einzelhandel<br />
offenbar wenig Sympathien fand. Die Mitgliederwerbung<br />
ging schleppend voran, so daß Hechingens Ortsgruppenleiter Wilhelm<br />
Fecker, Inhaber eines Kolonialwarengeschäfts, noch Anfang<br />
Januar 1934 enttäuscht den Hechinger Geschäftsleuten ins Gewissen<br />
redete: »Ich bin mir darüber ... klar, daß der Kern und das innere<br />
Wesen des Nationalsozialismus auch heute noch von einem<br />
großen Teil nicht recht erfaßt und begriffen sein will... Lassen Sie<br />
sich doch zu diesem idealen Gedanken nicht immer schieben.« Hz.<br />
Bl. 4/ 5. 1. 1934. Der möglicherweise größte politische Erfolg der<br />
Hechinger NS-Hago war die Einführung einer Zweigstellensteuer<br />
durch die Hechinger Gemeindevertretung im August 1933, Hz.<br />
Bl. 188/ 17. 8. 1933, Z 187/ 18. 8.1933. Der 20prozentige Zuschlag<br />
zur Gewerbesteuer, der die alte Forderung zum Inhalt hatte, das<br />
Monopol der großen Warenhäuser zu brechen, war für Hechingens<br />
Stadtkasse unbedeutend. Die eher symbolische Steuer erbrachte<br />
350 RM und traf die Filiale der Bankkommandite Siegmund<br />
Weil, das Kaufhaus Euler und das Kaffeegeschäft Kaiser. Wilhelm<br />
Fecker wurde immerhin im Juni 1934 als Vertreter des Hechinger<br />
Einzelhandels in den Gemeinderat der Stadt berufen, Hz. Bl. 144/<br />
26. 6. 1934, 147/ 30. 6. 1934, Z 136/ 26. 6. 1934, 139/ 30. 6. 1934.<br />
Sein Amt hatte er nur ein Jahr inne. Bei der Neuberufung des Gemeinderats<br />
nach der Reform der Deutschen Gemeindeordnung<br />
1935 wurde er nicht mehr berücksichtigt. Seine Verwicklung in den<br />
Zusammenbruch des Bankhauses Weil in Horb brachte ihm Ende<br />
26
1935 eine Untersuchungshaft und 1936 die Verurteilung zu acht<br />
Monaten Gefängnis und 8000 RM Geldstrafe wegen Vergehens gegen<br />
die Devisen-Amnestieverordnung ein, Hz. Bl. 273/ 22.11.1935,<br />
102/ 2. 5.1936,104/ 5. 5. 1936,105/ 6. 5.1936. Auch die NS-Frauenschaft<br />
um ihre Ortsgruppenführerin E. Köster und Kreisleiterin<br />
Paula Dersch hatte keine nennenswerten Erfolge beim Ausbau der<br />
Organisation. »Das Interesse der Frauen von Hechingen an der<br />
Frauenbewegung von heute und ihrer vielseitigen Arbeit« sei »sehr<br />
gering«, stellte die Frauenschaftsleiterin noch im April 1934 fest,<br />
Hz. Bl. 91/ 20. 4. 1934. Mehr Interesse erfuhr der erst im Herbst<br />
1933 gegründete Bund Königin Luise, ein Ableger des Stahlhelm,<br />
zu dem die NS-Frauenschaft ein zweispältiges Verhältnis entwickelte.<br />
Aber auch die Auflösung der Stahlhelm-Frauenorganisation<br />
im Frühjahr 1934 brachte die NS-Frauenschaft nicht voran.<br />
Der Durchbruch kam erst durch eine massive Werbeaktion Ende<br />
1935.<br />
26 Hz. Bl. 35/ 12. 2.1934.<br />
27 Hz. Bl. 92/21.4.1934.<br />
28 StaS, Ho 235, 20,1, VIII, A 21, Lageberichte Staatspolizeistelle 3.<br />
1. 1934, 3.3. 1934.<br />
2' Hz. Bl. 142/ 23. 6. 1934.<br />
30 Hz. Bl. 144/ 26. 6. 1934.<br />
" Hz. Bl. 116/23.5. 1934, 144/26.6. 1934, 145/ 27. 6. 1934.<br />
32 Hz. Bl. 147/ 30. 6. 1934. Die »Versammlungen gegen das Miesmachertum«<br />
hätten bei den kritisierten Bevölkerungskreisen »lebhafte<br />
Verstimmung« hervorgerufen, berichtete die Staatspolizeistelle<br />
Sigmaringen in ihrem Tagesbericht vom 5. 7. 1934, StaS, Ho 235,<br />
20,1, VIII, A 21.<br />
33 Hz. Bl. 158/ 13. 7. 1934, vgl. oben, S. 4.<br />
34 Hz. Bl. 247/ 26.10.1934,252/ 2.11.1934, Z 239/26.10.1934. Opfer<br />
der Selbstjustiz Pauls wurde der frühere Zentrumspolitiker<br />
Franz Dreher, der in der katholischen Arbeiterbewegung engagiert<br />
war und 1933 als einziges Mitglied des Hohenzollerischen Kommunallandtags<br />
von der NSDAP als Hospitant abgelehnt wurde.<br />
35 Hz. Bl. 149/ 3. 7. 1934.<br />
36 Hz. Bl. 158/ 13. 7. 1934.<br />
37 Hz. Bl. 148/2. 7.1934.<br />
38 Hz. Bl. 148/ 2. 7.1934, StaS, Ho 235,20,1, VIII, A 21, Lagebericht<br />
Regierungspräsident 8. 8.1934, auch Lagebericht Staatspolizeistelle<br />
4. 8. 1934. Daß diese Passage der Rede im Bericht der Hz. Bl.<br />
verschwiegen wurde, führte zu ernsthafter Verstimmung im Regierungspräsidium.<br />
3' Hz. Bl. 167/24. 7. 1934.<br />
40 Martin Broszat, a. a. O., S. 271.<br />
41 StaS, Ho 235, 20,1, VIII, A 21, Bericht Bürgermeister Bindereif 7.<br />
8. 1934, Bericht Fliegerortsgruppe Hechingen des Deutschen<br />
Luftsport-Verbandes 7. 8. 1934.<br />
42 StaS, Ho 13, 1, 1001, Vorfälle in Hechingen aus Anlaß des Christ<br />
König Festes, StaS, Ho 235,20,1, VIII, F24, Sonderaktion Schraermeyer.<br />
Die Schwierigkeit, die SA-Schule auf dem Lindich zu kontrollieren,<br />
mag für die Hechinger SA unterstützend gewirkt haben.<br />
Jedenfalls randalierten Angehörige der Schule auch im Juli 1934<br />
noch im Schützenhaus. Die Schützengilde um ihren Vorsitzenden<br />
Paul Richter fand danach allerdings den Mut, mit einer Strafanzeige<br />
zu reagieren, StaS, Ho 235, 20,1, VIII, Fl 8, Bl. 69 f.<br />
43 Zur Geschichte der Hechinger Judengemeinde während des Nationalsozialismus<br />
s. Manuel Werner, Die Juden in Hechingen als<br />
religiöse Gemeinde, in: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte,<br />
21/ 1985, S. 49 ff. Schon im Herbst 1934 kam es zu einem ernsthaften<br />
Zwischenfall, als SA-Männer einen Juden verprügelten, der in die<br />
Schweiz ausgewandert war und sich zu einem Besuch in Hechingen<br />
aufhielt, StaS, Ho 235, 20,1, VIII, A 21.<br />
44 Hz. Bl. 187/ 17. 8.1934.<br />
«5 Hz. Bl. 268/ 18. 11. 1934.<br />
46 Nach dem Ergebnis der Volkszählung hatte Hechingen 1933 unter<br />
den hauptberuflich Erwerbstätigen 17,2 Prozent (470) Selbständige<br />
oder leitende Angestellt, 8,2 Prozent (223) mithelfende Familienangehörige,<br />
die - in Landwirtschaft und Einzelhandel - wohl<br />
vor allem den Haushalten der Selbständigen zuzurechnen sind, 5,9<br />
Prozent (162) Beamte, 14,7 Prozent (400) Angestellte, 48,1 Prozent<br />
(1312) Arbeiter und 5,8 Prozent (158) Hausangestellte, Statistik des<br />
Deutschen Reichs, Berlin, 1935, Bd. 456, Heft 26, S. 32 f. Diese soziale<br />
Aufteilung fand sich in den Gemeindevertretungen nie wieder.<br />
Dort machte nach der Kommunalwahl 1929 der Anteil der<br />
Selbständigen und leitenden Angestellten 68,8 Prozent, der Beamten<br />
und Angestellten jeweils 6,3 Prozent und der Arbeiter 18,8 Prozent<br />
aus. Oder in der Zahl der Sitze: Elf Selbständige und leitende<br />
Angestellte, jeweils ein Beamter und Angestellter und drei Arbeiter.<br />
Die am 5.3.1933 gewählte Gemeindevertretung - jetzt mit vier<br />
NSDAP-Vertretern - hatte dieselbe Zusammensetzung. Wegen der<br />
Gleichschaltung konnte sie in der vom Wähler bestimmten Form<br />
nicht zusammentreten. Von den am 28.6.1934 berufenen zehn Gemeinderäten<br />
waren acht Selbständige oder leitende Angestellte und<br />
jeweils einer Beamter und Arbeiter. Im Juli 1935 wurden sieben<br />
Selbständige oder leitende Angestellte, zwei Beamte und ein Arbeiter<br />
berufen. Daß die Ausschaltung der Arbeiterschaft als politische<br />
Kraft das Ergebnis der nationalsozialistischen Machtergreifung<br />
war, wird auch in dieser Beziehung deutlich. - Anhaltspunkte<br />
für die soziale Herkunft der NSDAP-Anhänger und - -mitglieder<br />
könnte - solange eine soziologische Analyse nicht vorliegt -<br />
der Blick auf die Wahlergebnisse liefern: Bei den Wahlen 1932/33<br />
gab es die besten Ergebnisse stets im Stimmlokal Rathaus, also in<br />
der eigentlichen Oberstadt, wo die Wirtschaftskrise und das Erstarken<br />
der KPD Einzelhandel und Handwerk um seine Existenz<br />
fürchten ließ. Das mittelständisch dominierte Zentrum öffnete sich<br />
der NSDAP als erstes.<br />
47 Dem Gemeinderat von 1935 gehörten Hermann Bumüller, Fritz<br />
Müller jr., Josef Löffler, Felix Riester, Albert Schmid, Franz Josef<br />
Simmendinger, G. Barthold Strobel, Hermann Wagner, Paul Weidle<br />
und Richard Wolf an. Simmendinger und Weidle waren Exponenten<br />
der NSDAP. Albert Schmid, Landwirt, hatte sich vor 1933<br />
im Bauernverein engagiert, der nach der Machtergreifung 1933<br />
bruchlos in der NSDAP aufgegangen war. Die übrigen Gemeinderäte<br />
hatten nach 1933 durch ihre Arbeit in Handwerker- und Einzelhandelsorganisationen<br />
die Neuordnung unterstützt oder - wie<br />
Richard Wolf - ihren Betrieb frühzeitig der Partei geöffnet. Felix<br />
Riester war der einzige Arbeiter in der Hechinger Gemeindevertretung<br />
1935.<br />
48 StaS, Ho 235, 20,1, VIII, A 21, Lageberichte 3. 8. 1934, 4. 8. 1934,<br />
5. 7. 1934.<br />
Eine gekürzte Fassung ist erschienen im Schwarzwälder Bote, Nr.<br />
148/ 30. 6. 1994, 149/ 1. 7. 1994, 150/ 2. 7.1994,151/ 4. 7.1994,152/<br />
5. 7. 1994.<br />
JOSEF SCHULER<br />
Junginger Dorfgeschichten<br />
Dr<br />
Haadlanger<br />
Ma sotts it glauba, daß schau ieber hundertdreißg Johr vrganga<br />
sind. Dr Ludwig und dr Coanrad sind Brüeder gsei, a<br />
Tatsach, dia au i iehrem Firmaschild »Gebr. Bosch« zum Ausdruck<br />
komma isch. All zwee sind diftelege Mechaniker gsei,<br />
und älls, was se a'gregt hand, hot under iehrena gschickta<br />
Hend Form a'gnumma, sei's a Dieraschloß fiers Pfarrhaus, a<br />
Fuurschbritz ge Bechtoldsweiler num oder gar a Durmuhr<br />
uff da grad wieder uffbauta Zoller nuff. Iehra Temprament<br />
isch aber so vrschieda gsei, wies no zwisched zwee Brüeder<br />
sei ka. Griebeg und bsonna dr Ludwig, laut und tempramentvoll<br />
dr Coanrad. Ma hot s'Johr 1856 gschrieba und<br />
s'ischd a bsunderer Dag gsei, mo'se dia Uhr mondert hand, i<br />
luftiger Haih uff em Zollerdurm doba. Grund gnueg zum<br />
Ei'kehra uff em Hoaweag, zum Veschbera und a'weng feira<br />
z'Boll im »Hiisch«. Und dr Coanrad braachted und vrzehlts<br />
älla Leit, mo's hand wissa wella, daß se a nuie Durm-Uhr<br />
mondiert hand uff dr Burg doba, bis's am Ludwig z'dumm<br />
woara isch: »Jo«, sait'r, und dr Schnauzbart juckt em aweng,<br />
»i hau se mondiert, und du hoschd d'Loater ghebt.«<br />
27
EDWIN ERNST WEBER<br />
Stadtrechts-Verleihung an Pfullendorf durch König Friedrich II. - Urkunde vom<br />
2. Juni 1220 (GLAK D 26)<br />
Stadtrechts-Verleihungsurkunde<br />
Friedrichs II. für Pfullendorf von<br />
1220 (Generallandesarchiv Karlsruhe<br />
D 26)<br />
6) ribus et pacis inimicis conculcentur<br />
et dampna seu incommoda<br />
patiantur sicut<br />
hucusque multis retro temporibus<br />
perpessi sunt, presertim<br />
cum locus idem cum<br />
omniui<br />
T iw * —-<br />
1) In nomine sánete et individué<br />
trinitatis. Fridericus secundus<br />
divina favente dementia<br />
Romanorum rex<br />
semper augustus et rex Sycilie.<br />
2) Regalis eminentie interesse<br />
decernimus inveterata renovare,<br />
dissipata ad honorent<br />
et utilitatem imperii<br />
recolligere, destructa queque<br />
restau-<br />
3) rare atque ad eorum relevationem<br />
regie eminentie robur<br />
et benivolentiam omnimodis<br />
adhibere. Considerantes<br />
damp na atque lesiones<br />
que<br />
4) et quas hactenus sustinuit<br />
imperium ex dispersione<br />
optime ville nostre in Pfullendorf,<br />
ex innata quoque<br />
nobis munificentia compassi<br />
la-<br />
5) boribus et erumpnis quas<br />
incole ipsius ville nimio ignis<br />
Ímpetu et voracitate nuper<br />
sunt perpessi; nolentes<br />
super omnia quod ipsi de cetera<br />
a malefacto-<br />
Mjtù t'. U_J<br />
* , 1 "J "J- J'JT<br />
w<br />
. |jl t^fXmmml^y f^jf ft^jnf I»""* —»»j»—"« L -<br />
B r f f-t<br />
rt<br />
P? »UfjU. JS.Û — • 3<br />
liyij y í^-j, U-f—r rt — - t<br />
MU<br />
J-p<br />
. S l ^ j .h»» f i — . —<br />
—<br />
j."* f J.<br />
—• ¿y^í-y jMry-f"*- f"<br />
1<br />
I<br />
7) bus attinentiis suis paterna hereditate ad nos propie dinoscatur<br />
pertinere, locum ipsum in perpetuam instituimus<br />
libertatem, in fundo eiusdem loci civi-<br />
8) tatem de cetero esse volentes, omnia iura omnesque iustas<br />
et honestas consuetudines secundum instituitiones et liberates<br />
aliarum civitatum nostrarum eidem<br />
9) civitati in Pfullendorf liberaliter inpendentes atque presentís<br />
scripti nostri patrocinio perpetuo confirmantes. Volumus<br />
etiam quod omnes persone que usque<br />
10) ad témpora ista in loco sepedicto commorate sunt, cuiuscumque<br />
sint conditionis, in iure et honore nunc a nostra<br />
recepto largitate de cetero permaneant. Inhibe-<br />
11) mus omnino ne servus alicuius sive censualis vel cuiuscumque<br />
sint conditionis, ministerialium tantummodo nostrorum,<br />
in civitatem ipsam in ius istud recipiatur nisi<br />
12) de domini sui fuerit volúntate. Superaddimus etiam ne aliquis<br />
in ipsa civitate pro cive habeatur vel ius civis hebeat<br />
nisi faciat ibidem residentiam.<br />
13) Regio etiam edicto sanccimus quod quicumque in loco<br />
sepedicto civis esse voluerit et iure atque honore ipsius civitatis<br />
gaudere voluerit omnia civitatis<br />
14) faciat servida exceptis clericis ad divinum cultum ibidem<br />
destinatis. Ceterum decernimus et perpetuo volumus a civibus<br />
illius civitati nostre observari<br />
15) quod, si quis civium eius unam vel plures habuerit areas<br />
nudas scilicet non superedificatas nec eas a proximo die<br />
festo sancti Michahelis infra spatium unius<br />
16) anni superedifacaverit, area illa vel si plures fuerint, ad nostrum<br />
devoluantur domanium; dummodo paupertas non<br />
intreveniat vel eiusdem aree ad concivem<br />
28
17) suum secundum instituta civitatis iusta venditio. Si etiam<br />
de novo aqueductus ad facienda molendina ibidem capiantur,<br />
volumus et statuimus,<br />
18) ut molendina illa ad munitionem cedant civitatis ad nostram<br />
voluntatem. Ad maiorem autem gratie nostre circa<br />
eundem locum nostrum evidentiam<br />
19) et quod cives civitatis illius promptiores existant ad eius<br />
constructionem seu munitionem usque ad sex continuos<br />
annos ab omni exactio-<br />
20) ne cives eius, qui nunc sunt vel in posterum istis succedent,<br />
totaliter absolvimus, statuentes tarnen quod his annis<br />
quolibet anno<br />
21) ad munitionem civitatis 20 marce a civibus eius communiter<br />
persolvantur. Verum quia dilectus clericus noster<br />
Ulricus huius facti ex-<br />
22) titit auctor et fidelissimus cooperator ex gratia regie serinitatis<br />
ipsum et totam familiam suam cum areis suis a tota<br />
conditione preta-<br />
23) xata volumus esse exemptum. Ut itaque huius nostre largitatis<br />
donatio perpetuo vigoro pro futuris observetur<br />
temporibus nec ab aliquo in poste-<br />
24) rum valeat aliquomodo infringi, hoc scriptum tarn civitati<br />
memorate eiusque civibus tarn presentibus quam futuris<br />
quam ad memoriam ommnium<br />
25) indulsimus sigillo maiestatis nostre communitum. Hii<br />
sunt testes: Sifridus Moguntinus, Engelbertus Coloniensis<br />
archiepiscopi, Ha-<br />
26) inricus Wormatiensis electus, Ekkemphertus Babenbergensis<br />
episcopus, Lodwicus comes palatinus Reni et dux<br />
Bawarie, comes Gerardus de Diets,<br />
27) Eberhardus nobilis de Eberstein, Hainricus nobilis de<br />
Niffen, Wernherus de Bonlanden, dapifer imperii, et frater<br />
suus Philippus, Eberhardus,<br />
28) dapifer de Walpurch, Chunradus de Winterstet, pincerna,<br />
et alii quam plures.<br />
29) Ego Chunradus, Metensis et Spirensis episcopus, imperialis<br />
aule cancellarius, vice domini Sifridi Moguntinensis<br />
archiepiscopi totius Germanie arcicancellarii, recognovi.<br />
30) Datum Wormatie in presentia gloriosi Hainrici ducis Suuevie<br />
in Romanorum regem electi anno dominie millesimo<br />
ducentesimo vigentesimo Indictione octa<br />
31) quarto nonas iunii regnante domino nostro Friderico secundo<br />
divina favente dementia Romanorum rege Semper<br />
augusto et rege Siciliae invictissimo,<br />
32) anno Romani regni eius in Germania octo, Sicilie vero trevigintesimo.<br />
Übersetzung:<br />
Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit.<br />
Friedrich II., durch göttliche Gunst und Milde Römischer<br />
König, allzeit Mehrer des Reiches und König von Sizilien.<br />
Zum Nutzen unserer königlichen Hoheit haben wir beschlossen,<br />
das alt Gewordene zu erneuern, das Zerstreute zur<br />
Ehre und zum Nutzen des Reiches wieder zu sammeln, auch<br />
das Zerstörte wiederherzustellen und zu deren Wiederaufrichtung<br />
auf alle Weise die Macht und Gunst der königlichen<br />
Hoheit anzuwenden. In Erwägung der Verluste und Schäden,<br />
welche das Reich bisher aus der (Besitz-)Zerstreuung<br />
Besitzverschleuderung lt. Groner unseres trefflichen Dorfes<br />
in Pfullendorf erlitten hat, auch aus der uns angeborenen Milde<br />
und aus Mitgefühl für die schweren Nöte und Mühsale,<br />
welche die Einwohner dieses Dorfes durch eine Feuersbrunst<br />
unlängst erduldet haben, und da wir vor allem nicht wollen,<br />
daß dieselben im übrigen von Übeltätern und Friedensbrechern<br />
belästigt werden und Schäden und Unannehmlichkeiten<br />
erleiden, wie sie dies bisher verschiedentlich erdulden<br />
mußten, vor allem aber, weil dieser Ort mit allem seinem Zubehör<br />
uns aus dem väterlichen Erbe eigentümlich zugehört,<br />
haben wir diesem Ort immerwährende Freiheit verliehen und<br />
wünschen weiterhin, daß auf dem Boden dieses Ortes eine<br />
Stadt sei. (Um dies zu fördern,) verleihen wir freigebig dieser<br />
Stadt Pfullendorf alle Rechte und alle rechtmäßigen und<br />
ehrenvollen Gerechtsame Rechtsgewohnheiten gemäß den<br />
Ordnungen und Freiheiten anderer unserer Städte und bestätigen<br />
dies durch den Schutz unserer vorliegenden Urkunde<br />
auf immer.<br />
Wir wollen auch, daß alle Personen, welche bis zu dieser Stunde<br />
am oftgenannten Ort sich aufgehalten haben, gleichgültig<br />
welchen Standes sie sein mögen, in dem von unserer Großmut<br />
empfangenen Recht und der ehrenhaften Stellung künftighin<br />
verbleiben. Überhaupt verbieten wir, daß irgendein Höriger<br />
oder Zinspflichtiger gleich welches Herrn und welchen Standes<br />
er sei - mit Ausnahme unserer Dienstleute -, in dieser<br />
Stadt im Bürgerrecht aufgenommen werde, es sei denn, es sei<br />
mit Willen seines Herrn geschehen. Fernerhin wollen wir,<br />
daß keiner in dieser Stadt als Bürger angenommen werden<br />
oder das Bürgerrecht erhalten soll, der dort nicht seinen<br />
Wohnsitz nehmen will. Durch königlichen Befehl bestimmen<br />
wir auch, daß wer immer am oftgenannten Ort Bürger sein<br />
und das Recht und die ehrenhafte Stellung dieser Stadt genießen<br />
will, alle Pflichten der Stadt erfüllt; davon ausgenommen<br />
sind lediglich die dort zum Gottesdienst bestimmten<br />
Geistlichen.<br />
Weiterhin entscheiden und wollen wir, daß die Bürger dieser<br />
unserer Stadt stets beachten, daß, wenn ein Bürger einen oder<br />
mehrere leere beziehungsweise nicht überbaute (Haus-)Plätze<br />
vermutlich i. S. von Hofstatt besitzt und diese ab nächstem<br />
St. Michaelisfest nicht binnen eines Jahres überbaut hat, dieser<br />
Platz beziehungsweise diese Plätze in unseren Besitz übergehen<br />
- es sei denn, Armut sei der Grund oder der Platz sei<br />
durch einen rechtmäßigen Verkauf gemäß den Satzungen der<br />
Stadt an einen Mitbürger gelangt. Falls neuerlich Wasserleitungen<br />
zum Bau von Mühlen dort angelegt werden, wollen<br />
und bestimmen wir, daß jene Mühlen zur Stadtbefestigung<br />
beitragen gemäß unserem Willen.<br />
Zum größeren Beweis unserer Gnade gegenüber diesem Ort<br />
und damit die Bürger jener Stadt bereitwilliger zum Bau ihrer<br />
Befestigung sich zeigen, haben wir sie auf sechs Jahre von<br />
jeder Steuer völlig befreit - ungeachtet, ob es sich um Bürger<br />
handelt, die jetzt dort leben oder künftig an ihre Stelle treten.<br />
Jedoch haben wir festgesetzt, daß die Bürger miteinander<br />
während dieser Zeit alljährlich 20 Mark zur Stadtbefestigung<br />
aufbringen. Weil aber unser geliebter Kleriker Ulrich der Urheber<br />
und getreuliche Mitarbeiter dieses Rechtsaktes war,<br />
wollen wir aus Gnade der königlichen Hoheit, daß er selbst<br />
und seine ganze Hausgenossenschaft mit seinem Gut von der<br />
ganzen vorgenannten Verpflichtung ausgenommen wird.<br />
Damit daher die aus unserer Großmut erfolgte Schenkung<br />
dauerhaften Bestand behält für künftige Zeiten und von niemandem<br />
künftig auf irgendeine Weise gebrochen werden<br />
kann, haben wir bewilligt, daß diese Urkunde sowohl für die<br />
erwähnte Stadt und ihre jetzigen und zukünftigen Bürger wie<br />
auch zur Erinnerung aller durch das Siegel unserer Majestät<br />
bekräftigt wird.<br />
Diese sind die Zeugen: Sifrid Erzbischof von Mainz, Engelbert<br />
Erzbischof von Köln, Heinrich erwählter Bischof von<br />
Worms, Ekkemphert Bischof von Bamberg, Ludwig Pfalzgraf<br />
bei Rhein und Herzog von Bayern, Graf Gerard von<br />
Diez, der Edle Eberhard von Eberstein, der Edle Heinrich<br />
von Neiffen, Reichstruchseß Wernher von Bolanden und sein<br />
Bruder Philipp, Eberhard Truchseß von Waldburg, Schenk<br />
Konrad von Winterstetten und viele andere.<br />
Ich, Konrad, Bischof von Metz und Speyer, Kanzler des kaiserlichen<br />
Hofes, habe in Vertretung des Herrn Sifrid, Erzbi-<br />
29
schof von Mainz und Erzkanzler für ganz Deutschland, die<br />
Urkunde anerkannt.<br />
Gegeben zu Worms in Gegenwart des glorreichen Herzogs<br />
Heinrich von Schwaben, erwählter Römischer König, im Jahre<br />
des Herrn Eintausend zweihundert zwanzig, in der 8. Indiktion,<br />
am 2. Juni, unter der Regierung unseres unüberwindbaren<br />
Herrn Friedrichs II., durch göttliche Gunst und<br />
Milde Römischer König, allzeit Mehrer des Reiches, und König<br />
von Sizilien, im 8. Regierungsjahr seines Römischen und<br />
23. seines sizilischen Königtums.<br />
ARMIN HEIM<br />
»Der Herold der Sigmaringer Landschaft«<br />
Der Landschaftsmaler<br />
Gustav Meinrad Steidle starb vor 50 Jahren<br />
Einfache Wiesenraine, Baumgruppen, waldumsäumte<br />
Flußtäler - meist sind es die ganz einfachen Bildthemen, die<br />
den Reiz seiner Landschaftsmalerei ausmachen. Den »Herold<br />
der Sigmaringer Landschaft« hat man ihn genannt. Vor fünfzig<br />
Jahren, am 29. Juni 1944, ist er in seiner Vaterstadt Sigmaringen<br />
gestorben, der Maler und Kirchenrestaurator Gustav<br />
Meinrad Steidle.<br />
Steidle gehörte nicht zu den Avantgardisten seiner Generation.<br />
Seine Landschaftsmalerei - neben der Porträtmalerei der<br />
eigentliche künstlerische Schwerpunkt in seinem Schaffen -<br />
zeigt sich weitgehend der Tradition verpflichtet, den süddeutschen<br />
und französischen Realisten. Was den Maler allerdings<br />
von seinen Vorbildern unterscheidet, ist die auffallende<br />
Breite seiner Farbpalette, die schon in der besonderen Ausdrucksstärke<br />
seiner frühen Werke zur Geltung kommt. Steidles<br />
Kunst zielt nicht auf intellektuelle Selbstbespiegelung:<br />
wohl gelingt es dem Maler aber, traditionelle Bestrebungen<br />
der realistischen Landschaftsmalerei der Jahrhundertwende<br />
mit einer selbstbewußter gewordenen künstlerischen Subjektivität<br />
in Einklang zu bringen, das Aufdecken von Schönheit<br />
und Harmonie im Einfachen und natürlich Gewachsenen<br />
also nicht als Selbstzweck zu begreifen, sondern mit der<br />
Darstellung individueller Empfindungswerte zu verbinden.<br />
Seine erste künstlerische Ausbildung hatte der am 3. Oktober<br />
1878 in Sigmaringen geborene Gustav Meinrad Steidle bereits<br />
in seiner Heimatstadt genossen, nämlich in der Werkstatt<br />
des berühmten Hofmalers Gustav Bregenzer<br />
(1850-1919). Die weiteren Studienjahre hatten den jungen<br />
Künstler nach Karlsruhe, Stuttgart, München, Paris, Berlin<br />
und Florenz geführt, ehe er sich als Kirchenrestaurator in seiner<br />
Vaterstadt Sigmaringen niederließ und das Atelier seines<br />
Lehrers Bregenzer in der Buchhaldenstraße weiterführte.<br />
Neben seiner künstlerischen Tätigkeit hat sich Steidle auch<br />
als Restaurator in verschiedenen Kirchen Hohenzollerns wie<br />
etwa St. Johann in Sigmaringen, Wald, Habsthal, Hettingen,<br />
Oberschmeien, Vilsingen, Bachhaupten und Bittelschieß<br />
oder im Diözesanmuseum Rottenburg - Steidle gilt als der<br />
Entdecker des sogenannten »Meisters von Sigmaringen« -<br />
Gemälde von G. Steidle, Foto Armin Heim<br />
verdient gemacht. In seinem eigentlichen künstlerischen<br />
Schaffen ist Gustav Steidle von der Kunstwelt kaum zur<br />
Kenntnis genommen worden. Zu schnell ist die allgemeine<br />
kunstgeschichtliche Entwicklung über seine Auffassung von<br />
Malerei hinweggeschritten. So finden sich heute - abgesehen<br />
vom Sigmaringer Heimatmuseum - keine Arbeiten des Malers<br />
in öffentlichen Kunstsammlungen. Die allermeisten seiner<br />
Landschaftsbilder und Porträts sind in Sigmaringer Bürgerhäusern<br />
verstreut. Gleichwohl sind diese Gemälde in<br />
ihrem unverkennbaren und originellen Stil ein beredtes Zeugnis<br />
dafür, daß in der Kunst des 20. Jahrhunderts auch auf dem<br />
Boden des Traditionellen durchaus fruchtbare künstlerische<br />
Auseinanderetzungen und stilistische Weiterentwicklungen<br />
möglich waren. Gerade unter mittlerweile veränderten<br />
kunsthistorischen Perspektiven erscheint eine Künstlerpersönlichkeit<br />
wie Gustav Meinrad Steidle einer Neuentdeckung<br />
und -bewertung würdig.<br />
Das Buch zum Jubiläum<br />
Das Leben und Wirken der Weißenauer Mönche<br />
durch die Jahrhunderte steht im Mittelpunkt<br />
dieser reich bebilderten und repräsentativ<br />
gestalteten Festschrift zur 850. Wiederkehr<br />
der Gründung der Prämonstratenserabtei. Die<br />
23 facettenreichen Einzelbeiträge zeigen dabei<br />
nicht nur einen historisch bedeutsamen und interessanten<br />
Ausschnitt der Geschichte Oberschwabens,<br />
sie werfen auch ein durchaus differenziertes<br />
Licht auf die prämonstratensische<br />
Geisteshaltung.<br />
DM 48.-<br />
580 Seiten mit 136 Abbildungen, davon 27 farbig,<br />
17 x 24 cm, Leinen mit Schutzumschlag<br />
ISBN 3-7995-0414-1<br />
-a^.<br />
/I"<br />
Jan Thorbecke Verlag<br />
Sigmaringen<br />
30
Buchbesprechungen<br />
An die Autoren der Hohenzollerischen<br />
Heimat<br />
Unter dem Titel 200 JAHRE FREUDENWEILER ist vor<br />
kurzem ein Geschichts- und Heimatbuch erschienen, das die<br />
Entwicklung dieser am nördlichsten Zipfel des Kreisgebietes<br />
Sigmaringen gelegenen Ortschaft von ihrer Gründung unter<br />
Baron Marquard Carl Anton von Speth bis in unsere Tage in<br />
vielen Details nachzeichnet. (Anlaß für die Gründung und<br />
den Bau der Wirtschaft zum »Löwen« im Jahre 1795 war damals<br />
das Bedürfnis gewesen, Wanderern und Reisenden auf<br />
der langen Wegstrecke zwischen Neufra und Ebingen v. a.<br />
im Winter Schutz und die Möglichkeit zu einer Stärkung zu<br />
bieten.)<br />
Die Verfasser, das Ehepaar Siegfried und Annemarie Lorch,<br />
haben neben bereits veröffentlichtem Material insbesondere<br />
auch die vorhandenen archivalischen Quellen genutzt (Gemeinde-<br />
und Pfarrarchiv Neufra, Kreisarchiv Sigmaringen)<br />
und sich zusätzlich durch Gespräche mit älteren Mitbürgern<br />
eine breite Wissensbasis verschafft.<br />
Hervorzuheben ist auch die gute sprachlich-stilistische Gestaltung<br />
der Ausführungen und die Bebilderung. (Hrsg. von<br />
der Gemeinde Neufra, 78 Seiten, fest gebunden, ca. 25 DM).<br />
Konrad und Ulrich von Jungingen<br />
(Dr. H. Rädle)<br />
Beiträge zur Biographie der beiden Deutschordenshochmeister<br />
von Casimir Bumiller und Magdalene Wulfmeier.<br />
Herausgegeben von der »Arbeitsgemeinschaft Heimat Jungingen«<br />
mit Unterstützung des Deutschordensmuseums Bad<br />
Mergentheim. Casimir Bumiller berichtet ausführlich über<br />
die Geschichte der Familie von Jungingen und die beiden<br />
Hochmeister. Daß einer oder gar zwei Herren von Jungingen<br />
Hochmeister des Deutschen Ordens waren, ist wohl allgemein<br />
bekannt, aber nur wenige dürften Einzelheiten darüber<br />
wissen. Die Herren von Jungingen gaben nämlich schon<br />
1278 ihre Burg oberhalb des Dorfes Jungingen auf und gingen<br />
nach (Bad) Waldsee. Doch schon 1316 zog es sie wieder<br />
nach Norden, ins Laucherttal. Sie erwarben die Burg Schiltau,<br />
bei der die neue Burg und Siedlung Jungnau entstanden.<br />
Wolfgang von Jungingen kam 1352 durch seine Frau Ursula<br />
in Besitz der Herrschaft Neu-Hohenfels. Vermutlich zwischen<br />
1355 und 1360 wurden, wohl schon in Neu-Hohenfels,<br />
die Söhne Konrad und Ulrich, die späteren Hochmeister geboren.<br />
1393 wurde Konrad von Jungingen Hochmeister des deutschen<br />
Ordens. Vielleicht hatte er seine Ordenslaufbahn in der<br />
Kommende auf der Mainau begonnen. Auch sein Bruder Ulrich<br />
machte in der Ordenshierarchie einen schnellen Aufstieg.<br />
Zweck des Ritterordens war der Kampf gegen die Heiden.<br />
Nachdem die heidnischen Prussen missioniert waren, kämpften<br />
die Ritter gegen die Litauer. Als sich 1386 die Dynastien<br />
Polens und Litauens zusammenschlossen und Litauen christlich<br />
wurde, standen dem Orden mächtige und feindliche<br />
Nachbarn gegenüber. Hochmeister Konrad versuchte auf diplomatischem<br />
Wege mit den Gegnern zurecht zu kommen.<br />
Nach seinem Tode 1407 wählte das Generalkapitel Konrads<br />
Bruder, Ulrich von Jungingen zum Hochmeister. Schon drei<br />
Jahre später kam es zum Krieg mit Jagiello, dem König von<br />
Litauen und Polen. In der Schlacht bei Tannenberg und<br />
Grunwald erlitt der Orden eine vernichtende Niederlage. Zusammen<br />
mit fast allen ausgerittenen Ordensbrüdern fiel auch<br />
Hochmeister Ulrich von Jungingen.<br />
Magdalene Wulfmeier vom Deutschordensmuseum in Bad<br />
Mergentheim schreibt über Hochmeister Konrad von Jun-<br />
Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Beiträge, ohne<br />
die unsere Heimatzeitschrift nicht existieren könnte.<br />
Leider werden manche von Ihnen enttäuscht sein, daß<br />
ihr Beitrag wieder nicht dabei ist. Dies hängt nicht nur<br />
mit der an sich sehr erfreulichen Zunahme der Beiträge<br />
zusammen, sondern vor allem mit deren Länge. Zudem<br />
möchten wir allen Lesern etwas bringen, was aber<br />
nicht möglich ist, wenn die ganze Zeitschrift von zwei<br />
bis drei Beiträgen gefüllt ist. Daher unsere Bitte: Ein<br />
Beitrag der ungeteilt erscheinen soll, nicht mehr als<br />
vier bis fünf Schreibmaschinenseiten. Anmerkungen<br />
nur die allernotwendigsten oder die Möglichkeit, daß<br />
Interessenten Kopien anfordern können. Bitte lassen<br />
Sie sich dadurch nicht entmutigen und senden Sie weiterhin<br />
Ihre Beiträge. Nochmals herzlichen Dank für<br />
Ihre Mitarbeit.<br />
Die Schriftleitung der Hohenzollerischen Heimat.<br />
gingen und die Verhältnisse im Deutschen Orden zu seiner<br />
Zeit. Trotz der Kürze des Kapitels bekommt der Leser einen<br />
sehr guten Überblick über den Deutschen Orden an der Wende<br />
vom 14. zum 15. Jahrhundert.<br />
Verblendung, Mord und Widerstand<br />
Aspekte nationalsozialistischer Unrechtsherrschaft im Gebiet<br />
des heutigen Zollernalbkreises von 1933- 1945<br />
Herausgeber Zollernalbkreis Jugendring e. V. und Zollernalbkreis.<br />
Anläßlich der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des 20. Juli 1944<br />
in Lautlingen veranstaltete der Jugendring Zollernalbkreis die<br />
Sommerakademie »Nationalsozialismus und Widerstand«.<br />
Die dort gehaltenen Vorträge wurden jetzt als Buch herausgegeben.<br />
Drei der Aufsätze handeln von Claus Schenk Graf von Staufenberg:<br />
»Claus Schenk Graf von Stauffenberg - ein württembergischer<br />
Preuße im Widerstand gegen Krieg und Diktatur«<br />
von Prof. Dr. Doering-Manteuffel, Tübingen. »Claus<br />
Schenk Graf von Stauffenberg, Prägende Kräfte in Kindheit<br />
und Jugend« und »Schwerste Zeiten, Gräfin Caroline von<br />
Stauffenberg beschreibt ihr Leben nach dem 20. Juli 1944«,<br />
beides von Dr. Peter Thaddäus Lang, Balingen.<br />
Ein Schwerpunkt der NS-Herrschaft im Zollernalbkreis waren<br />
die Konzentrationslager des »Unternehmen Wüste«, der<br />
1944 überstürzt aufgebauten Ölschiefer-Industrie. Aus den<br />
Konzentrationslagern Natzweiler, Auschwitz, Dachau, Buchenwald<br />
und dem estnischen Lager Vaivara brachte die SS<br />
viele tausend Häftlinge als Arbeitskräfte in die insgesamt sieben<br />
Lager. Über die Lager und das Schicksal der Häftlinge<br />
berichtet Dr. Andreas Zekorn, Balingen.<br />
Weitere Aufsätze sind: »Staatssicherheitssystem und Widerstand<br />
im Dritten Reich« von Hermann Weiß, München, »Nationalsozialismus<br />
in einer kleinen Stadt - Balingen<br />
1923-1939« von Dr. Hans Schimpf-Reinhardt, Balingen.<br />
Über die »Euthanasie« im Dritten Reich am Beispiel Hohenzollern<br />
schreibt Dr. Gabriel Richter, Emmendingen. Das<br />
sehr empfehlenswerte Buch hat 120 Seiten und ist mit vielen<br />
historischen Fotos ausgestattet. Es ist zum Preis von<br />
12,80 DM über eine Buchhandlung oder direkt beim Landratsamt<br />
Balingen zu beziehen.<br />
31
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 72488 Sigmaringen<br />
M 3828<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Register 1994<br />
Seite<br />
Seite<br />
Bingen, Zur Kunst- und Baugeschichte der Pfarrkirche<br />
»Mariä Himmelfahrt« in Bingen S. 55<br />
Brodmann, Korbinian, Das Korbinian-Brodmann-<br />
Museum in Hohenfels-Liggersdorf S. 21<br />
Buchbesprechungen: Albstadt (Bildband) S. 31<br />
Spuk, Von Geisterburgen und<br />
Gespensterschlössern in Baden-<br />
Württemberg S. 31<br />
Herdwangen-Schönach,<br />
Heimatbuch S. 64<br />
Zollernalb-Profile 3, Jahrbuch<br />
des Zollernalbkreises S. 30<br />
Burren, Vom Burren und seiner Umgebung S. 11<br />
Dietfurter Kapellenstiftung S. 17<br />
Fidelis-Akademie am 24. April 1993 in Stans<br />
(Schweiz) S. 23<br />
Glatt-Oberhof, Geschichte der fürstlichhohenzollerischen<br />
Domäne (Schluß) S. 32<br />
Gauselfinger Bevölkerung im 16. Jahrhundert S. 2<br />
Geiselhart, Thomas (zum 100. Todestag) S. 36<br />
Hartmann, Joseph, Ein »ausgezeichneter« Lehrer in<br />
Inzigkofen S. 27<br />
<strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong>, Exkursion nach<br />
Potsdam und in die Mark Brandenburg vom 16. bis<br />
20. Mai 1994 S. 29<br />
<strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong>, Vorstand in<br />
Freiberg in Sachsen S. 62<br />
Junginger Dorfgeschichten - Gambrinus S. 18<br />
Junginger Dorfgeschichten - Geist-reiches S. 29<br />
Junginger Dorfgeschichten - »Rezept« S. 46<br />
Junginger Dorfgeschichten - »Man müßte<br />
Klavierspielen können« S. 63<br />
»Kille«, Stichwort »Kille« S. 15<br />
Killer, Die Geschichte der Peitschenmacher<br />
von Killer S. 9<br />
Leibold, Maria, Neuer Gedichtband S. 64<br />
St. Luzenkirche gibt Rätsel auf - eine Tür, die ins<br />
Leere führt S. 4<br />
Meßkirch, Das Zimmernschloß in Meßkirch -<br />
ein Vorbild für andere Schloßanlagen im Umkreis S. 35<br />
Meßkirch, Das Ende der Meßkircher Fürstenherrlichkeit<br />
S. 50<br />
Mörike, Eduard Mörike und sein Bruder Karl Mörike<br />
in Scheer S. 58<br />
Owingen, Renovation der alten Jakobuskirche S. 47<br />
900 Jahre Owingen - »Aufwiegler, Aufrührer und<br />
Rottierer« S. 52<br />
Sattlerkapelle, Die neue Sattlerkapelle S. 1<br />
Sigmaringen, Ein spätgotischer Altarflügel in<br />
Sigmaringen. Zuweisung an die Weckmannwerkstatt S. 25<br />
Sigmaringen, Musik der Renaissance S. 41<br />
Sigmaringen, Eine mittelalterliche Münze mit dem<br />
Sigmaringer Hirsch S. 44<br />
Tauffeiern, Ein Verbot der Tauffeiern aus dem<br />
Jahr 1778 S. 14<br />
Trochtelfingen, Herstellung eines Fasses in<br />
Handarbeit S. 28<br />
Trochtelfingen, Auf der Walz S. 40<br />
Trochtelfingen, Aus den Visitationsakten des ehemaligen<br />
Kapitels Trochtelfingen 1574-1709 (I) S. 45<br />
Trochtelfingen. Aus den Visitationsakten des ehemaligen<br />
Kapitels Trochtelfingen 1574-1709 (II) S. 60<br />
Veringenstadt, Zur Veringenstädter Heiligen-Sippe S. 13<br />
Wallenstein, Ein Mordplan gegen Wallenstein S. 7<br />
Weil, Alfred, Hechingen in New Vork - Zum<br />
94. Geburtstag von Alfred Weil S. 19<br />
Wiest Joseph (100. Geburtstag) S. 55<br />
v. Zimmern, Vor 400 Jahren erlosch die Dynastie der<br />
Grafen von Zimmern S. 34<br />
Zwiefalten, Ein Magnusstab im Kloster Zwiefalten S. 27<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
ISSN 0018-3253<br />
Erscheint vierteljährlich.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landes teile mit der Geschichte<br />
ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: DM 11,00 jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803 843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
32<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Armin<br />
Heim<br />
Sonnenhalde la, 88605 Meßkirch<br />
Wilhelm<br />
Rößler<br />
Am Schönenberg 7/1, 72488 Sigmaringen<br />
Josef<br />
Schuler<br />
Killertalstraße 55, 72417 Jungingen<br />
Rolf Vogt<br />
Marktplatz 6, 72379 Hechingen<br />
Dr. Edwin Ernst Weber,<br />
Kreisarchivar<br />
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
Verlagsanstalt<br />
72488 Sigmaringen, Karlstraße 10<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
Eichertstraße 6, 72501 Gammertingen<br />
Telefon 07574/4407<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge verantwortlich.<br />
Mitteilungen der Schrifdeitung sind<br />
als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare werden<br />
an die Adresse des Schriftlei tcrs erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
M 3828 F<br />
Herausgegeben vom<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
45. Jahrgang Nr. 3/September <strong>1995</strong><br />
Vorlage: Fürstlich Hohenzollernsche Sammlungen, Sigmaringen<br />
Karlsplatz und Ständehaus in Sigmaringen um 1880<br />
Das Bild ist dem neu erschienenen Band »Sigmaringen in alten Ansichten« von Maren Kuhn Rehfus und Werner Kuhn entnommen,<br />
das in diesem Heft besprochen wird.<br />
Ohne weiteres ist dieses 115 Jahre alte Foto nicht zu erkennen. Nicht nur, daß Fürst Carl umziehen mußte, um dem Namen<br />
und dem Reiterdenkmal Leopolds Platz zu machen, auch das Gebäude rechts im Hintergrund sieht recht fremd aus. Es ist<br />
der alte Prinzenbau, ursprünglich ein Schlößchen, das für die Fürstin Amalie Zephyerine gebaut und später in den Prinzenbau<br />
einbezogen wurde. Der erste Landtag, auch Ständeversammlung genannt, wurde 1833 im Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen<br />
gewählt. 1846 wurde mit dem Bau des Ständehauses nach Plänen von Wilhelm Laur begonnen. Wegen der Revolution<br />
von 1848 gab es nie eine Einweihung und der Landtag benützte das Gebäude nur einmal während einer kurzen Sitzungsperiode<br />
im April 1849. Dann kamen die Preußen und es gab keinen Landtag mehr. Der Sitzungssaal wurde als allgemeiner<br />
Festsaal benützt. Spar- und Leihkasse und Amtsgericht teilen sich das Gebäude. Durch Umbauten wurde die Fassade<br />
im Lauf der Zeit nicht gerade zu ihrem Vorteil verändert.<br />
33
Buchbesprechung<br />
Sigmaringen in alten Ansichten<br />
Am 25. August d. J. wurde im Sitzungssaal des Landeshauses<br />
in Sigmaringen von Bürgermeister Gerstner, Dr. Werner<br />
Kuhn und Verleger Dr. Georg Bensch ein neuer Thorbecke-<br />
Bildband »Sigmaringen in alten Ansichten« vorgestellt. Die<br />
Idee zu diesem Bildband hatte Frau Dr. Kuhn-Rehfus bei der<br />
Zusammenstellung ihres 1989 erschienenen historischen<br />
Stadtführers, für den sie schon eine größere Anzahl alter Ansichten<br />
verwendete. Ihr plötzlicher Tod im Jahre 1993 ließ<br />
das Projekt zunächst ruhen. Wie Dr. Werner Kuhn ausführte,<br />
sei ihm irgendwann klar geworden, daß er seiner Frau die<br />
Fortführung und Fertigstellung dieses Bildbandes einfach<br />
schuldig sei.<br />
Dieses Buch mit seinen 229 Abbildungen bereitet nicht nur<br />
ein ästhetisches Vergnügen, sondern es ist auch ein beneidenswerter<br />
Beitrag zur Stadtgeschichte von Sigmaringen.<br />
Zweifellos ist die Darstellung der Stadt Sigmaringen in alten<br />
Ansichten besonders reizvoll, weil es seit der Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts eine große Auswahl von Bildern der damaligen<br />
Residenzstadt gibt. Aus der Zeit vor 1800 sind nur wenige<br />
Abbildungen bekannt. Immerhin gibt eine kolorierte Federzeichnung<br />
auf der »Landtafel des oberen Donautals« von<br />
1587 einen Begriff von der mauerumgebenen Stadt mit dem<br />
stattlichen Schloß und dem weit entfernt liegenden Kloster<br />
Hedingen. Zwei Ölgemälde aus der Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
zeigen noch unverändert die »mittelalterliche«Ansicht<br />
von Sigmaringen.<br />
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwandelte sich das<br />
unbedeutende Städtchen in die Haupt- und Residenzstadt des<br />
souveränen Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen und<br />
wurde nun auch für Maler und Zeichner interessant. Es überwiegen<br />
zu dieser Zeit die graphischen Techniken wie Aquatinta<br />
und Lithographie. So z. B. Werke von Bleuler, Eggli,<br />
Obach und Emminger; aber auch Zeichnungen von Hofkavalier<br />
v. Mayenfisch, lithographiert von S. Lütz.<br />
Die ältesten erhaltenen Sigmaringer Fotografien stammen<br />
von Edwin Bilharz, der schon seit 1867 Erfolg mit seinen Fotografien<br />
von Kunstwerken des fürstlichen Museums hatte.<br />
1877 lieferte Mencke, Wandsbeck ausgezeichnete Fotos für<br />
den Fürstenhof. Seit 1880 gab es ca. 50 Jahre lang die Bilder<br />
von Foto-Kugler. Zeichnungen und Fotografien sind auch<br />
von Baurat Eduard Eulenstein (1841-1896) erhalten.<br />
Dem Bildteil vorangesetzt ist eine kurze Stadtgeschichte. Die<br />
einzelnen Bereiche der Stadt werden in sechzehn getrennten<br />
Kapiteln behandelt, denen jeweils eine kurze Einführung vorangestellt<br />
ist.<br />
Aus gutem Grund wurde das Jahr 1945 als Zäsur für »alte<br />
Ansichten« gesetzt, denn Sigmaringen hat seither seine Einwohnerzahl<br />
verdoppelt und sich auf den Höhen beiderseits<br />
der Donau ungehemmt ausgebreitet. Diese Veränderung<br />
wird anhand von Stadtplänen und Luftaufnahmen von 1806<br />
bis in die Gegenwart gezeigt.<br />
Mehr als zwanzig Gesamtansichten zeigen Stadt und Schloß<br />
im Lauf von über zwei Jahrhunderten. Gut dokumentiert ist<br />
z. B. der Schloßbrand von 1893 und der nachfolgende Wiederaufbau.<br />
Uberhaupt wird das Stadtbild vom Schloß und<br />
fürstlichen Bauten wie z. B. der Reithalle dominiert.<br />
Ein früher Anstoß für die Entwicklung der Stadt war der Bau<br />
der Antonstraße durch Fürst Anton Alois um 1810. Die anfangs<br />
recht bescheidene Bebauung wurde erst im Lauf der<br />
Zeit mit der Volksschule und dem Landeshaus »städtischer«.<br />
Aber nicht nur auf Bildern der Vorstadt ist die alte ackerbürgerliche<br />
Kultur noch zu spüren, auch auf dem Marktplatz<br />
stehen 1870 bäuerliche Leiterwagen und sonstiges Gerümpel<br />
herum.<br />
Sehr vornehm, eben fürstlich, nehmen sich dagegen der Leopoldplatz<br />
(früher Karlsplatz) mit Ständehaus und Prinzenbau<br />
und die Karlstraße aus. Zahlreiche Bauten der Karlstraße<br />
sind heute noch hervorragende Baudenkmäler des 19. Jahrhunderts.<br />
Zum Teil standen die Gebäude 1880/90 noch ganz<br />
in freier Landschaft (Abb. 162 u. 163).<br />
Wie z. B. die ehemalige Unteroffiziersvorschule, ist manches<br />
ganz verschwunden. Wer weiß noch, daß die Karlstraße einst<br />
von einer Brauerei »geziert« wurde? Vieles hat sich aber im<br />
Lauf der Zeit auch nicht zu seinem Vorteil verändert.<br />
Die Ausstattung des Buches läßt keine Wünsche offen, dank<br />
namhafter Zuschüsse zu einem moderaten Preis. Natürlich<br />
ist ein solches Buch immer Ergebnis einer Auswahl, aber man<br />
darf wohl sagen, daß das Thema nicht besser und vollständiger<br />
hätte behandelt werden können. B.<br />
Maren Kuhn-Rehfus, Werner Kuhn, »Sigmaringen in alten<br />
Ansichten«. 229 Bilder, davon 28 in Farbe, DM 39.-. Erschienen<br />
im Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen.<br />
OTTO H. BECKER<br />
Französische Quellen zum Kriegsende in Sigmaringen 1944/45<br />
Teill<br />
Bei der Erforschung der Geschichte der Vichy-Regierung<br />
und des Kriegsendes in Sigmaringen 1944/45 stieß der Verf.<br />
u. a. auch auf das von Jean-Luc Barré bearbeitete Buch »Réconquerir«<br />
(Wiedereroberung), in welchem eine Fülle von<br />
Schreiben von und an den Kommandeur der 1. Französischen<br />
Armee »Rhin et Danube«, Armeegeneral Jean de Lattre de<br />
Tassigny, aus der Zeit von 1944 bis 1945 ediert sind. Zwei<br />
Quellen aus dieser Publikation, welche die Einnahme der<br />
Stadt Sigmaringen zum Gegenstand haben, sollen in dieser<br />
<strong>Ausgabe</strong> der Hohenzollerischen Heimat in deutscher Übersetzung<br />
wiedergegeben und kurz kommentiert werden.<br />
1. Befehl des Armeegenerals de Lattre de Tassigny an General<br />
Bethouart vom 21. April 1945<br />
»Mein lieber Bethouart!<br />
Ich habe erfahren, daß Du in Donaueschingen (Brücke intakt)<br />
und in Tuttlingen bist und die Donau bei Mühlheim<br />
überquert hast.<br />
34
QJitttetiungen aug bcm<br />
Veranstaltungen im 4. Quartal <strong>1995</strong><br />
@efcf)tcf)tgt>eretn<br />
I. Vorträge im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg<br />
in Sigmaringen<br />
Dr. Casimir Bumiller,<br />
Bollschweil:<br />
»Die Hohenzollerische Landessammlung. Eine viel<br />
gerühmte, aber wenig beachtete museale Einrichtung«.<br />
Montag, 9. Oktober, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Landeshauses<br />
(Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
Dr. Otto Becker,<br />
Sigmaringen:<br />
»Die Kreisreform 1973 und Hohenzollern«<br />
Montag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Landeshauses<br />
(Antonstraße 11) in Sigmaringen.<br />
Auf vielfachen Wunsch wird die Vortragsreihe im Rahmen<br />
der Heimattage in Hechingen wiederholt.<br />
Prof. Dr. Wilfried Schöntag,<br />
Stuttgart:<br />
»Die schwäbischen und die brandenburgisch-preußischen<br />
Hohenzollern. Dynastische Verbindungen und<br />
deren politische Wirkkraft«.<br />
Montag, 13. November, um 20 Uhr im Hohenzollern-<br />
Saal der Kreissparkasse in Hechingen.<br />
Den 2. Vortrag der Reihe mit dem Thema »Die jüdischen<br />
Gemeinden Hechingen und Haigerloch« wird Herr Rektor<br />
Otto Werner beim Verein Alte Synagoge in Hechingen<br />
im Januar 1996, zu dem auch die Mitglieder des Hohenzollerischen<br />
<strong>Geschichtsverein</strong>s eingeladen sind, wiederholen.<br />
Der genaue Termin wird noch rechtzeitig in der<br />
Hohenzollerischen Heimat sowie in der Hechinger Lokalpresse<br />
bekanntgegeben.<br />
II. Gegenbesuch des Freiberger Altertumsvereins e. V.<br />
beim Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Vom 30. September bis 3. Oktober <strong>1995</strong> wird der Vorstand<br />
des Freiberger Altertumsvereins den Besuch einer<br />
Abordnung des Vorstandes und Beirates des Hohenzollerischen<br />
<strong>Geschichtsverein</strong>s vom 21. bis 23. Oktober<br />
vergangenen Jahres (vgl. Bericht von Herrn Dr. Vees in<br />
der HH Jg. 1994 S. 62 f.) erwidern.<br />
Dabei soll in Hechingen auch eine Zusammenkunft der<br />
Vorstandsmitglieder des Freiberger Altertumsvereins mit<br />
Mitgliedern des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />
stattfinden. Der genaue Termin und das Programm dieser<br />
Veranstaltung wird in der Hechinger und in der Sigmaringer<br />
Lokalpresse rechtzeitig bekanntgegeben.<br />
gez. Dr. Otto Becker<br />
Vorsitzender<br />
Bravo!<br />
Nun mit Vollgas nach Sigmaringen!<br />
Nach Mühlheim nimmst Du die nördlichen und südlichen<br />
Straßen nach Sigmaringen. Nach der Verbindungsstraße Tuttlingen<br />
- Stockach fährst Du über Meßkirch nach Sigmaringen.<br />
In Sigmaringen riegle alles ab und zwar mit Gewalt, stelle dazu<br />
einen zuverlässigen und entschlossenen Mann und jemand<br />
an seine Seite, der sofort die Politiker einsperrt und hülle Dich<br />
bis zu meiner Ankunft in Schweigen. Ich habe besondere Anweisungen<br />
von General de Gaulle.<br />
Danach fliege südlich der Donau nach Ulm auf irgendeinem<br />
Weg und mit allen Mitteln.<br />
Die Amerikaner werden uns vielleicht ausquartieren. Aber<br />
die Trikolore wird dort geweht haben.<br />
Das wird uns in nächster Zukunft helfen, Biberach, Memmingen<br />
und Kempten einzunehmen, was für unseren zukünftigen<br />
Stützpunkt in den Alpen unerläßlich ist.<br />
Ich beglückwünsche Dich für Deine schnelle, tatkräftige Aktion.<br />
Mehr denn je vertraue ich Dir und Deinen wunderbaren<br />
Untergebenen.<br />
Richte an alle, an Deinen Stabschef, an de Hesin, an Sudre,<br />
an Lebel meine herzliche Dankbarkeit aus.<br />
Übermittle allen Deinen tapferen Truppen meine Bewunderung<br />
und meine Dankbarkeit.<br />
Das ist eine prächtige Leistung auf französische Art!<br />
Ganz herzlichst«<br />
Nach dieser Quelle bestand der Hauptauftrag an General<br />
Bethouart darin, so schnell wie möglich Sigmaringen einzunehmen,<br />
um dort die »Politiker« einzusperren. Dabei konnte<br />
es sich nur um die Angehörigen der Vichy-Regierung handeln.<br />
Bemerkenswert dabei ist, daß der französischen<br />
Führung damals noch nicht bekannt war, daß die Angehörigen<br />
der Vichy-Regierung Sigmaringen bereits verlassen hatten.<br />
Bekanntlich wurde Marschall Petain als letzter Vertreter<br />
der Kollaborateure am 21. April 1945 um 4 Uhr in der Frühe<br />
am Sigmaringer Schloß abgeholt und zunächst nach Wangen<br />
im Allgäu verbracht.<br />
Zum anderen war Bethouart beauftragt, mit größter Eile nach<br />
Ulm vorzudringen. Der Zweck dieser Operation bestand eindeutig<br />
darin, den Franzosen in Oberschwaben, im Allgäu und<br />
in den Alpen Faustpfänder für die späteren Verhandlungen<br />
mit den Amerikanern über die Einrichtung der französischen<br />
Besatzungszone in Süddeutschland zu verschaffen.<br />
2. Rechenschaftsbericht des Generals Bethouart über die Einnahme<br />
der Stadt Sigmaringen vom 22. April 1945<br />
»Nachdem Sigmaringen diesen Morgen gegen 11 Uhr durch<br />
den Verband Vallin von der 1. Panzerdivision eingenommen<br />
worden ist, begab ich mich ebenfalls dorthin, um eventuell<br />
nötige Maßnahmen zu ergreifen. Bis zu meiner Ankunft hat<br />
mir Kommandant Vallin Rechenschaft gegeben, daß kein<br />
Franzose in Sigmaringen geblieben war mit Ausnahme einiger<br />
vereinzelter Milizionäre, die sich verstecken konnten, und<br />
daß er im Begriffe sei, dem nachzugehen.<br />
35
Ich habe das Schloß und die Appartements des Marschalls<br />
und seines Gefolges besucht. Es zeigte eine ziemlich überstürzte<br />
Abreise, die Visitenkarten waren noch an den Türen,<br />
aber kein Archiv war zu finden. Der Marschall, der den<br />
Wunsch geäußert hatte, in Sigmaringen zu bleiben, war auf<br />
Anordnung des deutschen Botschafters abgereist, der ihn gestern<br />
am 21. April um 4 Uhr morgens im Auto mit der Marschallin<br />
und ihrem letzten Personal, das bei ihnen geblieben<br />
war, begleitete; die viertausend Franzosen, Milizionäre und<br />
andere, hätten die Gegend seit einigen Tagen verlassen.<br />
Im Sigmaringer Schloß lebten der Marschall und die Marschallin,<br />
der General Bridoux, der General Debeney, die Herren<br />
de Brinon, Déat, Luchaire, Darnand, Admirai Bléhaut.<br />
Nach den Wächtern des Schlosses und den Einwohnern sollen<br />
sie sich über Kempten nach Garmisch begeben haben mit<br />
Ausnahme von Darnand, der nach Italien mit dem Vorhaben<br />
abgereist sein soll, nach Frankreich zurückzukehren, um sich<br />
dort einer Widerstandsgruppe anzuschließen, die in der Gegend<br />
von Besançon bestehen soll.<br />
Ich habe im Schloß in Sigmaringen den Prinzen Ernst von<br />
Sachsen getroffen, dessen Frau eine von Hohenzollern ist. Er<br />
ist unmittelbar nach der Abreise des Marschalls in das Schloß<br />
zurückgekehrt. Er hat mir erklärt, daß zwei seiner Stiefschwestern<br />
(belles-soeurs) von den Nazis ins Konzentrationslager<br />
verbracht worden sind und daß die Zivilbevölkerung<br />
darüber erzürnt sei, die Fortsetzung eines Kampfes ohne<br />
Hoffnung mitanzusehen, und daß selbst viele Nazis die<br />
Fortsetzung des Kampfes lächerlich fänden. Darüber hinaus<br />
hat er mich gebeten, ob es möglich wäre, diese guten Neuigkeiten<br />
und die seiner Kinder der Großherzogin von Luxemburg<br />
zu telefonieren, die seine Schwägerin sei, von welcher<br />
er seit fünf Jahren getrennt sei.<br />
P.S.: Eine Sendeanlage von großer Stärke in der Nähe von Sigmaringen<br />
ist völlig zerstört vorgefunden worden.«<br />
Der Bericht des Generals enthält einige interessante Fakten.<br />
So hatten sich offensichtlich nicht alle Milizionäre flüchten<br />
können. Durch diese Nachricht wird der Bericht von Klara<br />
Steidle abgestützt, wonach im Prinzengarten Milizionäre erschossen<br />
wurden. Wichtig ist auch der Hinweis, daß die Mitglieder<br />
der Vichy-Regierung bzw. der »Kommission für die<br />
Verteidigung der nationalen Interessen« keine schriftlichen<br />
Unterlagen zurückgelassen hatten.<br />
Der Bericht, wonach Staatspräsident Pétain in Sigmaringen<br />
bleiben wollte, dann aber auf Weisung des deutschen Botschafters<br />
Reinebeck abreiste, ist durchaus glaubwürdig. So<br />
hat der damals 89jährige Marschall die sichere Schweiz, die<br />
ihm am 24. April die Einreise gestattet hatte, am 26. April<br />
1945 wieder verlassen, um sich in Frankreich den Justizbehörden<br />
zu stellen. Übertrieben ist jedoch die Angabe, daß<br />
sich 4000 Franzosen in Sigmaringen und Umgebung befunden<br />
haben sollen. Nach heutigen Erkenntnissen dürfte selbst<br />
in der Endphase des Krieges die französische Kolonie kaum<br />
die Zahl von 2000 Personen überschritten haben. Wertvoll<br />
sind auch die Ausführungen des Prinzen Ernst Heinrich von<br />
Sachsen (1896-1971), der übrigens ein Bruder der Fürstin<br />
Margarete von Hohenzollern (1900-1962) war, wonach die<br />
deutsche Bevölkerung und selbst Nazis die hoffnungslose<br />
Fortsetzung des Kampfes ablehnten.<br />
Bei der Zerstörung der Donaubrücke in Laiz sowie der Laizer-<br />
und der Sägebrücke durch die Deutschen unmittelbar<br />
vor dem Einmarsch der Franzosen ist es nicht geblieben. Vor<br />
dem anrückenden Feind wurde, wie wir aus dem Post Scriptum<br />
erfahren, ferner eine starke Sendeanlage bei Sigmaringen<br />
zerstört. Dabei handelt es sich vermutlich um die Anlage auf<br />
dem Nonnenhof bei Laiz, wo die militärische Abwehr unter<br />
Admirai Canaris eine Abhör- und Sendeanlage unterhielt.<br />
Quellennachweis<br />
Réconquérir 1944-1945. Textes réunis et présentés par Jean Luc Barré.<br />
Paris 1985.<br />
Klara Steidle: Die Kongregation der Schwestern der christlichen Liebe<br />
in Sigmaringen. Eine Chronik in 5 Bänden. Teil 5: Marien-Lyzeum<br />
1935-1954. Masch. Sigmaringen (1984).<br />
Literaturnachweis<br />
Henry Rousso: Un château en Allemagne. La France de Pétain en exil<br />
Sigmaringen 1944-1945. Paris 1980.<br />
XAVER PFAFF<br />
Zum Frühwerk des Sigmaringer Malers Meinrad von Au (1712-1792)<br />
Unter dem Einfluß der Ideen und Praktiken des aufgeklärten<br />
Absolutismus verfügte der österreichische Monarch Josef<br />
II. im Oktober 1781 die Aufhebung aller Orden, die durch<br />
ihren beschaulichen Charakter zur Stärkung des Staates<br />
nichts beitrügen. Lange vor Eintritt der allgemeinen Säkularisation<br />
bedeutete so das Jahr 1782 auch das gewaltsame Ende<br />
für die hohenzollerischen Klöster Laiz und Gorheim bei<br />
Sigmaringen, in denen franziskanische Terziarinnen nahezu<br />
ein halbes Jahrtausend gelebt und gewirkt hatten. Der Klosterbesitz<br />
wurde in den Folgejahren zugunsten des vorderösterreichischen,<br />
seit 1806 hohenzollerischen Religionsfonds<br />
veräußert.<br />
Laut den Eintragungen in einem Verkaufsprotokoll des fürstlichen<br />
Rentamtes vom 9. Januar 1815 wurde ein Großteil des<br />
Inventars der Gorheimer Michaelskapelle öffentlich versteigert.<br />
Die zwei Nebenaltäre »mit Ausnahme eines Altarblatts,<br />
den hl. Anton darstellend«, gelangten nach Harthausen/Scher,<br />
die »Bildnisse der 12 Apostel, auf Leinwand<br />
gemahlt«, nach Sigmaringendorf, »ein hl. Veit und 4 Tafeln«<br />
nach »Schmeihen«, »ein Bild des hl. Rochus, 1 hl. Anna« nach<br />
Laiz, die Kirchenstühle und zwei große Reliquientafeln in die<br />
Pfarrkirche von Sigmaringen. Den Zuschlag für den Hochaltar,<br />
1782 noch »St. Michels Altar« genannt, die Chorstühle<br />
und die Kreuzwegstationen hatte für 68 Gulden die Heiligenpflegschaft<br />
der Nikolauskirche von Veringenstadt erhalten.<br />
Der Altar wurde dort anstelle des abgebrochenen Hochaltaraufbaues<br />
vom Sigmaringer Schreiner Fidel Schreiber neu<br />
erstellt. Da kein Altar dieser Kirche dem hl. Michael gweiht<br />
war, mußten die Blätter des Gorheimer Altares eine andere<br />
Verwendung gefunden haben. Es spricht alles dafür, daß das<br />
zentrale Gorheimer Hochaltarblatt zu einem ungewissen<br />
Zeitpunkt in die Friedhofs- und Wallfahrtskirche Deutstetten<br />
überführt worden ist. In jener früheren Pfarrkirche von<br />
Veringenstadt hängt nämlich an der Nordseite des Langhauses<br />
ein auf Leinwand gemaltes Ölbild, in dem großformatig<br />
der Erzengel Michael dargestellt ist. Eine thematische Bezie-<br />
36
hung zur Deutstetter Kirche ergibt sich deshalb, weil<br />
Michael von alters her als Patron der Verstorbenen verehrt<br />
wurde und weil der Michaelistag infolgedessen in<br />
Deutstetten ein wichtiger Wallfahrtstag war.<br />
Das Tafelbild bleibt unter den bekannten Stiftungen<br />
für die Wallfahrtskirche unerwähnt. Die Bildmaße<br />
(H. 1,94 m, B. 1,38 m), der offensichtlich beschnittene<br />
Zustand und der in späterer Zeit angefügte schlichte<br />
Rahmen weisen das Gemälde als ehemaliges Altarblatt<br />
aus. Die ursprüngliche Verwendung als Altarblatt in<br />
der Kirche ist ausgeschlossen. Walther Genzmer datierte<br />
das Gemälde in die Mitte des 18. Jahrhunderts.<br />
Die schlechte Bilderhaltung erlaubte eine ikonographische<br />
Deutung erst nach der Erstellung von Detailaufnahmen.<br />
Die dominierende Gestalt in der Bildmitte ist der auf<br />
einem wuchtigen Wolkenband stehende Erzengel<br />
Michael, welcher in der Rolle des Paradiesvorstehers<br />
in der hochgestreckten Linken eine Seelenwaage hält.<br />
Als Seelenwäger wird Michael erst seit dem Hochmittelalter<br />
abgebildet. In Harnisch und Helm gekleidet,<br />
trägt er in seiner Rechten das Flammenschwert als Zeichen<br />
seines Sieges über den Satan. Links von ihm sitzt<br />
Christus, eine Lilie haltend, die ihn als unschuldiges<br />
Lamm Gottes kenntlich macht. Ein Band mit der verdeckten<br />
Aufschrift »Agnus Dei« unterstreicht diese<br />
Eigenschaft Christi ebenso wie das dargestellte Lamm<br />
als Attribut des rückseitig abgebildeten Johannes Baptista,<br />
der sich mit Christus im Zwiegespräch befindet.<br />
Die Wiedergabe Johannes des Täufers ist in zweierlei<br />
Hinsicht nicht zufällig: Zum einen wird er in vielfältiger<br />
Weise zusammen mit Michael in Weltgerichtsszenen<br />
als »Vorläufer« Christi nachgebildet, zum anderen<br />
deutet seine Anwesenheit schon auf die Auftraggeber<br />
des Bildes hin. Denn rechts von Michael steht in<br />
schwarzem Ordenshabit der hl. Franziskus mit dem<br />
auf seine Stigmatisation bezogenen Kruzifix in Händen.<br />
Franz von Assisi, dessen eigentlicher Taufname<br />
Johannes Baptista lautete, hegte zu seinem ersten Namenspatron<br />
zeitlebens eine besondere Verehrung,<br />
weshalb beide des öfteren gemeinsam dargestellt wurden. Der<br />
Ordensgründer wird als Fürbitter in das Bildgeschehen einbezogen.<br />
Etwas versteckt hinter Franziskus ist die hl. Klara von Assisi<br />
mit einer Lilie als ihrem individuellen Attribut wiedergegegeben.<br />
Ihre Darstellung im Verein mit derjenigen des hl.<br />
Franziskus entspricht der ordenseigenen Ikonographie und<br />
bildet einen deutlichen Beleg dafür, daß das Deutstetter<br />
Gemälde franziskanische Auftraggeber hatte. Obwohl die Figur<br />
der Ordensheiligen im Bildaufbau nahezu untergeht, unterscheidet<br />
sie sich in theologischer Hinsicht von den übrigen<br />
heiligen Gestalten: Sie hat das Privileg, dasselbe Attribut<br />
zu tragen wie Christus. Hierdurch wird absichtlich ihre Bedeutung<br />
hervorgehoben, denn Christus wird in der Eigenschaft<br />
des Gotteslammes ansonsten nicht zwangsläufig mit<br />
einer Lilie versinnbildlicht.<br />
Links oben erkennt man unter einer Schar Putten die Heilige<br />
Dreifaltigkeit in der eigenwilligen Form von drei gleichgebildeten<br />
bekrönten Jünglingen, die gesondert Kreuz, Taube<br />
und Weltkugel in Händen tragen. In der christlichen Kunst<br />
taucht die Abbildung der Trinität als drei gleichgebildete Gestalten<br />
seit dem 9. Jahrhundert auf. Dabei bestand jedoch immer<br />
die Gefahr, daß die Künstler den dogmatischen Boden<br />
der kirchlichen Glaubenslehre verlassen. Papst Benedikt<br />
XIV. hat 1745 vor solchen Darteilungen gewarnt und die Wiedergabe<br />
des Heiligen Geistes allein als Jüngling sogar verboten.<br />
In der farblichen Ausführung sticht vor allem das eindringliche<br />
Türkis im Harnisch des Erzengels ins Auge, das sich im<br />
r .<br />
Jr<br />
Hl.<br />
v mi ;<br />
kk ?<br />
A ' . ! 5<br />
Michael als Seelenwäger, ehemaliges Hochaltarblatt der Michaelskapelle<br />
des früheren Tertiarinnenklosters Gorheim in der Wallfahrtskirche Deutstet<br />
Bildhintergrund wiederholt. Bemerkenswert ist auch die Erscheinung<br />
des Johannes Baptista als dunkle, beschattete<br />
Rückenfigur. Joseph Ignaz Wegscheider (1704-1759) verwandte<br />
mit Vorliebe diese Gestaltungsmittel in seinen Werken.<br />
Allein die im Tafelbild sichtbaren kompositioneilen<br />
Schwächen verweisen auf einen anderen Künstler. Neben<br />
dem Mangel an räumlicher Tiefe wirken besonders die Assistenzfiguren<br />
im gestischen Ausdruck undynamisch und statisch<br />
zusammengefügt. Darüber hinaus führt die Rückenfigur<br />
inhaltlich nicht in das Bildgeschehen ein und trägt auch<br />
nicht zur Perspektive bei. In der Behandlung des Lichts läßt<br />
sich dennoch bereits eine künstlerisch hochwertige Hand ersehen.<br />
Meinrad von Au, der während seiner Ausbildungszeit mit<br />
Wegscheider zusammengetroffen sein mußte, hat in seinen<br />
eigenen Werken vorzugsweise die Abbildung von Rückenfiguren<br />
übernommen. In Abhängigkeit von Wegscheider<br />
steht auch das Türkisblau als vorherrschende Farbstufe in einem<br />
Votivbild der Pfullendorfer Wallfahrtskirche Maria<br />
Schray. Das Ölbild aus dem Jahre 1742 stellt die früheste<br />
bekannte Arbeit des Malers in dieser Technik dar. Jener Farbton<br />
verliert sich im späteren Œuvre.<br />
Kennzeichen der Kontrastgestaltung in der Malweise Wegscheiders<br />
und Franz Joseph Spieglers (1691-1757) ist ferner<br />
der von links oben kommende Lichteinfall. Das Merkmal findet<br />
sich im Gesamtwerk des Sigmaringer Malers wieder. Im<br />
Deutstetter Tafelbild ist die verdeckte Lichtquelle gleichermaßen<br />
plaziert und beleuchtet den Erzengel so stark, daß sich<br />
an Harnisch und Helm Lichtreflexe bilden. Die Handschrift<br />
37
Meinrads von Au zeigt sich desgleichen an den langen schlanken<br />
Fingern des Christus und in der Bearbeitung der Physiognomien<br />
des hl. Michaels und der hl. Klara, die mit vorgewölbter<br />
Stirm und schwungvoll betonter Nasenwurzel erscheinen.<br />
Typisch außerdem die erhobenen Hände der Personen<br />
der Dreifaltigkeit, bei denen die abgespreizten kleinen<br />
Finger unnatürlich wirken (vgl. besonders Christus im Chorfresko<br />
der Pfarrkirche St. Johann in Sigmaringen). Solche anatomischen<br />
Verzeichnungen sind unter anderem in der Entwurfsskizze<br />
und in der Ausführung des 1741 geschaffenen<br />
Langhausfreskos der Pfarrkirche von Harthausen/Scher zu<br />
entdecken.<br />
Bei der Bearbeitung der Gewänder verwandte der Maler, wie<br />
beim Erzengel und den Personen der Dreifaltigkeit, gerne<br />
eckig bewegte Tücher und spitz auf den Knöchel zulaufende<br />
Zipfel. Die Wiedergabe der übermäßig großen und hohen<br />
Puttenköpfe erinnert stark an die Darstellungsweise in Benzingen<br />
(Pfarrkirche, südlicher Seitenaltar) oder Otterswang<br />
(Pfarrkirche, Hauptdeckenfresko). Dasselbe gilt für die<br />
Durchführung der Beinstellung des hl. Michael im Vergleich<br />
mit derjenigen des hl. Sebastian in Harthausen/Scher (Pfarrkirche,<br />
südlicher Seitenaltar).<br />
Augenscheinlich ist, daß nur der Erzengel und Klara mit hellem<br />
Inkarnat abgebildet sind, während die übrigen Gestalten<br />
eine dunklere, bräunliche Fleischfarbe aufweisen. Einen derartig<br />
auffallenden Kontrast zur Betonung der Protagonisten<br />
trifft man vornehmlich in den frühen Werken des Meinrad<br />
von Au sehr häufig an.<br />
Auf die Darstellung des Heiligen Geistes als Jüngling verzichtete<br />
unser Maler in all seinen übrigen Bildern. In einem<br />
frühen Andachtsbild hat er ein weiteres Mal den Heiligen<br />
Geist in menschlicher Gestalt abgebildet, wofür wiederum<br />
klösterliche Auftraggeber verantwortlich waren. Daß dabei<br />
der Heilige Geist in Gestalt einer Frau gemalt wurde, könnte<br />
am originellen Bemühen liegen, das päpstliche Verbot von<br />
1745 zu unterwandern.<br />
Bis zur Jahrhundertmitte ließ von Au einen ausgesprägten<br />
Sinn für die Einzelgestalt in kraftvollen Farben erkennen. Jene<br />
Auffassung verrät auch das Deutstetter Bild. In den späteren<br />
Arbeiten schwand die Vorliebe für starke Farben. Sein<br />
volles kompositionelles Vermögen konnte der Maler eigentlich<br />
nur als Freskant ausschöpfen.<br />
Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die Veringenstädter<br />
Wallfahrtskirche seit dem 18. Jahrhundert von Eremiten betreut<br />
wurde, die dem 3. Franziskanerorden angehörten. Sie<br />
kommen als Auftraggeber deshalb nicht in Frage, weil das Tafelbild<br />
nicht für die Kirche geschaffen war. Zudem sind die<br />
einfachen Laienbrüder erst seit 1753 nachgewiesen.<br />
Schon Franz Anton von Au (1672-1715), der Vater unseres<br />
Künstlers, war von den Gorheimer Konventsfrauen 1699 mit<br />
der Neufassung der Seitenaltäre und 1715 mit der des Hochaltares<br />
betraut worden. Es ist anzunehmen, daß der Faßmaler<br />
noch für weitere, unbedeutendere Arbeiten herangezogen<br />
worden ist. So verwundert es nicht, wenn eine Generation<br />
später in einem Aufhebungsinventar vermerkt ist, die Gemälde<br />
in den Konventszimmern seien »zum theil von Ow gemacht«.<br />
Weiterhin heißt es in den Inventaren bei der Einschätzung<br />
des Hochaltars jedesmal: »Ist von dem Mahler zu<br />
Sigmaringen taxiert worden«. Weder bei den Nebenaltären<br />
noch beim übrigen Inventar wurde ein solcher Zusatz angemerkt.<br />
Daß mit dem »Maler zu Sigmaringen« Meinrad von<br />
Au gemeint war, liegt auf der Hand. Denn in den achtziger<br />
Jahren war der Künstler längst zur berühmten Malerpersönlichkeit<br />
avanciert, aus dessen Schatten Johann Fidelis Wetz<br />
(1741-1820), der andere Sigmaringer Maler aus jener Zeit, erst<br />
nach dem Tode Meinrads von Au treten konnte.<br />
Preußen in Hohenzollern<br />
Eine Ausstellung im Staatsarchiv Sigmaringen<br />
Die Ausstellung wurde vom Staatsarchiv Sigmaringen<br />
und vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg gestaltet.<br />
Das Staatsarchiv zeigt zahlreiche Exponate zur<br />
hohenzollerischen Geschichte und den Beziehungen zu<br />
Preußen, wie man sie in dieser Form noch nie gesehen<br />
hat. Auch das ausgestellte Bildmaterial ist einmalig. Der<br />
Begleitband zur Ausstellung erschien im Thorbecke<br />
Verlag und bietet Gelegenheit, die ausgestellten Dokumente<br />
in Ruhe nachzulesen. Der Band ist mit zahlreichen<br />
Abbildungen ausgestattet.<br />
Öffnungszeiten: Noch bis 29. Oktober täglich 10 bis<br />
17 Uhr außer Montag.<br />
Kult und Wohnen in den<br />
Höhlen des oberen Donautals<br />
Eine zweite Ausstellung aus Anlaß der Heimattage Baden-Württemberg<br />
in Sigmaringen ist in der Alten Schule<br />
zu sehen. Sie zeigt die Leistungen moderner Archäologie<br />
an den Ergebnissen der Grabungen in den Höhlen<br />
des Donautals in den letzten Jahrzehnten. Die Ausstellung<br />
ist ebenfalls hervorragend gestaltet und sehr<br />
sehenswert.<br />
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10 bis 12 Uhr,<br />
Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr, noch bis 29. Oktober.<br />
Dementsprechend steht in einem Laizer Aufhebungsinventar<br />
bei der Wertschätzung des Gnadenaltars, den Meinrad von<br />
Au 1771 gefaßt hatte, der Zusatz: »Von dem Sigmaringer<br />
Mahler von Ow taxiert«.<br />
Ein weiteres Tafelbild, das auf die Hand Meinrads von Au<br />
weist, wird in einer Abstellkammer in der Pfarrkirche von Inneringen<br />
verwahrt. Obgleich das Gemälde einer dringenden<br />
Konservierung bedürfte, ist man überrascht vom stellenweise<br />
frisch wirkenden Kolorit und von der Ästhetik des Bildaufbaus.<br />
Das hohenzollerische Kunstdenkmälerwerk gab als<br />
Entstehungszeit lediglich das 18. Jahrhundert an. Dargestellt<br />
ist die Himmelfahrt Mariens, seit dem Spätbarock ein beliebtes<br />
Thema in der sakralen Kunst.<br />
Maria schwebt in Orantenhaltung über dem offenen Sarkophag.<br />
Die Mondsichel, auf der sie mit einem Fuß steht, verleiht<br />
ihr Züge des apokalyptischen Weibes. Der Sternenkranz<br />
über ihrem Haupt und die verherrlichenden Engel deuten sie<br />
aber in erster Linie als Immaculata Conceptio, das heißt als<br />
Unbefleckte Empfängnis. In typischer Weise ist die Himmelfahrt<br />
mit dem Akt der Krönung verknüpft. Von den zwölf<br />
Aposteln, die um den leeren Sarkophag gruppiert sind, werden<br />
Petrus mit dem Schlüssel, Paulus mit spitzem Bart und<br />
Johannes mit dem Buch traditionsgemäß in den Vordergrund<br />
gerückt. Direkt hinter dem Sarkophag steht in dunkler Barttracht<br />
Jakobus, der ahnungsvoll gegen den Himmel zeigt.<br />
Aus der Bildkomposition in der Form eines Andreaskreuzes,<br />
in dessen Schnittpunkt sich Maria befindet, läßt sich bei diesem<br />
Gemälde eine stärkere Abhängigkeit von Spiegier ableiten.<br />
Die auffahrende Maria ist in Haltung und Farbigkeit eine direkte<br />
Kopie oder vielleicht aufgrund der höheren Qualität<br />
38
eine Vorlage der Mariendarstellung des bereits zitierten Andachtsbildes<br />
(Sigmaringen, Heimatmuseum), das Meinrad<br />
von Au im Jahre 1746 sehr wahrscheinlich im Auftrag des<br />
Augustinerinnenklosters Inzigkofen gemalt hat. Für die Gewänder<br />
von Petrus und Johannes verwendete von Au um 1765<br />
im Deckenfresko »Maria Himmelfahrt« (Mörsingen, Pfarrkirche)<br />
dieselben Grundfarben wie im Inneringer Tafelbild.<br />
Besonders bei Johannes erkennt man ungeachtet der Verschiedenheit<br />
des Werkstoffes das übereinstimmende Lachsrot<br />
des Obergewandes und das gelbgehöhte Grün des Untergewandes.<br />
In beiden Abbildungen zeigt dieses Untergewand<br />
den einzigen deutlichen Grünton im gesamten Bildaufbau.<br />
Das Inneringer Tafelbild weist auch die übrigen Eigentümlichkeiten<br />
der Malweise von Au's auf: Die links oben plazierte<br />
verdeckte Lichtquelle, das helle Inkarnat der Maria und die<br />
im Kontrast stehende bräunliche Fleischfarbe der Assistenzfiguren,<br />
die in die Stirn ragenden Nasenwurzeln bei Johannes<br />
und Petrus, die extrem gefächerte Fingerstellung der<br />
linken Hand Petri, der filigrane Zeigegestus des Jakobus (vgl.<br />
u. a. das Deckenfresko neben der Kanzel in der Haigerlocher<br />
Schloßkirche), die Betonung der Augenlider des Johannes<br />
(vgl. die Ölskizze »Apostelspeisung« in Senden, Privatbesitz),<br />
die hohe und vorgewölbte Stirn des Petrus und Paulus<br />
oder etwa die Kopfform der Putten am rechten oberen<br />
Bildrand.<br />
Da die kräftig gefärbten Hauptfiguren sehr intensiv beleuchtet<br />
sind und dadurch starke Hell-Dunkel-Kontraste erzeugt<br />
werden, darf man eine frühe Arbeit des Malers annehmen.<br />
Der beiderseits angedeutete Architekturrahmen zeigt die Absicht<br />
des Künstlers, Raumtiefe zu erzeugen, obwohl das nur<br />
wenig gelungen ist. Immerhin legt dieser gestalterische Fortschritt<br />
den Schluß nahe, daß das Bild zeitlich nach dem Deutstetter<br />
Gemälde entstanden ist.<br />
Die Bildmaße (h 2,10 m, br 1,15 m) und die Form der erhaltenen<br />
Umrahmung kennzeichnen das Tafelbild ebenfalls als ehemaliges<br />
Altarblatt, das für die Inneringer Pfarrkirche nicht gemalt<br />
sein konnte. Außerdem war der Patroziniumswechsel der<br />
Inneringen Maria Himmelfahrt
früheren Inneringer Liebfrauenkapelle der jetzigen Kreuzkapelle,<br />
zur Entstehungszeit des Bildes bereits vollzogen.<br />
Der Hochaltar der Pfarrkirche im nahegelegenen Harthausen/Scher<br />
ist seit 1742 zu Ehren der in den Himmel aufgefahrenen<br />
Jungfrau Maria konsekriert. Nach einem Eintrag der<br />
dortigen Heiligenrechnungen vom 20. Januar 1747 wurden<br />
»Herrn Meinrad von Au, Mahler in Sigmaringen, für beide<br />
Aldar blätter in den Hoch Aldar« 70 Gulden bezahlt. Weiter<br />
ist zu lesen: »Da die Mahler das Aldar blatt gebracht, selbes<br />
aufgezogen und in den Aldar hinein gericht, Verzöhrt worden,<br />
35 Kreuzer«. Die Altarblätter mußten demnach schon<br />
im Jahre 1746 gemalt worden sein.<br />
Im Jahre 1901 wurde das große Hochaltarblatt entfernt und<br />
durch ein anderes Gemälde ersetzt. Das ursprüngliche Altarblatt<br />
ist seither verschollen. Noch vor der Jahrhundertwen-<br />
de wurde es als Werk des Sigmaringer Malers erkannt. Das<br />
durch unsachgemäße Überarbeitung stark verfälschte Auszugbild<br />
mit der Darstellung des hl. Wendelin hängt heute an<br />
der Südseite des Langhauses.<br />
Das in Inneringen aufbewahrte Tafelbild könnte durchaus<br />
mit dem ehemaligen Harthauser Hochaltarblatt identisch<br />
sein. Dafür sprächen neben dem möglichen Entstehungsjahr<br />
die Maße des Harthauser Barockretabels und die erhaltene<br />
Rahmenform des Auszugbildes. Weitere archivalische Auskünfte,<br />
die einen Zusammenhang erhärten könnten, ließen<br />
sich bislang nicht auffinden.<br />
(Interessenten können eine Kopie des Manuskripts mit zahlreichen<br />
Anmerkungen, Quellen und Literaturangaben bei der<br />
Schriftleitung anfordern - bitte 3,- DM Porto beilegen).<br />
JOSEF SCHULER<br />
Josefs-Dag im »Cive«<br />
Vorbemerkung<br />
der Schriftleitung<br />
Früher fiel der »Cive« jedem Autofahrer auf, der durch Jungingen<br />
kam, denn auf dem Dach stand mit riesengroßen<br />
Buchstaben »Cive« und kein Fremder konnte sich vorstellen,<br />
was Cive bedeutete. Vor mehr als 30 Jahren wurde das alte<br />
Haus abgebrochen. In diesem Jahr feiert der Kirchenchor von<br />
Jungingen sein 215 -jähriges Jubiläum. Dem Chor wird zu diesem<br />
Jubiläum am 19.11.<strong>1995</strong> die Zelter-Plakette und die Palestrina-Medaille<br />
verliehen. Der Autor der »Junginger Dorfgeschichten«,<br />
Josef Schuler, ist Ehrenmitglied des Junginger<br />
Kirchenchores und er schildert, wie die fünf Josefe des Kirchenchores<br />
früher im »Cive« ihren Namenstag feierten.<br />
Josefs-Dag<br />
im »Cive«<br />
»Singe, wem Gesang gegeben!«<br />
Drum bin-e mit 18 Johr au e-da Kircha-Chor eidreatte - und<br />
it weage da Mädle, wia ma vielleicht moana mecht. S hett jo<br />
schließleg sei kenna, denn seallmol hot-s nu junge Menscher<br />
gea im Chor, mo beim Heira wiedr ausgschieda sind.<br />
S isch koa leichte Zeit gsei sealmol am End dr zwanzger Johr.<br />
Am Freitegzobed no zwua Schdund Gsangbrob isch d Gurgl<br />
ausdrickned gsei, und ma hett se geann im »Hiisch« aweng<br />
aagfeichted, abr do hot dr Gealdseggl it mitdau. Also hot ma<br />
»dreimol leer gschluckt« und isch dapfer hoa-maschiert. D<br />
Mädle sind drweil Arm in Arm schdroßnuf - schdroßna flaniert<br />
und hand Volksliadr gsunga. Isch no zuafällig amol a<br />
Auto kumma, sind se ausgschweekt und schbaliergschdanda.<br />
Aber »keine Regel ohne Ausnahme!«<br />
Am odr um da Josefsdag, do isch d Prob kiezr woara, und ma<br />
hot nohear mitenand Namensdag gfeired. Mr häne nämleg<br />
under deam Dutzend Manna it weniger als feif Josef ghett: da<br />
Eibaseppl, Gummiseppl und Schneiderseppl, da Heizelmaa-<br />
Josef und da Clemens. Dear hot au Josef ghoaßa, abr ma hota<br />
no seim Vaddr gschria. Und no isch ma zum »Cive« ganga,<br />
weil dear au a Josef gsei isch.<br />
Abr iebr da »Cive« mues i zeschda no a baar Woat vrliara:<br />
Voar 1888, mo d Landschdroß ge Killer no iebr d Schitte gloffa<br />
und s Obrdoarf no a Sackgaß gsei isch, hot des Wietschäftle<br />
i-dr Kurf dinn no »Zur schönen Aussicht« ghoaßa. Dr jung<br />
Wiet Josef Bumiller hot se seallmol um a Sagg-Geald umgsea<br />
und fier en Hoagrlochr Juda Hasa-, Goaßa- und andre Felle<br />
uffkauft. Dear Jud hot Cive ghoaßa. Merked-r jabbes? Dear<br />
Nama isch bald am Wiet und a-dr Wietschaft hanga blieba<br />
und schließleg am Wietshaus-Giebl gschdanda. Ma isch in<br />
»Cive« ganga. Des isch a alte, oafache, kleine, needere, vrraichte,<br />
abr au saubere, hoammelige, gmüetlege »Boiz« gsei,<br />
dia alt und jung, reich und arm, Männlein und Weiblein aazoga<br />
hot. Am Samschdeg-Zmittag isch sogar d Prominenz -<br />
dr Vogt, Lehrer und Fabrikanta- am Schdammdisch gseatza.<br />
Fier vill Viehgässer, Schittemer und Obrdiarfr, dia nachts uff<br />
em Hoaweag gsei sind, isch des »eweg Liechtle« im »Cive«<br />
zua-ma Hindrnis woara, um des se fäschd it rumkumma sind.<br />
Dr »Kibitz« isch amol mannhaft anera vrbei kumma, no hotr<br />
no zwanzg Mättr umkehrt und zua se sealbr gsait: »Des isch<br />
en Schoppa weat!« (Im »Cive« nadierleg!) Ma hot da Wiet<br />
mega, - i sieh en heit no neabed seira Porzella-Pfeif naus<br />
schmunzla - und sei Dechterle, d »Cive-Luis«, isch a Leabe<br />
lang mit dr Wietschaft vrheired gsei, obwohl-s a Freier it<br />
gfehlt hot.<br />
Wear s eschd mol da »Cive«bsuecht hot, isch glei mittla e-d<br />
Wietschaft nei-gschdolpered. S isch nämleg vom Hof aus a<br />
diafe Schdäffel na-ganga. Zwee oafache Disch mit Schdial, a<br />
kleine Theke, a Gloadr-Reacha und a Kanona-Ofele - des<br />
40
isch de ganz Ausschdatting gsei. Dischdiecher hot ma schbara<br />
kenna, se hette beim Kata-schbiela nu ghindered. A da<br />
Feaschdr sind kleine Schbannerle ghanged, und nachts hot<br />
ma Rollo ra-zoga. Jagd-Szena druff-danna hand da Wiet als<br />
Jäger ausgwiesa. R hot also s Reacht ghett, a Jagdgwehr schbaziera<br />
z-draga. Weiter isch iebr dia Leideschaft it vill bekannt<br />
gsei. (D Reh und Hasa hand drweil Wilderer gschossa.)<br />
S Neabedzimmerle, dur a Brittrwaad a-drennt, isch dr Jugend<br />
iehra Reich gsei. A dr Waad ringsum a Schrand, zwee schmale<br />
Disch, und wenn dia bsetzt gsei sind, hots koa Durkomma<br />
maih gea. Uff ema winziga Dischle im Eck isch a Gramofo<br />
gschdanda mit a baar Blatta dabei. Dia hot dr »Cive-Paul«,<br />
Sohn des Hauses und vo Beruf Schdudent, heardau, daß-r d<br />
Jugend vrzamsa kaa, was em au glunga isch.<br />
Dr »Cive« hots it gean gsea, und de alta Schdammgäschd hand<br />
bruttled. Es mues fier dia Manna koa Vrgniega gsei sei, en<br />
Obed lang z-heira: »Und sollt isch im Leben ein Mädel mal<br />
frein, dann muß es am Rhein nur geboren sein!« Mo dear Satz<br />
au da Junga zum Hals raus ghanged isch, hand sen umtexted:<br />
»Und sollst du im Leben freien einmal, dann nimm dir ein<br />
Mädel, der Fluß ist egal!« Hot dr Schandarm amol i-dr Wietschaft<br />
davann weagem Sitzabieiba kassiert, sind Neabedzimmer-Gäschd<br />
oafach durs Feaschdr naus schdifta ganga. (Foto)<br />
Und wenn naachts a Wunderfitz hot loschora wella, was<br />
im »Cive« no botta isch, hot-r zum Vendilatr neigucked. Isch<br />
dear abr am Laufa gsei, hettesch dr leicht en billiga Rausch<br />
holla kenna. E dr Wietschaft isch normalerweise Bier vom<br />
Faß ausgscheekt woara. Abr s hot au zwua Sorta Wei aus dr<br />
Flasch gea. Wenn oar obeds no a Schinkawuscht-Veschber<br />
wella hot, isch d Luis zeschda zum Feaschdr gloffa und hot<br />
gucked, ob dr »Oite-Metzger« gega-iebr no Liacht hot. No<br />
eschd hot se d Bschdelling a-gnomma.<br />
De sanitära Vrhältnis mues i no extra schildera. Oba, neabed<br />
dr Küche, isch a Blums-Klo gsei, aune Liecht und aune Wasser.<br />
Als Ergänzeng hots i-dr privata Haus-eele hindr dr Dier<br />
a schreege, vrroschtede Bleach-Rinna gea, dia abr nu dags-iebr<br />
benutzt woara isch. Bei Naacht sind d Manna zua iehrem<br />
Gschäft en Reih und Glied naus a-d Mischde na-gschdanda.<br />
(Des isch fier des Gschiechtle wichtig.)<br />
Jetz abr zruck zua ausem Chor. S-ischd a scheener, »feuchtfröhlicher«<br />
Obed gsei. Und mo de letzschda Manna ganga<br />
sind, hots en Neabel ghett. Odr sind gar dia Herra beneabled<br />
gsei? Jedenfalls hot dr Clemens ghereg kämpfa mtiesa da<br />
Käppelesbuckel nuff. A Liacht aus em Schlofzimmer hot em<br />
schliaßleg da Weag gwiesa a sei Bett. D Anges, sei A-getraute,<br />
wachd no und erfaßt d Situazio mit oam Blick. Eisiges<br />
Schweiga! Se hot grad iebrschlaga, was fier en scheena Sunntegs-Brota<br />
dear Rausch gea hett, und des mached se it gschbrächeger.<br />
Am andra Marga isch se ällrdings umso lauter. Se<br />
hebt em Josef sein schene, bloa Kittl undr d Nas na, und dia<br />
schmeckt nadierleg glei, was bodda isch. Dr Kittl-Buckl isch<br />
nämleg dodal vrkotzed und schdingt zum Himmel. Dr Josef<br />
vrbricht se da Kopf, mo-nera doch sowiaso jedes oazelne<br />
Hoor waih duet. Wenn dia Sauerei wenigschdens vanna dann<br />
wär, no wär alles klar! R hot jo it wissa kenna, daß dia Schealte<br />
eigentleg em Heinzelmaa gealta sott. Dear isch nämleg a-<br />
dr Cive-Mischde i-dr zweita Roih, sozuesaga en Warteschdelling,<br />
gschdanda, und dobei hots-en »übermannt«.<br />
Ibrigens isch a-dr gleicha Schdell - as »Cives« Mischde - fufzg<br />
Johr voarher no a »anrüchigere« Sach bassiert, wia dr Atte<br />
villmol vrzehlt hot.<br />
Domols, voar hundrt Johr, isch d Jugend au it vill andrsch gsei<br />
wia heitzuadag. Abr wenn se heit iehre iebrschissige Kraft<br />
beim Fueßball, beim Tennis odr uff hundrt andre Arta Iausweara<br />
ka, hand se seallmol mitenand grauft, daß Featze gfloga<br />
sind. Wenn dabei abr Bluet gflossa isch, no sind se uff em<br />
Königlich Preußischen Amtsgericht z Hechinga dunn augmüetleg<br />
woara. No hand se da oana odr andra Sündr fier vier<br />
odr segs Wocha »in Erholung« gschickt, bei freier Koschd<br />
und Loschie. Isch nohear besser gsei? No hot so a Kerle it nu<br />
en Bick uff da Neabedbuhler ghet, dear em s Mensch ausgschbanned<br />
hot. Jetz isch no a Wuet uff d Obrigkeit dazuakomma,<br />
dia en eigschberrt hot. (Zua Aureacht nadierleg). Am<br />
Sunnteg isch ällamol a Schandarm vo Hechinga ruff-komma,<br />
dear hot müesa no em Reachta sea. Seallmol hots no koa<br />
Neonliacht uff da Schdroßa gea, da ma hett Zeiting leasa kenna.<br />
E da Gassa ischs zeitweileg kuahnaacht gsei.<br />
Und e sora Naacht ischs no bassiert: Da Schandarm - uff em<br />
Kontrollgang zum »Cive« - hand pletzleg segs, ächt kräftege<br />
Jungmanna-Arm umschlunga und - blumps! - es »Cives«<br />
Mischdlachaloch nei-kheit. Husch - hot d Naacht da ganza<br />
Schpuck vrschluckt. Do leit-r also, der Repräsentant des Königs<br />
von Preußen, bis zum Hals e-dr Mischdlacha und hot<br />
Müah, do wiedr raus-z-komma. No mues-r e deam Zuaschdand<br />
- da Tschako hot-r vrlaura - ge Hechinga na maschiara<br />
und voar sei Weib nadreatta und, was no schlimmer isch, seim<br />
Voargesetzta Melding macha. »Landfriedensbruch« schreibt<br />
s Wochablättle e graoßa Leattera. Hechinga tobed, s Ländle<br />
lached. Däglang weand de Vrdächtega vrheirdt, abr dia sind<br />
zuer Tatzeit schau lang em Bett gsei, wia ses fier brave Bürger<br />
gheirt, und ieberhaupt, so jabbes duet ma it und a Junginger<br />
schau gar it! Abr dr Schdaatsanwalt mues a »Exempel<br />
statuieren«. Also hot-r iebr s ganz Oat a Vieteljohr Ausgangsschberre<br />
vrhängt. Des hoaßt, ab obeds um zehne deaff<br />
neamed maih uff dr Schtroß sei. Drei Schandarma mit uffpflanzta<br />
Seitagwehr sind Schtreife gloffa und hand des Vrbot<br />
iebrwacht.<br />
Doch jetz wiedr en graußa Schbrung zum Josefsdag im »Cive«.<br />
Dear Obed isch wia a Abschied gsei. S Johr 1933 isch<br />
kumma, und nohear hot dr Kirchachor nunz maih zum Lacha<br />
gkett. S hot fäschd a-weng Bekennermuet braucht, e dr Kirch<br />
zua singa, und it jedr hot dea ghett. Zua ma Besinnungstag<br />
hot ma 1935 a Genehmigeng vom Landratsamt braucht. Des<br />
hot gschrieba: »Nach Mitteilung der Geheimen Staatspolizei<br />
werden gegen die rein religiöse Veranstaltung Einwendungen<br />
nicht erhoben. Da die unter Ziffer 8 der Einladung vorgesehene<br />
Pflege einer gemütlichen Stimmung durch weltliche<br />
Lieder über das natürliche und bestimmungsgemäße Betätigungsgebiet<br />
der Kirchenchöre hinausgeht, wird gebeten, das<br />
Zusammensein zum Vesper ohne Gesang stattfinden zu lassen.«<br />
Heit sind dia alta Gschichta schau lang vrgeassa. Vrgeassa<br />
fäschd s »Dausedjährige Reich«, mo doch so vill Auheil<br />
brocht hot. Dr »Cive« isch 1962 dr Schbitzhacka zum Opfer<br />
gfalla. Heit schdoht a seira Schdell a moderns Gschäftshaus.<br />
(Killertalstraße 27) Nu dr Kirchenchor singt schener als amol.<br />
Dabei sind nadierleg au wiedr a baar Seppl, halt andre wia<br />
seallmol. Abr Mädle singed koanne maih uff dr Schdroß rum.<br />
Des wär erschdens z-gfährleg. Zweitens geand jetz vrheirede<br />
Weiber da Too a. Und drittens kehrt ma no dr Prob heit ei,<br />
des gheirt zum feschda Programm. Neamed vrsauft maih da<br />
Sunntegsbrotaund iebrhaupt: Kameradschaftspflege schdoht<br />
e da Schdaduta - und dia mues ma eihalta!<br />
P ¿BA WlMÄJiUI<br />
_K. "\T l« *<br />
SIGMARINGEN TIL<br />
«»^hf^ )|b Thorbecke<br />
196 S. mit 229 Abb., davon<br />
28 farbig • 21 x 20 cm • Leinen<br />
ISBN 3-7995-3430-X<br />
Subskriptionspreis<br />
bis 31. 12. <strong>1995</strong><br />
(danach DM 48.-)<br />
Tff<br />
J~7.—<br />
41
WALTER KEMPE UND HERMANN FRANK<br />
Aus der Geschichte Lausheims, Teil 1<br />
Der Ort<br />
Lausheim ist ein kleiner Flecken mit 70 Einwohnern, der nach<br />
wie vor von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt wird. Eine<br />
Tierklinik hat kürzlich ihre Pforten geöffnet. Manche Bewohner<br />
gehen heute ihrem Lebensunterhalt außerhalb des<br />
Orts nach.<br />
Lausheim liegt westlich von Magenbuch in Richtung Mottschieß,<br />
auf und an zwei kleinen Hügeln, zwischen denen sich<br />
quellenreiche Wiesen hinziehen.<br />
Im Norden liegt der Lausheimer Weiher, angelehnt an die<br />
Waldungen des Störenbergs. Uber den Staudamm führt die<br />
Straße nach Levertsweiler.<br />
Nicht zu verwechseln ist unser Lausheim mit einem alten<br />
Pfarrdorf gleichen Namens bei Stühlingen, das im ehemaligen<br />
badischen Seekreis, heute Landkreis Waldshut, liegt.<br />
Die verwaltungsmäßige<br />
Gliederung<br />
Lausheim ist mit dem Schicksal Magenbuchs und des früheren<br />
Amtes Ostrach bereits seit dem 13. Jahrhundert verbunden,<br />
so gehörte es auch im Laufe der nächsten Jahrhunderte<br />
zu den 4 Stammdörfern des salemischen Amtes Ostrach.<br />
Ostrach, Levertsweiler, Lausheim und Magenbuch. Die Gemeindeverfassung<br />
von 1838 besagt: »Die beiden Orte Magenbuch<br />
und Lausheim bilden eine Gemeinde ..., aber beide<br />
Orte sind in Beziehung auf Trieb, Weg und Steg, auf Gemeinschaftsnutzen<br />
und Bürgerrecht vollkommen getrennt<br />
und bilden sofern zwei verschiedene Markungen«.<br />
Im Amtsblatt der preußischen Regierung in Sigmaringen vom<br />
13. Juni 1936 lesen wir dann, daß gemäß der neuen Deutschen<br />
Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 (sie bedeutete das<br />
Ende der demokratischen kommunalen Selbstverwaltung)<br />
die frühere Teilgemeinde Lausheim als Ortsteil der Gemeinde<br />
Magenbuch eingemeindet wurde, jedoch ihren bisherigen<br />
Namen weiterzuführen habe.<br />
Seit der Gemeindereform von 1975 ist Lausheim ein Wohnbezirk<br />
des Teilorts Magenbuch der Gesamtgemeinde<br />
Ostrach, Landkreis Sigmaringen.<br />
Der Namen<br />
Michel Buck gibt folgende Wortdeutung:<br />
1. Ein Lausgütlein ist soviel wie der kleinste Bruchteil eines<br />
zerteilten Hofes.<br />
2. Laus, mittelhochdeutsch Lüs, aber Lüz, Lüze kann soviel<br />
wie Versteck oder Schlupfwinkel für Wild oder Jäger, aber<br />
auch Hinterhalt bedeuten (die auch heute noch »quasi versteckte«<br />
Lage von Lausheim könnte sehr wohl dafür sprechen).<br />
3. Lussen waren auch Allmendteile (Gemeinschaftsanteile),<br />
die ursprünglich nach dem Los an die Dorfgenossen verteilt<br />
wurden.<br />
Die<br />
Schreibweise<br />
1259 Luzhain, 1266 Luzhaim, 1274 Lüzhain, 1324 Lushain,<br />
1399 Lusshain, 1494 Luhshain, 1514 Lushaym, 1593 und 1700<br />
Laußen, 1734 Lausheimb, später nur noch Lausheim.<br />
Die Chronisten<br />
Im Zusammenhang mit der Geschichte von Magenbuch bzw.<br />
Ostrach, haben sich mit Lausheim u. a. 1845 Eugen Schnell,<br />
um 1870 Pfarrer Melchior Keller von Magenbuch und um<br />
1881 der Magenbucher Lehrer Leo Frank befaßt. Einige geschichtliche<br />
Kenntnisse über Lausheim verdanken wir auch<br />
K. H. Zingeler, Pater Benedikt Hänggi und Pfarrer Friedrich<br />
Eisele.<br />
Die urkundliche Zeit<br />
Sigifrid, Sohn des Wolverad, Edler von Weiler, war Besitzer<br />
eines Gutes bei Magenbuch, das er zur Zeit des Bischofs Otto<br />
I. von Konstanz (1071-1086) dem Kloster Petershausen bei<br />
Konstanz schenkte. Die Familie war auch in der Gegend von<br />
Burgweiler begütert. Etwa 200 Jahre nach dieser ersten urkundlichen<br />
Erwähnung von Magenbuch in der Chronik des<br />
Klosters Petershausen, tritt im Jahre 1274 ein Abt dieses Klosters<br />
zusammen mit Manegold, Graf von Nellenburg, als Lehensherr<br />
von Gütern in und um Magenbuch auf. Diese Güter<br />
hatte der Ritter Friedrich von Magenbuch im Tausch dem<br />
Kloster Salem übereignet, zu Pfullendorf und auf offener<br />
Straße, wie damals üblich.<br />
In dem Vertrag von 1274 werden sowohl Güter- als auch<br />
Flurnamen aufgeführt. Es heißt dann weiter: » seien es<br />
nun Acker, Wiesen, Weiden, Hofräume, gebaute und ungebaute<br />
Felder, Gehölze, Gebüsche, Wege und unwegsame<br />
Plätze, Fußpfade, Wasser und Wasserleitungen nebst allen<br />
Rechten.«<br />
Bei der Aufzählung der Güter wird Lausheim im Anschluß<br />
an Raigers Gut genannt. Es ist nicht auszuschließen, daß es<br />
sich um das oben erwähnte Gut des Sigifrid von Weiler handelte,<br />
das er um 1071 dem Kloster Petershausen übertragen<br />
hatte.<br />
Der Tausch von 1274 dürfte für das Kloster Salem bei der Abrundung<br />
seiner Besitzungen in dieser Gegend von besonderer<br />
Bedeutung gewesen sein. Schon 1259 begann diese, als die<br />
Gebrüder Conradus und Hernestus, genannt Wels, ihren Besitz<br />
in Lausheim an das Kloster Salem gaben.<br />
Vier Jahre nach dem Pfullendorfer Vertrag von 1274 traten<br />
dann die Rosnaer Verwandten der Herren von Magenbuch<br />
in Lausheim in Erscheinung. Es waren die Gebrüder Burkard,<br />
Ebo und Rüdiger von Rosenow (Rosna), die als Vögte<br />
der Geschwister Heinrich, Conrad und Diemout Linder obrigkeitliche<br />
Rechte über deren Besitz Lindersgut in Lausheim<br />
ausübten. Als Käufer des Gutes mit allem Zubehör wird wieder<br />
das Kloster Salem genannt. Der Vertrag wurde diesmal<br />
in Mengen abgeschlossen (siehe Urkunde von 1278 auf Seite<br />
1, Abb. 1). Dabei lernen wir auch weitere Verwandte der Herren<br />
von Rosna und der Familie Linder kennen. Außer dem<br />
Vertreter der Kurie in Konstanz siegelte Heinrich von Anamaechingen<br />
(Emerkingen bei Ehingen/Donau). Die Gebrüder<br />
von Rosenow waren Söhne seiner Schwester. Auch Gerung,<br />
Plebanus von Thalhain - wohl Thalhain unter Rosna<br />
gelegen - bedurfte, wegen erblicher Rechte, der Zustimmung<br />
zum Verkauf. Von Seiten der Familie Linder werden u. a. vorgestellt:<br />
Uolric, genannt Durner, seine Söhne und seine<br />
Schwester Judenta.<br />
Wie bei den Kaufverträgen von 1279 und 1288 auf dem nicht<br />
weit von Ostrach liegenden Arnoldsberg (Schlößlehof),<br />
bleibt auch hier die Frage offen, ob die Grundstücke, die 1259,<br />
1274 und 1278 an Salem fielen, zu einem Gut oder zu verschiedenen<br />
Höfen in Lausheim gehörten.<br />
42
Versteckt im Schatten der großen Höfe, die Lausheimer Kapelle St. Rupertus.<br />
Foto: Dr. Hermann Frank<br />
Ähnlich wie in Bachhaupten errichtete Salem dann in Lausheim<br />
einen Wirtschaftshof, auch Grangie genannt.<br />
Nach Einverleibung der Kirchenpfründe von Ostrach und<br />
Burgweiler durch das Kloster Salem, wurde es 1324 notwendig,<br />
die im Bereich der Grafschaft bzw. Herrschaft Sigmaringen<br />
liegenden wertvollen Salemer Besitzungen abzusichern.<br />
So übernahm damals der Sigmaringer Vogt Ulrich<br />
Mürli die Schirmherrschaft und damit auch den militärischen<br />
Schutz.<br />
Auffallend ist in dem Schirmbrief vom 10. November 1324<br />
die Reihenfolge der Schutzobjekte: das ist Lausheim ihr Hof,<br />
Ostrach, Burgweiler, Magenbuch, Levertsweiler, Spöck und<br />
Wangen.<br />
Die Stellung Lausheims dürfte somit schon vor diesem Vertrag<br />
von Bedeutung gewesen sein. Es ist daher nicht verwunderlich,<br />
daß bereits im Jahr 1294 Ritter Ulrich von Königsegg<br />
und sein Sohn im salemischen Lausheim erscheinen,<br />
um ihre Burg Leiterberg den Vertretern des Klosters Salem<br />
käuflich zu übertragen. Auch einen Magister in Lausheim finden<br />
wir 1297 bei einer Beurkundung, wohl als autorisierten<br />
Vertreter des Klosters Salem: Bruder E. aus Riedlingen.<br />
Die Entwicklung der Güter in Lausheim<br />
1324 gab es in Lausheim »Salem ihr Hof« als Grangie. Eisele<br />
nennt ihn Maierhof.<br />
1465 finden wir dann im Urbar der salemischen Pfleg Pfullendorf,<br />
zu der das Amt Ostrach gehörte, unter Lausheim einen<br />
Oberhof.mit zwei Häusern und einen Unterhof Sie wurden<br />
von zwei Bauern odern Maiern geführt.<br />
I. Im salemischen Oberhof Wirkte Hans Geiger. Bis 1617 läßt<br />
sich der Familienname nachweisen. Im gleichen Jahr wohnte<br />
hier dann Johannes Bernhardt. Etwa hundert Jahre später,<br />
1715, lesen wir im Lehensbrief des Abtes Stephan von Salem,<br />
ausgestellt für den oberen Hof, daß er wieder einem Johannes<br />
Bernhardt verliehen wurde. Er hatte ein 6-käriges (teiliges)<br />
Wohnhaus und eine 3-kärige Scheuer zur Verfügung.<br />
Sein Hof grenzte im Osten und im Süden an den Unterhof.<br />
Nach Unterlagen von 1763 war der Oberhof mit 174 Morgen<br />
etwa gleich groß wie der Unterhof.<br />
Als nach dem Ende der Herrschaft des Reichsstiftes Salem im<br />
Jahre 1803 die Lehensträger dem neuen Landes- und Lehensherren,<br />
dem Fürsten von Thum und Taxis, feierlich huldigten,<br />
wird als Inhaber dieses Lausheimer Gutes Oberhof<br />
Anton Bernhard genannt.<br />
Auch nach Ubergabe der Landesherrschaft an den Fürsten<br />
von Hohenzollern-Sigmaringen im Jahre 1806, blieb Thum<br />
und Taxis hier Lehensherr als Standesherrschaft bis zur Ablösung<br />
der Lehen und Uberführung in Privatbesitz Mitte des<br />
19. Jahrhunderts.<br />
In den zuständigen Urbarien und Grundsteuer-Katastern<br />
läßt sich der Name Bernhardt auf dem Hof bis 1869 nachweisen.<br />
Ab 1846 erhielt er die Nr. 46. Aus dieser Familie<br />
stammte Konrad Bernhardt, ein Sohn des Franz Joseph Bernhardt.<br />
Er feierte am 17. Juni 1798 seine Primiz vor der Mühle<br />
in Magenbuch. Auf der Mühlebrücke war ein Altar aufgerichtet.<br />
Konrad Bernhardt war von 1802 bis zu seinem Tode<br />
1806 Pfarrer von Tafertsweiler. Sein Bruder Johann Ernst<br />
Bernhardt war Laienbruder im Kloster Salem. Er starb 1810<br />
bei einem anderen Bruder, dem Martin Bernhardt, Adlerwirt<br />
in Hausen a. A.<br />
Karl Bühler vom Altschiatterhof, Pfarrei Emmingen bei Engen,<br />
heiratete dann eine Tochter der Familie Bernhardt und<br />
erhielt das Gut. Schließlich kam 1887 Alois Senn aus<br />
Schwäbiishausen. Nach seiner Heirat mit Theresia Bühler<br />
übernahm er den Hof. Das Anwesen brannte am 10. August<br />
1949 ab. Familie Senn ist jetzt auf den Höfen Nr. 111 und 125<br />
(heute Nr. 14 und 10) zu finden.<br />
II. Auf dem ebenfalls 1465 erwähnten Unterhof. finden wir<br />
1519 Hans Grad. 1534 übergab Hans Grad der Alt an Hans<br />
Rechlin (Reichlin, Reichle), der eine M. Störin heiratete.<br />
Bis 1702 erscheint weiterhin der Familienname Rechlin bei<br />
43
den Lehensträgern des Gutes. In diesem Jahr starb Martin<br />
Rechlin, Karl Knäpple aus Einhart heiratete seine Witwe und<br />
übernahm das Gut.<br />
1715 stand hier ein 5-käriges Wohnhaus sowie eine 4-kärige<br />
Scheuer mit Ofenhaus, Speicher und Schweinestall.<br />
Bei der Übernahme der Herrschaft durch den Fürsten von<br />
Thum und Taxis im Jahre 1803 war bei der Huldigung Adrian<br />
Knäpple vom Lausheimer Unterhof vertreten. Im<br />
Primär-Kataster von Lausheim wird der Hof 1846 unter Nr.<br />
43 geführt (heute Nr. 52). Besitzrechte hatte Pankraz Knäpple.<br />
Der Name Knäpple ist bis zum heutigen Tag mit diesem<br />
Hof verbunden, bei dem wohl seit dem 12. Jahrhundert die<br />
romanische Lausheimer Kapelle steht.<br />
Die Scheuern der beiden Höfe standen südlich der Straße.<br />
Der Oberhof hatte um 1846 die Scheuer Nr. 47, der Unterhof<br />
die Scheuer Nr. 44. Bei Teilungen entstanden hier selbständige<br />
Höfe.<br />
III. 1887 erbaute Franz Xaver Bühler westlich der alten<br />
Scheuer an der Straßenbiegung ein neues Wohnhaus mit der<br />
Gebäude Nr. 47 (heute Nr. 63). Bühler heiratete damals Klothilde<br />
Böhm und erhielt die Hälfte von Karl Bühlers Bernhardt'schen<br />
Oberhof (90 Morgen). Die alte Scheuer Nr. 47<br />
brannte 1890 ab und wurde durch eine neue neben dem<br />
Wohnhaus ersetzt (Nr. 47 c). Lorenz Kohler aus Buchheim<br />
kaufte 1903 das Anwesen, das 1924 zwischen Johann und Otto<br />
Kohler nochmals geteilt wurde.<br />
IV. Die Scheuer des Unterhofes, Nr. 44, die damals Pankraz<br />
Knäpples Witwe gehörte, erhielt Melchior Andelfinger um<br />
1851. Er heiratete Karoline Knäpple und baute hier ein<br />
Wohnhaus. Seine Felder bekam er vom Knäpple'schen Hof.<br />
1903 übernahm Anton Riegger aus Moos bei Hattenweiler.<br />
Er mußte den damals abgebrannten Hof neu errichten. Ab<br />
1921 saß dann Anton Steinhart aus Hettingen nach Einheirat<br />
auf diesem Anwesen, das heute noch im Besitz der Familie<br />
ist.<br />
V. Östlich des Knäpple'schen Unterhofes entstand jenseits<br />
der Straße nach Levertsweiler um 1849 ein weiterer Hof, als<br />
Pankratius Knäpple jr. Katharina Fetscher heiratete. Es war<br />
nun Haus Nr. 77, heute Nr. 11. Er erhielt so, wie Melchior<br />
Andelfinger beim Hof Nr. 44, Felder vom Knäpple'schen<br />
Gut.<br />
Durch Einheirat kam um 1897 Joseph Schmid aus Friedberg<br />
in den Besitz des Anwesens, das heute noch der Familie<br />
gehört.<br />
Aus dem Oberhof sind somit später die verschiedenen Höfe<br />
der Familien Senn und Kohler, aus dem Unterhof die Höfe<br />
der Familien Knäpple, Steinhart und Schmid hervorgegangen.<br />
VI. Das Reichsstift Salem führte laut Urbar Nr. 7 von 1705<br />
und laut den Lehensbriefen von 1715 außerdem Oberhof des<br />
Johannes Bernhardt, damals »Gambs«, später »Haas« genannt,<br />
und dem Unterhof des Karl Knäpple, damals »Haas«<br />
später »Gambs« genannt, noch einen dritten Lehenshof Er<br />
wurde 1705 und 1715 Johannes Keller verliehen. Name »Otter«.<br />
Es ist nicht auszuschließen, daß der als 3. Bürger in Lausheim<br />
1593 und 1617 erwähnte Michael Groß auf diesem Hof<br />
angesiedelt war.<br />
Nach dem Ostracher Urbar Nr. 15 mit einer Güterbeschreibung<br />
von Magenbuch und Lausheim aus dem 18. Jahrhundert,<br />
wurde das Lausheimer Lehensgut »Otter«geteilt:<br />
Sebastian Bernhardt hatte einen Hof und ein Gut »1/2 Otter«,<br />
Salemer Eigentum, laut Protokoll auf seinen Leib verliehen,<br />
Marx Bernhardt ein 4-käriges Haus und Garten »1/2<br />
Otter«, das damals auf Parzelle 306 stand. Ob die Gebäude<br />
des noch ungeteilten Gutes »Otter« dem Sebastian Bernhardt<br />
bei der Teilung verblieben sind oder an anderer Stelle standen,<br />
geht aus den verfügbaren Unterlagen nicht hervor.<br />
Auf dem ersten Gut »1/2 Otter«, später Haus Nr. 53, heute<br />
Nr. 26, saß dann Konrad Binder, der Anna Bernhardin (Bernhardt)<br />
heiratete. 1867 ging durch Heirat der Hof Binder auf<br />
Johann Kugler aus Rosna über. 1870 werden hier Joseph Ott,<br />
dann Otto Ott und Maria Ott genannt. Heute wohnt hier Alfons<br />
Andelfinger. Er kam aus dem Futtererhof Nr. 54.<br />
Der zweite Hof »1/2 Otter« war das späterere Haus Nr. 58,<br />
heute Nr. 38. Es lebten hier zunächst Söldner (auch Seidner<br />
genannt), wie auch auf dem gegenüberliegenden Hof Tiger<br />
Haus Nr. 56 (heute Nr. 37).<br />
1736 wohnte in diesem 2. Hof »1/2 Otter« der Weber Josephus<br />
Möhrle aus Mettenbuch, 1759 der Webergesell Franz<br />
Gmeiner aus Krauchenwies und 1763 Joseph Handgrad aus<br />
Rosna. Sie hatten hier eingeheiratet.<br />
Als 1747 Salem keine Felder mehr selbst bestellte, überließ<br />
man den Söldnern Acker und Wiesen zur Benutzung. Sie hatten<br />
dafür bis zur Auflösung des Klosterstaates 1803 besondere<br />
Dienstleistungen zu erbringen. Es waren hiernach keine<br />
reinen Taglöhner, oft aber Handwerker.<br />
Bei der Neuverteilung der Schupflehen (Lehen auf Zeit) in<br />
Lausheim an die drei Söldner Biesenberger, Handgrad und<br />
Matthä Möhrle, erhielt 1803 auch Joseph Handgrads Witwe<br />
die Felder für ihren Hof zugeteilt. Ihr Sohn Balthasar wird<br />
1824 Wirt genannt. 1846 war dem Gehöft Nr. 58 eine Branntweinbrennerei<br />
angeschlossen. Sie war in dem hinter dem<br />
Wohnhaus gelegenen »Brennhäusle« untergebracht. Später<br />
braute hier der Gastwirt Striegel sein Weißbier. Erst in jüngster<br />
Zeit wurde es abgerissen. 1938 heiratete Joseph Nusser<br />
Maria Striegel. Sie betrieben die Gastwirtschaft zur Traube<br />
weiter. Heute befindet sich auf dem Anwesen die Praxis und<br />
Tierklinik von Dr. Kummerer, seine Frau ist eine geborene<br />
Nusser.<br />
Als gastliches Haus finden wir heute in Lausheim das Cafe<br />
Seestüble der Familie Joseph Kohler.<br />
1753 setzte das Reichsstift Salem als neuen Klee- und Wasenmeister<br />
Ignaz Ritter, Sohn des Altshausener Scharfrichters,<br />
ein. Ihm fiel die Entsorgung verendeter Tiere zu. Gleichzeitig<br />
war er zuständig für den Vollzug der Todesstrafe. Seine<br />
Wohnung nahm er in Lausheim auf dem Gütle »Wildschwein«,<br />
später Haus Nr. 52, heute Nr. 23/25. 1784 finden<br />
wir hier den Kleemeister Joseph Sorg. Sein Sohn Johannes besaß<br />
1846 das Haus. Er war der letzte Scharfrichter in Hohenzollern.<br />
1872 zog ein weiterer Joseph Sorg hier ein, der<br />
Waldschütz war und aus Magenbuch stammte. 1901 heiratete<br />
der Forstwart Jakob Dangel aus Betzenweiler am Bussen<br />
Mathilde Sorg, die Tochter des Waldschütz.<br />
Ein Jäger hatte 1569 in Lausheim einen Sitz auf der Schafswiese.<br />
Georg Kugler von Tafertsweiler bekam damals das<br />
Häusle uff der Schafswies. Er durfte hier ohne Erlaubnis weder<br />
Vieh noch Schafe, Schweine oder Hennen halten. 1803 erfahren<br />
wir, daß des Jägers Gütle schon vor langer Zeit von<br />
der Schafswies genommen wurde und das zugehörige Ackerfeld<br />
mit Wiese dem Jäger in Magenbuch zur Benutzung überlassen<br />
wurde. Die Flurbezeichnung »Schafwiese« besteht<br />
heute noch, nordwestlich von Lausheim.<br />
Das Haus Nr. 60 im mittleren Teil von Lausheim, heute Nr.<br />
31, wurde 1816, durch Konrad Riebsam errichtet. 1839 finden<br />
wir hier den Schuhmacher Andreas Riebsam. 1851 besitzt<br />
Fidel Riebsam das Haus Nr. 60, 1903 die Familie des<br />
Schneiders Bachmor. 1937 wohnt die Familie Irmler in diesem<br />
Haus, heute die Familie Holzer.<br />
Es sei hier noch das Haus Nr. 96, heute Nr. 24 erwähnt, das<br />
44
nach 1869 Johann Kugler, 1924 Hermann Rauch, 1928 Anton<br />
Rauch gehörte und heute von der Familie Sturm bewohnt<br />
wird.<br />
Die wehrhaften Männer Lausheims<br />
Die Bürger der kleinen Siedlung Lausheim mußten, neben<br />
ihren Abgabe- und Frohnpflichten, wenn es erforderlich war,<br />
auch ihre Wehrfähigkeit von der Obrigkeit kontrollieren lassen.<br />
Das war schon so zu Zeiten des Reichsstifts Salem, nachdem<br />
der Klosterstaat 1611 die Landesherrschaft über sein Amt<br />
Ostrach von den Grafen von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
zunächst pfandweise erhielt. Wie wir aus früheren Ausführungen<br />
dieser Serie wissen, übernahm Abt Thomas I.<br />
Wunn, der Bauernsohn aus Grasbeuren, im Jahre 1615 die<br />
Regierung des Klosterstaates. Er ließ u. a. die Untertanen,<br />
Hintersassen, lehens- und leibeigenen Leute des Amtes<br />
Ostrach zur sogenannten Huldigung zum Amtshaus nach<br />
Ostrach kommen. Die Huldigung war mit einer Vereidigung<br />
verbunden:... mit handgegebner Treu und Erstattung eines<br />
leiblichen Eids mit aufgehobenen Fingern.« Am 6. Juli 1615,<br />
7.00 Uhr, fanden sich auch die zum Amt Ostrach gehörigen<br />
wehrhaften Untertanen aus Lausheim ein. »Nach offenem<br />
Trommelstreich, mit ihren auferlegten Uber- und Seitengewehren«<br />
waren sie vor dem Amtshaus angetreten. Nach der<br />
feierlichen Handlung und Besichtigung der Wehr wurde eine<br />
Musterung in der Ostracher Zehntscheuer durch die salemischen<br />
Beamten vorgenommen. Was an Ubergewehren<br />
fehlte, wurde ergänzt.<br />
Ahnlich dürfte es 1685, nach dem Dreißigjährigen Krieg, bei<br />
der Amtsübernahme des salemischen Abts Emanuel Sulger<br />
zugegangen sein. Hier waren neben anderen Lausheimern<br />
und ihren ledigen Söhnen von den genannten Höfen Johann<br />
Bernhardt und Martin Rechlin vertreten.<br />
Als der Fürst von Thum und Taxis 1803 die Regierung übernahm,<br />
finden wir bei der Huldigung, wie bereits erwähnt, Anton<br />
Bernhardt und Adrian Knäpple.<br />
Zum Kampf mit der Waffe wurden der Lausheimer Bürger<br />
Andreas Riebsam und der Vorfahr des Schneiders Bachmor,<br />
Friedrich Bachmor, unter der Landesherrschaft Hohenzollerns<br />
nach 1806, verpflichtet. Sie gehörten der Nassauischen<br />
Brigade an, die zwischen 1809 und 1813 auf Seiten Napoleons<br />
in Spanien eingesetzt wurde. Später, 1838, erhielten sie von<br />
der Fürstlich Hohenzollerischen Regierung in Sigmaringen<br />
noch ausstehenden Sold nachbezahlt.<br />
Immer wieder, wenn es nun zu kriegerischen Handlungen<br />
kam, in die das Land einbezogen war, mußten Lausheimer<br />
Bürger, ob nah oder fern ihrer Heimat, mitziehen bis in die<br />
Zeit der großen Weltkriege dieses Jahrhunderts.<br />
(Teil 2 folgt im nächsten Heft)<br />
45
HERBERT RÄDLE<br />
Zu einer Sebastiansfigur in Oberschmeien - Frage nach der Herkunft<br />
In der St.-Georgs-Kirche in Oberschmeien befindet sich an<br />
der Nördlichen Langhauswand eine frühbarocke Sebastians-<br />
Figur (Abb. 1). Ihre hohe künstlerische Qualität läßt daran<br />
zweifeln, daß sie ursprünglich für die relativ bescheidene<br />
Oberschmeier Kirche geschaffen wurde. Eher wird sie aus<br />
der Kirche des ehemaligen Franziskanerinnenklosters Laiz<br />
stammen, die seit der Säkularisation Laizer Pfarrkirche ist.<br />
Und Oberschmeien war lange Zeit Filiale von Laiz (vgl.<br />
Genzmer, wie Anm. 1, S. 264).<br />
Der Bildhauer der Figur ist unbekannt. Genzmer datiert die<br />
Figur pauschal auf Mitte 17. Jh., Hermann (wie Anm. 1) nennt<br />
die Zeit zwischen 1615 und 1620 für ihre Entstehung.<br />
Dieser Sebastiansfigur soll im folgenden eine Johannes-Evangelista-Figur<br />
gegenübergestellt werden, die sich in Ellwangen<br />
befindet und die auffallende stilistische Ähnlichkeiten<br />
aufweist (Abb. 2). Die Ellwanger Figur ist datiert 1627, ihr<br />
Bildhauer ist ebenfalls unbekannt.<br />
Abb. 1: Hl. Sebastian in Sigmaringen-Oberschmeien. Lindenholz,<br />
vollrund, neuere Fassung, H. 67,5 cm, B. 30 cm, T. 16 cm. Unbekannter<br />
Bildhauer, 1615/20. Bildnachweis wie Anm. 1, S. 175<br />
Abb. 2: Hl. Johannes Evangelista, ursprünglicher Standort Schloßkapelle<br />
Ellwangen; heute Staatliches Liegenschaftsamt Ellwangen.<br />
Linden(?)holz, alte Fassung, H. 112 cm, B. 55 cm, T. 40 cm. Unbekannter<br />
süddeutscher Bildhauer, dat. 1627. Bildnachweis: V. Himmelein,<br />
in: Die Renaissance, wie Anm. 1, S. 566<br />
Vergleich der beiden ungefähr gleichzeitig entstandenen<br />
Figuren<br />
Die Figuren lassen sich etwa folgendermaßen beschreiben:<br />
Bei beiden Darstellungen handelt es sich um jugendliche<br />
Männergestalten. Beide stehen mit leicht vorgestelltem linkem<br />
»Spielbein« relativ aufrecht da. Auch in der Gewandung<br />
findet man noch wenig barocke Bewegtheit, die Gewandgestaltung<br />
wirkt eher noch spätgotisch. Ein gewisses barockes<br />
Pathos drückt sich - abgesehen von den Händen - lediglich<br />
in der Haltung der Köpfe aus. Beide Figuren haben volles,<br />
lockiges Haar und ein volles, weich-sinnliches Gesicht.<br />
46
Die Frage, ob beide Statuen auf dieselbe Herkunft (Bildhauer,<br />
Werkstatt) zurückgehen, sei zur Diskussion gestellt.<br />
Es ist bekannt, daß zwischen dem Franziskanerinnenkloster<br />
Laiz und dem Stift Ellwangen um 1600 insofern eine Verbindung<br />
bestand, als der Ellwanger Fürstpropst und Herr zu Ellwangen<br />
Wolfgang von Hausen (dort 1584-1602; dann<br />
1602-1613 Bischof von Regensburg) für seine Schwester Barbara<br />
von Hausen, Franziskanerin (Priorin?) in Laiz, um 1600<br />
das schöne Epitaph gestiftet hat, das noch heute in der Laizer<br />
(Pfarr-)Kirche zu sehen ist. Dieses Epitaph gilt als Werk von<br />
Hans Dürner aus Biberach, jenem Bildhauer also, der 1613 in<br />
Ellwangen starb, wo er noch kurz vor seinem Tode die Figuren<br />
für den Hochaltar der St.-Vitus-Kirche fertiggestellt hatte<br />
(heute ebendort im nördlichen Querschiff aufgestellt.<br />
Der Name Hans Dürner verbürgt also eine Verbindung zwischen<br />
Ellwangen und Laiz. Im Falle der in Abb. 1 und 2 gezeigten<br />
Figuren, die meiner Meinung nach dieselbe künstlerische<br />
Handschrift zeigen, bleibt es aber vorerst unmöglich<br />
einen Urhebernamen zu nennen.<br />
Literatur:<br />
W. Genzmer (Hrsg.), Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, Band 2,<br />
Sigmaringen 1948, 264 ff. M. Hermann, Kunst im Landkreis Sigmaringen,<br />
Sigmaringen 1986, 142; 174. Bruno Bushart, Die Basilika zum<br />
Hl. Vitus in Ellwangen, Ellwangen 1988, S. 23 (Abb.) S. 28 f. Volker<br />
Himmelein, in: Die Renaissance (Ausstellungskatalog), hrsg. vom<br />
Bad. Landesmuseum Karlsruhe, Band 2, 1986, S. 566.<br />
JOHANN ADAM KRAUS |<br />
Aus den Visitationsakten des ehemaligen Kapitels Trochtelfingen 1574-1709<br />
(Fortsetzung)<br />
Bericht des Pfarrers von Trochtelfingen vom Dezember 1650<br />
An Gütern hat die Pfarrei Trochtelfingen: 46 Jauchert verpachtete<br />
Acker, wovon ich bei der spärlichen Bebauung nur<br />
20 Scheffel Frucht erhielt. Wiesen 2 Jauchert, die etwa 6 Wagen<br />
Heu ergaben. Die drei Gärten geben das Gemüse für das<br />
Pfarrhaus.<br />
Aus obigen Einkünften sind dieses Jahr 50 fl abzuschreiben,<br />
die den Franziskanern von Hechingen für Aushilfe im Sommer<br />
an Festtagen mit Predigt und Messe zu zahlen waren<br />
während der Vakanz. Außerdem erhielten sie für ihre Mühe<br />
reichlich Almosen. Dazu kommen noch Unkosten durch<br />
Herrn Johann Christopherus Han, jetzt Pfarrer in Leutweiler,<br />
als er vorübergehend die Pfarrei Trochtelfingen versah.<br />
Außer den Kosten seiner Haushaltung für 14 Tage verkaufte<br />
er aus den Pfarreinkünften 22 Säcke Getreide für 44 fl, von<br />
denen er 20 fl zurückzugeben versprach.<br />
Einige Pfarr- und Kaplaneilehen sind noch verschuldet.<br />
Der Pfarrer hat außer der Seelsorge in der Stadt und den drei<br />
Filialen auch die Pflicht zum täglichen Chorgebet. Und weil<br />
das zu viel ist für ihn, nimmt er zwei Kapläne zu Koadjutoren,<br />
denen er jährlich für die Hilfe zusammen 25 fl gibt und<br />
für sie ein Pferd hält. Die <strong>Ausgabe</strong>n des Pfarrers für die notwendigen<br />
jährlichen Zusammenkünfte mit Mahlzeiten usw.<br />
mögen 100 Pfund Heller ausmachen.<br />
Kapläne sind hier, wie schon gesagt, vier, deren jeder aus der<br />
Stadt und den Filialorten an festem Gehalt bezieht:<br />
Zinsen und vom Patron 45 Pfund hl. Frucht von Lehengilten<br />
und Zehnten vom Herzog von Württemberg und zum kleineren<br />
Teil vom Patron: 60 Säcke. An Präsenzgeld für Anwesenheit<br />
im Chor und für Jahrtage: über 30 Pfund. Von letzteren<br />
werden zur Zeit kaum 2-3 gehalten, die die Einkünfte<br />
der Präsenzpflege nicht eingehen.<br />
Der dritte Kaplan als sog. Nachprediger, der an kleineren<br />
Festen den Pfarrer beim Predigen unterstützt und allander<br />
Sonntag Christenlehre hält, bekommt dafür vom Patron 30<br />
fl. Der vierte ist gewöhnlich Sammler der Präsenzgelder und<br />
Pfleger derselben, wofür er als Lohn 13 Pfund Heller bezieht.<br />
An Gütern hat jeder Kaplan einen Garten und 2 x /i Jauchert<br />
Wiesen. Die Unkosten sind klein.<br />
Nur eine der vier Kaplaneien ist z. Zt. besetzt, und zwar vom<br />
Magister Johannes Hirninger aus Inneringen, der in bisherigen<br />
Kriegszeiten etwa 33 Pfund Heller Geldeinkünfte hatte,<br />
an Getreide 49 Scheffel, dazu das Drittel Kleinzehnten in<br />
Trochtelfingen (nämlich von Tieren, Hülsenfrüchten, Hanf<br />
und Raps, zusammen im Wert von 14 fl), dazu das Heu von<br />
seinen Pfründewiesen und Kraut aus dem Garten. Außerdem<br />
hat er als Koadjutor, wie oben bemerkt, noch 15 fl und für<br />
sein Predigtamt 22 fl. Die andern Kaplaneien sind schon einige<br />
Jahre frei, teils wegen Priestermangel, teils wegen Magerkeit<br />
der Einkünfte. Aus diesen 3 Pfründen gingen dieses<br />
Jahr ein (vorher noch weniger): Geld 10 Pfund H., Getreide<br />
86 Scheffel, Heu 4 Wagen. Dies alles wurde von den Obern<br />
verteilt: ein Drittel an die Vakanzpflege und zwei Drittel dem<br />
Pfarrer und Kaplan, die auch die Lasten der vakanten Benefizien<br />
zu tragen hatten.<br />
Außerdem gibt es an der Pfarrkirche Trochtelfingen noch ein<br />
weiteres Benefizium, das immer unbesetzt ist. Es ist aus Steinhilben,<br />
wo es einst einen Kaplan ernährte, hierher übertragen<br />
worden, und heißt Vakanzpflege. Sie bezieht aus Zinsen und<br />
zwei Dritteln des Kleinzehnten zu Steinhilben etwa 115 fl und<br />
24 Scheffel Frucht. Hieraus soll der Lohn des Schulmeisters<br />
und die notwendigen <strong>Ausgabe</strong>n zum Unterhalt des Pfründehauses<br />
genommen werden. Jedoch ist seit vielen Jahren wenig<br />
Getreide und überhaupt kein Geld eingegangen. Daher<br />
erhält der Schulmeister nur mit Not seinen Lohn und das fragliche<br />
Haus ist ruinös. Zur Reparation waren 80 fl seit langem<br />
gesammelt, aber der genannte Herr Joh. Christophorus Han<br />
ließ sich 30 fl davon vom Gemeindevorsteher auszahlen, die<br />
er bis Martini zurückzugeben versprach, aber es besteht wenig<br />
Hoffnung, sie wieder zu bekommen.<br />
Von den fünf Benefiziatenhäusern bedürfen drei keiner Erneuerung.<br />
Zwei aber sind deren sehr bedürftig, da sie einzufallen<br />
drohen, wenn nichts geschieht, doch sollte dazu der<br />
Herr Han seine Schuld zurückzahlen.<br />
Die Präsenzeinkünfte bestehen in Zinsen, die sich auf 179 fl<br />
belaufen würden, aber längst ist nichts mehr eingegangen, da<br />
die Pfarrkinder ganz ausgepreßt sind. Präsenz- und Vakanzpfleger<br />
ist gewöhnlich ein Kaplan, der vor dem Pfarrer jährlich<br />
abrechnet. /T, £ , ,<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
47
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 72488 Sigmaringen<br />
M 3828<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Hegau-Fahrt des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />
Im Rahmen seiner Studienfahrten unternahm der Hohenzollerische<br />
<strong>Geschichtsverein</strong> am 1. Juli <strong>1995</strong> eine Ganztagesexkursion<br />
in den Hegau. Auf dem Hohentwiel, der ersten Station,<br />
führte das Vereinsmitglied Dr. Casimir Bumiller, Bollschweil.<br />
Als Verfasser eines Buches über den Hohentwiel verstand<br />
es Dr. Bumiller, die angereisten Geschichtsfreunde<br />
nicht nur mit profunden Kenntnissen, sondern auch durch<br />
die Fähigkeit, Forschungsergebnisse verständlich und plastisch<br />
zu vermitteln, zu begeistern.<br />
Einführend ging Dr. Bumiller auf die Exklavensituation der<br />
seit 1519 württembergischen Feste im katholischen Vorderösterreich<br />
ein. Ohne direkte Verbindungen zu Württemberg<br />
mußten in der kleinen Exklave alle Versorgungseinrichtungen<br />
wie Schmiede, Bäckerei, Metzgerei, Sattlerei usw.<br />
geschaffen werden. Auf dem Berg entstand so eine kleine<br />
Stadt, in der Schmiede hämmerten und sogar eine Windmühle<br />
klapperte. Die Trauben, die an den Hängen des Vulkankegels<br />
heranreiften, wurden vor Ort gekeltert. Der Wein diente ausschließlich<br />
zur Versorgung der Besatzung; die Tagesration<br />
pro Mann bestand, wie der Führer den verblüfften Zuhörern<br />
mitteilte, aus sage und schreibe vier Litern Wein. Autark war<br />
man schließlich auch bei der Bestattung der Toten. Diese wurden<br />
auf einem eigenen Friedhof beigesetzt.<br />
Zur Aufrechterhaltung der Disziplin in der Festung hatte man<br />
eine äußerst harte Dienstordnung erlassen. Um die Soldaten<br />
vor schweren Straftaten abzuschrecken, war ein Galgen am<br />
Weg zur Feste aufgerichtet. Dennoch waren, wie Dr. Bumiller<br />
ausführte, unter den Soldaten, von denen vor allem auch<br />
Festigkeit im protestantischen Glauben erwartet wurde,<br />
Schlägereien und Besäufnisse an der Tagesordnung.<br />
Vor der äußersten Umwallung erläuterte Dr. Bumiller die<br />
Baugeschichte der Festung, die von Herzog Ulrich von Württemberg<br />
und seinen Nachfolgern zu einem Bollwerk des Protestantismus<br />
in Vorderösterreich ausgebaut wurde. So legte<br />
man in zwei Jahrhunderten Ring um Ring um die frühere mittelalterliche<br />
Burganlage. Nach 1735 versank die Wehranlage<br />
in einem Dornröschenschlaf; sie diente wie andere württembergische<br />
Festungen als Staatsgefängnis, als deren prominentester<br />
Insasse der Staatsrechtslehrer Johann Jakob Moser gilt.<br />
Als 1800 die Franzosen den Hohentwiel belagerten, bestand<br />
die Besatzung nur noch aus Veteranen. Der Kommandant<br />
übergab kampflos die Festung, die danach teilweise geschleift<br />
wurde.<br />
Der schweißtreibende Aufstieg lohnte sich. Auf dem Plateau<br />
angelangt, erschloß sich den Geschichtsfreunden bei strahlendem<br />
Sonnenschein ein herrlicher Blick auf die Hegauberge,<br />
den Hohenkrähen und den Hohenhewen, sowie auf den<br />
Bodensee. Dr. Bumiller sprach nun über die einzelnen Burggeschlechter<br />
des Hegaus, die Herzogin Hadwig, durch Scheffels<br />
Roman Ekkehard allseits bekannt, das Georgskloster auf<br />
dem Hohentwiel, das Kaiser Heinrich II. 1005 nach Stein a.<br />
Rh. verlegte, und den Festungskommandanten Konrad Widerholt,<br />
der sich im Dreißigjährigen Krieg durch seine kühnen<br />
Ausfälle und Streifzüge einen Namen gemacht hat.<br />
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Hegau-Haus visävis<br />
vom Hohentwiel ging es dann nach Stein a. Rh., wo die<br />
Teilnehmer, in zwei Gruppen geteilt, das sehenswerte Lindwurm-Museum<br />
mit seiner kompletten Einrichtung aus der<br />
Biedermeierzeit und das historische Rathaus besuchten. Eine<br />
Gruppe konnte sogar die sonst verschlossene hochromanische<br />
Kirche des ehemaligen Georgsklosters besichtigen, das<br />
bis zur Reformation bekanntlich den Kirchensatz der Verenakirche<br />
in Straßberg innehatte. Auf der Rückfahrt wurde<br />
in Bodman Rast gemacht, wo die Teilnehmer auf einer Terrasse<br />
am Bodenseeufer eine Erfrischung einnehmen konnten<br />
und Zeit zum Gespräch fanden.<br />
Otto H. Becker<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
ISSN 0018-3253<br />
Erscheint vierteljährlich.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der Geschichte<br />
ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: DM 11,00 jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
Die Autoren dieser<br />
Dr. Otto H.<br />
Becker<br />
Hedinger Straße 17,<br />
72488 Sigmaringen<br />
Nummer:<br />
Dr. Hermann Frank<br />
Im Wägner 24, 72070 Unterjesingen<br />
Walter Kempe<br />
Silcherstraße 11, 88356 Ostrach<br />
Xaver Pf äff<br />
Dr. Kayser-Straße 40,<br />
72488 Sigmaringen<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13 a,<br />
92318 Neumarkt<br />
Josef Schuler<br />
Killertalstraße 55, 72417 Jungingen<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
Verlags anstalt<br />
72488 Sigmaringen, Karlstraße 10<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
Eichertstraße 6, 72501 Gammertingen<br />
Telefon 07574/4407<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge verantwortlich.<br />
Mitteilungen der Schriftleitung sind<br />
als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare werden<br />
an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.<br />
48
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
M 3828 F<br />
Herausgegeben vom<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
45. Jahrgang Nr. 4 / Dezember <strong>1995</strong><br />
Ortsmitte von Rangendingen nach der Ortssanierung. Das Bild der Gemeinde wird von der neugotischen Pfarrkirche St. Gallus und Eulogius<br />
geprägt. Links davon die barocke Kirche des 1804 aufgehobenen Dominikanerinnenklosters.<br />
CASIMIR BUMILLER<br />
1200 Jahre Rangendingen<br />
Zum Ursprung der politischen Gemeinde<br />
Rangendingen<br />
Rangendingen gehört mit Hechingen, Burladingen, Bisingen<br />
oder Wessingen zu den wenigen ehemals hohenzollerischen<br />
Orten, die bereits in der Zeit Karls des Großen ins Licht der<br />
Geschichte traten. Am 7. Mai des Jahres 795 schenkte ein gewisser<br />
Heriker zu seinem Seelenheil alles, was er in Rangendingen<br />
besaß, der dortigen Peterskirche. Der Priester Audadcar<br />
hielt diese Schenkung schriftlich fest und vergaß auch<br />
nicht, die zehn Zeugen, alles wohl Rangendinger Bauern, die<br />
die Schenkung bekräftigten, auf einem Pergament zu verzeichnen.<br />
Diese Urkunde mit der Ersterwähnung des Jubiläumsortes<br />
ist im Archiv des Klosters St. Gallen erhalten, wohl deshalb,<br />
weil schon wenige Jahre später die Rangendinger Peterskirche<br />
in die Verfügungsgewalt dieses mächtigen Reichsklosters<br />
überging. Aus einer beschädigt überlieferten Urkunde des<br />
Jahres 802, die wiederum ein Rangendinger Pfarrer namens<br />
49
Tachari anfertigte, läßt sich jedenfalls dieser Sachverhalt ermitteln.<br />
So wurde damals aus der ursprünglichen Rangendinger<br />
Peterskirche bis auf den heutigen Tag eine Galluskirche.<br />
Damit haben wir bereits ein erstes traditionsbildendes Element<br />
der Rangendinger Geschichte gefunden, das den gesamten<br />
überlieferten Zeitraum von 1200 Jahren überspannt.<br />
Es sind ja in den schnell veränderlichen Verhältnissen und<br />
Strukturen der Geschichte solche langlebigen Elemente, die<br />
wir gerade in einer Zeit radikalen Wandels als identitätsstiftende<br />
Merkmale unserer Heimatgeschichte suchen.<br />
Wir können froh sein um diese frühen urkundlichen Belege<br />
zur Rangendinger Orts- und Kirchengeschichte, denn auch<br />
das pergamentene Gedächtnis der Archive ist löcherig und<br />
vergänglich. Wo Urkunden verloren sind, erscheint die Geschichte<br />
wie ausgelöscht, erscheint ein Dorf wie nicht existent,<br />
obwohl wir wissen, daß es existierte. Ein solches<br />
Schicksal teilt Rangendingen übrigens mit sehr vielen anderen<br />
Orten. Zwischen den Jahren 802 und 1275, also beinahe<br />
500 Jahre lang, schweigen die Quellen über die heutige Jubiläumsgemeinde.<br />
Wir können uns für diese dunkle Zeit nur<br />
an zwei Elemente geschichtlichen Überdauerns klammern:<br />
Auch über diese dunklen Jahrhunderte hinweg werden die<br />
namenlosen Rangendinger zum Heiligen Gallus, ihrem Patron,<br />
gebetet und ihm den Zehnten gereicht haben, und<br />
während dieser ganzen Zeit dürfte Rangendingen wie schon<br />
um das Jahr 800 ein Pfarrort von zentraler Bedeutung gewesen<br />
sein.<br />
Erst um das Jahr 1300 beginnt eine umfangreiche historische<br />
Überlieferung zum Dorf Rangendingen. Und die Quellen des<br />
späteren Mittelalters und in der frühen Neuzeit bestätigen<br />
unsere Einschätzung. Rangendingen beherbergte um 1435<br />
um die 200 Einwohner, was für damals viel war, und es war<br />
im Jahr 1548 mit 393 Einwohnern neben Grosselfingen die<br />
größte Gemeinde der Grafschaft Zollern. Aber die Größe allein<br />
sagt noch nichts über die Bedeutung eines Dorfes aus.<br />
Hören wir also, wie die, die es wissen mußten, den Flecken<br />
charakterisierten. Da finden wir in einem Verzeichnis des Jahres<br />
1467 z. B. folgenden Satz: »Rangendingen ist ein sehr vermögentliches<br />
gutes Dorf an Holz und Feld.« Dieses schmeichelhafte<br />
Urteil hatte natürlich seine Kehrseite, denn wo viel<br />
war, wollten die Herrschaften auch viel holen.<br />
Das Urteil stammt übrigens erstaunlicherweise nicht, wie<br />
man erwarten könnte, aus der zollerischen Kanzlei in Hechingen,<br />
sondern von einem hohenbergischen Beamten in<br />
Haigerloch. Und das lenkt unseren Blick auf die bislang wenig<br />
beachtete Tatsache, daß Rangendingen ja bis zum Jahr<br />
1467 zwischen Hohenzollern und Hohenberg geteilt war. Es<br />
gab in Rangendingen zwei Untertanengruppen: ein Teil der<br />
Bauern mußte seine Abgaben nach Haigerloch, der andere<br />
aber nach Hechingen entrichten. Das war jedoch aus der Sicht<br />
der Untertanen ein unhaltbarer Zustand, und wir werden sehen,<br />
daß sich die Rangendinger mit dieser faktischen Spaltung<br />
des Dorfes nicht abgefunden haben.<br />
Nach dem Aussterben der Herren von Rangendingen um das<br />
Jahr 1300, über die wir leider nicht allzuviel wissen, ging das<br />
allgemeine Gerangel um das wirtschaftlich hochinteressante<br />
Dorf Rangendingen los. Nicht nur die Grafen von Zollern<br />
faßten hier Fuß, sondern alle in der Nähe seßhaften Adelsgeschlechter<br />
wie die Stauffenberger und die von Ow und sogar<br />
Hechinger Patrizierfamilien wie die Bronber und die<br />
Walch besaßen in Rangendingen Grund und Boden, Höfe<br />
und Wälder, Zehnten und andere Einkünfte. Rangendingen<br />
hatte nicht nur relativ gute Ackerflächen und ausgedehnte<br />
Waldreserven, sondern war damals das einzige zollerische<br />
Dorf mit Weinbau - bereits 1412 ist einmal vom Weingarten<br />
des Schwarzgrafen Friedrich von Zollern die Rede.<br />
Der wichtigste Konkurrent der Zollergrafen unter den<br />
Grundbesitzern in Rangendingen waren die Grafen von Hohenberg,<br />
deren Herrschaft 1381 an Osterreich überging.<br />
Österreich und Zollern teilten sich also in Rangendingen die<br />
größten Besitzkomplexe und die größten Gruppen von leibeigenen<br />
Untertanen. Jede Gruppe wählte ihren eigenen Vogt,<br />
der das Dorf gegenüber der jeweiligen Herrschaft vertrat.<br />
Aber wie sollte die Dorfgenossenschaft unter dieser Zersplitterung<br />
der Leibeigenen und unter den vielen Herren ihre<br />
internen Dorfangelegenheiten regeln? Und - was noch<br />
wichtiger war - welcher Herrschaft unterlag überhaupt die<br />
dörfliche Rechtsprechung? Das war der Stein des Anstoßes,<br />
und diese Frage zwang die Rangendinger im späten Mittelalter<br />
zu einer bemerkenswerten kollektiven und d. h. gemeindlichen<br />
Anstrengung.<br />
Die damaligen Ereignisse lassen sich aus einer sogenannten<br />
»Kundschaft« rekonstruieren, die Graf Eitelfriedrich I. am 1.<br />
April 1435 in Rangendingen einholte. Eitelfriedrich war aus<br />
dem verheerenden Krieg mit seinem Bruder als Sieger hervorgegangen<br />
und ließ sich nun in diesem Jahr in einem Lagerbuch<br />
zusammentragen, was ihm in seiner schwer gebeutelten<br />
Grafschaft noch an Rechten zustand. Er trommelte in<br />
Rangendingen nicht weniger als 17 alte Männer zusammen<br />
und ließ sich durch ihre einhelligen Aussagen bestätigen, daß<br />
der Stab und die Vogtei, also die Gerichtsherrschaft in Rangendingen<br />
bei der Herrschaft Hohenzollern lag und vom<br />
Vogt der zollerischen Untertanen, damals einem Burkart<br />
Herre, auszuüben sei.<br />
Die teilweise bis zu achtzig Jahre alten Männer - darunter ein<br />
Bentz Mössing, ein Conrad Schneider, ein Hans Keck, ein<br />
Claus Lins und ein Ulrich Sauer - führten auch den Grund<br />
an, weshalb der Stab bei Hohenzollern liegen solle. Es sei<br />
nämlich vor ungefähr 50 Jahren, so erinnerten sie sich, zu einem<br />
Konflikt der Rangendinger mit der hohenbergischen<br />
Herrschaft gekommen. Die Hohenberger hätten damals in<br />
hohem Maße den Wald Mark geplündert und Bauholz nach<br />
Haigerloch geführt, was ihnen die Untertanen schließlich verwehrt<br />
hätten. Darauf seien die Hohenberger mit einem Banner,<br />
also unter militärischem Schutz wieder aufgetaucht, um<br />
das Abholzen fortzusetzen, aber die Rangendinger hätten ihnen<br />
das Banner abgenommen, also die Waffenknechte wohl<br />
überwältigt.<br />
Aufgrund dieser Vorgänge hätten sich die Untertanen beraten,<br />
und es wurde »die gantz geburschafft ainmündig, das man<br />
sich an die herrschafft von Zolre ergäbe«, »darumb das sie<br />
inen ir zwing und bänne hülfe beschirmen«. Das heißt also,<br />
die ganze Bauernschaft kam damals überein, sich aufgrund<br />
dieses Konflikts der Herrschaft Zollern zu ergeben, wofür<br />
die Zollergrafen den Schutz und Schirm über das Dorf übernahmen.<br />
Man kann den Zeitpunkt dieser dramatischen Ereignisse<br />
näher eingrenzen. Wenn die alten Rangendinger<br />
Männer sich im Jahr 1435 erinnerten, daß sich dies alles vor<br />
etwa 50 Jahren abgespielt habe, so kommen wir ungefähr in<br />
Jahr 1385. Und wenn wir uns erinnern, daß Hohenberg 1381<br />
an Österreich übergegangen war, so liegt es auf der Hand,<br />
daß sich dieser Holzkonflikt bald nach 1381, nach dem Aufzug<br />
der österreichischen Herrschaft in Haigerloch abgespielt<br />
haben muß.<br />
Das heißt aber, damals im späten 14. Jahrhundert war das dörfliche<br />
Entscheidungsgremium der Gemeinde in Rangendingen<br />
voll ausgebildet. Denn das alte Wort »geburschafft«, Bauernschaft<br />
war damals gleichbedeutend mit dem Begriff »Gemeinde«.<br />
Die Gemeinde war die Versammlung der volljährigen<br />
Männer. Was man im Mittelalter übrigens unter volljährig<br />
verstand, lehrt uns die zeitgleiche Dorfordnung von Owingen,<br />
die schon die mehr als 12jährigen Knaben zur Gemeinde<br />
zuließ. Was aber vielleicht das wichtigste an dem frühen<br />
Beleg der Rangendinger Gemeinde ist: sie trat damals schon<br />
50
,5ofcti3oUcrtfd>c fcxnfce %<br />
Mitteilungen aug bem @efcf)icf)t3t>erein<br />
Veranstaltungen im 1. Quartal 1996<br />
I. Vorträge<br />
1. Privatdozent Dr. Tilman Allert, Tübingen:<br />
»Fürstin Eugenie - Fürst Friedrich Wilhelm Konstantin<br />
von Hohenzollern-Hechingen, eine Ehe am Hechinger<br />
Fürstenhof«.<br />
Montag, 22. Januar, um 20 Uhr im Spiegelsaal des Prinzenbaus<br />
in Sigmaringen.<br />
2. Dr. Andreas Zekorn, Balingen:<br />
»Die Städte Sigmaringen und Hechingen im 17. und 18.<br />
Jahrhundert«<br />
Montag, 5. Februar, um 20 Uhr im Hohenzollern-Saal des<br />
Neuen Schlosses (Kreissparkasse) in Hechingen.<br />
3. Dr. Otto Becker, Sigmaringen:<br />
»Die Kreisreform 1973 und Hohenzollern«<br />
Montag, 4. März, um 20 Uhr im Hohenzollern-Saal des<br />
Neuen Schlosses (Kreissparkasse) in Hechingen.<br />
Hingewiesen wird ferner auf die folgenden Vortragsveranstaltungen<br />
des Vereins Alte Synagoge in Hechingen:<br />
Rektor Otto Werner,<br />
Hechingen:<br />
»Die ehemaligen jüdischen Gemeinden Haigerloch und<br />
Hechingen, benachbart und doch verschieden«.<br />
Montag, 29. Januar, um 20 Uhr in der Alten Synagoge in<br />
Hechingen.<br />
II. Exkursionen<br />
Der Hohenzollerische <strong>Geschichtsverein</strong> veranstaltet am<br />
Samstag, 30. März, eine Halbtagesexkursion nach Straßberg,<br />
wo uns Rektor Gerhard Deutschmann auf dem<br />
»Heimatgeschichtlichen Wanderweg Straßberg«<br />
führen wird. Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit Privatfahrzeugen.<br />
Abfahrt: jeweils um 13.30 Uhr in Hechingen, Oberer<br />
Torplatz, und in Sigmaringen, Parkplatz vor<br />
der Stadthalle.<br />
Treffpunkt: um ca. 14 Uhr vor dem Rathaus in Straßberg.<br />
Rückfahrt: um ca. 17 Uhr.<br />
Anmeldungen von Selbstfahrern sowie für Interessenten,<br />
die eine Mitfahrgelegenheit suchen, sind zu richten<br />
aus dem Bereich Hechingen an Herrn Dr. Vees (Tel.<br />
07471/5620) und aus dem Bereich Sigmaringen an Frau<br />
Liebhaber (Tel. 07571/101-558).<br />
gez. Dr. Otto Becker<br />
mit einer Entscheidung von historischer Tragweite, nämlich<br />
der Weichenstellung zugunsten Hohenzollerns, in ihrer politischen<br />
Funktion hervor.<br />
Dies ist deshalb so wichtig, weil wir über die Gemeindebildung<br />
in Hohenzollern sonst erst relativ spät Bescheid wissen.<br />
Die frühen Nachrichten in Rangendingen zeigen jedoch, daß<br />
wir auch im Zollerischen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts<br />
mit einer recht starken Gemeindebewegung rechnen müssen,<br />
was nichts anderes heißt, als daß die Dörfer ihre Angelegenheiten<br />
in die eigene Hand zu nehmen versuchten und dabei<br />
auch unzumutbare herrschaftliche Verhältnisse verändern<br />
konnten. Gerade in Rangendingen sollte dies zu einem Element<br />
historischer Kontinuität ersten Ranges werden.<br />
Die Entscheidung Rangendingens zugunsten der Herrschaft<br />
Hohenzollern hat wohl dazu beigetragen, daß Österreich im<br />
Jahr 1467 auf seinen Teil am Dorf verzichtete und das Dorf<br />
somit ganz zollerisch wurde. Bekanntlich hat die Entscheidung<br />
dem Dorf nicht nur Glück gebracht. Damals, in den<br />
letzten Jahrzehnten des Mittelalters, mochten die Rangendinger<br />
mit ihrer Vereinigung unter Zollern wohl zufrieden<br />
sein, hundert Jahre später stellte sich dies völlig anders dar.<br />
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts wurde Rangendingen<br />
nämlich mit den übrigen Dörfern des Fürstentums HohenzollernHechingen<br />
in die jahrhundertelange Auseinandersetzung<br />
der Untertanen mit den Grafen und Fürsten in Hechingen<br />
gezwungen, die aus ihrem viel zu kleinen Land mehr<br />
herauszupressen versuchten, als es hergab.<br />
In diesem Konflikt, der sich nur oberflächlich um die freie<br />
Pirsch drehte und der mit bewaffneter Hand, aber auch juristisch<br />
vor den Reichsgerichten ausgefochten wurde, konnten<br />
die Rangendinger die Tragfähigkeit ihrer politischen Gemeindetradition<br />
erproben. Immer wieder waren sie gezwungen,<br />
in Gemeindeversammlungen darüber zu beraten, ob sie<br />
sich an den provokativen Jagdveranstaltungen der übrigen<br />
Untertanen beteiligten, ob sie an der Generalrebellion von<br />
1619 teilnehmen oder ob sie vom Jahr 1700 an gegen die Herrschaft<br />
vor dem Reichskammergericht prozessieren sollten.<br />
Hatten sich die Rangendinger im Mittelalter für Hohenzollern<br />
entschieden, so protestierten sie jetzt regelmäßig gegen<br />
die von ihnen gewählten »natürlichen« Herren, weil diese<br />
ihren Teil des Herrschaftsvertrags längst aufgekündigt hatten<br />
und von den Untertanen Ungebührliches verlangten.<br />
Nicht weniger als 15 Aufstände mußten sich die Fürsten von<br />
Hohenzollern-Hechingen von ihren Untertanen zwischen<br />
1584 und 1796 gefallen lassen, und immer standen Rangendinger<br />
mit in vorderster Reihe. Insbesondere in der Koordination<br />
der verschiedenen Aktivitäten der »Landschaft« seit<br />
dem Jahr 1700 spielten Rangendinger eine herausragende<br />
Rolle. So befand sich die Kanzlei der Landschaft, also der Vereinigung<br />
der Gemeinden 1700 im Haus des Christian Wannenmacher,<br />
und in späteren Jahren spielte auch der Rangendinger<br />
Nagelschmied Beutter eine führende Rolle.<br />
Was der zollerische Untertanenkonflikt über 200 Jahre hinweg<br />
letztendlich gebracht hat, kann man auch im Nachhinein<br />
nur schwer beurteilen. Das wichtigste Ergebnis erscheint<br />
mir jedoch, daß die hohenzollerischen Gemeinden aus ihrem<br />
51
Zusammenschluß zur »Landschaft« mit dem Landesvergleich<br />
von 1796 so etwas wie ein hohenzollerisches Grundgesetz<br />
erlangt haben, und dies allein wäre in verfassungsgeschichtlicher<br />
Hinsicht ein ausreichender Erfolg der Gemeindebewegung<br />
in Hohenzollern gewesen. Diesen Endpunkt der<br />
Entwicklung im Auge, ist es dennoch wichtig darauf zu verweisen,<br />
daß die politische Gemeindebewegung in Hohenzollern<br />
damals schon auf eine 400jährige Geschichte zurückblicken<br />
konnte, und Rangendingen zählte sicherlich zu den<br />
starken Trägern dieser Bewegung.<br />
Wenn wir so die Gemeinde und ihre politische Funktion als<br />
eine bestimmende Kraft der Rangendinger Geschichte in der<br />
Zeit zwischen 1381 und 1796 beschreiben können, so darf<br />
doch nicht übersehen werden, daß diese Einigkeit und Einmütigkeit<br />
von Dorf und Gemeinde Rangendingen sehr stark<br />
von außen bestimmt war, eben durch den immerwährenden<br />
Konflikt mit der Herrschaft. Diese politisch erzwungene Einigkeit<br />
nach außen verdeckt bis zu einem gewissen Grad die<br />
innerdörflichen Konflikte und Auseinandersetzungen, die es<br />
natürlich auch gab und die öfters, wie das früher auf den Dörfern<br />
üblich war, handgreiflich gelöst wurden.<br />
Anlaß für Konflikte innerhalb der Dorfgemeinschaft gab es<br />
bekanntlich genug. Da herrschte ein ständiger Hader zwischen<br />
den Vollbauern und den ärmeren Hintersassen um die<br />
Anteile am Allmand, da gab es Nachbarschafts- und Grenzstreitigkeiten<br />
aller Art. Aufgestaute Feindschaften und Ehrverletzungen<br />
unter den Dorfgenossen entluden sich unter<br />
dem notorischen Einfluß von Bier und Wein in Schlaghändeln<br />
und mitunter in tödlichen Auseinandersetzungen. Die<br />
älteste Nachricht von zwei Totschlägen in Rangendingen<br />
stammt noch aus dem Mittelalter: schon im Jahr 1463 wurden<br />
ein Klaus Fuchs und ein Ulrich Sauer von Dorfgenossen<br />
im Streit erschlagen. Zwei weitere Totschläge auf Rangendinger<br />
Gemarkung ereigneten sich im 16. Jahrhundert.<br />
Zu einem folgenschweren Totschlag, der eine größere Untersuchung<br />
nach sich zog, kam es um das Jahr 1610 anläßlich<br />
eines Richtfestes. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie nahe dörfliches<br />
Gemeinschaftsgefühl - denn ein Hausbau war immer<br />
eine kollektive Angelegenheit, beim Richtfest war fast das<br />
ganze Dorf versammelt - und das Zerbrechen der Gemeinschaft<br />
im Streit beisammen lagen.<br />
In dieselbe Zeit, in die Jahre 1588 bis 1627 fällt übrigens auch<br />
das düsterste Kapitel der Rangendinger Geschichte, die Hexenverfolgung.<br />
Nicht weniger als 20 Rangendinger Frauen<br />
wurden während dieser Zeit von ihren Nachbarinnen und<br />
Dorfgenossen als Hexen denunziert und den Hechinger<br />
Richtern zugeführt - 12 allein im Jahr 1610. Nicht von allen<br />
wissen wir, ob sie auf dem Scheiterhaufen endeten oder ob<br />
sie, wie auch immer, davon kamen. Auch die Hexenverfolgung<br />
bot einen rechtlichen Rahmen und ein soziales Ventil,<br />
um kollektive Ängste, existentielle Sorgen und lang schwelende<br />
Nachbarschaftskonflikte auszutragen. Es wäre sicherlich<br />
eine lohnende Aufgabe, einmal etwas mehr Licht in diese<br />
40 bedrückenden Jahre Rangendinger Geschichte zu bringen.<br />
Irgendwie in die Geschichte verstrickt war in jener Zeit<br />
auch der Pfarrer Lienhard Klotz, ein leidenschaftlicher Spieler<br />
und Trinker vor dem Herrn, der den Rangendingern öfters<br />
Anlaß zu Klagen gab.<br />
Ich erwähne dieses weniger glorreiche und kaum untersuchte<br />
Kapitel Rangendinger Geschichte, um nicht das Gefühl<br />
aufkommen zu lassen, das Dorfleben in früherer Zeit wäre<br />
die reine Idylle gewesen. Es gab Spannungen im Inneren, und<br />
es gab Konflikte nach außen, und zu allem Überfluß gab es<br />
Katastrophen höherer Gewalt wie Mißernten, Pestzeiten und<br />
den Dreißigjährigen Krieg. Es ist eigentlich erstaunlich, daß<br />
die Gemeinde als regulierendes und steuerndes Instrument<br />
des Dorfes diese Herausforderungen letztendlich unbeschadet<br />
überstanden hat und es sogar inmitten heftiger innerdörflicher<br />
Konflikte es noch geschafft hat, einen Widerstand gegen<br />
die Herrschaft zu organisieren wie die Teilnahme an der<br />
Generalrebellion von 1619 oder den Aufstand von 1732, in<br />
dessen Verlauf die Männer geschlossen mit ihrem Vieh ins<br />
benachbarte Ausland, nach Hirrlingen und Wachendorf ausgezogen<br />
sind.<br />
Nach dem Untergang des Alten Reiches und nach dem Übergang<br />
Hohenzollerns an Preußen im Jahr 1850 kamen auf Dorf<br />
und Gemeinde Rangendingen neue Herausforderungen zu.<br />
Es galt hier wie überall in Deutschland das große Problem<br />
des 19. Jahrhunderts, die soziale Frage, im kleinen zu lösen.<br />
Für die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immerumdie 1300<br />
Einwohner mußten neue Erwerbsmöglichkeiten gefunden<br />
werden. Es ist immer wieder erstaunlich, wie erfinderisch die<br />
Not des 19. Jahrhunderts unsere Ururgroßväter machte: Wie<br />
etwa die Killertäler ein kollektives System des Hausierhandels<br />
entwickelten. Wie die Wilflinger in Scharen als Maurer<br />
und Gipser auf die Walz gingen. Und wie ein Teil der Rangendinger<br />
ihr Heil in der Leineweberei suchte und fand.<br />
All diese gewerblichen Auswege waren Notsäulen des Überlebens,<br />
bis eine neue Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung,<br />
die Industrialisierung, Fuß faßte. Nach Rangendingen ist die<br />
Textilindustrie bekanntlich durch die jüdischen Unternehmer<br />
Löwengard und Levi aus Hechingen gekommen. Damit<br />
war dann schlagartig um die Jahrhundertwende die wirtschaftliche<br />
Grundlage für die Entwicklung zur modernen<br />
EDWIN ERNST WEBER<br />
Vortrag »775 Jahre Stadt Pfullendorf. Gedanken zur Stadtrechtsverleihung durch<br />
König Friedrich II. von 1220«<br />
Pfullendorf feiert <strong>1995</strong> das 775jährige Jubiläum seiner Erhebung<br />
zur Stadt. In einer Pergamenturkunde vom 2. Juni 1220<br />
verleiht der damalige Stauferkönig Friedrich II. der hiesigen<br />
Ortschaft immerwährende Freiheit und bekundet sodann seinen<br />
Willen, daß »in fundo eiusdem loci civitatem (.. .) esse«,<br />
daß also künftighin auf dem Boden dieses Ortes eine Stadt<br />
sei. Dieser königliche Rechtsakt vor genau 775 Jahren ist für<br />
Pfullendorf der Startpunkt einer bemerkenswerten historischen<br />
Entwicklung, die der Stadt im oberen Linzgau zusammen<br />
mit dem benachbarten Überlingen und zeitweise auch<br />
Konstanz unter den Städten des westlichen Bodenseeraums<br />
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eine Sonderstellung einräumt.<br />
Mithin Grund genug, das diesjährige Jubiläum dieses<br />
einschneidenden und folgenschweren Vorgangs zur bewußten<br />
Besinnung auf die eigene Stadtgeschichte und mithin auch<br />
auf die eigenen Wurzeln und die eigene Herkunft zu nutzen.<br />
Die Stadt Pfullendorf ist nicht aus dem Nichts erwachsen, die<br />
Stadt hat vielmehr eine dörfliche Vergangenheit. Offenbar im<br />
Bereich der heutigen Vorstadt existierte bereits einige Jahrhunderte<br />
lang vor der Stadtgründung ein Bauerndorf, dessen<br />
Name - »Dorf am Phuol« - mit einiger Wahrscheinlichkeit<br />
von den zahlreichen Sümpfen und Weihern, die ehedem das<br />
52
Gebiet nördlich des Bodensees durchsetzten, hergeleitet ist.<br />
Eine Abstammung der Siedlung vom antiken Juliomagus und<br />
womöglich gar eine Gründung durch Julius Cäsar, wie dies<br />
die ruhmbegierigen Reichsstädter in der Frühen Neuzeit<br />
wahrhaben wollten, ist eine der historischen Nachprüfung<br />
nicht standhaltende Legende und beruht auf einer Fehlinterpretation<br />
einer spätantiken Straßenkarte! Bis um das Jahr<br />
1400 läßt sich in den erhaltenen Quellen neben der Stadt das<br />
nicht in den ummauerten Bereich einbezogene »Dörflin«<br />
nachweisen. Ausweislich der Ortsnamensendung auf -dorf<br />
ist Pfullendorf eine Siedlung der älteren Ausbauzeit des 7.<br />
und 8. Jahrhunderts. Das bäuerlich-landwirtschaftliche Element<br />
behält darüber hinaus auch in der eigentlichen Stadt stets<br />
einen hohen und unübersehbaren Stellenwert. Im Grunde genommen<br />
bis in unser Jahrhundert hinein ist Pfullendorf zu<br />
einem gewissen Teil immer auch eine Ackerbürgerstadt, in<br />
einer der zuletzt fünf städtischen Zünfte sind die städtischen<br />
Bauern organisiert und wirken im Rahmen der Zunftverfassung<br />
am Stadtregiment mit.<br />
Zur Vorgeschichte der Stadtrechtsverleihung von 1220<br />
gehören darüber hinaus aber auch die Grafen von Pfullendorf<br />
mit ihrer vermutlich im Bereich des ehemaligen Dominikanerinnenklosters<br />
gelegenen Burg. Die Ersterwähnung eines<br />
Gero comes de Phullindorf, also eines Graf Gero von<br />
Pfullendorf, in der Petershausener Klosterchronik für die<br />
Zeitspanne von 1080 und 1084 ist zugleich auch der erste erhaltene<br />
Quellenbeleg für die Ortschaft selbst, nach der sich<br />
die Grafensippe benannte. Soweit dies die spärlichen und in<br />
der Forschung nicht immer einheitlich interpretierten Quellenbelege<br />
zu erkennen geben, sind die Pfullendorfer Grafen<br />
ein Zweig der auf den karolingischen Reichsadel zurückgehenden<br />
»Udalrichinger« und gehören mit ihren Besitzungen<br />
im Linzgau und im Hegau im 12. Jahrhundert zu den bedeutendsten<br />
Adelsfamilien im Bereich des Herzogtums Schwaben.<br />
Der letzte und zugleich wichtigste Sproß dieser Hochadelsfamilie<br />
ist Graf Rudolf von Pfullendorf, der zwischen<br />
1134 und 1180 in einer Vielzahl von urkundlichen Nennungen<br />
für die Verhältnisse dieser Schriftarmen Zeit recht präzise<br />
und bis hin zu persönlichen Zügen zu fassen ist. Graf Rudolf<br />
ist ein treuer Gefolgsmann des Stauferkaisers Friedrich<br />
Barbarossa, der bei den Heerfahrten und Verwaltungsreisen<br />
des Herrschers in Deutschland und Italien stets im engsten<br />
Kreis des Hofstaates anzutreffen ist. In nicht weniger als 41<br />
erhaltenen Kaiserurkunden tritt Rudolf in der Regierungszeit<br />
Barbarossas seit 1152 als Zeuge auf. Darüber hinaus ist<br />
der Pfullendorfer Graf mit seinem zielstrebig ausgebauten<br />
Besitzkonglomerat zwischen Hegau und Linzgau, Bregenz,<br />
St. Gallen und Chur eine entscheidend wichtige Stütze für die<br />
staufische Reichs- und Italienpolitik. Bereits zu Lebzeiten bestellt<br />
Graf Rudolf, der nach 1180 ohne männliche Nachkommen<br />
als Pilger im Heiligen Land stirbt, den mit ihm verwandten<br />
Stauferkaiser zum Alleinerben des größten Teiles<br />
seiner Besitzungen. Im ausgehenden 12. Jahrhundert werden<br />
damit unser Dorf Pfullendorf und die benachbarte, 1183 erstmals<br />
urkundlich genannte Grafenburg (»Castrum«) staufischer<br />
Hausbesitz. Und noch mit einem weiteren Kaiserhaus<br />
stehen die Pfullendorfer Grafen in verwandtschaftlicher Beziehung:<br />
Ita, die Tochter Graf Rudolfs, ist die Gemahlin Albrechts<br />
III. von Habsburg und damit die Urgroßmutter von<br />
König Rudolf von Habsburg.<br />
Soweit sich dies anhand der spärlichen Quellenbelege überhaupt<br />
rekonstruieren läßt, entsteht oberhalb des Dorfes Pfullendorf<br />
im Umfeld der Grafenburg im 12. Jahrhundert eine<br />
stadtähnliche Marktsiedlung, auf die sich die in der Stadtrechtsurkunde<br />
von 1220 vermeldete »villa« mit einiger Wahrscheinlichkeit<br />
bezieht. Wie nicht zuletzt auch die Stadterhebungsurkunde<br />
ausweist, hat diese Siedlung in den<br />
Thronkämpfen nach dem Tod von Barbarossas Sohn, Kaiser<br />
Heinrich VI., überaus harte Zeiten zu bestehen: Von Zer-<br />
An die Bezieher der »Hohenzollerischen Heimat«, die<br />
nicht Mitglieder des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />
sind.<br />
Durch die steigenden Kosten für Porto und Druckkosten<br />
ist leider eine Erhöhung des Bezugspreises unserer<br />
Zeitschrift notwendig. Der Bezugspreis beträgt ab<br />
1. 1. 1996 DM 13,- statt bisher DM 11,-.<br />
Störungen ist hier ebenso die Rede wie von wiederholten<br />
Schäden und Beeinträchtigungen durch Übeltäter und Friedensbrecher<br />
und nicht zuletzt auch von einer offenbar verheerenden<br />
Feuersbrunst. In diesen unruhigen Kriegs- und<br />
Notzeiten im ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhundert<br />
ging offenbar ein Großteil des vom Erbe Rudolfs<br />
herrührenden staufischen Hausbesitzes im Umfeld von Pfullendorf<br />
wieder verloren.<br />
So also sehen in groben Zügen die Vorgeschichte und der<br />
Hintergrund des königlichen Rechtsaktes aus, dessen Jubiläum<br />
wir in diesem Jahr begehen. Was aber hat nun eigentlich<br />
den Stauferkönig und späteren Kaiser Friedrich II. veranlaßt,<br />
die keineswegs sonderlich bedeutsame Siedlung Pfullendorf<br />
durch die Erhebung zur Stadt auszuzeichnen? Neben<br />
dem in der Urkunde genannten allgemeinen Anliegen der<br />
Wiederherstellung der weitgehend zerstörten und ruinierten<br />
staufischen Hausmacht im Linzgau und am Bodensee sowie<br />
der Hilfe und dem Schutz für die zuletzt von allerhand<br />
Schicksalsschlägen getroffenen Pfullendorfer geht es dem<br />
König wohl in erster Linie darum, einen neuen Stütz- und<br />
Konzentrationspunkt für die Königsmacht in der Region zu<br />
schaffen. Dabei mag durchaus auch, wie dies in der Forschung<br />
mitunter betont wird, die Reminiszenz an die Pfullendorfer<br />
Grafen und deren einstige enorme Bedeutung für die staufische<br />
Reichs- und Italienpolitik eine gewisse Rolle gespielt haben.<br />
Die Urkunde enthält jedenfalls den ausdrücklichen<br />
Hinweis, daß die »villa« Pfullendorf samt ihrem Zubehör<br />
dem König aus seinem väterlichen Erbe eigentümlich zugehöre.<br />
Für die weitere Entwicklung der künftigen Stadt haben vor<br />
allen Dingen zwei Bestimmungen in der sogenannten Dispositio<br />
der Königsurkunde höchst konkrete Auswirkungen:<br />
Zum einen erhält die Siedlung als äußeres Merkmal ihrer neuen<br />
Rechtsqualität eine Ummauerung, die von der Bürgerschaft<br />
in gemeinschaftlicher Arbeit zu errichten ist. Gewissermaßen<br />
als Starthilfe für dieses aufwendige Bauunternehmen<br />
wird den Pfullendorfer Stadtbürgern für die Dauer von<br />
sechs Jahren eine Steuerbefreiung gewährt, wobei sie allerdings<br />
gleichzeitig gemeinschaftlich jährlich 20 Mark über ihre<br />
Arbeitskraft hinaus zur Stadtbefestigung beitragen müssen.<br />
Zum anderen und vor allen Dingen aber wird Pfullendorf<br />
jetzt zu einem städtischen Rechtsbezirk, innerhalb dessen,<br />
im absoluten Gegensatz zur ansonsten scharf ausgeprägten<br />
Rechtsungleichheit in der feudalen Gesellschaft, gleiche<br />
Rechte und gleiche Pflichten für alle mit dem Bürgerrecht<br />
ausgestatteten Bewohner gelten. Ausdrücklich wird bestimmt,<br />
daß wer in der neuen Stadt Bürger zu sein wünscht<br />
und das Recht und die ehrenhafte Stellung dieser Stadt genießen<br />
will, er auch alle Pflichten der Stadt erfüllen muß; Ausnahmen<br />
hiervon werden lediglich dem örtlichen Pfarrklerus<br />
zugestanden. Zur Absicherung dieser Rechtsgleichheit aller<br />
Bürger wird weiterhin verfügt, daß kein Höriger oder Zinsmann<br />
irgendeines anderen Herrn - mit Ausnahme allein der<br />
staufischen beziehungsweise königlichen Dienstleute - in der<br />
Stadt im Bürgerrecht aufgenommen werden darf, es sei denn,<br />
dies geschehe mit Zustimmung des jeweiligen Herrn, der damit<br />
indessen seinen Untertan aus seiner herrschaftlichen Bindung<br />
entließe.<br />
53
Zu einem gewissen Teil haben die Pfullendorfer ihre Stadterhebung<br />
der Vermittlung des Klerikers Ulrich zu verdanken,<br />
der in der Kaiserurkunde ausdrücklich als »huius facti<br />
(...) auctor et fidelissimus cooperator« gewürdigt wird, mithin<br />
also als Urheber und Veranlasser der Stadtrechtsverleihung.<br />
Als kleine Entschädigung für seine Mühe wird Ulrich,<br />
den Josef Groner nicht zu Unrecht als »Vater der Stadt« charakterisiert<br />
hat, zusammen mit seiner Hausgenossenschaft<br />
von den übrigen Bürgern zur Stadtbefestigung auferlegten<br />
Lasten befreit.<br />
Mit dem Untergang der Staufer, zu deren Hausbesitz Pfullendorf<br />
seit 1180 gehört hatte, büßt die Stadt in der Mitte des<br />
13. Jahrhunderts ihren unmittelbaren Stadtherrn und gleichzeitig<br />
auch die mediatisierende Herzogsgewalt in Schwaben<br />
ein. Als Stadtherr wird jetzt lediglich noch der König anerkannt,<br />
wobei die herrschaftlichen Rechte in Verwaltung und<br />
Rechtspflege in Pfullendorf wie auch anderenorts in einer langen<br />
Kette von Privilegierungen Schritt für Schritt beschnitten<br />
und ausgehöhlt werden. Von König Rudolf von Habsburg<br />
läßt man sich 1282 eine eigene, unabhängige Gerichtsbarkeit<br />
gewähren, von der allerdings noch das Hochgericht<br />
über todeswürdige Verbrechen ausgenommen ist, das weiter<br />
dem königlichen Stadtherrn beziehungsweise dessen örtlichem<br />
Vertreter, dem Ammann, vorbehalten bleibt. 1331 wird<br />
die Befreiung von fremden Gerichten und mithin die weitgehend<br />
unabhängige städtische Justiz-Ausübung erreicht.<br />
Von König Sigismund erhält Pfullendorf 1415 sodann die<br />
Hochgerichtsbarkeit über das Stadtgebiet verliehen, und im<br />
Jahr darauf vermag man ihm überdies auch noch für 70 Mark<br />
Silber das bisher noch dem Reich gehörende Ammannamt abzukaufen.<br />
Obgleich diesem Erwerb 1434 die erste kaiserliche Verleihung<br />
der Blutgerichtsbarkeit nachfolgt, können sich die Pfullendorfer<br />
ihres Erfolges nur für begrenzte Zeit freuen: Als<br />
nämlich 1460 die bis dahin unbedeutende Herrschaft Sigmaringen<br />
durch kaiserlichen Lehnsbrief zur reichslehenbaren<br />
Grafschaft erhoben und die alten Sigmaringer Forstgrenzen<br />
zu Grafschafts- und Hochgerichtsgrenzen umgestaltet werden,<br />
führt dies rundum zu endlosen Konflikten mit den<br />
Nachbarherrschaften, die sich von den Sigmaringer Grafen<br />
und deren energisch vorgetragenem Anspruch auf die Blutgerichtsbarkeit<br />
in ihrer eigenen Orts- und Territorialherrrschaft<br />
beeinträchtigt sehen. Im Fall der Reichsstadt Pfullendorf,<br />
wo es um die Ausübung der Hochgerichtsbarkeit außerhalb<br />
des eigentlichen, ummauerten Stadtbezirkes geht, ziehen<br />
sich die Streitigkeiten an den obersten Reichsgerichten<br />
durch das gesamte 16. Jahrhundert hin, ohne daß es jemals zu<br />
einer wirklichen, definitiven Klärung der Konfliktfragen gekommen<br />
wäre.<br />
Das große Ziel aller mittelalterlichen und frühneuzeitlichen<br />
Stadt- wie auch Landgemeinden ist die kommunale Autonomie,<br />
also die Erlangung eines Höchstmaßes an innerer Eigenständigkeit<br />
und Unabhängigkeit vom jeweiligen Stadtherrn.<br />
Die größten Autonomiespielräume bis hin zu einer mit<br />
adligen oder geistlichen Reichsständen vergleichbaren Landesherrschaft<br />
erlangen dabei die Reichsstädte, ohne daß indessen,<br />
wie die neuere Forschung nachweisen konnte, der<br />
Kaiser als Stadtherr und als Machtfaktor innerhalb der Stadtverfassung<br />
gänzlich verdrängt worden wäre. Auch in Pfullendorf<br />
läßt sich, dem allgemeinen Trend des Aufstiegs der<br />
Genossenschaftlichkeit im ausgehenden Mittelalter folgend,<br />
im 14. und 15. Jahrhundert unverkennbar das Vordringender<br />
kommunalen Autonomie zu Lasten der Position des kaiserlichen<br />
Stadtherrn konstatieren. Dessen örtlicher Vertreter,<br />
der sogenannte Ammann oder Minister, der übrigens über<br />
lange Zeit von den Herren von Gremiich als der führenden<br />
Stadtadelsfamilie gestellt wird, gerät zu Beginn des 15. Jahrhunderts<br />
endgültig unter städtische Kontrolle und sinkt in<br />
der Folge zum vergleichsweise bedeutungslosen und jährlich<br />
durch Wahl neubesetzten Vorsitzenden beim Stadtgericht<br />
herab. Bereits im 14. Jahrhundert geht der bestimmende Einfluß<br />
innerhalb der Stadt auf die kommunalen Selbstverwaltungsgremien<br />
über: 1273 ist in den Quellen erstmals von den<br />
consules civitatis, also dem städtischen Rat, die Rede, 1330<br />
werden Gericht und Rat genannt.<br />
Das nach der Stadtrechtserhebung von 1220 wohl wichtigste<br />
Datum in der älteren Stadtgeschichte ist sodann das Jahr 1383,<br />
das die Einführung der Zunftverfassung in Pfullendorf und<br />
damit die Institutionalisierung der auf die zunächst sechs und<br />
seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert noch fünf städtischen<br />
Zünfte gestützten stadtgenossenschaftlichen Selbstverwaltung<br />
bringt. Drei Jahre später, 1386, wird mit Hainrich Ortlieb<br />
der erste Bürgermeister von Pfullendorf urkundlich erwähnt.<br />
Organe der Zunftverfassung in Pfullendorf sind der<br />
jährlich nach Weihnachten von der städtischen Bürgerschaft<br />
gewählte 50köpfige Große Rat sowie der aus 17 Mitgliedern<br />
bestehende Kleine Rat, der unter dem Vorsitz des gleichfalls<br />
jährlich neuzuwählenden Bürgermeisters das eigentliche<br />
Stadtregiment in einem höchst umfassenden Sinne ausübt.<br />
Trotz dieser auf den ersten Blick vermeintlich weitgehenden<br />
Bürgerbeteiligung am Stadtregiment sollte man diese mittelalterliche<br />
und frühneuzeitliche Zunftverfassung tunlichst<br />
nicht mit modernen demokratischen und republikanischen<br />
Verfassungsverhältnissen verwechseln. Zum einen ist die<br />
kommunale Mitwirkung stets auf die verbürgerten Familienväter<br />
der Stadt begrenzt, Frauen, unverheiratete Männer<br />
und vor allem auch die zeitweise beträchtliche Zahl nichtbürgerlicher<br />
Beisitzer ist bis in das 19. Jahrhundert hinein generell<br />
von der politischen Teilhabe und Mitsprache ausgeschlossen.<br />
Zum anderen entwickelt sich auch in Städten mit<br />
Zunftverfassung, wie neuere Forschungen etwa zu Rottweil<br />
oder Überlingen ergeben haben, de facto ein sogenanntes<br />
»Quasi-Patriziat«, das die für das Stadtregiment ausschlaggebenden<br />
Positionen und Organe bei nur marginaler Beteiligung<br />
der übrigen Bürgerschaft für sich reserviert und beherrscht.<br />
Mit einer kurzen, durch einen kaiserlichen Eingriff<br />
in das Pfullendorfer Stadtregiment bedingten Unterbrechung<br />
in den 1550er Jahren hat die im ausgehenden 14. Jahrhundert<br />
durchgesetzte Zunftverfassung in Pfullendorf bis zum Übergang<br />
der Stadt an Baden 1803 Bestand.<br />
Im 14. und 15. Jahrhundert wird die Reichsstadt Pfullendorf<br />
dann sogar selbst zum Landesherr über ein kleines ländliches<br />
Territorium in der Nachbarschaft. Über die im weiten Umkreis<br />
besessenen Grund- und zehntherrschaftlichen Rechte<br />
hinaus, vermag die Stadt mit Hilfe ihres bis in die neuere Zeit<br />
hinein vermögenden HeiligGeist-Spitals seit dem ausgehenden<br />
14. Jahrhundert die Ortsherrschaft über die Orte 111-<br />
mensee, Groß- und Kleinstadelhofen, Waldbeuren und Zell<br />
sowie verschiedene benachbarte Weiler käuflich zu erwerben.<br />
Diese in vier Amter eingeteilte sogenannte »Landschaft«<br />
mit 1802 insgesamt 718 Einwohnern gegenüber 1394 Bewohnern<br />
innerhalb der Stadt ist bis in das 19. Jahrhundert<br />
hinein die wichtigste Grundlage für die Einkünfte der Stadt<br />
und zumal des Spitals. Wie allenthalben in der Feudalzeit profitieren<br />
auch die Reichsstadt Pfullendorf und ihre Bürgerschaft<br />
ganz enorm von einem Vermögenstransfer aus dem abhängigen<br />
Land an die Inhaber feudaler Rechts- und Leistungsansprüche.<br />
Innerhalb der Stadtmauern werden das bürgerliche Leben<br />
und der Alltag im Mittelalter und der Frühen Neuzeit in einem<br />
hohen Maße von den sich alsbald nach der Stadtgründung<br />
bildenden frommen Stiftungen und religiösen Gemeinschaften<br />
geprägt. Da ist zunächst das 1257 erstmalig erwähnte<br />
Heilig-Geist-Spital mit seiner wichtigen Funktion in der<br />
Alten-, Armen und Krankenfürsorge zum Nutzen der städtischen<br />
Bürgerschaft. Die Verwaltung des bis in die Mitte des<br />
54
19. Jahrhunderts im Bereich des heutigen Gasthauses »Deutscher<br />
Kaiser« untergebrachten Spitals mit seinem bedeutenden<br />
Vermögen und seinen umfangreichen Feudalrechten obliegt<br />
dem städtischen Bürgermeister und dem Kleinen Rat, als<br />
deren Verwaltungsorgane drei Spitalpfleger und ein sogenannter<br />
Schaffner tätig sind. Gleichfalls bereits im 13. Jahrhundert<br />
entsteht die St.-Katharinen-Stiftung mit der gleichnamigen<br />
Kapelle und dem Leprosenhaus im Bereich des heutigen<br />
Gasthauses »Deutsches Haus« als Isoliereinrichtung für<br />
mit ansteckenden Krankheiten behaftete Stadtbewohner.<br />
Wichtige Bestandteile der sozialen und religiösen Infrastruktur<br />
des alten Pfullendorf sind weiterhin eine ganze Reihe<br />
von geistlichen Stiftungen, Armenfonds und Ausbildungsstipendien,<br />
Pfleghöfe der Klöster Königsbronn, Salem<br />
und Wald, die beiden aus Beginen-Gemeinschaften hervorgegangenen<br />
städtischen Klöster der Dominikanerinnen und<br />
der Franziskanerinnen und nicht zuletzt auch die bis in das<br />
14. Jahrhundert zurückverfolgbare Kapelle Maria Schray mit<br />
ihrer zeitweise florierenden Marienwallfahrt.<br />
Bei ihrer Pfarrkirche, deren Ersterwähnung übrigens in die<br />
Zeit vor der Stadterhebung in das ausgehende 12. Jahrhundert<br />
zurückreicht, vermag die Reichsstadt erst zu einem relativ<br />
späten Zeitpunkt das Präsentations- beziehungsweise<br />
Nominationsrecht für den Stadtpfarrer zu erlangen. Das ehedem<br />
zunächst in gräflichem und sodann in staufischem Besitz<br />
befindliche Patronat war 1347 vom damaligen König Karl<br />
IV. dem Kloster Königsbronn geschenkt und diesem im folgenden<br />
Jahr inkorporiert worden. Die personelle Besetzung<br />
der Stadtpfarrei obliegt damit offiziell bis in das 16. Jahrhundert<br />
hinein dem von Württemberg bevogteten Kloster.<br />
Nach der Säkularisierung von Königsbronn durch Württemberg<br />
in der Reformationszeit einigen sich die Reichsstadt<br />
und das Herzogtum darauf, daß der Pfarrsatz mit der Verpflichtung,<br />
für den Unterhalt von Pfarrhaus sowie des Stadtpfarrers<br />
und zweier Hilfsgeistlichen aufzukommen, bei<br />
Württemberg verbleibt, das Nominationsrecht aber, das Anrecht,<br />
bei Vakanz der Pfarrei dem zuständigen Konstanzer<br />
Bischof einen geeigneten Kandidaten vorzuschlagen, der<br />
Stadt überlassen wird. Der Pfullendorfer Pfarrkirche, der neben<br />
dem eigentlichen Pfarrbenefizium zeitweise noch bis zu<br />
16 weitere Pfründe angegliedert sind, gehören bis in das<br />
19. Jahrhundert hinein die Filialen Denkingen und Aftholderberg<br />
an.<br />
Die Stadterhebung des Jahres 1220 ist mithin der Ausgangspunkt<br />
einer ganz bemerkenswerten stadtgeschichtlichen Entwicklung<br />
mit unmittelbaren politischen und sozialen Auswirkungenbis<br />
in das beginnende 19. Jahrhundert hinein. Erst<br />
durch die Mediatisierung der Reichsstadt durch Baden 1803<br />
büßt Pfullendorf seine letztlich im Rechtsakt des Jahres 1220<br />
angelegte Sonderstellung als staufische und sodann als<br />
Reichsstadt wieder ein und sinkt aufgrund ihrer wirtschaftlichen<br />
Strukturschwäche bis in die Nachkriegszeit zu einer<br />
Landstadt von minderer Bedeutung ab. Im Selbstverständnis<br />
und einem gewissen städtischen Stolz der Pfullendorfer Bürgerschaft<br />
scheinen mir die Folgewirkungen der einstigen<br />
Reichsstadtstellung indessen teilweise bis auf den heutigen<br />
Tag nachzuklingen.<br />
Herangezogene Quellen und Literatur:<br />
- Stadterhebungsurkunde Friedrichs II. von 1220 für Pfullendorf<br />
(GLAK Selektbestand D).<br />
- Karl Schmid, Graf Rudolf von Pfullendorf und Kaiser<br />
Friedrich I. Freiburg 1954 (Bd. I der Forschungen zur oberrheinischen<br />
Landesgeschichte)<br />
- Die Chroniken der Stadt Pfullendorf. Hg. u. bearb. von<br />
Josef Groner, Pfullendorf 1982.<br />
- Josef Groner, Pfullendorf im Linzgau. 30 Themen zur Geschichte<br />
einer ehemals Freien Reichsstadt, Pfullendorf 1988.<br />
—Johanna Sachse, Die Freie Reichsstadt Pfullendorf, in: Die ehemals<br />
Freie Reichsstadt Pfullendorf und ihre Geschlechter. Hg. v. d. Stadt<br />
Pfullendorf, Pfullendorf 1964, S. 7-22.<br />
- Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden. Hg. v.<br />
d. Badischen Historischen Kommission. Bearb. von Albert Krieger,<br />
2 Bde., Heidelberg 1904/05.<br />
- Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen<br />
und Gemeinden, Bd. VII., Regierungsbezirk Tübingen. Hg. v.<br />
d. Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Stuttgart 1978.<br />
-Dieter-Wilhelm Mayer, Die Grafschaft Sigmaringen und ihre<br />
Grenzen im 16. Jahrhundert. Die Rolle des Forsts beim Ausbau der<br />
Landeshoheit, Sigmaringen 1956 (Heft 4 der Arbeiten zur Landeskunde<br />
Hohenzollerns).<br />
WALTER KEMPE UND HERMANN FRANK<br />
Aus der Geschichte Lausheims, Teil 2<br />
Der Futterer Hof<br />
Der Futterer Hof, Haus Nr. 54, heute Nr. 34, hat seine besondere<br />
Geschichte. 1701 und 1708 erfahren wir aus Berichten,<br />
daß der Klosterstaat Salem sechs sogenannte äußere Höfe<br />
unterhielt, die vom salemischen Jägermeister und vom salemischen<br />
Hofmetzger kontrolliert wurden. Es handelte sich<br />
um die Höfe Dornsberg (Gem. Eigeltingen, Kr. Konstanz),<br />
Madachhof (Gem. Mainwangen, Kr. Konstanz), Gründelbuch<br />
(Gemeinde Buchheim, Kr. Tuttlingen), Bachhaupten,<br />
Malaien (bei Denkingen, etwa um die Mitte des letzten Jahrhunderts<br />
abgerissen) und Lausheim.<br />
Um 1738 hatte Salem dann das Hofgut zu Lausheim neu errichtet,<br />
das vorher in anderer Form bestand. Auf Grund eines<br />
Gutachtens des Pflegeamtes Pfullendorf wurden später,<br />
wie oben erwähnt, den 3 Söldnern zu Lausheim 1747 einige<br />
Ackerfelder und Wiesen überlassen. Aus dem Hofgut wurde<br />
ein Viehhof, in dem 30 Stück Schmalvieh (junge<br />
Schlachtrinder) standen und dem nur noch Wiesen zugeteilt<br />
wurden. Ein herrschaftlicher Futterer versorgte diesen Hof.<br />
Er hatte das kleine herrschaftliche Wohnhaus ohne Garten<br />
zur Verfügung.<br />
Der rechte Flügel des Ökonomiegebäudes diente als Zehntscheuer.<br />
Sie wurde 1732 zusammen mit dem damals noch kleinen<br />
Wohnhaus (Nr. 54) errichtet, als die alte Zehntscheuer<br />
nach einem Blitzschlag abgebrannt war. Diese stand südwestlich<br />
der späteren Zehntscheuer, wurde schon 1509 erwähnt<br />
und war bei der Abgabe von Vogtgarben der Zehntscheuer<br />
von Ostrach gleichgestellt.<br />
Um 1793 kam Fidelis Andelfinger als Futterer nach Lausheim.<br />
Und nun hören wir, was kein geringerer als Pater Benedikt<br />
Hänggi, Pfarrer zu Habsthal und den alten Lausheimern<br />
noch als »'s Päterle« ein Begriff, in seinem Büchlein<br />
55
»Aus den klosterherrlichen Zeiten des alten Oberamtes<br />
Ostrach im 18. Jahrhundert«, 1904 über diesen letzten herrschaftlichen<br />
Futterer zu berichten wußte:<br />
»Als reichsäbtlicher Kutscher sah Fidel Andelfinger, ehe ihm<br />
Abt Robert den Futtererhof zu Lausheim verlieh, noch den<br />
vollen Glanz der Reichsabtei in den 80er und 90er Jahren des<br />
vorletzten Jahrhunderts. In dieser Diensteigenschaft, in einer<br />
flotten, goldbetreßten Montur, auf dem Hut mit einem wallenden<br />
Federbusch über dem Salemer Wappen ausgerüstet,<br />
fuhr er mit seinem gnädigen Herrn, selber auch glänzend, in<br />
die »obere Herrschaft« und wer darf sich wundern, wenn des<br />
Kastners »Annemeile« aus Bachhaupten dem prächtigen Burschen,<br />
dem alle Gauschönen im alten Oberamt nur ein Loblied<br />
sangen, die Hand zum Lebensbunde reichte.«<br />
Fidelis Andelfinger wurde 1767 in Grasbeuren geboren. Er<br />
heiratete 1793 Anna Maria (»Annemeile«) Kohlhund, die<br />
Tochter des Kastners (Verwalter) vom Bachhaupter Amtshof.<br />
Als Futterer in Lausheim erhielt er seine Besoldung vom<br />
Bursieramt in Salem. Nach Übernahme der salemischen<br />
Herrschaft Ostrach durch die Fürstlich Thum und Taxis '-<br />
sehe Regierung in Regensburg erfolgte 1803 die Neuplanung<br />
in Lausheim.<br />
Auf Grund reiflicher Überlegungen und Vorschläge des<br />
Oberamts Ostrach entschied 1804 Regensburg, den neuen<br />
Kameralhof zu Lausheim dem Fidel Andelfinger schupflehenweise<br />
zu überlassen. Er mußte sich als Leibeigener einkaufen.<br />
Der Kameralhof bekam 33 Jauchert Ackerfeld, 12<br />
Mannsmahd Wiesen und ca. 2 Tagwerk Garten zugeteilt. Die<br />
Viehhaushälfte der großen Zehntscheuer mußte für das Lehensgut<br />
zu einer Scheuer mit kleineren Stallungen, Frucht -<br />
und Heubehältnissen umgebaut werden, da die Zehntscheuer-Hälfte<br />
weiterhin von der Herrschaft benötigt wurde. Das<br />
Wohnhaus als Futterer wurde ihm belassen. Weil es aber<br />
ziemlich klein war, durfte er es um ein Kar erweitern. Das<br />
Vieh, das jetzt noch im Viehhaus stand, hatte er noch bis zum<br />
Frühjahr zu versorgen, dann wurde es verkauft bzw. versteigert.<br />
Seine Besoldung als Futterer fiel dann weg. Fidel Andelfinger<br />
starb 1839. Seinem Sohn Michael übergab die Witwe<br />
1845 das Erbe. Er kaufte 1861 die Zehntscheuer (Nr. 55)<br />
von der Standesherrschaft.<br />
Pater Hänggi begegnete 1904 dem 99jährigen »Futterer-Näne«<br />
(Großvater) Michael Andelfinger, der auf dem Weg zur<br />
kleinen Lausheimer Kapelle war:<br />
»Er stützte sich auf einen Stock und strebte sicheren Schrittes<br />
vom Bauernhaus bei der stolzen, wappengeschmückten<br />
Zehntscheuer rainabwärts dem lieben Kirchlein zu.«<br />
Der Futterer-Näne hat die hundert Jahre vollgemacht und<br />
noch etwas dazu. Am 19. September 1904 konnte er, hochgeehrt,<br />
seinen lOOsten Geburtstag feiern. Er war der älteste<br />
Mensch von ganz Hohenzollern. Am 28. März 1906 ist er im<br />
Alter von 101 Jahren, 6 Monaten und 9 Tagen gestorben.<br />
Auch dem Enkel des Fidel, Anton Andelfinger, der den Hof<br />
1878 übernahm, war ein langes Leben beschieden. Er starb<br />
1935. Heute wohnt hier wiederum dessen ältester Enkel Joseph<br />
Andelfinger, zusammen mit der Familie seines Schwiegersohnes<br />
Eberhardt.<br />
Die Kapelle St. Rupertus<br />
Kirchlich war Lausheim schon sehr früh ein Filial der Kirche<br />
zu Magenbuch, die seit 1255 dem Kloster Salem gehörte.<br />
Im Bereich der ältesten Güter Lausheims, dem ehemaligen<br />
Ober- und Unterhof, steht nun die bereits erwähnte romanische<br />
Kapelle aus dem 12. Jahrhundert.<br />
Ihr Baujahr ist nicht bekannt, jedoch dürfte ihr Schicksal mit<br />
dem 1324 bekundeten Hof Salems zusammenhängen. In die-<br />
Der Futtererhof, Wohnhaus und Zehntscheuer von 1732.<br />
Foto: Ilse Kempe<br />
sem Jahr sollte der Pfarrer zu Ostrach einmal in der Woche,<br />
sowie am Tage des Patronen und der Kirchweih, in der Kapelle<br />
Messe lesen.<br />
Aufschluß über die Besitzverhältnisse gibt 1461 die Verleihung<br />
der Pfarrkirche zu Magenbuch. Abt Ludwig von Salem<br />
übergab sie Pfaff Johann Stayger aus Veringen. Hierbei wurde<br />
klargestellt, daß der Altar zu Lausheim, bzw. die Kapelle,<br />
mit seiner Nutzung der Kirche zu Magenbuch nicht verhaftet<br />
noch gehörig sei. Als Eigentum Salems empfing sie Pfaff<br />
Stayger jährlich von neuem aus der Hand des Abtes.<br />
1566 mußte Hans Geyger vom Oberhof zu Lausheim u. a.<br />
der Kapelle zu Lausheim 1 Pfund Wachs aus den Öläckern<br />
geben.<br />
Nach der Auflösung des Klosterstaats Salem 1803, finden wir<br />
die Kapelle, laut Primärkataster des Jahres 1846, im Besitz der<br />
Gemeinde Lausheim, Parzelle Nr. 50. Ob die bauliche Unterhaltspflicht<br />
den Erben Salems, nämlich den Fürsten von<br />
Thum und Taxis, oder der Gemeinde zufiel, war noch nicht<br />
geklärt.<br />
Als kirchlicher Patron der Kapelle wird, mindestens seit Abt<br />
Petrus von Salem im Jahre 1594 eine Inventur vorgenommen<br />
hatte, St. Rupertus genannt. Nach älteren Dokumenten war<br />
die Kapelle vorher, z. B. 1494, St. Bernhardus geweiht. Ein<br />
ähnlicher Wechsel des Patroziniums fand um 1592 bei den<br />
Pfarrkirchen St. Pankratius in Magenbuch und in Ostrach<br />
statt, die vorher »Unserer Lieben Frau« geweiht waren.<br />
Die Renovationen der Lausheimer Kapelle<br />
Das ehrwürdige Alter der Kapelle zu Lausheim läßt es als sicher<br />
erscheinen, daß in den 8 bis 900 Jahren ihres Bestehens<br />
der Zahn der Zeit sich immer wieder bemerkbar machte. Besonders<br />
in wirtschaftlich schlechten Zeiten, an denen ja kein<br />
Mangel war, mögen Bereitschaft und Möglichkeit zum Konservieren<br />
und Renovieren nicht besonders groß gewesen sein.<br />
Wir dürfen als sicher annehmen, daß es in der Geschichte der<br />
Kapelle kritische, ja existenzbedrohende Zeiten gegeben hat.<br />
Offensichtlich kam aber immer rechtzeitig Hilfe für ihre Rettung.<br />
Anhaltspunkte über zwei dieser früheren und wohl wesentlichen<br />
Wiederherstellungen der Kapelle, geben uns die erneuten<br />
Weihen durch die Weihbischöfe des Bistums Konstanz,<br />
zu dem Lausheim wohl seit seiner Gründung bis zur<br />
Aufhebung der Diözese im Jahre 1827 gehörte.<br />
56
Zwei Original-Urkunden befinden sich im Staatsarchiv Sigmaringen.<br />
Die erste, bezeugt, daß am 9. August 1494 Daniel,<br />
der Weihbischof des Bischofs von Konstanz - es dürfte Thomas<br />
Berlower gewesen sein - die Kapelle im Ort Lausheim,<br />
Pfarrei Magenbuch, zu Ehren des heiligen Bernhardus wiederum<br />
geweiht hat. Ebenso weihte er den Altar sowohl zu<br />
Ehren desselben, als auch u. a. des St. Rupertus. Den<br />
Kirchweihtag für Kapelle und Altar setzte er auf Sonntag vor<br />
Michaelis fest.<br />
Die nächste uns bekannte, urkundlich überlieferte Altarweihe<br />
in der Filialkirche Lausheim bei Magenbuch fand am 11.<br />
August 1763 statt. Sie wurde durch Franziskus Carolus Josephus<br />
Fugger, Weihbischof des damaligen Bischofs von<br />
Konstanz, Franz Konrad, Kardinal von Rodt, vorgenommen.<br />
Er hat in der Kapelle den Altar zu Ehren des heiligen Bischofs<br />
Rupertus geweiht und Reliquien von heiligen Märtyrern eingeschlossen.<br />
Allen Gläubigen, die den Altar am Weihetag besuchen,<br />
verlieh er einen Ablaß von 40 Tagen.<br />
Sehr starke Verfallserscheinungen der Kapelle werden uns aus<br />
der Zeit um 1850 gemeldet. Ausführliche Unterlagen des Jahres<br />
1854 berichten, daß der Zustand der Decke der Kapelle<br />
zu Lausheim deren Einsturz befürchten ließ und die Gottesdienstbesucher<br />
stark gefährdete. Die königliche Regierung in<br />
Sigmaringen verfügte, daß bis zur Klärung der Unterhaltspflicht<br />
des Baus, die Gemeinde Magenbuch-Lausheim in<br />
Vorlage der Kosten zu treten habe. Das Bürgermeisteramt<br />
Magenbuch berichtete damals dem königlichen Oberamt:<br />
»... das Dach der Kapelle wurde ganz frisch umgeschlagen,<br />
neu verschindelt, der First mit neuen Hohlziegeln versehen<br />
und gut vermauert. Bei der Ausbesserung der Decke fiel ein<br />
Stück nach dem anderen von selbst herunter und mußte erneuert<br />
werden«.<br />
Eine der weiteren, größeren Baufälligkeiten wurde in den<br />
siebziger Jahren dieses Jahrhunderts registriert. Die Kapelle<br />
war wiederum in einem desolaten Zustand. Dies gab den Anstoß<br />
zur Gründung der Bürgerinitiative »Interessengemeinschaft<br />
zur Erhaltung der Lausheimer Kapelle«, am 2.11.1981.<br />
Dank dieser Initiative des damaligen Ortschaftsrates konnte<br />
unter Federführung der Herren Peter Senn und Hubert Frank<br />
das Interesse an der Erhaltung des historischen Kleinods bei<br />
einer breiten Öffentlichkeit mit voller Unterstützung der<br />
amtlichen Stellen geweckt werden. Nach Fertigstellung der<br />
umfangreichen, mit namhaften Kosten und Eigenleistungen<br />
verknüpften Renovierungsarbeiten, stellte sich im Jahre 1985<br />
eine im neuen Glanz erstrahlende Kapelle St. Rupertus dar.<br />
In einer hübschen Festschrift wurde das über die Kapelle bisher<br />
Bekannte, insbesondere ihre Ausstattung, dokumentiert.<br />
EDWIN ERNST WEBER<br />
Der Nachlaß des Heimatforschers Josef Deschler im Kreisarchiv Sigmaringen<br />
Ab sofort steht im Kreisarchiv Sigmaringen der Nachlaß des<br />
hohenzollerischen Lehrers und Heimatforschers Josef Deschler<br />
(1897-1991) für die wissenschaftliche und heimatkundliche<br />
Benutzung zur Verfügung. Der zum 1. April 1994<br />
als Schenkung an das Kreisarchiv Sigmaringen gelangte persönliche<br />
und heimatgeschichtliche Nachlaß wurde mittlerweile<br />
archivfachlich geordnet, neu verpackt und verzeichnet.<br />
Der Bestand mit einem Umfang von 0,3 laufenden Metern<br />
und einer Laufzeit von 1757 bis 1987 ist durch ein Findbuch<br />
erschlossen. Reichhaltige Aufschlüsse birgt der Nachlaß vor<br />
allem zur Ortsgeschichte von Bingen und Ablach und darüberhinaus<br />
des gesamten Sigmaringer Raums.<br />
Josef Deschler wurde am 26. September 1897 in Bingen als<br />
Sohn des Bauern Johann Deschler und seiner Ehefrau Katharina<br />
geb. Kiene geboren. Seine schulische Ausbildung erhielt<br />
er zunächst an der örtlichen Volksschule und von 1910 bis<br />
1913 an der Benediktiner-Oblatenschule (Ordensgymnasium)<br />
Emaus in Prag. Im Herbst 1913 gab er die vor allem auch<br />
auf Veranlassung seines Onkels, des Beuroner Paters<br />
Hieronymus Kiene, gefaßte Absicht, in den geistlichen Stand<br />
einzutreten, wieder auf und nahm im Jahr darauf das Lehrerstudium<br />
an der preußischen Präparandenanstalt in Hechingen<br />
auf. Nach der Unterbrechung durch den Militär- und<br />
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und der langen Rekonvaleszenz<br />
nach einer schweren Verwundung an der Westfront<br />
1918 setzte Deschler vom September 1919 bis 1921 sein Lehrerstudium<br />
in Hechingen und sodann am Lehrerseminar in<br />
Boppard a. Rh. bis zur ersten Dienstprüfung fort. Aufgrund<br />
der schlechten Beschäftigungslage im Schuldienst war Deschler<br />
in der Folge bis 1925 zunächst als Büroangestellter bei der<br />
Hauptfürsorgestelle des Landeskommunalverbandes im Sigmaringer<br />
Landeshaus tätig, ehe er zum 1. Mai 1925 den ersehnten<br />
Lehrerberuf mit einer Vertretungstätigkeit an der damals<br />
zweiklassigen Volksschule in Thalheim dann doch antreten<br />
konnte. Nach der zweiten Dienstprüfung 1927 wurde<br />
Josef Deschler die etatmäßige Lehrerstelle an der einklassigen<br />
Volksschule in Rosna übertragen. Unterbrochen von verschiedenen<br />
Dienstvertretungen während des Zweiten Welt-<br />
Der Ablacher Lehrer und Heimatforscher Josef Deschler (1897) -<br />
1991) Foto: Kreisarchiv Sigmaringen XI/12 Nr. 6<br />
57
krieges blieb er der Rosnaer Schulstelle über 17 Jahre bis 1945<br />
treu.<br />
Wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP, in der er zeitweise<br />
als Blockleiter und Presseleiter tätig war, wurde Deschler<br />
nach dem Kriegsende zeitweise vom Lehrerdienst suspendiert,<br />
Ende 1945 an die Volksschule Ablach und schließlich<br />
von 1947 bis 1948 nach Abschluß seines Entnazifizierungsverfahrens<br />
als Sühnemaßnahme für die Dauer eines Jahres<br />
an die Volksschule Scheer strafversetzt. Die Tätigkeit als<br />
Volksschullehrer in Ablach übte er bis zu seiner Pensionierung<br />
im Jahr 1965 und sodann noch ein weiteres Jahr als Vertragslehrer<br />
aus.<br />
Als Schulmeister alter Prägung entwickelte Josef Deschler an<br />
seinen Einsatzorten stets auch eine ausgesprochen rege außerdienstliche<br />
Aktivität. In Rosna bekleidete er über mehrere<br />
Jahre auch das Amt des Gemeinderechners, in Ablach übernahm<br />
er 1946 für lange Jahre den Organisten- und Chorleiterdienst<br />
an der örtlichen Pfarrkirche. Bis 1970 führte er an<br />
seinem Wohnort auch die Ortschronik, weiterhin tätig war<br />
er als Mitglied und sodann als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats<br />
sowie des Obst- und Gartenbauvereins Ablach.<br />
Aus seiner 1932 mit Marieluise Engler aus Frankfurt geschlossenen<br />
Ehe sind drei Söhne hervorgegangen. Im hohen<br />
Alter von 93 Jahren ist Josef Deschler am 23. März 1991 in<br />
Ablach verstorben.<br />
Neben seiner Lehrertätigkeit und den verschiedenen von ihm<br />
übernommenen öffentlichen Aufgaben gehörte die große<br />
Leidenschaft von Josef Deschler indessen stets der Erforschung<br />
der Heimatgeschichte. Deschler gehört der Generation<br />
der historisch interessierten und engagierten Schullehrer<br />
an, die das Bild der hohenzollerischen Orts- und Landesgeschichtsforschung<br />
im 19. und 20. Jahrhundert ganz<br />
maßgeblich geprägt und bestimmt haben. Die Ergebnisse seiner<br />
heimatkundlichen Forschungen hat er in einer stattlichen<br />
Reihe von Veröffentlichungen vor allem in der Hohenzollerischen<br />
Volkszeitung und sodann, in der Nachkriegszeit, in<br />
der Hohenzollerischen Heimat einem breiten Publikum vorgestellt.<br />
Schwerpunkte seines historischen Interesses waren<br />
dabei sein Wohnort Ablach und vor allen Dingen das heimatliche<br />
Bingen, dessen Chronist und Ortshistoriker er im<br />
eigentlichen Sinn geworden ist. Neben seinen veröffentlichten<br />
Werken bildet die im Nachlaß enthaltene reiche Materialsammlungen<br />
mit handschriftlichen Niederschriften, Zeitungsausschnitt-<br />
und Aufsatzsammlungen eine Fundgrube<br />
vor allem für die ortsgeschichtliche Forschung des Sigmaringer<br />
Raums und hier zumal der Orte Bingen und Ablach.<br />
Uberraschend ist in seinem Nachlaß eine konkrete Planung<br />
für eine Bingener Ortsgeschichte zum Vorschein gekommen,<br />
die in elf Kapiteln neben bereits veröffentlichten Arbeiten<br />
Deschlers mehrere noch nicht publizierte Manuskripte enthält.<br />
Die Bandbreite der darin abgehandelten Themen reicht<br />
vom dörflichen Fasnetbrauchtum über die örtliche Kirchenund<br />
Wirtschaftsgeschichte bis zur Flurnamensforschung.<br />
Eine überaus fruchtbare Tätigkeit entwickelte Josef Deschler<br />
sodann als Heimat- und Archivpfleger, mit Aktivitäten u. a.<br />
auch in den Bereichen Flurnamens-, Dialekt- und Volksliedforschung.<br />
Sein sprachliches Talent ist neben seiner Tätigkeit<br />
als langjähriger Lokalberichterstatter für die örtliche Presse<br />
in den zahllosen von ihm hinterlassenen Gedichten und Reden<br />
zu allen nur denkbaren Anlässen des dörflichen Lebens<br />
sowie in seinen humorvollen Jugend- und Dorfgeschichten<br />
zu erkennen. Im Nachlaß finden sich auch zahlreiche Proben<br />
dieser Seite von Josef Deschler.<br />
JOHANN ADAM KRAUS t<br />
Aus den Visitationsakten des ehemaligen<br />
Kapitels Trochtelfingen 1574-1709<br />
(Fortsetzung)<br />
Bericht des Pfarrers von Trochtelfingen vom Dezember 1650<br />
(fol. 679a) Die Einkünfte der Nachpredigerpfründe betragen<br />
30 fl, wovon jedoch acht z. Zt. nicht eingehen; die restlichen<br />
22 gibt der Herr Patron. Endlich sind für die hl. Messe, die<br />
täglich nach der Matutin von einem Kaplan gelesen wird, vom<br />
verstorbenen Herrn Mag. Martin Benkler kurz vor seinem<br />
Tode 800 fl gestiftet worden, die bei Riedlinger Bürgern stehen.<br />
Doch ist hierüber noch nichts Schriftliches gemacht, sowenig<br />
wie über die Pfründen.<br />
Der Kirchenheilige (St. Martin) hat jährliche Geldzinsen von<br />
etwa 400 fl, an Getreide 70 Scheffel, an Eigengütern 18 Jauchert<br />
Acker und 11 Jauchert Wiesen. Hiervon sind zu unterhalten:<br />
die Fabriken der Kirche und Kapellen, die Jahrtage,<br />
die Lampen und Lichter der Kirche und die Rosenkranzbruderschaft.<br />
Die Jahrtage wurden seit 3 Monaten wieder gehalten, soweit<br />
dies möglich ist. Eine Rosenkranzbruderschaft hat neulich<br />
die hochgeb. Gräfin von Fürstenberg in der Kirche gegründet<br />
unter Zuweisung eines jährlichen Zinses von 15 fl, doch<br />
ging bisher noch nichts davon ein. Die Lasten werden von<br />
der Stiftung getragen; der Collator versprach Regelung der<br />
Sache. Der Lampen und Lichter in der Kirche sind es sehr<br />
viele, auch einige ewige darunter. Vor dem Allerheiligsten<br />
konnte in den letzten Jahren nicht immer eine brennen, ich<br />
weiß nicht, ob mehr aus Nachlässigkeit oder aus Armut. Doch<br />
wird allmählich alles wieder in Ordnung gebracht.<br />
(fol. 680) Betr. Kirchenfabrik ist zu berichten: Die Pfarrkirche<br />
ist an Bau und Ausstattung in Ordnung. Doch mußten vor einigen<br />
Jahren zur Unterstützung der armen Einwohner die goldenen<br />
Geräte und anderes um 500 fl nach Ulm versetzt werden<br />
an eine katholische Dame von Adel. Doch soll alles innerhalb<br />
Jahresfrist rückgelöst werden. Auch der Baron von Speth zu<br />
Gammertingen seligen Angedenkens hat einen Silberkelch als<br />
Pfand aus unserer Kirche erhalten und verschleudert, auch bisher<br />
weder Ersatz geleistet, noch einen Schuldschein ausgestellt.<br />
Kapellen in und um die Stadt Trochtelfingen gibt es fünf: 1) die<br />
Michaelskapelle mit einem Altar in Nachbarschaft der Kirche,<br />
2) die Erhardskapelle außerhalb der Stadt am Friedhof, ebenfalls<br />
mit nur einem Altar. Sie ist sehr ruinös und soll zeitig im<br />
Frühjahr durch die Pfleger renoviert werden, 3) die Nikolauskapelle<br />
(auf dem Hennenstein) mit drei Altären. Doch sind zwei<br />
davon durch Soldaten zerstört und profaniert. Sonst hat der Bau<br />
nicht gelitten. 4) Die Kapelle U. Lieben Frau vor dem Tor, mit<br />
zwei Altären, ist unversehrt. 5) Die Liebfrauenkapelle in Entfernung<br />
von einer Stunde (auf der Haid) mit 2 Altären, einem<br />
zugehörigen Haus mit Scheuer als Wächterwohnung. Die Kapellewar<br />
einst durch Wunder berühmt, jetzt ganz verlassen und<br />
schadhaft. Sie soll aber zeitig im Frühjahr auf Kosten eines frommen<br />
Mannes in Erfüllung eines Gelübdes erneuert werden.<br />
Der Kirchenpatron (St. Martin) hat außerdem zwei eigene<br />
Häuser in der Stadt, die er auch reparieren muß, sobald dies<br />
geschehen kann.<br />
58
Heiligenpfleger sind außer dem Pfarrer noch zwei Bürger, die<br />
jährlich vor dem Pfarrer und Stadtrat (Senat) abzurechnen haben,<br />
was jedoch in den verflossenen Kriegsläuften nicht immer<br />
geschah. Wegen Größe der Ausstände und Nachlässigkeit<br />
der Rechner ist sehr darauf zu dringen. Der neubestellte<br />
Rechner wird darauf zu sehen haben, daß sein Vorgänger die<br />
Sache in Ordnung bringt. Die Ausstände der Fabrik betragen<br />
einige tausend Gulden, die in den letzen Jahren nicht eingingen.<br />
Die Zeit muß lehren, was da zu tun sei. Bei den meisten<br />
Posten kann man noch Hoffnung haben.<br />
Außerdem existiert noch eine andere fromme Stiftung, die<br />
nicht zur Kirche, sondern zum Friedhof gehört, nämlich ein<br />
kleines Heim für die Übernachtung von Armen. Sie hat nur<br />
einige bescheidene Jahreszinsen. Das Haus wurde von Soldaten<br />
zerstört, auch blieben die Einkünfte aus und keine Abrechnung<br />
mehr wurde gemacht. Die Angelegenheit gehört<br />
vom Stadtrat neu geregelt. Dieser hat auch das Präsentationsrecht<br />
von Studenten auf zwei Freiburger Stipendien, die<br />
einst Weihbischof Melchior Fattlin stiftete. Doch erhält sie<br />
seit einigen Jahren niemand mehr. Es wäre zu wünschen, daß<br />
der alte Rechtszustand wiederhergestellt würde.<br />
Von den Filialen: 1. Steinhilben hat zwei genügend gute Fabriken<br />
d. h. eine Kirche und eine (Johannes-)Kapelle. Deren<br />
Einkünfte betragen an Geld 26 fl und Getreide 2 Scheffel,<br />
worüber zwei Bauern sorgfältig Rechnung führen, obgleich<br />
z. Zt. viele Zinsen ausstehen. (Am Rande bemerkt: Zwei Altäre<br />
sind profaniert, wie auch der einzige Altar in der zur Kirche<br />
gehörigen Kapelle, die nicht weit vom Dorfe steht.)<br />
2. Wilsingen hat eine neue und praktisch verwaltete Heiligenfabrik,<br />
die an Geld jährlich 132 Gulden Zins einnehmen<br />
sollte, aber davon fast nichts erhalten kann. Die Kirche hat 3<br />
Güter, von denen jedoch nur zwei gebaut werden und diese<br />
nur teilweise, so daß heuer lediglich 8 Scheffel Getreide eingingen.<br />
Die beiden Bebauer haben 1633 letztmals vor dem<br />
Abt von Zwiefalten abgerechnet, doch ohne Zuzug des Pfarrers.<br />
Dieser hat daher auch nie Gelegenheit, seine Wünsche<br />
und Beschwerden über die Kirchenverwaltung vorzubringen.<br />
So brennt z. B. auch kein Licht vor dem Allerheiligsten, das<br />
nicht in einem würdigen Gefäß, sondern in einer hölzernen<br />
Schatulle oder Büchse verwahrt wird. Auch ist die Reparatur<br />
der Kirche vernachlässigt.<br />
3. Hörschwag hat ein elendes Hüttlein als Kirche, das zur<br />
Gottesdienstfeier kaum genügend ausgestattet ist, auch keine<br />
Einkünfte besitzt. Der Fürst von Zollern(-Hechingen) bezieht<br />
zwar die Zehnten und hätte folglich die Baupflicht, gibt<br />
aber keine Beihilfe. Der Bau hat keinen konsekrierten Altar.<br />
Ehemals bestand noch eine vierte Filiale in Meidelstetten, das<br />
jetzt andersgläubig ist und einen eigenen Prädikanten hat.<br />
Stadt Gammertingen (fol. 681 fg).<br />
Hier sind zwei Heiligenfabriken, der Pfarrkirche und der St.<br />
Michaelskapelle. An ersterer besteht ein einziges Benefizium,<br />
dessen Collator der Herr Baron von Speth in Gammertingen<br />
ist. Inhaber ist z. Zt. der Hochw. H. Andreas Benkler, Magister<br />
der Philosophie. An Einkünften gibt er an:<br />
Aus allerlei Zinsen 17 fl, an Opfern etwa 3 fl, an Frucht fest<br />
vom Collator 70 Sack, die er die letzten vier Jahre wieder voll<br />
erhielt. Von mehreren Bauern aus deren Gütern ehemals 53<br />
Sack, teils Dinkel, teils Haber, jetzt bekommt er wegen fehlender<br />
Bebauung kaum ein Drittel davon.<br />
Der Pfarrer von Benzingen schuldet dem von Gammertingen<br />
12 Sack Dinkel und Vesen in fixo, was unter den Vorgängern<br />
immer reibungslos einging, während der jetzige Pfarrer von<br />
dort sich nicht dazu verstehen will, weswegen die Hilfe der<br />
Obrigkeit anzurufen sein wird.<br />
Von bestimmten Äckern hat der Pfarrer das Recht, die<br />
neunte Garbe zu sammeln. Da sie jedoch fast wüst liegen, hat<br />
er diesen Sommer nur 12 Garben gekriegt. Die Novalzehnten<br />
werden ihm ganz verweigert, obgleich sein Vorgänger sie<br />
sicher bekam. Die Streitsache ist bisher nicht nach Konstanz<br />
an den kirchlichen Richter berichtet; es ist aber doch gegen<br />
sein Erwarten zu einem Prozeß gekommen, zu dessen<br />
Führung die Mittel fehlen, und der Pfarrer hat, des Streitens<br />
müde, bisher nachgegeben.<br />
An Kleinzehnten erhält der Pfarrer aus Gammertingen und<br />
Bronnen den von Hülsenfrüchten, Hanf, Raps und allem<br />
Gemüse, aber nicht wie seine Vorgänger. Denn diese bezogen<br />
von Hanf- und Flachsländern den Zehnten von allem,<br />
was man darauf baute. Jetzt nimmt den Fruchtzehnten davon<br />
die weltliche Behörde. Den Heuzehnten in Bronnen hat er<br />
von allen Wiesen, in Gammertingen nur von 22 Jauchert, die<br />
jedoch heute teils in Äcker verwandelt sind, so daß der weltliche<br />
Zehntherr den Zehnten nimmt.<br />
Der Pfarrer gibt an, da man ihm den Bohnen- und Linsenzehnten<br />
nicht streitig machen konnte, habe man ein Gesetz<br />
gemacht, wonach die Bauern nur höchstens eine halbe Jauchert<br />
damit anpflanzen durften, was zweifellos gegen den<br />
Pfarrer gemünzt sei. An lebendem Zehnten (von Tieren) erhält<br />
er nur von jedem Stück, ob aufgezogen oder verkauft, einen<br />
Kreuzer oder Denar, was zusammen nicht über einen<br />
Gulden ausmacht.<br />
An Eigengütern hat er 3 Gärten und 4 Jauchert Acker, wovon<br />
nur ein kleiner Teil bebaut wird.<br />
(fol. 682) Als Hauptlast der Pfarrei gibt er an, daß er jährlich<br />
vier opulente Mähler den Stadtbehörden geben müsse.<br />
Das ganz ruinöse Pfarrhaus mit der Scheuer, die in gleichem<br />
Zustand ist, hat der Pfarrer nach langem vergeblichen Betteln<br />
beim Collator um deren Reparierung, endlich notgedrungen<br />
selbst instand setzen lassen, um den Einsturz zu verhindern.<br />
So mußte er nicht nur sein Geld, sondern auch sein Recht<br />
drangeben. Die Fabriken der Kirche und Kapelle, obwohl<br />
beide unversehrt erhalten, sind mit Ornat sehr schlecht versehen.<br />
Beide haben eigene Güter und, wenn auch bescheidene,<br />
Einkommen. Jede hat zwei Bürger als Pfleger, die jedoch<br />
seit Jahren keine Rechenschaft mehr gaben, wohl mehr aus<br />
Schuld des Collators, dem sie in Gegenwart des Pfarrers zu<br />
geben wären.<br />
Keinerlei Urkunden oder Schriften oder Kopien über die Güter<br />
der Kirche sind in Hand des Pfarrers oder der Pfleger, sondern<br />
liegen beim Patronatsherrn (von Speth). Erstere können<br />
also keine genügende Kenntnis besitzen. Auch beklagt sich<br />
der Pfarrer, er habe nicht einmal über die Pfarrgüter und sein<br />
eigenes Benefizium irgendwelche Dokumente und könne so<br />
leicht der Rechte beraubt werden.<br />
Aus Kirchenbesitz hat der verstorbene Herr Johannes Christopherus<br />
Speth vor einigen Jahren 5 Kelche, eine Monstranz,<br />
ein Ziborium und andere Silbergefäße um eine Geldsumme<br />
nach St. Gallen (apud St. Gallum) in die Hände Andersgläubiger<br />
versetzt, zum eigenen Verbrauch, hat dann den Lösetermin<br />
verpaßt und so die Kirche zu seinen Gunsten betrogen,<br />
auch bisher nichts davon gutgemacht.<br />
Einst war hier an der Kirche eine Bruderschaft des Ewigen Rosenkranzes<br />
gestiftet, zu deren Fonds der Baron von Speth jährlich<br />
35 fl stiftungsgemäß zuzuschießen hätte. Aber er gab bisher<br />
nur einen kleinen Teil. Auch wären viele Jahrtage für Verstorbene<br />
zu feiern, die schon lange ausfallen mußten, weil die<br />
vom Baron dazu geschuldeten Beträge nicht gegeben werden.<br />
Endlich schuldet der genannte Herr der Kirche noch viel mehr,<br />
da er deren Güter benützt, oder besser gesagt, ausnutzt. Er hat<br />
jedoch bisher nichts als seine Zahlungsunfähigkeit dargetan.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
59
HERBERT RÄDLE<br />
Wer schuf das Grabmal des Ritters Albrecht Speth in Neufra?<br />
In dem Bildband Kunst im Landkreis Sigmaringen weist<br />
Manfred Hermann das Laizer Epitaph der Nonne Barbara<br />
von Hausen, einer Schwester des Ellwanger Propstes Wolfgang<br />
von Hausen, mit Recht dem Biberacher Bildhauer Hans<br />
Dürner zu (S. 142). Im Dienst Wolfgangs von Hausen schuf<br />
Dürner in den Jahren 1610-1613 auch den Ellwanger Hochaltar<br />
1 .<br />
Wenn Hermann freilich meint (ebendort S. 142), Dürner habe<br />
auch das Grabmal des Ritters Albrecht Speth in Neufra<br />
(gest. 1608, vgl. Abb. 1) geschaffen, so wird man ihm darin<br />
nur schwer folgen können. Stilistische Gründe sprechen dagegen.<br />
Das Neufraer Denkmal wirkt altertümlicher und weist<br />
nichts von der feinen Bewegtheit im Figurenstil Dürners auf.<br />
Der Urheber des Neufraer Grabmals muß meiner Meinung<br />
nach eher in der Umgebung von Sem Schlör (1530-1598) gesucht<br />
werden, der in Hall eine große Werkstatt führte und<br />
dessen geradezu schon fabrikmäßig arbeitender Betrieb 2 Epitaphien<br />
weit über den lokalen Raum hinaus lieferte.<br />
Sem Schlör hat auch am Hofe Herzog Ludwigs von Württemberg<br />
(1554-1593) gewirkt. Für ihn schuf er seit 1579 die<br />
sog. Alten Herren von Württemberg, jene Reihe der württembergischen<br />
Grafendenkmäler, die sich noch heute im<br />
Chor der Stuttgarter Stiftskirche befinden.<br />
Ihm wird aber auch das Grabmal des Hans Ludwig Speth (gestorben<br />
1583) zugeschrieben, das sich in der gotischen Pfarrkirche<br />
Höpfigheim bei Ludwigsburg befindet. Die beigefügte<br />
Abb. 2 läßt die große Ähnlichkeit erkennen, die das Höpfigheimer<br />
Speth-Denkmal mit dem gut 25 jüngeren Grabmal<br />
Albrecht Speths in Neufra verbindet.<br />
Abb. 2: Grabmal des Hans Ludwig Speth (gestorben 1583). Sem<br />
Schlör zugeschrieben. Höpfigheim, Kreis Ludwigsburg. Bildnachweis<br />
Fleischhauer, Die Renaissance im Herzogtum Württemberg,<br />
Stuttgart 1971 Abb. 72.<br />
Anmerkungen<br />
1 Heute im nördlichen Querschiff der Ellwanger Basilika befindlich.<br />
Vgl. B. Bushart, Die Basilika zum Hl. Vitus in Ellwangen, Ellwangen<br />
1988, S. 30.<br />
1 Vgl. W. Fleischhauer, Neues zum Werk des Bildhauers Sem Schlör,<br />
in: Württembergisch Franken, Bd. 50, 1966, S. 111-123, sowie<br />
H. Ricke, Hans Morinck, Sigmaringen 1973, S. 33 f.<br />
Abb. 1: Grabmal des Ritters Albrecht Speth von 1608. Pfarrkirche<br />
Neufra (Hohenz.)<br />
Maren Kuhn-Rehfus<br />
Werner Kuhn<br />
SIGMARIÜGEN Siemarinsen<br />
m ' 8,;iiniī|ai CUgllliU lllgcil<br />
in alten<br />
Ansichten<br />
196 Seiten mit 229 Abb.,<br />
davon 28 farbig<br />
21x20 cm • Leinen<br />
ISBN 3-7995-3430-X<br />
Subskriptionspreis bis 31.12.<strong>1995</strong> T~V"jy Q<br />
(danach DM 48.-)<br />
UiVl J s<br />
ife Jan Thorbecke Verlag<br />
60
JOSEF SCHULER<br />
Junginger Dorfgeschichten<br />
Vom Chrischtboom zum Narraboom<br />
Weihnächda, was fier a Zauberwoat! Do druumed de Junga<br />
vom Chrischdkendle und de Alta vo dr vrgangena Jugend, au<br />
wenn se no so armseleg gsei isch. Schau mit-m eschda Advent<br />
isch ma vrzaubered gsei, und wenn ma beim Rorate e dr dunkla<br />
Kirch de eschd Keez aabrennt und dia altvrtrauta Lieder<br />
gsunga hot, isch wam warm woara ums Heaz, au wenn ma<br />
kalte Füeß ghett hot. Vo Weihnächda bis Dreikeneg isch oa<br />
Feschd gsei. Wia glückleg ma seallmol - au aune Radio und<br />
Fernsear - gsei isch, ka-ma a deara Schdell garit beschreiba.<br />
Am Dag no Dreikeeneg aber hot dr Luft aus ama andera Eck<br />
blosed. Do hand de junga Leit d Faßned eröffned, ma isch<br />
»Maschgera« ganga. Ma hot d Faßnedkischd uff dr Behne uffdau<br />
und isch es vrruckteschd Häs neigschlupft. No isch des<br />
bunt Völkle, Buaba und Mädle, obeds mit »Narri-Narro« dur<br />
d Gassa tolled. Und weil ma seallmol weneg Geald ghett hot,<br />
isch dia Bande oafach e-d Privathäuser ganga, weils deet<br />
Moschd und Schnaps umasuschd gea hot, vielleicht au, weil<br />
es deet aweng hoammeleger zuaganga isch. (D Wietschafta<br />
sind schbäter »hoagsuecht« woara). Dr Witz dabei isch dear<br />
gsei: Ma isch vrdeckt ganga, hot d Haut mit Gsiechtslarv,<br />
Kapp und Heetscha zuadeckt, daß wan jo neamed kennt. Nu<br />
so ka-ma se auscheniert bewega, ka seim Geganiebr mit vrschdellter<br />
Schdimm ällerhand Bosheita es Gsicht saga, (wa<br />
ma suschd it dät) und sein Wunderfitz wecka, wa wohl under<br />
deara Larv dunna sei. Uff dia Weis hot a Vrliebter au ausloschora<br />
kenna, wia-s dahoam bei seira »Flamme« so aussieht.<br />
S hot ällerdings Schbezialischda gea, wia z. B. da alta »Cive«,<br />
dia fäschd jeden Maschgara kennt hand am Gang, dr Halting,<br />
Beweging, dr Schdimm oder ama Blick hindr d Larv. Wenn<br />
des hot jabber vrzwinga wella, isch schneall a luschdege Rauferei<br />
in Gang kumma. Kuzum, s ganz isch a Riesa-Gaude gsei,<br />
dia zuadeam fäschd nunz koschded hot. Dia Leit, mo fier d<br />
Faßned koan Sinn ghett, oder da Schdroßadreck gfircht hand<br />
(seallmol sind d Gassa neit teert gsei) oder gar z-gnereg fier<br />
en Schnaps gsei sind, hand s Haus halt vrriegled. Jede Gruppe<br />
(2-8 und maih) hot sowiaso iehre schbeziella Häuser ghett.<br />
Era langa Faßned isch dees, wia-ner ui deeka kenned, a zimmlicher<br />
Schlauch gsei.<br />
Vill isch andersch woara, seit dia Junga vo seallmol alt woara<br />
sind. Maschgera e Privathäuser geits schau lang nemme. I<br />
sags nu hälinga, aber d Faßned isch a Gschäft woara. Und<br />
Weihnächda? Ma sieht voar lauter Päckle s Kripple underm<br />
Chrischdboom nemme: S Chrischkindle isch reich und d Kinder<br />
satt und arm woara. A was solle se no a Freid hau, se hand<br />
doch alles.<br />
Aber dr Fortschritt hot aus jetz an nuia Brauch beschert. Mr<br />
kenne jetz dr Nochberschaft en optischa Weihnächtsgrueß<br />
schicka, wenn mr a Liechter-Pyramide es Feaschder schdelle,<br />
a Chrischdbeemle mit elektrescha Keeza uf da Balkon oder<br />
gar en Voargaata setze. Wenn deet schau a schees Bemle<br />
gwaßa isch, wia beim Rudolf, zhendereschd e Bachenau dahin,<br />
isch des no oafacher. Vom eeschda Advent a freit se dear,<br />
wenn-r obeds am Feaschder schdoht und sei Dännle e-de<br />
dunkel, kalt Winternaacht nei leichted, wenn dr Köhlbearg,<br />
dear schwaaz und mächteg am Naachthimmel schdoht, so<br />
heall ieberschdrahlt wuud. Isch des it a Gleichnis fier-d Weihnächdsbotschaft?<br />
Mo aber Dreikeneg vrbei gsei isch, und dear Boom ällawein<br />
no brennt hot, hand seine Musikkamerada afanga foppa, obr<br />
denn Weihnächda it vrgeassa kenn, s gang doch dr Faßned<br />
zua. Aber dr Rudolf isch eisern gsei: »Eschd a Liechtmeaß<br />
vrlischd dr Schdeann am Kripple.« Aber mo-ner ama scheena<br />
Dag uffwached und no em Weatter gucked, draut-r seina<br />
Auga it. Sei scheene Dann isch ibr und ibr mit bunta Bendl<br />
und ällerhand Faßned-Gruschd behanga. Aus seim schdolza<br />
Chrischdboom isch ieber d Naachd a Narra-Boom woara. O<br />
dia Musikanta! Dia hand em jetz beibrocht, daß ma se it gega<br />
d Zeit schdemma kaa, daß ma vierse und it hindersche<br />
gucka mues. Und glei hot se sei Humor gmelded. Wear no,<br />
außer ihm, hot sein oagena, ganz persöhnlega Narraboom.<br />
Geschehen 1990, geschrieben für das Festbuch: 19. Jugendmusiktage<br />
mit Kritikspiel und 125 Jahre Volksmusik in Jungingen,<br />
20.-23. Mai 1993<br />
Buchbesprechungen<br />
Preußen in Hohenzollern, Begleitband zur Ausstellung, die<br />
vom 2. September bis 12. November <strong>1995</strong> im Staatsarchiv Sigmaringen<br />
gezeigt wurde.<br />
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit der von 1850 bis<br />
1945 dauernden »Preußenzeit« in Hohenzollern. <strong>1995</strong> sind<br />
es 50 Jahre her, daß diese Zeit zu Ende ging. Unter dem Titel<br />
»Daten, Fakten und Strukturen« zeigte das Staatsarchiv<br />
Sigmaringen in der Ausstellung zahlreiche Exponate zur hohenzollerischen<br />
Geschichte und den Beziehungen zu<br />
Preußen, wie man sie in dieser Form noch nie gesehen hat.<br />
Im Begleitband zur Ausstellung findet man den Inhalt von<br />
ausgestellten Dokumenten mit zusammenfassenden und verbindenden<br />
Texten, dazu zahlreiche Abbildungen von Exponaten.<br />
Dem Abschnitt vorangestellt ist eine Einführung von<br />
W. Schöntag über die Hohenzollerischen Lande als Teil<br />
Preußens.<br />
Auslöser für den Anschluß der beiden hohenzollerischen<br />
Fürstentümer an Preußen war die Revolution von 1848, die<br />
ausführlich dargestellt wird. Obwohl die Revolution schließlich<br />
in ganz Deutschland scheiterte, hatte sie den hohenzollerischen<br />
Fürsten gezeigt, daß sie ohne Hilfe von außen nicht<br />
in der Lage waren, ihre Staatsgewalt aufrecht zu erhalten und<br />
daß die Revolutionäre sie nicht nur um die Macht, sondern<br />
auch um ihren Besitz bringen wollten. Erfreulicherweise sind<br />
die wichtigsten der damals handelnden Personen abgebildet:<br />
Fürst Friedrich Wilhelm Konstantin von Hechingen, Pfarrer<br />
Joseph Blumenstetter, Fürst Carl und Erbprinz Carl Anton<br />
von Sigmaringen. Pfarrer Josef Sprißler und Dr. Karl Otto<br />
Würth.<br />
Nach den Verfassungen der beiden Fürstentümer wäre die<br />
Abtretung an Preußen ohne Zustimmung der Landtage nicht<br />
möglich gewesen. Jedoch wurden weder die Landtage noch<br />
das Volk befragt. Am 12. März 1850 hob König Friedrich<br />
Wilhelm IV. von Preußen die beiden Verfassungen auf und<br />
führte die Preußische Verfassung ein.<br />
Die Gefühle der Bevölkerung in Hohenzollern gibt am be-<br />
61
sten die Festansprache von Rabbiner Dr. Samuel Mayer, Hechingen<br />
am 8. April 1850 wieder (S. 37): »... Bisher lebten wir<br />
in einem ... traulichen Verhältnisse zu unserem Fürsten und<br />
seinen Beamten; wir konnten unsere Wünsche zu jeder Zeit<br />
persönlich vortragen, ... und wir konnten augenblickliche<br />
Abhülfe erwarten ... Der neue König kennt uns noch nicht<br />
und seine Beamten wissen noch wenig von uns; muß da nicht<br />
die Seele ängstlich in die Zukunft schauen?... Unser Fürstentum<br />
zeigt das Bild der Lebens-Unfähigkeit kleiner Staaten<br />
...« Vor allem in Hechingen wußte man, daß es bei der<br />
enormen Verschuldung und der allgemeinen Rückständigkeit<br />
des Fürstentums keine andere Lösung gab. Anders waren<br />
die Verhältnisse im Fürstentum Sigmaringen, wo die Bevölkerung<br />
überwiegend gegen die Aufgabe der Selbständigkeit<br />
war.<br />
Für die Abtretung ihrer Souveränitäts- und Regierungsrechte<br />
an den König von Preußen durften die Fürsten ihren gesamten<br />
Besitz behalten und bekamen vom preußischen Staat<br />
noch eine beachtliche Leibrente. Ihre bisherigen Länder wurden<br />
fortan von Preußen alimentiert.<br />
Am 23. August 1851 nahm der König von Preußen auf der<br />
Burg Hohenzollern die Erbhuldigung seiner neuen Untertanen<br />
entgegen. Schon im Jahr 1850, wenige Monate nach der<br />
Besitznahme durch Preußen, wurde der Grundstein zum<br />
Neuaufbau der Zollerburg gelegt. Freiherr von Stillfried verhalf<br />
den preußischen Zollern, durch Verknüpfung mit der<br />
Familie der schwäbischen Zollern, zu einer bis ins hohe Mittelalter<br />
reichenden Tradition. Neben verschiedenen Dokumenten<br />
werden einige sehr interessante Fotos von den Bauarbeiten<br />
auf der Burg gezeigt.<br />
Der Landeskommunalverband war die eigentliche Klammer,<br />
die Hohenzollern bis 1972 zusammenhielt. Nach der Eingliederung<br />
an Preußen war Hohenzollern durch zwei Abgeordnete<br />
im Preußischen Abgeordnetenhaus vertreten. Im<br />
Lande wurde der Wunsch nach Selbstverwaltung immer wieder<br />
vorgebracht. Durch die Hohenzollernsche Amts- und<br />
Landesordnung vom 2. April 1873 wurde dieser Wunsch erfüllt.<br />
Der Kommunallandtag wurde gegründet und zur<br />
Führung laufender Geschäfte ein Landesausschuß eingesetzt.<br />
Mit dem Landeskommunalverband hatte die Bevölkerung<br />
Hohenzollerns wieder das, was sie seit der Zugehörigkeit zu<br />
Preußen vermißt hatte, eine ortsnahe und persönlich ansprechbare<br />
Verwaltung. Uber die Zuständigkeiten des Landeskommunalverbandes<br />
wird ausführlich berichtet. 1947<br />
wurde die Selbstverwaltung der beiden hohenzollerischen<br />
Kreise in der Verfassung des Landes Württemberg-Hohenzollern<br />
und 1950 in einem Gesetz über den Landeskommunalverband<br />
festgeschrieben.<br />
Durch das Kreisreformgesetz vom 26. Juli 1971 wurde der<br />
Landeskommunalverband der Hohenzollerischen Lande mit<br />
Wirkung zum 1. Januar 1973 aufgehoben. Einzige heute noch<br />
existierende Einrichtung des Kommunalverbandes ist die<br />
Hohenzollerische Landesbahn.<br />
Im Fürstentum Sigmaringen wurden schon früh Maßnahmen<br />
zur Förderung von Landwirtschaft und Gewerbe unternommen,<br />
wozu besonders die 1834 gegründete Spar- und Leihkasse<br />
zu rechnen ist. Neben der Förderung von Industrie und<br />
Landwirtschaft trieb Preußen vor allem den Eisenbahn- und<br />
Straßenbau voran.<br />
Die katholische Kirche in den Fürstentümern Hohenzollern<br />
wurde 1821 durch Staatsvertrag an die badische Landesdiözese<br />
Freiburg angeschlossen. Die Einführung der Preußischen<br />
Verfassung befreite die katholische Kirche in Hohenzollern<br />
vom Staatskirchentum und führte zu einem Aufblühen<br />
des religiösen Lebens (O. Becker). Allerdings wurden<br />
die meisten der kirchlichen Einrichtungen im »Kulturkampf«<br />
(1872 bis 1887) geschlossen und konnten erst 1887 wieder<br />
eröffnet werden.<br />
Nach dem Anschluß an Preußen erfolgte die Bildung von<br />
evangelischen Pfarreien Sigmaringen und Hechingen, zu denen<br />
später Pfarreien in Haigerloch, Dettingen und Gammertingen<br />
kamen. Die Zollerburg war von Preußen zu einer starken<br />
Festung ausgebaut worden. Im Gegensatz zur Zeit der<br />
Fürstentümer, wurden praktisch alle Wehrpflichtigen eingezogen<br />
und mußten ihren Militärdienst in preußischen Garnisonen<br />
ableisten. Im Land selbst gab es aber nur die kleine<br />
Garnison auf der Burg Hohenzollern und seit 1910 eine Unteroffiziers-Vorschule<br />
in Sigmaringen.<br />
Eine besonders kritisch betrachtete Rolle spielten in Hohenzollern<br />
die preußischen Beamten. Eine treffende Charakterisierung<br />
ist auf S. 117 abgedruckt. Wegen des häufigen Beamtenwechsels<br />
sah man in Amtern und Gerichten ständig neue<br />
Gesichter. Da ihnen Sprache und Gebräuche der Eingeborenen<br />
fremd waren, bemühten sich die meisten um eine schnelle<br />
Rückversetzung in die angenehmeren Gefilde des Nordens.<br />
Einige fanden aber auch in Hohenzollern eine Heimat, wie<br />
die im Buch aufgeführte Beamtenfamilie Longard. Ein wenig<br />
zu kurz kommen in der Darstellung die zahlreichen Hohenzollern,<br />
die im preußischen Staatsdienst beschäftigt waren<br />
und Karriere machten.<br />
Preuße oder<br />
Hobenzoller?<br />
Liest man dieses Kapitel, so wird einem bewußt, daß die Hohenzollern<br />
eine weitgehend ausgestorbene Spezies sind. Sie<br />
waren echte Schwaben, sind aber in ihrer Geschichte niemals<br />
Württemberger oder Badener, sondern eben Hohenzollern<br />
gewesen. Dies zu begreifen ist heute ziemlich schwierig. Mit<br />
Anekdoten, Gedichten und anderen Beiträgen wird versucht,<br />
etwas von der »hohenzollerischen Kultur« zu vermitteln.<br />
Wer erinnert sich z. B. noch daran, daß die Schulen in Hohenzollern<br />
eigene Schulbücher hatten?<br />
Die Frage der Integration Hohenzollerns in einen Staat<br />
»Großschwaben« wurde schon 1918/19 debattiert. Mit der<br />
Aufhebung Preußens nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine<br />
Lösung unausweichlich. Das Regierungspräsidium Sigmaringen<br />
wurde am 15. März 1946 aufgelöst. Immerhin behielten<br />
1947 in der Verfassung von Württemberg-Hohenzollern<br />
die beiden Kreise Sigmaringen und Hechingen ihren<br />
Landeskommunalverband. Vieles von dem, was damals erregt<br />
debattiert wurde, ist längst vergessen und schlummert in<br />
den Archiven. 1951 stimmte eine große Mehrheit der hohenzollerischen<br />
Bevölkerung für die Bildung eines »Südweststaates«.<br />
Aber bei der Bildung des neuen Landes Baden-<br />
Württemberg wurde Hohenzollern nicht einmal mehr angesprochen.<br />
Geflissentlich wurde übersehen, daß sich nicht<br />
zwei, sondern drei Staaten zusammengeschlossen hatten. Immerhin<br />
hat Ministerpräsident Teufel in seiner Ansprache zu<br />
den Sigmaringer Heimattagen gezeigt, daß ihm dies bekannt<br />
ist - ein später Trost.<br />
Die Entwicklung des Landes nahm seit 1951 einen Verlauf,<br />
der bald zeigte, daß die alten Strukturen nicht mehr haltbar<br />
waren. Die Gemeinde- und Kreisreform brachte tiefgreifende<br />
Veränderungen im ganzen Bundesland. Seit dem 1. Januar<br />
1973 ist Hohenzollern nur noch eine historische Erinnerung.<br />
Geschichte in<br />
Gegenständen<br />
Dieser Teil der Ausstellung und des Buches wurde vom Haus<br />
der Geschichte Baden-Württemberg bearbeitet und gestaltet.<br />
Von außen betrachtet ist fünfzig Jahre nach dem Ende der<br />
Preußenzeit Hohenzollern nur noch ein Kuriosum, wie es<br />
Dutzende in Baden-Württemberg gibt (und was hatten wir<br />
Hohenzollern uns alles eingebildet). Gezeigt wird »eine Ansammlung<br />
von Gegenständen, die der blinde geschichtliche<br />
Zufall übriggelassen hat.« Es handelt sich um 20 Gegenstände,<br />
wie zum Beispiel ein Brief von Goethe an Erbprinz Carl,<br />
62
das Original der Emser Depesche, die den Krieg von 1870/71<br />
auslöste, die altbekannte Geldtruhe von 1866 und so banale<br />
Dinge wie fünf Böller, mit denen angeblich bei der Ankunft<br />
des Preußenkönigs 1851 geschossen wurde, ein Bild des<br />
Schulschiffes Niobe von 1908 und einige Gegenstände, die<br />
scheinbar mit dem Thema »Preußen in Hohenzollern« nur<br />
wenig zu tun haben. Die Objekte wurden in weißen Gehäusen<br />
ausgestellt, die von dem Wiener Bühnenbildner Thomas<br />
Hamann gestaltet wurden (S. 194 u. 195). Auf dem Behälter<br />
stand jeweils ein Text, der die Geschichte des Objektes beschrieb.<br />
Im Buch steht der Text immer neben der Abbildung<br />
des Objektes. Dies erlaubt es, die Objekte zu betrachten und<br />
die Beschreibungen in Ruhe zu lesen.<br />
Antiquarische Geschichte, der Beitrag von Albrecht Krause,<br />
zeigt wie man Geschichte als »antiquarische Sicht der Vergangenheit«<br />
betrachten kann. Der Preuße und der Hohenzollern,<br />
Preußen und die Hohenzollern, Preußen und Hohenzollern<br />
sind die Kapitel, in denen mehr die persönlichen<br />
Beweggründe der agierenden Personen und die jeweilige<br />
Zeitstimmung als der Lauf der »großen Geschichte« gezeigt<br />
werden.<br />
Das Kapitel »Eine Ausstellung« zeigt Entstehungsgeschichte<br />
und die Intentionen der Ausstellung. Schade, daß man dies<br />
nicht vor dem Besuch der Ausstellung lesen konnte, dann wäre<br />
vielleicht manches verständlicher gewesen.<br />
Preußen in Hohenzollern, Begleitband zur Ausstellung Sigmaringen<br />
<strong>1995</strong>, herausgegeben vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg<br />
und dem Staatsarchiv Sigmaringen, bearbeitet<br />
von Otto H. Becker, Katja Gürtler, Albrecht Krause,<br />
Lioba Schlör, Wilfried Schöntag, Jürgen Treffeisen, Volker<br />
Trugenberger. Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen. DM 38,-<br />
H. Burkarth<br />
Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1994<br />
Im Band 1994 wird über zwei Ausgrabungen im Bereich der<br />
früheren Hohenzollerischen Lande berichtet. Ausgrabungen<br />
im Randbereich des römischen Vicus bei Burladingen (H.<br />
Reim).<br />
Die Planung eines Gewerbegebietes im Gewann »Kleineschle«<br />
machte eine archäologische Untersuchung notwendig,<br />
da hier im Bereich des Kastells Burladingen mit den Überresten<br />
einer römischen Zivilsiedlung (Vicus) zu rechnen war.<br />
Das Gebiet liegt am westlichen Stadtrand von Burladingen,<br />
nördlich der Bahnlinie. Nach Voruntersuchungen wurde<br />
1992 mit großflächigen Ausgrabungen begonnen. Diese wurden<br />
1993 fortgesetzt und im Oktober 1994 abgeschlossen.<br />
Am östlichen Rand der Siedlung wurde eine etwa 40 x 39 m<br />
große Viereckanlage mit quadratischen, tief fundierten Holzpfosten<br />
aufgedeckt. Über die Funktion der Anlage ist nichts<br />
bekannt; zu denken wäre ev. an einen kultisch-religiösen<br />
Zweck. In der Nähe fand sich eine römische Straße in Südwest-Nordost-Richtung.<br />
Die Straße konnte auf einer Länge<br />
von ca. 200 m nachgewiesen werden. Sie verläuft schnurgerade<br />
und ist 4,50 -5m breit. Der Straßenkörper besteht aus<br />
mehreren Lagen von Kalksteinschotter. Ostlich der Straße<br />
wurde ein unregelmäßiges Grabengeviert gefunden, das als<br />
Einfriedung eines Gräberfeldes gedeutet werden kann. Darin<br />
wurden die Fundamente eines rechteckigen Steinbaus<br />
nachgewiesen, die ev. Reste eines Grabmals sein könnten. Im<br />
Rahmen der Grabung wurden auch drei Brandgräber aus der<br />
Urnenfelderzeit gefunden. Schon 1899 beim Bahnbau und<br />
1984 bei der Neutrassierung der Bundesstraße 32 wurden<br />
Gräber aus dieser Zeit gefunden. Weitere Grabungen im<br />
2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes wurden deshalb vorgesehen.<br />
Hechingen - Stein. Tempelbezirk. Kopf einer lebensgroßen Junostatue.<br />
Ausgrabungen im Tempelbezirk der Gutsanlage von Hechingen-Stein<br />
(S. Schmidt-Lawrenz).<br />
Bei den Grabungen 1993 war ein Tempelbezirk vermutet<br />
worden, was sich dann 1994 bestätigte. Zu den 1993 im Innenbereich<br />
aufgedeckten drei Kapellen kamen fünf weitere.<br />
Sie sind alle gleichartig in Größe und Ausrichtung. Es konnten<br />
wieder zahlreiche Teile von Sandsteinskulpturen freigelegt<br />
werden. Von dem Oberkörper eines Mannes wird vermutet,<br />
daß es sich um den Giganten einer Jupitergigantensäule<br />
handelt. Im vorhergehenden Jahr wurde das Fragment<br />
eines anderen Giganten gefunden, was vermuten läßt,<br />
daß in Hechingen-Stein zwei dieser Denkmäler vorhanden<br />
waren. Der bedeutendste Fund ist der lebensgroße Kopf einer<br />
Junostatue. Frisur und Gesicht sind aufwendig gearbeitet.<br />
In den Augenhöhlen waren ursprünglich Einlagen, die<br />
aus einem anderen Material gefertigt waren. Da alle Statuenfragmente<br />
aus dem vor Ort anstehenden Stubensandstein gefertigt<br />
sind, kann man annehmen, daß sie in der Gutsanlage<br />
selbst geschaffen wurden.<br />
Von den Fundmünzen sind zwei Sesterze der römischen Kaiser<br />
Antonius Pius und Commodus erwähnenswert, die von<br />
der Ofenfelshöhle bei Harthausen a. d. Sch. stammen sollen.<br />
Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1994,<br />
herausgegeben vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg,<br />
zusammengestellt von Jörg Biel, Konrad Theiss Verlag<br />
Stuttgart. B.<br />
Adel am oberen<br />
Neckar<br />
Beiträge zum 900jährigen Jubiläum der Familie von Ow.<br />
Herausgegeben von Franz Quarthai und Gerhard Faix. biblotheca<br />
académica Verlag Tübingen, Leinen DM 89,-<br />
Eine Familie wird 900 Jahre alt und sie blüht bis in unsere Tage<br />
in den zwei gesunden Zweigen der Freiherren von Ow-
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 72488 Sigmaringen<br />
M 3828<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Wachendorf und der Freiherren von Ow-Felldorf. Im Jahre<br />
1095 wird der Name von Ow erstmals urkundlich erwähnt,<br />
wie heute noch über dem Schloßtor in Wachendorf zu lesen<br />
Gerbold und Werner, die Freien von Owe,<br />
Albrecht von Wachendorf, Wolf auch von Owe,<br />
halfen zu Kloster Alpirsbachs Baue<br />
1095<br />
Herren von Ow waren mit vielen anderen Adligen des deutschen<br />
Südwestens Zeugen der Stiftung des Klosters Alpirsbach<br />
im Schwarzwald. Franz Quarthai und Gerhard Faix haben<br />
auf Bitten von Sigurd Freiherr von Ow-Wachendorf ein<br />
Buch zu diesem 900-Jahr-Jubiläum herausgegeben. Ist das<br />
nun eine Linear-Geschichte einer Adelsfamilie, wie sie von<br />
Eliten gerne vorgelegt wird, im Gegensatz zum Erleben von<br />
Geschichte der sogenannten »kleinen Leute«, die nur die zyklische<br />
Wiederkehr von Liebe, Haß, Geburt und Tod kennen?<br />
So ist das Buch nicht! Es ist im besten Sinne ein Buch<br />
unserer Heimat, des deutschen Südwestens mit ihrem<br />
Schwerpunkt am oberen Neckar, dem oberen Neckargäu und<br />
dem südwestlichen Albvorland.<br />
Der Glücksfall einer 900jährigen Familienkontinuität hat die<br />
Herausgeber zu einem Konzept umfassender Darstellung<br />
dieses schwäbischen Ländchens verlockt, die uns in 13 Beiträgen<br />
auf fast 600 Seiten, reich bebildert, eine Kulturgeschichte<br />
schenkt, die spannend wie ein Kriminalroman ist und unsere<br />
lebhafte Anteilnahme erfährt. Das Gerüst der Ow'schen<br />
Familie gibt Johann Ottmar; ein differenziertes und kenntnisreiches<br />
Siedlungsbild in den ehemaligen Herrschaften der<br />
Herren von Ow zeichnet Siegfried Kullen. Rudolf Seigel stellt<br />
die Ow'schen Archive und die Dorfordnungen der Herren<br />
von Ow vor, während Hans Harter den Herren von Ow im<br />
11. und 12. Jahrhundert nachgeht und mit viel Vergnügen liest<br />
man seine Gedanken zu Hartmann von der Aue, dem Minnesänger<br />
und Dichter des Armen Heinrich. War er nun ein Mitglied<br />
dieser Ow'schen Familie oder nicht? Gerhard Kittelberger<br />
und Dieter Manz gehen dem Geflecht der Bindungen<br />
der Ow'schen Familien zu Obernau und Rottenburg nach,<br />
und Maren Kuhn-Rehfus läßt uns in einem nachgelassenen<br />
Beitrag einen faszinierenden Blick in die Welt der Klöster tun,<br />
in denen Ow'sche Frauen als Nonnen lebten. Die Wirtschaftsgeschichte<br />
der Güter im 19. Jahrhundert behandeln<br />
Ludwig Gekle und Patrick Baudoux: Daß Adel auch hart Arbeiten<br />
und gut Wirtschaften heißt, wird hier deutlich.<br />
Eine warmherzige und persönliche Note zeigen die beiden<br />
Beiträge über Honor von Ow und Hans-Otto von Ow-Wachendorf,<br />
die von Mitgliedern der Familie verfaßt sind. Der<br />
mit einem umfangreichen Register ausgestattete Band ist ein<br />
Lesebuch und ein Nachschlagwerk zugleich, der allen empfohlen<br />
ist, die hier heimisch sind oder es werden wollen.<br />
Dr. Adolf Vees<br />
Verschenken Sie ein Stück Heimat<br />
250 Naturschutzgebiete<br />
. im Regierungsbezirk<br />
T* •• I *<br />
lUtZ Tubingen<br />
Der reichbebilderte Führer<br />
zu den geschützten Kostbarkeiten<br />
zwischen Bodensee<br />
und Schwäbischer Alb<br />
412 Seiten mit 342 Farbabbildungen.<br />
Karte '17x24 cm • Leinen<br />
ISBN 3-7995-5170-0<br />
DM 48.-<br />
Tlb Jan Thorbecke Verlag<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
ISSN 0018-3253<br />
Erscheint vierteljährlich.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der Geschichte<br />
ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: DM 13,00 jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
Die Autoren dieser<br />
Dr. Casimir<br />
Bumiller<br />
Nummer:<br />
Hexental 32, 79283 Bollschweil<br />
Dr. Hermann Frank<br />
Im Wägner 24, 72070 Unterjesingen<br />
Walter Kempe<br />
Silcherstraße 11, 88356 Ostrach<br />
Johann<br />
Adam Kraus f<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13 a,<br />
92318 Neumarkt<br />
Josef<br />
Schuler<br />
Killertalstraße 55, 72417 Jungingen<br />
Dr. Edwin Ernst<br />
Weber<br />
Kreisarchivar<br />
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
Verlagsanstalt<br />
72488 Sigmaringen, Karlstraße 10<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
Eichertstraße 6, 72501 Gammertingen<br />
Telefon 07574/4407<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge verantwortlich.<br />
Mitteilungen der Schriftleitung sind<br />
als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare werden<br />
an die Adresse des Schrifdeiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.<br />
64