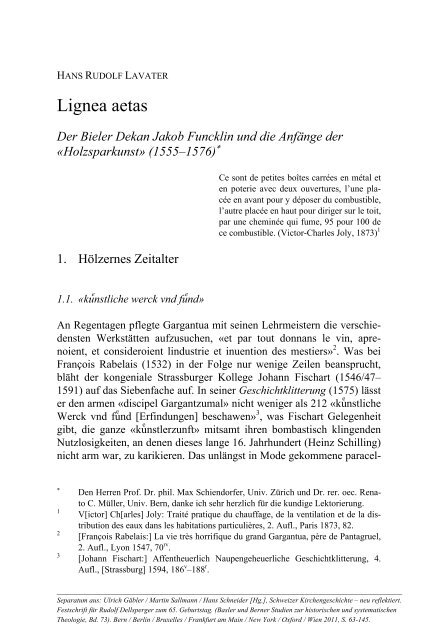Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HANS RUDOLF LAVATER<br />
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong><br />
Der Bieler Dekan Jakob Funcklin und die Anfänge der<br />
«Holzsparkunst» (1555–1576) Ce sont de petites boîtes carrées en métal et<br />
en poterie avec deux ouvertures, l’une placée<br />
en avant pour y déposer du combustible,<br />
l’autre placée en haut pour diriger sur le toit,<br />
par une <strong>ch</strong>eminée qui fume, 95 pour 100 de<br />
ce combustible. (Victor-Charles Joly, 1873) 1<br />
1. Hölzernes Zeitalter<br />
1.1. «ku nstli<strong>ch</strong>e werck vnd fu nd»<br />
An Regentagen pflegte Gargantua mit seinen Le<strong>hr</strong>meistern die vers<strong>ch</strong>iedensten<br />
Werkstätten aufzusu<strong>ch</strong>en, «et par tout donnans le vin, aprenoient,<br />
et consideroient lindustrie et inuention des mestiers» 2 . Was bei<br />
François Rabelais (1532) in der Folge nur wenige Zeilen beanspru<strong>ch</strong>t,<br />
bläht der kongeniale Strassburger Kollege Johann Fis<strong>ch</strong>art (1546/47–<br />
1591) auf das Siebenfa<strong>ch</strong>e auf. In seiner Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tklitterung (1575) lässt<br />
er den armen «discipel Gargantzumal» ni<strong>ch</strong>t weniger als 212 «ku nstli<strong>ch</strong>e<br />
Werck vnd fu nd [Erfindungen] bes<strong>ch</strong>awen» 3 , was Fis<strong>ch</strong>art Gelegenheit<br />
gibt, die ganze «ku nstlerzunft» mitsamt i<strong>hr</strong>en bombastis<strong>ch</strong> klingenden<br />
Nutzlosigkeiten, an denen dieses lange 16. Ja<strong>hr</strong>hundert (Heinz S<strong>ch</strong>illing)<br />
ni<strong>ch</strong>t arm war, zu karikieren. Das unlängst in Mode gekommene paracel-<br />
<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Den Herren Prof. Dr. phil. Max S<strong>ch</strong>iendorfer, Univ. Züri<strong>ch</strong> und Dr. rer. oec. Renato<br />
C. Müller, Univ. Bern, danke i<strong>ch</strong> se<strong>hr</strong> herzli<strong>ch</strong> für die kundige Lektorierung.<br />
V[ictor] Ch[arles] Joly: Traité pratique du <strong>ch</strong>auffage, de la ventilation et de la distribution<br />
des eaux dans les habitations particulières, 2. Aufl., Paris 1873, 82.<br />
[François Rabelais:] La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel,<br />
2. Aufl., Lyon 1547, 70 rv .<br />
[Johann Fis<strong>ch</strong>art:] Affentheuerli<strong>ch</strong> Naupengeheuerli<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tklitterung, 4.<br />
Aufl., [Strassburg] 1594, 186 v –188 r .<br />
____________________________________________________________________________<br />
Separatum aus: Ulri<strong>ch</strong> Gäbler / Martin Sallmann / Hans S<strong>ch</strong>neider [Hg.], S<strong>ch</strong>weizer Kir<strong>ch</strong>enges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te – neu reflektiert.<br />
Festsc<strong>hr</strong>ift für Rudolf Dellsperger zum 65. Geburtstag. (Basler und Berner Studien zur historis<strong>ch</strong>en und systematis<strong>ch</strong>en<br />
Theologie, Bd. 73). Bern / Berlin / Bruxelles / Frankfurt am Main / New York / Oxford / Wien 2011, S. 63-145.
64<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
sis<strong>ch</strong>en Neophytentum muss ebenso dran glauben wie die «Holtzsparkunst»<br />
und diesbezügli<strong>ch</strong>e Patente:<br />
Es le<strong>hr</strong>t do<strong>ch</strong> der Obercelsis<strong>ch</strong> Theop<strong>hr</strong>astus in seiner Metaformirung, wie man<br />
Riesen vnnd Zwerglin soll im Perdmist [!] außbru ten vnnd Kinder ohn Weiber ma<strong>ch</strong>en.<br />
[…] Dise Spagiris<strong>ch</strong>e Kunden werden bald […] ein Weibsparkunst erfinden,<br />
wie jene die Holtzsparkunst. Hierzu werden die Weiber keim [keinem]<br />
Priuilegy geben. 4<br />
Offenbar konnte Fis<strong>ch</strong>art voraussetzen, dass seine Leser Begriffli<strong>ch</strong>keit<br />
und Anspielungen auf Anhieb verstehen würden. Wenn ‹Holtzsparkunst›<br />
die Kunst war, «das zu allerley Bedürfnissen, besonders aber das zur<br />
Feuerung nöthige Holz zu sparen» 5 – inwiefern war sie denn um 1575<br />
ein offenkundiges Thema?<br />
Eine Untersu<strong>ch</strong>ung, die, wie die vorliegende, den Fokus auf die<br />
te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Realisierung und die Diffusion der Holzsparkunst im s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>-oberdeuts<strong>ch</strong>en<br />
Raum wä<strong>hr</strong>end des Zeitraumes 1555–1576 legt,<br />
darf si<strong>ch</strong> mit drei kurzen Antworten begnügen: a) Seit Mitte des 16.<br />
Ja<strong>hr</strong>hunderts gibt es als Topos der im 18. Ja<strong>hr</strong>hundert si<strong>ch</strong> häufenden<br />
Holzsparliteratur das Stereotyp der herrs<strong>ch</strong>enden oder drohenden Holzknappheit.<br />
b) Ob diesem eine allgemeine Holzkrise zugrundelag, wie<br />
Rolf-Jürgen Gleitsmann und Rolf Peter Sieferle annahmen, 6 oder ob es<br />
si<strong>ch</strong> vielme<strong>hr</strong> um eine künstli<strong>ch</strong>e Verknappung handelte, mittels derer<br />
konkurrierende Ambitionen anderer Grossverbrau<strong>ch</strong>er bekämpft werden<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Fis<strong>ch</strong>art, Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tklitterung (wie Anm. 3), 106 r im Zusammenhang mit Gargantuas<br />
extrauteriner Geburt. ‹weibsparkunst› ist somit die Kunst, Weiber zu sparen.<br />
Corr. die Konjektur in DWb 10, 1781 «ein weibsparkunst erfinden wie jene (weiber)<br />
die holzsparkunst», ebenso die Behauptung, Fis<strong>ch</strong>art akzentuiere hier die<br />
Holzsparkunst als eine «Weibskunst» [!] bei Karin Hausen: Häusli<strong>ch</strong>er Herd und<br />
Wissens<strong>ch</strong>aft. Zur frühneuzeitli<strong>ch</strong>en Debatte über Holznot und Holzsparkunst in<br />
Deuts<strong>ch</strong>land, in: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und Emanzipation (FG Reinhard Rürup), hg. v. Mi<strong>ch</strong>ael<br />
Grüttner, Rüdiger Ha<strong>ch</strong>tmann u. Heinz-Gerhard Haupt, Frankfurt a. M. 1999,<br />
700–727, 714. Davon unberü<strong>hr</strong>t bleibt Hausens plausible Darstellung, wie die te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e<br />
Ausstattung des Haushalts me<strong>hr</strong> und me<strong>hr</strong> zum experimentellen Tummelfeld<br />
aufgeklärter Männer wird.<br />
Johann C<strong>hr</strong>istoph Adelung: Grammatis<strong>ch</strong>-kritis<strong>ch</strong>es Wörterbu<strong>ch</strong> der Ho<strong>ch</strong>deuts<strong>ch</strong>en<br />
Mundart, 4 Bde., Leipzig, 1793–1801, Bd. 2, 1276.<br />
Rolf-Jürgen Gleitsmann: Rohstoffmangel und Lösungsstrategien. Das Problem<br />
vorindustrieller Holzknappheit, in: Te<strong>ch</strong>nologie und Politik 16 (1980), 104–154;<br />
Rolf Peter Sieferle: Der unterirdis<strong>ch</strong>e Wald. Energiekrise und industrielle Revolution,<br />
Mün<strong>ch</strong>en 1982.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 65<br />
sollten, wie Joa<strong>ch</strong>im Radkau und Ingrid S<strong>ch</strong>äfer mit guten Gründen vors<strong>ch</strong>lugen,<br />
7 ist hier ni<strong>ch</strong>t zu untersu<strong>ch</strong>en. c) Der hohe Anteil der holzsparenden<br />
Te<strong>ch</strong>nologien an den seit 1550 im Rei<strong>ch</strong> und in den Territorien<br />
erteilten Privilegien (Abb. 1) ist ein Indiz dafür, dass die ‹gefühlte› Holzknappheit<br />
jedenfalls ein signifikantes Phänomen war. 8<br />
1.2. Holz- und Geldfresser<br />
Na<strong>ch</strong> dem bekannten Ausspru<strong>ch</strong> Werner Sombarts (1916) bildete die<br />
Zentralressource Holz in den vorindustriellen Gesells<strong>ch</strong>aften Europas<br />
«so se<strong>hr</strong> den allgemeinen Stoff aller Sa<strong>ch</strong>dinge, daß alle Kultur vor dem<br />
7<br />
8<br />
Joa<strong>ch</strong>im Radkau: Zur angebli<strong>ch</strong>en Energiekrise des 18. Ja<strong>hr</strong>hunderts. Revisionistis<strong>ch</strong>e<br />
Betra<strong>ch</strong>tungen über die «Holznot», in: VSWG 73 (1986), 1–37; Ingrid S<strong>ch</strong>äfer:<br />
Im Vorfeld der industriellen Revolution – Höhepunkt oder Ende des «hölzernen<br />
Zeitalters», in: Ferrum 63 (1991), 27–33. Über die divergierenden<br />
Nutzungsinteressen in Oberhasli vgl. zuletzt Martin Stuber: Waldwirts<strong>ch</strong>aft, in:<br />
Berns mä<strong>ch</strong>tige Zeit, hg. v. André Holenstein u. a., Bern 2006, 411–416, 413f.<br />
(Lit.). Zur «Holznot» als Argument zur Dur<strong>ch</strong>setzung von Reformen im Raum<br />
Nordosts<strong>ch</strong>weiz, Züri<strong>ch</strong> und Graubünden vgl. Katja Hürlimann: S<strong>ch</strong>lussberi<strong>ch</strong>t<br />
Projekt «Holznot» (18./19. Jh.), Internes Papier ETH Züri<strong>ch</strong>, Departement Umweltwissens<strong>ch</strong>aften,<br />
Arbeitsberei<strong>ch</strong> Wald- und Forstges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te, 2004.<br />
Quellen: Österrei<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>es Staatsar<strong>ch</strong>iv / Haus-, Hof und Staatsar<strong>ch</strong>iv / Rei<strong>ch</strong>shofrat<br />
(im Folgenden: OeStA/HHStA/RHR): Gratialia et Feudalia / Gewerbe-, Fabriksund<br />
Handlungsprivilegien 1489–1802 (digitaler Katalog); Fritz Hoffmann: Beiträge<br />
zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Erfindungss<strong>ch</strong>utzes in Deuts<strong>ch</strong>land im se<strong>ch</strong>zehnten Ja<strong>hr</strong>hundert,<br />
in: Zeitsc<strong>hr</strong>ift für Industriere<strong>ch</strong>t 10 (1915), 85–98; Hans Müller: Patents<strong>ch</strong>utz<br />
im deuts<strong>ch</strong>en Mittelalter, in: Gewerbli<strong>ch</strong>er Re<strong>ch</strong>tss<strong>ch</strong>utz und Urheberre<strong>ch</strong>t 44<br />
(1939), 936–953; Hansjörg Pohlmann: Neue Materialien zur Frühentwicklung des<br />
deuts<strong>ch</strong>en Erfinders<strong>ch</strong>utzes im 16. Ja<strong>hr</strong>hundert, in: Gewerbli<strong>ch</strong>er Re<strong>ch</strong>tss<strong>ch</strong>utz und<br />
Urheberre<strong>ch</strong>t 62 (1960), 272–283; Charles Hiegel: Les essais de réduction de la<br />
consommation de bois des salines lorraines (1572–1630). Progrès te<strong>ch</strong>nique ou<br />
<strong>ch</strong>imères?, in: Actes du 103 e congrès national des sociétés savantes (Nancy-Metz<br />
1978), Paris 1979, 303–318; Hans-Jürgen Creutz: Die Herausbildung des Erfindungss<strong>ch</strong>utzes<br />
in Sa<strong>ch</strong>sen im 15. und 16. Ja<strong>hr</strong>hundert, in: JWG 23 (1983), 91–110;<br />
Rolf-Jürgen Gleitsmann: «Wir wissen aber, Gott Lob, was wir thuen»: Erfinderprivilegien<br />
und te<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>er Wandel im 16. Ja<strong>hr</strong>hundert, in: Zeitsc<strong>hr</strong>ift für Unternehmensges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
30 (1985), 69–95; François J. Fu<strong>ch</strong>s: Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es te<strong>ch</strong>niques au<br />
XVI e siècle. De quelques essais de réduction de consommation de bois à Strasbourg,<br />
in: Ho<strong>ch</strong>finanz Wirts<strong>ch</strong>aftsräume Innovation (FG Wolfgang von Stromer),<br />
hg. v. Uwe Bestmann u. a., 3 Bde., Trier 1987, Bd. 3, 1099–1114.
66<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
19. Ja<strong>hr</strong>hundert ein ausgespro<strong>ch</strong>en hölzernes Gepräge trägt» 9 . Dabei rangierte<br />
Holz als Brennstoff im Berei<strong>ch</strong> der Privathaushalte (Heizen, Ko<strong>ch</strong>en,<br />
Was<strong>ch</strong>en), der so genannten Feuergewerbe (S<strong>ch</strong>miede, Brauer, Bäcker,Töpfer,<br />
Ziegler, Glasma<strong>ch</strong>er) und des Grossgewerbes (Erzhütten,<br />
Salinen, Glashütten) mit 90% deutli<strong>ch</strong> vor Holz als Werkstoff. 10<br />
Abb. 1: Bestandesentwicklung der bisher na<strong>ch</strong>gewiesenen holzsparenden<br />
Te<strong>ch</strong>nologien (Holzsparkünste) 1501–1600 im Verglei<strong>ch</strong> zu den glei<strong>ch</strong>zeitigen<br />
Erfinderprivilegien im Rei<strong>ch</strong>.<br />
Die bes<strong>ch</strong>eidene Energieeffizienz der vormodernen Produktionsmittel 11<br />
(Tab. 1, Abb. 2 und 3) fü<strong>hr</strong>te dazu, dass in ho<strong>ch</strong> industrialisierten Regionen<br />
das Na<strong>ch</strong>wu<strong>ch</strong>spotential der Wälder, die Transportkapazitäten und<br />
9<br />
10<br />
11<br />
Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus, Bd. 2/2, 3. Aufl., Mün<strong>ch</strong>en u. a.<br />
1919, 1139. Vgl. Joa<strong>ch</strong>im Radkau: Das «hölzerne Zeitalter» und der deuts<strong>ch</strong>e Sonderweg<br />
in der Forstte<strong>ch</strong>nik, in: «Nützli<strong>ch</strong>e Künste». Kultur- und Sozialges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
der Te<strong>ch</strong>nik im 18. Ja<strong>hr</strong>hundert, hg. v. Ulri<strong>ch</strong> Troitzs<strong>ch</strong>, Münster u. a. 1999, 97–<br />
118, 97f.<br />
Joa<strong>ch</strong>im Radkau unter Mitarbeit von Ingrid S<strong>ch</strong>äfer: Holz – Wie ein Naturstoff<br />
Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te sc<strong>hr</strong>eibt, Mün<strong>ch</strong>en 2007, 21.<br />
Zur Beurteilung des Wirkungsgrade frühneuzeitli<strong>ch</strong>er Verbrennungsanlagen vgl.<br />
Radkau, Holz (wie Anm. 10), 90–93.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 67<br />
die Bedarfsanforderungen der Industrie zunehmend auseinander klafften,<br />
was die Kommerzialisierung und die Verteuerung des Holzes deutli<strong>ch</strong><br />
bes<strong>ch</strong>leunigte.<br />
Tab. 1: A: Nutzwirkungsgrad von Heizanlagen, B: Produkt-Holzverhältnis ausgewählter<br />
Erzeugnisse.<br />
A: Nutzwirkungsgrade 12 [%]<br />
Offenes Feuer auf ebener Erde 10<br />
Offene Siedepfannen (Salinen) 25 bis 20. Ja<strong>hr</strong>hundert<br />
Offener Kamin 5–35<br />
Eiserne Öfen 65–70 ab 20. Ja<strong>hr</strong>hundert<br />
Ka<strong>ch</strong>elofen 65–75 ab 20. Ja<strong>hr</strong>hundert<br />
B: Produkt-Holz-Verhältnis 13 (Dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittswerte 16.–18. Ja<strong>hr</strong>hunert)<br />
Salz (Verdampfung der Sole) 1:7<br />
Roheisen 1:15<br />
S<strong>ch</strong>miedeeisen 1:30<br />
Silber 1:200<br />
Pottas<strong>ch</strong>e 1:700 Bu<strong>ch</strong>e<br />
1:2’000 Fi<strong>ch</strong>te<br />
Glas 1:2’400 (1 kg 0.5 ha Ei<strong>ch</strong>enwald)<br />
Der geringe thermis<strong>ch</strong>e Wirkungsgrad der frühneuzeitli<strong>ch</strong>en häusli<strong>ch</strong>en<br />
Heiz- und Ko<strong>ch</strong>anlagen – no<strong>ch</strong> 1833 war «je Feuerstelle der jä<strong>hr</strong>li<strong>ch</strong>e<br />
Na<strong>ch</strong>wu<strong>ch</strong>s eines Hektars Bu<strong>ch</strong>enwald zu verans<strong>ch</strong>lagen» 14 – belastete<br />
die Haushaltungskasse empfindli<strong>ch</strong>. Ende 1556 klagt Wolfgang Musculus<br />
(1497–1563): «Das holtz gestadt [kostet] mi<strong>ch</strong> jars bitz [bis] uff die<br />
10 cronen; ist ein zimli<strong>ch</strong>s lo<strong>ch</strong> in myn besoldung» 15 . Im Verhältnis zu<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Alfred Faber: Entwicklungsstufen der häusli<strong>ch</strong>en Heizung, Mün<strong>ch</strong>en 1957, 50, 65,<br />
148; Rolf-Jürgen Gleitsmann: Aspekte der Ressourcenproblematik in historis<strong>ch</strong>er<br />
Si<strong>ch</strong>t, in: Scripta Mercaturae 15 (1981), 33–90, 35; Gleitsmann, Erfinderprivilegien<br />
(wie Anm. 8), 112; Radkau, Holz (wie Anm. 10), 204; Hermann Recknagel, Eberhard<br />
Sprenger u. Ernst-Rudolf Sc<strong>hr</strong>amek (Hg.): Tas<strong>ch</strong>enbu<strong>ch</strong> für Heizung + Klimate<strong>ch</strong>nik<br />
07/08, 73. Aufl., Mün<strong>ch</strong>en 2007, 510, 513.<br />
Radkau, Holz (wie Anm. 10), 115; Gleitsmann, Ressourcenproblematik (wie Anm.<br />
12), 51, 56f.<br />
Gleitsmann, Ressourcenproblematik (wie Anm. 12), 57.<br />
StAZH E II 360, 213 (W. Musculus an H. Bullinger, 31. Dezember 1556), freundli<strong>ch</strong>er<br />
Hinweis von Herrn lic. theol. Rainer Henri<strong>ch</strong>.
68<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Abb. 2: Spinnstube. Holzs<strong>ch</strong>nitt von Bartel<br />
Beham, um 1524 16 (Auss<strong>ch</strong>nitt). Infolge<br />
seiner grossvolumigen Auslegung, des Abbrandes<br />
auf der Sohle des Unterbaus ohne<br />
Luftzufu<strong>hr</strong> und fehlender Rau<strong>ch</strong>gasfü<strong>hr</strong>ung<br />
verhindert dieser Ka<strong>ch</strong>elofen traditioneller<br />
Bauart jegli<strong>ch</strong>e Heizökonomie.<br />
Abb. 3: Bierbrauer. Holzs<strong>ch</strong>nitt von<br />
Jost Ammann, um 1568 17 (Auss<strong>ch</strong>nitt).<br />
Im Hintergrund rü<strong>hr</strong>t der Gehilfe bei<br />
grosser Flamme in der Würzpfanne.<br />
Diese Anlage arbeitete mit einem Nutzwirkungsgrad<br />
unter 50%.<br />
seinem Ja<strong>hr</strong>esgehalt von 150 kr 18 errei<strong>ch</strong>ten die Energiekosten des Berner<br />
Theologieprofessors einen Anteil von 6.7%, ein Aufwand, der mit<br />
entspre<strong>ch</strong>enden Ausgaben in Konstanz (um 1557: 18 fl 10.8 kr) und<br />
der Nürnberger Patrizierhaushalte Tu<strong>ch</strong>er (1507–1517: 6.2–7.9%) und<br />
Behaim (1548/49: 13.48 fl) verglei<strong>ch</strong>bar ist. 19<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
Abb. aus Alison G. Stewart: Distaffs and Spindles, in: Saints, Sinners, and Sisters:<br />
Gender and Northern Art in Medieval and Early Modern Europe, hg. v. Jane L.<br />
Carroll, Ashgate 2003, 127–154, 128.<br />
Abb. aus Hans Sa<strong>ch</strong>s: Eygentli<strong>ch</strong>e Besc<strong>hr</strong>eibung aller Sta nde, Frankfurt 1568,<br />
M iij r .<br />
Musculus bezog 1554 nebst freier Wohnung 120 fl in bar und 130 fl in Wein,<br />
Dinkel und Hafer, vgl. Reinhard Bodenmann: Wolfgang Musculus (1497–1563),<br />
Genève 2000, 41, n. 99.<br />
Vgl. C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß: Collectaneen zum Ja<strong>hr</strong>e 1557, StadtA Konstanz, Hs. A I<br />
8, Teilband VIII, 38½–39 (vgl. Anh. 2). Herrn Mi<strong>ch</strong>ael Kuthe, Konstanz, danke i<strong>ch</strong><br />
für die bes<strong>ch</strong>leunigte Bes<strong>ch</strong>affung dieser wi<strong>ch</strong>tigen Ar<strong>ch</strong>ivalie. Zu S<strong>ch</strong>ulthaiß:<br />
J[ohann] Marmor (Hg.): Constanzer Bisthums-C<strong>hr</strong>onik von C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß,
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 69<br />
Den thermis<strong>ch</strong>en Mängeln damaliger Heizanlagen gesellte si<strong>ch</strong> die<br />
Belästigung dur<strong>ch</strong> Rau<strong>ch</strong>gase hinzu. Bekannt sind die wiederholten Klagen<br />
des Erasmus über den neuen wels<strong>ch</strong>en Kamin, den ihm der Drucker<br />
Johannes Froben im Haus ‹Zur alten Treu› hatte einbauen lassen. Na<strong>ch</strong><br />
nur einer Heizperiode erwägt der Humanistenfürst im Februar 1522 die<br />
Emigration «ob nidorem hypocaustorum» 20 . Do<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> um die ges<strong>ch</strong>lossenen<br />
Öfen stand es in dieser Hinsi<strong>ch</strong>t offenbar ni<strong>ch</strong>t viel besser. Im Juni<br />
1528 wurden im Pfarrhaus Sumiswald ein neuer «ba<strong>ch</strong>offen und stubenoffen»<br />
gesetzt, was offenbar ni<strong>ch</strong>t verhindern konnte, dass si<strong>ch</strong> der Prädikant<br />
Lucius Danner im Januar 1529 veranlasst sah, Zwingli einen seufzenden<br />
Gruss «aus unserem verrussten (fuliginosa) Amt und Häus<strong>ch</strong>en<br />
in Sumiswald» zu s<strong>ch</strong>icken. 21<br />
Angesi<strong>ch</strong>ts der soeben skizzierten objektiv vorhandenen oder subjektiv<br />
empfundenen Holzengpässe, des s<strong>ch</strong>ieren Sparzwangs oder der<br />
blossen Spartugend und der gestiegenen Ansprü<strong>ch</strong>e an einen minimalen<br />
Wohnkomfort, bestand ebensoviel Handlungsbedarf wie Entwicklungspotential.<br />
Als historis<strong>ch</strong>e Lösungsstrategien, deren «Zielsetzung über die<br />
reine ‹Mangelverwaltung› hinausgingen», besc<strong>hr</strong>ieb Rolf-Jürgen Gleitsmann<br />
1981 im Wesentli<strong>ch</strong>en a) die Sparstrategien (rationellere Erzeugung<br />
und Nutzung des Brennstoffes Holz), b) die Verlagerungsstrategien<br />
(Substitution dur<strong>ch</strong> Torf und Kohle) und c) die Haubergwirts<strong>ch</strong>aft (regenerative<br />
Nutzung der Wälder). 22 Historis<strong>ch</strong> hat si<strong>ch</strong> erwartungsgemäss<br />
die Verlagerungsstrategie dur<strong>ch</strong>gesetzt. Unsere Untersu<strong>ch</strong>ung besc<strong>hr</strong>änkt<br />
si<strong>ch</strong> indessen auf die nördli<strong>ch</strong> der Alpen seit 1550 einsetzenden systematis<strong>ch</strong>en<br />
Versu<strong>ch</strong>e rationellerer Brennholznutzung und deren Vermarktung.<br />
20<br />
21<br />
22<br />
in: Freiburger Diöcesan-Ar<strong>ch</strong>iv 8 (1874), 3–101, 3–5; Ulf Dirlmeier: Untersu<strong>ch</strong>ungen<br />
zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeuts<strong>ch</strong>en<br />
Städte des Spätmittelalters (Mitte 14. bis Anfang 16. Ja<strong>hr</strong>hundert), Heidelberg<br />
1978, 255, 418.<br />
Vgl. Z VII, Nr. 175 (J. Nepos an H. Zwingli, ca. 21. März 1521). P[ercy] S[tafford]<br />
Allen u. a. (Hg.): Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami, 12 Bde., Oxford 1906–<br />
1958, Bd. 5, Nr. 1248 (Erasmus an M. S<strong>ch</strong>inner, 14. Dezember 1521); Nr. 1258<br />
(Erasmus an M. Davidts, 9. Februar 1522).<br />
Z X, Nr. 800 (L. Danner an H. Zwingli, 19. Januar 1529).<br />
Gleitsmann, Ressourcenproblematik (wie Anm. 12), 120–135.
70<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
2. «kunst unnd gottesgab»<br />
Der in der frühen Neuzeit vermutli<strong>ch</strong> mit einem hohen Aufmerksamkeitswert<br />
versehene Neologismus ‹Holtzsparkunst› verbindet die Zentralressource<br />
‹Holz› mit der ‹Sparsamkeit› als einer Kardinaltugend aller<br />
‹guten Policey und Oeconomie› 23 . Der Wortteil kunst (ars) verheisst zudem<br />
ein innovatives te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>es Wissen und Können, 24 das die gottgegebene<br />
Holznot zu wenden, wenn ni<strong>ch</strong>t gar zu «überlisten» 25 vermag.<br />
Glei<strong>ch</strong>zeitig meint kunst das «te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Hilfsmittel und Sa<strong>ch</strong>system»<br />
selbst, und dies in einem dur<strong>ch</strong>aus modernen, konkret-instrumentellen<br />
Sinne. 26<br />
Auf unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Weise geben die Zeitgenossen der ‹nüw erfundnen<br />
khunst deß holtzsparens› i<strong>hr</strong>er Ahnung um die grundsätzli<strong>ch</strong>e<br />
Di<strong>ch</strong>otomie von ars und natura Ausdruck. Patentgebende Gremien neigen<br />
dazu, die «nova inventa» religiös zu legitimieren. 27 So versi<strong>ch</strong>ern die<br />
Obrigkeiten von Strassburg und Züri<strong>ch</strong> im Ingress i<strong>hr</strong>er Privilegien, es<br />
habe der Erfinder<br />
uß sonderer verlyhung vnd gnaden des alme<strong>ch</strong>tigen ein söli<strong>ch</strong> kunst erfunden, das<br />
in einheitzung der stuben und ko<strong>ch</strong>en [!] ungeuarli<strong>ch</strong> der halb theil holtzes […]<br />
erspart […] werden mag. 28<br />
Au<strong>ch</strong> der Winterthurer C<strong>hr</strong>onist Ulri<strong>ch</strong> Meyer (1502–1576/77) sieht in<br />
der Holzsparkunst einen Beweis für die «groß wunderbarli<strong>ch</strong> alme<strong>ch</strong>tig-<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
Vgl. Paul Mün<strong>ch</strong>: Ordnung, Fleiss und Sparsamkeit. Texte und Dokumente zur<br />
Entstehung der «bürgerli<strong>ch</strong>en Tugenden», Mün<strong>ch</strong>en 1984, passim.<br />
Vgl. Matthias Lexer: Mittelho<strong>ch</strong>deuts<strong>ch</strong>es Handwörterbu<strong>ch</strong>, 3 Bde., Leipzig 1872–<br />
1878, Bd. 1, 1780–1782 (kunst).<br />
Petrus Dasypodius: Dictionarium Latinogermanicum, 9. Aufl. (?), Strassburg 1559<br />
[ohne Paginierung]: «Ars: Kunst, listigkeyt. Artifex: Ein ku nstler oder handwercks<br />
man».<br />
Vgl. Wilfried Seibicke: Te<strong>ch</strong>nik, Versu<strong>ch</strong> einer Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Wortfamilie um<br />
in Deuts<strong>ch</strong>land vom 16. Ja<strong>hr</strong>hundert bis etwa 1830, Düsseldorf 1968, 276f.<br />
Vgl. die expliziten c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>en Deutungsmuster bezügli<strong>ch</strong> der zeitgenössis<strong>ch</strong>en<br />
Mas<strong>ch</strong>inente<strong>ch</strong>nik bei Johann Mathesius: Sarepta oder Bergpostill, Nürnberg 1562,<br />
Vorrede aiij v –aviij r . Zur Thematik immer no<strong>ch</strong> wegleitend: Ansgar Stöcklein: Leitbilder<br />
der Te<strong>ch</strong>nik. Biblis<strong>ch</strong>e Tradition und te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>er Fortsc<strong>hr</strong>itt, Mün<strong>ch</strong>en 1969.<br />
ZBZH, Ms. S 89, 94 (29. Juni 1555).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 71<br />
keitt Gottes, die er würckett im mens<strong>ch</strong>en vnd dur<strong>ch</strong> inn, das semli<strong>ch</strong>e<br />
kunst zur letsten zitt [neuli<strong>ch</strong>] erfunden ist worden.» 29<br />
Anders und nü<strong>ch</strong>terner der Bieler C<strong>hr</strong>onist Bendi<strong>ch</strong>t Re<strong>ch</strong>berger<br />
(1509–1566), wel<strong>ch</strong>er der «nüwen holtzersparungskunst» die ewige<br />
Kunst Gottes gegenüber stellt: «Aber die vralty kunst von gott ers<strong>ch</strong>affen<br />
fartt für vnd fältt nitt» 30 .<br />
Die Konkretisierung des Abstraktums kunst im Sinne von Mas<strong>ch</strong>ine<br />
(Pumpwerk) etablierte si<strong>ch</strong> gegen Ende des 13. Ja<strong>hr</strong>hunderts im Bergbau<br />
31 und bereitete die im letzten Drittel des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts vollzogene<br />
dauerhafte Verbindung von kunst qua Kü<strong>ch</strong>enherd bzw. Stubenofen vor,<br />
wie sie Friedri<strong>ch</strong> Staub, der Mitbegründer des S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Idiotikons,<br />
1877 an einem s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Beispiel aus dem Ja<strong>hr</strong>e 1557 ans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong><br />
illustriert hat. 32 Das Spektrum der zwis<strong>ch</strong>en 1555 und 1560<br />
auftau<strong>ch</strong>enden Neologismen ist breit: Mit «ars de parcendis lignis in<br />
coquendo ac calefaciendo conclavia» bietet der Arzt und poeta laureatus<br />
Mi<strong>ch</strong>ael Toxites s<strong>ch</strong>on 1556 eine griffige Terminologie. 33<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
Ulri<strong>ch</strong> Meyer: Winterthurer C<strong>hr</strong>onik 1540–1573, Stadtbibliothek Winterthur Ms.<br />
4° 102, 94 r –95 r , 95 r . Transkription des Holzspar-Abs<strong>ch</strong>nitts bei: G[ustav] Geilfus:<br />
Lose Blätter aus der Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te von Winterthur, 4 Teile in 1 Bd., Winterthur 1867–<br />
1871, Teil 3, 34f.; F[riedri<strong>ch</strong>] Staub: Ein s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>-alemannis<strong>ch</strong>es Lautgesetz,<br />
in: Fromanns Deuts<strong>ch</strong>e Mundarten 7 (NF 1) (1877), 18–36, 191–207, 333–389,<br />
201f. Herrn Prof. Dr. Max S<strong>ch</strong>iendorfer danke i<strong>ch</strong> für die freundli<strong>ch</strong>e Überlassung<br />
der entspre<strong>ch</strong>enden Digitalisate. Zu Ulri<strong>ch</strong> Meyer vgl. Georg von Wyss: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
der Historiographie in der S<strong>ch</strong>weiz, Züri<strong>ch</strong> 1895, 221f. «kunst unnd gottesgab»<br />
(Kft. Ottheinri<strong>ch</strong> v. d. Pfalz an Kft. August v. Sa<strong>ch</strong>sen, 1. Oktober 1556), zitiert<br />
na<strong>ch</strong> Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 92.<br />
Bendi<strong>ch</strong>t Re<strong>ch</strong>berger: Bieler C<strong>hr</strong>onik, StadtA Biel, CCXLIX, Nr. 12, 111f. An dieser<br />
Stelle sei der Stadtar<strong>ch</strong>ivarin, Frau lic. phil. Chantal Greder-Fournier, für i<strong>hr</strong>e<br />
freundli<strong>ch</strong>e und kenntnisrei<strong>ch</strong>e Hilfestellung herzli<strong>ch</strong> gedankt. Zu Re<strong>ch</strong>berger und<br />
seiner C<strong>hr</strong>onik vgl. Werner Bourquin u. Walter Bourquin: Biel. Stadtges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>es<br />
Lexikon, 2. Aufl., Biel 2008, 320.<br />
Marcus Popplow: Neu, nützli<strong>ch</strong>, erfindungsrei<strong>ch</strong>. Die Idealisierung von Te<strong>ch</strong>nik in<br />
der frühen Neuzeit, Münster u. a. 1998, 22.<br />
Staub, Lautgesetz (wie Anm. 29), 201f. Die etymologis<strong>ch</strong>e Herleitung von kunst<br />
qua Herd von (ustrina) findet si<strong>ch</strong> nur no<strong>ch</strong> in der älteren Literatur, vgl.<br />
Franz Joseph Stalder: Versu<strong>ch</strong> eines s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Idiotikon, 2 Bde., Aarau<br />
1812, Bd. 2, 144.<br />
«Kunst Holz zu sparen beim Ko<strong>ch</strong>en und Heizen», StAZH E II 345, 421 (M. Toxites<br />
an H. Bullinger, 24. September 1556). Zu Toxites: Herbert Jaumann: Handbu<strong>ch</strong><br />
Gele<strong>hr</strong>tenkultur der Frühen Neuzeit, bisher 1 Bd., Berlin u. a. 2004, 663 (Lit.).
72<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
An zeitgenössis<strong>ch</strong>en Synonymen bilden si<strong>ch</strong> heraus: kunst des holzsparens,<br />
holtz(er)spar(ungs)kunst, holtzsparung (lignorum parsimonia,<br />
, xylophidia, ), ars focaria der holtzsparkunst,<br />
oder au<strong>ch</strong> nur holtzkunst (ars lignaria). 34 Die Erfinder gelten als holtzku<br />
nstler, i<strong>hr</strong> Produkt sind die nüw kunstöffen, lignaria fornaces, bzw. das<br />
organum hypocausticum, coquinarium, pistorium oder lignaria fornaces.<br />
Se<strong>hr</strong> viel seltener meint kunst das neue Verfa<strong>hr</strong>en (ignaria ratio). So hat<br />
der C<strong>hr</strong>onist Meyer «no<strong>ch</strong> nie […] kein offen gese<strong>ch</strong>en, dar inn dise<br />
künst probiertt sige worden» 35 .<br />
Die Amalgamierung von <strong>ch</strong>unst und Herd (Abb. 4) war in der deuts<strong>ch</strong>en<br />
S<strong>ch</strong>weiz eine derart gründli<strong>ch</strong>e, dass die alte abstrakte Wortbedeutung<br />
hier «teilweise erst dur<strong>ch</strong> die Sc<strong>hr</strong>iftspra<strong>ch</strong>e wieder vermittelt wurde»<br />
36 . Entgegen der Darstellung in Grimms Deuts<strong>ch</strong>em Wörterbu<strong>ch</strong><br />
1873 37 blieb die furnologis<strong>ch</strong>e Konnotation des Wortes ni<strong>ch</strong>t nur auf die<br />
S<strong>ch</strong>weiz besc<strong>hr</strong>änkt. In den hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Absatzgebieten der neuen<br />
Heizte<strong>ch</strong>nologie, d. h. in weiten Teilen der deuts<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>weiz, in Baden-Württemberg,<br />
im Elsass, in Bayern, in der Pfalz, in Deuts<strong>ch</strong>-Lot<strong>hr</strong>ingen<br />
und im Vorarlberg bezei<strong>ch</strong>nete die <strong>ch</strong>unst (<strong>ch</strong>ôst, <strong>ch</strong>oust, <strong>ch</strong>ûst,<br />
au<strong>ch</strong> <strong>ch</strong>oustli, <strong>ch</strong>üüstli) bis weit ins 20. Ja<strong>hr</strong>hundert a) den Kü<strong>ch</strong>enherd,<br />
b) den dur<strong>ch</strong> das Kü<strong>ch</strong>enfeuer beheizten Stubenofen (daher oft der<br />
<strong>ch</strong>oust) mit Sitzgelegenheit oder c) den Ofentritt. Zahlrei<strong>ch</strong> sind die<br />
Komposita (kunstherd, k.lo<strong>ch</strong>, k.ring, k.ro<strong>hr</strong>, etc.). 38<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
Der Begriff Holtzkunst blieb offenbar ein «völlig deuts<strong>ch</strong>er Gegenstand». Jedenfalls<br />
vermo<strong>ch</strong>te der französis<strong>ch</strong>e Übersetzer von J. Hallers Ephemeriden in der «ars<br />
lignaria» ni<strong>ch</strong>ts anderes als «la science de la baguette devinatoire» zu sehen, vgl.<br />
Spicilège ou extrait anecdotique des ephémèrides de Jean Haller, Doyen de Berne,<br />
in: Le Conservateur Suisse 11 (1829), 357–372, 369.<br />
Meyer, Winterthurer C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 29), 95 r .<br />
Friedri<strong>ch</strong> Staub, Ludwig Tobler u. a.: Wörterbu<strong>ch</strong> der s<strong>ch</strong>weizerdeuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e,<br />
bisher 16 Bde., Frauenfeld 1881–2009 (im Folgenden: S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon),<br />
Bd. 3, 367–369, 368.<br />
DWb 11, 2667–2684.<br />
S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon 3, 367–369; Ernst O<strong>ch</strong>s u. a. (Hg.): Badis<strong>ch</strong>es Wörterbu<strong>ch</strong>,<br />
bisher 5 Bde., La<strong>hr</strong> 1925–2000, Bd. 3, 329; Hermann S<strong>ch</strong>illi: Das S<strong>ch</strong>warzwaldhaus,<br />
Stuttgart 1955, 62–65; Adelbert v. Keller u. a. (Hg.): S<strong>ch</strong>wäbis<strong>ch</strong>es<br />
Wörterbu<strong>ch</strong>, 7 Bde., Tübingen 1904–1936, Bd. 4, 854f.; Ernst Martin u. a. (Hg.):<br />
Wörterbu<strong>ch</strong> der elsässis<strong>ch</strong>en Mundarten, 2 Bde., Strassburg 1899, Bd. 1, 451b–<br />
453a; Johann S<strong>ch</strong>meller u. a. (Hg.): Bayeris<strong>ch</strong>es Wörterbu<strong>ch</strong>, 2 Bde., 2. Aufl.,<br />
Stuttgart 1872–1877, Bd. 1, 1266; Ernst C<strong>hr</strong>istmann u. a. (Hg.): Pfälzis<strong>ch</strong>es Wör-
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 73<br />
Abb. 4: Emmentaler Bauernstube<br />
mit Chunst und<br />
Fuulbett.<br />
«Bloß vom Ko<strong>ch</strong>en, also<br />
von der Chunst der Kü<strong>ch</strong>e<br />
her einigermaßen erwärmt<br />
und daher bisweilen selber<br />
Chunst oder au<strong>ch</strong> ‹Kunstofen›<br />
genannt, leistet der<br />
untere Ofenteil in der äußern<br />
Stube seine besonders<br />
ausdauernden und lei<strong>ch</strong>t zu<br />
erlangenden Dienste.» 39<br />
3. Der Konstanzer Holzspar-Cluster<br />
3.1. «Konstanz, o weh, am Bodensee …»<br />
39<br />
40<br />
Neuere Te<strong>ch</strong>niktheorien gehen ni<strong>ch</strong>t me<strong>hr</strong> vom Konzept des individuellen<br />
Erfinders aus, sondern vielme<strong>hr</strong> von einem kontinuierli<strong>ch</strong>en Variationsprozess,<br />
der die bestehenden Te<strong>ch</strong>nologien den si<strong>ch</strong> graduell verändernden<br />
sozialen Kontextbedingungen anpasst: «Au<strong>ch</strong> eine neue<br />
Te<strong>ch</strong>nik, die im Na<strong>ch</strong>hinein als revolutionäre Erfindung bezei<strong>ch</strong>net wird,<br />
ist emergentes Produkt dieses Prozesses der kleinteiligen Variation» 40 .<br />
Diese allgemeine Feststellung trifft mit hoher Wa<strong>hr</strong>s<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong>keit au<strong>ch</strong><br />
auf die Mitte der 1550er Ja<strong>hr</strong>e in Ers<strong>ch</strong>einung tretende «nüwe holtzkunst»<br />
zu, deren Entwicklung, Finanzierung und europaweite Vermarkterbu<strong>ch</strong>,<br />
6 Bde., Wiesbaden u. a. 1965–1997, Bd. 5, 228; Ferdinand Follmann<br />
(Hg.): Wörterbu<strong>ch</strong> der deuts<strong>ch</strong>-lot<strong>hr</strong>ingis<strong>ch</strong>en Mundarten, Leipzig 1909, 320a–<br />
321a.<br />
Emanuel Friedli: Bärndüts<strong>ch</strong> als Spiegel bernis<strong>ch</strong>en Volkstums, 8 Bde., Bern<br />
1905–1927, Bd. 1: Lützelflüh, 228, 231.<br />
Helmut Bremer u. Andrea Lange-Vester: Soziale Milieus und Wandel der Sozialstruktur.<br />
Die gesells<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Herausforderungen und die Strategien der sozialen<br />
Gruppen, Wiesbaden 2006, 190.
74<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
tung einem we<strong>ch</strong>selseitig verwandten oder befreundeten Cluster von<br />
Konstanzern im Exil zugeordnet werden kann (Abb. 5).<br />
Abb. 5: Die Hauptakteure des Holzspar-Konsortiums Frommer & Zwick in i<strong>hr</strong>en Ges<strong>ch</strong>äftsbeziehungen<br />
1554–1576. 41<br />
Wegen i<strong>hr</strong>er herois<strong>ch</strong>en Weigerung, si<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem verlorenen S<strong>ch</strong>malkaldis<strong>ch</strong>en<br />
Krieg dem Augsburger Interim zu unterwerfen, war die dur<strong>ch</strong><br />
Fernhandel begüterte Freie Rei<strong>ch</strong>sstadt Konstanz mit der Rei<strong>ch</strong>sa<strong>ch</strong>t und<br />
einem Embargo belegt worden. 42 Am 13. Oktober 1548 musste sie kapi-<br />
41<br />
42<br />
Quellen: Blarer BW; Literatur (vgl. die jeweiligen Namenregister): Ri<strong>ch</strong>ard E<strong>hr</strong>enberg:<br />
Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Creditverke<strong>hr</strong> im 16. Ja<strong>hr</strong>hundert,<br />
2 Bde., Jena 1896; Ascan Westermann: Die Zahlungseinstellung der Handlungsgesells<strong>ch</strong>aft<br />
der Gebrüder Zangmeister zu Memmingen 1560, in: VSWG 6 (1908),<br />
460–516; Aloys S<strong>ch</strong>ulte: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Großen Ravensburger Handelsgesells<strong>ch</strong>aft,<br />
3 Bde., Stuttgart u. a. 1923; Friedri<strong>ch</strong> Wielandt: Das Konstanzer Leinengwerbe,<br />
2 Bde., Konstanz 1950/1953; Anne Brückner: Das Ges<strong>ch</strong>äftsbu<strong>ch</strong> des Konstanzer<br />
Tu<strong>ch</strong>händlers Peter Kintzer aus den Ja<strong>hr</strong>en 1554–1566, in: Sc<strong>hr</strong>iften des<br />
Vereins für die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Bodensees 109 (1991), 21–92; Frank Göttmann,<br />
Andreas Nutz (Hg.): Die Firma Felix und Jakob Grimmel zu Konstanz und Memmingen.<br />
Quellen und Materialien zu einer oberdeuts<strong>ch</strong>en Handelsgesells<strong>ch</strong>aft aus<br />
der Mitte des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts, Stuttgart 1999.<br />
Anton Maurer: Der Übergang der Stadt Konstanz an das Haus Österrei<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> dem<br />
s<strong>ch</strong>malkaldis<strong>ch</strong>en Kriege (Diss. phil. Basel), Frauenfeld 1904.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 75<br />
tulieren und «spanis<strong>ch</strong> lernen» 43 . Wä<strong>hr</strong>end die Stadt mit dem Verlust der<br />
Rei<strong>ch</strong>sunmittelbarkeit bestraft wurde, sahen si<strong>ch</strong> die politis<strong>ch</strong>-religiösen<br />
Fü<strong>hr</strong>ungsspitzen 44 der dur<strong>ch</strong> sc<strong>hr</strong>iftgemässe Predigt, Kir<strong>ch</strong>enzu<strong>ch</strong>t und<br />
einen rei<strong>ch</strong>en Lieders<strong>ch</strong>atz weit ausstrahlenden Reformation zum Exil<br />
gezwungen. Unter all jenen, «denen unser C<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>e religion und ri<strong>ch</strong>sfrihait<br />
lieber was dan unser vatterland, huß und hof, hab und gut» 45 , befanden<br />
si<strong>ch</strong> mit i<strong>hr</strong>en Familien die Brüder Ambrosius und Thomas Blarer,<br />
deren Vetter Konrad Zwick und der junge Prädikant Jakob Funcklin.<br />
Abb. 6: Planvedute der Stadt Biel. Holzs<strong>ch</strong>nitt von Heinri<strong>ch</strong> Vogtherr d.<br />
Ä. (?), um 1547/48. 46<br />
3.2. Jakob Funcklin (1522/23–1565)<br />
Als Sohn des früh verstorbenen Stadtsc<strong>hr</strong>eibers Jakob Funcklin, aufgewa<strong>ch</strong>sen<br />
im reformatoris<strong>ch</strong>en Umfeld der politis<strong>ch</strong>-geistigen Fü<strong>hr</strong>ungss<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>t<br />
seiner Heimatstadt Konstanz, wirbt s<strong>ch</strong>on der zehnjä<strong>hr</strong>ige (Jo-<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
Emil Bloes<strong>ch</strong>: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>-reformierten Kir<strong>ch</strong>en, 2 Bde., Bern<br />
1898–1899, Bd. 1, 313.<br />
Hans Rudolf Lavater: Regnum C<strong>hr</strong>isti etiam externum. Huldry<strong>ch</strong> Zwinglis Brief<br />
vom 4. Mai 1528 an Ambrosius Blarer in Konstanz, in: Zwa 15 (1981), 338–381<br />
(Lit.).<br />
ZBZH, Ms. A 83, 165 r (Gregor Mangolt: Konstanzer C<strong>hr</strong>onik). Die transkribierte<br />
Exulantenliste verdanke i<strong>ch</strong> Herrn Pfr. Dr. h. c. Alfred Vögeli †, Frauenfeld.<br />
Abbildung aus Johannes Stumpf: Gemeiner lobli<strong>ch</strong>er Eydgnos<strong>ch</strong>aft Stetten, Landen<br />
vnd Völckeren C<strong>hr</strong>onickwirdiger thaaten besc<strong>hr</strong>eybung, 2 Bde., Züri<strong>ch</strong> 1547–1548,<br />
Bd. 2, 267 v , vgl. Bourquin, Biel (wie Anm. 30), 435.
76<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
hann) Jakob Funcklin 47 in treuherzigem Latein um die Freunds<strong>ch</strong>aft<br />
Ambrosius Blarers, dem er «lieber als ein Sohn» werden wird. Na<strong>ch</strong> dem<br />
Besu<strong>ch</strong> der Konstanzer Lateins<strong>ch</strong>ule (Lopadius) studiert Funcklin 1536–<br />
1541 in Basel (Grynäus), Tübingen, Strassburg (Dasypodius) und Isny<br />
(Fagius). Anfang 1542 heiratet er die vermögende Konstanzerin Anna<br />
Grützer, die ihm vier Tö<strong>ch</strong>ter s<strong>ch</strong>enken wird. Als Blarers Famulus lernt<br />
der junge Funcklin die Fü<strong>hr</strong>er der s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>-oberdeuts<strong>ch</strong>en Reformation<br />
persönli<strong>ch</strong> kennen. Weiterhin unterhält er die in Isny begründete<br />
Privatburse für die zahlrei<strong>ch</strong>en jungen Söhne der Familien Blarer und<br />
Zwick. Im November 1542 avanciert er zum vierten der neun Konstanzer<br />
Stadtpfarrer, an deren Spitze Ambrosius Blarer stand. Na<strong>ch</strong> der Katastrophe<br />
von 1548 findet Funcklin mit Familie und S<strong>ch</strong>ützlingen Zuflu<strong>ch</strong>t in<br />
St. Gallen. Au<strong>ch</strong> das Pfarramt Tägerwilen, das er seit Frühja<strong>hr</strong> 1549 versieht,<br />
erweist si<strong>ch</strong> als Dur<strong>ch</strong>gangsstation auf dem Weg in den zweiten<br />
Lebensabs<strong>ch</strong>nitt. In den ersten Tagen des Ja<strong>hr</strong>es 1550 errei<strong>ch</strong>t ihn aus<br />
Biel am Jura die Einladung zur Präsentation. Der Lokalc<strong>hr</strong>onist Re<strong>ch</strong>berger<br />
notiert:<br />
Ist also har komen her Jacob Fünklÿ, bürtig von Costentz, für einen predicanten<br />
angnomen vff dem 7. tag Jenners; mornendes sin erstÿ predig gethon. 48<br />
Die seit Konstanz sistierten literaris<strong>ch</strong>en Aktivitäten hat Funcklin trotz<br />
zunehmender Amtsbürden als Pfarrer, Chorri<strong>ch</strong>ter und S<strong>ch</strong>ulherr se<strong>hr</strong><br />
bald wieder aufgenommen. Im August 1550 bringt er zusammen mit<br />
Bieler Bürgern seine Tragœdi von dem Ry<strong>ch</strong>en Mann vnd armen Lazaro<br />
zur Auffü<strong>hr</strong>ung. Dem gemeindekate<strong>ch</strong>etis<strong>ch</strong> motivierten Primeur sollten<br />
si<strong>ch</strong> bis März 1565 ni<strong>ch</strong>t weniger als 16 weitere aktenkundige Inszenierungen<br />
ans<strong>ch</strong>liessen. Seit Ende August 1551 mit dem geistli<strong>ch</strong>en Nä<strong>hr</strong>vater<br />
Ambrosius Blarer wiedervereint, der auf Ersu<strong>ch</strong>en und Betreiben<br />
47<br />
48<br />
Vgl. neuerdings Max S<strong>ch</strong>iendorfer: Die Bühne als Kanzel. Der Bieler Prädikant<br />
und Dramatiker Jakob Funcklin (1522/23–1565), in: Nova Acta Paracelsica NF<br />
22/23 (2008/09), 151–174 (Lit.). Herr Prof. Dr. Max S<strong>ch</strong>iendorfer gewä<strong>hr</strong>te mir zudem<br />
freien Einblick in den umfangrei<strong>ch</strong>en biografis<strong>ch</strong>en Teil seiner in Entstehung<br />
begriffenen Gesamtausgabe der Werke Funcklins, wofür i<strong>ch</strong> ihm se<strong>hr</strong> herzli<strong>ch</strong> danke.<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene willkommene Materialien zu Funcklin überliess mir in verdankenswerter<br />
Weise Frau Dr. Margrit Wick-Werder, Biel.<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 76.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 77<br />
der Bieler Obrigkeit die zweite Praedikatur versieht, 49 wä<strong>hr</strong>end Funcklin<br />
das Dekanat übertragen wird, errei<strong>ch</strong>t das na<strong>ch</strong> Konstanzer Vorbild reorganisierte<br />
c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>e Gemeinwesen am Südfuss des Jura in geistiger<br />
Verbindung mit Calvin und regem Austaus<strong>ch</strong> mit den bena<strong>ch</strong>barten Kollegen<br />
Farel, Viret und Beza seine hohe reformatoris<strong>ch</strong>e Blüte. Alten<br />
Konstanzer Geist atmen namentli<strong>ch</strong> die von Bullinger und Haller glei<strong>ch</strong>ermassen<br />
getadelte Zu<strong>ch</strong>tordnung von 1552 sowie der auf der Grundlage<br />
des erweiterten Konstanzer Nüw gesangbü<strong>ch</strong>le 1540 und einiger erst<br />
in den 1560er Ja<strong>hr</strong>en publizierter geistli<strong>ch</strong>er Lieder Funcklins eingefü<strong>hr</strong>te<br />
Gemeindegesang.<br />
Na<strong>ch</strong> Blarers Weggang Ende August 1559 beteiligt si<strong>ch</strong> Funcklin<br />
als federfü<strong>hr</strong>ender (Co-) Autor der revidierten Chor- und Ehegeri<strong>ch</strong>tssatzung<br />
1559/60, der Synodalstatuten 1562 und der S<strong>ch</strong>ulordnung 1564/65.<br />
Seit Herbst 1559 verwitwet, vermählt er si<strong>ch</strong> im Sommer 1560 mit Anna<br />
Jeger, der i<strong>hr</strong>erseits verwitweten S<strong>ch</strong>wester des angesehenen Bieler Ratsherrn<br />
Heinri<strong>ch</strong> Jeger, die zwei Tö<strong>ch</strong>ter in die Ehe bringt. Anfang 1564<br />
errei<strong>ch</strong>en die Spitzen des besonders aggressiven Pestzuges, der s<strong>ch</strong>on<br />
1563 aus dem Elsass und der Lombardei in die S<strong>ch</strong>weiz vorgedrungen<br />
war, au<strong>ch</strong> Biel. 50 Dem C<strong>hr</strong>onisten Re<strong>ch</strong>berger zufolge sterben hier bis<br />
Mitte 1566 insgesamt 640 Personen, unter ihnen am 3. November 1565<br />
au<strong>ch</strong> der «wolgelertt herr Jacob Fünckly» 51 .<br />
3.3. Konrad Zwick (1500–1557)<br />
Anders als sein jüngerer und bekannterer Bruder Johannes hat Konrad<br />
Zwick bisher no<strong>ch</strong> keinen Biografen gefunden. 52 Na<strong>ch</strong> Studien in Freiburg<br />
(«medicus») und Bologna (stud. iur.), 1525 Grossrat, 1526–1548<br />
Kleinrat. Von Beruf Kaufmann, mit Beteiligung an vers<strong>ch</strong>iedenen Han-<br />
49<br />
50<br />
51<br />
52<br />
Vgl. Rudolf Pfister: Ambrosius Blarer in der S<strong>ch</strong>weiz 1548–1564, in: Der Konstanzer<br />
Reformator Ambrosius Blarer 1492–1564. Gedenksc<strong>hr</strong>ift zu seinem 400.<br />
Todestag, hg. v. Bernd Moeller, Konstanz u. a. 1964, 205–227 (revisionsbedürftig).<br />
Markus Mattmüller: Bevölkerungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der S<strong>ch</strong>weiz, 2 Bde., Basel 1987, Bd.<br />
1, 228–236 (Lit.).<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 147f.<br />
Vgl. Bernd Moeller: Johannes Zwick und die Reformation in Konstanz, Gütersloh<br />
1961 (QFRG 28) (Lit.); Jörg Vögeli (Hg.): Sc<strong>hr</strong>iften zur Reformation in Konstanz<br />
1519–1538, 3 Bde., Tübingen u. a. 1972–1973 (SKRG 39–41), Bd. 2/2, 1222–1224<br />
(biografis<strong>ch</strong>e Skizze).
78<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
delsgesells<strong>ch</strong>aften (Abb. 5), verheiratet mit Amalia Muntprat, me<strong>hr</strong>ere<br />
Söhne. Neben seinem Vetter («consobrinus»), dem Bürgermeister und<br />
Rei<strong>ch</strong>svogt Thomas Blarer, fü<strong>hr</strong>ender Aussenpolitiker und Gesandter des<br />
reformatoris<strong>ch</strong>en Konstanz von zuweilen prophetis<strong>ch</strong>-herbem Ton. Innenpolitis<strong>ch</strong><br />
profiliert si<strong>ch</strong> Konrad Zwick vor allem dur<strong>ch</strong> die Erarbeitung<br />
und Dur<strong>ch</strong>setzung der Konstanzer Zu<strong>ch</strong>tordnung 1531. 53<br />
Na<strong>ch</strong> dem Fall von Konstanz findet Konrad Zwick seit Spätherbst<br />
1548 Zuflu<strong>ch</strong>t auf dem Landgut Ro<strong>hr</strong> bei Fällanden in der Vogtei Greifensee.<br />
Unter die «perpetuo conscripti» gezählt und zur Maximalbusse<br />
von 1’000 Gulden unter Bes<strong>ch</strong>lagnahme der Güter verurteilt, beginnt für<br />
die exilierten Vettern Blarer und Zwick eine s<strong>ch</strong>wierige Zeit der ökonomis<strong>ch</strong>en<br />
Unsi<strong>ch</strong>erheit, 54 obs<strong>ch</strong>on es an s<strong>ch</strong>önen Beweisen der Solidarität<br />
ni<strong>ch</strong>t fehlt:<br />
Kann i<strong>ch</strong> Deinem Bruder, der fast sein ganzes Vermögen verloren haben soll, oder<br />
Zwick dienen, so mögen sie über mi<strong>ch</strong> gebieten, 55<br />
sc<strong>hr</strong>eibt der Freund aller Exulanten, Heinri<strong>ch</strong> Bullinger, an Ambrosius<br />
Blarer. No<strong>ch</strong> 1557 erinnert Thomas Blarer den Bruder an die symbiotis<strong>ch</strong>e<br />
Gemeins<strong>ch</strong>aft mit Konrad Zwick und an das anspru<strong>ch</strong>svolle Ethos,<br />
das beide im Dienst am c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>en Gemeinwesen beseelte:<br />
Diese strenge Gesinnung veranlaßte mi<strong>ch</strong>, mit dem Genossen in der Leitung des<br />
Staatswesens au<strong>ch</strong> in Privatsa<strong>ch</strong>en zusammenzugehen, und hat mi<strong>ch</strong> in S<strong>ch</strong>aden<br />
gestürzt, besonders dur<strong>ch</strong> die Verbindung mit Hatzenberg, die er ausgesonnen hatte,<br />
damit wir uns der c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>en Gestaltung der Stadt widmen und die Sorge für<br />
das Vermögen andern übertragen könnten, deren Treue glei<strong>ch</strong>en Gewinn verspra<strong>ch</strong>,<br />
wie i<strong>hr</strong> Trug S<strong>ch</strong>aden bra<strong>ch</strong>te: Bernbecius und Holzeius meine i<strong>ch</strong>; […] So hängt<br />
no<strong>ch</strong> ein großer Teil meines Besitzes von Zwicks Erfolg ab. 56<br />
Im Rahmen unserer Untersu<strong>ch</strong>ung muss dieser Briefabs<strong>ch</strong>nitt genügen,<br />
um die makroökonomis<strong>ch</strong>e Situation zu illustrieren, in der si<strong>ch</strong> die meisten<br />
oberdeuts<strong>ch</strong>en Handelshäuser unter den Bedingungen des Frühkapi-<br />
53<br />
54<br />
55<br />
56<br />
Fritz Hauss: Zu<strong>ch</strong>tordnung der Stadt Konstanz 1531, La<strong>hr</strong> 1931.<br />
Davon zeugen um die 180 Abs<strong>ch</strong>nitte im Blarer-Briefwe<strong>ch</strong>sel zwis<strong>ch</strong>en Herbst<br />
1548 (Blarer BW 2, Nr. 1582) und Frühja<strong>hr</strong> 1566 (Blarer BW 3, Nr. 2655).<br />
Blarer BW 3, Nr. 1582 (H. Bullinger an A. Blarer, 20. Oktober 1548).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2090 (T. Blarer an A. Blarer, 4. März 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 79<br />
talismus befanden: 57 a) Übli<strong>ch</strong> war die Kapitalbes<strong>ch</strong>affung vorzugsweise<br />
im Kreis von Familienangehörigen, Freunden und Mitarbeitern des Unternehmens.<br />
b) Allenthalben ging die markante Zunahme der Kreditvolumina<br />
mit einer von überhöhten Agrar- und Landpreisen mit verursa<strong>ch</strong>ter<br />
Inflation einher. c) Das sol<strong>ch</strong>ermassen angeheizte Klima des Wu<strong>ch</strong>ers<br />
und der hektis<strong>ch</strong>en Spekulation verleitete viele zu unrealistis<strong>ch</strong>en Hoffnungen<br />
und unbeda<strong>ch</strong>ten Geldanlagen.<br />
Im letzten Lebensdrittel befasste si<strong>ch</strong> Konrad Zwick beharrli<strong>ch</strong><br />
und verbissen mit einer «kriegskunst» und einer «holtzsparkunst», was<br />
zum «phantastis<strong>ch</strong>en Kopf» 58 und zur zeitweiligen Melan<strong>ch</strong>olie, 59 von<br />
der die Freunde wussten, zu passen s<strong>ch</strong>eint. Was anfängli<strong>ch</strong> den Ans<strong>ch</strong>ein<br />
der «Liebhaberei» 60 hatte, konnte unter gewandelten Bedingungen<br />
dur<strong>ch</strong>aus zum ernsthaften Einsatz kommen: die Kriegskunst im S<strong>ch</strong>malkaldis<strong>ch</strong>en<br />
Krieg (1546/48) bei der gegebenenfalls notwendigen militäris<strong>ch</strong>en<br />
Verteidigung des Reformationswerks, die Holzsparkunst im Exil<br />
zur Aufbesserung der familiären Finanzen.<br />
Bei den Täufern soll Konrad Zwick zuletzt «seine spirituelle Heimat»<br />
gefunden haben. 61 No<strong>ch</strong> bevor er seine Erfindungen finanziell ver-<br />
57<br />
58<br />
59<br />
60<br />
61<br />
Vgl. Otto Sigg: Konkurs und Wu<strong>ch</strong>er in der Stadt und Lands<strong>ch</strong>aft Züri<strong>ch</strong> um 1570.<br />
Zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Frühkapitalismus, in: Zür<strong>ch</strong>er Tas<strong>ch</strong>enbu<strong>ch</strong> NF 102 (1982),<br />
13–25; Wolfgang Reinhard: Oligar<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e Verfle<strong>ch</strong>tung und Konfession in oberdeuts<strong>ch</strong>en<br />
Städten, in: Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, hg. v. Antoni<br />
Maczak, Mün<strong>ch</strong>en 1988, 47–62; Franz Mathis: Die deuts<strong>ch</strong>e Wirts<strong>ch</strong>aft im 16.<br />
Ja<strong>hr</strong>hundert, Mün<strong>ch</strong>en 1992; Mark Häberlein: Brüder, Freunde und Betrüger. Soziale<br />
Beziehungen, Normen und Konflikte in der Augsburger Kaufmanns<strong>ch</strong>aft um<br />
die Mitte des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts, Berlin 1998; Mi<strong>ch</strong>ael North: Kommunikation, Handel,<br />
Geld und Banken in der Frühen Neuzeit, Mün<strong>ch</strong>en 2000.<br />
Moeller, Zwick (wie Anm. 52), 13. Ein ni<strong>ch</strong>t namentli<strong>ch</strong> genannter Sohn Konrad<br />
Zwicks hatte visionäre Anwandlungen, vgl. Blarer BW 3, Nrn. 1723, 1729.<br />
Blarer BW 3, 2001 (J. Jung an A. Blarer, 8. Juli 1555).<br />
Vögeli, Sc<strong>hr</strong>iften (wie Anm. 52), 1224.<br />
Ohne Beleg: Paul Gerhard Aring: Art. Zwick, Konrad, in: BBKL 14 (1998), 671f.;<br />
vgl. Johannes Ficker: Das Konstanzer Bekenntnis für den Rei<strong>ch</strong>stag zu Augsburg<br />
1530, in: Theologis<strong>ch</strong>e Abhandlungen (FG Julius Holtzmann), Tübingen u. a.<br />
1902, 243–297, 275. Wi<strong>ch</strong>tigster Beleg: Blarer BW 3, Nr. 1948 (A. Blarer an T.<br />
Blarer, 5. November 1554): «Doleo supra modum illius vicem, cum audiam doctis<br />
nonnullis ac praestantissimis viris anabaptistam nunc et nescio quem fanaticum<br />
hominem videri […]. C<strong>hr</strong>istus fü<strong>hr</strong>e ihn zurück!» Übrigens sympathisierten die mit<br />
den Zwick und den Blarer ges<strong>ch</strong>äftli<strong>ch</strong> liierten Peter S<strong>ch</strong>er d. J., Klaus von Grafeneck<br />
(Verfasser von Ayn newes wunderbarli<strong>ch</strong>s ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>t von Mi<strong>ch</strong>el Sattler z Rottenburg<br />
am Necker, Nürnberg 1527), Johann Winther von Anderna<strong>ch</strong> und Mi<strong>ch</strong>ael
80<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
werten konnte, ist er am 6. Februar 1557 na<strong>ch</strong> kurzer Krankheit gestorben.<br />
62 Vom ehemaligen Mentor Jakob Funcklin und den Brüdern Blarer<br />
tatkräftig unterstützt, übernahm der älteste (?) Sohn Jakob Zwick 63 von<br />
seinem Vater einen S<strong>ch</strong>uldenberg und die Verantwortung für Mutter<br />
Amalia und die Ges<strong>ch</strong>wister.<br />
4. Konrad Zwicks Erfindungen<br />
4.1. Kriegskunst<br />
Die Begriffsinkonsistenz ma<strong>ch</strong>t es s<strong>ch</strong>wierig, die von Konrad Zwick Anfang<br />
der 1540er Ja<strong>hr</strong>e entwickelte Kriegskunst (Abb. 5 und 7) näher zu<br />
bestimmen. Wä<strong>hr</strong>end kriegskunst (ars bellica) die strategis<strong>ch</strong>e Fähigkeit<br />
meint, 64 weisen die in den Quellen vorkommenden Termini kriegswerkzeug,<br />
kriegstück, kriegsrüstung in die Ri<strong>ch</strong>tung einer Kriegsmas<strong>ch</strong>ine 65<br />
im Sinne von «Ges<strong>ch</strong>ütz und Feuerro<strong>hr</strong>» 66 . Seitdem die Artillerie bei<br />
Agnadello 1509 erstmals zum offensiven Einsatz gekommen war und in<br />
den ans<strong>ch</strong>liessenden oberitalienis<strong>ch</strong>en Kriegen i<strong>hr</strong> kriegsents<strong>ch</strong>eidendes<br />
62<br />
63<br />
64<br />
65<br />
66<br />
Toxites mit S<strong>ch</strong>wenckfeld. Vgl. Caroline Grits<strong>ch</strong>ke: «Via Media». Spiritualistis<strong>ch</strong>e<br />
Lebenswelten und Konfessionalisierung. Das süddeuts<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>wenckfeldertum im<br />
16. und 17. Ja<strong>hr</strong>hundert, Berlin 2006 (Reg.).<br />
Vögeli, Sc<strong>hr</strong>iften (wie Anm. 52), 1224 (Gregor Mangolt), vgl. Blarer BW 3, Nrn.<br />
2086, 2088.<br />
Nur wenig ist über ihn bekannt: Seit Mai 1559? (vgl. Blarer BW 3, Nr. 2353, 17.<br />
Mai 1559) Pfleger des soeben säkularisierten Klosters Zimmern bei Nördlingen,<br />
1564 Konsistorialrat. Vgl. Reinhold Herold: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Reformation in der<br />
Grafs<strong>ch</strong>aft Oettingen 1522–1569, Halle 1902, 64.<br />
DWb 11, 2279; Georg Karl Friedri<strong>ch</strong> Viktor von Alten (Hg.): Handbu<strong>ch</strong> für Heer<br />
und Flotte. Enzyklopädie der Kriegswissens<strong>ch</strong>aften und verwandter Gebiete, 6<br />
Bde., Berlin 1911–1914, Bd. 5, 602.<br />
DWb 11, 2279: kriegskünstler (ma<strong>ch</strong>inator bellicus).<br />
Friedri<strong>ch</strong> Kü<strong>ch</strong> (Hg.): Politis<strong>ch</strong>es Ar<strong>ch</strong>iv des Landgrafen Philipp des Großmütigen<br />
von Hessen, 4 Bde., Leipzig u. a. 1904–1959, Bd. 1, Nr. 892 (K. Zwick an Ldgf.<br />
Ph. v. Hessen, Februar 1546 / Januar 1547): «Seltsame Ges<strong>ch</strong>ütze und Feuerro<strong>hr</strong>e.<br />
Erfindung eines Kriegswerkzeugs».
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 81<br />
Potential geoffenbart hatte, 67 war das Interesse der Erfinder und der Potentaten<br />
an optimierten Ges<strong>ch</strong>ützen gestiegen, 68 im Falle Zwicks dasjenige<br />
Philipps von Hessen und Ferdinands von Österrei<strong>ch</strong>. Der beharrli<strong>ch</strong>en<br />
Überzeugungsarbeit Ambrosius Blarers und Heinri<strong>ch</strong> Bullingers in<br />
den Ja<strong>hr</strong>en 1544/45 ist es letztli<strong>ch</strong> zu verdanken, dass der Erfinder Geheimhaltung<br />
verspra<strong>ch</strong> und si<strong>ch</strong> bereit erklärte, sein «kriegstück» lieber<br />
den Evangelis<strong>ch</strong>en – die Rede ist von Züri<strong>ch</strong>, Konstanz, den «Eidgenossen»,<br />
von «Deuts<strong>ch</strong>land» – für den ni<strong>ch</strong>t unwa<strong>hr</strong>s<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong>en Fall defensiver<br />
Handlungen zur Verfügung zu stellen. 69 Wä<strong>hr</strong>end des S<strong>ch</strong>malkaldis<strong>ch</strong>en<br />
Krieges verhandelte Zwick erneut mit dem Landgrafen von<br />
Hessen, 1547/48 au<strong>ch</strong> mit dem Stellvertreter Sebastian S<strong>ch</strong>ertlins, Marcell<br />
Dietri<strong>ch</strong> von S<strong>ch</strong>anckwitz, der ebenfalls eine Kriegsmas<strong>ch</strong>ine erfunden<br />
haben soll. 70<br />
Abb. 7: Gegen feindli<strong>ch</strong>e Kavallerie geri<strong>ch</strong>tete grosskalibrige Ges<strong>ch</strong>ütze,<br />
Holzs<strong>ch</strong>nitt um 1540. 71<br />
67<br />
68<br />
69<br />
70<br />
71<br />
Vgl. Bernd von Guseck: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Kriegskunst für Militairakademien und<br />
Offiziere aller Grade, 3. Aufl., Berlin 1867, 101; Hans Delbrück: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der<br />
Kriegskunst im Rahmen der politis<strong>ch</strong>en Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te, 4 Bde., Berlin 1900–1920, Bd.<br />
4, 102–107.<br />
Von Alten, Handbu<strong>ch</strong> (wie Anm. 64), Bd. 4, 190–195, 208 (Lit.).<br />
Vgl. die Dokumente aus dem Zeitraum Januar 1544 bis Juli 1546 in Blarer BW 2,<br />
Nrn. 1057, 1060, 1071f., 1082, 1154f., 1157, 1161f., 1177, 1188, 1193, 1196,<br />
1201, 1207, 1214f., 1217, 1219, 1306.<br />
Blarer BW 2, Nrn. 1464, 1487, 1583, vgl. Alfred Hartmann u. Beat Rudolf Jenny<br />
(Hg.): Die Amerba<strong>ch</strong>korrespondenz, bisher 12 Bde., Basel 1942–1995 (im Folgenden:<br />
Amerba<strong>ch</strong> BW), Bd. 8, 36f.<br />
Abb. aus: Vannoccio Biringuccio: De la Pirote<strong>ch</strong>nia, (1. Ausg. 1540), na<strong>ch</strong> der<br />
französis<strong>ch</strong>en Ausgabe, Paris 1572, 163 v .
82<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
No<strong>ch</strong> zu Lebzeiten s<strong>ch</strong>eint Zwick die «wunderbarli<strong>ch</strong> kriegsrüstung»<br />
dem Pfalzgrafen Ottheinri<strong>ch</strong> verpfändet zu haben. 1557 meldet «der<br />
treffli<strong>ch</strong>e Gönner der Erben, Graf Ludwig [von Oettingen]», sein Interesse<br />
an der Erfindung an, wä<strong>hr</strong>end «Freund F[uncklin] ohne Auftrag in<br />
Bern und Züri<strong>ch</strong>» verhandelt. 72 1558 ersu<strong>ch</strong>t Klaus von Grafeneck, der<br />
Amtmann des Grafen von Oettingen, Herzog C<strong>hr</strong>istoph von Württemberg<br />
um Vermittlung beim Verkauf seines kriegsstücks um 20’000 Kronen<br />
an König Philipp. 73 Spätestens 1576 s<strong>ch</strong>eint die Höllenmas<strong>ch</strong>ine<br />
wieder in Zwick’s<strong>ch</strong>en Familienbesitz zurück geke<strong>hr</strong>t zu sein, da si<strong>ch</strong><br />
Jakob Zwick bei der Supplikation um Verlängerung des Holzsparkunst-<br />
Rei<strong>ch</strong>spatentes von 1557 auf die jüngst stattgefundene «allerunderthenigste<br />
eroffnung aines gehaimen kriegsstuckhs» bezieht. 74<br />
4.2. Die Holzsparkunst von Frommer & Zwick<br />
Im Folgenden beziehen si<strong>ch</strong> die [Nummern] in eckigen Klammern auf den Überblick<br />
«Verbreitung der Holzsparkunst von Frommer & Zwick 1554–1576» (Tab.2).<br />
4.2.1. Die Väter<br />
[1] Konrad Zwicks wenig erfolgrei<strong>ch</strong>e Versu<strong>ch</strong>e mit «seiner neuen Erfindung<br />
wegen des Holzes» bes<strong>ch</strong>äftigen die Gebrüder Blarer erstmals<br />
im November 1554. 75 Da es si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> bei diesem «novum inventum»<br />
vermutli<strong>ch</strong> eher um eine handwerkli<strong>ch</strong>-empiris<strong>ch</strong>e Optimierung bekannter<br />
Prinzipien und vorhandener Konstruktionen als um eine e<strong>ch</strong>te Basisinnovation<br />
handelt, stellt si<strong>ch</strong> die Frage na<strong>ch</strong> mögli<strong>ch</strong>en inspirierenden<br />
Vorlagen. Aktenkundiger Primeur ist die holzsparende Biersiedepfanne<br />
72<br />
73<br />
74<br />
75<br />
Blarer BW 2, Nr. 2104 (T. Blarer an A. Blarer, ca. Mitte August 1557).<br />
Vgl. Viktor Ernst (Hg.): Briefwe<strong>ch</strong>sel des Herzogs C<strong>hr</strong>istoph von Wirtemberg, 4<br />
Bde., Stuttgart 1899–1907 (im Folgenden: BW Wirtemberg), Bd. 4, Nr. 418 (Anm.<br />
2).<br />
OeStA/HHStA/RHR, Grat Feud Gewerbe-, Fabriks- und Handlungsprivilegien 11–<br />
59, 611f. (vor dem 17. August 1576).<br />
Blarer BW 3, Nrn. 1948 (A. Blarer an T. Blarer, 5. November 1554), 2001 (J. Jung<br />
an A. Blarer, 8. Juli 1555).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 83<br />
des Conrad von Gittelt, für die er 1550 eine böhmis<strong>ch</strong>e, 1551 eine kaiserli<strong>ch</strong>e<br />
und 1552 eine sä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>e Freiheit erlangt hatte. 76<br />
Tab. 2: «Verbreitung der Holzsparkunst von Frommer & Zwick 1554–1576».<br />
76<br />
Creutz, Herausbildung (wie Anm. 8), 98f. Zu den Anfängen der Holzsparkunst in<br />
der Antike vgl. K[arl] A[ugust] Böttiger: Zur Holzsparkunst der alten Römer, in:<br />
Der neue Teuts<strong>ch</strong>e Merkur 2 (1794), 283–305.
84<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Eine hohe Übereinstimmung in theoretis<strong>ch</strong>er wie in praktis<strong>ch</strong>er Hinsi<strong>ch</strong>t<br />
weisen die 1556/57 optimierten Zwick’s<strong>ch</strong>en Sparöfen mit den Darlegungen<br />
des genialen Girolamo Cardano (1501–1576) auf. In De subtilitate<br />
libri XXI, 1. Aufl. Nürnberg 1550, hatte der Mailänder Universalgele<strong>hr</strong>te<br />
u. a. eine bisher übersehene revolutionäre Flammentheorie entwickelt,<br />
die im Unters<strong>ch</strong>ied zu der no<strong>ch</strong> im späten 18. Ja<strong>hr</strong>hundert im<br />
S<strong>ch</strong>wange gehenden Phlogistonle<strong>hr</strong>e die Anwesenheit von Luft als Voraussetzung<br />
für jegli<strong>ch</strong>en Verbrennungsvorgang postulierte und die Entstehung<br />
gasförmiger Verbrennungsprodukte besc<strong>hr</strong>ieb. 77 Im Folgewerk<br />
De rerum varietate libri XVII, 1. Aufl. Basel 1557, besc<strong>hr</strong>ieb Cardano<br />
sodann einen von der Te<strong>ch</strong>nikges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te ni<strong>ch</strong>t weniger verna<strong>ch</strong>lässigten<br />
gemauerten Ko<strong>ch</strong>herd mit Rost und As<strong>ch</strong>enfall und aufliegender kupferner<br />
Ofenplatte mit versenkten Kasserollen, wie er gegenwärtig in Mailand<br />
in Gebrau<strong>ch</strong> sei:<br />
Clibanus ad coquendum multa, simul utilis, nunc in usu Mediolani, […] quoniam<br />
conclusus ignis, triplo efficaciores vires habet. 78<br />
[2] Na<strong>ch</strong> viermonatiger Abwesenheit 79 kann Konrad Zwick den Vettern<br />
Blarer Anfang Juni 1555 einen «verheißungsvollen Anfang seines Glückes»<br />
in Aussi<strong>ch</strong>t stellen 80 – um bereits einen Monat später wieder in<br />
nörgelnde «Grämli<strong>ch</strong>keit» zu verfallen, was die Freunde befür<strong>ch</strong>ten<br />
lässt, «der Erfolg entspre<strong>ch</strong>e au<strong>ch</strong> hierin dem Wuns<strong>ch</strong> und Aufwand<br />
ni<strong>ch</strong>t» 81 . Was war ges<strong>ch</strong>ehen? Die spärli<strong>ch</strong>en Quellen lassen die Annahme<br />
zu, Zwick habe in eben diesen Tagen von einem ernstzunehmenden<br />
Konkurrenten in Strassburg erfa<strong>hr</strong>en. Dort nämli<strong>ch</strong> hatte der Magistrat<br />
am 29. Juni 1555 dem Bürger Friedri<strong>ch</strong> Frommer bestätigt, dieser habe<br />
auß sonnderer verlyhung unnd genad deß Allme<strong>ch</strong>tigen newli<strong>ch</strong> ein slli<strong>ch</strong> kunst erfunden,<br />
das inn einheitzung der stuben und ko<strong>ch</strong>en ungeverli<strong>ch</strong> der halb theyl holtz<br />
77<br />
78<br />
79<br />
80<br />
81<br />
«Est enim flamma nihil aliud, quam aër accensus», Hieronymus Cardanus: De<br />
subtilitate Libri XXI, Lyon 1559, 51f.<br />
Hieronymus Cardanus: De rerum varietate Libri XVII, Basel 1557, 663. Vgl. hierzu<br />
Abb. 13 unten.<br />
Blarer BW 3, Nrn. 1960, 1970, 1980.<br />
Blarer BW 3, Nr. 1994 (A. Blarer an T. Blarer, 5. Juni 1555).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2001 (J. Jung an A. Blarer, 8. Juni 1555).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 85<br />
[…] erspart […] werden […] mag […] vnd also zgli<strong>ch</strong> rÿ<strong>ch</strong>en vnnd armen zgebru<strong>ch</strong>en<br />
seer nutzli<strong>ch</strong>. 82<br />
Aufgrund widersprü<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>er Aussagen muss die Frage na<strong>ch</strong> dem «primus<br />
inventor et ar<strong>ch</strong>itectus» offen bleiben. Für seine Freunde und Bekannten<br />
kam diese E<strong>hr</strong>e selbstverständli<strong>ch</strong> Konrad Zwick zu. 83 Differenzierter<br />
stellt Ambrosius Blarer den Sa<strong>ch</strong>verhalt dar. Calvin gegenüber<br />
rühmt er im Dezember 1556 «das erstaunli<strong>ch</strong>e und hö<strong>ch</strong>st zuverlässige<br />
Verfa<strong>hr</strong>en [ratio], das von meinem Vetter Konrad Zwick und einigen<br />
andern [paucis aliis] erfunden worden ist.» 84<br />
Über die Identität der «pauci alii» geben jene Bes<strong>ch</strong>eid, die zu diesen<br />
oder zu weiteren Akteuren der neuen Te<strong>ch</strong>nologie in Beziehung stehen.<br />
So kennt der mit Ambrosius Blarer und Funcklin vertraute Bieler<br />
C<strong>hr</strong>onist Re<strong>ch</strong>berger drei glei<strong>ch</strong>zeitige Väter der «nüwen holtzersparungskunst»:<br />
«Erstli<strong>ch</strong> ist sy erfunden worden dur<strong>ch</strong> die wolerfarnen und<br />
gelerten herren Frydri<strong>ch</strong> Frömer, burger zu Straßburg, Cunrad Zwyck jm<br />
Ror, jm Züri<strong>ch</strong>erbiett gelegen, vnd Hans Vlri<strong>ch</strong> Kündigman, burger jn<br />
Costantz.» 85<br />
Wiederum anders der mit Kundigmann bekannte Konstanzer C<strong>hr</strong>onist<br />
C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß. Dieser bringt Re<strong>ch</strong>bergers Namen in eine<br />
zeitli<strong>ch</strong>e Abfolge und stellt die Wiege der Holzsparkunst unmissverständli<strong>ch</strong><br />
na<strong>ch</strong> Strassburg. Zudem weiss er von «anderen», die die Erfindung<br />
optimiert und vertrieben haben:<br />
Dise kunst hat erstli<strong>ch</strong> erda<strong>ch</strong>t M. Fridri<strong>ch</strong> [Lakune; gemeint ist Friedri<strong>ch</strong> Frommer],<br />
tis<strong>ch</strong>ma<strong>ch</strong>er zu Strasburg, darna<strong>ch</strong> hat ou<strong>ch</strong> Conrat Zwick, sesshafft im Ror<br />
in Züri<strong>ch</strong>biett, vnd Hans Vlri<strong>ch</strong> Kundigmann, stürsc<strong>hr</strong>iber hie, vnd andere söl<strong>ch</strong>s<br />
verbessert vnd volgend in das werck gebra<strong>ch</strong>t. 86<br />
4.2.2. Anfänge des Konsortiums Frommer & Zwick<br />
[3] Mit der Absi<strong>ch</strong>t, die obrigkeitli<strong>ch</strong> beglaubigte Erfindung grossräumiger<br />
zu verwerten, hatte Frommer bereits im Sommer 1555 einen Antrag<br />
82<br />
83<br />
84<br />
85<br />
86<br />
ZBZH Ms. S 89, 94 (29. Juni 1555); Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 91 (s. d. =<br />
vor 16. Mai 1556).<br />
So M. Toxites (StAZH E II 345, 421), J. Jung (Blarer BW 3, Nr. 2001), W. Musculus<br />
(StAZH E II 359, 2960).<br />
CO 15, Nr. 2559 (12. Dezember 1556) = Blarer BW 3, Nr. 2079 (lat.).<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 111.<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen (wie Anm. 19), 39.
86<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
(«supplication») auf ein Rei<strong>ch</strong>spatent gestellt. Das dur<strong>ch</strong> den Rei<strong>ch</strong>stag<br />
zu Augsburg (5.2.–25.9.1555) huldvoll entgegengenommene Gesu<strong>ch</strong><br />
musste jedo<strong>ch</strong> wegen ges<strong>ch</strong>äftli<strong>ch</strong>er Überlastung auf den nä<strong>ch</strong>sten<br />
Rei<strong>ch</strong>stag vers<strong>ch</strong>oben werden. 87 Die Frommer auferlegte Wartezeit gab<br />
Konrad Zwick Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit dem Konkurrenten.<br />
Vermutli<strong>ch</strong> kam es zu dem von S<strong>ch</strong>ulthaiß angedeuteten Te<strong>ch</strong>nologieabglei<strong>ch</strong>,<br />
mit Si<strong>ch</strong>erheit zur Gesells<strong>ch</strong>aftsgründung. Mitte Mai 1556<br />
hört man erstmals von ni<strong>ch</strong>t namentli<strong>ch</strong> genannten «verwandten [Teilhabern]<br />
der holtzsparung, so newli<strong>ch</strong> erfunden ist» 88 .<br />
Die Zeit bis zum Rei<strong>ch</strong>stag von Regensburg (13.7.1556–16.3.1557)<br />
nutzt das Konsortium zum Anti<strong>ch</strong>ambrieren und Lobbyieren. Dabei verfa<strong>hr</strong>en<br />
die «gesandten [Anwälte] der Konsorten» in den Formen, wie sie<br />
das Patentprüfungsverfa<strong>hr</strong>en vor dem Rei<strong>ch</strong>shofrat vorsieht. 89 Dieses<br />
verlangt a) eine Beglaubigung («transsumt»), dass der Antragsteller im<br />
Besitz des Urheberre<strong>ch</strong>ts sei – hierzu kann Frommers Strassburger<br />
Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief vorgelegt werden. Sodann sind na<strong>ch</strong>zuweisen b) die<br />
Neuheit der Erfindung («neu erfundne khunst deß holtzsparenns»), c) der<br />
gemeine Nutzen («rei<strong>ch</strong>en und armen zum besten») und d) die Praxistaugli<strong>ch</strong>keit<br />
des Objekts bzw. des Verfa<strong>hr</strong>ens. Für die drei ersten anwaltli<strong>ch</strong>en<br />
Aspekte war se<strong>hr</strong> wa<strong>hr</strong>s<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> der ehemalige Diplomat Zwick<br />
zuständig, wä<strong>hr</strong>end der Handwerker Frommer für die Erklärung der<br />
te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Zei<strong>ch</strong>nung und des Modells (Kleine Probe, «visierung») und<br />
für die praktis<strong>ch</strong>e Vorfü<strong>hr</strong>ung (Grosse Probe) besser qualifiziert war.<br />
[4–6] Zuallererst ersu<strong>ch</strong>t das neue Holzsparkonsortium die bekanntermassen<br />
innovationsfreudigen Territorialfürsten C<strong>hr</strong>istoph von Württemberg<br />
90 und den unlängst zum Kurfürsten erhobenen Ottheinri<strong>ch</strong> von<br />
87<br />
88<br />
89<br />
90<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 91, (s. d. = vor 16. Mai 1556); OeStA/HHStA/<br />
RHR, Grat Feud Gewerbe-, Fabriks- und Handlungsprivilegien 11–59, 609 r –610 v ,<br />
613 r (13. März 1557).<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 90f. (Kft. Ottheinri<strong>ch</strong> an Kft. August, 16. Mai<br />
1556). Darauf bezieht si<strong>ch</strong> A. Blarer, wenn er Bullinger gegenüber «die Erfindung<br />
des Vetters C. Z. und der Seinen [et suorum]» erwähnt, CO 15, Nr. 2559 (12. Dezember<br />
1556). «et suorum» steht für den aktienre<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Terminus mitverwandte,<br />
Konsorten, Teilhaber.<br />
Stefan E<strong>hr</strong>enpreis: Kaiserli<strong>ch</strong>e Geri<strong>ch</strong>tsbarkeit und Konfessionskonflikt. Der<br />
Rei<strong>ch</strong>shofrat unter Rudolf II. 1576–1612, Göttingen 2006, 67 (Lit.).<br />
Vgl. Franz Brendle: Dynastie, Rei<strong>ch</strong> und Reformation: Die württembergis<strong>ch</strong>en<br />
Herzöge Ulri<strong>ch</strong> und C<strong>hr</strong>istoph, die Habsburger und Frankrei<strong>ch</strong>, Stuttgart 1998<br />
(Lit.).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 87<br />
der Pfalz 91 um Unterstützung des laufenden Patentantrages bei den<br />
Rei<strong>ch</strong>sständen. Weitere Anträge gehen na<strong>ch</strong> Dresden und Mün<strong>ch</strong>en. In<br />
Stuttgart oder Neuburg sind «proben» der neuen Erfindung vorgesehen.<br />
Dies alles ges<strong>ch</strong>ieht, «na<strong>ch</strong>dem der erfinder [sc. Frommer] ausskhaufft<br />
worden und wir die mittl zu unseren handen gebra<strong>ch</strong>t» 92 . Die Einzelheiten<br />
kennt S<strong>ch</strong>ulthaiß:<br />
Conrat Zwick hat M. Fridri<strong>ch</strong>en mit ainliff [elf] tausend gulden von diser holtz<br />
kunst hingelöst [ausgekauft] vermeinende, dardur<strong>ch</strong> ain vil merers ze vberkummen,<br />
wel<strong>ch</strong>es im aber wit gefelt, denn söl<strong>ch</strong>e kunst bald in verklainerung kom. 93<br />
Die Usanz, Privilegierungen zu kaufen oder zu pa<strong>ch</strong>ten und sie mit<br />
we<strong>ch</strong>selnden Personen und Namen zu betreiben, 94 erregte indessen die<br />
Ungnade des ebenfalls angefragten Kurfürsten August von Sa<strong>ch</strong>sen:<br />
Daß wir aber denen, so die Holzersparung ni<strong>ch</strong>t erfunden, sondern nur um i<strong>hr</strong>es eigenen<br />
Nutzens willen von dem Erfinder an si<strong>ch</strong> gekauft und damit fast das ganze<br />
Rei<strong>ch</strong> bes<strong>ch</strong>atzen [hier: mit Nutzungsgebü<strong>hr</strong>en belegen] und bes<strong>ch</strong>weren wollen,<br />
zu i<strong>hr</strong>em eigennützigen Vornehmen zehnjä<strong>hr</strong>igen Consens geben sollten, das haben<br />
wir unseres Era<strong>ch</strong>tens billig Bedenken. 95<br />
Wie wenig jedo<strong>ch</strong> die bemerkenswerte Begründung in diesem Falle zutraf,<br />
belegen spätere Abgeltungsverhandlungen der Teilhaber mit dem<br />
dur<strong>ch</strong>aus ges<strong>ch</strong>äftstü<strong>ch</strong>tigen «Erfinder», die darin gipfelten, dass der<br />
Graf von Oettingen Anfang 1560 beim Strassburger Rat intervenieren<br />
musste, damit Frommer ni<strong>ch</strong>t «so vnmilt vnnd vnc<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>» mit den<br />
Zwick verfa<strong>hr</strong>e, und «dasz er bedencken wolle, dasz er dieser kunst nit<br />
91<br />
92<br />
93<br />
94<br />
95<br />
Vgl. Hans Ammeri<strong>ch</strong> (Hg.): Kurfürst Ottheinri<strong>ch</strong> und die humanistis<strong>ch</strong>e Kultur in<br />
der Pfalz, Speyer 2008. Von 1555/56 datieren Hans Kilians Zei<strong>ch</strong>nungen von Ottheinri<strong>ch</strong>s<br />
al<strong>ch</strong>emistis<strong>ch</strong>em Laborinventar, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod.<br />
Pal. germ. 302.<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 91 (Holzspar-Konsorten an Kft. Ottheinri<strong>ch</strong>, vor<br />
16. Mai 1556).<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen (wie Anm. 19), 39.<br />
Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie Anm. 8), 94; Marc Silberstein: Erfindungss<strong>ch</strong>utz<br />
und merkantilistis<strong>ch</strong>e Gewerbeprivilegien, Winterthur 1961, 99.<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 92 (Kft. August an Kft. Ottheinri<strong>ch</strong>, 20. Oktober<br />
1556), vgl. Johannes Falke: Die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Kurfürsten August von Sa<strong>ch</strong>sen in<br />
volkswirths<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Beziehung, Leipzig 1868, 244f.
88<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
wenig genossen» 96 . Der von Thomas Blarer sekundierte Jakob Zwick<br />
errei<strong>ch</strong>te am 14. Januar 1560 für seine finanziell gebeutelte Familie immerhin<br />
soviel, dass Frommer 2’000 Goldgulden in zwei Tran<strong>ch</strong>en rückvergütete.<br />
97<br />
5. … bis na<strong>ch</strong> Rom und Konstantinopel<br />
5.1. «lignariae artis Chananeus»<br />
Am 6. Februar 1557 war Konrad Zwick na<strong>ch</strong> kurzer Krankheit gestorben.<br />
98 Unter der Rubrik «Holzsparkunst» sc<strong>hr</strong>eibt der Berner Dekan Johannes<br />
Haller am 16. Juni 1557 in sein Tagebu<strong>ch</strong>:<br />
I<strong>hr</strong> erster Urheber war Konrad Zwick aus Konstanz, ein ges<strong>ch</strong>ickter und erfinderis<strong>ch</strong>er<br />
Mann. Aber er starb, als man si<strong>ch</strong> ans<strong>ch</strong>ickte, sie bekannt zu ma<strong>ch</strong>en. Seine<br />
Na<strong>ch</strong>folger, von wel<strong>ch</strong>en in den Na<strong>ch</strong>barländern Helvetiens Jakob Funkli, Pfarrer<br />
von Biel, diese Sa<strong>ch</strong>e mit Ges<strong>ch</strong>ick betrieb, verbreiteten die Kunst, na<strong>ch</strong>dem hiezu<br />
von allen Seiten viel Geld aufgebra<strong>ch</strong>t worden war, bis na<strong>ch</strong> Rom und Konstantinopel<br />
und erwirkten viele Privilegien von Kaisern, Königen, Fürsten und Republiken.<br />
99<br />
Mit Dekan Haller in der Sa<strong>ch</strong>e übereinstimmend, notiert Re<strong>ch</strong>berger<br />
zum Ja<strong>hr</strong>esanfang 1557 – Kriterium ist offenbar das in diesem Ja<strong>hr</strong> erteilte<br />
Rei<strong>ch</strong>spatent:<br />
vnd aber des geda<strong>ch</strong>ten Hans Vlri<strong>ch</strong>s Kündigmans re<strong>ch</strong>ter bruder muterhalb, herr<br />
Jacob Fünckelin, vnser predicantt zu Bielln, gemeltÿ holtzersparungskunst jn der<br />
96<br />
97<br />
98<br />
99<br />
Fu<strong>ch</strong>s, Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8), 1109, n. 15a (= Strasbourg, Procès verbaux des<br />
XXI, 1560, 2v°).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2215 (T. Blarer an A. Blarer, 13. Januar 1560). Vgl. au<strong>ch</strong> die<br />
Nrn. 2173, 2207, 2208, 2210, 2214. Die gute Beziehung zu Frommer blieb intakt:<br />
Am 14. August 1560 lässt T. Blarer launig den «zweifa<strong>ch</strong>en Daedalus Friedri<strong>ch</strong><br />
Frommer und Frau» grüssen, Blarer BW 3, Nr. 2269, vgl. Nr. 2380 (26. August<br />
1561).<br />
Blarer BW 3, Nrn. 2086, 2088<br />
Eduard Bähler (Hg.): Das Tagebu<strong>ch</strong> Johannes Hallers aus den Ja<strong>hr</strong>en 1548–1561,<br />
in: AHVKB 23 (1917), 238–355, 275.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 89<br />
Eÿdsgnoßs<strong>ch</strong>afftt, als zu Bernn, zu Lucern, jn den andren vier ortenn, zu Basell, zu<br />
Millhusenn, vnd anders<strong>ch</strong>wo jn der Eÿdsgnoßs<strong>ch</strong>afftt, ou<strong>ch</strong> vßerthalb, als zu Jenff<br />
vßgebra<strong>ch</strong>tt vnd gelernett [gele<strong>hr</strong>t] hat. 100<br />
Bevor wir die dur<strong>ch</strong> zwei voneinander unabhängige Zeitzeugen festgestellte<br />
erstaunli<strong>ch</strong> weiträumige Diffusion der neuen Heiz- und Ko<strong>ch</strong>te<strong>ch</strong>nologie<br />
auf i<strong>hr</strong>en Realitätsgehalt untersu<strong>ch</strong>en, soll die Rolle i<strong>hr</strong>es Hauptagenten<br />
Jakob Funcklin mit wenigen Stri<strong>ch</strong>en angedeutet werden.<br />
Abb. 8: Untersc<strong>hr</strong>ift Jakob Funcklins (StadtA Biel LII 30, 10. März<br />
1558).<br />
Es war auf Ambrosius Blarers ausdrückli<strong>ch</strong>e Bitte hin, dass Funcklin die<br />
Ges<strong>ch</strong>äfte des verstorbenen Konrad Zwick im Dienst und Interesse der<br />
Erbengemeins<strong>ch</strong>aft weiter fü<strong>hr</strong>te. 101 Funcklin besass indessen au<strong>ch</strong> genügend<br />
intrinsis<strong>ch</strong>e Motive für sein selbstloses Handeln, stand er do<strong>ch</strong> zur<br />
Familie, deren Söhne er von 1541 bis mindestens 1550 als Tutor in Isny<br />
wie als Privatle<strong>hr</strong>er in Konstanz, St. Gallen, Tägerwilen und no<strong>ch</strong> in Biel<br />
mit erzogen hatte, in einem nahezu verwandts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Verhältnis. 102<br />
Der erstaunli<strong>ch</strong>e Systemdruck, den Funcklin in nur kurzer Zeit aufbaute,<br />
und seine oftmals überbordenden Ideen und Fähigkeiten erfüllten<br />
die Freunde mit wa<strong>ch</strong>sender Besorgnis:<br />
Au<strong>ch</strong> i<strong>ch</strong> wüns<strong>ch</strong>te, dass ein anderer statt Funklis si<strong>ch</strong> der Zwick annähme; do<strong>ch</strong><br />
treue Verwalter sind selten, und sein Dienst für die Erben des um die c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>e<br />
Gemeins<strong>ch</strong>aft ho<strong>ch</strong>verdienten Mannes ist viel wert. 103<br />
100<br />
101<br />
102<br />
103<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 111f.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2133 (1. März 1558).<br />
Blarer BW 2, Nr. 944; HBBW 12, Nr. 1632 (22. Mai 1542). Funcklins 1546 und<br />
1547 geborenen Tö<strong>ch</strong>tern Anna und Katrina war Amalia Zwick-Muntprat Patin,<br />
vgl. Hans-C<strong>hr</strong>istoph Rublack: Die Einfü<strong>hr</strong>ung der Reformation in Konstanz von<br />
den Anfängen bis zum Abs<strong>ch</strong>luß 1531, Gütersloh u. a. 1971 (QFRG 40), 153.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2119 (A. Blarer an T. Blarer, 28. November 1557).
90<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Im Falle Funcklins ging es ni<strong>ch</strong>t nur um Nebenbes<strong>ch</strong>äftigungen, denen<br />
die meisten zeitgenössis<strong>ch</strong>en Amtsbrüder in unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>em Umfang<br />
na<strong>ch</strong>gingen, 104 sondern in wa<strong>ch</strong>sendem Masse um die grundsätzli<strong>ch</strong>e<br />
Vereinbarkeit von Pfarramt und europaweit angelegtem Salesmanagement<br />
und Nebenerwerb: 105<br />
Wolan, i<strong>ch</strong> wuns<strong>ch</strong> von hertzen, das es alles gerathe z dem pryß Gottes vnd vffbuwung<br />
siner kir<strong>ch</strong>en, vnd das der gt ho<strong>ch</strong>begabet mann ni<strong>ch</strong>ts thu e, das seinem<br />
ampt ubel zymme vnd z ergernusß gerathe. 106<br />
S<strong>ch</strong>on ein flü<strong>ch</strong>tiger Blick auf das Itinerar Funcklins vom Ja<strong>hr</strong> 1557<br />
(Tab. 2) zeigt, wieviel si<strong>ch</strong> der Bieler Dekan und sein Amtsbruder Ambrosius<br />
Blarer die Freundespfli<strong>ch</strong>t gegenüber den Zwick kosten liessen.<br />
Im Januar 1557 sc<strong>hr</strong>eibt Blarer seinem Bruder:<br />
Deine Briefe vom 7. und 30. November habe i<strong>ch</strong> zusammen am 6. Dezember erhalten,<br />
wegen der ständigen Predigten infolge Abwesenheit Funklis und sonstiger Ges<strong>ch</strong>äfte<br />
aber ni<strong>ch</strong>t eher Zeit zur Beantwortung gefunden. 107<br />
104<br />
105<br />
106<br />
107<br />
Eine Studie über die von Theologen und Gemeindepfarrern der Reformationszeit<br />
getriebene Allotria ist ein altes Desiderat. Sie dürfte den Farel-S<strong>ch</strong>üler Antoine de<br />
Froment (1509–1581) ni<strong>ch</strong>t vergessen, der neben dem Pfarramt mit Gewürzen,<br />
Wein und Öl handelte, si<strong>ch</strong> als Steuereinnehmer betätigte und zuletzt den Betrieb<br />
eines Mäd<strong>ch</strong>enpensionats ins Auge fasste, vgl. Henri Vuilleumier: Histoire de<br />
l’église réformée du pays de Vaud sous le régime bernois, 4 Bde., Lausanne 1927–<br />
1933, Bd. 1, 384f. Für das 18.–20. Ja<strong>hr</strong>hundert vgl. ansatzweise Uwe Albre<strong>ch</strong>t:<br />
Himmelrei<strong>ch</strong> auf Erden. Evangelis<strong>ch</strong>e Pfarrer als Naturfors<strong>ch</strong>er und Entdecker,<br />
Stuttgart 2007.<br />
Pfarrer Johannes Mathesius (1504–1565) finanzierte aus dem Erlös einer ergiebigen<br />
Ze<strong>ch</strong>e im böhmis<strong>ch</strong>en Joa<strong>ch</strong>imsthal die dortige Lateins<strong>ch</strong>ulbibliothek, vgl.<br />
Herbert Wolf: Art. Johannes Mathesius, in: NDB 16 (1990), 369f. Der reformierte<br />
Pfarrer Johannes Rhenanus (um 1528–1581) erwarb si<strong>ch</strong> internationalen Ruf als<br />
Sa<strong>ch</strong>verständiger in der Salinente<strong>ch</strong>nik. 1563 experimentierte er mit der Substitution<br />
von Holz- dur<strong>ch</strong> Steinkohle. Sein Wissen legte er 1567–1585 in seiner bislang<br />
ungedruckten 2000-seitigen «Salzbibel» nieder, vgl. Hans Henning Walter: Art. Johannes<br />
Rhenanus, in: ADB 21 (2003), 494f.<br />
Vgl. Blarer BW 3, Nr. 2592 (A. Blarer an Katharina Blarer, 3. März 1564), hier<br />
na<strong>ch</strong> der freundli<strong>ch</strong> überlassenen Transkription ab originali von Herrn Prof. Dr.<br />
Max S<strong>ch</strong>iendorfer.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2084 (A. Blarer an T. Blarer, 18. Januar 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 91<br />
Erstaunli<strong>ch</strong> übrigens au<strong>ch</strong> die Na<strong>ch</strong>si<strong>ch</strong>t des Bieler Rates, musste do<strong>ch</strong><br />
die Gemeinde wä<strong>hr</strong>end Wo<strong>ch</strong>en und Monaten auf die Anwesenheit i<strong>hr</strong>es<br />
Vorstehers verzi<strong>ch</strong>ten. Selten genug liess si<strong>ch</strong> aus der Not eine Tugend<br />
ma<strong>ch</strong>en, etwa, wenn si<strong>ch</strong> die Obrigkeit im Frühja<strong>hr</strong> 1558 eine Ges<strong>ch</strong>äftsreise<br />
Funcklins zu nutze ma<strong>ch</strong>te, um seine diplomatis<strong>ch</strong>en Dienste am<br />
Frankfurter Rei<strong>ch</strong>stag in Anspru<strong>ch</strong> zu nehmen, – was «herrn Jacob»<br />
Gelegenheit gab, no<strong>ch</strong> länger ausser Landes zu bleiben:<br />
Wellendt mir min vsspliben z gt halten, vnd allso früntli<strong>ch</strong> ein zÿtlin no<strong>ch</strong> gedult<br />
haben, dann mir nitt zwÿfelt, so jr, min herren, herna<strong>ch</strong> vff min ankunft wie si<strong>ch</strong> all<br />
mine sa<strong>ch</strong>en zgetragen verstendigt, werden jr ni<strong>ch</strong>ts an mi<strong>ch</strong> zürnen künden, so<br />
bin i<strong>ch</strong> gts willens vnd fürhabens, diss, so i<strong>ch</strong> die zyt versumpt, herna<strong>ch</strong> mitt der<br />
gnad Gottes z eruollen vnd erstatten. 108<br />
In Frankfurt traf Funcklin den Berner Kollegen Haller, der mit der übli<strong>ch</strong>en<br />
kleinen Bosheit na<strong>ch</strong> Züri<strong>ch</strong> rapportierte: «Au<strong>ch</strong> Funcklin war dort,<br />
der Eiferer in der Holzkunst» – «lingnariae [!] artis Chananaeus» 109 .<br />
Funcklins Eifer s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> indessen ni<strong>ch</strong>t auf Verkaufsgesprä<strong>ch</strong>e<br />
und kommentierte Vorfü<strong>hr</strong>ungen besc<strong>hr</strong>änkt zu haben. Letztere wusste<br />
der Dramatiker in ihm allerdings re<strong>ch</strong>t wirkungsvoll zu inszenieren, wie<br />
Haller seinem Tagebu<strong>ch</strong> anvertraut:<br />
Übrigens hatte diese Kunst wirkli<strong>ch</strong> einen gewissen S<strong>ch</strong>ein für si<strong>ch</strong>, namentli<strong>ch</strong>,<br />
wenn man sie mit s<strong>ch</strong>önen Worten, mit kunstvoller Demonstration und Gestikulation<br />
herausstri<strong>ch</strong>. 110<br />
Handwerkli<strong>ch</strong>-te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong> offenbar ni<strong>ch</strong>t weniger begabt, 111 legte Funcklin<br />
anfängli<strong>ch</strong> sogar im operativen Berei<strong>ch</strong> des Unternehmens Hand an. So<br />
war er Anfang 1557 damit bes<strong>ch</strong>äftigt, «Muster der Kunst» anzufertigen,<br />
112 womit ni<strong>ch</strong>t etwa jene verkleinerten Ofenmodelle gemeint waren,<br />
wel<strong>ch</strong>e die Hafner zu Werbezwecken in i<strong>hr</strong>en Werkstätten aufzustellen<br />
108<br />
109<br />
110<br />
111<br />
112<br />
StadtA Biel LII, Nr. 30 (J. Funcklin an den Rat zu Biel, 10. März 1558).<br />
StAZH E II 370, 253 (Johannes Haller an Heinri<strong>ch</strong> Bullinger, 12. April 1558).<br />
Chananeus: «Simon Chananaeus ipse est qui ab alio Evangelista scribitur Zelotes,<br />
Chana quippe zelus interpretatur», Thomas von Aquin: Catena ad Matthaeum 10:4.<br />
Tagebu<strong>ch</strong> J. Haller (wie Anm. 99), 275.<br />
1554 bittet Gerwig Blarer Funcklin um sein Rezept für rote und s<strong>ch</strong>warze Tinte,<br />
Blarer BW 3, Nr. 1923 (9. Mai 1554).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2088 (W. Musculus an A. Blarer, 16. Februar 1557).
92<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
pflegten, 113 sondern um einen regelre<strong>ch</strong>ten Studierzimmerofen, den<br />
Musculus na<strong>ch</strong> Mögli<strong>ch</strong>keit im Pfarrhaus Am Ring Nr. 4 besi<strong>ch</strong>tigen<br />
wollte. 114<br />
5.2. Auf dem Weg zum Rei<strong>ch</strong>spatent<br />
[7] Im Februar 1555 bes<strong>ch</strong>affen si<strong>ch</strong> Jakob Funcklin und Ulri<strong>ch</strong> Kundigmann<br />
eine Konstanzer Aufenthaltsgenehmigung, 115 kurz davor oder<br />
dana<strong>ch</strong> kommt Konrad Zwick na<strong>ch</strong> Biel. 116 Anfang November 1556 reist<br />
Funcklin in Begleitung des einflussrei<strong>ch</strong>en Ratsherrn Heinri<strong>ch</strong> Jeger,<br />
seines späteren S<strong>ch</strong>wagers, über Züri<strong>ch</strong> (Heinri<strong>ch</strong> Bullinger, Thomas<br />
Blarer, Konrad Zwick?), Griesenberg (Barbara von Ulm) wiederum na<strong>ch</strong><br />
Konstanz, wo vermutli<strong>ch</strong> Verhandlungen mit Kundigmann stattfinden. 117<br />
Ende 1556 s<strong>ch</strong>einen si<strong>ch</strong> die massgebli<strong>ch</strong>en Protagonisten der Holzsparkunst<br />
– Agenten wie Aktionäre – gefunden zu haben (vgl. Abb. 5).<br />
[8] Territorialherrli<strong>ch</strong>e Freiheiten zu besitzen, eine sol<strong>ch</strong>e vom prestigeträ<strong>ch</strong>tigen<br />
Stadtstaat Bern zumal, 118 erhöhte die Aussi<strong>ch</strong>t auf ein<br />
Rei<strong>ch</strong>spatent um ein Beträ<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>es. «Vergeßt die Holzkunst ni<strong>ch</strong>t!»,<br />
mahnt der s<strong>ch</strong>on früh eingeweihte Wolfgang Musculus im Oktober 1556<br />
die Freunde in Biel. 119 Am 11. Dezember werden Funcklin und Kundigmann<br />
von einem si<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> gelangweilten Rat empfangen: «I<strong>ch</strong> […] erfu<strong>hr</strong><br />
gestern, daß man das große Gut wenig s<strong>ch</strong>ätzt», verrät Musculus<br />
113<br />
114<br />
115<br />
116<br />
117<br />
118<br />
119<br />
Harald Rosmanitz: Exkurs: Der Ka<strong>ch</strong>elofen und seine Entwicklung bis ins 18.<br />
Ja<strong>hr</strong>hundert, in: 1200 Ja<strong>hr</strong>e Ettlingen. Ar<strong>ch</strong>äologie einer Stadt. Beiheft zur Ausstellung,<br />
Ar<strong>ch</strong>äologis<strong>ch</strong>e Informationen aus Baden-Württemberg 4 (1988), 87–92.<br />
Blarer BW 3, Nr. 289 (W. Musculus an A. Blarer, 2. März 1557). Zu Funcklins<br />
mutmassli<strong>ch</strong>er Adresse vgl. Bourquin, Biel (wie Anm. 30), 333.<br />
Wolfgang Wimmermann: Rekatholisierung, Konfessionalisierung und Ratsregiment,<br />
Sigmaringen 1994, 92, Anm. 135. (2. Februar 1555).<br />
StadtA Biel CCXCI, Bd. 32 (Seckelamtsre<strong>ch</strong>nung 1555), freundli<strong>ch</strong>er Hinweis von<br />
Herrn Prof. Dr. Max S<strong>ch</strong>iendorfer.<br />
Blarer BW 3, Nrn. 2077 (5. November 1556), 2078 (5. November 1556 ); StadtA<br />
Biel CCXCI, Bd. 32, (sub 22./23. Dezember 1556).<br />
Die Holzsparkunst in Bern s<strong>ch</strong>ildert quellenmässig nahezu ers<strong>ch</strong>öpfend Hans Morgenthaler:<br />
Bern und die Holzsparkunst im 16. Ja<strong>hr</strong>hundert, in: AnzSG 18 (1920),<br />
93–105. Zusammenfassend: Martin Stuber: Der Holzsparofen von Jakob Funkli<br />
1556/57, in: Holenstein, Berns mä<strong>ch</strong>tige Zeit (wie Anm. 7), 419.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2074 (20. Oktober 1556).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 93<br />
Ambrosius Blarer. Er selber wäre gerne bereit, das Sparpotential der<br />
neuen Te<strong>ch</strong>nologie gegen eine Gebü<strong>hr</strong> zu nutzen. 120<br />
[9] In eben diesen Tagen geht der Bieler Ratsherr Stephan Wyttenba<strong>ch</strong><br />
auf Blarers Veranlassung auf promotional tour na<strong>ch</strong> Genf. Blarer<br />
legt Calvin die Erfindungen («inventa») des Vetters Zwick ans Herz und<br />
empfiehlt die breite Produktepalette von «camini» 121 , «furni» und «fornaces»<br />
aufs Wärmste. 122 Konkrete Verhandlungen mit dem Genfer Rat<br />
s<strong>ch</strong>einen Funcklin und Kundigmann jedo<strong>ch</strong> erst na<strong>ch</strong> Neuja<strong>hr</strong> 1557 gefü<strong>hr</strong>t<br />
zu haben. 123<br />
[10] In der Weihna<strong>ch</strong>tswo<strong>ch</strong>e 1556 finden vor dem Rat der Stadt<br />
Basel Demonstrationen statt, die no<strong>ch</strong> an der Zurza<strong>ch</strong>er Herbstmesse<br />
1557 zu reden geben. Der opinion leader Bonifatius Amerba<strong>ch</strong> übt si<strong>ch</strong><br />
indessen in Zurückhaltung und lässt es lieber «ander lüt brobieren» 124 .<br />
[11] Der am 9. Dezember 1556 dur<strong>ch</strong> «Frideri<strong>ch</strong>en Frommers holtzsparungs<br />
kunst verwandtenn» beim Supplikationsauss<strong>ch</strong>uss in Mainz<br />
eingerei<strong>ch</strong>te Patentantrag wird am 31. Dezember vom Fürstenrat beraten<br />
und an den Rei<strong>ch</strong>shofrat überwiesen. 125<br />
120<br />
121<br />
122<br />
123<br />
124<br />
125<br />
Blarer BW 3, Nr. 2080 (12. Dezember 1556).<br />
Vorne offene Feuerstätten, DWb 11, 100. Der mit den Brüdern Blarer befreundete<br />
Strassburger Arzt und Universalgele<strong>hr</strong>te Johann Winter von Anderna<strong>ch</strong> (vgl. Anm.<br />
61) gab in De pestilentia commentarius in quatuor dialogos distinctus, Strassburg<br />
1565, den «wels<strong>ch</strong>en caminen» (camini Gallici sive Italici) bei der Pesthygiene den<br />
Vorzug vor den Ka<strong>ch</strong>elöfen (hypocausta apud Germanos), vgl. Joseph Krieger:<br />
Beiträge zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Volksseu<strong>ch</strong>en. Zur medicinis<strong>ch</strong>en Statistik und Topographie<br />
von Strassburg im Elsass, Strassburg 1879, 137. Im so genannten Troja-<br />
Kamin auf S<strong>ch</strong>loss Nesselrode-Hugenpoet (Westfalen) s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> ein wels<strong>ch</strong>er<br />
Holzspar-Kamin von 1577 erhalten zu haben. Vgl. Fr[iedri<strong>ch</strong>] Tophof: Kamin im<br />
S<strong>ch</strong>losse Nesselrode-Hugenpoet, in: Zeitsc<strong>hr</strong>ift für Bauwesen 27 (1877), 91–98,<br />
96: «Der innere Raum hinter dem Kaminaufbau ist hohl und na<strong>ch</strong> Art der Ka<strong>ch</strong>elöfen<br />
zur Ansammlung und für den Dur<strong>ch</strong>zug der warmen Luft eingeri<strong>ch</strong>tet [steigende<br />
und stürzende Rau<strong>ch</strong>gaszüge, HRL]. Den glei<strong>ch</strong>en Zweck haben zwei senkre<strong>ch</strong>te<br />
Kanäle im Mauerkörper der aufgehenden Wände, die Absperrung und<br />
Regulierung der Luft erfolgt dur<strong>ch</strong> Klappen.»<br />
Dasypodius, Dictionarium (wie Anm. 25): caminus = offen, bzw. kemmin; furnus =<br />
ba<strong>ch</strong> off; fornax = brenofen (Blarer BW 3, Nr. 2080: ba<strong>ch</strong>ofen).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2079 = CO 15, Nr. 2559 (12. Dezember 1556); Blarer BW 3, Nr.<br />
2081 = CO 16, Nr. 2571 (31. Dezember 1556).<br />
BW Amerba<strong>ch</strong> 10/2, Nr. 4228, Anm. 6 (= StABS Fin G 18).<br />
OeStA/HHStA/MEA-RTA 42, 4 r (1. Supplikationsauss<strong>ch</strong>uß-Protokoll) (9. Dezember<br />
1556); 525 r (2. Fürstenratsprotokoll) (RK RTA 39) (31. Dezember 1556).<br />
Herrn Prof. Dr. Rolf Decot, Mainz, danke i<strong>ch</strong> für die freundli<strong>ch</strong>e Überlassung sei-
94<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
[12] Re<strong>ch</strong>berger zufolge soll Funcklin die Holzsparkunst au<strong>ch</strong> «zu<br />
Lucern, jn den andren vier ortenn [Uri, S<strong>ch</strong>wyz, Ob- und Nidwalden,<br />
Zug] […] vßgebra<strong>ch</strong>tt vnd gelernett [gele<strong>hr</strong>t]» haben. 126 Die im Einzelnen<br />
ni<strong>ch</strong>t dokumentierte Ges<strong>ch</strong>äftsreise wird wä<strong>hr</strong>end jener Januartage<br />
1557 stattgefunden haben, als Ambrosius Blarer dem Bruder seine Überlastung<br />
«infolge Abwesenheit Funklis» klagte und glei<strong>ch</strong>zeitig der Hoffnung<br />
Ausdruck gab, «dass der große Rei<strong>ch</strong>tum des Vetters (auf den i<strong>ch</strong><br />
me<strong>hr</strong> nur im Traum hoffe), au<strong>ch</strong> Dir zu Nutzen komme» 127 .<br />
[13] Auf Anfang 1557 zu datieren ist wohl au<strong>ch</strong> die Abfu<strong>hr</strong>, wel<strong>ch</strong>e<br />
Funcklin seitens des reformierten Glarner Landammanns Joa<strong>ch</strong>im Bäldi<br />
«mit dem Hinweis auf die stolzen Forste» zuteil wurde. 128<br />
[14] Gemäss Re<strong>ch</strong>berger soll «herr Jacob» die «edle kunst» au<strong>ch</strong><br />
na<strong>ch</strong> dem oberelsässis<strong>ch</strong>en Mülhausen getragen haben. Zu diesem Zugewandten<br />
Ort der Eidgenossens<strong>ch</strong>aft besass Funcklin, wie si<strong>ch</strong> weisen<br />
wird, eine besondere Affinität. 129<br />
[15] Vermutli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Bullingers Vermittlung haben die Agenten<br />
des Holzsparkonsortiums im Januar 1557 Gelegenheit, vor einem Ratsauss<strong>ch</strong>uss<br />
der Stadt Züri<strong>ch</strong> eine «grosse Probe» mit «Stubenofen, Ko<strong>ch</strong>herd<br />
und Backofen» im weitläufigen Kloster Oetenba<strong>ch</strong> abzulegen. 130<br />
[16] Von erfolgrei<strong>ch</strong>en Demonstrationen vor dem Rat zu Strassburg<br />
weiss Johannes Sturm Anfang Januar 1557 dem König C<strong>hr</strong>istian III. von<br />
Dänemark zu beri<strong>ch</strong>ten: «pecuniam non paruam pro se & ciuibus dedit»,<br />
es kam, mit anderen Worten, zu einem Nutzungsvertrag. Neben dem<br />
ganzen Spektrum der häusli<strong>ch</strong>en Holzsparte<strong>ch</strong>nik hat das Konsortium offenbar<br />
grosste<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>e und militäris<strong>ch</strong>e (?) Anwendungen im Kö<strong>ch</strong>er:<br />
«alia adhuc habent secretiora quae ad salinas, & ad tincturam, & ad<br />
126<br />
127<br />
128<br />
129<br />
130<br />
ner Transkripte. Vgl. Hauptstaatsar<strong>ch</strong>iv Stuttgart (im Folgenden: HStA Stuttgart) H<br />
262, Bd. 47, 524 r –526 r (31. Dezember 1556).<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 111f. (sub 1557).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2084 (18. Januar 1557).<br />
Georg Thürer: Kultur des alten Landes Glarus, Glarus 1936, 326 (ohne Beleg).<br />
Bäldi hatte 1548 mit dem Freiberg Kärpf 1548 das älteste Wildreservat der<br />
S<strong>ch</strong>weiz gegründet, vgl. Veronika Feller: Art. Joa<strong>ch</strong>im Bäldi, in HLS 1 (2002),<br />
677.<br />
Vgl. unten Abs<strong>ch</strong>n. 7.2.2. c).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2085 (1. Februar 1557); CO 16, Nr. 2595 (8. Februar 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 95<br />
rationem militarem, aliasque commoditates pertinent» 131 . Am 1. April<br />
meldet Sturm die Anwesenheit von zwei auswärtigen Holzkünstlern<br />
(Funcklin und Kundigmann?), die unlängst ein Rei<strong>ch</strong>spatent erlangt hätten,<br />
«quorum alter multis principibus et magistratibus <strong>ch</strong>arus et acceptus<br />
est» 132 . Über Musteröfen, die er bei Sturm gesehen hat, wird der Jurist<br />
François Hotman Calvin Ende Mai ausfü<strong>hr</strong>li<strong>ch</strong> Beri<strong>ch</strong>t erstatten. 133<br />
5.3. Im Zenith<br />
[17] Vier Tage vor Abs<strong>ch</strong>luss des Rei<strong>ch</strong>stages zu Regensburg, am 13.<br />
März 1557, erteilt König Ferdinand I.<br />
den erfindern, als obgemeltem Fridri<strong>ch</strong> Frommer, Konrad Zwicken zue Rhor seligen<br />
verlaßnen khindern unnd erben, unnd Hanns Ulri<strong>ch</strong> Kündigman, Burger zue<br />
Costentz, unnser kunigli<strong>ch</strong>e freyhait […] im einheitz, ko<strong>ch</strong>en, ba<strong>ch</strong>en vnnd<br />
iebung der wels<strong>ch</strong>en caminen. 134<br />
Das 10-jä<strong>hr</strong>ige Rei<strong>ch</strong>spatent ist in den kaiserli<strong>ch</strong>en Erblanden und in den<br />
Rei<strong>ch</strong>sstädten direkt verwertbar 135 und mit dem Re<strong>ch</strong>t verbunden, die<br />
«khunst» gegen eine Lizenzgebü<strong>hr</strong> von einem Drittel der eingesparten<br />
Heizkosten zu vertreiben, bei einer Busse von «zwainzig Markh lo tigs<br />
goldts» für jede Urheberre<strong>ch</strong>tsverletzung. Die erfolgverspre<strong>ch</strong>ende Urkunde<br />
gibt das Konsortium umgehend in den Druck:<br />
131<br />
132<br />
133<br />
134<br />
135<br />
Andreas S<strong>ch</strong>uhma<strong>ch</strong>er (Hg.): Briefe gele<strong>hr</strong>ter Männer an die Könige in Dänemark<br />
vom Ja<strong>hr</strong> 1522 bis 1663, 3 Bde., Kopenhagen u. a. 1758f. (im Folgenden: Dänemark<br />
BW), Bd. 2, 345f. (3. Januar 1557).<br />
Dänemark BW 2, 349 (1. April 1557).<br />
CO 16, Nr. 2638, vgl. unten, Anh. 1. Zur Holzsparkunst in Strassburg vgl. Fu<strong>ch</strong>s,<br />
Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8).<br />
OeStA/HHStA/RHR Grat Feud Gewerbe-, Fabriks- und Handlungsprivilegien 11–<br />
59, 609 r –610 v .613 r (13. März 1557), «Collationata na<strong>ch</strong> dem re<strong>ch</strong>ten haupt-originalbrieff<br />
von Regenspurg, den 18 ten Augustj Anno 76». Vgl. au<strong>ch</strong>: OeStA/HHStA/<br />
MEA RTA 42, 63ff. (1. Supplikationsauss<strong>ch</strong>uß-Protokoll) (15. März 1557 [!]).<br />
Herrn Prof. Dr. Rolf Decot danke i<strong>ch</strong> für die freundli<strong>ch</strong>e Überlassung au<strong>ch</strong> dieses<br />
Transkriptes.<br />
Zum Geltungsberei<strong>ch</strong> der kaiserli<strong>ch</strong>en Privilegien vgl. Silberstein, Erfindungss<strong>ch</strong>utz<br />
(wie Anm. 94), 61–64.
96<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Copey vnnd Abtruck der Rö[mis<strong>ch</strong>en] Kön[igli<strong>ch</strong>en] May[estät] Freyheit / den erfündern<br />
der Holtzersparungskunst / auff Jüngst gehaltnem Rei<strong>ch</strong>stag zu Regenspurg<br />
/ diß lauffenden Lvij. Jars gegeben, Strassburg (S. Emmel) 1557, 4°. 136<br />
[18] Na<strong>ch</strong> wie vor sind in Bern nur wenige, dafür umso einflussrei<strong>ch</strong>ere<br />
Persönli<strong>ch</strong>keiten an der neuen Erfindung interessiert. Es sind dies, ausser<br />
den Theologen Musculus und Haller, denen Ambrosius Blarer ein «organum<br />
hypocausticum» gezeigt hatte, der Generalkommissär der Waadt<br />
Niklaus Zurkinden 137 sowie drei weitere Burger. Diesen Kreisen verdankt<br />
es Funcklin, dass er die «visirung vnnd munster [!] ettli<strong>ch</strong>er stu -<br />
cken» in der Ratstube vorfü<strong>hr</strong>en darf, worüber ihm die Staatskanzlei «vff<br />
sin begär» am 23. März 1557 eine Beglaubigung ausstellt. 138<br />
[19] Eine Kopie des Berner Kunds<strong>ch</strong>aftsbriefs s<strong>ch</strong>ickt Funcklin am<br />
31. März an Calvin zuhanden des Staatssekretärs Mi<strong>ch</strong>el Roset. Die Angelegenheit<br />
ist mit diesem abgespro<strong>ch</strong>en: «is curabit negotium senatui<br />
proponi. Tu si quid potes, promoveto id diligenter» 139 .<br />
[20] Am glei<strong>ch</strong>en Tag überbringt Funcklin einen Brief ähnli<strong>ch</strong>en Inhalts<br />
dem Freund Farel na<strong>ch</strong> Neuenburg. 140<br />
[21] Dank der erfolgrei<strong>ch</strong>en Probe, die der «landtsëß Jacob Zwick<br />
z Ror vnnd anndere der holtzsparung kunst verwandten» vor einem<br />
136<br />
137<br />
138<br />
139<br />
140<br />
Vorhanden in: Göttingen, Niedersä<strong>ch</strong>s. Staats- und Universitätsbibliothek, 8 OEC<br />
I, 3838; Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, H: L 338.4° Helmst. (6); London,<br />
British Museum 9325.b.24, vgl. Miriam Usher C<strong>hr</strong>isman: Bibliography of<br />
Strasbourg imprints, 1480–1599, New Haven u. a. 1982, 41. Früheste Erwähnung<br />
bei Johann Jacob S<strong>ch</strong>übler: Nützli<strong>ch</strong>e Vorstellung und deutli<strong>ch</strong>er Unterri<strong>ch</strong>t von<br />
Zierli<strong>ch</strong>en, bequemen und Holtz ersparenden Stuben-Oefen, Nürnberg 1728, Vorberi<strong>ch</strong>t,<br />
1, sowie Johann Heinri<strong>ch</strong> Zedler: Universal-Lexicon, 64+4 Bde., Leipzig<br />
1731–1754, Bd. 14 (1739), 711.<br />
Bekannt sind Zurkindens mathematis<strong>ch</strong>e und physikalis<strong>ch</strong>e Interessen, Eduard<br />
Bähler: Nikolaus Zurkinden von Bern 1506–1588, Züri<strong>ch</strong> 1912, 173f. 1584 demonstrierte<br />
der greise Zurkinden ein die Me<strong>ch</strong>anik der Handfeuerwaffen revolutionierendes<br />
S<strong>ch</strong>nellfeuergewe<strong>hr</strong> mit drehbarer Ladetrommel, vgl. Organ der Militärwissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en<br />
Vereine 10 (1875), XCIII.<br />
StABE A II 211, 43 (23. März 1557); A I 347, 671 (23. März 1557); Burgerbibliothek<br />
Bern Mss. h.h. I 117, 32 r (Berner C<strong>hr</strong>onik J. Haller d. Ae.), vgl. StABE DQ 14<br />
(Berner C<strong>hr</strong>onik von J. Haller und W. Müslin, Absc<strong>hr</strong>ift), 49 (23. März 1557).<br />
CO 16, Nr. 2611 (31. März 1557).<br />
Bibliothèque des Pasteurs Neu<strong>ch</strong>âtel [Depositum im Staatsar<strong>ch</strong>iv Neu<strong>ch</strong>âtel] portefeuille<br />
IX, liasse IV, no. 29 (31. März 1557), freundli<strong>ch</strong>er Hinweis von Herrn lic.<br />
theol. Rainer Henri<strong>ch</strong>, vgl. Blarer BW 3, S. 861, Anh. 3 (1. April 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 97<br />
Ratsauss<strong>ch</strong>uss in Züri<strong>ch</strong> abgelegt haben, 141 und in Würdigung der «von<br />
ettli<strong>ch</strong>en potentaten vnnd herrs<strong>ch</strong>afften» ausgestellten Kunds<strong>ch</strong>aftsbriefe,<br />
erlangt das Konsortium, das einen Werbefeldzug «bÿ vnnseren get<strong>hr</strong>üwen<br />
lieben Eÿdtgnossen» beabsi<strong>ch</strong>tigt, am 3. April 1557 ein günstiges<br />
Zeugnis. 142<br />
[22] Eben davon s<strong>ch</strong>eint man in Bern weitere Verhandlungen abhängig<br />
gema<strong>ch</strong>t zu haben. Eine Einladung der «holtz ku nstler von Byel<br />
jn miner H[erren] costen» fällt genau auf jenen 2. Juni 1557, als der Rat<br />
eine empfindli<strong>ch</strong>e Reduktion der Holzdeputate aus dem Bremgartenwald<br />
bes<strong>ch</strong>liessen sollte. 143 «Lignariae fornaces hic nunc eriguntur Funcklio<br />
authore», meldet Haller am 9. Juni na<strong>ch</strong> Züri<strong>ch</strong>, was wohl soviel heisst,<br />
dass ansässige Hafner unter Funcklins Anleitung daran waren, eine grosse<br />
Probe aufzubauen. 144 Eine Wo<strong>ch</strong>e später ist es so weit:<br />
Am 16. Juni [1557] fand ein gemeinsames Mittagessen des Rates zu Predigern<br />
[ehem. Dominikanerkloster] mit Jakob Funkli statt zur Erprobung der Holzsparkunst.<br />
Das Gastmahl gefiel einigen besser als diese Kunst, die si<strong>ch</strong> später als ni<strong>ch</strong>tig<br />
erwies. […] Unsere Obrigkeit gab ihnen 1’000 Pfund. Na<strong>ch</strong>dem aber das Aktienkapital<br />
(pecunia quaestuaria) zusammengebra<strong>ch</strong>t worden war, versagte diese<br />
Kunst zur grossen Entrüstung derer, die, zum Besten gehalten, grosse und vergebli<strong>ch</strong>e<br />
Opfer dafür gebra<strong>ch</strong>t hatten. 145<br />
Hallers retrospektiver «Tage»bu<strong>ch</strong>eintrag, in wel<strong>ch</strong>em subjektive und<br />
objektive Negativeins<strong>ch</strong>ätzungen si<strong>ch</strong> vermis<strong>ch</strong>en, 146 sollte in der berni-<br />
141<br />
142<br />
143<br />
144<br />
145<br />
146<br />
Funcklin war in diesen Tagen na<strong>ch</strong>weisli<strong>ch</strong> in Züri<strong>ch</strong>, Blarer BW 3, Nr. 2094 (A.<br />
Blarer an H. Bullinger, 15. April 1557).<br />
ZBZH, Ms. S 89, 95 (3. April 1557) = Ms. S 89, 94 (Simleriana; vgl. S. 145, Nr. 4).<br />
StABE A II 211, 302 (31. Mai 1557); A II 211, 311 (2. Juni 1557), vgl. Morgenthaler,<br />
Holzsparkunst (wie Anm. 118), 97–99 (Quellen).<br />
StAZH E II 370a, 578 (W. Musculus an H. Bullinger, 9. Juni 1557). Autor ist «ein<br />
vrheber eins dings, der den anfang tht oder rhat gibt», Dasypodius, Dictionarium<br />
(wie Anm. 25). Ortsansässige Handwerker kamen 1557 in Ulm wie in Züri<strong>ch</strong> zum<br />
Einsatz, vgl. die Nummern [22] und [33] im Text.<br />
Tagebu<strong>ch</strong> J. Haller (wie Anm. 99), 275f.; vgl. C<strong>hr</strong>onik Haller/Müslin (wie Anm.<br />
138), 34 r : «Am 17.[!] Junij.»<br />
Hallers Reserviertheit Funcklin gegenüber ist alt: Als «iuvenem satis sibi fidentem,<br />
ut audio» bezei<strong>ch</strong>net der Berner Dekan den glei<strong>ch</strong>altrigen Bieler Kollegen von Anfang<br />
an, StAZH E II 370, 112 (J. Haller an H. Bullinger, 17. Januar 1550), vgl.<br />
au<strong>ch</strong> Blarer BW 3, Nr. 1983 (W. Musculus an A. Blarer, 30. April 1555). Zu den<br />
entrüsteten Aktionären gehörte mögli<strong>ch</strong>erweise au<strong>ch</strong> jener Niklaus IV. (?) Diesba<strong>ch</strong>,<br />
dem Funcklin bzw. dessen Witwe 3’000 Kronen s<strong>ch</strong>uldig geblieben war,
98<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
s<strong>ch</strong>en Historiographie perpetuieren. Am deutli<strong>ch</strong>sten bei dem ebenso<br />
quellenkundigen wie obrigkeitstreuen Mi<strong>ch</strong>ael Stettler (1580–1642), 147<br />
der die ganze Holzsparkunst als eine einzige Beutels<strong>ch</strong>neiderei darstellt,<br />
inszeniert dur<strong>ch</strong><br />
etli<strong>ch</strong>e betru ger, vermeinte künstler vndt hungerige landtstrÿ<strong>ch</strong>er, deren der a<strong>ch</strong>tbariste<br />
von Costentz bürtig.» 148 – «Diese betrieger flicketen si<strong>ch</strong> au<strong>ch</strong> in die statt<br />
Bern mit glatten worten ein. […] Deß gelts war viel, deß vortheils aber wenig. 149<br />
Von alledem ist im Frühsommer 1557 jedo<strong>ch</strong> weder etwas zu hören no<strong>ch</strong><br />
zu lesen. Im Gegenteil: Am 21. Juni erlangen Funcklin und Konsorten<br />
einen feierli<strong>ch</strong>en Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief in zweifa<strong>ch</strong>er Ausfü<strong>hr</strong>ung (Abb. 9).<br />
H Jacob Füncklin vnd | sinen mittverwandten holtz | künstlern<br />
ein s<strong>ch</strong>ÿn oder | kundts<strong>ch</strong> brieff der holtzkunst halb<br />
wie | jnen die statt Züri<strong>ch</strong> einen | gäben. 150<br />
Abb. 9: Bern, Ratsmanual:<br />
Eintrag des<br />
Ratssc<strong>hr</strong>eibers unter<br />
dem 21. Juni 1557.<br />
Ausserdem wird den Holzkünstlern zugesi<strong>ch</strong>ert, dass die bernis<strong>ch</strong>en<br />
Tagsatzungs-Abgeordneten mit den Boten der anderen Orte über allfällige<br />
Privilegien «inn den Frÿen Ämpteren vnnd Gemeÿn Vogtÿen der<br />
Eydtgnoss<strong>ch</strong>afft» verhandeln würden. 151 Der am 24. Juni den Hafnern<br />
abverlangte Eid, die «nu w erfundne kunst des holtzsparens» nur gegen<br />
147<br />
148<br />
149<br />
150<br />
151<br />
StAZH E II 344, 33 (J. Finsler an H. Bullinger, 21. März 1572). Die Kenntnis beider<br />
Briefe an Bullinger verdanke i<strong>ch</strong> Herrn lic. theol. Rainer Henri<strong>ch</strong>.<br />
Zu Mi<strong>ch</strong>ael Stettler: Urs Martin Zahnd: «Wir sind willens ein kronick besc<strong>hr</strong>iben<br />
ze lassen». Bernis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tssc<strong>hr</strong>eibung im 16. und 17. Ja<strong>hr</strong>hundert, in: Berner<br />
Zeitsc<strong>hr</strong>ift für Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und Heimatkunde 67 (2005), 37–61, 43–46 (Lit.).<br />
StABE DQ 11 (Stettler C<strong>hr</strong>onik, Manuskript), 171 r .<br />
Mi<strong>ch</strong>ael Stettler, C<strong>hr</strong>onicon, 2 Teile in 1 Bd., o. O. [Bern] 1626, Theil II, 195.<br />
StABE A II 212, 24 (Ratsmanual); A I 347, 768 (Missive).<br />
StABE A II 212, 24 (21. Juni 1557) (Ratsmanual); A IV 194, 152 v f. (27. Juni 1557)<br />
(Instruktion).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 99<br />
eine Lizenzgebü<strong>hr</strong> «zeoffnen», 152 verleiht dem bernis<strong>ch</strong>en «s<strong>ch</strong>ÿn» den<br />
Charakter eines regelre<strong>ch</strong>ten Privilegs.<br />
[23] Da der Stand Bern in den Deuts<strong>ch</strong>en Gemeinen Vogteien ledigli<strong>ch</strong><br />
die Grafs<strong>ch</strong>aft Baden mitverwaltete, bedurfte das Konsortium zur<br />
grossräumigen Diffusion seiner Produkte der Unterstützung Züri<strong>ch</strong>s. Um<br />
si<strong>ch</strong> diese zu si<strong>ch</strong>ern, s<strong>ch</strong>eint Zwick S<strong>ch</strong>ulthaiß zufolge dem Stand Züri<strong>ch</strong><br />
die unentgeltli<strong>ch</strong>e Nutzung der Holzsparkunst angeboten zu haben:<br />
Conrat Zwick hat denen von Zuri<strong>ch</strong> als siner oberkait freÿ<br />
vergebens [unentgeltli<strong>ch</strong>] mit gethailt. 153<br />
An jenem 16. Juni 1557, als Jakob Funcklin sein Glück in Bern versu<strong>ch</strong>t,<br />
fü<strong>hr</strong>t Jakob Zwick eine Demonstration auf dem elterli<strong>ch</strong>en Landgut «Im<br />
Ro<strong>hr</strong>» dur<strong>ch</strong>. Der Grossveranstaltung war na<strong>ch</strong> dem Winterthurer C<strong>hr</strong>onisten<br />
Meyer ein Werberummel mit «brummen [beru men = prahlen] vnd<br />
vßsc<strong>hr</strong>ygen vnd erbietung» vorangegangen. Geladen waren Hafnermeister<br />
und interessierte Bürger von Züri<strong>ch</strong>, S<strong>ch</strong>affhausen, Diessenhofen,<br />
Stein am Rhein, Frauenfeld, Wil, Winterthur, Rapperswil und «au<strong>ch</strong> ander<br />
vmligend stett»:<br />
Diesen hand da die fro mden meyster yre kunst probiertt mit ba<strong>ch</strong>en, süden vnd<br />
bratten, alles uon einem für [Feuer], vnd das uon lüczell [wenig] holcz. I<strong>ch</strong> hab<br />
no<strong>ch</strong> nie […] kein offen gese<strong>ch</strong>en, darin diße kunst probiert sige worden, woll<br />
[obwohl] etli<strong>ch</strong> burger gsin sind, die willens sind, ein semli<strong>ch</strong>en offen laßen ma<strong>ch</strong>en.<br />
154<br />
[24] Gemäss Meyer sind die «fro mden meister» au<strong>ch</strong> «für die Drÿg<br />
Pündt [Drei Bünde] gen Chur uffhin kerrtt», und zwar in Begleitung des<br />
Baumeisters Othmar Laubi, des späteren S<strong>ch</strong>ultheissen von Winter-<br />
152<br />
153<br />
154<br />
StABE A II 212, 32. Ni<strong>ch</strong>t alle Ofenbauer s<strong>ch</strong>einen si<strong>ch</strong> daran gehalten zu haben,<br />
vgl. Blarer BW 3, Nr. 2113 (W. Musculus an A. Blarer, 5. Oktober 1557). In Bern<br />
waren etwa vier Hafnermeister glei<strong>ch</strong>zeitig tätig, vgl. Adriano Bos<strong>ch</strong>etti-Maradi:<br />
Berner Hafner – zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te eines Handwerks, in: Holenstein, Berns mä<strong>ch</strong>tige<br />
Zeit (wie Anm. 7), 438 (Lit.).<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen (wie Anm. 19), 39. Diese Mitteilung bezieht si<strong>ch</strong> vermutli<strong>ch</strong><br />
eher auf Konrads Sohn Jakob Zwick, da zu Lebzeiten des älteren Zwick das<br />
neue Heizprinzip ni<strong>ch</strong>t einmal im engsten Freundeskreis enthüllt worden war, vgl.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2088 (W. Musculus an A. Blarer, 16. Februar 1557).<br />
Meyer, Winterthurer C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 29), 94 rv .
100<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
thur, 155 «der ist ÿr redner gsin, hand ÿn blo net [ents<strong>ch</strong>ädigt]». Zu einem<br />
Ges<strong>ch</strong>äftsabs<strong>ch</strong>luss kommt es jedo<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t, da der Freistaat Graubünden<br />
das Ergebnis der laufenden Tagsatzungsverhandlungen abwartet: «Was<br />
vnsere Eÿdgnossen thu gind, das wellind sÿ au<strong>ch</strong> thn.» 156<br />
[25] An der Badener Ja<strong>hr</strong>re<strong>ch</strong>nung vom 27. Juni 1557 ist das Holzsparges<strong>ch</strong>äft<br />
ni<strong>ch</strong>t traktandiert. Am 4. September erteilt Bern seinen<br />
Boten wiederum eine Instruktion, do<strong>ch</strong> am 5. müssen die «erfinder der<br />
nüwen holtz sparungskunst» – Funcklin oder J. Zwick – i<strong>hr</strong> Anliegen in<br />
Abwesenheit der Berner Gesandts<strong>ch</strong>aft vorbringen. Wegen «vnglÿ<strong>ch</strong>er<br />
meÿnung» wird das Ges<strong>ch</strong>äft «ad referendum» genommen. Da einzelne<br />
Orte mit den Holzkünstlern in der Zwis<strong>ch</strong>enzeit bereits verhandelt hatten,<br />
ents<strong>ch</strong>eidet die Tagsatzung am 30. November 1557, allfällige «stürr<br />
vnnd handdtrei<strong>ch</strong>ung an iren [sc. der Holzkünstler] gehepten costen»<br />
jedem Ort freizustellen. Au<strong>ch</strong> die Kir<strong>ch</strong>en und Klöster in den Gemeinen<br />
Vogteien, «wel<strong>ch</strong>e dann große fhürr bru<strong>ch</strong>en», sollten si<strong>ch</strong> gegebenenfalls<br />
«mit den erfindern diser holtzkunst gu ttli<strong>ch</strong> vert<strong>hr</strong>agen» 157 . Mit diesem<br />
Ergebnis konnte das Konsortium zufrieden sein oder au<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t.<br />
[26] In Entspre<strong>ch</strong>ung einer Supplikation Funcklins «innamen vnd<br />
von wägen deß edlen vesten Jacob Zwicken z Ror vnd siner mithafften»,<br />
erweitert der Rat zu Bern am 23. Juli 1557 den Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief<br />
vom 21. Juni zu einer «Holzku nstleren frÿheit»:<br />
Den erfindern der holtz ersparung kunst ein priuilegium, dz M[ine] h[erren] jnen<br />
vergöndt, x. jar lang mit der landts<strong>ch</strong>afft derohalb zeüberkhommen, wie sÿ es begärdt.<br />
Vnd sol den amptluthen allenthalben gsc<strong>hr</strong>iben werden, wär die kunst bru<strong>ch</strong>te<br />
vor und ee er si<strong>ch</strong> mit den künstlern gsetzt hette, das derselb Mh. x. lb verfallen<br />
sin sölle. 158<br />
155<br />
156<br />
157<br />
158<br />
Eidgnößis<strong>ch</strong>-S<strong>ch</strong>weytzeris<strong>ch</strong>er Regiments E<strong>hr</strong>en-Spiegel, Zug 1706, 89; HBLS 4<br />
(1927), 612.<br />
Meyer, Winterthurer C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 29), 95 v .<br />
StABE A II 212, 272; A III 30, 600 (4. September 1557); A IV 38, 167 (5. September<br />
1557), vgl. Joseph Karl Kruetli (Bearb.): Die eidgenössis<strong>ch</strong>en Abs<strong>ch</strong>iede aus<br />
dem Zeitraume von 1556 bis 1586 (Die Amtli<strong>ch</strong>e Sammlung der älteren Eidgenössis<strong>ch</strong>en<br />
Abs<strong>ch</strong>iede, Bd. 4,2a), Bern 1861 (im Folgenden: EA 4,2a), 48f.; StABE A<br />
IV 194, 297 v (30. November 1557); A IV 38, 214f. (31.[!] November 1557), vgl.<br />
EA 4,2a, 56.<br />
StABE A II 212, 120; A I 348, 28–31 (23. Juli 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 101<br />
Am 4. September wird den «holtzku nstlern» die hohe E<strong>hr</strong>e zuteil, «den<br />
offen jn der rhatstuben allhie» ma<strong>ch</strong>en zu dürfen, na<strong>ch</strong> dessen Fertigstellung<br />
300 Kronen – der seinen O<strong>hr</strong>en ni<strong>ch</strong>t trauende Ratsc<strong>hr</strong>eiber notiert<br />
«iij c gulden» – zur Auszahlung kommen sollen. 159 Der stolze Betrag<br />
spri<strong>ch</strong>t si<strong>ch</strong> herum, wie Musculus na<strong>ch</strong> Biel meldet:<br />
Über die Holzsparkunst ist das Gerü<strong>ch</strong>t entstanden, es werde hier ni<strong>ch</strong>t angeboten,<br />
was anderswo günstiger geliefert werde, weshalb viele si<strong>ch</strong> über Herrn Jakob aufregen<br />
und wenig freundli<strong>ch</strong> von der ganzen Erfindung reden. 160<br />
[27] Um einiges entspannter gestalten si<strong>ch</strong> die Verhältnisse in Konstanz,<br />
wo seit Juli 1557 neue Stubenöfen unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>er Ma<strong>ch</strong>art in den<br />
Amtsräumen des Holzspar-Konsorten und «raitesc<strong>hr</strong>eibers» (Sekretär<br />
des Almosenamts) Ulri<strong>ch</strong> Kundigmann stehen, aber au<strong>ch</strong> anderswo in<br />
der Stadt. Öfen zum Erwärmen der Was<strong>ch</strong>lauge («b<strong>ch</strong>ofen»), Backund<br />
Ko<strong>ch</strong>öfen runden das Sortiment ab, über dessen Taugli<strong>ch</strong>keit C<strong>hr</strong>istoph<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß allerdings eine ernü<strong>ch</strong>ternde Eins<strong>ch</strong>ätzung abgibt: «I<strong>ch</strong><br />
hab ain bu<strong>ch</strong>offen lassen ma<strong>ch</strong>en, was [war] gut; das ander alles solt<br />
[taugte] gar ni<strong>ch</strong>ts.» 161<br />
[28] In Neuenburg bringt es Funcklins Propaganda zuwege, dass<br />
einzelne Bauherren Bereits<strong>ch</strong>aft zeigen, i<strong>hr</strong>e Häuser mit holzsparenden<br />
Öfen auszustatten. Auf die lizenzierten Hafner warten sie freili<strong>ch</strong> bis<br />
September 1557 vergebli<strong>ch</strong>, da Funcklin ohne das verspro<strong>ch</strong>ene Neuenburger<br />
Privileg ni<strong>ch</strong>ts unternehmen will. 162<br />
[29] Au<strong>ch</strong> in Lausanne wundert man si<strong>ch</strong> Mitte September 1557,<br />
«daß die Ersteller der neuen Öfen so lange zögern». Man erwartet sie<br />
tägli<strong>ch</strong>, «besonders Beza, aber au<strong>ch</strong> Viret». Am 1. Oktober stellt Ambro-<br />
159<br />
160<br />
161<br />
162<br />
StABE A II 212, 272 (4. September 1557). Auszahlungen: StABE B VII 458d, 17 v<br />
(100 kr, 2. November 1557); B VII 694c, 58 (150 kr, Ende 1558); B VII 458d, 15 v<br />
(50 kr, 9. Januar 1559).<br />
«De xylophidia rumor hoc increbuit esse hic non ea proposita, quam iam commodiora<br />
alibi traduntur, eamque ob causam multi succensent D. Iacobo et parum amice<br />
de toto invento loquuntur», Blarer BW 3, Nr. 2113 (W. Musculus an A. Blarer,<br />
5. Oktober 1557).<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen (wie Anm. 19), 39.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2107 (C. Fabri an A. Blarer, 2. September 1557); Nr. 2110 (C.<br />
Fabri an A. Blarer, 17. September 1557).
102<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
sius Blarer die Hafner in Aussi<strong>ch</strong>t: «Funkli wird zur letzten Vollendung<br />
na<strong>ch</strong>folgen», was offenbar Anfang Dezember endli<strong>ch</strong> der Fall ist. 163<br />
[30] Ob Funcklins ans<strong>ch</strong>liessende Fa<strong>hr</strong>t na<strong>ch</strong> Genf im Dienste der<br />
Holzsparkunst oder der Kir<strong>ch</strong>e stand oder beidem zuglei<strong>ch</strong>, ist ni<strong>ch</strong>t<br />
me<strong>hr</strong> zu ermitteln. Jedenfalls hofft Ambrosius Blarer, sein Kollege möge<br />
«bald dort sein und unsere Erwartung erfüllen» 164 .<br />
5.4. Rücks<strong>ch</strong>läge<br />
[31] Ganz ergebnislos endet der Versu<strong>ch</strong>, die Holzsparkunst in Polen zu<br />
etablieren. Als Agent fungiert hier der vermutli<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Bullinger vermittelte<br />
«Anglo-Züri<strong>ch</strong>er» John Bur<strong>ch</strong>er, 165 dessen Reise na<strong>ch</strong> Polen anfängli<strong>ch</strong><br />
der kir<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>en Annäherung gegolten hatte. Mit einer Vollma<strong>ch</strong>t<br />
Jakob Zwicks und einem Empfehlungssc<strong>hr</strong>eiben Bullingers versehen,<br />
errei<strong>ch</strong>t der Engländer Anfang November 1557 Krakau und Piczów, wo<br />
ihn der Reformator Jan aski an den Kurfürsten von Wilna weiter empfiehlt.<br />
Von da erhofft si<strong>ch</strong> Bur<strong>ch</strong>er direkten Zugang zum König: «Privilegium<br />
consequuturum non dubito», beri<strong>ch</strong>tet er na<strong>ch</strong> Hause. Auf das<br />
Vidimus des Königs unter die mittlerweile zugesi<strong>ch</strong>erte Freiheit wartet<br />
der Engländer no<strong>ch</strong> im Februar 1558 in Krakau, wo er «mindestens 500<br />
Bierbrauer» unterri<strong>ch</strong>ten könnte. Ein bes<strong>ch</strong>leunigtes Verfa<strong>hr</strong>en ist allerdings<br />
nur gegen S<strong>ch</strong>miergelder zu haben. Bullinger möge so gut sein<br />
«Master James Zwickius» zu sagen, «how impossible it is to effect a<br />
matter of su<strong>ch</strong> importance with so little means». Am 6. Juni ersu<strong>ch</strong>t Bullinger<br />
aski erneut, «ut omni opera diligentiaque cures privilegium ipsi<br />
concedi». Zehn Tage später drängt die zu Re<strong>ch</strong>t besorgte<br />
Hauptinvestorin Barbara von Ulm-Blarer i<strong>hr</strong>en Bruder Thomas, «über<br />
163<br />
164<br />
165<br />
Blarer BW 3, Nr. 2108 (G. Blarer an A. Blarer, 15. September 1557); Nr. 2112 (A.<br />
Blarer an G. und D. Blarer, 1. Oktober 1557), vgl. Nr. 2128 (23. November 1557);<br />
Nr. 2120 (A. Blarer an J. Calvin, 3. Dezember 1557).<br />
CO 16, Nr. 2770 (A. Blarer an J. Calvin, 3. Dezember 1557, corr. «Fernelius» zu<br />
«Funclius») = Blarer BW 3, Nr. 2120 (corr. «eure Erwartungen» zu «unsere [nostrae]<br />
E.»).<br />
Vgl. Esther Frances Mary Hildebrandt: A Study of the English Protestant Exiles in<br />
Northern Switzerland and Strasbourg 1539–47 and their Role in the English Reformation,<br />
(Ph. D. Thesis, Durham 1982), (Xerokopie), 41–49; Carrie Euler: Couriers<br />
of the Gospel: England and Zuri<strong>ch</strong>, 1531–1558, Züri<strong>ch</strong> 2006 (Zür<strong>ch</strong>er Beiträge<br />
zur Reformationsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te 25), 75f.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 103<br />
die Sa<strong>ch</strong>e, die sie in Polen wegen der Holzsparkunst hat», an Funcklin zu<br />
sc<strong>hr</strong>eiben. Bur<strong>ch</strong>ers letzter Brief aus Polen datiert vom 30. November<br />
1558. Darin bittet er Bullinger um seine Empfehlung beim König und<br />
beim polnis<strong>ch</strong>en Adel. Wenig später s<strong>ch</strong>eint der Glücklose die Heimreise<br />
angetreten zu haben.<br />
Mitte März 1559 fassen die Blarer auf Funcklins Rat hin einen Verkauf<br />
des Polenges<strong>ch</strong>äftes an die Augsburger Fugger ins Auge. Im Februar<br />
1560 wird Bullinger um Rat bei der gütli<strong>ch</strong>en oder re<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>en Lösung<br />
des Vertrags mit Bur<strong>ch</strong>er vor dessen Heimke<strong>hr</strong> na<strong>ch</strong> England<br />
gefragt. Ob Bur<strong>ch</strong>er der Aufforderung na<strong>ch</strong>gekommen ist, «an jenen<br />
, der das königli<strong>ch</strong>e Privilegium in Verwa<strong>hr</strong>ung hat», zu sc<strong>hr</strong>eiben,<br />
bleibt wohl für immer offen. 166<br />
[32] Gemäss Mitteilung des Grafen Ludwig XVI. von Oettingen-<br />
Oettingen an den Herzog von Württemberg haben im Winter 1557/58 die<br />
«maister» der Holzsparkunst Konrad Egloff von Konstanz 167 und Hans<br />
Lobsinger von Nürnberg, 168<br />
weli<strong>ch</strong>er ein sonnderer fürnemer künstler in dern vnnd anndernn sa<strong>ch</strong>en ist, […]<br />
die ko<strong>ch</strong>- vnd stuben ofen […] beÿ mir [S<strong>ch</strong>loss Alerheim?] vffgeri<strong>ch</strong>t. Darjnnen<br />
i<strong>ch</strong> den winter bestenndige vnnd dermassen ersparung im werckh befunden, das i<strong>ch</strong><br />
166<br />
167<br />
168<br />
Hastings Robinson (Hg.): Original Letters relative to the English Reformation,<br />
written during the Reigns of King Henry VIII., King Edward VI., and Queen Mary:<br />
<strong>ch</strong>iefly from the Ar<strong>ch</strong>ives of Zuri<strong>ch</strong>, 2 Bde., Cambridge 1846/1847 (im Folgenden:<br />
Original Letters), Bd. 2, Nr. 328 (J. Bur<strong>ch</strong>er an H. Bullinger, 4. November 1557);<br />
Nr. 329 (J. Bur<strong>ch</strong>er an H. Bullinger, 16. Februar 1558); Nr. 330 (J. Bur<strong>ch</strong>er an H.<br />
Bullinger, 1. März 1558). StAZH E II 342,370 (H. Bullinger an J. aski, 6. Juni<br />
1558). Blarer BW 3, Nr. 2142 (T. Blarer an A. Blarer, 16. Juni 1558). Original Letters<br />
2, Nr. 332 (J. Bur<strong>ch</strong>er an H. Bullinger, 27. Oktober 1558); Nr. 333 (J. Bur<strong>ch</strong>er<br />
an H. Bullinger, 30. November 1558). Blarer BW 3, Nr. 2176 (T. Blarer an A. Blarer,<br />
12. März 1559); Nr. 2224 (A. Blarer an H. Bullinger, 16. Februar 1560), vgl.<br />
Nr. 2238 (H. Bullinger an A. Blarer, 22. April 1560); Nr. 2239 (A. Blarer an H.<br />
Bullinger, 1. Mai 1560).<br />
1535 ist die Frau eines Konrad Egloff von Tägerwilen, Bürger zu Konstanz, bezeugt,<br />
vgl. Konrad Beyerle: Die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Chorstifts St. Johann zu Konstanz,<br />
in: Freiburger Diözesan-Ar<strong>ch</strong>iv (NF) 5 (1904), 1–139, 125. 1576 erlangt ein ni<strong>ch</strong>t<br />
näher bestimmter Conrad Egloff als «mitverwandter» von F. Frommer und J.<br />
Zwick ein Rei<strong>ch</strong>spatent, vgl. unten Nr. [45].<br />
Der «Spinnrädlein-Ma<strong>ch</strong>er» Hans Lobsinger (1510–1584) war in der Tat ein vielseitiger<br />
Handwerker und Erfinder, vgl. Albert Bartelmeß: Hans Lobsinger und seine<br />
Erfindungen, in: Mitteilungen des Vereins für Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Stadt Nürnberg 52<br />
(1963/1964), 256–264.
104<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
disen summer [1559] alle öfen auf dieselbigenn gattung will ma<strong>ch</strong>en, vnd daneben<br />
den ko<strong>ch</strong>ofen für mein geprau<strong>ch</strong>, der mir sonderli<strong>ch</strong>en gefelt, do<strong>ch</strong> alles von erden<br />
[gebrannter Ton], vnnd nit ple<strong>ch</strong>. 169<br />
[33] Au<strong>ch</strong> in Ulm versu<strong>ch</strong>en die Konsorten Fuss zu fassen. 170 Im Frühsommer<br />
1557 bauen zwei Meister – Egloff und Lobsinger (?) – 171 unter<br />
Beizug von vereidigten ortsansässigen Hafnern vers<strong>ch</strong>iedene Ofenmodelle.<br />
Ein Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief wird den Holzkünstlern verweigert, do<strong>ch</strong><br />
winken ihnen im Falle einer zufriedenstellenden Probezeit von se<strong>ch</strong>s<br />
Monaten 1’500 Gulden. Um die Ja<strong>hr</strong>eswende 1557/58 versu<strong>ch</strong>en die<br />
Holzkünstler den zögernden Rat mit einem Sonderangebot für holzsparende<br />
«Salzpfannen, Ziegel- und Kalköfen, Bierpfannen, Färbereien,<br />
Laug-, Blei<strong>ch</strong>-, Was<strong>ch</strong>- und andere Kessel» günstig zu stimmen. Ein<br />
Brand, den ein neu erri<strong>ch</strong>teter Ofen aus Eisenble<strong>ch</strong> im Rathaus beinahe<br />
verursa<strong>ch</strong>t, 172 fü<strong>hr</strong>t zum klägli<strong>ch</strong>en Abbru<strong>ch</strong> der Ges<strong>ch</strong>äftsbeziehung.<br />
[34] Wä<strong>hr</strong>end der Verhandlungen mit dem Ulmer Rat um die Ja<strong>hr</strong>eswende<br />
1557/58 lassen die Agenten des Holzspar-Konsortiums ni<strong>ch</strong>t<br />
ohne Stolz einfliessen, es habe die Stadt Frankfurt i<strong>hr</strong>e Kunst bereits angenommen.<br />
173<br />
[35] Dass Jakob Zwick 1557 und 1579 au<strong>ch</strong> französis<strong>ch</strong>e Patente erlangt<br />
habe, will Marc Silberstein ni<strong>ch</strong>t auss<strong>ch</strong>liessen. 174<br />
[36/37] Mit einem Empfehlungsbrief an Philipp Melan<strong>ch</strong>thon 175<br />
verreitet Funcklin am 13. Januar 1558 na<strong>ch</strong> «Halle in Sa<strong>ch</strong>sen, wo die<br />
Salzpfannen sind» 176 . Die Reise endet jedo<strong>ch</strong> bereits in Frankfurt am<br />
Main, wo er Gelegenheit hat, den Sa<strong>ch</strong>senfürsten am so genannten «Kur-<br />
169<br />
170<br />
171<br />
172<br />
173<br />
174<br />
175<br />
176<br />
HStA Stuttgart, Oettingen 28 (L. v. Oettingen an C. v. Württemberg, 21. Mai<br />
1558), fehlt in BW Wirtemberg 4.<br />
J[ohann] C[<strong>hr</strong>istoph] von S<strong>ch</strong>mid: Beytrag zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Holzsparkunst, in:<br />
Württembergis<strong>ch</strong>e Ja<strong>hr</strong>bü<strong>ch</strong>er 6 (1823), 169–180, leider ohne Datumsangaben.<br />
Diese werden wenig später na<strong>ch</strong> Wien berufen, vgl. unten Nr. [38].<br />
Terminus ante quem ist 24. September 1558, vgl. unten Nr. [39].<br />
V. S<strong>ch</strong>mid, Beytrag (wie Anm. 170), 175.<br />
Silberstein, Erfindungss<strong>ch</strong>utz (wie Anm. 94), 98, Anm. 23. Viellei<strong>ch</strong>t basieren<br />
au<strong>ch</strong> die holzsparenden Salinenpfannen in Lot<strong>hr</strong>ingen auf dem Prinzip Frommer &<br />
Zwick, vgl. Hiegel, Essais (wie Anm. 8), passim.<br />
MBW 8, Nr. 8606. Der me<strong>hr</strong>fa<strong>ch</strong> bezeugte Brief Blarers (Blarer BW 3, Nrn 2129<br />
u. 2131) ist ans<strong>ch</strong>einend ni<strong>ch</strong>t an Melan<strong>ch</strong>thon zugestellt worden.<br />
Der Holzbedarf der Hallenser Saline betrug jä<strong>hr</strong>li<strong>ch</strong> 30’000 Klafter = 100’170m 3 ,<br />
vgl. Otto Fürsen: Die kursä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>en Floßkontrakte mit der Stadt Halle, in: Neues<br />
Ar<strong>ch</strong>iv für Sä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und Alterthumskunde 23 (1902), 64–83, 82.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 105<br />
fürstentag» (25. Februar–19. März 1558) zu sehen. Am 8. April ist Herr<br />
Jakob «direkt von Frankfurt heimgeke<strong>hr</strong>t» 177 .<br />
5.5. Funcklins Nebenprojekte<br />
Zu dieser drei ganze Monate dauernden Abwesenheit des Dekans Funcklin<br />
von Herd und Herde geben die Bestände des Bieler Stadtar<strong>ch</strong>ivs willkommene<br />
Hintergrundinformationen.<br />
Anfang März 1558 trifft C<strong>hr</strong>istoffel Wyttenba<strong>ch</strong>, der Meier von<br />
Biel, in Basel zufällig auf Funcklin. Dieser steht kurz vor der Abreise<br />
na<strong>ch</strong> Frankfurt, wohin er si<strong>ch</strong> in Begleitung seines Halbbruders, des<br />
Konstanzer Grossrats Ulri<strong>ch</strong> Kundigmann, und des Amtmanns von Badenweiler,<br />
Ludwig Wolf von Habsberg, 178 begeben will. Ans<strong>ch</strong>einend<br />
hatte der badis<strong>ch</strong>e Junker in die Holzsparkunst investiert und war ausersehen<br />
worden, das Unternehmen am Kurfürstentag in ein nobles Li<strong>ch</strong>t zu<br />
rücken. Die günstige Gelegenheit und Konstellation ausnützend, betraute<br />
der Rat von Biel die drei Ges<strong>ch</strong>äftsleute etwas überstürzt mit der e<strong>hr</strong>envollen<br />
Aufgabe, die alten Freiheitsbriefe der Stadt dur<strong>ch</strong> den am 26. Februar<br />
zum Kaiser ausgerufenen Ferdinand I. bestätigen zu lassen. 179<br />
5.5.1. Silberbergwerk Staufen<br />
Die Vermutung, es sei Anfang 1558 in Basel über das Holzsparges<strong>ch</strong>äft<br />
hinaus zu weiteren Kontrakten zwis<strong>ch</strong>en Funcklin, Kundigmann und<br />
Habsberg gekommen, wird dur<strong>ch</strong> einen Bieler Na<strong>ch</strong>gang im Zusammenhang<br />
mit der Regelung von Funcklins Na<strong>ch</strong>lass bestätigt. Am 20. April<br />
1567 sagt Peter Hans Wis<strong>ch</strong>ing 180 aus:<br />
177<br />
178<br />
179<br />
180<br />
Blarer BW 3, Nr. 2133 (A. Blarer an H. Bullinger, 1. März 1558); Nr. 2141 = CO<br />
17, Nr. 2805 (A. Blarer an J. Calvin, 14. Mai 1558); Blarer BW 3, Nr. 2137 (A.<br />
Blarer an H. Bullinger, 12. April 1558).<br />
Eckdaten bei Julius Kindler von Knoblo<strong>ch</strong>: Oberbadis<strong>ch</strong>es Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>terbu<strong>ch</strong>, 3<br />
Bde., Heidelberg 1898–1919, Bd. 1, 592. Habsberg ist 1560 als Stubengeselle der<br />
Basler Herrenzunft «zum Seufzen» bezeugt, Andreas Heusler: Verfassungsges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
der Stadt Basel im Mittelalter, Basel 1860, 258 (corr. «Habsburg»).<br />
StadtA Biel CXXX.5, 299–303 (5. März 1558); LII 30 (10. März 1558); CXXIII.5,<br />
304f. (13. März 1558). Na<strong>ch</strong> dem Rei<strong>ch</strong>stag nahm si<strong>ch</strong> Kundigmann der Sa<strong>ch</strong>e an:<br />
StadtA Biel CXXIII.5, 307–309 (14. April 1558), 361f. (17. August 1559), 428f.<br />
(zwis<strong>ch</strong>en 24. April u. 3. Mai 1561); CXVII.44 (28. Januar 1563).<br />
Name in Ergänzung zu Bourquin, Biel (wie Anm. 30), 491.
106<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Item, wie z Stauffen an ein sÿlber ertz sige er [Funcklin] theilhafft gsin, sampt der<br />
von Hapsperg, Doctor Adam von Bodensteÿn 181 vnd einer von Frÿburg im Brißgouw,<br />
vnd villi<strong>ch</strong>t ander mer. Vermeint, es sige vil dahin gewendt [investiert] worden.<br />
182<br />
Die Angabe «z Stauffen» bezieht si<strong>ch</strong> vermutli<strong>ch</strong> auf ein ni<strong>ch</strong>t näher<br />
bestimmbares Gangbergwerk im S<strong>ch</strong>warzwälder Münstertal. 183 Angesi<strong>ch</strong>ts<br />
des notoris<strong>ch</strong>en Silbermangels in der Eidgenossens<strong>ch</strong>aft pflegten<br />
ges<strong>ch</strong>äftstü<strong>ch</strong>tige Privatpersonen Minen im umliegenden Ausland zu<br />
pa<strong>ch</strong>ten oder entspre<strong>ch</strong>ende Beteiligungen zu erwerben. 184 So s<strong>ch</strong>loss der<br />
Rat von Basel am 29. März 1560 mit Ludwig Wolf von Habsberg und<br />
seinen leider ni<strong>ch</strong>t namentli<strong>ch</strong> genannten «mittgewerckenn» einen Vertrag,<br />
womit si<strong>ch</strong> die Stadt die Ausbeute der Gruben am Todtnauer Berg<br />
(«Muggenbrunn» und «Zum Gau<strong>ch</strong>») gegen 10 Gulden die Mark und ein<br />
Darlehen von 2’000 Gulden si<strong>ch</strong>erte. 185 Wegen ungenügender Erträge<br />
musste das Abkommen 1562 sistiert werden. 186<br />
Diese Konnotation ma<strong>ch</strong>t es no<strong>ch</strong> wa<strong>hr</strong>s<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong>er, dass Habsberg<br />
& Co die Absi<strong>ch</strong>t hatten, si<strong>ch</strong> anlässli<strong>ch</strong> des Frankfurter Kurfürstentages<br />
1558 au<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>ürf- und Exportre<strong>ch</strong>te zu si<strong>ch</strong>ern.<br />
181<br />
182<br />
183<br />
184<br />
185<br />
186<br />
Sohn des Andreas Karlstadt, paracelsis<strong>ch</strong>er Arzt in Basel (1528–1577), vgl. Walther<br />
Killy: Literaturlexikon. Autoren und Werke deuts<strong>ch</strong>er Spra<strong>ch</strong>e, 15 Bde., Gütersloh<br />
u. a. 1988–1993, Bd. 2 (1989), 45f. (Lit.).<br />
StadtA Biel CLXVI.99, 10 r (20. April 1567).<br />
Vgl. die Übersi<strong>ch</strong>tskarten bei Wolfgang Werner u. Volker Dennert: Lagerstätten<br />
und Bergbau im S<strong>ch</strong>warzwald, Freiburg i. Br. 2004, 15, sowie bei Albre<strong>ch</strong>t S<strong>ch</strong>lageter:<br />
Zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Bergbaus im Umkreis des Bel<strong>ch</strong>en, in: Der Bel<strong>ch</strong>en, hg.<br />
v. Frank Baum, Karlsruhe 1989, 127–310, 200. Die im Folgenden skizzierten Gegebenheiten<br />
betra<strong>ch</strong>tet Herr Landesbergdirektor Dipl.-Ing. Volker Dennert, Freiburg,<br />
dem i<strong>ch</strong> für seine wertvollen Auskünfte herzli<strong>ch</strong> danke, als typis<strong>ch</strong>. Soweit<br />
i<strong>ch</strong> sehe, datieren die frühesten im Generallandesar<strong>ch</strong>iv Karlsruhe befindli<strong>ch</strong>en Dokumente<br />
über den Bergbau im Amt Staufen von 1572.<br />
Th[eodor] von Liebenau: Der Streit um das Leberthal-Silber. Ein Beitrag zur<br />
Münzges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts, in: Revue Suisse de Numismatique 9 (1899),<br />
265–281.<br />
Rudolf Thommen (Hg.): Urkundenbu<strong>ch</strong> der Stadt Basel, Bd. 10, Basel 1908, 451–<br />
453 (Nr. 425).<br />
Ri<strong>ch</strong>ard Hallauer: Der Basler Stadtwe<strong>ch</strong>sel 1504-1576. Ein Beitrag zur Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
der Staatsbanken, Basel 1904, 139. Zum Besitzerwe<strong>ch</strong>sel von Bergwerksteilen im<br />
S<strong>ch</strong>auinsland im Ja<strong>hr</strong>e 1563 vgl. Paul Priesner: Die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Gemeinde<br />
Hofsgrund (S<strong>ch</strong>auinsland), Bd. 1, Freiburg i. Br. 1987, 46.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 107<br />
5.5.2. Seifengewerbe S<strong>ch</strong>opfheim<br />
Eine weitere Vergesells<strong>ch</strong>aftung Funcklins mit Habsberg und anderen<br />
Personen, unter ihnen der Bieler Ratsherr und Lehensmüller Hans<br />
Glatt 187 und Onop<strong>hr</strong>ius Hürus 188 aus dem alten Konstanzer Bekanntenkreis,<br />
erwähnt der über die si<strong>ch</strong> verzweigenden Unternehmungen des<br />
ehemaligen Amtsbruders zunehmend besorgte Ambrosius Blarer im<br />
März 1564:<br />
Er [Funcklin] we<strong>ch</strong>st in groß ri<strong>ch</strong>tumb, aber no<strong>ch</strong> nun [nur] in der hoffnung. Sollts<br />
fa len, wurde er ou<strong>ch</strong> vnsuber vfston. Wa [wo] er gellt ers<strong>ch</strong>meckt, dz nympt er vff<br />
sampt sinen mitthafften, das sind der von Habsperg, Glatta, Noffel [Onop<strong>hr</strong>ius]<br />
Hürusß, waiß nitt, ob iren me<strong>hr</strong> sind. Habend einen grossen seiffen gwerb vnderhanden<br />
z S<strong>ch</strong>opffein [S<strong>ch</strong>opfheim], ist ein klen stettle vnder Basel; habend z Basel<br />
allein me<strong>hr</strong> dann tusend guldin vffgenommen ou<strong>ch</strong> bi vyl ander leuten. 189<br />
Wie die Witwe Anna Funcklin-Jeger im April 1567 zu Protokoll gibt,<br />
war i<strong>hr</strong> Mann Ende 1564 am Seifengewerbe zu S<strong>ch</strong>opfheim 190 mit 700<br />
Gulden beteiligt:<br />
Item, gly<strong>ch</strong> na<strong>ch</strong> Ruppes todt [Funcklins S<strong>ch</strong>wager] habe er [Funcklin] gon Basel<br />
vij c Gulden ges<strong>ch</strong>ickt, weist nit anders, dan er habs im seyff gwerb bru<strong>ch</strong>t. 191<br />
Au<strong>ch</strong> diese Ges<strong>ch</strong>äftsgründung lässt si<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t datieren. Viellei<strong>ch</strong>t rei<strong>ch</strong>t<br />
die Idee dazu ins Ja<strong>hr</strong> 1557 zurück, als Funcklin Wolfgang Musculus<br />
den Rat erteilte, «zeitig As<strong>ch</strong>e zu sammeln und zu kaufen» 192 , war do<strong>ch</strong><br />
187<br />
188<br />
189<br />
190<br />
191<br />
192<br />
Bourquin, Biel (wie Anm. 30), 163, 419.<br />
Bruder des bekannteren Hieronymus Hürus (Hyrus), HBBW 12, 102f.; des Rates<br />
1538–1548, vgl. Kindler, Ges<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>terbu<strong>ch</strong> (wie Anm. 177), 185; in den 1560er<br />
Ja<strong>hr</strong>en mit T. Blarer ges<strong>ch</strong>äftli<strong>ch</strong> verbunden, vgl. Blarer BW 3, Nrn. 2231, 2306,<br />
2343.<br />
Kantonsbibliothek St. Gallen, Vad. IX, 154 (A. Blarer an K. Blarer, 3. März 1564),<br />
na<strong>ch</strong> der Transkription ab originali von Herrn Prof. Dr. Max S<strong>ch</strong>iendorfer. Blarer<br />
BW 3, Nr. 2592 übersetzt ungenau «ein großes Gewerbe».<br />
Me<strong>hr</strong>ere Anfragen beim Museum der Stadt S<strong>ch</strong>opfheim blieben leider ohne Antwort.<br />
Zur historis<strong>ch</strong>en Seifenproduktion vgl. Robert Riemers<strong>ch</strong>mid: Die deuts<strong>ch</strong>e<br />
Seifenindustrie. Eine Darstellung der volkswirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Bedeutung i<strong>hr</strong>er te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en<br />
Entwicklung (Diss. rer. oec.), Mün<strong>ch</strong>en 1910.<br />
StadtA Biel CLXVI.99, fol. 13 v .<br />
Blarer BW 3, Nr. 2085 (W. Musculus an A. Blarer, 1. Februar 1557).
108<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
zur Herstellung von 1 kg Pottas<strong>ch</strong>e (K 2 CO 3 ), dem Ausgangsmaterial für<br />
Seife und Glas, die 700 bis 2’000fa<strong>ch</strong>e Menge Holz nötig (Tab. 1).<br />
5.6. Letzte Aktivitäten zu Funcklins Lebzeiten<br />
[38] Auf Ersu<strong>ch</strong>en seines Amtmanns Jakob Zwick ri<strong>ch</strong>tet Ludwig XVI.<br />
von Oettingen-Oettingen am 21. Mai 1558 ein Empfehlungssc<strong>hr</strong>eiben an<br />
den Herzog C<strong>hr</strong>istoph von Württemberg zugunsten der «maister» der<br />
Holzsparkunst. Unter anderem fü<strong>hr</strong>t der Graf aus, Konrad Egloff von<br />
Konstanz habe neuli<strong>ch</strong><br />
z Wien in Österrei<strong>ch</strong> bey der Ko [nigli<strong>ch</strong>en], jetzund Kaÿ[serli<strong>ch</strong>en] M[ajestä]t<br />
[…] die muster irer M[ajestä]t gema<strong>ch</strong>t<br />
und anerbiete si<strong>ch</strong> jetzt, zusammen mit Meister Hans Lobsinger von<br />
Nürnberg in Stuttgart oder wo immer Dur<strong>ch</strong>lau<strong>ch</strong>t es wüns<strong>ch</strong>e, Proben<br />
i<strong>hr</strong>es Könnens abzulegen. 193<br />
[39] Auf dieses Anerbieten reagiert der Württemberger am 28. Mai<br />
bemerkenswert unwillig:<br />
Wir lassen es ain kunst, ain kunst sein und gedenken hinfurter ko<strong>ch</strong>en und braten<br />
ze lassen, wie wir und unsere voreltern bisher au<strong>ch</strong> gethon haben. 194<br />
Der Gesinnungswandel des no<strong>ch</strong> unlängst an der «Holtzkunst» dur<strong>ch</strong>aus<br />
interessierten Fürsten steht vermutli<strong>ch</strong> im Zusammenhang mit dem peinli<strong>ch</strong>en<br />
Zwis<strong>ch</strong>enfall in Ulm, 195 den C<strong>hr</strong>istoph auf der Rückseite eines<br />
Briefes, in wel<strong>ch</strong>em Klaus von Grafeneck um die Empfehlung einer<br />
Kriegsmas<strong>ch</strong>ine höhernorts ersu<strong>ch</strong>t, bissig kommentiert (Abb. 10).<br />
193<br />
194<br />
195<br />
Wie Anm. 169. Zu Egloff und Lobsinger vgl. oben Nr. [32].<br />
BW Wirtemberg 4, Nr. 418 (28. Mai 1558).<br />
Siehe oben Nr. [33].
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 109<br />
Abb. 10: Herzog C<strong>hr</strong>istoph<br />
von Württemberg<br />
über Kriegs- und Holzkünste<br />
(24. September<br />
1558).<br />
«Mags lernen [le<strong>hr</strong>en] wen er will; hatt nit nott meinethalben;<br />
wirdet zuversi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> ain holtz kunst geli<strong>ch</strong> sein,<br />
da die von Ulm ir radthauß darob s<strong>ch</strong>ier verbrendt<br />
hetten –.» 196<br />
[40] Au<strong>ch</strong> in Bern ist der Ges<strong>ch</strong>äftsverlauf alles andere als zufriedenstellend.<br />
«Gantz fründtli<strong>ch</strong>» dankt man hier Funcklin am 21. Mai 1558 «für<br />
üwer müy vnd arbeit» und bes<strong>ch</strong>ämt ihn glei<strong>ch</strong>zeitig mit der Anweisung,<br />
er möge über den Ofen, «so ir vnns in vnnsere rhattstuben hand rüsten<br />
laßen», verfügen, da der alte «no<strong>ch</strong> gt vnd beständig» sei. 197 1558/59<br />
muss in der S<strong>ch</strong>miedenpfrund im Burgerspital ein neuer Ofen gesetzt<br />
werden, weil «der nüw kunst offen hat gefält.» 198<br />
196<br />
197<br />
198<br />
HStA Stuttgart, Adel Grafeneck (1558) = BW Wirtemberg IV Nr. 418, Anm. 2.<br />
StABE A II 215, 325; A III 30, 849 (21. Mai 1558), in Beantwortung eines (verlorenen)<br />
Briefes Funcklins vom 19. Mai. Es handelte si<strong>ch</strong> um einen zweiten Ofen, da<br />
der erste gemäss Vertrag vom 24. September 1557 installiert und im Mai 1558 bereits<br />
zu einem Drittel abbezahlt war, vgl. oben Nr. [26].<br />
Vgl. Hans Morgenthaler: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des Burgerspitals der Stadt Bern, Bern 1945,<br />
95.
110<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
[41] Es s<strong>ch</strong>eint, als habe die Grosse Probe in Wien 199 den kaiserli<strong>ch</strong>en<br />
Rat und Oberproviantkommissär Martin Peckher 200 bewogen, dem<br />
Holzspar-Konsortium Zwick & Frommer beizutreten und beim Kurfürsten<br />
August von Sa<strong>ch</strong>sen dafür zu werben. Im Hoflager zu Dresden demonstrieren<br />
die konzessionierten Hafner einen stubenoffen und wels<strong>ch</strong>en<br />
camin, desglei<strong>ch</strong>en einen verborgenen stubenoffen, au<strong>ch</strong> ein back- und<br />
ko<strong>ch</strong>offen sambt einem offen in eine badestuben. 201<br />
Gestützt auf das dur<strong>ch</strong>weg zufriedenstellende Resultat und die kaiserli<strong>ch</strong>e<br />
Freiheit von 1557 erlangt der «gesandte und mitconsorte» Peckher<br />
am 13. Juni 1558 – die Aversion des Kurfürsten 202 gegen das Konsortienwesen<br />
s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> mittlerweile gelegt zu haben – ein unbefristetes<br />
kursä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>es Privileg, 203 das die Inhaber alsbald in den Druck geben<br />
(Abb. 11).<br />
Abb. 11: Kurfürstli<strong>ch</strong>-<br />
Sä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>es Privileg vom<br />
13. Juni 1558 für Martin<br />
Peckher & Co. Unicum,<br />
im Angebot des Londoner<br />
Antiquariats von Susanne<br />
S<strong>ch</strong>ulz-Falster: Catalogue<br />
eight, o. O. [London] u. J.<br />
[ca. 2005], Nr. 88.<br />
[42] Ein polnis<strong>ch</strong>es Patent blieb dem Konsortium versagt, hingegen gelingt<br />
es dem Agenten John Bur<strong>ch</strong>er trotz besc<strong>hr</strong>änkter Mittel vor Ende<br />
Oktober 1558 eine litauis<strong>ch</strong>e Urkunde zu erhalten. 204<br />
199<br />
200<br />
201<br />
202<br />
203<br />
204<br />
Siehe oben bei Nr. [38].<br />
Martin Peckher von Wien wurde am 23. November 1560 geadelt, vgl. Franz-Karl<br />
Wißgrill: S<strong>ch</strong>auplatz des landsässigen Nieder-Oesterrei<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>en Adels, 2 Bde.,<br />
Wien 1795, Bd. 2, 360.<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 93.<br />
Vgl. bei Anm. 95.<br />
Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8), 93; Müller, Patents<strong>ch</strong>utz (wie Anm. 8), 943,<br />
947.<br />
Siehe oben Nr. [31]. Original Letters 2, Nr. 332 (J. Bur<strong>ch</strong>er an H. Bullinger, 27.<br />
Oktober 1558), vgl. Blarer BW 3, Nr. 2224 (A. Blarer an H. Bullinger, 16. Februar<br />
1560).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 111<br />
[43] Gemäss dem Polyhistor A<strong>ch</strong>illes P. Gasser (1505–1577) versu<strong>ch</strong>te<br />
Jakob Zwick 1559 in Augsburg Fuss zu fassen:<br />
In diesem Ja<strong>hr</strong> kam ein Constantzer, Nahmens Zwick, na<strong>ch</strong> Augspurg, wel<strong>ch</strong>er eine<br />
neue Art von Oefen, wordur<strong>ch</strong> viel Holtz ha tte erspa<strong>hr</strong>et werden sollen, erfunden,<br />
und die Kunst, dieselbe anzulegen, ein- und andere Personen ums Geld gele<strong>hr</strong>et;<br />
es erforderte aber die Zuri<strong>ch</strong>t- und Unterhaltung dieser Oefen so viele Unkosten,<br />
daß diese Kunst bald i<strong>hr</strong>en Credit verlo<strong>hr</strong>en. 205<br />
[44] In den letzten Tagen des Ja<strong>hr</strong>es 1560 wartet Jakob Zwick «bei den<br />
Seinen auf Briefe aus Me<strong>ch</strong>elberga». Offensi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> waren Funcklins<br />
Bemühungen auf dem Frankfurter Kurfürstentag ni<strong>ch</strong>t vergebli<strong>ch</strong> gewesen,<br />
au<strong>ch</strong> hatte das sä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>e Privileg genügend Wirkung gezeitigt, um<br />
die Betreiber der mecklenburgis<strong>ch</strong>en Salinen zu interessieren. 206 Um<br />
1560 standen in Betrieb die Werke Sülten, Sülze und Conow. 207<br />
6. Letzte Nac<strong>hr</strong>i<strong>ch</strong>ten<br />
6.1. Konkurrenz<br />
Ab 1560 zeigt die Bestandesentwicklung der holzsparenden Te<strong>ch</strong>nologien<br />
im Rei<strong>ch</strong> und in den Territorien ein stetiges Wa<strong>ch</strong>stum (Abb. 1).<br />
Folgeri<strong>ch</strong>tig sah si<strong>ch</strong> das Konsortium Zwick & Frommer in den beiden<br />
Dezennien 1558–1577 dem Druck von mindestens 17 aktenkundigen<br />
Konkurrenzunternehmungen ausgesetzt. 208 Der Wettbewerb war nur<br />
dur<strong>ch</strong> die Optimierung von Prinzip und Te<strong>ch</strong>nik, die Berücksi<strong>ch</strong>tung von<br />
205<br />
206<br />
207<br />
208<br />
Annales Augustani 1576, zitiert bei Paul von Stetten: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Heil. Ro m.<br />
Rei<strong>ch</strong>s Freyen Stadt Augspurg, Frankfurt u. a. 1743, 535.<br />
Vgl. oben, Nrn. [36] und [41], Blarer BW 3, Nr. 2306 (T. Blarer an A. Blarer, 31.<br />
Dezember 1560).<br />
Vgl. Georg C<strong>hr</strong>istian Friedri<strong>ch</strong> Lis<strong>ch</strong>: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Saline zu Sülten bei Brüel,<br />
in: Ja<strong>hr</strong>bü<strong>ch</strong>er des Vereins für Mecklenburgis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und Altertumskunde<br />
11 (1846), 157–161; August Theis: Die Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Saline zu Sülze, Peine<br />
1979; Friedri<strong>ch</strong> Stu<strong>hr</strong>: Zur älteren Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te der Saline zu Conow, in: Ja<strong>hr</strong>bü<strong>ch</strong>er<br />
des Vereins für Mecklenburgis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te und Altertumskunde 74 (1909),<br />
200–202.<br />
Vgl. Einzelheiten und Quellenhinweise in der bei Anm. 8 angegebenen Literatur.
112<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Surrogatbrennstoffen (Torf und Steinkohle) und dur<strong>ch</strong> Expansion auf<br />
grosste<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>e Anwendungsberei<strong>ch</strong>e zu gewinnen. Ansätze hierzu<br />
zeigte das Konsortium von Anfang an.<br />
Auf vier zum Teil se<strong>hr</strong> erfolgrei<strong>ch</strong> operierende Konkurrenten muss<br />
hier in der gebotenen Kürze hingewiesen werden, deren zeitli<strong>ch</strong>e, geographis<strong>ch</strong>e<br />
und sa<strong>ch</strong>systemis<strong>ch</strong>e Distanz zur Holzsparkunst von Zwick<br />
& Frommer derart gering ist, dass der Gedanke an Werkspionage oder<br />
Raubkopie mindestens ni<strong>ch</strong>t abwegig ers<strong>ch</strong>eint.<br />
6.1.1. Martin Stieber, Nürnberg<br />
1557 ma<strong>ch</strong>t der Nürnberger «cate<strong>ch</strong>ista» Gregor Forwerck, 209 der seinerzeit<br />
als «collaborator» an der Lateins<strong>ch</strong>ule zu Rothenburg o. T. erfa<strong>hr</strong>en<br />
hatte, «was kalt Stuben und teuer Holzkauf sei», den Rothenburger Rat<br />
auf eine erfolgrei<strong>ch</strong>e Holzsparkunst seines Na<strong>ch</strong>barn, des Golds<strong>ch</strong>mieds<br />
Martin Stieber, 210 aufmerksam. Dieser habe dafür eine Freiheit des Erzherzogs<br />
Ferdinand I. und einen Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief der Stadt Nürnberg<br />
erlangt. Zudem habe Stieber ein böhmis<strong>ch</strong>es Patent am Laufen. 211<br />
6.1.2. Jeremias Neuner & Co, Strassburg<br />
1571 rei<strong>ch</strong>t der vers<strong>ch</strong>uldete Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er Mi<strong>ch</strong>ael Kogmann beim<br />
Rat der Stadt Strassburg ein Unterstützungsgesu<strong>ch</strong> für eine 1563 entwickelte<br />
neue grossraumtaugli<strong>ch</strong>e Ko<strong>ch</strong>herd-Heizofen-Kombination ein,<br />
die ein Drittel des Brennholzes einsparen soll. An deren früherer Veröffentli<strong>ch</strong>ung<br />
habe ihn Friedri<strong>ch</strong> Frommers «holtz ersparungs Khunst, so<br />
zu Regenspurg A° 57 ediert, gehindert». Am 16. Juni 1572 erhalten Mi<strong>ch</strong>ael<br />
Kogmann, der Strassburger Festungsingenieur Jeremias Neuner<br />
209<br />
210<br />
211<br />
Gregor Forwerck von Pirna, 1543 Stadtsc<strong>hr</strong>eiber in Hammelburg, 1545–1548<br />
Le<strong>hr</strong>er in Rothenburg o. T., von 1553 bis zu seinem Tod 1576 Diakon (cate<strong>ch</strong>ista)<br />
an St. Egidien zu Nürnberg, vgl. Johannes Merz: Beziehungsgefle<strong>ch</strong>te von Eliten<br />
als Indikator religiöser Entwicklungslinien. Die Städte der Fürstabtei Fulda im 16.<br />
Ja<strong>hr</strong>hundert, in: AMRhKG 45 (1993), 213–258, 222, Anm. 23.<br />
Martin Stieber (Styber), Golds<strong>ch</strong>miedemeister in Nürnberg 1549/50, gest. 1592,<br />
vgl. Marc Rosenberg: Der Golds<strong>ch</strong>miede Merkzei<strong>ch</strong>en, 3 Bde., 3. Aufl., Frankfurt<br />
1922–1925, Bd. 3, 91 (Nr. 3902).<br />
[August S<strong>ch</strong>mitzlein?]: No<strong>ch</strong> ein Nürnberger Kunststück, in: Die Linde (Beilage<br />
zum Fränkis<strong>ch</strong>en Anzeiger) 10 (1920), 23f. Herrn Dr. Ri<strong>ch</strong>ard S<strong>ch</strong>mitt vom Verein<br />
Alt-Rothenburg danke i<strong>ch</strong> herzli<strong>ch</strong> für die ebenso freundli<strong>ch</strong>e wie ras<strong>ch</strong>e Zustellung<br />
des abgelegenen Artikels.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 113<br />
und der Wirt und Seifensieder Heinri<strong>ch</strong> Kogmann auf eine Holzsparkunst<br />
ein 10-jä<strong>hr</strong>iges kaiserli<strong>ch</strong>es Privileg, das sie no<strong>ch</strong> im glei<strong>ch</strong>en Ja<strong>hr</strong><br />
drucken lassen:<br />
Copey vnnd Abdruck der Roemis<strong>ch</strong>en Kayserli<strong>ch</strong>en Maiestat Freyheit den Erfindern<br />
der Holtzsparrungskunst. Geben zu Wienn am Kayserli<strong>ch</strong>en Hoff. Den 16. Junij<br />
Anno M.D.L.XXII. Getruckt zu Straßburg dur<strong>ch</strong> Theodosium Rihel [1572], 4<br />
Bll. 4°. 212<br />
Absatzgebiete des zunehmend diversifizierenden Konsortiums Neuner &<br />
Kogmann (gelegentli<strong>ch</strong> Neuner & Georg Zol<strong>ch</strong>er) sind: 1572 Lot<strong>hr</strong>ingen<br />
und Hessen, 1574 England, Frankrei<strong>ch</strong> und Kursa<strong>ch</strong>sen, 1580 Burgund.<br />
Dem kursä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>en Privilegierungsvorhaben legte Neuner Transsumpte<br />
über erfolgrei<strong>ch</strong>e Proben in Wien, Fritzlar, Kassel, Mansfeld, Leimba<strong>ch</strong>,<br />
Eisleben und Leipzig bei, zudem eine Empfehlung des Dietri<strong>ch</strong> von Kunowitz<br />
auf Hungaris<strong>ch</strong> Brod und Ostra in Mä<strong>hr</strong>en. 1575 erlangte Neuner<br />
die Erneuerung des Rei<strong>ch</strong>spatentes auf holzsparende Salzpfannen, Badfeuer,<br />
Färbe- und Braukessel sowie Stubenfeuer. 213<br />
6.1.3. Heinri<strong>ch</strong> Meyer von Züri<strong>ch</strong>-Höngg<br />
1575 setzt der Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er Heinri<strong>ch</strong> Meyer von Züri<strong>ch</strong>-Höngg 214 auf<br />
dem Zür<strong>ch</strong>er Rathaus einen Stubenofen mit der «nüw erfundenen holltzsparungskunst»,<br />
auf die er ein Patent bege<strong>hr</strong>t. 215 Mit na<strong>ch</strong>haltigem Erfolg<br />
installiert er 1576/77 Stuben- und Bratöfen sowie einen «jngemu<strong>hr</strong>ten<br />
Khessel» in den Häusern der Altbürgermeister von Mülhausen. 216 Einen<br />
Grossteil des Ja<strong>hr</strong>es 1579 verbringt Meyer in Ulm mit dem Bau von<br />
Öfen, Ko<strong>ch</strong>herden und Kesselheizungen. 217 1579 beguta<strong>ch</strong>tet der Hof-<br />
212<br />
213<br />
214<br />
215<br />
216<br />
217<br />
Vorhanden: Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire: M.113.812; Wolfenbüttel,<br />
Herzog August-Bibliothek: H: L 338.4° Helmst. (6); Göttingen: Niedersä<strong>ch</strong>sis<strong>ch</strong>e<br />
Staats- und Universitätsbibliothek: 8 OEC I, 3838.<br />
Vgl. Müller, Patents<strong>ch</strong>utz (wie Anm. 8), 942, Hiegel, Essais (wie Anm. 8), 307f.,<br />
Fu<strong>ch</strong>s, Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8), 1101–1104, Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie<br />
Anm. 8), 69, 73, 92.<br />
Teilnehmer an der Zür<strong>ch</strong>er Hirsebreifa<strong>hr</strong>t 1576 na<strong>ch</strong> Strassburg, J[acob] Bä<strong>ch</strong>told:<br />
Das glückhafte S<strong>ch</strong>iff von Züri<strong>ch</strong>, in: Mittheilungen der Antiquaris<strong>ch</strong>en Gesells<strong>ch</strong>aft<br />
20 (1880), 85–143, 114.<br />
Samuel Vögelin: Das Alte Züri<strong>ch</strong>, 2. Aufl., Züri<strong>ch</strong> 1878, 178f.<br />
Fu<strong>ch</strong>s, Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8), 1106.<br />
V. S<strong>ch</strong>mid, Beytrag (wie Anm. 170), 178–180.
114<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
und Landesar<strong>ch</strong>itekt Heinri<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>ickhardt d. J. (1558–1634) eine Vorfü<strong>hr</strong>ung<br />
der «Holtz Spa<strong>hr</strong> Kunst» des «Heinri<strong>ch</strong> Mäuer von Züri<strong>ch</strong>» in<br />
der Stuttgarter Hofwäs<strong>ch</strong>e. Weitere Na<strong>ch</strong>prüfungen erfolgen zu den von<br />
Meyer bereits umgesetzten Bauten bei einem Färber in der Esslinger<br />
Vorstadt und einem Badekessel in Göppingen. 218 Anfang 1585 erhält<br />
Meyer Gelegenheit zur einer grossen Probe in Bern. Na<strong>ch</strong> 5 Wo<strong>ch</strong>en, bei<br />
glei<strong>ch</strong>zeitiger Instruktion der örtli<strong>ch</strong>en Hafnermeister, erri<strong>ch</strong>tet er im<br />
Grossen Spital «stubenöffen und keßlen, die ingmuret», wofür ihm der<br />
Rat am 15. Februar 1585 ein Zeugnis ausstellt. 219<br />
6.1.4. Georg Waggenbü<strong>ch</strong>el von Konstanz<br />
Am 12. Juni 1575 ersu<strong>ch</strong>t Georg Waggenbü<strong>ch</strong>el die Badener Tagsatzung<br />
um einen eidgenössis<strong>ch</strong>en Kunds<strong>ch</strong>aftsbrief für seine «neue Holzkunst».<br />
Hiefür legt er entspre<strong>ch</strong>ende Beglaubigungen der Stadt Konstanz und des<br />
Abtes von Petershausen vor. 220<br />
6.2. Rinasce più gloriosa<br />
[45] Wie Phönix steigt das tot geglaubte Unternehmen von Zwick &<br />
Frommer na<strong>ch</strong> einer unerklärli<strong>ch</strong>en Quellenlücke von me<strong>hr</strong> als 16 Ja<strong>hr</strong>en<br />
– Jakob Funcklin, die Gebrüder Blarer, Wolfgang Musculus, Johannes<br />
Calvin und Guillaume Farel sind längst tot, Johannes Haller und Heinri<strong>ch</strong><br />
Bullinger 1575 gestorben – no<strong>ch</strong> einmal aus der As<strong>ch</strong>e: Am 17. August<br />
1576 unterzei<strong>ch</strong>net Kaiser Maximilian II. eine «Confirmatio vber<br />
ain holtzersparungskunst fur Jacoben Zwick et consortes» (Abb. 12). 221<br />
Bestätigt wird das Ferdinandeis<strong>ch</strong>e Rei<strong>ch</strong>spatent vom 13. März 1557,<br />
218<br />
219<br />
220<br />
221<br />
HStA Stuttgart N 220 T 11. Zu S<strong>ch</strong>ickhardt: Robert Kretzs<strong>ch</strong>mar (Hg.): Neue<br />
Fors<strong>ch</strong>ungen zu Heinri<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>ickhardt, Stuttgart 2002 (Lit.). S<strong>ch</strong>ickhardt hinterliess<br />
eine bisher zu wenig bea<strong>ch</strong>tete Reihe von kommentierten Quers<strong>ch</strong>nitten dur<strong>ch</strong><br />
holzsparende Öfen und Herde aus dem Zeitraum 1596/1634: HStA Stuttgart N 220<br />
T 47–49 und T 54–55.<br />
Vgl. Morgenthaler, Holzsparkunst (wie Anm. 118), 103f., Morgenthaler, Burgerspital<br />
(wie Anm. 197), 95.<br />
EA 4,2a, 566f.<br />
OeStA/HHStA/RHR, Grat Feud Gewerbe-, Fabriks- und Handlungsprivilegien<br />
607 r –614 r .
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 115<br />
begünstigt sind «Jacob Zwickh» sowie der na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong> beigefügte<br />
«Conradt Egloff sambt jren mitverwanten von Costentz» 222 .<br />
Abb. 12: «Confirmatio vber ain holtzersparungskunst fur Jacoben Zwick et consortes»<br />
vom 17. August 1576.<br />
Das Faszikel enthält a) Die «Confirmatio» des Kaiser Maximilian II. (607 r –608 r , 614 r );<br />
b) Das Transsumpt des Rei<strong>ch</strong>sprivilegs vom 13. März 1557 (609 r –610 v , 613 rv ); c) Die<br />
Supplikation von J. Zwick, C. Egloff und Mitverwandten (611 r –612 v ).<br />
222<br />
V. S<strong>ch</strong>mid, Beytrag (wie Anm. 170), 172 nennt überdies einen Veith Ziegler, der<br />
si<strong>ch</strong> «später» Zwick und Egloff anges<strong>ch</strong>lossen haben soll.
116<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Soweit wir sehen, ist dies die letzte dokumentierte Nac<strong>hr</strong>i<strong>ch</strong>t über die<br />
Gesells<strong>ch</strong>aft Zwick & Co, dieses Paradigma einer vergessenen Erfindung,<br />
die zu dem no<strong>ch</strong> grösseren Gebiet der fehlges<strong>ch</strong>lagenen Innovationen<br />
gehört. 223 Die deswegen bis heute ausgebliebene te<strong>ch</strong>nikgenetis<strong>ch</strong>e<br />
Wertung und Einordnung soll in den letzten beiden Abs<strong>ch</strong>nitten<br />
initiiert werden.<br />
7. Das Prinzip der «neuwen o ffen»<br />
Da die Urheber te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>er Innovationen jederzeit Na<strong>ch</strong>bauten zu befür<strong>ch</strong>ten<br />
hatten, befanden sie si<strong>ch</strong> auf einer steten «Gratwanderung zwis<strong>ch</strong>en<br />
Geheimhaltung und öffentli<strong>ch</strong>keitswirksamer Präsentation» 224 . So<br />
finden si<strong>ch</strong> im Sc<strong>hr</strong>iftenverke<strong>hr</strong> zum Privilegierungsverfa<strong>hr</strong>en zwar regelmässig<br />
weits<strong>ch</strong>weifige Aufzählungen aller Vorzüge der «nu w erfundenen<br />
kunst», do<strong>ch</strong> wird das zum Na<strong>ch</strong>bau notwendige Prinzip stets<br />
ausgeblendet. Die ersten Holzkunst-Publikationen im Sinne späterer<br />
Mas<strong>ch</strong>inenbü<strong>ch</strong>er und «books of secrets» 225 ers<strong>ch</strong>einen erst im 17. Ja<strong>hr</strong>hundert,<br />
es sind dies die wegweisende Holtzsparkunst 1618 von Franz<br />
Keßler und die Furnologia 1666 des Georg Andreas Böckler 226 . Immerhin<br />
ermögli<strong>ch</strong>en vier zeitgenössis<strong>ch</strong>en Quellen unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>er Provenienz<br />
einige vorsi<strong>ch</strong>tige Aussagen über die konstruktiven Merkmale und<br />
die Funktionsweise der neuen holzsparenden Feuerungen aus dem Angebot<br />
des Konsortiums Zwick & Frommer.<br />
223<br />
224<br />
225<br />
226<br />
Reinhold Bauer: Brau<strong>ch</strong>en wir eine «Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te des S<strong>ch</strong>eiterns»? Fehlges<strong>ch</strong>lagene<br />
Innovationen als Gegenstand der historis<strong>ch</strong>e Te<strong>ch</strong>nikgenesefors<strong>ch</strong>ung, in: Hamburger<br />
Wirts<strong>ch</strong>afts-C<strong>hr</strong>onik NF 4 (2004), 57–84.<br />
Popplow, Idealisierung (wie Anm. 31), Kapitel 3.4, 65–77.<br />
Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie Anm. 8), 84. Vgl. au<strong>ch</strong> William Eamon:<br />
Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern<br />
Culture, Princeton 1996.<br />
Franz Keßler: Holtzsparkunst. Das ist ein sol<strong>ch</strong> newe, zuvorn niemalhln gemein,<br />
no<strong>ch</strong> am Tag gewesene inuention etli<strong>ch</strong>er unters<strong>ch</strong>iedtli<strong>ch</strong>ere Kunsto fen, Frankfurt<br />
a. M. 1618, vgl. Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 169f. Georg Andreas<br />
Böckler: Furnologia, oder: Hausha ltli<strong>ch</strong>e Oefen-Kunst, Frankfurt a. M. 1666, vgl.<br />
Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 118–121.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 117<br />
7.1. «Wie i<strong>ch</strong> ym na<strong>ch</strong>denk …»<br />
7.1.1. Im Ans<strong>ch</strong>luss an Funcklins und Kundigmanns Berner Präsentation<br />
vom 11. Dezember 1556 in Bern versu<strong>ch</strong>t si<strong>ch</strong> Wolfgang Musculus<br />
die Wirkungsweise der neuen Ko<strong>ch</strong>herde zure<strong>ch</strong>t zu legen. Aufgefallen<br />
war ihm vor allem die indirekte Erwärmung der Ko<strong>ch</strong>häfen dur<strong>ch</strong> Heissluft:<br />
Wie i<strong>ch</strong> ym na<strong>ch</strong>denk, so würt der ko<strong>ch</strong>ofen uff die wyß syn wie ein distillirofen,<br />
also das das feür under den häfen seye und unders<strong>ch</strong>eiden mit einem interstitio<br />
[Zwis<strong>ch</strong>enraum], also das an die häfen weder flamm no<strong>ch</strong> rau<strong>ch</strong>, sonder allein die<br />
eingefangne hitz unden uffkhumme. 227<br />
7.1.2. Einen ähnli<strong>ch</strong> konstruierten Ko<strong>ch</strong>ofen mit Topfmulden («foramina»,<br />
«vasa») und seitli<strong>ch</strong> einzufü<strong>hr</strong>enden Bratspiessen («verua») hatte<br />
François Hotman wenige Monate später im Mai 1557 bei Johannes<br />
Sturm zu Strassburg gesehen. Als Prinzip aller neuen Öfen hebt Hotman<br />
in einem Brief an Calvin (Anh. 1) hervor: a) die Luftzufu<strong>hr</strong> an das<br />
Brenngut von unten her (so genannte Primärluft), b) die Rostfeuerung<br />
(«craticula»), c) den As<strong>ch</strong>enfall und d) die von Musculus ebenfalls verzei<strong>ch</strong>nete<br />
Trennung von «Rau<strong>ch</strong>» und Wärme dur<strong>ch</strong> den Einsatz eines<br />
Heizkessels («cacabus»). 228 Hotmans verhältnismässig präzise Besc<strong>hr</strong>eibung<br />
erlaubt die Rekonstruktion eines Sparherdmodells frühester Ma<strong>ch</strong>art<br />
na<strong>ch</strong> Zwick & Frommer (Abb. 13).<br />
7.1.3. Von der historis<strong>ch</strong>en Ofenbaukunde gänzli<strong>ch</strong> unbea<strong>ch</strong>tet<br />
enthalten die Collectaneen des C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß (1512–1584) von<br />
Konstanz eine ausfü<strong>hr</strong>li<strong>ch</strong>e Darstellung und Bewertung von se<strong>ch</strong>s Anlagen<br />
der «Holtz sparung» (Anh. 2), 229 wie sie um 1557/58 in seiner Heimatstadt<br />
aufgestellt worden waren.<br />
227<br />
228<br />
229<br />
Blarer BW 3, Nr. 2080 (W. Musculus an A. Blarer, 12. Dezember 1556). Ans<strong>ch</strong>auli<strong>ch</strong>e<br />
Modelle von zeitgenössis<strong>ch</strong>en Destillieröfen bei Walter Ryff: Das new groß<br />
Distillierbu<strong>ch</strong>, Frankfurt a. M. 1545.<br />
CO 16, Nr. 2638 (F. Hotman an J. Calvin, 28. Mai 1557). François Hotman:<br />
Re<strong>ch</strong>tsgele<strong>hr</strong>ter und politis<strong>ch</strong>er Sc<strong>hr</strong>iftsteller, seit 1556 Professor für römis<strong>ch</strong>es<br />
Re<strong>ch</strong>t in Strassburg, vgl. Mi<strong>ch</strong>ael Hausin: Art. Hotman, François, in: BBKL 29<br />
(2008), 698–701 (Lit.).<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen (wie Anm. 19), 38½–39.
118<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Abb. 13: Topfherd na<strong>ch</strong> Zwick & Frommer<br />
1557. (Rekonstruktion H. R. Lavater)<br />
na<strong>ch</strong> der autoptis<strong>ch</strong>en Besc<strong>hr</strong>eibung von<br />
François Hotman, Strassburg.<br />
Abb. 14: «Ko<strong>ch</strong>ofen mit zweyen Ha -<br />
fen», aus Franz Keßler: Holtzsparkunst,<br />
Frankfurt 1618 (Fig. 30 zu<br />
Kap. 26).<br />
a) Bei Stubenofen I handelt es si<strong>ch</strong> um einen Plattenofen mit Brat- und<br />
Koc<strong>hr</strong>ö<strong>hr</strong>e. Die hohe Dampfemission ma<strong>ch</strong>te ihn indessen für den<br />
Wohnberei<strong>ch</strong> ungeeignet. b) Charakteristis<strong>ch</strong> für Stubenofen II sind drei<br />
aus einem Feuerkasten heraus gefü<strong>hr</strong>te, untereinander verbundene Heizro<strong>hr</strong>e<br />
(viellei<strong>ch</strong>t ähnli<strong>ch</strong> Abb. 15). Diese Radiatoren unterlagen offenbar<br />
vors<strong>ch</strong>nellem Vers<strong>ch</strong>leiss. c) Stubenofen III mit Luftzufu<strong>hr</strong> von unten<br />
und Rostfeuerung weist die von Hotman festgestellten Hauptmerkmale<br />
des Strassburger Ofens auf. Zusätzli<strong>ch</strong> werden hier die brennenden<br />
Rau<strong>ch</strong>gase aus dem Feuerungsraum in einen oberen Brennraum oder liegenden<br />
Zug («boden») geleitet, wo sie zu weiterer Nutzwärme verbrennen,<br />
bevor sie dur<strong>ch</strong> einen Sturzzug («ain ror von ziegeln») in den Kamin<br />
geleitet werden (für das Prinzip vgl. Abb. 16). Dur<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>liessen<br />
aller Öffnungen und der Drosselklappe («das ober rô<strong>ch</strong>lo<strong>ch</strong>») na<strong>ch</strong> dem<br />
Abbrand wird die Wärme im Ofen behalten. «Das was die best gattung»,<br />
lautet das Urteil des dur<strong>ch</strong>aus kritis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>ulthaiß. d) Mit dem Spareffekt<br />
des im Feuerungsberei<strong>ch</strong> analog konstruierten beheizbaren Was<strong>ch</strong>kessels<br />
(vgl. Abb. 17) war S<strong>ch</strong>ulthaiß ebenfalls zufrieden: «I<strong>ch</strong> hab ain<br />
bü<strong>ch</strong>offen lassen ma<strong>ch</strong>en; was gut.» e) Weniger brau<strong>ch</strong>bar s<strong>ch</strong>eint der<br />
zweistöckige Backofen gewesen zu sein, bei wel<strong>ch</strong>em der untere «boden»<br />
den oberen erwärmen sollte. g) Der mit Hotmans Topfofen (Abb.<br />
13) bauähnli<strong>ch</strong>e Ko<strong>ch</strong>ofen – er besass statt der Bratspiesse ein Bratro<strong>hr</strong> –
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 119<br />
hatte zwar einen annehmbaren Wirkungsgrad, war aber umständli<strong>ch</strong> zu<br />
bedienen.<br />
Abb. 15: S<strong>ch</strong>iffs- oder<br />
Kontorofen aus Georg<br />
Andreas Böckler: Furnologia,<br />
Frankfurt 1666<br />
(Fig. G zu Kap. VIII).<br />
Abb. 16: «Ein se<strong>hr</strong> nutzbare<br />
arth s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>tes<br />
[s<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>tes] Kunstofens»,<br />
aus Franz Keßler: Holtzsparkunst,<br />
Frankfurt 1618<br />
(Fig. 25 zu Kap. 23).<br />
Abb. 17: «Braw-, Fa rb-,<br />
Siedt- oder Was<strong>ch</strong>kessel»,<br />
aus Franz Keßler: Holtzsparkunst,<br />
Frankfurt 1618<br />
(Fig. 31 zu Kap. 28).<br />
7.2. Die ‹Mülhauser Holzkunst›<br />
7.2.1. Die se<strong>ch</strong>s Ofen- und Herdmodelle<br />
1832 fanden die Holzs<strong>ch</strong>nitte eines anonymen Mülhauser Druckes von<br />
1564 (Abb. 18b) mit dem etwas seltsamen Titel Holtzkunst / Verzei<strong>ch</strong>nuß<br />
der figuren und neuwen o fen / von der ersparung der neuwen erfundenen<br />
Holtzkunst erstmals die Aufmerksamkeit der Kunsthistoriker, 230 wenig<br />
später der Antiquare und der Bibliophilen. So bes<strong>ch</strong>enkte der Strassburger<br />
Privatgele<strong>hr</strong>te, Bibliomane und Drucker Paul Heitz 1886 seine<br />
Freunde mit einem unkommentierten Faksimile der ‹Mülhauser Holzkunst›,<br />
wie wir sie abkürzend nennen wollen, «na<strong>ch</strong> dem Unicum in der<br />
Zür<strong>ch</strong>er Stadtbibliothek» 231 . Do<strong>ch</strong> bereits 1888 ma<strong>ch</strong>te Charles S<strong>ch</strong>midt<br />
230<br />
231<br />
Vgl. unten, Kap. 7.2.4.<br />
Vgl. unten, Anh. 3 C.
120<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
in seiner Toxites-Biographie auf eine frühere Auflage von 1563 aufmerksam<br />
(Abb. 18a). 232<br />
Abb. 18a (Ai r ) Abb. 18b (Ai r )<br />
Titelblätter der 1563 und 1564 bei Peter S<strong>ch</strong>mid zu Mülhausen gedruckten anonymen<br />
Bildflugsc<strong>hr</strong>ift mit fünfzehn Holzs<strong>ch</strong>nitten von holzsparenden Stuben-, Brat-, Ko<strong>ch</strong>und<br />
Backöfen. (Besc<strong>hr</strong>eibung der Drucke in Anh. 3a.b.)<br />
Seither fü<strong>hr</strong>en die furnologis<strong>ch</strong>e Standardwerke die ‹Mülhauser Holzkunst›<br />
gerne als illustratives Beispiel für erste Holzsparversu<strong>ch</strong>e aus der<br />
zweiten Hälfte des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts an, ohne jedo<strong>ch</strong> über den Sitz im<br />
Leben dieser erratis<strong>ch</strong>en Publikation Genaues beizubringen. 233<br />
Da die s<strong>ch</strong>male Bros<strong>ch</strong>üre nur aus Titelblatt, Übersc<strong>hr</strong>iften, kargen Legenden<br />
und Holzs<strong>ch</strong>nitten ohne erklärenden Text besteht, ist es zu verstehen,<br />
dass diese Holtzkunst im Unters<strong>ch</strong>ied zu den Holzkünsten von<br />
Keßler und Böckler in der eins<strong>ch</strong>lägigen Historiographie bislang wenig<br />
Bea<strong>ch</strong>tung gefunden hat. Die 15 Illustrationen von insgesamt se<strong>ch</strong>s<br />
Ofen- und Herdmodellen laden indessen zum Blättern ein.<br />
a) «Der erst Stobenofen» (Abb. 19a) besitzt einen dur<strong>ch</strong> verzierte<br />
s<strong>ch</strong>male Eckka<strong>ch</strong>eln begrenzten massiven langre<strong>ch</strong>teckigen Unterbau.<br />
232<br />
233<br />
C[harles] S<strong>ch</strong>midt: Mi<strong>ch</strong>ael S<strong>ch</strong>ütz genannt Toxites, Strassburg 1888, 60, Anm. 50.<br />
Vgl. etwa Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 91f. (Druckja<strong>hr</strong> 1567); 364,<br />
Anm. 44 (Druckja<strong>hr</strong> 1564). Rosemarie Franz: Der Ka<strong>ch</strong>elofen, 2. Aufl., Graz 1981,<br />
74 (Autor: Peter S<strong>ch</strong>mid).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 121<br />
Unklar ist die materielle Bes<strong>ch</strong>affenheit der grossen Mittelfelder. 234 Eine<br />
Seite des Feuerungskastens ist mit der Wand verbunden, dur<strong>ch</strong> die er<br />
von aussen beheizt wird. Der bogenförmige Eins<strong>ch</strong>nitt des Sockels gibt<br />
den Blick frei auf den ummauerten Teil des Luft- bzw. As<strong>ch</strong>enlo<strong>ch</strong>s.<br />
Darüber erhebt si<strong>ch</strong> wa<strong>hr</strong>s<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> ein Heizkessel, 235 dessen Abwärme<br />
dur<strong>ch</strong> den Gitterrost im oberen Abs<strong>ch</strong>luss des Unterbaus entwei<strong>ch</strong>en<br />
kann. Zusätzli<strong>ch</strong>e Konvektionswärme wird dur<strong>ch</strong> die Radiatoren des<br />
vierfa<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enen, vermutli<strong>ch</strong> keramis<strong>ch</strong>en Oberbaus abgegeben.<br />
236 Die Verlängerung der Rau<strong>ch</strong>gaswege und deren Ableitung auf<br />
Höhe der freiplastis<strong>ch</strong> gestalteten Bekrönung mit dem Zür<strong>ch</strong>er und Bieler<br />
Wappen verspri<strong>ch</strong>t zusätzli<strong>ch</strong>e Holzökonomie.<br />
b) «Der ander Stobenofen» (Abb. 19b) s<strong>ch</strong>eint in einigem Abstand<br />
von der Wand zu stehen. Dadur<strong>ch</strong> kann in Verbindung mit dem von vier<br />
Füssen gestützten, frei über dem Boden erhobenen Feuerungskasten ein<br />
beträ<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>er Zuwa<strong>ch</strong>s an Wärmestrahlung errei<strong>ch</strong>t werden. Der Unterbau<br />
besitzt eine seitli<strong>ch</strong>e Feuertüre und ein von vorne bes<strong>ch</strong>ickbares<br />
Bratro<strong>hr</strong> («Ko<strong>ch</strong>ka<strong>ch</strong>el») mit hinauf klappbarer Doppeltüre. 237 Besonders<br />
aufwändig gehalten sind die Füllungen des dreifa<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enen<br />
Oberofens (antithetis<strong>ch</strong>e Delphine, kämpfende Reiter) sowie die von<br />
zwei vollplastis<strong>ch</strong>en fackeltragenden Putten gehaltene krönende Halbtonne<br />
mit dem Mülhauser Wappen im Bogenfeld.<br />
c) «Der dritte Stobenofen» (Abb. 19c) übernimmt auf doppelbogigem<br />
Sockel vom ersten Ofen den Unterbau und vom zweiten den Oberbau,<br />
diesen allerdings ohne Füllungen. Im Bogenfeld der rollwerkgekrönten<br />
Halbtonne das Basler Wappen. Auf und neben dem As<strong>ch</strong>ekasten<br />
findet si<strong>ch</strong> die Signatur des Forms<strong>ch</strong>neiders (vgl. au<strong>ch</strong> Abb. 23).<br />
234<br />
235<br />
236<br />
237<br />
Eine «Kombination von Eisenplatten und Ka<strong>ch</strong>eln» vermutet Ingeborg Unger: Kölner<br />
Ofenka<strong>ch</strong>eln. Die Bestände des Museums für Angewandte Kunst und des Kölnis<strong>ch</strong>en<br />
Stadtmuseums, Köln 1988, 10. 1558 wollte si<strong>ch</strong> der Graf von Oettingen einen<br />
holzsparenden Ko<strong>ch</strong>ofen «von erden vnd nit ple<strong>ch</strong>» setzen lassen, vgl. oben bei<br />
Anm. 169.<br />
Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 91 denkt an einen «mitten dur<strong>ch</strong> den<br />
Feuerraum gelegten Warmlufts<strong>ch</strong>a<strong>ch</strong>t», viellei<strong>ch</strong>t Hotmans «cacabus», vgl. Anh. 1.<br />
Unger, Ofenka<strong>ch</strong>eln (wie Anm. 233), 41f. spri<strong>ch</strong>t diesen Aufbauten «reinen<br />
S<strong>ch</strong>muckzweck» zu. Drei nebeneinander angeordnete Ro<strong>hr</strong>e erwähnt S<strong>ch</strong>ulthaiß,<br />
vgl. Anh. 2, [2].<br />
Vgl. den Stuben-Ko<strong>ch</strong>ofen bei S<strong>ch</strong>ulthaiß, Anh. 2, [1].
122<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Abb. 19a (Aij r ) Abb. 19b (Aij v ) Abb. 19c (Aiij r )<br />
Abb. 19a–c: Die drei holzsparenden Stubenöfen aus der ‹Mülhauser Holtzkunst› 1563<br />
bzw. 1564.<br />
Abb. 20a (Aiij v ) Abb. 20b (Aiiij r )<br />
Abb. 20 a–b: Zwei holzsparende Brat- und Ko<strong>ch</strong>öfen aus der ‹Mülhauser Holtzkunst›<br />
1563 bzw. 1564.<br />
d) Die «bratt vnd ko<strong>ch</strong>o fen» gab es in zwei lei<strong>ch</strong>t differierenden Ausfü<strong>hr</strong>ungen.<br />
1) Ein kombinierter Back-/Ko<strong>ch</strong>herd auf drei Etagen mit wandseitigem<br />
Bratro<strong>hr</strong>, berostetem Feuerungsraum und Luftlo<strong>ch</strong>/As<strong>ch</strong>efall;<br />
vorgelagert ein analog befeuerter Topfherd mit drei Ko<strong>ch</strong>mulden; 238<br />
238<br />
Vgl. die Topfherde bei Hotman (Abb. 13), S<strong>ch</strong>ulthaiß (Anh. 2, [6]).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 123<br />
dazwis<strong>ch</strong>en ein von den bena<strong>ch</strong>barten Ofenteilen erwärmter Backofen 239<br />
(Abb. 20a). 2) Die Illustration des bauähnli<strong>ch</strong>en zweiten Modells ist<br />
zweigeteilt: oben ein Brat-/Kasserollenherd mit zwei Ko<strong>ch</strong>mulden, unten<br />
der Herdsockel mit einem System von liegenden Rau<strong>ch</strong>gaszügen (Abb.<br />
20b).<br />
e) Die nä<strong>ch</strong>sten drei Blätter zeigen einen «ba<strong>ch</strong>ofen mit seinen<br />
bo den stuckweisz», d. h. eine von unten na<strong>ch</strong> oben gehende Explosivdarstellung<br />
der se<strong>ch</strong>s Etagen in Draufsi<strong>ch</strong>t (Abb. 21 re<strong>ch</strong>ts) sowie die Aussenansi<strong>ch</strong>t<br />
des ganzen Backofens (Abb. 21 links), der mit dem von<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß besc<strong>hr</strong>iebenen Modell Nr. 5 identis<strong>ch</strong> s<strong>ch</strong>eint. 240<br />
Abb. 21: Holzsparender Backofen aus der ‹Mülhauser Holtzkunst› 1563 bzw. 1564.<br />
links: ba<strong>ch</strong>ofen gantz mit dreyen thürlein oder mundlo <strong>ch</strong>ern (Av v ).<br />
re<strong>ch</strong>ts: Explosionsdarstellung der se<strong>ch</strong>s bo den (Av v –Av r ), (Montage H. R. Lavater).<br />
Legende: (1) Sockel mit Lufftlo<strong>ch</strong> oder a s<strong>ch</strong>enlo<strong>ch</strong> A. (2) Feuerraum mit Rost und Befülltüre<br />
B für Brennholz (das eynfeüren). (3) Backro<strong>hr</strong> (kast) mit Befülltür C für das<br />
Backgut (Eyns<strong>ch</strong>iessen). Steigende Züge (ho ly) auf drei Seiten. c: S<strong>ch</strong>ieber oder Stopfen<br />
für die Luftzufu<strong>hr</strong> oder die Dampfableitung (?). (4) Liegende Züge (ho ly). Rau<strong>ch</strong>gaswege<br />
unklar. (5) analog 3. (6) Steigende Züge (seitli<strong>ch</strong>: Rau<strong>ch</strong>, Mitte: Dampf?). (7) Abde-<br />
239<br />
240<br />
Vgl. das bei S<strong>ch</strong>ulthaiß, Anh. 2, [5] besc<strong>hr</strong>iebene Prinzip.<br />
S<strong>ch</strong>ulthaiß, Anh. 2, [5].
124<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
ckung (der oberste boden des ba<strong>ch</strong>ofens) mit Drosselklappe (fürs<strong>ch</strong>ub) b und Ableitung<br />
der Rau<strong>ch</strong>gase in den Kamin.<br />
1–7 = bo den; B, C, E = thürlein oder mundlo <strong>ch</strong>er.<br />
Unter der Voraussetzung ri<strong>ch</strong>tiger Interpretation der unklaren Massangabe bei boden B<br />
und der Masshaltigkeit der Darstellung, hätte dieser Backofen (1 Zoll = 2.5cm) die Abmessungen<br />
H 87.5 x B 75 x T 62.5 cm.<br />
7.2.2. Zuordnung des anonymen Druckes von 1563 und 1564<br />
Die erstmals von Rolf-Jürgen Gleitsmann 1985 geäusserte Vermutung,<br />
es könnte zwis<strong>ch</strong>en der ‹Mülhauser Holzkunst› und den «Aktivitäten des<br />
seit 1556 se<strong>hr</strong> erfolgrei<strong>ch</strong> agierenden Fromers<strong>ch</strong>en Holzsparkonsortiums»<br />
ein Zusammenhang bestehen, 241 kann dur<strong>ch</strong> me<strong>hr</strong>ere Beoba<strong>ch</strong>tungen<br />
bestätigt werden: a) Die von François Hotman und C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß<br />
besc<strong>hr</strong>iebenen Ofenmodelle des Konsortiums Zwick & Frommer<br />
lassen si<strong>ch</strong> allesamt zwanglos auf die Illustrationen des Mülhauser Druckes<br />
beziehen. b) Alle drei dort abgebildeten Stubenöfen fü<strong>hr</strong>en in i<strong>hr</strong>en<br />
freiplastis<strong>ch</strong> gestalteten Kranzka<strong>ch</strong>eln (Abb. 22), Trophäen glei<strong>ch</strong>, die<br />
Hoheitszei<strong>ch</strong>en von Städten, zu denen das Konsortium Zwick & Frommer<br />
erwiesenermassen ges<strong>ch</strong>äftli<strong>ch</strong>e Beziehungen hatte: Züri<strong>ch</strong>, Biel,<br />
Mülhausen und Basel. c) Für die Drucklegung der Holtzkunst in Mülhausen<br />
spre<strong>ch</strong>en die freunds<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en und ges<strong>ch</strong>äftli<strong>ch</strong>en Kontakte, die<br />
Jakob Funcklin na<strong>ch</strong> diesem Zugewandten Ort der Eidgenossens<strong>ch</strong>aft<br />
pflegte. In Mülhausen versah der mit Funcklin glei<strong>ch</strong>zeitig aus Konstanz<br />
vertriebene Martin Wetzler seit 1554 ein Pfarramt. 242 Mit einem persönli<strong>ch</strong>en<br />
Einsatz von 51 fl hatte der Exulant im Frühsommer 1557 zur<br />
Gründung der vom Rat mit 400 fl kreditierten ersten Mülhauser Druckerei<br />
Peter S<strong>ch</strong>mid & Hans S<strong>ch</strong>irenbrand beigetragen. 243 Anfang 1557 (?)<br />
241<br />
242<br />
243<br />
Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie Anm. 8), 84f., 91 (Ausgabe 1563). Den wertvollen<br />
briefli<strong>ch</strong>en Austaus<strong>ch</strong> mit dem Autor (Anfang 1987) verdanke i<strong>ch</strong> der<br />
freundli<strong>ch</strong>en Vermittlung von Herrn Prof. Dr. Hans-Jürgen Goertz, Hamburg. Die<br />
Autors<strong>ch</strong>aft Frommers zieht der Katalog der BNU Strasbourg (Holtzkunst 1564)<br />
aufgrund einer handsc<strong>hr</strong>iftli<strong>ch</strong>en Notiz von [Johann Wilhelm] Baum (1809–1878)<br />
in Erwägung.<br />
Ernest Meininger: Les Pasteurs à Mulhouse, in Mitteilungen des Historis<strong>ch</strong>en<br />
Museums von Mülhausen 43 (1923), 65–112, 76. Rublack, Einfü<strong>hr</strong>ung (wie Anm.<br />
102), 161.<br />
Vgl. neuerdings C<strong>hr</strong>istoph Reske: Die Bu<strong>ch</strong>drucker des 16. und 17. Ja<strong>hr</strong>hunderts<br />
im deuts<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>gebiet, Wiesbaden 2007, 621f. (Lit.), leider ohne Berücksi<strong>ch</strong>-
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 125<br />
Abb. 22: Kranzka<strong>ch</strong>eln der Stubenöfen<br />
(Abb. 19a–c) mit den Hoheitszei<strong>ch</strong>en<br />
der Städte Züri<strong>ch</strong> und Biel<br />
(oben), Mülhausen (Mitte), Basel<br />
(unten).<br />
Abb. 23: Monogramm des Forms<strong>ch</strong>neiders<br />
‹HBW› mit S<strong>ch</strong>neidmesser<br />
auf dem Sockel dritten Stubenofens<br />
(vgl. Abb. 19c).<br />
fand hier Funcklins «edle kunst» Absatz und Werts<strong>ch</strong>ätzung, 244 wie die<br />
Kranzka<strong>ch</strong>el von Stubenofen II (Abb. 22) stolz verkündet. Zur besseren<br />
Bewerbung seiner Produkte s<strong>ch</strong>eint das von Funcklin vertretene Konsortium<br />
re<strong>ch</strong>t bald, spätestens 1563, den Druck einer illustrierten Kundenmappe<br />
(«Verzei<strong>ch</strong>nuß der figuren»!) ins Auge gefasst zu haben – im 16.<br />
Ja<strong>hr</strong>hundert ein absolutes Novum, gab es do<strong>ch</strong><br />
wä<strong>hr</strong>end dieser Zeitspanne, viellei<strong>ch</strong>t mit Ausnahme einer 1563 bei Peter S<strong>ch</strong>midt<br />
zu Mühlhausen [!] gedruckten Bildflugsc<strong>hr</strong>ift, keine einzige im te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Sinne<br />
hinrei<strong>ch</strong>end aufs<strong>ch</strong>lußrei<strong>ch</strong>e Publikation zum Themenkomplex Holzsparkünste. 245<br />
244<br />
245<br />
Ein diesbezügli<strong>ch</strong>er Druckauftrag Funcklins an die unterstützungsbedürftige<br />
Mülhauser Offizin hatte dieser und deren Kreditoren gegenüber<br />
den Charakter einer Gefälligkeit und eines Gegenges<strong>ch</strong>äfts – ni<strong>ch</strong>t weniger<br />
als jene Anthologie von Predigten Ambrosius Blarers «wider tod<br />
vnnd sterben», die Funcklin im Frühsommer 1561 bei Peter S<strong>ch</strong>mid hatte<br />
herausbringen wollen, samt einer Dedikation an den «Burgermeister vnd<br />
Rat der statt Mülhusen […] gegen vilfaltiger Eer, liebe vnnd fründtung<br />
der wi<strong>ch</strong>tigen Korrektur von Rainer Henri<strong>ch</strong>: Neues über Fros<strong>ch</strong>auers Korrektor<br />
Peter S<strong>ch</strong>mid von Bis<strong>ch</strong>ofszell, in: Zwa 18 (1990/91), 390–392.<br />
Vgl. oben im Text bei Anm. 129.<br />
Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie Anm. 8), 84.
126<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
s<strong>ch</strong>afft, so mir von euwer F[ürsi<strong>ch</strong>tigen] E[rsamen] W[ysheit] mermalen<br />
erzeigt vnnd bewisen worden» 246 . d) Anfang 1557 bat Wolfgang Musculus<br />
die Zwick um allfällige Unterlagen über die neuen Sparöfen. Jakob<br />
Zwick verspra<strong>ch</strong> zwar umgehend «das Beste», ersu<strong>ch</strong>te ihn jedo<strong>ch</strong>, «die<br />
Enthüllung abzuwarten» 247 , stand do<strong>ch</strong> die Erfindung unmittelbar vor<br />
i<strong>hr</strong>er Rei<strong>ch</strong>sprivilegierung, die denn am 13. März au<strong>ch</strong> erfolgen sollte.<br />
Dass es zu diesem Zeitpunkt eine Besc<strong>hr</strong>eibung der Holtzkunst und vermutli<strong>ch</strong><br />
au<strong>ch</strong> entspre<strong>ch</strong>ende Zei<strong>ch</strong>nungen gab, die man hätte enthüllen<br />
können, darf vorausgesetzt werden, mussten do<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>e bereits anlässli<strong>ch</strong><br />
des Patentantrages eingerei<strong>ch</strong>t werden. 248 Es war ein besonderer<br />
Vertrauensbeweis, dass Ambrosius Blarer dem ungeduldigen Freund Ende<br />
Februar 1557 ein Exemplar «organum hypocausticum» vorzeitig zur<br />
Ansi<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>ickte. Gerne, sc<strong>hr</strong>ieb Musculus zurück, würde er jetzt au<strong>ch</strong><br />
no<strong>ch</strong> «die anderen organa, coquinarium et pistorium», sehen: «I<strong>ch</strong> werde<br />
sie zurückgeben und s<strong>ch</strong>weigen» 249 . Bei dieser Aufzählung muss auffallen,<br />
dass die von Musculus genannten organa mit den Übersc<strong>hr</strong>iften der<br />
‹Mülhauser Holzkunst› in Nomenklatur und Abfolge exakt übereinstimmen:<br />
«organum hypocausticum»: «stobenofen», «organum coquinarium»:<br />
«nun volgent die bratt vnd ko<strong>ch</strong>o fen», «organum pistorium»:<br />
«ba<strong>ch</strong>ofen». – Gab es denn eine ‹Mülhauser Holtzkunst› vor 1563?<br />
7.2.3. ‹Mülhauser Holtzkunst› 1557<br />
Im April 1559 trennten si<strong>ch</strong> die Partner der Offizin S<strong>ch</strong>mid & S<strong>ch</strong>irenbrand.<br />
Das bei dieser Gelegenheit erstellte und glückli<strong>ch</strong>erweise erhaltene<br />
«Verzei<strong>ch</strong>nuss der Truckery zn Barfssern» nennt unter der Rubrik<br />
«ges<strong>ch</strong>nittenen figuren und alphabet» unter anderen au<strong>ch</strong> «15 figuren in<br />
die holtzkunst». Darunter verstand Joseph Coudre, der frankophone Herausgeber<br />
des historis<strong>ch</strong>en Inventars, «les bois de différents modèles<br />
246<br />
247<br />
248<br />
249<br />
Funcklins Vorrede vom 1. März 1561, 3 v . Da Blarer Funcklins eigenmä<strong>ch</strong>tige<br />
Drucklegung in Mülhausen erfolgrei<strong>ch</strong> hintertrieben hatte, ers<strong>ch</strong>ien die Predigtsammlung<br />
na<strong>ch</strong> einem hüben wie drüben s<strong>ch</strong>arf gefü<strong>hr</strong>ten Briefwe<strong>ch</strong>sel s<strong>ch</strong>liessli<strong>ch</strong><br />
in Züri<strong>ch</strong>: Ambrosius Blarer: Der geistli<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>atz C<strong>hr</strong>istenli<strong>ch</strong>er vorbereitung<br />
vnd glo ubigs trosts wider tod vnnd sterben, Züri<strong>ch</strong> (C<strong>hr</strong>. Fros<strong>ch</strong>auer) 1561, vgl.<br />
Blarer BW 3, Nr. 2368 (J. Funcklin an A. Blarer, 21. Juli 1561).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2088 (W. Musculus an A. Blarer, 16. Februar 1557).<br />
Vgl. Pohlmann, Materialien (wie Anm. 8), 275; Hoffmann, Beiträge (wie Anm. 8),<br />
88, Anm. 22; Müller, Patents<strong>ch</strong>utz (wie Anm. 8), 940 (Abb. 9).<br />
Blarer BW 3, Nr. 2089 (W. Musculus an A. Blarer, 2. März 1557).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 127<br />
dont nos imprimeurs se servaient en guise de fleurons et de culs-delampe»<br />
250 . Die im 16. Ja<strong>hr</strong>hundert seltene Konnotation von «holtzkunst»<br />
qua Holzs<strong>ch</strong>nitt, 251 namentli<strong>ch</strong> aber die Gegebenheit, dass beide Ausgaben<br />
der Holtzkunst aus der Offizin Peter S<strong>ch</strong>mid genau 15 Holzs<strong>ch</strong>nitt-<br />
Illustrationen beinhalten und laut Titel ein «Verzei<strong>ch</strong>nuß der figuren […]<br />
der neuwen erfundenen Holtzkunst» sein wollen, bestärkt uns in der Annahme,<br />
dass es vor April 1559 entweder 15 einzelne «figuren» der neuen<br />
Sparöfen, wenn ni<strong>ch</strong>t gar eine erste Auflage der Holtzkunst gegeben hat.<br />
Die Veranlassung des Druckes im Umfeld des Patentierungsvorganges<br />
zu su<strong>ch</strong>en (1. Antrag: Frühsommer 1555, 2. Antrag: Spätja<strong>hr</strong><br />
1556, Freiheit: Frühja<strong>hr</strong> 1557), legt unter anderem die Beoba<strong>ch</strong>tung nahe,<br />
dass die 8 Abbildungen des «ba<strong>ch</strong>ofen» mit Legenden, Massangaben<br />
und Referenzbu<strong>ch</strong>staben versehen sind. Da die Illustrationen weder für<br />
eine Patentprüfungskommission selbsterklärend waren, no<strong>ch</strong> einem Hafner<br />
als Bauanleitung dienen konnten, steht zu vermuten, dass zum «Verzei<strong>ch</strong>nuß<br />
der figuren» au<strong>ch</strong> eine zugehörige Besc<strong>hr</strong>eibung existierte.<br />
Charles S<strong>ch</strong>midt 1888 und Esther Hildebrandt 1982 glaubten eine sol<strong>ch</strong>e<br />
in jener «ars de parcendis lignis in coquendo ac calefaciendo conclavia»<br />
erkennen zu können, die Mi<strong>ch</strong>ael Toxites im September 1556 erwähnt 252<br />
und zu deren Verbreitung er aus Sympathie zu Konrad Zwick und Interesse<br />
an der Sa<strong>ch</strong>e hatte beitragen wollen: «Toxites […] had offered<br />
Zwick his help in developing and publicising his invention by translating<br />
Zwick’s work into Latin» 253 .<br />
Unabhängig davon: terminus ante quem für die erste ‹Mülhauser<br />
Holzkunst› ist das Gründungsdatum der Druckerei S<strong>ch</strong>mid & S<strong>ch</strong>irenbrand<br />
im Frühsommer 1557, terminus post quem ist das Inventurdatum<br />
April 1559. Für die letzte uns bekannte Ausgabe 1564 ist der terminus<br />
250<br />
251<br />
252<br />
253<br />
Joseph Coudre: Inventaire inédit d’une imprimerie et imagerie populaire de Mulhouse<br />
1557–1559, in: Bulletin du Musée Historique de Mulhouse 2 (1877), 41–92,<br />
48, 61.<br />
So etwa in Paul Behaims bekanntem Verzei<strong>ch</strong>nus und Registratur der Kupfersti<strong>ch</strong>e<br />
und Holzs<strong>ch</strong>nitte (1618), Friedri<strong>ch</strong> Leits<strong>ch</strong>uh (Hg.): Katalog der Handsc<strong>hr</strong>iften der<br />
Königli<strong>ch</strong>en Bibliothek zu Bamberg, 2 Bde., Leipzig 1887, Bd. 1, 96f., Nr. 301.<br />
DWb 10, 1775 hat nur scientia lignorum mit Hinweis auf Colerus’ Hausbu<strong>ch</strong><br />
1595/97.<br />
Vgl. oben im Text bei Anm. 33.<br />
Hildebrandt, Exiles (wie Anm. 165), 46, vgl. S<strong>ch</strong>midt, Toxites (wie Anm. 231), 60.<br />
ars kann si<strong>ch</strong> auf eine Sc<strong>hr</strong>ift dieses Titels beziehen, oder au<strong>ch</strong> nur auf das neue<br />
heizte<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Verfa<strong>hr</strong>en im Allgemeinen.
128<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
post quem Peter S<strong>ch</strong>mids Wegzug na<strong>ch</strong> Frankfurt im Mai 1564. 254 Dass<br />
die Ausgaben 1563 und 1564 in eine Zeit fallen, als der quellenkundige<br />
Zenith des Unternehmens bereits übersc<strong>hr</strong>itten war, kann irritieren. Oder<br />
war die späte Drucklegung etwa Teil einer Vorwärtsstrategie angesi<strong>ch</strong>ts<br />
der rü<strong>hr</strong>igen Konkurrenz?<br />
7.2.4. Autors<strong>ch</strong>aft der Holzs<strong>ch</strong>nitte<br />
Seit François Brulliot 1832 hält si<strong>ch</strong> die hartnäckige Behauptung, das am<br />
Unterbau des dritten Stubenofens angebra<strong>ch</strong>te Monogramm des Forms<strong>ch</strong>neiders<br />
HB (HBW!) mit S<strong>ch</strong>neidmesser (Abb. 23) sei dem Maler<br />
Hans Bocksberger d. J. (geb. 1539), 255 bzw. Johann Mel<strong>ch</strong>ior Bocksberger<br />
(gest. um 1587) 256 zuzusc<strong>hr</strong>eiben, dies, obwohl Georg Nagler s<strong>ch</strong>on<br />
1863 hiefür weder Belege no<strong>ch</strong> Gründe hatte finden können, da Hans<br />
Bocksberger «Maler, und ni<strong>ch</strong>t Forms<strong>ch</strong>neider von Profession war» 257 ,<br />
was übrigens au<strong>ch</strong> auf Johann Mel<strong>ch</strong>ior Bocksberger zutrifft. Die von<br />
Johann D. Passavant 1863 mit einem Fragezei<strong>ch</strong>en versehene Zusc<strong>hr</strong>eibung<br />
an den Xylographen Bernard Jobin 258 s<strong>ch</strong>eitert unseres Era<strong>ch</strong>tens<br />
bereits am Monogramm. So müssen denn der entwerfende wie der ausfü<strong>hr</strong>ende<br />
Illustrator der ‹Mülhauser Holzkunst› mit Nagler weiterhin zu<br />
den unbekannten Meistern gezählt werden. Dass der Forms<strong>ch</strong>neider<br />
HBW in Beziehung zur Offizin S<strong>ch</strong>mid & S<strong>ch</strong>irenbrand gestanden hatte,<br />
belegt eine von diesem monogrammierte «Contrafactur der Lo bli<strong>ch</strong>en<br />
Statt Mülhusen» 259 .<br />
254<br />
255<br />
256<br />
257<br />
258<br />
259<br />
L[éonard] G[éorges] Werner: La première Imprimerie Mulhousienne, in: Bulletin<br />
du Musée Historique de Mulhouse 49 (1929), 59–107, 65.<br />
François Brulliot: Dictionnaire des Monogrammes, marques figurées, lettres initiales,<br />
noms abrégés, première partie, Mün<strong>ch</strong>en 1832, 18. Vgl. Charles Le Blanc: Manuel<br />
de l’amateur d’estampes, 4 Bde., Bd. 1, Paris 1854, 394f.; Katalog der ZBZH<br />
(Alte Drucke 14.42,8); neuerdings Urs B. Leu, Raffael Keller u. Sandra Weidmann:<br />
Konrad Gessner’s Private Library, Leiden u. a. 2008, 75, Nr. 61.<br />
Katalog der Biblioteca Vaticana, Data record 940527.<br />
Georg Kaspar Nagler: Die Monogrammisten, 5 Bde., Bd. 4, Mün<strong>ch</strong>en 1863, Nr.<br />
607, 191f.; Susanne Kaeppele: Die Malerfamilie Bocksberger aus Salzburg, Salzburg<br />
2003, 180, 294. Frau Dr. Susanne Kaeppele, Mannheim, danke i<strong>ch</strong> für den erhellenden<br />
Briefkontakt.<br />
J[ohann] D[avid] Passavant: Le Peintre-Graveur, 6 Bde., Bd. 4, Leipzig 1863, 330–<br />
332.<br />
Edouard Benner: Notice sur une vue de Mulhouse du XVI e siècle, in: Bulletin du<br />
Musée Historique de Mulhouse 15 (1890), 37–46. HBW s<strong>ch</strong>eint 1556 au<strong>ch</strong> für Fro-
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 129<br />
8. S<strong>ch</strong>lussbilanz<br />
8.1. «hat übel hußgehalten …»<br />
Bendi<strong>ch</strong>t Re<strong>ch</strong>bergers kurzes Summar der Vita Jakob Funcklins endet<br />
mit einem Missklang. Auf die dur<strong>ch</strong>weg positive Würdigung, wona<strong>ch</strong><br />
der wolgelertt herr Jacob Fünckly unser predicantt by 15. joren gwesenn hie z<br />
Bielln und uns gar wol gelertt, Gott sy lob, und helff uns allen zu einem seligen<br />
end, Amen,<br />
folgt die lakonis<strong>ch</strong>e Feststellung: «Hatt übel hußghalten» 260 . Gerne bedienten<br />
si<strong>ch</strong> dieser vermutli<strong>ch</strong> erst na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong>, spätestens 1566, angehängten<br />
Qualifikation die wenig zahlrei<strong>ch</strong>en Biographen Funcklins für<br />
Anspielungen «Er [Funcklin] s<strong>ch</strong>eint au<strong>ch</strong> im Leben ein Vielbrau<strong>ch</strong>er<br />
gewesen zu sein» 261 oder Behauptungen auf s<strong>ch</strong>maler Quellenbasis: «F.s<br />
Bemühungen um die Verbreitung der Holzsparkunst […] fü<strong>hr</strong>ten ihn in<br />
den Ruin.» 262<br />
Funcklins gewiss ni<strong>ch</strong>t weg zu diskutierende, vom Bieler Rat spätestens<br />
seit Januar 1556 vermutete persönli<strong>ch</strong>e Vers<strong>ch</strong>uldung 263 lässt si<strong>ch</strong><br />
im Dreisatzverfa<strong>hr</strong>en weder ermitteln no<strong>ch</strong> erklären. Sie ist re<strong>ch</strong>t eigentli<strong>ch</strong><br />
die Vektorenresultante aus c<strong>hr</strong>istli<strong>ch</strong>er Uneigennützigkeit, ho<strong>ch</strong>fliegenden<br />
Plänen, ökonomis<strong>ch</strong>er Unkenntnis und einer Vielzahl von harten<br />
Fakten. So ist daran zu erinnern, dass Funcklins Projekte mit Krise und<br />
Verfall grosser oberdeuts<strong>ch</strong>er Handelshäuser zeitli<strong>ch</strong> zusammenfielen, 264<br />
sowie dass mindestens zwei prominente Teilhaber an den Zwick’s<strong>ch</strong>en<br />
Unternehmungen (Abb. 5) Anfang der 1560er Ja<strong>hr</strong>e insolvent geworden<br />
waren: 1560 fallierte der grosse Memminger Tu<strong>ch</strong>händler Eberhard<br />
Zangmeister, 1562 der s<strong>ch</strong>illernde Augsburger Kapitalist Jakob Herbrot,<br />
260<br />
261<br />
262<br />
263<br />
264<br />
ben gearbeitet zu haben, vgl. Rudolf Wackernagel (Hg.): Re<strong>ch</strong>nungsbu<strong>ch</strong> der Froben<br />
& Episcopius, Bu<strong>ch</strong>drucker und Bu<strong>ch</strong>händler zu Basel 1557–1564, Basel 1881,<br />
108.<br />
Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik (wie Anm. 30), 147f.<br />
Emil Ermatinger: Di<strong>ch</strong>tung und Geistesleben der deuts<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>weiz, Mün<strong>ch</strong>en<br />
1933, 205.<br />
Pars pro toto: Hans-Beat Flückiger: Art. Fünklin, Jakob, in: HLS 5 (2006), 24.<br />
StadtA Biel CXXIII, Nr. 5, 581f. (Biel an Konstanz, 26. Januar 1556).<br />
Vgl. Mathis, Wirts<strong>ch</strong>aft (wie Anm. 57), 81 (Lit.).
130<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
dessen Passiven si<strong>ch</strong> auf sagenhafte 554623 fl bzw. 766029 fl belaufen<br />
haben sollen. 265<br />
Über Jakob Funcklins Ges<strong>ch</strong>äftsgebaren ist, soweit wir sehen, nur<br />
so viel beizubringen, wie dieses Gegenstand obrigkeitli<strong>ch</strong>er Erbs<strong>ch</strong>aftserkundigungen<br />
war. Dass er ein ordentli<strong>ch</strong>es Ges<strong>ch</strong>äftsbu<strong>ch</strong> («s<strong>ch</strong>uldtb<strong>ch</strong>»)<br />
gefü<strong>hr</strong>t hat, geht aus einer se<strong>hr</strong> aufs<strong>ch</strong>lussrei<strong>ch</strong>en Aussage der<br />
To<strong>ch</strong>ter Anna Chuard-Funcklin vom 12. April 1567 hervor:<br />
Item, als Heinri<strong>ch</strong> Jeger uff ein mol sin s<strong>ch</strong>wöster fragt, who irs eemans seligen<br />
testament wäre, da bra<strong>ch</strong>t sy im sin s<strong>ch</strong>uldt b<strong>ch</strong> dar. Und hat darby heymli<strong>ch</strong> ein<br />
fäderen in der handt, die gab sy irem brder, der tilckett [stri<strong>ch</strong>] damit ettwas uß<br />
dem b<strong>ch</strong>, laß drin und spra<strong>ch</strong>: Er hat vil gts geordnet und gema<strong>ch</strong>t; wan man nun<br />
[nur] wüßte, who daß wäre. Also gab er daß b<strong>ch</strong> siner s<strong>ch</strong>wöster wider. 266<br />
Dass Funcklins Witwe und S<strong>ch</strong>wager vor und wä<strong>hr</strong>end der Erri<strong>ch</strong>tung<br />
des Erbs<strong>ch</strong>aftsinventars konspiriert hatten, war au<strong>ch</strong> von Aussenstehenden<br />
beoba<strong>ch</strong>tet worden. Wirkli<strong>ch</strong> bemerkenswert ers<strong>ch</strong>eint jedo<strong>ch</strong>, dass<br />
der bilanzkundige Ratsherr Heinri<strong>ch</strong> Jeger na<strong>ch</strong> Einsi<strong>ch</strong>t in Funcklins<br />
Journal keinen dur<strong>ch</strong>weg katastrophalen Finanzstatus, sondern vielme<strong>hr</strong><br />
eine Anzahl von transitoris<strong>ch</strong>en Aktiven hatte feststellen können.<br />
Die ni<strong>ch</strong>t in allen Teilen transparente Erbs<strong>ch</strong>aftssa<strong>ch</strong>e veranlasste<br />
Biel, si<strong>ch</strong> im Januar 1566 in Konstanz zu erkundigen, «mitt wasserley<br />
gewerber by sinem läbenn vmbgangen», und ob dessen<br />
Halbbruder und Teilhaber an der Holzkunst, «Vlri<strong>ch</strong> Kündigman Steürsc<strong>hr</strong>yber<br />
vnnd deß rhats by v<strong>ch</strong>, siner handlung halben ettwäs zwüssen<br />
sin mö<strong>ch</strong>te» 267 . Die im April 1567 mit 18 Bielerinnen und Bielern dur<strong>ch</strong>gefü<strong>hr</strong>ten<br />
Einvernahmen trugen zur Klärung der finanziellen Verhältnisse<br />
wenig bei, liessen jedo<strong>ch</strong> das verdunkelnde Verhalten der Witwe<br />
Funcklin umso deutli<strong>ch</strong>er hervortreten. 268 Ein vom Ehemann beim Landvogt<br />
von Nidau (Jakob Mi<strong>ch</strong>el) aufgenommenes Darlehen von 600 kr,<br />
dessen Rückzahlung sie verspro<strong>ch</strong>en, aber nie getätigt hatte, trug Anna<br />
265<br />
266<br />
267<br />
268<br />
Vgl. Westermann, Zahlungseinstellung (wie Anm. 45); E<strong>hr</strong>enberg, Fugger (wie<br />
Anm. 45), 235.<br />
StadtA Biel CLXVI Nr. 99, 5 rv .<br />
StadtA Biel CXXIII.5, 581f. (Biel an Konstanz, 25. Januar 1566).<br />
StadtA Biel CLXVI, Nr. 99: Kunnts<strong>ch</strong>afft Brief antreffendt herr Jacob Funcklins<br />
verlassne husfrouw (12.–30. April 1567), 20 Seiten in f°, Absc<strong>hr</strong>ift von 1572.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 131<br />
Funcklin-Jeger im Oktober 1568 einige Tage Beugehaft ein. 269 Von einer<br />
fünfmal höheren Forderung hat der Bieler Pfarrer Josua Finsler im März<br />
1572 gehört:<br />
Diese Wo<strong>ch</strong>e forderte ein Junker Diesba<strong>ch</strong> 270 3’000 Kronen von der Witwe Funcklins,<br />
meines Vorgängers; darüber wird jedo<strong>ch</strong> weiterhin gestritten. 271<br />
Ein letztes Mal fällt der Name Funcklin im März 1574 anlässli<strong>ch</strong> der<br />
Na<strong>ch</strong>lassregelung seines einstigen «mithaften» im Seifengewerbe, Hans<br />
Glatt. Mit diesem zusammen, sc<strong>hr</strong>eibt Biel an Bern, habe der einstige<br />
vorstender vnnserer kil<strong>ch</strong>en alhie […] ettli<strong>ch</strong>erleÿ gewerb getrÿben vnnd si<strong>ch</strong> gegen<br />
Einanderen versc<strong>hr</strong>ÿben vnnd Jre vberkhomnus nÿemandt offenbaren wöllen,<br />
dardur<strong>ch</strong> sÿ vill s<strong>ch</strong>ulden gema<strong>ch</strong>t. 272<br />
Wie ho<strong>ch</strong> diese S<strong>ch</strong>ulden s<strong>ch</strong>lussendli<strong>ch</strong> waren, lässt si<strong>ch</strong> vermutli<strong>ch</strong><br />
ni<strong>ch</strong>t me<strong>hr</strong> ermitteln. Na<strong>ch</strong> Einbezug aller eins<strong>ch</strong>lägigen Quellen 273 beziffern<br />
wir Jakob Funcklins Ausgabenübers<strong>ch</strong>uss auf etwa 7000 kr.<br />
Diese Summe entspra<strong>ch</strong> annähernd 46 Ja<strong>hr</strong>essalären des Bieler Dekans.<br />
274<br />
269<br />
270<br />
271<br />
272<br />
273<br />
274<br />
StABE A II 245, 256 sowie StadtA Biel LIX, Nr. 231 (Bern an Biel, 6. Oktober<br />
1568). Zu Jakob Mi<strong>ch</strong>el vgl. Alfred S<strong>ch</strong>eidegger: Die Berner Glasmalerei von 1540<br />
bis 1580, Bern 1947, 132.<br />
Mögli<strong>ch</strong>erweise Niklaus IV. Diesba<strong>ch</strong> (1503–1585), vgl. zu diesem Rudolf Dellsperger:<br />
Wolfgang Musculus (1497–1563). Leben und Werk, in: Wolfgang Musculus<br />
(1497–1563), hg. v. Rudolf Dellsperger, Rudolf Freudenberger u. Wolfgang<br />
Weber, 23–36, 34.<br />
«Hac septimana nobilis quidam Diesba<strong>ch</strong>ius 3’000 coronatos petijt a vidua Funclii,<br />
praedecessoris mei; de his autem adhuc litigatur», StAZH E II 344,33 (J. Finsler an<br />
B. Leemann, 21. März 1572), freundli<strong>ch</strong>er Hinweis von Herrn lic. theol. Rainer<br />
Henri<strong>ch</strong>.<br />
StadtA Biel CXXIII, Nr. 5, 798f. (Bern an Biel, 20. März 1574), freundli<strong>ch</strong>er Hinweis<br />
von Herrn Prof. Dr. Max S<strong>ch</strong>iendorfer.<br />
StABE A II 212, 272; Blarer BW 3, Nrn. 2145, 2322f., 2561, 2592, 2625; StadtA<br />
Biel CLXVI Nr. 99; StAZH E II 344,33; StadtA Biel CXXIII.5.<br />
Lohnsumme na<strong>ch</strong> StadtA Biel CXXXI.15 (2. März 1561): 100 fl zuzügli<strong>ch</strong> 15<br />
Viertel Korn und 14 Saum Wein. Aequivalente bere<strong>ch</strong>net na<strong>ch</strong> Re<strong>ch</strong>berger, C<strong>hr</strong>onik<br />
(wie Anm. 30), 85 (Preise 1555).
132<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
8.2. «rÿ<strong>ch</strong>en vnnd armen zgebru<strong>ch</strong>en seer nutzli<strong>ch</strong>»<br />
Den theoretis<strong>ch</strong>en Wert der historis<strong>ch</strong>en Sparofenliteratur – und somit<br />
wohl au<strong>ch</strong> des praktis<strong>ch</strong>en Ofenbaues – s<strong>ch</strong>ätzte Joa<strong>ch</strong>im Radkau 2007<br />
als gering ein: Zwar habe sie «einige wi<strong>ch</strong>tige te<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>e Grundeinsi<strong>ch</strong>ten»<br />
enthalten, do<strong>ch</strong> sei ohne Regelungste<strong>ch</strong>nik und Gasanalyse<br />
«ni<strong>ch</strong>t einmal das Problem klar zu formulieren» gewesen. 275 Umso höher<br />
beurteilte Alfred Faber 1950 die Mögli<strong>ch</strong>keiten der Empirie, wenn er der<br />
‹Frankfurter Holzsparkunst 1618› des Franz Keßler (Abb. 14, 16, 17)<br />
attestierte, «die feuerungste<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>en Vorgänge im Stubenofen ri<strong>ch</strong>tig<br />
erkannt», bzw. «alle wesentli<strong>ch</strong>en Merkmale eines neuzeitli<strong>ch</strong>en Zimmerofens<br />
[…] vorweggenommen» zu haben. 276 An wel<strong>ch</strong>en theoretis<strong>ch</strong>en<br />
und praktis<strong>ch</strong>en Standards der Neuzeit ist ein frühneuzeitli<strong>ch</strong>er<br />
Sparofen zu messen?<br />
8.2.1. Holzverbrennung<br />
Bei der Holzverbrennung wird die photosynthetis<strong>ch</strong> gespei<strong>ch</strong>erte <strong>ch</strong>emis<strong>ch</strong>e<br />
Energie zu Wärmeenergie gewandelt. Feuer ist die Wa<strong>hr</strong>nehmungsform<br />
dieser Umwandlung. Idealerweise verläuft die kontrollierte Holzverbrennung<br />
in einem Ofen in zwei teilweise sync<strong>hr</strong>onen Stufen: 277<br />
Der energieverbrau<strong>ch</strong>ende (endotherme) erste Teilprozess beinhaltet<br />
die Trocknung, die Zersetzung und die Vergasung des Holzes im Glutbett<br />
(ab 250° C), wobei 85 Gew.% der trockenen Holzmasse als brennbare<br />
flü<strong>ch</strong>tige Gase (v. a. CO, H 2 , C x H y ) freigesetzt werden und 15 Gew.%<br />
als energierei<strong>ch</strong>e Holzkohle auf dem Rost verbleiben. Zur Überfü<strong>hr</strong>ung<br />
der festen Holzstoffe in den gasförmigen Zustand wird so genannte Primärluft<br />
(O 2 +N 2 ) benötigt, die dur<strong>ch</strong> den Feuerungsrost dem unteren Teil<br />
des Feuerraums zugefü<strong>hr</strong>t wird.<br />
Im energieliefernden (exothermen) zweiten Teilprozess vergast die<br />
Holzkohle (ab 500° C) und oxidieren die brennbaren Gase (ab ca. 700° C<br />
bis ca. 1’500° C) zu CO 2 und H 2 O. Der Ausbrand der Gase wird dur<strong>ch</strong> so<br />
genannte Sekundärluft unterstützt, die in den oberen Teil des Feuerrau-<br />
275<br />
276<br />
277<br />
Radkau, Holz (wie Anm. 10), 201f.<br />
Alfred Faber: 1000 Ja<strong>hr</strong>e Werdegang von Herd und Ofen, Mün<strong>ch</strong>en u. a. 1950<br />
(Deuts<strong>ch</strong>es Museum, Abhandlungen und Beri<strong>ch</strong>te 18, H. 3), 29. Vgl. Franz, Ka<strong>ch</strong>elofen<br />
(wie Anm. 232), 74.<br />
Thomas Nussbaumer: Holzenergie. Teil 1: Grundlagen der Holzverbrennung,<br />
Blauen 2000 (S<strong>ch</strong>weizer Baudokumentation August 2000, 1–8).
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 133<br />
mes eingeleitet wird. Die Oxidation der Holzkohle setzt der Energie<br />
frei, wä<strong>hr</strong>end die doppelt so s<strong>ch</strong>nell ablaufende Oxidation der Vergasungsprodukte<br />
der thermis<strong>ch</strong>en Energie erbringt. Diese teilt si<strong>ch</strong> über<br />
die Flamme an die Ofenwände und den na<strong>ch</strong>ges<strong>ch</strong>obenen Brennstoff<br />
mit.<br />
8.2.2. Der ideale Sparofen<br />
Zur Errei<strong>ch</strong>ung einer vollständigen Verbrennung bzw. eines optimalen<br />
thermis<strong>ch</strong>en Wirkungsgrades ergeben si<strong>ch</strong> aus der Verbrennungstheorie<br />
und dem praktis<strong>ch</strong>en Abbrandverhalten von Holz eine Reihe von Anforderungen,<br />
278 die eine Sparofenkonstruktion zu erfüllen hat, nämli<strong>ch</strong>: a)<br />
Trennung von Feuer und As<strong>ch</strong>e dur<strong>ch</strong> Einziehen eines freien Feuerungsrostes,<br />
279 b) ges<strong>ch</strong>lossener, auf die Rostgrösse abgestimmter, mögli<strong>ch</strong>st<br />
kleiner Feuerraum, c) regulierbare Zufu<strong>hr</strong> von Sauerstoff im Übers<strong>ch</strong>uss<br />
unterhalb des Rostes (Primärluft) und im oberen Berei<strong>ch</strong> des Feuerraums<br />
(Sekundärluft), d) optimale Dur<strong>ch</strong>mis<strong>ch</strong>ung der Sekundärluft mit den<br />
brennbaren Gasen, e) ausrei<strong>ch</strong>ende Verweilzeit der Gase in der heissen<br />
Zone, d. h. gebremster Wärmeabzug dur<strong>ch</strong> Verlängerung der Rau<strong>ch</strong>gaswege<br />
mittels steigenden, liegenden, stürzenden Zügen, Zirkulierro<strong>hr</strong>en,<br />
Drosselklappe im Rau<strong>ch</strong>gasweg; im Falle der Ko<strong>ch</strong>öfen: Kasserollenherd<br />
mit maximaler Wärmeeinwirkung auf den Ko<strong>ch</strong>topf, f) Vergrösserung<br />
der Ofenoberflä<strong>ch</strong>e: Se<strong>ch</strong>splattenofen (Ofen von der Wand abgerückt<br />
und auf Füssen), Ka<strong>ch</strong>elaufsätze, Dur<strong>ch</strong>si<strong>ch</strong>ten, Radiatoren,<br />
Zirkulierro<strong>hr</strong>e, g) gut ziehender S<strong>ch</strong>ornstein.<br />
Na<strong>ch</strong> eingehender Prüfung der in der ‹Mülhauser Holzkunst<br />
1563/64› dargestellten Öfen und Herde 280 anhand der obgenannten Kriterien<br />
für ökonomis<strong>ch</strong> und funktional befriedigende Öfen ergibt si<strong>ch</strong> der<br />
eindrückli<strong>ch</strong>e Befund, dass die Holzverbrennungsanlagen na<strong>ch</strong> Zwick &<br />
Frommer gut 50 Ja<strong>hr</strong>e vor der bahnbre<strong>ch</strong>enden ‹Frankfurter Holzkunst<br />
1618› des Franz Keßler sämtli<strong>ch</strong>e prinzipiellen und konstruktiven Merkmale<br />
neuzeitli<strong>ch</strong>en Ofenbaus aufweisen oder erkennen lassen, die auf<br />
278<br />
279<br />
280<br />
Umfassend: Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 196–209.<br />
Radkau, Holz (wie Anm. 10), 201: «S<strong>ch</strong>on mit einer so simplen Innovation wie<br />
dem eisernen Rost ließ si<strong>ch</strong> die Regelung des Feuers und die Brennstoffnutzung<br />
erhebli<strong>ch</strong> verbessern.»<br />
Vgl. oben Kap. 7.
134<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
empiris<strong>ch</strong>em Wege damals zu gewinnen waren. 281 Freili<strong>ch</strong> blieben den<br />
Holzsparkünstlern Frommer & Zwick & Egloff und i<strong>hr</strong>en Konkurrenten<br />
gerade jene Aspekte vers<strong>ch</strong>lossen, die den thermis<strong>ch</strong>en Wirkungsgrad<br />
von Heizanlagen am signifikantesten beeinflussen, und deren theoretis<strong>ch</strong>e<br />
Grundlagen erst im letzten Drittel des 18. Ja<strong>hr</strong>hunderts erarbeitet<br />
worden waren, 282 nämli<strong>ch</strong> die Zufu<strong>hr</strong> von Sekundärluft und deren Verwirbelung<br />
mit den Holzgasen.<br />
8.3. Summa summarum<br />
8.3.1. Sparpotential<br />
Mit grossem Engagement hatte Ambrosius Blarer am letzten Tag des<br />
Ja<strong>hr</strong>es 1556 Johannes Calvin für die neue Erfindung zu begeistern versu<strong>ch</strong>t,<br />
indem er deren «ganz unglaubli<strong>ch</strong>e Nützli<strong>ch</strong>keit (commoditas) für<br />
fast die ganze Mens<strong>ch</strong>heit» herausstri<strong>ch</strong>. 283 Mit fast identis<strong>ch</strong>en Worten<br />
erkundigte si<strong>ch</strong> Blarer im Februar 1557 bei Heinri<strong>ch</strong> Bullinger na<strong>ch</strong> dem<br />
Erfolg von Konrad Zwicks «inventum […] omnibus fere mortalibus<br />
utilissimum, de commoda lignorum parsimonia» 284 .<br />
In den Patentanträgen und in der Werbung gaben die Holzkünstler<br />
des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts die erzielbaren Brennstoffeinsparungen verständli<strong>ch</strong>erweise<br />
ni<strong>ch</strong>t allzu niedrig an (Tab. 3). Andererseits besassen die Kunden<br />
bei der Ans<strong>ch</strong>affung eines patentierten Ofens immerhin eine minimale<br />
Garantie, dass dessen Neuheit und Nützli<strong>ch</strong>keit von einem<br />
Expertengremium geprüft worden war. Wenn die Brennstoffnutzung<br />
s<strong>ch</strong>on mit dem Einzug eines Eisenrostes signifikant zu beeinflussen<br />
war, 285 so lassen die in der ‹Mülhauser Holzkunst 1563/64› dokumentier-<br />
281<br />
282<br />
283<br />
284<br />
285<br />
Vgl. Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 118: «Wenn wir von den anonym<br />
ers<strong>ch</strong>ienenen Entwürfen einiger verbesserter Ka<strong>ch</strong>elöfen im Ja<strong>hr</strong>e 1564 [‹Mülhauser<br />
Holtzsparkunst›] absehen, so gebü<strong>hr</strong>t Keßler jedenfalls die Priorität vor den<br />
späteren Sa<strong>ch</strong>verständigen wie Böckler (1666), Roose, Sturm (1696), Leutmann<br />
(1720), wel<strong>ch</strong>e die te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Neuerung in i<strong>hr</strong>e Öfen übernommen haben.»<br />
Entdeckung des O 2 : C. W. S<strong>ch</strong>eele 1771 und J. Priestley 1774; Oxidationstheorie:<br />
A. Lavoisier 1774; Gasanalyse und ‹Sekundärluftprinzip›: R. W. Bunsen 1838;<br />
Wärmetheorie: R. Mayer 1842.<br />
CO 16, Nr. 2571 = Blarer BW 3, Nr. 2081 (31. Dezember 1556).<br />
CO 16, Nr. 2595 = Blarer BW 3, Nr. 2087 (8. Februar 1557).<br />
Vgl. oben Anm. 278.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 135<br />
ten konstruktiven Neuerungen, nämli<strong>ch</strong>: Primärluftzufu<strong>hr</strong> dur<strong>ch</strong> As<strong>ch</strong>efall<br />
und Rost, verlängerte Rau<strong>ch</strong>gaswege mit Drosselklappe, kompakte<br />
und di<strong>ch</strong>te Bauweise, die verspro<strong>ch</strong>enen Einsparungen von einem Drittel<br />
keineswegs unrealistis<strong>ch</strong> ers<strong>ch</strong>einen.<br />
Tab. 3: Nominelle Brennstoffeinsparung vers<strong>ch</strong>iedener Holzkünste (1545–1796) 286<br />
1545 Jan Colterman 50% Brauen, Färben, Seifensieden<br />
1555 Friedri<strong>ch</strong> Frommer «der halb theyl» Heizen und Ko<strong>ch</strong>en<br />
1556 Konrad Zwick «duplo ac triplo paucior» Heizen, Ko<strong>ch</strong>en und Backen<br />
1559 Hans R. Blumenkher «den dritten thail» Salzsieden<br />
1572 Jeremias Neuner «den drittn tail» Heizen<br />
1582 Leonhard Danner > Heizen<br />
1584 Max Zolmeyer 25% Ziegel- und Kalkbrennen<br />
1796 Joseph Danzer > 70% Kasserollenherd<br />
Um no<strong>ch</strong> die letzten Bedenken der Kunden zu zerstreuen, verzi<strong>ch</strong>teten<br />
Zwick & Frommer auf eine feste (einmalige) Lizenzgebü<strong>hr</strong>, sondern kalkulierten<br />
dieselbe in Proportion zu den tatsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> erzielten Einsparungen.<br />
So statuierten die Patenturkunden von 1557 und 1576, dass der Lizenznehmer<br />
den dritten theil des gellts, so er mit dieser khunst eins einigen Jars an holtz ersparen<br />
mag, den erfündern zue ergetzli<strong>ch</strong>ait zue bezalen s<strong>ch</strong>uldig sein solle. 287<br />
Das Spektrum der aktenkundigen Kundenzufriedenheit rei<strong>ch</strong>t vom Fazit<br />
des Grafen von Oettingen, der im Winter 1557/58 «bestendige und dermassen<br />
ersparung im werckh befunden», dass er alle alten Öfen auszutaus<strong>ch</strong>en<br />
geda<strong>ch</strong>te, bis hin zum verni<strong>ch</strong>tenden Urteil C<strong>hr</strong>istophs von<br />
Württemberg, der die «kunst» zuletzt «ain kunst sein» lassen wollte. 288<br />
286<br />
287<br />
288<br />
Quellen: ZBZH, Ms. S 89, 94; Blarer BW 3, Nr. 2079; Faber, Entwicklungsstufen<br />
(wie Anm. 12), 92, 148; Gleitsmann, Erfinderprivilegien (wie Anm. 8), 87.<br />
OeStA/HHStA/RHR, Grat Feud Gewerbe-, Fabriks- und Handlungsprivilegien,<br />
11–59, f. 610 r (17. August 1576). Bei einer angenommenen Einsparung von seiner<br />
Heizkosten von 10 kr (vgl. Anm. 18) hätte W. Musculus eine Lizenzgebü<strong>hr</strong> von<br />
3.7lb bzw. 1.1 kr bezahlt.<br />
HStA Stuttgart, Oettingen 28 (L. v. Oettingen an C<strong>hr</strong>. v. Württemberg, 21. Mai<br />
1558); BW Wirtemberg 4, Nr. 418 (C<strong>hr</strong>. v. Württemberg an L. v. Oettingen, 28.<br />
Mai 1558).
136<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
8.3.2. Ein S<strong>ch</strong>uss in den Ofen?<br />
Trotz anfängli<strong>ch</strong> vielverspre<strong>ch</strong>ender Ergebnisse und reger Na<strong>ch</strong>frage war<br />
es dem Konsortium Zwick & Frommer und seinem rü<strong>hr</strong>igen Generalagenten<br />
Jakob Funcklin offenbar ni<strong>ch</strong>t gelungen, i<strong>hr</strong>e zukunftsweisende<br />
Holzkunst gewinnbringend zu vermarkten. Die bereits erwähnten Faktoren,<br />
die wirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e Ungunstlage, der Konkurrenzdruck und die Misswirts<strong>ch</strong>aft<br />
einzelner Akteure, hatten an diesem Misserfolg gewiss i<strong>hr</strong>en<br />
Anteil.<br />
a) Weitere Gegebenheiten, die den Ges<strong>ch</strong>äftserfolg gefä<strong>hr</strong>deten, waren<br />
Johann C<strong>hr</strong>istoph von S<strong>ch</strong>mid 1823 zufolge «wenigstens zum Theil<br />
ebenso se<strong>hr</strong> dem Neid und der Mißgunst der zum Bauen beigezogenen<br />
heimis<strong>ch</strong>en Handwerksleute und der Sorglosigkeit der Dienstboten im<br />
Holzzulegen, als der zweckwidrigen Bauart der Oefen und dem ungeeigneten<br />
Material, woraus sie gema<strong>ch</strong>t wurden, zuzusc<strong>hr</strong>eiben.» 289 In den<br />
Quellen unseres Untersu<strong>ch</strong>ungsberei<strong>ch</strong>s sind Futterneid und Missgunst<br />
der Hafner kein Thema.<br />
b) Dagegen beoba<strong>ch</strong>tet Alfred Faber 1957 bei den frühneuzeitli<strong>ch</strong>en<br />
Ofenbauern eine generelle, dur<strong>ch</strong> fortsc<strong>hr</strong>ittsfeindli<strong>ch</strong>e Zunftsatzungen<br />
verstärkte gedankenträge Renitenz gegenüber allem Zunftfremden. 290<br />
Diesbezügli<strong>ch</strong>e Erfa<strong>hr</strong>ungen musste der Hamburger Mennonitenprediger<br />
Gerrit Roosen (1612–1711) na<strong>ch</strong> der Publikation einer vielbea<strong>ch</strong>teten<br />
Sc<strong>hr</strong>ift über den Ka<strong>ch</strong>el-Ofen 1695 mit der Altonaer Töpferinnung ma<strong>ch</strong>en.<br />
291<br />
c) Auf einen weiteren erfolgshemmenden Faktor ma<strong>ch</strong>t Joa<strong>ch</strong>im<br />
Radkau 2007 aufmerksam: «Der Ofenbau war traditionell Sa<strong>ch</strong>e der<br />
Töpfer, deren Fähigkeiten dur<strong>ch</strong> eiserne Roste und komplizierte Ro<strong>hr</strong>und<br />
Abzugfü<strong>hr</strong>ungen übersc<strong>hr</strong>itten wurden» 292 . Die unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Befähigung<br />
der von den Holzkünstlern vermutli<strong>ch</strong> nur flü<strong>ch</strong>tig instruierten<br />
289<br />
290<br />
291<br />
292<br />
V. S<strong>ch</strong>mid, Beytrag (wie Anm. 170), 175f.<br />
Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 96.<br />
G[errit] R[oosen]: Nutzba<strong>hr</strong>er und jetzt gründli<strong>ch</strong>er Unterri<strong>ch</strong>t von dem jetzo gewöhnli<strong>ch</strong>en<br />
Brau<strong>ch</strong> und Art der unrahthsahmen Ka<strong>ch</strong>el-Ofen, Hamburg (K. Neumann),<br />
1695; ders.: Appendix an dem Bü<strong>ch</strong>lein von der Verbesserung der Ka<strong>ch</strong>el-<br />
Ofen, Hamburg (K. Neumann), 1695. Zu Roosen: Nanne van der Zijpp: Art. Roosen,<br />
Gerrit, in: ME 4, 357 (ohne Hinweis auf Roosens Holzsparsc<strong>hr</strong>iften, über die<br />
i<strong>ch</strong> gelegentli<strong>ch</strong> zu publizieren gedenke).<br />
Radkau, Holz (wie Anm. 10), 203.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 137<br />
lokalen Ofenbauer s<strong>ch</strong>eint eine plausible Erklärung für den beoba<strong>ch</strong>teten<br />
we<strong>ch</strong>selnden Erfolg der Sparöfen zu sein.<br />
d) Einen optimalen thermis<strong>ch</strong>en Wirkungsgrad erbra<strong>ch</strong>ten die neuen<br />
Ofenkonstruktionen indessen au<strong>ch</strong> nur bei sa<strong>ch</strong>gemässer Bedienung.<br />
Wurden die Ka<strong>ch</strong>elöfen bisher mit unzerkleinerten Klafters<strong>ch</strong>eiten im<br />
Einmalbrand beheizt, so erforderte der enge Feuerungsraum der neuen<br />
Sparöfen eine ganze Reihe von ungewohnten Verri<strong>ch</strong>tungen, wie das<br />
mühsame (zeit- und lohnintensive!) Sägen und Spalten des Holzes in<br />
ofengere<strong>ch</strong>te Portionen («pfunde»), das sorgfältige Aufs<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>ten der<br />
S<strong>ch</strong>eite auf dem Rost, die ständige Kontrolle der Luftzufu<strong>hr</strong> über das<br />
Mundlo<strong>ch</strong>, das häufige Na<strong>ch</strong>legen zum Weiterbrand sowie das re<strong>ch</strong>tzeitige<br />
Betätigen der Drosselklappe im Rauc<strong>hr</strong>o<strong>hr</strong>. 293 Auf eben diese oftmals<br />
unverständli<strong>ch</strong>en und immer unbeliebten Arbeiten nahm das konkurrierende<br />
Strassburger Konsortium Neuner & Kogmann Bezug, als es<br />
1571 in seiner Supplikation an den Rat darauf hinwies, dass Frommers<br />
Holzkunst<br />
aller hand maengel vnnd ungelegenheyten gehabt und mit vers<strong>ch</strong>eutterung [Zerkleinerung]<br />
des holtz, au<strong>ch</strong> veraenderung der oefen, nit geringen vnkosten nothwendigli<strong>ch</strong><br />
erfodert hat. 294<br />
Demgegenüber garantierte Neuners Rei<strong>ch</strong>spatent 1572, «das [dass] nit<br />
allein der dritte theil Holtz und drueber, sonder au<strong>ch</strong> vil zeit und mühe<br />
ersparet wird.» 295<br />
e) Definitiv absc<strong>hr</strong>eckend wirkten die hohen Installations- und Unterhaltskosten.<br />
Zwar hatte Frommers Strassburger Patent vom Juni 1555<br />
vollmundig verspro<strong>ch</strong>en, dass das neue<br />
wer<strong>ch</strong> ou<strong>ch</strong> also ges<strong>ch</strong>affen, das es am jme nit kostli<strong>ch</strong>, sonder ein jeder na<strong>ch</strong> sinem<br />
vermo gen dasselbig anri<strong>ch</strong>ten , 296<br />
do<strong>ch</strong> musste beispielsweise der Graf von Hohenlohe 1588 für das Setzen<br />
eines «Kunstofens in der neuen Kü<strong>ch</strong>e» 45 Kronen auslegen. 297 Sollte<br />
293<br />
294<br />
295<br />
296<br />
297<br />
Vgl. Faber, Entwicklungsstufen (wie Anm. 12), 212f.<br />
Fu<strong>ch</strong>s, Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8), 1102, 1112, n. 33 (Interpunktion HRL).<br />
Fu<strong>ch</strong>s, Re<strong>ch</strong>er<strong>ch</strong>es (wie Anm. 8), 1102, 1104 (fehlerhafte Paginierung).<br />
ZBZH, Ms. S 89, 94 (29. Juni 1555).<br />
Jost Weyer: Graf Wolfgang II. von Hohenlohe und die Al<strong>ch</strong>emie, Sigmaringen<br />
1992, 438.
138<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
dieser stolze Betrag den gängigen Ans<strong>ch</strong>affungskosten entspro<strong>ch</strong>en haben,<br />
so waren Kunstöfen für den gemeinen Mann jedenfalls uners<strong>ch</strong>wingli<strong>ch</strong>.<br />
Kostspielig war gemäss dem Augsburger Historiographen<br />
Pirmin Gasser (1576) au<strong>ch</strong> der Unterhalt:<br />
Es erforderte aber die Zuri<strong>ch</strong>t- und Unterhaltung dieser Oefen so viele Unkosten,<br />
daß diese Kunst bald i<strong>hr</strong>en Credit verlo<strong>hr</strong>en. 298<br />
8.3.3. «Wen Gott ein land strafen «will, so nimpt er dem folck for an<br />
die vernuftt»<br />
Um 1509 hatte der 10-jä<strong>hr</strong>ige Walliser Bauernsohn Thomas Platter<br />
(1499–1582) ein numinoses Erlebnis eigener Art:<br />
Als wier über den berg Grimßlen na<strong>ch</strong>tz in ein wirtzhuß kammen, hatt i<strong>ch</strong> nie kein<br />
ka<strong>ch</strong>ell offen gsä<strong>ch</strong>en, und s<strong>ch</strong>ein der man [Mond] in ka<strong>ch</strong>len. Do wond [glaubte]<br />
i<strong>ch</strong>, es weri so ein groß kalb, dan i<strong>ch</strong> gsa<strong>ch</strong> nr zwo ka<strong>ch</strong>len s<strong>ch</strong>inen; das meint i<strong>ch</strong><br />
die ougen. 299<br />
Dieses novum ac tremendum an der Grimsel s<strong>ch</strong>eint neuere ofenges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e<br />
Erkenntnisse zu bestätigen, wona<strong>ch</strong> der Übergang von der<br />
Kamin- zur (Ka<strong>ch</strong>el-) Ofenheizung zu Anfang des 16. Ja<strong>hr</strong>hunderts<br />
breitflä<strong>ch</strong>ig erst in Oberdeuts<strong>ch</strong>land, im s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Mittelland und<br />
in Teilen der Nord- und Osts<strong>ch</strong>weiz erfolgt war, wä<strong>hr</strong>end die westli<strong>ch</strong>en<br />
und südli<strong>ch</strong>en Randregionen der S<strong>ch</strong>weiz no<strong>ch</strong> bis ins 19. Ja<strong>hr</strong>hundert<br />
die Kaminfeuerung favorisierten. 300<br />
Unter dem Eindruck der klimatis<strong>ch</strong>en Ungunstlage (Kleine Eiszeit)<br />
und si<strong>ch</strong> verknappender Holzressourcen erfolgte zeitli<strong>ch</strong> parallel zur<br />
Verbreitung der neuen Heizmethode bereits deren te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Perfektionierung<br />
unter dem S<strong>ch</strong>lagwort ‹Holzkunst›. Der bis in die Intimität der<br />
Stube und Kü<strong>ch</strong>e hinein rei<strong>ch</strong>ende heizte<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Paradigmenwe<strong>ch</strong>sel, 301<br />
bei dem die alltägli<strong>ch</strong>en Verri<strong>ch</strong>tungen des Heizens und Ko<strong>ch</strong>ens von<br />
Grund auf neu erlernt werden mussten, überforderte die Zeitgenossinnen<br />
298<br />
299<br />
300<br />
301<br />
Annales Augustani (wie Anm. 205). S<strong>ch</strong>ulthaiß zufolge unterlagen besonders die<br />
Radiatoren dem Vers<strong>ch</strong>leiss, vgl. Anh. 2, Nr. [2].<br />
Alfred Hartmann (Hg.): Thomas Platter, 2. Aufl., Basel 1999, 36,26–37,1.<br />
Vgl. Martin Illi: Art. Heizung in: HLS 6 (2007), 244f.<br />
Vgl. Hans-Joa<strong>ch</strong>im S<strong>ch</strong>midt: Ist das Neue das Bessere?, in: ders. (Hg.): Tradition,<br />
Innovation, Invention. Fortsc<strong>hr</strong>ittsverweigerung und Fortsc<strong>hr</strong>ittsbewusstsein im<br />
Mittelalter, Berlin 2005, 7–24.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 139<br />
und Zeitgenossen ni<strong>ch</strong>t weniger als die unters<strong>ch</strong>iedli<strong>ch</strong>e Funktionstaugli<strong>ch</strong>keit<br />
der neuen Öfen und Herde. Anders als der Herzog C<strong>hr</strong>istoph von<br />
Württemberg, der si<strong>ch</strong> im Mai 1558 in einem zornigen Akt der Verweigerung<br />
vorgenommen hatte, «hinfurter ko<strong>ch</strong>en und braten ze lassen, wie<br />
wir und unsere voreltern bisher au<strong>ch</strong> gethon haben», 302 s<strong>ch</strong>eint si<strong>ch</strong> die<br />
um eine ganze Generation ältere Zurza<strong>ch</strong>er Patrizierin Amalia Re<strong>ch</strong>burger<br />
seufzend in die Erfordernisse der neuen Zeitläufte ergeben zu haben,<br />
wenn sie im Oktober 1557 an Bonifatius Amerba<strong>ch</strong> sc<strong>hr</strong>eibt:<br />
Zum andren so ist das holcz so wolfel [wohlfeil] worden; i<strong>ch</strong> hab no<strong>ch</strong> iij holczer<br />
[Waldstücke]; sie werdend nit mer gelten; dan die holcz kunst kostend so fil, das<br />
i<strong>ch</strong> mi<strong>ch</strong> miner hölczeren behelfen will. I<strong>ch</strong> hab all min tag gehörtt: Wen Gott ein<br />
land strafen will, so nimpt er dem folck for an die vernuftt. Hans Iackob sagtt mir,<br />
ir wellend es ander lüt brobieren lassen: I<strong>ch</strong> hor sagen, es ma<strong>ch</strong> ein stuben warm;<br />
aber des tagx iiii, v mallen wider wermen [anheizen] mit denen pfunden [Holzportionen],<br />
wil man nit arfruren. 303<br />
Wie immer man über die ‹Mülhauser Holtzkunst› und i<strong>hr</strong>en Hauptagenten<br />
Jakob Funcklin denken mo<strong>ch</strong>te: sie war ein erster bedeutsamer<br />
Sc<strong>hr</strong>itt auf dem no<strong>ch</strong> lange ni<strong>ch</strong>t zu Ende gegangenen Weg zur «Intelligenten<br />
Energie».<br />
Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. Suspiciendi tamen sunt.<br />
Seneca, Ep. 64,9f.<br />
<br />
Viel haben sie geleistet, die vor uns waren, do<strong>ch</strong> sie haben ni<strong>ch</strong>t alles vollendet.<br />
Glei<strong>ch</strong>wohl gebü<strong>hr</strong>t ihnen Bewunderung.<br />
302<br />
303<br />
BW Wirtemberg 4, Nr. 418 (28. Mai 1558).<br />
BW Amerba<strong>ch</strong> 10,2, Nr. 4228 (A. Re<strong>ch</strong>burger an B. Amerba<strong>ch</strong>, 19. Oktober 1557).
140<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Anhang 1: François Hotman an Johannes Calvin, 28. Mai<br />
1557 (CO 16, Nr. 2638)<br />
In eckigen Klammern: Deuts<strong>ch</strong>e Äquivalente na<strong>ch</strong> Petrus Dasypodius: Dictionarivm<br />
latinogermanicum et vice versa, Strassburg 1535.<br />
«Apud Sturmium aliquot aedificati sunt fornaces [brennofen, ba<strong>ch</strong>ofen]<br />
arte nova et mirabili. Vidi heri novum recentique excogitatum hac forma:<br />
[Abb. 24a] Forma est undique quadrata quae quatuor pediculis<br />
sustinetur, ut aer, in quo tota vis artis posita est, subire possit ad ignem<br />
alendum, impositum craticulae, quod in omnibus fornacibus adhibetur.<br />
In medio est ingens cacabus [ein pfan] rotundus sed oblongus, cuius in<br />
fundo, ut dixi, clatrato [gelender, gettere] ignis est qui subtus respirat,<br />
sic ut cinis illuc excidat. Is cacabus opertus est tegmine, cuius in medio<br />
parvum foramen est quo fumus emanat, flamma et calor nullo modo.<br />
Nam hic conclusus vasa [ein ietli<strong>ch</strong> ges<strong>ch</strong>irr] omnia imposita quae vides<br />
ita fovet ut carnes elixentur. Ab utraque parte clatratus quoque est, sed<br />
ferrea valva [ein geteylte thür, die zwyfalt auff einander gehet oder fensterlade]<br />
quae detrahi potest munitus. Ad eas fenestras tria et quatuor<br />
verua [bratspyß] apponuntur quibus carnes torrentur. Usitatior forma<br />
tres habet gradus: [Abb. 24b] Infimus cinerem recipit, secundus ignem<br />
habet clatris ferreis impositum, tertius foramina quae ollis [haf, dopff]<br />
impositis obturantur ut calor conclusus fumum exhalare per eam partem<br />
possit quae parieti admovetur. Si mathematicus essem vel pictor, figuram<br />
tibi melius descripsissem. Sed garrire tecum volui.»<br />
Bei Sturm sind ein paar Öfen von neuer und wunderbarer Kunstfertigkeit<br />
gebaut worden. I<strong>ch</strong> habe gestern einen neuen und kürzli<strong>ch</strong> erfundenen<br />
gesehen, der folgendes Aussehen hat:<br />
Die Form ist allseits quadratis<strong>ch</strong>, sie wird von<br />
vier Füss<strong>ch</strong>en gestützt, damit die Luft, auf wel<strong>ch</strong>er<br />
das ganze Prinzip der Kunst beruht, von<br />
unten einströmen kann, um das Feuer zu nä<strong>hr</strong>en,<br />
wel<strong>ch</strong>es auf einem kleinen Rost liegt, was<br />
in allen Öfen zur Anwendung kommt. In der<br />
Mitte befindet si<strong>ch</strong> ein mä<strong>ch</strong>tiger runder, aber<br />
Abb. 24a<br />
längli<strong>ch</strong>er Kessel, auf dessen vergittertem Boden, wie gesagt, Feuer ist,<br />
das unten atmet, so dass die As<strong>ch</strong>e dort hindur<strong>ch</strong> fallen kann. Dieser<br />
Kessel ist mit einem Deckel vers<strong>ch</strong>lossen, in dessen Mitte eine kleine
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 141<br />
Öffnung ist, dur<strong>ch</strong> die der Rau<strong>ch</strong> abzieht, das Feuer und die Wärme [jedo<strong>ch</strong>]<br />
auf keine Weise. Denn wenn dieser [Kessel] ges<strong>ch</strong>lossen ist, heizt<br />
er alle Gefässe, die Du [auf den Ofen] daraufgestellt siehst, derart auf,<br />
dass Fleis<strong>ch</strong>stücke gesotten werden. Auf beiden Seiten ist ebenfalls ein<br />
Gitter, jedo<strong>ch</strong> versehen mit einer geteilten Türe, die man herab ziehen<br />
kann. Zu diesen Fensteröffungen werden drei oder vier Bratspiesse hinzugefü<strong>hr</strong>t,<br />
mit denen man Fleis<strong>ch</strong> brät. Die gebräu<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>ere Ausfü<strong>hr</strong>ung<br />
hat drei Stufen:<br />
Die unterste nimmt die As<strong>ch</strong>e auf, die zweite trägt auf einem Gitterrost<br />
das Feuer, die dritte [hat] Lö<strong>ch</strong>er, die dur<strong>ch</strong> [darin] eingesetzte Töpfe<br />
verstopft werden, damit die einges<strong>ch</strong>lossene<br />
Hitze dur<strong>ch</strong> jenes Teil den Rau<strong>ch</strong> abgeben<br />
kann, das an die Wand herangefü<strong>hr</strong>t wird.<br />
Wäre i<strong>ch</strong> ein Mathematiker oder ein Maler,<br />
so hätte i<strong>ch</strong> die Form besser besc<strong>hr</strong>ieben.<br />
Abb. 24b<br />
Do<strong>ch</strong> i<strong>ch</strong> wollte mit Dir plaudern.<br />
Anhang 2: C<strong>hr</strong>istoph S<strong>ch</strong>ulthaiß, Collectaneen zum<br />
Ja<strong>hr</strong>e 1557<br />
(StadtA Konstanz Hs. A I 8, Teilband VIII, 38½–39.)<br />
[38½] Anno Domini. 1557. […] Holtz sparung erfunden.<br />
Im Julio hat man angefangen die nüwen öffen der holtzsparung ze ma<strong>ch</strong>en,<br />
vnd erstli<strong>ch</strong> in der Reÿte a vnd Hoffstatt huss b by dem Hegelisthor c ;<br />
da haben Bastion Brunner vnd Ludwig Pantrion, beid haffner, die öffen<br />
gema<strong>ch</strong>t, namli<strong>ch</strong> [1] ainen stubenoffen mit ainem eÿsin kasten, darin<br />
hat man in der stuben geko<strong>ch</strong>ett; eß hatt aber ain grossen dampff in die<br />
stuben geben von der kost, derhalben man in bald geendert hat. [2] Item<br />
a<br />
b<br />
c<br />
Das 1563 erweiterte Raiteamt (heute: Obere Laube 51) war für die Verteilung der<br />
Almosen zuständig, vgl. J[ohannes] Marmor: Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong>e Topographie der Stadt<br />
Konstanz und i<strong>hr</strong>er nä<strong>ch</strong>sten Umgebung, Konstanz 1860, 92. Hier wirkte der weiter<br />
unten erwähnte Associé des Holzsparkonsortiums Frommer & Zwick Ulri<strong>ch</strong> Kundigmann<br />
als Raitesc<strong>hr</strong>eiber.<br />
Verwaltungsgebäude der Sondersie<strong>ch</strong>en, südli<strong>ch</strong> des S<strong>ch</strong>netztors (heute: Hussenstrasse<br />
39), Marmor, Topographie (wie Anm. a), 180.<br />
1837 abgebro<strong>ch</strong>en, Marmor, Topographie (wie Anm. a), 93.
142<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
vnd sunst ain stuben offen one ain söl<strong>ch</strong>en kasten mit dreÿen roren on<br />
ein andern d , dardur<strong>ch</strong> die hitz vnd ro<strong>ch</strong> vom für geloffen bis daß es den<br />
vsgang hat funden. Die ror, so gross vnd lang, haben nit wellen [39]<br />
bestendig sein, derhalben sÿ ou<strong>ch</strong> herna<strong>ch</strong> geendert worden. [3] Sÿ habend<br />
ou<strong>ch</strong> ander stuben öffen gema<strong>ch</strong>t, die habend vnden röst vnd lufft<br />
lö<strong>ch</strong>er vnder dem re<strong>ch</strong>ten mundtlo<strong>ch</strong> e gehabt vnd oben darin ain boden f ,<br />
us dem selbigen boden ist ain ror von ziegeln gema<strong>ch</strong>t hnab gangen,<br />
dardur<strong>ch</strong> der ro<strong>ch</strong> sin usgang hat mögen haben. So dann das für verbrunnen,<br />
hat man vnden das lufft lo<strong>ch</strong>, das mundtlo<strong>ch</strong> wue man jnfu rt,<br />
vnd das ober ro<strong>ch</strong>lo<strong>ch</strong> verma<strong>ch</strong>t, so ist die werme alle im offen belieben,<br />
vnd das was die best gattung. [4] Sÿ habend ou<strong>ch</strong> bü<strong>ch</strong>öffen g gema<strong>ch</strong>t,<br />
die vnden lüfft lö<strong>ch</strong>er oder getter gehabt, darin ou<strong>ch</strong> vil holtz ersparet<br />
wirt. [5] Item, sÿ ma<strong>ch</strong>ten ain ba<strong>ch</strong>offen mit zwaÿen böden ob ein andern;<br />
so man den vndern warmbt, so was der ober ou<strong>ch</strong> warm. Die belaiben<br />
aber ou<strong>ch</strong> nit in die lenge. [6] Item, sie ma<strong>ch</strong>ten ein ko<strong>ch</strong> offen in<br />
die ku<strong>ch</strong>e, in dem man allerlaÿ ko<strong>ch</strong>en mo<strong>ch</strong>t in den heffen, so darin<br />
gema<strong>ch</strong>t wie die s<strong>ch</strong>erer heffen in s<strong>ch</strong>ergaden h . Darnebent was vnden<br />
ain thürle, darin man braten kundt, vnd alles mit wenigem holtz. Die wil<br />
aber söl<strong>ch</strong>es alles ein sundren vliß in dem infüren vnd ko<strong>ch</strong>en erfordert,<br />
ist söl<strong>ch</strong> bald wider abgangen – bis an die stuben öffen vnd bü<strong>ch</strong>öffen<br />
mit den wind- oder lufft lö<strong>ch</strong>ern.<br />
Dise kunst hat erstli<strong>ch</strong> erda<strong>ch</strong>t M. Fridri<strong>ch</strong> i tis<strong>ch</strong>ma<strong>ch</strong>er zu Strasburg,<br />
darna<strong>ch</strong> hat ou<strong>ch</strong> Conrat Zwick, sesshafft im Ror in Züri<strong>ch</strong>biett, vnd<br />
Hans Vlri<strong>ch</strong> Kundigmann, stürsc<strong>hr</strong>iber hie, vnd andere söl<strong>ch</strong>s verbessert<br />
vnd volgend in das werck gebra<strong>ch</strong>t. Sÿ habend ou<strong>ch</strong> bÿ der Rö<br />
Kö Mt vnd den stenden des Rÿ<strong>ch</strong>s ain priuilegium j<br />
erworben, das diese kunst niemant bru<strong>ch</strong>en soll, man vertrage si<strong>ch</strong> dann<br />
mit inen vnd gebe inen von dem ersparten holtz, so ainer mit der kunst<br />
d<br />
e<br />
f<br />
g<br />
h<br />
i<br />
j<br />
aneinander.<br />
Ofenlo<strong>ch</strong>, S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon 3, 1035f.<br />
Stockwerk, vgl. S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon 4, 1026 (3.).<br />
b<strong>ch</strong>ofen: Herd, in wel<strong>ch</strong>em die Was<strong>ch</strong>lauge (b<strong>ch</strong>e) zubereitet wird, S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es<br />
Idiotikon 1, 112.<br />
Barbierstube, S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon 2, 119. Abbildungen von «s<strong>ch</strong>erer heffen»,<br />
die von unten beheizt sind, bei Alfred Martin: Deuts<strong>ch</strong>es Badewesen in vergangenen<br />
Tagen, Jena 1906, 80 (Abb. 36) u. 180 (Abb. 82).<br />
Lakune; gemeint ist Friedri<strong>ch</strong> Frommer.<br />
Privileg vom 13. Mai 1557, von dessen Lizenzbestimmungen S<strong>ch</strong>ulthaiß genaue<br />
Kenntnis hat.
<strong>Lignea</strong> <strong>aetas</strong> 143<br />
[in] aim jar ersparen mag, ainen dritten teil, das ist: so ainer hie vor 18<br />
gl vmb holtz ain jar hat müssen geben, das halb thail erspart<br />
er darmit, von dem selben halben thail gehört inen ain dritten theil, das<br />
ist 3 gl.<br />
Conrat Zwick hat M. Fridri<strong>ch</strong>en mit ainliff tausend gulden von diser<br />
holtz kunst hingelöst vermeinende, dardur<strong>ch</strong> ain vil merers ze vberkummen,<br />
wel<strong>ch</strong>es im aber wit gefelt, denn söl<strong>ch</strong>e kunst bald in verklainerung<br />
kom. Conrat Zwick hat denen von Zuri<strong>ch</strong> als siner oberkait freÿ<br />
vergebens mit gethailt l , des gli<strong>ch</strong>en het ou<strong>ch</strong> Hans Vlri<strong>ch</strong> Ku ndigman hie<br />
gethon, wel<strong>ch</strong>s ain rat von im angenommen vnd im lassen sagen, daß ain<br />
rath si<strong>ch</strong> danckbarli<strong>ch</strong> gegen in wel erzaigen.<br />
I<strong>ch</strong> hab ain bü<strong>ch</strong>offen lassen ma<strong>ch</strong>en; was gut; das ander alles solt m gar<br />
ni<strong>ch</strong>ts.<br />
Anhang 3: Die Druckausgaben der ‹Mülhauser Holtzkunst›<br />
(VD 16 H 4556)<br />
A. Ausgabe 1563<br />
[S<strong>ch</strong>warz:] Holtzkunst/ || [Rot:] VEEzei<strong>ch</strong>nuß [!] der figu= || ren vnnd<br />
neuwen o fen / || von der ersparung der neuwen || erfundenen Holtz= ||<br />
kunst. [S<strong>ch</strong>warz:] || [HS<strong>ch</strong>n. in Rot-S<strong>ch</strong>warz: Zwei Löwen halten das<br />
gegeneinander geneigte, vom gekrönten Rei<strong>ch</strong>ss<strong>ch</strong>ild überhöhte Mülhauser<br />
Wappenpaar] || Gedruckt z Mülhausen im || oberen Elsa ß / dur<strong>ch</strong><br />
Pe= || ter S<strong>ch</strong>mid. 1563.||<br />
2°. [5] Bl., unpag.; Bogensignatur Aij–Aiiij (Ai rv und Av rv n. gedr.)<br />
Drucktypen: S<strong>ch</strong>waba<strong>ch</strong>er in vier Sc<strong>hr</strong>iftgraden. Abbildungen: (1) Ai r :<br />
Titelholzs<strong>ch</strong>nitt. (2) Aij r : Unter Übersc<strong>hr</strong>ift Der erst Stobenofen: Ofen<br />
mit kubis<strong>ch</strong>em Feuerkasten und dreifa<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enem Oberbau. (3)<br />
l<br />
m<br />
«I<strong>ch</strong> bitte, meiner Base [Amalia Zwick] in Ro<strong>hr</strong> und i<strong>hr</strong>en Kindern bei Eueren<br />
Herren zu einem Gnadenbeweis für die ihnen ges<strong>ch</strong>enkte ‹Kunst der Holzsparung›<br />
zu verhelfen», Blarer BW 3, Nr. 2133 (A. Blarer an Bullinger, 1. März 1558).<br />
nüt-söllend: untaugli<strong>ch</strong>, ni<strong>ch</strong>tsnutzig, S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es Idiotikon 7, 781f.
144<br />
Hans Rudolf Lavater<br />
Aij v : Der ander Stobenofen: Ofen mit zwei Serviceöffnungen im Unterbau<br />
und zweifa<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enem Aufsatz. (4) Aiij r : Der dritte Stobenofen:<br />
bauähnli<strong>ch</strong> mit (2), jedo<strong>ch</strong> mit zweifa<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong>bro<strong>ch</strong>enem Aufsatz.<br />
Monogramm HBW mit Messer<strong>ch</strong>en. (5) Aiij v : Nun volgent die bratt und<br />
ko<strong>ch</strong>o fen: Kombinierter Back- und Ko<strong>ch</strong>ofen auf drei Etagen mit drei<br />
Ko<strong>ch</strong>mulden. (6) Aiiij r oben: bauähnli<strong>ch</strong> mit (5), jedo<strong>ch</strong> nur zwei Ko<strong>ch</strong>mulden.<br />
(7) Aiiij r unten: Unterteil von (6) mit Einsi<strong>ch</strong>t in das System von<br />
liegenden Rau<strong>ch</strong>gaszügen. – Aiiij v : Der ba<strong>ch</strong>ofen mit seinen bo den<br />
stuckweiß. Auf den folgenden drei Blättern sieben von unten na<strong>ch</strong> oben<br />
gehende Explosivdarstellungen eines Backofens sowie die Aussenansi<strong>ch</strong>t<br />
desselben: (8) Luftlo<strong>ch</strong>, (9) Feuerrost, (10) Backraum 1. – Av r : (11)<br />
Liegende Rau<strong>ch</strong>gaszüge, (12) Backraum 2, (13) Liegende Rau<strong>ch</strong>gaszüge.<br />
– Av r : (14) Abdeckung mit Rau<strong>ch</strong>gasklappe, (15) Backofen mit drei<br />
Türen und zwei S<strong>ch</strong>iebereglern.<br />
Exemplare<br />
1. Wolfenbüttel, Herzog Albre<strong>ch</strong>t Bibliothek, H: O 92.2° Helmst.<br />
URN digitalisierter Volltext: .<br />
Das Exemplar stammt aus der 1576 gegründeten<br />
Academia Julia Carolina (Universität Helmstedt).<br />
2. Basel, Universitätsbibliothek, Js II 1:1.<br />
B. Ausgabe 1564<br />
Wie Ausgabe 1563 (identis<strong>ch</strong>er Fingerprint) mit Ausnahme des Druckja<strong>hr</strong>s<br />
1564.<br />
Exemplare<br />
1. Mün<strong>ch</strong>en, Bayeris<strong>ch</strong>e Staatsbibliothek, Res/2 Crim. 41 Beibd.2.<br />
URN digitalisierter Volltext: nbn:de:bvb:12-bsb00029509-6.<br />
2. Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp.Pal.II.44(int.6).<br />
2° (30 cm). [6] Bl., letztes Bl. n. bedruckt. Letzte Nummer eines<br />
1569 datierten Konvoluts aus dem Besitz des Pfalzgrafen Ludwig<br />
VI. (1539–1583) zusammen mit se<strong>ch</strong>s weiteren Drucken vorwiegend<br />
geometris<strong>ch</strong>-me<strong>ch</strong>anis<strong>ch</strong>en Inhalts aus dem Zeitraum<br />
1546/1567.<br />
Hans Rudolf Lavater-Briner, Pfr. Dr. h. c., Altstadt 5, CH 3235 Erla<strong>ch</strong><br />
h.r.<strong>lavater</strong>@bluewin.<strong>ch</strong>