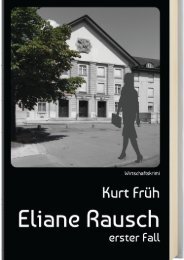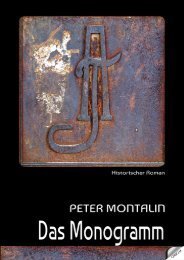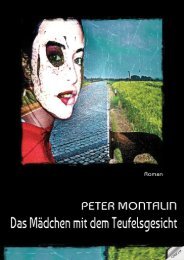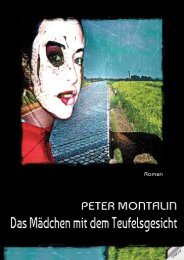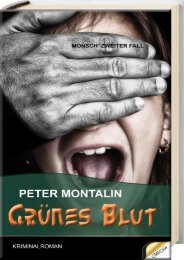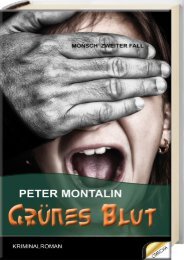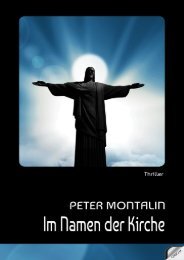Im Namen der Kirche
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prolog<br />
Nachdenklich legte ich den Telefonhörer zurück auf die Gabel. Mir war als<br />
würden alle Presseberichte <strong>der</strong> letzten Monate zeitgleich auf mich<br />
einstürzen. Presseberichte in denen die katholische <strong>Kirche</strong>, auf ihre<br />
Hinrichtung wartend, an die Wand gestellt wurde. Ich schaute auf und<br />
erblickte meine drei Klee', mein ganzer Stolz.<br />
Es sind keine Reproduktionen, nein sie sind echt, seit über siebzig Jahren<br />
im Besitz unserer Familie, und so vor fünf Jahren an mich übergegangen,<br />
zum Leidwesen meines Vaters, <strong>der</strong> sich übergangen fühlte, und deswegen<br />
bis heute noch keinen Fuß in meine Wohnung gesetzt hat. Meine Mutter<br />
hatte damals meinen Großvater davon überzeugt, dass diese drei<br />
Kostbarkeiten bei mir bestens aufgehoben wären und so kam es, dass sie<br />
nach einer Nacht- und Nebelaktion plötzlich in meinem kleinen<br />
Arbeitszimmer hingen. Man fragte mich nur, wo ich mich denn am Meisten<br />
aufhalten würde, und sie bekamen sodann einen wun<strong>der</strong>schönen Platz<br />
direkt gegenüber meinem Schreibtisch, wo sie tagsüber von <strong>der</strong> Sonne und<br />
nachts von drei Spots beleuchtet wurden. Jeden Tag, wenn ich sie mir<br />
betrachtete, erregten sie aufs Neue meinen heimlichen Stolz.<br />
Ansonsten war das Leben nicht immer ganz einfach in Zürich und vor allem<br />
nicht im Kreis 4. Ich fragte mich zuweilen, ob es unbedingt ratsam war,<br />
solche Kostbarkeiten an einem Ort aufzubewahren, wo es von Dieben und<br />
Junkies nur so wimmelte.<br />
Dauernd war irgendwie Lärm im Haus und vor <strong>der</strong> Türe standen die Nutten<br />
herum und warteten auf ihre Freier. So war an manchen Tagen bis in die<br />
Morgenstunden ganz schön was los. Da ich als Freischaffen<strong>der</strong> viel<br />
zuhause arbeitete, ging das bisweilen ganz schön an die Substanz, aber die<br />
Wohnung war günstig und entsprach einigermaßen meinem Geschmack.<br />
Doch am heutigen Tag es war Mittwoch, <strong>der</strong> 14.Mai 2008 erreichte mich<br />
besagter Telefonanruf, <strong>der</strong> mir nicht aus dem Kopf wollte, und von dem ich<br />
nicht wusste, in welche Schublade ich ihn stecken sollte. Der Stimme nach<br />
war es eine alte Frau, die mich freundlich fragte, ob ich ihr helfen könnte,<br />
ihren Enkel zu suchen, <strong>der</strong> seit sechzehn Jahren spurlos verschwunden sei.
Die Polizei wäre dafür weit besser geeignet, gab ich ihr zur Antwort, aber<br />
die alte Dame liess sich nicht beirren. Sie wollte einen Journalisten, da<br />
diese einiges besser recherchierten, als die Polizei, und überhaupt bekäme<br />
man von denen nur die Antwort, dies sei schon zu lange her. Nein, sie<br />
wollte, dass ich sie am Donnerstag besuche, um mir nähere Einzelheiten<br />
mitzuteilen.<br />
Wie sie gerade auf mich käme, fragte ich sie.<br />
Doch sie antwortete nur, dass ich empfohlen worden sei, von wem spiele<br />
keine Rolle.<br />
Ich solle doch um neun Uhr morgen Vormittag vorbeischauen, für nähere<br />
Einzelheiten, meinte sie.<br />
Nach meinem Journalistikstudium, welches von meinem Vater stets als<br />
unnütz belächelt wurde und mich in eine Außenseiterrolle manövrierte, da<br />
bei ihm nur Unternehmer etwas zählten und es außer Betriebswirtschaft<br />
kein Fach gab, das sich auch nur annähernd zu studieren lohnte, wollte ich<br />
mich dem Enthüllungsjournalismus zuwenden. Dabei war ich ihm so<br />
ähnlich, dass mich jedes Mal das Gefühl überkam gegen mein eigenes<br />
Spiegelbild anzurennen. Ich habe dann bei <strong>der</strong> Neuen Zürcher Zeitung ein<br />
zweijähriges Volontariat absolviert, welches mir zwar Einblick in die<br />
Tagespresse gewährte, sonst aber in Bezug auf journalistische Recherchen<br />
nicht gerade viel Spielraum bot.<br />
Aus seinen drei Jungs wollte mein Vater Vollblutunternehmer machen,<br />
welche die Familiendynastie weiterführten. Dank einem Fond, <strong>der</strong> noch<br />
mein Großvater für mich eingerichtet hatte, war ich finanziell soweit<br />
unabhängig, dass ich es mir leisten konnte, mich für verschiedene<br />
Zeitungen und Zeitschriften, als freier Mitarbeiter zu verdingen.<br />
Dies war am Anfang kein leichtes Unterfangen, sodass ich diesen Fond oft<br />
bis zur Schmerzgrenze ausreizen musste, um mir einen halbwegs<br />
anständigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Doch heute zehn Jahre später<br />
war ich doch soweit, dass ich von meiner journalistischen Tätigkeit<br />
einigermaßen leben konnte.
Den Durchbruch, <strong>der</strong> zur Anerkennung meiner journalistischen<br />
Fähigkeiten führte, schaffte ich mit einer umfassenden Recherche, welche<br />
zur Festnahme eines lang gesuchten Rauschgiftrings führte. Wäre<br />
eigentlich auch Sache <strong>der</strong> Polizei gewesen, aber diese Idioten hatten die<br />
Sache gründlich vermasselt. Jedenfalls konnte ich mich nach dieser<br />
Geschichte, welche mir auch einige Drohungen einbrachte, am Anfang vor<br />
Aufträgen kaum noch retten.<br />
Und nun dies.<br />
Ich wusste nicht, was sich diese alte Dame vorstellte.<br />
Mal sehen, was das Internet hergibt. Wann hat sie gesagt war das?<br />
September 1992?<br />
Ein bisschen Vorabrecherche kann vielleicht nicht schaden. Ich werde auch<br />
gleich fündig.<br />
Doch Moment mal.<br />
Aus <strong>der</strong> Psychiatrie ist <strong>der</strong> abgehauen. Das hat sie mir allerdings nicht<br />
gesagt. Was wollte die Alte mir denn da anhängen? Und allein war er auch<br />
nicht. Ein siebzehnjähriges Mädchen muss mit ihm zusammen das Weite<br />
gesucht haben. Die Polizei hatte überhaupt keine Anhaltspunkte.<br />
Nein, Dominik, das musst du dir aus dem Kopf schlagen. Ich werde es <strong>der</strong><br />
Alten gleich morgen mitteilen. Die kann mich mal, schließlich habe ich<br />
genug an<strong>der</strong>e Aufträge.<br />
Pünktlich um neun stand ich dann doch in Luzern vor dem Haus. Die<br />
mussten eine Menge Geld haben, wenn ich mir das Anwesen so<br />
betrachtete. Arm waren die auf keinen Fall. Der neue Motor in meinem<br />
alten MG A hatte für dieses Mal durchgehalten und ich parkte den Wagen<br />
in <strong>der</strong> Einfahrt. Irgendetwas sagte mir, dass ich beobachtet werde, o<strong>der</strong><br />
täuschte ich mich? Nein, im letzten Moment sah ich, wie <strong>der</strong> Vorhang des<br />
Seitenfensters neben dem Eingang zurückschlug.<br />
Das Haus stammte etwa aus den zwanziger Jahren des vorigen<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts, war aber sehr gut erhalten und von einer riesigen<br />
Grünfläche eingerahmt. Sogar mein alter Herr würde wahrscheinlich<br />
neidvoll aufblicken, wenn er an meiner Stelle stünde. Einen Gärtner
konnten sie sich jedenfalls leisten und die Rosen unterlagen<br />
wahrscheinlich <strong>der</strong> Pflege <strong>der</strong> guten alten Frau.<br />
Langsam stieg ich aus meiner alten Karre, ein Geschenk von meinem<br />
Großvater und näherte mich dem Anwesen. Anstelle einer Glocke war<br />
rechts eine Zugvorrichtung, wie in früheren Zeiten, als elektrisch noch ein<br />
Fremdwort war. Die ganze Front des Hauses war mit irgendwelchen<br />
Rankpflanzen abgedeckt, sodass man nicht einmal den Verputz sehen<br />
konnte. Offensichtlich stand ich unter Dauerbeobachtung, denn als ich<br />
nach <strong>der</strong> Glocke greifen wollte, ging auch schon die Türe auf.<br />
Eine etwa achtzig Jahre alte, aber gut erhaltene Dame mit streng<br />
zurückgekämmten Haaren streckte mir ihre zitternde Hand entgegen. Nur<br />
ihre geknickte Haltung machte ihr wahres Alter augenscheinlich, aber sie<br />
war mir gleich sympathisch.<br />
»Sie müssen Dominik Ehrmann sein. Schönes Auto, da fühlt man sich<br />
gleich fünfzig Jahre jünger bei dem Anblick.«<br />
»Ich hab ihn auch schon acht Jahre, und als ich ihn geschenkt bekam, war<br />
er auch schon zweiundvierzig.«<br />
»Doch kommen Sie bitte herein. Darf ich Ihnen Ihre Jacke abnehmen? Ihre<br />
Mappe werden Sie wahrscheinlich brauchen?«<br />
»Hören Sie mal, gute Frau. Ich glaube Sie verschwenden nur Ihre Zeit mit<br />
diesem Projekt. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann.«<br />
»Jetzt kommen Sie doch erst mal rein und setzen Sie sich, damit ich Ihnen<br />
alles von Anfang an erzählen kann. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«<br />
»Gern, mit Milch, und ohne Zucker«, ließ ich mich überreden.«<br />
Während die Alte in <strong>der</strong> Küche verschwand schaute ich mich um. Das<br />
Wohnzimmer war dem Haus entsprechend ziemlich geräumig und mit den<br />
verschiedensten Antiquitäten, aus unterschiedlichen Epochen vollgestopft.<br />
Ein wahrscheinlich echter Renoir bildete das Prunkstück des Raumes,<br />
bemerkte ich mit dem sachverständigen Blick eines Kenners. Die Fenster<br />
müssen nachträglich eingesetzt worden sein, da sie in ihrer Größe nicht<br />
den zwanziger Jahren entsprachen. Die Sitzgelegenheiten waren alt und<br />
nicht gerade bequem, aber ich hatte auch nicht vor, den ganzen Tag hier<br />
zu verbringen. Auf einem Beistelltischchen stand eine chinesische Vase,<br />
wahrscheinlich aus <strong>der</strong> Ming Dynastie.
»Andreas hatte auch seine Freude an alten Autos. Schon als Zehnjähriger<br />
hat er Modelle gesammelt«, erklärte Frau Winter, als sie mit dem Kaffee<br />
zurückkam.<br />
»Nehmen Sie doch bitte Platz, wo immer sich möchten.« Ich setzte mich<br />
auf einen Stuhl von irgendeinem französischen Louis und ließ mir Kaffee<br />
einschenken.<br />
»Nun erzählen Sie mir doch bitte, was Sie genau von mir wollen?«<br />
»Wie ich Ihnen bereits am Telefon erklärt habe, handelt es sich um das<br />
Verschwinden unseres Enkels Andreas vor nunmehr sechzehn Jahren. Er<br />
war damals achtzehn, also 1974 geboren, und zwar am 31.Juli. Wäre gut,<br />
wenn Sie sich das Datum aufschreiben würden, könnte wichtig sein.«<br />
»Moment mal Frau Winter, ich habe Ihnen noch gar nicht zugesagt, dass<br />
ich den Auftrag übernehme.«<br />
»Dann müssen wir uns wahrscheinlich erst über die Bezahlung einig<br />
werden, ich möchte ungern alles zweimal erzählen.«<br />
»Es geht mir weniger um die Bezahlung, son<strong>der</strong>n um die praktische<br />
Umsetzbarkeit Ihres Auftrags.«<br />
»Sehen Sie, Herr Ehrmann. Die Polizei hat vor sechzehn Jahren, als die<br />
Spuren noch frisch waren nichts aber auch gar nichts Greifbares zutage<br />
geför<strong>der</strong>t. Wir hätten schon damals jemand an<strong>der</strong>en einschalten sollen,<br />
ließen uns aber von zuständigen Beamten aufschwatzen, dass alles an<strong>der</strong>e<br />
sinnlos sei, wenn die Polizei nichts findet. Erst als wir diesen Januar von<br />
den sexuellen Übergriffen im Kloster Gabrielsberg erfuhren, und dass ein<br />
Onkel von Andreas in diese Sache verwickelt ist, beschlossen wir <strong>der</strong> Sache<br />
noch einmal nachzugehen.«<br />
»Sie meinen also, Andreas sei möglicherweise ein Opfer?«<br />
»Wir vermuten es stark, da sein Onkel ihn nach dem Tod seiner Eltern<br />
dorthin gebracht hat.«<br />
»Aber er war zuletzt in einer psychiatrischen Klinik, wissen Sie warum?<br />
Und was hat sein Onkel mit <strong>der</strong> ganzen Angelegenheit zu tun?«<br />
»Das haben Sie also schon herausgefunden«, strahlte die Alte. »Man hat<br />
uns 1990 gesagt er leide an paranoi<strong>der</strong> Schizophrenie.«<br />
»Und wer hat diese Diagnose gestellt?«<br />
»Der Chefarzt <strong>der</strong> Klinik St. Martin in Stans.«
»Erzählen Sie von Anfang an. Alles was Sie wissen und lassen Sie nichts<br />
aus.« Langsam aber sicher begann mich das Thema zu interessieren.<br />
»Wir wollten ihn natürlich sofort besuchen, aber man sagte uns, wir<br />
könnten nicht zu ihm, da er sehr gewalttätig sei. Und das ging dann volle<br />
zwei Jahre so. Wir haben immer wie<strong>der</strong> Anlauf genommen, aber stets<br />
dieselbe Antwort erhalten.«<br />
So saß ich geschlagene sechs Stunden bei Frau Winter, welche nur durch<br />
das Mittagessen unterbrochen wurden. Es war doch recht ungewöhnlich,<br />
dass die Winters in einem Zeitraum von zwei Jahren nie zu ihrem Enkel<br />
vorgelassen wurden. Etwa nach zwei Stunden stieß auch ihr Mann zu uns,<br />
ein fast weißhaariger etwa Fünfundachtzigjähriger, doch ein relativ gut<br />
erhaltenes Exemplar von einem Hünen von Mann.<br />
Um sechzehn Uhr setzte ich mich in meinen MG und fuhr mit gemischten<br />
Gefühlen Richtung Zürich.<br />
In Sihlbrugg legte ich im Mövenpick eine Kaffeepause ein. Ich musste mir<br />
über Einiges klar werden, denn außer einem vor fünfzehn Jahren in Hanau<br />
abgestempelten Brief, in dem Andreas seinen Großeltern mitteilt, dass es<br />
ihm gut geht, hatte ich nichts aber auch gar nichts nur halbwegs<br />
Brauchbares in <strong>der</strong> Hand. Die Bezahlung war mit vierhun<strong>der</strong>t Franken<br />
Tagessatz plus Spesen mehr als gut, an dem konnte es nicht scheitern.<br />
Trotzdem hatte ich mir einen Tag Bedenkzeit ausbedungen und die Winters<br />
mit meiner Entscheidung auf Morgen vertröstet. Ich versprach ihnen, es<br />
mir nicht leicht zu machen.<br />
Und nun saß ich da, bei einem Kaffee und war hin- und hergerissen.<br />
Einerseits interessierte mich das Thema, da sexuelle Gewalt in <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong><br />
ja gerade sehr aktuell war, aber dem standen die äußerst dürftigen<br />
Angaben gegenüber.<br />
Bei meiner Befragung brachte ich noch in Erfahrung, dass Andreas einen<br />
Jugendfreund hatte. Frau Winter meinte, es könnte eine Möglichkeit sein,<br />
dass dieser Jugendfreund mit <strong>Namen</strong> Markus Bucher wisse, wo Andreas<br />
sich aufhält.
Natürlich schoss mir sofort die Frage in den Kopf, warum sie diesen Freund<br />
nicht schon selbst danach gefragt hätten. Dies sei versucht worden, aber<br />
we<strong>der</strong> über seine Eltern noch sonst irgendwie, sind sie an seine Adresse<br />
gekommen und das mutete doch schon sehr komisch an. Und da wäre noch<br />
dieser Pater Benjamin <strong>der</strong> Onkel von Andreas, <strong>der</strong> irgendwohin versetzt<br />
wurde, wie das bei <strong>der</strong> katholischen <strong>Kirche</strong> in solchen Missbrauchsfällen<br />
Gang und Gäbe war. Lauter Fragezeichen, aber vielleicht ein Anfang…?<br />
Doch was mich am Meisten interessierte, war die Thematik, welche für<br />
eine Story genügend Zündstoff zu liefern versprach und so beschloss ich<br />
nach dem letzten Schluck Kaffee, den Auftrag anzunehmen. Ich glaubte<br />
mittlerweile auch, dass ich mit meiner journalistischen Spürnase intakte<br />
Chancen hatte, ihn zu finden.
Luzern 1974 – 1986<br />
Das Eheglück von Walter und Gisela Winter war perfekt, als Andreas am<br />
31.Juli 1974 das Licht <strong>der</strong> Welt erblickte. Andreas war kein normales Kind<br />
und bereits mit zwei Jahren den an<strong>der</strong>en gleichaltrigen Kin<strong>der</strong>n weit<br />
voraus. Schon früh nahm ihn sein Vater, <strong>der</strong> seinen Lebensunterhalt als<br />
Vizedirektor bei <strong>der</strong> damaligen Bankgesellschaft in Luzern verdiente, zum<br />
Fischen und an<strong>der</strong>en Freizeitaktivitäten mit.<br />
Bereits im Alter von vier Jahren rechnete Andreas besser, als ein Schüler<br />
<strong>der</strong> vierten Klasse und konnte Lesen und Schreiben, obwohl ihn seine<br />
Eltern keineswegs dazu antrieben. Trotzdem wurde Andreas erst mit sechs<br />
eingeschult, aber auf Anraten seines Lehrers sofort in die zweite Klasse<br />
versetzt, welche er als Klassenbester abschloss.<br />
Trotz seiner Intelligenz fiel es Andreas nicht schwer, Freundschaften zu<br />
schließen. Schon früh wurden <strong>der</strong> ein Jahr ältere Markus Bucher und<br />
Andreas dicke Freunde, die unzertrennlich ihre Freizeit verbrachten. Die<br />
Winters lebten in einem Einfamilienhaus in <strong>der</strong> Oberseeburg in Luzern, die<br />
Buchers zwei Häuser weiter. Der sehnliche Wunsch von Andreas nach<br />
einem Hund, wurde ihm im Alter von fünf Jahren erfüllt und sein Labrador<br />
Alec und er waren von da an unzertrennlich. <strong>Im</strong> Park am See beim<br />
Verkehrshaus waren die beiden Jungs mit Alec fast täglich anzutreffen.<br />
Auch Bubenstreiche gehörten zur Tagesordnung.<br />
So waren sie wie besessen darauf, Alec immer dann ins Wasser zu schicken,<br />
wenn eine schick angezogene Dame im Anmarsch war, um ihn dann im<br />
richtigen Moment zurückzupfeifen, schütteln zu lassen und abzuhauen.<br />
Das ging so lange, bis die Rechnungen <strong>der</strong> Chemisch Reinigung so hoch<br />
wurden, dass Vater Winter <strong>der</strong> Kragen platzte.<br />
Schon früh kam immer öfters <strong>der</strong> Bru<strong>der</strong> von Andreas Mutter, <strong>der</strong><br />
dreißigjährige Pater Benjamin zu Besuch, <strong>der</strong> in einem Kloster als Lehrer<br />
arbeitete und an dem kleinen Jungen beson<strong>der</strong>en Gefallen fand. Pater<br />
Benjamin war nicht beson<strong>der</strong>s groß und hatte trotz seiner erst dreißig<br />
Jahre bereits einen kleinen Bauchansatz.
Als Andreas acht Jahre alt war, überredete Benjamin seine Mutter, ihm<br />
Andreas für einen Tag zu überlassen, damit er ihm das Kloster zeigen<br />
könne.<br />
»Du willst ihn aber nicht gleich zum Papst machen«, lächelte die Mutter.<br />
So bestiegen Benjamin und Andreas an einem Maimorgen im Jahr 1982 im<br />
Bahnhof Luzern den Zug und fuhren nach Gabrielsberg.<br />
Benjamin war sehr freundlich mit Andreas. Er kaufte ihm am Bahnhof ein<br />
Eis und wurde nicht müde, die vielen Fragen, mit denen <strong>der</strong> kleine Andreas<br />
ihn löcherte, zu beantworten. Andreas hatte kurze Hosen an, dachte sich<br />
aber nichts weiter dabei, als Benjamin ihm immer wie<strong>der</strong> die Hand auf<br />
seinen Oberschenkel legte. Die ganze Fahrt über ließ Benjamin keinen<br />
Augenblick Erklärungsnotstand aufkommen.<br />
In Gabrielsberg angekommen wan<strong>der</strong>ten sie vom Bahnhof zum Kloster.<br />
»Das ist ja riesig«, meinte Andreas.<br />
»Es wohnen auch sehr viele Leute drin und muss Platz haben für viele<br />
Schüler. Vielleicht gehst du auch einmal hier zur Schule, wer weiß? Du<br />
kannst hier das Gymnasium besuchen.«<br />
Andreas war beeindruckt von den großen Räumen. Nachdem er Andreas<br />
die Klassenzimmer gezeigt hatte, fragte er ihn, ob er sehen wolle, wo er<br />
wohne und führte ihn in einen Seitentrakt direkt in sein Zimmer.<br />
»Nicht gerade komfortabel«, meinte Andreas.<br />
»Das ist auch nicht nötig, schließlich ist das ein Kloster und kein 5-Sterne<br />
Hotel.«<br />
»Warum bist du eigentlich Priester geworden?«<br />
»Das ist eine lange Geschichte. Aber ich glaube vor allem, weil es Vater<br />
und Mutter so wollten. Früher war es so, dass man gern irgendeinen<br />
Heiligen in <strong>der</strong> Familie hatte.«<br />
»Dann darfst du nie eine Frau haben?«<br />
»Nein, das habe ich geschworen. Hat eigentlich schon jemand dein<br />
Zipfelchen gesegnet?«<br />
»Was gesegnet?«<br />
»Ja, dein Zipfelchen, das was du zwischen den Beinen trägst und mit dem<br />
du Pipi machst.«<br />
»Muss man denn das?«
»Ja, aber man darf niemandem davon erzählen, sonst wird <strong>der</strong> liebe<br />
Herrgott sehr böse.«<br />
»Und wer kann einem das Zipfelchen segnen?«<br />
»Je<strong>der</strong> Priester kann das. Wenn du willst, mach ich das bei dir, ich bin<br />
schließlich auch Priester. Lass deine Hose herunter und leg dich aufs Bett.«<br />
Andreas tat wie ihm geheißen.<br />
»Die Unterhose natürlich auch«, sagte Benjamin und schaute Andreas mit<br />
lüsternen Augen an.<br />
Benjamin nahm den kleinen Penis von Andreas in seine rechte Hand und<br />
fing an ihn zu streicheln. Seine linke Hand führte er in seine Hose.<br />
»Muss das denn sein«, fragte Andreas.<br />
»Ja, das dauert jetzt ein Weilchen, dann wird meine göttliche Milch auf dein<br />
Zipfelchen fließen.«<br />
Nach einer Weile nahm Benjamin seinen Penis aus <strong>der</strong> Hose und…<br />
»Au, das ist ja eklig, was ist das?«<br />
»Das ist die göttliche Milch. Die reib ich dir jetzt ein und damit ist dein<br />
Zipfelchen jetzt gesegnet. Aber so einen Segen muss man ständig<br />
wie<strong>der</strong>holen, das ist wie mit <strong>der</strong> heiligen Beichte. Nur so bleibt man rein<br />
vor Gott.<br />
Da hast du ein Taschentuch, damit kannst du dich abwischen und vergiss<br />
ja nicht: Zu keiner Menschenseele ein Wort, sonst kommt Gottes Strafe<br />
über dich, und das möchtest du doch nicht?«<br />
Sie verließen das Kloster, Andreas bekam im Dorf noch eine Cola, dann<br />
fuhren mit dem nächsten Zug wie<strong>der</strong> Richtung Luzern.<br />
»Und meiner Mama darf ich auch nichts sagen«?, fragte Andreas noch<br />
sichtlich verstört.<br />
»Ich hab dir gesagt keinem Menschen, beson<strong>der</strong>s deiner Mama nicht.«<br />
In dieser Nacht wurde Andreas das erste Mal von Albträumen geplagt.<br />
<strong>Im</strong>mer wie<strong>der</strong> sah er im Traum den großen Penis von Benjamin und die<br />
heilige Milch, welche schließlich daraus … Mit je<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>holung des<br />
Traums wurde <strong>der</strong> Penis größer, sodass Andreas das Gefühl hatte, von<br />
einem Gartenschlauch abgespritzt zu werden und aus dem Gartenschlauch<br />
wurde ein Feuerwehrschlauch.
Jede Nacht in <strong>der</strong> folgenden Woche wie<strong>der</strong>holte sich <strong>der</strong> Traum, sodass<br />
Andreas sich keinen an<strong>der</strong>en Rat mehr wusste, als sich seinem Freund<br />
Markus anzuvertrauen.<br />
Die beiden saßen auf einem Stein am Ufer des Vierwaldstättersees und<br />
starrten auf das in <strong>der</strong> Abendsonne glitzernde Wasser.<br />
»Wurde dein Zipfelchen auch schon gesegnet?«<br />
»Mein was wurde gesegnet?«<br />
»Jetzt komm, du weißt schon dein Zipfelchen.«<br />
»Wovon sprichst du überhaupt?«<br />
»Ich darf dir eigentlich gar nichts erzählen, sonst erwartet mich die Strafe<br />
Gottes, Pater Benjamin hat’s gesagt.«<br />
»Und bitte was sollst du nicht erzählen?«<br />
»Eben das mit dem Segnen. Keinem Menschen darf ich das sagen.«<br />
»Dann erzähl's doch dem Stein da hinten.«<br />
»Gute Idee, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen?«<br />
Andreas erzählte dem Stein alles haarklein, was er erlebt hatte in<br />
Benjamins Zimmer.<br />
»Und das soll ich dir glauben?«<br />
»Ich lüge nicht«, entgegnete Andreas böse.<br />
»Schon gut, schon gut, ich glaub's dir ja. Und du meinst wirklich da ist was<br />
dran?«<br />
»Warum sollte Pater Benjamin mich anlügen, schließlich ist er ein heiliger<br />
Mann.«<br />
»Da hast du auch wie<strong>der</strong> Recht. Hat’s weh getan?«<br />
»Das nicht, es war nur ein bisschen unangenehm, beson<strong>der</strong>s als er mein<br />
Zipfelchen in die Hand nahm.«<br />
»Und er hat wirklich gesagt man müsse das wie<strong>der</strong>holen, wie die Beichte.«<br />
»Ja, und du wirst es ganz bestimmt niemandem erzählen, schwörst du es<br />
bei <strong>der</strong> Jungfrau Maria?«<br />
»Ich schwöre es.«<br />
In den nächsten Jahren wurde diese Behandlung Andreas noch einige Male<br />
zuteil. Mit <strong>der</strong> Zeit musste er den großen Penis von Benjamin selbst in die<br />
Hand nehmen und so lange daran reiben, bis die ›göttliche Milch‹…
Als Andreas zehn war, fragte ihn sein Vater in den Sommerferien, ob er ihn<br />
nach Frankfurt begleiten möchte. Andreas war hellbegeistert von <strong>der</strong> Idee<br />
seines Vaters.<br />
Er staunte Bauklötze, als er die vielen Flugzeuge am Flughafen Zürich-<br />
Kloten sah.<br />
Sein Vater erklärte ihm die verschiedenen Maschinen und fragte ihn, ob er<br />
denn keine Angst vor dem Fliegen habe. Andreas verneinte und sagte nur,<br />
dass Fliegen etwas wäre, was er schon immer gern wollte.<br />
Es war ein sehr unruhiger Flug, doch endlich landeten sie nach einer<br />
knappen Stunde Flugzeit glücklich in Frankfurt.<br />
Sie suchten sich ein Taxi und ließen sich durch den Feierabendverkehr zum<br />
Hotel Hilton chauffieren.<br />
Der Vater von Andreas hatte am nächsten Morgen einige Termine, sagte<br />
aber, dass er am Nachmittag frei wäre, und sie die Stadt unter die Lupe<br />
nehmen könnten. Er nannte ihm die Nummer vom Zimmerservice, um das<br />
Frühstück zu bestellen.<br />
»Warte hier auf mich und rühre dich nicht von <strong>der</strong> Stelle, du könntest<br />
verloren gehen in dieser großen Stadt.«<br />
Andreas tat wie ihm geheißen. Er bestellte das Frühstück, welches ihm<br />
nach etwa fünfzehn Minuten serviert wurde, und aß gierig vier Croissants.<br />
Doch dann fing er sich an zu langweilen und beschloss entgegen <strong>der</strong><br />
Weisung seines Vaters das Hotel zu inspizieren. Er fuhr mit dem Lift bis ins<br />
Erdgeschoss und trat, sich zweimal umsehend, in die große Hotelhalle mit<br />
den dicken weißen Säulen, die ihm schon am Vorabend aufgefallen waren.<br />
Plötzlich tippte ihn jemand auf die Schulter und Andreas zuckte zusammen.<br />
»Kann ich dir helfen junger Mann«, fragte eine freundliche weibliche<br />
Stimme. Er drehte sich um und blickte direkt ins Gesicht einer<br />
wun<strong>der</strong>schönen Frau.<br />
»Ich möchte mir nur das Hotel ansehen«, antwortete Andreas, dessen<br />
Kopf eine hochrote Farbe angenommen hatte.<br />
»Bist wohl aus <strong>der</strong> Schweiz, junger Mann?«<br />
»Ja, aus Luzern.«
»Soll ich dir das Hotel zeigen, ich habe im Moment Pause und sowieso<br />
nichts Besseres zu tun.«<br />
»Das wäre sehr lieb von Ihnen, arbeiten Sie hier?«<br />
»Ja, an <strong>der</strong> Rezeption. Was willst du zuerst sehen, das Schwimmbad?«<br />
»Au toll, hier gibt es sogar ein Schwimmbad?«<br />
»Ein sehr großes dazu.«<br />
Sie nahm ihn bei <strong>der</strong> Hand. »Ich heiße Rosi und wer bist du?«<br />
»Andreas, Andreas Winter.«<br />
»Freut mich Herr Andreas Winter.«<br />
»Und wie heißen Sie mit Nachnamen«, fragte Andreas während sie die<br />
Lobby durchschritten.<br />
»Elmenhorst.«<br />
»Wie bitte?«<br />
»Elmenhorst, das ist ein deutsches Geschlecht, gibt’s wahrscheinlich nicht<br />
in <strong>der</strong> Schweiz. Aber du darfst ruhig Rosi zu mir sagen.«<br />
Rosi führte Andreas erst durch die Bar, dann ins Schwimmbad und<br />
schließlich in den Ball Raum.<br />
Andreas kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, sodass er mit offenem<br />
Mund neben Rosi herging. Nach <strong>der</strong> Führung bot ihm Rosi an <strong>der</strong><br />
Rezeption einen Stuhl an und organisierte ein Glas Limonade.<br />
Andreas kam sich vor wie <strong>der</strong> Hoteldirektor persönlich, als plötzlich sein<br />
Vater die Lobby betrat und auf die Rezeption zusteuerte.<br />
»Was machst denn du hier? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf deinem<br />
Zimmer bleiben?«<br />
»Aber Herr Winter«, sagte Rosi. »Wir haben uns prächtig unterhalten und<br />
ich habe Ihrem Sohn das Hotel gezeigt. Er hat überhaupt nichts angestellt,<br />
Sie haben einen wun<strong>der</strong>vollen Jungen.«<br />
Herrn Winter blieb nichts weiter übrig, als sich bei Rosi zu bedanken. Auf<br />
dem Weg zum Zimmer bekam Andreas aber noch einmal so richtige<br />
Schelte.<br />
Sie gingen auf den Henninger Turm zum Mittagessen und sein Vater zeigte<br />
Andreas am Nachmittag die Stadt.
»Wir müssen uns beeilen Andreas. Um halb acht geht unser Flieger, und<br />
wir haben noch unser Gepäck im Hotel.«<br />
Andreas verabschiedete sich von Rosi und sie sagte ihm: »Wenn du wie<strong>der</strong><br />
einmal in Frankfurt bist, kommst du mich besuchen.«<br />
»Klar doch, sagte Andreas.«<br />
Gegen halb neun landeten sie auf dem Flughafen Zürich-Kloten und fuhren<br />
auf dem schnellsten Weg nach Luzern, wo sie gegen zehn Uhr abends<br />
eintrafen und von Alec stürmisch begrüßt wurden.<br />
Eine Woche später war Andreas wie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schule.<br />
Am Freitag 8.Oktober 1986, die Eltern von Andreas waren nach Zürich<br />
gereist, kam die Schreckensnachricht. Die Eltern von Andreas waren beide<br />
tot. Ein Tanklaster ist von einer Rampe auf die unten liegende Fahrbahn<br />
gestürzt und hat das Auto <strong>der</strong> Winters unter sich begraben. Sie hatten<br />
beide nicht den Hauch einer Chance.<br />
Andreas litt Höllenqualen am Verlust seiner Eltern und wurde<br />
vorübergehend bei seinen Großeltern einquartiert.<br />
Aber er hatte die Rechnung ohne Pater Benjamin gemacht, <strong>der</strong> seine<br />
Großeltern so lange beschwatzte, bis diese schließlich einwilligten, ihn in<br />
die Internatsschule des Klosters Gabrielsberg zu geben. Alles Wehren<br />
nützte Andreas nichts mehr. Kaum waren seine Eltern unter <strong>der</strong> Erde,<br />
wurde er von Benjamin am Schlafittchen gepackt und nach Gabrielsberg<br />
verfrachtet, wo er in die erste Klasse des Gymnasiums eintrat.
Zürich Mai 2008<br />
Dominik ging die Suche sehr methodisch an. Aufgrund <strong>der</strong> möglichen<br />
Brisanz des Themas begann er, die Zeitungen nach den Missbrauchsfällen<br />
im Kloster Gabrielsberg zu durchforsten. Er fand dokumentiert nur den<br />
Fall Benjamin Kramer, <strong>der</strong> jedoch nach <strong>der</strong> Entdeckung, wie vom Erdboden<br />
verschluckt zu sein schien.<br />
Nach Rücksprache mit <strong>der</strong> alten Frau Winter handelte es sich bei diesem<br />
Benjamin tatsächlich um den Onkel von Andreas.<br />
Eine telefonische Anfrage beim Kloster ergab ebenfalls keinen Aufschluss<br />
über den <strong>der</strong>zeitigen Aufenthaltsort von Pater Benjamin. Dominik<br />
überlegte, griff zum Telefon und ließ sich mit <strong>der</strong> Einwohnerkontrolle von<br />
Gabrielsberg verbinden. Dort erhielt er bestätigt, dass auch Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Klostergemeinschaft bei <strong>der</strong> Gemeinde registriert sein müssen.<br />
Er beschloss persönlich vorbeizuschauen und dachte in <strong>der</strong> Hoffnung,<br />
keiner würde einen Ausweis verlangen, sich als Neffe von Kramer<br />
auszugeben. Am Morgen des 16. Mai setzte er sich in seinen Oldtimer und<br />
fuhr über Luzern nach Gabrielsberg. Ohne lang zu suchen, fand er die<br />
Gemeindeverwaltung. Dominik entschied vorerst nicht zu erwähnen, dass<br />
es sich um ein Mitglied des Klosters handelt, son<strong>der</strong>n vorzugeben, es ginge<br />
um einen normalen stinklangweiligen Einwohner.<br />
Eine hübsche junge Brünette mit kerzengeraden, langen Haaren, die<br />
wahrscheinlich noch in <strong>der</strong> Ausbildung war, stand von ihrem Schreibtisch<br />
auf und öffnete die Schalterflügel.<br />
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie in ihrem sehr speziellen<br />
Obwaldnerdialekt und lächelte Dominik freundlich zu.<br />
»Ich wollte meinen Onkel besuchen und musste feststellen, dass er nicht<br />
mehr in Gabrielsberg wohnt, wo er vor fünf Jahren gewohnt hat.«<br />
»Wie heißt denn ihr Onkel?«<br />
»Benjamin Kramer.«<br />
Sie drehte sich abrupt um, ging an ihren Arbeitsplatz und tippte etwas in<br />
ihren Computer.
Er dachte schon, wahrscheinlich Glück gehabt, als sie an den Schalter<br />
zurückkam, um ihm mitzuteilen, dass sie über den Aufenthaltsort von<br />
Herrn Kramer keine Auskunft erteilen dürfe. Gleichzeitig schob sie ihm<br />
mehr als diskret einen zusammengefalteten Zettel zu, den er schnell in<br />
seiner Tasche verschwinden ließ.<br />
»Tut mir Leid, man sieht sich« und schon schlossen sich die Schalterflügel.<br />
Er verließ das Gemeindehaus und schielte draußen verstohlen auf den<br />
Zettel.<br />
Treffen sie mich um 12.15 Uhr im Café Twiny.<br />
Um die Zeit zu vertreiben, fuhr er wahllos eine Stunde durch Gabrielsberg<br />
und setzte sich um 11.30 Uhr ins Café.<br />
Pünktlich um 12.15 tippte ihm die Dame vom Gemeindehaus auf die<br />
Schulter, grüßte und nahm ihm gegenüber Platz.<br />
»Ich heiße Vreni, und Sie sind kein Neffe, und er ist auch nicht Ihr Onkel,<br />
stimmts?«<br />
»Wenn Sie so wollen, ja. Wird das etwa ein Verhör?«<br />
»Was sind Sie denn nun?«<br />
»Ich bin freischaffen<strong>der</strong> Journalist und habe von einer Privatperson den<br />
Auftrag jemanden zu finden und dieser Kramer könnte mir vielleicht<br />
weiterhelfen.«<br />
Sie räusperte sich, blickte ihm in die Augen und bedachte ihn mit einem<br />
mehr als abgeklärten Blick.<br />
»Da ich ihn nicht in unserem System gefunden habe, wurde ich sofort<br />
stutzig, weil mich vor etwa zwei Wochen eine Dame angerufen hat und mir<br />
dieselbe Frage stellte. Durch Zufall habe ich nach diesem Telefonat<br />
herausgefunden, dass es Leute gibt, die einfach aus dem System entfernt,<br />
und in einer geheimen Datei aufbewahrt werden. Da ich unbedingt wissen<br />
wollte, was das für Leute sind, habe ich begonnen herumzuspionieren und<br />
die Kartei in einem Schrank des Gemeindepräsidenten gefunden. Das<br />
Einzige, was ich entdeckt habe, sind drei <strong>Namen</strong>, die alle im Umfeld des<br />
Klosters angesiedelt sind. Sie müssen mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie<br />
die Quelle dieser Information niemals preisgeben werden, was auch<br />
geschieht.«<br />
»Ich verfahre gewöhnlich so mit meinen Informanten.«
»Also Ihr Herr Kramer ist weggezogen, und zwar an den Starnberger See<br />
in einen Ort mit dem <strong>Namen</strong> Bernried. Was er dort macht, ist mir nicht<br />
bekannt.«<br />
»Und die an<strong>der</strong>en zwei?«<br />
»Die habe ich mir lei<strong>der</strong> nicht gemerkt, nur dass einer von ihnen nach<br />
Österreich gezogen ist. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum versteckt<br />
man drei Paters vor <strong>der</strong> Öffentlichkeit?«, fragte Vreni.<br />
»Denken Sie mal scharf nach. Haben Sie vor etwa vier Monaten von den<br />
sexuellen Übergriffen gehört?«<br />
»Ja schon, aber was hat das mit den Dreien zu tun? Au Scheiße, manchmal<br />
könnte ich mir an den Kopf schlagen. Einer von denen ist damals durch die<br />
Presse geschleift worden und damit nichts Schlimmeres passiert, hat man<br />
die zwei an<strong>der</strong>en auch verschwinden lassen.«<br />
»Genau.«<br />
»Und was wollen Sie jetzt weiter unternehmen?«<br />
»Diesem Kramer einen Besuch abstatten, persönlich natürlich.«<br />
»Das tönt spannend, Sie haben ja auch ganz schön was in <strong>der</strong> Hand am<br />
liebsten würde ich mitkommen.«<br />
»Es war schon anständig genug, dass Sie das Risiko auf sich genommen<br />
haben, mir in dieser Situation zu helfen. Das rechne ich Ihnen hoch an.<br />
Haben Sie Hunger? Ich möchte Sie gerne zum Mittagessen einladen.«<br />
»Fräulein können wir etwas zu Essen bestellen?«<br />
Sie bestellten das Essen und Vreni fing an, ihn auszufragen über seinen<br />
Beruf. Sie schien sich wirklich für den Beruf des Journalisten zu<br />
interessieren.<br />
Um halb zwei verabschiedete er sich von ihr und versprach ihr, von<br />
Bernried eine Karte zu schicken.<br />
Gegen vier war er wie<strong>der</strong> zurück in Zürich. Er setzte sich sofort hinter<br />
seinen Computer und fand auf <strong>der</strong> Gemeindewebseite, was ihn keineswegs<br />
erstaunte, den <strong>Namen</strong> B. Kramer unter Pfarrer von Bernried.<br />
Er fand es schon ziemlich erstaunlich, dass das Kloster dazu in <strong>der</strong> Lage<br />
war, einfach Personen aus dem Computer <strong>der</strong> Einwohnerkontrolle<br />
verschwinden zu lassen. Die <strong>Kirche</strong> sah offensichtlich ihre Aufgabe nur<br />
darin, ihre Angehörigen zu schützen, ungeachtet, was diese getan haben.
Am Montag wollte er sich gleich auf den Weg machen. Diesem Pfaffen<br />
würde er mal tüchtig einheizen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass<br />
jemand in dieser Gemeinde über sein ach so gütiges Vorleben Bescheid<br />
wusste.<br />
Aber warum eigentlich erst am Montag? Diese Spezies arbeitet doch vor<br />
allem am Wochenende.<br />
Dominik setzte sich in seinen Wagen und fuhr los. In St. Margrethen an <strong>der</strong><br />
Schweizer Grenze wurde er rechts ran gewunken. »Ich habe aber nichts<br />
zu verzollen«, schnaubte Dominik.<br />
»Ich wollte mir nur Ihren Wagen genauer ansehen«, erwi<strong>der</strong>te <strong>der</strong> Zöllner.<br />
»Tippe auf späte fünfziger, hab ich Recht.«<br />
»1958, ums genau zu sagen.«<br />
»Und immer noch <strong>der</strong> gleiche Motor?«<br />
»Nein, den Motor habe ich vor einem Jahr gegen einen neuen<br />
ausgetauscht. Auch das Kühlersystem ist neu, da es im Sommer im Stau<br />
immer mal wie<strong>der</strong> gekocht hat.«<br />
»Und das ist jetzt behoben?«<br />
»Ja, keine Probleme mehr.«<br />
»Muss einiges kosten, so einen Wagen zu unterhalten.«<br />
»Ja, aber dafür leiste ich mir sonst nichts und den Unterhalt verdiene ich<br />
mir mit Schmuggeln«, grinste Dominik.<br />
»Also dann, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.«<br />
Dominik beschloss über Memmingen Richtung München zu fahren und in<br />
Landsberg nach rechts, Richtung Bernried abzubiegen. Er war froh, dass<br />
er sein Dach öffnen konnte, denn für die Jahreszeit herrschte eine<br />
beträchtliche Hitze.<br />
In Bernried angekommen, war Dominiks Strategie sich erst mal im Dorf<br />
etwas umzuhören. So setzte er sich erst ins Gasthaus Engel an den<br />
Stammtisch.<br />
»Na kommens aus <strong>der</strong> Schwäz«, fragte ihn sein Sitznachbar, mit dem er<br />
ein belangloses Gespräch angefangen hatte.<br />
»Ja, warum hört man das?«<br />
»Un wia, Sie reden fast wie unser neuer Pforrherr.«
»Warum, ist <strong>der</strong> auch aus <strong>der</strong> Schweiz«, fragte Dominik mit schiefem<br />
Grinsen im Gesicht.<br />
»Ja, <strong>der</strong> ist vor etwa drei Monat hia akoa, nachdem unsa alter Pforrherr<br />
s'Zeitliche gsegnet hot.«<br />
»Ah, <strong>der</strong> ist erst drei Monate hier? Und wie macht er sich so?«<br />
»Warum wollens das denn wissen?«<br />
»Man wird sich doch noch über seine Landleute erkundigen dürfen.«<br />
»Ja, er is holt koana von uns. Aber es geht scho. Ma munkalt er sä<br />
strofversetzt woarda, so wie dieser Pfarrer Braun aus dem Fernsea, <strong>der</strong><br />
auch immer an einen an<strong>der</strong>en Ort hi vasetzt wiard. Der Dicke, wenn's<br />
wissen, wen i moan.«<br />
Wenn <strong>der</strong> wüsste, wie Recht er hat.<br />
Nach einer Stunde verließ Dominik das Gasthaus und steuerte direkt auf<br />
das Pfarrhaus zu.<br />
Nach zweimaligem Läuten öffnete sich langsam die Tür und eine sicher<br />
drei Zentner schwere mittelalterliche Frau mit den Händen in den Hüften<br />
baute sich vor ihm auf.<br />
»Was wollen Sie?«<br />
»Den Pfarrer sprechen.«<br />
»Da kann je<strong>der</strong> kommen. Um was geht’s?«<br />
»Das möchte ich Hochwürden selber sagen.«<br />
»Ich darf Sie aber nicht zu ihm lassen, wenn Sie mir nicht sagen, worum<br />
es sich handelt und jetzt verschwinden Sie.«<br />
»So, jetzt machen sie mal halblang gute Frau. Ich bin hier von einer<br />
Schweizer Versicherung. Es geht um eine alte Angelegenheit von damals<br />
in <strong>der</strong> Schweiz und darüber muss ich mit Hochwürden sprechen.«<br />
»Na dann, kommen's halt herein und setzen sie sich da nie<strong>der</strong>. Ich rufe<br />
ihn.«<br />
Er hatte sich Benjamin ganz an<strong>der</strong>s vorgestellt, als die Gestalt, die da<br />
gerade auf ihn zusteuerte. Er war klein und dick. Alles in allem eine<br />
unscheinbare Gestalt, an die man sich schlecht erinnert, wenn man sie<br />
nicht ein paar Mal zu Gesicht bekommen hat.<br />
»Von einer Versicherung sind Sie? Haben Sie eine Karte?«
»Ja, ich bin von <strong>der</strong> Versicherung, die Ihnen versichert, dass Sie hier nicht<br />
mehr lange Pfarrer sind, wenn Sie nicht den Mund aufmachen.«<br />
»Was fällt Ihnen ein, verlassen Sie sofort mein Haus.«<br />
»Das wird nicht mehr lange das Ihre sein, wenn ich es jetzt verlasse. Dann<br />
werden Sie sich vor lauter Schlagzeilen nicht mehr retten können, und <strong>der</strong><br />
liebe Gott wird Ihnen auch nicht mehr helfen. Die Leute hier werden nicht<br />
sehr davon erbaut sein, von einem ›Kindlificker‹ betreut zu werden.«<br />
»Nicht so laut kommen Sie in mein Büro.«<br />
Dominik nahm vor dem Schreibtisch Platz.<br />
»Was wollen Sie von mir?«<br />
»Steile Karriere muss schon sagen. Erst Kin<strong>der</strong>schän<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schweiz,<br />
dann Pfarrer in Deutschland. Die <strong>Kirche</strong> hat wie<strong>der</strong> Mal das verdammt<br />
zynische Gefühl, sie könne mit einem kleinen Ortswechsel alles vergessen<br />
machen.«<br />
»Hören Sie, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich habe<br />
geschworen, es kommt nie wie<strong>der</strong> soweit.«<br />
»Ach so, geschworen haben Sie? Sie haben doch auch geschworen, Gott zu<br />
dienen? Und dann vergreifen Sie sich in seinem und im <strong>Namen</strong> <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong><br />
an kleinen Jungs? Sie erzählen mir jetzt sofort alles, was ich wissen will,<br />
sonst fällt Ihre Predigt morgen aus, weil das ganze Dorf davon Kenntnis<br />
hat, was für ein Saukerl Sie in Wirklichkeit sind. Die Zeitungen werden es<br />
dann am Montagmorgen auf <strong>der</strong> Titelseite verkünden. O<strong>der</strong> soll ich noch<br />
dazu schreiben, dass Sie sich gebessert haben und heute Köchinnen und<br />
Nonnen vögeln?«<br />
»Sind Sie sich bewusst, dass Sie eben dabei sind, mein ganzes Leben zu<br />
ruinieren?«<br />
»Der einzige <strong>der</strong> hier Leben ruiniert sind Sie selbst, und zwar nicht nur Ihr<br />
eigenes, son<strong>der</strong>n die Zukunft vieler kleiner Jungs, die Ihnen anvertraut<br />
waren. Haben Sie eigentlich eine leise Ahnung davon, welchen seelischen<br />
Schaden Sie Ihren Schutzbefohlenen zugefügt haben?«<br />
»Was wollen Sie?«<br />
»Ich will alles wissen über Ihr Leben, und zwar von dem Tag an, an dem<br />
diese Schweinereien begonnen haben.«
Benjamin, <strong>der</strong> bis jetzt zum Fenster hinausgestarrt hatte, setzte sich hinter<br />
seinen Schreibtisch und schaute Dominik lange an.<br />
»Das kann ich nicht.«<br />
»Und ob Sie das können.« Dominik wollte schon aufstehen.<br />
»Halt, warten Sie. Wenn ich Ihnen alles erzähle, schreiben Sie dann nichts<br />
über mich?«<br />
»Sagen wir’s mal so. Es könnte Ihre Situation verbessern.«<br />
Dann begann er zu erzählen und Dominik drückte unbesehen die<br />
Aufnahmetaste seines Diktafons in <strong>der</strong> Jackentasche.<br />
»Und wo sind Ihre zwei Mitstreiter heute, und wie heißen sie?«<br />
Er erzählte Dominik alles haarklein. Nur eines verschwieg er, nämlich, dass<br />
es einen Vierten im Bunde gab. Dominik war davon überzeugt, dass ihm<br />
Benjamin nur die halbe Wahrheit erzählt hatte, doch es wurde ihm von<br />
dem, was er hörte schon speiübel. Auf die Frage wo Andreas heute sei,<br />
wusste Benjamin keine Antwort. Es war nicht zu fassen, wozu diese<br />
heiligen Männer fähig waren.