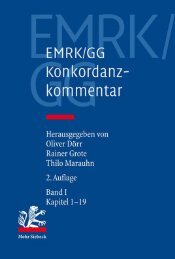Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
§ 36 „Evangelisches Gottesdienstbuch“ und „Reformierte Liturgie“<br />
Veränderung der<br />
Wahrnehmung<br />
mung zu überschreiten, ein um immer mehr Stücke erweiterter Eröffnungsteil<br />
des Gottesdienstes entspricht; in diesem Zusammenhang wurde sogar<br />
schon kritisch vom Eröffnungsteil als dem „Wasserkopf“ des Gottesdienstes<br />
gesprochen (Bieritz 59f.). Will man dies jedoch positiv wenden, kann formuliert<br />
werden: Die Schwelle wird auf dramaturgischem Wege zeitlich gedehnt.<br />
Dazu passt auch die Beobachtung, dass es wesentlich leichter ist, den<br />
Weg zurück zu finden, denn der Sendungs- und Segnungsteil des Gottesdienstes<br />
ist sehr viel kürzer und weniger variantenreich.<br />
Real ist auch die Unterbrechung der „Geschäftstätigkeit“ (Schleiermacher<br />
70–72) schon durch den Kirchgang selbst vollzogen. Aber Wort und Sakrament<br />
suchen mit verschiedenen diskursiven und symbolischen Elementen<br />
die äußere Unterbrechung in eine innere Wahrnehmungsveränderung zu<br />
überführen. Die dramaturgische Betrachtungsweise des Gottesdienstes richtet<br />
ihren Blick nicht nur auf die einzelnen Elemente und auf deren historisch<br />
entstandene und veränderte Bedeutung, sondern auf deren Zusammenwirken<br />
als Verlangsamung und damit auf die Intensivierung der gottesdienstlichen<br />
Schwelle und Unterbrechung. Am Schluss dieses Buches, nachdem die einzelnen<br />
Schritte des Gottesdienstes erläutert wurden, wird darauf näher einzugehen<br />
sein (→ § 47).<br />
Zusammenfassung<br />
Das liturgische Handeln kann als eine Form des künstlerischen Handelns<br />
beschrieben werden, weil dazu die Kenntnis von Regeln ebenso erforderlich<br />
ist wie die situativ notwendige Durchbrechung der Regeln. Die (professionelle)<br />
Handlungskompetenz setzt dabei zunächst verschiedene Kenntnisse<br />
und Verstehensfähigkeiten voraus, um die es in den bisherigen Paragraphen<br />
dieses Buches ging. In dem jetzt folgenden handlungsorientierten Kapitel<br />
(§§ 35–48) soll der Sonntagsgottesdienst als der „Normalfall“ und als Modell<br />
zugrundegelegt werden. Im Hinblick auf die liturgische Gestaltung soll dabei<br />
besonders auf die „Dramaturgie“ des Gottesdienstes geachtet werden. Darunter<br />
wird der Zusammenhang der einzelnen gottesdienstlichen Elemente im<br />
Hinblick darauf verstanden, wie das Mitfeiern des Gottesdienstes zur Schwellenerfahrung<br />
und Unterbrechung des alltäglichen Zeiterlebens werden kann.<br />
§ 36 Das „Evangelische Gottesdienstbuch“ und die<br />
„Reformierte Liturgie“ aus dem Jahr 1999<br />
Literatur: Karl-Heinrich Bieritz: Struktur. Überlegungen zu den Implikationen<br />
eines Begriffs im Blick auf künftige Funktionen liturgischer Bücher, in: ders.: Zeichen<br />
setzen. Beiträge zu Gottesdienst und Predigt, Stuttgart 1995, 61–81 ♦ Evangelisches<br />
396<br />
Leseprobe aus Meyer-Black: <strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
(c) 2011 <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> www.mohr.de