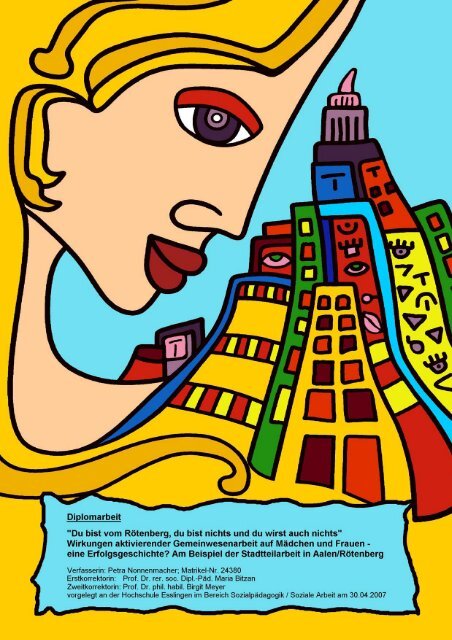Untitled - AG Rötenberg
Untitled - AG Rötenberg
Untitled - AG Rötenberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung ......................................................................................................................4<br />
1. Gemeinwesenarbeit (GWA) in der Theorie............................................................. 6<br />
1.1 Zur Geschichte von Gemeinwesenarbeit....................................................................7<br />
1.1.1 Die Anfänge von Gemeinwesenarbeit ...................................................................7<br />
1.1.2 Die Entwicklung der Gemeinwesenarbeit in Deutschland ...................................12<br />
1.1.3 Wesentliche Ansätze von Gemeinwesenarbeit ...................................................16<br />
1.2 Gemeinwesenarbeit – Heute so gut wie gestern? ....................................................16<br />
1.2.1 Was ist GWA und was tut sie? ............................................................................17<br />
Exkurs: Individualisierung und Pluralisierung ......................................................18<br />
1.2.2 Der Soziale Raum und sein Quartier ...................................................................24<br />
1.2.3 GWA morgen – ein Ausblick................................................................................25<br />
1.2.4 Saatgut: GWA......................................................................................................27<br />
1.3 Das weibliche Gemeinwesen - „Eine Stadt der Frauen oder das Land der<br />
Amazonen?“...............................................................................................................28<br />
1.3.1 Weibliche Lebenslagen im Spiegelbild der Gesellschaft .....................................29<br />
1.3.2 Wenn ein Gemeinwesen zum Brennpunkt wird… ...............................................34<br />
Exkurs: Frauen und Armut ...................................................................................35<br />
1.3.3 Frauenwelten im „Brennpunkt“ ............................................................................37<br />
1.4 Das aktivierende weibliche Gemeinwesen ...............................................................41<br />
2. Aktivierende Gemeinwesenarbeit in der Praxis: ................................................. 43<br />
2.1 Der Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>: „dr Schlauch…so hot des ghoisa“ .....................................44<br />
2.2 Schwarz auf Weiß: Der <strong>Rötenberg</strong> in Zahlen ...........................................................47<br />
2.2.1 Bevölkerungsstruktur: „...a bissle mulitikulturell isch scho gut…“ ........................47<br />
2.2.2 Einkommen: „Wenn ich Handwerker bestelle, ist die erste Frage, ob ich bar<br />
bezahlen kann“ .............................................................................................................49<br />
2.2.3 Wohnungen: „s´isch ja au koin Komfort me in dene Wohnunga“.........................51<br />
2.2.4 Ruf und Stadtgestalt: „…d´r Ruf isch scho seit ewig und drei Tag versaut…“.....53<br />
2.2.5 Leben im Stadtteil: „Also i hab uff´m Röteberg a schees Leba, des sag i“ ..........55<br />
2.2.6 Identität: „Wenn Sie vom <strong>Rötenberg</strong> spricht, heißt es immer „mein <strong>Rötenberg</strong>“ .55<br />
2.3 Das Jugend- und Nachbarschaftszentrum (JNZ) .....................................................56<br />
2.3.1 Entstehung des Jugend- und Nachbarschaftszentrum........................................56<br />
2.3.2 Allgemeines Porträt des Jugend- und Nachbarschaftszentrum...........................57<br />
2.3.3 Angebote für Frauen............................................................................................59
3. Forschungsdesign.................................................................................................. 60<br />
3.1. Wieso, weshalb, warum – Was spricht für qualitative Sozialforschung? .................61<br />
3.1.1 Die qualitative Ausrichtung dieser Arbeit .............................................................62<br />
3.1.2 Die Qual der Wahl: angewandte Methodik ..........................................................62<br />
Exkurs: Gruppeninterviews ..................................................................................62<br />
Exkurs: Dichte Beschreibung...............................................................................63<br />
3.1.3 Mut zur „Farbe“ ....................................................................................................65<br />
3.2 Mein „Material“..........................................................................................................66<br />
3.2.1 Gruppeninterviews...............................................................................................66<br />
3.2.2 Buch: <strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten – Meisterinnen des Lebens ..................68<br />
3.2.3 Sozialraumbeobachtungen ..................................................................................68<br />
3.2.4 Dokumentenrecherche ........................................................................................69<br />
4. Wirkungen aktivierender weiblicher GWA ........................................................... 69<br />
4.1. Lebendiges „Material“: Eine Wertschätzung............................................................70<br />
4.1.1 Frauen plaudern „aus dem Nähkästchen“ ...........................................................70<br />
4.1.2 Ben Aalen-<strong>Rötenberg</strong>´da otoyorum – Ich lebe in Aalen <strong>Rötenberg</strong>.....................73<br />
4.2 Erfahrungen der Anerkennung .................................................................................76<br />
4.2.1 Anerkennung durch die Projektarbeit „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“...........76<br />
4.2.2 Anerkennung durch Institutionen .........................................................................79<br />
4.2.3 Anerkennung durch lokale Presse.......................................................................82<br />
4.3 Erfahrungen der Selbstwirksamkeit ..........................................................................82<br />
4.3.1 Deutschkurs: „Wofür brauchst du deutsch- willst du Lehrerin werden?“..............83<br />
4.3.2 Selbstorganisation: „des kriega mr scho na, au ohne Stütz“ ...............................86<br />
4.3.3 Ausbildung zur Tagesmutter: „Jetzt möchte ich noch mehr lernen“.....................88<br />
4.4 Was bleibt: Widersprüche.........................................................................................89<br />
5. Wirksamkeit und Handeln in der weiblichen GWA.............................................. 92<br />
5.1 Die theoretischen Handlungselemente in der Praxis................................................94<br />
5.2 Die Wirksamkeit des Handelns.................................................................................96<br />
5.3. Vom Nutzen der Ahnung .........................................................................................97<br />
Literaturverzeichnis: ................................................................................................ 101<br />
Abkürzungsverzeichnis: .......................................................................................... 109<br />
2
Anlagen:<br />
Anlage 1:<br />
Anlage 2:<br />
Anlage 3:<br />
Anlage 4:<br />
Anlage 5:<br />
Stadtplan <strong>Rötenberg</strong>/ Aalen<br />
Interview am 22.11.2006 mit fünf Teilnehmerinnen des<br />
„Nähtreffs“ im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>/Aalen<br />
Teilstrukturierter Interviewleitfaden für den „Nähtreff“<br />
Interview am 16.02.2007 mit sieben Teilnehmerinnen des<br />
„Deutschkurses“ im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>/Aalen<br />
Teilstrukturierter Interviewleitfaden für den „Deutschkurs“<br />
Erklärung<br />
Im Übrigen …<br />
3
0BEinleitung<br />
Auf der Suche nach einem „lustvollen“ Thema für meine Diplomarbeit war mir bereits<br />
sehr früh klar, dass dieses aufgrund meiner Erfahrungen von Praktika und ehrenamtlichem<br />
Engagement, „frauenbewegt“ werden würde. Das Thema der Diplomarbeit kristallisierte<br />
sich letzten Endes in einer überraschenden Eigendynamik heraus, nachdem<br />
das Büchlein „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten – Meisterinnen des Leben“ mich an<br />
einem schwülen Sommertag im August letzen Jahres gefunden hatte. Was mich zu<br />
Beginn am meisten faszinierte, war die Offenheit, mit der die Frauen in diesem Buch<br />
ihr Leben erzählen: Von ihrer arbeitsreichen Kindheit, dem Glück des ersten Kindes,<br />
vom betrunkenen Ehemann, der alles zunichte machte, wofür frau gekämpft hatte und<br />
von der Schönheit des Augenblicks. Aber nicht nur der Inhalt des Buches, sondern<br />
auch die „Verpackung“ dieser faszinierenden Frauenleben ließ vermuten, dass sich<br />
hinter diesem Buch jede Menge Anerkennung und Wertschätzung sowie handfeste und<br />
konkrete Arbeit „mit Herz“ verbarg. Beides machte mich so neugierig, dass ich einfach<br />
zum Telefonhörer griff und mit den Organisatorinnen des Buches Kontakt aufnahm, um<br />
sie von meiner Idee einer Diplomarbeit über die dort lebenden Frauen zu überzeugen.<br />
Die Kontaktaufnahme gestaltete sich überraschend unproblematisch, innerhalb weniger<br />
Minuten war ein Termin vereinbart, und ich war eingeladen. Vor Ort konnte ich mir<br />
dann einen Einblick in die Vielseitigkeit der Praxis der pädagogischen Fachkräfte in<br />
dem Aalener Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> verschaffen und entschied mich schließlich für das<br />
Thema „Wirkungen aktivierender Gemeinwesenarbeit auf Mädchen und Frauen - eine<br />
Erfolgsgeschichte?“ Im Laufe der praktischen Arbeiten musste ich den Titel leider auf<br />
die Zielgruppe der Frauen eingrenzen, da im Überschwang der Planungen nicht einschätzbar<br />
war, dass der zusätzliche Blick auf die Mädchen sowohl den zeitlichen als<br />
auch den inhaltlichen Rahmen meiner Arbeit sprengen würde. Im folgenden geht es<br />
also um Wirkungen aktivierender Gemeinwesenarbeit auf Frauen in sozialen Brennpunkten.<br />
Innerhalb der bunten Praxis aktivierender Gemeinwesenarbeit, die ich im<br />
Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> vorfand, interessierte mich primär die Frage, welche Wirkungen die<br />
sozialpädagogische Arbeit auf die Frauen in ihren Lebenszusammenhängen, in ihrem<br />
direkten Wohnumfeld sowie auf ihre eigene Biographie haben.<br />
Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich ausführlich auf die Theorie von Gemeinwesenarbeit<br />
eingehen: Auf die Geschichte von GWA, auf die wesentlichen Handlungselemente<br />
und schließlich im Rahmen meines Erkenntnisinteresses insbesondere auf die Spezifi-<br />
4
ka von weiblichem Gemeinwesen und der daraus resultierenden aktivierenden GWA<br />
mit Frauen.<br />
Im zweiten Teil gebe ich einen Überblick über den Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>, also seine historische<br />
Entwicklung und die statistische „Landschaft“, um dann das Jugend- und<br />
Nachbarschaftszentrum, den Dreh- und Angelpunkt der aktivierenden Gemeinwesenarbeit<br />
im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>, genauer zu beleuchten.<br />
Der dritte Teil stellt das Forschungsdesign vor und beschäftigt sich mit den Begründungen,<br />
warum ich mich für qualitative empirische Sozialforschung entschieden habe<br />
und insbesondere für einen multiperspektivischen Zugang zum Thema, bestehend aus<br />
teilstrukturierten Leitfadeninterviews, sozialräumlicher Erkundung, Informationen aus<br />
der lokaler Berichterstattung der Presse und aus den veröffentlichten Lebensgeschichten<br />
der Frauen aus dem obig genannten Buchprojekt.<br />
In meinem vierten empirischen Teil stehen die Wirkungen weiblicher Gemeinwesenarbeit<br />
auf Frauen im Vordergrund. Hierzu stelle ich zunächst die Frauen vor, die mir in<br />
ihren Erzählungen einen Einblick in ihre spezifischen Lebenswelten erlaubten. Im Fokus<br />
stehen im folgenden die erkennbaren Erfahrungen der Anerkennung und der<br />
Selbstwirksamkeit, aber auch die Erfahrungen von Widersprüchen, die aus den gesellschaftlichen<br />
Verhältnissen im Zuge der Moderne und im Besonderen aus der strukturellen<br />
Diskriminierung von Frauen resultieren.<br />
In meinem letzen Teil werde ich die im Eingang beschriebene Theorie mit der dargestellten<br />
Praxis verknüpfen. Hierbei gehe ich im Besonderen auf die Frage ein, wie sich<br />
die theoretischen Handlungselemente aktivierender Gemeinwesenarbeit in der Praxis<br />
des sozialpädagogischen Tuns und Lassens auf dem <strong>Rötenberg</strong> konkretisieren. Des<br />
Weiteren erlaube ich mir, „intuitiv“ der Frage nachzugehen, welche Faktoren für eine<br />
gelingende aktivierende Gemeinwesenarbeit zusätzlich notwendig sind, nämlich die<br />
„praktische Klugheit“ und „andere Ahnungen“.<br />
Da Sprache zwischen Menschen eine soziale Macht darstellt, übt sie auch Macht über<br />
die Gedanken eines jeden Menschen aus. Was in uns denkt und dichtet, das ist Sprache<br />
– Sprache schafft also zunächst Bewusstsein. Um den Leserinnen und Lesern<br />
dieser Arbeit die nach wie vor bestehende strukturelle Benachteiligung von Frauen -<br />
auch in der Sprache – bewusst zu machen, findet im folgenden das „generische Femininum“<br />
Verwendung. Dies bedeutet, dass in dieser Arbeit kontinuierlich die weibliche<br />
5
Sprachform – für Frauen und Männer - angewandt wird. Abweichungen von dieser<br />
Sprachverwendung finden statt, wenn sie zur Vermeidung geschichtlicher Verfälschungen<br />
notwendig sind oder wenn ausschließlich Männer gemeint sind.<br />
Nicht zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle bei den <strong>Rötenberg</strong>er Frauen bedanken<br />
für ihre Offenheit und Herzlichkeit, bei den Mitarbeiterinnen des Jugend- und Nachbarschaftszentrums<br />
(JNZ) <strong>Rötenberg</strong> für die geduldige Beantwortung meiner Fragen und<br />
bei Brigitte Geßler, der Leiterin des JNZ, die mich während der ganzen Zeit tatkräftig<br />
unterstützte und mich mit ihrer Kunst - Informationen zu beschaffen, die es eigentlich<br />
nicht gibt - immer wieder aufs Neue überraschen konnte.<br />
1B1. Gemeinwesenarbeit (GWA) in der Theorie<br />
In den 1960er und 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts avancierte Gemeinwesenarbeit<br />
neben der Gruppenarbeit und der Einzelfallhilfe zur dritten Methode der Sozialen Arbeit.<br />
In der Weiterentwicklung verlor sie sich in den folgenden Jahren in eng geführten<br />
Theoriediskussionen und Richtungsstreitigkeiten bis sie fast ganz aus der pädagogischen<br />
Methodendiskussion entschwand. Vor dem Hintergrund aktueller lebenswelt-<br />
1<br />
und sozialraumorientierter Theorien kann inzwischen von einer RenaissanceF F von Gemeinwesenarbeit<br />
gesprochen werden. Heute wird GWA als sozialräumliche Strategie<br />
verstanden, die sich in ihrer Ganzheitlichkeit auf den Stadtteil bezieht. Ihre zentralen<br />
Arbeitsprinzipen sind die Orientierung am „Eigensinn“ der Menschen sowie die Gestaltung<br />
derer Lebensräume. GWA bietet das Grundverständnis sowie das notwendige<br />
Methodenrepertoire, um fundierte Beiträge zur Beteiligung, Aktivierung und Selbstorganisation<br />
in der Gesellschaft zu leisten (vgl. Gillich 2004a, 7).<br />
Im Folgenden werde ich zunächst die Geschichte, Arbeitsprinzipien sowie die grundsätzlichen<br />
Handlungselemente von GWA im Allgemeinen aufzeigen. Anschließend<br />
gehe ich auf die Lebenslagen als Ausgangspunkt von GWA und im speziellen - vor<br />
dem Hintergrund meines Erkenntnisinteresses - auf Lebenslagen von Frauen im Gemeinwesen<br />
ein, um abschließend die daraus resultierenden Konsequenzen für eine<br />
gelingende Gemeinwesenarbeit mit Frauen aufzuzeigen. Wohl wissend, dass man der<br />
GWA mit ihrer faszinierenden Geschichte sowie ihrer vielfältigen Praxis mit einer Skizzierung<br />
nicht gerecht werden kann, muss ich im Rahmen dieser Arbeit „skizzenhaft“<br />
bleiben.<br />
1 Vgl. Rausch 1998<br />
6
8B1.1 Zur Geschichte von Gemeinwesenarbeit<br />
Im ersten Teil dieses Kapitel möchte ich die Anfänge von Gemeinwesenarbeit näher<br />
aufzeigen, deren Wurzeln in den Traditionslinien der Settlementarbeit gründen und<br />
deren historische Ausgangspunkte in England und den Vereinigten Staaten von Amerika<br />
zu finden sind. Nach einer Darstellung der Entwicklung von GWA in Deutschland<br />
findet dieses Kapitel seinen Abschluss in einem kurzen Abriss der unterschiedlich gewachsenen<br />
Ansätze von Gemeinwesenarbeit in der Bundesrepublik. Der geschichtliche<br />
Werdegang von Gemeinwesenarbeit ist meines Erachtens von besonderer Bedeutung,<br />
da er die Grundlage für ein ganzheitliches Verständnis bildet. „Geschichte ist<br />
nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes – also der Boden auf dem wir stehen<br />
und bauen“ (Hans von Keler, dt. Theologe, *1925).<br />
1.1.1 Die Anfänge von Gemeinwesenarbeit<br />
Die Settlement-Bewegung nahm ihren Anfang im England des 19. Jahrhunderts. Im<br />
Mutterland des modernen Industrialismus traten erstmalig jene problematischen Auswirkungen<br />
der industriellen Revolution und des Frühkapitalismus und deren Auswirkungen<br />
auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der armen Bevölkerung zutage, die<br />
später unter dem Begriff der „Sozialen Frage“ in allen westlichen Industrieländern ihren<br />
Niederschlag fanden. Die Folgen der Umstrukturierung der Wirtschaft, der enorme<br />
Bedarf an Fabrikarbeitskräften sowie die daraus resultierende Verstädterung bildete<br />
die Grundlage für eine tief greifende Spaltung der Gesellschaft entlang der Klassengrenzen.<br />
Das Schlagwort des damals real existierenden „Manchester Kapitalismus“<br />
dient auch heute noch als Synonym für die Beschreibung menschenunwürdiger und<br />
ungerechter Verhältnisse (vgl. Müller 1991, 30 f).<br />
Vor diesem Hintergrund erkannte die Settlement-Bewegung in London, dass sozialpolitische<br />
und bildungspolitische Unterprivilegierung einander bedingten und deshalb<br />
auch zur sozialen die geistige Emanzipation gehörte (Oelschlägel 2001a, 655). Diese<br />
Erkenntnis bedingte die Ablehnung des Almosenwesens, die Bevormundung der<br />
Hilfsbedürftigen sowie jegliches Klassendünkel. Durch Bildung, Organisation und Gemeinschaftsarbeit<br />
sollten Wege zur Selbsthilfe aufgezeigt und das Verständnis zwischen<br />
Besitzenden und Besitzlosen geweckt werdenF F (vgl. Oelschlägel 2001a, 655).<br />
2<br />
Die Kernidee der sich daraus formierenden Settlement-Bewegung war daher so ein-<br />
2 Der Settlement-Bewegung ging es grundsätzlich, ähnlich wie Pestalozzi, um eine allseitige<br />
Bildung (vgl. Müller 1991, 42).<br />
7
3<br />
fach wie genial. Angehende Akademikerinnen und Angehörige der MittelschichtF F zogen<br />
in spezielle „Niederlassungen“ (Settlements) in den Armenvierteln, um die miserablen<br />
Umweltbedingungen der Armensiedlung „hautnah“ erleben zu können. Das<br />
Wichtigste war jedoch, dass sie sich die Menschen und ihre Lebensweisen zu Eigen<br />
machten und so aktive Nachbarschaftsbeziehungen zu den Menschen pflegen konnten.<br />
Die Londoner Settlerinnen wollten jedoch nicht nur durch unmittelbare Hilfe Unterstützung<br />
bieten, sondern bemühten sich ebenso um strukturelle Veränderungen im<br />
Wohngebiet auf kommunaler und gesellschaftlicher Ebene (vgl. Müller 1991, 42).<br />
Ausgehend von London breitete sich die Settlement-Bewegung relativ schnell nach<br />
Nordamerika aus. Vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert entstanden Settlements<br />
in Frankreich, Kanada, Finnland, den Niederlanden, Japan, Deutschland, Österreich,<br />
Russland und Ungarn. Die erste formelle Verbindung gründete sich im Jahre<br />
1911 in Amerika und nannte sich „National Federation of Settlements and Neighbourhood<br />
Centres“. Auf der zweiten internationalen Konferenz im Jahre 1926 in Paris<br />
4<br />
gründete sich unter der Leitung von Jane AddamsF F und dem französischen Arbeitsminister<br />
Justin Godart die „International Association of Settlements“. Sie versteht sich<br />
heute als weltweite Interessenvertretung und Lobbyistin im Sinne der Settlement-<br />
Bewegung (vgl. Eberhardt 1995, 66).<br />
Toynbee Hall (London)<br />
Als eines der wenigen Länder in Europa verfügte England seit dem 16. Jahrhundert<br />
5<br />
über eine staatliche Armenpflege, die per Gesetz die steuerzahlenden BesitzerInnenF F<br />
und NutznießerInnen von Grund und Boden verpflichtete, Armenkinder, arbeitsunfähige<br />
und erwerbslose Menschen durch Naturalien und Geld zu unterhalten. Neben Einrichtungen<br />
wie Arbeitshäuser, die mehr Zuchthäusern glichen und welche die Hilfsbedürftigen<br />
eher davon abhalten sollten Unterstützung zu beantragen, entwickelte sich<br />
ein privates System der Wohlfahrtspflege, das im Wesentlichen von kirchlichen Kräften<br />
gestützt wurde. Die privaten Wohlfahrtsverbände verteilten nach eigenem Gutdünken<br />
Spendengelder als Almosen an die Armen, doch: „Die Politik der Repression gegenüber<br />
den Armen schlug fehl, weil sie nicht humanitär verankert war, und die humanitäre<br />
Politik schlug fehl, weil sie nicht wissenschaftlich begründet war; und die<br />
3 Der größte Anteil der Mitarbeiterinnen des Settlements waren StudentInnen, die in diesem<br />
Zusammenhang als „Residents“ bezeichnet wurden (vgl. Müller 1991, 42f).<br />
4 Jane Addams (1860-1935): Amerikanische Sozialpolitikerin und Pazifistin, kämpfte für den<br />
Kinderschutz sowie das Frauenwahlrecht (vgl. Müller 1991, 93).<br />
5 Im geschichtlichen Teil findet eine Abweichung der weiblichen Schreibweise statt, um geschichtlichen<br />
Verfälschungen entgegenzuwirken (Anmerkung der Autorin).<br />
8
wissenschaftlich begründete Politik schlug fehl, weil sie durch ihre Institutionalisierung<br />
die Individualität vertreibt“ (Barnett 1915 zit. in Müller 1991, 47).<br />
Ausgehend von dieser Situation gründete der Gemeindepfarrer Samuel Barnett und<br />
seine Frau Henrietta Barnett im Jahre 1884 die erste Universitätsniederlassung in<br />
Whitechapel, einem Elendsviertel im Osten von London. Diese neu entstandene Einrichtung<br />
benannten sie nach dem sozial engagierten Historiker und Nationalökonomen<br />
Arnold Toynbee (1852-1883), der als einer der ersten seine Ferien inmitten der Ärmsten<br />
verbrachte, um so seine Vorstellung von einer gerechteren Welt in die Praxis umzusetzen<br />
(vgl. Wendt 1995, 153). Samuel Barnett entwickelte gemeinsam mit Studenten<br />
der Universität Cambridge ein Konzept einer Gesellschaft „in der Kooperation die<br />
Rolle von Mildtätigkeit übernimmt – und Gerechtigkeit die Rolle von Nächstenliebe“<br />
(Barnett 1918 zit. in Müller 1991, 41). Toynbee Hall wurde als soziales Projekt weit<br />
6<br />
über die Grenzen Englands hinaus bekanntF F und löste buchstäblich eine Welle von<br />
Settlement-Gründungen aus. Toynbee Hall markiert den Beginn der Settlement-<br />
Bewegung und existiert noch heute (vgl. Müller 1991, 58).<br />
Hull House (Chicago)<br />
Nach New York war Chicago zu jener Zeit die größte nordamerikanische Stadt. Auch<br />
hier war die Problemsituation des 19. Jahrhunderts sichtbar: Industrialisierung und<br />
Frühkapitalismus sowie die damit einhergehenden strukturellen Veränderungen der<br />
Wirtschaft und die fehlenden Einwanderungsbestimmungen führten nicht nur zu einem<br />
beispiellosen Schmelztiegel der Kulturen, sondern hinterließen auch katastrophale<br />
Lebens- und Arbeitsbedingungen. Im scharfen Kontrast dazu standen der Reichtum<br />
von zwei Prozent der amerikanischen Bevölkerung, der 60 Prozent des Volkseinkommens<br />
ausmachte, sowie 341 Großunternehmen der Industriemagnaten Morgan und<br />
Rockefeller, die allein 20 Prozent des Volkseinkommens kontrollierten (vgl. Staub-<br />
Bernasconi 1994, 40).<br />
Im Jahre 1889 gründete Jane Addams gemeinsam mit Ellen Gates Starr ein offenes<br />
Nachbarschaftshaus in einem von Armut und Elend geprägten Viertel von Chicago,<br />
das nach seinem Vorbesitzer und Erbauer Chales J. Hull benannt war. Bei einer Bestimmung<br />
der historischen Bedeutung von Hull House ist zu verdeutlichen, dass die<br />
6 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besuchte Alice Salomon Toynbee Hall und war tief beeindruckt<br />
von der Idee der Settlementbewegung, so dass sie daraufhin gemeinsam mit anderen<br />
bürgerlichen Frauen das „Feierabend-Haus“ in Berlin gründete. Dies stellte eine Zufluchtsstätte<br />
für junge Frauen der Arbeiterklasse dar, die keinen anderen Ort hatten, an dem sie hätten bleiben<br />
können, sondern sich lediglich einen Schlafplatz für eine bestimmte Tageszeit mieten konnten<br />
(vgl.Hwww.sgw.hsmagdeburg.de/europeansocialwork/pdf/german<br />
/CommunityWork_ger_De.pdfH, am 10.03.2007).<br />
9
damaligen Settlerinnen für die Geschichte der Gemeinwesenarbeit ein Exempel statuierten.<br />
Ihr Bezug auf die Beziehung zwischen Arbeits- und Lebensbedingungen und<br />
die pädagogische und politische Einflussnahme darauf kann als größter Verdienst der<br />
7<br />
Frauen um Jane Addams gewertet werdenF F. Die wichtigsten Leitgedanken von Hull<br />
House stellten folgende Funktionen dar: „Erstens unmittelbare Hilfe und gleichzeitig<br />
Forschungsarbeiten als Grundlage für sozialpolitische Vorstöße, zweitens soziale und<br />
kulturelle Bildung und Kompetenztraining für ein Überleben und Zurechtfinden in einem<br />
gnadenlosen urbanen Kontext und als drittes: soziale Reform“ (Brieland zit. in<br />
Staub-Bernasconi 1994, 41). Für Jane Addams und die Frauen von Hull House gab es<br />
weder die strikte Trennung der sozialpädagogischen Felder in Kinder- und Jugendhilfe,<br />
Erwachsenenarbeit oder Kulturarbeit noch die künstliche Separation zwischen Sozialpädagogik<br />
und Sozialpolitik. Alle Angebote, die sie für Kinder und Jugendliche gestalteten,<br />
hatten letzten Endes nur das Ziel, das Leben der Erwachsenen, konkreter:<br />
das Leben der berufstätigen Frauen zu erleichtern. Für jede Gruppe (Immigranten,<br />
Kinder, Frauen, Erwachsene) gab es speziell zugeschnittene Angebote (vgl. Müller<br />
1991, 76). Mit diesem Fokus auf die Arbeiterinnen der Nachbarschaft kann von einem<br />
ersten geschlechtsspezifischen Konzept in der Sozialen Arbeit gesprochen werden.<br />
Für die Gründung von Hull House spielte neben Jane Addams eigener Biographie<br />
nicht zuletzt die Tatsache eine Rolle, dass es den Collegeabsolventinnen in dieser<br />
Zeit weder gestattet war, ein autonomes Leben von ihren Familien und Ehemännern<br />
zu führen, noch einen einflussreichen Beruf auszuüben. So lässt Jane Addams auch<br />
„keinen Zweifel daran, dass auch ganz persönliche Ziele eine Rolle spielten, ja dass<br />
Hull House letztendlich ein Selbsthilfeprojekt von gebildeten Frauen war, die endlich<br />
gesellschaftlich relevante Arbeit leisten wollten und dass diese Selbsthilfe – teilweise<br />
im Unterschied zu heute – Hilfe und Denken an andere mit einschloss“ (Staub-<br />
Bernasconi 1994, 41).<br />
Jane Addams politische Aktivitäten konzentrierten sich primär auf den Kinderschutz,<br />
8<br />
das Frauenwahlrecht sowie die internationale FriedensbewegungF F. Ihre soziale Friedens-<br />
und Gesellschaftspraxis wurde jedoch vom Großteil der männlichen Gesellschaft<br />
ignoriert und bekämpft. Staub-Bernasconi spricht in diesem Zusammenhang<br />
von einem „sanfte(n) Entschwinden einer Nobelpreisträgerin“ (Staub-Bernasconi 1995,<br />
7 Eine von Jane Addams nicht beabsichtigte Wirkung der Settlement-Arbeit war die Professionalisierung<br />
des Sozialarbeiterberufes. Noch zu Lebzeiten lehnte sie die damit einhergehende<br />
Spezialisierung, Individualisierung und im Besonderen die Entpolitisierung der Sozialen Arbeit<br />
entschieden ab (vgl. Eberhardt 1995, 182).<br />
8 Im Jahr 1915 wurde sie zur Präsidentin des Internationalen Friedenskongresses sowie des<br />
Internationalen Frauenbundes für Frieden und Freiheit, der sich im selben Jahr in Den Haag<br />
gründete (vgl. Müller 1991, 93).<br />
10
25). Quasi über Nacht wurde Jane Addams von einer „Slumheiligen“ zur „Roten Hexe“<br />
und gefährlichsten Frau Amerikas (Davis zit. in Staub-Bernasconi 1994, 50). Die Vorurteile<br />
gegen die „Revolutionärin“ Jane Addams wurden wiederbelebt, und die Presse<br />
verteufelte sie als „dumme, eingebildete Maid, die möglicherweise sinnvolle Barmherzigkeit<br />
in Hull House ausübte“, nun aber von Dingen spreche, die „weit über ihre geistige<br />
Kapazität hinausgehe …, (wisse sie doch) nichts über die wissenschaftliche Disziplin<br />
und Methoden der Kriegsführung“ (Staub-Bernasconi 1994, 51). Ihr Ziel war gewesen,<br />
die USA aus dem ersten Weltkrieg heraushalten, während die öffentliche Meinung<br />
auf eine Teilnahme am Krieg drängte. Als Folgen dieser Hetzkampagne sind ein<br />
absolutes Rede- und Publikationsverbot, Überwachung durch Beamte des Staatsschutzes,<br />
Mobbing und fast zehn Jahre gesellschaftliche Ausgrenzung zu nennen. Im<br />
Jahre 1919 wurde die noch heute bestehende und bei der UNO als NGO akkreditierte<br />
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (WILPF) gegründet, zu deren Präsidentin<br />
Jane Addams gewählt wurde. Im Jahre 1931 wurde ihr der Friedensnobelpreis<br />
verliehen, den sie allerdings mit einem Kriegsbefürworter teilen musste (vgl. Staub-<br />
Bernasconi 1994, 51).<br />
Saul Alinsky und das Community Organizing<br />
Im Jahre 1909 wurde in einem Chicagoer Slum der „geistige Vater“ des Communitiy<br />
9<br />
OrganizingF F geboren, Saul D. Alinsky (1909-1972). Müller beschreibt Saul Alinsky in<br />
seiner Methodengeschichte der Sozialarbeit als „harten Brocken“ (vgl. Müller 1992,<br />
114). Alinsky selbst nannte sich einen „Radikalen“, verstand sich als „Organizer“ und<br />
gab seinen Beruf mit „Antifaschist“ an (vgl. Alinsky 1999, 11). Alinsky baute im Laufe<br />
seines Lebens in ganz Amerika Bürgerorganisationen auf und entwickelte die dafür<br />
notwendigen Strukturen. Er selbst war jedoch nie Mitglied einer Organisation, da dies<br />
seinen Überzeugungen widersprochen hätte.<br />
Nach dem Studium der Archäologie verließ er die Universität Chicagos relativ unbeeindruckt<br />
und arbeitslos. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die damals vorherrschenden<br />
Verhältnisse: Das reiche Amerika litt zu jener Zeit an den Folgen des<br />
„Schwarzen Freitags“, der größten Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts, und<br />
Chicago galt als Welthauptstadt des organisierten Verbrechens (vgl. Müller 1992,<br />
115). Durch ein eher zufällig erhaltenes Stipendium der Kriminologie, studierte er die<br />
Welt des Al Capones und durchleuchtete die Organisationsstrukturen der Mafia.<br />
„Dann arbeitete er als Handlungsforscher für ein Institut zur Erforschung von Jugendkriminalität.<br />
Seine erste Organisation baute er nach dem Ende des zweiten Weltkrie-<br />
9 Um den besonderen Ansatz von Alinsky zu kennzeichnen, findet die Bezeichnung Community<br />
Organizing hier in Abgrenzung der Begriffe Community Organization (vgl. Kapitel 1.2.3.) sowie<br />
Community Development (ausführlich vgl. Müller 1994, Bd. 2, 106ff.) Verwendung.<br />
11
ges auf. Es war die Organisation der Chicagoer Hinterhöfe: „back of the yards“. Er<br />
entwickelte Organisations- und Konfliktstrategien, die ihn bei der Industrie und den<br />
staatlichen Institutionen zu einem gefürchteten Mann machten“ (vgl. Müller 1992,<br />
115).<br />
Seine Grundannahme war schlicht und wirkungsvoll: Jede Gemeinde oder Stadt besitzt<br />
eine etablierte Machstruktur, die sich den Änderungen bzw. Verbesserungen der<br />
mittellosen Bürgerinnen widersetzt. Um die gewünschten Verbesserungen dennoch<br />
durchsetzen zu können, bedarf es der Bildung einer so genannten Gegen-Macht.<br />
Macht tritt meist in Form von Kapital oder vielen Menschen auf, was bedeutet, dass<br />
Menschen mit wenig Kapital diesen Mangel durch ihre große Anzahl kompensieren<br />
können. Durch gemeinsames Handeln besteht die Möglichkeit, politische Gegner von<br />
10<br />
bestimmten Notwendigkeiten zu überzeugenF<br />
F (vgl. Müller 1992, 116). Nach Alinsky<br />
kann „das Ziel einer Bürgerorganisation in einem Slum nur die Beseitigung des Slums<br />
sein. Dieses Ziel ist nur dann erreichbar, wenn in diesem Slum eine starke Bürger-<br />
Organisation entsteht, die mehr ist als eine Organisation der im Viertel vertretenen<br />
Organisationen: der Vereine, Gewerkschaften, Kirchengemeinden, Sportclubs […]. Sie<br />
muss in der Bevölkerung verankert sein. Sie muss die Probleme aufgreifen, die ihr<br />
unter den Nägeln brennen, z.B. verstopfte Abwasserkanäle, Ratten, Schlaglöcher in<br />
den Straßen, ein fehlender Zebrastreifen, Häuser, die verfallen, eine nicht funktionierende<br />
Müllabfuhr […], oder auch Fragen der Gesundheitsversorgung, der Sozialhilfe,<br />
der Arbeit, der Umweltverschmutzung oder der Rassendiskriminierung“ (Alinsky 1999,<br />
13). Community Organizing handelt nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit,<br />
der Selbstbestimmung und der Solidarität. Die Vorraussetzung hierzu bildet das Vertrauen<br />
in die Fähigkeit der Menschen, ihre Lebensbedingungen eigenständig zu gestalten.<br />
1.1.2 Die Entwicklung der Gemeinwesenarbeit in Deutschland<br />
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden zwei bedeutende Projekte, mit denen die<br />
Tradition des Settlements in Deutschland fortgesetzt wurde und die nach OelschlägelF<br />
F „mit gutem Recht“ als Vorläufer von GWA genannt werden können: Das Ham-<br />
11<br />
12<br />
burger Volksheim und die soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-OstF<br />
F (S<strong>AG</strong>-Ost).<br />
10 Als genialer Stratege machte Alinsky mit ungewöhnlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam,<br />
wie z. B. mit dem „Klo-Streik“ in Chicago, bei dem er drohte, den Internationalen Flughafen<br />
O´Hare unbenutzbar zu machen, indem jeden Tag 2500 schwarze Bürgerinnen rund um die Uhr<br />
die Toiletten besetzten würden (vgl. Müller,1992, 116)<br />
11 Vgl.Oelschlägel 2001a, 656<br />
12 Ausführliche Darstellung der o.g. Projekte vgl. Oelschlägel 2001a, 655<br />
12
Das Hamburger Volksheim wurde im Jahr 1901 unter dem direkten Einfluss der Settlementbewegung<br />
von Walter Claasen gegründet. Da er sich (selbst in der Nachkriegszeit)<br />
an sozialistischen Positionen orientierte, stellte das Hamburger Volksheim eine<br />
für die Nachbarschaftsbewegung eher untypische Entwicklung dar (vgl. Oelschlägel<br />
2001a, 655). Die S<strong>AG</strong>-Ost wurde im Jahr 1911 von dem Theologen und ehemaligen<br />
Pfarrer der Hofkirche Potsdam, Friedrich Siegmund-Schulze, gegründet. Dieser zog<br />
mit seiner Familie und wenigen Freunden in das Arbeiterviertel Berlin-Friedrichshain.<br />
Durch die Niederlassung einer gebildeten und der bürgerlichen Klasse zuordenbare<br />
Gruppe in einem der ärmsten Bezirke sowie dem satzungsgemäßen Ziel der Klassenversöhnung,<br />
stellt die S<strong>AG</strong>-Ost im Gegensatz zum Hamburger Volksheim die klassische<br />
Variante des Settlementgedankens dar (vgl. Oelschlägel 2001a, 655). Nach<br />
1920 entstanden in ganz Deutschland weitere Arbeitsgemeinschaften und Volksheime,<br />
aus denen im Jahr 1925 die „Deutsche Vereinigung der Nachbarschaftssiedlungen“<br />
entstand. Viele dieser Einrichtungen mussten jedoch nach der Machtergreifung<br />
durch die Faschisten im Jahr 1933 ihre Arbeit aufgeben bzw. wurden geschlossen.<br />
13<br />
Führende Persönlichkeiten, unter ihnen auch Siegmund-Schulz und Herta KrausF<br />
F,<br />
mussten ins Exil fliehen.<br />
Abgesehen von den o.g. Projekten sind die Traditionslinien von Gemeinwesenarbeit in<br />
Deutschland nicht der Praxis entwachsen. „GWA war Import aus den USA und den<br />
Niederlanden. Importeure waren die Lehrenden der Schulen für Sozialarbeit, die<br />
GWA-Kenntnisse im Rahmen des Reeducation-Programmes der Alliierten von Studienreisen<br />
mitbrachten“ (Oelschlägel 2001a, 656). Mitte der 1960er Jahre war GWA<br />
nicht mehr „nur“ in Lehrbüchern zu finden, sondern es entwickelte sich eine erste Praxis.<br />
Das Ende des so genannten „Wirtschaftswunders“ hinterließ Spuren: Die Gemeindekassen<br />
waren leer und die Problemlagen in den Städten und deren Randgebieten<br />
spitzten sich zu. Es schien offensichtlich, dass Soziale Arbeit mit ihren bisherigen<br />
Instrumentarien, Einzelfallhilfe und Gruppenpädagogik, überfordert war, so dass<br />
eine gesteigerte Aktivität der GWA verzeichnet werden konnte. GWA als dritte Methode<br />
der Sozialen Arbeit versuchte, die Systembedingtheit der vorliegenden Probleme<br />
aufzuzeigen und dadurch eine Veränderung des Politikbewusstseins herbeizuführen.<br />
Das Grundprinzip von GWA war eine Schwerpunktverlagerung weg von der reinen<br />
Fürsorge hin, zur aktiven Teilnahme und Unterstützung der Bewohnerinnen sowie der<br />
Förderung der infrastrukturellen und materiellen Ausstattung des Wohngebietes (vgl.<br />
Müller 1992, 109).<br />
13 Hertha Kraus (1897-1968), stellt eine bedeutende Wegbereiterin in der Sozialen Arbeit in<br />
Deutschland und den USA dar (vgl. vertiefende Literatur in Müller 1992, 74 ff.).<br />
13
Beginnend mit der Protestbewegung Ende der 1960er Jahre, sowie der aus Amerika<br />
stammenden Parole: „Power to the poor people“ wurden die politischen Aspekte des<br />
Community Organizing in einigen Projekten in Deutschland übernommen und führten<br />
zu den zwei wesentlichsten Aspekten von Gemeinwesenarbeit, die in Deutschland<br />
neben der Aktivierung als Kennzeichen bekannt wurden: „Parteilichkeit“ und „Konfliktorientierung“F<br />
F (vgl. L<strong>AG</strong> Soziale Brennpunkte Nds. e.V. 2002, 8). In den verschiede-<br />
14<br />
nen GWA-Projekten variierte die strategische Vorgehensweise, insbesondere im Umgang<br />
mit Konflikten, so dass sich verschiedene Methodenansätze entwickelten (vgl.<br />
Oelschlägel 2001, 656). Die Studentenbewegung übte einen wesentlichen Einfluss auf<br />
die Entwicklung der GWA aus. Zum einen begann damit die eigenständige Rezeption<br />
15<br />
sowie Diskussion der GWA in DeutschlandF<br />
F, zum anderen stellte sie sozialarbeiterische<br />
sowie gesellschaftspolitische Gegebenheiten nachhaltig in Frage: „Da war die<br />
Rede von Widerstand, Betroffenenbeteiligung, Veränderung von Verhältnissen, Organisation<br />
von Gegenmacht, Kampf dem Establishment […]: Vokabeln, die das bundesdeutsche<br />
Bürgertum, aber auch die dadurch geprägte bürgerliche Soziale Arbeit<br />
nachhaltig irritierten“ (Hinte 2002, 535).<br />
Um die historische Bedeutung von Gemeinwesenarbeit als Methode bestimmen zu<br />
können, lohnt sich an dieser Stelle ein Blick auf die so genannte linke Theorie und<br />
Praxis zu werfen. Ende der 1970er Jahre wurde immer offensiver gegen systemunangepasste<br />
Gemeinwesenprojekte eingegriffen, wobei sich die staatlichen Strategien auf<br />
Disziplinierung oder Streichung der finanziellen Mittel zu beschränken schienen. Des<br />
Weiteren zeigte der Radikalenerlass, das Vorgehen gegen Mitglieder kommunistischer<br />
16<br />
Gruppen sowie die TotalitarismusdiskussionF<br />
F ihre ideologische Wirkung. Radikalere<br />
Projekte wurden zurückgenommen und weitestgehend aufgehoben. Müller schreibt in<br />
seiner Methodengeschichte der Sozialen Arbeit dazu: „GWA, insbesondere in ihrer<br />
aggressiven, konfliktorientierten Form, hatte die Reformpolitik der späten 1960er und<br />
frühen 1970er Jahre provokativ und zuverlässig begleitet. Wirtschaftskrise und nach-<br />
14 Parteilichkeit: Grundlegend für die damalige Situation war der Gegensatz zwischen denen,<br />
die über gesellschaftliche Ressourcen verfügten (Fabriken, Wohnungen, Handelshäuser…) und<br />
denjenigen, die davon abhängig waren, also Arbeiterinnen, Käuferinnen, Mieterinnen. Parteiliche<br />
GWA war ohnehin meist in Armutsgebieten tätig. Konfliktorientierung: GWA setzte dort an,<br />
wo Konflikte herrschten. Ziel ist es, soziale Resignation und Apathie in Empörung und diese<br />
wiederum in Widerstand zu verwandeln (vgl. L<strong>AG</strong> Soziale Brennpunkte Nds. e.V. 2002, 9).<br />
15 Die Victor-Gollancz-Stiftung bündelte und entwickelte diese weiter (als vertiefende Literatur<br />
empfiehlt sich Müller 1992, 123-139).<br />
16 Totalitarismus bezeichnet politische Systeme, die durch Gleichschaltung aller sozialen, kulturellen<br />
und individuellen Äußerungen nach Maßgabe einer verordneten Ideologie gekennzeichnet<br />
sind. Dabei wird oft mit aktuell politischer und ideologischer Stoßrichtung darauf hingewiesen,<br />
dass eine Ähnlichkeit zwischen linken und rechten Diktaturen bestehe. Dies führt bis heute<br />
zu unzulässigen Gleichsetzungen, in deren Folge die Besonderheiten des Nationalsozialismus,<br />
des Faschismus und des Realsozialismus verschwimmen (vgl. Meyers Lexikon 1992)<br />
14
lassende Experimentierfreude von Gemeinden und Verbänden, Berufsverbote und<br />
Einschränkungen im Sozial- und Bildungsbereich begannen nun wieder zu greifen und<br />
(vielleicht allzu rasch) eine allgemeine Mutlosigkeit zu verbreiten“ (Müller 1992, 131 f).<br />
So verlor GWA als dritte Methode der Sozialen Arbeit immer mehr an Bedeutung.<br />
Rückblickend muss jedoch der fortschrittliche Ansatz von GWA betont werden, von<br />
dem zentrale Elemente wie beispielsweise die Ressourcen- und LebensweltorientierungF<br />
F in der heutigen Sozialen Arbeit zu finden sind. Die Herangehensweise, dass<br />
17<br />
Menschen aktiv an ihrer eigenen Lebensgestaltung arbeiten, wurde sehr gefördert und<br />
18<br />
findet heute in Form des Empowerment-AnsatzesF<br />
F Eingang in sozialarbeiterische<br />
Interventionen. Des Weiteren fand die der GWA zugrunde liegende Aktivierung der<br />
Betroffenen, die Koordination und Vernetzung in der Sozialen Arbeit ihren Niederschlag.<br />
Durch das im Jahr 1980 erschiene Buch „Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip.<br />
Eine Grundlegung“ befreiten die drei Autoren, Jaak Boulet, Jürgen Krauß und Dieter<br />
Oelschlägel, GWA „aus dem bornierten Streit in der deutschen Rezeptionsgeschichte<br />
der drei klassischen „methods of social work“, indem sie es als „Arbeitsprinzip“<br />
reformierten“ (Müller 2004, 30). Zuvor war auf einer Tagung über konfliktorientierte<br />
GWA in Berlin der Tod der GWA formuliert worden (vgl. Hinte 2002, 537):<br />
Todesanzeige<br />
Nach einem kurzen aber arbeitsreichen Leben verstarb unser liebstes<br />
und eigenwilligstes Kind GWA an:<br />
- Allzuständigkeit, Eigenbrötelei und Profilierungsneurose<br />
- methodischer Schwäche und theoretischer Schwindsucht<br />
- finanzieller Auszehrung und politischer Disziplinierung.<br />
Wir, die trauernden Hinterbliebenen, fragen uns verzweifelt, ob<br />
dieser frühe Tod nicht hätte verhindert werden können?<br />
Quelle: Müller 1992, 131<br />
17 Lebensweltorientierung: Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit setzte sich in den letzten<br />
Jahren zunehmend als Rahmenkonzept durch. Lebensweltorientierung nimmt Bezug auf die<br />
gegebenen Lebensverhältnisse der Adressatinnen, in denen „Hilfe zur Kunst des Lebens“ praktiziert<br />
wird. Des Weiteren bezieht sich das Konzept Lebenswelt auf individuelle, soziale und<br />
politische Ressourcen sowie auf soziale Netzwerke und lokale wie regionale Strukturen. Im<br />
Jahre 1991 fand das Lebensweltkonzept im neuen SGB VIII (KJHG) seinen gesetzlichen Niederschlag.<br />
Das Konzept wurde maßgeblich von Thiersch geprägt (vgl. Thiersch 1995, 5).<br />
18 Die wörtliche Übersetzung von Empowerment bedeutet „Selbstbefähigung und Eigenmacht“.<br />
Als Ziel von Empowerment kann die Freisetzung von vorhandenen, wenn auch oft verschütteten<br />
Fähigkeiten/Ressourcen des Menschen genannt werden, um dadurch eigene Lebenswege<br />
und Lebensräume selbstbestimmt gestalten zu können (vgl. Herriger 2002, 262).<br />
15
1.1.3 Wesentliche Ansätze von Gemeinwesenarbeit<br />
Bevor GWA als „Arbeitsprinzip“ verstanden wurde, stellte sie neben der Einzelfallhilfe<br />
und der Gruppenarbeit die dritte Methode der sozialen Arbeit dar. In der Literatur wird<br />
19<br />
jedoch immer wieder explizit darauf verwiesen, dass es „die“F<br />
F GWA nicht gibt. Diese<br />
Aussage bezieht sich meines Erachtens auf die verschiedenen methodischen Ansätze<br />
von Gemeinwesenarbeit, die sich durch die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen<br />
der 1970er Jahre entwickelten. Hinte nennt „neben integrativfürsorgerischen<br />
Spielarten (Ross 1971; Caouste Gulbenkian Foundation 1972) […]<br />
sowohl technokratische (Rothmann u.a. 1979) aber auch aggressive (Alinsky 1974),<br />
emanzipatorische (Boulet u.a. 1980) sowie basisdemokratische (Karas/Hinte1978)<br />
Varianten“ (Hinte 2002, 535). Müller unterschied „am Beispiel von Murray Ross und<br />
Saul Alinsky harmonisierende und aggressive Strategien von GWA und Strategien von<br />
oben, Strategien von unten und Strategien aus der Mitte der Fachbasis. Boulet, Krauß<br />
und Oelschlägel bedachten die in den Niederlanden entwickelte Differenzierung in<br />
territoriale, funktionale und kategoriale Gemeinwesenarbeit…“ (Müller 2004, 30). Von<br />
einem detaillierteren Blick bezüglich einer spezifischen Darstellung der jeweiligen Ansätze<br />
musste ich mich leider aufgrund von Eingrenzungskriterien distanzierenF<br />
20<br />
F.<br />
1.2 Gemeinwesenarbeit – Heute so gut wie gestern?<br />
Die sich in einem ständigen Wandel befindenden strukturellen und gesellschaftlichen<br />
Bedingungen brachten auch eine Veränderung von Gemeinwesenarbeit mit sich.<br />
GWA wurde – neben der Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit - lange Zeit lediglich als<br />
dritte Methode Sozialer Arbeit klassifiziert und verstanden. Das durch Boulet, Krauß<br />
21<br />
und Oelschlägel formulierte Arbeitsprinzip GWAF<br />
F brachte im Jahr 1980 Bewegung in<br />
die komplex gewordene Fach- bzw. Methodendiskussion. Maria Lüttringhaus spricht in<br />
diesem Zusammenhang von einem „konzeptionellen Durchbruch“ (vgl. Hinte u.a.<br />
2001, 53). Nachdem GWA lange Zeit ein Randgruppendasein fristete, scheint sich nun<br />
eine Trendwende anzudeuten. Die Grundaussagen von GWA halten Einzug in die<br />
verschiedensten Felder Sozialer Arbeit, wenn auch großteils im neuen „Outfit“. Genannt<br />
werden können hier die Konzepte des bürgerschaftlichen Engagements, des<br />
Empowerments, sozialraumorientierte Jugendhilfe oder lebensweltorientierter ge-<br />
19 vgl. Oelschlägel u.a. 2001, 653<br />
20 Weitere Literatur zu den Traditions- und Entwicklungslinien der GWA vgl. Wendt (1989),<br />
Oelschlägel (2000) und Müller (1992).<br />
21 vgl. Boulet u.a. 1980<br />
16
22<br />
23<br />
meindenaher ArbeitF<br />
F. Andern OrtsF<br />
F wird von einer ökosozialen Sozialarbeit oder<br />
sozialen Stadtteilarbeit, von Milieuarbeit und Quartiersmanagement gesprochen. Diese<br />
vielfachen Wortkreationen lassen laut Oelschlägel vermuten, dass der Begriff Gemeinwesenarbeit<br />
zum einen eine fehlende Modernität suggeriert (Oelschlägel zit. in<br />
Rausch 1998, 195) und zum anderen, dass das, was hinter den neuen Wortkreationen<br />
steckt entweder nicht neu ist oder wie bei der stadtteilbezogenen Sozialen Arbeit den<br />
Versuch darstellt, Gemeinwesenarbeit gegenüber kommunalen Auftraggebern neu zu<br />
profilieren: „In diesem Falle kann ich die Einführung eines neuen Etiketts verstehen,<br />
musste doch Marketing für Gemeinwesenarbeit gegenüber Kommunen betrieben werden,<br />
die sich vor der im Ruf des Unruhestifters stehenden Gemeinwesenarbeit fürchteten“<br />
(Oelschlägel 1997, 37).<br />
Dennoch bleibt meines Erachtens vielfach unklar, was nun genau unter GWA verstanden<br />
werden soll. Daher scheint es mir angebracht, zunächst das Selbstverständnis<br />
von GWA sowie ihr Tun anhand zentraler Handlungselemente vorzustellen. Nach einer<br />
Klärung der Begrifflichkeiten des Sozialraumes sowie des Quartiersmanagements<br />
möchte ich abschließend einen Ausblick über die neueren Entwicklungen von GWA<br />
vermitteln.<br />
1.2.1 Was ist GWA und was tut sie?<br />
Bei der Klärung dessen, was Gemeinwesenarbeit ist, werde ich mich in den folgenden<br />
Ausführungen an Oelschlägel orientieren, der neben Hinte die bundesdeutsche Gemeinwesenarbeitsdiskussion<br />
über ein Vierteljahrhundert maßgeblich prägte. Beginnen<br />
möchte ich dabei mit einer sehr prägnanten Darstellung vom Jahr 1999, in der er zu<br />
beschreiben versucht, was an GWA wesentlich ist.<br />
„Wenn Gemeinwesenarbeit drauf steht, ist keine Gemeinwesenarbeit drin, wenn<br />
− keine Theorie drin ist,<br />
− keine Überprüfung, keine Evaluation dabei ist,<br />
− nicht gefragt wird, was die Leute wollen und wie man sich mit ihnen verständigt,<br />
− nicht zielgruppenübergreifend gearbeitet wird<br />
− nach dem Prinzip „avanti dilletanti“ vorgegangen wird<br />
Gemeinwesenarbeit ist es dann, wenn viele unterschiedliche, auch konfliktmässig miteinander<br />
agierende Gruppen in einem Projekt mitmachen“ (Oelschlägel zit. in Gillich<br />
2004b, 267).<br />
22 vgl. Hinte u. a. 2001<br />
23 vgl. Rausch 1998<br />
17
Bevor ich in die Thematik des Selbstverständnisses von Gemeinwesenarbeit tiefer<br />
einsteige, erscheinen mir einige Bemerkungen zum gesellschaftlichen Wandel dieser<br />
Zeit angebracht. Diese Annahme findet ihre Begründung in der These, dass der praktische<br />
sowie theoretische Zustand von Gemeinwesenarbeit immer als Reflex auf gesellschaftliche<br />
Entwicklungen verstanden werden muss (vgl. Oelschlägel 2001b, 93).<br />
01BExkurs: Individualisierung und Pluralisierung<br />
In der Sozialen Arbeit erlangte das Konzept der Individualisierung und Pluralisierung<br />
vor allem mit dem Achten Jugendbericht der Bundesregierung (1990) fachöffentliche<br />
Aufmerksamkeit. Dieser Bericht plädierte erstmals sehr eindrücklich für einen differenzierten<br />
Blick auf die Lebensverhältnisse der Adressatinnen mit ihren individuellen und<br />
spezifischen Deutungs- und Handlungsmustern, im Kontext der gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen, sowie den daraus entstehenden Möglichkeiten, aber auch den Schwierigkeiten.<br />
So sehen beispielsweise die Befürworterinnen der Globalisierungsprozesse<br />
die Chancen der Weiterentwicklung von Demokratie, Menschenrechten und Wohlstand<br />
in der ganzen Welt, während die Kritikerinnen auf die Folgen der Globalisierung durch<br />
die gegenwärtigen (neo)liberalen Praktiken verweisen, nämlich vertiefende soziale Ungerechtigkeit,<br />
weit verbreitete Armut und ökologische Zerstörung – letztendlich auf einen,<br />
im wahrsten Sinne des Wortes, grenzenlosen Kapitalismus. Meiner Meinung nach<br />
können Pluralisierung und Individualisierung als die beiden Seiten der Medaille dieser<br />
industriekapitalistischen Modernisierung gesehen werden, in Folge derer sich Lebensund<br />
Arbeitswelten entfremden, Sicherheiten erodieren und den Menschen zunehmend<br />
Strategien der Lebensbewältigung abverlangt werden.<br />
Die Bedeutung des Wortes Individualisierung verführt buchstäblich zu Irritationen. Im<br />
umgangssprachlichen Gebrauch ist sinngemäß eher ein Prozess der Vereinzelung<br />
gemeint, in dem der einzelne Mensch dem Ganzen gegenübergestellt wird. Etymologisch<br />
kann die Wurzel des Wortes über das lateinische „individuum“ bis zum griechischen<br />
„átamos“ zurückverfolgt werden, was so viel wie „unteilbar“ bedeutet (vgl. Duden<br />
24<br />
1989, 303). Doch gerade die Atomisierung, also die Vereinzelung, meint BeckF<br />
F nicht<br />
25<br />
mit „Individualisierung“. Denn das „vereinzelte Individuum“F<br />
F wird weder atomisiert<br />
noch lebt es auf einer Insel. Vielmehr muss es mit einer selbst gebastelten Landkarte<br />
den eigenen Weg in einem unübersichtlichem Gelände und einem vielfältigen Geflecht<br />
aus Individuen und Gruppen suchen (vgl. Winkler 1992, 67 f.).<br />
24 Der Soziologe Ulrich Beck prägte im Jahre 1986 mit dem gleichnamigen Titel den Begriff der<br />
Risikogesellschaft (vgl. Beck 1986).<br />
25 vgl. Marx, Karl; Engels, Friedrich: Das kommunistische Manifest (1847)<br />
18
Individualisierung steht also für zunehmende Möglichkeiten aber auch Notwendigkeiten<br />
neuer und offener Formen der Lebensführung, was Partnerschaften, Familie und Beruf,<br />
die berufliche Karriereplanung oder die Gestaltung der Wohn-, Verwandtschafts- und<br />
Nachbarschaftsverhältnisse betrifft (vgl. Thiersch 1995, 18). Pluralisierung der Lebenslagen<br />
meint die Unterschiedlichkeit von Lebensstrukturen, die aus Verschiedenheiten<br />
des Geschlechts, der Ethnie, der Bildung, der ökonomischen Verhältnisse, der Familienkonstellation<br />
oder des Wohnortes (Stadt/Land oder Ost/West) resultieren (vgl. ebd.,<br />
18).<br />
Um die neuen Möglichkeiten und Chancen im o.g. Sinne jedoch überhaupt nutzen zu<br />
können, müssen „altbackene“ und normative Vorgaben verworfen und neue Strategien<br />
gestrickt werden. Die aktive Inszenierung des eigenen Lebensentwurfes bedarf in einer<br />
Gesellschaft, in der Verlässlichkeiten rar geworden sind, eines sicheren Fundamentes,<br />
einer hohen Risikobereitschaft, eines vielseitigen Aushandlungsgeschickes und einer<br />
gut ausgestatteten „Trickkiste“. Im öffentlichen Diskurs scheint oftmals nur eine einseitige,<br />
nämlich eine positive Bewertung stattzufinden, die jedoch meist zu kurz greift.<br />
Nach meiner Einschätzung gerät viel zu schnell die Tatsache aus dem Blickfeld, dass<br />
die genannten Entwicklungen in den Lebenswelten der Menschen oft zu Unsicherheiten<br />
und Ängsten führen, und so nicht nur von einer beliebigen und freien Wahl nach<br />
dem “Wünsch-mir-was-Prinzip“ ausgegangen werden kann. „Die alltägliche Lebenswelt<br />
der Menschen ist zersplittert in eine Vielzahl von Entscheidungssituationen, für die es<br />
(nicht trotz, sondern wegen der breiten Angebotspalette) keine verlässlichen Rezepte<br />
mehr gibt“ (Hitzler u.a. 1994, 308). Auf diese Weise kann Alltag zu einem riskanten<br />
Unterfangen werden. Nicht nur weil sich die gerade gewählte Option möglicherweise<br />
als nicht sehr vorteilhaft erweist, sondern auch, weil sich die Bedingungen, unter denen<br />
die konkrete Entscheidung getroffen wurde, rasch verändern und somit die jeweiligen<br />
Wirkungen unvorhersehbar bleiben (vgl. Hitzler u.a. 1994, 308). Dies führt nicht nur zu<br />
einer zunehmenden Verunsicherung in den traditionellen Deutungs- und Handlungsmustern,<br />
sondern birgt auch die Gefahr eines Werterelativismus in sich, in dem traditionelle<br />
Milieus, wie beispielsweise die Familie, die in Krisensituationen Schutz vor persönlichen<br />
Sinnkrisen bieten könnte, immer mehr an Bedeutung verlieren. Der Grad der<br />
Anonymisierung nimmt immer mehr zu und dies nicht nur in Großstädten. Es entstehen<br />
neue soziale Ungleichheiten, die zusätzlich zu den bereits bestehenden ständig an<br />
26<br />
Gewicht gewinnenF<br />
F. „Die Medien produzieren Surrogate eigener Erfahrung und suggerieren<br />
Aktivität und Dabeisein: ´Man trifft sich sozusagen am Abend weltweit und<br />
schichtübergreifend am Dorfplatz des Fernsehens und konsumiert die Nachrichten´“<br />
26 Soziale bzw. traditionelle Ungleichheiten sind bezogen auf materielle Ressourcen, Zugehörigkeit<br />
zu Nation, Generation, Geschlecht sowie auf Partizipation an Bildung, Arbeit, Gesundheitsförderung<br />
und sozialen Dienstleistungen.<br />
19
(Oelschlägel 2001b, 94). Auch die großen gesellschaftlichen Organisationen wie Wohlfahrtsverbände,<br />
Gewerkschaften oder Parteien verlieren an identitäts- sowie milieustiftender<br />
Wirkung (vgl. Oelschlägel 2001b, 94 f.).<br />
Im Zuge der genannten Modernisierungen veränderte sich auch zwangsläufig das<br />
Leben im Stadtteil und führte somit auch zu einer Veränderung des Gemeinwesens.<br />
Aus traditionellen Milieus wurden kleine Submilieus. Unbehagen machte sich breit, die<br />
Nachbarinnen kannten sich untereinander nicht mehr, was zu einer Zunahme von<br />
Entfremdungs- und Vereinsamungsprozessen führte. Besonders in den 1990er Jahren<br />
waren zwei unterschiedliche Entwicklungen in den Gemeinwesen zu registrieren: Zum<br />
einen reagierten sie auf die sozialpolitischen Umbrüche mit Abschottung und ideologischen<br />
Homogenisierungsprozessen (wie Ausländerfeindlichkeit und Rassismus), zum<br />
anderen wurden Gemeinwesen inhomogener. Gemeint ist hiermit, dass durch die Zunahme<br />
von Subkulturen das Gemeinwesen immer mehr auseinander driftete. Konkreter:<br />
Die Kluft zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen wurde aufgrund<br />
eines fehlenden Wertekonsenses immer größer (vgl. Oelschlägel 1993, 70)..<br />
Was ist GWA:<br />
In Anbetracht der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wird die<br />
Notwendigkeit einer sozialarbeiterischen und stadtteilpolitischen Interventionsstrategie,<br />
die den sozialen Raum und damit das Verhältnis der Menschen zueinander und<br />
zu ihrem Stadtteil berücksichtigt, immer deutlicher. Nach Oelschlägel gibt es eine solche<br />
Strategie seit den 1960er Jahren (vgl. Oelschlägel 2001b, 100). Im Handbuch der<br />
Sozialen Arbeit beschreibt er Gemeinwesenarbeit als eine sozialräumliche Strategie,<br />
die sich nicht pädagogisch auf einzelne Bewohnerinnen bezieht, sondern in einem<br />
ganzheitlichen Sinne auf den Stadtteil. Um bestehende Defizite aufzuheben, arbeitet<br />
GWA mit den vorhandenen Ressourcen im Stadtteil, als auch mit den Bewohnerinnen,<br />
mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebensverhältnisse im Stadtteil zu erreichen (vgl.<br />
Oelschlägel 2001a, 653). Des Weiteren betont Oelschlägel, dass er Gemeinwesenarbeit<br />
als professionelle Strategie versteht, „die Fachlichkeit und Kontinuität sichert und<br />
die nicht gleichzusetzen ist mit Formen bürgerschaftlichen Engagements im Stadtteil<br />
und diese auch nicht ersetzen soll“ (Oelschlägel 2001b, 100). Gemeinwesenarbeit<br />
kann daher als eine sozialkulturelle Interventionsstrategie verstanden werden, deren<br />
Merkmale im Folgenden konkreter aufgezeigt werden (vgl. Oelschlägel 2001a, 653):<br />
20
• Gemeinwesenarbeit erfasst, erklärt und bearbeitet, soweit wie möglich, soziale<br />
Problemlagen in ihren raum-zeitlichen, historischen sowie gesellschaftlichen Dimensionen.<br />
Auf dieser Grundlage werden Theorien aus verschiedenen wissenschaftlichen<br />
Disziplinen integriert, beispielsweise aus den Sozialwissenschaften,<br />
der politischen Ökonomie, der Psychologie oder der Erziehungswissenschaft.<br />
27<br />
Durch ihr interdisziplinäresF<br />
F Selbstverständnis grenzt sich GWA historisch gegen<br />
gewisse Formen der Einzelfallhilfe sowie deren theoretische Begründungen<br />
in der Sozialarbeit ab (vgl. Oelschlägel 2001a, 653).<br />
• Aufgrund dieser Erkenntnis lehnt Gemeinwesenarbeit die Aufsplitterung in einzelne<br />
methodische Bereiche ab und integriert stattdessen Methoden der Sozialpädagogik<br />
und der Sozialarbeit, der Sozialforschung, der Psychologie sowie<br />
„des politischen Handelns in Strategien professionellen Handelns in sozialen<br />
Feldern“ (Oelschlägel 2001, 653). GWA ist demnach als Prinzip zu verstehen<br />
und ist somit mehr als die dritte Methode der Sozialarbeit. Folglich existieren<br />
ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Gemeinwesenarbeit, die sich an den<br />
jeweiligen lokalen Richtigkeiten orientieren (Oelschlägel 2001a, 653).<br />
• Die Analysen und Strategien von Gemeinwesenarbeit beziehen sich auf einen<br />
Ort, der meist eine sozialräumliche Einheit darstellt (Quartiere, Institutionen…),<br />
wo Menschen mit all ihren unterschiedlichen Problemlagen anzutreffen sind. In<br />
diesem Zusammenhang wird in der Regel von einem Gemeinwesen gesprochen.<br />
Ein zentraler Aspekt hierbei stellt die ganzheitliche Betrachtungsweise dar. Im<br />
Besonderen geht es hierbei um die Lebensformen, die Lebensverhältnisse sowie<br />
die Lebenszusammenhänge der Menschen, auch aus der individuellen Perspektive<br />
der Individuen (Lebensweltorientierung). Gemeinwesenarbeit greift daher<br />
nicht ein von außen definiertes Problem auf, sondern richtet den Blick auf all jene<br />
Schwierigkeiten, die für die dort lebenden Menschen von Bedeutung sind.<br />
Ziel von Gemeinwesenarbeit ist die Umorganisation der Quartiere in handelnde<br />
Gemeinwesen. GWA möchte den dort lebenden Menschen eine Stimme geben,<br />
so dass sie in ihrer Lebenswelt handlungsfähiger agieren und somit Veränderungen<br />
herbeiführen können mit dem Ziel, eine lokale Identität für den Stadtteil<br />
zu entwickeln. Die daraus zu ziehende Schlussfolgerung kann nur heißen, dass<br />
Gemeinwesenarbeit weit aus mehr ist „als „Stadtteilorientierung“, „Gemeinwese-<br />
27 Eine interdisziplinäre Arbeitsweise oder Forschung umfasst mehrere voneinander unabhängige<br />
Fachgebiete, die einer meist wissenschaftlichen Fragestellung mit ihren jeweiligen Methoden<br />
nachgehen (vgl. Meyers Lexikon 1992)<br />
21
28<br />
norientierungF<br />
F“ im Sinne der Öffnung einer Institution zum Stadtteil hin, um deren<br />
Arbeit effektiver zu machen, z.B. Öffnung der Schule, Dezentralisierung psychosozialer<br />
Dienste, stadtteilorientierte Volkshochschularbeit“ (Oelschlägel<br />
2001a, 653).<br />
• Als ihren zentralen Inhalt sieht Gemeinwesenarbeit daher die Aktivierung der<br />
Menschen in ihrer individuellen Lebenswelt. Die Menschen sollen auf ihrem Weg<br />
zu autonomen und politisch aktiv handelnden und lernenden Individuen begleitet<br />
werden mit dem Ziel, sich selbst eine zunehmende Kontrolle über ihre Lebensverhältnisse<br />
zu verschaffen. Hierbei wird auf gemeinsame Problembearbeitung<br />
(bis hin zum Widerstand) sowie den damit einhergehenden Kompetenzerfahrungen<br />
Wert gelegt (vgl. Oelschlägel 2001a, 653).<br />
Was tut GWA – Wesentliche Handlungselemente:<br />
Gemeinwesenarbeit begegnet zum einen als Handlungsfeld und zum anderen als Arbeitsprinzip<br />
sozialer Intervention. Oelschlägel betont, „Gemeinwesenarbeit ist stets<br />
beides“ (Oelschlägel 2000a, 654). Als Handlungsfeld Sozialer Arbeit präsentiert sich<br />
GWA in Form zahlreicher Projekte unterschiedlicher Träger, als Arbeitsprinzip entspricht<br />
GWA der bereits genannten Definition einer sozialräumlichen Strategie, die in<br />
allen Bereichen Sozialer Arbeit und darüber hinaus handlungsleitend sein kann. Die<br />
Grundelemente von GWA zeichnen sich durch eine – von unterschiedlichen Autorinnen<br />
benannte - Übereinstimmung aus, die ich im Folgenden vorstellen möchte (vgl.<br />
Oelschlägel 2004, 11):<br />
UNützliche Dienstleistungen (Ressourcen)<br />
Die Erfahrungen in GWA-Projekten zeigen nach Oelschlägel, dass gerade Menschen<br />
in benachteiligten Wohngebieten mehr als andere die soziale Arbeit sowie ihre Einrichtungen<br />
und Mitarbeiterinnen nach dem Nutzen beurteilen. Es soll am Ende „etwas<br />
herauskommen“ und nicht nur geredet werden. GWA benötigt daher nützliche Dienstleistungen,<br />
da die Menschen sonst einfach wegbleiben. Unter nützlichen Dienstleistungen<br />
können beispielsweise materielle Ressourcen (z.B. Räume, Ämterfahrten),<br />
personelle Ressourcen (Betreuung/Beratung), Infrastruktur (Orte an denen sich Menschen<br />
organisieren können) sowie soziale Netze und Stützsysteme, verstanden werden.<br />
28 Gemeinwesenorientierung ist das, was häufig bereits als Gemeinwesenarbeit etikettiert wird.<br />
Eine Institution öffnet sich dem Gemeinwesen zum einen, um die jeweilige Zielgruppe besser zu<br />
erreichen (z.B. Jugendheime, VHS, Streetwork), zum anderen um dessen Ressourcen für die<br />
eigene Arbeit und die einen Klienten besser nutzen zu können (z.B. Schule, Kita oder ASD),<br />
(vgl. Oelschlägel 2004, 11)<br />
22
U<br />
Von besonderer Bedeutung ist die Ressource Netzwerk, da durch diese emotionale<br />
Unterstützung geleistet und praktische Alltagshilfe angeboten werden kann. Des Weiteren<br />
findet ein Austausch von Kompetenzen und Ressourcen statt, durch die Gefühle<br />
des Selbstwerts und der Sicherheit gewonnen werden können (vgl. Oelschlägel<br />
2001b, 102).<br />
UGWA berät und aktiviert<br />
Um Menschen zu einem selbstbewussten und selbstbestimmten Sein „aktivieren“ zu<br />
können, müssen die jeweiligen Zielformulierungen in erster Linie den Möglichkeiten der<br />
Beteiligten angepasst werden. Hier muss nach den objektiven, also den tatsächlichen<br />
Lebensumständen der Menschen und nach deren subjektiv vorhandenen Einfluss- und<br />
Veränderungsmöglichkeiten gefragt werden. Das bedeutet, dass GWA nach der Perspektive<br />
der Individuen fragt, da nur so Ergebnisse des geplanten Handelns für die<br />
Menschen antizipierbar sind (vgl. Oelschlägel 2001b, 102).<br />
UKulturelle Gemeinwesenarbeit fördert Eigentätigkeit und Genuss<br />
Ausgehend von der Annahme, dass alle Menschen kulturelle Ausdrucks- und Aneignungsbedürfnisse<br />
haben, stellt Kultur kein vom alltäglichen Leben getrenntes Phänomen<br />
dar, sondern eine Gestaltungsmöglichkeit der individuellen Lebensverhältnisse.<br />
Oelschlägel beschreibt Kultur als wichtigen Aspekt eines „guten Lebens“, das im Besonderen<br />
das Ziel von Gemeinwesenarbeit sein sollte (vgl. Oelschlägel 2001b, 103).<br />
Dies bezieht sich nicht nur auf den „Konsum“ bzw. Genuss von Kultur, sondern auch<br />
auf die eigenen kulturellen und schöpferischen Tätigkeiten (vgl. Oelschlägel 2001b,<br />
103). Als Ziel von Gemeinwesenarbeit kann ein anregendes sowie reichhaltiges kulturelles<br />
Milieu im Stadtteil, genannt werden (vgl. ebd., 103).<br />
UGWA ist Teil lokaler Politik<br />
Durch eine zunehmende Kommunalisierung der Sozialpolitik sowie der Verlagerung<br />
von immer mehr Funktionen (z.B. Arbeitsbeschaffung) auf die kommunale Ebene, werden<br />
soziale Verantwortung und Problembewältigungen direkt in die Stadtteile getragen.<br />
Gemeinwesenarbeit muss hier zur Verteidigung der Lebensräume und Handlungsmöglichkeiten<br />
der Bewohnerinnen reagieren. Die Schlussfolgerung daraus kann nur heißen,<br />
dass GWA in der Gestaltung von sozialen Räumen immer auch politisch ist und<br />
unterschiedlicher Formen der Einmischung bedarf (vgl. Oelschlägel 2001b, 103).<br />
23
Vernetzung im Stadtteil<br />
Gemeinwesenarbeit und Stadtteilentwicklung können nur mit veränderungsbereiten<br />
Akteurinnen funktionieren. In jedem Stadtteil sind formelle oder informelle Gruppierungen<br />
zu finden: „Ob als Hausgemeinschaft oder Kneipengruppe, als Sportclub oder<br />
Freizeitclique, als Frauentreff oder Schrebergartenfreunde, als Mädchentreff oder Discogruppe,<br />
als islamische Gemeinde oder Nachbarschaftsverein…“(Fritz/Thies 1997 zit.<br />
in Oelschlägel 2001a, 654). All diese Gruppieren können für das Quartiersmanagement<br />
gewonnen werden. Ziel hierbei ist jedoch nicht, die einzelnen Gruppierungen zu Daueraktivistinnen<br />
zu machen, sondern ein Netz zu „spinnen“, das zu wichtigen Anlässen<br />
mobilisiert werden kann (vgl. Oelschlägel 2001a, 654).<br />
1.2.2 Der Soziale Raum und sein Quartier<br />
Die Trendvokabel „Sozialraum“ scheint Hochkonjunktur zu haben: Von der Jugendhilfe<br />
über soziale Stadterneuerung bis hin zur Öffnung von Schulen in Stadtteilen wird von<br />
ihr gesprochen. Für die GWA sind die „räumlichen“ Gegebenheiten sowohl als Be- und<br />
Verhinderung, aber auch als zentrale Ressource einer gemeinschaftlichen Lebensbewältigung<br />
zu verstehen. Auch hier spielt der Wandel der Moderne im Sinne von Individualisierung<br />
und Pluralisierung eine große Rolle (vgl. Oelschlägel 2004, 13). Die Menschen<br />
müssen ihr Leben – und das ist Chance und Bedrohung zugleich – selbst inszenieren<br />
sowie sich selbst in „Szene“ setzen: „Sie müssen eigene Kontakte herstellen<br />
sowie die eigene Attraktivität hervorheben, Beziehungen pflegen und zugleich lösen,<br />
um wieder neue eingehen zu können. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich eine soziale<br />
Infrastruktur umso hilfreicher, „die ihren Bedürfnissen entspricht und (ihnen) bei<br />
der Lebensbewältigung unter die Arme greift und…irgendetwas, was ihnen aus der<br />
Patsche hilft, wenn sie sich verstrickt haben und in bedrohliche Krisen geraten“ (Kronauer<br />
in Oelschlägel 2004, 13).<br />
Der Raum, sei es nun die Hochschule, das Altersheim oder der Stadtteil bildet für die<br />
konkret agierenden Menschen auch immer eine sozialräumliche Einheit, die durch das<br />
gegenseitige Wechselspiel der unterschiedlichen ökonomischen, sozialen, kulturellen<br />
oder symbolischen Dimensionen bestimmt wird. Diese vielschichtigen Prozesse sind<br />
meist nur im unmittelbaren Kontext, also in der Teilhabe am Alltag, erfahrbar. GWA<br />
suchte bereits seit ihren Anfängen in der Settlement-Bewegung die unmittelbare Nähe,<br />
um die jeweiligen Deutungs- und Handlungsmuster marginalisierter Bevölkerungsgruppen<br />
besser verstehen zu können. So wirkte GWA bereits vor der Wende zum „Alltag“<br />
innerhalb der alltäglichen Handlungsfelder und beteiligte sich an den gewöhnlichen<br />
Lebensabläufen der Menschen (vgl. Rausch 1998, 201ff).<br />
24
Im sozialräumlichen Konzept des Quartiersmanagements, dem Oelschlägel einen „rasanten<br />
Anstieg“ bescheinigt, werden die zentralen Aspekte von GWA aktuell wieder<br />
aufgenommen. Als Ursache dafür können hier die bereits beschriebenen gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen genannt werden, insbesondere die Segregation der Städte. Die in<br />
diesen Quartieren vorherrschende Komplexität an Problemen und Aufgaben kann die<br />
„klassische“ Sozialarbeit nicht mehr leisten. Die dafür in der Gemeinwesenarbeit entwickelte<br />
Strategie, die sich ganzheitlich auf den Stadtteil und nicht pädagogisch auf einzelne<br />
Individuen richtet, wurde lange nicht beachtet und blieb so in der Perspektive des<br />
Sozialen verhaftet. Inzwischen kann jedoch, laut Oelschlägel, von einer Annäherung<br />
zwischen GWA und Stadtentwicklung gesprochen werden (z.B. Bürgerbeteiligung, lokale<br />
Ökonomie), die als Stadtteil- oder Quartiersmanagement bezeichnet werden kann<br />
(vgl. Oelschlägel 2004, 14). Für Hinte stellt das Quartiersmanagement die konsequente<br />
Fortführung des Arbeitsprinzips GWA dar sowie der darauf basierenden stadtteilbezogenen<br />
Sozialen Arbeit. Von zentraler Bedeutung ist – ebenso wie in der Gemeinwesenarbeit<br />
auch - die Aktivierung und Motivation von Bewohnerinnen, eigene Ideen und<br />
Leistungen in den Stadtteil einzubringen. Alisch weist jedoch darauf hin, dass sich<br />
Quartiersmanagement als klassisches Projektmanagement versteht indem es die jeweilige<br />
Aufgabe in einem befristeten Zeitraum mit einem vordefinierten Ziel und den<br />
29<br />
entsprechenden Kriterien zur Zielerreichung bewältigtF<br />
F. Nach Oelschlägel markiert<br />
dies den Unterschied zwischen Quartiersmanagement und Gemeinwesenarbeit, da<br />
GWA ausgehend von den Potentialen und Bedürfnissen der Menschen, weder einen<br />
Projektzeitraum noch ein konkretes Ziel vorab benennen kann (vgl. Oelschlägel 2004,<br />
14).<br />
1.2.3 GWA morgen – ein Ausblick<br />
Im Folgenden werden die neueren Entwicklungslinien der GWA in Form der stadtteilbezogenen<br />
Sozialen Arbeit, der Community Organization und der Gemeinwesenökonomie<br />
näher beleuchtet.<br />
Stadtteilbezogenen Soziale Arbeit:<br />
Als eine bedeutende Entwicklungslinie von GWA kann die Stadtteilbezogene Soziale<br />
Arbeit genannt werden. Seit dem Jahr 1981 existiert das von Hinte initiierte Institut für<br />
Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung (ISSAB) in Essen, das sich bis in die<br />
29 vgl. Alisch, Monika: Soziale Stadterneuerung in Deutschland – Implementationshürden und<br />
Lösungswege, Hwww.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/alisch/soziale_stadtentwicklung.htmH,<br />
19.02.2007<br />
25
neuen Bundesländer in vielfältigen Bereichen sozialer Arbeit bis hin zur Politikberatung<br />
ausweiten konnte. Als wichtig bezeichnet Oelschlägel den Beitrag des ISSAB in Bezug<br />
auf eine gemeinwesenorientierte Profilierung des Allgemeinen Sozialen Dienstes<br />
(ASD). Des Weiteren sieht Oelschlägel hinter den anfangs oftmals polemischen Formulierungen<br />
des ISSAB wichtige Impulse für die Gemeinwesenarbeit, vor allem in Bezug<br />
einer kritischen Auseinandersetzung: „Es geht um eine nicht-pädagogische Kompetenz<br />
der Professionellen, die die Wünsche und Interessen der Betroffenen in den<br />
Vordergrund stellen und deshalb im Stadtteil Moderationsfunktionen übernehmen und<br />
um eine Beteiligung an Einflussnahme auf das öffentliche politische Leben im Stadtteil,<br />
in der Gesamtstadt und gegebenenfalls in der Region durch GWA zu erreichen, die<br />
Verwaltungen nicht prinzipiell als Gegner, sondern bis zum Beweis des Gegenteils als<br />
Bündnispartner sieht und deshalb eine Scharnierfunktion als intermediäre Instanz im<br />
Stadtteil übernimmt“ (Oelschlägel 2001a, 657).<br />
So gestalten sich die Unterschiede zu Gemeinwesenarbeit als nicht sehr groß. Dies<br />
schlägt sich auch in der Fachliteratur nieder, in der die Begriffe GWA und Stadtteilbezogene<br />
Soziale Arbeit zunehmend synonyme Verwendung finden (vgl. Oelschlägel<br />
2001a, 657).<br />
Community Organization (CO):<br />
Seit einigen Jahren kann von einer neuen Welle der Rezeption bezüglich Communitiy<br />
Organization gesprochen werden. Als Ursache für die neuerliche Besinnung auf CO<br />
nennt Oelschlägel die vielerorts knapp werdenden Mittel in GWA-Projekten sowie<br />
Probleme wie Armut, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Gewalt auf den Straßen, die<br />
auch Gemeinwesenarbeiterinnen vor neue Herausforderungen stellen (vgl. Oelschlägel<br />
2001a, 658). Da GWA die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen großflächig vernachlässigt<br />
hat, erscheint es nicht verwunderlich, wenn bundesdeutsche Studentinnen mit<br />
Blick auf die USA von dem hiesigen Stand der Lehre enttäuscht sind. Doch die Beschäftigung<br />
mit GWA in Deutschland sowie die Erfahrungen mit CO in den USA<br />
schrieben sich historisch wie empirisch nieder, so dass das „Forum für Community<br />
organizing“ (FOCO) gegründet werden konnte. Das Ziel des Forums ist es, methodische<br />
Trainings anzubieten sowie die eigene CO-Praxis mit Kolleginnen zu reflektieren,<br />
einschlägige Literatur auszuwerten und zu übersetzen sowie auch in der BRD Community<br />
Organization Projekte aufzubauen (vgl. ebd., 658).<br />
Oelschlägel sieht die Diskussion um CO neben den praktischen Effekten der Trainings<br />
„als notwendige und nachhaltige Erinnerung daran, was wir in der GWA seit 30 Jahren<br />
an Wissen und Können angesammelt haben, und als ausdrückliche Aufforderung, das<br />
26
phantasievoll und engagiert anzuwenden, anstatt in Routinen zu erstarren (Oelschlägel<br />
2001a, 658).<br />
Gemeinwesenökonomie:<br />
Da die GWA lange Zeit die Ökonomie vernachlässigte und es bisweilen immer noch<br />
tut, erheben sich laut Oelschlägel zu Recht kritische Stimmen, die ein Umdenken fordern.<br />
Bedingt durch die gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen geraten die Kommunen<br />
zunehmend unter Handlungsdruck. Erfahrungen aus GWA-Projekten zeigen, dass<br />
Menschen, die aus dem Arbeitsleben herausfallen, immer öfter auf ihr Quartier bzw.<br />
auf ihre Lebenswelt verwiesen werden. Das Gemeinwesen wird zur Ressource der<br />
Existenzsicherung in Form von sozialen Netzen oder informellen Kreditsystemen und<br />
zur Ressource der Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben. Zugleich<br />
wächst gerade in armen Stadtteilen der Bedarf an Arbeit in Bereichen der Infrastruktur<br />
sowie der sozialen Dienstleistung vor allem in Form von Kinderbetreuung, Alters- und<br />
Krankenversorgung (vgl. Oelschlägel 2001a, 658). Gemeinwesenökonomie verknüpft<br />
praktisch den örtlichen Bedarf mit den Ressourcen des Gemeinwesens. Inzwischen<br />
gibt es auch international eine Vielzahl dieser basisökonomischen Ansätze, „denen<br />
gemeinsam ist, dass sie, aus der Not geboren, von der Nutzung der Arbeits- und Gestaltungskraft<br />
der Menschen in den Gemeinwesen als der entscheidenden und oft einzigen<br />
sozialproduktiven Ressource ausgehen und Grundbedürfnisse in den Nahräumen<br />
decken (Elsen 1997 zit. in Oelschlägel 2001a, 658).<br />
1.2.4 Saatgut: GWA<br />
Abschließend möchte ich auf die Ausgangsfrage dieses Kapitels zurückkommen, nämlich<br />
ob GWA im Heute immer noch mit den „wilden Zeiten“ von früher – die flächendeckend<br />
wohl nie so wild warenF<br />
F- verglichen werden kann. In der Literatur findet sich für<br />
30<br />
31<br />
die momentane Entwicklung von GWA häufig die Metapher „die Saat geht aufF<br />
F“. Lüttringhaus<br />
spricht dagegen eher von einer neuen Züchtung, „ein Mix aus verschiedenen<br />
Strängen – und einer davon ist wohl oft die Gemeinwesenarbeit“ (Lüttringhaus<br />
2004,17). Des Weiteren merkt sie an, dass das Saatgut GWA nicht selbstverständlich<br />
in verschiedenen Feldern Sozialer Arbeit aufgegangen ist, sondern dass die Kerngedanken<br />
von Gemeinwesenarbeit großteils über PersonenF<br />
F gesät<br />
32<br />
wurden.<br />
30 vgl. Krebs 2004<br />
31 vgl. Gillich u.a. 2004a<br />
32 Zu nennen sind hier Heinz Ries, C.W. Müller, Dieter Oelschlägel und Wolfgang Hinte für die<br />
Bereiche des Quartiersmanagement sowie der Jugendhilfe (vgl. Lüttringhaus 2004,17).<br />
27
F -<br />
Ein Blick auf den Theoriediskurs von Sozialer Arbeit zeigt, dass dieser zum einen sehr<br />
33<br />
stark durch das Lebensweltkonzept von ThierschF<br />
F geprägt ist. Dieser, so Lüttringhaus,<br />
beziehe sich jedoch in seinen Ausführungen weder auf Gemeinwesenarbeit noch verorte<br />
er sich in irgendeiner Form in dieser Tradition. Parallel zum Lebensweltkonzept<br />
34<br />
gab es zwar auch eine Diskussion um das EmpowermentF<br />
F, doch auch hier wurden,<br />
laut Lüttringhaus, die Linien von Gemeinwesenarbeit nur implizit aufgenommen. Zum<br />
anderen ist der Praxisdiskurs sehr stark durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
(KJHG) geprägt, über dieses auch die kommunalen Ressourcen verteilt werden. Auch<br />
hier ist Gemeinwesenarbeit nicht genannt, es ist lediglich vom Lebensumfeld die Rede.<br />
Zwar wird in §1 KJHG auf die Gestaltung von Umweltbedingungen als ein zentraler<br />
Bestandteil Sozialer Arbeit hingewiesen, eine konkrete Nennung von GWA als Arbeitsfeld<br />
findet jedoch keine Erwähnung. Dies stimmt mit Blick auf die finanziellen MittelF<br />
F<br />
35<br />
nachdenklich. Dennoch vermittelt die derzeitige Bewegung ein positives Bild, und so<br />
möchte ich mit einem Zitat von Hinte abschließen, der einen viel versprechenden Blick<br />
in die Zukunft von Gemeinwesenarbeit wagt: „Die konzeptionellen und methodischen<br />
„Pfunde“ der GWA sind immer noch eine ausgezeichnete Grundlage, um zahlreiche<br />
Arbeitsvollzüge etwa in Jugendhilfe und Stadtentwicklung zu analysieren und zu<br />
verbessern…(und) angesichts verbreiteter methodischer Bedürftigkeit in den etablierten<br />
Feldern kommunalen Handelns kann man gemeinwesenarbeiterischen Traditionen<br />
durchaus eine erfreuliche Zukunft vorhersagen (Hinte 2004, 10).<br />
1.3 Das weibliche GemeinwesenF<br />
das Land der Amazonen?“<br />
36<br />
„Eine Stadt der Frauen oder<br />
Gemeinwesenorientierte Soziale Arbeit vertritt den Anspruch ganzheitlicher Problemlösungsansätze.<br />
GWA geht demnach von den spezifischen Lebenswelten der Menschen<br />
aus, um so deren jeweilige Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen zu erweitern<br />
beziehungsweise zu stärken. Um die besonderen Lebenswelten von Frauen und Männern<br />
nicht aus den Augen zu verlieren, bedarf es geschlechtsspezifischer Deutungsund<br />
Handlungsmuster. Eine Analyse weiblicher Lebenswelten kann jedoch nur in<br />
Kombination verschiedener Konzepte vorgenommen werden. Auf den ersten Blick bietet<br />
sich hier das Konzept der Lebensweltorientierung nach ThierschF<br />
F an, durch<br />
37<br />
wel-<br />
33 Vgl. Thiersch 1995<br />
34 Vgl. Herriger 1991<br />
35 Nach wie vor sind alle Pflichtleistungen des KJHG derzeit Einzelfallleistungen (Hinte 2004, 7).<br />
36 Der Begriff „Das weibliche Gemeinwesen“ wird in Anlehnung an Bitzan verwendet, die diesen<br />
maßgeblich prägte (vgl. Bitzan 1993, 217 )<br />
37 vgl. Thiersch 1995<br />
28
ches der Gesamtzusammenhang des Individuums, die jeweilige „Kunst des Lebens“ in<br />
all seinem Facettenreichtum erkannt werden könnte. Da das Konzept der Lebensweltorientierung<br />
in seinem bisherigen Ansatz jedoch ohne Berücksichtigung der Geschlechterdifferenz<br />
beschrieben ist, orientiere ich mich im Folgenden an dem „Lebenslagen-Ansatz“<br />
nach Enders-Dragässler und Sellach (vgl. 2004).<br />
Vor diesem Hintergrund werde ich zunächst auf die Lebenslagen von Frauen im Allgemeinen<br />
sowie auf die von „Brennpunktfrauen“ im Besonderen eingehen. Nach einer<br />
Skizzierung der spezifischen Frauenwelten folgt eine Definition des weiblichen Gemeinwesens<br />
sowie die Bedeutung und das Selbstverständnis aktivierender weiblicher<br />
Gemeinwesenarbeit.<br />
1.3.1 Weibliche Lebenslagen im Spiegelbild der Gesellschaft<br />
Im Jahr 1621 forderte die französische Philosophin Marie Le Jars de Gournay als –<br />
soweit bekannt – erste überhaupt die völlige Gleichstellung von Mann und Frau. Relativ<br />
unbeeindruckt vergingen die nächsten 133 Jahre, bevor 1754 mit der deutschen Ärztin<br />
Dorothea von Erxleben in Halle erstmals eine Frau per Ausnahmeregelung promovieren<br />
durfte. Selbst die französische Revolution vergaß ihre Schwestern und verabschiedete<br />
am dritten September 1789 die neue Verfassung: „Déclaration des Droits de<br />
l´Homme et du Citoyen“. Die Wortwahl „Erklärung der Rechte des Mannes und des<br />
Bürgers“ war keine bloße Unbedachtheit, sondern Programm. Als Reaktion darauf veröffentlichte<br />
die Schriftstellerin und Philosophin Olympe de Gouges ihren eigenen Gesetzentwurf.<br />
In einem der Präambel vorangestellten Text mit dem Titel „die Rechte der<br />
Frau“ fragt sie den Mann: „Sage mir, wer hat dir die souveräne Macht verliehen, mein<br />
Geschlecht zu unterdrücken?“ (Rullmann/Schlegel 2000, 69). Zwei Jahre später wurde<br />
38<br />
Olympe de GougesF<br />
F verhaftet und hingerichtet (vgl. Rullmann u.a.2000, 61ff).<br />
Heute, 218 Jahre später schreiben wir das Jahr 2007 und noch immer wird viel über<br />
den Unterschied, der einen Unterschied zu machen scheint - das Geschlecht - gesprochen.<br />
So wurde beispielsweise das Jahr 2007 von der Europäischen Kommission zum<br />
Jahr der „Chancengleichheit für alle“ erklärt und auch Angela Merkel forderte am 22.<br />
39<br />
FebruarF<br />
F dieses Jahres, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung weltweit stärker<br />
38 Niemand kann genau sagen, ob Olympe de Gouges in direktem Zusammenhang mit dieser<br />
Frauenrechtsdeklaration hingerichtet wurde, doch ihr Eintreten für ein Menschsein, das keine<br />
Unterschiede zwischen Frau und Mann kannte, machte sie suspekt 38 (vgl. Rullmann u.a. 2000,<br />
62).<br />
39 Rede der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der vom Bundesministerium<br />
und der Weltbank veranstalteten Tagung zur „Wirtschaftsmacht Frauen“ (vgl.<br />
Hwww.angela-merkel.de/pdf/ 070222-rede-merkel-gleiche-rechte-fuer-frauen.pdfH, 25.02.2007).<br />
29
in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. Die rechtliche Gleichstellung in Deutschland<br />
regelt seit dem Bestehen der Bundesrepublik der Artikel drei des Grundgesetzes. Dennoch<br />
musste 45 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes dieser Artikel um<br />
einen Satz erweitert werden, so dass dort heute geschrieben steht: „Der Staat fördert<br />
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und<br />
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ (vgl. Grundgesetz 2002, 15). Dies<br />
bedeutet, dass im Jahr 1994 die „Sache“ Gleichberechtigung einer Realitätsbegutachtung<br />
nicht standhielt da durch die Änderung implizit zugegeben wurde, dass nach wie<br />
vor Benachteiligungen bestehen.<br />
Im Zuge der Egalisierung einzelner Lebensbereiche von Frauen und Männern ist festzustellen,<br />
dass die Chancen von Frauen, das Gleiche tun zu können wie die Männer,<br />
noch nie so hoch waren wie heute. Die Zeiten, in denen Frauen als aparte Feigenblätter<br />
einer von Männern dominierten Welt galten, scheinen vorbei – und damit auch die<br />
platten und ungeschminkten Benachteiligungen, wie sie vor wenigen Jahrzehnten noch<br />
gang und gäbe waren. Auch wenn es zuweilen mit der Gleichberechtigung im Alltag<br />
noch hapert, verstehen viele junge Frauen die Aufregung der „alten“ Kämpferinnen<br />
nicht mehr. Heute prägen neue und attraktivere Leitbilder von Frauen die öffentliche<br />
Landschaft. Frauen scheinen zu Schmiedinnen ihres eigenen Glücks geworden: Sie<br />
sind selbständig, attraktiv, berufstätig, selbstbewusst und setzen souverän ihre Wünsche<br />
um. Da bleibt wenig Zeit für Klagen über unzureichende Unterstützung oder Verletzungen,<br />
die zu Unsicherheiten und Ängsten führen können. Doch in wie weit entsprechen<br />
diese Wunschvorstellung der wirklichen Realität? Bitzan spricht in diesem<br />
Zusammenhang von einem „geschlechtsspezifischen Verdeckungszusammenhang der<br />
Moderne“: „Wir haben Modernisierung beschrieben als Entöffentlichung des geschlechtshierarchischen<br />
Widerspruchs, als Individualisierung gesellschaftlicher Widersprüche,<br />
die deren Lösungen zu einem Privatproblem macht“ (Bitzan 1991, 68). Gemeint<br />
ist hiermit, dass die Lebenswelten von Frauen nicht nur befreiter sondern auch<br />
belastender geworden sind, dass zu den vermehrten Optionen, die Frauen heute zur<br />
Verfügung stehen, nur bedingt vermehrte Realisierungsmöglichkeiten hinzugekommen<br />
sind. Dies führt zu Widersprüchlichen und Unverträglichkeiten in den jeweiligen Frauenwelten,<br />
die zunehmend als privates Problem diskutiert werden. So wird beispielsweise<br />
die Bewältigung von Familie und Beruf als Frauenfrage und nicht als Familienfrage<br />
gedacht und gilt somit als persönliche Aufgabe, die frau bewältigen kann oder an der<br />
sie scheitert (vgl. Bitzan 1991, 69). Die folgende Skizzierung weiblicher Lebenslagen<br />
kann daher nur in Bezug zu den von der Frauenforschung entwickelten Kategorien des<br />
30
40<br />
weiblichen LebenszusammenhangsF<br />
F, der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sowie<br />
einer Politisierung der „Frauenproblematik“ („das Private ist Politisch“) gesehen<br />
werden.<br />
Der „Lebenslagen-Ansatz“:<br />
Der Begriff Lebenslage ist im Jahre 1931 von Otto Neurath zur „Charakterisierung des<br />
Zusammenwirkens unterschiedlicher Faktoren in den konkreten Lebensverhältnissen“<br />
(Enders-Dragässler u.a. 2002, 19) geprägt worden. In Anlehnung an Ingeborg NahnsenF<br />
F haben Glatzer und Hübinger in den 1990er Jahren den Begriff „Lebenslage“ als<br />
41<br />
Rahmen bzw. Spielraum definiert, der von äußeren wie strukturellen - aber individuell<br />
nicht beeinflussbaren - Merkmalen der Existenz bestimmt ist. Mit dem Begriff Lebenslagen<br />
wird ein sozialwissenschaftliches Konzept beschrieben, in dem das Zusammenwirken<br />
von unterschiedlichen ökonomischen, sozialen und kulturellen Faktoren in den<br />
konkreten Lebensverhältnissen von Individuen sowie Gruppen theoretisch erfasst wird.<br />
Zu den Lebenslagen zählen folglich eine Vielzahl von Merkmalen die aus ähnlich strukturellen<br />
Bedingungen der jeweiligen Lebenssituation resultieren und die neben dem<br />
Zugang von und zu materiellen Gütern sowie immateriellen Werten ebenso die Interessen<br />
und Erwartungen der Individuen und Gruppen umfassen (vgl. Enders-Dragässler<br />
u.a. 2002, 19). Der Begriff Lebenslage nach Glatzer und Hübinger zeichnet sich durch<br />
folgende Aspekte aus:<br />
• Lebenslage ist multidimensional, d.h. sie ist von unterschiedlichen objektiven,<br />
subjektiven sowie von ökonomischen, nicht ökonomischen und immateriellen Dimensionen<br />
geprägt (z.B. Einkommen, Qualität des Wohnens, Gesundheit).<br />
• Lebenslage erfährt eine zentrale Bestimmung durch das Haushaltseinkommen,<br />
da durch dieses der Zugang zur Befriedigung zahlreicher weiterer Bedürfnisse<br />
gewährt oder verwehrt wird.<br />
• Lebenslage zeigt die Möglichkeiten und Grenzen von individuellen Handlungsspielräumen<br />
auf (vgl. Enders-Dragässler u.a. 2002, 19).<br />
Aus dem Blickwinkel der Frauenforschung erweist sich der „Lebenslagen-Ansatz“ für<br />
eine genaue Beschreibung der komplexen und widersprüchlichen Lebensrealität von<br />
Frauen als besonders geeignet. Durch ihn entstehen nicht nur Einblicke in die - durch<br />
soziokulturelle wie geschlechtsspezifische Benachteiligung geprägten - Lebenswelten<br />
von Frauen. Auch die vorherrschenden Armutsrisiken von allein Erziehenden und woh-<br />
40 Weiblicher Lebenszusammenhang meint hier nicht die konkrete Lebenssituation jeder einzelnen<br />
Frau, sondern ist vielmehr als Struktur sowie als symbolisches System zu verstehen, in<br />
dem sich jede Frau zu bewegen hat (sowie auch Männer) und in dem sie ihre eigenen Lösungswege<br />
finden muss (vgl. Bitzan 1991,68), sowie Bitzan 1993 und Prokop 1976).<br />
41 vlg. Nahnsen, Ingeborg 1975<br />
31
nungslosen Frauen, von Frauen mit Behinderung, von Frauen mit Migrationshintergrund<br />
oder von Frauen im ländlichen Raum finden durch dieses Konzept Beachtung<br />
(vgl. Enders-Dragässler u.a. 2002, 22). Das von Glatzer u.a. (in Anlehnung an Nahnsen)<br />
formulierte Konzept erweist sich jedoch als geschlechtsneutral und somit unvollständig.<br />
Durch die fehlende Geschlechterperspektive, fehlt der Blick auf das Geschlechterverhältnis<br />
sowie auf die ihm zugrunde liegenden Machtstrukturen und den<br />
daraus resultierenden gesellschaftlich strukturierten sowie faktischen Ungleichheiten<br />
von Frauen, insbesondere im Hinblick auf die unbezahlte Haus- und VersorgungsarbeitF<br />
F in der Familie (vgl. Enders-Dragässler u.a. 2002, 22). Diese Aspekte werden im<br />
42<br />
Folgenden kurz skizziert:<br />
Angekommen im 21. Jahrhundert des digitalen Kapitalismus erscheinen die alten und<br />
traditionellen Rollen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung wie Reliquien aus vergangenen<br />
Tagen. Die „Ernährerrolle“ des Mannes wird mehr und mehr brüchig und das<br />
43<br />
im letzten Jahr neu eingeführte EltergeldF<br />
F macht Hoffnung auf Veränderung. Diese<br />
neuen Leitbilder der partnerschaftlichen Ehe modifizieren scheinbar alte Strukturen der<br />
Arbeitsteilung sowie Entscheidungskompetenzen innerhalb der Familie. Empirische<br />
Untersuchungen machen jedoch deutlich, dass die neuen Partnerschaftsideologien<br />
zwar die Einstellungen in Richtung eines gemeinsamen Modells verändern, aber auf<br />
der Verhaltensebene kaum Einfluss auf bestehende Strukturen genommen haben. In<br />
einer vom Deutschen Jugendinstitut München durchgeführten Befragung gaben 80<br />
Prozent der Männer an, durch die Existenz eines Kindes in der Familie in keiner Weise<br />
beruflich oder in der Realisierung von Freizeitinteressen eingeschränkt zu sein (vgl.<br />
Meier 2003, 17 ff). Für beinahe den gleich hohen Prozentsatz von jungen Müttern bedeutet<br />
also die Geburt eines Kindes den – mutmaßlich - vorübergehenden Ausstieg<br />
aus dem Beruf. Diese Entscheidung wirkt sich für den weiteren berufsbiographischen<br />
Verlauf von Frauen, in Anbetracht der nach wie vor bestehenden Privilegierung von<br />
kontinuierlichen, männlichen Normalbiographien als Leitmuster im Zugang zu Einkommen,<br />
Berufskarrieren und Alterssicherung negativ aus. Daraus lässt sich die Schluss-<br />
42 Unbezahlte Arbeit – dazu zählen Arbeiten im Haushalt, Kinderbetreuung, Krankenpflege oder<br />
bürgerschaftliches Engagement – umfasst nach der neuen Zeitbudgeterhebung des Statistischen<br />
Bundesamtes im Jahr 2001/2002 mehr Stunden als bezahlte Arbeit. Laut der Studie leisten<br />
Frauen mit knapp 31 Stunden deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer (19 ½ Std.) (vgl.<br />
Statistisches Bundesamt 2004, 67 ff.).<br />
43 Inwiefern das Elterngeld zu einer Lösung des Prinzips der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern<br />
beitragen kann ist m.E. fraglich. Dies zeigt auch ein Blick auf Schweden. Dort wurden<br />
im Jahr 2006 die Vätermonate beim Elterngeld vorrangig während der Fußballweltmeisterschaft<br />
genommen! (vgl. Rede der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel am<br />
22.02.2007 (vgl. Hwww.angela-merkel.de/pdf/070222-rede-merkel-gleiche-rechte-fuer-frauen.pdfH,<br />
10.03.2007).<br />
32
folgerung ziehen, dass im Übergang zur Mutterschaft geschlechtsspezifische Rollenbilder<br />
verstärkt zum Tragen kommen und den Frauen somit unterschiedliche Formen<br />
des „Spagates“ zwischen familiärer Reproduktion und Erwerbsarbeit (bzw. Teilzeitarbeit)<br />
nach wie vor bleiben.<br />
In Bezug auf einkommens– und sozialversicherungsreduzierende Faktoren birgt die<br />
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ein besonderes Armutsrisiko für Frauen, da die<br />
grundlegenden sozialpolitischen Maßnahmen zur sozialen Sicherung (Krankenversicherung<br />
und Rentenversicherung) in der Regel an die Vollzeit-Erwerbsarbeit gebunden<br />
sind. In der Umsetzung des Sozialstaatsprinzips wird zwar auf die Notlagen von Frauen<br />
reagiert, jedoch gestaltet sich dieses System subsidiär, da die sozialen Netze erst<br />
bei eintretender Verarmung einsetzen. Einkommensverluste sowie soziale Abhängigkeitsverhältnisse,<br />
die durch unbezahlte Haus- und Familienarbeit entstehen, werden<br />
als individuelle Problemlagen gesehen und nicht als strukturell bedingte (vgl. Enders-<br />
Dragässler u.a. 2004, 23). Die Haus- und Familienarbeit sowie die damit verbundene<br />
ökonomische wie soziale Abhängigkeit von Frauen bleiben ebenso wie die grundlegende<br />
Bedeutung der häuslichen Umsorgung für das soziale Gefüge der Gesellschaft<br />
weitestgehend unbeachtet und werden außer in der sozialwissenschaftlichen Frauenforschung<br />
(bzw. Haushaltswissenschaften) kaum untersucht (vgl. Enders-Dragässler<br />
u.a. 2004, 23).<br />
Handlungs- und Entscheidungsspielräume von Frauen (und Männern) sind großteils<br />
(und in gegensätzlicher Weise) von sozialen Bindungen bestimmt, die weitestgehend<br />
über den Zugang zu Ressourcen, über die Befriedung materieller und sozialer Bedürfnisse<br />
sowie über Schutz vor Armut und Gewalt entscheiden. Soziale Bindungen können<br />
für Frauen in ihrer Wirkung, also in der Befriedung von Grundbedürfnissen, eine<br />
ebenso große Rolle spielen wie beispielsweise das Einkommen und können daher<br />
ebenso mit Abhängigkeiten verbunden sein. Die gesamte Komplexität der objektiven<br />
und subjektiven Bedeutung von sozialen Bindungen mit ihren jeweils geschlechtsrollenspezifischen<br />
Zuschreibungen und Bewertungen wie Mutterschaft, Ehe, soziale<br />
Netzwerke oder die Wahrnehmung von Behörden und Institutionen, sind im „Lebenslagen-Ansatz“<br />
systematisch zu berücksichtigen. Ansonsten bleiben (nach wie vor) die<br />
dadurch bedingten Begrenzungen weiblicher Entscheidungs- und Handlungsspielräume<br />
verborgen (vgl. Enders-Dragässler u.a. 2004, 24 f).<br />
Als weiterer Punkt, der im Konzept des „Lebenslagen-Ansatzes“ nicht bedacht wurde,<br />
kann die Bedeutung von Gewaltbedrohungen und/oder -erfahrungen im Leben von<br />
33
Frauen genannt werden. Anhand des fehlenden Blicks auf mögliche gewaltgeprägte<br />
Lebensverhältnisse von Frauen sowie den daraus entstehenden Folgen, bleiben Fragen<br />
der Gesundheit, der körperlichen und seelischen Integrität, der Sicherheit sowie<br />
der aktiven und sexuellen Selbstbestimmung von Frauen ausgeklammert (vgl. ebd.,<br />
25).<br />
Der „Lebenslagen-Ansatz“ wurde daher von Enders-Dragässler u.a. um folgende geschlechtsspezifische<br />
Dimensionen erweitert. Als weitere Handlungs- und Entscheidungsebenen<br />
bzw. „Handlungsspielräume“ werden definiert:<br />
• Geschlechtsrollenspielraum: Abbau und Überwindung von offenen und verdeckten<br />
Benachteiligungen von Frauen (bzw. offene und verdeckte Privilegierung von<br />
Männern); Eingrenzung von Handlungsspielräumen und materiellen Rechten auf<br />
Grund der Übernahme von Haus- und Familienarbeit, Benachteiligungen auf dem<br />
Arbeitsmarkt bzw. in der sozialer Absicherung.<br />
• Sozialbindungsspielraum, als Spielraum sozialer und häuslicher Bindungen mit<br />
dem Fokus auf Belastungen und Entlastungen, Versorgung und Verpflichtung<br />
durch Mutterschaft, Familienzugehörigkeit, Ehe und Partnerschaft; Gewaltbedrohung<br />
in sozialen Bindungen, Zugang zu und Teilhabe an sozialen Beziehungen.<br />
Schutz- und Selbstbestimmungsspielraum: Gesundheit, körperliche, seelische und<br />
mentale Integrität, Sicherheit vor Gewalt und Nötigung, Schutz vor wirtschaftlichen und<br />
sozialen Folgen von Gewalt, aktive und sexuelle Selbstbestimmung als Handlungsspielraum<br />
für ein selbst bestimmtes Leben bei körperlichen, seelischen oder geistigen<br />
Beeinträchtigungen, als Recht auf eigenständiges Wohnen.<br />
Schließlich ist der „Lebenslagen-Ansatz“ noch um die Dimension der durch Rechtswege<br />
strukturierten bzw. begrenzten Handlungsspielräume von Migrantinnen zu erweitern,<br />
die durch einen oftmals von der Ehe abhängigen Aufenthaltsstatus in ihrer<br />
Selbstbestimmung bzw. in ihrem Zugang zur Erwerbstätigkeit eingeschränkt sind (vgl.<br />
Enders-Dragässler u.a. 2002, 30).<br />
1.3.2 Wenn ein Gemeinwesen zum Brennpunkt wird…<br />
Die Unruhen in Frankreich im Herbst 2005 lenkten auch in Deutschland wieder den<br />
Fokus auf die „heimischen“ sozialen Brennpunkte. Wie auch in Paris werden in<br />
Deutschland Wohngebiete der sozial Schwächeren gerne an den Rand der Städte gedrängt<br />
und können aus traditioneller Sicht häufig als „Tatort“ von Gemeinwesenarbeit<br />
beschrieben werden.<br />
34
Allgemein wird ein Wohnquartier mit einem hohen Anteil von Menschen, die in belastenden<br />
Lebenslagen und unterdurchschnittlich schlechten Wohnverhältnissen leben,<br />
als sozialer Brennpunkt bezeichnet. Im Jahr 1979 bezeichnete der deutsche Städtetag<br />
diejenigen Wohngebiete als soziale Brennpunkte, in denen Faktoren, welche die Lebensbedingungen<br />
ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen von<br />
Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten“ (Deutscher Städtetag<br />
1979, 12). Als Indikatoren können neben beengten und schlechten Wohnverhältnissen,<br />
niedriges Einkommen, Kinderreichtum bei geringem Einkommen sowie ein niedriges<br />
Bildungsniveau, hoher Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und nicht zuletzt der negative<br />
Ruf der Siedlung genannt werden (vgl. Salz 1991, 9). Salz beschreibt soziale<br />
Brennpunkte nicht nur als ein „manifestes Zeichen von Armut und Ausgrenzung“ (Salz<br />
1991, 9), sondern auch als „ genau jenes Schreckgebilde, auf das man mit Fingern<br />
zeigen kann“ (Salz 1991, 85). Vascovics spricht auch von einer „residentialen Segregation“:<br />
„Den betroffenen Menschen werden intensive Abweichungen gegenüber Normen<br />
der äußeren Erscheinung (Kleidung, Sprache), des Kontakts und der Interaktion, sowie<br />
der Ordnung und Sauberkeit zugeschrieben (zum Beispiel ungepflegt, laut, ordinär,<br />
brutal, aggressiv, unordentlich, asozial, kriminell). Sehr schlechte Wohnverhältnisse<br />
(Häuser und deren Umgebung) werden für sie als typisch angesehen“ (Vascovics 1976<br />
zit. in Rausch 1998, 249). Da das Leben in sozialen Brennpunkten symbolisch für einen<br />
langen Deklassierungsprozess infolge von Armut stehen kann, erscheint mir an<br />
dieser Stelle ein Exkurs bezüglich der Thematik Armut angebracht.<br />
1BExkurs: Frauen und Armut<br />
Ist von Armut die Rede, so wird in der Regel zwischen absoluter und relativer Armut<br />
unterschieden. Absolute Armut stellt eine Bedrohung der physischen Existenz dar,<br />
während die in Wohlstandsgesellschaften, wie beispielsweise Deutschland, vorzufindende<br />
Armut in der Regel als relative Armut bezeichnet wird. Relative Armut ist mit<br />
dem Lebensstandard einer Gesellschaft verknüpft (vgl. Geißler 2002, 246). Die Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) spricht von Armut, wenn Menschen monatlich weniger<br />
als die Hälfte des Durchschnittseinkommens ihres Landes zur Verfügung haben. Dementsprechend<br />
würde die Armutsrisikogrenze in Deutschland bei ca. 600 Euro liegen.<br />
Armutsgrenzen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die so genannte „Einkommensarmut“<br />
den gesellschaftlichen Status und die daraus resultierenden Folgen nicht<br />
umfassend darstellen kann (ebd., 246). Auf Grund dieser Tatsache wird im 2. Armutsund<br />
Reichtumsbericht der Bundesregierung anhand des „Lebenslagen-Ansatzes“ eine<br />
globalere Beschreibung von Armut versucht. Dieser versteht Armut als Unterversor-<br />
35
gung in verschiedenen Bereichen wie z.B. materielle Armut, Bildungsbenachteiligung,<br />
kulturelle Armut, soziale Armut, Armut an Worten, emotionale Armut, ausländerspezifische<br />
Benachteiligungen sowie der Unterversorgung an technischer und sozialer Infrastruktur<br />
(vgl. BMAS 2005, 42). Abschließend kann hier formuliert werden, dass alle<br />
Beschreibungen von Armut eines gemeinsam haben, nämlich die ungleiche Verteilung<br />
von Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (vgl. BMAS 2005, 17 ff.).<br />
Als die Frauenforschung Mitte der 1970er Jahre die Bedeutung von Armut für Frauen<br />
erkannte, wurde diese mit den Begriffen „Feminisierung der Armut (vgl. Pfaff 1992)<br />
bzw. mit der These „Die Armut ist weiblich“ (vgl. Reinl 1997) unterstrichen. Heute<br />
spricht man eher von einer „Infantilisierung“ von Armut. Kinderreiche Familien oder<br />
allein Erziehende tragen ein höheres Armutsrisiko als Kinderlose oder Ehepaare, die<br />
ihre Kinder gemeinsam erziehen. Nach dem aktuellen 2. Armuts- und Reichtumsbericht<br />
der Bundesregierung liegt das Armutsrisiko bei Frauen mit 14,4 Prozent über dem<br />
von Männern (12,6 Prozent). Besonders betroffen von Armut sind Arbeitslose und allein<br />
Erziehende – faktisch sind dies mit 97 Prozent weitestgehend Frauen. Die Sozialhilfequote<br />
lag Ende 2003 bei 3,4 Prozent, wobei Frauen, vor allem allein Erziehende<br />
mit 3,7 Prozent häufiger Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten als Männer (vgl. BMAS<br />
2001, 17 u. 58 ff). Als geschlechtsspezifische Armutsrisiken von Frauen können die<br />
strukturelle Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, geschlechtsspezifische<br />
Arbeitsteilung sowie die sozialen Sicherungssysteme genannt werden. In neueren<br />
Studien findet darüber hinaus auch die Bedeutung des Gewaltpotentials, im häuslichen<br />
Bereich als spezifisches weibliches Armutsrisiko, Erwähnung.<br />
Die Theorien der ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Armutsforschung sind<br />
denen der Frauenforschung insofern ähnlich, als dass bei beiden die Einkommensarmut<br />
weitestgehend im Mittelpunkt steht und die Diskussion somit primär im Rahmen<br />
des monetären Ressourcenansatzes geführt wird. Der zentrale Unterschied zur Frauenforschung<br />
besteht jedoch darin, dass die Erklärungsansätze von Armut in der allgemeinen<br />
Armutsforschung „geschlechtsneutral“ formuliert sind. Somit bleibt die Verfolgung<br />
der Wirkungskette auf der Ebene des Arbeitsmarktes sowie dem System sozialer<br />
Sicherung stehen, weil nur bezahlte Arbeit wahrgenommen wird. Unbezahlte Familienund<br />
Hausarbeit bleibt nach wie vor analytisch unberücksichtigt (vgl. Sellach 2000, 4)<br />
36
1.3.3 Frauenwelten im „Brennpunkt“<br />
Die folgenden Beschreibungen basieren auf der These, dass es sich bei „Brennpunktfrauen“<br />
nicht etwa um extrem „hilfsbedürftige“ Frauen handelt, sondern dass sich die<br />
Lebenssituation von Frauen in sozialen Brennpunkten aus der Summierung unterschiedlicher<br />
„zugespitzter“ Lebenslagen ergibt. Bitzan macht diesen Zusammenhang in<br />
dem Bild deutlich, „dass die Lebenssituation von Brennpunktfrauen, wie in einem<br />
Brennglas, die gesellschaftliche Situation von Mädchen und Frauen generell deutlich<br />
macht“ (Bitzan 1993, 217). Die Beschreibung der Lebenssituation von Frauen in sozialen<br />
Brennpunkten muss daher immer auf den zwei wesentlichen Bestimmungsmomenten<br />
ihrer sozialen Lage basieren: Zum einen sind hier die Bedingungen und Anforderungen<br />
sowie die vorherrschenden Strukturen ihres konkreten Lebensumfeldes zu<br />
nennen (Deklassierung), zum anderen die ihres Geschlechtes, also ihre gelebte Realität<br />
als „Frauen“ (vgl. Bitzan 1991,67). Diese zwei Seiten einer Existenz bedeuten eine<br />
faktische Potenzierung von problematischen Bedingungen, da jede für sich eine<br />
grundsätzliche Benachteiligung darstellt. Weiterhin bestätigen die kategorialen Begriffe<br />
der Klasse sowie des Geschlechts die bereits formulierte These, dass Gemeinwesenarbeit<br />
immer eine Summierung von Interessenskonflikten darstellt und daher nie von<br />
„der“ Gemeinwesenarbeit gesprochen werden kann (vgl. Bitzan 1991, 67).<br />
Bevor ich im Folgenden auf die einzelne Aspekte frauenspezifischer Lebenswelten in<br />
sozialen Brennpunkten eingehe, möchte ich jeglichen Typisierungen und Pauschalisierungen<br />
vorbeugend betonen, dass die folgenden Punkte lediglich als „Rahmenbeschreibung“<br />
verstanden werden dürfen. Es liegt mir fern, die Sinnzusammenhänge der<br />
jeweiligen Frauenwelten sowie die individuelle Besonderheit und Eigentümlichkeit von<br />
Frauen zu mindern.<br />
Wohnen:<br />
Augrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der damit verbundenen Zuständigkeit<br />
für den Reproduktionsbereich stellt der Nahbereich des Gemeinwesens<br />
von Frauen ihr Lebens- bzw. Arbeitsfeld als fürsorgende Mutter, Hausfrau, Geliebte,<br />
Nachbarin und Hilfeleistende dar. „Die Wohnung ist für jede Frau – sei sie nun erwerbstätig<br />
oder nicht – der Arbeitsplatz, an dem sie ihre „eigentliche“ Aufgabe zu erfüllen<br />
hat“ (Bitzan 1991,68), Seite). Somit nimmt die Beschaffenheit der Wohnung sowie<br />
das Wohnungsumfeld eine wichtige Rolle für die Frauen ein, da die Wohnung faktisch<br />
das „Aushängeschild“ ihrer hausfraulichen sowie mütterlichen Kompetenz darstellt.<br />
Ein zentrales Merkmal sozialer Brennpunkte stellen die schlechten bis gesundheitsgefährdenden<br />
(z.B. Schimmel) Wohnverhältnisse dar. Die Wohnungen zeichnen sich<br />
durch extreme Enge, Hellhörigkeit und oftmals fehlende sanitäre Anlagen aus. Fehlen-<br />
37
de Infrastrukturen aller Art, also Bushaltestellen, Ärzte, Lebensmittelläden oder Spielplätze,<br />
sowie in der Regel geringe Mobilitätsmöglichkeiten (Frauen haben oft keinen<br />
Führerschein und wenn doch, dann fährt der Mann mit dem Auto zur Arbeit) erschweren<br />
und verkomplizieren die Arbeitsbedingungen der Frauen (vgl. Bitzan 1993, 219).<br />
Das „Scheitern“ in diesem Dschungel der Unzulänglichkeiten fällt selbstredend negativ<br />
auf sie zurück.<br />
Arbeit:<br />
Die ökonomische Situation der Frauen in sozialen Brennpunkten ist großteils sehr<br />
schlecht. Aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung verfügen nur wenige<br />
Frauen über eine Ausbildung und noch weniger über eine Erwerbsarbeit, die für sie<br />
und die Kinder eine Existenzsicherung bedeuten könnte. Die Situation verschärft sich,<br />
wenn der für die Versorgung zuständige Partner selbst erwerbslos ist, die Frau keinerlei<br />
Zugriff auf sein Einkommen hat oder sie ohne Partner lebt. Hier wird die Brüchigkeit<br />
des Konzeptes der Familiensubsidarität deutlich (vgl. Bitzan 1993, 220). Was bleibt, ist<br />
die Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung, die bereits aufgrund der gesetzlichen<br />
Bestimmungen den Zugang zu möglichen Erwerbsquellen und neuen Partnerschaften<br />
erschwert (verstärkte Anrechnung des Partnereinkommens durch Hartz IV). Durch den<br />
Bezug öffentlicher Gelder wird sie jedoch noch mehr auf die Rolle von Mutter und<br />
Hausfrau reduziert und steht damit unter immensem Druck, diese Aufgaben perfekt zu<br />
meistern, d.h. noch mehr Hausfrau, noch mehr Mutter zu sein. Als Folge davon kann<br />
die Unterdrückung eigener Bedürfnisse genannt werden, vor deren Hintergrund Selbstund<br />
Fremdbestätigungen (Identitätserfahrungen) nur über Beziehungs- und Erziehungsarbeit<br />
gesammelt werden können. Bei Scheitern der Beziehung oder Ehe sowie<br />
bei Auffälligkeiten der Kinder scheinen die Frauen in ihrer Rolle versagt zu haben. I-<br />
dentität und Selbstwert hängen so in widersprüchlicher Weise zusammen (vgl. Bitzan<br />
1993, 222).<br />
Soziale Beziehungen und Öffentlichkeit:<br />
Trotz der schlechten Infrastruktur- und Wohnqualität in sozialen Brennpunkten herrscht<br />
eine relativ hohe „Wohnzufriedenheit“ vor. Diese wird meist durch die engen sozialen<br />
Kontakte begründet, die für emotionale Sicherheit, Wohlbefinden und Unterstützung im<br />
Alltag stehen und stark mit dem spezifischen Leben in Brennpunkten zusammenhängen.<br />
Diese „private Öffentlichkeit" der Nähe, Überschaubarkeit sowie die zwangsläufigen<br />
Einblicke in die Nachbarschaft prägen das soziale Bezugsnetz der Frauen janusköpfig.<br />
Gemeint ist damit, dass sich die sozialen Bezüge der Frauen als sehr zwiespältig<br />
zwischen Unterstützung und sozialer Kontrolle gestalten. Dies kann als „Drahtseil-<br />
38
akt“ beschrieben werden, in dem sich kleine Hilfestellungen (z.B. Kinderbetreuung) im<br />
Alltag sowie gegenseitige Kontrolle als Mutter und Hausfrau ständig neu austarieren<br />
müssen. Die Frauen messen „die Andere“ an den eigenen widersprüchlichen und nicht<br />
erfüllbaren Anforderungen. Dadurch erkennen sie im Spiegel „der Anderen“ die eigene<br />
Situation und können daraus Stärke beziehen. Gleichzeitig zwingt sie dieses Spiegelbild<br />
aber auch dazu, sich selbst abzugrenzen, um sich nicht ebenso deklassifizierend<br />
definieren zu müssen. Individualisierende Sozialarbeit erkennt diesen Zusammenhang<br />
nicht, da sie ebenso wie die Frauen, frau unter dem Blickwinkel gelingender Erziehungs-<br />
und Haushaltsarbeit betrachtet und damit die Falle der Konkurrenz verstärkt<br />
(vgl. Bitzan 1991, 70).<br />
Soziale Beziehungen und Kommunikation finden in der alltäglichen Frauenwelt ihren<br />
Platz am Küchentisch, Kinderspielplatz oder im Hof des Hauses. Der Austausch über<br />
Lebenssituation, Ärger oder Notwendigkeiten von Veränderungen finden an diesen<br />
zentralen Plätzen mit anderen Müttern oder Nachbarinnen statt. Dadurch wird den<br />
Frauen oftmals Kommunikationsunwille und politisches Desinteresse zugeschrieben.<br />
Frauen haben jedoch aus ihrer konkreten Lebenssituation heraus viel zu lokaler Wohnungspolitik,<br />
städtischer Lebensqualität oder der momentanen Schulsituation zu sagen.<br />
„Es ist für sie genauso wichtig wie die Brotpreise, das beschädigte Treppenhaus,<br />
das blutende Knie des Kindes oder eine weitere Schwangerschaft in der Nachbarschaft.<br />
Würde sich Politik tatsächlich auf alltägliche Lebensqualität beziehen, hätte sie<br />
hier ihre ersten Expertinnen“ (Bitzan 1993, 224).<br />
Um jedoch nicht Gefahr zu laufen, diese „Nicht-Öffentlichkeit“ zu idealisieren, spricht<br />
Bitzan in diesem Zusammenhang von dem weiblichen Gemeinwesen als einer UnterkulturF<br />
F „die von der gesellschaftlichen Marginalisierung der Frauen und der strukturel-<br />
44<br />
len Inferiorität des Reproduktionsbereiches (also Frauenalltag und Frauenarbeit) gekennzeichnet<br />
ist“ (Bitzan 1993, 224 f). Die zwei verschiedenen Lebensbereiche der<br />
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit werden häufig mit dem Begriff der Dichotomie, also<br />
der „Zweiteilung“ von öffentlich und privat zu fassen versucht. Hauser widmet sich dieser<br />
sozialpolitischen Funktion von Privatheit genauer. Ihre These lautet dahingehend,<br />
dass „die Öffentlichkeit und Privatheit die Frauen in der untergeordneten Stellung hält,<br />
indem sie zu einer Ordnungsstruktur wurde, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung<br />
begründet, die Geschlechter an entgegengesetzten Orten positioniert und somit die<br />
Geschlechterdifferenz zu einer Art Kitt organisiert, der allgemein zerrissene Sozialstrukturen<br />
zusammenhält“ (Hauser 1987 zit. in Bitzan 1993, 225).<br />
44 Boucquey beschreit Unterkultur als: „Die Komplizenschaft des Abhängigen mit seiner Abhängigkeit,<br />
weil ihm Schlimmeres droht und weil diese Abhängigkeit selbst Trost für seine Erniedrigung<br />
schafft“ (Boucqey 1977 zit. in Bitzan 1993, 224).<br />
39
Dieser Ausschluss von Öffentlichkeit (also Möglichkeiten der Vergesellschaftung,<br />
Rechte etc.) macht die strukturelle Beschaffenheit der sozialen Erfahrung als Frau und<br />
als Arme sichtbar. Schlussfolgernd können „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ als Verhaltens-<br />
und Verarbeitungssettings gesehen werden, die einhergehen mit einer entsprechenden<br />
gesellschaftlichen Position, die bis in Deklassierungsprozesse hineinwirken<br />
und dort noch einmal die Hierarchisierung gesellschaftlicher Orte verdeutlichen<br />
(vgl. Bitzan 1993, 225). In diesem Kontext bedeutet „Weiblichkeit“ die Fähigkeit des<br />
45<br />
(Über-)LebensF<br />
F, also die Fähigkeit, durch ein bestimmtes Verhalten Abhängigkeit und<br />
Unterdrückung auszuhalten. Diese Verhaltensweisen bedeuten zwar eine Verlängerung<br />
der Abhängigkeit, doch im gleichen Maße machen sie diese auch lebbar (vgl.<br />
ebd., 225). Die Männer, die von Form und Funktion der eben beschriebenen Unterkultur<br />
nichts wissen (wollen), strafen diese mit Ignoranz oder Ironie, obwohl sie von ihr<br />
profitieren. „Deshalb weiß auch die herrschende Kultur nichts davon. Deshalb flüchtet<br />
sich die Unterkultur in Frauenzeitschriften, in die Waschsalons und die Kaufmannsläden.<br />
Die Friseursalons sind die Tempel dieses aus Ausdauer und Trost bestehenden<br />
weiblichen Wissens. Hier wird über Beschwerden aller Art geklagt, hier wird getröstet,<br />
so gut es geht. Illusionen werden geschaffen. Es wird versucht, sich hübsch zu machen,<br />
eine List unter anderen. Jeder Frauenklatsch feiert sie, diese Unter-Kultur. Auf<br />
der Schwelle der Türen, in der Behaglichkeit der Wohnzimmer.“ (Boucquey 1977 zit. in<br />
Bitzan 1993, 225). Dieser Aspekt könnte eine mögliche Antwort auf die Frage sein,<br />
warum Frauen das „(Über-)Leben“ in sozialen Brennpunkten eher oder „besser“ gelingt<br />
46<br />
als MännernF<br />
F, was aber dann auch hieße, dass die weiblichen Fähigkeiten notwendig<br />
sind, um mit der auf die Frauen ausgeübten Macht zurecht zu kommen. Abschließen<br />
möchte ich an dieser Stelle mit einem Zitat von Ferguson, die dazu schreibt: „Sie (die<br />
Weiblichkeit) schützt die Machtlosen vor den schlimmsten Aspekten der Unterordnung<br />
und verlängert gleichzeitig den untergeordneten Status“ (Ferguson 1985 zit. in Bitzan<br />
1993, 226).<br />
45 vgl. dazu Rich: „Im Kampf ums Überleben lügen wir. Wir belügen unsere Chefs, wir belügen<br />
Gefängniswärter, die Polizei, die Männer, die Macht über uns haben, die uns und unsere Kinder<br />
legalerweise besitzen, und unsere Liebhaber, die uns zum Beweis unserer Männlichkeit brauchen.<br />
Wie alle machtlosen Menschen laufen wir eine bestimmte Gefahr: dass wir vergessen,<br />
dass wir lügen, oder dass das Lügen zu einer Waffe wird, von der wir auch in Beziehungen<br />
Gebrauch machen, die keine Macht über uns haben“ (Rich 1990, 28f).<br />
46 Für Männer hat das Gemeinwesen meist einen anderen Stellenwert, da sie nicht in gleicher<br />
Weise wie Frauen davon abhängig sind. Daher halten sie sich weitestgehend fern von angebotenen<br />
Aktivitäten. Bei Männern wurde ein hohes Maß an Desorientierung und Persönlichkeitszerstörung<br />
(oft durch Alkoholabhängigkeit) festgestellt. Dies kann als Umorientierung auf den<br />
nicht erreichten Lebenszusammenhang gedeutet werden (vgl. Bitzan 1993, 218).<br />
40
1.4 Das aktivierende weibliche Gemeinwesen<br />
Der Begriff des „weiblichen Gemeinwesens“ wird in der Literatur maßgeblich von Bitzan<br />
verwendet und führt, laut ihr, in der Regel erst einmal zu Irritationen, Missverständnissen<br />
und falschen Assoziationen. Denn gemeint ist hier nicht „ein eigenständiges,<br />
territorial abgegrenztes, nur von Frauen belebtes Gemeinwesen – etwa die Stadt<br />
der Frauen oder das Land der Amazonen“(Bitzan 1994, 118). Der Begriff des weiblichen<br />
Gemeinwesens soll vielmehr die „spezifischen lebensweltlichen Zusammenhänge<br />
und Verstrickungen der weiblichen Armutsexistenz zusammenfassen, um einerseits<br />
die Kennzeichnung als weibliche ´Normalexistenz´ nicht aus den Augen zu verlieren,<br />
andererseits einen Interpretationsrahmen für GWA mit Frauen herzustellen“ (Bitzan<br />
1994, 217). Der kategoriale Begriff des weiblichen Gemeinwesens kann letztendlich<br />
nur die Frage nach den alltäglichen Lebenswelten von Frauen sein, nämlich die Frage,<br />
welche „Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Partizipation bzw. Verfügung an<br />
materiellen Gütern und gesellschaftlichem Einfluss ihnen strukturell eröffnet oder verschlossen“<br />
(Bitzan 1991,68) werden.<br />
„Gemeinwesenarbeit sieht ihren zentralen Aspekt in der Aktivierung der Menschen in<br />
ihrer Lebenswelt“ (vgl. Oelschlägel 2001b, 101). Darauf basierend könnte die These<br />
47<br />
formuliert werden, dass die „aktivierende Befragung“F<br />
F schon immer und immer noch<br />
das Handlungselement erster Wahl von Gemeinwesenarbeit darstellt. Damit ist gemeint,<br />
dass Gemeinwesenarbeit vorhandene Aktivitätsbereitschaft organisiert bzw. sie<br />
bereits immer schon nach vorhandener Aktivität suchte (vgl. Hinte 2004, 49). Hinte<br />
beschreibt aktivierende Gemeinwesen wie folgt: „Wir motivieren nicht, sondern suchen<br />
nach vorhandenen Motiven. GWA geht es also nicht darum, Leute zu etwas zu bringen,<br />
das sie nicht wollen, sondern der Zugang besteht darin, herauszufinden, was die<br />
Menschen wollen und dann mit ihnen gemeinsam darüber nachzudenken, wie sie<br />
selbst möglichst erfolgreich an der Durchsetzung ihrer Interessen arbeiten können.<br />
Denn nur, wer selbst mit seinen Möglichkeiten etwas tut, erhält darüber Würde – deshalb<br />
tut GWA nichts für die Leute und bedient sie nicht […] GWA achtet konsequent<br />
die Tatsache, dass Menschen immer schon aktiv sind, und es folglich darum geht, vorhandene<br />
Aktivitäten zu kombinieren mit dem vorhandenen Methodenrepertoire der<br />
Fachkräfte (Hinte 2004, 50).<br />
47 vgl. Hauser 1971 und Hinte u.a. 1989<br />
41
Das weibliche Gemeinwesen versus „Aktivierung“?<br />
Meist sind es die Frauen, die im Gemeinwesen aktiv sind und sich unermüdlich um die<br />
Sicherung des Überlebens kümmern: Sie sorgen für gefüllte Kühlschränke, beschaffen,<br />
wie auch immer, Geld, halten notwenige soziale Kontakte aufrecht, zaubern immer<br />
wieder neue Ressourcen hervor und halten die Wohnung in „Schuss“. Diese These gilt<br />
nicht nur für Brennpunktfrauen, sondern auch für Frauen allgemein (vgl. Bitzan 1994,<br />
124). Bezogen auf soziale Brennpunkte heißt das, dass Frauen seit jeher im Stadtteil<br />
aktiv sind, weswegen an dieser Stelle eine begriffliche Unterscheidung zwischen „aktiv“<br />
und „Aktivierung“ getroffen werden soll.<br />
Aktivierung in der weiblichen Gemeinwesenarbeit muss zum einen als Sichtbarmachung<br />
„gläserner“ Aktivitäten von Frauen verstanden werden. Gemeint ist hier das Management<br />
der alltäglichen Anforderungen unter den erschwerten Bedingungen in Armut.<br />
Diese Leistungen der Frauen erscheinen oft so selbstverständlich und perfekt,<br />
dass sie nicht nur ihrem Umfeld und den Professionellen, sondern auch den Frauen<br />
selbst zu entgehen scheinen. Weder die „Anderen“ noch frau selbst ist sich ihrer Leistung<br />
bewusst, so dass sie sich selbst als ungenügend, defizitär und ihre Belange als<br />
48<br />
unrelevant empfindetF<br />
F. Dadurch werten sich die Frauen gegenseitig ab und verdecken<br />
das „Geleistete“. Erstes Ziel aktivierender weiblicher Gemeinwesenarbeit muss daher<br />
sein, die Arbeit von Frauen und ihre Aktivitäten sichtbar, klar und schätzbar zu machen,<br />
in der Frauenöffentlichkeit genauso wie im übrigen Gemeinwesen (vgl. Bitzan<br />
1994, 125).<br />
Zum anderen leben Frauen zu oft mit der Erfahrung, für alles verantwortlich zu sein,<br />
z.B. dafür dass die Kleinfamilie zerfällt, sich Frauen von ihren Männern scheiden lassen,<br />
eine Karriere anstreben oder vielleicht überhaupt nicht heiraten möchten. Gemeint<br />
ist, dass überall dort, wo Alltag in seiner „ursprünglichen“ Form nicht mehr funktioniert,<br />
Frauen die Schuld daran zu tragen scheinen (vlg. Bitzan 1994, 126). Eine zweite Zielrichtung<br />
weiblicher Gemeinwesenarbeit muss daher heißen, diese Indienstnahme von<br />
globaler „Allzuständigkeit“ aufzudecken und Entlastung zu schaffen. Dies setzt natürlich<br />
auf beiden Seiten, also auf professioneller sowie auf Seite der „Brennpunktfrauen“,<br />
einen Reflektionsprozess darüber voraus, was frau als „normal“ empfindet.<br />
Ein weiterer Aspekt der Aktivierung muss sein, dass sich die Frauen selbst ernst nehmen,<br />
und dies zum Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten machen. Frauen sind es oft nicht<br />
gewohnt und werden auch selten dazu ermutigt, ihre eigenen Interessen durchzuset-<br />
48 Aufgabe von weiblicher Gemeinwesenarbeit ist hier auch, diese „Einigelungstaktik“ von Frauen<br />
zu kritisieren. Das Sichtbarmachen ihrer Arbeit und die Übung von „Kritik“ an ihren Bewältigungsstrategien,<br />
bedeutet Wertschätzung mit dem Ziel, sie als gleichwertige Akteurinnen des<br />
öffentlichen Lebens sichtbar zu machen (vgl. Bitzan 1994, 125).<br />
42
zen. Unter dem großen Motto „Sorge für alle“ ist für „Eigenzeit“ wenig Platz und wird<br />
oft als Inbegriff von Schuld und Egoismus erfahren. Mit Blick auf die Theorie der Vergesellschaftung<br />
darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass Frauen dies nicht<br />
ohne Eigennutz und Eigeninteresse tun. Doch in diesem Kontext kann immer von einem<br />
abgeleiteten Gewinn gesprochen werden. Denn nach wie vor ist es schwer, eigene<br />
Interessen zu formulieren und diese auch vor sich selbst bestehen zu lassen, vor<br />
allem, wenn sich diese gegen Menschen richten, für die frau sich verantwortlich fühlt.<br />
In der Regel wissen Frauen jedoch ganz gut, was ihnen gut tut, was sie sich wünschen<br />
und was sie zum „glücklicher“ sein brauchen. Hier muss aktivierende weibliche Gemeinwesenarbeit<br />
ansetzen und dieses Wissen als Basis zur Aktivierung nutzen. Dieses<br />
Verständnis von aktivierender weiblicher Gemeinwesenarbeit liegt den folgenden<br />
Ausführungen zu Grunde.<br />
2B2. Aktivierende Gemeinwesenarbeit in der Praxis:<br />
Nachdem sich das erste Kapitel intensiv mit der Geschichte von Gemeinwesenarbeit<br />
sowie ihrem Tun beschäftigte, stellt dieses nun den Sprung von der Theorie in die Praxis<br />
dar. Bevor ich entlang theoretischer Überlegungen und wissenschaftlicher Auswertungsmethodik<br />
den empirischen Teil dieser Arbeit vorstelle, dreht sich nun erst einmal<br />
alles um den Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>. Dieses Kapitel kann als virtuelle Stadtrundfahrt verstanden<br />
werden, in der ich zunächst einige Eckdaten über die Stadt Aalen sowie die<br />
historische Entstehung der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> skizzieren möchte. Der zweite Teil<br />
richtet sein Augenmerk gezielt auf die statistischen Werte: Hier geht es um Zahlen,<br />
Zahlen und nochmals Zahlen. Das Institut für Stadtplanung und Sozialforschung Weeber<br />
+ Partner führte im Jahr 2004 eine repräsentative Bewohnerinnenbefragung in der<br />
Siedlung <strong>Rötenberg</strong> durch. In dem Wissen, dass die von Weeber + Partner erhobenen<br />
Daten nicht mehr „up-to-date“ sind, entschied ich mich bewusst für deren Nutzung, da<br />
diese einen schlaglichtartigen Einblick in die konkreten Lebensbedingungen der Menschen<br />
vor Ort ermöglicht. Des Weiteren versicherten mir die Mitarbeiterinnen des Jugend-<br />
und Nachbarschaftszentrums, dass sich die Ergebnisse der Bewohnerinnenbefragung<br />
im Jahr 2004 nach wie vor mit ihren Erfahrungswerten decken. Vorstellen<br />
möchte ich verschiedene Aspekte der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> wie beispielsweise die Bevölkerungsstruktur,<br />
die vorherrschenden Wohn- wie Einkommensverhältnisse der Bewohnerinnen<br />
sowie den Ruf des Stadtteils und die Stadtgestalt. Auch die soziale Infra-<br />
43
struktur wie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder den Weg zum nächsten<br />
Lebensmittelladen möchte ich kurz beschreiben. Im letzten Teil dieses Kapitels<br />
werde ich die „Spielstube“ – so wird das Jugend- und Nachbarschaftszentrum im Alltagsjargon<br />
der <strong>Rötenberg</strong>erinnen genannt – vorstellen.<br />
2.1 Der Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>: „dr Schlauch…so hot des ghoisa“<br />
Aalen ist das größte wirtschaftliche Zentrum in der Region Ost-Württemberg, liegt eine<br />
Bahnstunde von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt und zählt 67.000 Einwohnerinnen,<br />
verteilt auf sieben umliegende Stadtbezirke. Die Erzgewinnung früherer Jahre<br />
wurde inzwischen von modernen Maschinenbaubetrieben und Technikunternehmen<br />
abgelöst, und auch der Dienstleistungssektor gewann in den letzten Jahren an Bedeutung.<br />
Die Siedlung <strong>Rötenberg</strong>, ein Teilort des Stadtbezirkes Wasseralfingen, liegt von<br />
Stuttgart kommend auf der rechten Seite der B 19 an einem nach Westen abfallenden<br />
49<br />
Hang des Kochertals und gilt als einer der „sozialen BrennpunkteF<br />
F“ der Stadt Aalen.<br />
Die historische Altstadt mit ihrer Fußgängerzone liegt nur circa tausend Meter entfernt,<br />
und der Bahnhof ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Bedingt durch die Bundes- und<br />
Umgehungsstraße ist die Siedlung jedoch geographisch vom Rest der Stadt abgetrennt<br />
und gerät u.a. daher leicht aus dem Blickfeld der Aalener Bevölkerung (vgl.<br />
Geßler 2006, 9).<br />
Der Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> wird im Norden entlang der <strong>Rötenberg</strong>straße von landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen und einem Waldstück begrenzt. Westlich bildet die parallel<br />
zu den Bahngleisen verlaufende Charlottenstraße die Begrenzung, im Süden der<br />
Fußweg zwischen Charlottenstraße und der Fahrbachstraße. Die östliche Grenze der<br />
Siedlung stellt das entlang der Hangkante angrenzende Wohngebiet „Heide“ dar (siehe<br />
Karte). Dieses wird vorwiegend von Bürgerinnen der Mittelschicht bewohnt und gilt als<br />
ein eher „angesehener“ Stadtteil. Obwohl eine geographische Trennung der Wohngebiete<br />
nicht ersichtlich ist, wird die Abgrenzung durch das optische Erscheinungsbild<br />
deutlich: Schön verputzte Ein- und Zweifamilienhäuser auf der einen Seite, eng aneinander<br />
gebaute Wohnblocks, deren Fassaden zum Teil dringend renovierungsbedürftig<br />
erscheinen und deren Fenster noch Originale aus Nachkriegszeiten darstellen, auf der<br />
anderen Seite. Herausgeputzte Vorgärten in der Heide stehen den wenigen und kleinen,<br />
dafür aber zum Teil liebevoll bepflanzten „Fleckchen“ im <strong>Rötenberg</strong> gegenüber<br />
(vgl. Geßler 2006, 9). Die Bewohnerinnen der „Heide“ grenzen sich sehr entschieden -<br />
49 Der Begriff „sozialer Brennpunkt“ wird hier in Anlehnung an die lokale Presse verwendet (vgl. Schwäbische<br />
Post, 12.02.2004)<br />
44
ebenso wie die übrige Bevölkerung Aalens auch - von denen des <strong>Rötenberg</strong>s ab,<br />
dementsprechend sich die Beziehung der Bewohnerinnen zueinander gestaltet. Die<br />
Leiterin des Stadtplanungsamtes beschreibt das Verhältnis der Bewohnerinnen als<br />
schwierig: „Die beiden Gebiete sind durch einen Stacheldraht getrennt. Einige Mädchen<br />
haben mir erzählt, dass sie Angst haben, aus Versehen diesen zu überschreiten,<br />
weil sie schon verscheucht wurden“ (Schwäbischer Post, 12.02.2004).<br />
Entstehung der Siedlung <strong>Rötenberg</strong><br />
Der östliche Bereich des Aalener Bahnhofs, unweit der Innenstadt gelegen, wurde erst<br />
Ende des 19. Jahrhunderts besiedelt. Dort ließ sich in direkter Nähe zu den Gleisanlagen<br />
ein Ausbesserungswerk der Bahn nieder, dessen Gebiet bis in die jüngste Vergangenheit<br />
von der Firma „Baustahl“ genutzt wurde. Das erste Wohngebiet stellte eine<br />
Eisenbahnersiedlung dar, die heute die Gebäude der Braunenstraße 9 und 10 darstellen<br />
(siehe Karte). An der Stelle, an der sich das heutige Jugend- und Nachbarschaftszentrum<br />
befindet, wurden nach dem Ersten Weltkrieg eingeschossige Holzbaracken<br />
von der Stadt Aalen errichtet. Diese dienten armen und kinderreichen Familien als<br />
Notunterkünfte und wurden bis zu Beginn der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts<br />
genutzt. Aufgrund der geraden Anordnung der Baracken prägte sich im Bewusstsein<br />
der Aalener Öffentlichkeit die Bezeichnung „im Schlauch“ ein. Dieser Name wird auch<br />
heute noch synonym für den <strong>Rötenberg</strong> verwendet (vgl. Weeber + Partner 2004, 9).<br />
Die eigentliche Siedlung entstand jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach<br />
Kriegsende gab es eine große Zahl an Kriegsflüchtlingen und Heimatvertriebenen, so<br />
dass die Einwohnerzahl der Stadt Aalen zwischen 1947 und 1958 von 22.000 auf<br />
30.000 anstieg. Auf Grund dieser Entwicklung verzeichnete die Stadt Aalen den höchsten<br />
Bevölkerungszuwachs im gesamten Südwesten. Als Reaktion auf die rapide Zunahme<br />
der dort ansässigen Bewohnerinnen und der dadurch entstandenen Wohnungsnot<br />
wurde zwischen den Jahren 1953 und 1963 mit dem Bau fester Häuser im<br />
zentralen Bereich des „Schlauchs“ begonnen. In dieser Zeit wurden abschnittsweise<br />
von Nord nach Süd 55 Mehrfamilienhäuser von der Stadt Aalen sowie der städtischen<br />
Wohnungsbaugesellschaft und anderen Baugenossenschaften errichtet (siehe Karte).<br />
Diese stellten insgesamt 500 „Einfachstwohnungen“ mit weitestgehend standardisierten<br />
Grundrissen dar, die in der Regel aus einer Wohnküche, ein bis drei weiteren<br />
Zimmern, einer Etagen-Toilette und einem Gemeinschaftsbad im Kellergeschoss bestanden<br />
(vgl. Geßler 2006, 9).<br />
45
Einrichtungen zur Nahverkehrsversorgung oder sozialer Infrastruktur waren damals<br />
nicht vorgesehen gewesen. Erst als in den siebziger Jahren die letzten Barackenunterkünfte<br />
abgerissen wurden, entstand Platz für die dringend notwendig gewordenen<br />
Spiel- und Sportflächen und das Jugend- und Nachbarschaftszentrum. Teilweise wurde<br />
bereits zu dieser Zeit versucht, das Milieu der Siedlung „aufzulockern“, indem einigen<br />
Familien Wohnungen in anderen Stadtteilen angeboten wurden. Die Stadt, die<br />
50<br />
ursprünglich EigentümerinF<br />
F von etwa der Hälfte der Wohnungen war, begann in den<br />
achtziger Jahren mit den ersten Sanierungsmaßnahmen. Diese beinhalteten den Einbau<br />
von BädernF<br />
F und WCs sowie Modernisierungsmaßnahmen bezüglich der Haus-<br />
51<br />
technik. Diese baulichen Maßnahmen unterblieben bei den Gebäuden der Wohnungsbau<br />
Aalen GmbH in der Regel bis heute (vgl. Geßler 2006, 9). Durch Mittel des Wohnumfeldprogrammes<br />
des Landes Baden-Württemberg konnten im Jahr 1983 die vorhandenen<br />
„Trampelwege“ durch Gehsteige und Treppen ersetzt werden, zusätzlich<br />
entstanden Grünflachen, Parkplätze und Garagen sowie eine ausreichende Straßenbeleuchtung.<br />
Im Jahr 2001 lud die Wohnungsbau GmbH Aalen erstmalig ihre Mieterinnen zu einem<br />
„Gespräch am runden Tisch“. Die Mieterinnenversammlung im Jugend- und Nachbarschaftszentrum<br />
wurde von den Bürgerinnen mit großem Interesse aufgenommen und<br />
erfreute sich einer hohen Besucherinnenzahl: Ca. hundert von ihnen waren gekommen.<br />
Die Brücke war geschlagen, beide Parteien nutzen erstmalig die Möglichkeit des<br />
gemeinsamen Gespräches. Seit diesem ersten gemeinsamen „Aufeinandertreffen“<br />
bürgerten sich die Versammlungen des städtischen Wohnungsbaus ein und finden bis<br />
heute regelmäßig statt.<br />
Ein Ziel, dass sich der Gemeinderat der Stadt Aalen gesetzt hatte, war die Erstellung<br />
eines ganzheitlichen Sozialkonzeptes für die Siedlung <strong>Rötenberg</strong>. Im Sommer 2004<br />
war es dann soweit und die Aufnahme in das EU-Förderprogramm „Die soziale<br />
52<br />
Stadt“F<br />
F war gelungen. Seit November desselben Jahres wurden von verschiedenen<br />
Trägern mehrere LOS-Projekte (Lokales Kapital für soziale Zwecke) initiiert, die ebenfalls<br />
von der EU gefördert werden. Die „Rundumpolitur“ des Stadtteils <strong>Rötenberg</strong> begann<br />
(vgl. Schwäbische Post, 17.11.2004).<br />
50 Mittlerweile hat die Stadt Aalen ihre Wohnungen auf dem <strong>Rötenberg</strong> an die städtische Wohnungsbau<br />
GmbH verkauft (vgl. Geßler 2006, 10).<br />
51 Drei Wohneinheiten wurden zu zwei Wohnungen zusammengelegt, die dann jeweils ein Bad erhielten<br />
(vgl. Geßler 2006. 10).<br />
52 Vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden Probleme der Stadtentwicklung – insbesondere<br />
in den so genannten „benachteiligten“ Stadtteilen – haben Bund und Länder 1999 das Programm „Stadtteile<br />
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ gestartet. Ziel ist es, in einem neuen integrativen<br />
Ansatz zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Stadtteilen beizutragen, in denen sich soziale<br />
und ökonomische Probleme häufen (vgl. Hwww.sozialestadt.deH, 22.01.2007)<br />
46
2.2 Schwarz auf Weiß: Der <strong>Rötenberg</strong> in Zahlen<br />
Aalen ist nicht Berlin und der <strong>Rötenberg</strong> nicht Neukölln, dennoch sind die Probleme oft<br />
ähnlich. Wenn die Mitarbeiterinnen von ihrem Arbeitsalltag erzählen, fallen Worte wie:<br />
„Wohnungssanierung, interkultureller Garten und Soziale Stadt“. Aber sie berichten<br />
auch von wachsenden Problemen, von Arbeitslosigkeit, von Kindern, die kein Deutsch<br />
mehr sprechen, von zunehmender Gewalt in Familien und dem bedenklichen Einfluss<br />
islamischer Gruppen.<br />
53<br />
2.2.1 Bevölkerungsstruktur: „...a bissle mulitikulturell isch scho gut…“F<br />
Am 30.06.2006 lebten in der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> 1.032 Menschen. Der nicht deutsche<br />
Anteil von Bewohnerinnen stieg in den vergangenen dreißig Jahren kontinuierlich an<br />
54<br />
und betrug am Stichtag 43,2 ProzentF<br />
F. Die Bewohnerinnen mit türkischer Nationalität<br />
stellen daran nicht nur mit 29,9 Prozent den größten Anteil dar, sondern machen auch<br />
55<br />
den größten Teil junger Familien aus. In der HaushaltsbefragungF<br />
F des Institutes für<br />
Stadtplanung und Sozialforschung (Weeber + Partner) wurden als Herkunftsländer<br />
neben der Türkei noch Sri Lanka, Kongo, Italien, Kroatien und Pakistan genannt. In der<br />
Altersgruppe von 21 bis 40 Jahre stellen Menschen ausländischer Herkunft die Mehrheit<br />
dar.<br />
Gesamtbevölkerung des <strong>Rötenberg</strong>s nach Nationalität<br />
(Stichtag: 30.06.2006 )<br />
Angaben in Prozent<br />
Quelle: Stadtplanungsamt Aalen<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0-20<br />
17,7<br />
12,7<br />
21-40<br />
13,9<br />
14,6 14,5<br />
41-60<br />
11,5<br />
über 60<br />
10,7<br />
4,4<br />
deutsch<br />
nicht deutsch<br />
53 Übersetzung: „Ein wenig multikulturell ist schon gut“ (Elsa, 511)<br />
54 Zum Vergleich: In der Gesamtstadt beträgt der Ausländeranteil zum 31.12.2004 9,6 Prozent (vgl.<br />
Hwww.aalen.deH, 21.01.2007).<br />
55 Für die repräsentative Bewohnerbefragung wurde aus allen Haushalten im <strong>Rötenberg</strong> mittels eines<br />
Zufallverfahrens eine Stichprobe gezogen. Da nur ein geringer Teil der Haushalte über ein Telefon (Festnetzanschluss)<br />
verfügt, wurde ein Teil der Interviews persönlich durchgeführt. An zwei Tagen waren mehrere<br />
Interviewerinnen verschiedener Sprachqualifikationen im <strong>Rötenberg</strong> unterwegs (vgl. Weeber +Partner<br />
2004, 37).<br />
47
Setzt man die aktuellen Zahlen vom Jahr 2006 in Vergleich zum Jahr 2000, so fällt ein<br />
Rückgang ausländischer Bewohnerinnen auf. Es kann davon ausgegangen werden,<br />
dass die statistischen Werte ausländischer Mitbürgerinnen aufgrund der veränderten<br />
Rechts-grundlage, also den Möglichkeiten der Einbürgerung, zurückgegangen sind. Da<br />
den mir vorliegenden Unterlagen diesbezüglich keine Angaben zu entnehmen sind und<br />
der rechtliche Begriff der Staatsbürgerschaft eher weniger aussagekräftig erscheint,<br />
um ein genaueres Bild von den im Stadtteil lebenden Menschen mit Migrationshintergrund<br />
zu bekommen, lohnt sich meines Erachtens hier ein Blick auf die Statistik im<br />
Jahr 2000. In diesem Jahr lag der statistische Ausländeranteil bei circa 58 Prozent.<br />
Gesamtbevölkerung des <strong>Rötenberg</strong>s nach Nationalität<br />
(Stichtag: 30.06.2000 )<br />
Angaben in Prozent<br />
Quelle: Weeber + Partner 2004<br />
25<br />
20<br />
20,5<br />
20,7<br />
15<br />
11<br />
12,2 11,7 12<br />
10<br />
5<br />
7,3<br />
4,6<br />
0<br />
0-20<br />
21-40<br />
41-60<br />
über 60<br />
deutsch<br />
nicht deutsch<br />
Der Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> hat zum Stichtag des 30.06.2006 eine vergleichsweise junge<br />
Bevölkerung. Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahren beträgt<br />
im <strong>Rötenberg</strong> 30,4 Prozent (Aalen gesamt: 21.9 ProzentF<br />
F). Die Altersgruppe der<br />
56<br />
Erwachsenen von 21- bis 40 Jahren (28,5 Prozent) sowie der Bewohnerinnen bis 60<br />
Jahren (26,1 Prozent) entspricht in etwa dem gesamtstädtischen Durchschnitt der<br />
Stadt Aalen (26,7 Prozent bzw. 26,4 Prozent). Die ältere Generation ab 61 Jahren<br />
macht dagegen nur knappe 15 Prozent aus (Aalen gesamt: 25 Prozent) (vgl. Weeber +<br />
Partner 2004, 26). Den Hauptanteil der jungen Bevölkerung machen zum Großteil die<br />
ausländischen Haushalte in der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> aus. Da die Zahlen aus dem Jahr<br />
2000, die Anteile der Menschen mit Migratrationshintergrund deutlicher erkennen lassen,<br />
lohnt sich es sich an dieser Stelle, nochmals einen Blick darauf zu werfen (siehe<br />
Grafik oben):<br />
56 Die statistischen Angaben der Stadt Aalen beziehen sich auf den Stichtag des 31.12.2004 (vgl. Statistisches<br />
Jahrbuch Aalen 2005, 27ff)<br />
48
• Mehr als ein Drittel der ausländischen Bevölkerung stellen Kinder und Jugendliche<br />
bis 20 Jahre mit einem Prozentsatz von 35,7 Prozent dar (deutsche Kinderund<br />
Jugendliche: 17,2 Prozent).<br />
• Etwa genauso viele (36 Prozent) sind junge Erwachsene bis 40 Jahren (deutsche:<br />
25,9 Prozent).<br />
• Dagegen gehören jeweils knappe 30 Prozent der deutschen Bevölkerung den<br />
beiden älteren Altersgruppen zwischen 41 und 60 Jahren bzw. älter als 60 Jahre<br />
an.<br />
Basierend auf den Ergebnissen der Haushaltsumfrage des Instituts Weeber + Partner<br />
lebt die überwiegende Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund schon lange<br />
in Deutschland. Fast zwei Drittel der ausländischen Männer leben zwischen 11 und 30<br />
Jahren hier, ein Fünftel bereits länger. Bei den Frauen ist die Aufenthaltsdauer weniger<br />
einheitlich, wobei auch bei ihnen mehr als die Hälfte zwischen 11 und 30 Jahren in<br />
Deutschland verbracht haben. Zehn Prozent von ihnen leben erst seit ein bis zwei Jahren<br />
hier, weitere 16 Prozent zwischen drei und zehn Jahren (vgl. Weeber + Partner<br />
2004, 39).<br />
2.2.2 Einkommen: „Wenn ich Handwerker bestelle, ist die erste Frage, ob ich bar<br />
57<br />
bezahlen kann“F<br />
Um die Höhe des Einkommens beurteilen zu können, spielt die Haushaltsgröße, also<br />
die Zahl der zu versorgenden Personen, eine entscheidende Rolle. Daher berechnete<br />
das Sozialforschungsinstitut Weeber + Partner für alle Haushaltsgrößen spezifische<br />
Einkommensklassen: Klasse eins (arm) erfasst das monatliche Nettoeinkommen, das<br />
58<br />
dem jeweiligen Haushalt an SozialhilfeF<br />
F und Miete zustehen würde. Die zweite und<br />
dritte Klasse (geringes und mittleres Einkommen) berücksichtigt Einkommensgrenzen<br />
59<br />
nach dem zweiten WohnbaugesetzF<br />
F (Einkommensgrenze nach § 25 entspricht gerin-<br />
57 Vgl. Stadt Aalen/aalener Frauenbeauftragte/JNZ 2005, 56)<br />
58 Die Sozialhilfe ist in Deutschland eine öffentlich-rechtliche Sozialleistung, die auf dem Art. 20 Abs. 1 des<br />
Grundgesetzes basiert. Aus dem verfassungsrechtlich garantierten Sozialstaatsprinzip ergibt sich die<br />
Verpflichtung des Staates, einen Mindeststandard des menschlichen Daseins sicherzustellen. Das Sozialhilferecht<br />
ist seit dem 1. Januar 2005 ein eigenständiges Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Seit<br />
dieser Zeit teilt sich die Sozialhilfe neben dem Arbeitslosengeld II (SGB II) die Funktion der Sicherung des<br />
soziokulturellen Existenzminimums für jeweils unterschiedliche Personenkreise. Von 1991 bis 2004 war<br />
die Sozialhilfe im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) geregelt (vgl. Fachlexikon der Sozialen Arbeit 2002,<br />
887).<br />
59 Die Einkommensgrenze nach § 25 ff des zweiten Wohnbaugesetzes (II. WoBauG) beträgt für einen<br />
Einpersonenhaushalt circa 11.760 €, Zweipersonenhaushalt circa 17.077€, zuzüglich für jede weitere zur<br />
Familie rechnende Angehörige 4.090 € (vgl. Bundesgesetzblatt 1994 Teil I: 2138 im Internet:<br />
Hwww.jura.uni-sb.de/BGBl/TEIL1/1994/19942138.1.HTMLH, 19.02.2007).<br />
49
gem Einkommen, plus 60% entspricht mittlerem Einkommen). In die vierte Klasse fallen<br />
alle „höheren“ Einkommen (vgl. Weeber + Partner 2004, 40)<br />
Unter den befragten Haushalten überwiegen die Einkommen auf bzw. unter Sozialhilfeniveau<br />
mit 42 Prozent. Laut Weeber + Parner zeigt sich dies daran, dass 35 Prozent<br />
der Haushalte Arbeitslosengeld/-hilfe erhalten und 7 % Sozialhilfe beziehen. Aufgrund<br />
der vorliegenden Zahlen kann davon ausgegangen werden, dass mehr als die Hälfte<br />
über ein geringes (24 Prozent) oder mittleres (29 Prozent) Einkommen verfügen.<br />
Haushalte mit höherem Einkommen sind nur mit 6 Prozent vertreten (Weeber + Partner<br />
2004, 40).<br />
Werden die Einkommensverhältnisse nach den Altersverhältnissen des HaushaltsvorstandesF<br />
F sowie der Nationalität unterschieden, so ergibt sich folgendes<br />
60<br />
Bild:<br />
• Jüngere Haushalte bis 40 Jahre, dicht gefolgt von den 40- bis 60-Jährigen, haben<br />
eher geringere Einkommen bzw. Einkommen auf Sozialhilfeniveau.<br />
• Haushalte mit Haushaltsvorständen ab 61 Jahren und älter sowie jüngere Haushalte<br />
im Alter zwischen 21 und 40 Jahren verfügen mehrheitlich über mittlere Einkommen.<br />
• Haushaltsvorstände im Alter von 41 bis 60 Jahren beziehen vorwiegend gehobene<br />
Einkommen (vgl. Weeber + Partner 2004, 40)<br />
Viele Haushalte der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> leben in sozial schwierigen Verhältnissen.<br />
Dies verdeutlicht die nachfolgende Beschäftigungssituation: Von den befragten Haushalten<br />
sind 27 Prozent der Männer arbeitslos, ein Viertel ist in Rente und nicht einmal<br />
die Hälfte (44 Prozent) ist Vollzeit beschäftigt. Die geringfügig und Teilzeit beschäftigten<br />
Männer machen hier einen verschwindend kleinen Anteil aus (vgl. Weeber + Partner<br />
2004, 41). Der Großteil der befragten Frauen im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> geht der unbezahlten<br />
Tätigkeit der „Hausfrau“ (43 Prozent) nach. Lediglich ein Viertel der Frauen<br />
ist in irgendeiner Form beschäftigt: 13 Prozent der Frauen arbeiten Vollzeit, 9 Prozent<br />
Teilzeit und 3 Prozent sind geringfügig beschäftigt. Etwa ein Fünftel von ihnen ist in<br />
Rente und 9 Prozent der Frauen sind arbeitslos.<br />
60 Bei Paaren wird auf die ältere Person Bezug genommen<br />
50
Beschäftigungsverhältnisse nach Geschlecht<br />
in der Siedlung <strong>Rötenberg</strong><br />
(Stichtag: 31.03.2004)<br />
Angaben in Prozent<br />
Quelle: Weeber + Partner 2004<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
44<br />
Frauen<br />
Männer<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
13<br />
12<br />
9<br />
9<br />
27<br />
23<br />
20<br />
43<br />
vollzeit beschäftigt<br />
geringfügig oder<br />
teilzeit beschäftigt<br />
arbeitslos<br />
in Re nte<br />
Hausfrau<br />
Der prozentuale Anteil der Männer und Frauen, die eine höhere Berufsausbildung haben<br />
(z.B. Meister-, Fachhochschule bzw. Hochschulabschluss) ist sehr gering, oftmals<br />
ist gar keine Berufsausbildung vorhanden, was 53 Prozent der Männer und 71 Prozent<br />
der Frauen betrifft. Bei den Männern haben 41 Prozent eine abgeschlossene Lehre,<br />
bei den Frauen liegt der Anteil bei lediglich 27 Prozent (vgl. Weeber + Partner 2004,<br />
41).<br />
61<br />
2.2.3 Wohnungen: „s´isch ja au koin Komfort me in dene Wohnunga“F<br />
Im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> leben ausschließlich Mieterinnen. Nach Angaben der Haushaltsbefragung<br />
des Institutes Weeber + Partner im Jahr 2004 stehen den befragten<br />
Haushalten im Durchschnitt circa drei Zimmer (3,3) ohne Küche bzw. Wohnküche und<br />
ohne Bad zur Verfügung. Die durchschnittliche Zimmerzahl pro Person liegt bei einem<br />
Zimmer, die durchschnittliche Wohnfläche bei 20 qm. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt<br />
ist das sehr wenig. Dieser lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im<br />
Jahr 2002 bei 36,5 qm (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, 284). Die Anzahl der Zimmer<br />
pro Haushalt, sowie die pro Person zur Verfügung stehende Wohnfläche entspre-<br />
61 Übersetzung: „Es ist ja auch kein Komfort mehr in den Wohnungen“ (Caroline, 239)<br />
51
chen dem Wohnangebot des <strong>Rötenberg</strong>s mit überwiegend kleineren Wohnungen (vgl.<br />
Weeber + Partner 2004, 42).<br />
Um die Wohnraumsituation auf dem <strong>Rötenberg</strong> besser einschätzen zu können, möchte<br />
ich mich an den Richtwerten des Wohnungsbindungsgesetzes (WohnbinGVWV,<br />
GAB1, 18.10.1995, 571) orientieren. Laut diesem Gesetz sind Wohnungen<br />
• „überbelegt“, wenn mehr als zwei Personen in einer Wohnung leben wie diese<br />
Zimmer hat oder zwei Personen in einer Ein-Zimmer-Wohnung wohnen,<br />
• „leicht überbelegt“, wenn eine Person mehr in einer Wohnung lebt, als Zimmer<br />
zur Verfügung stehen,<br />
• „unterbelegt“, wenn die Zahl der Zimmer die Zahl der Personen um eine übersteigt,<br />
• „ausreichende“, wenn die Personenzahl der Anzahl der Zimmer entspricht (vgl.<br />
Weeber + Partner 2004, 42).<br />
Da die Größe der Zimmer nicht berücksichtigt werden, können auch bei „ausreichender<br />
Versorgung“ beengte Wohnverhältnisse angetroffen werden, wenn z.B. die Zimmer<br />
sehr klein sind. Bei den von Weeber + Partner im Jahr 2004 befragten Haushalten waren<br />
17 Prozent der Wohnungen überbelegt und weitere 15 Prozent leicht überbelegt.<br />
Dabei handelte es sich vorwiegend um junge Haushalte bis 40 Jahre und Haushalte<br />
mit Kindern. Zusätzlich war auch ein großer Anteil der Wohnungen unterbelegt (19<br />
Prozent) bis leicht unterbelegt (25 Prozent). Dies trifft mehrheitlich bei älteren Haushalten<br />
bis 60 Jahren zu, bei denen die Kinder ausgezogen waren. Bei rund einem Viertel<br />
der befragten Haushalte lag eine ausreichende Versorgung vor (vgl. Weeber + Partner<br />
2004, 42).<br />
Bezüglich der Wohnzufriedenheit sind weniger als die Hälfte der befragten Bewohnerinnen<br />
mit dem baulichen Zustand der Wohnung zufrieden. Viele empfinden ihre Wohnung<br />
als „in Ordnung“, nachdem sie selbst viel renoviert haben: „Wir haben alles selber<br />
gemacht. Mussten die Wohnung sogar selber ausräumen (Möbel), Schimmel und<br />
Wasser entfernen. Hier wird nichts gemacht“ (Weeber und Partner 2004, 43). 53 Prozent<br />
der <strong>Rötenberg</strong>erinnen wünschen sich erhebliche Verbesserungen. Der häufigste<br />
genannte Grund für einen Umzug war der schlechte Zustand der Wohnung: „Ich muss<br />
im Keller duschen“, „Ich hab keine eigenes Bad, also ein Gemeinschaftsbad“, „Die<br />
Wohnung ist zu klein und sehr alt“, „Wir haben uns wegen Schimmel beschwert, aber<br />
es wird nichts gemacht…“(Weeber + Partner 2004, 43). Ebenso viele wollen umziehen,<br />
weil die Wohnungsgröße nicht mehr dem Bedarf entspricht und zu klein ist: „Die Woh-<br />
52
nung ist zu klein „…wir haben nur ein Bad und eine Toilette für sieben Personen“<br />
(Weeber + Partner 2004, 43). Anderen gefällt das Milieu nicht oder sie fühlen sich auf<br />
dem <strong>Rötenberg</strong> nicht wohl: „Weil das Treppenhaus schmutzig ist und draußen auf den<br />
Straßen sehr viel Müll rum liegt, sogar Möbelstücke“, „zu viele Ausländer“, „zu viele<br />
Alkoholiker, schlechte Umgebung“ (Weeber + Partner 2004, 43).<br />
Die Ruhe beim Wohnen wird insgesamt mit der Note 2,5 bewertet. Oft beschweren<br />
sich Bewohnerinnen über Lärmbelästigungen durch spielende Kinder und durch Menschen<br />
mit Alkoholproblemen, die vor allem auch nachts häufig laut sind. Da die Wohnungen<br />
sehr hellhörig sind, „hören wir alles von unseren Nachbarn“. (vgl. Weeber +<br />
Partner 2004, 45).<br />
2.2.4 Ruf und Stadtgestalt: „…d´r Ruf isch scho seit ewig und drei Tag versaut…“F<br />
62<br />
Die Mängel im Ortsbild der Siedlung sind u. a. ein Grund für das negative Image des<br />
<strong>Rötenberg</strong>s in der Aalener Öffentlichkeit. Die isolierte Lage jenseits der Gleisanlage ist<br />
weder dem Image des Stadtteils noch der Integration seiner Bewohnerinnern förderlich.<br />
Die Eingänge der Siedlung wirken vor allem durch herumliegenden Müll wenig einladend.<br />
Der <strong>Rötenberg</strong> gilt als „schlechte Adresse“ und das hat Folgen. Allein die Tatsache,<br />
auf dem <strong>Rötenberg</strong> zu wohnen, führe zu Benachteiligungen, so die Bewohnerinnen:<br />
„Wenn du ne Bewerbung wo Zaumweg druffstoht wegschicksch, die isch<br />
63<br />
scho…wird scho erledigt. Die fällt gleich hinda nunder“F<br />
F. Funktionale Verflechtungen<br />
zu angrenzenden Wohngebieten sowie zur Gesamtstadt gestalten sich schwierig. Die<br />
meisten Aalener Bürgerinnen kennen den <strong>Rötenberg</strong>, wie es heißt, nur vom „Hören<br />
sagen“ (vgl. Weeber + Parnter 2004, 49).<br />
Die Verkehrssituation wird in der Haushaltsumfrage im Jahr 2004 sehr schlecht bewertet.<br />
60 Prozent der Bewohnerinnen vergeben höchstens die Note „befriedigend“.<br />
Hauptkritikpunkt der Befragten ist, dass zu schnell und rücksichtslos gefahren wird.<br />
Aufgrund fehlender Geh- und Radwege stellt das für die auf der Straße spielenden<br />
Kinder eine große Gefahr dar (vgl. Weeber + Parnter 2004, 49).<br />
Öffentliche Verkehrsmittel nutzen nach Angaben von Weeber + Partner nur wenige<br />
Menschen im <strong>Rötenberg</strong>. Die meisten Bewohnerinnen ohne Auto gehen zu Fuß in die<br />
62 Übersetzung: „…der Ruf ist schon seit ewig und drei Tagen versaut…“ (Elsa, 449)<br />
63 „Wenn du eine Bewerbung wo Zaumweg drauf steht wegschickst, die ist schon…wird schon erledigt.<br />
Die fällt gleich hinten runter.“ (Elsa: 278)<br />
53
Stadt. Dies scheint mit der Grund dafür zu sein, dass lediglich zehn Prozent der Bewohnerinnen<br />
die öffentlichen Verkehrsmittel mit der Note „schlecht“ bewerten. Laut<br />
dem Institut Weeber + Partner ist der öffentliche Nahverkehr nicht ausreichend, vor<br />
allem für ältere Menschen, die darauf angewiesen sind. Die Bushaltestellen liegen außerhalb<br />
der Siedlung und sind für viele Bewohnerinnen zu weit entfernt (vgl. Weeber +<br />
Partner 2004, 49).<br />
Bezüglich der Ordnung und Sicherheit fühlen sich die meisten Bewohnerinnen auf dem<br />
<strong>Rötenberg</strong> wohl und sicher. 63 Prozent bewerten den Aspekt „Ordnung und Sicherheit“<br />
mit „gut bis sehr gut“. Dennoch werden von vielen fehlende Ordnung und eine ausreichende<br />
Beleuchtung der Fußwege vermisst. Laut der Haushaltsumfrage von Weeber +<br />
Partner lassen Eltern ihre Kinder ungern allein auf den Spielplatz, da sich dort immer<br />
wieder Menschen mit Alkoholproblemen aufhalten (vgl. Weeber + Partner 2004, 49).<br />
Die Einkaufsmöglichkeiten bewerten die Bewohnerinnen im <strong>Rötenberg</strong> als „schlecht“<br />
bis „sehr schlecht“. Lediglich ein Viertel von ihnen wertet mit „gut“ bis „sehr gut“. Bis<br />
vor kurzem gab es noch einen Drogeriemarkt, diesen gibt es seit Herbst letzten Jahres<br />
jedoch nicht mehr. Besonders für Menschen ohne Auto und ältere Bewohnerinnen des<br />
Stadtteils stellt dies eine beschwerliche Situation dar: „Für ein Brot muss man in die<br />
Stadt“ oder „Wenn man etwas vergessen hat, muss man noch mal in die Stadt“ (Weeber<br />
+ Partner 2004, 50). Die Befragten wünschen sich zumindest einen Bäcker mit den<br />
wichtigsten Grundnahrungsmitteln für die Siedlung (vgl. Weeber + Partner 2004,50).<br />
Notenvergabe einzelner Aspekte des Stadtteils <strong>Rötenberg</strong><br />
(Stichtag: 31.03.2004)<br />
Angaben in Noten<br />
Quelle: Weeber + Partner 2004<br />
5<br />
4<br />
2,4 2,5<br />
2,9<br />
3,4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
ÖPNV Ordnung, Sicherheit Verkehr Einkaufen<br />
54
64<br />
2.2.5 Leben im Stadtteil: „Also i hab uff´m Röteberg a schees Leba, des sag i“F<br />
Das Zusammenleben in der Nachbarschaft wird mit der Note von 2,4 bewertet. 60 Prozent<br />
der Bewohnerinnen bewerten es mit „sehr gut“ bis „gut“. Häufig haben die Bewohnerinnen<br />
jedoch wenig Kontakt zu einander, so das Forschungsinstitut Weeber +<br />
Partner. Die Leute sind nett und grüßen sich oder helfen einander auch einmal, aber<br />
nur sehr wenige sprechen von „Zusammenhalt“. Viele haben den Eindruck, dass<br />
„Deutsche und Ausländer voneinander getrennt werden“ und „wir dadurch nicht die<br />
Möglichkeit haben, uns zu integrieren“ (Weeber + Partner 2004, 46). „Mein Mann kann<br />
noch nicht gut deutsch…seine Kollegen sind fast alle Türken, unsere Nachbarn sind<br />
Türken und zu Hause sprechen wir auch türkisch. So hat er keine große Gelegenheit,<br />
sein Deutsch zu verbessern“ (Stadt Aalen 2005, 62f). Das Zusammenleben der einzelnen<br />
Bevölkerungsgruppen im Stadtteil wird von der Hälfte der Bewohnerinnen als<br />
„sehr gut“ bis „gut“ bewertet. Jedoch ist es eher ein Nebeneinander, als dass von einem<br />
Zusammenleben gesprochen werden kann, so Weeber + Partner. Die einzelnen<br />
Bevölkerungsgruppen haben kaum oder gar keinen Kontakt untereinander. Eine türkische<br />
Mutter beschreibt es so: „Alle Türken sind auf einem Haufen. Allgemein viele<br />
Ausländer. Das ist nichts für unsere Kinder, sie haben mit Deutsch Probleme“ (Weeber<br />
+ Partner 2004, 46). Probleme gibt es besonders in den Häusern, in denen Menschen<br />
mit Alkoholproblemen wohnen. Dies führt zu Konflikten, da die Bewohnerinnen sich<br />
bedroht und unsicher fühlen. Am meisten fühlen sie sich jedoch durch Lärm belästigt.<br />
Ein weiteres Problem, das zu Streit führt, ist der Müll um und in den Häusern und die<br />
Missachtung der Kehrwoche oder anderer Regeln im Haus.<br />
2.2.6 Identität: „Wenn Sie vom <strong>Rötenberg</strong> spricht, heißt es immer „mein <strong>Rötenberg</strong>“F<br />
65<br />
Zwei Drittel der Bewohnerinnen leben „gerne“ bis „sehr gerne“ auf dem <strong>Rötenberg</strong>, 17<br />
Prozent leben „teilweise gern“ und 15 Prozent „ungern“ bis „sehr ungern“ dort. Diese<br />
Ergebnisse des Institutes Weeber + Partner sind unabhängig von der Haushaltsform,<br />
erhoben, also ob die Befragten mit Kindern oder ohne leben. Der Anteil der allein Lebenden<br />
sowie der allein Erziehenden, die „gerne“ bis „sehr gerne“ auf dem <strong>Rötenberg</strong><br />
wohnen, ist überdurchschnittlich hoch. Unterschiede sind eher hinsichtlich des Alters<br />
der Bewohnerinnen festzumachen. In der Generation mittleren Alters (41-60 Jahre) ist<br />
64 Übersetzung: „Also ich habe auf dem <strong>Rötenberg</strong> ein schönes Leben, das sag ich“ (Silvana,<br />
209)<br />
65 Vgl. Stadt Aalen 2005, 49<br />
55
die Zufriedenheit am größten, circa 75 Prozent der Befragten leben „gerne“ bis „sehr<br />
gerne“ im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>.<br />
Bei einer Unterscheidung nach Nationalität leben die türkischen Bewohnerinnen am<br />
wenigsten gerne auf dem <strong>Rötenberg</strong>: 42 Prozent gaben an, „teilweise ungern“, „ungern“<br />
oder „sehr ungern“ dort zu sein.<br />
2.3 Das Jugend- und Nachbarschaftszentrum (JNZ)<br />
Träger des JNZ ist die Arbeitsgemeinschaft <strong>Rötenberg</strong> (<strong>AG</strong> <strong>Rötenberg</strong>), die dieses<br />
Jahr ihr 34-jähriges Bestehen feiern kann. Fachaufsicht führen die katholische und<br />
evangelische Kirche zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt. Die Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>Rötenberg</strong> geht auf eine Initiative einer engagierten Lehrerin zurück, der aufgefallen<br />
war, dass immer mehr Kinder aus dem <strong>Rötenberg</strong> die Förderschule besuchten.<br />
2.3.1 Entstehung des Jugend- und Nachbarschaftszentrum<br />
Die Anfänge der pädagogischen Arbeit im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong> initiierten die evangelische<br />
und katholische Kirchengemeinde und ihre Wohlfahrtsverbände – Diakonie und<br />
Caritas – sowie der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt. Gemeindepfarrer und Personen<br />
aus den Verbänden arbeiteten mit großem persönlichem Engagement an einer außerschulischen<br />
Förderung der <strong>Rötenberg</strong>er Kinder. In Zusammenarbeit mit Schülerinnen<br />
der örtlichen Gymnasien wurde eine Hausaufgabenbetreuung über den Bund Deutscher<br />
Katholischer Jugend (BDKJ) eingerichtet sowie eine Spielplatzbetreuung in den<br />
Ferien. Auch wenn die von Aalener Studentinnen organisierte Spielplatzbetreuung<br />
ohne Spielplatz auskommen musste, war doch ein Anfang gemacht (vgl. Geßler 2006,<br />
2).<br />
Der <strong>AG</strong> <strong>Rötenberg</strong> standen zunächst keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung,<br />
und die Betreuung der Kinder und Jugendlichen erfolgte ehrenamtlich. Die <strong>AG</strong> war mit<br />
ihren Angeboten in verschiedenen Räumlichkeiten zu Gast, unter anderem im katholischen<br />
Kindergarten St. Franziskus und im Saumweg 8 (siehe Karte), der „Spielstube“<br />
für Vorschulkinder. Aufgrund der beengten Räumlichkeiten sowie unterschiedlicher<br />
Zielgruppen, war diese Zeit stark durch Nutzungskonflikte geprägt. Bewohnerinnen<br />
fühlten sich durch den morgendlichen Kinderlärm und die später folgende Discomusik<br />
gestört. Aufgrund des großen Engagements aller Beteiligten und einer langsam<br />
schwindenden Skepsis seitens Verwaltung und Gemeinderat bezüglich dieser „Art“ von<br />
56
Jugendarbeit wurde die Stadt aktiv und baute in den Jahren 1975/76 das JNZ im westlichen<br />
Teil der Siedlung (vgl. Geßler 2006, 3).<br />
Daraufhin entstand die erste hauptamtliche Personalstelle mit vorerst 50 Prozent, die<br />
später jedoch zu einer vollen Stelle erweitert wurde und der relativ schnell eine weitere<br />
folgte. Die Stellen wurden bei den Kirchengemeinden eingerichtet und je hälftig von<br />
der Stadt Aalen und dem Ostalbkreis finanziert. Seit dem Jahr 1989 bildet die <strong>AG</strong> <strong>Rötenberg</strong><br />
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dies brachte nicht nur eine Anerkennung<br />
als gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe mit sich, sondern stellte eine erhebliche<br />
Arbeitsentlastung dar. Die bis dahin erhaltenen Zuschüsse des Landesjugendhilfeplans<br />
liefen bis dato über den Landesjugendring, was sich als sehr aufwendig gestaltete.<br />
Als anerkannter Träger konnte die <strong>AG</strong> <strong>Rötenberg</strong> nun eigene Mittel beantragen.<br />
2.3.2 Allgemeines Porträt des Jugend- und Nachbarschaftszentrum<br />
Das Jungend- und Nachbarschaftszentrum der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> wirkt mit seinem<br />
hellgrünen Anstrich und den blauen Fensterläden sehr einladend. Im Hof gibt es<br />
Tischkicker, Tischtennisplatten und einen großen Spielplatz. Auch innen ist die<br />
„Spielstube“ ansprechend gestaltet. Bunte Flyer weisen auf Kurse und Veranstaltungen<br />
hin, und die aktuellsten Zeitungsartikel über die Siedlung zieren die Bürotüren. Mit<br />
seinen fünf Gruppenräumen, einer gemütlichen Computernische, zwei Büros sowie<br />
einer Küche und einer Werkstatt stellt das Jungend- und Nachbarschaftszentrum eine<br />
Grundfläche von ca. 295 qm dar. Dennoch scheint kein Quadratmeter zu viel zu sein<br />
(vgl. Geßler 2006, 7). Zur Mittagszeit, wenn das Kinder- und Jugendangebot beginnt,<br />
ist es mit der morgendlichen Beschaulichkeit vorüber: Kinder flitzen durch den Flur,<br />
eine Tür knallt, man hört Kichern und vergnügtes Quietschen, wenn die Mädchen und<br />
Jungen einer Mitarbeiterin ihr wertvollstes Hab und Gut bieten, um so ihr Lieblingsspiel<br />
ausleihen zu können. Spiele und Bücher werden im JNZ nur über eine Pfandabgabe<br />
verliehen. Aber nicht nur Kinder und Jugendliche kommen in das Jungend- und Nachbarschaftszentrum,<br />
auch viele Erwachsene nehmen Beratungen in Anspruch und suchen<br />
den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen. Das langjährige Angebot und eine konstante<br />
Besetzung des Personals verschaffen dem JNZ eine hohe Akzeptanz unter allen<br />
Bevölkerungsgruppen.<br />
Als in den 80er Jahren der Anteil der türkischen Bevölkerung in der Siedlung <strong>Rötenberg</strong><br />
zunahm, begann das JNZ in einer von der Stadt Aalen zur Verfügung gestellten<br />
Wohnung mit Kursangeboten für türkische Frauen. Kurz danach konnte in diesen<br />
Räumlichkeiten ein türkisches Begegnungszentrum eingerichtet werden. Seit dieser<br />
57
Zeit organisiert ein türkischer Sozialarbeiter Kurse und bietet Unterstützung, Beratung<br />
sowie Begleitung an und hilft beim Übersetzen. Seit geraumer Zeit ist das Büro des<br />
Mitarbeiters in das Jugend- und Nachbarschaftszentrum integriert. Die Kurse für Frauen<br />
finden weiterhin in der Wohnung direkt gegenüber statt, da die Frauen dort ungestört<br />
und in einem geschützten Rahmen die Angebote wahrnehmen können. Neben<br />
Deutsch und Alphabetisierungs-Kursen finden im türkischen Begegnungszentrum auch<br />
die Treffen des internationalen Frauentreffs statt.<br />
Das JNZ ist von Montag bis Freitag geöffnet und stellt mit vier hauptamtlich Beschäftigten<br />
(mit insgesamt 350 Prozent), einem Zivildienstleistenden sowie einer Praktikantin<br />
das Kernteam dar. Unterstützt von Honorarkräften und vielen ehrenamtlichen Helferinnen<br />
aus der Siedlung bietet die „Spielstube“ ein buntes und vielfältiges Angebot an:<br />
Betreuung, Beratung und Weiterbildung sowie Spiel – und Treffmöglichkeiten sollen<br />
die Integration einzelner Bevölkerungsgruppen fördern und im Einzelfall Hilfestellung<br />
leisten. Aus früheren Besucherinnen sind selbst Eltern geworden, die Vertrauen in die<br />
Arbeit der Mitarbeiterinnen haben, wenn Hilfe notwendig ist. Die Leute kommen ins<br />
JNZ wenn es Probleme in der Nachbarschaft gibt, Handyverträge gekündigt werden<br />
müssen, Mängel im Wohnumfeld zu beseitigen sind und mit ganz normalen, alltäglichen<br />
Sorgen. So hat das Jungend- und Nachbarschaftszentrum eine wichtige Vermittlungsfunktion,<br />
da es allgemeine Lebensberatung anbietet und eine erste Anlaufstelle in<br />
Problemsituationen darstellt. Für viele ist es aber auch wichtig, dass einfach jemand da<br />
ist und sei es auch nur für ein kurzes „Schwätzchen“. Das JNZ stellt ein offenes Haus<br />
für alle Menschen in der Siedlung dar, die Rat suchen und Hilfe brauchen. Während<br />
meiner Besuche hat sich für mich immer mehr das Wort „ZUSTAENDIG“ als Schlüsselbegriff<br />
geformt. Es scheint mir am Ehesten den roten Faden des beruflichen „Tuns<br />
uns Lassens“ der Mitarbeiterinnen zu beschreiben. ZUSTAENDIG setzt sich für mich<br />
dabei aus den nachfolgenden zentralen Arbeitsprinzipien zusammen:<br />
Z ugänge aller Art<br />
U nterstützung<br />
S eele im Stadtteil<br />
T ranskulturelle Brücken schlagen<br />
A ktivieren statt klientifizieren<br />
E ntwickeln statt lösen<br />
N ach außen gehen<br />
D emonstrativ in der eigenen Position<br />
I dentitäten ermöglichen<br />
G astfreundlich<br />
58
2.3.3 Angebote für Frauen<br />
Im Rahmen der „Sozialen Stadt“ wurde die Siedlung <strong>Rötenberg</strong> in das europäische<br />
LOS-Programm aufgenommen. LOS steht für „Lokales Kapital für Soziale Zwecke“.<br />
Initiator ist die Bundesregierung, die gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfond<br />
(EFS) bundesweit ausgewählte Projekte finanziell unterstützt. Zielgruppen dieser Mikroprojekte<br />
sind Arbeits- und Wohnungslose, behinderte Menschen, Aussiedlerinnen<br />
und Migrantinnen, also Menschen die in irgendeiner Form Benachteiligung erleben. Zu<br />
den Projekten gehören beispielsweise der „alkoholfreie Treffpunkt“ der Caritas, der<br />
Bewohnertreff „Treff in-<strong>Rötenberg</strong>“ in Trägerschaft der Salvatorgemeinde, eine „Ein-<br />
Mann“- Initiative in Form eines Hausmeisterservices und ein Interkultureller Garten in<br />
Zusammenarbeit mit der VHS Aalen (vgl. Schwäbische Post, 14.12.2004). Vor dem<br />
Hintergrund meines Forschungsinteresses werde ich im Folgenden drei LOS-Projekte,<br />
die sich speziell an die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen richten, näher vorstellen:<br />
„<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“:<br />
Im Jahr 2005 ist das Buch „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ in gemeinsamer Zusammenarbeit<br />
mit der Frauenbeauftragten der Stadt Aalen und dem JNZ <strong>Rötenberg</strong>,<br />
im Rahmen von LOS entstanden. Elf Frauen erzählten in verschiedenen Lebensaltern<br />
(von 15-70 Jahren) aus verschiedenen Kulturkreisen mit individuellen Wünschen und<br />
Lebenswegen, aber mit einem gemeinsamen Ort, den sie Heimat nennen, ihre Lebensgeschichte:<br />
„Elf mal Schicksal, Tragik, Hoffnung, Lebensfreude und Lebensmut.<br />
Unverblümt, Ungeschönt und hart an der Realität“ schrieb die Schwäbische Post im<br />
Juni des Jahres 2005 (vgl. Schwäbische Post, 17.06.2005). In einem Interview erklärt<br />
Maria Steybe, die Frauenbeauftragte der Stadt Aalen, die sinngemäße Intention des<br />
Projektes: „Wer dieses Buch liest, sieht den <strong>Rötenberg</strong> mit anderen Augen und hat<br />
ansatzweise das Gefühl, was Frauen leisten, die in die Fremde gegangen oder hier<br />
geboren sind“ (ebd., 17). Ziel des Projektes war es, das Selbstbewusstsein der Frauen<br />
zu stärken und Vorurteile gegenüber dem <strong>Rötenberg</strong> abzubauen (vgl. ebd., 17).<br />
Deutschkurse gegen die Sprachlosigkeit:<br />
Deutschkurse sind auf dem <strong>Rötenberg</strong> keine Neuigkeit. 1073 <strong>Rötenberg</strong>erinnen haben<br />
in den zurückliegenden 20 Jahren die Sprachkurse des JNZs besucht (vgl. Wilpert,<br />
Schäbische Post, 16.04.2005). In der Vergangenheit wurden Kurse meist über das<br />
Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge finanziert, seit den LOS-Projekten bestehen<br />
wechselnde Trägerschaften. Der aktuelle Sprachkurs wird vom ortsansässigen islami-<br />
59
schen Kulturverein Aalen, der D.I.T.I.P-Moschee finanziertF<br />
66<br />
F. Der Kurs findet dreimal<br />
pro Woche statt, zweimal vormittags und einmal abends, und zählt ca. 14 Schülerinnen,<br />
die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Mustafa Uguz, ein Mitarbeiter des<br />
JNZ <strong>Rötenberg</strong>, erklärt die Kurse für lebensnotwenig, da sie Menschen – im Besonderen<br />
Frauen - aus ihrer Sprachisolation befreien können (vgl. ebd., 20).<br />
Internationaler Frauentreff:<br />
Der Internationale Frauentreff entstand im Rahmen der LOS-Projekte im September<br />
2005 und steht unter der Trägerschaft der <strong>AG</strong> <strong>Rötenberg</strong>. Seit dieser Zeit treffen sich<br />
Frauen unterschiedlicher Nationen, im Alter von 25 bis 50 Jahren aus der Siedlung<br />
<strong>Rötenberg</strong>, wöchentlich zum Frauentreff. Dieser stellt einen Ort des Austausches und<br />
der Unterstützung dar, bei dem Frauen der Siedlung Zugang zu lebenspraktischen<br />
Informationen bekommen, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Im<br />
Frauentreff werden relevante Themen wie Gesundheits-, Ernährungs- und Erziehungsfragen<br />
sowie verschiedene Schulsysteme und Berufsfelder oder das Lesen von Zeitungen,<br />
Freizeitgestaltung und Zeitmanagement behandelt. Darüber hinaus erhalten<br />
die Frauen Kontakte zu Anlaufstellen in Verwaltungen und Behörden und nehmen außerhalb<br />
ihres Wohnortes an kulturellen Veranstaltungen teil (vgl. Schwäbische Post,<br />
30.01.2007).<br />
3B3. Forschungsdesign<br />
Unter Forschungsdesign kann im weiteren Sinne die Gesamtheit aller Entscheidungen,<br />
welche das Vorgehen der Untersuchung betreffen, verstanden werden. Hierbei werden<br />
die Gründe für die Wahl der entsprechenden Methoden und ihre Operationalisierung in<br />
der Praxis dargestellt. Um die Auswahl der Untersuchungsmethode zu erläutern, wird<br />
sich das vorliegende Kapitel zu Beginn mit den methodischen Grundlagen dieser Arbeit<br />
beschäftigen. Die empirische Sozialforschung wird zunächst als Ausgangspunkt der<br />
Methodenwahl erklärt, anschließend wird die qualitative Ausrichtung der Untersuchung<br />
erläutert, um schließlich die Untersuchungsmethode zu begründen. Nachdem im zweiten<br />
Teil das weitere forschungstechnische Vorgehen näher erläutert wird, befasst sich<br />
der dritte Teil mit der praktischen Durchführung der Interviews sowie der entsprechenden<br />
Auswertungsmethodik.<br />
66 D.I.T.I.P Moschee des Türkisch islamischen Kulturvereins Aalen e.V. gründet sich im Jahr 1985. Der<br />
Dach-verband stellt die „Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion“ (Diyanet Isleri Türk-Islam<br />
Birligi/DITIP) dar, der nach eigenen Angaben etwa 600 Gemeinden in Deutschland betreut (vgl.<br />
Hhttp://www.diyanet.org/de/ startseite/index.phpH, 24.02.2007).<br />
60
3.1. Wieso, weshalb, warum – Was spricht für qualitative Sozialforschung?<br />
Das Wort Empirie stammt aus dem Griechischen (empeiria) und bedeutet übersetzt<br />
erfahrungsgemäß oder auf Erfahrung begründet (vgl. Kluge 1989, 177). Empirische<br />
Sozialforschung kann daher als eine Überprüfung theoretisch formulierter Annahmen<br />
an bezeichnenden Wirklichkeiten verstanden werden. Sie hat das Ziel, Ausschnitte der<br />
sozialen Realität möglichst unverfälscht zu erfassen, um daraus neue Erkenntnisse<br />
gewinnen zu können (vgl. Atteslander 1993, 11). Die empirische Sozialforschung lässt<br />
sich in die quantitative und qualitative Sozialforschung gliedern. Im Laufe ihrer Geschichte<br />
nahm sie sich die Exaktheit der Naturwissenschaften als Vorbild, infolge dessen<br />
sich der Fokus auf die Entwicklung quantitativer und standardisierter Methoden<br />
richtete. Als Leitgedanken der quantitativen Forschung können unter anderen die klare<br />
Isolierbarkeit von Ursache und Wirkung, die Messbarkeit und Quantifizierbarkeit von<br />
Phänomenen, die genaue Plan- und Formulierbarkeit von Untersuchungsanordnungen<br />
sowie die objektive Mess- und Beschreibbarkeit der Wirklichkeit genannt werden (vgl.<br />
Atteslander 1993, 13).<br />
Der qualitativen Sozialforschung liegt hingegen das interpretative Paradigma zu Grunde,<br />
indem sie die soziale Realität aus Sicht des individuell handelnden Menschen analysiert.<br />
Methoden der qualitativen Sozialforschung stellen beispielsweise die Analyse<br />
von Biographien, qualitative Interviews und Gruppendiskussionen dar (vgl. Atteslander<br />
1993, 13). Die in der quantitativen Sozialforschung weitestgehend ausgeklammerte<br />
Subjektivität der Forscherinnen und der untersuchten Subjekte werden nicht nur von<br />
Vertreterinnen der qualitativen Forschung, sondern auch von Seiten feministischer<br />
67<br />
Wissenschaftlerinnen stark in Frage gestellt. Maria MiesF<br />
F fordert insbesondere in der<br />
feministischen Forschung eine bewusste Parteilichkeit anstelle von Objektivität beziehungsweise<br />
Wertefreiheit: „Bewusste Parteilichkeit hingegen begreift nicht nur die<br />
´Forschungsobjekte´ als Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Zusammenhangs,<br />
sondern auch die Forschungssubjekte selbst. Sie ist alles andere als bloßer Subjektivismus<br />
oder bloße Einfühlung, sondern schafft auf der Basis einer Teilidentifizierung<br />
zwischen Forschern und Erforschten so etwas wie eine kritische und dialektische Distanz.<br />
Sie ermöglicht die Korrektur subjektiver Wahrnehmungsverzerrung auf beiden<br />
Seiten, auf der Seite der Forscher durch die Erforschten, auf der Seite der Erforschten<br />
67 Maria Mies ist emeritierte Professorin für Soziologie an der Fachhochschule Köln. Sie ist seit vielen<br />
Jahren aktiv in der Frauen-, Ökologie- und Dritte-Welt-Bewegung und hat zahlreiche Artikel und mehrere<br />
Bücher zu den genannten Themenkomplexen veröffentlicht (vgl. Mies 1995).<br />
61
durch die Forscher, und trägt sowohl zu einer umfassenden Erkenntnis der sozialen<br />
Realität bei als auch zur Bewusstseinsbildung der am Forschungsprozess Beteiligten“<br />
(Mies 1995, 58).<br />
3.1.1 Die qualitative Ausrichtung dieser Arbeit<br />
Meine Forschungsarbeit hat die Wirkungen des Handelns aktiver Gemeinwesenarbeit<br />
auf Frauen am Praxisbeispiel des JNZ zum Thema. Da das Ziel meiner Befragung<br />
nicht in der Repräsentativität von Ergebnissen liegt, sondern in der Erläuterung sozialer<br />
Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven, die zu einem Gesamtbild verdichtet<br />
werden sollen, lag die Entscheidung für die qualitative Sozialforschung im Falle meiner<br />
Einzelfallstudie nahe. Sie scheint mir geeignet, die Wirkungszusammenhänge zu erklären<br />
und das soziale Handeln aus Sicht der Betroffenen zu erfassen.<br />
Weiterhin scheinen mir die beiden wesentlichen Prinzipien bei der Datenerhebung und<br />
der späteren Auswertung, nämlich die Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation,<br />
für mein Forschungsvorhaben sehr dienlich zu sein: Das Prinzip der Offenheit lässt<br />
eine flexible Durchführung der Untersuchungen zu, welche in der quantitativen Forschung<br />
aufgrund der standardisierten Methoden nicht umsetzbar wäre. Das Prinzip der<br />
Kommunikation wiederum ermöglicht die „Kommunikationsbeziehung mit dem Forschungsobjekt“<br />
und stellt sicher, dass die „bedeutungsstrukturierten Daten“ den Regeln<br />
der Kommunikation und nicht denen der wissenschaftlichen Forschung unterliegen<br />
(vgl. Flick 2006, 28 ff).<br />
3.1.2 Die Qual der Wahl: angewandte Methodik<br />
Im Dschungel der möglichen Methoden qualitativer Sozialforschung habe ich mich für<br />
leitfadengestützte Gruppeninterviews entschieden. Ergänzt werden diese anhand von<br />
Erzählungen des bereits beschriebenen Buches „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten<br />
(siehe Kapitel 2.3.3), Sozialraumbeobachtungen und Datenrecherchen in der lokalen<br />
Presse sowie in Arbeitskonzepten des Jungend- und Nachbarschafszentrums <strong>Rötenberg</strong>.<br />
21BExkurs: Gruppeninterviews<br />
In der Literatur werden Gruppendiskussionen, Gruppeninterviews und Fokusgruppen<br />
nicht einheitlich definiert. So bezeichnet Lamnek (1995) Gruppendiskussionen beispielsweise<br />
als spezifische Form von Gruppeninterviews, während Flick (1995) Grup-<br />
62
pendiskussionen und Gruppeninterviews als zwei nebeneinander stehende Techniken<br />
von Gruppenverfahren unterscheidet. Friedrichs (1990) spricht hingegen nur von<br />
Gruppendiskussionen, erläutert aber auch mögliche Varianten ohne diese jedoch mit<br />
Namen zu nennen. Als gemeinsamen Nenner aller drei Varianten kann die moderierte<br />
Diskussion einer Gruppe zu einem vorgegebenen Thema genannt werden.<br />
In Anlehnung an Morgan (1997) entschied ich mich vor dem Hintergrund meines Forschungsinteresses<br />
für homogene Gruppen. Die Homogenität von Gruppen gestaltet<br />
sich in Gruppendiskussionsverfahren aus dem Grunde vorteilhaft, da die Teilnehmerinnen<br />
über einen ähnlichen Hintergrund verfügen (z.B. soziale Position, Beruf oder Geschlecht)<br />
und die Diskussion in der Gruppe somit oftmals leichter fällt, da keine kulturellen<br />
und statusmäßigen Barrieren überwunden werden müssen. Diese Vermutung<br />
basiert auf der These, dass wenn Menschen im alltäglichen Leben nicht viel miteinander<br />
sprechen, sich dieses Verhalten besonders in der „künstlichen“ Situation einer<br />
Gruppendiskussion widerspiegelt (vgl. Morgan 1997, 13ff.).<br />
Die Auswertung der gewonnenen Daten basiert auf der qualitativen Technik der Strukturierung<br />
nach Mayring (2000), wobei ich mich bei der Darstellung der Ergebnisse für<br />
die Methode der dichten Beschreibung nach Geertz (1983) entschieden habe.<br />
Ziel der inhaltlichen Strukturierung nach Mayring ist es, je nach Erkenntnisinteresse<br />
Themen und Inhalte aus dem gewonnen Material heraus zu filtern und zusammenzufassen.<br />
Nach erfolgter Transkription des Interviewmaterials werden gewisse Themen<br />
und Inhalte anhand einer theoriegeleiteten Kategorienbildung bestimmt. Das extrahierte<br />
Material wird nach erfolgreicher Bearbeitung mittels der vorangegangenen Kategorienbildung,<br />
in Paraphrasen zusammengefasst (vgl. Mayring 2000, 89). Ausgewertet<br />
wird das Material anhand der von mir bestimmten, wirkungsanalytischen Gesichtspunkte<br />
der Anerkennungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen sowie den erlebten Erfahrungen<br />
von Ambivalenzen.<br />
Für die Darstellung der Ergebnisse in Form der „dichten Beschreibung“ nach Geertz<br />
spricht im Wesentlichen mein multiperspektivisches Material und seine besondere Betonung<br />
kultureller Facetten bei sozialen Interaktionen, die ich mit Blick auf meine thematische<br />
Fragestellung für besonders bedeutend halte.<br />
31BExkurs: Dichte Beschreibung<br />
Der Begriff der „dichten Beschreibung“ wurde im Jahr 1973 von Clifford Geertz in die<br />
Ethnologie eingeführt (vgl. Cassierer 1996, 47 ff.). Im Gegensatz zur dünnen Beschreibung,<br />
die sich primär auf das Sammeln von Daten beschränkt, heißt dichte Beschreibung,<br />
die komplexen und oft übereinander gelagerten und ineinander verwobenen<br />
63
Vorstellungsstrukturen herauszuarbeiten und dadurch einen Zugang zur Gedankenwelt<br />
der zu untersuchenden Subjekte zu erschließen (vgl. Geertz 1983, 1).<br />
Nach Geertz kann nur anhand der Methode der „dichten Beschreibung“ eine wissenschaftliche<br />
Analyse von Kultur gewährleistet werden, da allein sie auf die Rekonstruktion<br />
von Bedeutungs- und Sinnsystemen abzielt. Dabei betont Geertz die Bedeutung im<br />
Gegensatz zur Struktur: „Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist,<br />
das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses<br />
Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die<br />
nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutung sucht“<br />
(Geertz 1983, 9). Mittels der dichten Beschreibung, können komplexe und in einem<br />
Zusammenhang stehende Vorstellungen und Gedanken untersucht werden wodurch<br />
ein Zugang zu Wahrnehmungen und Einstellungen von Menschen, die in einer empirischen<br />
Untersuchung befragt werden, ermöglicht wird. Geertz zeigt, dass Kultur als<br />
öffentlicher Diskurs verstanden werden kann, der im „Hof, auf dem Markt und auf dem<br />
städtischen Platz“ anzutreffen ist. Gemeint ist damit, dass kulturelle Erfahrungen in ein<br />
zusammenhängendes, öffentliches System von Symbolen gebettet sind, durch das die<br />
Welt erst verständlich werden kann.<br />
Im Folgenden möchte ich den Geertschen Kulturbegriff, anhand eines Beispiels verständlicher<br />
machen: Zwei Mädchen bewegen beispielsweise das Lid ihres rechten Auges<br />
blitzschnell. Bei der einen ist es ein ungewolltes Zucken, bei der anderen ein heimliches<br />
Zeichen an ihre Freundin. Trotz des identischen Ablaufs der jeweiligen Bewegung<br />
besteht ein gewichtiger Unterschied zwischen Zucken und Zwinkern. Während<br />
das zuckende Mädchen lediglich ihr Augenlid bewegt, möchte die „Zwinkerin“ etwas<br />
mitteilen und zwar auf ganz präzise und besondere Weise: Sie richtet sich absichtlich<br />
an eine ganz bestimmte Person, um eine Nachricht zu übermitteln und tut dies nach<br />
einem gesellschaftlich festgelegten Code, ohne dass die anderen Anwesenden eingeweiht<br />
sind. Angenommen, es gäbe noch ein drittes Mädchen, das zur Belustigung das<br />
Zucken des ersten Mädchens auf amateurhafte Weise parodiert, würde sie dies ebenfalls<br />
durch das Bewegen ihres rechten Augenlides tun. Auch hier kann von einem gesellschaftlich<br />
festgelegten Code gesprochen werden. Die vermittelte Nachricht stellt die<br />
„Lächerlichmachung“ des Mädchens dar, dessen Auge zuckte. Anhand dieses Beispiels<br />
möchte ich verdeutlichen, worum es bei der dichten Beschreibung geht. Nämlich<br />
darum, wie eine „Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen“ (Geertz 1983) - wie beispielsweise<br />
Zucken, Zwinkern und Paradieren - produziert, verstanden und interpretiert<br />
werden kann (vgl. Geertz 1983, 12). Laut Geertz versetzt eine gute Interpretation im<br />
Sinne der dichten Beschreibung den Leser mitten hinein in das Geschehene. „Wenn<br />
sie das nicht tut, sondern statt dessen etwas anderes in uns bewirkt – Bewunderung<br />
64
für ihre Eleganz, die Klugheit des Interpretierenden oder für die Schönheit der Euklidischen<br />
Ordnung -, dann mag sie zwar durchaus ihren eigenen Reiz haben, liefert aber<br />
etwas ganz anderes, als was sie liefern sollte: nämlich herauszufinden, worum es bei<br />
dem ganzen Hin und Her“ des Zwinkerns geht (Geertz 1983, 10).<br />
3.1.3 Mut zur „Farbe“<br />
Die der gemeinwesenorientierten Sozialen Arbeit zu Grunde liegende Lebensweltorientierung,<br />
wird umgangssprachlich häufig mit dem normativen Slogan „vom Fall zum<br />
Feld“ verkürzt. Meine eigene Betrachtungsweise des Feldes, welches hier der <strong>Rötenberg</strong><br />
darstellt, möchte ich an Kurt Lewins Feldtheorie veranschaulichen. Unter dem<br />
Eindruck des Daseins als Soldat im ersten Weltkrieg schrieb Lewin einen kurzen Aufsatz<br />
(vgl. Lewin 1982, 315 ff.), in dem prägnant zum Ausdruck kommt, dass ein Feld<br />
sich im Auge der Betrachterin je nach Situation wandeln oder neu konstituieren und<br />
somit nie eine eindeutige Angelegenheit darstellen kann: Eine Spaziergängerin wird ein<br />
und dieselbe Landschaft nach anderen Kriterien beurteilen als beispielsweise ein Soldat.<br />
Dort, wo sie die Topographie vielleicht unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet,<br />
wird er nach Möglichkeiten des Schutzes und der Deckung suchen. „Feld“ ist<br />
also nicht gleich „Feld“, da die Betrachtungsweise immer von der jeweiligen Perspektive<br />
abhängt, die wiederum geprägt ist von den persönlichen Erfahrungen, von der aktuellen<br />
Lebenssituation, den historischen gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht zuletzt<br />
von individuellen Wünschen, Bedürfnissen und „Empfindsamkeiten“. Da das Feld<br />
seinen Sinn also erst in der Wahrnehmung der jeweiligen Akteurinnen entfalten kann,<br />
bedeutet dies, dass „gerade der persönliche Zugang zum Feld, die Haltung zu den<br />
untersuchten Menschen in ihren spezifischen Milieus, ein originelles und suchendes<br />
Vorgehen bei der Methodenentwicklung, Mut zur Theorienbildung – oft quer zu eingefahrenen<br />
Gleisen – bei qualitativer Forschung eine große Rolle spielen. Trotz vielfältiger<br />
Versuche zur Standardisierung und Kodifizierung qualitativer Forschung und zur<br />
Entwicklung von Lehrtraditionen bleibt immer noch ein unaufhebbarer ´Rest´, der durch<br />
die Person des Forschers, seine Originalität, Hartnäckigkeit, sein Temperament, seine<br />
Vorliebe – eben seinen unverwechselbaren Stil – bestimmt wird. In der Person der<br />
prägenden Forscher, in ihrem Erfindungsreichtum, ihrer Beobachtungsgabe, ihrer Sensibilität<br />
für Äußerungen, ihrem Sinn für Situationen und ihrer ´Kunst der Interpretation´<br />
liegt begründet, was ihr Werk zu Klassikern des Feldes und zu ´Riesen´ macht, auf<br />
deren Schultern wir stehen“ (Flick 2006, 32).<br />
Nun liegt es mir fern, für mein „Werk“ ein „Riesentum“ zu beanspruchen – die zur Verfügung<br />
stehende Zeit für eine Diplomarbeit und meine überschaubaren Erfahrungen in<br />
65
Theorie und Praxis empirischer Sozialforschung führen dies bereits „ad absurdum“ -,<br />
vielmehr möchte ich hiermit verdeutlichen, dass ich mir meiner „Farben“ bewusst bin,<br />
die ich in das Feld mitgebracht habe, dass mich manche Situationen und Erzählungen<br />
sehr bewegt und mich einzelne Themen nochmals besonders sensibilisiert haben und<br />
ich dennoch guter Dinge bin, mit dieser Arbeit den Sichtweisen, Deutungen und dem<br />
„Eigensinn“ der Frauen auf dem <strong>Rötenberg</strong> gerecht zu werden.<br />
3.2 Mein „Material“<br />
Im Folgenden beschreibe ich mein „Material“, das - wie bereits einleitend erwähnt -<br />
multiperspektivische Sichtweisen erlaubt. Dies sind zum einen die Sichtweisen der<br />
Frauen, die ich in Gruppeninterviews kennenlernen durfte und die Sichtweisen der<br />
Frauen, die über das Buchprojekt öffentlich wurden. Dies sind weiterhin eigene Eindrücke<br />
und Erkenntnisse, die ich über Sozialraumbeobachtung gewann „öffentliche“<br />
Sichtweisen, die mir in Form der Berichterstattung in der lokalen Presse zugänglich<br />
waren und die Sichtweisen der Mitarbeiterinnen des JNZ, die ich in Gesprächen und<br />
Aktenrecherchen erfuhr.<br />
3.2.1 Gruppeninterviews<br />
Auf der Grundlage eines von mir entwickelten, teilstrukturierten Interviewleitfadens<br />
führte ich insgesamt zwei Gruppendiskussionen mit verschiedenen Frauengruppen<br />
durch, die in den jeweiligen Projekträumlichkeiten auf dem <strong>Rötenberg</strong> stattfanden. Die<br />
vertraute Atmosphäre erleichterte den Frauen, meines Erachtens den Gesprächseinstieg.<br />
Positiv ist hierbei noch zu erwähnen, dass die Räume während der Diskussion<br />
für niemand anderen zur Verfügung standen, so dass die Frauen in einem geschützten<br />
Rahmen, offen und frei sprechen konnten.<br />
Die Kontaktaufnahme zu den interviewenden Gruppen stellte sich als sehr unkompliziert<br />
dar, was zu großen Teilen dem Engagement von Brigitte Geßler, der Geschäftsführerin<br />
des Jugend- und Nachbarschaftszentrums <strong>Rötenberg</strong> zu verdanken ist. Sie<br />
unterstützte mich bei der Wahl der zu interviewenden Frauengruppen, knüpfte erste<br />
Kontakt und stellte mich den Frauen vor. Dies bedeutete von Seiten der Frauen einen<br />
erheblichen Vertrauensvorschuss für mich, der den gesamten Ablauf meines Forschungsprojektes<br />
positiv prägte. Durch die von Brigitte Geßler geknüpften Kontakte<br />
war es mir auch möglich, die Frauen bereits im Vorfeld kennen zu lernen, was mir sehr<br />
wichtig war. Sie sollten sich ein Bild von meiner Person sowie meines Forschungsvor-<br />
66
habens machen können, um auf dieser Basis ihre individuelle Entscheidung für oder<br />
gegen ein Interview treffen zu können. Ich stellte mich insgesamt zwei Frauengruppen<br />
vor, die mir sehr offen und neugierig begegneten, so dass die Interviewtermine sehr<br />
spontan und zeitnah vereinbart werden konnten.<br />
Mein Leitfaden orientierte sich an folgenden Themenkomplexen:<br />
• sinnhaftes Leben<br />
• subjektives Wohlbefinden<br />
• Einflussnahme auf die Umwelt<br />
• positive soziale Beziehungen<br />
• Selbstakzeptanz<br />
• persönliches Wachstum<br />
• Autonomie<br />
Diese Themenfelder orientieren sich an der „Wohlbefindens- bzw. well-being“ Forschung,<br />
die auf dem Modell des „psychological well-being“ von Ryff und Singer (vgl.<br />
Ryff u.a. 2000, 1000) basiert. Dieses Modell gründet auf einer von Ryffs (1980) entwickelten<br />
Theorie, die sich durch die Integration verschiedener psychologischer Perspektiven<br />
auszeichnet. Ryffs greift dabei auf unterschiedliche Entwicklungstheorien (vgl.<br />
Erikson 1959, Neugarten 1969), klinische Theorien der persönlichen Entfaltung und<br />
Reifung (vgl. Jung 1933, Rogers 1961, Maslow 1969) sowie Theorien der seelischen<br />
Gesundheit (vgl. Jahoda 1958) zurück. Beim „psychological well-being“ Modell handelt<br />
es sich um einen, die gesamte Lebensspanne des Individuums umfassenden Wohlbefindlichkeitsbegriff,<br />
der durch eine multidimensionale Herangehensweise erfasst wird.<br />
Diese Herangehensweise basiert auf den obigen sechs Dimensionen, die auch als<br />
Wegbereiter auf der Suche nach dem Glück bezeichnet werden (vgl. ebd., 100).<br />
Die Theoriefolie „der Suche nach dem Glück“ schien mir auf der Suche nach den Wirkungen<br />
aktivierender Gemeinwesenarbeit auf die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen, eine passende<br />
Wünschelrute“ zu sein, da das jeweilige individuelle Streben nach Glück stets eng mit<br />
der Familie, der Nachbarschaft sowie dem Gemeinwesen verwoben ist. Gemeinwesenorientierte<br />
Soziale Arbeit kann vor diesem Hintergrund mit ihren aktivierenden Handlungselementen<br />
(vgl. Kapitel 1.2.1) im mäeutischen Sinne als „Geburtshelferin“ verstanden<br />
werden, mit dem Ziel eines gelingenderen und sinnhafteren Lebens, das geprägt<br />
ist von subjektivem Wohlbefinden, einer beeinflussbaren Umwelt, positiven sozialen<br />
Beziehungen, Selbstakzeptanz sowie individuellem Wachstum und Autonomie.<br />
Die Wirkungen aktivierender GWA auf die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen kann meines Erachtens<br />
nur im Gesamtzusammenhang erfasst werden, was ein holistisches Handeln meinerseits<br />
erfordert. Gemeint ist hiermit, dass forschungstechnische Arbeit im Sinne einer<br />
Wirkungsanalyse lediglich vor dem Hintergrund der Ganzheitlichkeit möglich ist, da nur<br />
67
der holistische Blick es vermag, die subjektiven Realitäten der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen<br />
anhand von erlebten Wirkungsprozessen wiederzuspiegeln. Methodisch scheint dies<br />
am ehesten in einem Gespräch beziehungsweise in einer Diskussion realisierbar, indem<br />
sich die erfahrenen Wirkungserlebnisse der Frauen in einem geschützten Rahmen<br />
entfalten und zugleich aktivierende und hemmende Aspekte aufgedeckt werden<br />
können.<br />
Im Vorfeld der Interviews führte ich einen Pretest mit weiblichen Kommilitoninnen meines<br />
Semesters durch, die in groben Zügen über die Grundthematik meines Forschungsvorhabens<br />
informiert waren. Mit deren Hilfe konnte ich nicht nur einige inhaltlichen<br />
Details meines Interviewleitfadens verbessern, sondern mir wurde die Möglichkeit<br />
eröffnet, den geplanten Ablauf in einer realen Interviewsituation zu testen. Da ich zum<br />
ersten Mal mit der Methode der Gruppendiskussion arbeitete, stellte das Austesten der<br />
Moderationsrolle eine wichtige Erfahrung für mich dar.<br />
3.2.2 Buch: <strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten – Meisterinnen des Lebens<br />
Das Buch „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ spiegelt in anschaulicher Weise das Lebensgefühl<br />
der Siedlung wieder und zeigt, wie sehr die „<strong>Rötenberg</strong>erinnen“ – entgegen<br />
allen Vorurteilen – an ihrem Stadtteil hängen und dort verwurzelt sind. Anhand der<br />
Lebensgeschichten der Frauen wird deutlich, wie wichtig diese für den Stadtteil sind.<br />
Sie sind es, die trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse die Familien zusammenhalten,<br />
die Kindererziehung übernehmen und dem Stadtteil „Leben einhauchen“. Das Buch<br />
wurde von der <strong>Rötenberg</strong>er Frauenbeauftragten, Uta-Maria Steybe initiiert und über<br />
LOS – Lokales Kapital für lokale Zwecke - gefördert. Die Lebensgeschichten der Frauen,<br />
wurden von der iranischen Journalistin und Soziologin Farzaneh Fallahian recherchiert<br />
und aufgeschrieben (vgl. Kapitel 2.3.3) .<br />
3.2.3 Sozialraumbeobachtungen<br />
Um mir einen Eindruck über den <strong>Rötenberg</strong> zu verschaffen, der mir gänzlich unbekannt<br />
war, ermöglichte mir die Leiterin des JNZ<strong>Rötenberg</strong>, Brigitte Geßler, zu Beginn meiner<br />
Forschungsarbeit eine Führung durch die Siedlung. Dies war für meine weitere Forschungsarbeit<br />
von immenser Bedeutung, da ich mir so ein eigenes Bild von den dort<br />
vorherrschenden Verhältnissen und den dort lebenden Menschen machen konnte. Die<br />
hierbei entstandenen ersten Eindrücke und Beobachtungen hielt ich in einem Beobachtungsprotokoll<br />
fest, das in die folgende Wirkungsanalyse mit einfließt.<br />
68
3.2.4 Dokumentenrecherche<br />
Recherchiert wurde in Arbeitskonzepten als auch in Dokumentationen des Jugend- und<br />
Nachbarschaftszentrums <strong>Rötenberg</strong>, in der lokalen Presse Aalens sowie einschlägiger<br />
Fachliteratur. Die Ergebnisse der Recherchearbeiten stellen die Grundlage der Interviewdurchführung<br />
und deren Auswertung dar.<br />
4B4. Wirkungen aktivierender weiblicher GWA<br />
Die Frage nach der Wirksamkeit Sozialer Arbeit wird vor dem Hintergrund zunehmend<br />
knapper werdender öffentlicher Mittel in den letzten Jahren immer häufiger und vor<br />
allem nachdrücklicher gestellt. Somit scheint es nicht verwunderlich, wenn Trendvokabeln<br />
wie „Wirksamkeit“ und „Erfolg“ den aktuellen sozialpädagogischen Diskurs beherrschen.<br />
Seit der im Jahr 1988 von Luhmann und Schorr entfachten Diskussion um<br />
das Technologiedefizit der Pädagogik wird versucht, dieses Defizit anhand immer neuerer<br />
und verbesserter Technologien zu beseitigen. Als Kennzeichen von Technologien<br />
kann eine klare Ursache-Wirkungs-Kausalität genannt werden, die, wie Luhmann und<br />
Schorr nachgewiesen haben, in der Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit nicht<br />
umsetzbar und meines Erachtens auch nicht erstrebenswert erscheint (vgl. Langhanky<br />
u.a. 2004, 174 ff.). Ausgehend davon distanziere ich mich in meinen nachfolgenden<br />
Ausführungen von dem teleologischen Wirksamkeitsverständnis. Die in diesem Kapitel<br />
vorgenommene Wirkungsanalyse aktivierender gemeinwesenorientierter Sozialer Arbeit<br />
auf Frauen stützt sich auf das philosophische Verständnis von Wirkungen, im Sinne<br />
der „causa efficiens“. Diese stellt nach dem aristotelischen Verständnis die „Wirkursache“<br />
dar und wird als äußerer Anstoß von Bewegung verstanden (Kluge 1989, 795).<br />
Wenn ich im folgenden die Wirkungen aktivierender Gemeinwesenarbeit beschreibe,<br />
so sind damit erfahrungswirksame Erlebnisse, Begegnungen oder Ereignisse gemeint,<br />
die in den individuellen Lebenswelten der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen etwas ins „Rollen“<br />
brachten oder in irgendeiner Weise „Nebenwirkungen“ zeigten.<br />
Bevor ich jedoch auf die konkreten Wirkungen aktivierender GWA auf die <strong>Rötenberg</strong>er<br />
Frauen eingehe, erscheint mir zunächst eine Vorstellung dieser und deren Wirkungen<br />
auf mich angebracht. Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich daher den von mir<br />
interviewten Frauen und deren spezifischen Lebenswelten. Im zweiten Kapitel werde<br />
ich dann auf die wirksamen Erfahrungen der Anerkennung eingehen, die sich zum ei-<br />
69
nen auf das Buchprojekt „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ sowie auf Anerkennungserlebnisse<br />
mittels Institutionen und der lokalen Presse beziehen. Nachdem sich der<br />
dritte Teil mit den „Aus- und Nebenwirkungen“ von Selbstwirksamkeitserfahrungen<br />
beschäftigt, werde ich abschließend auf die Widersprüche in den alltäglichen Lebenswelten<br />
der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen eingehen.<br />
4.1. Lebendiges „Material“: Eine Wertschätzung<br />
Da das folgende Kapitel dieser Arbeit zu großen Teilen auf lebendigem „Material“ in<br />
Form der geführten Interviews beruht und die selbstverständliche Mitwirkung der Frauen<br />
an meiner Forschungsarbeit samt ihrer Offenheit meine ersten und sehr theorielastigen<br />
Schritte mit Leben füllte, erscheint mir eine Würdigung der spezifischen Frauenleben<br />
angebracht. Anhand einer kurzen Vorstellung der verschiedenen Charaktere<br />
soll der dieser Arbeit zu Grunde liegende Respekt vor den spezifischen Sinnzusammenhängen<br />
und der individuellen Besonderheit der interviewten Frauen zum Ausdruck<br />
gebracht werden.<br />
4.1.1 Frauen plaudern „aus dem Nähkästchen“<br />
Der Nähtreff ist ein Angebot des „Bewohnertreffs <strong>Rötenberg</strong>“, der im Rahmen der<br />
LOS-Projekte von der Kirchengemeinde Salvator getragen wird. Der Nähtreff wurde<br />
vor drei Jahren gegründet und findet seit dieser Zeit in einem regelmäßigen Turnus<br />
von zwei Wochen statt. Derzeit stellt der Nähtreff eine reine Frauengruppe dar. Die<br />
begeisterten Hobby-Näherinnen erzählen mir jedoch stolz, dass sie auch schon des<br />
öfteren Männer in ihre Gruppe aufgenommen hätten. Der Nähtreff stellte mein erstes<br />
Interview im Rahmen dieser Arbeit dar, bei dem fünf Frauen anwesend waren, die ich<br />
im folgenden kurz vorstellen möchte:<br />
Silvana:<br />
Silvana ist 41 Jahre jung und geschieden. Sie ist auf dem <strong>Rötenberg</strong> aufgewachsen<br />
und hat mehrere Geschwister, die wie sie auf dem <strong>Rötenberg</strong> wohnen. Silvana lebt<br />
gerne auf dem <strong>Rötenberg</strong> und will von dort auch nicht mehr weg. Zwischendurch<br />
wohnte sie mal zwei Jahre in Schwäbisch Gmünd, konnte sich dort aber nie richtig<br />
einleben: Das sei einfach nicht ihre Heimat gewesen, sagt sie. Silvana wirkt auf mich<br />
sehr aufgeschlossen und interessiert. Schade findet sie, dass zum Nähtreff immer die<br />
gleichen Leute und eben immer nur „Deutsche“ kämen. Sie würde gerne neue Leute<br />
70
und deren Kultur näher kennen lernen, wie beispielsweise beim <strong>Rötenberg</strong>er Ramadanfest.<br />
Dieses wird von den türkischen Bewohnerinnen organisiert und Silvana erzählt<br />
begeistert von den gemeinsamen Gesprächen und dem leckeren türkischen Gebäck.<br />
Aber abgesehen davon, fühlt sich Silvana im Nähtreff gut aufgehoben. Sie erzählt,<br />
dass die Mitarbeiterinnen immer ein offenes Ohr hätten und Unterstützung bieten<br />
würden, wenn man mal richtige Probleme habe. Meist gehe es jedoch sehr lustig zu<br />
und sie hätten viel Spaß miteinander.<br />
Elsa:<br />
Elsa wohnt seit ungefähr 20 Jahren auf dem <strong>Rötenberg</strong>, ihr Alter hat sie mir nicht verraten.<br />
Schätzungsweise ist sie jedoch so zwischen vierzig und fünfzig Jahre jung.<br />
Nach ihrer Scheidung zog Elsa auf den <strong>Rötenberg</strong>, da sie dort eine Wohnung bekam.<br />
Während dieser Zeit arbeitete sie noch eine Weile im Altersheim, dann wurde ihr gekündigt.<br />
Ihre Chefin habe sie angemacht wegen ihrer „<strong>Rötenberg</strong>-Methoden“, erzählt<br />
sie. Aber Elsa lässt sich nicht anmachen wegen ihres Wohnortes und zwar von niemandem.<br />
Das war vor zwölf Jahren. Danach hat Elsa keinen festen Job mehr gefunden.<br />
Als dann vor drei Jahren der Bewohnertreff gegründet wurde, half Elsa bei der<br />
Renovierung der Räume mit und ist seit dieser Zeit aktiv dabei. Zur Frage, welchen<br />
Ruf der <strong>Rötenberg</strong> hat, meint Elsa, dass die Gegend schon immer verpönt gewesen<br />
sei und sich früher nicht mal die Polizei auf den <strong>Rötenberg</strong> getraut habe. Die seien<br />
immer im Kommandowagen gekommen, erzählt sie. Lediglich ein einziger habe sich<br />
alleine raufgetraut. Für das Leben auf dem <strong>Rötenberg</strong> wünscht sich Elsa, dass man<br />
wieder mehr zusammenlebe und nicht immer übereinander schimpfe. Es solle wieder<br />
so werden wie früher, als man sich gegenseitig geholfen und das geteilt hätte, was<br />
man hatte, ohne lange betteln zu müssen. Auch das Zusammenleben mit den Türken<br />
könnte nach Elsas Meinung besser sein, auch wenn es eigenlicht keine Probleme mit<br />
den Türken gebe. Ansonsten wünscht sich Elsa, das alles so bleibt, wie es ist.<br />
Blandine:<br />
Blandine wohnt seit fünfzig Jahren auf dem <strong>Rötenberg</strong>. 55 Jahre war sie verheiratet<br />
und seit fast zehn Jahren ist sie Witwe. Blandine arbeitete früher im <strong>Rötenberg</strong>er<br />
Wirtshaus und kennt daher seit ihrer Kindheit fast alle. Sie selbst hat acht Kinder, zwei<br />
Pflegekinder und vier Enkel. Blandine erzählt rückblickend von einem harten Leben. Im<br />
weiteren Verlauf des Gesprächs erzählt Blandine, dass ihr Sohn studiert habe und heute<br />
Ingenieur sei, was sie sehr stolz mache. Sie kann es nicht verstehen, wenn man<br />
immer alles auf die Umgebung schiebe. Ihr Sohn sei schon immer gut in der Schule<br />
gewesen und alle ihre Kinder hätten etwas gelernt. Dafür hätten sie und ihr Mann aber<br />
71
auch hart gearbeitet. Mit dem alltäglichen Leben auf dem <strong>Rötenberg</strong> ist Blandine zufrieden.<br />
Das Einzige, was ihr Schwierigkeiten bereitet, ist das Einkaufen. Der Fußweg<br />
in die Stadt sei zwar nicht weit, aber der Rückweg recht beschwerlich, da es den Berg<br />
hoch gehe, erklärt sie mir.<br />
Caroline:<br />
Caroline, Anfang 30, ist auf dem <strong>Rötenberg</strong> geboren und aufgewachsen. Verheiratet<br />
sei sie mit einem Türken, mit dem sie drei Kinder habe, wie sie berichtet. Als sie heiratete,<br />
ist sie vom <strong>Rötenberg</strong> weggezogen und hat heute ein eigenes Haus. Caroline<br />
erzählt viel von ihrer Jugend auf dem <strong>Rötenberg</strong>, von der „Spielstub“ und den gemeinsamen<br />
Unternehmungen: von Wanderausflügen, Sommerferienlager und Nachtwanderungen.<br />
Einmal in der Woche sei immer Disco gewesen, wovon sie noch heute<br />
schwärmt. Nach ihrem Jahrgang hat das aber alles aufgehört, da immer weniger Deutsche<br />
kamen und die türkischen Mädchen an den Ausflügen mit Übernachtung nicht<br />
teilnehmen durften. Aus diesem Grund gab es auch immer öfter Streit und die Ausflüge<br />
wurden seltener. Caroline spricht während des Gesprächs immer wieder davon, wie<br />
schön ihre Jugend auf dem <strong>Rötenberg</strong> gewesen sei und dass sie so einen Zusammenhalt,<br />
wie sie ihn damals gehabt hätten, noch nie anderswo erlebt habe. Aber heute sei<br />
das eben alles anders, erklärt sie. Dies ist auch der Grund, warum sie sich nicht vorstellen<br />
kann, ihre Kinder auf dem <strong>Rötenberg</strong> aufwachsen zu lassen. Caroline geht es<br />
nicht darum, dass so viele Ausländer auf dem <strong>Rötenberg</strong> wohnen, ihr Mann sei ja selber<br />
einer, aber es lebten eben nur noch Ausländer hier. Sie betont noch mal, dass es<br />
nichts mit den Leuten zu tun habe, die hier wohnen würden. Es gehe einfach um das<br />
Ganze, sagt sie, dass es eben nicht mehr so sei wie früher und immer mehr Leute<br />
„raufgesteckt“ würden, die sonst niemand haben möchte. Trotzdem kommt Caroline<br />
immer noch gerne auf den <strong>Rötenberg</strong>. Im Sommer besucht sie fast jeden Tag ihre Mutter,<br />
und auch ihre Kinder sind gerne hier, da auf dem <strong>Rötenberg</strong> immer was los ist.<br />
Aber hier zu wohnen kann sie sich nicht mehr vorstellen. Die Wohnungen seien<br />
„menschlich nicht zumutbar“, meint sie empört. Dennoch hat Caroline ihre Herkunft nie<br />
verleugnet. Obwohl es, wie sie sagt, früher schon schlimm gewesen sei, wenn man<br />
vom <strong>Rötenberg</strong> kam. Caroline findet das schade, denn es gäbe ja auch gute Menschen<br />
auf dem <strong>Rötenberg</strong> und nicht nur „die anderen“, sagt sie. Den schlechten Ruf des <strong>Rötenberg</strong>s<br />
machen nach Carolines Meinung die Menschen selbst und besonders diejenigen,<br />
die es am wenigsten etwas anginge.<br />
Olga:<br />
Olga ist eine ältere Dame, die im Jahr 1956 auf den <strong>Rötenberg</strong> gezogen ist und im<br />
letzten Jahr ihr fünfzigjähriges Jubiläum feiern durfte. An dem Interview beteiligt sich<br />
72
Olga nur wenig. Sie ist vielmehr damit beschäftigt, dass es den Frauen und mir an<br />
nichts fehlt. Später erklärt sie mir dann, dass sie hier für alles zuständig sei und im Bewohnertreff<br />
arbeite. Eigentlich sei sie immer hier, erzählte sie mir.<br />
4.1.2 Ben Aalen-<strong>Rötenberg</strong>´da otoyorum – Ich lebe in Aalen <strong>Rötenberg</strong><br />
Endlich allein zum Bäcker oder Metzger. Endlich selbständig einkaufen ohne Dolmetscherin.<br />
In dem von mir besuchten Deutschkurs pauken seit Herbst letzten Jahres<br />
zehn <strong>Rötenberg</strong>er Frauen die deutsche Sprache. Möglich macht dieses Angebot ein<br />
Mikroprojekt im Rahmen des Bundesmodellprogramms „LOS“. Am Tag meines Interviews<br />
zählt der Deutschkurs insgesamt sieben Frauen, die mich neugierig und aufmerksam<br />
mustern. In Vorgesprächen wurde mir erklärt, dass einigen Frauen eine längere<br />
Unterhaltung auf Deutsch noch schwer falle, weshalb sich die Lehrerin des Kurses,<br />
Nuran Öezcan, bereit erklärte, zu übersetzen. Umso beeindruckter bin ich dann,<br />
als sich bei der Begrüßungsrunde alle Frauen auf Deutsch vorstellen. Die anwesenden<br />
sieben Teilnehmerinnen des Deutschkurses sind die Gesprächspartnerinnen meines<br />
zweiten Interviews, die ich im folgenden kurz vorstellen möchte:<br />
Semra:<br />
Semra ist 43 Jahre jung, verheiratet und kommt aus der Türkei. Sie hat vier Kinder,<br />
drei Jungen und ein Mädchen. Semra lebt seit 18 Jahren in Deutschland, doch nach<br />
wie vor fällt es ihr sehr schwer, deutsch zu sprechen. Semra ist Hausfrau, ihr Mann<br />
arbeitet nicht mehr. Dieser habe, wie sie mir erzählt, vor einem halben Jahr einen<br />
schlimmen Arbeitsunfall gehabt, von dem er sich bis heute nicht mehr richtig erholt<br />
hätte. Als sie mir davon berichtet, macht sie eine beschwörende Geste. Ihr scheint es<br />
schwer zu fallen, darüber zu reden. Semra trägt ein Kopftuch. Als ich sie frage, ob sie<br />
damit negative Erfahrungen gemacht habe, verneint sie. So etwas habe sie noch nie<br />
erlebt, sie könne sich auch nicht vorstellen, dass irgendjemand sie nicht mögen würde,<br />
nur weil sie Türkin sei. Auf meine Frage, wie ihr ihre Wohnung gefällt, nickt sie nur.<br />
Nach einer kurzen Pause erzählt sie dann, dass der Japaner in der Nachbarwohnung<br />
sehr viel schimpfe und seine Frau auch schlagen würde. Sie schüttelt den Kopf und<br />
sagt, sie hätte eigentlich gedacht, dass die Japaner intelligente Menschen seien. Von<br />
dem Deutschkurs hat Semra in der Moschee erfahren. Es mache ihr sehr viel Spaß, zu<br />
lernen, erzählt sie mir.<br />
73
Veronika:<br />
Veronika kommt aus Kasachstan, ist 58 Jahre jung, verheiratet und lebt seit vier Jahren<br />
in Deutschland. Vor zwei Jahren ist sie auf den <strong>Rötenberg</strong> gezogen. Veronika hat<br />
zwei Kinder, die ebenfalls in Deutschland leben. Ihr Sohn wohnt in Schwäbisch<br />
Gmünd, ihre Tochter in Aalen. Veronika möchte unbedingt arbeiten. Ihr Mann und sie<br />
sind beide zuhause. Sie erzählt, dass sie manchmal das Gefühl habe, ihr Kopf platze<br />
vom „rumsitzen“ in der kleinen Wohnung. Weiter erzählt sie, dass sie fast jeden Tag<br />
eine Bewerbung schreibe, aber aufgrund ihrer schlechten Sprachkenntnisse sei es<br />
sehr schwierig, Arbeit zu finden. Zu ihren Nachbarn, die alle aus unterschiedlichen<br />
Ländern stammen, hat Veronika ein gutes Verhältnis. Sie sagt, die ganze Welt wohne<br />
in ihrem Haus.<br />
Yasemin:<br />
Yasemin ist in der Türkei geboren, 45 Jahre jung, lebt seit 16 Jahren in Deutschland.<br />
Sie spricht sehr gutes Deutsch, möchte aber noch besser sprechen lernen. Sie ist verheiratet<br />
und hat zwei Kinder, die 12 und 15 Jahre alt sind. Der Vormittag gehöre ihr,<br />
berichtet Yasemin strahlend. In dieser Zeit besucht sie den Deutschkurs sowie einen<br />
Gymnastikkurs oder geht spazieren. Als ich Yasemin frage, wie oft sie ihre Familie in<br />
der Türkei besuchen könne, seufzt sie tief und lange. Nach einer Pause und einem<br />
weiteren Seufzer meint sie, alle zwei bis drei Jahre. „Thema ist Wunde“, sagt Yasemin.<br />
Sie vermisst ihre Familie sehr und kann kaum darüber sprechen.<br />
Yelda:<br />
Yelda kommt ebenfalls aus der Türkei, ist 35 Jahre jung und verheiratet. Seit zwölf<br />
Jahren lebt Yelda in Deutschland und hat vier Kinder. Sie hat sich in Deutschland eingelebt,<br />
inzwischen sagt sie, wäre es für sie schwieriger, wieder in Istanbul zu leben.<br />
Besonders gut gefielen ihr in Deutschland die grüne Landschaft, die Wälder, die frische<br />
Luft und vor allem die Regeln, erzählt sie lachend, z.B. Verkehrsregeln. Am Anfang war<br />
es in Deutschland sehr schwierig für sie. Immer musste sie jemand begleiten, wenn sie<br />
krank war oder zum Arzt musste. Für Yelda wurde der Kurs mit der Zeit immer wichtiger.<br />
Es mache Spaß mit den anderen Frauen zusammen zu lernen, zu sprechen und<br />
zu lachen. Den Stress würden sie vor der Tür lassen, erzählt Yelda lachend.<br />
Saziye:<br />
Saziye ist in Istanbul geboren, ist 41 Jahre jung, hat zwei Kinder und lebt seit neun<br />
Jahren in Deutschland. Das erste, was mir Saziye lachend erzählt, ist, dass sie Aalen<br />
sehr klein und sehr langweilig fände. In der Türkei, sagt sie, hätte sie sehr viel mehr<br />
74
unternehmen können, hätte mehr Freizeit gehabt und sei oft ins Theater oder ins Restaurant<br />
gegangen. Hier in Deutschland, erzählt sie, gehe sie nie aus.<br />
Hanife:<br />
Hanife stammt aus der Türkei, ist 38 Jahre jung und hat drei Töchter. Sie ist verheiratet<br />
und lebt seit 19 Jahren in Deutschland. Bei der Frage, ob sie gerne eine Frau ist, antwortet<br />
mir Hanife, dass sie manchmal lieber ein Mann wäre. Männer hätten mehr freie<br />
Zeit, kämen nach Hause, setzten sich vor den Fernseher und sagten, mach mir das,<br />
bring mir das Essen hier her! Darum sei es besser, ein Mann zu sein. Diese arbeiteten<br />
acht Stunden im Geschäft, dann hätten sie frei. Sie dagegen habe immer Arbeit, im<br />
Haus, mit den Kindern, bis sie ins Bett ginge. Aber nur aus diesem Grund sei Mann<br />
sein besser.<br />
Ihre Antwort auf die Frage nach einem besonders schönen Erlebnis möchte ich an dieser<br />
Stelle wörtlich wiedergeben, da ich diese sehr beeindruckend fand: „Ich war im<br />
neunten Monat schwanger, habe im Haus ein paar Sachen aufgeräumt, als ich ein<br />
Kind weinen hörte. Als ich aus dem Fenster sah, habe ich ein Kind gesehen, dass auf<br />
dem Kofferraum eines großen Autos lag, eines pickups. Das Kind war behindert und<br />
blutete stark. Aufgeregt habe ich meinen Mann gerufen, schnell, schnell. Mein Mann<br />
war zu langsam, ich konnte nicht warten, das Fenster stand offen und so bin ich aus<br />
dem ersten Stock auf die Ladefläche des pickups gesprungen. Mein Mann kam und hat<br />
mich geschimpft, auch meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater haben geschimpft.<br />
Ich bin mit dem Kind ins Haus gegangen, habe es gewaschen, dann suchten<br />
wir seine Familie. Am nächsten Tag kam mein erstes Kind auf die Welt, ein Mädchen.<br />
Alles war ok“ (Hanife, 263-273).<br />
Merva:<br />
Merva lebte bis vor neun Monaten noch in der Türkei. Sie ist 34 Jahre jung, verheiratet<br />
und hat zwei Kinder. Merva ist während des Interviews sehr zurückhaltend und schüchtern.<br />
Nuran übersetzt für sie und erzählt, dass sie sehr aufgeregt sei. Sie habe sich<br />
noch nicht eingelebt, alles erscheine ihr noch fremd und das Sprachproblem mache ihr<br />
zu schaffen. Als ich Merva nach ihrem ersten Eindruck frage, den sie von Deutschland<br />
hatte, übersetzt Nuran: Sie wollte einkaufen am Bahnhof, dort sah sie einen nackten<br />
Mann, der tanzte. Sie war total schockiert, die anderen Menschen klatschten dagegen<br />
alle. Sie dachte, die seien hier alle verrückt.<br />
75
4.2 Erfahrungen der Anerkennung<br />
„Die Anerkennung unseres Seins und die Bestätigung unseres Werts sind der Sauerstoff<br />
unseres Dasein“ (Todorov 1996, 107).<br />
Todorov und Taylor zufolge zählt das Streben nach Anerkennung zu den menschlichen<br />
Grundbedürfnissen und stellt ein zentrales Identitätsziel dar (vgl. Taylor 1997, 15). Laut<br />
Honneth stehen Anerkennung und Identität in einer konstitutiven Wechselwirkung zueinander,<br />
wobei Anerkennung ein moralisches Gut im Sinne des Anerkennens, des<br />
Anerkanntseins sowie des Sichanerkennens darstellt. Diese Dimensionen ermöglichen<br />
Erfahrungen der unterschiedlichen Anerkennungsformen mittels bestimmter Rechte<br />
oder Gemeinschaften (z.B. als rechtsfähige Person oder als Freund), anhand derer<br />
sich Menschen durch ihr Gegenüber anerkannt wissen. Über diese aktive Ankerkennung<br />
und das Anerkanntsein eröffnet sich die Möglichkeit, sich selbst anerkennen zu<br />
können und dadurch eine positive Selbstbeziehung herzustellen, die sich in Selbstvertrauen,<br />
Selbstschätzung und Selbstachtung ausdrückt (vgl. Burdewick 2003, 251 ff).<br />
Aufgrund der strukturell verankerten „Abwertung“ von Weiblichkeit, die sich, wie bereits<br />
beschrieben (vgl. Kapitel 1.3.1), bei Brennpunktfrauen potenziert, stellen Erfahrungen<br />
der Ankerkennung eine Schlüsselfunktion im Sinne von Türöffnerinnen dar, anhand<br />
derer Zugänge in die spezifischen Frauenwelten ermöglicht werden können. Ziel hierbei<br />
ist es, die verborgenen und oftmals entwerten Leistungen von Frauen sichtbar zu<br />
machen und anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund wird Anerkennung als ein zentrales<br />
Element aktivierender weiblicher GWA verstanden. Die unterschiedlichen Formen<br />
der Ankerkennung möchte ich im folgenden anhand der Projektarbeit „<strong>Rötenberg</strong>er<br />
FrauenGeschichten“, sowie den erlebten Erfahrungen der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen mit Institutionen<br />
und der lokalen Presse näher erläutern.<br />
4.2.1 Anerkennung durch die Projektarbeit „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“<br />
Elf Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, erzählen ihr Leben: Zum einen ist<br />
hier das arbeitsreiche Leben der Brigitte zu nennen. Sie ist 63 Jahre jung, in Schlesien<br />
geboren und hat mit 15 Jahren angefangen zu arbeiten. Urlaub ist für sie ein Luxus,<br />
den sie bis heute nicht verwirklichen konnte. Seit 40 Jahren lebt sie auf dem <strong>Rötenberg</strong>,<br />
hatte Zeit ihres Lebens kaum Geld, überlebte zwei alkoholkranke Männer und<br />
schwärmt heute noch von ihrer „größten Reise“ – einem Ausflug in die Wilhelma. Heut<br />
lebt Brigitte alleine, sie will mit keinem Mann mehr zusammenleben. Wenn sie abends<br />
von der Arbeit heimkommt, freut sie sich an ihren zwei Hunden und braucht keine<br />
Angst mehr davor zu haben, tyrannisiert und misshandelt zu werden. Brigitte hatte es<br />
76
als Frau im Leben nicht leicht, dennoch sagt sie energisch: „Ein Mann zu sein, nein<br />
Danke!“ (Stadt Aalen 2005, 23). Oder Rubila, 27 Jahre jung, die Werkstoffkunde an der<br />
Fachhochschule Aalen studiert. Rubila ist in Pakistan geboren. Mit 12 Jahren kam sie<br />
mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihre Kindheit, sagt sie, habe sie in Pakistan zurückgelassen.<br />
Ihre Eltern sprachen überhaupt kein Deutsch, in der Schule musste sie<br />
alles selbst regeln. Damals wäre Rubila gerne wieder nach Pakistan zurück, wo sie<br />
wieder Kind hätte sein dürfen. Heute kann sich Rubila nicht mehr vorstellen, in Pakistan<br />
zu leben. „Ich bin eine deutsch-pakistanische Frau […] zu welcher Religion ich gehöre<br />
oder wie ich mich ankleide, gehört zu meiner persönlichen Freiheit“ (Stadt Aalen<br />
2005, 15). Dann ist da Azimet, die vor 41 Jahren nach Deutschland kam und die ihre<br />
Kinder und ihren kranken Mann zurück ließ, um in Deutschland Arbeit zu finden. Sie<br />
wollte ihrer Familie irgendwann etwas bieten können. „Ich fuhr nach Deutschland, während<br />
in Istanbul meine kleine Tochter an ihrem ersten Geburtstag nach mir weinte. Und<br />
ich brach in Tränen aus, weil ich die Milch, die eigentlich mein Kind trinken sollte, in der<br />
Zugtoilette abpumpte“ (Stadt Aalen 2005, 43). Oder Sieglinde, die ihre Hausaufgaben<br />
immer zweimal machte und dann die falsche Version abgab, weil das weniger Ärger<br />
gab: „Von mir wurde erwartet, dumm zu sein, also habe ich mich auch so benommen“<br />
(Stadt Aalen 2005, 52). Diese skizzenhaften Einblicke in die jeweiligen Frauenwelten<br />
auf dem <strong>Rötenberg</strong> lassen sehr viel Vertrauen und Offenheit in dem Buchprojekt vermuten<br />
und stellen für mich ein sicheres Indiz einer respektvollen und anerkennenden<br />
Grundhaltung von Seiten der Professionellen dar, die meines Erachtens die Vorraussetzung<br />
für eine gelingende aktivierende weibliche Gemeinwesenarbeit ist. Im folgenden<br />
möchte ich diese These mittels der Dimensionen des Respekts, der Offenheit sowie<br />
der Schaffung öffentlicher Teilhabe näher erläutern:<br />
Respekt vor den „Meisterinnen des Lebens“<br />
Die Dimension des Respekts zeigt sich für mich in der professionellen Begleitung der<br />
Frauen. Das Buchprojekt der „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ wurde von der Aalener<br />
Frauenbeauftragten initiiert und über LOS finanziert. Geschrieben wurde das Buch von<br />
der iranischen Journalistin und Soziologin Farzaneh Fallahian. Die Kontakte zu den<br />
Frauen wurden durch persönliche Gespräche geknüpft: Die Leiterin des JNZ, Brigitte<br />
Geßler, sprach insgesamt ca. 25 <strong>Rötenberg</strong>er Frauen an, wovon elf bereit waren, ihre<br />
Lebensgeschichte aufzurollen. Die Erzählungen wurden von Farzaneh Fallahian recherchiert<br />
und niedergeschrieben. Die Gestaltung sowie das Design übernahm die<br />
Grafikerin Beate Herbert. Diese professionelle Herangehensweise, angefangen von<br />
der „Investition“ öffentlicher Gelder über die persönliche Ansprache der Frauen bis hin<br />
zur Engagierung von Fachkräften, die für eine gelingende Umsetzung des Projektes<br />
77
Sorge trugen, bestätigt meines Erachtens eine wertschätzende und anerkennende<br />
Grundhaltung von Seiten der Professionellen und in Konsequenz Anerkennung für die<br />
biografischen Leistungen der Frauen.<br />
Offenheit<br />
Das Erzählen des eigenen Lebens ist immer auch eine „Abrechnung“ mit sich selbst.<br />
Offenheit ist eine wesentliche Voraussetzung hierfür. Das Erzählen des eigenen Lebens<br />
bedeutet, zwischen Hoffnungen und Erfahrungen der Vergangenheit und deren<br />
Wirkungen für die Gegenwart eine sinnhafte Brücke zur Zukunft zu schlagen. Diese<br />
muss stabil und tragfähig sein, um die personale und soziale Identität zu sichern. Für<br />
die Frauen in sozialen Brennpunkten bedeutet dies auch, sich die Frage nach dem<br />
Selbstverständnis als Frau zu beantworten. Das Erzählen heißt, die Kluft zu schließen<br />
zwischen dem Wunsch nach Bestätigung, Zuwendung und Anerkennung in ihrer weiblichen<br />
Rolle und der „harten“ Realität des Frauenalltags in sozialen Brennpunkten und<br />
somit die alltäglichen und lebenseinschneidenden Erfahrungen des Versagens- bzw.<br />
des Scheiterns in einen Zusammenhang zu stellen, der es den Frauen ermöglicht, vor<br />
sich selbst zu bestehen. Diese emotional sehr aufwühlende Leistung der Rekonstruktion<br />
des eigenen Lebens kann meines Erachtens nur in einer wertschätzenden und anerkennenden<br />
Atmosphäre gelingen. Die Offenheit der Frauen, die „Ungeschöntheit“<br />
ihrer Erzählungen und die spürbare Authentizität ist für mich ein deutliches Indiz dafür,<br />
dass diese Atmosphäre in dem Projekt der „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ mehr als<br />
gegeben war.<br />
Schaffung öffentlicher Teilhabe<br />
Basierend auf der bereits beschriebenen strukturell verankerten geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung sowie dem damit einhergehenden Ausschluss der Frauen aus der<br />
Öffentlichkeit, kann die Teilhabe der Frauen am öffentlichen Leben als eine weitere<br />
Dimension von Anerkennung verstanden werden. Anhand einer öffentlichkeitswirksamen<br />
Kampagne des Buches „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ wirkten die Erzählungen<br />
der „Meisterinnen des Lebens“ über die Grenzen des <strong>Rötenberg</strong>s hinaus. Berichte<br />
über die Frauen waren in fast allen lokalen Zeitungen zu finden, wie beispielsweise in<br />
den Aalener Nachrichten, der Schwäbischen Post oder der Remszeitung. Des Weiteren<br />
fand in der Reihe „Frau des Monats“ der Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb<br />
(STOA) eine Lesung mit anschließender Podiumsdiskussion statt, in deren Rahmen<br />
fünf Geschichten aus dem Buch vorgelesen wurden. Diese bewusst initiierte und organisierte<br />
öffentliche Wertschätzung der „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“ ist meines<br />
Erachtens ein weiteres Indiz für Erfahrungen der der Anerkennung für die Frauen: Im<br />
78
Wissen um strukturelle Ausschlusskriterien von Brennpunktfrauen in der Öffentlichkeit<br />
sowie der Notwendigkeit anerkennender und wertschätzender Arbeit werden die Leistungen<br />
und Tätigkeiten von Frauen sichtbar gemacht und erfahren damit öffentliche<br />
Anerkennung.<br />
4.2.2 Anerkennung durch Institutionen<br />
Der <strong>Rötenberg</strong> leidet wie kein anderer Stadtteil Aalens unter den bereits seit Jahrzehnten<br />
vorherrschenden Vorurteilen seitens der Aalener Bevölkerung. Um die erschwerten<br />
Umstände des Lebensmanagements von Frauen in Armut sichtbar zu machen, bedarf<br />
es eines anerkennenden Umgangs, auch und vor allem durch öffentlichkeitswirksame<br />
Institutionen. Nur mittels einer anerkennenden Kooperation dieser können meines Erachtens<br />
die Belange und Bedürfnisse der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen auch in der Aalener<br />
Öffentlichkeit verständlich und nachvollziehbar gemacht werden. An drei Beispielen<br />
möchte ich die anerkennende Haltung der agierenden Institutionen auf dem <strong>Rötenberg</strong><br />
vorstellen:<br />
Beispiel 1: Der Bürgermeister kommt<br />
In einem Stadtteilspaziergang führten die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils <strong>Rötenberg</strong><br />
der Stadtverwaltung vor Augen, was genau in der Siedlung getan werden<br />
müsse. Der Spaziergang wurde im Rahmen der Aufnahme des <strong>Rötenberg</strong>s in das<br />
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ durchgeführt. Mehr als zwanzig Bürgerinnen<br />
und Bürger nahmen an dem zweistündigen Rundgang durch die Siedlung mit Bürgermeister<br />
Dr. Eberhard Schwerdtner teil. Wichtige Stationen stellten vor allem die Kinderspielplätze<br />
dar, die mangelhaft ausgestattet und die ob Verunreinigungen durch<br />
Glasscherben und Hundekot nicht nutzbar waren. Ein weiteres Problem war der Müll,<br />
der zu großen Teilen einfach auf der Straße entsorgt wurde. Bei der Begutachtung der<br />
Wohnhäuser fiel vor allem der schlechte Zustand ins Auge. Zum Teil hatten die älteren<br />
Wohnungen nur Gemeinschaftsduschen im Keller zu bieten. Ebenfalls nicht zu übersehen<br />
war der Mangel an Einkaufsmöglichkeiten und die mangelhafte öffentliche Beleuchtung<br />
im Stadtteil (vgl. Schwäbische Post, 08.04.2003).<br />
Anhand des Stadtteilrundgangs wurden erstmalig die erschwerten Lebensumstände im<br />
Stadtteil, die Mängel unter denen die dort lebenden Frauen „haushalten und wirtschaften“<br />
müssen, aufgedeckt. Die Sichtbarmachung der schwierigen, arbeitsverlängernden<br />
und verkomplizierenden Voraussetzungen, unter denen die <strong>Rötenberg</strong>erinnen ihren<br />
hausfraulichen und mütterlichen Pflichten nachkommen, stellt eine Aufwertung ihrer<br />
erbrachten Leistungen dar. Der Rundgang durch das Gemeinwesen war im weitesten<br />
79
Sinne ein Gang „quer durch“ den Arbeitsplatz der <strong>Rötenberg</strong>erinnen. Wer, wenn nicht<br />
diese, könnten die vorherrschenden Unzulänglichkeiten der Siedlung wirksamer aufzeigen<br />
als die Expertinnen selbst. Die Erfahrung der Anerkennung zeigt sich für mich<br />
darin, dass die Frauen vom Bürgermeister persönlich „gehört“ wurden und er sie in<br />
ihrem Wissen als „Fachfrauen“ ernst nahm. Die dadurch erfahrene Teilhabe und die<br />
Möglichkeit der Mitbestimmung stellt meines Erachtens eine bedeutsame Erfahrung<br />
dar.<br />
Beispiel 2. Stadtteilrundgang der besonderen Art<br />
Zum Auftakt des internationalen Frauentages am 08. März 2005 lud die Leiterin des<br />
Stadtplanungsamtes, Ingrid Stoll-Haderer, zu einem „Stadtteilrundgang – aus Sicht der<br />
Frau“ ein, um das alltägliche Leben der Frauen in der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> kennen zu<br />
lernen. Die Bewohnerinnen des <strong>Rötenberg</strong>s wurden dazu eingeladen, ihren Wünschen<br />
aber auch den Schwierigkeiten, mit denen sie im Alltag zu kämpfen haben, „Luft“ zu<br />
verschaffen. Viele der Frauen hatten sich bereits im Vorfeld an die Leiterin des JNZ,<br />
Brigitte Geßler gewandt und im Vorfeld ihre Sorgen und Nöte angesprochen: „Das<br />
hauptsächliche Problem ist, dass die Wohnungen für größere Familien rar sind und<br />
viele nicht einmal Dusche oder Bad, sondern nur ein Waschbecken haben“ erklärt Brigitte<br />
Geßler gegenüber der Aalener Zeitung (Aalener Nachrichten, 09.03. 2005). Die<br />
Schwäbische Post beschreibt den Alltag am <strong>Rötenberg</strong> im Jahr 2005 wie folgt: „Enge<br />
Wege, die keiner schippt. Treppen ohne Handlauf. Straßen ohne Laternen. Die wunden<br />
Punkte der Siedlung sind kaputte Fensterscheiben, die nicht ersetzt werden. Türen,<br />
die obwohl sie neu sind, nicht richtig schließen. Desolate Fensterläden und zu<br />
wenig Platz zum Spielen für die Kinder“ (Schwäbische Post, 09.03.2005). Zum Stadtteilrundgang<br />
hatten sich laut der Schwäbischen Post ca. 30 Frauen eingefunden, um<br />
bei der Anderthalbstunden-Tour den <strong>Rötenberg</strong> aus einer anderen Perspektive kennen<br />
zu lernen und um mit den Bewohnerinnen zwanglos ins Gespräch zu kommen.<br />
Die erfahrene Anerkennung der „Brennpunktfrauen“ drückt sich meines Erachtens in<br />
der Teilhabe an der (Frauen-)Öffentlichkeit“ aus. Anhand dieses spezifischen Stadtrundgangs<br />
hatten die <strong>Rötenberg</strong>erinnen die Möglichkeit, den Besucherinnen einen<br />
„lebendigen“ Einblick in die vorherrschenden Verhältnisse zu vermitteln. Sie konnten<br />
von den Bedingungen ihres Lebens- und Arbeitsfeldes als Mütter, Ehe- und Hausfrauen<br />
berichten. Ihre Zuhörerinnen, selbst Frauen, die um die anfallenden Arbeiten und<br />
Anforderungen des Reproduktionsbereiches wissen, konnten so die alltäglichen Leistungen<br />
der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen und deren „haushalten“ unter den vorherrschenden<br />
Mängeln und Unzulänglichkeiten besonders wertschätzen. Diese erfahrene Anerkennung<br />
unter „Gleichen“ ist meines Erachtens von besonderer Bedeutung, da die Leis-<br />
80
tungen der Frauen unter den erschwerenden Umständen des Lebensmanagements in<br />
Armut im Alltag oft als selbstverständlich gehandelt werden und im Verborgenen stattfinden.<br />
Die erfahrene Anerkennung durch die Aalener Frauen wirkt meines Erachtens<br />
einer Leistungsabwertung der Frauen entgegen, die ihre eigene Arbeit meist als defizitär,<br />
ungenügend und irrelevant empfinden.<br />
Beispiel 3: Das Nachbarschaftszentrum macht stark<br />
Das Jugend- und Nachbarschaftszentrum <strong>Rötenberg</strong> (JNZ) stellt nicht nur ein offenes<br />
Haus für die alltäglichen Probleme und Notlagen der Bewohnerinnen dar, sondern es<br />
hat auch die geschlechtsspezifischen Lebenslagen im Blick und die damit verbundenen<br />
spezifischen Bedürfnisse der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen. Diesem Anspruch soll anhand verschiedener<br />
Herangehensweisen entsprochen werden. So beispielsweise durch das<br />
Projekt „Zivilcourage“, das die Stadtverwaltung, die Polizei und das JNZ in gemeinsamer<br />
Zusammenarbeit mit der Opferschutzorganisation „Weißer Ring“ gestaltete (vgl.<br />
Schwäbische Post, 20.04.2004). Hierbei erhielten Mädchen und Frauen die Möglichkeit,<br />
einen Aikido-Anfängerkurs zu besuchen und eine moderne Art der Selbstverteidigung<br />
zu erlernen. Im Vordergrund stand hier, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen<br />
lernen sowie eine positives Körper- und Selbstwertgefühls zu entwickeln. Des Weiteren<br />
bietet das JNZ den Frauen in lockerer Atmosphäre Anregungen der „Freizeitgestaltung“.<br />
Dazu zählen auch kulturelle Impulse wie ein Besuch im Limesmuseum oder in<br />
der Stadtbücherei. Elsa, eine Frau aus dem Frauennähtreff, berichtet begeistert von<br />
geplanten und vergangenen Unternehmungen: „ […] na macher ma no a Grippafahrt<br />
im Dezember, nach Elwanga oder do do war mar mol in, war ma scho am Kocherursprung<br />
und hinterher semmer Fisch esse ganga in der Angelzucht, gell. So Sache macher<br />
mo scho au, ne. Oder an Jahresausflug, des Johr war ma in der Wilhelma, war au<br />
68<br />
sehr schönF<br />
F“ (Elsa, 469-472).<br />
Hierbei erfahren die Frauen (Selbst- und Fremd-) Bestätigung, lernen „Eigenzeit“ für<br />
sich selbst zu beanspruchen, versteckte Interessen auf- und zu entdecken sowie deren<br />
praktische Umsetzung. Gerade für Brennpunktfrauen stellt dies eine wichtige Erfahrung<br />
des Sichselbstanerkennens und des sich selbst „Wichtignehmens“ dar.<br />
68 Übersetzung: „[…] dann machen wir noch eine Grippenfahrt im Dezember nach Ellwangen,<br />
oder wir waren auch schon am Kocherursprung und später sind wir in der Angelzucht Fisch<br />
essen gegangen. Oder an unserem Jahresausflug, dieses Jahr waren wir in der Wilhelma, das<br />
war auch sehr schön“<br />
81
4.2.3 Anerkennung durch lokale Presse<br />
Der <strong>Rötenberg</strong> gilt im Bewusstsein der Aalener Öffentlichkeit nach wie als „problematisch“.<br />
Die Gründe für das schlechte Image liegen nach wie vor im äußeren Erscheinungsbild<br />
der Gebäude. So erzählt auch Dilay in den „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“:<br />
„Was zuallererst auf dem <strong>Rötenberg</strong> bedrohlich wirkt, ist der Zustand der Häuser“<br />
(Stadt Aalen 2005, 39). Aber auch das Wissen um die schlechte Ausstattung der Wohnungen<br />
und der Vorbehalte angesichts des hohen Ausländeranteils sowie der hohen<br />
Konzentration von Menschen mit sozialen Problemen bestätigen das Bild des <strong>Rötenberg</strong>s<br />
als „schwierigen Stadtteil“. Die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit des JNZ setzt<br />
genau an diesen Vorurteilen an. Durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit soll die<br />
Aalener Bevölkerung aufgeklärt, informiert und auf den neuesten Stand gebracht werden,<br />
was aktuelle Sanierungsmaßnahmen, Angebote und Veranstaltungen betrifft. Ziel<br />
ist es, Vertrauen und Verständnis für die spezifische Lebenswelt der <strong>Rötenberg</strong>erinnen<br />
(und <strong>Rötenberg</strong>er) zu schaffen und den oftmals vergessenen Stadtteil in das Blickfeld<br />
der Aalener Bevölkerung zu rücken.<br />
Dies wird durch eine wohlwollende Berichterstattung der lokalen Presse unterstützt, die<br />
sachlich und klar über die Mängel und Probleme der Siedlung <strong>Rötenberg</strong> berichtet, die<br />
jedoch auch kritisch und erklärend die strukturell benachteiligte Situation beschreibt<br />
und um Verständnis wirbt und die nicht zuletzt über Feste, Aktionen, Projekte und Veranstaltungen<br />
berichtet. Diese Form der Berichterstattung, die Positives nicht verklärt<br />
und Negatives nicht verheimlicht, sondern erklärt, stellt meines Erachtens eine besondere<br />
Wertschätzung und Anerkennung dar und zeugt davon, dass die <strong>Rötenberg</strong>erinnen<br />
(und <strong>Rötenberg</strong>er) als Akteurinnen ihrer spezifischen Lebenswelt sowie als Partnerinnen<br />
des öffentlichen Lebens ernst genommen werden.<br />
4.3 Erfahrungen der Selbstwirksamkeit<br />
Das Konzept der Selbstwirksamkeit gewinnt derzeit in der deutschsprachigen FachliteraturF<br />
F zunehmend an Aktualität. Im Bereich der pädagogisch-psychologischen Motiva-<br />
69<br />
tionsforschung wird dem von Albert Bandura in den 1980er Jahren entwickelten Konzept<br />
nicht nur eine hohe Erklärungskraft, sondern auch eine hohe praktische Bedeutung<br />
zugesprochen. Selbstwirksamkeit kann als subjektive Gewissheit definiert werden,<br />
die Menschen dazu befähigt, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf der<br />
Basis subjektiver Kompetenzen bewältigen zu können. Ursprünglich wurden Selbst-<br />
69 vgl. Flammer 1990, Schwarzer 1998, Jerusalem/Mittag 1999<br />
82
wirksamkeitserwartungen vor allem als individuelle Konstrukte aufgefasst. Zwischenzeitlich<br />
wurde das Konzept der Selbstwirksamkeit jedoch von Bandura (vlg. Bandura<br />
1997) um die Ebene der kollektiven Überzeugungen erweitert, nach dem dieser Aspekt<br />
in der Vergangenheit nur am Rande Erwähnung fand. Bei der kollektiven Selbstwirksamkeitserwartung<br />
geht es primär um die Einschätzungen der Gruppen-<br />
Selbstwirksamkeit, die sich aus der Koordination und Kombination verschiedener Ressourcen<br />
zu einem gemeinsamen Wirkungspotenzial ergeben (vgl. Jerusalem 2002, 8).<br />
Um Selbstwirksamkeitsprozesse aktivieren zu können, bedarf es meines Erachtens<br />
zunächst eines Ortes, an dem die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen von<br />
Frauen gestärkt werden können, der gleichermaßen die subjektiven Lebenszusammenhänge<br />
der Frauen erkennt, sowie darüber hinaus einen organisatorischen Rahmen,<br />
im Sinne einer Frauengruppe, bildet. Allein durch die Gruppe als solches, durch<br />
Kontakte zu anderen Frauen und durch die Erkenntnis, mit den vorherrschenden Problemen<br />
nicht alleine zu sein, zu sehen, dass andere Frauen dieselben Schwierigkeiten<br />
und Problemsituationen durchleben, kann die Erfahrung der Gemeinsamkeit faktisch<br />
über die Gruppe hinaus wirken und zu einer Stärkung der individuellen Kompetenzen<br />
einer jeden Frau führen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die zum Teil erfahrenen<br />
und als persönlich bewerteten Beschränkungen als strukturell bedingte aufzudecken.<br />
Die Interpretation von Barrieren und deren Aufhebung stellt eine maßgebliche Bedeutung<br />
für die Selbstwirksamkeit von Frauen dar. Das vorliegende Kapitel hat zum Ziel,<br />
das so eben beschriebene theoretische Konstrukt von Selbstwirksamkeit am Beispiel<br />
der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen zu beleuchten und die Bedeutung für die dort lebenden Frauen<br />
herauszustellen.<br />
70<br />
4.3.1 Deutschkurs: „Wofür brauchst du deutsch- willst du Lehrerin werden?“F<br />
Als ich den Frauen des Kurses die Frage stelle, ob sie bei dem Wunsch, Deutsch zu<br />
lernen, von ihrer Familie Unterstützung bekämen, verneint der Großteil von ihnen. Der<br />
Rest schweigt. Die Lehrerin des Deutschkurses antwortet mir. Die Frauen würden oft<br />
keine Unterstützung von der Familie erhalten, erzählt sie, da sie aus der Türkei hierher<br />
kämen, um ihrer Aufgaben als Ehefrau und Mutter zu entsprechen und dafür bräuchten<br />
sie kein Deutsch. Hanife erzählt: „Meine Schwiegermutter hat auch gefragt, wofür<br />
brauchst du Deutsch? Willst du Lehrerin werden? Schwiegereltern wollten nicht, früher.<br />
Jetzt ist ok“ (Hanife, 217-218). Hanife gilt in der Gruppe als Musterschülerin. Sie erzählt,<br />
dass sie in der Türkei nie die Möglichkeit gehabt habe, lesen und schreiben zu<br />
lernen. Als sie nach Deutschland gekommen sei, hätte sie sich bei ihrer Familie durch-<br />
70 Vgl. Hanife, 218<br />
83
gesetzt und zunächst die Alphabetisierungskurse im JNZ besucht, die sie jedoch durch<br />
die Geburt ihrer Kinder immer wieder unterbrechen hätte müssen. Nach der Geburt<br />
ihrer Kinder besuchte Hanife dann drei Monate lang einen Alphabetisierungskurs der<br />
Volkshochschule und lernte Deutsch. Danach machte sie ihren Führerschein und arbeitet<br />
nun seit 16 Jahren an der Berufschule als Reinigungsfrau. Bei der Frage, was<br />
Hanife noch lernen möchte, antwortet sie: „Noch besser deutsch sprechen“ (Hanife,<br />
243).<br />
Bei der Frage, was sich durch den Deutschkurs verändert hätte, antwortet Yasemin:<br />
„Ich gehe überall alleine hin, egal wohin, ich kann alles alleine machen. Es gefällt mir<br />
nicht, wenn ich jemanden brauche, das ist Selbständigkeit, das ist gut für mich“ (Yasemin,<br />
84). Selbständigkeit und Unabhängigkeit scheinen für Yasemin sehr wichtig zu<br />
sein. Sie erzählt auch, dass sie zweimal in der Woche arbeiten gehe, um ihr eigenes<br />
Geld zu verdienen, so brauche sie kein Geld von ihrem Mann, erklärt sie mir (Yasemin,<br />
90-91). Das einzig Schwierige in Deutschland sei für Yasemin die Sprache, aber sie<br />
will lernen. Wenn ihre Kinder nachmittags nach Hause kommen, macht sie ihre<br />
Hausaufgaben zusammen mit ihrer Tochter: „[…] ich meine und sie ihre, das freut meine<br />
Tochter sehr arg, sie sagt immer: ´Ah Mama, hast du auch Hausaufgaben?´ Dann<br />
sage ich ja, siehst du ich bin auch fleißig und mache meine Hausaufgaben. Das freut<br />
sie. Und sie schaut immer in meine Fehler, sie kontrolliert und sagt, das ist falsch, das<br />
kann man nicht so schreiben. Sie verbessert mich“ (Yasemin, 232-235) Yasemin erzählt,<br />
dass sie dann sehr stolz auf ihre Tochter sei.<br />
Saziye erzählt, dass sie nach dem Deutschkurs alleine beim Arzt gewesen wäre und<br />
sie sich sehr darüber gefreut habe, dies alleine zu bewerkstelligen: „[…] also selbständig<br />
sein“ (Saziye, 248). Früher, berichtet sie, habe sie sich immer mit ´“Händen und<br />
Füßen“ verständigt.<br />
Vom Deutschkurs hat Yasemin von einer Freundin erfahren. Sie findet das Angebot<br />
sehr gut, da es nichts kostet. Jede Frau kann nach eigenem Ermessen 10 oder 20 Euro<br />
spenden, aber das ist freiwillig. Das sei gut, sagt sie. Vorher habe sie schon „anderswo“<br />
gesucht, aber die Kurse seien alle sehr teuer gewesen. Ein Integrationskurs<br />
koste pro Person ca. 630 Euro, erzählt sie. „[…] Wir alle arbeiten für vier, fünf Euro die<br />
Stunde, verdienen wenig, und das ist nur für drei Monate. Dieser Kurs geht von September<br />
bis Juni. Wir müssen Deutsch lernen“ (Yasemin, 201-204). Semra hat vom<br />
Deutschkurs in der Moschee erfahren, die den diesjährigen Deutschkurs organisiert<br />
(Semra, 193). „Seit 1983 gibt es hier Deutschkurs. Mund zu Mund“ (Yasemin, 199-<br />
200).<br />
84
Für Yasemin ist der Deutschkurs wie eine Familie. Gemütlich, nicht so groß, sagt sie.<br />
Auch für Yelda ist er im Alltag wichtig. Sie erzählt, dass sie vier kleine Kinder habe und<br />
daher „viel Arbeit“. Sie besuche den Deutschkurs nur zweimal die Woche, aber „es ist<br />
eine sehr schöne Aktivität und Abwechslung, sehr gute Abwechslung, mit anderen<br />
Frauen zusammen, zu sprechen und zu lernen, das macht Spaß. Wir lernen viel,<br />
Stress vor der Türe lassen, Stressabbau, zusammen mit Freundinnen etwas lernen,<br />
die Sprache sprechen. Zuhause gibt es nur Kinder und Haushalt. Man kommt weg von<br />
zuhause“ (Yelda, 229).<br />
Als ich die Frauen nach einem besonderen Erlebnis frage, das sie mit dem Deutschkurs<br />
in Verbindung bringen würden, erzählt Yasemin: „Ich war sechs Monate in<br />
Deutschland, ich wollte unbedingt lernen Fahrradfahren. Ich habe viele gesehen mit<br />
Fahrrad. Das hat mir so gut gefallen, ich habe gesagt, ich muss auch fahren. Kinder<br />
von meinem Schwager haben mir geholfen, dann alle waren in Schule, mein Mann war<br />
weg, ok, ich fahre jetzt ganz allein. Dann bin ich alleine nach oben gefahren, dann runter<br />
gefahren, und war so schnell, war aufgeregt, konnte nicht bremsen, bin gegen Auto<br />
von Schwager gefahren und meine Auge sofort in eine Sekunde, tausend Ameisen,<br />
meine Auge war so blau. Alle haben geschimpft mit mir, Mann, Kinder, Schwiegermutter.<br />
Mein Mann hat gesagt, was soll ich den anderen sagen. Du siehst aus wie geschlagen.<br />
Dann musste ich in Arbeit, konnte nicht sprechen. Habe Lehrerin gefragt, sie<br />
soll für mich aufschreiben, mein Mann hat mich nicht geschlagen, bin vom Fahrrad<br />
gefallen. Das war so komisch […] Das war so lange, das Auge blau, einen Monat. Alle<br />
haben gesagt ich darf nicht Fahrrad fahren, aber ich mache trotzdem. Ich möchte lernen“<br />
(Yasemin, 249-257).<br />
Die anhand dieses Teilabschnitts beschriebenen Erfahrungen der Frauen, zeigen meines<br />
Erachtens bereits große Wirkung. Die genannten Erlebnisse und Veränderungen,<br />
die der Deutschkurs für die Frauen bewirkte, im Sinne von Eigenzeit für sich selbst zu<br />
beanspruchen, neue Interessen und Fähigkeiten zu entdecken und zu erlernen sowie<br />
persönliche Wünsche gegenüber Personen durchzusetzen, die ihnen „übergeordnet“<br />
sind, stellen für mich gelingende und positive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit dar.<br />
85
71<br />
4.3.2 Selbstorganisation: „des kriega mr scho na, au ohne StützF<br />
F“<br />
Die Nähgruppe ist ein Angebot des Bewohnertreffs <strong>Rötenberg</strong>, dessen Förderung über<br />
72<br />
LOSF<br />
F, Ende des Jahres ausläuft. Der Bewohnertreff wurde zusammen mit den Bewohnerinnen<br />
(und Bewohnern) des <strong>Rötenberg</strong>s aufgebaut. Elsa erzählt: „[…] ja und vor<br />
zwoi Johr hammer no dui gschicht a´gfanga. Da hemmer da henne alles dapeziert, und<br />
73<br />
grichtetF<br />
F“ (Elsa, 31-32). Als im weiteren Verlauf des Gesprächs LOS und das Ende<br />
der Finanzierung zum Thema wird, sagt Elsa: „au wenn´s uns nachher nemme [… ]<br />
sponsert wird, dass mers eifach selber weiterbetreibe kennet. Des wär uns scho recht.<br />
74<br />
Aber i denk au, dass mr da a Chance hend, äh das des irgendwie weitergohtF<br />
F“ (Elsa,<br />
45-46). Elsa wirkt sehr zuversichtlich, als sie dies erzählt. Sie glaubt an die Gruppe und<br />
kann sich gut vorstellen, den Bewohnertreff auch ohne Finanzierung über LOS aufrechterhalten<br />
zu können. Schließlich sind sie immer zusammen und haben viel Spaß<br />
miteinander: „Emmer zamma, also Mittwochs beim Nähe, und au so sen mir immer<br />
75<br />
zammaF<br />
F […] viemal in der Woch treffe mr uns, no demmer bastle, oder fahre mr wo<br />
na, ja also aregungen hemmer immer gnug, und´s macht richtig Spaß“ (Elsa, 36-37).<br />
Auch Silvia ist froh, dass es das Angebot des Nähtreffs gibt: „mir gfällts halt dahanna,<br />
ja aber i be gern dahann, beim Nähkurs, aber au so. Des isch so gut, dass mir au dahanna<br />
was hend. Weil sonscht hockt ma halt immer me uff der Stroß, und au mal andre<br />
leut, um uns rumF<br />
F […]“ (Silvana, 21-24). Die Atmosphäre des Nähtreffs wirkt sehr<br />
76<br />
vertraut und „heimelig“. Blandine wohnt im gleichen Haus und „kommt gschwend runder,<br />
wenn sie Zeit hatF<br />
F“ erzählt Elsa. Auch Caroline, die nicht mehr auf dem Röten-<br />
77<br />
berg wohnt, kommt regelmäßig zur Nähgruppe. Elsa erzählt wertschätzend, was Caroline<br />
schon alles gemacht hat, obwohl sie gar keine Ahnung vom nähen hatte. „Aber sie<br />
78<br />
hot scho tolle sache gmacht, seit herF<br />
F“ (Elsa, 56). Anhand dieser Aussage von Elsa<br />
71 Übersetzung: „Das bekommen wir schon hin, auch ohne Unterstützung“ (Elsa, 46)<br />
72 Mit dem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend<br />
(BMFSFJ) können bis zum Jahr 2007 Mikroprojekte in den Gebieten „Die Soziale Stadt“ gefördert<br />
werden. LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke wird aus dem Europäischen Sozialfonds<br />
(ESF) gefördert (vgl. Konzeption 2006, 15)<br />
73 Übersetzung: „Ja und vor zwei Jahren haben wir die Geschichte hier angefangen. Da haben<br />
wir hier drin alles tapeziert und gerichet“<br />
74 Übersetzung: „Auch wenn wir später nicht mehr finanziert werden, dass wir es einfach selber<br />
weitermachen können. Das wäre uns schon recht“.<br />
75 Übersetzung: „Ja, wir sind immer zusammen, also Mittwochs beim Nähen, und auch so sind<br />
wir immer zusammen […] viermal in der Woche treffen wir uns, dann basteln wir was, oder fahren<br />
irgendwo hin, ja, also Anregungen haben wir genügend, uns macht das richtig Spaß“<br />
76 Übersetzung: „Mir gefällts halt hier. Ja, aber ich bin gerne hier, beim Nähkurs, aber auch so.<br />
Das ist schon gut, dass wir hier auch was haben. Weil sonst sitzen wir halt immer mehr auf der<br />
Straße rum, und auch mal andere Leute um uns rum“<br />
77 Übersetzung: „[…] kommt kurz runter, wenn sie Zeit hat.<br />
78 Übersetzung: „Aber sie hat schon tolle Sachen gemacht, seit sie hier ist“<br />
86
wird deutlich, dass die Frauen die Nähgruppe nutzen um ihre Kompetenzen zu erweitern<br />
und dies auch untereinander erkennen und wertschätzen.<br />
Olga erzählt mir im Laufe des Gesprächs, dass sie neulich Jubiläum feiern konnte „50<br />
Jahre <strong>Rötenberg</strong>“, dazu gratulierte ihr die Wohnungsbaugesellschaft und sie bekam<br />
eine Urkunde überreicht. Blandine regte sich daraufhin sehr auf: „[...] i fend das a wenig<br />
overschämt, dass des blos in oire Wohnung gilt und et au für die, die füfzig Jahr<br />
79<br />
obe wohnetF<br />
F“ (Blandine, 145-146). Die Urkunde der Wohnungsbaugesellschaft erhalte<br />
nur, wer fünfzig Jahre in derselben Wohnung gewohnt habe, erklärt mir Blandine. Sie<br />
wohne jetzt bereit seit 1956 im selben Haus und hätte aufgrund der Kinder öfters umziehen<br />
müssen, also eben in eine größere Wohnung, erzählt Blandine. Sie weiß noch<br />
ganz genau wie das damals war: „I hab mein Mietvertrag erscht seit 1978 und i weiß<br />
au warum, da hendse damals bei uns umbaut, hend Bäder gmacht, Kachelöfe neibaut<br />
und und ab do, hemmer glaub mehr Miete zahle müsse, und dann hemmer wieder´n<br />
80<br />
neue Mietverträg kriegtF<br />
F“ (Blandine, 152-155). Blandine kann sich noch sehr genau an<br />
alles erinnern, sogar an die Jahreszahl. Die detaillierten Erinnerungen von Blandine<br />
deuten meines Erachtens sehr eindrücklich daraufhin, dass der damalige Umbau der<br />
Wohnung ein sehr wichtiges Ereignis für sie dargestellt haben muss. Diese These<br />
möchte ich anhand eines weiteren Beispiels untermauern. Als Blandine von früher und<br />
der Entstehung der ersten Häuser auf dem <strong>Rötenberg</strong> erzählt, kann sie mir auch hier<br />
die exakte Jahreszahl benennen:: „[…] 1954 send da Leit eizoge, des wois i weil damals<br />
mei Schwägere als erschte da reizoge ischF<br />
F“ (Blandine, 73). Blandine weiß also<br />
81<br />
ganz genau wann, wie, was in der Siedlung passierte. Die Siedlung <strong>Rötenberg</strong> stellt<br />
Blandines Lebens- und Arbeitsfeld als Mutter, Haus- und Ehefrau und als frühere Wirtin<br />
dar, in diesem sie sich als Expertin auskennt. Durch die verweigerte Ehrenurkunde<br />
scheint deutlich zu werden, wie sehr sich Blandine in ihrer Kompetenz missachtet fühlt.<br />
Sie kann das so nicht akzeptieren und scheint gewillt die verweigerte Anerkennung<br />
einzufordern:: „[…] des kriegt er no zu höre, der […], wenn er in d´Spielstub na kommt,<br />
82<br />
do gang i na, und des hört derF<br />
F“ (Blandine, 159-160). Hier kommt sehr klar zum Vorschein,<br />
dass Blandine von ihren Kompetenzen und ihrem Recht auf Anerkennung ü-<br />
berzeugt ist, und selbstwirksam aktiv werden möchte, um ihr Recht geltend zu machen.<br />
79 Übersetzung: „ Ich find das ein wenig unverschämt, dass das bloß in einer Wohnung gilt und<br />
nicht auch für die, die bereits fünfzig Jahre oben wohnen“<br />
80 Übersetzung: „Ich habe mein Mietvertrag erst seit 1978 und ich weiß auch ganz genau warum,<br />
da haben die damals umgebaut, haben Bäder gemacht und Kachelöfen eingebaut und und<br />
ab da, mussten wir glaube ich mehr Miete bezahlen, und dann haben wir einen neuen Mietvertrag<br />
bekommen“<br />
81 Übersetzung: „1954 sind da die Leute eingezogen, weil das weiß ich, weil damals meine<br />
Schwägerin als erste eingezogen ist“<br />
82 Übersetzung: „Das bekommt er noch zu hören, der […], wenn er in die Spielstube kommt,<br />
dann gehe ich runter, und das bekommt er zu hören“<br />
87
83<br />
4.3.3 Ausbildung zur Tagesmutter: „Jetzt möchte ich noch mehr lernenF<br />
F“<br />
Die Anfragen im JNZ von berufstätigen muslimischen Frauen, die nach einer Betreuung<br />
ihrer Kinder suchten, wurde im Jahr 2006 immer häufiger und drängender. Daraufhin<br />
initiierte das JNZ gemeinsam mit dem Aalener Verein PATEF<br />
F im Rahmen des<br />
84<br />
Bund-Länderprogramms „Soziale Stadt“ das Projekt „Muslimische Frauen als Tagesmütter“.<br />
Das Projekt orientierte sich inhaltlich eng am Curriculum des Landesverbandes<br />
der Tagesmütter, bedürfnisorientiert wurde es jedoch um Module zum Thema Ernährung,<br />
Entwicklungspsychologie sowie um das Modul der Sprachförderung ergänzt.<br />
Die Informationsveranstaltungen im JNZ hätten hierbei wertvolle Unterstützungsarbeit<br />
geleistet und Türen geöffnet, so die Schwäbische Post (vgl. Schwäbische Post,<br />
08.4.2006). Mit dem Ziel später ihr eigenes Geld verdienen zu können, ließen sich an<br />
insgesamt 14 Terminen sieben Teilnehmerinnen, sechs Türkinnen und eine Frau aus<br />
Sri Lanka als Tagesmütter qualifizieren. Inhaltlich ging es primär um die Erwartungen<br />
der Tagespflege, die rechtliche Situation, den Umgang mit Konflikten, Erziehungsfragen<br />
bis hin zu Techniken der Gesprächsführung. „Da gab es sehr lebhafte Diskussionen“<br />
erinnert sich Sylvia Kreuzer an so manche Redeschlacht während der Kurse. Wie<br />
wertvoll das Projekt für die Frauen gewesen war, zeigte sich beim Abschlussfest des<br />
Projektes: „Ich habe so viel gelernt, jetzt möchte ich noch mehr machen“ berichtete<br />
eine Teilnehmerin und überlegte, ob sie eine Ausbildung als Kinderpflegerin anhängen<br />
sollte (Schwäbische Post, 29.05.2006). Auch die anderen Frauen waren sich einig, viel<br />
gelernt zu haben und präsentierten stolz ihr erworbenes Diplom (vgl. Schwäbische<br />
Post, 08.02.2006).<br />
Das Projekt der „Tagesmütter“ kann meines Erachtens exemplarisch für einen gelingenden<br />
Selbstwirksamkeitsprozess stehen, anhand dessen muslimische Frauen eine<br />
subjektive Überzeugung ihrer Kompetenzen gewinnen konnten. Diese positive Erfahrung<br />
der Selbstwirksamkeit motiviert, auch in Zukunft neue und schwierige Herausforderungen<br />
anzugehen.<br />
83 Schwäbische Post, 08.02.2006<br />
84 Pate ist ein Verein für Pflegeeltern, Adoptivelter, Tagesmütter und Eltern im Ostalbkreis (vgl.<br />
Schwäbische Post, 08.04.2006).<br />
88
4.4 Was bleibt: Widersprüche<br />
85<br />
In der Philosophie werden WidersprücheF<br />
F als die Wurzel aller Bewegung, als alles<br />
Lebendige überhaupt, gesehen. (vgl. Bitzan 1993, 263). Basierend auf diesem Grundverständnis<br />
können anhand von Widersprüchen gewünschte und gezielte Veränderungen<br />
bewirkt werden, vorausgesetzt, dem jeweiligen Handeln liegt ein bewusster und<br />
rationaler Umgang mit diesen zu Grunde. Betrachten wir unseren alltäglichen Umgang<br />
mit Widersprüchen, so kann in der Regel ein grundlegendes Streben nach einer Auflösung<br />
dieser festgestellt werden. Im Alltag stellt dieses Handlungsmuster einen meist<br />
notwendigen und bewussten Umgang dar, der im weiteren Sinne als eine produktive<br />
Handlung zur Durchsetzung eigener Interessen bezeichnet werden kann.<br />
Die zu Beginn dieser Arbeit beschriebenen weiblichen Lebenslagen (vgl. Kapitel 1.31.)<br />
können als ein Konglomerat an Widersprüchlichkeiten verstanden werden, das in der<br />
Geschlechterhierarchie sowie der individualisierten Gesellschaft seinen Niederschlag<br />
findet. Das Leben von Frauen kann daher faktisch als (privates) Arrangement in Widersprüchen<br />
bezeichnet werden. Die Schwierigkeit, die in den vorherrschenden Widersprüchlichkeiten<br />
der jeweiligen Frauenleben liegt, ist die, dass dieses Arrangement<br />
nicht wie gewohnt, aufgelöst werden kann. Denn jede Art von Entscheidung, die zu<br />
einer Auflösung der Grundproblematik führen könnte, jede Art von Befreiungsidee –<br />
„einseitig, defizitär, mit Verzicht, Unbehagen, Missachtung oder Einsamkeit behaftet“<br />
ist (Bitzan 1993, 263). Die Schwierigkeit kann daher in der „Uneindeutigkeit“ gesehen<br />
werden, denn je stärker sich frau mit ihrer traditionellen Rolle identifiziert, desto subjektloser<br />
wird sie durch die Sorge um andere. Durchbricht sie jedoch die „alten“ Vorstellungen<br />
von Weiblichkeit, umso mehr wird sie Sanktionen und Missachtung erfahren.<br />
Diese Paradoxie aufzudecken stellt einen bedeutenden „Entzauberungsmoment“<br />
86<br />
dar, der zugleich als Grundstein feministischerF<br />
F und in diesem Sinne auch aktivierender<br />
weiblicher GWA verstanden werden kann.<br />
85 „Widerspruch - Wechselwirkung zweier koexistierender Gegensätze, die einander bedingen,<br />
zugleich aber als Gegensätze einander ausschließen, die sich also untereinander im Verhältnis<br />
der Einheit und des Widerstreits, des ´Kampfes´ befinden…Während der logische Widerspruch<br />
nur in der Sphäre des Denkens existiert, ist der dialektische Widerspruch den Dingen, Prozessen,<br />
Systemen usw. der objektiven Realität selbst eigen und stellt die Quelle aller Bewegung,<br />
Veränderung und Entwicklung dar..“ (Buhr/Klaus 1976 zit. in Bitzan 1993, 262). Der Gedanke<br />
des Widerspruchs wurde zunächst durch Hegel und dann in der marxistischen Lehre vom dialektischen<br />
Materialismus ausformuliert (vgl. Bitzan 1993, 262).<br />
86 In Anlehnung an Bader u.a. wird „Feminismus“ in der vorliegen Arbeit als politisches Programm<br />
verstanden, das eine „Entzauberung“ strukturell bedingter Widerspruchsdimensionen<br />
und die Entwicklung eines kollektiven Selbstverständnisses von Frauen als kollektives Subjekt<br />
sowie die Befreiung aus männlichen Zuschreibungen bewirken soll, und damit untrennbar mit<br />
radikaler Herrschaftskritik verbunden ist (vgl. Bitzan 1993, 264).<br />
89
Die beschriebenen wirksamen Erfahrungen der <strong>Rötenberg</strong>er Frauen möchte ich im<br />
folgenden nun in einen Interpretationsrahmen stellen, anhand dessen gleichermaßen<br />
die gegebenen Widersprüchlichkeiten sowie das Bedeutende feministischer Arbeit herausgestellt<br />
werden kann. Exemplarisch möchte ich dies an zwei Grundmaximen aktivierender<br />
weiblicher GWA, der Lebensweltorientierung und der Parteilichkeit, näher<br />
erläutern.<br />
Lebensweltorientierung:<br />
Die Lebenslagen armer Frauen können, wie bereits in Kapitel 1.3.3 beschrieben, nur in<br />
der Analyse des „weiblichen Lebenszusammenhangs“, der geschlechtsspezifischen<br />
Arbeitsteilung, sowie einer Politisierung der „Frauenproblematik“ verstanden werden.<br />
Der Begriff der Lebensweltorientierung entspricht im weitesten Sinne diesen Prämissen,<br />
da er die Analyse individueller Lebenslagen sowie die spezifischen Fähigkeiten<br />
und Kompetenzen mit sozialpolitischen Rahmenbedingungen verknüpft. Auffällig ist<br />
dabei nur, „daß alle bisher erschienenen Äußerungen zum Lebensweltkonzept von<br />
Männern stammen und ihnen die geschlechtsdifferenzierte Betrachtungsweise fehlt.<br />
Wir gehen davon aus, daß der von der Frauenforschung geprägte Begriff des „weiblichen<br />
Lebenszusammenhangs“ bereits viele im Lebensweltkonzept bisher mehr theoretisch<br />
formulierte Anliegen umsetzt,…“ (Projekt: Berufliche und Politische Bildung für<br />
Frauen 1987 zit. in Bitzan 1993, 265).<br />
Lebensweltorientierung stellt daher eine der aktiven weiblichen GWA zu Grunde liegende<br />
Haltung dar, die sich auf die spezifischen Sinnzusammenhänge der Lebenswelten<br />
von Frauen bezieht. Nur dadurch kann der jeweilige Ausgangspunkt von Brennpunktfrauen<br />
für ihr Handeln bzw. ihr Nicht-Handeln ergründet und die subjektive Bedeutung<br />
erfasst werden, die sie biographischen Ereignissen, erlebten Erfahrungen und<br />
87<br />
Absichtserklärungen beimessenF<br />
F. „Mit der Kategorie des Widerspruchs lässt sich eine<br />
so gemeinte Lebensweltorientierung als das subjektiv sinnvolle Lösen vielfältiger diffuser,<br />
sich gegenseitig beschränkender Ansprüche theoretisch greifen“ (Bitzan 1993,<br />
266). Die widersprüchlichen und dadurch oft unverständlichen Verhaltensweisen von<br />
Brennpunktfrauen brauchen so nicht mehr auf der individuellen Ebene diskutiert werden<br />
als beispielsweise Unfähigkeit oder Versagen, sondern bieten beiden Parteien,<br />
den Mitarbeiterinnen wie den Brennpunktfrauen, gleichermaßen die Chance, Verhaltensweisen,<br />
Erwartungen und Zwänge zu erklären, sich diese bewusst zu machen und<br />
zum Ausgangspunkt sozialpädagogischer Arbeit zu machen. Diese Theoriefolie möchte<br />
ich am Beispiel des bereits beschriebenen Projektes „Tagesmütter“ (vgl. Kapitel<br />
4.3.3) erläutern.<br />
87 Um Missverständnissen vorzubeugen möchte ich an dieser Stelle betonen, dass es hierbei<br />
nicht um eine Romantisierung der jeweiligen Frauenleben im „Milieu“ geht.<br />
90
Die Frauen äußerten beim JNZ vermehrt den Wunsch, ihr eigenes Geld verdienen zu<br />
wollen. Als mit Blick auf die spezifischen Stärken und Fähigkeiten der Frauen die Idee<br />
einer Ausbildung als Tagesmutter entstand, traten erhebliche Zweifel bei den Frauen<br />
auf. Der Großteil war in der Tradition der Großfamilie aufgewachsen und konnte mit<br />
dem Begriff „Tagesmutter“ rein gar nichts in Verbindung bringen. Die Kursleiterin beschrieb<br />
als eine der Hürden des Projektes, den Frauen den Sinn des Kurses verständlich<br />
zu machen. Hierbei spielte die Unterstützungsarbeit des JNZ eine große Rolle. In<br />
persönlichen Gesprächen, die durch das Vertrauensverhältnis der Mitarbeiterinnen des<br />
JNZ getragen wurden, konnte den Frauen die Gewissheit vermittelt werden, dass es<br />
primär um sie ginge und nicht um das Projekt an sich: sie würden die „Hauptdarstellerinnen“<br />
sein. Danach galt es in unzähligen Aufklärungsgesprächen, die Familien der<br />
Frauen, sowie die Ehemänner über das Projekt und die Inhalte zu informieren (vgl.<br />
Schwäbische Post, 08.02.2006).<br />
In Widersprüchen lebensweltorientiert zu arbeiten, bedeutet also auch, „immer in Bewegung<br />
zu bleiben“, sich nicht in scheinbar zutreffenden Bildern und Vorstellungen<br />
einrichten, um so die weibliche Lebensweise in ihren gesellschaftlichen Möglichkeitsrahmen<br />
der Produktion und Reproduktion zu verstehen und damit an den spezifischen<br />
Handlungsbedingungen für Frauen in sozialen Brennpunkten anzuknüpfen.<br />
Parteilichkeit:<br />
Die Ermöglichung des Projektes „Tagesmütter“ lag faktisch darin, die Frauen ins Zentrum<br />
der Aufmerksamkeit zu rücken. Dies setzte voraus, die spezifischen Realitäten der<br />
Frauen, ihr subjektives Erleben wahrzunehmen und mit Blick auf deren Auswirkungen<br />
zu interpretieren. Anhand dieses Vorgehens wird eine Haltung ersichtlich, die in feministischen<br />
Konzepten eine zentrale Vorraussetzung darstellt, die Parteilichkeit.<br />
Parteilichkeit kann definiert werden als eine „solidarische Grundhaltung, die Frauen<br />
und Mädchen ernst nimmt, ihnen Glauben schenkt, ihre Interessen als eigenständige<br />
und eigenlegitimierte akzeptiert und gezielt in den Vordergrund stellt. Parteilichkeit bedeutet,<br />
aufzuhören mit der Funktionalisierung von Frauen für die eigenen Interessen<br />
anderer und ihr Schicksal mit dem eigenen (als Frau) in Verbindung zu bringen. Parteilichkeit<br />
ist eine bewusste Entscheidung, sich auf Frauen zu beziehen“ (Bitzan 1993,<br />
268).<br />
Hinter dem Paradigma der Parteilichkeit steht die patriarchale Unterdrückung, von der<br />
im Grundsatz alle Frauen gleich betroffen sind. Somit kann Parteilichkeit als eine politische<br />
Haltung verstanden werden, in der sich alle Frauen gemeinsam gegen die Diskriminierung<br />
zur Wehr setzen, um ihren selbst bestimmten Raum in der Gesellschaft<br />
zurück zu erobern.<br />
91
Historisch bedingte sich die Haltung der Parteilichkeit somit als notwendiger Solidarisierungsweg,<br />
leider jedoch meist über die Irrungen vereinfachter Gleichsetzungen von<br />
„Klientinnen“ und Pädagoginnen. Während in früheren Diskussionen die Grenzen von<br />
„Betroffenheit“ primär an der Professionalität festgemacht wurden, rückt heute vor allem<br />
die Bedeutung der Ungleichheit von Frauen und damit die Erkenntnis der Verschiedenheit<br />
in den Vordergrund. Parteilichkeit kann vor dem Hintergrund aktivierender<br />
GWA in Brennpunkten als Interpretationsrahmen verstanden werden, der in gleichem<br />
Maße den frauenspezifischen wie lebensweltorientierten Blick wahrt und die jeweiligen<br />
Handlungsweisen an den Interessen der Frauen ansetzt. In diesem Sinn kann Parteilichkeit<br />
als eine kämpferische widerspruchsorientierte Kompetenz verstanden werden,<br />
die nicht auf harmonische Interessenausgleiche abzielt.<br />
5B5. Wirksamkeit und Handeln in der weiblichen GWA<br />
Die Begriffe Wirksamkeit und Handeln sind eng miteinander verwoben, da das, was wir<br />
für wirksam halten, also unsere Handlungsstrategie, die Art unserer Handlungen beeinflusst.<br />
Der französische Sozialwissenschaftler François Jullíen fragt in seinem Buch „Über die<br />
Wirksamkeit“ inwiefern es gelingen kann, das klassische (teleologische) Verständnis<br />
von Wirksamkeit zu verlassen (vgl. Kapitel 4): „Es ist derart geläufig, dass wir es nicht<br />
mehr sehen – dass wir uns nicht mehr sehen: Wir entwickeln eine Idealform (eidos),<br />
die wir als Ziel (telos) setzen, und dann handeln wir, um sie in die Realität umzusetzen.<br />
All das liefe von selbst – Ziel, Ideal, Wille: die Augen auf das Modell gerichtet,<br />
…entscheiden wir, in die Welt einzugreifen und der Realität Form zu geben. Und je<br />
mehr wir es verstehen, in unserem Handeln dieser Idealform nahe zu bleiben, umso<br />
größer ist die Chance, damit Erfolg zu haben“ (Jullíen 1993, 13). Dieses von Jullíen<br />
beschriebene Schema der klassischen Wirksamkeit würde in der Umsetzung gemeinwesenorientierter<br />
Praxis entweder zu einer Verstellung des lebensweltorientierten Blickes<br />
führen oder in pure Manipulation des sozialräumlichen Feldes ausarten. Dieser<br />
Konstruktion liegt das faktische Scheitern in der Praxis zu Grunde, da das Ideal bzw.<br />
das Ziel nie wirklich erreicht werden kann. Das Handeln einer lebensweltorientierten<br />
Praxis kann sich daher nicht der Technik der Zielkonstruktionen bedienen, sondern hier<br />
gilt es vielmehr, sich an der praktischen Wirksamkeit auf der „Suche nach dem Glück<br />
oder dem gelingenderen Alltag“ in einem bestimmten Handlungsrahmen zu orientieren.<br />
Die Wirksamkeit muss eine „mit der Praxis verbundene Form der Intelligenz“ entwi-<br />
92
ckeln, die sich durch „Spürsinn, Scharfsinn, Voraussicht, geistige Geschmeidigkeit,<br />
List, Gewieftheit, Wachsamkeit und einen guten Riecher für gute Gelegenheiten“ auszeichnet<br />
(Jullíen 1999, 20).<br />
Diese besondere Form von Klugheit, nennt Jullíen „metis“. Dieser Begriff findet seinen<br />
88<br />
Ursprung in der griechischen Antike und der ersten Frau Zeus, die nicht nur KronosF<br />
F<br />
mit einem Brechmittel half, seine verknoteten und verworrenen Kinder auszuspucken<br />
und zu entwirren, sondern auch Zeus zur Geburt der Athene verhalf, der Göttin der<br />
Weisheit (vgl. Langhanky u.a. 2004, 177). Der Begriff „metis“ als Synonym für eine<br />
Hebammenkunst (Mäeutik) ist im übertragenem Sinne für aktivierende Gemeinwesenarbeit<br />
wesentlich: GWA agiert sozusagen als Geburtshelferin für aktivierende Handlungsweisen<br />
aus der komplexen Wirklichkeit der Adressatinnen. Damit jedoch der Begriff<br />
„metis“ dem Anspruch des Handelns gemeinwesenorientierter Arbeit entsprechen<br />
kann, bedarf dieser meines Erachtens einer Erweiterung um das Adjektiv „praktisch“.<br />
Diese findet in Anlehnung an Bourdieu statt, der in seinem Anspruch an die Ethnologen<br />
von dem „praktischen Sinn“ spricht. Hierzu schreibt er: „Die Ethnologen hingegen wären<br />
nicht so fixiert auf die Sprache des mechanischen Modells, wenn sie unter der Idee<br />
des Gabentausches … auch ihre eigenen Gesellschaftsspiele verstünden, die sprachlich<br />
als Takt, Fingerspitzengefühl, Feinfühligkeit, Gewandtheit oder Lebensart bezeichnet<br />
werden – nur andere Namen für den praktischen Sinn…“ (Bourdieu 1997 zit. in<br />
Langhanky u.a. 2004, 177). In den folgenden Ausführungen findet in Anlehnung an<br />
Jullíen und Bourdieu der Begriff „metis“ seine Umsetzung in der Kunst der praktischen<br />
Klugheit, die mir für die Darstellung der Handlungsweisen aktivierender weiblicher<br />
GWA von enormer Bedeutung erscheint. Der erste Teil dieses Kapitels beleuchtet die<br />
Umsetzung der wesentlichen Handlungselemente von GWA in der <strong>Rötenberg</strong>er Praxis.<br />
Im Folgenden gehe ich auf die Wirksamkeit des Handelns kurz ein, um abschließend<br />
die Notwendigkeit von Ahnungen und deren Nutzen im Sinne der „praktischen Klugheit“<br />
zu erläutern.<br />
88 Kronos stellt in der griechischen Mythologie den jüngsten Sohn der Gaia (Erde) und des Uranos<br />
(Himmel) dar.<br />
93
9B5.1 Die theoretischen Handlungselemente in der Praxis<br />
Nach der bereits ausführlich dargestellten Theorie sowie den beschriebenen Wirkungen<br />
aktivierender weiblicher GWA auf die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen erscheint mir die Verknüpfung<br />
der theoretischen Handlungsweisen mit der Praxis angebracht. Dargestellt<br />
werden soll diese anhand der wesentlichen Elemente (vgl. Kapitel 1.2.1) von Gemeinwesenarbeit.<br />
Nützliche Dienstleistungen (Ressourcen)<br />
Dieses Handlungselement konkretisiert sich in der alltäglichen Arbeit der Mitarbeiterinnen<br />
auf dem <strong>Rötenberg</strong> in einem spezifisch lebensweltlichen Blick, der erkennt, „was<br />
Frauen wollen“: Egal ob es um (Schutz-)Räume, um Alphabetisierungs- und Sprachkurse<br />
oder um Verhandlungen mit der Wohnungsbaugesellschaft geht, die Mitarbeiterinnen<br />
des JNZ versuchen den Frauen einen niedrigschwelligen Zugang zu den notwendigen<br />
Ressourcen zu ermöglichen. Nützliche Dienstleistungen erfahren die Frauen<br />
aber auch bei ihren ganz „unspektakulären“ Sorgen Alltag: Die Mitarbeiterinnen sind<br />
da, sie haben eine offene Tür sowie ein offenes Ohr für die Anliegen und nehmen auch<br />
die „kleinen“ Sorgen und Nöte der Frauen ernst. Das Ziel hierbei ist, gemeinsam mit<br />
den Frauen einen Rahmen der gelingenderen Alltagsbewältigung zu schaffen.<br />
Beratung und Aktivierung<br />
Die Umsetzung dieses Handlungselementes durch die Mitarbeiterinnen des JNZ drückt<br />
sich in der konkreten Beratung in Alltagssituationen, in der begleitenden Beratung von<br />
selbstorganisierten Projekten und in der Aktivierung der <strong>Rötenberg</strong>frauen zur selbstbestimmten<br />
Gestaltung ihres Lebens aus. Das meines Erachtens eindrücklichste Beispiel<br />
hierfür sind die „<strong>Rötenberg</strong>er FrauenGeschichten“. Aber auch der Nähkurs, der<br />
Deutschkurs oder die Tatsache, dass sich die Frauen das bisher begleitete Projekt des<br />
„Bewohnertreffs“ nun auch in Eigenregie zutrauen, kann als sicheres Indiz von gelingender<br />
Beratung und Aktivierung interpretiert werden. Es zeigt, dass die Mitarbeiterinnen<br />
die Widersprüchlichkeiten des spezifischen Frauenlebens in Armut erkannt haben<br />
und exakt an diesen Knotenpunkten ansetzen. Lediglich anhand des lebensweltlichen<br />
Blickes auf die subjektiven Perspektiven sowie einem für die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen akzeptierbaren<br />
Handeln können diese „Knoten“ sichtbar gemacht und eventuell auch<br />
„gelockert“ werden.<br />
94
Kulturelle Gemeinwesenarbeit fördert Eigentätigkeit und Genuss<br />
Angesichts des hohen Prozentsatzes von Menschen mit Migrationshintergrund in der<br />
Siedlung <strong>Rötenberg</strong>, spielt das Handlungselement Kultur, im besonderen auch bei<br />
Frauen, eine bedeutsame Rolle: „In der Fremde, besonders dort, wo man ständig daran<br />
erinnert wird, dass man fremd ist, wird versucht, ein Stück Heimat aufzubauen, um<br />
Selbstwertgefühle zu stärken“ (Stadt Aalen 2005, 29). Anhand vieler unterschiedlicher<br />
Projekte und Aktionen, wie beispielsweise das jährliche interkulturelle Sommerfest auf<br />
dem <strong>Rötenberg</strong> oder das „Ramadanfest“, versuchen die Mitarbeiterinnen, den verschiedenen<br />
Kulturen Raum zu geben, die kulturellen Fähig- und Fertigkeiten der Frauen<br />
sichtbar und dadurch auch „wertschätzbar“ zu machen, mit dem Ziel, sie in ihrer<br />
Vielfalt und ihrer Andersartigkeit zu stärken.<br />
GWA ist Teil lokaler Politik<br />
Lokale Politik als zentrales Element aktivierender GWA wird im <strong>Rötenberg</strong> besonders<br />
deutlich, wenn man auf die über 30-jährige Geschichte und den aktuellen Stand der<br />
Dinge blickt. Die langjährige Lobbyarbeit der Mitarbeiterinnen für mehr Lebensqualität<br />
im Stadtteil, insbesondere für die Interessen von Frauen, trägt Früchte: Durch die Akquise<br />
von Programmen wie „Soziale Stadt“ und „LOS“ hat sich die Lebens- und Wohnqualität<br />
wesentlich verbessert. Die Strategie, sich nicht mit den politischen Nebenbühnen<br />
zu begnügen, sondern die Themen der Frauen und ihre Lebenswelten regelmäßig<br />
auf der politischen Hauptbühne zu platzieren, scheint zumindest, was die Entwicklung<br />
von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der Frauen betrifft, Wirkung zu zeigen.<br />
Dieses parteiliche Engagement der Mitarbeiterinnen des JNZ für die Verbesserung der<br />
Lebensräume der Frauen im Stadtteil zeugt meines Erachtens von einem grundsätzlich<br />
politischen Verständnis von GWA, das sich in unterschiedlichen Formen der Einmischung<br />
konkretisiert.<br />
Vernetzung<br />
Vernetzung als Handlungselement aktivierender GWA scheint auf den ersten Blick<br />
grundsätzlich zu sein, und dennoch halte ich eine kurze Erläuterung für notwendig.<br />
Vernetzung bedeutet zum einen, die Vernetzung von Information: Teilhabe an den für<br />
den Stadtteil wichtigen Informationen. Dies kann beispielsweise der Stand der Dinge<br />
im Rahmen von Projekten der Sozialen Stadt oder LOS sein oder Veränderungen<br />
betreffen, die eher verwaltungstechnischer oder politischer Natur sind. Vernetzung bedeutet<br />
zum Zweiten, die Angebote für die <strong>Rötenberg</strong>erinnen im Sinne von Brauchbarkeit<br />
sowie der zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit zu gestalten. Zum dritten heißt<br />
Vernetzung, die Kooperation der politisch Verantwortlichen sowie der Träger im Stadt-<br />
95
teil. Das Paradebeispiel hierfür stellt meines Erachtens das Projekt Soziale Stadt dar,<br />
in dessen Rahmen die Mitarbeiterinnen mit feinfühliger bis hartnäckiger Moderation der<br />
Interessen von Verwaltung, Politik und Gemeinwesen in vielseitigen Projekten versuchen,<br />
die Interessen der Stadtteilbewohnerinnen zum roten Faden des politischen und<br />
verwaltungstechnischen Tuns und Lassens zu machen.<br />
5.2 Die Wirksamkeit des Handelns<br />
Die Handlungen der Mitarbeiterinnen des Jugend- und Nachbarschaftszentrum können<br />
als eine grundsätzliche und kontinuierliche Aufnahme von Verhandlungen „rund um“<br />
alles Soziale verstanden werden, mit dem Ziel, dieses in einem öffentlichen Raum zu<br />
platzieren.<br />
Frei interpretiert nach Hannah Arendt könnte das Handeln der Mitarbeiterinnen auch<br />
als Handeln gegen „das Absterben des Staates und des Gemeinsinns, der sich nur im<br />
öffentlichen Raum zur Geltung bringen kann (und) den damit verbundenen Praxisentzug<br />
und das Überhandnehmen der reinen Verwaltung“ (Arendt 1987, 81) verstanden<br />
werden. Die Frage des Handelns führt Arendt in ihrem Buch „Macht und Gewalt“ weiter<br />
aus: „Was den Menschen zu einem politischen Wesen macht, ist seine Fähigkeit zu<br />
handeln; sie befähigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache<br />
mit ihnen zu machen, sich Ziele zu setzen und Unternehmungen zuzuwenden, die<br />
ihm nie in den Sinn kommen können, wäre ihm nicht diese Gabe zuteil geworden, etwas<br />
Neues zu beginnen“ (Arendt 1987, 81).<br />
Diese dem Handeln zu Grunde liegende Haltung, die „wie keine andere menschliche<br />
Fähigkeit unter dem ´Fortschritt´ der Neuzeit gelitten hat“ (ebd., 81) erscheint mir im<br />
JNZ grundlegend verankert zu sein: Handeln wird hier als Fähigkeit verstanden, sich<br />
zusammenzutun, zu kooperieren, gemeinsam soziale Bezüge zu gestalten und gemeinsam<br />
etwas zu verändern. Diese grundlegende Haltung zeigt, dass Handeln in diesem<br />
Sinne nicht etwas ´Gemachtes´ ist, sondern eine Entwicklung darstellt, das notwendige<br />
„gemeinsame Dritte“ herauszufinden. Im weitesten Sinne kann diese Haltung<br />
auch als „die Suche nach dem Glück oder dem gelingenderen Alltag“ verstanden werden,<br />
woraus eine ganz andere Art und Weise im Umgang mit dem Feld resultiert. Wirksamkeit<br />
kann daher nicht in der Herstellung von etwas gesehen werden, sondern in<br />
seiner Entstehung: als etwas, das durch das Zusammenkommen von Ressourcen erkennbar<br />
wird, wodurch die Mitarbeiterinnen im Handeln an Bedeutung verlieren. Das<br />
bedeutet zwangsläufig auch, dass das Handeln im Feld gerade da, wo es am erfolg-<br />
96
eichsten ist, nicht mehr als Handeln der Mitarbeiterinnen identifiziert werden kann (vgl.<br />
Langhanky u.a. 2004, 180).<br />
Das Bedeutende an der „praktischen Klugheit“ im Handeln der Mitarbeiterinnen auf<br />
dem <strong>Rötenberg</strong> besteht für mich in der besonderen Aufmerksamkeit bezüglich der Gelegenheiten<br />
im Feld oder anders formuliert, in der Kunst, den alltäglichen Blick auf die<br />
Gunst der Stunde zu richten. Gemeint ist hiermit, dass das Zusammentreffen von Bedarf<br />
und Ressource, von Interesse und Anfrage, von Zeit und Ort nur begrenzt organisiert<br />
bzw. „gemacht“ werden kann. Das Bedeutende daran erscheint mir, dass sich alle<br />
Handelnden als Koordinatorinnen dieser Gelegenheiten verstehen (vgl. Langhanky u.a.<br />
2004, 179). Doch auch hier zeigt sich das Problem der Wirksamkeit, denn worin kann<br />
der Erfolg im Handeln gesehen werden: Wenn eine Mitarbeiterin scheinbar zufällig<br />
einer Frau im Stadtteil mit musikalischen Fähigkeiten begegnet, die ein Konzert geben<br />
möchte? Oder was stellt den Handlungsbeitrag einer Mitarbeiterin dar, wenn eine Mutter<br />
an einem Stadtteilfest eine andere Mutter kennen lernt und sich neben der entstehenden<br />
Freundschaft eine wechselseitige Beziehung der Unterstützung entwickelt?<br />
Erfolgreiches Handeln der Mitarbeiterinnen des <strong>Rötenberg</strong>s kann als eine „Ermöglichung“<br />
von Möglichkeiten gesehen werden. Die Mitarbeiterinnen ziehen sich nach der<br />
Verknüpfung zweier Möglichkeiten zurück, bleiben im Hintergrund, sind da, wenn sie<br />
gebraucht werden im respektvollen Vertrauen in die Fähigkeiten, Eigensinnigkeiten und<br />
Gestaltungspotenziale der Frauen.<br />
5.3. Vom Nutzen der AhnungF<br />
89<br />
In seiner Skizze zu „Ahnung und Erkenntnis“ beschreibt Hogrebe Ahnungen im Verhältnis<br />
zu Wissen wie folgt: „Ahnungen stehen so am Anfang unserer kognitiven Karriere<br />
und bleiben an sie angeschlossen, selbst wenn wir kognitiv avancieren. Der Zusammenhang<br />
lässt sich so skizzieren: Ahnungen weisen in die richtige Richtung oder<br />
sie tun es nicht. Avancierte Ahnungen sind Vermutungen und diese bestätigen sich<br />
oder tun es nicht. Avancierte Vermutungen sind Meinungen und die sind begründet<br />
oder sie sind es nicht. Avancierte Meinungen sind Wissen und das ist wahr. … Da wir<br />
aber nie sicher sein können, ob wir wirklich wissen, muss der gesamte Corpus unserer<br />
Überzeugungen, Meinungen und unseres Wissens stets von unserer Ahnungsnatur<br />
umgriffen bleiben, wenn wir für Neues in grundsätzlicher Weise empfänglich bleiben<br />
wollen“ (Hogrebe zit. in Langhanky u.a. 2004, 191). Die Basis unserer Wahrnehmung<br />
89 Vgl. Langhanky u.a. 2004<br />
97
von sozialen Bezügen stellt nach Hogrebe die Ahnung dar, im Besonderen dort, wo<br />
Neues an die Stelle von Routinen tritt oder wo komplexe Situationen Kooperationen<br />
und Scharniere benötigen. Ahnungen scheinen also etwas Grundlegendes zu sein und<br />
können trotz ihrer Ungewissheit hilfreich sein: „Die Gebrechlichkeit von Ahnungen erwies<br />
sich in der Regel nicht als Hindernis ihres Nutzens für das Leben. Im Gegenteil:<br />
Ahnungen beschleunigen unsere Geschäft mit Informationen, sie helfen uns, die Übersicht<br />
zu behalten und in gewissen Situationen mit heiler Haut davonzukommen“ (ebd.,<br />
192).<br />
Das sozialräumliche Handeln der Mitarbeiterinnen am <strong>Rötenberg</strong> zeichnet sich meines<br />
Erachtens durch die bewusste Nutzung von Ahnungen aus, anhand derer die Erfassung<br />
komplexer Situationen erleichtert wird. Die Ahnungen sind sozusagen eine Art<br />
Antenne, Gespür oder Sensorium für soziale Situationen. Ahnungen erleichtern und<br />
fördern die Kreativität in der Gestaltung von Kommunikation und Kooperation und stellen<br />
Formen einer elementaren sensorischen Erfahrung dar, die in dialogischen Prozessen<br />
unbewusst genutzt werden. In Anbetracht der endlosen Versuche, das Technologie-Defizit<br />
(vgl. Kapitel 4) instrumentell zu beseitigen, gerät die Nutzung von Ahnungen<br />
immer mehr ins Hintertreffen und verliert an Bedeutung. Die Unterschlagung von Ahnungen<br />
als Bestandteil der Wahrnehmung hieße jedoch, den ersten „Fundus“ und die<br />
erste „Hellsichtigkeit“, auf der spätere Handlungen aufbauen können, zu ignorieren.<br />
Gerade im Zuge der Moderne und ihrer zu Grunde liegenden Komplexität erscheint es<br />
mir umso bedeutender, „Ahnungen“ wieder mehr ins Blickfeld zu rücken, ihre Gültigkeit<br />
zu prüfen und sich mit ihnen als einem wichtigen Sensorium für die Suche nach dem<br />
Glück oder dem gelingenderen Alltag zu beschäftigen.<br />
6. Schlussbetrachtung: Aktivierende GWA auf dem <strong>Rötenberg</strong> –<br />
eine Erfolgsgeschichte?<br />
Die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Frage, ob es sich bei den beschriebenen Wirkungen<br />
aktivierender Gemeinwesenarbeit auf die <strong>Rötenberg</strong>er Frauen um eine Erfolgsgeschichte<br />
handelt, ist auch an dieser Stelle nicht so einfach zu beantworten. Für die<br />
Frauen selbst lohnt es sich allemal – doch die Wirkungen auf die gerechteren und gelingenderen<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse bleiben nach wie vor in der privaten Öffentlichkeit<br />
der Frauen verborgen. Dieser Widerspruch begegnete mir in meinen Recherchen<br />
im <strong>Rötenberg</strong> immer wieder und sprang mich auch bei der Auseinandersetzung<br />
mit Theorie und Praxis wie ein bösartiges „Kastenteufelchen“ regelmäßig an. Auf<br />
Grund dieser scheinbar allgegenwärtigen „bösen Überraschung“ verfestigte sich mein<br />
Eindruck, dass es sich hierbei um ein grundlegendes Problem Sozialer Arbeit im All-<br />
98
gemeinen sowie der GWA im Besondern handelt. Aus einem zwischenzeitlich existentiell<br />
gewordenen Bedürfnis heraus, möchte ich daher die letzten Seiten dieser Arbeit<br />
nutzen, um den Fragen nach dem Selbstverständnis sowie der politischen Veränderungsmacht<br />
Sozialer Arbeit nach zu gehen.<br />
Seit ihren Anfängen übernimmt die Soziale Arbeit die Funktion der „Mittlerin“ zwischen<br />
den gesellschaftlichen Verhältnissen unter dem Diktat des (inzwischen) digitalisierten<br />
Kapitalismus und den Individuen mit ihren Grundbedürfnissen nach Geborgenheit und<br />
Anerkennung, nach Verwurzelung, Identität, Kreativität und Orientierung. Sie hat dafür<br />
zu sorgen, dass die Individuen in dieser Gesellschaft „überleben“, „bestehen“ und sich<br />
möglichst „funktionierend“ in die vorherrschenden Strukturen einreihen. In Zeiten des<br />
globalen Sparens scheint auch die Soziale Arbeit nicht um eine Kategorienbildung, die<br />
Wichtiges von Unwichtigem sowie Pflicht und Kür voneinander trennt, herum zu kommen.<br />
In Zeiten, in denen man sich auf das Wesentliche besinnen sollte, scheinen die<br />
öffentlichen Geldgeber die Forderung von gezielten Angeboten für Frauen und Mädchen<br />
als rebellische Dreistigkeit gegenüber der aktuellen finanzpolitischen Landschaft<br />
zu empfinden. Da der Anspruch einer grundsätzlichen Generalisierung des geschlechtsspezifischen<br />
Blicks, durch den die tatsächliche Geschlechtergerechtigkeit der<br />
Wirklichkeit erfasst werden könnte, in der Sozialen Arbeit nach wie vor aussteht, kann<br />
dies nur eine Rückbesinnung auf den politischen Auftrag, der vielerorts unversehens<br />
unter den Tisch fällt, bedeuten.<br />
In der praktischen Umsetzung müsste dies heißen, sich nicht hinter gesellschaftlichen<br />
Notwendigkeiten zu verstecken, keine bedingungslosen Arrangements mit den politischen<br />
„Sparern“ der Nation zu treffen sowie den viel zitierten Slogan des „Förderns<br />
und Forderns“ an die Stelle zu adressieren, an die er gehört, an die Politik: Mann/Frau<br />
sollte dies durch Einmischungskonzepte unter dem Zeichen der Parteilichkeit, sowie<br />
durch hartnäckige Konfrontation (heraus)fordern. Soziale Arbeit im Allgemeinen und<br />
GWA im Besonderen darf sich nicht länger vor den offiziellen und kommunalen Politikbereichen<br />
drücken, wenn sie wirklichen Einfluss auf die Lebensbedingungen ihrer<br />
Adressatinnen haben möchte. Um sich also nicht der euklidischen Ordnung der Vernunft<br />
beugen zu müssen, bedarf es neuer, bunter und kreativer Formen der Vernetzung,<br />
der Bündnisse und Kooperationen.<br />
Das Problem liegt meines Erachtens allgemein darin begründet, dass wir als Frauen<br />
und Männer in der „Hitze“ der heutigen Lebenswelten nur selten Zeit haben „inne zu<br />
halten“, um über die Bedeutungen und Wirkungen unseres Handels nachzudenken.<br />
Die meisten Handlungen verrichten wir, ohne deren Gründe oder deren Wirkungen,<br />
99
oder beides zu verstehen. Nehmen wir einmal das Beispiel des Autofahrens: Die wenigsten<br />
Menschen, die ein Auto fahren, wissen, wie es funktioniert. Im Prinzip ist das ja<br />
auch nicht wichtig. Die letzte Reaktion der Wirkungskette erfahren wir, indem das Auto<br />
schnell oder langsam fährt oder vielleicht stehen bleibt. Was sich jedoch im Inneren der<br />
Maschine abspielt, welchen Belastungen die verschiedenen Lager, Zylinder oder Kolben<br />
ausgesetzt sind, darüber wissen die Wenigsten etwas. Die Frage ist nun, was es<br />
ändern würde, wenn wir den genauen Ablauf des Zusammenspiels verschiedener Kräfte<br />
verstehen würden. Zunächst einmal nichts, da wir uns in jedem Falle für die Nutzung<br />
des Autos entscheiden würden. Und dennoch, je häufiger wir Handlungen verrichten,<br />
deren Gründe, Bedingungen und Wirkungen uns nicht bewusst sind, umso häufiger<br />
werden wir selbst zu Grund, Bedingung und Wirkung von Handlungen anderer. Dieses<br />
Beispiel soll von meiner Seite als Appell verstanden werden, sich die eigenen Handlungen<br />
bewusst zu machen, um politische Wirkungen erzielen zu können. In Zeiten, in<br />
denen es so einfach ist, in Zynismus zu verfallen und die Träume und Utopien zu verwerfen,<br />
bevor ihnen Flügel wachsen können, soll diese Forderung als Aufruf zur „Verteidigung<br />
des Glücks“ verstanden werden.<br />
Als abschließende Empfehlung meine ich im Übrigen, dass wir des öfteren die „sublunare“<br />
Weltsicht, also die Sicht vom Mond aus, einnehmen sollten. Man/frau betrachte<br />
die Erde vom Monde aus und betrachte zunächst die Perspektive: die Sonne strahlt<br />
und die Sterne haben sich herausgeputzt, die Schlüsselblumen sprießen und die Vöglein<br />
zwitschern in Harmonie…und da, aufdringlich und unschön ragen die Missstände<br />
gen Himmel, getaucht in cooles Blau, Grau und Schwarz, ganz unauffällig – und nur<br />
vom Mond aus sieht man ihre feuerrote Spitzen, die so rot in den Sphären des Universums<br />
leuchten, wie die Nase Pinocchios, wenn er lügt…<br />
100
6BLiteraturverzeichnis:<br />
Aalener Nachrichten: „Die Probleme finden sich oftmals hinter der Fassade“, am<br />
09.03.2005<br />
Alinsky, Saul D.: Anleitung zum Mächtigsein. Ausgewählte Schriften. 2. Aufl.; Göttingen:<br />
Lamuv Verlag GmbH, 1999<br />
Alinsky, Saul D.: Die Stunde der Radikalen. Ein praktischer Leitfaden für realistische<br />
Radikale. Strategien und Methoden der Gemeinwesenarbeit II. Gelnhausen/Berlin:<br />
Burckhardthaus-Verlag, 1974<br />
Arendt, Hannah: Macht und Gewalt. München: Piper, 1987<br />
Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung. 7. bearbeitete Aufl.;<br />
Berlin: Walter de Gruyter Verlag, 1993<br />
Bandura, Albert: Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman, 1997<br />
Beck, Ulich; Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg): Riskante Freiheiten. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp, 1994<br />
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt<br />
a.M.: Suhrkamp, 1986<br />
Bitzan, Maria: „Das weibliche Gemeinwesen – verdeckte Provinz der GWA- oder: wie<br />
kommt der Küchentisch auf die Straße?“ In: Bitzan, Maria; Klöck, Tilo: Jahrbuch<br />
Gemeinwesenarbeit 5. Politikstrategien – Wendungen und Perspektiven. München:<br />
<strong>AG</strong> SPAK Bücher, M 122, 1994<br />
Bitzan, Maria: „Das weibliche Gemeinwesen. Zur sozialpädagogischen Arbeit mit<br />
Frauen in Brennpunkten“. Widersprüche, 11, 1991, 67-75<br />
Bitzan, Maria: „Das weibliche Gemeinwesen. Zur sozialpädagogischen Arbeit mit<br />
Frauen in Brennpunkten“. Widersprüche 11, 1991, 67-75<br />
Bitzan, Maria; Klöck, Tilo: Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 5. Politikstrategien – Wendungen<br />
und Perspektiven. München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher, M 122, 1994<br />
Bitzan, Maria; Klöck, Tilo: Wer streitet denn mit Aschenputtel? – Konfliktorientierung<br />
und Geschlechterdifferenz. München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher, M 108, 1993<br />
Boulet, Jaak; Krauß, Jürgen; Oelschlägel, Dieter: Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip.<br />
Eine Grundlegung. Bielefeld, 1980<br />
Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Lebenslagen in Deutschland. Der 2.<br />
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin, 2005<br />
Burdewick, Ingrid: Jugend – Politik – Anerkennung. Eine qualitative Studie zur politischen<br />
Partizipation 11 – bis 18-Jähriger. Opladen: Leske + Budrich, 2003<br />
Cassirer, Ernst: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der<br />
Kultur. Hamburg: Meiner, 1996<br />
Deutscher Städtetag: Hinweise zur Arbeit in sozialen Brennpunkten. Köln, 1979<br />
101
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hg): Fachlexikon der Sozialen<br />
Arbeit. 5. Aufl.; Frankfurt a.M.: Eigenverlag, 2002<br />
Dieter Oelschlägel: „Einmischen und skandalisieren. Vorläufige Bemerkungen zum<br />
Wandel des Politikverständnisses in der Gemeinwesenarbeit“. sozial extra 2, 1991, 7-8<br />
Duden: Das Herkunftswörterbuch. Bd. 7. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1989<br />
Ebbe, Kisten; Friese, Peter: Milieuarbeit. Grundlagen präventiver Sozialarbeit in lokalen<br />
Gemeinwesen. Stuttgart, 1989<br />
Eberhart, Cathy: „Jane Addams – Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Refompolitik“. In:<br />
Harenberg: Das Buch der tausend Frauen. Mannheim: Meyers Lexikonverlag, 1995<br />
Enders-Dragässler, Uta; Sellach, Brigitte: „Weibliche „Lebenslagen“ und Armut am<br />
Beispiel von allein erziehenden Frauen“. In: Hammer, Veronika; Lutz, Ronald (Hg):<br />
Weibliche Lebenslagen und soziale Benachteiligung. Theoretische Ansätze und empirische<br />
Beispiele. Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2002<br />
Erikson, Erik: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1959<br />
Flammer, August: Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit. Bern: Huber, 1990<br />
Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Reinbeck bei Hamburg:<br />
Rowohlt Taschenbuch-Verlag, 2006<br />
Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl.; Opladen:<br />
Westdeutscher Verlag, 1990<br />
Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands. Die gesellschaftliche Entwicklung<br />
vor und nach der Vereinigung. 3. Aufl.; Opladen: Westdeutscher Verlag, 2002<br />
Geßler, Brigitte: Konzeption der Arbeitsgemeinschaft <strong>Rötenberg</strong>. Aalen, 2006<br />
Gillich, Stefan (Hg): Gemeinwesenarbeit: Die Saat geht auf. Grundlagen und neue<br />
sozialraumorientierte Handlungsfelder. 1. Aufl.; Gelnhausen: TRIGA Verlag, 2004a<br />
Gillich, Stefan: „Ein Arbeitsprinzip schlägt Wurzeln: Gemeinwesenarbeit in der<br />
Wohnungslosenhilfe“. In: Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg): Gemeinwesenarbeit.<br />
Entwicklungslinien und Handlungsfelder. 1. Aufl.; Neu-Ulm: <strong>AG</strong> Spack Bücher,<br />
2004b<br />
Gillich, Stefan: „Einführung“. In: Gillich, Stefan (Hg): Gemeinwesenarbeit: Die Saat<br />
geht auf. Grundlagen und neue sozialraumorientierte Handlungsfelder. 1. Aufl.;<br />
Gelnhausen: TRIGA Verlag, 2004a<br />
Grundgesetz mit Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland,<br />
Menschenrechtskonvention, Verfahrensordnung Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte,<br />
Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Parteiengesetz, Untersuchungsausschussgesetz<br />
und Gesetz über den Petitionsausschuß. 38., Aufl. München: Deutscher<br />
Taschenbuch Verlag, 2003<br />
102
Hammer, Veronika; Lutz, Ronald (Hg): Weibliche Lebenslagen und soziale Benachteiligung.<br />
Theoretische Ansätze und empirische Beispiele. Frankfurt, New York: Campus<br />
Verlag, 2002<br />
Herriger, Norbert: „Empowerment – Annäherung an ein neues Fortschrittprogramm<br />
der sozialen Arbeit“. Neue Praxis, 3, 1991, 221-229<br />
Hinte, Wolfgang: „Entlang den Interessen der Wohnbevölkerung. Zur Erinnerung<br />
an die Radikalität eines Konzepts“. In: Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg.):<br />
Gemeinwesenarbeit. Entwicklungslinien und Handlungsfelder. 1. Aufl.; Neu-<br />
Ulm: <strong>AG</strong> Spack Bücher, 2004, 45-55<br />
Hinte, Wolfgang: „Gemeinwesenarbeit. Zur Erinnerung an ein aktuelles Konzept“.<br />
forum sozial, 1,2004, 7-10<br />
Hinte, Wolfgang: „Von der Gemeinwesenarbeit über die Stadtteilarbeit zum Quartiersmanagement“.<br />
In: Thole, Werner (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein<br />
einführendes Handbuch. Opladen: Leske + Budrich, 2002<br />
Hinte, Wolfgang; Lüttringhaus, Maria; Oelschlägel, Dieter: Grundlagen und Standards<br />
der Gemeinwesenarbeit. Reader. Münster: Votum Verlag, 2001<br />
Hitzler, Ronald; Honer, Anne: „Bastelexistenz. Über subjektive Konsequenzen der<br />
Individualisierung“. In: Beck, Ulich; Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg): Riskante Freiheiten.<br />
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994, 307-315<br />
Jahoda, Maria: “Environment and mental health”. International Social Science Journal,<br />
11, 1959, 14-23<br />
Jerusalem Matthias; Pekrun, Reinhard: Emotion, Motivation und Leistung. Göttingen:<br />
Hogrefe, 1999<br />
Jerusalem, Matthias: „Einleitung“. In: Jerusalem, Matthias; Hopf, Diether (Hg):<br />
„Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen“. Zeitschrift für<br />
Pädagogik. 44. Beiheft, 2002<br />
Jerusalem, Matthias; Mittag, Waldemar: „Selbstwirksamkeit, Bezugsnormen, Leistung<br />
und Wohlbefinden“. In: Jerusalem Matthias; Pekrun, Reinhard: Emotion, Motivation<br />
und Leistung. Göttingen: Hogrefe, 1999, 223-245<br />
Jullíen, François: Über die Wirksamkeit. Berlin: Merve Verlag, 1999<br />
Jung, Carl G.: Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Zürich, 1933<br />
Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl.; Berlin,<br />
New York: De Gruyter, 1989<br />
Krebs, Wolfgang: „Die fünf Wellen“. In: Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg): Jahrbuch<br />
Gemeinwesenarbeit 7. Entwicklungslinien und Handlungsfelder. München: <strong>AG</strong><br />
SPAK Bücher M 165, 2004, 57-65<br />
Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung. Band 1 Methodologie, 3. korrigierte<br />
Aufl.; Weinheim: Beltz, 1995<br />
103
Langhanky, Michael; Frieß, Cornelia; Hußmann, Marcus; Kunstreich, Timm: Erfolgreich<br />
sozial-räumlich handeln. Eine Evaluation der Hamburger Kinder- und Familienzentren.<br />
Bielefeld: Kleine Verlag GmbH, 2004<br />
Leibfried, Stephan; Voges, Wolfgang (Hg): Armut im modernen Wohlfahrtsstaat.<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992 (Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie<br />
und Sozialpsychologie)<br />
Lewin, Kurt: Feldtheorie. Werkausgabe Band 4. Stuttgart, 1982<br />
Lüttringhaus, Maria: „Erfolgsgeschichte Gemeinwesenarbeit – die Saat geht auf?“ In:<br />
Gillich, Stefan (Hg): Gemeinwesenarbeit: Die Saat geht auf. Grundlagen und neue<br />
sozialraumorientierte Handlungsfelder. 1. Aufl.; Gelnhausen: TRIGA Verlag, 2004a,<br />
16-26<br />
Maslow, Abraham H.: Motivation und Persönlichkeit. Reinbeck, 1969<br />
Mayring, Phillip: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 7. Aufl.;<br />
Weinheim: Beltz Verlag, 2000<br />
Meier, Uta: „Warum Frauen und Männer (keine) Kinder haben wollen“. Frühe Kindheit,<br />
1, 2003, 16-23<br />
Meyer, Elisabeth: „…wenn der Mut nicht gewesen wäre…“. Ein Frauenleben im sozialen<br />
Brennpunkt. In: Rösgen, Neumaier, Hillenbrand, Luner (Hg): Jahrbuch Gemeinwesenarbeit<br />
4. Frauen. München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher, M78, 1987<br />
Meyers Grosses Taschenlexikon. 4. Aufl.; Mannheim, 1992<br />
Mies, Maria (Hg.): Ökofeminismus. Beiträge zur Theorie und Praxis. Zürich: Rotpunktverlag,<br />
1995<br />
Mies, Maria: „Feministische Forschung. Wissenschaft – Gewalt – Ethik“. In: Mies, Maria<br />
(Hg.): Ökofeminismus. Beiträge zur Theorie und Praxis. Zürich: Rotpunktverlag,<br />
1995<br />
Morgan, David L.: Focus groups as qualitative research. Thousand oaks: Sage Publications,<br />
1997<br />
Müller, C. Wolfgang: Wie Helfen zum Beruf wurde. 1 Bd. 3. unveränderte Aufl.;<br />
Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1991<br />
Müller, C. Wolfgang: Wie Helfen zum Beruf wurde. 2 Bd. 2. Aufl.; Weinheim und<br />
Basel 1992<br />
Müller, Siegfried; Otto, Ulrich (Hg): Armut im Sozialstaat. Gesellschaftliche Analysen<br />
und sozialpolitische Konsequenzen. Neuwied: Luchterland, 1997<br />
Müller, Wolfgang C.: „Von der Methode zum Prinzip. Dieter Oelschlägel als Gemeinwesenarbeiter“.<br />
In: Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg): Jahrbuch Gemeinwesenarbeit<br />
7, Entwicklungslinien und Handlungsfelder. München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher M 165,<br />
2004, 29-32<br />
104
Nahnsen, Ingeborg: „Bemerkung zum Begriff der Sozialpolitik in den Sozialwissenschaften“.<br />
In: Osterland, Martin (Hg): Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotential.<br />
Frankfurt a.M., 1975<br />
Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg): Gemeinwesenarbeit. Entwicklungslinien und<br />
Handlungsfelder. 1. Aufl.; Neu-Ulm: <strong>AG</strong> Spack Bücher, 2004b<br />
Odierna, Simone; Berendt, Ulrike (Hg): Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 7. Entwicklungslinien<br />
und Handlungsfelder. München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher M 165, 2004<br />
Oelschlägel, Dieter: „Aktuelle Entwicklungen in der Gemeinwesenarbeit mit besonderer<br />
Berücksichtigung der neuen Bundesländer“. In: Hinte, Wolfgang; Lüttringhaus, Maria;<br />
Oelschlägel, Dieter: Grundlagen und Standards der Gemeinwesenarbeit. Münster:<br />
Votum Verlag, 2001b, 92-114<br />
Oelschlägel, Dieter: „Gemeinwesenarbeit“. In: Otto, Hans-Uwe; Thiersch, Hans (Hg):<br />
Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik. 2. völlig neu überarbeitete Aufl.; Neuwied,<br />
Kriftel: Luchterhand, 2001a<br />
Oelschlägel, Dieter: „Sich schämen ist nicht genug – Gemeinwesenarbeit im Armutsquartier“<br />
Brennpunkte Sozialer Arbeit „Armut“. Neuwied, 1993, 60-96<br />
Oelschlägel, Dieter: Stand und Trends der GWA in Deutschland. In: forum SOZIAL,<br />
1, 2004, 11-18<br />
Osterland, Martin (Hg): Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotential. Frankfurt<br />
a.M., 1975<br />
Otto, Hans-Uwe; Thiersch, Hans (Hg): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik. 2.<br />
völlig neu überarbeitete Aufl.; Neuwied, Kriftel: Luchterhand, 2001<br />
Pfaff, Anita: „Feminisierung der Armut durch den Sozialstaat“. In: Leibfried, Stephan;<br />
Voges, Wolfgang (Hg): Armut im modernen Wohlfahrtsstaat. Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag, 1992 (Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie),<br />
(32), 421-455<br />
Rausch, Günter: „Eine Renaissance der Gemeinwesenarbeit. Zukunftsperspektiven<br />
feldorientierter Sozialarbeit“. In: Sozialpädagogik, 1, 1997, 2-8<br />
Rausch, Günter: Gemeinschaftliche Bewältigung von Alltagsproblemen – Gemeinwesenarbeit<br />
in einer Hochhaussiedlung. Münster: LIT Verlag, 1998<br />
Rauschenbach, Thomas; Gängler, Hans (Hg): Soziale Arbeit und Erziehung in der<br />
Risikogesellschaft. Neuwied: Luchterhand, 1992<br />
Rauter, E.A.: Wie eine Meinung in einem Kopf entsteht. Über das herstellen von Untertanen.<br />
5. Aufl. München: Weismann Verlag, 1972<br />
Reinl, Heidi: „Ist die Armut weiblich?“ Über die Ungleichheit der Geschlechter im Sozialstaat“.<br />
In: Müller, Siegfried; Otto, Ulrich (Hg): Armut im Sozialstaat. Gesellschaftliche<br />
Analysen und sozialpolitische Konsequenzen. Neuwied: Luchterland, 1997, 113-<br />
134<br />
105
Rogers, Carl R.: On becoming a person – a psychotherapists view of Psychotherapy.<br />
Constable, 1961<br />
Röser, Jutta: Frauenzeitschriften und weiblicher Lebenszusammenhang. Themen,<br />
Konzepte und Leitbilder im sozialen Wandel. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992<br />
Rösgen, Neumaier, Hillenbrand, Luner (Hg): Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 4. Frauen.<br />
München: <strong>AG</strong> SPAK Bücher, M78, 1987<br />
Rullmann, Marit; Schlegel, Werner: Frauen denken anders. Philo-Sophias 1x1.<br />
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000<br />
Ryff, C.D, & Singer, B.: “Interpersonal flourishing: a positive health agenda for a<br />
new millennium”. Personality and Social Psychological Review, 4, 2000, 30-44<br />
Ryff, C.D.: “Psychological well-being in adult life”. Curriculum Psychological Science,<br />
4, 1995, 99-104<br />
Ryff, C.D.; Keyes, C.L.M.: The structure of psychological well-being revisted.<br />
Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 1995<br />
Salz, Günther: Armut und Reichtum. Soziale Brennpunkte als Erbe der sozialen Frage:<br />
praktische Erfahrungen und theoretische Einsichten. Freiburg, 1991<br />
Schwäbische Post: „Damit die Bürger sich sicher fühlen“, am 20.04.2004<br />
Schwäbische Post: „Die meisten wollen nicht weg vom <strong>Rötenberg</strong>“, am 12.02.2004<br />
Schwäbische Post: „Eine besondere Erlebnistour für Frauen“, am 09.03.2005<br />
Schwäbische Post: „Für viele Frauen eine Offenbarung“, am 08.02.2006<br />
Schwäbische Post: „Probleme vor Augen“, am 08.04.2003<br />
Schwäbische Post: „Tagesmütter-Ausbildung für Musliminnen“, am 08.04.2006<br />
Schwarzer, Ralf: Themenheft Selbstwirksamkeit. Unterrichtswissenschaft 26, 2, 1998,<br />
98-172<br />
Sellach, Ulrike: Ursache und Umfang von Frauenarmut. Gutachten. Frankfurt a.M.:<br />
Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauenforschung e.V., 2000<br />
Stadt Aalen: Statistisches Jahrbuch 2005. Daten, Zahlen, Informationen. Aalen:<br />
Stadtmessungsamt und kommunale Statistikstelle, 2005a<br />
Stadt Aalen; aalener Frauenbeauftragte; JNZ <strong>Rötenberg</strong> (Hg): <strong>Rötenberg</strong>er Frauen-Geschichten.<br />
Meisterinnen des Lebens. Aalen, 2005b<br />
Stadt Aalen; Weber + Partner: Aalen – <strong>Rötenberg</strong>. Stuttgart, 2004<br />
Statistisches Bundesamt (Hg).: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik<br />
Deutschland. Wiesbaden, 2006<br />
106
Statistisches Bundesamt: Alltag in Deutschland. Analysen zur Zeitverwendung. Beiträge<br />
zur Ergebniskonferenz der Zeitbudgeterhebung 2001/2002. Wiesbaden: Forum<br />
der Bundesstatistik, Bd. 43, 2004<br />
Staub-Bernasconi, Silvia: lokal, national, international oder: vom Ende der Bescheidenheit,<br />
Bern, Stuttgart: Haupt, 1995<br />
Staub-Bernasconi, Sylvia: „Waren die Frauen von Hull-House in Chicago wirklich<br />
Gemeinwesenarbeiterinnen?“ In: Bitzan, Maria; Klöck, Tilo (Hg): Jahrbuch<br />
Gemeinwesenarbeit 5. Politikstrategien – Wendungen und Perspektiven. München:<br />
<strong>AG</strong> SPAK Bücher M 122, 1994<br />
Taylor, Charles: Das Unbehagen der Moderne. 3. Aufl.; Frankfurt a.M.: Suhrkamp,<br />
1997<br />
Taylor, Charles: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit einem Beitrag<br />
von Beitrag von Jürgen Habermas. Frankfurt a.M.: Fischer, 1997<br />
Thiersch, Hans: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Aufgaben der Praxis im<br />
sozialen Wandel. 2. Aufl.; München: Juventa Verlag, 1995<br />
Thole, Werner (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit. Ein<br />
einführendes Handbuch. Opladen: Leske + Budrich, 2002<br />
Todorov, Tzvetan: Abenteuer des Zusammenlebens. Versuch einer allgemeinen<br />
Anthropologie. Berlin: Wagenbach, 1996<br />
Weeber + Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung: Stadt Aalen.<br />
Stuttgart, 2004<br />
Wendt, Wolf Rainer: Geschichte der Sozialen Arbeit. 4. Aufl.; Stuttgart, 1995<br />
Wendt, Wolf-Rainer: „Gemeinwesenarbeit. Ein Kapitel zur Entwicklung und zu ihrem<br />
gegenwärtigen Stand“. In: Ebbe, Kisten; Friese, Peter: Milieuarbeit. Grundlagen präventiver<br />
Sozialarbeit in lokalen Gemeinwesen. Stuttgart, 1989, 1-34<br />
Winkler, Michael: „Modernisierungsrisiken. Folgen für den Begriff der Sozialpädagogik“.<br />
In: Rauschenbach, Thomas; Gängler, Hans (Hg): Soziale Arbeit und Erziehung in<br />
der Risikogesellschaft. Neuwied: Luchterhand, 1992, 61-69<br />
Hwww.aalen.deH, 21.01.2007<br />
Hwww.angela-merkel.de/pdf/070222-rede-merkel-gleiche-rechte-fuer-frauen.pdfH,<br />
25.02.2007<br />
Hwww.angela-merkel.de/pdf/070222-rede-merkel-gleiche-rechte-fuer-frauen.pdf,<br />
10.03.2007H<br />
Hwww.diyanet.org/de/ startseite/index.phpH, 24.02.2007<br />
Hwww.jura.uni-sb.de/BGBl/TEIL1/1994/19942138.1.HTML, 19.02.2007H<br />
Hwww.sgw.hsmagdeburg.de/europeansocialwork/pdf/german/CommunityWork_ger_D<br />
e.pdfH, 10.03.2007<br />
107
Hwww.sozialestadt.deH, 22.01.2007<br />
Hwww.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/alisch/soziale_stadtentwicklung.htmH,<br />
19.02.2007<br />
Hwww.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/alisch/soziale_stadtentwicklung.htmH,<br />
19.02.2007<br />
108
7BAbkürzungsverzeichnis:<br />
<strong>AG</strong><br />
ASD<br />
BDKJ<br />
BMAS<br />
BSHG<br />
bzw.<br />
ca.<br />
CO<br />
D.I.T.I.P<br />
dt.<br />
ebd.<br />
EFS<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Allgemeiner Sozialer Dienst<br />
Bund Deutscher Katholischer Jungend<br />
Bundesministerium arbeit und Soziales<br />
Bundessozialhilfegesetz<br />
beziehungsweise<br />
circa<br />
Community Organization<br />
Diyanet Isleri Türk-Islam Birligi- Türkisch-islamische Union<br />
der Anstalt für Religion<br />
deutsche<br />
Ebenda<br />
Europäischen Sozialfond<br />
f. folgende Seiten<br />
ff.<br />
mehrere folgende Seiten<br />
FOCO<br />
Forum für Community Organization<br />
GWA<br />
Gemeinswesenarbeit<br />
ISSAB<br />
Institut für stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung<br />
JNZ<br />
Jugend- und Nachbarschaftszentrum<br />
KJHG<br />
Kinder- und Jugendschutzgesetz<br />
L<strong>AG</strong> Landesarbeitsgemeinschaft ???<br />
LOS<br />
Lokales Kapital für soziale Zwecke<br />
NGO<br />
Non Government Organizations<br />
o.g.<br />
oben genannt<br />
S<strong>AG</strong>-Ost<br />
Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin Ost<br />
SGB VIII (KJHG)<br />
Sozialgesetzbuch<br />
St.<br />
Sankt<br />
STOA<br />
Städtisches Theater Ostalbkreis<br />
u.a.<br />
unter anderem<br />
UNO<br />
United Nation Organization<br />
vgl.<br />
Vergleich<br />
VHS<br />
Volkshochschule<br />
WHO<br />
Welthandelsorganisation<br />
WILPF<br />
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit<br />
WoBauG<br />
Wohnungsbaugesetz<br />
WohnbinGVWV<br />
Wohnungsbindungsgesetzes<br />
zit.<br />
zitiert<br />
109
Anlage 2:<br />
Interview am 22.11.2006 mit fünf Teilnehmerinnen des „Nähtreffs“<br />
im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>/Aalen<br />
P: Würden Sie mir kurz sagen wie sie heißen?<br />
S: Urban<br />
P: Wenn Sie wollen dürfen Sie mir auch gerne Ihr Alter verraten? Müssen Sie aber<br />
natürlich nicht, wenn Sie nicht wollen!<br />
S: I ben 41. Au scho so alt<br />
P: das ist doch in der Blüte des Lebens<br />
Gemurmel, alle reden durcheinander!<br />
S: Sie mechts doch reihenweis, hend ihr des no et mitkriegt<br />
E: Ja also, no erzähl mal dein Lebenslauf!<br />
Lachen<br />
S: Ja was solle verzähle, wege dahanna, wegen derer Gruppe bei de Näher?<br />
P: Was können sie mir vom <strong>Rötenberg</strong> erzählen, also z.B. wie lange sie hier schon<br />
leben, sind sie verheiratet…<br />
…gemurmel…<br />
S: I leb seit 41 Jahr do, I ben da aufgwachse uffm Röteberg, gschieda bin i, verheiratet<br />
bene et, mehrere Geschwister han i, die au uff´m Röteberg wohnet.<br />
E: n´ganze Staat! elf, zwölf?<br />
S: soviel semmer au et. Mir gfällts halt dahanna. Ja, aber i be gern dahann, beim Nähkurs,<br />
aber au so! Des isch so gut, dass mir au dahanna was hend. Weil sonscht hockt<br />
ma halt immer me uff der Stroß, und au mal andre leut, um uns rum. Des war jetzt des<br />
einzigschte was i jetzt sage könnt.<br />
P: Verraten Sie mir auch ihren Namen?<br />
S: Frau Brot, du kommst dra!<br />
E: Ja! Also, Marie-Luise, also Elsa isch mer lieber! ond i wohn seit 20 Johr do obe,<br />
nach der Scheidung binne da rauf zoge, hab a Wohnung kriegt. Ja und dann habe, a<br />
zeitlang habe no gschafft, im Altersheim, und no bene entlasse worde, ja und seitdem<br />
bene jetzt zwölf Johr arbeitslos! No habbe zwischendurch mol a halbes Johr was ghet,<br />
na wars au wieder rum, ja und vor zwoi Johr hammer no dui gschicht a´gfanga. Da<br />
hemmer da henne alles dapeziert, und grichtet.<br />
P: den Bewohnertreff?<br />
E: Ja, den hemmer dann ufbaut mit der Frau G. und so, da hammer ellas renoviert und<br />
so, des isch da jo auch scho fünf, sechs johr leergstande und …jo na hemmer so unser<br />
1
Gruppe agfange, viermal in der Woch treffe mr uns, no demmer bastle, oder fahre mr<br />
wo na, ja also aregungen hemmer immer gnug, und´s macht richtig Spaß.<br />
P: Und der Bewohnertreff, wie lange gibt es denn jetzt schon?<br />
E: zwei Johr. Also em November send´s zwei Jahr.<br />
P: Habt ihr das alles miteinander aufbebaut?<br />
E: Ja, also so Gerda war zu dere Zeit no et so dabei, die kommt erscht so seit ma halbe<br />
Johr, bissle und Caroline au, ja i mei se hat Familie und Kinder, no hosch au et immer<br />
Zeit, aber grad zum nähe kommt se recht gern. und jo, also uns uns wärs scho arg<br />
recht wenn´s irgendwie weitergange dät, au wenn´s uns nachher nemme äh äh sponsert<br />
wird, dass mers eifach selber weiterbetreibe kennet. Des wär uns scho recht. Aber<br />
i denk au, dass mor da a Chance hend, äh das des irgendwie weitergoht.<br />
P: Ist das hier eine feste Gruppe?<br />
E: Ja, mr send eigentlich scho zemlich stabil.<br />
S: .Emmer zamma, also Mittwochs beim Nähe, und au so sen mir immer zamma.<br />
E: Also, jetzt, äh, grad Frau Dubinah, se schafft jo do, und sie und i, jo, mir send eigentlich<br />
immer da. Au sie isch oft do immer, Blandine, kommt gschwend runder, wenn<br />
sie Zeit hat<br />
P: Ah sie wohnen hier im Haus?<br />
E: Ja, ja, und grad Caroline kommt no immer zum nähe, des isch scho, se hot scho<br />
einiges gmacht, obwohl´s gar koi Ahnung ghet hat mit´m dr Nähmasche, oder net viel,<br />
halt vo dr Schul her no a bissle, aber sie hot scho tolle sache gmacht, seit her, ja.<br />
C: des isch ja eine Knieverstärkung, mei Ma muss ja auf de Knie rumrutscha,<br />
…..gemumel, gelächter….<br />
P: Könnten Sie mir auch kurz Ihren Namen sagen?<br />
B: Ja, meine Name isch Berta Zinkstein, jo ich wohn scho seit füfzg Johr dahenne, be<br />
seit 55 Jahr verheiratet, verwitwet seit scho fascht zehn Johr<br />
E: Ha jo, Blandine hat früher s´lokal ghet, dr schluckspecht, war unser Stammwirtin<br />
B: jo deshalb kenne halt die ganze jonge do, die da uff´gwachse send, ja, han acht<br />
Kinder, vier Enkel, ja,…ja, war a hards lebe,<br />
E: Und no zwei nebeher mit uff´zoge, ne<br />
B: Ja, ja, zwei Pflegekinder gehabt, ja,ja seit vierzg Jahr dahenne, hab scho drei Umbau<br />
mitgmacht,<br />
P: Wie alt ist das Haus hier?<br />
B: Des Haus isch baut worda um, anno 1954 ist des bezogen worden, also s´erschte,<br />
bezoge worda<br />
E: Also so ´52, ´53 isch´s, wirds baut worda sei, noi nach´m Krieg oifach<br />
2
B: Noi, noi 1954 isch des, äh beziehbar, 1954 send da Leit eizoge, weil des wois i weil<br />
damals mei Schwägere als erschte da reizoge isch<br />
E: Also no wirds 1953 baut worra sei?<br />
B: Also 1956 be i eizoge, und so lang wohne do<br />
P: Was waren das für Häuser?<br />
B: Des war früher alles Bauland, da oba<br />
E: Gar nix Blandine, da war eigentlich bloß Wies und Acker<br />
B: Da unde, send Barracka, und des war a Sandgrub dahanne alles<br />
P: Barracken?<br />
E: Baracka, des waret lauter Holzhäuser, so Blockhäuser,<br />
B: Aber…<br />
E: no send so nach und nach die da abaut worda<br />
S: für´d Flüchling oder net, für´d Flüchling send die baut worda<br />
E: Flüchtling send viel raus komme, aus de Barraka,<br />
B. Ja aber für andre halt au, die em himmelwerk gschafft hend<br />
E: für die Leut hot ma da so baut,<br />
B: Ha früher waret´s zwölf Partie, heit sends blos no sechs, send größer gworda die<br />
Wohnunga, hat ma halt aus zwei Wohnunga eine gmacht,<br />
P: Ah, früher waren das zwölf Wohnungen?<br />
B: Ja zwölf Partie waret des früher<br />
E: Jo, a Familie hat do vielleicht zwei, drei Zimmer khet, mit drei vier Kinder, mehr wars<br />
jo damoals et, ne<br />
B: I hab, i ben da obe eizoge 1956, uff der linke seite drübe, oba, ganz oba, da habe<br />
zwei Zimmer khet, und a Kiche, da hots kei Bad, und nix gäh, und zom Klo hosch naus<br />
míesa, von der kiche naus no,<br />
E: Ja aber ihr hend no au em em Keller no au die Gemeinschaftswäschkiche khet, wo<br />
ma badet, also badet, also der Kessel a´gschürt hot, und so<br />
B: Ja desch scho, do hot ma no em Samstags abwechselt, Freitags machets die,<br />
Samstags machet die, no hot me de Kessel a´gschürt und badet, und die kleinere Kinder,<br />
die hat me in der Kiche badet,<br />
S: Des kame sich gar nemme vorstelle<br />
B: Des kennet ihr euch gar nemme vorstelle<br />
P: Ich weiß das nur noch von meiner Oma, die Samstags ihren Ofen anschmiss….<br />
3
B: Jo, jo, des weiß sogar mei Caroline no,<br />
C: Jo freilich,<br />
E: die hent em Sommer in der Wäschkuche badet, im winter hosch immer em Freidig<br />
mittag, send vier so Kessel uff´m Herd g´standa noch´m Kocha, und no isch Badwasser<br />
gmacht worra, bis obends da Vadder komma isch vom Gschäft, das waret no,<br />
d´Mama und der Vadder waret die letschte die badet hent. Oma und mr Kinder scho<br />
mittags<br />
B: Ja wo da hann no der kleine Spielplatz war, no hammer do Spiele gmacht mit dene<br />
Kinder, immer denen Kinder von der „Spielstub“ aus, des war emmer so nett, da machet<br />
se jetzt au nix mehr,<br />
E: Scho lang nix mehr, das war em Afang emmer, und no isch d´Luscht vergange<br />
B: Jetzt isch ja scho unda, aber des isch……<br />
P: Was war da? Mit wem?<br />
E: Von der Spielstube, die haben ein Bussle gehabt<br />
B: Des isch alles weg! Koi Geld, gell<br />
P: Was ist die Spielstube?<br />
C: Das ist das Jugend- und Nachbarschaftszentrum! Mir send immer übers Wochenende,<br />
als ins Wochenende, jo also in so in so a Jugendherberge, semmer da oder die<br />
Jugendliche<br />
E: Ja, ja<br />
C: Oder im Sommer ins Ferienlager<br />
E: Ja vierzehn Tag lang,<br />
C: Da war i nie dabei, aber so, no hat ma halt nachts Nachtwanderunge g´macht,<br />
E. Also schene Sache hend se scho g´macht früher,,<br />
M. Also ´s ganze Wochenende dann des war scho<br />
E: Aber no hots halt au mit denen, no send viele Türke komme, no hots halt Probleme<br />
gebe, do hend se mitmache däffä, aber fort hand die Mädla niergends mit na däffa, und<br />
no hots halt do immer bissle reibereie gebbe, und no hot ma des irgendwie gar nemme<br />
gmacht, a zeitlang, gell, und wie g´seit, Deitsche send jo kaum me unde, die Deitsche<br />
sind immer weniger g´worra<br />
C: Ja i glaub, nach uns hat des so aufghört, mir hend au immer ein offener Obend<br />
ghabt in der Spielstub unda, also des war dann a disco, eimal in der Woch, ja<br />
B: Und des isch jetzt halt älles wegfalle<br />
E: Ja weil sich au niemand me intressiert, no äll Johr hot ma, d´Jugend an Maibaum<br />
g´macht, seit drei, vier Johr machts au niemand me oder scho länger,<br />
B: ha des isch scho zeh Johr her,<br />
4
….geplauder,<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
P: und Sie sind wann hierher gezogen?<br />
O: 1956, ja, ja, ich hatte jetzt erst fünfzigjähriges Jubiläum<br />
E: Jo, aber i hab scho zu ihre g´sagt, i fend des a wenig overschämt, dass des blos in<br />
oire (einer) Wohnung gilt und et au für die, die füfzig Jahr obe wohnet,<br />
…alle durcheinander…<br />
B: Noi, des goht mr et um des, ich wohn jetzt seit 1956 in dem Haus henne, dass ich<br />
mal Kinder krieg, und noch oben ziehge muss, obe, dass i a größere Wohnung han,<br />
dess isch doch aber onaweg in oim Haus.<br />
P: Und das zählt dann irgendwie nich, oder wie?<br />
B: Noi, in einer Wohnung. I hab mein Mietvertrag erscht seit 1978 und i weiß au warum,<br />
da hendse damals bei uns umbaut, hend Bäder gmacht, Kachelöfe neibaut, und<br />
und ab do, hemmer glaub mehr Miete zahle müsse, und dann hemmer wieder ´n neue<br />
Mietvertrag kriegt. Aber des mus der Wohnungsbau doch aufliege, seit wann i dahenne<br />
wohn<br />
E: Ha jo<br />
O: Die müssen ja da sein alle<br />
B: Net wege dem, aber des kriegt er no zu höre, der E., wenn er in ´d Spielstub na<br />
kommt, do gang i na, und und des hört der<br />
alle reden durcheinander<br />
Vorstellung meiner Diplomarbeit, wie kam ich auf das Thema,<br />
P: Wenn sie irgendjemand etwas über den <strong>Rötenberg</strong> erzählen würden, was würden<br />
sie sagen?<br />
E: Also, i kann mi no erinnre, an die Barrake unde, und des war ja immer verpöhnt, dr<br />
Schlauch, Schlauch, so hot des ghoisa<br />
S: Do wo jetzt´s Nachbarschaftszentrum stoht, des hot ma Schlauch g´hoisa<br />
E: Worum oder weshalb, wahrscheinlich weil sie so wie uff ma Schlauch g´stande sind,<br />
die Barrake, i wois es au et so genau, s´waret halt drei Roihe, wie viel Familie hend da<br />
drunter g´wohnt? Auf jeder Barack?<br />
B: An haufa, des weis ich au et<br />
E: Jo des war halt immer a bisle a verpöhnte Gegend, da hot sich au koin Polizist alloi<br />
na traut, blos ein oinziger hot sich alloi ruff traut, die andre send immer blos im Kommandowage<br />
komme<br />
…Gelächter…<br />
B: Ha doch des stimmt<br />
5
E: Doch, doch, a zeitlang war´s scho schlimm? Und einer der hot so a Mofa g´het, ne,<br />
und der isch komme, hat´s vor d´Barrack na g´stellt, isch nei, hat mit de Eldern<br />
g´wätschzt, und in der Zeit send, hend d´Junge s´Mofa ausananderbaut<br />
…gelächter…Räder und so weg, na ischer rauskomme, secht er: „ und wenn des Mofa<br />
net in zeh Minute fertig isch, repariert isch, na isch aber was los, no nemme euch alle<br />
mit“ ne, also gut, na hends die Buba schnell wieder z´samma baut, guat, der hat no a<br />
bierle trunka, na war des wieder ok, nachher hend se aber alle kriegt, vo de Vädder,<br />
ne, d´Junge, und des war jo obe offe, ne, und wenn halt Polzei vorne an die erscht<br />
Barack hergfahre isch, no send die abghaut und do vorne naus, die hend nie oin verwischt<br />
B: Also i woiß no, wo die Spielstub am A´fang, da hat mein Ma und ich, da hemmer<br />
immer Zwiebelkucha backa,<br />
E: Au, ja<br />
B: Unde in der Spielstub, bei Feschla, waret, Kartoffelsalat gmacht, und no isch sogar<br />
dr Oberbürgermeister komme<br />
E: Ja, ja<br />
B: Do hemmer Kartoffelsalat g´macht, gell, also do war´s sche no<br />
E: Aber heit, heit isch nix meh los,<br />
…lautes Gemurmel….<br />
E: Ja no, no send discos uff g´macht worda, und und na send die Junge nadierlich do<br />
na ganga, no war des nemme intressant<br />
C: Noi, ma muss auch wirklich sage, ma muss ehrlich sei, s´isch halt nemme so<br />
E: Ha jo, du bisch au me nakomme<br />
C: Ja des war oifach, wenn de no älter worra bisch, ne isch´s halt, bisch au schaffa<br />
ganga und<br />
E: Orientiersch de halt andersch,<br />
C: Ma isch halt na, zu de Hausufgabe na gange, also middags, und aber irgendwann<br />
wirsch, also isch da halt au weniger los gwä, und na kommts halt au uf die Leut a die<br />
da send, und uff die Betreuer, aber, ja mir hend scho gute Betreuer ghet, aber<br />
S: Die hend halt wieder ganga müssa und na warsch wieder,<br />
E: Jo, des goht halt au immer blos a Jahr, gell, oder höchstens zwei, drei wenn se<br />
d´Ausbildung machet<br />
S: Also i hab uff´m Röteberg a sches Lebe, des sag i,<br />
E: Also i mecht et wo andersch wohna,<br />
allgemeine Zustimmung<br />
C: I mecht nemme da wohna, da mecht i ganz ehrlich sei<br />
E: Du hosch jetzt dei Haus, isch ja klar,<br />
6
C: Noi, des hot nix damit zum do, dass i die Leit et mag oder sonscht ebbes, aber,<br />
E: Bisch dei Haus gwehnt, die eigens, isch doch klar,<br />
C: Ja, auch eifach vom ganze, ja,ja, des isch eifach, des isch halt eifach nemme so wie<br />
früher, sie stecket jo au viel meh… leit rauf …wo … ja,<br />
E: Lauter Kruscht no, ja<br />
C: Und da hoist dann au wieder, ja stecket alles möglich rauf wo andersch net bleibe<br />
ka<br />
E: Jo wo nermet will,<br />
O: Die Alkoholiker, die will die Stadt alle weghaben<br />
B: Die stecket no me rauf, wie dass scho da sind.<br />
C: Aber des isch au,<br />
E: Wie will er die entsorge, no muss er´s he mache. oder was<br />
C: Aber i komm gern, ich hab zwar an wunderschöne Garde, i komm aber em Sommer<br />
trotzdem, mit meine Kinder,<br />
B: Jeden Dag do her,<br />
C: Grad zu meiner Murder jetzt, da und und lass die da spiele, weil do halt au Kinder<br />
drum rum send, aber, aber wohne möchte i eigentlich nemme, scho vom ganze, ja, des<br />
isch<br />
E. Du hosch ´jetzt dei eigens,<br />
C: Des isch halt eifach,<br />
E: Bisch verheiret, hasch Familie, s´alles anders, freilich<br />
C: Deswege komme trotzdem gern daher, deswege du i trotzdem et verleigne dass i<br />
herkomm, des hann i au no ni do, aber, ja, aber s´isch eifach ebbes anders. Ja, wenn<br />
de mal was anders gwehnt bisch, vom wohne her<br />
E: Ja<br />
C: I muss ja au ehrlich sage, s´isch ja au kein Konform me in dene Wohnunga, was<br />
isch des scho? also, des isch, wenn ich do obe bei euch aguck, des isch normalerweise<br />
menschlich nicht zumutbar, dass die leut immer no ohne Bad lebet, und´s wasser<br />
rufpombe muss, und s´öl in der Kanne …ja, und, des isch normalerweise, zum Teil<br />
no´s Klo im Gang, wo da raus musch aus der Wohnung,<br />
O: Manchmal für zwei Familien eine Toilette,<br />
E: Ja<br />
C: Und des send oifach Zuständ<br />
E: Ja, aber so schlimm isch´s ja auch net- s´isch ja scho viel besser gworda`<br />
7
P: War der Ruf immer schon schlechter als dass es tatsächlich ist?<br />
E: Ja, also dr Röteberg, dem hängt immer bisle, so a, assozial a, da saget viele, da<br />
wille net wohne, da wohnet lauter assoziale, also des, brengsch au nie weg,<br />
S: Obwohl, also wenn ma, jetzt obends naus guckt, so am achte, do herrscht eine Ruhe,<br />
do herscht du nix, da hersch koi Sau schreie, do hersch du nix, da isch so ruhig,<br />
C: I moi, mei Jugend war sche, mir hend viel unternomme, die ganze Jugendliche eigentlich,<br />
da, also da hent sich älle uff´m Spielplatz troffa, na isch ma zusammghockt<br />
und, aber des waret eifach zeita wo, wo sche waret und wo jetzt aber vorbei send…jo<br />
gut, des hanne jetzt zwar no nirgends gseh, dass des so gmacht wird wie mir´s gmacht<br />
hend, also von dem her möchte i des jetzt garet misse, aber rein vo meine Kinder<br />
mecht i des jetzt da obe nemme, weil des wirklich, also mei Ma isch au a Türke, et wege<br />
dem, aber weil des wirklich nur no Ausländer send,<br />
E: also der Ali isch me Deitscher wie Türk<br />
C: S´isch halt eifach nemme, ja, s´war früher so schlimm wenn de gsagt hosch du<br />
bisch vom Röteberg, und<br />
E: Und des werdet ma au, egal wie alt mer werdet, et loswerde,<br />
P: Was heißt es, es war schlimm?<br />
C: Das se halt immer gsagt hend, die andere Leit, vom Röteberg kommt nix rechts,<br />
E: Du hosch au Probleme wenn, wenn de wo vorstellsch, uns sagsch vom Röteberg,<br />
na wirsch konsequent net eigstellt,<br />
B: Des dorsch au et sage, die wo uff der Heide wohnet, die send au net so agseh,<br />
E: Die wo em Hangweg wohnet, die wohnet, die send ja alle vo der Heide, die alte Kuh<br />
wo em em Altersheim war, die hot emmer gsagt von der Heide, sage: „Wo kommet Sie<br />
her?“ Sage Zaumweg isch em Röteberg, net uff der Heide, grad mit Fleis immer.<br />
C: Ja aber des hann i no nie do, grad weil i me für des et schäm, des<br />
E: Heidenei,<br />
C: Es gibt überall sozial Schwache, und und<br />
E: Sag sie hend a schöne Wohnung ghet, müsset sie sich schäme weil sie am Röteberg<br />
gwohnt hend, sie hend et uff der Heid gwohnt, nänänänänäää<br />
…..lautes gemurmel, alle reden aufgeregt durcheinander<br />
E: Wenn du ne Bewerbung wo Zaumweg druffstoht wegschickst, die isch scho<br />
E: Wird scho erledigt,<br />
B: Die fällt glei hindenunter<br />
E: Scho abhackt, ja,ja<br />
C: Und d´leut bohret ja au, in Aale, jo wo in Aale, i mei i sag des ja au, i hab no nie a<br />
Problem ghet, zum saga dass i vom Röteberg komm<br />
8
O: Das sag ich freiweg<br />
E: Noi, noi<br />
C: Au als i no Jugendlich war, no sonscht, der der mit mir nix zum do haba wollt, weil i<br />
vom Röteberg komm, der hat halt Pech ghabt<br />
O: Wenn einer nur die Adresse sieht, und die Menschen nach der Adresse beurteilt<br />
E: Ja aber<br />
O: Der tut mir leid<br />
E: Des wird halt konsequent so gmacht, do em gschäft hanne mit eure a Malheur ghet,<br />
no hot se sich beschwert, na hot d´Chefin mi gstellt, und na semmer alle uff de Balkon<br />
naus ghock, na sagt Chefe, meine Rötebergmethode kenne lasse wo se na ghöret, na<br />
sage, für da wo i wohn lasse me fei net amache, gell, aber vo niemand, weil mei Wohnung<br />
isch en Ordnung, i han a Bad und alles, i han a schene Wohnung<br />
P: Sie haben vorher gesagt, sie möchten hier nicht weg<br />
S: Nö, i möchte da et weg, i hann zwei Johr in Schwäbisch´Gmünd gwohnt, und des<br />
war mei Heimat net, da habe me net wohgfühlt, uff´m Röteberg isch´s , und da bleib i<br />
jetzt au<br />
E: Oh ja, hend viele scho gschrie, wo´s auszoge send, da komme nemme rauf, nie<br />
wieder Röteberg, und jetzt send se wieder da<br />
S: Ja wohnet wieder uff´em Röteberg<br />
E: Oder mechtet gern wieder rauf, und krieget kei Wohnung, des isch scho recht, und<br />
und so vom wohne isch´s ideal, in´d Stadt hosch´s et weit, acht Minuta bisch in der<br />
Stadt drinne, oder ens Freibad hosch fünf Minuta, ha des isch doch wunderbar, Hallebad<br />
zehn Minuta, von der Lage her isch´s supper, gell<br />
C: Gut, die Wohnlage wär einwandfrei, von dem her, also, aber, des isch halt eifach,<br />
wenn se alle megliche Leit, Leit doherschicket<br />
E: Ja des isch halt, die die wo woandersch net dürfet<br />
C: Die leut, die scho emmer obe wohnet die<br />
E: Die werdet mit über ein Kamm g´schert, ja<br />
P: Gibt es Stress?<br />
E: Ha noi, weil se eifach<br />
C: Ha noi weil, wenn die letzte Penner oder so, die anders kein<br />
E: Die waret jetzt fünf, sechs Jahr uff der Straß, da obe krieget se a Wohnung, und na<br />
hänget se blos in der Gegend rum<br />
C: Gut, es muss ja scho sei dass die Leut au irgendwo unterkomme, aber des isch<br />
dann halt scho wieder so… geballt, in ei deng, wenn da jetzt mal da einer wohne dät<br />
und do und in der Stadt<br />
9
E: Dann dat´s sich verteile<br />
C: Dann dät des nie so, aber no machet se halt aus dem Gebiet, wenn die Wohnunge<br />
jetzt bissle renoviert werdet<br />
E: Scho wieder negativ<br />
C: Scho wieder uff ein Haufe lauter. lauter… sozial<br />
E: Weil weil dend se den en a Haus nei, wo fünf, sechs Familie recht send, no muss<br />
sich der apasse, ne, no det der gar ret so rumspinne, wie wenn se do en eim eim Block<br />
drinne send, wo alle saufet, da spinnet se natürlich meh, isch klar<br />
C: Da hauet se da jetzt wieder alle nei, wo anderschwo keine Wohnungen findet, und<br />
die andere müsset halt drunter leide, wenn a Familie da scho eh und je wohnt, und<br />
kann dann, no nemme schlafe weil drei Stück nebe dra jede Abend party machet und<br />
kein job hend, die kennet ja au party mache, isch ja logisch, aber wenn halt einer wirklich<br />
arbeite muss, und aufstande muss, dann geht des halt net, wie willsch´n des mache…<br />
E: Wie war´s denn, em Sommer hemme drausa Frühstück gmacht, Mittwochs morgens,<br />
drausa, na kommt au einer und mault blöd rum: „Ja lauter Säufer, und so bäh,<br />
bäh“, sag i: „Was, i wohn jetzt seit zwanzig Johr da hob und i be kei Alkoholiker, des<br />
verbitt i mir, ne hammer über an ältere Mo g´schwätzt, mo storbe isch, na jo, der hat<br />
sich tot g´soffa, seit se. Na sag i, denn kennsch du doch gar ret, wie kasch denn des<br />
sage, ha jo, er hat a weile oba gwohnt und ihm isch alles gstohle worra, na sag i, du<br />
hosch doch nix ghet, was will mr dir stehla, und wenn du so weiterschwätsch no erlaub<br />
i mir, dass i dir eine Klatsch, weil so nicht, na ischer au nemme komme, gott sei dank,<br />
und äh zwei Tag später lauft er mr do entgege, mit der Bierflasch in der Hand, no sage,<br />
so, du musch andere ebbes hoiße, komm no nemme rauf, i schlag de ra, no ischer au<br />
nemme komme<br />
C:..Wenn de als Jugendliche sagsch du kommsch vom Röteberg, dann gibt’s scho erst<br />
amal g´schwind an, i mei send et alle so, aber s´waret scho<br />
E: Ja, ja,<br />
C: Des isch eifach,<br />
E: Des wirsch dahanna nie weg bringe<br />
C: Hat sich der Ruf mit der Zeit verändert?<br />
E: Ha noi,<br />
C: Ja gut, normalerweise dürft die jüngere Generation dürfte des ja eigentlich gar nimmer<br />
wisse, aber des wird halt immer weiter erzählt, und wenn die heimganget und saget,<br />
i kenn an Bua vom Röteberg, na saget die, jo Mädle bisch du verrückt, was willsch<br />
au mit so oim,<br />
gelächter….<br />
C: Des spricht sich halt emmer weiter, i hab jo viele sache vo früher au net kannt, und<br />
wenn dann irgendwo na kommsch, na heißt´s a des sond doch die und die…<br />
E: Ja da waret vielleicht zwei, drei Familie hobe, die a wenig Polizeibekannt waret, und<br />
die hend halt den Ruf verstärkt,<br />
10
C: I moi, es gibt jo au rechte Leut, es gibt ja net nur solche,<br />
E: Aber desch isch ja halt au emmer des Thema, des schlägt ja niemand a, es geht ja<br />
emmer bloß ums negative, wo beurteilt wird,<br />
S: Du sollsch doch von deiner Lebensgeschichte erzähle<br />
E: Hemmer doch, hemmer doch, mr schwätzet die ganze zeit nix anders als von unserer<br />
Lebensgeschichte,<br />
C: Ja, i bin hier gebore und aufgwachse, wohne möchte i jetzt zwar nemme da, des<br />
isch nix negatives, aber<br />
E: Wenn ma´s gwöhnt isch, a eiges Häusle und so, da wet i au nemme zrück<br />
C: Noi, des isch, also des isch nix negatives, also des isch wirklich, deswege komme i<br />
trotzdem gern uff´s Rötebergfescht, oder sonstige<br />
S: Des fend i au sehr sche<br />
P: Dann hat der <strong>Rötenberg</strong> auch etwas positives, wenn es Sie immer wieder hierher<br />
zurückzieht?<br />
C: Klar, i mei die Gemeinschaft zwischen uns Jugendlichen, des war scho emmer toll,<br />
des hab von niemand bisher ghört, dass die des au so gmacht hend wie mir<br />
E: Wenn was war, hent se zusammaghalte,<br />
C: Ja des<br />
S: Muss au so sei<br />
C: Sag des war dann au, dass ma wirklich, uff´m Spielplatz gange isch und sich troffe<br />
hot, da wars au egal ob da au a paar jüngere dabei waret, oder a paar ältere, da wars<br />
dann halt eifach, bisch da ghockt und hosch dein zigarett g´raucht, gekicher, oder au<br />
mal ebbes tronga, gelächter von allen, ja, oder jetzt grad wen ma emmer so auf die<br />
Wochenendfahrten gegangen sind<br />
E: Ja da hend se em sommer da unda uff der Wies zwei, drei Zelt na gstellt, und na<br />
hend die Kinder vo da, oi, zwei Woche in de Ferien gschlofa und<br />
C: Also des möchte i net misse, ich weiß net ob des jetzt anderswo, gut da hat´s au<br />
was gebe, aber so toll war des au net, des, ja<br />
S: Des weis ma ja nedda, mir hend au gnug agstellt<br />
E: Ja aber wenn de so rumguckt hosch in der Stadt, do hosch koine so Cliqua g´funda<br />
wie da, mit fufzehn bis zwanzig, wo emmer z´samma ghockt send, des war scho ok,<br />
P: Was ist Ihnen wichtig, hier am <strong>Rötenberg</strong>?<br />
E: Ja,ja oifach, gut, ja, dass ma sich oifach wieder me me zusammalebt, und net emmer<br />
emmer so so, i, i und der andere daugt nix, oder so, oifach, so, ja so wie´s früher<br />
war, ma hot anander g´holfa, ma hat wenig g´het aber das wenige hot ma teilt, was ma<br />
heit oifach nemme macht, gohts eim schlecht, war einer da der eim gholfa hat, so ohne<br />
froga, ohne bettla, des war ganz automatisch,<br />
11
S: Ja mal Salz oder bascht kurz uff meine Kender uff?<br />
E: Der allgemeine, der allgemeine Zusammehalt, der, der, der isch nemme do, des<br />
isch halt überall so<br />
S: Der isch nemme do<br />
E: Oder früher send di, sie sagt ja au emmer, oin Tag hat die mal an Kucha gmacht<br />
und no isch ma z´samma g´hockt, nachmittags vorem Haus, im Wechsel war des alles,<br />
oder isch die g´schwend zum Doktor in´d Stadt, hot mo uff´d Kinder uffpasst, und so,<br />
des isch alles automatisch gwa, früher, gell, jetzt frog a mal heit, na heisst´s: „ Ja i han<br />
koi Zeit!“<br />
C: Gut, i moi, früher hosch die Leit au vo Afang a kennt, aber wenn jetzt,<br />
E: Noi, i sag dr allgemeine Z´sammehalt war früher oifach besser, da hat et jeder so<br />
guckt, ha was will i mit derer, ko mi am Arsch lecke, und so woisch, do hot ma scho<br />
z´sammagehalta, me<br />
S: Jo, des stimmt, da hosch scho recht, der Z´sammahalt war scho mehr, und dicker<br />
E: Jeder hot grabble und do missa für sein bissle Lebensunterhalt, ne und do hat ma<br />
z´sammaghalta, jetzt hot jeder meh khet, und uff oimal isch´s losganga:“Ha wa will i mit<br />
dene?<br />
S: Die hend zwar au et viel meh wie mir, aber<br />
E: Und das ma halt au vielleicht, äh, äh, äh, äh, grad, also da oba gibt’s koi große<br />
Probleme mit de Ausländer, ja<br />
C: Noi Marlies, es gibt keine Probleme mit de Ausländer, aber vo außa heißt´s na halt:<br />
„Da gibt´s es bloß no Türka, da wohnet e bloß no Türka“.<br />
E: Ja<br />
C: Des isch halt dann scho wiedar so, weil,<br />
E: Negativ, ja<br />
C: Ja, die Leit send oifach so<br />
E: Wobei, wobei ja Türka au net schlecht sind<br />
C: Ja klar, bei dene gibt´s genau so rechte Leit bei de Ausländer, wie bei de Deitsche<br />
genau so<br />
E:So isch´s, überall gibt’s recht und schlecht, ja<br />
C: D´Leit machet des, und genau die Leit, die´s am wenigschta agoht,<br />
E: Ja, ja des könnt me vielleicht no a bissle fördra, da hobe, des, des, Ausländer mit<br />
Deitsche, so mehr z´samma machet, net bloß jetzt oimal em Jahr, mit´m Feschtle, oder<br />
so, woisch,<br />
C: Ja, aber sisch, wenn jetzt a fescht isch, oder so, no schaffet ma trotzdem z´samma,<br />
dann<br />
12
E: Ja, ober des sot halt underm Johr, halt au bissle meh sei, weisch,<br />
C: wer ist scho ebbes ausländisch´s und türkisch scho mal glei gar ret, aber wenn die<br />
Leit dann dahanna an Stand hend und ihre gute Sacha ausbreitet, dann<br />
E: ja,ja<br />
C: dann sind die ganze gute Sache ganz schnell weg,<br />
O: ah, die gefüllten Weinblätter,<br />
E: ja, also des isch, also äh, türkische Küche isch au net schlecht,<br />
O: nein,nein,<br />
E: die isch sehr gut, v, i, also viel Gemüse, viel ….<br />
C: es gibt eigentlich gar net immer so viel Fleisch in der türkische Küche,<br />
E: noi, normal edda, woisch, die hent vielleich au oi, oder zwoimal in der Woch, hend<br />
die Fleisch, dahoim au, au in der Türkei denne, da wird me Gemüse g´essa, mit, mit<br />
Kartoffla und Tomada und zeug, Auberginen, Zucchini<br />
C: ja, des send halt oifach, das war scho emmer so, dass wenn da do oben rumhängsch,<br />
nix rechts wirsch, da wird sich au nix ändra,<br />
E: der Ruf isch scho, seit ewig und drei Tag versaut,<br />
P: Und wie ist die Nähgruppe hier enstanden?<br />
E: ja au so, des hot irgendwie, wer hot des a´fganga, Frau Pfeffer hot des a´gfanga, ja,<br />
genauso alle vier Wocha kommt a Frisöse, die schneidet uns billig die Haare, desch<br />
isch prima, und des send also Sacha wo ma au gern annimmet, i mein da zahle mr<br />
acht Euro in der Stadt zahlsch elf oder zwölf, des macht scho was aus, sie schneidet<br />
gut und fönt sogar, und tut´s et bloß schneide. Also, des isch scho ok,<br />
P: Und wie lange gibt es schon den Nähtreff hier?<br />
E: Der Nähtreff isch, ha, wie lang macha mr den? a johr etwa oder a dreiviertel Johr?<br />
O: Zuerst war er da unten, dann sind wir hierher, also schon fast zwei Jahre<br />
P: Und das ist immer so eine feste Gruppe?<br />
S: Ja, emmer mir halt<br />
B: S´ waret au scho me da,<br />
E: Jo, s´waret au scho Männer da, wo wo en Reißverschluss neignäht hend in d´Hos,<br />
ha ja, des hemmer au scho g´het<br />
…gemurmel<br />
E: Jo der hot a Töchterle, des hot er no emmer mitbracht<br />
P: Und treffen Sie sich auch außerhalb der Nähgruppe?<br />
13
E: Noi, so eigentlich net, gut, i moi, mr send eh immer z´samma, aber so treffe direkt<br />
do´hoim, demmer uns net, zu dem hammer ja do die Treffa, des reicht eigentlich<br />
au.…und dann sag jo und na macher ma no a Grippafahrt im Dezember, nach Elwanga<br />
oder do do war mar mol in, war ma scho am Kocherursprung und hinterher semmer<br />
Fisch esse ganga in der Angelzucht, gell. So Sache macher mo scho au, ne. Oder an<br />
Jahresausflung, des Johr war ma in der Wilhelma, war au sehr schön.<br />
….nähmaschinengeratter…<br />
N: aaahhhh, jetzt lauft mein Finger heiß dahanna<br />
B: also i weiß et was die immer so, ich weiß no wo mei Sohn studiert hat, und und der<br />
hat ja, der isch ja ziemlich uff´d Schul ganga, äh no hot er jo Ingenieur, drausa in der<br />
Ingenieurschule g´macht<br />
N: mhm, mhm<br />
B: Und wenn se do ….. g´het hend em Amtsgricht, hat der Amtsrichter immer g´sagt,<br />
nemmet se sich mal a Beipsiel am Herrn Z., gell, ha mein Berthold der war ja scho super<br />
in der Schul, der hot ja Zeugnisse und Belobigungen und und ma däff net alles blos<br />
auf auf d´Umgebung, ma muss au selber ebbes dazu do,<br />
N: Des isches<br />
B: Mei Äldeschter der het au studiere kenne, aber der hot eifach net g´wollt,<br />
N: Des isches<br />
B: Aber heit bereut er´s vielleicht, gell, aber jetzt ischer au, vorige Woch 57´ge<br />
g´worda, scho vorbei, gell aber der bereut des, der isch alleweil mit so re Schullehrerin,<br />
glaub zeh Johr lang ganga, hat dere emmer d´Heft helfe korriegiert und, der war emmer,<br />
im moi des war für uns scho hart, soviel Kinder und die na studiere g´lasst und die<br />
andere zwei lernet g´lasst und des war scho, des war scho schwierig. Gell i moi des<br />
mecht i au nemme mitmacha, aber mein Ma der hot halt aujeden Samstag g´schafft<br />
dass er a Taschageld selber g´het hot weil des andere jo dahoim brauht worra isch,<br />
gell, wenn er halt a Biergeld will no hot er halt am Samstig au schaffa müsse oder<br />
wenn Kinderfescht war, hot der emmer g´schafft, und des Geld hot er mit de Kinder<br />
verbraucht am Kinderfescht<br />
N: Aber des isch doch schön<br />
B: Ja also da hot er au a Bier tronga, so isch des net, aber…das do erscht´s Bier dro<br />
g´wä wär und dann erscht Familie, des hot´s bei uns net gä, bei uns hot et bloß der<br />
Vadder s´Fleisch griegt und Kinder nedde, do hots emmer g´heisa die Kinder brauchets<br />
nötiger wie i…<br />
…Nähmaschinengeratter…<br />
P: In der Spielstube sind Sie da auch ab und zu?<br />
E: Also i war wenig unda, i komm jetzt erscht sei i dahann bin, kommt ma enger mit<br />
dere dengs z´samm, oder wenn mir a größere Feier hend, dass mir ma Leut send, na<br />
kenne mir unda<br />
…alle reden durcheinander…<br />
14
S: Ramadan war zu Ende, und henn mir unda a Feschtle g´macht, hend Brezeln, Süßigkeiten<br />
und dann hend die Türka uns eiglade, des war sehr schön. Und die ganze<br />
Türka hend sich halt unterhalta mit uns, mir hend mit dene Frühstück g´macht, und des<br />
war echt schön. Des sot ma me aufbaue.<br />
C: A bisle Multikulturell isch scho gut<br />
B: Jo das ma do a bissle me z´samm kommt, i moi die send scho so lang do, ma isch´s<br />
doch gar nemme anders g´wöhnt, wie bloß no mit Deitsche, des bisch doch gar nemme<br />
g´wöhnt,<br />
C: Also ich koch des gern noch was mei Schwägerin mir zoigt<br />
B: Ja sicher, sicher, warum au net, des schmeckt ja au gut<br />
S: Des Gebäck was die am Fescht brocht hend, des war so super, und und des war<br />
echt so sche, der Tag der Vormittag, Mittwoch, wo da hättet mir normalerweise Frühstück<br />
dahanna g´het, mir sind da au nonder g´anga, und die hend uns eiglade und des<br />
war echt sche<br />
C: So soll´s ja au sei, des soll ja au<br />
B: I sag jo, des sott ma vielleicht öfters macha, dass ma mit dene a wenig z´samma<br />
kommt, die kennet au super<br />
C: Also früher waret et so viele Ausländer hemmer ja au net, aber die wenige die do<br />
waret, i be au zu meiner Freundin, do hosch g´esse und ´s war eifach mal was anders<br />
B: Und wo andersch schmeckts eh am beste<br />
C: Bei uns isch´s halt wegem Schweinefleisch, aber des war ja trotzdem, i find<br />
B: Ha ja dein Onur hot scho früher lieber an Leberkäswecke g´esse wie a sucuc<br />
…Gelächter…<br />
C: Noi, mein Ma ist so ebbes et<br />
…Lachen…<br />
S: Noi des war echt schön, da sot ma scho schaua, das ma des nomal na kriegt<br />
P: War das das erste Mal?<br />
S: Ja, das erste Mal, z.B. am Sommerfest helfet se scho au mit, und des war echt<br />
schön, muss ich saga, und des sot ma scho öfters macha<br />
E: Ja, des kann ma ja mal mit der Brigitte schwätza, dass ma do vielleicht einmal em<br />
Monat a wenig z´samma hockt, oder wenn die wisset dass do hanna g´näht wird, sagt<br />
die eine oder andere vielleicht doch einmal, dass sie kommt. Des wisset die vielleicht<br />
gar net, ne? So a türkische Frau oder so, oder so indische Fraua, dass se einfach au<br />
mit kommet, und mitnäha kennet, oder so<br />
P: Macht ihr Werbung für den Nähtreff, oder …?<br />
E: Ha noi,<br />
15
S: Mir hend an Aushang, also mr hends am Anfang ausghängt, und in Briefkästen geschmissen,<br />
aber send halt emmer blos Deitsche komme, ich weiß net worum die net<br />
komma send, und mir hend au austeilt, Zettel, mir hend scho Werbung g´macht aber<br />
wenn sie net kommet kenne mir au nix macha und so isch des halt, und mir send halt a<br />
kleine Gruppe, also halt emmer die Gleiche die do send, mr machtet also mir machet<br />
halt Montags zum Beispiel Essa, mir kochet do, mir spielet do, am Montag macher mir<br />
so a Steckla, so Adventssteckla, die beratet uns, bei Bewerbungen oder zeiget halt<br />
oder wenn jemand Schulda hot, was ma da no macha kann, und Mittwochs isch immer<br />
Frühstück, des isch umsonst, dass d´Leut kommat und frühstücken können, mir brenget<br />
halt emmer, a Päckle Kaffee, oder schmeißet mal oi. zwoi Euro so nei, dass mir<br />
des immer wieder nachkaufa k´hennet<br />
P: Ist in der Spielstube nicht auch Beratung?<br />
E: Ja, do isch Allgemein a Beratung und für´d Schüler, Hausaufgabebetreuung, also<br />
wo se na g´kennet mittags, und die hend au ganz nette Gruppa<br />
P: Sind sie mit den MitarbeiterInnen zufrieden, oder was würden Sie sich noch wünschen?<br />
S: Ja, also des send Leit, wenn da mal richtig Probleme hosch, und de willsch mit denen<br />
reden, zum Beispiel wenn jemand Schulden hat, dann helfet die oim dabei, dass<br />
man des vielleicht a Jahr standa lassa kann, und dann nexscht Johr vielleicht weiter<br />
zahlt, also da helfet se oim wirklich<br />
E: Und au grad die Praktikanten, von der Caritas, die wechslet jo ell viertel, halb Johr<br />
und da hemmer no mit niemand Schwierigkeiten gehabt, egal wer kommt, und die andere<br />
kommet sogar noch ma halba Johr wieder auf B´such, weils dene so g´falla hat<br />
bei uns, da kama also nix sage, des klappt scho gut<br />
S: Also mit de Leit semmer scho, mir machet au Spässla und<br />
P: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für den <strong>Rötenberg</strong> wünschen?<br />
E: Das alles so bleibt wie´s isch, dass es et schlechter wird, sondern dass so bleibt<br />
wie´s isch, gut manches könnt ma besser macha, saga mr grad mal der Kontakt mit<br />
Ausländer oder so, weil mir hend ja alles obe, Russa, Inder, mir send international, mir<br />
könntet viel macha, so wenn von jedem a bisle was da wär<br />
P: Einkaufsmöglichkeiten haben Sie genügend?<br />
E: An Lade fehlt vielleicht scho, und wenn´s blos mal für an Salat wär den ma vergisst,<br />
oder so, des wär scho recht, aber jetzt hat ja obe de Schlecker zu g´macht, wenn da an<br />
Lidl oder so ebbes neikomme dät, des wär scho gut.<br />
B: I kann halt nemme so gut da na laufa in der E-Center, na komme gut aber rauf<br />
komme halt nemme,<br />
N: Wie lange dauert des bis Sie da unten sind?<br />
B: Drunda bin i glei, da brauch ich fünf Minute, aber rauf brauch i a halbe Stund,<br />
E: Ja, rauf isch halt der scheiß Buckel,<br />
16
C: Ja früher hammar halt wenigstens so an kleine Lade, des war scho besser wie wenn<br />
jetzt gar nix mehr da ist, früher isch halt, des wois i no, a Bäckerauto durch g´fahra, no<br />
hosch halt da mal kurz ebbes kaufa kenne<br />
N: aber des isch doch überall so, dass die kleine Läde weg kommet, da ka ja au keiner<br />
mehr davo lebe, die große Märkt, die send halt viel billiger, gell<br />
E: Ja, so isch des<br />
…Aufbruchsstimmung, - die Mädels packen zusammen...<br />
17
Anlage 3: Teilstrukturierter Interviewleitfaden für den „Nähtreff“<br />
Einleitung<br />
Aufrechterhaltungsfragen<br />
Vorstellung meiner Person:<br />
• Name, Alter, Studium<br />
• Diplomarbeitsthema <strong>Rötenberg</strong><br />
• Besteht die Möglichkeit das Gespräch<br />
aufzuzeichnen? (Anonymisierung?)<br />
• falls sie Fragen haben an mich<br />
oder etwas nicht verstehen, einfach<br />
direkt nachfragen.<br />
• Wie wollen Sie angesprochen werden?<br />
Vorstellungsrunde Frauen:<br />
„Ich möchte gerne mit einer Vorstellungsrunde<br />
beginnen, in der<br />
jede von Ihnen kurz etwas zu ihrer<br />
Person (Name, Alter, Familienstatus)<br />
sagt und erzählt, seit wann sie<br />
auf dem <strong>Rötenberg</strong> lebt!<br />
• Wie kamen Sie auf den <strong>Rötenberg</strong>?<br />
• Was war ihr erster Gedanke/Eindruck<br />
als sie auf den <strong>Rötenberg</strong><br />
kamen? –<br />
• Woran denken Sie, wenn sie an<br />
den <strong>Rötenberg</strong> denken?<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
das ihnen dazu<br />
einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an<br />
was ihnen spontan einfällt<br />
• Wie war das für Sie?<br />
1
Hauptteil:<br />
• Könnt ihr mir etwas über den <strong>Rötenberg</strong><br />
erzählen?<br />
• Welchen Ruf hat der <strong>Rötenberg</strong> in<br />
Aalen?<br />
• Wie sehen Sie das?<br />
• Fühlen Sie sich hier wohl (zu Hause)?<br />
Möchten Sie wo anders wohnen?<br />
• Können Sie mir erzählen wie Sie<br />
in diese Gruppe kamen?<br />
• Was machen Sie hier so alles?<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
das ihnen dazu<br />
einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an<br />
was ihnen spontan einfällt<br />
• Wie war das für Sie?<br />
• Was kennen Sie sonst noch für<br />
Angebote auf dem <strong>Rötenberg</strong>?<br />
• Was ist für sie wichtig auf dem<br />
<strong>Rötenberg</strong>?<br />
Abschluss:<br />
• Wenn Sie einen Wunsch frei hätten,<br />
was würden Sie sich für den<br />
<strong>Rötenberg</strong> wünschen?<br />
2
Anlage 4:<br />
Interview am 16.02.2007 mit sieben Teilnehmerinnen des Deutschkurses<br />
im Stadtteil <strong>Rötenberg</strong>/Aalen<br />
U1 Semra:<br />
• kommt aus der Türkei<br />
• ist 43 Jahre alt<br />
• ist seit 18 Jahren ist sie in Deutschland<br />
• verheiratet<br />
• vier Kinder, drei Jungs, ein Mädchen<br />
• arbeitet nicht<br />
U2. Vera<br />
• kommt aus Kasachstan<br />
• ist 58 Jahre alt,<br />
• seit vier Jahren in Deutschland (seit 2 Jahren in <strong>Rötenberg</strong>)<br />
• hat zwei Kinder, Sohn (33) lebt in Schwäbisch Gmünd, Tochter (37) lebt<br />
in Aalen (Kinder seit 15 Jahren)<br />
• ihr Mann und sie arbeiten nicht<br />
U3. Yasemin<br />
• 45 Jahre alt<br />
• verheiratet<br />
• kommt aus der Türkei<br />
• seit 16 Jahren in Deutschland<br />
• hat zwei Kinder (15 und 12)<br />
• ist hier um Deutsch zu lernen (schreiben)<br />
U4. Yelda<br />
• 35 Jahre alt<br />
• kommt aus der Türkei<br />
• verheiratet<br />
• ist seit 12 Jahren in Deutschland<br />
• hat vier Kinder<br />
U5. Saziye<br />
• 2 Kinder<br />
• Türkei<br />
• verheiratet<br />
1
• seit 9 Jahren in Deutschland<br />
• 41 Jahr alt<br />
U6. Hanife<br />
• kommt aus der Türkei<br />
• ist 38 Jahre alt<br />
• hat 3 Kinder ( 3 Mädchen)<br />
• seit 19 Jahren in Deutschland und ist im Deutschkurs um Deutsch zu lernen<br />
Hanife ist „Musterschülerin“, in der Türkei hatte sie keine Möglichkeit die Schule zu<br />
besuchen, sie war noch nicht ein Tag hier dann kam sie hier her und hat schreiben und<br />
lesen gelernt. Als erstes hat sie Alphabetisierungskurs besucht, daher hat es sehr lange<br />
gedauert, weil der Erwachsene Alphabetisierungskurs kann man nicht vergleichen<br />
mit dem Unterricht von Kindern, ist total anders. Sie hat regelmäßig Alphabetisierungskurs<br />
besucht, sie ist sehr, sehr intelligent, aber sie hat leider keine Möglichkeit gehabt,<br />
in der Türkei die Schule zu besuchen. Sehr fleißig, sie ging auch in die Volkshochschule<br />
– musste jedoch lange Pause machen wegen den Kindern, aber dann ging sie drei<br />
Monate in die Volkshochschule. Danach hat Hanife ihren Führerschein gemacht und<br />
16 Jahre an der Berufsschule gearbeitet.<br />
U7. Merva<br />
• kommt aus der Türkei<br />
• verheiratet<br />
• ist 34 Jahre alt<br />
• habe 2 Kinder<br />
• ist seit 9 Monaten in Deutschland<br />
Wie kamen Sie nach Deutschland?<br />
Durch Heirat<br />
Vera: Ich komme aus Kasachstan, zusammen mit der Familie ihres Sohnes, die<br />
Schwester ihres Bruders wohnt auch in Deutschland.<br />
Eindruck von Deutschland:<br />
Saziye kommt aus Istanbul, sehr große Stadt, Aalen ist sehr klein und sie fand es<br />
langweilig.<br />
Yelda kommt auch aus Istanbu, aber sie hat sich eingewöhnt und jetzt wäre es für sie<br />
schwierig in Istanbul zu Leben, da die Lebensqualität hier viel besser ist, auch die<br />
Landschaft ist grün, es gibt Wälder, frische Luft, alles ist viel sauberer und es gibt klare<br />
2
Regeln, z.B. Verkehrsregeln. Da sie kein Deutsch sprechen konnte war es am Anfang<br />
sehr schwierig für sie, zum Beispiel wenn sie krank war und zum Arzt gehen musste,<br />
sie braucht jemand, egal wohin sie möchte – es muss sie jemand begleiten. Daher hat<br />
sie angefangen am Deutschkurs teilzunehmen.<br />
Hat sich durch den Deutschkurs etwas verändert? Gehen sie jetzt alleine zum<br />
Arzt?<br />
Saziye: Es ist immer noch schwierig wenn sie zu ihrem Hausarzt geht, aber sie kann<br />
sprechen, früher hat sie sich mit mit Händen und Füßen verständigt.<br />
Yasemin: Ich gehe überall allein hin, egal wohin, ich kann alles alleine machen. Es<br />
gefällt mir nicht wenn ich immer jemanden brauche, das ist Selbständigkeit, das ist gut<br />
für mich.<br />
Schwierig ist es in Deutschland nur aufgrund der Sprache.<br />
Haben Sie auch freie Zeit für sich, etwas das ihnen gut tut?<br />
Yasemin: der Vormittag gehört mir, ich arbeite 2x die Woche als Putzfrau, dann mache<br />
ich den Deutschkurs, besucht den Gymnastikunterricht. Am Nachmittag kommen dann<br />
die Kinder, Hausaufgaben, Kochen, Einkaufen, Putzen. Aber ich verdiene mein eigenes<br />
Geld, ich brauche kein Geld von meinem Mann.<br />
Yelda hat vier Kinder und hat daher viel Arbeit. Sie kommen oft alle zu unterschiedlichen<br />
Zeiten nach Hause, daher ist sie oft am hin und herlaufen, bis sie alle abgeholt<br />
hat. Sie hat noch ein kleines Kind, das noch nicht im Kindergarten ist. Sie macht nur<br />
Deutschkurs für sich (3x) und der Frauentreff.<br />
Arbeiten ihre Männer?<br />
Semra: Mein Mann hatte schweren Unfall und ist zuhause.<br />
Vera: Mein Mann und ich sind beide zuhause, nur in der Wohnung, schwierig, habe oft<br />
das Gefühl Kopf platzt.<br />
Was ist besser/schlechter geworden seit sie in Deutschland sind?<br />
Seit dem Euro haben alle finanziellen Schwierigkeiten.<br />
Ihre Familie vermissen sie alle sehr.<br />
Saziye: Familie fehlt ihr sehr! : Familie in der Türkei fehlt, in der Türkei kann man zusammen<br />
ausgehen, sie hat mehr Freizeit in der Türkei, sie kennt sich aus, Theater,<br />
Restaurant, hier in Deutschland hat sie keine Möglichkeit gemeinsam auszugehen…in<br />
der Türkei mit den Kindern in „luna parks“ (Freizeitparks) oder Parkanlagen – mehr<br />
3
Angebote für die Kinder, in der Türkei ist sie mit den Kindern viel ausgegangen – dafür<br />
fehlen hier die Angebote, hier ist es am Samstag /WE langweilig,<br />
Yasemin: ich gehe spazieren!<br />
Yelda: in der Türkei freier – da sie noch nicht verheiratet waren, dort konnten sie tun<br />
und lassen was sie wollten, konnten ausgehen, waren frei. Nach der Heirat ist alles<br />
anders.<br />
Yasemin: Ja klar, nach der Heirat ist alles anders. Jetzt gibt es Kinder und viel Arbeit.<br />
Das liegt nicht an Deutschland, sondern daran dass wir verheiratet sind.<br />
Ihre Eltern, sind die alle noch in der Türkeit?<br />
Ja, nur die Familie vom Ehemann lebt hier in Deutschland.<br />
Wie oft sehen sie ihre Familie?<br />
Yasemin: langes und tiefes Seufzen. Oh je, kommt darauf an, alle zwei, drei Jahre.<br />
Das ist lange Zeit, sehr sehr lange, es ist schwer. Besuch ist schwer, nicht, gar nicht<br />
einfach. Bis man zum Konsulat kommt, Yaseminns Familie kommt aus Atakya – und<br />
muss nach Ankara auf das Konsulat. Sehr weiter Weg. Oder die Arbeitslosen können<br />
nicht kommen, muss man viel nachweisen. Thema ist Wunde – habe großes Heimweh.<br />
Soleiman: jedes Jahr<br />
Vera: keine Geld, war schon fünf Jahre nicht mehr da<br />
Sind Sie gerne eine Frau oder wären sie lieber ein Mann?<br />
Yasemin: auf jedenfall eine Frau.<br />
- alle stimmen zu – lieber eine Frau!<br />
Hanife: wäre manchmal lieber ein Mann, Männer haben viel mehr freie Zeit, kommen<br />
nach Hause, setzen sich vor den Fernsehen, und sagen: mach mir das, bring mir das<br />
Essen hier her! Ist besser ein Mann. Sie arbeiten acht Stunden im Geschäft, dann haben<br />
sie Frei. Ich habe immer Arbeit, im Haus, mit Kindern, bis ich ins Bett gehe. Aber<br />
nur aus diesem Grund.<br />
Was ist schwierig im Stadtteil?<br />
Merva, da sie erst seit neun Monaten hier ist, kann sie das nicht sagen. Sie hat sich<br />
hier noch nie eingelebt. Hat im Moment nur Sprachprobleme.<br />
Alle: Die größte Schwierigkeit die sie haben ist Sprache.<br />
Saziye: Wenn die Lehrerin ihrer Tochter „schwäbisch“ redet, hat sie Probleme zu verstehen.<br />
Aber sie versehen sich irgendwie?<br />
4
Hanife:<br />
Kontakte mit Nachbarn:<br />
Semra: Türkisch, Arabisch, Deutsch, Russisch,<br />
Vera: gute Kontakt, in meine Haus leben alles zusammen, ganze Welt! Afghanisch,<br />
Pakistanisch, alles gemischt. Kontakt habe ich wenn ich mit meine Enkelin spazieren<br />
gehe, dann Kinder spielen, Frauen reden, sprechen, Kuchen probieren, Tee – gute<br />
Kontakt.<br />
Ist es oft laut hier – oder was ärgert sie auf dem <strong>Rötenberg</strong>?<br />
Hanife: Es gibt Arbeitslose (alleinstehende Männer/Obdachlose), die ihren Müll einfach<br />
auf die Straße stellen, das ärgert sie da das auf sie alle im Haus zurückfällt. Das ist<br />
große Problem, diese gehörten nicht zum <strong>Rötenberg</strong>, sind fremde. Die trinken viel und<br />
machen Lärm.<br />
Sind Sie mit den Wohnungen zufrieden?<br />
Hanife: Früher habe ich in schlechte Haus gewohnt. Vier, fünf Obdachlose zusammen<br />
und dazwischen eine Familie. Das ist nicht gut für Haussegen. Die schlafen Tagsüber<br />
weil sie so viel trinken und machen nachts Krach. Das gibt Ärger. Diese Familie muss<br />
immer Kehrwoche machen!<br />
Semra: Der Japaner neben mir schlägt seine Frau sehr viel, oft Streit! Ich dachte Japaner<br />
sind intelligent? Steht halb fünf auf, fernsehen und dann viel schimpfen.<br />
Gibt es Vorteile weil Sie Türkinnen sind?<br />
Semra: früher war es besser – jetzt ist es schwieriger, aber Fremdenfeindlichkeit spürt<br />
sie nicht, hat noch nie so etwas erlebt. Sie vermutet nicht, dass sie von jemanden nicht<br />
gemocht wird nur weil sie Türkin ist.<br />
Saziye: ich auch nicht<br />
Yelda: Es gibt schon, manchmal wenn sie Auseinandersetzungen haben, haben sie<br />
schon gesagt, geht wieder in eure eigene Heimat oder Land. Die Nachbarn haben das<br />
gesagt. Bei Streitigkeiten sagen sie geht zurück in die Türkei.<br />
Semra: Deutsche Man viel Biera trinken und dann… Geste mit der Hand (viel schimpfen).<br />
Am Anfang war es schwieriger-, jetzt ist besser besser, damals/früher war schlechter<br />
Es gibt hier gar keine Einkaufsmöglichkeiten,- gehen sie alleine einkaufen?<br />
5
Saziye: Ja, alleine. In <strong>Rötenberg</strong> gibt es leider keine Einkaufszentrum. Das nächste ist<br />
sehr weit zu Fuß. Ohne Auto ist es sehr schwierig, weil es ist zu weit.<br />
Fahren sie mit Ihren Männern einkaufen, oder wie machen sie das?<br />
Semra: kein Führerschein, gehe mit meine Sohn.<br />
Yasemin: Ich habe Führerschein, gehe alleine.<br />
Vera, wie gehen Sie einkaufen? – mit meine Beine<br />
Vera: möchte gerne arbeiten, suche eine Arbeit. Ich will, ich schreibe jeden Monat zwei<br />
Bewerbungen, aber keine Arbeitsplatz. Sehr viele junge Familien haben auch keinen<br />
Arbeitsplatz. Jeden Tag sitze zu Hause, sehr schlecht. Meine Kopf geht kaputt. Mann<br />
und Frau sitze zuhause, aber Frauen haben viele Arbeit zuhause, kochen, waschen,<br />
putzen, aber meine Mann sitzen, schlafen, lesen Zeitung. Problem, sehr große Probleme.<br />
Wie haben sie vom Deutschkurs erfahren?<br />
Yasemin: Von meiner Freundin, Bekannte.<br />
Semra: In der Moschee erfahren.<br />
Yasemin: Es kostet nichts, das ist sehr gut. Freiwillig, man kann geben Spende. 10, 20<br />
€, das ist sehr günstig. Teilnahme ist kostenlos. Dieses Jahr hat den Deutschkurs die<br />
Ditip-Moschee organisiert – neues Mikroprojekt. Aber seit 25 Jahren gibt es das Angebot<br />
des Deutschkurses, aber Deutschkurs gibt es immer. Die Frauen fragen beim<br />
Nachbarschaftszentrum nach, ist bekannt. Seit 1983 gibt es hier Deutschkurs. Mund zu<br />
Mund. Deutschkurs ist wie eine Familie, gemütlich, nicht so groß.<br />
Yasemin: Habe schon wo anders gesucht wegen Deutschkurs, aber sehr teuer. Ein<br />
Integrationskurs kostet pro Person circa. 630 Euro. Wir alle arbeiten für vier/fünf Euro<br />
die Stunde, verdienen wenig, und das ist nur für drei Monate. Dieser Kurs geht von<br />
September bis Juni. Wir müssen Deutsch lernen.<br />
Was hat ihre Familie dazu gesagt, als sie den Deutschkurs gemacht haben? Bekommen<br />
Sie Unterstüztung?<br />
Yasemin: Nein, überhaupt nicht.<br />
MitarbeiterIn: Zum Großteil werden die Frauen von den „Eltern“ unterstützt, daher sind<br />
die Kurse angenommen. Aber das heißt nicht, dass ist generell so. Wenn es eine Frau<br />
verboten bekommt, darf nich an Deutschkurs teilnehmen. Leider, tut ganz arg weh, es<br />
heißt deine Aufgabe als Frau ist aus der Türkei hierherkommen, du hast deine Aufgabe<br />
als Mutter und Kochen, also was ist das, wofür brauchst du Deutschkurs „willst du Professor<br />
werden, oder was willst du in Deutschland?“ Sie sagen zu mir als Sozialberater,<br />
6
was willst du von unsere Tochter, lass deine Finger da weg, lass uns in Ruhe, du störst<br />
unsere Familie, warum machst du so ein Angebot? Lass das. Hier auf dem <strong>Rötenberg</strong><br />
geht das, da der Kurs eingebunden ist, aber noch immer herrscht 50 % Sprachlosigkeit.<br />
Das tut ganz arg weh.<br />
Hanife: Meine Schwiegermutter hat auch gefragt, wofür brauchst du Deutsch? Willst du<br />
Lehrerin werden?“ Schwiegereltern wollen nicht, früher. Jetzt ist OK.<br />
(Sie nehmen viermal am Deutschkurs teil, am Frauentreff und Gymnastikurs?<br />
Nuran: Im Frauentreff machen wir ein Erziehungsseminar, was ist unsere Heimat, was<br />
ist Kindererziehung, welche Probleme haben unsere Kinder. Das ist 5x. Das kostet 15,-<br />
Euro.)<br />
Welche Erfahrungen machen Sie mit diesen Kursen? Hilft es im Alltag?<br />
Yasemin: Hier trifft sich alles, hier gibt es kein Haushalt.<br />
Yelda: Es ist eine sehr schöne Aktivität- und Abwechslung, sehr gute Abwechslung, mit<br />
anderen Frauen zusammen, zu sprechen, zu lernen, das macht Spaß. Wir lernen viel,<br />
Stress vor der Tür lassen , Stressabbau, zusammen mit Freundinnen etwas lernen, die<br />
Sprache sprechen. Zuhause gibt es nur Kinder und Haushalt. Man kommt weg von<br />
zuhause.<br />
Yasemin: Die Kinder kommen, wir müssen kochen, Hausaufgaben machen, ich mache<br />
zusammen mit meiner Tochter Hausaufgabe, ich meine und sie ihre, das freut meine<br />
Tochter sehr arg, sie sagt immer: Ah, Mama, hast du auch Hausaufgabe? Dann sage<br />
ich ja, siehst du ich bin auch fleißig und mache meine Hausaufgabe. Das freut sie. Und<br />
sie schaut immer in meine Fehler, sie kontrolliert und sagt, das ist falsch, das kann<br />
man nicht so schreiben. Sie verbessert mich. Das macht mich sehr stolz.<br />
Was möchten Sie noch lernen?<br />
Yasemin: EDV, Computer.<br />
Nuran: Ab März wir machen Frauencomputerkurs.<br />
Yasemin: Das freut uns wirklich, Grundkurs. Internet, können wir billiger mit unserer<br />
Familie in der Türkeisprechen, cok güzel. Meine Tochter kann, mein Sohn kann, mein<br />
Mann kann, nur ich kann nicht. Besser als Telefon und man kann sehen.<br />
Hanife: noch besser deutsch sprechen<br />
Gibt es ein besonders schönes Erlebnis, dass sie mit den Kursen in Verbindung<br />
bringen?<br />
7
Saziye: Ein schönes Erlebnis war nach dem Deutschkurs, sie war allein beim Arzt, und<br />
sie hat sich darüber sehr gefreut. Weil sie alleine gehen konnte. Also Selbständig zu<br />
sein.<br />
Yasemin: Ich war sechs Monate in Deutschland, ich wollte unbedingt lernen Fahrradfahren.<br />
Ich habe viele gesehen mit Fahrrad. Das hat mir so gefallen ich habe gesagt,<br />
ich muss auch fahren. Kinder von meinen Schwager haben mir geholfen, dann alle<br />
waren in Schule, mein Mann war weg, ok, ich fahre jetzt ganz alleine. Dann bin ich<br />
alleine nach oben gefahren, dann runter gefahren, und war so schnell, war aufgeregt,<br />
konnte nicht bremsen, bin gegen Auto von Schwager gefahren und meine Augen sofort<br />
in eine Sekunde, tausend Ameisen, meine Auge war so blau. Alle haben geschimpft<br />
mit mir, Mann, Kinder, Schwiegermutter. Mein Mann hat gesagt, was soll ich den anderen<br />
sagen. Du siehst aus wie geschlagen. Dann musst ich in Arbeit, konnte nicht sprechen.<br />
Habe Lehrerin gefragt, sie soll für mich aufschreiben, mein Mann hat mich nicht<br />
geschlagen, bin vom Fahrrad gefallen. Das war so komisch. Gehe einkaufen mit<br />
Schwiegermutter, die Frau in Aldi schaut mich komisch an, dachte arme Frau, Mann<br />
schlägt sie. Das war so lange, das Auge blau, einen Monat. Alle haben gesagt ich darf<br />
nicht Fahrrad fahren, aber ich mache trotzdem. Ich möchte lernen.<br />
Hanife:<br />
Ich war schwanger, im neunten Monat, am nächsten Tag musste ich ins Krankenhaus<br />
– Kaiserschnitt machen. Ich habe im Haus Sachen aufgeräumt, und habe gehört, ein<br />
Kind weint. Ein Kind lief gegen den Kofferaum eines großen Mitsubishi, es war behindert,<br />
und hat geweint. Kind ist hat geblutet, und hatte viel Angst. Ich hab meinen Mann<br />
gerufen, schnell, eine Kind weint ist in Gefahr, hat sich verletzt. Er lieft runter, aber war<br />
langsam. Ich konnte nicht warten, Fenster war offen, ich bin gesprungen, hochschwanger,<br />
auf den Kofferraum, hab das Kind in die Arme genommen, mein Mann kommt.<br />
Junge war fünf Jahre alt, konnte nicht sprechen, habe ihn nach Hause genommen, und<br />
habe ihn gewaschen, dann haben wir Familie gesucht. Mein Mann hat sehr geschimpft<br />
mit mir, warum bist du gesprungen, Mann hat geschumpfen, Schwiegermama und<br />
Schwiegerpapa hat geschumpfen. War meine erste Tochter, ein Tag danach, Geburt.<br />
Alles war OK.<br />
Merjam: Wollte zum einkaufen, und sah einen nackten Mann am Bahnhof. Sie hat gedacht,<br />
oh je, sind alle so in Deutschland. War total schockiert und die anderen Leute<br />
haben alle geklatscht. Sie dachte die sind hier alle verrückt.<br />
8
Anlage 5: Teilstrukturierter Interviewleitfaden für den „Deutschkurs“<br />
Einleitung<br />
Aufrechterhaltungsfragen<br />
Vorstellung meiner Person:<br />
• Name, Alter, Studium<br />
• Diplomarbeitsthema <strong>Rötenberg</strong><br />
• Besteht die Möglichkeit das Gespräch<br />
aufzuzeichnen? (Anonymisierung?)<br />
• falls sie Fragen haben an mich oder<br />
etwas nicht verstehen, einfach direkt<br />
nachfragen.<br />
• Wie wollen Sie angesprochen werden?<br />
Vorstellungsrunde Frauen:<br />
„Ich möchte gerne mit einer Vorstellungsrunde<br />
beginnen, in der jede von<br />
Ihnen kurz etwas zu ihrer Person (Name,<br />
Alter, Familienstatus) sagt und erzählt,<br />
seit wann sie hier in Deutschland<br />
ist und seit wann sie auf dem <strong>Rötenberg</strong><br />
lebt!<br />
• Wie kamen Sie auf den <strong>Rötenberg</strong>?<br />
• wo haben sie vorher gewohnt (Türkei?<br />
Wo?)<br />
• Wie war es nach Deutschland/Aalen zu<br />
kommen?<br />
• Was war ihr erster Gedanke/Eindruck<br />
als sie auf den <strong>Rötenberg</strong> kamen? –<br />
• Woran denken Sie, wenn sie an den<br />
<strong>Rötenberg</strong> denken?<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
das ihnen dazu einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an was<br />
ihnen spontan einfällt<br />
• Wie war das für Sie?<br />
Hauptteil<br />
„Der <strong>Rötenberg</strong> gilt als sozialer Brennpunkt<br />
mit vielen Problemen. Wie ist es<br />
für Sie hier zu leben?<br />
• Lebt ihre Familie/Verwandschaft auch<br />
hier?<br />
• Wie sieht ein normaler Tag bei ihnen<br />
aus<br />
- Erledigungen (Ämter, Einkauf, Essen<br />
vorbereiten, Kinder<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
1
- haben Sie freie Zeit für sich (Interessen?<br />
Freunde?<br />
- Kontakte im Stadtteil? Zu wem –<br />
Deutsche Frauen?<br />
- kommen Sie raus aus dem Stadtteil?<br />
- arbeiten Sie? möchten Sie gerne?<br />
• Ist ihr Mann berufstätig? Wie lange<br />
sind sie bereits verheiratet?<br />
• Fühlen sie sich wohl auf dem <strong>Rötenberg</strong>?<br />
• Wo ist ihr zuhause? Heimweh?<br />
• Was hat sich seit sie hier sind verbessert-<br />
verschlechtert?<br />
• Sind Sie gerne eine Frau – oder wären<br />
Sie lieben ein Mann?<br />
• Fühlen Sie sich als Frau gleichberechtigt?<br />
„Was gestaltet sich schwierig im Stadtteil?“<br />
• Konflikte/Ärger (mit den Nachbarn,<br />
Wohnungsbau, Busverbindungen?.)<br />
• Vorurteile gegen Ausländer<br />
• Ist es oft laut? Lärm?<br />
• Wie sind Sie mit ihren Wohnungen<br />
zufrieden?<br />
das ihnen dazu einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an was<br />
ihnen spontan einfällt<br />
Wie war das für Sie?<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
das ihnen dazu einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an was<br />
ihnen spontan einfällt<br />
• Wie war das für Sie?<br />
„Mir fällt- auf es gibt gar keine Einkaufsmöglichkeiten?<br />
Ist das schwierig<br />
für Sie?<br />
• wie kommen Sie hin?<br />
• Gehen sie alleine einkaufen? Sprache?<br />
„Der Deutschkurs ist ja auch ein Projekt<br />
des Jugend- und Nachbarschaftszentrum.<br />
Wie kamen Sie dazu?“<br />
• Woher haben Sie davon erfahren?<br />
2
• Wessen Idee war es daran teilzunehmen?<br />
• Was erhoffen Sie sich durch den<br />
Kurs?<br />
• Treffen Sie sich auch außerhalb der<br />
Gruppe?<br />
• Was sagt ihr Mann/Kinder/Familie<br />
dazu?<br />
• Was könnte verbessert werden?<br />
„Viele von Ihnen nehmen ja noch an<br />
weiteren Kursen wie dem interkulturellen<br />
Frauentreff oder dem Alphabetisierungskurs<br />
teil?<br />
• Welche Erfahrungen machen Sie damit<br />
• Hilft es Ihnen im Alltag?<br />
• und dann<br />
• können Sie mehr darüber<br />
erzählen<br />
• gibt es sonst noch etwas<br />
das ihnen dazu einfällt<br />
• wie ging es weiter?<br />
• fangen sie damit an was<br />
ihnen spontan einfällt<br />
• Wie war das für Sie?<br />
„Sie haben viel erzählt über die Kurse<br />
die sie besuchen,- hat sich für Sie dadurch<br />
etwas verändert?<br />
• im Alltag?<br />
• Kontakte?<br />
• an ihrer Sicht vom Stadtteil?<br />
„Was möchten Sie gerne noch lernen?“<br />
„Gibt es im Rahmen der besuchten Kurse/Projekte<br />
ein wichtiges Erlebnis für<br />
Sie?<br />
Abschluss:<br />
„Wenn sie sich im Stadtteil etwas wünschen<br />
dürften, was wäre es?“<br />
„Gibt es etwas, was sie den MitarbeiterInnen<br />
noch gerne an´s Herz legen<br />
würden?“<br />
Gibt es etwas, was ich vergessen habe<br />
und sie noch ansprechen möchten?<br />
- NOCHMALS HERZLICHEN DANK<br />
3
UErklärung:<br />
„Hiermit versichere ich gemäß § 27 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung der<br />
Fachhochschule für Sozialwesen Esslingen, dass ich diese Diplomarbeit selbständig<br />
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.“<br />
Esslingen, den 30. April 2007<br />
Petra Nonnenmacher