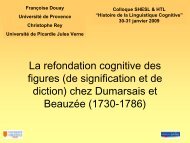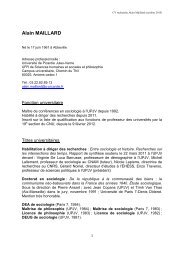Soziolinguistik im suburbanen Milieu: Kreol, Pidgin, Sondersprache?
Soziolinguistik im suburbanen Milieu: Kreol, Pidgin, Sondersprache?
Soziolinguistik im suburbanen Milieu: Kreol, Pidgin, Sondersprache?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A paraître dans / Erscheint in :<br />
Bierbach, Christine; Rita Franceschini (éds.), Diversité linguistique en contexte urbain : banlieues<br />
plurilingues, variétés du français et plurilinguisme. Tübingen, Paris : Stauffenburg / L’Harmattan.<br />
[Date de rédaction / Verfasst in 02/2001]<br />
Frank Jablonka<br />
<strong>Soziolinguistik</strong> <strong>im</strong> <strong>suburbanen</strong> <strong>Milieu</strong>: <strong>Kreol</strong>, <strong>Pidgin</strong>, <strong>Sondersprache</strong>?<br />
0. Die <strong>suburbanen</strong> Agglomerationen, wie sie seit Beginn der 70er Jahre in Frankreich entstanden<br />
sind, ziehen erst seit kürzerer Zeit die Aufmerksamkeit der Stadtsprachenforschung und der<br />
<strong>Soziolinguistik</strong> auf sich. Die sozialen Strukturen und die sie vermittelnden kommunikativen<br />
Dynamiken in diesen <strong>Milieu</strong>s sind in hohem Maße frankreichspezifisch und mit den Verhältnissen<br />
in anderen Ländern, etwa in Deutschland, nicht oder nur bedingt zu vergleichen, obwohl sich in<br />
völlig verschiedenen Kontexten überraschende Parallelentwicklungen feststellen lassen.<br />
Insbesondere geht mit der Entwicklung dieser seit etwa drei Jahrzehnten angelegten Siedlungen die<br />
Herausbildung einer spezifischen Varietät des Französischen einher, die einer beschleunigten<br />
Dynamik unterliegt. Diese Varietät steht <strong>im</strong> Mittelpunkt der folgenden Erörterungen.<br />
Diese soziale und soziolinguistische Situation, die von äußerst komplexen sprachlichen, ethnischen<br />
und kulturellen Kontakten sowie von starken sozialen Spannungen geprägt ist, ist eindeutig<br />
eine Spätfolge der kolonialen Vergangenheit Frankreichs, was einen nicht zu vernachlässigenden<br />
Aspekt der genannten Frankreichspezifik ausmacht. Eins der Hauptmerkmale der <strong>suburbanen</strong><br />
Agglomerationen in Frankreich ist der hohe Anteil von Immigranten insbesondere aus den<br />
ehemaligen Kolonien (bzw. Protektoraten, wie <strong>im</strong> Falle Marokkos), wobei in den meisten Fällen<br />
das maghrebinische Element quantitativ eindeutig dominiert, aber auch aus Schwarzafrika, teils<br />
auch aus den DOM/TOM, aus Asien (Indochina, aber auch China, Korea) sowie auch aus dem<br />
europäischen Ausland (Portugal, Türkei, Spanien u.a.); in der Franche-Comté ist in den letzten<br />
Jahren ein steigender Anteil aus Osteuropa zu verzeichnen, insbesondere aus der ehemaligen<br />
Sowjetunion und (Ex-)Jugoslawien. Es liegt eine multiethnische, multikulturelle und multilinguale<br />
– teils explosive – Bevölkerungsmischung vor. Denn diese überaus komplexe Kultur und<br />
Sprachkontaktsituation ist von starken sozioökonomischen Spannungen begleitet, die sich<br />
gelegentlich entladen.<br />
1. Von besonderem Interesse ist <strong>im</strong> vorliegenden Zusammenhang die emergente, äußerst cha-
akteristische Sprachvarietät, die als Ausdruck und Medium dieser spezifischen <strong>suburbanen</strong><br />
Lebensform zu betrachten ist. Ich möchte meine linguistischen Ausführungen mit der Analyse einer<br />
<strong>im</strong> Sommer 1999 in L’Argentine (Z.U.P. in Beauvais / Oise) aus dem Munde einer jungen<br />
Sprecherin vernommenen Äußerung beginnen, die ein ansehnliches Maß an Ingredienzen der<br />
<strong>suburbanen</strong> französischen Sprachvarietät enthält:<br />
‘tain, c’te keum i me fait kiffer.<br />
Dieser Satz läßt sich wie folgt analysieren:<br />
– ‘tain Aphärese von putain (Interjektion, eventuell Tabuform)<br />
– c’te generisches Demonstrativadjektiv (maskulin und feminin)<br />
– keum verlan-Form von mec mit Apokope (mec → keumé → keum)<br />
– i reduziertes anaphorisches Subjektpronomen<br />
– kiffer Verbalderivation von dial. arab. kif (cannabishaltige Droge), ‘avoir envie’ 1<br />
Über die Klassifikation dieser Varietät besteht derzeit ein Höchstmaß an Uneinigkeit. So spricht<br />
Goudailler in seinem von Claude Hagège eingeleiteten Buch Comment tu tchatches von einer<br />
französisch basierten “interlangue” (Goudailler: 1997, 6-7), woraus sich entnehmen läßt, daß es sich<br />
um eine Kontaktvarietät handle, die durch das Vorliegen unvollständiger Sprachkompetenz<br />
gekennzeichnet sei. 2 Zugleich spricht derselbe Autor (ebd., 7) aber auch von “langue reubeu”, 3 was<br />
auf eine subkulturell konnotierte ethnospezifische Kontaktvarietät hinausliefe, sowie von der<br />
“langue commune des cités, sorte de Koïné” (ebd., 15); hier liegt offenbar ein geolinguistisches<br />
Klassifikationsmerkmal vor, bezogen auf ein diskontinuierliches Sprachgebiet. Schließlich rechnet<br />
Goudailler (ebd., 14-15) diese Varietät auch noch zu den “argots sociologiques”, 4 womit sie als eine<br />
Art Jargon bzw. <strong>Sondersprache</strong> aufzufassen wäre.<br />
Fabienne Melliani (2000; 2001) konzentriert sich auf die Interaktion von Jugendlichen der<br />
zweiten Immigrantengeneration aus dem arabischen Sprachraum in der banlieue von Rouen; sie<br />
n<strong>im</strong>mt damit also den spezifischen reubeu-Aspekt dieser Varietät unter die Lupe. Die Autorin<br />
spricht von “langue métisse” und “discours métissé”. Der Begriff des métissage hat <strong>im</strong><br />
gegenwärtigen Diskurs in Frankreich Konjunktur (cf. Bonniol: 1997; Mufwene: 1997b; auch<br />
Leconte: 1997); er bezeichnet aber von Haus aus ein rein biologisches Phänomen, nämlich das der<br />
1Wobei die semantische Motivierung klar sein dürfte: In der <strong>suburbanen</strong> Lebensform gehört Cannabis eben zu den<br />
Dingen, auf die man in besonderem Maße Lust hat. – Ins Deutsche übertragen, würde der Satz mit einer vergleichbaren<br />
kommunikativen Funktion in etwa folgendermaßen lauten: “Der Typ törnt mich voll an, äy.”<br />
2Dabei ist zu bemerken, daß der sozial definierte Begriff “Interlekt” sicherlich passender wäre als der der “interlangue”,<br />
der eine dynamische lernerspezifische Individualkompetenz bezeichnet.<br />
3Reubeu: Reverlanisierungsprodukt von arabe über beur; gemeint ist die zweite aus den arabischsprachigen Ländern<br />
stammende Immigrantengeneration.<br />
4Worin er mit L.-J. Calvet (1994b) einer Meinung ist.
Rassenmischung. 5 Insbesondere liegt für Melliani aber eine “interstitielle” Varietät vor. Der Begriff<br />
des interstice, auf den <strong>im</strong> Folgenden noch einzugehen sein wird (cf. Abschnitt 3.2.), entstammt der<br />
Stadtsoziologen-Schule von Chicago. Es handelt sich <strong>im</strong> Ursprung um einen geographischen, nicht<br />
linguistischen Terminus <strong>im</strong> Sinne einer Übergangszone. Der Begriff wird bei Calvet (1994b)<br />
kulturell uminterpretiert. Insofern wäre unter einer “interstitiellen Varietät” ein Interlekt zu<br />
verstehen, dessen Entstehung und Funktion mit einem Bruch und der Neugenese der Identität(en)<br />
der Sprechergruppen zusammenhängen.<br />
Gabriel Manessy versucht ebenfalls, den von ihm so bezeichneten “Jargon” von Immigranten<br />
begrifflich zu erfassen und vertritt folgende Ansicht: “il semble qu’il y aurait avantage à placer<br />
l’étude des variétés urbaines dans la perspective générale sur la pidginisation 6 et la créolisation”<br />
(Manessy: 1993, 23). Damit verträglich ist auch die Auffassung von Jacqueline Billiez (1993), die<br />
von “parler véhiculaire interethnique” spricht. Das Attribut “véhiculaire” anstatt “vernaculaire”<br />
erscheint überraschend, da hierdurch der Schluß nahegelegt wird, <strong>im</strong> Vordergrund stehe die rein<br />
instrumentelle (referentielle) Funktion des Informationsaustauschs. Dies ist aber nach Billiez hier<br />
gerade nicht der Fall. Ferner ist fraglich, ob es sich um eine rein interthnische, also von<br />
Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen verwendete Varietät, handelt. Dies ist sicherlich<br />
nicht (jedenfalls nicht nur) der Fall. L.-J. Calvet (1994b, 70) geht in seiner Kritik noch einen Schritt<br />
weiter, indem er eine entgegengesetzte Argumentation vertritt: In seinen Augen ist die Varietät<br />
nicht inter-, sondern intraethnisch, da sich in ihr eine neue, emergente – eben interstitielle – Kultur<br />
artikuliert und konstituiert.<br />
Nach dieser Skizzierung der gegenwärtigen Debatte in Frankreich wird kaum zu bestreiten sein,<br />
daß bei der Klassifikation dieser neuen Kontaktvarietät ein beträchtliches Maß an Konfusion<br />
herrscht. Das Ziel der folgenden Ausführungen ist zu versuchen, die herrschende terminologische<br />
Verwirrung zu entwirren und die Varietät der französischen cités in bezug auf ihre<br />
Klassifizierbarkeit in den Griff zu bekommen und auf den Begriff zu bringen.<br />
2. Diese Aufgabe erweist sich als nicht unproblematisch, weil auch in <strong>Kreol</strong>istik und Kontaktlinguistik<br />
keineswegs überall Klarheit herrscht. Die Lage ist so unübersichtlich und komplex, daß<br />
Mufwene (1997a) die Klassifizierung von <strong>Pidgin</strong>- und <strong>Kreol</strong>sprachen als Sprachtypen rundweg<br />
ablehnt und nur ihre unter best<strong>im</strong>mten sozialhstorischen Bedingungen erfolgte Benennung<br />
(“baptes<strong>im</strong>al protocol”, ibid., 55) akzeptieren mag. “Thus, pidgins and creoles are special kinds of<br />
restructured varieties which are typically developed between the 17 th and the 19 th centuries out of<br />
5Ist diese überraschende Vermischung von biologischen und kulturellen Kategorien am Ende ein Echo der kolonialen<br />
Vergangenheit?<br />
6Die suburbane Varietät in Frankreich wird m.W. bisher nicht explizit mit <strong>Pidgin</strong>s in Verbindung gebracht. Auch ist<br />
festzuhalten, daß diese Varietät nicht, wie das sogenannte “<strong>Pidgin</strong>-Deutsch”, von erwachsenen Migranten verwendet<br />
wird, sondern typischerweise von Jugendlichen gesprochen wird.
the contact of European and non-European langages and outside Europe.” (ebd.) Er schlägt vor, den<br />
unangemessenen Gebrauch der Begriffe <strong>Pidgin</strong> und <strong>Kreol</strong> als Sprachbezeichnungen aufzugeben und<br />
etwa durch “contact varieties” zu ersetzen (ebd., 57). Dieser Punkt ist von zentraler Bedeutung:<br />
Wenn es also zutrifft, daß sich die <strong>Kreol</strong>istik in der Kontaktlinguistik auflösen läßt – eine Ansicht,<br />
auf die auch die Ausführungen von Chaudenson (1978; 1989; 1992) hinauslaufen – dann stellt sich<br />
das aufgeworfene Klassifikationsproblem überhaupt nicht. Allerdings wäre damit das Problem nur<br />
verschoben, da sich unmittelbar die Frage nach alternativen Klassifikationskriterien auftäte.<br />
2.1. Sarah Thomason (1997) versucht, den Fallstricken der Begriffsverwirrung zu entgehen, indem<br />
sie von Grenzfällen und Zwischenstufen absieht und die Kriterien von prototypischen <strong>Pidgin</strong>s und<br />
<strong>Kreol</strong>s zu inventarisieren sucht. Wir werden überprüfen, ob die Kriterien auch bei der <strong>suburbanen</strong><br />
Varietät in Frankreich erfüllt sind.<br />
Prototypische <strong>Pidgin</strong>s<br />
prototypische <strong>Kreol</strong>s<br />
a) Kontakt von drei oder mehr Sprachgruppen; idem<br />
auch bei der <strong>suburbanen</strong> Sprachvarietät in Frankreich<br />
b) Handel oder sonstige beschränkte Kommunikationszwecke nicht der Fall<br />
cités: nicht der Fall<br />
c) nur beschränkter Kontakt; keine Notwendigkeit für die Grup- idem<br />
pen, die Sprache(n) des/der anderen zu lernen<br />
cités: nicht der Fall; die Migrantenkinder sind früh durch Medien<br />
und Schulsystem dem französischen Standard ausgesetzt; sie<br />
müssen ihn erwerben, um in der Schule zu bestehen; aber: erste<br />
Kontakte mit dem Französischen erfolgen in einer Non-Standard-<br />
Varietät, die erlernt werden muß, um von den peers anerkannt und<br />
integriert zu werden<br />
d) Wenn eine dominante Sprachgruppe vorliegt, wird ihr Lexikon idem<br />
zugrunde gelegt.<br />
Lexikalisiert werden nur die praktisch relevanten<br />
Reiches Lexikon, für alle<br />
Bereiche (Handel etc.), da nur beschränkte Kommunikationsziele Kommunikationsbereiche<br />
bestehen.<br />
der Sprachgemeinschaft<br />
tauglich.<br />
Die cité-Varietät tendiert<br />
eher zu den <strong>Kreol</strong>s.<br />
Ferner sind <strong>Pidgin</strong>s, <strong>im</strong> Gegensatz zu <strong>Kreol</strong>sprachen, keine Erstsprachen. Hinzu kommt nach<br />
Thomason (1997), daß <strong>Pidgin</strong>s über eine reduzierte Morphosyntax verfügen (schwer erlernbare<br />
Elemente werden el<strong>im</strong>iniert, insbesondere <strong>im</strong> Bereich der Flexionsmorphologie), während für<br />
<strong>Kreol</strong>s eine “Kompromiß-Grammatik” charakteristisch ist, die aus den Kontaktsprachen hervorgeht.<br />
Zwar besteht häufig eine reduzierte Morphologie, jedoch ist sie für alle Kommunikationsbedürfnisse<br />
der Gemeinschaft hinreichend. Allerdings sind diese beiden distinktiven Merkmale:<br />
reiche Morphosyntax / Lexik und das Kriterium der Erstsprache, nicht notwendig gekoppelt.<br />
Eine reiche Morphosyntax schließt die Abwesenheit von Muttersprachlern nicht aus; hier bestehen
unscharfe Grenzen (“fuzzy boundaries”, ebd., 79). Vor diesem Hintergrund kann auch die<br />
Klassifizierung der <strong>suburbanen</strong> Varietät in Frankreich das Kriterium der Erstsprachigkeit nicht<br />
mehr ausschlaggebend sein. In der Tat wird die cité-Varietät von Sprechern zahlreicher<br />
Erstsprachen verwendet, sei es einer dieser Varietät nahestehenden Sub-/Nonstandardvarietät des<br />
Französischen und/oder einer Migrantensprache (z.B. dialektales Arabisch). Es ist entscheidend,<br />
daß die von jugendlichen peer-groups gesprochene cité-Varietät zwar <strong>im</strong> Kontakt von Sprechern<br />
verschiedener Erstsprachen entstanden ist, daß aber der Spracherwerb von (autochthonen oder<br />
Immigranten-)Kindern <strong>im</strong> Kontakt mit den Sprechern dieser Varietät in entscheidender Weise<br />
beeinflußt werden kann. M.a.W., es ist die Varietät des Französischen, mit der die Kinder in den<br />
peer-groups als erste in Berührung kommen (können) und die sie als (Quasi-)Erstsprache erwerben<br />
(können), die aber aus dem komplexen Sprach- und Kulturkontakt als emergente, nichterstsprachliche<br />
Varietät hervorgegangen ist. 7 Allerdings gewährleistet das Schulsystem (die école<br />
élémentaire beginnt in Frankreich bekanntlich bereits ab dem dritten Lebensjahr) einen<br />
hinreichenden Input in einer standardnahen Varietät des Französischen, so daß ein divergenter<br />
Sprachwandel (zumindest partiell) abgefangen wird; somit wird verhindert, daß diese Varietät in<br />
eine andere Richtung abdriftet. 8<br />
2.2. Es ist natürlich nicht zu leugnen, daß gegenüber ‘klassischen’ <strong>Kreol</strong>isierungs- bzw. <strong>Pidgin</strong>isierungsprozessen,<br />
wie sie in den Kolonien anzutreffen waren, erhebliche Unterschiede bestehen.<br />
Insbesondere fungiert das Französische nicht als Lexifier der sich herausbildenden Varietät; eher<br />
wird hier das Französische (bzw. werden seine Substandard-Varietäten) relexikalisiert, und zwar<br />
durch Argotismen (‘tain), verlan (keum), Arabismen (kiffer) etc. Das hängt natürlich damit<br />
zusammen, daß die dominante Sprache hier nicht in die Kolonien exportiert wird, sondern daß <strong>im</strong><br />
Gegenteil die Sprachen, die in den ehemals (oder noch <strong>im</strong>mer) von Frankreich dominierten<br />
Gebieten behe<strong>im</strong>atet sind, ins Mutterland, in die Metropole <strong>im</strong>portiert werden. 9 Diese umgekehrte<br />
Bewegung ist die Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln; sie ist seine Konsequenz <strong>im</strong><br />
20/21. Jahrhundert, die der Post-/Neokolonialismus und das damit zusammenhängende Nord-Süd-<br />
Gefälle <strong>im</strong> Zeichen der Globalisierung mit sich bringen. Überspitzt formuliert: Die Plantagen auf<br />
den Antillen sind die cités von heute; der heutige maghrebinische Industriearbeiter (oder RMIste) ist<br />
der schwarze Plantagenarbeiter von gestern. Von daher ist eine sozialhistorische Kontinuität des<br />
multiplen Sprach- und Kulturkontakts festzustellen, insofern man die Genesebedingungen der<br />
‘klassischen’ <strong>Pidgin</strong>s und <strong>Kreol</strong>s (die Mufwene als einzige als solche anerkennt) auf die heutigen<br />
Verhältnisse transponiert. Und insofern ist es nur konsequent, daß, wie Winford (1997, 4) ausführt,<br />
7Auch ‘klassische’ <strong>Kreol</strong>sprachen können zugleich als Erst- und als Zweitsprache fungieren; ein bekannter Fall ist das<br />
Tok Pisin.<br />
8Daß sie etwa auf das Arabische hin konvergiert.<br />
9Erhellend ist in diesem Zusammenhang auch die Kontakttypologie von Stehl (1989).
der Terminus <strong>Kreol</strong> “is now used to refer to a much wider range of contact languages than to which<br />
it originally referred”. Außerdem, so Winford, besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß sich die<br />
Termini <strong>Pidgin</strong>isierung und <strong>Kreol</strong>isierung nicht nur auf die Genese von <strong>Pidgin</strong>s und <strong>Kreol</strong>s beziehen,<br />
sondern “to processes they share wich varieties of other contact outcomes” (ebd., 12). Dabei<br />
ist zu bedenken, daß es sich bei der <strong>Kreol</strong>isierung nach Mufwene um eine schrittweise<br />
Umstrukturierung und Differenzierung der dominanten (europäischen) Sprache handelt, also um<br />
einen divergenden Sprachwandel, der durch eine Verschiebung des demographischen Gefüges<br />
sowie durch prekäre Interaktionsmuster ausgelöst wird. Beides ist in den <strong>suburbanen</strong> cités gegeben:<br />
massive Verschiebung der Bevölkerungsstruktur durch Konzentration heterogener<br />
Migrantengruppen, und prekäre Kommunikationsmuster.<br />
2.3. Ein weiteres Problem betrifft die morphosyntaktische Strukturdifferenzierung. Winford weist<br />
darauf hin, daß diese auch in anderen als <strong>Pidgin</strong>- und <strong>Kreol</strong>sprachen zu finden ist. Ferner ist<br />
bekannt, daß auch <strong>Kreol</strong>sprachen über Flexionsmorphologie verfügen können. 10<br />
Nun lassen sich in der <strong>suburbanen</strong> cité-Varietät Ansätze von morphosyntaktischer Strukturreduzierung<br />
feststellen, und zwar aufgrund eines weiteren Merkmals von <strong>Kreol</strong>isierung: Nach<br />
Winford (1997, 12), “creolization is that complex of sociolinguistic change comprising expansion<br />
in inner form”, einhergehend mit der Erweiterung der Anwendungsbereiche und sozialen<br />
Kommunikationsfunktionen. Beides ist in der hier interessierenden französischen Varietät gegeben:<br />
Der Anwendungsbereich von Argot-Techniken erweitert sich, etwa durch die Verlanisierung von<br />
Argotismen (choper → pécho, mit Resemantisierung ‘acheter de la drogue’), 11 insbesondere<br />
solcher, die ihrerseits auf arabischen Einfluß zurückgehen (deublé ← argot bled ← dial. arab. bled;<br />
klass. arab. balad ‘pays’). Diese Erhebung des Argot in die zweite (und dritte) Potenz findet man<br />
auch in der Reverlanisierung (Arabe → beur → reubeu). Zudem erweitert sich der Bereich der<br />
sozialen Kommunikationsfunktionen (z.B. der poetischen Funktion, etwa <strong>im</strong> Rap).<br />
Nun ist der verlan zwar zunächst ein rein lexikalisches Phänomen, hat aber morphologische<br />
Konsequenzen, nämlich gerade <strong>im</strong> Hinblick auf die Strukturreduzierung. Ein Beispiel ist die<br />
Genusmarkierung: die Opposition maskulin vs. feminin wird el<strong>im</strong>iniert.<br />
Elle est auch ([oS]) la téci. (Schüleräußerung, Collège Diderot, Planoise)<br />
Hier wird das französische Adjektiv chaud <strong>im</strong> Maskulinum zugrunde gelegt und der Verlanisierung<br />
unterzogen; ansonsten müßte es *deucho oder *deuche (← chaude, letztere Form mit Apokope)<br />
lauten.<br />
Diese Struktur ist außerhalb des verlan rekurrent, so <strong>im</strong> Bereich des französischen Demon-<br />
10Ein Beispiel ist die Numerusmarkierung <strong>im</strong> haïtianischen <strong>Kreol</strong> (cf. Mufwene: 1997a, 51).<br />
11Schüler des Collège Diderot in Planoise (Besançon): “Y a même les surveillants qui viennent pécho.”
strativums ce, dessen Substandard-Form in der <strong>suburbanen</strong> cité-Varietät durchweg c’te lautet.<br />
c’te mytho (Seguin/Teillard: 1996, 209) 12<br />
Il a tué son voisin et il est resté là, c’te débile. (ebd., 105)<br />
Gleiches gilt für die Numerusmarkierung: Die Markierung -al → -aux entfällt, analog zur in den<br />
meisten Fällen auftretenden Struktur mit 0-Suffix:<br />
Les profs i sont pas normals. (Schüleräußerung Collège Diderot, Planoise)<br />
Durch Generalisierung erfolgt eine Vereinfachung der Regeln der Flexionsmorphologie.<br />
Auch ist eine Reduzierung der Allomorphie des best<strong>im</strong>mten Artikels festzustellen: Vor verlan-<br />
Ausdrücken wird der best<strong>im</strong>mt Artikel nicht elidiert:<br />
Passe, passe le oinj (Verlanisationsprodukt von joint). (NTM) 13<br />
Elle joue le auch. (Verlanisationsprodukt von chaud) (Seguin/Teillard: 1996, 180; jouer le auch ‘se vanter’)<br />
Auch führt die Verlanisierung von Verben keineswegs zur Bildung neuer Konjugationsklassen,<br />
sondern die Verbflexion ist ebenso wie die Markierung des participe passé 0. Diese Vereinfachung<br />
hat aber ganz andere Gründe als eine etwaige schwere Erlernbarkeit: Es gibt nichts zu konjugieren,<br />
weil entweder die Ausgangsform eine bereits flektierte Form des französischen Standards bildet<br />
oder das Verlanisationsprodukt keiner (bekannten) Verbklasse angehört, ergo auch keine<br />
Flexionsregeln vorhanden sind. Wozu auch? Die Flexion ist ja (in den meisten Fällen) redundant.<br />
Gleiches gilt für Verben, die aus der Zigeunersprache übernommen sind und mit der Endung -ave<br />
versehen sind: j’vais te marave (‘frapper’), je l’ai marave, j’te marave (cf. Seguin/Teillard: 1996,<br />
220).<br />
Verbale verlan-Formen<br />
vom Infinitiv (oder participe passé) abgeleitet<br />
von flektierter Verbalform abgeleitet<br />
Bien ouèj! (← joué; Seguin/Teillard: 1996, 176) Et les gendarmes comme ils l’ont<br />
J’ai bébar mon cousin. (← barber ‘mentir’; ebd., tège. [← jète] (ebd., 87)<br />
182)<br />
Hier j’ai cramé [repérer, surprendre] le keum qui m’a Rachide, je l’ai oide dans le coupéta<br />
[← taper ‘voler’] mon scooter. (ebd.,<br />
loir. (verlan mit Wortart-<br />
189) wechsel: ← doigt ‘mettre la<br />
Les petits, dans ma cité, ils prennent des tickets et main aux fesses; ebd., 204)<br />
ils font comme s’ils pédo. [← doper ‘fumer’]<br />
12Seguin und Teillard haben sich um die Erfassung der <strong>suburbanen</strong> cité-Varietät in besonderer Weise verdient gemacht,<br />
indem sie ein mit Collège-Schülern in der banlieue parisienne erarbeitetes Substandard-Wörterbuch (Seguin/Teillard<br />
1996) veröffentlichten. Sämtliche Wörterbucheinträge sind durch von Schülern vorgeschlagene und als besonders<br />
charakteristisch angesehene Beispielsätze erläutert. Ich gestatte mir, einige dieser Beispielsätze zu Explikationszwecken<br />
heranzuziehen.<br />
13Auf dem Album Paris sous les bombes.
(ebd., 205/6)<br />
Putain, me chauffe pas, j’suis déjà<br />
vénère. (← énerve; hier wird ein<br />
participe passé von einer konjugierten<br />
Verbalform abgeleitet;<br />
ebd., 217)<br />
2.4. Es erhebt sich die Frage, ob sich aus diesen Befunden Rückschlüsse auf die Kompetenz <strong>im</strong><br />
französischen Standard ableiten lassen. Dies scheint nur recht bedingt der Fall zu sein. Auf der<br />
einen Seite ist den Sprechern die französische Standardform, von der die verlan-Form abgeleitet<br />
wird, offensichtlich bekannt. Andererseits st<strong>im</strong>mt auffälligerweise die syntaktische Funktion der<br />
verlan-Form mit der der zugrundeliegenden Standardform nicht <strong>im</strong>mer überein. Es wäre allerdings<br />
voreilig, hieraus Rückschlüsse auf etwaige Kompetenzdefizite <strong>im</strong> Verbalsystem des französischen<br />
Standards zu ziehen.<br />
Die Kompetenzproblematik ist aber auch in bezug auf das Arabische relevant. Die Integration<br />
von Xenismen zieht auch Strukturreduzierungen <strong>im</strong> Bereich der arabischen Phonologie nach sich:<br />
Das arabische Phonem /ð/, welches <strong>im</strong> französischen Konsonantismus keine Entsprechung findet,<br />
wird el<strong>im</strong>iniert und durch ein Allophon des Phonems /r/, ein aspiriertes [{h] ersetzt, wie etwa in<br />
folgender Äußerung, die von einem jungen Sprecher in Planoise an seinen Pitbull gerichtet wurde:<br />
Allez mange ton [È{haluf]; c’est bon ça. (dial. arab. [ÈðaLuf], ‘Schwein’, ‘Wildschwein’, ‘Schweinefleisch’)<br />
Hinzuzufügen ist, daß komplementär zur Komplexitätsreduktion morphologischer Strukturen auch<br />
die gegenläufige Tendenz vorliegt: eine Erweiterung der Formenvielfalt durch neue Derivationsregeln:<br />
– verbale verlan-Formen + Suffix -ment → Substantiv: tèjement (‘rejet’)<br />
– Verbstamm + Suffix -os → Adjektiv: craignos (‘dangereux’)<br />
– auch Adjektiv + Suffix -os → Adjektiv (gravos, rapidos, gratos)<br />
3. Aus den bisherigen Erörterungen lassen sich m.E. keine überzeugenden Argumente ableiten, die<br />
gegen das Vorliegen einer <strong>Kreol</strong>isierung sprächen. Dem hier vorgeschlagenen erweiterten Sinn des<br />
Terminus kommt eine <strong>im</strong> französischen Diskurs vertretene Auffassung entgegen, wonach der<br />
Begriff der <strong>Kreol</strong>isierung nicht nur auf sprachliche Phänomene anzuwenden ist, sondern auch auf<br />
die Dynamik von Kultursystemen (cf. Bonniol: 1997; Chaudenson: 1992). Dies ist auf die<br />
Kontaktprozesse in den französischen banlieues gut anwendbar, was mit dem Problem der<br />
Transition und Transformation von Identität(en) in Zusammenhang steht.<br />
3.1. Frei nach dem von Bickerton zurückgewiesenen “Cafeteria-Prinzip” (cf. Calvet: 1997, 233)
schöpfen die Sprecher aus dem vielfältigen Vorrat an sprachlich-kommunikativen Techniken, die<br />
sich ihnen <strong>im</strong> <strong>suburbanen</strong> Diskurs-Universum darbieten (dazu Leconte: 1997, 145). Daß von den<br />
Kontaktsprachen das Arabische stärker als alle anderen zum Zuge kommt – und zwar bei<br />
Sprechergruppen gleich welcher ethnisch-kulturellen Herkunft –, hängt, abgesehen von der rein<br />
zahlenmäßigen Dominanz arabophoner Migranten, zweifellos auch damit zusammen, daß die<br />
arabische Sprache und Kultur tendenziell gewissermaßen als Inbegriff der Alterität angesehen<br />
werden. Die sprachlich vermittelte Individuation ist insbesondere eine “Individuation gegen”<br />
(Stierlin: 1994, 41 ff.): gegen eine als feindlich empfundene Welt – identifiziert mit der Welt der<br />
Autoritäten, von der sich die hier interessierenden jugendlichen Sprechergruppen abgelehnt,<br />
ausgegrenzt, stigmatisiert fühlen; gegen die Institutionen dieser ‘feindlichen’ Welt, insbesondere<br />
ihre Bildungseinrichtungen, wo die cité-Sprecher aufgrund des Drucks der präskriptiven Norm des<br />
französischen Standards vielfach als Erste der schulischen Selektion zum Opfer fallen. Insofern die<br />
hegemoniale Ordnung als Gegner angesehen wird, erklärt sich das Einhergehen von kryptischen<br />
und identitätsstiftenden Funktionen völlig zwanglos: Natürlich dürfen die Vertreter der<br />
hegemonialen Ordnung (v.a. Lehrer und Polizei) nicht mitbekommen, wie die Mitglieder der<br />
<strong>suburbanen</strong> ingroup sich gegen sie und durch sie hindurch zu behaupten versuchen:<br />
Quand y s’passe un truc et y a les keufs on parle verlan. (Schüleräußerung, Collège Diderot, Planoise)<br />
3.2. Was in Frankreich zu beobachten ist, ist die Genese einer spezifischen <strong>suburbanen</strong> cité-Kultur<br />
und -Identität sui generis aus dem multiplen Kontakt heraus. Es handelt sich hierbei, wie es die<br />
Rap-Gruppe NTM 14 formuliert, um eine Art ‘Paralleluniversum’, das der ‘legit<strong>im</strong>en’ und<br />
hegemonialen Ordnung entgegengesetzt ist; eine Kontakt-Kultur und -Identität, die durch die<br />
suburbane cité-Varietät artikuliert, interpretiert und reproduziert wird. In diesem Zusammenhang<br />
mag der Verweis auf die Etymologie von kreol (< lat. creare) erhellend sein (cf. d’Ans: 1997, 233):<br />
<strong>Kreol</strong> ist, was vor Ort entsteht, d.h. weder autochthon, bereits vorhanden ist noch <strong>im</strong>portiert wird. 15<br />
Für Calvet (1994b, 30) ist diese Kultur (und damit auch diese Sprachvarietät) “interstitiell”, da sie<br />
<strong>im</strong> Sinne der Chicagoer Schule eine Etappe auf dem Weg “compétition – conflit – adaptation –<br />
ass<strong>im</strong>ilation” ist, auf dem sich aber auch die ass<strong>im</strong>ilierende Kultur (und Sprache) verändert.<br />
3.3. Gleichwohl bleibt für Calvet die cité-Varietät <strong>im</strong> wesentlichen ein Argot (cf. Calvet 1997b,<br />
280), also eine gruppenspezifische <strong>Sondersprache</strong>. Hierbei sollte aber nicht vergessen werden, daß<br />
auch <strong>Sondersprache</strong>n, Jargons, in vielen Fällen Kontaktsprachen sind. Das französische Argot hat,<br />
ebenso wie das Rotwelsch in Deutschland, zahlreiche Ausdrücke aus der Zigeunersprache<br />
14Cf. Das Stück “Tout n’est pas si facile” (auf dem Album Paris sous les bombes): “D’évoluer dans un système<br />
parallèle / où les valeurs de base étaient pêle-mêle”. Und weiter: “On venait tous du même quartier / On avait tous la<br />
même culture de cité”.<br />
15Aus eben diesem Grunde lehnt Calvet für diese Varietät das Attribut “interethnique” ab; cf. Abschnitt 1.
aufgenommen, die, wie gesehen (cf. Abschnitt 2.3.), teils in der cité-Varietät weiterleben (z.B.<br />
marave, frz. ‘frapper’), und während das Rotwelsch mit Elementen des Hebräischen / Jiddischen<br />
angereichert wurde (cf. Kluge: 1901), hat auch die Aufnahme von Arabismen <strong>im</strong> französischen<br />
Argot Tradition (cf. Christ: 1991), so z.B. bled (cf. Abschnitt 2.3.), klebs ‘chien’ < dial. arab. kelb,<br />
klass. arab. kelb. 16 Zwischen diesen beiden Arten von Kontaktsprachen, d.h. <strong>Kreol</strong>s einerseits und<br />
<strong>Sondersprache</strong>n / Jargons auf der anderen Seite, besteht quasi eine ‘Wahlverwandtschaft’.<br />
Aufschlußreich sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Halliday zu “antilanguages”<br />
(Halliday: 1978, 164-182). Darunter sind Sprachen zu verstehen, die Ausdruck und Medium von<br />
“antisocieties” und “countercultures” (ebd., 164) sind, welche sich als bewußte Alternativen zur<br />
herrschenden Lebensform verstehen (“the acting out of a distinct social structure”,ebd., 167),<br />
einhergehend mit alternativen sozialen (Gegen-)Identitäten und gesellschaftlichen<br />
Wirklichkeitsentwürfen. Charakteristisch für antilanguages sind die partielle Relexikalisierung<br />
bestehender Sprachen und u.U. Sprachenspaltung, d.h. “a process of fission, the splitting off from<br />
an established language” (ebd., 165), wobei allerdings eine Kontinuität zwischen (etablierter)<br />
Sprache und antilanguage besteht, als Korrelat zur Kontinuität zwischen herrschender<br />
Gesellschaftsordnung und Gegengesellschaft (ebd., 171). Beide Seiten sind komplementär. 17<br />
Weiterhin erwähnt Halliday die kryptische und die poetische (bzw. ludische) Sprachfunktion (ebd.,<br />
166). Allerdings kann eine antilanguage <strong>im</strong> Sinne Hallidays (ebd., 171) nicht Erstsprache sein. Sie<br />
hat eindeutig die Charakteristika einer gruppenspezifischen <strong>Sondersprache</strong>, ist aber zugleich auch<br />
Resultat einer Dynamik von (vielfach komplexen) Sprachkontakten. Von besonderem Interesse ist<br />
hier der von Halliday (ebd., 172) Fall der “Calcutta underworld language”; diese Bengali-basierte<br />
Varietät weist nicht nur Strukturen auf, die zum verlan analog sind, sondern (neben Anglizismen<br />
und Einflüssen des Hindi) auch Arabismen. An einem völlig entlegenen Fleck der Erde finden sich<br />
demnach sprachliche Erscheinungen, die zu den Prozessen in den <strong>suburbanen</strong> Agglomerationen<br />
Frankreichs ebenso deutliche wie überraschende Analogien aufweisen.<br />
Ferner ist mit Winford festzuhalten, daß <strong>Sondersprache</strong>n / Jargons, sofern sie sich stabilisieren,<br />
die Entstehung von <strong>Kreol</strong>s auslösen können. “The starting point of creolization need not be a<br />
pidgin, but may be a pre-pidgin, or a subordinate language variety of some sort.” (Winford: 1997,<br />
12) Diese “subordinate language variety” ist in den <strong>suburbanen</strong> Agglomerationen Frankreichs<br />
zweifellos gegeben. Und Sarah Thomason (1997, 83) betont, daß auf dem Wege der Stabilisierung<br />
16Erstaunlicherweise liegt die arabische Pluralform kleb der Singularform <strong>im</strong> Argot zugrunde. Auch wird die<br />
Pluralform kleb von magrebinischen Immigranten der zweiten Generationen in arabischen Diskursen verwendet.<br />
Solcherart gelagerte Fälle werden von Séfiani (2000) <strong>im</strong> Rahmen ihrer Analyse einer emergenten Außenvarietät des<br />
Dialektarabischen in französischen <strong>suburbanen</strong> Agglomerationen (<strong>im</strong> vorliegenden Fall in der banlieue von Besançon)<br />
diskutiert.<br />
17Unter Bezugnahme auf Levi-Strauss führt Halliday (ebd., 175-6) aus, daß die Gegengesellschaft zugleich in einem<br />
“metaphorischen” und einem “metonymischen” Verhältnis zur herrschenden Gesellschaftsordnung stehe, jedoch innerhalb<br />
desselben umfassenden Gesellschaftssystems.
eine Kontaktvarietät für einige Zeit unvermeidlich das Stadium einer “semi-language” durchläuft,<br />
d.h. “a speech form that is not completely ad hoc but also not completely language-like in its<br />
systemic properties. The most common are jargon [meine Hervorhebung; F.J.] and pre-pidgin.”<br />
4. Damit dürfte feststehen, daß die Kontaktvarietät in französischen banlieues eine distinkte<br />
Technik darstellt, die zwar auf systemischer Ebene Stabilitätsdefizite aufweist, aber hinsichtlich der<br />
Verwendungsmodalitäten durchaus habitualisiert ist. Sie ist syntopisch (sie wird in den <strong>suburbanen</strong><br />
cités gesprochen); sie ist synstratisch (sie wird in erster Linie von sozial Benachteiligten<br />
gesprochen) und symphasisch (streng informell); sie ist (sit venia verbo) syngenerationell (sie wird<br />
vorzugsweise von Jugendlichen, aber auch Kindern verwendet) und <strong>im</strong> wesentlichen auf ein<br />
Medium (Oralität) beschränkt. Wir können feststellen, daß es sich bei jener <strong>im</strong> komplexen Sprachund<br />
Kulturkontakt emergenten Varietät um eine Züge von <strong>Kreol</strong>isierung aufweisende<br />
<strong>Sondersprache</strong> handelt, die nicht nur einer antilanguage <strong>im</strong> Sinne Hallidays (1978) recht nahe<br />
kommt, sondern die auch <strong>im</strong> wesentlichen alles mitbringt, was eine funktionelle Sprache <strong>im</strong> Sinne<br />
Coserius (1988, 285) braucht.<br />
Literatur<br />
Billiez, Jacqueline (1993), “Le ‘parler véhiculaire interethnique’ de groupes d’adolescents en milieu urbain”, in: Actes<br />
du colloque international “Des langues et des villes”, organisé conjointement par le CERPL (Paris V) et le<br />
CLAD (Dakar) à Dakar, du 15 au 17 décembre 1990, Paris, 117-126<br />
Bonniol, Jean-Luc (1997), “Genèses créoles: de l’usage de la notion d’homologie”, in Hazaël-Masieux / de Robillard,<br />
15-27.<br />
Burke, Peter (1995), “Introduction”, in: ders., Porter, Roy (hg.), Languages and Jargons. Contributions to a Social<br />
History of Language, Cambridge (UK), pp. 1-21.<br />
Calvet, Louis-Jean (1994a), L’argot, Paris.<br />
Calvet, Louis-Jean (1994b), La voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris.<br />
Calvet, Louis-Jean (1997), “Les faits de la théorie (autour d’une rencontre avec les études créoles de Robert<br />
Chaudenson)”, in Hazaël-Massieux / de Robillard, 225-238.<br />
Chaudenson, Robert (1978), Les créoles français, Paris.<br />
Chaudenson, Robert (1989), Créoles et enseignement du français. Français, créolisation, créoles et français marginaux.<br />
Problèmes d’apprentissage, d’enseignement et d’aménagement linguistique dans les espaces créolophones, Paris.<br />
Chaudenson, Robert (1992), Des îes, des hommes, des langues. Essai sur la créolisation linguistique et culturelle, Paris.<br />
Christ, Graciela (1991), Arabismen <strong>im</strong> Argot. Ein Beitrag zur französischen Lexikographie ab der Hälfte des 19.<br />
Jahrhunderts, Frankfurt/M. u.a.<br />
Coseriu, Eugenio (1988), Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Tübingen.<br />
d’Ans, André-Marcel (1997), “Créoles sans langue créole: les ‘Criollos’ d’Hispano-Amérique,” in Hazaël-Massieux /
de Robillard, 29-50.<br />
Deprez de Heredia, Christine (1997), “Influence de la migration urbaine sur la communication familiale: nouvelles<br />
normes, nouvelles formes, nouvelles stratégies“, in Hazaël-Massieux / de Robillard, 567-576.<br />
Goudailler, Jean-Pierre (1997), Comment tu tchatches. Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris.<br />
Halliday, M.A.K. (1978), Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning, London.<br />
Hazaël-Massieux, Marie-Christine / Didier de Robillard (hgg., 1997), Contacts de langue, contact de culture,<br />
créolisation. Mélanges offerts à Robers Chaudenson à l’occasion de son soixantième anniversaire, Paris.<br />
Jablonka, Frank (2001), “Patchwork identitaire en situation et contact linguistique conflictuel”, in: Canut, Cécile / Jean-<br />
Marie Prieur (hgg.), Traverses 2: Langues en contact et incidences subjectives. Langues en contact et incidences<br />
subjectives, Montpellier, 155-169.<br />
Kluge, Friedrich (1901), Rotwelsch, Straßburg.<br />
Leconte, Fabienne (1997), La famille et les langues. Une étude sociolinguistique de la deuxième génération de<br />
l’<strong>im</strong>migration africaine dans l’agglomération rouennaise, Paris.<br />
Lepoutre, David (1997), Cœur de banlieue. Codes, rites et langage, Paris.<br />
Manessy, Gabriel (1993), “Modes de structuration des parlers urbains”, in: Actes du colloque international “Des<br />
langues et des villes”, organisé conjointement par le CERPL (Paris V) et le CLAD (Dakar) à Dakar, du 15 au 17<br />
décembre 1990, Paris, 7-27.<br />
Melliani, Fabienne (2000), La langue du quartier. Appropriation de l’espace et identités urbaines chez des jeunes issus<br />
de l’<strong>im</strong>migration maghrébine en banlieue rouennaise, Paris.<br />
Melliani, Fabienne (<strong>im</strong> Druck), “Langue métisse et ethnicité urbaine,” in: Canut, Cécile / Jean-Marie Prieur (hgg.),<br />
Travrses 2: Langues en contact et incidences subjectives, Montpellier, 109-120,<br />
Mufwene, Solikoko S. (1997a), “Jargons, <strong>Pidgin</strong>s, Creoles, and Koines: What are they?”, in Spears/Winford, 35-69.<br />
Mufwene, Solikoko S. (1997b), “Métissages de peuples et métissages de langues”, in Hazaël-Massieux / de Robillard, 51-<br />
70.<br />
Séfiani, Kheira (2000), Approche sociolinguistique des parlers urbains des enfants mghrébins à travers les interférences<br />
français/arabe. Mémoire préparé et présenté pour l’obtention du D.E.A. en Sciences du Langage, Didactique et<br />
Sémiotique, option Sociolinguistique. Besançon (Université de Franche-Comté) [Ms.].<br />
Seguin, Boris / Frédéric Teillard (1996), Les Céfrans parlent aux Français. Chronique de la langue des cités, Paris.<br />
Spears, Arthur K. / Donald Winford (hgg., 1997), The Structure and Status of <strong>Pidgin</strong>s and Creoles, Amsterdam,<br />
Philadelphia.<br />
Stehl, Thomas (1989), “Typologie des contacts linguistiques: langues romanes, créoles français et dialectes italiens”, in:<br />
Foresti, Fabio / Elena Rizzi / Paola Benedini (hgg.), L’italiano tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso<br />
internazionale di studi, Bologna, 25-27 settembre 1986, Roma, 115-124, 331-333.<br />
Stierlin, Helm (1994), Individuation und Familie. Studien zur Theorie und therapeutischen Praxis, Frankfurt/M.<br />
Thomason, Sahra G. (1997), “A Typology of contact languages”, in Spears/Winford, 71-88<br />
Winford, Donald (1997), “Introduction: on the Structure and Status of <strong>Pidgin</strong>s and Creoles”, in Spears/Winford, 1-31.
Résumé<br />
Si la sociolinguistique urbaine est dotée d’une riche tradition de recherche en France aussi bien que<br />
hors de France, les cités périphériques, phénomène relativement récent, attirent l’attention des<br />
sociolinguistes depuis assez peu de temps. Les structures sociales dans ces milieux suburbains et les<br />
dynamiques communicationnelles et linguistiques qui les véhiculent semblent être spécifiques de la<br />
France et ne sont pas comparables avec la situation dans d’autres pays européens, comme<br />
l’Allemagne, par exemple. Le développement des quartiers suburbains est notamment accompagné<br />
par l’émergence d’une variété linguistique du français, soumise à une dynamique accélérée. Etant<br />
donné que jusqu’à présent aucun consensus sur la classification de cette variété de contact n’a pu<br />
être trouvé, le présent article a pour but de faire face à la confusion terminologique dans la<br />
discussion actuelle.<br />
Il est évident que cette situation sociale et sociolinguistique, marquée par des contacts plurilinguistiques<br />
et pluriethniques extrêmement complexes et par de fortes tensions sociales, est un effet<br />
retardé du passé colonial de la France. L’une des stratégies de recherche les plus prometteuses dans<br />
les quartiers en question semble être l’application d’un modèle créoliste. Il convient toutefois de<br />
souligner que le problème qui est à l’origine de la variété suburbaine en question n’est pas<br />
essentiellement un déficit de compétence, et elle n’est pas non plus principalement une réaction aux<br />
besoins de communication interethnique, comme c’était le cas dans les colonies à l’époque de la<br />
créolisation proprement dite. Il apparaît, par exemple, que la verlanisation est un procédé purement<br />
lexical, mis en œuvre ad hoc à partir de lexèmes appartenant au standard (ou au sous-standard)<br />
français, maîtrisés par les locuteurs. Mais la fonction cryptique de ces stratégies de communication<br />
entraîne à son tour des réductions structurelles sur le plan morphologique (par ex. marquage du<br />
genre), caractéristiques des pidgins et créoles.<br />
De plus, le terme de “communication intraethnique” paraît plus approprié à ce phénomène de<br />
contact que l’affirmation d’une quelconque caractéristique interethnique, puisque nous sommes en<br />
présence d’une culture suburbaine émergente, de transition, à ce titre dite “interstitielle”, dont le<br />
vecteur symbolique et identitaire les plus <strong>im</strong>portant est la variété linguistique en question. Eu égard<br />
aux affinités entre langues créoles et jargons, nous recourrons au terme d’“antilangue”, proposé par<br />
Halliday (1978), pour caractériser la variété suburbaine du français comme un type d’argot atteint<br />
de certains traits de créolisation. Cette variété qui s’inscrit dans un projet de forme de vie alternative<br />
et contestataire – mais qui coexiste néanmoins avec l’ordre dit ‘légit<strong>im</strong>e’, hégémonique dans la<br />
même société – mérite sans aucun doute la dénomination de “langue fonctionnelle” (au sens de<br />
Coseriu: 1988) à part entière.