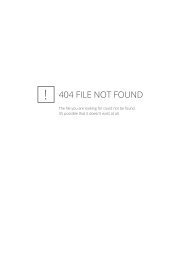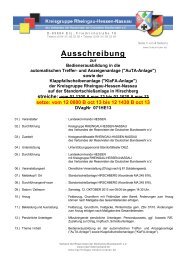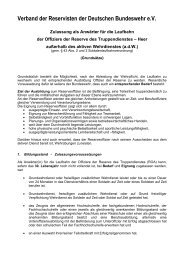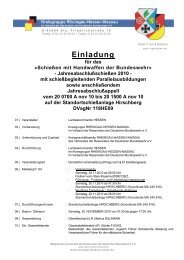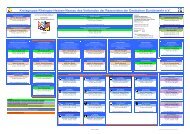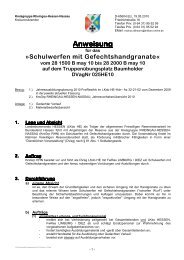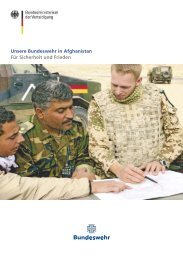Zeitschrift "Militärgeschichte"
Zeitschrift "Militärgeschichte"
Zeitschrift "Militärgeschichte"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Heft 3/2005<br />
Militärgeschichte<br />
<strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung<br />
C 21234 ISSN 0940 – 4163<br />
Militärgeschichte im Bild: 12. November 1955 – Gründungstag der Bundeswehr<br />
Bundesmarine<br />
Sanitätsdienst vor Verdun<br />
Major Kuhn<br />
Was ist Strategie?<br />
Militärgeschichtliches Forschungsamt<br />
MGFA
IMPRESSUM<br />
Militärgeschichte<br />
<strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung<br />
Herausgegeben<br />
vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt<br />
durch Oberst Dr. Hans Ehlert und<br />
Oberst i.G. Dr. Hans-Hubertus Mack<br />
(V.i.S.d.P.)<br />
Produktionsredakteur der<br />
aktuellen Ausgabe:<br />
Major Heiner Bröckermann M.A.<br />
Redaktion:<br />
Major Heiner Bröckermann M.A. (hb)<br />
Hauptmann Agilolf Keßelring M.A. (aak)<br />
Bildredaktion:<br />
Dipl.-Phil. Marina Sandig<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Richard Göbelt, Cand. Phil.<br />
Lektorat:<br />
Dr. Aleksandar-S. Vuletić<br />
Layout/Grafik:<br />
Maurice Woynoski<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Redaktion »Militärgeschichte«<br />
Militärgeschichtliches Forschungsamt<br />
Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam<br />
Telefon: (03 31) 97 14 -569<br />
Telefax: (03 31) 97 14 -507<br />
Homepage: www.mgfa.de<br />
Technische Herstellung:<br />
MGFA, Schriftleitung<br />
Manuskripte für die Militärgeschichte werden<br />
an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt<br />
eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet.<br />
Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt<br />
der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung,<br />
Übersetzung usw. Honorarabrechnung<br />
erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die<br />
Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter<br />
Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise,<br />
fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung<br />
sind nur nach vorheriger schriftlicher<br />
Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben<br />
erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme<br />
in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen<br />
auf CD-ROM. Die Redaktion hat<br />
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die<br />
Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser <strong>Zeitschrift</strong><br />
durch Angabe eines Link verwiesen wird.<br />
Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwortung<br />
für die Inhalte aller durch Angabe<br />
einer Linkadresse in dieser <strong>Zeitschrift</strong> genannten<br />
Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt<br />
für alle ausgewählten und angebotenen Links<br />
und für alle Seiteninhalte, zu denen Links oder<br />
Banner führen.<br />
© 2005 für alle Beiträge beim<br />
Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA)<br />
Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt<br />
worden sein, bitten wir ggf. um Mitteilung.<br />
Druck:<br />
SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden<br />
ISSN 0940-4163<br />
Editorial<br />
vor 157 Jahre wurde die erste deutsche<br />
Marine im Zuge der Bewilligung durch die<br />
Nationalversammlung in Frankfurt am Main<br />
gegründet. Die Handelsflotte der Staaten<br />
des Deutschen Bundes umfasste damals fast<br />
7000 Schiffe. Während der Deutsche Bund<br />
im Kriegsfall zehn Armeekorps mobilisieren<br />
konnte, verfügte er über keine gemeinsame<br />
Kriegsflotte. So kam es 1848 zu jener ersten<br />
Gründung im Angesicht eines Konfliktes<br />
mit Dänemark. Die Seestadt Bremerhaven<br />
wurde der erste Flottenstützpunkt, und<br />
zum ersten Admiral wurde der Sachse<br />
Karl Rudolf Bromme (1804–1860), genannt 5<br />
Brommy, ernannt. Er war 1848 mit einem SAIL 2005 Bremerhaven: Vor dem<br />
Bestseller bekannt geworden und empfahl italienischen Schulschiff »Amerigo Vespucci«<br />
sich so selbst für sein hohes Amt. Sein Buch<br />
»Die Marine. Eine gemeinfassliche Darstellung des gesammten Seewesens für die Gebildeten<br />
aller Stände« verdeutlichte den Deutschen, was ihnen fehlte: Eine gemeinsame<br />
Marine und die Vorteile einer Seemacht. Das voluminöse Werk, das im Laufe der<br />
Zeit mehrere Auflagen erfuhr, ist aber auch eine Quelle ewiger Wahrheiten über<br />
den Seemann, wie die folgenden Auszüge beweisen:<br />
»Der Körper dieser eigenen Menschenklasse trotzt der Hitze und Kälte, der Trockenheit,<br />
dem Nebel, Regen und Schnee; ... wenn sein Gaumen auch eine hohe Sinnesbildung hat, so<br />
ist sein Magen viel weniger zart ... Im Hafen angelangt, zeigt er häufig eine überraschende<br />
Entwicklung der Körperkraft, so dass man ihm gar nicht anmerkt, dass er der Ruhe nach<br />
einer stürmischen, mühevollen Reise bedürftig wäre.«<br />
Brommy, der mit 14 Jahren als Schiffsjunge seine Karriere begonnen hatte, musste<br />
bereits 1852 die Versteigerung seiner Schöpfung erleben. Nach dem Scheitern<br />
der Revolution von 1848/49 und der Aufhebung der dänischen Seeblockade war<br />
auch das Ende der ersten deutschen Marine gekommen. Österreich und Preußen<br />
setzten auf den Ausbau Ihrer eigenen Verbände. Aus der sehr kleinen preußischen<br />
Marine, die damals auch das Flaggschiff »Barbarossa« übernommen hatte, entwickelte<br />
sich später die Marine des Norddeutschen Bundes und dann des Kaiserreichs.<br />
Deren Geschichte schloss sich die der Marinen der Weimarer Republik und<br />
des »Dritten Reiches« an.<br />
Der Neuanfang als Bundesmarine stand 1956 unter dem günstigen Stern der<br />
NATO, dem größten Seebündnis aller Zeiten. Und diese Mitgliedschaft in der<br />
NATO verwirklichte auch den langen deutschen Traum von Seemacht. Die Bundeswehr<br />
knüpft inzwischen wieder an die alten Traditionen der Marine von 1848<br />
und die Idee vom Bürgersoldaten an. Das zeigte auch der diesjährige Festakt zu 50<br />
Jahren Bundeswehr anlässlich der SAIL 2005 in Bremerhaven. Die deutsche Einheit<br />
brachte 1990 für die Bundesmarine auch eine Namensänderung. Als Deutsche<br />
Marine steht sie nun im Einsatz oder wirkt als »Botschafter in Blau« für unseren<br />
demokratischen Rechtsstaat in Übersee.<br />
Viel Freude beim Lesen des Aufsatzes zur jungen Bundesmarine und der anderen<br />
Beiträge zur Militärgeschichte und Strategie wünscht Ihnen<br />
Heiner Bröckermann M.A., Major<br />
Anmerkung in eigener Sache: Dem Heft liegt das historische Poster<br />
»Unsere Bundeswehr stellt Freiwillige ein!« bei.<br />
Foto: Sabine Fangmann
D i e A u t o r e n<br />
Inhalt<br />
Die Herausforderungen eines maritimen Neuanfangs:<br />
• Vor 50 Jahren schlug die<br />
Geburtsstunde der Bundesmarine<br />
4<br />
Dr. Johannes Berthold<br />
Sander-Nagashima,<br />
geboren 1957 in Stein b. Pforzheim,<br />
Fregattenkapitän und Wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am MGFA, Potsdam<br />
• Der Sanitätsdienst vor Verdun im<br />
Ersten Weltkrieg<br />
• Major Kuhn<br />
Ein unbekanntes Mitglied des deutschen<br />
Widerstandes vom 20. Juli 1944<br />
10<br />
14<br />
Christoph Schneider,<br />
geboren 1969 in Gräfeling,<br />
Lehramtsassessor und wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Institut für Geschichte der<br />
Medizin, Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München<br />
Prof. Dr. Boris Khavkin,<br />
geboren 1954 in Moskau,<br />
Akademie der Militärwissenschaften,<br />
Moskau<br />
• Was ist Strategie?<br />
Definition zur Kunst des Feldherrn<br />
• Service<br />
Das historische Stichwort:<br />
Die Schlacht auf dem Lechfeld 955<br />
Medien online/digital<br />
Lesetipp<br />
Ausstellungen<br />
Geschichte kompakt<br />
• Militärgeschichte im Bild<br />
12. November 1955 – Bonn, Ermekeilkaserne<br />
Der umstrittene Geburtstag der Bundeswehr<br />
18<br />
22<br />
22<br />
24<br />
26<br />
28<br />
30<br />
31<br />
Direktor und Prof. Dr. Beatrice Heuser,<br />
geboren 1961 in Bangkok (Thailand),<br />
Leiter Abteilung Forschung, MGFA,<br />
Potsdam<br />
(v.l.n.r.) Staatssekretär Dr. Josef Rust,<br />
Generalleutnant Adolf Heusinger,<br />
Bundesverteidigungsminister Theodor Blank<br />
und Generalleutnant Dr. Hans Speidel nach<br />
der Feierstunde am 12. November 1955<br />
auf dem Hof der Bonner Ermekeilkaserne<br />
im Mittelpunkt des Interesses der Fotografen.<br />
Die ersten 101 Soldaten der neuen deutschen<br />
Streitkräfte erhielten an diesem Tag von<br />
Minister Blank ihre Ernennungsurkunden.<br />
Foto: picture-alliance/dpa<br />
Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Eberhard Birk, Offizierschule der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck; Dr. Klaus-Jürgen Bremm, Osnabrück;<br />
René Henn M.A., Salzwedel; Hauptmann Thorsten Loch M.A., MGFA; Leitender Wiss. Direktor Dr. Bruno Thoß, MGFA
Bundesmarine<br />
Die Herausforderungen eines maritimen Neuanfangs:<br />
Vor 50 Jahren schlug die Geburtsstunde<br />
der Bundesmarine<br />
dpa/Picture-Alliance<br />
Am 12. November 1955 erhielten<br />
bisherige zivile Mitarbeiter<br />
des »Bundesministeriums für<br />
Verteidigung« die ersten Ernennungsurkunden,<br />
die dadurch nunmehr offiziell<br />
zu Angehörigen der neuen Bundesmarine<br />
wurden. Und gegen Ende<br />
des Monats war die somit gegründete<br />
Marine ganze 26 Mann stark. Die<br />
geringe Zahl des Personals und die<br />
Tatsache, dass die Marine noch über<br />
kein einziges Schiff oder Boot verfügte,<br />
sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen,<br />
dass ihre Gründerväter bereits<br />
wichtige Vorarbeiten geleistet hatten.<br />
Bei ersten Überlegungen hatten die<br />
NATO-Verbündeten einen westdeutschen<br />
deutschen maritimen Verteidigungsbeitrag<br />
gar nicht und später<br />
nur als Küstenvorfeldmarine (»Brown<br />
Water Navy« wegen des im Watt und<br />
den Flüssen vorwiegend anzutreffenden<br />
braunen Wassers) in Erwägung<br />
gezogen. Dagegen konnten Kreise ehemaliger<br />
Angehöriger der Kriegsmarine<br />
des »Dritten Reiches«, aus denen<br />
später auch die erste Führungsgeneration<br />
der Bundesmarine hervorging (an<br />
dieser Stelle seien Friedrich Ruge, Gerhard<br />
Wagner, Karl-Adolf Zenker und<br />
Heinrich Gerlach genannt), diese Einschränkungen<br />
überwinden. Sowohl<br />
was den Aufgabenkatalog als auch<br />
den Umfang und die Zusammensetzung<br />
betrifft, gelang es ihnen, die Tür<br />
für eine künftige Rolle der Bundesmarine<br />
als kleinen aber grundsätzlich<br />
gleichberechtigten Partner innerhalb<br />
des westlichen Bündnisses zu öffnen.<br />
Die Zustimmung der NATO zu einer<br />
Flotte, welche nicht mehr nur aus<br />
Kleinbootsverbänden, sondern auch<br />
aus Ubooten und Jagdbombern sowie<br />
»Blue-Water«-Elementen (Fregatten und<br />
Zerstörer) bestehen sollte, erfolgte<br />
schließlich 1955. Der Umstand, dass<br />
die Bundesmarine die kleinste Teilstreitkraft<br />
der künftigen Bundeswehr<br />
werden sollte, kam ihr dabei wie auch<br />
wiederholt später durchaus zugute.<br />
Denn dadurch befand sie sich sowohl<br />
aus der Sicht der Verbündeten als auch<br />
der westdeutschen Öffentlichkeit tendenziell<br />
im Windschatten der Aufmerksamkeit,<br />
die sich viel stärker auf<br />
die größeren Schwesterteilstreitkräfte<br />
Heer und Luftwaffer richtete. Aus dieser<br />
Perspektive erschienen nicht nur<br />
die meisten Marineforderungen vergleichsweise<br />
moderat, sondern stießen<br />
gelegentliche maritime »Missgeschicke«<br />
(z.B. Probleme mit Neubauten von<br />
5 Vizeadmiral Friedrich Ruge, Inspekteur der<br />
Marine 1957–1961<br />
Fahrzeugen und Schiffen) auf ein eher<br />
verhaltenes Interesse in der Öffentlichkeit.<br />
Flotte im NATO-Auftrag<br />
Im Dezember 1955 billigte die NATO<br />
einen Umfang der bundesdeutschen<br />
Flotte von 142 Kleinfahrzeugen und<br />
Booten, darunter auch 12 Uboote, 18<br />
Zerstörer und Geleitfahrzeuge, sowie<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
4<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
MGFA-Nachlass Ruge<br />
5 Indienststellung eines Geleitbootes<br />
(Fregatte) der KÖLN-Klasse<br />
MGFA-Nachlass Ruge<br />
3 Am 16. Januar 1956 überreichte Verteidigungsminister<br />
Theodor Blank anlässlich<br />
seines Besuches bei der Marine-Lehrkompanie<br />
in Wilhelmshaven dem Fregattenkapitän<br />
Griemann dessen Ernennungsurkunde.<br />
58 Luftfahrzeuge. Mit dieser Streitmacht<br />
plante die Führung der Bundesmarine,<br />
im Kriegsfall die Zugänge<br />
zur Ostsee zu sichern und die gegnerischen<br />
Seewege in der Ostsee zu unterbrechen.<br />
Außerdem sollten das Heer<br />
unterstützt und die eigenen Seewege<br />
geschützt werden. Dabei dachten die<br />
Verantwortlichen bereits daran, sich<br />
auch am Konvoidienst der NATO im<br />
Nordatlantik, wenn gleich im begrenzten<br />
Umfang, zu beteiligen.<br />
Solche Überlegungen stießen in den<br />
Anfangsjahren der Bundesmarine bei<br />
einigen der größeren NATO-Partner<br />
aber keineswegs auf Zustimmung.<br />
Der schließlich gefundene Kompromiss<br />
im Jahre 1955 enthielt die Formel<br />
vom Einsatz der Bundesmarine in den<br />
deutschen »Küsten- und angrenzenden<br />
Gewässern« und wies somit auf<br />
die prinzipelle Möglichkeit hin, deutsche<br />
Vorstellungen einer »Blue-Water«-<br />
Marine in Zukunft zu realiseren. Das<br />
Spannungsfeld zwischen bereitwilliger<br />
Eingliederung der Bundeswehr/<br />
Bundesmarine in die NATO und der<br />
Wahrung als legitim betrachteter westdeutscher<br />
maritimer Interessen innerhalb<br />
des Bündnisses war damit bereits<br />
vorgezeichnet. Ein Thema, das bis auf<br />
den heutigen Tag nichts an Aktualität<br />
verloren hat.<br />
5 Vizeadmiral Ruge fertigte diese Bildcollagen<br />
für sein privates Fotoalbum an. Sie verdeutlichen<br />
den Aufbau der Bundesmarine quasi<br />
aus dem Nichts heraus.<br />
Vordienstzeit in drei Marinen<br />
Es waren keineswegs allein konzeptionelle<br />
und bündnispolitische Herausforderungen,<br />
mit denen sich die junge<br />
Bundesmarine konfrontiert sah. Die<br />
Masse der Marineangehörigen und<br />
insbesondere des führenden Personals<br />
hatten in bis zu drei deutschen Vorgängermarinen<br />
(Kaiserzeit, Weimarer<br />
Republik und »Drittes Reich«) gedient<br />
und fanden sich nach Gründung der<br />
Bundesmarine erneut als Träger des<br />
blauen Tuchs, nun aber in einer völlig<br />
veränderten innenpolitischen wie auch<br />
außenpolitischen Landschaft wieder.<br />
Deshalb sollen zumindest einige Anmerkungen<br />
zur Mentalität, die bei führenden<br />
Marineoffizieren anzutreffen<br />
war, gemacht werden.<br />
Der erste Inspekteur der Bundesmarine<br />
(1957–1961), Vizeadmiral Friedrich<br />
Ruge, von Hause aus mit einer gehörigen<br />
Portion Humor gesegnet, führte<br />
die Bundesmarine in durchaus väterlicher<br />
Weise und verstand es, bei Konflikten<br />
mäßigend auf die Beteiligten<br />
einzuwirken. Konfliktpotentiale gab es<br />
vor allem bei Problemen im Zusammenhang<br />
mit der »Großadmiralsfrage«.<br />
Die Großadmirale der Kriegsmarine<br />
Erich Raeder und Karl Dönitz waren in<br />
den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen<br />
verurteilt worden und Dönitz<br />
saß zum Zeitpunkt der Gründung<br />
der Bundesmarine noch im Spandauer<br />
Kriegsverbrechergefängnis ein. Für viele<br />
ehemalige Angehörige der Kriegsmarine<br />
war das Grund genug, eine<br />
Mitarbeit am Aufbau der Bundesmarine<br />
abzulehnen, da sie Raeder und<br />
Dönitz als zu unrecht verurteilte maritime<br />
Märtyrer ansahen. Ruges späterer<br />
Nachfolger als Inspekteur, Karl-<br />
Adolf Zenker, berührte diesen wunden<br />
Punkt, als er im unmittelbaren Umfeld<br />
der Gründung der Bundesmarine, im<br />
Januar 1956 in einer Ansprache das<br />
»Großadmiralsproblem« ohne die erforderliche<br />
Differenzierung aufgriff<br />
und dadurch für Aufsehen bis in den<br />
Bundestag sorgte. Ebenso gab es in<br />
den Reihen der Ehemaligen erhebliche<br />
Meinungsverschiedenheiten darüber,<br />
wie der Umsturzversuch gegen Hitler<br />
vom 20. Juli 1944 und die Haltung der<br />
daran beteiligten Offiziere zu bewerten<br />
seien.<br />
Ruge verstand es, marineintern geschickt<br />
auf vermittelnde Sprachregelungen<br />
hinzuwirken und letztlich breite<br />
öffentliche Unterstützung in der Bevölkerung<br />
für den anstehenden Neuaufbau<br />
der Bundesmarine zu mobilisieren.<br />
Mit seinem Stellvertreter Gerhard<br />
Wagner stand ihm hierin ein erfahrener<br />
Helfer zur Seite, dessen ausgleichende<br />
Art schließlich in dessen Verwendung<br />
in der Schlüsselposition als COMNAV-<br />
BALTAP (Kommander der Seestreitkräfte<br />
der Ostseezugänge) sehr vorteilhaft<br />
zur Geltung kam. Vorher hatten<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 5
Bundesmarine<br />
Heiner Bröckermann<br />
5 Das Segelschulschiff GORCH FOCK, benannt nach dem Pseudonym<br />
des Schriftstellers Johann Kinau, der 1916 an Bord von SMS<br />
WIESBADEN in der Skagerrakschlacht fiel, lief 1958 vom Stapel.<br />
5 Das Schulschiff DEUTSCHLAND, Klasse 440, diente für Generationen<br />
von Offizieren und Unteroffizieren der Bundesmarine als schwimmende<br />
Ausbildungsstätte. Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
Ruge und Wagner bei einem informellen<br />
Jagdausflug das Vertrauen und die<br />
Unterstützung ihrer dänischen Kameraden<br />
gewinnen können, für die es<br />
aus politischen Gründen aufgrund der<br />
jüngsten Vergangenheit nicht einfach<br />
war, in Kriegszeiten dänische Streitkräfte<br />
einem deutschen Offizier unterstellen<br />
zu müssen, selbst wenn dieser<br />
als NATO-Befehlshaber als Vertreter<br />
des Bündnisses handelte.<br />
Auf anderen Gebieten war und blieb<br />
Ruge einer Tradition verhaftet, die vor<br />
1945 geprägt worden war. Es fiel ihm<br />
schwer, den Befehlshaber des Flottenkommandos<br />
Konteradmiral Rolf Johannesson,<br />
einen sehr unabhängigen und<br />
kritischen Geist, zu ertragen. So notierte<br />
Ruge über ihn lapidar: »Muss weg.«<br />
Dabei hätte es sich durchaus gelohnt<br />
zu ergründen, was Johannesson eigentlich<br />
bewegte, denn jener hatte es nicht<br />
nur während des Zweiten Weltkrieges<br />
in einer im Kameradenkreis aufsehenerregenden<br />
Weise gewagt, sich kritisch<br />
über Hitler zu äußern, sondern er hob<br />
1957 mit Unterstützung des des Historikers<br />
Jürgen Rohwer eine bis heute<br />
bestehende Institution der Bundesmarine<br />
aus der Taufe: die jährliche Historisch-taktische<br />
Tagung der Flotte; ein<br />
Forum, das seitdem Raum für konstruktive<br />
und kontroverse Reflexion<br />
innerhalb des Offizierkorps der Bundesmarine<br />
geboten hat.<br />
Bundesmarine und Innere Führung<br />
Das mit Aufstellung der Bundeswehr<br />
ebenfalls ganz neu entwickelte Konzept<br />
der Inneren Führung scheint der<br />
erste Inspekteur der Bundesmarine niemals<br />
völlig verinnerlicht zu haben.<br />
Zwar setzte er sich mit dessen geistigen<br />
Architekten, Wolf Graf Baudissin, hierüber<br />
auseinander, war aber schließlich<br />
der Meinung, dass es sich hierbei um<br />
ein Prinzip handele, »das vernünftige<br />
Leute in der Marine doch schon immer<br />
befolgt hätten«. Dennoch blieb wohl<br />
zeitlebens die Frage für ihn offen,<br />
was der Vorgesetzte im Rahmen des<br />
Konzepts der Inneren Führung denn<br />
eigentlich »konkret tun« solle. Bei der<br />
Personalführung haderte Ruge stets<br />
damit, dass er hier zu wenig Einfluss<br />
zu haben glaubte, denn sie lag letztlich<br />
in den Händen eines zivilen Abteilungsleiters<br />
des Ministeriums. Offiziell<br />
trat Ruge zwar für »Offenheit und Ehrlichkeit«<br />
im Umgang mit den Untergebenen<br />
ein, was aber Grenzen gehabt<br />
zu haben scheint, da aus seiner Sicht<br />
die Eröffnungspflichten des Beurteilungssystems<br />
der Bundeswehr »viel zu<br />
weitgehend« waren und er es befürwortete,<br />
die Untergebenen darüber im<br />
Dunkeln zu lassen, ob sie beispielsweise<br />
auf ihren gegenwärtigen Dienstposten<br />
befördert werden konnten oder<br />
nicht.<br />
Dergleichen patriarchalische Tendenzen<br />
waren wohl durchaus repräsentativ<br />
für den bei vielen Flaggoffizieren<br />
(Offiziere im Admiralsrang)<br />
seinerzeit herrschenden Geist. So hatte<br />
der spätere Flottenchef und Architekt<br />
der Modernisierung der Bundesmarine<br />
Vizeadmiral Heinrich Gerlach<br />
intern noch vor der Gründung der Bundesmarine<br />
die Eignung des deutschen<br />
Volkes für die Demokratie in Zweifel<br />
gezogen. Solche Haltungen unterschieden<br />
sich jedoch keineswegs von vielfach<br />
auch sonst in der Gesellschaft der<br />
jungen Bundesrepublik vorhandenen<br />
Einstellungen.<br />
Menschenbild und politisches Denken<br />
der Philosophie der Aufklärung,<br />
obgleich zwar mit dem Grundgesetz<br />
nunmehr zur Verfassungsgrundlage<br />
des Staates und somit auch der Bundesmarine<br />
geworden, prägten eben noch<br />
keineswegs im vollen Umfang das tatsächliche<br />
Denken des Führungspersonals<br />
der neuen Marine. Dies ist keineswegs<br />
überraschend, wenn man in<br />
Betracht zieht, dass die Ablehnung<br />
genau dieser Prinzipien von den Marineoffizieren<br />
während ihres Dienstes<br />
in den Vorgängermarinen der Bundesmarine<br />
sozusagen mit der Muttermilch<br />
aufgesogen worden war. Noch in<br />
den 1970er Jahren hatte praktisch die<br />
gesamte Führungsspitze der Bundesmarine<br />
auf diesem Gebiet ihre Schwierigkeiten,<br />
obgleich inzwischen mehr als<br />
zehn Jahre vergangen waren, in denen<br />
man die notwendigen »Hausaufgaben«<br />
hätte machen können. Das vom<br />
deutschen Marinehistoriker Michael<br />
Salewski als »schmale Bögen der Kontinuität«<br />
bezeichnete und primär an<br />
den Personen Ruge und Wagner festgemachte<br />
Fortwirken von Haltungen<br />
und Einstellungen aus den Vorgängermarinen<br />
der Bundesmarine scheint sich<br />
tatsächlich hier noch ausgewirkt zu<br />
haben. Aus diesen Schwierigkeiten mit<br />
der Inneren Führung kann geschlossen<br />
werden, dass diese Kontinuitätsbögen<br />
in mancher Hinsicht keineswegs<br />
so schmal waren.<br />
6<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
5 Das Landungsboot L 750 KROKODIL wurde 1958 bei der US Navy gekauft<br />
und später mit einer neuen Bugrampe und einem Hubschrauberdeck ergänzt.<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
Konzepte für den Ernstfall<br />
Auf Grundlage des in den konzeptionellen<br />
Dokumenten niedergelegten<br />
Aufgabenkataloges und der damaligen<br />
NATO-Strategie der »massiven (atomaren)<br />
Vergeltung« (Massive Retaliation)<br />
begann die Marine unter Ruges<br />
Führung ab 1958 konkretere Überlegungen<br />
darüber anzustellen, wie sie<br />
ihren Auftrag im Kriegsfall erfüllen<br />
konnte. Das damalige Kriegsbild ging<br />
von einem atomaren und konventionellen<br />
Großangriff des Warschauer<br />
Paktes aus, wobei von Anfang an und<br />
über eine Dauer von etwa 30 Tagen der<br />
Austausch von Nuklearschlägen im<br />
Vordergrund stehen würde. Diese Phase<br />
hoffte die Bundesmarine, gestützt<br />
auf eine Versorgung durch in See<br />
stehende logistische Komponenten,<br />
noch vergleichsweise besser zu überstehen<br />
als die im höheren Maß von<br />
ortsfesten Landeinrichtungen abhängigen<br />
Schwesterteilstreitkräfte Heer<br />
und Luftwaffe.<br />
Der Schwerpunkt des gegnerischen<br />
Angriffs wurde im Ostseebereich erwartet.<br />
Die Abwehr der hier angenommenen<br />
triphibischen Landungsoperationen<br />
großen Stils gegen die<br />
Ostseezugänge sollte dann als dynamische<br />
Vorwärtsverteidigung erfolgen:<br />
Man wollte die gegnerischen Landungsverbände<br />
bereits möglichst weit<br />
ostwärts mit Ubooten angreifen, in der<br />
mittleren Ostsee stellen, durch kombinierte<br />
Angriffe von Schnellbooten,<br />
Jagdbombern und Zerstörern entscheidend<br />
schwächen und spätestens im<br />
Bereich der Landungsstrände durch<br />
den zusätzlichen defensiven Einsatz<br />
von Minen vollends zerschlagen.<br />
Gleichzeitig sollten dem Gegner auch<br />
die Nutzung der Seewege der Ostsee<br />
zur Unterstützung seines Vorstoßes<br />
nach Westeuropa verwehrt und die<br />
eigenen Nachschubrouten von Westen<br />
gesichert werden.<br />
Eine Serie von Planspielen, die die<br />
Bundesmarine zur Klärung verschiedener<br />
Aspekte solcher Operationen bis<br />
Anfang der 1960er Jahre durchführte,<br />
führte jedoch bald zu einer ernüchternden<br />
Erkenntnis: Insbesondere in<br />
den militärisch entscheidenden Gebieten<br />
der mittleren und westlichen Ostsee<br />
waren aufgrund der erdrückenden<br />
sowjetischen Überlegenheit an modernen<br />
Seeluftstreitkräften erfolgreiche<br />
Operationen bundesdeutscher und dänischer<br />
Überwasserkräfte nicht möglich.<br />
Damit wurde auch das Zusammenwirken<br />
zwischen Jagdbombern<br />
und Schnellbooten, die ursprünglich als<br />
das wichtigste Mittel zur Abwehr von<br />
Landungsverbänden betrachtet worden<br />
waren, hinfällig. Man ging nun<br />
davon aus, dass selbst nach durchgeführtem<br />
Atomic Strike Plan ASP der<br />
NATO, Zielplanung für Einsätze von<br />
Nuklearwaffen, die gegnerische Luftüberlegenheit<br />
noch nicht hinreichend<br />
reduziert sein würde. Ohne massive<br />
Hilfe der NATO-Partner sah die Marineführung<br />
keinerlei Möglichkeit, den<br />
sowjetischen Vormarsch in der Ostsee<br />
aufzuhalten. Das war durchaus eine<br />
Art konzeptioneller Offenbarungseid,<br />
denn letztlich war ja die Notwendigkeit<br />
eines bundesdeutschen maritimen<br />
Verteidigungsbeitrages gerade mit dem<br />
5 Das Uboot U1. Die Klasse 201 wurde 1962 in Dienst<br />
gestellt. U1 blieb nach einem Umbau zur Klasse 205 A<br />
noch bis 1991 im Dienst. Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
Fehlen von NATO-Kräften in der Ostsee<br />
sowie der speziellen deutschen<br />
Kenntnis von Seegebiet und Gegner<br />
dort gerechtfertigt worden.<br />
Die Lage veränderte sich jedoch<br />
wesentlich, als die Jagdbomber der<br />
Marineflieger der sowjetischen Rotbannerflotte<br />
in der Ostsee 1961 der sowjetischen<br />
Luftverteidigung unterstellt<br />
wurden. Daher standen sie nicht mehr<br />
für Einsätze gegen Seeziele zur Verfügung<br />
und übten diese Rolle auch nicht<br />
mehr, sondern waren nur noch für den<br />
Kampf gegen westliche zum »strike«<br />
einfliegende Luftstreitkräfte vorgesehen.<br />
Damit waren aber keineswegs alle<br />
Sorgen der Bundesmarine weggefallen,<br />
denn inzwischen waren Schiff-Schiff-<br />
Flugkörper auf den sowjetischen Einheiten<br />
eingeführt worden, denen der<br />
Westen damals noch nichts Gleichwertiges<br />
entgegen zu setzen hatte.<br />
Erweitert wurde dieses neue Bedrohungspotzenzial<br />
durch weit reichende<br />
Flugkörper an Bord der neu eingeführten<br />
sowjetischen »Badger«-Bomber.<br />
Dieser Bedrohung entsprach auch<br />
die erste »offizielle« von Vizeadmiral<br />
Edward Wegener entworfene Konzeption<br />
der Marine noch nicht, weshalb<br />
Zenker, seit 1961 Ruges Nachfolger als<br />
Inspekteur, den nachmaligen Flottenchef<br />
Gerlach beauftragte, einen Ausweg<br />
aus dieser unbefriedigenden Situation<br />
zu finden. Dieser entwarf daraufhin die<br />
Vision einer bis etwa 1970 zu modernisierenden<br />
Flotte, in der mit Flugabwehrflugkörpern<br />
bestückte Korvetten<br />
einen Luftschirm bilden sollten,<br />
unter dem dann mit verbesserter Artillerie,<br />
vor allem aber mit weitreichen-<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 7
Bundesmarine<br />
Meuterei oder Bürgerrecht?<br />
Fernab konzeptioneller Probleme ereignete sich in der<br />
Flotte 1971 eine Art »kleiner Meuterei«, die wohl besonders<br />
geeignet ist zu belegen, dass auch in der Marine<br />
»überkommene Autoritäten einem bisher ungekannten<br />
Legitimationszwang« unterworfen wurden: Offiziere eines<br />
Marinefliegergeschwaders hatten sich für eine Gleichbehandlung<br />
bei den Zulagen eingesetzt und sich in diesem<br />
Zusammenhang kurz vor der entscheidenden Sitzung des<br />
zuständigen Bundestagsausschusses zu diesem Thema an<br />
den Bundeswehrverband, an SPD- und FDP-Abgeordnete<br />
sowie den Wehrbeauftragten Fritz-Rudolf Schultz<br />
gewandt. Außerdem waren über die Vertrauensleute zahlreiche<br />
Briefe in dieser Angelegenheit an Verteidigungsminister<br />
Helmut Schmidt (SPD) gelangt.<br />
Die Marineführung reagierte prompt: Die Vertrauensleute<br />
wurden kurzfristig nach Bonn gerufen, wo der<br />
stellvertretende Inspekteur Vizeadmiral Heinz Kühnle<br />
ihnen gegenüber angeblich nicht allein seinen Unmut<br />
5 Verteidigungsminister Helmut Schmidt mit Vertrauensmännern der<br />
Bundeswehr<br />
ausdrückte, sondern ihnen auch das Recht bestritt, sich vor vollständiger Ausschöpfung des Beschwerdeweges an den Wehrbeauftragten<br />
zu wenden, dessen Notwendigkeit er ohnehin nicht einsehe, und er bezweifelte zudem das Recht des Soldaten, sich mit<br />
einer Petition direkt an den Minister zu wenden. Sogleich nach der Rückkehr der Vertrauensleute untersagte ihnen der Kommandeur<br />
der Marinefliegerdivision persönlich, die Äußerungen des stellvertretenden Inspekteurs an die Presse dringen zu lassen, und<br />
kurz darauf teilte der Geschwaderkommodore seinen Offizieren die »schärfste Missbilligung« ihres Vorgehens durch den Inspekteur<br />
Vizeadmiral Gert Jeschonnek, den Flottenchef Vizeadmiral Armin Zimmermann und den Kommandeur der Marinefliegerdivision<br />
Flottillenadmiral Günter Luther mit. Er verbot ihnen jegliche direkte Kontaktaufnahme mit dem Wehrbeauftragten, Minister und<br />
den Abgeordneten sowie sich an die Öffentlichkeit zu wenden.<br />
Unverzüglich verstießen die empörten Offiziere gegen diesen Befehl, informierten den Wehrbeauftragten<br />
und forderten, obgleich der zwischenzeitlich herbeigeeilte Kommandeur der<br />
Marinefliegerdivision den Befehl des Kommodore widerrufen hatte, die Bestrafung des Inspekteurs,<br />
seines Stellvertreters, des Flottenchefs und des Kommandeurs der Marinefliegerdivision.<br />
Der Inspekteur bestritt nun in einem Fernschreiben, dass der Versuch gemacht worden sei,<br />
den Offizieren das Petitionsrecht vorzuenthalten, warf ihnen aber vor, den Dienstweg nicht<br />
5 Vizeadmiral Gert Jeschonnek,<br />
Inspekteur der Marine<br />
1967–1971<br />
eingehalten zu haben. Seine Missbilligung wollte er nur auf ausdrücklichen Befehl des Ministers<br />
zurücknehmen. Die betroffenen Offiziere bekräftigten indessen in Presseinterviews ihre<br />
Haltung und erklärten, dass der Inspekteur ihnen im Endeffekt zwar bescheinigt habe, dass<br />
ihre Aktivitäten rechtens gewesen seien, ihnen aber zugleich beizubringen versucht habe, es sei<br />
»nicht alles richtig was rechtens ist«.<br />
In seinem Abschlussbericht konstatierte der Wehrbeauftragte »Unklarheiten« in den Befehlen<br />
und Äußerungen der beteiligten Flaggoffiziere und riet dazu, »Fehler, die aus menschlicher<br />
Unvollkommenheit begangen worden sind«, zuzugeben. Autorität werde dadurch eher gewonnen<br />
denn verloren. Wenngleich es dazu nicht kam, konnten schließlich alle Beteiligten zufrieden<br />
mit dem Ausgang der Affäre sein: Die Zulagen der Offiziere wurden auf ein einheitliches<br />
Niveau angehoben und einer der Beschwerdeführer wurde später Kommodore seines Geschwaders.<br />
Der stellvertretende Inspekteur wurde der nächste Inspekteur der Marine, der Chef der Marinefliegerdivision der übernächste<br />
Inspekteur, der Flottenchef gar Generalinspekteur der Bundeswehr und der damalige Inspekteur ging planmäßig in den Ruhestand.<br />
Zwölf Tage nach der Pensionierung hob Verteidigungsminister Schmidt die Missbilligung des vormaligen Inspekteurs auf.<br />
Dieser in der deutschen Marinegeschichte einmalige Vorgang belegt eine Veränderung, deren Richtung erkennbar wird, wenn<br />
man sich verdeutlicht, dass ein derartiges Aufbegehren samt Petition ans Parlament von Untergebenen in den Marinen, in denen<br />
die Gründerväter der Bundesmarine gedient hatten, kaum vorstellbar war. Kam dergleichen, wie z.B. 1917 in der kaiserlichen<br />
Marine, dennoch vor, so waren Todesurteile und Staatskrise nicht weit. Umgekehrt erscheint es heute als kaum vorstellbar, dass<br />
einem Angehörigen der Deutschen Marine seine Petitionsrechte bestritten würden.<br />
dpa/Der Spiegel<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
8<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
5 Schnellboot P6191 HUGIN, Klasse 152<br />
5 Zerstörer Z1 (D 170). Die Zerstörer Z1 bis<br />
Z6 wurden Ende der 1950er Jahre als<br />
Leihgabe von der US Navy übernommen.<br />
Nach mehreren Verlängerungen der Leihfrist<br />
wurden sie 1976 angekauft.<br />
5 Der Zerstörer LÜTJENS (D 185) ist ein im<br />
Text genannter DDG. Er wurde im Auftrag<br />
der Bundesregierung in den USA gebaut<br />
und am 22. März 1969 in Dienst gestellt.<br />
den, drahtgelenkten Torpedos bewaffnete<br />
Schnellboote zusammen mit dem<br />
bereits zur Einführung vorgesehenen<br />
F-104-Jagdbombern vom Typ »Starfighter«<br />
nunmehr mit deutlich verbesserten<br />
Erfolgsaussichten eingesetzt<br />
werden sollten. Krönung des Modernisierungsprogrammes<br />
sollte aber der<br />
Lenkwaffenzerstörer werden, von dem<br />
man sich nicht allein eine wichtige Rolle<br />
bei der Landungsabwehr in der Ostsee<br />
erhoffte – er sollte sogar so ausgerüstet<br />
sein, dass er den Abwehrkampf<br />
in der östlichen Ostsee führen konnte.<br />
Als wichtiges Bindeglied all dieser<br />
neuen modernen Waffensysteme war<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
Marine-Fotoarchiv Wilhelmshaven<br />
5 Jagdbomber F 104 STARFIGHTER<br />
das computerbestückte Marineführungssystem<br />
vorgesehen, das die Flotte<br />
befähigen sollte, auch im Zeitalter der<br />
Bedrohung durch überschallschnelle<br />
Flugkörper rechtzeitig zu handeln.<br />
Zenker war durchaus erfolgreich<br />
damit, sich der notwendigen politischen<br />
Unterstützung zur Finanzierung<br />
dieses Programms zu versichern; der<br />
Zeitplan konnte jedoch nicht eingehalten<br />
werden, nicht zuletzt weil sich<br />
etliche unerwartete Schwierigkeiten<br />
auftaten. Zwar lief die Beschaffung<br />
des Lenkwaffenzerstörers (DDG), nicht<br />
zuletzt dank des Vertrauens, das Zenker<br />
bei Verteidigungsminister Kai-Uwe<br />
von Hassel genoss, vergleichsweise<br />
zügig an. Doch schon 1964 musste<br />
die Marine ernüchtert feststellen, dass<br />
ausgerechnet der DDG für die vorgesehenen<br />
Ostseeaufgaben völlig unbrauchbar<br />
war. Erschwerend kamen<br />
finanzielle Einschnitte unter der CDU/<br />
CSU-SPD-Regierung der großen Koalition<br />
ab 1966 hinzu, die letztlich dazu<br />
führten, dass das Marineführungssystem<br />
erst in der ersten Hälfte der 1980er<br />
Jahre einsatzbereit wurde. Erste Schritte<br />
zur Einführung von Seeziel-Flugkörpern<br />
erfolgten am Beginn der 1970er<br />
Jahre, als mit den Schnellbooten der<br />
Klasse 148 mit »Exocet«-Flugkörpern<br />
bestückte Boote von Frankreich erworben<br />
wurden.<br />
Inzwischen hatte sich allerdings auch<br />
auf internationaler Ebene der verteidigungspolitische<br />
Hintergrund wesentlich<br />
und zum Vorteil für die Marine<br />
gewandelt: Ende 1967 war nämlich<br />
das Konzept der »Massive Retaliation«<br />
durch die »Flexible Response« als<br />
NATO-Strategie abgelöst worden. Sie<br />
sah anstatt der von der eigentlichen<br />
Aggressionsart unabhängigen, sofortigen<br />
nuklearen Reaktion nunmehr<br />
eine dem Grad der Aggression angepasste<br />
Antwort vor. Als wahrscheinlichstes<br />
Szenario wurden nun Formen<br />
des begrenzten Krieges angesehen. Für<br />
die Bundesmarine bedeutete dies eine<br />
kaum zu überschätzende Erleichterung<br />
ihrer Aufgaben, waren doch ihre vorhandenen<br />
und geplanten begrenzten<br />
Ressourcen erheblich besser in der<br />
Lage, den neuen, ebenfalls als eher<br />
begrenzt gedachten Herausforderungen<br />
zu entsprechen. Zusammen mit<br />
dem Modernisierungsprogramm sah<br />
die »konzeptionelle Zukunft« für die<br />
Bundesmarine nun ganz erheblich<br />
erfreulicher aus als während der ersten<br />
Begegnung mit der harschen Realität<br />
am Ende der 1950er Jahre. Wie<br />
sich dies jedoch tatsächlich gestaltet<br />
hat, wird letztlich erst mit der Verfügbarkeit<br />
der Akten für die Forschung zu<br />
beantworten sein.<br />
Erstmals im 20. Jahrhundert scheinen<br />
ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre<br />
in Deutschland die verfügbaren maritime<br />
Mittel den ihr gestellten Aufgaben<br />
auch tatsächlich entsprochen zu haben.<br />
Zudem ist festzustellen, dass auch der<br />
Wunsch der Gründerväter der damaligen<br />
Bundesmarine, ihre Marine zu<br />
einem kleinen aber weltweit wieder<br />
geschätzten und geachteten Partner<br />
zu machen, heute in einem Ausmaß<br />
erreicht ist, das sie sich damals kaum<br />
erträumt haben dürften, zumal dies<br />
im krassen Gegensatz zu den Vorgängermarinen<br />
nicht im Konflikt, sondern<br />
im NATO-Bündnis und in Kooperation<br />
mit der internationalen Völkergemeinschaft<br />
der Vereinten Nationen erreicht<br />
worden ist.<br />
• Johannes Berthold Sander-Nagashima<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 9
Sanitätsdienst vor Verdun<br />
5<br />
Erste Hilfe an der Front<br />
Der Sanitätsdienst vor Verdun im Ersten Weltkrieg<br />
Bayer. Hauptstaatsarchiv,<br />
Abteilung IV, Kriegsarchiv<br />
BSD-San 4<br />
»Die Verhältnisse des Weltkrieges<br />
sind über alles hinausgewachsen,<br />
was Kriege je gezeitigt hatten.«<br />
Diese Worte, ausgesprochen vom<br />
Nachfolger Moltkes des Jüngeren, dem<br />
vormaligen Kriegsminister und Chef<br />
der Obersten Heeresleitung (OHL) im<br />
Ersten Weltkrieg, General der Infanterie<br />
Erich von Falkenhayn, können auch<br />
zur Beschreibung der Situation des<br />
Militärsanitätswesens während des<br />
Krieges verwendet werden. Noch nie<br />
zuvor in der europäischen Geschichte<br />
wurde ein Militärsanitätswesen mit<br />
einer so gewaltigen Zahl schwerer und<br />
schwerster Verwundungen wie auch<br />
Erkrankungen konfrontiert.<br />
Die ärztlichen Erfahrungen im<br />
Ersten Weltkrieg waren für die<br />
moderne Medizin ein Wendepunkt<br />
von globaler Bedeutung, von<br />
dem viele weitere technische Entwicklungen<br />
im 20. Jahrhundert ihren Ausgang<br />
nahmen. Dies gilt sowohl für<br />
die Bereiche der Hygiene, der chirurgischen<br />
Versorgung, der routinemäßigen<br />
Tetanusimpfung, der Bluttransfusion<br />
als auch für die Röntgen- und<br />
Labordiagnostik.<br />
Statistisch gesehen erlitt jeder überlebende<br />
Soldat im Durchschnitt eine<br />
Verletzung während des Krieges und<br />
geriet infolgedessen in Kontakt mit<br />
dem Militärsanitätswesen. Bei einer<br />
Gesamtstärke des deutschen Heeres<br />
im Jahre 1917/18 von 7,1 Millionen<br />
Mann, führt der Sanitätsbericht über<br />
das Deutsche Heer im Weltkriege eine<br />
erschreckende Zahl von 1,9 Millionen<br />
toten Deutschen und 5,6 Millionen Verwundungen<br />
an.<br />
Die Mobilisierung für den Krieg<br />
umfasste das gesamte medizinische<br />
System des deutschen Kaiserreiches.<br />
Insgesamt wurden 25 000 Ärzte eingesetzt,<br />
davon ein Viertel in der Heimat.<br />
Neben dem militärischen Sanitätsdienst<br />
leistete auch die »Freiwillige<br />
Krankenpflege« mit 202 000 Personen<br />
Hilfe.<br />
Als eine der bekanntesten Schlachten<br />
und als Beispiel für die Grenze einer<br />
sanitätsdienstlichen Versorgung kann<br />
die Schlacht vor Verdun im Jahr 1916<br />
angesehen werden. In deren Verlauf<br />
setzte die OHL 48 deutsche Divisionen<br />
ein, mehr als 600 000 Soldaten starben<br />
auf beiden Seiten der Front.<br />
Verdun wurde im Gedächtnis der<br />
Menschen – bis heute – zum Symbol<br />
einer »ewigen Schlacht«, einer »Blut-<br />
10<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
»Frankreichs Kräfte sollen<br />
verbluten« – Angriffsziel<br />
Verdun<br />
deutsche 5. Armee<br />
Avocourt<br />
Malancourt<br />
Forges<br />
Maas-Gruppe-West<br />
304<br />
Toter Mann<br />
(Mort Homme)<br />
Frontlinie am 21.2.1916<br />
Frontlinie Ende Juli 1916<br />
Frontlinie am 15.12.1916<br />
Permanente Anlagen der<br />
Festung Verdun<br />
Angriffe deutscher Truppen<br />
Gegenangriffe der französischen<br />
Truppen im<br />
Oktober und Dezember 1916<br />
0 5 10<br />
km<br />
Nach dem Scheitern der deutschen Offensive<br />
in der ersten Kriegsphase änderte die<br />
OHL die Taktik des militärischen Vorgehens<br />
im Verlauf des Jahres 1915, da General<br />
von Falkenhayn erkennen musste, dass<br />
Deutschland nicht mehr die wirtschaftlichen<br />
und militärischen Mittel zur Verfügung<br />
hatte, einen völligen Sieg zu erringen.<br />
Als Alternative sollte nun der Wille des<br />
Gegners zermürbt und letztendlich gebrochen<br />
werden. Die Strategie der Abnutzungsschlacht<br />
war geboren. Sie sah vor,<br />
die Alliierten an der Westfront solange in<br />
immer schwerere Kämpfe zu verwickeln,<br />
bis in Frankreich nicht mehr genug Menschen<br />
und Material zur Verfügung standen,<br />
um den Kampf fortzusetzen. Falkenhayn<br />
nahm an, dass das Deutsche Reich als Angreifer bei Verdun den Kräfteeinsatz beliebig begrenzen und kontrollieren könne. Die<br />
Franzosen würden dagegen »weißbluten«. Selbst wenn die Festung dem deutschen Angriff der 5. Armee standhielt, blieb so das strategische<br />
Ziel erhalten, nämlich die Schwächung und schließlich die Zermürbung des französischen Heeres.<br />
In und um Verdun waren seit der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 von der französischen Armee zahlreiche stark<br />
befestigte moderne Forts errichtet worden. Diese Festungsanlagen beiderseits des Flusses Maas (Frz.: Meuse) wurden von drei Seiten<br />
von dicht bewaldeten Höhen eingeschlossen. Der deutsche Angriffsraum umfasste dort ein Areal von ca. 16 x 16 Kilometern.<br />
Me u s e<br />
deutsche<br />
Ma a s<br />
"He ilige S tra ß e " ("Voie S a cré e )<br />
n. Souilly und Bar -le-Duc<br />
M a a<br />
5. Armee<br />
s -<br />
Ornes<br />
Douaumont Fort Douaumont<br />
Fort Souville<br />
Verdun<br />
G r u<br />
Die Schlacht um Verdun 1916<br />
p p<br />
Vaux<br />
Fleury Fort Vaux<br />
e - O<br />
deutsche 5. Armee<br />
s t<br />
Etain<br />
Fresnes<br />
© Ing.-Büro für Kartographie J.Zwick, Gießen<br />
mühle«. Die traumatischen Erfahrungen<br />
der Kämpfe, die Hilflosigkeit des<br />
Sanitätswesens und die Hunderttausenden<br />
von Invaliden und Kriegsversehrten,<br />
prägten noch Jahre später das<br />
Straßenbild in Dörfern und Städten der<br />
Weimarer Republik.<br />
Am 4. Januar 1916 beschloss die OHL<br />
den Angriff der 5. Amee auf Verdun,<br />
der vom Generalstab mit äußerster<br />
Gründlichkeit vorbereitet wurde. Pioniere<br />
errichteten insgesamt 24 neue<br />
Bahn- und Verladestellen sowie Straßen,<br />
ebenso Artilleriestellungen, Unterkünfte,<br />
Munitionsdepots, Versorgungslager<br />
und ein dichtes Fernsprechnetz.<br />
Im Hauptangriffsgebiet platzierte das<br />
deutsche Heer 1200 Geschütze aller<br />
Art. Über 2,5 Millionen Granaten und<br />
ungeheure Mengen von Material wurden<br />
in das Kampfgebiet transportiert<br />
und dort gelagert.<br />
Auch der Sanitätsdienst versuchte,<br />
sich auf die kommende Schlacht vorzubereiten.<br />
Das Sanitätsdepot stellte<br />
Verbandsmaterial und Medikamente<br />
bereit. Die Grundvoraussetzungen für<br />
die medizinische Betreuung der Soldaten<br />
waren jedoch denkbar schlecht.<br />
Durch das schlechte Wetter liefen die<br />
Sanitätsunterstände schon vor Beginn<br />
der Offensive fußhoch voll Wasser<br />
und mussten zum Großteil aufgegeben<br />
werden. So fehlte es an bombensicheren<br />
Truppenverbandplätzen.<br />
Infolge der stets hohen Ausfallraten<br />
beim Sanitätspersonal konnte nicht ausreichend<br />
medizinisches Personal zur<br />
Verfügung gestellt werden. Die OHL<br />
verlegte in einen Angriffsraum vier<br />
neue Armeekorps und große Verbände<br />
schwerer Artillerie, in dem sich bis<br />
dahin nur fünf Feldlazarette und ein<br />
Ortslazarett mit insgesamt nur 1800<br />
Betten befanden. Es fehlte also schon<br />
vor Beginn der Offensive an der nötigen<br />
Infrastruktur und Koordination.<br />
Nur nach und nach konnten die rückwärtigen<br />
Einrichtungen der Hauptverbandplätze<br />
und Feldlazarette verbessert<br />
werden.<br />
Der Angriffstermin war auf den 12.<br />
Februar 1916 festgelegt, musste aber<br />
wegen des schlechten Wetters auf den<br />
21. des Monats verlegt werden. Der<br />
deutsche Angriff begann und verlief<br />
bis zum 25. Februar planmäßig;<br />
er brachte die französische Führung<br />
in eine ernste Krise. Der Befehl des<br />
französischen Oberkommandierenden,<br />
Verdun um jeden Preis zu halten,<br />
bewirkte jedoch die Verlängerung dieser<br />
furchtbaren Schlacht. Gegen die<br />
ständige Verstärkung der französischen<br />
Verteidigungskräfte kam nun<br />
die immer größer werdende Erschöpfung<br />
des Angreifers<br />
Verwundetentransport<br />
Die vorderste Frontlinie in Verdun<br />
bestand nicht aus einer durchgehenden<br />
Linie, sondern nur aus notdürftig miteinander<br />
verbundenen Wasserlöchern<br />
und Granattrichtern ohne Verbindung<br />
nach hinten; dazwischen befanden sich<br />
vereinzelte, betonierte Grabenstücke<br />
oder noch nicht ganz zusammengeschossene<br />
Werke. Jeden Versuch der<br />
Soldaten, sich tiefer einzugraben, um<br />
einen größeren Schutz zu erreichen,<br />
zerschlug die Feuerwirkung der Artillerie<br />
des Gegners. Tag und Nacht spiel-<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 11
Sanitätsdienst vor Verdun<br />
Gas<br />
Am 22. April 1915 setzten die Deutschen bei Ypern zum ersten Mal massenhaft Giftgas ein. Der Einsatz der Kampfgase übertraf<br />
alles bisher im Kriege erlebte Grauen. Von den Deutschen eingesetzt, indem Chlorgasflaschen in die vorderste Stellung eingegraben<br />
und das Chlorgas bei entsprechender Windrichtung auf die feindlichen Stellungen abgeblasen wurde, später in Granaten<br />
gefüllt, bewirkte es eine Verätzung der Schleimhäute. Die Franzosen verwendeten hingegen meist Phosphor- und Phosgengranaten.<br />
Die Phosgengranate war auch mit Zinntetrachlorid gefüllt und<br />
dieser zerfraß die Bindehäute der Augen, dadurch verloren viele Opfer<br />
ihr Augenlicht. Im September 1915 wurde auf deutscher Seite eine erste<br />
Gasmaske aus gummiertem Stoff mit abschraubbarem Filter eingeführt.<br />
Bayer. Hauptstaatsarchiv,<br />
Abteilung IV, Kriegsarchiv, BSD<br />
te sich der Kampf um einzelne Höhen<br />
ab. Kompanien, die eine Stärke von 220<br />
Mann aufwiesen, wurden schon auf<br />
dem verlustreichen Vormarsch in ihre<br />
Stellung auf 50 bis 80 Mann vermindert.<br />
Auch für den Sanitätsdienst gab es<br />
keine schusssicheren Unterstände. Die<br />
Verwundeten mussten deshalb häufig<br />
im Freien versorgt werden. Sanitätspersonal<br />
und Patienten waren somit<br />
ständig dem schweren Artilleriefeuer<br />
ausgesetzt.<br />
Die Rettungstaktik beschränkte sich<br />
daher auf einen möglichst raschen<br />
Abtransport der Verwundeten. Oft war<br />
dies jedoch auch nicht mehr möglich.<br />
Während des Verwundetentransports<br />
stieg die Zahl der Ausfälle bei den<br />
Krankenträgern stetig an. Ein Teil<br />
der verwundeten Soldaten wurde auf<br />
dem Rücktransport noch ein weiteres<br />
Mal verwundet oder sogar getötet.<br />
Der zunehmende Bedarf an Personal<br />
und Krankentragen konnte nicht mehr<br />
gedeckt werden. Den Abtransport behinderten<br />
auch die zahlreichen kleinen<br />
Schluchten, die Granatlöcher und<br />
das in großer Menge herumliegende<br />
Kriegsmaterial.<br />
Für die Krankenträger war es schwer,<br />
die Orientierung zu behalten. Im günstigsten<br />
Fall benötigten vier Krankenträger<br />
dreieinhalb Stunden, um vom<br />
vorgeschobenen Hauptverbandplatz<br />
(HVPL) aus einen Verwundeten über<br />
den Truppenverbandplatz zurück zum<br />
HVPL zu transportieren. Das Tragen<br />
der Verwundeten auf den Schultern<br />
der Krankenträger – das Gewicht der<br />
3<br />
Versorgung von<br />
Gasverwundeten<br />
leeren Krankentrage lag schon bei über<br />
36 Pfund – bereitete schon nach kurzer<br />
Zeit starke Schmerzen. Ein Verwundetenabtransport<br />
bei Nacht war nur<br />
schwer möglich, weil die Krankenträger<br />
nachts die vorderen Truppenverbandplätze<br />
mit den nötigen Arznei-,<br />
Verband- und Erfrischungsmitteln<br />
(Wein, Kaffee, Tee, Wasser) versorgen<br />
mussten. Um diesem Mangel zu begegnen,<br />
versuchte der Chef des Feldsanitätswesens,<br />
jeder Division möglichst<br />
zwei Sanitätskompanien zuzuteilen.<br />
Es fehlte an motorisierten Fahrzeugen,<br />
um den Abtransport der Verletzten<br />
zu beschleunigen. Die bespannten<br />
Sanitätsfahrzeuge waren zu schwerfällig<br />
und blieben häufig im Schlamm<br />
stecken. Erst gegen Ende der Schlacht<br />
verfügte die Armee über 242 Sanitätskraftwagen,<br />
59 Omnibusse, 27 Personenwagen<br />
und 66 Anhänger. Der Großteil<br />
der Verletzten wurde mit einer<br />
benzolbetriebenen Kleinbahn abtransportiert.<br />
Verletzungen und Krankheiten<br />
In der Kämpfen um Verdun waren<br />
die weitaus meisten Verwundungen<br />
schwere Artillerieverletzungen, gefolgt<br />
von Splitterverletzungen, Zermalmungen<br />
und Handgranatenverletzungen.<br />
Der Arzt eines Lazarettes beschrieb<br />
sehr plastisch den Zustand der Soldaten:<br />
»wo aus den Minensprengungen<br />
heraus furchtbar zugerichtete Menschen<br />
unmittelbar von den Schützengräben und<br />
Sturmangriffen uns zukamen.[...] Verwilderte,<br />
mit zerrissenen Kleidern, über und<br />
über mit einer Schmutzkruste bedeckt, von<br />
schwarzem Blut überronnen, verlaust und<br />
in einen schauerlichen Geruch von Schweiß<br />
und Eiter gehüllt, so werden sie hereingetragen.«<br />
Die Ärzte hatten mit diesen schweren<br />
Verletzungen nur wenig Erfahrungen.<br />
Medizinische Unsicherheiten gab<br />
es besonders im Bereich der Schmerzbehandlung.<br />
Auch die Bluttransfusion<br />
wurde von den deutschen Ärzten nur<br />
zögerlich eingesetzt. Schwierigkeiten<br />
bei der Blutgruppenbestimmung und<br />
Komplikationen bei der Bluttransfusion<br />
schreckten die Militärärzte ab.<br />
Ab März übertraf die Anzahl der<br />
Kranken die der Verwundeten um das<br />
Doppelte. Es waren vor allem Grippe<br />
und Magen-Darm-Erkrankungen, die<br />
die Truppe zusätzlich schwächten.<br />
Gründe für deren Ausbreitung waren<br />
die nasskalte Witterung, die großen<br />
körperlichen Belastungen und die nicht<br />
ausreichende Ernährung der Soldaten.<br />
Hygiene<br />
Die hygienischen Verhältnisse in Verdun<br />
waren unbeschreiblich. Eine<br />
geordnete Versorgung mit frischem<br />
Trinkwasser konnte nicht gesichert<br />
werden. Meist wurde der Durst der<br />
Mannschaften mit in Zeltbahnen aufgefangenem<br />
Regenwasser oder größtenteils<br />
mit dem Wasser aus gefüllten<br />
Granattrichtern, die oft durch Schmutz<br />
und Leichenteile verunreinigt waren,<br />
gestillt. Die Truppen waren, durch<br />
den ständigen Beschuss der Artillerie<br />
bedingt, nicht in der Lage, Latrinen<br />
und Abfallgruben anzulegen. Müll<br />
und Schrott gruben die Soldaten an<br />
Ort und Stelle ein oder legten ihn<br />
12<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
5 Truppenverbandplatz<br />
Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abteilung IV, Kriegsarchiv, BSD-San 11<br />
akg-images<br />
Deutsche Verluste in der Schlacht bei Verdun<br />
(21. Februar bis 11. Juli 1916)<br />
Anzahl<br />
Kranke 398 293<br />
Verwundete 241 860<br />
Gefallene 41 632<br />
Vermisste 26 739<br />
708 524<br />
Anteil an den<br />
Gesamtverlusten<br />
in Prozent<br />
56,2<br />
34,1<br />
5,9<br />
3,8<br />
100,0 5 Krankentransportwagen, Erster Weltkrieg<br />
Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abteilung IV, Kriegsarchiv, BSD-San 37<br />
5 Sanitätshund im Ersten Weltkrieg apportiert<br />
die Mütze eines Verwundeten (nach Roloff).<br />
einfach ab. Ein großes Problem bereiteten<br />
dem Sanitätsdienst die zahlreichen<br />
umherliegenden Leichen. In Folge des<br />
heftigen Artilleriebeschusses wurden<br />
bereits beerdigte Soldaten immer wieder<br />
aus ihren Gräbern herausgerissen.<br />
Eigens gebildete Desinfektionstrupps<br />
versuchten die menschlichen Überreste<br />
mit Hilfe umfunktionierter Reblausspritzen<br />
mit Chlorkalk zu besprühen.<br />
Trotz dieser Maßnahme war der<br />
Leichengeruch in den dauernd unter<br />
Sperrfeuer liegenden Schluchten außerordentlich<br />
stark. Dies hatte auch Auswirkungen<br />
auf die psychische Verfassung<br />
der Soldaten. Ein Kommandeur<br />
berichtete:<br />
»Dass in langen, schweren Feldzügen<br />
bewährte Offiziere vollständig mit den Nerven<br />
zusammenbrachen, war keine Seltenheit,<br />
wühlten doch die schweren Geschosse<br />
die mühsam bestatteten Leichen immer<br />
wieder aus und warfen ihre Fetzen unter<br />
die Lebenden, die unter Durst schwer litten<br />
und nicht zu essen vermochten, selbst wenn<br />
ihnen Nahrung zugeführt wurde, was bei<br />
der ständigen Gefährdung der Zufahrtswege<br />
schwierig war. Die Tag und Nacht<br />
nie aufhörende Lebensgefahr erschütterte<br />
auch die festesten Herzen. Die Unterkunft<br />
in den feuchten Waldlagern rückwärts war<br />
auch eine geringe Erholung für die zurückgezogenen<br />
Teile, die zudem beständig dem<br />
Gang in die vordere Hölle entgegensahen.«<br />
Vor Verdun setzten beide Kriegsgegner<br />
Gas ein. Deshalb wurde der Raum<br />
von der vorderen deutschen Linie bis<br />
zu einer Tiefe von acht Kilometern<br />
nach rückwärts als gasgefährdet angesehen.<br />
Dennoch gab es auf deutscher<br />
Seite zahlreiche Verluste, da noch nicht<br />
alle Soldaten mit Schutzmasken ausgerüstet<br />
worden waren. Häufig hatten die<br />
Soldaten ihre Masken auch nicht griffbereit,<br />
weil sie befehlsgemäß wegen<br />
Mangel an Raum ihr Gepäck und mit<br />
diesem die Gasschutzmasken außerhalb<br />
der Unterstände aufbewahrten.<br />
Das Heraussteigen aus den Unterständen,<br />
um die Masken anzulegen, genügte<br />
meist, um bei ihnen schwere Vergiftungen<br />
herbeizuführen. Ein Arzt beschrieb<br />
den Gesundheitszustand von<br />
Gasverletzten:<br />
»Werden die Kranken mit dem Kraftwagen<br />
ausgeladen, so liegen sie vielfach<br />
gekrümmt, in allen möglichen Verrenkungen<br />
auf ihrer Trage. Vielen steht eine<br />
Schaumsäule von fünf bis zehn Zentimetern<br />
Länge vor dem Munde, wieder andere<br />
brechen ohne Unterlass, wieder andere<br />
liegen in ihrem Kot. Ein anderer Teil liegt<br />
schon sterbend bewusstlos auf der Tragbare.<br />
Und viele werden tot aus dem Wagen<br />
herausgehoben. Sie sind auf der Fahrt vom<br />
Sanitätsunterstand zum Feldlazarett verstorben.«<br />
Für den Sanitätsdienst erwiesen sich,<br />
durch die ungünstigen militärischen<br />
und organisatorischen Bedingungen<br />
beeinflusst, die rettungstaktischen und<br />
logistischen Probleme als unlösbar. Es<br />
fehlte an Personal, Fahrzeugen und<br />
Material. Die eingesetzten Sanitätseinheiten<br />
waren nicht in der Lage, die Massen<br />
von Verletzten zu versorgen. Die<br />
vorsorglich eingerichteten Sanitätseinrichtungen<br />
waren nicht ausreichend,<br />
daher mussten die Entlausungsanstalten<br />
und Sonderlazarette für Infektionskrankheiten<br />
im Verlauf der Kämpfe<br />
stetig erweitert werden.<br />
Trotz immer mehr eingesetzter Sanitätskompanien<br />
und Feldlazaretten verschlechterte<br />
sich der Gesundheitszustand<br />
der Soldaten stetig. Die zunehmenden<br />
Krankheitsausfälle konnten<br />
nicht mehr ausgeglichen werden und<br />
wirkten sich immer mehr auf die<br />
Kampfkraft der Truppe aus. Dennoch<br />
konnte sich der Sanitätsdienst durch<br />
seinen Einsatz für die Verletzten bei<br />
den Kampftruppen zunehmend Respekt<br />
verschaffen und dabei einen<br />
wichtigen Schritt auf dem schwierigen<br />
Weg vom »Pillendreher« zu einer professionellen<br />
modernen medizinischen<br />
Behandlung von Soldaten zurücklegen.<br />
Bis zum Herbst 1916 dauerte der<br />
Kampf um Verdun. Auf dem Schlachtfeld<br />
explodierten 1,5 Millionen Granaten<br />
(d.h. 5600 pro qkm). Verdun war,<br />
gemessen an der Zahl der eingesetzten<br />
Truppen und Opfer, nicht die größte<br />
Materialschlacht des Ersten Weltkrieges,<br />
nirgends sonst aber hat sich<br />
die unvorstellbare Zerstörungsgewalt<br />
einer monatelangen Artillerieschlacht<br />
auf so engem Raum konzentriert.<br />
• Christoph Schneider<br />
Lesetipp:<br />
Wolfgang Eckart und Christoph<br />
Gradmann (Hrsg.), Die Medizin und<br />
der Erste Weltkrieg, 2. Aufl.,<br />
Herbolzheim 2003<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 13
Major Kuhn<br />
Major Kuhn<br />
Ein unbekanntes Mitglied<br />
des deutschen Widerstandes<br />
vom 20. Juli 1944<br />
Die ungewöhnliche Geschichte<br />
des deutschen Majors im<br />
Generalstab Joachim Kuhn<br />
(1913–1994) ist heute in Deutschland<br />
nur teilweise und in Russland gar<br />
nicht bekannt. Kuhn gehörte zum<br />
Widerstandskreis des 20. Juli 1944 und<br />
hatte Sprengstoff für die gescheiterten<br />
Anschläge auf Hitler 1943 und 1944<br />
beschafft. Eine Woche nach dem 20. Juli<br />
lief er zu den Russen über und wurde<br />
später in Moskau als Kriegsverbrecher<br />
verurteilt. Erst 1998 erfolgte seine<br />
posthume Rehabilitierung. Im Zuge<br />
des russischen Rehabilitierungsverfahrens<br />
kamen auch Kuhns Akten aus<br />
dem Jahre 1951 im Zentralen Archiv<br />
des Föderalen Sicherheitsdienstes ans<br />
Licht. Sie sind eine einzigartige Quelle<br />
sowohl zur deutschen als auch zur russischen<br />
Zeitgeschichte, weil Kuhn von<br />
beiden Diktatoren – dem deutschen<br />
und dem sowjetischen – als »Attentäter<br />
und Überläufer« (Hitler) beziehungsweise<br />
als »Kriegsverbrecher« (Stalin)<br />
verurteilt wurde.<br />
In Inhalt und Form steht die »Anklage<br />
gegen Kuhn, Joachim« in der selben<br />
Reihe wie die Fälle anderer kriegsgefangener<br />
deutscher Offiziere, die<br />
1945–1952 in der stalinistischen Sowjetunion<br />
wegen angeblicher oder tatsächlicher<br />
Kriegsverbrechen zur Verantwortung<br />
gezogen wurden. Doch<br />
war es für die sowjetische Untersuchungspraxis<br />
ungewöhnlich, dass den<br />
Materialien der Anklage gegen Kuhn<br />
seine »Eigenhändigen Aussagen« aus<br />
der Zeit vor der Verhaftung beigefügt<br />
wurden, obwohl diese Aussagen nicht<br />
der Anklage zugrunde gelegen hatten.<br />
Die Aussagen deutscher Offiziere, die<br />
sie nicht als Angeklagte, sondern als<br />
Kriegsgefangene machten, wurden in<br />
den Untersuchungsdossiers meist nicht<br />
aufbewahrt. Jede Publikation solcher<br />
»Eigenhändigen Aussagen« stellt deshalb<br />
eine wichtige historische Quelle<br />
dar.<br />
Ein hervorragender Offizier<br />
5 Major Joachim Kuhn<br />
Joachim Kuhn wurde am 2. August<br />
1913 in Berlin als Sohn des Patentanwalts<br />
Arthur Kuhn und seiner Frau<br />
Hildegard-Maria (geb. Kuster) geboren.<br />
Sein Großvater mütterlicherseits<br />
war General der Kavallerie.<br />
Mit 17 Jahren machte Kuhn das Abitur.<br />
Nach kurzem Besuch einer Technischen<br />
Hochschule trat er 1932 als<br />
Pionier in das 100 000-Mann-Heer der<br />
Reichswehr ein. 1933/34 besuchte er<br />
die Kriegsschulen in Dresden und<br />
München. Ende 1934 wurde er Leutnant.<br />
Als Bataillons- und Regimentsadjutant<br />
nahm Kuhn am Feldzug gegen<br />
Polen 1939 und als Kompaniechef am<br />
Feldzug gegen Frankreich 1940 teil.<br />
Den Beginn des Russlandkrieges 1941<br />
erlebte Kuhn als 1. Ordonnanzoffizier<br />
der 111. Infanteriedivision. Bis November<br />
1941 war er an der Ostfront, um<br />
danach bis Mai 1942 die Kriegsakademie<br />
des Generalstabes zu besuchen.<br />
Diese verließ er als Lehrgangsbester<br />
und wurde zum Oberkommando des<br />
Heeres/Generalstab des Heeres in die<br />
Organisationsabteilung versetzt. Als<br />
Generalstabsoffizier war Kuhn bis<br />
März 1944 in der dortigen Gruppe<br />
II unter der Leitung des damaligen<br />
Majors i.G. Claus Schenk Graf von<br />
Stauffenberg tätig. Die Zusammenarbeit<br />
mit Stauffenberg, wie Kuhn in seinen<br />
in russischer Gefangenschaft am 2.<br />
September 1944 geschriebenen »Eigenhändigen<br />
Aussagen« bemerkt, »war<br />
infolge seiner umfassenden Kenntnis<br />
und Bildung auf allen Gebieten des<br />
Lebens denkbar harmonisch, da wir<br />
viele Berührungspunkte in allgemeinen<br />
Lebens- und politischen Auffassungen<br />
hatten«.<br />
Am 22. Juni 1944 übernahm Major<br />
Kuhn die Stelle des Ia-Generalstabsoffiziers<br />
(Truppenführung und Operationsplanung)<br />
bei der 28. Jägerdivision.<br />
Am 20. Juli 1944 – dem Tag des Attentates<br />
auf Adolf Hitler – war Major Kuhn<br />
an der Front. Eine Woche später war<br />
er schon bei den Russen als, wie es in<br />
deutschen Quellen heißt, »Überläufer«.<br />
Kuhn aber beschreibt in den »Eigenhändigen<br />
Aussagen« seine Gefangennahme<br />
nicht als geplantes Überlaufen,<br />
sondern als erzwungene Flucht zum<br />
Selbstschutz (siehe Seite 15 »Eigenhändige<br />
Aussagen«). Schon am Tag seiner<br />
Flucht aus der Wehrmacht, am 27. Juli<br />
1944, wurden auch Kuhns Eltern durch<br />
die NS-Behörden in Sippenhaft genommen.<br />
Der Divisionskommandeur, Generalleutnant<br />
Gustav Heistermann von<br />
Sammlung Boris Khavkin<br />
14<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
»Eigenhändige Aussagen« Major Kuhns<br />
Am 19. Juli 1944 besuchte mich Generalmajor<br />
von Tresckow, Chef des Generalstabs der<br />
2. Armee, der wie ich, an der Umsturzorganisation<br />
beteiligt war. Ich war an der Front<br />
bei Bialystok als Ia der 28. Jägerdivision.<br />
General von Tresckow teilte mir mit, dass<br />
in diesen Tagen das seit Monaten erwartete<br />
Attentat auf Hitler erfolgen werde. Unsere<br />
Aufgabe sei, das Ergebnis in Ruhe und<br />
dann die Befehle von Generaloberst Beck<br />
– gew[esener] Chef des Generalstabes [seit<br />
1939 a.D.], abzuwarten.<br />
Infolge der Kampflage erfuhr ich von den<br />
Ereignissen des 20. Juli erst durch die Rundfunk-Mitteilung<br />
am 21.[7] um 7.oo Uhr.<br />
Wenige Stunden später teilte der Chef des<br />
Stabes des Korps – Major von Schönau [mit],<br />
bleiben und wenn es an der Zeit ist – zu sagen,<br />
was wir gewollt haben.«<br />
Als ich mich ungefähr auf 100 m entfernte,<br />
hörte ich, wie die Handgranate, die v.<br />
Tresckow bei sich hatte, explodierte.<br />
Auf meine offizielle Meldung über seinen<br />
Tod durch Partisanenhand wurde General v.<br />
Tresckow mit allen militärischen Ehren beigesetzt.<br />
Der OKW-Bericht erwähnte seinen<br />
Heldentod. Ich hatte in General v. Tresckow<br />
einen Kameraden verloren, der, wie kein<br />
[anderer], Vorbild war.<br />
In den folgenden Tagen wartete ich die<br />
Entwicklung der Repressalien Hitlers ab. Da<br />
die Hauptbeteiligten nicht mehr am Leben<br />
waren und mir Einzelheiten des Verlaufs des<br />
20. Juli, sowie der Grad der Aufdeckung<br />
Auf eine Frage General v. Ziehlbergs verneinte<br />
ich jede Beteiligung am Attentat, wies<br />
nur auf die bekannte Freundschaft mit Stauffenberg<br />
hin.<br />
General v. Ziehlberg sagte: »Wir wollen<br />
alles so offiziersmäßig wie möglich erledigen.<br />
Sie haben sich zum Korps zu begeben.« So verabschiedete<br />
er sich. Ich fuhr mit meinem<br />
Wagen und zwei Offiziere, die mich begleiten<br />
sollten, fuhren hinterher.<br />
3<br />
Generalleutnant<br />
Gustav Heistermann<br />
von Ziehlberg<br />
GDW-Berlin<br />
Bundesarchiv Bild 146-1972-025-12<br />
dass der Chef des Stabes der Armee General<br />
v. Tresckow käme, um sich über die Frontlage<br />
durch persönlichen Einblick zu unterrichten.<br />
Er hätte um meine Begleitung in das<br />
Gelände gebeten.<br />
General v. Tresckow kannte ebenfalls nur<br />
die Rundfunk-Nachricht vom Fehlschlag<br />
und vom Tode Becks, Stauffenbergs und<br />
Olbrichts. Kurz nach Beginn der Fahrt ins<br />
Gelände eröffnete er mir: »Sie wissen, vor<br />
Stauffenberg war ich unter Beck der geistige<br />
Vorarbeiter dessen, was gestern fehlschlug. Ich<br />
kenne jede Einzelheit der Organisation und<br />
fühle wie Beck und Stauffenberg die Mitverantwortung<br />
für das Geschehene. So ist auch<br />
meine Uhr abgelaufen.«<br />
Ich warf ein, über diese Entscheidung stünde<br />
mir kein Urteil zu; jedoch würden Menschen<br />
wie er in der nun kommenden schweren<br />
Zeit mehr denn je gebraucht. Er verwarf<br />
den Einwurf und fuhr fort: »So bitte ich Sie,<br />
falls Sie bereit sind, dafür zu sorgen, dass niemand<br />
von meinem freiwilligen Tod erfährt. Ich<br />
habe als von Partisanenhand gefallen zu gelten.<br />
Das ist im Interesse unserer Sache, der Beteiligten<br />
und meiner Familie unbedingt erforderlich.«<br />
Er gab mir die Hand und sagte: »Adieu, Sie<br />
haben – wenn es Ihnen gelingt am Leben zu<br />
5 Lagebaracke im »Führerhauptquartier<br />
Wolfsschanze« nach dem Attentat am<br />
20. Juli 1944<br />
der Organisation unbekannt waren, konnte<br />
ich annehmen, dass meine Verhaftung nicht<br />
unbedingt zu erwarten war.<br />
Am Morgen des 27. Juli, nach dem Fall<br />
von Bialystok, traf der Korps Ia - Major i.G.<br />
von Schönau ein und übergab in meiner<br />
Gegenwart dem Div. Kdr., Generalleutnant<br />
v. Ziehlberg, einen Brief des Kommandierenden<br />
General des 55. Korps - General d.<br />
Inf. Herrlein.<br />
General v. Ziehlberg überreichte ihn mir<br />
und ich las: »Auf höchsten Befehl ist Major<br />
i. G. Kuhn zu verhaften und dem Landespolizeigefängnis<br />
Berlin zuzuführen. Einspruch<br />
zwecklos. Unterschrift.«<br />
Der Korps la erläuterte, dass General Herrlein<br />
und Generaloberst Weiss (Oberbefehlshaber<br />
2. Armee) bereits vergeblich Einspruch<br />
erhoben hätten.<br />
Die Teilnahme der Generäle Weiss und<br />
Herrlein an meinem Schicksal kann ich nur<br />
durch ihr äußerst gutes Verhalten zu mir<br />
erklären, denn, soweit ich informiert bin,<br />
waren diese an der Verschwörung nicht beteiligt.<br />
Wenige Minuten blieben, um einen Entschluss<br />
zu fassen. Ich durfte mit meiner<br />
Kenntnis von Zusammenhängen und Personenkreis<br />
der Verschwörung nicht in die<br />
Hände des Himmlerschen Sicherheitsdienstes<br />
fallen. Selbstmord hatte ich mir vorgenommen<br />
nur zu verüben, wenn keine andere<br />
Möglichkeit bestand, mich der Verfolgung<br />
zu entziehen. Überlaufen war das Richtigste,<br />
es stand jedoch im Widerspruch zu den<br />
Begriffen und Traditionen, in denen ich erzogen<br />
war. Es blieb, den Tod durch die feindliche<br />
Kugel zu suchen. Dies konnte nichts<br />
Schreckendes haben, da uns am Umsturz<br />
Beteiligte täglich der Gedanke an ein schnelles<br />
Ende begleiten musste.<br />
Auf der Fahrt zum Gefechtsstand bog ich<br />
zur Front ab und bewegte mich rasch auf die<br />
russische Linie zu. Im Dorf Starosielce hielt<br />
ich mich auf, um das Weitere zu überlegen,<br />
wurde aber, durch polnische Bauern angegeben,<br />
von einer russischen Streife im Keller<br />
eines Bauernhauses überraschend gefangen<br />
genommen.<br />
Das Schicksal des Generals v. Ziehlberg<br />
und der anderen Offiziere, deren Haltung<br />
es mir praktisch ermöglichte, der Verhaftung<br />
zu entgehen, ist mir unbekannt.<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 15
Major Kuhn<br />
Sammlung Boris Khavkin<br />
Sammlung Boris Khavkin<br />
5 Major Kuhn vor ... ... und nach seiner Gefangennahme<br />
Ziehlberg, wurde in einem ersten Verfahren<br />
zu neun Monaten Gefängnis<br />
»wegen Ungehorsams« verurteilt, weil<br />
er Kuhns Flucht nach dem 20. Juli 1944<br />
ermöglicht hatte. Aber nach Hitlers<br />
Einspruch gegen das Urteil verhängte<br />
der 3. Senat des Reichskriegsgerichtes<br />
in Torgau am 21. November 1944 das<br />
Todesurteil. Am 2. Februar 1945 wurde<br />
von Ziehlberg in der Murellenschlucht<br />
im Berliner Stadtteil Spandau erschossen.<br />
Ob Kuhn am Tode von Ziehlbergs<br />
mitschuldig war, ist eine schwere moralische<br />
Frage, die aber nicht verschwiegen<br />
werden muss. Wie der Teilnehmer<br />
des militärischen Widerstandes und<br />
Kuhns Kamerad aus der Zeit 1943–1944<br />
Hans-Heinrich Herwarth von Bittenfeld<br />
(1904–1999) über Kuhn vermerkte:<br />
»Vielleicht schämte er sich seiner Handlungsweise,<br />
die nicht nur von den Nationalsozialisten,<br />
sondern auch von manchen<br />
seiner Freunde kritisiert wurde, die ihn<br />
für den Tod seines Divisionskommandeurs<br />
verantwortlich machten. Ich bin überzeugt,<br />
dass Kuhn, als er in kürzester Zeit die<br />
damalige Entscheidung hatte treffen müssen,<br />
sich ihre Konsequenzen nicht klargemacht<br />
hatte.«<br />
Am 4. August 1944 nach einem<br />
Gerichtsurteil des Volksgerichtshofes<br />
»wurden im Zusammenhang mit den<br />
Ereignissen des 20.7.1944 durch den<br />
Führer auf Vorschlag des Ehrenhofes<br />
des Heeres aus der Wehrmacht ausgestoßen:<br />
[...] Major i.G. Joachim Kuhn,<br />
Ia 28.Jg.Div., geflüchtet«. Am 6. Februar<br />
1945 wurde Kuhn von dem 3.<br />
Senat des Reichskriegsgerichtes unter<br />
dem Generalstabsrichter Schmauser in<br />
Abwesenheit des Angeklagten wegen<br />
der »Fahnenflucht zum Feind« und<br />
des Kriegsverrates zum Tode verurteilt.<br />
Hitlers persönliche Bestätigungsverfügung<br />
vom 20. Februar 1945 verlangte:<br />
»Das Urteil ist zu vollstrecken,<br />
sobald der Täter in die deutschen Hände<br />
gerät.«<br />
In sowjetischer Gefangenschaft<br />
Vom 12. August 1944 bis zum 1. März<br />
1947 war der Kriegsgefangene Kuhn<br />
in Moskau im Gefängnis des sowjetischen<br />
Innenministeriums inhaftiert.<br />
»Auf Grund der operativen Notwendigkeit«<br />
wurde sein Name in der Haft<br />
verändert. In den Gefängnisakten wurde<br />
Kuhn als Joachim Malowitz bezeichnet.<br />
Das Verhalten der Aufseher gegenüber<br />
dem Gefangenen und dessen<br />
Haftbedingungen waren anscheinend<br />
relativ gut. Die sowjetische Spionageabwehr<br />
SMERSCH (Abkürzung für<br />
»Tod den Spionen«) hat mit Kuhn<br />
aktiv »operativ gearbeitet«. Das Ergebnis<br />
dieser Zusammenarbeit war sensationell:<br />
am 17. Februar 1945 fanden<br />
die SMERSCH-Offiziere nach Kuhns<br />
Angaben in Mauerwald bei Rastenburg<br />
(Ostpreußen) im früheren Hauptquartier<br />
des OKH von Kuhn nach Anweisung<br />
Stauffenbergs im Herbst 1943 in<br />
der Erde versteckten Glas-und Metalldosen.<br />
In den Dosen war eine geheime<br />
Dokumentation der Anti-Hitler-<br />
Verschwörung versteckt. Es wurden<br />
Maßnahmen-Kalender, die Verordnung<br />
über die Verhängung des militärischen<br />
Ausnahmezustandes über das Heimatkriegsgebiet,<br />
Tagesbefehle und andere<br />
Befehle und Verordnungen, die zu<br />
einem gescheiterten Attentat auf Hitler<br />
im Führer-Hauptquartier in Rastenburg<br />
im Herbst 1943 gehörten,<br />
ausgegraben. Die Wahrheit der »Eigenhändigen<br />
Aussagen« von Kuhn wurde<br />
also bestätigt.<br />
Der SMERSCH-Chef Viktor Abakumov<br />
(1908–1954) hatte im Februar 1945<br />
vorgeschlagen, die gefundenen Akten<br />
der Anti-Hitler-Verschwörung in der<br />
UdSSR zu veröffentlichen; sie wurden<br />
jedoch praktisch bis 1998 geheimgehalten.<br />
Nach der Anweisung von Abakumov<br />
im Jahre 1947, der damals schon<br />
Minister für Staatsicherheit (MGB) war,<br />
wurde Kuhn auf eine MGB-Datscha<br />
zur Erholung untergebracht, wo er<br />
zur Repatriierung nach Ost-Deutschland<br />
als künftiger Mitarbeiter der neuen<br />
Verwaltung geschult wurde. Aber<br />
Kuhn äußerte sich negativ über die<br />
Sowjetmacht: in einem Privatgespräch<br />
sagte er angeblich, dass er sich von<br />
der Zusammenarbeit mit den Sowjetbehörden<br />
belästigt fühle und sich<br />
in Deutschland zu den Amerikanern<br />
begeben werde.<br />
1948 wurde Kuhn wieder ins Gefängnis<br />
geworfen. Er war ab dem 21. April<br />
16<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
akg-images<br />
5 Blick aus einer Gefängniszelle in Sibirien<br />
1948 im Gefängnis Lefortovo und ab<br />
dem 5. April 1950 im Gefängnis Butyrka<br />
in Moskau inhaftiert. Aber formal<br />
juristisch betrachtet, befand er sich in<br />
dieser Zeit nicht in Haft. Sein Haftbefehl<br />
wurde erst am 30. August 1951<br />
erlassen. Darin stand geschrieben, dass<br />
ein gewisser Hauptmann Mamajew<br />
Kuhn am »Ort des Aufenthaltes verhaften<br />
und durchsuchen sollte«. Der<br />
Ort des Aufenthaltes von Major Kuhn<br />
war in dieser Zeit schon lange die<br />
Strafanstalt Butyrka.<br />
Joachim Kuhn wurde als »Teilnehmer<br />
der Vorbereitung und Führung<br />
eines aggressiven Krieges gegen die<br />
Sowjetunion« laut »Punkt 1-a, Artikel II<br />
des Gesetzes Nr. 10 des Kontrollrates in<br />
Deutschland« angeklagt und schuldig<br />
gesprochen. Am 17.Oktober 1951 wurde<br />
Kuhn von der »Sonderberatung«<br />
[Anm.: Organ, dass kein Gericht war,<br />
aber trotzdem Strafen verhängen konnte]<br />
beim MGB der UdSSR zu einer<br />
25jährigen Gefängnisstrafe rückwirkend<br />
ab dem 27. Juli 1944 verurteilt.<br />
Die Beteiligung Kuhns an der deutschen<br />
Anti-Hitler-Opposition betrachteten<br />
die Untersuchungs- und Strafrichter<br />
als Straftatbestand.<br />
In der Anklageschrift »wurde festgestellt,<br />
dass die Teilnehmer der Verschwörung<br />
folgende Ziele hatten: die<br />
Vernichtung Hitlers, der Abschluss<br />
eines separaten Friedens mit England,<br />
Frankreich und den USA und die<br />
gemeinsame Fortsetzung des Krieges<br />
gegen die Sowjetunion«.<br />
Im sibirischen Sondergefängnis<br />
Elf Tage nach der Verurteilung, am<br />
6. Oktober 1951, beschloss Untersuchungsrichter<br />
Major der Staatssicherheit<br />
Kišigin, Kuhn als »Kriegsverbrecher<br />
[...] ins Sondergefängnis zur Strafverbüßung«<br />
zu überweisen. Das Sondergefängnis,<br />
in dem Kuhn 1951–1956<br />
inhaftiert wurde, war die in ganz<br />
Russland bekannte Alexandrowskij-<br />
Zwangsarbeiterzentrale in der sibirischen<br />
Stadt Irkutsk. Ironie des Schicksals<br />
war, dass der an der Vorbereitung<br />
des militärischen Umsturzes gegen<br />
Hitler 1944 beteiligte deutsche Offizier<br />
in dem selben Gefängnis eingesperrt<br />
wurde, wo 1826 russische Offiziere, die<br />
zuvor an einem Militärputsch gegen<br />
den russischen Zaren teilgenommen<br />
hatten, in Haft gewesen waren.<br />
In der Alexandrowskij-Zwangsarbeiterzentrale<br />
litt Kuhn an Unterernährung.<br />
In einem Brief vom 30. Juli 1952<br />
schrieb der Stellvertreter des Leiters der<br />
Gefängnisabteilung des MGB Oberstleutnant<br />
Maslennikov: »Es gibt Gründe<br />
zu vermuten, dass Kuhn entweder<br />
krank ist und an Schizophrenie leidet,<br />
oder dass er eine andere Behandlung<br />
verlangt und deswegen unsere Organe<br />
bewusst desinformiert.«<br />
In Freiheit<br />
Auf Grund des Erlasses des Präsidiums<br />
des Obersten Sowjets der UdSSR<br />
vom 28. September 1955 wurde Joachim<br />
Kuhn vorfristig freigelassen und<br />
am 16. Januar 1956 der Bundesrepublik<br />
Deutschland »zur weiteren Strafverbüßung«<br />
übergeben. Kuhn kehrte aus der<br />
Gefangenschaft zurück, hat aber nie<br />
mehr die Verbindung zu seinen früheren<br />
Freunden aufgenommen.<br />
»Der vergessene Verschwörer« stritt<br />
jahrelang mit den deutschen Behörden<br />
um seine Offizierspension. Heinrich<br />
Graf von Einsiedel (geb. 1921, dt.<br />
Jagdflieger und in sowjetischer Gefangenschaft<br />
Mitbegründer des Nationalkomitees<br />
Freies Deutschland und des<br />
Bundes der Offiziere, MdB 1994–98),<br />
der Kuhn Ende der siebziger Jahre in<br />
einer Pension in Bad Bocklet besucht<br />
hatte, schrieb:<br />
»In der BRD musste man sich eben schämen,<br />
zu den Russen übergelaufen zu sein<br />
[...] Einen Mann, der so zerbrochen war,<br />
wie Kuhn, wollte man nicht als ›Widerstandskämpfer‹<br />
präsentieren. Und dass es<br />
in Kreisen der Verschwörer auch Leute<br />
gab, die auch die Sowjetunion als möglichen<br />
Partner angesehen haben, war in den<br />
fünfziger Jahren, auf dem Höhepunkt des<br />
Kalten Krieges, auch ein Tabuthema. Also<br />
wurde er lebendig begraben.«<br />
Verarmt und vergessen starb Joachim<br />
Kuhn 1994 in Bad Brückenau. Vier<br />
Jahre später, am 23. Dezember 1998,<br />
wurde er vom Militärgericht des Moskauer<br />
Militärbezirks als Opfer politischer<br />
Verfolgung rehabilitiert, »weil<br />
in seinen Handlungen der Tatbestand<br />
fehlte«.<br />
• Boris Khavkin<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 17
Was ist Strategie?<br />
Was ist Strategie?<br />
Definitionen zur Kunst des Feldherrn<br />
Es gibt im Vokabular der gesellschaftlichen Zusammenhänge Wörter, deren Bedeutung sich in den Jahrhunderten<br />
ihrer Existenz einer Wandlung unterzogen haben. Dazu gehören Republik, Imperium, Demokratie und<br />
auch Strategie. Dieses aus dem Griechischen stammende Wort bezeichnete ursprünglich die Kunst des Feldherrn<br />
(Strategos). Als Einstieg in die neue Reihe von Beiträgen zur Strategie in der Militärgeschichte wird im folgenden<br />
Beitrag der Strategiebegriff anhand von Definitionen von der Antike bis heute thematisiert.<br />
Logo der neuen Reihe »Strategie« unter Verwendung eines Bildes von<br />
bpk/Antikensammlung; Foto: Jürgen Liepe; Gestaltung: MGFA<br />
Das Wort Strategie wurde im<br />
Mittelalter im lateinischen<br />
Westen des europäischen Kontinents<br />
kaum oder überhaupt nicht<br />
benutzt. Zwar hatte der byzantinische<br />
Kaiser Maurikios (539–602, Kaiser ab<br />
582) ein Strategikon verfasst, in dem<br />
er seine Weisheiten über die Kriegskunst<br />
der Nachwelt überlieferte, aber<br />
dieses Werk wurde im Westen Europas<br />
im Mittelalter wenig gelesen. Auch der<br />
Begriff Taktik fand im Mittelalter kaum<br />
Verwendung. Der byzantinische Kaiser<br />
Leon VI. der Weise (865–912, Kaiser ab<br />
886) schrieb eine Taktika, die aber<br />
ebenfalls im Westen bis zur frühen<br />
Neuzeit wenig zur Kenntnis genommen<br />
wurde, ehe sie im 18. Jahrhundert,<br />
zusammen mit dem schon genannten<br />
Strategikon, ins Französische übersetzt<br />
und gedruckt wurde.<br />
Die lange Wirkung der Antike<br />
Vom späten 4. Jahrhundert nach Christus<br />
bis weit in die Neuzeit waren die<br />
Werke des Flavius Vegetius Renatus<br />
(um 390) die »Bibel« der Kriegslehre.<br />
Er schrieb von »militärischen Dingen«,<br />
die um die Themen Heer, Befestigung,<br />
Belagerung, Schlacht und deren praktische<br />
Aspekte kreisten. Vegetius hat<br />
damit den bekanntesten Urtyp der<br />
noch heute benutzten Dienstvorschriften<br />
verfasst. Wo der Ausdruck »militärische<br />
Dinge« nicht verwandt wurde,<br />
schrieb man bis ins späte 18. Jahrhundert<br />
über die »Kriegskunst« oder die<br />
»Kriegswissenschaft«. Im Zeitalter der<br />
Aufklärung war dabei die Hoffnung<br />
weit verbreitet, dass man wissenschaftliche<br />
Prinzipien der Kriegskunst entdecken<br />
könnte, die für alle anwendbar<br />
seien – so wie die Gesetze der Physik<br />
oder der Chemie, die man damals<br />
allmählich zu systematischen Wissenschaften<br />
zusammenzufügen begann.<br />
Dabei waren die Kriegswissenschaftler<br />
des 18. Jahrhunderts oft von der<br />
Geometrie fasziniert und versuchten,<br />
zumindest auf der Ebene der Taktik,<br />
Vorgaben von der Regelmäßigkeit der<br />
Geometrie abzuleiten, und dies besonders<br />
bei Fragen der Bewegung von<br />
Truppen in Kolonnen oder anderen<br />
Formationen. Einer dieser »Geometren«<br />
war der Preuße Heinrich von<br />
Bülow (1752–1807), der um 1800 die<br />
Begriffe Strategie und Taktik wie folgt<br />
definierte:<br />
»Die Wissenschaft der kriegerischen<br />
Bewegung, außerhalb des gegenseitigen<br />
Gesichtskreises, zweier mit einander<br />
kriegführenden Heere, oder,<br />
wenn man lieber will, außerhalb des<br />
Wirkungskreises des groben Geschützes,<br />
außerhalb des Kanonenschusses<br />
u.s.w. ist Strategie. Die Wissenschaft<br />
der kriegerischen Bewegungen in<br />
Gegenwart des Feindes, so dass sie<br />
von demselben gesehen werden können,<br />
oder wenn man lieber will, von<br />
da an, wo der Wirkungskreis des groben<br />
Geschützes aufhört, ist Taktik.«<br />
3 Oberteil eines Kamms: Kaiser Leon VI. (l.),<br />
älteste datierte Elfenbeinschnitzerei<br />
Skulpturensammlung und Byzantinisches Museum, Inv.-Nr. 2006<br />
Politik und Strategie<br />
Eine andere Gattung der Literatur über<br />
den Krieg, die nicht in den Fußstapfen<br />
des Vegetius folgte, kann man über<br />
Machiavelli bis zu den klassischen<br />
Schriften zur Politik in der Antike<br />
zurückverfolgen. Niccolo Machiavelli<br />
(1469–1527) machte sich in Der Fürst<br />
Gedanken über die politische Dimension<br />
des Krieges, eine Dimension, die<br />
der Kriegskunst und der Taktik übergeordnet<br />
war. Für Machiavelli war es<br />
eine Selbstverständlichkeit, dass der<br />
Krieg ein Instrument der Politik sei –<br />
so selbstverständlich, dass er dies nie<br />
in seinen Werken formulierte. Ebenso<br />
galt dies für einige andere Staatsphilosophen,<br />
wie Justus Lipsius (1547–1606)<br />
und Hugo Grotius (1583–1645), aber<br />
auch für König Friedrich II. den Großen<br />
von Preußen (1712–1786), der zahlreiche<br />
Beiträge über die zwischenstaatlichen<br />
Beziehungen und die Bedeutung<br />
des Militärs verfasste. Aber die wenigsten,<br />
die sich mit »militärischen Dingen«<br />
im Engeren befassten, machten sich<br />
gleichzeitig Gedanken über den politischen<br />
Sinn und Zweck des Krieges.<br />
Es gab jedoch wichtige Ausnahmen:<br />
Santa Cruz de Marciado, ein spanischer<br />
Offizier und Diplomat (1684–1732) und<br />
der Franzose Jacques Antoine Hippolyte<br />
Graf Guibert (1743–1790), ein<br />
Bewunderer Friedrichs des Großen, der<br />
sowohl Anweisungen in der Tradition<br />
des Vegetius als auch Werke über das<br />
Verhältnis von Militär und Staat, Militär<br />
und Gesellschaft, sowie Ideologie<br />
und Krieg verfasste. Guibert sprach<br />
dabei noch allein von der Taktik.<br />
18<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
akg-images<br />
akg-images<br />
akg-images<br />
1 2 3<br />
Strategie und Taktik<br />
im 19. Jahrhundert<br />
In seinem berühmtesten Werk, den<br />
Betrachtungen über die Kriegskunst, benutzte<br />
Georg Heinrich von Berenhorst<br />
(1733–1814) lediglich den Ausdruck<br />
»Taktik«. Diese definierte er als Lehre<br />
der Wahl und des Gebrauchs der<br />
Waffen, sowie der Ausbildung und<br />
Übung der Soldaten, den Bewegungen<br />
von Einheiten im Verbund. In seinen<br />
Worten: »Alles, was zum eigentlichen<br />
Kampf gehört, was an einem gewissen<br />
Tage, zu einer gewissen Stunde,<br />
den Endausschlag dessen gibt, was die<br />
höheren Kriegswissenschaften, Heerführerkünste<br />
[…] bezielen.«<br />
Davon abgehoben, bezeichnete Berenhorst<br />
die »höheren Kriegswissenschaften«<br />
und »Heerführerkünste« als<br />
auf der Basis der Taktik aufgebaut, als<br />
etwas, dem »die Taktik zur Grundlage<br />
dient«. Anderswo bezeichnete er diese<br />
»Künste« als Strategie, aber definierte<br />
sie noch sehr unbefriedigend: »Strategie<br />
ist die Marschkunst, Taktik die<br />
Kampfeskunst.«<br />
Auch der preußische Kriegsphilosoph<br />
und General Carl von Clausewitz<br />
(1780–1831) verwendete in seinem<br />
Werk Vom Kriege sehr enge Definitionen.<br />
Nach seiner Einteilung war »Taktik<br />
die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte<br />
im Gefecht, die Strategie die<br />
Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum<br />
Zweck des Krieges«. Clausewitz’ Zeitgenosse<br />
und literarischer Rivale in der<br />
Analyse der napoleonischen Kriegführung,<br />
Antoine-Henri Baron de Jomini<br />
(1779–1869), definierte die Strategie als<br />
»die Kunst, die Übermacht des Heeres<br />
auf den wichtigen Punkt des Kriegstheaters<br />
oder der Operations-Zone hin<br />
zu führen« und an einer anderen Stelle<br />
als »die Kunst, auf der Landkarte<br />
Krieg zu führen; sie bezieht das ganze<br />
Theater der Operationen mit ein. Große<br />
Taktik ist die Kunst, Truppen auf<br />
dem Schlachtfeld zu verteilen, ausgerichtet<br />
an der Disposition des Terrains,<br />
oder sie in den Kampf zu führen, und<br />
die Kunst, auf dem Boden zu kämpfen,<br />
im Gegensatz zur Planung auf der<br />
Landkarte. […] Die Strategie entscheidet,<br />
wo man handeln muss, die große<br />
Taktik entscheidet die Art, in der dies<br />
ausgeführt wird, und den Einsatz der<br />
Truppen.«<br />
Der Weggefährte von Clausewitz und<br />
preußische General Otto August Rühle<br />
von Lilienstern (1780–1847) erlaubte<br />
sich einige kurze, brillante Überlegungen<br />
zu den politischen Zielen in seinem<br />
Handbuch für Offiziere von 1815,<br />
einem ansonsten umfangreichen Anleitungshandbuch<br />
à la Vegetius. Der Versuch<br />
von Clausewitz, die Essenz des<br />
Krieges und dessen Zusammenhänge<br />
mit der Politik zu erforschen, waren<br />
also nicht ganz neu. Aber in einer expliziten<br />
Thematisierung hat er einen neuen<br />
Ansatz zum Denken über den Krieg<br />
geliefert, dem seitdem keiner gleichgekommen<br />
ist.<br />
Auf Clausewitz’ Erkenntnisse bauend<br />
unterstrichen europäische sicherheitspolitische<br />
Denker die Rolle von Macht<br />
4<br />
1 Aus: Flavius Vegetius,<br />
»Der Unterwasserkämpfer«, Holzschnitt,<br />
koloriert; vier Bücher der Ritterschaft,<br />
Augsburg (Heinrich Steiner) 1529<br />
2 Niccolo Machiavelli, Gemälde, anonym,<br />
Ende 16. Jhd., nach zeitgenössischem<br />
Bildnis, Öl auf Holz<br />
3 Justus Lipsius (eigtl. Joest Lips),<br />
Kupferstich von E. de Boulonois nach<br />
Anthonis van Dyck (1599–1641); aus:<br />
I. Bullart, Academie des Sciences et<br />
des Arts, Teil 2, Antwerpen 1682, Berlin,<br />
Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte<br />
4 Hugo Grotius (eigentl. Huigh de Groot),<br />
niederl. Rechtsgelehrter und Staatsmann,<br />
»De iure belli ac pacis« (1625), Titelblatt<br />
der Ausgabe Frankfurt am Main, 1626<br />
akg-images<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 19
Was ist Strategie?<br />
Klassiker und Praktiker – Strategiedefinitionen<br />
im 20. Jahrhundert<br />
Der britische Hauptmann, Veteran des Ersten Weltkrieges und Militärhistoriker<br />
Sir Basil Liddell Hart (1895–1970) schrieb:<br />
»Die Strategie ist die Kunst, militärische Mittel zum Zweck der Politik<br />
einzusetzen. [...] Die Rolle der großen Strategie – der höheren Strategie<br />
– ist es, alle Ressourcen einer Nation oder Gruppe von Nationen zu<br />
koordinieren und so einzusetzen, dass das politische Objekt des Krieges<br />
erreicht wird – ein Ziel, was durch die grundsätzliche Politik definiert<br />
wird.«<br />
Bei Michael Handel (1942–2001), einem ehemals sehr beliebten Dozenten<br />
an den amerikanischen Militärakademien, findet man dies knapper<br />
zusammengefasst: »Strategie ist die Entwicklung und der Einsatz aller<br />
Ressourcen in Frieden und Krieg zur Unterstützung der staatlichen [nationalen]<br />
Politik, um den Sieg zu erringen.«<br />
Und ganz in der Tradition Michael Handels definierten die US-Amerikanischen<br />
Stabschefs 1989:<br />
»Die Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, in Frieden und Krieg<br />
politische, wirtschaftliche, psychische und militärische Kräfte zu entwickeln<br />
und zu benutzen, der Politik ein Maximum an Unterstützung zu<br />
gewährleisten, um die Wahrscheinlichkeit des Sieges und seiner guten<br />
Folge-Erscheinungen zu erhöhen und die Möglichkeit der Niederlage zu<br />
verringern.«<br />
Robert Osgood, ein amerikanischer Sicherheitsexperte, folgerte aus dem<br />
Kernwaffenzeitalter:<br />
»Militärische Strategie muss jetzt verstanden werden als nichts weniger<br />
als ein Gesamtkonzept für die Nutzung der Fähigkeit zum bewaffneten<br />
Zwang – zusammen mit wirtschaftlichen, diplomatischen und psychischen<br />
Macht-Instrumenten –, um die Außenpolitik am effektivsten mit<br />
offenen, geheimen und verschwiegenen Mitteln zu unterstützen.«<br />
Ein weiterer Clausewitz-Anhänger, Colin S. Gray, ein Stratege mit einer<br />
britisch-amerikanischen Karriere zwischen Wissenschaft und Politikberatung,<br />
sah »Strategie [… ] als die Brücke zwischen militärischer Gewalt<br />
und politischem Zweck, sie ist weder militärische Gewalt allein noch<br />
politischer Zweck […] Strategie [ist] die Anwendung von Gewalt und<br />
die Androhung von Gewalt für die Zwecke der Politik.«<br />
Die Interaktion der beiden Faktoren hat die amerikanischen Militärhistoriker<br />
Williamson Murray und Mark Grimsley dazu veranlasst, zu<br />
formulieren:<br />
»Strategie ist ein Prozess, eine andauernde Anpassung an sich verändernde<br />
Bedingungen und Umstände in einer Welt wo Zufall, Unsicherheit<br />
und Unklarheit herrschen.«<br />
Eng angelehnt an Liddell Hart schreibt der britische Sicherheitsexperte<br />
Sir Lawrence Freedman:<br />
»Die Strategie befasst sich mit dem Verhältnis zwischen (politischen)<br />
Zwecken und (militärischen, wirtschaftlichen, politischen usw.) Mitteln.<br />
Sie ist die Kunst, Macht zu schaffen.«<br />
und die Dialektik der Gewalt. Der preußische<br />
Generalstabschef Helmuth von Moltke der Ältere<br />
(1800–1891) war in diesem Punkt ein Schüler<br />
von Clausewitz. Er ordnete die Strategie zwischen<br />
Politik auf der höheren Ebene und Operationen<br />
auf einer niedrigeren Ebene an:<br />
»Die Politik bedient sich des Krieges für Erreichung<br />
ihrer Zwecke, sie wirkt entscheidend auf<br />
den Beginn und das Ende desselben ein, so<br />
zwar, dass sie sich vorbehält in seinem Verlauf<br />
ihre Ansprüche zu steigern oder aber mit einem<br />
minderen Erfolg sich zu begnügen. Bei dieser<br />
Unbestimmtheit kann die Strategie ihr Streben<br />
stets nur auf das höchste Ziel richten, welches die<br />
gebotenen Mittel überhaupt erreichbar machen<br />
[kann]. Sie arbeitet so am besten der Politik in<br />
die Hand, nur für deren Zweck, aber im Handeln<br />
völlig unabhängig von ihr.<br />
Die nächste Aufgabe der Strategie ist die Bereitstellung<br />
der Streitmittel, die im Vorhinein als<br />
Funktion von gegebenen Ressourcen, Geographie,<br />
Logistik usw. geplant werden kann und muss.<br />
Anders verhält es sich bei der weiteren Aufgabe<br />
der Strategie: die kriegerische Verwendung<br />
der bereitgestellten Mittel, also bei den Operationen.<br />
Hier begegnet unserem Willen sehr<br />
bald der unabhängige Wille des Gegners. Diesen<br />
können wir zwar beschränken, [...] vermögen<br />
ihn aber nicht anders zu brechen, als durch<br />
die Mittel der Taktik, durch das Gefecht.«<br />
Marxistisch-leninistische Definitionen hängten<br />
sich noch am längsten an eine solche technisch<br />
beschränkte Definition von Strategie und Taktik<br />
im Sinne von Jomini und Clausewitz an. Strategie<br />
wurde noch lange Zeit gesehen als die Vorbereitung<br />
und Führung eines Krieges ganz allgemein,<br />
während die Taktik die Organisation und Führung<br />
der Schlacht sei. In beiden Bereichen ist der<br />
Kern derselbe: der bewaffnete Kampf. Der Chef<br />
des Sowjetischen Generalstabes, Marschall Nikolaj<br />
Orgakov (1917–1994), schrieb noch 1979: »Kriegsstrategie«<br />
(voyennaya strategiya) sei »jener Teil<br />
der Militärkunst, der die Prinzipien der Vorbereitung<br />
[eines Krieges] und die Kriegsführung und<br />
die Kampagnen in ihrer Gesamtheit bestimme.«<br />
Und weiter meinte er, mit einem Bezug zu Clausewitz:<br />
»Strategische Militärhandlungen sind die<br />
fundamentalen Mittel, die politischen Zwecke des<br />
Krieges zu erreichen.«<br />
Enge, an der Wirklichkeit des Krieges orientierte<br />
Definitionen dieser Art scheinen generell beim<br />
Militär beliebt zu sein. In der westlichen Welt<br />
begann man aber spätestens mit dem Beginn des<br />
20. Jahrhunderts den Begriff Strategie inflationär<br />
zu verwenden. Nicht nur wurde in seine Definition<br />
– wie im eben erwähnten sowjetischen Beispiel<br />
– Clausewitz’ Postulat vom Krieg als der<br />
Weiterführung der Politik mit gewalttätigen Mit-<br />
20<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
Strategie<br />
3 Bild links:<br />
Helmuth von Moltke,<br />
Porträtaufnahme, um 1870<br />
Bild rechts: Carl von Clausewitz,<br />
Farblithographie nach dem Gemälde von<br />
Wilhelm Wach (um 1820)<br />
teln miteinbezogen, sondern auch die<br />
Massenkriege, die durch die industrielle<br />
Revolution und die Einführung neuer<br />
Beförderungsmittel möglich geworden<br />
waren, wurden jetzt in ein Konzept<br />
des Krieges integriert. Industrie, Nationalstaaten,<br />
politisches Ziel – dies alles<br />
schwang jetzt mit.<br />
Strategie im 21. Jahrhundert<br />
akg-images<br />
Der Doyen der aktiven britischen Militärhistoriker,<br />
Hew Strachan, hat aufgezeigt,<br />
wie der Kalte Krieg die Trennlinien<br />
zwischen Krieg und Frieden sowie<br />
der Politik und dem Krieg als dessen<br />
Instrument verwischt hat. Er führte,<br />
so Strachan, zu einer »Verschmelzung<br />
von Strategie und Politik«. Die Trennlinie<br />
zwischen Politik und Strategie<br />
war vielleicht nie ganz klar, und die<br />
Clausewitzsche Fiktion, dass der führende<br />
militärische Befehlshaber den<br />
»Kriegsrat« eines Landes nur in rein<br />
militärischen Dingen beraten sollte,<br />
aber keinen Einfluss auf politische Entscheidungen<br />
haben dürfe, führte über<br />
das ihm folgende Jahrhundert zu regen<br />
Debatten – die allerdings zumeist mit<br />
der Verachtung des preußischen Militärs<br />
gegenüber zivilistischen Regierungen<br />
zusammenhingen. Der Historiker,<br />
Verteidigungsberater und einstige<br />
US-Außenminister Henry Kissinger<br />
schrieb zu diesem Thema:<br />
»Eine Zweiteilung in Strategie und<br />
Politik kann nur zum Nachteil von<br />
beiden erfolgen. Sie verursacht die<br />
Identifikation von militärischer Macht<br />
mit der absolutesten Gewaltanwendung<br />
und sie verführt die Diplomatie<br />
zu einer Versessenheit auf Feinheiten.<br />
Da die schwierigen Probleme der<br />
Staatspolitik in einem Bereich liegen,<br />
wo sich politische, wirtschaftliche,<br />
psychische und militärische Faktoren<br />
akg-images<br />
überlappen, sollten wir die Fiktion<br />
aufgeben, dass es so etwas wie einen<br />
›rein‹ militärischen Rat gibt.«<br />
Genauso wenig gebe es in diesem<br />
Bereich ›rein‹ politische Überlegungen.<br />
Eklatanter noch als die Verschmelzung<br />
zwischen Strategie und Politik<br />
aber ist in unserem heutigen Gebrauch<br />
dieses Vokabulars die Verschmelzung<br />
des Wortes »Strategie« mit Wirtschaftsdenken.<br />
Wenn heute ein Lehrstuhl für<br />
»Strategie« ausgeschrieben wird, ist die<br />
Wahrscheinlichkeit größer, dass er zu<br />
den Wirtschaftswissenschaften gehört,<br />
als dass er sich mit der Sicherheitspolitik<br />
und ihrer Geschichte befasst, und<br />
Clausewitz wird gerne in Wirtschaftskreisen<br />
gelesen und zitiert. Regierungen<br />
entwickeln »Strategien« für den<br />
Umgang mit Arbeitslosigkeit, Wohnungsknappheit,<br />
Bildung, und jedes<br />
Unternehmen hat seinen Unternehmensplan<br />
oder seine »Strategie«.<br />
Wenn Clausewitz selbst den Begriff<br />
Strategie in seiner heutigen weiteren<br />
umgangssprachlichen Bedeutung gekannt<br />
hätte, hätte er selbst vielleicht<br />
formuliert:<br />
Strategie ist die Anwendung jeglicher<br />
zur Verfügung stehender Instrumente<br />
– bis hin zur Androhung und<br />
gar dem Einsatz von Gewalt – für den<br />
Zweck der Politik in einer Dialektik<br />
zweier (oder mehr) gegnerischer Willen<br />
mit dem Ziel, unsere Politik dem<br />
Gegner aufzuzwingen. Dabei ist Letzteres<br />
aber nur geglückt, wenn man<br />
seinen Willen dem Gegner erfolgreich<br />
und dauerhaft aufgezwungen hat, mit<br />
dem Resultat eines dauerhaften Friedens.<br />
Es ist aber eine Illusion, wenn man<br />
meint, Regierungen träfen Entscheidungen<br />
über den Gebrauch militärischer<br />
Gewalt (oder auch nur ihrer Androhung)<br />
nur mit klaren, langfristigen<br />
politischen Zielen im Blick. Wie der<br />
australisch-britische Sicherheitsexperte<br />
Hedley Bull (1932–1985) zu Recht<br />
gesagt hat, sind solche Entscheidungen<br />
meist das Produkt von Krisensituationen,<br />
in denen Regierungen halb blind<br />
herumstolpern und quasi im Dunklen<br />
nach Entscheidungsmöglichkeiten tasten,<br />
viel zu sehr damit beschäftigt, die<br />
Krise zu überleben als sich wirklich darüber<br />
klar zu sein, welche Richtung sie<br />
einschlagen, welche langfristigen Konsequenzen<br />
ihre Entscheidungen haben<br />
könnten, und welchen Abgründen sie<br />
damit vielleicht entgegensteuern.<br />
Selten ist der weise Entscheidungsträger,<br />
der nach klaren ethischen Prinzipien,<br />
mit politischem Weitblick und<br />
vollem Verständnis einer komplexen<br />
Krisensituation wirklich das Instrument<br />
der bewaffneten Gewalt in allen<br />
seinen Dimensionen vorsichtig abwägt,<br />
ehe er es zum Einsatz bringt. Noch seltener<br />
ist der Krieg, dessen Sinn und<br />
Zweck für die kriegsführenden Parteien<br />
von Anfang bis Ende derselbe<br />
bleibt. Daneben steht auch das Argument,<br />
meist mit dem israelischen Clausewitzianer<br />
Martin van Creveld verbunden,<br />
dass viele den Krieg führen,<br />
weil sie dies schlichtweg reizvoll finden,<br />
weil es ihrer Natur und ihrer<br />
Kultur entspricht und weil sie dafür<br />
höchstens noch eine gute Ausrede<br />
brauchen. Beide Überlegungen sollte<br />
man ernst nehmen, ehe man zu gläubig<br />
davon ausgeht, dass jedem Konflikt<br />
von Anfang bis Ende eine für uns<br />
nachvollziehbare, kohärente politische<br />
Zielsetzung zugrunde liegt.<br />
• Beatrice Heuser<br />
Lesetipp:<br />
Gérard Chaliand (Hrsg), The Art of<br />
War in World History, Berkeley: 1994;<br />
es existiert auch eine französische<br />
Originalausgabe: Anthologie<br />
Mondiale de la Stratégie, Paris: 1990<br />
Beatrice Heuser, Clausewitz lesen!,<br />
München 2005<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 21
Service<br />
Das historische Stichwort<br />
Die Schlacht<br />
auf dem Lechfeld<br />
955<br />
»Nicht gerade unblutig war der<br />
Sieg über ein so wildes Volk.«<br />
Widukind von Corvey<br />
akg-images<br />
akg-images<br />
Im Jahre 955 besiegten 7000–8000<br />
gepanzerte Reiter unter Führung<br />
des ostfränkischen Königs Otto I.<br />
in der Nähe von Augsburg ein Heer<br />
von leichten ungarischen Reitern. Die<br />
Schlacht auf dem Lechfeld gilt<br />
gemeinhin als erfolgreicher Abschluss<br />
der Abwehrkämpfe gegen die Magyaren<br />
(Eigenbezeichnung der Stämme<br />
Ungarns), die seit Ende des 9. Jahrhunderts<br />
das Ostfrankenreich und darüber<br />
hinaus weite Gebiete in Westeuropa<br />
mit ihren Raub- und Beutezügen heimgesucht<br />
hatten.<br />
3 »Die Schlacht auf dem<br />
Lechfeld«, Buchmalerei<br />
von Hektor Mülich,<br />
1457, Illustration zu der<br />
Meisterlinchronik Augsburg,<br />
Staatsbibliothek<br />
Zwar hatte auch Ottos Vater, König<br />
Heinrich I. (876–936) in der Schlacht bei<br />
Riade an der Unstrut 933 einen militärischen<br />
Sieg gegen die Ungarn errungen,<br />
jedoch hatte er weiterhin jahrelang Tributleistungen<br />
an die Magyaren geleistet,<br />
um die Zeit für den Ausbau zahlreicher<br />
Burgen und befestigter Plätze<br />
zu nutzen, an deren Mauern künftige<br />
Raubzüge »zerschellen« würden.<br />
Nach seiner Krönung zum König des<br />
Ostfrankrenreiches, das auch regnum<br />
teutonicum genannt wurde und aus<br />
dem später das Heilige Römisch Reich<br />
Deutscher Nation hervorging,<br />
musste sich Otto I.<br />
zunächst mit inneren Feinden<br />
im Reich auseinandersetzen,<br />
um seine Herrschaft<br />
zu sichern. Aber auch die<br />
äußere Be-drohung war zu<br />
Beginn seiner Herrschaft<br />
nicht gering. Ständig gab<br />
es Kämpfe an den östlichen<br />
Grenzen des Reiches.<br />
Dennoch konnte Otto I.<br />
sämtliche Schwierigkeiten<br />
überwinden. So wie er allen<br />
inneren Anfeindungen widerstehen<br />
konnte, gelang<br />
es ihm, einen unter seiner<br />
Herrschaft stehenden mitteleuropäischen<br />
zusammenhängenden<br />
Territorialverbund bis nach Italien aufzubauen.<br />
Dadurch wurden den Ungarn<br />
auf dem Weg nach Westen sowohl die<br />
nördlichen Routen durch Mähren und<br />
Böhmen als auch die südlichen Wege<br />
durch die Po-Ebene nach Italien versperrt.<br />
Für die Magyaren war dies eine<br />
ernsthafte Gefahr im Hinblick auf den<br />
Erfolg künftiger Streif- und Beutezüge.<br />
Aus dieser Perspektive betrachtet<br />
relativiert sich die magyarische Bedrohung<br />
im Jahre 955. Otto I. hat mit seinem<br />
Sieg über die Ungarn auf dem<br />
Lechfeld demnach nicht das christliche<br />
Abendland gerettet, sondern nur<br />
die verzweifelt nach einem letzten<br />
»Durchbruch« suchenden Ungarn in<br />
einer Schlacht zerschlagen. Das Reich<br />
Ottos I. hatte sich bereits vor diesem<br />
Sieg zur strategischen und machtvollen<br />
Barriere zwischen dem Stammsitz der<br />
Ungarn und ihren ehemaligen »Jagdrevieren«<br />
entwickelt. Es war zu stark und<br />
nicht zu schwach geworden. Dies geht<br />
auch – nach der »Sachsengeschichte«<br />
des Widukind von Corvey – aus Ottos<br />
Rede vor der Schlacht hervor: »Schämen<br />
müssten wir, die Herren fast ganz<br />
Europas, uns, wenn wir uns jetzt den<br />
Feinden unterwerfen.«<br />
Wie kam es zur Schlacht auf dem<br />
Lechfeld? Nachdem Otto I. die Meldung<br />
erneut einfallender ungarischer<br />
Truppen unter der Führung ihres Feldherrn<br />
Bolksu erreicht hatte, ordnete<br />
er unverzüglich die Mobilisierung der<br />
ihm zur Heerfolge verpflichteten Stämme<br />
der Sachsen, Schwaben, Bayern,<br />
Franken und Böhmen an. Die Lothringer,<br />
die zu weit vom befohlenen<br />
22<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
3 Der Sieg Ottos I. über die Ungarn: »Die Schlacht auf dem<br />
Lechfelde 955«. Schulwandbild aus dem »Dritten Reich«<br />
(nach einem Gemälde von Franz Roubal; Westfälisches<br />
Schulmuseum, Dortmund).<br />
Kaiser Otto I. in einer idealisierten 4<br />
Darstellung des 19. Jahrhunderts<br />
(Gemälde von Philipp Veit um 1840;<br />
Römer, Kaisersaal, Frankfurt a.M.).<br />
Sammelpunkt bei Augsburg entfernt<br />
waren, sollten für den Fall einer Niederlage<br />
des Hauptheeres eine Auffangstellung<br />
aufbauen. Für die belagerte<br />
Bevölkerung in der Bischofsstadt Augsburg<br />
spielten diese Pläne auch eine<br />
Rolle. Ihr Widerstand unter der Führung<br />
des später in der ottonisch-salischen<br />
Geschichtsschreibung überhöhten<br />
Bischofs Udalrich (später: hl. Ulrich)<br />
hätte bei Ausbleiben eines Entsatzheeres<br />
kaum Aufsicht auf Erfolg gehabt.<br />
Der ungarische Abzug von Augsburg<br />
nach kurzer Belagerung hatte seinen<br />
Grund in der Kenntnis vom Herannahen<br />
des Heeres unter Otto I. Dieses<br />
bestand aus acht, von Widukind als<br />
»Legionen« bezeichneten Verbänden<br />
unterschiedlicher Größe: Die ersten<br />
drei Abteilungen bildeten die Bayern,<br />
die vierte die Franken, die fünfte stellten<br />
die Sachsen unter Ottos Führung,<br />
die sechste und siebte Abteilung die<br />
Schwaben, die achte war jene der Böhmen<br />
am Ende des Heeres sowie der<br />
Tross.<br />
Am Tage des hl. Laurentius, dem 10.<br />
August, begann die Schlacht mit einem<br />
Angriff der Ungarn auf die Spitze des<br />
herannahenden Heeres und den Tross.<br />
Der Tross wurde erobert, geplündert<br />
und unzählige Böhmen wurden getötet<br />
oder gerieten in Gefangenschaft. Die<br />
Übrigen ergriffen die Flucht. Das Prozedere<br />
wiederholte sich, als die Ungarn<br />
die beiden Abteilungen der Schwaben<br />
angriffen. In dieser Situation, als mehr<br />
als ein Drittel des ostfränkischen Heeres<br />
bereits ohne Chance im Gefecht mit<br />
den Ungarn verwickelt war, erhielt die<br />
vierte Abteilung, die Franken, unter<br />
ihrem Führer Konrad dem Roten den<br />
Auftrag zum Gegenangriff. Dieser war<br />
so erfolgreich, dass der Tross und die<br />
Gefangenen zurückerobert bzw. befreit<br />
und die Ungarn zeitweilig in die Flucht<br />
geschlagen werden konnten. Konrad<br />
wurde während einer Gefechtspause,<br />
in der er seinen Helm absetzte, durch<br />
einen Pfeilschuss in die Kehle tödlich<br />
verwundet.<br />
Diese Zeit nutzte Otto I. zur Umgruppierung<br />
seiner Kräfte und zu einer<br />
Ansprache an seine Truppen. Nachdem<br />
er seine Rede beendet hatte »ergriff<br />
er den Schild und die Heilige Lanze<br />
und wandte zuerst selbst sein Ross<br />
gegen die Feinde, zugleich die Aufgabe<br />
des tapfersten Kriegers und des<br />
besten Feldherren erfüllend. Die Kühneren<br />
unter den Feinden leisteten<br />
anfangs Widerstand, dann, als sie ihre<br />
Gefährten die Flucht ergreifen sahen,<br />
erschreckten sie, gerieten zwischen die<br />
Reihen der Unsrigen und wurden niedergemacht«<br />
(Widukind von Corvey).<br />
Dies ist nicht notwendigerweise als<br />
eine exakte Beschreibung der Ereignisse<br />
zu sehen, sondern als allegorische<br />
Überhöhung mit einer politischer und<br />
theologischer Legitimationsperspektive<br />
zu werten, die eine zeitbedingte<br />
mittelalterliche Herrschaftsstilisierung<br />
beinhaltet. Damit ›transformierte‹ der<br />
Chronist Widukind den späteren Kaiser<br />
Otto I. in einer Mixtur von antikisierendem<br />
und christlich-heilsgeschichtlichem<br />
Muster zum Feldherren und<br />
Heereskaiser. Was sich hinter dieser<br />
Beschreibung verbirgt, ist die Überlegenheit<br />
der gepanzerten Reiterei Ottos<br />
I. über die leichten ungarischen Kräfte,<br />
die, ihrer rückwärtigen Verbindungen<br />
beraubt, »am zweiten und dritten<br />
Tage« (Widukind) nach den Anstrengungen<br />
der Schlacht auf der Flucht entweder<br />
im Lech ertranken oder von den<br />
Reitern Ottos I. in Stücke geschlagen<br />
wurden. Die gefangenen vornehmsten<br />
Heerführer der Ungarn wurden<br />
in Regensburg gehängt. So endete<br />
die Schlacht neben erheblichen Verlusten<br />
des Heeres von Otto mit der völligen<br />
und endgültigen Vernichtung der<br />
magyarischen Invasionstruppen.<br />
Die Folgen des Sieges indes waren<br />
beachtlich: Die Ungarn wurden als<br />
ernstzunehmende Macht dauerhaft geschwächt<br />
und stellten die Vorherrschaft<br />
Ottos I. wie auch später des Reiches<br />
nicht mehr in Frage. Die weitere<br />
historische Entwicklung sah Ungarn<br />
nach Annahme des Christentums durch<br />
König Stephan wenige Jahrzehnte später<br />
und seiner Heirat mit der Schwester<br />
des Kaisers Heinrich II. ab dem Jahre<br />
1044 als Lehen der deutschen Krone.<br />
Für Otto I. selbst stellte die Schlacht<br />
einen wichtigen Wendepunkt dar. Der<br />
Umstand der lästigen Ungarnzüge entledigt<br />
zu sein, der endgültige Erfolg<br />
gegen einen äußeren Feind und den<br />
Kritikern im Reich sowie der »Nachweis«<br />
des Schlachten- bzw. Königsheils<br />
steigerten sein Ansehen als Herrscher.<br />
Die Schlacht auf dem Lechfeld und die<br />
Bedeutung Ottos I. erhielten sofort eine<br />
historiographische Überhöhung. Seine<br />
Legitimation zur Ausübung des Kaiseramtes<br />
war jetzt in jeder Hinsicht<br />
gesichert. Am 2. Februar 962 wurde<br />
Otto I. in Rom von Papst Johannes XII.<br />
in St. Peter zum Kaiser gekrönt. Er<br />
war nun der Erneuerer des karolingischen<br />
Reichsgedankens – wenngleich<br />
beschränkt auf die ehemalige Osthälfte<br />
des Reiches Karls des Großen.<br />
Eberhard Birk<br />
akg-images<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 23
Service<br />
Medien online/digital<br />
Niemandsland<br />
Pat Barker, Niemandsland. Gelesen<br />
von Ulrich Pleitgen, Hamburg 2002.<br />
ISBN 3-89903-072-9; 3 Audio-CDs<br />
(200 min.), 23,00 Euro<br />
Pat Barker, Niemandsland, München<br />
1999. ISBN 3-423-12622-1; 323 S.,<br />
9,00 Euro<br />
Hörbücher erfreuen sich seit<br />
geraumer Zeit enormer Beliebtheit.<br />
Dabei wird nicht<br />
nur »leichte Kost« auf CD gebracht,<br />
wie man vielleicht meinen könnte, sondern<br />
auch anspruchsvollere literarische<br />
Werke finden ihren Weg in die<br />
CD-Regale. Eines dieser Werke ist die<br />
»Niemandsland«-Trilogie von Pat Barker.<br />
Die Schilderungen ergeben ein eindringliches<br />
Bild vom Grauen des<br />
Ersten Weltkrieges. Besonders interessant<br />
ist dabei, dass historische Fakten<br />
und fiktive Ereignisse miteinander verwoben<br />
werden. Im Mittelpunkt der<br />
Erzählung steht eine Nervenheilanstalt,<br />
in der Soldaten von der Front mit<br />
schwerwiegenden psychischen Krankheiten<br />
behandelt werden. Die fiktiven<br />
Akteure und deren Gespräche zeigen<br />
deutlich, was der Krieg aus einem<br />
Menschen machen kann. Das erlebte<br />
Martyrium und die erkannte Sinnlosigkeit<br />
des Geschehens führen zu einem<br />
Zerbrechen der Psyche. Das in dem<br />
Werk dargestellte Geschehen spielt sich<br />
überwiegend in den Gedanken der<br />
Insassen und in den Dialogen zwischen<br />
ihnen und dem medizinischen Personal<br />
der Anstalt ab.<br />
Die Lebensgeschichten im Hörbuch<br />
werden von dem bekannten Schauspieler<br />
Ulrich Pleitgen vorgetragen. Eindrucksvoll<br />
gelingt es ihm, den Zuhörer<br />
gleichsam zu fesseln und doch auch<br />
abzustoßen. Man erwartet gespannt<br />
die kommenden Ereignisse, ist jedoch<br />
ebenso erschüttert über deren meist<br />
brutale Dimensionen. Dies gilt nicht<br />
nur für die Wiedergabe von vergangenen<br />
Geschehnissen an der Front,<br />
auch die Behandlungsmethoden in der<br />
Anstalt rufen Unbehagen hervor.<br />
Wer eine Schilderung von Heldentaten<br />
und eine Glorifizierung des Krieges<br />
erwartet, wird von dem Werk Barkers<br />
enttäuscht sein. Hierzu eignen sich<br />
weder das Buch, das als Taschenbuchausgabe<br />
bereits seit 1999 vorliegt, noch<br />
das Hörbuch. Vielmehr werden gerade<br />
die Schattenseiten des Krieges und<br />
deren Auswirkungen auf die menschliche<br />
Psyche gezeigt. Dies gelingt dem<br />
Hörbuch nicht zuletzt durch die sprachliche<br />
Leistung Pleitgens. Wer sich indes<br />
lieber dem Lese- als dem Hörvergnügen<br />
hingeben möchte, dem sei die<br />
Taschenbuchausgabe des Werkes ans<br />
Herz gelegt.<br />
René Henn<br />
akg-images<br />
akg-images<br />
»Ich klage an...!«<br />
www.dreyfus-ausstellung.de<br />
Mit diesen Worten (Frz.<br />
»J’Accuse…!«) begann der<br />
offene Brief, den der Schriftsteller<br />
und Journalist Emile Zola 1898<br />
an den französischen Präsidenten richtete.<br />
Zugleich war dies der Höhepunkt<br />
des öffentlichen Streits um die Affäre<br />
Dreyfus.<br />
Vier Jahre zuvor war der jüdische<br />
Hauptmann Alfred Dreyfus zu Unrecht<br />
des Hochverrats angeklagt und verurteilt<br />
worden. Dreyfus wurde verdächtigt,<br />
der Verfasser des bordereaus<br />
(Anschreibens) zu sein, das die Preisgabe<br />
geheimer Militärinformationen<br />
an die Deutschen ankündigte. Trotz<br />
gegenteiliger Schriftgutachten und vieler<br />
Beweise, die für die Unschuld von<br />
Dreyfus sprachen, kam es auch in<br />
dem Wiederaufnahmeverfahren 1899<br />
zu einer erneuten Verurteilung. In<br />
Anbetracht der Unruhe, die dieser Justizskandal<br />
nicht nur in Frankreich hervorrief,<br />
und der bevorstehenden Weltausstellung<br />
in Paris (1900), entschloss<br />
sich die französische Regierung 10<br />
Tage nach der Urteilsverkündung zur<br />
Amnestie aller Straftaten, die mit der<br />
Affäre in Zusammenhang standen.<br />
Eine endgültige Rehabilitierung erfuhr<br />
Alfred Dreyfus allerdings erst 1906<br />
mit seiner Ernennung zum Ritter der<br />
Ehrenlegion.<br />
Die amerikanische Erziehungswissenschaftlerin<br />
Lorraine Beitler sammelte<br />
über drei Jahrzehnte lang Exponate<br />
zur Dreyfus-Affäre aus aller Welt und<br />
übergab kürzlich ihre umfangreiche<br />
Kollektion, die ca. 1300 Ausstellungsstücke<br />
umfasst, an die State University<br />
of Pennsylvania. Eine Auswahl hieraus<br />
wird anlässlich des 70. Todestages von<br />
24<br />
nline<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
3 oben:<br />
Degradierung von Dreyfus 1894, Farbdruck<br />
nach Henri Meyer, aus: Le Petit Journal,<br />
Suppl. illustre, 6. Jg., Nr. 217, Paris,<br />
13. Januar 1895, Paris, Privatsammlung<br />
unten:<br />
Dreyfus auf der Teufelsinsel 1896, Farbdruck,<br />
aus: Le Petit Journal, Suppl. illustre,<br />
7. Jg. Nr. 306, Paris, 27. Sept.1896,<br />
Berlin, Slg. Archiv f. Kunst & Geschichte<br />
digital<br />
Alfred Dreyfus erstmalig in Deutschland<br />
in einer Wanderausstellung präsentiert,<br />
die durch das Moses Mendels-<br />
5 Major Dreyfus nach seiner Rehabilitierung<br />
(2.v.r.) im Gespräch mit General Gillain und<br />
Major Targe , Bildpostkarte (1906, E. Le<br />
Deley), Paris, Privatsammlung<br />
akg-images<br />
sohn Zentrum in Potsdam vorbereitet<br />
wurde.<br />
Lorraine Beitler will mit der von<br />
ihr initiierten Ausstellung vor allem<br />
junge Menschen erreichen. Durch Aufklärung<br />
und Auseinandersetzung mit<br />
der Dreyfus-Affäre soll deren Sensibilität<br />
gegenüber Antisemitismus geweckt<br />
werden. Dreyfus steht somit als Synonym<br />
für politischen Radikalismus und<br />
antijüdische Propaganda, aber auch für<br />
die Verteidigung der Grundrechte und<br />
das Engagement für einen Unschuldigen.<br />
Die Ausstellung bietet Einblicke<br />
in die tief greifenden Auswirkungen,<br />
die diese Affäre auf Politik und Gesellschaft<br />
des fin de siècle in Frankreich,<br />
Europa und der Welt hatte. Dabei stehen<br />
die Akteure aus Militär, Politik<br />
und Justiz ebenso im Mittelpunkt wie<br />
Journalisten, Schriftsteller und Künstler.<br />
Die Schirmherrschaft für dieses Projekt,<br />
das unter Mitarbeit von Studenten<br />
der Universität Potsdam und der<br />
Freien Universität Berlin entstanden<br />
ist, haben u.a. Verteidigungsminister<br />
Dr. Peter Struck (für Hamburg) und der<br />
Innenminister des Landes Brandenburg<br />
Generalleutnant a.D. Jörg Schönbohm<br />
(für Potsdam) übernommen.<br />
Eröffnet wurde die Ausstellung bereits<br />
im Mai 2005 an der Führungsakademie<br />
der Bundeswehr in Hamburg<br />
und wird nach ihrer Präsentation<br />
in Potsdam in der Stiftung<br />
Centrum Judaicum/Neue Synagoge<br />
Berlin (1.9.–12.10.2005) und im Militärhistorischen<br />
Museum Dresden (18.10.–<br />
13.11.2005) zu sehen sein.<br />
Die begleitende Website bietet nicht<br />
nur Informationen zur Ausstellung,<br />
sondern ermöglicht auch das Herunterladen<br />
von umfangreichen Unterrichtsund<br />
Informationsmaterialien im pdf-<br />
Format.<br />
MMZ-Potsdam / hb<br />
Die Schlacht um Verdun<br />
http://www.geocities.com/bunker1914/<br />
verdun.htm<br />
Die Website »Die Schlacht um<br />
Verdun. Eine europäische Tragödie«<br />
von Erich Kassing ist<br />
eine gut gemachte und übersichtliche<br />
Darstellung der Kämpfe um die französische<br />
Festung Verdun im Ersten Weltkrieg.<br />
Neben chronologischen Informationen<br />
zum Ersten Weltkrieg von den ersten<br />
Kriegstagen 1914 bis zu den letzten<br />
Kämpfen 1918 liefert die Website<br />
auch biografische Fakten zu den maßgeblichen<br />
militärischen Führern, den<br />
Truppengattungen und Waffen auf<br />
dem Gefechtsfeld. Ein Schwerpunkt<br />
der Darstellung fällt folgerichtig auf die<br />
Bedeutung der Artillerie. Auch Berichte<br />
zum Frontalltag mit einer Auswahl<br />
von Erinnerungen beteiligter Soldaten<br />
fehlen nicht. Ausgewählte Militär- und<br />
Festungsbauten aus dem Raum Verdun<br />
werden detailliert und mit zahlreichen<br />
Abbildungen beschrieben.<br />
Ein »Höhepunkt« der Seite ist auch<br />
das dort präsentierte Verdun-Online-<br />
Lexikon von Stephan Klink, das Auszüge<br />
seiner umfangreichen privaten<br />
Publikation von über 2500 Stichwörtern<br />
zum Thema enthält. Hinweise<br />
zu den Gedenkstätten runden die Seite<br />
mit Informationen zur langen Wirkungsgeschichte<br />
dieser Schlacht ab, die<br />
für Generationen von Deutschen und<br />
Franzosen zum Inbegriff des Ersten<br />
Weltkrieges geworden ist.<br />
hb<br />
Ein Bayer im Ersten Weltkrieg<br />
http://www.geocities.com/<br />
CapeCanaveral/Galaxy/<br />
3402/wb1418/main.htm<br />
Einen individuellen Blick auf<br />
die Geschichte des Ersten<br />
Weltkrieges bietet die Website<br />
»Erlebnisbericht aus dem Ersten Weltkrieg«<br />
von Matthias Beimler. Auf der<br />
privaten Website sind die Notizen<br />
seines Urgroßvaters Wolfgang Böhm<br />
(1896–1960) aufbereitet worden. Der<br />
Infanterist Böhm beschrieb mit wenigen<br />
Worten seine Einsätze vor Verdun,<br />
in den Argonnen, an der Somme und<br />
in Flandern 1915 bis zu seiner Entlassung<br />
aus dem Militärdienst 1919. Es ist<br />
wohl das typische Beispiel von kurzen<br />
Aufzeichnungen, die für den Schreiber<br />
einen Anhalt für die eigene Erinnerung<br />
bieten sollen. So werden Kämpfe nur<br />
kurz beschrieben, wie an der Somme<br />
1916:<br />
»Wir mußten dann hinter der Zuckerfabrik<br />
ausschwärmen und dann ging<br />
das ganze Battaillon in Schützenlinie<br />
vor, weil die Engländer und Schottländer<br />
durchgebrochen waren. Am<br />
15., zwei Uhr nachmittags kamen wir<br />
dann in den Schützengraben und da<br />
hatten sich die Engländer schon wieder<br />
zurückgezogen und hatten den ganzen<br />
Tag viel Feuer. Am nächsten Tag,<br />
den 16., kamen die Engländer zweimal<br />
und wollten durchbrechen, wir haben<br />
es ihnen aber schon geholfen dafür.<br />
Haben die dicken Mauern der Engländer<br />
bloß niedergeschossen. Am 17.<br />
kamen sie halt wieder, aber wir haben<br />
sie wieder mit schweren Verlusten<br />
zurückgeworfen, wenn wir gleich dort<br />
nichts zu essen und zu trinken hatten.«<br />
Die knappen Texte werden durch<br />
ergänzende historische Informationen,<br />
aufbereitete Kartenskizzen und Fotos<br />
aus dem Familienbesitz sehr gut<br />
ergänzt. Wer will, kann sogar noch bei<br />
der Entzifferung von Textstellen helfen,<br />
wofür Auszüge der Originalnotizen<br />
vergrößert werden können. Neben<br />
einer kleinen Literaturliste ist vor allem<br />
die umfangreiche sortierte Linkliste<br />
zum Ersten Weltkrieg zu empfehlen.<br />
hb<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 25
Service<br />
Lesetipp<br />
Burgen und<br />
Festungen<br />
Contrescarpe, Glacisstraße, Wallstraße<br />
und andere Straßennamen<br />
lassen in so mancher Stadt noch den<br />
Bezug zu ehemaligen Festungsanlagen<br />
herstellen. Wer aber wissen will, was<br />
hinter diesen Bezeichnungen steckt,<br />
wird in gewöhnlichen Lexika nicht weit<br />
kommen. Der Reclam-Verlag versucht<br />
mit seinem Wörterbuch eine Lücke zu<br />
schließen und bietet ein preisgünstiges<br />
und handliches Nachschlagewerk<br />
zur Geschichte und Architektur von<br />
Dem ehemaligen Sozialwissenschaftler<br />
der Bundeswehr, Detlef<br />
Bald, ist es gelungen, mit seiner kritischen<br />
Geschichte der Bundeswehr<br />
anlässlich des Jubiläumsjahres erstmals<br />
eine handbuchartige und gut lesbare<br />
Überblicksdarstellung über die<br />
Geschichte der bundesdeutschen Streitde<br />
dies von dem Buch erwartet, wird<br />
enttäuscht. Vielmehr zeigt der Autor<br />
in seinem gut strukturierten und verständlich<br />
geschriebenen Werk wesentliche<br />
Aspekte auf, die in dem gewählten<br />
Zeitabschnitt für die Kriegsführung<br />
von herausgehobener Bedeutung<br />
waren. Dies geschieht zum einen<br />
Jürgen Luh,<br />
Kriegskunst in<br />
Europa 1650–1800,<br />
Köln 2004.<br />
ISBN 3-412-13703-0;<br />
298 S.,<br />
44,90 €<br />
Horst Wolfgang Böhme,<br />
Reinhard Friedrich<br />
und Barbara<br />
Schock-Werner (Hrsg.),<br />
Wörterbuch der Burgen,<br />
Schlösser und Festungen,<br />
Stuttgart 2004.<br />
ISBN 3-15-010547-1;<br />
285 S.,<br />
15,90 €<br />
Burgen, Schlössern und Festungen an.<br />
Schon in der Einleitung gelingt es, eine<br />
Jahrhunderte alte Baugeschichte kurz<br />
und interessant zu präsentieren. Wer<br />
über die 300 Einträge hinaus an weiteren,<br />
ausführlicheren Informationen<br />
interessiert ist, dem bietet das Literaturverzeichnis<br />
eine Auswahl von Standardwerken<br />
zur Thematik. Die allgemeine<br />
Verständlichkeit der Einträge ist<br />
überwiegend gelungen. Man wünscht<br />
sich jedoch mehr erklärende Zeichnungen<br />
und Abbildungen zu diesem komplexen<br />
Thema.<br />
hb<br />
Kriegskunst in<br />
Europa<br />
in den Bereichen der Logistik, des Festungskrieges,<br />
der Bewaffnung und der<br />
Taktik, zum anderen aber auch im<br />
Bereich der Ästhetik und des Selbstgefühls.<br />
Am interessantesten ist dabei<br />
sicherlich, dass Luh die Frage Nützlichkeit<br />
oder Unzulänglichkeit der damaligen<br />
Infanteriebewaffnung diskutiert.<br />
Vor allem dieser Aspekt verdiene<br />
besondere Beachtung, so der Autor, da<br />
für die Bewaffnung nicht ausschließlich<br />
technisch-militärische Gesichtspunkte<br />
im Vordergrund standen, sondern<br />
ästhetische Aspekte eine genauso<br />
große Rolle spielten. Dies wird vor<br />
allem aus dem Umstand ersichtlich,<br />
dass die Einheiten überwiegend mit<br />
Gewehren ausgerüstet waren, die<br />
durchaus zum äußeren Erscheinungsbild<br />
passten, aber nicht ihrer eigentlichen<br />
Zweckbestimmung – dem tödlichen<br />
Einsatz im Kampf – gerecht<br />
wurden.<br />
Abschließend lässt sich mit Blick<br />
auf das Buch festhalten, dass es dem<br />
Autor gelingt, sowohl bereits bekannte<br />
Details anschaulich zu vermitteln, als<br />
auch neue Blickwinkel zu erschließen.<br />
Die Aufteilung des Buches in einzelne,<br />
in sich geschlossene Kapitel kommt<br />
diesem Anliegen zugute.<br />
René Henn<br />
Die geduldete Armee<br />
Der ehemalige Redakteur der Tageszeitung<br />
»Die Welt« Clemens Range<br />
hat mit dem Titel seines Buches klar<br />
dargelegt, unter welchem Blickwinkel<br />
Clemens Range, Die geduldete Armee.<br />
50 Jahre Bundeswehr, Berlin 2005.<br />
ISBN 3-00-015382-9; 313 S.,<br />
45,00 €<br />
Der Buchtitel »Kriegskunst in Europa<br />
1650–1800« lässt auf den ersten<br />
Blick eher eine Abhandlung über<br />
die zeitgenössische theoretische Auseinandersetzung<br />
in Bezug auf die Kriegführung<br />
als eine an der Praxis orientierte<br />
Schilderung der eigentlichen<br />
Abläufe während eines Krieges in dieser<br />
Epoche vermuten. Doch wer geraer<br />
die Bundeswehr betrachtet. Im Kern<br />
einer Armee steht für Range der »Geist<br />
der Truppe«. Daher lässt er in einer<br />
mehr und weniger deutlichen Form<br />
auch durchblicken, welche Mängel in<br />
der Bundeswehr seiner Einschätzung<br />
nach herrschen. Immer wieder kommt<br />
er dabei auf die Themen der Traditionspflege,<br />
der Inneren Führung und den<br />
Umgang mit der Geschichte der Wehrmacht<br />
zurück. Hier überwiegt seine<br />
Kritik an der Praxis in der Bundeswehr.<br />
Dies wird selbst in dem ansonsten<br />
gelungenem lexikalischen Teil »Weltpolitische<br />
Ereignisse von 1949 bis 2004«<br />
deutlich. Im Übrigen ist das durchgehend<br />
bebilderte Werk mit vielen Details<br />
zu Einsätzen, Uniformierung, Bewaffnung<br />
und Personen ein hervorragendes<br />
Nachschlagewerk, dass durch ein<br />
Stichwortverzeichnis noch hätte abgerundet<br />
werden können.<br />
hb<br />
Die Bundeswehr<br />
26<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
Detlef Bald,<br />
Die Bundeswehr.<br />
Eine kritische Geschichte,<br />
1955–2005,<br />
München 2005<br />
(= beck’sche Reihe).<br />
ISBN 3-406-52792-2;<br />
232 S.,<br />
12,90 €<br />
kräfte vorzulegen. Dabei richtet sich<br />
sein Blick aber nicht auf eine Technikoder<br />
Organisationsgeschichte. Im Zentrum<br />
der Darstellung steht vielmehr<br />
die Entwicklung der Bundeswehr im<br />
gesellschaftspolitischen Kontext der<br />
Bundesrepublik.<br />
Bald entwickelt einen Spannungsbogen,<br />
der die fünfzigjährige Entwicklung<br />
der Bundeswehr zwischen<br />
dem politisch gewollten Reformprozess<br />
einer demokratisch ausgerichteten<br />
Parlamentsarmee einerseits und<br />
einer von der obersten militärischen<br />
Führung ausgehenden reaktionären<br />
Haltung andererseits einordnet.<br />
Obwohl Bald ein empfehlenswertes<br />
Handbuch vorlegt, dessen kritische<br />
Darstellung phasenweise wohltuend<br />
zu lesen und dessen Informationsgehalt<br />
hoch ist, wäre stellenweise<br />
eine größere Distanz zum Gegenstand<br />
wünschenswert gewesen.<br />
Thorsten Loch<br />
Kriegsbilder<br />
Bilder des Krieges als militärgeschichtliche<br />
Quelle sind bisher vor<br />
allem in der deutschen Forschung<br />
wenig berücksichtigt worden. Der<br />
Flensburger Professor Gerhard Paul<br />
versteht sein Buch als einen Beitrag<br />
zur Beseitigung dieses Defizits. Der<br />
Autor lädt den Leser ein zu einer<br />
reich bebilderten »Tour d’horizon« der<br />
Geschichte der Kriegsfotographie und<br />
der modernen visuellen Kriegsberichterstattung<br />
und spannt den Bogen vom<br />
Krimkrieg über die beiden Weltkriege<br />
bis hin zum 11. September 2001.<br />
Die Fotografie und später die Fernsehberichterstattung<br />
haben die zeitliche<br />
und räumliche Distanz zum Phänomen<br />
Krieg überwunden und ihn<br />
vom Schlachtfeld in die Wohnzimmer<br />
gebracht. In seiner Fähigkeit zur Beeinflussung<br />
der Öffentlichkeit wurde das<br />
Bild letztlich selbst zu einer »Ressource<br />
des Krieges« und damit zur politischen<br />
Waffe.<br />
Doch auch Fotografie und Film bleiben<br />
Kunstformen, die letztlich nur<br />
Ästhetisierungen des Krieges liefern.<br />
Wie alle anderen Medien sind<br />
auch sie nur ein Instrument zur<br />
mentalen Domestizierung des<br />
Krieges, die ihn als einen verstehbaren<br />
und bestimmten Prinzipien<br />
unterliegenden Ablauf erscheinen<br />
lassen. Selbst die modernste<br />
und freieste Form der Kriegsberichterstattung<br />
erneuert somit<br />
immer wieder nur die uralte Illusion<br />
von der Führbarkeit von<br />
Kriegen. Den Krieg als Mittel der<br />
Politik kann auch sie nicht desavouieren.<br />
Gerhard Paul, Bilder des Krieges – Krieg der<br />
Bilder. Die Visualisierung des modernen<br />
Krieges, Paderborn 2004.<br />
ISBN 3506 71739 1; 526 S.,<br />
49,90 €<br />
Pauls Arbeit ist letztlich ein Meilenstein<br />
auf diesem relativ neuen Forschungsfeld.<br />
Als Leser seiner eindrucksvollen<br />
Gesamtdarstellung hätte<br />
man sich freilich eine kompaktere und<br />
publikumsfreundlichere Art der Darstellung<br />
gewünscht.<br />
Klaus-Jürgen Bremm<br />
Afrika<br />
Irgendeine Vorstellung von Afrika<br />
hat jeder. Chaos, Krankheiten, Hunger,<br />
Armut, Krieg, Völkermord, apathische<br />
oder fröhliche Menschen, eine<br />
Welt-Elite von Laufsportlern und ein<br />
allseits geachteter UN-Generalsekretär.<br />
Christoph Marx,<br />
Geschichte Afrikas.<br />
Von 1800 bis<br />
zur Gegenwart,<br />
Paderborn 2004.<br />
ISBN 3-506-71748-0;<br />
391 S.,<br />
18,90 €<br />
Vieles, was wir mit Afrika verbinden,<br />
scheint aber nie den Kontinent<br />
als Ganzes zu beschreiben, ist Klischee<br />
und mit fließenden Grenzen<br />
schlimmstenfalls Rassismus. Christoph<br />
Marx wagt sich an eine<br />
Strukturierung des unbekannten<br />
Kontinents der 52 Staaten, der<br />
immerhin ein Fünftel der Landmasse<br />
unserer Erde umfasst. Unter<br />
den drei Abschnitten Expansion,<br />
Lebenswelten unter kolonialer<br />
Herrschaft, Brüche und Kontinuitäten<br />
beschreibt der Autor das<br />
gewaltige Kaleidoskop afrikanischer<br />
Geschichte und Politik der<br />
letzten 200 Jahre. In kurzen Abschnitten<br />
werden Beispiele präsentiert,<br />
um sich den Themen Kriege,<br />
staatliche und wirtschaftliche Entwicklung<br />
von Ländern und Regionen<br />
anzunähern. Weiterführende Literaturangaben<br />
und eine Auswahlbibliographie<br />
ermöglichen es dem Leser, sein<br />
Wissen weiter zu vertiefen. Hat man<br />
sich mit der sehr durchstrukturierten<br />
Anlage der Darstellung angefreundet,<br />
bietet sich ein umfassender Blick auf<br />
unsere afrikanischen Nachbarn.<br />
hb<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 27
Service<br />
Ausstellungen<br />
• A u g s b u r g<br />
Als Frieden möglich<br />
war – 450 Jahre Augsburger<br />
Religionsfriede<br />
Maximilianmuseum<br />
Augsburg<br />
Philippine-Welser-Straße 24<br />
86150 Augsburg<br />
Telefon: (08 21) 3 24 41 62<br />
Telefax: (08 21) 3 24 41 05<br />
e-mail:<br />
kunstsammlungen.stadt@<br />
augsburg.de<br />
website:<br />
www.augsburgerreligionsfriede.de<br />
Dienstag, Mittwoch, Freitag<br />
9.00 bis 19.00 Uhr<br />
Donnerstag<br />
9.00 bis 21.00 Uhr<br />
Samstag, Sonntag<br />
10.00 bis 19.00 Uhr<br />
Eintritt: 7,00 Euro<br />
ermäßigt 5,50 Euro<br />
16. Juni bis<br />
16. Oktober 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
Zu Fuß ist das Museum<br />
(ausgeschildert) vom<br />
Hauptbahnhof aus in etwa<br />
10 Minuten zu erreichen.<br />
• B e r l i n<br />
Aufstand des Gewissens.<br />
Militärischer Widerstand<br />
gegen das NS-Regime<br />
1933–1945<br />
Luftwaffenmuseum der<br />
Bundeswehr<br />
Groß Glienicker Weg<br />
14089 Berlin-Gatow ð<br />
Telefon: (030) 81 10 76 9<br />
Telefax: (030) 36 43 11 98<br />
e-mail:<br />
info@luftwaffenmuseum.com<br />
website:<br />
www.luftwaffenmuseum.de<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
9.00 bis 17.00 Uhr<br />
(letzter Einlass 16.00 Uhr)<br />
20. September bis<br />
29. November 2005<br />
und noch das gesamte Jahr:<br />
Geschichte der<br />
militärischen<br />
Luftfahrt in<br />
Deutschland<br />
seit 1884<br />
Die Hugenotten<br />
Deutsches Historisches<br />
Museum – PEI Bau<br />
Hinter dem Gießhaus 3<br />
10117 Berlin<br />
Telefon: (030) 20 30 40<br />
Telefax: (030) 20 30 45 43<br />
website: www.dhm.de<br />
Täglich<br />
10.00 bis 18.00 Uhr<br />
24. August bis<br />
21. November 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
S-Bahn: Stationen<br />
»Hackescher Markt« und<br />
»Friedrichstraße«; U-Bahn:<br />
Stationen »Französische<br />
Straße«, »Hausvogteiplatz«<br />
und »Friedrichstraße«; Bus:<br />
Linien 100, 157, 200 und<br />
348 bis zu den Haltestellen<br />
»Staatsoper« oder »Lustgarten«.<br />
• B o n n<br />
Entschieden für Frieden.<br />
50 Jahre Bundeswehr<br />
Stiftung Haus der<br />
Geschichte der<br />
Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
Museumsmeile<br />
Willy-Brandt-Allee 14<br />
53113 Bonn<br />
Telefon: (02 28) 9 16 50<br />
Telefax: (02 28) 9 16 53 02<br />
e-mail: post@hdg.de<br />
Eintritt frei<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
9.00 bis 19.00 Uhr<br />
10. Oktober bis<br />
20. Oktober 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
U-Bahn: Linien U 16, 63,<br />
65 bis Station »Heussallee/<br />
Museumsmeile«; Bus: Linien<br />
610, 630 bis Haltestelle<br />
»Bundeskanzlerplatz/Heussallee«.<br />
Dschingis Khan und seine<br />
Erben – Das Weltreich der<br />
Mongolen<br />
Friedrich-Ebert-Allee 4<br />
53113 Bonn<br />
Telefon: (02 28) 9 17 10<br />
Telefax: (02 28) 9 17 12 09<br />
e-mail:<br />
info@kah-bonn.de<br />
website:<br />
www.bundeskunsthalle.de<br />
Donnerstag<br />
bis Sonntag<br />
10.00 bis<br />
19.00 Uhr<br />
Dienstag u.<br />
Mittwoch<br />
10.00 bis<br />
21.00 Uhr<br />
Montag geschlossen<br />
Eintritt: 7,00 Euro<br />
ermäßigt 3,50 Euro<br />
16. Juni 2005 bis<br />
25. September 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
U-Bahn: U 16, 63, 66 (in<br />
Richtung Regierungsviertel)<br />
bis Haltestelle »Heussallee«.<br />
Die Linie 16 verbindet die ð<br />
Kunst- und Ausstellungshalle<br />
mit dem Wallraf-Richartz-<br />
Museum und dem Museum<br />
Ludwig in Köln (Station<br />
»Dom/Hauptbahnhof«);<br />
Bus: Linien 610 und 630 bis<br />
Haltestelle »Heussallee«.<br />
• C o b u r g<br />
Zwischen Politik<br />
und Krieg. Wehrhafte<br />
Eidgenossen im<br />
16. Jahrhundert<br />
Kunstsammlungen<br />
der Veste Coburg<br />
96450 Coburg<br />
Telefon: (0 95 61) 87 90<br />
Telefax: (0 95 61) 8 79 79<br />
e-mail:<br />
sekretariat@<br />
kunstsammlungen-coburg.de<br />
website:<br />
www.kunstsammlungencoburg.de<br />
April bis Oktober täglich<br />
10.00 bis 17.00 Uhr<br />
November bis März täglich<br />
außer Montag<br />
13.00 bis 16.00 Uhr<br />
Eintritt: 3,30 Euro<br />
ermäßigt 1,80 Euro<br />
7. April bis<br />
2. November 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
Von April bis November wird<br />
die Fahrt mit dem Veste-<br />
Express zur Veste Coburg<br />
empfohlen. (Abfahrt ab<br />
Herrngasse von 9.45 bis<br />
16.45 Uhr alle 30 Min.) Der<br />
Aufstieg zur Veste führt von<br />
der Stadt aus auf verschiedenen<br />
Wegen durch den im<br />
englischen Stil angelegten<br />
Hofgarten.<br />
• D e l i t z s c h<br />
Deutsche Jüdische<br />
Soldaten. Von der Epoche<br />
der Emanzipation bis zum<br />
Zeitalter der Weltkriege<br />
Heeresunteroffizierschule I<br />
Feldwebel-Boldt-Kaserne<br />
Fw-Boldt-Str. 1<br />
04509 Delitzsch<br />
Telefon: (0 34 20) 27 70<br />
Täglich geöffnet, Besuch von<br />
Nichtangehörigen der ð<br />
28<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
Bundeswehr ist nach vorherigerAbsprache<br />
möglich.<br />
1. September bis<br />
2. Dezember 2005<br />
• I n g o l s t a d t<br />
125 Jahre Bayerisches<br />
Armeemuseum –<br />
Neuerwerbungen aus<br />
dem 1. Weltkrieg, der<br />
Weimarer Republik und<br />
dem 2. Weltkrieg<br />
Bayerisches<br />
Armeemuseum – Reduit<br />
Tilly (Klenzepark)<br />
Paradestraße 4<br />
85049 Ingolstadt<br />
Telefon: (08 41) 9 37 70<br />
Telefax: (08 41) 9 37 72 00<br />
e-mail:<br />
sekretariat@bayerischesarmeemuseum<br />
website:<br />
www.bayerischesarmeemuseum.de<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
8.45 bis 16.30 Uhr<br />
15. Juni 2005 bis<br />
6. Januar 2006<br />
Landkarten aus dem<br />
Bayerischen<br />
Armeemuseum – seltene<br />
Karten vom 17. bis<br />
20. Jahrhundert<br />
Bayerisches<br />
Armeemuseum – Neues<br />
Schloss<br />
Paradeplatz 4<br />
85049 Ingolstadt<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
8.45 bis 16.30 Uhr<br />
7. Juli 2005 bis<br />
26. März 2006<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
Öffentliche Verkehrsmittel bis<br />
Reduit Tilly; PKW: Parkmöglichkeiten<br />
in der Tillygarage.<br />
• K o n s t a n z<br />
Im Schutze mächtiger<br />
Mauern. Das spätrömische<br />
Kastell von Konstanz und<br />
sein Umfeld<br />
Archäologisches<br />
Landesmuseum Konstanz<br />
Benediktinerplatz 5<br />
78467 Konstanz ð<br />
Telefon: (0 75 31) 9 80 40<br />
Telefax: (0 75 31) 6 84 52<br />
e-mail:<br />
info@konstanz.alm-bw.de<br />
website:<br />
www.konstanz.alm-bw.de<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
10.00 bis 18.00 Uhr<br />
Eintritt: 4,00 Euro<br />
ermäßigt: 3,00 Euro<br />
30. April bis<br />
1. November 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
Alle Konstanzer Stadtbusse<br />
halten direkt vor dem<br />
Landesmuseum, Haltestelle<br />
»Sternenplatz«.<br />
• K ö n i g s<br />
W u s t e r h a u s e n<br />
Lange Kerls. Muster,<br />
Mythos oder Maskerade<br />
Schloss Königs<br />
Wusterhausen<br />
Schlossplatz 1<br />
15711 Königs Wusterhausen<br />
Telefon: (0 33 75) 21 17 00<br />
Telefax: (0 33 75) 21 17 02<br />
e-mail: e.preisse@spsg.de<br />
website:<br />
www.lange-kerls-kw.de<br />
Täglich außer Montag von<br />
10.00 bis 18.00 Uhr<br />
Eintritt: 6,00 Euro<br />
ermäßigt 5,00 Euro<br />
3. Juli bis 3. Oktober 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
S-Bahn/Regionalbahn: Von<br />
Berlin oder Potsdam mit S 7<br />
bis »Westkreuz«, dann mit<br />
S 46 bis Königs Wusterhausen<br />
oder R 2 ab Berlin Zoo oder<br />
Ostbahnhof – vom Bahnhof<br />
sind es 10 Min. Fußweg durch<br />
die Bahnhofstraße bis zum<br />
Ende, dann rechts abbiegen. ð<br />
PKW: B179 oder A10 Abfahrt<br />
»Königs Wusterhausen«.<br />
• L ü n e b u r g<br />
Germania auf dem Meere.<br />
Bilder und Dokumente<br />
zur deutschen Marinegeschichte<br />
1848 bis 1998<br />
Museum für das<br />
Fürstentum Lüneburg<br />
Wandrahm Straße 10<br />
21337 Lüneburg<br />
Telefon: (0 41 31) 4 38 91<br />
Telefax: (0 41 31) 40 54 97<br />
e-mail: info@museumlueneburg.de<br />
Dienstag bis Freitag<br />
10.00 bis 16.00 Uhr<br />
Samstag bis Sonntag<br />
11.00 bis 17.00 Uhr<br />
Eintritt: 2,60 Euro<br />
ermäßigt 1,30 Euro<br />
4. September bis<br />
1. November 2005<br />
Verkehrsanbindungen:<br />
Das Museum befindet sich in<br />
der Nähe der Nordlandhalle<br />
und des Hauptbahnhofs.<br />
• M u n s t e r<br />
Das Eiserne Kreuz<br />
Deutsches<br />
Panzermuseum Munster<br />
Hans-Krüger-Str. 33<br />
29633 Munster<br />
Telefon: (0 51 92) 25 52<br />
Telefax: (0 51 92) 13 02 15<br />
website:<br />
panzermuseum@munster.de<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
10.00 bis 18.00 Uhr<br />
Eintritt: 5,00 Euro ð<br />
ermäßigt 2,50 Euro<br />
1. September bis<br />
30. November 2005<br />
• N e u b u r g<br />
a.d. D o n a u<br />
Von Kaisers Gnaden!<br />
500 Jahre Pfalz Neuburg<br />
Schloss Neuburg an<br />
der Donau<br />
Telefon: (0 84 31) 64 43 12<br />
Telefax: (0 84 31) 64 43 43<br />
e-mail:<br />
landesausstellung.neuburg@<br />
bsv.bayern.de<br />
website: www.hdbg.de<br />
Täglich von<br />
9.00 bis 18.00 Uhr<br />
Eintritt: 6,00 Euro<br />
ermäßigt 4,00 Euro<br />
3. Juni bis 16. Oktober 2005<br />
• S a l z b u r g<br />
Schiff voraus – Marinemalerei<br />
des 14. bis<br />
19. Jahrhunderts<br />
Residenzgalerie Salzburg<br />
Residenzplatz 1<br />
A-5010 Salzburg<br />
Telefon: +43 (662) 8 40 45 10<br />
Telefax: +43 (662) 84 04<br />
51 16<br />
e-mail::<br />
residenzgalerie@salzburg.gv.at<br />
website:<br />
www.residenzgalerie.at<br />
Dienstag bis Sonntag<br />
10.00 bis 17.00 Uhr<br />
Eintritt: 6,00 Euro<br />
ermäßigt 5,00 Euro<br />
16. Juli bis<br />
1. November 2005<br />
Richard Göbelt<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 29
Service<br />
Geschichte kompakt<br />
27. Juni 1955<br />
5 Beamte der Wehrverwaltung<br />
Bonn, um 1960<br />
20. August 1985<br />
Regierungserklärung zur Wehrverwaltung<br />
SKA/IMZBw/Hoffmann/07.08.1985 SKA/IMZBw/Altarchiv<br />
Das war neu in der deutschen Militärgeschichte.<br />
Mit der Gründung der Bundeswehr<br />
sollte auch eine strikte Trennung von militärischer<br />
Kommandogewalt und ziviler Wehrverwaltung<br />
eingeführt werden. Seit Aufstellung<br />
der stehenden Heere in der frühen Neuzeit, wo<br />
der Kompaniechef eigenverantwortlich wirtschaften<br />
musste, bis zu den Massenheeren des<br />
20. Jahrhunderts blieben immer Teile der Verwaltung<br />
unter dem Befehl eines Soldaten. Mit<br />
der Gründung der Bundeswehr war damit<br />
Schluss. Die Konzeption dieser neuen Form<br />
der Bundeswehrverwaltung wurde in einer Regierungserklärung schon am<br />
27. Juni 1955 der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Neben Personal- und Besoldungswesen,<br />
Haushalt, Dienstzeitversorgung, Berufsförderung und sozialer<br />
Betreuung wurde im Kern folgende Aufgabe beschrieben: »Lieferung der persönlichen<br />
und sachlichen Mittel für die Aufstellung, Ergänzung, Unterhaltung<br />
und Versorgung der Streitkräfte und der ihnen dienenden Einrichtungen«. Im<br />
Oktober 1955 richtete man sechs Arbeitsgruppen ein, die den Kern der neuen<br />
Wehrbereichsverwaltungen in Kiel, Hannover, Düsseldorf, Wiesbaden, Stuttgart<br />
und München bildeten. Das Prinzip der vom militärischen Befehl unabhängigen<br />
Wehrverwaltung wurde im März 1956 im Artikel 87b des Grundgesetzes<br />
verankert. Das in der konsequenten Trennung der Bereiche seltene Prinzip<br />
führte in der Folgezeit zu einer nicht immer spannungsfreien, aber letztlich<br />
wohl effektivsten Form der Unterstützung des rasanten Aufwuches der Bundeswehr<br />
im Kalten Krieg.<br />
hb<br />
Vorläufiges Ende der Einsätze der<br />
Luftwaffe im Sudan und in Äthiopien<br />
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium<br />
der Verteidigung, Peter Kurt<br />
Würzbach, legte am 20. August 1985 eine Bilanz<br />
des Hilfseinsatzes der Luftwaffe in den Hungergebieten<br />
Äthiopiens und des Sudan vor und<br />
versicherte, die Bundeswehr werde sich auch<br />
künftig »der humanitären Herausforderung<br />
weltweit stellen«. Vor Einsetzen der Regenzeit<br />
endete am 31. September 1985 der Einsatz der<br />
Bundeswehr in diesen Krisengebieten.<br />
Seit November 1984 hatte die deutsche Luftwaffe mit Transall- und Boeing<br />
707-Flugzeugen der drei Lufttransportgeschwader aus Hohn, Wunstorf und<br />
Landsberg in so genannten Shuttle-Einsätzen große Mengen an Hilfsgütern in<br />
das äthiopische Landesinnere gebracht (s. Foto). Über 10 000 Tonnen Hilfsgüter<br />
sind in diesen Monaten in 1109 Einsätzen in den Norden Äthiopiens geflogen<br />
worden.<br />
Seit Mai 1985 wurden auch Maschinen gestartet, die Hungerregionen im<br />
Sudan mit Nahrungsmitteln versorgten. In 7428 Einsätzen wurden insgesamt<br />
3675 Tonnen Fracht – hauptsächlich Nahrungsmittel und Medikamente – in<br />
den Sudan transportiert. Aber auch deutsche Soldaten waren vor Ort als Fachausbilder<br />
für angehende Auto- und Fernmeldemechaniker, als Fahrlehrer und<br />
als Berater im Sanitätswesen eingesetzt. Damit wurden allein in Khartoum,<br />
der Hauptstadt des Sudan, 300 neue Ausbildungsplätze geschaffen.<br />
Die Soldaten der Bundeswehr leisteten mit ihrem Einsatz für die von Hungersnot<br />
und Dürre geplagten Völkern Afrikas »praktischen Friedensdienst<br />
im Sinne des Entwicklungsdienstes ergänzender Art«, so der Parlamentarische<br />
Staatssekretär Würzbach. Die Hilfsaktion war Bestandteil eines Programmes<br />
der Bundesregierung, mit dem insbesondere Infrastrukturmängel im Verkehrs-<br />
und Fernmeldebereich weniger entwickelter Länder gemildert werden<br />
sollen. 165 Millionen DM fanden sich dafür im Verteidigungshaushalt für<br />
einen Dreijahreszeitraum zwischen 1984 und 1987. Die Kosten des zehnmonatigen<br />
Dauereinsatzes in Äthiopien und im Sudan betrugen 54 Millionen DM.<br />
Richard Göbelt<br />
Heft 4/2005<br />
Militärgeschichte<br />
<strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung<br />
Atomwaffen sind im aktuellen Kampf gegen den<br />
Terrorismus kaum anwendbar, stellen also keine<br />
Option für den militärischen Einsatz dar. Anders<br />
vor 50 Jahren. Da waren sie das wirksame Drohpotential<br />
im Kalten Krieg zwischen dem Warschauer<br />
Pakt und der NATO. Und dass man nicht<br />
nur drohte, sondern zum Einsatz auch stets bereit<br />
war, gehörte zum Funktionieren des »Gleichgewichts<br />
des Schreckens«. Nach den USA, die<br />
mit den Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki<br />
Atomwaffen zum ersten Mal und bislang einzigen<br />
Mal 1945 eingesetzt hatten, wurden mit<br />
der Sowjetunion 1949, Großbritannien 1952 und<br />
Frankreich 1960 europäische Staaten neue »Atommächte«.<br />
China, Indien, Pakistan und vermutlich<br />
Israel folgten.<br />
5 Otto Hahn vor einem Atommodell<br />
(Genfer Konferenz über Atomenergie, August 1955)<br />
Die nächste Ausgabe der Militärgeschichte<br />
befasst sich unter anderem mit dem Thema der<br />
westeuropäischen Verteidigungsstrategien am<br />
Beginn der 1950er Jahre. Das Risiko der nuklearen<br />
Vernichtung sollte nicht kalkulierbar sein.<br />
So wollte man potenzielle Angreifer von einem<br />
Waffengang abschrecken. Besonders die europäischen<br />
Partner der USA, allen voran die Bundesrepublik<br />
Deutschland, hatten ein Interesse am<br />
Funktionieren des Prinzips der Abschreckung<br />
auf der einen und der Abwendung eines Atomkrieges<br />
in Europa auf der anderen Seite. Der<br />
Schlüssel dazu waren glaubhafte Konzepte einer<br />
konventionellen Verteidigung und einer schnellen<br />
Reaktion auf einen sowjetischen Angriff.<br />
Ohne einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag<br />
war eine erfolgreiche Verteidigung des Westens<br />
nicht möglich. Zugleich war die Mitwirkung<br />
an der westeuropäischen Verteidigung von der<br />
Bundesrepublik nur zu erreichen, wenn sie als<br />
gleichberechtigter Partner in die NATO aufgenommen<br />
würde und die Bevölkerung der Bundesrepublik<br />
zumindest in den strategischen Planungen<br />
eine Überlebenschance hätte.<br />
Dass es gerade wegen der nuklearen Bedrohung<br />
diese Chance geben könnte, war damals<br />
auch den Zeitgenossen klar. Der deutsche Entdecker<br />
der Kernspaltung Otto Hahn (1879–1968)<br />
bemerkte dazu nüchtern: »Solange die Atombombe<br />
sich nur in Händen der beiden Großmächte<br />
befindet, gibt es keinen Krieg. Gefährlich<br />
wird es erst, wenn sich jeder das dazu notwendige<br />
Plutonium aus der Drogerie holen kann.« hb<br />
akg-images/AP<br />
30<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005
Militärgeschichte im Bild<br />
12. November 1955<br />
Bonn, Ermekeilkaserne<br />
Der umstrittene Geburtstag<br />
der Bundeswehr<br />
Am 12. November 1955, dem 200 Geburtstag<br />
4<br />
von General v. Scharnhorst werden die ersten<br />
Ernennungsurkunden überreicht<br />
Bundespresseamt/Altarchiv SKA/IMZ<br />
Am Vormittag des 12. November<br />
1955 versammelten sich<br />
in der Kraftfahrzeughalle der<br />
Bonner Ermekeilkaserne 101 Mitarbeiter<br />
des im Sommer eingerichteten Verteidigungsministeriums,<br />
um aus der<br />
Hand ihres Ministers als erste westdeutsche<br />
Soldaten ihre Ernennungsurkunden<br />
zu empfangen. Der Akt<br />
hatte über 50 Vertreter der Medien<br />
mobilisiert. Aus der Tageszeitung Die<br />
Welt war zwei Tage später zu entnehmen,<br />
dass dies »Die Geburtsstunde<br />
der neuen Streitkräfte« gewesen sei.<br />
Von seinem Bundeskanzler Konrad<br />
Adenauer sollte sich der verantwortliche<br />
Ressortchef Theodor Blank dafür<br />
allerdings den Rüffel einhandeln, dass<br />
zumindest zu erwarten gewesen wäre,<br />
»wenn alle schon Uniformen gehabt<br />
hätten, und wenn zum Schluss der<br />
Feier das Deutschlandlied gespielt<br />
worden wäre«. Mit »Missstimmung<br />
und Verärgerung« reagierte man auch<br />
in der militärischen Abteilung des<br />
Ministeriums auf diese reine »Schaunummer<br />
für die Presse«. Ihr Diensttagebuch<br />
verzeichnete deshalb die<br />
Versicherung des Abteilungsleiters,<br />
des späteren Generalinspekteurs Adolf<br />
Heusinger, dass diese ausgesprochen<br />
unterkühlte Zeremonie nicht als<br />
»Geburtsstunde neuer Wehrmacht anzusehen«<br />
sei. Das werde erst dem 2.<br />
Januar 1956, dem Tag des Zusammentretens<br />
der Lehrkompanien in Andernach<br />
(Heer), Nörvenich (Luftwaffe)<br />
und Wilhelmshaven (Marine) vorbehalten<br />
bleiben.<br />
Wozu dann diese Eile jetzt im Herbst<br />
1955? Die Antwort lag in der Wahrnehmung<br />
eines nur langsam in Gang kommenden<br />
Streitkräfteaufbaus von Seiten<br />
der NATO. Die Bundesrepublik war<br />
seit Mai Allianzmitglied, ohne dass<br />
seither Vorzeigbares an militärischer<br />
Umsetzung erkennbar geworden wäre.<br />
Adenauers Moskaureise im September<br />
schien im Gegenteil darauf hinzudeuten,<br />
dass die Bundesregierung nur<br />
schnell dabei war, die politischen Vorzüge<br />
aus ihren gewonnenen internationalen<br />
Spielräumen zu nutzen. Aus<br />
Fontainebleau bei Paris meldete der<br />
erste Nationale Militärische Vertreter,<br />
Oberst Graf Kielmansegg, besorgt, dass<br />
man bei SHAPE (Oberkommando der<br />
Alliierten Streitkräfte in Europa) den<br />
Eindruck habe, die Deutschen hätten<br />
es nicht eilig, nun auch ihre militärischen<br />
Verpflichtungen zu erfüllen. Er<br />
warnte: »Das Interesse an uns nimmt<br />
ab, weil das Vertrauen in uns schwindet.«<br />
Wollte man dem gegensteuern, musste<br />
man zumindest ein symbolisches<br />
Signal setzen. Schon am 8. November<br />
war deshalb die Entscheidung gefallen:<br />
»Am 12.11.1955 ist 200. Geburtstag<br />
von Scharnhorst. Dann sollen die<br />
ersten Ernennungsurkunden an Soldaten<br />
übergeben werden.« Auf die<br />
Tradition stiftende Rolle des preußischen<br />
Heeresreformers hatten schon<br />
Monate zuvor der von der Notwendigkeit<br />
grundlegender Reformen überzeugte<br />
Major a.D. Wolf Graf Baudissin<br />
und vor allem Bundespräsident Theodor<br />
Heuss hingewiesen. Wie nach<br />
der preußischen Niederlage von 1806<br />
musste es auch jetzt nach der noch weit<br />
einschneidenderen militärischen Katastrophe<br />
von 1945 darauf ankommen,<br />
einen neuen Soldatentyp zu schaffen,<br />
der militärische und staatsbürgerliche<br />
Rollen zu vereinen verstand.<br />
Vor diesem Hintergrund lasen sich<br />
denn auch die Nachbetrachtungen zum<br />
schmucklosen Auftreten in der Ermekeilkaserne<br />
durchaus differenzierter. In<br />
der schon zitierten Zeitung Die Welt<br />
spiegelte sich ganz der Unmut des<br />
Kanzlers über eine wenig eindrucksvolle<br />
»Verpflichtung ohne Hymne und<br />
Musik« wieder. Von den anwesenden<br />
Soldaten verfügten gerade einmal 12<br />
Offiziere über Uniformen; der Rest präsentierte<br />
sich in Zivil. Genau diese<br />
sehr zurückgenommene Inszenierung<br />
bewertete die Frankfurter Rundschau<br />
aber als »erfreulich zivil«. Und auch<br />
unter den militärischen Kritikern fand<br />
sich bei aller Missstimmung immerhin<br />
»der Gehalt der Rede Blanks« als<br />
»erfreulich« gewürdigt. Wenn er den<br />
Neuanfang unter das Motto stellte,<br />
»aus den Trümmern des Alten wirklich<br />
etwas Neues wachsen [zu lassen],<br />
das unserer veränderten sozialen, politischen<br />
und geistigen Situation gerecht<br />
wird«, dann nahm er vor aller Öffentlichkeit<br />
das Signal notwendiger innermilitärischer<br />
Reformen als Voraussetzung<br />
für die Integration der neuen<br />
Streitkräfte in Staat und Gesellschaft<br />
der zweiten deutschen Republik auf.<br />
Stellt man diesen Ansatz in den<br />
Mittelpunkt der Überlegungen über<br />
den »Gründungstag« der Bundeswehr,<br />
dann ist der 12. November 1955 als<br />
Anlass mit Zukunft gewählt.<br />
Bruno Thoß<br />
Militärgeschichte · <strong>Zeitschrift</strong> für historische Bildung · Ausgabe 3/2005 31
NEUE PUBLIKATIONEN DES MGFA<br />
4<br />
4<br />
4<br />
Manfred Messerschmidt,<br />
Die Wehrmachtjustiz 1933 bis 1945.<br />
Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt,<br />
Paderborn: Schöningh 2005, XIV, 512 S., 39,90 Euro,<br />
ISBN 3-506-71349-3<br />
Entschieden für Frieden: 50 Jahre Bundeswehr 1955 bis 2005.<br />
Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
herausgegeben von Klaus-Jürgen Bremm, Hans-Hubertus Mack<br />
und Martin Rink, Freiburg i.Br.: Rombach Verlag 2005,<br />
VIII, 672 S., 38 Euro, ISBN 3-7930-9438-3<br />
Wegweiser zur Geschichte. Bosnien-Herzegowina.<br />
Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
herausgegeben von Agilolf Keßelring, Paderborn: Ferdinand<br />
Schöningh 2005, 168 S. , 9,90 Euro, ISBN 3-506-72976-4<br />
4<br />
Klaus-Jürgen Bremm,<br />
Von der Chaussee zur Schiene.<br />
Militärstrategie und Eisenbahnen in Preußen von 1833 bis zum<br />
Feldzug von 1866, München: Oldenbourg 2005, XII, 295 S.<br />
(= Militärgeschichtliche Studien, 40), 24,80 Euro,<br />
ISBN 3-486-57590-2<br />
4<br />
4<br />
Bernd Lemke,<br />
Luftschutz in Großbritannien und Deutschland 1923 bis 1939.<br />
Zivile Kriegsvorbereitungen als Ausdruck der staats- und<br />
gesellschaftspolitischen Grundlagen von Demokratie und<br />
Diktatur, München: Oldenbourg 2005, X, 524 S.<br />
(= Militärgeschichtliche Studien, 39), 44,80 Euro,<br />
ISBN 3-486-57591-0<br />
Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 bis 1945.<br />
Erster Halbband: Politisierung, Vernichtung, Überleben. Zweiter<br />
Halbband: Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung. Im Auftrag<br />
des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes herausgegeben von<br />
Jörg Echternkamp, München: Deutsche Verlags-Anstalt 2004,<br />
Erster Halbband: XIV, 993 S., 49,80 Euro,<br />
ISBN 3-421-06236-6;<br />
Zweiter Halbband: XIII, 1112 S,49,80 Euro,<br />
ISBN 3-421-06528-4<br />
(= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, 9/1 und 9/2)