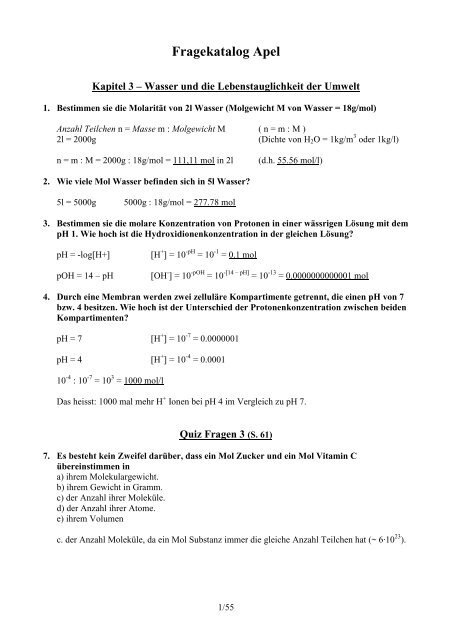Fragekatalog Apel Lösungen 3
Fragekatalog Apel Lösungen 3
Fragekatalog Apel Lösungen 3
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fragekatalog</strong> <strong>Apel</strong><br />
Kapitel 3 – Wasser und die Lebenstauglichkeit der Umwelt<br />
1. Bestimmen sie die Molarität von 2l Wasser (Molgewicht M von Wasser = 18g/mol)<br />
Anzahl Teilchen n = Masse m : Molgewicht M ( n = m : M )<br />
2l = 2000g (Dichte von H2O = 1kg/m 3 oder 1kg/l)<br />
n = m : M = 2000g : 18g/mol = 111,11 mol in 2l (d.h. 55.56 mol/l)<br />
2. Wie viele Mol Wasser befinden sich in 5l Wasser?<br />
5l = 5000g 5000g : 18g/mol = 277.78 mol<br />
3. Bestimmen sie die molare Konzentration von Protonen in einer wässrigen Lösung mit dem<br />
pH 1. Wie hoch ist die Hydroxidionenkonzentration in der gleichen Lösung?<br />
pH = -log[H+] [H + ] = 10 -pH = 10 -1 = 0.1 mol<br />
pOH = 14 – pH [OH - ] = 10 -pOH = 10 -[14 – pH] = 10 -13 = 0.0000000000001 mol<br />
4. Durch eine Membran werden zwei zelluläre Kompartimente getrennt, die einen pH von 7<br />
bzw. 4 besitzen. Wie hoch ist der Unterschied der Protonenkonzentration zwischen beiden<br />
Kompartimenten?<br />
pH = 7 [H + ] = 10 -7 = 0.0000001<br />
pH = 4 [H + ] = 10 -4 = 0.0001<br />
10 -4 : 10 -7 = 10 3 = 1000 mol/l<br />
Das heisst: 1000 mal mehr H + Ionen bei pH 4 im Vergleich zu pH 7.<br />
Quiz Fragen 3 (S. 61)<br />
7. Es besteht kein Zweifel darüber, dass ein Mol Zucker und ein Mol Vitamin C<br />
übereinstimmen in<br />
a) ihrem Molekulargewicht.<br />
b) ihrem Gewicht in Gramm.<br />
c) der Anzahl ihrer Moleküle.<br />
d) der Anzahl ihrer Atome.<br />
e) ihrem Volumen<br />
c. der Anzahl Moleküle, da ein Mol Substanz immer die gleiche Anzahl Teilchen hat (~ 6·10 23 ).<br />
1/55
8. Wie viel Gramm Essigsäure (C2H4O2) muss man nehmen um zehn Liter einer 0.1 mol/l<br />
wässrigen Essigsäurelösung herzustellen? (Beachten sie: Das Atomgewicht beträgt für<br />
Kohlenstoff etwa 12, für Wasser 1 und für Sauerstoff 16.)<br />
a) 10g<br />
b) 0.1 g<br />
c) 6 g<br />
d) 60 g<br />
e) 0.6 g<br />
d. 60 g<br />
Molgewicht der Essigsäure M [C2H4O2] = 2·12 + 4·1 + 2·16 = 60g/mol<br />
mit n = c·V und n = m : M<br />
m = c·V·M = 0.1 mol/l · 10l · 60g/mol = 60g<br />
9. Durch sauren Niederschlag ist der pH-Wert eines bestimmten Sees auf 4.0 abgesunken.<br />
Wie hoch ist die Protonenkonzentration des Sees?<br />
a) 4.0 mol/l<br />
b) 10 -10 mol/l<br />
c) 10 -4 mol/l<br />
d) 10 -14 mol/l<br />
e) 4%<br />
c. 10 -4 mol/l, da [H + ] = 10 -pH<br />
10. Wie hoch ist die Hydroxidionenkonzentration des in Frage 9 erwähnten Sees?<br />
a) 10 -7 mol/l<br />
b) 10 -4 mol/l<br />
c) 10 -10 mol/l<br />
d) 10 -14 mol/l<br />
e) 10 mol/l<br />
c. 10 -10 mol/l, da [OH - -[14 – pH]<br />
] = 10<br />
Kapitel 7 – Ein Rundgang durch die Zelle<br />
1. Nenne Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen.<br />
Prokaryoten Eukaryoten<br />
Typisch für Organismen der Domänen Archaea<br />
und Bacteria<br />
2/55<br />
Typisch für Vertreter der Domäne Eukarya<br />
(Protisten, Pflanzen, Pilze und Tiere)<br />
Klein (Ø 0.1-10 μm Durchmesser) Gross (Ø 10-100 μm Durchmesser)<br />
Einfacher Aufbau (selten Vielzellig) Komplexer Aufbau (häufig Vielzellig)<br />
Kein Zellkern, DNA liegt im Nucleoid<br />
(Kernäquivalent: Bereich ohne abschliessende<br />
Membran, in dem sich das genetische Material<br />
konzentriert) → bestimmte Strukturen fehlen:<br />
- Kein Spindelapparat<br />
- Keine Nucleoli<br />
- Keine Zellkernteilung (Mitose/Meiose)<br />
Zellkern, der durch eine Membran (Kernhülle)<br />
vom Rest der Zelle abgeschlossen ist und die<br />
Chromosomen beinhaltet<br />
- Spindelapparat für die Zellkernteilung<br />
- Nucleoli (Kernkörperchen: Bildung von rRNA)<br />
- Mitose/Meiose
Die meisten Organellen der eukaryotischen<br />
Zelle kommen nicht vor (inneres<br />
Membransystem fehlt)<br />
Ausserdem gibt es keine membranumhüllten<br />
Organellen<br />
Besitzen meist nur ein einzelnes grosses,<br />
zirkuläres „Chromosom“<br />
(Bakterienchromosom)<br />
Fehlen von Histonen (Proteine zur<br />
„Komprimierung“ der DNA)<br />
Häufiges Vorhandensein kleinerer vom<br />
Chromosom unabhängiger DNA-Ringe (so<br />
genannte Plasmide, die einige, wenige Gene<br />
beinhalten)<br />
Kleinere 70 S-Ribosomen 80 S-Ribosomen<br />
3/55<br />
Endomembransystem bestehend aus<br />
Plasmamembran, Kernhülle, ER, Golgi-Apparat,<br />
Lysosomen, Vakuolen und Vesikel<br />
Membranumhüllte Organellen mit spezialisierter<br />
Form und Funktion (z.B Mitochondrien,<br />
Chloroplasten etc.)<br />
Mehrere Chromosomen vorhanden (lineare<br />
Doppelhelix)<br />
Anlagerung der chromosomalen DNA an<br />
Histone (geringerer Platzverbrauch)<br />
Nur in ganz wenigen Fällen kommen Plasmide<br />
bei Eukaryoten vor<br />
Keine Kompartimentierung Kompartimentierung der Zelle, sodass<br />
verschiedene Reaktionen, die sich ansonsten<br />
nicht vertragen, gleichzeitig ablaufen können<br />
Praktisch kein Membranfluss (Transport<br />
zwischen den einzelnen Organellen über<br />
Vesikel)<br />
Kein Cytoskelett (besitzen wahrscheinlich<br />
jedoch eine ähnliche Struktur)<br />
Die verschiedenen Kompartimente stehen über<br />
Vesikel miteinander in Verbindung<br />
Cytoskelett, verantwortlich für die<br />
Cytoplasmaströmung (pflanzliche Zellen)<br />
Ungeschlechtliche Vermehrung (asexuell) Geschlechtliche oder ungeschlechtliche<br />
Fortpflanzung (je nach Art)<br />
2. Warum sind Zellen mikroskopisch klein?<br />
Die Oberfläche muss im Verhältnis zum Volumen genügend gross sein, um den<br />
Stoffaustausch (Atemgase, Nährstoffe und Abfallstoffe) über die Plasmamembran zu<br />
bewerkstelligen. Ein zu grosses Volumen würde Stoffmengen zum Austausch bereitstellen, die<br />
von der kleinen Oberfläche nicht schnell genug ausgetauscht werden könnten. Deshalb besitzen<br />
grössere Organismenarten in der Regel keine grösseren, sondern mehr Zellen als kleinere<br />
Lebewesen.<br />
Anmerkung: Das Volumen bei kugelförmigen Objekten nimmt im Vergleich zur Oberfläche<br />
viel schneller zu. Dies liegt daran, dass bei einem Wachstum (eine Vergrösserung des<br />
Durchmessers und somit des Radius) die Oberfläche quadratisch zunimmt (O = 4πr 2 ), während<br />
hingegen das Volumen mit der dritten Potenz ansteigt (V = 4 /3πr 3 ) → das Verhältnis ist besser<br />
umso kleiner die Objekte sind.<br />
3. Beschreibe den Aufbau und die Funktion der Plasmamembran.<br />
Die Plasmamembran besteht aus einer Phospholipiddoppelschicht, in die eine Vielfalt von<br />
Proteinen ein- oder angelagert ist. Die Doppelschicht entsteht, weil Phospholipide<br />
amphipathisch sind, d.h. sie bestehen aus einem hydrophoben Teil (den vom Wasser<br />
abgewandten Phospholipidschwänzen) und einem hydrophilen Teil (den Köpfen der
Phospholipide und Proteinen), der dem Wasser zugewandt ist. An der Aussenseite der Membran<br />
sind zusätzlich Kohlenhydrate angeheftet, die eine wichtige Rolle in der Zell-Zell-Erkennung<br />
spielen.<br />
Die Membran ist nicht starr, denn die Proteine und Lipide sind ständig in Bewegung (Drehung<br />
um die eigene Achse oder Seitwärtsdrift). Je höher die Temperatur, desto beweglicher ist die<br />
Membran.<br />
Die Plasmamembran grenzt die Zelle gegen Aussen ab (hält inneres Milieu aufrecht) und lässt<br />
nur bestimmte Stoffe passieren - selektive Barriere (Permeabilität). Sie steuert somit den<br />
Stoffaustausch zwischen Zelle und Umgebung. Welche Funktionen die Plasmamembran erfüllt<br />
hängt von der Art ihrer Phospholipide, Proteine und Kohlenhydrate ab.<br />
4. Nenne die Zusammensetzung und Funktion des Endomembransystems.<br />
Das Endomembransystem besteht aus den folgenden verschiedenen Membranen:<br />
− Kernhülle<br />
− endoplasmatisches Retikulum (glattes/raues ER)<br />
− Golgi-Apparat<br />
− Lysosomen<br />
− verschiedenartigen Vakuolen<br />
− Vesikel<br />
− Plasmamembran (keine eigentliche innere Membran, aber über Vesikel in Verbindung<br />
stehend mit ER und anderen Membranen)<br />
Diese sind entweder unmittelbar miteinander verbunden oder es erfolgt ein Austausch via<br />
Vesikel (winzige membranumhüllte Bläschen). Die verschiedenen inneren Membranen gleichen<br />
sich jedoch trotz Vernetzung nicht in Form und Funktion. Beispielsweise sind Dicke,<br />
molekulare Zusammensetzung, sowie Stoffwechselfunktion einer Membran nicht festgelegt,<br />
sondern können sich im Laufe ihrer Existenz mehrfach ändern. Dies macht das innere<br />
Membransystem zu einem komplexen, dynamischen Bestandteil der Kompartimentierung.<br />
Glattes ER: Wirkt bei vielfältigen Stoffwechselvorgängen mit, unter anderem beim<br />
Kohlenhydratstoffwechsel und bei der Beseitigung von Giften und Arzneimitteln. Einige seiner<br />
Enzyme sind wichtig für die Synthese von Fettsäuren, Phospholipiden, Steroiden (wie den<br />
Geschlechtshormonen) und anderen Lipiden. Das glatte ER steuert ausserdem die<br />
Kalziumioneneinlagerung bei Muskelzellen.<br />
Raues ER: Zu den Funktionen des rauen ERs gehört die Proteinsynthese (durch die an ihm<br />
haftenden Ribosomen) und die Membranproduktion.<br />
Golgi-Apparat: Hier werden die Produkte des ER abgewandelt, gespeichert und dann zu<br />
anderen Bestimmungsorten weiterbefördert (Fertigungs-, Lager, Sortierungs- und<br />
Versandzentrale). Einige Makromoleküle werden hier aber auch selber erzeugt (unter anderem<br />
viele der von der Zelle ausgeschiedenen Polysaccharide). Cis-Seite = Empfang (konvex), trans-<br />
Seite = Versand (konkav).<br />
Lysosomen: Dienen zur intrazellulären Verdauung von Makromolekülen (Magen und Mülleimer<br />
der Zelle). Beinhalten Enzyme für die Hydrolyse von Proteinen, Polysacchariden, Fetten und<br />
Nucleinsäuren (findet in saurem Milieu bei ungefähr pH 5 statt).<br />
Vakuolen: Entsprechen Vesikeln, sind jedoch um einiges grösser.<br />
Nahrungsvakuolen entstehen durch Phagozytose (umschliessen von Substratteilchen und<br />
verschmelzen mit einem Lysosom zur Verdauung).<br />
4/55
Kontraktile Vakuolen haben die Aufgabe überschüssiges Wasser aus der Zelle zu pumpen.<br />
Zentrale Vakuolen (oder Zellsaftvakuolen) kommen in Pflanzen vor und dienen der<br />
Speicherung von organischen Verbindungen, als Reservoir für anorganische Ionen, als<br />
Ablagerungsort schädlicher Stoffwechselprodukte und haben zusätzlich die<br />
Verdauungsfunktion wie die Lysosomen bei Tieren. Sie können auch Pigmente an lagern und<br />
so Tiere zur Bestäubung anlocken oder giftige und ungeniessbare Stoffe zum Schutz vor<br />
Tierfrass beinhalten.<br />
Vesikel: Verteilen Produkte des ER, Transport zwischen den Zisternen des Golgi-Apparats und<br />
Abtransport vom selben weg.<br />
5. Was sind cis- und trans-Zisternen des Golgi-Apparats, welche Rolle spielen sie?<br />
Der Golgi-Apparat besitzt eine eindeutige Polarität, d.h. seine Zisternen an der konvexen und<br />
konkaven Seite unterscheiden sich deutlich in Struktur und Funktion.<br />
Die cis-Seite ist konvex, die trans-Seite konkav. In der Regel ist die cis-Seite dem ER und<br />
Zellkern zugewandt. Sie nimmt die Substanzen auf (Transportvesikel verschmelzen mit der<br />
Membran des Golgi-Apparats), welche dann den Golgi-Apparat an der zur Plasmamembran<br />
zeigenden trans-Seite wieder verlassen (schnürt Transportvesikel ab und kennzeichnet sie für<br />
die verschiedenen Bestimmungsorte in der Zelle).<br />
Die Substanzen werden auf dem Weg von der cis- zur trans-Seite oft chemisch abgewandelt und<br />
gespeichert bevor sie wieder in Vesikel verpackt ins Cytosol (Zellplasma) gelangen. Diese<br />
Abwandlung verläuft in mehreren Stufen in den verschiedenen Zisternen, die unterschiedliche<br />
Enzymgemische enthalten. Die Zisternen verbinden also den Golgi-Apparat mit dem restlichen<br />
Endomembransystem und erlauben so den Stoffaustausch zwischen Organellen der Zelle.<br />
6. Nenne Aufgabe und Besonderheiten des Lysosoms.<br />
Lysosomen sind Membransäcke, die hydrolytische Enzyme zur Verdauung von<br />
Makromolekülen wie Proteinen, Säuren und Polysacchariden enthalten.<br />
Für diese Verdauung pumpen die H + -Membranpumpen der Lysosomen H + -Ionen ins Innere und<br />
schaffen so einen pH-Wert von 5 (Enzyme arbeiten am effizientesten, bei pH 7 im Cytosol<br />
wären sie praktisch wirkungslos). Die noch inaktiven Enzyme der Lysosomen werden vom<br />
rauen ER gebildet und in Transportvesikel zum Golgi-Apparat geschickt, wo sie aktiviert<br />
werden bevor sie ihre Arbeit in den Lysosomen verrichten können.<br />
Wird ein einzelnes Lysosom beschädigt und gibt seinen Inhalt ins Cytoplasma entsteht somit<br />
kein grösserer Schaden für die Zelle, den hydrolytische Enzyme in der Regel anrichten würden.<br />
5/55
Die vielfältigen Wirkungsweisen der Lysosomen sind:<br />
− Phagozytose: kleine Organismen oder Esspartikel werden umschlossen, die entstehende<br />
Vakuole fusioniert mit einem primären Lysosom (beinhaltet die Verdauungsenzyme) → es<br />
entsteht ein so genanntes sekundäres Lysosom. Die Verdauungsprodukte wandern als<br />
Nährstoffe für die Zelle ins Cytosol.<br />
− Autophagie: zelleigenes organisches Material (z.B. Organell) wird vom Lysosom<br />
umschlossen, in Monomere zerlegt und anschliessend ins Cytosol zum Recyceln<br />
zurückgegeben. Dieser Vorgang dient der Erneuerung der Zelle.<br />
− Apoptose: Programmierter Zelltod, die Zelle wird von Lysosomen selbst verdaut (Abbau<br />
von beispielsweise unnötigem Gewebe).<br />
Das Fehlen solcher Lysosomen führt zu seltenen, schweren Krankheiten. Dabei werden in der<br />
Zelle unverdaute Substanzen angehäuft, die schliesslich andere Zellfunktionen in<br />
Mitleidenschaft ziehen und schwerwiegende Schäden zur Folge haben können.<br />
7. Die Wichtigkeit der zellulären Kompartimentierung. Nenne Beispiele.<br />
Zu den Hauptaufgaben der zellulären Kompartimentierung gehört die Arbeitsteilung, der<br />
Zellschutz und die örtliche und zeitliche Trennung verschiedener unkompatibler Reaktionen.<br />
− Lysosomen arbeiten nur bei pH 5, der Rest der Zelle braucht aber pH 7 → Abgrenzung<br />
nötig, sodass Enzymeigenschaften effektiv genutzt werden können (ermöglicht verschiedene<br />
pH-Milieus innerhalb einer Zelle).<br />
− Nucleus hält Erbmaterial zusammen → erleichtert die Zellteilung, schützt die Gene durch<br />
Abtrennung vor Schädigung und Mutationen.<br />
− Mitochondrien besitzen eine Oberflächenvergrösserung im Innern, die ihnen einen<br />
Energieumsetzung im grossen Stil ohne Verluste an die Umgebung erlaubt.<br />
− Ribosomen schwimmen nicht einfach im Cytosol herum, sondern sind dort konzentriert, wo<br />
sie gebraucht werden (z.B. raues ER).<br />
− Zentralvakuole (Pflanzen): Tonoplast ist selektiv in der Durchlässigkeit/Transport von<br />
löslichen Stoffen. Dies ermöglicht eine andere Zusammensetzung der Flüssigkeit (cell sap)<br />
im Innern als ausserhalb (Cytosol). Ein Beispiel ist das Aufbewahren von giftigen<br />
Nebenprodukten, die der Zelle schaden würden, falls sie sich im Cytosol anhäuften.<br />
− Peroxisomen spalten von verschiedenen organischen Schadstoffen Wasserstoff ab. Das<br />
entstehende Wasserstoffperoxid (H2O2) ist extrem giftig, wird jedoch durch in den<br />
Peroxisomen enthaltene Enzyme in Wasser und Sauerstoff umgewandelt → Abschirmung<br />
und Einschränkung auf kleinsten Raum zur Beseitigung von schädlichen<br />
Stoffwechselprodukten.<br />
8. Welche Arten von Vakuolen gibt es? Nenne Beispiele, Gemeinsamkeiten und<br />
Unterschiede.<br />
Gemeinsamkeit: Membranumhüllte Bläschen mit verschiedenen Funktionen.<br />
− Nahrungsvakuole: durch Phagozytose gebildet, Zwischenspeicherung der Nahrung<br />
− Kontraktile Vakuole: pumpt überschüssiges Wasser entgegen der Osmose aus der Zelle (in<br />
vielen Süsswasserprotisten zum Schutz vor dem Platzen)<br />
− Zentralvakuole: entsteht durch Verschmelzen mehrere Vakuolen, durch eine Membran<br />
(Tonoplast) abgeschlossen und nur in Pflanzen vorkommend. Speichert Nährstoffe,<br />
übernimmt die Abfallentsorgung (Funktion der Lysosomen bei Tieren), schützt vor Tierfrass<br />
durch Einlagerung ungeniessbarer und giftiger Stoffe (Alkaloide, Duftstoffe) und ist für das<br />
6/55
Wachstum verantwortlich (Aufnahme von Wasser und Bildung eines Binnendruckes, damit<br />
die Zelle wächst). Zusätzlich kann sie Pigmente zum Anlocken von Tieren für die<br />
Bestäubung enthalten.<br />
9. Welche membranösen Organellen gibt es, die nicht (warum nicht?) zum<br />
Endomembransystem gezählt werden? Gebe Beispiele an und nenne deren funktionelle<br />
Besonderheiten.<br />
Nicht zum Endomembransystem gehören die Mitochondrien, Chloroplasten und Peroxisomen.<br />
Der Grund dafür ist bei den Mitochondrien und Chloroplasten, dass die Membranproteine nicht<br />
vom ER, sondern von freien Ribosomen im Cytosol und zusätzlich von eigenen, in ihnen<br />
enthaltenen Ribosomen gebildet werden (sie besitzen eine Doppelmembran → keine<br />
Verbindung zum inneren Membransystem). Sie enthalten aber nicht nur eigene Ribosomen,<br />
sondern auch kurze, ringförmige DNA. Des weiteren sind sie semiautonom, sprich sie wachsen<br />
und vermehren sich unabhängig von äusseren Faktoren (vgl. Endosymbiontentheorie).<br />
Die Peroxisomen dagegen schnüren sich nicht wie die Lysosomen vom Endomembransystem<br />
ab, sondern wachsen, indem sie Proteine und Lipide (im Cytosol hergestellt) aufnehmen. Ihre<br />
Vermehrung erfolgt durch Teilung, sobald sie eine bestimmte Grösse erreicht haben.<br />
Mitochondrien: Ort der Zellatmung, dem Prozess, der mit Hilfe von Sauerstoff aus Zucker,<br />
Fetten und anderen Energielieferanten ATP herstellt. Von zwei Membranen umschlossen, eine<br />
äussere, glatte und eine innere, stark gefaltete, die so genannte Christae. Dadurch entstehen<br />
zwei Innenbereiche, der Intermembranraum und die von der Christae umgebene Matrix (enthält<br />
die Ribosomen sowie die mitochondriale DNA). Ein Teil der Zellatmung findet hier in der<br />
Matrix statt, die für die ATP-Synthese nötigen Proteine jedoch sind in die Innenmembran<br />
eingelagert (grosse Oberfläche → effiziente Zellatmung).<br />
Chloroplasten (fast nur bei Pflanzen): Ort der Photosynthese, bei der aus Wasser und<br />
Kohlendioxid mit Hilfe von Sonnenenergie Zucker (Glucose) und Sauerstoff hergestellt wird.<br />
Enthalten das Pigment Chlorophyll und bestimmte Enzyme und Moleküle, die zur<br />
Photosynthese benötigt werden.<br />
Wie die Mitochondrien sind Chloroplasten ebenfalls von zwei Membranen umschlossen (bilden<br />
einen schmalen Intermembranraum). Ganz im Inneren befinden sich scheibenförmig<br />
abgeflachte Vesikel (sog. Thylakoide), welche gestapelt Grana genannt werden. Den<br />
Raum um die Thylakoide herum nennt man Stroma, den Innenraum der<br />
Thylakoidmembransäckchen wird als Thylakoidlumen bezeichnet.<br />
Peroxisomen: Sind nur von einer Membran umschlossen, spezialisierte Vesikel. Sie enthalten<br />
Enzyme zur Abspaltung von Wasserstoff (der auf molekularen Sauerstoff übertragen wird →<br />
Bildung von H2O2) von verschiedenen Substraten. Einige bauen Fettsäuren zu kleineren<br />
Molekülen, die danach in den Mitochondrien als Brennstoff zur Zellatmung dienen, ab.<br />
Peroxisomen in der Leber entgiften auf diese Art und Weise auch Alkohol und andere<br />
organische Schadstoffe. Das entstehende extrem toxische Wasserstoffperoxid wird durch<br />
weitere, in den Peroxisomen enthaltene Enzyme neutralisiert (Umwandlung in Wasser und<br />
Sauerstoff).<br />
10. Beschreibe Struktur und Funktion der Bestandteile des Cytoskeletts.<br />
Das Cytoskelett ist ein aus Proteinen aufgebautes Netzwerk im Cytoplasma jeder Zelle. Es<br />
besteht aus dynamisch auf und abbaubaren, dünnen, fadenförmigen Zellstrukturen (Filamenten).<br />
7/55
Mikrotubuli: Sind lange, röhrenförmige aus Tubulinproteinen bestehende Stäbe im Cytoplasma<br />
aller Eukaryoten. Die Mikrotubuli sind verantwortlich für die Form und Stabilisation der Zelle,<br />
dienen aber auch als „Schienen“, auf welchen Organellen, die mit Motorproteinen ausgestattet<br />
sind, entlang gleiten können. Während der Zellteilung sind sie ausserdem an der Trennung der<br />
Chromosomen beteiligt.<br />
In den meisten Zellen gehen die Mikrotubuli von einem zentralen Bereich (Centrosom) aus und<br />
bilden somit eine Art druckresistenten „Tragbalken“. Bei Tierzellen und niederen<br />
Pflanzenzellen liegt zusätzlich ein Paar von Centriolen (Bündel aus 9-ringförmig angeordneten<br />
Mikrotubulitripletts) im Centrosom, welche bei der Stabilisierung mithelfen.<br />
Eine weitere Anwendung finden Mikrotubuli bei Eukaryoten in den Cilien und Geisseln, wo sie<br />
für den Schlag der Geisseln (Flagellen) und Cilien (Wimpern) sorgen. So können sich viele<br />
Einzeller mit Hilfe von Cilien oder Geisseln durchs Wasser bewegen und auch Spermien<br />
vielzelliger Tiere und mancher Pflanzen sind mit solchen Geisseln ausgestattet.<br />
Auch unsere Luftröhre ist mit Flimmerhäarchen (Cilien) ausgekleidet, sodass Schleim und<br />
hängen gebliebene Schmutzteilchen aus dem Atemtrakt befördern werden können.<br />
Mikrofilamente: Sind widerstandsfähige „Schnüre“ aus Actinproteinen (zwei in einander<br />
verdrehte Aktinketten) im Cytoplasma eukaryotischer Zellen. Im Gegensatz zur<br />
Druckentlastung durch Mikrotubuli haben Mikrofilamente die Aufgabe Zug aufzufangen. Sie<br />
bilden häufig mit anderen Proteinen knapp unterhalb der Plasmamembran ein kompliziertes<br />
Geflecht, das der Zellrinde (Aussenschicht des Cytoplasmas) eine gelartige Konsistenz verleiht<br />
→ Aufrechterhaltung der Zellform.<br />
Mikrofilamentbündel bilden den Kern von Mikrovilli (zarte Fortsätze, die für eine grössere<br />
Oberfläche sorgen → z.B. Nährstoffaufnahme im Darm) und verstärken sie so. Auch für die<br />
Zellbewegung spielen diese Filamente in Zusammenarbeit mit dem Protein Myosin eine<br />
wichtige Rolle (Kontraktion von Muskelzellen, Teilung einer Zelle in zwei Tochterzellen durch<br />
Einschnürung, amöboides Wandern einer Zellen durch das Ausstrecken von Pseudopodien).<br />
Diese Actin-Myosin-Wechselwirkung und der Konsistenzunterschied (Sol/Gel) tragen auch zur<br />
Cytoplasmaströmung (Kreisbewegung des Cytoplasmas) in Pflanzenzellen bei und sorgen<br />
dadurch für eine schnellere Verteilung der Substanzen in der Zelle.<br />
Für die Zellmobilität durch Mikrotubuli und Mikrofilamente sind Interaktionen mit<br />
Motorproteinen unter ATP-Verbrauch nötig.<br />
Intermediärfilamente: Liegen in der Grössenordnung zwischen den „grossen“ Mikrotubuli und<br />
den „kleinen“ Mikrofilamenten (daher Intermediärfilamente). Es gibt eine Vielzahl an<br />
verschiedenen Intermediärfilamenttypen, die aus unterschiedlichen Proteinuntereinheiten (meist<br />
Keratine) aufgebaut sind. Je nach Zelltyp ändert sich deshalb ihre Zusammensetzung im<br />
Gegensatz zu den einheitlich vorkommenden Mikrotubuli und Mikrofilamenten.<br />
Sie sind ein stabiler Bestandteil der Zelle, der häufig an verschiedenen Orten auf- und abgebaut<br />
wird und übernehmen den Hauptanteil der Fixierung der Zellgestalt (zugresistentes Grundgerüst<br />
der Zelle). Des weiteren sind sie auch für die Befestigung bestimmter Organellen verantwortlich<br />
unter anderem halten sie den Zellkern an seinem Platz (bilden die innere Auskleidung der<br />
Kernhülle).<br />
Zellen deren Funktionen sich direkt von ihren Form herleitet werden fast immer durch<br />
Intermediärfilamente stabilisiert (langen Fortsätze von Axonen, Hornhaut und Haare,<br />
Epidermis).<br />
8/55
11. Wie schliessen Pflanzen und Tiere ihre Zelloberflächen ab, wie bleiben benachbarte Zellen<br />
in Kontakt?<br />
Tierzelle:<br />
An die Plasmamembran ist eine hoch entwickelte extrazelluläre Matrix geknüpft, die aus<br />
Glykoproteinen (vor allem Kollagen, das kräftige Fasern bildet) besteht. Diese Glykoproteine<br />
sind über Fibronectine mit den Integrinen - in die Plasmamembran eingelagerte<br />
Rezeptormoleküle – verbunden. Eine weitere Verbindung besteht nun zwischen den Integrinen<br />
und den Mikrofilamenten des Cytoskeletts, sodass Veränderungen in der extrazellulären Matrix<br />
an die Zelle weitergeleitet werden können und umgekehrt (mechanische Signalübertragung).<br />
Wahrscheinlich kann die Zelle über diesen und andere Vorgänge alle Zellen in einem Gewebe<br />
koordinieren.<br />
Dies ist jedoch nicht die einzige Verbindung zwischen benachbarten Zellen. Tiere besitzen<br />
zusätzlich drei Haupttypen von direkten Zellverbindungen:<br />
Tight Junctions: Verbindungen zwischen zwei Membranen benachbarter Zellen. Bilden<br />
Gürtel/Bänder rund um die Zellen und regulieren dadurch den Transport von Molekülen über<br />
Epithelgewebe (Diffusionsbarriere). Ausserdem haben sie eine so genannte „Zaun-Funktion“,<br />
d.h. sie verhindern die freie Bewegung von Membrankomponenten (beispielsweise sollen<br />
Mikrovilli nur auf einer Membranseite vorkommen).<br />
Desmosomen: Haftkontakte (wie Nieten), die die Zellen über ihre Intermediärfilamente zu<br />
widerstandsfähigen Gewebeschichten verbinden (z.B. Schutz vor Schwerkraft). Über die<br />
Desmosomen ist auch das Cytoskelett an der Plasmamembran verankert → verleiht zusätzliche<br />
Stabilität.<br />
Gap Junctions: Sind winzige wassergefüllte Cytoplasmakanäle (Poren), durch die Salzionen,<br />
Zucker, Aminosäuren und andere kleine Moleküle ausgetauscht werden können. Sie dienen<br />
deshalb der chemischen Kommunikation zwischen den Zellen. Wird eine Zelle geschädigt,<br />
können die Poren geschlossen werden, die Zelle wird von ihren Nachbarn abgekoppelt →<br />
Stoffe gehen nicht verloren.<br />
Pflanzenzelle:<br />
Die Abgrenzung erfolgt durch die im Vergleich zur Plasmamembran viel dickere Zellwand,<br />
welche die Zelle schützt, ihr die feste Form verleiht und übermässige Wasseraufnahme<br />
verhindert. Sie besteht bei allen Pflanzen aus Zellulose hergestellten Mikrofibrillen, welche in<br />
eine Grundsubstanz (Matrix) aus anderen Polysacchariden und Proteinen eingelagert ist. Je nach<br />
Zelltyp unterscheidet sich jedoch die chemische Zusammensetzung.<br />
Junge Pflanzen bilden zuerst dünne, biegsame primäre Zellwände, welche über eine dünne<br />
Schicht (Mittellamelle), die reich an klebrigen Pektinen ist, zusammengehalten werden. Reift<br />
die Zelle heran und stellt schliesslich das Wachstum ein wird die Zellwand verstärkt, indem<br />
entweder härtere Substanzen darin eingelagert werden oder eine weitere sekundäre Zellwand<br />
ausgebildet wird (Holz besteht überwiegend aus sekundären Zellwänden).<br />
Plasmodesmen: Die Zellwände sind von Kanälen durchzogen, so genannte Plasmodesmen,<br />
durch welche sich das Cytosol austauschen kann. Somit verbinden diese Kanäle den lebende<br />
Inhalt benachbarter Zellen miteinander, Wasser und kleine gelöste Moleküle können<br />
ungehindert passieren (unter geeigneten Bedingungen sogar bestimmte Proteine und RNA-<br />
Moleküle). Makromoleküle, die in Nachbarzellen transportiert werden müssen, gelangen an<br />
Cytoskelettfasern zu den Plasmodesmen.<br />
9/55
Quiz Fragen 7 (S. 159-160)<br />
2. Welche der folgenden Aussagen ist eine zutreffende Beschreibung gebundener<br />
Ribosomen?<br />
a) Gebundene Ribosomen sind in einer eigenen Membran eingehüllt.<br />
b) Gebundene Ribosomen unterscheiden sich in ihrer Struktur von freien Ribosomen.<br />
c) Gebundene Ribosomen synthetisieren in der Regel Membranproteine und sekretorische<br />
Proteine.<br />
d) Am häufigsten befinden sich gebundene Ribosomen an der Cytoplasmaseite der<br />
Plasmamembran.<br />
e) Gebundene Ribosomen liegen gehäuft im Innenraum des rauen ER.<br />
c. Gebundene Ribosomen synthetisieren in der Regel Membranproteine und sekretorische<br />
Proteine.<br />
3. Welches der folgenden Organellen ist am schwächsten mit dem inneren Membransystem<br />
assoziiert?<br />
a) die Kernhülle<br />
b) die Chloroplasten<br />
c) der Golgi-Apparat<br />
d) die Plasmamembran<br />
e) das ER<br />
b. die Chloroplasten. Zum Endomembransystem gehören die Kernhülle, ER, Golgi-Apparat,<br />
Lysosomen, Vesikel, Vakuolen und die Plasmamembran.<br />
4. Pankreaszellen bauen radioaktiv markierte Aminosäuren in Proteine ein. Anhand dieser<br />
Markierung neu synthetisierter Proteine kann man ihren weiteren Weg in der Zelle<br />
verfolgen. In diesem Fall geht es um ein Enzym, das am Ende aus den Pankreaszellen<br />
ausgeschieden wird. Welchen der folgenden Wege wird das Protein in der Zelle mit der<br />
grössten Wahrscheinlichkeit einschlagen?<br />
a) ER → Golgi-Apparat → Zellkern<br />
b) Golgi-Apparat → ER → Lysosom<br />
c) Zellkern → ER → Golgi-Apparat<br />
d) ER → Golgi-Apparat → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen<br />
e) ER → Lysosom → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen<br />
d. ER → Golgi-Apparat → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen. Im ER werden<br />
die Proteine hergestellt, im Golgi-Apparat modifiziert und über Vesikel an die Plasmamembran<br />
zur Ausscheidung aus der Zelle transportiert.<br />
5. Welches der folgenden Organellen kommt sowohl in Pflanzen- als auch Tierzellen vor?<br />
a) Chloroplasten<br />
b) Wand aus Cellulose<br />
c) Tonoplast<br />
d) Mitochondrien<br />
e) Centriolen<br />
d. Mitochondrien. Chloroplasten, Wand aus Cellulose und Tonoplasten kommen nur in<br />
Pflanzen, Centriolen hingegen nur in Tieren vor.<br />
10/55
6. Welcher der folgenden Bestandteile ist in Prokaryotenzellen vorhanden?<br />
a) Mitochondrien<br />
b) Ribosomen<br />
c) Kernhülle<br />
d) Chloroplasten<br />
e) ER<br />
b. Ribosomen. Mitochondrien und Chloroplasten waren früher nach der Endosymbiontentheorie<br />
Prokaryotenzellen (also nicht nur Bestandteile), Kernhülle und ER kommen nur in<br />
eukaryotischen Zellen vor.<br />
7. Welcher Zelltyp bietet wahrscheinlich die besten Voraussetzungen zur Untersuchung von<br />
Lysosomen? Begründen sie ihre Antwort.<br />
a) Muskelzellen<br />
b) Nervenzellen<br />
c) phagocytierende weisse Blutzellen<br />
d) Blattzellen einer Pflanze<br />
e) Bakterienzelle<br />
c. phagocytierende weisse Blutzellen, da eine ihrer Hauptfunktionen das Verdauen von<br />
Fremdmaterial und Krankheitserregern ist (beinhalten dazu besonders viele Lysosomen).<br />
8. Welche der folgenden Aussagen trifft eine richtige Unterscheidung zwischen Pro- und<br />
Eukaryotenzellen, die ihre Ursache im Fehlen eines Cytoskeletts bei den Prokaryoten hat?<br />
a) Kompartimentierte Organellen kommen nur in Eukaryotenzellen vor.<br />
b) Bei Prokaryoten beobachtet man keine Cytoplasmaströmung.<br />
c) Nur Eukaryotenzellen können sich bewegen.<br />
d) Prokaryotenzellen haben in der Regel einen Durchmesser von 10 μm oder weniger.<br />
e) Nur in Eukaryotenzellen liegt das genetische Material gehäuft in einem Bereich, der von der<br />
übrigen Zelle getrennt ist.<br />
b. Bei Prokaryoten beobachtet man keine Cytoplasmaströmung. Das bei Prokaryoten fehlende<br />
Cytoskelett ist bei Eukaryotenzellen zuständig für die Plasmaströmung.<br />
9. Welches der folgenden Paare von Struktur und Funktion passt nicht zusammen?<br />
a) Nucleolus; Ribosomenproduktion<br />
b) Lysosom; Verdauung im Zellinneren<br />
c) Ribosom; Proteinsynthese<br />
d) Golgi-Apparat; Ausscheidung von Zellprodukten<br />
e) Mikrotubuli; Muskelkontraktion<br />
e. Mikrotubuli; Muskelkontraktion. Mikrofilamente und nicht Mikrotubuli sind für die Zell-/<br />
Muskelkontraktionen verantwortlich.<br />
10. Cyanid bindet an die Moleküle mindestens einer Substanz, die an der ATP-Produktion<br />
mitwirkt. Wo wird man den grössten Teil des Cyanids finden, wenn eine Zelle damit in<br />
Kontakt gekommen ist?<br />
a) in den Mitochondrien<br />
b) in den Ribosomen<br />
c) in den Peroxisomen<br />
d) in den Lysosomen<br />
e) im endoplasmatischen Retikulum<br />
11/55
a. in den Mitochondrien, mögliche Erklärung → da diese im Vergleich zu den anderen grössere<br />
Mengen an Eisen (Metallkomplexbildung mit Cyanid) enthalten.<br />
Kapitel 8 – Membranstruktur und Funktion<br />
1. Welche Beobachtungen/Experimente führten zum Modell einer Membranstruktur?<br />
Die ersten Modelle des molekularen Aufbaus von Biomembranen entwickelte man schon<br />
Jahrzehnte bevor man diese Gebilde in den Fünfzigerjahren erstmals am Elektronenmikroskop<br />
sehen konnte. Bereits 1895 vermutete C. Overton, Membranen müssten aus Lipiden bestehen.<br />
Dies schloss er aus seinen Beobachtungen, dass fettlösliche (lipophile) Substanzen viel<br />
einfacher in Zellen eindringen können als solche, die sich nicht in Fett lösen (lipophobe).<br />
Zwanzig Jahre später analysierte man dann Membranen roter Blutzellen und stellte fest, dass<br />
diese aus Lipiden und Proteinen zusammengesetzt sind.<br />
Anmerkung: Nur die hydrophilen Köpfe der Phospholipide tauchen ins Wasser ein → ein<br />
weiterer Beweis, dass Membranen amphipathisch sind.<br />
Unter dem Elektronenmikroskop erkennt man zwei Dunkelstreifen mit einem hellen Streifen<br />
dazwischen → hydrophile Phosphatköpfchen und Proteine umgeben Fettsäuren (hydrophobe<br />
Schwänze).<br />
2. Welche Beobachtungen/Experimente unterstützen das „Fluid mosaic“-Modell einer<br />
Membran?<br />
„Fluid mosaic“-Modell: Membranen werden als Mosaiken aus Proteinmolekülen, die in einer<br />
flüssigen Doppelschicht aus Phospholipiden liegen, angesehen.<br />
1917 → Herstellung von künstlichen Membranen durch I. Langmuir. Dafür löste er<br />
Phospholipide in Benzol und gab das Gemisch anschliessend in Wasser. Nachdem Verdunsten<br />
des Benzols fand er als Rückstand einen dünnen Film aus Phospholipiden auf der<br />
Wasseroberfläche. Er beobachtete dabei, dass nur die hydrophilen Köpfchen der Phospholipide<br />
ins Wasser eingetaucht waren.<br />
1925 → E. Gorter und F. Grendel meinen erkannt zu haben, dass Zellmembranen in der Tat<br />
Lipiddoppelschichten seien, deren Dicke zwei Moleküle betrage. Eine solche Doppelschicht<br />
könnte eine stabile Abgrenzung zwischen zwei wässrigen Kompartimenten bilden, weil die<br />
hydrophoben Schwänze der Phospholipide – durch die Molekülanordnung – gegen das Wasser<br />
abgeschirmt sind, während die hydrophilen Köpfe damit in Kontakt kommen.<br />
Das Experiment: Gorter und Grendel massen den Phospholipidgehalt der aus den roten<br />
Blutzellen isolierten Membran und stellten fest, dass er gerade ausreichte, um die Zelle mit zwei<br />
Molekülschichten zu umgeben.<br />
1935 → Davson-Danielli-Modell: Die Membran ist wie ein Sandwich aufgebaut, mit einer<br />
Lipiddoppelschicht zwischen zwei Schichten globulärer Proteine.<br />
In den 50er Jahren konnte man Membranen zum ersten Mal unter dem Elektronenmikroskop<br />
erkennen (zwei Dunkelstreifen umgeben einen helleren Streifen) → Hypothese über den<br />
„Sandwichaufbau“ wird scheinbar bestätigt.<br />
Das Davson-Danielli-Modell besitzt jedoch zwei Schwachpunkte:<br />
12/55
1. Man zweifelte, dass alle Membranen der Zelle gleich aufgebaut sind (im<br />
Elektronenmikroskop sehen die verschiedenen Membranen keineswegs einheitlich aus).<br />
2. Die Lage der Proteine im Sandwichmodell bereitete Kopfzerbrechen. Membranproteine sind<br />
nämlich ebenfalls amphipathisch. Wenn sie als durchgehende Schicht auf der Membran<br />
lägen, kämen auch ihre hydrophoben Bereiche mit Wasser in Berührung.<br />
1972 → S. J. Singer und G. Nicolson schlagen ein verändertes Membranmodell vor. Die<br />
Phospholipiddoppelschicht ist in diesem Modell nicht von festen Proteinschichten bedeckt,<br />
sondern die Membranproteine sind einzeln in die Doppelschicht eingelagert und ragen nur mit<br />
ihren hydrophilen Bereichen in das umgebende Wasser. Diese Molekülanordnung würde den<br />
hydrophilen Regionen von Phospholipiden und Proteinen den grösstmöglichen Kontakt mit dem<br />
Wasser gestatten und ihren hydrophoben Bereichen gleichzeitig eine nichtwässrige, lipophile<br />
Umgebung bieten.<br />
Überzeugende Belege für die Einlagerung von Proteinen in die Phospholipiddoppelschicht<br />
lieferte schliesslich das Verfahren des so genannten Gefrier-ätzens. Dabei wird die Membran<br />
zwischen den beiden Phospholipidschichten gespalten und unter dem Elektronenmikroskop<br />
betrachtet → innere und äussere Membran sehen nicht gleich aus (man erkennt kieselartige<br />
Strukturen im inneren der Membran).<br />
3. Wie lässt sich die Beweglichkeit von Proteinen innerhalb der Membran experimentell<br />
nachweisen?<br />
Fusioniert man im Labor eine menschliche Zelle<br />
mit einer Mauszelle, sind die Proteine der beiden<br />
Arten in der Membran der Hybridzelle nach kaum<br />
einer Stunde völlig vermischt.<br />
4. Erkläre die folgenden Begriffe: Turgor, Osmose, semipermeable Membran,<br />
Osmoregulation, Plasmolyse.<br />
Turgor: Bei Lebewesen mit Zellwänden besteht häufig ein Druck durch den Protoplasten (der<br />
gesamte Inhalt einer Zelle ohne Zellwand, von Plasmamembran abgeschlossen) gegen die aus<br />
Zellulose bestehende Zellwand (entgegen dem Wanddruck, d.h. die Zellwand ist nur bis zu<br />
einem gewissen Betrag dehnbar). Für diesen Druck, der Turgor oder Turgordruck genannt wird,<br />
sind osmotische Vorgänge verantwortlich. Pflanzenzellen besitzen beispielsweise oft einen<br />
hypertonischen Zellsaft, sodass durch Osmose Wasser aufgenommen wird → Protoplast<br />
schwellt an, bis die Zellwand einer weiteren Ausdehnung entgegenwirkt.<br />
Turgeszent nennt man solche Zellen, deren Turgor gross ist. Von deturgeszenten Zellen spricht<br />
man dagegen, wenn durch Wasserabwanderung nach Aussen der Turgor kleiner wird. Für die<br />
meisten Pflanzenzellen ist der turgeszente Zustand normal (gesund) → turgeszente Zellen<br />
übernehmen eine Stützfunktion. Ist die Umgebung isotonisch oder hypertonisch werden die<br />
Zellen schlaff, sprich die Pflanze welkt.<br />
Osmose: Ist eine Form der Diffusion. Dabei diffundiert ein Lösungsmittel (z.B. Wasser) durch<br />
eine semipermeable Membran zwischen einer hypotonischen und hypertonischen Lösung in<br />
dem Bestreben, die hypertonische so zu Verdünnen, dass schlussendlich beide <strong>Lösungen</strong> gleich<br />
konzentriert sind (dahinter steht das Prinzip der Thermodynamik: möglichst hohe Entropie).<br />
Diese Diffusion von Wasser durch eine selektiv permeable Membran ist ein Sonderfall des<br />
passiven Transports.<br />
13/55
Semipermeable Membran: Membran, die für bestimmte Teilchen - meist kleine Moleküle oder<br />
Ionen - durchlässig ist für andere, meist grössere, jedoch nicht oder die Stoffe nur in eine<br />
bestimmte Richtung passieren lässt.<br />
Osmoregulation: Dies ist die Steuerung des Salz- und Wasserhaushalts bei Lebewesen (Tiere<br />
ohne starre Zellwände, die einem hyper- oder hypotonischen Milieu ausgesetzt sind haben<br />
besondere Anpassungen entwickelt → Pantoffeltierchen besitzen für Wasser ungewöhnlich<br />
schwer durchlässige Membranen und kontraktile Vakuolen zum Schutz vor dem Platzen).<br />
Plasmolyse: Die Membran einer Zelle kann als semipermeable Membran, die osmotisch<br />
wirksam ist, aufgefasst werden. Legt man Pflanzenzellen in eine Lösung, deren Konzentration<br />
höher ist als die des Vakuolensafts (hypertonische Umgebung), beginnt Wasser aus der Vakuole<br />
nach Aussen zu diffundieren. Dadurch nimmt der Turgor ab und der Protoplast beginnt sich von<br />
der Zellwand abzulösen. Den Beginn dieses Vorganges nennt man Grenzplasmolyse, alles in<br />
allem Plasmolyse (für Pflanzen normalerweise tödlich). Bis zu einem bestimmten Grad (solange<br />
kein übermässiger Schaden entstand) ist dieser Vorgang reversibel.<br />
5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Transportproteinen und Enzymen.<br />
Gemeinsamkeiten:<br />
− Beides sind Proteine.<br />
− Wie Enzyme können auch Transportproteine abgesättigt werden. Von jedem Typ eines<br />
Transportproteins gibt es nur eine begrenzten Anzahl Kopien in der Plasmamembran. Falls<br />
nun alle diese Moleküle ihre Fracht mit der maximal möglichen Geschwindigkeit binden<br />
und durch die Membran schleusen, verläuft der Transport mit Maximalgeschwindigkeit<br />
(volle Auslastung).<br />
− Wie Enzyme können auch Transportproteine durch Moleküle gehemmt werden, die dem<br />
normalen Substratmolekül ähneln. In solchen Fällen konkurriert der Hemmstoff (Inhibitor)<br />
mit dem Substrat um die Bindung am Protein.<br />
− Wie ein Enzym, das für ein Substrat (chemische Verbindung) spezifisch ist, so ist auch ein<br />
Transportprotein auf eine gelöste Substanz spezialisiert und besitzt eine Bindungsstelle, die<br />
dem aktiven Zentrum des Enzyms entspricht (Schlüssel-Schloss-Prinzip).<br />
Unterschiede:<br />
− Anders als Enzyme katalysieren Transportproteine in der Regel keine chemischen<br />
Reaktionen – die gebundenen Moleküle werden in ihrer chemischen Zusammensetzung<br />
nicht verändert - , sondern ihre Aufgabe besteht darin physikalische Vorgänge zu<br />
beschleunigen. Nämlich die Diffusion von Molekülen durch eine Membran, die für die<br />
betreffende Substanz ansonsten nahezu undurchlässig wäre.<br />
− Enzyme können sich zu Multienzymkomplexen zusammen lagern (steigert ihre Effizienz),<br />
was bei Transportproteinen nicht vorkommen.<br />
6. Erkläre den Unterschied zwischen erleichterter Diffusion (facilitated diffusion) und<br />
aktivem Transport (active transport).<br />
Erleichterte Diffusion: Polare Moleküle und Ionen, die von der Lipiddoppelschicht gestoppt<br />
würden, diffundieren mit Hilfe kanalbildender Transportproteine durch die Membran. Dies ist<br />
eine Form des passiven Transports (gelöste Substanzen diffundieren nur in die Richtung des<br />
elektrochemischen Gradienten, es ist dazu keine Energie erforderlich). Manche Kanalproteine<br />
auch bilden gesteuerte Kanäle, d.h. sie öffnen oder schliessen sich auf einen äusseren Reiz hin.<br />
14/55
Aktiver Transport: Im Gegensatz zur erleichterten Diffusion können gelöste Stoffe von manchen<br />
Transportproteinen entgegen ihrem Konzentrationsgefälle durch die Plasmamembran befördert<br />
werden. Dieser Transport verläuft somit „bergauf“, gegen das Bestreben der Diffusion<br />
(Entropie) und erfordert deshalb Energie in Form von ATP. Um Substanzen gegen deren<br />
Konzentrationsgradienten durch eine Membran zu pumpen, muss die Zelle Energie aus ihrem<br />
Stoffwechsel aufwenden, deshalb wird diese Art des Stoffaustausches auch als aktiver Transport<br />
bezeichnet.<br />
7. Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Natrium/Kalium-Pumpe<br />
und einer Proton-Pumpe.<br />
Natrium/Kalium-Pumpe Protonen-Pumpe<br />
Ist das wichtigste Membranprotein in tierischen<br />
Zellen, das aktiv Ionen transportiert und dadurch<br />
ein Membranpotenzial (elektrische Spannung<br />
zwischen Aussen- und Innenseite der Membran)<br />
erzeugt.<br />
Transportiert Natrium- und Kaliumionen im<br />
Verhältnis 3:2 (für jeweils drei Natriumionen,<br />
die aus der Zelle befördert werden, transportiert<br />
die Pumpe zwei Kaliumionen hinein).<br />
ATP phosphoryliert das Transportprotein und<br />
treibt dadurch die Konformationsänderung an.<br />
15/55<br />
Ist die bedeutendste elektrogene Pumpe der<br />
Pflanzen, Bakterien und Pilze.<br />
Sie befördert aktiv Protonen (H + ) aus der Zelle<br />
in das umgebende Milieu, aber nichts rein.<br />
Gemeinsamkeiten:<br />
− Indem diese elektrogenen Pumpen eine Spannung an ihrer Membran aufbauen, speichern sie<br />
Energie, die für die Aktivität der Zelle nutzbar gemacht werden kann.<br />
− Bei beiden Pumpen wird insgesamt pro „Umdrehung“ eine positive Ladung nach Aussen<br />
verschoben.<br />
− Spalten ATP (Hydrolyse) um die Energie für den Transport zu gewinnen (aktiver Transport<br />
entgegen dem Konzentrationsgradienten).<br />
Quiz Fragen 8 (S. 180)<br />
1. In welchen Punkten gibt es Unterschiede zwischen den Membranen der Eukaryoten?<br />
a) Phospholipide kommen nur in manchen Membranen vor.<br />
b) Manche Proteine kommen ausschliesslich in bestimmten Membranen vor.<br />
c) Nur bestimmte Membranen der Zelle sind selektiv permeable.<br />
d) Nur ganz bestimmte Membranen sind aus amphipathischen Molekülen aufgebaut.<br />
e) Manche Membranen haben eine hydrophobe, dem Cytosol zugewandte Oberfläche, bei<br />
anderen ist eine hydrophile Oberfläche dem Cytosol zugewandt.<br />
b. Manche Proteine kommen ausschliesslich in bestimmten Membranen vor. Jede Membran hat<br />
eine für sie charakteristische Proteinausstattung, die vor allem durch die Funktion der Zelle<br />
bestimmt wird. Ausserdem haben Zellen die Fähigkeit Nachbarzellen anhand der Moleküle<br />
(verzweigte Oligosaccharide) auf deren Oberfläche zu erkennen und zu unterscheiden<br />
(Oligosaccharide haben je nach Typ oder Zelle unterschiedliche Struktur und Position auf der<br />
Zelloberfläche und dienen daher gut als Unterscheidungsmerkmale).
2. Nach dem Flüssig-Mosaic-Modell der Membranstruktur sind die Proteine der Membran<br />
vorwiegend<br />
a) als ununterbrochenen Schicht über die innere und äussere Oberfläche der Membran<br />
ausgebreitet.<br />
b) auf das hydrophobe Innere der Membran beschränkt.<br />
c) in eine Lipiddoppelschicht eingebettet.<br />
d) zufällig in der Membran verteilt, ohne dass es eine feste Innen-Aussen-Polarität gäbe.<br />
e) in der Lage, sich ungehindert von der Membran zu entfernen und sich in der Umgebenden<br />
Lösung zu verteilen.<br />
c. in eine Lipiddoppelschicht eingebettet. Die meisten Proteine driften innerhalb der Membran<br />
umher (wie Eisberge im Wasser) und drehen sich dabei um die Längsachse. Da aber auch<br />
Proteine wie Phospholipide amphipathisch sind, ist die Einbettung in die Lipiddoppelschicht<br />
die beste Variante ihre hydrophoben Bereiche vor dem Wasser zu schützen.<br />
Integrale Membranproteine sind in die Lipiddoppelschicht eingelagert, während periphere<br />
Membranproteine an die Oberfläche gebunden sind.<br />
3. Welcher der folgenden Einflüsse würde die Fluidität der Membran verstärken?<br />
a) ein höherer Anteil an ungesättigten Phospholipiden<br />
b) eine niedrigere Temperatur<br />
c) ein relativ hoher Proteingehalt der Membran<br />
d) ein grösserer Anteil relativ grosser Glykolipide im Vergleich zu Lipiden mit geringerem<br />
Molekulargewicht<br />
e) ein hohes Membranpotenzial<br />
a. ein höherer Anteil an ungesättigten Phospholipiden. Bei niedriger Temperatur verfestigt sich<br />
die Membran gelartig, ein hoher Anteil an Phospholipiden mit ungesättigten Fettsäuren wirkt<br />
diesem Verhalten jedoch entgegen (Festigungspunkt wird erst bei noch niedrigeren<br />
Temperaturen erreicht). Dies liegt daran, dass ungesättigte Fettsäuren einen Knick in ihren<br />
Kohlenwasserstoffschwänzen besitzen, was sie am dichten Zusammenrücken hindert → erhöhte<br />
Fluidität.<br />
Ein weiterer Faktor, der die Fluidität der Membran verändert ist Cholesterol, ein Steroid, das<br />
zwischen den Phospholipidmolekülen der Membran eingelagert wird → trägt zur<br />
Stabilisierung der Membranfluidität bei.<br />
4. Welcher der folgenden Vorgänge schliesst alle anderen ein?<br />
a) Osmose<br />
b) Diffusion einer gelösten Substanz durch eine Membran<br />
c) erleichterte Diffusion<br />
d) passiver Transport<br />
e) Transport von Ionen entlang ihres elektrochemischen Gradienten<br />
d. passiver Transport. Passiver Transport fasst folgende Vorgänge zusammen: Diffusion (z.B.<br />
Austausch von O2 und CO2 in der Lunge), erleichterte Diffusion (mit Hilfe von<br />
Carriermolekülen z.B. Transport von Glucose in die Zelle), Osmose (z.B Austausch in den<br />
Kapillaren), Filtration (z.B Harnentstehung in den Nieren) und Ionentransporte entlang<br />
elektrischer Gradienten (z.B. Ruhepotential → Kaliumionenkanäle offen).<br />
16/55
5. Wir gehen von dem Modell für die Saccharoseaufnahme in Abb. 8.18 aus. Welche der<br />
folgenden Massnahmen hätte im Experiment eine stärkere Saccharoseaufnahme zur<br />
Folge?<br />
a) Senkung der Saccharosekonzentration ausserhalb der Zellen<br />
b) Senkung des pH-Werts ausserhalb der Zellen<br />
c) Senkung des pH-Werts im Cytoplasma<br />
d) Zusetzen eines Hemmstoffes, der die Regeneration von ATP verhindert<br />
e) Zusetzen einer Substanz, welche die Membran durchlässiger für Protonen macht<br />
b. Senkung des pH-Werts ausserhalb der Zellen. Das Membranprotein Saccharose-<br />
Wasserstoffionen-Cotransporter kann Saccharose nur gegen einen Konzentrationsgradienten<br />
transportieren, wenn das Saccharose-Moleküle zusammen mit einem Wasserstoffion auftritt.<br />
Ein tieferer extrazellulärer pH (mehr H + -Ionen) fördert somit den Saccharosetransport in die<br />
Zelle (Beispiel eines Symports).<br />
6. Warum haben Phospholipide in wässrigem Milieu das Bestreben, sich in einer<br />
Doppelschicht anzuordnen?<br />
Diese Struktur schützt die hydrophoben Schwänze der Phospholipide vor dem Wasser, während<br />
die hydrophilen Köpfe dem Wasser zugewandt sind (daher kommt der spezifische<br />
Membranaufbau).<br />
7. Die Kohlenhydrate, die an manche Proteine und Lipide der Plasmamembran gebunden<br />
sind, werden während der Fertigstellung der Membran im Golgi-Apparat angefügt. Die<br />
neue Membran bildet dann Transportvesikel, die an die Zelloberfläche wandern. Auf<br />
welcher Seite der Vesikelmembran finden sich die Kohlenhydrate?<br />
Sie liegen auf der Membraninnenseite des Transportvesikels, denn die Vesikel entstehen durch<br />
Einschnürung der Membran. Moleküle, die sich zuvor also auf der Aussenseite der Membran<br />
befanden, sind dann neu auf der Innenseite des Vesikels (siehe dazu S. 178 Abb. 8.19).<br />
8. Das Hormon Adrenalin kann eine Leberzelle veranlassen gespeichertes Glykogen zu<br />
hydrolysieren und Zucker auszuschütten. Das Hormon gelangt aber niemals ins<br />
Zellinnere. Erklären sie.<br />
Adrenalin (auch Epinephrin genannt) bindet an einen Rezeptor auf der Oberfläche der<br />
Leberzellen und aktiviert einen Signalübertragungsweg im Zellinneren, an dessen Ende die<br />
Freisetzung des Zuckers steht.<br />
9. Wie kann man mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik die Diffusion einer<br />
Substanz durch eine Membran erklären?<br />
Der zweite Hauptsatz besagt, dass bei der Reaktionsrichtung eine Tendenz zur<br />
Unordnung/Zufälligkeit (Entropie) besteht. Gleiche Konzentrationen einer Substanz auf beiden<br />
Seiten einer Membran sind eine zufälligere Verteilung als unterschiedliche Konzentrationen<br />
(dies würde einer willkürlichen Ordnung in zwei unterschiedliche „Gruppen“ entsprechen).<br />
Durch die Diffusion einer Substanz in einen anderen Bereich, in dem sie anfangs weniger<br />
konzentriert war, nimmt die Entropie zu, wie es nach dem zweiten Hauptsatz verlangt wird.<br />
10. Warum reicht es nicht aus, eine Lösung einfach als „hypotonisch“ zu bezeichnen?<br />
„Hypertonisch“ und „hypotonisch“ sind relative Begriffe (griech. hypo = unter, hyper = über).<br />
Eine Lösung, die hypertonisch zu Leitungswasser ist, kann zu Meerwasser hypotonisch sein.<br />
Man muss also immer angeben, womit man die Lösung vergleicht.<br />
17/55
Kapitel 12 – Der Zellzyklus<br />
1. Beschreibe den Ablauf eines Zellzyklus, nenne die wichtigsten Schritte vor, während und<br />
nach der Mitose. Nenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei tierischen und<br />
pflanzlichen Zellen.<br />
Anmerkung: Zur Vollständigkeit empfiehlt sich das Nachlesen des Zellzyklus im Campbell.<br />
Der Zellzyklus besteht häufig zu ungefähr 90% aus der Interphase (Wachstumsperiode),<br />
während die Mitosephase (M-Phase zusammengesetzt aus der Mitose und Cytokinese) nur den<br />
im Vergleich dazu relativ kurzen restlichen Zeitraum umfasst. Die Interphase lässt sich in drei<br />
Abschnitte einteilen:<br />
Interphase:<br />
G1-Phase: Zelle wächst durch Nährstoffaufnahme, Produktion von Proteinen und<br />
cytoplasmatischen Organellen (G kommt von „gap“, also Lücke/Abstand).<br />
S-Phase: Zelle wächst wie in der G1-Phase, zusätzlich werden aber die Chromosomen<br />
verdoppelt/kopiert (S steht für die Synthese der DNA).<br />
G2-Phase: Zelle wächst wie in den anderen zwei Phasen und schliesst schlussendlich die<br />
Vorbereitungen für die Zellteilung ab.<br />
Auf die Interphase folgt die Mitosephase (die Teilung der Zelle), die in der Regel zur<br />
vereinfachten Beschreibung in weitere fünf Phasen (bilden zusammen die Mitose) plus die<br />
Cytokinese unterteilt wird.<br />
Mitotische Phase:<br />
Prophase:<br />
Im Zellkern:<br />
− DNA in Form von Chromatinfasern windet sich spiralförmig auf und kondensieren (erst<br />
jetzt unter dem Lichtmikroskop als Chromosomen erkennbar)<br />
− Jedes verdoppelte Chromosom bildet dabei ein X (ein Paar verbundener<br />
Schwesterchromatiden, man spricht auch von 2-Chromatiden-Chromosome)<br />
− Nucleoli (Kernkörperchen) verschwinden<br />
Im Cytoplasma:<br />
− Mitosespindel bildet sich (besteht aus Mikrotubuli, die von den beiden Centrosomen<br />
ausgehen)<br />
− Centrosomen verschieben sich in entgegengesetzte Richtung auseinander (angetrieben durch<br />
die länger werdenden Pol-Mikrotubuli)<br />
Prometaphase:<br />
− Die Kernhülle zerfällt und die Spindelfasern (Mikrotubuli der Spindel) können nun mit den<br />
noch weiter kondensierten Chromosomen in Wechselwirkung treten<br />
− Die Mikrotubuli binden an die Kinetochoren – das sind spezielle Strukturen im<br />
Centromerbereich der Chromosomen, die als Ansatzstellen für die Spindelfasern dienen –<br />
und veranlassen die Chromosomen zu ruckartigen Bewegungen.<br />
− Die nicht an den Kinetochoren verankerten Mikrotubuli (sog. Pol-Mikrotubuli) agieren mit<br />
solchen vom gegenüberliegenden Zellpol<br />
18/55
Metaphase:<br />
− Die Centrosomen befinden sich nun an den Zellpolen<br />
− Chromosomen ordnen sich in der Äquatorialebene zur so genannten Metaphaseplatte an,<br />
sodass alle Centromere in einer Ebene liegen (geschieht mechanisch über Zug an den<br />
Kinetochoren)<br />
Anaphase:<br />
− Chromosomen trennen sich → es entstehen zwei identische 1-Chromatiden-Chromosomen,<br />
die durch Verkürzen des Kinetochor-Mikrotubulis zu den den Zellpolen gezogen werden.<br />
− Die Pol-Mikrotubuli werden hingegen gleichzeitig länger und drängen die Pole noch weiter<br />
auseinander.<br />
− Das Ende der Anaphase ist erreicht, sobald sich an jedem Zellpol der gleiche, vollständige<br />
Chromosomensatz befindet.<br />
Telophase:<br />
− Pol-Mikrotubuli verlängern sich weiter (Abstand zwischen Zellpolen wird noch grösser)<br />
− An den Zellpolen bilden sich aus den Fragmenten des ursprünglichen Zellkerns und anderen<br />
Teilen des Endomembransystems zwei neue Tochterzellkerne<br />
− Die Chromatinfasern der Chromosomen entspiralisieren sich<br />
− Der Spindelapparat bildet sich zurück, damit ist die Mitose (Zellkernteilung) abgeschlossen<br />
In der Regel hat mittlerweile auch die Cytokinese (Teilung des Cytoplasmas) bereits begonnen<br />
(oftmals in der späten Ana- oder Telophase), sodass kurz nach der Mitose die ursprüngliche<br />
Zelle in zwei Tochterzellen geteilt ist.<br />
Unterschiede:<br />
− Tiere besitzen 2 Centrosomen mit 2 Centriolen-Paaren. Die Mikrotubuli erstrecken sich<br />
kreisförmig von den Centrosomen aus, jedes Centrosom besteht dabei aus zwei Centriolen<br />
− Pflanzen hingegen haben 2 Centrosomen jedoch keine Centriolen<br />
− Die Teilung der Zelle erfolgt bei Tieren durch die Bildung einer Furche (sog.<br />
Teilungsfurche: Ring aus Mikrofilamenten). Dies geschieht durch Kontraktionen dieses<br />
Mikrofilamentringes (Wechselwirkung von Actin und Myosin) → Teilung durch<br />
Abschnüren<br />
− Pflanzen transportieren Zellwandmaterial in Vesikeln vom Golgi-Apparat zur<br />
Äquatorialebene, die dann zusammen die Zellplatte bilden. Die Zellplatte wächst mit<br />
fortschreitendem Einbau von Zellwandmaterial bis sie sich an der Aussengrenze der Zelle<br />
mit der Plasmamebran verbindet → Zellmembran und Zellwand entstehen<br />
2. Welche experimentellen Befunde sprechen für ein Zell-Zyklus-Kontrollsystem?<br />
Anfang der siebziger Jahre legten verschiedene Experimente die Vermutungen nahe, dass der<br />
Zell-Zyklus von spezifischen chemischen Signalen vorangetrieben wird. Eines der ersten<br />
Indizien dafür lieferten Experimente mit kultivierten Säugetierzellen. Man fusionierte dabei<br />
zwei Zellen, die sich in unterschiedlichen Phasen des Zellzyklus befanden und erhielt so eine<br />
einzelne Zelle mit zwei Zellkernen. Befand sich eine der Ausgangszellen in der S-, die andere<br />
aber in der G1-Phase, trat der G1-Zellkern sofort in die S-Phase über, als wäre er durch<br />
Substanzen aus dem Cytoplasma der anderen Zelle dazu angeregt worden. Auch wenn eine<br />
Zelle in der M-Phase mit einer anderen Zelle in irgendeinem der Interphase-Stadium<br />
verschmolzen wurde, begann der Zellkern der Interphase sofort mit der Mitose (falls sich die<br />
zweite Zelle in der G1-Phase befindet, d.h. die Chromosomen wurden noch nicht verdoppelt,<br />
entstehen 1-Chromatiden-Chromosomen).<br />
19/55
3. G1, G2, G0, S, M: Nenne Unterschiede und Bedeutung dieser Begriffe für den Ablauf des<br />
Zellzyklus.<br />
G1: Wichtigster Kontrollpunkt, auch als Restriktionspunkt bei Säugetieren bezeichnet. Erhält<br />
die Zelle an diesem Punkt ein Auslösesignal durchläuft sie normalerweise den ganzen<br />
Zellzyklus und teilt sich. Fehlt ein solches Signal verlässt die Zelle den Zellzyklus und tritt in<br />
die G0-Phase. Während dieser Phase wächst die Zelle und bereitet sich auf die S-Phase vor.<br />
S: Wachstum und Verdoppelung der DNA, sehr wichtig (ohne S-Phase hätten die Tochterzellen<br />
nur die Hälfte der Chromosomen nach der Mitose). Fehler in dieser Phase sind fatal!<br />
G2: Kontrollpunkt, Verhindert Mitose im Falle eines Fehlers (z.B. wenn S-Phase nicht<br />
funktioniert hat). Die Zelle wächst und schliesst die Vorbereitungen für die Zellteilung ab.<br />
G0: Wenn die Zelle kein „grünes Licht“ vom G1-Kontrollpunkt erhalten hat, endet hier der<br />
Zyklus und wechselt in den sich nicht teilenden Zustand. Die meisten Zellen des<br />
menschlichen Körpers befinden sich in dieser Phase (stark spezialisierte Nerven- und<br />
Muskelzellen teilen sich nie), einige Zellen können jedoch durch bestimmte äussere Reize in<br />
den Zellzyklus zurückkehren → Leber kann sich repariert, indem nach einer Verletzung<br />
Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden.<br />
M: Teilung der Chromosomen und des Zellkerns, Kontrollpunkt: Die Trennung der<br />
Chromatiden in der Anaphase wird so lange unterbunden, bis alle Kinetochore mit<br />
Spindelfasern verbunden sind und alle Chromosomen in der Metaphaseplatte angeordnet sind<br />
→ versichert, dass bei der Mitose jede Tochterzelle den gleichen Zellkerninhalt aufweist.<br />
4. Was sind Wachstumsfaktoren (Growth factors) und welche physiologische Bedeutung<br />
haben sie?<br />
Die meisten Säugetierzellen teilen sich nur, wenn das Nährmedium Wachstumsfaktoren<br />
enthält. Wachstumsfaktoren sind demnach allgemein gesagt Proteine, die von bestimmten<br />
Zellen im Organismus abgegeben werden und andere Zellen zur Teilung anregen. Im Falle des<br />
Zellzyklus sind sie externe Signale, die helfen den Zellzyklus zu regulieren.<br />
Ein typisches Beispiel für einen Wachstumsfaktor sind Platelet-derived growth factors (PDGF).<br />
Sie werden von Blutplättchen produziert und sind verantwortlich für die Teilung von<br />
Fibroblasten (Bindegewebszellen). Dies spielt eine wichtige Rolle beim Wundverschluss. Nach<br />
einer Verletzung geben nämlich Blutplättchen PDGF ab und regen so die Fibroblasten zur<br />
Vermehrung an, welche wiederum zur Wundheilung bei tragen.<br />
Wachstumsfaktoren verhelfen zu einer dichteabhängigen Hemmung, d.h. in einer zu dichten<br />
Kultur stellen Zellen ihre Vermehrung ein, weil nicht genügend Nährstoffe und<br />
Wachstumsfaktoren vorhanden sind (siehe S. 267 Abb. 12.16).<br />
5. Wodurch unterscheiden sich Krebszellen von normalen Zellen?<br />
− Krebszellen sind nicht an das Kontrollsystem des Zellzyklus gebunden.<br />
− Kennen keine dichteabhängige Hemmung, sprich sie hören nicht auf sich zu teilen, wenn<br />
nicht mehr genügend Wachstumsfaktoren vorhanden sind und bilden somit anstelle der<br />
Einzelzellschichten dicke Klumpen. Die Ursache dafür ist, dass Krebszellen selber<br />
Wachstumsfaktoren herstellen können oder diese gar nicht brauchen.<br />
− Normale Zellen teilen sich nur wenn sie an einer Unterlage angeheftet sind (z.B.<br />
extrazelluläre Matrix). Bei Krebszellen ist diese Teilungseinschränkung nicht vorhanden.<br />
20/55
− Falls sie ihre Teilung überhaupt einmal einstellen, geschieht dies an zufällig ausgewählten<br />
Stellen im Zellzyklus und nicht an den normalen Kontrollpunkten → Krebszellen teilen<br />
sich viel öfters und somit schneller als andere Zellen.<br />
− Können sich unendlich oft teilen solange genügend Nährstoffe vorhanden sind. Normale<br />
Zellen altern und sterben nach 20-50 Teilungen, Krebszellen werden darum auch als<br />
potenziell unsterblich oder immortalisiert bezeichnet.<br />
− Besitzen häufig eine abnormale Chromosomenzahl, ihr Stoffwechsel ist aus dem<br />
Gleichgewicht und sie erfüllen ihre nützliche Funktion nicht mehr.<br />
− Durch Zelloberflächenveränderung verlieren sie den Kontakt zu Nachbarzellen → wandern<br />
in benachbartes Gewebe.<br />
− Können Metastasen (weit entfernte Ableger vom Tumor) bilden indem sie sich über die<br />
Lymph- und Blutgefässe verteilen.<br />
Das Problem beginnt, indem eine Zelle die Transformation (Vorgang bei dem eine normale<br />
Zelle zur Krebszelle wird) durchmacht. Erkennt das Immunsystem die transformierte Zelle nicht<br />
als gefährlich (was im Normalfall passiert) kann sie sich unter Umständen vermehren und<br />
einen Tumor bilden (Masse abnormaler Zellen in gesundem Gewebe). Bleibt der Tumor wo er<br />
ist spricht man von einem gutartigen Tumor, der meist keine gesundheitlichen Probleme bereitet<br />
und sich chirurgisch vollständig entfernen lässt. Bösartige Tumore befallen dagegen andere<br />
Zellen und beeinträchtigen so die dazugehörigen Organe → Krebs.<br />
Quiz Fragen 12 (S. 270)<br />
1. Der Anstieg der Enzymaktivität von Proteinkinasen im Laufe des Zellzyklus ist<br />
zurückzuführen auf<br />
a) Synthese von Kinasen an den Ribosomen.<br />
b) Aktivierung inaktiver Kinasen durch Bindung an Cyclin.<br />
c) Umwandlung des inaktiven Cyclins in eine aktive Kinase durch Phosphorylierung.<br />
d) Spaltung der inaktiven Kinasemoleküle durch Proteasen im Cytoplasma.<br />
e) Rückgang der Konzentration äusserer Wachstumsfaktoren auf einen Wert unterhalb der<br />
Hemmschwelle.<br />
b. Aktivierung inaktiver Kinasen durch Bindung an Cyclin. Normalerweise liegen die<br />
Proteinkinasen in einer wachsenden Zelle in gleich bleibender Konzentration vor, sie sind<br />
jedoch die meiste Zeit inaktiv. Durch Binden an Cyclin werden die Kinasen aktiviert, die<br />
Cyclinkonzentration ist jedoch relativ grossen Schwankungen unterworfen, d.h. umso mehr<br />
Cyclin vorhanden ist desto höher ist auch die Enzymaktivität.<br />
2. Sie sehen im Mikroskop, wie sich in der Mitte einer Zelle eine Zellplatte bildet; gleichzeitig<br />
entstehen an den Polen der Zelle neue Zellkerne. Bei dieser Zelle handelt es sich<br />
vermutlich um<br />
a) eine Tierzelle während der Cytokinese.<br />
b) eine Pflanzenzelle während der Cytokinese.<br />
c) eine Tierzelle in der S-Phase des Zellzyklus.<br />
d) einen Bakterienzelle während der Teilung.<br />
e) eine Pflanzenzelle in der Metaphase.<br />
b. eine Pflanzenzelle während der Cytokinese. Nur Pflanzen teilen ihre Zelle mit Hilfe der<br />
Zellplatte (Ausbildung während der Cytokinese) von den neuen Zellkerne kann man auf das<br />
Ende der Telophase und somit auf den Beginn der Cytokinese schliessen.<br />
21/55
3. Vinblastin ist ein Wirkstoff, der häufig in der Chemotherapie von Krebserkrankungen<br />
eingesetzt wird. Es stört den Aufbau der Mikrotubuli; seine Wirkung liegt also daran, dass<br />
a) die Bildung der Mitosespindel verhindert wird.<br />
b) die Phosphorylierung von regulatorischen Proteinen verhindert wird.<br />
c) die Cyclinproduktion unterdrückt wird.<br />
d) Myosin denaturiert wird, sodass die Teilungsfurche sich nicht ausbilden kann.<br />
e) die DNA-Synthese gehemmt wird.<br />
a. die Bildung der Mitosespindel verhindert wird. Die Spindelfasern der Mitosespindel setzen<br />
sich aus Mikrotubuli zusammen → ohne Spindelapparat ist keine Zellteilung möglich.<br />
4. In einem Gewebe, in dem viele Mitosen ablaufen, enthält eine bestimmte Zelle nur halb so<br />
viel DNA wie einige andere Zellen. Die fragliche Zelle befindet sich wahrscheinlich in der<br />
a) G1-Phase<br />
b) G2-Phase<br />
c) Prophase<br />
d) Metaphase<br />
e) Anaphase<br />
a. G1-Phase. In der G1-Phase wurde die DNA noch nicht verdoppelt. Dies geschieht erst in der<br />
nachfolgenden S-Phase und die doppelte Ausführung der DNA hält danach an bis die<br />
Cytokinese abgeschlossen ist (worauf wieder die G1-Phase oder G0-Phase eintritt).<br />
5. Ein Unterschied zwischen einer Krebszelle und einer normalen Zelle besteht darin, dass<br />
a) die Krebszelle keine DNA synthetisieren kann.<br />
b) der Zellzyklus der Krebszelle in der S-Phase verharrt.<br />
c) Krebszellen sich auch dann weiterhin teilen, wenn sie dicht bei dicht liegen.<br />
d) Krebszellen nicht richtig funktionieren, weil sie der dichteabhängigen Hemmung unterliegen.<br />
e) Krebszellen sich ständig in der M-Phase des Zellzyklus befinden.<br />
c. Krebszellen sich auch dann weiterhin teilen, wenn sie dicht bei dicht liegen. Krebszellen<br />
unterliegen nämlich nicht der dichteabhängigen Hemmung.<br />
6. Die Abnahme der MPF-Menge am Ende der Mitose wird verursacht durch<br />
a) den Abbau der Proteinkinase (Cdk).<br />
b) den Rückgang der Cyclinsynthese.<br />
c) die enzymatische Zerstörung von Cyclin.<br />
d) die DNA-Synthese.<br />
e) die Zunahme des Zellvolumens im Verhältnis zum Genom.<br />
c. die enzymatische Zerstörung von Cyclin. Der Mitose-Promotor-Faktor, kurz MPF, trägt<br />
während der M-Phase zu seiner eigenen Inaktivierung bei, indem er einen Prozess in Gang setzt,<br />
der zur Zerstörung des Cyclins führt.<br />
22/55
7. Eine rote Blutzelle hat eine Lebensdauer von 120 Tagen. Ein Erwachsener besitzt fünf<br />
Liter Blut, und jeder Kubikmillimeter davon enthält 5 Millionen rote Blutzellen. Wie viele<br />
neue Zellen müssen in jeder Sekunde produziert werden, damit die gesamte Population<br />
ersetzt werden kann?<br />
a) 30'000<br />
b) 2'400<br />
c) 2'400'000<br />
d) 18'000<br />
e) 30'000'000<br />
c. 2'400'000. 1 Liter entspricht einem Kubikdezimeter (1dm 3 ), umgerechnet auf Kubikmilimeter<br />
ergibt dies → 1dm 3 = 100mm · 100mm · 10 mm = 1'000'000mm 3 .<br />
Jetzt besitzt ein Erwachsener jedoch nicht 1 Liter sondern 5 Liter Blut, wobei jeder<br />
Kubikmilimeter 5 Mio. Blutzellen enthält:<br />
5l · 5'000'000 Blutzellen · 1000000mm 3 = 25'000'000'000'000 Blutzellen.<br />
Innerhalb der 120 Tage Lebensdauer muss der Körper diese riesige Anzahl an Blutzellen<br />
ersetzen, er hat also 120d · 24h · 60min · 60s = 10'368'000 Sekunden Zeit dafür. Pro Sekunde<br />
ergibt das eine Produktion von etwas mehr als 2'400'000 Blutzellen.<br />
8. Die Struktur bei Pflanzenzellen, die in ihrer Funktion der Teilungsfurche der Tierzelle<br />
entspricht, ist<br />
a) das Chromosom<br />
b) die Zellplatte<br />
c) der Zellkern<br />
d) das Centrosom<br />
e) der Spindelapparat<br />
b. die Zellplatte<br />
9. Bei manchen Lebewesen läuft die Mitose ohne nachgeschaltete Cytokinese ab. Dies führt<br />
zu<br />
a) Zellen mit mehreren Zellkernen.<br />
b) ungewöhnlich kleinen Zellen.<br />
c) Zellen ohne Zellkerne.<br />
d) Zerstörung der Chromosomen.<br />
e) Zellzyklen ohne S-Phase.<br />
a. Zellen mit mehreren Zellkernen. Die Cytokinese ist die Teilung des Cytoplasmas, sodass zwei<br />
Tochterzellen mit gleicher Ausstattung entstehen.<br />
10. Welcher der folgenden Vorgänge läuft in der Mitose nicht ab?<br />
a) Verpackung der Chromosomen<br />
b) Replikation der DNA<br />
c) Trennung der Schwesterchromatiden<br />
d) Ausbildung der Spindel<br />
e) Trennung der Centrosomen<br />
b. Replikation der DNA. Diese findet in der S-Phase der Interphase statt, erst nach der<br />
Interphase folgt die Mitose während der M-Phase.<br />
23/55
11. Die lichtmikroskopische Aufnahme zeigt Zellen an der Spitze einer Zwiebelwurzel, die<br />
sich gerade teilen. Bezeichnen sie jeweils eine Zelle, die sich in den folgenden Stadien<br />
befindet: Interphase, Prophase, Metaphase, Anaphase. Beschreiben sie die wichtigsten<br />
Ereignisse, die sich in jeder dieser Phasen abspielen.<br />
Siehe Seite 18 für den Ablauf der einzelnen Phasen.<br />
Kapitel 13 – Meiose und sexuelle Entwicklungszyklen<br />
1. Beschreibe die Lebenszyklen eines Haplonten, Diplonten, Haplodiplonten (alternativer<br />
Generationswechsel).<br />
Der Wechsel zwischen Meiose und Befruchtung findet bei allen sich sexuell fortpflanzenden<br />
Organismen statt, er unterscheidet sich aber im Zeitablauf der Ereignisse von Art zu Art.<br />
Anmerkung: Fortpflanzung Meiose 2n → 1n (kann nicht bei 1n stattfinden), Mitose 1n → 1n<br />
Entwicklungszyklus eines Diplonten:<br />
Dieser Zyklus ist für Menschen, die meisten Tiere und auch für manche niedere Pflanzen und<br />
Protisten charakteristisch.<br />
Bei Diplonten sind die Gameten die einzigen<br />
haploiden Zellen. Die Meiose findet während der<br />
Bildung der Gameten statt (genauer gesagt führt sie<br />
zur Bildung der Gameten), die sich dann bis<br />
Befruchtung nicht mehr teilen. Die nach der<br />
Befruchtung entstandene diploide Zygote teilt sich<br />
mitotisch und entwickelt sich zu einem vielzelligen<br />
diploiden Organismus (Diplont).<br />
24/55
Entwicklungszyklus eines Haplonten:<br />
Für viele Pilze, niedrigere Pflanzen sowie einige tierähnliche Protisten (z.B. Malariaerreger<br />
Plasmodium) ist der haplontische Entwicklungszyklus charakteristisch.<br />
Nach der Fusion der Gameten (Befruchtung) bildet<br />
sich eine diploide Zygote und es findet sofort eine<br />
Meiose statt. Dies führt zu haploide Zellen, die sich<br />
mitotisch teilen und einen vielzelligen haploiden<br />
Organismus bilden oder als haploide Einzeller leben<br />
(Haplonten). Dieser Haplont bildet seine Gameten<br />
durch Mitose und nicht etwa durch Meiose (!). Die<br />
Zygote ist somit das einzige diploide Stadium beim<br />
Haplonten.<br />
Die Entwicklungszyklen der Diplonten und der Haplonten nennt man einfache<br />
Generationsfolgen. Viele Pflanzenarten durchlaufen jedoch einen dritten Typen von<br />
Entwicklungszyklus, der als Generationswechsel oder genauer als diplohaploider<br />
Generationswechsel bezeichnet wird.<br />
Entwicklungszyklus eines Haplodiplonten:<br />
In diesem Entwicklungszyklus gibt es sowohl diploide als auch haploide vielzellige Stadien.<br />
Das diploide vielzellige Stadium nennt man Sporophyt (2n).<br />
Im Sporophyt entstehen durch Meiose haploide<br />
Zellen, die Sporen. Im Gegensatz zu Gameten<br />
entwickelt sich eine Spore zu einem vielzelligen<br />
Individuum ohne dass sie vorher mit einer anderen<br />
Zelle fusioniert. Die Spore teilt sich mitotisch und<br />
bildet ein vielzelliges haploides Stadium, den<br />
Gametophyten (n).<br />
Im Gametophyten entstehen durch Mitose Gameten.<br />
Das Ergebnis der Befruchtung ist eine diploide<br />
Zygote, die sich dann durch Mitosen zum<br />
Sporophyten der nächsten Generation entwickelt.<br />
Bei diesem Zyklus geht der Sporophyt aus dem<br />
Gametophyt und der Gametophyt aus dem<br />
Sporophyten hervor → der Organismus ist ein<br />
Haplodiplont.<br />
Sporophyt 2n → Meiose → Sporen 1n → Mitose → Gametophyt 1n → Mitose → Gameten 1n<br />
→ Befruchtung → Zygote 2n → Mitose → Sporophyt 2n<br />
2. Karyotyp, homologe Chromosomen, Autosomen, Sexchromosomen: Definiere diese<br />
Begriffe und grenze sie gegeneinander ab.<br />
Karyotyp: Jede menschliche, somatische Zelle (das sind alle Zellen ausser Spermien und Eier)<br />
besitzt 46 Chromosomen. Diese Chromosomen unterscheiden sich anhand ihrer Grösse und der<br />
25/55
Lage ihrer Centromere. Nach Behandlung mit bestimmten Farbstoffen zeigt jedes Chromosom<br />
ein typisches Bandenmuster. Nun liegen die menschlichen Chromosomen paarweise vor. Ordnet<br />
man sie also nach Grösse und Gestalt zu Paaren an, bekommt man eine Darstellung, die<br />
Karyotyp genannt wird.<br />
Homologe Chromosomen: Chromosomen, die ein Paar bilden - also dieselbe Länge, dieselbe<br />
Centromerposition und dasselbe Bandenmuster besitzen - nennt man homologe Chromosomen.<br />
Diese zwei Chromosomen eines Paares tragen Gene für dieselben Erbmerkmale (z.B. das Gen<br />
für die Augenfarbe liegt auf beiden Chromosomen am gleichen Ort, eines vererbt durch den<br />
Vater, das andere durch die Mutter).<br />
Autosomen: Bezeichnet alle Chromosomen ausser die Geschlechtschromosomen X und Y.<br />
Sexchromosomen/Geschlechtschromosomen: Es gibt eine Ausnahme der Regel der homologen<br />
Chromosomen bei menschlichen Somazellen: Die X und Y Chromosomen. Frauen besitzen<br />
zwei X-Chromosomen (XX), Männer ein Y und ein X Chromosom (XY). Da diese<br />
Chromosomen geschlechtsbestimmend sind, nennt man X und Y Chromosomen auch<br />
Geschlechtschromosomen (alle anderen Chromosomen nennt man Autosomen).<br />
3. Beschreibe die Unterschiede zwischen einer mitotischen und einer meiotischen Teilung. Zu<br />
welchen unterschiedlichen Resultaten führen die beiden Teilungswege?<br />
− Die Mitose unterscheidet sich als erstes in der Zahl der Zellteilungen von der Meiose. In der<br />
Mitose gibt es eine Zellteilung, die aus Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase<br />
besteht. Die Meiose besteht aus zwei Zellteilungen, die ebenfalls aus Prophase, Metaphase,<br />
Anaphase und Telophase bestehen (sie werden jedoch zweimal durchlaufen).<br />
− In der Prophase I der Meiose beginnen sich die Chromosomen zu verdichten und die<br />
homologen Chromosomenpaare finden sich zu Paaren zusammen (Synapsis). Jedes<br />
Chromosomenpaar ist als Tetrade angeordnet, die aus vier parallel angeordneten<br />
Chromatiden besteht. An mehreren Stellen (Chiasmata) haben sich die Chromatiden<br />
homologer Chromosomen gekreuzt. Das Crossing-over findet statt. Diesen Vorgang findet<br />
man nur in der Meiose.<br />
− Das Produkt der Meiose sind vier Tochterzellen. Jede besitzt halb so viele Chromosomen<br />
(n) wie die Mutterzelle. Die Tochterzellen sind genetisch weder mit der Mutterzelle noch<br />
untereinander identisch (weil sich in der Anaphase I homologe Chromosomen trennen und<br />
in der Anaphase II dann die Schwesterchromatide).<br />
Die Bedeutung der Mitose ist die Entwicklung eines vielzelligen Organismus aus einer Zygote,<br />
die Produktion der Zellen für das Wachstum und die Gewebeheilung.<br />
Die Bedeutung der Meiose ist die Produktion der Gameten, die Reduktion der<br />
Chromosomenzahl auf die Hälfte und das Sorgen für genetische Variabilität der Gameten.<br />
4. Welche drei Faktoren tragen zur genetischen Variabilität bei der geschlechtlichen<br />
Fortpflanzung bei?<br />
Freie Rekombination der Chromosomen:<br />
In der Metaphase der Meiose I liegen die Chromosomen gepaart in der Metaphaseplatte. Die<br />
Orientierung in Bezug auf die Pole ist zufällig, es bestehen für jedes Paar zwei Möglichkeiten.<br />
Für die Tochterzelle gibt es also eine Chance von 50% das mütterliche oder väterliche<br />
Chromosom eines homologen Chromosomenpaares zu bekommen.<br />
Jeder Gamet repräsentiert eine von allen möglichen Rekombinationen. Die Zahl der möglichen<br />
26/55
Chromosomenkombinationen in den Gameten durch freie Kombination ist 2 n , wobei n die<br />
haploide Chromosomenzahl darstellt. Die Anzahl möglicher Rekombinationen mütterlicher und<br />
väterlicher Chromosomen in den Gameten beim Menschen (n=23) beträgt 2 23 , also ungefähr 8<br />
Millionen!<br />
Der Mensch besitzt 23 Chromosomenpaare, diese sind vergleichbar mit Münzen, die entweder<br />
Kopf oder Zahl anzeigen können. Wirft man nun diese 23 Münzen, jede einzelne mit 2<br />
möglichen Ausgängen, erhält man 2·2·2...·2 (23x) = 2 23 mögliche Kombinationen.<br />
Crossing-over:<br />
Aufgrund der freien Rekombination der Chromosomen bei der Meiose produziert jeder von uns<br />
Gameten mit unterschiedlichen Kombinationen von Chromosomen beider Eltern.<br />
Bis jetzt haben wir angenommen, dass jedes einzelne Chromosom eines Gameten nur<br />
mütterliches oder väterliches Genmaterial enthält. Dem ist aber nicht so. In den Chromosomen<br />
sind Gene mütterlichen und väterlichen Ursprungs kombiniert. Dies geschieht durch Crossingovers,<br />
welche in der Prophase der Meiose I stattfindet.<br />
Hier paaren sich homologe Chromosomen (Synapsis). Diese Paarung ist sehr präzise, homologe<br />
Gene liegen genau Seite an Seite. Das Crossing-over findet statt, wenn sich homologe<br />
Anschnitte zweier NICHT-Schwesterchromatiden berühren (Chiasmata = Stellen, wo sich<br />
Chromatiden aneinander binden und Genmaterial austauschen). Beim Menschen findet dieser<br />
Vorgang im Durchschnitt 2-3 Mal pro Chromosomenpaar statt.<br />
Zufälligkeit der Befruchtung:<br />
Ein weibliches Ei enthält eine von 2 23 möglichen Kombinationen von Chromosomen und wird<br />
von einem Spermium befruchtet, das ebenfalls eine von 2 23 möglichen Kombinationen von<br />
Chromosomen enthält. Es entsteht also eine Zygote, die eine von 2 23 x 2 23 (64 Billionen)<br />
möglichen diploiden Rekombinationen darstellt (noch ohne den Einbezug von Crossing-overs).<br />
Quiz Fragen 13 (S. 290)<br />
1. Eine menschliche Zelle, die 22 Autosomen und ein Y-Chromosom enthält ist<br />
a) eine Somazelle eines Mannes.<br />
b) eine Zygote.<br />
c) eine Somazelle einer Frau.<br />
d) ein Spermium.<br />
e) ein Ei.<br />
d. ein Spermium. Somazellen und Zygote sind diploid, während das Ei kein Y-Chromosom<br />
enthalten kann.<br />
2. Homologe Chromosomen bewegen sich zu den entgegengesetzten Zellpolen einer sich<br />
teilenden Zelle während der<br />
a) Mitose.<br />
b) Meiose I.<br />
c) Meiose II.<br />
d) Befruchtung.<br />
e) binären Spaltung.<br />
b. Meiose I.<br />
27/55
3. Die Meiose II ist einer Mitose ähnlich, weil<br />
a) homologe Chromosomen eine Tetrade ausbilden.<br />
b) vor der Zellteilung DNA-Replikation stattfindet.<br />
c) die Tochterzellen diploid sind.<br />
d) sich die Schwesterchromatiden während der Anaphase trennen.<br />
e) die Chromosomenzahl reduziert wird.<br />
d. sich die Schwesterchromatiden während der Anaphase trennen.<br />
4. Der DNA-Gehalt einer diploiden Zelle in der G1-Phase des Zellzyklus wird bestimmt<br />
(siehe Kapitel 12). Wenn der DNA-Gehalt x beträgt, dann ist der DNA-Gehalt derselben<br />
Zelle in der Metaphase der Meiose I<br />
a) 0.25x.<br />
b) 0.5x.<br />
c) x.<br />
d) 2x.<br />
e) 4x.<br />
d. 2x. Die DNA wird in der S-Phase (gleich nach der G1-Phase) verdoppelt und erst in der<br />
Anaphase der Meiose I (auf die Metaphase folgend) wieder reduziert → 2x.<br />
5. Wenn wir das Schicksal der Zell-Linie aus Frage 4 weiterverfolgen, so ist der DNA-Gehalt<br />
in der Metaphase der Meiose II<br />
a) 0.25x.<br />
b) 0.5x.<br />
c) x.<br />
d) 2x.<br />
e) 4x.<br />
c. x. Die DNA wurde nach der Verdoppelung bisher einmal reduziert. Die nächste Reduktion<br />
erfolgt erst in der Anaphase der Meiose II, deshalb → x.<br />
6. Wie viele verschiedene Kombinationen mütterlicher und väterlicher Chromosomen<br />
können in Gameten von Organismen mit einer diploiden Chromosomenzahl von 8 (2n = 8)<br />
auftreten?<br />
a) 2<br />
b) 4<br />
c) 8<br />
d) 16<br />
e) 32<br />
d. 16. Da 2n = 8 folgt n = 4 → 2 n = 2 4 = 16.<br />
28/55
7. Das direkte Meioseprodukt einer Pflanze ist<br />
a) eine Spore.<br />
b) ein Gamet.<br />
c) eine Zygote.<br />
d) ein Sporophyt.<br />
e) ein Gametophyt.<br />
a. eine Spore. Der Sporophyt (2n) bildet durch Meiose die Sporen (1n). Gameten (1n) werden<br />
vom Gametophyt (1n) durch Mitose gebildet und die Zygote ist kein Zellteilungsprodukt<br />
sondern die Verschmelzung zweier Gameten (Befruchtung).<br />
8. Vielzellige haploide Organismen<br />
a) werden als Sporophyten bezeichnet.<br />
b) erzeugen neue Zellen für das Wachstum durch eine Meiose.<br />
c) produzieren Gameten durch eine Mitose.<br />
d) werden nur in aquatischen Habitaten gefunden.<br />
e) sind das direkte Ergebnis der Syngamie.<br />
c. produzieren Gameten durch die Mitose. Sporophyten sind diploid, neue Zellen für das<br />
Wachstum werden durch Mitose erzeugt und das Ergebnis der Syngamie (Verschmelzung<br />
zweier Gameten) ist eine diploide Zygote.<br />
9. Crossing-over trägt zur genetischen Variabilität bei, da es zum Austausch von<br />
Chromosomenbereichen führt zwischen<br />
a) Schwesterchromatiden eines Chromosoms.<br />
b) Chromatiden nicht-homologer Chromosomen.<br />
c) Nicht-Schwesterchromatiden homologer Chromosomen.<br />
d) nicht-homologen Loci des Genoms.<br />
e) Autosomen und Geschlechtschromosomen.<br />
c. Nicht-Schwesterchromatiden homologer Chromosomen.<br />
10. Im Entwicklungszyklus von Pflanzen findet man ein bestimmtes Stadium, das es bei<br />
Tieren nicht gibt, nämlich<br />
a) Gameten.<br />
b) Zygote.<br />
c) vielzellige Diploide.<br />
d) vielzellige Haploide.<br />
d. vielzellige Haploide.<br />
Kapitel 14 – Mendel und der Genbegriff<br />
1. Warum eigneten sich Erbsen besonders gut für Mendels Erbversuche?<br />
Erbsen sind in vielen Variationen erhältlich: Violette/weisse Blüten, grüne/gelbe Bohnen usw.,<br />
des weiteren ist es einfach sicher zu stellen, dass nur die Individuen miteinander gekreuzt<br />
werden, die man selber kreuzen will (Erbsen sind Selbstbestäuber, dass heisst sie sind zwittrig<br />
und geben ihre Pollen auf die eigene Narbe). Mendel entfernte deshalb die Staubblätter der<br />
Erbsen bevor sie Pollen produzieren konnten und bestäubte danach diese Narben mit Pollen<br />
einer anderen Pflanze (Fremdbefruchtung). Weitere Vorteile von Erbsen sind:<br />
29/55
− die Generationszeit ist relativ kurz<br />
− es entstehen viele Nachkommen<br />
− es lassen sich mit geringem Aufwand grosse Mengen an Versuchspflanzen züchten<br />
− mit Erbsen kann man gezielte Kreuzungsexperimente machen<br />
Mendel verliess sich bei seinen Experimenten immer nur auf eindeutige Merkmale (entweder<br />
oder) und begann seine Züchtungsexperimente immer mit reinerbigen Erbsenrassen. Ein<br />
bisschen Glück war natürlich auch dabei, hätte er nicht Merkmale genommen die<br />
dominant/rezessiv sind, sondern intermediär, hätte er die Gesetze wohl nie gefunden.<br />
2. Die vier Mendelschen Aussagen zur Wirkungsweise eines Gens.<br />
1. Alternative Zustandsformen (Allele) eines Gens bedingen die genetische Variabilität bei<br />
Erbmerkmalen.<br />
Beispielsweise traten zwei Versionen von Blütenfarben auf, eine violette und eine weisse.<br />
Solche alternativen Versionen eines Gens werden als Allele bezeichnet. Mit dem heutigen<br />
Wissen können wir dieses Konzept mit den Chromosomen und der DNA in Verbindung<br />
bringen.<br />
Jedes Gen befindet sich an einem definierten Ort auf einem bestimmten Chromosom. Die DNA-<br />
Sequenz dieses Ortes kann jedoch etwas variieren und somit auch der Informationsgehalt des<br />
Gens. D.h. die beiden Allele, die entweder purpurfarbene oder weisse Blüten bedingen,<br />
stellen zwei DNA-Varianten des Locus für die Blütenfarbe auf einem Erbsenchromosom dar.<br />
2. Für jedes Merkmal besitzt ein Organismus zwei Allele, je eines von jedem Elternteil.<br />
Ein diploider Organismus besitzt homologe Chromosomenpaare, wobei jeweils eines vom Vater<br />
und eines von der Mutter stammt → jeder Genlocus ist zweimal vorhanden. Diese homologen<br />
Loci können nun identische Allele tragen (homozygot: bei reinerbigen Erbsen der Fall) oder<br />
sich unterscheiden (heterozygot).<br />
3. Wenn die beiden Allele unterschiedlich sind, dann wird eines, und zwar das dominante Allel<br />
voll exprimiert. Das andere, das rezessive Allel, zeigt keinerlei Ausprägung.<br />
Deshalb hatten Mendels F1-Pflanzen alle purpurfarbene Blütten, weil das Allel für diese<br />
Variante dominant und das Allel für die weisse Blütenfarbe rezessiv war → dominant-rezessiver<br />
Erbgang.<br />
4. Die beiden Allele für jedes Merkmal segregieren (trennen sich) bei der Gametenbildung.<br />
Eine Eizelle oder eine Spermazelle erhält nur eines der beiden Allele, die in den Somazellen des<br />
betreffenden Organismus noch gemeinsam vorliegen. Auf die Chromosomen bezogen entspricht<br />
diese Trennung oder Segregation der Reduktion der Chromosomenzahl vom diploiden zum<br />
haploiden Satz während der Meiose.<br />
3. Beschreibe die drei Mendelschen Erbregeln. Welche experimentellen Voraussetzungen<br />
waren notwendig, um diese Regeln zu finden? Welche dieser drei Regeln musste<br />
nachfolgend korrigiert werden?<br />
1. Mendel’sche Regel (Uniformitätsregel, Reziprozitätsregel):<br />
In seinen ersten Experimenten kreuzte Mendel reinerbige Erbsenlinien, die sich in einem<br />
Merkmal unterschieden, z. B. große und zwergwüchsige Linien. Als Nachkommen erhielt er<br />
Hybride, die keine Mischung beider Eigenschaften aufwiesen, sondern äußerlich dem<br />
großwüchsigen Elternteil entsprachen. Als Erklärung postulierte er Erbeinheiten, die wir heute<br />
30/55
Gene nennen und die häufig in unterschiedlichen Zustandsformen (Allelen) auftreten. Man<br />
unterscheidet dominante (A) und rezessive (a) Zustandsformen eines Gens, wobei das<br />
dominante Allel die Wirkung des rezessiven Allels unterdrückt und äußerlich in Erscheinung<br />
tritt. Mendel erkannte, dass Gene in normalen Körperzellen gewöhnlich paarweise vorkommen,<br />
sich aber bei der Entstehung der Geschlechtszellen (Ei- und Samenzellen) aufteilen. Jedes Gen<br />
aus einem solchen Paar gelangt dabei in eine andere Geschlechtszelle. Bei der Vereinigung von<br />
Ei- und Samenzelle entsteht wieder ein Genpaar, in dem das dominante Allel (in dem genannten<br />
Fall für die Großwüchsigkeit) die Wirkung des rezessiven (für Zwergwuchs) überdeckt. Diese<br />
Ergebnisse liefern die Grundlage für die 1. Mendel’sche Regel, nach der eine Kreuzung zweier<br />
reinerbiger Eltern, die sich in einem oder mehreren Merkmalen unterscheiden, eine<br />
gleichförmige (uniforme), mischerbige (Aa) Tochtergeneration hervorbringt. Die Uniformität<br />
der Tochtergeneration wird nicht beeinflusst, wenn der jeweils andere Elternteil das betreffende<br />
Merkmal aufweist (reziproke Kreuzung).<br />
2. Mendel’sche Regel (Spaltungsregel, Dominanzregel):<br />
Um zu beweisen, dass es solche Erbeinheiten gibt, kreuzte Mendel die erste Generation der<br />
großwüchsigen Hybriderbsen (Aa×Aa) untereinander. Wie sich dabei herausstellte, tauchten in<br />
der ersten Tochtergeneration wieder kleinwüchsige Erbsenpflanzen (aa) auf, und zwar<br />
kleinwüchsige und großwüchsige im Verhältnis eins zu drei. Daraus zog er den Schluss, dass<br />
sich die Gene zu den Paaren AA, Aa und aa zusammengefunden hatten. Wie er bei weiteren<br />
Kreuzungsexperimenten feststellte, gingen aus den reinerbigen AA-Pflanzen bei<br />
Selbstbestäubung nur große Nachkommen hervor, und die Nachkommen der aa-Exemplare<br />
waren stets klein. Bei der Kreuzung der Aa-Hybride fand sich unter den Nachkommen wieder<br />
das gleiche Zahlenverhältnis von 3 : 1. Aufgrund dieser Versuchsergebnisse beschrieb Mendel<br />
die 2. Mendel’sche Regel, nach der die Nachkommen einer Kreuzung mischerbiger Individuen<br />
nicht mehr gleichförmig sind, sondern ihr äußeres Erscheinungsbild in einem bestimmten<br />
Zahlenverhältnis aufspalten. Dieses Zahlenverhältnis wird sowohl durch die Anzahl der<br />
Merkmale (Genorte), in denen sich die Eltern unterscheiden, als auch durch den Erbgang<br />
beeinflusst. Man unterscheidet einen dominant-rezessiven Erbgang (das dominante Allel<br />
unterdrückt die Wirkung des rezessiven) von einem intermediären Erbgang (die Wirkung beider<br />
Allele ist erkennbar; ein mischerbiges Individuum nimmt eine mittlere Erscheinungsform an).<br />
Bei einem dominant-rezessiven Erbgang spaltet sich das äußere Erscheinungsbild der<br />
Tochtergeneration im Verhältnis 3 : 1 auf falls nur ein Merkmal betrachtet wird. Bei<br />
einem intermediären Erbgang ist das Verhältnis 1 : 2 : 1.<br />
3. Mendel’sche Regel (Regel von der unabhängigen Aufspaltung der Allelenpaare):<br />
Wie weitere Kreuzungsexperimente mit Elterngenerationen zeigten, die sich in zwei oder<br />
mehreren Merkmalen unterschieden, werden die einzelnen Genorte und damit die<br />
Merkmalsausprägungen unabhängig voneinander weitergegeben und sind frei miteinander<br />
kombinierbar. Allerdings gilt die 3. Mendel’sche Regel nur für Gene, die auf verschiedenen<br />
Chromosomen liegen. Zufälligerweise waren die sieben Merkmale der Erbsenpflanzen, die<br />
Mendel untersuchte, auf verschiedenen Chromosomen lokalisiert. Ansonsten hätte er keine<br />
statistische Verteilung der Merkmalskombinationen erhalten.<br />
Voraussetzungen um diese Regeln zu finden:<br />
− Experimente mit reinerbigen Rassen beginnen<br />
− sich nur auf eindeutige Merkmale verlassen (entweder oder)<br />
− Vererbung einer Merkmalsform über drei aufeinanderfolgende Generationen untersuchen:<br />
P-, F1- und F2-Generation (hätte Mendel seine Experimente nach der F1-Generation<br />
abgebrochen, wären ihm die grundlegenden Gesetzesmässigkeiten verborgen geblieben.).<br />
31/55
Die letzte der drei Regeln musste nachfolgend korrigiert werden. Sie gilt nur für Merkmale<br />
welche auf verschiedenen Chromosomen liegen, das hat Mendel noch nicht gewusst.<br />
4. Was ist ein dominantes Allel (Dominanz, Codominanz, Intermediär)? Erkläre am Beispiel<br />
der Blutgruppen 0, A, B, AB.<br />
Dominantes Allel: Allel, dessen Merkmal ausgeprägt wird, wenn ein zweites anderes Allel<br />
vorhanden ist. (Ein rezessives Allel wird nicht ausgeprägt, wenn ein dominantes Allel<br />
vorhanden ist, sondern nur wenn zwei rezessive Allele aufeinander treffen.)<br />
Codominanz: Zwei Merkmale werden nebeneinander auf dem selben Organismus vollständig<br />
ausgeprägt.<br />
Intermediärer Erbgang: Die F 1 -Hybriden zeigen ein gemischtes Erscheinungsbild, das zwischen<br />
den beiden elterlichen Phänotypen liegt (eine Pflanze mit Erbinformationen für rote und weisse<br />
Blüten hätte demnach rosa Blüten).<br />
AB0-Blutgruppensystem:<br />
Die meisten Gene kommen in mehr als zwei allelen Formen vor. Das AB0-Blutgruppensystem<br />
des Menschen ist ein Beispiel für solche multiplen Allele eines einzigen Gens.<br />
Die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 beruhen auf verschiedenen Kombinationen der drei Allele<br />
I A , I B und i. I A und I B sind für die Ausbildung eines bestimmten Kohlenhydrates (entweder<br />
Kohlenhydrat A oder B) zuständig, während i zu keinem der beiden Kohlenhydrate führt. Weil<br />
jedes Individuum zwei Allele trägt, gibt es demzufolge sechs verschiedene Genotypen. Dabei<br />
sind sowohl I A als auch I B dominant über das Allel i → vier Phänotypen:<br />
Individuen mit I A I A oder I A i besitzen somit Blutgruppe A, Individuen mit den Allelen I B I B oder<br />
I B i hingegen Blutgruppe B. Rezessiv Homozygote, ii, haben Blutgruppe 0, da sie weder das<br />
Molekül A noch das Molekül B produzieren. Die Allele I A und I B sind codominant, d.h. in<br />
einem heterozygoten Individuum mit Genotyp I A I B werden beide Allele vollständig exprimiert,<br />
was zur Ausbildung der Blutgruppe AB führt.<br />
Beim AB0-Blutgruppensystem gibt es keine intermediären Typen (keine Mischformen<br />
zwischen A,B oder 0).<br />
5. Durch welche Besonderheiten zeichnet sich ein quantitatives Merkmal aus? Wie lässt sich<br />
der Einfluss der Gene nachweisen? Beschreibe den Erbgang.<br />
Ein quantitatives Merkmal zeichnet sich dadurch aus, dass eine Entweder-Oder-Klassifizierung<br />
nicht möglich ist, weil das Merkmal innerhalb einer Population ein Kontinuum bildet (z.B. die<br />
Körpergrösse → lässt sich durch eine Glockenkurve darstellen, siehe Abb. 14.12). Diese<br />
Variabilität in der Quantität deutet in der Regel auf polygene Vererbung hin, d.h. zwei oder<br />
mehr Gene wirken zusammen um einen Phänotyp hervorzubringen (Gegenteil von Pleiotropie:<br />
eine Reihe von phänotypischen Erscheinungen werden durch ein einzelnes Gen beeinflusst).<br />
Ein solches Beispiel ist die menschliche Hautfarbe. Sie wird (der Einfachheit halber) von drei<br />
Genen beeinflusst. Allele A, B und C stehen dabei für eine dunkle Hautfarbe, a, b und c für eine<br />
helle (A,B und C sind vollständig dominant über a,b und c). Ein Mensch mit Genotyp AABBCC<br />
hätte also sehr dunkle Hautfarbe, während einer mit Genotyp aabbcc sehr helle Hautfarbe hat.<br />
Weil die Allele eine kumulative Wirkung haben würden die beiden Genotypen AaBbCc und<br />
AABbcc gleichermassen (3x dominant) zur Bräunung der Haut beitragen (usw.).<br />
Der Einfluss der Gene lässt sich durch Kreuzungsexperimente nachweisen. Beim Menschen<br />
verwendet man Stammbaumanalysen, da keine Kreuzngsexperimente durchgeführt werden<br />
können. (Beschreibe den Erbgang ?!)<br />
32/55
Quiz Fragen 14 (S. 315-317)<br />
1. Ein Hahn mit grauen Federn paart sich mit einer Henne desselben Phänotyps. Unter<br />
ihrem Nachwuchs sind 15 graue, 6 schwarze und 8 weisse Küken. Was ist die einfachste<br />
Erklärung für die Vererbung des Federkleides bei den Küken? Welche Zusammensetzung<br />
der Nachkommenschaft würden sie aus der Paarung eines grauen Hans mit einer<br />
schwarzen Henne erwarten?<br />
Unvollständige Dominanz (intermediärer Erbgang), dabei sind Heterozygote (Ss) grau. Die<br />
Paarung eines grauen Hahns mit einer schwarzen Henne sollte ungefähr die gleiche Anzahl<br />
grauer und schwarzer Nachkommen erbringen. Ss x Ss → SS : 2 Ss : ss (1 schwarz : 2 grau : 1<br />
weiss)<br />
2. Bei einigen Pflanzen erhält man nach Kreuzung einer reinerbigen, rotblütigen Pflanze mit<br />
einer ebenso reinerbigen weissblütigen Pflanze ausschliesslich Nachkommen mit<br />
rosafarbenen Blüten: RR (rot) x rr (weiss) -> Rr (rosa). Falls die Blütenstellung (axial oder<br />
terminal) genauso vererbt wird wie bei der Erbse (siehe Tabelle 14.1 S. 296), wie ist das<br />
Verhältnis der Genotypen und Phänotypen in der F1-Generation der folgenden Kreuzung:<br />
axial – rot (reinerbig) x terminal – weiss? Wie sind die Ergebnisse der F2-Generation?<br />
Anmerkung: Axial ist die dominante, terminal die rezessive Merkmalsform.<br />
Parental-Kreuzung ist AARR x aarr. Genotyp der F1 ist AaRr, Phänotyp ist ausschliesslich axialrosa.<br />
Genotyp der F2 sind 4 AaRr : 2 AaRR : 2 Aarr : 2 AARr : 2 aaRr : 1 AARR : 1 aaRR :<br />
1 AArr : 1 aarr. Phänotypen sind 6 axial-rosa : 3 axial-rot : 3 axial-weiss : 2 terminal-rosa :<br />
1 terminal-weiss : 1 terminal-rot.<br />
3. Blütenstellung, Stiellänge und Samenform sind drei Merkmale, die Mendel untersucht hat.<br />
Jedes wird von einem unabhängig segregierenden Gen codiert, wobei die Verhältnisse von<br />
Dominanz und Rezessivität wie folgt sind:<br />
Merkmal dominant rezessiv<br />
Blütenstellung axial (A) terminal (a)<br />
Stiellänge lang (L) kurz (l)<br />
Samenform rund (R) runzelig (r)<br />
Man lässt bei einer Pflanze, die heterozygot für alle drei Merkmale ist, Selbsbestäubung<br />
zu. Welches der folgenden Ergebnisse würden sie bei der Nachkommenschaft erwarten?<br />
(Hinweis: Es geht schneller, die Statistikregeln anzuwenden als ein riesiges Punnettsches<br />
Quadrat zu erstellen.)<br />
a) homozygot für die drei dominanten Merkmale<br />
b) homozygot für die drei rezessiven Merkmale<br />
c) heterozygot<br />
d) homozygot für axial und lang, heterozygot für Samenform<br />
a) 1 /64, die Wahrscheinlichkeit für ein Gamet mit nur dominanten Allelen ist 1 /8 (AaLlRr → ½<br />
für A · ½ für L · ½ für R). Zwei solche Gameten verschmelzen nun also mit der<br />
Wahrscheinlichkeit 1 /8 · 1 /8 = 1 /64.<br />
b) 1 /64, gleich wie a).<br />
c) 1 /8, es gibt 8 verschiedene Gametenpaare, die zu heterozygoten Tochterpflanzen führen. Jedes<br />
Gametenpaar hat 1 /64 Wahrscheinlichkeit zu verschmelzen, bei 8 Gametenpaaren ergibt dies<br />
eine gesamte Wahrscheinlichkeit von 8 · 1 /64 = 1 /8.<br />
d) 1 /32, es gibt nur 2 verschiedene Gametenpaare (ALR x ALr und ALr x ALR) → 2 · 1 /64 = 1 /32.<br />
33/55
4. Ein schwarzes Meerschweinchen wird mit einem Albino verpaart. Der Wurf besteht aus<br />
12 schwarzen Jungen. Kreuzt man den Albino mit einem zweiten schwarzen<br />
Meerschweinchen, entstehen 7 schwarze und 5 albinoide Junge. Wie kann man dieses<br />
Ergebnis erklären? Schreiben sie die Genotypen der Eltern, der Gameten und der<br />
Nachkommen auf.<br />
Albino ist ein rezessives Merkmal; schwarz ist dominant. Erste Kreuzung: Eltern BB x bb,<br />
Gameten B und b; Nachkommen alle Bb. Zweite Kreuzung: Eltern Bb x bb; Gameten 1 /2 B, 1 /2 b<br />
und b; Nachkommen 1 /2 Bb (schwarz), 1 /2 bb (albino).<br />
5. Bei der Sesampflanze ist das Allel für die Entstehung einer einzigen Fruchtkapsel (P)<br />
dominant über das Allel für drei Kapseln (p), das Allel für normale Blätter (L) ist<br />
dominant über das für runzlige Blätter (l). Kapselzahl und Blattform werden unabhängig<br />
voneinander vererbt. Bestimmen sie die Genotypen der beiden Elternpflanzen für alle<br />
unten angegebenen Kreuzungsergebnisse:<br />
a) 318 einkapselig/normal, 98 einkapselig/runzlig<br />
b) 323 dreikapselig/normal, 106 dreikapselig/runzlig<br />
c) 410 einkapselig/normal<br />
d) 150 einkapselig/normal, 147 einkapselig/runzlig, 51 dreikapselig/normal, 48<br />
dreikapselig/runzlig<br />
e) 223 einkapselig/normal, 72 einkapselig/runzlig, 76 dreikapselig/normal, 27<br />
dreikapselig/runzlig<br />
a) PPLl x PPLl, PpLl oder ppLl<br />
b) ppLl x ppLl<br />
c) PPLL x jeder der 9 möglichen Genotypen oder Ppll x ppLL<br />
d) PpLl x Ppll<br />
e) PpLl x PpLl<br />
6. Ein Mann mit Blutgruppe A heiratet eine Frau mit Blutgruppe B. Ihr Kind hat<br />
Blutgruppe 0. Wie ist der Genotyp dieser Individuen? Welche anderen Genotypen, und<br />
mit welcher Häufigkeit, erwarten sie bei Kindern dieser Ehe?<br />
Mann I A i; Frau I B i; Kind ii. Andere Genotypen für Kinder sind ¼ I A I B , ¼ I A i, ¼ I B i.<br />
7. Die Gefiederfarben einer Entenart werden durch ein Gen mit drei Allelen bestimmt. Die<br />
Allele H und I sind codominant, das Allel i ist gegenüber den beiden anderen Allelen<br />
rezessiv. Wie viele Phänotypen sind bei den Nachkommen einer Entenschar möglich, die<br />
alle denkbaren Kombinationen dieser drei Allele beherbergen?<br />
Vier.<br />
8. Phenylketonurie (PKU) ist eine rezessive Erbkrankheit. Welche Wahrscheinlichkeit haben<br />
folgende Ereignisse, wenn Vater und Mutter Träger sind?<br />
a) Alle drei Kinder haben normalen Phänotyp.<br />
b) Eines oder zwei Kinder sind PKU-krank.<br />
c) Alle drei Kinder sind PKU-krank.<br />
d) Mindestens ein Kind ist phänotypisch normal. (Beachten sie, dass die Summe der<br />
Wahrscheinlichkeiten 1 ergeben muss.)<br />
a) ¾ x ¾ x ¾ = 27 /64<br />
b) 1 – 27 /64 = 37 /64<br />
c) ¼ x ¼ x ¼ = 1 /64<br />
d) 1 – 1 /64 = 63 /64<br />
34/55
9. Der Genotyp eines F1-Individuums aus einer tetrahybriden Kreuzung lautet AaBbCcDd.<br />
Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten in der F2 folgende Genotypen auf, wenn man eine<br />
freie Kombination dieser vier Gene annimmt?<br />
a) aabbccdd<br />
b) AaBbCcDd<br />
c) AABBCCDD<br />
d) AaBBccDd<br />
e) AaBBCCdd<br />
a) 1 /256<br />
b) 1 /16<br />
c) 1 /256<br />
d) 1 /64<br />
e) 1 /128<br />
10. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird jedes der folgenden Elternpaare den unten<br />
aufgeführten Nachwuchs erhalten (unter der Annahme der freien Segregation der<br />
Allelpaare)?<br />
a) AABBCC x aabbcc → AaBbCc<br />
b) AABbCc x AaBbCc → AAbbCC<br />
c) AaBbCc x AaBbCc → AaBbCc<br />
d) aaBbCC x AABbcc → AaBbCc<br />
a) 1<br />
b) 1 /32<br />
c) 1 /8<br />
d) 1 /2<br />
11. Sowohl Karin als auch Stefan haben ein Geschwister, das unter Sichelzellanämie leidet.<br />
Weder Karin noch Stefan noch einer ihrer Eltern hat diese Krankheit, und keiner von<br />
ihnen wurde jemals auf das heterozygote Merkmal untersucht. Benutzen sie dies<br />
Informationen, um die Wahrscheinlichkeit zu errechnen, mit der ein Kind dieses Paares<br />
Sichelzellanämie bekommen wird.<br />
1 /9<br />
12. Im Jahre 1981 adoptierte eine Familie in Kalifornien eine verirrte Katze mit rundlichen,<br />
nach hinten gebogenen Ohren. Seither wurden Hunderte von Nachkommen dieser Katze<br />
geboren, und Katzenzüchter hofften, diesen Katzentyp reinerbig zu züchten. Nehmen sie<br />
an, sie besässen die erste derartige Katze und wollten daraus eine reinerbige Rasse<br />
entwickeln. Wie würden sie prüfen, ob das Allel für gebogene Ohren dominant oder<br />
rezessiv ist? Wie würden sie reinerbige Katzen selektieren? Wie könnten sie sicher sein,<br />
dass sie reinerbig sind?<br />
Falls das Allel für gebogene Ohren dominant ist, dann ergibt die Kreuzung zwischen der<br />
Original-Mutante mit geraden Ohren Nachkommen sowohl mit gebogenen als auch geraden<br />
Ohren. Falls die Mutation rezessiv ist, dann entstehen aus der Kreuzung gebogen x gebogen<br />
ausschliesslich Katzen mit gebogenen Ohren. Sie wissen, dass die Katzen reinerbig sind, wenn<br />
Paarungen von „Gebogenen“ nur „gebogenen“ Nachwuchs haben. Eine reinerbige Katze mit<br />
gebogenen Ohren ist homozygot (für das dominante Allel, welches zu gebogenen Ohren führt).<br />
35/55
13. Nehmen sie an, eine neu entdeckte, rezessive vererbte Krankheit träte nur bei Menschen<br />
der Blutgruppe 0 auf, obwohl die Krankheit und die Blutgruppe unabhängig voneinander<br />
vererbt werden. Ein gesunder Mann mit der Blutgruppe A und eine gesunde Frau mit der<br />
Blutgruppe B haben ein Kind mit dieser Krankheit. Die Frau ist nun wieder schwanger.<br />
Welche Wahrscheinlichkeit besteht für das zweite Kind, diese Krankheit zu erben?<br />
Nehmen sie an, beide Eltern seien heterozygot für das „krankmachende“ Gen.<br />
1 /16<br />
14. Bei Tigern ist ein rezessives Allel für das Fehlen der Fellpigmente und für das Schielen<br />
verantwortlich. Welcher Prozentsatz der Nachkommenschaft aus der Paarung zweier<br />
normaler Tiger, die heterozygot für dieses Allel sind, wird schielen? Welcher Prozentsatz<br />
wird Albino (ein „weisser“ Tiger) sein?<br />
25% werden schielen; alle schielenden Nachkommen werden auch weiss sein.<br />
15. Beim Mais hemmt das dominante Allel I die Färbung der Körner, während sich in<br />
Pflanzen mit dem homozygot rezessiven Allel i die Körner färben. An einem anderen<br />
Genort führt das dominante Allel P zu purpurnen Körnern, während der rezessive<br />
Genotyp pp zu roten Körnern führt. Welche phänotypische Aufspaltung erwarten sie in<br />
der F1-Generation bei einer Kreuzung zweier Pflanzen, die heterozygot für beide Allele<br />
sind?<br />
Das dominante Allel I ist epistatisch über den P/p-Genort, und daher wird die F1-Generation 9<br />
I_p_ (farblos) : 3 I_pp (farblos) : 3 iiP_ (purpurfarben) : 1 iipp (rot). Insgesamt, 12 farblos : 3<br />
purpurn : 1 rot.<br />
16. Der unten abgebildete Stammbaum zeigt das Auftreten von Alkaptonurie, einer<br />
Erbkrankheit mit biochemischer Grundlage. Die Kranken, in der Abbildung mit dunklen<br />
Kreisen oder Vierecken markiert, sind nicht in der Lage, eine Substanz namens Alkapton<br />
abzubauen, welche den Urin und das Gewebe dunkel färbt. Ist Alkaptonurie auf ein<br />
dominantes oder ein rezessives Allel zurückzuführen? Tragen sie alle Genotypen ein, die<br />
sie mit Sicherheit ableiten können. Welche Genotypen sind für die übrigen Individuen<br />
möglich?<br />
Rezessiv; Georg = Aa, Lena = aa, Sandra = AA oder Aa, Thomas = aa, Hans = Aa, Wilma = aa,<br />
Anna = Aa, Michael = Aa, Daniel/Albert = Aa, Tina = AA oder Aa, Carla = aa, Christoph = AA<br />
oder Aa<br />
17. Ein Mann hat sechs Finger an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuss. Seine Frau und<br />
seine Tochter haben die normale Zahl von Fingern und Zehen. Überzählige Glieder stellen<br />
ein dominantes Merkmal dar. Wie viele der Kinder dieses Paares würden von der Statistik<br />
her überzählige Finger und Zehen zeigen?<br />
1 /2, der Mann muss heterozygot sein (ansonsten würden alle Kinder überzählige Glieder<br />
besitzen). Aa x aa → ½ Aa, ½ aa<br />
36/55
Kapitel 15 – Die chromosomale Grundlage der Vererbung<br />
1. Was sind die Grundlagen für die Chromosomentheorie der Vererbung? Wie verhält sich<br />
diese Theorie zu den von Mendel gefundenen Erbgesetzen? Welche Beobachtungen gibt<br />
es, die nicht mit den Mendelschen Erbgesetzen erklärt werden können?<br />
Die Grundlagen der Chromosomentheorie sind einerseits die Entdeckung/Beobachtung der<br />
Mitose und Meiose, die man mit verbesserten Mikroskopen Ende des 19.Jh langsam zu<br />
verstehen begann, und andererseits die Gesetze von Mendel.<br />
Die Chromosomentheorie entstand und wurde weiterentwickelt als die Biologen die<br />
Übereinstimmungen zwischen dem Verhalten der Chromosomen und Mendels Erbfaktoren (also<br />
den Gene) erkannten und diese dann miteinander kombinierten.<br />
Chromosomen und Gene kommen in diploiden Zellen beide paarweise vor, homologe<br />
Chromosomen und Allele trennen sich während der Meiose und die Befruchtung führt wieder<br />
zu gepaarten Chromosomen und Genen → Erkenntnis: Gene haben bestimmte Genorte (Loci)<br />
auf den Chromosomen und es sind diese Chromosomen, welche getrennt und unabhängig<br />
verteilt werden.<br />
Geschlechtsgebundene Gene (das sind Gene auf den Geschlechtschromosomen X oder Y) und<br />
gekoppelte Gene (liegen auf demselben Chromosom und werden deshalb meist gemeinsam<br />
vererbt) können mit den Mendelschen Gesetzen nicht erklärt werden. Dies zeigten die<br />
Ergebnisse von Morgans Versuchen.<br />
Morgan kreuzte einen weiblichen Wildtyp der Fruchtfliege Drosophila (rote Augen) mit einer<br />
männlichen Mutante (rezessives Allel für weisse Augen). In der F2-Generation beobachtete er<br />
zwar die klassische 3 : 1 Aufspaltung der Phänotypen, das Merkmal für weisse Augen fand sich<br />
jedoch nur bei den Männchen → das Allel für weisse Augen ist ausschliesslich auf dem X-<br />
Chromosom lokalisiert. Weil Weibchen (XX) zwei Genkopien für dieses Merkmal tragen,<br />
während Männchen (XY) nur eine Genkopie besitzen, kommen in der F2-Generation keine<br />
weissaugigen Weibchen vor (sie müssten das rezessive Allel auf beiden X-Chromosomen<br />
tragen, das ist jedoch in der zweiten Tochtergeneration nicht möglich).<br />
Bei einem weiteren Versuch von Morgan führte eine Drosophila-Rückkreuzung (verschiedene<br />
Körperfarbe und Flügelgestalt) nicht wie erwartet zu vier phänotypischen Klassen (1:1:1:1),<br />
sondern hauptsächlich zu den zwei Phänotypen der Eltern → gekoppelte Gene, die auf dem<br />
gleichen Chromosom liegen und daher gemeinsam vererbt werden. Die anderen zwei<br />
„gemischten“ Phänotypen kamen dennoch in geringer Anzahl vor → die Koppelung ist nicht<br />
absolut, Crossing-over ermöglicht die Rekombination der Gene.<br />
Ausserdem lassen sich auch plasmatische Erbfaktoren (extrachromosomale Gene) nicht mit<br />
Mendels Aussagen erklären. In den Mitochondrien sind extrachromosomale Gene auf kleine<br />
ringförmige DNA-Moleküle (Plasmide) vorhanden und bei Pflanzen zusätzlich auch in den<br />
Plastiden (einschliesslich Chloroplasten). Diese cytoplasmatischen Gene werden nicht nach<br />
denselben Regeln auf die Gameten verteilt wie die Chromosomen in der Meiose.<br />
2. Zwei genetische Loci haben auf einer Koppelungsgruppe einen Abstand von 110<br />
Centimorgan. Wie kann man beweisen, dass diese Gene auf einem und nicht auf zwei<br />
Chromosomen lokalisiert sind?<br />
2 Loci, die 50 Centimorgan entfernt sind, haben eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass<br />
zwischen ihnen eine ungerade Zahl an Crossing-overs stattfindet. Das ist derselbe Wert, wie<br />
wenn sie auf zwei verschiedenen Chromosomen wären. Somit kann nicht direkt gesagt werden,<br />
37/55
ob Loci, die 50 oder mehr Centimorgan voneinander entfernt sind, auf demselben Chromosom<br />
liegen.<br />
Erstellt man aber mit Hilfe von Rekombinationsdaten mit anderen Genen eine Kopplungskarte,<br />
kann man beweisen, dass die Loci auf dem gleichen Chromosom liegen. Die 110 Centiomorgan<br />
ergeben sich dann durch Addieren der einzelnen Centimorganabstände (zwischen Genen, die<br />
weniger als 50cM voneinander entfernt und somit auf dem gleichen Chromosom liegen). Der<br />
Beweis erfolgt also schrittweise, liegen sowohl A und B als auch B und C auf dem gleichen<br />
Chromosom, dann liegen auch die Gene A und C auf dem gleichen Chromosom.<br />
3. Wie unterscheidet sich der Erbgang eines Gens, das auf einem Geschlechtschromosom<br />
liegt (XY-Chromosom), von dem eines normalen Gens?<br />
− Die Gene auf dem Y-Chromosom können nur von Vater zu Sohn weitergegeben werden.<br />
− Die Gene auf dem X-Chromosom werden vom Vater nur an die Tochter, von der Mutter an<br />
Tochter und Sohn weitergegeben.<br />
− Bei XY-Chromosomen ist nur teilweise ein Crossing-over möglich.<br />
− Bei rezessiven Allelen (auf dem X-Chromosom) hat eine Frau nur den entsprechenden<br />
Phänotyp, wenn sie homozygot ist.<br />
− Bei einem Mann spricht man nicht von homo- oder heterozygot, sondern hemizygot, bei ihm<br />
wird jedes rezessive Allel (X-Chromosom), das er von seiner Mutter erbt, exprimiert.<br />
Deshalb sind bei Männern geschlechtsgebundene Krankheiten viel häufiger als bei Frauen.<br />
4. Wie lassen sich plasmatische Erbfaktoren von „mendelnden“ Genen unterscheiden?<br />
Plasmatische Erbfaktoren gibt es, da Mitochondrien und bei den Pflanzen zusätzlich Plastide,<br />
wie z.B. Chloroplasten, eigene Gene ausserhalb des Zellkerns besitzen (extrachromosomale<br />
Gene). Diese plasmatische Erbfaktoren weisen eine sogenannte maternale Vererbung auf, sprich<br />
sie werden nicht nach den Regeln der Meiose vererbt und lassen sich dadurch von den<br />
„mendelnden“ Genen unterscheiden. D.h die Zygote bekommt alle diese Mitochondrien<br />
beziehungsweise Plastide vom Cytoplasma der Eizelle → alle plasmatischen Erbfaktoren<br />
werden von der Mutter vererbt.<br />
Quiz Fragen 15 (S. 337)<br />
1. Ein Bluter (Hämophilie ist eine rezessiv und X-chromosomal vererbte Krankheit) hat eine<br />
gesunde Tochter. Diese heiratet einen Mann, der das normale Allel trägt. Wie gross ist die<br />
Wahrscheinlichkeit für eine Tochter oder einen Sohn aus dieser Ehe, Bluterin (Bluter) zu<br />
sein? Welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass alle vier Söhne dieses Paares an<br />
Bluterkrankheit leiden?<br />
0; ½, 1 /16<br />
2. Pseudohypertophe Muskeldystrophie ist eine Krankheit, bei der die Muskeln allmählich<br />
schwinden. Sie tritt nur bei Knaben offensichtlich gesunder Eltern auf und führt schon<br />
im Jugendalter zum Tode. Wird diese Krankheit durch ein dominantes oder rezessives<br />
Allel verursacht? Ist das Vererbungsmuster X-chromosomal oder autosomal? Wie kann<br />
man dies nachweisen? Erklären sie, warum diese Krankheit nur bei Knaben und nicht bei<br />
Mädchen ausbricht.<br />
Rezessiv. Falls die Krankheit dominant vererbt würde, so würde sie zumindest einen Elternteil<br />
des Kindes betreffen, das mit dieser Krankheit geboren wurde. Geht man von der Annahme aus,<br />
dass das Vererbungsmuster X-chromosomal ist müsste ein Mädchen um diese Krankheit<br />
auszubilden die rezessiven Allele beider Eltern geerbt haben. Dies würde ausserordentlich<br />
38/55
selten auftreten, insbesondere weil männliche Individuen mit diesem Allel im Alter eines<br />
Teenagers sterben. → rezessiv / X-chromosomal<br />
3. Rot-Grün-Blindheit wird durch ein X-chromosomales rezessives Allel verursacht. Ein rotgrün-blinder<br />
Mann heiratet eine Frau mit normalem Sehvermögen. Wie gross ist die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass beide eine rot-grün-blinde Tochter bekommen? Wie gross ist die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass ihr erster Sohn rot-grün-blind ist? (Beachten sie die etwas<br />
unterschiedliche Formulierung der beiden Fragen).<br />
¼ für jede Tochter (Chance ½, dass das Kind weiblich ist x ½ Chance für einen homozygot<br />
rezessiven Genotyp); ½ für den ersten Sohn.<br />
4. Eine Wildtyp-Fruchtfliege (heterozygot für graue Körperfarbe und normale Flügel) wird<br />
mit einer schwarzen Fliege mit Stummelflügel gekreuzt. Die Verteilung der Phänotypen<br />
unter den Nachkommen ist folgende: Wildtyp, 778; schwarz-stummelflügelig, 785;<br />
schwarz-normalflügelig, 158; grau-stummelflügelig, 162. Wie gross ist die<br />
Rekombinationsfrequenz der Gene für Körperfarbe und Flügelgestalt?<br />
17% → Rekombinationen : Total (320 : 1883 = 16.99%)<br />
5. Welches Vererbungsmuster eines erblichen Stoffwechseldefekts könnte einen Genetiker<br />
zur Annahme bringen, dass es sich um die Wirkung eines defekten mitochondrialen Gens<br />
handelt?<br />
Die Krankheit würde immer von der Mutter vererbt werden.<br />
6. Ein aneuploides Individuum ist phänotypisch eine Frau, aber ihre Zellen zeigen zwei<br />
Barr-Körperchen. Wie steht die Zusammensetzung der Geschlechtschromosomen dieses<br />
Individuums aus?<br />
XXX. Normalerweise wird eines der beiden X-Chromosomen bei der normalen Zellteilung<br />
(z.B. Wachstum) inaktiviert und liegt dann als Barr-Körperchen in der Zelle vor. Der Grund<br />
dafür ist, dass, falls beide X-Chromosomen aktiv wären, sie doppelt so häufig wie nötig<br />
transkribiert würden. Bei der Eizellenbildung wird das Barr-Körperchen wieder reaktiviert.<br />
7. Bestimmen sie die Reihenfolge der Gene auf einem Chromosom anhand der folgenden<br />
Rekombinationsfrequenzen: A-B, 8 Karteneinheiten; A-C, 28 Karteneinheiten; A-D, 25<br />
Karteneinheiten; B-C, 20 Karteneinheiten; B-D, 33 Karteneinheiten.<br />
D-A-B-C<br />
8. Ungefähr fünf Prozent der Individuen mit Down-Syndrom tragen eine chromosomale<br />
Translokation. In den meisten Fällen ist eine Kopie des Chromosoms 21 an das<br />
Chromosom 14 angefügt. Wie kommt es durch diese Translokation zu Kindern mit Down-<br />
Syndrom?<br />
Das kombinierte 14-21 Chromosom wird sich bei der Meiose wie ein einzelnes Chromosom<br />
verhalten. Wenn ein Gamet das kombinierte 14-21 Chromosom plus eine normale Kopie des<br />
Chromosoms 21 trägt, so wird es zu Trisomie 21 kommen, wenn sich dieser Gamet mit einem<br />
normalen Gameten vereinigt.<br />
9. Häufiger als vollständig polyploide Tiere sind Mosaike, die mit Ausnahme einiger Areale<br />
polyploider Zellen diploid sind. Wie könnte man sich vorstellen, dass diese Individuen mit<br />
einem Mosaik aus polyploiden und diploiden Zellen durch einen Fehler bei der Mitose<br />
entstehen?<br />
An einem bestimmten Punkt der Entwicklung könnte eine Zelle des Embryos nach der<br />
Duplikation seiner Chromosomen keine Mitose mehr durchlaufen. Darauf folgende normale<br />
Zellzyklen würden genetische Kopien dieser tetraploiden Zelle hervorbringen.<br />
39/55
10. Nehmen sie an, die Gene A und B wären gekoppelt und ihre Abstand betrüge 50<br />
Karteneinheiten. Ein für beide Loci heterozygotes Individuum wird mit einem Individuum<br />
gekreuzt, das für beide Loci homozygot rezessiv ist. Wie viel Prozent der<br />
Nachkommenschaft zeigen Phänotypen, die durch Crossing-over-Ereignisse entstehen?<br />
Wie würden sie das Ergebnis interpretieren, wenn sein nicht gewusst hätten, dass A und B<br />
gekoppelt sind?<br />
50% der Nachkommenschaft würde Phänotypen zeigen, die durch Crossing-over bedingt sind.<br />
Das Ergebnis würde das Gleiche sein, wenn in einer Kreuzung A und B nicht gekoppelt wären.<br />
Weitere Kreuzungen mit anderen Genen auf demselben Chromosom würden eine Kopplung der<br />
Gene zeigen, die sich in Karteneinheiten ausdrücken liesse.<br />
11. Bei Drosophila befinden sich die Allele für weisse Augen und für behaarte Flügel (hairy)<br />
auf demselben Chromosom und sind 1.5 Centimorgan voneinander entfernt. Ein<br />
Genetiker stellt in einer bestimmten Fliegenpopulation eine unabhängige Segregation<br />
dieser Gene fest; dass heisst, sie verhalten sich so, als lägen sie auf unterschiedlichen<br />
Chromosomen. Welche Erklärungsmöglichkeiten bieten sich für diese Beobachtung?<br />
Eine Hypothese wäre, dass durch Translokation eines der Gene an ein anderes Chromosom<br />
verlagert wurde.<br />
12. In einer anderen Kreuzung wird eine Wildtyp-Fruchtfliege (heterozygot für graue<br />
Körperfarbe und rote Augen) mit einer schwarzen Fruchtfliege mit purpurfarbenen<br />
Augen gekreuzt. Die Nachkommenschaft zeigt folgende phänotypische Aufspaltung:<br />
Wildtyp, 721; schwarz-purpur, 751; grau-purpur, 49; schwarz-rot, 45. Wie gross ist die<br />
Rekombinationsfrequenz der Gene für Körper- und Augenfarbe? Bei der Beantwortung<br />
dieser und der Frage 4 sollten sie auch das folgende Problem lösen: Welche<br />
Fliegenmutanten (Genotypen und Phänotypen) würden sie miteinander kreuzen, wenn sie<br />
die Reihenfolge der Gene für Körperfarbe, Flügelform und Augenfarbe auf dem<br />
Chromosom bestimmen wollten?<br />
6%. Wildtyp (heterozygot für normale Flügel und rote Augen) x Mutant (rezessiv homozygot<br />
für Stummflügel und purpurne Augen).<br />
13. Eine Raumsonde entdeckt einen Planeten, der von Individuen bewohnt wird, die sich nach<br />
demselben Muster wie die Menschen vermehren. Drei phänotypische Merkmale sind<br />
Körpergrösse (G = gross, g = Zwergenwuchs), Fühler am Kopf (F = mit, f = ohne) und<br />
Schnauzenform (S = gerade, s = hängend). Da diese Kreaturen keine Intelligenz besitzen,<br />
machten die Wissenschaftler von der Erde einige kontrollierte Kreuzungsexperimente,<br />
indem sie verschiedene heterozygote Individuen in Rückkreuzungen untersuchten. Bei<br />
einem grossen Heterozygoten mit Fühlern setzt sich die Nachkommenschaft wie folgt<br />
zusammen: Gross mit Fühlern, 46; Zwergenwuchs mit Fühlern, 7; Zwergenwuchs ohne<br />
Fühler, 42; gross und keine Fühler, 5. Bei einem Heterozygoten mit Fühlern und gerader<br />
Schnauze setzt sich die Nachkommenschaft wie folgt zusammen: Fühler und gerade<br />
Schnauze, 47; Fühler und Hängeschnauze, 2; keine Fühler und Hängeschnauze, 48; keine<br />
Fühler und gerade Schnauze, 3. Bestimmen sie die Rekombinationsfrequenzen für beide<br />
Experimente.<br />
Zwischen G und F, 12%; zwischen F und S, 5%.<br />
40/55
14. Bezugnehmend auf die Information der Aufgabe 13 wurde eine weitere Rückkreuzung mit<br />
einem Heterozygoten für Körpergrösse und Schnauzenform durchgeführt. Die<br />
Nachkommen sind: gross und gerade Schnauze, 40; Zwergenwuchs und gerade Schnauze,<br />
9; Zwergenwuchs und Hängeschnauze, 42; gross und Hängeschnauze, 9. Errechnen sie die<br />
Rekombinationsfrequenzen aufgrund dieser Daten. Benutzen sie die Antwort auf die<br />
Frage 13, um die korrekte Reihenfolge der drei gekoppelten Gene zu bestimmen.<br />
Zwischen G und S, 18%. Die Reihenfolge der Gene ist G-F-S.<br />
Kapitel 16 – Die molekulare Grundlage der Vererbung<br />
1. Mit welchen Experimenten liess sich die stoffliche Identität von Genen aufklären?<br />
Da man nun wusste, dass Gene auf Chromosomen liegen, kamen nur die beiden chemischen<br />
Komponenten der Chromosomen – DNA und Proteine – als genetisches Material in Frage.<br />
Anfänglich favorisierte man noch Proteine, weil zuwenig über die Nukleinsäuren bekannt war,<br />
doch Experimente mit Mikroorganismen (Bakterien und Bakterienviren, sogenannten Phagen)<br />
führten schlussendlich zum Durchbruch für die DNA als Erbmaterial:<br />
− Frederick Griffith machte Experimente mit Streptococcus pneumoniae, einem<br />
Lungenenzündung hervorrufenden Bakterium. Beim mischen eines durch Hitze abgetöteten<br />
pathogenen (d.h. die Krankheit verursachend) Stammes des Bakteriums mit einem lebenden<br />
harmlosen Stamm wandelten sich einige der harmlosen Zellen in die pathogene Form um<br />
(Transformation: genotypische und phänotypische Veränderung durch Aufnahme von<br />
externer DNA). Diese Eigenschaft des Erbmaterials lieferte die Basis für weitere Versuche.<br />
− Oswald Avevery reinigte verschiedene Chemikalien aus den durch Hitze abgetöteten<br />
pathogenen Bakterien und versuchte damit lebende harmlose Bakterien zu transformieren.<br />
Dies gelang jedoch nur mit DNA, dennoch blieb die Fachwelt skeptisch.<br />
− Alfred Hershey und Martha Chase führten darauf Experimente mit einer T2-Phage, einem<br />
Virus der E. coli befällt, durch. Man wusste, dass der Phage T2 wie auch andere Viren sehr<br />
einfach aufgebaut ist (Viren bestehen fast nur aus DNA oder manchmal RNA und einer<br />
schützenden Proteinhülle). Die Frage die sich nun stellte war, welche virale Komponente ist<br />
für die Umprogrammierung der Bakterienzelle verantwortlich?<br />
Sowohl Protein als auch DNA wurden deshalb mit verschiedenen radioaktiven Isotopen<br />
(Sulfat kommt nur in Proteinen vor und Phosphor praktisch nur in der DNA) markiert und<br />
dann E. coli von diesen Phagen infiziert. Durch Zentrifugation trennten sich die Phagen<br />
wieder vom Bakterium und es entstanden zwei Phasen: ein aus freien Phagen bestehende<br />
Überstand und ein Zentrifugat aus E. coli-Zellen. Bei den proteinmarkierten Phagen fand<br />
sich die meiste Radioaktivität im Überstand → das Protein war nicht in die Wirtszelle<br />
gedrungen. Bei den Phagen mit markierter DNA war hingegen das Zentrifugat radioaktiver<br />
→ DNA ist ins Bakterium eingedrungen. Dies war ein äusserst starker Beweis für die DNA<br />
als Erbsubstanz.<br />
− Einen zusätzlichen Beweis lieferte Erwin Chargaff. Er analysierte die<br />
Basenzusammensetzung verschiedener Organismen und fand heraus, dass jede Art ein<br />
unterschiedliches Mengenverhältnis der vier nitrogenen Basen besitzt → molekulare<br />
Diversität des genetischen Materials. Die Anzahl von Adenin und Thymin entspricht sich<br />
jedoch sowie die von Guanin und Cytosin.<br />
Watson und Crick entdeckten schlussendlich anhand von Röntgenbeugungsdaten die<br />
Doppelhelix als DNA-Struktur. Das Watson-Crick Modell erklärte Chargaffs Regel der<br />
Basenpaarung. Dies und auch die Korrelation des DNA-Gehalts einer Zelle vor und nach der<br />
Mitose sprach für die Rolle der DNA als Ermaterial.<br />
41/55
2. Der experimentelle Nachweis der semikonservativen DNA-Replikation (Meselson-Stahl-<br />
Experiment).<br />
Das Meselson- Strahl-Experiment testete drei Modelle von DNA Replikation. Das konservative<br />
Modell, bei dem die ursprünglichen Stränge intakt bleiben und die Neuen ganz aus neu<br />
synthetisiertem Material bestehen. Im Gegensatz dazu steht das semikonservative Modell, bei<br />
dem die beiden Tochtermoleküle je aus einem ursprünglichen und einem neuen Strang bestehen<br />
und beim dispersiven Modell sind alle vier DNA-Stränge aus „alter“ und „neuer“ DNA<br />
aufgebaut.<br />
Meselson und Stahl züchteten E . coli Bakterien während mehreren Generationen in einem<br />
Medium mit dem schweren Stickstoffisotop 15 N. Die Bakterien bauten diesen Stickstoff in ihre<br />
Nukleotide und dadurch in ihre DNA ein. Danach wurden die Bakterien dann in ein Medium<br />
mit dem üblichen, leichteren Stickstoffisotop 14 N transferiert. Jede neue DNA, die in den<br />
Bakterien synthetisiert wurde, sollte dadurch spezifisch leichter sein als die “alte” DNA, welche<br />
im 15 N Medium synthetisiert wurde. Somit konnten Meselson und Stahl nach einer<br />
Zentrifugation der DNA Extrakte die DNA an der unterschiedlichen Dichte unterscheiden. Die<br />
erste Replikation im 14 N Medium produzierte eine Bande von Hybrid ( 15 N - 14 N) DNA. Dieses<br />
Ergebnis eliminierte das konservative Model (danach hätten ja zwei Banden mit 15 N-DNA und<br />
14 N-DNA entstehen sollen.). Eine zweite Replikation produzierte beides, eine leichtere Bande<br />
und die Hybrid-Bande aus der ersten Replikation. → dispersives Modell eliminiert, es müsste<br />
immer nur eine Bande entstehen. Das schon von Watson und Crick vorgeschlagene<br />
semikonservative Modell hatte sich also als richtig erwiesen.<br />
3. Beschreibe den Prozess der DNA-Replikation: Welche Rolle spielen DNA-Polymerase,<br />
Ligase, Primase, Helicase, Single-strand binding proteins, Okazaki-Fragmente?<br />
Die DNA-Replikation beginnt an einem bestimmten Ort, dem „Origin of replication“<br />
(spezifische DNA-Sequenz). Das bakterielle Chromosom besitzt einen einzigen solchen<br />
Ursprungsort (da ringförmig), eukaryotische Chromosomen hingegen über Hunderte oder<br />
Tausende (die Replikation beginnt hier gleichzeitig an vielen Stellen). Proteine, welche die<br />
Replikation einleiten, erkennen diese Sequenz und binden an dieser Stelle an die DNA. Die<br />
zwei Elternstränge werden dort voneinander getrennt und es entsteht eine Replikationsblase mit<br />
zwei Replikationsgabeln (Y-förmige Region an jedem Ende der Replikationsblase).<br />
Die Helicase ist dabei das Enzym, dass die Doppelhelix an der Replikationsgabel aufdreht<br />
(trennt die gepaarten Basen, wodurch die DNA-Einzelstränge erst entstehen). Dann heften sich<br />
sofort Kopien des single-strand binding protein (SSB-Protein) an und verhindern damit, dass<br />
die beiden Stränge sich gleich wieder verbinden. Die Blässchen dehnen sich während der<br />
Replikation solange seitlich in beide Richtungen aus, bis sie fusionieren und so zwei<br />
unabhängige Tochterstränge entstehen.<br />
Die Verlängerung („Elongation“) des neuen DNA-Strangs an der Replikationsgabel wird durch<br />
Enzyme, die DNA-Polymerasen, katalysiert. Einzelne Nukleotide binden an die<br />
komplementären Nukleotide des DNA-Strangs und werden dann durch die DNA-Polymerase<br />
Nukleotide für Nukleotid zu einem neuen Strang verknüpft. Diese Polymerisation verbrauch<br />
jedoch Energie die von den zu verknüpfenden Nukleotiden (eigentlich Nukleosid-Triphosphate,<br />
dazu zählt auch ATP) zur Verfügung gestellt wird. Bindet ein solches Monomer an das Ende<br />
eines wachsenden DNA-Stranges, verliert es zwei seiner drei Phosphatgruppen als<br />
Pyrophosphat. Die darauf folgende Hydrolyse von Pyrophosphat zu anorganischem Phosphat<br />
liefert die benötigte Energie.<br />
Die DNA-Polymerase ist jedoch nur im Stande dem freien 3’-Ende (eines wachsenden DNA-<br />
Stranges) Nukleotide hinzuzufügen. D.h. nur einer der neuen DNA–Stränge kann kontinuierlich<br />
von der 5’ in die 3’-Richtung verlängert werden → „leading strand“/Leitstrang genannt. Der<br />
zweite Strang muss von der Replikationsgabel weg synthetisiert werden (auch 5’ → 3’, da die<br />
42/55
ursprünglichen Stränge antiparalelle sind) → „lagging strand“/Folgestrang. Im Gegensatz zum<br />
leading strand kann der lagging strand nur über viele kurze Sequenzen verlängert werden. Diese<br />
Sequenzen, Okazaki-Fragmente genannt, sind bei Eukaryoten etwa 100 bis 200 Nukleotide<br />
lang. Damit daraus ein intakter DNA-Strang entsteht benötigt es ein weiteres Enzym, die DNA-<br />
Ligase, die schliesslich die Okazaki-Fragmente verbindet.<br />
Eine weitere Besonderheit der DNA-Polymerase ist, dass sie ein neues Nukleotid nur an ein<br />
bereits existierendes Nukleotid anheften kann. Damit nun die DNA-Synthese überhaupt starten<br />
kann benötigt es demnach ein kurzes Segment, welches bereits an den Einzelstrang gebunden<br />
ist. Ein solcher Primer (ca. 10 Nukleotide lang) ist ein kurzes RNA-Segment, welches durch das<br />
Enzym Primase synthetisiert wird (die Primase kann solche RNA-Ketten wie alle RNA-<br />
Polymerasen ohne Primer beginnen). → DNA-Polymerase fügt dem Primer Nukleotide hinzu<br />
und die Primer werden dann später von einer anderen DNA-Polymerase mit DNA ersetzt, bevor<br />
die Ligase die Fragmente verbindet. Beim leading strand braucht es nur einen Primer, beim<br />
lagging strand hingegen für jedes Okazaki-Fragment einen eigenen.<br />
4. Welche Aufgabe haben Telomere?<br />
Da die DNA-Polymerase auch einen Primer nur ersetzen kann, falls vor dem Primer bereits<br />
Nukleotide existieren entsteht beim leading strand ganz am Anfang eine Lücke. Die Folge<br />
wären immer kürzer werdende DNA-Stränge. Prokaryoten haben dieses Problem nicht, weil sie<br />
kreisförmige DNA besitzen, aber was machen Eukaryoten? Die chromosomale DNA von<br />
Eukaryoten hat spezielle Nukleotidsequenzen, sogenannte Telomere, an ihren Enden. Telomere<br />
enthalten keine Gene, stattdessen viele Wiederholungen einer kurzen Nukleotidsequenz<br />
(zwischen 100 und 1000 Wiederholungen) → so werden bei der Verkürzung keine Gene<br />
abgeschnitten. Beim Menschen ist diese Sequenz normalerweise TTAGGG.<br />
Zusätzlich schützt die Telomer-DNA und spezielle mit ihr assoziierte Proteine die freien Enden<br />
vor einem „Verkleben“ mit anderer DNA und verhindert, dass die Zelle den kontrollierten<br />
Zelltod, die Aptose, auslöst → ein freier Doppelstrang am Ende eines DNA-Moleküls würde als<br />
43/55
Doppelstrangbruch gemeldet.<br />
Auf längere Zeit gesehen braucht es dennoch eine möglichkeit die verkürzten Telomere zu<br />
regenerieren. Dies wird durch die Telomerase bewerkstelligt. Sie ist eine reverse Transkriptase,<br />
d.h. sie kann eine DNA-Sequenz anhand einer RNA-Matrize synthetisieren. Dafür trägt sie eine<br />
kurze RNA-Sequenz in ihrem Protein, die als Vorlage für neue Telomersegmente am 3’-Ende<br />
des Telomers dient → der komplementäre Strang wird durch Primase, DNA-Polymerase und<br />
Ligase aufgefüllt. Die Telomerase ist in den meisten Zellen jedoch nicht vorhanden, sondern nur<br />
in den Keimbahnzellen (aus welchen die Gameten hervorgehen). Telomere sind deshalb bei<br />
älteren Individuen kürzer als bei jungen, was eventuell die limitierende Faktoren für unsere<br />
natürliche Lebensspanne sein könnte.<br />
Quiz Fragen 16 (S. 355)<br />
1. Bei seinen Arbeiten mit dem Erreger der Lungenentzündung bei Mäusen fand Griffith,<br />
dass<br />
a) die Proteinhülle pathogener Zellen nichtpathogene Zellen transformieren kann.<br />
b) durch Hitze abgetötete pathogene Zellen Lungenentzündung hervorrufen.<br />
c) ein Stoff aus den pathogenen Zellen in nichtpathogene Zellen übertragen wird und diese<br />
dadurch pathogen werden.<br />
d) die Polysaccaridhülle der Bakterien Lungenentzündung hervorruft.<br />
e) Bakteriophagen ihre DNA in Bakterien injiziert hatten.<br />
c. ein Stoff aus den pathogenen Zellen in nichtpathogene Zellen übertragen wird und diese<br />
dadurch pathogen werden.<br />
2. E. Coli-Zellen werden in 15 N-Medium kultiviert und dann in 14 N-Medium übertragen. Sie<br />
wachsen in diesem Medium zwei Generationen (zwei Zellteilungen), dann wird DNA aus<br />
den Zellen extrahiert und zentrifugiert. Welche Dichteverteilung der DNA würden sie in<br />
diesem Experiment erwarten? Begründen sie ihre Antwort.<br />
a) eine Bande hoher Dichte und eine Bande niedriger Dichte<br />
b) eine Bande mittlerer Dichte<br />
c) eine Bande hoher Dichte und eine Bande mittlerer Dichte<br />
d) eine Bande niedriger dichte und eine Bande mittlerer Dichte<br />
e) eine Bande niedriger Dichte<br />
d. eine Bande niedriger dichte und eine Bande mittlerer Dichte<br />
3. Eine Biochemikerin hatte Moleküle isoliert und gereinigt, die an der DNA-Replikation<br />
beteiligt sind. Wenn sie diese zu DNA gab, so fand DNA-Replikation statt, aber die<br />
gebildeten DNA-Moleküle trugen Defekte. Jedes Molekül bestand aus einem normalen<br />
DNA-Einzelstrang, der mit zahlreichen kurzen Fragmenten von einigen hundert<br />
Nucleotiden gepaart war. Was fehlte offensichtlich in diesem Proteingemisch? Begründen<br />
sie ihre Antwort.<br />
a) DNA-Polymerase<br />
b) DNA-Ligase<br />
c) Nucleotide<br />
d) Okazaki-Fragmente<br />
e) Primer<br />
b. DNA-Ligase<br />
44/55
4. Warum ist die DNA-Synthese des Leit- und des Folgestrangs unterschiedlich?<br />
a) Nur am 5'-Ende eines DNA-Moleküls befindet sich ein Replikationsursprung.<br />
b) Helikasen und einzelstragbindende Proteine greifen am 5'-Ende an.<br />
c) Die DNA-Polymerase kann neue Nucleotide nur an das 3'-Ende eines wachsenden DNA-<br />
Strangs anknüpfen.<br />
d) Die DNA-Ligase arbeitet nur in 3'->5'-Richtung.<br />
e) Die DNA-Polymerase kann nur einen Strang auf einmal replizieren.<br />
c. Die DNA-Polymerase kann neue Nucleotide nur an das 3'-Ende eines wachsenden DNA-<br />
Strangs anknüpfen.<br />
5. Jemand analysiert die Anzahl unterschiedlicher Basen in einem DNA-Stück. Welches<br />
Ergebnis wäre mit den Basenpaarungs-Regeln vereinbar? Begründen sie ihre Antwort.<br />
a) A = G<br />
b) A + G = C + T<br />
c) A + T = G + T<br />
d) A = C<br />
e) G = T<br />
b. A + G = C + T, da A und T sowie G und C in gleichem Masse vorkommen.<br />
6. Der Primer, der zur Initiation eines neuen DNA-Strangs benötigt wird, besteht aus<br />
a) RNA.<br />
b) DNA.<br />
c) einem Okazaki-Fragment.<br />
d) einem Strukturprotein.<br />
e) einem Thymin-Dimer.<br />
a. RNA.<br />
7. Eine eukaryotische Zelle ohne Telomerase würde<br />
a) unfähig sein, DNA aus der umgebenden Lösung aufzunehmen.<br />
b) unfähig sein, fehlgepaarte Nucleotide in den DNA-Tochertersträngen zu identifizieren und zu<br />
korrigieren.<br />
c) bei jeder Replikationsrunde eine schrittweise Verkürzung der Chromosomen erfahren.<br />
d) eine grössere Wahrscheinlichkeit besitzen, in eine Krebszelle umgewandelt zu werden.<br />
e) für jedes angefügte Okazaki-Fragment ein fremdes Nucleotid einbauen.<br />
c. bei jeder Replikationsrunde eine schrittweise Verkürzung der Chromosomen erfahren.<br />
8. Die Elongation (Verlängerung) des Leitstrangs bei der DNA-Synthese<br />
a) verläuft der Replikation entgegengesetzt.<br />
b) läuft in 3'->5'-Richtung.<br />
c) führt zu Okazaki-Fragmenten.<br />
d) ist von der DNA-Polymerase abhängig.<br />
e) braucht keinen Matrizen-Strang.<br />
d. ist von der DNA-Polymerase abhängig.<br />
45/55
9. Der spontane Verlust von Aminogruppen aus dem Adenin führt zu Hypoxanthin, einer<br />
unnatürlichen Base, die gegenüber einem Thymin eingebaut wird. Welche Kombination<br />
von Molekülen könnte die Zelle verwenden, um solch einen Schaden zu reparieren?<br />
a) Nuclease, DNA-Polymerase, DNA-Ligase<br />
b) Telomerase, Primase, DNA-Polymerase<br />
c) Telomerase, Helikase, einzelstrangbindende Proteine<br />
d) DNA-Ligase, Proteine der Replikationsgabel, Adenase<br />
e) Nuclease, Telomerase, Primase<br />
a. Nuclease, DNA-Polymerase, DNA-Ligase (Nucleasen schneiden beschädigte DNA-Segmente<br />
aus dem Strang heraus)<br />
10. Aus der Beobachtung, dass Defekte in den Enzymen der DNA-Reparatur mit an der<br />
Entstehung von Krebs beteiligt sind, lässt sich schliessen, dass<br />
a) Krebs erblich ist.<br />
b) unkorrigierte Veränderungen in der DNA Krebs erzeugen können.<br />
c) Krebs nicht entstehen kann, wenn die Reparaturenzyme korrekt arbeiten.<br />
d) Mutationen gewöhnlich zu Krebs führen.<br />
e) Krebs durch Umweltfaktoren entsteht, welche die DNA-Reparaturenzyme schädigen.<br />
b. unkorrigierte Veränderungen in der DNA Krebs erzeugen können.<br />
Kapitel 17 – Vom Gen zum Protein<br />
1. Beschreibe Experimente, mit denen die „Ein Gen – ein Enzym“-Hypothese von Beadle<br />
und Tatum unterstützt wurde.<br />
In den 30er Jahren untersuchten Beadle und Ephrussi verschiedene Mutationen welche einen<br />
Einfluss auf die Augenfarbe der Drosophila haben. Sie stellten dann die Spekulation auf, dass<br />
verschiedene Mutationen die Pigmentsynthese störten, indem sie die Produktion von Enzymen<br />
verhinderten, welche bei der Pignmentsynthese beteiligt sind.<br />
Beadle und Tatum experimentierten mit verschiedenen Stoffwechselmutanten des<br />
Brotschimmels Neurospora crassa. Der Wildtypstamm benötigt zum Wachsen auf einem<br />
Agarmedium nur Saccharose, anorganischen Salzen und das Vitamin Biotin. Aus diesen<br />
Komponenten dieses „Minimalsmediums“ ist der Schimmel in der Lage alle anderen benötigten<br />
Moleküle selber herzustellen. Im Gegensatz dazu fanden sie auxotrophe Mutanten, welche<br />
unfähig sind sich mittels der Minimalernährung zu entwickeln → können gewisse essentielle<br />
Moleküle nicht aus den Komponenten des Minimalmediums synthetisieren. Die meisten dieser<br />
Auxotrophen überleben jedoch auf einem „Vollmedium“, das alle 20 Aminosäuren und noch<br />
andere wichtige Nährstoffe enthält.<br />
Um den Stoffwechseldefekt in den Auxotrophen zu ermitteln nahmen Beadle und Tatum<br />
wachsende Mutanten und verteilten sie auf verschiedenen Minimalmedien, welche je einen<br />
zusätzlichen Nährstoff enthielten. Dadurch entdeckten sie, dass es drei verschiedene Klassen<br />
von Mutanten gab, die nur mit Hilfe der Aminosäure Arginin wachsen konnten → defekter<br />
Stoffwechselweg für die Synthese von Arginin, wobei jede Klasse ein anderes defektes Gen hat.<br />
Beadle und Tatum vermuteten, dass Arginin in drei Schritten synthetisiert wird. Eine<br />
Vorläufersubstanz wird in Ornithin umgewandelt, dies wiederum zu Citrullin umgesetzt und das<br />
wird schliesslich zu Arginin. Einer der drei Mutantenklassen benötigte Arginin, eine andere<br />
entweder Arginin oder Citrullin und die letzte konnte nach Zugabe von einer der drei<br />
Substanzen – Arginin, Citrullin oder Ornithin – wachsen. Beadle und Tatum schlossen daraus,<br />
46/55
dass jedes der mutierten Gene normalerweise die Produktion eines bestimmten Enzyms bewirkt,<br />
welches für eine dieser drei Argininsynthesestufen notwendig ist und dass die Mutationen der<br />
betroffenen Gene zum Ausfall des entsprechenden Enzyms führen → „Ein Gen-ein-Enzym-<br />
Hypothese“: die Rolle eines Gens besteht darin, die Produktion eines spezifischen Enzyms zu<br />
bewirken.<br />
Diese Hypothese wurde später modifiziert. Nicht alle Proteine sind Enzyme, trotzdem sind<br />
solche Proteine (wie Keratin oder Insulin) Genprodukte. Zudem sind viele Proteine aus zwei<br />
oder mehr verschiedenen Polypeptidketten aufgebaut und jede dieser Untereinheiten wird durch<br />
ein eigenes Gen codiert. → „Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese“.<br />
2. Beschreibe Experimente, mit denen der genetische Code entschlüsselt wurde.<br />
Das erste Codon (Basentriplett) wurde 1961 durch Marshall Nierenberg entschlüsselt. Er<br />
synthetisierte dafür eine künstliche mRNA, indem er lauter Uracilstickstoffbasen<br />
aneinanderhängte → besitzt nur ein einziges Codon UUU, egal wo auch immer die Translation<br />
anfängt. Diese Poly(U)-RNA gab er zusammen mit einer Mischung von Aminosäuren,<br />
Ribosomen und anderen für die Proteinsynthese nötigen Komponenten in ein Reagenzglas.<br />
Dadurch wurde Poly(U) in ein Polypeptid translatiert, das nur eine einzige Sorte von<br />
Aminosäure enthielt, nämlich Phenylalanin. Das Triplett UUU codiert demnach die Aminosäure<br />
Phenylalanin (Phe).<br />
Die Decodierung der Codons AAA, GGG und CCC erfolgten ganz analog dazu, für gemischte<br />
Tripletts (z.B. AUA, CGA) hingegen mussten kompliziertere Techniken eingesetzt werden.<br />
3. Beschreibe die wichtigsten Schritte der Translation. Welche RNA-Typen sind beteiligt und<br />
wie unterscheiden sie sich?<br />
Die Translation ist die eigentliche Proteinsynthese, bei der die Basensequenz (Tripletts) der<br />
mRNA in Aminosäuren übersetzt werden. Sie lässt sich in 3 Abschnitte gliedern:<br />
Initiation: Die mRNA, eine tRNA mit der ersten Aminosäure des zu synthetisierenden<br />
Polypeptids sowie die beiden ribosomalen Untereinheiten werden zusammengebracht. Dann<br />
bindet die kleine ribosomale Untereinheit an eine spezifische Basensequenz am 5’-Ende der<br />
mRNA. Unmittelbar danach folgt das Initiationscodon, AUG, an dem die Translation beginnt.<br />
Die Initiator-tRNA (trägt stets Met) bindet darauf am Initiationscodon. Ist dies geschehen tritt<br />
die grosse Untereinheit des Ribosoms hinzu → es entsteht ein funktionsfähiges Ribosom. Um<br />
diesen Translations-Initiationskomplex zu bilden benötigt die Zelle zusätzlich Energie in Form<br />
eines GTP-Moleküls (Guanosin-Triphosphat).<br />
Elongation: Nun werden eine Aminosäure nach der anderen entsprechend der Basensequenz an<br />
die Start-Aminosäure angehängt. Dies erfolgt, indem das mRNA-Codon an der A-Stelle des<br />
Ribosoms Wasserstoffbrücken zum Anticodon einer tRNA, die die passende Aminosäure trägt,<br />
ausbildet. Dann wird die tRNA durch einen Elongationsfaktor unter Energieverbrauch zur A-<br />
Stelle geschoben. Die grosse ribosomale Untereinheit katalysiert jetzt die Bildung der<br />
Peptidbindung zwischen dem Polypeptid, das an der P-Stelle hängt (anfänglich nur Met), und<br />
der gerade eingetroffenen Aminosäure an der A-Stelle. Dabei trennt sich das Polypeptid von der<br />
P-Stelle gebundenen tRNA. Die tRNA in der A-Stelle wird zusammen mit dem gebundenen<br />
Polypeptid zur P-Stelle verlagert → durch die Wasserstoffbrückenbindung mit der mRNA wird<br />
auch diese um ein Triplett mitverschoben, das nächste Codon rückt somit an die A-Stelle. In der<br />
Zwischenzeit hat sich die „hinterste“ tRNA zur E-Stelle verlagert und verlässt das Ribosom.<br />
Auch dieser Schritt, die sogenannte Translokation, verbraucht Energie.<br />
47/55
Termination: Das letzte Stadium ist erreicht, sobald ein Terminationscodon zur A-Stelle des<br />
Ribosom kommt (UAA, UAG oder UGA). Ein als Release-Faktor bezeichnetes Protein besetzt<br />
das Terminationscodon der mRNA und spaltet das fertige Polypeptid unter Addition eines<br />
Wassermoleküls von der letzten tRNA ab. Das Ribosom gibt die Polypeptidkette und die<br />
mRNA frei und zerfällt anschliessend wieder in seine grosse und kleine Untereinheit.<br />
mRNA: Auch Messenger-RNA genannt, ist die Abschrift der DNA-Vorlage und dadurch die<br />
Anleitung, die den Bauplan des Proteins enthält. Sie transportiert die genetische Botschaft von<br />
der DNA (bei Eukaryoten also aus dem Zellkern) zur Proteinsynthese-Maschinerie (Ribosom).<br />
tRNA: Die Transfer-RNA ist vereinfacht gesagt der Übersetzer des Triplettcodes in die<br />
„Aminosäurensprache“. Ihre Aufgabe ist es Aminosäuren aus dem Cytoplasma zum Ribosom zu<br />
transportieren. Jede tRNA bindet dabei eine spezifische Aminosäuren zu seinem Anticodon,<br />
dennoch gibt es nur 45 tRNAs und nicht 64 wie Codons → einige tRNAs besitzen Anticodons,<br />
die mehr als ein Codon erkennen. Dies liegt daran, dass die Basenpaarung zwischen der dritten<br />
Base des Codons und der entsprechenden Base des tRNA-Anticodons nicht exakt erfolgt<br />
(Wobble-Hypothese). Die tRNA besteht im Gegensatz zur mRNA aus nur etwa 80 Nukleotiden<br />
(mRNA aus mehreren hundert) und faltet sich selbst in eine 3D-Struktur (l-förmig) mit vier<br />
eigenen Basenpaarungsregionen (Wasserstoffbrücken) und drei Schlaufen → Kleeblattstruktur.<br />
rRNA: Die ribosomale RNA bildet zusammen mit Proteinen die Untereinheiten des Ribosoms<br />
(60%). Da die meisten Zellen tausende von Ribosomen enthalten ist sie der häufigste RNA-Typ<br />
in der Zelle.<br />
48/55
4. Erkläre den Unterschied zwischen „missense“, „nonsense“ und „frame shift“ Mutationen.<br />
Auf welche Weise können bei diesen Mutationen Merkmalsänderungen ausgelöst werden?<br />
Punktmutationen, bei denen ein Basenpaar vertausch wurde, sind gewöhnlich „missense“-<br />
Mutationen, d.h. das veränderte Triplett codiert immer noch eine Aminosäure und ist damit ein<br />
sinvolles Codon, allerdings nicht zwingenderweise mit dem „richtigen Sinn“. Es ist eine<br />
stumme Mutation falls sie nicht im codierenden Bereich eines Gens (Intron) erfolgt oder falls<br />
zwar ein verändertes Codon entsteht, dies jedoch in die gleiche Aminosäure übersetzt wird (ist<br />
vorallem dann der Fall, wenn die dritte Base eines Codons betroffen ist). Und auch wenn eine<br />
einzelne falsche Aminosäure in die Polypeptidkette eingebaut wurde, bleibt dies meist ohne<br />
grosse Folgen für das Protein.<br />
Falls sich durch vertauschen eines Basenpaares das Codon jedoch in ein Stoppcodon ändert,<br />
spricht man von einer „nonsense“-Mutation. Die Translation endet somit verfrüht und das<br />
resultierende Polypeptid wird daher kleiner sein als das vom normalen Gen codierte. Nahezu<br />
alle „nonsense“-Mutationen führen zu einem untauglichen Proteine.<br />
Im Gegensatz zu den Punktmutationen gibt es auch noch sogenannte Insertionen oder<br />
Deletionen. Sie entstehen in einem Gen durch Einfügung oder Verlust eines oder mehrerer<br />
Nukleotidpaare und haben für das entstehende Protein oftmals schwerer wiegende<br />
Auswirkungen als die Punktmutationen. Diese Insertionen und Deletionen verändern den<br />
Leseraster der Basentripletts, falls die Anzahl eingefügter oder deletierter Nukleotide kein<br />
Vielfaches von drei ist → „frame shift“-Mutationen. Früher oder später führt diese<br />
Leserasterverschiebung zu einem Nonsense-Triplett, sprich zu einem frühzeitgen Abbruch der<br />
Translation. Liegt das veränderte Basensegment nicht sehr nahe am Ende des Gens, entsteht mit<br />
grosser Sicherheit ein nichtfunktionelles Protein.<br />
Proteine sind direkt für den Phänotyp eines Organismus verantwortlich (z.B. Augenfarbe bei<br />
Drosophila), d.h. falls durch eine Mutation ein Protein nicht mehr richtig hergestellt wird, kann<br />
die Mutation im weniger schlimmen Fall indirekt „nur“ zu einer Merkmalsänderung führen (im<br />
schlimmsten Fall ist die Mutation lethal).<br />
5. Beschreibe den Ames-Test.<br />
Der Ames-Test ist ein Testverfahren, um vorallem chemische Mutagene – Stoffe, die<br />
Mutationen auslösen – auf ihre Wirkungsweise zu untersuchen. Dazu werden Auxotrophen<br />
(Bakterien, die durch Mutationen in einem Gen nicht mehr in der Lage sind, eine bestimmte<br />
Aminosäure zu synthetisieren) auf einem Nährboden aufgebracht, der die für diese Mutanten<br />
überlebensnotwendigen Nährstoffe (Aminosäuren) nicht enthält. Damit nun die Bakterien<br />
überleben können müssen sie eine Rückmutation durchmachen, welche ihnen erlaubt die<br />
benötigte Aminosäure selbst herzustellen.<br />
Man setzt diese Bakterien also dem potentiellen Mutagen aus, indem man beispielsweise ein<br />
damit getränktes Filterpapier auf den Nährboden auflegt. Zum Vergleich wird zusätzlich eine<br />
weitere, das Mutagen nicht enthaltende Kultur angelegt. Bilden sich nach dem anschliessenden<br />
Bebrüten Bakterienkolonien, so sind einzelne Bakterien gewachsen und haben also die<br />
Fähigkeit zur Synthese der entsprechenden Aminosäure zurückerlang (diese Rückmutation tritt<br />
in der Regel auch spontan von selbst auf, jedoch in viel geringerem Masse). Durch Auszählen<br />
der Kolonien rückmutierter Bakterien kann dadurch die mutagene Wirkung des zu testenden<br />
Stoffes ermittelt werden<br />
49/55
Quiz Fragen 17 (S. 382-383)<br />
1. Basenpaar-Substitutionen, welche die dritte Base des Codons betreffen, führen<br />
höchstwahrscheinlich nicht zu Fehlern im Polypeptid. Dies ist der Fall, weil<br />
a) Basenpaar-Substitutionen korrigiert werden, bevor die Transkription beginnt.<br />
b) Basenpaar-Substitutionen auf Introns beschränkt sind und diese Regionen später aus der<br />
mRNA entfernt werden.<br />
c) die meisten tRNAs nur an die ersten zwei Basen des Anticodons stark binden.<br />
d) ein Signalerkennungs-Partikel den Fehler korrigiert, bevor die mRNA das Ribosom erreicht.<br />
e) transkribierte Fehler snRNPs anziehen, die dann Spleissen und Korrektur stimulieren.<br />
c. die meisten tRNAs nur an die ersten zwei Basen des Anticodons stark binden.<br />
2. In eukaryotischen Zellen kann die Transkription beginnen, wenn<br />
a) die zwei DNA-Stränge sich vollständig getrennt haben und der Promotor exponiert ist.<br />
b) die entsprechenden Transkriptionsfaktoren an den Promotor gebunden haben.<br />
c) die 5'-Cap der mRNA entfernt wurde.<br />
d) die Introns von der Prä-mRNA entfernt wurden.<br />
e) DNA-Nucleasen eine Transkriptionseinheit aus der nicht-codierenden DNA<br />
herausgeschnitten haben.<br />
b. die entsprechenden Transkriptionsfaktoren an den Promotor gebunden haben.<br />
3. Welche der folgenden Aussagen über ein Codon ist falsch?<br />
a) Es besteht aus drei Nucleotiden.<br />
b) Es kann zusammen mit anderen Codons für dieselbe Aminosäure codieren.<br />
c) Es codiert nie mehr als eine Aminosäure.<br />
d) Es ist ein Fortsatz am Ende eines tRNA-Moleküls.<br />
e) Es ist die Grundeinheit des genetischen Codes.<br />
d. Es ist ein Fortsatz am Ende eines tRNA-Moleküls.<br />
4. Beadle und Tatum entdeckten verschiedene Klassen von Neurospora-Mutanten, die in der<br />
Lage waren, auf Minimalmedium mit Arginin zu wachsen. Klasse I-Mutanten waren auch<br />
fähig, auf Medium mit entweder Ornithin oder Citrulin zu wachsen, während Klasse II-<br />
Mutanten auf Citrulinmedium wachsen konnten, nicht aber auf Ornithinmedium. Der<br />
Weg der Argininsynthese ist wie folgt:<br />
Vorläufer A → Ornithin B → Citrulin C → Arginin<br />
Aus dem Verhalten ihrer Mutanten konnten Beadle und Tatum schliessen, dass<br />
a) ein Gen für den ganzen Stoffwechselweg codiert.<br />
b) der genetische Code der DNA ein Triplett-Code ist.<br />
c) Klasse-I-Mutanten die Mutationsorte weiter hinten in der Nucleotidkette haben als Klasse-II-<br />
Mutanten und deshalb mehr funktionale Enzyme besitzen.<br />
d) Klasse-I-Mutanten ein defektes Enzym für den Schritt A, Klasse-II-Mutanten ein defektes<br />
Enzym für den Schritt B besitzen.<br />
e) Klasse-I-Mutanten ein defektes Enzym für den Schritt B und Klasse-II-Mutanten ein defektes<br />
für den Schritt C haben.<br />
d. Klasse-I-Mutanten ein defektes Enzym für den Schritt A, Klasse-II-Mutanten ein defektes<br />
Enzym für den Schritt B besitzen.<br />
50/55
5. Ein Anticodon eines bestimmten tRNA-Moleküls ist<br />
a) komplementär zu dem korrespondierenden mRNA-Codon.<br />
b) komplementär zu dem entsprechenden Triplett in der rRNA.<br />
c) der Teil der tRNA, der an eine spezifische Aminosäure bindet.<br />
d) austauschbar. Dies ist abhängig von der Aminosäure, die an die tRNA bindet.<br />
e) katalytisch, wobei die tRNA zu den Ribozymen zu rechnen ist.<br />
a. komplementär zu dem korrespondierenden mRNA-Codon.<br />
6. Welche der folgenden Aussagen stimmt für die Prozessierung der RNA nicht?<br />
a) Exons werden herausgeschnitten und hydrolysiert, bevor die mRNA aus dem Zellkern<br />
austritt.<br />
b) Die Anwesenheit von Introns könnte die Crossing-over-Häufigkeit zwischen Abschnitten<br />
eines Gens, die für Polypeptid-Domänen codieren, erhöhen.<br />
c) Ribozyme sind an dem RNA-Spleissen beteiligt.<br />
d) RNA-Spleissen wird durch Spleissosomen katalysiert.<br />
e) Ein Primärtranskript ist oft viel länger als die reife RNA, die den Kern verlässt.<br />
a. Exons werden herausgeschnitten und hydrolysiert, bevor die mRNA aus dem Zellkern<br />
austritt.<br />
7. Welche der folgenden Aussagen gilt für die Translation sowohl in Pro- als auch in<br />
Eukaryoten?<br />
a) Translation findet gleichzeitig mit der Transkription statt.<br />
b) Das Produkt der Transkription wird sofort translatiert.<br />
c)Das Codon UUU codiert für Phenylalanin.<br />
d) Ribosomen werden durch Streptomycin gehemmt.<br />
e) Das Signalerkennungs-Partikel (SRP) bindet an die ersten 20 Aminosäuren eines bestimmten<br />
Proteins.<br />
c.Das Codon UUU codiert für Phenylalanin.<br />
8. Identifizieren sie unter Benutzung des genetischen Codes in Abbildung 17.4 eine mögliche<br />
5' → 3'-Sequenz von Nucleotiden auf dem DNA-Matrizenstrang, die für eine mRNA<br />
codiert, welche in die Aminosäuresequenz Phe-Pro-Lys übersetzt werden kann.<br />
a) UUU-GGG-AAA<br />
b) GAA-CCC-CTT<br />
c) AAA-ACC-TTT<br />
d) CTT-CGG-GAA<br />
e) AAA-CCC-UUU<br />
d. CTT-CGG-GAA, → Phe = UUU oder UUC. Pro = CCU, CCC, CCA oder CCG. Lys = AAA<br />
oder AAG, die mRNA wäre also von 5’ → 3’ für dieses Beispiel UUC CCG AAG. Der DNA-<br />
Matrizenstrang von 5’ → 3’dazu ist einfach die komplementären Basen (A für U) von rechts<br />
nach links aneinander gereiht (da antiparallel).<br />
51/55
9. Welche der folgenden Mutationen könnte am wahrscheinlichsten eine schädigende<br />
Wirkung auf einen Organismus ausüben? Erklären sie ihre Antwort.<br />
a) eine Basenpaar-Substitution<br />
b) eine Deletion von drei Basen etwa in der Mitte des Gens<br />
c) der Austausch einer einzelnen Base etwa in der Mitte eines Introns<br />
d) der Austausch einer einzelnen Base am Ende der codierenden Sequenz<br />
e) die Insertion einer einzelnen Base dicht hinter dem Startpunkt der codierenden Sequenz<br />
e. die Insertion einer einzelnen Base dicht hinter dem Startpunkt der codierenden Sequenz.<br />
Dadurch wird der Leseraster um eine Einheit (Base) verschoben, wodurch jedes Codon<br />
abgeändert wird.<br />
10. Welche Komponente ist nicht direkt am Vorgang der Translation beteiligt?<br />
a) mRNA<br />
b) DNA<br />
c) tRNA<br />
d) Ribosom<br />
e) GTP<br />
b. DNA<br />
Kapitel 20 – Gentechnik und Genomics<br />
1. Erkläre die DNA-Sequenzierung nach der „dideoxy-Methode“.<br />
Die DNA-Sequenzierung nach der dideoxy-Methode ist eine Kombination verschiedener<br />
Techniken, wie der DNA-Synthese, der DNA-Markierung und einer hochauflösenden<br />
Gelelektrophorese. Zur Sequenzierung eines einzelsträngigen DNA-Fragments wird ein<br />
Reaktionsgemisch mit all den Substanzen zur Synthese der komplementären Stränge hergestellt.<br />
Dazu gehören ein radioaktivmarkierter Primer (der zum 3’-Ende des zu sequenzierenden<br />
Matrizenstrangs passt), DNA-Polymerase und die vier Desoxyribonukleotid-Triphosphate<br />
(dATP, dCTP, dTTP, dGTP). Zusätzlich enthält das Reaktionsgemisch diese vier Nukleotide in<br />
modifizierter Form, nämlich als Didesoxyribonukleotid-Triphosphat (ddATP usw.). → den<br />
ddNTPs fehlt am 3’-C-Atom die Hydroxygruppe, d.h. beim Einbau eines solchen Nukleotids<br />
kann die Kette nicht fortgesetzt werden → Kettenabbruch.<br />
Die Synthese der neuen Stränge startet am Primer und setzt sich solange fort, bis ein Didesoxy-<br />
Nukleotid eingebaut wird. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der Einbau beider<br />
Nukleotidvarianten gleich häufig → es entstehen alle möglichen DNA-Segmentlängen.<br />
Nun werden die neuen DNA-Stränge durch eine besonders lange<br />
Polyacrylamidgelelektrophorese (kann Stränge auftrennen, welche sich nur um ein Nukleotid<br />
unterscheiden) getrennt. → die Didesoxy-Nukleotide sind mit je einer bestimmten Farbe<br />
fluoreszenzmarkiert und es entsteht ein kontinuierliches Bandenmuster. Von diesem<br />
Bandenmuster lässt sich nun leicht die Reihenfolge der Basen des zu sequenzierenden Strangs<br />
an Hand der unterschiedlich Färbung der Reihe nach ablesen (geschieht heutzutage meist<br />
automatisiert).<br />
52/55
2. Was sind Restriktionsenzyme und welche Rolle spielen sie bei der DNA-Technologie?<br />
Restriktionsenzyme sind Enzyme, welche DNA-Moleküle an spezifischen Stellen schneiden.<br />
Von Natur aus schützen sie Bakterien vor fremder DNA (z.B. von Viren oder anderen<br />
Bakterienzellen), indem sie die fremde DNA in einem Vorgang, der sich Restriktion nennt,<br />
zerschneiden. Die meisten dieser Enzyme wirken sehr spezifisch, sprich sie schneiden nur ganz<br />
bestimmte kurze Nukleotidsequenzen an bestimmten Stellen innerhalb dieser Sequenz (eine<br />
solche Erkennungssequenz nennt sich Restriktions-Schnittstelle). Die eigene DNA schützt das<br />
Bakterium vor dem „Restriktionsverdau“ durch Anheftung einer Methylgruppe an Adenin und<br />
Cytosin in den Erkennungssequenzen der Restriktionsenzyme. Beim Schneiden des DNA-<br />
Moleküls entstehen oftmals überstehende Einzelstränge, sogenannte „sticky ends“. Diese kurzen<br />
Fortsätze können Wasserstoffbrücken zwischen komplementären einzelsträngigen Abschnitten<br />
anderer DNA-Moleküle ausbilden, die beispielsweise vom selben Enzym geschnitten wurden.<br />
Restriktionsenzyme kommen vorallem bei der Klonierung zum Einsatz. Denn erst sie<br />
ermöglichen das Einfügen von zu klonierender DNA in einen Plasmidring.<br />
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Restriktionsfragment-Analyse. Dabei wird ein<br />
längeres DNA-Molekül zuerst mit Restriktionsenzymen geschnitten. Die verschieden langen<br />
Fragmente werden danach gelelektrophoretisch aufgetrennt → man erhält ein Bandenmuster,<br />
das charakteristisch für das Ausgangsmolekül und die eingesetzten Restriktionsenzyme ist. So<br />
lassen sich in der Tat viele kleinere DNA-Moleküle von Viren und Plasmiden durch ihr Muster<br />
identifizieren. Oder man vergleicht damit zwei unterschiedliche DNA-Moleküle, die z.B.<br />
verschiedene Allele eines Gens tragen.<br />
3. Was sind Plasmide und wie können sie in der DNA-Technologie eingesetzt werden?<br />
Plasmide sind kleine von den Chromosomen unabhängige DNA-Ringe, die vorallem in<br />
Bakterien vorkommen und relativ wenige Gene, maximal rund zwei Dutzend, tragen. Es gibt<br />
jedoch auch bestimmte Plasmide, die sich reversibel in das Chromosom einer Zelle einbauen<br />
können. Die Replikation eines solchen Plasmiden geschieht normalerweise frei im Cytoplasma<br />
(oder falls in einer Wirtszelle als integraler Bestandteil des Chromosoms). Die Plasmidgene<br />
werden unter normalen Bedingungen nicht für das Überleben oder die Reproduktion des<br />
Bakteriums benötigt. Sie können hingegen von Vorteil sein, wenn Bakterien in ungünstige<br />
Umweltbedingungen geraten, da sie die Rekombination mit anderen verwandten Bakterien<br />
ermöglichen → z.B. Austausch von Resistenzgenen.<br />
Plasmide sind unter anderem ein wichtiger Bestandteil unserer Klonierungsmethoden. Das<br />
ursprüngliche Plasmid wird Klonierungsvektor genannt, d.h. es ist ein DNA-Molekül, das<br />
fremde DNA in eine Zelle einschleusen und sie dort zur Vermehrung bringen kann. Das Plasmid<br />
und das einzubauende Gen oder DNA-Stück werden dazu mit demselben Restriktionsenzym<br />
geschnitten → es entstehen kompatible überstehende Enden, wodurch das geöffnete Plasmid mit<br />
der zu klonenden DNA verklebt. Mit einer Ligase verbindet man diese DNA-Fusion dauerhaft<br />
→ rekombinantes Plasmid. Dies kann nun relativ einfach in ein Bakterium zurückgegeben<br />
werden. Reproduziert sich das Bakterium, repliziert sich auch das rekombinante Plasmid in der<br />
Zelle und auch die auf ihm enthaltenen Gene.<br />
Ausserdem verwendet man Plasmide zur Speicherung der klonierten Gene. Der vollständige<br />
Satz von Tausenden rekominanten Plasmid-Klone, von denen jeder Kopien eines bestimmten<br />
Segments des ursprünglichen Genoms enthält, bezeichnet man als genomische Bibliothek<br />
(„genomic library“).<br />
53/55
4. Wurzelhalsgallentumore entstehen auch dann, wenn unmittelbar nach Kontaktaufnahme<br />
Agrobakterien wieder von der Verwundungsstelle der Pflanze entfernt werden. Bitte<br />
erklären.<br />
Das Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens (und alle Agrobakterien) verfügt über die<br />
Fähigkeit andere Pflanzen zu infizieren, indem es einen Abschnitt seiner eigenen DNA mit Hilfe<br />
eines Plasmids (Ti-Plasmid) in die chromosomale DNA der Wirtspflanze einbaut (das spezielle<br />
darin ist, dass die übertragenen Gene, obwohl sie von einem Bakterium stammen, typisch<br />
eukaryotische Struktur besitzen und so auch in die Pflanzen-DNA eingebaut werden können).<br />
Auch nach dem Entfernen des Bakteriums teilt sich die infizierte Pflanzenzelle um zu Wachsen,<br />
deshalb enthält jede neu daraus entstehende Tochtergeneration die Krankheit hervorrufende<br />
DNA → es bilden sich Wurzelhalsgallentumore.<br />
5. Welchen Vorteil haben Agrobakterien durch das Auslösen eines pflanzlichen Tumors?<br />
Die in die Pflanze eingeschleusten Gene veranlassen die infizierten Pflanzenzellen Opine – das<br />
sind stickstoffreiche organische Verbindungen – zu produzieren. Der Pflanze selber ist es nicht<br />
möglich diese Opine zu verwerten, den in den Pflanzen lebenden Bakterien dienen sie jedoch als<br />
Stickstoff-, Kohlenstoff- und Energiequelle. Jeder Agrobakteriumstamm induziert und verwertet<br />
dabei seine eigenen spezifischen Opine.<br />
6. Wie kann die Fähigkeit der Agrobakterien Tumore auszulösen für eine genetische<br />
Transformation von Pflanzen ausgenützt werden?<br />
Fremde Gene können gentechnisch in eine nicht pathogene Version des Ti-Plasmid eingebaut<br />
und mit dem rekombinanten Plasmid eine Pflanze infiziert werden. Die gewünschten Gene<br />
werden dann in die Chromosomen der Pflanzezellen eingebaut. Der Vorteil dabei ist, dass bei<br />
vielen Pflanzenarten aus einer einzelnen Gewebezelle in Kultur eine vollständige Pflanze<br />
regeneriert werden kann. So ist es möglich Pflanzen herzustellen, die das fremde Gen enthalten,<br />
exprimieren und an die Nachkommen weitergeben ohne dabei Tumore auszubilden. →<br />
gentechnisch veränderte Pflanzen mit beispielsweise Resistenzen gegen Krankheiten und<br />
Verderb.<br />
Quiz Fragen 20 (S. 468)<br />
1. Welches der folgenden Werkzeuge der Gentechnik ist mit einer falschen Anwendung<br />
verknüpft?<br />
a) Restriktionsenzyme – Herstellung von RFLPs<br />
b) DNA-Ligase – ein Enzym, das DNA schneidet und Restriktionsfragmente mit klebrigen<br />
Enden erzeugt<br />
c) DNA-Polymerase – wird bei der Polymerase-Kettenreaktion zur Vermehrung von DNA-<br />
Abschnitten eingesetzt<br />
d) reverse Transkriptase – Herstellung von cDNA aus mRNA<br />
e) Gelelektrophorese - DNA-Sequenzierung<br />
b. DNA-Ligase – ein Enzym, das DNA schneidet und Restriktionsfragmente mit klebrigen<br />
Enden erzeugt<br />
54/55
2. Welche der folgenden Aussagen trifft auf cDNA aus menschlichem Hirngewebe als<br />
Ausgangsmaterial nicht zu?<br />
a) Sie könnte durch die Polymerase-Kettenreaktion vervielfacht werden.<br />
b) Sie könnte dazu benutzt werden, um eine vollständige Genombibliothek anzulegen.<br />
c) Sie wird mithilfe der reversen Transkriptase aus mRNA hergestellt.<br />
d) Sie könnte als Sonde verwendet werden, um Gene von Interesse zu lokalisieren.<br />
e) Ihr fehlen die Introns der menschlichen Gene und daher könnte man diese Gene<br />
wahrscheinlich in Phagen-Vektoren einbauen.<br />
b. Sie könnte dazu benutzt werden, um eine vollständige Genombibliothek anzulegen.<br />
3. Pflanzen lassen sich leichter genetisch manipulieren als Tiere, weil<br />
a) Pflanzengene keine Introns enthalten.<br />
b) mehr Vektoren vorhanden sind, um rekombinante DNA in Pflanzenzellen einzuschleusen.<br />
c) eine somatische Pflanzenzelle sich zu einer vollständigen Pflanze entwickeln kann.<br />
d) rekombinante Gene durch Mikroinjektion in die Pflanze eingebracht werden können.<br />
e) Pflanzenzellen grössere Zellkerne besitzen.<br />
c. eine somatische Pflanzenzelle sich zu einer vollständigen Pflanze entwickeln kann.<br />
8. Welche der folgenden Sequenzen auf einem doppelsträngigen DNA-Molekül könnte als<br />
Schnittstelle für ein bestimmtes Restriktionsenzym dienen?<br />
a) A A G G<br />
T T C C<br />
b) A G T C<br />
T C A G<br />
c) G G C C<br />
C C G G<br />
d) A C C A<br />
T G G T<br />
e) A A A A<br />
T T T T<br />
c. G G C C<br />
C C G G<br />
9. In der Terminologie der Gentechnik bezeichnet der Begriff Vektor<br />
a) ein Enzym, das DNA in Restriktionsfragmente zerlegt.<br />
b) die klebrigen Enden eines DNA-Fragments.<br />
c) einen RFLP-Marker.<br />
d) ein Plasmid, mit dem man DNA in eine lebende Zelle einführen kann.<br />
e) eine DNA-Sonde, um bestimmte Gene zu identifizieren.<br />
d. ein Plasmid, mit dem man DNA in eine lebende Zelle einführen kann.<br />
55/55