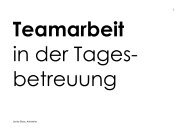Kennzahlen - Bildung und Betreuung
Kennzahlen - Bildung und Betreuung
Kennzahlen - Bildung und Betreuung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ressort Schulen<br />
ANHANG ZUM EVALUATIONSBERICHT<br />
SCHUL- UND FAMILIENERGÄNZENDE<br />
TAGESSTRUKTUREN FÜR SCHÜLERINNEN<br />
UND SCHÜLER IM KANTON BASEL-STADT<br />
Teil 1: Ergebnisse der Gruppendiskussionen<br />
Dorothee Schaffner, Fachhochschule für Soziale Arbeit<br />
Teil 2: Vollkostenberechnungen der einzelnen Tagesbetreuungsangebote<br />
Mirjam Schmidli, Erziehungsdepartement Basel-Stadt<br />
Basel, September 2003
Literaturverzeichnis Anhang<br />
1 Einleitung.............................................................................................................................4<br />
Teil 1: Ergebnisse der Gruppendiskussionen (Dorothee Schaffner)..........................................5<br />
2 Auswertung der Erfahrungen mit integrierten Tagesschulen auf der Primarstufe , ............5<br />
3 Auswertung der Erfahrungen der Tagesschulangebote im Kleinklassenbereich Primar-<br />
<strong>und</strong> Orientierungsstufe , ....................................................................................................13<br />
4 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesbetreuungsstrukturen an einer<br />
Heilpädagogischen Schule ...............................................................................................21<br />
5 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesstrukturen an den Orientierungsschule<br />
Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel , ...............................................................................................26<br />
6 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesbetreuungsstrukturen an den<br />
Orientierungsschule Wasgenring <strong>und</strong> Gellert , ..................................................................34<br />
7 Auswertung der Erfahrungen der AnbieterInnen von Tagesheimen für Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen......................................................................................................................41<br />
8 Auswertung der Erfahrungen von AnbieterInnen von Mittagstischangeboten ................46<br />
9 Auswertung der Erfahrungen mit Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorten, Lukasclub <strong>und</strong> Schülerclubs ,<br />
...........................................................................................................................................58<br />
10 Auswertung der Diskussionen mit Vertreterinnen <strong>und</strong> Vertretern diverser Interessen-<br />
<strong>und</strong> Fachgruppen ..............................................................................................................63<br />
11 Verteilung der Angebote auf die Teilregionen im Kanton Basel-Stadt ............................76<br />
12 Leitfragen: Qualitative Befragung der einzelnen Angebote .............................................81<br />
13 Leitfragen zur Befragung der Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen...........................................82<br />
Teil 2: Vollkostenberechnungen der einzelnen Tagesbetreuungs-angebote (Mirjam Schmidli)<br />
...........................................................................................................................................84<br />
14 Vergleich der Angebotstypen aus ökonomischer Sicht....................................................84<br />
15 Vorbemerkungen...............................................................................................................84<br />
16 Kosten der Mittagstischangebote .....................................................................................96<br />
17 Kostenvergleich zwischen den Mittagstischangeboten..................................................104<br />
18 Kosten des Schülerclubs.................................................................................................105<br />
19 Kosten des Schülerhorts Bläsi-Krippe ............................................................................107<br />
20 Kosten Tagesschule PS Regelklasse Niederholz..........................................................109<br />
21 Kosten Tagesschule PS Regelklasse Kleinhüningen ....................................................111<br />
22 Kosten Tagesschule OS Regelklasse Grendelmatten...................................................113<br />
23 Kosten Tagesschule OS Regelklasse Hebel..................................................................115<br />
24 Kosten der Tagesbetreuung OS Wasgenring (bisher)...................................................117<br />
25 Kostenabschätzung für künftiges Modell Tagesbetreuung OS im Wasgenring (Plan) .119<br />
26 Kosten Tagesbetreuung OS Gellert................................................................................121<br />
27 Kostenvergleich zwischen Tagesstrukturen im Regelschulbereich...............................123<br />
28 Kosten Tagesschule PS KKL Bachgraben.....................................................................124<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
2
29 Kosten Tagesschule PS KKL Richter-Linder I................................................................126<br />
30 Kosten der Tagesschule OS KKL Wettstein (bisher) .....................................................128<br />
31 Kostenabschätzung der Tagesschule OS KKL Wettstein (Plan)...................................130<br />
32 Kosten Tagesschule OS KKL Geller (bisher) .................................................................132<br />
33 Kostenabschätzung der Tagesbetreuung OS KLL Gellert (Plan)..................................134<br />
34 Kosten der Tagesbetreuung HPS Ackermätteli .............................................................136<br />
35 Kostenvergleich der Tagesbetreuungsangebote im sonderpädagogischen Bereich....138<br />
36 Kontaktadressen .............................................................................................................139<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
3
1 Einleitung<br />
Die Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003) untersucht den Ist-Zustand bezüglich Tagesstrukturen<br />
für Schulkinder <strong>und</strong> liefert Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Empfehlungen zur Weiterentwicklung des<br />
bestehenden Gesamtangebots.<br />
Zahlreiche Gruppendiskussionen mit AnbieterInnen <strong>und</strong> Verantwortlichen von<br />
Tagesstrukturen dienten dazu, die spezifischen Merkmale der unterschiedlichen Angebote zu<br />
erfassen: z.B. die Konzepte, den Umfang, die Verknüpfbarkeit mit andern Strukturen, die<br />
regionale Verteilung, den materiellen, räumlichen <strong>und</strong> personellen Aufwand sowie die<br />
effektiven <strong>und</strong> kalkulatorischen Vollkosten der Angebote. Ebenso wurden Gruppendiskussionen<br />
mit Fachpersonen <strong>und</strong> InteressenvertreterInnen durchgeführt. Diese liefern<br />
weitere Hinweise auf wahrgenommene Bedürfnisse bezüglich Tagesbetreuungsstrukturen.<br />
Ebenso konnte die gewünschte Stossrichtung hinsichtlich des künftigen Gesamtmodells auf<br />
diese Weise ermittelt werden.<br />
Die umfangreichen Ergebnisse sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im<br />
Evaluationsbericht enthalten, sondern werden an dieser Stelle der Öffentlichkeit zugänglich<br />
gemacht. Sie dienen der weitern Vertiefung in die Thematik <strong>und</strong> liefern wertvolle Hinweise für<br />
die Ausgestaltung <strong>und</strong> Weiterentwicklung der Angebotspalette.<br />
Der Anhang gliedert sich in zwei Teile: Der erste Teil enthält die qualitativen Ergebnisse der<br />
zahlreichen Gruppendiskussionen, welche mit Vertreterinnen <strong>und</strong> Vertretern der<br />
bestehenden Angebote sowie mit Personen aus Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen durchgeführt<br />
wurden. Dieser Teil wurde von der Auftragnehmerin der Evaluation – Frau Dorothee<br />
Schaffner, Fachhochschule für Soziale Arbeit beider Basel – durchgeführt. Der zweite Teil,<br />
welcher intern von Frau Mirjam Schmidli, Stab Schulen bearbeitet wurde - enthält die<br />
quantitativen Ergebnisse, d.h. die ausführlichen Instrumente <strong>und</strong> Daten zu den<br />
Vollkostenberechungen der Angebote.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
4
Teil 1: Ergebnisse der Gruppendiskussionen (Dorothee Schaffner)<br />
2 Auswertung der Erfahrungen mit integrierten Tagesschulen auf<br />
der Primarstufe 1,2<br />
2.1 Profil: Tagesschule an der Primarstufe als schulintegrierte<br />
Tagesbetreuungsstruktur<br />
Bereits seit 1988 besteht in Kleinbasel eine Tagesschulprojekt auf der Primarschulstufe. Seit<br />
1996 bestehen an zwei Standorten (Kleinhüningen, Rektorat Primarschule Kleinhühnigen<br />
<strong>und</strong> Niederholz, Rektorat der Schulen Riehen <strong>und</strong> Bettingen) je eine Tagesschule für je zwei<br />
Klassenstufen mit ungefähr gleicher Struktur, aber je eigener Identität.<br />
Tagesschulen stellen ein umfassendes <strong>und</strong> ganzheitliches Konzept dar, welches Schule <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong> räumlich <strong>und</strong> konzeptionell integriert. Durch diese enge Verzahnung von<br />
Unterrichtstätigkeit <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> – welche beide von den Lehrkräften übernommen werden<br />
– ergeben sich neben organisatorischen <strong>und</strong> strukturellen vor allem pädagogische Vorteile<br />
(vgl. Binder, Tuggener, Mauchle, 2000) 3 . Tagesschulen ermöglichen neben dem normalen<br />
Unterricht zahlreiche Lernsituationen, um soziale <strong>und</strong> kognitive Kompetenzen zu erweitern<br />
(z.B. durch klassenübergreifende Projekte, Flexibilität, ganzheitliche Lernumwelten,<br />
zahlreiche Gelegenheiten sozialen Lernens etc.). Die Möglichkeit, sich in wechselnden Rollen<br />
zu erleben, bietet die Gr<strong>und</strong>lage für tragfähige Beziehungen <strong>und</strong> ein positives erzieherisches<br />
Klima. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung der<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>und</strong> zur Förderung der Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration.<br />
Aus der Perspektive der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bietet die Tagesschule eine<br />
Tagesstruktur, welche sich durch ein hohes Mass an Konstanz <strong>und</strong> Kontinuität positiv auf das<br />
Lernen <strong>und</strong> Erleben in der Schule auswirkt (keine unnötigen Schnittstellen, Entstressung des<br />
Tagesablaufs, verlässliche Strukturen bieten Sicherheit). Aus der Sicht erwerbstätiger Eltern<br />
bietet die Tagesschule – im Vergleich zu andern Angeboten – die umfassendste<br />
Tagesbetreuungsstruktur. Nicht abgedeckt ist dabei allerdings die Schulferienzeit.<br />
1 Die Erfahrungen der TagesschulanbieterInnen auf der Primarstufe wurden einerseits mittels eines qualitativen<br />
Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen Treffen abgegeben worden ist, ermittelt. Diesen haben je<br />
eine Lehrperson der Primartagesschule Kleinhüningen <strong>und</strong> Niederholz, Riehen, ausgefüllt zurückgesandt.<br />
Andererseits wurde mit den AnbieterInnen eine Gruppendiskussion zu relevanten Fragestellungen<br />
(Fokusgruppen-Methode) durchgeführt. Im Folgenden werden die ausgewerteten Erfahrungen aus den<br />
qualitativen Fragebögen sowie den Gruppendiskussionen dargestellt. Der Bericht wurde von VertreterInnen<br />
der beiden Tagesschulen verifiziert.<br />
2 Teilnehmende an der Gruppendiskussion waren VertreterInnen folgender Tagesschulangebote auf der<br />
Primarstufe: Rektorin der Schulen von Riehen <strong>und</strong> Bettingen sowie eine Lehrerin Tagesschule Niederholz,<br />
Rektor der Primartagesschule Kleinbasel sowie eine Lehrerin der Primartagesschule Kleinhüningen.<br />
3 Binder, H.-M., Tuggener, D. & Mauchle, M. (Eds.). (2000). Handbuch für die Planung <strong>und</strong> Realisierung öffentlicher<br />
Tagesschulen. Zürich: Werd Verlag.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
5
7.30 Uhr<br />
16.30 Uhr<br />
Auffangzeit , Freizeit<br />
Unterrichtszeit<br />
Mittagszeit<br />
Unterrichtszeit<br />
Aufgabenzeit<br />
Auffangzeit, Freizeit/Kurse<br />
Quelle: (Binder et al., 2000)<br />
Tagesschulen sind in der Regel während der ganzen Woche – mit Ausnahme am<br />
Mittwochnachmittag – geöffnet. Das Angebot setzt sich aus Kern- <strong>und</strong> Blockzeiten sowie<br />
Auffangzeiten zusammen. Üblicherweise werden auch Aufgabenzeiten angeboten. Innerhalb<br />
der Auffangzeit wählen die Eltern selbst, wann die Kinder kommen oder gehen können<br />
Tagesschulen orientieren sich am Normalitätsprinzip, d.h. an Regelschulen.<br />
Dementsprechend sind die Unterrichtszeiten den jeweiligen kantonalen Gesetzen angepasst,<br />
ebenso entspricht die Klassengrösse <strong>und</strong> Ausbildung der Lehrkräfte diesen Gr<strong>und</strong>lagen.<br />
Als Zielgruppe richtet sich das Angebot gr<strong>und</strong>sätzlich an Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, welche<br />
eine Regelklasse besuchen könnten, aber einen höheren <strong>Betreuung</strong>sbedarf haben (Kinder<br />
voll erwerbstätiger Eltern oder Alleinerziehender, hoher Bedarf an einer lernförderlichen,<br />
konstanten Lernumgebung), <strong>und</strong> an Eltern, die den schulischen Ansatz der Tagesschulen<br />
bevorzugen.<br />
Durch ihren ganzheitlichen Ansatz haben Tagesschulen ein begrenztes Potential, auch<br />
verhaltensauffällige oder fremdsprachige Kinder zu integrieren. Der zunehmende Bedarf an<br />
Plätzen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit spezifischen Problemen im Sozial- <strong>und</strong><br />
Verhaltensbereich kann heute Tagesschulen an Grenzen bringen <strong>und</strong> führte in den letzten<br />
Jahren dazu, dass die Klassen bewusster zusammengesetzt wurden, um die Tragfähigkeit<br />
einer Klasse garantieren zu können. Insofern kann das aktuelle Tagesschulangebot in Basel<br />
eigentlich nur einen kleinen Teil von Kindern mit spezifischen Problemen aufnehmen.<br />
Im Folgenden werden einzelne Teilbereiche der Tagesschulen genauer beleuchtet, um die<br />
spezifische Qualität, die Chancen, die Grenzen sowie die Entwicklungspotentiale auszuloten.<br />
2.2 Kernangebot einer Tagesschule auf der Primarstufe: Unterricht,<br />
<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung in einem<br />
Ein besonderes Merkmal des Tagesschulkonzepts ist die enge Verzahnung von<br />
Unterrichtstätigkeit, <strong>Betreuung</strong>saufgaben <strong>und</strong> Verpflegung. Dies ermöglicht es, die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler aus wechselnden Perspektiven ganzheitlich wahrzunehmen <strong>und</strong><br />
mit ihnen in unterschiedlichen Situationen in Kontakt zu treten, was sich auf den ganzen<br />
Betrieb positiv auswirkt <strong>und</strong> eine optimale individuelle Förderung ermöglicht. Für die Kinder<br />
schafft diese Struktur Konstanz <strong>und</strong> Kontinuität <strong>und</strong> dadurch Verlässlichkeit.<br />
Ein weiterer Vorteil der Verzahnung von <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Lehre besteht darin, dass die<br />
Unterrichtszeiten flexibler abgehalten werden können <strong>und</strong> natürlicher Raum für<br />
projektorientiertes Arbeiten besteht. Die <strong>Betreuung</strong> ausserhalb des Unterrichts kann ebenso<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
6
flexibel gestaltet werden. Eine Mischung zwischen angeleiteter <strong>und</strong> selbst bestimmter Freizeit<br />
hat sich bisher bewährt.<br />
In den beiden Primartagesschulen übernehmen die Lehrkräfte neben dem Unterrichten auch<br />
<strong>Betreuung</strong>saufgaben während der unterrichtsfreien Zeit über Mittag <strong>und</strong> am Nachmittag. Die<br />
je zwei Klassen pro Standort (z.B. in Riehen gegenwärtig 1. <strong>und</strong> 4. Klasse) stehen je drei<br />
Lehrkräfte zur Verfügung. Die enge Zusammenarbeit sowie die Doppelrolle der Lehr-<br />
/<strong>Betreuung</strong>spersonen erfordert hohes Engagement von den Lehrkräften <strong>und</strong> die Bereitschaft<br />
zu intensivierter Teamarbeit.<br />
2.3 Essen<br />
Das Essen wird bei beiden Tagesschulen von KöchInnen in der Schulküche selbst zubereitet<br />
<strong>und</strong> abgegeben. Beim Essen wird – mit Rücksicht auf Kinder- <strong>und</strong> Elternwünsche – auf eine<br />
saisongerechte, kinderfre<strong>und</strong>liche Ernährung geachtet.<br />
Die Kinder helfen zwar beim Tischdecken <strong>und</strong> Abwaschen im Rahmen von Ämtchen mit, das<br />
Küchenpersonal wird aber nicht mit <strong>Betreuung</strong>saufgaben betraut. Für die <strong>Betreuung</strong> der<br />
Kinder während der Mahlzeiten sind die Lehrpersonen zuständig. Die gemeinsamen Essen<br />
(„Mittagessen am Familientisch“, Znüni <strong>und</strong> Zvieri) sowie die Rituale r<strong>und</strong> ums Essen stellen<br />
wichtige Eckpunkte im Angebot der Primartagesschulen dar <strong>und</strong> werden von den Lehrkräften<br />
betreut.<br />
2.4 Zielpublikum <strong>und</strong> aktuelle NutzerInnen<br />
Die beiden Tagesschulen auf der Primarstufe richten ihr Angebot gr<strong>und</strong>sätzlich an alle Eltern<br />
von Kindern zwischen der 1. <strong>und</strong> 4. Primarschulklasse, welche die Regelschule besuchen<br />
können <strong>und</strong> ein ganzheitliches pädagogisches <strong>Betreuung</strong>sangebot wünschen. Allerdings wird<br />
bei der Auswahl ein Schwerpunkt auf sozial schwächere <strong>und</strong> allein erziehende Eltern gelegt.<br />
Bei der Verteilung der aktuellen NutzerInnen zeigt sich nach Aussage der TeilnehmerInnen<br />
der Gruppendiskussion folgendes Bild: Ein grosser Prozentsatz der Eltern ist allein<br />
erziehend. Ferner sind Kinder von Schweizer Eltern bzw. von Eltern aus Mischehen<br />
überdurchschnittlich, Kinder anderer Nationalitäten unterdurchschnittlich vertreten. Kinder<br />
nichtschweizerischer Nationalität, welche die Tagesschulen besuchen, gehören eher der<br />
Mittelschicht an.<br />
Laut Aussagen der Tagesschulverantwortlichen ist von Seiten der Eltern, Lehrkräfte <strong>und</strong> des<br />
Schulpsychologischen Dienstes sowie von der Abteilung Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutz (AKJS) in<br />
den letzten Jahren die Nachfrage nach Plätzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen <strong>und</strong><br />
Schwierigkeiten (Kinder mit Lernschwierigkeiten, mit sozialen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten<br />
u.a.) gestiegen. Darunter waren zum Teil auch Kinder, welche eigentlich eine<br />
Kleinklasse oder Heilpädagogische Sonderschule besuchen sollten, deren Eltern das<br />
Einverständnis dazu aber nicht gegeben haben. Ebenso erfolgten vermehrt Anfragen<br />
während der Primarschulzeit aufgr<strong>und</strong> heilpädagogischer Abklärungen.<br />
Die Tagesschule mit ihren ganzheitlichen Möglichkeiten wird aus dieser Perspektive als<br />
geeignete Schul- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>sform angesehen, um Kindern mit spezifischen schulischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Schwierigkeiten eine Integrationschance zu vermitteln. Die zunehmende<br />
Nachfrage des Angebots für „schwierige Fälle“ hat aber Folgen für die Primartagesschulen.<br />
Da die Primartagesschule eine Regelschule darstellt mit den entsprechenden Bedingungen<br />
der Volksschule (Klassengrösse 25 SchülerInnen, keine heilpädagogische Ausbildung der<br />
Lehrpersonen), können Kinder mit spezifischen Bedürfnissen nur beschränkt aufgenommen<br />
werden. Zu viele Kinder mit Schwierigkeiten gefährden zudem die Tragfähigkeit der<br />
Lerngruppe <strong>und</strong> führen zur Überforderung der Lehrpersonen <strong>und</strong> der SchülerInnen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
7
Eine bewusste Abgrenzung gegenüber Kleinklassen <strong>und</strong> Heilpädagogischen Schulangeboten<br />
wurde deshalb in den letzten Jahren vermehrt notwendig. Weiter wurde bei der Aufnahme<br />
neuer SchülerInnen auf eine „ges<strong>und</strong>e“ Durchmischung der Gruppen geachtet, sie sollte die<br />
Tragfähigkeit der Gruppe gewährleisten. Als Folge davon <strong>und</strong> mangels Plätzen mussten<br />
einige Kinder mit besondern Bedürfnissen abgewiesen werden.<br />
Kommentar<br />
Durch ihren ganzheitlichen Ansatz haben Tagesschulen zwar Potential, auch<br />
verhaltensauffällige oder fremdsprachige Kinder zu integrieren, allerdings nur in begrenztem<br />
Rahmen. So dürfen Tagesschulen nicht mit anspruchsvollen Kindern, welche eventuell in<br />
einer andern Institution besser betreut werden könnten, überbelastet werden, sonst kann die<br />
Tagesschule ihren Auftrag als Regelschule nicht mehr erfüllen.<br />
Der festgestellte, zunehmende Bedarf an Plätzen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit<br />
spezifischen Problemen im Sozial- <strong>und</strong> Verhaltensbereich darf insofern nicht auf Kosten von<br />
Regeltagesschulen gehen. Das Erziehungsdepartement muss sich mit diesen neuen<br />
Tendenzen in der Volksschule gr<strong>und</strong>sätzlich auseinander setzen, um geeignete Angebote für<br />
Kinder mit besondern Schwierigkeiten anbieten zu können. Die gesamte Volksschulstufe<br />
steht heute vor der Herausforderung, sich den wandelnden Bedingungen in unserer<br />
Gesellschaft anzupassen. Es kann nicht sein, dass die zunehmenden „schwierigen Fälle“ von<br />
der Volksschule ausgeschlossen <strong>und</strong> speziellen oder privaten Institutionen überlassen<br />
werden.<br />
2.5 Aktuelle Belegszahlen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Die beiden Primartagesschulen können zurzeit je 50 Kinder aufnehmen. Je zwei<br />
Jahrgangsklassen werden jeweils pro Standort geführt. Die beiden Primartagesschulen sind<br />
seit 15 Jahren ausgelastet. Die Belegszahlen sind zwar leicht schwankend, in der Regel wird<br />
die mögliche Belegszahl aber erreicht. In den letzten Jahren ist nach Aussage der<br />
Tagesschulverantwortlichen die Zahl von Anfragen insgesamt gestiegen, sodass jedes Jahr<br />
einige Kinder abgewiesen werden mussten. Genaue Zahlen, die den eigentlichen Bedarf<br />
zeigen können, existieren allerdings nicht (fehlende Erhebung des Bedarfs <strong>und</strong> fehlende<br />
Steuerung der Angebote). Laut Auskunft des Vereins Tagesschulen sind auch auf das<br />
kommende Schuljahr 2003/04 in der Primartagesschule Niederholz mehr Anmeldungen<br />
eingegangen als Plätze vorhanden sind.<br />
Insgesamt bestehen Hinweise darauf, dass der Bedarf an Tagesschulplätzen auf der<br />
Primarstufe höher wäre, als das bestehende Angebot zählt. Ebenso bestehen<br />
Rückmeldungen von Eltern, dass diese auf die Anmeldung in die Tagesschule verzichten,<br />
weil die aktuellen Standorte (Riehen <strong>und</strong> Kleinhüningen) zu unzumutbaren Distanzen für<br />
Primarschulkinder führen.<br />
2.6 Öffnungszeiten<br />
Die Tagesschulen auf der Primarstufe bieten während fünf Tagen ein Schul- <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong>sangebot (siehe weiter oben): Montag, Dienstag, Donnerstag <strong>und</strong> Freitag von 7.30<br />
bis 16.30/16.45 Uhr <strong>und</strong> am Mittwoch von 7.30 bis 14.20/14.30 Uhr.<br />
Während der Schulferien wird keine zusätzliche <strong>Betreuung</strong> angeboten, was aus Sicht der<br />
Eltern zu einem Mangel gezählt werden muss.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
8
Kommentar<br />
Im Falle der Tagesschulen auf der Primarstufe zeigt sich – wie auch bei andern Angeboten –<br />
das Problem der <strong>Betreuung</strong> während der Ferien. Ingesamt besteht diesbezüglich<br />
Entwicklungsbedarf.<br />
2.7 Infrastruktur <strong>und</strong> Räume<br />
Eine Tagesschule braucht grosszügige <strong>und</strong> vielfältig nutzbare <strong>und</strong> abgrenzbare Innenräume<br />
(wie Klassenräume, Gruppenräume, Essraum, Küche) sowie Aussenräume (mit Grünflächen<br />
<strong>und</strong> Trockenplätzen für Spiele), die abgesichert sind <strong>und</strong> Spielgeräte enthalten. In beiden<br />
Tagesschulstandorten arrangiert man sich mit dem bestehenden Platzangebot, ist allerdings<br />
der Meinung, dass dies unbedingt optimiert werden müsste.<br />
Kommentar<br />
Es wird deutlich, dass Tagesschulen wie auch andere familien- <strong>und</strong> schulergänzende<br />
Tagesbetreuungsstrukturen einen relativ grossen Raumbedarf haben, um den<br />
unterschiedlichen Bedürfnissen von Bewegung, Ruhen, Essen <strong>und</strong> Spielen gerecht werden<br />
zu können. Bei einer Planung des Ausbaus von weitern Angeboten muss dem Rechnung<br />
getragen werden. Um in einer Stadt wie Basel neue Räume zu erhalten, müssen dringend<br />
Kooperationspartner gef<strong>und</strong>en werden, welche helfen, geeignete Räume zu finden.<br />
2.8 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgt über gemeinsame Gespräche <strong>und</strong> über Aktivitäten<br />
der Schule, an denen die Eltern teilnehmen können. Die Eltern werden aber nicht verpflichtet,<br />
bei der <strong>Betreuung</strong> mitzuhelfen.<br />
Der Austausch mit den Eltern ist wichtig, da diese die Verantwortung für ihre Kinder haben<br />
<strong>und</strong> daran interessiert sind, wie die Kinder betreut werden. Von Seiten der Eltern werden<br />
immer wieder längere Öffnungszeiten <strong>und</strong> Ferienlösungen thematisiert. Ebenso wird als<br />
schwierig angesehen, dass der Quartierbezug häufig nicht hergestellt werden kann, wenn die<br />
Schule nicht im eigenen Wohnquartier steht, dies nimmt den Kinder die Möglichkeit, ihre<br />
Wohnumgebung kennen zu lernen.<br />
2.9 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Die beiden Primartagesschulen befinden sich je in einem Schulkomplex mit normalem<br />
Regelklassenbetrieb. Die Zusammenarbeit mit diesen Klassen erfolgt nicht regelmässig,<br />
sondern vielmehr projektbezogen. Ebenso erfolgen Absprachen bezüglich der Raumnutzung,<br />
ansonsten wird die Möglichkeit der Zusammenarbeit noch wenig genutzt. Die<br />
unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung zwischen den beiden<br />
Primarschulformen erschweren die Zusammenarbeit.<br />
Kommentar<br />
Die unterschiedlichen Ansätze der öffentlichen Volksschule <strong>und</strong> der Tagesschulen scheinen<br />
die Zusammenarbeit zu erschweren. Tagesschulklassen können eher Synergien mit andern<br />
Tagesschulklassen schaffen. Dies gilt es bei einem Ausbau des Angebots mit zu<br />
berücksichtigen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
9
2.10 Personal, Ausbildung<br />
Je drei Lehrkräfte mit Primarlehrerpatent übernehmen pro Klasse sowohl die<br />
Unterrichtstätigkeit wie auch die <strong>Betreuung</strong> der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler. <strong>Betreuung</strong>sarbeit<br />
wird etwas schlechter entlöhnt: Erstens werden nur zwei Drittel des Lektionsansatzes<br />
verrechnet, zweitens eine <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>e 60 Minuten, während eine Lektion 45 Minuten<br />
dauert. So entsprechen 90 Unterrichtsminuten 180 <strong>Betreuung</strong>sminuten, was Anlass zu Kritik<br />
am Finanzierungsschlüssel liefert. Die Tagesschulverantwortlichen betonen kritisch, dass die<br />
<strong>Betreuung</strong>szeit ebenfalls vorbereitet werden müsse <strong>und</strong> oft intensiver <strong>und</strong> ermüdender sei als<br />
eine Unterrichtsst<strong>und</strong>e. Die <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en werden im Verhältnis zu den<br />
Anstellungsprozenten auf die drei Lehrkräfte verteilt. Zusätzlich werden je zwei KöchInnen<br />
mit einem Pensum von je insgesamt 1,2 Stellen pro Standort angestellt.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich ist als Qualifikation das Lehrpatent erforderlich. Damit ist eine qualitativ gute<br />
pädagogische <strong>Betreuung</strong> während der Tagesschulzeiten gewährleistet. Die befragten<br />
Personen nennen weiter folgende Qualitäten, welche für die Arbeit an Tagesschulen<br />
notwendig sind: hohe Motivation, Teamfähigkeit, hohe Bereitschaft für die<br />
Erziehungstätigkeit, soziale Kompetenz, emotionale Belastbarkeit, Bereitschaft, Elternarbeit<br />
zu übernehmen.<br />
Die Erfahrungen mit den ganzheitlichen Arbeitsweisen der Tagesschullehrkräfte sind sehr<br />
positiv. Eine Trennung der Aufgaben (<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Lehre) bzw. die Übergabe der<br />
<strong>Betreuung</strong>saufgabe an sozialpädagogisch ausgebildetes Personal wird zwar als eine<br />
denkbare Lösung betrachtet, welche aber nicht gewünscht wird. Dadurch ginge einerseits die<br />
Möglichkeit des ganzheitlichen Zugangs verloren <strong>und</strong> andererseits würden neue Aufgaben,<br />
aber auch Konflikte entlang der Schnittstellen entstehen, was bei einem gleichwertigen Team<br />
(gleiche Profession) weit weniger der Fall sei. Die Lehrpersonen fühlen sich gegenwärtig mit<br />
ihren Arbeitsbedingungen sehr zufrieden, obwohl sie in Tagesschulen im Vergleich zu<br />
Regelschulen längere Präsenzzeiten (bei gleichem Lohn) in Kauf nehmen müssen.<br />
Kommentar<br />
Die Arbeit in der Primartagesschule erfordert ein hohes Engagement der Lehrpersonen. Die<br />
Bereitschaft zu (siehe oben) höherer Präsenzzeit <strong>und</strong> der Übernahme von erzieherischen<br />
Aufgaben über das üblich Mass hinaus, ist eine beachtliche Leistung, die gewürdigt werden<br />
muss. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, einen St<strong>und</strong>enpool für zusätzliche<br />
Entlastungsst<strong>und</strong>en für Supervision, Teamsitzungen <strong>und</strong> Weiterbildungsmöglichkeiten zur<br />
Verfügung zu stellen.<br />
2.11 Kosten, Finanzierung<br />
Die Kosten der Primartagesschulen errechnen sich aus den Aufwendungen für Lohnkosten<br />
der Lehrpersonen, ihre Entgeltung für die <strong>Betreuung</strong>szeit, die Lohnkosten des<br />
Küchenpersonals sowie aus den Materialien, der Infrastruktur <strong>und</strong> den Raumkosten. Deutlich<br />
wird aus dem Vergleich der beiden Primartagesschulen eine grosse Differenz in Bezug auf<br />
die Raumkosten.<br />
Während die einen diese Differenz kritisieren, halten die andern dagegen, dass die<br />
Berechnungsgr<strong>und</strong>lage ungenügend sei. Letztere wünschen, dass in die Berechnung auch<br />
die zusätzlich erbrachten Leistungen einbezogen werden, welche durch die Auslastung, den<br />
Anteil von SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen sowie durch die Integrations- <strong>und</strong><br />
Präventionsleistung bestimmt werden.<br />
Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich durch das Erziehungsdepartement. Ein kleiner Anteil<br />
wird durch Elternbeiträge abgedeckt, welche in einem Beitragsmodell festgelegt sind. Bisher<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
10
war der tiefste Ansatz bei Fr. 3.20, der Höchstansatz bei Fr. 32.50 (welcher bei einem<br />
Einkommen von ca. Fr. 6000.- bereits erreicht ist). Die Elternbeiträge sind nach Aussagen<br />
der Tagesschul-anbieterInnen zu tief. Ebenso zeigt ein interkantonaler Vergleich, dass die<br />
Elternbeiträge im Kanton Basel-Stadt eher tief sind. In anderen Kantonen werden<br />
Elternbeiträge ab Fr. 30.- erhoben. Die Elternbeiträge müssten insofern wohl überlegt <strong>und</strong><br />
neu angepasst werden. Einerseits wäre nach Aussagen der DiskussionsteilnehmerInnen eine<br />
Indexierung sicher sinnvoll, andererseits müssten die lohnabhängigen Ansätze überarbeitet<br />
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Beitrag für sozial benachteiligte Eltern weiterhin<br />
möglichst gering gehalten werden kann, um nicht einer sozialen Diskriminierung Vorschub zu<br />
leisten.<br />
Die DiskussionsteilnehmerInnen regen weiter dazu an, die Angebote nicht nur aufgr<strong>und</strong><br />
finanzieller Kriterien zu beurteilen, sondern ebenso die qualitativen Aspekte mit<br />
einzubeziehen. Eine Tagesschule bietet ein komplexes <strong>Betreuung</strong>sangebot <strong>und</strong> insofern<br />
mehr Leistung als zeitlich knappere <strong>und</strong> weniger konsistente Angebote. Viele Eltern sind<br />
bereit, für mehr Leistung <strong>und</strong> Qualität auch mehr zu bezahlen. Weiter wird auf die<br />
Schwierigkeit hingewiesen, faire, vergleichbare Zahlen der Angebote zu erheben, insofern<br />
müsse man Zahlen vorsichtiger kommunizieren, als dies zum Teil in der Vergangenheit<br />
immer wieder der Fall war.<br />
Kommentar<br />
Bei einer Steuerung der gesamten schul- <strong>und</strong> familienergänzenden Angebote müssen die<br />
Elternbeiträge neu festgelegt werden (Indexierung, Lohnabhängigkeit, Minimal-<br />
/Maximalbeitrag). Ziel muss es sein, Kostentransparenz <strong>und</strong> für vergleichbare<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebote einheitliche Ansätze zu schaffen.<br />
2.12 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Gegenwärtig wird vom Verein für Tagesschulen in Basel Werbung für das Angebot gemacht.<br />
Von Seiten des Erziehungsdepartements wird diesbezüglich Zurückhaltung geübt. Da das<br />
Angebot bezüglich Nachfrage bereits zu gering scheint <strong>und</strong> bisher ein Ausbau nicht denkbar<br />
war, machte es wenig Sinn, Werbung zu betreiben.<br />
2.13 Entwicklungspotential<br />
Die Tagesschulen auf der Primarstufe stellen seit bald 15 Jahren ein Provisorium dar. In<br />
dieser Zeit konnte das Angebot sich durchaus sehen lassen. Wer davon profitieren konnte,<br />
schätzt die Leistung positiv ein. Das langjährige Schattendasein der Tagesschulen hat nach<br />
Auffassung der TagesschulbefürworterInnen die Entwicklung des Angebots aber verhindert<br />
<strong>und</strong> zu einer unbefriedigenden Situation geführt.<br />
Nach Auffassung der DiskussionsteilnehmerInnen ist das Angebot zeitgemäss <strong>und</strong> der<br />
Bedarf erwiesen, ein Ausbau deshalb dringend nötig. Als Problem, das mit den aktuellen<br />
Standorten der Tagesschulangebote verknüpft ist, wurde der mangelnde Quartierbezug der<br />
Kinder <strong>und</strong> die oft weiten Schulwege sowohl von Eltern wie von Lehrpersonen mehrfach<br />
genannt. Bei einem Ausbau der Tagesschulen – mindestens eine Tagesschule pro<br />
Schulkreis, besser pro Quartier – könnte dieses Problem entschärft werden. Ein weiteres<br />
Entwicklungspotential sehen die AnbieterInnen in einem klaren durchgehenden Angebot vom<br />
Kindergarten bis in die Orientierungsstufe. Und schliesslich müssen zusätzliche Angebote<br />
während der Schulferien geschaffen werden.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
11
Kommentar<br />
Da die aktuellen Tagesschulen auf der Primarstufe seit bald 15 Jahren ein Provisorium<br />
darstellen, besteht hier Entscheidungs- <strong>und</strong> Handlungsbedarf. Eine Überführung in ein<br />
Definitivum durch die Verankerung im Schulgesetz würde die Gr<strong>und</strong>lage schaffen, das<br />
Angebot angemessen <strong>und</strong> bedürfnisorientiert zu entwickeln.<br />
Eine Streichung des Angebots ist zur heutigen Zeit aus bildungspolitischen Gründen kaum<br />
denkbar, die Führung eines Provisoriums für weitere 15 Jahre aber auch nicht sinnvoll. Hier<br />
ist eine klare Stellungnahme durch das Erziehungsdepartement erforderlich.<br />
2.14 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Die Unterstellung der Tagesschulen wie bisher unter die Rektorate der Schulkreise wird zum<br />
jetzigen Zeitpunkt als sinnvoll erachtet. Dies ermöglicht einen Austausch mit den andern<br />
Regelschulangeboten im Schulkreis <strong>und</strong> gewährt den Informationsfluss <strong>und</strong> die Koordination<br />
von andern Angeboten wie z.B. der Musikschule. Begrüsst würde aber ein fachlicher<br />
Zusammenschluss (Kompetenzzentrum) unter den verschiedenen Tagesschulangeboten. Ein<br />
fachlicher Austausch wäre der Planung <strong>und</strong> Entwicklung sowie Angleichung bzw.<br />
Diversifizierung (Profilbildung) der Angebote dienlich.<br />
Bei einem Ausbau im Rahmen eines Gesamtmodells würde die Schaffung eines<br />
Tagesschulrektorat begrüsst, welches die Belange der Tagesschulen besser vertreten<br />
könnte. Weiter müsste die Tagesschule nach Auffassung der DiskussionsteilnehmerInnen im<br />
Schul- bzw. <strong>Bildung</strong>sgesetz verankert werden können.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich müsste ein Gesamtkonzept gemäss Diskussionsr<strong>und</strong>e unterschiedliche<br />
Angebote an familienergänzenden <strong>Betreuung</strong>sstrukturen enthalten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen für die<br />
Entwicklung dieser vielfältigen Angebote schaffen. Ein Ausbaukonzept müsste für alle<br />
Angebotstypen erstellt werden können. Nur die vermeintlich billigste Version dürfte nicht<br />
allein die Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage darstellen.<br />
Weiter müsste die regionale Abdeckung gesichert werden, sodass jeder Schulkreis<br />
mindestens eine Tagesschule auf der Primarstufe (vier Tagesschulen), evtl. sogar bereits im<br />
Kindergarten anbieten könnte.<br />
Insgesamt wird vom Erziehungsdepartement eine langfristige sorgfältige Planung gewünscht,<br />
damit ein effizientes <strong>und</strong> qualitativ gutes Gesamtkonzept entstehen kann, welches die<br />
Entwicklung der Angebote positiv unterstützt. Dazu gehören die Setzung von Rahmenbedingungen<br />
(Gesamtkonzept, Finanzierungsmodelle etc.), die Beratung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
der Angebote (Entwicklungsplanung) <strong>und</strong> die Übernahme der Koordination der<br />
unterschiedlichen Angebote sowie die Öffentlichkeitsarbeit .<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
12
3 Auswertung der Erfahrungen der Tagesschulangebote im<br />
Kleinklassenbereich Primar- <strong>und</strong> Orientierungsstufe 4,5<br />
3.1 Kleinklassen-Tagesschulen (KKL-TS)<br />
a) Tagesschulangebote für Kleinklassen auf der Primarstufe (PS)<br />
Gegenwärtig bestehen an zwei Standorten Tagesschulen für Kleinklassen auf der<br />
Primarstufe: die KKL-Tagesschule PS Richter-Linder (KKL-TS/PS) sowie die KKL-<br />
Tagesschule PS Bachgraben (KKL-TS/PS). Beide Schulen können je 28 Kinder aufnehmen.<br />
Diese werden pro Standort in 2 zweistufigen Klassen mit je max. 14 Kindern oder in zwei<br />
Halbklassen mit sieben Kindern geführt.<br />
b) Tagesschulangebote für Kleinklassen auf der Orientierungsstufe (OS)<br />
Im Kleinklassenbereich auf der Orientierungsstufe konnten in den letzten Jahren Erfahrungen<br />
mit unterschiedlichen Tagesschulmodellen gemacht werden. Eine integrierte Tagesschule<br />
(ITOS), welche SchülerInnen der Klein- <strong>und</strong> Regelklassen gemeinsam betreute, läuft auf<br />
Ende Schuljahr 2002/03 aus. Seit 2001/02 wird eine Tagesschule nur für die<br />
KleinklassenschülerInnen der OS geführt, sie löst die ITOS ab. Notwendige<br />
Modellanpassungen sowie Standortwechsel führten zu den Veränderungen. Der<br />
Veränderungsprozess ist auch noch nicht abgeschlossen, was die Erfassung des Angebots<br />
etwas erschwert.<br />
Zurzeit <strong>und</strong> im kommenden Schuljahr bestehen auf Orientierungsstufe folgende Kleinklassen-<br />
Tagesschulen OS:<br />
• Auf der Orientierungsstufe (5. bis 7. Klasse) bestehen in diesem Jahr zwei Tagesschulen<br />
(im Gellert seit Schuljahr 2002/03, im Wasgenring seit Schuljahr 2001/02). Aktuell wird im<br />
Schulhaus Gellert eine Klasse von 15 SchülerInnen im 1. OS-Jahr <strong>und</strong> im Schulhaus<br />
Wasgenring eine Klasse von 16 SchülerInnen im 2. OS-Jahr betreut. Im Schulhaus<br />
Thomas Platter Wettstein besuchen dieses Jahr zudem noch 14 KKL-SchülerInnen im<br />
Schuljahr 2002/03 die Tagesschule ITOS; dieses Angebot wird ab Schuljahr 2003/04 nicht<br />
mehr weitergeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass weitere Anpassungen nötig sind,<br />
weshalb auch für die separat geführten KKL-Tagesschulen OS das Konzept nochmals<br />
überarbeitet wurde.<br />
• Auf das kommende Schuljahr 2003/04 werden an den Standorten Gellert <strong>und</strong> Wettstein je<br />
21 SchülerInnen auf der Orientierungsstufe KKL in dreistufigen Klassen – von 1. bis 3.<br />
KKL OS – betreut. Der Standort Wasgenring fällt dann weg (siehe Konzept Kleinklassen-<br />
Tagesschulen „2x21“ vom 23.8.2002)<br />
Im Folgenden wird das Angebot der Kleinklassen-Tagesschulen der Primarstufe <strong>und</strong> der<br />
Orientierungsstufe zusammenfassend dargestellt. Obwohl bezüglich Alter unterschiedliche<br />
Schwerpunkte im <strong>Betreuung</strong>skonzept <strong>und</strong> der Infrastruktur usw. gesetzt werden <strong>und</strong> sich<br />
durch das Fachlehrersystem auf der Orientierungsstufe einige Unterschiede ergeben, die den<br />
4 Die Erfahrungen der AnbieterInnen von Kleinklassen-Tagsschulen auf der Primarstufe <strong>und</strong> der<br />
Orientierungsstufe wurden einerseits mit Hilfe eines qualitativen Fragebogens ermittelt. Dieser wurde von je<br />
zwei Lehrkräften jeder Stufe gemeinsam ausgefüllt. Andererseits wurde mit zwei Lehrkräften <strong>und</strong> einer vom<br />
Rektorat KKL für den Tagesschulbereich eingesetzten Fachperson eine Gruppendiskussion zu relevanten<br />
Fragestellungen (Fokusgruppen-Methode) durchgeführt. Die folgenden Ausführungen stellen eine<br />
zusammenfassende Auswertung der Erfahrungen der AnbieterInnen dar. Sie wurden anschliessend durch<br />
das Rektorat der Kleinklassen verifiziert.<br />
5 An der Gruppendiskussion nahmen folgende Vertreterinnen teil: vom Rektorat KKL für den Tagesschulbereich<br />
OS eingesetzte Fachperson <strong>und</strong> Lehrerin an Kleinklasse Tagesschule Orientierungsstufe, Schulhausleitung<br />
der Tagesschule-Kleinklasse Primar Richter-Linder, Schulleitung Tagesschule-Kleinklasse Primar<br />
Bachgraben.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
13
Tagesschulbetrieb bestimmen, bestehen bezüglich des Gr<strong>und</strong>konzepts mehr Ähnlichkeiten<br />
als Differenzen. Wo zentrale Unterschiede bestehen, werden diese separat betrachtet.<br />
3.2 Profil: Kleinklassen-Tagesschulen<br />
Tagesschulen für Kleinklassen entsprechen weitgehend dem Konzept von Tagesschulen<br />
(vgl. Profil Tagesschulen). Angestrebt wird ein ganzheitliches Konzept. Das heisst, Unterricht,<br />
<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung werden von der Schule geführt <strong>und</strong> räumlich <strong>und</strong> konzeptionell<br />
eng verzahnt. Die Kleinklasse-Tagesschule versteht sich als Lebensgemeinschaft, in der die<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen Geborgenheit <strong>und</strong> dauerhafte Beziehungen finden. In diesem<br />
konzeptionellen Rahmen kann speziell auf die Bedürfnisse <strong>und</strong> Probleme (im sozialen,<br />
emotionalen oder kognitiven Bereich) der Kleinklassenkinder eingegangen werden. Den<br />
Kindern wird bei der Überwindung ihrer Lernschwächen <strong>und</strong> Entwicklungsrückstände<br />
geholfen, das Selbstwertgefühl gestärkt <strong>und</strong> die Entwicklung des Gemeinschaftssinns<br />
angestrebt. Das Ziel der Kleinklassen-Tagesschulen ist es, die SchülerInnen so zu fördern,<br />
dass allenfalls ein späterer Übertritt in die Regelklasse möglich wird. Die Kinder werden im<br />
Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten nach dem Lehrplan der Regelklassen Basel-Stadt<br />
unterrichtet. Damit strebt die Kleinklassen-Tagesschule die Integration <strong>und</strong><br />
Chancengleichheit ihrer SchülerInnen an.<br />
„Ziel ist eine altersmässige, ganzheitliche Erziehung <strong>und</strong> Förderung in einer<br />
gemeinschaftsbildenden Schulkultur, welche dem heilpädagogischen Auftrag der Kleinklassen<br />
entspricht. Das heisst: Balance zwischen Konzentration <strong>und</strong> Entspannung, Balance von Kopf,<br />
Hand <strong>und</strong> Herz sowie individuelle Förderung. Das beinhaltet auch Spiel, spontane Aktionen<br />
<strong>und</strong> Gemeinschaftsanlässe. Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler erhalten Anregungen zum<br />
Entdecken ihrer besonderen Fähigkeiten <strong>und</strong> Neigungen sowie zur Gestaltung ihrer freien<br />
Zeit“ (vgl. Konzept Tagesschule Kleinklasse OS, 23.8.2002).<br />
Die Kleinklassen-Tagesschulen unterscheiden sich in einigen Punkten von den<br />
Tagesschulen für Regelschülerinnen <strong>und</strong> -schüler in Basel-Stadt:<br />
• Danach müssen die Lehrkräfte über eine heilpädagogische Zusatzqualifikation verfügen.<br />
• Neben den Lehrkräften übernehmen SozialpädagogInnen die <strong>Betreuung</strong>sfunktion.<br />
• Ein weiterer Unterschied besteht bezüglich der Zielgruppe. Hier besteht der<br />
Nachweisbedarf einer doppelten Indikation (Lernförderung <strong>und</strong> soziale Bedingungen).<br />
Einerseits müssen potentielle Kleinklassenschülerinnen <strong>und</strong> -schüler vorgängig vom<br />
Schulpsychologischen Dienst (SPD) bezüglich einer Indikation (im emotionalen, sozialen<br />
oder kognitiven Bereich) abgeklärt <strong>und</strong> für die Tagesschulen empfohlen werden. Ferner<br />
muss ein spezieller <strong>Betreuung</strong>sbedarf aufgr<strong>und</strong> der sozialen Bedingungen der<br />
Herkunftsfamilie (Alleinerziehende, sozial benachteiligte Familien, Schwierigkeiten in der<br />
Herkunftsfamilie etc.) bestehen. Und schliesslich entscheidet das Rektorat Kleinklasse,<br />
wer in der Tagesschule aufgenommen werden kann.<br />
• Die geringere SchülerInnenzahl ist ein weiteres Merkmal der Kleinklassen. Eine Halb-<br />
Kleinklasse besteht aus 7 SchülerInnen; auf der Primarstufe werden 2 x 2 x 7 = 28, <strong>und</strong><br />
auf der Orientierungsstufe 3 x 7 = 21 als Tagesschuleinheit geführt.<br />
Kleinklassen-Tagesschulen bieten eine Ganztagesbetreuung von Montag bis Freitag jeweils<br />
von 7.40 bzw. 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, am Mittwoch in der OS bis um 14.00 Uhr. Während der<br />
Schulferien bleibt die Tagesschule geschlossen. Alle Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen verbringen<br />
den ganzen Tag in der Schule. Der Tagesablauf ist in Unterrichtszeit <strong>und</strong> unterrichtsfreie Zeit<br />
eingeteilt.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
14
Kleinklasse-Tagesschule<br />
7.40 Uhr OS-Stufe<br />
8.00 Uhr Primarstufe<br />
17.00 Uhr<br />
Rhythmisierter Tagesablauf<br />
Auffangzeiten<br />
Unterricht<br />
Mittagszeit<br />
Unterricht oder<br />
Freizeitangebot<br />
<strong>und</strong>/oder Aufgabenzeit<br />
3.3 Kernangebot einer Kleinklasse-Tagesschule: Unterricht,<br />
Förderst<strong>und</strong>en, sozialpädagogische <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung in<br />
einem<br />
Die Kleinklasse-Tagesschule entspricht dem Tagesschulkonzept für RegelschülerInnen.<br />
Entsprechend kann die enge Verzahnung von Unterrichtstätigkeit, <strong>Betreuung</strong>saufgaben <strong>und</strong><br />
Verpflegung als das Kernangebot betrachtet werden (siehe weiter oben). Insbesondere für<br />
die Kinder, welche soziale, kognitive <strong>und</strong> psychische Indikationen aufweisen, schafft diese<br />
Struktur Konstanz <strong>und</strong> Kontinuität <strong>und</strong> dadurch Verlässlichkeit, was eine wichtige Gr<strong>und</strong>lage<br />
für die individuelle Förderung darstellt.<br />
Im Gegensatz zum Modell Tagesschule für RegelschülerInnen in Basel-Stadt werden die<br />
Kinder hier nicht von den Lehrkräften ausserhalb des Unterrichts betreut, sondern<br />
überwiegend von SozialpädagogInnen. Diese gestalten die unterrichtsfreie Zeit, indem sie<br />
sich nach den Bedürfnissen der Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen sowie der gesetzten Schulziele<br />
richten. Die Freizeitangebote berücksichtigen den Rhythmus „Spannung – Entspannung“ <strong>und</strong><br />
unterstützt damit auch den Unterricht. Ebenso wird dafür gesorgt, dass die SchülerInnen ihre<br />
Aufgaben vor Entlassung nach Hause in der Tagesschule erledigt haben. Dabei werden sie<br />
von Lehrpersonen oder SozialpädagogInnen unterstützt.<br />
Die Koordination <strong>und</strong> Kooperation zwischen den Lehrkräften einerseits (Fachlehrersystem<br />
auf der Orientierungsstufe) <strong>und</strong> Lehrpersonen, TherapeutInnen <strong>und</strong> SozialpädagogInnen<br />
andererseits wird im Tagesschulkonzept der Orientierungsstufe explizit berücksichtigt. Dies<br />
soll trotz interdisziplinärer Zusammenarbeit Beziehungskonstanz <strong>und</strong> Vernetzung<br />
ermöglichen (siehe dazu auch „Zusammenarbeit mit Schule“).<br />
Ein weiterer Vorteil im Tagesschulkonzept ist die integrierte Verpflegungsmöglichkeit. Schule<br />
wird dadurch zum ganzheitlichen Lebensraum, in dem wichtige schulische <strong>und</strong><br />
ausserschulische Erfahrungen gemacht werden können.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
15
3.4 Essen<br />
Die Verpflegung der SchülerInnen – zwei Zwischenverpflegungen <strong>und</strong> ein Mittagessen – in<br />
der Schule stellt ein wichtiges Angebot der Tagesschule dar. Das Essen wird in allen<br />
Tagesschulen in der Schulküche von einer Köchin/einem Koch zubereitet <strong>und</strong> schliesslich an<br />
die Schulgruppen geliefert. Die KöchInnen sind für die Zubreitung der abwechslungsreichen<br />
<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>en Mahlzeiten zuständig (artgerechte Tierhaltung, vitaminreiche Nahrung etc. ).<br />
Der Service wird von den SchülerInnen <strong>und</strong> den SozialpädagogInnen übernommen.<br />
Helfen beim Kochen bietet den Kindern die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen mit<br />
Realitätsbezug zu machen. Ebenso werden sie durch die Übernahme von Ämtchen in<br />
alltägliche Arbeiten integriert. Zurzeit ist die pädagogische Anleitung der SchülerInnen nicht<br />
im Pflichtenheft der KöchInnen enthalten <strong>und</strong> wird je nach Person anders gehandhabt. Wie<br />
weit die Köchin die Kinder mithelfen lassen soll, kann <strong>und</strong> will, steht noch zur Diskussion.<br />
Zweifellos bietet die Mitarbeit in der Küche für viele Kinder wichtige Erfahrungen.<br />
3.5 Zielpublikum, aktuelle NutzerInnen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Die Zielgruppe wird gr<strong>und</strong>sätzlich durch Kinder <strong>und</strong> Jugendliche mit spezieller schulischer<br />
<strong>und</strong> sozialer Indikation, die vom Schulpsychologischen Dienst bestätigt wurde, bestimmt.<br />
Hinzu kommt der Bedarf nach einer ganzheitlichen Tagesbetreuungsstruktur im Rahmen der<br />
Tagesschule. In der Regel ist eine doppelte Indikation erforderlich (schulische <strong>und</strong> soziale<br />
Indikation bzw. Familiensituation), welche den Bedarf nach einer Tagesschule im Bereich<br />
Kleinklassen bestimmt. KindergärtnerInnen, Lehrpersonen der Regelschule, aber auch der<br />
Kleinklasse <strong>und</strong> Vertreter des Schulpsychologischen Dienstes, der Abteilung Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendschutz (AKIS), der Familienberatungsstelle (Fabe) etc. spielen bei der Empfehlung<br />
der Kleinklasse-Tagesschule eine massgebliche Rolle.<br />
Bezüglich Zusammensetzung der Kleinklassen zeigt sich ein geringerer Anteil von Mädchen<br />
als Jungen sowie ein höherer Anteil an ausländischen als an schweizerischen SchülerInnen,<br />
was einem schweizerischen Gesamtbild in Kleinklassen in der Schweiz entspricht, wie<br />
zahlreiche Studien dazu belegen.<br />
Weiter zeigt sich, dass viele Kinder vorher eine schwierige Schulkarriere durchlaufen haben<br />
(Regelklasse, Einschulungsklasse, Abklärung gegen Widerstand der Eltern, Kleinklasse),<br />
alles wurde probiert, um die Kleinklasse oder einen Heimaufenthalt zu vermeiden. Die<br />
Kleinklasse wird oft als letzte Station vor der Fremdplatzierung wahrgenommen.<br />
Entsprechend traumatisiert kommen viele Kinder in die Kleinklassen-Tagesschulen. Dies<br />
beeinträchtigt das Image der Kleinklassen-Tagesschulen. Die Erfahrung zeigt weiter: Für<br />
„schwierige Fälle“, welche eigentlich ein Heim besuchen sollten, ist die Tagesschule nicht<br />
geeignet. Hier werden Grenzen der <strong>Betreuung</strong>smöglichkeiten sichtbar.<br />
a) Die Kleinklassen-Tagesschulen Primarschule (Bachgraben, Richter-Linder) können je 28<br />
SchülerInnen aufnehmen (insgesamt 56).<br />
b) Die aktuellen Kleinklassen-Tagesschulen (Gellert, Wasgenring, ITOS Thomas-Platter-<br />
Wettstein) bieten Platz für je 14 SchülerInnen (insgesamt 42).<br />
c) Die künftigen Kleinklassen Tagesschulen Orientierungsstufe (Gellert <strong>und</strong> Wettstein)<br />
können je 21 (insgesamt 42) SchülerInnen aufnehmen.<br />
Die Kleinklassen-Tagesschulen haben eine Kapazitätsgrenze erreicht, es bestehen deshalb<br />
keine Probleme, das Angebot auszulasten. Die Nachfrage übersteigt laut Befragten vielmehr<br />
das Angebot.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
16
Kommentar<br />
Die Tagesschulen im Regelschulbereich wie im Kleinklassenbereich kämpfen auf<br />
unterschied-lichen Etagen mit ähnlichen Problemen in Bezug auf „schwierige SchülerInnen“<br />
bzw. SchülerInnen mit multifaktoriellen Problemlagen im sozialen, kognitiven, soziokulturellen<br />
<strong>und</strong> psychischen Bereich. Wenn die Regelschule die Schwierigkeiten nicht auffangen kann,<br />
wird als nächste Schulform meist eine ganzheitlichere Form wie die Tagesschule in Betracht<br />
gezogen.<br />
3.6 Infrastruktur <strong>und</strong> Räume<br />
Kleinklassen-SchülerInnen brauchen in allen Altersstufen Aussen- <strong>und</strong> Innenräume, um sich<br />
bewegen zu können, aber auch um sich zurückziehen zu können. Erforderlich sind<br />
altersgerechte Gemeinschafts- <strong>und</strong> Rückzugszonen, Bewegungsräume <strong>und</strong> Ruheplätze mit<br />
entsprechender Möblierung <strong>und</strong> Infrastruktur.<br />
a) Den Kleinklassen-Tagesschulen Primarstufe stehen pro 14 SchülerInnen je zwei Räume<br />
als Unterrichts-, Spiel- <strong>und</strong> Esszimmer zur Verfügung. Zudem bestehen separate<br />
Werkräume sowie eine Küche für die Zubereitung der Mahlzeiten. Für Turnen <strong>und</strong><br />
Rhythmik können die Räume der nahen Schulen mitgenutzt werden.<br />
b) In der Kleinklassen-Tagesschule Gellert stehen dem jetzigen Modell zwei Schulräume <strong>und</strong><br />
zwei Aufenthaltsräume zur Verfügung. In der Tagesschule Wasgenring sind es drei<br />
Schulräume <strong>und</strong> zwei Freizeiträume (wovon einer von der Tagesbetreuung an der OS<br />
mitgenutzt wird). Die Küche, Fachräume <strong>und</strong> die Turnhalle werden mit der gesamten<br />
Orientierungsstufe des Standorts geteilt.<br />
Nach Aussage der Befragten kann die Raumgestaltung, welche nach heilpädagogischen<br />
Fördergesichtspunkten wichtig wäre, in den gegenwärtigen Angeboten noch zu wenig<br />
umgesetzt werden. Insbesondere für den Rückzug stehen wenig Möglichkeiten zur<br />
Verfügung. Weiter sind die Befragten der Meinung, dass zu wenig kreative Aussenräume<br />
bestehen. In Bezug auf die Sanitäranlagen sind weiter grosse Unterschiede <strong>und</strong> Mängel zu<br />
bezeichnen (z.B. fehlende Mädchentoilette, fehlendes Warmwasser). Um etwas verändern zu<br />
können, müsste der finanzielle Rahmen grösser sein.<br />
Insgesamt müsste nach Auffassung der Befragten die Raumplanung bei Umverteilungen von<br />
Schulen <strong>und</strong> der Entwicklung besser mitberücksichtigt werden. Infrastrukturkosten,<br />
Erneuerungs- bzw. Anpassungskosten könnten sich klarer amortisieren lassen <strong>und</strong><br />
Neukosten vermieden werden.<br />
3.7 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgt wie auch bei andern Angeboten im Rahmen von<br />
Elterngesprächen, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen <strong>und</strong> Informationsveranstaltungen.<br />
Allerdings zeigen sich bei Gruppenveranstaltungen oft die Schwierigkeiten bezüglich<br />
Fremdsprachigkeit <strong>und</strong> unterschiedlicher Bedürfnisse der Eltern.<br />
Sehr wichtig eingeschätzt <strong>und</strong> häufig durchgeführt werden Einzel- <strong>und</strong> Beratungsgespräche<br />
mit Eltern. Nach Aussage der Befragten schätzen die Eltern eine gute Kooperation mit der<br />
Schule <strong>und</strong> wünschen regelmässige Öffnungszeiten. Gr<strong>und</strong>sätzlich melden sie wenig<br />
Bedürfnisse an. Weiter vermissen die Lehrkräfte oft das Bewusstsein der Eltern für ihre<br />
Verantwortung für die Kinder. Dieses mit den Eltern zu entwickeln, erfordert einen<br />
langfristigen <strong>und</strong> zeitintensiven Prozess <strong>und</strong> führt dennoch nicht immer zum Erfolg. Viele<br />
Eltern sind auf Erziehungshilfe angewiesen, welche die Lehrkräfte <strong>und</strong> SozialpädagogInnen<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
17
aber nicht immer vermitteln können. Unterschiedliche soziokulturelle Hintergründe<br />
erschweren hier oft die fruchtbare Zusammen-arbeit.<br />
3.8 Zusammenarbeit in der Schule<br />
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften <strong>und</strong> sozialpädagogischem<br />
Personal wird im Tagesschulkonzept sehr betont <strong>und</strong> als sehr anspruchsvoll wahrgenommen.<br />
Auf der Orientierungsstufe verschärft sich dieses Problem weiter durch das<br />
Fachlehrersystem, das weitere Absprachen unter noch mehr Personal erforderlich macht.<br />
a) Auf der Primarstufe wird die interdisziplinäre Kooperation ebenfalls als eine wichtige<br />
Herausforderung gesehen, es besteht hier allerdings noch kein detailliertes Konzept der<br />
Zusammenarbeit.<br />
b) Ein klares Konzept an den Kleinklassen-Tagesschule auf der Orientierungsstufe soll die<br />
fruchtbare Kooperation gewährleisten. Dieses regelt die intensive Teamarbeit,<br />
Zuständigkeiten, Präsenzzeiten sowie Entschädigung für die zusätzlich investierte Zeit.<br />
Einerseits regelt es die Kooperation unter den Lehrkräften selbst, andererseits die<br />
Teamarbeit von Lehrpersonen <strong>und</strong> SozialpädagogInnen. Dafür steht ein klares Zeitgefäss<br />
zur Verfügung (1 ½ St<strong>und</strong>en pro Woche).<br />
c) Bei Elterngesprächen, Fallbesprechungen mit SchulpsychologInnen <strong>und</strong> andern<br />
Dienststellen nehmen entsprechend SozialpädagogInnen <strong>und</strong> Lehrkräfte teil. Ebenso<br />
nehmen Lehrkräfte <strong>und</strong> SozialpädagogInnen an Supervisionsveranstaltungen, Kolonien<br />
etc. teil.<br />
Von den Befragten wird als Voraussetzung für eine gelingende Kooperation von Schule <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong>sangebot Folgendes genannt: Teamarbeit, Transparenz <strong>und</strong> klare Konzepte,<br />
Zeitgefässe. Ebenso werden gerade diesbezüglich Grenzen <strong>und</strong> Herausforderungen<br />
festgestellt. Danach ist die Zeit oft zu knapp für Austausch, Planung, Reflexion sowie für<br />
Schul- <strong>und</strong> Teamentwicklung.<br />
Kommentar<br />
Die gelingende Kooperation unter den verschiedenen Professionen stellt eine wichtige<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die Umsetzung des Tagesschulkonzepts dar. Sie muss bewusst gestaltet<br />
werden <strong>und</strong> genügend zeitlichen Raum <strong>und</strong> finanzielle Ressourcen erhalten <strong>und</strong> nicht nur<br />
nebenbei erbracht werden. Weiter ist motiviertes Personal nötig. Ein Beitrag dazu können die<br />
unterstützenden Arbeitsbedingungen sein (Zeit, Entlöhnung).<br />
a) In den Kleinklassen-Tagesschulen der Primarstufe (Richter-Linder- <strong>und</strong> Bachgraben-<br />
Schulhaus) wird unterschiedliches Personal angestellt: Pro Standort stehen 360<br />
Stellenprozent für Lehrkräfte mit heilpädagogischer Zusatzausbildung, 260 Stellenprozent<br />
für SozialpädagogInnen <strong>und</strong> 85 Stellenprozent für KöchInnen zur Verfügung.<br />
b) In den Kleinklassen-Tagesschulen der Orientierungsstufe (Gellert, Thomas-Platter-<br />
Wettstein) steht je ein Unterrichtslektionendach (ULD) von 58 Lektionen für den Unterricht<br />
<strong>und</strong> 125 Stellenprozent für die sozialpädagogische <strong>Betreuung</strong> zur Verfügung. Je 125<br />
Stellenprozent stehen im Gellert <strong>und</strong> Wettstein für die Küche zur Verfügung, die allerdings<br />
gleichzeitig auch für die Tagesbetreuung der Regelklasse auf der OS zuständig ist.<br />
Die Anforderungen bezüglich Qualifikation <strong>und</strong> Aufgaben bzw. Zuständigkeiten des<br />
jeweiligen Personals sind in entsprechenden Richtlinien festgehalten. Darüber hinaus<br />
erfordert die Arbeit in einer Tagesschule Kleinklasse sowohl von Lehrkräften, wie auch von<br />
SozialpädagogInnen ein hohes Mass an Teamfähigkeit, Selbstständigkeit <strong>und</strong> eine hohe<br />
Motivation, auch erzieherische Aufgaben zu übernehmen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
18
Schwierigkeit in Bezug auf die Personalrekrutierung ergibt sich durch das hohe Engagement<br />
bezüglich Kooperation <strong>und</strong> Teamarbeit. Mehraufwand ist an Tagesschulen unvermeidbar,<br />
dies macht engagierte Leute erforderlich.<br />
Die SozialpädagogInnen haben eine Jahresarbeitszeit, welche auf 40 Schulwochen<br />
gerechnet wird, was dazu führt, dass die höchstmögliche Anstellung 70% sein kann. Dies<br />
scheint die Arbeitsstelle für Männer weniger attraktiv zu machen. Die unterschiedliche<br />
Entlöhnung <strong>und</strong> die unterschiedliche Arbeitszeitenregelung im Vergleich zu den Lehrkräften<br />
führt trotz Klärung ebenfalls immer wieder auch zu Spannungen zwischen den zwei<br />
Professionen.<br />
Kommentar<br />
Insbesondere in Tagesschulen mit interdisziplinären Teams muss ein Konzept für die<br />
Kooperation <strong>und</strong> den gegenseitigen Austausch <strong>und</strong> die Planung bestehen. Weiter muss die<br />
dafür benötigte Zeit klar umrissen sein <strong>und</strong> entlöhnt werden.<br />
3.9 Kosten, Finanzierung (Erziehungsdepartement <strong>und</strong> Elternbeiträge)<br />
Die Schul-, Verbrauchs- <strong>und</strong> Unterrichtsmaterialien laufen über das übliche Budget für<br />
Kleinklassen an Primarschulen oder Orientierungsschulen. Ebenso werden die Löhne der<br />
Lehrkräfte, SozialpädagogInnen <strong>und</strong> KöchInnen durch das Erziehungsdepartement beglichen<br />
(Unterrichtslektionendach).<br />
Für die <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung bezahlen die Eltern einen Betrag, der sich nach ihrem<br />
Einkommen richtet. Dieser bewegt sich gemäss aktuellem Beitragsmodell zwischen einem<br />
Minimum von Fr. 3.20 <strong>und</strong> einem Maximum von Fr.32.50 pro Tag. Der Küche stehen Fr. 7.50<br />
pro Tag <strong>und</strong> Kind (Znüni, Mittagessen, Zvieri) zur Verfügung.<br />
Ebenfalls kritisch äussern sich die Befragten zu den oft bemängelten hohen Kosten der<br />
Tagesschulen. Sie sind der Überzeugung, dass sich in den letzten Jahren Kosten hätten<br />
vermeiden lassen, wenn eine langfristige <strong>Bildung</strong>s- <strong>und</strong> Raumplanung stattgef<strong>und</strong>en hätte.<br />
Ein Wechsel der Standorte von Tagesschulen (Umzugskosten, Infrastrukturkosten,<br />
Verbrauch von Personalressourcen ) <strong>und</strong> die relativ kleinen Einheiten pro Standort würden<br />
die Kosten unnötig erhöhen. In der klaren strategischen Planung wird insofern<br />
Veränderungspotential ausgemacht.<br />
3.10 Entwicklungspotential<br />
a) Auf der Primarstufe scheint die Umsetzung des Tagesschulkonzepts für Kleinklassen gut<br />
zu funktionieren. Eine wichtige Herausforderung ist ein klares Konzept für die Kooperation<br />
zwischen den unterschiedlichen Professionen. Die Kooperation muss verbindlich<br />
institutionalisiert werden.<br />
b) Das Angebot auf der Orientierungsstufe steht in einem bereits länger dauernden<br />
Entwicklungs- <strong>und</strong> Orientierungsprozess einerseits <strong>und</strong> einem Umzugsprozess<br />
andererseits. Dies hat in den letzten Jahren viel Energien bei den Beteiligten gebraucht.<br />
Die Erfahrungen aus unterschiedlichen Modellen der Kleinklassen-Tagesschulen sind<br />
zahlreich, z.T. aber noch wenig begleitet ausgewertet worden. Ausgehend von diesen<br />
Erfahrungen wurde ein neues Konzept für Tagesschulen an der Orientierungsschule für<br />
das kommende Schuljahr geschaffen. Neu an diesem Konzept ist die dreistufige<br />
Klassenführung mit je 21 Jugendlichen der 1. bis 3. Orientierungsstufe an den beiden<br />
Standorten Wettstein <strong>und</strong> Gellert (siehe Konzept vom 23.8.2002).<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
19
Kommentar<br />
Der Ausbau <strong>und</strong> die Weiterentwicklung sowie der Standortwechsel der Kleinklassen-<br />
Tageschulen auf der Orientierungsstufe basiert auf Erfahrungen. Wichtige Erkenntnisse<br />
konnten bereits umgesetzt werden.<br />
3.11 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Insgesamt wird von einer Gesamtkonzeption eine langfristige pädagogische<br />
Entwicklungsplanung nach primär pädagogischen <strong>und</strong> soziokulturellen Gesichtspunkten<br />
erwartet, welche auch die Raum- <strong>und</strong> Standortfrage mitberücksichtigt. Zudem müssen<br />
genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Die Finanzen dürfen die <strong>Bildung</strong>splanung<br />
nicht primär leiten. Weiter wird aufgr<strong>und</strong> der hohen Nachfrage nach Tagesschulplätzen der<br />
Ausbau der Tagesschulen als wichtig erachtet.<br />
In Bezug auf ein Gesamtmodell betonen die Befragten, dass die Verankerung der<br />
Tagesschulen als Schulangebot im Schulgesetz dringend notwendig ist. Eine klare Haltung<br />
des Erziehungsdepartements ist nach mehr als 15 Jahren Erfahrung mit Tagesschulen im<br />
Primarschulbereich sicher angebracht. Das Tagesschulangebot kann nicht im<br />
Tagesbetreuungsgesetz verankert werden, denn es geht explizit um ein besonderes<br />
Schulangebot („Schule muss Schule bleiben“).<br />
Die Kleinklassen-Tagesschulen werden in der Öffentlichkeit als vergleichsweise teuer<br />
wahrgenommen <strong>und</strong> auch kritisiert. Dabei wird nach Auffassung der<br />
Tagesschulverantwortlichen eine falsche Berechnungsgr<strong>und</strong>lage verwendet. So bieten<br />
Tagesschulen explizit mehr Leistung (heilpädagogischer Ansatz, integratives Angebot von<br />
Unterricht, <strong>Betreuung</strong>, Verpflegung) als die meisten Angebote auf der Volksschule. Was dies<br />
den Schulkindern bringt, müsste laut Befragten in einer vergleichenden Untersuchung einige<br />
Jahre nach der Schulentlassung konkret erfasst werden. Die Vermutung besteht allerdings<br />
bereits, dass das ganzheitliche Konzept Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit doppelter Indikation<br />
(schwieriger familiärer Hintergr<strong>und</strong>, soziale, kognitive oder psychische Indikation) eine<br />
Chance für positive Erfahrungen während der Schullaufbahn bietet. Damit trägt die<br />
Tagesschule einen wichtigen Teil zur Integration der Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen bei.<br />
Die organisatorische Zuordnung zum Rektorat Kleinklasse wird weiterhin als richtig beurteilt.<br />
Das Rektorat Kleinklasse vertritt die Belange der Kleinklassen-Tagesschulen optimal. Die<br />
Anbindung an eine künftige Abteilung, welche sich mit Tagesbetreuungsstrukturen befasst,<br />
macht nicht Sinn, da so die schulischen Anliegen zu wenig berücksichtigt werden<br />
(vergleichbar mit der gesetzliche Einbindung ins Schulgesetz).<br />
Bezüglich Öffentlichkeitsarbeit durch das Erziehungsdepartement wird zwar gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
wahrgenommen, dass neue Bestrebungen im Gange sind. Insbesondere die Information<br />
bezüglich Mittagstischangeboten sei in letzter Zeit deutlich wahrnehmbar. In Bezug auf die<br />
Interessen der Tagesschulen wird die Informationspolitik als noch zu gering eingeschätzt. Die<br />
Lehrkräfte <strong>und</strong> Eltern erwarten hier eine klare <strong>und</strong> offene Informationspolitik durch das<br />
Erziehungsdepartement.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
20
4 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesbetreuungsstrukturen<br />
an einer Heilpädagogischen Schule 6<br />
4.1 Profil: Tagesbetreuung an der Heilpädagogischen Schule<br />
Ackermätteli: Schule <strong>und</strong> Hort<br />
Die Heilpädagogische Schule Basel-Stadt stellt eine von der IV anerkannte staatliche<br />
Sonderschule dar für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche, die aufgr<strong>und</strong> ihrer geistigen Behinderung<br />
spezielle Förderung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> benötigen. Neben allgemeinen<br />
Entwicklungsverzögerungen <strong>und</strong> starken Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich zeigen<br />
einige Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler auch Auffälligkeiten im körperlichen, psychischen <strong>und</strong><br />
sozialen Bereich. Die Heilpädagogische Schule bietet sowohl separative als auch integrative<br />
Schulformen an. Die Einweisung erfolgt nach einer sorgfältigen Abklärung durch eine<br />
Fachstelle <strong>und</strong> wird immer wieder überprüft 7 .<br />
An Heilpädagogischen Schulen arbeiten Lehrkräfte mit einer heilpädagogischen Ausbildung,<br />
Sozialpädagoginnen <strong>und</strong> -pädagogen, Therapeutinnen <strong>und</strong> Therapeuten sowie<br />
Praktikantinnen <strong>und</strong> Praktikanten in interdisziplinären Teams zusammen. Sie stellen die<br />
nötige Schulung, Therapierung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> der Kinder sicher.<br />
An der Heilpädagogischen Schule Ackermätteli in Basel-Stadt besteht seit 1973 ein Hort.<br />
Gegenwärtig werden 24 Kinder der Heilpädagogischen Schule Ackermätteli im Alter von 7 bis<br />
11 Jahren (1. bis 5. Klasse) in einem schulintegrierten Hort betreut. Dazu bestehen drei<br />
altersgemischte Hortgruppen. Der Hort ist von Montag bis Freitag von jeweils 12.00 Uhr bis<br />
17.00 Uhr geöffnet.<br />
Kommentar<br />
Unterricht, Therapie<br />
8.30–12.00 Uhr<br />
13.30–17.00 Uhr Hort<br />
Mittagessen <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong>smöglichkeit<br />
12.00–17.00 Uhr<br />
Die Kombination von Heilpädagogischer Schule <strong>und</strong> schulnahem Hort stellt im Vergleich zu<br />
Schulheimen im heilpädagogischen Bereich eine niederschwelligere Form der <strong>Betreuung</strong> dar<br />
<strong>und</strong> ermöglicht es den Eltern, stärker an der <strong>Betreuung</strong> der Kinder selbst teilzuhaben bzw.<br />
6 Die Erfahrungen der Heilpädagogischen Schulen mit Tagesbetreuungsangeboten wurden einerseits mittels<br />
eines qualitativen Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen Treffen abgegeben worden ist, ermittelt.<br />
Dieser wurde von der Rektorin der Heilpädagogischen Schulen Basel ausgefüllt, sie nahm zusammen mit<br />
einer weitern Lehrkraft an der Gruppe teil. Im Folgenden werden die ausgewerteten Erfahrungen aus den<br />
qualitativen Fragebögen sowie den Gruppendiskussionen dargestellt. Der Bericht wurde schliesslich durch<br />
eine Diskussionsteilnehmerin verifiziert.<br />
7 vgl. Flyer: Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Heilpädagogische Schulen Basel-Stadt, HPS<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
21
den Hort als zusätzlich mögliches Angebot zu wählen. Im Vergleich zu Tagesschulen stellt<br />
das Modell Ackermätteli eine weniger ins Schulprogramm integrierte Form der <strong>Betreuung</strong> dar.<br />
Hort <strong>und</strong> Schule im Ackermätteli stehen in einem additiven Modell mehr oder weniger<br />
verbindlich in Kooperation.<br />
4.2 Kernangebote: Schule <strong>und</strong> Hort<br />
Das Hortangebot im Rahmen der Heilpädagogischen Schule Ackermättli stellt ein<br />
spezifisches Angebot von Schule <strong>und</strong> schulnaher Tagesbetreuungsstruktur dar. Im<br />
Gegensatz zur Tagesschule auf der Primarstufe – die sich als durchwegs schulintegriertes<br />
Modell versteht, indem die <strong>Betreuung</strong> wie auch der Unterricht von den Lehrkräften geleistet<br />
wird – stehen hier zwei unterschiedliche Angebote mit unterschiedlich qualifiziertem Personal<br />
auf engem Raum in Kooperation.<br />
Die schulische <strong>Betreuung</strong> der Kinder mit unterschiedlichsten Formen <strong>und</strong> Graden von<br />
Behinderungen erfordert ein hohes Mass an Know-how. Ein interdisziplinäres Team<br />
übernimmt die Schulung, <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Therapie der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler während<br />
der Unterrichtszeit.<br />
Nach Bedarf steht für die Förderung, Erziehung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
zwischen bzw. nach den Unterrichtszeiten ein schulnaher Hort zur Verfügung. Das<br />
gemeinsame Essen <strong>und</strong> die <strong>Betreuung</strong> während der unterrichtsfreien Zeit bietet eine wichtige<br />
Tagesbetreuungsstruktur für Kinder <strong>und</strong> Eltern. Sie bietet Gelegenheit für alltägliche,<br />
lebenspraktische Erfahrungen (Ernährung, Hygiene, Kommunikation etc). Weiter bestehen<br />
zahlreiche Lernmöglichkeiten beim Spielen, Basteln, Hausaufgaben Lösen etc.<br />
Je ein Zweierteam von SozialpädagogInnen betreut in der Regel eine altersgemischte<br />
Gruppe. Die Teams der Hortgruppen sind ab 9.30 Uhr in der Schule anwesend, um<br />
vorzubereiten, sich zu besprechen etc. Ab 12.00 Uhr kommen die SchülerInnen.<br />
Kommentar<br />
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrkräften, TherapeutInnen <strong>und</strong><br />
SozialpädagogInnen stellt die Gr<strong>und</strong>lage für eine breite Förderung der Schulkinder dar <strong>und</strong><br />
kann damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration leisten.<br />
4.3 Essen<br />
Das Essen gehört zum Hortangebot für die Hortkinder. Zur Herstellung des Essens ist ein<br />
Koch angestellt, welcher für die drei Hortgruppen in der schuleigenen Küche kocht.<br />
Arbeitszeit ist von 9.00 bis 13.00 Uhr, eine Küchenhilfe arbeitet zusätzlich von 12.00 bis<br />
14.00 Uhr.<br />
Da ein grosser Teil der HortbesucherInnen aus andern Kulturen stammt, wird auf ein<br />
vollwertiges, biologisches <strong>und</strong> auch multikulturelles Angebot geachtet, das religiöse Gebote<br />
respektiert.<br />
4.4 Zielpublikum, aktuelle NutzerInnen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich steht das Angebot allen Kindern der Heilpädagogischen Schule Ackermätteli<br />
als freiwilliges Angebot zur Verfügung, sie stellen das Zielpublikum dar. Zurzeit werden 24<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
22
Schulkinder in drei altersgemischten Hortgruppen mit je 8 Kindern im Alter von 7 bis 11<br />
Jahren betreut. Pro Schulklasse besucht ca. je ein Drittel der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler auch<br />
den Hort.<br />
Bezüglich der NutzerInnen des Hortangebots zeigt sich folgendes Bild. Da die<br />
HortbesucherInnen alle aus der Heilpädagogischen Schule stammen, bestimmen ihre<br />
Indikationen (kognitive, psychische oder verhaltensmässige Auffälligkeit) gr<strong>und</strong>sätzlich das<br />
Bild der NutzerInnen.<br />
Einigen Kindern <strong>und</strong> Eltern wurde der Hort durch eine Fachstelle (wie HPD, SPD, AKJS)<br />
dringend empfohlen. Weiter besucht ein überproportionaler Anteil fremdsprachiger Kinder in<br />
der HPS den Hort.<br />
Grenzen bezüglich NutzerInnen werden gemäss Erfahrungen dort erreicht, wo der<br />
<strong>Betreuung</strong>sbedarf durch Mehrfachbehinderungen der einzelnen Kinder (fehlende Selbstständigkeit)<br />
die Kapazität des Personals übersteigt.<br />
Mit den 24 aktuell besetzten Plätzen ist das Hortangebot im Ackermätteli ausgeschöpft. Die<br />
Nachfrage übersteigt in der Regel die bestehende Platzzahl, was zu Abweisungen Einzelner<br />
führt – insbesondere älterer Kinder. Ein Ausbau des Angebots auch für über Elfährige wird<br />
am Schuljahr 2003/04 realisiert. Ebenso wird auf das grosse Einzugsgebiet hingewiesen.<br />
Eine Erweitung des Angebots auf andere Stadtgebiete wäre sinnvoll.<br />
4.5 Infrastruktur <strong>und</strong> Räume<br />
Dem Hort stehen aktuell drei Gruppenräume sowie eine kleinere Küche zur Verfügung.<br />
Daneben besteht die Möglichkeit, die Aussenanlage der Schule zu nutzen. Das<br />
Raumangebot wird als zu knapp wahrgenommen, da nur ein Raum pro Hortgruppe zur<br />
Verfügung steht <strong>und</strong> die Küche für diese Grösse an ihre Grenzen stösst.<br />
Ein Hort würde neben Gruppenräumen auch einen Hauptraum sowie eine anregende<br />
Aussenspielfläche benötigen. Weiter sind kindgerechte Spielgeräte <strong>und</strong> Mobiliar notwendig.<br />
Erwünscht ist im Rahmen eines Gesamtmodells eine klare Regelung des Platzbedarfs für<br />
entsprechende Angebote.<br />
4.6 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Elternarbeit bezieht sich vor allem auf individuelle Kontakte mit Eltern <strong>und</strong> Beratungen. Die<br />
sprachliche Vielfalt der Familien erschwert gemeinsame Elternabende mit<br />
Informationscharakter. Nach Bedarf können auch DolmetscherInnen beigezogen werden.<br />
4.7 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler werden im Hort in altersgemischten Gruppen betreut, d.h. die<br />
Kinder kommen aus unterschiedlichen Klassen. Dies erhöht den Koordinations- <strong>und</strong><br />
Kooperationsaufwand für die SozialpädagogInnen beträchtlich.<br />
Aktuell bestehen wöchentlich festgelegte Teamsitzungen unter den Sozialpädagoginnen<br />
sowie vierzehntägliche gemeinsame Sitzungen mit Lehrkräften <strong>und</strong> TherapeutInnen.<br />
Gemeinsame Schulhausaktivitäten <strong>und</strong> -projekte liefern weitere Möglichkeiten der<br />
Kooperation.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
23
Kommentar<br />
Nach Aussage der Befragten ist die Kooperation zwischen unterschiedlichen Professionen<br />
aus unterschiedlichen Handlungszusammenhängen (Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>) teilweise<br />
schwierig. Um eine fruchtbare Zusammenarbeit garantieren zu können, müssten klare<br />
Kooperationsgefässe <strong>und</strong> allenfalls Präsenzzeiten der Lehrkräfte (Kernzeiten) festgelegt<br />
werden. Hier wird Entwicklungspotential ermittelt.<br />
4.8 Personal, Ausbildung<br />
Für den Unterricht an der Heilpädagogischen Schule sind ausgebildete HeilpädagogInnen<br />
zuständig. Für den relativ hohen Therapiebedarf stehen unterschiedliche TherapeutInnen zur<br />
Verfügung. Für die <strong>Betreuung</strong> im Hort werden SozialpädagogInnen angestellt. Sie sind von<br />
9.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Hort anwesend. Pro Hortgruppe stehen jeweils zwei<br />
SozialpädagogInnen für je 8 Kinder zur Verfügung. Eine SozialpädagogIn ist jeweils für drei<br />
Jahre zur Hortleiterin gewählt.<br />
Zusätzlich zu den Professionellen in den beiden Hauptangeboten kommen PraktikantInnen,<br />
welche sowohl im Unterricht wie auch im Hort eingesetzt werden können, zum Einsatz. Die<br />
unterschiedlichen Professionen, die damit verb<strong>und</strong>enen Differenzen bezüglich Lohn <strong>und</strong><br />
Arbeitszeiten sowie das unterschiedliche soziale Ansehen führen häufig zu Spannungen <strong>und</strong><br />
erschweren die interdisziplinäre Kooperation.<br />
Als Möglichkeit, die Situation zu entschärfen wird diskutiert, die Lehrkräfte in 42-St<strong>und</strong>en-<br />
Modus (nicht nach Lektionen) anzustellen, um neben der Unterrichts- auch eine gewisse<br />
Präsenzzeit garantieren zu können.<br />
4.9 Kosten, Finanzierung (Erziehungsdepartement <strong>und</strong> Elternbeiträge)<br />
Die Eltern steuern für die Mittagsbetreuung (12.00 bis 14.00h) im Hort Fr. 3.– <strong>und</strong> für die<br />
Nachmittagsbetreuung (14.00 bis 17.00 Uhr) Fr. 7.– bei. Der Hort im Rahmen des<br />
Heilpädagogischen Schulangebots wird mit Fr. 7.– von der IV unterstützt. Der Rest <strong>und</strong><br />
ebenso das schulische Angebot werden vom Erziehungsdepartement beglichen. Insgesamt<br />
werden die Kosten als sehr hoch eingeschätzt, was als Nachteil wahrgenommen wird.<br />
4.10 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich steht das Angebot allen Kindern der Heilpädagogischen Schule Ackermätteli<br />
als freiwilliges Angebot zur Verfügung. In diesem Sinn werden die Kinder <strong>und</strong> Eltern sowohl<br />
bei der Abklärung im Heilpädagogischen Dienst auf das Angebot aufmerksam gemacht, wie<br />
auch durch die Schule selbst. Weitere Öffentlichkeitsarbeit ist nicht erforderlich, da die<br />
Nachfrage das Angebot übersteigen würde.<br />
4.11 Entwicklungspotential<br />
Bezüglich Kooperation zwischen der Schule <strong>und</strong> dem Hort wird Veränderungspotential<br />
wahrgenommen. Eine engere Verzahnung von Schule <strong>und</strong> Hort wird erwünscht, allerdings ist<br />
dazu ein klares Konzept <strong>und</strong> eine Entwicklungszeit erforderlich. In diesem Zusammenhang<br />
müssten ebenso Kernzeiten für die Lehrpersonen festgelegt werden, damit eine Kooperation<br />
möglich würde.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
24
Ein weiterer Bedarf wird bezüglich Ferienangeboten wahrgenommen.<br />
4.12 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Tagesbetreuungsstrukturen müssten Richtlinien bezüglich Basisqualifikation des Personals,<br />
Finanzierung, Raumbedarf für bestimmte Angebotstypen enthalten. Ebenso müsste im<br />
Rahmen eines Gesamtmodells die regionale Verteilung der Angebote gesteuert werden.<br />
Ferner wird eine gesetzliche Verankerung der Tagesbetreuungsstruktur als notwendig<br />
erachtet.<br />
Im Rahmen eines Gesamtmodells müssten Modelle für eine Ferienbetreuung mitbedacht<br />
werden.<br />
Es wird weiter angeregt, Fortbildungsmöglichkeiten für Personal im familienergänzenden<br />
Bereich anzubieten.<br />
Die Zusammenarbeit mit der Schulhausleitung <strong>und</strong> dem zuständigen Rektorat wurde bisher<br />
als gut beurteilt. Die Funktion des Erziehungsdepartements wird in der Schaffung von<br />
Rahmenbedingungen (Sicherung der Finanzen, Räume, Platzkoordination, Steuerung des<br />
Angebots) für die Tagesbetreuungsstrukturen gesehen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
25
5 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesstrukturen an den<br />
Orientierungsschule Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel 8,9<br />
5.1 Profil: Tagesstruktur an den Orientierungsschulen Grendelmatten<br />
<strong>und</strong> Hebel<br />
Orientierungsschule mit Tagesstruktur, bzw. Tagesschule Grendelmatten<br />
Die Orientierungsschule Grendelmatten mit Tagesstruktur wurde 1998 eröffnet. Das Projekt<br />
entstand aus dem Bedarf der Regelschule nach einem Angebot für SchülerInnen, die einen<br />
überschaubaren Schulbetrieb brauchen, <strong>und</strong> aus dem Bedürfnis des kantonalen Schulheims<br />
Gute Herberge, eine Brücke zwischen Heimklassen <strong>und</strong> Regelklassen zu schaffen. Das<br />
Projekt wurde extern begleitet, dreimal jährlich wurde eine Standortbestimmung mit allen<br />
Beteiligten durchgeführt, um laufend Anpassungen vornehmen <strong>und</strong> die Projektentwicklung<br />
dokumentieren zu können. Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde 2001 beim<br />
Erziehungsrat die Anerkennung der Orientierungsschule Grendelmatten als Regelklasse<br />
beantragt. Ab Schuljahr 2001/02 wurde die Orientierungsschule Grendelmatten als<br />
Regelklasse anerkannt <strong>und</strong> dem Rektorat der Landschulen Riehen <strong>und</strong> Bettingen unterstellt.<br />
Heute stellt die Orientierungsschule Grendelmatten eine Tagesschule mit Modellcharakter<br />
dar.<br />
Die Stärke der Tagesschule liegt in ihrer Flexibilität. Die Verbindung von Lernzeit <strong>und</strong><br />
ausserunterrichtlicher <strong>Betreuung</strong>szeit bietet hier die Möglichkeit flexibel auf die individuellen<br />
Lernbedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. Die SchülerInnen der OS Grendelmatten sind<br />
normal begabte Kinder der Regelschule <strong>und</strong> des Schulheims Gute Herberge, welche eine<br />
überschaubare Umgebung mit konstanten Beziehungen <strong>und</strong> wenig Wechsel bezüglich<br />
Fächern <strong>und</strong> Räumen brauchen. Dies sind insbesondere Kinder mit Schwierigkeiten im<br />
affektiven, sozialen <strong>und</strong> kognitiven Bereich (mit Problemen in der Herkunftsfamilie, Lern- <strong>und</strong><br />
Verhaltensschwierigkeiten usw.).<br />
Ein kleines Team von drei bis vier Lehrkräften übernimmt die <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Unterrichtung<br />
der SchülerInnen. Das Team unterrichtet alle Fächer der Orientierungsstufe. Es wird<br />
stufenübergreifend in durchlässigen Lerngruppen gearbeitet. Auf diese Weise kann der<br />
Unterricht den individuellen Fähigkeiten der SchülerInnen besser angepasst werden. Neben<br />
klassischen Unterrichtsfächern gehört auch die Verrichtung von Alltäglichkeiten – wie<br />
Spielen, Kochen, Gartenarbeit, Pflege von Umgangsformen <strong>und</strong> Freizeitgestaltung – zum<br />
Programm der Tagesschule OS Grendelmatten. Damit bietet die Tagesschule Grendelmatten<br />
eine umfassende Tagesbetreuungsstruktur.<br />
Die Schule dauert von 8.00 bis 15.00 Uhr, zuzüglich einer freiwilligen Aufgabenst<strong>und</strong>e. Der<br />
Mittwochnachmittag <strong>und</strong> die Schulferien sind frei.<br />
8 Die Erfahrungen der AnbieterInnen der Tagesbetreuungsstruktur an der Orientierungsschule Grendelmatten<br />
<strong>und</strong> Hebel wurden einerseits mittels eines qualitativen Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen<br />
Treffen abgegeben worden ist, ermittelt. Diesen haben Lehrpersonen der jeweiligen Orientierungsschulen<br />
ausgefüllt zurückgesandt. Andererseits wurde mit allen AnbieterInnen von Tagesbetreuungsangeboten an<br />
Orientierungsschulen eine gemeinsame Gruppendiskussion zu relevanten Fragestellungen (Fokusgruppen-<br />
Methode) durchgeführt. Im Folgenden werden die ausgewerteten Erfahrungen aus den qualitativen<br />
Fragebögen sowie den Gruppendiskussionen dargestellt.<br />
9 Teilnehmende an der Gruppendiskussion, in deren Rahmen alle Formen von Tagesstrukturen, die auf der<br />
OS-Stufe von den Schulen angeboten werden, zur Sprache kamen, waren folgende Personen:<br />
Sozialpädagoginnen Tagesbetreuung OS, Schulhausleitung OS Thomas-Platter-Wettstein, Lehrer OS<br />
Wasgernring, Rektorin OS Basel Ost, Sozialpädagogin Tagesbetreuung BS, Rektor OS Basel West,<br />
Konrektor OS Riehen, Lehrperson OS Grendelmatten, Lehrperson OS Hebel.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
26
Tagesstruktur bzw. Tagesschule Grendelmatten<br />
Tagesstruktur<br />
8.00–15.00 Uhr<br />
flexibler, individueller<br />
Unterricht <strong>und</strong><br />
Umgang mit<br />
alltäglichen Aufgaben<br />
Orientierungsschule mit Tagesstruktur, Hebel<br />
Seit Beginn des Schuljahrs 2002/03 wird an der Orientierungsschule Hebel in Riehen eine 1.<br />
Klasse der Orientierungsstufe mit <strong>Betreuung</strong>sstruktur angeboten. Geplant ist, das Angebot<br />
Schritt für Schritt für je einen Klassenzug von der 1. bis 3. OS einzuführen. Dieses Angebot<br />
versteht sich als Antwort auf den Bedarf nach einer erhöhten <strong>Betreuung</strong>sstruktur für<br />
SchülerInnen, welche verlässliche Tagesstrukturen <strong>und</strong> konstante Beziehungen brauchen.<br />
Das Angebot richtet sich vor allem an allein erziehende Eltern <strong>und</strong> Kinder mit einem erhöhten<br />
Bedarf an <strong>Betreuung</strong> (z.B. aufgr<strong>und</strong> sozialer Indikationen). Dies sind laut Aussage der<br />
Befragten insbesondere SchülerInnen, welche beim Wechsel in die Orientierungsschule<br />
auffällig werden, Schwierigkeiten mit dem Fachlehrersystem <strong>und</strong> dem häufigen Wechsel von<br />
Bezugspersonen haben. Einen heilpädagogischen Auftrag hat die Schule allerdings nicht. Im<br />
Gegensatz zum Angebot der Grendelmatten steht auch die individuelle Lernförderung nicht<br />
explizit im Zentrum. Für die Aufnahme wird erwartet, dass die potentiellen SchülerInnen dem<br />
Unterricht bisher folgen konnten. Einzelne SchülerInnen mit Schwierigkeiten bezüglich<br />
Lernverhalten <strong>und</strong> -motivation können allerdings mit normal belastbaren SchülerInnen<br />
unterrichtet werden. Die Auswahl für die Klasse trifft das Rektorat auf Anfrage der Eltern <strong>und</strong><br />
nach Rücksprache mit den Primarlehrkräften.<br />
Die Verbindung von <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Unterricht, die Konstanz der Bezugspersonen (drei bis<br />
vier Lehrkräfte pro Klasse) schafft Möglichkeiten, SchülerInnen mit spezifischen<br />
Schwierigkeiten die nötige Stabilität <strong>und</strong> Konstanz zu bieten. Dieser Rahmen ermöglicht es,<br />
die SchülerInnen individueller zu fördern.<br />
Ein Klasse kann 15 SchülerInnen der Orientierungsstufe aufnehmen. Der erste Klassenzug<br />
ist 2002/03 mit 13 SchülerInnen gestartet. Im nächsten Schuljahr wird ein neuer Zug<br />
gestartet. Ein Team von drei Lehrkräften unterrichtet <strong>und</strong> betreut die Klasse während des<br />
gesamten Tages. Gemeinsam mit den SchülerInnen wird zweimal gekocht, <strong>und</strong> zweimal wird<br />
das Essen von den Lehrkräften zubereitet. Ab dem Schuljahr 2003/04 kocht jede Klasse<br />
zweimal für beide Klassen.<br />
Tagesstruktur an der OS Hebel<br />
<strong>Betreuung</strong>szeit<br />
ab 7.30 Uhr<br />
Blockzeiten mit<br />
betreuter Mittagszeit<br />
8.00–15.00 Uhr<br />
<strong>Betreuung</strong>szeit<br />
bis 16.00 Uhr<br />
ab 2003/04 mit Hausaufgabenbetreuung<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
27
Die Öffnungszeiten des Angebots sind Montag, Dienstag, Donnerstag <strong>und</strong> Freitag von 8.00<br />
Uhr bis 15.00 Uhr. Am Mittwoch schliesst die Schule um 12.00 Uhr. Während der Ferien ist<br />
das Angebot geschlossen.<br />
Die beiden Schulangebote mit Tagesbetreuungsstruktur für OrientierungsschülerInnen haben<br />
neben einigen schulspezifischen <strong>und</strong> kontextspezifischen Unterschieden viele Ähnlichkeiten<br />
bezüglich des Konzepts, weshalb sie im Folgenden gemeinsam dargestellt werden.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird mehr über das Schulangebot der Grendelmatten geschrieben, da bereits<br />
längere Erfahrungszeit besteht, während das Angebot Hebel erst seit einem Jahr (2002/03)<br />
läuft.<br />
5.2 Kernangebot der Tagesbetreuungsstrukturen an den<br />
Orientierungsschulen Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel: Unterricht,<br />
<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung in einem<br />
Die Verbindung von Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> sowie Verpflegung bietet im Umgang mit der<br />
oft anspruchsvollen Zielgruppe wichtige Voraussetzungen. Dies ermöglicht es, zwischen<br />
verschiedenen Lernfeldern <strong>und</strong> Interessenschwerpunkten zu wechseln <strong>und</strong> so auf die<br />
individuellen Lernbedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. Die SchülerInnen werden in die<br />
Gestaltung des schulischen Alltags einbezogen, sie helfen kochen, abwaschen,<br />
Gartenarbeiten verrichten. Dabei wird auf ein hohes Mass an Eigenverantwortung <strong>und</strong> -<br />
initiative geachtet. Die Präsenz <strong>und</strong> wachsame Begleitung durch die Lehrpersonen<br />
unterstützt die Begleitung der individuellen Prozesse. Wenn immer möglich werden „echte“<br />
Situationen <strong>und</strong> Anlässe genutzt, um soziales Lernen zu üben: Verantwortlichkeit,<br />
Teamfähigkeit, Kritik- <strong>und</strong> Konfliktfähigkeit sowie Kooperationsfähigkeit. Weiter werden in den<br />
Blockzeiten die Hausaufgabenzeiten mit einbezogen.<br />
Die Tagesschule Grendelmatten versteht sich allerdings nicht als heilpädagogisches oder<br />
sozialpädagogisches Angebot, sondern als Tagesschule mit besonderem pädagogischem<br />
Ansatz für SchülerInnen der OS. Sie versteht sich unter anderem auch als Antwort auf<br />
Schwierigkeiten, welche die Einführung der Orientierungsschule manchen SchülerInnen<br />
bereitet. Danach stellen das Fachlehrkräftesystem, das Fachwahl- <strong>und</strong> Optionswahlsystem,<br />
die erweiterten Lernformen hohe Anforderungen an die Selbstständigkeit <strong>und</strong><br />
Eigenverantwortung der SchülerInnen <strong>und</strong> Eltern, was viele überfordert <strong>und</strong> zu<br />
Schulversagen, Verhaltensauffälligkeit usw. führen kann.<br />
Konstante <strong>und</strong> überschaubare Beziehungen, ganzheitliche <strong>und</strong> lebensnahe<br />
Lernmöglichkeiten <strong>und</strong> individuelle Förderung bieten hier eine Alternative für SchülerInnen<br />
mit besonderen Problemen.<br />
Ebenso wie bei der Tagesschule Grendelmatten verfolgt das Projekt Tagesbetreuung an der<br />
Orientierungsschule Hebel das Ziel, SchülerInnen durch eine enge Verzahnung von<br />
Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> Konstanz <strong>und</strong> individuelle Förderung zu ermöglichen. Damit leisten<br />
beide Schulangebote einen wesentlichen Beitrag zur Integration von SchülerInnen mit<br />
Schwierigkeiten im psychosozialen Bereich, die in der normalen Orientierungsschule<br />
auffallen, stören <strong>und</strong> immer häufiger freigestellt werden.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
28
5.3 Essen<br />
Die Verpflegung wird unterschiedlich organisiert. Zurzeit kochen die Lehrkräfte in der<br />
Grendelmatten einmal pro Woche mit den SchülerInnen gemeinsam. Die restlichen drei Tage<br />
wird das Essen bei der Tagesschule Niederholz geholt.<br />
Auf eine abwechslungsreiche, vollwertige <strong>und</strong> meist biologische <strong>und</strong> vegetarische Ernährung<br />
wird geachtet. Die selbst gekochten Menus werden mit den SchülerInnen gemeinsam<br />
zusammengestellt.<br />
Im Hebel kochen SchülerInnen mit der Hauswirtschaftslehrerin zweimal, die restlichen Male<br />
kochen die Lehrpersonen. Die SchülerInnen planen die Menuzusammenstellung mit, helfen<br />
beim Kochen, Tischdecken <strong>und</strong> Aufräumen. Geachtet wird auf ein saisonales <strong>und</strong> regionales<br />
Angebot. Ab dem Schuljahr 2003/04 wird jede Klasse zweimal für beide Klassen kochen.<br />
5.4 Zielpublikum, aktuelle NutzerInnen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Die Orientierungsschule Grendelmatten steht gr<strong>und</strong>sätzlich allen SchülerInnen der 1. bis 3.<br />
Orientierungsstufe der öffentlichen Schulen von Riehen <strong>und</strong> Bettingen (Regelklassen,<br />
Kleinklassen) <strong>und</strong> dem kantonalen Schulheim Gute Herberge, offen. Es bestehen ca. 15<br />
Plätze. Das Tagesschulangebot richtet sich speziell an SchülerInnen, welche konstante<br />
Beziehungen <strong>und</strong> Abläufe brauchen. Dies sind Kinder mit Schwierigkeiten im affektiven,<br />
sozialen <strong>und</strong> kognitiven Bereich (Herkunftsfamilie, Lern- <strong>und</strong> Verhaltensschwierigkeiten<br />
usw.). Sozial- wie auch heilpädagogische Indikationen sind Voraussetzungen für die<br />
Heimplatzierung im Schulheim Gute Herberge. Die Heimkinder besuchen in der Regel<br />
während drei bis vier Jahren die heiminterne Schule <strong>und</strong> können dann die externe<br />
Tagesschule Grendelmatten während der Orientierungsstufe besuchen, während sie in<br />
Wohngruppen des Heims wohnen.<br />
Die Zielgruppe der Tagesbetreuungsstruktur im Hebel ist insbesondere durch die<br />
psychosozialen Indikationen ihrer SchülerInnen geprägt. Im Unterschied zur Grendelmatten<br />
werden hier keine Heimkinder aufgenommen. Im Hebel besteht zurzeit ein Platzangebot für<br />
15 SchülerInnen.<br />
Individuelle Lernförderung <strong>und</strong> ebenso soziales Lernen in einem konstanten Rahmen stellen<br />
die Gr<strong>und</strong>lagen der Angebote dar. Damit wird nach speziellem pädagogischem Ansatz<br />
gearbeitet. Grenzen der Angebote bestehen bezüglich der <strong>Betreuung</strong>smöglichkeiten.<br />
SchülerInnen mit mehrfachen Indikationen, starken Verhaltensauffälligkeiten, mit<br />
Behinderungen sowie Schüler-Innen mit kaum sozialen Fähigkeiten können die Tragfähigkeit<br />
der Gruppe verunmöglichen.<br />
Für die Grendelmatten wird das Angebot durch die Primarlehrkräfte <strong>und</strong> mittels Flyer bekannt<br />
gemacht, andererseits melden sich die Eltern häufig auf Empfehlung des<br />
Schulpsychologischen Dienstes für diese Schulform an. Zusammen mit dem<br />
Schulpsychologischen Dienst <strong>und</strong> dem Rektorat wird schliesslich über die Aufnahme<br />
bestimmt. Insgesamt können 15 Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen die Tagesschule Grendelmatten<br />
besuchen. Im Idealfall werden je zur Hälfte SchülerInnen des Schulheims <strong>und</strong> SchülerInnen<br />
der öffentlichen Schulen Riehen <strong>und</strong> Bettingen aufgenommen.<br />
Ganz ähnlich verhält es sich beim Angebot Hebel. Die Primarlehrkräfte informieren die Eltern<br />
bezüglich des Angebots, das Rektorat bestimmt schliesslich in Absprache mit den Beteiligten<br />
über die mögliche Aufnahme im Angebot.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
29
5.5 Öffnungszeiten<br />
Die Schule Grendelmatten arbeitet mit Blockzeiten, welche von 8.00 bis 15.00 Uhr dauern<br />
<strong>und</strong> eine gemeinsame Mittagszeit enthalten. In der Grendelmatten wird zuzüglich eine<br />
freiwillige Aufgabenst<strong>und</strong>e angeboten. Im Hebel besteht ein <strong>Betreuung</strong>sangebot inklusive<br />
Aufgabenhilfe von 7.30 bis 16.00 Uhr. Der Mittwochnachmittag <strong>und</strong> der Samstag sind bei<br />
beiden Angeboten frei. Während der Schulferien wird kein zusätzliches <strong>Betreuung</strong>sangebot<br />
aufrechterhalten.<br />
5.6 Infrastruktur <strong>und</strong> Räume<br />
Die Tagesschule Grendelmatten befindet sich in einem Gebäude des Schulheims Gute<br />
Herberge. Neben dem Schulzimmer, das auch als Esszimmer dient, stehen drei weitere<br />
kleinere Räume, darunter ein Gruppenraum, ein Büro sowie eine Küche <strong>und</strong> ein kleiner Mal-<br />
<strong>und</strong> Zeichenraum zur Verfügung. Ein parkähnlicher Umschwung wird bei trockenem Wetter<br />
genutzt. Als Mangel wird zurzeit der fehlende Rückzugs- <strong>und</strong> Ruheraum einerseits <strong>und</strong> die<br />
gleichzeitige Nutzung des Schulraums als Essraum andererseits festgehalten. Da die Räume<br />
zum Schulheim Gute Herberge gehören <strong>und</strong> nur noch bis 2004 genutzt werden können, wird<br />
die Raumsuche als dringliches Thema gesehen.<br />
Die Tagesbetreuung OS Hebel ist im Schulgebäude der Orientierungsstufe einquartiert.<br />
Insofern stehen die Räume der Schule <strong>und</strong> zusätzliche Container zur Verfügung. Zum<br />
Kochen kann die Schulküche genutzt werden. Für den Ausbau des Angebots auf alle drei<br />
Schuljahre würden drei Klassenzimmer, drei Esszimmer <strong>und</strong> ein Aufenthaltsraum sowie eine<br />
zusätzliche Schulküche gebraucht. Zurzeit fehlen noch geeignete Aufenthaltsräume mit<br />
Spielmöglichkeiten. Insgesamt wird die Raumsituation als prekär beurteilt.<br />
5.7 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird als sehr wichtig erachtet. Dafür stehen<br />
Elterninformationenabende <strong>und</strong> -gespräche zur Verfügung. Zwei Beurteilungs- <strong>und</strong><br />
Beratungsgespräche pro Jahr finden mit den Erziehungsverantwortlichen statt. Ebenso<br />
werden die Eltern nach Möglichkeit bei Festen oder beim Kochen ihrer Spezialitäten<br />
eingesetzt oder wenn immer möglich beigezogen, wenn spezielle Kompetenzen oder<br />
Materialien usw. gebraucht werden. Die Eltern äussern auch Wünsche – wie z.B.<br />
Hausaufgaben lösen. Aufgr<strong>und</strong> der positiven Rückmeldungen gehen die Lehrkräfte der<br />
Grendelmatten davon aus, dass die Eltern mehrheitlich sehr zufrieden sind mit dem Angebot.<br />
Da ein Anteil der SchülerInnen aus dem Schulheim Gute Herberge stammt, ergeben sich an<br />
Stelle von Elternkontakten auch Kontakte zu SozialpädagogInnen des Heims. Die Lehrkräfte<br />
der Tagesschule treffen sich deshalb einmal pro Monat mit den SozialpädagogInnen.<br />
Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird auch in der OS Hebel gepflegt. Drei Elternabende,<br />
nach Bedarf Elterngespräche, ein Elternkommunikationsheft <strong>und</strong> Elternratssitzungen<br />
gewährleisten die nötige Kommunikation. Für die geplante <strong>Betreuung</strong> der Hausaufgaben<br />
nach Schulschluss wäre es wünschenswert, wenn Eltern einbezogen werden könnten.<br />
5.8 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Da die Lehrkräfte auch die <strong>Betreuung</strong>sarbeit übernehmen, bestehen bezüglich der internen<br />
Kooperation zwischen unterschiedlichen Professionen keine Schwierigkeiten. Die Lehrkräfte<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
30
verstehen sich als Team <strong>und</strong> zeigen eine ähnliche Wertorientierung. Hierin ist ein klarer<br />
Vorteil dieses Angebots zu erkennen.<br />
Zur Förderung der Integration der Schule in die öffentlichen Schulen <strong>und</strong> die Öffentlichkeit<br />
werden laufend Projekte <strong>und</strong> Veranstaltungen sowie Austauschmöglichkeiten gesucht.<br />
5.9 Personal, Ausbildung<br />
Ein Team von ca. vier bis fünf Lehrpersonen übernimmt sowohl den Fächerunterricht sowie<br />
die <strong>Betreuung</strong> der SchülerInnen zwischen den Unterrichtseinheiten. Die Arbeit in<br />
Orientierungsschulen mit Tagesbetreuungsstrukturen erfordert wie die Arbeit in<br />
Tagesschulen neben der fachlichen Qualifikation ein hohes Mass an Flexibilität, Motivation<br />
<strong>und</strong> Belastbarkeit.<br />
In der Grendelmatten erhalten die Lehrpersonen für den <strong>Betreuung</strong>steil über den Mittag <strong>und</strong><br />
das Kochen zwei Drittel des Lektionsansatzes, was dem Ansatz von Tagesschulen<br />
entspricht. Ein höheres Kostendach (50 Lektionen bzw. 3,57 Lektionen pro Kind) aufgr<strong>und</strong><br />
der anspruchsvollen Schülerschaft sichert die Finanzierung der Lehrerlöhne. Jede Lehrkraft<br />
leistet in der Regel 10% zusätzlich unentlöhnte Arbeit. Da für die Verpflegung einmal selbst<br />
gekocht wird <strong>und</strong> die restlichen Male das Essen geliefert wird, werden keine Personalkosten<br />
für die Küche erforderlich. Ebenso entstehen durch diese Form keine Kosten für weiteres<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonal.<br />
Den Eltern werden – vergleichbar wie bei Mittagstischangeboten – ein Beitrag von Fr. 6.– pro<br />
Tag für das Essen verrechnet.<br />
Im Konzept Tagesbetreuung Orientierungsschule Hebel ist ein Dreierteam von Lehrkräften<br />
für die Unterrichtung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> einer Klasse vorgesehen. Die Lehrkräfte müssen über<br />
eine entsprechende Ausbildung verfügen. Weiteres Personal ist nicht erforderlich, da auch<br />
das Kochen übernommen wird. Die Lohnkosten werden über ein entsprechendes<br />
Kostendach finanziert. Die <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en werden zu zwei Drittel des Lektionenansatzes<br />
entgolten.<br />
5.10 Kosten, Finanzierung<br />
Die Kosten der Lehrerlöhne werden über ein erhöhtes Kostendach – begründet aus der<br />
Zielgruppe – beglichen. Im Angebot Grendelmatten werden Elternbeiträge für das<br />
Mittagessen erhoben. Das Gleiche gilt für die OS Hebel. Der erhöhte Platzbedarf wird<br />
ebenfalls durch das Schulbudget beglichen.<br />
5.11 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Mit Flyern, Informationsveranstaltungen, M<strong>und</strong>-zu-M<strong>und</strong>-Propaganda wird für das jeweilige<br />
Angebot geworben. Im Falle der Grendelmatten besteht eine höhere Nachfrage als es Plätze<br />
hat, insofern ist zu viel Werbung nicht sinnvoll. Öffentlichkeitsarbeit muss aber betrieben<br />
werden, um das Angebot <strong>und</strong> die Anliegen zu kommunizieren <strong>und</strong> die Integration des<br />
Angebots in der öffentlichen Wahrnehmung voranzutreiben.<br />
Im Falle des Angebots Hebel entspricht die Platzzahl dem Bedürfnis. Die Akzeptanz ist gut.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
31
5.12 Entwicklungspotential<br />
Die Tagesschule Grendelmatten, welche bereits auf Erfahrungen seit 1998 zurückblicken<br />
kann, fand sehr schnell ihre Stellung in der Basler Schullandschaft <strong>und</strong> entspricht heute<br />
einem offensichtlichen Bedürfnis. Das Pilotprojekt wurde zunächst für drei Jahre bewilligt.<br />
Eine externe Begleitung, mehrmalige Standortbestimmung <strong>und</strong> Zwischenberichte halfen das<br />
Projekt zu entwickeln 10 . Nach der Projektphase 2001 wurde beim Erziehungsrat eine<br />
Anerkennung der Tagesschule Grendelmatten beantragt, welche gutgeheissen wurde.<br />
Das Tagesbetreuungsangebot an der OS Hebel besteht erst seit diesem Schuljahr (2002/03).<br />
Erste Erfahrungen werden laufend erfasst <strong>und</strong> Standortbestimmungen sind nötig.<br />
Kommentar<br />
Beide Angebote stellen umfassende Schulangebote mit Tagesbetreuungsstrukturen dar, die<br />
konzeptionell mit Tagesschulen vergleichbar sind. Das Angebot richtet sich bei beiden an<br />
SchülerInnen, welche klare <strong>und</strong> konstante Beziehungen <strong>und</strong> Strukturen brauchen, sowie eine<br />
<strong>Betreuung</strong> zwischen den Schulzeiten. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Die<br />
Angebote liefern einen wichtigen Beitrag zur Integration. SchülerInnen mit psychosozialen<br />
Schwierigkeiten, welche sich auf ihre schulischen Leistungen negativ auswirken <strong>und</strong> damit<br />
ihre Schullaufbahn gefährden, haben oft Mühe in der Orientierungsstufe.<br />
Verhaltensauffälligkeiten, schlechte Leistungen, Repetitionen, Abklärungen <strong>und</strong> Freistellung<br />
aus der Schule können die Folge sein.<br />
Dies wirft auch Fragen bezüglich der Orientierungsschule auf. Durch das Fachlehrersystem<br />
<strong>und</strong> damit das Wegfallen von Bezugspersonen, aber auch durch die Freifach- <strong>und</strong> Optionswahlfachmöglichkeit<br />
<strong>und</strong> die neuen Lernformen stellt die Orientierungsschule hohe<br />
Anforderungen an die Selbstständigkeit <strong>und</strong> Selbstverantwortung der SchülerInnen. Wer<br />
darin keine Unterstützung von Elternseite oder andern Bezugspersonen hat <strong>und</strong> selbst zu<br />
wenig gefestigt ist, scheint mit dem Ansatz potentiell Mühe zu haben.<br />
Die hier beschriebenen Angebote legen andere Schwerpunkte <strong>und</strong> bieten eine konstantere<br />
Tagesstruktur <strong>und</strong> damit die Gr<strong>und</strong>lage fürs Lernen. Diese Erfahrungen, aber auch<br />
Erfahrungen mit der Orientierungsschule müssten weiter evaluiert <strong>und</strong> in Relation gesetzt<br />
werden. Letztlich liefern dieser Erfahrungen auch Potential für die Entwicklung der<br />
Orientierungsschule.<br />
5.13 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird auch auf dieser Stufe ein Bedarf nach ganzheitlicher <strong>Betreuung</strong><br />
wahrgenommen. Ein Ausbau von Tagesschulen bzw. umfänglichen Tagesstrukturen an<br />
Orientierungsschulen wird deshalb von den Verantwortlichen als wichtig erachtet.<br />
Zunächst wäre dazu eine klare Haltung des Erziehungsdepartements nötig. Eine rechtliche<br />
Verankerung der Tagesschulen sei dann der nächste Schritt. Dauerhafte Pilotprojekte<br />
würden zu viele Ressourcen binden <strong>und</strong> verhinderten die Etablierung. Klare Konzepte, eine<br />
Steuerung der Angebote <strong>und</strong> die Begleitung der Umsetzungsphasen seien weiter wichtig.<br />
Nach Auffassung der Befragten sollten nach Möglichkeit genügend Standorte mit ähnlichen<br />
Angeboten ausgestattet werden. Tagesschulangebote bieten klar den Vorteil, dass die<br />
Verzahnung zwischen unterrichtszentrierten <strong>und</strong> ausserunterrichtlichen Lernangeboten<br />
besser gewährleistet werden kann (Platz für informelles <strong>und</strong> soziales Lernen). Damit ist ein<br />
umfassenderes Lernen möglich, was für zahlreiche SchülerInnen heute sehr wichtig ist, da<br />
die familiären Strukturen dies weniger gewährleisten können.<br />
10 Siehe dazu das Konzept <strong>und</strong> die Zwischenberichte zum Schulprojekt Grendelmatten, Rektorat Landschulen<br />
Riehen <strong>und</strong> Bettingen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
32
Bei einem Ausbau der Tagesschulen wäre es sinnvoll, diese an einem eigenen Standort zu<br />
entwickeln, da der spezifische Rhythmus der Tagesschulen oft nicht mit dem der normalen<br />
Regelschulen harmoniert.<br />
Weiter regen die DiskussionsteilnehmerInnen dazu an, der Frage nach dem Umgang mit<br />
„schwierigen“ SchülerInnen bzw. den Schwierigkeiten von SchülerInnen im bestehenden<br />
Orientierungsschulangebot nachzugehen. Hier sei eine Klärung nötig. Immer mehr müssten<br />
ganzheitliche schulische Angebote schwierige SchülerInnen aufnehmen, da die Grenzen<br />
zwischen Regelschule <strong>und</strong> sonderschulischen Angeboten zunehmend verwischt würden:<br />
„Kleinklassen, die keine sein wollen bzw. dürfen!“ Tagesschulangebote sollten aber<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich die Struktur der Gesamtbevölkerung abbilden.<br />
Kommentar<br />
Ebenso wie die Verantwortlichen der Tagesbetreuungsangebote an den<br />
Orientierungsschulen Wasgenring <strong>und</strong> Gellert sehen die Verantwortlichen der<br />
Tagesbetreuung an den Orientierungsschulen Hebel <strong>und</strong> Grendelmatten einen Bedarf für<br />
eine umfassendere Tagesstruktur. Zahlreiche Kinder scheinen heute mit den<br />
Lernbedingungen in der Orientierungsschule Mühe zu haben. Danach brauchen einige<br />
SchülerInnen auch auf der Orientierungsstufe noch eine ganzheitliche <strong>Betreuung</strong>, die ihnen<br />
hilft, die Anforderungen <strong>und</strong> die Struktur der Orientierungsstufe (Fachlehrersystem,<br />
Wahlfächer, Raumwechsel etc.) zu bewältigen, zumal ihnen das Elternhaus dabei wenig<br />
Unterstützung bieten kann. Die Erfahrungen mit den Tagesbetreuungsangeboten<br />
Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel liefern insgesamt zahlreiche Hinweise, welche auch die<br />
Entwicklung der Orientierungsschule beeinflussen könnten. Schulformen, welche in ihrem<br />
pädagogischen Konzept die Verankerung von Unterricht <strong>und</strong> Tagesbetreuung enthalten,<br />
verstehen sich als Antwort auf den wahrgenommenen <strong>Betreuung</strong>sbedarf einzelner<br />
SchülerInnen.<br />
Weiter wird – wie auch in der Diskussion mit den TagesschulanbieterInnen auf der<br />
Primarstufe – deutlich, dass Tagesschulen bzw. Schulen mit Tagesstruktur im Spannungsfeld<br />
von Regelschulangeboten <strong>und</strong> sonderschulischen Angeboten liegen. Der ganzheitliche<br />
pädagogische Ansatz der Angebote führt zu einer vermehrten Platznachfrage durch Eltern,<br />
Lehrkräfte <strong>und</strong> Institutionen im Bereich Kinder <strong>und</strong> Jugendschutz sowie durch den<br />
Schulpsychologischen Dienst. Insbesondere für Kinder mit psychosozialen Problemen in <strong>und</strong><br />
mit der Schule, welche im Rahmen des Regelschulangebots überfordert sind, werden<br />
umfassende Tagesstrukturen wichtig. Oft wird mit dem Besuch des speziellen Schulangebots<br />
auch die Einweisung in eine Kleinklasse vermieden. Diese Schultypen verstehen sich aber<br />
als Regelschulangebote ohne heilpädagogischen Auftrag <strong>und</strong> können nur eine begrenzte<br />
Anzahl „schwieriger“ Kinder aufnehmen. Diese Erfahrungen müssten weiter aufgearbeitet<br />
werden. Eine Klärung bezüglich der Funktion <strong>und</strong> Abgrenzung der diversen Angebote ist<br />
dringend nötig. Damit stellt sich auch die Frage nach der Rolle der Tagesschule bzw.<br />
Tagesstrukturen in Orientierungsschulen. Sollen sich Tagesschulangebote primär mit<br />
schwierigen Kindern befassen, also ein Spezialangebot darstellen? Oder sollen<br />
Tagesbetreuungsstrukturen primär für RegelklassenschülerInnen bestehen, die nur zu einem<br />
gewissen Teil auch „schwierigere“ Kinder mittragen können? Letzteres würde zur Integration<br />
der SchülerInnen zweifellos mehr beitragen als ausgrenzende Sonderangebote, es würde<br />
aber einige Angebote mehr erfordern.<br />
Und schliesslich stellt sich die Frage, welches Ziel hinter den unterschiedlichen verwendeten<br />
Bezeichnungen steckt. So grenzen sich die heutigen Angebote auf der Orientierungsstufe<br />
vom Begriff Tagesschule ab durch Begriffe wie Tagesbetreuungsstruktur OS Wasgenring <strong>und</strong><br />
Gellert oder Tagesstruktur OS Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel, obwohl insbesondere die Projekte<br />
Grendelmatten <strong>und</strong> Hebel als solche bezeichnet werden könnten.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
33
6 Auswertung der Erfahrungen mit Tagesbetreuungsstrukturen<br />
an den Orientierungsschule Wasgenring <strong>und</strong> Gellert 11,12<br />
6.1 Profil: Tagesbetreuung bzw. Hort an den Orientierungsschulen<br />
Wasgenring <strong>und</strong> Gellert<br />
Seit dem Schuljahr 2001/02 wird im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts an der<br />
Orientierungsschule Basel am Standort Wasgenring, Grossbasel-West, <strong>und</strong> seit 2002/03 am<br />
Standort Gellert, Grossbasel-Ost eine Tagesbetreuung für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der<br />
Regelschule angeboten. Das Projekt versteht sich als Nachfolgeprojekt der in diesem Jahr<br />
auslaufenden Tagesschule ITOS. Die Tagesschule ITOS stellte eine integrierte Tagesschule<br />
für OrientierungsschülerInnen der Regelklasse <strong>und</strong> der Kleinklasse dar. Ziel war es, die<br />
KleinklassenschülerInnen während der Essenszeit, der Freizeit <strong>und</strong> im Rahmen der<br />
Wahlfächer gemeinsam mit RegelklassenschülerInnen zu betreuen. Die Auswertung der<br />
Erfahrungen zeigen, dass die Tagesschule ITOS mit zu vielen Problemen zu kämpfen hatte,<br />
die unter anderem aus dem Integrationsgedanken der Kleinklasse in die Regelklasse<br />
resultierten (z.B. Aufrechterhaltung der Leistungsziele, Zusammensetzung der Regelklasse<br />
bezüglich Geschlecht, sozialer Herkunft, Indikation etc.). Ebenso fehlte die nötige<br />
Unterstützung des Tagesschulkonzepts unter anderem durch das Erziehungsdepartement<br />
<strong>und</strong> durch die Politik, was enorm viele Ressourcen der Angestellten verbrauchte. Weiter<br />
fehlte eine langfristige Planung <strong>und</strong> Ausrichtung des Angebots.<br />
Als Konsequenz daraus wurde das Auslaufen der Angebote <strong>und</strong> eine Entflechtung der<br />
beiden Bereiche beschlossen, was zahlreiche Konsequenzen mit sich zog (Infrastruktur,<br />
Finanzierung, Personelles, Standortwechsel). Daraus entstanden die künftigen Kleinklassen-<br />
Tagesschulen der Orientierungsstufe an den Standorten Gellert <strong>und</strong> Thomas-Platter-<br />
Wettstein (siehe dazu die Auswertungen der Kleinklassen-Tagesschulen) <strong>und</strong> eine<br />
hortähnliche Tagesbetreuungsstruktur für OrientierungsschülerInnen der Regelklasse an den<br />
Standorten Gellert <strong>und</strong> Wasgenring (siehe nachfolgende Beschreibung). Der ursprünglich<br />
ebenfalls geplante Standort Thomas-Platter-Wettstein wurde nicht realisiert.<br />
Neu am Konzept der Tagesbetreuung auf der Orientierungsstufe ist, dass Unterricht<br />
einerseits, <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung andererseits getrennt organisiert werden. Für die<br />
Verpflegung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> der Freizeit <strong>und</strong> der Hausaufgaben stehen SozialpädagogInnen<br />
zur Verfügung. Die Tagesbetreuung an der Orientierungsstufe stellt ein schulergänzendes<br />
Angebot dar (im Gegen-satz zu einem schulintegrierten Angebot wie die Tagesschule),<br />
insbesondere für SchülerInnen der 1. <strong>und</strong> 2. Orientierungsschulklasse, die einen höheren<br />
<strong>Betreuung</strong>sbedarf haben. Dies können Kinder mit erhöhtem <strong>Betreuung</strong>sbedarf von<br />
erwerbstätigen Eltern bzw. allein erziehenden Eltern sein. Gr<strong>und</strong>sätzlich steht das Angebot<br />
allen RegelschülerInnen offen. Das Angebot deckt aller-dings keine heilpädagogischen<br />
Bedürfnisse ab. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis wird weiter angestrebt. Die<br />
11 Die Erfahrungen der AnbieterInnen der Tagesbetreuungsstruktur an der Orientierungsschule Wasgenring <strong>und</strong><br />
Gellert wurden einerseits mittels eines qualitativen Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen Treffen<br />
abgegeben worden ist, ermittelt. Diesen haben Lehrpersonen der jeweiligen Orientierungsschulen ausgefüllt<br />
zurückgesandt. Andererseits wurde mit allen AnbieterInnen von Tagesbetreuungsangeboten an<br />
Orientierungsschulen eine gemeinsame Gruppendiskussion zu relevanten Fragestellungen (Fokusgruppen-<br />
Methode) durchgeführt. Im Folgenden werden die ausgewerteten Erfahrungen aus den qualitativen<br />
Fragebögen sowie den Gruppendiskussionen dargestellt. Der Bericht wurde anschliessend verifiziert.<br />
12 Teilnehmende an der Gruppendiskussion, in deren Rahmen alle Formen von Tagesstrukturen, die auf der<br />
OS-Stufe von den Schulen angeboten werden, zur Sprache kamen, waren folgende Personen:<br />
Sozialpädagogin Tagesbetreuung OS, Schulhausleitung OS Thomas-Platter-Wettstein, Lehrer OS<br />
Wasgernring, Rektorin OS Basel Ost, Sozialpädagogin Tagesbetreuung BS, Rektor OS Basel West,<br />
Konrektor OS Riehen, Lehrperson OS Grendelmatten, Lehrperson OS Hebel.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
34
Schulleitung entscheidet schliesslich, wer aufgenommen wird. Bisher profitierten im<br />
Wasgenring, Grossbasel-West, 9 SchülerInnen <strong>und</strong> im Gellert, Grossbasel-Ost, 5<br />
SchülerInnen vom Angebot. Wie viele SchülerInnen je aus andern Quartieren in das<br />
Tagebetreuungsangebot aufgenommen werden können, ist von der Klassenbildung im<br />
Schulhaus abhängig. Für das kommende Schuljahr wird insgesamt mit ca. 36 SchülerInnen<br />
(18 im Wasgenring, 18 im Gellert) gerechnet.<br />
Unterricht im<br />
Fachlehrersystem<br />
Tagesbetreuung<br />
OS, Hort<br />
11.15/12.00–17.00<br />
Uhr<br />
Mittagessen, Zvieri<br />
Hausaufgaben<br />
Freizeit<br />
Die Tagesbetreuungsstruktur steht von Montag bis Freitag von 11.15/12.00 bis 17.00 Uhr zur<br />
Verfügung. Am Mittwoch ist das Angebot bis 14.00 Uhr offen, es wird aber nach Bedarf auch<br />
länger aufrechterhalten. Während der Schulferien ist die Tagesbetreuung geschlossen.<br />
6.2 Kernangebot der Tagesbetreuung an der Orientierungsstufe: Schule<br />
<strong>und</strong> Tagesbetreuungsstruktur bzw. Hort<br />
SchülerInnen, welche vom Tagesbetreuungsangebot an der Orientierungsstufe Wasgenring<br />
<strong>und</strong> Gellert profitieren, nutzen das normale Angebot der Regelklassen (Unterricht,<br />
Projektwochen, Kolonien, Sportlager) <strong>und</strong> das Frei- <strong>und</strong> Optionswahlfachangebot.<br />
Die schulfreie Zeit verbringen sie in einer hortähnliche organisierten<br />
Tagesbetreuungsstruktur. Die SchülerInnen der 1. <strong>und</strong> 2. Orientierungsschule werden in<br />
jahrgangs- <strong>und</strong> klassen-übergreifenden Gruppen von SozialpädagogInnen betreut. Die<br />
Tagesbetreuung an der Orientierungsstufe versteht sich als Bindeglied zwischen der Schule<br />
<strong>und</strong> dem Elternhaus <strong>und</strong> ist für die Freizeit der SchülerInnen zuständig. Im Zentrum der<br />
<strong>Betreuung</strong> steht die Unterstützung der Selbst-, Sozial- <strong>und</strong> Sachkompetenz der SchülerInnen<br />
sowie die Pflege von Umgangsformen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>werten. Die <strong>Betreuung</strong> der Hausaufgaben<br />
stellt neben der Freizeitgestaltung eine wichtige Arbeit im Rahmen des Angebots dar. Bei<br />
einer <strong>Betreuung</strong> in der Regel von zehn bis fünfzehn St<strong>und</strong>en pro Woche ist Kontinuität<br />
gewährleistet, dies liefert die Gr<strong>und</strong>lage von tragfähigen Beziehungen. Ebenso bieten die<br />
gemischten Gruppen neue Erfahrungs-möglichkeiten, eigene Rollen wahrzunehmen, was<br />
von den SozialpädagogInnen als grosse Chance erlebt wird.<br />
Die SchülerInnen erhalten ein Mittagessen <strong>und</strong> ein Zvieri am Nachmittag, das im Rahmen<br />
des <strong>Betreuung</strong>sangebots gemeinsam eingenommen wird. Nachhilfest<strong>und</strong>en, therapeutische<br />
<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Einzelfallbetreuung erfolgen wie bei allen RegelschülerInnen im Rahmen des<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
35
Klassenverbandes auf Initiative des Teams <strong>und</strong> in Zusammenarbeit mit den zuständigen<br />
Diensten.<br />
6.3 Essen<br />
Das Essen (Mittagessen <strong>und</strong> Zvieri) wird von KöchInnen (120 Stellenprozent) bereitgestellt.<br />
An beiden Standorten ist der Koch/die KöchIn noch bis Ende Schuljahr 2002/03 gleichzeitig<br />
für die Verpflegung der Kleinklassen-Tagesschule auf der Orientierungsstufe zuständig. Dies<br />
ermöglicht es, Synergien zu nutzen. Es wird auf eine saisongerechte, ausgewogene <strong>und</strong><br />
abwechs-lungsreiche Ernährung geachtet. Ebenso werden vegetarische wie Hauptgerichte<br />
mit Fleisch angeboten. Nationalitätenspezifische Wünsche <strong>und</strong> generell Wünsche der<br />
SchülerInnen werden mitberücksichtigt.<br />
Das Essen wird schliesslich in die Räume der Tagesbetreuung geliefert bzw. geholt. Dort<br />
wird es mit den SozialpädagogInnen gemeinsam eingenommen. R<strong>und</strong> ums Essen sind<br />
weitere Möglichkeiten sozialen Lernens gegeben.<br />
6.4 Zielpublikum <strong>und</strong> aktuelle NutzerInnen<br />
Die OrientierungsschülerInnen der Regelklassen an den genannten Standorten stellen das<br />
Zielpublikum dar. Die Angebote bieten Platz für je 18 SchülerInnen. Aktuell (seit 2001/02)<br />
werden die Angebote wie folgt genutzt:<br />
STS Gellert, Grossbasel-Ost<br />
STS Wasgenring, Grossbasel-West<br />
bisher neu angemeldet<br />
2003/04<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
6<br />
(seit 2002/03)<br />
9<br />
(seit 2001/02)<br />
Total gemäss Anmeldung (per Mai 2003) 15 33<br />
Da im Schuljahr 2003/04 der erste Jahrgang (2001/02) im Wasgenring entlassen wird,<br />
können auf das kommende Schuljahr neue SchülerInnen aufgenommen werden. Am<br />
Standort Gellert wurde der Betrieb erst seit diesem Schuljahr (2002/03) aufgenommen, was<br />
die relativ geringen Belegzahlen erklärt. Insgesamt haben sich bis heute 41 Eltern <strong>und</strong><br />
SchülerInnen für das Angebot interessiert, davon kann gemäss Erfahrung ca. ein Drittel<br />
abgezogen werden. Somit ist schliesslich mit ca. 32 SchülerInnen an beiden Standorten zu<br />
rechnen.<br />
Ebenso wie bei andern Tagesbetreuungsangeboten werden bezüglich der Gruppendurchmischung<br />
Grenzen des Angebots wahrgenommen. Danach kann ein Übermass an<br />
SchülerInnen mit psychosozialen Schwierigkeiten den Betrieb des Angebots überfordern.<br />
Nach Schätzung der SozialpädagogInnen im Wasgenring hätten 30-50% der betreuten<br />
SchülerInnen eine zusätzliche Therapie nötig, welche im Rahmen des <strong>Betreuung</strong>sangebots<br />
nicht geboten werden kann.<br />
15<br />
18<br />
36
6.5 Öffnungszeiten<br />
Das <strong>Betreuung</strong>sangebot steht von 11.15 bis 17.00 Uhr jeweils am Montag, Dienstag,<br />
Donnerstag <strong>und</strong> Freitag offen. Am Mittwoch ist von 12.00 bis 14.00 Uhr – nach Bedarf aber<br />
auch länger – offen. Keine <strong>Betreuung</strong> findet – wie bei andern schulnahen Angeboten –<br />
während der Schulferien statt.<br />
6.6 Raum <strong>und</strong> Infrastruktur<br />
Für die <strong>Betreuung</strong> im Gellert sind zwei Räume vorhanden. Im Gellert-Schulhaus wird weiter<br />
ein Gang als wichtiger Raum genutzt. Im Wasgenring wird ein Raum für gemeinsame<br />
Aktivitäten wie Essen, Spielen etc. genutzt. Dieser Raum ist laufend betreut. Ein zweiter<br />
Raum dient im Wasgenring ausschliesslich der stillen Beschäftigung wie Hausaufgaben<br />
Lösen, Lesen <strong>und</strong> Ausruhen. Dieser Raum ist nur teilweise während dem Lösen der<br />
Hausaufgaben betreut.<br />
Am Standort Gellert werden die Räume meist multifunktional genutzt. Insgesamt werden die<br />
vorhandenen Möglichkeiten positiv eingeschätzt.<br />
6.7 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern <strong>und</strong> SozialpädagogInnen wird als gemeinsame<br />
Aufgabe verstanden <strong>und</strong> beruht auf gegenseitiger Offenheit <strong>und</strong> Verbindlichkeit. Im<br />
Wasgenring stehen für die Eltern immer eine Lehrperson <strong>und</strong> eine SozialpädagogIn als<br />
Ansprechperson zur Verfügung. Einmal pro Jahr wird mindestens ein Elternabend<br />
durchgeführt. Je nach Bedarf finden aber auch monatlich oder täglich Elternkontakte statt.<br />
Eltern melden mehrheitlich Positives zurück. Sie wünschten sich eine Weiterführung mit evtl.<br />
stufengerechter Anpassung auch während der 3. Orientierungsstufe (z.B. Umgang mit<br />
Freiheit).<br />
6.8 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Die Zusammenarbeit mit der Schule, so zeigen die bereits längern Erfahrungen im<br />
Wasgenring, stellt eine grosse Herausforderung dar <strong>und</strong> muss geregelt werden. Das<br />
Fachlehrersystem an der Orientierungsschule erhöht den Personalsbestand beträchtlich, was<br />
Absprachen <strong>und</strong> gegenseitige Informationen erschweren kann. Anfängliche Schwierigkeiten<br />
bezüglich Kommunikation, Information, Zuständigkeit <strong>und</strong> Instanzenwege mussten geklärt<br />
werden. Ein Konzept regelt im Wasgenring die Kooperation. Die SozialpädagogInnen werden<br />
heute als Teil des Kollegiums eines Schulhauses verstanden. Dennoch wird bezüglich<br />
Informationsverteilung <strong>und</strong> Aufgabenteilung von Seiten der SozialpädagogInnen im<br />
Wasgenring noch Verbesse-rungsbedarf angemeldet.<br />
Die SozialpädagogInnen im Wasgenring treffen sich einmal wöchentlich zu einer<br />
Teamsitzung (innerhalb der Arbeitszeit). Einmal im Monat werden die KöchInnen eingeladen.<br />
Eine SozialpädagogIn nimmt obligatorisch an der Schulhauskonferenz teil (innerhalb der<br />
Arbeitszeit). Diese Person übernimmt die Funktion für ein Jahr <strong>und</strong> ist gleichzeitig<br />
Ansprechperson für die Schulleitung. Die SozialpädagogInnen können an Aktionen,<br />
Unternehmungen, Projekten usw. im Schulhaus teilnehmen. Die Tagesbetreuung muss<br />
jedoch gewährleistet sein.<br />
Im Gellert-Schulhaus sind SozialpädagogInnen in der Regel auch in der 10-Uhr-Pause<br />
anwesend. Dies bietet Raum für informelle Gespräche, Absprachen <strong>und</strong> gegenseitige<br />
Information zwischen Lehrkräften, Abwart <strong>und</strong> SozialpädagogInnen, was wiederum zur<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
37
Schulhauskultur beiträgt. Gr<strong>und</strong>sätzlich wird auch hier die gegenseitige Information <strong>und</strong><br />
Zusammenarbeit noch als verbesserungswürdig betrachtet.<br />
Kommentar<br />
Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit von klaren Konzepten bezüglich Zuständigkeit <strong>und</strong><br />
Zusammenarbeit. Ferner wird deutlich, dass die Entwicklung einer guten Zusammenarbeit<br />
Zeit <strong>und</strong> die nötige Aufmerksamkeit aller braucht <strong>und</strong> nicht unterschätzt werden darf.<br />
6.9 Personal, Ausbildung<br />
Für die <strong>Betreuung</strong> der SchülerInnen werden SozialpädagogInnen angestellt. Sie arbeiten<br />
nach Pflichtenheften <strong>und</strong> folgen den schulinternen Weisungen <strong>und</strong> speziellen<br />
Vereinbarungen mit den Schulleitungen sowie den berufsspezifischen Standards. Während<br />
der <strong>Betreuung</strong>szeit wurden immer zwei <strong>Betreuung</strong>spersonen einberechnet. Vorgesehen sind<br />
bei einer Belegung von 18 Personen etwa 130 Stellenprozent. Eine 100%-Anstellung ist<br />
aufgr<strong>und</strong> der Ferienzeit <strong>und</strong> der täglichen Arbeitszeit nicht möglich. Etwa 70%-Anstellungen<br />
sind möglich. Diese Teilzeitstellen sind daher nicht immer leicht zu besetzen. Insbesondere<br />
Männer melden sich kaum auf solche Stellen, was auf dieser Stufe als Mangel<br />
wahrgenommen wird.<br />
Insgesamt beklagen die Angestellten der Tagesbetreuung Wasgenring die knappe<br />
Besprechungszeit bzw. die Zeit für fachspezifische Reflexion.<br />
Für die Verpflegung sorgen KöchInnen. Total 120 Stellenprozent stehen dazu zur Verfügung.<br />
An beiden Standorten sind die KöchInnen gleichzeitig für die Verpflegung der Kleinklassen<br />
zuständig. Die Verantwortung für das Küchenpersonal <strong>und</strong> das <strong>Betreuung</strong>spersonal liegt bei<br />
den Rektoraten der Orientierungsstufe <strong>und</strong> im Wasgenring der Kleinklasse. Die<br />
Kostenberechung ist von einem der Rektorate zu leisten.<br />
6.10 Kosten, Finanzierung<br />
Die Regelung der Finanzierung, die Kostenberechung wird über das Rektorat der<br />
Orientierungsstufe erledigt. Gr<strong>und</strong>sätzlich gelten die gleichen Ansätze für Elternbeiträge wie<br />
bei Tagesschulen. Sie belaufen sich von Fr. 3.50 min. bis auf Fr. 35.20 max. pro Tag<br />
<strong>Betreuung</strong>.<br />
6.11 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Information der Eltern betreffend Angebot erfolgt über die PrimarlehrerInnen einerseits<br />
<strong>und</strong> über Flyer andererseits. Standortwechsel <strong>und</strong> die Neukonzeption der Tagesbetreuung an<br />
der Orientierungsstufe in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass die Belegzahlen noch<br />
wenig gesteuert werden können. Auf das Schuljahr 2003/04 sind alle Plätze besetzt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Aufhebung des Standorts Thomas-Platter-Wettstein besteht zusätzlich eine<br />
Warteliste.<br />
Insgesamt wird beklagt, dass die Tagesbetreuung an der Orientierungsstufe in der<br />
Öffentlichkeit noch kaum wahrgenommen wird.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
38
6.12 Entwicklungspotentialn<br />
Die Tagesbetreuung an den Orientierungsschule Wasgenring <strong>und</strong> Gellert werden im Rahmen<br />
eines dreijährigen Pilotprojekts geführt. Am Standort Wasgenring läuft das Projekt seit dem<br />
Schuljahr 2001/02, am Standort Gellert seit dem Schuljahr 2002/03. Zwischenberichte sollen den<br />
Verlauf dokumentieren <strong>und</strong> die künftige Form mitbestimmen. Eine externe Projektevaluation<br />
wurde vorgesehen.<br />
Im ersten Evaluationsbericht (Lewin 2001), der auch die auslaufenden Tagesschulen ITOS<br />
mitberücksichtigte, wurden folgende Entwicklungsnotwendigkeiten für den Standort Wasgenring<br />
festgehalten.<br />
• Gr<strong>und</strong>sätzlich steht die Tagesbetreuung vor der Schwierigkeit, ein Profil zu entwickeln.<br />
Tagesbetreuung in der Schule stellt auch gegenwärtig noch ein relativ neues Angebot dar, das<br />
auf Profilbildung <strong>und</strong> -kommunikation angewiesen ist. Die Herausforderung besteht darin, nicht<br />
bloss als Hütedienst wahrgenommen zu werden, sondern als erzieherisches Angebot, das die<br />
Gesamtentwicklung der betreuten SchülerInnen unterstützt <strong>und</strong> entwickeln hilft. Dazu ist unter<br />
anderem ein Pflichtenheft nötig, das die Aufgaben <strong>und</strong> Ziele der Arbeit transparent macht, den<br />
Gestaltungsraum festlegt <strong>und</strong> die Zuständigkeiten <strong>und</strong> Instanzenwege klärt.<br />
• Die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Professionen sowie zwischen den unterschiedlichen<br />
Instanzen gestaltete sich zunächst schwierig. Eine so intensive Zusammenarbeit<br />
wie im Vorgängermodell ITOS wurde nicht gewünscht. Dennoch musste die Zusammenarbeit<br />
gewährleistet werden. Dazu mussten Instanzenwege, Zuständigkeiten, Kommunikationswege<br />
geklärt <strong>und</strong> Teamsitzungen festgelegt werden.<br />
• Ebenso musste geklärt werden, wer welche Infrastruktur <strong>und</strong> welche Räume nutzen kann.<br />
Danach mussten Absprachen zwischen den SozialpädagogInnen der Tagesbetreuung<br />
Orientierungsschule <strong>und</strong> den SozialpädagogInnen der Kleinklassen-Tagesschule Orientierungsstufe<br />
bezüglich gemeinsam genutzten Räumen getroffen werden.<br />
• Mangels Erfahrungen mit dem <strong>Betreuung</strong>sangebot bestanden am Anfang Schwierigkeiten, die<br />
Plätze zu besetzen. Die externe Evaluation empfahl, vermehrt Öffentlichkeitsarbeit zu machen.<br />
Ein Imagewechsel erfordert ein höheres Mass an Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Ebenso wurden durch die externe Evaluation Herausforderungen genannt, welche die<br />
damals noch bestehende ITOS (integrierte Orientierungsschule) betrafen. Unter anderem<br />
führten Schwierigkeiten wie die folgenden zum Scheitern des Angebots: zu grosse, nicht<br />
tragfähige Gruppen, schlechte Durchmischung bezüglich Geschlecht, sozialer Herkunft,<br />
Indikation, aber auch fehlende Profilentwicklung, anfänglich schlechte Zusammenarbeit<br />
zwischen Lehrkräften <strong>und</strong> SozialpädagogInnen sowie die fehlende Unterstützung durch das<br />
Erziehungsdepartement <strong>und</strong> die Öffentlichkeit. Im Detail wird nicht weiter darauf<br />
eingegangen, da das ITOS-Modell inzwischen abgebrochen wurde bzw. bis 2003/04 im<br />
Rahmen von Kleinklassen-Tagesschulen einerseits <strong>und</strong> den hier besprochenen<br />
Tagesbetreuungsstrukturen an der Orientierungsstufe anderseits weiter-geführt wird.<br />
Kommentar<br />
Insgesamt zeigen positive Erfahrungen gegenwärtig, dass auf der Orientierungsstufe durchaus<br />
Bedarf nach einer höheren <strong>Betreuung</strong> besteht. Weiter zeigte sich, dass die Entflechtung auf der<br />
Orientierungsstufe von Unterricht (Fachlehrersystem) <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> begrüsst wird <strong>und</strong> mit einem<br />
entsprechenden Kooperationskonzept (Verantwortungen, Zusammenarbeit etc.) zu gewährleisten<br />
ist. Ebenso hat sich bewährt, dass die <strong>Betreuung</strong>sgruppen nicht den Schulgruppen entsprechen,<br />
wodurch sich für viele Jugendliche neue Rollen <strong>und</strong> Chancen ergeben.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
39
6.13 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Die TeilnehmerInnen an der Gruppendiskussion beurteilen die Erfahrungen mit den<br />
unterschiedlichen Modellen an Tagesbetreuungsstrukturen auf der Orientierungsstufe<br />
kritisch. Insgesamt ist viel Energie in die Entwicklung geflossen, was nicht durchwegs zum<br />
Erfolg geführt hat. Die DiskussionsteilnehmerInnen sind der Meinung, dass in der<br />
Öffentlichkeit schliesslich die Schwierigkeiten im ITOS-Modell zu stark wahrgenommen <strong>und</strong><br />
die anfallenden Kosten kritisiert wurden, während standortspezifische Vorteile kaum ins<br />
Gewicht fielen <strong>und</strong> weiterentwickelt werden konnten. Man ist durchaus der Auffassung, dass<br />
es einen Bedarf an Tagesbetreuungsstrukturen gibt. Wichtig wäre es, die Erfahrungen zu<br />
reflektieren <strong>und</strong> die Entwicklung der bestehenden Angebote zu begleiten. Weiter wird betont,<br />
dass zu den umfassenden <strong>Betreuung</strong>sstrukturen wie der Tagesschule oder jetzigen<br />
Tagesbetreuungsstruktur an Orientierungsschulen kaum Alternativen bestehen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird von einem Gesamtmodell erwartet, dass eine lebensraumorientierte<br />
Entwicklung gefördert wird, d.h. Angebote im Wohn- <strong>und</strong> Schulquartier entstehen. Im<br />
Rahmen eines künftigen Gesamtprojekts Tagesbetreuung wünschen sich die Schulleitung<br />
der Orientierungsstufe, die Lehrkräfte <strong>und</strong> SozialpädagogInnen weiter die Entwicklung eines<br />
Konzepts für Tagesschule auf der OS. Eine klare gesetzliche <strong>und</strong> konzeptionelle<br />
Verankerung ist notwendig, um die Entwicklung sinnvoll auszugestalten. Im Zusammenhang<br />
mit Primar-tagesschulen könnte so ein sinnvolles, klar durchgeführtes Angebot entstehen.<br />
Die gegenwärtige Tagesbetreuung an der Orientierungsstufe würde schliesslich zu Gunsten<br />
der neuen Tagesschule an der Orientierungsstufe fallen gelassen. In der Form einer<br />
Tagesschule würden Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> wieder näher zusammengeführt <strong>und</strong> andere<br />
Unterrichtsformen wären möglich.<br />
Weiter wäre ein eigener Standort für die Entwicklung der Tagesschulen auf der Primar- <strong>und</strong><br />
Orientierungsstufe wichtig. Tagesschulen könnten so ihre spezifische Kultur besser entfalten.<br />
Im Rahmen eines Gesamtmodells müssten dringend Überlegungen bezüglich der Ferienbetreuung<br />
angestellt werden. Die bestehenden Angebot decken den Bedarf keineswegs ab.<br />
In Bezug auf die Rahmenbedingungen für die <strong>Betreuung</strong>saufgaben der SozialpädagogInnen<br />
auf der Orientierungsstufe sind bisher keine kantonal geltenden Richtlinien entstanden, auch<br />
wurde eine Fachbegleitung durch das Erziehungsdepartement bisher kaum wahrgenommen.<br />
Hier ist ebenfalls Entwicklungspotential wahrzunehmen.<br />
Kommentar<br />
Die Entwicklung <strong>und</strong> Erfahrungen der Tageschulen auf der Orientierungsstufe (ITOS) sowie<br />
die Erfahrungen mit getrennten Tagesbetreuungsangeboten – Kleinklassen-Tagesschule OS<br />
<strong>und</strong> Tagesbetreuung an der OS – zeigen, dass viele Schwierigkeiten im Zusammenhang mit<br />
der unklaren Haltung des Erziehungsdepartements im Umgang mit Tagesschulen stehen.<br />
Danach wurde für Standortwechsel, Raum- <strong>und</strong> Infrastrukturbeschaffung bzw. die<br />
Ressourcen-beschaffung insgesamt sehr viel Energie aufgewendet. Ausserdem wurde die<br />
Planung <strong>und</strong> Entwicklung der Angebote zu wenig begleitet.<br />
Weiter zeigen die Erfahrungen, dass auf der Orientierungsstufe durchaus ein Bedarf an<br />
umfassenden Tagesbetreuungsstrukturen besteht. Und schliesslich wird deutlich, dass der<br />
Erfolg der Tagesbetreuungsstruktur zentral mit der Organisationsform bzw. den<br />
Kooperations-bedingungen von Schule <strong>und</strong> Tagesbetreuungsangebot zusammenhängt.<br />
Danach entstehen insbesondere dann Chancen auf Integration, wenn die Angebote in klarer<br />
Verbindung zu der Schule stehen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird die idealste Lösung eigentlich in<br />
der Tagesschule gesehen, welche die enge Verzahnung von Schule <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> als<br />
pädagogisches Konzept versteht.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
40
7 Auswertung der Erfahrungen der AnbieterInnen von<br />
Tagesheimen für Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen 13<br />
Tagesheime bieten von ihrer Tradition her eine Tagesstruktur insbesondere für Säuglinge<br />
<strong>und</strong> Kinder im Vorschulbereich. Damit fallen sie nicht in den Zuständigkeitsbereich des<br />
Ressorts Schulen im Erziehungsdepartement, sondern in den Zuständigkeitsbereich des<br />
Ressorts Dienste, Abteilung Tagesbetreuung. In Basel-Stadt werden Tagesheime oder<br />
Krippen von subventionierten, privaten <strong>und</strong> betrieblichen Trägerschaften angeboten.<br />
Insgesamt standen ende 2001 1640 Plätze zur Verfügung, mit denen 2345 Kinder betreut<br />
wurden (Pulli, Stern & Iten, 2002) 14 . Der Kanton subventioniert unter anderem die Angebote<br />
des Basler Frauenvereins <strong>und</strong> des Vereins Kinderkrippe Bläsistift, weshalb das Gespräch mit<br />
Vertreterinnen beider Vereine geführt wurde.<br />
Da die meisten Krippen bzw. Tagesheime aber eine gewisse Anzahl ihrer Kinder auch im<br />
Schulalter weiter betreuen, entstehen in der Gruppe der Schulkinder faktisch<br />
Überschneidungen bezüglich der Zuständigkeit. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung<br />
der familien- <strong>und</strong> schulergänzenden Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler werden die Tagesheime insofern nur hinsichtlich ihrer Leistung bezüglich dieser<br />
Altersgruppe zum Vergleich beigezogen. Exemplarisch werden die Erfahrungen mit<br />
Schulgruppen in der Bläsikrippe vorgestellt.<br />
7.1 Profil: Tagesheim für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Kinderkrippen oder Tagesheime bieten eine umfassende <strong>und</strong> ganzheitliche Tagesstruktur<br />
primär für Säuglinge <strong>und</strong>/oder Vorschulkinder (ab 2 Monate bis 7 Jahre). Da der Bedarf nach<br />
umfassender <strong>Betreuung</strong> auch mit dem Schuleintritt für viele Kinder weiter gegeben ist, bieten<br />
einige Krippen auch Plätze für Schulkinder. Gr<strong>und</strong>sätzlich setzen die jeweiligen Tagesheime<br />
ihre eigenen Schwerpunkte.<br />
Eine ganzheitliche <strong>Betreuung</strong> in der vertrauten Atmosphäre der Krippe unterstützt die Entwicklung<br />
von seelischen, körperlichen <strong>und</strong> geistigen Fähigkeiten bereits in den ersten<br />
Lebens-jahren. Selbstständigkeit <strong>und</strong> Individualität einerseits <strong>und</strong> Gemeinschaftssinn<br />
anderseits werden angestrebt. Die Zusammensetzung der Kinder in den Krippen entspricht<br />
dem Bevölkerungsbild der Quartiere. Danach werden je nach Quartier auch viele<br />
fremdsprachige Kinder unterschiedlichster Herkunft betreut. Die frühe Möglichkeit in den<br />
Tagesheimen, die Kinder mit der hiesigen Kultur vertraut zu machen, leistet einen wichtigen<br />
Beitrag zur Integration der Kinder.<br />
Neben der <strong>Betreuung</strong> stellt das gemeinsame Essen einen wichtigen Bereich für soziales<br />
Lernen dar.<br />
Qualifizierte KleinkinderzieherInnen, HortnerInnen etc. sorgen für eine qualitativ hoch<br />
stehende <strong>Betreuung</strong> der Kinder. Nach Bedarf arbeiten die MitarbeiterInnen mit<br />
PsychologInnen oder SupervisorInnen zusammen. Zielvereinbarungen, Weiterbildung <strong>und</strong><br />
Teamarbeit garantieren die fachliche Entwicklung des Personals.<br />
13 Die Erfahrungen der TagesheimanbieterInnen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der Primarstufe wurden<br />
einerseits mittels eines qualitativen Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen Treffen abgegeben<br />
worden ist, ermittelt. Diesen haben auf Empfehlung des Basler Frauenvereins <strong>und</strong> des Bläsikrippenvereins je<br />
eine Vertreterin zum Ausfüllen erhalten. Andererseits wurde mit den beiden Vertreterinnen ein Gespräch zu<br />
den relevanten Fragestellungen durchgeführt. Im Folgenden werden die ausgewerteten Erfahrungen aus den<br />
qualitativen Fragebögen sowie den Gesprächen dargestellt. Der Bericht wurde anschliessend durch die<br />
Interviewpartnerinnen verifiziert.<br />
14 Pulli, R., Stern, S. & Iten, R. (2002). Familienergänzende Tagesbetreuung im Kanton Basel-Stadt. Ergebnisse der<br />
Bedarfsabschätzung <strong>und</strong> -prognose. Schlussbericht zuhanden des Erziehungsdepartement des Kantons Basel-<br />
Stadt.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
41
Tagesheime haben gegenüber den meisten andern Angeboten den Vorteil, dass ihre<br />
Öffnungszeiten am umfassendsten sind. Sie haben täglich von jeweils ca. 6.15/6.30 Uhr bis<br />
18.00/18.30 Uhr geöffnet. Ein weiterer Vorteil z.B. gegenüber Tagesschulen ist eindeutig<br />
darin zu sehen, dass auch ein Angebot in den Schulferien besteht.<br />
7.2 Zielgruppe <strong>und</strong> Nachfrage der Tagesheime<br />
Da zurzeit in Basel-Stadt noch keine erweiterten Tagesbetreuungsangebote für<br />
Kindergartenkinder oder Primarschulkinder (mit Ausnahme der zwei Tagesprimarschulen)<br />
beste-hen, betreuen die meisten Tagesheime auch SchülerInnen der Primarschule, vereinzelt<br />
sogar OrientierungsschülerInnen.<br />
Die Hauptzielgruppe der Tagesheime wird je nach Schwerpunkt durch Säuglinge (0 bis 2J.)<br />
<strong>und</strong>/oder Vorschulkinder (2 bis7 J.) bestimmt. Ein kleinerer Teil von SchülerInnen (7 bis 16 J.)<br />
wird je nach Tagesheim ebenfalls betreut. Gemäss der Studie „Familienergänzende Tagesbetreuung<br />
im Kanton Basel-Stadt“ (vgl. Pulli et al., 2002, S. 29) bestand im Jahr 2001 ein<br />
Platzangebot von insgesamt 1640 privaten <strong>und</strong> subventionierten Plätzen, in denen r<strong>und</strong> 2350<br />
Kinder betreut werden konnten. Davon sind r<strong>und</strong> 80% Kleinkinder oder Kinder im<br />
Vorschulalter bzw. nur 20% Schulkinder (Pulli et al., 2002, S. 25). Dies waren laut Auskunft<br />
der Abteilung Tagesbetreuung knapp 250 SchülerInnen. Die Nachfrage nach<br />
Vollzeitbetreuungsplätzen für Schulkinder ist zwar geringer als bei Vorschulkindern, besteht<br />
aber dennoch. Dies wird auch von der erwähnten Studie bestätigt (Pulli et al., 2002).<br />
7.2.1 Schulkinder im Tagesheim<br />
Mangels Alternativen zu Tagesheimen – welche ein sehr umfassendes Angebot bereitstellen<br />
– wird die Weiterführung der Tagesheimstruktur für jüngere Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler von<br />
einigen Eltern als grosser Bedarf eingestuft. Für Kinder erwerbstätiger Eltern, welche auf eine<br />
<strong>Betreuung</strong> an drei bis fünf Tage die Woche angewiesen sind, bestehen für die ersten<br />
Primarschuljahre kaum Alternativen zum Tagesheim.<br />
Einige Tagesheime bieten sogar einen Mittagstisch <strong>und</strong> teilweise Hausaufgabenhilfe für<br />
OrientierungsschülerInnen im ersten <strong>und</strong> teilweise zweiten OS-Jahr an. Die <strong>Betreuung</strong> der<br />
OS-SchülerInnen bereitet für die Tagesheime oft einen organisatorischen Aufwand <strong>und</strong> wird<br />
nicht ohne weiteres als wünschenswert eingeschätzt. Gr<strong>und</strong>sätzlich sind die BetreiberInnen<br />
der Angebote der Meinung, OS-SchülerInnen brauchten eigentlich keine Tagesheime mehr.<br />
Insbesondere für ältere SchülerInnen seien Angebote nötig, welche auf die spezifischen<br />
Bedürfnisse dieser Altersgruppe eingehen.<br />
Gemäss Erfahrung der AnbieterInnen sind es vor allem Kinder, welche bereits im<br />
Vorschulalter im Tagesheim waren, die eine Weiterführung ab Schulalter wünschen.<br />
Der Umgang mit den Schulkindern stellt aber eine Herausforderung für die Tagesheime dar.<br />
Laut Aussagen der Befragten bestehen kaum Konzepte für den Umgang mit SchülerInnen.<br />
Auch verfügt das Personal in der Regel nicht über die nötige Qualifikation, um mit<br />
SchülerInnen zu arbeiten. In dieser Altersgruppe wäre eine sozialpädagogische,<br />
animatorische Ausbildung sinnvoller. Ebenfalls mit der Ausweitung des Angebots für<br />
Schulkinder entsteht der Bedarf nach neuen Berechnungs- <strong>und</strong><br />
Finanzierungsgr<strong>und</strong>modellen. Danach müssen Sollzahlen erhöht werden, um genügend<br />
Einnahmen erwirtschaften zu können. Der veränderte zeitliche <strong>Betreuung</strong>saufwand (z.B. nur<br />
eine St<strong>und</strong>e morgens vor der Schule, erst ab 12.00 Uhr, nur über Mittag etc.) verlangt<br />
notwendig auch organisatorische <strong>und</strong> inhaltliche Anpassung. Zurzeit besteht diesbezüglich<br />
noch viel Unklarheit.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
42
7.3 Beispiel: Schulgruppe in der Bläsikrippe<br />
Die Bläsikrippe besteht bereits seit 1871 <strong>und</strong> ist damit die älteste Krippe in Basel-Stadt. Die<br />
Krippe hat 38 Plätze, die aufgr<strong>und</strong> von Teilzeitbelegungen insgesamt für 56 Kinder einen<br />
<strong>Betreuung</strong>splatz bieten. Betreut werden die Kinder in vier Gruppen, wovon eine Gruppe eine<br />
SchülerInnengruppe darstellt. Die Schulgruppe ist 1988 auf Wunsch der ErzieherInnen<br />
entstanden <strong>und</strong> durch eine zusätzliche Raumerweiterung möglich geworden.<br />
Die Erfahrungen mit der Schulgruppe für 7- bis 10-Jährige der Bläsikrippe werden im<br />
Folgenden dargestellt <strong>und</strong> sollen exemplarisch für ähnliche Angebote stehen, welche zurzeit<br />
ebenfalls entwickelt werden.<br />
7.3.1 Kernangebot: <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Verpflegung im Hort<br />
Die Schulgruppe umfasst pro Tag nie mehr als 10 bis12 Kinder. Sie werden von zwei<br />
Personen betreut, wovon eine Person über eine sozialpädagogische Qualifikation verfügt <strong>und</strong><br />
eine Person im Praktika ist. Die Kinder kommen in der Regel nach der Unterrichtszeit am<br />
Morgen um 12.00 Uhr ins Tagesheim. Zunächst wird gemeinsam gegessen. Danach besteht<br />
Zeit für Hausaufgaben <strong>und</strong> schliesslich für die Freizeit (teils angeleitet, teils frei gestaltbar).<br />
7.3.2 Essen<br />
Das Essen wird von einer Köchin für die ganze Bläsikrippe zubereitet <strong>und</strong> an die jeweiligen<br />
Gruppen verteilt.<br />
7.3.3 Nutzerinnen, Belegszahlen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Aktuell nutzen zu einem Hauptteil Kinder, welche als Kleinkind bereits in der Bläsikrippe<br />
waren das Angebot. Einige wenige stossen auf Gr<strong>und</strong> von Empfehlungen durch den<br />
Schulpsychologischen Dienst oder die Lehrkräfte etwas später noch dazu. Nach Erfahrung<br />
der Leiterin der Bläsikrippe haben etwa 4 von 10 Kindern sehr komplexe<br />
Familienhintergründe. Im Gegensatz zu früher wird das Krippenangebot heute vermehrt auch<br />
von Schweizer Eltern beansprucht (50%).<br />
Wie bereits die Studie „Tagesbetreuung im Kanton Basel-Stadt“ (Pulli et al., 2002)<br />
nachweisen konnte, besteht auch laut Auskunft der Befragten heute ein erhöhter Bedarf an<br />
Teilzeitbetreuungsplätzen. Danach werden <strong>Betreuung</strong>smöglichkeiten für 50% nachgefragt.<br />
Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Belegzahlen. Um die vollständige Belegung zu<br />
garantieren, müssen mehr NutzerInnen als effektiv Plätze bestehen aufgenommen werden,<br />
was zu einem erhöhten Aufwand bezüglich der Zusammenstellung von optimalen Gruppen<br />
führt. Bisher war das Angebot aber immer ausgelastet. Bei der Auswahl werden Kinder aus<br />
dem Quartier bevorzugt sowie Kinder von Alleinerziehenden oder von Familien, in denen<br />
beide Elternteile aus wirtschaftlichen Gründe erwerbstätig sein müssen.<br />
Da die Schulgruppe noch durch die Kleinkindergruppen quersubventioniert werden kann,<br />
werden etwa 13 bis14 Kinder benötigt, um das Ziel zu erreichen. Würde die<br />
Quersubventionierung wegfallen, müssten mindestens 15 Plätze besetzt werden können.<br />
7.3.4 Öffnungszeiten<br />
Für die SchülerInnen besteht das Angebot von 12.00 bis 18.00 Uhr. Wer zudem schon<br />
morgens vor der Schule <strong>Betreuung</strong>sbedarf hat, kann vom bestehenden Angebot des<br />
Tagesheims profitieren (Auffangzeit von 6.15 Uhr an).<br />
Ebenso bestehen Angebote auch in den Schulferien, was einen enormen Vorteil gegenüber<br />
schulorientierten Angeboten darstellt. In den Ferien ist das Angebot von 9.00 bis 18.00 Uhr<br />
offen. Dieses Ferienangebot wird von ca. der Hälfte der Kinder wahrgenommen.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
43
7.3.5 Zusammenarbeit mit den Eltern<br />
Die Kinderkrippe unterstützt mit ihrem Angebot die elterliche Erziehung. Deshalb wird grosser<br />
Wert auf einen gemeinsamen Austausch gelegt. Gemeinsame Gespräche bezüglich<br />
Entwicklungsstand, Gewohnheiten <strong>und</strong> familiärer Situation helfen, die gemeinsame Aufgabe<br />
zu bewerkstelligen. In der täglichen <strong>Betreuung</strong>sarbeit übernimmt die Krippe auch häufig die<br />
Funktion einer Drehscheibe für Anliegen der Familie <strong>und</strong> des weitern <strong>Betreuung</strong>sumfeldes.<br />
7.3.6 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Die LeiterInnen der Schulgruppe pflegen einen guten Kontakt zu den Lehrkräften der<br />
jeweiligen SchülerInnen. Dies bietet Möglichkeiten, die einzelnen Kinder spezifisch zu<br />
unterstützen <strong>und</strong> zu fördern. Auf Wunsch der Lehrkräfte oder der Eltern nehmen die<br />
LeiterInnen auch an gemeinsamen Gesprächen teil.<br />
7.3.7 Räume<br />
Für die <strong>Betreuung</strong> der Schülergruppe stehen ein grosser Raum (30m 2 ) <strong>und</strong> ein kleiner Raum<br />
(10 m 2 ), eine Toilette sowie eine kleine Küche in einem Aussengebäude der Krippe zur<br />
Verfügung. Zusätzlich ist der Werkraum der Krippe mitbenutzbar. Leider steht kaum ein<br />
Aussenraum zur Verfügung.<br />
7.3.8 Finanzierung<br />
Für die Belegung <strong>und</strong> die Finanzierung gelten bisher folgende Richtlinien. Fünfmal die<br />
Woche das Angebot von 12.00 bis 18.00 Uhr in Anspruch zu nehmen, entspricht 75% der<br />
Belegszeit in Tagesheimen. Wer zusätzlich auch morgens vor dem Unterricht in der Krippe<br />
betreut wird, beansprucht 100%. Gefordert wird eine minimale Belegung von 40%.<br />
Die zusätzlich beanspruchte Zeit wird separat verrechnet. Die Elternbeiträge sind<br />
lohnabhängig. Bei Vollzeitbelegung beträgt der Beitrag 10% des Bruttoeinkommens. Bei<br />
einem Einkommen von mehr als Fr. 5000.– im Monat erhöht sich der Elternanteil pro Fr.<br />
100.– um 0,1%. Bei einer vollen Belegung (5 Tage) werden gemäss Subventionsvertrag mit<br />
dem Kanton Basel-Stadt höchstens ca. Fr. 2300.– pro Platz verrechnet. Die Krippenplätze<br />
werden vom Erziehungsdepartement einkommensabhängig subventioniert.<br />
7.3.9 Personal<br />
Die Schulgruppe in der Bläsikrippe wird im Unterschied zu der Gruppe der Kleinkinder –<br />
welche von KleinkinderzieherInnen betreut wird – von einem/r SozialpädagogIn oder einem/r<br />
PraktikantIn geführt. Die BetreuerInnen der Schulgruppe <strong>und</strong> jene der Kleinkind- <strong>und</strong><br />
Säuglingsgruppen treffen sich regelmässig zu Teamsitzungen. Ebenfalls helfen die<br />
BetreuerInnen der Schulkinder auch bei der <strong>Betreuung</strong> der jüngern Kinder mit oder<br />
übernehmen deren <strong>Betreuung</strong> während Sitzungen.<br />
7.4 Entwicklungspotential <strong>und</strong> Herausforderungen<br />
Wie die Erfahrungen mit Schulkindern zeigen, hat die Anpassung der Tagesheimangebote an<br />
die Bedürfnisse von Schulkindern einige organisatorische Veränderungen zur Folge, die<br />
kritisch betrachtet werden müssen.<br />
Die zeitliche Strukturveränderung des Angebots – statt ganztags nur von 12.00 bis 18.00 Uhr<br />
– bedingt die Sollzahlenerhöhung, damit die Finanzierung garantiert werden kann. Dies<br />
bedeutet, dass in den Stosszeiten über Mittag <strong>und</strong> nach der Schule grössere Gruppen bei<br />
gleich bleibendem Personal betreut werden müssen, was wiederum Auswirkungen auf die<br />
<strong>Betreuung</strong>squalität hat.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
44
Insbesondere Kinder, welche eine grosse Konstanz <strong>und</strong> intensivere <strong>Betreuung</strong> benötigen,<br />
kommen dadurch tendenziell zu kurz. Ebenso ist das soziale Lernen schwieriger anzuleiten.<br />
Gemäss Erfahrungen der Befragten gilt, je kleiner die Kinder, desto eher ist <strong>Betreuung</strong> in<br />
einem überschaubaren konstanten Rahmen notwendig. Ebenso sind konstante Strukturen<br />
wichtig für Kinder, welche einen hohen <strong>Betreuung</strong>sbedarf haben (75 bis100%). Täglich<br />
wechselnde grosse Gruppen führen zu Unruhe <strong>und</strong> fehlender Beziehungskonstanz zwischen<br />
den Kindern <strong>und</strong> zwischen den Kindern <strong>und</strong> dem Personal.<br />
Nach Aussage der Befragten sind für Kinder mit Teilzeitbetreuungsbedarf sowie Schulkinder<br />
etwa von der 3. Klasse an auch Kombinationen von Mittagstisch <strong>und</strong> Nachmittagsbetreuung<br />
denkbar. Kinder welche Teilzeitbetreuungsbedarf (1 bis 2 Tage) haben, werden in der Regel<br />
auch nicht in Tagesheimen aufgenommen. Meist bestehen Mindestbetreuungszeiten. Für<br />
den Teilzeit-betreuungsbedarf würden sich A-la-carte-Angebote besser eignen. Allerdings gilt<br />
auch hier, dass gewisse Kinder aufgr<strong>und</strong> von sozialen Indikationen auch nach der 3. Klasse<br />
einen erhöhten <strong>Betreuung</strong>sbedarf haben. Für diese Kinder wäre eine <strong>Betreuung</strong> im<br />
Tagesheim sicher weiter sinnvoll.<br />
Und schliesslich würde sich diese Veränderung der Gruppengrösse auch auf den<br />
Raumbedarf auswirken, denn bei gleich bleibendem Raumangebot würde man da <strong>und</strong> dort<br />
an Grenzen stossen (fehlende Rückzugsmöglichkeiten, Unruhe etc.). Ebenso stellt sich die<br />
Frage nach dem erforderlichen Personal für die <strong>Betreuung</strong> der Schulkinder. Es zeigt sich,<br />
dass beispielsweise die Begleitung der Hausaufgaben sehr personalintensiv sein kann. Der<br />
Beizug von Springerinnen bzw. Personal im St<strong>und</strong>enlohn zur Verstärkung während der<br />
Hauptauslastungszeiten muss hier überlegt werden.<br />
7.5 Gedanken zu einem Gesamtmodell<br />
Die befragten Vertreterinnen der genannten Trägerschaften sehen die Notwendigkeit, dass<br />
die Schnittstellen zwischen klassischen Tagesheimangeboten (mit Schwerpunkt bei<br />
Säuglingen <strong>und</strong> Vorschulkindern) <strong>und</strong> Angeboten für Schulkinder geklärt werden muss. Die<br />
Erfahrungen zeigen, dass es für die Kinder ideal ist, wenn die Schnittstelle nicht gleichzeitig<br />
mit der Schnittstelle Schuleintritt zusammenfällt. Optimal sei, einen Wechsel nach der 1. oder<br />
2. Klasse zu vollziehen. Weiter zeigt die Erfahrung, dass 3.- <strong>und</strong> 4.-Klässler andere<br />
Interessen haben <strong>und</strong> eine andere Form der <strong>Betreuung</strong> benötigen.<br />
Für die OrientierungsschülerInnen, welche meist an 3 bis 4 Nachmittagen Unterricht haben,<br />
scheint nach Auffassung der Befragten ein Mittagstisch <strong>und</strong> allenfalls eine Hausaufgabenbetreuung<br />
ausreichend.<br />
Als sehr wichtig wird die Planung von weitern Ferienangeboten für Schulkinder beurteilt.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich wird eine kantonale Strategie befürwortet, welche unterschiedliche Wahlmöglichkeiten<br />
bietet. Dies würde es den Eltern ermöglichen, nach ihren Bedürfnissen zu<br />
wählen. Wobei die Angebote klar umrissen <strong>und</strong> die Schnittstellen zu andern Angeboten<br />
geklärt werden müssten.<br />
Weiter wird die notwendige Professionalität des Personals angesprochen. Es sei<br />
unerlässlich, dass pro Gruppe eine qualifizierte Person anwesend sei.<br />
Insgesamt ist die Leitung sowie die Vermittlung <strong>und</strong> Information durch das Erziehungsdepartement<br />
oder eine beauftragte Stelle wichtig <strong>und</strong> erwünscht. Eine weitere Aufgabe des<br />
Erziehungsdepartements wird in einer Vereinheitlichung der Elternbeiträge gesehen.<br />
Überlegungen müssten weiter angestellt werden für Zielgruppen, welche wegen sprachlicher<br />
Schwierigkeiten oder sozialer Indikationen in den herkömmlichen Angeboten meist Mühe<br />
haben bzw. bereiten.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
45
8 Auswertung der Erfahrungen von AnbieterInnen von<br />
Mittagstischangeboten<br />
8.1 Profil: Mittagstisch<br />
Mittagstische bieten für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler eine gemeinsame Mahlzeit <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong>szeit während der Mittagspause – in der Regel zwischen 12.00 <strong>und</strong> 13.30/14.00<br />
Uhr. Der Mittagstisch ist ein Ort um soziale Kontakte zu knüpfen <strong>und</strong> für soziales Lernen.<br />
Ferner ermöglichen Mittagstische den Eltern eine sinnvolle Tages- <strong>und</strong> Arbeitseinteilung.<br />
Damit tragen diese generell zur Entlastung insbesondere berufstätiger Eltern <strong>und</strong> Kinder in<br />
der Mittagspause bei (kein Pendeln, hektisches Mittagessen, kein Unterbruch in der<br />
Erwerbsarbeit etc.).<br />
Innerhalb des Gesamtangebots an familienergänzenden <strong>Betreuung</strong>sangeboten stellt der<br />
Mittagstisch insbesondere in Kombination mit schul- <strong>und</strong> stufenübergreifend noch zu<br />
koordinierenden Blockzeiten am Morgen ein wichtiges Angebot dar. An den Basler<br />
Kindergärten <strong>und</strong> Primarschulen sind Blockzeiten am Morgen bereits flächendeckend<br />
realisiert worden. Mit der Fünftagewoche werden sie per Schuljahr 2003/04 auch an der<br />
Orientierungsschule eingeführt. Damit garantieren Mittagstische in Kombination mit<br />
Blockzeiten in der Regel eine <strong>Betreuung</strong>szeit bis 14.00 Uhr. Für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler,<br />
insbesondere aber OrientierungsschülerInnen, welche am Nachmittag ebenfalls Unterricht<br />
haben, bietet der Mittagstisch ein wichtiges Bindeglied im Tagesprogramm. Für<br />
Primarschulkinder mit weniger Nachmittagsunterricht reicht der Mittagstisch allerdings alleine<br />
oft nicht aus, um den <strong>Betreuung</strong>sbedarf umfänglich zu decken.<br />
Unterricht<br />
mit Blockzeiten<br />
z.B. 8.00–12.00 Uhr<br />
Mittagstisch<br />
12.00–13.30/14.00 Uhr<br />
teilweise<br />
Unterricht<br />
am Nachmittag<br />
Mittagstische werden während der Schulzeit zwischen zwei- bis fünfmal wöchentlich<br />
angeboten <strong>und</strong> können einmal oder mehrmals pro Woche besucht werden. In der Regel ist<br />
eine Anmeldung für ein Quartal oder Semester erforderlich. Mittagstische können im Prinzip<br />
von allen Kindern vom Kindergarten bis zur Orientierungsschule, d.h. im Alter von 6 bis 13<br />
Jahren besucht werden. Während Kindergartenkinder in allen fünf Pilotprojekten bisher die<br />
Ausnahme bilden, wird ein Mittagstisch (Bruderholz-Titus) fast ausschliesslich von<br />
Primarschulkindern <strong>und</strong> ein zweiter (Brunnmatt) nur von OrientierungsschülerInnen besucht.<br />
An drei Mittagstischen halten sich SchülerInnen der Primarschule <strong>und</strong> der<br />
Orientierungsschule anzahlmässig die Waage.<br />
Fragt man nach der Zielgruppe der Mittagstische, so werden in den Gruppendiskussionen<br />
zwei Aspekte sichtbar: Erstens ist das Angebot für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche mit relativ<br />
geringem <strong>Betreuung</strong>sbedarf sinnvoll, welche ein bis mehrmals pro Woche vom Angebot<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
46
Gebrauch machen wollen <strong>und</strong> für die restliche Tageszeit in anderen <strong>Betreuung</strong>sstrukturen<br />
(Familie, Nachbarschaft, Lukas-Club oder Schule etc.) eingeb<strong>und</strong>en sind. Weiter eignet sich<br />
der Mittagstisch für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der Orientierungsstufe, welche auch am<br />
Nachmittag Unterricht haben.<br />
Zweitens deckt der Mittagstisch bei einem relativ hohen <strong>Betreuung</strong>sbedarf die erforderliche<br />
Zeit zu wenig ab. Vor allem für jüngere Kinder auf der Primarstufe ohne Unterricht am<br />
Nachmittag <strong>und</strong> für Jugendliche mit einem hohen <strong>Betreuung</strong>sbedarf (jede Woche täglich,<br />
ganztags, wenig Unterricht am Nachmittag, Bedarf nach klaren Strukturen) müsste eine<br />
Kombination von Mittagstisch <strong>und</strong> Nachmittagsbetreuung – im Sinne eines Nachmittagshorts<br />
– angeboten werden können. Wobei hier auf die möglichst hohe personelle Konstanz <strong>und</strong><br />
Kontinuität im <strong>Betreuung</strong>spersonal geachtet werden müsste, damit stabile Beziehungen zum<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonal aufgebaut werden können <strong>und</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern keine<br />
unnötigen Schnittstellen zugemutet werden müssen. In der Orientierungsschule Brunnmatt<br />
besteht als Anschlussmöglichkeit der Lukas-Club.<br />
Obwohl die bestehenden Mittagstischangebote sich in ihren Gr<strong>und</strong>zügen gleichen, sind<br />
ebenso gr<strong>und</strong>sätzliche Unterschiede entlang folgender Bedingungen zu erkennen:<br />
c) Ausgangsbedingungen (Entstehungskontext, InitiantInnen, Interessengruppen, Quartierstruktur)<br />
d) Trägerschaft (Kirche, offene Jugendarbeit, Verein, gemeinnützige Vereinigung,<br />
Erziehungsdepartement u.a.)<br />
e) Infrastruktur (Aufenthalts- <strong>und</strong> Essräume, Küche etc.)<br />
f) Finanzierungsmodelle (Beiträge Dritter, Kantonsbeiträge, Spenden, Stiftungsgelder,<br />
Elternbeiträge)<br />
g) Personal (ehrenamtlich Tätige mit oder ohne spezifische Ausbildung, professionelle<br />
Angestellte mit spezifischer Ausbildung im pädagogisch-sozialen Bereich oder gelernte<br />
KöchInnen)<br />
h) Entlöhnung (unbezahlte ehrenamtliche Leistung, Entlöhnung gemäss Richtlinien von<br />
Berufsverbänden)<br />
i) Zielgruppe (altersmässig gemischte Gruppen, Primarschulkinder, SchülerInnen der<br />
Orientierungsschule)<br />
j) Organisationsstruktur (Unterschiede bezüglich Bereitstellung der Mahlzeiten: Bestellung<br />
<strong>und</strong> Lieferung des Essens oder selbst kochen)<br />
k) Unterschiede zeigen sich auch bezüglich (sozial-)pädagogischen Schwerpunktsetzungen<br />
<strong>und</strong> weitern handlungsleitenden Gr<strong>und</strong>haltungen (z.B. Ansätze offener Jugendarbeit,<br />
christliche Gr<strong>und</strong>haltung <strong>und</strong> Unterrichtung, gemeinnützige Haltung, sozialpädagogische<br />
Schule „Schule als Lebensraum“).<br />
l) Und schliesslich werden quartierspezifische Eigenheiten sichtbar, welche sich auf die<br />
Zugänge zur Zielgruppe <strong>und</strong> die Kommunikation im Quartier, die Unterstützung durch<br />
Interessengruppen etc. auswirken <strong>und</strong> je spezifische Zugänge zur Schule <strong>und</strong> zu den<br />
Eltern oder Quartiervereinigungen erforderlich machen <strong>und</strong> unterschiedliche Bedürfnisse<br />
der Zielgruppen aufzeigen.<br />
Im Folgenden werden einige relevante Punkte des Mittagstisches genauer diskutiert.<br />
8.2 Kernangebote eines Mittagstisches<br />
Das Kernangebot des Mittagstisches besteht einerseits im gemeinsamen Mittagessen <strong>und</strong><br />
andererseits in der <strong>Betreuung</strong> während der Mittagszeit, d.h. der Zeit zwischen den<br />
Unterrichtszeiten bzw. von ca. 12.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr. Die spezifische Leistung des<br />
Mittagstischangebotes kann auf unterschiedlichen Ebenen sichtbar gemacht werden.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
47
Zunächst bieten die Mittagstische eine reichhaltige, ges<strong>und</strong>e aber auch kindergerechte<br />
Ernährung an. Die Herstellung des Essens, die Darbietung, aber auch das Eingehen auf<br />
unterschiedliche Bedürfnisse stellt für die AnbieterInnen oft eine grosse Herausforderung dar,<br />
denn was ges<strong>und</strong> ist, wird nicht unbedingt von allen Kindern oder Eltern geschätzt. Kinder<br />
sind von zu Hause aus anderes Essen gewöhnt oder haben wenig Erfahrung bezüglich<br />
abwechslungsreicher, ges<strong>und</strong>er Nahrung, oder Eltern haben andere Vorstellungen in Bezug<br />
auf „gutes“ Essen u.a. Weiter gilt es spezielle Wünsche zu berücksichtigen wie<br />
beispielsweise vegetarisches Essen oder andere kulturbedingte Essgewohnheiten.<br />
Die Organisation des gemeinsamen Essens (Tisch decken, gemeinsam essen, aufräumen,<br />
abwaschen etc.), die Rituale r<strong>und</strong> um das Essen, der Umgang mit dem eigenen Hunger, das<br />
Probierverhalten, die Esskultur, die Gespräche bieten weitere wichtige Lerninhalte, welche im<br />
Rahmen eines Mittagstisches möglich werden. Die alters- <strong>und</strong> kulturgemischten Gruppen<br />
stellen eine wichtige Voraussetzung dar, von- <strong>und</strong> miteinander zu lernen.<br />
Neben der Nahrung <strong>und</strong> dem gemeinsamen betreuten Essen als soziale Tätigkeit bietet der<br />
Mittagstisch den Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen primär eine betreute Mittagszeit an.<br />
Unterschiedliche Raumangebote müssen sicherstellen, dass sich die Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler je nach Bedürfnis austoben oder ausruhen können (siehe 1.4 Infrastruktur). Im<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonal finden sie Vertrauenspersonen, welche sich mit ihnen austauschen,<br />
ihnen zuhören oder mit ihnen spielen oder basteln. Bei einigen Mittagstischangeboten zeigt<br />
sich auch, dass die Eltern, Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen froh wären, wenn im Rahmen des<br />
Mittagstisches auch das Lösen der Hausaufgaben Platz finden könnte.<br />
Obwohl darin eine wichtige weitere Funktion insbesondere hinsichtlich schulergänzender<br />
<strong>Betreuung</strong>sstruktur (Förderung der Chancengleichheit) gesehen werden kann, muss dazu<br />
festgehalten werden, dass in der kurzen Zeit über Mittag neben dem Essen, Ausruhen oder<br />
Austoben oft zu wenig Zeit für Hausaufgaben bleibt. Weiter zeigt die Erfahrung, dass die<br />
Aufgabenhilfe in gewissen Fällen eine spezielle Ausbildung von Seiten des<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonals sowie eine gute Zusammenarbeit mit der Schule erforderlich macht.<br />
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine optimale Gestaltung des Mittagstisches neben<br />
dem Raumangebot auch stark von der Anzahl des <strong>Betreuung</strong>spersonals abhängig ist. So<br />
zeigen die Gespräche mit den MittagstischanbieterInnen, dass meist eher zu wenig Personal<br />
zur Verfügung steht, sodass nicht mit allen BesucherInnen gespielt werden kann,<br />
Hausaufgaben gelöst <strong>und</strong> gleichzeitig der Essraum <strong>und</strong> die Küche wieder in Ordnung<br />
gebracht werden können. Freiwillige HelferInnen übernehmen hier in einigen Fällen wichtige<br />
Arbeiten (siehe 1.10 Personal).<br />
Kommentar<br />
Insgesamt wird deutlich, dass das Mittagstischangebot weit mehr bietet als nur eine<br />
Mittagsverpflegung, was manchen Eltern nicht in diesem Sinne bewusst zu sein scheint. Auf<br />
der andern Seite ist der Handlungsspielraum der AnbieterInnen durch die kurze Dauer relativ<br />
begrenzt. Hohe sozialpädagogische Ziele hinsichtlich Integration <strong>und</strong> Chancengleichheit<br />
lassen sich mit diesem Angebot kaum tiefer gehend realisieren. Ebenso ist das Lösen der<br />
Hausaufgaben durch die zeitliche <strong>und</strong> personelle Begrenzung meist nicht möglich. Die<br />
<strong>Betreuung</strong> der Hausaufgaben müsste nach dem Mittagstisch oder nach dem<br />
Nachmittagsunterricht angeboten werden können (nach Möglichkeit von der Schule selbst).<br />
8.3 Essen selbst zubereiten, liefern lassen oder selbst mitbringen?<br />
Für die Essenszubereitung zeichnen sich bei den bestehenden Mittagstischangeboten zwei<br />
unterschiedliche Möglichkeiten ab. Die einen MittagstischanbieterInnen kümmern sich selbst<br />
um die Essenszubereitung (Planung, Einkauf <strong>und</strong> Zubereitung), die anderen lassen das<br />
Essen von einem Restaurant in der Nähe zubereiten <strong>und</strong> liefern. In letzterem Fall werden in<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
48
Absprache mit den Essenslieferanten gemeinsam Menupläne erstellt bzw.<br />
Rahmenbedingungen ausgehandelt, welche das spezifische Bedürfnis der<br />
MittagstischbesucherInnen berücksichtigen (vegetarische Menus <strong>und</strong> Menus mit Fleisch oder<br />
nach Bedarf mit speziellen Fleischsorten).<br />
Hinsichtlich der Lernmöglichkeiten während des Essens (Rituale, Essgewohnheit, Kultur,<br />
Arbeiten r<strong>und</strong> ums Essen etc.) bestehen praktisch keine Unterschiede. Beide Möglichkeiten<br />
scheinen daneben aber ihre Vor- <strong>und</strong> Nachteile zu haben. So zeigt sich, dass im ersten Fall<br />
„selbst kochen“ – im Gegensatz zur Variante „Essen liefern lassen“ – zwar direkter auf die<br />
Essbedürfnisse der Kinder eingegangen werden kann. Weiter erleben die Kinder, wie das<br />
Essen zubereitet wird. Ausserdem zeigen die vergleichenden Erfahrungen des Mittagstisches<br />
St. Johnann, dass diese Variante bei vorhandener Küche günstiger ist als der Fremdeinkauf<br />
der Mahlzeiten. Auf der anderen Seite steht in diesem Modell weniger Zeit für die <strong>Betreuung</strong><br />
der Kinder zur Verfügung, wenn das Kochen <strong>und</strong> Aufräumen durch das <strong>Betreuung</strong>spersonal<br />
geleistet werden muss. Dagegen steht bei der Variante „Essen liefern lassen“ mehr Zeit für<br />
die <strong>Betreuung</strong> zur Verfügung. Und schliesslich kann diese Variante hohe Raum- <strong>und</strong><br />
Infrastrukturkosten vermindern helfen, insbesondere wenn diese neu eingerichtet werden<br />
müssen.<br />
Bezüglich der Kosten für die Essenszubereitung <strong>und</strong> Nahrungsmittel unterscheiden sich die<br />
beiden Modelle kaum.<br />
Kommentar<br />
Zu prüfen wäre in diesem Zusammenhang auch ein Mittagstisch – insbesondere für die<br />
Orientierungsstufe – mit selbst mitgebrachtem Essen. Wobei auch hier auf eine gewisse<br />
Infrastruktur geachtet werde müsste: Essraum, evtl. Aufwärmmöglichkeit, Geschirr etc. Wobei<br />
auch bei dieser Variante auf das gemeinsame Essen als soziale Tätigkeit (Rituale, Regeln,<br />
Gespräche, Rücksicht etc.) geachtet werden müsste, damit das Mittagessen nicht zu einer<br />
Fastfoodkultur verkommt.<br />
8.4 Infrastruktur <strong>und</strong> Räume<br />
Den einzelnen Mittagstischen stehen sehr unterschiedliche Raumangebote <strong>und</strong><br />
Infrastrukturen zur Verfügung, was sich sowohl auf die Essenszubereitung <strong>und</strong> das<br />
gemeinsame Essen auswirkt, wie auch auf die <strong>Betreuung</strong>smöglichkeiten nach dem Essen.<br />
Die bestehenden Mittagstische finden sich mit den gegebenen Raumangeboten zurecht,<br />
wünschten sich aber zum Teil noch mehr Raum, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der<br />
Kinder zu befriedigen.<br />
Ideal scheinen eine Küche, ein Essraum <strong>und</strong> mehrere Innenräume, welche unterschiedlichen<br />
Bedürfnissen (kochen, essen, ausruhen, austoben, spielen, Aufgaben lösen etc.) gerecht<br />
werden, ebenso ist ein Aussenraum wichtig, der das gemeinsame Spiel (Fussball, laut sein<br />
etc.) insbesondere im Sommer <strong>und</strong> bei schönem Wetter zulässt.<br />
Kommentar<br />
Obwohl der Mittagstisch im Vergleich zu andern <strong>Betreuung</strong>sangeboten hinsichtlich zeitlicher<br />
Abdeckung ein relativ knappes Angebot darstellt, bestehen ähnliche Bedürfnisse für Räume<br />
wie bei andern <strong>Betreuung</strong>sangeboten. Deutlich wird, dass der Mittagstisch nicht ohne die<br />
Nutzung bestehender <strong>und</strong> zur Verfügung gestellter Räume auskommen kann, andernfalls<br />
entstehen zu hohe Kosten.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
49
8.5 Zielgruppen <strong>und</strong> aktuelle NutzerInnen der Angebote<br />
Einer der fünf Mittagstische (Bruderholz-Titus) wird fast ausschliesslich von<br />
Primarschulkindern besucht. Ein zweiter Mittagstisch (Brunnmatt) - er befindet sich als<br />
einziger in einem Schulhaus – steht nur Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern der Orientierungsschule<br />
offen. Die drei weitern Mittagstische werden sowohl von Primar- wie von<br />
OrientierungsschülerInnen besucht. In einzelnen Fällen werden auch Kindergartenkinder ab<br />
dem zweiten Kindergartenjahr betreut.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass die altersmässige Durchmischung Chancen wie auch Gefahren<br />
beinhalten kann. Insbesondere kleine Kinder, welche noch klare Strukturen <strong>und</strong><br />
Ansprechpersonen benötigen, können in einer altersmässig stark durchmischten,<br />
wechselnden <strong>und</strong>/oder grossen Gruppe untergehen <strong>und</strong> sich verloren fühlen. Dies hat in<br />
einzelnen Fällen auch zu Abmeldungen von jüngern Kindern geführt. Die Grossen geben in<br />
der Regel den Ton an. Die gegenseitige Rücksichtnahme muss zuerst gelernt werden. Bis<br />
eine Gruppenkultur entsteht, braucht es Zeit <strong>und</strong> eine konstante Gruppe über eine gewisse<br />
Zeit.<br />
Die nationalitätenspezifische Durchmischung wurde bisher als Bereicherung empf<strong>und</strong>en,<br />
kann laut Aussage der MittagstischanbieterInnen aber ebenfalls an Grenzen führen<br />
(Sprache, Kultur). Gemäss Erfahrungen im Mittagstisch St. Johann scheint das Angebot aber<br />
vor allem von Schweizern oder gut angepassten Ausländern genutzt. Für sozial<br />
benachteiligte, auffällige Kinder scheint das Angebot bezüglich Kosten, Verbindlichkeit,<br />
Anpassung an Regeln etc. offensichtlich bereits zu hochschwellig zu sein. Evtl. könnte hier<br />
mit Elternarbeit Einfluss genommen werden.<br />
Bezüglich geschlechtsspezifischer Mischung zeigen sich Unterschiede: Ein Mittagstisch<br />
(G<strong>und</strong>eldingerfeld) hat mehr Jungen als Mädchen, welche vom Angebot profitieren, in einem<br />
weitern Mittagstisch wurde überlegt, den Mädchen wegen unterschiedlicher Bedürfnisse<br />
einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen (Mittagstisch St. Johann).<br />
Kommentar<br />
Die Erfahrungen zeigen, dass sowohl durch die altersmässige wie kulturelle Durchmischung<br />
der Mittagstischgruppen Grenzen entstehen können. Während bei altersmässig stark<br />
durchmischten Gruppen tendenziell die Kleinen untergehen, ist in sprachlich sehr<br />
heterogenen Gruppen die Integrations- <strong>und</strong> Sprachförderung nicht mehr gewährleistet.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass Mittagstischangebote meist eher zu wenig<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonal haben <strong>und</strong> die BesucherInnen ebenfalls wechseln. Insofern<br />
Mittagstischangeboten ebenfalls integrative Wirkung zugesprochen werden soll, muss bei<br />
Mittagstischgruppen auch die Zusammensetzung <strong>und</strong> ein entsprechender<br />
<strong>Betreuung</strong>sschlüssel berücksichtigt werden, wie bei anderen familienergänzenden<br />
<strong>Betreuung</strong>ssystemen. Weiter muss genügend Zeit bestehen, soziale Konflikte, welche sich<br />
durch die Gruppenzusammensetzung ergeben, auch gemeinsam zu lösen.<br />
Und schliesslich müsste überlegt werden, wie finanzschwächere, bildungsferne Familien<br />
ohne grosse Bürokratie ermuntert werden können, das Angebot zu nutzen (Elternarbeit).<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
50
8.6 Aktuelle Belegszahlen <strong>und</strong> Sollzahlen<br />
Die Mittagstische unterscheiden sich bezüglich der Sollzahlen mit einer Ausnahme<br />
(Mittagstisch Brunnmatt 15 ) nicht gross. Die Sollzahl beträgt je nach Raumkapazität zwischen<br />
30 <strong>und</strong> 40 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler. Drei der AnbieterInnen haben diese Zahlen mehr oder<br />
weniger erreicht. Ein Mittagstisch ist noch in der Aufbauphase, kann aber von einer positiven<br />
Entwicklung sprechen. Die Gespräche mit den AnbieterInnen haben gezeigt, dass etwa 30<br />
Kinder erforderlich sind, damit der Mittagstisch finanzierbar wird. Auf der andern Seite wird<br />
eine organisatorische Grenze bei etwa 40 Personen erreicht. Diese Grenze wird bestimmt<br />
durch die Raumkapazität, Ressourcen fürs Kochen, Lärmpegel, <strong>Betreuung</strong>skapazität,<br />
Übersicht, Gruppenzusammen-setzung etc.<br />
Kommentar<br />
Bei der Planung weiterer Mittagstischangebote muss die mögliche Grösse stärker in Bezug<br />
gesetzt werden zu den Sollzahlen (welche sich durch die finanzielle Deckung <strong>und</strong> die<br />
Organisierbarkeit vor Ort bestimmen).<br />
8.7 Öffnungszeiten<br />
Die bestehenden Mittagstischangebote sind während der Schulzeit in der Regel von 12.00<br />
bis 14.00 Uhr geöffnet. Unterschiede bestehen bezüglich der Häufigkeit des<br />
Mittagstischangebots. Während drei AnbieterInnen zweimal pro Woche (Dienstag <strong>und</strong><br />
Donnerstag bzw. Montag <strong>und</strong> Freitag) offen sind, haben nur zwei Mittagstische von Montag<br />
bis Freitag geöffnet (Mittagstisch St. Joseph, Mittagstisch im G<strong>und</strong>eli).<br />
Ein Nachteil der Mittagstischangebote ist – so die Rückmeldung der Eltern – dass das<br />
Angebot nur während der Schulzeit angeboten wird, was zu <strong>Betreuung</strong>sproblemen in den<br />
Schulferien führt.<br />
Kommentar<br />
In den Öffnungszeiten wird deutlich, dass Mittagstische nur einen kleinen Anteil der<br />
Tagesbetreuungsstruktur abdecken. Für Familien <strong>und</strong> Kinder, welche eine umfassendere<br />
<strong>Betreuung</strong>sstruktur brauchen (Alter, klare Strukturen, wenige Schnittstellen), reicht der<br />
Mittagstisch meist kaum.<br />
Ebenso wie bei andern schulergänzenden <strong>Betreuung</strong>sstrukturen ergibt sich das Problem der<br />
<strong>Betreuung</strong> während der Ferien. Dazu bestehen bereits Ideen wie Quartierkinderwochen,<br />
Lager etc., die Finanzierung muss allerdings noch gesichert werden.<br />
8.8 Zusammenarbeit mit Eltern<br />
Die Information <strong>und</strong> Zusammenarbeit mit den Eltern wird von den MittagstischanbieterInnen<br />
als sehr wichtig eingeschätzt. Diese liefert eine wichtige Basis für die Unterstützung des<br />
Angebots. Die Erfahrung in den Mittagstischen zeigt, dass einige Eltern falsche Vorstellungen<br />
des Angebots (nur Verpflegung) <strong>und</strong> andere teilweise hohe Ansprüche an das Essen haben.<br />
Weiter zeigt die Gruppendiskussion, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern leichter fällt,<br />
wenn in Quartieren die Elternarbeit institutionalisiert ist (z.B. durch Elternvereinigung) oder in<br />
anderem Kontext Elternarbeit geleistet wird (z.B. kirchliche Elternarbeit). Schwierigkeiten<br />
15 Der Mittagstisch Brunnmatt unterscheidet sich durch seine Schulnähe konzeptionell etwas von den andern<br />
Angeboten. Er ist als Teil der Schulkultur entstanden <strong>und</strong> hilft, den schulischen Alltag in vertrauten Strukturen<br />
zu beruhigen (Ansatz „Schule als Lebensraum“). Ein weiterer Unterschied ergibt sich durch die weitgehend<br />
ehrenamtliche Arbeit (bzw. neu mit pauschaler Entlöhnung) der HelferInnen, weshalb bisher keine Sollzahlen<br />
vorgegeben werden mussten.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
51
estehen in Quartieren, welche über keinen klar organisierten Zugang zu den Eltern verfügen<br />
(z.B. im G<strong>und</strong>eldinger Feld).<br />
Kommentar<br />
Es wird deutlich, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig ist, einerseits, um die<br />
Zielgruppe informieren zu können, andererseits, um den Kontakt mit den Eltern der<br />
BenutzerInnen zu gewährleisten. Weiter zeigt sich, dass es leichter fällt, mit Eltern in Kontakt<br />
zu treten, wenn diese in irgendeiner Form organisiert sind (Elternverein, Elternrat etc.). In<br />
Gegenden, in denen die Eltern wenig organisiert sind, müssen andere Formen <strong>und</strong> Zugänge<br />
zu diesen gesucht werden. In diesem Zusammenhang wird die Zusammenarbeit mit der<br />
Schule oder mit Freizeitangeboten als sehr wichtig eingeschätzt. Hier liegen sicherlich<br />
Potentiale, welche noch zu wenig ausgelotet worden sind.<br />
8.9 Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Ebenso wie bei andern familienergänzenden <strong>Betreuung</strong>sstrukturen lassen sich die Angebote<br />
hinsichtlich ihrer Nähe zur Schule einteilen. Während vier der aktuellen Angebote sich als<br />
additive Angebote verstehen lassen, welche zwar in Kontakt mit der Schule stehen, aber<br />
nicht im schulischen Kontext entstanden sind, ist nur ein Mittagstisch als schulintegriertes<br />
Angebot konzipiert (Brunnmatt).<br />
Aus der Sicht der MittagstischanbieterInnen ist die Zusammenarbeit mit der Schule wichtig,<br />
da sie den Zugang zur Zielgruppe sichert <strong>und</strong> ein wichtiger Werbekanal für die Angebote<br />
darstellt.<br />
Kommentar<br />
Die gute Zusammenarbeit mit der Schule ist in mehrfacher Hinsicht wichtig <strong>und</strong> stellt eine<br />
grosse Chance dar. Eine gute familienergänzende Struktur kann gleichzeitig auch als eine<br />
schulergänzende Struktur verstanden werden. Untersuchungen zeigen, dass gute<br />
familienergänzende <strong>Betreuung</strong>sangebote die Chancen des Schulerfolgs unter bestimmten<br />
Prämissen steigern können. Eine qualitativ hochstehende <strong>Betreuung</strong> (u.a. in den Kriterien<br />
<strong>Betreuung</strong>sperson/Kind-Schlüssel, Personalqualifikation, räumlich-materielle Ausstattung) hat<br />
positive Auswirkungen auf die Sprache <strong>und</strong> das soziale Verhalten der Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendlichen. Gut betreute, ernährte <strong>und</strong> erholte Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler können zudem<br />
vom Unterrichtsgeschehen besser profitieren.<br />
8.10 Personal, Ausbildung, Ehrenamtlichkeit<br />
Bezüglich Qualifikation wird aus der Sicht der AnbieterInnen von Mittagstischen Folgendes<br />
als Bedingung für die Arbeit genannt: Das Personal muss Erfahrung im Umgang mit Kindern<br />
haben <strong>und</strong> eine Vorbildfunktion übernehmen können. Eine spezielle Qualifikation sei erst<br />
erforderlich, wenn das Angebot (zeitlich <strong>und</strong> inhaltlich) erweitert werde. Wird ein<br />
Mittagstischangebot ausgebaut durch Aufgabenhilfe <strong>und</strong> Nachmittagsbetreuung, ist zu<br />
prüfen, welche Qualifikation die AnbieterInnen jeweils zusätzlich mitbringen müssen oder wie<br />
sie sich die nötige Qualifikation aneignen könnten.<br />
Bei vier der fünf Mittagstischangebote sind je zwei Personen durch einen Arbeitsvertrag<br />
angestellt. Daneben helfen aber mindestens bei drei dieser Mittagstischangebote jeweils ein<br />
bis zwei Personen (Mütter, Väter u.a.) ehrenamtlich mit (Mithilfe bei der <strong>Betreuung</strong>, beim<br />
Kochen bei der Administration etc.). Beim Mittagstisch Brunnmatt – der in der Schule<br />
entstanden ist – wird ein grosser Teil der Arbeit durch eine Lehrperson sowie durch ein acht-<br />
bis zehnköpfiges HelferInnenteam (Kochen, Betreuen etc.) erledigt.<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
52
Als <strong>Betreuung</strong>sschlüssel für einen Mittagstisch wird von den AnbieterInnen ein Verhältnis von<br />
ca. 1:10 als sinnvoll erachtet. Nur in einem Fall wird ein Verhältnis von 1:7 befürwortet.<br />
Mindestens zwei Personen sollen aber in jedem Fall präsent sein.<br />
Kommentar<br />
Bei einem Ausbau der Tagesbetreuungsstrukturen im Rahmen eines Gesamtangebots des<br />
Erziehungsdepartements müssten die Personalfrage (Qualifikation, Weiterbildung) sowie die<br />
Entlöhnung <strong>und</strong> Versicherung einheitlich gelöst werden. Eine einheitliche Lösung würde die<br />
finanzielle Unterstützung klären helfen, das Ansehen erhöhen <strong>und</strong> ergäbe zahlreiche<br />
Synergien wie z.B. die gemeinsame Personalversicherung (Krankenkasse, Betriebsunfall-<br />
<strong>und</strong> Nichtbetriebsunfallversicherung), evtl. gemeinsame Administration, Angebotsaustausch,<br />
evtl. Angebotserweiterung in den Ferien durch Bündelung der Ressourcen,<br />
Personalaustausch.<br />
Um die Qualität der Angebote garantieren zu können, müsste mindestens eine sozialpädagogisch<br />
qualifizierte Person angestellt werden, welche je nach Grösse des<br />
Mittagstisches von zusätzlichen MitarbeiterInnen in ihrer Arbeit unterstützt wird.<br />
Es ist zu überlegen, ob allenfalls Vorbereitungskurse anzubieten sind (entsprechend den<br />
Babysitterkursen oder Kursen für Tagesfamilien).<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003)<br />
53
Tabelle 1: Übersicht: Angebot, Belegzahlen, Angestellte, HelferInnen, Räume, Finanzierung<br />
Angebot Angebotshäufigkeit<br />
MT St. Johann<br />
MT St. Joseph<br />
Kleinbasel<br />
MT Bruderholz-Titus<br />
MT G<strong>und</strong>eldingerfeld<br />
MT Brunnmatt<br />
Öffnungszeiten<br />
BesucherInnenzahl<br />
2x pro Woche<br />
12.00–14.00 Uhr<br />
durchschnittlich 30<br />
Personen (bis 40)<br />
5x pro Woche<br />
12.00-–14.00 Uhr<br />
30–50 Personen<br />
2x pro Woche<br />
12.00–14.00 Uhr<br />
ca. 40 Personen<br />
5x pro Woche<br />
12.00–14.00 Uhr<br />
20–25 Personen<br />
2x pro Woche<br />
12.00–13.30 Uhr<br />
ca. 7 Personen<br />
Anzahl bezahlte<br />
Angestellte<br />
2 Personen für die<br />
<strong>Betreuung</strong><br />
(40%)<br />
2 StudentInnen<br />
2 weitere Personen<br />
für die <strong>Betreuung</strong><br />
2 Personen<br />
(je 2x 6h)<br />
1 Projektleitung<br />
1 PraktikatIn<br />
(mind. 2 Pers.)<br />
(40%)<br />
Team von 8<br />
HelferInnen, welche<br />
sich abwechseln<br />
Entlöhnung Anzahl freiwillige<br />
HelferInnen bzw.<br />
geleistete Arbeit,<br />
welche nicht direkt<br />
verrechnet wurde<br />
35.–/h 2–3 Personen in der<br />
Küche <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong><br />
25.–/h mit Vertrag<br />
25.– St<strong>und</strong>enlohn<br />
nach Aufwand<br />
30.–/h 2 Personen für<br />
<strong>Betreuung</strong><br />
je nach Funktion<br />
zwischen 23.– <strong>und</strong><br />
26.–/h<br />
50.– pro Mittagstischeinsatz<br />
Synergienutzung mit<br />
Robi-Spiel-Aktion<br />
(Personal,<br />
Administration,<br />
Versicherung)<br />
Unentgeltlich zur Verfügung<br />
stehende Räume<br />
div. Räume der Stadtmission (2<br />
Räume für laute, 2 für stillere<br />
Beschäftigungen)<br />
Beiträge:<br />
Erziehungsdepartement<br />
(ED)<br />
Evaluation „Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Kanton Basel-Stadt“ (2003) 54<br />
Küche<br />
Pausenhof des Vogesen-<br />
Schulhauses <strong>und</strong> St.-Johann-Park<br />
Restaurant ‘ge.m.a’,<br />
2 Freizeiträume der Kinder- <strong>und</strong><br />
Jugendarbeit St. Joseph<br />
Hof der Pfarrei St. Joseph<br />
je ein Essraum in Titus- <strong>und</strong> Bruder-<br />
Klaus-Kirche<br />
je ein Küche in Titus- <strong>und</strong> Bruder-<br />
Klaus-Kirche<br />
je ein Aufenthaltsraum der Titus-<br />
<strong>und</strong> der Bruder-Klaus-Kirche<br />
je ein Aussenhof<br />
Räume des SpielFelds bzw. die<br />
Räume <strong>und</strong> Angebote des Areals<br />
G<strong>und</strong>eldingerfeld<br />
Küche<br />
Esszimmer<br />
Pausenplatz, Räumlichkeiten der<br />
Schule<br />
Zimmer des Lukas-Clubs im<br />
Schulhaus Brunnmatt<br />
Eltern<br />
ED 10.–<br />
Eltern 5.– (bei<br />
Vorausbezahlung<br />
sonst 6.–)<br />
ED 10.–<br />
Eltern 6.– - 10.–<br />
ED 9.–<br />
Eltern 6.– -10.–<br />
ED 10.–<br />
Eltern 6.– - 10.–<br />
ED 10.–<br />
Eltern 5.–
8.11 Trägerschaften<br />
Bei vier der fünf Mittagstische leisten die Trägerschaften (kirchliche Trägerschaften im Falle<br />
des Mittagstisches Bruderholz-Titus, St. Johann <strong>und</strong> St. Joseph <strong>und</strong> die Schule bzw. die<br />
verantwortliche Lehrperson als Trägerschaft im Schulhaus Brunnmatt) einen wesentlichen<br />
Beitrag zum Gelingen der Mittagstische. Die Trägerschaften steuern Sachmittel (Infrastruktur<br />
wie Küchenausstattung, Geschirr, Spielgeräte etc.), Räume (Innen- <strong>und</strong> Aussenräume) <strong>und</strong><br />
ehrenamtliche Arbeitskräfte bei. Die so beigesteuerten Leistungen ermöglichen es<br />
gegenwärtig, die Mittagstischangebote überhaupt entstehen zu lassen.<br />
Kommentar<br />
Bei der Planung <strong>und</strong> Steuerung weiterer Mittagstischangebote durch das<br />
Erziehungsdepartement müsste dies mitberücksichtigt werden. Ohne die wertvolle<br />
Unterstützung durch bestehende Institutionen kann die <strong>Betreuung</strong>sstruktur kaum<br />
kostenrealistisch <strong>und</strong> qualitativ ausgebaut werden. Es gilt Beziehungen zu potentiellen<br />
Kooperationsinstitutionen zu suchen, zu pflegen <strong>und</strong> zu unterstützen, um bestehende<br />
Ressourcen optimal nutzen zu können.<br />
8.12 Kosten <strong>und</strong> Finanzierung<br />
Bei einer Vollkostenrechnung bestimmen sich die Kosten der Mittagstische hauptsächlich<br />
durch die Raum-, Infrastruktur-, Personalkosten sowie durch die Materialkosten<br />
(Nahrungsmittel, Putzmittel, Bastelmaterial etc.).<br />
Die bestehenden Mittagstischangebote können alle auf Räume zurückgreifen, welche ihnen<br />
von der Trägerschaft (Kirche, Freizeitangebote, Schule) zur Mitbenutzung zur Verfügung<br />
gestellt werden. Dies ist ein wesentlicher Beitrag an die Gesamtkosten. Weiter zeigt die<br />
Übersichtstabelle weiter oben, dass auch bezüglich Personal in der Regel unentgeltliche<br />
Arbeitsleistung durch freiwillige HelferInnen erbracht wird. Diese Wertleistungen (zur<br />
Verfügung gestellte Räume, unentgeltlicher Arbeiteinsatz) fliessen bisher kaum in die<br />
Kostenberechnung der Mittagstische ein.<br />
Kommentar<br />
Die meisten Mittagstischangebote sind bis anhin nicht kostendeckend <strong>und</strong> daher auf<br />
Spenden <strong>und</strong> Leistungen Dritter angewiesen. Bei einer Vollkostenrechnung müssen die<br />
effektiv erbrachten Leistungen transparent gemacht werden, um eine gewisse<br />
Vergleichbarkeit mit andern <strong>Betreuung</strong>sangeboten schaffen zu können. Und in einem weitern<br />
Sinn trägt diese Kostenbeleuchtung auch zu einer Wertschätzung der Wertleistungen durch<br />
Dritte bei. Überlegungen müssen angestellt werden, wie kostendeckende Strukturen<br />
aufgebaut werden könnten (Verhältnis von Kosten, NutzerInnenzahl <strong>und</strong> Elternbeiträgen),<br />
ohne dass die <strong>Betreuung</strong>squalität leidet.<br />
Bei der Mittagstischplanung im Rahmen eines Gesamtkonzepts müsste diesem Umstand<br />
Rech-nung getragen werden. Gemäss einer Einschätzung der Kosten durch das Erziehungsdepartement<br />
würde sich ein Mittagstischplatz bei einer Vollkostenrechnung auf ca. Fr. 42.–<br />
belaufen.<br />
Auf der Einnahmenseite sind die Elternbeiträge von Fr. 6.– bis 10.– sowie der Beitrag des<br />
Erziehungsdepartements von Fr. 10.– <strong>und</strong> Initialisierungskosten zu verzeichnen, d.h.<br />
Einnahmen von ca. Fr. 18.– pro Mittagstischplatz. Mit den Leistungen durch die Trägerschaft<br />
(Räume, Infrastruktur wie Küchenmaterial, Spielgeräte etc.) <strong>und</strong> die Freiwilligenarbeit können<br />
die bestehenden Angebote bei voller Belegung in etwa ihre Kosten decken. Dies macht<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
55
einmal mehr deutlich, dass die Kooperation mit andern Institutionen (Kirche, Schule,<br />
Freizeitorganisationen, Vereinen etc.) zwingend ist, wenn die Mittagstischkosten in einem<br />
akzeptablen Rahmen bleiben sollen. Angeregt wurde in der Gruppendiskussion, allenfalls<br />
einen kleinen finanziellen Beitrag der Einnahmen an die Raumkosten mit zu berücksichtigen.<br />
Zu wessen Lasten dies gehen könnte, müsste weiter überlegt werden.<br />
Ebenso müssten die Personalkosten vereinheitlicht werden. Für ausgebildetes Personal<br />
muss gemäss MittagstischanbieterInnen mit einem St<strong>und</strong>enlohn von ca. Fr. 30.– bis 35.–, für<br />
Mitarbei-terInnen mit Fr. 20.– bis 25.– gerechnet werden. Dennoch wären auch hier<br />
Wertleistungen wie freiwillige Arbeit sehr wichtig.<br />
Insgesamt ist bei einem Ausbau der Mittagstischangebote mit Mehrkosten zu rechnen, die<br />
sich nicht durch Elternbeiträge ausgleichen liessen. Es wird deutlich, dass das Erziehungsdepartement<br />
<strong>und</strong> die AnbieterInnen weiterhin auf die Kooperation <strong>und</strong> finanzielle<br />
Mitunterstützung durch Dritte angewiesen sein wird. Hier scheint es wichtig, von Seiten des<br />
Erziehungs-departements mögliche Kooperationspartnerschaften zu finden <strong>und</strong> diese zu<br />
pflegen (durch Koordination, gemeinsame Personalversicherung, Administration <strong>und</strong> Aus-<br />
bzw. Weiterbildung, Beratung).<br />
8.13 Werbung <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Mittagstische informieren ihre Zielgruppe in der Regel über Flyer, welche über die<br />
Schule, die kirchliche <strong>und</strong> offene Jugendarbeit verteilt werden. Die Erfahrung zeigt, dass die<br />
M<strong>und</strong>-zu-M<strong>und</strong>-Propaganda (basierend auf konkreten positiven Erfahrungen) in der Schule,<br />
unter KollegInnen <strong>und</strong> Eltern die wirksamste Werbemethode darstellt. Die Mittagstische<br />
haben weitere Werbeaktionen geplant oder bereits durchgeführt, wie z.B. ein gratis<br />
Mittagessen für diejenigen, welche einen Gast mitbringen sowie für den Gast.<br />
Bei den Eltern direkt für das Angebot werben zu können, war bisher schwierig. Hier ist die<br />
Zusammenarbeit mit der Schule <strong>und</strong> Elternarbeit nötig.<br />
Kommentar<br />
Eine weitere wichtige Ebene der Öffentlichkeitsarbeit stellen das Erziehungsdepartement <strong>und</strong><br />
Elternvereinigungen sowie Vereine <strong>und</strong> Interessengruppen dar, welche sich für die eine oder<br />
andere <strong>Betreuung</strong>sstruktur stark machen. Mit der Gesamtkoordination der<br />
<strong>Betreuung</strong>sstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler durch das Erziehungsdepartement<br />
müsste auch eine einheitliche Information <strong>und</strong> Vermittlung der Angebote erfolgen.<br />
8.14 Entwicklungspotentiale<br />
In der Gruppendiskussion wurde die knappe Zeit von zwei St<strong>und</strong>en problematisiert. Die<br />
Mittagszeit ist sehr kurz, davon nimmt das gemeinsame Essen relativ viel Zeit ein, danach ist<br />
bei allen – insbesondere bei jenen, die am Nachmittag Unterricht haben – eine Pause nötig.<br />
Für mehr ist im Rahmen der verfügbaren Zeit kaum Platz.<br />
Von Seiten der Eltern, der Kinder, aber auch der Lehrkräfte wäre eine Aufgabenhilfe nach<br />
dem Mittagstisch bzw. nach dem Nachmittagsunterricht ebenfalls sehr erwünscht. Dies<br />
könnte aber nur sinnvoll geleistet werden, wenn das Mittagstischangebot zeitlich ausgedehnt<br />
werden könnte. Ebenso wurde problematisiert, dass der Mittagstisch für Kinder ohne<br />
Nachmittagsunterricht oft den <strong>Betreuung</strong>sbedarf ungenügend abdeckt.<br />
Das Entwicklungspotential der Mittagstischangebote kann einerseits in der Erweiterung des<br />
Angebots gesehen werden, andererseits in der besseren Verknüpfung mit andern<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
56
Angeboten. Denkbar <strong>und</strong> wünschenswert wäre es, das Angebot um eine<br />
Nachmittagsbetreuung mit Aufgabenhilfe <strong>und</strong> Freizeitbetreuung auszuweiten, das den Eltern<br />
die Freiheit liesse, unterschiedliche Zeiteinheiten zu nutzen (Mittagstisch plus<br />
Nachmittagsbetreuung). Der Vorteil des Ausbaus eines bestehenden Angebots – gegenüber<br />
einer additiven Lösung – bestünde darin, dass die Kinder nicht von einem Angebot zum<br />
andern wechseln müssten <strong>und</strong> das <strong>Betreuung</strong>spersonal konstant bleiben würde. Damit<br />
könnte für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit einem grösseren <strong>Betreuung</strong>sbedarf mehr Kontinuität<br />
<strong>und</strong> Konstanz geschaffen werden.<br />
Kommentar<br />
In praktisch allen Gruppendiskussionen mit den AnbieterInnen wurde deutlich, dass vor allem<br />
Kinder mit höherem <strong>Betreuung</strong>sbedarf schlecht zurechtkommen mit vielen unterschiedlichen,<br />
patchworkartig zusammengesetzten <strong>Betreuung</strong>sstrukturen (Schnittstellenprobleme, fehlende<br />
Konstanz). Insbesondere für jüngere Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der Primarschulstufe mit<br />
wenig Nachmittagsunterricht müssten erweiterte <strong>Betreuung</strong>sangebote bestehen.<br />
Mittagstisch*<br />
12.00–14.00 Uhr<br />
Mittagessen <strong>und</strong> betreute<br />
Mittagspause<br />
Mittagstisch**<br />
plus<br />
Aufgabenhilfe<br />
12.00–15.00 Uhr<br />
in Kombination mit offener<br />
Kinder- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />
Anderseits ist ein weiteres Entwicklungspotential in der engeren Zusammenarbeit mit der<br />
Schule erkennbar. Je klarer die Kooperation zwischen Schule <strong>und</strong> Mittagstisch bzw. -hort,<br />
desto besser sind Synergien zu nutzen <strong>und</strong> Ziele wie Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration<br />
tatsächlich zur realisieren.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
Mittagstisch***<br />
plus<br />
Aufgabenhilfe<br />
plus<br />
Nachmittags-Freizeit-Hort<br />
12.00–17.00 Uhr<br />
57
9 Auswertung der Erfahrungen mit Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorten,<br />
Lukasclub <strong>und</strong> Schülerclubs 16,17<br />
Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, alle zurzeit vom Erziehungsdepartement<br />
subventionierten oder finanzierten Angebote mit Tagesstrukturanteil für Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler darzustellen, um ihren Nutzen hinsichtlich eines Gesamtmodells von<br />
Tagesbetreuungsstrukturen abschätzen zu können. Insofern werden im Folgenden auch die<br />
Angebote der Abteilung Schule + Freizeit, Ressort Dienste, dargestellt.<br />
Die Abteilung Schule + Freizeit organisiert <strong>und</strong> finanziert schulnahe Angebote im<br />
Freizeitbereich. Für PrimarschülerInnen bestehen unter anderem die Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte<br />
an ca. 17 Schulstandorten, der Schülerclub St. Johann (Pilotprojekte), diverse Freizeit- <strong>und</strong><br />
Ferienprojekte sowie Angebote subventionierter Institutionen (Band Jugendhilfe, Jugend-<br />
Elektronikzentren). Für OrientierungsschülerInnen besteht an acht bis zehn Standorten ein<br />
Lukasclub. Davon werden nachfolgend nur jene Angebote kurz charakterisiert, welche im<br />
Rahmen von Tagesstrukturen gewisse Relevanz haben.<br />
9.1 Profil: Spiel- <strong>und</strong> Bastelhort<br />
Gegenwärtig bestehen an 17 Primarschulstandorten Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte. Die Spiel- <strong>und</strong><br />
Bastelhorte blicken bereits auf eine über 100-jährige Tradition zurück. Sie entstanden damals<br />
als Angebot für benachteiligte Eltern <strong>und</strong> Kinder, um ihnen in der Winterzeit eine<br />
Abwechslung anzubieten. 1958 entstand eine Verordnung, wonach Angebote für<br />
Ferienversorgung <strong>und</strong> Freizeitbeschäftigung für Schulkinder geschaffen werden sollten. 1984<br />
entstanden Gr<strong>und</strong>lagen im Schulgesetz, heute ist die Freizeitbeschäftigung für Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendliche im kantonalen Jugendhilfegesetz geregelt.<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte bieten Primarschulkindern die Möglichkeit, während der Wintermonate<br />
an mehreren Nachmittagen pro Woche im Hort zu spielen oder zu basteln. Je nach<br />
Ressourcen der HortmitarbeiterInnen werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Jedes<br />
Kind erhält zudem eine kleine Zwischenverpflegung (Apfel <strong>und</strong> Brot). Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte<br />
stellen ein niederschwelliges <strong>Betreuung</strong>sangebot für PrimarschülerInnen dar. In der Regel<br />
besuchen etwa 800 bis 900 Primarschulkinder das Angebot (15 bis 20% der<br />
PrimarschülerInnen). Gemäss Erfahrungen der AnbieterInnen wären etwa 30 bis 40% der<br />
Kinder nicht betreut, wenn das Angebot nicht bestünde. Eltern wünschten sich deshalb einen<br />
Ausbau der bestehenden Angebote: täglich, länger <strong>und</strong> ganzjährig.<br />
Pro Spiel- <strong>und</strong> Bastelhort wurden etwa 2002/03 ca. 14 bis 16 Kinder bereut. In der Regel<br />
steht für 10 Kinder ein/e MitarbeiterIn zur Verfügung. Ab durchschnittlich 15 Kindern werden<br />
zwei MitarbeiterInnen eingesetzt. Diese verfügen zu einem Drittel über eine pädagogische<br />
oder sozialpädagogische Ausbildung. Der überwiegende Teil hat keine Ausbildung in diesem<br />
Bereich, hat sich die notwendigen Fähigkeiten aber selbst angeeignet. Da die Angebote<br />
unterschiedlich ausgelastet sind, muss das Personal sehr flexibel eingesetzt werden können.<br />
Nach Bedarf werden für einzelne Anlässe auch Eltern mit einbezogen.<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte werden von November bis Januar während zwölf Wochen jeweils am<br />
Nachmittag nach der Schule angeboten. Das Angebot kann zwischen ein- bis fünfmal pro<br />
Woche in Anspruch genommen werden. Die Gruppengrösse entscheidet schliesslich über die<br />
16 Die Erfahrungen wurden einerseits mittels eines qualitativen Fragebogens, welcher vor einem gemeinsamen<br />
Treffen abgegeben worden ist, ermittelt. Andererseits wurde mit der verantwortlichen Person für<br />
Freizeitangebote aus der Abteilung Schule <strong>und</strong> Freizeit sowie einer Betreuerin des Schülerclubs ein<br />
Gespräch zu relevanten Fragestellungen durchgeführt. Die folgenden Ausführungen stellen eine<br />
zusammenfassende Auswertung der Erfahrungen dar.<br />
17 Teilnehmende am Gespräch waren der Leiter der Abteilung Schule <strong>und</strong> Freizeit sowie die zuständige<br />
Fachmitarbeiterin für den Freizeitbereich. Die Bericht wurde von den Beteiligten anschliessend verifiziert.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
58
Häufigkeit der Besuchsmöglichkeiten pro Woche. Öffnungszeiten sind jeweils am Montag,<br />
Dienstag, Donnerstag von 16.00–18.00 Uhr, am Mittwoch von 14.00–17.00 Uhr <strong>und</strong> am<br />
Freitag von 14.00–16.00 Uhr.<br />
Dazu stehen Räume der Schulhäuser zu Verfügung (z.B. Religionszimmer, Werkraum,<br />
Turnhalle u.a.). Dass das Angebot im gewohnten Schulumfeld angeboten wird, wird als<br />
Vorteil wahrgenommen (Bekanntheit des Orts, der Räume, Nähe zur Schule wirkt Vertrauen<br />
erweckend). Auf der andern Seite führt die Nähe zur Schule auch immer wieder zu<br />
Schwierigkeiten (Raumnutzung, HauswartInnen etc.).<br />
Die Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte werden hauptsächlich durch das Erziehungsdepartement, Ressort<br />
Dienste, finanziert. Die Eltern bezahlen für die <strong>Betreuung</strong> nichts, sie müssen lediglich einen<br />
einmaligen Verpflegungs- <strong>und</strong> Materialanteil von Fr. 30.– entrichten. Die Kinder müssen sich<br />
für die ganzen zwölf Wochen anmelden.<br />
Kommentar<br />
Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte werden nur während der drei Wintermonate (November bis Januar)<br />
geführt. Sie bieten insofern keine ganzjährige schulergänzende <strong>Betreuung</strong>sstruktur für<br />
Primarschulkinder, sondern lediglich einen Tagesstrukturanteil über eine bestimmte Zeit.<br />
Ebenso fehlt eine Alternative in den Ferien. Es ist zu überlegen, ob dieses Angebot den<br />
heutigen Bedürfnissen nach einer umfassenderen Struktur angepasst werden könnte. Eine<br />
Möglichkeit in diesem Sinn stellt das nachfolgend beschriebene Pilotprojekt Schülerclub dar.<br />
9.2 Profil: Pilotprojekt Schülerclub<br />
Der Schülerclub St. Johann besteht seit 1994 als Pilotprojekt. Er repräsentiert eine<br />
Tagesbetreuungsstruktur, welche im Kontext erster Diskussionen im Bereich<br />
„Tagesbetreuung an den Schulen“ <strong>und</strong> als Weiterentwicklung der Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte<br />
konzipiert war. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Auftrag des Departements vom<br />
3.11.1994 zur „Erarbeitung eines Konzepts für Tagesbetreuung im Schulumfeld“, der 1995<br />
zum Konzeptentwurf für Schülerclubs an der Primarschule geführt hat.<br />
Der Konzeptentwurf Schülerclub baut auf den Erfahrungen <strong>und</strong> dem wahrgenommenen<br />
Entwicklungsbedarf der Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte auf. Im Unterschied zum Spiel- <strong>und</strong> Bastelhort<br />
besteht der Schülerclub ganzjährig <strong>und</strong> täglich. Der Konzeptvorschlag umfasste auch ein<br />
Mittagstischangebot, das beim Pilotprojekt aber schliesslich wegfiel. Die <strong>Betreuung</strong>seinheiten<br />
sollten nach Bedarf von Eltern <strong>und</strong> Kindern gewählt werden können (à la carte). Ein weiteres<br />
Ziel bestand darin, ein kostengünstigeres Angebot zu schaffen als diejenigen der<br />
Tagesheime <strong>und</strong> Tagesschulen, welche für SchülerInnen in der Regel zu umfangreiche <strong>und</strong><br />
teure Angebote bereitstellen. Das Sparpotential wurde insbesondere in folgenden drei<br />
Bereichen gesehen: erstens durch Anstellung von Personen ohne qualifizierte Ausbildung,<br />
aber mit Erfahrung in der Kinderbetreuung, zweitens durch Nutzung bestehender Räume in<br />
den Schulen, drittens waren Mittagstische nur als betreute Lunchmahlzeiten geplant (womit<br />
die Kosten für Küchen-infrastruktur, Personal, Nahrungsmittel wegfallen würden.) Das<br />
Konzept Schülerclub wurde in Fachkreisen in der Folge kritisiert. Angriffspunkte boten<br />
folgende Punkte: die Idee, Personal ohne qualifizierte Ausbildung anzustellen, von Seiten der<br />
Schulen wurden zusätzlich anfallende Aufgaben für die Schule befürchtet, die<br />
TagesheimanbieterInnen empfanden das Angebot als Konkurrenz. Und nicht zuletzt wurde<br />
die Idee der Lunchverpflegung kritisiert.<br />
Dennoch entstand schliesslich das Pilotprojekt Schülerclub St. Johann (ohne Mittagstisch).<br />
Das Angebot richtet sich entsprechend an PrimarschülerInnen der Schulstandorte St.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
59
Johann, Volta <strong>und</strong> Peters. In der Regel nutzen 6 bis 20 Schulkinder pro Nachmittag den<br />
Schülerclub. Durchschnittlich wird das wöchentliche Angebot pro Kind zwei- bis dreimal<br />
genutzt. Die PrimarschülerInnen werden im Schülerclub betreut, nehmen an gemeinsamen<br />
Aktivitäten <strong>und</strong> Ausflügen <strong>und</strong> am Spielen <strong>und</strong> Basteln teil. Sie erhalten eine<br />
Zwischenverpflegung (Apfel <strong>und</strong> Brot) im Club.<br />
Für die <strong>Betreuung</strong> des Schülerclubs stehen 66 Stellenprozent zur Verfügung (zu einem<br />
Ansatz von Fr. 25.– pro St<strong>und</strong>e). Eine MitarbeiterIn betreut ca. 10 Kinder, ab 15 Kindern<br />
werden zwei Personen für die <strong>Betreuung</strong> des Schülerclubs eingesetzt.<br />
Das Angebot ist von Montag bis Freitag jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet <strong>und</strong> kann an<br />
mehreren Tagen genutzt werden. Die Kinder melden sich für ein Semester an.<br />
Der Elternbeitrag beträgt für ein Semester Fr. 100.–/pro Nachmittag (bei 20 Wochen pro<br />
Semester ergibt dies Fr. 5.– pro Nachmittag). Eine feste Anmeldung für ein Semester wird<br />
erwartet. Die Hauptfinanzierung erfolgt durch das Erziehungsdepartement.<br />
9.3 Profil: Lukasclub<br />
Die Lukas-Stiftung wirkt seit 1856 zum Wohle der Schuljugend. Die Lukas-Clubs sind im<br />
schulischen Umfeld bereits höchst traditionsreiche <strong>Betreuung</strong>sangebote in den<br />
Wintermonaten. Seit 1959 werden die Lukas-Clubs vom Erziehungsdepartement<br />
subventioniert.<br />
Lukas-Clubs richten ihr Angebot an OrientierungsschülerInnen. Sie bieten den SchülerInnen<br />
die Möglichkeit, sich im schulischen Umfeld nach dem Unterricht zu treffen, zu spielen <strong>und</strong><br />
werken, Aufgaben zu lösen <strong>und</strong> auch herumzuhängen (Jugendtreff). Eine kleine<br />
Zwischenverpflegung wird abgegeben. Das Angebot wird jeweils von 8 bis 23 SchülerInnen<br />
genutzt (durchschnittlich 16 SchülerInnen). Die Angebote bestehen an acht bis zehn<br />
Orientierungsschulstanorten. Sie sind von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Einige haben<br />
zusätzlich an einem bis drei Abenden pro Woche geöffnet. Als Räume stehen<br />
Aufenthaltsräume oder Turnhallen im Schulhaus zur Verfügung.<br />
Das Angebot steht den SchülerInnen gratis zur Verfügung, kann so oft genutzt werden, wie<br />
Bedarf besteht, es besteht keine Anmeldepflicht.<br />
Die <strong>Betreuung</strong> des Lukas-Clubs wird teilweise von Lehrpersonen <strong>und</strong> teilweise durch externe<br />
Personen abgedeckt. Pro Lukas-Club werden ein bis Personen eingesetzt. Die extern<br />
beigezogenen MitarbeiterInnen erhalten einen St<strong>und</strong>enlohn von Fr. 25.– in der St<strong>und</strong>e.<br />
Die Erfahrungen mit den niederschwelligen Lukasclubs sind sehr positiv. Der Lukasclub stellt<br />
ein kostengünstiges Angebot dar, das zunehmend von den OrientierungsschülerInnen<br />
genutzt wird.<br />
9.4 Entwicklungspotential der Angebote mit Tagesstrukturanteil<br />
Kommentar<br />
Die hier dargestellten unterschiedlichen Angebote, welche bisher von der Abteilung Schule +<br />
Freizeit betreut <strong>und</strong> (mit-)finanziert wurden, sind in unterschiedlichen historischen Kontexten<br />
entstanden <strong>und</strong> versuchen einen Teil der unterrichtsfreien Zeit mit einem <strong>Betreuung</strong>sangebot<br />
abzudecken. Insofern sind es klar Freizeitangebote. Die Erfahrungen aus den Angeboten<br />
können zweifellos genutzt werden, sie bedürfen im Rahmen einer Gesamtkonzeption aber<br />
einer Anpassung an die heutigen Bedürfnisse nach umfassenderen <strong>und</strong> ganzjährigen<br />
Tagesstrukturen.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
60
Einerseits wäre es sicher sinnvoll, sich auf möglichst einen Angebotstyp im Schulbereich für<br />
die Primarstufe (ähnlich wie Schülerclub) <strong>und</strong> evtl. einen für die Orientierungsstufe zu<br />
beschränken.<br />
Dieser müsste ganzjährig <strong>und</strong> nach Möglichkeit mehrmals die Woche zwischen <strong>und</strong> nach den<br />
Unterrichtszeiten offen sein (möglichst bis 17.00 Uhr, evtl. bis 18.00 Uhr). Optimalerweise<br />
müsste nach Bedarf auch ein Mittagstischangebot <strong>und</strong> ein <strong>Betreuung</strong>sangebot für<br />
Hausaufgaben gewählt werden können.<br />
Es ist sinnvoll, bei der Entwicklung eines Angebots die Erfahrungen der Mittagstische <strong>und</strong><br />
weiterer Freizeitangebote (wie z.B. Robi-Spiel-Aktion) mitzuberücksichtigen <strong>und</strong> ein<br />
gemeinsames Modell zu entwickeln. Der Vorteil der Angebote besteht zweifellos darin, dass<br />
bereits viel Erfahrung mit kindergerechter Freizeitbetreuung besteht. Die (Mit-)Gestaltung der<br />
Freizeit <strong>und</strong> der soziale Umgang in Gruppen soll auch weiterhin Ziel der Angebote bleiben.<br />
Nach Möglichkeit sollte die Initiative zur Ausgestaltung eines Angebots von der Schule<br />
ausgehen. Damit könnten optimale Voraussetzungen für ein spezifisches Angebot<br />
geschaffen werden, das in die jeweilige Schulstruktur passt <strong>und</strong> den jeweiligen Bedürfnisse<br />
der Beteiligten weitgehend entspricht. Laut Auskunft der Befragten sind die meisten<br />
Angebote jeweils nur zu Gast in den Schulen <strong>und</strong> müssen versuchen, sich möglichst gut<br />
anzupassen. Kooperationsgefässe zwischen der Schule <strong>und</strong> den Freizeitangeboten bestehen<br />
in der Regel nicht. Hier ist Entwicklungspotential erkennbar. Klare Kooperationsgefässe<br />
helfen einerseits, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, <strong>und</strong> andererseits können Synergien<br />
der Zusammenarbeit entstehen.<br />
Bei einem Ausbau der Angebote müsste die Frage der Räume mit in die Planung einbezogen<br />
werden. Nach Aussage der Gesprächsteilnehmer stehen in der Regel eher zu wenig Räume<br />
zur Verfügung, ebenso bestehen kaum Räume, um Material dauerhaft aufbewahren zu<br />
können. Gerade die Frage nach geeigneten <strong>und</strong> genügend Räumen wird vorgängig oft nicht<br />
genügend geklärt. Hier kann der Ausbau im schulischen Umfeld durchaus an Grenzen<br />
stossen. Ebenso muss der Unterhalt der Räume sowie die Nutzung der Infrastruktur<br />
abgesprochen werden.<br />
Eine Vereinheitlichung der Angebote müsste auch auf der Ebene der Finanzierung<br />
angestrebt werden. Die gegenwärtigen Angebote unterscheiden sich diesbezüglich sehr<br />
stark. Die Höhe des Elternbeitrags ist mitzuberücksichtigen.<br />
Das Personal verfügt bisher zu einem überwiegenden Teil über keine Ausbildung im<br />
sozialpädagogischen oder pädagogischen Bereich. Gefordert wurde bisher vor allem:<br />
Erfahrung im Umgang <strong>und</strong> in der <strong>Betreuung</strong> von Kindern, Fähigkeit zum Führen von<br />
Gruppen, Kreativität, Flexibilität, Eigeninitiative sowie Fähigkeiten im Umgang mit andern<br />
Erwachsenen im schulischen Umfeld (Lehrkräften, Abwart, Eltern). Da die Angebote zeitlich<br />
befristet sind oder nur einige St<strong>und</strong>en pro Woche ausmachen, konnten bisher aber keine<br />
Vollzeitstellen angeboten <strong>und</strong> finanziert werden (Nebenverdienst). Ebenso konnte kein<br />
Lohnklassenanstieg angeboten werden. Hier könnte hinsichtlich der Anstellungsbedingungen<br />
ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, wenn die Entlöhnung bei allen Angeboten den<br />
kantonalen Lohnrichtlinien angepasst würden – bei den Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorten entspricht<br />
dies kantonalen Richtlinien.<br />
Bei der Entwicklung bestehender Angebote ist folgender Punkt kritisch zu reflektieren. Die<br />
hier beschriebenen Angebote lassen sich klar dem Freizeitbereich zuordnen, d.h. sie sind<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich niederschwellig, freiwillig <strong>und</strong> richten sich nach Nachfrage, Trends <strong>und</strong><br />
Bedürfnissen. Werden diese Angebote erweitert <strong>und</strong> mit der <strong>Betreuung</strong>sfunktion beauftragt,<br />
kann ein Spannungsfeld von unterschiedlichen Interessenschwerpunkten (Freizeitangebot<br />
<strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>sangebot) entstehen.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
61
Obwohl es in der betreuten ausserunterrichtlichen Freizeit zwischen Schule <strong>und</strong> Elternhaus<br />
ebenfalls um Freizeitgestaltung geht, besteht im Vergleich zu freiwilligen Freizeitangeboten<br />
ein Verpflichtungsdruck (als Garantie für ein klares <strong>Betreuung</strong>sverhältnis, Verlässlichkeit<br />
etc.), weiter wird ein erhöhtes Mass an pädagogischer <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Förderung erwartet.<br />
Als schulnahes <strong>Betreuung</strong>sangebot besteht weiter die Gefahr, von der Schule<br />
instrumentalisiert zu werden. Dabei darf eine Tagesstruktur nicht zu einer verlängerten<br />
Schulzeit für „schulische Nachbehandlung“ missbraucht werden. Die <strong>Betreuung</strong> der<br />
Hausaufgaben kann allerdings ein weiteres Teilstück im Angebot sein, muss aber klar<br />
wählbar <strong>und</strong> begrenzt sein.<br />
9.5 Stellungnahme zu einem Gesamtkonzept durch den Leiter der<br />
Abteilung Schule <strong>und</strong> Freizeit<br />
Laut Auskunft des Leiters der Abteilung Schule + Freizeit führte die fehlende<br />
Gesamtkonzeption bezüglich Tagesbetreuungsstrukturen bisher zu Energieverlust <strong>und</strong><br />
unnötigen Wiederholungen (z.B. Konzept für Tagesbetreuung im Schulumfeld,<br />
Konzeptentwurf für Schülerclub – Tagesbetreuung an den Primarschulen im Kanton Basel-<br />
Stadt vom 20.2.1998).<br />
Die Schaffung einer Gesamtkonzeption auf der Gr<strong>und</strong>lage des neu entstehenden<br />
Tagesbetreuungsgesetzes wird deshalb als dringend notwendig erachtet. Eine klare<br />
Strategie ist notwendig. Dazu gehören klare Entscheide bezüglich künftiger Angebote,<br />
vergleichbare Regelungen der Personalanstellung <strong>und</strong> Entlöhnung, Schaffung von<br />
vergleichbaren Leistungseinheiten, Vereinheitlichung der Subventions- <strong>und</strong> Elternbeiträge<br />
etc.<br />
Bei der Gesamtkonzeption muss darauf geachtet werden, dass keine sich unnötig<br />
konkurrenzierenden Angebote entstehen. Im schulnahen Bereich müsste ein Angebot<br />
bestehen, das je nach <strong>Betreuung</strong>sbedarf zwischen ein- bis fünfmal wöchentlich gewählt<br />
werden kann <strong>und</strong> sich ähnlich wie der Schülerclub nach den Unterrichtszeiten richtet. Weiter<br />
müsste das Angebot um ein Mittagstischangebot erweitert werden können. Damit könnte eine<br />
<strong>Betreuung</strong>sstruktur von 12.00 bis ca. 17.00 resp. 18.00 Uhr geschaffen werden. Weiter<br />
zeigen Erfahrungen, dass ein schulnahes <strong>Betreuung</strong>sangebot am meisten Vorteile bietet,<br />
wenn es im Schulumfeld erwünscht <strong>und</strong> mitgetragen wird. Übernimmt die Schule die<br />
Verantwortung, kann das Angebot optimal in die Schulstruktur eingepasst werden <strong>und</strong> die<br />
Kooperationsbedingungen können verbessert werden.<br />
Weiter sind Angebote auch während der Schulferien ein dringender Bedarf.<br />
Bei einer Gesamtkonzeption muss ferner darauf geachtet werden, dass die Zuständigkeiten<br />
<strong>und</strong> Schnittstellen geklärt werden zwischen der Abteilung Tagesbetreuung <strong>und</strong> der Abteilung<br />
Schule + Freizeit (beide im Ressort Dienste) einerseits <strong>und</strong> andererseits zwischen der<br />
Abteilung Tagesbetreuung <strong>und</strong> dem Ressort Schulen (zuständig für Tagesschulen), von<br />
welchem aktuell die Evaluation der familienergänzenden Tagesbetreuung von Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler ausgeht.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
62
10 Auswertung der Diskussionen mit Vertreterinnen <strong>und</strong><br />
Vertretern diverser Interessen- <strong>und</strong> Fachgruppen<br />
10.1 Ausgewählte Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen<br />
Die Diskussion um Tagesbetreuung kann aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erfolgen<br />
<strong>und</strong> entsprechend unterschiedliche Hinweise für die Ausgestaltung der Strukturen liefern. Die<br />
Auswahl der befragten Vertreterinnen <strong>und</strong> Vertreter von Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen ist<br />
keineswegs vollständig. Im Rahmen der vorliegenden Erhebung musste eine Auswahl<br />
getroffen werden. Die befragten Gruppen verdeutlichen exemplarisch die unterschiedlichen<br />
Perspektiven, die es zu berücksichtigen gilt.<br />
Kürzel Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen Vertretene Perspektive<br />
ATB Abteilung Tagesbetreuung, Ressort<br />
Dienste, Erziehungsdepartement<br />
AKJS<br />
AJFP<br />
SPD<br />
Abteilung Kinder <strong>und</strong> Jugendschutz,<br />
Justizdepartement<br />
Abteilung Jungend, Familie <strong>und</strong><br />
Prävention, Justizdepartement<br />
Kantonaler Schulpsychologischer Dienst,<br />
Erziehungsdepartement<br />
AGI Arbeitsgruppe Integration,<br />
Erziehungsdepartement<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
Der Bereich der Tagesbetreuung wird im Kanton<br />
Basel-Stadt vom Erziehungsdepartement verwaltet.<br />
Das Ressort Dienste führt eine Abteilung<br />
Tagesbetreuung. Sie ist für das Thema insgesamt<br />
zuständig <strong>und</strong> konzentriert sich in der praktischen<br />
Ausrichtung auf die Angebote für Kinder im<br />
Vorschulalter sowie bei Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
auf schulexterne Angebote von staatlichen <strong>und</strong><br />
privaten Tagesheimen.<br />
Die genannten Institutionen befassen sich im Kontext<br />
von Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutzfragen <strong>und</strong> Fragen zur<br />
Integration <strong>und</strong> Prävention mit<br />
Tagesbetreuungsstrukturen<br />
Fragen im Kontext von Chancengleichheit <strong>und</strong><br />
Integration in allen Bereichen des gesellschaftlichen<br />
Lebens<br />
GEROS Gesamtelternrat der Orientierungsstufe Elternperspektive<br />
PV Personalverbände: Gewerkschaft<br />
Erziehung (GE), Verein des Personals<br />
öffentlicher Dienste (VPOD),<br />
Schulsynode<br />
Personalperspektive<br />
VTS Verein Tagesschulen VertreterInnen eines ganzheitliches Schulangebots<br />
mit Tagesstruktur<br />
Die Vertreterinnen <strong>und</strong> Vertreter der Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen wurden zu drei<br />
Themenfeldern befragt. Diese wurden ihnen als Vorbereitung jeweils vor dem gemeinsamen<br />
Gespräch zugestellt. Eine vollständige Wiedergabe aller Aspekte ist im Rahmen dieser Arbeit<br />
nicht möglich. Die folgende Zusammenfassung beschränkt sich auf die Darstellung der<br />
zentralen Diskussionspunkte. Die Aussagen wurden anschliessend von allen Beteiligten<br />
verifiziert. Sie zeigen sowohl den gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen Perspektiven<br />
wie auch die Unterschiede.<br />
63
10.2 Fragestellung <strong>und</strong> Ergebnisse<br />
10.2.1 Frage 1: Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration<br />
Die Vorlage zum Tagesbetreuungsgesetz ist von der Regierung an den Grossen Rat<br />
überwiesen worden. Ein erstes Ziel von Tagesbetreuung lautet sinngemäss: Tagesstrukturen<br />
fördern Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in ihrer Entwicklung von Gr<strong>und</strong>kompetenzen <strong>und</strong><br />
verbessern ihre Integration <strong>und</strong> ihre Chancengleichheit.<br />
Inwiefern fördern die bestehenden Angebote aus Ihrer Sicht die Entwicklung von<br />
Gr<strong>und</strong>kompetenzen sowie die Integration <strong>und</strong> die Chancengleichheit unserer Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler? Mit welcher Angebotspalette <strong>und</strong> zu welchen Bedingungen können mit den<br />
gegebenen Ressourcen am meisten Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler gefördert werden?<br />
Antworten: Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration<br />
Abt. Tagesbetreuung<br />
(ATB)<br />
Abt. Kinder <strong>und</strong><br />
Jugend-schutz (AKJS)<br />
Abt. Jugend, Familie,<br />
Prävention (AJFP)<br />
Schulpsychologischer<br />
Dienst (SPD)<br />
Antwortkategorien<br />
Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration: Das Ziel lässt sich am<br />
ehesten realisieren, wenn Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> möglichst eng verzahnt sind.<br />
Die Schule muss zum „Erlebnisraum“ werden. Dazu gehören:<br />
• klare Verantwortlichkeit<br />
• verbindliche Ansprechpersonen<br />
• Konstanz<br />
• Klare Kommunikationsstrukturen zwischen Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> wären<br />
Voraussetzung dazu. Der Bezug zum Kind von allen Beteiligten ist<br />
entscheidend.<br />
• Sprachförderung (Zweisprachigkeit), Kulturaustausch<br />
Neue Zielgruppe, veränderter Bedarf: Die drei Vertreter der AKJS, der AJFP<br />
<strong>und</strong> des SPD konstatieren, dass der Bedarf an schul- <strong>und</strong> familienergänzenden<br />
<strong>Betreuung</strong>smöglichkeiten im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen<br />
zugenommen hat. Für einen grossen Teil der Schulkinder besteht ein Bedarf<br />
nach <strong>Betreuung</strong> über Mittag oder am Nachmittag. Weiter stellen die Befragten<br />
eine Zunahme von „komplexen Fällen“ fest (Sozialisationsdefizite, soziale<br />
Auffälligkeit, Lernstörungen, somatische Probleme, Schwierigkeiten in der<br />
Herkunftsfamilie etc.). Viele Eltern können aus unterschiedlichen Gründen ihre<br />
<strong>Betreuung</strong>sfunktion nicht mehr umfänglich wie bisher erfüllen. Ebenso fehlt für<br />
viele SchülerInnen eine Aufgabenhilfe.<br />
Ferner problematisieren die Befragten die Schwierigkeiten der Basler Schulen im<br />
Umgang mit auffälligen Schulkindern (häufig Mehrfachindikationen). Danach<br />
bestehen zu wenig Plätze für diese Kinder. Als Folge davon wird eine gewisse<br />
Beliebigkeit im Umgang mit auffälligen SchülerInnen wahrgenommen sowie eine<br />
Aussonderungstendenz (mangelnde Tragfähigkeit der Schule).<br />
Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration: Ein differenziertes<br />
Angebot für unterschiedliche Bedürfnisse in Schulnähe oder im Quartier ist nötig,<br />
um sowohl die Schule wie die Eltern in ihrer <strong>Betreuung</strong>sfunktion zu unterstützen<br />
<strong>und</strong> SchülerInnen dadurch bessere Integrationschancen zu ermöglichen.<br />
Anzahl von <strong>Betreuung</strong>sangeboten: Eine Tagesstruktur kann nur einen Beitrag<br />
zur Integration <strong>und</strong> Chancengleichheit leisten, wenn die Durchmischung der<br />
Angebote die Tragfähigkeit der Gruppe ermöglicht. Es kann nicht angehen,<br />
Angebote nur mit „schwierigen“ Fällen zu besetzen. Das bedeutet, dass eine<br />
bestimmte Anzahl von Angeboten bestehen muss, damit die soziale<br />
Durchmischung garantiert werden <strong>und</strong> zur Förderung der Schulkinder beitragen<br />
kann.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
64
Arbeitsgruppe<br />
Integration (AGI)<br />
Gesamtelternrat der<br />
OS (GEROS)<br />
Personalverbände<br />
(PV)<br />
Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration: Unter diesem Gesichtspunkt<br />
müssen gemäss der Vertreterinnen <strong>und</strong> Vertreter der AGI folgende Punkte<br />
berücksichtigt werden:<br />
Die Tagesbetreuungsangebote <strong>und</strong> die schulischen Angebote müssen nach<br />
Möglichkeit eine kooperierende Einheit bilden (wie z.B. Tagesschulen,<br />
Tagesbetreuungsstrukturen im Kontext der Schule). Die Integration von<br />
Schulkindern mit persönlicher oder sozialer Indikation, aber auch die Integration<br />
von fremdsprachigen Kindern erfordert einen klar strukturierten, ganzheitlichen<br />
<strong>Betreuung</strong>srahmen, Bezugspersonen <strong>und</strong> möglichst wenig Schnittstellen. Wichtig<br />
sind folgende Aspekte:<br />
• Verbindlichkeit<br />
• Beziehungsqualität<br />
• klare Strukturen, Übersichtlichkeit,<br />
• Kooperation zwischen <strong>Betreuung</strong>spersonal <strong>und</strong> Lehrpersonen<br />
• garantierte <strong>Betreuung</strong> von 8.00 bis 17.00 Uhr<br />
• möglichst wenig Schnittstellen<br />
• Stabilität <strong>und</strong> Kontinuität (personell, zeitlich)<br />
• intensive Sprachförderung<br />
• professionelles Personal (insbesondere mit Sozialkompetenz, interkulturellen<br />
Kompetenzen, pädagogischen Kompetenzen)<br />
Die VertreterInnen des GEROS sind gr<strong>und</strong>sätzlich der Meinung, dass es die<br />
Elternmeinung nicht gibt („21 Meinungen im Elternrat“).<br />
Altersspezifische Angebotstypen: Stehen die Interessen der SchülerInnen im<br />
Zentrum, dann müssen sich Tagesbetreuungsstrukturen zunächst am Alter der<br />
Schulkinder orientieren. Für jüngere Kinder müssen umfassende, ganzheitliche<br />
Strukturen angeboten werden, die Kontinuität <strong>und</strong> Verlässlichkeit bieten. Für<br />
OrientierungsschülerInnen würden in der Regel weniger umfassende Angebote<br />
ausreichen. Bei einer Mittagszeit von 12.00 bis 13.30 Uhr reicht ein Mittagstisch<br />
oder allenfalls ein Raum, um den mitgebrachten Lunch essen zu können völlig.<br />
Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration: Obwohl die Frage nach Chancengleichheit<br />
<strong>und</strong> Integration gestellt wurde, lieferten die befragten Eltern kaum Antworten<br />
dazu. Für Eltern scheint die gute <strong>Betreuung</strong> während ihrer Abwesenheit im<br />
Zentrum zu stehen. Dass die Angebote darüber hinaus noch weitere Funktionen<br />
erfüllen können, scheint weniger bewusst zu sein.<br />
Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration: Zur Förderung der<br />
Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration sind umfassende Tagesstrukturen, wie sie<br />
beispielsweise in Tagesschulen angeboten werden sinnvoll. Die enge<br />
Verzahnung von <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Unterricht bietet Kontinuität, wenig Schnittstellen<br />
<strong>und</strong> ist reizvermindernd. Damit liefert sie eine gute Basis für das Lernen. Ebenso<br />
wird betont, dass <strong>Betreuung</strong>sstrukturen bereits im Kindergarten gute Wirkung auf<br />
die sprachliche <strong>und</strong> soziale Integration haben.<br />
Die Erfahrung zeigt weiter, dass <strong>Betreuung</strong>s- <strong>und</strong> Unterrichtszeiten aus einem<br />
Guss mehr Qualität erzielen können.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
65
Verein Tagesschulen<br />
(VTS)<br />
Zusammenfassender Kommentar<br />
Förderung von Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration in Tagesschulen: Aus der Sicht<br />
des VTS stellt die Tagesschule zweifellos ein sehr wertvolles Angebot dar.<br />
Grosszügige zeitliche Rahmenbedingungen, fliessende Übergänge von der<br />
Unterrichtszeit zur Freizeit, hohe Konstanz <strong>und</strong> verlässliche, klare Strukturen im<br />
Alltag helfen Stress vermeiden. Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen profitieren in<br />
konstanten Lerngruppen vom Schulstoff aber auch von den intensiven sozialen<br />
Beziehungen untereinander. In diesem Sinn kann das Tagesschulangebot einen<br />
wichtigen Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration beitragen.<br />
Im Kontext des gesellschaftlichen Wandels wird ein erhöhter Bedarf an <strong>Betreuung</strong>sformen<br />
wahrgenommen. Die Befragten befürworten alle ein Gesamtmodell mit unterschiedlichen<br />
Angebotstypen. Die unterschiedlichen Angebote sollen je nach <strong>Betreuung</strong>sbedarf wählbar<br />
sein. Danach ist der <strong>Betreuung</strong>sbedarf abhängig vom zeitlichen Bedarf (Vollzeit- oder<br />
Teilzeitbetreuung), vom Alter <strong>und</strong> von spezifischen Indikationen der Schulkinder (z.B. soziale<br />
Probleme <strong>und</strong> Lernschwierigkeiten). Die Darstellung auf der nachfolgenden Seite soll diesen<br />
Zusammenhang illustrieren.<br />
Neben dem generell erhöhten Bedarf nach Tagesbetreuungsplätzen sind klar strukturierte,<br />
ganzheitliche Angebote gemäss Fachpersonen wichtig für die Integration von Schulkindern<br />
mit persönlicher oder sozialer Indikation, aber auch für die Integration von fremdsprachigen<br />
Kindern. Optimal wird eine enge Verzahnung von Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>, mit wenig<br />
Schnittstellen gesehen. Wichtig sind weiter folgende Aspekte:<br />
• Verbindlichkeit<br />
• Beziehungsqualität<br />
• klare Strukturen, Übersichtlichkeit<br />
• Kooperation zwischen <strong>Betreuung</strong>spersonal <strong>und</strong> Lehrpersonen<br />
• garantierte <strong>Betreuung</strong> von 7.00 bis 17.00/18.00 Uhr,<br />
• möglichst wenig Schnittstellen<br />
• Stabilität <strong>und</strong> Kontinuität (personell, zeitlich)<br />
• intensive Sprachförderung<br />
• professionelles Personal (insbesondere mit Sozialkompetenz, interkulturellen Kompetenzen,<br />
pädagogischen Kompetenzen)<br />
• genügend Angebote, damit die soziale Durchmischung möglich ist<br />
Der letzte Punkt liefert einen wichtigen Hinweis auf den Umfang von integrativen<br />
<strong>Betreuung</strong>sstrukturen. Denn Angebote können nur einen Beitrag zu Integration <strong>und</strong><br />
Chancengleichheit leisten, wenn die Durchmischung der Angebote die Tragfähigkeit der<br />
Gruppe noch zu lässt. Es kann nicht angehen, Angebote nur mit „schwierigen“ Fällen<br />
aufzufüllen. Darauf haben auch die bestehenden AnbieterInnen von Angeboten hingewiesen.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass nur bis etwa zu einem Drittel anspruchsvollere Schulkinder in einer<br />
Gruppe betreut werden können. Steht die Förderung fremdsprachiger Kinder im Zentrum, so<br />
wird eine Mischung von zwei Sprachen als richtig erachtet (keine Multisprachlichkeit).<br />
Das bedeutet, dass eine bestimmte Anzahl von Angeboten bestehen muss, damit eine<br />
optimale soziale Durchmischung garantiert werden kann. Weiter zeigt sich, dass die<br />
Angebote sorgfältiger auf die Zusammensetzung achten müssen, wenn Integration als Ziel<br />
formuliert wird.<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003)<br />
66
Übersicht: <strong>Betreuung</strong>styp in Abhängigkeit von zeitlichem Bedarf, Alter <strong>und</strong> allfälligen Indikationen der Schulkindern<br />
1. <strong>Betreuung</strong>stypen in Abhängigkeit von zeitlichem Bedarf, Alter sowie Indikation<br />
niedriger hoher<br />
<strong>Betreuung</strong>sgrad <strong>Betreuung</strong>sgrad<br />
- z.B. kein <strong>Betreuung</strong>sschlüssel - <strong>Betreuung</strong>sschlüssel<br />
- kaum spezielles Konzept - <strong>Betreuung</strong>skonzept<br />
- z.T. ehrenamtliche <strong>und</strong> qualifizierte Arbeit - professionelles Personal<br />
- keine oder lose Kooperation mit der Schule - Kooperation mit Schule<br />
- rel. geringe Zeitdauer - umfassendes Angebot (ganztägig<br />
- Selbstverantwortung der Beteiligten mehrmals wöchentlich, ganzjährig)<br />
- erhöhter Anspruch an integrative Leistung<br />
niedrig hoher <strong>Betreuung</strong>sgrad<br />
Angebotstypen<br />
Mittagstisch MT mit Aufgabenhilfe MT mit Nachmittaghort<br />
Tagesheime/-horte<br />
Nutzung v. Schülerräumen Lukasclub SchülerInnenclub Tagesbetreuung OS Tagesschulen<br />
Aufgabenhilfe<br />
Spiel- <strong>und</strong> Baselhort Tagesmütter<br />
2. Integrative Leistung<br />
niedrig, nicht angestrebt hoch, angestrebt<br />
3. Kosten<br />
niedrig hoch<br />
Evaluation ‚familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler’ (2003) 67
10.2.2 Frage 2: Elterlicher Bedarf nach familienergänzenden <strong>Betreuung</strong>sstrukturen<br />
Entsprechend einer zweiten Zielsetzung ermöglichen Tagesstrukturen „Eltern Erwerbsarbeit,<br />
den Erhalt <strong>und</strong> die Verbesserung ihrer beruflichen Qualifikation sowie die Wahrnehmung von<br />
Aufgaben im sozialen <strong>und</strong> öffentlichen Bereich, <strong>und</strong> den Arbeitgebenden die Gewinnung <strong>und</strong><br />
Erhaltung von Arbeitskräften mit Erziehungspflichten“.<br />
Inwiefern entsprechen die dargestellten Angebote nach Ihrer Einschätzung der elterlichen<br />
Nachfrage nach familienergänzenden Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler? Mit<br />
welcher Angebotspalette <strong>und</strong> zu welchen Bedingungen können im Rahmen der gegebenen<br />
Ressourcen am meisten Eltern <strong>und</strong> Arbeitgebende von Tagesstrukturen profitieren?<br />
Antwortkategorien<br />
ATB Bedarf der Eltern: Eltern wünschen eine klare durchgehende Tagesstruktur für ihre<br />
Kinder mit möglichst wenig Schnittstellen bzw. mit ineinander greifenden Nahtstellen. Voll<br />
erwerbstätige Eltern wünschen sich weiter, dass im Rahmen der <strong>Betreuung</strong>sangebote<br />
Hausaufgaben gelöst werden können. Ebenso werden Ferienangebote als Bedarf<br />
angemeldet. Bedarf wird zudem angemeldet nach vermehrten Mittagstischangeboten. In<br />
Bezug auf die Kosten zeigt sich, dass hohe Elternbeiträge abschrecken.<br />
AKJS, AJFP,SPD Erziehungsfunktion muss bei den Eltern bleiben: In Bezug auf die Eltern wird<br />
festgehalten, dass bei der Schaffung von Angeboten der Selbsthilfeaspekt nicht verloren<br />
gehen darf. Es geht nicht darum, den Eltern alles abzunehmen bis hin zu ihrer<br />
Erziehungsfunktion. Die Hauptverantwortung für die Erziehung muss bei den Eltern<br />
bleiben, die <strong>Betreuung</strong>sangebote bieten lediglich eine Unterstützung bzw. Ergänzung der<br />
elterlichen <strong>Betreuung</strong>.<br />
Bedürfnis der Eltern: Damit Angebote für Eltern attraktiv sind, müssen diese nach<br />
Bedürfnis wählbar sein, ein verlässliches <strong>Betreuung</strong>sangebot darstellen, <strong>und</strong> die Kosten<br />
müssen angemessen, vergleichbar <strong>und</strong> transparent sein.<br />
Eine weniger zentrale Rolle spielt für viele Eltern die integrative Leistung der Angebote.<br />
AGI Bedürfnis der Eltern: Die Nachfrage nach <strong>Betreuung</strong>splätzen für fremdsprachige Kinder<br />
war früher im Vergleich zu Schweizer Kindern höher. In den letzten Jahren hat hier ein<br />
Ausgleich stattgef<strong>und</strong>en. Dabei suchen Eltern in der Regel eine Tagesstruktur, wenn<br />
beide Elternteile erwerbstätig sind. Oberstes Kriterium der Wahl ist nach Einschätzung<br />
der AGI meist die Kostenfrage. Fragen zur Qualität <strong>und</strong> zu Förder- <strong>und</strong><br />
Integrationsmöglichkeiten folgen, wenn überhaupt, erst danach. Nach Erfahrung der AGI<br />
schätzen Eltern häufig den Förderbedarf der Kinder auch nicht gleich hoch ein wie<br />
beispielsweise die Lehrkräfte. Hier besteht ein potentielles Spannungsverhältnis<br />
zwischen dem Wollen der Eltern <strong>und</strong> dem der Arbeitsgruppe Integration. Gemäss<br />
VertreterInnen der AGI besteht ein Bedarf an Elternarbeit.<br />
GEROS Bedürfnis der Eltern: Wichtig sind für Eltern verlässliche Strukturen, in denen die<br />
Schulkinder altersentsprechend <strong>und</strong> bedarfsgerecht betreut werden. Aus der Sicht der<br />
Eltern werden für kleinere Kinder umfassendere Angebote begrüsst, für<br />
OrientierungsschülerInnen reichen in der Regel Mittagstische <strong>und</strong><br />
Hausaufgabenangebote im Schulhaus. Weiter wird als wichtig erachtet, dass den<br />
SchülerInnen im Schulhaus ein Aufenthaltsraum zur Verfügung steht, in dem sie z.B.<br />
auch ein- bis zweimal pro Woche ihren Lunch essen könnten.<br />
Die gegenwärtige Informationspolitik wird auf Seiten der Elternvertretung als mühsam<br />
wahrgenommen. Es besteht keine Übersicht über die bestehenden Angebote.<br />
Die Elternbeiträge müssten nach Auffassung der Eltern neu diskutiert <strong>und</strong> vergleichbar<br />
über die unterschiedlichen Angebote angesetzt werden.<br />
68
PV<br />
Bedürfnis der Eltern: Für Eltern bieten Tagesschulen die umfassendsten <strong>und</strong><br />
verlässlichsten Strukturen. Hier ist der Tagesablauf durchgehend strukturiert, die übrigen<br />
Zeiten zwischen <strong>und</strong> nach dem Unterricht müssen nicht extra organisiert werden. Nicht<br />
alle Eltern haben allerdings einen so hohen <strong>Betreuung</strong>sbedarf. Insofern müssen auch<br />
andere Angebote wie Mittagstische wählbar sein.<br />
VTS Bedürfnis von Eltern mit hohem <strong>Betreuung</strong>sbedarf: Aus der Sicht der Eltern bieten<br />
Tagesschulen sinnvolle ganzheitliche <strong>und</strong> verlässliche Tagesbetreuungsstrukturen an,<br />
welche den <strong>Betreuung</strong>sbedarf während der Schulzeit annähernd optimal abdecken.<br />
Einzig, dass Tagesschulen ihre Türen in den Schulferien schliessen, wird von Eltern<br />
immer wieder als Problem wahrgenommen. Hier besteht Lösungsbedarf.<br />
Ferner entstehen beim gegenwärtigen Tagesschulenangebot in Basel-Stadt einerseits<br />
Probleme der Erreichbarkeit, weil nur zwei öffentliche Primartagesschulen für den<br />
ganzen Kanton bestehen, andererseits führt das unkoordinierte Angebot zu<br />
Übergangsproblemen. Um den <strong>Betreuung</strong>sbedarf zahlreicher Eltern abdecken zu<br />
können, wäre ein klares Konzept <strong>und</strong> Angebot vom Kindergarten bis in die<br />
Orientierungsstufe notwendig. Weiter ist wünschbar, dass Tagesschulen in den<br />
Quartieren angeboten werden, damit die Kinder den Kontakt zu ihrem Quartier nicht<br />
verlieren <strong>und</strong> insbesondere jüngern Kinder keine weiten Schulwege zugemutet werden<br />
müssen.<br />
Elternbeiträge: In Bezug auf die Kosten sind die Vertreterinnen des VTS der Meinung,<br />
dass die Elternbeiträge neu berechnet werden müssten: Der Maximalbeitrag von Fr.<br />
32.50 pro Tag darf nicht erhöht werden, sollte aber nicht bereits bei einem Brutto-<br />
Monatseinkommen von ca. Fr. 8000.– erreicht werden. Eine neue Skalierung mit tieferen<br />
Beiträgen für tiefere Einkommen ist deshalb notwendig. Wichtig ist zudem, dass die<br />
Elternbeiträge für alle <strong>Betreuung</strong>sangebote auf dem gleichen, transparenten Raster<br />
beruhen. In Tagesheimen müssten diese demzufolge nach unten korrigiert werden. Nur<br />
so kann die Forderung der Chancengleichheit <strong>und</strong> Integration wirklich erfüllt <strong>und</strong> eine<br />
gute Durchmischung in den einzelnen Angeboten gewährleistet werden.<br />
Zusammenfassender Kommentar<br />
Ein vielfältiges Angebot, das entsprechend den Bedürfnissen gewählt werden kann, wird<br />
gewünscht. Eltern sind weiter auf verlässliche Strukturen während des ganzen Jahres<br />
angewiesen, d.h. auch während der Schulferien. Hier wird ein grosser Bedarf nachgewiesen.<br />
Ferner ist nach Auffassung der Befragten eine bessere Informationspolitik <strong>und</strong> Transparenz<br />
bezüglich der Angebote nötig. Bei der Wahl von Angeboten stellt die Kostenfrage weiter eine<br />
wesentliche Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage dar. Erwünscht wird eine einheitliche, transparente <strong>und</strong><br />
subventionierte Kostenberechnung.<br />
Die Befragung zeigt schliesslich, dass zwischen den Erwartungen an <strong>Betreuung</strong>sstrukturen<br />
der Eltern <strong>und</strong> jenen der Fachpersonen potentiell Unterschiede bestehen. Eltern scheinen die<br />
Frage nach der Integration <strong>und</strong> Chancengleichheit weniger zentral zu gewichten, bei ihnen<br />
steht die gesicherte <strong>und</strong> möglichst durchgehende familienergänzende <strong>Betreuung</strong> während<br />
ihrer Abwesenheit im Zentrum (Verantwortungsabgabe; siehe auch unter Frage 1). Bei den<br />
Fachpersonen steht die integrative Leistung von Angeboten stärker im Zentrum. In dieser<br />
unterschiedlichen Schwerpunktsetzung <strong>und</strong> Bewertungsgr<strong>und</strong>lage liegt ein<br />
Spannungsverhältnis, das Potential für Missverständnis <strong>und</strong> Fehlplanung enthält. Weiter<br />
zeigen sich darin auch Grenzen des Integrationsgedankens. Wird dieser von Elternseite nicht<br />
ebenso wahrgenommen, wird die Kostenfrage immer primäre Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage<br />
bleiben, während die Qualität sek<strong>und</strong>är bleibt. Hier wird von Seiten der Fachpersonen der<br />
Bedarf nach Elternarbeit wahrgenommen.<br />
69
10.2.3 Frage 3: Welches Gesamtmodell wird befürwortet?<br />
Die bestehenden schul- bzw. familienergänzenden Tagesstrukturen (sfeTS) sind so<br />
eingerichtet, dass sie fakultativ wählbar sind. Bei Tagesschulen sind Tagesstrukturen für<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ein integrierter, obligatorisch gewählter Bestandteil des<br />
Schulprogramms. Mittagstische, Clubs, Horte <strong>und</strong> weitere Angebote mit<br />
Tagesstrukturanteilen ergänzen die Schule in der Wahrnehmung ihres Kerngeschäfts. Diese<br />
à la carte wählbaren Angebote können in <strong>und</strong> von Schulen selber organisiert sein. Oder sie<br />
werden im Auftrag von Schulen im oder ausserhalb des Schulhauses durchgeführt. Oder sie<br />
werden von nichtschulischen Trägerschaften im oder ausserhalb vom Schulhaus geführt,<br />
unverbindlich additiv zu Schulen oder kooperativ mit Schulen vernetzt.<br />
Mit welcher Form der Zuordnung schulergänzender Tagesstrukturen kann aus Ihrer Sicht die<br />
grösstmögliche <strong>Bildung</strong>swirkung erreicht werden? Mit welcher Variante kann das<br />
Platzangebot optimal auf den Bedarf nach familienergänzenden Tagesstrukturen abgestimmt<br />
werden? Welche<br />
Form beurteilen Sie als für die Schulen realisierbar?<br />
ATB/UK Stufen- <strong>und</strong> betreuungsbedarfsgerechtes Gesamtangebot: Für PrimarschülerInnen mit<br />
einem vollzeitigen Bedarf nach <strong>Betreuung</strong> (von 7.00 bis 18.00 Uhr) müssten<br />
Tagesschulen ergänzt mit Ferienangeboten bestehen.<br />
Für Primarschulkinder mit einem schulergänzenden <strong>Betreuung</strong>sbedarf von drei bis fünf<br />
Nachmittagen sind unterschiedliche Angebote denkbar: Kinder, welche bereits im<br />
Vorschulalter ein Tagesheim besuchten, sollten die Möglichkeit haben, in diesem<br />
vertrauten Umfeld weiterbetreut zu werden.<br />
Andererseits könnte für SchülerInnen der Primar- <strong>und</strong> der Orientierungsschule mit<br />
einem <strong>Betreuung</strong>sbedarf von drei bis fünf Nachmittagen ein modifiziertes<br />
Tagesschulangebot in klassenübergreifenden Gruppen mit verbindlicher <strong>Betreuung</strong><br />
nach den Unterrichtszeiten bestehen. Dabei müsste die Aufgabenhilfe ein integraler<br />
Bestandteil sein. Die Kommunikation zwischen Lehrkräften <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>spersonal<br />
muss klar geregelt <strong>und</strong> möglichst regelmässig stattfinden.<br />
Für Kinder mit einem relativ geringen Anteil an Tagesbetreuung (bis max. zwei<br />
Nachmittage) reichen in der Regel Mittagstische mit anschliessenden A-la-carte-<br />
Angeboten (ähnlich wie das Angebot der Spiel- <strong>und</strong> Bastelhorte).<br />
Mit der geplanten Einführung der Fünftagewoche auf der Orientierungsstufe würde die<br />
Mittagszeit auf 1,5 St<strong>und</strong>en schrumpfen. Die Verpflegung über Mittag <strong>und</strong> die<br />
zusätzliche <strong>Betreuung</strong> könnte damit im Verantwortungsbereich der Schule gesehen<br />
werden. Generell wäre eine umfassendes Schulangebot von 7.40 Uhr bis 16.00 Uhr mit<br />
Aufgabenhilfe in Freist<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Mittagsverpflegung sinnvoll.<br />
Verzahnung von Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> als Schulprogramm: In einem eng<br />
verzahnten Angebot „Schule als Erlebnisraum“ werden Chancen zur Verbesserung des<br />
Lernorts Schule gesehen. Danach helfen Kontakte <strong>und</strong> Interessen sowie<br />
Verbindlichkeiten über den Unterricht hinaus, das Lernklima positiv zu unterstützen.<br />
Finanzierung <strong>und</strong> Mittelsteuerung: Die Elternbeitragsbemessung müsste vereinheitlicht<br />
werden, d.h. gleiche Ansätze für Tagesheime <strong>und</strong> Tagesschulen. Weiter ist zu<br />
berücksichtigen, dass die Kosten für die Eltern eine wichtige Beurteilungsgr<strong>und</strong>lage<br />
darstellen. Gr<strong>und</strong>sätzlich muss die Mittelsteuerung zu gezieltem Einsatz von<br />
Ressourcen beitragen (Qualität nur, wo es sie braucht!).<br />
Qualifiziertes Personal: Regelmässige Angebote im Bereich der Kinderbetreuung<br />
erfordern qualifiziertes <strong>Betreuung</strong>spersonal.<br />
70
AKJS, AJFP,<br />
SPD<br />
Differenziertes Angebot, nach Bedürfnis wählbar: Wünschenswert ist ein differenziertes<br />
Angebot für verschiedene Interessen (K<strong>und</strong>enorientierung). Die Beziehungsqualität<br />
sowie die Konstanz sind dabei wesentlich.<br />
Ferienangebote: Bisher ist die <strong>Betreuung</strong> während der Ferien kaum geklärt. Die<br />
Schulferien sind ein Vielfaches länger als Ferien von Erwerbstätigen. Ein umfassendes<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebot muss auch während der schulfreien Zeit Angebote bereithalten.<br />
Gegenwärtig wird mit Ausnahme der Tagesheime von keinem Angebot eine<br />
Ferienalternative angeboten. Hier ist Handlungsbedarf sichtbar.<br />
Elternarbeit: Es ist darauf zu achten, dass die Verantwortung der Erziehung bei den<br />
Eltern bleibt <strong>und</strong> diese auch wahrgenommen werden kann. Insofern stellt die<br />
Elternarbeit eine wichtige flankierende Massnahme dar.<br />
Funktion des Erziehungsdepartements: Vom Erziehungsdepartement wird die<br />
prospektive gesamtkantonale Koordination <strong>und</strong> Entwicklung der Tagesstrukturen<br />
erwartet (Raumplanung, Ressourcenplanung, Kostentransparenz,<br />
Programmgestaltung). Bestehende Angebote sollen evaluiert, begleitet <strong>und</strong> entwickelt<br />
werden. Weiter sollen die bestehenden Angebote koordiniert werden (einheitliche<br />
Kosten, Anstellungsbedingungen, Ressourcen etc.). Die Kooperation mit andern<br />
bestehenden Institutionen ist dringend nötig, um bestehende Ressourcen nutzen zu<br />
können. Auch Selbsthilfemodelle (Tagesmütter) sollen gefördert werden. Es kann nicht<br />
darum gehen, immer wieder neue Institutionen zu schaffen.<br />
Bestehende Angebote beispielsweise im Bereich Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutz sowie der<br />
Prävention sollen nicht konkurrenziert werden (keine Funktionalisierung der<br />
Freizeitarbeit für schulische Zwecke). Schul- <strong>und</strong> familienergänzende Strukturen<br />
übernehmen die Funktion der familiären <strong>Betreuung</strong> für eine bestimmte Zeit. Ziel ist die<br />
ganzheitliche konstante <strong>und</strong> verlässliche <strong>Betreuung</strong> der Kinder. Kinder- <strong>und</strong><br />
Jugendarbeit verfolgt andere Ziele (Fähigkeiten kennen lernen, ausserschulisches<br />
soziales Lernen etc.) <strong>und</strong> eröffnet den Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen neue Räume. Es gilt<br />
die Grenzen zu andern Aufgabenbereichen zu definieren. Es besteht allerdings die<br />
Möglichkeit, die Angebote miteinander zu verbinden. Die Entwicklung eines<br />
Gesamtangebots an Tagesstrukturen erfordert insofern die Kooperation über das<br />
Departement hinaus.<br />
Die Schulen müssen sich den veränderten Bedingungen ebenfalls anpassen können<br />
<strong>und</strong> nicht die störenden Schulkinder aussondern. Dazu müssen die Schulkassen<br />
differenzierter zusammengesetzt <strong>und</strong> entsprechend den Belastungsfaktoren mit<br />
genügend <strong>Betreuung</strong>spersonal <strong>und</strong> Lehrerst<strong>und</strong>en versehen werden. Weiter Chancen<br />
werden in der Elternarbeit, der Unterstützung der Lehrpersonen <strong>und</strong> der Kooperation mit<br />
Helferorganisationen wie z.B. Schulsozialarbeit gesehen.<br />
AGI Klares subventioniertes Angebot: Gr<strong>und</strong>sätzlich betonen die Vertreterinnen <strong>und</strong><br />
Vertreter der AGI, dass eine Förderung der Chancengleichheit über Sprachförderung<br />
<strong>und</strong> kulturelle Einbindung nur über ein pädagogisch klares Tagesbetreuungsangebot<br />
möglich ist, welches sich dadurch auszeichnet, dass eine enge Verzahnung zwischen<br />
Tagesbetreuung <strong>und</strong> Schule besteht, das Verbindlichkeit, Kontinuität sowie den<br />
ganzheitlichen Umgang mit den Kindern ermöglicht. Ein weiterer Schwerpunkt muss in<br />
der Professionalität der Sprachförderung gesehen werden. Untersuchungen sollen<br />
zeigen, durch welche Rahmenbedingungen das Ziel der Chancengleichheit optimal<br />
gefördert werden kann.<br />
Weiter wird deutlich, dass das ganztägige <strong>und</strong> ganzheitliche <strong>Betreuung</strong>sangebot<br />
insbesondere bei Primarschülern <strong>und</strong> jüngern Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern der<br />
Orientierungsschule (höchstens bis zur 6. Klasse) ein wichtiges Angebot darstellt.<br />
Sinnvoll sind in diesem Zusammenhang sicher Tagesschulen auf der Primarstufe.<br />
Denkbar ist auch eine Kombination von Halbtagesheimen (-horten), welche in engem<br />
Kontakt mit der Schule stehen. Wenig sinnvoll – im Hinblick auf Sprachförderung – sind<br />
zahlreiche unkoordinierte Angebotstypen (Schule, Mittagstisch, Nachbarin,<br />
Freizeitangebot, Strasse etc.) mit je andern <strong>Betreuung</strong>spersonen. Weiter wird angeregt,<br />
bereits auf der Kindergartenstufe anzusetzen <strong>und</strong> allenfalls Tageskindergärten<br />
71
anzubieten. Forschung auf dieser Altersstufe ist sehr wichtig.<br />
Die Erfahrungen zeigen ferner, dass Jugendliche mit zunehmendem Alter weniger in<br />
umfassende Angebote eingeb<strong>und</strong>en werden wollen (zu viel Nähe führt zu Konflikten,<br />
Bedürfnis nach Abgrenzung). Sie brauchen zwar ebenso Verpflegungsangebote, evtl.<br />
auch Lern- <strong>und</strong> Aufgabenunterstützung, die Angebote müssen aber nicht mehr in einem<br />
einheitlichen Angebot <strong>und</strong> ganztägig sein.<br />
Die AGI würde je eine Tagesschule oder Tagesbetreuungsstruktur auf der<br />
Primarschulstufe in jedem Schulkreis begrüssen. Da Tagesstrukturen immer Gefahr<br />
laufen, dass eine Häufung von Kindern mit sozialer <strong>und</strong> persönlicher Indikation den<br />
Schulalltag letztlich so erschweren, dass das Gr<strong>und</strong>konzept nicht realisiert werden kann,<br />
ist es aus Sicht der AGI sinnvoll, klare Kriterien zu definieren, welche Kinder <strong>und</strong> wie<br />
viele aufgenommen werden können, um eine optimale soziale Durchmischung<br />
gewährleisten zu können. Dies bedeutet aber auch, dass eine bestimmte Anzahl an<br />
Angeboten vorhanden sein muss.<br />
Information, Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen (Elternarbeit), einheitliche<br />
Politik bezüglich Kosten <strong>und</strong> Subvention (nicht zu hohe Elternbeiträge) <strong>und</strong> mehr<br />
gemischte Angebote sowohl für Fremdsprachige wie Sprachk<strong>und</strong>ige.<br />
GEROS Angebote im Gesamtkonzept: Eltern begrüssen ein Gesamtangebot, das<br />
unterschiedliche Bausteine für unterschiedliche Bedürfnisse anbietet. Für jüngere Kinder<br />
<strong>und</strong> Kinder mit hohem <strong>Betreuung</strong>sbedarf werden ganzheitlichere <strong>und</strong> umfassende<br />
Angebote erwünscht. Auf der Orientierungsstufe müssten zumindest Mittagstische <strong>und</strong><br />
allenfalls Hausaufgabenbetreuung im Angebot stehen. Weiter wünschen sich Eltern,<br />
dass die Jugendlichen im Schulhaus mehr Raum zur Verfügung haben, wo sie sich<br />
zwischen <strong>und</strong> nach der Schule aufzuhalten können. Wünschenswert wäre, wenn sich<br />
die SchülerInnen mindestens bis 16.00 Uhr in der Schule aufhalten könnten<br />
(niederschwellige Formen der <strong>Betreuung</strong> in der Schule wie z.B. der Schülerclub). Die<br />
bestehenden Angebote müssten auf ihre Tauglichkeit überprüft <strong>und</strong> allenfalls an die<br />
neuen Bedürfnisse angepasst werden.<br />
PV<br />
Ferienangebote: Weiter wird ein dringender Bedarf für <strong>Betreuung</strong>sangebote während<br />
der Ferien ausgemacht. Denkbar ist, dass einige Angebote bestehen, welche<br />
überregional besucht werden könnten.<br />
Aufgaben des Erziehungsdepartements: Im Hinblick auf ein Gesamtkonzept wird von<br />
Seiten des Erziehungsdepartements eine klare Steuerung der Angebote<br />
(Informationspolitik, Übersicht über die Angebote, deren Kosten) erwartet. Die Eltern<br />
müssten rechtzeitig über die Angebote in den Quartieren oder Schulkreisen informiert<br />
werden.<br />
Nach Ansicht der VertreterInnen der Personalverbände ist die Schaffung von<br />
Tagesstrukturen Aufgabe des Staats, der Wirtschaft <strong>und</strong> der Familien. Tagesstrukturen<br />
müssen wählbar sein. Insbesondere auf der Primarstufe müssen diese ganzheitlich <strong>und</strong><br />
umfassend <strong>und</strong> eng mit der Schule verzahnt sein („aus einem Guss“). Für<br />
OrientierungsschülerInnen müssen Mittagstische <strong>und</strong> Aufenthaltsräume zur Verfügung<br />
stehen. Ein schrittweiser Ausbau der Tagesschulen <strong>und</strong> der Tagesstrukturen an<br />
Schulen wird als sinnvoll erachtet.<br />
Insgesamt müsste Lernen <strong>und</strong> Lebensförderung in einem Konzept schrittweise im<br />
Schulkontext verankert werden. Schule muss mit der dauerhaften <strong>Betreuung</strong> der<br />
SchülerInnen zu einem Lebensraum werden.<br />
Dazu sind qualifiziertes Personal <strong>und</strong> Hilfskräfte unterschiedlicher Professionen nötig.<br />
Die Kooperation soll zur Entlastung <strong>und</strong> nicht Belastung des Personals führen. Klärung<br />
<strong>und</strong> Abgrenzung der Aufgaben <strong>und</strong> Zuständigkeiten sowie Kooperationskonzepte sollen<br />
die Kooperation im schulischen Umfeld ermöglichen. Aus personalpolitischer Sicht<br />
bestehen noch zahlreiche Unklarheiten <strong>und</strong> Spannungsfelder in Bezug auf die Löhne.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich müssen Überlegungen angestellt werden bezüglich der Entlöhnung des<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonals <strong>und</strong> der Lehrkräfte (unterschiedliche Lohnklassen,<br />
72
unterschiedliche Arbeitsbedingungen). Weiter sollen keine ehrenamtlichen Personen<br />
eingesetzt werden. Alle Arbeiten sollen entlöhnt werden.<br />
VTS Angebote im Gesamtkonzept: Die Frage, ob Mittagstisch, SchülerInnenclub,<br />
Tageseltern, Tagesheime oder Tagesschulen das Gelbe vom Ei seien, stellt sich für den<br />
Verein Tagesschulen nicht. Nach Auffassung des Vereins kann nur ein vielfältiges<br />
Angebot den unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern <strong>und</strong> Kinder gerecht werden.<br />
Aufgabe des Erziehungsdepartements: Ein klares Konzept, das die Steuerung,<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Koordination der Angebote regelt, wird von Seiten des<br />
Erziehungsdepartements erwartet. Folgende Aspekte müssten gemäss der<br />
Vertreterinnen des VTS weiter geklärt werden können:<br />
Informationspolitik: Eine einheitliche, transparente Informationspolitik von Seiten des<br />
Erziehungsdepartements wird als wichtig erachtet.<br />
Kostenschlüssel: Ebenso wie die klare Regelung der Elternbeiträge ist eine Klärung in<br />
Bezug auf die Kostenberechnungsgr<strong>und</strong>lagen notwendig (Kostenschlüssel für alle<br />
Angebote vergleichbar).<br />
Elternbeiträge: Eine einheitliche <strong>und</strong> transparente Regelung für alle staatlichen <strong>und</strong><br />
staatlich subventionierten Tagesbetreuungsangebote ist nötig. Für das zweite <strong>und</strong> jedes<br />
weitere Kind einer Familie, welches eine Tagesbetreuungsinstitution besucht, soll<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich weniger bezahlt werden müssen als für das erste Kind. Gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
dürfen die Elternbeiträge nicht erhöht werden.<br />
Berücksichtigung von Geschwistern: Besucht ein Kind ein bestimmtes<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebot, sollten weitere Kinder der gleichen Familie bei der Vergabe von<br />
Plätzen in dieser Institution prioritär berücksichtigt werden, ebenso sollen Kinder bei<br />
Folgeeinrichtungen berücksichtigt werden. Dadurch kann einerseits die Koordination<br />
innerhalb der Familie besser unterstützt werden <strong>und</strong> andererseits den einzelnen Kindern<br />
ein sinnvolles Angebot über alle Stufen garantiert werden.<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebote während der Ferien: Alle schulnahen <strong>und</strong> schulinternen<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebote haben den Mangel, dass die <strong>Betreuung</strong> während der Schulferien<br />
nicht garantiert werden kann. Es besteht ein hoher Bedarf an neuen<br />
Ferienbetreuungsangeboten, welche unterschiedlichen <strong>Betreuung</strong>sbedarf abdecken.<br />
Weiter müssten bestehende Angebote besser <strong>und</strong> frühzeitig kommuniziert werden,<br />
damit eine Planung möglich ist. Hier wäre eine Kooperation der zuständigen<br />
Abteilungen im Erziehungsdepartement, aber auch im Sozialdepartement bzw.<br />
Justizdepartement sicher wichtig.<br />
Ausbau des Tagesschulangebotes: Innerhalb des Gesamtangebots an<br />
Tagesbetreuungsstrukturen ist nach Auffassung des Vereins Tagesschulen auch ein<br />
Ausbau der Tagesschulen nötig.<br />
Dazu müssten Tagesschulen endlich vom Provisorium zum Definitivum wechseln<br />
können. Eine Verankerung im Schulgesetz wird als wichtig erachtet. Das<br />
Schattendasein bindet zu viele Energien <strong>und</strong> behindert die Entfaltung des Angebots. Die<br />
klare Anerkennung der Tagesschulen bildet die Gr<strong>und</strong>lage für die Qualität <strong>und</strong><br />
Entwicklung des Angebots. Tagesschulen entsprechen den öffentlichen Regelklassen<br />
<strong>und</strong> dürfen deshalb nicht mit zu vielen Kindern mit spezifischen Bedürfnissen <strong>und</strong><br />
Problemlagen überbeansprucht werden. Auch hier ist die Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong><br />
Steuerung notwendig.<br />
Bei einem Ausbau der Tagesschulen müssten diese einem eigenen Rektorat unterstellt<br />
werden können. Nur so können die Belange der Tagesschule umfänglich bearbeitet<br />
werden.<br />
Um die Bedürfnisse nach einer umfassenden Tagesbetreuungsstruktur mit klarem<br />
pädagogischem Ansatz abdecken zu können, müssen aus Sicht des Vereins die<br />
73
Tagesschulen ausgebaut werden. Als Vision formuliert der Verein folgende Ausbauform:<br />
7 Tagesschulstandorte für die Primarschule mit je einer Klasse pro Jahrgang. Dies<br />
schafft Plätze für ca. 700 Kinder (für ca. jedes achte Kind).<br />
4 Tagesschulstandorte für die Orientierungsstufe mit je einer Klasse pro Jahrgang. Dies<br />
schafft Plätze für ca. 300 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler (für ca. jedes dreizehnte Kind).<br />
Als Minimalvariante bzw. für den Beginn wäre nach Auffassung des Vereins<br />
Tagesschulen zumindest ein Angebot in jedem Schulkreis für alle Schulstufen (evtl.<br />
Halbklassen pro Jahrgang) einschliesslich der Orientierungsstufe <strong>und</strong> des Kindergartens<br />
zu schaffen.<br />
Zusammenfassender Kommentar<br />
Angebote im Gesamtmodell: Insgesamt wünschen die Befragten ein differenziertes<br />
Angebot (unterschiedliche Bausteine) für verschiedene Interessen (K<strong>und</strong>enorientierung).<br />
Erforderlich sind danach sowohl umfassende <strong>Betreuung</strong>sangebote (wie Tagesschulen oder<br />
Tagesheime/-horte) als auch niederschwellige Angebote (wie Aufgabenhilfen, st<strong>und</strong>enweise<br />
<strong>Betreuung</strong>, Mittagstisch). Gr<strong>und</strong>sätzlich soll gelten, je jünger die Kinder <strong>und</strong> je höher der<br />
<strong>Betreuung</strong>sbedarf, desto eher werden umfassende <strong>Betreuung</strong>sangebote befürwortet. Für<br />
PrimarschülerInnen mit geringem Bedarf sowie OrientierungsschülerInnen können<br />
Mittagstische in Kombination mit Aufgabenhilfen oder einzelnen Nachmittagsangeboten<br />
durchaus reichen. Weitere Kriterien für integrative Angebote wurden bereits weiter oben<br />
beschrieben. Generell gilt aber, dass Beziehungsqualität <strong>und</strong> Konstanz eine wichtige<br />
Gr<strong>und</strong>lage für alle Angebote darstellt. Weiter wird eine <strong>Betreuung</strong> bis mindestens 16.00 Uhr,<br />
evtl. eher länger, als wichtig eingeschätzt. Und schliesslich müsste im Rahmen des<br />
Gesamtkonzepts ein alternatives Angebot für die Ferien bereitgestellt werden.<br />
Von einzelnen Fachpersonen würde in einem weitern Schritt eine Entwicklung der Schule hin<br />
zu einer „Schule als Lebensraum“ befürwortet. In der engen Verzahnung von Unterricht <strong>und</strong><br />
weitern Erfahrungsräumen werden wichtige Gr<strong>und</strong>lagen für eine förderliche Lernumwelt<br />
gesehen.<br />
Funktion des Erziehungsdepartements: Vom Erziehungsdepartement wird die prospektive<br />
gesamtkantonale Koordination <strong>und</strong> Entwicklung der Tagesstrukturen erwartet, dazu gehören<br />
folgende Leistungen:<br />
• Ressourcenplanung <strong>und</strong> -steuerung<br />
• Kostentransparenz <strong>und</strong> Vereinheitlichung der Elternbeiträge <strong>und</strong> Subventionsbeiträge (Kosten<br />
sollen kein Hinderungsgr<strong>und</strong> sein)<br />
• Raumplanung<br />
• prospektive Programmgestaltung <strong>und</strong> -entwicklung <strong>und</strong> Evaluation<br />
• Festlegen von Qualitätskriterien für Personal, Koordination der Anstellungsbedingungen<br />
(Sozialleistungen, Versicherungen, Löhne etc.)<br />
• Unterstützung der Kooperation mit bestehenden Institutionen<br />
• Selbsthilfemodelle (Tagesmütter) sollen weiter gefördert werden <strong>und</strong> ehrenamtliche<br />
Leistungen weiter willkommen sein<br />
• Information <strong>und</strong> Steuerung der Angebote<br />
• Elternarbeit<br />
• Bereitstellen einer genügend grossen Anzahl von <strong>Betreuung</strong>splätzen, damit eine ges<strong>und</strong>e<br />
soziale Durchmischung in den einzelnen Angeboten möglich bleibt<br />
74
• Einbezug von Migrantenorganisationen bei der Planung von Angeboten<br />
• Kooperation zwischen Lehrpersonen <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>spersonen muss intensiv begleitet <strong>und</strong><br />
entwickelt werden<br />
Insbesondere die Kooperation mit andern Angeboten <strong>und</strong> Trägerschaften macht auch klare<br />
Abgrenzungen zwischen Freizeit- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>sangeboten erforderlich. Die Entwicklung<br />
eines Gesamtangebots an Tagesstrukturen erfordert insofern die Kooperation innerhalb des<br />
Erziehungsdepartements <strong>und</strong> darüber hinaus.<br />
75
11 Verteilung der Angebote auf die Teilregionen im Kanton Basel-<br />
Stadt<br />
Nr. Teilräume mit<br />
PLZ<br />
1 St. Johann<br />
4025<br />
4031<br />
4056<br />
2 Grossbasel<br />
Zentrum-West<br />
4001<br />
4009<br />
4051<br />
4054<br />
4055<br />
3 Grossbasel Süd<br />
4053<br />
4059<br />
4 Grossbasel Ost<br />
4052<br />
5 Unteres<br />
Kleinbasel<br />
4019<br />
4057<br />
6 Kleinbasel<br />
Süd-Ost<br />
4058<br />
7 Riehen/Bettingen<br />
4125<br />
4126<br />
dazu gehörende<br />
Gebiete<br />
St. Johann<br />
Bachletten<br />
Gotthelf<br />
Iselin<br />
Am Ring Altstadt<br />
Vorstädte<br />
G<strong>und</strong>eldingen<br />
Bruderholz<br />
Breite<br />
St. Alban<br />
Clara<br />
Matthäus<br />
Klybeck<br />
Kleinhüningen<br />
Altstadt KB<br />
Wettstein<br />
Hirzbrunnen<br />
Rosental<br />
Riehen<br />
Bettingen<br />
<strong>Betreuung</strong>sangebot in den Teilräumen Plätze<br />
2002/03<br />
keine Tagesschulen oder Schulen mit Tagesstruktur<br />
Mittagstisch St. Johann<br />
Schülerclub St. Johann (durchschnitt pro Tag)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
Tagesschule für Kleinklasse Primar (TS/KKL/PS),<br />
Bachgraben<br />
Schule mit Tagesbetreuung für Orientierungsstufe<br />
(STS/OS), Wasgenring<br />
bisher kein Mittagstisch (2 Mittagstische in Planung)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
keine Tagesschule oder Schule mit Tagesstruktur<br />
Mittagtisch Bruderholz-Titus<br />
Mittagstisch G<strong>und</strong>eldingerfeld<br />
Mittagstisch Brunnmatt (OS)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
Tagesschule für Kleinklassen der Orientierungsstufe<br />
(TS/OS/KKL), Gellert ab 2003/04<br />
Schule mit Tagesbetreuung für die Orientierungsstufe<br />
(STS/OS), Gellert<br />
bisher kein Mittagstisch (2 Mittagstische in Planung)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
Tagesschule Regelklasse Primarschule (TS/PS),<br />
Kleinhüningen<br />
Schule mit Tagesstruktur Heilpädagogische Schule<br />
(STS/HPS)<br />
Mittagstisch Kleinbasel St. Joseph<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
Tagesschule Kleinklasse Primarschule (TS/PS/KKL),<br />
Richter-Linder<br />
Tagesschule Kleinklasse Orientierungsstufe<br />
(TS/OS/KKL), Wettstein ab 2003/04<br />
bisher kein Mittagstisch (2 Mittagstische in Planung)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
Tagesschule Regelklasse Primarschule (TS/PS),<br />
Niederholz<br />
Tagesschule Regelklasse Orientierungsschule (TS/OS),<br />
Hebel<br />
Tagesschule Regelklasse Orientierungsschule (TS/OS),<br />
Grendelmatten<br />
bisher kein Mittagstisch (1 Mittagstisch in Planung)<br />
Plätze in Tagesheimen/-familien<br />
(vgl. Unterteilung der Teilräumen Pulli et al., 2002)<br />
0<br />
30<br />
13<br />
90<br />
28<br />
18<br />
0<br />
80<br />
0<br />
40<br />
25<br />
12<br />
30<br />
21<br />
18<br />
0<br />
40<br />
50<br />
24<br />
50<br />
70<br />
24<br />
21<br />
0<br />
20<br />
50<br />
15<br />
15<br />
0<br />
20<br />
76
Anzahl Plätze<br />
Verteilung der Angebotstypen auf kantonale<br />
Teilräume, 2002/03<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
St. Johann<br />
Grossbasel<br />
Zentrum-<br />
West<br />
Grossbasel<br />
Süd<br />
Grossbasel<br />
Ost<br />
Unteres<br />
Kleinbasel<br />
Kleinbasel<br />
Süd-Ost<br />
1 TS/STB 0 46 0 39 74 45 80<br />
2 MT 30 0 77 0 50 0 0<br />
3 Schülerclub 13 0 0 0 0 0 0<br />
4 Tagesheim,-familie 90 80 30 40 70 20 20<br />
1 TS/STB 2 MT 3 Schülerclub 4 Tagesheim,-familie<br />
Riehen/<br />
Bettingen<br />
77
11.1 ÜBERSICHTSKARTE ZUR REGIONALEN VERTEILUNG DER MITTAGSTISCHE<br />
MITTAGSTISCHE<br />
AB SCHULJAHR 2002/03<br />
1 MITTAGSTISCH KLEINBASEL St. JOSEPH<br />
ORT: KIRCHE ST. JOSEPH<br />
AMERBACHSTR. 9 / 4057 BASEL<br />
2 MITTAGSTISCH KINDERZMITTAG ST. JOHANN<br />
ORT: STADTMISSION / MARTIN LUTHER KING HAUS<br />
VOGESENSTR. 28 / 4056 BASEL<br />
3 MITTAGSTISCH GUNDELDINGER FELD<br />
ORT: SPIELFELD GUNDELDINGER FELD<br />
DORNACHERSTR. 192 / 4053 BASEL<br />
4 MITTAGSTISCH BRUNNMATT<br />
ORT: SCHULHAUS / OS BRUNNMATT<br />
INGELSTEINWEG 6 / 4053 BASEL<br />
5 MITTAGSTISCH BRUDERHOLZ<br />
ORT: KIRCHEN TITUS & BRUDER KLAUS<br />
BRUDERHOLZ / 4051 & 4059 BASEL<br />
2<br />
1<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Quelle: U. Keller; 2003<br />
79
11.2 TAGESSCHULEN UND SCHULEN MIT EIGENEM BETREUUNGSANGEBOT<br />
AB SCHULJAHR 2003/2004<br />
11 HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE ACKERMÄTTELI MIT HORT<br />
ORT: RASTATTERSTR. 32 / 4057 BASEL<br />
10 OS MIT TAGESBETREUUNG GELLERT<br />
ORT: EMAUNEL BÜCHEL STR. 15 / 4052 BASEL<br />
9 OS MIT TAGESBETREUUNG WASGENRING<br />
ORT: WELSCHMATTSTR. 30 / 4055 BASEL<br />
8 TAGESSCHULE KKL OS WETTSTEIN<br />
ORT: HAMMERSTRASSE 27 / 4058 BASEL<br />
7 TAGESSCHULE KKL OS GELLERT<br />
ORT: EMANUEL BÜCHEL STR. 15 / 4052 BASEL<br />
6 TAGESSCHULE KKL PRIMAR BACHGRABEN<br />
ORT: HEGENHEIMERMATTWEG 202 / 4123 ALLSCHWIL<br />
5 TAGESSCHULE KKL PRIMAR RICHTER LINDER<br />
ORT: HAMMERSTRASSE 27 / 4058 BASEL<br />
6<br />
9<br />
5<br />
2<br />
11<br />
8<br />
7<br />
10<br />
1<br />
4<br />
3<br />
1 TAGESSCHULE PRIMAR NIEDERHOLZ<br />
ORT: NIEDERHOLZSTRASSE 95 / 4125 RIEHEN<br />
2 TAGESSCHULE PRIMAR KLEINHÜNINGEN<br />
ORT: DORFSTRASSE 51 / 4057 BASEL<br />
3 TAGESSCHULE OS GRENDELMATTEN<br />
ORT: ÄUSSERE BASELSTRASSE 192 / 4125 RIEHEN<br />
Quelle: U.Keller, 2003<br />
80
12 Leitfragen: Qualitative Befragung der einzelnen Angebote<br />
Fragenschwerpunkte 1. Teil<br />
• Zielpublikum, NutzerInnen, Belegzahlen<br />
• <strong>Betreuung</strong><br />
• Verpflegung<br />
• Zusammenarbeit mit Schule (Schule <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>)<br />
• Zusammenarbeit mit Eltern<br />
• Personal<br />
• Infrastruktur, insbesondere Raumbedarf<br />
• Entwicklungspotential<br />
Ziel:<br />
a) Angebot charakterisieren,<br />
b) spezifische Leistung im Vergleich zu andern Tagesbetreuungsangeboten,<br />
c) Ermittlung von Chancen, Herausforderungen<br />
d) Entwicklungspotential<br />
Fragenschwerpunkte 2. Teil<br />
• Gesamtkonzept: Stellenwert <strong>und</strong> Positionierung innerhalb eines Gesamtkonzepts<br />
• Angebotspalette<br />
• Organisatorische Zuordnung<br />
• Funktion des Erziehungsdepartements<br />
Ziel:<br />
a) Gedanken zum Gesamtmodell<br />
81
13 Leitfragen zur Befragung der Fach- <strong>und</strong> Interessengruppen<br />
Fragen A<br />
Die Vorlage zum Tagesbetreuungsgesetz ist von der Regierung an den Grossen Rat<br />
überwiesen worden. Ein erstes Ziel von Tagesbetreuung lautet sinngemäss: Tagesstrukturen<br />
fördern Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in ihrer Entwicklung von Gr<strong>und</strong>kompetenzen <strong>und</strong><br />
verbessern ihre Integration <strong>und</strong> ihre Chancengleichheit.<br />
Im Anhang finden Sie einen Überblick der bestehenden Angebote an schulergänzenden<br />
Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler: Inwiefern fördert dieses Angebot aus Ihrer<br />
Sicht die Entwicklung von Gr<strong>und</strong>kompetenzen sowie die Integration <strong>und</strong> die<br />
Chancengleichheit unserer Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler? Mit welcher Angebotspalette <strong>und</strong> zu<br />
welchen Bedingungen können mit den gegebenen Ressourcen am meisten Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler gefördert werden?<br />
Fragen B<br />
Entsprechend einer zweiten Zielsetzung ermöglichen Tagesstrukturen „Eltern Erwerbsarbeit,<br />
den Erhalt <strong>und</strong> die Verbesserung ihrer beruflichen Qualifikation sowie die Wahrnehmung von<br />
Aufgaben im sozialen <strong>und</strong> öffentlichen Bereich, <strong>und</strong> den Arbeitgebenden die Gewinnung <strong>und</strong><br />
Erhaltung von Arbeitskräften mit Erziehungspflichten“.<br />
Inwiefern entsprechen die im Anhang dargestellten Angebote aus Ihrer Sicht der Nachfrage<br />
nach familienergänzenden Tagesstrukturen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler? Mit welcher<br />
Angebotspalette <strong>und</strong> zu welchen Bedingungen können im Rahmen der gegebenen<br />
Ressourcen am meisten Eltern <strong>und</strong> Arbeitgebende von Tagesstrukturen profitieren?<br />
Frage C<br />
Die bestehenden schul- bzw. familienergänzenden Tagesstrukturen (sfeTS) sind so<br />
eingerichtet, dass sie fakultativ wählbar sind. Bei Tagesschulen sind Tagesstrukturen für<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ein integrierter, obligatorisch gewählter Bestandteil des<br />
Schulprogramms. Mittagstische, Clubs, Horte <strong>und</strong> weitere Angebote mit<br />
Tagesstrukturanteilen ergänzen die Schule in der Wahrnehmung ihres Kerngeschäfts. Diese<br />
à la carte wählbaren Angebote können in <strong>und</strong> von Schulen selber organisiert sein. Oder sie<br />
werden im Auftrag von Schulen im oder ausserhalb des Schulhauses durchgeführt. Oder sie<br />
werden von nichtschulischen Trägerschaften im oder ausserhalb vom Schulhaus geführt,<br />
unverbindlich additiv zu Schulen oder kooperativ mit Schulen vernetzt.<br />
82
Unten finden Sie vier Organisationsvarianten: Mit welcher Form der Zuordnung<br />
schulergänzender Tagesstrukturen kann aus Ihrer Sicht die grösstmögliche <strong>Bildung</strong>swirkung<br />
erreicht werden? Mit welcher Variante kann das Platzangebot optimal auf den Bedarf nach<br />
familienergänzenden Tagesstrukturen abgestimmt werden? Welche Form beurteilen Sie als<br />
für die Schulen realisierbar?<br />
83
Teil 2: Vollkostenberechnungen der einzelnen Tagesbetreuungsangebote<br />
(Mirjam Schmidli)<br />
14 Vergleich der Angebotstypen aus ökonomischer Sicht<br />
15 Vorbemerkungen<br />
15.1.1 Situationsanalyse<br />
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine quantitative <strong>und</strong> qualitative Analyse<br />
der bestehenden Angebote an staatlich subventionierten familienergänzenden Tagesstrukturen<br />
für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler. Das nachfolgende Kapitel stellt die quantitative Seite der<br />
verschiedenen Angebote in den Vordergr<strong>und</strong>. Qualitative Aspekte wurden hier nur zum Teil<br />
berücksichtigt. Gr<strong>und</strong>sätzlich handelt es sich um eine Zusammenstellung der Vollkosten der<br />
verschiedenen schulergänzenden Angebote für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>und</strong> nicht um eine<br />
Kosten-Nutzen-Analyse. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die verschiedenen Angebote zu<br />
bewerten <strong>und</strong> Empfehlungen bezüglich der zu bevorzugenden Varianten abzugeben. Diese<br />
Gr<strong>und</strong>satzentscheidungen muss die Regierung fällen. Wir können hier nur aufzeigen, welche<br />
Angebote existieren, wie sie organisiert sind <strong>und</strong> welche Kosten sie verursachen.<br />
15.1.2 Modell<br />
Die ausgewiesenen Kosten für Tagesstrukturen sind die Kosten, die zusätzlich zu den<br />
Unterrichtskosten anfallen. Um diese zu eruieren, wurden alle Kosten, die im Rahmen des<br />
obligatorischen Unterrichts ohnehin anfallen, von den Gesamtkosten in Abzug gebracht. Die<br />
Unterrichtsräume sind deshalb – auch wenn sie mehrfach genutzt werden können - in den<br />
Gesamtkosten nicht berücksichtigt.<br />
15.1.3 Qualitätskennzahlen<br />
Um die ausgewiesenen Kosten in Relation zu einem wie auch immer gearteten Nutzen zu setzen,<br />
wurde eine Qualitätskennzahl entwickelt. Die Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en, die pro Kind pro Woche<br />
aufgewendet werden, zeigen den Aufwand der für die intensive oder extensive <strong>Betreuung</strong> zu<br />
leisten ist. Intensive <strong>Betreuung</strong> bedeutet, dass mehr Personal pro Zeiteinheit anwesend ist,<br />
extensive <strong>Betreuung</strong> drückt aus, dass die Öffnungszeiten ausgedehnt werden. Sowohl die eine<br />
als auch die andere Form von <strong>Betreuung</strong> bedeutet eine Dienstleistung am Kind, welche Kosten<br />
verursacht. Die Grösse „<strong>Betreuung</strong>sschlüssel“, das heisst die Anzahl Kinder pro betreuende<br />
Person, kann sich im Verlaufe des Tages sowie von Tag zu Tag ändern, sodass auf eine<br />
Durchschnittsgrösse zurückgegriffen werden muss. Die folgende Illustration (einer nicht Basel-<br />
84
städtischen Schule) zeigt auf, wie sich die Anzahl der Kinder <strong>und</strong> die Anzahl der Betreuer/innen<br />
im Tagesablauf ändert. Ebenfalls kann man ersehen, dass während der Unterrichtszeit am<br />
Vormittag die Nutzung der Räumlichkeiten <strong>und</strong> die Beschäftigung des <strong>Betreuung</strong>spersonals<br />
systembedingte Brüche aufweist. Räume stehen leer <strong>und</strong> Betreuer/innen sind mit anderen<br />
Aufgaben ausgefüllt.<br />
Anzahl St<strong>und</strong>en<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Verteilung Kinder <strong>und</strong> Betreuende im Tagesablauf<br />
7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18<br />
Tageszeit<br />
Kinder<br />
Betreuende<br />
In den Anwesenheitsst<strong>und</strong>en der <strong>Betreuung</strong>spersonen sind auch jene St<strong>und</strong>en enthalten, die für<br />
konzeptionelle Tätigkeiten, Vorbereitung für Animation (Basteln, Sport), Aufräumen,<br />
Sitzungsteilnahme, Erledigen von administrativen Aufgaben <strong>und</strong> Elternarbeit dienen. Auch diese<br />
vielfältigen Aufgaben beinhalten Dienstleistungen am Kind <strong>und</strong> werden deshalb in der<br />
Qualitätskennzahl berücksichtigt.<br />
Die <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro Woche (inkl. Zeitaufwand für ergänzende Aufgaben) können aus der<br />
Summe der Beschäftigungsgrade der Betreuerinnen <strong>und</strong> Betreuer berechnet werden, indem sie<br />
mit der Anzahl St<strong>und</strong>en pro Schulwoche multipliziert werden. Beispiel: Eine <strong>Betreuung</strong>sperson ist<br />
zu 60% beschäftigt. Bei einer Arbeitszeit von 42 Std. / Woche sind dies 6 Std. <strong>und</strong> 18 Min. pro<br />
Tag. Bei 12 Wochen Schulferien, in denen der Hort oder die Schule nicht geöffnet ist, kommt man<br />
mit diesem Beschäftigungsgrad auf 8 Std. Arbeitszeit pro Tag (Frei- <strong>und</strong> Feiertage sind<br />
eingerechnet). Die St<strong>und</strong>en, in denen Betreuer/innen anwesend sind, werden summiert <strong>und</strong> in<br />
Bezug gesetzt zu der Anzahl betreuter Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler. Die so ermittelte Kennzahl<br />
illustriert das Ausmass an <strong>Betreuung</strong>, die dem Kind direkt oder indirekt zugute kommt. Nicht<br />
enthalten in der Kennzahl sind Indikatoren, wie Fremdsprachigenanteil, Anteil Kinder mit sozialer<br />
85
Indikation <strong>und</strong> weiterer Faktoren, die einen Einfluss auf den <strong>Betreuung</strong>sbedarf haben könnten.<br />
Die Qualitätskennzahl kann aber – im Rahmen von weiterführenden Analysen - problemlos um<br />
diese Gewichtungsfaktoren erweitert werden.<br />
15.1.4 Raumkosten<br />
Im Kanton Basel-Stadt existiert bisher keine Umlage der effektiven Mietkosten der staatlichen<br />
Liegenschaften auf die Kostenträger. Die Raumkosten müssen deshalb kalkulatorisch ermittelt<br />
werden. Sie setzen sich folgendermassen zusammen:<br />
Kostenart Preis pro m2<br />
Möblierte Miete inkl. Heizkosten <strong>und</strong> Gebäudeunterhalt (1% des Gebäudewerts) 260.-<br />
Reinigung 30.-<br />
Brauchenergie (Elektrisch, Gas) 10.-<br />
Kleiner Unterhalt / Kehricht / Telefon 1.-<br />
Hauswartung 13.-<br />
Total 314.-<br />
Alle Angaben beziehen sich auf die Netto-Nutzfläche (d.h. ohne Gänge, WC <strong>und</strong> Mauern). Die Preise<br />
verstehen sich pro Jahr.<br />
Quelle: Erziehungsdepartement, Abt. Bauplanung<br />
Generell stellt sich bei der Bemessung der Mietkosten die Frage nach dem Auslastungsgrad der<br />
Räumlichkeiten. Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, dass manche Räume zwischendurch leer<br />
stehen. Dennoch müssen die Kosten für den ganzen Zeitraum getragen werden. Bei fremd<br />
gemieteten oder genutzten Objekten habe ich nach Möglichkeit die effektiven Mietkosten<br />
berücksichtigt, bei staatlichen Liegenschaften wurden die oben erwähnten kalkulatorischen<br />
Preise herbei gezogen. Am sinnvollsten <strong>und</strong> kostengünstigsten sind Nutzungsmodelle, die<br />
verschiedene Angebote <strong>und</strong> Tätigkeiten kombinieren. Am Vormittag können die Räume von<br />
Kleinkinder-Spielgruppen gemietet werden, am Abend stehen sie für Vereine zur Verfügung.<br />
Wie schon erwähnt, werden nur diejenigen Räume in der Vollkostenberechnung beachtet, die<br />
zusätzlich notwendig sind, um eine <strong>Betreuung</strong> anzubieten. Die Unterrichtsräume, Werkräume <strong>und</strong><br />
Lehrerzimmer wurden nicht in die Berechnung mit einbezogen. Grösse <strong>und</strong> Ausstattung der<br />
Klassenzimmer haben also keinen Einfluss auf die Vollkosten für Tagesstrukturen pro Schüler/in<br />
pro Jahr. Für den abger<strong>und</strong>eten Gesamteindruck wurden sie in einer separaten Spalte<br />
verzeichnet.<br />
Die angegebenen Quadratmeter pro Schulhaus <strong>und</strong> Hinweise zur jeweiligen Nutzung sind von<br />
der Abteilung Bauplanung des Erziehungsdepartements erhoben worden.<br />
86
15.1.5 Personalkosten<br />
Der grösste Kostenanteil an den Gesamtkosten sind die Personalkosten. Aus Gründen der<br />
Einfachheit <strong>und</strong> der Vergleichbarkeit wurden nicht die effektiven Lohnsummen veranschlagt,<br />
sondern die Kosten, die bei einer durchschnittlichen Einstufung (Stufe 14) entstehen. Es wurden<br />
die Bruttolohnkosten des Jahres 2002 berücksichtigt, damit eine abgeschlossene<br />
Rechnungsperiode betrachtet werden konnte. Zu den Bruttolohnkosten (incl. 13. Monatslohn) ist<br />
ein Zuschlag von 30% bei den Sozialpädagogen <strong>und</strong> ein Zuschlag von 34% bei den<br />
Lehrpersonen hinzuzurechnen. Dieser Zuschlag deckt Zulagen, Vertretungskosten,<br />
Sozialversicherungsbeiträge, Personalversicherungsbeiträge, Unfall- <strong>und</strong> Krankenversicherungen<br />
<strong>und</strong> den übrigen Personalaufwand (Weiterbildung, etc.) ab. Die Krankentaggelder, welche in der<br />
Jahresrechnung als Einnahmen verbucht werden können, sind im Zuschlag bereits mindernd<br />
berücksichtigt.<br />
Dies ergibt folgende Jahreslöhne (2002):<br />
Lohnklasse Bruttojahreslohn Zuschlag Total (ger<strong>und</strong>et)<br />
16 117’393 34% 157’300<br />
14 101’786 34% 136’400<br />
12 89’027 30% 115’700<br />
7 67’203 30% 87’400<br />
5 61’496 30% 79’900<br />
4 59’088 30% 76’800<br />
Quelle: Finanzdepartement, Zentraler Personaldienst<br />
15.1.6 Kalkulatorische Personalkosten<br />
Bei den Mittagstischen wird ein Teil der Arbeit ehrenamtlich geleistet oder zu symbolischen<br />
Preisen entschädigt. Um diese ehrenamtliche Arbeit in der Vollkostenrechnung berücksichtigen<br />
zu können, wurden kalkulatorische Personalkosten verwendet. Das heisst, wenn der Staat<br />
jemanden anstellen würde, müssten die Arbeitnehmerinnen <strong>und</strong> Arbeitnehmer nach folgendem<br />
Lohn-Schema beschäftigt werden.<br />
Funktion Lohnklasse<br />
Hortleiter/in ohne Diplom 7<br />
Sozialpädagoge/in mit Diplom 12<br />
Mitarbeiter/in Hort 5<br />
Koch/Köchin 7<br />
Hilfskoch/Köchin 4<br />
Quelle: Erziehungsdepartement, Personalabteilung Schulen<br />
87
Für die Entscheidungsfindung, welche <strong>Betreuung</strong>sarten wie kostenintensiv sind, ist es notwendig,<br />
nicht nur die effektiven Nettokosten zu berücksichtigen, sondern auch die kalkulatorischen<br />
Kosten, die ein Angebot generieren würde, wenn sämtliche Kosten vom Staat getragen werden<br />
müssten (wie dies bei den Tagesschulen der Fall ist). Die Finanzierungsmodelle müssen<br />
nachhaltig sein. Um diesbezüglich Transparenz zu erstellen, wurden die aktuellen Nettokosten<br />
durch eine Spalte mit den kalkulatorischen Kosten sowie eine Spalte mit deren Differenz ergänzt.<br />
Diese Differenz zeigt den quantifizierbaren volkswirtschaftlichen Nutzen auf, den die<br />
ehrenamtliche Arbeit generiert.<br />
15.1.7 Verwaltungskosten<br />
Für interne Verwaltungsaufgaben wurde ein Zuschlag von 6% auf die Personalkosten<br />
geschlagen, ausser in den Fällen, wo diese ausdrücklich durch das <strong>Betreuung</strong>spersonal bereits<br />
abgedeckt werden.<br />
15.1.8 Erträge<br />
Anschubsfinanzierungen des B<strong>und</strong>es oder des Kantons wurden nicht berücksichtigt, da die<br />
ordentlichen betrieblichen Kosten eines Angebotes interessieren. Die Höhe der Nettokosten wird<br />
von der Struktur der Elternbeiträge beeinflusst. Die Beiträge sind gesetzlich geregelt <strong>und</strong><br />
bewegen sich an den Tagesschulen von 3.20 Fr. bis 32.25 Fr. pro Kind <strong>und</strong> Tag. Um den Einfluss<br />
dieser nicht steuerbaren Erträge aufzuzeigen, wurden die Elternbeiträge pro Schüler/in pro Jahr<br />
in der Übersicht aufgelistet.<br />
15.2 Die Resultate<br />
Nachfolgend werden die durchschnittlichen Vollkosten pro Angebot präsentiert. Die detaillierten<br />
Aufstellungen der Kosten von jeder einzelnen Schule können auf der Internet Seite<br />
www.edubs.ch/die_schulen/projekte/tagesbetreuung eingesehen werden.<br />
88
Kostenvergleich Tagesstrukturen<br />
Angebot TS PS TB OS TS OS LS TS PS KKL TS OS KKL TB HPS<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr<br />
Elternbeiträge pro<br />
Schüler/in<br />
Nettoaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr<br />
12'560 16'227 8'101 16'921 18'227 29'901<br />
3'282 1'493 960 1'607 1'146 348<br />
9'195 14'685 7'141 15'265 17'013 29'097<br />
Anzahl<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro<br />
Woche<br />
2.48 2.94 1.69 4.66 4.20 14.61<br />
Quellen: Erziehungsdepartement, Stab Schulen, M. Schmidli (2003)<br />
Legende<br />
• TS PS = Tagesschulen Primarschule (Kleinhüningen, Niederholz)<br />
• TB OS = Tagesbetreuung Orientierungsschule (Wasgenring, Gellert)<br />
• TS OS LS = Tagesschulen Orientierungsschule Landschulen (Grendelmatte, Hebel)<br />
• TS PS KKL = Tagesschulen Primarschule Kleinklassen (Richter Linder, Bachgraben)<br />
• TS OS KKL = Tagesschulen Orientierungsschule Kleinklassen (Gellert, Wettstein)<br />
• TB HPS = Tagesbetreuung Heilpädagogische Schule<br />
35'000<br />
30'000<br />
25'000<br />
20'000<br />
15'000<br />
10'000<br />
5'000<br />
-<br />
TS PS TB OS TS OS<br />
LS<br />
Vollkosten nach Angeboten<br />
TS PS<br />
KKL<br />
Quelle: Erziehungsdepartement, Stab Schulen<br />
TS OS<br />
KKL<br />
TB<br />
HPS<br />
Gesamtaufwand<br />
pro Schüler/in pro<br />
Jahr<br />
Elternbeiträge pro<br />
Schüler/in<br />
Nettoaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr<br />
89
Die folgende Tabelle zeigt an einem Beispiel (TS Niederholz) auf, wie die Kosten auf Personal-<br />
<strong>und</strong> Sachkosten verteilt sind. Fast 80% der Kosten sind Personalausgaben. Das bedeutet, dass<br />
nicht die Grösse <strong>und</strong> Anzahl der genutzten Räume der bestimmende Kostenfaktor sind, sondern<br />
das beschäftigte Personal.<br />
<strong>Betreuung</strong>spersonen<br />
Anteil an den Gesamtkosten<br />
Quelle: M. Schmidli (2003)<br />
15.2.1 Tagesschulen der Primarschulen<br />
Verwaltungs-<br />
kostenanteil<br />
kalkulatorische<br />
Mieten<br />
Köche/innnen<br />
Nebenräume<br />
Lager<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong><br />
Die beiden Tagesschulen der Primarschule Kleinhüningen <strong>und</strong> Niederholz haben ein identisches<br />
Konzept. Die <strong>Betreuung</strong> der Kinder wird durch Lehrpersonen geleistet, welche diese Aufgabe<br />
zusätzlich zum Unterrichten bewältigen, wobei die <strong>Betreuung</strong>szeit mit einem Faktor 2:3<br />
umgerechnet wird. (Zwei Lektionen Unterricht entsprechen 3 „Lektionen“ <strong>Betreuung</strong>). Beide<br />
Schulen haben gleich viele Lektionen für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Unterricht zur Verfügung. Für<br />
Sachausgaben wird eine schülerzahlabhängige Grösse herbeigezogen. Wenn sich die beiden<br />
Primarschulen dennoch in den Vollkosten unterscheiden, so liegt dies a) an der Grösse der<br />
Räumlichkeiten, b) an der Zahl der betreuten Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> c) an den<br />
Elternbeiträgen. Bei einer Plan-Schülerzahl von je 50 Schüler/innen machen die<br />
Kostenunterschiede pro Kopf noch etwa 1000.- aus. Sie sind zum grössten Teil auf die<br />
unterschiedlichen Räumlichkeiten zurückzuführen.<br />
15.2.2 Tagesbetreuung an der Orientierungsschule<br />
Die Tagesbetreuung an der Orientierungsschule wurde in den vergangenen zwei Jahren neu<br />
konzipiert. Die ITOS, die integrierten Tagesschulen der OS, wurden durch<br />
Tagesbetreuungsangebote ersetzt, bei denen die räumliche Trennung von Unterricht <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong> Teil des Konzepts ist. Durch die Neukonzeption <strong>und</strong> aus Platzgründen ergab sich eine<br />
Verschiebung der Standorte. Die Tagesschule Wasgenring bedient seit dem Schuljahr 03/04 nur<br />
noch Regelschüler/innen <strong>und</strong> keine Kleinklassen-Schüler/innen mehr, während am Standort<br />
90
Thomas Platter/Wettstein nur noch Kleinklassen betreut werden. Die Gesamtschüler/innen-Zahl<br />
der betreuten Kinder bleibt jedoch erhalten. Die neuen <strong>Betreuung</strong>sformen befinden sich noch im<br />
Aufbau <strong>und</strong> es ist deshalb schwierig, repräsentatives Zahlenmaterial zu finden. Bei der<br />
Gruppenbildung wurden bewusst Plätze frei gehalten für die Jahrgänge des folgenden<br />
Schuljahres. Die Belegung ist deshalb noch unvollständig.<br />
Um eine aussagekräftige Zahl präsentieren zu können, habe ich den Aufstellungen mit den<br />
effektiven Kosten noch ein Blatt mit einer Planbelegung von 18 Schüler/innen hinzugefügt. Die<br />
Kosten sind dennoch wesentlich höher als bei den Primarschulen. Der Gr<strong>und</strong> dafür liegt a) in der<br />
im Verhältnis zu den kostentreibenden Elementen geringen Schülerzahl <strong>und</strong> b) in den niedrigen<br />
Elternbeiträgen v.a. am Standort Wasgenring. Bei einer Belegung von 25 Schüler/innen würden<br />
sich die Kosten im Rahmen der Primar Tagesschulen bewegen.<br />
15.2.3 Tagesschulen OS Landschulen<br />
Die zwei Tagesschulen der Landgemeinden haben ein von den städtischen Orientierungsschulen<br />
komplett verschiedenes Konzept, welches sich auf die Kosten senkend auswirkt. Hier wird<br />
bewusst eine starke Vernetzung von Unterricht <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> angestrebt, was die Identität<br />
sowohl der Lerngruppe als auch des Personals als auch der Räumlichkeiten zur Folge hat.<br />
Synergien können dadurch optimal ausgenutzt werden. Das heisst: Die Betreuer/innen sind am<br />
Ort, da sie an der Schule auch unterrichten. Es gibt keine Zeitverluste durch Schulhauswechsel.<br />
Durch die Personalunion von Betreuer/innen <strong>und</strong> Lehrpersonen kann der Koordinationsaufwand<br />
für organisatorische <strong>und</strong> strategische Aufgaben minimiert werden. Pro Schüler <strong>und</strong> Schülerin<br />
stehen mit 1.69 deutlich weniger <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en zur Verfügung als an der Primarschule.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der ausgenutzten Synergien kann trotzdem ein hochwertiges <strong>Betreuung</strong>sangebot<br />
gewährleistet werden. Zudem wird angenommen, dass die OS Schüler/innen eine weniger<br />
intensive <strong>Betreuung</strong> benötigen als Primarschüler/innen. Andererseits sind die Lehrpersonen der<br />
OS in einer höheren Lohnklasse angesiedelt, was sich in den Kosten niederschlägt. Die<br />
Elternbeiträge sind an diesen Standorten ausgesprochen niedrig.<br />
In der Tagesschule Grendelmatte wurden die Mittagessen im Rechnungsjahr 2002 fremd<br />
bezogen, seit Januar 03 wird jedoch selber gekocht. In der Tagesschule Hebel ist die Vernetzung<br />
von Unterricht <strong>und</strong> Verpflegung noch intensiver. Die Kinder bereiten zusammen mit der<br />
Hauswirtschaftslehrerin das Essen selber zu. Dazu können sie die Schulküche des Hebel<br />
Schulhaus benützen. Sie essen in den Schulräumen, weshalb keine zusätzlichen Räume zur<br />
<strong>Betreuung</strong> weder notwendig noch vorhanden sind.<br />
Es ist zu beachten, dass diese kostengünstigen Konzepte nur beschränkt reproduzierbar sind.<br />
Die Infrastruktur der Schulküche muss vorhanden sein <strong>und</strong> sie darf nicht durchgehend belegt<br />
sein. Die personellen Voraussetzungen müssen gegeben sein, insgesamt kann wahrscheinlich<br />
91
nur eine kleine Schülergruppe mit diesem <strong>Betreuung</strong>skonzept funktionieren. Es lohnt sich jedoch,<br />
zu überprüfen, ob noch weitere Schulen die Rahmenbedingungen dafür bereitstellen könnten.<br />
15.2.4 Tagesschulen für Kleinklassen<br />
Der Kostenunterschied zwischen Kleinklassen Tagesschulen <strong>und</strong> Regelklassen Tagesschulen,<br />
bzw. Tagesbetreuung ist vor allem auf grössere <strong>Betreuung</strong>sintensität der<br />
Kleinklassenschülerinnen <strong>und</strong> –schüler zurück zu führen. Die Anzahl der <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Kind <strong>und</strong> Woche ist etwa doppelt so gross wie an den Regelklassen. Unterschiede zwischen den<br />
Standorten sind hauptsächlich auf die Raumgrösse zurück zu führen. Die Elternbeiträge sind<br />
durchwegs niedrig. Die Kosten der Kleinklassentagesschulen sind hoch, es ist aber zu beachten,<br />
dass dieses Angebot bis zu einem bestimmten Grad teure Heimeinweisungen verhindern kann.<br />
15.2.5 Tagesbetreuung an der heilpädagogischen Schule<br />
Der Kostenunterschied der Tagesbetreuung an der heilpädagogischen Schule im Vergleich zu<br />
den Kleinklassen Tagesschulen ist nochmals auf eine grössere <strong>Betreuung</strong>sintensität zurück zu<br />
führen. Die Kinder sind aufgr<strong>und</strong> einer körperlichen oder geistigen Behinderung auf intensivere<br />
<strong>Betreuung</strong> angewiesen. Zudem kommt hinzu, dass eine andere Tarifstruktur der Elternbeiträge im<br />
Sonderschulbereich zur Anwendung kommt. Die Eltern müssen maximal 10.- pro Kind <strong>und</strong> Tag<br />
für Verpflegung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> zahlen, für einkommensschwache Personen gibt es<br />
Ermässigungen.<br />
15.2.6 Mittagstische<br />
Die Mittagstische bieten zwei- bis fünfmal pro Woche ein warmes Mittagessen für Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler des Quartiers an. Neben der Verpflegung wird auch ein Rahmenprogramm<br />
angeboten. Die Mittagstische sind vom ED subventioniert, besitzen jedoch eine private oder<br />
kirchliche Trägerschaft. Die Räumlichkeiten werden von der Trägerschaft meist unentgeltlich zur<br />
Verfügung gestellt <strong>und</strong> die Verpflegung <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> der Kinder wird an manchen Standorten<br />
durch ehrenamtliche Mitarbeit ergänzt.<br />
92
Mittagstische MT St. Johann MT Brunnmatt MT Bruderholz MT St. Joseph<br />
Durchschnittliche<br />
Belegung pro Tag<br />
Anzahl<br />
Mittagsbetreuungen<br />
pro Jahr<br />
Gesamtaufwand<br />
pro<br />
Mittagsbetreuung<br />
Elternbeiträge pro<br />
Mittagsbetreuung<br />
Beträge ED pro<br />
Mittagsbetreuung<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulato-<br />
rische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulato-<br />
rische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulato-<br />
rische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulato-<br />
rische<br />
Kosten<br />
30 30 5.2 5.2 34 34 25 25<br />
2160 2160 323 323 2'650 2'650 3'944 3'944<br />
29 40 41 87 17 35 20 26<br />
6 6 5 5 8 8 8 8<br />
10 10 10 10 9 9 10 10<br />
Nettoaufwand pro<br />
Mittagsbetreuung<br />
13 25 26 72 0 18 2 8<br />
Quelle: Angaben der Trägerschaften, M. Schmidli (2003)<br />
Die Kostenunterschiede der betrachteten vier Mittagstische sind unter anderem auf die Zahl der<br />
Teilnehmer/innen zurück zu führen. Eine Auslastung von 5 –10 Schülern treibt die Kosten pro<br />
Mittagsbetreuung nachfolgende Tabelle illustriert den Zusammenhang zwischen Gruppengrösse<br />
<strong>und</strong> Vollkosten pro <strong>Betreuung</strong>seinheit. Der Bedarf an Koch- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>spersonal steigt nicht<br />
linear zur Zahl der verpflegten Kinder. Für Aussagen bezüglich der optimalen Gruppengrösse,<br />
unter Berücksichtigung von qualitativen Kriterien wie z.B. eines <strong>Betreuung</strong>sschlüssels von<br />
maximal 10 Kindern pro <strong>Betreuung</strong>sperson, ist das vorliegende Datenmaterial noch zu wenig<br />
umfangreich.<br />
Anzahl Essen / Kosten pro Essen<br />
100.0<br />
90.0<br />
80.0<br />
70.0<br />
60.0<br />
50.0<br />
40.0<br />
30.0<br />
20.0<br />
10.0<br />
-<br />
Vollkosten in Abhängigkeit von der Auslastung<br />
1 2 3 4<br />
Quelle: Angaben der Trägerschaften, eigene Berechnungen<br />
Durchschnittliche Belegung<br />
pro Tag<br />
Gesamtaufwand pro Essen<br />
93
Wenn man nur die gut belegten Mittagstische betrachtet, ergeben sich durchschnittliche Gesamt-<br />
Kosten von 22.- Fr., resp. 34.- Fr. wenn man auch die kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.<br />
Von diesen Kosten übernehmen die Eltern durchschnittlich 7 Fr., die Beiträge des ED belaufen<br />
sich auf 10.- Fr. pro Kind <strong>und</strong> Tag. Daraus ergeben sich Nettokosten von 5.- Fr. resp. 17.- Fr.<br />
Diese Nettokosten werden von der jeweiligen Trägerschaft getragen <strong>und</strong> bestehen zum Beispiel<br />
darin, dass die Projektleitung finanziert wird oder Räume zur Verfügung gestellt werden.<br />
Um eine Vergleichsbasis mit den Tagesschulen zu erhalten, zeigt die nachfolgende<br />
Zusammenstellung, wie viel eine Person pro Jahr kosten würde, wenn sie regelmässig an einem<br />
Mittagstisch verpflegt <strong>und</strong> betreut würde. (Ausgehend von 39 Schulwochen <strong>und</strong> 5-maligem<br />
Besuch pro Woche). Bei geringerer Frequenz reduziert sich der Jahresaufwand pro Kind<br />
entsprechend.<br />
Jahresaufwand bei 5<br />
Mittagsbetreuungen pro<br />
Woche<br />
Durchschnittliche Kosten<br />
effektiv<br />
Durchschnittliche<br />
Vollkosten<br />
Gesamtaufwand 4290.- 6630.-<br />
Davon Elternbeiträge 1365.- 1365.-<br />
Davon Beiträge ED 1950.- 1950.-<br />
Nettoaufwand 975.- 3315.-<br />
Quelle: M. Schmidli (2003)<br />
15.2.7 Schülerclub<br />
Eine Ergänzung zu den Mittagstischen stellt zum Beispiel das Pilotprojekt Schülerclub St. Johann<br />
dar. Die Kinder werden von 14.00 bis 17.00 Uhr betreut <strong>und</strong> mit Spielen <strong>und</strong> Basteln beschäftigt.<br />
Der Hort ist ein- bis viermal pro Woche benutzbar (an mindestens einem Nachmittag haben die<br />
Kinder Schule <strong>und</strong> bedürfen keiner <strong>Betreuung</strong>). Ursprünglich war geplant, das Angebot mit einem<br />
Mittagstisch zu kombinieren, um eine umfassende <strong>Betreuung</strong> anbieten zu können. Dieses Projekt<br />
kann sicher weiter verfolgt werden. Der Hort findet nur während der Schulwochen statt.<br />
Schülerclub<br />
Durchschnittliche<br />
Belegung pro Tag<br />
Anzahl Nachmittags-<br />
betreuungen pro Jahr<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Kind / Tag<br />
Elternbeiträge pro<br />
Kind / Tag<br />
13 Kinder<br />
2'457<br />
31 Fr.<br />
5 Fr.<br />
94
Nettoaufwand pro<br />
Kind / Tag<br />
15.2.8 Tagesheime<br />
26 Fr.<br />
Die Tagesheime sind eigentlich nicht Objekt dieser Untersuchung. Da sie aber einen<br />
bedeutenden Vorteil gegenüber den bisher dargestellten Angeboten in sich vereinigen, soll hier<br />
exemplarisch ein „Tagi“ vorgestellt werden. Die Tagesheime sind auch während den Schulferien<br />
geöffnet, für berufstätige Eltern ist dies ein entscheidender Aspekt. Die Tagesheime bieten<br />
<strong>Betreuung</strong> für Kinder im Vorschulalter an. Vereinzelt gibt es aber auch Schülergruppen für<br />
Primarschulkinder. Die Kosten im Tagesheim sind höher als bei anderen <strong>Betreuung</strong>sangeboten,<br />
da jüngere Kinder eine intensivere <strong>Betreuung</strong> erfordern als Schulkinder <strong>und</strong> eine Mischkalkulation<br />
erstellt wird. Eine Aufstellung der Kosten befindet sich auf der angegebenen Internetseite.<br />
15.2.9 Fazit<br />
Die Auslegeordnung zeigt, dass die verschiedenen Angebote unterschiedlich hohe Kosten<br />
verursachen. Die Gründe dafür liegen in der Komplexität der Verknüpfung von Unterricht <strong>und</strong><br />
<strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> in der Auslastung der Angebote. Durch geschicktes Kombinieren von personellen<br />
<strong>und</strong> räumlichen Ressourcen können Kosten eingespart werden. Offen ist die Auswirkung der<br />
verschiedenen Modelle auf die schulische <strong>und</strong> persönliche Entwicklung der Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler. Es fehlen noch Instrumente, um die qualitativen Effekte zu erfassen, die vorliegenden<br />
Daten können aber als Gr<strong>und</strong>lage dienen für die politische Diskussion <strong>und</strong> Wege bereiten für<br />
weitere Untersuchungen.<br />
95
16 Kosten der Mittagstischangebote<br />
16.1 Mittagstisch Bruderholz<br />
MT Bruderholz<br />
Personalaufwand<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung<br />
Jahreslohn incl.<br />
AG Beiträge Effektive Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten Differenz<br />
Hortleiterin 30% 87'400 15'600 26'220 10'620<br />
Köchin 30% 87'400 15'600 26'220 10'620<br />
Mitarbeiterinnen 30% 79'900 2'018 23'970 21'952<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 300 m2 0 3900 3'900<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 10121 10121 -<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1622 1622 -<br />
Total 44'961 92'053 47'092<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 21'286<br />
Subvention ED 27'375<br />
Total 48'661<br />
96
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Effektiv Kalkulatorisch<br />
Durchschnittliche Belegung pro Tag 34 34<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>en pro Jahr 2650 2650<br />
Gesamtaufwand pro Mittagsbetreuung 17 35<br />
Elternbeiträge pro Mittagsbetreuung 8 8<br />
Beträge ED pro Mittagsbetreuung 9 9<br />
Nettoaufwand pro Mittagsbetreuung (0) 18<br />
Öffnungszeiten<br />
Dienstag u. Donnerstag 12.00 - 14.00<br />
Bemerkungen<br />
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen erhalten Ihre bezahlten Elternbeiträge zurück erstattet.<br />
Die Raummiete würde 50.- / Tag kosten.<br />
97
16.2 Mittagstisch Brunnmatt<br />
MT Brunnmatt<br />
Personalaufwand<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung<br />
Jahreslohn incl.<br />
AG Beiträge Effektive Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten Differenz<br />
Hortleiter 10% 87'400 8'400 8'740 340<br />
Köchin 20% 87'400 3'100 17'480 14'380<br />
Sachaufwand - -<br />
kalkulatorische Mieten 80 m2 0 260 260<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 1'767 1767 -<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 0 -<br />
Total 13'267 28'247 14'980<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 1'615<br />
Subvention ED 3'230<br />
Total 4'845<br />
98
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Effektiv Kalkulatorisch<br />
Durchschnittliche Belegung pro Tag 5.2 5.2<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>en pro Jahr 323 323<br />
Gesamtaufwand pro Mittagsbetreuung 41 87<br />
Elternbeiträge pro Mittagsbetreuung 5 5<br />
Beträge ED pro Mittagsbetreuung 10 10<br />
Nettoaufwand pro Mittagsbetreuung 26 72<br />
Öffnungszeiten<br />
Montag u. Freitag 12.00 - 13.30<br />
Bemerkungen<br />
Räumlichkeiten <strong>und</strong> Spielmaterial werden vom Schulhaus (Brunnmatt) zur Verfügung gestellt.<br />
Der Lohn des Hortleiters wird von der Kirche bezahlt.<br />
99
16.3 Mittagstisch St. Johann<br />
MT St. Johann<br />
Personalaufwand<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung<br />
Jahreslohn incl.<br />
AG Beiträge Effektive Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten Differenz<br />
Hortleiter/in 38% 87'400 31'920 33'212 1'292<br />
Köchin 24% 87'400 20'160 20'976 816<br />
Ehrenamtliche<br />
Mitarbeiter/innen 20% 79'900 - 15'980 15'980<br />
Zentrale Administration 1'200 1'200<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 300 m2 0 6'000 6'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 8'640 8640 -<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1080 1080 -<br />
Total 63'000 87'088 24'088<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 12'520<br />
Subvention ED 21'600<br />
Spenden 1'000<br />
Total 34'120<br />
100
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Effektive Kosten Kalkulatorische Kosten<br />
Durchschnittliche Belegung pro Tag 30 30<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>en pro Jahr 2160 2160<br />
Gesamtaufwand pro Mittagsbetreuung 29 40<br />
Elternbeiträge pro Mittagsbetreuung 6 6<br />
Beträge ED pro Mittagsbetreuung 10 10<br />
Nettoaufwand pro Mittagsbetreuung 13 25<br />
Öffnungszeiten<br />
Dienstag u. Donnerstag 12.00 - 14.00<br />
Bemerkungen<br />
Der Hortleiter <strong>und</strong> eine Köchin sind von der Evangelischen Stadtmission angestellt.<br />
101
16.4 Mittagstisch St. Joseph<br />
MT St. Joseph<br />
Personalaufwand<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung<br />
Jahreslohn incl.<br />
AG Beiträge Effektive Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten Differenz<br />
Hortleitung 16'000 16'000 -<br />
Mitarbeiter/innen 65% 79'900 30'468 51'935 21'467<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 220 m2 0 3'900 3'900<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 27'600 27'600 -<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 5000 5000 -<br />
Total 79'068 104'435 25'367<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 31'500<br />
Subvention ED 39'440<br />
Total 70'940<br />
102
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Effektiv Kalkulatorisch<br />
Durchschnittliche Belegung pro<br />
Tag 25 25<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>en pro Jahr 3944 3944<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Mittagsbetreuung 20 26<br />
Elternbeiträge pro<br />
Mittagsbetreuung 8 8<br />
Beträge ED pro<br />
Mittagsbetreuung 10 10<br />
Nettoaufwand pro<br />
Mittagsbetreuung 2 8<br />
Öffnungszeiten<br />
Montag - Freitag 12.00 - 14.00<br />
Bemerkungen<br />
Kostenlose Projektaufbauarbeit der Trägerschaft Maxxi-Spielen <strong>und</strong> Lernen.<br />
Ab Schuljahr 03/04 liegt die Trägerschaft bei den Robi-Spiel-Aktionen<br />
Die Mittagessen werden von der Gemeinschaft für Mensch <strong>und</strong> Arbeit (Arbeitslosen-<br />
Projekt) geliefert.<br />
16.5 Mittagstisch G<strong>und</strong>eldingerfeld<br />
Bemerkung: Die genauen Zahlen zum Mittagstisch G<strong>und</strong>eldingerfeld lagen beim Abschluss der Evaluation nicht vor.<br />
103
17 Kostenvergleich zwischen den Mittagstischangeboten<br />
Mittagstische MT St. Johann MT Brunnmatt MT Bruderholz MT St. Joseph<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulatorische<br />
Kosten<br />
Effektive<br />
Kosten<br />
Kalkulato-<br />
rische<br />
Kosten<br />
Durchschnittliche<br />
Belegung pro<br />
Tag 30 30 5.2 5.2 34 34 25 25<br />
Anzahl<br />
<strong>Betreuung</strong>en<br />
pro Jahr 2160 2160 323 323 2'650 2'650 3'944 3'944<br />
Gesamtaufwand<br />
pro<br />
Mittagsbetreuung 29 40 41 87 17 35 20 26<br />
Elternbeiträge<br />
pro<br />
Mittagsbetreuung 6 6 5 5 8 8 8 8<br />
Beträge ED pro<br />
Mittagsbetreuung 10 10 10 10 9 9 10 10<br />
Nettoaufwand<br />
pro<br />
Mittagsbetreuung 13 25 26 72 0 18 2 8<br />
104
18 Kosten des Schülerclubs<br />
Schülerclub<br />
Personalaufwand<br />
Anderweitige<br />
Nutzung<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit<br />
Kosten für<br />
<strong>Betreuung</strong><br />
Hortleiterin<br />
Jahreslohn incl. AG<br />
40% Beiträge 87'400 34'960<br />
Mitarbeiterinnen<br />
Jahreslohn incl. AG<br />
17% Beiträge 79'900 13'184<br />
Verwaltungskostenanteil 2'889<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 70 70m2 314 21'980<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 1'082<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 2'422<br />
Total 76'516<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 10'570<br />
Total 10'570<br />
105
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Durchschnittliche Belegung<br />
pro Tag 12.6<br />
Anzahl Nachmittags-<br />
betreuungen pro Jahr 2'457<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Nachmittagsbetreuung 31<br />
Elternbeiträge pro<br />
Nachmittagsbetreuung 5<br />
Nettoaufwand pro<br />
Nachmittagsbetreuung 26<br />
Öffnungszeiten<br />
Montag – Freitag 14.00 – 17.00<br />
106
19 Kosten des Schülerhorts Bläsi-Krippe<br />
Bläsi-Krippe Budget 03<br />
Krippenleitung 100%<br />
Koch/Köchin 90%<br />
Sozialpädagoge 100%<br />
Kleinkindererzieherinnen 380%<br />
Praktikantinnen 400%<br />
Reinigungspersonal 38%<br />
Personalaufwand incl.<br />
Sozialleistungen <strong>und</strong><br />
sonstigem Personalaufwand 717'073<br />
Büromaterial<br />
Externe Buchhaltung u.<br />
Revision<br />
Verwaltungskosten 25'550<br />
<strong>Betreuung</strong>sräume 438 m2<br />
Nebenräume 127 m2<br />
Lager 33 m2<br />
Aussenspielfläche 200 m2<br />
Mehrzweckraum 109 m2<br />
Mietkosten total incl. Energie,<br />
Unterhalt 96'600<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 46'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 12'300<br />
Versicherung 1'300<br />
Total 898'823<br />
107
Erträge<br />
Elternbeiträge 274'055 (Beiträge 02)<br />
Subventionen<br />
Verpflegung Personal<br />
Erträge total 897'550<br />
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Anzahl Plätze 38 Bei teilzeitlicher <strong>Betreuung</strong> können entsprechend mehr Kinder betreut werden.<br />
Gesamtaufwand pro Platz pro<br />
Tag 103<br />
Elternbeiträge pro Platz pro<br />
Tag 31<br />
Öffnungszeiten<br />
Montag - Freitag 6.15 - 18.00 230 Tage im Jahr<br />
Anmerkungen<br />
Die Kinderkrippe ist auch während der Ferien geöffnet.<br />
Es handelt sich hier um Durchschnittskosten pro Platz. Die Schüler in der Schülergruppe<br />
benötigen natürlich weniger <strong>Betreuung</strong>. Die Kosten können jedoch nicht zugewiesen<br />
werden.<br />
108
20 Kosten Tagesschule PS Regelklasse Niederholz<br />
Kostenaufstellung TS Niederholz<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 0% 121% AG Beiträge 90'000 108'900 108'900<br />
Sozialpädagog/innen 0%<br />
Jahreslohn incl.<br />
0% AG Beiträge - -<br />
Lehrpersonen 310%<br />
Jahreslohn incl.<br />
240% AG Beiträge 133'000 731'500 319'200<br />
kalkulatorische Löhne -<br />
Verwaltungskostenanteil 25'686<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 160 300 m2 310 142'600 93'000<br />
Nebenräume Lager 0 30 m2 100 3'000 3'000<br />
Schulmaterial 8'973<br />
Verbrauchsmaterialien Nahrungsmittel 35'040<br />
Verbrauchsmaterialien <strong>Betreuung</strong> 3'900<br />
Total 597'699<br />
109
Erträge<br />
Elternbeiträge<br />
Verpflegung Personal<br />
B<strong>und</strong>essubventionen<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Erträge gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
162'666 162'666<br />
4'200 4'200<br />
Total 166'866<br />
Bemerkungen:<br />
1. Beschäftigungsgrad <strong>und</strong> Raumnutzung: anteilmässige Verteilung auf verschiedene Angebote<br />
2. Durchschnittliche Lohnkosten für diese Funktion (Annahme Stufe 14)<br />
3. Die Verwaltungskosten betragen im Durchschnitt 5-6% der Gesamtkosten<br />
4. Kalkulatorische Mieten incl. Heizung, Reinigung, Brauchenergie, kleiner Unterhalt, Hauswartung<br />
5. <strong>Betreuung</strong> beinhaltet: Aufsicht beim Essen, Animation (Sport, Basteln), Aufgabenhilfe<br />
6. Ein <strong>Betreuung</strong>sgrad von 100% entspricht einer <strong>Betreuung</strong> von 8-10 Std. pro Tag<br />
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Ist Plan<br />
Anzahl Schüler/innen 50<br />
<strong>Betreuung</strong>sgrad 100%<br />
Nebenräume ohne Kostenfolge benutzbar ja<br />
Gesamtaufwand pro Schüler/in pro Jahr 11'954<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 3'253<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in pro Jahr 8'617<br />
<strong>Betreuung</strong> von 7.30 - 16.45, Mittwoch: 7.30 - 14.45<br />
110
21 Kosten Tagesschule PS Regelklasse Kleinhüningen<br />
Kostenaufstellung TS Kleinhüningen<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 121% AG Beiträge 90'000 108'900 108'900<br />
Jahreslohn incl.<br />
Sozialpädagog/innen<br />
AG Beiträge - -<br />
Lehrpersonen 300%<br />
Jahreslohn incl.<br />
170% AG Beiträge 133'000 625'100 226'100<br />
kalkulatorische Löhne -<br />
Verwaltungskostenanteil 20'100<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 420 300 m2 310 223'200 93'000<br />
Nebenräume Lager 60 m2 100 6'000 6'000<br />
Schulmaterial 13'410<br />
Verbrauchsmaterialien Nahrungsmittel 43'932<br />
Verbrauchsmaterialien <strong>Betreuung</strong> -<br />
Total 511'442<br />
111
Erträge<br />
Elternbeiträge<br />
Verpflegung Personal<br />
B<strong>und</strong>essubventionen<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Erträge gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
155'590 155'590<br />
4'000 4'000<br />
Total 159'590<br />
Bemerkungen:<br />
1. Beschäftigungsgrad <strong>und</strong> Raumnutzung: anteilmässige Verteilung auf verschiedene Angebote<br />
2. Durchschnittliche Lohnkosten für diese Funktion (Annahme Stufe 14)<br />
3. Die Verwaltungskosten betragen im Durchschnitt 5-6% der Gesamtkosten<br />
4. Kalkulatorische Mieten incl. Heizung, Reinigung, Brauchenergie, kleiner Unterhalt, Hauswartung<br />
5. <strong>Betreuung</strong> beinhaltet: Aufsicht beim Essen, Animation (Sport, Basteln), Aufgabenhilfe<br />
6. Ein <strong>Betreuung</strong>sgrad von 100% entspricht einer <strong>Betreuung</strong> von 8-10 Std. pro Tag<br />
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Ist Plan<br />
Anzahl Schüler/innen 47<br />
<strong>Betreuung</strong>sgrad 100%<br />
Nebenräume ohne Kostenfolge benutzbar ja<br />
Gesamtaufwand pro Schüler/in pro Jahr 10'882<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 3'310<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in pro Jahr 7'486<br />
<strong>Betreuung</strong> von 7.30 - 16.30, Mittwoch: 7.30 - 14.20<br />
112
22 Kosten Tagesschule OS Regelklasse Grendelmatten<br />
TS OS Grendelmatten<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Köche/innnen<br />
Jahreslohn incl.<br />
20% AG Beiträge 87'400 17'480 17'480<br />
Lehrpersonen 160%<br />
Jahreslohn incl.<br />
52% AG Beiträge 157'300 333'476 81'796<br />
Verwaltungskostenanteil 5'957<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 120 40m2 314 50'240 12'560<br />
Schulmaterial 3'450<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 14'400<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 3'900<br />
Total 136'093<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 14'400 14'400<br />
Verpflegung Personal<br />
B<strong>und</strong>essubventionen<br />
Total 14'400<br />
113
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Ist<br />
Anzahl Schüler/innen 15<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 25<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 1.67<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 9'073<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 960<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 8'113<br />
Bemerkungen<br />
Muss 2004 an einen neuen Ort<br />
114
23 Kosten Tagesschule OS Regelklasse Hebel<br />
TS OS Hebel<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Köche/innnen<br />
Jahreslohn incl.<br />
0% AG Beiträge 87'400 - -<br />
Lehrpersonen 116%<br />
Jahreslohn incl.<br />
50% AG Beiträge 157'300 261'118 78'650<br />
Verwaltungskostenanteil 4'719<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 60 0 m2 314 18'840 -<br />
Schulmaterial 3'440<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 13'440<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 3'000<br />
Total 99'809<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 13'440 13'440<br />
Verpflegung Personal<br />
B<strong>und</strong>essubventionen<br />
Total 13'440<br />
115
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Ist<br />
Anzahl Schüler/innen 14<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 24<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 1.71<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 7'129<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 960<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 6'169<br />
Öffnungszeiten<br />
Montag - Freitag 7.30 - 15.00<br />
Mittwoch 7.30 - 12.00<br />
Bemerkungen<br />
Die Klasse wird in einem Pavillon unterrichtet, wo sie auch das Essen einnimmt, <strong>und</strong> kann Schulküche,<br />
Lehrerzimmer <strong>und</strong> weitere Schulräume des Hebel Schulhauses mitbenutzen.<br />
Die Klasse bereitet unter Anleitung der Hauswirtschaftslehrerin ihre Mahlzeiten selber zu.<br />
116
24 Kosten der Tagesbetreuung OS Wasgenring (bisher)<br />
TB OS Wasgenring<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 50% AG Beiträge 87'400 43'700 43'700<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
111% AG Beiträge 115'700 128'427 128'427<br />
Verwaltungskostenanteil 10'328<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 400 90 m2 314 153'860 28'260<br />
Nebenräume Lager 10 m2 100 1'000 1'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 9'032<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'500<br />
Total 222'247<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 14'926<br />
Verpflegung Personal 883<br />
Total 15'809<br />
117
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Schnitt 01/02 <strong>und</strong> 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 10<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro Woche 53<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro Schüler pro Woche 5.30<br />
Gesamtaufwand pro Schüler/in pro Jahr 22'225<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'493<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in pro Jahr 20'644<br />
Bemerkungen<br />
Es handelt sich um mehrstufige Klassen, die im Aufbau sind. Es werden bewusst Plätze frei gehalten, damit für jeden Jahrgang die<br />
Möglichkeit einer Tagesbetreuung besteht.<br />
Im Schuljahr 01/02 <strong>und</strong> 02/03 wurden die Räumlichkeiten <strong>und</strong> das Kochpersonal mit den Kleinklassen geteilt.<br />
118
25 Kostenabschätzung für künftiges Modell Tagesbetreuung OS im Wasgenring (Plan)<br />
TB OS Wasgenring Plan<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 86% AG Beiträge 87'400 75'164 75'164<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
111% AG Beiträge 115'700 128'427 128'427<br />
Verwaltungskostenanteil 12'215<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 400 180m2 314 182'120 56'520<br />
Nebenräume Lager 20m2 100 2'000 2'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 16'257<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'500<br />
Total 292'083<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 26'866<br />
Verpflegung Personal 883<br />
Total 27'749<br />
119
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Plan<br />
Anzahl Schüler/innen 18<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 53<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 2.94<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 16'227<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'493<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 14'685<br />
Bemerkungen Plankosten bei Vollbelegung mit 18 Schüler/innen.<br />
120
26 Kosten Tagesbetreuung OS Gellert<br />
TB OS Gellert<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 50% AG Beiträge 87'400 43'700 43'700<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
117% AG Beiträge 115'700 135'369 135'369<br />
Verwaltungskostenanteil 10'744<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 80 m2 314 25'120 25'120<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 13'819<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'500<br />
Total 230'252<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 21'145<br />
Verpflegung Personal 1'000<br />
Total 22'145<br />
121
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Schnitt 01/02 <strong>und</strong> 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 10<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro Woche 56<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro Schüler pro Woche 5.60<br />
Gesamtaufwand pro Schüler/in pro Jahr 23'025<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 2'115<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in pro Jahr 20'811<br />
Bemerkungen<br />
Die Köch/innen kochen auch für die KKL Tagesschule an diesem Standort, der Beschäftigungsgrad wurde anteilmässig auf die<br />
beiden Angebote verteilt.<br />
Es handelt sich um mehrstufige Klassen, die im Aufbau sind. Es werden bewusst Plätze frei gehalten, damit für jeden Jahrgang die<br />
Möglichkeit einer Tagesbetreuung besteht.<br />
122
27 Kostenvergleich zwischen Tagesstrukturen im Regelschulbereich<br />
Vergleich Tagesstrukturen Regelschulen<br />
Angebot TS PSK TS PSLS TS PS TB OS TB OS TS OS LS TS OS LS TS OS LS<br />
Kleinhüningen Niederholz<br />
Wasgenring<br />
Plan Gellert Grendelmatte Hebel<br />
Gesamtaufwand<br />
pro Schüler/in pro<br />
Jahr 13'529 11'673 12'601 16'227 23'025 9'073 7'129 8'101<br />
Elternbeiträge pro<br />
Schüler/in 3'311 3'253 3'282 1'493 2'115 960 960 960<br />
Nettoaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 10'134 8'340 9'237 14'685 20'811 8'113 6'169 7'141<br />
Anzahl<br />
<strong>Betreuung</strong>s-<br />
st<strong>und</strong>en pro<br />
Schüler pro Woche 2.55 2.40 2.48 2.94 5.60 1.67 1.71 1.69<br />
123
28 Kosten Tagesschule PS KKL Bachgraben<br />
Kostenaufstellung TS PS KKL Bachgraben<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Personalaufwand<br />
Jahreslohn<br />
incl. AG<br />
Köche/innnen 62% Beiträge<br />
Jahreslohn<br />
87'400 54'188<br />
incl. AG<br />
Sozialpädagog/innen 260% Beiträge 115'700 300'820<br />
Verwaltungskostenanteil 21'300<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 595 92 m2 314 215'718 28'888<br />
Nebenräume Lager 20 m2 100 2'000 2'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 29'304<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 3'434<br />
Total 439'934<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 43'844<br />
Verpflegung Personal 756<br />
Total 44'600<br />
124
<strong>Kennzahlen</strong><br />
SJ 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 29<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 125<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 4.31<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 15'170<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'512<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 13'632<br />
Bemerkungen<br />
Die Tagesschule ist in einem eigenen Gebäude<br />
125
29 Kosten Tagesschule PS KKL Richter-Linder I<br />
Kostenaufstellung TS Richter-Linder I<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 60% AG Beiträge 87'400 52'440<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
250% AG Beiträge 115'700 289'250<br />
Verwaltungskostenanteil 20'501<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 219 167m2 314 121'204 52'438<br />
Nebenräume Lager 12m2 100 1'200 1'200<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 29'818<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 2'458<br />
Total Aufwand 448'105<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 40'875<br />
Verpflegung Personal 1'692<br />
Total Erträge 42'567<br />
126
<strong>Kennzahlen</strong><br />
SJ 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 24<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 120<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 5.00<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 18'671<br />
Elternbeiträge pro<br />
Schüler/in 1'703<br />
Nettoaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 16'897<br />
127
30 Kosten der Tagesschule OS KKL Wettstein (bisher)<br />
Kostenaufstellung TS OS KKL Wettstein (bisher)<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 125% AG Beiträge 87'400 109'250 109'250<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
175% AG Beiträge 115'700 202'475 202'475<br />
Verwaltungskostenanteil 18'704<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 144 290 m2 314 136'276 91'060<br />
Nebenräume Lager 36 m2 100 3'600 3'600<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 13'917<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'232<br />
Total 440'238<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 23'020<br />
Verpflegung Personal 773<br />
Total 23'793<br />
128
<strong>Kennzahlen</strong><br />
SJ 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 13<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 84<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 6.46<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 33'864<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'771<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 32'034<br />
Bemerkungen<br />
Die Raumkosten beinhalten auch einen Rhythmikraum von 150 m2.<br />
129
31 Kostenabschätzung der Tagesschule OS KKL Wettstein (Plan)<br />
Kostenaufstellung TS OS KKL Wettstein<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 125% AG Beiträge 87'400 109'250 109'250<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
175% AG Beiträge 115'700 202'475 202'475<br />
Verwaltungskostenanteil 18'704<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 144 290m2 314 136'276 91'060<br />
Nebenräume Lager 36m2 100 3'600 3'600<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 21'410<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'895<br />
Total 448'394<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 35'415<br />
Verpflegung Personal 1'189<br />
Total 36'604<br />
130
<strong>Kennzahlen</strong><br />
SJ 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 20<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 84<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 4.20<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 22'420<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'771<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 20'589<br />
Bemerkungen<br />
Die Raumkosten beinhalten auch einen Rhythmikraum von 150 m2.<br />
Die variablen Kosten wurden proportional zu den Schüler/innen-Zahlen erhöht.<br />
131
32 Kosten Tagesschule OS KKL Geller (bisher)<br />
Kostenaufstellung TS OS KKL Gellert (bisher)<br />
Personalaufwand<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 75% AG Beiträge 87'400 65'550 65'550<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
175% AG Beiträge 115'700 202'475 202'475<br />
Verwaltungskostenanteil 16'082<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 180 140 m2 314 100'480 43'960<br />
Nebenräume Lager 20 m2 100 2'000 2'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 24'873<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 977<br />
Total 355'917<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 17'197<br />
Verpflegung Personal 1'353<br />
Total 18'550<br />
132
<strong>Kennzahlen</strong><br />
SJ 02/03<br />
Anzahl Schüler/innen 15<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 84<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 5.60<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 23'728<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'146<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 22'491<br />
Bemerkungen<br />
Die Küche der OS Tagesbetreuung Gellert kocht auch für die KKL Tagesschule. Der Beschäftigungsgrad wurde<br />
deshalb anteilsmässig verteilt.<br />
133
33 Kostenabschätzung der Tagesbetreuung OS KLL Gellert (Plan)<br />
Kostenaufstellung TS OS KKL Gellert (Plan)<br />
Unterricht<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit Kosten/Einheit Kosten gesamt<br />
davon<br />
Tagesschule<br />
Personalaufwand<br />
Jahreslohn<br />
incl. AG<br />
Köche/innnen 75% Beiträge<br />
Jahreslohn<br />
87'400 65'550 65'550<br />
incl. AG<br />
Sozialpädagog/innen 175% Beiträge 115'700 202'475 202'475<br />
Verwaltungskostenanteil 16'082<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 180 140m2 314 100'480 43'960<br />
Nebenräume Lager 20m2 100 2'000 2'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 33'164<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 1'302<br />
Total 364'533<br />
Erträge<br />
Elternbeiträge 22'929<br />
Verpflegung Personal 1'353<br />
Total 24'282<br />
134
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Plan<br />
Anzahl Schüler/innen 20<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 84<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 4.20<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 18'227<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 1'146<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 17'013<br />
Bemerkungen<br />
Die Küche der OS Tagesbetreuung Gellert kocht auch für die KKL Tagesschule. Der Beschäftigungsgrad wurde<br />
deshalb anteilsmässig verteilt.<br />
Die variablen Kosten wurden proportional zur Schüler/innen-Zahl erhöht.<br />
135
34 Kosten der Tagesbetreuung HPS Ackermätteli<br />
Tagesbetreuung Ackermätteli<br />
Personalaufwand<br />
<strong>Betreuung</strong> /<br />
Verpflegung Einheit<br />
Kosten/<br />
Einheit Tagesschule<br />
Jahreslohn incl.<br />
Köche/innnen 54% AG Beiträge 87'400 47'196<br />
Sozialpädagog/innen<br />
Jahreslohn incl.<br />
400% AG Beiträge 115'700 462'800<br />
Küchenhilfe<br />
Jahreslohn incl.<br />
20% AG Beiträge 76'800 15'360<br />
Vorpraktikantinnen<br />
Jahreslohn incl.<br />
300% AG Beiträge 13'800 41'400<br />
Verwaltungskostenanteil 34'005<br />
Sachaufwand<br />
kalkulatorische Mieten 140 m2 314 43'960<br />
Nebenräume Lager 20 m2 100 2'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
Nahrungsmittel 35'000<br />
Verbrauchsmaterialien<br />
<strong>Betreuung</strong> 6'000<br />
Total 687'721<br />
136
Erträge<br />
Elternbeiträge 8'000<br />
Verpflegung Personal 4'500<br />
Invalidenversicherung 6'000<br />
Total 18'500<br />
<strong>Kennzahlen</strong><br />
Ist<br />
Anzahl Schüler/innen 23<br />
<strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en pro<br />
Woche 336<br />
Anzahl <strong>Betreuung</strong>sst<strong>und</strong>en<br />
pro Schüler pro Woche 15<br />
Gesamtaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 29'901<br />
Elternbeiträge pro Schüler/in 348<br />
Nettoaufwand pro Schüler/in<br />
pro Jahr 29'097<br />
137
35 Kostenvergleich der Tagesbetreuungsangebote im sonderpädagogischen Bereich<br />
Vergleich Tagesstrukturen im sonderpädagogischer Bereich<br />
Angebot TS PS KKL TS PS KKL TS PS KKL TS OS KKL TS OS KKL TS OS KKL TB HPS<br />
Richter-Linder I Bachgraben<br />
Gellert<br />
Plan<br />
Wettstein<br />
Plan Ackermätteli<br />
Gesamtaufwand<br />
pro Schüler/in pro<br />
Jahr 18'671 15'170 16'921 18'227 22'420 18'227 29'901<br />
Elternbeiträge pro<br />
Schüler/in 1'703 1'512 1'607 1'146 1'771 1'146 348<br />
Nettoaufwand pro<br />
Schüler/in pro Jahr 16'897 13'632 15'265 17'013 20'589 17'013 29'097<br />
Anzahl<br />
<strong>Betreuung</strong>s-<br />
st<strong>und</strong>en pro<br />
Schüler pro Woche 5.00 4.31 4.66 4.20 4.20 4.20 14.61<br />
138
36 Kontaktadressen<br />
Teil 1: Qualitative Auswertung der Gruppendiskussionen<br />
Dorothee Schaffner<br />
Fachhochschule für Soziale Arbeit beider Basel<br />
Thiersteinerallee 57<br />
4053 Basel<br />
Dorothee.Schaffner@fhsbb.ch<br />
Teil 2: Vollkostenberechnungen<br />
Mirjam Schmidli<br />
Stab Schulen<br />
Erziehungsdepartement Basel-Stadt<br />
Leimenstrasse 1<br />
4001 Basel<br />
Mirjam.Schmidli@bs.ch<br />
Bezugsadresse des Berichts <strong>und</strong> Anhangs<br />
Ueli Keller<br />
Stab Schulen<br />
Erziehungsdepartement Basel-Stadt<br />
Leimenstrassen 1<br />
4001 Basel<br />
Tel: 061 267 62 93<br />
Ueli.Keller@bs.ch