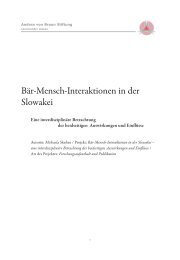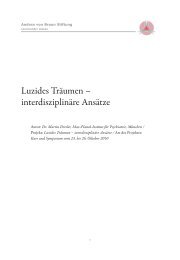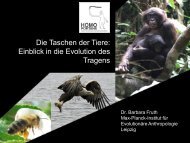LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
LP AvB Tincheva Nele 02 - Andrea von Braun Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Andrea</strong> <strong>von</strong> <strong>Braun</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
<strong>von</strong>einander wissen<br />
Wir müssen <strong>von</strong> der Möglichkeit des Blickwechsels Gebrauch machen, indem wir den Text<br />
nicht nur räumlich, sondern auch örtlich wahrnehmen: als zweidimensional fixierte, begrenzte<br />
Buchstabenfolge, die uns wiederholte, punktuelle Stellenlektüre gestattet. Wir können entscheiden,<br />
an welchen Stellen wir den Text-Ort wieder zum Lese-Raum machen, wo wir „wieder<br />
einsteigen“ wollen. So gelingt es uns, zwei Bewegungsmuster im Text zu konturieren, die<br />
beide auf das Zentrum der Rede abzielen, auf das, was Wirklichkeit für Celan heißt:<br />
„Begegnung! Begegnung!“ (139)<br />
1.) Hin zum Anderen: Schritt hinaus. Das Gedicht ist, erstens, auf der Suche nach einem<br />
Anderen, seinem Gesprächspartner, „es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es<br />
sucht es auf, es spricht sich ihm zu.“ (EF 9) Dieser Partner ist ubiquitär: er kann überall sein.<br />
„Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses<br />
Anderen.“ Das Gedicht versucht, „auf jenes Ferne und Besetzbare zuzuhalten“ (EF 11); das<br />
Gelingen dieses Versuchs allerdings ist höchst ungewiss: Der Zielpunkt ist ja ubiquitär zu<br />
denken. Bei dem Versuch, eine Karte des Weges zu ihm zu zeichnen, stoßen wir auf eine parallaktische<br />
Differenz: Ubiquität schlägt um in Utopie, in Ortlosigkeit – ein ubiquitärer Ort ist<br />
eben kein Ort, er ist ein Ort ohne Örtlichkeit, eine wandernde Stelle ohne feste Koordinaten.<br />
Wie wäre eine solche Stelle zu erreichen? Sie kann ja höchstens angetroffen, aber nicht angesteuert<br />
werden. In der „Bremer Rede“ heißt es denn auch:<br />
Das Gedicht kann […] eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer hoffnungsstarken<br />
– Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an<br />
Herzland vielleicht. (Bremer Rede, a.a.O., 186)<br />
Voraussetzung für das Erreichen des ubiquitär-utopischen „Herzlandes“ ist allemal der<br />
Schritt hinaus: eine „ins Offene und Leere und Freie weisende[n] Frage“ (EF 10),<br />
ein Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben in einen dem Menschlichen<br />
zugewandten und unheimlichen Bereich – denselben, in dem die Affengestalt, die Automaten<br />
und damit… ach, auch die Kunst zuhause zu sein scheinen. (EF 5)<br />
Dort erst kann das Gedicht seinen Ort finden: wiederholt und dauerhaft sichtbar (lesbar) in<br />
seiner örtlichen Gestalt, der zweidimensionalen Textfläche voller unveränderlicher Buchstaben,<br />
die, analog Orten auf einer Karte, durch rekurrierende Lese-Linien verbunden werden<br />
können. Zugleich wird es Begegnungsraum, in dem das Gespräch mit dem Anderen statt finden<br />
kann – als „eine, einmalige, punktuelle Gegenwart“ (EF 10). Hier ist seine Wahrnehmung<br />
an ein vergängliches Hier-und-Jetzt gebunden, in dem es als „Gegenwart und Präsenz“ zu<br />
einem Anderen spricht. Wir müssen das Gedicht also als Raum und Ort zugleich betrachten.<br />
Nach de Certeau wäre das nicht möglich: wir hatten gesehen, dass zwar Raum und Ort materiell<br />
dasselbe sind – wie das Gedicht als Text es selbst ist –, dass sie aber durch einen Wechsel<br />
10